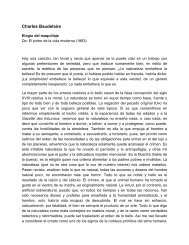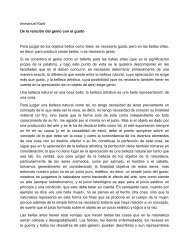Negation als Spiegel Utopie aus epistemologischer Sicht
Negation als Spiegel Utopie aus epistemologischer Sicht
Negation als Spiegel Utopie aus epistemologischer Sicht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
müssen, geschaffen wird. Wenn uns <strong>als</strong>o der Text auffordert, uns eine Gesellschaft vorzustellen, in der Jugendliche nicht<br />
in der Familie erzogen werden, können wir zu Recht fragen, wo und wie sie denn leben sollen. Oder wenn wir durch<br />
einen anderen Text angeregt werden, uns eine Gesellschaft ohne Geldwirtschaft vorzustellen, scheint es berechtigt, zu<br />
fragen »wie kann es nach Ansicht des Autors vermieden werden, daß einige wenige den Großteil der vorhandenen<br />
Güter für sich in Anspruch nehmen, bevor die Mehrheit überhaupt eine Möglichkeit hatte, selbst einen Anspruch<br />
darauf zu erheben«.<br />
Wenn wir (wie die meisten <strong>Utopie</strong>-Historiker) Daniel Defoes Robinson Crusoe <strong>als</strong> utopischen Text verstehen, wären<br />
wir uns, glaube ich, darin einig, daß er eine hohe Dichte, aber wenig utopische Intensität besitzt. Das Gegenteil<br />
könnte man dagegen von zahlreichen bedeutenden <strong>Utopie</strong>n der Renaissance behaupten, daher stellt sich die Frage, ob<br />
große utopische Intensität immer mit niedriger utopischer Dichte verbunden ist. Ein Grund für eine solche negative<br />
Beziehung besteht darin, daß, je mehr gewöhnliche Spielregeln man wegfallen läßt und je mehr normale bzw.<br />
bestehende Bedingungen verhindert oder abgeschafft werden, desto größer scheint die Informationslücke zu werden,<br />
desto mehr Fragen muß der Utopist folglich unbeantwortet lassen. Ist diese Hypothese richtig? Eine Untersuchung<br />
der formalen Charakteristika anhand einiger utopischer Texte könnte darauf eine Antwort geben. Zwei Methoden<br />
zur Schließung der Lücke, die gleichzeitig charakteristische Stilmittel einer bestimmten utopischen Textart zu sein<br />
scheinen, könnte man bezeichnen mit »Die Wende zur Generalisation« und »Die Wende zur Geometrie«.<br />
IV. Die Wende zur Generalisation: Der Traum von der Formalisierung<br />
In Campanellas Sonnenstaat sind die Krieger zu einer Zeit uniformiert, <strong>als</strong> sie es im normalen Leben noch nicht<br />
waren. Die Kleidung ist nicht der einzige Bereich menschlichen Lebens, in dem Campanella Uniformität einführen<br />
will. Zeitmeßgeräte und Wetterfahnen spielen eine bedeutsame Rolle in seinem Staat, Dinge, die in der<br />
Renaissance den Beginn einer zunehmenden Reglementierung im Hinblick auf Zeit, Kontrolle und angepaßtes<br />
Verhalten markierten und charakteristisch für das Zeitalter der Eisenbahnen und der Fabriksirenen sind.<br />
Welche Bedeutung hat diese Uniformität? Eine Gruppe von Individuen einheitlich zu kleiden, ihnen<br />
beizubringen, auf ein Kommando hin die gleichen Bewegungen zu machen und zur gleichen Zeit zu kommen<br />
bzw. zu gehen, dies sind natürlich Methoden, die für eine Verhaltensreglementierung charakteristisch sind. Auch ist<br />
es wichtig zu erkennen, daß diese Reglementierung durch eine Änderung im Informationsgrad der Situation bewirkt<br />
wird. Aus der <strong>Sicht</strong> der allgemeinen Informationstheorie repräsentiert eine Truppe, deren Mitglieder sich auf dasselbe<br />
Wort hin identisch bewegen, bzw. eine Stadt, in der alle Einwohner in Häusern von gleicher Größe, Form und<br />
Raumaufteilung leben, einen niedrigeren Informationsgrad verglichen mit einem Zustand, wo diese Generalisation<br />
nicht stattgefunden hat. Die Faktoren, die die Kontrolle einer Gesellschaft auf der Realität!- und Aktionsebene<br />
erleichtern, sind genau dieselben, die es uns leicht machen, mögliche Gesellschaften, <strong>als</strong>o <strong>Utopie</strong>n, zu beschreiben.<br />
Generalisierte Verhaltensmerkmale, Konventionen und Kodexe, <strong>als</strong>o alle jene Faktoren, die Max Weber mit einer<br />
effizienten Bürokratie verbindet, dienen sowohl der Kontrolle <strong>als</strong> auch der Beschreibung. Einige Aspekte einer<br />
Situation zu generalisieren, heißt unter bestimmten Bedingungen, sie zu kontrollieren. Aber gleichzeitig kann man<br />
auf diese Weise einer utopischen Variation der Wirklichkeit einen informativen Inhalt geben, die sich sonst in<br />
Abstraktionen verlieren könnte, da sie so viele Eigenschaften der vielfältigen »gewöhnlichen« Existenz negiert. Die<br />
Bedeutung der Tatsache, daß Generalisation ein äußerst effizientes Mittel zur Kontrolle einer Situation ist und<br />
zugleich eine der wirksamsten Methoden, einem utopischen Konstrukt Sinn zu geben, sollte nicht unterschätzt<br />
werden.<br />
Hängt die Möglichkeit der Kontrolle von der Konstruktion einer Gesellschaft ab, die informationsarm ist, oder hat<br />
die Notwendigkeit, die Komplexität der Welt auf leicht beschreibbare Strukturen zu reduzieren, eine politische<br />
Kontrolle <strong>als</strong> notwendige Folge? Oder ist es vielmehr so, daß eine bestimmte Form politischer Macht identisch ist mit<br />
einem Zustand, der leicht beschreibbar und durch einen niedrigen Informationsgrad gekennzeichnet ist? Handelt es sich<br />
dabei immer um eine zentralisierte Form der Macht? Natürlich ist die Erwähnung der Weberschen Begriffe von