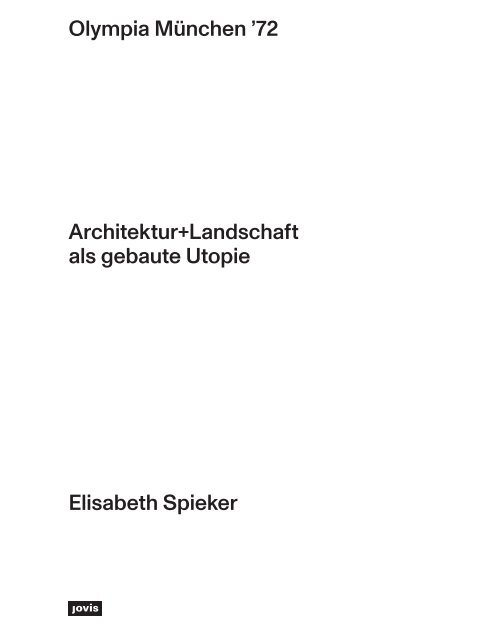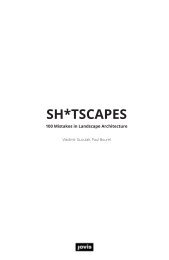Olympia München '72
ISBN 978-3-86859-728-8
ISBN 978-3-86859-728-8
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Olympia</strong> München ’72<br />
Architektur+Landschaft<br />
als gebaute Utopie<br />
Elisabeth Spieker
9 Skizze vom Damals, Karla Kowalski<br />
10 Erinnerungen, Stefan Behnisch<br />
11 Einleitung<br />
Kapitel 1<br />
Bewerbung<br />
14 Zwischen Modernisierung<br />
und Hypothek der Vergangenheit<br />
14 Politik und Gesellschaft<br />
15 Architektur und Städtebau<br />
16 München – Stadt im Aufbruch<br />
16 Stadtplanung und Stadtimage als<br />
Entwicklungsinstrument<br />
16 Der Stadtentwicklungsplan von 1963<br />
21 Die Organisatoren der Spiele<br />
21 Hans-Jochen Vogel<br />
22 Willi Daume<br />
23 München wird <strong>Olympia</strong>stadt<br />
23 Motive<br />
24 Blitzbewerbung<br />
27 Sportpark Oberwiesenfeld<br />
32 Vergabe nach München<br />
32 Organisationsstrukturen und<br />
Planungsentscheidungen<br />
35 Im Gespräch: Hans-Jochen Vogel<br />
Kapitel 2<br />
Denkmodelle zur<br />
Architekturlandschaft<br />
46 Die Architekten der Spiele –<br />
Behnisch & Partner mit Jürgen Joedicke<br />
46 Günter Behnisch<br />
46 Fritz Auer<br />
47 Winfried Büxel<br />
48 Jürgen Joedicke<br />
49 Erhard Tränkner<br />
49 Carlo Weber<br />
51 Impulse in den 1960er-Jahren<br />
53 Stadtgrün – Volkspark – Sportpark<br />
54 Anfänge des Stadtgrüns<br />
54 Volksparks<br />
55 Sportparks<br />
55 Organische Stadtlandschaften<br />
59 Utopische Modelle<br />
zu Stadt und Gesellschaft<br />
59 Volkshaus als ästhetisches und<br />
sozialreformerisches Ideal<br />
60 Utopien als Lösungsversprechen<br />
61 Situationalistische Internationale<br />
62 Situationsarchitektur und Möglichkeitsräume<br />
63 Konstruktionsmodelle für Dachlandschaften<br />
63 Traditionslinien seit den 1920er-Jahren<br />
65 Frei Otto<br />
66 Prinzip hängendes Dach<br />
66 Großhüllen und Dächer über der Landschaft<br />
71 Modell und Impuls – Deutscher Pavillon auf der<br />
Weltausstellung in Montreal<br />
71 Architektur für ein neues Bild der<br />
Bundesrepublik<br />
71 Stuttgarter Verbindungen und personelle<br />
Kontinuitäten<br />
73 Architektonisches Konzept<br />
74 Planung und technische Besonderheiten<br />
80 Auswirkungen<br />
81 Im Gespräch: Frei Otto<br />
Kapitel 3<br />
Wettbewerb<br />
98 Auslobung und Leitmotive<br />
99 Bearbeitung des Wettbewerbs<br />
99 Motivation und Ansätze<br />
100 Erdstadien<br />
103 Modellierung der Landschaft<br />
110 Entstehung der Dachidee<br />
118 Formulierung der Konzeption<br />
118 Die Entscheidung<br />
121 Nach dem Erfolg<br />
127 Im Gespräch: Günter Behnisch<br />
Kapitel 4<br />
Dach<br />
138 Verwirklichung der Utopie?<br />
138 Problematik des Wettbewerbsdachs<br />
140 Konventionell oder experimentell?<br />
142 Olympische Landschaft mit fremdem Dach?<br />
143 Unterschiedliche Überdachungsvarianten<br />
145 Punktgestütztes Hängedach kontra<br />
randgestützte Variante<br />
149 Beginn der gemeinsamen Arbeit<br />
151 Jörg Schlaich<br />
151 Entscheidung für das Zeltdach
156 Aufgaben und Zielvorstellungen<br />
156 Organisation des Teams<br />
160 Jürgen Joedicke<br />
161 Das Zeltdach –<br />
Konstruktive Konfliktpotenziale<br />
161 Zuständigkeiten<br />
162 Frei Otto und das Institut für Leichte<br />
Flächentragwerke<br />
163 Weiterentwicklung der Holzschalenlösung<br />
165 Pavillon für die Bundesgartenschau Euroflor in<br />
Dortmund<br />
166 Olympisches Dach aus Holz, Beton, Folie oder<br />
Acrylglas?<br />
169 Netzkonzept und Konstruktion<br />
des Stahlseilnetzes<br />
169 Maschenweite<br />
171 Seile und Knotenpunkte<br />
172 Montage- und Spannkonzept<br />
174 Formfindung und Zuschnitt<br />
174 Arbeiten am Modell<br />
177 Netzgeometrie und Zuschnitt<br />
180 Neue Methoden: Finite-Elemente-Methode<br />
(FEM) und Kraft-Dichte-Methode<br />
183 Berechnung des Stadions<br />
185 Berechnung der Sporthalle<br />
188 Berechnung der Schwimmhalle und<br />
der Zwischenteile<br />
Kapitel 5<br />
Landschaft<br />
250 Architekturlandschaft als Gestaltungsidee<br />
256 Günther Grzimek<br />
257 Konzept der Landschaft<br />
258 Gesellschaftliche Dimension<br />
261 Ausführung der Arbeiten<br />
261 Zusammenarbeit im Team<br />
263 Gestaltung vor Ort<br />
266 Demokratische Landschaft<br />
268 Charakteristische Situationen und Elemente<br />
268 See und Uferzone<br />
268 Elemente für Spiel und Sport<br />
274 Wege<br />
275 Wiese, Rasen und Bäume<br />
275 Brücken und Beleuchtung<br />
277 Übergänge zwischen Landschaft und Bauten<br />
278 Temporäre Architektur und<br />
Besucherversorgung<br />
279 Temporäre Konstruktionen<br />
284 Restaurants Nord und Süd<br />
288 Pavillon in der Schwimmhalle<br />
291 Café am Berg<br />
295 Besucherinformation<br />
297 Möblierung der Landschaft<br />
189 Im Gespräch: Klaus Linkwitz<br />
204 Ausführung und Montage<br />
204 Ausschreibung der Stahlbauarbeiten<br />
210 Fundamente<br />
211 Renaissance des Stahlgusses<br />
212 Maste<br />
212 Montage<br />
220 Klimahüllen für Sport- und Schwimmhalle<br />
226 Aufwärmhalle<br />
226 Überdachung der Osttribüne des Stadions<br />
227 Unterschiedliche Akteure und Denkansätze<br />
228 Behnisch & Partner<br />
230 Frei Otto<br />
232 Leonhardt und Andrä<br />
232 Reaktionen im Spiegel unterschiedlichen<br />
Denkens<br />
234 Impulse für die wissenschaftliche Forschung<br />
235 Im Gespräch: Jörg Schlaich<br />
299 Bildstrecke<br />
Kapitel 6<br />
Visuelle Gestaltung<br />
332 Ein neues Gesicht für die Bundesrepublik<br />
332 Otl Aicher<br />
334 Eine Aufgabe von „schwerwiegender<br />
Verantwortung“<br />
336 Elemente des Erscheinungsbilds<br />
338 Emblem<br />
342 Die Abteilung XI<br />
342 Teamarbeit<br />
344 Normenbuch<br />
345 Farben<br />
347 Piktogramme<br />
351 Bekleidung<br />
353 Souvenirs<br />
356 Sportplakate<br />
356 Stadtdesign<br />
359 Woodstock<br />
Kapitel 7<br />
Olympisches Dorf<br />
362 Vor der Planung<br />
362 Rahmenbedingungen der Bewerbung<br />
363 Olympisches Dorf ohne Wettbewerb?<br />
366 Aktion <strong>Olympia</strong><br />
366 Das Männerdorf<br />
366 Mehrstufiges Optimierungsverfahren<br />
368 Personelle Verflechtungen<br />
373 Leitidee „Straße“<br />
374 Wohnungs- und Wohnhaustypen<br />
376 Nach den Spielen<br />
376 Das Frauendorf<br />
378 Interdisziplinäre Teamarbeit<br />
418 Die Spielstraße<br />
418 Werner Ruhnau<br />
419 Kontroversen um das Konzept<br />
422 Künstler und Aktionen<br />
426 Schlussveranstaltung<br />
Kapitel 9<br />
Schluss<br />
430 5. September 1972<br />
430 Akteure<br />
432 Mehrdimensionaler Kontext<br />
Kapitel 8<br />
Kunst und Kultur<br />
380 Olympischer Sommer – Kunst- und<br />
Kulturprogramm des Organisationskomitees<br />
380 In der Tradition von Pierre de Coubertin<br />
381 Ausstellungen<br />
383 Edition <strong>Olympia</strong><br />
384 Deutsches Mosaik<br />
384 Kunst am <strong>Olympia</strong>-Bau<br />
385 „Integrierte“ Kunst auf dem Oberwiesenfeld<br />
389 Kinetische Kunst<br />
391 Beratung durch Galeristen<br />
Anhang<br />
435 Endnoten<br />
448 Literatur<br />
458 Abkürzungen<br />
459 Archive<br />
459 Zeitzeugengespräche und Korrespondenzen<br />
459 Bauten Architekten Ingenieure<br />
461 Bildnachweis<br />
462 <strong>Olympia</strong>-Team von Behnisch & Partner<br />
464 Dank<br />
464 Impressum<br />
393 Die Künstler und ihre Projekte<br />
393 Kunstwettbewerb für die ZHS<br />
394 Kunstwettbewerbe für die Zugangsbereiche von<br />
S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn<br />
395 Wasserfontänen für die Eingangsbereiche<br />
396 Kunstwettbewerbe für das Olympische Dorf<br />
397 Media-Linien<br />
399 Großplastiken an den Autobahnzufahrten<br />
400 Wasserwolke<br />
401 Sphärische Objekte<br />
404 Friedensdenkmal auf dem <strong>Olympia</strong>berg<br />
406 Liegendes Kreuz<br />
407 Olympic Mountain Project<br />
408 Fluorescent Light<br />
409 Square<br />
410 Levitated Mass <strong>Olympia</strong><br />
411 Fassaden der Sport- und Schwimmhalle<br />
412 Gestaltung der Schwimmhallenrückwand<br />
414 Negative Entscheidungen
Mitte 1966 kamen Hans-Jochen Vogel Zweifel<br />
an der laufenden Ausrichtung der Stadtentwicklung.<br />
Wesentlichen Einfluss übten die zu dieser Zeit<br />
viel gelesenen kritischen Schriften zu Gesellschaft<br />
und Stadt aus, die seine Nachdenklichkeit über<br />
den Zustand der neu gebauten Städte wesentlich<br />
vertieft hatten, von Autoren wie John Kenneth<br />
Galbraith 26 , Jean Fourastié 27 , Hans Paul Bahrdt 28 ,<br />
Lewis Mumford, Alexander Mitscherlich 29 und Jane<br />
Jacobs 30 . Er erkannte die Notwendigkeit, auch das<br />
Gesellschaftssystem in wichtigen Punkten zu reformieren<br />
und der gesellschaftspolitischen Komponente<br />
in der Kommunalpolitik Raum zu geben.<br />
Ebenso hinterfragte er die zunehmende Entwicklungsbeschleunigung<br />
in vielen Bereichen und die<br />
bislang als selbstverständlich propagierte Trennung<br />
von Wohn- und Arbeitsbereich. 31<br />
Auch Otl Aicher kannte zumindest einige dieser<br />
Schriften 32 und hatte sich in den 1960er-Jahren wie<br />
Vogel intensiv mit den Planungsproblemen deutscher<br />
Großstädte beschäftigt, die er in einer siebenteiligen<br />
Serie in der Wochenzeitung Die Zeit mit dem<br />
Titel „Der klassische Städtebau ist tot – Eine Reihe<br />
kritischer Betrachtungen über moderne Planung“ 33<br />
umfassend behandelte und auch München nicht<br />
ausnahm. Er teilte Vogels Kritik am Zustand der<br />
Städte und an der zerfallenden Einheit von Zentrum,<br />
Vorstädten und Umland und liefert präzise Beschreibung<br />
und Bewertungen, wobei er mit Vogels Ansatz<br />
einer Stärkung des Kerns und eines Ausbaus des<br />
öffentlichen Nahverkehrs nicht übereinstimmte.<br />
4<br />
Als Präsident des Deutschen Städtetags<br />
organisierte Vogel unter Mithilfe von Abreß im Mai<br />
1971 in München eine Tagung unter dem Motto<br />
„Rettet unsere Städte jetzt!“ 34 , zu der er auch<br />
Galbraith als Redner eingeladen hatte. Vogel forderte<br />
eine Abkehr von der propagierten Urbanität durch<br />
Dichte und eine deutlicher an den Bewohnern<br />
orientierte, menschlichere Stadt. Er stellte seine<br />
Überlegungen zur Notwendigkeit einer vorausschauenden,<br />
nachhaltigen Stadtentwicklung auf der Basis<br />
einer interdisziplinären wissenschaftlichen Stadtforschung<br />
vor, die Dynamisierungsprozesse rechtzeitig<br />
erkennen müsse und die er mit einer sinnvollen<br />
Verkehrspolitik verknüpfte. 35 Als Basis dafür diente<br />
ihm sein bereits im Oktober 1969 vorgetragenes<br />
Referat „Die Stadtregion als Lebensraum“ 36 , in dem<br />
er gegen die Auswüchse der allein an ökonomischen<br />
Maßstäben orientierten Städte und gegen die<br />
Lahmlegung der Innenstädte durch Funktionentrennung<br />
eintrat sowie Maßnahmen gegen die zunehmende<br />
Bedrohung des ökologischen Gleichgewichts<br />
durch Verschmutzung und Lärm forderte. Vogel<br />
resümierte knapp zehn Jahre nach der Festlegung<br />
des Plans, dass er kritiklos von einer Wachstumsideologie,<br />
steigender Konsumrate und Motorisierung<br />
ausgegangen sei, jedoch Umweltthemen außer Acht<br />
gelassen habe. 37<br />
Der Stadtentwicklungsplan hatte jedoch den<br />
Grundstein gelegt, damit die darin schon festgeschriebenen<br />
Maßnahmen in der kurzen Planungszeit<br />
bis zu den Olympischen Spielen überhaupt realisiert<br />
werden konnten. Deren Ausrichtung sorgte natürlich<br />
auch für eine erhebliche Beschleunigung der<br />
geplanten Stadtentwicklungs- und Infrastrukturmaßen,<br />
für eine positive Entwicklung der bislang<br />
vernachlässigten nördlichen Stadtteile und einen<br />
umfassenden Ausbau des öffentlichen Verkehrs- und<br />
Schienennetzes. Für den Bau der U-Bahn, der mit<br />
dem Spatenstich am 1. Februar 1965 startete, wurde<br />
sogar ein eigenes Referat eingerichtet.<br />
München avancierte zwar schon seit 1964<br />
aufgrund seiner rasanten Entwicklung immer mehr<br />
zu „Deutschlands heimlicher Hauptstadt“ 38 , jedoch<br />
erhielt sein Image durch die Olympischen Sommerspiele<br />
auch international ein enorm hohes Ansehen.<br />
Die visionäre zukunftsweisende Gestaltung konnte<br />
die bislang vorherrschenden konservativen und<br />
regional geprägten Leitvorstellungen und das<br />
klassizistische Erbe der Stadt um die weit über<br />
München und Bayern hinausreichende Ausstrahlung<br />
einer modernen, zukunftsorientierten Stadt ergän-<br />
4 <br />
Der Spiegel, Heft 39,<br />
23. September 1964<br />
20 21<br />
Bewerbung<br />
München – Stadt im Aufbruch
zen und bereichern. Vogels Erfolge mündeten 1972<br />
noch vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in<br />
seine Berufung zum Bundesminister für Raumordnung,<br />
Bauwesen und Städtebau in der Regierung<br />
unter Willy Brandt.<br />
Die Organisatoren der Spiele<br />
Die Ausrichtung und Entstehung der Olympischen<br />
Spiele in München ist nicht ohne die beiden zen tralen<br />
Figuren zu denken, ohne die sich Konzept und<br />
Gestaltung nicht hätten durchsetzen lassen. Als<br />
Willi Daume, Präsident des Nationalen Olympischen<br />
Komitees (NOK), am 28. Oktober 1965 an Hans-<br />
Jochen Vogel herantrat, um ihm den Vorschlag für<br />
die Bewerbung der Stadt München zur Ausrichtung<br />
der Olympischen Spiele zu unterbreiten, hatten sich<br />
zwei Persönlichkeiten gefunden, die „selbstbewusste<br />
und letztlich typische Vertreter der ersten beiden<br />
Generationen der jungen Bundesrepublik“ waren,<br />
„angetrieben von einer großen Arbeitsmoral und<br />
dem Wissen um ihre Verantwortung für die Verbesserung<br />
der Gesellschaft“ 39 .<br />
Hans-Jochen Vogel<br />
Hans-Jochen Vogel (1926–2020) gehörte zu den<br />
Vertretern der 45er oder „skeptischen Generation“<br />
40 , der 1945 etwa zwischen 15 und 25 Jahre<br />
alten jungen Männer, die durch ihre Kriegserfahrungen<br />
als Soldaten, bei der Marine, der Luftwaffe<br />
oder durch ihre Kindheit im „Dritten Reich“ geprägt<br />
waren. Sie strebten in der jungen Bundesrepublik<br />
nach pragmatisch orientieren Lebenskonzepten, die<br />
Sicherheit und Selbstständigkeit im Privaten boten,<br />
waren aber auch neuen, sich eröffnenden Chancen<br />
und technischen Möglichkeiten gegenüber sehr aufgeschlossen.<br />
Ihnen gemeinsam waren ein scharfes<br />
Bewusstsein über die bestehende gesellschaftliche<br />
Situation und eine strikte Ablehnung jeglicher linker<br />
oder rechter Ideologien. Auch viele weitere Akteure<br />
wie Otl Aicher, Günter Behnisch 41 und seine Partner,<br />
Klaus Linkwitz, Frei Otto und Werner Ruhnau sind<br />
dieser Generation zuzurechnen, deren lebensgeschichtliche<br />
Erfahrungen im „Dritten Reich“ und<br />
die Ausbildung nach dem Krieg zu einem ähnlichen<br />
Lebensbild und zu einem vergleichbaren Denkraum<br />
und Demokratieverständnis geführt hatten.<br />
Aufgewachsen in Göttingen und Gießen, der<br />
Vater Professor für Tierzucht und der Großvater<br />
Tiermediziner, stammte Vogel aus einer Familie des<br />
gehobenen Bildungsbürgertums. Er hatte ab 1943 die<br />
beiden letzten Kriegsjahre als Soldat der Wehrmacht<br />
erleben müssen und konnte vermutlich nur durch<br />
eine erlittene Verwundung überleben. Diese Erlebnisse<br />
machten ihn jedoch zu einem überzeugten<br />
Demokraten. 42 Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften<br />
in München und Marburg promovierte<br />
er 1950 und trat im selben Jahr der SPD bei. Nach<br />
Stationen in München, Traunstein und als Justiziar in<br />
der bayerischen Staatskanzlei wurde er 1958 Stadtrat<br />
und Leiter des Rechtsreferats und 1960 mit nur 34<br />
Jahren zum Oberbürgermeister gewählt.<br />
Vogel hatte den Weg in die Politik gewählt, da<br />
ihm sein Engagement für das Gemeinwohl wichtiger<br />
war als die eigenen Interessen. Seine Überzeugungen<br />
von christlichen, menschlichen Werten<br />
und sozialer Gerechtigkeit führten ihn in die SPD,<br />
da diese für ihn sehr wichtigen Gesichtspunkte in<br />
dieser Partei am besten vertreten zu sein schienen. 43<br />
In einer Ansprache anlässlich des Volkstrauertags<br />
am 15. November 1964 formulierte er: „Gewinn und<br />
Genuß sind nicht die Mitte des Daseins. Leben heißt,<br />
sich an Werten orientieren und die eigene Persönlichkeit<br />
verantwortungsbewusst zu entwickeln […].“ 44<br />
Impulse für eine inhaltliche Neuorientierung sah<br />
Vogel nicht zuletzt bei den Linkssozialisten, die im<br />
Exil gelebt und durch ihren geistigen Austausch<br />
Erfahrungen mitgebracht hatten, die ihm für eine<br />
neue Ausrichtung wichtig erschienen. Waldemar von<br />
Knoeringen war eine dieser Persönlichkeiten, und<br />
einige für Vogel maßgebliche Überzeugungen, die<br />
ebenfalls später Basis des Godesberger Programms<br />
wurden, zitierte er aus einer Rede des früheren<br />
bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner<br />
vom April 1945: „Gemeinsamkeit des Menschlichen<br />
über alle Unterschiede der Religion, Nation und<br />
Klasse hinweg; […] Jeder Mensch hat seinen Wert<br />
und seine Würde; […] Pferch der gesellschaftlichen<br />
Klassenscheidung.“ 45<br />
Vogel war nicht nur angetrieben durch die<br />
Möglichkeit, für München eine Transformation in die<br />
Moderne zu erreichen, sondern auch von dem Willen,<br />
die Gesellschaft entsprechend seiner humanistischdemokratischen<br />
Denkweise für alle Menschen gleichermaßen<br />
zu gestalten.
7<br />
Luftbild des Oberwiesenfelds<br />
mit dem im Bau befindlichen<br />
Fernsehturm, der Eissporthalle<br />
und dem Gelände der Münchener<br />
BAUMA, 1965/66<br />
26 27<br />
Bewerbung<br />
München wird <strong>Olympia</strong>stadt
pulsierenden Metropole um die Jahrhundertwende.<br />
Die Broschüre endete mit den Abbildungen eines<br />
Stadionentwurfs und den Plänen der „Olympischen<br />
Stadt“ auf dem Oberwiesenfeld.<br />
Sportpark Oberwiesenfeld<br />
7<br />
Die brachliegende Fläche im Münchner Norden<br />
unweit der Innenstadt bot ideale Voraussetzungen<br />
für den Standort der zentralen olympischen Sportstätten.<br />
Der Name war angelehnt an die ursprüngliche<br />
Nutzung als Landsitz „Wiesenfeld“ mit Gärten<br />
und Obstbäumen. Seit dem 18. Jahrhundert diente<br />
das etwa 280 Hektar große Gebiet unterschiedlichsten<br />
Nutzungen, so als Turnanstalt, Armeestützpunkt<br />
und Exerzierplatz mit Kasernengebäuden<br />
und Freiflächen für Militärparaden – hauptsächlich<br />
südlich des Nymphenburg-Biedersteiner Kanals.<br />
Das Areal nördlich des Kanals wurde ab etwa 1900<br />
als Luftschiff- und Flugzeuglandeplatz genutzt und<br />
in den 1930er-Jahren zu Münchens erstem zivilen<br />
Flugplatz mit Empfangsgebäude und Flugzeughalle<br />
ausgebaut, eröffnet am 3. Mai 1931. Parallel dazu<br />
entwickelten sich in den Randbereichen zahlreiche<br />
kleinere und größere Betriebe aus der Flugzeug- und<br />
Rüstungsindustrie. Ab 1939 löste der neue Flughafen<br />
Riem den Standort Oberwiesenfeld ab, der<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg von 1955 bis 1968 für<br />
die Sport- und Privatfliegerei genutzt wurde. Zwischen<br />
1947 und 1956 sammelte die Stadt im Süden<br />
des Exerzierplatzes den Bauschutt des Kriegs. Der<br />
Schuttberg mit einem Volumen von etwa 10 Millionen<br />
Kubikmeter wurde bewusst in Form einer halbrunden<br />
Tribüne angeschüttet, um das Oval als Basis für<br />
das Großstadion verwenden zu können. In der Folge<br />
diente er – mit Gras und Buschwerk bewachsen – als<br />
Rodelhügel und Freizeitbrache für die Bevölkerung<br />
der umliegenden Stadtviertel. Zuletzt fand dort von<br />
1962 bis 1966 die internationale Baumaschinenausstellung<br />
(BAUMA) statt. 67<br />
Mit dem Stadtentwicklungsplan sollte der im<br />
Gegensatz zum Münchener Süden strukturschwache,<br />
durch Industrieansiedlungen, Arbeiterviertel<br />
und Sozialwohnungen benachteiligte Norden aufgewertet<br />
und als Naherholungsgebiet mit Sportanlagen<br />
zur aktiven Freizeitgestaltung ausgewiesen<br />
werden – ganz im Sinn der zeitnahen Konsolidierung<br />
einer Freizeitgesellschaft.<br />
Dass das Oberwiesenfeld bislang für eine Bebauung<br />
nicht genutzt werden konnte, war nicht zuletzt<br />
den aufgeteilten Besitzverhältnissen zwischen
Dieses „Sportzentrum von internationalem<br />
Maßstab“ sowie ein Modell des weiterentwickelten<br />
Stadions, nun als „<strong>Olympia</strong>stadion“ betitelt, waren<br />
in die Bewerbungsbroschüre neben den Antworten<br />
an das IOC abgebildet. Hinzu kam die schon in<br />
Planung befindliche studentische Wohnanlage, die<br />
als Olympisches Frauendorf dienen sollte. Ein<br />
Stadtplan zeigte die Verteilung der Sportstätten<br />
in der Stadt und deutlich erkennbar die gewünschte<br />
Konzeption der „Spiele der kurzen Wege und der<br />
Konzentration, der engen Bindung von Sport und<br />
Kultur und der Rückkehr zu einfachen Spielen“. Auch<br />
ein Hinweis auf die Qualitäten der näheren Umgebung,<br />
das Alpenvorland und die oberbayerische<br />
Seenplatte fehlte nicht. 75 Damit waren alle wichtigen<br />
Vorgaben skizziert, die Anfang 1967 in den Ideenund<br />
Bauwettbewerb für das Oberwiesenfeld<br />
einfließen und dem gestalterischen und visuellen<br />
Konzept zugrunde gelegt werden konnten. 76<br />
Das Stichwort der kurzen Wege knüpft dabei an<br />
eine lange Tradition an, die Sportstätten konzentriert<br />
an einem Ort in grüner Umgebung unterzubringen.<br />
Nicht erst in Berlin 1936, wie sehr häufig referiert,<br />
sondern schon bei den Spielen 1912 in Stockholm<br />
und in Amsterdam 1928, die beide für Coubertin als<br />
Vorbild für moderne Sportanlagen galten, waren die<br />
Bauten in kurzer Distanz zueinander in Parks oder<br />
Grünbereichen angelegt. 77<br />
Ganz entscheidend war jedoch, dass Werner<br />
Wirsing, Vorsitzender des Werkbunds Bayern,<br />
Hans-Jochen Vogel noch vor der Abgabe der<br />
Bewerbung die Notwendigkeit von weitreichenden<br />
gestalterischen Maßnahmen nahelegte, die hohen<br />
Ansprüchen zu genügen hatten. Um das durchzusetzen,<br />
empfahl er, einen Gestaltungsberater ins<br />
Organisationskomitee zu berufen und ein Komitee<br />
einzusetzen, das eine übergreifende, für alle Bereiche<br />
einheitliche Gestaltung entwickeln sollte.<br />
Eingeschlossen darin sah er die Durchführung<br />
von Wettbewerben für die wichtigsten Gebäude,<br />
um „die besten Kräfte“ zu gewinnen und „die Bauten<br />
zu einer Demonstration vorbildlicher zeitgemäßer<br />
Architektur werden zu lassen“. 78 Daraufhin beauftragte<br />
Vogel am 12. Januar 1966, schon kurz nach<br />
der Abgabe der Bewerbung, seinen Pressesprecher<br />
Otto Haas, sich mit der Bitte um ein Exposé zur<br />
visuellen Ausstattung von Olympischen Spielen an<br />
das Büro von Otl Aicher zu wenden. 79<br />
10<br />
Modell der Sportanlagen auf<br />
dem Oberwiesenfeld für die<br />
Bewerbung in Rom, April 1966<br />
30 31<br />
Bewerbung<br />
München wird <strong>Olympia</strong>stadt
10
Die Architekten der Spiele –<br />
Behnisch & Partner mit<br />
Jürgen Joedicke<br />
Als Einstieg in die unterschiedlichen Kategorien der<br />
Denkmodelle und Vorbilder zeigen Leben, Werdegang<br />
und das Frühwerk der beteiligten Architekten,<br />
welchen Einfluss die Weltbilder und Erfahrungen<br />
der Akteure auf ihre Motivation und Entscheidungen<br />
hatten. Alle gehörten ausnahmslos der etwas weiter<br />
gefassten 45er Generation an, die als Vorreiter für die<br />
Aufarbeitung der Katastrophe des „Dritten Reichs“<br />
gilt. Ihnen wird in der Geschichtsschreibung eine<br />
entscheidende Rolle bei der demokratischen Ausrichtung,<br />
der Liberalisierung und den gesellschaftlichen<br />
Reformen in der Bundesrepublik zugewiesen.<br />
Günter Behnisch<br />
Günter Behnisch (1922–2010) 1 wuchs in dem kleinen<br />
Arbeiterdorf Lockwitz südlich von Dresden auf. Im<br />
Gegensatz zu der damals noch weit verbreiteten<br />
Herrschaftsgläubigkeit prägte ein freidenkerisches<br />
Elternhaus sein späteres Handeln und seine Weltanschauung,<br />
die gekennzeichnet war durch eine ausgeprägte<br />
soziale Verantwortung und das Bedürfnis<br />
nach Gerechtigkeit. Sein Vater war ein angesehener<br />
Volksschullehrer und wirkte aktiv in der SPD und im<br />
Gemeinderat mit. Ebenso wichtig erschien Behnisch<br />
im Rückblick die Unordnung und Ungezwungenheit<br />
der naturräumlich-architektonischen Situation seines<br />
Geburtsorts. Die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit<br />
in der Natur wurde später entscheidend<br />
für seine Wahrnehmung von Raumsituationen und<br />
formte sich dauerhaft zu einer naturnahen Raumauffassung.<br />
Überlagert wurden die positiven Kindheitseindrücke<br />
von der schwierigen wirtschaftlich und<br />
politisch instabilen Situation in den 1930er-Jahren.<br />
Vor diesem Hintergrund ist seine Mitgliedschaft bei<br />
der Hitlerjugend zu sehen, denn das Natur- und Gemeinschaftserlebnis<br />
hatte den jungen Behnisch zur<br />
Jugendbewegung der Wandervögel geführt, die politisch<br />
von den Nationalsozialisten vereinnahmt wurde.<br />
Behnisch meldete sich im Dezember 1939 mit<br />
17 Jahren zur Marine. Nach einer Ausbildung als<br />
Offiziersanwärter kam er zur U-Boot-Marine, 1944<br />
erhielt er den Dienstgrad „Oberleutnant zur See“, und<br />
er galt als einer der jüngsten Kommandanten im<br />
„Dritten Reich“. Obwohl er jeden Einfluss dieser Zeit<br />
auf sein architektonisches Denken bestritten hat, 2<br />
müssen die traumatischen Erlebnisse der Dunkelheit<br />
und Enge des U-Boot-Kriegs das Streben nach<br />
räumlicher Offenheit, Licht und Luft deutlich verstärkt<br />
haben. In englischer Kriegsgefangenschaft<br />
ab Juni 1945 erhielt er den ersten Zugang zur<br />
Architektur durch Bernd Kösters, einem ehemaligen<br />
Assistenten von Paul Schmitthenner, der zu den<br />
wichtigen Lehrern der damals in Deutschland<br />
führenden Stuttgarter Schule zählte. Besonders<br />
in England wurden die „re-education“-Programme<br />
in den PoW (Prisoners of War)-Lagern für die<br />
deutschen Gefangenen schon frühzeitig angewendet,<br />
um politisch-historische Bildung zu vermitteln<br />
und neue gedankliche Grundlagen für den Aufbau<br />
eines demokratischen Staats herauszubilden. Nach<br />
seiner Entlassung konnte Behnisch als Geheimnisträger<br />
nicht mehr zu seiner Familie in die inzwischen<br />
sowjetisch besetzte Zone zurückkehren. Nach einem<br />
Baupraktikum in Osnabrück begann er im Herbst<br />
1947 mit dem Studium in Stuttgart. Auch die landschaftliche<br />
Kleinteiligkeit und die Topografie der<br />
württembergischen Stadt mit ihren grünen Hängen<br />
und der Ortsbezug der Stadtelemente waren für ihn<br />
ausschlaggebend und trugen später wesentlich zur<br />
Entfaltung seiner Fähigkeiten bei.<br />
Nach 1948 bildete sich in Stuttgart mit einer<br />
neuen Generation von Professoren eine liberale,<br />
pluralistische Lehre aus. Sie profitierte vom Spannungsfeld<br />
der unterschiedlichen Persönlichkeiten,<br />
die mit neuen Impulsen und einer demonstrativen<br />
Offenheit auf viele Studenten anziehend wirkte. Vor<br />
allem Günter Wilhelm und Rolf Gutbrod sind unter<br />
den Lehrenden herauszuheben. Wilhelm sensibilisierte<br />
Behnisch durch die Bauaufgabe Schule für<br />
neue gesellschaftliche Prozesse und demokratische<br />
Wertvorstellungen. Ab 1947 war Behnisch bei seinem<br />
Lehrer als studentische Hilfskraft, nach dem Diplom<br />
ab 1951 als Assistent und eine kurze Zeit in dessen<br />
Büro beschäftigt. Gutbrod regte einen freieren<br />
Umgang mit Konstruktion und Material und den Mut<br />
zum Andersdenken an, um sich von gewohnten<br />
Form- und Vorstellungsschemata lösen zu können.<br />
Von 1950 bis zu seiner Bürogründung im Jahr 1952<br />
zusammen mit Bruno Lambart arbeitete Behnisch im<br />
Büro von Gutbrod.<br />
Fritz Auer<br />
Fritz Auer (*1933) 3 wurde in Tübingen geboren und<br />
wuchs in Kirchentellinsfurt auf, seine Eltern waren<br />
Lehrer und engagierte evangelische Christen. Die<br />
46 47<br />
Denkmodelle zur Architekturlandschaft<br />
Die Architekten der Spiele
Herrschaft der Nationalsozialisten bestimmte<br />
ebenfalls seine Kindheit und Schulzeit, die gegen<br />
Ende des Kriegs zwangsläufig in eine Mitgliedschaft<br />
beim Jungvolk mündete. Durch die Hausbaupläne<br />
seiner Eltern fand er zur Architektur. Der damalige<br />
Schmitthenner-Assistent Erich Wiemken hatte das<br />
Haus geplant, es konnte aber erst ab 1951 mit einem<br />
anderen Architekten umgesetzt werden. Auer<br />
faszinierte, wie die vom Architekten noch von Hand<br />
gezeichneten Werkpläne für die Handwerker so<br />
verständlich und lesbar waren, dass ein Haus daraus<br />
entstehen konnte. Er absolvierte ein Vorpraktikum in<br />
einer Schreinerei und bewarb sich 1953 über eine<br />
Eignungsprüfung an der damaligen Technischen<br />
Hochschule Stuttgart bei dem ehemaligen Bauhaus-<br />
Schüler Maximilian Debus. Er konnte – was die<br />
Professoren in Erstaunen versetzte – mit seinem<br />
Wissen über Hans Poelzig Punkte sammeln, das er<br />
sich zuvor aus Theodor Heuss’ Buch über Poelzig<br />
angelesen hatte.<br />
Wie schon Behnisch war auch Auer geprägt von<br />
der neuen Generation der Stuttgarter Lehrer nach<br />
1948. Neben der Baugeschichte, gelehrt von Harald<br />
Hanson, und der Baukonstruktion von Günter<br />
Wilhelm sind ihm aber vor allem Hans Kammerer und<br />
der weltgewandte Hans Volkart in Erinnerung<br />
geblieben. Kammerer stellte mit seiner lockeren und<br />
lebendigen Art im Fach „Einführen in das Entwerfen“<br />
fantasievolle kleine Aufgaben, um den Studenten<br />
zeichnerische Bildung und die Lust am Entwerfen zu<br />
vermitteln. Im vierten Semester traf er am Institut<br />
von Günter Wilhelm in seiner Korrekturgruppe auf<br />
Günter Behnisch, der sich als Stundenassistent<br />
einen Teil seines Lebensunterhalts verdiente und<br />
junge Architekten für sein expandierendes Büro<br />
suchte. Fritz Auer und auch Carlo Weber, der<br />
ebenfalls aus der benachbarten Studentengruppe<br />
hinzukam, absolvierten dort ab 1955 die damals<br />
erforderliche einjährige Zwischenpraxis. Das etwas<br />
unordentliche Büro im Dachgeschoss eines Einfamilienhaus<br />
machte einen genauso lockeren Eindruck<br />
wie Behnisch selbst.<br />
Auer und Weber hatten sich bereits zu Studienbeginn<br />
kennengelernt, da sie häufig gemeinsam den<br />
Weg hoch zur Stuttgarter Kunstakademie am<br />
Weißenhof gehen mussten, wo damals aufgrund der<br />
Kriegszerstörungen auch die Architekten ausgebildet<br />
wurden. Behnisch war durch seine lässige Art bei<br />
den Studenten beliebt, und Auer berichtete, dass er<br />
häufig hemdsärmelig, mit Sandalen bekleidet und<br />
braungebrannt aus dem Mineralbad Leuze kommend<br />
zu den Korrekturen erschien. „Während sich die<br />
anderen Assistenten als kleine Professoren gaben,<br />
schien Behnisch ständig in Ferienstimmung zu sein;<br />
er hätte genauso gut ein etwas älterer Student sein<br />
können, der sein Studium nur seinem spendablen<br />
Vater zuliebe betreibt, um, von zuhause ungestört,<br />
seinen Liebhabereien nachgehen zu können.“ 4 Auch<br />
nach der Zwischenpraxis blieben Auer und Weber<br />
beide im Büro, um weiterhin zahlreiche Wettbewerbe<br />
zu zeichnen.<br />
1958 erhielt Auer über den DAAD ein Stipendium<br />
für ein zweisemestriges Auslandsstudium an<br />
der renommierten Cranbrook Academy of Art in<br />
Bloomfield Hills, Michigan, USA. Nach seinem<br />
Masterabschluss 1959 arbeitete er noch ein Jahr im<br />
Büro von Yamasaki & Associates in Birmingham,<br />
Michigan. In den USA beeindruckte ihn besonders<br />
die Klarheit der Entwürfe von Mies van der Rohe,<br />
aber ebenso lernte er auch die Bauten von Frank<br />
Lloyd Wright, Walter Gropius und Marcel Breuer als<br />
Vorbilder kennen. Nach seiner Rückkehr fand Auer<br />
1961 schnell wieder den Einstieg ins Büro von<br />
Behnisch, das sich inzwischen ganz auf das Bauen<br />
mit Fertigteilen konzentriert hatte. 1962 schloss er<br />
mit einer Diplomarbeit bei Günter Wilhelm sein<br />
Studium in Stuttgart ab.<br />
Winfried Büxel<br />
Winfried Büxel (1928–2010) 5 stammte aus Schabo/<br />
Bessarabien, damals zu Rumänien und heute zur<br />
Ukraine gehörend. Sein Vater war ein angesehener<br />
Bauingenieur, der seine Ausbildung in den 1920er-<br />
Jahren in Stuttgart und Dresden absolviert hatte. In<br />
dem kleinen Weinbauerndorf am Schwarzen Meer<br />
verbrachte Winfried Büxel eine unbeschwerte<br />
Kindheit. Für eine höhere Schulbildung auf einem<br />
Gymnasium wollten sich seine Eltern jedoch nicht<br />
mit den regionalen Möglichkeiten abfinden. So kam<br />
Büxel 1939 nach Dresden, wo er zunächst bei seinen<br />
Großeltern mütterlicherseits wohnte und im<br />
Folgejahr in ein Internat wechselte. Ungeplant<br />
entging er so der turbulenten Umsiedelungsphase,<br />
welche die restliche Familie seit dem Sommer 1940<br />
durchleben musste und die sie über mehrere<br />
Zwischenstationen schließlich nach Stuttgart führte.<br />
Kurz vor Ende des Kriegs wurde der erst<br />
16-Jährige zum Reichsarbeitsdienst einberufen und<br />
im April 1945 für den Abwehrkampf gegen die auf<br />
Berlin vorrückenden Russen eingesetzt. Ein Granatsplitter<br />
beendete seinen kurzen Einsatz, und es
1<br />
Frankreich. Das Prägende an der École nationale<br />
supérieure des Beaux-Arts in Paris, dieser „Schicksalsgemeinschaft“<br />
wie Carlo Weber es nannte, war<br />
die gegenseitige Hilfe: Die Jüngeren lernten von den<br />
Erfahrungen und dem Können der Älteren, während<br />
sie ihnen beim Aufzeichnen oder anderen Arbeiten<br />
assistieren mussten. Durch diese Arbeitsweise<br />
konnte Weber seine zeichnerischen Fähigkeiten<br />
entscheidend weiterentwickeln. Nach dem Abschluss<br />
des Studiums arbeitete er noch ein weiteres<br />
Jahr bei dem Architekten Louis Arretche und den<br />
Architektenbrüdern Xavier und Luc Arsène-Henry,<br />
von denen ihm besonders die Eigenarten der Pariser<br />
Arbeitswelt und das Laissez-faire im Umgang mit<br />
architektonischen Problemen in Erinnerung blieb.<br />
Nach seiner Rückkehr nach Stuttgart 1961<br />
konnte Weber direkt wieder bei Günter Behnisch<br />
im Büro einsteigen. Gleichzeitig musste er seinen<br />
noch ausstehenden fünften Abschlussentwurf am<br />
Institut von Rolf Gutbrod nachholen, betreut von<br />
Peter Schenk, den er schon seit seiner „Gastarbeitertätigkeit“<br />
im Düsseldorfer Partnerbüro von Günter<br />
Behnisch und Bruno Lambart kannte.<br />
1966 gründete Günter Behnisch mit Fritz Auer,<br />
Winfried Büxel, Erhard Tränkner und Carlo Weber<br />
die Partnerschaft Behnisch & Partner (B&P), zu der<br />
1970 noch Manfred Sabatke hinzukam. Das Gründungsjahr<br />
markiert gleichzeitig einen grundlegenden<br />
Wandel, der von den produktionsbestimmten<br />
Vorfertigungsbauten zur Situationsarchitektur führte.<br />
Auf der Suche nach einer neuen Ausdrucksweise<br />
im Bauen, die einer neuen Konzeption von Gesellschaft<br />
gerecht werden konnte, kam Behnisch zu der<br />
Überzeugung, dass Architektur unter den gleichen<br />
Bedingungen entwickelt werden musste wie der Weg<br />
zu einer offenen, am Menschen orientierten, vielfältigen<br />
Demokratie: im Entstehungsprozess, in der<br />
räumlichen Ausbildung, mit einem durchschaubaren<br />
konstruktiven Gefüge und mit der Ablesbarkeit der<br />
verwendeten Materialien.<br />
1<br />
Behnisch & Partner mit<br />
Jürgen Joedicke, v.l.n.r. Fritz<br />
Auer, Winfried Büxel, Jürgen<br />
Joedicke, Günter Behnisch,<br />
Erhard Tränkner, Carlo Weber,<br />
Oktober 1967<br />
50 51<br />
Denkmodelle zur Architekturlandschaft<br />
Die Architekten der Spiele
Impulse in den 1960er-Jahren<br />
Schon im Frühwerk von Günter Behnisch und ab<br />
1966 von B&P lassen sich Ansätze nachzeichnen, die<br />
als Impulse für die Wettbewerbsidee von München<br />
gelten können und deren spätere inhaltliche und<br />
gestalterische Ausformung andeuten. Die ersten<br />
Arbeiten lehnten sich deutlich an die Stuttgarter<br />
Lehre an und profitierten vom quantitativen Nachholbedarf<br />
der Nachkriegszeit. Einer der frühen Bauten,<br />
die Vogelsangschule in Stuttgart (1955–1961), ist<br />
ein charakteristisches Beispiel für die Reformideen<br />
dieser Zeit, bei der die Kerngedanken der<br />
Licht-Luft- Sonne-Bewegung und regionaltypische<br />
Bezüge zu einer Einheit verschmelzen. Die Schule<br />
entspricht ganz der zeittypischen Vision einer Durchdringung<br />
von Stadt und Natur, dem städtebaulichen<br />
Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt<br />
entsprechend. Die Charakteristika „fließender Raum“<br />
und „modellierte Landschaft“ sind hier schon deutlich<br />
zu erkennen. 14<br />
Bei der Planung für die Ingenieurschule in Ulm<br />
(1959–1963) forcierte Behnisch die industrielle Produktion<br />
als neue Baumethode, die den Wunsch nach<br />
Vollkommenheit und Perfektion in der Ausführung<br />
zu erfüllen schien. Aber auch schon hier lassen sich<br />
erste Anregungen für das olympische Landschaftskonzept<br />
ausmachen. Die Gestaltung des Geländes<br />
entstand in Zusammenarbeit mit Günther Grzimek,<br />
der von 1947 bis 1960 als Gartenamtsleiter in Ulm<br />
tätig war. Mit dem Thema der Freiraumplanung für<br />
Schulen hatte er sich während seiner gesamten<br />
praktischen Tätigkeit kontinuierlich befasst, 15 und<br />
aus den Planungen für Ulm entwickelte sich eine<br />
lang andauernde Zusammenarbeit zwischen beiden<br />
Büros. Der erste von Grzimek stammende Entwurf<br />
für das Gelände in Ulm orientierte sich noch streng<br />
an den orthogonalen Gebäudekanten, während im<br />
überarbeiteten, wesentlich von Behnisch + Lambart<br />
beeinflussten Entwurf 16 die Wege deutlich weicher<br />
geformt und auch enger an den ursprünglichen<br />
Wettbewerbsentwurf angelehnt waren. Das Aushubmaterial<br />
wurde zunächst im Süden des Grundstücks<br />
zwischengelagert. Weil die Reste der Festungsmauern<br />
am südlichen Grundstücksrand des Gaisenbergs<br />
die Sicht auf die Stadt versperrten, hatte Günther<br />
Grzimek die Idee, den Aushub liegen zu lassen und<br />
später als Hügel auszuformen, um einen freien Blick<br />
auf die Stadt zu erhalten. 17 Daneben wurde die bestehende<br />
Kiefernbepflanzung als vertikales Element<br />
bewusst in den Entwurf einbezogen und ergänzt. Mit<br />
einer geschwungenen Wegeführung aus Rasensteinen<br />
um den Hügel konnte der südliche Teil an den<br />
bestehenden öffentlichen Park angebunden werden.<br />
18 Andreas König konstatiert, dass die „konzeptionelle<br />
Strenge Grzimeks und Behnischs gestalterische<br />
Freiheit“ hier zum ersten Mal aufeinandertreffen<br />
und der Einfluss Behnischs als Initialzündung für<br />
eine erste gestalterische Umorientierung Grzimeks<br />
gelten kann. 19 Der Beginn dieser Zusammenarbeit<br />
war ein wichtiger Baustein für die Wettbewerbsidee<br />
der <strong>Olympia</strong>anlagen.<br />
1967 erhielt Behnisch aufgrund seiner Erfolge<br />
mit vorgefertigten Bauten und Typensystemen einen<br />
Ruf an die TU Darmstadt und trat die Nachfolge<br />
von Ernst Neufert an, dem international bekannten<br />
Fachmann für Normierungsfragen und Bauentwurfslehre.<br />
Zu diesem Zeitpunkt wollten Günter Behnisch<br />
und seine späteren Partner aber bereits neue Wege<br />
beschreiten. Ein Büroausflug im Juli 1963 in die<br />
Niederlande gab dazu entscheidende Impulse. 20<br />
Auf dem Programm standen neben den Bauten von<br />
Johannes van den Broek und Jacob Bakema vor<br />
allem zwei Sozialbauten von Johannes Duiker, 21<br />
welche die Architekten besonderes begeisterten.<br />
Das Sanatorium Zonnestraal in Hilversum und die<br />
Freiluftschule in Amsterdam zeigen eine licht-, luftund<br />
sonnendurchflutete Architektur, deren Leichtigkeit<br />
und Minimalprinzip in der äußeren Erscheinung<br />
großen Einfluss auch schon auf die Architektur der<br />
1920er-Jahre hatte. Dass gerade diese Bauten sich<br />
dauerhaft in Behnischs Gedächtnis einprägten, lag<br />
nicht nur an der äußeren Ästhetik des Transparenten,<br />
sondern auch daran, dass sie zudem mit einer<br />
sozialen Utopie verbunden waren. 22 Beeindruckend<br />
waren auch die auf dem Weg liegenden transparenten<br />
Gewächshäuser mit dünnen Metallprofilen, deren<br />
Ausdruck den Wandel zum Leichten bestärkten. In<br />
Diskussionen mit den Mitarbeitern festigte sich der<br />
gemeinsame Entschluss, die bisherige Forcierung<br />
des Bauens mit vorgefertigten Teilen und Systemen<br />
aufzugeben und sich neuen Schwerpunkten und Inhalten<br />
zuzuwenden. 23 Unmittelbarer Ausdruck dieser<br />
neuen Denkweise waren die ab 1966 mit minimierten<br />
dünnen Stahlskelettkonstruktionen geplanten Sporthallen<br />
in Waiblingen und Rothenburg o.d. Tauber. 24<br />
Die Außenanlagen des zugehörigen Gymnasiums in<br />
Waiblingen plante Günther Grzimek als bewussten<br />
Kontrast zum Gebäude. Gelände und Pausenbereiche<br />
legte er zum Teil in freien Formen dreidimensional<br />
wellenförmig an. Die Formen wurden nicht<br />
gezeichnet, sondern der Kies direkt vor Ort mit einem
16<br />
16<br />
Modell Hoch-Tiefpunktfläche,<br />
Frei Otto und Larry Medlin, 1964<br />
68 69<br />
Denkmodelle zur Architekturlandschaft<br />
Konstruktionsmodelle für Dachlandschaften
zu ermöglichen, entstand das Modell einer regelmäßigen<br />
Hoch-Tiefpunktfläche, gebaut von Ottos<br />
Mitarbeiter Larry Medlin, bestehend aus einem<br />
vorgefertigten Standardnetz mit der konstanten<br />
Maschenweite von 50 Zentimetern, das an den<br />
Hoch- und Tiefpunkten mit Seilschlaufen gespannt<br />
war. Dieser Schritt zu einem reinen Seilnetz war die<br />
grundlegende Konstruktionsidee für die Dächer von<br />
Montreal und München. 104<br />
Als Anregung für das Konzept des Deutschen<br />
Pavillons in Montreal entstand 1964 – noch bevor<br />
Frei Otto zum Wettbewerb eingeladen wurde – die<br />
Ideenskizze eines weitgespannten Dachs über einem<br />
innerstädtischen Park, die vorsah, die einzelnen<br />
Ausstellungspavillons unter diesem großen Dach<br />
zusammenzufassen. 105 Kurz nach Bekanntwerden<br />
der Zusage für die Olympischen Spiele an München<br />
wurde Frei Otto in einem Interview im September<br />
1966 gefragt, ob er sich ähnliche Großhüllen wie in<br />
Montreal auch für die Lösung einiger Bauaufgaben<br />
für die <strong>Olympia</strong>de vorstellen könne. Er bemerkte,<br />
dass man darunter „ein Schwimmbad, Kinderspielplätze,<br />
Sportanlagen inmitten einer Parklandschaft<br />
unterbringen kann. […] Ein Entwurfsgedanke, der<br />
Gutbrod und mir ganz besonders am Herzen liegt,<br />
wird in Montreal nur noch angedeutet sichtbar werden,<br />
nämlich die zusammenhängende grüne Parklandschaft,<br />
die den gesamten Pavillon durchziehen<br />
sollte, jene ‚Erholungslandschaft‘, in die die Exponate<br />
unaufdringlich eingefügt werden. Vielleicht ergibt<br />
sich an anderer Stelle einmal die Gelegenheit, daß<br />
sich dieser Gedanke zur vollen Entfaltung bringen<br />
lässt.“ 106<br />
Im April 1967 – kurz nach der Wettbewerbsausschreibung<br />
für die <strong>Olympia</strong>anlagen – zeichnete Otto<br />
ein „Stadion für 100.000 mit ausfahrbarem Dach“,<br />
das aus seinen Überlegungen zu wandelbaren,<br />
ausfahrbaren Konstruktionen hervorgegangen war.<br />
Der durch Erdwälle begrenzte, allseitig begehbare<br />
Innenraum konnte entsprechend den Witterungsbedingungen<br />
mit einem wandelbaren Dach geöffnet<br />
oder geschlossen werden. Eine raffbare Membran<br />
ist an einem 180 Meter hohen, über das Stadion geneigten<br />
Pylon aufgehängt und wird kegelförmig über<br />
abgespannte Seile zu 15 Fußpunkten geführt. Die<br />
geraffte, transluzente Haut kann bei Bedarf zu einer<br />
flachen Kuppel ausgefahren werden. Die Ideenskizze<br />
wurde Ende Mai 1967 als eine Weiterentwicklung der<br />
ausfahrbaren Dachkonstruktionen für das Theater in<br />
Cannes (1965), der Kunsteisbahn in Davos (1966/67)<br />
und der Stiftsruine in Bad Hersfeld (1970) veröffentlicht.<br />
Die Anwendungsmöglichkeiten übertrug Otto<br />
ausdrücklich auch auf ein „Stadion der <strong>Olympia</strong>größe“,<br />
das „in dieser Weise nach Wunsch abzuschließen,<br />
und wenn nötig, heizbar zu machen“ 107 sei.<br />
Die Ideenskizze steht in unmittelbarem zeitlichen<br />
Zusammenhang mit dem Wettbewerb für die<br />
<strong>Olympia</strong>bauten, obwohl zu diesem Zeitpunkt die<br />
Zeltdachlösung über der modellierten Landschaft<br />
bei B&P schon gezeichnet war. Sie erinnert ebenfalls<br />
an Tauts Volkshauszeichnung in Die Auflösung der<br />
Städte. Beide wollten ein vielseitig nutzbares, gesellschaftliches<br />
Zentrum für gemeinsame Freizeit- und<br />
Sporterlebnisse schaffen, das Otto noch durch eine<br />
wandelbare Hülle ergänzte. In einer weiterentwickelten<br />
Version wurde das Stadion über die Nutzung als<br />
olympische Sportarena hinaus als Zentrum für vielfältige<br />
Aktivitäten vorgestellt. „Der ständig steigende<br />
Bedarf unserer Gesellschaft nach erlebnisreicher<br />
Freizeitgestaltung erfordert Großräume, die variabel<br />
genug sind, sich verschiedenen Nutzungen anzupassen.<br />
[…] Ein olympisches Stadion mit beweglichen<br />
Tribünen wird von einer wandelbaren Dachhaut<br />
überspannt. Unterhalb der Tribünen ist Terrassenlandschaft,<br />
die vielfältig genutzt werden kann. […] So<br />
wird dieser Raum in ein Zentrum gesellschaftlicher<br />
Aktivitäten verwandelt.“ Es könne ein „Spiel- und<br />
Festival-, ein Multimediaraum für unzählige Freizeitaktivitäten“<br />
entstehen. 108 Die Übertragung der<br />
Idee einer flexiblen Großraumüberdachung auf ein<br />
Stadion in <strong>Olympia</strong>größe ist sicherlich dem Interesse<br />
der deutschen Architekten an der viel beachteten<br />
Wettbewerbsauslobung im Frühjahr 1967 geschuldet.<br />
Frei Otto hatte sich aber – in Absprache mit Rolf<br />
Gutbrod – ganz bewusst gegen eine Teilnahme entschieden.<br />
109 Er war der Aufgabenstellung <strong>Olympia</strong><br />
gegenüber generell kritisch eingestellt und bezeichnete<br />
sie später als „Kolossaltheater“. 110<br />
Den Wettbewerbsbearbeitern im Büro Behnisch<br />
– so die Aussage von Fritz Auer und Carlo<br />
Weber – war dieser im April 1967 in der Zeitschrift<br />
Bauwelt gezeigte Entwurf jedoch nicht bekannt und<br />
so konnte dessen Aussage noch nicht in eine für<br />
die Wettbewerbsarbeit taugliche Idee transformiert<br />
werden. 111 Sowohl Behnisch als auch die anderen<br />
Wettbewerbsbearbeiter waren aber mit Frei Ottos<br />
Gedankenwelt sehr vertraut. Den Architekten bekannte<br />
Beispiele waren die Stadt in der Arktis und<br />
die Stadt der Zukunft. 112 Der grundlegende Ansatz<br />
Ottos, Städte, Landschaften oder Arenen mit<br />
schützenden, transparenten Dächern zu überdecken<br />
und folglich nicht mehr geschlossenen Raum als
20<br />
Raumbegrenzungen, nur mit klimatisch notwendigen,<br />
absenkbaren Tüchern und Windschutzvorrichtungen<br />
versehen. Ein leichtes, weit schwingendes<br />
Zeltdach überspannt eine terrassenartig-unregelmäßige<br />
„Ausstellungslandschaft“ und wird durch eine<br />
kuppelförmige Holzkonstruktion für das Auditorium<br />
als drittes konstruktives und architektonisches<br />
Element vervollständigt. Schon hier hatte Egon Eiermann<br />
zunächst Zweifel an der Baubarkeit des Dachs<br />
geäußert. 127<br />
Planung und technische Besonderheiten<br />
Der Entwurf wurde zwischen der Wettbewerbsentscheidung<br />
im Juni 1965 und der Eröffnung im<br />
Sommer 1967 geplant und realisiert. Das Zeltdach<br />
überdeckte mit einem vorgespannten Seilnetz eine<br />
Grundfläche von knapp 8.000 Quadratmetern und<br />
war nach dem Prinzip des Hoch-Tiefpunktmodells<br />
an acht in festem Raster stehenden, verschieden<br />
hohen Masten aufgehängt. Das Netz bestand aus<br />
12 Millimeter starken, schwach gedrehten Seilen,<br />
die mit einer für die Begehung günstigen Maschenweite<br />
von 50 Zentimetern und festen Kreuzklemmen<br />
in Bahnen von 9,5 Metern vorgefertigt waren. Die in<br />
Deutschland präfabrizierten Netzflächen wurden vor<br />
Ort in Montreal am Boden zusammengefügt, mit der<br />
20<br />
Ansicht des Pavillons mit Lagune<br />
sogenannten Luftmontage über 54 Millimeter starke<br />
Grat- und Randseile an den Masten hochgezogen<br />
und die Zugkräfte in Betonanker abgeleitet. Die<br />
raumbegrenzende Schicht aus einer transluzenten<br />
Dachhaut wurde unter das tragende, vorgespannte<br />
Seilnetz gehängt und mit der Unterseite über sogenannte<br />
Federteller verbunden. Sie war hergestellt<br />
aus gewebtem und mit PVC beschichtetem<br />
Polyester gewebe und ebenfalls in 1,5 Meter breiten<br />
Bahnen vorgefertigt. 128<br />
Zur Ermittlung der genauen Geometrie, der<br />
geometrischen Konstruktionsdaten, des Zuschnitts<br />
sowie der Seilkräfte, der Verformungen und Dehnungen<br />
im Netz war ein aufwendiges Messmodell<br />
im Maßstab 1:75 aus feinen Stahldrähten von entscheidender<br />
Bedeutung. Messtechnik und Rechenprogramme<br />
für die photogrammetrische Aufnahme<br />
existierten noch nicht, deshalb wurde diese Methodik<br />
nur als ergänzendes, unabhängiges Verfahren hinzugezogen.<br />
Der Nachweis der Kräfte in dem mehrfach<br />
unbestimmten statischen System ließ sich jedoch<br />
nicht allein anhand von mathematischen Berechnungen<br />
vornehmen, sondern musste ergänzend am<br />
Modell gemessen werden. In diesem Punkt führte die<br />
Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren von L+A<br />
und Frei Ottos Team zu erheblichen Spannungen,<br />
weil die Zuschnittsabnahme der Modelle nicht genau<br />
21<br />
Auditorium mit Holzkuppel und<br />
Netz im Bau<br />
22<br />
Dachkonstruktion mit Blick auf<br />
die vorgelagerte Insel<br />
74 75<br />
Denkmodelle zur Architekturlandschaft<br />
Modell und Impuls
21<br />
22
7–8<br />
probiert wurden. 34 Er hatte die besondere Fähigkeit,<br />
die Idee der bewegten Geländemodellierung in den<br />
Skizzen und Zeichnungen präzise und verständlich<br />
darzustellen. „Wenn du im Team arbeitest“, so Carlo<br />
Weber, „musst du es so darstellen, dass der andere<br />
es nachvollziehen kann. Wenn ich einen roten, gelben<br />
und grünen Stift nehme und das Wasser blau mache,<br />
ist das eine Mehrarbeit von drei oder fünf Minuten,<br />
die ich in eine Skizze reinstecke. Aber plötzlich kann<br />
der Andere das nachvollziehen. Und deswegen,<br />
wenn es ideal läuft, können wir als Team zu einem<br />
Thema mehr schaffen als eine Person in einem Kopf.<br />
Das ganze Problem des Ein-Mann-Architekten ist es,<br />
alles in einem Kopf zu denken, während eine Gruppe<br />
von verschiedenen Seiten einsteigt, und dann kann<br />
ein höheres Niveau erreicht werden.“ 35<br />
Anschließend war für die Umsetzung der „Nichtarchitektur“<br />
auch ein Modell notwendig, an dem mit<br />
neuen, ungewöhnlichen Arbeitsmitteln die komplexe<br />
Modellierung des Geländes überprüft und anschaulich<br />
gemacht werden konnte. Auf einer großen, etwa<br />
1,5 x 2 Meter großen Tischplatte wurden im Maß-<br />
7–8<br />
Behnisch & Partner beim Besuch<br />
des Dziesięciolecia-Stadion<br />
(Stadion des 10. Jahrestages) in<br />
Warschau/Polen, 1968<br />
104 105<br />
Wettbewerb<br />
Bearbeitung des Wettbewerbs
9–10<br />
Das Pildammsteatern nördlich<br />
des Stadions in Malmö, 1968<br />
9–10<br />
stab 1:1.000 einige der Alternativen zunächst als<br />
Mulden und Erdbewegungen aus Sägespänen, dann<br />
aus Sand modelliert und daraus das zusammenhängende<br />
Landschaftsgeflecht geformt. 36 Da für<br />
die Vergleichbarkeit und Abwägung der Vor- und<br />
Nachteile der Umbau jeweils zu lange gedauert<br />
hätte, wurden die verschiedenen Lösungen von drei<br />
gleichen Standorten aus nach dem erstmaligen<br />
Aufbau mit der Polaroid-Kamera fotografiert, um die<br />
Auswahl zu erleichtern. 37 Zunächst konzentrierte<br />
das Wettbewerbsteam die Modellierung mithilfe der<br />
vom Schuttberg aufgenommenen Erdbewegung im<br />
Südteil des Geländes. Neben dem Trümmerschutt<br />
war auch der Aushub der bereits im Bau befindlichen<br />
U-Bahn auf dem Gelände gelagert. In einer<br />
folgenden Diskussion regte Behnisch an, auf der<br />
Basis der Erdstadien-Krater, die freie Formen im<br />
Schnitt erzeugten, das Thema Erdmodellierung auch<br />
im Grundriss weiterzuführen und mit dem Aushub<br />
weitere Bereiche zu modellieren. 38 So wurden die<br />
weich geschwungenen Bewegungen der Dämme<br />
vom Plateau in der Mitte ausgehend zu den vorgesehenen<br />
Verkehrsanschlusspunkten nach Nordosten<br />
(U-Bahn), Nordwesten (S-Bahn) und nach Süden<br />
(Tram) weitergeführt, um die Bereiche südlich und
26<br />
26<br />
Südvariante mit Konkretisierung<br />
des Dachs, Carlo Weber, Mai/<br />
Juni 1967<br />
27<br />
Wettbewerbsplan mit Verkehrsschema,<br />
Juli 1967<br />
108 109<br />
Wettbewerb<br />
Bearbeitung des Wettbewerbs
27
eckig wurde, während es vorher weiche, neubarocke oder Jugendstilformen gab.<br />
Mit einer Reiße können Sie anders zeichnen als mit einer Zeichenfeder. Wir haben<br />
das dann auch an unseren Arbeiten gesehen. Bauten, die mit Plastilin entworfen<br />
sind, werden anders aussehen als solche, die aus Pappe geschnitten sind. Oder<br />
aus Holzklötzchen.<br />
ES:<br />
Gab es ein konkretes Beispiel, an dem Sie das festgestellt haben?<br />
GB:<br />
Das war unsere eigene Erfahrung. Ob das die Finanzierungstechnik ist oder die<br />
Terminplanung, das drückt alles der Architektur einen Stempel auf, oder auch das<br />
Juristische, denn was heute entsteht, ist alles juristische Architektur. Die ist so<br />
gemacht, dass man nachweisen kann, dass man keinen Fehler gemacht hat. Wir<br />
haben damals, als wir das Modell für München entwickelt haben, eine große<br />
Platte genommen und Sand darauf gekippt. Sand ist das Material, das die wenigsten<br />
Eigengesetze hat, und daraus ist die landschaftliche Architektur geworden.<br />
ES:<br />
Es entsteht ja auch heute schon wieder eine andere, vielleicht neue Architektur<br />
mit dem Computer. Sehen Sie da wieder eigene Gesetzmäßigkeiten?<br />
GB:<br />
Das eine ist sehr zwanghafte Architektur, aber mit neuen, anderen Zwängen als<br />
früher. Ich war vor Kurzem in Amerika, in einem großen Büro in New York, und die<br />
haben immer von „Deadline“ gesprochen, wir haben heute Abend „Deadline“. Ich<br />
habe gefragt: „Wer stirbt denn?“ Und sie sagten: „Nein, nein, wir müssen bis dahin<br />
die Werkpläne fertig haben!“ Das sind diese Terminplanungen, da kann nichts<br />
mehr ausreifen, sondern es muss immer zu der „Deadline“ jedes Detail zack, zack<br />
entstehen, und das sieht man den Dingern ja auch an. Klar, der Computer reproduziert<br />
ja Vorentwickeltes, man kann das Detail vielleicht ein kleines Stückchen<br />
damit weiterentwickeln. Wenn Sie die CAD-Grundrisse anschauen, da sind die<br />
Treppen vorgeprägt von irgendeinem Idioten, der in irgendeinem Büro saß und<br />
den wir uns nie ins Büro nehmen würden. Und plötzlich kommt durch den Computer<br />
ein schlechter Mitarbeiter ins Büro. Das gibt es bei uns gar nicht, der wird<br />
rausgeschmissen. Bei uns ist eine computerfreie Zone, nur die Sekretärin muss<br />
einen Computer haben.<br />
ES:<br />
Was halten Sie denn von den Theorien, ein Computer könne sogar über<br />
Zufallsgeneratoren entwerfen?<br />
GB:<br />
Es kommt darauf an, wie Sie es machen. Ich glaube schon, dass man, wenn man<br />
den Computer beherrschen könnte, damit sicherlich ein neues Formenrepertoire<br />
findet. Und man müsste einen guten Computermann haben, der das wirklich<br />
weiterentwickeln kann. Ich kann das nicht. Wir benutzen Computer schon für<br />
Grafiken und so weiter. Nur möchte ich nicht, dass sie das Geschehen in unserem<br />
Büro bestimmen. In der Chaos-Diskussion wird aber deutlich, dass gerade das<br />
nicht rationell Bearbeitete viele unbewusste Einflüsse in die Arbeit hineinlässt,<br />
Dinge, an die man selbst gar nicht gedacht hat. Schiller hatte zu Goethe gesagt,<br />
dass alles, was er [Goethe] schreibt, in seiner Intuition liegt, dass in ihm die Natur<br />
geschrieben hat, nicht er selbst. Und das ist in der Architektur genauso, man<br />
schreibt oder man zeichnet, da rutschen einfach Dinge hinein, die man rational<br />
nicht geplant hat. Insofern ist die Architektur natürlich vielfältiger, lebendiger,<br />
überraschender, wenn sie nicht mit dem Computer gemacht wird, und es bringt<br />
dich selbst weiter.<br />
128 129<br />
Im Gespräch<br />
Günter Behnisch
ES:<br />
Die Jahre 1967/68 waren für Sie gekennzeichnet durch die Parallelität von<br />
mehreren Ereignissen. Eine gesellschaftliche Aufbruchsstimmung kündigte<br />
sich an, Sie traten in Darmstadt die Nachfolge von Ernst Neufert am Lehrstuhl<br />
für Baugestaltung und Industriebaukunde an und haben den Wettbewerb<br />
für München gewonnen. Wie war das alles zu bewältigen?<br />
GB:<br />
Das war natürlich eine sehr große Belastung, ich war zeitlich sehr unter Druck. Ich<br />
hatte das Büro in Stuttgart und in München und musste in Darmstadt den Lehrstuhl<br />
übernehmen, und in der Zeit haben auch meine gesundheitlichen Probleme<br />
angefangen. Davor hatte ja Neufert den Lehrstuhl, und es war klar, dass ich nicht<br />
mit Bauordnungslehre weitermache, dass die Lehre verändert werden muss. Es<br />
war auch besprochen, dass ich das nach meinen Vorstellungen machen konnte.<br />
ES:<br />
Wie haben Sie denn in Darmstadt auf die 68er-Bewegung reagiert, wie haben<br />
sich die sicherlich auch dort stattfindenden Studentenproteste ausgewirkt?<br />
GB:<br />
Ich wurde ja gleich mit den Reformen und den 68er-Problemen konfrontiert. Und<br />
ich habe mich schon am Anfang dagegengestellt, vor allem dagegen, dass mit<br />
dieser Bewegung plötzlich Leute aufsteigen wollten. Das war der sogenannte<br />
Mittelbau, der Assistent wollte Professor sein. Und dann habe ich gesagt: „Macht<br />
doch erstmal eure Promotion oder macht euch sonst irgendwie einen Namen,<br />
dann geht’s schon weiter.“ Es hat auch dazu geführt, dass plötzlich die Professo-<br />
1<br />
Olympische Brezeln für<br />
Behnisch & Partner: Bäckerin<br />
Treiber, Günter Behnisch, Erhard<br />
Tränkner, Carlo Weber, Fritz<br />
Auer (hinten), Hermann Peltz,<br />
Frau Motzer, Armin Gsell (vorne),<br />
Oktober 1967<br />
1
hatte zu nachhaltigen Spannungen und Differenzen<br />
geführt, die auch Jahre später nicht ausgeräumt<br />
waren. In einer Nachbetrachtung sah Frei Otto die<br />
mangelnde Anerkennung seiner Arbeit „in dem<br />
dümmsten Kompetenzgerangel begründet, das es<br />
im Bauwesen seit der Teilung in Berufsgruppen der<br />
Architekten und Ingenieure gab“. 165 Er hatte versucht,<br />
bei den Detailentscheidungen des Seilnetzes<br />
seine erprobten Lösungen einzubringen, um die<br />
Risiken der Neuentwicklungen für die komplizierte<br />
Konstruktion zu minimieren. Fritz Leonhardts und<br />
Jörg Schlaichs Ziel war es, ein Baukastensystem aus<br />
möglichst wenigen Sonderelementen zu realisieren,<br />
das mit vielen gleichartigen und auch rationell in Serie<br />
zu fertigenden Teilen im Sinn einer ästhetischen<br />
Einheit wirkt.<br />
Formfindung und Zuschnitt<br />
Arbeiten am Modell<br />
Während die technischen Fragen hauptsächlich<br />
zwischen den Ingenieuren von L+A und Frei Otto<br />
verhandelt wurden, arbeiteten B&P beim Entwurf der<br />
Netzgeometrie eng mit dem IL zusammen. Auch hier<br />
gab es grundsätzlich verschiedene Planungs- und<br />
Denkansätze, die in anhaltenden Auseinandersetzungen<br />
zu Tage traten. Bei Otto stand die Suche nach<br />
einer unbekannten Form entsprechend den Eigenschaften<br />
von Zeltstrukturen im Vordergrund – gefunden<br />
in einem Formbildungsprozess unter der Berücksichtigung<br />
von naturwissenschaftlicher Analyse.<br />
Bei Behnisch dagegen überwogen formal-konzeptionelle,<br />
aber auch ganz praktisch-funktionale Überlegungen<br />
wie angemessene Raumhöhen und Dachneigung,<br />
Beheizbarkeit und Fassadenanschlüsse. Alle<br />
Teile des Dachs sollten möglichst weitgehend den<br />
übergeordneten Ideen des Gestaltungskonzepts –<br />
spielerisch, schwungvoll, leicht – entsprechen. Dazu<br />
gehörte zum Beispiel, die Materialität der transparenten<br />
Dachhaut und die Dimension des Dachs auf<br />
Augenhöhe des Menschen erlebbar zu machen, um<br />
den großen Konstruktionsteilen die Schwere und<br />
Distanz zu nehmen. Die Dachfläche sollte deshalb<br />
möglichst weit bis zum Boden heruntergezogen und<br />
bodennahe Details wie unter anderem die Entwässerung<br />
mussten sorgfältig überlegt werden.<br />
Frei Otto und das IL hatten im Juli 1968 mit dem<br />
Bau der Tüllmodelle für die erste Phase der Formfindung<br />
und etwas später, Anfang 1969, mit dem Bau<br />
174 175<br />
Dach<br />
Formfindung und Zuschnitt
32<br />
Modellbauarbeiten der<br />
Arbeitsgruppe Dach des IL<br />
am großen Tüllmodell im<br />
Baubüro von Behnisch & Partner,<br />
Projektleiter Ulrich Hangleiter<br />
mit Mitarbeitern<br />
32
ES:<br />
Was war denn der stärkere Antrieb?<br />
KL:<br />
Das war natürlich die neue deutsche Situation. Es gab die neuen, interessanten<br />
architektonischen Vorstellungen von Behnisch, Eiermann und Aicher. Die Generation<br />
der Davongekommenen wollte ein anderes Lebensgefühl vermitteln – mit<br />
Offenheit, Heiterkeit und Gelassenheit. Wir bekamen Karten, und ich war mit<br />
meinen Söhnen bei der Eröffnung, als Kurt Edelhagen dort seine Lieder spielte,<br />
mit den Peitschen und so weiter. Uns sind die Tränen gekommen. Dieses Bauwerk,<br />
diese künstliche Landschaft waren unglaublich gelungen, und dann kamen<br />
die Mannschaften hereinmarschiert – ich war hin und weg! Ich bin in das Institut<br />
gekommen und habe gesagt: „Diese <strong>Olympia</strong>de gibt mir meinen Glauben an die<br />
Menschen wieder!“ Es war unvorstellbar, wie das gewirkt hat. Das ist übergesprungen,<br />
wie man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und die Leute<br />
saßen in der Landschaft! Es war keine große Verbrüderung, aber es war wirklich<br />
das Ambiente – das war einmalig. Für Behnisch war das ein unglaublicher Erfolg.<br />
Als damals der Hochsprung der Damen war, gab es eine deutsche Teilnehmerin –<br />
Ulrike Meyfahrt. Der Wettkampf ging bis spät in die Nacht. Wir hatten auch Karten,<br />
und als sie Anlauf nahm, da schallte von der Tribüne her ein deutliches „Hopp“,<br />
und das brachte sie total aus dem Konzept. Es entstand eine Massenablehnung,<br />
ein Pfeifen, ein Zornesausbruch dieses ganzen Stadions, der eindeutig auf diesen<br />
„Hopp-Schrei“ gemünzt war. Und dann kehrte wieder diese friedvolle Stimmung<br />
ein, und sie gewann ja dann auch noch irgendwann.<br />
ES:<br />
Wie konnten denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie mit diesem<br />
neuen Verfahren gewonnen hatten, später genutzt werden? Wie ist der<br />
Stand der Entwicklung heute?<br />
KL:<br />
Das hatte gewaltige Auswirkungen. Die Kraft-Dichten haben jetzt – nach einer<br />
Inkubationszeit von ungefähr 20 Jahren – eine Enkelgeneration von jungen Wissenschaftlern<br />
in Frankreich, Italien, Brasilien, in den Niederlanden, sogar in China<br />
und neuerdings in Zürich hervorgerufen. Und die Entwicklung ist noch nicht ganz<br />
zu Ende. Ich habe gewisse Dinge, die noch veröffentlicht werden müssen, und es<br />
gibt immer noch Leute, die daran arbeiten. Um einige Beispiele zu nennen: Schüler<br />
von mir haben die Allianz-Arena in München 2005 gemacht. Das Dach des<br />
<strong>Olympia</strong>stadions in Montreal 1976 mit dem herabhängenden Dach ist zusammen<br />
mit Jörg Schlaich entstanden, die Sporthalle in Jeddah 1981 mit Ted Happold,<br />
Michael Dickson, Ian Lidell und Ove Arup und das Solemar in Bad Dürrheim 1987<br />
mit dem Ingenieur Fritz Wenzel. Bei der Multihalle in Mannheim 1975 hat unser<br />
Büro Linkwitz-Preuss Frei Ottos umgekehrtes Hängemodell mithilfe unseres<br />
Verfahrens der Kraft-Dichten vermessen und in eine exakte Gleichgewichtsfigur<br />
umgesetzt.<br />
Im Gespräch mit Elisabeth Spieker am 26. Januar 2012 und 7. März 2013<br />
202 203<br />
Im Gespräch<br />
Klaus Linkwitz
3<br />
Vorgespanntes Netz nach der<br />
Montage, Herbst 1971<br />
3
50–54<br />
Sonnenfundament: Karla<br />
Kowalski bemalt das<br />
Schwergewichtsfundament<br />
des Stadionrandkabels, bevor<br />
es unter den Erdmassen der<br />
Landschaft verschwindet.<br />
208 209<br />
Dach
50–54
68<br />
68<br />
Hochziehen und Spannen des<br />
Netzes über dem Stadion, 1971<br />
Dach<br />
69–70<br />
Spannvorgang bei der Sporthalle,<br />
1971<br />
71–73<br />
Eindeckungsarbeiten bei<br />
der Schwimmhalle, 1972: Die<br />
Montage erfolgt direkt auf dem<br />
Seilnetz. Die Fugen sind mit ca.<br />
13 Zentimeter breiten Neoprene-<br />
Gummiprofilen geschlossen und<br />
über Aluminiumschienen an die<br />
Plattenränder geklemmt.<br />
69<br />
216 217<br />
Ausführung und Montage
70<br />
71–73
75<br />
Provisorische Tribüne an der<br />
Ostseite der Schwimmhalle, 1972<br />
222 223<br />
Dach<br />
Ausführung und Montage
75<br />
der verschweißt sind. Als Oberseite umschließt eine<br />
kastenförmige PVC-Folie den gesamten Kern und ist<br />
mit der Unterseite an den Rändern verschweißt. Die<br />
vorgefertigten 8 x 2 Meter großen Einzelstücke mit<br />
einer Stärke von 10 Zentimetern in der Sport- und<br />
14 Zentimetern in der Schwimmhalle wurden vor der<br />
Montage zu Fertigungseinheiten von 200 Quadratmetern<br />
zusammengefügt und dann vor Ort zu durchschnittlich<br />
1.000 Quadratmeter großen Abschnitten<br />
durch geschnürte Stöße geschlossen. Für die<br />
Aufhängung entwickelte Frei Otto kleeblattförmige<br />
Teller aus mit Kunststoff überzogenem Federstahl, an<br />
denen – gleichmäßig verteilt – die Abschnitte über<br />
Seile hochgezogen, am Seilnetz befestigt, untereinander<br />
verschnürt und gespannt wurden. 245<br />
Jedoch zeigte sich Mitte August 1971 schon<br />
vor der Montage an den gelagerten und noch nicht<br />
eingebrachten Platten die Anfälligkeit des Dämmmaterials<br />
gegen Hitze, sichtbar durch Schrumpfungen<br />
und Verfärbungen. 246 Nach der Fertigstellung<br />
der Montage traten Anfang 1972 erste Schäden auch<br />
an der montierten Decke auf, da sich aufgrund der<br />
teilweise auf bis zu 100 ºC ansteigenden Temperaturen<br />
im Dachzwischenraum die Isolierkerne braun<br />
verfärbten und stark schrumpften. Die U-Decke war<br />
entgegen den vom Forschungsinstitut für Wärmeschutz<br />
München empfohlenen und untersuchten<br />
weißen Mustern mit einer klar durchsichtigen Oberplane<br />
ausgeführt worden, was wesentlich höhere<br />
Temperaturen zu Folge hatte. Verstärkt wurde das<br />
vermutlich materialbedingte Problem durch die zu<br />
gering dimensionierten Lüftungsschlitze und die<br />
nicht ausreichende Belüftung. Noch vor der Eröffnung<br />
der Spiele sollten zusätzlich eingebaute,<br />
mechanische Entlüftungsgeräte und vergrößerte<br />
Öffnungen die Temperatur senken, was aber in<br />
dem gewünschten Maß nicht gelang. Aufgrund<br />
der fehlenden Schutzwirkung des Kerns kam es zu<br />
einem erheblichen Festigkeitsabfall, vor allem an den<br />
Nahtverbindungen der Tragefolie. Sanierungsmaßnahmen<br />
konnten jedoch erst nach den Olympischen<br />
Spiele ergriffen werden. 247<br />
Die OBG strebte 1973 zunächst ein Beweissicherungsverfahren<br />
zur Klärung der Ursachen an,<br />
verpflichtete dann aber die Firma Kaefer zur Behebung<br />
der Mängel und sicherte ihr eine Kostenbeteiligung<br />
von 50 Prozent zu. Ohne Inanspruchnahme<br />
der vollen Gewährleistung und weitgehend ohne<br />
Beteiligung von Frei Otto, Wilhelm Schaupp und B&P,<br />
also ohne Berücksichtigung der gestalterischen<br />
Grundsätze und Urheberrechte, suchte Mertz mit
ES:<br />
Welche Aufgaben hatte Fritz Leonhardt als Bürochef? Konnte er sich bei allen<br />
seinen Aufgaben überhaupt zeitlich engagieren?<br />
JS:<br />
Leonhardt war sehr großzügig, indem er mir freie Wahl bei der Auswahl der Mitarbeiter<br />
ließ. Ich durfte das Team innerhalb von L+A zusammenstellen, damit es<br />
funktioniert: Rudolf Bergermann für das Stadiondach, Knut Gabriel für das Sporthallendach,<br />
Ulrich Otto für das Schwimmhallendach, Karl Kleinhanß für die Zwischendächer<br />
und Günter Mayr für die Konstruktion, der wichtigste Mann beim<br />
Dach. Die Auswahl kam zustande, weil natürlich alle sehr gut waren, weil wir uns<br />
sehr gut verstanden haben, obwohl wir alle doch sehr unterschiedlich waren.<br />
Leonhardt war zu der Zeit Rektor an der Universität in Stuttgart und hat sich<br />
zunächst kaum beteiligt, sondern sein Partner Kuno Boll. Irgendwann hat er dann<br />
Herrn Boll abgelöst, aber er konnte es sich als Rektor überhaupt nicht leisten, am<br />
Projekt teilzunehmen. Dann kam diese unglückliche Situation, dass der Chef der<br />
OBG, Carl Mertz, insistiert hat, dass Herr Leonhardt alle vier bis sechs Wochen<br />
einmal in München erscheint. Obwohl das gar keinen Sinn machte, denn Leonhardt<br />
war ja gar nicht mehr in die Details involviert. Ich hatte einen guten Kontakt<br />
zu Herrn Mertz. Er hat mich akzeptiert, weil auch Günter Behnisch mich und uns<br />
akzeptiert hat und auch zu Fritz Auer ein sehr freundschaftliches Verhältnis bestand<br />
und besteht. Aber er sagte mir dann ganz offen: „Ich bin Beamter, ich bin<br />
Sachverwalter, aber kein Fachmann, und ich muss damit rechnen, dass alles<br />
schiefgeht. Jeder sagt, das Dach ist etwas ganz Neues, so etwas gab es noch nie.<br />
Dann wird man mir den Vorwurf machen, dass ich das in den Sand gesetzt habe.<br />
Deshalb muss ich jeden Monat in meinen Kalender eintragen können: ‚Leonhardt<br />
was here.‘ Leonhardt ist der bedeutendste und bekannteste Ingenieur – nehmen<br />
Sie es mir nicht übel, junger Mann, das sind Sie nicht –, und wenn ich reinschreiben<br />
kann, ich habe den bedeutendsten Ingenieur alle vier Wochen hier gehabt,<br />
dann kann mir nichts passieren.“ Und das, obwohl der ja gar nicht genau wusste,<br />
was gerade im Einzelnen läuft. Das hat dazu geführt, dass an dem Tag, an dem<br />
Leonhardt kam, Probleme aufgeworfen wurden, bei denen eine Entscheidung<br />
getroffen werden musste. Ein typisches Beispiel dafür war die Einführung des<br />
Neoprenepuffers als Verbindungselement von Seilnetz und Plexiglas. In seiner<br />
Autobiografie steht dann, das Detail sei von ihm gemacht. Die Idee stammte aber<br />
nicht von ihm, sondern von einem ganz cleveren Ingenieur aus der Mannschaft<br />
der ARGE Lichtdach. Er hat nicht viel Einfluss genommen, aber mir sehr viel<br />
Rücken deckung gegeben und uns bestärkt, dass das, was wir machen, kein Blödsinn<br />
ist. Das ist schon auch sehr wichtig.<br />
ES:<br />
Behnisch hat Ihnen sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Er hat gesagt,<br />
wenn er jemandem zutraut, das Dach zu bauen, dann Ihnen. Wie war seine<br />
Rolle, sein Einfluss auf das Dach-Team?<br />
JS:<br />
Behnisch hatte eine stattliche Gruppe von zwölf Leuten, dazu kamen Fritz Auer,<br />
Winfried Büxel und Cord Wehrse. Er hat sich dabei nie in das Tagesgeschäft eingemischt,<br />
hat sich dazugesetzt, hat Auer geholt oder mich, um seine Wünsche<br />
mitzuteilen, und dann ging er wieder. Er hat sich patriarchalisch über das Ganze<br />
gespannt, sich aber nicht so sehr in Einzelheiten eingemischt, gerade bei der<br />
Auseinandersetzung um das Dach, wo Fred Severud und andere dazu geholt<br />
wurden. Das war eine harte Zeit, mich der Kritik und den Gutachten ausgesetzt zu<br />
sehen, gerade in Bezug auf den Punkt, mit dem man alles ruinieren kann – den<br />
Schwingungen. Wir haben damals gesagt, das kann gar nicht schwingen, weil es<br />
Montagevorgang Seilnetz<br />
Sporthalle:<br />
1<br />
Phase I: Das am Boden<br />
ausgelegte Netz N ist mit den<br />
Gußteilen G verbunden. Der<br />
Hauptmast M ist schon mit den<br />
endgültigen Abspannseilen A,<br />
die kleinen Maste m mit der<br />
unterspannten Stütze U sind mit<br />
Hilfsabspannungen H aufgestellt.<br />
2<br />
Phase II: Die Gußsättel G2 und<br />
G3 werden mit Kranen oder<br />
Hilfszügen Z auf den Mast<br />
m2 und die Stütze U gesetzt,<br />
wobei ein Teil des Netzes N mit<br />
hochgezogen wird.<br />
3<br />
Phase III: Der Außenmast m1<br />
wird aufgestellt. Die Stütze mit<br />
G2 und der Sattel G4 werden<br />
mit dem angeschlossenen<br />
Netz angehoben. Dazu werden<br />
Hilfsseile V zur Verlängerung der<br />
Litzenbündel L über den Kopf des<br />
Hauptmasts gezogen.<br />
4<br />
Phase IV: Der Gußsattel G5<br />
wird auf m3 gesetzt. Die<br />
Litzenbündel L werden im<br />
Mastkopf eingehängt. Der Mast<br />
M1 wird nach außen gekippt.<br />
Damit beginnt der eigentliche<br />
Spannvorgang.<br />
238 239<br />
Im Gespräch<br />
Jörg Schlaich
1–4
16<br />
17<br />
18<br />
19–22<br />
16<br />
Lagerung von Lindenbäumen in<br />
Gärfässern<br />
17<br />
Transport der Bäume mit<br />
Baufahrzeugen<br />
18<br />
Arbeitsskizze zur Umsetzung von<br />
Wegkreuzungen, Carlo Weber,<br />
18. Februar 1970<br />
19–22<br />
Landschaft im Bau, 1969–1971<br />
264 265<br />
Landschaft<br />
Ausführung der Arbeiten
Ausfallstraßen Landshuter Allee, Landshuter Straße<br />
und Dachauer Straße waren in der Nachkriegszeit die<br />
für die Münchner Alleen charakteristischen und von<br />
Grzimek benötigten Lindenbäume gepflanzt worden.<br />
Josef Wurzer hatte die Idee, etwa die Hälfte der viel<br />
zu dicht stehenden Bäume entfernen zu lassen, um<br />
sie für das Oberwiesenfeld verwenden zu können. In<br />
halbierten Bierfässern von bis zu 7 Metern Durchmesser,<br />
zur Verfügung gestellt von den Münchner<br />
Brauereien, ließ er die bis zu 2 Meter umfassenden<br />
Stämme im Bereich südlich des <strong>Olympia</strong>bergs<br />
zwischenlagern und später auf dem Gelände für die<br />
Rasterpflanzungen wieder einsetzen. 46 Da die Pflanzen<br />
zu einem beträchtlichen Teil aus den eigenen Beständen<br />
stammten, lagen also Leitung, Ausführung<br />
und Lieferung in einer Hand. Insgesamt wurden etwa<br />
3.000 Bäume und 180.000 Gehölze gepflanzt, 47 aus<br />
einer Spezialmischung von 800 Zentnern Grassamen<br />
wuchsen 180.000 Quadratmeter Rasen. 48<br />
Im Juli 1969 lag der Vorentwurf, im September<br />
1969 der überarbeitete Entwurf für die Landschaftsgestaltung<br />
vor. Die freien Modellierungen<br />
von Hügeln, Mulden, Wällen und die Wegeführungen<br />
mit breiten Massen- sowie schmalen Seitenwegen<br />
und Trampelpfaden waren nun grob aufgezeichnet.<br />
Viele Elemente ließen sich jedoch nicht im Plan vorgegeben.<br />
Um genau auf die Situation des Geländes<br />
reagieren zu können, mussten die Modellierungen<br />
in intensiver Abstimmung zwischen Weber, Grzimek<br />
und Wurzer direkt vor Ort gelöst und zusammen mit<br />
den Baggerführern endgültig geformt werden. 49<br />
Behnisch und Grzimek waren sich bei fast allen<br />
Überlegungen einig. Konflikte gab es jedoch bei<br />
dem Vorschlag, die Linden in Form von Alleen und<br />
in geometrischem Raster zu pflanzen, was Behnisch<br />
zu ordentlich war. Er hatte sich eine natürliche und<br />
gewachsene Optik für alle Baumgruppen vorgestellt,<br />
ließ sich dann aber überzeugen. 50 Reibungspunkte<br />
und Meinungsverschiedenheiten entstanden, wenn<br />
um das optimale Ergebnis gerungen werden musste.<br />
So kam es häufig vor, dass bereits geformte Modellierungen<br />
wieder verändert werden mussten, wenn<br />
sie nicht dem übergeordneten Konzept entsprachen,<br />
wenn bessere Lösungen gefunden wurden oder die<br />
noch nicht festgelegten Dachverankerungen Umplanungen<br />
notwendig machten. Erdmassen mussten<br />
vielfach abgetragen, wieder aufgeschüttet, erhöht,<br />
vertieft oder abgeflacht werden, um Blickbeziehungen<br />
zur Stadt oder Durchblicke zu anderen markanten<br />
Punkten zu erreichen. Auch am bestehenden<br />
Berg waren Anpassungen notwendig. Es war sehr<br />
hilfreich, das „organische Prinzip“ mit freien Formen<br />
konsequent einzuhalten, da es gegenüber orthogonalen<br />
Strukturen leicht Veränderungen ermöglichte<br />
und die spätere Einfügung der Fundamente und<br />
Konstruktionen für das Dach wenig Probleme bereitete.<br />
51 Gerade im Bereich der Landschaftsplanung<br />
stellte es sich als unerlässlich heraus, erst während<br />
des Bearbeitungsprozesses Entscheidungen zu treffen<br />
und dabei in wechselseitigem Wissensaustausch<br />
und in Diskussionen die bestmögliche Lösung zu<br />
erarbeiten.<br />
Um möglichst naturnahe Wege zu erhalten,<br />
sollte das Grün beidseitig sehr dicht anschließen.<br />
Deshalb wurden Pflasterreihen mit Fugen versehen,<br />
Wege aus dem Gelände „herausgeschnitten“ und<br />
dann der Einschnitt durch Anböschen wieder angepasst.<br />
Ein anderer „Trick“ war, die Parallelität an besonders<br />
wirksamen Stellen zu stören, zum Beispiel<br />
dort Buckel einzufügen, Pflanzen einzubinden oder<br />
das Pflaster in die Grünflächen zu ziehen. 52 So war<br />
es notwendig, Passagen oder Kreuzungen, die über<br />
eine Länge von beispielsweise 10–20 Metern linear<br />
gepflastert und mit eckigen Pflastersteinen als geometrisch<br />
„saubere“ Rundungen ausgeführt waren,<br />
wieder herauszureißen und neu zu verlegen. Bei den<br />
gemeinsamen Baustellenbegehungen mit den ausführenden<br />
Firmen hielt Carlo Weber die Korrekturmaßnahmen<br />
zumeist in Arbeitsskizzen fest, stimmte<br />
sie dann mit Grzimek ab, und seine Mitarbeiter<br />
setzten sie um. So schlug er beispielsweise vor, die<br />
Wegkreuzungen „unkonventionell, überraschend<br />
[als] Folge von Bereichen“ 53 anzulegen. Es war<br />
jedoch schwierig, die von B&P gewünschten, nicht<br />
linearen Wegeführungen und die damit verbundenen<br />
Änderungen bei den Firmen durchzusetzen.<br />
Weber schilderte als weitere Problematik bei der<br />
Zusammenarbeit, dass das Grzimek-Team die sich<br />
während der Ausführung ergebenden Umplanungen<br />
des Behnisch-Teams häufig nicht akzeptierte und<br />
alle Entscheidungen immer erst mit Grzimek besprechen<br />
musste. 54<br />
Die „harten, kurzfristigen Kontroversen, die zur<br />
Absteckung des Handlungsspielraums beitrugen“<br />
führte Günter Hänsler aus Grzimeks Team aber auch<br />
darauf zurück, dass „Persönlichkeiten verschiedenster<br />
Neigung, Fähigkeit und Kenntnis am Werk<br />
waren, die meist noch nie zusammengearbeitet<br />
hatten“. 55 Christoph Valentien, Landschaftsarchitekt<br />
und ab 1980 Inhaber des Lehrstuhls für Landschaftsarchitektur<br />
an der TU Weihenstephan, betonte<br />
rückblickend, dass die Gestaltung ohne die enge
24<br />
Landschaft<br />
25<br />
270 271<br />
Charakteristische Situationen und Elemente
26<br />
24<br />
Theatron mit Sitzstufen am<br />
nördlichen Ufer, 1972<br />
25<br />
Übergang von der Rasenböschung<br />
zu den Stufen des<br />
Theatrons, 1972<br />
26<br />
Südliches Seeufer mit<br />
Sumpfwiese und Blick auf<br />
die provisorische Tribüne der<br />
Schwimmhalle, 1972
58–60<br />
Restaurant Nord: Zugangsrampe,<br />
Biergarten und Speisenangebot,<br />
Behnisch & Partner mit Domenig<br />
und Huth, 1972<br />
286 287<br />
Landschaft<br />
Temporäre Architektur und Besucherversorgung
58–60
Pavillon in der Schwimmhalle<br />
Günther Domenig und Eilfried Huth waren ebenfalls<br />
für die Cafeteria in exponierter Lage im Eingangsbereich<br />
der Schwimmhalle beauftragt. Sie konzipierten<br />
eine frei begehbare, organische Plastik, die mit einer<br />
Eingangsrampe durch die Fassade griff und so auch<br />
direkt von außen betreten werden konnte. Der Pavillon<br />
mit etwa 75 Plätzen, Getränkeausgabe, Küchenund<br />
Vorratsräumen, sanitären Anlagen und internem<br />
Versorgungslift war zunächst aus Kunststoff geplant,<br />
was aber an den Brandschutzvorschriften scheiterte.<br />
Die Architekten entschieden sich für eine tragende<br />
Primär- und eine formgebende, geschweißte Sekundärkonstruktion<br />
aus gebogenem Rundstahl mit einer<br />
Verkleidung aus nichtrostendem Chromnickelstahlgewebe.<br />
111 Auch hier waren die Klimaanlage und die<br />
Lüftungsrohre offen sichtbar belassen und rotviolett,<br />
die Stahlkonstruktion hellblau lackiert. Die aufgeständerte,<br />
pilzartige Struktur wirkte wie ein riesiges<br />
Geflecht aus Organen, Rippen und Gefäßen, die von<br />
einer Haut umfasst waren. Carlo Weber beschrieb sie<br />
als ausgemagertes Gerüst aus Stahlrohren, überzogen<br />
mit Hühnerdraht, was die Möglichkeit bot, vollkommen<br />
freie Formen herzustellen. 112 Der Pavillon<br />
„sollte ein besonderer Ort werden, ein Anspruch, der<br />
uns, Domenig und mich, wochenlang herausforderte<br />
und unsere ganze Energie bis tief in die Nacht mit eindringlichen<br />
Diskussionen beanspruchte. Das Ergebnis,<br />
eine Art Tagtraum, waren dann die ersten Skizzen,<br />
die später ‚geometrisiert‘ wurden und über Zeichnungen<br />
zu Modellen führten“, 113 so Eilfried Huth.<br />
Der Münchner Pavillon zeigt eine formale<br />
Ähnlichkeit zur Trigon-Struktur, die auch Günther<br />
Domenig selbst anspricht, ebenso wie zum Innenraum<br />
der Z-Bank in Wien-Favoriten. 114 Beide bestehen<br />
aus organhaften Strukturen, die betreten<br />
werden können – in Graz über einen spiralförmig um<br />
die zentrale Kugel gelegten Schlauch, umhüllt mit<br />
einer dünnen Membran, in München mit schlauchähnlichen<br />
Rampen, umwickelt mit Drahtgeflecht.<br />
Aber auch ihre Nähe zum österreichischen Künstler-<br />
Architekten Friedrich Kiesler mit seinem Endless<br />
House ist unübersehbar.<br />
288 289<br />
Landschaft<br />
Temporäre Architektur und Besucherversorgung
61<br />
Pavillon in der Schwimmhalle<br />
im Bau, Gerüststruktur ohne<br />
Verkleidung, Domenig und Huth,<br />
1972<br />
61
21<br />
Auswahl an Informationspiktogrammen<br />
und 21 Sportpiktogramme,<br />
Otl Aicher. Die digitale<br />
Version der Piktogramme ist von<br />
den analogen Handzeichnungen<br />
1972 leicht abweichend.<br />
348 349<br />
Visuelle Gestaltung<br />
Die Abteilung XI
21
22<br />
Gegenständen und Subzeichen aus Pfeil oder Querbalken.<br />
99<br />
„das sieht nach einschränkung der darstellungsmöglichkeit<br />
aus, ist es aber nicht. auch wenn es an<br />
sich schon schwierig sein mag sportarten durch<br />
bewegungsform zu charakterisieren, ist es uns auch<br />
bei zusätzlichen formalen einschränkungen immer<br />
gelungen auch für absonderliche disziplinen ein zeichen<br />
zu finden, das man ohne großen lernprozeß sofort<br />
verstehen kann.“ 100 Aicher skizzierte die Figuren,<br />
sein Mitarbeiter Gerhard Joksch war aber derjenige,<br />
der das Raster und die 21 Piktogramme letztlich konzipierte.<br />
101 Die zahlreichen Informationszeichen entwickelte<br />
Aicher zusammen mit Alfred Kern parallel zu<br />
den Elementen für den Frankfurter Flughafen.<br />
Der durchschlagende Erfolg der Piktogramme<br />
von Masaru Katsumi in Tokio bewirkte, dass sie auch<br />
in Mexiko 1968 – hier mehr die Ausrüstung illustrierend<br />
– und bei allen weiteren Spielen zu einem wichtigen<br />
Bestandteil des Erscheinungsbilds wurden.<br />
Aber erst Otl Aicher abstrahierte die Zeichen stärker,<br />
versuchte sie mehr geometrisch zu fassen und<br />
systematisch aus einem Rastersystem zu entwickeln<br />
mit dem Ziel, die Signifikanz zu erhöhen und mehr<br />
formale Einheitlichkeit zu schaffen. Die Rationalisierung<br />
und Typisierung der Grafik entsprach derjenigen<br />
der industriellen, seriellen Bauweisen der Zeit.<br />
Aber trotzdem hatte Aicher seine Zeichen nicht nur<br />
aus einer wissenschaftlichen Systematik entwickelt,<br />
sondern immer auch aus der Anschauung. Wenn er<br />
nicht sicher war, ob ein Zeichen wirklichkeitsgetreu<br />
gelungen war, schickte er einen Mitarbeiter in den<br />
Garten und ließ ihn zum Beispiel einen Ball in das<br />
dort aufgestellte Fußballtor schießen, um seinen<br />
grafischen Entwurf zu überprüfen. 102<br />
22<br />
Otl Aicher vor den<br />
Piktogrammen, 24. Juli 1970<br />
23<br />
Passierschein von<br />
Günter Behnisch, 1972<br />
23<br />
Visuelle Gestaltung<br />
Die Abteilung XI
Bekleidung<br />
Ein weiteres auffälliges Charakteristikum während<br />
der Spiele waren die „Uniformen“ des offiziellen<br />
Personals und die Dirndl der Hostessen, die für die<br />
Durchführung der Wettkämpfe und die Betreuung<br />
der Gäste zuständig waren. Auch hier wurde der<br />
Farbkatalog des Erscheinungsbilds als verbindlich<br />
festgelegt und entsprechend der unterschiedlichen<br />
Aufgabenbereiche nach Kleidungstyp und Farben<br />
in acht verschiedene Gruppen differenziert. 103<br />
Himmelblau erhielt der Ordnungsdienst, Orange<br />
die Kontrolleure, Rot die Kampfrichter, Dunkelgrün<br />
die Wettkampfhelfer, Dunkelblau das Personal des<br />
OK, Silbergrau das technische Personal, Gelb das<br />
Reinigungs- und Servicepersonal und Weiß das<br />
medizinische Personal. Das machte es für die Besucher<br />
einfacher, die zahlreichen Zuständigkeiten zu<br />
unterscheiden.<br />
Die Arbeitsgruppe der Abteilung XI des OK mit<br />
Otl Aicher, der Modedesignerin Vera Simmert und<br />
dem französischen Designer André Courrèges war<br />
für die Entwürfe verantwortlich. Ursprünglich als<br />
Ingenieur ausgebildet, war Courrèges bekannt für<br />
seine futuristischen, unkonventionellen Entwürfe, die<br />
ganz den aktuellen Zeitgeist der 1960er-Jahre trafen.<br />
Seine Ideen entwickelte er häufig aus der Arbeitswelt,<br />
und für die Spiele einigte man sich auf den für<br />
die meisten Aufgaben passenden Safaristil. Es gab<br />
je Farbe Anzüge mit klassischem Sakko oder mit<br />
aufgesetzten Taschen im Safaristil, Overalls, Trikots<br />
und sportliche Kostüme, jeweils abhängig von der<br />
Funktion des Trägers. Auffälligstes Kleidungsstück<br />
waren die silberfarbenen, an Rücken und Ärmeln<br />
mit Streifen in Regenbogenfarben ausgestatteten<br />
Motorradanzüge für die Kurierfahrer des IOC, vervollständigt<br />
mit hellblauen Helmen, passend zu den<br />
ebenfalls blau lackierten Motorrädern, gesponsert<br />
von BMW.<br />
„Für Courrèges war das Entwerfen von Kleidern<br />
ein Planungsvorgang. In der Übereinstimmung von<br />
Ästhetik und rationalem Kalkül ergab sich eine Gemeinsamkeit<br />
mit den Gestaltungskriterien für das<br />
neue Erscheinungsbild der Spiele überhaupt.“ 104 Und<br />
auch hier sorgte Daume dafür, dass die konsequente<br />
Linie von Aicher durchgesetzt und nicht durch<br />
konservative Eingriffe verwässert werden konnte.<br />
„Ihm ist es zu verdanken, daß die oft sehr konträren<br />
Auffassungen, die Widerstände von innen und außen<br />
doch noch zu einem guten Resultat führten.“ 105 So<br />
hatte Aicher mit Unterstützung von Daume gegen die<br />
24<br />
<strong>Olympia</strong>-Hostessen während<br />
einer Pause im Olympischen Dorf<br />
24<br />
25<br />
25<br />
Mitglied des Wettkampfteams im<br />
zentralen Bereich
29<br />
Hauptplakat mit <strong>Olympia</strong>dach<br />
Visuelle Gestaltung<br />
29<br />
354 355<br />
Die Abteilung XI
30–33<br />
Sportplakate Schwimmen,<br />
Leichtathletik, Bogenschießen<br />
und Turnen<br />
30–33
5
ment“ schon in den 1960er-Jahren von Berkeley bis<br />
nach Stuttgart. So stammte auch der Bauingenieur<br />
Eberhard Haug, 1964 einer der ersten Assistenten<br />
von Frei Otto an der Universität Stuttgart, aus diesem<br />
Umfeld.<br />
Auch die Planung des <strong>Olympia</strong>dorfs entstand<br />
unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Veränderungen<br />
der späten 1960er-Jahre, der neuen städtebaulichen<br />
Leitbilder und der zahlreichen utopischen<br />
Architekturmodelle. Neben Yona Friedmans Raumstadtbändern,<br />
Eckhard Schulze-Fielitz’ Raumstädten<br />
und Richard Dietrichs Metastadt beeindruckten die<br />
Architekten besonders die visionären Arbeiten von<br />
Cedric Price und Rudolf Dörnach. Ebenso standen<br />
Wohnungsbauprojekte in Thamesmead, Roehampton,<br />
Cumbernauld und London im Fokus des Büros. 53<br />
Nicht zuletzt brachte Murray Church durch seine<br />
Kontakte zu britischen Kollegen diese Einflüsse<br />
in die Planung ein. Neue Ideen zum Umgang mit<br />
dem öffentlichen Raum und seiner Beziehung zum<br />
Bewohner lieferten auch die Vorbilder des Strukturalismus<br />
– so die Arbeiten von Aldo van Eyck und<br />
Nicolaas John Habraken, die Siedlung Halen von<br />
Atelier 5 (1962) und Mosche Safdies Habitat in Montreal<br />
(1967). Als Modell für das <strong>Olympia</strong>dorf gilt jedoch<br />
insbesondere die Satellitenstadt Toulouse-Le Mirail<br />
(1962–1977) von Georges Candilis, Alexis Josic und<br />
Shadrach Woods, bei der Fußgänger- und Fahrverkehr<br />
getrennt verlaufen. 54<br />
Erwin Heinle selbst nennt Publikationen von<br />
Christopher Alexander und Serge Chermayeff wie<br />
Community and Privacy, Hans Paul Bahrdt mit Öffentlichkeit<br />
und Privatheit als Grundformen städtischer<br />
Soziierung, Karl Jaspers Begriffe zur Individualität<br />
und Selbstverwirklichung sowie Schriften von<br />
Alexander Mitscherlich und Alexis de Tocqueville.<br />
Diese Beispiele durchzogen die zeitgenössische,<br />
soziologisch geprägte Debatte zur Stadtplanung und<br />
waren für die Konzeption von entscheidender Bedeutung.<br />
55 Essenziellen Fragen des Wohnens dieser Zeit<br />
zielten auf eine neue Betrachtung der Polaritäten Privatheit–Öffentlichkeit<br />
und Rückzug–Kommunikation<br />
sowie auf die Prinzipien Selbstverwirklichung–Individuation<br />
und Orientierung– Ablesbarkeit. Diese Trennungen<br />
entsprachen seit 1933 dem dogmatischen<br />
Leitbild der Charta von Athen und den Grundsätzen<br />
der CIAM, seit dem Ende der 1950er-Jahre wurde<br />
aber immer deutlicher Kritik an den monofunktionalen<br />
Planungen der wiederaufgebauten Städte und<br />
dem Verlust des vielfältigen öffentlichen urbanen<br />
Raums laut.<br />
Leitidee „Straße“<br />
Der Titel des aus dem Optimierungsverfahren<br />
hervorgegangen Entwurfs lautete „Straße“ und beschreibt<br />
die Leitidee, das Prinzip Straße als Bewegungs-,<br />
Erschließungs- und Kommunikationsraum<br />
in den Mittelpunkt zu stellen. Wesentliches Merkmal<br />
ist dabei die vollständige Trennung der Fahrstraßen<br />
von den darüberliegenden Fußgängerbereichen –<br />
eine Lösung, die schon Le Corbusier mit der Charta<br />
von Athen eingefordert hatte und die – entgegen<br />
anderer Dogmen – auch in den „autogerechten“<br />
1960er-Jahren nichts an Aktualität eingebüßt hatte.<br />
Der Straßenverkehr wird ebenerdig auf drei Hauptfahrstraßen<br />
geführt und ist mit dem öffentlichen<br />
Verkehrsnetz der Lerchenauer beziehungsweise<br />
Moosacher Straße verbunden, während die Ebene<br />
darüber ausschließlich für Fußgänger zugänglich ist.<br />
Fast alle Wohnungen werden von hier erschlossen,<br />
die „Straßen“ sind sowohl an die Fahrebene als auch<br />
an die nord-südlich verlaufende Hauptachse mit<br />
dem Forum und den Infrastruktureinrichtungen angebunden.<br />
56 Diese konsequente Trennung war eine<br />
wichtige Voraussetzung, um den von B&P geplanten<br />
landschaftlichen Charakter und die Verwebung mit<br />
den Grünbereichen des Geländes umzusetzen.<br />
Als Folge der Abkehr von der funktionalistischen<br />
Stadt war die Idee der Straße in den 1960er- und<br />
1970er-Jahren ein verbreitetes städtebauliches Leitthema,<br />
das in unterschiedlichsten Ausprägungen<br />
die planerischen Ansätze bestimmte. Unter anderem<br />
mit Fußgängerbereichen, -decks und -straßen<br />
sollte dem Menschen wieder eine höhere Bedeutung<br />
beigemessen und das Auto zurückgedrängt<br />
oder eliminiert werden. Das wirkte sich sowohl bei<br />
der Organisation der Gebäude selbst als auch auf<br />
die Neuinterpretation des öffentlichen Raums aus,<br />
häufig in Verbindung mit einer von den Fußgängern<br />
teilweise oder vollständig getrennten Organisation<br />
des Fahrverkehrs. 57<br />
Um das Gelände des Olympischen Dorfs nördlich<br />
des Mittleren Rings mit den Sportstätten im<br />
Süden zusammenzubinden, wurden ausgehend vom<br />
Leitmotiv des Schuttbergs die Geländebewegungen<br />
über die Straßenschneise des Mittleren Rings<br />
hinweg nach Norden weitergeführt und die Bereiche<br />
durch Brücken und auf Dämme gelegte Wege angeschlossen.<br />
Die nördliche und östliche Grenze wird<br />
durch die bestehende Moosacher und Lerchenauer<br />
Straße bestimmt, im Süden begrenzt ein Fußgängerdamm<br />
das Gelände, der die U-Bahnstation mit dem<br />
5<br />
Sportler im Zentrum des<br />
Olympischen Dorfs, 1972
erfolgte 80 und auch in der Folge das Projekt nicht<br />
mehr aufgenommen wurde.<br />
Kunstwettbewerbe für das Olympische Dorf<br />
Die Bedingungen für die Planung der Kunstobjekte<br />
im Olympischen Dorf waren unproblematischer als<br />
im Südteil des Geländes, da hier unterschiedliche<br />
städtebauliche Situationen größeren Spielraum für<br />
die Projekte erlaubten. Die zwei ebenfalls beschränkten<br />
und honorierten Wettbewerbe wurden von den<br />
Bauträgern ausgelobt und von Heinle und Wischer<br />
(H+W) betreut. Für das Zentrum zwischen den beiden<br />
Kirchen waren die Studenten der drei Akademien in<br />
München, Stuttgart und Essen, für das Forum zehn<br />
anerkannte internationale Künstler eingeladen: Hans<br />
Hollein, Victor Vasarely, Philip King, Richard Smith,<br />
Eduardo Paolozzi, Enrico Castellani, Walter Pichler,<br />
Michelangelo Pistoletto, Jean Tinguely und David<br />
Hamilton. 81<br />
Die Wettbewerbe wurden Anfang Oktober<br />
1971 ausgelobt und im Dezember 1971 entschieden.<br />
Während für das Zentrum zwei Anerkennungen für<br />
die Arbeiten von Cedric Price sowie der Entwicklungsgruppe<br />
Design (Franco Clivio, Dieter Raffler)<br />
ausgesprochen wurden, erreichte Hans Hollein mit<br />
seinem „System der Umweltkoordinierung“, den<br />
sogenannten Media-Linien, den ersten Preis. 82 Die<br />
Media-Linien waren zunächst nur für das Forum geplant,<br />
sollten dann aber entsprechend der Empfeh-<br />
11<br />
10<br />
Plexiglasblumen im<br />
Eingangsbereich der Mensa,<br />
Josef Gollwitzer, 1972<br />
11<br />
Kinetische Aluminiumplastik im<br />
Olympischen Dorf, Roland Martin,<br />
Modell 1971<br />
12<br />
Räumliches Mühlespiel,<br />
Peer Clahsen, Modell 1971<br />
10<br />
12<br />
Kunst und Kultur<br />
396 397<br />
Die Künstler und ihre Projekte
lung des Preisgerichts über das ganze Olympische<br />
Dorf ausgedehnt werden. Unklar ist, warum der<br />
prämierte Entwurf einer „Informationsphäre“ mit<br />
Ausstellungsständen und Sitzplätzen von Cedric<br />
Price nicht beauftragt wurde. Er selbst vermutete<br />
Kostengründe, da beide Informationssysteme den<br />
Kostenrahmen gesprengt hätten. 83<br />
Die OBG beauftragte weitere Arbeiten unabhängig<br />
von den Wettbewerben, finanziert aus dem<br />
Budget für Kunst am Bau, so die Plexiglasblumen von<br />
Josef Gollwitzer im Eingangsbereich der Mensa, die<br />
kinetische Aluminiumplastik, Silbersäule genannt,<br />
von Roland Martin im Eingangsbereich der Schule in<br />
der Nadistraße, ein räumliches Mühlespiel von Peer<br />
Clahsen im Innenhof und Wandteppiche von Ewald<br />
Kröner in der Schule.<br />
Media-Linien<br />
Der Wiener Architekt Hans Hollein gehörte in den<br />
1960er-Jahren zur jungen Wiener Avantgarde,<br />
die gegen den Funktionalismus der Nachkriegsarchitektur<br />
aufbegehrte. 1967 hatte er mit seinem<br />
Manifest „Alles ist Architektur“ Aufsehen erregt, in<br />
dem er eine Erweiterung und Neudefinition des traditionellen<br />
Verständnisses von Architektur und eine<br />
vollständige Aufhebung der Grenzen zu anderen<br />
Disziplinen forderte. Nicht nur Gebautes und materiell<br />
Gedachtes, sondern die gesamte Umwelt und<br />
alle sie beeinflussenden Medien betrachtete er als<br />
Architektur. Architektur sollte als Medium zur Kommunikation<br />
dienen und ebenfalls Mittel wie Licht,<br />
Temperatur und Geruch zur Definition von Raum<br />
und Umwelt nutzen. Seine experimentellen Entwürfe<br />
beschäftigten sich mit den Themen der Raumfahrt<br />
und folgerichtig auch mit minimalen, autarken<br />
Wohn- und Lebensbedingungen, die in den 1960er-<br />
Jahren im Fokus vieler Künstler standen. Bekannt<br />
waren seine pneumatischen Hüllen, unter anderem<br />
ein aufblasbares „mobiles Büro“, sowie auch seine<br />
technischen Objekte und Stadtstrukturen. 84<br />
13<br />
Wettbewerbsskizzen mit<br />
Funktionselementen der<br />
Media-Linien: Lichtband und<br />
Strahler, Kaltluftausbläser,<br />
Infrastrahlerheizung, Lautsprecher,<br />
Orientierungshilfe,<br />
Film- und Diaprojektor, mobile<br />
Informationselemente, Wasservorhang,<br />
Sonnenschutzrollos<br />
und -segel, transparente Dächer,<br />
Bodenheizung, Transport, etc.,<br />
Hans Hollein, 1971<br />
13
mit seinem Projekt sehr zurücknehmen musste, da<br />
er aufgrund der schmalen Wege Bühnen und Buden<br />
teilweise über der Wasserfläche des Sees bauen<br />
musste. 222 Neben dieser „Budenhalbinsel“ gab es<br />
weitere Schwerpunkte mit sogenannten Showterrassen<br />
für Musikaufführungen, einer Medienstraße und<br />
einem Multivisionszentrum. Das schon im Wettbewerb<br />
vorgesehene Theatron am nördlichen Seeufer<br />
bot sich als Freilichtbühne an und fasste zirka 2000<br />
Plätze, die einem Amphitheater ähnlich stufenförmig<br />
zum Seeufer abgesenkt waren. Zusätzlich wurde<br />
eine temporäre Seebühne schwimmend auf dem<br />
See platziert.<br />
Künstler und Aktionen 223<br />
Für die Sparte Theater war Frank Burckner zuständig.<br />
Straßentheatergruppen sollten den historischen<br />
Kontext und die Höhepunkte der Olympischen Spiele<br />
kritisch-anekdotisch mit der szenischen Form der<br />
Groteske darstellen. Ausgewählt waren die <strong>Olympia</strong>den<br />
408 v. Chr., Athen 1896, Stockholm 1912, Los<br />
Angeles 1932, Mexiko-Stadt 1968 und das zukünftige<br />
Jahr 2000, Berlin 1936 wurde bewusst ausgespart.<br />
Le Grand Magic Circus (Paris) unter der Leitung von<br />
Jérôme Savary zeigte die Olympischen Spiele 1896<br />
und Pierre de Coubertin mit pantomimisch-skurrilen<br />
Szenen, die Gruppe Tenjō Sajiki (Tokio) unter der Regie<br />
von Shūji Terayama thematisierte das Massaker<br />
von Tlatelolco an Studenten 1968 in Mexiko-Stadt.<br />
Die Theatergruppe Mixed Media Company (Berlin)<br />
ließ auf einer „Prozession“, die vom Multivisionszentrum<br />
über die Straße zum Theatron führte, in die<br />
Zukunft der Spiele blicken. Robert Jungk entwickelte<br />
zusammen mit Frank Burckner die Vorlage für die<br />
futurische Szenerie mit Ereignissen und Stationen<br />
bis zur <strong>Olympia</strong>de 2000.<br />
Pantomimen und Clowns zeigten ihre Künste<br />
vor allem am Südufer des Sees, Samy Molcho (Tel<br />
Aviv/Wien) inszenierte Kindertheater und Mitmachspiele.<br />
Die Pip Simmons Theatre Group (London)<br />
wollte mit Aktionen nahe am Publikum eine intensive<br />
Interaktion erreichen. Mircea Krishan wirkte in der<br />
Gruppe der Artisten, Imitatoren und Zauberer mit.<br />
Der Bereich der Bildenden Kunst war auf der<br />
Budenhalbinsel angesiedelt, geleitet von Anita<br />
Ruhnau. Sie hatte sich von Karl-Heinz Hering, dem<br />
Direktor des Düsseldorfer Kunstvereins, beraten<br />
lassen. Er lieferte wichtige Anregungen und stellte<br />
Kontakte nach New York zu Andy Warhol, Roy Lichtenstein<br />
und Robert Rauschenberg her, 224 deren<br />
Engagement aber aus Kostengründen scheiterte.<br />
Die Künstler sollten politische und gesellschaftliche<br />
Tagesereignisse oder das olympische Geschehen<br />
kritisch-ironisch kommentieren. Es durften keine<br />
fertigen Objekte verwendet werden, sondern die<br />
Zuschauer sollten den Entstehungsprozess vor Ort<br />
mitverfolgen können. Roy Adzak fertigte Negativplastiken<br />
von Sportobjekten oder Sportlern an, Fritz<br />
Schwegler kommentierte Vorkommnisse des Tages<br />
mit Gesängen und Gedichten, Anatol Herzfeld goss<br />
Läuferplaketten aus Blei und diskutierte mit dem<br />
Publikum. Herbert Schneider, der auch das Plakat zur<br />
Spielstraße gestaltete, platzierte seine Figuren auf<br />
48<br />
46–47<br />
Besucher auf der Spielstraße und<br />
eine Aktion von Le Grand Magic<br />
Circus, 1972<br />
48<br />
Theatergruppe Mixed Media<br />
Company während einer Aufführung<br />
im Theatron, 1972<br />
46–47<br />
422 423<br />
Kunst und Kultur<br />
Die Spielstraße
einer schwimmenden Bühne. Materialspiele bot die<br />
Gruppe Haus-Rucker-Co mit einem Riesenbillard am<br />
Nordhang des Bergs, Franz Falch schuf bewegliche<br />
Hinkelsteine aus Polyester, die zum Spiel und zur<br />
Bewegung auffordern sollten und versetzt werden<br />
konnten. Timm Ulrichs lief täglich einen Marathon in<br />
seiner „Olympischen Tretmühle“, eine Kunstaktion in<br />
einer Art Hamsterrad, die das Leistungs- und Wettkampfprinzip<br />
der <strong>Olympia</strong>de ironisch kommentierte.<br />
Die Medienstraße und die Musik lagen in der<br />
Verantwortung von Josef Anton Riedl und Johannes<br />
Goehl. Hier bot sich ein Bereich für spielerisch erfahrbare,<br />
sinnliche Wahrnehmungen, die Sehen<br />
(Filme, Dias, Laser), Hören (Musik und Geräusche),<br />
Fühlen (haptische Böden) und Riechen (Duftorgel)<br />
aktivieren sollten. Im Dezember 1969 hatten Ruhnau<br />
und sein Team für das Pop- und Beatprogramm bekannte<br />
Namen wie Jimi Hendrix, Irmin Schmidt mit<br />
Can, Led Zeppelin, die Beatles, Mothers of Invention<br />
und Pink Floyd vorgeschlagen. 225 Solche Veranstaltungen<br />
und die zu erwartenden Besuchermassen<br />
wären, so das OK, mit großen organisatorischen<br />
Schwierigkeiten sowie Sicherheits- und Ordnungsproblemen<br />
verbunden, 226 und man befürchtete<br />
eine unkontrollierbare Flut junger Menschen wie in<br />
Woodstock. Das Programm wurde eingeschränkt auf<br />
49<br />
49<br />
Showterrassen für Musikaufführungen<br />
und Budenhalbinsel für<br />
die bildende Kunst im westlichen<br />
Bereich der Spielstraße, 1972<br />
50<br />
Budenhalbinsel mit Turm der<br />
Intendanz und Schwimmbühne<br />
mit weißen Figuren von Herbert<br />
Schneider, auf dem See die<br />
Wasserwolke von Heinz Mack, im<br />
Hintergrund die Seebühne und<br />
das Theatron, 1972<br />
50
deutsche und internationale Interpreten aus den Bereichen<br />
Jazz, Folklore und Experimentalmusik.<br />
Das Multivisionszentrum im östlichen Bereich<br />
der Spielstraße bot nach Anbruch der Dunkelheit<br />
audiovisuelle Darstellungen mit Live-Bildern, aktuellen<br />
Informationen oder historischen Szenen aus den<br />
Bereichen Film, Fotografie und Fernsehen. Auf zwei<br />
Türmen installierte Projektoren bespielten simultan<br />
fünf zum See hin ausgerichtete Leinwände mit Dias,<br />
Filmen oder Videos, die aus Ereignissen des Tages<br />
künstlerisch-experimentell zusammengestellt waren<br />
oder das Thema Sport behandelten. Die Arbeiten<br />
von Leo Fritz Gruber und Horst H. Baumann zeigten<br />
zusammenmontierte historische Bild- und Tondokumente<br />
verschiedener <strong>Olympia</strong>den sowie Collagen<br />
von Bewegungen und Bewegungsabläufen. Pavel<br />
Blumenfeld präsentierte bildhafte Assoziationen von<br />
deutschen Städten.<br />
Schlussveranstaltung<br />
Die Idee der Spielstraße entsprach besonders dem<br />
Konzept der heiteren und menschlichen Spiele und<br />
dem Anspruch des Kunstausschusses, Internationalität<br />
und Weltoffenheit in München zu verankern.<br />
Das für die 1960er-Jahre zeittypische „Happening“<br />
– zum ersten Mal im Bereich des Sports angesiedelt<br />
– war letztendlich die einzig umgesetzte,<br />
wenn auch nur temporäre Kunstform mit kritischen<br />
Inhalten, die heftig umstritten von den Verantwortlichen<br />
des OK mehrheitlich abgelehnt und letztlich<br />
nur geduldet war. Die Eröffnung der Spielstraße fand<br />
am 26. August 1972 statt. Nach dem Attentat auf die<br />
israelischen Sportler am 5. September 1972 wurde<br />
sie zunächst unterbrochen. In seiner Sitzung am<br />
6. September 1972 entschied das OK dann die sofortige<br />
endgültige Schließung mit der Begründung,<br />
dass die heitere, ironisch-kritische Ausrichtung<br />
nicht mehr der veränderten Situation entspräche. 227<br />
Alle weiteren Kultur-, Kunst- und Sportveranstaltungen<br />
dagegen wurden weitergeführt. Die tragischen<br />
Ereignisse lieferten so einen willkommenen Grund<br />
zur Auflösung der Spielstraße, aber dennoch war<br />
diese mit 1,2 Millionen Besuchern eine äußerst<br />
erfolgreiche und bislang einmalige olympische Veranstaltung.<br />
Auch für die anderen Kunstprojekte scheiterten<br />
letztlich weitgehend alle Bemühungen, Ideen mit aktuellen<br />
politisch-kritischen Aspekten oder vollständig<br />
neuen Ansätzen einzubeziehen. In Bezug auf den<br />
54<br />
<strong>Olympia</strong> Regenbogen zur<br />
Schlussfeier der XX. Olympischen<br />
Spiele, Otto Piene,<br />
11. September 1972 (Ausführung<br />
Winzen Research, St. Paul, MN,<br />
USA)<br />
Kunst und Kultur
54
Dank<br />
Impressum<br />
Mein Dank gilt allen, die diese<br />
Arbeit mit umfangreichen Informationen<br />
unterstützt und durch<br />
die Überlassung von Bildern und<br />
Reproduktionsrechten ermöglicht<br />
haben, insbesondere<br />
Fritz Auer,<br />
Günter Behnisch,<br />
Stefan Behnisch,<br />
heinlewischer,<br />
Christian Kandzia,<br />
Christine Kanstinger,<br />
Karla Kowalski,<br />
Klaus Linkwitz,<br />
Suse Iris Heilmann Linkwitz,<br />
Frei Otto,<br />
Jörg Schlaich,<br />
Hans-Jochen Vogel,<br />
Carlo Weber<br />
und vielen anderen.<br />
Für die Unterstützung bei der<br />
Recherche nach den Mitarbeitern<br />
von Behnisch & Partner danke ich<br />
Fritz Auer,<br />
Tina Häcker,<br />
Peter Horn,<br />
Christian Kandzia,<br />
Heinz Kistler<br />
und Cord Wehrse.<br />
Gefördert wurde die Publikation<br />
durch<br />
Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft DFG<br />
Behnisch Architekten<br />
sbp schlaich bergermann<br />
partner<br />
Auer Weber<br />
Trotz nachdrücklicher Bemühungen<br />
ist es nicht gelungen,<br />
sämtliche Urheber der Fotos<br />
und Abbildungen zweifelsfrei zu<br />
ermitteln. Die Urheberrechte sind<br />
jedoch gewahrt. Sollten Ansprüche<br />
bestehen, bitten wir um eine<br />
entsprechende Mitteilung.<br />
Alle Zitate aus den Archivquellen<br />
wurden im Original belassen.<br />
© 2022 by ovis Verlag GmbH<br />
Das Copyright für die Texte liegt<br />
bei der Autorin.<br />
Das Copyright für die Abbildungen<br />
liegt bei den Fotografen/<br />
Inhabern der Bildrechte.<br />
Alle Rechte vorbehalten.<br />
Umschlagmotiv:<br />
Landschaft mit Menschen<br />
während der Olympischen<br />
Spiele 1972, © Behnisch &<br />
Partner<br />
<strong>Olympia</strong>-Regenbogen<br />
zur Schlussfeier der<br />
XX. Olympischen Spiele,<br />
Otto Piene, 11. September<br />
1972 (Ausführung Winzen<br />
Research, St. Paul, MN,<br />
USA), © Otto Piene Archiv<br />
Lektorat:<br />
Sandra Leitte<br />
Gestaltung und Satz:<br />
Floyd E. Schulze<br />
Lithografie:<br />
Bild1Druck, Berlin<br />
Gedruckt in der Europäischen<br />
Union<br />
Bibliografische Information der<br />
Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek<br />
verzeichnet diese Publikation<br />
in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische<br />
Daten sind im Internet über<br />
http://dnb.d-nb.de abrufbar.<br />
ovis Verlag GmbH<br />
Lützowstraße 33<br />
10785 Berlin<br />
www.jovis.de<br />
ovis-Bücher sind weltweit im<br />
ausgewählten Buchhandel<br />
erhältlich. Informationen<br />
zu unserem internationalen<br />
Vertrieb erhalten Sie von Ihrem<br />
Buchhändler oder unter<br />
www.jovis.de.<br />
ISBN 978-3-86859-728-8<br />
464 464<br />
Anhang<br />
Impressum