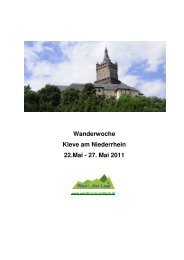Die Kelten am 50. Breitengrad - Wandern TSG Sulzbach eV 1888 ...
Die Kelten am 50. Breitengrad - Wandern TSG Sulzbach eV 1888 ...
Die Kelten am 50. Breitengrad - Wandern TSG Sulzbach eV 1888 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>Kelten</strong> <strong>am</strong> <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong><br />
<strong>Die</strong>tzenbach<br />
Streckenlänge: 16,2 km<br />
Höhenmeter: 135 m<br />
- 1 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
<strong>Die</strong>se Wanderung führt uns ins Messeler Hügelland, dort wo der Odenwald zu Ende ist. Hier<br />
werden wir den <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong> überschreiten und das <strong>Kelten</strong>grab „Auf der Bulau“ nebst<br />
Skulpturengruppe, die den Bestattungsritus der <strong>Kelten</strong> symbolisiert, besichtigen.<br />
Starten werden wir die Wanderung <strong>am</strong> Waldstadion in <strong>Die</strong>tzenbach, wo wir unsere Autos<br />
zurücklassen. <strong>Die</strong> Wanderstrecke führt durch Wald, <strong>am</strong> Hexenberg entlang und an einem<br />
Angelteich 1 vorbei, welcher von einem kleinen Bächlein, dem Kaupenwiesengraben, gespeist<br />
wird. Durch den Kappenwald erreichen wir den <strong>Die</strong>tzenbacher Ortsteil „Waldacker“. Hier<br />
führt uns der Weg durch eine ruhige Wohngegend zielstrebig auf den <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong> 2 zu.<br />
Eine Installation mit 18 Infotafeln informiert darüber, welche weiteren Städte und Gebiete auf<br />
der Erde auf dem <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong> liegen. Wenn wir unseren Bildungshorizont erweitert<br />
haben, finden wir kurz darauf noch eine Information über die Dünenlandschaft <strong>am</strong><br />
Lerchenberg 3 . Vor der Einkehr können wir uns noch über Methoden der Landvermessung 4<br />
informieren. Nach Überqueren der Bundesstraße 459 erreichen wir auch schon bald das<br />
Schützenhaus Diana R gegenüber einem Bogenschießplatz, in welchem wir einkehren (wir<br />
haben schon 9,5 km hinter uns). Nachdem wir uns gestärkt und aufgewärmt haben geht es<br />
durch Messenhausen, vorbei an der Messenhäuser Kapelle 5 - leider von innen nicht zu<br />
besichtigen -, über den Hainchesbuckel zur kulturhistorischen Erlebnisstätte „Auf der Bulau“ 6 .<br />
Auch hier können wir unsere Kenntnisse über die <strong>Kelten</strong>, welche uns auf unseren<br />
Wanderungen immer wieder begegnen, erweitern. Und dann ist schon das Ende der<br />
heutigen Wanderung in Sicht, die Autos wieder erreicht.<br />
Anfahrt<br />
<strong>Sulzbach</strong> – A5 Richtung Frankfurter Kreuz – Ausfahrt 22-Frankfurt a. Main-Flughafen A3<br />
Richtung München/Würzburg/Offenbach/F-Süd - Ausfahrt 52-Offenbacher Kreuz A661<br />
Richtung Darmstadt/Egelsbach/Dreieich - Ausfahrt 19-Dreieich Richtung Dreieich-<br />
Sprendlingen/Dreieich-Götzenhain - Weiter auf L3317 - links Richtung <strong>Die</strong>tzenbacher<br />
Str./K173 abbiegen - rechts abbiegen auf Offenthaler Str.<br />
Navi<br />
Waldstadion, Offenthaler Str. 81, 63128 <strong>Die</strong>tzenbach
- 2 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org<br />
R Einkehr Schützenhaus Diana<br />
5 Messenhäuser Kapelle<br />
6 „Auf der Bulau“<br />
Legende<br />
S Start<br />
Z Ziel<br />
1 Angelteich<br />
2 <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong><br />
3 Lerchenberg<br />
4 Landvermessung
Informationen<br />
- 3 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
Regionalpark RheinMain<br />
Mit dem Regionalpark RheinMain wird ein Netz von landschaftlich reizvollen Wegen und Anlagen<br />
geschaffen. Wichtige Bausteine sind Alleen und Streuobstwiesen, Bäume, Kunstwerke und<br />
Aussichtspunkte, aber auch Zeugnisse der Industriekultur und die Schönheit der Kulturlandschaft.<br />
Zentrales Anliegen ist der Ausgleich der Interessen von Naturschutz, Erholungsnutzung und<br />
Denkmalschutz. <strong>Die</strong> Regionalparkroute Rödermark mit ihren beiden Erlebnisstätten „Auf der Bulau"<br />
und „<strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong>" ist ein gutes Beispiel hierfür. Der Weg führt durch eine alte Kulturlandschaft mit<br />
zahlreichen Zeugnissen aus verschiedenen Epochen der Erd- und Menschheitsgeschichte.<br />
Gleichzeitig stellt er ein Bindeglied zu weiteren Regionalparkprojekten in <strong>Die</strong>tzenbach Dreieich und<br />
Rodgau dar.<br />
<strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong><br />
Das Stadtgebiet von Rödermark wird auf der Höhe von Waldacker vom 5O. nördlichen <strong>Breitengrad</strong><br />
durchschnitten. <strong>Die</strong> Linie ist Teil des erdumspannenden Koordinatennetzes von Längen- und<br />
<strong>Breitengrad</strong>en, das weltweit als Grundlage zur Ortsbestimmung dient. Ausgehend vom Äquator (0°)<br />
wird die geografische Breite Richtung Nordpol (90° Nord) und Südpol (90° Süd) gemessen. <strong>Die</strong><br />
geografische Länge wird in der Regel von dem 1911 festgelegten Nullmeridian, der durch das<br />
englische Greenwich läuft, um die<br />
halbe Erdkugel nach Osten (180° Ost) bzw. Westen (180° West) bis zur Datumsgrenze gemessen.<br />
<strong>Die</strong> Installation nimmt den Besucher mit auf eine imaginäre Reise rund um den Globus entlang dem<br />
<strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong>, der durch die Kontinente Europa, Asien und Nord<strong>am</strong>erika und die nördlichen<br />
Regionen des Atlantik und des Pazifik führt. Auf seiner Linie passiert man ganz unterschiedliche<br />
Klimazonen und Landschaften: Wüsten und Meere, mächtige Gebirgszüge und endlose Ebenen, alte<br />
Kulturstädte und menschenleere Gegenden.<br />
• Alëuten<br />
<strong>Die</strong> Inselkette der Alëuten zwischen Nord<strong>am</strong>erika und Asien erstreckt sich von Alaska (USA) auf<br />
einer Länge von rund 1.750 km bis zu den Kommandeurinseln (Russland). Geografisch schneidet<br />
sie dabei die Datumsgrenze (180. Längengrad). <strong>Die</strong> Inseln sind vulkanischen Ursprungs und<br />
gehören zum nördlichen Teil des pazifischen Feuerrings. <strong>Die</strong> Vulkane erheben sich bis 2.861 m<br />
über Meereshöhe, einige von ihnen sind noch aktiv. Im Norden fällt das Gelände steil in das 4.096<br />
m tiefe Becken des Beringmeers ab, im Süden schließt sich der 7.822 m tiefe Alëutengraben im<br />
Pazifik an, der in Teilen dem <strong>50.</strong> <strong>Breitengrad</strong> folgt.<br />
1741 von Vitus Bering während einer russischen Expedition entdeckt, wurden die Aleuten 1867<br />
zus<strong>am</strong>men mit Alaska an die USA verkauft. Von den über 150 Inseln sind nur sieben bewohnt. <strong>Die</strong><br />
Hauptinsel ist Unalaska mit dem Flottenstützpunkt Dutch Harbor.<br />
• Vancouver<br />
Vancouver Island an der Pazifikküste gehört zum kanadischen Bundesstaat British Columbia.<br />
Gegenüber der Insel auf dem Festland liegt Vancouver. Ihren N<strong>am</strong>en erhielten die ca. 580.000<br />
Einwohner zählende Universitätsstadt und die Insel nach dem britischen Offizier George Vancouver,<br />
der die Region 1792 erforschte. Archäologische Funde im Tal des Fräser Rivers deuten darauf hin,<br />
dass die Gegend schon vor drei Jahrtausenden besiedelt war. <strong>Die</strong> hier lebenden Indianervölker der<br />
Musque<strong>am</strong> und Squ<strong>am</strong>ish besaßen bereits eine hoch entwickelte Kultur mit festen Siedlungen.<br />
1886 zerstörte ein Brand große Teile der historischen Altstadt. 1986 war Vancouver Ausrichter der<br />
Weltausstellung. 2010 werden hier die XXI. Olympischen Winterspiele stattfinden, erstmals in einer<br />
auf Meereshöhe gelegenen Stadt. Nach San Francisco besitzt Vancouver die zweitgrößte<br />
„Chinatown" in Nord<strong>am</strong>erika.<br />
• Columbia River<br />
Der 1.953 km lange Columbia River ist der wasserreichste Fluss Nord<strong>am</strong>erikas, der in den<br />
Pazifischen Ozean fließt. Mit seinem Nebenfluss, dem Snake River, besitzt er eine Länge von 2.240<br />
km. 1792 entdeckten die ersten Europäer den Columbia River. 1805 erreichte eine Expedition vom<br />
Osten auf dem Landweg seine Mündung. Sein Quellgebiet liegt in British Columbia in Kanada. Der<br />
Columbia fließt durch den mittleren Osten des US-Bundesstaates Washington. <strong>Die</strong> letzten 480<br />
Kilometer bilden die Grenze zwischen den Bundesstaaten Washington und Oregon. Das erweiterte
- 4 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
Zuflussgebiet erstreckt sich über die Staaten Montana und Idaho. Bei Astoria mündet der Columbia<br />
River in den Pazifik.<br />
Früher war der Fluss wild und reich an Lachsen. <strong>Die</strong> natürliche Lachswanderung wird heute von<br />
Staudämmen stark eingeschränkt. Dem im Rahmen des „New Deal" in den 30er-Jahren des letzten<br />
Jahrhunderts realisierten Kraftwerks- und Staud<strong>am</strong>mbau widmete Woody Guthrie das Lied „Roll On<br />
Columbia".<br />
• Winnipeg<br />
<strong>Die</strong> Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba liegt <strong>am</strong> Zus<strong>am</strong>menfluss des Red River mit dem<br />
Assiniboine River. Mit ca. 620.000 Einwohnern größte Stadt der Provinz, ist Winnipeg Heimat von<br />
mehr als der Hälfte der Ges<strong>am</strong>tbevölkerung von Manitoba.<br />
Auf dem heutigen Stadtgebiet wurde 1738 mit Fort Rouge der erste Posten in der Gegend errichtet.<br />
<strong>Die</strong> Stadt Winnipeg wurde 1873 gegründet. Ihr N<strong>am</strong>e leitet sich vom indianischen N<strong>am</strong>en des<br />
nördlich der Stadt gelegenen Sees her und bedeutet „Schl<strong>am</strong>miges Wasser". Trotz warmer<br />
Sommertemperaturen ist Winnipeg im Winter eine der kältesten Städte der Welt. Während fünf<br />
• Sankt-Lorenz-Strom<br />
Der 1.197 km lange Sankt-Lorenz-Strom bildet den Abfluss der riesigen Seenplatte des Great Lakes<br />
District in den Atlantik. Über weite Strecken folgt die Grenze zwischen den USA und Kanada seinem<br />
Verlauf. Östlich von Quebec mündet er in den Sankt-Lorenz-Golf. Nimmt man die Zuflüsse der<br />
Großen Seen hinzu, so beträgt die Länge zwischen der Atlantikmündung und der <strong>am</strong> weitesten<br />
entfernten Quelle 3,058 km.<br />
Lange Zeit war der Sankt-Lorenz-Strom wegen seiner vieler Stromschnellen und Untiefen nur<br />
eingeschränkt schiffbar. In den 5Oer-Jahren des letzten Jahrhunderts wurde daher ein System von<br />
Schleusen und Kanälen errichtet, durch die der Schiffsverkehr über die Großen Seen und die<br />
anschließenden Flüsse bis in die Mitte des Kontinents ermöglicht wurde. Der Sankt-Lorenz-Golf, der<br />
Übergang des Sankt-Lorenz-Stromes in den Atlantik, ist die Heimat zahlreiche Walarten, unter<br />
anderen Blau-, Finnwale und Beluga-Wale, die im Mündungsgebiet reichhaltige Nahrung finden.<br />
• Land’s End<br />
Land's End ist der westlichste Punkt der Hauptinsel Großbritanniens. <strong>Die</strong> Klippen zählen zu den<br />
beliebtesten touristischen Zielen in Cornwall. <strong>Die</strong> Westspitze ist auch heute noch nur zu Fuß zu<br />
erreichen.<br />
• <strong>Die</strong>ppe<br />
<strong>Die</strong> französische Hafenstadt liegt an der Alabasterküste, einem Teil der französischen Atlantikküste,<br />
an der Mündung der Arques in den Ärmelkanal. Der N<strong>am</strong>e weist auf den für die Schifffahrt<br />
günstigen natürlichen Hafen hin. Mit seinen 36.500 Einwohnern ist <strong>Die</strong>ppe auch heute noch ein<br />
wichtiger Fischerei- und Seehafen. <strong>Die</strong> Stadt liegt knapp zwei Autostunden von Paris entfernt und ist<br />
daher vor allem an Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel für die Pariser Bevölkerung.<br />
Regelmäßige Fährverbindungen verkehren nach Großbritannien.<br />
Um 900 gegründet, entwickelte sich <strong>Die</strong>ppe bis zum 14. Jahrhundert zu einem bedeutenden<br />
Seehandelsplatz. Französische Entdeckungsfahrten nach Amerika und Afrika nahmen hier Ihren<br />
Ausgang. 1694 wurde die Stadt durch eine niederländisch- englische Flotte fast vollständig<br />
vernichtet. Ein Großteil der Altstadt mit ihren barocken Häuserfassaden ist heute noch durch den<br />
folgenden Wiederaufbau geprägt. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich <strong>Die</strong>ppe zu einem der ersten<br />
mondänen Badeorte Frankreichs. <strong>Die</strong> beeindruckende Küstenlandschaft und das besondere Licht<br />
fasziniert bis heute viele Künstler. Das hoch über der Stadt thronende Schloss aus dem 15.<br />
Jahrhundert beherbergt heute ein Museum mit einer großen Elfenbeins<strong>am</strong>mlung.1942 scheiterte<br />
hier der Versuch einer Landung durch britische und kanadische Truppen unter erheblichen<br />
Verlusten. Alle zwei Jahre im September findet in <strong>Die</strong>ppe das internationale Drachenfest statt.<br />
• Ardennen, Tal der Ourthe<br />
Als Teil des Rheinischen Schiefergebirges erstrecken sich die Ardennen über die Länder Belgien,<br />
Luxemburg und Frankreich. Das größtenteils bewaldete Gebirge ist zwischen Mosel und Maas stark<br />
zerklüftet. Jenseits der Maas verflacht das Profil zum flandrischen Tiefland. Im Osten schließen sich<br />
das Hohe Venn und die Eifel an.
- 5 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
<strong>Die</strong> Gipfel der höchsten Berge übersteigen 650 m kaum. Das flache Gebirge wird von Flusstälern<br />
durchzogen, die oft tief und schluchtartig mit steilen Abstürzen von 200 m Höhe eingeschnitten sind.<br />
<strong>Die</strong> schlechten Böden der Hochebenenflächen erlauben meist nur Weidewirtschaft, in den Tälern<br />
hingegen findet man fruchtbare Böden. Den Hauptreichtum des Gebirges bilden die Wälder, meist<br />
Eichen- und Buchenmischwälder, sowie die Bodenschätze: Eisen, Blei, Antimon, Kupfer, Mangan,<br />
vor allem aber die großen Steinkohlevorkommen im Norden, die in der Zeit der Industrialisierung<br />
den Reichtum der Region begründeten.<br />
• Mainz<br />
Das Stadtgebiet des heutigen Mainz war bereits in der Steinzeit besiedelt. Erste dauerhafte<br />
Ansiedlungen sind keltischen Ursprungs. Von der keltischen Gottheit Mogon leitet sich auch der<br />
antike N<strong>am</strong>e der Stadt, Mogontiacum, her <strong>Die</strong> Stadtgründung gehört in die Zeit des Kaisers<br />
Augustus. Mainz ist somit eine der ältesten Städte Deutschlands. Seit 89 n. Chr. Hauptstadt der<br />
römischen Provinz Germania Superior, wurde sie schon früh Bischofssitz. Von hier aus wurde im 8.<br />
Jahrhundert durch Bonifatius die Christianisierung des Ostens betrieben. 782 wurde Mainz zum<br />
Erzbistum erhoben. Anfang des 11. Jahrhunderts begann unter Erzbischof Willigis der Bau des<br />
Mainzer Doms.<br />
1462 wurde Mainz kurfürstliche Residenz. Seit 1816 gehörte es zum Großherzogtum Hessen-<br />
Darmstadt. Ab 1886 setzte mit der Gründerzeit ein Bauboom und Bevölkerungszuwachs ein.<br />
Während des Zweiten Weltkrieges wurde Mainz durch britische Bomber fast völlig zerstört. Heute<br />
zählt die Landeshauptstadt von Rheinlandpfalz 192.000 Einwohner. <strong>Die</strong> Universitätsstadt ist d<strong>am</strong>it<br />
zugleich größte Stadt des Landes.<br />
• Aschaffenburg<br />
Aschaffenburg <strong>am</strong> Main wurde im 5. Jahrhundert von den Alemannen gegründet.<br />
Besiedlungsspuren reichen in die Steinzeit zurück. <strong>Die</strong> erste urkundliche Erwähnung st<strong>am</strong>mt aus<br />
dem Jahr 957. 975 wurde der Bau der Stiftskirche St. Peter und Alexander begonnen. <strong>Die</strong> Kirche mit<br />
ihrem spätromanischen Kreuzgang beherbergt eines der wenigen erhaltenen Kruzifixe im<br />
romanischen Stil sowie die “Beweinung Christi" von Matthias Grünewald. 989 entstand eine<br />
Holzbrücke über den Main. Seit 1161 besitzt Aschaffenburg Stadtrechte. 1605 wurde mit dem Bau<br />
des Schlosses Johannisburg begonnen, das 1619 fertig gestellt wurde. Bis 1803 gehörte<br />
Aschaffenburg zum Mainzer Kurfürstentum, seit 1814 zu Bayern.<br />
Unweit des Schlosses ließ König Ludwig 1840 das Pompejanum errichten. Beide Gebäude wurden<br />
im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Nach ihrem Wiederaufbau beherrschen sie nun wieder<br />
das Stadtbild vom Main her. Der nahe gelegene Park Schonbusch ist der älteste Englische<br />
Landschaftsgarten in Deutschland.<br />
• Schneeberg<br />
Der Schneeberg ist mit 1.051 m der höchste Berg im Fichtelgebirge. Den Gipfelbereich umgibt ein<br />
Felsenmeer aus Granitblocken. Der Berg war wegen seiner Fernsicht strategisch schon immer von<br />
Bedeutung: Bereits 1498 existierte auf verschiedenen Höhen rund um den Schneeberg ein Netz von<br />
Beobachtungsstationen. 1879 baute der Deutsch-Österreichische Alpenverein die erste<br />
Besteigungsanlage und eine einfache Steinhütte. 1904 folgte eine Blockhütte und 1926 der<br />
Aussichtsturm „Backöfele". Nach dem 2. Weltkrieg übernahmen die US-Streitkräfte einen Teil des<br />
Gipfels, 1961 die Bundeswehr den nördlich angrenzenden Bereich Bis 1994 blieb der Berggipfel<br />
militärisches Sperrgebiet. 1995 erwarb der Landkreis Wunsiedel den Bereich um das „Backöfele". In<br />
Zus<strong>am</strong>menarbeit mit dem Naturpark Fichtelgebirge erfolgten Renaturierungsmaßnahmen. Seit 1996<br />
besteht wieder freier Zugang zum Aussichtsturm „Backöfele".<br />
• Prag<br />
Um 800 durch die sagenhafte Fürstin Libussa gegründet, gehörte Prag im 14. Jahrhundert zu den<br />
größten Städten Europas. Der 1344 begonnene St.Veits-Dom wurde erst im 20. Jahrhundert fertig<br />
gestellt. Mit der 1348 gegründeten Karlsuniversität besitzt Prag die älteste Universität in<br />
Mitteleuropa. Der Prager Fenstersturz von 1618 war Anlass für den Dreißigjährigen Krieg. Eine<br />
erneute Blütezeit erlebte Prag unter der Herrschaft der Habsburger. Heute befindet sich hier der Sitz<br />
der Tschechischen Regierung.<br />
Der Burgberg war bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt.
- 6 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
• Rzeszów<br />
Rzeszów liegt im Südosten Polens in der Flussebene der Wistok <strong>am</strong> Rande des Talkessels von<br />
Sandomierz unweit der Karpaten. Mit 159.000 Einwohnern ist die Hauptstadt der Woiwodschaft<br />
Karpatenvorland ein wichtiges Zentrum der Region.<br />
Durch die Nähe zur Ukraine im Osten und zur Slowakei im Süden ist die Stadt<br />
zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt geworden. Rzeszów ist römisch-katholischer Bischofssitz,<br />
es besitzt eine Universität und eine polytechnische Hochschule.<br />
• Kiew<br />
Mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern ist die ukrainische Hauptstadt zugleich größte Stadt des<br />
Landes. Kiew liegt <strong>am</strong> bis hierhin für kleinere Seeschiffe befahrbaren Fluss Dnjepr. Aufgrund seiner<br />
vielen Kirchen und Klöster und seiner Bedeutung für die orthodoxe Christenheit wird Kiew auch als<br />
Jerusalem des Ostens bezeichnet.<br />
Im 5. Jahrhundert gegründet, wurde die slawische Stadt 882 fürstliche Residenz der Rus. 988 wurde<br />
Kiew von dem zum Christentum übergetretenen Großfürsten Wladimir l. ausgebaut und befestigt. Im<br />
11. und 12. Jahrhundert war die Stadt mit etwa <strong>50.</strong>000 Bewohnern eine der größten Städte<br />
Europas. 1240 wurde Kiew von Mongolen vollständig zerstört. Im 16. und 17. Jahrhundert zu Polen<br />
gehörend, fiel die Stadt 1667 wieder an Russland und wurde Hauptstadt eines russischen<br />
Gouvernements. 1834 wurde die Universität gegründet. 1934 wurde Kiew Hauptstadt der<br />
Sowjetrepublik Ukraine. Seit 1991 ist Kiew Hauptstadt der unabhängigen Ukraine. 2004 fanden hier<br />
die Massenproteste der „Orangenen Revolution“ statt, die zur weiteren Demokratisierung des<br />
Landes führten.<br />
Zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gehören die Sophienkathedrale, eine fünfschiffige<br />
Kreuzkuppelkirche aus dem 11. Jahrhundert, die mittlerweile Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist,<br />
die Kiewer Höhlenklöster, die Klosterkirche St. Michael mit den goldenen Kuppeln, sowie das<br />
Goldene Tor von Kiew.<br />
• Altai-Gebirge, Belucha (Kasachstan)<br />
Das Altai-Gebirge liegt im Grenzgebiet von Kasachstan, Russland, der Mongolei und China. Sein<br />
Verlauf erstreckt sich von Nordwesten nach Südosten. Der nordwestliche Teil des Gebirges bildet<br />
die Wasserscheide zwischen den großen sibirischen Flüssen Ob, Irtysch und Jenissei. Seine<br />
zahlreichen Gebirgsseen sind während der Eiszeit entstanden. Das Relief des Altais ist stark<br />
gegliedert Steile Gebirgskämme, breite Plateaus und Senken wechseln sich ab. Um die<br />
Hochgebirgszone gruppieren sich Mittelgebirge und Hochflächen. Großräumig ist das Gebirge von<br />
großen Seen umgeben, unter anderem dem Baikalsee im Osten.<br />
Der höchste Berg des Altai-Gebirges ist mit 4.506 m der Berg Belucha, der sich in der russischen<br />
Republik Altai etwa 300 km östlich der kasachischen Großstadt Ust-K<strong>am</strong>enogorski befindet. <strong>Die</strong><br />
offizielle Erstbesteigung erfolgte im Jahr 1914.<br />
• Manzhouli (China)<br />
Manzhouli gehört zum Verwaltungsgebiet Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der<br />
Volksrepublik China. <strong>Die</strong> Grenzstadt zu Russland liegt an der Eisenbahnstrecke Peking-Moskau und<br />
ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Region. Im Handel mit Russland ist Manzhouli von<br />
besonderer Bedeutung für ganz Nordostchina. 1931 wurde von der Deutsch-Chinesischen<br />
Luftverkehrsgesellschaft EURASIA, an der die Lufthansa beteiligt war, hier der erste planmäßige<br />
Flugverkehr in China aufgenommen. <strong>Die</strong> 2.500 km lange Strecke Schanghai-Nanking-Tsinanfu-<br />
Peking-Linsi-Manzhouli war die erste regelmäßig beflogene Linie des Landes. Dem ersten Piloten<br />
stand für diesen Flug anfangs lediglich eine 20 Jahre alte Landkarte im Maßstab 1:1 Mio. zur<br />
Verfügung.<br />
• Heihe (China)<br />
Heihe ist eine aufstrebende Großstadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang <strong>Die</strong> Stadt liegt im<br />
Nordosten Chinas auf dem Gebiet der früheren Mandschurei <strong>am</strong> Heilong-Fluss, direkt gegenüber<br />
der russischen Stadt Blagoweschtschensk. Heihe hat große Bedeutung als Handelszentrum,<br />
insbesondere der Handel mit Russland spielt eine wichtige Rolle. Zus<strong>am</strong>men mit<br />
Blagoweschtschensk bildet Heihe eine Freihandelszone.<br />
31 km von Heihe entfernt liegt die historische Stadt Aigun. 1881 wurde hier das Abkommen<br />
zwischen der Regierung des chinesischen Kaiserreichs und dem
zaristischen Russland geschlossen.<br />
- 7 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
• K<strong>am</strong>tschtka (Russland)<br />
<strong>Die</strong> mit 370.000 km 2 größte Halbinsel Ostasiens liegt <strong>am</strong> Pazifik zwischen der Beringstraße im<br />
Osten, dem Ochotskischen Meer im Westen und Sachalin im Süden. Ihren N<strong>am</strong>en verdankt<br />
K<strong>am</strong>tschatka dem mit 758 km längsten Fluss der Halbinsel, der in den nördlichen Pazifik mündet.<br />
<strong>Die</strong> größte Stadt, Petropawlowsk, war während des Kalten Krieges einer der wichtigsten<br />
sowjetischen Flottenstützpunkte. Daher war der größte Teil der Halbinsel bis in die 90er-Jahre des<br />
letzten Jahrhunderts militärisches Sperrgebiet. Erst in den letzten Jahren ist sie wieder Besuchern<br />
zugänglich.<br />
Wie im Falle der Aleuten, erfolgte die Erforschung der vulkanisch bis heute aktiven Gegend im 18.<br />
Jahrhundert durch den Dänen Vitus Bering im Auftrag des russischen Zaren. 1996 wurde die<br />
Vulkanregion von K<strong>am</strong>tschatka, die größtenteils als Naturpark ausgewiesen ist, von der UNESCO in<br />
die Liste der<br />
Weltnaturerbe-Regionen aufgenommen.<br />
Lerchenberg<br />
Quer durch das Rhein-Main-Dreieck erstreckt sich in Ost-West-Richtung eine Kette von Sanddünen,<br />
die im Quartär vor etwa 1 Mio. Jahren aufgeweht wurden. Im nördlichen Teil des Stadtgebietes von<br />
Rödermark sind noch heute an vielen Stellen Reste dieser Dünenlandschaft zu beobachten, so auch<br />
hier <strong>am</strong> Lerchenberg.<br />
In der Vorgeschichte wurde der Dünenzug auf Grund seiner durch die Jahreszeiten gewährleisteten<br />
Trockenheit als Verkehrsweg genutzt. Daher finden sich entlang seines Verlaufes immer wieder<br />
Zeugnisse menschlicher Besiedlung.<br />
In den 1930er-Jahren diente die Anhöhe als Start- und Landeplatz für die Segelfliegerei. <strong>Die</strong><br />
Leichtbau-Flugzeuge entstanden alles<strong>am</strong>t in<br />
Eigenarbeit. Mit Hilfe eines Gummiseiles wurden die Segelflieger durch Muskelkraft in die Höhe<br />
katapultiert und konnten so eine Distanz von mehreren hundert Metern zurücklegen.<br />
Nach dem 2. Weltkrieg begann man im Bereich um den Lerchenberg mit dem Sand- und Kiesabbau.<br />
Stellenweise reichten die Abbaugruben bis 20m unter das umgebende Bodenniveau. Nach der<br />
Einstellung des Betriebes füllten sich die Kiesgruben mit Grundwasser. <strong>Die</strong> erhaltenen Reste der<br />
Düne sind stark eingewachsen und stellen mit ihrer Vegetation ein Biotop für zahlreiche<br />
Pflanzen- und Tierarten dar.<br />
Grenzen und Landvermessung<br />
Im Kappenwald, ca. 500 m weiter nördlich, steht ein Stein, der Zeugnis von der trigonometrischen<br />
Landvermessung gibt, wie sie im Großherzogtum Hessen erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
durchgeführt wurde. Ausgehend von einem Basisdreieck zwischen Großem Feldberg, Melibokus und<br />
Donnersberg wurde das Land in Dreiecke aufgeteilt und die Eckpunkte mit Steinen markiert. Durch<br />
Ermittlung der Winkel und Seitenlängen erhielt man ein Netz von Messpunkten, das die Erstellung<br />
exakter Kartenwerke und die genaue Festlegung von Grenzverläufen ermöglichte. Mit dieser Methode<br />
wurden die Grundlagen für das moderne Katasterwesen gelegt.<br />
Grenzen wurden zu allen Zeiten sorgfältig markiert. Es gab Landwehren aus Wall, Graben und Hecke,<br />
an Grenzschneisen wurden Bäume und Büsche gerodet und Gräben angelegt, Grenzsteine trugen<br />
Ortsn<strong>am</strong>en oder Wappen. Alte Grenzsteine finden sich zwischen Ober-Roden und Messenhausen in<br />
der Nähe des Schützenhauses, sowie zwischen Urberach, <strong>Die</strong>tzenbach und Messenhausen. Weitere<br />
Steine markierten die Grenze zwischen der Röder Mark und den Jagdrevieren der Landgrafen von<br />
Hessen, der Freiherren von <strong>Die</strong>burg und der Mainzer Kurfürsten. <strong>Die</strong>se alten Grenzsteine<br />
verdeutlichen, wie Landschaft durch den Menschen über Jahrhunderte gestaltet wurde. Sie stehen<br />
daher unter Denkmalschutz.<br />
In früheren Zeiten war der Verlauf von Grenzen oft Anlass zu Streitigkeiten. Daher wurde bei offiziellen<br />
Flurbegehungen geprüft, ob Grenzsteine verschwunden oder versetzt worden waren. Seit dem 17.<br />
Jahrhundert kontrollierten vereidigte Feldmesser die Grenzverlaufe mit Messruten, die Ergebnisse<br />
wurden schriftlich festgehalten und im Gelände markiert. Trotz größter Sorgfalt blieb diese Methode<br />
jedoch ungenau.<br />
Heute erfolgt die Vermessung mittels satellitengestützter Positionsbestimmung (Global Positioning<br />
System - GPS).
Messenhäuser Kapelle<br />
1820 Stiftung der Kapelle anstelle eines alten Heiligenhäuschens<br />
durch Franz, Georg und Erwein Malsi<br />
Seit alljährliche Prozession <strong>am</strong> Dreifaltigkeitssonntag mit<br />
1856 Festgottesdienst an der Kapelle<br />
1862 Anschaffung eines Glöckchens<br />
1890 - Anstrich des Innenraumes<br />
1935/36 Erweiterung der Kapelle durch die Pfarrgemeinde Ober-Roden<br />
1967 Renovierung<br />
1968 Übereignung an die katholische Pfarrgemeinde Ober-Roden<br />
2005 Nach der Reparatur der durch einen Autounfall verursachten<br />
Schäden wird die Kapelle erneut ihrer Bestimmung übergeben.<br />
- 8 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
Kulturhistorische Erlebnisstätte »Auf der Bulau«<br />
Der Höhenzug der Bulau stellt eine besondere Landmarke dar, der seine Existenz den geologischen<br />
Verhältnissen verdankt.<br />
Funde aus der Steinzeit belegen, dass der Mensch diesen Höhenrücken seit Anbeginn als<br />
Siedlungsland nutzte. Ein vorgeschichtlicher Höhenweg, dessen Verlauf durch zahlreiche Hügelgräber<br />
aus der Bronze- und der Hallstattzeit markiert ist, zog in west-östlicher Richtung über die Höhe. Der<br />
Flurn<strong>am</strong>e »Zur Walstatt« weist zurück in diese Epoche, in der die Örtlichkeit als Begräbnisstätte<br />
genutzt wurde. In römischer Zeit verlief hier die Trasse einer Fernstraße von Mainz zum Limes. Heute<br />
eröffnet die Höhenlage dem Besucher einen Fernblick bis weit über das <strong>Die</strong>burger Becken. <strong>Die</strong><br />
kulturhistorische Erlebnisstätte erläutert die Besonderheiten dieses geschichtsträchtigen Ortes.<br />
Unmittelbar <strong>am</strong> Waldrand wurden zwei stark erodierte Grabhügel aus der <strong>Kelten</strong>zeit in ihrer<br />
vermutlichen Größe wieder aufgeschüttet und mit einem Steinkranz versehen. Eine Skulpturengruppe<br />
symbolisiert den Bestattungsritus zur Zeit der Entstehung der Hügelgräber.<br />
Vor den Hügelgräbern wurde ein Teilstück der römischen Straße in ihrem Aufbau und verschiedenen<br />
Belagarten rekonstruiert. <strong>Die</strong> Nachbildung eines römischen Meilensteines verweist auf das römische<br />
<strong>Die</strong>burg.<br />
Ein hölzerner Steg führt zurück in die Erdgeschichte. Von der Panor<strong>am</strong>aplattform geht der Blick über<br />
den Altort von Urberach und das Quellgebiet der Rodau bis hin zu Spessart und Odenwald.<br />
Römischer Straßenbau<br />
Für die Beherrschung und Verwaltung des riesigen Imperium Romanum war ein gutes Straßennetz<br />
unabdingbare Voraussetzung. In erster Linie für die schnelle Verlegung der Truppen angelegt, trug es<br />
erheblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der römischen Provinzen bei.<br />
<strong>Die</strong>se Straßen waren außerordentlich solide konstruiert. Zunächst wurden die Trassen von<br />
Landvermessern (agrimensores) festgelegt, danach erfolgten der Aushub und der Aufbau in mehreren<br />
Schichten. Meilensteine gaben die Entfernungen zu den nächsten Orten an.<br />
In seiner Blütezeit verfügte das römische Reich über ca. 100.000 Kilometer Staatsstraßen, die von<br />
Rom bis nach Britannien, Afrika und Asien führten. Viele moderne Hauptverkehrsrouten folgen heute<br />
noch den römischen Trassen.<br />
Entlang der Hauptrouten befanden sich in regelmäßigen Abständen Raststätten (mansiones). Neben<br />
der Möglichkeit zur Verpflegung und Übernachtung für die Reisenden, standen hier auch Zugtiere zum<br />
Wechseln zur Verfügung.<br />
<strong>Die</strong> Reisegeschwindigkeit des normalen Reisenden betrug ca. 7,5 km in der Stunde. Eine staatliche<br />
Beförderungsanstalt, der cursus publicus, hielt Kuriere, Pferde, Wagen und Zugtiere für die kaiserliche<br />
Verwaltung bereit. Hierdurch war es kaiserlichen Kurieren möglich, innerhalb kürzester Zeit<br />
Nachrichten von den Provinzhauptstädten nach Rom zu übermitteln.<br />
Der Straßenabschnitt auf der Bulau gehörte zu einer Verkehrsverbindung, die von Mainz,<br />
Legionsstandort und Hauptstadt der Provinz Obergermanien, über Heddernheim und <strong>Die</strong>burg bis an<br />
den Limes führte
Römische Fernstraße<br />
<strong>Die</strong> Römer legten ihre Straßen auf höherem<br />
Gelände oder kleinen Dämmen an. Der<br />
Straßenaufbau besaß eine Höhe von ca. 1,40<br />
m. Nach dem Aushub wurden die<br />
Grundsteine verlegt (statumen, 1), darüber<br />
folgten faustgroße Steine (ruderatio, 2),<br />
nussgroße Kieselsteine (nucleus, 3) und die<br />
Deckschicht aus feinem Schotter (summa<br />
crusta, 4). An beiden Seiten befanden sich<br />
Wasserabzugsgräben (5).<br />
Römischer Meilenstein<br />
Der Meilenstein ist die Kopie des 1831<br />
zwischen Altheim und Kleestadt gefundenen<br />
Steines. <strong>Die</strong> Inschrift gibt die Entfernung zum<br />
römischen <strong>Die</strong>burg in gallischen Meilen, den<br />
Leugen, an. Eine Leuge entsprach ca. 2.220<br />
m. Nach der Titulatur des regierenden<br />
Kaisers folgte die Abkürzung des Ortsn<strong>am</strong>en<br />
(AAM) und die Entfernungsangabe (LIIII).<br />
Bruchsteinpflaster<br />
Höfe und Zufahrten römischer Landgüter, den<br />
villae rusticae, wurden mit Bruchsteinpflaster<br />
in Kalkmörtel oder in Sand verlegt. <strong>Die</strong>se<br />
Pflasterung hatte eine lange Lebensdauer<br />
und ist teilweise bis heute erhalten. Das Bild<br />
zeigt den gepflasterten Hof vor dem<br />
Haupthaus einer solchen villa rustica.<br />
Polygonpflaster<br />
Der polygonal verlegte Pflasterbelag ist<br />
typisch für Straßen römischer Städte. <strong>Die</strong><br />
Straßen hatten Rand- und Trittsteine, die<br />
unseren Zebrastreifen ähneln.<br />
<strong>Die</strong> Abstände zwischen den Trittsteinen<br />
waren genormt und entsprachen der<br />
Spurbreite von Kutschen.<br />
- 9 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de
- 10 / 10 -<br />
www.wandern.tsg-sulzbach.de<br />
Keltischer Totenkult<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kelten</strong> sind das erste vorgeschichtliche Volk, dessen Kulturkreis sich in seiner Blütezeit über ganz<br />
Europa bis nach Kleinasien erstreckte.<br />
Schriftliche Aufzeichnungen wurden nicht hinterlassen, nur wenige Informationen über ihre Geschichte<br />
und Lebensweise sind durch griechische und römische Schriftsteller des 5. - 1. Jahrhunderts v. Chr.<br />
überliefert. Als Quellen zum Verständnis der keltischen Kultur sind wir daher heute vor allem auf die<br />
archäologischen Funde angewiesen. Zu diesen archäologischen Zeugnissen aus keltischer Zeit<br />
gehören auch die Urberacher Grabhügel.<br />
Hügelgrabbestattungen waren in der Bronzezeit (ca. 1500-1200 v. Chr.), in der Hallstattzeit (ca. 800-<br />
500 v. Chr.) und in der Latenezeit (ca. 500-50 v. Chr.) üblich.<br />
Auf dem Gebiet von Rödermark sind Funde aus all diesen Epochen belegt <strong>Die</strong> Hügelgräber „Auf der<br />
Bulau“ st<strong>am</strong>men aus der Hallstattzeit. <strong>Die</strong> Gräber wurden archäologisch nicht näher untersucht Über<br />
den Aufbau und die Ausstattung solcher Gräber geben jedoch aufwendig ausgestattete<br />
Hügelgrabbestattungen, wie die Funde von Offenbach-Rumpenheim oder<br />
dem <strong>Kelten</strong>fürsten vom Glauberg, näheren Aufschluss. Hier fanden sich im Zentrum der Hügel<br />
Grabk<strong>am</strong>mern aus Holz oder Stein, in denen die Toten teilweise mit reichen Beigaben, wie Waffen,<br />
Trinkgeschirr, Prunkmöbeln, Schmuck und sogar Leichenwagen beigesetzt wurden.<br />
Auf dieses Brauchtum nimmt auch die Skulpturengruppe vor dem unteren Grabhügel Bezug.