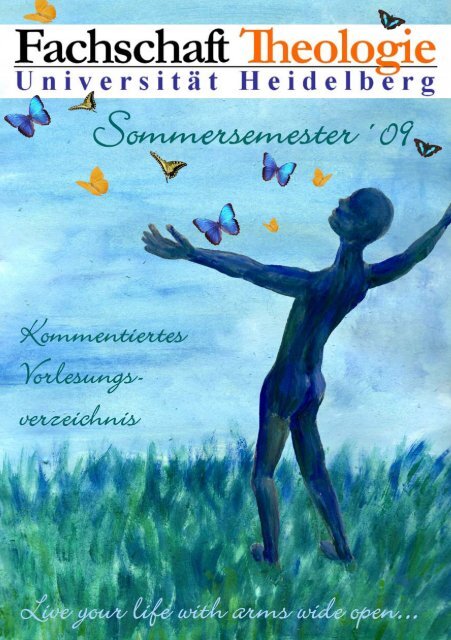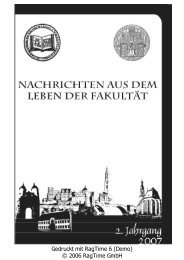S - Theologische Fakultät - Universität Heidelberg
S - Theologische Fakultät - Universität Heidelberg
S - Theologische Fakultät - Universität Heidelberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Für das Studium bei Mohr Siebeck<br />
Maßgeschneiderte<br />
Informationen:<br />
www.mohr.de<br />
Calvin Handbuch<br />
Herausgegeben von<br />
Herman J. Selderhuis<br />
Die Calvinforschung erlebt<br />
derzeit ein erneutes Aufblühen<br />
weltweit. Der 500.<br />
Geburtstag Calvins, der im<br />
Jahr 2009 gefeiert wird, hat<br />
der Forschungsarbeit neue<br />
Impulse gegeben. Mit dem<br />
vorliegenden Handbuch soll<br />
die Forschung unterstützt<br />
und stimuliert werden. Die<br />
Beiträger möchten damit<br />
neben den Fachgelehrten<br />
auch jenen eine verlässliche<br />
Information bieten, die sich<br />
nicht wissenschaftlich oder<br />
von Berufs wegen mit Calvin<br />
beschäftigen.<br />
Auf der Grundlage jüngster<br />
Forschungsergebnisse bietet<br />
ein internationales Team von<br />
anerkannten Wissenschaftlern<br />
eine umfangreiche Übersicht<br />
über die Biographie,<br />
Theologie und Wirkungsgeschichte<br />
Calvins. Dies<br />
macht das Werk zu einem<br />
bisher einzigartigen Handbuch<br />
der Calvinforschung.<br />
Der Band erscheint zugleich<br />
in englischer Sprache bei<br />
Eerdmans, in italienischer<br />
Sprache bei Claudiana und in<br />
niederländischer Sprache bei<br />
Kok.<br />
2008. XI, 569 Seiten. ISBN 978-3-<br />
16-149229-7 Broschur € 39,–; ISBN<br />
978-3-16-149791-9 Leinen € 79,–<br />
Augustin Handbuch<br />
Herausgegeben von<br />
Volker H. Drecoll<br />
Dieses Handbuch bündelt die<br />
weitverzweigte Forschung zu<br />
Augustin. Es gibt einen Überblick<br />
über Leben und Schriften<br />
des Kirchenvaters, sein<br />
historisches Umfeld, die<br />
Autoren und Tradtionen, die<br />
ihn beeinflußten, sowie über<br />
die zentralen Auseinandersetzungen<br />
um sein Werk.<br />
2007. XIX, 799 Seiten. ISBN 978-3-<br />
16-148269-4 Broschur € 79,–; ISBN<br />
978-3-16-148268-7 Leinen € 149,–<br />
Luther Handbuch<br />
Herausgegeben von<br />
Albrecht Beutel<br />
Dieses neu konzipierte Lehrund<br />
Studienbuch gewährt<br />
verläßliche und bündige<br />
Orientierung über Leben,<br />
Werk und Wirkung Martin<br />
Luthers. Das Buch ist für<br />
Fachleute und Liebhaber der<br />
Theologie, aber auch der<br />
angrenzenden Disziplinen<br />
wie der Geschichtswissenschaft,<br />
Germanistik oder<br />
Philosophie von Interesse.<br />
2005. XIV, 537 Seiten. ISBN<br />
978-3-16-148267-0 fadengeheftete<br />
Broschur € 44,–; ISBN 978-3-16-<br />
148266-3 Leinen € 89,–<br />
Bitte fordern Sie unseren<br />
aktuellen Gesamtkatalog an.<br />
Mohr Siebeck<br />
Tübingen<br />
info@mohr.de<br />
www.mohr.de
Studienausgabe RGG 4<br />
4., völlig neu<br />
bearbeitete Auflage 2008.<br />
9.046 Seiten,<br />
262 Abbildungen,<br />
65 Karten und Pläne,<br />
fadengeheftete Broschur,<br />
ISBN 978-3-8252-8401-5<br />
EUR (D) 498,00<br />
www.utb.de<br />
RGG 4 – Religion in<br />
Geschichte und Gegenwart –<br />
jetzt als Studienausgabe<br />
Mit der vierten Auflage erreicht die RGG eine hundertjährige<br />
Geschichte. Wie kaum ein anderes Werk der religionswissenschaftlichen<br />
und theologischen Geschichte spiegeln alle<br />
vier Auflagen sowohl als Gesamtdarstellung als auch in den<br />
einzelnen Artikeln Religion und religiöse Weltanschauungen<br />
ihrer jeweiligen Zeit wider.<br />
Für die vierte Auflage wurden die Fächer und Stichwortlisten<br />
an die neuen wissenschaftlichen Gegebenheiten angepasst.<br />
Neu ist auch die über Europa hinausreichende internationale<br />
Perspektive bei den Fachberatern und Autoren.<br />
In acht Bänden plus Register steht Ihnen in dieser vierten,<br />
völlig neu bearbeiteten Auflage ein Handwerkszeug und<br />
Wissensfundus erster Güte zur Verfügung.<br />
Die günstige, ungekürzte Studienausgabe erscheint kurz<br />
nach Vollendung der Originalausgabe bei UTB und ist damit<br />
hochaktuell.
Editorial<br />
2009 hat begonnen und das Sommersemester steht vor der Tür. Witzig, dass das KVV dafür<br />
schon mitten im kalten Winter verkauft wird. Als dieses KVV in Druck gegangen ist, hatten wir<br />
in <strong>Heidelberg</strong> gerade 10 Grad unter Null. In dieser Eiseskälte im Dezember und Januar hat sich<br />
eine sympathische Theologiestudentin hingesetzt und uns ein klein wenig Sommerstimmung<br />
auf das Titelblatt des KVV gezaubert. Deshalb, liebe Tine, gilt der erste Dank in diesem Editorial<br />
dir. Danke, dass du dir so viel Mühe mit unserem Deckblatt gemacht hast – handgezeichnet,<br />
digitalisiert und weiter verziert! Wir sind begeistert.<br />
Weiterer Dank gilt Herrn Schmitt, Frau Grote und ihrem Team im Dekanat für die enge Zusammenarbeit<br />
und die gute Kommunikation.<br />
Nicht zuletzt noch ein herzliches Dankeschön an alle, die sonst an der Herstellung des KVVs<br />
beteiligt waren. Ihr (vor allem Tobias H.) habt so viel Arbeit auf euch genommen und eure<br />
Unterstützung war sehr wertvoll.<br />
Zum Schluss noch ein Hinweis: Die Stelle des »KVV-Chefredakteures« wird neu besetzt. Da für<br />
diese Position noch jemand gesucht wird, beachtet bitte die abgedruckte »Stellenanzeige«.<br />
Bleibt nur noch, allen Mitgliedern und Freunden der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> (und natürlich auch<br />
den Studierenden) ein schönes und erfolgreiches Sommersemester 2009 zu wünschen.<br />
Euer KVV-Team<br />
www.theologie.uni-heidelberg.de/fachschaft<br />
Das »Kommentierte Vorlesungsverzeichnis der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> <strong>Heidelberg</strong>« wird herausgegeben von der Fachschaft<br />
Theologie, Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Mail: kvv@theologie.uni-heidelberg.de<br />
Redaktion: Stefan Karcher, Christian Brost, Tobias Dötzkirchner, Tobias Habicht, Anna-Maria Schmidt<br />
Deckblatt: Christine Siegel
In eigener Sache<br />
Mittwoch, 13.30 Uhr – da hast du keine Lehrveranstaltung? Dann komm zu uns, zur Fachschaft<br />
Theologie in den Fachschaftskeller (Treppenabgang bei KiGa I)! Hier kannst du Hochschulpolitik<br />
betreiben, Studiengebühren sinnvoll vergeben, Partys organisieren, Studientage vorbereiten und<br />
beim KVV mitarbeiten – oder auch einfach nur nette Leute treffen, Kaffee trinken und viel Spaß<br />
haben.<br />
Die Fachschaft Theologie besteht derzeit aus etwa 15 aktiven Mitgliedern, die sich einmal in der<br />
Woche treffen und versuchen, den Unialltag besser und schöner zu machen. Damit wir auch<br />
dieses Semester was erreichen können, brauchen wir DICH! Also, komm vorbei, wir freuen uns<br />
auf dich!<br />
Eine weitere Information an alle, die neu in <strong>Heidelberg</strong> sind: Solltet ihr einmal nicht<br />
wissen, wohin mit euren Fragen, wendet euch vertrauensvoll an eure Fachschaft, wir helfen euch<br />
gerne weiter. Kommt einfach mittwochs ab 13.30 Uhr vorbei oder besucht uns im Internet unter<br />
www.theologie.uni-heidelberg.de/fachschaft. Dort findet ihr viele weitere Informationen<br />
über unsere <strong>Fakultät</strong> und das Leben und Studium in <strong>Heidelberg</strong>.<br />
Semestertermine<br />
Sommersemester 2009<br />
Semesterzeit 01. März – 31. August 2009<br />
Vorlesungszeit 30. März – 11. Juli 2009<br />
Vorlesungsfreie Zeit 10. April bis 13. April 2009 (Ostern)<br />
01. Mai (Tag der Arbeit)<br />
21. Mai (Christi Himmelfahrt)<br />
01. Juni (Pfingstmontag)<br />
11. Juni (Fronleichnam)<br />
Wintersemester 2009/10<br />
Semesterzeit 01. September 2009 – 28. Februar 2010<br />
Vorlesungszeit 05. Oktober 2009 – 30. Januar 2010<br />
Vorlesungsfreie Zeit 23. Dezember 2009 – 06. Januar 2010
Studium<br />
Informationen für Bachelor<br />
Jedem Bachelorstudenten wird zu Beginn des Studiums zuerst erklärt, dass der Bachelor wahnsinnig<br />
kompliziert ist und dass dieses Studium im Grunde eh niemand versteht. Das sehen wir<br />
Bachelorstudenten nicht so, also keine Angst!<br />
Die wichtigsten Informationen findest du unter:<br />
www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/christentumundkultur.html<br />
Darüber hinaus sind zwei Dokumente für dich besonders wichtig: Auf der <strong>Fakultät</strong>shomepage<br />
findest du unter »Studium« das Modulhandbuch und die Prüfungsordnung. Beides solltest du dir<br />
herunterladen bzw. ausdrucken!<br />
Als Bachelor musst du je nach Gewichtung des Faches unterschiedlich viele Module mit einer<br />
Prüfungsleistung absolvieren. Diese Module setzen sich in der Regel aus zwei Veranstaltungen<br />
meist einer Vorlesung und einem dazugehörigen Proseminar zusammen. Im Modulhandbuch wird<br />
zu jedem Modul aufgeführt, welche Veranstaltungen dafür notwendig sind, wie viel Arbeit dafür<br />
vorgesehen ist, wie viele Punkte du dafür bekommst und noch ein paar nützliche Informationen<br />
mehr. In der Prüfungsordnung kannst du dann nachlesen, welche Module du für Christentum und<br />
Kultur als Haupt- bzw. Nebenfach brauchst, um für die Abschlussarbeit zugelassen zu werden.<br />
Bei weiteren Fragen wendest du dich am besten an unseren Fachstudienberater Dirk Schwiderski<br />
Lehramtsinfo<br />
Bei Fragen zu deinem Studium wendest du dich am besten an das Zentrum für Lehrerbildung<br />
(ZLB) www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/zlb/<br />
Ein gelegentlicher Blick auf die Internetseite lohnt sich, dort werden aktuelle Veranstaltungen und<br />
Beratungstermine angekündigt.<br />
Beim ZLB bekommst du außerdem Informationen zu Studienmöglichkeiten, Bewerbung und Zulassung,<br />
Studienanforderungen, Praktika, Fachwechsel oder Wechsel von Hochschulorten, Parallelstudium,<br />
Lernen und Prüfungen, sowie Unterstützung in schwierigen Phasen des Studiums oder<br />
Orientierungshilfen.<br />
Für Fragen, die speziell dein Studium der Theologie betreffen, wende dich bitte an unseren Fachstudienberater<br />
Dirk Schwiderski.<br />
Informationen bezüglich des Ethisch Philosophischen Grundlagenstudiums (EPG) erhältst du im<br />
Internet unter www.rzuser.uni-heidelberg.de/~d04/epg/<br />
Für das Schulpraxissemester<br />
bewirbst du dich unter www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za242/PS/
Falls du dein Praxissemester gerne als assistant teacher oder assistante absolvieren möchtest,<br />
wende dich an das Landeslehrerprüfungsamt (LLPA) in Baden-Württemberg:<br />
http://www.kultusportal-bw.de/servlet/PB/-s/1lem65npz8uw7roc9c694xiiu1927d7/menu/1180555/index.html<br />
Prüfungsordnungen online:<br />
Zwischenprüfung (ZP) Uni <strong>Heidelberg</strong> allgemeiner Teil<br />
www.zuv.uni-heidelberg.de/studsekr/rechtsgrundlagen/ordnungen/05/0500101.pdf<br />
ZP Uni <strong>Heidelberg</strong> besonderer Teil ev. Theologie<br />
www.zuv.uni-heidelberg.de/studsekr/rechtsgrundlagen/ordnungen/01/0101104.pdf<br />
Die Prüfungsordnungen zum Staatsexamen finden sich auf den Seiten des LLPA unter »Ausbildungs-<br />
und Prüfungsordnungen«.<br />
Auf der Internetpräsenz der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> (www.theologie.uni-heidelberg.de/)<br />
findest du unter der Rubrik »Studium« weitere nützliche Links und Hinweise.<br />
Die <strong>Theologische</strong> <strong>Fakultät</strong><br />
• Dekanat<br />
Hauptstr. 231, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: 54 3334/35<br />
Fax: 54 3372<br />
E-Mail: dekanat@theologie.uni-heidelberg.de<br />
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-13 Uhr<br />
Dekan<br />
Prof. Dr. Jan Christian Gertz<br />
Tel.: 54 3334/35<br />
Prodekan<br />
Prof. Dr. Christoph Strohm<br />
Tel.: 54 3334/35<br />
Studiendekanin<br />
Prof. Dr. Friederike Nüssel<br />
Tel.: 54 3341 (Sekretariat)
• Prüfungsamt (inkl. Zwischenprüfung)<br />
Ines Pollmann E-Mail: pruefungsamt@theologie.uni-heidelberg.de<br />
Raum 002, Tel. 54 3371<br />
Sprechstunde: Di 14-16 Uhr/Telefonisch: Di 10.30-11.30 Uhr<br />
• Fachstudienberatung Ev. Theologie &<br />
Ausstellung von BAföG-Bescheinigungen<br />
Dr. Dirk Schwiderski E-Mail: dirk.schwiderski@wts.uni-heidelberg.de<br />
KiGa Z. 123, Tel.: 54 3394<br />
Sprechstunde: Di 11.30-13 Uhr<br />
• EPG-Koordination<br />
Dr. Frank Martin Brunn, KiGa Z. 211, Tel.: 54 2414<br />
E-Mail: frank-martin.brunn@wts.uni-heidelberg.de<br />
Sprechstunde: Mi 14.30 Uhr – 16 Uhr<br />
Seminare & Institute<br />
• Wissenschaftlich-<strong>Theologische</strong>s Seminar<br />
Kisselgasse 1<br />
69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
• Praktisch-<strong>Theologische</strong>s Seminar<br />
Karlstr. 16<br />
69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
• Diakoniewissenschaftliches Institut<br />
Das Diakoniewissenschaftliche Institut (DWI) bietet die Möglichkeit, das soziale Handeln der<br />
Kirche, die Diakonie, theologisch und sozialwissenschaftlich zu reflektieren. Im Rahmen der Lehrveranstaltungen<br />
möchten die Vorlesungen anhand ausgewählter Beispiele einen Überblick über<br />
Theorie und Praxis der Diakonie in Kirchengeschichte und Gegenwart bieten. Die sozialwissenschaftlichen<br />
Vorlesungen haben das Ziel, Kenntnisse und Problemstellungen des jeweiligen Be-
eichs zu vermitteln. In den Seminaren werden spezielle Fragen aus Diakonie, Gemeindeaufbau,<br />
Ökumene, Probleme der sozialen Arbeit, historischen Entwicklung und theologischen Begründung<br />
behandelt. Einblicke in die diakonische Praxis erfolgen durch Exkursionen und Praxisprojekte.<br />
Drei Möglichkeiten bieten sich an, das Angebot des DWI wahrzunehmen:<br />
Grundsätzlich sind die Veranstaltungen des DWI als integraler Bestandteil des Studiums der<br />
Praktischen Theologie offen für alle Studierenden. Es ist also durchaus möglich, nur einzelne<br />
ausgewählte Vorlesungen und Seminare zu besuchen.<br />
Zum anderen steht der Weg offen, am DWI ein diakoniewissenschaftliches Zusatzstudium<br />
aufzunehmen. Im Zeitraum von vier – bzw. zwei – Semestern kann ein Curriculum absolviert<br />
werden, das der Schwerpunktbildung dient. Zukünftigen Pfarrerinnen/Pfarrern und kirchlichen<br />
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern soll im Blick auf relevante Bereiche der Diakonie eine spezifische<br />
Kompetenz vermittelt werden.<br />
Seit dem Wintersemester 2008 ist die Möglichkeit eines viersemestrigen Master-<br />
Ergänzungsstudiengangs »Diakonie – Führungsverantwortung in christlich-sozialer<br />
Praxis« eröffnet, der sich an Interessierte mit abgeschlossenem Studium (Theologie, Psychologie,<br />
Medizin, Pädagogik usw.) richtet. Für die individuelle Studienplanung wird eine ausführliche Studienberatung<br />
empfohlen. Mehr über die Studienmöglichkeiten: Karlstr. 16, Zimmer 105 und bei<br />
den MitarbeiterInnen des DWI. Für weitere Informationen siehe auch http://www.dwi.uni-hd.de.<br />
Sprechstunden<br />
Prof. Dr. Heinz Schmidt nach Vereinbarung DWI Zi. 104<br />
Christian Oelschlägel nach Vereinbarung DWI Zi. 102<br />
Anika Christina Albert nach Vereinbarung DWI Zi. 101<br />
• Ökumenisches Institut<br />
Plankengasse 1<br />
69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Bibliotheken<br />
<strong>Fakultät</strong>sbibliothek Theologie http://www.theologie.uni-hd.de/bib/<br />
Bibliotheksleitung<br />
Dr. theol. Beate Müller, Dipl.-Bibl.<br />
KiGa Z. 112, Tel.: 54 3280<br />
E-Mail: beate.mueller@wts.uni-heidelberg.de
Bibliothek des Wissenschaftlich-<strong>Theologische</strong>n Seminars<br />
Ansprechpartnerinnen<br />
Dr. Beate Müller, Dipl.-Bibl. E-Mail: beate.mueller@wts.uni-heidelberg.de<br />
KiGa Z. 112, Tel.: 54 3280<br />
Bettina Böhler, Dipl.-Bibl. E-Mail: bettina.boehler@wts.uni-heidelberg.de<br />
KiGa Z. 109, Tel.: 54 3283<br />
Karin Bühler, Bibliotheksassistentin E-Mail: karin.buehler@wts.uni-heidelberg.de<br />
KiGa Z. 111, Tel.: 54 3282<br />
Öffnungszeiten<br />
Semester Semesterferien<br />
Mo-Fr 8-21.45 Uhr Mo-Fr 8-19.45 Uhr<br />
Sa 9-18 Uhr<br />
Bibliothek des Praktisch-<strong>Theologische</strong>n Seminars und des DWI<br />
Ansprechpartnerinnen<br />
Bettina Böhler, Dipl.-Bibl. E-Mail: bettina.boehler@wts.uni-heidelberg.de<br />
Karl Z. 205, Tel. 54 3328 oder 54 3283<br />
Alla Gilberg, E-Mail: alla.gilberg@pts.uni-heidelberg.de<br />
Beschäftigte im Bibliotheksdienst<br />
Karl Z. 204 und Aufsicht, Tel. 54 3329<br />
Öffnungszeiten<br />
Semester Semesterferien<br />
Mo-Fr 8-20 Uhr aktuelle Infos auf der Homepage und Aushänge beachten<br />
Sa 9-18 Uhr<br />
Bibliothek des Ökumenischen Instituts<br />
Ansprechpartnerin<br />
Karin Bühler, Bibliotheksassistentin E-Mail: karin.buehler@wts.uni-heidelberg.de<br />
donnerstags: Tel. 54 3390, übrige Zeit: Tel. 54 3282<br />
Öffnungszeiten<br />
Semester Semesterferien<br />
Mo-Do 9-20.30 Uhr aktuelle Infos auf der Homepage und Aushänge beachten<br />
Fr 9-18 Uhr
<strong>Universität</strong>sbibliothek (Hauptstelle)<br />
Plöck 107-109<br />
69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Website: www.ub.uni-heidelberg.de<br />
Öffnungszeiten<br />
Ausleihe Lesesaal<br />
Mo-Fr 9-19 Uhr Mo-Fr 8.30-22 Uhr<br />
Sa 9-13 Uhr Sa-So 9-22 Uhr<br />
Die UB ist auch in den Semesterferien durchgehend geöffnet. Geänderte Öffnungszeiten sowie<br />
Schließungen an Feiertagen finden sich auf der Homepage.<br />
Ausleihbibliothek <strong>Theologische</strong> Studienbibliothek <strong>Heidelberg</strong><br />
Neuenheimer Landstraße 2<br />
69120 <strong>Heidelberg</strong><br />
Website: www.badischer-theologendienst.de<br />
Öffnungszeiten<br />
Semester Semesterferien<br />
Mo-Di 14-17 Uhr aktuelle Infos auf der Homepage und Aushänge beachten<br />
Mi 09-12 Uhr / 14-17 Uhr<br />
Fehlt dir ein Buch und es ist nicht in der Bibliothek vorhanden?<br />
Dann mach doch einen Vorschlag zur Anschaffung neuer Bücher! Ein Antragsformular erhältst du<br />
an der Pforte der Bibliotheken der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong>. Du kannst deine Vorschläge auch<br />
online abschicken unter: theologie.uni-hd.de/bib/anschaffung.htm<br />
Gremien<br />
<strong>Fakultät</strong>srat<br />
Wer entscheidet eigentlich über die wirklich wichtigen Dinge einer <strong>Fakultät</strong>? Wer arbeitet in Berufungskommissionen<br />
für neue Stellen mit? Und wer entscheidet darüber, ob Anträgen, wie z. B.<br />
der Verteilung der Studiengebühren, stattgegeben wird oder nicht?<br />
Natürlich die Professoren und Dozenten! Allerdings nicht nur, denn eine kleine, aber wichtige<br />
Gruppe von 6 StudentInnen sitzt 2-3-mal im Semester mit dem Dekan, den Professoren und<br />
Vertretern des akademischen Mittelbaus zusammen an einem Tisch und entscheidet mit, bringt<br />
Ideen und Anträge ein und versucht, den Anliegen und Interessen der Mitstudierenden Gehör zu<br />
verschaffen.
Dieses beschlussfassende Gremium nennt sich <strong>Fakultät</strong>srat. Die studentischen Vertreter einer<br />
jeden <strong>Fakultät</strong> werden immer im Sommersemester bei den uniweiten Gremienwahlen in diesen<br />
Rat gewählt.<br />
Bei weiteren Fragen bzgl. des <strong>Fakultät</strong>srates sind die studentischen Vertreter für euch mittwochs<br />
zwischen 14 und 15 Uhr im Fachschaftskeller zu erreichen.<br />
Studienkommission<br />
Die Studienkommission besteht aus 4 Professoren, 3 Vertretern des Mittelbaus und 4 Studentischen<br />
Mitgliedern. Unter Vorsitz der Studiendekanin befasst sie sich mit allen Fragen zu Lehre und<br />
Lehrangebot. Darunter fallen Studien- und Prüfungsordnungen, sowie die Kontrolle des Lehrangebots.<br />
Gleichstellungskommission<br />
An der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> steht als Gleichstellungsbauftragter Professor Doktor Winrich Löhr<br />
zur Verfügung. Die Sprechstunde wird nach Vereinbarung abgehalten, Anmeldung über das Büro<br />
Karlstr. 2, Zimmer 205. Studentische Vertreterinnen der Gleichstellungskommission sind Tina<br />
Winter und Johanna Kluge.<br />
<strong>Universität</strong>sgottesdienste<br />
Die <strong>Universität</strong>sgottesdienste werden im Rhythmus des Kirchenjahres in der Regel sonntags um<br />
10 Uhr gefeiert, sowohl in der vorlesungsfreien Zeit als auch im Semester.<br />
An zwei Sonntagen des Monats (in der Regel am ersten und dritten Sonntag), zum Semesteranfang,<br />
zum Semesterende und an den hohen Feiertagen wird Gesamtgottesdienst, an den übrigen<br />
Sonntagen Predigtgottesdienst gefeiert. Im Gesamtgottesdienst sind Wortverkündigung und Feier<br />
des Heiligen Abendmahls verbunden. In der Peterskirche herrscht ökumenische Gastfreundschaft:<br />
Alle Getauften, unabhängig davon, welcher Kirche sie angehören und wie alt sie sind, sind zum<br />
Abendmahl herzlich eingeladen. Im Predigtgottesdienst steht die Wortverkündigung in Schriftlesungen<br />
und Predigt im Zentrum. Während des Semesters wird ein Mal pro Monat im Anschluss an<br />
einen Predigtgottesdienst zum Predigtnachgespräch eingeladen. In regelmäßigen Abständen wird<br />
auch Kindergottesdienst gefeiert: Vor der Predigt gehen die Kinder in die Sakristei und lernen dort<br />
eine biblische Geschichte kennen, singen, malen und spielen; zur Feier des Abendmahls kehren<br />
sie zurück. In der Kirche ist auch eine Spiel- und Krabbelecke für kleine Kinder eingerichtet.<br />
Am ersten Sonntag im Monat gibt es in der Regel nach dem Gottesdienst Kirchkaffee.<br />
Für Predigt und Liturgie sind die ordinierten und beauftragten Mitglieder der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong><br />
und die Studierendenpfarrer Franziska Gnändinger und Albrecht Herrmann verantwortlich.<br />
Organisiert wird der <strong>Universität</strong>sgottesdienst vom <strong>Universität</strong>sprediger, Prof. Dr. Helmut Schwier,<br />
in Zusammenarbeit mit dem gewählten Kapitel der Peterskirche.<br />
Weitere regelmäßige Gottesdienste sind der Abendmahlsgottesdienst mit reich ausgestalteter<br />
Liturgie am Mittwochmorgen (anschließend gemeinsames Frühstück) und während des Semesters<br />
die Abendgottesdienste der ESG am Mittwoch sowie die Gottesdienstreihe »Inspirationen am<br />
Abend«.
Semestereröffnungsgottesdienst ist am 5. April 2009,<br />
Semesterschlussgottesdienst am 5. Juli 2009.<br />
Während des ganzen Jahres:<br />
Sonntag, 10 Uhr, <strong>Universität</strong>sgottesdienst (Peterskirche)<br />
Mittwoch, 7 Uhr, Abendmahlsgottesdienst (Chorraum der Peterskirche)<br />
Während des Semesters:<br />
Mittwoch, 18.15 Uhr, Abendgottesdienst der ESG (Kapelle im Karl-Jaspers-Haus, Plöck 66)<br />
Ansprechpartner:<br />
Prof. Dr. Helmut Schwier, <strong>Universität</strong>sprediger, Tel.: 543326,<br />
Mail: helmut.schwier@pts.uni-heidelberg.de<br />
Pfarrerin Franziska Gnändinger, Pfarrer Albrecht Herrmann, ESG-PfarrerIn, Tel.: 163230,<br />
Mail: esg@uni-heidelberg.de<br />
Weitere Informationen: www.peterskirche-heidelberg.de und über die Homepage der <strong>Theologische</strong>n<br />
<strong>Fakultät</strong> (»<strong>Universität</strong>sgottesdienste«).<br />
Mittwochmorgengottesdienst<br />
Seit Anfang der 1960er Jahre wird am Mittwochmorgen ein Abendmahlsgottesdienst als lutherische<br />
Messe gefeiert, der zugleich spirituelle Traditionen der ökumenischen Liturgiefamilien bewahrt.<br />
Prof. Albrecht Peters und seine Frau begründeten diese Tradition, die von Prof. Adolf<br />
Martin Ritter und seiner Frau übernommen wurde. Seit 2004 hat Dr. Joachim Vette die Organisation<br />
der Gottesdienste übernommen. Der Gottesdienst zeichnet sich durch eine reiche Liturgie<br />
aus, die von der Gemeinde aktiv mitgestaltet wird. Die Predigten werden von Mitgliedern der<br />
theologischen <strong>Fakultät</strong> mitgestaltet. Der Gottesdienst findet jeden Mittwoch, auch in den Semesterferien,<br />
von 7 bis 8 Uhr in der Peterskirche statt. Dafür lohnt sich frühes Aufstehen wie sonst<br />
selten. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Frühstück mit frischen Brötchen<br />
und viel Kaffee und Tee in der Glaskapelle der Peterskirche. Weitere Anfragen gerne an Dr.<br />
Vette.
Konvente<br />
Konvente setzen sich aus den Studierenden der einzelnen Landeskirchen zusammen und werden<br />
ca. 2 Mal im Semester einberufen. Auf den Konventstreffen habt ihr die Möglichkeit euch über<br />
Anliegen auszutauschen, die eure Landeskirche betreffen, neue Informationen über Prüfungsordnungen<br />
etc. zu erhalten oder einfach nur gemütlich zusammensitzen und eure zukünftigen Kollegen<br />
besser kennen zu lernen.<br />
Nähere Informationen darüber, wer alles in eurem ist, wo ihr euch trefft etc. erhaltet ihr bei<br />
eurem Konventssprecher oder auf dem Konventsbrett im WTS (am Treppenabgang neben KiGa I).<br />
Ach ja… solltet ihr euer Konvent nicht hier finden, schaut auf dem Konventsbrett nach oder gründet<br />
selbst eins. Fragt dazu einfach bei eurer Landeskirche an.<br />
Baden<br />
Liebe Badenerinnen und Badener,<br />
zu unserem traditionsgemäßen Grillkonvent im Sommersemester 2009 laden wir euch alle herzlich<br />
ein.<br />
Wir freuen uns darauf, euch in fröhlicher Runde kennenzulernen und die neusten Infos zu Studium<br />
und Landeskirche auszutauschen.<br />
Eure Konventssprecherinnen<br />
Carolin und Julia<br />
(carolin.knapp@web.de; klein-j@web.de)<br />
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz<br />
Du hast deine heimischen Berlin-Brandenburger Gefilde verlassen und willst dich fern deiner<br />
Landeskirche ins theologische Abenteuer stürzen? DU BIST NICHT ALLEIN! Der Konvent<br />
wartet auf dich! Hier kannst du deine Berliner Mitstreiter kennenlernen und bekommst Informationen<br />
rund um unsere Landeskirche. Interesse? Dann melde Dich bei Anna<br />
(anna2000@nexgo.de)
Hannover Konvent<br />
Liebe Hannoveranerinnen und Hannoveraner<br />
wir laden euch ein in gemütlicher Runde ein paar Mal im Semester Leute aus der alten Heimat<br />
kennenzulernen, gemeinsam Informationen über das Studium auszutauschen und das Neueste<br />
aus der Landeskirche zu erfahren…. und das mal wieder auf Hochdeutsch ;-)<br />
Wir freuen uns auf euch<br />
Robert (0176/64624855) und Annabell (06221) 3265860<br />
Pfalz-Konvent<br />
SETh<br />
Hast auch du den Sprung über den Rhein gewagt<br />
und dich für ein Theologiestudium in <strong>Heidelberg</strong><br />
entschieden?<br />
Dann schau doch einfach mal bei einem Treffen<br />
des Pfalzkonvents vorbei und finde bei geselligem<br />
und fröhlichem Beisammensein heraus, wen es<br />
aus deiner Landeskirche noch alles hierher verschlagen<br />
hat!<br />
Infos zum nächsten Treffen gibt´s am Aushang im<br />
WTS an der Kellertreppe oder bei mir: Tobias<br />
(tobiasdtz@web.de)<br />
Der SETh ist der Studierendenrat der Evangelischen Theologie und somit unsere Interessenvertretung<br />
auf Bundesebene. Er verhandelt auf Augenhöhe mit der EKD und den bundesweiten Hochschulgremien<br />
und verschafft unseren Anliegen und Problemen Gehör. Der SETh vernetzt die<br />
Fachschaft- und Konventsarbeit vor Ort. Dreimal jährlich treffen sich Delegierte aus Fachschaften<br />
und Konventen zur Vollversammlung, um Informationen auszutauschen und zu aktuellen Themen<br />
Stellung zu beziehen.<br />
Momentan handelt es sich hierbei beispielsweise um die geplante Modularisierung des Diplom-<br />
und Pfarramtsstudiengangs oder die Fremdsprachenkenntnisse für Lehramtsstudierende.<br />
Aktuelle Stellungnahmen, Berichte, Protokolle und alles Weitere findet ihr auf<br />
www.interseth.de<br />
Anliegen und Fragen könnt ihr dort im Internetforum äußern oder per E-Mail senden.
Stadtplan für <strong>Heidelberg</strong>er Theologiestudenten<br />
Einrichtungen der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong><br />
(1) Dekanat Hauptstraße 231<br />
(2) Wissenschaftlich-<strong>Theologische</strong>s Seminar Kisselgasse 1<br />
(3) Praktisch-<strong>Theologische</strong>s Seminar Karlstraße 16<br />
(4) Ökumenisches Institut Plankengasse 1-3<br />
(5) Kirchengeschichte Karlstraße 2<br />
(6) Hauptstraße 216 (Eingang am Karlsplatz)<br />
Weitere Einrichtungen der <strong>Universität</strong> <strong>Heidelberg</strong><br />
(7) Historisches Seminar Grabengasse 3-5<br />
(8) Heuscheuer Mantelgasse<br />
(9) Ägyptologisches Institut + SKPh Marstallhof 4<br />
(10) <strong>Universität</strong>sbibliothek Plöck 107-109<br />
(11) Studentensekretariat/Univerwaltung Seminarstraße 2<br />
Weitere<br />
(12) FIIT Hauptstraße 240<br />
(13) Petersstift Neuenheimer Landstraße 2<br />
Kirchen<br />
(14) Heiliggeistkirche<br />
(15) Peterskirche<br />
(16) Jesuitenkirche<br />
Mensen<br />
(17) Marstallmensa<br />
(18) Triplexmensa
Teil II – Veranstaltungsübersicht und Kommentare<br />
Benutzungshinweise<br />
• Die Veranstaltungen der theologischen <strong>Fakultät</strong> beginnen grundsätzlich in der ersten<br />
Vorlesungswoche. Sollte eine Veranstaltung früher oder später beginnen, ist das in der<br />
Zeile »Beginnt am:« vermerkt. Meistens stehen hier auch die Termine für Vorbesprechungen<br />
von Blockveranstaltungen.<br />
• Die »Zielgruppe:« bezeichnet die Studiereneden, für die die Veranstaltung empfohlen<br />
wird und ist nicht als Zulassungsbeschränkung zu verstehen.<br />
• Unter »Teilnahmevorrausetzungen:« findet man alle Vorleistungen, die zur<br />
Teilnahmen an dieser Veransltung erforderliche sind. Sind keine speziellen<br />
Vorrausetzungen erforderlich, fehlt diese Zeile.<br />
• Die Veranstaltungen der theologischen <strong>Fakultät</strong> sind meistens anmeldungsfrei. Sollte<br />
aus bestimmten Gründen (z. B. Teilnehmerbeschränkung usw.) eine Voranmeldung<br />
erforderlich sein, findet man im Veranstaltungskommentar die Zeile: »Anmeldung:«<br />
und die genauen Anmeldeformalitäten.<br />
• Die Zahl hinter »Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche:« gibt an, wie viele<br />
Stunden man zusätzlich zur Seminarzeit pro Woche zur Vor- und Nachbereitung<br />
aufbringen sollte. Sie wird von den jeweiligen Dozentinnen/Dozenten als Schätz- bzw.<br />
Erfahrungswert angegeben und kann u. U. in der Realität abweichen.<br />
• Will man in einer Veranstaltung einen Schein erwerben, wird in der Zeile<br />
»Leistungsnachweis:«darauf hingewiesen, welche Leistungen dafür erbracht werden<br />
müssen. Bitte die Dozentinnen/Dozenten nicht auf dieser Angabe im KVV festnageln,<br />
denn es ist immer mal wieder möglich, dass hier nur »Proseminararbeit« angegeben<br />
wurde und man dennoch um ein zusätzliches Referat gebeten wird.<br />
• Kolloquien, Repetitorien, Sozietäten und eine Übersicht über EPG/PhE Veranstaltungen<br />
sind am Ende des Kommentarteils unter »Weitere Veranstaltungen« aufgelistet.<br />
Zum Schluss: Der Aktualitätsstand des KVV ist auf der Umschlaginnenseite angegeben.<br />
Änderungen am Lehrangebot, die nach diesem Datum vorgenommen wurden, sind hier deshalb<br />
nicht eingearbeitet. Ein aktuelles Lehrangebot, mit aktuellen Zeiten und Räumen, hängt im WTS<br />
(neben KiGa I), ÖInst, PTS und im Dekanat aus. Man sollte sich an diesen Stellen rechtzeitig<br />
darüber informieren, ob ein Zeit- oder Raumänderung vorgenommen oder Veranstaltungen<br />
aufgenommen oder gestrichen wurden!
Stundenplan<br />
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag<br />
8-9<br />
9-10<br />
10-11<br />
11-12<br />
12-13<br />
13-14<br />
14-15<br />
15-16<br />
16-17<br />
17-18<br />
18-19<br />
19-20<br />
20-21<br />
21-22
Veranstaltungen im Sommersemester 2009<br />
Sprachkurse<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
Hebräisch I � S. 30<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
Einführung in die griechische Sprache I - Griechisch für Anfänger � S. 32<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
Einführung in die griechische Sprache II - Griechisch für Fortgeschrittene � S. 32<br />
MEISTERS<br />
Latein I: Einführung in Sprache und Kultur Roms - Latein für AnfängerInnen � S. 34<br />
MEISTERS<br />
Latein II: Einführung in Sprache und Kultur Roms (Forts.) - Latein für<br />
Fortgeschrittene � S. 35<br />
Vorlesungen<br />
PROF. GERTZ<br />
AT | Überblickslehrveranstaltung: Klassische Propheten (für Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en) � S. 38<br />
PROF. DIEBNER<br />
AT | Mose - Gab es ihn? Und wer war »Mose«? (für Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en) � S. 39<br />
PROF. LAMPE<br />
NT | Überblicksvorlesung: »Die kanonischen Evangelien im Profil« � S. 46<br />
N. N.<br />
NT | Überblicksvorlesung � S. 47<br />
PROF. THEIßEN<br />
NT | Das Verstehen des Neuen Testaments in der modernen Zeit (Hermeneutik) � S. 47<br />
PROF. LÖHR<br />
KG | Überblicksvorlesung: KG I (Alte Kirche) � S. 53<br />
PROF. STROHM<br />
KG | Überblicksvorlesung: KG III (Reformation) � S. 53<br />
PROF. LÖHR<br />
KG | Geschichte des Christentums im Überblick: KG I (Antike und Mittelalter) für<br />
BA Christentum und Kultur � S. 54<br />
PD DR. KLEIN<br />
KG | Geschichte des sozialen Protestantismus � S. 54<br />
DR. PICKER<br />
KG | Pfälzische Kirchengeschichte in der NS-Zeit � S. 55<br />
PROF. WELKER<br />
ST | Christologie � S. 62<br />
PROF. TANNER<br />
ST | Überblicksvorlesung: Geschichte der Ethik seit der Reformation (Vorlesung<br />
und Übung)<br />
� S. 63<br />
PROF. PLATHOW<br />
ST | »Theologie der Liebe. Augustin –<br />
doctor caritatis« � S. 64
PD DR. HAIGIS<br />
ST | Kirche der Freiheit in einer pluralistischen Gesellschaft � S. 64<br />
PD DR. ETZELMÜLLER<br />
ST | Gottesdienst als Thema ökumenischer Theologie � S. 65<br />
PD DR. WLADIKA<br />
ST | Repetitorium Dogmatik � S. 65<br />
PROF. BERGUNDER<br />
RW | Überblickslehrveranstaltung: Einführung in die Religionswissenschaft und<br />
Interkulturelle Theologie (Missionswissenschaft) � S. 78<br />
PD DR. HARTUNG<br />
RP | Einführung in die Religionsphilosophie � S. 81<br />
PD DR. WLADIKA<br />
RP | Geschichte der Philosophie im Überblick (Repetitorium) � S. 81<br />
PROF. SCHOBERTH<br />
PT | Einführung in die Religionspädagogik � S. 83<br />
PROF. LIENHARD<br />
PT | Die Zukunft der evangelischen Kirche in Europa – am Beispiel von Deutschland<br />
und Frankreich � S. 84<br />
PROF. MÖLLER/PD DR. HEYMEL<br />
PT | Sternstunden der Predigt � S. 84<br />
N. N.<br />
DW | Diakonische Leitlinien im Alten und Neuen Testament � S. 93<br />
Proseminare<br />
DR. KOCH<br />
AT | Einführung in die Exegese des Alten Testaments � S. 39<br />
DR. VETTE<br />
AT | Einführung in die Exegese des Alten Testaments � S. 40<br />
SCHRÖDER<br />
NT | Einführung in die Methoden der neutestamentlichen Exegese � S. 48<br />
THEOBALD<br />
NT | Einführung in die Methoden der neutestamentlichen Exegese � S. 48<br />
DR. KÖCKERT<br />
KG | Einführung in die Methoden der Kirchengeschichte: Die Klosterregel des<br />
Benedikt von Nursia (Regula Benedicti) � S. 55<br />
GRANDCLÈRE-PRAETORIUS<br />
KG | Einführung in die Methoden der Kirchengeschichte: Calvin � S. 56<br />
DR. SPRINGHART<br />
ST | Karl Barths Lehre vom Wort Gottes � S. 66<br />
SCHMIDTKE<br />
ST | Adolf von Harnack: Das Wesen des Christentums � S. 66<br />
MAßMANN<br />
ST | Einführung in die Trinitätslehre anhand von Pannenbegs Theologie � S. 67<br />
HAUSTEIN<br />
RW | Einführung in die Religionsgeschichte Afrikas � S. 78
PROF. LIENHARD<br />
PT | Homiletisches Proseminar: Einführung in die Predigttheorie<br />
� S. 85<br />
DR. KERNER<br />
PT | Religionspädagogisches Proseminar � S. 86<br />
PROF. SCHOBERTH/ DR. KROCHMALNIK<br />
PT | Religionspädagogisches Proseminar: Der Lehrer – traditionelles und<br />
modernes Bild des Religionspädagogen � S. 86<br />
Hauptseminare<br />
PROF. GERTZ<br />
AT | Segen als Thema des Alten Testaments � S. 40<br />
PROF. KEGLER<br />
AT | Esra/Nehemia. Wiederaufbau in der Perserzeit � S. 41<br />
PROF. DIEBNER/PROF. NAUERTH<br />
AT | Garizim und Synagoge � S. 41<br />
N.N.<br />
NT | Titel folgt � S. 49<br />
N.N.<br />
NT | Titel folgt � S. 49<br />
PROF. SCHWIER<br />
NT | Die Auferstehung Jesu Christi � S. 49<br />
PROF. WANDER<br />
NT | Zur Kritik moderner Jesusbilder � S. 49<br />
PROF. PÖTTNER<br />
NT | Die Bibel in gerechter Sprache � S. 49<br />
PROF. BUSCH<br />
NT | Dämonen und Exorzismen im NT � S. 50<br />
DR. HUPE<br />
NT | (Post-)Moderne Gerechtigkeitsdiskurse und Neues Testament � S. 51<br />
PROF. LÖHR/ PROF. HALFWASSEN<br />
KG | Philosophische Theologie in der Spätantike: Ps.-Dionysius Areopagita � S. 57<br />
PD DR. NOORMANN<br />
KG | Athanasius � S. 58<br />
PD DR. EHMANN<br />
KG | Martin Luther, Disputatio de homine � S. 58<br />
PROF. WELKER<br />
ST | Anthropologie: Moltmann – Jüngel – Pannenberg � S. 67<br />
PROF. TANNER<br />
ST | Geschichte und Normen – Das Historismusproblem bei Ernst Troeltsch � S. 68<br />
PROF. NÜSSEL/PROF. TANNER<br />
ST | Bioethik – ein neues Feld ökumenischer Kontroversen � S. 68<br />
PROF. PLATHOW<br />
ST | Die Wirklichkeit der Kirche (evang., röm.-kath., orth., freikirchl.)<br />
� S. 69<br />
PROF. DRECHSEL/ PD DR. MÜHLING<br />
ST | Glaube und Zweifel – Systematisch-theologische und Praktisch-Theol. Aspekte � S. 69
PROF. HÜBNER<br />
ST | Neue Schöpfungstheologien � S. 69<br />
PROF. TANNER<br />
ST | Toleranz – zum historischen Profil des Begriffs � S. 70<br />
PD DR. LÄMMLIN/DR. VÖGELE<br />
ST | Glaube zwischen Vernunft und Gefühl – Symbole und Rituale in der<br />
Zivilgesellschaft � S. 70<br />
PD DR. ETZELMÜLLER<br />
ST | Parusie, Gericht-Auferstehung, Ewiges Leben. Themenfelder christlicher<br />
Eschatologie � S. 70<br />
PD DR. FREUND<br />
ST | Theologie im Umbruch – Texte zur Theologie der Aufklärungszeit � S. 71<br />
PROF. BERGUNDER<br />
RW | Religiöser Nationalismus im Vergleich. Theorien und Fallbeispiele � S. 79<br />
PROF. SCHWIER<br />
PT | Homiletisches Seminar: Ostern predigen � S. 87<br />
PROF. SCHOBERTH<br />
PT | Der Kleine Katechismus im Religionsunterricht � S. 87<br />
PD DR. NEIJENHUIS<br />
PT | Glocken in Theorie und Praxis � S. 88<br />
PROF. MÖLLER/DR. MAUTNER<br />
PT | Kirchenpädagogisches Seminar: »Die Heiliggeistkirche in <strong>Heidelberg</strong> in<br />
theologischer und kunstgeschichtlicher Sicht« � S. 88<br />
PD DR. HEYMEL<br />
PT | »Singet dem Herrn ein neues Lied!« - Erneuerung des liturgischen Betens aus<br />
der Sprache der Bibel<br />
� S. 89<br />
PROF. DRECHSEL<br />
PT | Gemeinde – Altenheim – Krankenhaus – Gefängnis. Seelsorgefelder im<br />
Vergleich � S. 89<br />
PROF. DRECHSEL/PD DR. MÜHLING<br />
PT | Glaube und Zweifel – systematisch-theologische und praktisch-theologische<br />
Perspektiven � S. 90<br />
PD DR. LÄMMLIN/PD DR. VÖGELE<br />
PT | Systematisch-theologisches/praktisch-theologisches Seminar: Glaube<br />
zwischen Vernunft und Gefühl – Symbole und Rituale in der Zivilgesellschaft � S. 90<br />
PROF. RUPP/OSTR HOYNINGEN-HUENE/DISCHINGER<br />
PT | Religion in der Alltagskultur als Gegenstandsbereich des<br />
kompetenzorientierten Religionsunterrichts � S. 91<br />
KASPER<br />
PT | »Ethische Themen und ihre didaktische Behandlung im Evang. Religionsunterricht«<br />
� S. 91<br />
PROF. SCHNEIDER-HARPPRECHT<br />
PT | Der Kindergottesdienst � S. 92<br />
PROF. SCHMIDT/PROF. WEBER<br />
DW | Kritische Lebensereignisse und ihre religiöse Relevanz � S. 94<br />
N. N.<br />
DW | Rechtes Handeln, Nächstenliebe, Solidarität � S. 95
DR. SCHWARTZ<br />
DW | Diakonische Unternehmenskultur<br />
� S. 96<br />
PROF. MÜLLER<br />
DW | Rabbinische Texte zur Gerechtigkeit � S. 96<br />
Oberseminare<br />
PROF. LAMPE<br />
NT | Neue Forschungen im NT<br />
� S. 51<br />
PROF. NÜSSEL<br />
ST | Zur Aktualität der Erbsündenlehre � S. 73<br />
Übungen<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
SK/AT | Hebräische Lektüre: Das Buch Ruth � S. 31<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
SK/AT | Nichttiberische hebräische Textzeugen des AT � S. 31<br />
DR. HUG<br />
SK/AT | Syrische Lektüre für Anfänger � S. 37<br />
DR. HUG<br />
SK/AT | Syrische Lektüre für Fortgeschrittene � S. 38<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
SK/NT | Lektüre des Römerbriefes � S. 34<br />
MEISTERS<br />
SK/KG | Lektüre-Übung Augustinus, Confessiones � S. 36<br />
MEISTERS<br />
SK/KG | Anthropologie und Ethik der Stoa (Seneca, epistulae morales) im Vergleich<br />
zur christlichen Ethik (bibl.Texte) � S. 37<br />
DR. KOCH<br />
AT | Bundestheologie im AT � S. 42<br />
DR. VETTE/DR. HUPE<br />
AT | »Das Alte Testament im Lukanischen Doppelwerk« � S. 43<br />
PROF. DIEBNER/DR. GRIESHAMMER/PROF. NAUERTH<br />
AT | Texte des Koptischen Museums Kairo � S. 43<br />
PFR. GÜNTHER<br />
AT | Mischna-Traktakt. Pirke Aboth – Die Sprüche der Väter: Lektüre und<br />
Interpretation � S. 45<br />
DR. AUGENSTEIN<br />
NT | Bibelkunde des Neuen Testaments � S. 51<br />
LUKE WELCH<br />
NT | Neutestamentliche Textkritik � S. 52<br />
DR. KÖCKERT<br />
KG | Bekehrung im antiken Christentum � S. 60<br />
DR. SCHNEIDER<br />
KG | Briefe Melanchthons an König Heinrich VIII von England � S. 59
PD DR. EHMANN<br />
KG | Zeitgeschichtlich-konfessionskundliche Übung: Ökumenische, rk-prot. Texte � S. 60<br />
KLEIN<br />
ST | Grundkurs Analytische Religionsphilosophie � S. 74<br />
NOORDVELD<br />
ST | Einführung in das Denken J. Calvins. Lektüre ausgewählter Texte � S. 74<br />
DR. BRUNN<br />
ST | Einführung in die Ethik mit klassischen Texten � S. 74<br />
KLEIN<br />
ST | Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit � S. 75<br />
DR. BRUNN / KOLB<br />
ST | Sportethik und Geschlechterdifferenz � S. 76<br />
PROF. BERGUNDER<br />
RW | Grundtexte der Religionswissenschaft und Interkulturellen Theologie<br />
(Missionswissenschaft) � S. 80<br />
DR. SCHAEDE<br />
RP | Einführung in die Religionsphilosophie anhand der Lektüre von Immanuel<br />
Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (EPG 1) � S. 81<br />
KLEIN<br />
RP | Grundkurs Analytische Religionsphilosophie � S. 82<br />
HENSCHEN<br />
RP | Gerechtigkeitstheorien � S. 82<br />
BRAATZ<br />
PT | Liturgisches Singen � S. 92<br />
FERDINAND<br />
PT | Gemeinde wahrnehmen � S. 92<br />
ALBERT<br />
DW | Schlaglichter der Diakoniegeschichte � S. 96
Blockveranstaltungen<br />
Allgemeine und einführende Veranstaltungen<br />
ALBERT/OELSCHLÄGEL<br />
[ET] Einführung in das diakoniewissenschaftliche Studium<br />
FOCKEN<br />
� S. 29<br />
[EP] Examensprojekt � S. 29<br />
Intensivsprachkurse<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
Feriensprachkurs: Griechisch I � S. 33<br />
MEISTERS<br />
Feriensprachkurs: Latein I � S. 36<br />
Altes Testament<br />
PROF. GERTZ<br />
[OS] Reste hebräischen Heidentums im Alten Testament (Blockseminar) � S. 42<br />
PROF. OEMING/PROF. LIPSCHITS<br />
[Ü] Vorbereitung der Grabung in Ramat Rahel � S. 46<br />
PROF. REICH<br />
[BV] Jerusalem, wie Jesus es kannte � S. 46<br />
Neues Testament<br />
PD DR. CZACHESZ<br />
[S] Ritual und Überlieferung im Frühen Christentum � S. 50<br />
Kirchengeschichte<br />
PROF. DÖRFLER-DIERKEN<br />
[S] Friedenskämpfer - Glaubenskrieger � S. 59<br />
HAUSTEIN/SUARSANA<br />
[Ü] Pfingstliche Theologien<br />
� S. 61<br />
GRANDCLÈRE-PRAETORIUS<br />
[Ü] Auf den Spuren Calvins � S. 61<br />
Systematische Theologie<br />
PROF. DUCHROW/ PROF. VASSILIADIS/ PROF. KALAITZIDIS<br />
[S] Biblical Liberation Theology, Patristic Theology and the Ambivalence of<br />
Modernity in Orthodox and Ecumentical Perspective (post-graduate<br />
Oberseminar) � S. 72<br />
PROF. NÜSSEL ET AL.<br />
[S] The triune God - a God of dialogue and peace? � S. 72
DR. SPRINGHART<br />
[Ü] Bedenken, dass wir sterben müssen… � S. 73<br />
PROF. NÜSSEL/SCHMIDTKE/WAGNER<br />
[Ü] Frühes Christentum und Ökumene in Rom (mit Exkursion) � S. 76<br />
KLEIN<br />
[Ü] Die natürliche Gotteserkenntnis des Menschen: Anthropologie und<br />
Epistemologie in J. Calvins "Instituio Christianae Religionis" (1559) und in A.<br />
Plantigas "Wareanted Christian Belief" (2000) � S. 77<br />
Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft<br />
HAUSTEIN/SUARSANA<br />
[Ü] Pfingstliche Theologien<br />
Philosophie und Religionsphilosophie<br />
PD DR. WLADIKA<br />
[BV] Platon, Politeia<br />
Praktische Theologie<br />
� S. 61<br />
� S. 83<br />
PD DR. NÜCHTERN<br />
[V] Kasualien � S. 85<br />
Diakoniewissenschaften<br />
DR. MICHEL<br />
[S] Werteorientiertes Management. Überlegungen zu einem werteorientierten<br />
Management auf Makro-, Meso- und Mikroebene in Theorie und Praxis. � S. 94<br />
N. N.<br />
[S] Konfliktfelder materialer Ethik in diakoniewissenschaftlicher Perspektive � S. 95<br />
Lehrauftrag für feministische Theologie<br />
DR. KÖSER/DEMIRCI<br />
[BS] Interkulturelle Öffnung - Grundlagen - theologische Reflexion –<br />
Praxiserfahrung<br />
EPG 1 & 2<br />
PD DR. WLADIKA<br />
EPG 1 |[BV] Platon, Politeia<br />
� S. 99<br />
� S. 83<br />
N. N.<br />
EPG 2 |[S] Konfliktfelder materialer Ethik in diakoniewissenschaftlicher<br />
Perspektive � S. 95
Lehrauftrag: Katholische Theologie � S. 97<br />
Lehrauftrag: Feministische Theologie � S. 97<br />
Weitere Veranstaltungen � S. 100<br />
EPG 1/2, PhE � S. 100<br />
Repetitorien � S. 102<br />
Kolloquien � S. 102<br />
Sozietäten � S. 103<br />
Weitere Veranstaltungen für Studierende der DW � S. 104<br />
Lehrexport � S. 105<br />
Empfehlenswerte Veranstaltungen � S. 109
Allgemeine und einführende Veranstaltungen<br />
ALBERT/OELSCHLÄGEL<br />
ET<br />
30.03.2009 | 10-16 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Einführung in das<br />
diakoniewissenschaftliche Studium<br />
Der Einführungstag will interessierten Studierenden und Examinierten aller Wissenschaften<br />
Informationen zu den Zulassungs- und Studienmöglichkeiten des DWI, zu Anerkennungs- und<br />
Prüfungsordnungsfragen, zu Studieninhalten und beruflichen Perspektiven vermitteln. Darüber<br />
hinaus sollen neu eingeschriebene Studierende der diakoniewissenschaftlichen Schwerpunkt- und<br />
Ergänzungsstudiengänge Hinweise für den Beginn ihres Studiums am DWI bekommen:<br />
Arbeitsweise und Veranstaltungen, Personelles und Aktuelles, Räumlichkeiten und Bibliothek,<br />
Literatur etc.<br />
Zielgruppe: StudieninteressentInnen und Neueingeschriebene der DWI-Studiengänge<br />
FERDINAND<br />
AP<br />
Do 16-18 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
»Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt<br />
sind…« – Einführung in das theologische Studium am<br />
Beispiel der Ekklesiologie<br />
Das AnfängerInnenprojekt bietet eine Einführung in das Theologiestudium. Ziel ist die Befähigung<br />
der TeilnehmerInnen, ihr (Grund-)Studium sinnvoll aufzubauen und Grundkenntnisse in der wissenschaftlichen<br />
Theologie zu erwerben. Die verschiedenen theologischen Disziplinen werden von<br />
FachvertreteInnen und Fachvertretern anhand des Leitthemas »Kirche« (Ekklesiologie = Lehre<br />
von der Kirche) vorgestellt. Schließlich führt das AnfängerInnenprojekt in wissenschaftliches<br />
Arbeiten ein und vermittelt die dazu erforderlichen Schlüsselkompetenzen wie Literaturrecherche,<br />
Lese- und Arbeitstechniken, Strukturieren und Präsentation. Die Lehrveranstaltung wird durch<br />
eine Wochenendveranstaltung ergänzt und schließt mit der obligatorischen Orientierungsprüfung<br />
ab.<br />
LITERATUR:<br />
wird in der Veranstaltung bekannt gegeben<br />
Zielgruppe: StudienanfängerInnen (Pfarramts- und LehramtsstudentInnen)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3h<br />
Leistungsnachweis: obligatorische Orientierungsprüfung<br />
FOCKEN<br />
EP<br />
03.04.2009 | 14-16 Uhr<br />
+ 2 Blocks, Termine folgen<br />
Examensprojekt (Informationsveranstaltung und<br />
2 Blockseminare Fr/Sa)<br />
Das Examensprojekt vemittelt Schlüsselkompetenzen für die Lernphase vor dem Examen und für<br />
die Prüfungen. Literatur zum Lernen und Festigen des Allgemeinwissens wird vorgestellt. Die
Bereitschaft zur gründlichen Vorbereitung und Mitgestaltung der Blockseminare ist Voraussetzung<br />
für die Teilnahme.<br />
LITERATUR:<br />
Helga Esselborn-Krumbiegel, Leichter lernen. Strategien für Prüfung und Examen (UTB 2755),<br />
Paderborn, München, Wien, Zürich 2006.<br />
Zielgruppe: Studierende aller Studiengänge in der letzten Studienphase vor Beginn der<br />
Examensvorbereitung<br />
Anmeldung: Anmeldung bei der Informationsveranstaltung<br />
Sprachen<br />
Hebräisch, Griechisch und Latein sind die Sprachen, die jedem Theologiestudenten im Laufe<br />
seines Studiums begegnen werden. Deshalb besteht die Möglichkeit sich in vorbereitenden Kursen<br />
an der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> auf die Hebraicums- sowie die staatliche Latinums- und Graecumsprüfung<br />
vorzubereiten. Welche Sprachvorrausetzungen für die einzelnen Studiengänge erforderlich<br />
sind, ist den einzelnen Prüfungsordnungen zu entnehmen.<br />
Hebräisch<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
SK<br />
Mo-Do 9-11 Uhr<br />
KiGa I<br />
Hebräisch I<br />
Hebräisch I ist ein Intensivkurs, der in die hebräische Sprache des Alten Testaments einführt.<br />
Vermittelt werden die Grundlagen der Formenbildung und Syntax sowie ein Grundwortschatz von<br />
ca. 800 Wörtern. Ziel ist die Befähigung zu selbständiger Lektüre alttestamentlicher Texte. Der<br />
Kurs bereitet gezielt auf die Hebraicumsprüfung am Ende des Semesters vor.<br />
Teilnahmevoraussetzung ist die Bereitschaft zu intensiver Mitarbeit, die zusätzlich zum Kursbesuch<br />
pro Woche ca. 20 Stunden Vor- und Nachbereitung umfaßt (Grammatik, Vokabeln, Übersetzen).<br />
Es ist nicht empfehlenswert, neben Hebräisch I noch andere lernintensive Sprachkurse (z.B.<br />
Latein I/II oder Griechisch I/II) zu besuchen. Begleitend zum Kurs findet ein Hebräisch-Tutorium<br />
statt.<br />
Zur Vorbereitung auf den Kurs: Jenni, Lehrbuch S.30 (das Alphabet) und S.10-17 (kurzer<br />
Überblick zur geschichtlichen Einordnung der hebräischen Sprache und Schrift).<br />
LITERATUR:<br />
Ab der 1. Sitzung ist mitzubringen: E. Jenni, Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten<br />
Testaments, 3. Aufl. Basel 2003 (oder 2. Aufl. 1981).<br />
Im Laufe des Semesters benötigen Sie eine Biblia Hebraica Stuttgartensia (beliebige Aufl.) und W.<br />
Gesenius – F. Buhl, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament,<br />
unveränd. Neudruck der 1915 erschienenen 17. Aufl. (nicht die noch unvollständige 18. Aufl.!).
Zum kursbegleitenden Üben empfohlen: J. M. Grassau, Vokabeltrainer Hebräisch / Griechisch /<br />
Lateinisch, CD-ROM für Windows in der Version 2 (gelb) oder 3 (blau) (Anschaffung oder Ausleihe<br />
in der Lehrbuchsammlung der UB). Lerndateien mit Vokabeln und Formen werden im Kurs zur<br />
Verfügung gestellt.<br />
Zielgruppe: Studierende ohne Hebraicum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 20 h/Woche zusätzlich zum Kursbesuch<br />
Leistungsnachweis: Hebraicum zum Kursabschluß; für BA Christentum und Kultur Modul BA-AT<br />
4a<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
Ü<br />
Di 13-14 Uhr<br />
KiGa I<br />
Hebräische Lektüre: Das Buch Ruth<br />
Durch kursorische Lektüre eines einfachen hebräischen Prosatextes sollen die durch das<br />
Hebraicum erworbenen Kenntnisse erhalten und vertieft werden. Zur 1 .Sitzung vorzubereiten:<br />
Ruth 1,1-10.<br />
LITERATUR:<br />
Wird während der Veranstaltung bekanntgegeben.<br />
Zielgruppe: Studierende aller Semester<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebraicum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: abhängig vom Kenntnisstand<br />
Leistungsnachweis:Für Bachelor Christentum und Kultur, geeignet für die Module AT 1, 2, 3a,<br />
4a, 4b, NT 2 (Leistungsnachweis nach Absprache)<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
Ü<br />
Di 14-15 Uhr<br />
Dek<br />
Nichttiberische hebräische Textzeugen des AT<br />
Der in der Biblia Hebraica abgedruckte Codex Petropolitanus (ehemals Leningradensis) ist ein<br />
später Zeuge der tiberischen Aussprachetradition, die in der jüdischen und christlichen Exegese<br />
quasi normative Geltung erlangt hat. In dieser Übung sollen vergleichend ausgewählte Beispiele<br />
nichttiberischer Textzeugen betrachtet und im Hinblick auf Ihren Lautbestand diskutiert werden.<br />
Geplant sind Textfragmente mit babylonischer und palästinischer Punktation sowie Ausschnitte<br />
aus der fragmentarisch erhaltenen Hexapla des Origenes, die in der 2. Spalte (Secunda) eine<br />
Transkription des hebräischen Textes mit griechischen Buchstaben bietet. Einzelheiten werden in<br />
der konstituierenden Sitzung besprochen.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebraicum, Griechischkenntnisse; Bereitschaft, sich mit<br />
unterschiedlichen Schriftsystemen und den Grundlagen der historischen Phonologie des<br />
Althebräischen zu beschäftigen
Leistungsnachweis: Für Bachelor Christentum und Kultur, geeignet insbesondere für die<br />
Module AT 2, 3a, 4b, NT 2 (Leistungsnachweis nach Absprache)<br />
Griechisch<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
SK<br />
Mo 14-16 Uhr | HS 007<br />
Mi 9-11 Uhr | ÖInst<br />
Do 9-11 Uhr | ÖInst<br />
Einführung in die griechische Sprache I -<br />
Griechisch für Anfänger<br />
Griechisch I ist der erste der beiden Sprachkurse, die als Vorbereitung für das Graecum konzipiert<br />
sind. Im Kurs Griechisch I steht der Unterricht der altgriechischen Formenlehre im Vordergrund.<br />
Durch die Übersetzung der im Lese- und Arbeitsbuch angebotenen Texte, sowie einiger<br />
zusätzlicher Texte werden auch erste Grundkenntnisse in altgriechischer Syntax vermittelt, welche<br />
im Kurs Griechisch II vertieft werden. Vorgesehen sind Vokabeltests und zwei kleine Klausuren zur<br />
Selbsteinschätzung.<br />
Zu den Aufgaben des Kurses zählt nicht zuletzt die Vermittlung fundamentaler Kenntnisse antiker<br />
Geschichte und Literatur, die für das Verständnis der Originaltexte notwendig sind und die<br />
faszinierende Kultur der griechischen Antike spürbar machen. Vorgesehen ist ebenso die Lektüre<br />
mehrerer z.T. adaptierter neutestamentlicher Texte.<br />
LITERATUR:<br />
Kantharos, Griechisches Unterrichtswerk, Lese- und Arbeitsbuch (Klett Verlag)<br />
Eine griechische Grammatik, sehr empfehlenswert:<br />
Hellas, Griechische Grammatik (Buchner Verlag) oder<br />
Ars Graeca, Grammatik (Schöningh Verlag)<br />
Ein Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch, z.B. Gemoll (besonders empfehlenswert) oder<br />
Benseler<br />
Zielgruppe:Alle Theologiestudierenden, die sich für die staatliche Graecumsprüfung vorbereiten<br />
Teilnahmevorrausetzungen:Aktive Mitarbeit und regelmäßiger Besuch des Kurses werden<br />
dringend empfohlen.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche:ca. 6 h<br />
Leistungsnachweis:Der Kurs dient als Voraussetzung für den Besuch von Griechisch II<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
SK<br />
Mo 11-13 Uhr | KiGa I<br />
Mi 11-13 Uhr | Dek<br />
Do 11-13 Uhr | Dek<br />
Einführung in die griechische Sprache II -<br />
Griechisch für Fortgeschrittene<br />
Aufgabe des Kurses ist die Vertiefung der bereits im Kurs Griechisch I erworbenen Kenntnisse in<br />
der Formenlehre und der Aufbau von Kenntnissen im altgriechischen Satzbau. Gelesen werden v.<br />
a. ausgewählte Abschnitte aus Platons »Apologie« und dem Dialog »Phaidon«, sowie mehrere<br />
kleine Ausschnitte anderer platonischer Werke, die dem Schwierigkeitsgrad der Graecumsprüfung<br />
entsprechen und einen Überblick über die in den Werken Platons diskutierten Themen erlauben.
Vorgesehen sind mehrere Probeklausuren, die z. T. außerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit,<br />
nach Absprache mit den Teilnehmern stattfinden. Stammformentests und Probeübersetzungen<br />
kleiner Texte ohne Wörterbuch sollen zu einer größeren Vertrautheit mit der altgriechischen<br />
Morphologie und Lexik führen.<br />
Der Kurs beginnt mit einer Wiederholung des Materials von Griechisch I. Eine selbständige<br />
Wiederholung der im ersten Sprachkurs unterrichteten Grammatik ist allerdings sehr<br />
empfehlenswert.<br />
LITERATUR:<br />
Platon, Apologie und Kriton nebst Abschnitten aus Phaidon (Aschendorf Verlag)<br />
Eine altgriechische Grammatik, sehr empfehlenswert:<br />
Hellas, Griechische Grammatik (Buchner Verlag)<br />
Oder<br />
Ars Graeca, Grammatik (Schöningh Verlag)<br />
Ein Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch, z.B. Gemoll (besonders empfehlenswert)oder Benseler<br />
Zielgruppe: Alle Theologiestudierenden, die sich für das Graecum vorbereiten<br />
Teilnahmevorausetzungen: Griechisch I<br />
Aktive Mitarbeit und regelmäßiger Besuch des Kurses werden dringend empfohlen.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: min. 6 h<br />
Leistungsnachweis: Ziel des Kurses ist das Bestehen der staatlichen Graecumsprüfung<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
SK<br />
02.02.2009-<br />
27.02.2009<br />
Feriensprachkurs: Griechisch I<br />
Griechisch I ist der erste der beiden Sprachkurse, die als Vorbereitung für das Graecum konzipiert<br />
sind. Im Kurs Griechisch I steht der Unterricht der altgriechischen Formenlehre im Vordergrund.<br />
Durch die Übersetzung der im Lese- und Arbeitsbuch angebotenen Texte werden auch erste<br />
Grundkenntnisse in altgriechischer Syntax vermittelt, welche im Kurs Griechisch II vertieft werden.<br />
Der Ferienkurs ist als ein Intensivkurs konzipiert, der eine tägliche mehrstündige Nacharbeitung<br />
der behandelten Themen fordert. Sehr empfehlenswert ist der regelmäßige Besuch des im<br />
Rahmen des Kurses angebotenen Tutoriums.<br />
LITERATUR:<br />
Kantharos, Griechisches Unterrichtswerk, Lese- und Arbeitsbuch (Klett Verlag); Eine griechische<br />
Grammatik, sehr empfehlenswert: Hellas, Griechische Grammatik (Buchner Verlag) oder Ars<br />
Graeca, Grammatik (Schöningh Verlag); Ein Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch (z.B. Gemoll<br />
(sehr empfehlenswert) oder Benseler<br />
Beginnt am: 02.02.2009<br />
Zielgruppe: Alle Theologiestudierenden, die sich für die staatliche Graecumsprüfung vorbereiten<br />
Teilnahmevorausetzungen: Aktive Mitarbeit und regelmäßiger Besuch des Kurses und des<br />
Tutoriums<br />
Anmeldung: Schicken Sie bitte bis zum 25.01.2009 eine Email an anna.tzvetkovaglaser@wts.uni-heidelberg.de
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: mindestens 15 h<br />
Leistungsnachweis: Der Kurs dient als Voraussetzung für den Besuch von Griechisch 2<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
Ü<br />
Mi 17-18 Uhr<br />
KiGa II<br />
Lektüre des Römerbriefes<br />
Im Laufe der Lektüreübung werden ausgewählte Abschnitte aus dem Römerbrief gelesen, deren<br />
sprachliche Kommentierung im Vordergrund steht. Hingewiesen wird vor allem auf lexikalische<br />
und grammatische Phänomene, die das neutestamentliche Griechisch kennzeichnen. Die Übung<br />
bietet die Möglichkeit, die eigenen Griechischkenntnisse aufzufrischen, sowie das eigene<br />
Vokabular zu erweitern. Übersetzungshilfen sind vorgesehen. Erwartet wird eine selbstständige<br />
Vorbereitung der zu übersetzenden Texte (10-15 Verse pro Sitzung).<br />
LITERATUR:<br />
Alle Teilnehmer, die ein Neues Testament auf Griechisch besitzen (sehr empfehlenswert ist die<br />
Edition Nestle-Aland), können dieses mitbringen und benutzen. Es besteht die Möglichkeit, Kopien<br />
der zu übersetzenden Texte zu bekommen.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Griechischkenntnisse (mindestens Griechisch 1)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1-2 h<br />
Leistungsnachweis: Die Teilnahme kann durch einen Schein nachgewiesen werden<br />
Latein<br />
MEISTERS<br />
SK<br />
Mo 14-16 Uhr | ÜR K 2<br />
Di 9-11 Uhr | ÜR K 3<br />
Do 14-16 Uhr | ÜR K 3<br />
Latein I: Einführung in Sprache und<br />
Kultur Roms - Latein für AnfängerInnen<br />
Der Sprachkurs Latein I (Einführung in Sprache und Kultur Roms = Latein für AnfängerInnen) ist<br />
der erste von zwei Sprachkursen, die auf das Latinum vorbereiten. Es werden die grammatischen<br />
Grundlagen behandelt (Formenlehre und Syntax) sowie ein Grundwortschatz gelernt, immer mit<br />
Blick auf die Lektürefähigkeit (Cicero) und die schriftliche und mündliche Latinumsprüfung.<br />
Vokabeltraining und Übersetzungstechnik gehören ebenso zum Inhalt des Sprachkurses wie<br />
Grundlagenwissen zur Antike, das ggf. am Rande Gegenstand der mündlichen Prüfung ist. Das<br />
Erlernen einer wunderschönen Sprache mit Ausstrahlung nicht nur auf die romanischen Sprachen,<br />
sondern auch auf Geist, Kunst und Kultur ist selbstredend der kostenlose Nebeneffekt. Neben<br />
regelmäßiger Teilnahme und intensiver Mitarbeit sollten Sie mindestens 4-6 Std. wöchentlich vor-<br />
und nachbereiten, um die Voraussetzung zu schaffen, unmittelbar im folgenden Semester den<br />
Sprachkurs Latein II zu besuchen und die Prüfungsreife zu erlangen. Das Lehrbuch und die<br />
Begleitgrammatik sollten Sie zur ersten Veranstaltung mitbringen, sie erhalten darüber hinaus<br />
umfangreiches Zusatzmaterial.
LITERATUR:<br />
Für die erste Veranstaltung: 1. Litora (Texte u. Übungen+Lernvokabeln). Lehrgang für den spät<br />
beginnenden Lateinunterricht. V&R 2005 (ISBN 3-525-71750-4). 2. Litora Begleitgrammatik, V&R<br />
2005 (ISBN 3-525-71752-0). Weitere Grammatiken, Wörterbücher etc. werden Ihnen vorgestellt<br />
und ggf. zur Anschaffung empfohlen.<br />
Beginnt am: 31.03.2009<br />
Teilnahmevorausetzungen: aktive Mitarbeit, regelmäßige Teilnahme, intensive Vor- und<br />
Nachbereitung<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: mindestens 4-6 Std. zusätzlich zum Kursbesuch<br />
von 6 h.<br />
MEISTERS<br />
SK<br />
Mo 9-11 Uhr | ÜR K 3<br />
Mi 9-11 Uhr | Dek<br />
Do 9-11 Uhr | ÜR K 3<br />
Latein II: Einführung in Sprache und Kultur<br />
Roms (Forts.) - Latein für Fortgeschrittene<br />
Der Sprachkurs Latein II (Einführung in Sprache und Kultur Roms = Latein für Fortgeschrittene)<br />
führt den Sprachkurs Latein I fort (siehe deshalb auch dort). Der Kurs gliedert sich in drei Teile:<br />
1. Die Behandlung der grundlegenden grammatischen Phänomene wird abgeschlossen. 2.<br />
(Hauptteil) Übersetzung von Texten aus mittelschweren (prüfungsrelevanten) Cicero-Reden 3.<br />
Zusätzliche Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Darüber hinaus wird Ihre<br />
Übersetzungstechnik weiter geschult, Ihr Wortschatz (Cicero-Spezialvokabular) weiter ausgebaut<br />
und Ihr Hintergrundwissen vertieft. Durch Probeklausuren auf Prüfungsniveau können Sie Ihren<br />
Leistungsstand jederzeit realistisch einschätzen. Da es unerlässlich ist, mindestens etwa 20<br />
Cicero-Texte zu übersetzen, um eine gewisse Routine und Sicherheit zu erlangen, sind eine sehr<br />
aktive Mitarbeit sowie eine intensive Vor- und Nachbereitung von mindestens 8-10 Std.<br />
wöchentlich zusätzlich zum Kursbesuch unerlässlich. Sie erhalten umfangreiches Zusatzmaterial,<br />
etwa vertiefende Grammatikübersichten, Spezialvokabular zu Cicero, Einführungen in Leben und<br />
Werk Ciceros etc.<br />
LITERATUR:<br />
Für die erste Veranstaltung: 1. Litora (Texte u. Übungen+Lernvokabeln). Lehrgang für den spät<br />
beginnenden Lateinunterricht. V&R 2005 (ISBN 3-525-71750-4). 2. Litora Begleitgrammatik, V&R<br />
2005 (ISBN 3-525-71752-0). Weitere Grammatiken, Wörterbücher, Wortschätze etc. werden<br />
Ihnen vorgestellt und zur Anschaffung empfohlen.<br />
Zielgruppe: TeilnehmerInnen des Sprachkurses Latein I vom WS 2008/2009 sowie<br />
TeilnehmerInnen mit sehr guten Lateingrundkenntnisse aus der Schule oder aus Lateinkursen<br />
Teilnahmevorausetzungen: aktive Mitarbeit, regelmäßige Teilnahme, intensive Vor- und<br />
Nachbereitung<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: mindestens 8-10 Std. wöchentlich zusätzlich zum<br />
Kursbesuch von 6 Std.
MEISTERS<br />
SK<br />
5 Wochen in<br />
Vorlesungsfreier Zeit<br />
(Aug./Sept. 09)<br />
Feriensprachkurs: Latein I<br />
Erstmals haben Sie die Möglichkeit den Sprachkurs Latein I in einem Ferienkurs zu absolvieren,<br />
um dann im darauf folgenden Wintersemester Latein II zu absolvieren, so dass Sie bei<br />
entsprechendem Einsatz bereits im Frühjahr 2010 das Latinum erwerben können. Die geplanten<br />
Unterrichtszeiten: Mo-Fr 9.00-10.30 u. 10.45-12.15. Der Sprachkurs Latein I (Einführung in<br />
Sprache und Kultur Roms = Latein für AnfängerInnen) ist der erste von zwei Sprachkursen, die<br />
auf das Latinum vorbereiten. Es werden die grammatischen Grundlagen behandelt (Formenlehre<br />
und Syntax) sowie ein Grundwortschatz gelernt, immer mit Blick auf die Lektürefähigkeit (Cicero)<br />
und die schriftliche und mündliche Latinumsprüfung. Vokabeltraining und Übersetzungstechnik<br />
gehören ebenso zum Inhalt des Sprachkurses wie Grundlagenwissen zur Antike, das ggf. am<br />
Rande Gegenstand der mündlichen Prüfung ist.<br />
Das Erlernen einer wunderschönen Sprache mit Ausstrahlung nicht nur auf die romanischen<br />
Sprachen, sondern auch auf Geist, Kunst und Kultur ist selbstredend der kostenlose Nebeneffekt.<br />
Neben regelmäßiger Teilnahme und intensiver Mitarbeit sollten Sie mindestens 2-4 Std. täglich,<br />
also 10-20 Std. wöchentlich, vor- und nachbereiten. Diese Vor- und Nachbereitung ist gerade bei<br />
einem Intensivkurs unerlässlich, damit sich der Stoff setzen kann und die vertiefenden<br />
Übungseinheiten innerhalb der Veranstaltung auf fruchtbaren Boden fallen. Das Lehrbuch und die<br />
Begleitgrammatik sollten Sie zur ersten Veranstaltung mitbringen, sie erhalten darüber hinaus<br />
umfangreiches Zusatzmaterial.<br />
Anmeldemodalitäten werden noch bekannt gegeben.<br />
LITERATUR:<br />
Für die erste Veranstaltung: 1. Litora (Texte u. Übungen+Lernvokabeln). Lehrgang für den spät<br />
beginnenden Lateinunterricht. V&R 2005 (ISBN 3-525-71750-4). 2. Litora Begleitgrammatik, V&R<br />
2005 (ISBN 3-525-71752-0). Weitere Grammatiken, Wörterbücher etc. werden Ihnen vorgestellt<br />
und ggf. zur Anschaffung empfohlen.<br />
Zielgruppe: alle interessierten Theologiestudierenden<br />
Teilnahmevorausetzungen: aktive Mitarbeit, regelmäßige Teilnahme, intensive Vor- und<br />
Nachbereitung<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-4 Std. täglich (!), also 10-20 Std. wöchentlich zur<br />
Vor- u. Nachbereitung der tägl. 4 Std. LV<br />
MEISTERS<br />
Ü<br />
Di 14-15 Uhr<br />
KiGa II<br />
Lektüre-Übung Augustinus, Confessiones<br />
Die Confessiones des Augustinus gehören zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur;<br />
darüber hinaus werden die theologischen Kerngedanken des Kirchenvaters an einer überaus<br />
bildreichen und kraftvollen Sprache nicht nur deutlich, sondern lassen sich auch gut behalten und<br />
wiedergeben. Es sollen zentrale mit zahlreichen Anmerkungen versehene Texte aus den
Confessiones behandelt werden, die einen guten ersten Einblick in die Confessiones vermitteln.<br />
Sie erhalten zu den Arbeitstexten Übersichten zum Aufbau des Werkes sowie zu Leben und Werk<br />
des Augustinus.<br />
LITERATUR:<br />
Sie erhalten Literaturempfehlungen zu Beginn und im Verlauf der Veranstaltung.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Interesse, lateinische Grundkenntnisse<br />
Leistungsnachweis: Teilnahme-Schein<br />
MEISTERS<br />
Ü<br />
Di 15-16 Uhr<br />
KiGa II<br />
Anthropologie und Ethik der Stoa (Seneca,<br />
epistulae morales) im Vergleich zur<br />
christlichen Ethik (bibl.Texte)<br />
Die Anthropologie und Ethik der Stoa, insbesondere wie sie in den wunderschönen, literarisch<br />
brillanten und zugespitzt formulierten epistulae morales ad Lucilium von Seneca vorgetragen wird,<br />
war und ist bis heute sehr populär. Viele Gedanken der Stoa scheinen dem christlichen<br />
Menschenbild und einer christlichen Ethik sehr nah. Immerhin hat sich in der Antike ein<br />
apokrypher Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca eine Zeitlang als vermeintlich echt halten<br />
können. In dieser Leküre-Übung sollen daher wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten der<br />
Ethik der Stoa und einer biblischen Ethik erarbeitet werden, einerseits an ausgewählten Briefen<br />
des Seneca, anderseits an biblischen Texten (Vulgata). Sie erhalten dazu Texte mit zahlreichen<br />
erhellenden Anmerkungen sowie darüber hinaus Texte zum Hintergrund, zum Verständnis und zur<br />
Vertiefung.<br />
LITERATUR:<br />
Sie erhalten Literaturempfehlungen zu Beginn und im Verlauf der Veranstaltung.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Interesse, lateinische Grundkenntnisse<br />
Leistungsnachweis: Teilnahme-Schein<br />
Syrisch<br />
DR. HUG<br />
Ü<br />
Mo 18-19 Uhr<br />
KiGa II<br />
Lektüre vokalisierter Originalprosa nach Absprache<br />
Syrische Lektüre für Anfänger<br />
LITERATUR:<br />
A. Ungnad, Syrische Grammatik mit Übungsbuch. 2. Aufl. 1932, Nachdruck 1992 (mehrfach in der<br />
Lehrbuchsammlung der UB)
Teilnahmevorausetzungen: syrische Grundkenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: abhängig vom Kenntnisstand<br />
Leistungsnachweis: nach Absprache (BA Christentum und Kultur Module BA-AT 4c, BA-ÜK 2)<br />
DR. HUG<br />
Ü<br />
Mo 13-14 Uhr<br />
KiGa II<br />
Lektüre syrischer Texte nach Absprache<br />
Syrische Lektüre für Fortgeschrittene<br />
Teilnahmevorausetzungen: solide Syrischkenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: abhängig vom Kenntnisstand<br />
Leistungsnachweis: nach Absprache (BA Christentum und Kultur Module BA-AT 4c, BA-ÜK 2)<br />
Altes Testament<br />
Das Studium des Alten Testamentes (AT) beschäftigt sich mit der Entstehung des AT, seiner<br />
Theologie und seiner Einordnung in die Geschichte, Religionsgeschichte und Umwelt des antiken<br />
Israels. Die Studierenden sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig das AT mit Hilfe wissenschaftlicher<br />
Methoden auszulegen, die Bedeutung des AT für heute zu erfassen und auch zu<br />
vermitteln. Eine zusätzliche Möglichkeit zur Vertiefung des Studiums des AT bietet in <strong>Heidelberg</strong><br />
die interreligiöse Zusammenarbeit mit der Hochschule für jüdische Studien.<br />
Vorlesungen<br />
PROF. GERTZ<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
V Do 12-13 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Überblickslehrveranstaltung: Klassische<br />
Propheten (für Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en)<br />
Die Prophetie des Alten Testaments gehört zu den eindrücklichsten Phänomenen der israelitischjüdischen<br />
Religion. Mit dem Aufkommen der Schriftprophetie im 8. Jh. v. Chr. vollzieht sich ein<br />
tiefgreifender Wandel im Gottes- und Selbstverständnis des antiken »Israel«, der die Literatur und<br />
Religion des Alten Testaments maßgeblich geprägt hat. Zugleich sind die Propheten immer als die<br />
markantesten Persönlichkeiten der israelitisch-jüdischen Religion wahrgenommen worden, die<br />
auch im Christentum und Islam bis in die Gegenwart hinein eine zentrale Rolle einnehmen.<br />
Ausgehend von der Exegese zentraler Texte des Amos-, des Hosea- und Jesajabuches fragt die<br />
Vorlesung nach den historischen und religionsgeschichtlichen Wurzeln des Phänomens und den<br />
Anfängen der literarischen Überlieferungsbildung. Hebräischkenntnisse sind hilfreich, aber keine<br />
Voraussetzung. Als Begleitung wird ein Tutorium zur Vorlesung angeboten.
LITERATUR:<br />
J. Blenkinsopp, Geschichte der Prophetie. Von den Anfängen bis zum hellenistischen Zeitalter,<br />
Stuttgart u. a. 1998; K. Koch, Die Profeten I, UB 280, Stuttgart u. a. 31995, II, UB 281, Stuttgart<br />
u. a. 21988; R. G. Kratz, Die Propheten Israels, München 2003; K. Schmid, Hintere Propheten, in:<br />
J.C. Gertz (Hg.), Grundinformation Altes Testament, 32008.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2h<br />
Leistungsnachweis: Je nach Studien- und Prüfungsordnung: Teilnahmeschein; Klausur oder<br />
mündliche Prüfung<br />
PROF. DIEBNER<br />
V<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
NUni HS 4a<br />
Mose - Gab es ihn? Und wer war<br />
»Mose«? (für Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en)<br />
Gab es einen »historischen« Mose oder nicht? Wenn ja: Wer war er, welche Funktion hatte er? Ist<br />
diese identisch mit der uns in der jüdischen Thora beschriebenen, die in der christlichen Tradition<br />
als »Pentateuch« oder die »fünf Bücher Mose« rezipiert wurde? - Nach Martin Noth (1948) ist nur<br />
die Grabesnotiz über Moses Tod (vgl. Dtn 34) historisch. Doch niemand weiß, wo dieses Grab<br />
liegt. Nach Jan Assmann (1997; dt. 1998) war Mose ein rebellischer ägyptischer Gaufürst der<br />
Amarnazeit. Doch was hat ein solcher »Mose« mit dem der biblischen Überlieferung zu tun? Es<br />
sollen die Bemühungen der Forscher um einen »historischen« Mose in den letzten 50 Jahren<br />
besprochen werden und auch die literarische Funktion Moses in der jüdischen Tradition, der sich<br />
die christliche anschloss.<br />
LITERATUR:<br />
Die begleitende Literatur wird im Verlauf der Veranstaltung je bekannt gegeben. Als Vorbereitung<br />
sinnvoll wäre die Lektüre des Artikel »Mose« in einer der jüngeren theologischen Enzyklopädien<br />
(TRE, NBL, RGG 4 )<br />
Zielgruppe: Studierende mittleren und höheren Semesters; alle am Thema Interessierte<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebräisch- und Griechischkenntnisse günstig<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: je nach Interesse 2-4 h<br />
Leistungsnachweis: Individuelle Absprache; abhängig von Studienfach und Anforderungen<br />
Proseminare<br />
DR. KOCH<br />
PS<br />
Do 16-18 Uhr<br />
Dek<br />
Einführung in die Exegese des Alten Testaments<br />
In der Veranstaltung sollen die klassischen Methoden der historisch-kritischen Exegese<br />
kennengelernt und eingeübt werden. Daneben sollen auch neuere exegetische Ansätze in den
Blick kommen. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, einen alttestamentlichen<br />
Text eigenständig auslegen und eine wissenschaftliche Hausarbeit anfertigen zu können.<br />
LITERATUR:<br />
U. Becker, Exegese des Alten Testaments. Ein Methoden- und Arbeitsbuch, Tübingen 2005.<br />
Weitere Literatur wird im Seminar besprochen.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie im Grundstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebraicum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4-6h<br />
Leistungsnachweis:Benoteter Schein für eine Proseminararbeit; unbenoteter Schein für ein<br />
Protokoll und regelmäßige Mitarbeit<br />
DR. VETTE<br />
PS n. V.<br />
Einführung in die Exegese des Alten Testaments<br />
s. Proseminar AT von Herrn Dr. Koch. Dieses Proseminar wird als Zusatzangebot bereit gestellt,<br />
falls es aufgrund der Teilnehmerzahlen sinnvoll sein sollte.<br />
Zielgruppe: StudienanfängerInnen<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebraicum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4h<br />
Leistungsnachweis: Proseminarschein<br />
Haupt-/Oberseminare<br />
PROF. GERTZ<br />
S<br />
Do 16-18 Uhr<br />
KiGa I<br />
Segen als Thema des Alten Testaments<br />
Segen und Fluch gehören zu den grundliegenden Ausdrucksformen religiöser Kommunikation, in<br />
der sich göttliche und irdische Dimensionen verbinden. Umfasst der von Gott ausgehende Segen<br />
das Individuum, das erwählte Volk, die gesamte Menschheit und die Schöpfung, so bezeichnet der<br />
Fluch die Störung der gottgewollten Ordnung. Im Seminar werden die prägenden Texte des Alten<br />
Testaments auf ihre theologischen Vorstellungsgehalte und ihre soziale Funktion hin untersucht.<br />
LITERATUR:<br />
M. Leuenberger, Segen und Segenstheologien im alten Israel. Untersuchungen zu ihren religions-<br />
und theologiegeschichtlichen Konstellationen und Transformationen, AThANT 90, Zürich 2008.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: AT-Proseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein; benoteter Schein aufgrund einer Seminararbeit
PROF. KEGLER<br />
S<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
Dek<br />
Esra/Nehemia. Wiederaufbau in der Perserzeit<br />
Die Perserzeit gilt heute vielen Alttestamentlern als die fruchtbarste Zeit theologischer<br />
Textproduktion im antiken Israel. Mit den Büchern bzw. dem Buch Esra / Nehemia besitzen wir<br />
eine einzigartige Quelle, die den Wiederaufbau Jerusalems nach der Zerstörung durch die<br />
Babylonier zum Thema hat. Im Seminar soll der Aufbau des Buches als theologische Konzeption<br />
erarbeitet, archäologische Fragen aufgrund der Angaben des Nehemiabuches und der Grabungen<br />
in der Davidstadt erörtert werden, die Reformmaßnahmen Esras und Nehemias theologie- und<br />
sozialgeschichtlich analysiert und die Bedeutung der Torah für das nachexilische Israel / Juda<br />
beleuchtet werden.<br />
LITERATUR:<br />
Erhard Gerstenberger, Israel in der Perserzeit: 5. und 4. Jahrhundert v. Chr: Biblische<br />
Enzyklopädie Bd. 8, 2005; Albertz, Rainer, Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit. 2.<br />
Vom Exil bis zu den Makkabäern, Grundrisse zum Alten Testament 8, 2, Vandenhoeck & Ruprecht,<br />
Göttingen, 1992; 2. Auflage 1997<br />
Beginnt am: 20.Apr.08<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: AT-Proseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis:Hauptseminararbeit<br />
PROF. DIEBNER/PROF. NAUERTH<br />
S<br />
Mo 14-16 Uhr<br />
KiGa II<br />
Garizim und Synagoge<br />
Welcher ist der älterer Kultort des alten Israel? Ist es der samaritanische Garizim bei<br />
Sichem/Nablus? Oder ist es der jerusalemer Berg Zion? Vermutlich ist der Garizim die alte<br />
Kultstätte Israels und der Zion ein jüngerer »häretischer« Ableger. Wir pflegen den Zion für die<br />
»wahre Kultstätte« Israels zu halten, weil wir die biblischen Überlieferungen aus der judäischen<br />
Optik und polemischen Würdigung zu rezipieren pflegen. Aber der ältere und traditionelle Kultort<br />
dürfte der Garizim sein. - Der Religionssoziologe H. G. Kippenberg (1971) begründete eine völlig<br />
neue Bewertung und Datierung des »samaritanischen Schismas«. B. J. Diebner (2002) vertritt die<br />
Meinung, dass es sich ein »judäisches Schisma« im 2. Jahrhundert v. Chr. handele und dass die<br />
jerusalemer Zionsgemeinde kaum früher die Bezeichnung als »Israel« im ekklesiologischen Sinne<br />
übernommen haben dürfte. - Welche Reflexe hinterlassen Samaritaner und Judäer im »jüdischen«<br />
Kulturspektrum in der Folgezeit? Literarische und archäologische Zeugnisse sollen untersucht<br />
werden: in Palästina, in Ägypten, im ägäischen Mittelmeerraum.<br />
LITERATUR:<br />
H. G. Kippenberg: Garizim und Synagoge. RGVV XXX. Berlin, New York, 1971. Weitere Literatur<br />
wird im Laufe des Seminars bekannt gegeben.
Beginnt am: 20.04.2009<br />
Zielgruppe: Theologiestudierende der mittleren und höheren Semester, Orientalisten,<br />
(christliche) Archäologen. Studierende der Klassischen Altertumswissenschaften.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Einige Kenntnis der Geschichte des vorderen Orients von ca. 500<br />
v. Chr. bis 500 n. Chr. förderlich, auch Sprachkenntnisse (Hebräisch, Griechisch, Latein)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Je nach Interesse und eventueller<br />
Leistungsanforderungen; 2-4 h sollten eingeplant werden.<br />
Leistungsnachweis: Ja nach Studiengang und Absprache; Hausarbeit; Referat ( schriftlich)<br />
PROF. GERTZ<br />
OS<br />
BV 26./27. Juni 2009<br />
FIIT<br />
Reste hebräischen Heidentums im<br />
Alten Testament (Blockseminar)<br />
Das Alte Testament ist in seiner vorliegenden Form ganz überwiegend das literarische Zeugnis<br />
des sich formierenden Judentums der nachexilischen Zeit. Im Seminar wird die Frage diskutiert,<br />
ob - und wenn ja wie - ein methodisch kontrollierter Zugriff auf die vorexilische Literatur der<br />
Staaten Juda und Israel hinter der vorliegenden Gestalt möglich ist.<br />
LITERATUR:<br />
Texte und Sekundärliteratur werden in der Vorbesprechung genannt.<br />
Beginnt am: Vorbesprechung am 1. Donnerstag im Semester um 14 Uhr c. t. | Dekanat<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: AT-Hauptseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein; benoteter Schein aufgrund einer Seminararbeit<br />
Übungen<br />
DR. KOCH<br />
Ü<br />
Mi 18-20 Uhr<br />
KiGa II<br />
Bundestheologie im AT<br />
Der »Bund« (hebr. bryt) ist im Alten Testament die zentrale Metapher für die Darstellung des<br />
Gottesverhältnisses Israels. Während dem ältesten Bundeskonzept im Deuteronomium die<br />
restriktiven altorientalischen Vasallenverträge Modell standen, gehen jüngere Bundeskonzepte (im<br />
Deuteronomismus, der Priesterschrift und im Jeremiabuch) ihre - theologisch äußerst spannenden<br />
- eigenen Wege. In der Übung sollen die wichtigsten Bundeskonzepte auf ihre theologische<br />
Interpretationskraft hin untersucht werden. Darüber hinaus soll der Ausdruck auch in Bezug auf<br />
seine Tragfähigkeit im jüdisch-christlichen Dialog in den Blick genommen werden.<br />
LITERATUR:<br />
W. Groß, Zukunft für Israel. Alttestamentliche Bundeskonzepte und die aktuelle Debatte um den<br />
Neuen Bund, SBS 176, Stuttgart 1998. Weitere Literatur wird in der Übung besprochen.
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1-2h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein<br />
DR. VETTE/DR. HUPE<br />
Ü<br />
Mi 16-18 Uhr<br />
KiGa I<br />
»Das Alte Testament im Lukanischen<br />
Doppelwerk«<br />
Das Lukasevangelium zeigt eine Fülle unterschiedlicher Strategien, wie alttestamentliche<br />
Traditionen aufgenommen und verarbeitet werden. In dieser Übung werden wir dieser Vielfalt<br />
nachgehen, um unseren Verstehenshorizont zum LkEv zu erweitern.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Graecum und Hebraicum empfohlen<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein<br />
PROF. DIEBNER/DR. GRIESHAMMER/<br />
PROF. NAUERTH<br />
Ü<br />
Mo 17-19 Uhr<br />
ÄI<br />
Texte des Koptischen Museums Kairo<br />
Überwiegend Texte in koptischer Sprache sollen behandelt werden, aber natürlich auch ihre<br />
Fundzusammenhänge und »ursprünglichen« Funktionen. Daher hat die Veranstaltung auch<br />
archäologische Aspekte.<br />
LITERATUR:<br />
Die Texte stammen zumeist aus Ausstellungskatalogen und Grabungspublikationen. Diese werden<br />
je bekannt gegeben.<br />
Beginnt am: 20.04.2009<br />
Zielgruppe: Kirchengeschitlich interessierte Theologen, Ägyptologen (mit Prüfungsinteresse für<br />
Koptologie im Nebenfach).<br />
Teilnahmevorausetzungen: Griechisch- und Koptischkenntnisse förderlich; die Texte werden<br />
aber in den Sitzungen minutiös übersetzt.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 0-4 h (bei verbereitenden Übersetzungen)<br />
Leistungsnachweis: Studiengangabhängig
Gesucht wird<br />
ein Macher für das KVV Wintersemester 2009/10.<br />
Was sind deine Aufgaben? - Du bist hauptverantwortlich dafür, dass es am<br />
Ende des Sommersemesters 2009 ein neues KVV geben wird.<br />
Was ist zu tun? - Du solltest dir ein kleines Team aufbauen und die Bereiche<br />
Planung, Kommentare, Werbung, Druck, Verkauf organisieren und am Laufen<br />
halten.<br />
Was musst du können und haben? - Du solltest dich mit Word und Excel<br />
auskennen (oder jemanden kennen, der sich auskennt), brauchst Einfühlungsvermögen<br />
im Kontakt mit Dozenten und Verhandlungsgeschick mit<br />
Werbekunden und Druckereien.<br />
Was ist nicht zu tun? - Du musst das Rad nicht neu erfinden!!! Systeme,<br />
Kontakte, Listen usw. sind wohlorganisiert und übersichtlich vorhanden. Du<br />
musst einfach nur das fortsetzen, was in diesem und letztem Semester bereits<br />
begonnen wurde. Außerdem kannst du dich jederzeit vertrauensvoll an<br />
die Verantwortlichen aus den letzten Semestern wenden und erhältst eine<br />
Einführung und Unterstützung.<br />
Was bringts? - Arbeit, Erfahrung und viel Spaß und gute Verbindungen mit<br />
Dozenten und vielen anderen Mitarbeitern der <strong>Fakultät</strong> und die Fachschaft<br />
wird dich lieben.<br />
Und jetzt? - Melde dich! Mail an: kvv@theologie.uni-heidelberg.de genügt.
PFR. GÜNTHER<br />
Ü<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Der Mischna-Traktakt Pirke Awot – Die Sprüche<br />
der Väter: Lektüre und Interpretation<br />
Pirke Awot - Sprüche der Väter heißt ein Mischnatraktat mit fünf Kapiteln, dem später ein<br />
sechstes hinzugefügt wurde. Enthalten sind die Lebensregeln der bedeutendsten Weisen (»Väter«)<br />
vom 3. Jahrhundert v. Chr. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. Neben den Sprüchen Salomos und<br />
denen des Jesus Sirach sind die »Sprüche der Väter« die volkstümlichsten und beliebtesten<br />
geworden. Auch zur Zeitgeschichte bieten sie Interessantes und Wertvolles, denn sie spiegeln die<br />
Auseinandersetzung der pharisäischen Richtung mit dem Hellenismus, den Sadduzäern und dem<br />
aufkommenden Christentum. Zur Einstimmung wird zuerst das angefügte 6. Kapitel gelesen mit<br />
den Sprüchen über den Wert und die Bedeutung der Beschäftigung mit der Thora. An<br />
Textausgaben (vokalisiert und mit Übersetzung) besteht kein Mangel. Die »Sprüche der Väter«<br />
sind zudem eine gute Einführung in ein späteres Stadium des Hebräischen, in das rabbinische<br />
Hebräisch.<br />
Zielgruppe: Mittlere Semester<br />
Teilnahmevorausetzungen: Hebräisch-Kenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Entsprechend den Vorkenntnissen<br />
Leistungsnachweis: Referat<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
Ü<br />
� S. 31<br />
DR. SCHWIDERSKI<br />
Ü<br />
DR. HUG<br />
Ü<br />
DR. HUG<br />
� S. 31<br />
� S. 37<br />
Ü � S. 38<br />
Hebräische Lektüre: Das Buch Ruth<br />
Nichttiberische hebräische Textzeugen<br />
des AT<br />
Syrische Lektüre für Anfänger<br />
Syrische Lektüre für Fortgeschrittene
DR. SCHWIDERSKI<br />
SK<br />
� S. 32<br />
PROF. OEMING/<br />
PROF. LIPSCHITS<br />
BS<br />
PROF. REICH<br />
BS<br />
09./10.05.2009<br />
10-13+14-17 Uhr<br />
Vorbespr.:<br />
31.03.2009, 11-13Uhr<br />
Block:<br />
15.-17.05.2009<br />
Neues Testament<br />
Hebräisch I<br />
Vorbereitung der Grabung in Ramat Rahel<br />
Jerusalem, wie Jesus es kannte<br />
Zum Studium des Neuen Testamentes (NT) gehört es, sich mit dem neutestamentlichen Kanon<br />
und seiner Umwelt auseinanderzusetzen, insbesondere der politischen und religiösen Geschichte<br />
des Judentums unter römischer Herrschaft und der Geschichte des Urchristentums. Außerdem soll<br />
es Kenntnis der Hauptprobleme neutestamentlicher Theologie unter Berücksichtigung des Verhältnisses<br />
zum Alten Testamentes und zur Theologie des frühen Judentums sowie Fragestellungen<br />
christlicher und geschlechtergerechter Hermeneutik vermitteln.<br />
Zu seinen Zielen zählt es, sich in die Gedankenwelt des NT zurechtzufinden und eine eigene,<br />
reflektierte Auslegung zu ermöglichen.<br />
Vorlesungen<br />
PROF. LAMPE<br />
V | Do 9-11 Uhr<br />
NUni HS 6<br />
V Ü | Mi 10-11 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Überblicksvorlesung: »Die kanonischen<br />
Evangelien im Profil«<br />
Die kanonischen Evangelien sollen in ihrem je sehr eigenen situativen und theologischen Profil<br />
dargestellt werden, so dass sich ein Vergleich dieser unterschiedlichen Profilierungen ergeben<br />
kann. In der Übung sollen Fragen der Vorlesung vertieft, nach Möglichkeit aber auch einzelne<br />
Evg.-Texte im Urtext erarbeitet werden (für die Übung wäre also Griechisch Voraussetzung, für<br />
die Vorlesung dagegen nicht)<br />
LITERATUR:<br />
in einer der bekannten »Einleitungen« (nach Wahl) die entspr. Abschnitte über die synoptische<br />
Frage und die vier Evangelien
Beginnt am: 02.04.2009 (nicht am Mi 01.04.)<br />
Teilnahmevorausetzungen: keine, aber Griechischkenntnis wären hilfreich, NT-<br />
Proseminarkenntnisse ebenfalls, aber keine Voraussetzung<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: für die Übung 2 Std. Die Vorlesung am Do ist aber<br />
auch ohne die Übung am Mi besuchbar, und umgekehrt.<br />
Leistungsnachweis: mdl. Vorlesungsprüfung am Ende des Semesters, allerdings nur für die, die<br />
sowohl Vorlesung als auch Übung besuchten.<br />
PROF. PÖTTNER<br />
V<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
NUni HS 8<br />
Die Entstehung des Christentums als<br />
pluraler Religion<br />
Die Vorlesung befasst sich mit der Grundstruktur des Christentums, wie es sich im Neuen Testament<br />
als Teil der Präkanonischen Edition von Septuaginta als Altem Testament und Neuem Testament<br />
zeigt. Dabei wird sich zeigen, dass hier der Entwurf einer in sich pluralen christlichen<br />
Religion vorliegt, welche die konfessionelle Struktur der christlichen Religion weitgehend vorstrukturiert.<br />
Die Methode ist daher eher textsemiotisch-wirkungsgeschichtlich ausgelegt. Im NT und<br />
seinem Bezug auf das AT schlagen sich verschiedene narrative und bildliche Muster nieder, um<br />
die Erlösung durch Jesus von Nazaret darzustellen, diese werden exemplarisch nachvollzogen.<br />
Die normative Frage wird religionsphilosophisch zu klären versucht: Kann es verteidigt werden,<br />
den Lebenssinn bildlich auszudrücken?<br />
LITERATUR:<br />
Gerd Theißen, Die Religion der ersten Christen, 2003; Martin Pöttner, Formatives Christentum, in:<br />
O. Wischmeyer (Hgin.), Herkunft und Zukunft der Neutestamentlichen Wissenschaft, 2003, 165ff.<br />
Zielgruppe: Studierende aller Semester aus Theologie und Religionswissenschaft<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2h<br />
PROF. THEIßEN<br />
V<br />
Mi 14-16 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Das Verstehen des Neuen Testaments in<br />
der modernen Zeit (Hermeneutik)<br />
Hermeneutik kreist um zwei Fragen: Welchen Erkenntnis- und Wahrheitswert haben die Geistes-<br />
verglichen mit den Naturwissenschaften? Welchen Geltungsanspruch haben Texte aus der Vergangenheit<br />
für die Gegenwart? In der Bibelauslegung konzentrieren sich beide Fragen: Eine<br />
theologische Auslegung der Bibel will in ihr eine Wahrheit für Welt- und Lebensinterpretation<br />
gewinnen. Wir verfolgen diesen Versuch in der Geschichte der Bibelauslegung. Mit der Erosion<br />
einer naiven narrativ erzählbaren Heilsgeschichte wurde die Bibel neu gewertet: als Dichtung und<br />
Ethik im 18. Jh., als Erscheinung einer Idee und als Geschichte im 19. Jh., als Zeugnis der Religion<br />
(um 1900), als Kerygma (im 20.Jh.) und in der Gegenwart als Zeichensprache. Auch die Verirrungen<br />
nationalsozialistischer Exegeten gehören in diese Geschichte der Hermeneutik, dazu aber<br />
auch die konservativen Gegenströmungen heilsgeschichtlichen Denkens. Die wichtigsten Entwürfe<br />
einer Hermeneutik in der Gegenwart werden dargestellt und ein eigener Versuch wird in Umrissen
dargestellt, bei dem die Grundfrage ist: Was in der Bibel erweist sich durch alle humanwissenschaftliche<br />
Analyse und Kritik hindurch als gültig?<br />
LITERATUR:<br />
Allgemeine Hermeneutik: Jean Grondin, Einführung in die philosophische Hermeneutik, Darmstadt<br />
22001. <strong>Theologische</strong> Hermeneutik: J. Lauster, Religion als Lebensdeutung, Darmstadt 2005.<br />
Biblische Hermeneutik: M. Oeming, Biblische Hermeneutik. Eine Einführung, Darmstadt 1998.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Pro-/Haupt-/Oberseminare<br />
SCHROEDER<br />
PS<br />
Do 14-16 Uhr<br />
ÖInst<br />
Einführung in die Methoden der<br />
neutestamentlichen Exegese<br />
Im Proseminar werden klassische und neue Methoden der Auslegung des Neuen Testaments<br />
erarbeitet und eingeübt. Ziel des PS ist es, selbständiges exegetisches Arbeiten zu lernen, um<br />
eine wissenschaftliche Auslegung eines ntl. Textes verfassen zu können. Die intensive Arbeit am<br />
griechischen ntl. Text mit textkritischen, literarkritischen, formgeschichtlichen, traditions- und<br />
motivgeschichtlichen, religionsgeschichtlichen und neueren Ansätzen ist dabei Gegenstand des<br />
PS.<br />
LITERATUR:<br />
Wird zu Beginn des Proseminars bekannt gegeben.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Graecum<br />
Anmeldung: schriftliche Anmeldung ab Mo, 30.03.2009, Zi. 017 im WTS<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4 h<br />
Leistungsnachweis: Proseminararbeit (benoteter Schein)<br />
THEOBALD<br />
PS<br />
Di 16-18 Uhr<br />
Dek<br />
Einführung in die Methoden der<br />
neutestamentlichen Exegese<br />
Im Proseminar werden die klassischen Methoden der historisch-kritischen Exegese kennengelernt<br />
und eingeübt. Daneben sollen auch alternative/ ergänzende Ansätze in den Blick genommen<br />
werden. Ziel der Veranstaltung ist es, selbstständiges exegetisches Arbeiten zu erlernen, um im<br />
Rahmen einer Proseminararbeit einen neutestamentlichen Text wissenschaftlich auslegen zu<br />
können.
LITERATUR:<br />
Wird in der ersten Sitzung bekannt gegeben.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Graecum<br />
Anmeldung: Schriftliche Anmeldung ab Mo, 30.03.2009, im WTS (Zi. 010)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4-6 h<br />
Leistungsnachweis: Proseminararbeit<br />
PROF. PÖTTNER<br />
S<br />
Di 18-20 Uhr<br />
Dek<br />
Friedrich Schleiermachers Hermeneutik<br />
im Kontext seiner Exegesetheorie<br />
Die Hermeneutik Schleiermachers ist in den letzten dreißig Jahren allmählich wiederentdeckt<br />
worden, sie bietet immer noch große Anregungen für die schwierige und unendliche Aufgabe des<br />
Verstehens.<br />
Das SE befasst sich ausführlich mit dem Text und übt an Beispielen praktisch, worum es dabei<br />
geht. Zudem werden wir zu verstehen versuchen, wie die Hermeneutikonzeption in<br />
Schleiermachers Theologiekonzeption einbezogen ist.<br />
Seminarplan und Literaturliste ab Ende Februar unter<br />
http://www.martinpoettner.de/html/lehrmaterialien.html.<br />
Literatur:<br />
F. D. E. Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik (stw 211); Kurze Darstellung des <strong>Theologische</strong>n<br />
Studiums.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium aus Theologie und Religionswissenschaft<br />
Teilnahmevorausetzung: Exegetisches Proseminar oder vergleichbare<br />
religionswissenschaftliche Veranstaltung<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 6 Stunden<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
PROF. SCHWIER<br />
S<br />
Di 14-16 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Die Auferstehung Jesu Christi<br />
Dass Jesus Christus aus dem Tod auferweckt wurde, ist das Grundbekenntnis des frühen<br />
Christentums und gleichzeitig in Moderne und Gegenwart heftig umstritten. Wir analysieren im<br />
Seminar die entsprechenden Bibeltexte in gemeinsamer Arbeit, um das Zeugnis des NT zu<br />
verstehen und mit Gegenwartsfragen zu konfrontieren. Dem Seminar korrespondiert das<br />
homiletische Seminar, in dem die Predigtarbeit anhand der hier gewonnenen exegetischen<br />
Ergebnisse erfolgt.<br />
LITERATUR:
H.-J. Eckstein / M. Welker (Hg.): Die Wirklichkeit der Auferstehung, Neukirchen 2002; J. Becker:<br />
Die Auferstehung Jesu Christi nach dem Neuen Testament, Tübingen 2007<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: NT Proseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
PROF. WANDER<br />
S<br />
PROF. PÖTTNER<br />
S<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
KiGa I<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
KiGa I<br />
Zur Kritik moderner Jesusbilder<br />
Die Bibel in gerechter Sprache<br />
Das Übersetzungskonzept der Bibel in gerechter Sprache wird z. T. scharf kritisiert. Das SE<br />
untersucht anhand von Mt 5,21-48 und Joh 1,1-18 exemlarisch die Berechtigung dieser Kritik.<br />
Zudem wird zu verstehen versucht, welche Übersetzungskonzepte die Übersetzer/innen verfolgt<br />
haben und wie dies zu der klassischen Konzeption Schleiermachers steht. Seminarplan und<br />
Literaturliste ab Ende Februar unter: www.martinpoettner.de/html/lehrmaterialien.html.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium aus Theologie und Religionswissenschaft<br />
Teilnahmevorausetzungen: Griechisch und Hebräisch<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 6-8 h<br />
Leistungsnachweis: Hauptseminararbeit<br />
PROF. BUSCH<br />
S<br />
Di 18-20 Uhr<br />
KiGa I<br />
Dämonen und Exorzismen im NT<br />
In der Antike wurde ein Dämon wahrgenommen wie heutzutage elektrischer Strom: Er ist<br />
eigentlich unsichtbar, nur an seiner Wirkung erfahrbar und kann zerstörerische Kräfte entfalten.<br />
Wer mit Dämonen umgehen kann, genießt größte Hochachtung. Im Seminar werden wir die<br />
Dämonenvorstellungen im Neuen Testament und seiner Umwelt nachzeichnen. Wir werden dabei<br />
in die antike Volksreligiosität einerseits und in die zeitgenössische philosophische Diskussion<br />
andererseits eintauchen. Dabei sind gründliche Kenntnisse der alten Sprachen und der<br />
exegetischen Methoden unabdingbar.<br />
LITERATUR:<br />
Lange, A.(Hg.), Die Dämonen. Die Dämonologie der israelitisch-jüdischen und frühchristlichen<br />
Literatur im Kontext ihrer Umwelt, Tübingen 2003<br />
Beginnt am: 21.04.2009<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latinum, Graecum, Zwischenprüfung
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4 h<br />
Leistungsnachweis: Referat und Seminararbeit<br />
PD DR. CZACHESZ<br />
S s. u.<br />
Ritual und Überlieferung im Frühen Christentum<br />
(Gesprächspartner: Prof. Gerd Theißen)<br />
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den Riten des Urchristentums, aufgrund des Neuen<br />
Testaments und ausgewählter apokyphen Texten. Die Belege werden im Rahmen von<br />
verschiedenen Ritualtheorien ausgewertet, mit kognitiven Ritualtheorien als Schwerpunkt. Wir<br />
fragen u.a. nach den Emotionen und religiösen Erfahrungen, die die urchristlichen Riten<br />
auslösten, sowie nach der Rolle von Ritualen, Emotionen, und Erfahrungen in der Entstehung und<br />
Überlieferung von Traditionen und theologischen Konzepten.<br />
Das Seminar findet in drei Blöcken statt: 24/25. April, 15/16. Mai, 29/30. Mai, immer am<br />
Freitagmittag (14.00-17.00) und Samstagmorgen (9.00-12.00). Vorbesprechung: 3. April.<br />
LITERATUR:<br />
Eine Auswahl von Texten wird am Anfang des Seminars aufgegeben.<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
DR. HUPE<br />
S<br />
Di 18-20 Uhr<br />
KiGa II<br />
(Post-)Moderne Gerechtigkeitsdiskurse<br />
und Neues Testament<br />
Die aktuelle Finanzkrise führt es symbolisch vor Augen: Der interdisziplinäre Gerechtigkeitsdiskurs<br />
muss und wird neu bestimmt werden. Die bisher lange Zeit erfolgreichen, distributiv und<br />
universalistisch ausgerichteten Gerechtigkeitstheorien (z.B. Rawls und Walzer) erfahren z. Zt.<br />
durch personale und kontextbezogene Modelle eine interessante und ernst zu nehmende<br />
Erweiterung und Kritik. Aus Perspektive des Neuen Testaments bietet sich hier die Chance, eine<br />
theologische Stimme in den philosophischen Diskurs einzubringen, die nicht zuletzt mit Blick auf<br />
»Jesu Gerechtigkeitshandeln« wichtige Topoi setzen und inhaltlich-konkret füllen kann. Die Übung<br />
wird analysieren, wo die Schnittpunkte der Diskurse liegen und wie hier philosophisch-formal und<br />
inhaltlich-neutestamentlich argumentiert werden kann.<br />
LITERATUR:<br />
Wird zu Beginn bekannt gegeben.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein bei Kurzreferat
PROF. LAMPE<br />
OS<br />
Fr 13-15 Uhr<br />
Dek<br />
Neue Forschungen im NT<br />
Hier stellen v.a. die am Lehrstuhl arbeitenden DokorandInnen Einzelabschnitte ihrer jeweiligen<br />
Forschungsprojekte vor und unterziehen Sie der Kritik der Seminargruppe. Auch werden zuweilen<br />
Quellentexte zusammen analysiert, die für Einzelprojekte der TeilnehmerInnen relevant sind.<br />
Zielgruppe: DoktorandInnen und höhere Semester<br />
Anmeldung: Per Tel. oder E-mail<br />
Leistungsnachweis: Referat<br />
Übungen<br />
DR. AUGENSTEIN<br />
Ü<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
HS 007<br />
Bibelkunde des Neuen Testaments<br />
Die Übung hat das Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über Inhalt und<br />
Struktur der neutestamentlichen Schriften zu verschaffen. Dazu werden zu Hause die Schriften<br />
des Neuen Testaments kursorisch gelesen. In der Übungsstunde werden dann diese Vorarbeiten<br />
vertieft und wichtige gattungsgeschichtliche, historische und theologische Themen behandelt. Die<br />
Übung will auch gezielt auf die Bibelkundeprüfung vorbereiten.<br />
LITERATUR:<br />
Reader wird in der ersten Sitzung ausgegeben; eine Bibelkunde eigener Wahl<br />
Zielgruppe: Studierende in den Anfangssemestern<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1 Arbeitstag pro Woche<br />
Leistungsnachweis: Bibelkundeprüfung<br />
PROF. PÖTTNER<br />
Ü<br />
Fr 16-18 Uhr<br />
Dek<br />
Aharon Agus' »Das Judentum in seiner<br />
Entstehung«<br />
Agus' Interpretation des Judentums in seiner formativen Phase wird zu verstehen versucht. Dabei<br />
geht es um das Verständnis des Judentums als einer dynamischen Schriftreligion im Unterschied<br />
zu einer priesterlich bestimmten Religion. Tiefe und Leistungsfähigkeit der rabbinischen<br />
Religiosität, wie Agus sie sieht, sollen erfasst werden.<br />
LITERATUR:
Aharon R. E. Agus, Das Judentums in seiner Entstehung, 2001; Martin Pöttner, Aharon Agus'<br />
Beitrag zum Verständnis des Entstehens des Christentums, in: Ronen Reichman (Hg.), "Der Odem<br />
des Menschen ist eine Leuchte des Herrn", 2006, 15ff; in diesem Gedenkband auch weitere<br />
wichtige Beitäge zum Verständnis Agus', etwa von Jan Assmann, 1ff.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie und Religionswissenschaft mit Interesse am Judentum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4 h<br />
WELCH<br />
Ü<br />
Fr 10-12 Uhr<br />
KiGa II<br />
Neutestamentliche Textkritik<br />
War der Römerbrief eigentlich ein Brief an Rom? Ist eine weibliche Apostelin in der Bibel bezeugt?<br />
Müssen Frauen, laut Paulus, in der Kirche schweigen? Wie lautet das Ende des<br />
Markusevangelium? Die Methoden, wie man den Text dieser Stellen im NT festlegt, wird in dieser<br />
Veranstaltung behandelt. Wie man eine Lesart der andere vorzieht, wird gründlich diskutiert und<br />
eingeübt. Nach der Erörterung der Methoden, werden einige Handschriften vorgestellt, die<br />
maßgeblich für die Rekonstruktion der Überlieferung sind. Nach dieser Veranstaltung sollen die<br />
Teilnehmer, durch Verwendung der gängigen Hilfsmittel, alle Lesarten kritisch und<br />
wissenschaftlich beurteilen können.<br />
LITERATUR:<br />
B. und K. Aland, Der Text des neuen Testaments, Stuttgart 1981; Nestle-Aland, Novum<br />
Testamentum Graecum, 27. Auflage; Bruce M. Metzger and Bart D. Ehrman, The Text of the New<br />
Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, 4. Auflage, Oxford 2005; Bruce<br />
Metzger, The early versions of the New Testament, Oxford 1977; Bruce Metzger, Textual<br />
Commentary to the New Testament, Stuttgart 1994<br />
Beginnt am: 10.04.2009<br />
Teilnahmevorausetzungen: NT Proseminar oder begleitend<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
TZVETKOVA-GLASER<br />
Ü<br />
� S. 36<br />
Lektüre des Römerbriefes
Kirchengeschichte<br />
Wie hat der christliche Glaube seit der Zeit der ersten Christen Gestalt angenommen, sich entwickelt<br />
und gewandelt? Wieso sieht die Kirche heute so aus wie wir sie kennen und nicht anders?<br />
Diesen Fragen geht die Kirchengeschichte nach. Sie bietet in Vorlesungen einen Überblick über<br />
ihre wichtigsten Epochen und führt sowohl in das historische als auch das theologische wissenschaftliche<br />
Arbeiten ein.<br />
Vorlesungen<br />
PROF. LÖHR<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
V Fr 11-12 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Überblicksvorlesung: KG I (Alte Kirche)<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte des Christentums vom ersten bis zum<br />
fünften Jahrhundert. Behandelt werden u.a. die Ausbreitung des Christentums, die Debatten mit<br />
dem Heidentum, Christenverfolgungen und Märtyrer, die Entstehung einer kirchlichen<br />
Organisation, die Entstehung der Unterscheidung von Orthodoxie und Häresie, das Verhältnis von<br />
Kirche und Staat, die ersten vier Konzilien, die Entstehung des christlichen Gottesdienstes und des<br />
Kirchenjahrs. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.<br />
LITERATUR:<br />
Als Lehrbuch zur begleitenden Lektüre wird empfohlen: Ernst Dassmann, Kirchengeschichte, Bdd.<br />
I–II,2, Kohlhammer-Studienbücher Theologie, Bdd. 10/ 11,1/ 11,2, Stuttgart<br />
1991/2000.1996.1999. Weitere Literatur wird in der Vorlesung genannt.<br />
Zielgruppe: Studierende aller Semester<br />
Teilnahmevorausetzungen: Interesse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: entsprechend der Intensität der Nachbereitung<br />
Leistungsnachweis: mündl. Vorlesungsprüfung; mündl. Prüfung als Teil der Zwischenprüfung<br />
PROF. STROHM<br />
Mi 9-11 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
V Do 9-10 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Überblicksvorlesung: KG III<br />
(Reformation)<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Kirchen- und Theologiegeschich-te der<br />
Reformationszeit (bis ca. 1555). Sie richtet sich sowohl an Anfänger und Anfängerinnen als auch<br />
an fortgeschrittene Studierende, die Ereignisse, Per-sonen und Entwicklungen des behandelten<br />
Zeitraum noch einmal im Zu-sammenhang erarbeiten wollen. In der Vorlesung wird edv-gestützt<br />
Bild- und Kartenmaterial präsentiert.
LITERATUR:<br />
Beutel, A.: Luther-Handbuch, Tübingen 2005; Lohse, B.: Luthers Theologie in ihrer historischen<br />
Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995; Reformation,<br />
ausgew.u. komm. v. V. Leppin (KThQ 3), Neukirchen-Vluyn 2005; Seebaß, G.: Geschichte des<br />
Christentums III: Spätmittelalter – Reformation – Konfessionalisierung (<strong>Theologische</strong><br />
Wissenschaft, 7), Stuttgart 2006.<br />
Zielgruppe: Studierende in den Anfangssemestern oder später<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2h<br />
Leistungsnachweis: Benoteter Schein nach schriftlicher Prüfung od. mündl. Prüfung als Teil der<br />
Zwischenprüfung<br />
PROF. LÖHR<br />
V<br />
Di 11-13 Uhr<br />
NUni HS 7<br />
Geschichte des Christentums im Überblick: KG I<br />
(Antike und Mittelalter) für BA Christentum und Kultur<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte des Christentums vom 1.bis zum<br />
15.Jahrhundert. Behandelt werden u.a. die Mission des Christentums in Antike und Mittelalter, die<br />
Entstehung einer kirchlichen Organisation (Papsttum), die Entstehung und Entwicklung des<br />
Mönchtums, die verschiedenen Kirchenspaltungen, die wichtigsten Synoden und Konzilien, die<br />
Geschichte der Frömmigkeit. Die Vorlesung richtet sich vor allem an Studierende des Bachelor-<br />
Studienganges »Christentum und Kultur«.<br />
LITERATUR:<br />
Wird in der Vorlesung genannt.<br />
Zielgruppe: BA-Studierende<br />
Teilnahmevorausetzungen: Interesse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: je nach Intensität der Nachbereitung<br />
Leistungsnachweis: mündl. Vorlesungsprüfung<br />
PD DR. KLEIN<br />
V<br />
Mo 10-12 Uhr<br />
NUni HS 5<br />
Geschichte des sozialen Protestantismus<br />
Von den Almosenordungen der Reformationszeit über die großen Einzelinitiativen des Pietismus<br />
(z.B. Halle'sche Anstalten) und der Erweckungsbewegung (z.B. Retungshausbewegung), die<br />
zentrale Gestalt Johann Hinrich Wicherns und die Begründung der Inneren Mission, die »soziale<br />
Frage« des 19. Jahrhunderts, bis zur Entsehung des Diakonischen Werkes 1957 sowie der<br />
Sozialen Marktwirtschaft aus dem Geiste des sozialen Protestantismus wird in der Vorlesung der<br />
Bogen geschlagen.
LITERATUR:<br />
für einen ersten Überblick: Erich Beyreuther, Geschichte der Diakonie und der Inneren Mission in<br />
der Neuzeit, Berlin 1983.<br />
Beginnt am: erste Semesterwoche, dann 14 tg. 2std. (Ort und Zeit s. Aushang)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2h<br />
Leistungsnachweis: Vorlesungsprüfung<br />
DR. PICKER<br />
V<br />
Do 11-13 Uhr<br />
NUni HS 4<br />
Pfälzische Kirchengeschichte in der NS-Zeit<br />
Pfälzische Kirchengeschichte ist nicht nur eine Sache für Spezialisten oder eingefleischte Pfälzer.<br />
Der regionalkirchengeschichtliche Fokus bietet die besondere Chance, sehr konkrete<br />
Anschauungen zu gewinnen. Protestantische Affinität zum Nationalsozialismus, Gleichschaltung,<br />
Kirchenkampf, Anpassung und Widerstand, Verfolgung und Krieg, Entnazifizierung und<br />
Erinnerungskultur – alle diese Themenfelder der Vorlesung verbinden sich mit konkreten<br />
Menschen, Orten und Institutionen in der Pfalz. Die allgemeine Kirchengeschichte wird durch<br />
diesen Fokus illustriert, ergänzt, kritisch überprüft und manchmal überhaupt erst recht<br />
verständlich. In der Vorlesung werden die pfälzischen Entwicklungen immer wieder in einen<br />
größeren Rahmen gestellt, so dass auch allgemeinhistorisch Interessierte mit Gewinn teilnehmen<br />
können.<br />
LITERATUR:<br />
Kurt Meier, Der Evangelische Kirchenkampf, 3 Bdd., Göttingen ²1984; Gerhard Nestler, Hannes<br />
Ziegler (Hgg.) Die Pfalz unterm Hakenkreuz, Landau 1993; Manfred Gailus/Wolfgang Krogel<br />
(Hgg.), Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirchen im Nationalen, Berlin 2006<br />
Beginnt am: 16.4.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie und der Geschichtswissenschaften<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 0-2 h<br />
Pro-/Haupt-/Oberseminare<br />
DR. KÖCKERT<br />
PS<br />
Fr 9-11 Uhr<br />
KiGa I<br />
Einführung in die Methoden der Kirchengeschichte: Die<br />
Klosterregel des Benedikt von Nursia (Regula Benedicti)<br />
Die Benediktsregel versteht sich als eine Anleitung zum wahren christlichen Leben. Benedikt von<br />
Nursia (gest. ca. 547) schrieb sie für die Mitglieder der klösterlichen Gemeinschaft, die er auf dem<br />
Monte Cassino gegründet hatte. Von dort breitete sie sich aus und prägte das abendländische<br />
Mönchtum so stark wie kaum eine andere Klosterregel. In dem Proseminar werden wir die<br />
Benediktsregel studieren, ihre Vorgänger und ihre Wirkungsgeschichte erarbeiten und einen
lebendigen Einblick in die Lebenshaltung und Theologie christlicher Asketen in der Spätantike und<br />
im Mittelalter gewinnen. Dabei werden Sie Methoden des historischen Arbeitens einüben und<br />
lernen, historische und theologische Fragestellungen zu entwickeln.<br />
LITERATUR:<br />
TEXTAUSGABE: Die Benediktusregel – Regula monachorum, Lateinisch-deutsch, übersetzt von<br />
Burkhard Ellegast, herausgegeben im Auftrag der Salzburger Äbtekonferenz, vierte verbesserte<br />
Auflage, Beuron 2006, ISBN: 978-3-87071-141-2 3-87071-141-8. LITERATUR: Arnold Angenendt,<br />
Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900, 3. Auflage, Stuttgart/<br />
Berlin/ Köln 2001; Adalbert de Vogüé, Art. Benedikt von Nursia, TRE 5, Berlin/ New York 1980,<br />
538-549. ZUR METHODIK: Christoph Markschies, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, Tübingen 1995.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latinum<br />
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 1. April unter<br />
charlotte.koeckert@wts.uni-heidelberg.de<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein: regelmäßige Vorbereitung und Mitarbeit, Anfertigung<br />
eines Protokolls oder eines Referats; benoteter Schein: eine zusätzliche schriftliche Hausarbeit<br />
GRANDCLÈRE-PRAETORIUS<br />
PS<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
ÖInst<br />
Einführung in die Methoden der<br />
Kirchengeschichte: Calvin<br />
Calvin (1509-1564) ist eine der zentralen Figuren der Reformationzeit. In diesem Seminar werden<br />
wir uns mit verschiedenen Aspekten seiner Biographie, Theologie und Rezeption beschäftigen.<br />
Anhand ausgewählter Texte wollen wir Methoden des historischen Arbeitens erlernen, die dazu<br />
befähigen, historische und theologische Themen selbstständig erarbeiten zu können.<br />
LITERATUR:<br />
VORBEREITEND: eine Biographie Calvins (z.B. Thomas H. Parker, John Calvin: A Biography,<br />
London 1975; Denis Crouzet, Jean Calvin: vies parallèles, Paris 2000). ZUR METHODIK: Christoph<br />
Markschies, Arbeitsbuch Kirchengeschichte, Tübingen 1995.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grundstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latinum<br />
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ameldung bis 27. März unter<br />
celine.grandclere@wts.uni-heidelberg.de<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein: regelmäßige Vorbereitung und Mitarbeit, Anfertigung<br />
eines Protokolls oder eines Referats; benoteter Schein: eine zusätzliche schriftliche Hausarbeit
PROF. LÖHR/ PROF. HALFWASSEN<br />
S<br />
Do 18-21 Uhr<br />
KiGa I<br />
Philosophische Theologie in der<br />
Spätantike: Ps.-Dionysius Areopagita<br />
Die christliche Rezeption der griechischen Metaphysik erreicht ihren Höhepunkt mit einem Autor,<br />
den wir bis heute nur unter seinem Pseudonym kennen: Dionysius Areopagita. Der Autor gibt vor,<br />
der von Paulus bei seiner Predigt über den unbekannten Gott bekehrte Athener Ratsherr<br />
Dionysius zu sein. Sein Denken aber basiert ganz und gar auf dem Neuplatonismus, und zwar auf<br />
jener späten Form des Neuplatonismus, für die Proklos, der 485 gestorbene »Hegel der Antike«<br />
steht. Die von Proklos mit aller Konsequenz durchgeführte Theorie des absoluten Einen, das in<br />
reiner Transzendenz jenseits des Seins und aller denkbaren Bestimmungen steht und darum<br />
überhaupt nur in Negationen zu umkreisen ist, wendet Dionysius rigoros auf den christlichen Gott<br />
an: das unsagbare Eine ist Gott oder richtiger: die »Übergottheit«. Dionysius wird damit zum<br />
Begründer einer negativen Theologie als dem Versuch, das Unsagbare zu sagen, indem man sagt,<br />
was es nicht ist; Sprache und Denken sollen in ihrem eigenen Vollzug überstiegen werden.<br />
Zugleich aber kennt Dionysius auch eine affirmative Theologie, die bei ihm freilich nur analoge<br />
und metaphorische Bedeutung hat als Vorstufe zur negativen Theologie. Sein Denken blendet den<br />
Weltbezug Gottes nicht aus, versucht ihn aber konsequent auf die Transzendenz hin zu denken:<br />
so ist Gott zugleich alles und nichts, nämlich jenseits von allem. Wirkungsgeschichtlich war dieser<br />
Versuch von größtem Einfluß: unter anderen auf Johannes Eriugena, Meister Eckhart, Nikolaus<br />
von Kues und Angelus Silesius. Neuerdings wird der christliche Platonismus des Dionysius von<br />
philosophischer Seite wieder gewürdigt; auch die Enzyklika Benedikts XVI. »Deus caritas est«<br />
bezieht sich positiv auf ihn. Im Seminar wollen wir die umfangreiche Schrift Über göttliche Namen<br />
in Auszügen und den kurzen Text Über mystische Theologie lesen. Die Teilnahme setzt die<br />
Bereitschaft zur Übernahme eines Referats über einen Textabschnitt voraus; Griechischkenntnisse<br />
der Teilnehmer sind erwünscht. Eine Liste mit Referatsthemen wird rechtzeitig ausgehängt.<br />
LITERATUR:<br />
TEXTAUSGABEN: De divinis nominibus, hg. v. B. R. Suchla, PTS 33, Berlin/ New York 1990; De<br />
mystica theologia, in: De coelesti hierarchia (u.a.), hg. v. G. Heil/ A. M. Ritter, PTS 36, Berlin/<br />
New York 1991. ÜBERSETZUNGEN: Pseudo-Dionysius Areopagita, Über die mystische Theologie<br />
und Briefe, hg. v. A. M. Ritter, BGrL 40, Stuttgart 1994. Pseudo-Dionysius Areopagita, Die Namen<br />
Gottes, hg. v. B. R. Suchla, BGrL 26, Stuttgart 1988; Von den Namen zum Unbenennbaren,<br />
Auswahl und Einl. von E. von Ivanka, Einsiedeln 1956. Kopiervorlagen von Text und Übersetzung<br />
werden rechtzeitig bereitgestellt. LITERATUR: W. Beierwaltes, Platonismus im Christentum,<br />
Frankfurt a. M. 1998, bes. S. 44-84. W. Beierwaltes, Denken des Einen, Frankfurt a. M. 1985. J.<br />
Halfwassen, Plotin und der Neuplatonismus, München 2004.<br />
Zielgruppe: Interessierte im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Griechischkenntnisse; Bereitschaft zur Übernahme eines Referats<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4 h<br />
Leistungsnachweis: Nach Absprache.
PD DR. NOORMANN<br />
S<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
KiGa I<br />
Athanasius<br />
Wie kaum ein zweiter hat Athanasius, Bischof von Alexandrien von 328 bis 373, die Geschichte<br />
des Christentums im 4. Jh. mit geprägt. Als junger Diakon begleitete er im Jahr 325 seinen<br />
Bischof Alexander von Alexandrien zum Konzil von Nicäa. In den nachfolgenden, bis zum Konzil<br />
von Konstantinopel 381 andauernden trinitarischen Streitigkeiten wird Athanasius zum<br />
entschiedensten Verfechter des nicänischen Bekenntnisses und wird deshalb insgesamt fünfmal<br />
ins Exil verbannt. Das Seminar wird sich daher mit der Geschichte des trinitarischen Streites und<br />
der Rolle, die Athanasius darin spielt, beschäftigen. Darüber hinaus werden die grundlegenden<br />
theologischen Vorstellungen des Athanasius, die im Hintergrund seines theologischkirchenpolitischen<br />
Engagements stehen, erarbeitet.<br />
LITERATUR:<br />
Zur Einführung: K. Metzler, Athanasius von Alexandrien, in: Lexikon der antiken christlichen<br />
Literatur, hg. v. S. Döpp / W. Geerlings, 1998, 58-62; P. Stockmeier, Athanasius, in: Klassiker der<br />
Theologie, hg. v. H. Fries / G. Kretschmar, Bd.1, 1981, 44-61. Die bekannteste theologische<br />
Schrift des Athanasius, das Doppelwerk Contra gentes / De incarnatione Verbi, liegt jetzt,<br />
zusammen mit der Schrift De decretis Nicaeni synodi, in einer erschwinglichen Neuübersetzung<br />
vor: Athanasius von Alexandria. Gegen die Heiden. Über die Menschwerdung des Wortes Gottes.<br />
Über die Beschlüsse der Synode von Nizäa. Aus dem Griechischen übers. u. hg. von Uta Heil,<br />
2008.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: KG Proseminar; Graecum<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h<br />
Leistungsnachweis: Benoteter Schein aufgrund einer Seminararbeit oder eines ausgearbeiteten<br />
Referats<br />
PD DR. EHMANN<br />
S<br />
Mo 14-16 Uhr<br />
KiGa II<br />
Martin Luther, Disputatio de homine<br />
Der kurze Text (40 Sätze!) hat es in sich. Luther entfaltet in seinen Thesen über den Menschen<br />
(s)eine reformatorische Anthropologie. Es geht um Vernunft und Philosophie, um die Bestimmung<br />
des Menschen und den eschatologischen Horizont von Luthers Theologie. Die überschaubare<br />
Grundlage ermöglicht es, sehr genau hinzuschauen und diverse Interpretationen zu erproben<br />
bzw. vorliegende zu prüfen. Natürlich muss auch der historische Kontext angemessen gewürdigt<br />
werden (Reformationsgeschichte, Biographie Luthers). Die Interpretation orientiert sich am<br />
lateinischen Text, daher empfiehlt sich zur Lektüre nicht nur ein erster Blick auf die Übersetzung,<br />
sondern ein zumindest zweiter auf das lateinische Original.
LITERATUR:<br />
zur Anschaffung empfohlen (Grundlage im Seminar): Martin Luther, Lateinisch-Deutsche<br />
Studienausgabe, Band 1, Leipzig 2006, 663-669 (vgl. WA 39/1 und StA 5)<br />
Zielgruppe: höhere und hohe Semester<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latein, Proseminarschein und Bereitschaft zum Referat<br />
Anmeldung: per e-Mail<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 - 4 h<br />
Leistungsnachweis: Hausarbeit<br />
PROF. DÖRFLER-DIERKEN<br />
S<br />
1. Termin: 20./21.06.2009<br />
2. Termin: n.V.<br />
Friedenskämpfer - Glaubenskrieger<br />
Die Begriffe Krieger / Kämpfer / Soldat erleben gegenwärtig eine Renaissance, das Vertrauen in<br />
die Wirkung militärischer Mittel scheint zu wachsen. Religiöse Überzeugung spielt als Motivator für<br />
Terroristen ebenso wie für staatlich bestellte Soldatinnen und Soldaten eine immer wichtigere<br />
Rolle. Diese zeitdiagnostische Überlegung will die Veranstaltung zum Anlass nehmen, Grundtexte<br />
der christlichen Tradition zum Thema Soldat zu lesen und zu interpretieren. Tertullian, Luther,<br />
Ignatius von Loyola sollten unbedingt auf der Lektüreliste stehen. Wenn Interesse besteht,<br />
können auch Texte aus anderen Religionen (etwa Islam und Zen-Buddhismus) herangezogen<br />
werden können.<br />
LITERATUR:<br />
eigenständige Recherche<br />
Beginnt am: 24.04.2009, 10 Uhr s.t.<br />
Anmeldung: Anmeldung per e-mail<br />
Leistungsnachweis: wie üblich<br />
Übungen<br />
DR. SCHNEIDER<br />
Ü<br />
Mo 18-20 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Briefe Melanchthons an König Heinrich<br />
VIII von England<br />
Die Lektüre ausgewählter Briefe in lateinischer Sprache verdeutlicht M. Wirksamkeit und<br />
Ausstrahlung in ganz Europa. Die Briefe werfen ein Licht auf die politischen Bedingungen für die<br />
Ausbreitung der Reformation in Europa und lassen Grundzüge von Melanchthons Theologie<br />
erkennen. Wenig bekannt ist, dass M. seine Loci communes von 1535 diesem Herrscher gewidmet<br />
hat. Je nach Voraussetzungen und Interessen können Auswahl und Schwerpunktsetzung<br />
angepasst werden. Auf Wunsch ist auch ein Besuch in der Melanchthon- Forschungsstelle der<br />
<strong>Heidelberg</strong>er Akademie der Wissenschaften und eine Exkursion zur Europäischen Melanchthon -
Akademie möglich. Die Übung begleitet die Edition von Melanchthon deutsch (bislang erschienen<br />
Bd.1+2, Leipzig 1997ff) – eine Veröffentlichung wichtiger Mel. Schriften in deutscher Sprache.<br />
LITERATUR:<br />
Wird bei Beginn bekanntgegeben<br />
Beginnt am: 06.04.2009<br />
Zielgruppe: Theologen, Historiker, Klass. Philologen<br />
Teilnahmevorausetzungen: Lateinkenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmebescheinigung<br />
PD DR. EHMANN<br />
Ü<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
KiGa II<br />
Zeitgeschichtlich-konfessionskundliche<br />
Übung: Ökumenische, rk-prot. Texte<br />
Zur ökumenischen Verständigung zwischen den Kirchen gehört die Kenntnis der jeweils »anderen«<br />
Konfessionskirche(n). Die Lektüreübung soll dazu verhelfen, Grundtexte der evangelischkatholischen<br />
Verständigung der letzten Jahrzehnte zur Kennntnis zu nehmen, einzuordnen und zu<br />
würdigen.<br />
LITERATUR:<br />
Die Textgrundlage wird eigens für die Übung erstellt. Wer sie in Reichweite hat, mag die 3 bdg.<br />
Ausgabe der »Dokumente wachsender Übereinstimmung« einmal sichten. Die Textauswahl richtet<br />
sich nach den Interessen im Kolleg.<br />
Zielgruppe: mittlere Semester<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
DR. KÖCKERT<br />
Ü<br />
Di 11-13 Uhr<br />
KiGa II<br />
Bekehrung im antiken Christentum<br />
Christliche Bekehrungsgeschichten erzählen, wie Menschen Christen wurden. Dabei machen sie<br />
die geistig-religiöse Entwicklung eines Menschen plausibel und konstruieren dessen neue<br />
Identität. Aus den ersten Jahrhunderten der Christentumsgeschichte sind sehr unterschiedliche<br />
Zeugnisse von Bekehrungen zum Christentum erhalten. In dieser Übung wollen wir einige dieser<br />
Zeugnisse analysieren und fragen, wie in ihnen der Weg zum Christentum dargestellt wird und<br />
wie in ihnen eine christliche Identität umrissen wird. Eine Vermutung ist, daß dabei ein sehr<br />
vielfältiges Bild vom antiken Christentum zu Tage treten wird. In der ersten Sitzung wird die<br />
Auswahl der Texte besprochen.
LITERATUR:<br />
Gustave Bardy, Menschen werden Christen. Das Drama der Bekehrung in den ersten<br />
Jahrhunderten, herausgegeben von Josef Blank, Freiburg/ Basel/ Wien 1988.<br />
Beginnt am: Dienstag, 7. April<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latein- und Griechischkenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-4 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein<br />
GRANDCLÈRE-PRAETORIUS<br />
Ü<br />
Fr-Sa 08./09.05.09 (HD)<br />
Sa-Di 23.-26.05.09 (Genf)<br />
Auf den Spuren Calvins<br />
Der 500. Geburtstag Calvins wird in der protestantischen Welt reichlich gefeiert. Dies ist Anlass<br />
genug sich auf die geistigen und räumlichen Spuren dieses herausragenden Reformators und<br />
französischen Humanisten zu begeben. Die Veranstaltung umfasst ein Blockseminar und eine<br />
Exkursion nach Genf (8.-9. Mai und 23.-27. Mai). Im Blockseminar werden wir uns vorbereitend<br />
einen Überblick über Calvins Leben, seine Theologie und Wirkung verschaffen. Dann werden wir<br />
in Genf nicht nur die Orte seines Lebens und Wirkens besuchen, sondern auch an einigen<br />
Veranstaltungen im Rahmen der »International Conference Calvin and his influence. 1509-2009«<br />
teilnehmen. Voraussichtlich wird die Exkursion mit Mitteln der Studiengebühren unterstützt.<br />
LITERATUR:<br />
Eine Biographie Calvins (z.B. Thomas H. Parker, John Calvin: A Biography, London 1975; Denis<br />
Crouzet, Jean Calvin: vies parallèles, Paris 2000). Weitere Hinweise erhalten Sie während der<br />
Informationsveranstaltung am 2. Februar<br />
Beginnt am: Infoveranstaltung Mo 02.02.2009, 11 Uhr | KiGa II<br />
Teilnahmevorausetzungen: Latinum; Teilnahme an Blockseminar (<strong>Heidelberg</strong> 8.-9. Mai) und<br />
Exkursion (Genf 23.-27. Mai); Bereitschaft ein Referat zu übernehmen.<br />
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Studierende begrenzt. Ameldung bis 15. Februar<br />
unter celine.grandclere@wts.uni-heidelberg.de<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein: Referat<br />
HAUSTEIN/SUARSANA<br />
Ü<br />
MEISTERS<br />
Ü<br />
� S. 79<br />
� S. 37<br />
Pfingstliche Theologien<br />
Anthropologie und Ethik der Stoa (Seneca,<br />
epistulae morales) im Vergleich zur<br />
christlichen Ethik (bibl.Texte)
MEISTERS<br />
Ü<br />
� S. 36<br />
Systematische Theologie<br />
Lektüre-Übung Augustinus, Confessiones<br />
Das Studium der systematischen Theologie umfasst die Disziplinen Dogmatik, Ethik, Ökumenische<br />
Theologie und Philosophie. Ihre Aufgabe ist es, den christlichen Glauben in seinen Voraussetzungen,<br />
in seinem Glaubensinhalt und in seinen Konsequenzen für das menschliche Handeln systematisch<br />
zu reflektieren. In der Dogmatik werden Kenntnisse zu biblischen, historischen und gegenwartsbezogenen<br />
Themen vermittelt und Möglichkeiten zur Integration dieser Themen in theologische<br />
Lehren aufgezeigt. Ferner wird die Fähigkeit zur argumentativen Darlegung der Inhalte<br />
des christlichen Glaubens eingeübt. In der Ethik sollen die Studierenden Kenntnis und Einsicht in<br />
Probleme christlich motivierten Handelns in Geschichte und Gegenwart gewinnen und zu eigenem<br />
ethischen Urteilen befähigt werden. In der Ökumenischen Theologie werden Kenntnisse über die<br />
Beziehungen der christlichen Kirchen untereinander, deren theologische Grundlegung in ihren<br />
unterschiedlichen Traditionen und ihre Bedeutung für das gesellschaftliche und politische Zusammenleben<br />
vermittelt. Ziel der Religionsphilosophie ist es, den selbständigen Umgang mit Fragestellungen<br />
und zentralen Texten der Philosophie zu lehren.<br />
Vorlesungen<br />
PROF. WELKER<br />
Di 11-12 Uhr<br />
NUni HS 8<br />
V Mi 11-13 Uhr<br />
NUni HS 8<br />
Christologie<br />
Die Vorlesung behandelt die wichtigsten Themen der Christologie. Sie nimmt dabei die klassischen<br />
und zeitgenössischen Positionen und Fragestellungen auf. Jede Woche werden kurze Schlüsseltexte<br />
behandelt. Tutorien zur Vorlesung werden angeboten.<br />
Themen:<br />
• Die Faszination und die Problematik des »nahen Gottes«; Der nahe Gott ohne Christus<br />
und die Ferne des historischen Jesus; »Wer ist Jesus Christus für uns heute?«<br />
(Bonhoeffer);<br />
• Die klassischen Fragen nach dem historischen Jesus; Die »dritte Frage« nach dem<br />
historischen Jesus und der Archäologismus; Die »vierte Frage« nach dem historischen<br />
Jesus; Alttestamentliche Christologie?;<br />
• Der Streit um die Historizität der Auferstehung (Strauss, Bultmann, Lüdemann,<br />
Pannenberg); Die Wirklichkeit der Auferstehung;<br />
• Theologie und Philosophie des Kreuzes (Luther, Hegel, Bonhoeffer, Moltmann, Jüngel);<br />
Die Offenbarungskraft des Kreuzes: mehr als der leidende Gott; Opfer und Sühne;
• Der erhöhte Christus; Der öffentliche Christus und die Lehre vom dreifachen Amt<br />
(Calvin, Schleiermacher, Barth); Das kommende Reich Gottes als Emergenzgeschehen;<br />
Sakramentale und gottesdienstliche Gegenwart Christi und der christliche Humanismus;<br />
• Die Parusie Jesu Christi zum Gericht und zum ewigen Leben; Die Offenbarung des<br />
dreieinigen Gottes.<br />
LITERATUR:<br />
Neben den Schlüsseltexten empfiehlt sich einer der folgenden Bände zur begleitenden Lektüre:<br />
Wolfhart Pannenberg, Grundzüge der Christologie, Gütersloh, 7. Aufl. 1990; Jürgen Moltmann,<br />
Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, Gütersloh, 7.<br />
Aufl. 2002; Paul Tillich, Systematische Theologie Bd. 2, neue Ausgabe, De Gruyter 1987; Gerd<br />
Theißen / Annette Merz, Der historische Jesus, Vandenhoeck 1997; Hans-Joachim Eckstein /<br />
Michael Welker, Die Wirklichkeit der Auferstehung, Neukirchen, 3. Aufl. 2005.<br />
PROF. TANNER<br />
V | Do 11-13 Uhr<br />
NUni HS 4a<br />
V Ü | Di 14-15 Uhr<br />
ÖInst<br />
Überblicksvorlesung: Geschichte der Ethik<br />
seit der Reformation (Vorlesung und Übung)<br />
Die Reformatoren läuten mehr ungewollt als gewollt eine neue Epoche der Ethik ein. Die<br />
konfessionelle Spaltung führt zu einer intensiven Suche nach ethischen Grundlagen für das<br />
Zusammenleben, die unabhängig sind von den Besonderheiten konfessionell-dogmatischer<br />
Lehren. So bildet sich zunächst eine eigene Staatstheorie, die an einem Zusammenhang zwischen<br />
Gemeinwesen und Religion noch festhält, sich aber mit dem spezifisch neuzeitlichen Naturrecht<br />
immer stärker gegenüber Theologie und Kirchen verselbständigt. Die Souveränität staatlicher<br />
Macht und später die Autonomie der Bürger in einem Gemeinwesen werden zu Schlüsselthemen<br />
des philosophischen und theologischen Auseinandersetzungen. Die theologischen Debatten im 18.<br />
und 19. Jahrhundert polarisieren sich im Streit um Recht und Grenzen der modernen Autonomie.<br />
Die politische und ökonomische Doppelrevolution im 19. Jahrhundert radikalisiert nochmals den<br />
theologischen und kirchlichen Streit um die Legitimität der Moderne. Die Vorlesung soll einen<br />
Überblick über bis in die Gegenwart hineinwirkende Reaktionsmuster auf diese<br />
Modernisierungsprozesse geben.<br />
LITERATUR:<br />
Trutz Rendtorff, Artikel: Ethik der Neuzeit, in: TRE Bd X, 481 - 517; Jan Rohls, Geschichte der<br />
Ethik, Tübingen 1991; John Rawls, Geschichte der Moralphilosophie, Frankfurt a. Main 2002<br />
Beginnt am:2. April 2009 (Übung am 7. April 2009)<br />
Zielgruppe:Studierende im Grund- und Hauptstudium
PROF. PLATHOW<br />
V<br />
Mo 15-16 Uhr<br />
ÖInst<br />
»Theologie der Liebe. Augustin –<br />
doctor caritatis«<br />
Liebe – vielstimmig, pluriform, ganzheitlich – wird philosophisch u. theologisch in Geschichte u.<br />
Gegenwart bedacht: u. a. Platon, besonders Augustin: caritas, Luther: die am Kreuz geborene<br />
Liebe des Kreuzes, Papst Benedict XVI.: Deus caritas est, u. a. (eros, agape, philia). Von bibl.theol.<br />
Verständnis her wird Liebe dann systematisch-theologisch reflektiert: Gott ist Liebe, Liebe<br />
und Zorn, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit; Liebe zu Gott und zum Nächsten, Liebe in Ehe und<br />
Familie, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft (Grundwerte und Gottes Gebot)<br />
LITERATUR:<br />
Platon, Symposium; Augustin, Bekenntnisse u. De doctrina Christiana; A. Nygren, Eros u.<br />
Agape,1955; H. v. Campenhausen, Latein. Kirchenväter; Th. Fuhrer, Augustinus, 2004; Enzyklika:<br />
Deus caritas est; W. Härle, Dogmatik; G. Härle, Lyrik - Liebe - Leidenschaft, 2007; H. Kuhn,<br />
Liebe.Geschichte eines Begriffs, 1975<br />
Beginnt am: 20.04.2009<br />
Zielgruppe: Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1 h<br />
Leistungsnachweis: schriftliches Essay<br />
PD DR. HAIGIS<br />
V<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
NUni HS 4<br />
Kirche der Freiheit in einer<br />
pluralistischen Gesellschaft<br />
Im Sommer 2006 hat der Rat der EKD das »Impuls-« oder »Perspektivpapier« »Kirche der<br />
Freiheit« veröffentlicht. Es enthält - ausgehend von einer Erhebung der aktuellen Daten und<br />
Tendenzen - die Planungsziele für die Entwicklung der evangelischen Kirche in Deutschland für die<br />
nächsten rund 20 Jahre. Inzwischen ist dieses Papier breit rezipiert und diskutiert worden. Die<br />
Vorlesung will ausgehend von einer Vorstellung des Impulspapiers nach den ekklesiologischen<br />
und gesellschaftstheoretischen Überlegungen, die im Hintergrund stehen, fragen und<br />
Perspektiven für das Selbstverständnis der evangelischen Kirche in einer pluralistischen<br />
Gesellschaft aufzeigen.<br />
LITERATUR:<br />
Kirche der Freiheit. Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert (hrsg. v.<br />
Kirchenamt der EKD), Hannover 2006<br />
Beginnt am: 22.04.09<br />
Zielgruppe: Studierende mittlerer und oberer Fachsemester<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein
PD DR. ETZELMÜLLER<br />
V<br />
Di 12-13 Uhr<br />
NUni HS 8<br />
Gottesdienst als Thema ökumenischer Theologie<br />
Allein in Berlin feiern Sonntag für Sonntag über 70 verschiedene Kirchen und Konfessionen<br />
Gottesdienst. Doch der ökumenischen Bewegung fällt es schwer, diese Vielfalt zu verstehen. Auf<br />
Weltebene schwankt die Ökumenische Bewegung zwischen der Suche nach einer Einheitsliturgie<br />
und dem Eingeständnis, dass wir im gottesdienstlichen Leben radikal getrennt seien. Indem die<br />
Vorlesung die biblischen Bezüge zentraler liturgischer Traditionen freilegt, möchte sie zeigen, dass<br />
die Fülle christlicher Gottesdienstformen dadurch untereinander verbunden ist, dass alle<br />
Traditionen die Bibel als entscheidenden Bezugspunkt haben. Doch die biblischen Überlieferungen<br />
konstituieren nicht nur die Einheit, sondern auch die Differenz der Liturgien. Die Vorlesung bietet<br />
einen konfessionskundlichen Überblick über die großen Liturgietraditionen von der Orthodoxie bis<br />
zur Pfingstbewegung und entfaltet ein ökumenetheologisches Konzept, das die biblisch<br />
begründeten Differenzen zwischen den Konfessionen fruchtbar machen möchte. Die Vorlesung<br />
greift Einsichten meiner Habilitationschrift auf, gewährt also Einblick in aktuelle Forschung. Bei<br />
Interesse besteht die Möglichkeit, jeweils im Anschluß an die Vorlesung das Vorgetragene im<br />
kleinen Kreis zu diskutieren.<br />
LITERATUR:<br />
Peter Cornehl, Der Evangelische Gottesdienst. Biblische Kontur und neuzeitliche Wirklichkeit,<br />
Stuttgart 2006.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: nach Interesse<br />
PD DR. MÜHLING<br />
Di 11-13 Uhr<br />
SenS<br />
V Mi 11-12 Uhr<br />
SenS<br />
Repetitorium Dogmatik<br />
Das Repetitorium bespricht die klassischen Loci der Dogmatik und stellt damit eine Hilfe für die<br />
Examensvorbereitung dar. Jedes theologische Thema wird anhand klassischer Texte, bzw. eines<br />
klassischen Entwurfs zum Thema von Arbeitsgruppen bearbeitet und einschließlich von<br />
Lesempfehlungen vorgestellt. Zusätzlich die Begleitlektüre einer Lehrbuchdogmatik und eines<br />
positionellen Enwurfs nach eigener Wahl empfohlen.<br />
LITERATUR:<br />
Wird im Seminar bekannt gegeben<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: ST-PS & ST-HS; Bereitschaft zur Übernahme einer<br />
Seminarpräsentation<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 3-6h
Proseminare<br />
DR. SPRINGHART<br />
PS<br />
Do 14-16 Uhr<br />
Dek<br />
Karl Barths Lehre vom Wort Gottes<br />
Die sog. »Wort-Gottes-Theologie« Karl Barths hat die theologische Landschaft des 20.<br />
Jahrhunderts nachhaltig geprägt und gehört zu den dogmatischen Klassikern. Im Proseminar<br />
werden grundlegende Texte Barths zu seiner Lehre vom Wort Gottes gelesen und diskutiert. Die<br />
TeilnehmerInnen sollen außerdem mit den wesentlichen Arbeitstechniken der Systematischen<br />
Theologie, mit den wichtigsten Hilfmitteln und mit dem argumentativen Umgang mit Texten<br />
vertraut gemacht werden. Zur Vorbereitung auf die erste Sitzung bietet sich der Artikel zu K.<br />
Barth von E. Jüngel an, in: Ch. Axt-Piscalar/J. Ringleben (Hg.), Denker des Christentums,<br />
Tübingen 2004, 285-310 und 319f. (alternativ: die einschlägigen Artikel in TRE oder RGG)<br />
LITERATUR:<br />
Texte von K. Barth werden in der ersten Sitzung genannt. Ergänzend: E. Busch, Karl Barths<br />
Lebenslauf, Gütersloh 1993 (5. Aufl.); ders., Die große Leidenschaft. Einführung in die Theologie<br />
Karl Barths, Gütersloh 1998<br />
Zielgruppe: Studierende der ev. Theologie (Pfarramt und Lehramt)<br />
Anmeldung: Anmeldung bitte bis 26.03.09 per e-mail an heike.springhart@wts.-uniheidelberg.de<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ein halber Arbeitstag<br />
Leistungsnachweis: Proseminararbeit<br />
SCHMIDTKE<br />
PS<br />
Do 18-20 Uhr<br />
ÖInst<br />
Adolf von Harnack: Das Wesen des<br />
Christentums<br />
Die Frage nach dem »Wesen des Christentums« stellt sich der Theologie sachlich seit ihren<br />
Anfängen, in greifbarer Gestalt aber v.a. seit der Aufklärung. Adolf von Harnack (1851-1930), der<br />
als herausragender Repräsentant des sog. Kulturprotestantismus gilt, hielt im Wintersemester<br />
1899/1900 vor rund 600 Hörern aller <strong>Fakultät</strong>en eine Vorlesung über »Das Wesen des<br />
Christentums«, die 1900 nach der stenographischen Aufzeichnung eines Zuhörers veröffentlicht<br />
wurde. Die »Wesensschrift« ist Harnacks populärstes Werk (es ist in der ersten Hälfte des 20. Jh.<br />
das - neben der Bibel - meistverkaufte theologische Buch in Deutschland) und bietet einen<br />
knappen, gut verständlichen Zugang zu seiner Theologie, die als Versuch gelten kann,<br />
Christentum und Moderne zu vermitteln. Im Proseminar soll anhand der Erarbeitung der<br />
»Wesensschrift« in die grundlegenden Arbeitsweisen und Fragestellungen der Systematischen<br />
Theologie eingeführt werden.<br />
LITERATUR:<br />
Adolf von Harnack: Das Wesen des Christentums. Sechzehn Vorlesungen vor Studierenden aller
<strong>Fakultät</strong>en im Wintersemester 1899/1900 an der <strong>Universität</strong> Berlin gehalten von Adolf v. Harnack,<br />
hg.v. Claus-Dieter Osthövener, Tübingen ²2007.<br />
Zielgruppe: Theologiestudierende im Grundstudium<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 2 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein, benoteter Schein (Proseminararbeit)<br />
MAßMANN<br />
PS<br />
Di 16-18 Uhr<br />
KiGa II<br />
Einführung in die Trinitätslehre anhand<br />
von Pannenbergs Theologie<br />
Die Trinitätslehre behandelt den Kern des christlichen Glaubens. Deshalb spielt sie nicht nur z.B.<br />
in kirchengeschichtlichen Entwicklungen eine sehr prominente Rolle, sondern auch in der systematischen<br />
Theologie. Gegenüber dem Verdacht, sie sei etwa zu spekulativ, geht das Proseminar<br />
ihrer biblischen Begründung und theologischen Bedeutung nach. Dabei lassen wir uns von einem<br />
der profiliertesten Theologen der Gegenwart leiten. Damit dieser anspruchsvolle Weg zu Ende<br />
gegangen werden kann, leitet der Kurs dazu an, sich unterwegs das methodische Handwerkszeug<br />
der systematischen Theologie anzueignen.<br />
LITERATUR:<br />
W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 1, Göttingen 1988, 283-364; G. Wenz, Wolfhart<br />
Pannenbergs Systematische Theologie. Ein einführender Bericht, Göttingen 2003; R. Weth (Hg.),<br />
Der lebendige Gott: Auf den Spuren neueren trinitarischen Denkens, Neukirchen 2005; M.<br />
Welker/M. Volf (Hg.), Der lebendige Gott als Trinität: Jürgen Moltmann zum 80. Geburtstag,<br />
Gütersloh 2006.<br />
Zielgruppe: Grundstudium<br />
Anmeldung: Anmeldung bitte vor Semesterbeginn per Email<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 3 h<br />
Leistungsnachweis: benoteter Schein für Proseminararbeit<br />
Haupt-/Oberseminare<br />
PROF. WELKER<br />
S<br />
Di 16-18 Uhr<br />
KiGa I<br />
Anthropologie: Moltmann – Jüngel – Pannenberg<br />
Das Seminar erschließt Beiträge zur Anthropologie in neuerer deutschsprachiger Systematischer<br />
Theologie.<br />
Themen:<br />
• (Moltmann): Der Mensch als Bild Gottes; Der Mensch als Seele und Leib;
• (Jüngel): Der Gott entsprechende Mensch; Der leistungsunfähige Mensch und die<br />
Menschenwürde; Der Tod als Geheimnis des Lebens; Grenzen des Menschseins;<br />
• (Pannenberg): Die Sonderstellung des Menschen; Weltoffenheit und<br />
Gottebenbildlichkeit; Sünde, Freiheit, Entfremdung; Identität und Nichtidentität; Mensch<br />
und Geist.<br />
LITERATUR:<br />
Jürgen Moltmann, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, Gütersloh, 4. Aufl. 1993,<br />
Kapitel IX. und X.; Eberhard Jüngel, Entsprechungen: Gott – Wahrheit – Mensch, Mohr Siebeck<br />
2003 (ausgewählte Beiträge); Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive,<br />
Vandenhoeck 2000 (ausgewählte Kapitel).<br />
PROF. TANNER<br />
S<br />
Di 16-18 Uhr<br />
ÖInst<br />
Geschichte und Normen – Das<br />
Historismusproblem bei Ernst Troeltsch<br />
Die starken Konzepte von »Vernunft« mit »unbedingten« Geltungsansprüchen haben im Zuge der<br />
Historisierung aller Wissensbestände an Überzeugungskraft verloren. Damit wurde auch auf dem<br />
Feld der Ethik die Frage nach der Begründung von Normen verschärft. Der protestantische<br />
Theologe und Religionsphilosoph Ernst Troeltsch hat in seinen Studien zur Geschichtsphilosophie<br />
und zum Historismus die Probleme der »Maßstabbildung« unter den Bedingungen eines<br />
verschärften Pluralismus in der Moderne und die Suchbewegungen nach tragfähigen<br />
Argumentationen jenseits der Alternative »Relativismus« oder »Letztbegründung« analysiert. Im<br />
Seminar sollen die Texte Troeltschs als Leitfaden zur Bearbeitung der Fragestellung dienen.<br />
LITERATUR:<br />
Ernst Troeltsch: Der Historismus und seine Probleme, Tübingen 1922. Kritische Neuausgabe (KGA<br />
16) Tübingen 2008<br />
Zielgruppe:Studierende im Hauptstudium<br />
PROF. NÜSSEL/PROF. TANNER<br />
S<br />
Do 16-18 Uhr<br />
ÖInst<br />
Bioethik – ein neues Feld ökumenischer<br />
Kontroversen<br />
Die beiden großen christlichen Kirchen haben sich bei Stellungnahmen im politischen Raum immer<br />
um ein ökumenisch-gemeinsames Vorgehen bemüht. Schon in den Auseinandersetzungen um die<br />
Regelung des Schwangerschaftsabbruchs zeigten sich allerdings Differenzen im Umgang mit den<br />
Konfliktlagen. Diese Differenzen haben sich verstärkt in den jüngsten Diskussionen um die<br />
Regelungen für den Schutz der frühesten Formen menschlichen Lebens, etwa auf dem Gebiet der<br />
Stammzellforschung. Im Seminar sollen die Konfliktlinien analysiert und mögliche tieferliegende<br />
theologische und konzeptionelle Differenzen herausgearbeitet werden.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium
PROF. PLATHOW<br />
S<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
ÖInst<br />
Die Wirklichkeit der Kirche (evang., röm.kath.,<br />
orth., freikirchl.)<br />
Was konstituiert und kennzeichnet die Kirche?, Welche bibl. Modelllbegriffe sind adäquat für die<br />
Kirche als geglaubte und sichtbare, als theol. und soziolog. Größe?, Wie ist das Verhältnis von<br />
Ämtern und Gemeinde?, Was ist der Auftrag der Kirche?, Was sind konfessionskundlichökumenische<br />
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Kirchen (Luther,<br />
Bonhoeffer, Vatikanum II, usw.)? Welche kirchenreformerischen Ansätze gibt es?, Welche<br />
ökumenischen Zielvorstellungen? Die Frage nach Wesen und Gestalt der Kirchen im theol. und<br />
soziolog. Verständnis wird in den konfessionskundlich-ökumenischen Horizonz gestellt (evang.,<br />
röm.-kath., orth., freikirchl.); im biblisch-theol. Begründungszusammenhang werden die<br />
genannten und weitere Fragen ekklesiolog., kirchentheoret. und kirchenkundl. Antworten<br />
zugeführt.<br />
LITERATUR:<br />
BSELK V, VII, VIII, XIV, XXVIII; M. Luther, von Konzilien u. Kirchen; Barmer Theol. Erklärung,<br />
1934; Leuenberger Kirchengemeinschaft (GEKE), Die Kirche Jesu Christi; Dogmat. Konstitution<br />
'Lumen gentium', Ökumenismusdekret; A. Basdekis (Hg.), Othodoxe Kirchen u. ökumenische<br />
Bewegung, 2006; E. Geldbach, Evang. Freikirchen, 1985; D. Bonhoeffer, Sanctorum communio,<br />
1930; U. Kühn, Kirche, 1980; M. Friedrich, Kirche, 2008<br />
Beginnt am: 20.04.2009<br />
Zielgruppe: mittlere u. höhere Semester<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: schiftl. Referat; Seminararbeit<br />
PROF. DRECHSEL/PD DR. MÜHLING<br />
S<br />
PROF. HÜBNER<br />
S<br />
Mo 14-16 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Mi 18-20 Uhr<br />
KiGa I<br />
Glaube und Zweifel – Systematischtheologische<br />
und Praktisch-Theol. Aspekte<br />
Neue Schöpfungstheologien<br />
Was bedeutet »Schöpfung«? Und was veranlaßt dazu, von »Schöpfung« zu sprechen? Religiöse<br />
Grundorientierungen wie der christliche Glaube prägen das Weltverständnis, in die theologische<br />
Reflexion gehen aber auch zeitgenössische Weltbilder ein. Die aktuelle weltanschauliche<br />
Diskussion um Kosmologie und Evolutionstheorie zeigt dieses Wechselverhältnis. Dem soll an<br />
Hand einschlägiger Texte nachgegangen werden, um im Diskurs Orientierung zu finden und<br />
weitergeben zu können.
LITERATUR:<br />
Klaiber, Walter: Schöpfung. Urgeschichte und Gegenwart. 2005; Welker, Michael: Schöpfung und<br />
Wirklichkeit. 1995; Körtner, Ulrich H.J.; Popp, Marianne (Hg.): Schöpfung und Evolution -<br />
zwischen Sein und Design. 2007<br />
Zielgruppe: Alle Studiengänge, Hörer aller <strong>Fakultät</strong>en<br />
Teilnahmevorausetzungen: <strong>Theologische</strong> / philosophische Vorkenntnisse, Interesse an<br />
interdisziplinären Fragestellungen<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h<br />
Leistungsnachweis: Referat, Seminararbeit<br />
PROF. TANNER<br />
S<br />
Fr 11-13 Uhr<br />
KiGa I<br />
Toleranz – zum historischen Profil des Begriffs<br />
(EPG 2)<br />
Religionen werden heute verstärkt wieder wahrgenommen als eine Quelle für Gewalt und<br />
politische Konflikte. In der Christentumsgeschichte gibt es auf dem Hintergrund des Wissens um<br />
die Gewaltpotentiale der eigenen Tradition zugleich auch eine breite Tradition der Reflexion über<br />
Konzepte der Toleranz und ihre möglichen Begründungen. Die Arbeit im Seminar soll der Analyse<br />
der verschiedenen Konzepte dienen. Den Leitfaden dazu wird die Publikation von Rainer Frost<br />
»Toleranz im Konflikt« (Frankfurt 2003) bilden.<br />
LITERATUR:<br />
Rainer Frost, Toleranz im Konflikt, Frankfurt a. M. 2003<br />
Zielgruppe: Studierende im Grund- und Hauptstudium<br />
PD DR. LÄMMLIN/DR. VÖGELE<br />
S<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
PD DR. ETZELMÜLLER<br />
S<br />
Mo 9-11 Uhr<br />
ÖInst<br />
Glaube zwischen Vernunft und Gefühl –<br />
Symbole und Rituale in der Zivilgesellschaft<br />
Parusie, Gericht-Auferstehung, Ewiges Leben.<br />
Themenfelder christlicher Eschatologie<br />
»Als ich in dem einzigen Gespräch, das ich - als junger Physiker - mit Karl Barth geführt habe, ihn<br />
fragte, ob ich nach seiner Ansicht weiter Physik treiben dürfte, da ich eingesehen habe, dass die<br />
Atombombe eine faktisch unausweichliche Folge der Physik ist, sagte er: º... Herr v. Weizsäcker,<br />
wenn Sie das glauben, was alle Christen bekennen und fast keiner wirklich glaubt, nämlich dass<br />
Christus wiederkommt, dann dürfen und sollen Sie weiter Physik machen; sonst nicht¿. Barth war<br />
für mich alles andere als ein Kirchenvater, aber diese Antwort ging mir in die Knochen« (Carl<br />
Friedrich von Weizsäcker). Von Weizsäcker leuchtete diese Antwort ein. Denn »eine Kirche, die<br />
nicht mehr, um die alten Worte noch einmal zu gebrauchen, auf die Wiederkunft des Herrn
wartet, hat den Kern ihres Wesens, ihrer Kraft aufgegeben«. Aber es erschien ihm zugleich<br />
fragwürdig, ob man so etwas glauben könne: »Weiß man als moderner Mensch überhaupt, was<br />
man damit meint?« Diese Erinnerungen und Fragen von Weizsäckers markieren das<br />
Erkenntnisinteresse des angebotenen Seminars. Verschiedene Themenfelder der Eschatologie<br />
sollen daraufhin befragt werden, was mit der Rede vom Kommen Christi, vom Gericht und vom<br />
ewigen Leben eigentlich gemeint ist, inwiefern man eine solche Rede heute noch verstehen und<br />
wie die inhaltlich geprägte christliche Erwartungshaltung Handeln in der Gegenwart orientieren<br />
kann. Ausgangspunkt sind die Enzyklika Spe salvi von Papst Benedikt XVI. und die Münsteraner<br />
Eschatologie-Vorlesung von Karl Barth aus dem Wintersemester 1925/26 (ein relativ unbekannter,<br />
aber lesenswerter Text von Karl Barth, der auch als Einführung in dessen Theologie dienen kann).<br />
LITERATUR:<br />
Papst Benedikt XVI., Enzyklika Spe salvi (diverse Ausgaben, u.a.;<br />
http://www.dbk.de/imperia/md/content/schriften/dbk2.vas/ve_179.pdf); Karl Barth, Unterricht in<br />
der christlichen Religion. Dritter Band: Die Lehre von der Versöhnung/Die Lehre von der Erlösung,<br />
Zürich 2003, 378-493.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Besuch eines Proseminars Systematische Theologie<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4 h<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
PD DR. FREUND<br />
S<br />
Do 16-18 Uhr<br />
KiGa II<br />
Theologie im Umbruch - Texte zur<br />
Theologie der Aufklärungszeit<br />
Theologie der Gegenwart steht im Wirkungsfeld der epochalen Veränderungen, die sich im<br />
philosophischen und theologischen Denken der Aufklärungszeit vollzogen haben. Anhand<br />
ausgewählter Texte vermittelt das Seminar einen exemplarischen Einblick in das Selbstverständnis<br />
der deutschen Aufklärung sowie in die Rezeption und Kritik der spätorthodoxen Dogmantik durch<br />
Neologie und Religionsapologetik. Abschluss und Ausblick bilden Auszüge aus dem »Wolfenbüttler<br />
Fragmentensteit«, in dem Lessing die Theologie seiner Zeit auf den Prüfstand gezwungen hat.<br />
LITERATUR:<br />
K. Aner, Die Theologie der Lessingzeit. Halle 1929; W. Philipp, Das Werden der Aufklärung in<br />
theologiegeschichtlicher Sicht. Göttingen 1957; G. Freund, Theologie im Widerspruch. Die<br />
Lessing-Goeze-Kontroverse. Stuttgart 1989<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Proseminar in syst. Theologie<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Benoteter Schein für Hauptseminararbeit
PROF. DUCHROW/ PROF.<br />
VASSILIADIS/ PROF. KALAITZIDIS<br />
S<br />
28.-30.05.2009<br />
Thessaloniki (Griechenland)<br />
Biblical Liberation Theology, Patristic<br />
Theology and the Ambivalence of<br />
Modernity in Orthodox and Ecumentical<br />
Perspective (post-graduate Oberseminar)<br />
Die gegenwärtigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Krisen sind letztlich eine Krise der<br />
westlichen Moderne. Für einen weltweiten Paradigmenwechsel ist deshalb ein Lernen von nichtwestlichen<br />
Kulturen und Glaubensformen notwendig. Grundlage bleibt die kontextuell gelesene<br />
Bibel, aber auch die kontextuell interpretierte orthodoxe Patristik und Spiritualität bietet<br />
überraschende Einsichten. Das Angebot der <strong>Theologische</strong>n <strong>Fakultät</strong> der Aristoteles-<strong>Universität</strong> in<br />
Thessaloniki, ein gemeinsames Blockseminar mit griechischen und deutschen fortgeschrittenen<br />
Studierenden zu organisieren, ist deshalb eine besondere Chance.<br />
LITERATUR:<br />
Hinkelammert, Franz, 2007, Das Subjekt und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten<br />
Subjekts, Edition ITP-Kompass, Münster. Bergmann, Sigurd, 1995, Geist, der Natur befreit - Die<br />
trinitarische Kosmologie Gregors von Nazianz im Horizont einer ökologischen Theologie der<br />
Befreiung, Grünewald, Mainz. Pixley, Jorge, 1997, Heilsgeschichte von unten. Eine Geschichte<br />
Israels aus der Sicht der Armen (1220 v. Chr. - 135 n. Chr.), Peter Athmann, Nürnberg.<br />
Beginnt am: 28.-30. Mai 2009 in Thessaloniki (Anreise 27.5., Abreise 31.5.)<br />
Zielgruppe: fortgeschrittene Studierende<br />
Teilnahmevorausetzungen: Englische Sprachkenntnisse, Bereitschaft, 30% der Flugkosten<br />
nach Thessaloniki selbst zu tragen (z.Zt. mit Olympic 50-60€, da der Studiengebührenfonds<br />
70%=ca. 140 € trägt). Der Aufenthalt wird von der Orthodoxen Akademie Volos finanziert.<br />
Anmeldung: Da die Preise des Fluges steigen, je später die Buchung, sollten die, die eine<br />
gemeinsame Frühbuchung wünschen, sich bis zum 15. Februar anmelden. Danach ist weiter eine<br />
individuelle Buchung möglich.<br />
Leistungsnachweis: schriftliche Arbeit<br />
PROF. NÜSSEL ET AL.<br />
S<br />
25.-28.06.2009<br />
ÖInst<br />
The triune God - a God of dialogue and peace?<br />
Das Blockseminar geht der Frage nach, welche Potentiale die christliche Vorstellung vom<br />
dreieinen Gott für eine Friedensethik und für das interreligiöse Gespräch enthält. Es soll der<br />
ökumenischen Begegnung Studierender aus unterschiedlichen Kontexten dienen. Daher werden<br />
Studierende unterschiedlicher Konfession aus England und aus anderen deutschen <strong>Universität</strong>en<br />
eingeladen. Zwei Hauptreferenten werden Vorträge zum Thema halten, die gemeinsam diskutiert<br />
und in mehreren workshops durch Textarbeit vertieft werden. Am Sonntag, 28.6. ist eine<br />
gemeinsame Abschlussexkursion nach Speyer geplant.<br />
LITERATUR:<br />
wird bei Anmeldung bekannt gegeben
Zielgruppe: Studierende mit ökumenischen Interessen<br />
Teilnahmevorausetzungen: Englischkenntnisse<br />
Anmeldung: bis 15. April 2009 an sabine.huffman@oek.uni-heidelberg.de<br />
Leistungsnachweis: benoteter Hauptseminarschein für Hauptseminararbeit<br />
PROF. NÜSSEL<br />
OS<br />
Do 20-22 Uhr<br />
ÖInst<br />
Zur Aktualität der Erbsündenlehre<br />
Die Lehre von der Erbsünde gehört zusammen mit der Rechtfertigungslehre zu den Kernthemen<br />
reformatorischer und protestantischer Lehrbildung. Schon in der Aufklärungszeit ist sie jedoch<br />
grundlegender Kritik unterzogen worden. Im Oberseminar soll der Frage nachgegangen werden,<br />
wie sich die Fragehorizonte im Blick auf die Erbsündenlehre verschoben haben und welche<br />
spezifischen Herausforderungen sich in der gegenwärtigen Diskussionslage identifizieren lassen.<br />
Auf dieser Basis sollen neue Entwürfe gemeinsam studiert und diskutiert werden, die die<br />
Aktualität der Erbsündenlehre zur Geltung zu bringen suchen.<br />
LITERATUR:<br />
W. Pannenberg, Systematische Theologie, Bd. 2, Göttingen 1990; I. U. Dalferth, Das Böse,<br />
Tübingen 2008.<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Systematisch-theologisches Pro- und Hauptseminar<br />
Anmeldung: per email an sabine.schmidtke@oek.uni-heidelberg.de<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4-5 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein aufgrund regelmäßiger Teilnahme<br />
Übungen<br />
DR. SPRINGHART<br />
Ü<br />
08./09.05.+05./06.06.<br />
KiGa II<br />
Bedenken, dass wir sterben müssen…<br />
Die aktuellen Debatten um das Sterben kreisen häufig um ethische oder praktisch-theologische<br />
Fragen des Umgangs mit dem Sterben. Eine dogmatische Reflexion darüber, wie wir Sterben, Tod<br />
und Endlichkeit verstehen wollen, kommt dabei nicht selten zu kurz. Das Blockseminar versucht,<br />
sich einer solchen Bestimmung des Sterbens zu nähern. Je nach Interesse der TeilnehmerInnen<br />
wäre auch vorstellbar, die Seminartage durch einen Gang über den <strong>Heidelberg</strong>er Bergfriedhof zu<br />
ergänzen.<br />
LITERATUR:<br />
E. Jüngel, Tod, Stuttgart 1971; A. Kruse, Das letzte Lebensjahr, Stuttgart 2007; H. Luther, Tod<br />
und Praxis, in: ZThK, Vol 88 (1991), 407-426; D. Sölle, Mystik des Todes, Stuttgart 2003
Beginnt am: Vorbesprechung am 02.04.2009, 18 Uhr s. t. | KiGa II<br />
Anmeldung: bitte per e-mail an heike.springhart@wts.uni-heidelberg.de<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
KLEIN<br />
Ü<br />
Di 9-11 Uhr<br />
KiGa II<br />
Grundkurs Analytische Religionsphilosophie<br />
An ausgewählten Positionen werden Sinn und Funktion von Religionsphilosophie vorgestellt und<br />
diskutiert. Der Schwerpunkt liegt in diesem Grundkurs auf analytischen und postanalytischen<br />
Perspektiven. Dabei werden u.a. Entwürfe der von L. Wittgenstein beeinflussten Religionsphilosophie,<br />
der Reformed Epistemology und des Theismus behandelt.<br />
LITERATUR:<br />
W. Jaeschke, Art. Religionsphilosophie, HWP 8 (1992), 748-763; D.Z. Philipps et al. (eds.),<br />
Philosophy of Religion in the 21st Century, Basingstoke 2001; Ch. Jäger (ed.), Analytische<br />
Religionsphilosophie, Paderborn 1998.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie und Philosophie<br />
Teilnahmevorausetzungen: Proseminar in Systematischer Theologie oder Philosophie<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
NOORDVELD<br />
Ü<br />
Di 9-11 Uhr<br />
ÖInst<br />
Einführung in das Denken J. Calvins.<br />
Lektüre ausgewählter Texte<br />
Im 500. Geburtsjahr Johannes Calvins (1509-1564) bietet diese Übung eine Einführung in das<br />
theologische Denken des Genfer Reformators. Anhand ausgewählter Primär- und Sekundärquellen<br />
werden wir uns mit zentralen Themen seiner Theologie, wie z.B. seiner Christologie, dem<br />
Zusammenhang von Rechtfertigung und Heiligung, der Bedeutung der doppelten<br />
Prädestinationslehre und auch seiner Abendmahlslehre, beschäftigen. Ziel der Übung ist es, die<br />
seit Max Weber und Stefan Zweig vorherrschende, negative Meinung über diesen reformierten<br />
Theologen zu überprüfen und vielleicht sogar ein wenig zu relativieren.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h Vorbereitung<br />
DR. BRUNN<br />
Ü<br />
Di 11-13 Uhr<br />
KiGa I<br />
Einführung in die Ethik mit klassischen<br />
Texten (EPG 1)<br />
Zu den Denkern, die maßgeblich die ethische Theoriebildung bis heute geprägt haben, gehören<br />
Aristoteles (Tugendethik), Kant (Pflichtenethik), Mill (Güterethik/Utilitarismus) und Luther<br />
(christliche Liebesethik). Ihre Positionen werfen aus unterschiedlichen Perspektiven Licht auf das
Ganze der Ethik und versuchen die Grundfrage der Ethik zu beantworten, die Kant in die Worte<br />
gefasst hat: »Was sollen wir tun?« An Hand ausgewählter Texte sollen diese vier Perspektiven<br />
erarbeitet werden. Mit Aristoteles tritt die Frage nach den Tugenden und damit nach den<br />
verschiedenen Handlungsweisen in den Vordergrund. Mit Kant suchen wir nach dem ethischen<br />
Minimum, also den Pflichten, die für jeden Menschen unbedingt gelten müssen. Mit Mill und<br />
anderen Utilitaristen fällt der Blick auf die Ziele, denen ethisches Handeln zu dienen hat und die<br />
von ihnen als den größten gesellschaftlichen Nutzen bestimmt werden. An Hand des Denkens von<br />
Luther wird schließlich deutlich, dass sich Ethik nicht voraussetzungslos betreiben lässt, sondern<br />
dass sie von weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen geprägt ist und getragen wird. Dies<br />
zeigt sich bei Luther als christliche Liebesethik. Ziel der Lehrveranstaltung ist es in erster Linie,<br />
Handwerkszeug für die Beschäftigung mit ethischen Fragen zu vermitteln. Das bedeutet, mit den<br />
in der Ethik üblichen Begrifflichkeiten vertraut zu werden, Arbeitsweisen der Ethik einzuüben,<br />
unterschiedliche Ansätze und Typen der Ethik an Hand von klassischen Texten kennen zu lernen<br />
sowie über die Voraussetzungen von Ethik nachzudenken.<br />
LITERATUR:<br />
Andersen, Svend: Einführung in die Ethik, Berlin/New York 2005 (2. Auflage)<br />
Zielgruppe: Lehramtstudierende, alle Interessierte<br />
Anmeldung: per Mail (frank-martin.brunn@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h Vorbereitung<br />
Leistungsnachweis: Protokoll + Klausur oder ausgearbeitetes Referat<br />
KLEIN<br />
Ü<br />
Di 18-20 Uhr<br />
ÖInst<br />
Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit<br />
(EPG 1)<br />
J. Rawls »Theorie der Gerechtigkeit« (1971) stellt eines der bedeutendsten Werke der Politischen<br />
Philosophie des 20. Jahrhunderts dar. Die darin enthaltene Erneuerung der Theorie des<br />
Gesellschaftsvertrags aus dem 17. und 18. Jh. und Rawls eigene Revision der Theorie in<br />
»Gerechtigkeit als Fairness« (2001) und »Das Recht der Völker« (2001) wird ebenso Thema sein<br />
wie eine kritische Diskussion seines Ansatzes, das politische Handeln vorrangig an ethische<br />
Normen zu binden.<br />
LITERATUR:<br />
J. Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit (Klassiker Auslegen 15), hg.v. O. Höffe, Berlin 1998; W.<br />
Kersting, John Rawls zur Einführung,Hamburg 1993; G. Schaal/F. Heidenreich, Theorien der<br />
Gerechtigkeit. Eine Einführung, Opladen 2008.<br />
Zielgruppe: Studierende des EPG, der Philosophie und der Theologie<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: EPG-Schein
DR. BRUNN / KOLB<br />
Ü<br />
Di 16-18 Uhr<br />
ISSW<br />
Sportethik und Geschlechterdifferenz<br />
(EPG 2)<br />
Sport ist ein beliebter Produzent dramatischer Bilder und Symbole, die Politik und Wirtschaft<br />
gerne zur Illustration ihrer Botschaften übernehmen. Doch wie steht es um die Gleichheit der<br />
Geschlechter im Sport? Wenn von »der Fußball-Nationalmannschaft« die Rede ist, geht es um die<br />
deutsche Fußballnationalmanschaft der Männer, obwohl die deutsche Nationalmanschaft der<br />
Frauen im Fußball die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ähnlich ist es, wenn von »der<br />
Bundesliga« gesprochen wird. Einige Sportarten haben sexistische Bekleidungsregeln (z.B.<br />
Beachvolleyball). Sind an vielen Stellen in unserer Gesellschaft Institutionen eingerichtet, die auf<br />
die Gleichbehandlung der Geschlechter in semantischer und pragmatischer Hinsicht achten, so<br />
scheint diese Aufgabe den Sport noch nicht recht erreicht zu haben.<br />
Die Übung will am Phänomen des Sports in die Methodik der Gender Studies einführen, Themen<br />
der Gender-Ethik im Sport herausarbeiten und Konsequenzen für die Pädagogik aufzeigen. Dabei<br />
soll der Sport als beispielhaftes Handlungsfeld begriffen werden, an dem eine allgemeine<br />
Kompetenz in Fragen der Gender-Ethik erlernt werden kann.<br />
LITERATUR:<br />
Hartmann-Tews, Ilse/ Rulofs, Bettina (Hg.): Handbuch Sport und Geschlecht (Beiträge zur Lehre<br />
und Forschung im Sport 158), Schorndorf 2006.<br />
Zielgruppe: Lehramtstudierende, alle Interessierte<br />
Anmeldung: per Mail (frank-martin.brunn@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Teilnahmevorausetzungen: ethische Grundkenntnisse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h Vorbereitung<br />
Leistungsnachweis: Protokoll + ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit<br />
PROF. NÜSSEL/SCHMIDTKE/WAGNER<br />
Termine s. u.<br />
ÖInst<br />
Ü<br />
Exkursion 1.-8.9.2009<br />
Frühes Christentum und Ökumene<br />
in Rom (mit Exkursion)<br />
Während der Exkursion sollen Schauplätze und Themen der frühen Christenheit und Ökumene<br />
»vor Ort« erkundet werden. Zur Vorbereitung dient eine Blockveranstaltung, in dessen Rahmen<br />
die Teilnehmenden Referate zur Thematik halten und hören werden. Geplante Programmpunkte<br />
während der Exkursion sind u.a.: Besuch der Vatikanischen Museen, Führungen im Petersdom<br />
und in den Katakomben, Gespräche in der deutschen Auslandsgemeine und im Vatikan. Die<br />
Kosten für Studierende werden sich vermutlich auf ca. 220 € belaufen (sollten finanzielle Gründe<br />
eine Teilnahme an der Exkursion unmöglich machen, wenden Sie sich bitte an genannte Kontaktperson).<br />
LITERATUR:<br />
wird in der konstituierenden Sitzung bekannt gegeben
Beginnt am: 17.04.2009, 16:00-18:00 (konstituierendes Treffen), 05./06.06.2009<br />
(Blockveranstaltung)<br />
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 06.04.2009 bei Sabine Schmidtke<br />
(s.schmidtke@oek.uni-heidelberg.de). Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.<br />
KLEIN<br />
BS<br />
15.-16.05.09 und<br />
10.-11.07.09<br />
Die natürliche Gotteserkenntnis des Menschen:<br />
Anthropologie und Epistemologie in J. Calvins<br />
»Instituio Christianae Religionis« (1559) und in<br />
A. Plantigas »Warranted Christian Belief« (2000)<br />
Das Seminar setzt eine vollständige Lektüre der Institutio Calvins und grundlegende Kenntnisse<br />
über sein Denken bereits voraus. Ausgehend von der Besprechung einzelner Textpassagen<br />
werden wir Calvins enge Verbindung von Anthropologie und Gotteslehre zum Ausgangspunkt<br />
nehmen, um deren historischen Kontext (humanistische Menschenbilder) und deren Relevanz für<br />
die gegenwärtige reformierte Epistemologie und Religionsphilosophie zu untersuchen.<br />
LITERATUR:<br />
J. Calvin, Institutio Christianae Religionis, hg.v. M. Freudenberg, Neukirchen-Vluyn 2008; A.<br />
Plantinga, Warranted Christian Belief, New York 2000.<br />
Beginnt am: 15.05.2009<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Kenntnisse über J.Calvin und sein Werk<br />
Anmeldung: Anmeldung zur Planung und Vorbereitung der Kurswochenenden an R. Klein<br />
(rebekka.klein@wts.uni-heidelberg.de).<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Durchführung von 2 Blockkursen an 2<br />
Wochenenden; pro Woche ca 2-3h Vorbereitung; Ausarbeitung Kurzreferat
Religionswissenschaft und<br />
Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft<br />
In der Religionswissenschaft werden theoretische Ansätze und Kenntnisse zum Islam, Hinduismus<br />
und Buddhismus sowie zu neuen religiösen Bewegungen und zur Esoterik vermittelt. In der Interkulturellen<br />
Theologie stehen die Theologie- und Christentumsgeschichte Asiens, Afrikas und Lateinamerikas<br />
sowie Grundfragen der interkulturellen Theologie (Interreligiöser Dialog, Theologie<br />
der Religionen, Mission, kontextuelle Theologien etc.) im Mittelpunkt.<br />
PROF. BERGUNDER<br />
V<br />
Mo 14-16 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Überblickslehrveranstaltung: Einführung in die<br />
Religionswissenschaft und Interkulturelle<br />
Theologie (Missionswissenschaft)<br />
Die Vorlesung führt in Gegenstände und Methoden der Religionswissenschaft und Interkulturellen<br />
Theologie (Missionswissenschaft) ein, wozu u. a. die Diskussion des Religionsbegriffs und des<br />
Verhältnisses von Religionswissenschaft und Theologie gehören. Thematisiert werden auch<br />
konkrete religionswissenschaftliche Zugänge zu Islam, Hinduismus und Buddhismus sowie<br />
zentrale missionswissenschaftliche Problemstellungen der Christentums- und Theologiegeschichte<br />
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, Grundfragen der interkulturellen Theologie und des<br />
interreligiösen Dialogs. Als Ergänzung und Vertiefung zur Vorlesung kann die Lektüreübung<br />
»Grundtexte der Religionswissenschaft und Interkulturellen Theologie (Missionswissenschaft)«<br />
besucht werden. Die Vorlesung wird von einer Beamer-Präsentation begleitet. Für aktuelle<br />
Informationen siehe auch »http://theologie.uni-hd.de/rm/«.<br />
LITERATUR:<br />
K. Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, Darmstadt 2002; H. G. Kippenberg/K. von<br />
Stuckrad, Einführung in die Religionswissenschaft, München 2003; C. Dahling-Sander (Hg.)<br />
Leitfaden ökumenische Missionstheologie, Gütersloh 2003.<br />
Leistungsnachweis:Mündliche Vorlesungsprüfung (Im Studiengang Theologie Prüfung nur als<br />
Überblickslehrveranstaltung bei zusätzlichem Besuch der Lektüreübung »Grundtexte«)<br />
HAUSTEIN<br />
PS<br />
Mi 18-20 Uhr<br />
ÖInst<br />
Einführung in die Religionsgeschichte Afrikas<br />
Die afrikanische Religionsgeschichte bietet ein vielseitiges Spektrum: angefangen vom alten<br />
Ägypten und frühen Christentum über Islam und die sog. »Stammesreligionen« bis hin zu<br />
Kimbanguismus und Pfingstbewegung. Die Erforschung und neuzeitliche Fortschreibung dieser<br />
Religionsgeschichte steht jedoch im Kontext der kolonialen Expansion Europas, die aufgrund der<br />
Quellenlage das historische Wissen über Religionen in Afrika strukturiert. Die Veranstaltung wird<br />
daher nicht nur anhand von ausgewählten Beispielen in die Vielfalt der afrikanischen<br />
Religionsgeschichte einführen, sondern zugleich die Erzeugung religionshistorischen Wissens und
die grundlegenden Theorien und Methoden der allgemeinen Religionsgeschichte kritisch<br />
bedenken. Für aktuelle Informationen siehe auch »http://theologie.uni-hd.de/rm«<br />
LITERATUR:<br />
Chidester, David: Savage Systems. Colonialism and Comparative Religion in Southern Africa.<br />
Charlottesville, VA: Univ. Press of Virginia, 1996 – Glazier, Stephen D. (Hrsg.): Encyclopedia of<br />
African and African-American Religions. New York: Routledge, 2001 – Kippenberg, Hans G.: Die<br />
Entdeckung der Religionsgeschichte. München: Beck, 1997.<br />
Zielgruppe: Studienanfänger/innen, mittlere Semester und alle Interessierte<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Leistungsnachweis: schriftliche Hausarbeit<br />
PROF. BERGUNDER<br />
S<br />
Di 14-16 Uhr<br />
KiGa I<br />
Religiöser Nationalismus im Vergleich.<br />
Theorien und Fallbeispiele<br />
Religionen werden immer wieder zur Legitimierung nationaler Identitäten herangezogen oder<br />
beanspruchen selbst, im Kern Nationalismus zu sein. Hierbei handelt es sich um ein globales<br />
Phänomen, das sich im Nahen Osten genauso wie in Süd- oder Südostasien findet und durch<br />
seine Bezüge zu militanten Bewegungen in den letzten Jahrzehnten auch in der breiteren<br />
Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt hat. In der Forschung ist dieses Phänomen meist als religiöser<br />
Fundamentalismus thematisiert worden. Dies droht aber die Besonderheiten des Zusammenhangs<br />
von Religion und Nation zu verdecken, den deshalb das Seminar thematisieren will, in der<br />
Hoffnung, dadurch neue, geeignetere konzeptionelle Perspektiven für die Religionswissenschaft zu<br />
gewinnen. Für aktuelle Informationen siehe auch »http://theologie.uni-hd.de/rm/«.<br />
LITERATUR:<br />
Zur Einführung: Adrian Hastings: The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and<br />
Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; Mark Juergensmeyer: Religious<br />
Nationalism Confronts the Secular State. New Delhi: Oxford University Press, 1994<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Proseminar<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit (für Theologiestudierende auch Erwerb des Nachweises über<br />
die Beschäftigung mit einer lebenden nicht-christlichen Religion möglich)<br />
HAUSTEIN/SUARSANA<br />
Ü<br />
Termine s. u.<br />
ÖInst<br />
Pfingstliche Theologien<br />
Die weltweite Pfingstbewegung ist zweifellos eine der dynamischsten Erscheinungen des<br />
Christentums der Gegenwart. Sie ist jedoch nicht immer leicht theologisch einzuordnen. Der<br />
großen Vielfalt der pfingstlich/charismatischen Theologie trägt diese Veranstaltung Rechnung,
indem ein breites Spektrum pfingstlicher Theologien – von den ersten dogmatischen Streitigkeiten<br />
der frühen Pfingstbewegung über charismatische Ökumeniker und neo-pentekostale Beiträge bis<br />
hin zu gegenwärtigen Entwürfen liberaler Akademiker – in gemeinsamer Lektüre unter die Lupe<br />
genommen werden sollen. Der Schwerpunkt wird dabei auf Beiträgen in pfingstlicher<br />
Kirchengeschichte, systematischer Theologie und interkultureller Theologie liegen. Für aktuelle<br />
Informationen siehe auch »http://theologie.uni-hd.de/rm«<br />
LITERATUR:<br />
Burgess, Stanley M., van der Maas, Eduard M. (Hrsg.): The New International Dictionary of<br />
Pentecostal and Charismatic Movements. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002.<br />
Beginnt am: Verbindliche Vorbesprechung am 15. April um 14 Uhr. Termine der Sitzungen:<br />
15./16. Mai und 29./30. Mai, jeweils 16-20 und 9-17 Uhr.<br />
Teilnahmevorausetzungen: gute Englischkenntnisse<br />
PROF. BERGUNDER<br />
Ü<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
ÖInst<br />
Grundtexte der Religionswissenschaft<br />
und Interkulturellen Theologie (Missionswissenschaft)<br />
(EPG 2)<br />
Die Veranstaltung erschließt zentrale Problemstellungen der Religionswissenschaft und<br />
Interkulturellen Theologie (Missionswissenschaft). Dazu werden klassische Entwürfe gelesen und<br />
diskutiert. Vor Beginn des Semesters werden der vorläufige Lektüreplan und ggf. aktuelle<br />
Informationen im Internet abrufbar sein (http://theologie.uni-hd.de/rm/).<br />
LITERATUR:<br />
Ein Reader wird zu Beginn der Veranstaltung zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grund- und Hauptstudium<br />
Anmeldung: Nur für diejenigen, die nicht Theologie/Christentum und Kultur oder<br />
Religionswissenschaft studieren, ist eine vorherige schriftliche Anmeldung per Email<br />
(Michael.Bergunder@wts.uni-heidelberg.de) bis zum 30.03.2009 erforderlich, falls sie einen<br />
Schein für für EPG2 erwerben möchten.<br />
Leistungsnachweis: Siehe Vorlesung »Einführung in die Religionswissenschaft und<br />
Interkulturelle Theologie (Missionswissenschaft)«, schriftliche Hausarbeit für EPG2
Philosophie und Religionsphilosophie<br />
PD DR. HARTUNG<br />
V<br />
Mi 8-10 Uhr<br />
NUni HS 5<br />
Einführung in die Religionsphilosophie<br />
Die Vorlesung wird einen Überblick über die Positionen und Konstellationen der<br />
Religionsphilosophie des 19. und 20. Jahrhunderts geben. Die Lehrveranstaltung ist als<br />
Einführung konzipiert, daher bedarf es keiner weiteren Voraussetzung außer der Bereitschaf, sich<br />
mit der Thematik auseinander zu setzen und zu weiterführenden Lektüre anregen zu lassen.<br />
LITERATUR:<br />
Eine Bibliographie zur begleitenden Lektüre wird zu Beginn der Lehrveranstaltung verteilt.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie und Philosophie<br />
PD DR. WLADIKA<br />
V<br />
Do 11-13 Uhr<br />
SGU 1016<br />
Geschichte der Philosophie im Überblick<br />
(Repetitorium)<br />
Diese Lehrveranstaltung soll im Sinne eines Grundkurses einen Überblick über die Geschichte der<br />
Philosophie geben, beginnend mit den ersten Denkern, durch viele große Denker, die griechischen<br />
Klassiker zunächst und auch viele Filiationen spätaqntiker neuplatonischer und sonstiger stoischer<br />
usf. Systembildung, weiter durch früh-, hoch- und spätmittelaterliche riesige Neubildungen und<br />
Synthesen von Glauben und Philosophie, schließlich durch die vielen Revolutionen und Stufen<br />
neuzeitlichen Denkens.<br />
DR. SCHAEDE<br />
Ü<br />
Di 11-13 Uhr<br />
ÖInst<br />
Einführung in die Religionsphilosophie anhand der<br />
Lektüre von Immanuel Kant, die Religion innerhalb<br />
der Grenzen der bloßen Vernunft (EPG 1)<br />
Kants Klassiker der Religionsphilosophie wird in Auszügen gründlich gelesen und interpretiert. Das<br />
wird verknüpft mit einer Schulung in philosophischen Argumentationstechniken und ethischer<br />
Urteilsbildung. Durch Kurzreferate zu Texten des unten genannten Readers wird zugleich ein<br />
Überblick über wichtige Positionen der Religionsphilosophie gegeben. Die Frage wird dann auch<br />
sein: Lässt sich Religion überhaupt philosophisch fassen - und wofür soll das gut sein? Am Ende<br />
der Veranstaltung sollte vor Augen stehen, was Religionsphilosophie leisten kann und will, und wo<br />
sie an Grenzen stößt.<br />
LITERATUR:<br />
Eine Ausgabe der im Titel genannten Schrift Kants.<br />
Es wird zu Beginn der Veranstaltung ein Reader zur Verfügung gestellt.
Zielgruppe: Studierende in den Fächern Theologie und Philosophie; Hörerinnen und Hörer aller<br />
<strong>Fakultät</strong>en, die einen Nachweis im Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudium benötigen<br />
Anmeldung: Erscheinen in der ersten Sitzung wird erwartet!<br />
Teilnahmevorausetzungen: Immatrikulation in eines der oben genannten Fächer<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Je nach Interpretations- und Lesefähigkeit 1-2 h<br />
Leistungsnachweis: Qualifizierter Schein nach mündlicher Prüfung oder ausgearbeitetem<br />
Kurzreferat<br />
HENSCHEN<br />
Ü<br />
Do 18-20 Uhr<br />
Dek<br />
Gerechtigkeitstheorien<br />
Auffassungen darüber, was gerecht und was ungerecht ist, divergieren in der Philosophie bisweilen<br />
erheblich. Utilitaristen glauben, dass eine gerechte Handlung eine solche ist, die den Nutzen<br />
einer Gemeinschaft maximiert. Nach Kant dagegen ist eine Handlung gerecht, wenn sie an sich<br />
gerecht ist und die praktische Vernunft den Willen zu dieser Handlung nötigt. Egalitäre Liberalisten<br />
und Kommunitaristen denken, dass es gerecht ist, wenn der Staat das Aufstellen von Spielautomaten<br />
besteuert, um Opernhäuser zu finanzieren (oder Vermögen besteuert, um Arbeitslose zu<br />
unterstützen). Libertaristen dagegen meinen, dass genau dies ungerecht ist. Libertaristen und<br />
egalitäre Liberalisten glauben, dass Verteilungsgerechtigkeit nichts mit einer Entlohnung tugendhaften<br />
Verhaltens oder moralischer Verdienste zu tun hat. Aristoteles dagegen behauptet, dass<br />
sich eine gerechte Verteilung von Ämtern und Ehren proportional zur Tugend der Beamten und<br />
Geehrten verhält. Das Proseminar soll nicht so etwas wie einen geschichtlichen Überblick über<br />
verschiedene Gerechtigkeitstheorien geben, sondern mit den wichtigsten philosophischen Argumenten<br />
vertraut machen, die verwendet werden, um Auffassungen wie die genannten zu begründen.<br />
LITERATUR:<br />
Aristoteles: Politik. Übers. v. Rolfes, Eugen. Hamburg: Meiner, 1990.; Bentham, Jeremy: An Introduction<br />
to the Principles of Morals and Legislation. New York: Columbia University Press, 1945.;<br />
Hayek, Friedrich A.: The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 2001.;<br />
Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Darmstadt: WBG, 1983.; MacIntyre,<br />
Alasdair: After Virtue. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 21984.; Mill, John Stuart:<br />
Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press, 1998.; Nozick, Robert: Anarchy, State, and Utopia.<br />
Basic Books 1974; Rawls, John: A Theory of Justice. Cambridge, MA: The Belknap Press of HUP,<br />
1971.; Walzer, Michael: Spheres of Justice. Basic Books 1983.<br />
Zielgruppe: Theologie-, Philosophie- und Lehramtsstudierende<br />
Teilnahmevoraussetzungen: gutes Leseverständnis englischer Texte<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3-5h<br />
Leistungsnachweis: 4 kurze essays < 1000 Wörter im Verlauf des Semesters<br />
KLEIN<br />
Ü<br />
� S. 74<br />
Grundkurs Analytische<br />
Religionsphilosophie
PD DR. WLADIKA<br />
BV<br />
24.04./15.05./26.06.<br />
jeweils von 8-16 Uhr<br />
Platon, Politeia<br />
Dieses Seminar soll einen Gesamtberblick über einen der bedeutendsten Texte der Tradition der<br />
Ethik geben. Platons ‑ Politeia entwickelt in einem gßrßen Zusammenhang eine Lehre von den<br />
Teilen der Tugend, der Gemeinschaft und der Seele, definiert auf extrem wirkmächtige Weise vor<br />
allem die Gerechtigkeit, gibt vielfltigste Auskunft in Erziehungs- und Bildungsfragen. Das alles<br />
brauchen wir, um heute in ethicis irgend etwas leisten zu können.<br />
LITERATUR:<br />
Platon, Politeia, in: Sämtliche Werke, bers. F. Schleichermacher, hrsg. K. Hlser, Bd. V,<br />
Frankfurt/M. 1991<br />
Beginnt am: Kostituierende Sitzung: 02.04.09, 10-11 Uhr.<br />
Praktische Theologie<br />
Die Praktische Theologie ist das jüngste Fach im Kanon der Wissenschaftlichen Theologie.<br />
Hier sollen den Studierenden die notwendigen Theorien vermittelt werden, wie der Pfarrberuf<br />
bzw. der Beruf des Religionslehrers in der Praxis umgesetzt werden kann.<br />
Das Fach wird aktuell im Studienbetrieb in die Teildisziplinen Homiletik (Predigtlehre), Liturgik<br />
(Gottesdienstlehre), Poimenik (Seelsorge), Pastoraltheologie (Gemeindeleitung und Amtsausführung),<br />
Kirchentheorie (Gemeindekonzeption und -Arbeit) und Religionspädagogik (Theorien über<br />
den Religionsunterricht) untergliedert.<br />
Vorlesungen<br />
PROF. SCHOBERTH<br />
V<br />
Mi 11-14 Uhr<br />
NUni HS 4<br />
Einführung in die Religionspädagogik<br />
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Themen und Gegenstandsbereiche der<br />
Religionspädagogik: Der Ort der Religionspädagogik im Ganzen der Praktische Theologie wird<br />
erörtert, das spannungsvolle Verhältnis von Religionspädagogik und Katechetik reflektiert und der<br />
religiöse Bildungs- und Erziehungsauftrag an der Schule thematisiert. Besonderes Augenmerk gilt<br />
der Gestalt religiöser Lernprozesse im Religionsunterricht – in der Geschichte (Konzeptionen) wie<br />
auch in der religiösen Gegenwartskultur heute. Zur Vorlesung wird eine 1stündige Übung<br />
angeboten. In der Übung werden die Themen aus der Vorlesung Einführung in die Religionspädagogik<br />
vertieft. Didaktisches Material wird für die Unterrichtsvorbe-reitung erarbeitet und<br />
wichtige religionspädagogische Texte diskutiert.
LITERATUR:<br />
Grethlein, Christian: Religionspädagogik, Berlin u.a.1998. Gutmann, Hans-Martin: Der Herr der<br />
Heerscharen, die Prinzessin der Herzen und der König der Löwen. Religion lehren zwischen<br />
Kirche, Schule und populärer Kultur, Gütersloh 1998. Kunstmann, Joachim: Religionspädagogik.<br />
Eine Einführung, Tübingen 2004. Meyer-Black, Michael: Kleine Geschichte der RP, Gütersloh 2003.<br />
Zielgruppe: Studierende im Grund- und Hauptstudium<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: gemeinsam mit der didaktischen Übung Überblicksveranstaltung Praktische<br />
Theologie – mündliche Prüfung<br />
PROF. LIENHARD<br />
V<br />
Di 11-13 Uhr<br />
NUni HS 1<br />
Die Zukunft der evangelischen Kirche in Europa –<br />
am Beispiel von Deutschland und Frankreich<br />
Seit seinem Erscheinen im Sommer 2006 wird der Text »Kirche der Freiheit« vielfältig<br />
kommentiert. In der Vorlesung wird es zunächst darum gehen ihn zu verstehen. Er wird dann<br />
verglichen mit ähnlichen Überlegungen aus anderen Kontexten. Wir werden auch die wichtigsten<br />
Stellungsnahmen untersuchen, um dann ein Bild für die Zukunft der evangelische Kirche in<br />
Europa zu entwerfen.<br />
LITERATUR:<br />
EVANGELISCHE KIRCHE IN DEUTSCHLAND (Hg.), Kirche der Freiheit. Perspektiven für die<br />
Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert, Hannover 2006. Materialband Diskussion des<br />
Impulspapiers, Hannover 2006, Zukunftskongress der Evangelischen Kirche in Deutschland,<br />
Hannover 2007.<br />
Zielgruppe: Hauptstudium<br />
Leistungsnachweis: Teilnahme und Vorlesungsprüfung<br />
PROF. MÖLLER/PD DR. HEYMEL<br />
V<br />
Fr 11-13 Uhr<br />
NUni HS 4a<br />
Sternstunden der Predigt<br />
Wie Stefan Zweigs Buch »Sternstunden der Menschheit« besonders dichte Augenblicke der<br />
Geschichte anschaulich macht, so sollen in dieser Vorlesung Predigten zu Gehör und zur Analyse<br />
kommen, in denen sich die Kirchengeschichte oder gar die Menschheitsgeschichte verdichtet hat,<br />
wie z.B. die Säulenpredigten des Chrysostomus, die die Stadt Antiochia im 4.Jh. vor der<br />
Zerstörung durchden byzantinischen Kaiser bewahrt haben, oder Augustins Predigt angesichts des<br />
Untergangs von Rom im Jahr 411 oder Luthers Invokavitpredigten von 1522 oder Martin Luther<br />
Kings Predigt von 1970 »I have a dream« usw. usw. Diese Vorlesung kann also ebenso mit<br />
kirchengeschichtlichem wie mit homiletischem Interesse gehört werden. Mündliche Prüfungen<br />
zum Abschluß können auf Wunsch zur Qualifikation abgelegt werden.
LITERATUR:<br />
Wird im Verlauf der Vorlesung genannt.<br />
Beginnt am: 17.04.2009<br />
Zielgruppe: alle Semester und Kontaktsemester<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1-2 h<br />
PD DR. NÜCHTERN<br />
13.-17.07.<br />
10 s. t. - 12 s. t.<br />
BV + 14 c. t. - 18 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Kasualien – Blockvorlesung mit<br />
Seminar- und Übungselementen<br />
Diese Intensivveranstaltung vermittelt einen Überblick über die sog. Kasualien. Neuere<br />
Kasualtheorien werden ebenso behandelt wie liturgische Fragen.<br />
LITERATUR:<br />
Joachim Matthes, Volkskirchliche Amtshandlungen. Lebenszyklus und Lebensgeschichte, in: ders.<br />
(Hg.), Erneuerung der Kirche. Stabilität als Chance Ergebnisse einer Umfrage, Gelnhausen 1975;<br />
Michael Nüchtern, Kirche bei Gelegenheit, PTheute 4, Stuttgart 1991; Volker Drehsen, Die<br />
Heiligung von Lebensgeschichten, in: ders., Wie religionsfähig ist die Volkskirche, Gütersloh 1994,<br />
S. 174 ff ; Eberhard Winkler, Tore zum Leben, Neukirchen 1995; Wilhelm Gräb,<br />
Lebensgeschichten – Lebensentwürfe – Sinndeutungen. Eine praktische Theologie gelebter<br />
Religion, Gütersloh 1998, bes. S. 172 ff; Kristian Fechtner, Kirche von Fall zu Fall. Kasualpraxis in<br />
der Gegenwart – eine Orientierung, Gütersloh 2003, Christian Albrecht, Kasualtheologie, Tübingen<br />
2006, Christian Grethlein, Grundinformation Kasualien. Kommunikation des Evangeliums an<br />
Übergängen im Leben, Göttingen 2007, Lutz Friedrichs, Kasualpraxis in der Spätmoderne, Leipzig<br />
2008, Michael Nüchtern, Kirche evangelisch gestalten, Münster 2008, Ulrike Wagner-Rau,<br />
Segensraum. Kasualpraxis in der modernen Gesellschaft, PTheute 50, 2. neubearbeitete Auflage<br />
Stuttgart 2008,<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie höheren Semesters<br />
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung per Mail bis 29.6.09<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 90 Minuten pro Tag<br />
Leistungsnachweis: Ja<br />
Proseminare<br />
PROF. LIENHARD<br />
PS<br />
Mi 9-11 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Homiletisches Proseminar: Einführung in<br />
die Predigttheorie<br />
Wir werden die Kunst der Predigtlektüre uns aneignen und parallel dazu das jüngste homiletische<br />
Lehrbuch bearbeiten.
LITERATUR:<br />
Albrecht Grözinger, Homiletik, Gütersloh, 2008.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Lesen der jeweils angegebenen Texte<br />
Leistungsnachweis: Proseminararbeit<br />
Zielgruppe: Grundstudium<br />
DR. KERNER<br />
PS<br />
Di 11-13 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Religionspädagogisches Proseminar<br />
Das Proseminar »Einführung in die Religionspädagogik« will religionspädagogische Grundlagen<br />
vermitteln. Beschäftigen werden wir uns mit Rahmenbedingungen und Bedingungsfaktoren<br />
religiöser Bildung im Allgemeinen wie schulischen Religionsunterrichts im Besonderen. Themen<br />
werden u.a. sein: die rechtlichen Bedingungen des Religionsunterrichts in der BRD, die<br />
einschlägigen religionspädagogischen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts, die Rolle des Lehrers/<br />
der Lehrerin, Situation und religiöse Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus<br />
sollen auch erste Schritte der Unterrichtsvorbereitung erprobt werden.<br />
LITERATUR:<br />
Joachim Kunstmann: Religionspädagogik. Eine Einführung, Tübingen/ Basel 2004.<br />
Zielgruppe: Studienanfänger (insbesondere Lehramtsstudierende)<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Leistungsnachweis: benoteter Schein für schriftliche Hausarbeiten während des Semesters<br />
PROF. SCHOBERTH/<br />
DR. KROCHMALNIK<br />
PS<br />
Di 16-18 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Religionspädagogisches Proseminar: Der<br />
Lehrer – traditionelles und modernes Bild des<br />
Religionspädagogen<br />
Das (interreligiöse) religionspädagogische Proseminar wird gemeinsam mit Prof. Dr. D.<br />
Krochmalnik von der Hochschule für Jüdische Studien in <strong>Heidelberg</strong> veranstaltet und geht den<br />
Grundfragen des religiösen Lernens nach. Welche Rolle den Lehrenden im religiösen Lernen<br />
zukommt soll dabei besonders thematisiert werden. Dazu werden das traditionelle und auch das<br />
moderne Bild des Lehrers befragt. Als interdisziplinäres Proseminar führt es auch ein in die<br />
Grundlagen des christlichen, jüdischen und muslimischen Lehrens und Lernens.<br />
LITERATUR:<br />
wird im Seminar bekanntgegeben<br />
Zielgruppe: Lehramt; Pfarramt<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3-4 h<br />
Leistungsnachweis: Proseminarschein für Religionspädagogik
Haupt-/Oberseminare<br />
PROF. SCHWIER<br />
S<br />
Di 18-21 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Homiletisches Seminar: Ostern predigen<br />
Hier werden die Wege zur Predigt erkundet und reflektiert, homiletische Theorien kennen gelernt<br />
und Predigtübungen im Seminar ausprobiert. Dies geschieht anhand von NT-Texten über die<br />
Auferstehung Jesu (daher ist die gleichzeitige Teilnahme am exeget. Seminar sehr empfohlen!).<br />
Erwartet wird von den Teilnehmenden neben der gründlichen Vorbereitung der Sitzungen die<br />
Bereitschaft zur theologischen und existentiellen Auseinandersetzung mit Bibeltexten, zur Suche<br />
nach kreativen Formen und verständlicher Sprache und zum regelmäßigen Predigthören (samt<br />
Feedback). Am Ende steht die eigene Erarbeitung einer Homiletischen Seminararbeit.<br />
Besonderheiten im Seminar sind neben der Verbindung zur Exegese die Möglichkeit, eine eigene<br />
Predigt im Gottesdienst zu halten und das Angebot zu einem Seminartag (voraussichtlich am<br />
Don., 25.6., 15-20h; Freit., 26.6., 9-13h) mit einem Theaterregisseur, der das Predigen noch<br />
einmal aus einer fremden Perspektive (Dramaturgie, Inszenierung, Aufführung) erschließt und<br />
einübt.<br />
LITERATUR:<br />
W. Engemann: Einführung in die Homiletik, 2002, 163-421; A. Grözinger: Homiletik, 2008.<br />
Zielgruppe: Studierende (Pfarramt) im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Homilet. PS (bzw. PT-Grundkurs) und exeget. PS<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
PROF. SCHOBERTH<br />
S<br />
Di 18-20 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Der Kleine Katechismus im Religionsunterricht<br />
Der Kleine Katechismus Martin Luthers zeigt eine spezifische Lehr- und Lernpraxis auf, in der an<br />
grundlegenden elementaren theologischen Fragestellungen gearbeitet wird. Als theologisches<br />
Summarium sind hier die für das Glauben-lernen wichtigsten Stücke aufgenommen, die auch für<br />
gegenwärtige religiöse Bildungsprozesse unerläßlich sind. Insofern thematisiert das Seminar<br />
angeleitet vom Kleinen Katechismus »Theologie im Religionsunterricht« und sucht nach der<br />
Ausgestaltung von Lernwegen in der Sekundarstufe I und II. Das Seminar bereitet auf die<br />
selbständige Unterrichtsvorbereitung vor.<br />
LITERATUR:<br />
wird im Seminar bekanntgegeben<br />
Zielgruppe: Lehramt; Pfarramt<br />
Teilnahmevorausetzungen: Religionspädagogisches Proseminar oder Grundkurs<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3-4 h
Leistungsnachweis: Fachdidaktischer Seminarschein<br />
PD DR. NEIJENHUIS<br />
S<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
Dek<br />
Glocken in Theorie und Praxis<br />
Glocken gehören zur Kirche und zum Ausdruck des Glaubens selbstverständlich dazu. Aber auch<br />
im weltlichen Bereich haben Glocken Funktion und Bedeutung. Im Seminar sollen diese<br />
Selbstverständlichkeiten mit Inhalt gefüllt werden: Glockengestalt, Glockenklang,<br />
Glockengebrauch, kirchliche und staatliche Gesetzgebung zum Glockeneinsatz etc. Es werden<br />
Glockentürme bestiegen, eine Glockengießerei aufgesucht, Klangbeispiele gehört, Literatur<br />
gelesen. Theologisch werden die Sinnzuschreibungen der Glocke und der mit ihr verbundenen<br />
Läuteordungen untersucht; der Glockenklang wird liturgisch als nonverbale Sprache des<br />
Gottesdienstes gewürdigt.<br />
LITERATUR:<br />
Kurt Kramer: Die Glocke. Eine Kulturgeschichte, Ostfildern 2007; Walter Reindell: Die Glocken der<br />
Kirche, in: Leiturgia 4, 1961, 858-886.<br />
Zielgruppe: Theologiestudierende und für alle Interessierten<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
PROF. MÖLLER<br />
S<br />
Di 9-11 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Kirchenpädagogisches Seminar: »Die<br />
Heiliggeistkirche in <strong>Heidelberg</strong> in theologischer<br />
und kunstgeschichtlicher Sicht«<br />
Die Heiliggeistkirche in <strong>Heidelberg</strong> ist eine spätgotische Kirche, deren Grundstein 1396 gelegt<br />
wurde, und deren Chorraum bereits 1410 fertig war. Es lohnt sich, am Beispiel dieser Kirche aus<br />
kunstgeschichtlicher wie aus theologischer Sicht den Raum, die Symbole und die Geschichte einer<br />
Kirche zu entdecken, um sie dann kirchenpädagogisch anderen Menschen zeigen zu können. Die<br />
Bereitschaft der TeilnehmerInnen zu Referaten und Protokollen und ggf. zu Seminarabeiten wird<br />
vorausgesetzt..<br />
LITERATUR:<br />
Literatur wird am Beginn des Seminars genannt.<br />
Beginnt am: 21.4.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-3 h
PD DR. HEYMEL<br />
S<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
»Singet dem Herrn ein neues Lied!« -<br />
Erneuerung des liturgischen Betens aus<br />
der Sprache der Bibel<br />
Liturgische Gebete geben dem gemeinschaftlichen Beten eine Sprachform. Sie sollen für die<br />
Gemeinde mit- und nachvollziehbar sein. Sie so zu formulieren, erfordert Kenntnis kirchlicher<br />
Gebetstraditionen und Sensibilität für die Sprache. Wie kann biblische Sprache zur Quelle und<br />
Anregung für das christliche Gebet werden? Das ist Thema des Seminars. Sein Ziel ist, in<br />
Orientierung an den Psalmen zu einer neuen Gebetssprache zu finden. Dazu dient die<br />
Beschäftigung mit den Psalmen unter liturgischen Aspekten, mit Ansätzen zu einer Theologie des<br />
Gebets und der Arbeit der Amsterdamer Theologie sowie die Analyse von liturgischen Gebeten<br />
aus verschiedenen kirchlichen Traditionen.<br />
LITERATUR:<br />
R.Albertz, Art. Gebet II., TRE 12, 34-42; A.Deeg, Das neue Lied und die alten Worte. Plädoyer für<br />
eine Erneuerung liturgischen Betens aus der Sprache der Bibel, DtPfBl 12/2007, 641-645;<br />
F.Schulz, Art. Gebet VII., TRE 12, 71-84<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4 h<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein; benoteter Schein für Seminararbeit<br />
PROF. DRECHSEL<br />
S<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Gemeinde – Altenheim – Krankenhaus –<br />
Gefängnis. Seelsorgefelder im Vergleich<br />
In den letzten Jahren wird, nach einer langen Zeit einer rein beziehungsorientierten<br />
Seelsorgetheorie, die Bedeutung des Kontextes der Seelsorge wieder entdeckt: Die Gemeinde<br />
braucht eine andere Antwort auf die Frage: Was ist eigentlich Seelsorge? als das Altenheim, das<br />
Gefängnis, das Krankenhaus. Was aber bedeutet ein solches Nebeneinander dann für die<br />
Seelsorgetheorie? In diesem Seminar wollen wir die Seelsorgefelder Gemeinde, Altenheim,<br />
Krankenhaus, Gefängnis (und die Notfallseelsorge) genauer analysieren: Wie sind die<br />
Rahmenbedingungen? Was heißt hier Seelsorge? Welches seelsorgliche Handeln ist notwenig?<br />
Welche Auswirkungen hat dies auf die Seelsorgetheorie? Dabei soll unter Einbeziehung der Frage<br />
nach der Praxis eine Annäherung geschehen an eine »Topologie der Seelsorge«, die die Basis<br />
abgibt für eine Neukonzeption der Poimenik.<br />
Zielgruppe: alle Studiengänge im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: prakt.-theol. Proseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Seminarschein
PROF. DRECHSEL/<br />
PD DR. MÜHLING<br />
S<br />
Mo 14-16 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Glaube und Zweifel – systematisch-theologische<br />
und praktisch-theologische Perspektiven<br />
Wie ist das mit dem Glauben in der Theologie? Geht es da um ein Nachdenken über den Glauben?<br />
Ist dafür Glaube die Voraussetzung? Ist Glaube schlicht Vertrauen? Oder bedarf er der inhaltlichen<br />
Bestimmung? Gibt es so etwas wie eine »notwendige« Glaubenssicherheit? Oder muss der Zweifel<br />
als ein ganz zentrales Element des Glaubens angesehen werden? Ist das theologische Denken<br />
eine Art institutionalisierter Zweifel am Glauben selbst? Im Kontext der Theologie geht es um<br />
Glaube auf ganz unterschiedlichen Ebenen: 1. Es geht um die Frage: Was ist eigentlich Glaube?<br />
und - zutiefst damit verbunden – Was ist eigentlich Zweifel? Im Kontext der Deutungsangebote<br />
der christlichen Tradition. Wobei ein annäherndes Verstehen an das, was »objektiv« sagbar ist,<br />
immer auch immer auch eine ganz subjektive Seite hat: den eigenen Glauben, den eigenen<br />
Zweifel. 2. Und es geht um die Frage nach der Weitergabe des Glaubens, wobei von dem<br />
Gedanken »Glaube als Geschenk« eine Anfrage entsteht an das ganze Treiben der Praktischen<br />
Theologie: Muss nicht die Rede vom »Glauben lernen« und vom »Glauben lehren« aus einer<br />
systematisch-theologischen Perspektive zutiefst angezweifelt werden? Nur, was »macht« dann<br />
eigentlich die Praktische Theologie? Solchen und ähnlichen Fragen wollen wir in diesem Seminar<br />
nachgehen, aus sytematisch- und praktisch-theologischer Perspektive. Dabei sollen neben den<br />
klassischen Topoi der Dogmatik und den glaubens- und zweifelsbezogenen Gegenwartsfragen<br />
auch konkrete Perspektiven wie die Frage nach dem Gebet, nach der Spiritualität usw. unter den<br />
Bedingungen theologischer Reflexion zum Thema werden.<br />
LITERATUR:<br />
wird im Seminar bekannt gegeben<br />
Teilnahmevorausetzungen: Bereitschaft zur Übernahme eines Referats<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
PD DR. LÄMMLIN/<br />
PD DR. VÖGELE<br />
S<br />
Mo 16-18 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Systematisch-theologisches/praktisch-theologisches<br />
Seminar: Glaube zwischen Vernunft und Gefühl –<br />
Symbole und Rituale in der Zivilgesellschaft<br />
Ausgangspunkt des Seminars ist die Beobachtung, dass Rituale sowohl für konfessionell-religiöse<br />
wie für zivilreligiöse Kommunikation eine besondere, wenn auch zu differenzierende Rolle spielen<br />
und immer gespielt haben. In welcher Weise sich die Rahmenbedingungen für Rituale und für<br />
symbolische Kommunikation und Sprache verändert haben und wie sich auch Teilnahmeformen<br />
und Rezeptionen dieser Rituale entwickeln, und welche kritischen Anfragen an die zivilreligiöse<br />
Ritualpraxis und Symbolsprache zu formulieren sind, wird im Rahmen der neueren Literatur<br />
diskutiert. Dabei spielt auch die Kontroverse im Verhältnis von Vernunft und Religion, Glaube und<br />
Gefühl eine zentraler Rolle.
LITERATUR:<br />
Jürgen Habermas/Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion,<br />
Freiburg 2005; Wolfgang Vögele, Weltgestaltung und Gewissheit. Alltagsethik und theologische<br />
Anthropologie, Münster 2002; Horst W. Opaschowski, Kathedralen des 21. Jahrhunderts.<br />
Erlebniswelten im Zeitalter der Eventkultur, 2000<br />
Zielgruppe: Theologiestudierende im Hauptstudium, Studierende der Religionswissenschaft<br />
Teilnahmevorausetzungen: PS (prakt.-theol./sysdt.-theol.) oder Vergleichbares<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Leistungsnachweis: Referat, Prototokoll, Seminararbeit<br />
PROF. RUPP<br />
S<br />
Di 16-18 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Religion in der Alltagskultur als<br />
Gegenstandsbereich des<br />
kompetenzorientierten Religionsunterrichts<br />
Neben der eigenen Religiosität, dem evangelischen Christentum und anderen Religionen und<br />
Weltanschaungen ist die Religion in der Alltagskultur Gegenstandsbereich des<br />
kompetenzorientierten Religionsunterrichts. Das Seminar will auf dem Hintergrund eines geklärten<br />
Religionsbegriffes religiöse Phänomene in der Alltagskultur wie z.B. in Filmen, in der Werbung, in<br />
der Popmusik beschreiben und daraufhin religiöse Lernprozesse für die Sekundarstufe I und II<br />
entwerfen. Schritte didaktischer Analyse werden angewendet. Das Seminar wird gemeinsam mit<br />
OStR Elmar von Hyningen-Huene (Studienseminar <strong>Heidelberg</strong>) und LRS Jochen Dischinger<br />
durchgeführt.<br />
LITERATUR:<br />
zu Beginn des Seminars wird eine ausführliche Literaturliste vorgelegt.<br />
Zielgruppe: Studierende für das Pfarramt und für das höhere Lehramt<br />
Teilnahmevorausetzungen: Proseminar<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Leistungsnachweis: Unterichtsentwurf<br />
KASPER<br />
S<br />
Di 14-16 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
»Ethische Themen und ihre didaktische Behandlung<br />
im Evang. Religionsunterricht«<br />
Dieses religionsdidaktische Seminar wir den Schwerpunkt auf die didaktisch-methodische Behandlung<br />
ethischer Fragestellungen im Religionsunterricht legen und dabei das bereits erworbene<br />
fachwissenschaftliche Wissen auf künftige Unterrichtssituationen exemplarisch anwenden.<br />
Die bisherige - zumindest punktuelle - Beschäftigung mit einem systematisch-theologischen Entwurf<br />
im Studium ist für diese Lehrveranstaltung unabdingbar!<br />
LITERATUR:
Eine Literaturliste wird in der ersten Sitzung bekannt gegeben; ein entsprechender Reader wird<br />
auf Wunsch erstellt!<br />
Zielgruppe: Lehramtsstudierende im Hauptstudium<br />
Teilnahmevorausetzungen: Religionspädagogische oder fachdidaktische Proseminararbeit<br />
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung per Mail unter WKasper@t-online.de. Begrenzung auf<br />
achtzehn Teilnehmer/-innen.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Fachdidaktische Seminararbeit (Erarbeitung einer Unterrichtsstunde mit<br />
präziser Analyse!)<br />
PROF. SCHNEIDER-<br />
HARPPRECHT<br />
S<br />
Do 18.15-21.30 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Der Kindergottesdienst<br />
Die bisherige - zumindest punktuelle - Beschäftigung mii einem systematisch-theologischen<br />
Entwurf im Studium ist für diese Lehrveranstaltung unabdingbar!<br />
Übungen<br />
BRAATZ<br />
Ü<br />
Di 16-18 Uhr<br />
Chorsaal der<br />
Friedenskirche, An<br />
der Tiefburg 10,<br />
69121 HD-<br />
Handschuhsheim<br />
Liturgisches Singen<br />
Schwerpunkte der Übung:<br />
• Psalmensingen responsorial und antiphonal - unterschiedliche Notationen und Traditionen,<br />
Praxis für den Gottesdienst<br />
• Das Stundengebet - Strukturen, Geschichte, Praxis<br />
• Responsorien im Hauptgottesdienst - Ordinariumsstücke und Proprien der evangelischen<br />
Tradition und des Graduale Romanum<br />
• Singen von Gregorianik, evangelischen Chorälen und neuen Liedern<br />
Zielgruppe: alle Studierenden<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 1 h<br />
FERDINAND<br />
Ü<br />
Do 11-13 Uhr<br />
ÜR K 3<br />
Gemeinde wahrnehmen
Die Übung ist erster Teil und Pilotprojekt eines dreistufigen Elementes in der Studienmitte zur<br />
Bearbeitung des Praxisbezuges im Theologiestudium (vor allem für »Pfarrämtler«) um das zentrale<br />
Element eines obligatorischen oder freiwilligen Gemeindepraktikums. Im Verbund mit der<br />
Erarbeitung ausgewählter Themen der Gemeindepraxis bzw. Pastoraltheologie und der Methoden<br />
vor allem ethnografischer Religionsforschung (teilnehmende Beobachtung, Interviews) sollen die<br />
TeilnehmerInnen kleine Forschungsprojekte erarbeiten (Auswahl eines Forschungsfeldes,<br />
Formulierung einer Fragestellung, Forschungsdesign), in deren Fokus Formen von Religiösität<br />
bzw. theologische Prägungen in ihrer Bedeutung für die Gestalt von Gemeinden oder<br />
Gemeindeteilen stehen.<br />
LITERATUR:<br />
Baumann, Martin: Qualitative Methoden in der Religionswissenschaft. Hinweise zur<br />
religionswissenschaftlichen Feldforschung. 2. Aufl. Marburg, 1998. (REMID); Knoblauch, Hubert:<br />
Qualitative Religionsforschung. Religionsethnografie in der eigenen Gesellschaft. Paderborn 2003;<br />
Meyer-Blanck, Michael/Birgit Weyel: Studien- und Arbeitsbuch Praktische Theologie. Göttingen<br />
2008; Angel, Hans-Ferdinand u.a.: Religiosität. Anthropologische, theologische und<br />
sozialwissenschaftliche Klärungen. Stuttgart 2006. (D IIIa 218); Dinter, Astrid u.a.: Einführung in<br />
die Empirische Theologie. Gelebte Religion erforschen. Göttingen 2007; Religionsmonitor 2008.<br />
Hrsg. v. Bertelsmann Stiftung. 2. Aufl. Gütersloh 2008.<br />
Zielgruppe: Studierende, die ein Gemeindepraktikum planen; alle Interessierten<br />
Teilnahmevorausetzungen: Regelmäßige Teilnahme, Lektüre, Mitarbeit, Referat od.<br />
Projektvorstellung, evtl. Protokoll<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3 h<br />
Diakoniewissenschaften<br />
ALBERT/OELSCHLÄGEL<br />
ET<br />
N. N.<br />
V<br />
�S. 29<br />
Di 11-13 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Einführung in das<br />
diakoniewissenschaftliche Studium<br />
Diakonische Leitlinien im Alten und<br />
Neuen Testament<br />
In dieser Veranstaltung lernen wir biblische Leitlinien diakonischen Handelns im Alten Testament<br />
und im Neuen Testament kennen, die theologisch reflektiert und auf die heutige Zeit übertragen<br />
werden.<br />
LITERATUR:<br />
Gerhard K. Schäfer/Theodor Strohm (Hg.): Diakonie - biblische Grundlagen und Orientierungen :<br />
ein Arbeitsbuch zur theologischen Verständigung über den diakonischen Auftrag. 3. Auflage.<br />
<strong>Heidelberg</strong> 1998.
Zielgruppe: Die Vorlesung richtet sich vor allem an Studierende, die einen Überblick über die<br />
biblisch-theologische Begründung diakonischen Handelns erlangen möchten.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 Stunden Vorbereitung und 1 St. Nachbereitung<br />
Leistungsnachweis: Hausarbeit oder mündliche Prüfung<br />
DR. MICHEL<br />
S<br />
17.-18.04.09 +<br />
08.-09.05.09<br />
ÜR K 2<br />
Werteorientiertes Management. Überlegungen zu<br />
einem werteorientierten Management auf Makro-,<br />
Meso- und Mikroebene in Theorie und Praxis.<br />
Es werden die grundlegenden Positionen zu einer Wirtschaftsethik, wie die der »Moralökonomik«<br />
von Karl Homann, die der »Integrativen Wirtschaftsethik« von Peter Ulrich und die der<br />
»Governanceethik« von Josef Wieland diskutiert. Die ethischen bzw. sozialethischen Maßstäben<br />
zur verantwortlichen Gestaltung der (Sozial-) Wirtschaft auf der Basis der EKD-Denkschrift<br />
»Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive« werden ermittelt und kritisch diskutiert<br />
(Frieden mit dem Kapital?, Ulrich Duchrow). Schließlich wird die »Gefangenendilemma-Situation«<br />
des Managements SGB-refinanzierter, staatlich durchregulierter und standardisierter diakonischer<br />
Dienstleister unter dem Paradigma aus Lukasevangelium 10 (selbstlose Samariter- bzw. bezahlte<br />
Wirtsfunktion) betrachtet.<br />
Die Komplexität des Managements auf der Mikroebene wird schließlich anhand des St. Gallener<br />
Managementmodell erschlossen und aus der Praxis heraus beraten.<br />
PROF. SCHMIDT/PROF. WEBER<br />
S<br />
Do 10-12 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Kritische Lebensereignisse und ihre<br />
religiöse Relevanz<br />
In der Biographieforschung kann sich das Hauptinteresse an der Lebens- und<br />
Schicksalsgeschichte von Individuen auf kritische Lebensereignisse, ihre Folgen und deren<br />
Bewältigungsversuche konzentrieren. Befragte Kinder und Jugendliche, die z.B. in Kolumbien auf<br />
der Straße leben, verweisen immer wieder auf traumatische Erfahrungen, die am Anfang ihrer<br />
Exklusionskarrieren stehen. Das Hauptseminar widmet sich dieser Thematik, ihrer Erforschung<br />
und der Entwicklung von Strategien der Inklusion. Ziel des Seminars ist Kenntnisse über<br />
Biographie- und Resilienzforschung, Kinder und Jugendliche in gesellschaftlichen<br />
Problemsituationen, Exklusionsphänomene in unterschiedlichen Gesellschaften zu erwerben.<br />
LITERATUR:<br />
siehe Literaturverzeichnis im Seminarplan (Aushang)<br />
Beginnt am: Do, 23.04.08; letzte Seminarsitzung am 26.07.09.<br />
Zielgruppe: Lehramtsstudenten, Studierende des Masterstudiengangs Straßenkinderpädagogik,<br />
Studierende der Uni und des DWI<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 4 h<br />
Leistungsnachweis: Referate, Präsentationen mit schriftlicher Ausarbeitung
N. N.<br />
S<br />
Do 14-16 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Rechtes Handeln, Nächstenliebe, Solidarität<br />
In dieser Veranstaltung lernen wir biblisch-theologische und philosophische Konzeptionen von<br />
Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe kennen und setzen diese in Beziehung zu heutigem<br />
Hilfehandeln am Beispiel von sozial ausgeschlossenen Menschen.<br />
Literatur:<br />
Gerechte Teilhabe - Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift des<br />
Rates der EKD zur Armut in Deutschland, Juli 2006. Güterloher Verlagshaus<br />
Zielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Studierenden der<br />
Diakoniewissenschaft und wird gemeinsam mit Studiengang Straßenkinderpädagogik der<br />
Pädagogischen Hochschule <strong>Heidelberg</strong> angeboten.<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 Stunden Vorbereitung und 1 St. Nachbereitung<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein für ein mündliches Impulsreferat mit Handout und didakt.<br />
Hinweisen; Benoteter Schein für ein mündl. Impulsreferat und zusätzlicher schriftliche<br />
Ausarbeitung des Referats<br />
N. N.<br />
S<br />
3.7.-5.7.2009 | 9 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Konfliktfelder materialer Ethik in diakoniewissenschaftlicher<br />
Perspektive<br />
Im Seminar werden ethische Konfliktfelder am Lebensbeginn und Lebensende bearbeitet.<br />
Unterschiedliche Ansätze werden anhand von Fallbeispielen besprochen und in Gruppen<br />
vorbereitet. Ziel ist der Erwerb einer ethisch-diakoniewissenschaftlichen Kompetenz zur Orientierung<br />
in ethischen Konfliktfeldern am Lebensbeginn und Lebensende.<br />
LITERATUR:<br />
Eberhard Schockenhoff: Ethik des Lebens. Ein theologischer Grundriß. 3. Aufl. Mainz 2000.<br />
Beginnt am: Vorbesprechung 24.03.2009 | 16 Uhr<br />
Zielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Studierenden der<br />
Diakoniewissenschaft.<br />
Teilnahmevorausetzungen: Ohne Teilnahme an der Vorbesprechung ist eine Belegung des<br />
Blocks nicht möglich!<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 Stunden Vorbereitung und 1 St. Nachbereitung<br />
Leistungsnachweis: Teilnahmeschein für ein mündliches Impulsreferat mit Handout und didakt.<br />
Hinweisen; Benoteter Schein für ein mündl. Impulsreferat und zusätzlicher schriftliche<br />
Ausarbeitung des Referats
DR. SCHWARTZ<br />
S<br />
Do 16-18 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Diakonische Unternehmenskultur<br />
Diakonische Einrichtungen unterscheiden sich (oder sollen sich unterscheiden) von anderen<br />
Anbietern von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen maßgeblich durch ihr Profil, die sie<br />
tragenden Wertvorstellungen, die sich in ihrer Arbeit äußern. Das Seminar geht der Frage nach,<br />
wie sich diese Kultur zeigt - in der Arbeit, bei den Mitarbeitenden, in der Außensicht -, woher sie<br />
gespeist ist - aus der biblischen Tradition, der Geschichte der Einrichtungen und der Anbindung<br />
zur Kirche - und wie sie geschärft und verstetigt werden kann.<br />
LITERATUR:<br />
Beate Hofmann, Diakonische Unternehmenskultur, Stuttgart 2008; Diakonisches Werk der EKD,<br />
Charakteristika einer diakonischen Kultur, Diakonie Texte 1.2008<br />
Beginnt am: 30. März bzw. 6. April 2009<br />
Teilnahmevorausetzungen: Interesse<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 2 h<br />
Leistungsnachweis: Referat oder Hausarbeit<br />
PROF. MÜLLER<br />
S<br />
Mo 11-13 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Rabbinische Texte zur Gerechtigkeit<br />
Der ehrwürdige biblische Begriff der Gerechtigkeit wird zusehends - schon biblisch und dann mehr<br />
und mehr in der nachbiblischen jüdischen Auslegungsgeschichte - zum Äquivalent für »soziale<br />
Gerechtigkeit« und damit zu einem Integral der nachmaligen »Diakonia«. Ein spannender<br />
Zusammenhang, den es zu untersuchen und an den Quellen zu verifizieren lohnt.<br />
ALBERT<br />
Ü<br />
Mi 11-13 Uhr<br />
ÜR K 2<br />
Schlaglichter der Diakoniegeschichte<br />
Kenntnisse historischer Entwicklungslinien sind für ein angemessenes Verstehen heutiger Diakonie<br />
unerlässlich. Deshalb gibt diese Veranstaltung einen Überblick über prägende Gestalten der<br />
Diakoniegeschichte vor allem im 19. Jahrhundert, richtet ihren Blick aber auch auf<br />
vorausgegangene und nachfolgende Entwicklungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der<br />
»weiblichen Diakonie«, denn sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart gilt, dass<br />
Diakonie im Wesentlichen von Frauen gestaltet wird, während Leitungsfunktionen - damals wie<br />
heute - zumeist in männlicher Hand liegen.
LITERATUR:<br />
Ursula Röper/Carola Jüllig, Die Macht der Nächstenliebe. Einhundertfünfzig Jahre Innere Mission<br />
und Diakonie 1848-1998, 2. Auflage, Stuttgart 2007; Volker Herrmann (Hg.), Zur Diakonie im 19.<br />
Jahrhundert. Überblicke - Durchblicke - Einblicke (DWI-Sonderinfo 6), <strong>Heidelberg</strong> 2005; Kaiser,<br />
Jochen-Christoph, Evangelische Kirche und sozialer Staat. Diakonie im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
hg. von Volker Herrmann, Stuttgart 2008; Jutta Schmidt, Beruf: Schwester. Mutterhausdiakonie<br />
im 19. Jahrhundert , Frankfurt/Main 1998; Adelheid M. von Hauff (Hg.), Frauen gestalten<br />
Diakonie, 2 Bände, Stuttgart 2006/2007.<br />
Zielgruppe: DWI-Studierende und alle Interessierten<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: schriftlich ausgearbeitetes Referat<br />
Exkursion und Praxisprojekte des DWI ab Seite 103.<br />
Lehrauftrag für katholische Theologie<br />
DR. RUTTE/PD DR. PETERSEN<br />
V<br />
Do 10-13 Uhr<br />
NUni HS 8<br />
Das Kreuz als Erkenntnisprinzip? Die Lehre<br />
des Paulus als bleibende Herausforderung<br />
für die Theologie und die Philosophie<br />
Gegenstand dieser auf zwei Semester angelegten systematischen Vorlesung ist die christliche<br />
Bestimmung des Gottesbegriffs vor dem normativen Hintergrund der paulinischen<br />
Kreuzestheologie. Die Vorlesung geht der Frage nach, was es philosophisch und theologisch<br />
bedeutet, Gott konsequent vom Ereignis des Todes Jesu Christi her zu begreifen. In diesem<br />
Kontext werden auch einflußreiche kreuzestheologische Entwürfe (Thomas von Aquin, Luther, von<br />
Balthasar, Rahner, Jüngel) und relevante philosophische Auseinandersetzungen mit dem<br />
Christentum (Kant, Hegel, Schelling, Nietzsche) diskutiert. Die Vorlesung ist interdisziplinär, d. h.<br />
sie wird von einem Theologen und einem Philosophen gemeinsam gehalten und wendet sich an<br />
Studierende der Theologie und Philosophie. Im Wintersemester 2009/10 wird die Vorlesung an<br />
der philosophischen <strong>Fakultät</strong> fortgesetzt.<br />
LITERATUR:<br />
Literaturliste wird bei der Vorlesung ausgeteilt.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie und Philosophie
Lehrauftrag für feministische Theologie<br />
DR. ELSDÖRFER<br />
S<br />
Mi 16-18 Uhr<br />
Öinst<br />
Frauen im Bereich des Islam<br />
»Gleichstellung« ist ein Begriff, den der Islam im Kontext der Beziehungen zwischen Männern und<br />
Frauen in der Religion und der Gesellschaft kennt. »Gleichberechtigung« dagegen ist ihm nicht<br />
geläufig.<br />
Der in Europa und Amerika – oft auf dem Kontext der Absetzung und des Kampfes mit dem<br />
Christentum – entwickelte Begriff der »Gleichberechtigung« impliziert alle Rechte der Frauen,<br />
sämtliche Rollen in der Gesellschaft ausüben zu können, die auch Männer ausüben können.<br />
Da in vielen islamischen Ländern die Religion stärker die gesellschaftlichen Normen bestimmt, als<br />
das im christlichen »Westen« mit seiner weitgehenden Trennung von Religion und Gesellschaft der<br />
Fall ist, gelten die religiösen Normen, die Mohammed in seiner Zeit aufgestellt hat, oft noch heute<br />
– nicht nur in Bezug auf die Frauen.<br />
Mohammed war ein Prophet der »Gerechtigkeit Allahs«, und so konnten zwar Frauen zu seiner<br />
Zeit durchaus Geld besitzen, ein Geschäft ausüben - Mohammeds erste Frau Chadidscha war eine<br />
erfolgreiche Geschäftsfrau – aber als Regel galt: Männer sind physisch stärker, ihre Aufgabe ist,<br />
die Frauen und Familien zu beschützen und zu ernähren – und deshalb erbten Männer mehr aus<br />
dem Familienerbe als die Frauen; schließlich oblag den Männern die Erhaltung der Familie.<br />
Im 19. Jahrhundert wurde von ägyptischen Sozialreformern gefordert, islamische Frauen zu<br />
höheren Schulen und öffentlicher Bildung zuzulassen, später auch das <strong>Universität</strong>sstudium in<br />
einigen islamischen Ländern legalisiert. Das Argument war: In den Händen der Frauen liegt die<br />
Bildung der nächsten Generation, und so muss alles daran gesetzt werden, dass die islamischen<br />
Frauen selbst gebildet sind, sonst verkümmert die Gesellschaft.<br />
Frauen und Familie – ein gesellschaftlicher Grundpfeiler im Islam – werden besonders<br />
aufmerksam verfolgt in den Augen des »Westens«. Mit Schleier und »Restriktionen« versehen<br />
scheinen Frauen hier zu verkümmern. Diesem Bild aber hält die sich ständig wandelnde<br />
»islamische Welt« so nicht stand. Frauen in der Türkei, im Iran, in Pakistan können studieren,<br />
Berufe ausüben – »gleichberechtigt« sind sie sicher in der Gesellschaft nicht, aber den Männern<br />
»gleichgestellt«, vor den Augen Allahs, im Sinne der Begriffe von Gerechtigkeit, die der Koran<br />
nahe legt.<br />
»Manche Fragen der westlichen feministischen Bewegung würden islamische Frauen nicht<br />
aufwerfen«, so schreibt Hamideh Mohagheghi in der Betrachtung meines Buches »Frauen in<br />
Christentum und Islam«, »die islamische Welt ist befangen von der Liebe zur Vergangenheit« – so<br />
schreibt Fatima Mernisssi, die wohl berühmteste Vordenkerin eines »islamischen Feminismus«-<br />
UNO – Beauftragte für Frauenfragen und marokkanische Soziologie-Professorin.<br />
In meinem Seminar möchte ich, ausgehend von meiner eigenen historischen und aktuellen Studie<br />
zur Situation von Frauen im Islam, islamischen »Feminismus« zu Wort und persönlicher<br />
Darstellung kommen lassen. Die Verwurzelung in der Kultur und Religion ist mir dabei genauso<br />
wertvoll wie die aktuelle politische und soziologische Betrachtung der Situation von Frauen in<br />
divergierenden islamischen Gesellschaften – vor allem geht es aber auch um die Situation<br />
islamischer Mitbürgerinnen in Deutschland, ihr Selbstverständnis und ihre religiöse, politische und<br />
kulturelle Verwurzelung.
LITERATUR:<br />
Ulrike Elsdörfer: Frauen in Christentum und Islam, Königstein 2006, Helmer Verlag<br />
Fatima Mernissi: Der politische Harem. Mohammed und die Frauen, Freiburg 1992, Herder Verlag<br />
Grit Klinkhammer: Moderne Formen islamischer Lebensführung, Marburg 2000, diagonal-Verlag<br />
Heide Oestreich: Der Kopftuch – Streit. Das Abendland und ein Quadratmeter Islam,<br />
Frankfurt/Main, Brandes & Apsel, 2005<br />
Zielgruppe: StudentInnen - 3. Lebensalter<br />
Teilnahmevorausetzungen: offen<br />
Anmeldung: Persönliche Anmeldung per e-mail<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 Stunden<br />
Leistungsnachweis: Referate, Hausarbeiten - qualifizierte Scheine<br />
DR. KÖSER/DEMIRCI<br />
BS 24.04.-26.04.2009<br />
Interkulturelle Öffnung - Grundlagen -<br />
theologische Reflexion - Praxiserfahrung<br />
Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diese Realität spiegelt sich auch in diakonischen Diensten<br />
und Einrichtungen sowie in Kirchengemeinden und den ihnen angeschlossenen sozialen Diensten<br />
(Kita, Jugenarbeit etc.) wider. Die wachsende Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
macht es erforderlich, den Prozess der interkulturellen Öffnung auch in Kirche und Diakonie<br />
voranzutreiben.<br />
Das Blockseminar vermittelt Grundlagen der Interkulturellen Öffnung und bietet eine theologische<br />
Reflexion zu Chancen und Grenzen dieses Prozesses.<br />
Ein interkulturelles Kompetenztraining sichert den Theorie-Praxis-Transfer und gibt Einblicke in die<br />
praktische Arbeit.<br />
LITERATUR:<br />
Eine Literaturliste wird Anfang April an alle angemeldeten Teilnehmenden verschickt.<br />
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis 30.3.2009 unter koeser@diakonie.de formlos für das<br />
Blockseminar an.<br />
Zielgruppe: Studierende der Theologie/Diakoniewissemschaften<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: vorbereitende Lektüre
Weitere Veranstaltungen<br />
EPG 1<br />
PROF. TANNER<br />
[V] Überblicksvorlesung: Geschichte der Ethik seit der Reformation<br />
DR. BRUNN<br />
[Ü] Einführung in die Ethik mit klassischen Texten.<br />
DR. SCHAEDE<br />
[Ü] Einführung in die Religionsphilosophie anhand der Lektüre von<br />
Immanuel Kant, die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen<br />
Vernunft<br />
� S. 63<br />
� S. 74<br />
� S. 81<br />
DR. LAX Fr 15-17 Uhr | KiGa I<br />
[Ü] Epikur – oder die Kunst, glücklich zu leben<br />
Epikurs Philosophie kreist um den Zentralbegriff der »hedone«, zu übersetzen mit Lust, Freude,<br />
Glück. Dieser vermeintliche Hedonismus hat dazu geführt, dass Epikur meist verkannt und als<br />
(Haupt-)Vertreter ungezügelten Genießens reiner Sinnesfreuden missgedeutet wurde und wird.<br />
Wer sich mit Epikurs erhaltenen Schriften und denen seiner späteren Anhänger befasst, wird<br />
jedoch schnell feststellen, dass es Epikur darum ging, dem Individuum Wege aufzuzeigen, wie<br />
dauerhaft glücklich zu leben ist und Lebensfreude wie Seelenruhe erlangt werden können durch<br />
Überwindung von (unbegründeter) Angst, Schmerz und (sinnlichen) Begierden. Wie im einzelnen<br />
diese Kunst des glücklichen Lebens, seine Ethik, aussieht und wie sie sich in das gesamte Weltverständnis<br />
Epikurs einfügt, wollen wir gemeinsam ergründen.<br />
LITERATUR:<br />
wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben<br />
Beginnt am: 3. April konstituierende Sitzung, danach ggf. als Blockveranstaltung<br />
Zielgruppe: alle Interessierten, EPG 1<br />
Anmeldung: ja<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 2 h<br />
Leistungsnachweis: gemäß EPG-Voraussetzungen; ausgearbeitetes Referat, Hausarbeit<br />
KLEIN<br />
[Ü] Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit<br />
RÜPPEL<br />
[Ü] Sinn und Sinne<br />
� S. 75<br />
Obwohl die Sinne unerlässlich beim Sammeln von Erfahrungswerten sind und maßgeblich zur<br />
Erkenntnis beitragen, werden sie von vielen Philosophen wegen mangelnder Zuverlässigkeit<br />
gegenüber den Erkenntnisvermögen Verstand und Vernunft abgewertet. Die Übung soll der<br />
Frage nachgehen, inwiefern sinnliche Eindrücke unsere Denkweise und Wertungen bestimmen,<br />
ob sinnliche Eindrücke einen (spezifischen) Wert haben und ob die Fragen nach Sinn ohne ästhetische<br />
Erfahrung auskommt. Dazu werden Texte aus verschiedenen Epochen der Philosophiegeschichte<br />
herangezogen. Leitende Fragen: »Macht etwas Sinn« oder ist es in sich »sinnvoll«? Liegt
Sinn im Objekt oder im Subjekt, wann verkehrt er zum Wahnsinn oder wird als Unsinn verachtet<br />
bzw. geschätzt? Inwiefern folgt Sinn im Leben einer moralischen Richtung? Kann man sich alternativ<br />
auf sinnlichen Genuss und Spiel beschränken? In dieser Übung sollen verschiedene Disziplinen,<br />
deren Wissenschafts- und Erkenntnisformen miteinander ins Gespräch kommen.<br />
LITERATUR:<br />
wird in der ersten Sitzung bekanntgegeben<br />
Zielgruppe: Lehramtsstudierende (EPG I) und Bachelor-Studierende<br />
Anmeldung: Anmeldung per Mail: andrea.rueppel@sap.com<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Klausur<br />
HENSCHEN<br />
[Ü] Gerechtigkeitstheorien<br />
PD DR. WLADIKA<br />
[BV] Platon, Politeia<br />
EPG 2<br />
� S. 82<br />
� S. 83<br />
PROF. TANNER<br />
[S] Toleranz – zum historischen Profil des Begriffs � S. 70<br />
DR. BRUNN / KOLB<br />
[Ü] Sportethik und Geschlechterdifferenz � S. 76<br />
N. N. Do 14-16 Uhr | ÜR K 2<br />
[S] Rechtes Handeln, Nächstenliebe, Solidarität<br />
N. N.<br />
[S] Konfliktfelder materialer Ethik in diakoniewissenschaftlicher<br />
Perspektive � S. 95<br />
PROF. BERGUNDER<br />
[Ü] Grundtexte der Religionswissenschaft und Interkulturellen<br />
Theologie (Missionswissenschaft) � S. 80<br />
PhE<br />
PROF. GERTZ<br />
[S] Segen als Thema des Alten Testaments � S. 40<br />
DR. HUPE<br />
[S] (Post-)Moderne Gerechtigkeitsdiskurse und Neues Testament � S. 51<br />
PD DR. ETZELMÜLLER<br />
[S] Parusie, Gericht-Auferstehung, Ewiges Leben. Themenfelder<br />
christlicher Eschatologie � S. 70
PD DR. FREUND<br />
[S] Theologie im Umbruch - Texte zur Theologie der Aufklärungszeit<br />
� S. 71<br />
PD DR. EHMANN<br />
[Ü] Zeitgeschichtlich-konfessionskundliche Übung: Ökumenische, rkprot.<br />
Texte � S. 60<br />
DR. KÖCKERT<br />
[Ü] Bekehrung im antiken Christentum � S. 60<br />
Repetitorien<br />
DR. PICKER Do 8-10 Uhr | ÜR K2<br />
KG | Kirchengeschichte<br />
Die Veranstaltung ergänzt die eigene Examensvorbereitung im Fach Kirchengeschichte. Das<br />
prüfungsrelevante Basiswissen wird wiederholt und strukturiert. Entsprechend den mündlichen<br />
Spezialgebieten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer können besondere Akzente gesetzt werden.<br />
Prüfungssimulationen, die Besprechung von Klausuraufrissen und Hilfestellungen zur Entwicklung<br />
individueller Vorbereitungsstrategien sowie zur Literaturauswahl ergänzen das Programm.<br />
LITERATUR:<br />
Basislektüre: Wolfgang Sommer/Detlef Klahr, Kirchengeschichtliches Repetitorium, Göttingen,<br />
4<br />
2006, oder andere aktuelle Überblicksdarstellungen.<br />
Lektüreplan und Literaturliste werden in der ersten Sitzung verteilt.<br />
Beginnt am: 16. April 2009<br />
Zielgruppe: Studierende in oder unmittelbar vor der Examensvorbereitung (Kirchliches Examen,<br />
Diplom, Staatsexamen, Magister)<br />
Teilnahmevorausetzungen: Grundstudium in Kirchengeschichte<br />
Anmeldung: formlos per e-mail<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-6 h<br />
Leistungsnachweis: Nein<br />
PD DR. MÜHLING<br />
ST | Repetitorium Dogmatik � S. 65<br />
PD DR. WLADIKA<br />
RP | Geschichte der Philosophie im Überblick � S. 81<br />
Kolloquien<br />
PROF. A. M. RITTER Do 18-20 Uhr | SKPh kÜR<br />
KG | Kirchenväter-Kolloquium: Johannes von Damaskus (?), »Erbauliche Geschichte<br />
von Barlaam und Joasaph«<br />
In gemeinsamer Lektüre unter Beteiligung von Fachleuten aus der Klassischen Philologie, der
Papyrologie, der neutestamentlichen Exegese und der Patristik soll ein Stück Weltliteratur erarbeitet<br />
werden, die meist unter dem Namen des Johannes von Damaskus überlieferte »Historia animae<br />
utilis de Barlaam et Ioasaph« (s.o.), die aber nach Auffassung des Herausgebers der jüngst<br />
erschienenen kritischen Ausgabe (s.u.) »mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit« unecht<br />
ist. Das mindert ihre Bedeutung jedoch nicht im geringsten; sind in ihr doch Teile der Buddhalegende,<br />
verschiedene indische Parabeln und das griechische Original der bis auf wenige Fragmente<br />
verlorenen frühen Verteidigung des Christentums aus der Feder des »Apologeten« Aristides verarbeitet<br />
worden zu einem Werk von unglaublicher geschichtlicher Wirkung und Verbreitung.<br />
LITERATUR:<br />
Robert Volk, Die Schriften des Johannes von Damaskos, VI, 2 (PTS 60), Berlin 2006 (Teilbd. 1 mit<br />
der Gesamteinleitung wird rechtzeitig zu Semesterbeginn vorliegen). Auf Übersetzungen ins<br />
Deutsche und andere moderne Sprachen wird beizeiten aufmerksam gemacht<br />
Zielgruppe: Alle an der Spätantike Interessierten, die ihre Sprachkompetenz im Altgriechischen<br />
befestigen und ein Stück Weltliteratur kennenlernen möchten<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: Zusätzlich zu den beiden Übungsstunden ca. zwei<br />
weitere<br />
Leistungsnachweis: Mündlich oder schriftlich möglich<br />
Prof. Strohm n. V.<br />
KG | Doktoranden/Habilitandinnen-Seminar<br />
Es werden die laufenden Arbeiten vorgestellt und diskutiert. Ferner neuere Forschungen zu<br />
spezifischen Themen diskutiert.<br />
Zielgruppe: Fortgeschrittene Studierende, Doktoranden, Habilitandinnen<br />
Teilnahmevorausetzungen: Rücksprache mit dem Dozenten<br />
Anmeldung: ja<br />
NOORDVELD Fr 14-17 Uhr (3-wöchentlich) | ÖInst<br />
ST | Kolloquium für ausländische Graduierte<br />
Beginnt am: Die erste Sitzung des Kolloquiums findet in der dritten Semesterwoche statt.<br />
Zielgruppe: ausländische Graduierte<br />
PROF. WELKER n. V.<br />
ST | Kolloquium für Doktorandinnen, Doktoranden und Postdocs.<br />
PROF. BERGUNDER BV n. V.<br />
RW | Forschungskolloquium, Blockveranstaltung<br />
Sozietäten<br />
DIV. Mo 18-20 Uhr | KiGa I<br />
Alttestamentliche Sozietät<br />
PROF. LAMPE / PROF. SCHWIER /N.N. Mi 18-21 Uhr | Dek<br />
Neutestamentliche Sozietät
PROF. LÖHR/PROF. STROHM U. A. Di 20 Uhr | ÖInst<br />
Kirchengeschichtliche Sozietät<br />
In der kirchengeschichtlichen Sozietät werden neuere Forschungen zur Kirchengeschichte vorgestellt<br />
und diskutiert<br />
Zielgruppe: fortgeschrittene Studierende<br />
PROF. SCHOBERTH n. V.<br />
Religionspädagogische Sozietät<br />
DIV. Mi 18-20 Uhr | ÜR K3<br />
Praktisch-theologische Sozietät<br />
Weitere Veranstaltungen für Studierende der DW<br />
Praxisprojekte<br />
OELSCHLÄGEL n. V.<br />
Auswertung zum Diakoniepraktikum und zum »Praxissemester Diakonie«, insbes. für<br />
Theologiestudierende der Evang. Landeskirche in Baden<br />
Im Mittelpunkt dieser Begleitung steht die Beratung und Auswertung von Diakoniepraktika von<br />
der Auswahl der Praktikumsstelle bis zur gemeinsamen abschließenden Reflexion der Erfahrungen<br />
und ihrer theologischen Relevanz im hospitierten Tätigkeitsfeld. Als besonderes Angebot wird auf<br />
die Möglichkeit hingewiesen, im Rahmen des diakonischen Gemeindeaufbaus der <strong>Heidelberg</strong>er<br />
Kapellengemeinde in der Plöck ein Diakoniepraktikum durchzuführen. – Bei ausreichender<br />
TeilnehmerInnenzahl wird im Anschluss an die Praktika ein gemeinsamer Auswertungstag<br />
veranstaltet. InteressentInnen vereinbaren bitte einen Beratungstermin.<br />
Zielgruppe: Studierende der Diakoniewissenschaft und Theologiestudierende, insbes. der Evang.<br />
Landeskirche in Baden<br />
Leistungsnachweis: Praktikumsbericht bzw. Praxissemesterbericht<br />
ALBERT n. V.<br />
Besprechung von Praxisprojekten<br />
Vorhaben von Praxisprojekten werden besprochen, ggf. vermittelt und begleitet. Diese können<br />
mit anderen Lehrveranstaltungen bzw. Handlungsfeldern diakonischer Praxis in Verbindung<br />
stehen. Erste Informationen sind als Merkblatt »Praxisprojekt« im DWI erhältlich. Es besteht<br />
zugleich die Möglichkeit der Studienberatung am DWI.<br />
Zielgruppe: Alle Interessierten<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2-4 h<br />
Leistungsnachweis: Praxisprojektbericht
Exkursion<br />
N. N. BV<br />
Exkursion zu einer diakonischen Einrichtung<br />
LITERATUR:<br />
wird bei der Vorbereitungssitzung bekannt gegeben.<br />
Beginnt am: weitere Informationen zum Ziel und Ablauf werden zu gegebener Zeit per Aushang<br />
bekannt gegeben, Auskunft gibt auch das Sekretariat des Diakoniewissenschaftlichen Instituts<br />
unter Tel. 06221/543336<br />
Zielgruppe: Studierende der Diakoniewissenschaft und alle Interessierten<br />
Teilnahmevorausetzungen: Besuch einer Vorbereitungssitzung, Übernahme eines Berichtes<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: ca. 4 Tage<br />
Kolloquien<br />
N.N./ALBERT/OELSCHLÄGEL Mi 13-15 Uhr | ÜR K 2<br />
Kolloquium für AbsolventInnen und DiplomandInnen<br />
Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, AbsolventInnen und DiplomandInnen am DWI die Gelegenheit<br />
zu geben, ihre Abschluss- und Diplomarbeitsprojekte nach Intention, Zielsetzung, Themenstellung<br />
und Methodik vorzustellen und zu diskutieren. Zugelassen sind alle Studierenden des DWI, die<br />
ihre Abschluss- bzw. Diplomarbeiten planen, entwerfen oder ausgestalten.<br />
Zielgruppe: Studierende der diakoniewissenschaftlichen Studiengänge<br />
N.N./STROHM/THIERFELDER n. V. | ÜR K 2<br />
Kolloquium für DoktorandInnen<br />
Das Kolloquium für Doktorandinnen und Doktoranden der Diakoniewissenschaft bietet die<br />
Gelegenheit, Konzeptionen und Methodik der Dissertation darzustellen und ins Gespräch zu<br />
bringen. Wir wollen die Kommunikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fördern und uns<br />
gegenseitig beraten. Die Themen umfassen das gesamte Spektrum der Diakoniewissenschaft.<br />
Zielgruppe: Studierende der diakoniewissenschaftlichen Studiengänge<br />
N. N. n. V.<br />
Kolloquium zum Dritten Sektor gemeinsam mit dem ‚Centrum für Soziale<br />
Investitionen und Innovationen’ (CSI) der <strong>Universität</strong> <strong>Heidelberg</strong><br />
Im Kolloquium werden anhand unterschiedlicher Vorträge Themen des Dritten Sektors wie<br />
Entwicklung der Zivilgesellschaft, Aktivierung der Verantwortung, Freiwilligen-Management,<br />
Steuerung von NGOs und NPOs, Stiftungsmodelle sowie Stellung des Dritten Sektors zwischen<br />
Markt und Staatvorgestellt und diskutiert.<br />
Zielgruppe: Fortgeschrittene Studierende, DiplomandInnen und DoktorandInnen
Lehrexport<br />
Altes Testament<br />
PD DR. JERICKE Di 15.30-17 Uhr | Uni Mannheim<br />
[V] Die Erzeltern-Erzählung im Buch Genesis (1. Mose)<br />
Die Lehrveranstaltung folgt einer textnahen Interpretation der Erzeltern-Erzählungen im Buch<br />
Genesis (1. Mose) Kapitel 12-50. Zudem werden Fragen der Entstehungsgeschichte der Texte,<br />
des historischen Hintergrunds, der Religionsgeschichte und der Wirkungsgeschichte besprochen.<br />
LITERATUR:<br />
wird in der Lehrveranstaltung angegeben<br />
Beginnt am: 17.02.2009<br />
Leistungsnachweis: mündliche Prüfung oder Referat<br />
DR. VETTE PH <strong>Heidelberg</strong><br />
[S] Am Anfang: Einführung in das Buch Genesis<br />
s. Eintragungen in StudIP<br />
LITERATUR:<br />
s. Eintragungen in StudIP<br />
Zielgruppe: Studierende an der PH-<strong>Heidelberg</strong><br />
Teilnahmevorausetzungen: Einschreibung an der PH<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3h<br />
Leistungsnachweis: Schein<br />
Neues Testament<br />
PROF. LAMPE Do 11.45-14 Uhr | Uni Mannheim<br />
[S] Sprachorientierte Einführung ins NT II<br />
siehe Vorlesungsverzeichnis Mannheim; kein Scheinerwerb für <strong>Heidelberg</strong>er Hauptseminare<br />
möglich<br />
SCHRÖDER PH <strong>Heidelberg</strong><br />
[S] In Absprache mit PH<br />
Kirchengeschichte<br />
PROF. STROHM Di 10-13 Uhr | Uni Mannheim<br />
[V] Kirchengeschichte des 19. u. 20. Jh<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Kirchen- und Theologiegeschichte des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts. Sie richtet sich sowohl an Anfänger und Anfängerinnen als auch an fortgeschrittene
Studierende, die Ereignisse, Per-sonen und Entwicklungen des behandelten Zeitraum noch einmal<br />
im Zusammenhang erarbeiten wollen. In der Vorlesung wird edv-gestützt Bild- und Kartenmaterial<br />
präsentiert.<br />
LITERATUR:<br />
Als knappe Übersichtsdarstellung kann zur vorbereitenden Lektüre empfohlen werden:<br />
Nowak, Kurt, Geschichte des Christentums in Deutschland: Religion, Politik und Gesellschaft vom<br />
Ende der Aufklärung bis zur Mitte des 20. Jahrhun-derts, München 1995; Ferner:Greschat, Martin<br />
(Hg.), Vom Konfessionalismus zur Moderne (KThQ IV), Neukirchen-Vluyn 1997 (Quellen!);<br />
Greschat, Martin/Hans-Walter Krumwiede (Hg.), Das Zeitalter der Weltkriege und Revolutionen<br />
(KThQ V), Neukirchen-Vluyn 1999 (Quellen!); Hauschild, Wolf-Dieter, Lehrbuch der Kirchen- und<br />
Dogmengeschichte, Bd. II: Reformation und Neuzeit, Gütersloh 1999; Wallmann, Johannes,<br />
Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation (UTB 1355), 6. Aufl., Tübingen 2006.<br />
Beginnt am: 30. März 2009<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2h<br />
Leistungsnachweis: Benoteter Schein nach Prüfung<br />
Systematische Theologie<br />
PROF. WELKER Do 14-16 Uhr | Uni Mannheim<br />
[V+Ü] Theologie und Naturwissenschaften<br />
Was kann die Theologie im Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften leisten?;<br />
Dialogmodelle und die neuere Dialoggeschichte; Was ist Schöpfung? Zur Weisheit antiken<br />
Weltordnungsdenkens; Zur Problematik naturalistischer und rein kosmologischer<br />
Weltwahrnehmungen (Dawkins, Hawking); <strong>Theologische</strong> und naturalistische Anthropologie;<br />
Fleisch – Leib – Bewusstsein – Herz – Seele – Gewissen – Geist: die komplexe Einheit der<br />
menschlichen Person als interdisziplinäre Herausforderung; Gesetzesbegriffe in Theologie und<br />
Naturwissenschaften; Unsichtbare Wirklichkeiten? Theologie und Naturwissenschaften über<br />
Fragen der Eschatologie<br />
LITERATUR:<br />
In der Übung werden folgende Texte diskutiert: J. Polkinghorne u. M. Welker, An den lebendigen<br />
Gott glauben. Ein Gespräch, Gütersloh 2005. Weitere Texte werden den Teilnehmenden genannt<br />
und z.T. zur Verfügung gestellt.<br />
Beginnt am: 30.03.2009<br />
PD DR. MÜHLING Di 16-18 Uhr | PH <strong>Heidelberg</strong><br />
[S] Grundzüge des Gespräches zwischen Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft<br />
Siehe StudIP der PH zu gegebener Zeit. Die Anmeldung erfolgt ebenso dort. Das Seminar wird an<br />
der PH angeboten und es werden PH-Teilnahme-/leistungsbestätigungen erteilt.<br />
LITERATUR:<br />
Wird im Seminar bekannt gegeben
Beginnt am: 20. April 2008<br />
Zielgruppe: Studierende der PH<br />
Teilnahmevorausetzungen: Bereitschaft zur Übernahme einer Seminarpräsentation<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 3h<br />
Leistungsnachweis: Seminararbeit<br />
Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft<br />
PROF. BERGUNDER Di 17-20 Uhr | Uni Mannheim<br />
[S+Ü] Weltreligionen<br />
Aktuelle Informationen unter http://theologie.uni-hd.de/rm/<br />
Praktische Theologie<br />
PROF. DRECHSEL BS | Uni Mannheim<br />
[S] Zwischen Sinnsuche und Lebensangst, Spaßgesellschaft und Kampf ums wirtschaftliche<br />
Überleben. Lebensfragen und Lebensprobleme junger Erwachsener heute<br />
Übergang ins Arbeitsleben, Selbstsuche, Sinnfindung, sexuelle Identität, Beziehung, Trennung,<br />
Suizid, Drogen, Konsumgesellschaft, »unzeitgemäße« Krankheit, Tod.... Eine Fülle an Themen,<br />
Problemen und möglichen Krisen bewegen und betreffen auf einer unmittelbaren Ebene<br />
Jugendliche und junge Erwachsene in unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Dabei stellt diese<br />
Gesellschaft dann noch einmal ganz unterschiedliche »kollektive Perspektiven« vor, unter denen<br />
das eigene Leben betrachtet werden kann (oder auch soll). Auf der Basis eines gemeinsam<br />
erarbeiteten Themenkatalogs sollen in diesem Seminar exemplarische Problemfelder in ihrem<br />
altersspezifischen sowie im gesellschaftlichen Zusammenhang gesichtet werden, um dann aus<br />
pastoralpsychologisch-theologischer Perspektive die Frage nach dem individuellen Umgang mit<br />
ihnen zu stellen. Das Interesse gilt dabei einer Grundlage für die Thematisierung dieser<br />
Problembereiche im Horizont religiöser Lebensdeutung.<br />
Beginnt am: Einführung: 17. 02., 12.00 - 13.30 | 2 Blöcke: 27./28.03.09 und 15./16.05.09<br />
jeweils 16-19 Uhr und 9-13 Uhr in Mannheim<br />
Zielgruppe: Studierende im Hauptstudium<br />
Zusätzlicher Arbeitsaufwand pro Woche: 2 h<br />
Leistungsnachweis: Seminarschein
Kurse im Petersstift (Termine s. Aushang Pstift)<br />
Zielgruppe: Vikarinnen und Vikare der badischen Landeskirche<br />
PROF. SCHWIER/DR. TREIBER<br />
Homiletischer Kurs für LehrvikarInnen der Badischen Landeskirche<br />
PROF. SCHOBERTH/ZIEGLER<br />
Religionspädagogischer Kurs für LehrvikarInnen der Badischen Landeskirche<br />
PROF. DRECHSEL/ZOBEL<br />
Poimenischer Kurs für LehrvikarInnen der Badischen Landeskirche<br />
PROF. LIENHARD/DR. TREIBER<br />
Pastorallehre und Kybernetik (Kurs für LehrvikarInnen der Badischen Landeskirche)<br />
Empfehlenswerte Veranstaltungen<br />
PD DR. THOMAS WILHELMI Fr 14-16 Uhr | PB SR 122<br />
KG | [S] Das protestantische Kirchenlied im 16. Und 17. Jahrhundert<br />
Vom ältesten erhaltenen Zeugnis eines deutschsprachigen geistlichen Liedes, dem Freisinger Petruslied (Anfang<br />
10. Jh.), führt eine lückenlose Tradition über eine erste Blüte im Mittelalter (die sog. »Leisen«) zur Zeit der<br />
Reformation, wo Martin Luther und andere (z.B. Nikolaus Herman, Thomas Müntzer, Paulus Speratus, Michael<br />
Weiße, Johannes Zwick und Huldrych Zwingli) bestehende Texte übersetzten und bearbeiteten und etliche neue<br />
Lieder schrieben. Im Zeitalter der Gegenreformation und der beginnenden protestantischen Orthodoxie erfuhr<br />
das evangelische Liedgut manche Erweiterungen (z.B. durch Kornelius Becker, Paul Eber und Philipp Nicolai). Zu<br />
einer Hochblüte kam es in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges und den darauffolgenden Jahrzehnten, dies nicht<br />
zuletzt durch die Bestrebungen der Sprach- und Dichtergesellschaften. Das protestantische Kirchenlied nimmt in<br />
der deutschen Barockdichtung einen zentralen Platz ein. Der bekannteste Kirchenlieddichter jener Zeit ist Paul<br />
Gerhardt; zu nennen sind aber u.a. auch Matthias Apelles von Löwenstern, Simon Dach, Johann Heermann,<br />
Johann Matthäus Meyfart, Georg Neumark, Johann Rist und Christian Knorr von Rosenroth.<br />
LITERATUR:<br />
Philipp Wackernagel: Das deutsche Kirchenlied, 5 Bde. Leipzig 1864-1877 (Reprint: Hildesheim 1990). Albert<br />
Fischer/Wilhelm Tümpel: Das deutsche evangelische Kirchenlied des 17. Jahrhunderts. 6 Bde. Gütersloh 1904-<br />
1916. Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch, 6 Bde. Göttingen 1953-1990. Handbuch zum<br />
Evangelischen Gesangbuch, Bde. 1ff. Göttingen 1995ff. Wolfgang Herbst: Komponisten und Liederdichter des<br />
Evangelischen Gesangbuchs. Göttingen ²2001. Markus Jenny: Luther, Zwingli, Calvin in ihren Liedern. Zürich<br />
1983. Volker Meid: Barocklyrik. Stuttgart 1986. Patrice Veit: Das Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers.<br />
Stuttgart und Wiesbaden 1986. Christian Bunners: Paul Gerhardt. Göttingen 2006. TRE 18, Berlin 1989, S. 602-<br />
643.<br />
Anmeldung: ab Ende Januar bei SignUP, obligatorisch. Anmeldung frühzeitig unter:<br />
Thomas.Wilhelmi@adw.uni-heidelberg.de<br />
Leistungsnachweis: Lektüre, Interpretation, Diskussion, Referate.<br />
BA B 3.1 HS: 10 LP durch Hausarbeit; HS Mag und LA: HS-Schein durch Hausarbeit. BA B 3.2 HS: 10 LP durch<br />
Hausarbeit; HS Mag und LA: HS-Schein durch Hausarbeit. BA B 3.3 HS: 10 LP durch Hausarbeit; HS Mag und<br />
LA: HS-Schein durch Hausarbeit.
Abkürzungen und Symbole<br />
Allgemein<br />
rollstuhlgerecht<br />
nicht rollstuhlgerecht<br />
Z. Zimmer/Büro<br />
Randregister *<br />
Allg. Allgemeine und einführende Veranstaltungen<br />
Spr. Sprachen<br />
AT Altes Testament<br />
NT Neues Testament<br />
KG Kirchengeschichte<br />
ST Systematische Theologie<br />
RW Religionswissenschaft und Interkulturelle<br />
Theologie/Missionswissenschaft<br />
Phil. Philosophie und Religionsphilosophie<br />
PT Praktische Theologie<br />
DW Diakoniewissenschaften<br />
* Die Abkürzungen des Randregisters entsprechen den Abkürzungen der<br />
Veranstaltungsübersicht ab Seite 20.<br />
Seminare und Institute<br />
AI Archäologisches Institut,<br />
Marstallhof 4<br />
FIIT Forschungszentrum Internationale<br />
und Interdisziplinäre Theologie,<br />
Hauptstr. 240<br />
HistSem Historisches Seminar,<br />
Grabengasse 3-5<br />
Karl PTS, Karlstr. 16<br />
KiGa WTS, Kisselgasse 1<br />
NUni Neue <strong>Universität</strong>,<br />
Grabengasse 1<br />
PH Pädagogische Hochschule (Alte PH),<br />
Keplerstraße 87<br />
PStift Petersstift, Neuenheimer Landstr. 35<br />
PTS Praktisch-<strong>Theologische</strong>s Seminar,<br />
Karlstr. 16<br />
SKPh Seminar für klassische Philologie,<br />
Marstallhof 4<br />
UniMA Uni Mannheim<br />
WTS Wissenschaftlich-<strong>Theologische</strong>s<br />
Seminar, Kisselgasse 1<br />
ZEKG Zentrums für Europäische Geschichtsund<br />
Kulturwissenschaften<br />
Veranstaltungen<br />
AP AnfängerInnen-Projekt<br />
BV Blockveranstaltung<br />
EP Examensprojekt<br />
EPG Veranstaltung im Rahmen des<br />
»Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums«<br />
(für Lehramtsstudierende)<br />
ET Einführungstag<br />
Ex Exkursion<br />
Ko Kolloquium<br />
Ku Kurs<br />
OS Oberseminar<br />
P Praxisprojekt<br />
PhE Veranstaltung für Lehramtsstudiengang<br />
Philosophie/Ethik<br />
PS Proseminar<br />
Rep Repetitorium<br />
S Hauptseminar<br />
SK Sprachkurs<br />
Soz Sozietät<br />
Ü Übung<br />
V Vorlesung<br />
Räume<br />
Dek Übungsraum im Dekanat<br />
KiGa … Übungsräume, Kisselgasse 1<br />
ÜR K … Übungsräume, Karlstr. 16<br />
HS 007 Hörsaal 007, Karlstraße 16<br />
ISSW Institut für Sport und Sportwissenschaft,<br />
INF 720<br />
NUni HS … Neue Uni, Hörsaal …<br />
ÖInst Ökumenisches Institut/ Übungsraum<br />
Plankengasse 1<br />
PB Germanistisches Seminar, Hauptstraße<br />
207-209<br />
SenS ehemaliger Senatssaal,<br />
Neue <strong>Universität</strong>, 2. OG<br />
SGU Seminargebäude am Uniplatz<br />
Grabengasse 14/Sandgasse 7
A<br />
B<br />
Kontakte und Sprechzeiten (Sommersemester 2009)<br />
Die Kontaktdaten der Dozenten in den vergangenen Semestern sind in den alten KVVs verfügbar<br />
unter:<br />
www.theologie.uni-heidelberg.de/fachschaft/<br />
Anika Christina Albert (anika.albert@dwi.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstraße 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543337 Fax: (06221) 543380<br />
Privat:<br />
Tel.: (06221) 756592 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. per Mail | Z. 101 (Karl)<br />
Dr. Jörg Augenstein (joerg.augenstein@ekiba.de)<br />
Blumenstr. 1, 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 9175208 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Prof. Dr. Michael Bergunder (michael.bergunder@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3289 Fax: (06221) 54 3290<br />
Sprechzeiten: Mi 13-14 u. n. V. | Hauptstr. 216<br />
Aktuelle Informationen unter http://theologie.uni-hd.de/rm/<br />
Kantor Michael Braatz (michael.braatz@ekihd.de)<br />
Ev. Friedensgemeinde Handschuhsheim, An der Tiefburg 10, 69121 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 4379010 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Dr. Frank Martin Brunn (frank-martin.brunn@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Interdisziplinäres Forum für Biomedizin und Kulturwissenschaften<br />
Projekt Menschenbild und Menschenwürde, Dekanat der Medizinischen <strong>Fakultät</strong>,<br />
Im Neuenheimer Feld 672, Raum 018, 69120 <strong>Heidelberg</strong><br />
Koordination des Ethisch-Philosophischen Grundlagenstudiums<br />
Wissenschaftlich <strong>Theologische</strong>s Seminar, Kisselgasse 1, Raum 211, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 2414/56 6825 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Mi 14.30 – 16 | Z. 211 (KiGa)
Prof. Dr. Peter Busch (peter.busch@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
PD Dr. István Czaches (istvan.czachesz@helsinki.fi)<br />
Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, Box 4, 00014 Helsinki<br />
Tel.: +358 (9) 19122886 Fax: +358 (9) 19124509<br />
Prof. Dr. Bernd Jørg Diebner (bernd.diebner@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543299 Fax: -<br />
Privat: Zuzenhausener Str. 3, 69234 Dielheim-Horrenberg<br />
Tel.: (06222) 71619 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Mo 10-11 | Z. 212 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Angelika Dörfler-Dierken (AngelikaDoerfler@bundeswehr.org)<br />
Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Prötzeler Chaussee 20, 15344 Strausberg<br />
Tel.: (03341) 581836 Fax: (03341) 581802<br />
Privat: Achtern Diek 16, 22927 Großhansdorf<br />
Tel.: (04102) 67345 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Vor und nach dem Blockseminar<br />
Prof. Dr. Wolfgang Drechsel (wolfgang.drechsel@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543323 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Montag 13-15 | Z. 404 (Karl)<br />
Prof. Dr. Ulrich Duchrow (ulrich.duchrow@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Alfred-Jost-Str. 7, 69124 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 786360 Fax: (06221) 786361<br />
PD Dr. Johannes Ehmann (johannes.ehmann@ki-eb.de)<br />
Konfessionskundliches Institut, Ernst-Ludwig-Str. 7, 64625 Bensheim<br />
Tel.: (06251) 843319 Fax: (06251) 843328<br />
Privat: Eichenstr. 36<br />
67067 Ludwigshafen<br />
Tel.: (0621) 5495174 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
C<br />
D<br />
E
F<br />
G<br />
Dr. Ulrike Elsdörfer (Ulrike.Elsdoerfer@gmx.net)<br />
Wiesengrundstr.6, 61462 Königstein<br />
Tel.: (06174) 22864 Fax: -<br />
PD Dr. Gregor Etzelmüller (Gregor.Etzelmueller@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3278 Fax: -<br />
Privat: Goethestr. 14, 69502 Hemsbach<br />
Tel.: (06201) 71271 Fax:<br />
Sprechzeiten: Mo 11-12 | Z. 221 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Johannes Eurich (johannes.eurich@dwi.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3336 Fax: (06221) 54 3380<br />
Manfred Ferdinand (manfred.ferdinand@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstraße 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3386 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Do 15-16<br />
Friedrich-Emanuel Focken (friedrich-emanuel.focken@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543306 Fax: -<br />
Privat: Dachsweg 5, 69221 Dossenheim<br />
Tel.: (06221) 485398 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 124 (KiGa)<br />
PD Dr. Gerhard Freund (gfleo@t-online.de)<br />
Eugenstraße 6, 71229 Leonberg<br />
Tel.: (07152) 42117 Fax: (07152)28382<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Prof. Dr. Jan Christian Gertz (jan.gertz@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3309 Fax: (06221) 54 3395<br />
Privat: Eckenerstraße 1, 69121 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 6530999 Fax:<br />
Sprechzeiten: Mi 12-13 | Z. 125 (KiGa)
Céline Grandclère-Praetorius (celine.grandclere@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3312 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 204 (Karl 2)<br />
Pfr. Karl Günther<br />
Höhenstr. 34, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 896608 Fax: (06221) 896610<br />
PD Dr. Peter Haigis (peter.haigis@pfarrverband.de)<br />
Schlossberg 67, 71394 Kernen<br />
Tel.: (07151) 45294 Fax: (07151) 45294<br />
Sprechzeiten: im Anschluss an die Lehrveranstaltung<br />
PD Dr. Gerald Hartung (gerald.hartung@fest-heidelberg.de)<br />
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e. V., Schmeilweg 5, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 9122 -37 Fax: (06221) 167257<br />
Sprechzeiten: n. V. | s. o.<br />
Jörg Haustein (joerg.haustein@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3360 Fax: (06221) 54 3290<br />
Sprechzeiten: Mi 12-13 | Hauptstr. 216<br />
Dr. Tobias Henschen (Tobias.Henschen@urz.uni-heidelberg.de)<br />
Philosophisches Seminar, Schulgasse 6, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Sprechzeiten: Mi 16-18<br />
PD Dr. Michael Heymel (michael.heymel@gmx.de)<br />
Tel.: (06151) 1360165<br />
Sprechzeiten: Mi n. V.<br />
PD Dr. Rolf Noormann (holtz-noormann@gmx.de)<br />
Sprechzeiten: Im Anschluss an das Seminar (Mo 13)<br />
Prof. Dr. Jürgen Hübner (juergen.huebner@fest-heidelberg.de)<br />
FEST, Schmeilweg 5, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 912224 Fax: (06221) 167257<br />
Privat: Silcherstr. 2, 69256 Mauer<br />
Tel.: (06226) 990565 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Mi 17-18 (nach Anmeldung!) | Z. 212 (KiGa)<br />
H
J<br />
K<br />
Dr. Verena Hug (verena.hug@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Dr. Henning Hupe (henning.hupe@urz.uni-hd.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3353 Fax: -<br />
Privat: Mümmelmannweg 1, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 895474 Fax:<br />
Sprechzeiten: Do 17-18 | Z. 014 (Kiga)<br />
PD Dr. Detlef Jericke (detlef.jericke@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3608 Fax: -<br />
Privat: Peterstaler Str. 35, 68118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 4319197 Fax: -<br />
Sprechzeiten: nach der Lehrveranstaltung | Z. 208 (Karl 2)<br />
OstD Wolfgang Kasper (wkasper@t-online.de)<br />
Hölderlin-Gymnasium <strong>Heidelberg</strong>, Plöck 40, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Privat: Breslauer Str. 61, 69124 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 783830 Fax: (06221) 783830<br />
Prof. Dr. Jürgen Kegler (juergen.kegler@ekiba.de)<br />
Dr. Wolfram Kerner (wolfram.kerner@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3331 Fax: -<br />
Privat:<br />
Tel.: (07258) 927421 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 13-14 | Z. 405 (Karl)<br />
Rebekka A. Klein (rebekka.klein@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3486 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 8-9 (mit Anmeldung) | Z. 225 (KiGa)<br />
PD Dr. Michael Klein (MKleinHamm@aol.com)<br />
Goethestr. 1, 57577 Hamm/Sieg<br />
Sprechzeiten: n. V.
Dr. Christoph Koch (christoph.koch@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3306 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 124 (KiGa)<br />
Dr. des Charlotte Köckert (charlotte.koeckert@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3314 Fax: (06221) 543623<br />
Sprechzeiten: Di 15-16 | Z. 207 (Karl 2)<br />
Dr. Silke Köser (koeser@diakonie.de)<br />
Diakonisches Werk der EKD e.V., Reichensteiner Weg 24, 14195 Berlin<br />
Tel.: (030) 83001 141 Fax: (030) 83001 286<br />
Sprechzeiten: silkekoeser@arcor.de<br />
PD Dr. Georg Lämmlin (laemmlin@ev-akademie-baden.de)<br />
Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 9175315 Fax: (0721) 917525315<br />
Privat: Kurzgewannstr. 13, 68526 Ladenburg<br />
Tel.: (06203) 16834 Fax:<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Prof. Dr. Peter Lampe (p@uni-hd.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3319 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Mi 11ct -12ct, um Warten zu vermeiden, Anmeldung bei<br />
vera.hirschmann@wts.uni-heidelberg.de | Dekanat Parterre<br />
Dr. Doris Lax (doris@lax-united.de)<br />
Tel.: (06372) 3928 Fax: (06372) 507710<br />
Sprechzeiten: n. V. | n. V.<br />
Prof. Dr. Fritz Lienhard (fritz.lienhard@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3325 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 15-17 | Z. 302 (Karl)<br />
L
M<br />
N<br />
Prof. Dr. Winrich Löhr (winrich.loehr@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3302 Fax: (06221) 54 3623<br />
Sprechzeiten: Do 10 Uhr | Z. 202 (Karl 2)<br />
Alexander Maßmann (Alexander.Massmann@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3488 Fax: -<br />
Stefan Meisters (stefan.meisters@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3487 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 210 (KiGa)<br />
Dr. Martin Michel (MEFMICHEL@aol.com)<br />
Tel.: (07251) 9384266 Fax: -<br />
Prof. Dr. Christian Möller (Christian.Moeller@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstrasse 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 212 (KiGa)<br />
PD Dr. Markus Mühling (markus.muehling@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Ökumenisches Institut, Plankengasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3520 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Z. 026 Kia)<br />
Prof. Klaus Müller (mueller-Kl@t-online.de)<br />
PD Dr. Jörg Neijenhuis (joerg.neijenhuis@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Am Gutleuthofhang 13, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 800336 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Diederik Noordveld (diederik.noordveld@oek.uni-heidelberg.de)<br />
Ökumenisches Institut, Plankengasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3346 Fax: (06221) 54 3259<br />
PD Dr. Michael Nüchtern (Michael.Nuechtern@ekiba.de)<br />
Blumenstraße 1, 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 9175300 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.
Prof. Dr. Friederike Nüssel (Friederike.Nuessel@oek.uni-heidelberg.de)<br />
Plankengasse 1-3, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543341 Fax: (06221) 543259<br />
Sprechzeiten: Do 15-16 Uhr, Anmeldung bitte bei sabine.huffman@oek.uni-heidelberg.de oder<br />
telefonisch unter 54 3341 | (Öinst)<br />
Christian Oelschlägel (Christian.Oelschlaegel@dwi.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstraße 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3339 Fax: (06221) 54 3380<br />
Sprechzeiten: Di 15-16 | Z. 102 (Karl)<br />
Prof. Dr. Manfred Oeming (Manfred.oeming@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3305 Fax: (06221) 54 3391<br />
Privat: Zeisigweg 14, 68799 Reilingen<br />
Tel.: (06205) 104000 Fax: (06205) 104900<br />
Sprechzeiten: Mi 11-30-12.30 Uhr | Zi. 125 (KiGa)<br />
PD Dr. Thomas Petersen<br />
Philosophisches Seminar, Schulgasse 6, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: 06221-542284<br />
Dr. Hanns-Christoph Picker (christoph.picker@eapfalz.de)<br />
Evangelische Akademie der Pfalz, Domplatz 5, 67346 Speyer<br />
Tel.: (06232) 6020-60 Fax: -<br />
Privat: Niedererdstraße 44, 67071 Ludwigshafen<br />
Tel.: (0621) 67180250 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | extern<br />
Prof. Michael Plathow (michael@plathow.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Privat: Beintweg 41, 69181 Leimen<br />
Tel.: (06224) 921730 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
PD Dr. Martin Pöttner (heidelberg@martinpoettner.de)<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
O<br />
P
R<br />
S<br />
Prof. Dr. Adolf-Martin Ritter (amritter@t-online.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 543299 Fax: -<br />
Privat: Herrenweg 66, 69151 Neckargemünd<br />
Tel.: (06223) 3799 Fax: (06223) 809053<br />
Sprechzeiten: Mi 9-11 (nur nach telefonischer Vereinbarung) | Z. 212 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Hartmut Rupp (Hartmut.Rupp@ekiba.de)<br />
Religionspädagogisches Institut der Badischen Landeskirche, Blumenstr. 5-7, 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 9175 -425/-427 Fax: (0721) 9175 -435<br />
Privat: Spessartstr. 7, 68753 Waghäusel<br />
Tel.: (07254) 8963 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Andrea Rüppel (andrea.rueppel@sap.com)<br />
Gertrude-von-Ubisch-Straße 17, 69124 <strong>Heidelberg</strong>-Kirchheim<br />
Tel.: (06221) 784574 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Dr. Thomas Rutte (hochschulpfarrer@khg-heidelberg.de)<br />
Edith-Stein-Haus, Neckarstaden 32, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 4340584 Fax: (06221) 4340588<br />
Dr. Stephan Schaede (stephan.schaede@fest-heidelberg.de)<br />
FEST <strong>Heidelberg</strong> - Institut für interdisziplinäre Forschungen, Schmeilweg 5, 69118 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 912222 Fax: (06221) 167257<br />
Privat: Dantestr. 25, 69115 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (0173) 4674754 Fax:<br />
Sprechzeiten: nach Vereinbarung: telefonisch oder nach der Veranstaltung | Anke Muno,<br />
Schmeilweg 5, 69118 <strong>Heidelberg</strong>; Tel.: 06221-912240<br />
Prof. Dr. Heinz Schmidt (heinz.schmidt@dwi.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstraße 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3336 Fax: (06221) 54 3380<br />
Sprechzeiten: n.V. (Anmeldung per E-Mail oder unter (06221) 54 3336)
Sabine Schmidtke (s.schmidtke@oek.uni-heidelberg.de)<br />
Plankengasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3512 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | R 013 (ÖInst)<br />
Dr. Martin Schneider (dr.schneider@melanchthon.com)<br />
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten, Melanchthonstrasse 1, 75015 Bretten<br />
Tel.: (07252) 944119 Fax: (07252) 944116<br />
Sprechzeiten: vor und nach der Übung<br />
PD Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht (Christoph.schneider-harpprecht@ekiba.de)<br />
Evangelischer Oberkirchenrat, Blumenstr. 1-7, 76133 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 9175400 Fax: (0721) 9175559<br />
Privat: Vorholzstr. 2, 76137 Karlsruhe<br />
Tel.: (0721) 4708069 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V.<br />
Prof. Dr. Ingrid Schoberth (ingrid.schoberth@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3332 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 13-14 | (06221) 54 3333 Frau Christiane Hemberger-Ullrich (Karl)<br />
Heidrun Schröder (heidrun.schroeder@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3541 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. per Mail | Z. 017 (KiGa)<br />
Dr. Werner Schwartz (werner.schwartz@diakonissen.de)<br />
Diakonissen Speyer-Mannheim, Hilgardstr. 26, 67346 Speyer<br />
Tel.: (06232) 22 1202 Fax: (06232) 22 1587<br />
Privat: Hilgardstr. 9, 67346 Speyer<br />
Tel.: (06232) 919610 Fax: (06232) 919612<br />
Sprechzeiten: n. V., evtl. vor und nach der Veranstaltung<br />
Dr. Dirk Schwiderski (dirk.schwiderski@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3394 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 11.30-13 | Z. 123 (KiGa)
T<br />
Prof. Dr. Helmut Schwier (helmut.schwier@pts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 16, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3326 Fax: (06221) 54 3190<br />
Sprechzeiten: Di 16-17 | Z. 304 (Karl)<br />
Dr. Heike Springhart (heike.springhart@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3278 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Do 13-14 | Z. 221 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Christoph Strohm (christoph.strohm@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstr. 2, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3315/3303 Fax: (06221) 543197<br />
Sprechzeiten: Mi 11.15-12.30 | Karl 2, 2. OG<br />
Yan Suarsana (yan.suarsana@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3312 Fax: -<br />
Sprechzeiten: n. V. | Karl 2<br />
Prof. Klaus Tanner (klaus.tanner@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3518 Fax: (06221) 54 3318<br />
Sprechzeiten: Di 15.15-16 | Z. 224 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Gerd Theißen (gerd.theissen@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3293 (kann sich im Laufe des Semesters ändern)<br />
Privat: Max-Josef-Str. 54/1, 69126 <strong>Heidelberg</strong><br />
Sprechzeiten: nach der Vorlesung n. V.| 019 (KiGa) (kann sich im laufe des Semesters ändern)<br />
Florian Theobald (florian.theobald@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3517 Fax: -<br />
Privat: Schillerstraße 32, 69115 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 7258276 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Di 14-15 | Z. 010 (KiGa)
Anna Tzvetkova-Glaser (anna.tzvetkova-glaser@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1,69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3350 Fax: -<br />
Privat:<br />
Tel.: (07151) 2056846 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Mi 14-15 | Z. 209 (KiGa)<br />
Dr. Joachim Vette (joachim.vette@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3516 Fax: -<br />
Privat: Kirchheimer Weg 16/1, 69124 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 6502651 Fax:<br />
Sprechzeiten: Mi 10-11 o. n. V. | Z. 126 (KiGa)<br />
Prof. Dr. Bernd Wander<br />
Luke Welch (welch_luke@hotmail.com)<br />
Prof. Dr. Michael Welker (michael.welker@wts.uni-heidelberg.de)<br />
Kisselgasse 1, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 3356 Fax: -<br />
Privat: Bannholzweg 51, 69151 Neckargemünd<br />
Sprechzeiten: Di 18-19 | Haupt 216<br />
PD Dr. Thomas Wilhelmi (Thomas.Wilhelmi@adw.uni-heidelberg.de)<br />
Karlstraße 5, 69117 <strong>Heidelberg</strong><br />
Tel.: (06221) 54 4396 Fax: -<br />
Sprechzeiten: Do 16.15-17.30/Fr 9-9.30 | Akademie-Büro 1<br />
PD Dr. Michael Wladika (michael.wladika@wts.uni-heidelberg.de)<br />
V<br />
W
DIE EVANGELISCHE<br />
STUDIERENDEN<br />
GEMEINDE<br />
lädt ein<br />
in das Karl-Jaspers-Haus, Plöck 66, schräg gegenüber der UB<br />
Mittwoch, 1. April 2009, Semestereröffnung<br />
ab 18.15 Uhr<br />
Gottesdienst � Fest �<br />
Vorstellung des Programms und der Gruppen<br />
jeden Mittwoch:<br />
18.15 Uhr Gottesdienst von und für Studierende<br />
19.15 Uhr Abendessen<br />
20.15 Uhr Gemeindeabend<br />
Regelmäßige Gruppen:<br />
Gottesdienst-Werkstatt, Christlich-Muslimisches Friedensgebet, Der Kreis,<br />
Kontemplation, ESG-Chor, Blechbläserensemble,<br />
Kammermusikkreis, Besuchsdienst in der Psychiatrie, Knast-<br />
AK, Theatergruppe Mikrokosmos, Tanzkurs und �kreis<br />
25.4.2009, 11.00 Uhr Internationale Brunch<br />
Alle Informationen zu<br />
Veranstaltungen und Gruppen findest Du unter<br />
www.esg-heidelberg.de