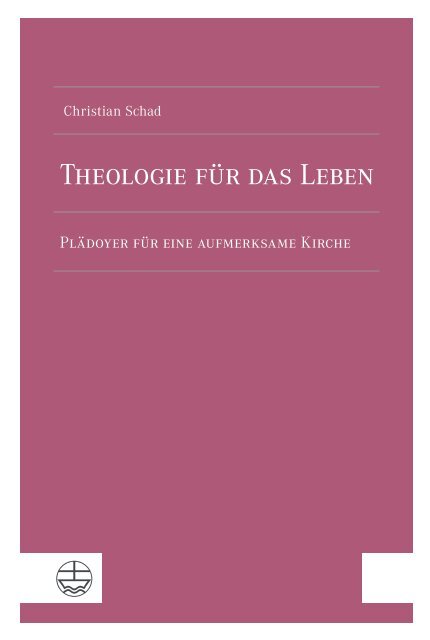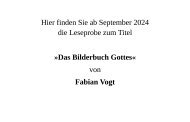Christian Schad: Theologie für das Leben (Leseprobe)
Theologie und Kirche gehören untrennbar zusammen. Christian Schad, von 2008 bis 2021 Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz und seit 2021 Präsident des Evangelischen Bundes, lebt diese Einheit. In 27 ausgewählten Beiträgen, die anlässlich seines 65. Geburtstags in dem vorliegenden Band erstmals gesammelt herausgegeben werden, spannt er in drei Kapiteln einen Bogen von der für ihn grundlegenden reformatorischen Theologie über die Gegenwartsbedeutung der innerprotestantischen Kirchenunionen sowie die theologischen Vordenker des 19. und 20. Jahrhunderts hin zu seinem Verständnis von Kirche. Er plädiert für eine „aufmerksame Kirche“, die in allen ihren Handlungsfeldern nur dann ihrem Auftrag gerecht wird, wenn sie nicht nur eine mutig agierende, sondern zuerst hörende Kirche ist und bleibt. Die umfangreiche Bibliographie Christian Schads dokumentiert dessen vielfältiges Wirken als evangelischer Theologe und Verantwortungsträger seiner Kirche.
Theologie und Kirche gehören untrennbar zusammen. Christian Schad, von 2008 bis 2021 Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz und seit 2021 Präsident des Evangelischen Bundes, lebt diese Einheit. In 27 ausgewählten Beiträgen, die anlässlich seines 65. Geburtstags in dem vorliegenden Band erstmals gesammelt herausgegeben werden, spannt er in drei Kapiteln einen Bogen von der für ihn grundlegenden reformatorischen Theologie über die Gegenwartsbedeutung der innerprotestantischen Kirchenunionen sowie die theologischen Vordenker des 19. und 20. Jahrhunderts hin zu seinem Verständnis von Kirche. Er plädiert für eine „aufmerksame Kirche“, die in allen ihren Handlungsfeldern nur dann ihrem Auftrag gerecht wird, wenn sie nicht nur eine mutig agierende, sondern zuerst hörende Kirche ist und bleibt.
Die umfangreiche Bibliographie Christian Schads dokumentiert dessen vielfältiges Wirken als evangelischer Theologe und Verantwortungsträger seiner Kirche.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong><br />
<strong>Theologie</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Leben</strong><br />
Plädoyer <strong>für</strong> eine aufmerksame Kirche
Inhalt<br />
Vorwort .................................................. 11<br />
Zum Geleit ............................................... 15<br />
I. Vonder Reformation zur Union<br />
Die Bibel –mehr als ein Buch ............................... 19<br />
Zum Schriftverst ndnis Martin Luthers<br />
ber <strong>das</strong> Gebet ........................................... 35<br />
Eine Erinnerung an Martin Luther<br />
Zur Freiheit berufen ....................................... 49<br />
Das Freiheitsverst ndnis Martin Luthers<br />
»Hier stehe ich ...« ........................................ 63<br />
Martin Luther, Lehrer der Kirche aus Heiliger Schrift und<br />
Vernunft<br />
»Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein« .............. 69<br />
Martin Luther und die Musik<br />
»Ein feste Burg ist unser Gott« .............................. 77<br />
Martin Luthers Auslegung des 46. Psalms<br />
Mitten im Todvom <strong>Leben</strong> umfangen ......................... 85<br />
Gedanken zu Sterben, Todund Trauer in reformatorischer<br />
Perspektive<br />
Sola gratia ............................................... 89<br />
Die reformatorische Botschaft von der freien Gnade Gottes
8 Inhalt<br />
Christlicher Glaube als Vernunftreligion ...................... 99<br />
Zur Gegenwartsbedeutung der pf lzischen Kirchenunion von<br />
1818<br />
II. Theologen der Neuzeit<br />
Fromm und modern zugleich ............................... 115<br />
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834)<br />
Kreuzestheologie kontrovers ............................... 121<br />
Schleiermacher und Luther im Vergleich<br />
Mit dem Anfang anfangen ................................. 129<br />
Karl Barth (1886–1968)<br />
Wie heute von Gott reden? ................................. 135<br />
Schleiermacher und Barth im Vergleich<br />
Redliche Rede von Gott .................................... 141<br />
Rudolf Bultmann (1884–1976)<br />
Ein Sprachlehrer des christlichen Glaubens ................... 147<br />
Ernst Fuchs (1903–1983)<br />
Auf der Suche nach gewiss machender Sprache ............... 153<br />
Gerhard Ebeling (1912–2001)<br />
Gott als Geheimnis der Welt ................................ 157<br />
Eberhard J ngel (1934–2021)<br />
Der Gott, auf den ich hoffe ................................. 163<br />
J rgen Moltmann (*1926)<br />
Pluralismus aus Glauben ................................... 167<br />
Christoph Schwçbel (1955–2021)
Inhalt 9<br />
III. Kirche im Hçren und Handeln<br />
ffentliche Religion in der offenen Gesellschaft ............... 173<br />
ber <strong>das</strong> Verh ltnis von Staat und Religion, von Kirche und<br />
Verfassungsordnung<br />
Unterwegs zu einer missionarischen Kirche ................... 187<br />
Mission als <strong>Leben</strong>svollzug<br />
Bekennen und Bekenntnis .................................. 203<br />
<strong>Leben</strong>s ußerungen der Kirche<br />
Gott in den Ohren liegen ................................... 217<br />
Das Gebet imGottesdienst der Kirche<br />
Kirchen- und Abendmahlsgemeinschaft ...................... 231<br />
Evangelisch-katholische Ann herungen<br />
Gemeinde und Diakonie ................................... 243<br />
Theologische Erw gungen zu einem Spannungsfeld<br />
Krankenhaus- und Gemeindeseelsorge ....................... 253<br />
Gegenw rtige Herausforderungen und Chancen<br />
Anfechtung und Gewissheit ................................ 269<br />
Kirche in Zeiten von Corona<br />
Nachweis der Erstverçffentlichungen ........................ 281<br />
Bibliographie <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> 1987–2022 ..................... 285<br />
Traudel Himmighçfer
Vorwort<br />
»Christliche <strong>Theologie</strong> ist – nach einer Definition von Gerhard Ebeling –›<strong>Theologie</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Leben</strong>‹; und Kirche ist nach der berühmten Definition von Dietrich<br />
Bonhoeffer ›Kirche <strong>für</strong> andere‹, Kirche <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> anderer. Zur <strong>Theologie</strong><br />
gehört darum von vornherein die Bindung an die Wirklichkeit der Kirche.<br />
Christliche <strong>Theologie</strong> ist von Anfang an im <strong>Leben</strong>szusammenhang der Kirche<br />
entstanden – und ist und bleibt auf diesen Zusammenhang angewiesen. Umgekehrt:<br />
Seit es die Kirche gibt, hat sie sich der <strong>Theologie</strong> bedient. Mit ihrer Hilfe<br />
wurde und wird die kirchliche Lehre auf ihren Wahrheitsgehalt hin geklärt und<br />
die Heilige Schrift ausgelegt. <strong>Theologie</strong> und Kirche stehen somit in einem Verhältnis<br />
der wechselseitigen Verantwortung <strong>für</strong>einander.«<br />
Diese <strong>für</strong> seine theologische Existenz sobezeichnenden Sätze finden sich in<br />
<strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>s Dankesrede anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde<br />
durch die Evangelisch-Theologische Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität<br />
Mainz am 10. Januar 2019. Dass er diese ihm so wichtige konstruktive<br />
Wechselbeziehung von <strong>Theologie</strong> und Kirche nicht nur einfordert, sondern sie<br />
Tag<strong>für</strong> Tagselbst gelebt hat und lebt, zeigt auch seine Biographie: zunächst (seit<br />
1986) als Gemeindepfarrer in Weingarten/Pfalz und Studierendenseelsorger<br />
am Fachbereich <strong>für</strong> Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaften in Germersheim,<br />
dann (seit 1991) als Theologischer Referent im Landeskirchenrat der<br />
Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer mit den Schwerpunkten Ökumene,<br />
Judaica, Liturgik und Hymnologieund seit 1996 als Dozent am Protestantischen<br />
Predigerseminar in Landau/Pfalz. Gerade auch in seinen kirchenleitenden Positionen<br />
blieb <strong>für</strong> ihn die <strong>Theologie</strong> die Leitwissenschaft: seit 1999 als Oberkirchenrat<br />
und Dezernent <strong>für</strong> die Bereiche Gottesdienst, Kirchenmusik, Diakonie,<br />
Ökumene, Missionarische Dienste und Seelsorge und von 2008 bis 2021 als<br />
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz. Dazu übernahm er über die<br />
Pfalz hinaus verantwortungsvolle Aufgaben, etwa als Vorsitzender der Vollkonferenz<br />
und des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland (UEK)(2013–2021), als evangelischer Vorsitzender<br />
des Kontaktgesprächskreises zwischen Vertretern der Deutschen Bischofskonferenz<br />
und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (2016–2022) oder<br />
als evangelischer Leiter der Konsultationsreihe zum Thema »Kirche und Kirchengemeinschaft«<br />
zwischender GemeinschaftEvangelischer Kirchen in Europa<br />
und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen. Selbst in seinem<br />
Ruhestand ist es <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> als dem evangelischen Vorsitzenden des<br />
Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen und<br />
als ehrenamtlichem Präsidenten des Evangelischen Bundes ein Herzensanliegen,<br />
darauf hinzuwirken, <strong>das</strong>s die wahre <strong>Theologie</strong> »praktisch« ist – ganz so, wie es
12 Vorwort<br />
Martin Luther in seinen Tischreden auf den Punkt gebracht hat: »Vera theologia<br />
est practica« (WA.TR 1, Nr. 153).<br />
Die Wurzeln von <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>s theologischem Denken und Handeln<br />
reichen zurück in seine Studienzeit: In Tübingen, Ende der 1970er-Jahre, waren<br />
seine maßgeblichen Lehrer der Kirchenhistoriker und Systematische Theologe<br />
Gerhard Ebeling, der 1962 in Zürich <strong>das</strong> erste Institut <strong>für</strong> Hermeneutik im<br />
deutschen Sprachraum gründete, der Inhaber des Lehrstuhls <strong>für</strong> Systematische<br />
<strong>Theologie</strong> und Religionsphilosophie sowie Direktor des Tübinger Instituts <strong>für</strong><br />
Hermeneutik, Eberhard Jüngel, und in Bonn, Anfang der 1980er-Jahre, der Alttestamentler<br />
und Direktor des dortigen Instituts <strong>für</strong> Hermeneutik, Antonius<br />
H. J. Gunneweg. Wassie <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> eröffneten und was seine theologische<br />
Existenz bis heute prägt, ist der Zugang zu einer hermeneutischen <strong>Theologie</strong>, der<br />
es darum geht, im Hören auf biblische Texte und in ihrer Auslegung sich deren<br />
Wahrheitsanspruch auch existentiell zu stellen. Also so lange wie nur möglich in<br />
die biblischen Texte einzukehren, um als ihr Ausleger ein mehr und mehr durch<br />
sie Ausgelegter zuwerden. Denn so wird die Wahrheit der biblischen Texte die<br />
unsrige, <strong>das</strong>s diese uns indie von ihnen angesagte neue Situation hinein übersetzen<br />
und uns Anteil an ihr geben; spricht uns doch die Bibel derart auf<br />
uns selber an, <strong>das</strong>s sieuns dabei zugleich auf unsere Situation vor Gott anspricht.<br />
Diese Übersetzung vollzieht sich nichtals Anpassung an unsals Leserinnenbzw.<br />
Hörer, vielmehr – als Folge unseres Ergriffenwerdens durch die Texte – als<br />
kritische Auseinandersetzung mit uns und unserer Vergangenheit sowie unserer<br />
jeweiligen Gegenwart. Luther kann darum sagen: »Beachte, <strong>das</strong>s die Kraft der<br />
Schrift die ist: Sie wird nicht in den gewandelt, der sie studiert, sondern sie<br />
verwandelt den, der sie liebt, in sich undinihre Kräfte hinein« (WA 3; 397,9–11,<br />
1. Psalmenvorlesung 1513–1515). Dadurch geben uns die biblischen Texte uns<br />
selber und die Welt neu zu verstehen. Sie sind vergleichbar einer Leuchte, in<br />
deren Licht wir uns und die Welt neu sehen lernen. Insofern kann Gerhard<br />
Ebeling sagen, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> Wort der Schrift <strong>das</strong>jenige ist, »was Verstehen eröffnet<br />
und vermittelt, also etwas zum Verstehen bringt. Das Wort selbst hat hermeneutische<br />
Funktion« (Wort Gottes und Hermeneutik, in: ders., Wort und Glaube,<br />
Tübingen 1960, S. 333 f.).<br />
Was <strong>für</strong> den einzelnen Christenmenschen gilt, gilt <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> zufolge<br />
auch <strong>für</strong> die Kirche als ganze: <strong>das</strong>s sie, bevor sie selber zu reden und zu agieren<br />
beginnt, zuerst hörende, wahrnehmende, »aufmerksame Kirche« ist. Aufmerksam<br />
<strong>für</strong> die biblischen Zeugnisse als Quellen des christlichen Glaubens, aufmerksam<br />
<strong>für</strong> die Geschichte ihrer Auslegung und die, diesie verantwortet haben,<br />
und aufmerksam <strong>für</strong> die eigene, vielstimmige und komplexe Gegenwart.<br />
Für diese »aufmerksame Kirche« hat <strong>Christian</strong><strong>Schad</strong> in unzähligenPredigten<br />
und Andachten, in Ansprachen, Vorträgenund Synodalberichten, in zahlreichen<br />
Veröffentlichungen nicht nur in theologischen Fachzeitschriften, sondern auch in<br />
kirchlichen und weltlichen Organen, geworben und plädiert und dabei ein breit
Vorwort 13<br />
gestreutes Publikum, auch über die eigene Konfession hinaus, angesprochen.<br />
Weggefährten und Kolleginnen aus Kirchenleitung und theologischer Wissenschaft<br />
würdigten sein Engagement inder 2021 anlässlich seines Abschieds<br />
als Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz in der Evangelischen<br />
Verlagsanstalt Leipzig erschienenen Festschrift »Neige Dein Ohr … Beiträge zur<br />
ökumenischen <strong>Theologie</strong>«.<br />
Am 14. Februar 2023 feiert <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> seinen 65. Geburtstag. Aus<br />
diesem Anlass ist ihm die vorliegende Publikation zugedacht. Sie vereint erstmals<br />
in einem Band insgesamt siebenundzwanzig seiner – auch ihm selbst<br />
wichtigen und <strong>für</strong> seine theologische Biographie charakteristischen – Aufsätze<br />
und Beiträge.<br />
Das erste Kapitel »Von der Reformation zur Union« ist auf den von <strong>Christian</strong><br />
<strong>Schad</strong> so hoch geschätzten Theologen Martin Luther und dessenzentrale Themen<br />
seiner reformatorischen <strong>Theologie</strong> fokussiert und klingt mit einem Blick auf die<br />
pfälzische Kirchenunion von 1818 und deren Gegenwartsbedeutung aus.<br />
Im zweiten Kapitel »Theologen der Neuzeit« würdigt <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> in<br />
neun Kurzbeiträgen bedeutende Denker des 19. und 20. Jahrhunderts, die <strong>das</strong><br />
Anliegen der Reformation jeweils bahnbrechend in ihre Zeit transformiert und<br />
weiterentwickelt haben: Friedrich Schleiermacher, Karl Barth und Rudolf Bultmann,<br />
dann die <strong>für</strong> <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> so prägenden ehemaligen bzw. gegenwärtigen<br />
Tübinger Theologen Ernst Fuchs, Gerhard Ebeling, Eberhard Jüngel und<br />
Jürgen Moltmann – ihre Porträts hängen gemeinsam mit dem Martin Luthers in<br />
<strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>s Arbeitszimmer – und zuletzt den jüngst verstorbenen Systematischen<br />
Theologen Christoph Schwöbel.<br />
Das dritte Kapitel »Kirche im Hören und Handeln« befasst sich mit einzelnen<br />
kirchlichen Handlungsfeldern und Themen, denen <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> in seinen<br />
über 35 Dienstjahren besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat und die ihm<br />
auch heute noch beachtenswert erscheinen. Hierzu zählen <strong>das</strong> Verhältnis von<br />
Staat und Religion, der missionarische Auftrag der Kirche, <strong>das</strong> aktuelle Bekennen<br />
des Glaubens im Echoraum des überkommenen christlichenBekenntnisses,<br />
<strong>das</strong> Gebet im Gottesdienst, die ökumenische Vision einer Kirchen- und Abendmahlsgemeinschaft,<br />
<strong>das</strong> Spannungsfeld von Gemeinde und Diakonie sowie die<br />
Seelsorge als Muttersprache der Kirche. Gedanken über die»Kirche in Zeiten von<br />
Corona« schließen diesen Textteil ab.<br />
Die bis in die Gegenwart reichende »Bibliographie <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>« dokumentiert<br />
noch einmal dessen vielfältigesWirken als evangelischer Theologe und<br />
Verantwortungsträger seiner Kirche.<br />
Alle Beiträge sind überarbeitet und aktualisiert. Ein Nachweis ihrer Erstveröffentlichungen<br />
findet sich am Ende des Buches. Drei Aufsätze werden hier<br />
erstmals publiziert. Die Anmerkungen und Literaturangaben sind vereinheitlicht;<br />
Abkürzungen richten sich nach Siegfried M.Schwertner, IATG 3 – Inter-
14 Vorwort<br />
nationales Abkürzungsverzeichnis <strong>für</strong> <strong>Theologie</strong> und Grenzgebiete, Berlin [u. a.]<br />
3 2017.<br />
Die Publikation des vorliegenden Bandes wurde ermöglicht durch namhafte<br />
Druckkostenzuschüsse der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der<br />
Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK),<br />
des Evangelischen Bundes, der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische<br />
Landeskirche) sowie der Kirchlichen Sozial- und Kulturstiftung, Speyer. Allen<br />
Zuschussgebern sei ganz herzlich hier<strong>für</strong> gedankt. Ein besonderer Dank gilt<br />
Herrn Kirchenpräsidenten Dr. Dr. h.c. Volker Jung, derzeit Vorsitzender der<br />
Vollkonferenz und des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen in der<br />
Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) und in dieser Funktion Nachfolger<br />
von <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>, <strong>für</strong> sein Geleitwort. Der Verlagsleiterin, Frau Dr. Annette<br />
Weidhas, danke ich, <strong>das</strong>s sie diePublikation in der Evangelischen Verlagsanstalt<br />
Leipzig ermöglicht und engagiert begleitet hat.<br />
Stellvertretend <strong>für</strong> so viele, die ihm begegnet sind und seine Nähe erfahren<br />
haben, die mit ihm zusammenarbeiteten, die im Dialog mit ihm standen, die<br />
mit ihm Gottesdienste und ganz und gar weltliche Feste feierten und dabei den<br />
Christen, den Menschen und Zeitgenossen <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> kennenlernen durften,<br />
danke ich ihm <strong>für</strong> gemeinsame Jahre theologischer Leidenschaft und konzentrierten<br />
Hörens auf <strong>das</strong> unverfügbare Wort des Evangeliums, gepaart mit<br />
erfahrener Menschenfreundlichkeit und achtsamer Empathie. Möge <strong>Christian</strong><br />
<strong>Schad</strong> uns auch weiterhin mit seiner Art, »<strong>Theologie</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Leben</strong>«zuentfalten,<br />
beschenken. Ich wünsche ihm, <strong>das</strong>s er unter Gottes Geleit noch viele Jahre in<br />
guter Gesundheit ein »<strong>Leben</strong> <strong>für</strong> die <strong>Theologie</strong>« führen kann.<br />
Speyer, im September 2022<br />
Dr. Traudel Himmighöfer<br />
Herausgeberin<br />
Leiterin der Bibliothek und Medienzentrale<br />
der Evangelischen Kirche der Pfalz
Zum Geleit<br />
»Auf jeden Fall bedarf es aber, um die Kircheleiten zu können, der <strong>Theologie</strong>. Und<br />
jedes ›Handeln mit theologischen Kenntnissen […] gehört immer in <strong>das</strong> Gebiet<br />
der Kirchenleitung‹, sodaß ›alle wahren Theologen auch an der Kirchenleitung<br />
Theil nehmen, und Alle die in dem Kirchenregiment wirksam sind auch in der<br />
<strong>Theologie</strong> leben‹.« Das hat Eberhard Jüngel – Schleiermacher zitierend und interpretierend<br />
– 1993 in einem Vortrag in Speyer gesagt. Es war ein Vortrag zum<br />
60. Geburtstag des damaligenpfälzischenKirchenpräsidenten Werner Schramm.<br />
Auch <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> hat seinerzeit als Theologischer Referent im Landeskirchenrat<br />
den Beitrag Jüngels gehört.<br />
<strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> lebt in der <strong>Theologie</strong>. So hat er auch seinen Dienst versehen –<br />
als Pfarrer, als Oberkirchenrat und als Kirchenpräsident der Evangelischen<br />
Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche). Er hat meines Erachtens viel<br />
von dem, was Eberhard Jüngel in dem Vortrag über »die theologische Aufgabe<br />
evangelischer Kirchenleitung« ausführt, geradezu verinnerlicht. 1<br />
Die in meinen Augen wesentlichen Punkte will ich hier nennen:<br />
⌥<br />
⌥<br />
⌥<br />
⌥<br />
Kirchenleitung hat dieAufgabe, die Kirche daran zu erinnern, sich selbst zu<br />
begrenzen. Denn es gilt, <strong>das</strong>s nicht wir es sind, »die da könnten die Kirche<br />
erhalten« (Martin Luther).<br />
Kirchenleitung erfolgt nichthierarchisch, sondern sie dient dem Auftrag der<br />
Kirche. Sie hört auf Gottes Wort und auf <strong>das</strong>, was Menschen bewegt. Sie zielt<br />
in ihren Entscheidungen auf Einsicht und Zustimmung. Wieder mit Luther:<br />
Sie wirkt »non vi, sed verbo« – nicht durch Gewalt, sondern durch<strong>das</strong> Wort.<br />
Kirchenleitung agiert nicht provinziell, sondern nimmt <strong>das</strong> Ganze der Kirche<br />
in den Blick. Sie sucht nach der Einheit der weltweiten Kirche Jesu Christi.<br />
Jüngel wörtlich: »Zur Reinheit des Auftrags der Kirche gehört aber nicht<br />
zuletzt dies: den dreieinigen Gott in einer die konfessionelle Vielfalt versöhnenden<br />
kirchlichen Einigkeit darzustellen und also dem Skandal einer<br />
gespaltenen Christenheit ein Ende zu machen.Evangelische Kirchenleitung<br />
hat die sichtbare Einheit der una sancta et apostolica als eine Zielbestimmung<br />
vor Augen zu stellen, die ohne Zögern Zug um Zug zu verwirklichen ihr<br />
wesentlich ist.«<br />
Kirchenleitung hat die Konsensfähigkeit von Lehraussagen zuprüfen und<br />
auf Gefährdungen aufmerksam zu machen.<br />
1<br />
Eberhard Jüngel, Was ist die theologische Aufgabe evangelischer Kirchenleitung?, in:<br />
ders., Indikative der Gnade – Imperative der Freiheit, Theologische Erörterungen IV,<br />
Tübingen 2000, S. 351–372.
16 Zum Geleit<br />
⌥<br />
Kirchenleitung ist nicht nur nach innen auf die Kirche bezogen, sondern<br />
immer auch auf die Welt. Dabei geht es darum, den Zuspruch und Anspruch<br />
des Evangeliums glaubwürdig in der Welt zu bezeugen, und zwar ohne irgendjemanden<br />
klerikal zu bevormunden.<br />
Nicht immer explizit, aber der Sache nach habe ich mit <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> viele<br />
Gespräche über diese Aufgaben geführt. Meistens anhand ganz konkreter kirchenpolitischer<br />
Herausforderungen und oft auch in Gesprächsrunden mit anderen<br />
Kolleginnen und Kollegen. Mal waren es Fragen, die uns als Kirchenleitende<br />
in den beiden Nachbarkirchen Pfalz und Hessen-Nassau bewegten, dann<br />
waren es Themen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), etwa in der<br />
Vorbereitung des Reformationsjubiläums oder aber im Blick auf die Weiterentwicklung<br />
der Zusammenarbeit von EKD, Vereinigter Evangelisch-Lutherischer<br />
Kirche Deutschlands (VELKD) und der Union Evangelischer Kirchen in der EKD<br />
(UEK). Ein besonderes Anliegen war und ist <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> die Ökumene. In<br />
aller Vielfalt nach der Einheit zu streben, ist <strong>für</strong> ihn ein wirkliches Herzensanliegen.<br />
Gemeinsam haben wir in unseren Gesprächen immer wieder den größeren<br />
Horizont gesucht – den Blick auf die gesellschaftliche und politische Situation,<br />
die hermeneutische und historische Perspektive und die theologischen<br />
Fragen, die uns in all dem begegnen. Dabei haben wir uns gegenseitig darin<br />
bestärkt, <strong>das</strong>s Kirchenleitung eine theologische und geistliche Aufgabe ist. Beeindruckt<br />
war ich immer wieder, wie sehr <strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong> dabei geradezu permanent<br />
im Gespräch mit der wissenschaftlichen <strong>Theologie</strong> war. Er hat den<br />
Kontakt insbesondere zu Professorinnen und Professoren der <strong>Theologie</strong> gepflegt<br />
und hat trotz der vielfältigen alltäglichen Anforderungen viel gelesen. Ja – und er<br />
hat dann Vorträge und Grußworte geschrieben und gehalten, Aufsätze, Artikel<br />
und Berichte verfasst und immer wieder gepredigt. Er hat so – im besten Sinn –<br />
Kirche durch <strong>das</strong> Wort geleitet. Es ist schön, <strong>das</strong>s einige seiner Texte jetzt in<br />
diesem Buch zugänglich sind. Ich wünsche der »<strong>Theologie</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Leben</strong>«, dem<br />
»Plädoyer <strong>für</strong> eine aufmerksame Kirche«, viele aufmerksame Leserinnen und<br />
Leser!<br />
Dr. Dr. h.c. Volker Jung<br />
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche<br />
in Hessen und Nassau<br />
Vorsitzender der Vollkonferenz und des Präsidiums<br />
der Union Evangelischer Kirchen in der<br />
Evangelischen Kirche in Deutschland
I. Vonder Reformation<br />
zur Union
Die Bibel –mehr als ein Buch<br />
Zum Schriftverst ndnis Martin Luthers<br />
»Luther und die HeiligeSchrift« – Lucas Cranach, der Künstler, hat dieses Motiv<br />
im Altarbild der Wittenberger Stadtkirche eindrucksvoll in Szene gesetzt. Rechts<br />
der sich auf die aufgeschlagene Bibel stützende Prediger, der dieses Buch als<br />
Bezeugung eines lebendigen Wortes versteht. Dieses Wort spricht die Menschen:<br />
Frauen und Männer, Alte und Junge, Erwachsene und Kinder, wie links im Bild<br />
dargestellt, offenbar so an, <strong>das</strong>s sie ganz Ohr sind. Ja, wir sollen es sehen: »Der<br />
Glaube kommt aus dem Hören« (Röm 10,17). Alles liegt demnach an der gebrauchten,<br />
der gepredigten, der verkündigten Bibel, an der lebendigen Stimme<br />
des Evangeliums, die öffentlich laut werden will.<br />
In der Mitte: Jesus Christus, der Gekreuzigte. Mit seiner Rechten weist Luther<br />
auf ihn, die Mitte der Schrift, hin: als auf <strong>das</strong> eine und einzige Wort, <strong>das</strong> der<br />
versammelten Gemeinde als Gabe und Geschenk dargereicht, ihr geradezu sakramentalausgeteilt<br />
wird. In diesem Bild malt uns Cranach auf einfache,inihrer<br />
Einfachheit aber genialen Weise <strong>das</strong> Schriftverständnis Martin Luthers vor Augen.<br />
Und wir müssen fragen: inwiefern?<br />
1. Luthers Spazierg nge: ber <strong>das</strong> Wesen christlicher<br />
Meditation<br />
»Allein die Schrift!«, »Sola scriptura!« 1 ,dieses Stichwort markiert eine Epochenwende.<br />
Weder <strong>das</strong> kirchliche Lehramt noch die Meinungen der verschie-<br />
1<br />
Vgl. Martin Luther, Predigten des Jahres 1528, WA 27; 287 und ders., Vorwort zu<br />
Melanchthons Annotationes (1522), WA 10,2; 310. Vgl. zum Folgenden durchgehend:<br />
Albrecht Beutel, Erfahrene Bibel. Verständnis und Gebrauch des verbum dei scriptum<br />
bei Luther, in: ders., Protestantische Konkretionen. Studien zur Kirchengeschichte,<br />
Tübingen 1998, S. 66–103, sowie ders., Gottes geschriebenes Wort, in: ders., In dem<br />
Anfang war <strong>das</strong> Wort. Studien zu Luthers Sprachverständnis, Tübingen 1991 (HUTh 27),<br />
S. 235–288.
20 I. Von der Reformation zur Union<br />
denen Interpreten durch die Jahrhunderte hindurch legen sie verbindlich aus.<br />
Vielmehr sei die Bibel »durch sich selbst ganz gewiss, ganz leicht verständlich,<br />
ganz offenbar und Auslegerin ihrer selbst, die alles prüft, beurteilt und<br />
erleuchtet« 2 :vergleichbar der strahlenden Sonne, die sich unsmitteilt, indem sie<br />
uns Licht und Wärme schenkt. 3 Nicht von einem neutralen, unbeteiligten<br />
Standort aus spricht Luther hier vom Widerfahrnis der Heiligen Schrift – als<br />
ginge es um pure Information über längst vergangene Geschichten und Nachrichten,<br />
um bloße Fakten- und Tatsachensicherung, ohne selbst davon berührt zu<br />
sein.<br />
Vielmehr soll ich, unter Einsatz meiner ganzen Existenz, die Bibel »meditieren«,<br />
<strong>das</strong> heißt »mit Gottes Wort umgehen: nicht allein im Herzen, sondern<br />
auch äußerlich die mündliche Rede und geschriebenen Worte im Buch immer<br />
treiben und reiben, lesen und wiederlesen, mit fleißigem Aufmerken und<br />
Nachdenken, was der heilige Geist damit meint«. 4 Anders als erwartet, stellt<br />
Luther hier <strong>das</strong> »Meditieren« anstatt auf Innerlichkeit ganz auf <strong>das</strong> Hören des<br />
äußeren Wortes ab. Er hält am Buchstaben, an der Grammatik des biblischen<br />
Textes fest, um sich vor einem Abdriften in müßige Spekulationen und Lieblingsgedanken<br />
zu bewahren. Ihnen gegenüber tritt Gottes Wort geradezu als<br />
»adversarius noster« 5 ,als »unser Widersacher« auf. Es bestätigt und bestärkt<br />
uns nicht einfach in dem, wo<strong>für</strong> wir uns halten und als was wir zu gelten<br />
wünschen. Nur durch die Verneinung und Erschütterung vermeintlicher<br />
Selbstverständlichkeiten hindurch – contra omnem experientiam 6 – gewährt uns<br />
Gottes Wort die wahrmachende Bejahung unserer selbst – und zieht uns so ins<br />
Einvernehmen, in den Frieden mit Gott. Gerade <strong>das</strong> Fremde, <strong>das</strong> Sperrige und<br />
Widerständige, <strong>das</strong> Unverbrauchte der biblischen Quellen, gilt es aufrechtzuerhalten<br />
und sie in ihrer lebenspendenden Kraft heute: auf dem Resonanzboden<br />
eigener Erfahrung sprudeln zu lassen. Das schließt den Gang in dieWüste nicht<br />
aus, sondern ein. Oft muss es uns regelrecht die Sprache verschlagen, bis wir<br />
endlich hören, was Gott uns und der Welt zu sagen hat.<br />
Luther verdeutlicht diesen Widerstreit nicht zufällig an der (auch unsere<br />
Gegenwart bestimmenden) Gebetsnot 7 ,die als Sprachkrise zugleich Ausdruck<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Martin Luther,Assertio omnium articulorum […]per bullam Leonis X. (1520), WA 7; 97.<br />
Vgl. ders., Weihnachtspostille (1522), WA 10,1,1; 62.<br />
Vgl. ders., Vorrede zum 1. Band der Wittenberger Ausgabe 1539, WA 50; 658–661,<br />
sprachlich überarbeitet von Gerhard Ebeling,Luther über <strong>das</strong> Studium der <strong>Theologie</strong>, in:<br />
ders., Studium der <strong>Theologie</strong>. Eine enzyklopädische Orientierung, Tübingen 1975, S. 177.<br />
Martin Luther, Dictata super Psalterium (1513–1516), WA 3; 574.<br />
Vgl. ders., Vorlesung über Jesajas (1527–1530), WA 31,2; 282.<br />
Vgl. ders., Eine einfältige Weise zu beten <strong>für</strong> einen guten Freund (1535), WA 38; 358–<br />
375 = Martin Luther, Ausgewählte Schriften, hrsg. von Karin Bornkamm und Gerhard<br />
Ebeling, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Insel Verlag 1982 (künftig: IL 2); 269–292.
Die Bibel –mehr als ein Buch 21<br />
unserer Glaubenskrise ist. Nicht <strong>das</strong> Gebetsgefühl, sondern <strong>das</strong> Gefühl, nicht<br />
beten zu können noch zu wollen (vgl. Röm 8,26); nicht die Gebetsstimmung,<br />
sondern die Ahnung, <strong>das</strong>s mit meinem Beten etwas nicht stimmt, bedingt nach<br />
Luther die Gebetssituation: »[…]Wenn ich fühle, daß ich durchfremde Geschäfte<br />
oder Gedanken kalt und ohne Lust zu beten geworden bin, […] nehme ich mein<br />
Psälterlein, laufe in die Kammer oder, wenn’s der Tag und die Zeit ist, in die<br />
Kirche zu den Leuten und fange an, die zehn Gebote, <strong>das</strong> Glaubensbekenntnis 8<br />
und […]etliche Sprüche Christi, des Paulus oder der Psalmen mündlich <strong>für</strong> mich<br />
selbst zu sprechen, ganz und gar wie die Kinder tun.« 9<br />
Das eigentliche Gebet kommt also nicht aus der Tiefe des Herzens, hervorgeholt<br />
etwa durch die Versenkung in sich selbst; sondern es kommt von außen,<br />
durch die buchstäbliche Meditation des Schriftwortes, und trifft dabei auf ein<br />
»erkaltetes Herz«. Erst dadurch: durch <strong>das</strong> Nach-Sprechen fremder Gebetsworte<br />
(vgl. Ps 1) wird der Mensch im Innern, im Herzen, in seinem Personzentrum also,<br />
erwärmt: »Wenn nun <strong>das</strong> Herz durch solch mündliches Sprechen erwärmt und zu<br />
sich selbst gekommen ist, so knie nieder oder stehe mit gefalteten Händen […]<br />
und sprich oder denke so kurz du kannst: Ach, himmlischer Vater, du lieber<br />
Gott […].« 10<br />
Demnach fängt <strong>das</strong> Herz, wenn es »recht erwärmt ist und zum Beten Lust<br />
hat«, an, die Gedanken auszusprechen, die ihm jetzt, in seiner konkreten Situation<br />
– etwa vom Vaterunser her – zufallen. Ja, es widerfahre mir dann,<strong>das</strong>s ich<br />
über dieser oder jener Bitte »in so reichen Gedanken spazieren komme, <strong>das</strong>s ich<br />
die andern [Bitten][…]lasse anstehen« 11 .SolchenSpaziergängenwill Luther um<br />
jeden Preis »Raum geben, ihnen mit Stille zuhören undsie beileibe nicht hindern.<br />
Denn da predigt der heilige Geist selbst, und ein Wort seiner Predigt ist besser als<br />
tausend unserer Gebete.« 12<br />
Beim meditativen Hersagen werden also die Textworte zum Medium, durch<br />
welches <strong>das</strong> Herz erweckt wird – und frei zu reden beginnt: Der Glaube ist<br />
mithin worthafter Glaube! Wie er aus dem empfangenen, vorgegebenen, vorgesprochenen<br />
Wort lebt, so lebt er auch in <strong>das</strong> verantwortende Wort hinein! Der<br />
vorgegebene Raum biblischer Sprache spielt mir dabei eine neue Sicht, eineneue<br />
Perspektive zu, bezieht mich in all meinen Erfahrungen mit ein in sie, wodurch<br />
ich mich selbst unddie Welt mit anderen Augen, mit den Augen Gottes nämlich,<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
Luther versteht nicht nur <strong>das</strong> Credo, sondern den gesamten Katechismus als Summe des<br />
biblischen Zeugnisses, als »Laienbibel«, vgl. ders., Katechismuspredigten. Zweite Predigtreihe<br />
(1528), WA 30,1; 27 und ders., Matth. 18–24, in Predigten ausgelegt (1537–<br />
1540), WA 47; 541.<br />
Ders., Eine einfältige Weise zu beten <strong>für</strong> einen guten Freund (1535), IL 2; 269.<br />
A.a. O., 270.<br />
A.a. O., 275.<br />
Ebd.
22 I. Von der Reformation zur Union<br />
wahrzunehmen lerne. Erfahrung wird so verändert, intensiviertund ganz und gar<br />
erneuert. Die Bibel ist <strong>das</strong> große Erfahrungsbuch und weist diejenigen, die sich<br />
mit ihr befassen, in eine neue Erfahrung ein: »Willst du die heilige christliche<br />
Kirche gemalet sehen mit lebendiger Farbe und Gestalt, in einem kleinen Bilde<br />
gefasset, so nimm den Psalter vor dich, so hast du einen feinen, hellen, reinen<br />
Spiegel, der dir zeigen wird, was die Christenheit sei. Ja, du wirstauch dich selbst<br />
drinnen und <strong>das</strong> rechte Gnotiseauton finden, dazu Gott selbst und alle Kreaturen.«<br />
13<br />
Worin diese neue Erkenntnis besteht? Darin, <strong>das</strong>s Gott sich in »seiner<br />
grundlosen Barmherzigkeit […] soväterlich zu mir verlorenem Menschen hinuntersenkt<br />
und sich selbst ungebeten, ungesucht, unverdient mir anbietet, mein<br />
Gott zu sein, sich meiner anzunehmen, und in allen Nöten mein Trost, mein<br />
Schutz, meine Hilfe und Stärke sein will. Wir armen, blinden Menschen haben<br />
doch sonst so mancherlei Götter gesucht und müßten sie noch suchen, wenn er<br />
sich nicht selbst sooffenbar hören ließe und sich uns nicht in unserer menschlichen<br />
Sprache anböte, daß er unser Gott sein wolle.« 14 Darum gilt: »Ubi verbum,<br />
ibi paradisus et omnia« 15 :»Wo [sein] Wort ist, da ist auch <strong>das</strong> Paradies und alles.«<br />
Es ist – wie menschliche Sprache überhaupt – <strong>Leben</strong>s-Vorgabe, <strong>Leben</strong>selixier,<br />
<strong>Leben</strong>smittel schlechthin. »Denn noch heute sauge ich« daran »wie ein Kind,<br />
trinke und esse von ihm wie ein alter Mensch, kann seiner nicht satt werden.« 16<br />
Selbst-, Welt- und Gotteserkenntnis gibt es also nicht auf dem direkten,<br />
kurzen Weg unmittelbarer Einsicht; sondern nur über den Umweg der Vermittlung<br />
durch biblische Bilder, Worte und Erzählungen. Ihre Funktion ist,<br />
wegzuführen; nicht nur von den Geschäften, sondern mehr noch von sich selbst,<br />
von den eigenen Gedanken und unmittelbaren Gefühlen, umfern der eigenen,<br />
bisherigen, altenSicht der Dinge eine neue Erfahrung, eine »durch Gott eröffnete<br />
Erfahrung mit aller Erfahrung« 17 zu stiften. Und darüber hinaus: durch dieses<br />
existentielle Sich-selbst-Versenken in den Text, in die alten Geschichten und<br />
biblischen Bilder, zu eigenem, selbstständigem Reden ermächtigt und instand<br />
gesetzt zu werden.<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
Ders., Luthers Vorrede auf den Psalter (1528/1545), WA.DB 10,1; 104f. =Mü 3 6, 37; vgl.<br />
auch ders., Die Vorlesung über den Römerbrief. Die Scholien (1515–1516), WA 56; 229.<br />
Ders., Eine einfältige Weise zu beten <strong>für</strong> einen guten Freund (1535), IL 2; 278 (Hervorhebung<br />
von mir).<br />
Ders., Vorlesungen über 1. Mose (1535–1545), WA 43; 673.<br />
Ders., Eine einfältige Weise zu beten <strong>für</strong> einen guten Freund (1535), IL 2; 277 – hier<br />
bezogen auf <strong>das</strong> Vaterunser.<br />
Eberhard Jüngel, Gott – um seiner selbst willen interessant, in: ders., Entsprechungen:<br />
Gott – Wahrheit – Mensch. Theologische Erörterungen, München 1980, S. 196 (Hervorhebung<br />
von mir).
2. Die Kunst des Dolmetschens<br />
Die Bibel –mehr als ein Buch 23<br />
Dass die Bibel in dieser Weise zur Sprachschule, zur Sprachschule des Glaubens,<br />
werden kann, dazu sollte nicht zuletzt die von Luther geleistete Übersetzungder<br />
Schrifthelfen. Dabei – seinem Sprachgebrauch gemäß – von »Dolmetschung« 18 zu<br />
reden, ist insofern treffender, als er diese Tätigkeit nicht als eine gleichsam<br />
mechanische, einlinige Bewegung, nicht als ein »Über-setzen« von der Ur- in die<br />
Muttersprache, ansah, sondern als ein fortwährendes Hin und Her, <strong>das</strong> sich mit<br />
der deutschsprachigen Wiedergabe immer auch <strong>für</strong> die Verbesserung des Verstehens<br />
verantwortlich wusste.<br />
Luther plädiert dabei zunächst <strong>für</strong> die Freiheit vom Buchstaben: im Sinne<br />
gegenwärtig wahrzunehmender Wortverantwortung. Oberstes Ziel ist, »daß ich<br />
rein und klar Deutsch geben möchte« 19 .Hierher gehört denn auch jene bekannte<br />
Passage, die man zur sprichwörtlichen Wendung:»dem Volk aufs Maul schauen«<br />
verdichtet hat. Freilich war damit nie ein »dem-Volk-nach-dem-Munde-Reden«<br />
gemeint; sondern die Aufforderung, »<strong>das</strong> Volk« und also »die Mutter im Hause,<br />
die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt« 20 in seinen<br />
ursprünglichen Sprechsituationen aufzusuchen und davon zu lernen. Die Freiheit<br />
vom Buchstaben hatte somit nur den einen Zweck, nämlich den im Urtext<br />
gemeinten Sinn auch im Deutschen treffsicher zu bewahren. So hat er etwa die<br />
holprig-korrekte Wiedergabe des Grußes, mit dem der Engel bei Maria eintritt,<br />
durch »voll Gnaden« (vgl. Lk 1,28) herzlich verspottet. Das klinge wie »ein Faß<br />
voll Bier, ein Beutel voll Geldes«. »Du Holdselige«, schlägt er stattdessen vor; noch<br />
lieber wäre ihm, er könnte ganz frei übersetzen: »Du liebe Maria!« 21<br />
In diesen Zusammenhang gehört auch Luthers bewusst vollzogene Einführung<br />
der Exklusivpartikel »allein« in den Text Römer 3,28: »daß der Mensch<br />
gerechtwerde ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben«; obwohl in der<br />
Vorlage doch nur »per fidem«, »durch den Glauben«, steht. Dabei beruft ersich<br />
zunächst auf die Eigenart der deutschen Sprache, die in der Verknüpfung einer<br />
negativen undeiner positiven Aussage die letztere durchein »allein« (entspricht<br />
unserem »nur«) profiliere. Allerdings habe ihn auch »der Text und die Meinung<br />
S. Pauli« 22 zu seiner Überzeugung genötigt. Denn Übersetzen heißt: Auslegen! Ob<br />
eine Stelle richtig übertragen worden ist, lässt sich darum letztlich nur von der<br />
Sache her entscheiden. Am Beispiel des »sola fide« aus Römer 3,28 stellt Luther<br />
klar, <strong>das</strong>s sich die sprachliche Kompetenz, die <strong>das</strong> Geschäft des Dolmetschens<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
Vgl. Martin Luther, Sendbrief vom Dolmetschen (1530), WA 30,2; 632–643 =Mü 3 6,<br />
9–20.<br />
A.a. O., Mü 3 6, 13.<br />
A.a. O., 14.<br />
A.a. O., 15.<br />
A.a. O., 17.
24 I. Von der Reformation zur Union<br />
allerdings erfordert, gerade darin erweist, <strong>das</strong>s sie sich zugleich als sachliche<br />
und <strong>das</strong> heißt als theologische Kompetenz kenntlich macht. Weil die Frage der<br />
Rechtfertigung ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben »<strong>das</strong><br />
Hauptstück christlicher Lehre« 23 ,den articulus stantis et cadentis ecclesiae,<br />
betrifft, steht seine Übersetzung nicht zur Disposition: »[…] wer S. Paulus lesen<br />
und verstehen soll, der muß wohl so sagen und kann nicht anders; seine Worte<br />
sind zu stark und leiden kein, ja gar kein Werk. Ists kein Werk, so muß es der<br />
Glaube allein sein.« 24<br />
Darum ist es ganz folgerichtig, wenn Luther die im Namen des Textsinns<br />
proklamierte Freiheit vom Buchstaben durch die gegenläufige Regel begrenzt.<br />
Denn mitunter könne es geboten sein, <strong>das</strong>s man um der Treue zum biblischen<br />
Buchstaben willen nicht gefällig, sondern wörtlich übersetzen müsse. Und dies<br />
hängt damit zusammen, <strong>das</strong>s die Art und Weise, wie die Bibel die alten Wörter<br />
neu verwendet 25 ,also der Brauch, die Weise, die ganz spezifische Art der Schrift<br />
zu reden (der modus loquendi scripturae 26 ), in seiner Sachnähe nicht zu übertreffen<br />
sei.<br />
Luther denkt hier besonders an die biblischen Bilder:andie Metaphern und<br />
Gleichnisse, die <strong>das</strong> Neue und Überraschende, <strong>das</strong> alle Dimensionen Sprengende<br />
des Gottesreiches uneinholbar präsentieren.Gerade die ungewöhnliche, die neue<br />
Sprache ist <strong>für</strong> ihn Spiegelbild der ungewöhnlich-neuen Sache. In der immer<br />
wiederkehrenden Mahnung, sich an die Sprache der Bibel zu gewöhnen und diese<br />
zu erlernen 27 ,ist darum stets die Aufforderung enthalten, sich der mit der<br />
Sprachzumutung gegebenen Verstehenszumutung auch lebenspraktisch auszusetzen:<br />
sich in dem sprachlich Fremden auch <strong>das</strong> sachlich Fremde, nämlich <strong>das</strong><br />
Urteil Gottes, anzueignen. Weil dieses quer steht zum Urteil und zur Sichtweise<br />
des Menschen, schärft Luther folglich immer wieder die antithetische Sprachund<br />
Denkstruktur der Bibel ein. 28 An diesem Dennoch des Glaubens aber entscheide<br />
sich nicht weniger als <strong>Leben</strong> oder Tod! Denn: »So Gott spricht, so geschieht’s«<br />
(Ps 33,9). »Unsers Herrgotts Sprach«ist nicht einebloßeStimme oder<br />
die leere Luft eines klingenden Instruments 29 ,»sed dictum et factum ist eins« 30 .<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
Ebd.<br />
A.a. O., 19.<br />
Vgl. ders., VomAbendmahl Christi. Bekenntnis (1528), WA 26; 277.<br />
Vgl. etwa ders., Vorlesung über die Stufenpsalmen (1532/33) [1540], WA 40,3; 225;<br />
ders., Weihnachtspostille 1522, WA 10,1,1; 544; ders., Wider die himmlischen Propheten,<br />
von den Bildern und Sakrament (1525), WA 18; 187; ders., Der Prophet Sacharja<br />
ausgelegt (1527), WA 23; 561.<br />
Vgl. ders., Predigten des Jahres 1536, WA 41; 658.<br />
Vgl. ders., In epistolam S. Pauli Galatas Commentarius [1531] (1535), WA 40,1; 391.<br />
Ders., Enarratio Psalmi secundi 1532, WA 40,2; 230.<br />
Ebd.
Die Bibel –mehr als ein Buch 25<br />
Im Anschluss an <strong>das</strong> biblische Wortverständnis ist <strong>für</strong> Luther »Wort« immer<br />
schöpferisches Tat-Wort (verbum efficax); nicht bloß Signal, nicht einfach nur<br />
Zeichen,<strong>das</strong> auf eine andere Sache außerhalb seiner hinweist, sondern die Sache,<br />
die neue Wirklichkeit, Anbruch der neuen Zeit, selbst. Es ist gerade <strong>das</strong> Wesen<br />
des göttlichen Wortes, <strong>das</strong>s es die Wirklichkeit dessen, was es aussagt, zugleich<br />
mit sich führt; nicht bloß beschreibt, sondern schafft, erschließt, sichtbar macht<br />
und im Vollzug des Sprechens auch darreicht, indem es tut, was es sagt – und<br />
sagt, was es tut. »Gott […]allein weiß, wie von Gott recht zu reden sei.« 31 An seine<br />
»seltsameRede undneue Grammatica« 32 sollen wir uns deshalb gewöhnen, nicht,<br />
um sie gedankenlos und unausgelegt nur zu rezitieren, sondern, durch ihre<br />
Widerständigkeit heilsam wachgerüttelt, aufmerksam zu werden <strong>für</strong> <strong>das</strong> Urteil<br />
Gottes, <strong>das</strong> unseren Blick schärfen und ihm eine neue Richtung geben will.<br />
Ohne Erinnerung – keine Erneuerung! Ohne eine gewisse Ungleichzeitigkeit kein<br />
Neubeginn! Gerade um der gegenwärtigen Sprachverantwortung, der gegenwärtigen<br />
<strong>Leben</strong>sbedeutsamkeit des christlichen Glaubens willen muss ein Prediger<br />
– nach Luther »mitten in der Schriftsitzen« 33 .Mit Rudolf Bohren lässt sich<br />
die Konsequenz aus dieser Ortsanweisung als »Erweiterung der Sprache« 34 bezeichnen.<br />
Damit aber kehrt sich die Verstehensaufgabe in gewisser Weise um:<br />
»Nicht so sehr die Übersetzung der Schrift inunsere Sprache stünde dann zur<br />
Debatte, sondern die Verwandlung unserer Sprache in die der Bibel!« 35<br />
3. Die Sprache des Glaubens zwischen Schrift und<br />
Erfahrung<br />
Es gibt offenbar einen Grundbestand an Bildern und Symbolen, ohne die der<br />
christliche Glaube nicht aussagbar ist; weshalb, wo jede Vertrautheit mit der<br />
biblischen Sprache verschwunden ist, auch die Zwiesprache mit Gott verstummen<br />
muss. Die Möglichkeit scheidet dann aus, die Schönheit und die Schrecklichkeit<br />
der Welt, die Freude und die Angst des eigenen Herzens, <strong>das</strong> Gefordertsein<br />
und dieSehnsucht nach Halt und Trost so zur Sprache zu bringen, <strong>das</strong>s<br />
sie vor Gott und von Gott her zur Wahrheit gelangen. Da<strong>für</strong> fehlen einem nun<br />
die Worte: die Bilder und Vorbilder, die Beispiele und Ermutigungen, die Erzählungen<br />
und überlieferten Erfahrungen, die Gebote und Zusagen, kurz, der<br />
Sprachraum der Bibel als eine unerschöpfliche Sprach-Hilfe. Man verliert aber<br />
auch den Beistand einzelner Sprüche oder Gebetsworte, die nun nichtmehrdem<br />
31<br />
32<br />
33<br />
34<br />
35<br />
Ders., Predigten des Jahres 1535, WA 41; 275.<br />
Ders., Predigten des Jahres 1531, WA 34,2; 480.<br />
Ders., Predigten Luthers, gesammelt von Joh. Poliander (1519–1521), WA 9; 664.<br />
Rudolf Bohren, Predigtlehre, München 4 1980, S. 131.<br />
A.a. O., S. 134.
er <strong>das</strong> Gebet<br />
Eine Erinnerung an Martin Luther<br />
1. Die Gebetsnot als Abgrundsituation<br />
Das Gebet steckt in der Krise. Ob nun »ein Gebetskollaps in der Moderne« diagnostiziert<br />
wird (GerhardEbeling) oder im Blick auf aktuelle Gebetspraxis gefragt<br />
wird: »Sind <strong>das</strong> noch Gebete?« (Manfred Seitz), ist dem Ergebnis nach gleich und<br />
verdichtet nur die leidvolle Erfahrung, nicht oder zumindest nicht mehr recht<br />
beten zu können. Warum? Weil <strong>das</strong> Gegenüber, <strong>das</strong> im Gebet mitgesetzte Du,<br />
Gottes Wirklichkeit also, verwaist, verschwunden ist. Die Gebetskrise ist im<br />
Letzten Gotteskrise, verursacht durchden Verlustseiner Nähe, die Erfahrung der<br />
Abwesenheit Gottes selbst. 1 Bete ich ins Leere hinaus?Diese Frage, die <strong>das</strong> Beten<br />
zuweilenbegleitet, wird fatal, wenn sie es am Ende ganz verhindert. Dann ist die<br />
Tür zur Gebetskammer ins Schloss gefallen, zugeschlossen von außen. Nicht,<br />
<strong>das</strong>s sich der Mensch nicht Ersatzkammern geschaffen hätte! Ingewisser Weise<br />
ist <strong>das</strong> Werk, <strong>das</strong> Selbstgewollte und Selbstgemachte, die ungebremste Aktivität,<br />
zum Heiligtum unseres Seins geworden. Und doch geht in entscheidenden<br />
Punkten die Rechnung nicht auf. Die beispiellosen Exzesse der Gewalt, die wir in<br />
unserem Jahrhundert sehen, stammen sie nicht aus der immer bedenkenloseren<br />
Entfesselung menschlicher Täterschaft? Und sind nicht gerade die Opfer, die <strong>für</strong><br />
immer Verstummten und dieunter Schmerzen Leidenden, bis hin zur seufzenden<br />
Kreatur um uns da<strong>für</strong> ansprechbar, <strong>das</strong>s sich <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> eben nicht mit unserem<br />
Werk deckt? Kein Wunder, <strong>das</strong>s angesichts dieser zerrissenen Welt die entgegengesetzte<br />
Richtung immer mehr an Attraktivität gewinnt: der Wegindie Innerlichkeit,<br />
in die Kammer der eigenen Seele. Ich-Erfahrung als Heils-Erfahrung.<br />
Sehnsuchtsvolle Suche nach Echtheit und Glück, nach Ganzheitlichkeit und Sinn,<br />
nach eindeutigem und erfülltem <strong>Leben</strong>.<br />
1<br />
Vgl. Rolf Schäfer, Gott und Gebet. Die gemeinsame Krise zweier Lehrstücke, in: ders.,<br />
Gotteslehre und kirchliche Praxis. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Ulrich Köpf und<br />
Reinhard Rittner, Tübingen 1991, S. 1–12.
36 I. Von der Reformation zur Union<br />
Aber tragen die Bilder, diejetzt in uns aufsteigen: aus der Tiefe unmittelbarer<br />
Selbsterfahrung, aus dem Gespräch ganz mit uns selbst? Haben sie Bestand vor<br />
den Szenen des Bösen und Nichtigen, die sich ja nicht bloß außerhalb, sondern<br />
auch in uns selbst abspielen? Dämmen sie die Angst, auch die Angst vor uns<br />
selber ein,wenn es um die Frage geht, was bleibt, worauf Verlass istim<strong>Leben</strong> und<br />
im Sterben?Oder zerreißt <strong>das</strong> Netz unserer Einbildungskraftanbeliebiger Stelle?<br />
Erweist es sich als trügerisch und ohnmächtig, weil geknüpft aus dem verklärenden<br />
Schein illusionärer Symbole und Wunschphantasien? Vermag ich es<br />
überhaupt, gemessen an der konkreten <strong>Leben</strong>serfahrung, Bürge zu sein <strong>für</strong><br />
Letztgewissheit und <strong>das</strong> heißt doch: <strong>für</strong> heiles, erlöstes, unbedingt bejahtes <strong>Leben</strong>?<br />
Die Not, die sprichwörtlich <strong>das</strong> Beten lehrt, ist trotz aller Ersatzhandlungen<br />
ganz offenbar nicht verebbt. Sie hat sich in gewisser Weise noch gesteigert. Denn<br />
mit dem Verlust des göttlichen Gegenübers ist auch die Quelle versiegt, aus der<br />
dem Gebet einst Sprache zufloss. »Ich bin stumm, wenn ich beten will« 2 ,soklagt<br />
Martin Walser die Vereinsamung des sprachlos auf sich selbstZurückgeworfenen<br />
an. Darin aber, <strong>das</strong>s alles nach und zum Gebet ruft, ohne <strong>das</strong>s erlösendes Gebetswort<br />
sich einstellen mag, darin besteht die eigentliche Krise, die Gebetsnot,<br />
die Unfähigkeit zum Beten.<br />
Eben dieser Abgrund steht auch <strong>für</strong> Luther am Anfang. Nicht <strong>das</strong> Gebetsgefühl,<br />
sondern <strong>das</strong> Gefühl, nicht beten zu können 3 ;nicht die Gebetsstimmung,<br />
sondern die Ahnung, <strong>das</strong>s mit meinem Beten etwas nicht stimmt, bedingt nach<br />
ihm die Gebetssituation. In seiner kleinen Schrift»Eine einfältige Weise zu beten<br />
<strong>für</strong> einen guten Freund« 4 von 1535 heißt es zu Beginn: »[…] wenn ich fühle, daß<br />
ich durchfremde Geschäfte oder Gedanken kalt undohne Lust zu beten geworden<br />
bin, […] nehme ich mein Psälterlein, laufe in die Kammer oder, wenn’s der Tag<br />
oder die Zeit ist, in die Kirche zu den Leuten und fange an, die zehn Gebote, <strong>das</strong><br />
Glaubensbekenntnis 5 und, je nachdem wie ich Zeit habe, etliche Sprüche Christi,<br />
des Paulusoder der Psalmen mündlich <strong>für</strong> mich selbst zu sprechen, ganz und gar<br />
wie die Kinder tun« 6 .<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Martin Walser, Halbzeit, Frankfurt a. M. 1973, S. 355.<br />
Vgl. Röm 8,26.<br />
Martin Luther, Eine einfältige Weise zu beten <strong>für</strong> einen guten Freund (1535), WA 38;<br />
358–375, im Folgenden zitiert nach Martin Luther, Ausgewählte Schriften, hrsg. von<br />
Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Bd. 2, Frankfurt a. M.: Insel Verlag 1982<br />
(künftig: IL 2); 269–292.<br />
Luther versteht nicht nur <strong>das</strong> Credo, sondern den gesamten Katechismus als Summe des<br />
biblischen Zeugnisses, als »Laienbibel«, vgl. ders., Katechismuspredigten. Erste Predigtreihe<br />
(1528), WA 30,1; 27 und ders., Matth. 18–24 in Predigten ausgelegt (1537–<br />
1540), WA 47; 541.<br />
Ders., IL 2; 269.
er <strong>das</strong> Gebet 37<br />
2. Das Sakrament des Wortes 7<br />
Die Gebetskammer muss mir demnach von außen wieder geöffnet werden. Das<br />
eigentliche Gebet kommt nicht aus der Tiefe des Herzens, hervorgeholt etwa<br />
durch die Versenkung in sich selbst, sondern von außen, durch die buchstäbliche<br />
Meditation des Schriftwortes 8 ,über den Umweg der Vermittlung durchbiblische<br />
Bilder, Worte und Erzählungen. In sie, in den Bildraum ihrer Farben, sollen wir<br />
uns regelrecht hineinfallen lassen, weil sie uns ablenken und fortführen sowohl<br />
von unserer rastlosen Geschäftigkeit als auch den eigenen Gedanken und Gefühlen<br />
– den gängigen Sehgewohnheiten und Leitbildern, den heimlichen und<br />
unheimlichen Hervorbringungen des »erkalteten« Herzens. Einprägen wollen sie<br />
uns dagegen den gnädigenGott, den uns in Liebe undFreundlichkeit zugeneigten<br />
Schöpfer. Behutsam unddoch mit überführender, freimachenderKraftsprechen<br />
sie in rettenden Zeichen, ihren Gegenbildern und Gegengeschichten, Gott an<br />
uns heran und tragen ihn hinein in unser <strong>Leben</strong>. Anschaulich und sinnenfällig 9<br />
wartet Gott uns darin entgegen. Einem überreich gedeckten Gabentisch vergleichbar,<br />
legt er sich in ihnen förmlich aus, bietet er sich uns dar und spricht:<br />
»Nehmet, esset!« 10 ,»Seht, was vor Augen liegt!« 11 ,»Schmecket und sehet, wie<br />
freundlich der Herr ist!« 12 .Sospendet er Nahrung <strong>für</strong> Leib und Seele. Er belebt<br />
unsren verfinsterten, gottvergessenen Blick und öffnetuns die Augen. Lässt uns<br />
zusammen mit sich auch uns und die gesamte Welt in einem neuen Licht erscheinen.<br />
Worin <strong>das</strong> Neue dieser Sichtweise besteht? Darin, <strong>das</strong>s Gott sich in<br />
»seiner grundlosen Barmherzigkeit […] zumir verlorenem Menschen hinuntersenkt<br />
und sich selbst ungebeten, ungesucht, unverdient mir anbietet mein Gott<br />
zu sein, sich meiner anzunehmen, und in allen Nöten mein Trost, mein Schutz,<br />
meine Hilfe und Stärke sein will. Wir armen blinden Menschen haben doch<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
Vgl. ders., Predigten Luthers, gesammelt von Joh. Poliander (1519–1521), WA 9; 440<br />
(übersetzt): »Alle Worte, alle Geschichten der Evangelien sind gewisse Sakramente, d.h.<br />
heilige Zeichen, durch welche Gott in den Glaubenden wirkt, was immer jene Geschichten<br />
meinen.« Siehe dazu <strong>Christian</strong> Möller, Welche Bedeutung hat der biblische<br />
Text <strong>für</strong> die Predigt?, in: ders., Seelsorglich predigen. Die parakletische Dimension von<br />
Predigt, Seelsorge und Gemeinde, Göttingen 1983, S. 15–29.<br />
Luther verweist in diesem Zusammenhang auf <strong>das</strong> biblische Urbild des »meditari«<br />
(Vulgata): Ps 1,1f., vgl. ders., IL 2; 270.<br />
Vgl. ders., IL 2; 276: »Gedanken, Sinne und Augen« (Hervorhebung von mir) sind »gar<br />
genau auf <strong>das</strong> Messer und auf die Haare [sc. zu] richten«, d.h. auf <strong>das</strong> biblische Wort<br />
[»Messer«] in der applicatio auf den Einzelnen [»Haare«]. So kommt es auch zum<br />
»Schmecken« der »Buchstaben oder Tüttel« (a. a. O., 277).<br />
Mt 26,26.<br />
2Kor 10,7.<br />
Ps 34,9.
38 I. Von der Reformation zur Union<br />
sonst so mancherlei Götter gesucht und müßten sie noch suchen, wenn er sich<br />
nicht selbst sooffenbar hören ließe und sich uns nicht in unserer menschlichen<br />
Sprache anböte, daß er unser Gott sein wolle« 13 .<br />
Sein Wort ist unsere zweite Muttersprache. <strong>Leben</strong>s-Vorgabe, <strong>Leben</strong>sraum,<br />
<strong>Leben</strong>smittel schlechthin, wie <strong>das</strong> uns von unseren Eltern anfänglich Zugesprochene:<br />
Kommunikation, in der <strong>Leben</strong>, Liebe und Sprache noch unmittelbar<br />
Eines sind. »Wiedergeburt aus dem Muttergrund der Heiligen Schrift« 14 ;»noch<br />
heute«, bekenntLuther, »sauge ich am Vaterunserwie ein Kind, trinke undesse<br />
von ihm wie ein alter Mann, kann seiner nicht satt werden« 15 .<br />
Washier erfolgt, ist nichts weniger als dieUmkehr, die Verwandlung unserer<br />
Einbildungskraft 16 .»Hier leuchtet […] ein großes Licht in dein Herz hinein« 17 ,so<br />
besingt Luther die in den »goldenen Buchstaben« 18 der Schrift, ihrem Wort-<br />
»Schatz« also 19 ,andringende Gegenwart Gottes. Und er vergleicht die uns darin<br />
vorgegebenen Sprachformen mit einem »Feuerzeug« 20 .Was in dem angefachten<br />
Feuer verbrennen muss,ist Gottes Abwesenheit; was gewärmt wird, sind unsere<br />
kalten Herzen, und was sich mit Hilfe dieses Feuerzeugs entzünden lässt, sind<br />
Gebete, ja geradezu Lob- und Danklieder 21 ,aber auch Bekenntnisse, Schuldeingeständnisse<br />
sowie Bittrufe um Hilfe. 22 Gebete des nach oben geöffneten und<br />
aufgeschlossenen Menschen, der Gottes zuvorkommende Menschenfreundlichkeit<br />
spiegelbildlich mit Gottesfreundlichkeit erwidert: »Wenn nun <strong>das</strong> Herz durch<br />
solch mündliches Sprechen erwärmt und zu sich selbst gekommen ist, so knie<br />
nieder oder stehe mit gefalteten Händen […] und sprich oder denke so kurz du<br />
kannst: Ach, himmlischer Vater, du lieber Gott« 23 .Demnach fängt <strong>das</strong> Herz, wenn<br />
es »recht erwärmt ist und zum Beten Lust hat« 24 ,an, die Gedanken auszusprechen,<br />
die ihm jetzt, in seiner konkreten <strong>Leben</strong>ssituation, etwa vom Vaterunser<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Martin Luther, IL2;278.<br />
Erik H. Erikson, Der junge Martin Luther, Frankfurt a. M. 1975, S. 229.<br />
Martin Luther, IL2;277.<br />
Vgl. Paul Ricœur, Stellung und Funktion der Metapher in der biblischen Sprache, in:<br />
ders. /Eberhard Jüngel,Metapher. Zur Hermeneutik religiöser Sprache, München 1974<br />
(Sonderheft EvTh), S. 70.<br />
Martin Luther, IL2;289 f.<br />
Ders., Crucigers Sommerpostille (1544), WA 21; 479.<br />
Vgl. ders., IL 2; 280.<br />
A.a. O., 289.<br />
Luther nennt die »Danksagung« (a.a. O., 277) »ein Gesangbüchlein«!<br />
In »Lehre«, »Danksagung«, »Beichte« und »Gebet« bestehen die vier Schritte der Meditation,<br />
Luthers »vierfaches oder […] vierfach gedrehtes Kränzlein« (a.a. O., 277). Vgl.<br />
dazu Martin Nicol, Meditation bei Luther, Göttingen 2 1991, S. 160–167.<br />
Martin Luther, IL2;270.<br />
A.a. O., 275.
er <strong>das</strong> Gebet 39<br />
her zufallen. Ja, es widerfahre mir dann, <strong>das</strong>s ich überdieser oder jener Bitte »in<br />
so reichen Gedanken spazieren komme, daß ich die andern [sc. Bitten] […]lasse<br />
anstehen«. Solchen Spaziergängen will Luther um jeden Preis »Raum geben,<br />
ihnen mit Stille zuhören und sie beileibe nicht hindern. Denn da predigt der<br />
heilige Geist selbst« 25 . – Es wird ein Geist sein, der aus der Bibel herüberweht!<br />
3. Die Schrift als Spazier-Raum<br />
Beim meditativen Hersagen werden die Textworte offenbar zum Medium, durch<br />
welches <strong>das</strong> Herz, <strong>das</strong> Personzentrum also, erweckt wird und die hilflose<br />
Sprachlosigkeit, <strong>das</strong> notvolle Ver-Sagen, schwindet. Wenn auch geleitet, getragen,<br />
inspiriert durch die Prägekraft des biblisch Vorgesprochenen, verstanden<br />
als Hör-Saal, als »Sprachschule des Glaubens« 26 ,sogibt Luther doch ausdrücklich<br />
25<br />
26<br />
Ebd. Vgl. zum Motiv des Spazierengehens die mit Luthers Gedanken gut zusammenstimmende<br />
Erzählung von Robert Walser, Der Spaziergang, Zürich 1978.<br />
Weil der menschliche vom Heiligen Geist unterschieden ist und er sich die Sprache der<br />
Schriftund des Geistes nicht selber aneignen kann, ist der Mensch, um zum Glauben zu<br />
kommen (vgl. Röm 10,17: »fides ex auditu«), an ein »praescriptum«, eine Vorgabe<br />
göttlicher Rede, gebunden, vgl. Martin Luther,Die Disputation über Joh 1,14 (1539), WA<br />
39,2; 4; ders., Die Zirkulardisputation de veste nuptiali (1537), WA 39,1; 288.304 u.ö.<br />
Denn »Gott […]allein weis, wie von Gott recht zu reden sey« (ders., Predigten des Jahres<br />
1535, WA 41; 275 – Hervorhebung von mir). Vgl. auch ders., Predigten des Jahres 1537,<br />
WA 45; 205: <strong>das</strong>s wir »unserm Herrn Jhesu Christo […]nachreden, wie er uns vorredet«.<br />
Gewendet auf die Vorgabe der Gebetssprache, kann Luther im Großen Katechismus in<br />
der Einleitung zum Vaterunser sagen: »Uber <strong>das</strong> sol uns auch locken und ziehen, <strong>das</strong> Gott<br />
neben dem Gebot und verheissunge zuvor kömpt und selbst die wort und weise stellet<br />
und uns in mund legt, wie und was wir beten sollen« (ders., Der Große Katechismus<br />
[1529],WA30,1; 196, Hervorhebung von mir, vgl. BSELK, S. 1076, 28–30). Aus alledem<br />
folgt, <strong>das</strong>s die Bibel als »praescriptum« in der Tatals Sprachschule des Glaubens fungiert.<br />
Zugespitzt etwa auf die Vorgabe der Psalmen gilt: »Summa, der Psalter ist eine rechte<br />
Schule, darinnen man den Glauben und gut Gewissen zu Gott lernt, übet und stärkt«<br />
(ders., Nachwort zum Psalter von 1525, WA.DB 10,1; 588, zit. nach Mü 3 6; 39). Liest es<br />
sich nicht wie ein erhellender Kommentar, wenn der Neutestamentler analog formuliert:<br />
»Das Neue Testament ist selber ein hermeneutisches Lehrbuch. Es lehrt die Hermeneutik<br />
des Glaubens, kurz, die Sprache des Glaubens, und ermutigt uns, die Sprache selbst<br />
auszuprobieren, damit wir mit – Gott vertraut werden.« (Ernst Fuchs, Das Neue Testament<br />
und <strong>das</strong> hermeneutische Problem, in: ders., Glaube und Erfahrung. Zum christologischen<br />
Problem im Neuen Testament, Gesammelte Aufsätze III, Tübingen 1965,<br />
S. 169). Im Blick auf die gegenwärtig wahrzunehmende theologische Sprachverantwortung<br />
hat darüber hinaus Gerhard Ebeling den ihm von Luther zugespielten Terminus<br />
»Sprachschule des Glaubens« (und die damit gemeinte Sache) fruchtbar gemacht: »Die
40 I. Von der Reformation zur Union<br />
den kreativen, phantasievollen Weg frei, <strong>das</strong> Gehörte eigenständig aus- und<br />
fortzuführen, also gerade im Ernstnehmen desselben, im existentiellen Sich-<br />
Hineinbegeben in die zugespielten Bilder, diese weiterzuspielen bzw. weiter zu<br />
imaginieren. 27<br />
»Solche Gedanken«, meinter, »kann <strong>das</strong> Herz […]sehr wohl mit ganz andern<br />
Worten, auch sehr wohl mit weniger oder mehr Worten aussprechen. Wenn ich<br />
auch selber mich an solche Worte und Silben nicht binde, sondern heute so,<br />
morgen anders die Worte spreche, je nachdem ich warm bin und Lust habe, bleibe<br />
ich doch gleichwohl so nahe ich auch immer kann bei denselben Gedanken<br />
und bei demselben Sinn« 28 .Offenbar versteht er die biblischen Szenen als unerschöpfliche<br />
Sprachhilfen, regelrechte Sprach-Kammern, in die hinein die obdachlos<br />
Gewordenen flüchten können, um dort einen Ort, eine Schutzzone, eine<br />
Herberge ungemeiner innerer Weiträumigkeit anzutreffen. Ineinem sehr konkreten<br />
Sinn also sollen wir uns in diese Behausungen, in die Gebetsworte, hineinbegeben,<br />
von ihnen Gebrauch machen, sie nutzen und benutzen 29 – und die<br />
Räume, die uns nunmehr offen stehen, wirklich begehen; den gewiesenen Weg<br />
selbst erproben, ausschreiten, eben er-fahren mit allem, was uns erfreut und<br />
beglückt, aber auch mit dem, was ängstet, bedroht und belastet. Mit all unsren<br />
Gedanken, gerade auch den dunklen – indemwir sie möglichst alle mitnehmen –,<br />
27<br />
28<br />
29<br />
systematische <strong>Theologie</strong> als umfassende Inangriffnahme theologischer Hermeneutik ist<br />
Sprachschule des Glaubens. Darum sind <strong>für</strong> sie die beiden ineinandergreifenden Methoden<br />
konstitutiv: der Sprachgeschichte des Wortes Gottes (einschließlich der<br />
Sprachgeschichte des Widerspruchs dagegen) nachzugehen und dadurch zur Begegnung<br />
mit den Phänomenen angeleitet sich <strong>für</strong> ein neues Zur-Sprache-Kommen des Wortes<br />
Gottes und <strong>das</strong> heißt <strong>für</strong> sprachschöpferisches Geschehen angesichts der begegnenden<br />
Wirklichkeit offen zu halten.« (Gerhard Ebeling, Diskussionsthesen <strong>für</strong> eine Vorlesung<br />
zur Einführung in <strong>das</strong> Studium der <strong>Theologie</strong>, in: ders., Wort und Glaube, Tübingen<br />
3 1967,S.456). Ganz sachgemäß bezeichnet denn auch Henning Schröer <strong>das</strong> Avancieren<br />
der »Metapher […]zur leitenden Kategorie auch der Homiletik« und der »Ästhetik« zum<br />
»Paradigma« <strong>für</strong> <strong>das</strong> Gottesdienst- und Predigtverständnis (s. Anm. 27) als Rückruf zur<br />
»theologischen Hermeneutik«! (Henning Schröer, Umberto Eco als Predigthelfer? Fragen<br />
an Gerhard Marcel Martin, in: EvTh 44 [1984], S.59f.).<br />
Vgl. die Parallele dieses Luther’schen Gedankens zur gegenwärtigen homiletischen und<br />
liturgischen Diskussion um die sog. Rezeptionsästhetik. Exemplarisch sei verwiesen auf<br />
Gerhard Marcel Martin, Predigt als »offenes Kunstwerk«? Zum Dialog zwischen Homiletik<br />
und Rezeptionsästhetik, in: EvTh 44 (1984), S. 46–58 und Karl-Heinz Bieritz,<br />
Gottesdienst als offenes Kunstwerk? Zur Dramaturgie des Gottesdienstes, in: PTh 75<br />
(1986), S. 358–373.<br />
Martin Luther, IL2;275.<br />
Vgl. dazu Luthers Wendung »studio, usu et experientia« – etwa in ders., In epistolam<br />
S. Pauli ad Galatas Commentarius [1531] (1535), WA 40,2; 135: Ulrich Köpf, Art. Erfahrung<br />
III/1, in: TRE 10 (1982), S. 113–116.
er <strong>das</strong> Gebet 41<br />
tauchen wir ein in die Wohnungen aus Licht: mit unseren zwiespältigen Empfindungen<br />
und wechselnden Gefühlen,dem jähen Entsetzen, dem mannigfaltigen<br />
Mitleiden, dem hilflosen Zornder bösen Verzweiflung. Wirwollen es alles, so gut<br />
es geht, hineinziehen in jene hellen, <strong>für</strong> die Farbenpracht der »bunten Gnade<br />
Gottes« 30 durchsichtigen Räume und uns spiegeln lassen durch die ungetrübte<br />
Bejahung, die uns von dorther entgegenkommt. Vielleicht bewahrheitet sich<br />
dann ja, was Luther gerade dem Verzweifelten verheißt: <strong>das</strong>s deine Anfechtung<br />
»dich nicht allein wissen und verstehen, sondern auch erfahren [sc. lehrt], wie<br />
recht, wie wahrhaftig, wie süß,wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort<br />
sei, Weisheit über alle Weisheit« 31 .<br />
Aus solcher Erfahrung allein wächst uns neue, gegenwärtige Sprache zu.<br />
Gerade angesichts der aktuell an Luthers Konzeption zu richtenden Frage, ob<br />
man heute »nicht noch unlustiger sei die Bibel aufzuschlagen, als Gott unmittelbar<br />
anzureden«, weil <strong>das</strong> »›Psälterlein‹ […] uns unvergleichlich viel ferner<br />
gerückt« 32 erscheint, als <strong>das</strong> im 16. Jahrhundert noch der Fall war, ist doch<br />
entschieden auf die sich jetztanbahnende Aufgabe der Auslegung hinzuweisen.<br />
»Auslegung« verstanden als lebenspraktische Anwendung der biblischen Botschaft<br />
auf je meine und die die Jetzt-Zeit bestimmende Situation. Das inhaltlich<br />
bleibend Fremde undSperrige des Evangeliums wird gerade darin gewahrt,<strong>das</strong>s<br />
es als mein und unser aller <strong>Leben</strong> und Sterben betreffend zum Ausdruck kommt.<br />
Nur in dieser Konfrontation kann überhaupt empfangene Sprache zu eigener<br />
Sprache werden. Nicht um sie gedankenlos undunausgelegt nur zu rezitieren, sie<br />
dadurch inWirklichkeit aber zu verschweigen, weist Luther uns in die Sprachkammern<br />
des biblischen Wortes ein, sondern um durch sie auf dem Resonanzboden<br />
eigener (vielfältiger und ambivalenter) Erfahrung – zu selbstverantwortetem<br />
Reden ermächtigt und instand gesetzt zu werden. Der Glaube ist mithin<br />
worthafter Glaube. Wieeraus dem empfangenen, vorgesprochenen Wort lebt, so<br />
lebt er auch in <strong>das</strong> verantwortende Wort hinein. Der vorgegebene Raum biblischer<br />
Sprache, in dem (wie in Speichern)geronnene Gotteserfahrung gleichsam<br />
abholbereit lagert, eröffnet mir dabei eine neue Sicht, eine neue Perspektive,<br />
wodurchich mich selbstund die Welt mit anderen Augen, mit den »Augen Gottes«<br />
nämlich 33 ,wahrzunehmen lerne. Erfahrung wird so verändert, intensiviert und<br />
ganz und gar erneuert. Die Bibel ist <strong>das</strong> große Erfahrungsbuch und weist die-<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
1Petr 4,10.<br />
Martin Luther,Vorrede zum 1. Bande der Wittenberger Ausgabe von 1539, WA 50; 660<br />
(Hervorhebung von mir), sprachlich überarbeitet nach Gerhard Ebeling,Luther über <strong>das</strong><br />
Studium der <strong>Theologie</strong>, in: ders., Studium der <strong>Theologie</strong>. Eine enzyklopädische Orientierung,<br />
Tübingen 1975, S. 177.<br />
Robert Leuenberger, Zeit in der Zeit. Über <strong>das</strong> Gebet, Zürich 1988, S. 208.<br />
Vgl. zu dieser Formulierung etwa Martin Luther, Vorlesungen über 1. Mose (1535–<br />
1545), WA 44; 600.
42 I. Von der Reformation zur Union<br />
jenigen, die in ihr »spazieren gehen«, in eine neue Erfahrung ein. Ihr existenzentschlüsselnder<br />
Sinn soll nun – bezogen auf die Gebetspraxis (und in Anlehnung<br />
an Luthers Vaterunser-Auslegung in o. g. Schrift) – an der vierten Bitte des<br />
Herrengebets exemplifiziert werden.<br />
4. Meditation auf <strong>das</strong> Gegebene<br />
»Unser tägliches Brot gib uns heute«, dieses Gebet, indem es <strong>das</strong> <strong>Leben</strong>snotwendige<br />
an <strong>Leben</strong>smitteln exklusiv von Gott erwartet, setzt die Betenden nach<br />
Luther in Bewegung, <strong>das</strong> gesamte <strong>Leben</strong> als unter dem Segen des Schöpfers<br />
stehend zu begreifen. 34 Sie also Abschied nehmen zu lassen vom <strong>Leben</strong> aus sich,<br />
vom <strong>Leben</strong> aus der Eigenmacht, und sie einzuweisen in dieGegenerfahrung des<br />
dankbaren Empfangens. In dieser Bitte werde ich dessen gewahr, <strong>das</strong>s ich selbst<br />
nicht Täter, nicht Selbstversorger, nicht Produzent des Brotes, sondern dessen<br />
Nutznießer bin und also schlechthin abhängig, angewiesen auf die mir gnädig<br />
gewährten Grundlagen des <strong>Leben</strong>s. In dieser Erkenntnis vollziehe ich gleichsam<br />
die Kehre vom Ausleger des Wortes zum durch <strong>das</strong> Wort Ausgelegten, vom<br />
Verstehenden zum Verstandenen. Demnach spricht mich diese Bitte des Vaterunsers<br />
dorthin, wo ich <strong>das</strong> Gottsein Gottes Gott allein überlasse – und damit<br />
zugleich eingewiesen werde in meine eigene Geschöpflichkeit. Errettet, befreit<br />
von der hybriden Verstiegenheit, wie Gott sein zu wollen, greiftdie Einsicht Platz,<br />
sich und alles Gegebene als Kreatur, als Gottes geliebte Schöpfung, anzunehmen<br />
35 und dies gewissermaßen mit Haut und Haaren zu existieren: <strong>das</strong>s wir<br />
physisch und psychischnichtaus uns heraus sind, sondernvon den Händender<br />
Mutter, die den Säugling wickelt, bis zu den Händen der Menschen, die unseren<br />
Leichnam begraben, aus der Erfahrung der Güte, also ursprünglich rezeptiv, leben;<br />
<strong>das</strong>s ich <strong>Leben</strong> im eigentlichen und letzten Sinne immer nur empfangen<br />
kann: als Gabe, als <strong>Leben</strong> aus dem Vorgegebenen. Wersich <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> hingegen<br />
nimmt, hat den Todbereits heraufbeschworen!<br />
Indem Luther nun selbst, seiner hermeneutischen Anweisung gemäß, im<br />
bereitgestellten Raum dieser Bitte ins Spazieren kommt, entdeckt er außer dem<br />
34<br />
35<br />
Vgl. ders., IL 2; 273.<br />
Vgl. zum Topos der »Menschwerdung des Menschen«: ders., Operationes in Psalmos<br />
(1519–1521), WA 5; 128: »Humanitatis seu (ut Apostolus loquitur) carnis regno, quod in<br />
fide agitur, nos sibi conformes facit et crucifigit, faciens ex infoelicibus et superbis diis<br />
homines veros, idest miseros et peccatores.«; ders., Luther an Spalatin in Augsburg<br />
(1530), WA.B 5; 415: »Wir sollen menschen und nicht Gott sein. Das ist die summa«; im<br />
Gegenüber zu ders., Disputatio contra scholasticam theologiam (1517), WA 1; 225: »Non<br />
potest homo naturaliter velle deum esse deum. Immo vellet se esse deum et deum non<br />
esse deum.«
II. Theologen der Neuzeit
Fromm und modern zugleich<br />
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834)<br />
Wegstationen<br />
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, geboren am 21. November 1768 in<br />
Breslau als Sohn eines reformierten Predigers, verbrachte prägende Schuljahre<br />
auf Lehrinstituten der Herrnhuter Brüdergemeine in Nieskyund Barby. In Halle<br />
studierte er <strong>Theologie</strong> und kam dort mit der Aufklärung in Berührung. Bevor er<br />
1796 zum ersten Mal nach Berlin kam, war er Hauslehrer und Hilfsprediger.<br />
Berlin war damals von der Aufklärung geprägt und ein Zentrumder beginnenden<br />
Romantik. Eine Stadt, in der ein aufgeschlossenes geistigesKlima herrschte und<br />
eine Salonkultur regen Austausch bot. Hier begegnete man sich unabhängig von<br />
Religion und Stand. Eine unglückliche Liebe vertrieb Schleiermacher 1802 allerdings<br />
wieder aus Berlin; er nahm daraufhin eine Hofpredigerstelle in Stolp<br />
an. 1804 ging er als Professor nach Halle, wo er neben <strong>Theologie</strong> auch Philosophie<br />
lehrte. 1807 kehrte er nach Berlin zurück. Hier wirkte er ab 1809 als reformierter<br />
Prediger an der Dreifaltigkeitskirche und heiratete im selben Jahr die junge<br />
Witwe eines Freundes, Henriette von Willich. Neben seiner Pfarrstelle lehrte<br />
Schleiermacher ab 1810ander neu gegründeten Friedrich-Wilhelms-Universität<br />
<strong>Theologie</strong> und Philosophie. Als beliebter Prediger und geachteter Professor starb<br />
er am 12. Februar 1834 in Berlin. Am 15. Februar wurde er beigesetzt. Leopold<br />
Ranke zufolge nahmen bis zu 30.000 Menschen an seiner Beerdigung teil.<br />
Schrittmacher der kirchlichen Unionen<br />
Schleiermacher, dieser Universalgelehrte, er gilt auch als Schrittmacher der<br />
kirchlichen Unionen des 19. Jahrhunderts. Bereits 1804 hat er im ersten seiner<br />
beiden »Unvorgreiflichen Gutachten inSachen des protestantischen Kir-
116 II. Theologen der Neuzeit<br />
chenwesens« 1 die Überwindung der innerevangelischen Trennung von reformierten<br />
und lutherischen Kirchen gefordert. Die »Fortdauer dieser Absonderung«<br />
gereiche »unter den gegenwärtigen Umständen der wahren Religiosität zum<br />
<strong>Schad</strong>en« 2 .Erunterscheidet in diesem Gutachten zwischen dem grundlegend<br />
Christlichen einerseits und den verschiedenen Lehrmeinungen und Riten andererseits,<br />
die die gemeinsame Grundüberzeugung nicht in Frage stellen. Als<br />
Erster verwendet Schleiermacher in diesem Zusammenhang den Begriff »Kirchengemeinschaft«<br />
3 ,die über konfessionelle Grenzen hinweg gelebt werde. Er<br />
signalisiert damit die Unterscheidung von äußeren Differenzen und innerer<br />
Gemeinsamkeit im Fundament des Glaubens. Sie besteht <strong>für</strong> ihn in der grundlegenden<br />
reformatorischen Einsicht der Rechtfertigung allein aus dem Glauben.<br />
Wo diese Einsicht gegeben ist, können unterschiedliche Konfessionen als Ausformungen<br />
des gemeinsamen Glaubenslebens betrachtet werden und die Glieder<br />
dieser Konfessionskirchen miteinander <strong>das</strong> Abendmahl feiern. Kirchengemeinschaft<br />
ist <strong>für</strong> Schleiermacher wesentlich Gottesdienstgemeinschaft. Die<br />
gemeinsame Feier des Abendmahls ist <strong>für</strong> ihn die zureichende und unüberbietbare<br />
Form kirchlicher Unionen. Hinsichtlich der Lehren der beteiligten<br />
Konfessionen ist dabei nur die rechtfertigungstheologische Übereinstimmung<br />
vorausgesetzt. Sie ist »<strong>das</strong> Wesentliche«, »die Hauptsache« 4 ,worin beide evangelischen<br />
Konfessionen eins sind. Fortbestehende Unterschiede dürfen sein, sie<br />
bilden aber keinen Trennungsgrund mehr. Insofern ist <strong>für</strong> Schleiermacher die<br />
innerevangelische Konfessionsdifferenz zu einem die christliche Religion behindernden<br />
Anachronismus geworden, den es zu überwinden gilt.<br />
Religion –Sinn und Geschmack f rs Unendliche<br />
Wozu aber brauchen Menschen überhaupt Religion?Würde es auf der Welt ohne<br />
sie nicht friedlicher zugehen? Sind es nicht die Wissenschaften, die die Dinge<br />
voranbringen und unsere Probleme lösen? Ist es nicht die vernünftige Ethik,<br />
die die Konflikte überwindet? Wer Wissen, Verstand und Moral hat, wozu muss<br />
dieser dann noch – glauben?<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Zwei unvorgreifliche Gutachten in Sachen<br />
des protestantischen Kirchenwesens zunächst in Beziehung auf den Preußischen Staat<br />
(Berlin 1804), in: ders., Schriften aus der Stolper Zeit (1802–1804), Kritische Gesamtausgabe,<br />
1. Abt.: Schriften und Entwürfe, Bd. 4, hrsg. v. Eilert Herms [u. a.], Berlin /New<br />
York 2002, S. 359–460.<br />
A.a. O., S. 371.<br />
A.a. O., S. 396.<br />
A.a. O., S. 373 f.
Fromm und modern zugleich 117<br />
Mit solchen Fragen sind nicht erst wir Heutigen konfrontiert. Sie sind schon<br />
durch die Aufklärung Gesprächsthema unter den Gebildeten der damaligen Zeit<br />
geworden. Bereits um 1800 gilt die Religion als etwas Veraltetes. Dagegen revoltiert<br />
Schleiermacher in seinem ersten theologischen Buch, <strong>das</strong> er 1799 – im<br />
Hauptberuf ist er Seelsorger und Prediger an der Charité in Berlin – anonym<br />
veröffentlicht. »Apologie« 5 ,sohat er <strong>das</strong> erste Kapitel inseinen später berühmt<br />
gewordenen Reden Ȇber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren<br />
Verächtern« überschrieben. Die Religion verteidigen, <strong>das</strong> ist Schleiermachers<br />
Thema. Verständlich machen will er, <strong>das</strong>s die Religion zum Menschsein des<br />
Menschen gehört. Wissenschaft, also <strong>das</strong> eigenständigeDenken, undMoral, also<br />
<strong>das</strong> gute Handeln, genügen nicht. Jeder Mensch braucht – gleichsam als dritte<br />
Dimension – den Glauben, die Religion. Sie ist <strong>für</strong> Schleiermacher »Sinn und<br />
Geschmack <strong>für</strong>s Unendliche« 6 .Also <strong>das</strong> Bewusstsein davon, <strong>das</strong>s die Wirklichkeit<br />
im Vorhandenen und Begreifbaren nicht einfach aufgeht, sondern in einem<br />
Unbedingten gründet – und deshalb auch da<strong>für</strong> offen ist. Neben dem Denken und<br />
dem Handeln ist die Religion, die Offenheit <strong>für</strong> den transzendenten Sinngrund<br />
des <strong>Leben</strong>s, im Menschen angelegt: als etwas Selbstständiges. Sie gehört einer<br />
eigenen »Provinz im Gemüthe« 7 an. Im Glauben erst zeigt sich, wer ich bin und<br />
worauf ich mein <strong>Leben</strong> gründe.<br />
Primat der religiçsen Erfahrung<br />
In der Verteidigung der Religion geht Schleiermacher einen eigenen Weg, der<br />
Schule gemacht hat – und bis heute eine der großen Möglichkeiten <strong>für</strong> die<br />
<strong>Theologie</strong> eröffnet. Schleiermacher setzt auf die religiöse Erfahrung. Vonihr hat<br />
die <strong>Theologie</strong> ihren Ausgang zu nehmen.Auf sie hat die kirchliche Verkündigung<br />
die Menschen anzusprechen. Dann erreicht sie auch die, die dem Glauben kritisch<br />
gegenüberstehen und der Kirche entfremdet sind.<br />
Das Gef hl schlechthinniger Abh ngigkeit<br />
Für Schleiermacher ist die religiöse Erfahrung von der Art, <strong>das</strong>s jeder und jede sie<br />
machen kann. Niemand soll dabei an übernatürliche Begegnungen mit etwas<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Ders., Apologie, in: ders., Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern<br />
(Berlin 1799), in: ders., Schriften aus der Berliner Zeit (1769–1799), Kritische<br />
Gesamtausgabe, 1. Abt.: Schriften und Entwürfe, Bd. 2, hrsg. v. Günter Meckenstock,<br />
Berlin /New York 1984, S. 189–205.<br />
Ders., Über die Religion, S. 212.<br />
A.a. O., S. 204.
118 II. Theologen der Neuzeit<br />
Mirakulösem denken. Die religiöse Erfahrung ist vielmehr mit einem Gefühl,<br />
mit einer Anschauung verbunden, die <strong>das</strong> Angeschaute seinerseits auslöst und<br />
im Menschen hervorbringt. Vondiesem Gefühl meint er sagen zu können, <strong>das</strong>s<br />
jede und jeder es gewiss schon einmal an sich wahrgenommen hat. In seinem<br />
theologischen Hauptwerk »Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der<br />
evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt« (1821/22) nennt er es:<br />
<strong>das</strong> »Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit« 8 .<br />
Schleiermacher geht es dabei nicht um Emotionen, schon gar nicht um<br />
oberflächliche Sentimentalitäten. Mit der Rede vom »Gefühl schlechthinniger<br />
Abhängigkeit« zielt er auf unser Bewusstsein davon, <strong>das</strong>s wir uns nicht selbst<br />
geschaffen haben und unser <strong>Leben</strong> nicht in der eigenen Hand halten. Sondern<br />
<strong>das</strong>s es grundlegend verdanktes <strong>Leben</strong> ist. Wir sind primär empfangende und<br />
aufnehmende Wesen, begabt mit Vertrauen und <strong>Leben</strong>digkeit, mit Erfüllung und<br />
Segen. Dieses Bewusstsein lässt sich nicht äußerlich andemonstrieren und<br />
kommt auch nicht durchReflexion zustande, nicht durchein mehr oder weniger<br />
angestrengtes Nachdenken über uns und unser <strong>Leben</strong>. Es entspringt vielmehr<br />
Erfahrungen, die wir von früh auf machen und die unser <strong>Leben</strong> – einmal mehr,<br />
einmal weniger eindrücklich – begleiten. Grunderfahrungen der Religionsind es:<br />
<strong>das</strong>s wir bedürftig und angewiesen sind auf so Vieles – auf Nahrung z.B., aber<br />
auch auf Liebe. Und <strong>das</strong>s <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> zuerst und vor allem Geschenk ist, unverfügbar,<br />
<strong>das</strong> wir nur dankbar und staunend annehmen können. Unsere Zerbrechlichkeit<br />
und Endlichkeit, der fragmentarische Charakter unseres <strong>Leben</strong>s, er<br />
verweist somit auf ein Letztes, <strong>das</strong> größer ist als wir selbst, auf einen unbedingten<br />
Sinngrund.<br />
Gott –<strong>das</strong> im Gef hl schlechthinniger Abh ngigkeit<br />
mitgesetzte Woher<br />
Das Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit ist <strong>für</strong> Schleiermacher noch kein<br />
Gottesbeweis. Aber in der Erfahrung, die sich in ihm ausspricht, erkennt er den<br />
Ausgangspunkt <strong>für</strong> eine überzeugende Rede von Gott. Siegibt dem »Wovon«, dem<br />
»Woher« unserer schlechthinnigen Abhängigkeit einen Namen und eineAdresse.<br />
Als wohltuend Abhängige werden wir dessen gewahr, in Beziehung zu Gott zu<br />
stehen. Das Wort »Gott«, es bringt die religiöse Erfahrung des Staunens und der<br />
Dankbarkeit, <strong>das</strong> Ergriffenwerden und Ergriffensein von den gnädigen Vorgaben<br />
unseres <strong>Leben</strong>s, auf den Begriff und zur Darstellung; drückt die innere Erfahrung<br />
8<br />
Vgl. ders., Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im<br />
Zusammenhange dargestellt. Zweite Auflage (1830/31), Kritische Gesamtausgabe,<br />
1. Abt.: Schriften und Entwürfe, Bd. 13, Teilbd. 1, hrsg. v. Rolf Schäfer, Berlin /New York<br />
2003, §4,S.32.
Fromm und modern zugleich 119<br />
aus. Zu ihm, zu Gott, können wir unsverhalten, ihm danken, ihn bitten, uns und<br />
unser <strong>Leben</strong> vor ihm besinnen – und damit einen Sinn finden.<br />
Im Gottesdienstsollen Menschen daher nicht nur in ihrem Verstand, sondern<br />
in ihrem religiösen Gefühlangesprochen werden. Die entscheidende Aufgabe der<br />
Predigt erkennt Schleiermacher darin, die Menschen im Licht biblischer Glaubenserfahrungen<br />
tiefer über sich und den Sinn ihres Daseins aufzuklären und<br />
dabei erfahrbar zu machen, <strong>das</strong>s wir im <strong>Leben</strong> geborgen, unbedingt gehalten<br />
sind – auch dort,wosich Sinn auf unbegreifliche Weise entzieht. Insofern gibtuns<br />
der Glaube die Kraft, im Glück wie in der Not Gott als den uns tragenden Grund<br />
festzuhalten.<br />
Die in Jesus von Nazareth vollbrachte Erlçsung<br />
Dieses Gottesbewusstsein ist in dem Menschen Jesus von Nazareth in höchstem<br />
Maße ausgebildet. Und nicht nur <strong>das</strong>: In seinen Reden und Gleichnissen, in<br />
seinem gesamten <strong>Leben</strong>svollzug kommt es so zur Darstellung, <strong>das</strong>s es sich uns<br />
mitteilt, uns ergreift und bewegt – und uns, die im Glauben Schwachen und<br />
Gehemmten, stets von Neuem unseres <strong>Leben</strong>svertrauens gewiss macht. Insofern<br />
unterscheidet sich die christliche Religion von allen anderen Religionen dadurch,<br />
»<strong>das</strong>s alles in derselben bezogen wird auf die durch Jesum von Nazareth vollbrachte<br />
Erlösung« 9 .Durch ihn immer wieder kräftig zum Vertrauen auf den<br />
tragenden Grund unseres Daseins geführt, kann ich getrost leben – und hoffentlich<br />
auch »selig sterben« 10 .<br />
Befreiung zu wahrer Humanit t<br />
In einer Zeit, inder <strong>das</strong> Christentum zerrieben zuwerden droht zwischen aufklärerischem<br />
Moralismus und amtskirchlichem Dogmatismus, da stößt dieser<br />
fromme Beter und moderne Zeitgenosse die Tür auf ins Freie: indem er die objektiven<br />
Aussagen über Gott reformuliert als subjektive, existenzielle <strong>Leben</strong>saussagen<br />
des Einzelnen; indem er uns aufmerksam macht auf die weltlichen<br />
9<br />
10<br />
A.a. O., §11, S. 93.<br />
In den sonntäglichen Hauptgottesdiensten hat Schleiermacher oft <strong>das</strong> Kollektengebet<br />
verwendet, <strong>das</strong> mit folgender Anrufung beginnt: »Barmherziger, getreuer Gott, der Du bei<br />
uns <strong>das</strong> helle Licht Deines Evangelii hast lassen aufgehen, bei welchem wir Dich und<br />
Deinen Willen recht erkennen und lernen können, wie wir christlich leben und selig<br />
sterben können […]«. Zit. nach: Agende <strong>für</strong> die evangelische Kirche in den Königlich<br />
Preußischen Landen. Mit besonderen Bestimmungen und Zusätzen <strong>für</strong> die Provinz<br />
Brandenburg, Berlin 1829, S. 68 f.
120 II. Theologen der Neuzeit<br />
Geschwisterder Religion – Musik, Tanz, Poesie, Kunst,Geselligkeit – unduns so<br />
den Wegbahnt <strong>für</strong> die religiöse Glaubenserfahrung. In ihr, am eigenen Ich also,<br />
bewahrheitet sich der Inhalt der Religion. Schleiermacher, darin bewusst Protestant,<br />
glaubt nicht auf bloße Autorität hin. Vielmehr erschließt sich ihm die<br />
christliche Wahrheit im persönlichen Glauben als innere Gewissheit. Sie macht<br />
uns <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> als endliches, vorläufiges, erlösungsbedürftiges bewusst. Die religiöse<br />
Erfahrung nimmt im Geschaffenen den Schöpferwahr. Sie befreit die Welt<br />
zur Weltlichkeit und uns zur wahren Humanität: Wir dürfen menschliche – der<br />
Geschöpflichkeit unseres Daseins entsprechende – Menschen sein!
Kreuzestheologie kontrovers<br />
Schleiermacher und Luther im Vergleich<br />
Luther undSchleiermacher: »diesen Problemknoten«, meint Gerhard Ebeling, hat<br />
uns »die Geschichte selbst […] unausweichlich auferlegt. Auch wer lieber alternativ<br />
formulierte: Luther oder Schleiermacher!, kann sich der seltsamen Verbindung<br />
dieser ungleichen Theologen nicht entziehen. An Luthers Wegzuuns<br />
steht nun einmal Schleiermacher. Und unser WegzuSchleiermacher trifft dort<br />
auf Luther. […]Luther und Schleiermacher – <strong>das</strong> ist, verschlüsselt in zwei Namen,<br />
seither immer noch, immer wieder die Konstellation protestantischer <strong>Theologie</strong>.«<br />
1 Da wir im Blick auf die Christologie einerseits auf verblüffende Berührungspunkte<br />
zwischen beiden Theologen stoßen, sich andererseits aber in den<br />
Folgerungen, die daraus gezogen werden, unübersehbare Differenzen, ja Gegensätze,<br />
auftun, legt sich ein Vergleich hier besonders nahe. Ich konzentriere<br />
mich im Folgenden auf <strong>das</strong> Verständnis des Kreuzes Jesu, genauer auf <strong>das</strong> Unwort<br />
vom Kreuz, den Schrei der Verlassenheit, wie er uns im Markus- und<br />
Matthäusevangelium 2 begegnet. Denn beide, Schleiermacher und Luther, gehen<br />
ausführlich auf <strong>das</strong> Zitat von Psalm 22,2 im Munde Jesu ein.<br />
So versuche ich, ausgehend von den Grundaussagen seiner Christologie,<br />
zunächst die Auffassung Schleiermachers zu entfalten, um auf diesem Hintergrund<br />
die Kreuzestheologie Luthers konzentriert in den Blick zu nehmen. Auf<br />
diese Weise lassen sich – bei deutlichen Parallelen – die Unterschiede umso<br />
klarer erkennen. 3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Gerhard Ebeling, Luther und Schleiermacher, in: ders., Lutherstudien, Bd. 3, Tübingen<br />
1985, S. 405–407.<br />
Vgl. Mk 15,34 und Mt 27,46.<br />
Vgl. im Folgenden durchgehend: Christine Axt-Piscalar, Gott und Glaube in den Differenzerfahrungen<br />
des <strong>Leben</strong>s. Überlegungen im Anschluss an Schleiermacher und<br />
Luther, in: Kreuz und Weltbild. Interpretationen von Wirklichkeit im Horizont des Todes<br />
Jesu, hrsg. v. Christof Landmesser /Andreas Klein, Neukirchen-Vluyn 2011, S. 79–99.
122 II. Theologen der Neuzeit<br />
1. Schleiermacher<br />
Das Spezifische der Person Jesu ist, Schleiermacher zufolge, nur dann recht erfasst,<br />
wenn er als der Erlöser der Menschheit gedacht und erfahren wird. Dass<br />
Jesus von Geburt an ein <strong>für</strong> alle Mal mit der »erlösende[n] Wirksamkeit« 4 ausgestattet<br />
ist, gründet in dem »eigentliche[n] Sein Gottes in ihm« 5 .Expressisverbis<br />
knüpft Schleiermacher damit an die soteriologisch relevante Zweinaturenlehre<br />
an: »In Jesu Christo waren die göttliche Natur und die menschliche Natur zu Einer<br />
Person verknüpft« 6 ;und er interpretiertdiese Lehre so, <strong>das</strong>s auf diese Weise <strong>das</strong><br />
Gottesbewusstsein Jesu – im Unterschied zu allen anderen Menschen – vom<br />
ersten <strong>Leben</strong>smoment bis in seinen Todhinein ungebrochen intensiv und unangefochten<br />
stark war. »Denn wenn der Unterschied zwischen dem Erlöser und<br />
uns Andern so festgestellt wird, daß statt unseres verdunkelten und unkräftigen<br />
<strong>das</strong> Gottesbewußtsein in ihm ein schlechthin klares und jeden Moment ausschließend<br />
bestimmendes war, welches daher als eine stetige lebendige Gegenwart,<br />
mithin als ein wahres Sein Gottes in ihm, betrachtet werden muß: so ist<br />
vermöge dieses Unterschiedes alles in ihm, dessen wir bedürfen, und vermöge<br />
seiner nur durch seine schlechthinnige Unsündlichkeit begrenzten Gleichheit<br />
mit uns auch alles so, daß und wie wir es aufzufassen vermögen. Nämlich <strong>das</strong><br />
Sein Gottes in dem Erlöser ist als seine innerste Grundkraft gesetzt von welcher<br />
alle Thätigkeit ausgeht, und welche alle Momente zusammenhält« 7 .Wenngleich<br />
die Deutung der altkirchlichen Zweinaturenlehre zwar von der »bisherigen<br />
Schulsprache« abweiche, so ruht sie <strong>für</strong> Schleiermacher »doch gleichmäßig auf<br />
dem paulinischen, Gott war in Christo und auf dem johanneischen, <strong>das</strong> Wort ward<br />
Fleisch« 8 auf. Es ist die ungebrochene Stetigkeit des Gottesbewusstseins, in der<br />
die Einheit mit Gott <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> Jesu prägt. Und zugleich ist es die Verwirklichung<br />
des wahren Menschseins des Menschen.<br />
Genau so ist Jesus der Erlöser: »Der Erlöser ist sonach allen Menschen gleich<br />
vermöge der Selbigkeit der menschlichen Natur, von Allen aber unterschieden<br />
durch die stete Kräftigkeit seines Gottesbewußtseins, welche ein eigentliches<br />
Sein Gottes in ihm war.« 9 Mit Gott eins, entspricht Jesu Tun, zu dem auch sein<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Friedrich D. E. Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der<br />
evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Zweite Auflage (1830/31), Kritische<br />
Gesamtausgabe, 1. Abt: Schriften und Entwürfe, Bd. 13, Teilbd. 1u.2,hrsg. v. Rolf<br />
Schäfer, Berlin /New York 2003, hier §11, 4, S. 99.<br />
A.a. O., §94, Leitsatz, S. 52.<br />
A.a. O., §96, Erster Lehrsatz, S. 60.<br />
A.a. O., §96, 3, S. 69.<br />
Ebd.<br />
A.a. O., §94, Leitsatz, S. 52.
Kreuzestheologie kontrovers 123<br />
Leiden gehört, ausnahmslos undvollkommen »dem göttlichen Willen« 10 .Esliegt<br />
darum in der Konsequenz dieser Auffassung, <strong>das</strong>s Schleiermacher <strong>das</strong> im Johannesevangelium<br />
überlieferte Kreuzeswort als den schlechthinnigen Gesamtausdruck<br />
des <strong>Leben</strong>sweges Jesu und seiner Hingabe an den Willen des Vaters<br />
auffasst. Das »Es ist vollbracht« (Joh 19,30) des johanneischen Christus ist der<br />
umfassende Ausdruck <strong>für</strong> <strong>das</strong> Selbstverständnis Jesu im Blick auf sein <strong>Leben</strong>. In<br />
einer Predigt über Joh 19,30 nennt Schleiermacher dieses Wort »<strong>das</strong> größte unter<br />
den letzten Worten unseres Erlösers« 11 .Entsprechend hat er mit dem im Markusund<br />
Matthäusevangelium überlieferten SterbenswortJesu »Mein Gott, mein Gott,<br />
warum hast du mich verlassen?« (Mk 15,34; Mt 27,46) größte Schwierigkeiten.<br />
Denn »<strong>für</strong> die Erfahrung, <strong>das</strong>s sich Christus als vom göttlichen Vater verlassen<br />
wahrgenommenhat, ist in der <strong>Theologie</strong> Schleiermachers kein rechter Platz. Sie<br />
ist geleitet von der ungetrübten Seligkeit des Gottesbewusstseins Jesu.« 12 Eben<br />
deshalb ficht ihn selbst sein Todnicht an – und trägt <strong>das</strong> Kreuzesgeschehen auch<br />
<strong>für</strong> Gott selbst nichts aus. Gerade weil Gott mit ihm eins ist, können <strong>das</strong> Leiden<br />
und der TodJesus nichtschrecken. Deshalb deutet Schleiermacher <strong>das</strong> Zitat von<br />
Ps 22,2 imMunde Jesu so, <strong>das</strong>s dieser mit den Anfangsworten den gesamten<br />
Psalm aufrufen wollte, der ja vom Sieg über den Todkünde. 13 Aufgrunddes Seins<br />
Gottes in ihm kann es <strong>für</strong> Schleiermacher keine Gottverlassenheit Jesu geben.<br />
Sonst wäre der Nazarener auch nicht fähig, der Erlöser von uns Menschen zu<br />
sein.<br />
Vehementkritisiert Schleiermacher darum die Auffassung, die <strong>das</strong> Gegenteil<br />
behauptet. Wörtlich spricht er von »der gekünstelten Erklärung, daß diese<br />
Gottverlassenheit zu dem gehörte, was Christus <strong>für</strong> uns leidenmußte« 14 .Obwohl<br />
hier kein Name genannt wird, wendet sich diese Aussage doch unmittelbar gegen<br />
Luther, der in seiner zweiten Psalmenvorlesung(1519–1521) ausführlich Ps 22<br />
im Blick auf die Passion Jesu in dem von Schleiermacher inkriminierten Sinne<br />
behandelt. 15<br />
Wirksam wird <strong>das</strong> erlösende und versöhnende Handeln Jesu nun allein in<br />
der Aneignung desselben im Glaubensleben jeder und jedes Einzelnen. Schlei-<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
A.a. O., §104, 3, S. 137.<br />
Friedrich D. E. Schleiermacher,Der lezte Blikk auf <strong>das</strong> <strong>Leben</strong>. Passionspredigt [über Joh<br />
19,30], in: ders., Kleine Schriften und Predigten, Bd. 3: Dogmatische Predigten der<br />
Reifezeit, hrsg. v. Hayo Gerdes /Emanuel Hirsch, Berlin 1969, S. 219.<br />
Für uns gestorben. Die Bedeutung von Leiden und Sterben Jesu Christi, hrsg. v. Kirchenamt<br />
der EKD, Gütersloh 2015, S. 106.<br />
Vgl. Friedrich D. E. Schleiermacher, Am1.April 1821 vormittags, in: ders., Predigten<br />
1820–1821, Kritische Gesamtausgabe, 3. Abt.: Predigten, Bd. 6, hrsg. v. Elisabeth<br />
Blumrich, Berlin /Boston 2015, S. 572–575.<br />
A.a. O., S. 572.<br />
Siehe unten »2. Luther«.
124 II. Theologen der Neuzeit<br />
ermacher spricht in diesem Zusammenhang von Jesus als dem »Urbild« und<br />
betont, <strong>das</strong>s <strong>das</strong> »Urbild« vom bloßen »Vorbild« durch seine»Productivität«, d. h.<br />
durch die besondere göttliche Kraft, unterschieden sei, in den Glaubenden <strong>das</strong><br />
Erlösungsbewusstsein hervorzurufen. 16 Es ist der produktive Geist Jesu selbst,<br />
durch den Jesus den Glaubenden an seinem Gottesbewusstsein, seinem ungetrübten<br />
Gottesverhältnis, Teil gibt und sie zur Liebe befähigt. 17<br />
So liegt die soteriologische Pointe der Christologie Schleiermachers darin,<br />
<strong>das</strong>s trotz weiter bestehender äußerer Übel, trotz Leiden und Tod, die an Jesus<br />
Christus Glaubenden dadurchnichtimLetzten angefochten werden; könnenjene<br />
doch nicht bis ins Innerste eines Menschen vordringen. Es ist die Kraft des<br />
Glaubens, Frucht der Teilhabe am Bewusstsein der ungetrübten Seligkeit Jesu,<br />
im Vertrauen auf die unerschütterliche Gewissheit der Liebe Gottes, auch dem<br />
Leiden und dem Todgegenüber innerlich überlegen zu sein: Die Übel, die »<strong>Leben</strong>shemmungen<br />
[…] nicht werden sie hinweggenommen, als ob er [sc. der Erlöste]<br />
schmerzlos und frei von Leiden sein sollte oder könnte, denn darum hat<br />
auch ChristusSchmerzen gehabt und gelitten, sondern nur Unseligkeit ist nicht<br />
in den Schmerzen und Leiden, weil sie als solche nicht in <strong>das</strong> innerste <strong>Leben</strong><br />
eindringen.« 18<br />
2. Luther<br />
Bevor die gravierenden Unterschiede zwischen Schleiermachers und Luthers<br />
Kreuzestheologie einsichtig werden, weise ich auf die Konvergenzen hin, die<br />
freilich die Differenzen nur umso klarer hervortreten lassen. Auch <strong>für</strong> Luther<br />
wird Christi erlösendes und versöhnendes Handeln allein im Glauben anihn<br />
wirksam: verstanden als existenzielle Teilhabe an ihm im Heiligen Geist. Und wie<br />
<strong>für</strong> Schleiermacher, so ist auch <strong>für</strong> Luthers Christusverständnis <strong>das</strong> paulinische<br />
Diktum »Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst« (2 Kor 5,19),<br />
mithin die altkirchliche Zweinaturenlehre, zentral. Die Heilsbedeutung des <strong>Leben</strong>s<br />
und Sterbens Jesu hängt – wie bei Schleiermacher – daran,<strong>das</strong>s in ihm Gott<br />
selbst in die Welt gekommen ist (vgl. Joh 1,14). Wäre dem nicht so, wäre in Jesus<br />
Christus nicht Gott selbstgegenwärtig, so wäre Christus, wie Luther sagen kann,<br />
ein »schlechter Heiland« und bedürfte »wohl selbst eines Heilands« 19 .Nur auf-<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
Vgl. ders., Der christliche Glaube, §93, 2, S. 44.<br />
Vgl. a. a. O., §100, Leitsatz, S. 104 (»Der Erlöser nimmt die Gläubigen in die Kräftigkeit<br />
seines Gottesbewußtseins auf, und dies ist seine erlösende Thätigkeit.«) und §101,<br />
Leitsatz, S. 112 (»Der Erlöser nimmt die Gläubigen auf in die Gemeinschaft seiner ungetrübten<br />
Seligkeit, und dies ist seine versöhnende Thätigkeit.«).<br />
A.a. O., §101, 2, S. 114.<br />
Martin Luther, Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis (1528), WA 26; 319,38 f.
Kreuzestheologie kontrovers 125<br />
grund dieser einzigartigen Einheit des Menschen Jesus mit Gott selbst kann<br />
Heil, können Erlösung und Versöhnung geschehen. Entsprechend heißt es in<br />
Luthers »Kleinem Katechismus« zum Zweiten Artikel: »Ich glaube, <strong>das</strong>s Jesus<br />
Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger<br />
Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen<br />
und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen, von allen<br />
Sünden vom Tode und von der Gewalt des Teufels; nicht mit Gold oder Silber,<br />
sondern mit seinem heiligen teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden<br />
und Sterben; auf <strong>das</strong>s ich sein eigen sei undinseinem Reich unter ihm lebe und<br />
ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist<br />
auferstanden vom Tode, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr« 20 .<br />
Die Radikalität, mit der Luther die Gegenwart Gottes inJesu <strong>Leben</strong> und<br />
Sterben erfasst, zeigt sich beispielhaftandessen schon erwähnterAuslegung von<br />
Ps 22,2, dem Schrei der Verlassenheit im Munde Jesu. In seiner zweiten Psalmenvorlesung,<br />
den Operationes in Psalmos (1519–1521), geht er ausführlich<br />
darauf ein. Während Schleiermacher bemüht ist, <strong>das</strong> Unwort vom Kreuz im<br />
Hinweis auf die Einheit des Sohnes mit Gott, dem Vater, regelrecht wegzuinterpretieren,<br />
geht Luthers Deutung exakt den entgegengesetzten Weg. Die Einheit<br />
mit Gott begrenzt nicht etwa <strong>das</strong> Ausmaß der erlittenen Verzweiflung;<br />
vielmehr kommt durch sie gerade die Bereitschaft, die Verzweiflung, den Todvon<br />
uns Menschen, ganz und gar zu durchleiden. Also die Freiheit dazu, sich dem<br />
Schmerz und dem Scheiternradikal auszusetzen, um uns – durch <strong>das</strong> Aushalten<br />
des Todes und der Gottverlassenheit – der Machtder Verzweiflung zu entreißen.<br />
So erreicht <strong>für</strong> Luther der am Kreuz schreiende Sohn gerade in seiner Anfechtung<br />
die größte soteriologische Nähe zu uns Menschen. Denn darin wird der Gekreuzigte<br />
jedem Gottverlassenen ähnlich, tritt er an unsere Stelle, damit diesen<br />
TodinGottverlassenheit fortan keiner mehr sterben muss.<br />
Damit es zu diesem Platztausch, zu diesem »wunderbaren Wechsel« 21 kommen<br />
kann, bedarf es freilich der Anwesenheit Gottes imKreuz Jesu, die in einem<br />
einzigartigen Kampfesgeschehen dem Todals »letztem Feind« (1 Kor 15,26)<br />
widerspricht. So ereignet sich Heil mitten im Unheil, ewiges <strong>Leben</strong> mitten im<br />
zeitlichen Tod. Gottes Schöpfermacht stemmt sich als gegenkräftige Aktivität<br />
gegen die Verzweiflung, so <strong>das</strong>s es hier zur Verzweiflung der Verzweiflung, zum<br />
Tod des Todes kommt. Die Vorstellung des Verschlingens aufnehmend, kann<br />
Luther in seinem Osterlied formulieren: »Die Schrift hat verkündet <strong>das</strong>, wie ein<br />
Todden andern fraß« 22 .<br />
Dass es dazu kommt, muss also gerade im Sterben JesuamKreuz Gott selbst<br />
in der »Waagschüssel« liegen und eben nicht nur ein bloßer Mensch: »Wo Gott<br />
20<br />
21<br />
22<br />
Ders., Der Kleine Katechismus (1529), in: BSELK, S. 872,1–10.<br />
Vgl. ders., Operationes in Psalmos (1519–1521), WA 5; 608,7.<br />
Ders., Lieder, Nr. 16, WA 35; 444,10 f.
126 II. Theologen der Neuzeit<br />
nicht mit in der Waage ist und <strong>das</strong> Gewicht gibt, so sinken wir mit unserer<br />
Schüssel zu Grunde. Das mein ich also: wo es nicht sollt heißen, Gott ist gestorben,<br />
sondern allein ein Mensch, so sind wir verloren. Aber wenn Gottes Tod<br />
und Gott gestorben in der Waagschüssel liegt, so sinket er unter und wir fahren<br />
empor.« 23<br />
Indem Gott selbst am Kreuz starb, wurde der Todbis ans Ende aus-gestorben;<br />
er hat sich dank der Gegenwart Gottes im Tode Jesu förmlich aus-gewirkt im<br />
Sinne von: erschöpft. So ging mitten aus dem Kreuz <strong>Leben</strong> hervor, <strong>Leben</strong> Gottes<br />
als ewiges <strong>Leben</strong>, <strong>das</strong> den Tod bereits hinter sich hat. Derart in Gottes <strong>Leben</strong><br />
aufgenommenund aufgehoben, hat der Todseine Verzweiflungsmacht verloren.<br />
Jesus hat im Unwort des Kreuzes die Gottverlassenheit ein <strong>für</strong> alle Mal aus- und<br />
zu Ende geschrien. Nun hat <strong>das</strong> <strong>Leben</strong> <strong>das</strong> letzte Wort. Die Einheit mit dem Vater<br />
enthebt Jesus nicht der Anfechtung. Sondern die Anfechtung wird überwunden,<br />
indem der Gott aus der Höhe aufs Innigste teilhat am Kreuz: Ehre sei Gott in der<br />
Tiefe!<br />
Wiebei Schleiermacher, so wird auch <strong>für</strong> Luther uns Menschen der Sieg des<br />
<strong>Leben</strong>s über den Todallein im Glauben geschenkt: als Sein in Christus. Als ewiges<br />
<strong>Leben</strong> ist es ein <strong>Leben</strong>, <strong>das</strong> den Todzwar noch vor sich hat, aber von der Macht des<br />
Todes befreit ist – und deshalb auch von seinem Stachel, von der Verzweiflung.<br />
Dies bedeutet <strong>für</strong> Luther allerdings nicht, <strong>das</strong>s der paradoxe Charakter des<br />
Glaubens, der wider alle Abwesenheitserfahrung Gottes an Gott festhält, damit<br />
aufgehoben wäre. Aber indem ich im Glauben teilhabe am Kreuz Jesu, kann und<br />
darf ich in der größten Anfechtung, wie Luther sagt, »gegen Gott zu Gott flüchten«<br />
24 :zudem Gott, der auch <strong>für</strong> mich den »letzten Feind« (1 Kor 15,26) überwunden<br />
hat. Angesichts des eigenen Todes, der noch gestorben werden muss, ist<br />
diese Gewissheit des Glaubens je und jeder Anfechtung abzuringen. Sie bleibt<br />
verborgene Gewissheit. In der Widerständigkeit, in der Spannung und Strittigkeit,<br />
im Zusammenleben der Gegensätze, hat sich der Glaube stets neu zu bewähren.<br />
Dieses Moment des Contra bleibt so lange, bis »Gott alles in allem«<br />
(1 Kor 15,28) sein wird.<br />
3. Luther oder Schleiermacher?<br />
Vergleicht man die gleichermaßen auf die Person Jesu Christi zentrierten Glaubenseinstellungen<br />
Schleiermachers und Luthers miteinander, wird man, so<br />
meine ich, Vorsicht walten lassen, die eine zu be<strong>für</strong>worten und die andere zu-<br />
23<br />
24<br />
Ders., VonKonziliis und Kirchen (1539), WA 50; 590,11–16.<br />
Ders., Operationes in Psalmos (1519–1521), WA 5; 204,26 f.: »ad Deum contra Deum<br />
confugere«.
Kreuzestheologie kontrovers 127<br />
rückzuweisen. 25 Beide sind Ausdruck tiefer persönlicher Glaubenserfahrungen,<br />
und beide verstehen sich im Licht des biblischen Zeugnisses. Gerade auf dem<br />
Resonanzboden eigener, sehr unterschiedlicher seelsorgerlicher Erfahrungen<br />
verbietet sich m. E. ein einfaches Entweder-oder.<br />
Luthers Auffassung ist geprägt von der Erfahrung abgründiger Anfechtung,<br />
die sogar dazu führen kann, Gott gegen Gott aufzurufen. Der Reformator stellt<br />
sich dem Phänomen tiefster Verzweiflung, verdichtet imSchrei der Gottverlassenheit,<br />
indem Jesus stellvertretend die »Krankheit zum Tode« auf sich nimmt,<br />
durchleidet und so überwindet. Darum bezeichnet er die Worte aus Psalm 22,2 als<br />
»die grosten wordt in tota scriptura« 26 :Trost <strong>für</strong> angefochtene Gewissen.<br />
Anfechtung aber widerfährt einem Menschen: ohne dessen Zutun und gegen<br />
seinen Willen. Deshalb lässt sich auch fehlende Anfechtung nicht zum<br />
Vorwurf machen. Ja, auch von glaubenden Menschen gilt: Anfechtung ist nicht<br />
jedermanns Sache! Ich kenne Menschen, die ohne Kampf, ohne Widerstand, ohne<br />
Contra, vielmehr im Innern gefasst und gefestigt inihr Sterben eingewilligt<br />
haben.<br />
So hat auch die Glaubenseinstellung, aus der heraus Schleiermacher formuliert,<br />
eine Luther gegenüber ganz andere Prägung. Sie ist geleitet von der<br />
unerschütterlichen Gewissheit der Liebe Gottes, des Vaters, wie sie in seinem<br />
Sohn erschienen ist. Vonihr vermag nichts und niemand den im Glauben mit<br />
Christus und seinem kräftigen Gottesbewusstsein Verbundenen zu trennen:<br />
Trost <strong>für</strong> ergebene Gewissen.<br />
Auf je ihre Weise geben Luther und Schleiermacher von der <strong>Leben</strong>skraft<br />
des Glaubens einen tiefenEindruck. Ob – und wenn ja, in welcher Gestalt sie sich<br />
erweist, lässt sich weder generell noch im Vorhinein sagen; sondern nur im<br />
Augenblick und bezogen auf <strong>das</strong> unvertretbareigene Ich.Sie steht bei jeder und<br />
jedem Einzelnen auf dem Spiel.<br />
25<br />
26<br />
Auch hier schließe ich mich dem Urteil von Christine Axt-Piscalar an, vgl. dies., Gott und<br />
Glaube, S. 98 f.<br />
Martin Luther, Tischreden aus den Jahren 1531–1546, Nr. 5493, WA.TR 5; 189,1.
<strong>Christian</strong> <strong>Schad</strong>, Dr. theol. h.c., Jahrgang 1958, studierte Evangelische <strong>Theologie</strong> und<br />
Philosophie in Bethel, Tübingen und Bonn. Er war von 2008 bis 2021 Kirchenpräsident<br />
der Evangelischen Kirche der Pfalz und von 2013 bis 2021 Vorsitzender der<br />
Vollkonferenz und des Präsidiums der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen<br />
Kirche in Deutschland (UEK). Von 2016 bis 2022 leitete er als evangelischer<br />
Co-Vorsitzender den Kontaktgesprächskreis zwischen der Evangelischen Kirche in<br />
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz. Seit 2020 ist er der evangelische<br />
Vorsitzende des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen,<br />
seit 2021 Präsident des Evangelischen Bundes. Er ist Träger der Ehrenplakette<br />
der Stadt Landau/Pfalz und des Kronenkreuzes der Diakonie in Gold und erhielt 2019<br />
die Ehrendoktorwürde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.<br />
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
© 2023 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere <strong>für</strong><br />
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Cover: Zacharias Bähring, Leipzig<br />
Foto Seite 5: © Klaus Landry, Speyer<br />
Satz: 3w+p, Rimpar<br />
Druck und Binden: Hubert & Co., Göttingen<br />
ISBN Print 978-3-374-07328-3 // eISBN (PDF) 978-3-374-07329-0<br />
www.eva-leipzig.de