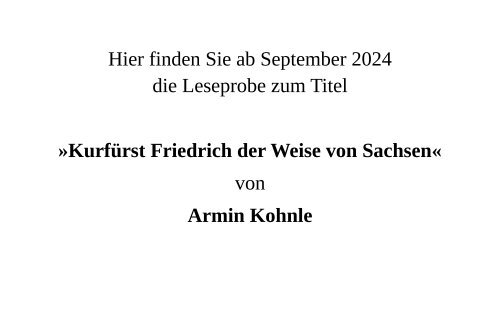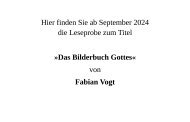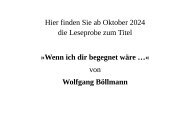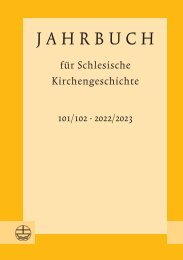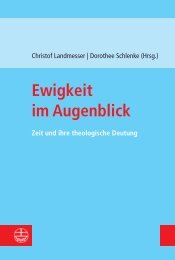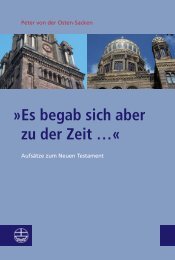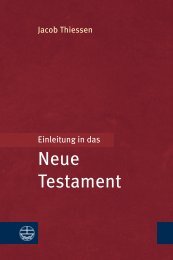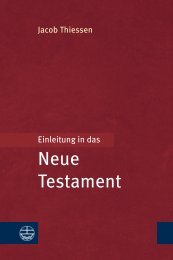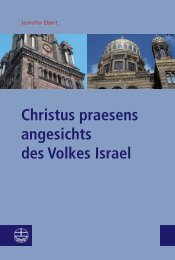Armin Kohnle: Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen (1463–1525)(Leseprobe)
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hier finden Sie ab September 2024<br />
die <strong>Leseprobe</strong> zum Titel<br />
»<strong>Kurfürst</strong> <strong>Friedrich</strong> <strong>der</strong> <strong>Weise</strong> <strong>von</strong> <strong>Sachsen</strong>«<br />
<strong>von</strong><br />
<strong>Armin</strong> <strong>Kohnle</strong>