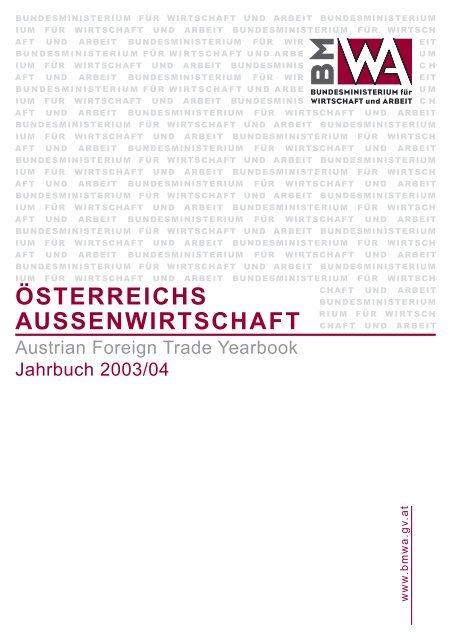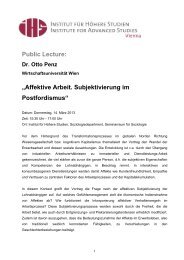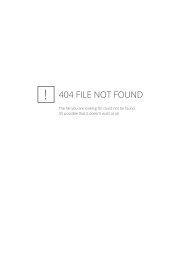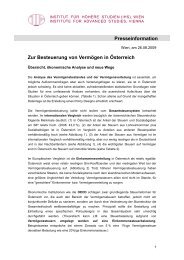2 internationale wirtschafts- politische rahmenbedingungen
2 internationale wirtschafts- politische rahmenbedingungen
2 internationale wirtschafts- politische rahmenbedingungen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
B U N D E S M I N I S T E R I U M F Ü R W I R T S C H A F T U N D A R B E IT BUNDESMINISTERIU M<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSC H<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
B U N D E S M I N I S T E R I U M F Ü R W I R T S C H A F T U N D A R B E IT BUNDESMINISTERIU M<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSC H<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCH<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
ÖSTERREICHS<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BU N D E S M I N I S T E R I U M<br />
IUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT BUNDESMINISTE R I U M F Ü R W I R T S C H<br />
AFT UND ARBEIT BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTS C H A F T U N D A R B E I T<br />
AUSSENWIRTSCHAFT<br />
Austrian Foreign Trade Yearbook<br />
Jahrbuch 2003/04<br />
www.bmwa.gv.at
ÖSTERREICHS AUSSENWIRTSCHAFT 2003/04<br />
HERAUSGEGEBEN VOM BUNDESMINISTERIUM<br />
FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT<br />
Wien, Juni 2004
Impressum<br />
Herausgeber und Medieninhaber<br />
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)<br />
Stubenring 1, 1011 Wien<br />
Gesamtleitung: Dr. Manfred Schekulin<br />
Koordination: Gertraud Tschinder<br />
Redaktion: Andrea Math (BMWA)<br />
Dr. Franz Müller (BMWA)<br />
Gertraud Tschinder (BMWA)<br />
Dr. Julia Wörz (wiiw)<br />
Kapitel 1–8 entstanden in Zusammenarbeit mit dem Wiener Institut für Internationale<br />
Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO)<br />
sowie Ao. Univ.-Prof. Wilfried Altzinger (WU Wien).<br />
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Michael Landesmann (wiiw)<br />
Projektkoordination: Dr. Julia Wörz (wiiw)<br />
Autoren: Ao. Univ.-Prof. Dr. Wilfried Altzinger (WU Wien)<br />
Mag. Mario Holzner (wiiw)<br />
Univ.-Prof. Dr. Michael Landesmann (wiiw)<br />
Dr. Sandor Richter (wiiw)<br />
Prof. Dr. Jan Stankovsky (WIFO)<br />
Mag. Waltraut Urban (wiiw)<br />
Mag. Hermine Vidovic (wiiw)<br />
Mag. Yvonne Wolfmayr (WIFO)<br />
Dr. Julia Wörz (wiiw)<br />
Statistik: Beate Muck (wiiw)<br />
Gabriele Wellan (WIFO)<br />
Grafische Gestaltung:<br />
Grafikstudio Sacher GmbH<br />
Hauptstraße 3/3/10, A-3010 Tullnerbach<br />
Herstellung:<br />
Druckerei Ferdinand Berger & Söhne GmbH.<br />
Wiener Straße 80, A-3580 Horn<br />
Verlags- und Herstellungsort:<br />
Wien<br />
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.<br />
Alle angegebenen Werte für das Jahr 2003 im Teil „Weltwirtschaft und Welthandel“ basieren auf Prognosen<br />
von WTO (April 2004), wiiw (Februar 2004), OECD (Dezember 2003) und IWF (September 2003). Der<br />
Teil „Österreichs Außenwirtschaft“ basiert auf den vorläufigen Ganzjahreszahlen 2003 (Statistik Austria,<br />
Oesterreichische Nationalbank), sowie auf der Prognose des WIFO (April 2004). Redaktionsschluss war<br />
der 30. April 2004 für den Österreich-Teil, der 28. Februar 2004 für den restlichen Teil.
Bundesminister<br />
Dr. Martin Bartenstein<br />
Die Integration Österreichs in die Weltwirtschaft nimmt laufend zu: Zwischen 1995 und<br />
2002 wuchsen die österreichischen Exporte (Waren und Dienstleistungen) um jährlich<br />
durchschnittlich +9 % und damit stärker als die Welt- (+3 %) bzw. EU-Exporte (+ 8,5%).<br />
Die Exportquote, das Verhältnis der Exporte zum BIP, stieg in diesem Zeitraum von<br />
37 % auf 53 %. Die Direktinvestitionsströme entwickelten sich noch dynamischer: Vor<br />
zehn Jahren machten die Investitionen ausländischer Unternehmen in Österreich 7 %<br />
des BIP aus, die Investitionen österreichischer Unternehmen im Ausland sogar nur<br />
2 %. Heute liegen sie in beiden Richtungen bei rd. 20 %. Österreichische Unternehmen<br />
gehören zu den größten Investoren in Mittel- und Südosteuropa.<br />
Dieser positive Trend setzte sich auch 2003 fort: In einem schwierigen <strong>internationale</strong>n<br />
Umfeld nahmen nach vorläufigen Zahlen der Nationalbank die Warenexporte um<br />
1,4 % auf 78,5 Mrd. Euro zu. Die Festigung des weltweiten Konjunkturaufschwungs<br />
sollte heuer stärkere Wachstumsimpulse und laut WIFO ein Exportwachstum von über<br />
4 % bringen. Auch die Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen im Ausland<br />
erreichten im Vorjahr mit 6,3 Mrd. Euro einen neuen historischen Höchstwert, der<br />
Gesamtbestand österreichischer Direktinvestitionen im Ausland erhöhte sich damit<br />
zum Jahresende 2003 auf rund 45 Mrd. Euro.<br />
Die Sicherung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit muss auch in Zukunft eine<br />
Top-Priorität der österreichischen wie der europäischen Wirtschaftspolitik bleiben.<br />
Österreich bekennt sich vollinhaltlich zum Lissabon-Prozess und dessen Ziel, die EU<br />
bis 2010 zur weltweit dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsregion zu<br />
entwickeln. Innerösterreichisch ist die Steuerreform 2005 ein Meilenstein zum Erhalt<br />
und zur weiteren Erhöhung der Attraktivität des Wirtschafts- und Arbeitsstandorts<br />
Österreich. Gleichzeitig setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gemeinsam<br />
mit der Wirtschaftskammer Österreich mit der Initiative „go international“ neue<br />
Impulse. Ziel von „go international“, für das bis 2005 50 Mio. Euro aus Budgetmitteln<br />
zur Verfügung stehen, ist es, die Exportquote weiter zu steigern, die Zahl der exportierenden<br />
Betriebe zu verdoppeln, den geographischen Radius der außenwirtschaftlichen<br />
Aktivitäten zu erweitern, den Dienstleistungsexport auch abseits des Tourismus zu<br />
forcieren und die österreichischen Direktinvestitionen im Ausland zu erhöhen.<br />
3
Den vielfältigen Anforderungen an eine zukunftsorientierte, umfassende und systematische<br />
– kurz: eine „strategische” – Außen<strong>wirtschafts</strong>politik ist auch das Jahresthema<br />
des diesjährigen – zehnten – österreichischen Außen<strong>wirtschafts</strong>jahrbuchs gewidmet.<br />
Es freut mich, dass es wieder gelungen ist, renommierte Autorinnen und Autoren für<br />
die Mitarbeit zu gewinnen, die dazu beitragen, dass dieses Jahrbuch seiner Rolle als<br />
wichtige österreichische Plattform für die Diskussion aktueller außenwirtschaftlicher<br />
Themen wieder einmal gerecht wird.<br />
Dr. Martin Bartenstein<br />
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit<br />
4
I N H A LT<br />
WELTWIRTSCHAFT UND WELTHANDEL 13<br />
1 Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004 15<br />
1.1 Globale Konjunkturentwicklung 15<br />
1.1.1 Konjunkturüberblick 2003 15<br />
1.1.2 Perspektiven für die Jahre 2004 und 2005 18<br />
1.2 Geld- und Fiskalpolitik 19<br />
1.3 Die Entwicklung der Arbeitsmärkte 21<br />
1.4 Regionale Entwicklungen 22<br />
1.4.1 Europäische Union 22<br />
1.4.2 USA 25<br />
1.4.3 Japan 26<br />
1.4.4 Mittel- und Osteuropäische Länder (MOEL) 28<br />
1.4.5 Südosteuropäische Länder (SOEL) 30<br />
1.4.6 Russland 32<br />
1.4.7 Türkei 33<br />
1.4.8 Asiatische Staaten 34<br />
1.4.9 China 35<br />
1.4.10 Argentinien 37<br />
1.4.11 Brasilien 38<br />
2 Internationale <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Rahmenbedingungen 40<br />
2.1 Die Europäische Union 40<br />
2.1.1 EU-Präsidentschaft 40<br />
2.1.2 EU-Erweiterung 43<br />
2.1.3 Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 45<br />
2.1.4 Außenbeziehungen der EU 45<br />
2.2 Regionale Abkommen 48<br />
2.2.1 Wirtschaftsintegration in Amerika 48<br />
2.2.2 Regionale Wirtschaftskooperation in Asien 49<br />
2.2.3 Afrika und Naher Osten 51<br />
2.3 Welthandelsorganisation (WTO) 51<br />
2.3.1 Laufende Verhandlungen 52<br />
2.3.2 Streitbeilegung 54<br />
5
I N H A LT<br />
6<br />
3 Entwicklung des Welthandels 57<br />
3.1 Der Welthandel in den Jahren 2002/03 57<br />
3.2 Ausblick für 2004 60<br />
3.3 Der Warenhandel 61<br />
3.3.1 Regionale Entwicklungen 62<br />
3.3.2 Sektorale Gliederung 66<br />
3.3.3 Entwicklung der Welthandelspreise 67<br />
3.4 Der globale Dienstleistungshandel 70<br />
3.5 Ausländische Direktinvestitionen 72<br />
3.5.1 Globale Entwicklungen 72<br />
3.5.2 Entwicklung in Osteuropa 73<br />
3.5.3 Entwicklung in Asien 74<br />
3.5.4 Institutionelle Veränderungen 74<br />
ÖSTERREICHS AUSSENWIRTSCHAFT 77<br />
4 Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick 79<br />
4.1 Die Konjunktur 2002/2003 und Ausblick auf 2004 79<br />
4.1.1 Aufschwung 2002 unterbrochen 79<br />
4.1.2 Weiteres Nachlassen der Konjunktur 2003 82<br />
4.1.3 Nur mäßige Konjunkturerholung 2004 84<br />
4.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Außenwirtschaft 86<br />
4.2.1 Die Außenwirtschaft in der VGR 86<br />
4.2.2 Preise und Wettbewerbsfähigkeit im Außenhandel 87<br />
4.2.3 Außenhandelsverflechtung der österreichischen Wirtschaft 89<br />
4.3 Beiträge zur Zahlungsbilanz 92<br />
5 Österreichs Warenhandel 96<br />
5.1 Überblick: Außenhandel 2002/03 sowie Ausblick auf 2004 96<br />
5.2 Aktive Handelsbilanz im Jahr 2002 99<br />
5.3 Starker Exporteinbruch im Jahr 2003 101<br />
5.3.1 Schlechte Rahmenbedingungen für den Export 102<br />
5.3.2 Regionale Entwicklung 102<br />
5.3.3 Sektorale Entwicklung 104
I N H A LT<br />
5.4 Regionale Struktur des Außenhandels:<br />
Bedeutung der EU-Erweiterung 106<br />
5.4.1 Starke Ausweitung der Exporte nach Mittel- und Osteuropa 107<br />
5.4.2 Der Außenhandel mit NAFTA und den Entwicklungsländern 110<br />
5.4.3 Handelsbilanz nach Regionen 110<br />
5.5 Die Güterstruktur des Außenhandels 112<br />
5.5.1 Positiver Strukturwandel im österreichischen Außenhandel 112<br />
5.5.2 Schwerpunktländer des österreichischen Exports 114<br />
5.5.3 Österreich auf Exporte mittlerer Qualität spezialisiert 115<br />
5.6 Österreichs Fahrzeugindustrie 116<br />
6 Der Außenhandel mit Dienstleistungen 119<br />
6.1 Sektorale Gliederung des Dienstleistungshandels 121<br />
6.1.1 Reiseverkehr 123<br />
6.1.2 Unternehmensbezogene Dienstleistungen 124<br />
6.1.3 Transporte 126<br />
6.1.4 Sonstige Positionen 126<br />
6.2 Regionale Entwicklung 127<br />
6.2.1 Geographische Konzentration 127<br />
6.2.2 Regionale Bilanzen 128<br />
7 Grenzüberscheitende Direktinvestitionen 130<br />
7.1 Einleitung 130<br />
7.2 Allgemeine Entwicklung der weltweiten Direktinvestitionen 131<br />
7.3 Österreichs Position im <strong>internationale</strong>n Vergleich 134<br />
7.3.1 Aktive und passive Direktinvestitionen im <strong>internationale</strong>n Vergleich 134<br />
7.3.2 Aktive und passive Direktinvestitionen nach Regionen 136<br />
7.3.3 Aktive und passive Direktinvestitionen nach Branchen 139<br />
7.3.4 Die Rentabilität der Direktinvestitionen 140<br />
7.3.5 Die Beschäftigungsentwicklung der Direktinvestitionen 143<br />
7.4 Unternehmensübernahmen und Fusionen 2003 144<br />
7.5 Bilaterale Investitionsschutzabkommen Österreichs 145<br />
7.6 Zusammenfassende Beurteilung 146<br />
Statistische Übersichten 149<br />
7
I N H A LT<br />
Eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik für<br />
Österreich: Die Internationalisierungsoffensive<br />
2003/2005 203<br />
8<br />
9 Eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik für Österreich 205<br />
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
9.1 Einleitung 205<br />
9.2 Strategisches Denken und strategisches Management 206<br />
9.3 Analyse der strategischen Ausgangssituation 208<br />
9.3.1 Umfeldanalyse/Globalisierungstrends 208<br />
9.3.2 Stärken-/Schwächenprofil der österreichischen Außenwirtschaft 213<br />
9.4 Anforderungen an eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik 217<br />
9.5 Die Internationalisierungsoffensive „go international” 219<br />
9.6 Ein „Außenwirtschaftliches Leitbild“ für Österreich 221<br />
10 Die Stabsstelle für Strategische Außenwirtschaft 226<br />
Franz Ceska<br />
10.1 Die Aufgaben der Stabsstelle 227<br />
10.2 „Go international“ – Die Internationalisierungsoffensive 228<br />
10.2.1 „Go international“ – Hintergrund 228<br />
10.2.2 Strategiefelder von „go international“ 229<br />
10.2.3 Die Umsetzung 231<br />
10.3 Ausblick 232<br />
11 Außenhandelsstruktur der österreichischen Industrie 234<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
11.1 Einleitung 234<br />
11.2 Theoretische Ansätze 235<br />
11.3 Methodische Grundlagen 236<br />
11.4 Branchenprofil des österreichischen Außenhandels 239<br />
11.4.1 Exportspezialisierung 239<br />
11.4.2 Komparative Vorteile (RCA-Werte) 243<br />
11.4.3 Unit Values im Export 245<br />
11.4.4 Strukturwandel 246<br />
11.5 Die Bedeutung des Osthandels für den Strukturwandel 249<br />
11.6 Schlussfolgerungen 253
I N H A LT<br />
12 Der erste Schritt – Motivation und Betreuung<br />
von Exporteuren 256<br />
Walter Koren<br />
12.1 Exportförderung und ihr Adressatenkreis 256<br />
12.2 Das fremde Marketingumfeld im Export 256<br />
12.3 Unternehmensinterne und -externe Exportbarrieren 257<br />
12.4 Exportmotive: Aktive und reaktive Strategien im Export 259<br />
12.5 Das Förderinstrumentarium der Kammerorganisation 260<br />
12.6 Das Gewinnen potenzieller Neuexporteure 264<br />
12.7 Die Prüfung der Exportfähigkeit 267<br />
12.8 Marktselektion und Marktsegmentierung 267<br />
12.9 Markteintrittsvarianten 268<br />
12.9.1 Indirekter Export 269<br />
12.9.2 Direkter Export 269<br />
12.9.3 Andere Formen der Marktbearbeitung 270<br />
12.9.4 Exportkooperation 271<br />
12.10 Ausblick 272<br />
13 Direktinvestitions-Förderung heute und morgen 273<br />
Reinhard Moser<br />
13.1 Zielvorgabe und Aufbau des Beitrages 273<br />
13.2 Ausgangssituation 273<br />
13.2.1 Inhaltliche Abgrenzung 273<br />
13.2.2 Problemfelder 275<br />
13.2.3 Förderungsarten und Förderungszulässigkeit 277<br />
13.3 Förderung ausländischer Direktinvestitionen in Österreich –<br />
Status quo 278<br />
13.3.1 Übersicht 278<br />
13.3.2 Unterstützung im Bereich der Risikoabsicherung 280<br />
13.3.3 Unterstützung im Bereich der Kapitalaufbringung 288<br />
13.4 Zukunft – Desiderate 291<br />
14 Dienstleistungen: Export ist mehr als Warenverkehr 297<br />
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
14.1 Die zunehmende Globalisierung des Dienstleistungshandels 297<br />
14.2 Vorüberlegungen für die empirische Analyse des<br />
Dienstleistungshandels 301<br />
9
I N H A LT<br />
10<br />
14.2.1 Theoretischer Hintergrund 301<br />
14.2.2 Statistische Erfassung von Dienstleistungen 302<br />
14.3 Sektorbetrachtungen 303<br />
14.3.1 Österreichs Dienstleistungshandel im <strong>internationale</strong>n Vergleich 304<br />
14.3.2 Die Betrachtung ausgewählter Sektoren 308<br />
14.3.3 Stärken und Schwächen aus österreichischer Sicht 309<br />
14.4 Politische Handlungsfelder 314<br />
15 IFIs als Außen<strong>wirtschafts</strong>partner für Österreich 320<br />
Ewald Nowotny<br />
15.1 Die für Österreichs Außenwirtschaft wichtigsten<br />
Finanzinstitutionen 320<br />
15.1.1 Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB, EIF), Luxemburg 321<br />
15.1.2 Weltbank-Gruppe (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID) 323<br />
15.1.3 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) 325<br />
15.1.4 Asian Development Bank (ADB) 327<br />
15.1.5 Council of Europe Development Bank (CEB) 328<br />
15.1.6 Nordic Investment Bank (NIB) 328<br />
15.2 Bereiche der Partnerschaft 328<br />
15.2.1 Regionale Aspekte 328<br />
15.2.2 Sektorale Aspekte 332<br />
15.2.3 Industriell-gewerblicher und Dienstleistungs-Bereich 333<br />
15.3 Kooperation mit IFIs – Erfahrungen und Chancen 334<br />
16 Cluster als Exportmotor 340<br />
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
16.1 Oberösterreich – das führende Exportbundesland Österreichs 340<br />
16.2 Export-Aktivitäten des Automobil-Clusters 342<br />
16.2.1 Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken 345<br />
16.3 Export-Aktivitäten des Kunststoff-Clusters 346<br />
16.4 Export-Aktivitäten des Möbel- und Holzbau-Clusters 347<br />
16.5 Export-Aktivitäten des Lebensmittel-Clusters 349<br />
16.6 Export-Aktivitäten des Gesundheits-Clusters 351<br />
16.7 Export-Aktivitäten des Mechatronik-Clusters 353<br />
16.8 Export-Aktivitäten des Ökoenergie-Clusters 355<br />
16.9 Die Zeit ist reif für Europäische Unternehmens-Netzwerke 356
I N H A LT<br />
17 Bedeutung der Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen 359<br />
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
17.1 Einleitung 359<br />
17.2 Zur Entwicklung der Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen 360<br />
17.3 Theorie und Empirie – die Rolle von Datenbanken und<br />
Forschungsinstituten 362<br />
17.4 Besondere Aspekte der Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen in Österreich 364<br />
17.5 Österreichische <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftliche Institute im<br />
Internationalen Vergleich 367<br />
17.6 Abschließende Betrachtungen 372<br />
18 Das „Kleine“, das „Grosse“ und das „Neue Lernen“ 381<br />
Harald Steindl<br />
18.1 Schlüsselqualifikationen für die Wissensgesellschaft 381<br />
18.1.1 Zur Leistungsfähigkeit des Schulsystems 382<br />
18.1.2 Mehr als ein Armutszeugnis 383<br />
18.1.3 Nachdenken statt Nachsitzen 385<br />
18.1.4 Das neue Fundament: Lernen lernen 386<br />
18.2 Wa(h)re Bildung 387<br />
18.2.1 Everything – Anything for Sale? 388<br />
18.2.2 McKinsey kommt – und bildet 389<br />
18.2.3 „School Governance“ auf dem Prüfstand 391<br />
18.2.4 Kindheit ist Lernen – Die neurobiologische Revolution 392<br />
18.2.5 Im Netzwerk des Wissens 393<br />
18.2.6 Jedem sein Ariadnefaden 395<br />
18.3 Fabula docet: Navigare necesse est (et non vivere) 395<br />
18.3.1 Eipeldauer im Tschad: 21 Thesen zum „Neuen Lernen“ 397<br />
19 Verzeichnins der Tabellen und Abbildungen 409<br />
20 Stichwortverzeichnis 415<br />
21 Verzeichnis der Länderaggregate und Abkürzungen 409<br />
21.1 Länderaggregate 409<br />
21.2 Abkürzungen 411<br />
11
WELTWIRTSCHAFT UND WELTHANDEL<br />
13
1 LAGE DER WELTWIRTSCHAFT 2003<br />
UND AUSBLICK 2004<br />
Der seit langem erwartete Aufschwung der Weltwirtschaft, welcher in den USA<br />
bereits im Jahr 2002 begonnen hatte, setzte im Jahr 2003 vor allem außerhalb<br />
Europas vollends ein. In den drei wichtigsten Wirtschaftsblöcken ergab sich somit<br />
ein recht unterschiedliches Bild. In den USA konnte der Aufwärtstrend auf eine<br />
breitere Basis gestellt werden und gewann mit 2,9 % Wachstum an Dynamik. In<br />
Japan wurde der Aufschwung (2,7 %) erstmals seit etwas mehr als einer Dekade<br />
vorwiegender Stagnation vom privaten Konsum und nicht von staatlichen Maßnahmen<br />
getragen. In der EU hingegen blieb die Entwicklung mit 0,7 % BIP-Zuwachs<br />
hinter den Erwartungen zurück, mit entsprechend negativen Auswirkungen auf die<br />
ohnehin zum Großteil wenig zufrieden stellende Lage der Arbeitsmärkte. Innerhalb<br />
Europas (Ost- und Westeuropa) zeichnet sich trotz eines leichten Anstiegs der<br />
Beschäftigung kurzfristig keine Verringerung der Arbeitslosigkeit ab.<br />
Die Prognosen für die Jahre 2004 und 2005 lassen eine dynamische Entwicklung<br />
vor allem in Asien und Nordamerika erwarten (2004: USA 4,2 %, Japan 1,8 %, China<br />
7 %). Die Aussichten für Europa sind ebenfalls gut, es wird auch weiterhin mit einem<br />
Wachstumsdifferential von rund 2 % zwischen dem Westen (EU: 1,9 %) und dem Osten<br />
(MOEL-8: 3,8 %) gerechnet. In Lateinamerika dürfte die jüngste Krise überwunden<br />
sein, die Voraussetzungen für ein stabiles Wirtschaftswachstum in den kommenden<br />
zwei Jahren (aufgrund der Umsetzung der Stabilitätsprogramme, Rückgang der Inflation,<br />
zunehmendes Investorenvertrauen und erfolgreiche Umschuldungen) sind gut.<br />
1.1 Globale Konjunkturentwicklung<br />
1.1.1 Konjunkturüberblick 2003<br />
Die Konjunkturentwicklung im Jahr 2003 verlief in den USA, der Eurozone und Japan<br />
(siehe Abbildung 1.1) unterschiedlich: Während sich Japan von der wirtschaftlichen<br />
Stagnation in den Jahren 2001 und 2002 erholte, die USA bereits seit 2002 eine wirtschaftliche<br />
Erholung erlebte, blieb das Wirtschaftswachstum in der Eurozone mäßig<br />
(bei etwa 0,5 %). Für die Erholung der globalen Konjunktur – der globale Output gewichtet<br />
zu Kaufkraftparitäten wuchs in den Jahren 2001 mit 2,4 %, 2002 mit 3,0 % und<br />
2003 mit 3,2 % 1 – war die Erholung der US-Wirtschaft von maßgeblicher Bedeutung,<br />
da insbesondere die hohen Leistungsbilanzdefizite der amerikanischen Wirtschaft<br />
zusätzliche, starke Nachfrageeffekte auf die wichtigsten Handelspartner auslösten.<br />
Dazu kamen eine Stabilisierung des Ölpreises nach dem Ende des Irakkrieges, sehr<br />
niedrige globale Zinssätze und robuste hohe Wachstumsraten in wichtigen asiatischen<br />
Wirtschaften (inklusive den bevölkerungsreichen Wirtschaften Chinas und Indiens).<br />
15
Besonders ab Mitte 2003 stieg im OECD-Raum die Profitabilität des Unternehmenssektors<br />
und damit die Investitionsneigung, die Aktienmärkte erholten sich von einem<br />
tiefen Stand und die Konjunktur – welche in den vergangenen zwei Jahren stark von<br />
der Bereitschaft der amerikanischen Konsumenten abhing, ihre Ausgaben aufrecht<br />
zu erhalten – bekam ein solideres, balancierteres Fundament.<br />
Konjunkturverlauf in den wichtigsten OECD-Regionen Abb. 1.1<br />
Reales BIP-Wachstum zum Vorjahr<br />
16<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
USA<br />
Eurozone<br />
Japan<br />
4Q00 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q03 2Q03 3Q03 4Q03<br />
Quelle: OECD Economic Outlook, Dezember 2003.<br />
Bestimmte Aspekte der globalen wirtschaftlichen Entwicklung liefern weiterhin Grund zur<br />
Besorgnis: Der Aufschwung scheint wiederum in hohem Maße von der Entwicklung der<br />
US-amerikanischen Wirtschaft abzuhängen und dort wiederum gab es eine Rückkehr<br />
zu dem aus der Mitte der 1980er-Jahre bekannten Phänomen des „Zwillingsdefizits“<br />
(Koinzidenz von starken Leistungsbilanz- und fiskalischen Defiziten; siehe Abbildung 1.2).<br />
Die Ökonomen erwarten, dass diese Situation längerfristig nicht haltbar sein wird und<br />
Prozesse in Gang gesetzt werden, welche diesen Ungleichgewichten entgegenwirken.<br />
Einer dieser Prozesse ist bereits im Gange, nämlich die starke Abwertung des US-Dollars<br />
vor allem gegenüber dem Euro (Dollarzonen sind automatisch an die Bewegungen<br />
des US-Dollar gebunden und die japanische Zentralbank versuchte – relativ erfolgreich
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
– eine starke Aufwertung der Yen/US-Dollar-Rate zu verhindern). Ein weiterer Prozess,<br />
welcher erwartet wird, ist ein Druck auf die <strong>internationale</strong>n Zinssätze. Dies würde wiederum<br />
längerfristig die globale Konjunkturentwicklung negativ beeinflussen.<br />
„Zwillings-Defizit“ in den USA Abb. 1.2<br />
Leistungsbilanz<br />
Quelle: IWF, World Economic Outlook, September 2003.<br />
Budgetdefizit<br />
1980 84 88 92 96 2000 04 08 -8<br />
Bisher blieben die Zinssätze auf einem historisch sehr niedrigen Niveau, da die US-<br />
Notenbank (Federal Reserve Bank) und die Europäische Zentralbank (EZB) einen<br />
sehr akkomodierenden Kurs fahren, welcher aufgrund der niedrigen Inflationsraten<br />
auch begründbar ist. Gründe für die niedrigen Inflationsraten in den USA sind die späte<br />
Erholung der Beschäftigungssituation, da die erste Phase der Konjunkturerholung zu<br />
starken Rationalisierungsmaßnahmen und Produktivitätssteigerungen genutzt wurde,<br />
und in Europa das Faktum, dass es bisher nur eine sehr mäßige Konjunkturbelebung gegeben<br />
hat und sich die Arbeitssituation noch gar nicht gebessert hat. Bei der sich Anfang<br />
2004 durchsetzenden weiteren positiven Konjunkturentwicklung und der Persistenz der<br />
großen fiskalischen Ungleichgewichte in den USA werden diese Faktoren an Bedeutung<br />
verlieren und eine Erhöhung der Zinssätze kann mittelfristig angenommen werden. Sollte<br />
dies passieren, kann es zu negativen Auswirkungen auf die Konsumausgaben kommen,<br />
insbesondere da die Haushaltsverschuldung hoch ist und die Vermögenswerte auf den<br />
Immobilienmärkten (welche sich besonders in den USA und in Großbritannien auf einem<br />
hohen Niveau befinden) relativ stark fallen könnten. Zusätzlich könnte eine Zinssteigerung<br />
die Entwicklungschancen hoch verschuldeter Länder stark beeinträchtigen.<br />
2<br />
0<br />
-2<br />
-4<br />
-6<br />
17
Als positiver Aspekt der globalen wirtschaftlichen Entwicklung ist zu erwähnen, dass die<br />
positive Konjunkturentwicklung international auf einem relativ breiten Fundament steht.<br />
So wuchs die japanische Wirtschaft nach einer langen Durststrecke mit respektablen<br />
Raten, bevölkerungsreiche asiatische Länder wuchsen mit sehr hohen Raten, wichtige<br />
Wirtschaften Lateinamerikas konnten sich stabilisieren und sogar die chronische<br />
Krisenregion Sub-Sahara-Afrika wuchs 2003 um 3,6 %. Ferner ist in der Eurozone<br />
das Potenzial vorhanden, die starken Produktivitätsentwicklungen, welche die USA in<br />
den späten 1990er-Jahren charakterisiert hatten, und die vor allem auf die Entwicklung<br />
und Diffusion von Informationstechnologien zurückzuführen waren, mit einiger<br />
Verzögerung und zu einem gewissen Grade nachzuholen. Mittel- bis langfristig kann<br />
das Wirtschaftswachstum Europas auch durch die positiven Effekte angebotsseitiger<br />
und fiskal<strong>politische</strong>r Reformen sowie durch die Integrationseffekte eines immer größer<br />
werdenden gemeinsamen Wirtschaftsraumes angekurbelt werden. Die EU-Erweiterung<br />
sowie die vertiefende wirtschaftliche Integration mit Regionen, welche sich auch auf<br />
Nicht-EU-Mitglieder erstreckt, dürften langfristig dahingehend wirken.<br />
1.1.2 Perspektiven für die Jahre 2004 und 2005<br />
Die OECD geht von einer Beschleunigung des Wirtschaftswachstums für die OECD-<br />
Länder insgesamt von 2,0 % im Jahre 2003, auf 3,0 % im Jahre 2004 und 3,1 % im<br />
Jahre 2005 aus (siehe auch Tabelle 1.2 in den Statistischen Übersichten). Die Prognosen<br />
bezüglich der wichtigsten OECD-Länder bzw. -Region sind recht unterschiedlich: Für die<br />
USA werden Wachstumsraten für 2004 von 4,2 % und für 2005 von 3,8 % erwartet; für<br />
die EU 1,9 % und 2,5 % und für Japan jeweils 1,8 %. Diese Differenzierung ist einerseits<br />
durch den starken fiskalischen Stimulus in der US-amerikanischen Wirtschaft begründet<br />
(siehe Abschnitt 1.2), andererseits durch die positiven Effekte der starken US-Dollar-Abwertung<br />
auf die amerikanische Leistungsbilanz sowie durch die angebotsseitige Stärke<br />
der US-Wirtschaft. In einigen Studien wird der amerikanischen Wirtschaft auch mittelfristig<br />
eine Fortsetzung des seit der Wende in den 1990er-Jahren positiven Trends des Produktivitätswachstums<br />
(und daher auch des potentiellen Outputwachstums) zugebilligt.<br />
Nach Einschätzung der Autoren dieses Kapitels könnte diese starke Differenzierung<br />
zwischen US-amerikanischem und europäischem bzw. japanischem Wachstum eventuell<br />
überzogen sein. Wie bereits erwähnt, wird auch die europäische Wirtschaft noch<br />
vom Diffusionsprozess neuer Technologien (besonders im Informations- und Kommunikationsbereich)<br />
sowie von den Vorteilen des sich vertiefenden Integrations- und<br />
Erweiterungsprozesses profitieren. Ein zusätzlicher Schub von fiskalischer Restriktion,<br />
nach den korrigierenden und mäßig stabilisierenden Maßnahmen in Deutschland und<br />
Frankreich, wird nicht zu erwarten sein, nachdem der wirtschaftliche Aufschwung auch<br />
18
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
die Defizitsituation verbessern sollte sowie auch der Stabilitäts- und Wachstumspakt<br />
nach den jüngsten Erfahrungen relativ lax ausgelegt werden wird. Andererseits kann<br />
es korrigierende fiskal<strong>politische</strong> Maßnahmen nach den Präsidentschaftswahlen in<br />
den USA geben. Die Verschuldungssituation des japanischen Unternehmens- und<br />
Bankensektors verbesserte sich maßgeblich und man kann erwarten, dass Japan auch<br />
von der starken Wachstums- und Integrationsdynamik im asiatischen Raum weiter<br />
profitieren wird. Die Wechselkursbewegungen sowie die handels<strong>politische</strong>n Entwicklungen<br />
sind schwer abzuschätzen und werden die transatlantischen wirtschaftlichen<br />
Beziehungen sicherlich maßgeblich beeinflussen.<br />
Wie bereits erwähnt wird die Zinssatzentwicklung die wirtschaftlichen Entwicklungen<br />
besonders in den Schwellenländern und ärmeren Regionen stark beeinflussen. Starke<br />
Umkehrbewegungen in der amerikanischen Leistungsbilanz, protektionistische Tendenzen<br />
und eine hohe Volatilität der Wechselkurse können insbesondere negative<br />
Auswirkungen auf die Wachstumschancen der Länder haben, welche von den reichen<br />
OECD-Ländern und der US-Wirtschaft stark abhängen.<br />
1.2 Geld- und Fiskalpolitik<br />
Die letzten fünf Jahre zeigten große Unterschiede in der Handhabung fiskal<strong>politische</strong>r<br />
(zu einem geringeren Maße auch geld<strong>politische</strong>r Instrumente) in den einzelnen OECD-<br />
Ländern bzw. -Regionen. Wie aus Tabelle 1.1 ersichtlich, gab es einen dramatischen<br />
Umschwung in der fiskalischen Position in der OECD insgesamt zwischen den Jahren<br />
2000 und 2003. Dem Nulldefizit im Jahr 2000 folgte ein Defizit von 3,8 % im Jahre<br />
2003 (siehe auch Tabelle 1.5 in den Statistischen Übersichten). Damit reagierte der<br />
Staatshaushalt entweder passiv (mit Hilfe automatischer Stabilisatoren wie in der<br />
Eurozone) oder aktiv (mit aktivistischen Steuererleichterungsprogrammen wie in den<br />
USA) auf den starken Wirtschaftsabschwung in den Jahren 2001 und 2002. Die Zahlen<br />
zeigen, dass sich die Fiskalposition in den USA von einem Überschuss von 1,4 %<br />
des BIP im Jahre 2000 zu einem Defizit von 4,9 % im Jahre 2003 wandelte (eine<br />
Veränderung von 6,3 Prozentpunkten), während die Veränderung in der Eurozone<br />
2,8 Prozentpunkte ausmachte (von 0,1 % auf –2,7 %). Japan hatte durchgehend sehr<br />
hohe Defizitpositionen (zwischen 6 % und 7,5 % des BIP) und daher keinen Spielraum<br />
für zusätzliche fiskalische Stimulierung.<br />
Wie aus Tabelle 1.1 ebenfalls ersichtlich, erwartet die OECD keine Veränderungen in<br />
den staatlichen Defizitpositionen dieser Länder bzw. Region in den Jahren 2004 und<br />
2005. Der öffentliche Schuldenstand als Anteil des BIP würde damit auf einen historisch<br />
sehr hohen Stand steigen (82 % im Jahre 2005 im OECD-Raum insgesamt). Dies verteilt<br />
sich auf die wichtigen OECD-Länder in folgender Weise: USA 68,5 %, Eurozone<br />
19
Budgetdefizit / -überschuss (Gesamter Staatshaushalt)<br />
in % des BIP/ des potenziellen BIP<br />
USA<br />
20<br />
Tab. 1.1<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Prognose<br />
Defizit/ Überschuss 1,4 -0,5 -3,4 -4,9 -5,1 -4,9<br />
zyklisch bereinigt 0,9 -0,2 -3,0 -4,5 -5,1 -5,0<br />
Japan<br />
Defizit/ Überschuss -7,4 -6,1 -7,1 -7,4 -6,8 -6,9<br />
zyklisch bereinigt -7,1 -5,5 -6,3 -6,9 -6,5 -6,6<br />
Eurozone<br />
Defizit/ Überschuss 0,1 -1,7 -2,3 -2,7 -2,6 -2,7<br />
zyklisch bereinigt -1,4 -1,9 -1,9 -1,7 -1,5 -1,8<br />
OECD<br />
Defizit/ Überschuss 0,0 -1,3 -2,9 -3,8 -3,8 -3,7<br />
zyklisch bereinigt -1,1 -1,4 -2,8 -3,4 -3,6 -3,7<br />
Quelle: OECD Economic Outlook, Dezember 2003.<br />
76,6 %, Japan 176,2 %. Kurzfristig schränkt dies die Möglichkeiten der OECD-Länder<br />
ein, eventuell auf zusätzliche negative Schocks zu reagieren. Längerfristig zeigt sich,<br />
dass ein Pfad der nachhaltigen Stabilisierung der staatlichen Finanzen noch nicht zufriedenstellend<br />
beschritten wurde, besonders in den OECD-Regionen, welche aufgrund<br />
der säkularen Tendenzen in der demographischen Entwicklung sowie der Verteuerung<br />
der Gesundheitssysteme besonders rasch handeln müssen.<br />
In der Geldpolitik konnte man ebenfalls Unterschiede zwischen der Politik der Federal<br />
Reserve Bank in den USA und der EZB in der Eurozone ausmachen: Die kurzfristigen<br />
Zinssätze, welche sich in den USA im Jahre 2000 auf 6,5 % beliefen, sanken auf 1,2 %<br />
im Jahr 2003, während die kurzfristigen Zinssätze in der Eurozone in derselben Periode<br />
von 4,4 % auf nur 2,3 % sanken. Fiskal- und geld<strong>politische</strong> Instrumente wurden also in<br />
den Jahren 2001 bis 2003 in den USA viel vehementer zur Stimulierung der Wirtschaft<br />
eingesetzt (Konsum und Investitionen) als in der Eurozone. In den nächsten beiden<br />
Jahren wird eine stärkere Konvergenz in den Zinssatzentwicklungen zwischen den<br />
USA und der Eurozone erwartet. Insgesamt wird der EZB – nach einer Phase, in der<br />
sie relativ spät auf die Verlangsamung der wirtschaftlichen Konjunktur reagiert hat – in<br />
der jüngsten Periode ein positiveres Zeugnis ausgestellt, da sie mit mehr Flexibilität<br />
und einem akkurateren Instrumentarium („inflation targeting“) auf Konjunkturentwicklungen<br />
reagiert. Eine der großen Herausforderungen der EZB in den nächsten Jahren<br />
wird es sein, bei der Bewältigung der komplizierten geld- und wechselkurs<strong>politische</strong>n<br />
Probleme in den neuen EU-Mitgliedstaaten – vor deren voller Mitgliedschaft in der<br />
Europäischen Währungsunion (EWU) – zu assistieren.
1.3 Die Entwicklung der Arbeitsmärkte<br />
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
Die schwache Wirtschaftsdynamik in der EU hatte eine weitere Verschlechterung auf<br />
dem Arbeitsmarkt zur Folge. Im Jahr 2003 erhöhte sich die Arbeitslosigkeit in zehn<br />
Mitgliedsländern, Ausnahmen bildeten lediglich Griechenland, Italien, Großbritannien<br />
und Finnland, wo leichte Rückgänge verzeichnet wurden, sowie Spanien und Finnland,<br />
wo die Arbeitslosigkeit stagnierte (siehe auch Tabelle 1.4 in den Statistischen<br />
Übersichten). Für die Eurozone bedeutet diese Entwicklung eine Zunahme der Arbeitslosenquote<br />
auf 8,8 % und in der gesamten EU auf 8 %. Wesentlichen Anteil<br />
an dieser im Vergleich zu den USA (6 %) und Japan (5,3 %) immer noch hohen<br />
Arbeitslosigkeit hatten vor allem die großen EU-Länder Deutschland, Frankreich und<br />
Spanien, die über dem Durchschnitt liegende Werte (9 – 11 %) auswiesen. In den<br />
kleineren Mitgliedsländern wie Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und Irland<br />
wurden, ähnlich wie in den vergangenen Jahren, nur knapp halb so hohe Arbeitslosenquoten<br />
verzeichnet. Gleichzeitig konnte die Beschäftigung in den EU-Ländern trotz<br />
schwacher Wirtschaftsleistung nahezu konstant gehalten werden, was jedoch auf eine<br />
stagnierende Produktivität hinweist. Die höchsten Beschäftigungszuwächse konnten<br />
in Spanien und Luxemburg erzielt werden (je plus 1,7 %), während Deutschland von<br />
den stärksten Arbeitsplatzverlusten (-1,5 %) betroffen war.<br />
Die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt spiegelt die seit drei Jahren andauernde<br />
wirtschaftliche Stagnation wider. Es zeigten sich zwar erste Tendenzen einer<br />
Beschäftigungszunahme im Bereich der produktionsnahen Dienstleistungen, diese<br />
konnten jedoch die Arbeitsplatzverluste in der Industrie und in der Bauwirtschaft<br />
bisher nicht kompensieren. Trotz des erwarteten Wirtschaftsaufschwungs rechnet<br />
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erst 2005 mit einer merklichen<br />
Erhöhung der Beschäftigung, während ein Sinken der Arbeitslosigkeit bereits 2004<br />
erwartet wird. Demgegenüber prognostizieren die OECD und die EU-Kommission einen<br />
Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland erst im Jahr 2005. Laut DIW durchläuft<br />
der deutsche Arbeitsmarkt gravierende strukturelle Änderungen, die von einer starken<br />
Ausweitung der Zahl geringfügig Beschäftigter (Mini-Jobs) zu Lasten versicherungspflichtiger<br />
Beschäftigter geprägt sind. Diese Entwicklung dürfte allerdings längerfristig<br />
eine Schwächung der finanziellen Basis der Sozialversicherung nach sich ziehen.<br />
Die wirtschaftliche Erholung in den USA zeigte bisher kaum positive Auswirkungen auf<br />
den Arbeitsmarkt. Die Zahl der arbeitslosen Personen nahm zwar seit Mitte 2003 leicht<br />
ab, dennoch erreichte die Arbeitslosigkeit das höchste Niveau seit 1994. Das kräftige<br />
Wirtschaftswachstum war in erster Linie Ausdruck hoher Produktivitätssteigerungen<br />
und hatte bisher nur einen geringen Beschäftigungszuwachs zur Folge.<br />
21
In den mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern war die Arbeitslosenquote fast<br />
doppelt so hoch wie in der EU. Nur Ungarn und Slowenien blieben unter dem EU-<br />
Durchschnitt, während die seit Jahren hohe Arbeitslosigkeit in Polen trotz einer<br />
Belebung des Wirtschaftswachstums weiter zunahm. Ausschlaggebend für diese<br />
Entwicklung waren u.a. demographische Faktoren – das Drängen geburtenstarker<br />
Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt – sowie die Freisetzung von Arbeitskräften im Zuge<br />
von Umstrukturierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft, im Kohlebergbau und in<br />
der Stahlindustrie. Jüngsten Berechnungen zufolge müsste in Polen ein Wirtschaftswachstum<br />
von rund 4 % erreicht werden, um die Beschäftigung zumindest konstant<br />
zu halten. In der Slowakei trat eine leichte Verbesserung der angespannten Situation<br />
auf dem Arbeitsmarkt ein, die Arbeitslosenquote war mit 18 % aber immer noch unter<br />
den höchsten. In Russland nahm die Arbeitslosigkeit im Jahr 2003 – gemessen sowohl<br />
an der standardisierten als auch an der registrierten Arbeitslosenquote – trotz<br />
eindrucksvoller Steigerung des Wirtschaftswachstums (7 %) leicht zu, gleichzeitig<br />
war die Beschäftigung mäßig rückläufig. Diese Entwicklung dürfte Ausdruck einer<br />
kräftigen Produktivitätsentwicklung sein, könnte aber auch Unzulänglichkeiten in der<br />
statistischen Datenerfassung widerspiegeln.<br />
Die Erwartungen der EU-Kommission und der OECD hinsichtlich der Entwicklung auf<br />
dem Arbeitsmarkt sind für das Jahr 2004 eher zurückhaltend. So wird zwar sowohl für<br />
die EU-15 als auch für die Beitrittsländer mit einem leichten Anstieg der Beschäftigung<br />
gerechnet, die Arbeitslosigkeit hingegen dürfte weiter zunehmen. Eine spürbare Erholung<br />
wird erst für 2005 prognostiziert. Das mittelfristige Ziel, die Beschäftigungsquote<br />
in der EU im Jahr 2005 auf 65 % zu erhöhen, wird trotz guter Ergebnisse in den<br />
vergangenen Jahren nicht erreicht werden können. Für die USA erwartet die OECD<br />
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit ab 2004.<br />
1.4 Regionale Entwicklungen<br />
1.4.1 Europäische Union<br />
In der EU dürfte die Talsohle durchschritten sein, wenn auch die erwartete wirtschaftliche<br />
Erholung nach wie vor langsam voran geht. Im ersten Halbjahr 2003 schlitterte<br />
ein Teil Westeuropas in eine veritable Rezession, welche die in der zweiten Jahreshälfte<br />
2002 einsetzende Erholung rasch zunichte machte. Im dritten Quartal wurden<br />
in der Region (im Vorjahresvergleich) wieder positive Wachstumsraten erzielt (EU:<br />
1,3 %, Eurozone: 1,1 %). Für das Jahr 2003 insgesamt geht die OECD von einem<br />
BIP-Wachstum in der EU von 0,7 % aus (Eurozone 0,5 %). Damit war das Wachstum<br />
geringer als in der OECD insgesamt (2 %) und stellte auch eine Abschwächung ge-<br />
22
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
genüber dem Vorjahr dar (EU: 1,1 %, Eurozone: 0,9 %). Für 2004 wird eine allgemeine<br />
Festigung der Konjunktur in Europa erwartet, das BIP-Wachstum der EU wird in der<br />
Herbstprognose der OECD mit 1,9 % (Eurozone 1,8 %) veranschlagt, wird aber noch<br />
immer deutlich geringer als in der OECD insgesamt ausfallen (3 %).<br />
Die (kontinental) europäische Wirtschaft wird schon seit längerer Zeit durch eine<br />
allgemeine Schwäche der Binnennachfrage (privater Konsum und Investitionen) charakterisiert.<br />
Da der öffentlichen Nachfrage wegen des Drucks zur Budgetkonsolidierung<br />
sehr enge Grenzen gesetzt sind, ist der Wirtschaftsraum sehr von Impulsen aus<br />
dem Ausland abhängig. Die starke effektive Aufwertung des Euro verzögerte jedoch<br />
2003 ein Durchschlagen der Erholung der Weltwirtschaft auf Europa und übte einen<br />
zusätzlichen Druck auf die ohnehin schon niedrigen Gewinne der Unternehmen und<br />
ihre Investitionsneigung aus. Ein weiterer Anstieg der Arbeitslosigkeit (auf 8,0 % in der<br />
EU-15) und eine signifikante Verschlechterung der Konsumentenstimmung dämpften<br />
den privaten Konsum. Im dritten Quartal zeichnete sich allerdings eine Erholung der<br />
Exporte ab und die OECD-Experten gehen davon aus, dass 2004 zuerst die Investitionen<br />
im Exportsektor anspringen werden und die Dynamik dann auch auf andere Sektoren<br />
übergreifen wird. Projektierte Steuersenkungen in mehreren Ländern und eine<br />
Verbesserung der Konsumentenstimmung sollen den privaten Konsum stimulieren. Es<br />
bleibt allerdings das Risiko, dass trotz Erholung der US-Wirtschaft die Dollarschwäche<br />
bestehen bleibt und den Aufschwung in Europa beeinträchtigt.<br />
Besonders enttäuschend verlief die Wirtschaftsentwicklung in den „großen“ EU-Ländern<br />
Deutschland, Frankreich und Italien. Eine wichtige Ausnahme stellte Großbritannien<br />
dar, das zusammen mit Schweden für die bessere Entwicklung der EU im Vergleich<br />
zur Eurozone sorgte. Relativ gut entwickelten sich auch Spanien und Griechenland. In<br />
Deutschland und Frankreich war die im EU-Stabilitätspakt festgelegte Grenze für das<br />
Budgetdefizit von 3 % des BIP bereits im Jahr 2002 überschritten worden – für Italien<br />
wird dies in naher Zukunft erwartet. Allen drei Ländern sind daher bei fiskal<strong>politische</strong>n<br />
Stimulierungsmaßnahmen enge Grenzen gesetzt.<br />
Deutschland<br />
Wegen des großen Gewichtes und der Offenheit seiner Wirtschaft kommt Deutschland<br />
für die Entwicklung des gesamten EU-Raums eine besondere Bedeutung zu. Laut<br />
OECD erzielte die deutsche Wirtschaft 2003 ein Nullwachstum 2 und fiel daher nochmals<br />
hinter das ohnehin schon schwache Wachstum von 2002 (0,2 %) zurück. Für 2004<br />
wird eine vom Export getragene Erholung mit einer Wachstumsrate des BIP von 1,4 %<br />
erwartet – weit unter dem OECD Durchschnitt von 3 %. Als Grund für die anhaltende<br />
Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft wird die schwache Binnennachfrage<br />
gesehen, die ihrerseits auf strukturelle Ursachen zurückgeführt wird. 3 In den vergan-<br />
23
genen Jahren waren die Wachstumsimpulse daher immer von der Außenwirtschaft<br />
ausgegangen. Im Jahr 2003 wurde die Binnennachfrage besonders durch die hohe<br />
Arbeitslosigkeit von über 9 % und die allgemeine Verunsicherung der Konsumenten<br />
und Investoren im Zusammenhang mit der Budgetkonsolidierungspolitik der Regierung<br />
gedämpft. Zusätzlich wurde die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft von der<br />
effektiven Aufwertung des Euro besonders hart getroffen. Die deutschen Ausfuhren<br />
gingen im ersten Halbjahr absolut zurück, nach einer gewissen Erholung im dritten<br />
Quartal ließ die Exportdynamik im vierten Quartal allerdings neuerlich nach. Der<br />
erwartete Aufschwung der deutschen Wirtschaft 2004 hängt daher sehr wesentlich<br />
von der weiteren Entwicklung des Euro-Kurses ab und ist mit entsprechenden Unsicherheiten<br />
behaftet.<br />
Italien<br />
Die italienische Wirtschaft stand 2003 unter einem ähnlich ungünstigen Stern wie die<br />
deutsche. Nachdem das BIP in der ersten Jahreshälfte auf Grund der schwachen<br />
Binnennachfrage stagniert hatte, reichte die moderate Belebung danach nur für ein<br />
Jahreswachstum von 0,5 %. Ähnlich wie in Deutschland trugen neben der Euro-Aufwertung<br />
auch die gedrückte Stimmung der Konsumenten und Investoren zum schwachen<br />
Wirtschaftsergebnis bei. Im Hinblick auf eine Beschleunigung der Weltwirtschaft wird<br />
für 2004 eine Fortsetzung der Erholung und ein mäßiges Wachstum von 1,6 % erwartet<br />
– wobei ebenso wie in Deutschland der Euro-Kurs ein gewichtiges Risiko darstellt.<br />
Frankreich<br />
Auch die französische Wirtschaft litt im ersten Halbjahr unter der schwachen Binnennachfrage<br />
und einem Einbruch der Exporte: Das BIP ging auf Jahresbasis um<br />
0,2 % zurück. Für 2003 insgesamt dürfte sich wegen der in der zweiten Jahreshälfte<br />
einsetzenden Erholung ein schwach positives BIP-Wachstum von 0,1 % ergeben<br />
haben. Die Stimmung der Unternehmer in Frankreich schien zu Jahresende 2003<br />
zuversichtlicher als in Italien und Deutschland, sie setzten auf die zunehmend wirksam<br />
werdende Sogwirkung durch den Aufschwung der Weltwirtschaft. Hinzu kommen<br />
staatliche Förderungsmaßnahmen für Investitionen. 4 Für 2004 geht die OECD daher<br />
von einem Wachstum in Frankreich von 1,7 % aus.<br />
Großbritannien<br />
In Großbritannien gingen die Uhren 2003 deutlich anders als in Kontinentaleuropa.<br />
Die wirtschaftliche Erholung setzte bereits im ersten Halbjahr ein und für das Jahr<br />
insgesamt wurde von der OECD ein stattliches BIP-Wachstum von 1,9 % (jüngere<br />
24
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
Schätzungen 2,1 %) angegeben. Damit war das Wachstum höher als im Jahr davor<br />
(1,7 %) und lag markant über dem EU-Durchschnitt (0,7 %). Interessanterweise ging<br />
der Aufschwung nicht vom Export aus, wie es angesichts der relativ geringeren Aufwertung<br />
des britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und dem Kursverlust gegenüber<br />
dem Euro zu erwarten gewesen wäre, sondern vom privaten und öffentlichen Konsum.<br />
Offenbar waren die Konsumenten optimistischer als auf dem Festland, wozu auch<br />
die im <strong>internationale</strong>n Vergleich sehr niedrige Arbeitslosenrate (5,0 %) beigetragen<br />
haben dürfte. Auch war die Expansion der öffentlichen Ausgaben zur Verbesserung<br />
des Gesundheits- und Erziehungswesens nicht dem starken Zwang zur Budgetkonsolidierung<br />
unterworfen wie in den großen Ländern der Eurozone. Das Budgetdefizit<br />
stieg merklich an und hatte 2003 rund 3 % des BIP erreicht. Zusammen mit einem<br />
Leistungsbilanzdefizit in ähnlicher Größenordnung wies die Wirtschaft Großbritanniens<br />
daher ein markantes „Zwillingsdefizit“ auf. Die Aussichten für 2004 werden mit einem<br />
prognostizierten BIP-Wachstum von etwa 2,7 % weiterhin günstig eingeschätzt 5 , wobei<br />
das größte Risiko nicht wie in der Eurozone von der Entwicklung der Wechselkurse,<br />
sondern von der Preisentwicklung des heimischen Immobilienmarktes auszugehen<br />
scheint, der eine wesentliche Determinante des privaten Konsums darstellt.<br />
1.4.2 USA<br />
Im Gegensatz zu Europa gewann die Konjunkturbelebung in den USA deutlich an<br />
Kraft. Nach der schwachen Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre dürfte nun wieder<br />
ein anhaltender Konjunkturaufschwung eingesetzt haben, der von der heimischen<br />
Nachfrage und von der sich allgemein erholenden Weltwirtschaft getragen wird. Die<br />
OECD wies für 2003 eine Wachstumsrate des BIP von 2,9 % aus 6 (2002: 2,4 %) und<br />
erwartet eine Beschleunigung des Wachstums auf 4,2 % im Jahr 2004.<br />
Zu Beginn des Jahres 2003 war eine auffallende Divergenz zwischen der gedrückten<br />
Stimmung der amerikanischen Konsumenten und den optimistischen Einschätzungen<br />
der Produzenten festzustellen. Mit dem Ende des Irakkrieges hellte sich auch die<br />
Stimmung der Konsumenten deutlich auf, und im zweiten Quartal setzte ein primär<br />
vom Konsum getragener Aufschwung ein (3,3 % Wachstum im Jahresvergleich). Da<br />
auch die Investitionen in Schwung kamen (Ausrüstungsinvestitionen, Software) und<br />
die Wirtschaftsentwicklung durch expansive Geld- und Fiskalpolitik massiv gestützt<br />
wurde, beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal weiter auf 8,2 %. Nachdem<br />
die Leitzinsen mit 1,25 % bereits im November 2002 einen historischen Tiefstand<br />
erreicht hatten, senkte die amerikanische Notenbank diese im Juni um weitere<br />
0,25 Prozentpunke auf 1 % ab. Ende Mai wurde der so genannte „Jobs & Growth<br />
Tax Relief Reconciliation Act“ verabschiedet, das dritte und massivste Konjunktur-<br />
25
stützungsprogramm seit dem Einbruch des Wirtschaftwachstums vor drei Jahren. 7<br />
Hinzu kamen starke Ausgabensteigerungen des Staates für militärische Zwecke und<br />
den Wiederaufbau im Irak und in Afghanistan. Das Budgetdefizit im Jahr 2003 dürfte<br />
infolgedessen auf rund 5 % des BIP angestiegen sein (von 3,4 % im Jahr 2002). Im<br />
vierten Quartal schwächte sich das Wirtschaftswachstum nach ersten Schätzungen des<br />
amerikanischen Wirtschaftsministeriums wieder etwas ab. Dennoch wurde noch immer<br />
eine Jahresrate von 4 % erreicht, wobei sich die Dynamik von der Binnennachfrage zur<br />
Auslandsnachfrage verlagert hatte. Während das Wachstum des privaten Konsums<br />
auf 2,6 % zurückfiel, expandierten die Exporte um 19,1 % (bei gleichzeitiger Zunahme<br />
der Importe um 11,3 %), was in Zusammenhang mit der verbesserten Weltkonjunktur,<br />
insbesondere der dynamischen Entwicklung wichtiger Handelspartner in Asien und<br />
den Wettbewerbsvorteilen infolge des niedrigen Dollarkurses zu sehen ist. Allerdings<br />
stieg das amerikanische Leistungsbilanzdefizit trotz der günstigen Rahmenbedingungen<br />
weiter an und betrug Ende 2003 satte 548,6 Mrd. USD und somit ebenso 5 %<br />
des BIP (2002: 4,6 %).<br />
Für das Jahr 2004 wird allgemein ein höheres Wachstum der US-Wirtschaft als 2003<br />
erwartet. Die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind günstig, die Konsumentenstimmung<br />
ist gut, das fiskalische Stimulierungspaket vom Mai 2003 dürfte zwar für<br />
den privaten Konsum an Wirkung verlieren, jedoch Investitionen weiter begünstigen<br />
und auch die Militärausgaben werden hoch bleiben. Auf der monetären Seite sind<br />
wegen der anhaltend niedrigen Inflation vorläufig keine signifikanten Leitzinserhöhungen<br />
zu erwarten. Der Verbraucherpreisindex stieg 2003 um 0,6 %. Das hohe<br />
Produktivitätswachstum im Jahr 2003 begünstigte die Gewinnbildung als wichtige<br />
Finanzierungsquelle für Investitionen und ermöglichte ein kräftiges Wachstum der<br />
Reallöhne. Allerdings schlug sich die wirtschaftliche Erholung bisher kaum auf dem<br />
Arbeitmarkt nieder. Die Arbeitslosenrate lag im vierten Quartal 2003 bei 6,2 %, – ein<br />
deutlicher Beschäftigungszuwachs wird erst 2005 erwartet. Ein gewisses Risiko für die<br />
zukünftige Wirtschaftsentwicklung stellt die hohe Verschuldung der Haushalte und das<br />
neuerliche Absinken der Sparquote auf nunmehr 1,5 % des verfügbaren Einkommens<br />
dar. Auch könnte das hohe „Zwillingsdefizit“ von Staatshaushalt und Leistungsbilanz<br />
nach Ansicht vieler Experten eine gefährliche Quelle für Wechselkursvolatilitäten<br />
werden und eine weitere Erhöhung des Staatsdefizits könnte das Zinsniveau erhöhen<br />
und so private Investitionen und Konsum dämpfen.<br />
1.4.3 Japan<br />
Der im Jahre 2002 begonnene Aufschwung setzte sich 2003 fort und gewann während<br />
des Jahres zunehmend an Dynamik. Die Erholung dürfte somit auch von länge-<br />
26
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
rer Dauer sein. Im letzten Quartal wuchs die japanische Wirtschaft gegenüber dem<br />
Vorquartal um 1,7 %, was einem Zuwachs von 7 % im Jahresvergleich entspricht.<br />
Insgesamt wurde im Jahr 2003 eine Wachstumsrate des BIP von 2,7 % erzielt. Das<br />
Wachstum lag somit deutlich über allen Erwartungen und stellte die höchste Zuwachsrate<br />
seit 1991 dar. Das nominelle BIP erhöhte sich allerdings aufgrund der anhaltenden<br />
Deflation nur um 0,2 %. Für nächstes Jahr wird eine gewisse Verlangsamung des<br />
Tempos, aber eine Fortsetzung des Wachstums erwartet. Die OECD geht von einem<br />
Wachstum des japanischen BIP von 1,8 % im Jahr 2004 aus.<br />
Anders als in den letzten Jahren wurde der Aufschwung in Japan diesmal nicht von<br />
staatlichen Stimulierungsmaßnahmen, sondern von der privaten Nachfrage getragen.<br />
Bereits 2002 belebte sich der private Konsum und im Jahr darauf legten auch die Investitionen<br />
zu. Die Außenwirtschaft leistete 2003 ebenfalls einen signifikant positiven<br />
Beitrag zum Wachstum. 8 Die Belebung der privaten Investitionen wird auf den Erfolg<br />
der Unternehmen bei ihren jahrelangen Bemühungen um Umstrukturierung und auf<br />
die Rückzahlung der Schulden, die beim Platzen der Spekulationsblase Anfang der<br />
1990er-Jahre entstanden waren, zurückgeführt. Die „Bilanz-Rezession“ scheint nunmehr<br />
überstanden und anstatt zur Abtragung von Altlasten wird der Cashflow endlich<br />
wieder für Investitionen in produktives Kapital verwendet. Das Wachstum der privaten<br />
Nachfrage wurde auch durch massive Steuerentlastungen und eine expansive<br />
Geldpolitik gestützt. Das Exportwachstum profitierte von der allgemeinen Erholung<br />
der Weltwirtschaft und der asiatischen Region im Speziellen, aber insbesondere vom<br />
starken Wachstum der Nachfrage aus China. Die japanischen Exporte nach China<br />
wuchsen um 44 %, sogar rascher als die chinesischen Importe insgesamt (40 %). Diese<br />
Entwicklung ergab sich trotz einer Aufwertung des Yen gegenüber dem US-Dollar.<br />
Letztere wurde allerdings durch Interventionen der japanischen Zentralbank in einem<br />
verhältnismäßig engen Rahmen gehalten. Als weniger erfreuliche Charakteristiken<br />
der japanischen Wirtschaftsentwicklung sind die anhaltende Deflation (BIP-Deflator:<br />
-2,4 %), die hartnäckige Arbeitslosigkeit – insbesondere unter Jugendlichen - sowie<br />
das stark auf einzelne Industrien (Elektronik, Automobilbau) konzentrierte Wachstum<br />
bei gleichzeitig massivem Nachhinken des Dienstleistungssektors zu erwähnen.<br />
Obwohl der Aufschwung in Japan diesmal als nachhaltig eingeschätzt wird, erwartet<br />
die OECD eine Verlangsamung des Wachstums für 2004. Ein wichtiger Grund sind die<br />
angekündigten Maßnahmen zur Budgetkonsolidierung, welche durch höhere Steuereinkünfte<br />
bei konstanten Ausgaben angestrebt wird. Ein weiteres Argument liegt in der<br />
anhaltenden Schwäche des Dienstleistungssektors. Als größten Risikofaktor für das im<br />
Jahr 2004 erwartete Wachstum von 1,8 % wird eine, die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
Japans signifikant verringernde, effektive Aufwertung des Yen gesehen.<br />
27
1.4.4 Mittel- und Osteuropäische Länder (MOEL)<br />
Die anhaltende Wachstumsschwäche in Westeuropa schlug sich nach wie vor nicht in<br />
derselben Stärke auf die Länder in Mittel- und Osteuropa durch. Die zehn Beitrittsländer<br />
wiesen zwar einen Wachstumsrückgang (von 4 % 2000 auf 2,5 % in den Jahren<br />
2001 und 2002) auf, jedoch nahm die Wachstumsdynamik in einigen Ländern rasch<br />
wieder zu (siehe auch Tabelle 1.6 in den Statistischen Übersichten). In Polen und<br />
der Slowakei beschleunigte sich das BIP-Wachstum bereits im Jahr 2002 wieder und<br />
dürfte 2003 erneut bei rund 4 % gelegen haben. Für Ungarn, Tschechien und Slowenien<br />
werden erst ab 2004 wieder höhere Wachstumsraten (von über 3 %) erwartet.<br />
Die Tatsache, dass die MOEL-5 die Stagnation innerhalb der EU-15 trotz ihres hohen<br />
Grades an wirtschaftlicher Verflechtung mit derselben ohne größere Schwierigkeiten<br />
verkraften konnten, kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden: Auf der einen<br />
Seite ist hier die geringe Synchronisierung der Konjunkturzyklen zwischen den bisherigen<br />
und den neuen Mitgliedsländern zu nennen. Letztere befinden sich nach wie<br />
vor in einem langfristigen Umstrukturierungs- und Aufholprozess mit einhergehenden<br />
institutionellen Veränderungen, welche in diesem Fall als Schutz vor kurzfristigen<br />
konjunkturellen Schwankungen gewirkt haben dürften. Andererseits unterliegen die<br />
MOEL sehr spezifischen makroökonomischen Rahmenbedingungen (Wechselkurse,<br />
teilweise große Leistungsbilanz- und Budgetdefizite). Für die mittlere Zukunft lässt<br />
sich durch die Übernahme einer EU-konformen Fiskal- und Geldpolitik ein höheres<br />
Ausmaß an Synchronisierung erwarten. Diese Harmonisierung und damit einhergehende<br />
budgetkonsolidierende Kürzungen im öffentlichen Konsum, den Investitionen und<br />
Sozialtransfers werden sich höchstwahrscheinlich dämpfend auf das BIP-Wachstum<br />
auswirken. Auf der anderen Seite sollten sich EU-Transfers im Rahmen der Struktur-<br />
und Kohäsionsfonds wiederum in einer Erhöhung der öffentlichen und privaten<br />
Investitionen niederschlagen. Aufgrund bestehender Unsicherheiten über das genaue<br />
Ausmaß und den Zeitpunkt dieser Transfers kann der Nettoeffekt des Beitritts derzeit<br />
nur schwer abgeschätzt werden. Die Anpassung der indirekten Steuern (und damit<br />
teilweise höhere Umsatzsteuern) sowie höhere Verbrauchssteuern (zum Beispiel auf<br />
Tabak) werden im Zuge des EU-Beitritts die Inflation vorübergehend etwas anheben<br />
und damit die realen verfügbaren Haushaltseinkommen und den Konsum einschränken.<br />
Nachdem der private Konsum aufgrund der vorliegenden Zahlen für 2003 wie<br />
bereits in den Jahren zuvor die Hauptstütze der dynamischen Wirtschaftsentwicklung<br />
darstellt, werden sich diese Faktoren ebenfalls dämpfend auf das BIP-Wachstum<br />
auswirken. Als wachstumsfördernder Faktor ist die lang erwartete wirtschaftliche Erholung<br />
in der EU-15 zu nennen. Diese dürfte über eine gestiegene Exportnachfrage die<br />
28
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
erfreulichen Wachstumsentwicklungen noch weiter antreiben und das BIP-Wachstum<br />
im Jahr 2005 wieder über die 4-Prozentmarke bringen.<br />
Die Außenwirtschaft stellt neben dem heimischen Konsum somit eine wesentliche<br />
Säule der mittel- und osteuropäischen Wirtschaft dar. Die erwähnten strukturellen und<br />
institutionellen Anpassungen führten in den letzten Jahren zu einer kräftigen Erhöhung<br />
der Arbeitsproduktivität in der Region. Dadurch lässt sich auch die gestiegene<br />
Wettbewerbsfähigkeit trotz gleichzeitiger reeller Aufwertungen einzelner Währungen<br />
und angesichts der schwachen Konjunktur in den Haupthandelspartnern erklären.<br />
Neben einer günstigen Entwicklung der Lohnstückkosten, welche die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der MOEL bei Gütern mit hoher Preiselastizität (und daher meist niedriger<br />
Wertschöpfung) längerfristig sichern dürften, trugen die durch FDI-Zufluss geprägten<br />
strukturellen Veränderungen auch zur vermehrten Schaffung von Produktionskapazitäten<br />
in Marktsegmenten mit höherer Wertschöpfung, geringer Preiselastizität und<br />
einem relativ hohen Kapital- und Humankapitalgehalt bei. Die spektakuläre Expansion<br />
der slowakischen Exporte im Jahr 2003 (um 27 % nach vorläufigen Zahlen) konnte<br />
zum Beispiel durch eine ausgeprägte Spezialisierung der Produktion auf einige wenige<br />
Nischen – im Wesentlichen auf die Autoindustrie – realisiert werden. Das Erfolgsrezept<br />
der MOEL scheint im Moment die erfolgreiche Spezialisierung auf wenige, jedoch<br />
qualitativ höherwertige Produktionszweige entsprechend der im Prozess der Umstrukturierung<br />
aufgebauten Kapazitäten zu sein. Jedoch auch in anderen Ländern der<br />
Region, welche in den vergangenen Jahren weniger stark von hohen FDI-Zuflüssen<br />
und so genannten „greenfield“-Investitionen profitieren konnten, zeigte sich ein leichter<br />
Trend in Richtung einer Verbesserung sowohl der Exportstruktur als auch der Qualität<br />
der exportierten Güter. Wie bereits erwähnt, wird der Aufschwung in Westeuropa für<br />
die Beitrittsländer darüber hinaus wieder verbesserte Exportmöglichkeiten schaffen.<br />
Allerdings besteht die Gefahr, dass die zunehmende Konkurrenz aus Asien und insbesondere<br />
China diese Möglichkeiten wieder einschränkt, nicht nur im Bereich der<br />
traditionellen arbeitsintensiven Exportgüter, sondern vermehrt auch in höherwertigen<br />
Gütersegmenten. Der Kostenvorteil der Beitrittsländer könnte teilweise auch durch<br />
Kosten, welche aufgrund diverser EU-Normen und Standards (Übernahme des acquis<br />
communautaire) und den entsprechenden Anpassungskosten vor allem für heimische<br />
und kleinere Unternehmen anfallen, gemindert werden. Ebenso wird die Übernahme<br />
des gemeinsamen Zolltarifs in manchen Fällen (zum Beispiel bei Textilien und Lebensmitteln)<br />
teilweise zu mehr Importen und damit auch zu Verlusten in der heimischen<br />
Produktion führen. Weiters könnte die gestiegene Nachfrage nach osteuropäischen<br />
Gütern unter Umständen aufgrund fehlender Kapazitäten nicht vollständig in entsprechende<br />
Exportströme umgesetzt werden.<br />
29
Die geringe Synchronisierung mit der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung zeigt sich<br />
auch anhand der ausländischen Kapitalzuflüsse. Im Gegensatz zur globalen Entwicklung<br />
wurden in Ost- und Mitteleuropa im Jahr 2002 Rekordzuflüsse von 22,6 Mrd.<br />
Euro verbucht, während das Jahr 2003 einen deutlichen Rückgang von passiven<br />
FDI-Strömen brachte. Dabei spielte die Tatsache, dass die Privatisierungsphase in<br />
den MOEL-5 großteils abgeschlossen ist, eine große Rolle. Für 2004 wird wiederum<br />
ein globaler Aufschwung erwartet, welcher sich jedoch in den MOEL aufgrund ihres<br />
bereits verhältnismäßig hohen Verhältnisses von FDI zu BIP weniger stark auswirken<br />
dürfte.<br />
Als nach wie vor großes Problem stellt sich die bereits in Abschnitt 1.3 erwähnte hohe<br />
Arbeitslosigkeit dar. Trotz eines leichten Rückgangs dürften die Arbeitslosenraten in<br />
den Jahren 2004 und 2005 zwischen 14 – 15 % und damit auf einem hohen Niveau<br />
verweilen. Dazu trugen einerseits die starken Produktivitätszuwächse bei, welche<br />
einen Rückgang der Arbeitslosigkeit trotz des hohen Produktionswachstums verhinderten.<br />
Andererseits wurde die Arbeitslosigkeit nicht als ein dringendes makroökonomisches<br />
Problem betrachtet, sondern als Problem zu wenig flexibler Arbeitsmärkte<br />
gesehen. Liberalisierungen in diesem Bereich dürften sich allerdings primär in einer<br />
Verlangsamung der Lohnzuwächse niederschlagen als in einer spürbaren Reduktion<br />
der Arbeitslosigkeit. Durch den EU-Beitritt und die folgende teilweise oder graduelle<br />
Öffnung der Arbeitsmärkte könnte eine gewisse Migration von Arbeitskräften von Ost-<br />
nach Westeuropa stattfinden. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürften diese Bewegungen<br />
jedoch nicht allzu groß sein. Diese Sichtweise wird auch durch die Tatsache begründet,<br />
dass die derzeitige Arbeitsmobilität innerhalb der nationalen Grenzen der Beitrittländer<br />
trotz großer regionaler Unterschiede sehr gering ist.<br />
1.4.5 Südosteuropäische Länder (SOEL)<br />
Das reale Wirtschaftswachstum der meisten Südosteuropäischen Länder (SOEL)<br />
verlangsamte sich 2003 im Vergleich zum Vorjahr geringfügig, blieb jedoch auf einem<br />
relativ hohem Niveau (siehe auch Tabelle 1.7 in den Statistischen Übersichten). Dazu<br />
dürfte neben der momentanen Nachfrageschwäche in der EU auch eine Dürreperiode<br />
beigetragen haben. Der Anteil der Landwirtschaft am BIP der SOEL ist in vielen Fällen<br />
beträchtlich und reicht von rund 7 % in Kroatien bis 34 % in Albanien.<br />
Nichtsdestotrotz lässt sich in den politisch stabileren Ländern der Region, welche<br />
bereits eine EU-Beitrittsperspektive haben (Bulgarien, Rumänien und Kroatien), eine<br />
positive strukturelle Veränderung der Wirtschaft in den letzten Jahren erkennen. Wie<br />
zuvor in den Ländern Mittel- und Osteuropas (MOEL) wird auch in den SOEL und<br />
insbesondere in den drei zuvor genannten Ländern der Prozess der Umstrukturierung<br />
30
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
durch Privatisierungen und stark anwachsende Zuströme ausländischer Direktinvestitionen<br />
(FDI) beschleunigt. Neben den gestiegenen FDI-Zuflüssen stiegen in<br />
Bulgarien, Rumänien und Kroatien im Jahr 2003 auch die heimischen Investitionen in<br />
Infrastruktur, verarbeitende Industrie und vermehrt auch in den Dienstleistungssektor<br />
(insbesondere im Tourismusbereich) an. Die Exportstruktur verbesserte sich, es kam<br />
zu einem Anstieg der Industriegüterausfuhren wie auch des Fremdenverkehrs. Die<br />
Situation am Arbeitsmarkt verbesserte sich in diesen Fällen ebenfalls geringfügig. Dies<br />
geschah vor dem Hintergrund stark fallender Inflationsraten. Auf der Negativseite der<br />
Bilanz ist zu verbuchen, dass im Vergleich zur positiven Exportentwicklung die Importe<br />
dieser Länder noch stärker angestiegen sind, was in der Regel zu einer dramatischen<br />
Verschlechterung der Handelsbilanz 2003 führte. In weiterer Folge verdoppelte sich<br />
das Leistungsbilanzdefizit in Bulgarien und Rumänien beinahe. In Kroatien konnte die<br />
ausgezeichnete Tourismussaison das Rekorddefizit in der Handelsbilanz abdämpfen<br />
und zu einer Verringerung des Leistungsbilanzdefizits im Jahr 2003 führen. Zurzeit<br />
können diese hohen Defizite von den einströmenden FDI und der privaten Verschuldung<br />
gedeckt werden. Insbesondere im Falle Kroatiens wird jedoch die zunehmende<br />
Auslandsverschuldung des Landes als Problem angesehen.<br />
Jene Länder der Region, die noch keine klare EU-Beitrittsperspektive für die kommenden<br />
Jahre haben (Albanien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Serbien-Montenegro)<br />
und unter einem hohen innen<strong>politische</strong>n Konfliktpotenzial leiden, konnten<br />
im Vergleich zu den anderen europäischen Transformationsländern bisher nur einen<br />
Bruchteil der ausländischen Direktinvestitionen anziehen. Auch in diesen Ländern<br />
stieg die Produktivität tendenziell an, allerdings um den Preis einer weiter steigenden<br />
Arbeitslosigkeit auf erschreckend hohem Niveau. So verzeichnete beispielsweise<br />
Mazedonien im Jahr 2003 trotz eines Anstieges der realen BIP-Wachstumsrate auf<br />
fast 3 % aus dem Zustand der Stagnation im Jahr 2002 heraus ein rapides Anschnellen<br />
der Arbeitslosenquote von rund 32 % auf fast 37 %. Dies ist u.a. auch durch eine<br />
10%ige Kürzung der Staatsausgaben zu erklären. In Serbien-Montenegro dürfte sich<br />
die Dürre im Jahr 2003 besonders negativ auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt<br />
haben, das um 3 Prozentpunkte auf nur mehr 1 % zurückging. Auch in Bosnien-Herzegowina<br />
verlangsamte sich das Wachstum im Jahr 2003. In beiden Ländern kam<br />
es zu einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das Wirtschaftswachstum der drei<br />
zuletzt erwähnten SOEL lag 2003 um einiges unter dem Durchschnitt der Region. Albanien<br />
ist das einzige Land aus dieser Gruppe, welches 2003 sowohl ein steigendes,<br />
überdurchschnittliches Wirtschaftwachstum von rund 6 % als auch eine Verminderung<br />
der Arbeitslosenquote verzeichnen konnte. Dazu trugen die Verbesserung der<br />
Stromversorgungslage sowie der weiter anhaltende Bauboom bei. Mit Ausnahme<br />
Mazedoniens gingen die Inflationsraten der Länder dieser Gruppe dem allgemeinen<br />
31
SOEL Trend folgend weiter zurück. In Bosnien-Herzegowina kam es 2003 mit einer<br />
Inflationsrate von nur mehr 0,3 % in Teilen des Landes bereits zu einer ausgeprägten<br />
Deflation. Die Leistungsbilanzdefizite der zuletzt erwähnten Länder entwickelten sich<br />
im Allgemeinen von 2002 auf 2003 durchwegs positiv. Die leichte Verbesserung der<br />
albanischen Leistungsbilanz im Jahr 2003 basierte auf einer zunehmenden Stärkung<br />
der albanischen Exportwirtschaft. In Mazedonien führte ein Ansteigen der Exporte<br />
bei gleichzeitig zurückgehenden Importen zu einer Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits<br />
auf 6 % des BIP. In Serbien-Montenegro gingen 2003 sowohl die Exporte<br />
als auch die Importe laut Zollstatistik, ausgedrückt in Euro, im Vergleich zum Vorjahr<br />
zurück, was die allgemeine wirtschaftliche Lage in diesem Lande widerspiegelt. Die<br />
Verbesserung der Leistungsbilanz Serbien-Montenegros im Jahr 2003 beruhte insbesondere<br />
auf einem massiven Anstieg der laufenden Transfers im Vergleich zum Jahr<br />
2002. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Überweisungen von Gastarbeitern.<br />
Allgemein lässt sich allerdings feststellen, dass das Leistungsbilanzdefizit aller SOEL<br />
2003 durchschnittlich doppelt so hoch war wie jenes der MOEL. Es bleibt zu hoffen,<br />
dass in den kommenden Jahren die regionalen Freihandelsabkommen sowie die<br />
asymmetrischen Freihandelsverträge mit der EU zu einem substantiellen Anstieg der<br />
Exporttätigkeit der SOEL führen werden.<br />
1.4.6 Russland<br />
Das russische BIP wuchs um mehr als 7 % im Jahr 2003, was der zweithöchsten<br />
Wachstumsrate seit Beginn der Transformation entsprach. 9 Seit der Finanzkrise im Jahr<br />
1998 vergrößerte sich das BIP somit um über 35 %. Eine Reihe von Faktoren waren<br />
für die ausgezeichnete Lage der russischen Wirtschaft verantwortlich: Die hohen Weltmarktpreise<br />
für Energie trieben das Exportwachstum stark an, die Investitionen, der<br />
private Konsum sowie die realen Haushaltseinkommen vermerkten hohe Zuwächse.<br />
Die ausländischen Währungsreserven erreichten durch den ansehnlichen Budgetüberschuss<br />
ein Rekordniveau und führten so zu einer leichten Währungsaufwertung,<br />
während sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit leicht rückläufig waren.<br />
Der russische Handelsbilanzüberschuss erreichte im Jahr 2003 ein Niveau von über<br />
50 Mrd. Euro, die Leistungsbilanz belief sich ebenfalls auf satte 9 % des BIP. In US-<br />
Dollar gemessen wuchsen die Exporte um mehr als 25 %, während die Importe mit<br />
20 % ebenfalls kräftig zulegten. Abgesehen von Wechselkursbewegungen (Euro/US-<br />
Dollar) ist dies vor allem auf die gestiegenen Energiepreise sowie die ebenfalls hohe<br />
Inlandsnachfrage sowohl nach Konsum- als auch nach Investitionsgütern zurückzuführen.<br />
Demnach dürfte auch das Exportwachstum 2004 wieder etwas nachlassen,<br />
während weiterhin ein hohes Importwachstum erwartet wird. Das Wirtschaftswachstum<br />
32
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
im Wahljahr 2004 wird hauptsächlich vom privaten Konsum und einer moderaten<br />
Ausdehnung der Investitionen getragen sein. Das Wiener Institut für Internationale<br />
Wirtschaftsvergleiche (wiiw) rechnet mit einer weiteren Expansion des BIP um etwa<br />
5 %. Das derzeitig hohe Wachstum wird nicht aufrecht zu erhalten sein, zumal in der<br />
näheren Zukunft keine zusätzlichen Wachstumsimpulse ersichtlich sind. Die hohe<br />
<strong>politische</strong> Stabilität (die Wiederwahl Präsident Putins im März) bedeutet gleichzeitig<br />
Unsicherheit über die Geschwindigkeit des Reformprozesses. Es herrscht weitgehende<br />
Übereinstimmung unter den Experten, dass ein selbsttragendes Wachstum mittel- und<br />
langfristig nur dann realisiert werden kann, wenn die strukturellen und institutionellen<br />
Reformen und die Reform des Bankensektors deutlich beschleunigt werden.<br />
Aufgrund des ungünstigen Investitionsklimas wird nicht mit einer spürbaren Ausweitung<br />
der ausländischen Direktinvestitionen gerechnet – im Jahr 2003 gab es sogar<br />
einen Nettoabfluss von Direktinvestitionen. Die jüngsten „Angriffe“ auf die Oligarchen<br />
könnten sogar die Kapitalflucht weiter erhöhen. Die erste Jahreshälfte 2003 brachte<br />
eine Steigerung des Zuflusses von Direktinvestitionen um rund 50 % gegenüber dem<br />
Vorjahr, während die russischen Investitionen im Ausland (und die Kapitalflucht) zurückgingen.<br />
Dies war einerseits durch die hohen Profite aufgrund der günstigen Preisentwicklung<br />
im Energie- und Metallsektor bedingt, andererseits durch die gestiegene<br />
Attraktivität des russischen Marktes angesichts des niedrigen globalen Zinsniveaus<br />
und der dadurch reduzierten Erträge auf den <strong>internationale</strong>n Anlagemärkten. Dieser<br />
Trend setzte sich allerdings in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr fort, teilweise kam<br />
es – u.a. aufgrund der Yukos Affäre – sogar zu einer gegenläufigen Entwicklung.<br />
Für die weitere russische Wirtschaftsentwicklung wird es nicht nur von besonderer<br />
Bedeutung sein, das Investorenvertrauen generell wieder herzustellen, auch eine<br />
Diversifizierung, weg von der bisherigen Ausrichtung auf die Rohstoffindustrie hin zur<br />
Sachgüterproduktion, wird notwendig sein.<br />
1.4.7 Türkei<br />
Mehrere Faktoren trugen zur guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei im Jahr<br />
2003 bei. Fallende Zinsen, zunehmendes Konsumenten- und Investorenvertrauen und<br />
das Bekenntnis der Regierung zum Stabilitätsprogramm (trotz einiger Abweichungen<br />
zu Beginn des Jahres) bildeten das Klima, welches zu einem realen BIP-Wachstum<br />
von 5,0 % führte. Für 2004 wird aufgrund eines anpassungsbedingten Lagerabbaus<br />
ein kaum merklicher Rückgang auf 4,9 % erwartet. Unter Beibehaltung der derzeitigen<br />
stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik dürfte sich die Dynamik 2005 jedoch wieder auf<br />
rund 5 1 /2 % erhöhen. Ähnlich wie in Mittel- und Osteuropa konnten auch in der Türkei<br />
stattliche Produktivitätszuwächse verzeichnet werden, was das hohe Wachstum bei<br />
33
gleichzeitig anhaltend hoher Arbeitslosigkeit (von rund 10 %) erklärt. Die Produktivitätsgewinne<br />
konnten u.a. aufgrund bereits erfolgreich durchgeführter Privatisierungen<br />
erreicht werden. Seit Beginn der Privatisierungen im Jahr 1984 wurden 167 Unternehmen<br />
privatisiert, 153 davon vollständig. Am wenigsten weit fortgeschritten sind<br />
Privatisierungen im Bankensektor. Die nach wie vor große Zahl an bevorstehenden<br />
Privatisierungen lässt auch 2004 und 2005 große Zugewinne an Produktivität im<br />
staatlichen Sektor erwarten. Ähnlich wie in den MOEL, blieb das Exportwachstum<br />
trotz der Flaute in den wichtigen westeuropäischen Exportmärkten auf einem hohen<br />
Niveau (von über 11 %), was vor allem auf eine erfolgreiche Produktdifferenzierung und<br />
Marktdiversifikation zurückzuführen ist. Der Außenbeitrag zum BIP blieb dennoch mit<br />
1,3 % 2003 negativ, was auf das hohe Importwachstum von über 16 % zurückzuführen<br />
ist. Der private Konsum sowie private Investitionen bildeten die wichtigsten Komponenten<br />
des Wachstums. In diesem und dem kommenden Jahr dürfte die heimische<br />
Nachfrage trotz eines leichten Rückgangs des Importwachstums nach wie vor eine<br />
große Rolle spielen, weshalb die Leistungsbilanz bei guten Wachstumsaussichten<br />
im Defizit bleiben wird. Der Tourismus konnte sich bereits in der zweiten Jahreshälfte<br />
2003 von der Beeinträchtigung durch die Kriegshandlungen im Irak erholen.<br />
1.4.8 Asiatische Staaten<br />
Die aufstrebenden Wirtschaften Ost- und Südostasiens stellten auch 2003 den dynamischsten<br />
Teil der Weltwirtschaft dar und übertrafen trotz des Wachstumseinbruchs im<br />
zweiten Quartal (als Folge der tödlichen Lungenseuche SARS [severe acute respiratory<br />
syndrom] und der dadurch bedingten Geschäftsausfälle) die meisten Prognosen.<br />
Das Wachstum wurde vom Export und in den besonders rasch wachsenden Ländern<br />
(China, Thailand) auch von der Binnennachfrage getragen. Im Export wirkte sich<br />
insbesondere die starke Importnachfrage Chinas, das mit den anderen asiatischen<br />
Staaten ein Handelbilanzdefizit aufwies, aber auch die Erholung Japans und der USA<br />
in der zweiten Jahreshälfte 2003 positiv aus. Für einige asiatische Länder, deren<br />
Währungen eng an den US-Dollar gebunden sind (insbesondere Hongkong, China,<br />
Malaysia), stellte auch die Dollarschwäche einen nicht unerheblichen Wettbewerbsvorteil<br />
auf den europäischen Märkten dar. Schließlich setzte sich auch die bereits im<br />
Vorjahr beginnende Erholung im IT-Bereich fort, was für die asiatischen Länder, als<br />
hervorragende Produzenten in diesem Bereich, von besonderer Bedeutung ist.<br />
Da die wichtigsten Wachstumsparameter gleich bleiben oder sich verbessern sollten,<br />
sind die Aussichten der Region für 2004 durchaus günstig zu bewerten. Der Internationale<br />
Währungsfonds (IWF) geht in seiner Herbstprognose von einer Beschleunigung<br />
des Wachstums in „emerging Asia“ auf 6,1 % aus (von 5,9 % 2003). Die Asiatische<br />
34
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
Entwicklungsbank (ADB) ist ähnlich optimistisch und erwartet für seine 41 Mitgliedsländer<br />
im Jahr 2004 eine durchschnittliche Wachstumsrate von 6,2 % (nach 5,7 %<br />
im Jahre 2003). Zu den Risiken zählen neben terroristischen Aktivitäten die mögliche<br />
Rückkehr von SARS, aber auch für den Menschen weniger fatale Seuchen, wie die in<br />
Asien immer wieder aufflammende Vogelgrippe. Diese kann schwere wirtschaftliche<br />
Schäden verursachen, insbesondere in Ländern wie Thailand, die stark vom Agrarexport<br />
und/oder vom Tourismus abhängig sind.<br />
Besonders hohe Wachstumsraten im Jahr 2003 verzeichneten China (9,1 %), Vietnam<br />
(7,2 %) und Thailand (6,1 %). Aber auch Malaysia, Indonesien und Taiwan konnten<br />
gegenüber dem Vorjahr an Wachstum zulegen. Enttäuschend war die Entwicklung<br />
in der Republik Korea, dessen Wirtschaft von Arbeitsniederlegungen einerseits und<br />
Bilanzfälschungen von Großkonzernen andererseits verunsichert war. Die ungelöste<br />
Nord-Korea Frage dürfte die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich beeinträchtigen. Die<br />
Philippinen zeigten ebenfalls ein relativ schwaches Ergebnis. Zu SARS und <strong>politische</strong>n<br />
Risiken mit dämpfender Auswirkung auf die Investitionslust kam eine außergewöhnliche<br />
Trockenheit hinzu, welche den Agrarsektor schwer beeinträchtigte.<br />
Von SARS am ärgsten betroffen waren Singapur und Hongkong, da diese Länder<br />
besonders stark vom Flugverkehr und vom Tourismus, insbesondere vom Einkaufstourismus,<br />
abhängig sind und außerdem wegen der Kleinheit ihres Territoriums das<br />
gesamte Land von der Seuche bzw. den Gegenmaßnahmen erfasst worden war.<br />
Singapur verzeichnete im zweiten Quartal einen Rückgang des BIP von 11 % gegenüber<br />
dem ersten Quartal, was im Jahresvergleich noch immer einer Abnahme des BIP<br />
von 4,2 % gleichkommt. Trotz einer starken Erholung der Wirtschaft in der zweiten<br />
Jahreshälfte dürfte daher das Wachstum 2003 insgesamt nur rund 1 % betragen<br />
haben. In Hongkong wird nun, nachdem die Wachstumsrate unter dem Eindruck von<br />
SARS auf 1,5 % zurückgenommen worden war, von einem Wachstum von 3 % im<br />
Jahr 2003 ausgegangen.<br />
1.4.9 China<br />
Das chinesische BIP wuchs im Jahr 2003 nach vorläufigen Angaben um 9,1 % – das<br />
ist die höchste Wachstumsrate seit der Asienkrise 1997/98. Für 2004 wird wegen<br />
geplanter Dämpfungsmaßnahmen der Regierung und des Zurückfahrens öffentlicher<br />
Investitionen ein etwas mäßigeres Wachstum von 8,5 % erwartet. Das Wachstum<br />
der chinesischen Wirtschaft übertraf damit im Jahr 2003 alle Erwartungen. Das hohe<br />
Wachstum im dritten und vierten Quartal (von 9,1 % bzw. 9,9 % im Jahresvergleich)<br />
machte den Einbruch im zweiten Quartal (um 6,7 %) aufgrund der Lungenseuche<br />
SARS mehr als wett. Die SARS-Epidemie und ihre Bekämpfung stellten zugleich<br />
35
die erste schwere Herausforderung für die vom Nationalen Volkskongress im März<br />
bestätigte neue Regierung, mit Präsident Hu Jintao und Premierminister Wen Jiabao<br />
an der Spitze, dar.<br />
Wegen des überaus raschen Wachstums weisen Experten im In- und im Ausland<br />
bereits seit einiger Zeit auf die Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft hin, die sich<br />
vor allem in bestimmten Sektoren wie dem Immobiliensektor, der Bauwirtschaft, der<br />
Metall- (vor allem Stahl), Zement- und Automobilindustrie manifestiert. Die Inflationsrate<br />
(Verbraucherpreisindex) zeigte zwar im Jahresdurchschnitt nur einen leichten Anstieg<br />
von 1,2%, beschleunigte sich jedoch in den letzten Monaten deutlich (Dezember 2003:<br />
3,2 % im Jahresvergleich).<br />
Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft wurde besonders von den Exporten<br />
(34,6 %) und den Investitionen (27 %) getragen, wobei private Investitionen eine<br />
zunehmende Rolle spielen. Die Privatwirtschaft gewinnt generell an Bedeutung, u.a.<br />
weil es seit Gründung der „State-owned Assets Supervision and Administration Commission“<br />
(SASAC) im Frühling dieses Jahres zunehmend auch für private in- und<br />
ausländische Investoren möglich ist, Anteile an Staatsunternehmen zu erwerben.<br />
Die ausländischen Direktinvestitionen blieben weiterhin kräftig und dürften das hohe<br />
Niveau des Vorjahres (53 Mrd. USD) knapp erreichen. Allerdings wuchsen auch die<br />
Importe sehr rasch, zum Teil als Folge des schrittweisen Zollabbaus, wie im Beitrittsvertrag<br />
Chinas zur WTO vorgesehen, zum Teil wegen des rasch wachsenden Bedarfs<br />
an Rohstoffen und Vorprodukten bei gleichzeitig steigenden Preisen für Rohwaren<br />
am Weltmarkt. Der Handelsbilanzüberschuss fiel daher geringer als im Vorjahr aus.<br />
Dabei ist festzustellen, dass China seinen Handelsbilanzüberschuss gegenüber den<br />
USA und der EU weiter ausbaute, hingegen mit vielen Ländern in der Region – so<br />
auch Japan – ein Handelsbilanzdefizit aufwies, was der regionalen Wirtschaft kräftige<br />
Impulse verlieh. Trotz des Vorwurfs der USA, China verschaffe sich mittels seiner stark<br />
unterbewerteten Währung unfaire Wettbewerbsvorteile am Weltmarkt, weigerte sich<br />
die chinesische Regierung bisher standhaft, von der fixen Bindung des Yuan an den<br />
US-Dollar abzugehen. Sie versuchte jedoch, durch eine großzügige „Einkaufstour“ anlässlich<br />
der Besuche von Handelsekretär Don Evans in China und von Premierminister<br />
Wen Jiabao in den USA, das Problem zu entschärfen. 10 Dumpingklagen der USA gegen<br />
chinesische Fernsehapparate und Möbel sowie eine Wiederbelebung von Textilquoten<br />
gegenüber China stehen jedoch weiterhin im Raum und könnten durchaus negative<br />
Auswirkungen auf den zukünftigen bilateralen Handel haben – was bei einem Anteil<br />
der USA von über 20 % am chinesischen Export auch gesamtwirtschaftlich bedeutsam<br />
wäre. Eine anhaltende Erholung der Weltwirtschaft, stark steigende Rohstoffpreise<br />
(in US-Dollar gemessen) und zunehmender inflationärer Druck im Inland könnten<br />
36
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
allerdings die Bereitschaft der chinesischen Regierung zur Flexibilisierung des Yuan<br />
und damit eine gewisse Aufwertung im Jahr 2004 erhöhen.<br />
1.4.10 Argentinien<br />
Nach einer dreijährigen Kontraktion der Wirtschaftsleistung konnte Argentinien 2003<br />
eine kräftige Expansion des BIP verbuchen. Das Wachstum der Wirtschaft von rund<br />
7 – 8 % wurde von einer schrittweisen Erholung des privaten Konsums, einer starken<br />
Expansion der Investitionen (ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau) und von<br />
einer kräftigen Steigerung der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten getragen.<br />
Die Arbeitslosenrate sank von mehr als 21 % im Jahr 2002 auf 15,5 %, allerdings<br />
blieben 55 % der Bevölkerung noch immer unter der Armutsgrenze. Ein spektakuläres<br />
Ergebnis wurde in Kampf gegen die Inflation erreicht: Nachdem die Verbraucherpreise<br />
im Vorjahr um 41 % gestiegen waren, belief sich die Inflation 2003 auf nur mehr<br />
3,7 %. Diese eindrucksvolle Reduktion der Inflation wurde von der Aufwertung des<br />
Pesos und dem Einfrieren der Preise für öffentliche Dienstleistungen unterstützt. Die<br />
15%ige Aufwertung des Peso gegenüber dem US-Dollar spiegelte einerseits den großen<br />
Handelsbilanzüberschuss wider (von durchschnittlich 1,5 Mrd. USD monatlich),<br />
andererseits die wachsende Nachfrage nach einheimischen Wertpapieren sowie das<br />
Ausbleiben der Tilgung der akkumulierten Auslandsschulden. Für das Jahr 2004 wird<br />
wieder ein starkes Wirtschaftswachstum erwartet. Die prognostizierte Wachstumsrate<br />
von ungefähr 6 % zusammen mit dem Zuwachs des BIP vom Vorjahr kann aller Wahrscheinlichkeit<br />
nach den Rückgang der Wirtschaftsleistung in den Krisenjahren 2000<br />
– 2002 endlich wieder wettmachen. Die Inflation wird sich auf 7 – 8 % beschleunigen,<br />
bliebe damit aber weit hinter der galoppierenden Preissteigerung von 2002 zurück.<br />
Der argentinischen Regierung gelang es, den konsolidierten Staatshaushalt mit 2,5 %<br />
Primärüberschuss im Jahr 2003 abzuschließen. Dies ist einerseits auf einen kräftigen<br />
Anstieg der Steuereinnahmen zurückzuführen, andererseits konnte die Regierung dem<br />
Druck widerstehen, mehr Staatsausgaben, sowohl im Zentralhaushalt als auch auf<br />
regionaler Ebene, zu tätigen. Nach massiven „Einkäufen“ auf dem Währungsmarkt<br />
erhöhte die Zentralbank die Währungsreserven des Landes auf über 13 Mrd. USD. Im<br />
August 2003 lief das provisorische Abkommen mit dem IWF aus, welches als Ersatz<br />
für ein gescheitertes mittelfristiges Wirtschaftsprogramm zur Wiederherstellung der<br />
makroökonomischen Stabilität geschlossen wurde. Die Präsidentenwahlen im Mai<br />
verbesserten wiederum die <strong>politische</strong>n Rahmenbedingungen für ein mittelfristiges<br />
Abkommen mit dem IWF. Die Popularität des neu gewählten Präsidenten Kirchner<br />
verspricht ein Ende der lang andauernden <strong>politische</strong>n Unsicherheit in Argentinien. Nach<br />
harten Verhandlungen einigten sich die neue Regierung und der IWF am 20. Septem-<br />
37
er 2003 über ein dreijähriges, 13,3 Mrd. USD umfassendes‚ „Standby-Abkommen“.<br />
Strategisches Ziel des Programms ist die Wiederherstellung der vollen Zahlungsfähigkeit<br />
des Staatshaushaltes um den nötigen Raum für Ausgaben im Sozialbereich und<br />
für die Infrastruktur zu schaffen. Dafür muss erst ein umfassendes Programm für die<br />
Umschuldung der öffentlichen und privaten Schulden ausgearbeitet werden. Weiters<br />
ist die finanzielle Situation der kommunalen Dienstleistungen zu konsolidieren und<br />
die angeschlagene Rechtssicherheit wesentlich zu verbessern, um das Vertrauen im<br />
Unternehmersektor wiederherzustellen. Das wesentlichste Element der strukturellen<br />
Reformen besteht in der Konsolidierung und Restrukturierung des Bankensektors.<br />
1.4.11 Brasilien<br />
Der, von der seit 2003 amtierenden Regierung unter Präsident da Silva („Lula“) durchgeführte,<br />
Stabilisierungs- und Anpassungskurs in Brasilien führte auf den Finanzmärkten<br />
zu einem regelrechten „Run“ auf die Börse in Brasilien. Aufgrund des stabilen<br />
Wechselkurses, einer restriktiven Geldpolitik und damit einhergehender rückläufiger<br />
Inflationsrate sanken die Risikoaufschläge beträchtlich. Die ebenfalls restriktive Fiskalpolitik<br />
(mit zurückhaltender Lohnentwicklung und gezielten Ausgabenkürzungen im<br />
öffentlichen Sektor) führte zur Einhaltung der IWF-Vorgabe eines Primärüberschusses.<br />
Während die Regierung bisher die Befürchtungen der Finanzwelt vor einem Chaos der<br />
Staatsfinanzen zerstreuen konnte, wurden die Erwartungen der eigenen Wählerschaft<br />
großteils noch nicht erfüllt. Die Wirtschaftsentwicklung blieb mäßig, das BIP dürfte nur<br />
um 0,5 % gewachsen sein, während die Arbeitslosigkeit auf einem viel zu hohen Niveau<br />
verharrte. Obwohl die Leistungsbilanz aufgrund der guten Exportentwicklung 2003<br />
beinahe ausgeglichen war, konnte dies nicht wesentlich zum Wirtschaftswachstum<br />
beitragen. Die Handelsbilanz war mit rund 25 Mrd. USD zwar stark überschüssig, was<br />
jedoch primär auf den Anstieg der Weltmarktpreise für wichtige Exportprodukte (Soja)<br />
sowie die wirtschaftliche Erholung in Argentinien zurückzuführen war und weniger auf<br />
eine gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Wirtschaft. Die im regionalen<br />
Vergleich hohen Produktionskosten stellen nach wie vor ein großes Hindernis für die<br />
Industrie dar. Der private Konsum und die Investitionen gingen in den ersten beiden<br />
Quartalen 2003 stark zurück, eine rasche Erholung ist aufgrund der oben beschriebenen<br />
Rahmenbedingungen nicht zu erwarten. Dennoch erwartet die OECD vor dem<br />
Hintergrund einer wieder leicht expansiveren Geldpolitik, fiskalischer Stabilität und<br />
der Fortsetzung des Exportbooms eine Beschleunigung des Wachstums auf 3,0 %<br />
im Jahre 2004 (2005: 3,5 %). Der Reformkurs des Präsidenten, welcher zweifellos<br />
notwendig ist, ist mittelfristig dringend auf einen wirtschaftlichen Erfolg, der auch für<br />
die ärmeren Bevölkerungsschichten sichtbar ist, angewiesen.<br />
38
Anmerkungen<br />
1 IWF, World Economic Outlook, September 2003.<br />
Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004<br />
2 Laut ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist das BIP im vergangenen Jahr<br />
sogar leicht gesunken (um 0,1 %).<br />
3 Zur Behebung der strukturellen Wachstumsschwäche werden von Experten vor allem eine<br />
Reform der Arbeitsmärkte und der staatlichen Transfers als vordringlich erachtet (siehe z.B.<br />
Bericht der „Hartz-Kommission“).<br />
4 So z.B. eine Sistierung der Gewerbesteuer für Neuinvestitionen. Auch die geplante Reform<br />
der Finanzen der Gebietskörperschaften soll Raum für Investitionsanreize schaffen. Um die<br />
Stimmung der Konsumenten und so den privaten Konsum zu heben, räumt die französische<br />
Regierung dem Abbau der hohen Arbeitslosigkeit Priorität ein.<br />
5 Im britischen Schatzkanzleramt rechnete man Ende Jänner mit einem etwas höheren Wachstum<br />
in der Größenordnung von 3 – 3,5 %.<br />
6 Das US-Handelsministerium gab nach ersten Schätzungen eine Wachstumsrate von 3,1 %<br />
für 2003 an.<br />
7 25 Millionen Familien werden nach offiziellen Angaben von den höheren Kindergutschriften<br />
profitieren, die noch 2003 zur Auszahlung kommen (in der Regel 400 USD pro Kind). Dazu<br />
kommen eine vorgezogene Senkung der Einkommenssteuer sowie spezielle Entlastungen<br />
für Ehepaare, Investitionsanreize für Unternehmen und eine drastische Senkung der Besteuerung<br />
von Dividenden und Kapitalgewinnen. Insgesamt werden für das Maßnahmenpaket<br />
zusätzlich 350 Mrd. USD, verteilt auf 10 Jahre, veranschlagt.<br />
8 Nach offiziellen japanischen Angaben trugen die private Nachfrage 2 Prozentpunkte und<br />
die Veränderung des Außenbeitrages 0,7 Prozentpunkte zum Wachstum des BIP von 2,7 %<br />
bei.<br />
9 Lediglich im Jahr 2000 lag die Wachstumsrate mit 10 % noch darüber.<br />
10 Insgesamt wurden Aufträge an amerikanische Unternehmen im Wert von 8 Mrd. USD von<br />
den Chinesen unterzeichnet.<br />
39
2 INTERNATIONALE WIRTSCHAFTS-<br />
POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN<br />
Im Jahr 2003 wurden unter griechischer Präsidentschaft mit der Unterzeichnung<br />
des Beitrittsvertrags für zehn neue Mitglieder die letzten Weichen für die größte<br />
Erweiterung in der Geschichte der Union gestellt. Die italienische Präsidentschaft<br />
hätte einen Entwurf für eine europäische Verfassung bringen sollen, die Einigung<br />
darüber wurde jedoch verschoben. Einigung konnte hingegen über eine Europäische<br />
Wachstumsinitiative erlangt werden. Die im ersten Halbjahr 2004 folgende irische<br />
Präsidentschaft setzte sich neben der Abwicklung der Erweiterung und der Vorlage<br />
eines Verfassungsentwurfs ambitionierte Ziele sowohl hinsichtlich der Vertiefung als<br />
auch in Bezug auf die künftige Erweiterung der Union um Bulgarien und Rumänien.<br />
Die Entscheidung des Ecofin-Rates im November, kein Defizitverfahren gegen Frankreich<br />
und Deutschland im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes einzuleiten,<br />
kann als historisch betrachtet werden und wurde sehr unterschiedlich beurteilt.<br />
Außerhalb Europas zeigt sich sowohl in Lateinamerika als auch in Asien eine<br />
zunehmende Tendenz zur Regionalisierung. Das ergebnislose Treffen der WTO-<br />
Handelsminister in Cancún vom September 2003 dürfte neben der verstärkten<br />
Konzentration auf regionale anstelle multilateraler Verhandlungen vor allem auch<br />
bilaterale Integrationsschritte weiterhin ermutigen. Die USA und die EU bemühen<br />
sich um größtmögliche Einflussnahme in den jeweils für sie wichtigen Regionen.<br />
Besonders in Asien zeigt sich bereits eine Reihe konkreter Schritte in Hinblick auf<br />
eine vertiefte regionale wirtschaftliche und auch <strong>politische</strong> Integration.<br />
2.1 Die Europäische Union<br />
2.1.1 EU-Präsidentschaft<br />
Griechische Präsidentschaft<br />
Die griechische Ratspräsidentschaft wurde in der Öffentlichkeit hauptsächlich durch<br />
zwei herausragende Ereignisse wahrgenommen: den Europäischen Konvent, der mit<br />
der Ausarbeitung einer europäischen Verfassung beauftragt war und die Unterzeichnung<br />
des Beitrittsvertrags mit den zehn neuen Mitgliedsländern. Mit der feierlichen<br />
Unterzeichung des Beitrittsvertrags am 16. April 2003 in Athen hat die EU die größte<br />
Erweiterung in ihrer Geschichte besiegelt.<br />
„Die EU zukunftsfähiger zu machen“ – so lautete der Arbeitsauftrag für den Europäischen<br />
Konvent, der in der Zeit vom 28. Februar 2002 bis zum 10. Juli 2003 den Entwurf<br />
eines „Vertrags über die Verfassung für Europa“ ausarbeitete. Wenige Tage nach dessen<br />
Präsentation, im Juni 2003, begrüßten die Staats- und Regierungschefs den Text<br />
in Thessaloniki als eine „wichtige Arbeitsbasis“ für die folgende Regierungskonferenz.<br />
40
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
Die Entscheidung über die neue Verfassung sollte im Rahmen des nachfolgenden<br />
italienischen Vorsitzes erfolgen.<br />
Abgesehen von diesen beiden wichtigen Ereignissen konnte die griechische Präsidentschaft<br />
auch in anderen Politikbereichen gute Erfolge erzielen: Im Rahmen der<br />
Umsetzung der Lissabonner Reformagenda erfolgte u.a. die endgültige Annahme des<br />
Steuerpakets und des Maßnahmenpakets für den Energiebinnenmarkt sowie eine<br />
Einigung über bessere Rechtsetzung in Form einer interinstitutionellen Vereinbarung<br />
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission.<br />
Gute Fortschritte konnten auch bei der Durchführung des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen<br />
(Pensionsfonds, Börsenprospekte und Wertpapierdienstleistungen)<br />
und bei der Verbesserung der grenzüberschreitenden Mobilität der EU-Bürger erzielt<br />
werden.<br />
Italienische Präsidentschaft<br />
Das Hauptziel des italienischen Vorsitzes, den Verfassungsentwurf im Rahmen der<br />
Regierungskonferenz im Dezember 2003 abzuschließen, konnte nicht erreicht werden.<br />
Bei der Sitzung der Staats- und Regierungschefs im Dezember 2003 gelang in einigen<br />
zentralen Fragen keine Einigung, insbesondere in der Frage über das künftige Abstimmungssystem<br />
im Rat. Angesichts dessen kam die italienische Ratspräsidentschaft<br />
zu der Überzeugung, dass eine gute Verfassung zu einem späteren Zeitpunkt einem<br />
schlechten Vertrag auf diesem Treffen vorzuziehen sei. Die nachfolgende irische Ratspräsidentschaft<br />
wurde von der Regierungskonferenz beauftragt, bis zum Europäischen<br />
Rat im März 2004 Vorschläge für das weitere Vorgehen zu sondieren.<br />
Die EU einigte sich im zweiten Halbjahr 2003 auf eine Europäische Wachstumsinitiative.<br />
Die Aktion betrifft sowohl materielle als auch immaterielle Investitionen in zwei<br />
Hauptbereichen: Infrastruktur der transeuropäischen Netze (Verkehr, Telekommunikation<br />
und Energie) und Innovation, Forschung und Entwicklung (einschließlich Umwelttechnologie).<br />
Sie ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung der Lissabonner Agenda<br />
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung der erweiterten<br />
Union durch höhere Investitionen in Sach- und Humankapital.<br />
Im November 2003 warnte eine von der Europäischen Kommission eingesetzte Arbeitsgruppe<br />
„Beschäftigung“ vor der drohenden Gefahr, die Wachstums- und Beschäftigungsziele<br />
der Lissabon-Strategie bis 2010 nicht zu erreichen, sollten die Mitgliedstaaten<br />
ihre Reformbemühungen nicht verstärken. Die Experten der Arbeitsgruppe<br />
machen vier Schlüsselthemen für notwendige Reformen aus: (1) mehr Anpassungsfähigkeit<br />
auf Seiten der Arbeitnehmer und der Unternehmen; (2) größere Attraktivität<br />
des Arbeitsmarktes für mehr Menschen; (3) mehr und effektivere Investitionen in das<br />
Humankapital und (4) eine effektivere Durchführung der Reformen durch bessere be-<br />
41
schäftigungs<strong>politische</strong> Maßnahmen. Um die Ziele von Lissabon zu erreichen, müssten<br />
in der EU 15 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.<br />
Im Dezember 2003 fand die EU mit einer klaren neuen Sicherheitsstrategie zu einer<br />
gemeinsamen Linie in der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP).<br />
Als globaler außen<strong>politische</strong>r Akteur will die EU in Zukunft aktiver sein, mehr Handlungsfähigkeit<br />
zeigen und in eng abgestimmten Aktionen vorgehen.<br />
Um die Migrationsströme besser kontrollieren zu können, gelangte die EU zu einer<br />
allgemeinen Ausrichtung bei den biometrischen Identifikationsmerkmalen in Visa bzw.<br />
in Aufenthaltstiteln. Die Kommission soll nun einen Vorschlag für die Aufnahme von<br />
biometrischen Identifikationsmerkmalen in Pässe unterbreiten. Weiters soll der Dialog<br />
mit jenen Drittstaaten, welche Herkunfts- und Transitländer für Migrationsströme sind,<br />
intensiviert werden. Ziel ist es, diese Drittstaaten bei den von ihnen selbst unternommenen<br />
Bemühungen, derartige Migrationsströme zu unterbinden, zu unterstützen.<br />
Irische Präsidentschaft<br />
Für das erste Halbjahr 2004 übernahm Irland den Vorsitz in der EU. Das von sich aus<br />
ambitionierte Programm wurde mit dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen über<br />
einen neuen Verfassungsvertrag unverhofft um eine neue und schwierige Aufgabe<br />
erweitert. Bei seinem Frühjahrstreffen im März 2004 in Brüssel begrüßte der Europäische<br />
Rat den irischen Bericht über die Erfolgsaussichten des Verfassungsprozesses.<br />
Gemäß den Empfehlungen des irischen Vorsitzes forderte der Rat die Wiederaufnahme<br />
der Verhandlungen innerhalb der Regierungskonferenz und setzte das Gipfeltreffen<br />
im Juni als Zieldatum für eine Einigung über den Verfassungstext fest.<br />
Bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen hat sich die irische Präsidentschaft<br />
erstmals an einem neuen Planungsinstrument der EU, dem Mehrjährigen<br />
Strategieprogramm, zu orientieren. Dieses Programm wurde von den sechs Präsidentschaften<br />
dieser Dreijahresperiode, darunter auch Österreich, für die Jahre 2004 bis<br />
2006 erstellt. Österreich trägt damit in besonderer Weise Mitverantwortung am Erfolg<br />
des irischen Vorsitzes. Eine vorrangige Aufgabe des irischen Vorsitzes wird darin<br />
bestehen, die Erweiterung erfolgreich zu gestalten und die vollständige und effektive<br />
Integration von zehn neuen Mitgliedstaaten in die EU und deren Beitritt am 1. Mai 2004<br />
zu gewährleisten. Weiters setzte der irische Vorsitz das Ziel, die Verhandlungen mit<br />
Bulgarien und Rumänien im Jahr 2004 abzuschließen, damit diese Länder der EU im<br />
Jänner 2007 beitreten können, falls sie dafür vorbereitet sind.<br />
Darüber hinaus steht 2004 vor allem die Neue Finanzvorausschau („Agenda 2007“) für<br />
die Jahre 2007 bis 2013 im Mittelpunkt des EU-Geschehens. Weiters sollen auch die<br />
Verhandlungen über eine Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung<br />
von Frauen und Männern beim Zugang zu und bei der Versorgung mit<br />
42
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
Gütern und Dienstleistungen zügig vorangetrieben werden. Im Bereich der gewerblichen<br />
Eigentumsrechte ist das wichtigste Ziel der Präsidentschaft, eine Einigung zur<br />
Verordnung über das Gemeinschaftspatent sowie zur damit in Verbindung stehenden<br />
Revision des Europäischen Patentübereinkommens zu erreichen. 1 Die Anerkennung<br />
beruflicher Befähigungsnachweise gilt ebenfalls als eines der schon lange identifizierten<br />
Haupthindernisse im Binnenmarkt. 2 Neben der Erweiterung sind somit eine Reihe<br />
wesentlicher Vertiefungsschritte in diesem Jahr zu erwarten.<br />
2.1.2 EU-Erweiterung<br />
Am 9. April 2003 gab das Europäische Parlament seine Zustimmung zur Erweiterung<br />
der Union und zur Aufnahme aller 10 Beitrittsländer. Die feierliche Unterzeichnung des<br />
Beitrittsvertrags erfolgte am 16. April 2003 in Athen. Die Bevölkerung in den Beitrittsländern<br />
stimmte in den Volksbefragungen 3 zum Teil mit überwältigender Mehrheit für<br />
einen EU-Beitritt. Die Verfahren zur Ratifikation des Beitrittsvertrags sind nunmehr in<br />
allen neuen und alten Mitgliedstaaten voll im Gange. 4 Mit Stand Ende 2003 hatten<br />
insgesamt sieben Mitgliedsstaaten und acht Beitrittsländer ihr Ratifikationsverfahren<br />
abgeschlossen.<br />
Die Kommission legte im November 2003 umfassende Monitoring-Berichte über den<br />
Stand der Beitrittsvorbereitung der Beitrittsländer sowie ein Strategiepapier und die<br />
Fortschrittsberichte für Rumänien, Bulgarien und die Türkei vor. In den Fortschrittsberichten<br />
der früheren Jahre prüfte die Kommission die Einhaltung der „Kriterien<br />
von Kopenhagen“, was die Grundlage für den Abschluss der Beitrittsverhandlungen<br />
bildete. Die Monitoring-Berichte von 2003, die letzte Evaluierung der “EU-Reife” der<br />
zehn Kandidatenländer vor ihrem Beitritt am 1. Mai 2004, konzentrierten sich einerseits<br />
auf den Stand der weiteren Umsetzung von Wirtschaftsreformen und andererseits auf<br />
den Stand der Einlösung der in den Verhandlungen eingegangenen Verpflichtungen<br />
zur abschließenden Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes. Obwohl die<br />
Beurteilung im Allgemeinen positiv war, kam die Kommission zu dem Ergebnis, dass<br />
in einer Reihe von Bereichen noch ernsthafte Bedenken bezüglich der Umsetzung bis<br />
zum Beitritt bestünden. Die Kommission forderte die künftigen Mitgliedsstaaten auf,<br />
unverzüglich entscheidende Maßnahmen zu setzen. Dies betraf gleichermaßen alle<br />
zehn Beitrittsländer und je nach Land ein bis vier Kapitel des Besitzstandes. Unter den<br />
Bereichen, die von der Kommission als problematisch erachtet wurden, lassen sich<br />
zwei Untergruppen feststellen: Die erste betrifft den Binnenmarkt, wo die „Problemländer“<br />
durch ihre Versäumnisse anderen Mitgliedern schaden könnten, die zweite<br />
betrifft die Weiterleitung von EU-Mitteln. In diesen Bereichen laufen die zukünftigen<br />
Mitglieder Gefahr, sich selbst Schaden zuzufügen.<br />
43
Die Versäumnisse im Themenbereich Binnenmarkt beziehen sich auf ungleiche Wettbewerbsbedingungen.<br />
Die am häufigsten erwähnten Probleme sind Verspätungen bei<br />
Maßnahmen in der Veterinär- und Pflanzenschutzkontrolle, im Bereich Lebensmittelsicherheit<br />
sowie bei der Festsetzung von Mindestanforderungen bezüglich Ausbildung<br />
und gegenseitiger Anerkennung für eine Reihe von Berufen. Die Sorgen bezüglich<br />
der Weiterleitung von EU-Mitteln betreffen ausschließlich den Agrarbereich. In fünf<br />
Beitrittskandidaten-Ländern ist die Errichtung von Zahlstellen für Direktzahlungen und<br />
Marktintervention und in vier Ländern die Anwendung des integrierten Verwaltungs-<br />
und Kontrollsystems (IACS) in Verzug. Ohne die nötigen Maßnahmen zur Änderung<br />
dieser Situation würden den betroffenen Ländern wichtige Vorteile der Mitgliedschaft<br />
entgehen.<br />
Die Kommission legt großes Gewicht darauf, dass die erwähnten Probleme rechtzeitig,<br />
d.h. noch vor dem Beitritt gelöst werden. Im Notfall dürften auch Sanktionen<br />
verhängt werden. So könnten z.B. EU-Mittel nicht freigegeben werden, bei Sorgen<br />
um die Lebensmittelsicherheit könnte die Ausfuhr aus einer Region oder einem Land<br />
gestoppt werden. Sollte ein Versäumnis das Funktionieren des Binnenmarktes ernsthaft<br />
beeinträchtigen, so kann ein neuer Mitgliedstaat oder seine Bürger oder Wirtschaftsteilnehmer<br />
aus bestimmten Binnenmarktvorschriften und von den Vorteilen der<br />
Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.<br />
Gleichzeitig mit dem Monitoring-Bericht über die Beitrittsländer veröffentlichte die Kommission<br />
ein Strategiepapier und Fortschrittsberichte über die Beitrittswerber Bulgarien,<br />
Rumänien und die Türkei. Die Kommission bescheinigte Bulgarien, bei Weiterführung<br />
seines Reformprogramms über eine funktionierende Marktwirtschaft zu verfügen und<br />
bald in der Lage zu sein, dem Wettbewerbsdruck in der EU standzuhalten. Weniger positiv<br />
fiel die Beurteilung Rumäniens aus. Das Land müsse noch weitere Anstrengungen<br />
unternehmen, um das erste Kopenhagener Kriterium (funktionierende Marktwirtschaft)<br />
zu erfüllen. Gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats in Kopenhagen<br />
vom Dezember 2002 werden die Beitrittsverhandlungen mit Rumänien und Bulgarien<br />
mit dem Ziel fortgesetzt, die beiden Länder 2007 als Mitglieder in die EU aufzunehmen.<br />
Bezüglich der Türkei liegen die Probleme in erster Linie bei der vollständigen Erfüllung<br />
der <strong>politische</strong>n Kriterien der EU-Mitgliedschaft. Es wurde bisher noch kein Termin für<br />
die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei genannt. Eine Entscheidung<br />
darüber war für den Europäischen Rat im Dezember 2004 auf Grundlage eines Berichts<br />
über die Erfüllung der <strong>politische</strong>n Kriterien durch die Türkei und einer Empfehlung der<br />
Kommission vorgesehen. Als ein weiterer Beitrittswerber stellte Kroatien am 21. Feber<br />
2003 seinen EU-Beitrittsantrag. Im April 2003 wurde die Kommission mit der Avis-<br />
Erstellung beauftragt, die im Frühjahr 2004 vorliegen sollte.<br />
44
2.1.3 Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)<br />
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
Unter anderem durch den Höhenflug der gemeinsamen Währung geriet einer der Grundpfeiler<br />
der Währungsunion, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, in Gefahr. Deutschland<br />
und Frankreich überschritten bereits in zwei aufeinander folgenden Jahren die erlaubte<br />
Grenze des Budgetdefizits von 3,0 % des BIP. Derzeit ist davon auszugehen, dass das<br />
Defizit im Jahr 2004 zum dritten Mal über dieser Grenze liegen wird. Laut Stabilitätspakt<br />
hätte diese Entwicklung schwerwiegende Folgen. Im Jahr 2001 verstieß Portugal als<br />
erstes EU-Land gegen den Stabilitätspakt der EU und überschritt beim Budgetdefizit die<br />
zulässige Grenze. Die Folge war eine strenge Mahnung aus Brüssel und Lissabon war<br />
damals gezwungen, entsprechende <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Maßnahmen zu treffen.<br />
Am 25. November 2003 traf der Rat der Finanzminister (Ecofin) die historische Entscheidung,<br />
das EU-Defizitverfahren gegen Deutschland und Frankreich auszusetzen.<br />
Eine Sperrminorität der Finanzminister aus Italien, Portugal, Irland und Luxemburg<br />
konnte die strengen Defizitvorgaben der EU-Kommission für Deutschland und Frankreich<br />
abblocken. Die Minister ersetzten diese Vorgaben – unter Umgehung des vorgeschriebenen<br />
Verfahrens des Stabilitätspakts – durch eine mildere und rechtlich unverbindliche<br />
Erklärung. Somit sind Deutschland und Frankreich lediglich dazu verpflichtet,<br />
ihre Neuverschuldung um 0,8 % (Frankreich) und 0,6 % (Deutschland) zu verringern,<br />
aber nicht zu einer Reduktion der strukturellen Budgetdefizite im kommenden Jahr um<br />
1,0 % beziehungsweise 0,8 %, wie in den von der Kommission vorgelegten bindenden<br />
Vorschriften vorgesehen.<br />
Die Meinungen über die Folgen dieser Entscheidung gingen auseinander, die Folgen<br />
für den Stabilitätspakt blieben offen. EU-Währungskommissar Pedro Solbes sprach<br />
von einer „Niederlage für Europa“ und konnte im Namen seiner Behörde nur mehr „tief<br />
bedauern“, dass die Eurogruppe „nicht dem Geist und den Regeln“ des Pakts gefolgt<br />
sei und „die rechtlichen Vorschriften missachtet“ habe. Für den deutschen Finanzminister<br />
Eichel war die Entscheidung „ein Sieg der Vernunft“: Deutschland dürfe nicht<br />
gezwungen werden, sich in die Stagnation „hineinzusparen“. Deutschland habe sich<br />
bisher an alle EU-Sparvorschriften gehalten. Er wolle sich aber nicht der Gefahr der<br />
im Stabilitätspakt vorgesehenen Bußgelder aussetzen, wenn die deutsche Neuverschuldung<br />
wegen der schlechten Konjunktur und trotz aller Reformen auch 2004 im<br />
dritten aufeinander folgenden Jahr über der erlaubten Grenze liegen sollte.<br />
2.1.4 Außenbeziehungen der EU<br />
Der Region Westbalkan, welche eine der Zukunftsregionen für die österreichische<br />
Wirtschaft ist, wird auch von der EU hohe Priorität einräumt. Die Integration dieser<br />
45
Länder in die europäischen Strukturen und schließlich ihre Mitgliedschaft in der EU<br />
sind die großen Herausforderungen der kommenden Jahre. Nicht zuletzt der EU-Gipfel<br />
von Thessaloniki im Juni vergangenen Jahres bestätigte, dass die Zukunft der Region<br />
in der EU liegt, wobei jedes Land darüber bestimmen soll, wie schnell es dabei voranschreitet.<br />
Demgemäß werden stark unterschiedliche Entwicklungen und Fortschritte<br />
im Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses (SAP) in den einzelnen<br />
Ländern der Region beobachtet. Kroatien, gefolgt von Mazedonien, gelten bezüglich<br />
des SAP als am weitesten fortgeschrittene Länder in der Region. Mit beiden Ländern<br />
wurden bereits Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) abgeschlossen,<br />
die derzeit ratifiziert werden. Wie bereits erwähnt, befindet sich der Antrag Kroatiens<br />
auf EU-Mitgliedschaft im Prüfungsstadium, wobei eine Stellungnahme der Kommission<br />
im Frühjahr 2004 zu erwarten war. Mit Albanien wurden Verhandlungen über den<br />
Abschluss eines SAA bereits aufgenommen. Hinsichtlich Bosnien-Herzegowina legte<br />
die Kommission ihren Bericht über den Stand der Vorbereitungen zur Ausverhandlung<br />
eines SAA bereits vor. Bezüglich eines SAA mit Serbien und Montenegro wird derzeit<br />
von der Kommission eine Machbarkeitsstudie erstellt.<br />
Im Hinblick auf die Erweiterung wurden seitens der Europäischen Kommission mit<br />
den MOEL Verhandlungen für sogenannte Doppelnull-Abkommen aufgenommen. Ziel<br />
dieser Abkommen ist es, einen weiteren Schritt in Richtung Handelsliberalisierung bei<br />
landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen zu setzen. Doppelnull bedeutet zum<br />
einen die Reduktion bzw. die Streichung von Zollsätzen, zum anderen den Wegfall<br />
von EU-Ausfuhrerstattungszahlungen. Diese Abkommen sind auf Gegenseitigkeit<br />
ausgerichtet. Doppelnull-Abkommen gibt es bisher mit Slowenien, der Tschechischen<br />
Republik, der Slowakei, Ungarn, Litauen, Lettland und Estland. Die Verhandlungen der<br />
Europäischen Kommission mit Polen wurden Anfang 2004 abgebrochen.<br />
Am 1. April 2003 trat das bereits im Juni 2000 in der beninischen Stadt Cotonou<br />
unterzeichnete Abkommen über Handel, Entwicklung und <strong>politische</strong> Zusammenarbeit<br />
zwischen 77 afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten (AKP-Staaten)<br />
und der EU in Kraft. Die Partnerschaft soll in den nächsten 20 Jahren vor allem zur<br />
Armutsbekämpfung, zur Verhütung gewaltsamer Konflikte und zur Verbesserung der<br />
Staatenführung beitragen.<br />
Der Dialog zwischen der EU und Lateinamerika nach dem 2. Gipfeltreffen im Mai<br />
2002 wurde auch auf subregionaler Ebene fortgesetzt. Hinsichtlich Mexiko kann drei<br />
Jahre nach Inkrafttreten des Freihandelsabkommens EU-Mexiko eine positive Bilanz<br />
gezogen werden: Seither ist das bilaterale Handelsvolumen um mehr als 25 % gestiegen.<br />
Die handelsbezogenen Bestimmungen des im November 2002 unterzeichneten<br />
Assoziationsabkommens EU-Chile traten mit 1. Februar 2003 provisorisch in Kraft.<br />
Dies erlaubt interessierten europäischen Unternehmen, noch vor Inkrafttreten des<br />
46
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
Abkommens, die Vorteile relevanter Bestimmungen des Abkommens zu nutzen. Hinsichtlich<br />
der laufenden Verhandlungen zwischen der EU und dem Mercosur - die zwei<br />
Kapitel <strong>politische</strong>r Dialog und Zusammenarbeit sind bereits abgeschlossen - wurde bis<br />
Ende 2003 in bisher elf Verhandlungsrunden kein entscheidender Durchbruch in den<br />
<strong>wirtschafts</strong>relevanten Bereichen erzielt, wohl aber wurde ein ambitionierter Zeitplan<br />
für die weiteren Verhandlungen festgelegt, der das Bekenntnis bekräftigt, die Verhandlungen<br />
bis 2005 abschließen zu wollen. Im Rahmen eines Assoziationsabkommens<br />
sollen der unbeschränkte Marktzugang für Anbieter von Güter und Dienstleistungen,<br />
öffentliche Beschaffung, Investitionen, weiters die Regelung von phytosanitären und<br />
veterinärmedizinischen Maßnahmen, Wettbewerb, geistiges Eigentum und ein Abkommen<br />
über Weine und Spirituosen geregelt werden. Die Kooperationsabkommen der<br />
EU mit der Andengemeinschaft und Zentralamerika (diese enthalten keine Freihandelsregelung)<br />
wurden im Dezember 2003 unterzeichnet. Ob bzw. in welcher Form eine<br />
weitere Vertiefung des Dialogs stattfinden soll, wird noch Gegenstand von internen<br />
EU-Konsultationen und Gesprächen mit der lateinamerikanischen Seite sein.<br />
Im Rahmen des informellen und institutionellen ASEM-Dialogs, der Zusammenarbeit<br />
EU-ASEAN und im Rahmen bilateraler (Gipfel-)Treffen mit einzelnen asiatischen<br />
Ländern arbeitet die EU konsequent an der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
mit Asien, jedoch ohne bisher konkrete Schritte für die Aufnahme<br />
von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit asiatischen Partnerländern<br />
gesetzt zu haben. Anlässlich des dritten Treffens der ASEAN-Handelsminister mit<br />
der Europäischen Kommission im April 2003 wurde ein Programm unter dem Namen<br />
„Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative“ (TREATI) beschlossen, um einen neuen<br />
Rahmen zur Dynamisierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Regionen<br />
zu schaffen. Dies könnte auch die Grundlage für ein künftiges Freihandelsabkommen<br />
zwischen den beiden Regionen bilden. Der Markt EU-25+ASEAN würde eine Milliarde<br />
Menschen und die Hälfte des Welthandels auf sich vereinigen.<br />
Die Errichtung einer Freihandelszone bis zum Jahr 2010 zwischen den EU-Mitgliedstaaten<br />
und den zwölf Mittelmeeranrainerstaaten rückte hingegen in greifbare Nähe.<br />
Dazu trugen u.a. Fortschritte bei der Implementierung bestehender Abkommen, der<br />
gezielte Einsatz von MEDA-Mitteln, der Abschluss der Verhandlungen über ein Assoziationsabkommen<br />
mit Syrien - dem letzten noch ausständigen bilateralen Abkommen<br />
- im Dezember 2003, sowie Fortschritte bei der Ausweitung der Paneuropäischen<br />
Kumulierung der Ursprungsregeln auf die Euromediterranen Staaten bei. Auch die<br />
im März 2003 von der Europäischen Kommission angenommene Erklärung „Wider<br />
Europe“, die einen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit mit den an die erweiterte<br />
EU angrenzenden Staaten schafft, soll zur Intensivierung der Beziehungen mit den<br />
Mittelmeerstaaten beitragen.<br />
47
2.2 Regionale Abkommen<br />
2.2.1 Wirtschaftsintegration in Amerika<br />
Nach zähen Verhandlungen während des Jahres 2003 bestätigten die Außenhandelsminister<br />
der zukünftigen FTAA-Partner am 20. November in Miami ihre Absicht,<br />
die Verhandlungen über die pan-amerikanische Freihandelszone zwischen allen 34<br />
Staaten Nord- und Südamerikas (mit Ausnahme Kubas) fortzusetzen. Die teilnehmenden<br />
Minister einigten sich zwar darauf, bis Anfang 2005 ein umfassendes und<br />
ausgeglichenes Freihandelsabkommen abzuschließen, räumten jedoch gleichzeitig<br />
ein, dass die Einhaltung dieses Termins aufgrund des nur schwach ausgeprägten<br />
<strong>politische</strong>n Willens bei einigen Verhandlungspartnern unwahrscheinlich sei. Bei der<br />
Tagung in Miami wurde betont, dass Flexibilität eine wichtige Bedingung des Erfolges<br />
ist. Aufgrund der Unterschiede sowohl im Entwicklungsniveau der Partnerländer als<br />
auch in der Größe der individuellen Volkswirtschaften müsse auf Bedürfnisse und<br />
Sensibilität aller Partner Rücksicht genommen werden. Es wurde zur Kenntnis genommen,<br />
dass einzelne Länder von anderen abweichende Verpflichtungen eingehen<br />
können. Das Abkommen wird eine gemeinsame Grundlage für Rechte und Pflichten<br />
der Unterzeichnerstaaten in folgenden Gebieten beinhalten: Marktzugang, Landwirtschaft,<br />
Dienstleistungen, Investitionen, öffentliche Beschaffung, geistiges Eigentum,<br />
Wettbewerbspolitik, Subventionen, Antidumping, Ausgleichzölle und Ausräumung von<br />
Konflikten. Verhandlungen in diesen Themenbereichen sind für alle FTAA Partnerländer<br />
verbindlich. Auf plurilateraler Basis dürfen sich interessierte Partnerländer über<br />
Liberalisierungsschritte in weiteren Themen einigen. 5<br />
Wie weit die Kooperation in den oben erwähnten verschiedenen Gebieten tatsächlich<br />
vertieft werden kann, ist noch offen und hängt zum Teil von Brasilien ab, dem wirtschaftlichen<br />
und <strong>politische</strong>n „Schwergewicht“ im Mercosur. Nach der Wahl von Nestor<br />
Kirchner zum neuen Staatspräsidenten erfolgte von argentinischer Seite eine zunehmende<br />
Unterstützung der Bemühungen Brasiliens um eine verstärkte Integration im<br />
Rahmen des Mercosur. Im August 2003 wurde ein Freihandelsabkommen zwischen<br />
Mercosur und Peru unterzeichnet, entsprechende Verhandlungen mit weiteren drei<br />
Ländern der Anden-Region sind im Gange. Die Forderungen nach einer Rückstufung<br />
des Mercosur auf eine Freihandelszone sind zwar in letzter Zeit verstummt, entscheidende<br />
Fortschritte um die Zollunion wurden jedoch bisher nicht an die Öffentlichkeit<br />
getragen. Ein gestärkter Mercosur sollte nach Absicht Brasiliens innerhalb der FTAA<br />
bessere Konditionen insbesondere gegenüber den USA erreichen. Parallel zu den<br />
FTAA-Verhandlungen vertieften die USA hingegen die Integration mit einigen Ländern.<br />
Nach ähnlichen Abkommen mit Mexiko und Chile wurde ein Freihandelsabkommen mit<br />
48
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
vier zentralamerikanischen Staaten (El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua)<br />
unterzeichnet. Das Abkommen mit Costa Rica wurde verschoben, weil sich die Partner<br />
nicht über die Liberalisierung des Telekommunikationssektors einigen konnten. Einige<br />
kleinere lateinamerikanische Länder, die wegen ihrer einfachen Wirtschaftstruktur<br />
durch die nordamerikanische Konkurrenz weniger zu befürchten haben als die relativ<br />
entwickelte Industrie Brasiliens, jedoch die neuen Absatzmärkte dort anlockend finden,<br />
nahmen die entsprechende Initiative Brasiliens mit wenig Begeisterung auf.<br />
2.2.2 Regionale Wirtschaftskooperation in Asien<br />
Zumindest aus längerfristiger Sicht wichtigstes Ereignis des Jahres 2003 war der<br />
ASEAN-Gipfel in Bali, wo die Staatengemeinschaft ankündigte, bis zum Jahre 2020<br />
eine Wirtschaftsgemeinschaft zu bilden, die zu einer engeren Zusammenarbeit der<br />
ASEAN-Länder im wirtschaftlichen, aber auch im (sicherheits-) <strong>politische</strong>n und soziokulturellen<br />
Bereich führen soll. Ein detailliertes Modell für diese Zusammenarbeit steht<br />
allerdings noch aus, der EU kommt dabei jedoch eine gewisse Vorbildfunktion zu. Die<br />
„ASEAN Community“ signalisiert ein „Zusammenrücken“ der ASEAN-Länder parallel<br />
zur gleichzeitig stattfindenden „Erweiterung“ mit Hilfe eines Netzes von Freihandelsabkommen.<br />
Nachdem im November 2002 zwischen ASEAN und China ein Abkommen<br />
zur Bildung einer Freihandelszone bis zum Jahr 2010 abgeschlossen worden war, 6<br />
wurde am Gipfel von Bali ein Rahmenabkommen zur Bildung einer Freihandelszone<br />
ASEAN-Indien unterzeichnet. Im November 2003 schließlich wurden zwischen ASEAN<br />
und Japan Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur Bildung einer Freihandelszone<br />
bis zum Jahr 2012 aufgenommen. Daneben wurden auch 2003 wieder zahlreiche<br />
Freihandelsabkommen einzelner ASEAN-Länder mit Nicht-Mitgliedern geschlossen,<br />
wobei insbesondere Singapur und Thailand besonders aktiv waren, da ihnen der Liberalisierungsprozess<br />
innerhalb ASEAN zu langsam voranschritt. Prominente Beispiele<br />
sind die Freihandelsabkommen: Singapur-USA und Thailand-Indien. 7<br />
China seinerseits schloss mit den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao spezielle<br />
Freihandelsabkommen, um ihnen einen besseren Marktzugang zu ermöglichen,<br />
aber auch um besser an ihrer Professionalität in bestimmten Dienstleistungsbereichen<br />
partizipieren zu können. 8<br />
Anlässlich des Bali-Gipfels unterzeichnete China als erstes Nicht-ASEAN-Land auch<br />
ein wichtiges sicherheits<strong>politische</strong>s Dokument der ASEAN, das „Treaty of Amity and<br />
Cooperation“ (TAC). Indien schloss sich spontan an und Japan machte noch im Dezember<br />
2003 eine Absichterklärung, das TAC ebenfalls bald zu unterzeichnen.<br />
Im Rahmen der Freihandelszone AFTA (ASEAN Free Trade Area) haben die sechs<br />
Originalunterzeichner (ASEAN-6) seit 1. Jänner 2003 die Zölle auf eine Vielzahl von<br />
49
Produkten (mehr als 44.000 Zolltarifnummern) auf 0 – 5 % reduziert mit dem Ziel bis<br />
2010 alle Zölle abzuschaffen. Der durchschnittliche Zoll für ASEAN-6-Länder im Rahmen<br />
des CEPT (Common Effective Preferential Tariff)-Schemas liegt nun bei 2,4 % im<br />
Vergleich zu fast 13 % im Jahr 1993, als mit den Zollsenkungen begonnen wurde. Die<br />
Zone soll schrittweise auf Vietnam (2006), Laos und Burma (2008) und Kambodscha<br />
(2010) ausgeweitet werden, wobei für diese das Ziel der Zollfreiheit erst für 2015 vorgesehen<br />
ist. Der durchaus positive Stand der ASEAN-weiten Zollabbaubemühungen<br />
für 2003 (88 % aller Produkte waren nur mehr mit einem Zoll zwischen 0 % und 5 %<br />
belastet), wird durch die Tatsache relativiert, dass nur rund 21 % des Gesamthandels<br />
von ASEAN intraregional abgewickelt wird. Zusätzlich wurden weitere Maßnahmen<br />
gesetzt, um bis 2010 die ASEAN Investment AREA (AIA) zur Aufhebung von Investitionsschranken<br />
zu schaffen. Verhandlungen bzw. erste Umsetzungsschritte über<br />
eine „Erweiterung“ der Freihandelszone AFTA auf Indien (bis 2011), China und Japan<br />
(bis 2012) sowie über die Schaffung einer ostasiatischen Freihandelszone ASEAN+3<br />
(China, Japan, Südkorea) haben sich konkretisiert und im Sinne einer Vertiefung von<br />
AFTA sind erste Schritte zur Ausarbeitung von Aktionsplänen in Schlüsselsektoren<br />
zur Verwirklichung einer ASEAN Economic Community (AEC) mit freiem Waren-,<br />
Dienstleistungs-, Personen- und Investitionsverkehr und einem freieren Kapitalfluss<br />
bis 2020 gesetzt worden.<br />
Das jährliche Gipfeltreffen der APEC fand dieses Jahr in Bangkok statt. Wie schon in<br />
den beiden vorangegangenen Jahren nahmen auf Drängen der USA wiederum sicherheits<strong>politische</strong><br />
Themen einen breiten Raum ein. Die 21 Mitgliedsstaaten verpflichteten<br />
sich u.a. zur Bekämpfung von Terrorzellen und zur Einschränkung des Handels mit<br />
mobilen Luftabwehrlenkwaffen (SAM-Raketen) – eine Erklärung zu Nordkorea kam<br />
jedoch nicht zustande. Im ökonomischen Bereich standen der Wunsch nach Wiederaufnahme<br />
der WTO-Gespräche und die gleichzeitige Forderung nach Konzessionen<br />
der USA und der EU beim Abbau von Agrarexportsubventionen im Vordergrund.<br />
Das Atomwaffenprogramm Nordkoreas im Fokus<br />
Nachdem im Oktober 2002 bekannt geworden war, dass Nordkorea an einem<br />
Programm zur Anreicherung von Uran zur Herstellung von Nuklearwaffen arbeitet<br />
und im November die USA ihre Schweröllieferungen an Korea eingestellt hatten,<br />
machte die Regierung Nordkoreas im Jänner 2003 ihre Ankündigung wahr, aus dem<br />
Atomsperrvertrag (Non-proliferation treaty – NPT) auszutreten. Dies bedeutet, dass<br />
seine atomaren Anlagen nicht mehr der Kontrolle der Inspektoren der Internationalen<br />
Atomenergie Agentur (IAEA) unterliegen und sich Korea daher ungestört seinen<br />
atomaren Entwicklungsplänen widmen kann. Auf Grund <strong>internationale</strong>r Proteste, vor<br />
50
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
allem seitens der USA, kam es im April 2003 zu „trilateralen“ Gesprächen zwischen<br />
China, USA und Nordkorea in Beijing, die jedoch bald erfolglos abgebrochen wurden.<br />
Im August folgten „6-Ländergespräche“ (China, Russland, Japan, Südkorea,<br />
Nordkorea, USA), die unter strengster Geheimhaltung in Beijing stattfanden, aber<br />
offenbar auch keinen Durchbruch brachten.<br />
Von einer Weiterführung der Wirtschaftsreformen in Nordkorea, die im Sommer<br />
2002 mit erheblichen Lohnerhöhungen, Preiserhöhungen, massiven Abwertung<br />
der koreanischen Währung und einer schrittweisen Marktöffnung im landwirtschaftlichen<br />
Bereich einhergegangen waren, ist wenig bekannt. In Südkorea hingegen<br />
geriet die „Sonnenscheinpolitik“ Präsident Kim Dae Jungs und seines ebenfalls<br />
für Versöhnung mit dem nördlichen Nachbarn eintretenden Nachfolgers Roh Moo<br />
Hyun massiv unter Beschuss, nachdem sich der Verdacht bestätigt hatte, dass<br />
das gefeierte Gipfeltreffen zwischen Kim Dae Jung (S-Korea) und Kim Jung Il<br />
(N-Korea) im Juni 2000 durch großzügige Spenden des Hyundai-Konzerns, mit<br />
Unterstützung der Regierung, in die Wege geleitet worden war. Die Grundstimmung<br />
in der Bevölkerung scheint dennoch positiv für eine weitere Öffnung gegenüber<br />
dem Norden zu sein.<br />
2.2.3 Afrika und Naher Osten<br />
Ende 2001 unterzeichneten die sechs Staaten des Golfkooperationsrates einen Vertrag<br />
zur Gründung einer Wirtschaftsunion, die von 2005 auf 2003 vorgezogen wurde. Für<br />
2010 ist eine Währungsunion vorgesehen.<br />
2.3 Welthandelsorganisation (WTO)<br />
Mit Jahresende 2003 – nach der Aufnahme Armeniens und Mazedoniens – gehörten<br />
der WTO 146 Mitglieder an. Die Beitrittsverhandlungen mit Kambodscha und Nepal<br />
konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Damit werden diese beiden Länder als erste<br />
Entwicklungsländer seit der Gründung der WTO mit großer Wahrscheinlichkeit 2004<br />
als Mitglieder aufgenommen werden. 9 Mit über 20 Ländern wird über eine Aufnahme<br />
verhandelt, darunter Russland, Saudi-Arabien und Bhutan (letztere Verhandlungen<br />
wurden unter dem österreichischen Vorsitz von Botschafter Petritsch geführt). Im April<br />
2003 langte auch ein Beitrittsansuchen von Afghanistan ein. Eine entsprechende<br />
Arbeitsgruppe wurde bisher noch nicht eingerichtet.<br />
Das herausragende Ereignis des Jahres 2003 war zweifelsohne die 5. Ministerkonferenz<br />
in Cancún/Mexiko, welche jedoch ergebnislos abgebrochen wurde. Obwohl der<br />
51
Ort für die Abhaltung der 6. WTO-Ministerkonferenz schon feststeht (Hongkong/China),<br />
ist der Zeitpunkt noch unklar. Gemäß dem im WTO-Abkommen vorgesehenen<br />
zumindest zweijährigen Rhythmus müsste sie spätestens im Herbst 2005 abgehalten<br />
werden. Die Entwicklung der Verhandlungen der Doha-Runde könnte jedoch ein<br />
Vorziehen dieses Ereignisses bewirken.<br />
2.3.1 Laufende Verhandlungen<br />
Durch den ergebnislosen Abbruch der fünften WTO-Ministerkonferenz, welche vom 10.<br />
bis 14. September 2003 in Cancún stattfand und die Weichen für einen erfolgreichen<br />
Abschluss der Doha-Runde am 1. Jänner 2005 hätte stellen sollen, erlitt die derzeit<br />
laufende „Entwicklungsrunde“ einen schweren Rückschlag. Entsprechend der Vorgabe<br />
der Minister von Cancún sollte der Allgemeine WTO-Rat im Dezember in Genf die<br />
erforderlichen Beschlüsse für die Weiterführung der seit Cancún suspendierten Verhandlungen<br />
nachholen. Es kam zu keiner diesbezüglichen Entscheidung, doch konnte<br />
man sich zumindest auf die weitere Vorgangsweise einigen. Die Verhandlungen sollen<br />
nach der Neubestellung der Vorsitzenden der einzelnen Verhandlungsgruppen, welche<br />
im Februar 2004 schließlich eingesetzt wurden, wieder aufgenommen werden.<br />
Der Rückschlag von Cancún ist umso bedauerlicher als die Doha-Runde als „Entwicklungsrunde“<br />
(„Doha Development Agenda“) speziell auf die besondere Berücksichtigung<br />
der Bedürfnisse von Entwicklungsländern ausgerichtet ist und ein positives Signal<br />
für diese somit ausblieb. Ebenso dürften jene Länder gerade auch die größten Verlierer<br />
einer Nicht-Fortsetzung der Verhandlungen sein. So konnte auch der ursprünglich<br />
schon 2002 vorgesehene Beschluss für die Stärkung einzelner Bestimmungen zur<br />
differenzierten Sonderbehandlung von Entwicklungsländern („special and differential<br />
treatment“) nicht gefasst werden. Der für die technische Hilfe an diese Länder<br />
eingerichtete „Doha Development Agenda Global Trust Fund“ (DDAGTF) wurde jedoch<br />
auch für 2004 mit mehr als 24 Mio. Schweizer Franken dotiert, wozu Österreich<br />
200.000 Euro beisteuerte.<br />
Beim Marktzugang blieb die Frage der Modalitäten der künftigen Zollverhandlungen<br />
weiterhin offen. Die EU strebt weiterhin wesentliche Zollsenkungen aller Mitglieder<br />
(einschließlich der Entwicklungsländer) auf der Grundlage einer allgemeinen Formel<br />
für sämtliche Industriewaren an. Für die USA sind schwerpunktmäßige Verhandlungen<br />
über einzelne Sektoren besonders wichtig. Die Entwicklungsländer wehren sich<br />
gegen verpflichtende Zollsenkungen, obwohl dem Handel zwischen Entwicklungsländern<br />
immer größere Bedeutung zukommt. Aufgrund unterschiedlicher Strukturen und<br />
Entwicklungsniveaus bilden die Entwicklungsländer keine homogene Gruppe und die<br />
von Industriestaaten geforderte unterschiedliche Behandlung war bisher politisch nicht<br />
52
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
durchsetzbar. Auch die besondere Behandlung von Umweltgütern sowie der Abbau<br />
von nicht-tarifären Handelshemmnissen sind noch weitgehend unklar.<br />
Der Zeitplan von Doha sah für die Land<strong>wirtschafts</strong>verhandlungen bis März 2003 die<br />
Festlegung von Modalitäten in allen drei Verhandlungssäulen (Marktzugang, Exportsubventionen,<br />
interne Stützung) sowie bei nicht handelsbezogenen Anliegen<br />
(Non-Trade Concerns – NTC, z.B. Verbraucher-, Umwelt- und Tierschutz) vor. Diese<br />
Frist konnte nicht eingehalten werden. Nachdem die EU im Juni 2003 weitreichende<br />
Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (Halbzeitbewertung der Agenda 2000) beschlossen<br />
und damit die Voraussetzungen für eine größere Verhandlungsflexibilität im<br />
Bereich interne Stützungen geschaffen hatte, legten die EU und die USA ein gemeinsames<br />
Papier vor, welches darüber hinaus auf einer Annäherung in den Bereichen<br />
Marktzugang (differenzierte Zollsenkung unter Berücksichtigung sensibler Produkte)<br />
und Exportwettbewerb (Gleichbehandlung aller Formen von Exportsubventionen)<br />
beruhte. Dieser vorgeschlagene Verhandlungsrahmen (ohne konkrete Fristen und<br />
Zahlen) für Abbauverpflichtungen bildete die Grundlage für den Entwurf der Ministererklärung<br />
für Cancún. Verhandlungen auf dieser Basis kamen jedoch nicht zustande,<br />
da eine von Brasilien angeführte Gruppe von Entwicklungs- und Schwellenländern<br />
(so genannte „G-20+“) eine Gegenposition mit weitgehenden einseitigen Forderungen<br />
an die Industrieländer aufbaute. Diese Gruppe forderte den Abbau der hohen<br />
Agrarzölle und -subventionen in den Industrieländern, da letztere eine unüberwindbare<br />
Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten der Entwicklungsländer darstellen. Der<br />
vorzeitige Abbruch der 5. WTO-Ministerkonferenz geht daher im Wesentlichen auf<br />
diese Konstellation bei den Agrarverhandlungen zurück, obwohl die Verhandlungen<br />
formal an der Frage über die Aufnahme neuer Bereiche (wie Investitionen) in die<br />
Verhandlungen scheiterten. 10<br />
Heftig umstritten waren also auch die sogenannten „Singapur-Themen“. Das Mandat<br />
von Doha sah für Cancún eine Entscheidung über die formelle Eröffnung von Verhandlungen<br />
über die Themen Investitionen, Wettbewerb, Transparenz im öffentlichen<br />
Beschaffungswesen und Handelserleichterungen vor. Eine Trennung der vier „Singapur-Themen“<br />
scheint sich nunmehr als Kompromiss abzuzeichnen. Die Verhandlungen<br />
über Handelserleichterungen und Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen<br />
könnten wieder aufgenommen werden. Wie mit Wettbewerb und Investitionen weiter<br />
verfahren wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. 11<br />
Im März des Jahres 2003 startete man bei den Dienstleistungen sehr erfolgreich<br />
mit der Beschlussfassung über eine der Schlüsselfragen der GATS-Verhandlungen,<br />
nämlich wie die von den Mitgliedern seit den vorangegangenen Verhandlungen autonom<br />
getroffenen Liberalisierungsmaßnahmen behandelt werden sollen (so genannte<br />
„modalities for treatment of autonomous liberalization“). Ebenfalls positiv anzumerken<br />
53
ist, dass es noch vor Cancún gelang, die Modalitäten für die Sonderbehandlung von<br />
am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs) in den Dienstleistungsverhandlungen zu<br />
beschließen. Die Verhandlungen zur weiteren Öffnung des Handels mit Dienstleistungen<br />
erfuhren durch den Rückschlag in Cancún ebenfalls einen Dämpfer. Die EU hatte<br />
bereits im Juli 2002 ihre Forderungen an insgesamt 109 WTO-Mitglieder gerichtet und<br />
selbst bisher 38 Forderungen von anderen Mitgliedern erhalten. Die Aufnahme der<br />
Arbeiten an einem gemeinsamen EU-Dienstleistungsangebot wurden im Januar 2003<br />
gestartet, im April 2003 finalisiert und anschließend der WTO übermittelt, wobei das<br />
österreichische Angebot in der WTO als Bestandteil des Angebots der Europäischen<br />
Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten vorgelegt wurde. Insgesamt haben seit<br />
März 2003 neben der EU 38 Mitglieder ihre Angebote vorgelegt. Nach EU-interner<br />
Auswertung der vorgelegten Angebote sind die meisten als wenig ambitioniert und eher<br />
bescheiden einzustufen. Nach Cancún kamen die bilateralen Verhandlungen über die<br />
gegenseitig vorgelegten Angebote fast zum Stillstand – die EU führte seit September<br />
2003 aufgrund der EU-internen Reflexion der Ergebnisse von Cancún keine bilateralen<br />
Gespräche mehr – und seither langten auch nur zwei weitere Angebote ein.<br />
Das Hauptgewicht der Verhandlungen im Sektor Umwelt liegt einerseits auf der Klärung<br />
des Verhältnisses multilateraler Umweltabkommen (MEAs) zu WTO-Vorschriften,<br />
andererseits auf verbessertem Informationsaustausch zwischen MEAs und WTO.<br />
Verhandlungsgegenstand ist ferner ein Abbau von Zollschranken und nicht-tarifären<br />
Handelshemmnissen für Umweltgüter und Umweltdienstleistungen. Ein besonderes<br />
Anliegen der EU ist auch die Umweltkennzeichnung von Waren.<br />
Für die Lösung der Frage, wie Entwicklungsländer ohne Produktionskapazitäten die im<br />
TRIPs-Übereinkommen vorgesehene Ausnahme der Zwangslizenz auch nutzen und<br />
damit verbesserten Zugang zu teuren, unter Patentschutz stehenden Medikamenten<br />
erhalten können, wurde mit einer Entscheidung des WTO-Rates im August 2003<br />
eine vorläufige Lösung gefunden, welche 2004 zu einer Anpassung des TRIPs-Übereinkommens<br />
führen soll und die auch von den WTO-Mitgliedern in ihren nationalen<br />
Rechtsordnungen umgesetzt werden sollte. Die EU leitete diesbezügliche Schritte<br />
bereits ein.<br />
2.3.2 Streitbeilegung<br />
Hinsichtlich der Überprüfung des Streitschlichtungsmechanismus, der als Herzstück<br />
des multilateralen Handelssystems gilt, wurde das Zieldatum für Verbesserungen und<br />
Klarstellungen durch den Allgemeinen WTO-Rat auf Mai 2004 verlängert. In dem für die<br />
EU bedeutenden Verfahren betreffend 30 % Schutzzölle der USA auf Stahleinfuhren<br />
erkannte das Schiedsgericht auf mangelnde WTO-Konformität der US-Maßnahmen.<br />
54
Internationale Wirtschafts<strong>politische</strong> Rahmenbedingungen<br />
In Entsprechung dieser Entscheidung hoben die USA ihre handelsschädigenden Zölle<br />
am 5. Dezember 2003 auf.<br />
Eine erwähnenswerte Entscheidung fiel im Dezember 2003 durch den Panelbericht in<br />
der Streitsache Indien–EU bezüglich unterschiedlicher Behandlung einzelner Entwicklungsländer<br />
im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems (Generalised System of<br />
Preferences – GSP). Daraus geht hervor, dass im Rahmen des GSP die Ungleichbehandlung<br />
unterschiedlicher Entwicklungsländer (ausgenommen eine Besserstellung<br />
der 49 ärmsten Entwicklungsländer) ebenso wie eine Verknüpfung von Marktöffnungszugeständnissen<br />
an bestimmte Auflagen nicht den Regeln der WTO entsprächen. Das<br />
würde bedeuten, dass die Sonderbehandlung nicht mit der gleichzeitigen Forderungen<br />
nach Einhaltung bestimmter Umwelt- und Sozialstandards verknüpft werden dürfte.<br />
Somit würde auf diesem Weg den Industrieländern die Möglichkeit der Durchsetzung<br />
solcher Standards genommen. Nachdem ebenfalls weitgehend Konsens darüber<br />
herrscht, dass sich sozial- und umwelt<strong>politische</strong> Standards auf multilateralem Weg<br />
aufgrund der starken Opposition der Entwicklungsländer wohl kaum durchsetzen lassen<br />
werden, dürfte sich damit der ohnehin bestehende, und oft mit Sorge beobachtete<br />
Trend zu bilateralen Handelsabkommen verstärken. Innerhalb solcher Abkommen<br />
wäre jedoch die Verhandlungsmacht der Industrieländer weitaus größer, was zu einer<br />
Verstärkung der Diskriminierung führen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob der erwähnte<br />
Panelbericht, gegen den die EU Berufung eingelegt hat, auch tatsächlich so streng<br />
interpretiert werden wird.<br />
Anmerkungen<br />
1 Die einzige noch offene Frage betrifft die Frist zur Vorlage der Übersetzungen, eine Einigung<br />
im März 2004 sollte vor diesem Hintergrund möglich sein. Bei Redaktionsschluss zu diesem<br />
Buch war noch kein Ergebnis bekannt.<br />
2 Der entsprechende Richtlinienvorschlag zielt insbesondere darauf ab, das System flexibler,<br />
klarer, anwendungsfreundlicher und einfacher zu gestalten und die bestehenden Regelungen<br />
zu konsolidieren. Dabei wird aber auch in bestehende Mechanismen eingegriffen. Der Vorsitz<br />
plant zu diesem Dossier eine <strong>politische</strong> Einigung im ersten Halbjahr 2004.<br />
3 Zypern war das einzige Land, wo es kein Referendum gab. Eine Einigung über die Wiedervereinigung<br />
der Insel, basierend auf dem UN-Plan, kam nicht zustande und ohne Wiedervereinigung<br />
der geteilten Insel bedarf es laut zypriotischer Verfassung keines Beitrittsreferendums.<br />
4 In Österreich wurde dem Beitrittsvertrag im Nationalrat am 3. Dezember 2003 (mit 2 symbolischen<br />
Gegenstimmen) mehrheitlich zugestimmt. Die Behandlung im Bundestag erfolgte<br />
am 18. Dezember 2003. Die Ratifikationsurkunde wurde am 23. Dezember 2003 in Rom<br />
hinterlegt.<br />
55
5 Mit Hinblick auf die beschränkte Popularität der geplanten FTAA wurden, insbesondere in<br />
vielen lateinamerikanischen Ländern, große Bemühungen unternommen, die Zivilgesellschaft<br />
in die Diskussion über das Abkommen einzubinden. Im Rahmen dieser Öffentlichkeitsarbeit<br />
wurde die dritte Arbeitsversion des FTAA-Textes auf der offiziellen Website des FTAA (www.<br />
ftaa-alca.org) zugänglich gemacht.<br />
6 Im Rahmen dieses Abkommens hat China quasi als Vorausleistung bereits heuer einige<br />
Agrarzölle für Importe aus den ASEAN-Ländern signifikant gesenkt und weiters den am<br />
wenigsten entwickelten Mitgliedern von ASEAN, Laos, Kambodscha, Myanmar und Vietnam,<br />
den Meistbegünstigungsstatus gewährt, noch bevor diese WTO-Mitglied geworden sind.<br />
7 Beim APEC-Gipfel in Bangkok 2003 signalisierten die USA ihre Bereitschaft, mit Thailand in<br />
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu treten und im Dezember kündigte Japan<br />
an, dass mit Malaysia, Thailand und den Philippinen Anfang 2004 bilaterale Verhandlungen<br />
über den Abschluss von Freihandelsabkommen aufgenommen werden sollen.<br />
8 Mainland-Macao (SAR) Closer Economic Partnership (CEPA); Mainland-Hong Kong (SAR)<br />
CEPA; beide Abkommen treten mit 1. Jänner 2004 in Kraft (vgl. Urban, 2003).<br />
9 Das Aufnahmeverfahren von Vanuatu wurde bereits 2001 abgeschlossen, der Beitritt erfolgte<br />
aber bis dato nicht.<br />
10 Bei Fortsetzung der Verhandlungen ist ein Kompromiss nicht ausgeschlossen. Das weitere<br />
Verfahren ist offen, da zunächst entschieden werden muss, in welchem Rahmen und auf<br />
welcher Basis die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Auch über die Behandlung<br />
der „Baumwollinitiative“, die von vier afrikanischen Ländern aufgebracht wurde und auf den<br />
gänzlichen Abbau aller handelsverzerrenden Stützungen in den Industrieländern (insbesondere<br />
den USA) im Baumwollsektor zielt, muss noch entschieden werden.<br />
11 Die EU zeigte bereits in Cancún diesbezüglich Flexibilität und bot an, auf die Themen Investitionen<br />
und Wettbewerb zu verzichten, konnte sich aber letztendlich nicht durchsetzen.<br />
56
3 ENTWICKLUNG DES WELTHANDELS<br />
Das Wachstum des Welthandelsvolumens von 4,5 % real im Jahr 2003 lag deutlich<br />
über jenem des globalen BIP von 2,5 %. Verantwortlich dafür waren die hohe Importnachfrage<br />
aus den USA (und in der Folge ein Rekorddefizit in deren Handelsbilanz)<br />
und die Exportsteigerungen aus Asien (insbesondere China) sowie aus den<br />
Transformationsländern. Westeuropa wies – abgesehen von aufwertungsbedingten<br />
nominellen Exportsteigerungen – so gut wie kein reales Exportwachstum auf. Für<br />
2004 erwartete die WTO im April 2004 eine Ausdehnung des Welthandelsvolumens<br />
um 7,5 %, ausgehend von einem globalen BIP-Wachstum von 3,7 %.<br />
In sektoraler Hinsicht war 2003 eine zunehmende Bedeutung des Handels mit<br />
chemischen Erzeugnissen, insbesondere Arzneiwaren, erkennbar, während der<br />
nach wie vor bedeutende IKT-Bereich stagnierte. Der Handel mit Dienstleistungen<br />
wuchs ebenfalls kräftig an, vor allem die unternehmensnahen Dienste wiesen sowohl<br />
niveau- als auch anteilsmäßig ein hohes Wachstum auf. Die ausländischen<br />
Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment – FDI) verblieben 2003 auf einem – im<br />
Vergleich zu den Rekordjahren 1999 und 2000 – ähnlich niedrigen Niveau, wobei<br />
sich der Rückgang an passiven Direktinvestitionsflüssen auf die Industrieländer<br />
– und hier wiederum auf die USA und Großbritannien – konzentrierte, während die<br />
Entwicklungsländer (wiederum China und Südostasien) weniger betroffen waren.<br />
Entgegen dem globalen Trend konnten die osteuropäischen Transformationsländer<br />
zusätzliche Direktinvestitionen anziehen.<br />
3.1 Der Welthandel in den Jahren 2002/03<br />
Im Jahr 2002 übertrafen die realen Zuwachsraten im Warenhandel wieder deutlich<br />
jene der globalen Produktion bzw. des weltweiten BIP zu konstanten Preisen (siehe<br />
Abbildung 3.1). 2001 war das reale BIP-Wachstum weltweit mit 1,5 % erstmals über<br />
jenem des Handelsvolumens, das mit –0,5 % sogar rückläufig war, gelegen. Im Jahr<br />
2002 wuchsen die Güterexporte dann wieder um 2,7 % real und 2003 dürften sie, nach<br />
vorläufigen Zahlen der WTO (vom April 2004), einen Zuwachs von 4,6 % gebracht haben<br />
(weltweites BIP: 1,8 % 2002 und 2,5 % 2003). Die vergangene Dekade ergab insgesamt<br />
eine weitaus größere Steigerung des Welthandelsvolumens (Durchschnitt 1995 – 2003:<br />
5,4 %) im Vergleich zum Wachstum des globalen BIP (1995 – 2003: 2,7 %).<br />
Bei der Betrachtung der in den Jahren 2001 und 2002 vergleichsweise geringen bzw.<br />
rückläufigen Wachstumsraten der globalen Handelsströme darf man nicht vergessen,<br />
dass in den 1990er-Jahren ein bisher unübertroffenes Wachstum nicht nur des Welthandels,<br />
sondern auch der <strong>internationale</strong>n Kapitalflüsse stattgefunden hatte. Somit<br />
kann ein Teil der Handelszuwächse auch auf eine gewisse Komplementarität (z.B.<br />
57
durch Produktionsverlagerungen ins Ausland, Fragmentierung der Produktionsprozesse)<br />
zwischen Exporten und FDI zurückgeführt werden. Das beeindruckende Wachstum<br />
der FDI-Flüsse wurde außerdem durch die zahlreichen Privatisierungsprogramme in<br />
vielen Regionen der Welt (Osteuropa, jedoch auch Lateinamerika und Afrika) sowie<br />
durch die Öffnung Chinas (die 2001 zum WTO-Beitritt führte) und durch die zunehmende<br />
regionale Integration der aufstrebenden, offenen asiatischen Volkswirtschaften<br />
stark angetrieben. Mit dem Ende der großen Privatisierungswellen wird mittel- bis<br />
langfristig mit allgemein niedrigen FDI-Zuwächsen gerechnet.<br />
Exporte, Produktion und globales BIP, reales Wachstum, 1995–2002 Abb. 3.1<br />
Reales Wachstum zum Vorjahr in %<br />
58<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
-3<br />
1995<br />
BIP<br />
1996<br />
Güterexporte<br />
Produktion<br />
1997<br />
1998<br />
Sachgüterexporte<br />
Sachgüterproduktion<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
Güterexporte= Agrargüter+Bergbauprodukte+Sachgüter, ebenso bei der Produktion.<br />
Die globale Produktion unterscheidet sich vom BIP, weil letzteres auch Dienstleistungen und die Bauwirtschaft beinhaltet.<br />
Quelle: WTO.<br />
2002<br />
Die Entwicklung der Waren- und Dienstleistungsströme macht deutlich, dass der<br />
Einbruch des Welthandels 2001 im Wesentlichen auf einen Rückgang beim Güterhandel<br />
zurückgeführt werden kann. Die Wachstumsraten des Gesamtvolumens der<br />
Güter und Dienstleistungen (2001: 0,1 %, 2002: 3,2 %, 2003: 2,9 %) lassen auf eine<br />
wesentlich ausgeglichenere Entwicklung bei den Dienstleistungen mit konstanterem<br />
und mäßigerem Wachstum schließen.<br />
Aufgrund der Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro, die sich mit Ende<br />
2003 und Anfang 2004 noch verstärkte, fiel das Wachstum der nominellen Warenhan-
Entwicklung des Welthandels<br />
delsströme wesentlich höher als erwartet aus. Der IWF wies nach einem nominellen<br />
Rückgang um 3,6 % (2001) für 2002 ein Wachstum von 4,6 % aus. 2003 dürfte einen<br />
Zuwachs von rd. 10 % (aufgrund der Daten für die ersten 3 Quartale) mit sich gebracht<br />
haben (siehe Tabelle 3.1). Das Wachstum der globalen Einfuhren belief sich auf ungefähr<br />
13 %. 1 Dies ist einerseits zum großen Teil auf die dynamische wirtschaftliche<br />
Entwicklung in Asien und den relativ früh einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung<br />
in den USA, andererseits auf die dadurch bedingte Erholung der Importnachfrage<br />
zurückzuführen. Die Trendwende fand unter schwierigen Rahmenbedingungen statt:<br />
Der globale Konjunkturaufschwung fiel relativ schwach aus, gleichzeitig war ein starker<br />
Rückgang der weltweiten Kapitalflüsse zu beobachten. Hinzu kamen beträchtliche<br />
Wechselkursschwankungen – der erwähnte Verfall des US-Dollars gegenüber dem<br />
Euro –, der Ausbruch der Lungenseuche SARS zu Beginn des Jahres 2003 und letztlich<br />
auch die weitverbreitete Angst vor Terroranschlägen (und dadurch Behinderungen der<br />
<strong>internationale</strong>n Transaktionen aufgrund von verstärkten Kontrollen und Auflagen).<br />
Entwicklung des Warenhandels, 2001–2003 Tab. 3.1<br />
Exporte<br />
nominelle Veränderung zum Vorjahr in %<br />
2001 2002 2003 1)<br />
Welt -3,6 4,6 9,8<br />
USA -5,3 -5,2 1,8<br />
EU 0,5 5,8 9,8<br />
Eurozone 2,0 6,1 10,4<br />
Japan -15,6 3,3 5,9<br />
China 7,0 22,1 39,1<br />
OECD -2,9 2,9 7,5<br />
Entwicklungsländer -4,9 7,8 13,7<br />
Importe<br />
Welt -3,2 4,0 12,9<br />
USA -4,7 1,9 6,5<br />
EU -1,7 3,3 17,1<br />
Eurozone -1,0 3,0 18,1<br />
Japan -8,0 -3,4 11,1<br />
China 8,2 21,3 17,6<br />
OECD -3,5 2,3 13,0<br />
Entwicklungsländer -2,7 7,4 12,7<br />
1) Schätzung, basierend auf den Zahlen für die ersten drei Quartale 2003.<br />
Quelle: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.<br />
Entsprechend dem langjährigen Trend lag 2003 das Wachstum in den Entwicklungsländern<br />
mit geschätzten 13,7 % Zuwachs bei den Exporten weit über dem der OECD-<br />
59
Länder von 7,5 %. Der Welthandel war 2003 besonders stark durch die Entwicklung in<br />
Asien beeinflusst: Einerseits ist hier die zunehmende regionale Integration zu nennen<br />
(siehe auch Kapitel 2.2.2), andererseits sind die hohen Zuwächse (sowohl in Asien als<br />
auch in den Entwicklungsländern) zum großen Teil durch den beeindruckenden Anstieg<br />
der chinesischen Exporte bedingt. Laut Angaben der WTO vom April 2004 betrug das<br />
nominelle Exportwachstum in etwa 35 % – die chinesischen Importe wuchsen demnach<br />
2003 um rund 40 %. Mit einem sich daraus ergebenden Anteil von beinahe 8 %<br />
an den weltweiten Warenexporten trug China stark zur globalen Dynamik bei. Starke<br />
Impulse für den Welthandel kamen auch aus Osteuropa. Die Transformationsländer<br />
waren neben Asien die Region mit den höchsten Zuwachsraten.<br />
Als weiterer wichtiger Stimulus für die rasche Erholung der Handelsströme kann die<br />
starke Importnachfrage der USA angeführt werden. Mit 6,5 % Import- gegenüber 1,8 %<br />
Exportwachstum zeigte 2003 die erstarkende US-amerikanische Inlandsnachfrage<br />
international ihre wachstumsfördernde Auswirkung. Die US-Exporte waren hingegen<br />
2001 und 2002 sogar rückläufig und nahmen erst 2003 wieder leicht zu.<br />
Trotz der mäßigen Konjunkturbelebung und der äußerst trägen Entwicklung der Inlandsnachfrage<br />
wies die EU-15 eine starke Belebung der Exporte auf, welche jedoch<br />
im Wesentlichen durch die Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar bedingt<br />
und daher auf TOT-Effekte zurückzuführen war: Das Wachstum lag 2002 bei 5,8 %,<br />
2003 dürfte der Zuwachs rd. 10 % betragen haben. Jedoch lag auch hier das Importwachstum<br />
mit 17,1 % über jenem der Exporte. Gemeinsam mit den Beitrittsländern<br />
kam die erweiterte EU-25 somit auf ein Wachstum der Exporte von 6,3 % (2002) und<br />
lag damit deutlich über dem globalen Durchschnitt. Die Importe lagen zwar 2002 mit<br />
3,3 % Wachstum noch weit darunter, 2003 dürfte allerdings eine deutliche Beschleunigung<br />
der Importnachfrage mit sich gebracht haben. 2<br />
Generell war das Wachstum der Welthandelsströme auf eine merkbare Erstarkung der<br />
Inlandsnachfrage (und damit der Importnachfrage) in den Industrieländern zurückzuführen,<br />
während die Exportentwicklung von den Entwicklungsländern (besonders China)<br />
getragen wurde. Im Jahr 2002 lag das Wachstum der Importnachfrage in den OECD-<br />
Ländern mit 2,3 % noch deutlich unter jenem der Entwicklungsländer von 7,4 %.<br />
3.2 Ausblick für 2004<br />
Für das Jahr 2004 erwartete die WTO im April 2004 eine kräftige reale Zunahme des<br />
Handelsvolumens um 7,5 %, ausgehend von einem realen BIP-Wachstum von weltweit<br />
3,7 %. Die Prognosen gelten vor dem Hintergrund merklich sinkender Ölpreise sowie<br />
eines leichten Anstiegs bei den Weltmarktpreisen für Sachgüter, welche bereits 2003 einen<br />
Anstieg aufgewiesen hatten. Ebenso stiegen 2003 die Preise für Agrarprodukte erstmals<br />
60
Entwicklung des Welthandels<br />
seit 1995 leicht an, was jedoch den säkularen Preisverfall für Agrarprodukte und sonstige<br />
Rohstoffe nicht wettmachen konnte. Daher ist weiterhin eine Verschlechterung der Terms<br />
of Trade für die meisten Entwicklungsländer zu erwarten, wodurch sich das Wachstumsdifferential<br />
gegenüber den Industrieländern verringern könnte. Entsprechend dem<br />
langjährigen Trend wird in den Entwicklungsländern ein höheres Wachstum erwartet.<br />
Weitere Risiken für den Warenhandel liegen einerseits im übermäßig hohen USamerikanischen<br />
Leistungsbilanzdefizit begründet, welches sicher nicht aufrecht zu<br />
erhalten sein wird und aufgrund geänderter Preisverhältnisse zu einem Rückgang der<br />
Importnachfrage und einem Anstieg der privaten Sparquote führen könnte. Andererseits<br />
bleibt abzuwarten, ob sich die westeuropäische Inlandsnachfrage den Erwartungen<br />
entsprechend erholen wird. Die starke Euro-Aufwertung zu Beginn des Jahres könnte<br />
sich gemeinsam mit gewissen Unsicherheiten für die Konsumenten (hervorgerufen<br />
durch die Reform der Pensions- und Sozialsysteme) dämpfend auswirken.<br />
3.3 Der Warenhandel<br />
Einige Merkmale der jüngeren Entwicklungen im Warenhandel erscheinen erwähnenswert:<br />
Erstens ist hier das hohe Handels- und Leistungsbilanzdefizit der USA zu nennen, das<br />
die rasche Erholung der globalen Handelsströme im Wesentlichen ermöglicht hatte.<br />
Durch die Kombination von fallenden Exporten und steigenden Importen wuchs 2002<br />
das Handelsbilanzdefizit auf 5 % des BIP. 3 Dieser Trend setzte sich 2003 verstärkt fort<br />
und führte zu einem weiteren Rekorddefizit. Die Hälfte dieses Defizits wurde gegenüber<br />
Asien angehäuft, wobei China allein für einen Großteil verantwortlich war. Diese Entwicklung<br />
ist langfristig sicher nicht aufrecht zu erhalten und der Verfall des US-Dollars<br />
ist eines der Anzeichen für diese Unvereinbarkeit. Jedoch wertete der US-Dollar hauptsächlich<br />
gegenüber dem Euro ab, während die wichtigsten asiatischen Währungen,<br />
allen voran der Yen, durch die aktive Geldpolitik der japanischen Notenbank, ihren<br />
Wert gegenüber dem US-Dollar beibehielten. Es erhebt sich daher die Frage, ob der<br />
Welthandel auf Dauer durch die US-Wirtschaft und ihre überdurchschnittlich große<br />
Importnachfrage gestützt werden kann, wie dies in der jüngeren Vergangenheit und<br />
vor allem während des jüngsten Wachstumseinbruchs geschah.<br />
Zweitens – und beinahe als Pendant zu den USA – war das Exportwachstum in<br />
China auch 2002 und vor allem 2003 überdurchschnittlich stark. Das Wachstum der<br />
chinesischen Handelsströme übertraf den globalen Durchschnitt in den 1990er-Jahren<br />
um beinahe das Dreifache. Während der Stagnation des Welthandels in den Jahren<br />
2001 und 2002 wuchsen die chinesischen Ex- und Importe immer noch um insgesamt<br />
30 %. Somit stieg China 2002 zur viertgrößten Handelsnation weltweit auf, nach der<br />
61
EU-15 (ohne Intra-Handel), den USA und Japan. Im Jahr 2003 wurde China sogar<br />
zum weltweit drittgrößten Importland mit einem Anteil von 6,9 %.<br />
Drittens kann eine strukturelle Veränderung der Handelsströme beobachtet werden.<br />
Vor allem der rege Handel von pharmazeutischen Produkten innerhalb der Industrieländer<br />
führte zu einem Anstieg des Anteils an chemischen Erzeugnissen im globalen<br />
Handel. Mit 10 % Exportwachstum übertraf diese Gütergruppe nicht nur die Automobilindustrie,<br />
sondern auch den Zuwachs bei Agrarprodukten. Ihr Anteil belief sich<br />
2002 auf 10,5 % an den gesamten Güterexporten. Der Handel mit Maschinen und<br />
Transportmitteln (einschließlich elektronischer Geräte) nahm jedoch mit 40,5 % immer<br />
noch den größten Platz ein.<br />
Viertens und letztens erscheint die stetige und rasch steigende Zahl an regionalen<br />
Handelsabkommen erwähnenswert. Mit Ende 2002 waren weltweit 176 regionale Handelsabkommen<br />
in Kraft, 259 waren bei der WTO angemeldet. Geschätzte 70 weitere<br />
Abkommen dürften in Kraft sein, ohne bei der WTO gemeldet zu sein und ebenso viele<br />
werden derzeit noch verhandelt. 4 Trotz dieser Entwicklung wuchs der Anteil der WTO-<br />
Mitglieder am Welthandel auf 95 % (2002). Im Allgemeinen konnte keine Ausdehnung<br />
der Anteile des intra-regionalen Handels in den einzelnen Regionalabkommen auf<br />
Kosten des globalen, multilateralen Handels beobachtet werden. Die Entwicklungen<br />
innerhalb der weltweit sechs bedeutendsten Regionalabkommen entsprachen ziemlich<br />
genau der globalen Entwicklung: Während der regionale Handel innerhalb der NAFTA,<br />
ANDEAN und dem Mercosur zurückging, wuchs der Binnenhandel in der EU, CEFTA<br />
und AFTA (ASEAN Free Trade Area) überdurchschnittlich stark.<br />
3.3.1 Regionale Entwicklungen<br />
In allen Regionen der Welt wurden 2002 im Vergleich zum Vorjahr wieder Zuwächse<br />
bei den Handelsströmen verzeichnet, wenn auch die Dynamik – wie bereits erwähnt<br />
– unterschiedlich stark ausfiel (siehe Tabellen 3.4 – 3.8 in den Statistischen Übersichten).<br />
Innerhalb der EU konnte zwar trotz schwacher Inlandsnachfrage ein relativ<br />
hohes nominelles Wachstum verzeichnet werden, dies ist jedoch vordringlich auf die<br />
Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen und schlug sich<br />
daher nicht in einem hohen Wachstum des Handelsvolumens nieder. Laut Angaben<br />
der WTO betrug das reale Wachstum 1 % exportseitig, während die Importe um 1 %<br />
real zurückgingen. Hingegen wuchsen die europäischen Dienstleistungsströme mit<br />
rd. 10 % im <strong>internationale</strong>n Vergleich äußerst kräftig. Besonders der Handel mit unternehmensnahen<br />
Dienstleistungen gewann an Bedeutung. Der Handel mit den Beitrittsländern<br />
stellte bereits 2002 die regionale Komponente mit der stärksten Dynamik dar.<br />
Der westeuropäische Handel mit den Transformationsländern wuchs im zweistelligen<br />
62
Entwicklung des Welthandels<br />
Bereich. Zur beinahen Verdoppelung des Überschusses in der Handelsbilanz der EU-<br />
15 trug hingegen der Handel mit Nordamerika und insbesondere mit den USA bei.<br />
Einem Wachstum der Exporte von 5 % stand hier ein Rückgang bei den Importen von<br />
6 % gegenüber. Obwohl die Exporte nach Asien mit 5 % etwas schneller wuchsen als<br />
die Importe, dehnte sich das bilaterale Handelsdefizit gegenüber dieser Region weiter<br />
aus. Die Entwicklungen gegenüber einzelnen asiatischen Handelspartnern verliefen<br />
stark unterschiedlich. Während der bilaterale Handel mit Japan im zweiten Jahr in<br />
der Folge zurückging, wuchs der Handel mit China mit zweistelligen Zuwachsraten.<br />
Damit wurde China zum drittgrößten Anbieter von Waren für die EU, hinter dem EU-<br />
Binnenmarkt selbst und den USA, jedoch noch vor Japan und der Schweiz. Trotz der<br />
ebenfalls stark gestiegenen EU-Exporte nach China, belief sich der Wert dieser Exporte<br />
2002 mit 32 Mrd. USD immer noch auf weniger als der Hälfte der Warenausfuhren in<br />
die Schweiz (66 Mrd. USD).<br />
Nicht nur für Europa, sondern für den Welthandel im Allgemeinen gewann China<br />
enorm an Bedeutung. Wie aus Tabelle 3.2 ersichtlich ist, rückte China 2002 sowohl<br />
export- als auch importseitig auf Platz vier der Weltrangliste vor, wenn man die EU als<br />
eine Handelsnation betrachtet. Dies ist nicht zuletzt auf die dynamische Wirtschaftsentwicklung,<br />
die dadurch bedingte starke chinesische Importnachfrage und das hohe<br />
Exportwachstum zurückzuführen. Die Wachstumsraten für 2003 lassen einen weiteren<br />
Anstieg der globalen Bedeutung Chinas erwarten.<br />
Die 10 wichtigsten Handelsnationen 2003<br />
(exklusive Intra-EU-Handel)<br />
Tab. 3.2<br />
Rang Exporteur Anteil Rang Importeur Anteil<br />
1 Extra-EU-Exporte 19,3 1 USA 21,9<br />
2 USA 12,7 2 Extra-EU-Importe 18,7<br />
3 Japan 8,3 3 China 6,9<br />
4 China 7,7 4 Japan 6,4<br />
5 Kanada 4,8 5 Kanada 4,1<br />
6 Hongkong 3,9 6 Hongkong 3,9<br />
inländ. Exporte 0,3 einbehaltene Importe 1) 0,4<br />
Re-Exporte 3,7 7 Mexiko 3,0<br />
7 Rep. Korea 3,4 8 Rep. Korea 3,0<br />
8 Mexiko 2,9 9 Singapur 2,1<br />
9 Taiwan 2,6 einbehaltene Importe 1) 1,1<br />
10 Singapur 2,5 10 Taiwan 2,1<br />
inländ. Exporte 1,4<br />
Re-Exporte 1,1<br />
1) Einbehaltene Importe bezeichnen Importe abzüglich Re-Exporte; relevant nur bei Honkong und Singapur.<br />
Quelle: WTO Presseaussendung, April 2004.<br />
63
Global gesehen zeichneten sich neben Asien (und hier insbesondere China) vor allem<br />
die EU-Beitrittsländer durch zweistellige Wachstumsraten – sowohl export- als auch<br />
importseitig – aus und blieben damit erneut (nach 2001) die Region mit dem höchsten<br />
Handelswachstum. Das Handelsvolumen Osteuropas (einschließlich der GUS-Staaten)<br />
entspricht in etwa jenem Südamerikas, steht jedoch im starken Gegensatz zur<br />
Entwicklung in Südamerika, wo nach dem Rückgang der Handelsströme im Jahre<br />
2001 eine Stagnation im Jahre 2002 folgte. Nicht nur die Handelsentwicklung, sondern<br />
auch die Entwicklung der FDI-Zuflüsse verlief in Osteuropa trotz des globalen<br />
Abwärtstrends positiv (siehe auch Abschnitt 3.5.2). Diese FDI-Zuflüsse gemeinsam<br />
mit dem nahen EU-Beitritt waren für die herausragende Handelsentwicklung dieser<br />
Region verantwortlich. Das reale Importwachstum aller Transformationsländer lag mit<br />
rd. 10 % über jenem der Exporte von 8 % und überstieg damit das reale BIP-Wachstum<br />
von rd. 4 % immer noch um gut das Doppelte. Die Exporte von Brennstoffen wuchsen<br />
besonders stark an, nachdem Russland, entgegen der rückläufigen Produktion in der<br />
OPEC, seine Ölförderung weiter vorantrieb. Ebenso fand 2002 ein starker Anstieg<br />
von Agrarexporten in die EU statt, wohin 40 % der osteuropäischen Agrarexporte<br />
flossen. Im Sachgüterbereich kam in Osteuropa den Exporten von Automobilteilen<br />
und Telekommunikationsgeräten eine große Bedeutung zu. Bei den Dienstleistungen<br />
verzeichneten die Exporte von Transportleistungen den größten Zuwachs. Die starke<br />
Konjunktur in der Region führte jedoch nicht zu einem Wachstum des intra-regionalen<br />
Handels. Während die Exporte nach Westeuropa und Asien 2002 mit zweistelligen<br />
Zuwachsraten auf 176 Mrd. USD bzw. 24,3 Mrd. USD anwuchsen, wuchs der intra-regionale<br />
Handel lediglich um 5 % auf 80 Mrd. USD an. Es ist außerdem bemerkenswert,<br />
dass der Außenhandel Tschechiens, Ungarns und Polens zusammengenommen den<br />
Handel Russlands, des weitaus größten Landes in der Region, überstieg.<br />
Der Schwerpunkt der nordamerikanischen Handelsbeziehungen richtete sich seit<br />
2000 auf die NAFTA, womit ein stetiger Verlust an Marktanteilen in Asien, Westeuropa<br />
und dem Nahen Osten einherging. Der Anteil der NAFTA an den nordamerikanischen<br />
Exporten betrug 2002 mehr als 50 %. Die Importe aus Asien, Westeuropa und Lateinamerika<br />
stiegen 2002 erneut an. Ein zeitlicher Vergleich der nordamerikanischen<br />
Importstruktur lässt erkennen, dass sowohl China als auch Mexiko zwischen 1995 und<br />
2002 bedeutende Marktanteile auf Kosten aller anderen Anbieter erringen konnten.<br />
Am stärksten gingen die Importe anteilsmäßig aus Hongkong, Japan, Singapur und<br />
Taiwan zurück.<br />
Lateinamerika verzeichnete 2002 die schlechteste Performance seiner Außenhandelsentwicklung<br />
seit der Schuldenkrise Anfang der 1980er-Jahre. Der Handel mit<br />
Gütern und Dienstleistungen war stark rückläufig, was auf die finanziellen Turbulenzen<br />
innerhalb des Mercosur, den erneuten Rückgang von Kapitalzuflüssen, die Unruhen in<br />
64
Entwicklung des Welthandels<br />
Venezuela und Kolumbien sowie die rückläufigen Touristenzahlen zurückzuführen war.<br />
Mehr als die Hälfte der lateinamerikanischen Einnahmen aus Dienstleistungsexporten<br />
kommen in der Regel aus dem Reiseverkehr, womit Lateinamerika die Region mit der<br />
weltweit größten Bedeutung des Reiseverkehrs ist. Der Rückgang der Handelsströme<br />
betraf den intra-regionalen Handel weitaus stärker als den extra-regionalen. Das<br />
Jahr 2003 verlief vor allem durch die Stabilisierung Argentiniens und Brasiliens und<br />
die dadurch hervorgerufenen Zuwächse im bilateralen Handel weitaus besser. Die<br />
bedeutendsten Handelspartner für die Region waren jedoch nach wie vor die USA<br />
(61 % Anteil 2002) und Westeuropa (12 %). Die Handelsbilanz der Region befand<br />
sich aufgrund der verringerten Kapitalzuflüsse und des unter anderem damit in Zusammenhang<br />
stehenden starken Nachfragerückgangs nach Importen 2002 erstmals<br />
im Überschuss, was auch 2003 anhielt.<br />
Das Handelsvolumen Asiens erholte sich rasch vom globalen Konjunktureinbruch<br />
2001, die Zuwächse beliefen sich 2002 bereits wieder auf rd. 10 % (und lagen damit<br />
um das Zweifache über dem globalen Durchschnittswert). Die nominellen Wachstumsraten<br />
blieben aufgrund des Rückgangs bei den Dollarpreisen für Importe und Exporte<br />
dieser Region deutlich darunter. In jedem Fall reichten die Zuwächse 2002 nicht aus,<br />
um den Rückgang des Handelsvolumens im Jahr zuvor wettzumachen (vor allem im<br />
Telekommunikationsbereich, bei Bekleidung, Textilien, Eisen und Stahlwaren und<br />
Bergbauprodukten). Das Wachstum des Handelsvolumens wurde vor allem durch den<br />
Aufschwung des intra-regionalen Handels getragen, dessen Anteil 2002 zwar beinahe<br />
die Hälfte des regionalen Handels betrug, damit jedoch noch immer unter dem Niveau<br />
von 1996 verblieb. Insgesamt verlief die Entwicklung in der Region stark unterschiedlich.<br />
Es ergab sich ein großer Kontrast zwischen den reichen, entwickelten Ländern, die<br />
eine sehr große Offenheit aufweisen, und den armen, bevölkerungsreichen Ländern<br />
wie Bangladesh, China, Indien, Indonesien, Myanmar und Pakistan. Interessant war<br />
auch die unterschiedliche Entwicklung zwischen den zwei größten Handelsnationen<br />
der Region: Trotz des Aufschwungs, der auch die japanische Außenwirtschaft erfasste,<br />
blieb das Exportwachstum Japans von rd. 6 % im Jahre 2003 weit hinter dem Chinas<br />
von beinahe 40 % zurück.<br />
Im Zusammenhang mit Asien ist auch die auffallend starke Ausdehnung im Süd-<br />
Süd-Handel zu erwähnen. In der vergangenen Dekade stieg der Anteil des Handels<br />
zwischen Entwicklungsländern am Welthandel von 6,5 % (1990) auf 10,6 % (2001).<br />
Dies kam vor allem durch die erweiterte und vertiefte Integration in Asien zustande,<br />
wo sich rd. zwei Drittel des Süd-Süd-Handels abspielen. Die Rolle von Handelsliberalisierungen<br />
für diese Entwicklung zeigt sich auch anhand der sektoralen Zusammensetzung<br />
des Süd-Süd-Handels: Die Verdoppelung des weltweiten Anteils wurde<br />
hauptsächlich durch das Wachstum im Sachgüterbereich, und hier vor allem bei den<br />
65
Elektronik- und Telekommunikationsgeräten erreicht, während die hohen Zollbarrieren<br />
im Agrarbereich, aber auch bei Textilien und Fahrzeugen, eine weitere Ausdehnung<br />
des Handels zwischen Entwicklungsländern behinderten.<br />
3.3.2 Sektorale Gliederung<br />
Im Jahr 2002 verzeichneten der Handel von chemischen Erzeugnissen und die Automobilzulieferindustrie<br />
das größte Wachstum innerhalb des Warenhandels. Die Weltexporte<br />
an Chemiewaren wuchsen um 10 % und beliefen sich auf 660 Mrd. USD, was einem<br />
Anteil von rd. 10 % an den Warenexporten gleichkam. Die drei wichtigsten Importeure<br />
für chemische Erzeugnisse (EU, USA und China) verzeichneten 2002 allesamt eine<br />
Rekordnachfrage. Das hohe Wachstum in dieser Kategorie kann hauptsächlich auf<br />
die Expansion des Handels mit pharmazeutischen Produkten zurückgeführt werden.<br />
Hohe Verkaufszahlen in den Industrieländern, die Verbreitung von <strong>internationale</strong>n<br />
Produktionsnetzwerken und steigende Re-Importe lagen diesem Trend zugrunde.<br />
Bemerkenswert war 2002 das US-amerikanische Handelsbilanzdefizit in dieser Kategorie,<br />
das erste seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.<br />
Der Handel von Automobilien und Zulieferteilen belief sich mit rd. 630 Mrd. USD ebenfalls<br />
auf ca. 10 % des Warenhandels. Auch hier waren 2002 überdurchschnittlich große<br />
Wachstumsraten zu verzeichnen, vor allem was die Exporte aus West- und Osteuropa<br />
und Asien anbelangte. Die zunehmende Handelsliberalisierung gemeinsam mit rasch<br />
steigenden FDI-Zuflüssen nach China und einer kräftigen Inlandsnachfrage führten<br />
2002 zu einem Importboom an Automobilprodukten nach China. Trotz dieses Anstiegs<br />
um 42 % verblieb der Anteil Chinas an den weltweiten Automobilimporten bei rd. 1 %.<br />
Weltweit werden die Handelsströme in dieser Produktkategorie nach wie vor durch<br />
die Nachfrage aus der EU und den USA bestimmt, welche zusammen mehr als zwei<br />
Drittel der gesamten Importe erhalten.<br />
Inwieweit die zwischen März 2002 und Dezember 2003 eingehobenen US-amerikanischen<br />
Importzölle auf Stahlprodukte die beobachtete Preissteigerung in dieser Produktgruppe<br />
ausgelöst und zu einer Regionalisierung der Stahlimporte geführt hatten,<br />
kann nicht exakt abgeschätzt werden. Beide Trends waren jedenfalls neben einer<br />
moderaten Erholung des Handels mit Eisen und Stahl gegenüber dem Kontraktionsjahr<br />
2001 deutlich zu beobachten. Somit nützte die gestiegene Importnachfrage aus der<br />
EU hauptsächlich den Anbietern in Westeuropa und in den Transformationsländern,<br />
während NAFTA-Partner und lateinamerikanische Stahlexporteure Marktanteile in den<br />
USA gewannen. Bemerkenswert ist auch hier wieder das Wachstum der chinesischen<br />
Importnachfrage (um 27 %). Im Jahr 2002 fragte China allein 9 % der weltweiten Stahlimporte<br />
nach und übertraf somit das Niveau der EU-Importe aus Drittländern.<br />
66
Entwicklung des Welthandels<br />
Die Wachstumsrate des Handels mit Textilien und Bekleidung lag mit rd. 4 % in etwa<br />
bei jener des Warenhandels insgesamt. Innerhalb der drei größten Importeure von<br />
Bekleidungsartikeln (EU, USA und Japan, welche gemeinsam mehr als vier Fünftel<br />
der globalen Importe erhielten) gab es stark unterschiedliche Entwicklungen: Die<br />
Nachfrage aus den USA stagnierte 2002, die aus Japan ging zurück, die EU hingegen<br />
fragte vermehrt Bekleidungswaren nach. Die bilateralen Exporte der für die EU<br />
bedeutendsten Anbieter (China, Türkei und Rumänien) wuchsen 2002 zwischen 15 %<br />
und 22 %. Trotz eines Anstiegs des tunesischen Importanteils in der EU ging der Anteil<br />
Afrikas an den EU-Importen insgesamt zurück. Die EU stellt den größten Exportmarkt<br />
für afrikanische Textilien und Bekleidung dar. Mit Ende des Multilateralen Abkommens<br />
über Textilien und Bekleidung in der WTO und der Abschaffung aller Importquoten<br />
am 1. Jänner 2005 dürften sich einschneidende Verschiebungen in der regionalen<br />
Exportstruktur für Textilien ergeben, welche vor allem China, Indien und Bangladesh<br />
begünstigen werden.<br />
Nach wie vor entwickelten sich die Handelsströme im Bereich der Elektronik- und Telekommunikationsausrüstungen<br />
mäßig. Das Wachstum in dieser Kategorie, welche in<br />
den 1990er-Jahren die dynamischste Entwicklung von allen Produktgruppen aufwies,<br />
stagnierte 2002 auf einem Niveau von rd. 840 Mrd. USD (was immer noch einem Anteil<br />
von gut 13 % gleichkam). Die drei größten Exporteure in dieser Kategorie (EU, USA<br />
und Japan) verzeichneten allesamt einen Rückgang ihrer Exporte. Hingegen wiesen die<br />
dynamischen asiatischen Volkswirtschaften eine kräftige Erholung der Exporte auf, vor<br />
allem der intra-regionale Handel mit Elektronik- und Telekommunikationsausrüstungen<br />
wuchs stark an (um beinahe 20 %). Ebenso wiesen die Beitrittsländer Ungarn, Tschechien<br />
und Polen als wichtige Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten<br />
für Westeuropa zweistellige Zuwachsraten bei den Exporten auf.<br />
3.3.3 Entwicklung der Welthandelspreise<br />
Wie bereits erwähnt, war das relativ hohe nominelle Wachstum des Welthandels u.a.<br />
durch die kontinuierliche Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar und die<br />
kräftige Ausdehnung der Exporte aus der Eurozone getragen (siehe Abbildung 3.2).<br />
Diese Dollarschwäche zeigte sich jedoch hauptsächlich gegenüber den wichtigsten<br />
europäischen Währungen, während die meisten asiatischen Währungen, so auch<br />
der japanische Yen, der Aufwertung mit Hilfe wiederholter Interventionen auf den<br />
Währungsmärkten und durch die Anhäufung großer ausländischer Währungsreserven<br />
entgehen konnten. Dies galt gleichermaßen für den chinesischen Yuan, was teilweise<br />
das rekordverdächtige Exportwachstum der chinesischen Exporte 2002 und 2003<br />
erklärt.<br />
67
Entwicklung der wichtigsten Wechselkurse zum Euro Abb. 3.2<br />
(jeweilige Währungseinheit pro Euro)<br />
68<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
01/99<br />
Quelle: OeNB.<br />
USD<br />
01/00<br />
100 Yen<br />
01/01<br />
Somit konnte der Verfall des US-Dollars, welcher neben einer verringerten Attraktivität<br />
der USA für ausländische Investoren auch die langfristige Unvereinbarkeit eines<br />
Rekorddefizits in der Handelsbilanz widerspiegelt, eine seiner Ursachen, nämlich das<br />
große Handelsbilanzdefizit mit Asien, nicht bekämpfen. Die UNCTAD erwähnte diesbezüglich<br />
in ihrem Entwicklungsbericht für das Jahr 2003 sogar Ähnlichkeiten zwischen<br />
der gegenwärtigen Entwicklung der Wechselkurse und den kompetitiven Abwertungen<br />
im Vorfeld der Welt<strong>wirtschafts</strong>krise in den 1930er-Jahren. Dem stehen selbstverständlich<br />
wesentlich veränderte Rahmenbedingungen, sowohl in geld<strong>politische</strong>r als auch<br />
in handels<strong>politische</strong>r Hinsicht, gegenüber. Die Wechselkursschwankungen führten<br />
jedoch allgemein zu einer hohen Volatilität auf den Devisenmärkten, worunter wiederum<br />
besonders die weniger entwickelten und ärmeren Länder zu leiden haben.<br />
Ein Blick auf Abbildung 3.3 zeigt eine Fortsetzung des langjährigen Verfalls der Welthandelspreise<br />
im Primär- und Sekundärsektor. Die Senkung der Preise für Industrieprodukte<br />
fiel dabei verhältnismäßig weniger stark aus als der Rückgang der Preise für<br />
Agrar- und die meisten anderen Primärgüter. Somit verschlechterte sich neuerlich die<br />
Lage für viele Entwicklungsländer, welche zum großen Teil von Primärgüterexporten<br />
GBP<br />
01/02<br />
SFR<br />
01/03<br />
01/04
Entwicklung des Welthandels<br />
abhängen und daher den Preisschwankungen ungeschützt ausgesetzt sind. Besonders<br />
auffallend ist der negative Trend bei den Preisen für Minerale und Nicht-Eisenmetalle,<br />
welcher sich aus der allgemeinen Konjunkturschwäche und damit einhergehenden<br />
Produktionsrückgängen in der Industrie erklärt. China spielt hier wiederum eine große<br />
Rolle als aufsteigender Markt für viele Minerale und Metalle. Die stark wachsende<br />
Nachfrage, welche sich aus der raschen Industrialisierung Chinas ergibt, könnte die<br />
Weltmarktpreise mittel- und langfristig wieder steigen lassen.<br />
Die einzige Ausnahme zu diesem Trend fallender Weltmarktpreise stellen die Preissteigerungen<br />
im Energiebereich dar, die hauptsächlich auf den Anstieg des Ölpreises<br />
– aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und der konsequenten Einhaltung der<br />
Förderquoten innerhalb der OPEC – zurückzuführen waren. Mit knapp 34 USD pro<br />
Barrel Rohöl war der Ölpreis im März 2004 wiederum auf demselben hohen Niveau<br />
wie ein Jahr zuvor, trotz eines zwischenzeitlichen Rückgangs nach Ende des Irak-<br />
Kriegs auf unter 24 USD. Dennoch wird für 2004 wieder ein Nachlassen der Ölpreise<br />
mit entsprechenden Auswirkungen auf den Welthandel erwartet.<br />
Entwicklung der wichtigsten Weltmarktpreise Abb. 3.3<br />
(1995=100)<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Quelle: OeNB.<br />
1995<br />
Primärgüter<br />
Minerale und NE-Metalle<br />
1996<br />
1997<br />
Nahrungsmittel<br />
1998<br />
Energie<br />
Industrieprodukte<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
69
3.4 Der globale Dienstleistungshandel<br />
Wie aus Tabelle 3.3 ersichtlich ist, wies der globale Handel mit Dienstleistungen seit<br />
1995 kontinuierliche Zuwächse auf. Im Jahr 2001, dem Krisenjahr für den Warenhandel,<br />
stagnierten zwar die Dienstleistungsexporte, doch ergab sich für die anteilsmäßig<br />
wichtigste Kategorie der unternehmensnahen Dienstleistungen ein nominelles Wachstum<br />
von 2 %. Die Entwicklung in den einzelnen Positionen präsentierte sich ziemlich<br />
unterschiedlich. Dem Wachstum bei den unternehmensnahen Diensten stand 2001<br />
ein Rückgang der Exporte sowohl im Reiseverkehr als auch bei den Transportleistungen<br />
(um 2 % bzw. 1 %) gegenüber. Dieser Trend setzte sich 2002 fort und ergab<br />
eine kräftige Ausdehnung der unternehmensnahen Dienste um 9 %, während die<br />
beiden anderen Kategorien mit 4 % immer noch gleich schnell wie der Warenhandel<br />
wuchsen. Insgesamt schien der Handel mit Dienstleistungen geringeren nominellen<br />
Schwankungen ausgesetzt gewesen zu sein, als der Güterhandel. Das Verhältnis des<br />
Niveaus der Warenausfuhren zu jenem der Dienstleistungsexporte lag auch in den<br />
vergangenen zwei Jahr relativ konstant bei ungefähr vier zu eins. 5<br />
Sektorale Gliederung des Welthandels Tab. 3.3<br />
70<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
1995–2000 2001 2002<br />
Warenexporte 5 -4 4<br />
Landwirtschaft -1 0 5<br />
Bergbau 10 -9 -1<br />
Sachgüterproduktion 5 -4 4<br />
Dienstleistungsexporte 4 0 6<br />
Transportleistungen 3 -1 4<br />
Reiseverkehr 3 -2 4<br />
Andere 2 2 9<br />
Quelle: WTO International Trade Statistics 2003.<br />
Betrachtet man den Gesamthandel mit Dienstleistungen, wie sie in der Zahlungsbilanz<br />
erfasst werden, so lassen sich im Vergleich zum Warenhandel zwar Gemeinsamkeiten<br />
hinsichtlich der globalen Bedeutung der wichtigsten Handelsnationen feststellen, die<br />
Salden der Dienstleistungsbilanz verhalten sich jedoch häufig konträr zum Saldo der<br />
jeweiligen nationalen Handelsbilanz (siehe dazu Tabellen 3.9 – 3.11 in den Statistischen<br />
Übersichten). So weist der Dienstleistungshandel eine viel höhere Konzentration auf<br />
die OECD-Länder, und hier wiederum auf die Triade EU–USA–Japan, auf als der Warenhandel:<br />
Die USA waren z.B. mit beinahe einem Fünftel aller Exporte 2002 die mit
Entwicklung des Welthandels<br />
Abstand wichtigsten Dienstleistungsexporteure. Beim Güterhandel lag ihr Anteil 2002<br />
bei rd. 10 % der Weltexporte. Zudem wies die US-amerikanische Dienstleistungsbilanz<br />
2002 mit über 60 Mrd. USD – trotz eines rückläufigen Trends in den letzten Jahren<br />
– einen sehenswerten Überschuss auf. Mit einem Anteil an den globalen Exporten von<br />
ca. 5 % war Japan 2002 der fünftgrößte Exporteur hinter den USA, Großbritannien,<br />
Deutschland und Frankreich. Während Japan und Deutschland ein Defizit aufwiesen,<br />
exportierten alle übrigen wichtigen Handelsnationen (Großbritannien, Frankreich,<br />
Spanien, und bis vor kurzem auch Italien) mehr Dienstleistungen als sie nachfragten.<br />
Die Dienstleistungsströme aus der EU wiesen vor allem in jüngerer Zeit hohe Wachstumsraten<br />
auf. Einige wenige europäische Länder – neben Deutschland auch Irland<br />
und seit 2001 zusätzlich Italien und die Niederlande – wiesen 2002 ein Defizit auf.<br />
Ebenso importierte China mehr Dienstleistungen, als es exportierte. Das Defizit belief<br />
sich 2002 mit 6,9 Mrd. USD auf rd. 17 % der Exporte. Der chinesische Anteil von 2,2 %<br />
an den Weltexporten 2001 entsprach ziemlich genau dem Niveau der österreichischen<br />
Dienstleistungsexporte von 33,3 Mrd. USD. Im Jahr darauf stiegen die Exporteinnahmen<br />
Chinas jedoch auf über 39 Mrd. USD an, während die österreichischen Exporte<br />
„nur“ auf 35,2 Mrd. USD wuchsen. Österreich konnte in der Vergangenheit immer einen<br />
Überschuss bei den Dienstleistungen erwirtschaften, jedoch war der langjährige Trend<br />
stark fallend. Der österreichische Anteil an den globalen Dienstleistungsexporten war<br />
ebenfalls leicht rückläufig und belief sich 2001 auf 2,2 % (1996: 2,6 %).<br />
Mit 47 % Anteil an den weltweiten Dienstleistungsexporten und steigender Tendenz<br />
stellten die unternehmensnahen Dienstleistungen (Finanzierung, Versicherung, Lizenzen<br />
und Patente, EDV- und Kommunikationsleistungen, etc.) die weitaus bedeutendste<br />
Kategorie dar. Die wichtigsten Exporteure in dieser Kategorie waren die USA, Großbritannien,<br />
Deutschland, Japan und Frankreich. Österreich nahm in dieser wichtigen<br />
Position den 14. Rang bei den Exporten weltweit ein, sein Anteil von 3 % (1995)<br />
verringerte sich jedoch entsprechend dem Trend im österreichischen Gesamthandel<br />
auf zuletzt 2,4 % (2002). Der globale Handel mit Transport- und Tourismusleistungen<br />
ging seit 1995 anteilsmäßig leicht zurück. So betrugen 2002 die jeweiligen Anteile<br />
22,3 % (Transportleistungen) und 30,6 % (Reiseverkehr). Die wichtigsten Exporteure<br />
im Reiseverkehr waren erneut die USA, diesmal gefolgt von Spanien, Frankreich, Italien<br />
und Großbritannien. Die Rolle Österreichs in dieser Kategorie war etwas größer und<br />
entsprach Rang acht der Exporteure weltweit, auch hier war die Tendenz fallend.<br />
71
3.5 Ausländische Direktinvestitionen<br />
Das Jahr 2002 brachte zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang der weltweiten<br />
grenzüberschreitenden Direktinvestitionen mit sich. Nach den Rekordzuflüssen in den<br />
Jahren 1999 und 2000 von über einer Bill. US-Dollar pro Jahr gingen die weltweiten<br />
FDI-Zuflüsse auf 824 Mrd. USD (2001) und 651 Mrd. USD (2002) zurück, was dem<br />
Niveau von 1998 entsprach. Nach ersten Schätzungen der UNCTAD stagnierten die<br />
Zuflüsse 2003 bei etwa 656 Mrd. USD, erst 2004 dürfte es, entsprechend der Konjunkturerholung<br />
und des wieder gestiegenen Investorenvertrauens, ein moderates<br />
Wachstum geben. Der Rückgang der <strong>internationale</strong>n Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen<br />
auf die globale Konjunkturschwäche zurückzuführen. Allerdings spielten eine<br />
Reihe weiterer Faktoren eine wichtige Rolle: Niedrigere Firmenbewertungen an den<br />
<strong>internationale</strong>n Börsen und gesunkene Renditen, das Ende der Strukturreformen in<br />
einigen Industrien (vor allem in den Transformationsländern) und das Ende der großen<br />
Privatisierungswellen in den fortgeschrittenen Transformationsländern trugen allesamt<br />
zum globalen Einbruch der Kapitalflüsse bei. Der Rückgang wurde zum Großteil durch<br />
die rückläufige Entwicklung bei den grenzüberschreitenden Firmenübernahmen und<br />
-zusammenschlüssen verursacht: Deren Zahl sank von 7.894 (2000) auf 4.493 (2002).<br />
Nicht nur die Anzahl, auch das durchschnittliche Volumen der Transaktionen verringerte<br />
sich beträchtlich – von 145 Mio. auf 82 Mio. USD; dementsprechend weniger waren<br />
auch Übernahmen mit einem Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. USD.<br />
3.5.1 Globale Entwicklungen<br />
Der Einbruch bei den passiven FDI fand vor allem in den Industrieländern statt, hier<br />
betrug der Wert der Neuzuflüsse 2002 nur mehr 40 % des Niveaus im Jahre 2000. In<br />
den Entwicklungsländern verringerten sich die Zuflüsse auf zwei Drittel des Wertes<br />
von 2000. Dementsprechend stieg der Anteil der Entwicklungsländer von 18 % auf<br />
25 % an den weltweiten passiven FDI-Flüssen. Nach wie vor konzentrieren sich jedoch<br />
sowohl die passiven als auch noch stärker die aktiven FDI-Flüsse in den OECD-<br />
Ländern. Gemessen am Verhältnis der FDI-Bestände zum BIP ergibt sich hingegen,<br />
wie in der Vergangenheit, in den Entwicklungsländern – und hier insbesondere in<br />
Süd- und Südostasien – eine weitaus höhere Bedeutung der FDI für die einzelnen<br />
Volkswirtschaften (siehe Tabelle 3.12 in den Statistischen Übersichten). Die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung der FDI-Bestände für die osteuropäischen Transformationsländer<br />
verzeichnete in der vergangenen Dekade ebenfalls einen steilen Aufwärtstrend,<br />
erreichte allerdings noch nicht das westeuropäische Niveau. Für Westeuropa (und<br />
insbesondere die EU-15) zeichnet sich seit 1998 eine überdurchschnittliche Zunahme<br />
72
Entwicklung des Welthandels<br />
der wirtschaftlichen Bedeutung der passiven FDI-Flüsse ab: 2002 betrugen diese 22 %<br />
der Bruttoinvestitionen.<br />
Der spektakuläre Einbruch bei den passiven Direktinvestitionen in den Industrieländern<br />
fand hauptsächlich in den USA und in Großbritannien statt (siehe Tabellen<br />
3.13 und 3.14 in den Statistischen Übersichten). In beiden Ländern war großteils der<br />
drastische Rückgang an grenzüberschreitenden Firmenübernahmen und -zusammenschlüssen<br />
dafür verantwortlich; in den USA spielten auch die außergewöhnlich hohen<br />
Rückzahlungen von firmen-internen Krediten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus<br />
eine Rolle. Diese beiden Länder waren gemeinsam für die Hälfte des Rückgangs in<br />
den 16 OECD-Ländern mit rückläufigen FDI-Zuflüssen verantwortlich. Einige wenige<br />
OECD-Mitglieder, darunter Australien, Deutschland, Finnland und Japan, verzeichneten<br />
hingegen 2002 leichte Zuwächse.<br />
Die aktiven Direktinvestitionen der Industrieländer lagen 2002 ebenfalls auf beinahe<br />
der Hälfte des Niveaus vom Jahr 2000. Ebenso gingen die aktiven FDI der Entwicklungsländer<br />
auf rd. 55 % des Wertes im Jahr 2000 zurück. Somit blieben die Anteile<br />
der jeweiligen Ländergruppen konstant. Die zentral- und osteuropäischen Länder<br />
hingegen konnten ihren Anteil an den weltweiten aktiven Direktinvestitionsflüssen von<br />
0,5 % im Jahre 2001 auf 1 % steigern.<br />
3.5.2 Entwicklung in Osteuropa<br />
Die osteuropäischen Transformationsländer konnten als einzige Region 2002 einen<br />
Zuwachs bei den passiven FDI-Flüssen (um beinahe 10 % gegenüber 2000) verbuchen<br />
und steigerten damit ihren weltweiten Anteil auf rd. 4 %. Den Rekordzuflüssen im Jahr<br />
2002 dürften 2003 etwas geringere Zuflüsse von 26 Mrd. USD gefolgt sein. Rückläufig<br />
waren vor allem die mit Privatisierungen in Zusammenhang stehenden FDI-Flüsse, weil<br />
einerseits die Zahl der noch zu privatisierenden Unternehmen zunehmend geringer<br />
wurde und andererseits die Nachfrage durch ausländische Investoren nachließ. Obwohl<br />
die MOEL nach wie vor einen Vorteil bei den Lohnkosten besitzen, verringern sich<br />
diese komparativen Vorteile vor allem in den Beitrittsländern aufgrund der Wechselkursentwicklung<br />
und aufgrund der Übernahme des „acquis communautaire” zunehmend.<br />
Der jüngste Rückgang an passiven FDI-Flüssen nach Osteuropa betraf daher nur die<br />
fünf Beitrittsländer Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, während<br />
im Baltikum, am Balkan oder in Russland und den GUS-Staaten kein Rückgang zu<br />
beobachten war. Dies spricht allerdings auch für den höheren Entwicklungsstand der<br />
fünf erstgenannten Länder: Einerseits ist der Privatisierungsprozess dort schon sehr<br />
weit fortgeschritten, andererseits zeigt sich bereits ein höheres Ausmaß an Integration<br />
und daher auch Synchronisierung mit den westlichen Industrieländern. Dafür spricht<br />
73
auch das Wachstum der aktiven FDI-Flüsse aus den fünf zentraleuropäischen Ländern<br />
und die damit einhergehende Veränderung der Nettoinvestitionsposition. Bereits<br />
in den ersten drei Quartalen 2003 beliefen sich die aktiven FDI-Flüsse der MOEL-5<br />
auf weit über 1 Mrd. USD und übertrafen den Ganzjahreswert für 2002 von 840 Mio.<br />
USD. Ein Teil dieser beeindruckenden Entwicklung ist auf die Abwertung des Dollars<br />
zurückzuführen; in Euro fiel die Steigerung etwas geringer aus, doch wurde die Milliardengrenze<br />
ebenfalls überschritten. Innerhalb Osteuropas konnte ein Abwandern<br />
der passiven FDI-Flüsse weiter nach Osten (Bulgarien und Rumänien) bzw. in jene<br />
Länder, die bisher wenig FDI erhielten (Kroatien, Serbien-Montenegro), beobachtet<br />
werden. Z.B. investierten zwei große ungarische Firmen (die Ölfirma MOL und die<br />
OTP Sparkasse) jeweils in Kroatien und in Bulgarien. Für 2004 wird innerhalb der<br />
MOEL ein geringes Anwachsen der FDI-Flüsse erwartet. Das Beitrittsjahr dürfte keine<br />
zusätzlichen Investitionsimpulse in den neuen Mitgliedsländern bringen. Der relative<br />
Kostenvorteil dürfte sich mittelfristig halten und daher ein Stimulus für Investitionen<br />
bleiben, allerdings wird das relativ hohe Ausbildungsniveau eine zunehmende Rolle<br />
für Investitionsentscheidungen spielen, was höherwertige und technologieintensivere<br />
Investitionen anlocken wird. Ebenso wird erwartet, dass vor allem asiatische Investoren<br />
zunehmend die MOEL als Plattform für die Erschließung des EU-Binnenmarktes<br />
verwenden werden.<br />
3.5.3 Entwicklung in Asien<br />
Asien verzeichnete 2002 einen Rückgang an Direktinvestitionen, die Entwicklung<br />
innerhalb der Region jedoch verlief stark unterschiedlich: Die passiven FDI-Flüsse<br />
sanken im Vergleich zum Vorjahr in 31 der 57 Länder, in einigen Ländern, wie z.B.<br />
China, Malaysia und die Philippinen, stiegen sie an. Innerhalb Asiens war ein hohes<br />
Ausmaß an intra-regionalen FDI-Flüssen zu beobachten, das die Ausdehnung von<br />
regionalen Produktionsnetzwerken und die zunehmende regionale Integration in Asien<br />
widerspiegelte. Sektoral war der Rückgang von Direktinvestitionen aufgrund der<br />
globalen Nachfrageschwäche und der Rationalisierung der Produktionsprozesse vor<br />
allem in der Elektronikindustrie zu spüren.<br />
3.5.4 Institutionelle Veränderungen<br />
Die optimistischen Erwartungen hinsichtlich der FDI für 2004 stützen sich auf eine Reihe<br />
institutioneller Veränderungen, die angesichts der geringen Kapitalzuflüsse in den<br />
letzten Jahren stattfanden. Eine Reihe von Ländern setzte entsprechende regulative<br />
Schritte zur Beschleunigung der Liberalisierung ihrer Kapitalmärkte. 2002 wurden 236<br />
74
Entwicklung des Welthandels<br />
FDI-fördernde Regulierungsmaßnahmen in 70 Ländern gesetzt. Asien erwies sich als<br />
die sich am schnellsten öffnende Empfängerregion. Nicht erst angesichts des globalen<br />
Rückgangs der FDI, sondern als Teil eines längerfristigen Trends schlossen immer<br />
mehr Länder bilaterale Investitionsabkommen sowie gegenseitige Doppelbesteuerungsabkommen<br />
ab. 2002 gab es 82 zusätzliche Investitionsabkommen zwischen 76 Ländern<br />
und 68 neue Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 64 Ländern. Weiters<br />
stieg, wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, die Zahl regionaler Handelsabkommen, die<br />
vermehrt eigene Investitionskapitel beinhalten. Die meisten dieser Abkommen wurden<br />
zwischen der EU und einer Reihe weniger entwickelter Länder, vor allem in Osteuropa<br />
und im Mittelmeerraum, geschlossen. Für die Beitrittsländer in Osteuropa wird es eine<br />
große Herausforderung sein, ihre FDI-Regime den EU-Richtlinien anzupassen und<br />
gleichzeitig die Rückflüsse aus EU-Mitteln im Rahmen der Regionalentwicklungsfonds<br />
und anderer Instrumente zu maximieren.<br />
Anmerkungen<br />
1 Laut Angaben der WTO vom April 2004 wuchsen die Weltgüterexporte und -importe 2003 in<br />
US-Dollar um je 16 %.<br />
2 Nominell fiel die Nachfragesteigerung aufgrund der Euro-Aufwertung wesentlich stärker aus,<br />
als real aufgrund des Konjunkturaufschwungs.<br />
3 Das amerikanische Leistungsbilanzdefizit fiel etwas geringer aus, wuchs jedoch ebenfalls<br />
von 4,6 % des BIP 2002 auf rd. 5 % 2003.<br />
4 Im März 2004 gab es nur vier WTO-Mitglieder – Hongkong, Macao, Mongolei, und Taiwan –,<br />
die an keinem regionalen Freihandelsabkommen beteiligt waren. Mit Ausnahme der Mongolei<br />
verhandelten zu diesem Zeitpunkt bereits alle übrigen drei um die Aufnahme in regionale<br />
Präferenzabkommen.<br />
5 Es sei in diesem Zusammenhang auf die Problematik der Abgrenzung und der statistischen<br />
Erfassung des Dienstleistungshandels hingewiesen. Siehe dazu auch Kapitel 14.<br />
75
ÖSTERREICHS AUSSENWIRTSCHAFT<br />
77
4 WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG<br />
ÖSTERREICHS IM ÜBERBLICK<br />
Nach dem Konjunktureinbruch 2001 – das reale BIP war nur um 0,8 % gestiegen<br />
– belebte sich das Wirtschaftswachstum in Österreich 2002 mit 1,4 % nur leicht.<br />
Zur Jahresmitte 2002 trübte sich die Stimmung der Unternehmen als Reaktion<br />
auf die Börsenkrise sowie die unsichere <strong>internationale</strong> Konjunktur ein, wodurch<br />
sich diese Schwächephase auch im Jahr 2003 fortsetzte. Das Wachstum verlor<br />
im Jahresverlauf weiter an Dynamik (von 1 % im 1. Quartal auf nur 0,5 % im<br />
4. Quartal). Mit einer Zunahme des realen BIP um 0,7 % für das Gesamtjahr<br />
konnte Österreich immerhin – wie schon 2002 – ein besseres Ergebnis als die<br />
Eurozone und Deutschland erreichen. Während 2002 die Außenwirtschaft der<br />
„Wachstumsmotor“ war, stabilisierte 2003 die Inlandsnachfrage, insbesondere die<br />
Investitionen, die Konjunktur. Der Außenbeitrag dämpfte 2003 das Wirtschaftswachstum<br />
um 1 Prozentpunkt. Die globale Erholung übertrug sich auch 2004 aufgrund<br />
der Euro-Aufwertung sowie der anhaltenden Nachfrageschwäche im Inland<br />
nur zögernd auf den Euroraum und damit auf Österreich. Es bleibt abzuwarten,<br />
ob sich der Aufschwung nach der jüngsten „Konjunkturpause“ weiter fortsetzen<br />
wird oder ob die zaghafte Belebung der zweiten Jahreshälfte 2003 bereits wieder<br />
zu Ende ist. Unter der Annahme, dass sich die Erholung der <strong>internationale</strong>n und<br />
österreichischen Konjunktur zwar verlangsamt, aber nicht zum Stillstand kommt,<br />
wird für das Jahr 2004 ein Wirtschaftswachstum von real 1,5 % prognostiziert.<br />
Auch 2004 wird die Inlandsnachfrage der stabilisierende Konjunkturfaktor sein.<br />
Die Außenwirtschaft dürfte 2004 mit +0,3 Prozentpunkten nur relativ wenig zum<br />
Wirtschaftswachstum beitragen.<br />
4.1 Die Konjunktur 2002/2003 und Ausblick auf 2004<br />
4.1.1 Aufschwung 2002 unterbrochen<br />
Im Frühjahr 2002 belebte sich das Wirtschaftswachstum in Österreich leicht, flachte<br />
aber im Jahresverlauf wieder merklich ab (Abbildung 4.1). Vor allem als Reaktion auf<br />
die Börsenkrise sowie die anhaltend unsichere <strong>internationale</strong> Konjunktur trübte sich<br />
zur Jahresmitte die Stimmung der Unternehmen ein. Die Hochwasserkatastrophe im<br />
Sommer 2002 beeinträchtigte die heimische Wirtschaft zusätzlich. Mit einer Zunahme<br />
des realen BIP um 1,4 % fiel 2002 die Erholung – nach dem Konjunktureinbruch 2001<br />
(+0,8 %) – nur sehr mäßig aus.<br />
Die Konjunkturschwäche kam vor allem im Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen<br />
(–2,8 %), insbesondere der Ausrüstungen (–5,2 %, davon Maschinen und Fahrzeuge<br />
79
jeweils etwa –7 %) zum Ausdruck. Etwas besser hielten sich die Bauinvestitionen, die<br />
nur um 0,7 % unter ihrem Vorjahresniveau blieben. Die Konsumnachfrage lieferte nur<br />
einen bescheidenen Beitrag zur Belebung der Konjunktur. Der private Konsum nahm<br />
um 0,8 % zu, der öffentliche Konsum stagnierte. Die Konsumenten hielten sich wegen<br />
der schlechten Arbeitsmarktlage und der Unsicherheiten über ihre künftige finanzielle<br />
Situation (auch infolge der Pensionsdebatte) bei Neuanschaffungen zurück.<br />
Entwicklung des realen BIP Abb. 4.1<br />
Veränderung zum Vorjahr/Vorquartal (in %)<br />
Quelle: WIFO.<br />
80<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
�<br />
��<br />
����<br />
����<br />
��������������<br />
����<br />
����<br />
����������������������������������<br />
Wichtigste Konjunkturstütze war 2002 der Außenbeitrag (siehe Tabelle 4.1 und Abbildung<br />
4.4), der mit 1,4 Prozentpunkten am Wachstum beteiligt war. Dies war nicht<br />
nur eine Folge der Ausweitung der Exporte, sondern auch der stagnierenden Importe.<br />
Die Gesamtexporte erreichten mit real +3,7 % die niedrigste Zunahme seit 1995, die<br />
Gesamtimporte nahmen nur um +1,2 % zu (siehe Tabellen 4.5 – 4.7 in den Statistischen<br />
Übersichten). Der Saldo der Leistungsbilanz war, zum ersten Mal seit 1991,<br />
aktiv (0,7 Mrd. Euro bzw. 0,3 % des BIP). Die Warenexporte lt. Außenhandelsstatistik<br />
stiegen real um 5,2 %, die Ausfuhren von Dienstleistungen blieben auf dem Vorjahresniveau<br />
(+0,1 %). Die Wareneinfuhren stagnierten mit +0,8 %. Schwach war vor<br />
allem die Nachfrage nach ausländischen Investitions- und Konsumgütern. Die Importe<br />
von Dienstleistungen stiegen um 3,1 %. Die Handelsbilanz ergab zum ersten Mal in<br />
der Nachkriegszeit einen Überschuss. Dazu trug auch die Verbesserung der Terms<br />
of Trade (TOT) um gut 1 % bei. Die Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
verbilligte die Einfuhren aus dem Dollarraum (u.a. Erdöl), die Preise der Importe gaben<br />
mehr nach als die der Exporte.<br />
Beiträge zum realen Wirtschaftswachstum Tab. 4.1<br />
2001 2002 2003 2004 *<br />
In Prozentpunkten<br />
Konsum 1) 0,5 0,5 0,8 1,0<br />
Ausrüstungsinvestitionen -0,2 -0,6 0,6 0,3<br />
Bauten -0,3 -0,1 0,3 0,3<br />
Vorratsveränderung 2) -0,1 0,2 0,1 -0,4<br />
Inländische Nachfrage -0,2 0,0 1,8 1,2<br />
Außenbeitrag 0,9 1,4 -1,0 0,3<br />
Exporte 3,8 2,0 0,5 2,5<br />
Importe -2,9 -0,6 -1,6 -2,1<br />
Bruttoinlandsprodukt 0,8 1,4 0,7 1,5<br />
1) Privat und Staat. 2) Einschließlich Statisistischer Differenz.<br />
* WIFO-Prognose vom April 2004.<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.<br />
In der Sachgüterproduktion (real +0,5 %) verstärkte sich der Wachstumseinbruch<br />
im Jahr 2002. Die wichtigste Ursache war die schwache Exportentwicklung. In der<br />
Bauwirtschaft setzte sich die negative Tendenz weiter fort (–0,5 %). Dank günstiger<br />
Bedingungen nahm die Bruttowertschöpfung in der Landwirtschaft (+5,7 %) sowie<br />
in der Energieversorgung (+5,3 %) kräftig zu, doch haben diese Sektoren nur einen<br />
geringen Anteil an der Entstehung des BIP.<br />
Die Inflation (VPI) stieg 2002 mit 1,8 % um fast 1 Prozentpunkt langsamer als im Vorjahr,<br />
vor allem dank der Beruhigung der Energiepreise in der ersten Jahreshälfte. Die Bargeldeinführung<br />
des Euro verteuerte die Ausgabenpositionen mit einem großen Gewicht<br />
im Warenkorb, wie z.B. Mieten und Energie, nicht überproportional. Der Übergang zur<br />
neuen Währung machte sich allerdings z.T. bei persönlichen Dienstleistungen und einigen<br />
Gütern des täglichen Bedarfs in Form von Preiserhöhungen bemerkbar, was bei den<br />
Konsumenten den Eindruck einer spürbaren Verteuerung hervorrief („Teuro“). Der harmonisierte<br />
europäische Verbraucherpreisindex wies im Jahresdurchschnitt 2002 einen<br />
Anstieg um 1,7 % aus. Damit lag Österreich unter den Euro-Ländern mit der niedrigsten<br />
Inflationsrate an dritter Stelle nach Deutschland (+1,3 %) und Belgien (+1,6 %).<br />
Infolge der Konjunkturschwäche verschlechterte sich 2002 die Arbeitsmarktlage. Die<br />
Zahl der Arbeitsplätze war im Jahresdurchschnitt 2002 um 14.000 (–0,5 %) niedriger<br />
als im Vorjahr. Besonders betroffen waren neben der Sachgüterproduktion (–2,5 %)<br />
das Bauwesen (–2,8 %) und die öffentliche Verwaltung (–1 %). Da sich das Arbeitskräfteangebot<br />
trotz der Konjunkturschwäche erhöhte, nahm die Zahl der Arbeitslosen<br />
81
mit fast 29.000 zusätzlichen Arbeitssuchenden kräftig zu. Diese Entwicklung ging auf<br />
die Zunahme des Angebotes von ausländischen Arbeitskräften und die Anhebung des<br />
Antrittsalters für die Frühpension zurück. Die Arbeitslosenquote nach österreichischer<br />
Berechnung stieg von 6,1 % (2001) auf 6,9 % (im Jahresdurchschnitt 2002), nach<br />
Eurostat-Definition von 3,6 % auf 4,3 %. Österreich hatte damit nach wie vor eine der<br />
niedrigsten Arbeitslosenquoten in der EU.<br />
Der Finanzierungssaldo des Staates lt. Maastricht-Definition war – nach einem Überschuss<br />
von 0,2 % des nominellen BIP im Jahr 2001 – im Jahr 2002 in etwa ausgeglichen<br />
(–0,2 %). Lt. VGR betrug das Defizit im Staatshaushalt 0,4 % des nominellen<br />
BIP. Der Fehlbetrag fiel niedriger aus als erwartet, weil sich die Steuereinnahmen trotz<br />
schwacher Konjunktur günstig entwickelten und die Unterstützungen für Hochwasseropfer<br />
geringer ausfielen als vorgesehen. Begünstigt wurde das Ergebnis auch durch<br />
die periodengerechte Aufteilung des Zinsaufwands und der Eigenmittelzahlungen an<br />
die EU, durch die diese Ausgaben geringer ausfielen als auf Cash-Basis.<br />
4.1.2 Weiteres Nachlassen der Konjunktur 2003<br />
In Westeuropa lies die Konjunktur 2003 weiter nach. Deutschland musste sogar<br />
einen Rückgang des realen BIP hinnehmen. Zur schwachen Binnennachfrage kam<br />
die Euroaufwertung hinzu, die den Export erschwerte. In den EU-Beitrittsländern hat<br />
sich das Wirtschaftswachstum beschleunigt und lag mit 3,6 % deutlich über jenem<br />
der EU-15 (siehe Abbildung 4.2).<br />
Wirtschaftswachstum in Österreich und in der EU-15 Abb. 4.2<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
* WIFO-Prognose<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
82<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0<br />
-0,5<br />
Österreich<br />
EU-15<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
In Österreich setzte sich 2003 die Schwächephase bereits das dritte Jahr fort. Mit<br />
einer Zunahme des realen BIP um +0,7 % konnte aber die österreichische Wirtschaft<br />
– ebenso wie schon 2002 – ein besseres Ergebnis als die Eurozone und Deutschland<br />
erreichen. Die Wachstumsdynamik flachte sich im Jahresverlauf ab, sie fiel von 1 %<br />
Wachstum im 1. Quartal auf nur 0,5 % im 4. Quartal zurück. Das um Saison- und<br />
Arbeitstagseffekte bereinigte BIP lässt seit Jahresanfang eine zögerliche Erholung<br />
erkennen, die allerdings zu Jahresende wieder nachließ (siehe Abbildung 4.1).<br />
Während 2002 die Außenwirtschaft der „Wachstumsmotor“ war, stabilisierte 2003 die<br />
Inlandsnachfrage die Konjunktur. Den größten Wachstumsbeitrag lieferten 2003 die<br />
Investitionen: Die Ausrüstungsinvestitionen nahmen real um 6,1 % zu; verstärkt angeschafft<br />
wurden sowohl Maschinen und Elektrogeräte (+6,8 %) als auch Fahrzeuge<br />
(+4,1 %). Der Impuls für die heimische Produktion hielt sich allerdings in Grenzen, da<br />
ein beträchtlicher Teil durch Importe gedeckt wurde. Im 4. Quartal 2003 stiegen die<br />
Ausrüstungsinvestitionen um 12 % an. Diese Zunahme war auf Vorzieheffekte wegen<br />
der ursprünglich bis Ende 2003 befristeten Investitionszuwachsprämie zurückzuführen.<br />
Wichtige Konjunkturstütze waren auch die Bauinvestitionen. Nach einem Rückgang in<br />
den zwei vorangegangenen Jahren wurden sie 2003 deutlich ausgeweitet (+2,8 %).<br />
Vor allem Investitionen im Infrastrukturbereich nahmen zu, da die öffentliche Hand mit<br />
Tiefbauaufträgen Impulse setzte. Auch im Wohnbau zeigten sich Erholungstendenzen<br />
(+1,6 %), nachdem das Bauvolumen seit sechs Jahren geschrumpft war.<br />
Der private Konsum stieg 2003 mit real 1,3 % etwas stärker als im Jahr zuvor; teils war<br />
dies auf Neuanschaffungen von PKWs zurückzuführen. Gegen Jahresende ließ die<br />
Kauflust jedoch nach (4. Quartal: –0,1 %). Der öffentliche Konsum war wie bisher von<br />
anhaltenden Sparbemühungen geprägt, dennoch war 2003 eine mäßige Expansion<br />
zu verzeichnen (+0,7 %).<br />
Der Außenbeitrag dämpfte 2003 das Wirtschaftswachstum um 1 Prozentpunkt. Nachdem<br />
die österreichische Exportwirtschaft 2002 trotz der <strong>internationale</strong>n Konjunkturschwäche<br />
noch relativ kräftig expandiert hatte, verlangsamte sich das Wachstum 2003<br />
mit nur mehr 1,0 % deutlich. Im Warenexport wurde das Vorjahresniveau real leicht<br />
übertroffen (+2,0 %), nicht aber im Export von Dienstleistungen. Der Gesamtimport<br />
wuchs mit real +3 % stärker als im Jahr 2002. Zugenommen hat aufgrund der lebhaften<br />
Nachfrage nach Ausrüstungsinvestitionen der Warenimport (real +4,7 %), an<br />
Dienstleistungen wurde um 0,8 % weniger eingeführt.<br />
Die größten Zuwächse an realer Wertschöpfung wurden 2003 im Bauwesen (+2,5 %)<br />
und in der Energie- und Wasserversorgung (+2,6 %) erreicht. Die meisten Dienstleistungsbranchen<br />
waren von der Konjunkturschwäche geprägt, die reale Wertschöpfung<br />
der Banken und Versicherungen stagnierte. Einen Rückgang gab es in der Sachgü-<br />
83
terproduktion (–0,2 %), in der öffentlichen Verwaltung (–0,2 %) und in der Land- und<br />
Forstwirtschaft (–4,8 %).<br />
Der intensive Wettbewerb, der starke Euro und die fallenden Importpreise hielten die<br />
Inflation niedrig: Der VPI verzeichnete mit +1,3 % den geringsten Anstieg seit 1999.<br />
Österreich zählte, nach Deutschland, zu den preisstabilsten Ländern der Eurozone.<br />
Die schwache Konjunktur ließ keine Besserung auf dem Arbeitsmarkt zu. Die Anzahl<br />
der unselbständig Beschäftigten nahm nur um 6.000 (+0,2 %) zu, die Arbeitslosenquote<br />
stieg geringfügig, auf 7,0 % bzw. 4,4 % (Eurostat) an. Der Finanzierungssaldo<br />
des Staates verschlechterte sich um 1 Prozentpunkt und wies ein Defizit von 1,1 %<br />
des BIP aus.<br />
4.1.3 Nur mäßige Konjunkturerholung 2004<br />
Die Erholung der Weltwirtschaft gewann zu Beginn des Jahres 2004 weiter an Stärke.<br />
Die Dynamik überträgt sich allerdings nur zögernd auf die Eurozone, wozu die starke<br />
Aufwertung des Euro sowie die anhaltende Schwäche der Binnennachfrage beitragen.<br />
Im Gegensatz zu den USA fehlen in der EU die expansiven Signale der Wirtschaftspolitik.<br />
Unternehmen und private Haushalte sind verunsichert und schieben geplante<br />
Investitionen auf bzw. neigen zu gesamtwirtschaftlich nachteiligem Vorsichtssparen.<br />
Seit Jahresbeginn 2004 trübten sich die Konjunkturaussichten für die Eurozone und<br />
für Österreich ein. Frühindikatoren (die Unternehmensbefragungen der Europäischen<br />
Kommission, der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, der WIFO-Konjunkturtest<br />
für Österreich) zeigen, dass das Geschäftsklima in der konjunkturreagiblen Sachgütererzeugung<br />
– nach einer kurzen Belebung von Mitte bis Ende 2003 – ungünstiger<br />
eingeschätzt wird. Die Unternehmen sehen keine weitere Verbesserung der Auftragslage<br />
und beurteilen die Produktionsaussichten zurückhaltender als zuvor. Es bleibt<br />
abzuwarten, ob sich der Aufschwung nach der jüngsten „Konjunkturpause“ weiter<br />
fortsetzen wird oder ob die zaghafte Konjunkturerholung der zweiten Jahreshälfte<br />
2003 bereits wieder zu Ende ist. Unter der Annahme, dass sich die Erholung der <strong>internationale</strong>n<br />
und österreichischen Konjunktur verlangsamt, aber nicht zum Stillstand<br />
kommt, wird für das Jahr 2004 ein Wirtschaftswachstum von real 1,5 % prognostiziert 1<br />
(siehe Tabelle 4.4 in den Statistischen Übersichten).<br />
Wie schon im vergangenen Jahr sollte auch 2004 die Inlandsnachfrage der stabilisierende<br />
Konjunkturfaktor sein. Die Dynamik der Ausrüstungsinvestitionen dürfte sich zwar<br />
abschwächen, aber immerhin um 3,0 % zunehmen. Die Ergebnisse des WIFO-Investitionstests<br />
lassen auf keine stärkere Erholung der Investitionsaktivitäten schließen.<br />
Die Bauwirtschaft könnte mit real 2,5 % wieder recht kräftig wachsen, insbesondere<br />
dank reger Investitionsaktivitäten im Infrastrukturbau. Der private Konsum wird sich<br />
84
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
voraussichtlich leicht beleben (+1,7 %), wobei vor allem dauerhafte Konsumgüter mehr<br />
nachgefragt werden (+3 %) 2 könnten.<br />
Die Außenwirtschaft dürfte 2004 mit +0,3 Prozentpunkten nur relativ wenig zum Wirtschaftswachstum<br />
beitragen. Die Gesamtexporte werden 2004 mit real 4,4 % vermutlich<br />
merklich stärker als in den beiden Vorjahren steigen. Die Belebung im Tourismus<br />
(+2,0 %) dürfte nur mäßig ausfallen. Die Zunahme der Gesamtimporte (+4,0 %) sollte<br />
nur knapp unter jener der Exporte bleiben.<br />
Ab Mitte 2003 zeichnete sich eine Belebung der konjunkturreagiblen Sachgütererzeugung<br />
ab. Produktionserwartungen und Auftragsbestände wurden im WIFO-Konjunkturtest<br />
wesentlich günstiger beurteilt, die Unternehmen schätzten die in die Zukunft<br />
reichenden Indikatoren optimistischer ein. Das Konjunkturbild trübte sich allerdings<br />
bereits wieder ein. Die Auftragsbestände nahmen nicht weiter zu, in der Umfrage<br />
vom März 2004 gingen die Produktionserwartungen saisonbereinigt gegenüber dem<br />
Vormonat zurück. Das WIFO erwartet nach einer Stagnation der Wertschöpfung in<br />
der Sachgütererzeugung im Jahr 2003 für heuer ein verhaltenes Wachstum von real<br />
2,2 %.<br />
Die Inflation erhöhte sich zu Jahresbeginn 2004 leicht, ohne allerdings die Marke<br />
von 2 % – die als Grenze der Preisstabilität gilt – zu erreichen. Im Jahresdurchschnitt<br />
dürfte der Preisauftrieb auf Verbraucherebene mit 1,6 % über jenem des Jahres 2003<br />
bleiben. Nach dem einheitlich berechneten Harmonisierten Verbraucherpreisindex<br />
wird die Inflation vermutlich 1,4 % betragen. Österreich bleibt eines der preisstabilsten<br />
Länder der Eurozone. Zum Preisauftrieb dürfte 2004 neben der Rohölverteuerung<br />
auf den Weltmärkten auch die Anhebung der Energiesteuern zu Jahresbeginn 2004<br />
beitragen. Die Energieverteuerung schlägt auch auf die Preise industriell-gewerblicher<br />
Güter durch, deren Anstieg aber durch den Rückgang der Lohnstückkosten in<br />
der Sachgütererzeugung und der Importpreise gedämpft wird. Die Bruttoeinkommen<br />
je unselbständig Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) steigen 2004 wie im Vorjahr um<br />
etwa 2½ %.<br />
Auf dem Arbeitsmarkt ist 2004 keine Trendwende zum Besseren abzusehen. Insgesamt<br />
sollte 2004 die Zahl der unselbständig aktiv Beschäftigten um 0,5 % steigen. Ein<br />
Beschäftigungszuwachs ist im öffentlichen und halböffentlichen Bereich zu erwarten:<br />
Für Unterricht und Gesundheit werden Arbeitskräfte nachgefragt. Auch bei den unternehmensnahen<br />
Dienstleistungen steigt die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse.<br />
Hier spiegelt sich der anhaltende Trend zur Auslagerung von Dienstleistungen aus<br />
der Industrie und dem öffentlichen Sektor wider. Im Baugewerbe sollte sich der Beschäftigungsrückgang<br />
aufgrund der regen Produktionszunahme verlangsamen. In<br />
der Sachgüterproduktion könnte die Erholung zu gering sein, um die Arbeitsplatzverluste<br />
zum Stillstand zu bringen. Dem nur leichten Anstieg der Beschäftigung steht<br />
85
eine beträchtliche Ausweitung des Arbeitskräfteangebots durch eine Zunahme der<br />
Zahl ausländischer Arbeitskräfte gegenüber. Durch die Saisonnierregelung kommen<br />
zusätzliche Arbeitskräfte nach Österreich, der Zugang zum Arbeitsmarkt wurde für<br />
länger im Inland ansässige Angehörige ausländischer Arbeitnehmer erleichtert. Die<br />
Änderungen im Pensionssystem haben einen angebotserhöhenden Effekt, da das<br />
effektive Pensionsantrittsalter kontinuierlich steigt. Die Arbeitslosenquote dürfte sich<br />
2004 von 7,0 % der unselbständigen Erwerbspersonen im Jahr 2003 auf 7,2 % erhöhen.<br />
Das entspräche einem Niveau von 246.000 Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt.<br />
Die Arbeitslosenquote laut Eurostat steigt vermutlich von 4,4 % auf 4,5 %. Dies ergäbe<br />
weiterhin einen der niedrigsten Werte der Eurozone.<br />
Der Finanzierungssaldo des Staates (Maastricht-Definition) sollte 2004 mit einem<br />
Abgang von 1,0 % des BIP knapp unter jenem des Vorjahres bleiben. Der Anstieg<br />
der Ausgaben für Sozialleistungen sollte aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und der<br />
steigenden Kosten für Kinderbetreuungsgeld und Altersteilzeitgeld voraussichtlich<br />
kräftig bleiben.<br />
4.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung der Außenwirtschaft<br />
4.2.1 Die Außenwirtschaft in der VGR<br />
Die Exporte laut VGR (Gesamtexporte; Exporte i. w. S.) erreichten im Jahr 2003 zu<br />
laufenden Preisen den Wert von 116 Mrd. Euro, in realer Rechnung (Preise 1995)<br />
112 Mrd. Euro. Mehr als zwei Drittel der Gesamtexporte bestehen aus Warenausfuhren,<br />
deren Anteil (zu laufenden Preisen) von 60 % (1993) auf 68 % (2003) anstieg. 3 Der<br />
Exportanteil des Reiseverkehrs fiel hingegen innerhalb von zehn Jahren von 19 % auf<br />
10,5 % zurück (siehe Tabellen 4.5 bis 4.7 in den Statistischen Übersichten).<br />
Die sonstigen Dienstleistungen waren 2003 mit 14 % am Export beteiligt, deren Anteil<br />
nahm um etwa 1 Prozentpunkt zu. Wichtigste Posten sind der Transport, unternehmensbezogene<br />
Dienstleistungen (Handel, operationales Leasing, technische Dienste<br />
usw.), Versicherungs-, Finanz- und Informationsdienste sowie Patente und Lizenzen.<br />
Entgegen manchen Erwartungen expandierten die Exporte von Waren deutlich stärker<br />
als jene von Dienstleistungen. Die Nicht aufteilbaren Leistungen (NAL) – eine<br />
Restgröße, die statistisch nicht erfasste Deviseneinnahmen auffängt – trugen 2003<br />
mit 7 % zum Gesamtexport bei.<br />
Die Gesamtimporte beliefen sich 2003 auf 113 Mrd. Euro, real auf 108 Mrd. Euro. Die<br />
Struktur der Importe war 2003 ähnlich jener der Exporte: Auf Waren entfielen 68 %,<br />
auf den Tourismus 9 %, auf die sonstigen Dienstleistungen und auf die NAL jeweils<br />
11,5 %. Im Vergleich zu 1993 veränderten sich die Anteile nur wenig, jene des Reise-<br />
86
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
verkehrs verringerten sich etwas. Die Bedeutung der NAL verdoppelte sich allerdings<br />
seit 1993, was auf Probleme der Außenhandelsstatistik hinweist.<br />
Die Gesamtexporte lt. VGR stiegen 2002 real um 3,7 %, wobei der höchste Zuwachs<br />
– trotz <strong>internationale</strong>r Konjunkturschwäche – mit 5,4 % bei Waren erzielt werden konnte.<br />
Die Ausfuhren von Dienstleistungen blieben nur etwa auf dem Vorjahresniveau: Die<br />
Einnahmen aus dem Tourismus nahmen zwar um 1,9 % zu, aus sonstigen Dienstleistungen<br />
um 3,4 %, doch brachten die NAL um 7,1 % weniger ein. Nachdem die österreichische<br />
Exportwirtschaft 2002 noch recht positiv abschloss, verlangsamte sich 2003<br />
das Wachstum – als Folge der Nachfrageschwäche der wichtigsten Handelspartner in<br />
Westeuropa und der Euroaufwertung – deutlich (+1,0 %). Im Güterexport wurde das<br />
Vorjahresniveau real leicht übertroffen (+2 %), nicht aber im Export von Dienstleistungen:<br />
Während im Reiseverkehr ein Zuwachs von 1,6 % erzielt werden konnte, gingen<br />
die Einnahmen aus sonstigen Dienstleistungen und NAL real zurück.<br />
Die Gesamteinfuhren nahmen 2002 real nur um 1,2 % zu, wobei Wareneinfuhren<br />
mit +0,4 % stagnierten. Schwach war vor allem die Nachfrage nach ausländischen<br />
Investitions- und Konsumgütern. Die realen Ausgaben für den Tourismus schrumpften<br />
um 4 %, die Importe von Dienstleistungen nahmen aber infolge des Anstiegs der NAL<br />
zu. Trotz schwächeren Wachstums der Binnenwirtschaft wuchsen 2003 die Gesamtimporte<br />
mit real +3,0 % stärker als im Jahr 2002. Der Warenimport nahm aufgrund der<br />
lebhaften Nachfrage nach Ausrüstungsinvestitionen zu (real +4,7 %), während die<br />
Dienstleistungsimporte zurückgingen.<br />
4.2.2 Preise und Wettbewerbsfähigkeit im Außenhandel<br />
Die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft wird vor allem durch<br />
die Entwicklung der relativen Preise und Kosten der heimischen Produktion und der<br />
Produktion der ausländischen Wettbewerber bestimmt. Diese Faktoren bilden jedoch<br />
nur einen – wenn auch besonders wichtigen – Teil der Konkurrenzsituation ab. Auch<br />
Nichtpreisfaktoren wie die Produktqualität, die Produktpalette, die Lieferfähigkeit, das<br />
Angebot an hochwertigen Dienstleistungen sowie auch das soziale Klima beeinflussen<br />
maßgeblich die Wettbewerbskraft einer Wirtschaft.<br />
Ein Indikator, der die relativen Preise und Kosten in einheitlicher Währung und damit<br />
die preisliche und kostenmäßige Wettbewerbsfähigkeit misst, ist der real-effektive<br />
Wechselkurs. Dieser kann auf Basis der relativen Arbeitskosten oder der relativen<br />
Verbraucherpreise errechnet werden. Die Aussagekraft dieser Wettbewerbsindikatoren<br />
zeigt sich bei einem Vergleich der Exportentwicklung und der Veränderung der realen<br />
Wechselkurse: Einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit (einem Sinken des realen<br />
Wechselkurses) folgen in der Regel Exportgewinne.<br />
87
Gemessen an der Entwicklung des realen Wechselkurses (auf Basis der relativen<br />
Preise) verbesserte sich in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre die Wettbewerbsposition<br />
der österreichischen Wirtschaft merklich. Die Jahre 2001 und 2002 brachten<br />
hingegen eine leichte, 2003 eine deutliche Aufwertung (+2,8 %), welche die Konkurrenzfähigkeit<br />
schwächte (siehe Tabelle 4.2). Im Jahr 2003 musste Österreich reale<br />
Marktanteilsverluste hinnehmen (vgl. Kap. 5.3). Eine wichtige Rolle spielte dabei die<br />
anhaltende Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro.<br />
Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs Tab. 4.2<br />
88<br />
1990–1995 1995–2000 2001 2002 2003 2004*<br />
durchschnittliche<br />
jährl. Veränderung in %<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Real effektiver Wechselkurs 1) - - 2,4 + 0,3 + 0,6 + 2,8 + 1,2<br />
Lohnstückkosten der Industrie + 0,5 - 3,1 + 1,6 - 0,7 + 0,3 - 1,2<br />
Relative Lohnstückkosten<br />
gegenüber den Handelspartnern 2) + 0,8 - 3,5 - 0,4 - 0,7 + 2,1 - 1,1<br />
Produktivität (Stunden) - + 5,1 + 1,6 + 3,6 + 1,5 + 3,4<br />
Exportpreise insgesamt + 0,9 + 0,8 - 0,1 - 0,5 - 0,1 + 0,1<br />
Waren - 0,1 + 0,6 - 0,9 - 0,9 - 0,6 - 0,2<br />
Tourismus + 3,4 + 1,6 + 2,1 + 1,8 + 2,1 + 2,0<br />
Importpreise insgesamt + 0,8 + 1,4 - 0,3 - 1,7 - 0,8 - 0,1<br />
Waren - 0,1 + 1,2 - 0,7 - 2,8 - 1,2 - 0,5<br />
Tourismus + 1,6 + 3,0 + 2,8 + 3,1 + 2,1 + 2,0<br />
TOT insgesamt + 0,1 - 0,6 + 0,2 + 1,3 + 0,7 + 0,2<br />
1) Auf Basis relativer Preise. 2) Minus bedeutet Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.<br />
* WIFO-Prognose vom April 2004.<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.<br />
Wichtige Hinweise auf die kostenbestimmte oder preisliche Wettbewerbsfähigkeit einer<br />
Wirtschaft liefert auch die Entwicklung der Arbeitskosten der Industrie in Relation zum<br />
Ausland. Die Arbeitskosten sind die wichtigste Kostenkomponente des Industriesektors.<br />
Verglichen werden zumeist Lohnstückkosten. Diese werden aus dem Verhältnis der<br />
Kosten einer Arbeitsstunde zur Stundenproduktivität errechnet.<br />
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre verbesserten sich die relativen Lohnstückkosten<br />
in der Sachgütererzeugung gegenüber den Handelspartnern um 3 % pro Jahr. Dazu<br />
trugen der hohe Anstieg der Produktivität (5,1 % pro Jahr) 4 , eine Stabilisierung der<br />
Wechselkurse sowie eine Verlangsamung des Lohnauftriebs bei. Die vorteilhaften<br />
Wettbewerbsbedingungen setzten sich auch 2001 und 2002 fort. Im Jahr 2002 gingen<br />
die Lohnstückkosten in der österreichischen Sachgütererzeugung um 0,7 % zurück, im<br />
selben Ausmaß verbesserte sich auch die Lohnstückkostenposition gegenüber dem<br />
Durchschnitt der Handelspartner. 2003 verschlechterten sich allerdings die Wettbe-
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
werbsbedingungen merklich: Die Lohnstückkosten der Industrie nahmen zwar nur um<br />
0,3 % zu, relativ zum Durchschnitt der Handelspartner stiegen sie aber um 2,1 % an.<br />
2004 sollten sich die Bedingungen wieder verbessern.<br />
Die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsstärke spiegelt sich auch in der Entwicklung der Außenhandelspreise<br />
wider, doch ist der Zusammenhang statistisch zumeist schwer<br />
nachzuweisen. Der Vorteil dieser Indikatoren besteht darin, dass es sich um Preise<br />
von Waren bzw. Dienstleistungen handelt, die direkt der <strong>internationale</strong>n Konkurrenz<br />
ausgesetzt sind. Der Nachteil besteht unter anderem darin, dass in Österreich für<br />
den Außenhandel keine echten Preise (wie beim Verbraucherpreisindex) erhoben<br />
werden, sondern dass nur Durchschnittswerte (Unit Values, Wert pro Menge) zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Die österreichischen Außenhandelspreise veränderten sich in den 1990er-Jahren nur<br />
wenig. Im Jahr 2000 stiegen – vor allem aufgrund der Verteuerung von Energie und<br />
Vorprodukten – die Exporte und Importe merklich an, die folgenden Jahre brachten<br />
wieder eine Verbilligung. Der wichtigste Faktor dieser Entwicklung war die Euroaufwertung.<br />
Auch die <strong>internationale</strong> Konjunkturschwäche übte Druck auf die Preise aus.<br />
Die Preise der Importe gaben 2002 und 2003 mehr nach als jene der Exporte, die<br />
TOT verbesserten sich vor allem im Jahr 2002. Auch für 2004 wird ein TOT-Gewinn<br />
erwartet. Im Reiseverkehr zogen die Preise kräftiger als im Warenhandel an. Im Export<br />
belief sich die Teuerung in den Jahren 2001 bis 2003 auf jeweils etwa 2 %, im Import<br />
sogar auf 3 %.<br />
4.2.3 Außenhandelsverflechtung der österreichischen Wirtschaft<br />
Die Bedeutung des Außenhandels für die österreichische Wirtschaft nahm in den<br />
letzten zehn Jahren stark zu. Gemessen am wirtschaftlichen Entwicklungsniveau und<br />
der Landesgröße ist die Internationalisierung Österreichs durch den Außenhandel mit<br />
der in anderen Industrieländern vergleichbar. Im Jahr 2003 entsprachen die Exporte<br />
von Waren und Dienstleistungen zu laufenden Preisen (116,2 Mrd. Euro) einem Anteil<br />
am BIP (Exportquote) von 51,8 %. Diese Quote ging zwar 2003 – infolge der stagnierenden<br />
Exporte – um 1 Prozentpunkt zurück, im Vergleich zu 1993 (36,0 %) stieg sie<br />
aber stark an. Der EU-Beitritt sowie die Ostöffnung, gekoppelt mit den Bemühungen<br />
der Wirtschaftspolitik im Rahmen der Exportoffensive, waren wichtige Faktoren für die<br />
Integration Österreichs in die Weltwirtschaft.<br />
Die steigende Bedeutung der Exporte spiegelt aber auch die zunehmende Globalisierung<br />
der österreichischen Wirtschaft durch Direktinvestitionen und die vertiefte<br />
Arbeitsteilung durch <strong>internationale</strong>s Outsourcing wider. Dabei findet eine Aufspaltung<br />
der Produktion in einzelne Produktionsstufen statt, die von Tochterunternehmen oder<br />
89
Nominelle Exportquoten lt. VGR Abb. 4.3<br />
* WIFO-Prognose<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.<br />
90<br />
In Relation zum BIP in %<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
����<br />
���<br />
���<br />
Waren<br />
Reiseverkehr<br />
���<br />
����<br />
1993<br />
Waren<br />
Reiseverkehr<br />
35,5<br />
1,9<br />
4,2<br />
4,2<br />
25,2<br />
1993<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
����<br />
1995<br />
3,7<br />
1,4<br />
4,4<br />
4,6<br />
27,2<br />
1995<br />
Sonstige Dienstleistungen<br />
NAL<br />
NAL<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
����<br />
2003<br />
Sonstige Dienstleistungen<br />
50,3<br />
5,9<br />
5,7<br />
4,6<br />
34,2<br />
2003<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
����<br />
2004*<br />
Nominelle Importquoten lt. VGR Abb. 4.4<br />
������������������������<br />
* WIFO-Prognose<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.<br />
50,5<br />
6,0<br />
5,6<br />
4,6<br />
34,2<br />
2004*
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
Außenbeitrag, nominell Abb. 4.5<br />
������������������������<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����<br />
* WIFO-Prognose.<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����<br />
�����<br />
unabhängigen Unternehmen jeweils an den kostengünstigsten Standorten produziert<br />
werden. Damit geht ein Anstieg im Handel von Zwischenprodukten einher.<br />
Parallel zu den Exporten entwickelten sich auch die Importe von Waren und Dienstleistungen<br />
außerordentlich dynamisch. Ihr Anteil am BIP (Importquote) stieg von 35,5 %<br />
1993 auf 50,3 % im Jahr 2003. Ebenso wie bei den Exporten ging auch die Importquote<br />
zuletzt etwas zurück (siehe Tabelle 4.6 in den Statistischen Übersichten).<br />
Der nominelle Außenbeitrag (Saldo der Exporte und Importe i.w.S.) war – ebenso wie<br />
die Leistungsbilanz – in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre negativ. 5 1997 belief sich<br />
das Defizit auf 2,8 Mrd. Euro (1,5 % des BIP). Seither zeichnet sich eine deutliche<br />
Tendenz zur Verbesserung ab. 2001 war der Außenbeitrag zum ersten Mal seit langem<br />
aktiv, 2002 und 2003 wurden Überschüsse von 2,2 % bzw. 1,5 % des BIP erreicht.<br />
Der Außenbeitrag ist ein wichtiger Wettbewerbsindikator und als Komponente der<br />
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ein bedeutender Bestimmungsfaktor des BIPs. Eine<br />
Komponentenzerlegung des Wirtschaftswachstums zeigt, dass 2001 und insbesondere<br />
2002 der reale Außenbeitrag der wichtigste Motor des Wirtschaftswachstums war.<br />
2003 bremste er allerdings das Wachstum (vgl. Abbildung 4.5).<br />
Die Zunahme der Außenhandelsverflechtung der österreichischen Wirtschaft resultiert<br />
großteils aus der dynamischen Entwicklung des Warenhandels. Die Exportquote für<br />
Güter vergrößerte sich von 21,7 % 1993 auf 35,3 % 2003 und dürfte auch 2004 weiter<br />
ansteigen. Die entsprechende Importquote nahm 2003 von 25,2 % auf 34,2 % zu.<br />
Gestiegen ist auch die Außenhandelsquote der sonstigen Dienstleistungen, welche<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����<br />
����<br />
91
2003 auf der Exportseite 7,3 % erreichte. Die Bedeutung des Reiseverkehrs blieb<br />
in diesem Zeitraum, mit geringen Schwankungen, konstant bei etwa 5,6 % auf der<br />
Exportseite und 4,6 % des BIP auf der Importseite.<br />
Eine besonders positive Entwicklung verzeichnete die traditionell stark negative Warenbilanz.<br />
Hatte der Handel mit Waren lt. VGR 1993 noch mit einem Defizit von –5,5 Mrd.<br />
Euro abgeschlossen, so konnte 2002 ein Überschuss von 4,0 Mrd. Euro, 2003 von<br />
2,5 Mrd. Euro erreicht werden. Die entsprechende Quote drehte sich von –3,5 % im<br />
Jahre 1993 auf +1,1 % im Jahr 2003.<br />
Die positive Entwicklung der Warenbilanz über den gesamten Zeitraum zeigt eine<br />
Verbesserung der <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit Österreichs an. Die starke<br />
Aktivierung der Handelsbilanz 2002 ist aber auch ein Ausdruck der Nachfrageschwäche<br />
im Inland. Insbesondere der Einbruch bei den Ausrüstungsinvestitionen und die<br />
schwache Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern (etwa PKWs) hatten einen<br />
Einbruch bei den Warenimporten zur Folge, der ausschlaggebend für die Entwicklung<br />
der Warenaußenhandelsbilanz war.<br />
Auch bei den sonstigen Dienstleistungen hielt die positive Entwicklung weiter an.<br />
Der Überschuss vergrößerte sich von 0,6 Mrd. Euro 1993 auf 3,7 Mrd. Euro 2003. In<br />
Prozent des BIP bedeutete das einen Anstieg von 0,4 % auf 1,6 %.<br />
Relativ ungünstig entwickelte sich die Reiseverkehrsbilanz. Der Überschuss im Reiseverkehr,<br />
der einstmals wichtigsten Devisenquelle Österreichs, sank von 4,2 Mrd.<br />
Euro (2,7 % des BIP) 1993 auf 2,0 Mrd. Euro (0,9 % des BIP) 2003. Die jüngste Entwicklung<br />
zeigt Anzeichen einer leichten Verbesserung. Unbefriedigend und schwer<br />
durchschaubar ist die Entwicklung des Restpostens NAL: Der Saldo der NAL drehte<br />
sich von +1,3 Mrd. Euro 1993 auf –4,8 Mrd. Euro 2003. Dieses Defizit war fast gleich<br />
groß wie der gemeinsame Überschuss der Waren- und Reiseverkehrsbilanz.<br />
4.3 Beiträge zur Zahlungsbilanz<br />
Im Anschluss an die vorhergehende Diskussion der österreichischen Außenwirtschaft<br />
laut VGR sei hier zusätzlich die Entwicklung der österreichischen Zahlungsbilanz,<br />
welche das Außenkonto der VGR bildet, in den Jahren 2002 und 2003 beschrieben.<br />
Eine Übersicht über die Salden der einzelnen Teilbilanzen findet sich in Tabelle 4.8 in<br />
den Statistischen Übersichten. 6<br />
Im Jahr 2002 ergab sich zum ersten Mal seit 1992 ein Leistungsbilanzüberschuss,<br />
welcher großteils durch den hohen Überschuss in der Güterbilanz (von 3,8 Mrd. Euro<br />
oder 0,7 % des BIP) bedingt war. Die aktive Güterbilanz spiegelte einerseits die bereits<br />
erwähnte Verbesserung der TOT wieder, andererseits führte die heimische Nachfrageschwäche<br />
zu niedrigen Importen im Vergleich zu den Exporten. Durch die starke<br />
92
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar im Jahr 2003 fiel der Überschuss in<br />
der Güterbilanz trotz ähnlich günstigen sonstigen Rahmenbedingungen mit 1,7 Mrd.<br />
Euro wesentlich geringer aus. Dennoch trug der Warenhandel im zweiten aufeinanderfolgenden<br />
Jahr positiv zur österreichischen Leistungsbilanz bei. 7 Der Überschuss<br />
in der traditionell positiven Dienstleistungsbilanz fiel mit 824 Mio. Euro nur in etwa halb<br />
so groß aus. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2002 (631 Mio. Euro Überschuss)<br />
war jedoch wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Der Reiseverkehr trug neben<br />
den unternehmensnahen Dienstleistungen trotz seiner stark rückläufigen Bedeutung<br />
zu diesem leichten Anstieg bei.<br />
Trotz der positiven Teilbilanzen – sowohl im Waren- als auch im Dienstleistungshandel<br />
– drehte sich der Saldo der Leistungsbilanz im Jahr 2003 allerdings wieder ins Minus,<br />
wobei das Defizit mit rund 2 Mrd. Euro (0,9 % des BIP) wesentlich geringer als im<br />
Durchschnitt seit 1995 ausfiel. Entgegen seines früheren Einflusses konnte der auch<br />
2003 überschüssige Warenhandel also trotz ungünstiger Bedingungen (Euro-Dollar-<br />
Wechselkurs) nicht für das schlechte Nettoergebnis verantwortlich gemacht werden.<br />
Vielmehr ergab sich der Nettoabgang in der Leistungsbilanz aufgrund des hohen<br />
Defizits bei den Einkommen (und hier wiederum bei den Vermögenseinkommen aus<br />
Portfolioinvestitionen) sowie bei den Transfers (sowohl öffentliche als auch private<br />
Transfers). Der relativ hohe Nettoabfluss bei den Einkommen aus Portfolioinvestitionen<br />
setzt sich somit seit Mitte der 1990er-Jahre ungebrochen fort. Neben der Repatriierung<br />
von Portfolioinvestitionseinkommen trugen auch die laufenden Transfers mit einem<br />
Nettoergebnis von –2,1 Mrd. Euro deutlich zum Leistungsbilanzdefizit im Jahr 2003 bei.<br />
Dies ist jedoch nicht auf die Transferzahlungen an die EU zurückzuführen, vielmehr<br />
dürfte es sich um erhöhte Entwicklungshilfegelder und Zahlungen an <strong>internationale</strong><br />
Organisation handeln.<br />
Die Nettoposition Österreichs gegenüber der EU kann nicht direkt aus der Zahlungsbilanz,<br />
bzw. einer ihrer Teilbilanzen herausgelesen werden, da die Zahlungen an die<br />
EU unter der Position „laufende öffentliche Transfers“ in der Leistungsbilanz verbucht<br />
werden, die Rückflüsse hingegen teilweise ebenfalls dort, teilweise aber in der neu<br />
geschaffenen Teilbilanz der Vermögensübertragungen. Mit –313 Mio. Euro erzielte<br />
Österreich 2003 gegenüber der EU das beste Nettoergebnis seit dem Beitritt im Jahr<br />
1995. Bereits seit dem Jahr 2000 verbesserte sich die Nettoposition Österreichs gegenüber<br />
der EU kontinuierlich (siehe Tabelle 4.3), wobei Österreich nach wie vor ein<br />
Nettozahler in der Gemeinschaft ist. Im Jahr 2003 standen leicht rückläufigen Zahlungen<br />
von 1,9 Mrd. Euro (2003) Rückflüsse von immerhin 1,6 Mrd. Euro gegenüber. Im<br />
Vergleich dazu beliefen sich die Rückflüsse aus dem EU-Budget im Beitrittsjahr 1995<br />
auf nur 0,7 Mrd. Euro, während die Zahlungen, welche aufgrund des BIP berechnet<br />
werden, damals bereits 1,3 Mrd. betrugen. Die Struktur der Rückflüsse macht deutlich,<br />
93
dass die Bedeutung des Regionalfonds mit rund 10 % Anteil nach wie vor zunimmt.<br />
Die größte Bedeutung kommt jedoch erneut den beiden Land<strong>wirtschafts</strong>fonds zu, im<br />
Rahmen derer rund drei Viertel der EU-Gelder nach Österreich fließen.<br />
Transferzahlungen Österreichs an die EU und Rückflüsse (in Mio. Euro) Tab. 4.3<br />
94<br />
1995 2000 2001 2002 2003<br />
Zahlungen 1.339 2.058 1.967 2.016 1.897<br />
Rückflüsse 729 1.384 1.388 1.569 1.583<br />
davon EAGFL-Garantie 1) 82 1.026 1.087 1.123 1.159<br />
EAGFL-Ausrichtung 1) 31 93 8 10 25<br />
Europ. Regionalfonds 0 95 108 74 162<br />
Europ. Sozialfonds 46 73 72 103 114<br />
Erstattung an MS 552 0 0 0 0<br />
Europ. Solidaritätsfonds 0 0 0 134 0<br />
Sonstige 2) 18 99 112 124 124<br />
Nettoposition -610 -674 -579 -447 -313<br />
1) 1995–1999: lediglich Bundeseinnahmen, EAGFL: Europ. Ausrichtungs- und Garantiefonds f. die Landwirtschaft.<br />
2) für 2003 Schätzung.<br />
Quelle: Bundesministerium für Finanzen, Stand April 2004.<br />
Nachdem die Zahlungsbilanz laut Definition immer ausgeglichen sein muss, stand<br />
2002 dem Überschuss in der Leistungsbilanz erstmals seit zehn Jahren ein Defizit in<br />
der Kapitalbilanz gegenüber (siehe wiederum Tabelle 4.8 in den Statistischen Übersichten).<br />
Der Abgang belief sich auf ungewöhnlich hohe 3,4 Mrd. Euro, wobei die<br />
Statistische Differenz mit 3,5 Mrd. Euro ebenfalls ungewöhnlich hoch ausfiel. Gemäß<br />
dem globalen Trend nahmen auch in Österreich sowohl 2002 als auch 2003 die Direktinvestitionszuflüsse<br />
stark ab, es kam sogar zu De-Investitionen. Mit nur 1 Mrd.<br />
Euro an Direktinvestitionszuflüssen (rund 0,5 % des BIP) 2002 war dieser Rückgang<br />
deutlich spürbar, die österreichischen Direktinvestitionen im Ausland blieben hingegen<br />
mit 5,6 Mrd. Euro (ca. 2,6 % des BIP) auf einem konstant hohen Niveau. Das Defizit in<br />
der Kapitalbilanz im Jahr 2002 ergab sich daher einerseits aufgrund der Nettoabflüsse<br />
von Direktinvestitionen im Wert von 4,6 Mrd. Euro, andererseits flossen 2002 auch um<br />
4,2 Mrd. Euro mehr Portfoliokapital ins Ausland als in österreichischen Wertpapieren<br />
investiert wurde. Die offiziellen Währungsreserven blieben wegen der relativ strikten<br />
Geldpolitik der EZB stabil. 2003 wies die Kapitalbilanz zur Abdeckung der erneut defizitären<br />
Leistungsbilanz dann wieder den gewohnten Überschuss auf. Entsprechend der<br />
globalen Lage kam es nach wie vor zu De-Investitionen bei den Direktinvestitionen, die<br />
aktiven Direktinvestitionen lagen mit 6,3 Mrd. Euro jedoch nur unwesentlich über den<br />
im Jahresvergleich wieder deutlich gestiegenen Zuflüssen von 6,1 Mrd. Euro. Diese<br />
rasche und starke Erholung der passiven Direktinvestitionen spricht für den Wirtschafts-
Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick<br />
standort Österreich und reflektiert die oben erwähnten langfristigen Verbesserungen<br />
der Wettbewerbsfähigkeit infolge einer gestiegenen Produktivität und von verbesserten<br />
Lohnstückkosten. Die Entwicklung bei den kurzfristigeren Portfolioinvestitionen verlief<br />
genau gegenläufig: Während hier der Zufluss mit 20 Mrd. Euro im Vergleich zum Jahr<br />
2002 konstant blieb, gingen die österreichischen Portfolioinvestitionen in ausländischen<br />
Wertpapieren von 25 Mrd. auf 15 Mrd. Euro zurück. Der Saldo dieser Teilbilanz war<br />
somit 2003 mit 5 Mrd. Euro im Überschuss.<br />
Anmerkungen<br />
1 WIFO-Prognose vom April 2004. Das IHS ist etwas optimistischer und erwartet ein Wirtschaftswachstum<br />
von 2,1 %.<br />
2 Die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer wird erst 2005 die verfügbaren Einkommen<br />
merklich erhöhen und die Ausweitung des privaten Konsums beschleunigen. Der Gesamteffekt<br />
der zweiten Etappe der Steuersenkung auf das Wirtschaftswachstum im Jahr 2005 wird vom<br />
WIFO auf +0,3 Prozentpunkte geschätzt.<br />
3 In realer Rechnung ergeben sich wegen unterschiedlicher Preisentwicklung geringe Differenzen.<br />
4 Produktion je geleisteter Arbeitsstunde.<br />
5 Der Außenbeitrag unterscheidet sich von der Leistungsbilanz durch Importe auf fob-Basis,<br />
Importabgaben und den Reparaturvormerkverkehr.<br />
6 Differenzen zwischen den beiden Rechenwerken ergeben sich trotz einer verbesserten<br />
Abstimmung gemäß den Vorschriften des BOP Manual 5 des IWF nach wie vor (siehe auch<br />
vorhergehende Fußnote).<br />
7 Die Diskrepanz zwischen dem hier berichteten Überschuss in der Güterbilanz und dem in<br />
Kapitel 5 erwähnten Defizit in der Handelsbilanz lt. VGR erwächst nicht alleine aus Unterschieden<br />
zwischen den beiden Rechenwerken, sondern auch daher, dass der obigen Analyse<br />
bereits die revidierte Zahlungsbilanz für 2003 zugrunde liegt, während die April-Prognose<br />
des WIFO noch vor Verfügbarkeit dieser Daten erstellt wurde.<br />
95
5 ÖSTERREICHS WARENHANDEL<br />
Der österreichische Export expandierte in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre bis<br />
2001 kräftig. 2002 schwächte sich die Exportdynamik auf 4,2 % (real 5,2 %) ab und<br />
fiel 2003 auf 1,4 % (2,0 %) weiter zurück. Die Handelsbilanz war 2002 – zum ersten<br />
Mal seit dem 2. Weltkrieg – aktiv (+0,3 Mrd. Euro). Dazu trugen die guten Ergebnisse<br />
der Exportwirtschaft, der Importrückgang und die günstigen Terms of Trade<br />
(TOT) bei. Das Jahr 2003 brachte wieder ein Defizit, das allerdings mit 1,4 Mrd.<br />
Euro geringer als in den Vorjahren ausfiel. Langfristig zeigt die Handelsbilanz somit<br />
eine deutliche Tendenz zur Besserung. 2004 dürfte sich der Export nur wenig<br />
erholen, da die träge Konjunktur und die schwache Importnachfrage bei wichtigen<br />
Handelspartnern den Wachstumsspielraum einengen. Die österreichischen Exporte<br />
dürften 2004 um 4,3 % (real 4,5 %) zunehmen. Die Warenimporte werden 2004<br />
voraussichtlich mit 3,5 % (real +4,0 %) etwa gleich stark wie 2003 wachsen. Die<br />
Handelsbilanz sollte auch 2004 ein Defizit ausweisen, das aber mit 0,8 Mrd. Euro<br />
etwas geringer als 2003 ausfallen dürfte. Die Außenhandelspreise dürften – ebenso<br />
wie schon 2002 und 2003 – zurückgehen und die TOT sich leicht verbessern.<br />
Analysen der Warenstruktur des österreichischen Exports unter dem Aspekt der<br />
Wettbewerbsfähigkeit und Wachstumschancen zeigen seit den 1980er-Jahren<br />
eine Reihe von Schwächezeichen bei der Spezialisierung der österreichischen<br />
Industrie auf moderne, wachstumsorientierte und technologisch anspruchsvolle<br />
Produktionszweige.<br />
5.1 Überblick: Außenhandel 2002/03 sowie Ausblick<br />
auf 2004<br />
Der österreichische Export hat in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre sowie auch<br />
noch 2000 und 2001 – dank Ostöffnung und überwiegend günstiger <strong>internationale</strong>r<br />
Rahmenbedingungen – mit zeitweise zweistelligen Wachstumsraten kräftig expandiert.<br />
2002 schwächte sich die Dynamik auf 4,2 % (real +5,2 %) ab und fiel 2003 weiter auf<br />
1,4 % (+2,0 %) zurück. Die nachlassende Konjunktur bei wichtigen Handelspartnern<br />
in Westeuropa und Zahlungsbilanzprobleme in Mittel- und Osteuropa belasteten in<br />
beiden Jahren die Ausfuhr. 2003 kam die starke Euro-Aufwertung dazu, welche die<br />
preisliche Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Exportwirtschaft verschlechterte.<br />
Während Österreich 2002 Marktanteile im Export gewinnen konnte, mussten 2003<br />
real spürbare Positionsverluste hingenommen werden.<br />
Das Exportwachstum ließ im Laufe des Jahres 2001 merklich nach und erreichte im<br />
Frühjahr 2002 seinen Tiefpunkt (1. Quartal: +0,8 % gegenüber dem Vorjahr). Im Som-<br />
96
Österreichs Warenhandel<br />
mer 2002 setzte ein Aufschwung ein, der ein Jahr lang mit Wachstumsraten von etwa<br />
5 % anhielt. Im Dezember 2002 prognostizierte das WIFO für 2003 noch eine Exportzunahme<br />
um 6,6 % (siehe Tabelle 5.1). Die Erwartungen eines Konjunkturaufschwungs<br />
haben sich aber in Europa nicht erfüllt: Im Sommer 2003 brach der Export neuerlich<br />
ein (2. Quartal –3,0 %) und erholte sich seither nur wenig (siehe Abbildung 5.1).<br />
Österreichs Außenhandel: Überblick Tab. 5.1<br />
Export<br />
2001 2002 2003 2004* Zum Vergleich<br />
2003 Prognose<br />
2002 1)<br />
Mrd. Euro<br />
Werte 74,3 77,4 78,5 81,8 81,1<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Werte + 6,5 + 4,2 + 1,4 + 4,3 + 6,6<br />
Real + 7,5 + 5,2 + 2,0 + 4,5 + 5,5<br />
Preise - 0,9 - 0,9 - 0,6 - 0,2 + 1,0<br />
Import<br />
Mrd. Euro<br />
Werte 78,7 77,1 79,8 82,6 81,2<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Werte + 5,0 - 2,0 + 3,5 + 3,5 + 6,9<br />
Real + 5,8 + 0,8 + 4,8 + 4,0 + 5,8<br />
Preise - 0,7 - 2,8 - 1,2 - 0,5 + 1,0<br />
Saldo<br />
Mrd. Euro<br />
Werte -4,4 0,3 - 1,4 - 0,8 - 0,1<br />
Veränderung 0,8 4,7 - 1,7 0,6 - 0,3<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
TOT - 0,2 + 2,0 + 0,6 + 0,3 + 0,0<br />
1) WIFO-Prognose vom Dezember 2002.<br />
* WIFO-Prognose vom April 2004.<br />
Quelle: Statistik Austria, Preise laut WIFO.<br />
Die Inlandskonjunktur war 2002 schwach (BIP real +1,4 %) und gab 2003 weiter nach<br />
(+0,7 %). Während aber 2002 die Importe um 2,0 % zurückgingen (real +0,8 %), nahmen<br />
sie 2003 mit 3,5 % (real +4,8 %) unerwartet stark zu. Maßgeblich für diese gegenläufige<br />
Entwicklung war die Nachfrage nach Investitionsgütern: Sie war 2001 und insbesondere<br />
2002 rückläufig, zog aber 2003 merklich an. Daran waren die durch die Investitionsprämie<br />
ausgelösten Vorzieheffekte beteiligt. 2003 wurden auch erheblich mehr PKWs<br />
gekauft (Echoeffekt: 4 Jahre nach Einführung der NOVA). Die Importverbilligung trug<br />
2002 mit –2,8 % mehr als 2003 (–1,2 %) zur Dämpfung der Einfuhr bei.<br />
Die Handelsbilanz war 2002 – zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg – aktiv (+0,3 Mrd.<br />
Euro). Dazu trugen die guten Ergebnisse der Exportwirtschaft, der Importrückgang<br />
97
Österreichs Export: Quartale nominell Abb. 5.1<br />
Veränderungen gegen das Vorjahr in %<br />
und die günstige Entwicklung der (TOT) bei. Das Jahr 2003 brachte wieder ein Defizit,<br />
das allerdings mit –1,4 Mrd. Euro geringer als in den Vorjahren war. Langfristig zeigt<br />
die österreichische Handelsbilanz somit eine deutliche Tendenz zur Besserung. Die<br />
unterschiedliche Dynamik der Exporte und Importe wirkte sich auf das Wirtschaftswachstum<br />
aus: Lieferte 2002 der Außenbeitrag noch Wachstumsimpulse, so dämpfte<br />
er 2003 das Wachstum.<br />
In der Weltwirtschaft setzte bereits 2002 eine Erholung ein, die 2003 an Stärke gewann<br />
und sich 2004 weiter fortsetzen dürfte. Der Aufschwung erfasste bisher allerdings vor<br />
allem die USA und den Fernen Osten (insbesondere China), 2003 auch Japan. In<br />
der EU-15 bzw. der Eurozone erreicht hingegen die Konjunktur 2003 den Tiefpunkt<br />
und dürfte 2004 nur sehr verhalten anziehen. Vor allem die anhaltende Stagnation in<br />
Deutschland bremst das Wachstum. Auch der Welthandel gewann seit 2002 an Dynamik<br />
und dürfte 2004 real um 7,5 % zunehmen. Das Wachstum der österreichischen<br />
Märkte wird allerdings 2004 um 2,5 Prozentpunkte niedriger sein.<br />
Der WIFO-Prognose vom April 2004 liegt die Annahme zugrunde, dass der Erdölpreis<br />
von 28,2 USD je Barrel 2003 auf 31 USD je Barrel 2004 ansteigen und der Euro gegenüber<br />
dem Dollar um etwa 8 % weiter aufwerten wird.<br />
Die träge Konjunktur bei wichtigen Handelspartnern engt 2004 den Wachstumsspielraum<br />
für die österreichische Warenausfuhr ein. Die Aufwertung des Euro wird einen<br />
Anstieg des effektiven Wechselkursindex für Industriewaren um 1,3 % zur Folge haben.<br />
Die realen Lohnstückkosten in einheitlicher Währung gegenüber den Handelspartnern<br />
98<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
0<br />
-3<br />
12,9<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
6,1 5,3<br />
2001<br />
2,4<br />
0,8<br />
6,6<br />
2002<br />
4,4<br />
5,1<br />
4,2<br />
-3,0<br />
2,6<br />
2003<br />
1,9
Österreichs Warenhandel<br />
werden sich – nach einer spürbaren Verschlechterung 2003 – 2004 wieder leicht (um<br />
1 %) verbessern, dennoch werden die heimischen Unternehmen Marktanteile verlieren.<br />
Die österreichischen Exporte dürften 2004 um 4,3 % (real 4,5 %) zunehmen.<br />
Die Warenimporte werden 2004 mit 3,5 % (real +4,0 %) etwa gleich stark wie 2003<br />
wachsen. Die Handelsbilanz wird auch 2004 ein Defizit ausweisen, das aber mit<br />
0,8 Mrd. Euro etwas geringer als 2003 ausfallen wird. Die Außenhandelspreise dürften<br />
– ebenso wie schon 2002 und 2003 – erneut zurückgehen. Die Verbilligung dürfte<br />
mit 0,2 % im Export bzw. 0,5 % im Import geringer ausfallen als in den Vorjahren und<br />
somit die TOT leicht verbessern.<br />
5.2 Aktive Handelsbilanz im Jahr 2002<br />
Das Wachstum der österreichischen Exporte ließ 2002 mit +4,2 % (real +5,2 %) weiter<br />
nach. Die Exportpreise blieben um 0,9 % unter dem Vorjahresniveau. Die <strong>internationale</strong>n<br />
Rahmenbedingungen – die schon 2001 für die österreichischen Exporteure<br />
schwierig waren – verschlechterten sich weiter. Bei wichtigen Handelspartnern in der<br />
Eurozone – insbesondere Deutschland – gab die Konjunktur nach. Auch die Nachfrage<br />
in den EU-Beitrittsländern lieferte weniger Impulse als in der Vergangenheit.<br />
Der Konjunkturaufschwung in den USA und in Asien (ohne Japan) sowie die damit<br />
zusammenhängende Belebung des Welthandels brachten der österreichischen Exportwirtschaft<br />
unmittelbar nur relativ wenige Vorteile.<br />
Der Export in die EU-15 nahm nur um 3,0 % zu, wobei vor allem die Lieferungen nach<br />
Frankreich und Deutschland nur knapp über dem Vorjahresniveau blieben. Der Extra-<br />
EU-Export (+6,1 %) entwickelte sich regional stark unterschiedlich: Kräftigen Zunahmen<br />
nach Südosteuropa und Südostasien (insbesondere nach China und den „4 Tigern“)<br />
stand eine mäßige Steigerung der Ausfuhren nach Mittel- und Osteuropa (4,2 %),<br />
der EFTA (4,4 %), den USA und Japan gegenüber. Der niedrige Erdölpreis engte das<br />
Importpotential der Energieexporteure ein (OPEC –12,1 %, Russland +1,7 %).<br />
Von der ausländischen Nachfrageschwäche waren vor allem die österreichischen<br />
Exporteure konsumnaher Fertigwaren (+1,8 %) und Bearbeiteter Waren (+0,7 %, davon<br />
Textilien –3,1 %, Stahl –1,6 %) betroffen. Etwas besser schnitten die Exporteure<br />
von Maschinen und Fahrzeugen ab, u.a. weil der Auslandsabsatz von PKWS florierte<br />
(+7,9 %). Kräftig ausgeweitet wurden auch die Chemieexporte (+12,0 %).<br />
Die österreichische Exportwirtschaft konnte sich 2002 im <strong>internationale</strong>n Wettbewerb<br />
gut behaupten und lieferte – gemessen an der schwachen Konjunktur – ein durchaus<br />
zufrieden stellendes Ergebnis. Dazu trug die Verbesserung der relativen Lohnstückkosten<br />
in der Sachgütererzeugung (gegenüber den Handelspartnern um 0,7 %, gegenüber<br />
Deutschland um 0,5 %) bei. Die realen Exporte Österreichs nahmen um gut 1½ Pro-<br />
99
zentpunkte stärker zu als der Welthandel und um fast 3½ Prozentpunkte mehr als das<br />
errechnete Wachstum der österreichischen Ausfuhrmärkte. 1 Die nominelle Rechnung<br />
wies ebenfalls auf eine beachtliche Ausweitung des österreichischen Marktanteils am<br />
OECD-Export hin (siehe Tabelle 5.2). Die österreichischen Anbieter verbesserten ihre<br />
Position gegenüber den Konkurrenten vor allem in Westeuropa – bemerkenswert war<br />
insbesondere das Vordringen auf den deutschen Markt –, in den Industriestaaten und<br />
in den Entwicklungsländern, in Übersee und auch in Südosteuropa. Nicht behaupten<br />
konnte Österreich hingegen seine Stellung in Mittel- und Osteuropa und in den Nachfolgestaaten<br />
der ehemaligen UdSSR.<br />
Österreichs Export-Marktanteile: Real und nominell Tab. 5.2<br />
Real<br />
Veränderung des Marktanteils<br />
100<br />
2000 2001 2002 2003 1) 2004<br />
Prognose<br />
am Marktwachstum + 0,8 + 5,2 + 3,3 - 2,1 - 0,5<br />
am Welthandel + 0,7 + 7,2 + 1,7 - 1,9 - 2,8<br />
Bestimmungsfaktoren<br />
In %<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Marktwachstum + 12,2 + 2,2 + 1,8 + 4,2 + 5,0<br />
Welthandel + 12,3 + 0,3 + 3,4 + 4,0 + 7,5<br />
Österreichs Export + 13,1 + 7,5 + 5,2 + 2,0 + 4,5<br />
Nominell<br />
Veränderung des Marktanteiles<br />
am OECD-Export in die Welt - 6,3 + 6,9 + 6,7 + 6,7<br />
Marktanteil am OECD-Export 1,59 1,70 1,82 1,94<br />
1) Real: Prognose; Nominell: Jänner bis Oktober.<br />
Quelle: OECD, WIFO.<br />
Die schwache Inlandskonjunktur, gemeinsam mit der merklichen Verbilligung der<br />
Importgüter (–2,8 %), hatten einen Rückgang der Einfuhren um 2 % zur Folge. Real<br />
(preisbereinigt) nahmen die Importe nur um 0,8 % zu. Der Einbruch der Importe setzte<br />
bereits zu Jahresende 2001 ein und erreichte im 1. Quartal 2002 (–3,2 %) seinen<br />
Tiefpunkt. Seit dem Frühjahr 2002 stabilisierten sich die Importe in etwa auf dem<br />
Vorjahresniveau. 2002 ging vor allem die Inlandsnachfrage nach Gütern mit hoher<br />
Importintensität, wie Ausrüstungsinvestitionen und dauerhaften Konsumgütern, stark<br />
zurück. Die Importe von Maschinen und Fahrzeugen schrumpften um 5,0 % unter<br />
das Vorjahresniveau, jene von bearbeiteten Waren um 5,7 % und an konsumnahen<br />
Fertigwaren wurde um 2,0 % weniger importiert als 2001.<br />
Die österreichische Handelsbilanz war 2002 – zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg – mit<br />
+0,3 Mrd. Euro (0,1 % des BIP) aktiv. Der Bilanzüberschuss gilt als ein großer Erfolg der<br />
In %
Österreichs Warenhandel<br />
Wirtschaftspolitik. Zu diesem Ergebnis trugen die Stärke der österreichischen Exportwirtschaft<br />
ebenso wie auch die schwachen Importe und die günstige Entwicklung der<br />
Außenhandelspreise bei. Im Vergleich zu 2001 verbesserte sich die Bilanz um 4,7 Mrd.<br />
Euro. Die Exporte nahmen um 3,1 Mrd. Euro zu, die Importe gingen um 1,6 Mrd. Euro<br />
zurück. Der Bilanzerfolg war somit zu etwa zwei Drittel dem Anstieg der Exporte, zu<br />
einem Drittel dem Rückgang der Importe zuzuschreiben. Real (preisbereinigt) verbesserte<br />
sich die Handelsbilanz um 3,2 Mrd. Euro, der Preiseffekt (Verbesserung der TOT<br />
um 2 %) war mit 1,5 Mrd. Euro am Ergebnis beteiligt (Tabelle 5.3).<br />
Handelsbilanz: Preis- und Mengeneffekte Tab. 5.3<br />
2001 2002 2003<br />
Veränderung zum Vorjahr<br />
in Mrd. Euro<br />
Export 4,6 3,2 1,1<br />
Import 3,8 -1,6 2,7<br />
Handelsbilanz 0,8 4,7 -1,7<br />
Davon Mengeneffekt 1)<br />
Export 5,2 3,8 1,5<br />
Import 4,3 0,6 3,7<br />
Saldo 0,9 3,2 -2,1<br />
Preiseffekt<br />
Export -0,6 -0,7 -0,5<br />
Import -0,5 -2,2 -0,9<br />
Saldo -0,1 1,5 0,5<br />
Handelsbilanz<br />
Nominell (in Mrd. Euro) -4,4 0,3 -1,4<br />
In % des BIP -2,1 0,1 -0,6<br />
1) Einschließlich Mischeffekt.<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
5.3 Starker Exporteinbruch im Jahr 2003<br />
2003 war kein Glanzjahr für die österreichische Außenwirtschaft: Die Exportdynamik<br />
verzeichnete den Tiefpunkt der vergangenen Dekade, der Außenhandel war kein<br />
Wachstumsmotor, sondern dämpfte die – ohnehin bescheidenen – inländischen Antriebskräfte.<br />
Die Exporte zu laufenden Preisen stiegen nur um 1,4 %, real um 2,0 %.<br />
Die Importe nahmen, vor allem infolge kräftiger Ausrüstungsinvestitionen und hoher<br />
PKW-Neuanschaffungen, mit +3,5 % (real +4,8 %) merklich stärker als die Exporte<br />
zu. Die Handelsbilanz war mit 1,4 Mrd. Euro passiv, das Defizit verschlechterte sich<br />
um 1,7 Mrd. Euro.<br />
101
5.3.1 Schlechte Rahmenbedingungen für den Export<br />
Die Rahmenbedingungen für den österreichischen Export waren 2003 ungünstig. Die<br />
<strong>internationale</strong> Konjunktur und der Welthandel belebten sich zwar leicht, doch blieb der<br />
Aufschwung weitgehend auf Nordamerika und Asien beschränkt. In Westeuropa – vor<br />
allem in Deutschland – schwächte sich das Wachstum weiter ab. Das Importpotential<br />
der EU-Beitrittsländer in Mittel- und Osteuropa wurde durch Zahlungsbilanz-Probleme<br />
gebremst. Zu der anhaltenden Nachfrageschwäche bei den wichtigen Handelspartnern<br />
in Europa kam die starke Aufwertung des Euros zum Dollar (+19,7 %) hinzu.<br />
Der nominell-effektive Wechselkurs zeigte für 2003 einen Anstieg gegenüber den<br />
Währungen der Handelspartner von 3,8 %, unter Berücksichtigung der länderspezifischen<br />
Preisentwicklung stieg der real-effektive Wechselkursindex um 2,8 %. Die<br />
relativen Lohnstückkosten (in einheitlicher Währung) in der Sachgütererzeugung<br />
nahmen erstmals seit 1995 stärker als bei den Handelspartnern zu (+2,1 %), sodass<br />
sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen außerhalb der<br />
Eurozone verschlechterte.<br />
Die Exportpreise gingen 2003 infolge der nur mäßigen Zunahme der Erzeugerpreise,<br />
der schwachen Konjunktur in den wichtigen österreichischen Exportmärkten in Europa<br />
und des verstärkten Konkurrenzdrucks aufgrund der Aufwertung leicht zurück (um<br />
0,6 %). Die Importpreise sanken trotz der spürbaren Verteuerung von Rohöl dank der<br />
Euro-Aufwertung um 1,2 %. Die Austauschverhältnisse der Exporte zu den Importen<br />
(TOT) konnten sich somit verbessern.<br />
Die aufwertungsbedingte Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit<br />
schlug sich in Marktanteilsverlusten nieder. Die realen österreichischen Exporte stiegen<br />
um jeweils etwa 2 Prozentpunkte schwächer als die österreichischen Ausfuhrmärkte<br />
bzw. der Welthandel. In nomineller Rechnung (bis Oktober 2003) konnte Österreich<br />
allerdings Marktanteile am OECD-Export gewinnen (+6,7 %). Divergenzen zwischen<br />
nominellen und realen Daten können kurzfristig infolge von Wechselkursschwankungen<br />
auftreten. Die Berechnung realer Marktanteile ist aufgrund fehlender regionaler<br />
Preisstatistiken nur eingeschränkt bzw. nur mit Hilfe von Schätzungen möglich. In<br />
Deutschland musste z.B. Österreich einen Verlust an realen Marktanteilen von –4 %<br />
2003 hinnehmen, in den USA von –6 % (vgl. hiezu Wolfmayr, 2004).<br />
5.3.2 Regionale Entwicklung<br />
Die schwache Konjunktur spiegelte sich vor allem im stagnierenden Export in die EU-<br />
15 (+0,5 %) wieder. Der Nachfrageausfall wirkte sich spürbar auf den Export nach<br />
Deutschland aus (nur +0,9 % Zuwachs), dem wichtigsten Handelspartner Österreichs<br />
102
Österreichs Warenhandel<br />
mit einem Exportanteil von 31,9 %. Die Flaute im Deutschland-Export ist indirekt zum<br />
Teil ebenfalls auf die Euro-Aufwertung zurückzuführen: Die deutsche Exportindustrie<br />
– zu der österreichische Betriebe enge Zulieferbeziehungen unterhalten – setzte<br />
57 % in Ländern außerhalb der Eurozone ab und war deshalb in hohem Maße von<br />
der Wechselkursentwicklung betroffen. Starke Rückschläge mussten im Export nach<br />
Großbritannien (–6,1 %), den Niederlanden und Spanien hingenommen werden, relativ<br />
gut waren die Ergebnisse in Italien.<br />
Auch der Export außerhalb der EU-15 verlor mit einer Zuwachsrate von 2,8 % im Vergleich<br />
zu den letzten Jahren deutlich an Schwung. In wichtigen Ländern und Regionen<br />
mussten Rückschläge hingenommen werden. Die Ausfuhren in die Schweiz blieben um<br />
0,3 % unter dem Vorjahresniveau, jene nach Japan um 6,2 % darunter. Die Exporte<br />
in die Entwicklungsländer außerhalb der OPEC (NOPEC) schrumpften um 9,9 %. Betroffen<br />
waren insbesondere die Ausfuhren nach China (–23,3 %), die NIC-6 (–9,1 %)<br />
und Südamerika. Vor dem Hintergrund der guten Konjunktur im fernöstlichen Raum<br />
ist das schlechte Abschneiden der österreichischen Exporteure auf diesen Märkten<br />
enttäuschend. Wettbewerbsnachteile durch den starken Euro spielten dabei mit eine<br />
Rolle. Eine WIFO-Studie zu Exportpotentialen der österreichischen Industrie zeigte<br />
allerdings auch auf, dass die Branchenstruktur des österreichischen Exportangebots<br />
zu wenig an die Nachfragestruktur der dynamischen Märkte in Fernost angepasst ist<br />
(Stankovsky/Wolfmayr, 2003).<br />
Der Export in die OPEC entwickelte sich – nach einem starken Einbruch 2002 – relativ<br />
lebhaft (+4,2 % insgesamt; Iran 43,5 %, Saudi-Arabien +14,8 %). Der Handel<br />
mit Nordamerika erreichte in den 1990er-Jahren eine hohe Dynamik, die aber schon<br />
2002 – als Folge der Konjunkturabschwächung aber auch der Euro-Aufwertung – zum<br />
Erliegen kam und auch 2003 nicht wieder an die früheren Jahre anschließen konnte.<br />
Die Exporte in die USA waren nur um rund 2 % höher als 2002. Sie schrumpften im<br />
ersten Halbjahr 2003 um 7 %, erholten sich aber in der zweiten Jahreshälfte – getragen<br />
vor allem durch Exporte von Maschinen und Fahrzeugen – außerordentlich kräftig.<br />
Mit einem Anteil von 5,2 % waren die USA 2003 der drittwichtigste österreichische<br />
Exportmarkt.<br />
Wichtige Stütze des österreichischen Exports waren 2003 – ebenso wie schon im<br />
Vorjahr – die Märkte Südosteuropas (+10,4 %; Rumänien +24,8 %; Bulgarien +11,4 %).<br />
Österreich nutzte auf den als unsicher geltenden Märkten seinen Informationsvorsprung.<br />
Der Konjunkturaufschwung in Russland, der auf hohen Energiepreisen basiert,<br />
kam auch den österreichischen Exporteuren zugute (+18,2 %). Stark ausgeweitet<br />
wurden auch die Ausfuhren in die Ukraine.<br />
Eher mäßig war das Wachstum der Ausfuhren in die EU-Beitrittsländer, das sich von<br />
5,9 % 2002 auf nur 3,0 % abschwächte. Die Ausfuhren in die baltischen Staaten<br />
103
nahmen zwar kräftig zu (+19,7 %), der Export in die MOEL-5 zeigte hingegen weniger<br />
Schwung. Die Länder dieser Region, die bereits eng mit der EU integriert sind, waren<br />
durch den Konjunktureinbruch in Westeuropa stärker betroffen.<br />
Vor allem der Nachfrageausfall in Ungarn (mit –4,9 % Wachstum) wirkte sich spürbar<br />
aus. Die Exporte nach Ungarn entwickelten sich schon im dritten Jahr in Folge rückläufig,<br />
seit 1997 auch die Marktanteile österreichischer Unternehmen. Stand Ungarn<br />
1997 an der 3. Stelle der österreichischen Exportrangliste, so fiel es 2003 auf den<br />
7. Rang zurück, bleibt damit aber immer noch der wichtigste Absatzmarkt in Osteuropa<br />
(MOEL-27). Eine drastische Zinserhöhung sowie nachlassende Wettbewerbsstärke<br />
dämpften das Wirtschaftswachstum und die Importe Ungarns. Betroffen waren insbesondere<br />
die österreichischen Lieferungen in der Maschinen- und Fahrzeugindustrie.<br />
Auch Unternehmensschließungen auf österreichischer Seite sowie eine teilweise<br />
Substitution von Warenexporten durch Direktinvestitionen dürften eine Rolle gespielt<br />
haben. Der österreichische Außenhandel mit Ungarn – wie auch jener mit anderen<br />
Nachbarstaaten – war in letzter Zeit durch einen verstärkten Handel mit Zwischenprodukten<br />
und Vorleistungen im Rahmen einer verstärkten vertikalen Arbeitsteilung mit<br />
diesen Ländern gekennzeichnet, die zu einem großen Teil über sogenannte „vertikale<br />
Direktinvestitionen“ (Auslagerung von Teilen der Produktion des österreichischen Unternehmens)<br />
erfolgt (vgl. Wolfmayr, 2004). Vertikale Direktinvestitionen und Exporte<br />
stehen dabei in einer komplementären Beziehung zueinander.<br />
Eher schwach war das Wachstum der österreichischen Exporte nach Polen (+2,5 %).<br />
Eine Verschlechterung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Anbieter<br />
durch die Aufwertung des Euros gegenüber der polnischen Währung von 14 %<br />
dürfte hier mit eine Rolle gespielt haben. Kräftiger entwickelten sich die Ausfuhren in<br />
die Slowakei (+11,4 %), nach Slowenien (+10,8 %) sowie Tschechien (+7,1 %).<br />
Der Anteil der MOEL-27 (früheren Planwirtschaften) am österreichischen Gesamtexport<br />
war 2003 mit 18,7 % der höchste seit 1989 und konnte sich seit dem <strong>politische</strong>n<br />
Umbruch in Osteuropa verdoppeln. Die acht Beitrittsländer aus Mittel- und Osteuropa<br />
waren mit 12,6 % am Export beteiligt. Sie stellen damit nach der EU die wichtigste<br />
Exportregion dar. Mit Malta und Zypern ergibt sich für die zehn EU-Beitrittsländer<br />
ein Exportanteil von 12,7 %. Ab 1. Mai 2004 werden demnach fast drei Viertel des<br />
österreichischen Außenhandels innergemeinschaftlicher Warenaustausch mit den<br />
wesentlichen Merkmalen des Binnenhandels sein (vgl. Wolfmayr, 2004).<br />
5.3.3 Sektorale Entwicklung<br />
Die Investitionsschwäche in der Eurozone, insbesondere in Deutschland, war die<br />
Hauptursache für die Stagnation der österreichischen Lieferungen von Maschinen und<br />
104
Österreichs Warenhandel<br />
Fahrzeugen (–0,6 %). Exportrückgänge verzeichneten u.a. die Autozulieferindustrie<br />
(–3,6 %), PKWs (–10,8 %), Büro- und EDV-Maschinen (–9 %), sowie Nachrichtengeräte<br />
(–16,2 %). Bei Nachrichtengeräten dürfte die Schließung einer österreichischen<br />
Produktionsstätte für TV-Geräte die Statistik beeinflussen. Auch der Auslandsabsatz<br />
von Konsumwaren nahm nur unterdurchschnittlich zu. Die Exporte Bearbeiteter Waren<br />
stiegen insgesamt um 3,1 %, wobei einer kräftigen Erholung der Stahlexporte ein<br />
spürbarer Rückgang bei Textilien gegenüber stand. Der Agrarexport setzte seinen<br />
Aufschwung fort.<br />
Der Warenimport stieg 2003 mit nominell 3,5 % und real 4,8 % deutlich kräftiger an als<br />
der Export. Die Impulse kamen dabei vor allem aus der Belebung bei den Ausrüstungsinvestitionen<br />
– einer Nachfragenkomponente mit hohem Importgehalt (60 %). Nach<br />
dem Einbruch der Investitionen 2001 sowie insbesondere 2002 war der Zuwachs um<br />
6 % 2003 ein Ergebnis von Nachholeffekten, aber auch der Investitionszuwachsprämie,<br />
die Anreize zu vorgezogenen Investitionen schuf. Die übrigen Nachfragekomponenten<br />
mit hoher Importwirkung – Exporte und dauerhafte Konsumgüter – blieben schwach.<br />
Eine Ausnahme war die kräftige Nachfrage nach PKWs. Ausschlaggebend dafür war<br />
ein „Echoeffekt“, wonach drei bis vier Jahre nach einem Neukauf eine Ersatzwelle einsetzt.<br />
Zuletzt wurden 1999 im Vorfeld der NOVA-Einführung im großen Ausmaß PKWs<br />
angeschafft, sodass 2003 der Echoeffekt wirksam wurde, der durch die Einführung<br />
neuer Automodelle zusätzlich verstärkt wurde (vgl. Wüger, 2004).<br />
Die Einfuhr von Maschinen und Fahrzeugen – die 2002 um 5,0 % schrumpfte – nahm<br />
2003 um 4,3 % zu (PKWs: +14,3 %). An Bearbeiteten Waren wurde um 2,2 % mehr importiert<br />
(Eisen und Stahl 8,7 %). Die Einfuhr von konsumnahen Fertigwaren stagnierte.<br />
Leicht rückläufig waren die Einfuhren von Rohstoffen (–0,7 %). Während die Importe<br />
von Erdöl mengenmäßig um –5,7 % zurückgingen, wurden die Mengen wichtiger<br />
Energieträger erheblich ausgeweitet (Erdgas +22 %, Strom 23,6 %, Erdölprodukte<br />
18,1 %). Die Importpreise von Erdöl (29,9 USD je Barrel) verteuerten sich auf Dollarbasis<br />
um 19,6 %, auf Eurobasis (196,1 Euro je Tonne) verbilligten sie sich hingegen<br />
um 0,1 %. Insgesamt nahmen die Importe von Brennstoffen wertmäßig von 5,7 Mrd.<br />
Euro auf 6,4 Mrd. Euro (+11,8 %) zu. Der Anteil der Brennstoffe am Gesamtimport,<br />
der 2000 – trotz wesentlich höherer Erdölpreise – nur 6,5 % ausgemacht hatte, stieg<br />
auf 8,0 %. Der Anteil der Brennstoffimporte am BIP war mit 2,9 % der höchste seit<br />
1985 (siehe Tabelle 5.4).<br />
105
Österreichs Energieimporte Tab. 5.4<br />
5.4 Regionale Struktur des Außenhandels:<br />
Bedeutung der EU-Erweiterung<br />
Die Regionalstruktur des Außenhandels wird von der geographischen und geo<strong>politische</strong>n<br />
Lage (Distanzen, Transportkosten), den historischen und kulturgeschichtlichen<br />
Beziehungen (Sprache, Mentalität), Wachstumsunterschieden sowie der Handelspolitik<br />
(Integration, Zugehörigkeit zu <strong>politische</strong>n Gruppierungen, Handelshemmnisse) bestimmt.<br />
Diese Faktoren wirken sich überwiegend mittel- und langfristig aus. Kurzfristig<br />
spielen für die regionale Zusammensetzung der Aus- und Einfuhren u.a. die Wechselkurse,<br />
Konjunkturdifferenzen und <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Eingriffe eine wichtige Rolle.<br />
Die regionale Ausrichtung des österreichischen Außenhandels wurde in den 1970er-<br />
und 1980er-Jahren vor allem durch die wechselvollen Auswirkungen der EFTA- und<br />
EG-Integration, die GATT-Liberalisierung sowie die Schwankungen der Energiepreise<br />
nach dem ersten Erdölschock 1973 beeinflusst, in den 1990er-Jahren durch die<br />
Ostöffnung sowie die schrittweise Einbeziehung der früheren Planwirtschaften in die<br />
europäischen Strukturen. Der Beitritt Österreichs zur EU im Jahr 1995 sowie die Euro-<br />
Einführung 2002 hatten unmittelbar keine messbaren Auswirkungen auf die regionale<br />
Außenhandelsstruktur, da die wichtigsten Integrationseffekte bereits früher realisiert<br />
worden sind (siehe auch Tabellen 5.7 – 5.10 in den Statistischen Übersichten).<br />
106<br />
1999 2000 2001 2002 2003<br />
Mrd. Euro<br />
Brennstoffe, Energie 2,9 4,9 5,5 5,7 6,4<br />
Erdöl und -erzeugnisse 2,0 3,4 3,3 3,3 3,5<br />
Erdöl 0,9 1,7 1,7 1,6 1,5<br />
Anteile am Gesamtimport in %<br />
Brennstoffe, Energie 4,4 6,5 7,0 7,4 8,0<br />
Erdöl und -erzeugnisse 3,0 4,5 4,2 4,2 4,4<br />
Erdöl 1,4 2,3 2,1 2,1 1,9<br />
In % des BIP<br />
Brennstoffe, Energie 1,5 2,4 2,6 2,6 2,9<br />
Erdöl und -erzeugnisse 1,0 1,6 1,5 1,5 1,6<br />
Erdöl 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7<br />
Importpreise für Erdöl<br />
Euro je t 121,7 238,5 212,6 196,4 196,1<br />
USD je Barrel 17,5 29,3 25,6 25,0 29,9<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO.
Österreichs Warenhandel<br />
5.4.1 Starke Ausweitung der Exporte nach Mittel- und Osteuropa<br />
Am 1. Mai 2004 wurden zehn neue Staaten in die EU aufgenommen. Zu den Beitrittsländern<br />
zählen fünf Länder aus Mittel- und Osteuropa (Polen, Slowenien, Tschechien,<br />
Ungarn und die Slowakei), drei baltische Länder (Estland, Lettland, Litauen) sowie<br />
Malta und Zypern. Mit den Nachbarstaaten baute die österreichische Wirtschaft seit<br />
der Ostöffnung 1989 intensive Wirtschaftsbeziehungen auf. Die übrigen Beitrittsländer<br />
spielten im österreichischen Außenhandel bisher eine unbedeutende Rolle, ihr Anteil<br />
am Gesamthandel überstieg nicht die 0,1 %-Marke. Die Erweiterung der EU um die<br />
baltischen Länder sowie Malta und Zypern dürfte damit insgesamt nur eine geringe<br />
wirtschaftliche Bedeutung für Österreich haben. Ausgehend von einem geringen Niveau<br />
des bilateralen Handels entwickelte sich aber die Ausfuhr in die baltischen Länder<br />
sehr dynamisch. Eine aktuelle Studie des WIFO zeigt, dass relativ viele Unternehmen<br />
die Märkte im Baltikum als interessant für ihr Unternehmen einstufen und sich hier in<br />
Zukunft wichtige Marktpotentiale für österreichische Unternehmen ergeben könnten<br />
(Stankovsky/Wolfmayr, 2003).<br />
Die Änderung der <strong>politische</strong>n und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach 1989 hat<br />
sich nachhaltig auf den Außenhandel mit den früheren Planwirtschaften ausgewirkt.<br />
Der Übergang dieser Region zur Demokratie und Marktwirtschaft hat für Österreich<br />
nicht nur die latente Bedrohung an der langen Ostgrenze (1.300 km) beseitigt, sondern<br />
brachte auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Österreich kam aus einer Randlage<br />
an der Grenze zwischen West und Ost in die Mitte eines zusammenwachsenden Kontinents,<br />
wodurch sich seine Standortattraktivität erheblich erhöhte (Stankovsky/Wolfmayr-Schnitzer,<br />
1995; Mayerhofer/Wolfmayr-Schnitzer, 1997). Die vorliegenden Simulationen<br />
der Effekte der Ostöffnung bzw. einer EU-Osterweiterung ergeben vorwiegend<br />
positive Wachstumsimpulse für die österreichische Wirtschaft (Breuss/Schebeck, 1996,<br />
1998; Breuss, 2001, 2002). Während die Mehrheit der österreichischen Unternehmen<br />
sich gut an die neuen Bedingungen anpasste und die Chancen entsprechend nutzte,<br />
verdeckte die positive Gesamtbewertung die teilweise großen Anpassungsprobleme<br />
in einigen der weniger wettbewerbsfähigen Produktbereichen.<br />
Schon vor der Ostöffnung 1989 hatte Österreich in den wirtschaftlichen Ost-West-<br />
Beziehungen spezifische Wettbewerbsvorteile und Kenntnisse gesammelt und eine<br />
Brückenfunktion zu den Ostmärkten aufgebaut. Diese Kenntnisse konnte Österreich<br />
vor allem in den ersten Jahren nach dem Umbruch im Osten zu seinem Vorteil nutzen.<br />
Früher als seine Konkurrenten erschlossen österreichische Unternehmen den neuen<br />
Markt und machten von den dortigen Investitionsmöglichkeiten Gebrauch. Österreich<br />
– vor allem Wien – wurde auch zu einem bevorzugten Standort für Osteuropazentralen<br />
multinationaler Konzerne (Stankovsky/Wolfmayr-Schnitzer, 1996; Mayerhofer/Wolf-<br />
107
mayr-Schnitzer, 1997). Die Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen mit Osteuropa<br />
stützte sich auch auf die schrittweise Integration der Region auf Grundlage der „Europaverträge“<br />
sowie auf die bedeutende Wirtschaftshilfe.<br />
Die österreichischen Exporte in die MOEL-27 stiegen zwischen 1993 und 2003 um das<br />
3,3fache, in die erfolgreichen Transformationsländer in Mittel- und Osteuropa (Ungarn,<br />
Tschechien, Slowakei, Polen) um das 2,9fache. Die Ausfuhren nach Südosteuropa entwickelten<br />
sich – nach dem Ende der Krise am Balkan – ebenfalls sehr gut. Die Exporte<br />
nach Russland bzw. die GUS verloren zwar in den 1990er-Jahren an Bedeutung, erholten<br />
sich aber wieder merklich. Infolge dieser dynamischen Entwicklung vergrößerte<br />
sich der Anteil der Ostexporte an der Gesamtausfuhr von 12½ % 1993 auf fast 19 %<br />
2003, jener von Mittel- und Osteuropa von 8 % auf 10½ %. Unter den 20 wichtigsten<br />
Handelspartnern Österreichs waren acht in Mittel- und Osteuropa. Produkte aus der<br />
Region konnten dank günstiger Preise, Qualitätssteigerungen und Unternehmensverflechtung<br />
ihre Position auf dem österreichischen Markt ständig ausbauen, der Anteil<br />
Osteuropas an der Einfuhr (14,7 %) hat sich seit 1993 in etwa verdoppelt.<br />
Die Bedeutung Osteuropas für den Außenhandel ist in Österreich zwei- bis dreimal größer<br />
als in anderen westlichen Ländern. An den Exporten der Industriestaaten (OECD)<br />
in die früheren Planwirtschaften war Österreich 2002 mit 6,7 % beteiligt, am Export<br />
nach Osteuropa mit 7,6 %, nach Südosteuropa mit 10,4 %. Für die Nachbarländer in<br />
Osteuropa zählt Österreich zu den wichtigsten Handelspartnern. Diese Marktstellung<br />
ist beachtlich, weil Österreich mit 8 Mio. Einwohnern ein relativ kleines Land ist und<br />
an den Exporten der OECD in die Welt nur mit 1,9 % partizipiert.<br />
Am stärksten vertreten ist Österreich in den MOEL-5. Den höchsten Marktanteil erreichte<br />
Österreich 2002 in Slowenien (15,7 %), gefolgt von Ungarn (12,5 %), der Slowakei<br />
(12 %) sowie Tschechien (7,4 %). In den Nachbarstaaten in Osteuropa ist die Marktstellung<br />
österreichischer Exporteure deutlich stärker als jene aller Konkurrenzländer.<br />
Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit und um den Einfluss der unterschiedlichen<br />
Größe der verglichenen Länder auszuschalten, wurden in Abbildung 5.2 die Marktanteile<br />
der Konkurrenzländer sowohl auf Basis des österreichischen Marktanteils als auch<br />
auf Basis des jeweiligen Weltmarktanteils standardisiert. Mit Österreich vergleichbare<br />
Werte in diesen Ländern erreicht nur Deutschland in Tschechien, aber auch hier liegen<br />
deutsche Exporteure hinter jenen aus Österreich zurück. Nicht ganz so eindeutig<br />
ist der Vorsprung Österreichs in Polen. Hier ist Deutschland stärker vertreten, etwa<br />
gleichwertig ist die Position Italiens, Schwedens, Finnlands und Dänemarks.<br />
108
Österreichs Warenhandel<br />
Standardisierte Marktanteile in MOEL-5 und Estland 20021: Abb. 5.2<br />
Österreich und Vergleichsländer<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
150<br />
120<br />
90<br />
60<br />
30<br />
0<br />
AT<br />
AT<br />
AT<br />
DE<br />
DE<br />
DE<br />
IT<br />
IT<br />
IT<br />
Tschechien<br />
NL<br />
NL<br />
SE<br />
SE<br />
FI<br />
FI<br />
NO<br />
NO<br />
DK<br />
DK<br />
CH<br />
CH<br />
Ein Vergleich der Unit Values im Außenhandel mit den MOEL-5 zeigt, dass höherwertige<br />
Waren aus Österreich gegen billigere Importgüter getauscht werden. Slowenien<br />
bildet die einzige Ausnahme. Die Unit Values der österreichischen Exporte<br />
sind um etwa das Dreifache höher als jene der Importe. Unit Values im Außenhandel<br />
bzw. deren Änderung stellen wichtige Erfolgsindikatoren im Außenhandel dar, die die<br />
„Qualität“ der Exportwaren und auch die Marktstärke des Exportlandes widerspiegeln<br />
(Wolfmayr, 2004).<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
AT<br />
DE<br />
IT<br />
Slowakei<br />
Ungarn Slowenien<br />
100<br />
Polen<br />
NL<br />
SE<br />
FI<br />
NO<br />
DK<br />
CH<br />
Ma ij<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
AT<br />
AT<br />
DE<br />
DE<br />
IT<br />
IT<br />
NL<br />
NL<br />
SE<br />
SE<br />
Estland<br />
1) Zweifach standadisierter Marktanteil errechnet sich wie folgt: Ma Ma wobei Ma…=Marktanteil; i=Exportland; j=Importland;<br />
öj öw<br />
w=Welt und ö=Österreich.<br />
Qelle: WIFO.<br />
Ma iw<br />
NL<br />
SE<br />
FI<br />
FI<br />
FI<br />
NO<br />
NO<br />
2.899<br />
NO<br />
DK<br />
DK<br />
DK<br />
CH<br />
CH<br />
CH<br />
109
Ein bedeutender Teil des Handels mit Mittel- und Osteuropa findet als sogenannter<br />
Intra-Firmen-Handel im Unternehmensverbund statt. Die Lieferungen österreichischer<br />
Muttergesellschaften bestehen oft aus Fertigprodukten, die von den Tochtergesellschaften<br />
im Osten vertrieben oder aus Komponenten und Teilen, die dort weiter verarbeitet<br />
werden; die Lieferungen nach Österreich sind typischerweise arbeitsintensive<br />
Vor- oder Fertigprodukte. Die Exporte von Waren österreichischer Muttergesellschaften<br />
an ihre Töchter in Mittel- und Osteuropa (Intra-Firmen-Exporte) erreichten 2001<br />
den Wert von fast 1 Mrd. Euro oder 7,5 % der gesamten Exporte in die MOEL-27.<br />
Besonders eng war die Unternehmenskooperation im Falle von Tschechien (Anteil<br />
des Intra-Firmen-Exportes fast 15 %) sowie von Ungarn und der Slowakei (jeweils<br />
10 %). Zu den Warenlieferungen kommt noch die Bereitstellung von Dienstleistungen<br />
an die Tochtergesellschaften, die einen Wert von 0,2 Mrd. Euro erreichte. Die Intra-<br />
Firmen-Importe aus den MOEL-27 beliefen sich auf 0,7 Mrd. Euro und konzentrierten<br />
sich ebenfalls auf die Nachbarländer; der Import aus der Slowakei wurde zu mehr als<br />
15 % im Firmenverbund abgewickelt. Die Bilanz des Intra-Firmen-Handels mit den<br />
MOEL-27 ergab für Österreich bei Waren einen Überschuss von 0,25 Mrd. Euro, bei<br />
den Dienstleistungen von 0,18 Mrd. Euro (vgl. Hunya/Stankovsky, 2004).<br />
5.4.2 Der Außenhandel mit NAFTA und den Entwicklungsländern<br />
Außergewöhnlich stark war auch die Expansion des Außenhandels mit den Ländern<br />
der NAFTA. Die Exporte stiegen seit 1993 auf das Dreifache, der Exportanteil nahm<br />
von 4,2 % auf 6,2 % 2003 zu. Ausschlaggebend waren vor allem die Ausfuhren in die<br />
USA. Die günstige Konjunkturlage und die gestiegene <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
trugen zum Exporterfolg bei.<br />
Nicht ganz zur Zufriedenheit Anlass gibt der Außenhandel mit den Entwicklungsländern.<br />
Der Exportanteil dieser Ländergruppe fiel zwischen 1993 und 2003 von 7,9 auf<br />
6,6 % zurück. Die Dynamik der österreichischen Exporte nach Fernost hat in den<br />
1990er-Jahren stark geschwankt und dürfte zum Teil mit dem Auslieferungszyklus<br />
bei Anlagenexporten, insbesondere nach China, zusammenhängen. Der wichtigste<br />
Markt in Fernost war für Österreich China mit einem Exportanteil von 1,1 %, gefolgt<br />
zumeist von Hongkong, Südkorea (0,4 %) und Taiwan.<br />
5.4.3 Handelsbilanz nach Regionen<br />
Die Handelsbilanz nach Regionen zeigte 2003 Überschüsse im Handel Österreichs<br />
mit den Mittel- und Osteuropäischen Ländern, der GUS und mit den Industriestaaten<br />
in Übersee, denen Defizite mit der EU und den meisten fernöstlichen Ländern gegen-<br />
110
Österreichs Warenhandel<br />
überstanden. 2003 beeinflusste der starke Import von Investitionsgütern vor allem das<br />
Handelsergebnis mit Deutschland, das mit 41 % am österreichischen Gesamtimport<br />
von Maschinen und Fahrzeugen beteiligt war. Die Handelsbilanz mit Deutschland<br />
im Bereich Maschinen und Fahrzeuge verschlechterte sich um 1 Mrd. Euro, insgesamt<br />
stieg das Defizit mit Österreichs wichtigstem Handelspartner um 1,3 Mrd. Euro.<br />
Groß ist das Defizit auch gegenüber den Niederlanden (0,8 Mrd. Euro), Irland und<br />
den skandinavischen Ländern. Im Handel mit Großbritannien (+1,6 Mrd. Euro), Italien<br />
(+1,3 Mrd. Euro) sowie Spanien können beachtliche und großteils zunehmende<br />
Überschüsse erwirtschaftet werden. Der Warenaustausch mit Frankreich war zuletzt<br />
in etwa ausgeglichen. Gegenüber der EU ergab sich 2003 ein Passivum von 5,8 Mrd.<br />
Euro, was langfristig gesehen eine starke Verbesserung bedeutet. Aktiv ist die Handelsbilanz<br />
mit der Schweiz.<br />
Hohe Überschüsse werden traditionell mit Osteuropa (MOEL-27) erreicht. Während<br />
jene mit Südosteuropa (2003 +1,8 Mrd. Euro) eine steigende Tendenz zeigen, hat sich<br />
das früher hohe Aktivum mit Mittel- und Osteuropa in den vergangenen Jahre deutlich<br />
verringert und machte 2003 nur 0,5 Mrd. Euro aus. Der Handel mit der Slowakei war<br />
bereits seit langem, mit Tschechien zum ersten Mal 2003 passiv (–0,2 Mrd. Euro). Ein<br />
zumeist geringes Defizit fällt gegenüber Russland bzw. der GUS an. Mit den zehn EU-<br />
Beitrittsländern ergab sich 2003 ein Überschuss von 1,4 Mrd. Euro. Im Außenhandel mit<br />
der NAFTA bzw. den USA konnte Österreich in jüngerer Vergangenheit Überschüsse<br />
erzielen, denen ein traditionelles Defizit mit Japan gegenüberstand. Überraschend sind<br />
die Salden im Handel mit den Entwicklungsländern: Mit den OPEC-Staaten konnten<br />
zuletzt leichte Aktiva erzielt werden, der Handel mit der NOPEC – vor allem mit den<br />
Ländern aus Fernost – wies hingegen beachtliche Defizite aus.<br />
Ein längerfristiger Vergleich der Handelsbilanzsalden zeigt eine anhaltende Tendenz<br />
zur Verbesserung (Abbildung 5.3). Ausschlaggebend dafür war die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit<br />
der österreichischen Exportwirtschaft in den Industrieländern. Seit<br />
Mitte der 1990er-Jahre konnte das Defizit gegenüber der EU-15 spürbar abgebaut,<br />
gegenüber den OECD-Staaten in Übersee sogar beseitigt und ein Überschuss aufgebaut<br />
werden. Die positive Bilanz mit Mittel- und Osteuropa sowie Südosteuropa trug<br />
maßgeblich zur Dämpfung des Gesamtdefizits bei. Seit 1997 zeichnet sich allerdings<br />
eine Verringerung des Exportüberschusses mit Mittel- und Osteuropa ab. Dies ist<br />
zum Teil auf einen verstärkten Vorleistungsbezug im Rahmen einer fortschreitenden<br />
vertikalen Arbeitsteilung mit diesen Staaten zurückzuführen. Der kostengünstige Bezug<br />
ermöglichte in vielen Bereichen eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und damit<br />
auch die bessere Durchsetzung auf den Märkten der Industriestaaten (vgl. Wolfmayr,<br />
2004).<br />
111
Österreichs Handelsbilanz, Saldo in % des BIP Abb. 5.3<br />
5.5 Die Güterstruktur des Außenhandels<br />
Die sektorale Zusammensetzung der Exporte und Importe hängt weitgehend vom<br />
Stand der Industrialisierung eines Landes und seiner wichtigen Handelspartner ab.<br />
Der Handel mit Agrarwaren sowie mit Rohstoffen und Energie wird durch die natürliche<br />
Ausstattung sowie auch durch <strong>politische</strong> Fragen auf den z.T. monopolisierten bzw.<br />
reglementierten Märkten bestimmt, der Agrarhandel überdies durch institutionelle<br />
Regelungen. Der Außenhandel mit Industriewaren spiegelt hingegen vor allem die<br />
Leistungsfähigkeit der Unternehmen sowie auch jene der Wirtschaftspolitik wider.<br />
5.5.1 Positiver Strukturwandel im österreichischen Außenhandel<br />
Eine erste Orientierung ermöglicht eine Strukturanalyse nach Warengruppen (SITC).<br />
In dieser Perspektive zeigt der Export langfristig eine deutlich erkennbare Tendenz zu<br />
anspruchsvollen Produkten und spiegelt so den Aufstieg Österreichs zu den führenden<br />
Industrienationen wider. Der Exportanteil von Maschinen und Fahrzeugen – in diese<br />
Warengruppe fallen die meisten höherwertigen Erzeugnisse – stieg von 25 % Anfang<br />
112<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-4<br />
-5<br />
-6<br />
1992<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
EU 15<br />
Südosteuropa, GUS<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
OECD-Übersee<br />
1996<br />
1997<br />
Entwicklungsländer<br />
1998<br />
1999<br />
MOEL 5<br />
2000<br />
2001<br />
Insgesamt<br />
2002<br />
2003
Österreichs Warenhandel<br />
der 1970er-Jahre auf 35 % Ende der 1980er-Jahre und auf über 40 % Ende der 1990er-<br />
Jahre. Eine wichtige Rolle in diesem Strukturwandel hatten in jüngerer Vergangenheit die<br />
Ostöffnung 1989 sowie der EU-Beitritt 1995, aber auch der Ausbau der Auto-Zulieferindustrie.<br />
Merklich zugenommen hat auch der Exportanteil der Chemischen Erzeugnisse<br />
sowie – seit der Öffnung der EU-Märkte – jener der Agrarwaren. Zurückgegangen ist<br />
hingegen die Bedeutung Bearbeiteter Waren (großteils industrielle Vorprodukte, wie Textilien<br />
und Stahl) sowie von Rohstoffen. Nicht ganz befriedigend ist, dass der Exportanteil<br />
konsumnaher Fertigwaren (zu diesen zählen sowohl traditionelle als auch moderne Produkte)<br />
langfristig bei 13 – 14 % verharrt und zuletzt eine eher fallende Tendenz aufwies<br />
(siehe auch Tabellen 5.11 und 5.12 in den Statistischen Übersichten).<br />
Eine längerfristige Analyse der Salden nach Warengruppen, welche die Leistungen der<br />
heimischen Erzeuger sowohl auf den Inlands- als auch auf den Auslandsmärkten widerspiegelt,<br />
zeigt wichtige Aspekte der <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit. Zwischen 1993<br />
und 2003 verringerte sich das Defizit der österreichischen Handelsbilanz insgesamt von<br />
7,1 Mrd. Euro auf 1,4 Mrd. Euro, d.h um 5,7 Mrd. Euro. In der Periode 1993/00 ging das<br />
Passivum um 1,9 Mrd. Euro zurück, was einer durchschnittlichen jährlichen Verbesserung<br />
von 0,3 Mrd. Euro entspricht. In den Jahren 2000/03 war der Bilanzerfolg mit 1,3 Mrd. Euro<br />
pro Jahr deutlich größer. Den wichtigsten Beitrag leistete der Maschinenhandel, dessen<br />
Saldo sich in der ersten Periode um 0,3 Mrd. Euro, in der zweiten um 0,6 Mrd. Euro pro<br />
Jahr verbesserte. Die 1993 mit 2,2 Mrd. Euro passive Bilanz brachte 2003 in diesem Sektor<br />
einen Überschuss von 1,6 Mrd. Euro. Auch in allen anderen Positionen des Industriewaren-<br />
und Agrarhandels waren die Bilanzverbesserungen in der zweiten Periode höher<br />
als in der ersten. Einen wichtigen Beitrag zum Abbau des Handelsbilanzdefizits lieferte<br />
allerdings auch der geringere Anstieg des Defizits im Handel mit Roh- und Brennstoffen.<br />
Eine Erdölverteuerung könnte den Bilanzerfolg schnell reduzieren (Tabelle 5.5).<br />
Handelsbilanzsalden nach Warengruppen 1993–2003 Tab. 5.5<br />
Handelsbilanz Veränderungen der Handelsbilanz<br />
pro Jahr<br />
Mio. Euro<br />
1993 2003 1993/2003 1993/2000 2000/2003<br />
Insgesamt -7.103 -1.361 574 266 1.294<br />
Industriewaren -4.128 3.654 778 603 1.188<br />
Chemische Erzeugnisse -1.215 -962 25 10 61<br />
Bearbeitete Waren 2.183 5.066 288 240 401<br />
Maschinen, Fahrzeuge -2.227 1.571 380 289 592<br />
Konsumnahe Fertigwaren -2.873 -1.977 90 21 249<br />
Agrarwaren -1.025 -207 82 43 173<br />
Roh- und Brennstoffe -1.950 -4.807 -286 -379 -67<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.<br />
113
5.5.2 Schwerpunktländer des österreichischen Exports<br />
In einer WIFO-Studie (Wolfmayr/Stankovsky, 2003) wurde versucht, interessante<br />
und Erfolg versprechende Exportmärkte (Schwerpunktländer) für die österreichische<br />
Industrie außerhalb der EU-15 zu finden und die dort vorhandenen Exportpotentiale<br />
abzuschätzen. 2 Die Warenstruktur des österreichischen Exports in diese Länder wurde<br />
mit zwei unterschiedlichen Ansätzen untersucht. Ein Vergleich der Strukturübereinstimmungsindizes<br />
(SÜI) von Österreich und acht ausgewählten Konkurrenzländern – dabei<br />
wurde die Warenstruktur des Exportangebots der Nachfragestruktur der Schwerpunktländer<br />
gegenübergestellt – gibt Hinweise auf kurzfristige Exportchancen. Diese<br />
Untersuchung liefert für Österreich günstige Ergebnisse. In fast allen traditionellen<br />
Märkten erreicht Österreich den besten oder zumindest den zweitbesten Wert des<br />
SÜI. Nur Deutschland hat eine ähnlich günstige Exportstruktur. In Mittel- und Osteuropa<br />
schneidet Österreich etwas besser ab, vor allem in Ungarn und Tschechien. In<br />
den OECD-Ländern in Übersee erreicht Deutschland gegenüber Österreich einen<br />
Vorsprung. Auch die Ergebnisse des Strukturvergleichs für die neuen Märkte sind<br />
positiv. Von den insgesamt 15 Schwerpunktländern hat Österreich in neun Fällen die<br />
günstigste Exportstruktur. Beachtlich sind vor allem die Resultate in Südamerika und<br />
im Nahen Osten.<br />
Auf mittlere und lange Sicht werden österreichischen Unternehmen im <strong>internationale</strong>n<br />
Wettbewerb vor allem bei solchen Produkten Aussichten auf Erfolg eingeräumt, bei<br />
denen die spezifischen Standortvorteile (Qualifikation der Arbeitskräfte, Verfügbarkeit<br />
moderner Technologie) eine wichtige Rolle spielen. Österreich hat Wettbewerbsvorteile<br />
dieser Art in den Technologiebranchen sowie bei der – vorwiegend auf mittlerer<br />
Technologie basierenden – traditionellen Sachgüterproduktion. Eine Analyse der Unit<br />
Values im österreichischen Export zeigt, dass die mit Abstand höchsten Werte eben in<br />
diesen zwei Gruppen erzielt werden. So gesehen entspricht die Marktstellung Österreichs<br />
im <strong>internationale</strong>n Wettbewerb nicht ganz den Erwartungen. Österreich erreicht<br />
die stärkste Position im Weltexport bei arbeitsintensiven Zweigen bzw. traditionellen<br />
Sachgütern. In Bezug auf die Schwerpunktländer zeigen hingegen die standardisierten<br />
Marktanteilsindikatoren auf Branchenebene insgesamt eine überwiegend vorteilhafte<br />
Position bei Technologiebranchen und traditionellen Sachgütern. Die Struktur der<br />
Exporte in die Schwerpunktländer spiegelt in hohem Maße die Wettbewerbsvorteile<br />
Österreichs wider und kann somit als „zukunftsorientiert“ bezeichnet werden. Die guten<br />
Ergebnisse im <strong>internationale</strong>n Vergleich bestätigen die Hypothese, dass Österreich<br />
in den Schwerpunktländern Exportchancen hat. Sie weisen auch darauf hin, dass die<br />
Übereinstimmung der bestehenden Außenhandelsstrukturen eine Erklärungsvariable<br />
114
Österreichs Warenhandel<br />
für den Markterfolg sein könnte. Dabei kommt es offensichtlich nicht allein auf den<br />
Anteil moderner Waren im Exportangebot an.<br />
Wolfmayr (2004) analysierte den österreichischen Außenhandel mit den zehn EU-Beitrittsländern.<br />
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Ostöffnung in den 1990er-Jahren<br />
den Strukturwandel in wünschenswerter Richtung unterstützt hat. Die österreichische<br />
Industrie hat Exportchancen vor allem in jenen Bereichen genutzt, für die sich bei der<br />
Integration von Ländern mit unterschiedlichem Entwicklungsniveau Vorteile erwarten<br />
lassen (technologieorientierte, skill-intensive und qualitätsorientierte Sektoren). Die<br />
Handelsbilanzsalden sind hier durchwegs positiv und die Exportüberschüsse jeweils<br />
deutlich höher als im österreichischen Außenhandel insgesamt. Gleichzeitig wurden<br />
die Beitrittsländer auch für diese Branchen zunehmend interessante Standorte für<br />
Zulieferbetriebe. In Österreich wurde in diesen Bereichen der Bezug von Zwischenprodukten<br />
sowie der Intra-Firmen-Handel – vorwiegend mit Ungarn, Tschechien und der<br />
Slowakei – intensiviert. Die Importe aus den wichtigsten Beitrittsländern expandierten<br />
zuletzt erheblich stärker als die Exporte. Der kostengünstige Bezug ermöglichte eine<br />
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Produkte auf Drittmärkten.<br />
Dieser Trend zum stärkeren Vorleistungsbezug dürfte sich auch nach der Erweiterung<br />
fortsetzen, da die Transaktionskosten geringer und „just-in-time“-Lieferungen noch<br />
leichter umzusetzen sein werden. Auch in Industrien mit vorwiegend ungünstigen<br />
Branchenmerkmalen (standardisierte, arbeitsintensive Produktionsverfahren, geringe<br />
Qualifikation der Arbeitskräfte, Preiswettbewerb) sind die Nachteile im Handel mit den<br />
Beitrittsländern zumeist nicht allzu stark hervorgetreten, es wurden jedoch gleichzeitig<br />
erhebliche Strukturanpassungen abverlangt. Diese benachteiligten Branchen haben in<br />
der ersten Hälfte der 1990er-Jahre die Öffnung der Märkte im Osten vor allem zum Bezug<br />
von Vorleistungen und Komponenten genutzt (wodurch Arbeitsplätze in Österreich<br />
verloren gingen), in der zweiten Hälfte haben aber auch diese Produktionsbereiche<br />
begonnen, die MOEL verstärkt als Absatzmärkte zu bearbeiten. Die komparativen<br />
Nachteile im Handel dieser Güter mit den Beitrittsländern wurden in dieser Zeit etwas<br />
abgebaut und teilweise die relativen Handelsbilanzsalden verbessert.<br />
5.5.3 Österreich auf Exporte mittlerer Qualität spezialisiert<br />
Die Struktur der nationalen Produktionskapazitäten hat unmittelbaren Einfluss auf die<br />
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, die mittel- bis langfristig nur durch einen Strukturwandel<br />
zugunsten moderner, innovativer und technologisch anspruchsvoller Produkte<br />
erhalten bzw. gesteigert werden kann. Das WIFO legte in jüngerer Vergangenheit<br />
mehrere Studien vor, in welchen die Warenstruktur des österreichischen Exports unter<br />
dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit und der sich ergebenden Wachstumschancen<br />
115
analysiert worden ist. Diese Studien zeigen seit den 1980er-Jahren eine Reihe von<br />
Schwächezeichen bei der Spezialisierung der österreichischen Industrie auf moderne,<br />
wachstumsorientierte und technologisch anspruchsvolle Produktionszweige auf. Im<br />
Vergleich mit den Industrieländern sind die österreichischen Produktionsstrukturen<br />
zu stark auf Branchen mit mittlerer bis niedriger Technologie spezialisiert. (Aiginger,<br />
1987; Hutschenreiter/Peneder, 1997; Peneder, 2002).<br />
Wolfmayr (2004) bestätigt die Ergebnisse früherer Strukturanalysen: Im Vergleich zu<br />
anderen EU-Ländern ist der Anteil technologisch anspruchsvoller, humankapitalintensiver<br />
und innovations- bzw. qualitätsorientierter Produktgruppen weiterhin unterdurchschnittlich.<br />
Im Zeitablauf ergibt sich für Österreich ein positiver Strukturwandel<br />
zugunsten von anspruchsvolleren Produkten. Der Exportanteil dieser Produkte in<br />
Österreich nahm etwas stärker zu als in der EU insgesamt. Der Strukturwandel in<br />
der österreichischen Exportindustrie ging insbesondere zu Lasten der traditionellen<br />
Sachgüterproduktion, aber auch der arbeitsintensiven und der kapitalintensiven Industrien.<br />
Die Strukturanalysen liefern aber auch Hinweise auf Möglichkeiten und Spielräume<br />
der Wirtschaftspolitik zur Förderung des Exports. Die Struktur der nationalen Produktionskapazitäten<br />
hat unmittelbaren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.<br />
Primäre Aufgabe der Wirtschaftpolitik ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen<br />
und Anreize zu schaffen, die den Strukturwandel erleichtern und die <strong>internationale</strong><br />
Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Unternehmen verbessern. Gefordert ist insbesondere<br />
die Technologiepolitik, da die Unterschiede im technologischen Entwicklungsniveau<br />
eine wichtige Quelle nationaler Wettbewerbsvorteile sind. Branchenspezifische<br />
Politikmaßnahmen – etwa der Schutz bestimmter Branchen im Wettbewerb mit den<br />
Beitrittsländern – erübrigen sich immer mehr mit einer Zunahme des intra-industriellen<br />
Handels und ließen sich auch kaum mit den Grundsätzen der Wirtschaftsförderung<br />
der Union in Einklang bringen.<br />
5.6 Österreichs Fahrzeugindustrie<br />
Die österreichische Fahrzeugindustrie expandierte in jüngerer Vergangenheit kräftig;<br />
in der Produktion und im Export wurde sie zu einer der wichtigsten Industriebranchen.<br />
2002 zählten zu diesem Wirtschaftszweig 377 Betriebe mit 25.400 Beschäftigten und<br />
einem Umsatz von 8,1 Mrd. Euro. Die Beschäftigung der Branche entsprach 5 % der<br />
gesamten Sachgütererzeugung, hinzu kamen noch zahlreiche Zulieferbetriebe aus<br />
anderen Wirtschaftszweigen. Die Fahrzeug- und Zulieferindustrie werden zumeist als<br />
automotiver Sektor bezeichnet. Die wichtigsten Unternehmen der Fahrzeugindustrie<br />
116
Österreichs Warenhandel<br />
sind BMW, Magna Steyr, Opel Austria Powertrain und MAN Steyr, zum Zulieferbereich<br />
zählen u.a. Miba (Gleitlager) und Eybl (Sitze) (Wolf, 2003).<br />
Die meisten der Unternehmen des automotiven Sektors sind zu drei Clustern zusammengeschlossen:<br />
Dem Automobil-Cluster Oberösterreich (siehe dazu auch Kapitel 16,<br />
Hochgatterer/Pöchhacker) mit rund 300 Unternehmen und einem automotiven Umsatz<br />
von 7 Mrd. Euro, dem Automobil-Cluster Steiermark (AC Styria) mit 200 Mitgliedern<br />
und einem Umsatz von 5,5 Mrd. Euro sowie dem Automotive Cluster Vienna Region<br />
(ACVR) mit 80 Partnern und einem Umsatz von 4,5 Mrd. Euro (Wolf, 2003).<br />
2003 exportierte die österreichische Fahrzeugindustrie Erzeugnisse im Wert von<br />
9,9 Mrd. Euro, was einem Anteil von 12,6 % am Gesamtexport entsprach. Die höchste<br />
Exportdynamik hatte die Branche in den 1990er-Jahren mit einer durchschnittlichen<br />
Wachstumsrate von 11,6 % p.a. erreicht. 1990 war die Fahrzeugindustrie mit 9,2 % am<br />
Export beteiligt gewesen. 2002 schwächte sich das Wachstum konjunkturbedingt ab<br />
(auf 1,9 %), 2003 schrumpften die Exporte um 2,8 %. Die wichtigsten Exportprodukte<br />
des Sektors sind PKWs (in Österreich werden Nischenprodukte für Weltkonzerne<br />
hergestellt), Kfz-Teile, Automotoren und LKWs.<br />
Österreichs Fahrzeug-Außenhandel 2003 Tab. 5.6<br />
Mio. Euro<br />
Export Import Saldo<br />
Anteile<br />
in %<br />
Veränd.<br />
zum Vorj.<br />
in %<br />
Mio. Euro<br />
Anteile<br />
in %<br />
Veränd.<br />
zum Vorj.<br />
in %<br />
Mio. Euro<br />
Kfz-Motoren 2.330 23,7 + 0,2 460 4,5 - 18,4 1.870<br />
Motorenteile 573 5,8 + 5,6 1.052 10,3 + 3,9 -479<br />
PKWs 3.067 31,1 - 10,8 4.617 45,4 + 14,3 -1.549<br />
LKWs 1.135 11,5 + 1,3 756 7,4 + 7,8 379<br />
Omnibusse 205 2,1 + 21,5 464 4,6 + 21,7 -259<br />
Kfz-Teile 2.284 23,2 + 1,3 2.539 25,0 - 14,0 -255<br />
Fahrzeuganhänger 258 2,6 - 11,3 288 2,8 + 1,3 -30<br />
Fahrzeuge insgesamt 9.852 100,0 - 2,8 10.175 100,0 + 2,4 -323<br />
Alle Waren 78.471 100,0 + 1,4 79.831 100,0 + 3,5 -1.361<br />
Anteil Fahrzeuge 12,6 12,7<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.<br />
Erzeugnisse der Fahrzeugindustrie stellen auch einen wichtigen Importposten dar:<br />
2003 waren es 10,2 Mrd. Euro bzw. 12,7 % der Importe. Etwa die Hälfte davon entfiel<br />
auf fertige PKWs, von Bedeutung waren auch Kfz-Teile. Die Importe schrumpften 2002<br />
um 3,3 %, die Belebung 2003 (+2,4 %) war vor allem einer höheren Nachfrage nach<br />
117
Pkw (+14,3 %) zuzuschreiben. Die Sektorbilanz war bisher stets negativ, die einzige<br />
Ausnahme war das Jahr 2002 mit einem Überschuss von 0,2 Mrd. Euro. Das Jahr<br />
2003 brachte wieder ein Defizit.<br />
Der wichtigste Exportmarkt der österreichischen Fahrzeugindustrie ist die EU, doch<br />
spielen auch die MOEL zunehmend eine wichtige Rolle. Osteuropa stellt wegen des<br />
großen Nachholbedarfs bei Fahrzeugen aber auch im Hinblick auf den Ausbau einer<br />
umfassenden Autoindustrie (Slowakei) in Zukunft einen aussichtsreichen Markt für die<br />
österreichischen Zulieferbetriebe dar.<br />
Anmerkungen<br />
1 Veränderung der Gesamtimporte der Handelspartner, gewichtet mit dem Anteil am österreichischen<br />
Export.<br />
2 Als „Schwerpunktländer“ wurden insgesamt 26 Länder ausgewählt – 11 traditionelle Märkte<br />
(in Mittel- und Osteuropa und in den Industriestaaten in Übersee) sowie 15 neue Märkte<br />
(Entwicklungsländer) – die gleichzeitig die Kriterien „hohes Wachstumspotential“ und „Exportchancen“<br />
erfüllen.<br />
118
6 DER AUSSENHANDEL MIT<br />
DIENSTLEISTUNGEN 1<br />
Der positive Nettobeitrag des Dienstleistungshandels zur österreichischen Leistungsbilanz<br />
wuchs 2003 im Vergleich zum Vorjahr wieder geringfügig auf 824 Mio.<br />
Euro an, blieb damit dennoch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt in den<br />
1990er-Jahren. Nach einem schwachen Exportwachstum (0,8 %) 2002 profitierten<br />
die österreichischen Dienstleistungsanbieter 2003 von der <strong>internationale</strong>n Konjunkturerholung<br />
(3,1 % Wachstum). Die Dienstleistungsimporte dagegen erwiesen<br />
sich mit Zuwächsen von 4,6 % (2002) und 2,7 % (2003) als stabiler. Das schlechte<br />
Export-Ergebnis 2002 ergab sich vor allem aufgrund von Rückgängen bei den unternehmensbezogenen<br />
Diensten und Bauleistungen, während der Reiseverkehr mit<br />
31,7 % Anteil an den Gesamtexporten einen weitgehend stabilen Einkommensfaktor<br />
bildete. Dennoch bleibt die langjährige Strukturverschiebung in Richtung zunehmende<br />
Bedeutung von unternehmensbezogenen Dienstleistungen (und ein Anstieg<br />
in der Position der „nicht aufteilbaren Leistungen“ – NAL) bestehen. In regionaler<br />
Hinsicht ergab sich eine zunehmende Konzentration auf Partnerländer innerhalb<br />
der EU-15, der Anteil der neuen Mitgliedsländer blieb mit 8,5 % der Exporte und<br />
7,2 % der Importe nahezu unverändert. Innerhalb der alten Mitgliedsländer jedoch<br />
wuchs die Bedeutung von Ländern wie Großbritannien, Niederlande, Frankreich und<br />
Belgien neben Deutschland, das mit 39,3 % der Exporte und 36,5 % der Importe<br />
nach wie vor wichtigstes Partnerland für Österreich ist.<br />
Die Bedeutung der Dienstleistungsexporte für die österreichische Leistungsbilanz<br />
nahm zu Beginn der 1990er-Jahre tendenziell ab. Seit 1997 stabilisierte sich der Anteil<br />
wieder und lag 2003 bei rd. 29 % der Deviseneinnahmen. Importseitig jedoch nahm<br />
die Bedeutung der Dienstleistungen in derselben Zeitperiode kontinuierlich zu und<br />
belief sich 2003 auf 27,6 % der Ausgaben in der Leistungsbilanz (1992: 22,1 %). Damit<br />
einhergehend fand auch eine Verschlechterung des Nettobeitrags der Dienstleistungen<br />
zur Leistungsbilanz statt (siehe auch Kapitel 4.3). Der Überschuss sank in der ersten<br />
Hälfte der 1990er-Jahre von 34,3 % der Exporte (1992) auf 3,6 % (1997) und belief<br />
sich zuletzt auf 2,8 % (2003). Damit stehen die Entwicklungen im Dienstleistungshandel<br />
im Gegensatz zu jenen im Güterhandel, dessen Defizit sich nicht nur in Prozent der<br />
Exporte, sondern auch absolut gesehen, kontinuierlich verringerte. Die Verringerung<br />
des positiven Beitrags des Dienstleistungshandels zur österreichischen Leistungsbilanz<br />
ist einerseits auf strukturelle Ursachen zurückzuführen (so expandierte der Handel in<br />
traditionell defizitären Positionen, v. a. auch die Position der NAL, besonders stark),<br />
andererseits auf regionale Strukturverschiebungen. Das Dienstleistungsbilanzdefizit<br />
gegenüber der NAFTA stieg beispielsweise stark an und belief sich 2003 alleine auf<br />
62,4 % der Exporte.<br />
119
Betrachtet man die Entwicklung des Dienstleistungshandels innerhalb der vergangenen<br />
Dekade, so stand einem Anstieg auf der Exportseite auf 171 % eine noch<br />
stärkere Erhöhung auf der Importseite auf 233 % gegenüber. Dies entspricht einer<br />
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % bei den Exporten, der ein<br />
durchschnittlicher Zuwachs der Importe von 9,4 % pro Jahr gegenüberstand. In beiden<br />
Fällen lagen die jüngsten Zuwächse entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen<br />
Lage deutlich unter dem langjährigen Trend.<br />
Nach zweistelligen Zuwachsraten in den Jahren 1999 und 2000 ging der Dienstleistungshandel<br />
in den darauffolgenden Jahren zurück. Exportseitig verringerte sich das<br />
Wachstum von 9,3 % (2001) auf 0,8 % (2002). Damit war im Dienstleistungshandel,<br />
nicht wie im Warenhandel erst 2003, sondern bereits 2002 das schwächste Ergebnis<br />
erzielt worden, während 2003 bereits wieder ein höheres Wachstum von 3,1% (nach<br />
vorläufigen Zahlen) erreicht wurde. Importseitig halbierte sich das Wachstum seit 2000<br />
in jedem Jahr in etwa, von 8,8 % (2001) auf 4,9 % (2002) und 2,7 (2003). Entsprechend<br />
dem globalen Bild erwies sich auch in Österreich der Dienstleistungshandel<br />
als wesentlich stabiler gegenüber Konjunkturschwankungen als der Warenhandel.<br />
Während 2002 die Nachfrage nach importierten Gütern sogar zurückging, blieb die<br />
Nachfrage nach Dienstleistungsimporten noch relativ hoch, nahm 2003 aber weiter<br />
ab. Die österreichischen Dienstleistungsexporteure bekamen dennoch die globale<br />
Rezession bereits 2002 zu spüren. Das extrem niedrige Jahreswachstum wurde durch<br />
geringere Exporte nach Übersee (NAFTA und Asien) sowie in die neuen Mitgliedsländer<br />
bedingt, wobei vor allem die Exporte von unternehmensnahen Dienstleistungen<br />
und Bauleistungen zurückgingen. Die globale Konjunkturerholung machte sich dann<br />
auch 2003 bereits in einer kräftigeren Erhöhung der Exporte bemerkbar, vor allem<br />
die Exporte von Bauleistungen erholten sich rasch und übertrafen bereits wieder das<br />
Niveau von 2001.<br />
Aufgrund der trägen Importnachfrage und der dynamischeren Exportentwicklung<br />
erhöhte sich der Überschuss in der Dienstleistungsbilanz, welcher mit 631 Mio. Euro<br />
2002 einen Tiefstand erreicht hatte, 2003 wieder geringfügig auf 824 Mio. Euro (siehe<br />
Abbildung 6.1). Lediglich 1997 war ein ähnlich schlechtes Ergebnis erzielt worden, in<br />
den übrigen Jahren erreichte der Dienstleistungsbilanzüberschuss Werte zwischen<br />
7,5 Mrd. Euro (1992) und 1,7 Mrd. (2000).<br />
120
Der Außenhandel mit Dienstleistungen<br />
Entwicklung der Dienstleistungsbilanz Abb. 6.1<br />
Devisenflüsse in Mrd. Euro<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
Quelle:OeNB.<br />
0<br />
1995<br />
Netto<br />
1996<br />
1997<br />
Ausfuhren<br />
1998<br />
1999<br />
Einfuhren<br />
6.1 Sektorale Gliederung des Dienstleistungshandels<br />
Die Struktur des österreichischen Dienstleistungshandels wies in den vergangenen drei<br />
Jahren keine wesentlichen Veränderungen auf. Langfristig betrachtet lässt sich jedoch<br />
eine deutliche Strukturverschiebung feststellen (siehe Abbildungen 6.2 und 6.3). Über<br />
die vergangene Dekade betrachtet, ist hier der bekannte Rückgang der Bedeutung<br />
des Reiseverkehrs zu erwähnen, dessen Anteil exportseitig von 47,7 % (1993) auf<br />
31,7 % (2003) sank. Importseitig war dieser Trend mit 40,5 % bzw. 27 % ebenfalls stark<br />
ausgeprägt. Dies ist jedoch kein österreichisches Spezifikum, sondern entspricht dem<br />
allgemeinen globalen Trend. Der Handel mit unternehmensbezogenen Dienstleistungen,<br />
dazu zählen u.a. EDV-Leistungen, Patente, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen,<br />
nahm hingegen vor allem seit dem EU-Beitritt an Bedeutung zu.<br />
Die langfristig zu beobachtende Strukturverschiebung in der Dienstleistungsbilanz<br />
ergibt sich hauptsächlich aufgrund der relativen Ausweitung der Position NAL. Dies<br />
stellt ein Problem für die Strukturanalyse dar, da in dieser Kategorie neben statistischen<br />
Ungenauigkeiten (u.a. durch Unterschiede in der Erfassung laut Außenhandelsstatistik<br />
und Zahlungsbilanz) auch Serviceleistungen, die in Verbindung mit Warengeschäften<br />
getätigt werden, erfasst werden. Die Bedeutung solcher Leistungen dürfte in der jüngeren<br />
Vergangenheit stark angestiegen sein. Die Umstellung der Zahlungsbilanzstatistik<br />
mit dem Jahr 2006 wird erstmals die Möglichkeit bieten, zukünftig mehr Klarheit über<br />
diese Serviceleistungen zu gewinnen. 2<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
4.000<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
Saldo in Mrd. Euro<br />
121
Weiters zeigt sich im Verhältnis zu den übrigen Kategorien ein Anstieg der Exporte von<br />
Transportleistungen. Vor allem in den Jahren 2002 und 2003 bewirkte dieser Zuwachs<br />
auch einen Rückgang des Anteils der NAL. Abgesehen davon erwies sich die Struktur<br />
der österreichischen Dienstleistungen sowohl export- als auch importseitig während<br />
der jüngsten Rezession als weitgehend stabil.<br />
Struktur der Dienstleistungseinnahmen Abb. 6.2<br />
In % der Exporte<br />
Quelle:OeNB.<br />
Struktur der Dienstleistungsausgaben Abb. 6.3<br />
In % der Importe<br />
Quelle:OeNB.<br />
122<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
100 %<br />
80 %<br />
60 %<br />
40 %<br />
20 %<br />
0 %<br />
1995<br />
1995<br />
1997<br />
1997<br />
1999<br />
1999<br />
2001<br />
2001<br />
2003<br />
2003<br />
NAL<br />
sonstige<br />
Transport<br />
unternehmensbez. DL<br />
Reiseverkehr<br />
NAL<br />
sonstige<br />
Transport<br />
unternehmensbez. DL<br />
Reiseverkehr
6.1.1 Reiseverkehr<br />
Der Außenhandel mit Dienstleistungen<br />
Wie bereits erwähnt, entwickelte sich der absolute Anteil des Reiseverkehrs an den<br />
Dienstleistungen – entsprechend seinem globalen Trend – seit langem rückläufig (siehe<br />
dazu Tabelle 6.1 in den Statistischen Übersichten). Die Bedeutung des Reiseverkehrs<br />
für Österreich ist je nach Betrachtungsweise unterschiedlich. Setzt man den Anteil<br />
der Reiseverkehrsexporte in Relation zur globalen Bedeutung des Reiseverkehrs, so<br />
zeigt sich trotz des überdurchschnittlich hohen Anteils bei den Exporten für Österreich<br />
keine ausgeprägte Spezialisierung auf diesen Sektor. Betrachtet man darüber hinaus<br />
die Nettoposition zwischen Exporten und Importen, so ergibt sich eine noch geringere<br />
Bedeutung des Reiseverkehrs für Österreich (siehe dazu auch Kapitel 14). Demgegenüber<br />
ist die relative Bedeutung der unternehmensbezogenen Dienstleistungen in<br />
Österreich – sowohl anteilsmäßig als auch in Relation zu den Haupthandelspartnern<br />
– wesentlich stärker. Mit knapp 1 % war der Nettobeitrag des Reiseverkehrs zum BIP<br />
mehr als doppelt so hoch wie der der Dienstleistungen insgesamt. Der Reiseverkehr<br />
laut Zahlungsbilanz gibt jedoch nicht ausreichend Auskunft über die tatsächliche Bedeutung<br />
des Tourismus für die österreichische Wirtschaft, welche wesentlich höher ist.<br />
Ein im Rahmen einer bereits etwas älteren Studie das WIFO erstelltes Tourismussatellitenkonto<br />
zur VGR (Smeral et al., 2002) stellt die vielfältigen volkswirtschaftlichen Verflechtungen<br />
des Tourismus umfassender dar, u. a. wurden die Ausgaben inländischer<br />
Gäste ebenfalls berücksichtigt. Demnach ist der Tourismus für Österreich durchaus<br />
eine wesentliche Komponente der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung, dessen<br />
Beitrag zum BIP 2001 in etwa 9 % betrug.<br />
Exporte<br />
Trotz abnehmender Tendenz ist der Reiseverkehr immer noch eine wichtige Kategorie<br />
für den Dienstleistungshandel. Nach wie vor resultieren knapp ein Drittel (31,7 %) der<br />
Dienstleistungsexporte aus dem <strong>internationale</strong>n Reiseverkehr. Für den Dienstleistungshandel<br />
insgesamt, und besonders im Reiseverkehr, ist Deutschland der mit Abstand<br />
wichtigste Handelspartner. Mehr als 50 % der Exporteinnahmen im Reiseverkehr<br />
(jedoch nur knapp 23 % der Importausgaben) wurden 2003 im bilateralen Handel mit<br />
dem Nachbarland erwirtschaftet, wobei dieser Anteil seit 1995 – ausgehend von 62 %<br />
– stetig sank. Stark angestiegen ist in derselben Zeitperiode der Anteil der Niederlande:<br />
Von 4,8 % (1995) verdoppelte sich der Exportanteil bis 2003 beinahe auf 9,3 %. Damit<br />
sind die Niederländer die zweithäufigsten ausländischen Touristen in Österreich. Die<br />
relativ hohen Zuwächse bei den Reiseverkehrexporten von 3,8 % im Jahr 2002 (in<br />
dem die Dienstleistungsexporte insgesamt um nur 0,8 % expandierten) wurden ebenfalls<br />
maßgeblich durch hohe Zugewinne gegenüber den Niederlanden (von 20,4 %)<br />
123
ermöglicht. 2003 erhöhten sich die Exporte in die Niederlande nochmals um beinahe<br />
38 % und damit auf über 1 Mrd. Euro. Aufgrund der geringen Reiseverkehrsimporte<br />
fiel die Teilbilanz gegenüber den Niederlanden mit 994 Mio. Euro Überschuss (oder<br />
87 % der Exporte) besonders gut aus. An dritter Stelle bei den Exporten lag im Jahr<br />
2003 Großbritannien (7,9 % Anteil), gefolgt von der Schweiz und Italien mit je 5,9 %<br />
Anteil und den USA (2,9 %). Während Touristen aus Großbritannien und Italien vermehrt<br />
ihr Geld in Österreich ließen, war der Wert der Reiseverkehrseinnahmen aus der<br />
Schweiz und besonders aus den USA rückläufig. Der Rückgang der Exporte in beide<br />
Länder – vor allem jedoch in die USA – kann gut mit der Wechselkursentwicklung in<br />
den vergangenen ein bis zwei Jahren erklärt werden. Inwieweit auch die Angst vor Terroranschlägen<br />
und ein dadurch bedingter allgemeiner Rückgang von Auslandsreisen<br />
ebenfalls eine Rolle spielte, kann aus dem vorliegenden Datenmaterial nicht ersehen<br />
werden; ein diesbezüglicher Einfluss ist jedoch wahrscheinlich.<br />
Importe<br />
Die häufigste Destination für österreichische Touristen ist Deutschland, mehr als ein<br />
Fünftel der Reiseverkehrsimporte wurden 2003 aus Deutschland bezogen. An zweiter<br />
Stelle bei den Importländern stand mit 14 % erneut Italien. Die Anteile beider Länder<br />
an den österreichischen Importen gingen in den letzten zehn Jahren stark zurück, die<br />
Österreicher verbrachten ihren Auslandsurlaub vermehrt in Griechenland und Ungarn<br />
(die Importe aus diesen Destinationen vervierfachten sich seit 1995); hohe Zuwächse<br />
verzeichneten auch Frankreich, Tschechien, die Schweiz und Belgien (wobei hier der<br />
„Brüssel-Effekt“ zu berücksichtigen ist). Deutlich lässt sich die gestiegene Attraktivität<br />
Osteuropas als Reiseland für Österreicher feststellen, was auch im stark gestiegenen<br />
Defizit gegenüber der Region seinen Ausdruck findet.<br />
6.1.2 Unternehmensbezogene Dienstleistungen<br />
Besonders dynamisch entwickelte sich in jüngerer Zeit der Handel mit unternehmensbezogenen<br />
Dienstleistungen. Wie in den meisten OECD-Ländern expandieren auch<br />
in Österreich vor allem die wissensbasierten Dienstleistungen, bei denen es um die<br />
Schaffung (F&E), die Verbreitung und die Anwendung (Beratung, etc.) von theoriegeleitetem<br />
Wissen geht. Dem wissensbasierten Dienstleistungssektor können auch<br />
jene Infrastrukturbereiche zugeordnet werden, die für die Erstellung und Erbringung<br />
der eigentlichen Dienstleistung von ausschlaggebender Bedeutung sind: Informations-<br />
und Kommunikationsdienste sowie Teile des Energie- und Verkehrssektors.<br />
Gerade letztere ermöglichen gleichzeitig die vermehrte Handelbarkeit, nicht nur von<br />
wissensbasierten, sondern auch von primären Dienstleistungen (wie Handels- und<br />
124
Der Außenhandel mit Dienstleistungen<br />
Bürotätigkeiten, etc.). Der Wert der österreichischen Exporte in dieser Kategorie (dies<br />
entspricht der Summe der Positionen Versicherungs- und Finanzdienstleistungen,<br />
EDV- und Informationsleistungen, Patente und Lizenzen, sowie sonstige unternehmensbezogene<br />
Dienstleistungen) erhöhte sich seit 1993 von 3,8 Mrd. auf 8,5 Mrd.<br />
Euro, der Anteil an den Gesamteinnahmen stieg von 17 % auf 22 %. Gemessen an<br />
ihrer globalen Bedeutung ergibt sich für Österreich damit eine deutlich ausgeprägte<br />
Spezialisierung auf diese Dienstleistungen (siehe dazu Kapitel 14).<br />
Der Handel mit unternehmensbezogenen Dienstleistungen ist traditionell überschüssig,<br />
selbst 2001 stieg der Überschuss dieser Positionen in Summe auf 1,4 Mrd. Euro und<br />
trug damit wesentlich zum guten Gesamtergebnis in der Dienstleistungsbilanz bei.<br />
Aufgrund hoher Importzuwächse fiel der Überschuss mit rund 600 Mio. Euro im Jahr<br />
2002 zwar geringer aus, war jedoch gemessen am Ergebnis der Dienstleistungsbilanz<br />
insgesamt immer noch hoch.<br />
Der Strukturwandel hin zu einer stärkeren Exporttätigkeit in den oben genannten Einzelpositionen<br />
ist als Ausdruck einer Verbesserung der Exportstruktur zu sehen. Vor<br />
allem im Bereich Versicherungsleistungen ergibt sich eine zunehmende Spezialisierung<br />
Österreichs, nicht nur innerhalb der Dienstleistungsbilanz, sondern auch im <strong>internationale</strong>n<br />
Vergleich (siehe wiederum Kapitel 14). Im Jahr 2003 wurde (nach vorläufigen<br />
Zahlen) in dieser Position erstmals ein Überschuss erwirtschaftet (siehe Tabelle 6.2<br />
in den Statistischen Übersichten). Weniger Anlass zur Freude geben die Teilbilanzen<br />
EDV- und Informationsleistungen, sowie Patente und Lizenzen, deren Defizit sich<br />
kontinuierlich ausweitet. Während sich bei den EDV-Leistungen sowohl die Exporte als<br />
auch die Importe in den letzten zehn Jahren vervierfachten, stiegen bei den Patenten<br />
die Importe mit rund 150 % Zuwachs wesentlich stärker als die Exporte (+36 %). Diese<br />
Entwicklung spricht für eine äußerst geringe Innovationstätigkeit österreichischer<br />
Unternehmen, die neue Ideen lieber aus dem Ausland ankaufen, anstatt sie selber<br />
zu entwickeln. Die große Anzahl Kleiner und Mittlerer Unternehmen (KMU) in Österreich<br />
kann teilweise als Erklärung für die geringe Forschungstätigkeit herangezogen<br />
werden. Hier eröffnen sich Spielräume für die Wirtschaftspolitik. Österreich verfügt mit<br />
dem Forschungsfreibetrag bereits über ein, im <strong>internationale</strong>n Vergleich großzügiges,<br />
Instrument der indirekten Forschungsförderung, das u.U. aufgrund fehlender Transparenz<br />
und mangelnder Einfachheit noch zu wenig genutzt wurde. Eine Evaluierung<br />
der Wirkungen des Freibetrags steht bis dato aus (Hutschenreiter, 2002).<br />
Gerade bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen lässt sich eine deutliche<br />
Differenzierung zwischen dem Handel mit Partnern im Westen und jenen im Osten<br />
erkennen. Ist Österreich gegenüber den (mengenmäßig weitaus gewichtigeren)<br />
westlichen Partnern ein Nettoimporteur, ergibt sich gegenüber Osteuropa, und hier<br />
insbesondere gegenüber den MOEL-5, ein Exportüberschuss in diesem Bereich.<br />
125
Österreich dürfte, was das Know-how von unternehmensrelevanten Serviceleistungen<br />
betrifft, eine Brückenfunktion für Osteuropa darstellen.<br />
6.1.3 Transporte<br />
Der relative Anstieg der Transportleistungen in der Dienstleistungsbilanz ist teilweise<br />
auf die Umstellung in der Zahlungsbilanzstatistik im Jahr 1998 zurückzuführen, wodurch<br />
der <strong>internationale</strong> Personenverkehr von der Position Reiseverkehr hierher wechselte.<br />
Der Anteil des <strong>internationale</strong>n Personenverkehrs an den Dienstleistungsexporten stieg<br />
von 2,9 % im Jahre 1993 auf 5,7 % im Jahre 2003, der Anteil der Transportleistungen<br />
insgesamt nahm in derselben Periode von 11,7 % auf 16,8 % zu. Die stärksten Zuwächse<br />
wurden im Lufttransport verzeichnet, der Wert der Exporteinnahmen stieg um<br />
mehr als das Dreifache auf zuletzt 2,7 Mrd. Euro. Gleichzeitig verfünffachte sich der<br />
Überschuss auf 1,4 Mrd. Euro und trug damit wesentlich zum positiven Saldo dieser<br />
Teilbilanz von 2,4 Mrd. Euro bei. Selbst in den Krisenjahren 2002 und 2003 konnten<br />
die Exporte von Transportleistungen noch stattliche Zuwächse von 10 % (2002) und<br />
6 % (2003) verzeichnen. Waren es im Jahr 2002 hauptsächlich die Exporte nach<br />
Osteuropa gewesen, die diese Entwicklung trugen, so expandierten 2003 die Exporte<br />
nach Westeuropa kräftig, während jene nach Osteuropa sogar zurückgingen.<br />
Der traditionell positive Saldo dieser Teilbilanz wird zu beinahe 70 % im Handel mit den<br />
alten EU-Mitgliedsländern (EU-15) erwirtschaftet, und hier insbesondere mit Deutschland<br />
und Großbritannien. Osteuropa trug mit einem Überschuss von 141 Mio. Euro<br />
ebenfalls zum positiven Gesamtergebnis bei, trotz des negativen Saldos gegenüber<br />
Tschechien und Polen.<br />
6.1.4 Sonstige Positionen<br />
Kommunikationsdienstleistungen<br />
Die dynamische Entwicklung in der mengenmäßig weniger bedeutenden Teilbilanz<br />
der Kommunikationsdienstleistungen fand 2002 ihren vorläufigen Endpunkt. Mit Einnahmen<br />
von 689 Mio. Euro (dies entsprach 1,8 % der Gesamtexporte) hatten sich die<br />
Exporte auf das Achtfache des Niveaus von 1993 erhöht. 2003 brachte erstmals seit<br />
einer Dekade einen Exportrückgang um 19 % auf 558 Mio. Euro. Gleichzeitig sanken<br />
die Importe in beiden Jahren um jeweils rund 13 %, wodurch sich der Überschuss<br />
2002 auf 217 Mio. Euro kräftig erhöhte. 2003 fiel er mit 145 Mio. Euro im Vergleich<br />
zum Vorjahr zwar wesentlich geringer aus, der langfristige Trend einer Umkehrung des<br />
einstmaligen Defizits in einen stabilen Überschuss setzte sich damit jedoch fort. Die<br />
Entwicklung in dieser Teilbilanz ist somit durchaus positiv zu sehen und spricht – im<br />
126
Der Außenhandel mit Dienstleistungen<br />
Zusammenhang mit den Exportzuwächsen bei den unternehmensnahen Dienstleistungen<br />
– ebenfalls für eine Verbesserung der Struktur des Dienstleistungshandels.<br />
Bauleistungen<br />
Die Bauleistungen stellen für Österreich mit 2,3 % Anteil exportseitig und 2,1 % importseitig<br />
(jeweils 2003) ebenfalls eine im <strong>internationale</strong>n Vergleich überdurchschnittlich<br />
wichtige Position dar, allerdings ergibt sich in dieser Position eine negative Spezialisierung.<br />
Anders ausgedrückt ist deren Bedeutung international gesehen importseitig<br />
größer als exportseitig. Besonders aus Polen importiert Österreich – gemessen an der<br />
Größe dieses Handelspartners – überdurchschnittlich viele Bauleistungen. Relativ niedrige<br />
Lohnkosten sowie eine entsprechende Ausbildung der Arbeitskräfte dürften hier<br />
eine Rolle spielen. Dessen ungeachtet ergibt sich in dieser Teilbilanz ein Überschuss,<br />
dessen Wert jedoch mit dem Konjunkturverlauf stark schwankt. Die Rezessionsjahre<br />
2002 und 2003 schlugen sich in geringeren Überschüssen von 104 Mio. bzw. 98 Mio.<br />
Euro nieder, das ist gegenüber den Jahren zuvor ein deutlicher Rückgang.<br />
6.2 Regionale Entwicklung<br />
6.2.1 Geographische Konzentration<br />
Während im Güterhandel sowohl bei den Exporten als auch bei den Importen eine<br />
Abnahme der hohen regionalen Konzentration zu beobachten war, nahm diese bei den<br />
Dienstleistungsexporten und -importen seit 1995 weiter zu. Beinahe 69 % der Exporte<br />
2003 waren für Partner innerhalb der EU-15 bestimmt, 68 % der Importe kamen aus<br />
der EU-15. Rechnet man die neuen Mitgliedsländer bereits ein, so betrug der Anteil des<br />
EU-Handels in der Dienstleistungsbilanz 77 % exportseitig und 75 % importseitig (siehe<br />
auch Tabelle 6.6 in den Statistischen Übersichten). Interessanterweise gab es keine<br />
übermäßig große Zunahme des Handels mit Partnern in Osteuropa. Durch die EU-Erweiterung<br />
könnte sich der Handel mit den Beitrittsländern jedoch überdurchschnittlich<br />
erhöhen, weil gerade in diesem Bereich die meisten Liberalisierungsschritte noch zu<br />
setzen sind. Der Handel mit Sachgütern ist durch die Europa-Abkommen bereits mehr<br />
oder weniger vollständig liberalisiert, hier werden keine unmittelbaren Effekte erwartet.<br />
Somit könnte der seit 1995 ziemlich konstante Anteil der neuen Mitgliedsländer von<br />
8,5 % der Exporte und 7,2 % der Importe (2003) in Zukunft tendenziell ansteigen.<br />
In den wirtschaftlich schwierigen Jahren 2002 und 2003 ergab sich eine verstärkte<br />
Konzentration auf die alten Mitgliedsländer als Handelspartner, wobei die Entwicklungen<br />
gegenüber einzelnen Ländern unterschiedlich waren: Vor allem die Exporte<br />
nach Großbritannien, in die Niederlande, nach Frankreich und Belgien dehnten sich<br />
127
kräftig aus, wobei der Reiseverkehr eine wichtige Rolle spielte. Insgesamt lag das<br />
Wachstum der Exporte in die alten Mitgliedsländer mit 2,2 % (2002) und 5,1 % (2003)<br />
nicht nur deutlich über dem Gesamtwachstum, in beiden Jahren ging der Handel mit<br />
Partnern außerhalb der EU-15 (und auch außerhalb der erweiterten EU-25) zurück.<br />
Die Importe aus Ländern außerhalb der EU-15 gingen erst 2003 zurück (um 0,4 %),<br />
jedoch übertraf auch hier das Wachstum mit alten Mitgliedsländern deutlich den<br />
weltweiten Durchschnitt.<br />
Die Entwicklung des Euro-Dollar-Wechselkurses und die schwache inländische Konjunktur<br />
wirkten sich besonders stark auf den Überseehandel aus. Die Exporte in die<br />
USA gingen im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr um rund 13 % zurück, die Importe<br />
nahmen 2002 erst mäßig und 2003 mit 11 % ebenfalls stark ab (siehe auch Tabellen<br />
6.3 und 6.4 in den Statistischen Übersichten). Somit verlor die NAFTA insgesamt an<br />
Bedeutung für Österreich. Die ASEAN-Gemeinschaft verlor ebenfalls an Bedeutung,<br />
hingegen wuchs der Handel mit China nicht nur absolut gesehen (um 16,4 % im Jahr<br />
2003), sondern auch relativ von 0,37 % auf 0,53 %. Bei den Importen verdoppelte sich<br />
der Anteil Chinas seit 1995, lag jedoch mit 0,4 % unter jenem der Exporte.<br />
Während gegenüber den MOEL die größten Zugewinne bereits in der zweiten Hälfte der<br />
1990er-Jahre erzielt worden waren und die Exportsteigerungen seit 2000 wesentlich<br />
geringer ausfielen, erwies sich der Handel mit Partnern in Südosteuropa nach wie vor<br />
als dynamisch. Die Exporte nahmen 2003 um beinahe 14 % zu, damit verdoppelte sich<br />
der Anteil der SOEL-7 exportseitig seit 1995 auf 2 %. Dieser Entwicklung stand 2003<br />
mit 28 % Zuwachs im Jahresvergleich erneut ein Importschub gegenüber, wodurch<br />
sich die Importe aus der Region seit 1995 vervierfachten. Allein aus Kroatien wurden<br />
mit 570 Mio. Euro um 58 % mehr Leistungen importiert als 2002. Dies entsprach 70 %<br />
der Importe aus der Region.<br />
6.2.2 Regionale Bilanzen<br />
Trotz ihrer relativ geringen Bedeutung erwirtschaftete Österreich im Handel mit den<br />
neuen Mitgliedsländern seit 1999 ansehnliche Überschüsse (siehe auch Tabellen 6.5<br />
und 6.7 in den Statistischen Übersichten). Mit 548 Mio. Euro lag der Überschuss 2003<br />
nur wenig unter jenem gegenüber den alten Mitgliedsländern von 780 Mio. Euro. Somit<br />
standen den Nettoeinnahmen von 1,3 Mrd. Euro aus der EU-25 Nettoabflüsse in den<br />
Extra-EU-Raum von 500 Mio. Euro gegenüber.<br />
Gegenüber den alten Mitgliedsländern resultierte der Löwenanteil des Überschusses<br />
nach wie vor aus dem Reiseverkehr. Die sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen<br />
wiesen 2003 ebenfalls einen Überschuss auf, jedoch waren die Teilbilanzen<br />
der übrigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen allesamt defizitär. Ein Defizit<br />
128
Der Außenhandel mit Dienstleistungen<br />
ergab sich auch in der Position der NAL. Gegenüber Deutschland, Großbritannien und<br />
den Niederlanden ergab sich das gleiche Bild. Im Handel mit Italien war Österreich<br />
Nettoimporteur von Reiseverkehrsleistungen und im Handel mit Frankreich wurde in<br />
allen Teilbilanzen der sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen, ausgenommen<br />
EDV und Patente und Lizenzen, ein Überschuss erwirtschaftet.<br />
Eine recht unterschiedliche Nettoposition ergibt sich gegenüber den neuen Mitgliedsländern<br />
in den einzelnen Positionen. Hier kam der Überschuss aus dem Handel im<br />
Bereich der unternehmensbezogenen Dienstleistungen sowie bei den Transportleistungen<br />
und den NAL zustande. Im Reiseverkehr ergab sich gegenüber den neuen<br />
Mitgliedern ein Defizit. Gegenüber Tschechien erwirtschaftete Österreich im zweiten<br />
aufeinanderfolgenden Jahr ein Defizit bei den Dienstleistungen insgesamt, welches<br />
durch die hohen Reiseverkehrsausgaben der Österreicher in Tschechien verursacht<br />
wurde. Dem standen jedoch hohe Überschüsse mit Polen und der Slowakei gegenüber.<br />
Bei beiden Ländern, besonders jedoch im Handel mit Polen, spielten Bauleistungen<br />
sowie sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen eine große Rolle.<br />
Der größte Überschuss gegenüber Polen ergab sich in der Position der NAL, was<br />
eine Interpretation der guten österreichischen Performance schwierig macht. Jedoch<br />
kann angenommen werden, dass ein wesentlicher Bestandteil des österreichischen<br />
Erfolgs in Osteuropa (in der NAL beinhaltete) Serviceleistungen im Zusammenhang<br />
mit Warengeschäften sind.<br />
Den Nettoexporten innerhalb Europas standen 2003 – wie in den Jahren zuvor – Nettoimporte<br />
aus Übersee gegenüber. Vor allem das Defizit gegenüber den NAFTA-Mitgliedern<br />
(1,4 Mrd. Euro 2003, davon gegenüber den USA 1,2 Mrd. Euro) fiel erneut hoch aus.<br />
Auch der Handel mit ASEAN-Mitgliedern sowie mit Japan war in den letzten zwei bzw.<br />
drei Jahren defizitär. Gegenüber den SOEL-7 ergab sich 2003 – nicht zuletzt aufgrund<br />
der hohen österreichischen Reiseverkehrsausgaben in Kroatien – ein Defizit.<br />
Anmerkungen<br />
1 Eine ausführliche Behandlung des Dienstleistungshandels sowie einer Analyse der österreichischen<br />
Position im <strong>internationale</strong>n Vergleich findet sich in Kapitel 14.<br />
2 Es wird erwartet, dass die Position der NAL mit der neuen Erfassung beträchtlich verringert<br />
wird. Obwohl gewisse Aspekte bestehen bleiben – so wird es nach wie vor Unterschiede<br />
zwischen Warenhandel laut Außenhandelsstatistik und Zahlungsbilanz aufgrund der unterschiedlichen<br />
Bewertung (CIF-FOB) geben – besteht die Möglichkeit, mehr Dienstleistungen<br />
auch als solche zu erfassen. Einerseits ergibt sich das durch die Umstellung der Erhebung<br />
auf eine direkte Erfassung der Leistung beim Wirtschaftstreibenden an Stelle der bisherigen<br />
Erfassung der damit in Zusammenhang stehenden Zahlung bei einem Finanzinstitut. Andererseits<br />
wird der Schwellenwert für meldepflichtige Transaktionen von 250.000 auf 50.000<br />
Euro herabgesetzt, wodurch mehr Geschäftsfälle erfasst werden.<br />
129
7 GRENZÜBERSCHEITENDE<br />
DIREKTINVESTITIONEN<br />
Im Anschluss an die große Fusionswelle der Jahre 1999 bis 2000 entwickelten<br />
sich die Direktinvestitionsströme sowohl weltweit als auch in Europa stark rückläufig.<br />
Demgegenüber konnte Österreich seine Position weltweit sowohl aktiv- als<br />
auch passivseitig stark verbessern. Aktivseitig waren die Direktinvestitionsströme<br />
gekennzeichnet durch starke Investitionen in Mittel- und Osteuropa, während passivseitig<br />
Deutschland seine Dominanz weiter ausbauen konnte. Die Beschäftigung<br />
der österreichischen Tochterunternehmen im Ausland übertraf 2001 erstmals jene<br />
der ausländischen Unternehmen in Österreich. Diese Entwicklung kann vor allem<br />
durch die hohen Arbeitsintensitäten der aktiven Direktinvestitionen in den mittel-<br />
und osteuropäischen Ländern erklärt werden kann. 2001 wurden knapp 85 % des<br />
gesamten Jahresergebnisses von 1,3 Mrd. Euro von Tochterunterunternehmen in<br />
Mittel- und Osteuropa erzielt. Die Eigenkapitalrentabilitäten dieser Tochterunternehmen<br />
übertrafen jene der Tochterunternehmen in der EU-15 bei weitem. Auch die<br />
passiven Direktinvestitionen in Österreich erzielten 2001 sehr hohe Erträge.<br />
Die Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft setzte sich somit in der<br />
Periode 2001 – 2003 fort und stärkte die weltweite Position Österreichs sowohl<br />
aktiv- als auch passivseitig zusätzlich. Insbesondere Österreichs Engagement in<br />
Mittel- und Osteuropa leistete zu dieser Entwicklung einen wesentlichen Beitrag.<br />
7.1 Einleitung 1<br />
Österreichs Direktinvestitionen im Ausland wuchsen in den vergangenen 15 Jahren<br />
überaus stark. Insbesondere die Ostöffnung forcierte diese Entwicklung. Gleichzeitig<br />
stiegen aber auch die ausländischen Direktinvestitionen in Österreich stark an. Es<br />
zeigt sich somit eine forcierte Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft.<br />
Diese Form der Internationalisierung hat sich in den Jahren 2001 – 2003 trotz weltweit<br />
rückläufiger Tendenzen weiter fortgesetzt. Im Jahre 2001 übertraf die Beschäftigung<br />
in österreichischen Tochterunternehmen im Ausland erstmals jene der ausländischen<br />
Tochterunternehmen in Österreich. All diese Entwicklungen machen eine genauere<br />
Untersuchung der österreichischen Direktinvestitionen sowie deren Auswirkungen<br />
auf die heimische Wirtschaft außergewöhnlich interessant. Im Folgenden soll daher<br />
die Entwicklung Österreichs sowohl im <strong>internationale</strong>n Vergleich als auch innerhalb<br />
Österreichs selbst dargestellt und analysiert werden.<br />
130
7.2 Allgemeine Entwicklung der weltweiten<br />
Direktinvestitionen<br />
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
Die weltweiten Direktinvestitionsströme verringerten sich 2002 abermals (vgl. Abbildung<br />
7.1). Dabei zeigt sich deutlich die Sonderstellung der Boomperiode 1999<br />
– 2000. Diese Zweijahresperiode ist gekennzeichnet durch eine weltweit äußerst<br />
positive Konjunkturentwicklung und war darüber hinaus geprägt durch eine Vielzahl<br />
an Übernahmen und Fusionen (Mergers and Aquisitions – M&As). Wenngleich der<br />
Rückgang der Direktinvestitionsströme 2001 – 2002 relativ stark ausfiel, so bleiben<br />
diese noch immer auf einem sehr hohen absoluten Niveau (siehe Tabelle 7.3 in den<br />
Statistischen Übersichten).<br />
Globale FDI-Ströme, 1980–2002 (Mrd. USD) Abb. 7.1<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
Welt<br />
0<br />
1980 1982<br />
Entwicklungsländer<br />
1984<br />
Quelle: UNCTAD Database, Web download.<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
Entwickelte Länder<br />
Mittel- und Osteuropa<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
Gründe für Rückgang der Direktinvestitionen nach 2000<br />
Der Rückgang der Direktinvestitionsströme nach 2000 steht zum Teil in unmittelbarem<br />
Zusammenhang mit der Boomperiode 1999/2000. Drei Motive sind für diesen Rückgang<br />
ausschlaggebend (UNCTAD, 2003): die makroökonomische Konjunkturentwicklung,<br />
die mikroökonomische Entwicklungen der Unternehmen sowie verschiedene<br />
institutionelle Gründe.<br />
131
• Makroökonomisch sind insbesondere der weltweite Konjunktureinbruch sowie der<br />
damit einhergehende Wachstumsrückgang verantwortlich für die Verringerung der<br />
Direktinvestitionsströme. Zentral waren dabei der Finanz- sowie der Telekommunikationssektor<br />
betroffen. Direktinvestitionsströme entwickeln sich zumeist parallel<br />
mit den nationalen Wachstumsraten. So zeichnete alleine die USA für 90 % des<br />
Rückgangs der Direktinvestitionsströme der Industrieländer. Auch Großbritannien<br />
verzeichnete einen extremen Rückgang, während Deutschland und auch<br />
Österreich einen leichten Anstieg registrieren konnten. Sowohl weltweit als auch<br />
insbesondere in den USA und Großbritannien war das Abflauen des M&A-Booms<br />
für den starken Rückgang der Direktinvestitionsströme maßgeblich verantwortlich.<br />
Hatte die Anzahl der M&As im Jahre 2000 noch 7.894 betragen, so fiel diese<br />
Anzahl im Jahre 2002 auf 4.493 zurück! Zusätzlich fiel der durchschnittliche Wert<br />
pro M&A von 145 auf 82 Mio. USD.<br />
• Mikroökonomisch war die Periode 2001/2002 durch Korrekturen der Marktwerte<br />
der Tochterunternehmen gekennzeichnet, welche im Zuge des M&A-Booms der<br />
beiden Vorjahre zumeist überbewertet worden waren. Der weltweite Rückgang<br />
der Börse in den Jahren 2001/2002 ist das typische Merkmal dieser Entwicklung.<br />
Zusätzlich verschlechterten sich auch die Rentabilität der Tochterunternehmen<br />
sowie die Finanzierung der Tochter- durch die Mutterunternehmen. Auch das<br />
Ausmaß der re-investierten Gewinne ging zurück. Überdies war diese Periode<br />
gekennzeichnet durch große firmeninterne Restrukturierungsprozesse im Anschluss<br />
an den M&A-Boom. Dies führte zu Schließungen einer großen Anzahl an<br />
Tochterunternehmen (siehe Tabelle 7.1).<br />
Desinvestitionen nach Übernahmen und Fusionen: Änderungen in der<br />
Anzahl der Tochterunternehmen und Gastländer (ausgewählte Fälle)<br />
132<br />
Jahr der<br />
Übernahme<br />
Anzahl im Jahr<br />
der Übernahme<br />
Vivendi Universal 2000 Tochterunternehmen 904 744<br />
(Vivendi-Seagram) Gastländer 52 50<br />
BHP Billiton 2001 Tochterunternehmen 184 60<br />
(BHP Billiton) Gastländer 30 20<br />
Unilever 2000 Tochterunternehmen 275 242<br />
(Unilever-Bestfoods) Gastländer 50 44<br />
Nestle 2001 Tochterunternehmen 428 398<br />
(Nestle-Raston Purina) Gastländer 63 86<br />
Quelle: UNCTAD 2003, S.18.<br />
Tab. 7.1<br />
2002
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
• Institutionell war die Periode 2001/2002 durch einen starken Rückgang der<br />
Privatisierungsprogramme gekennzeichnet. Dies betraf sowohl die Situation<br />
in den ehemaligen mittel- und osteuropäischen Ländern Ungarn und Polen als<br />
auch in Ländern Südamerikas (Brasilien, Argentinien). Zusätzlich war diese<br />
Periode – insbesondere in den USA – durch Firmenskandale gekennzeichnet<br />
(z.B. Enron), welche gleichfalls das Vertrauen der Investoren beeinträchtigten.<br />
Regionale Verteilung der FDI-Ströme, 1980–2002 (in %) Abb. 7.2<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1980 1982<br />
Entwickelte Länder<br />
Entwicklungsländer<br />
1984<br />
Quelle: UNCTAD Database, Web download.<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
Mittel - und Osteuropa<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
Die regionale Verteilung der Direktinvestitionsströme zeigt deutlich die Dominanz der<br />
Industrienationen (vergleiche Abbildung 7.2). Während in der Periode 1992 – 1998 im<br />
Zuge der großen Privatisierungsprogramme bis zu 40 % der jährlichen Direktinvestitionsströme<br />
in Entwicklungsländern (Brasilien, Argentinien, u.a.) flossen, fiel deren<br />
Anteil 1999/2000 auf unter 20 %. Gerade die großen M&As fanden ausschließlich<br />
zwischen den Industrienationen statt (z. B. Daimler, D/Chrysler, USA). Innerhalb der<br />
Entwicklungsländer nahm China eine Sonderolle ein. Mit Investitionsströmen von<br />
53 Mrd. USD überholt China 2002 bereits die USA (30 Mrd. USD) und rangierte hinter<br />
Luxemburg (126 Mrd. USD) weltweit auf Rang zwei. Von den drei angeführten Regionen<br />
konnte einzig Mittel- und Osteuropa wachsende Investitionsströme verzeichnen.<br />
Diese Investitionsströme waren vorwiegend durch Privatisierungen bedingt.<br />
133
Insgesamt gesehen war die Entwicklung der Jahre 2001/2002 dominiert durch die<br />
bescheidenen Wachstumsraten der Weltwirtschaft sowie durch die Folgewirkungen<br />
des M&A-Booms der Periode 1999/2000. Aktuelle Prognosen der UNCTAD lassen<br />
jedoch für die Periode 2004/2005 einen neuerlichen Anstieg der Investitionsströme<br />
erwarten (UNCTAD, 2004).<br />
7.3 Österreichs Position im <strong>internationale</strong>n Vergleich<br />
7.3.1 Aktive und passive Direktinvestitionen im <strong>internationale</strong>n<br />
Vergleich 2<br />
Direktinvestitionsbestände 1980–2002 (in % des BIP) Abb. 7.3<br />
Quelle: UNCTAD, FDI database; 2002 ist eine Schätzung.<br />
134<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0<br />
8<br />
9<br />
1<br />
1<br />
8<br />
9<br />
1<br />
2<br />
8<br />
9<br />
1<br />
3<br />
8<br />
9<br />
1<br />
Welt<br />
4<br />
8<br />
9<br />
1<br />
5<br />
8<br />
9<br />
1<br />
6<br />
8<br />
9<br />
1<br />
7<br />
8<br />
9<br />
1<br />
8<br />
9<br />
1<br />
9<br />
8<br />
9<br />
1<br />
aktiv<br />
0<br />
9<br />
1<br />
1<br />
9<br />
1<br />
2<br />
9<br />
1<br />
3<br />
9<br />
1<br />
4<br />
9<br />
1<br />
5<br />
9<br />
1<br />
passiv<br />
Um die relative Bedeutung von Direktinvestitionen einer Volkswirtschaft einschätzen zu<br />
können, werden diese in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) gestellt. In Abbildung<br />
7.3 sind diese Relationen sowohl für aktive als auch passive Direktinvestitionsbestände<br />
Österreichs dargestellt und werden mit den weltweiten Durchschnittswerten verglichen.<br />
Dabei zeigt sich deutlich die Globalisierung der Weltwirtschaft in Form von steigenden<br />
Direktinvestitionsbeständen. Betrug die Relation von Direktinvestitionen zum BIP<br />
1989 erst knapp 6 %, so stieg diese Relation 2002 bereits auf 22 % an. Die Werte<br />
für Österreich zeigen zwei interessante Entwicklungen: Erstens „internationalisierte“<br />
6<br />
9<br />
1<br />
7<br />
9<br />
1<br />
8<br />
9<br />
1<br />
9<br />
1<br />
0<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2<br />
*<br />
2<br />
0<br />
2
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
die österreichische Wirtschaft seit Beginn der 1990er-Jahre sehr stark und zweitens<br />
trifft dies für die aktiven Direktinvestitionen ungleich stärker zu. Über einen langen<br />
Zeitraum war die österreichische Wirtschaft sehr einseitig geprägt durch ausländische<br />
Direktinvestitionen in Österreich und nur durch geringe inländische Aktivitäten im Ausland.<br />
Dies ist zu einem Großteil auf die stark klein- und mittelständisch strukturierte<br />
österreichische Unternehmenslandschaft zurückzuführen. Diese Situation änderte<br />
sich zu Beginn der 1990er-Jahre grundsätzlich.<br />
Aktive Direktinvestitionen<br />
Aktivseitig stieg die Relation von Direktinvestitionen zu BIP (siehe Tabelle 7.4 in<br />
den Statistischen Übersichten) in nur 13 Jahren (1990 – 2002) von 2,6 % auf knapp<br />
20 %! Bedingt wurde diese Internationalisierung in erster Linie durch die Ostöffnung<br />
1989, welche es auch klein- und mittelständisch strukturierten Unternehmen leichter<br />
möglich machte, Investitionen im benachbarten mittel- und osteuropäischen Ausland<br />
durchzuführen. Österreich konnte in dieser Region aufgrund seiner langen historischen<br />
Beziehungen sowie seiner umfassenden Kenntnisse der ökonomischen und<br />
<strong>politische</strong>n Rahmenbedingungen sehr gut Fuß fassen. Zusätzlich wurde die aktive<br />
Internationalisierung auch stark forciert durch den Betritt Österreichs zur EU 1995. Zur<br />
Vorbereitung investierten zahlreiche österreichische Unternehmen verstärkt in dieser<br />
Region. Während sich also die passiven Direktinvestitionen im <strong>internationale</strong>n Einklang<br />
entwickelten, wurde durch die aktive Internationalisierung ein enormer Aufholprozess<br />
gestartet. Als Ergebnis dessen entwickelte sich die Relation von aktiven zu passiven<br />
Direktinvestitionen zwischen 1980 und 2002 von 0,17 auf 0,95! Die Prognosen der<br />
OeNB sagen für 2003 bereits eine ausgeglichene Relation von aktiven und passiven<br />
Direktinvestitionsbeständen voraus (OeNB, 2004).<br />
Passive Direktinvestitionen<br />
Im Unterschied zu den UNCTAD-Schätzungen für 2002 zeigen aktuelle Daten sowie<br />
die Prognose der OeNB (2004) eine Stagnation der passiven Direktinvestitionen für das<br />
Jahr 2002 an, prognostizieren allerdings ein neuerliches Hoch für das Jahr 2003.<br />
Die Direktinvestitionen des Auslands in Österreich waren und sind sehr stark geprägt<br />
durch einzelne Großprojekte. So war das Jahr 2000 geprägt durch die Fusion der Bank<br />
Austria mit der deutschen Hypo-Vereinsbank, wodurch ein Rekordergebnis an passiven<br />
Direktinvestitionsströmen von 9,6 Mrd. Euro verzeichnet werden konnte. 2002 gab es<br />
hingegen keinerlei Fusionen in dieser Größenordnung, wodurch die passiven Investitionsströme<br />
auf 1 Mrd. Euro einbrachen. Zusätzlich kam in diesem Jahr durch den<br />
Rückzug der Telekom Italia aus Österreich eine enorm hohe Desinvestition zustande.<br />
135
Im Jahr 2003 erreichten die passiven Direktinvestitionen allerdings mit 6,1 Mrd. Euro<br />
bereits wieder den dritthöchsten bisher beobachteten Wert.<br />
Auf eine Verschlechterung der Standortbedingungen Österreichs durch den „Ausreißer<br />
2002“ kann somit nicht geschlossen werden. Auch die Austrian Business Agency (ABA)<br />
erwartet für 2004/2005 einen weiteren Zustrom von ausländischen Direktinvestitionen<br />
nach Österreich (ABA, 2004).<br />
7.3.2 Aktive und passive Direktinvestitionen nach Regionen<br />
Aktive:<br />
Hinsichtlich der regionalen Untergliederung (siehe Tabelle 7.5 in den Statistischen<br />
Übersichten) wird hier zwischen drei Ländergruppen unterschieden: der Gruppe der<br />
„alten” EU-15, der Gruppe aller mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL-19) 3 sowie<br />
allen anderen Ländern 4 . Dies ist sinnvoll, weil hier einerseits Daten für die Periode<br />
1991–2001 untersucht werden; und zudem, weil – wie noch zu zeigen sein wird – zwischen<br />
diesen Ländergruppen starke strukturelle Unterschiede vorliegen.<br />
In der Periode 1991–2001 erhöhte sich der Direktinvestitionsbestand Österreichs im<br />
Ausland um knapp das Achtfache von 3,7 auf 29,2 Mrd. Euro. Wie bereits ausgeführt,<br />
war diese Periode vor allem durch den starken Anstieg der österreichischen Direktinvestitionen<br />
in Mittel- und Osteuropa gekennzeichnet. Der Anteil dieser Ländergruppe,<br />
gemessen am gesamten investierten Eigenkapital, stieg in dieser Periode von 21,1 %<br />
auf 34,6 % (+13,5 %-Punkte). Der Anteil der EU-15 fiel um nahezu genau den gleichen<br />
Anteil (von 50,8 % auf 39,2 %). Im Jahre 2001 entfielen innerhalb der MOEL-19 84 %<br />
aller Direktinvestitionsbestände auf die acht Beitrittsländer, davon wiederum 92 % auf<br />
die MOEL-5. Somit sind die Direktinvestitionsbestände sehr stark auf die unmittelbar<br />
angrenzenden Länder Mittel- und Osteuropas konzentriert. Insbesondere durch den<br />
starken Anstieg österreichischer Investitionen in Kroatien, aber auch in Rumänien und<br />
Bulgarien, gewinnen die Nicht-Beitrittsländer jedoch seit 2000 an Bedeutung.<br />
Betrachten wir die Region Mittel- und Osteuropa noch etwas genauer. Ende 2001 arbeiteten<br />
insgesamt 270.000 Beschäftigte in österreichischen Tochterunternehmen im<br />
Ausland. Dies war der höchste jemals erreichte Stand an Beschäftigung im Ausland.<br />
Davon waren jedoch 190.000 (oder 70,4 %) in Tochterunternehmen in den MOEL-<br />
19 beschäftigt. Und dies, obwohl deren Anteil am investierten Eigenkapital lediglich<br />
34,6 % betrug. Der Anteil, gemessen an der Anzahl der Tochterunternehmen, machte<br />
50,9 % aus.<br />
Wie aus Abbildung 7.4 ersichtlich, stiegen die Anteile der MOEL-19 in der Periode<br />
1991 – 2001 bei allen drei Kategorien, jedoch mit Abstand am stärksten bei der Beschäftigung<br />
(von 39,1 auf 70,4 %). Dies zeigt sehr deutlich einen wichtigen Aspekt der<br />
136
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
Aktive FDI: Anteile der MOEL-19 an Eigenkapital, Abb. 7.4<br />
Anzahl Tochterunternehmen und Beschäftigung (in %) 1991–2001<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Quelle: OeNB.<br />
1991<br />
1992<br />
Eigenkapital<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
Anzahl<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
Beschäftigung<br />
österreichischen Direktinvestitionen in dieser Region, nämlich die enorm hohe Arbeitsintensität.<br />
In Abbildung 7.5 ist die Entwicklung der Arbeitsintensität nach Regionen<br />
für die Periode 1991 – 2001 dargestellt. Dabei wird zweierlei ersichtlich: Erstens liegt<br />
ein drastischer Unterschied in der Arbeitsintensität zwischen den drei hier unterschiedenen<br />
Regionen vor und zweitens hat sich diese Kennzahl über die gesamte Periode<br />
verbessert, jedoch unterschiedlich nach Regionen.<br />
Die Arbeitsintensitäten der Tochterunternehmen in der EU-15 und den restlichen<br />
Ländern differieren zwar ebenfalls, jedoch nicht dramatisch. Zudem fand zwischen<br />
diesen beiden Regionen in der Periode 1991 – 2001 ein Annäherungsprozess statt.<br />
Die Differenz zwischen den MOEL-19 und der EU-15 sind hingegen außergewöhnlich<br />
hoch. So entfielen im Jahre 2001 auf eine Mio. Euro Eigenkapital fünf Beschäftigte<br />
in der EU-15, während in den MOEL-19 damit 19 Personen beschäftigt waren. Diese<br />
Differenz hat zwei Ursachen: Einerseits wurde (und wird) in den MOEL-19 aufgrund<br />
der relativ günstigen Arbeitskosten insbesondere in arbeitsintensiven Produktionen und<br />
Dienstleistungen investiert, andererseits war es auch häufig der Fall, dass österreichische<br />
Unternehmen – insbesondere im Zuge der großen Privatisierungsprogramme<br />
– einen Großteil der Betriebsübernahmen relativ kostengünstig abwickeln konnten.<br />
Noch bemerkenswerter ist der zeitliche Verlauf der Entwicklung der Arbeitsintensitäten<br />
in der Periode 1991 – 2001. In allen drei Regionen verringerte sich die Arbeitsinten-<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
137
Arbeitsintensität* der Tochterunternehmen, 1991–2001 Abb. 7.5<br />
*Gewichtete Beschäftigung pro Mio. Euro Eigenkapital<br />
Quelle: OeNB.<br />
sität aufgrund des technologischen Fortschritts – erwartungsgemäß – beträchtlich.<br />
Interessant sind hingegen die regionalen Unterschiede: Während die Arbeitsintensität<br />
in der EU-15 von 16 Personen pro investierte Millionen Euro auf fünf zurückging, so<br />
verbesserte sich diese in den MOEL-19 lediglich von 32 auf 19. Die Differenz der<br />
Arbeitsintensitäten zwischen diesen beiden Regionen erhöhte sich somit von vormals<br />
1:2 (1991) auf nunmehr 1:4 (2001)! Somit kann die enorm hohe Ausweitung der Beschäftigung<br />
in österreichischen Tochterunternehmen im Ausland ausschließlich durch<br />
die hohe Arbeitsintensität in den MOEL-19 sowie deren relative Zunahme gegenüber<br />
den Tochterunternehmen in der EU-15 erklärt werden. Dennoch kann jedoch bereits<br />
hier festgehalten werden, dass die Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa<br />
überdurchschnittliche Erträge erzielen (vgl. 7.3.4.).<br />
Passive:<br />
Die regionale Verteilung der passiven Direktinvestitionen (siehe Tabellen 7.6 und 7.7 in<br />
den Statistischen Übersichten) zeigt, dass Deutschland nach wie vor der mit Abstand<br />
größte Investor in Österreich ist. Auf Deutschland entfallen 47 % des investierten Eigenkapitals,<br />
46 % der Beteiligungen und 55 % der Beschäftigung. Gegenüber 1991<br />
hat Deutschland sogar weiterhin an Bedeutung gewonnen. Der Anteil am investierten<br />
Eigenkapital lag 1991 nur bei 41 %, hat jedoch – insbesondere durch die beiden großen<br />
138<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1991<br />
EU-15<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
MOEL-19<br />
1995<br />
1996<br />
Restliche Länder<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
Fusionen REWA/Billa und HVB/BA-CA – auf 47 % zugenommen. Neben Deutschland<br />
zählen die restlichen EU-Länder zu den größten Investoren in Österreich. Auf diese 13<br />
Länder entfallen 31 % des gesamten investierten Eigenkapitals (2001). Dabei zählen<br />
Großbritannien, die Niederlande, Frankreich und Italien zu den bedeutendsten Investoren.<br />
Der Anteil dieser Ländergruppe ist in den vergangenen zehn Jahren um sieben<br />
Prozentpunkte gestiegen. Für die weiteren 20 % des investieren Kapitals zeichnet die<br />
dritte Ländergruppe, wobei hier vor allem der Schweiz und Liechtenstein (als Sitz von<br />
Holdinggesellschaften) besondere Bedeutung zukommt. Investoren aus Mittel- und<br />
Osteuropa haben nach wie vor nur eine marginale Bedeutung.<br />
Vergleicht man die Verteilung von Beteiligungen sowie Beschäftigung auf die verschiedenen<br />
Ländergruppen, so zeigen sich mit Ausnahme der Länder Mittel- und Osteuropas<br />
keine Besonderheiten. Lediglich bei diesen Investoren zeigt sich, dass diese sowohl<br />
ein sehr geringes Investitionskapital pro Beteiligung als auch eine geringe Anzahl an<br />
Beschäftigte pro Beteiligung aufweisen. Bei diesen Unternehmen handelt es sich vor<br />
allem um Tochterunternehmen im Handel und in anderen Dienstleistungen.<br />
7.3.3 Aktive und passive Direktinvestitionen nach Branchen<br />
Aktiv:<br />
Sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite der Direktinvestitionsbestände 2001<br />
dominiert klar der Dienstleistungssektor mit einem Anteil von 74,0 % am Eigenkapital<br />
und 45,2 % an der Beschäftigung. Verstärkt wird dies vor allem durch die Holdinggesellschaften,<br />
welche unter dem Sektor Realitäten und unternehmensbezogene<br />
Dienstleistungen zusammengefasst werden. Aktivseitig (siehe Tabelle 7.8 in den<br />
Statistischen Übersichten) entfallen auf diesen Sektor 35,7 % des investierten Eigenkapitals,<br />
aber nur 8,6 % der Beschäftigung. Zweitgrößter Investor ist der Kredit- und<br />
Versicherungssektor, auf welchen 25,6 % des investierten Eigenkapitals entfällt. An<br />
nächster Stelle kommt der Handel mit 11,9 %.<br />
Auf die Sachgüterproduktion entfallen insgesamt lediglich 22,9 % des investierten<br />
Eigenkapitals. Innerhalb des Produktionssektors ist die Chemiebranche größter Auslandsinvestor<br />
(6,1 %). Insgesamt sind im Produktionssektor jedoch 53,0 % aller in<br />
österreichischen Tochterunternehmen Beschäftigten tätig. Diese hohe Beschäftigung<br />
ist wiederum aufgrund der hohen Arbeitsintensitäten einzelner Branchen erklärbar (u.a.<br />
Textil, Möbel, aber auch Holzverarbeitung und Fahrzeugbau). Demgegenüber weisen<br />
der Finanz- sowie der Holdingsektor nur äußerst geringe Arbeitsintensitäten auf.<br />
139
Passiv:<br />
Die Branchenstruktur der passiven Direktinvestitionen 2001 (siehe Tabelle 7.9 in den<br />
Statistischen Übersichten) wird geprägt durch den Dienstleistungssektor. 72,3 % des<br />
investierten Eigenkapitals entfielen auf den Tertiärsektor. Allerdings entfielen dabei<br />
33,8 % des Investitionsbestandes alleine auf den Holdingsektor, weitere 17,0 % auf<br />
den Handel und 17,3 % auf den Kredit- und Versicherungssektor. Die Verteilung der<br />
Beschäftigung hingegen unterscheidet sich sehr grundsätzlich von der Verteilung des<br />
Kapitals. So waren von den insgesamt 245.000 Beschäftigten 46,9 % im Produktionssektor<br />
tätig; dabei waren Chemie (6,5 %), Maschinenbau (6,6 %) und Elektrotechnik<br />
(12,7 %) die bedeutendsten Branchen. Innerhalb der Dienstleistungssektoren sticht<br />
der Handel mit einem Anteil von 28,4 % hervor, während im Kredit- und Versicherungsbereich<br />
sowie in den Holdinggesellschaften im Vergleich zur Investitionssumme nur<br />
unterproportionale Beschäftigungsanteile bestehen.<br />
7.3.4 Die Rentabilität der Direktinvestitionen<br />
Aktiv:<br />
Die Erträge der österreichischen Beteiligungsunternehmen im Ausland haben sich im<br />
Jahre 2001 gegenüber dem Vorjahr in Summe nicht verändert (siehe Tabelle 7.10 in<br />
den Statistischen Übersichten). Angesichts wachsender Eigenkapitalbestände hatte<br />
dies einen Rückgang der Eigenkapitalrentabilität (RoE) 5 von 5,6 % auf 4,6 % zur Folge.<br />
Unterscheiden wir die Ertragsentwicklung nach Regionen, so zeigen sich gravierende<br />
Unterschiede. Im Jahre 2001 wurden knapp 85 % des Jahresergebnisses von 1,3 Mrd.<br />
Euro in Mittel- und Osteuropa erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr konnte dabei<br />
Ungarn das Jahresergebnis auf 420 Mio. Euro verdoppeln und die Slowakei das ihre<br />
auf 192 Mio. Euro verdreifachen. Die Jahresergebnisse in Tschechien stiegen schwach<br />
auf 210 Mio. Euro. Lediglich die Ergebnisse in Polen fielen leicht, in Slowenien stark.<br />
Ebenso verdreifachten sich die Jahresergebnisse in den restlichen mittel- und osteuropäischen<br />
Ländern auf 220 Mio. Euro.<br />
Vergleichen wir die Eigenkapitalrentabilität auf aggregierter Ebene zwischen den drei<br />
Ländergruppen (vergleiche Abbildung 7.6), so zeigt sich, dass die Tochterunternehmen<br />
in den MOEL-19 inzwischen die erfolgreichste Gruppe darstellen. Zu Beginn der<br />
Transformationsperiode 1991 – 1995 kennzeichneten diese Unternehmen deutliche<br />
Anfangsschwierigkeiten. Bis 1996 konsolidierten sich diese Tochterunternehmen<br />
jedoch sehr erfolgreich und erzielten in den vergangen drei Jahren stets höhere<br />
Eigenkapitalrentabilitäten als Tochterunternehmen in der EU-15 sowie in der dritten<br />
Ländergruppe. Die Ertragsraten im Jahre 2001 betrugen für diese drei Regionen<br />
–0,6 % (EU-15), 11,1 % (MOEL-19) sowie 3,8 % (restliche Länder).<br />
140
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
Eigenkapitalrentabilität* nach Regionen, 1991–2001 (in %) Abb. 7.6<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
1991<br />
EU-15<br />
1992<br />
1993<br />
* Nettogewinn dividiert durch Eigenkapital.<br />
Quelle: OeNB.<br />
1994<br />
MOEL-19<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
Restliche Länder<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
Eigenkapitalrentabilität* einzelner MOEL, 1991–2001 (in %) Abb. 7.7<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
-20<br />
1991<br />
Ungarn<br />
1992<br />
1993<br />
* Nettogewinn dividiert durch Eigenkapital.<br />
Quelle: OeNB.<br />
Tschech. Rep.<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
Slowakei<br />
1998<br />
1999<br />
Slowenien<br />
2000<br />
2001<br />
141
Untersuchen wir einzelne MOEL getrennt (vergleiche Abbildung 7.7), so sehen wir,<br />
dass in Ungarn (insbesondere aufgrund des frühen Beginns der Privatisierungen) die<br />
Startprobleme am schnellsten überwunden werden konnten und diese Tochterunternehmen<br />
in der gesamten Periode 1991 – 2001 positive Erträge erwirtschafteten. In<br />
den drei anderen Mittel- und osteuropäischen Nachbarstaten Slowenien, Slowakei und<br />
Tschechien, erfolgte die Konsolidierung erst 1995 bzw. 1996. Seit damals erzielen jedoch<br />
die Tochterunternehmen in allen vier mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten steigende<br />
Ertragsraten. Auch die Tschechische Republik, bis 1999 ein Nachzügler, konnte<br />
in den vergangenen beiden Jahren an die gute Performance der anderen drei Länder<br />
anschließen. Lediglich in Slowenien verschlechterte sich 2001 die Ertragslage.<br />
Betrachten wir diese Ergebnisse weiters noch kurz auf der mikroökonomischen Ebene<br />
(vergleicheTabelle 7.2), so zeigt sich deutlich, dass die Ertragslage stark vom Alter der<br />
Tochterunternehmen abhängig ist. Während der Medianwert der Eigenkapitalrentabilität<br />
im Jahre 2001 bei 5,6 % lag, so erzielten neu gegründete Tochterunternehmen (im ersten<br />
Jahr) einen Ertrag von 1,3 %, jene mit einem Alter von zwei bis fünf Jahren 4,7 % und<br />
jene mit einem höheren Alter als fünf Jahre erwirtschafteten bereits 7,5 %. Dies ist ein<br />
deutlicher Indikator, dass die „start-up”-Probleme von neu gegründeten Tochterunternehmen<br />
in den MOEL überwunden werden konnten und nunmehr großteils sehr hohe<br />
Erträge erzielt werden.<br />
Eigenkapitalrentabilität in % (unterschieden nach<br />
verschiedenen Kriterien – Medianwert), 2001<br />
Insgesamt 5,6<br />
Länder Tschech. Republik 6,9<br />
142<br />
Deutschland 3,6<br />
EU-15 4,8<br />
Ungarn 9,9<br />
Polen 3,4<br />
Slowenien 3,0<br />
Slowakei 12,8<br />
andere MOEL 4,7<br />
Rest 3,8<br />
Alter bis 1 Jahr 1,3<br />
2-5 4,7<br />
> 5 7,5<br />
Branche Bergbau, Energie 4,1<br />
Sachgüter 7,7<br />
Dienstleistungen 4,5<br />
Typus Neugründung 4,8<br />
Quelle: Sonderauswertung der OeNB.<br />
Übernahme 6,2<br />
Tab. 7.2
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
Passiv:<br />
Rekordniveau erreichten auch die Erträge der unter ausländischem Einfluss stehenden<br />
österreichischen Direktinvestitions-Unternehmen. Das Jahresergebnis konnte erneut<br />
um 500 Mio. Euro auf beinahe 3,5 Mrd. Euro gesteigert werden. Dieser Zuwachs<br />
steht im Einklang mit der Zunahme des Kapitaleinsatzes, sodass sich die Eigenkapitalrentabilität<br />
mit 10,9 % gegenüber dem Jahr 2000 nicht verändert hat. Bei den unter<br />
Auslandseinfluss stehenden österreichischen Direktinvestitionsunternehmen waren<br />
offensichtlich die großen Unternehmen besonders erfolgreich, denn der Median der<br />
Eigenkapitalrentabilität ist von 6,8 auf 6,4 % leicht gesunken (vgl. Dell’mour, 2003).<br />
Auch für die passiven Direktinvestitionen gilt, dass die Ertragskraft der älteren Betriebe<br />
(älter als vier Jahre) mit 8,2 % deutlich über jener der jüngeren liegt. Deren mittlere<br />
Eigenkapitalrentabilität erreichte dagegen nur einen Wert von 0,0 %, das heißt, dass<br />
rund die eine Hälfte der jungen Unternehmen mit Gewinn, die andere mit Verlust<br />
abschloss.<br />
Die scheinbar überlegene Ertragskraft ausländischer Beteiligungen in Österreich<br />
gegenüber österreichischen Beteiligungen im Ausland resultiert daher aus der unterschiedlichen<br />
Altersstruktur. Drei Viertel der passiven, aber nur 60 % der aktiven<br />
Direktinvestitionen sind älter als vier Jahre. Wenn also junge Beteiligungen typischerweise<br />
von Anlaufverlusten gekennzeichnet sind, dann ist auch in den nächsten Jahren<br />
allein durch den „Alterungsprozess” eine weiterhin günstige Ertragsentwicklung zu<br />
erwarten.<br />
7.3.5 Die Beschäftigungsentwicklung der Direktinvestitionen<br />
2001 übertraf die Anzahl der Beschäftigung in Österreichs Tochterunternehmen im<br />
Ausland (aktiv) mit 270.000 erstmals die Anzahl der Beschäftigung in ausländischen<br />
Tochterunternehmen in Österreich (passiv) von 246.000. Dieser empirische Befund<br />
sorgt hin und wieder für Beunruhigung. Betrachten wir jedoch die Entwicklung von<br />
passiven und aktiven Beschäftigten (siehe Tabelle 7.11 und 7.12 in den Statistischen<br />
Übersichten) über die gesamte Periode 1991 – 2001, so zeigt sich schnell, dass diese<br />
Entwicklung durch zwei – sehr unterschiedliche – Faktoren geprägt war. Während die<br />
Beschäftigung in ausländischen Tochterunternehmen in Österreich über nahezu die<br />
gesamt Periode mit rd. 210.000 – 240.000 Beschäftigten relativ konstant blieb, entwickelte<br />
sich die Beschäftigung von österreichischen Tochterunternehmen im Ausland<br />
drastisch und stieg von 65.000 (1991) auf 270.000 (2002) an (vergleiche Abbildung<br />
7.8). Wie bereits dargelegt wurde, ist die Entwicklung auf der Aktivseite ausschließlich<br />
auf die hohen Arbeitsintensitäten der neuen Investitionen in Mittel- und Osteuropa<br />
zurückzuführen.<br />
143
Beschäftigungsentwicklung der aktiven und Abb. 7.8<br />
passiven Direktinvestitionen, 1991–2001<br />
Quelle: OeNB.<br />
Auf der der Passivseite stieg zwar auch das in Österreich investierte Eigenkapital<br />
kräftig an, diese Entwicklung wurde jedoch durch überaus starke Verbesserungen bei<br />
der Arbeitsintensität dieser Unternehmen nahezu vollständig kompensiert. Somit blieb<br />
die Beschäftigung konstant. Die Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa weisen<br />
aber nicht nur hohe Arbeitsintensitäten auf, sondern erzielten gleichzeitig auch hohe<br />
Erträge. Es handelte sich somit keineswegs um eine Verlagerung von Arbeitsplätzen,<br />
sondern um eine durchaus erwünschte Entwicklung, sowohl bei den aktiven als auch<br />
bei den passiven Direktinvestitionen.<br />
7.4 Unternehmensübernahmen und Fusionen 2003<br />
Die Fusionen und Übernahmen gingen 2003 nicht nur weltweit, sondern auch in der<br />
EU und in Österreich zurück. In der EU sanken die Fusionen um ein Fünftel auf 222,<br />
in Österreich um 9 % auf 307 Zusammenschlüsse. Anmeldepflichtig sind in der EU<br />
Zusammenschlüsse mit einem weltweiten gemeinsamen Umsatz der beteiligten Unternehmen<br />
von über 5 Mrd. Euro. Waren 2000, dem absoluten Spitzenjahr, 345 Fusionen<br />
in der EU angemeldet worden, so waren es 2003 nur noch 222 Fusionen – um<br />
mehr als ein Drittel weniger als 2000 und etwa 20 % weniger als noch 2002. Von bei<br />
der Europäischen Fusionskontrolle zu meldenden Zusammenschlüssen waren auch<br />
einige österreichische Unternehmen betroffen: so z.B. der Erwerb der Kontrolle von<br />
144<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
1991<br />
Aktiv<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
Passiv<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
General Electric durch Jenbacher; der Erwerb der größten österreichischen Brauerei<br />
BBAG durch Heineken; der Erwerb von BP-Tankstellen in Süddeutschland durch die<br />
OMV; die Zusammenlegung der Stromaktivitäten des Verbund und der Energie Allianz<br />
(Kammer für Arbeiter und Angestellte, 2004).<br />
War in Österreich entgegen dem <strong>internationale</strong>n Trend in den letzten Jahren kein<br />
massiver Rückgang bei den gemeldeten Zusammenschlüssen zu sehen gewesen,<br />
gingen im Jahr 2003 nun auch in Österreich die Zusammenschlüsse von 338 im Jahr<br />
2002 auf 307 im Jahr 2003 zurück.<br />
7.5 Bilaterale Investitionsschutzabkommen<br />
Österreichs<br />
Heute können sich Unternehmen meist auf Investitionsschutzabkommen berufen und<br />
ihre Ansprüche durch Schiedsgerichte unter dem Schutz der Weltbank durchsetzen.<br />
Ziel dieser völkerrechtlichen Verträge ist nicht nur, die Investitionen in Entwicklungsländern<br />
zu sichern, sondern durch die Gewähr von Sicherheit Investitionen zu fördern.<br />
Das Muster ist bei allen Verträgen gleich: Der Aufnahmestaat sichert dem Investor<br />
faire Behandlung zu. Einklagbare Ansprüche gewährleisten die Durchsetzung dieses<br />
Prinzips gegen den Aufnahmestaat und seine Behörden. Die gängigsten Verstöße sind<br />
Vertragsverletzungen, diskriminierende Gesetze, die Entziehung von Konzessionen<br />
oder Enteignungen. Dies ist besonders für kleine Unternehmen, die den (ersten)<br />
Schritt ins Ausland wagen, von besonderer Bedeutung. Wie die folgende Aufzählung<br />
der Länder zeigt, handelt es sich nahezu ausschließlich um Abkommen mit Entwicklungsländern.<br />
Wenngleich natürlich auch diesen Staaten gleiche Rechtssicherheit für<br />
deren Investitionen in Österreich zugesichert wird, so werden auf Grundlage dieser<br />
Abkommen natürlich insbesondere österreichische Investitionen im Ausland gefördert<br />
bzw. gesichert.<br />
Derzeit sind 54 österreichische Investitionsschutzabkommen in Kraft, und zwar mit<br />
Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bangladesh, Belarus, Belize,<br />
Bolivien, Bulgarien, Chile, China, Estland, Georgien, Hongkong/China, Indien,<br />
Iran, Jordanien, Jugoslawien, Kap Verde, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lettland, Libanon,<br />
Libyen, Litauen, Malaysia, Malta, Marokko, Mazedonien, Mexiko, Moldawien, Mongolei,<br />
Oman, Paraguay, Polen, Philippinen, Rumänien, Saudi-Arabien, Slowakei, Slowenien,<br />
Südafrika, Südkorea, Tadschikistan, Tschechien, Tunesien, Türkei, Russische Förderation,<br />
Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und Vietnam.<br />
145
Abkommen mit Algerien, Jemen, Namibia und Simbabwe sind ausverhandelt und<br />
können nach erfolgter parlamentarischer Beschlussfassung und Ratifizierung in den<br />
Unterzeichnerstaaten in Kraft treten.<br />
Zur Unterzeichnung vorbereitet sind Abkommen mit Ecuador, Guatemala, Nordkorea,<br />
Peru, Syrien, Uruguay, Kambodscha.<br />
7.6 Zusammenfassende Beurteilung<br />
Im Anschluss an die große Fusionswelle der Jahre 1999/2000 entwickelten sich die<br />
Direktinvestitionsströme sowohl weltweit als auch in Europa stark rückläufig. Unterstützt<br />
wurde dies durch eine weltweit schwache Konjunkturentwicklung 2002/2003 sowie<br />
durch umfassende firmen-interne Restrukturierungsprozesse. Während Österreich<br />
im Jahre 2002 aktivseitig seine Internationalisierung weiter intensivieren konnte und<br />
weltweit Marktanteile gewinnen konnte, musste passivseitig ein starker Einbruch<br />
verzeichnet werden. Dieser war jedoch geprägt durch eine einzige große große Desinvestition<br />
(Telekom Italia). Bereits 2003 konnte Österreich wieder hohe passive Direktinvestitionen<br />
verzeichnen (nach den vorläufigen Zahlen der OeNB: 6,1 Mrd. Euro).<br />
Ebenso erreichten auch die aktiven Direktinvestitionen 2003 wieder einen sehr hohen<br />
Wert (6,3 Mrd. Euro).<br />
Aktivseitig waren die Direktinvestitionsströme weiterhin gekennzeichnet durch starke<br />
Investitionen in Mittel- und Osteuropa, während passivseitig Deutschland seine Dominanz<br />
weiter ausbauen konnte. Sowohl aktiv- als auch passivseitig sind die Direktinvestitionen<br />
dominiert durch den Finanzsektor sowie durch Holdinggesellschaften.<br />
Die Beschäftigung der österreichischen Tochterunternehmen im Ausland übertraf<br />
2001 erstmals jene der ausländischen Unternehmen in Österreich. Eine nähere Betrachtung<br />
der Arbeitsintensitäten dieser Unternehmen zeigt, dass diese Entwicklung<br />
vor allem durch die hohen Arbeitsintensitäten der aktiven Direktinvestitionen in den<br />
mittel- und osteuropäischen Ländern erklärt werden kann, während die ausländischen<br />
Direktinvestitionen in Österreich hohe und steigende Kapitalintensitäten verzeichnen,<br />
wodurch trotz steigender Investitionen kaum zusätzlich Beschäftigung generiert werden<br />
konnte.<br />
2001 wurden knapp 85 % des gesamten Jahresergebnisses von 1,3 Mrd. Euro von<br />
Tochterunterunternehmen in Mittel- und Osteuropa erzielt. Die Eigenkapitalrentabilitäten<br />
dieser Tochterunternehmen übertrafen jene in der EU-15 um ein Mehrfaches.<br />
Auch die passiven Direktinvestitionen in Österreich erzielten 2001 sehr hohe Erträge.<br />
Einen großen Erklärungsbeitrag dafür bietet das Alter der Direktinvestitionen.<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Internationalisierung der<br />
österreichischen Wirtschaft auch in der Periode 2002/2003 fortsetzte und deren welt-<br />
146
Grenzüberscheitende Direktinvestitionen<br />
weite Position sowohl aktiv- als auch passivseitig weiter gestärkt wurde. Insbesondere<br />
Österreichs Engagement in Mittel- und Osteuropa leistete zu dieser Entwicklung einen<br />
wesentlichen Beitrag.<br />
Anmerkungen<br />
1 Als Datenquellen für den folgenden Abschnitt wurden Daten der Österreichischen Nationalbank<br />
(OeNB) sowie eine Sonderauswertung dieser Daten herangezogen. Für diese überaus<br />
großzügige Hilfe gilt mein ganz besonderer Dank Herrn Rene Dell’mour. Bei Herrn Christian<br />
Bellak möchte ich mich bedanken für die sorgfältige Durchsicht des Manuskriptes sowie für<br />
seine zahlreichen Verbesserungsvorschläge.<br />
2 Aktive Direktinvestitionen: Österreichische Direktinvestitionen im Ausland; Passive Direktinvestitionen:<br />
Ausländische Direktinvestitionen im Österreich;<br />
3 Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Albanien, Bosnien-Herzegowina,<br />
Bulgarien, Serbien und Montenegro, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien,<br />
Mazedonien, Rumänien, Russland, Ukraine, Weißrussland.<br />
4 dazu gehören u.a. USA, Kanada, Norwegen, Schweiz, Australien und Japan.<br />
5 Als Eigenrentabilität (return on equity; RoE) wird das Nettojahresergebnis dividiert durch das<br />
Eigenkapital (einschließlich Nettogewinne des laufenden Jahres) definiert.<br />
147
148
STATISTISCHE ÜBERSICHTEN<br />
149
150
Statistische Übersichten<br />
Reales BIP-Wachstum Tab. 1.2<br />
Europa<br />
Prognose<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Deutschland 1,7 1,9 3,1 1,0 0,2 0,0 1,4 2,3<br />
Frankreich 3,6 3,2 4,2 2,1 1,3 0,1 1,7 2,4<br />
Italien 1,7 1,7 3,3 1,7 0,4 0,5 1,6 2,1<br />
Großbritannien 3,1 2,8 3,8 2,1 1,7 1,9 2,7 2,9<br />
Belgien 2,1 3,2 3,7 0,7 0,7 0,7 1,9 2,8<br />
Dänemark 2,5 2,6 2,9 1,4 2,1 0,5 2,4 2,8<br />
Finnland 5,0 3,4 5,1 1,2 2,2 1,0 3,4 3,8<br />
Griechenland 3,4 3,4 4,4 4,0 3,8 4,0 4,1 3,6<br />
Irland 8,6 11,3 10,1 6,2 6,9 1,8 3,6 4,8<br />
Luxemburg 6,9 7,8 9,1 1,2 1,3 1,2 2,0 2,9<br />
Niederlande 4,3 4,0 3,5 1,2 0,2 -0,5 1,0 2,0<br />
Österreich 3,9 2,7 3,4 0,8 1,4 0,8 1,6 2,4<br />
Portugal 4,6 3,8 3,4 1,7 0,4 -0,8 1,5 2,6<br />
Schweden 3,6 4,6 4,4 1,1 1,9 1,5 2,3 2,7<br />
Spanien 4,3 4,2 4,2 2,8 2,0 2,3 2,9 3,1<br />
Eurozone 2,8 2,8 3,7 1,7 0,9 0,5 1,8 2,5<br />
EU-15 2,9 2,8 3,7 1,7 1,1 0,7 1,9 2,5<br />
Polen 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4 3,3 3,5 4,5<br />
Slowakei 4,0 1,3 2,2 3,3 4,4 3,9 4,2 4,4<br />
Slowenien 3,8 5,2 4,6 2,9 2,9 2,2 3,4 3,5<br />
Tschech. Rep. -1,0 0,5 3,3 3,1 2,0 2,5 2,9 3,2<br />
Ungarn 4,9 4,2 5,2 3,8 3,3 2,9 3,3 3,8<br />
Andere Länder<br />
USA 4,3 4,1 3,8 0,3 2,4 2,9 4,2 3,8<br />
Japan -1,1 0,1 2,8 0,4 0,2 2,7 1,8 1,8<br />
Kanada 4,1 5,5 5,3 1,9 3,3 1,8 2,8 3,2<br />
Australien 5,4 4,4 3,0 2,7 3,3 2,4 3,7 4,0<br />
Island 5,6 4,0 5,6 3,1 -0,2 1,9 3,7 5,6<br />
Korea -6,7 10,9 9,3 3,1 6,3 2,7 4,7 5,5<br />
Mexiko 4,9 3,7 6,6 -0,3 0,9 1,5 3,6 4,2<br />
Neuseeland -0,6 4,7 3,7 2,2 4,2 2,7 3,1 2,9<br />
Norwegen 2,6 2,1 2,8 1,9 1,0 0,6 2,8 2,0<br />
Schweiz 2,4 1,5 3,2 0,9 0,2 -0,5 1,2 1,8<br />
Türkei 3,1 -4,7 7,4 -7,5 7,8 5,0 4,9 5,4<br />
OECD 2,7 3,1 3,9 0,9 1,8 2,0 3,0 3,1<br />
China 7,8 7,1 8,0 7,3 8,0 9,1 7,0 .<br />
Russland -5,3 6,4 10,0 5,1 4,7 6,8 4,5 4,1<br />
Quellen: OECD Economic Outlook, Dezember 2003, wiiw.<br />
151
Wachstum der Verbraucherpreise Tab. 1.3<br />
Europa<br />
152<br />
Prognose<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Deutschland 0,6 0,6 1,4 1,9 1,3 0,9 0,8 0,7<br />
Frankreich 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 2,0 1,4 0,9<br />
Italien 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,0 1,9<br />
Großbritannien 2,7 2,3 2,1 2,1 2,2 2,8 2,6 2,7<br />
Belgien 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,4 1,4<br />
Dänemark 1,8 2,5 2,9 2,3 2,4 2,0 1,6 2,0<br />
Finnland 1,4 1,3 3,0 2,7 2,0 1,3 0,4 1,8<br />
Griechenland 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,5 3,6 3,5<br />
Irland 2,1 2,5 5,3 4,0 4,7 4,1 2,8 3,1<br />
Luxemburg 1,0 1,0 3,8 2,4 2,1 2,5 1,9 1,6<br />
Niederlande 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,3 1,2 1,1<br />
Österreich 0,8 0,5 2,0 2,3 1,7 1,3 1,0 1,1<br />
Portugal 2,2 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,1 1,8<br />
Schweden 0,4 0,3 1,3 2,6 2,4 2,1 1,4 2,2<br />
Spanien 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,2 2,8 2,9<br />
Eurozone 1) 1,2 1,2 2,2 2,4 2,3 2,0 1,5 1,4<br />
EU-15 1,8 1,2 2,3 2,4 2,1 2.0 1.9 1.7<br />
Polen 11,6 7,3 10,1 5,5 1,9 0,8 1,9 1,4<br />
Slowakei 6,7 10,6 12,0 7,3 3,1 8,6 7,9 4,0<br />
Slowenien 7,9 6,1 8,9 8,4 7,5 5,6 4,0 3,5<br />
Tschech. Rep. 10,7 2,1 3,9 4,8 1,8 0,7 2,6 2,4<br />
Ungarn 14,2 10,0 9,8 9,2 5,3 4,6 6,5 4,5<br />
Andere Länder<br />
USA 1,5 2,2 3,4 2,8 1,6 2,3 1,7 1,8<br />
Japan 0,7 -0,3 -0,7 -0,7 -0,9 -0,2 -0,2 -0,2<br />
Kanada 1,0 1,7 2,7 2,5 2,2 2,8 1,4 2,1<br />
Australien 0,9 1,5 4,5 4,4 3,0 2,8 2,0 2,3<br />
Island 1,7 3,2 5,1 6,4 5,2 2,0 2,6 3,6<br />
Korea 7,5 0,8 2,3 4,1 2,8 3,5 2,7 3,0<br />
Mexiko 15,9 16,6 9,5 6,4 5,0 4,5 3,4 3,1<br />
Neuseeland 1,3 -0,1 2,6 2,6 2,7 1,7 1,9 2,3<br />
Norwegen 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 1,2 2,5<br />
Schweiz 0,0 0,8 1,6 1,0 0,6 0,6 0,3 0,2<br />
Türkei 84,6 64,9 54,9 54,4 45,0 24,5 15,9 10,2<br />
OECD 4,0 3,4 4,0 3,4 2,6 . . .<br />
China -0,8 -1,4 0,4 0,7 -0,8 1,2 2,0<br />
Russland 27,6 85,7 20,8 21,6 16,0 13,6 10,0 8,0<br />
1) harmonisierter Verbraucherpreisindex.<br />
Quellen: OECD-Economic Outlook, Dezember 2003, MEI, WIFO, wiiw.
Statistische Übersichten<br />
Arbeitslosenrate (standardisiert) Tab. 1.4<br />
Europa<br />
Prognose<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Deutschland 9,1 8,4 7,8 7,8 8,6 9,3 9,5 9,4<br />
Frankreich 11,4 10,7 9,3 8,5 8,8 9,3 9,6 9,3<br />
Italien 11,7 11,3 10,4 9,4 9,0 8,7 8,7 8,6<br />
Großbritannien 6,2 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 5,0 5,0<br />
Belgien 9,3 8,6 6,9 6,7 7,3 7,9 8,0 7,5<br />
Dänemark 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 5,3 5,0<br />
Finnland 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,1 9,0 8,9<br />
Griechenland 10,9 11,8 11,0 10,4 10,0 9,3 9,0 8,8<br />
Irland 7,5 5,6 4,3 3,9 4,3 4,6 4,9 4,8<br />
Luxemburg 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,6 4,1 4,4<br />
Niederlande 3,8 3,2 2,9 2,5 2,7 3,7 5,1 5,4<br />
Österreich 4,5 3,9 3,7 3,6 4,3 4,4 4,5 4,0<br />
Portugal 5,1 4,5 4,1 4,1 5,1 6,4 7,0 7,1<br />
Schweden 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,5 5,6 5,5<br />
Spanien 15,2 12,8 11,3 10,6 11,3 11,3 10,9 10,4<br />
Eurozone 10,2 9,4 8,5 8,0 8,4 8,8 8,9 8,8<br />
EU-15 9,4 8,7 7,8 7,4 7,7 8,0 8,1 8,0<br />
Polen 10,2 13,4 16,4 18,5 19,8 19,3 19,6 19,0<br />
Slowakei 13,0 16,7 18,7 19,4 18,7 17,2 16,6 16,0<br />
Slowenien 7,4 7,2 6,6 5,8 6,1 6,6 6,3 6,2<br />
Tschech. Rep. 6,4 8,6 8,7 8,0 7,3 7,6 7,9 7,8<br />
Ungarn 8,4 6,9 6,3 5,6 5,6 5,8 5,8 5,7<br />
EU-Beitrittsländer 9,4 11,8 13,6 14,5 14,8 14,3 14,4 14,0<br />
EU-25 9,4 9,2 8,8 8,5 8,8 9,0 9,1 8,9<br />
Andere Länder<br />
USA 4,5 4,2 4,0 4,8 5,8 6,1 5,9 5,2<br />
Japan 4,1 4,7 4,7 5,0 5,4 5,3 5,2 5,0<br />
Kanada 8,3 7,6 6,8 7,2 7,6 7,8 7,8 7,4<br />
Australien 7,8 7,0 6,3 6,8 6,3 6,0 5,9 5,7<br />
Island 2,7 2,0 2,3 2,3 3,3 3,3 3,3 2,8<br />
Korea 7,0 6,3 4,1 3,8 3,1 3,4 3,3 3,0<br />
Mexiko 3,2 2,5 2,2 2,4 2,7 3,0 3,0 2,8<br />
Neuseeland 7,5 6,8 6,0 5,3 5,2 4,8 5,0 5,1<br />
Norwegen 3,1 3,2 3,4 3,5 4,0 4,5 4,7 4,5<br />
Schweiz 3,4 2,9 2,5 2,5 3,1 3,9 3,9 3,6<br />
Türkei 6,7 7,5 6,6 8,5 10,3 10,2 9,9 9,6<br />
China 1) 3,1 3,1 3,1 3,6 4,0 4,5 4,7 .<br />
Russland 13,5 13,0 10,5 9,1 8,0 8,5 8,0 9,0<br />
1) registrierte städtische Arbeitslose. Quellen: Eurostat, OECD, wiiw.<br />
153
Budgetdefizit/-überschuss in % des nominellen BIP Tab. 1.5<br />
Europa<br />
154<br />
Prognose<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Deutschland -2,2 -1,5 1,3 -2,8 -3,5 -4,1 -3,7 -3,5<br />
Frankreich -2,7 -1,8 -1,4 -1,5 -3,1 -4,0 -3,7 -3,5<br />
Italien -3,1 -1,8 -0,7 -2,7 -2,5 -2,7 -2,9 -3,9<br />
Großbritannien 0,1 1,1 3,9 0,7 -1,5 -2,9 -2,9 -3,2<br />
Belgien -0,7 -0,4 0,1 0,5 -0,0 0,2 0,0 -0,5<br />
Dänemark 1,1 3,2 2,5 2,8 2,0 0,8 1,0 1,5<br />
Finnland 1,6 2,2 7,1 5,2 4,2 2,6 1,9 2,0<br />
Griechenland -2,5 -1,8 -2,0 -1,4 -1,5 -1,6 -1,6 -1,5<br />
Irland 2,3 2,3 4,4 0,9 -0,2 -1,0 -1,3 -1,3<br />
Luxemburg 3,2 3,5 6,4 6,2 2,4 -0,3 -1,8 -2,6<br />
Niederlande -0,8 0,7 2,2 0,0 -1,6 -2,4 -2,5 -1,8<br />
Österreich -2,5 -2,4 -1,6 0,1 -0,4 -1,3 -1,2 -1,8<br />
Portugal -3,2 -2,9 -2,9 -4,3 -2,7 -2,9 -3,0 -2,3<br />
Schweden 2,3 1,3 3,4 4,6 1,1 0,2 0,5 1,0<br />
Spanien -3,0 -1,2 -0,8 -0,3 0,1 0,1 0,2 0,3<br />
Eurozone -2,3 -1,3 0,1 -1,7 -2,3 -2,7 -2,6 -2,7<br />
EU-15 -1,8 -0,8 0,7 -1,1 -2,0 -2,7 -2,6 -2,7<br />
Polen -2,3 -2,0 -2,5 -3,0 -3,7 -4,2 -5,0 -4,8<br />
Slowakei -5,3 -7,9 -13,9 -6,8 -7,2 -5,1 -4,1 -3,5<br />
Slowenien -0,8 -0,6 -1,3 -1,3 -3,0 . . .<br />
Tschech. Rep. -1,4 -2,4 -3,4 -2,7 -3,9 -6,6 -5,7 -5,1<br />
Ungarn -8,0 -5,6 -3,0 -4,7 -9,2 -5,2 -4,3 -3,3<br />
Andere Länder<br />
USA 0,3 0,7 1,4 -0,5 -3,4 -4,9 -5,1 -4,9<br />
Japan -5,5 -7,2 -7,4 -6,1 -7,1 -7,4 -6,8 -6,9<br />
Kanada 0,1 1,6 3,0 1,4 0,8 1,0 0,7 0,8<br />
Australien 0,7 1,9 0,6 0,0 1,1 0,8 0,5 0,5<br />
Island 0,5 2,4 2,5 0,3 -1,0 -1,0 0,2 0,8<br />
Korea 1,9 3,1 6,2 4,9 7,3 3,5 4,0 4,5<br />
Neuseeland 0,3 0,6 1,5 2,0 2,7 2,6 2,2 2,0<br />
Norwegen 3,6 6,1 15,0 13,7 10,9 9,8 9,7 8,4<br />
OECD 1) -1,4 -1,0 0,0 -1,3 -2,9 -3,8 -3,8 -3,7<br />
China -1,2 -2,1 -2,8 -2,6 -3,1 . . .<br />
Russland -5,7 -0,9 1,9 3,0 1,0 . . .<br />
1) ohne Mexiko, Türkei und Schweiz.<br />
Quellen: OECD Economic Outlook, Dezember 2003, wiiw.
Wirtschaftslage in den MOEL (2002–2003)<br />
und Prognose (2004–2005)<br />
Brutto-Inlandsprodukt<br />
Reale Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Statistische Übersichten<br />
Verbraucherpreise<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Tab. 1.6<br />
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005<br />
Prognose Prognose<br />
Tschechische Republik 2,0 2,9 3,3 4 1,8 0,1 3,5 2<br />
Ungarn 3,5 2,9 3,3 3,9 5,3 4,7 6,5 5<br />
Polen 1,4 3,7 4 4 1,9 0,8 2 3<br />
Slowakei 4,4 4,0 4,5 5 3,3 8,5 8 5<br />
Slowenien 2,9 2,2 3,4 3,5 7,5 5,6 4 3,5<br />
MOEL-5 2,2 3,4 3,8 4,0<br />
Estland 6,0 4,4 5,6 5,1 3,6 1,3 4 4<br />
Lettland 6,1 7,0 5,2 5,7 1,9 2,9 3 3<br />
Litauen 6,8 7,5 5,7 6,0 0,3 -1,2 2 3<br />
MOEL-8 2,5 3,6 3,9 4,2<br />
Arbeitslosenquote 1)<br />
in %, Jahresdurchschnitt<br />
Leistungsbilanz<br />
in % des BIP<br />
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005<br />
Prognose Prognose<br />
Tschech. Rep. 7,3 8,1 8,2 8,0 -6,4 -6,4 -6,1 -6,1<br />
Ungarn 5,8 5,9 6 6 -4,0 -6,6 -5,7 -5,3<br />
Polen 19,9 20,0 20 19 -3,6 -1,9 -2,5 -3,0<br />
Slowakei 18,5 18,0 16 15 -8,0 -1,3 -1,5 -2,1<br />
Slowenien 6,4 6,7 6,3 6 1,4 0,2 0,2 -0,4<br />
MOEL-5 15,3 15,4 15,3 14,6 -4,2 -3,5 -3,6 -3,8<br />
Estland 10,3 10,0 10 10 -12,3 -14,6 -12,2 -8,5<br />
Lettland 12,0 10,8 10 10 -7,6 -8,9 -9,5 -9,6<br />
Litauen 13,8 12,7 12 11 -5,3 -5,7 -5,8 -5,9<br />
MOEL-8 15,0 15,0 14,8 14,2 -4,4 -3,9 -4,0 -4,1<br />
1) laut Labour-Force-Konzept.<br />
Quelle: wiiw, Februar 2004; Prognosen für Baltische Staaten: Europäische Kommission 2003.<br />
155
Wirtschaftslage in den SOEL (2002–2003)<br />
und wiiw-Prognose (2004–2005)<br />
156<br />
Brutto-Inlandsprodukt<br />
Reale Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Verbraucherpreise<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Tab. 1.7<br />
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005<br />
Prognose Prognose<br />
Albanien 1) 4,7 5,8 6 6 5,2 2,3 3 3<br />
Bosnien-Herzegovina 1) 5,5 3,5 4 4 0,4 0,3 0,4 0,4<br />
Bulgarien 4,8 4,5 4,5 4 5,8 2,4 5 3<br />
Kroatien 1) 5,2 4,3 3,2 3,5 2,2 1,5 2 1,5<br />
Mazedonien 1) 0,3 2,8 4 4 1,4 2,4 3 2<br />
Rumänien 4,9 4,7 4,5 4,5 22,5 15,3 11 8<br />
Serbien & Montenegro 3) 4,0 1,0 2 3 16,5 9,4 8 8<br />
SOEL-7 4) 4,6 4,2 4,1 4,1 7,7 4,8 4,6 3,7<br />
Arbeitslosenquote 6)<br />
in %, Jahresdurchschnitt<br />
Leistungsbilanz<br />
in % des BIP<br />
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005<br />
Prognose Prognose<br />
Albanien 2) 15,8 15,2 15 15 -9,0 -8,5 -8 -8<br />
Bosnien-Herzegovina 2) 41 41,5 41 41 -18,5 -18 -17,5 -17,5<br />
Bulgarien 17,8 14,5 14 13 -4,9 -8,9 -7,1 -6,2<br />
Kroatien 14,8 14 14 13,5 -8,5 -6,1 -5,1 -4,5<br />
Mazedonien 31,9 36,7 36 35 -8,6 -6,0 -5,5 -5,3<br />
Rumänien 8,4 8 8 7 -3,4 -6,2 -6,8 -6,4<br />
Serbien & Montenegro 3) 13,8 14 15 15 -11,7 -8,8 -11,7 -11,7<br />
SOEL-7 5) 14,1 13,8 13,9 12,9 -6,9 -7,6 -7,7 -7,3<br />
1) Verbraucherpreise entsprechen den Einzelhandelspreisen. 2) Rate der registrierten Arbeitslosen. 3) Ohne Kosovo und Metohia.<br />
4) Verbraucherpreise entsprechen dem Durchschnitt der SOEL-7. 5) Schätzung der durchschnittlichen gewichteten Arbeitslosenquoe<br />
nach dem Labour-Fource-Konzept. 6) laut Labour-Fource-Konzept.<br />
Quelle: wiiw.
Statistische Übersichten<br />
Außenhandelsströme ausgewählter Ländergruppen Tab. 3.4<br />
Exporte<br />
1996 2002 1996 2002 2002 2001 2002<br />
Mio. USD Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Welt 5.300.740 6.419.230 100,0 100,0 172,5 -3,6 4,6<br />
Europa 2.328.324 2.782.911 43,9 43,4 173,5 1,2 6,3<br />
EU-15 2.074.720 2.430.160 39,1 37,9 168,6 0,5 5,8<br />
Eurozone 1.684.838 2.018.324 31,8 31,4 171,3 2,0 6,1<br />
EU-Beitrittsländer 86.795 153.456 1,6 2,4 298,2 10,7 13,5<br />
EU-25 2.161.515 2.583.616 40,8 40,2 173,1 1,1 6,3<br />
EFTA 129.933 150.177 2,5 2,3 158,2 1,2 6,0<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 197.929 291.597 3,7 4,5 273,8 -1,9 17,8<br />
NAFTA 919.095 1.106.267 17,3 17,2 168,0 -5,2 -3,9<br />
Südamerika 142.719 161.508 2,7 2,5 169,9 -3,2 0,1<br />
Asien 1.275.929 1.582.637 24,1 24,7 170,8 -8,1 8,0<br />
ASEAN+3 1.042.309 1.307.364 19,7 20,4 173,3 -9,0 8,4<br />
Afrika 84.721 137.608 1,6 2,1 223,9 -3,3 5,2<br />
OECD 3.829.882 4.492.132 72,3 70,0 163,6 -2,9 3,3<br />
OPEC 243.237 292.821 4,6 4,6 167,1 -9,1 -3,6<br />
ASEAN 342.429 403.541 6,5 6,3 188,2 -9,4 4,5<br />
Importe<br />
Welt 5.386.400 6.639.390 100,0 100,0 175,0 -3,2 4,1<br />
Europa 2.241.001 2.695.600 41,6 40,6 172,0 -0,8 4,0<br />
EU-15 1.956.310 2.321.950 36,3 35,0 166,5 -1,7 3,3<br />
Eurozone 1.565.182 1.873.959 29,1 28,2 167,2 -1,0 3,0<br />
EU-Beitrittsländer 122.204 189.948 2,3 2,9 283,9 7,4 12,1<br />
EU-25 2.078.514 2.511.898 38,6 37,8 171,8 -1,2 3,9<br />
EFTA 114.158 119.885 2,1 1,8 141,5 1,2 1,3<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 201.864 275.588 3,7 4,2 258,5 7,6 13,5<br />
NAFTA 1.103.278 1.632.086 20,5 24,6 198,2 -5,0 1,4<br />
Südamerika 151.702 125.576 2,8 1,9 131,9 -2,1 -19,0<br />
Asien 1.281.121 1.445.603 23,8 21,8 170,7 -4,8 6,3<br />
ASEAN+3 1.016.268 1.139.910 18,9 17,2 171,5 -5,6 6,7<br />
Afrika 91.230 149.087 1,7 2,2 200,5 -3,3 13,6<br />
OECD 3.882.467 4.837.945 72,1 72,9 175,2 -3,8 2,8<br />
OPEC 152.700 191.187 2,8 2,9 136,7 13,2 4,4<br />
ASEAN 377.565 355.198 7,0 5,4 152,6 -8,6 6,2<br />
1) ohne Moldawien.<br />
Quelle: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.<br />
157
Handelsbilanzen ausgewählter Ländergruppen Tab. 3.5<br />
158<br />
1996 2001 2002 1996 2001 2001 2002<br />
Mio. USD In % der Exporte<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in Mio. USD<br />
Europa 87.323 26.049 87.311 3,8 3,1 52.790 61.263<br />
EU-15 118.410 48.990 108.210 5,7 4,5 52.240 59.220<br />
Eurozone 119.656 82.810 144.365 7,1 7,2 54.953 61.554<br />
EU-Beitrittsländer -35.409 -34.357 -36.493 -40,8 -23,8 1.361 -2.136<br />
EU-25 83.001 14.633 71.717 3,8 2,8 53.601 57.084<br />
EFTA 15.775 23.346 30.292 12,1 20,2 253 6.946<br />
Zentral- und Osteuropa 1) -3.935 4.742 16.009 -2,0 5,5 -22.009 11.267<br />
NAFTA -184.184 -458.329 -525.819 -20,0 -47,5 20.867 -67.490<br />
Südamerika -8.984 6.452 35.932 -6,3 22,2 -2.015 29.480<br />
Asien -5.192 105.370 137.035 -0,4 8,7 -62.034 31.665<br />
ASEAN+3 26.041 137.996 167.454 2,5 12,8 -56.572 29.459<br />
Afrika -6.509 -492 -11.479 -7,7 -8,3 0 -10.987<br />
OECD -52.586 -356.408 -345.813 -1,4 -7,7 56.182 10.595<br />
OPEC 90.537 120.642 101.633 37,2 34,7 -51.786 -19.008<br />
ASEAN -35.136 51.798 48.343 -10,3 12,0 -8.685 -3.454<br />
1) ohne Moldawien.<br />
Quelle: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Entwicklung der Warenexporte (fob) für ausgewählte Länder Tab. 3.6<br />
1996 2002 1996 2002 2002 2001 2002 2002<br />
Mio. USD Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Exportquote<br />
1<br />
USA 622.949 693.123 11,8 10,8 148,8 -5,3 -5,2 6,6<br />
Deutschland 512.813 603.994 9,7 9,4 165,8 3,9 5,9 27,0<br />
Japan 411.302 416.632 7,8 6,5 114,9 -15,6 3,3 10,4<br />
Frankreich 287.458 331.094 5,4 5,2 152,6 -0,2 2,5 20,6<br />
China 151.165 325.711 2,9 5,1 355,2 7,0 22,1 26,3<br />
Großbritannien 258.295 276.264 4,9 4,3 153,3 -5,0 2,9 .<br />
Kanada 200.146 252.381 3,8 3,9 179,3 -5,1 -3,4 34,3<br />
Italien 250.840 251.150 4,7 3,9 149,2 1,8 4,3 18,9<br />
Niederlande 177.432 243.191 3,3 3,8 189,6 0,5 5,3 54,7<br />
Belgien . 213.497 . 3,3 . 0,8 13,5 77,6<br />
Hongkong 180.530 200.199 3,4 3,1 148,3 -6,0 5,5 123,9<br />
Korea 137.413 161.480 2,6 2,5 188,2 -12,8 7,8 33,9<br />
Mexiko 96.000 160.763 1,8 2,5 310,6 -4,8 1,5 25,2<br />
Singapur 125.125 125.087 2,4 1,9 168,9 -11,8 2,8 143,8<br />
Spanien 102.090 118.218 1,9 1,8 188,5 0,7 8,5 16,1<br />
Russland 83.979 107.224 1,6 1,7 243,4 -19,9 29,9 30,9<br />
Malaysien 78.214 93.387 1,5 1,5 198,2 -10,1 5,9 98,4<br />
Irland 47.365 87.786 0,9 1,4 300,8 8,6 5,9 64,1<br />
Schweiz 79.391 87.485 1,5 1,4 139,5 1,9 6,6 32,7<br />
Schweden 84.472 79.623 1,6 1,2 171,4 -13,0 7,5 33,1<br />
Österreich 57.827 78.515 1,1 1,2 198,0 4,9 11,0 34,0<br />
Thailand 55.743 68.851 1,1 1,1 185,3 -5,6 5,7 54,4<br />
Saudi Arabien 60.697 66.703 1,1 1,0 157,5 -7,7 -2,1 35,4<br />
Australien 60.257 65.159 1,1 1,0 153,2 0,4 2,8 16,3<br />
Norwegen 48.660 60.461 0,9 0,9 196,3 0,0 4,9 31,7<br />
Brasilien 47.763 60.122 0,9 0,9 155,0 4,8 2,2 13,1<br />
Indonesien 49.873 57.144 0,9 0,9 155,2 -9,3 1,5 .<br />
Dänemark 47.114 55.950 0,9 0,9 155,8 0,4 9,8 .<br />
Indien 32.325 50.521 0,6 0,8 240,7 6,2 11,6 .<br />
Finnland 38.434 44.836 0,7 0,7 191,9 -5,7 3,6 30,3<br />
Polen 24.440 40.986 0,5 0,6 289,8 13,9 13,7 .<br />
Vereinigte<br />
Arab. Emirate<br />
27.691 38.771 0,5 0,6 182,5 -1,3 -2,2 .<br />
Tschech. Rep. 22.132 38.080 0,4 0,6 323,4 15,0 14,5 51,8<br />
Philippinen 20.543 35.185 0,4 0,5 312,4 -15,6 9,5 45,1<br />
Türkei 23.100 35.058 0,4 0,5 228,5 12,8 11,9 19,1<br />
Ungarn 13.145 33.975 0,2 0,5 395,2 7,4 12,7 51,6<br />
1) Exporte in Relation zum BIP.<br />
Quelle: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.<br />
159
Entwicklung der Warenimporte (cif) für ausgewählte Länder Tab. 3.7<br />
160<br />
1996 2002 1996 2002 2002 2001 2002 2002<br />
Mio. USD Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Importquote<br />
1<br />
USA 817.818 1.202.360 15,2 18,1 199,4 -4,7 1,9 11,5<br />
Deutschland 444.527 486.014 8,3 7,3 147,4 -1,5 -1,3 21,8<br />
Japan 349.597 337.149 6,5 5,1 139,5 -8,0 -3,4 8,4<br />
Frankreich 275.905 328.309 5,1 4,9 162,0 -1,0 -0,1 20,4<br />
China 138.949 295.440 2,6 4,5 285,1 8,2 21,3 23,9<br />
Großbritannien 283.608 335.434 5,3 5,1 163,3 -3,6 3,9 .<br />
Kanada 187.042 244.179 3,5 3,7 164,5 -7,3 0,2 33,2<br />
Italien 206.987 242.996 3,8 3,7 164,6 -1,1 4,4 18,2<br />
Niederlande 160.990 218.783 3,0 3,3 193,1 -3,3 4,8 49,2<br />
Belgien . 197.512 . 3,0 . 1,9 10,7 71,8<br />
Hongkong 198.551 207.761 3,7 3,1 149,9 -5,6 3,1 128,6<br />
Korea 150.157 152.123 2,8 2,3 175,6 -12,1 7,8 31,9<br />
Mexiko 98.418 185.547 1,8 2,8 258,1 -3,5 0,2 29,1<br />
Singapur 131.329 116.482 2,4 1,8 136,4 -13,8 0,4 133,9<br />
Spanien 121.865 154.755 2,3 2,3 189,1 -1,4 8,5 21,0<br />
Russland 44.504 45.508 0,8 0,7 170,1 9,0 23,4 13,1<br />
Malaysien 78.441 79.506 1,5 1,2 174,3 -10,8 8,4 83,8<br />
Irland 34.958 51.427 0,7 0,8 238,9 0,0 1,5 37,6<br />
Schweiz 78.177 83.452 1,5 1,3 137,5 1,9 -0,7 31,2<br />
Schweden 66.584 63.915 1,2 1,0 163,7 -13,1 6,0 26,6<br />
Österreich 67.327 78.076 1,3 1,2 162,6 3,5 4,6 33,8<br />
Thailand 73.336 64.721 1,4 1,0 140,5 0,2 4,3 51,2<br />
Saudi Arabien 27.764 47.505 0,5 0,7 168,4 40,1 11,9 25,2<br />
Australien 67.713 76.506 1,3 1,2 163,8 -10,0 14,4 19,2<br />
Norwegen 33.936 34.158 0,6 0,5 150,6 0,6 6,8 17,9<br />
Brasilien 58.907 51.917 1,1 0,8 167,6 -0,7 -15,5 11,3<br />
Indonesien 42.902 31.285 0,8 0,5 110,4 -7,6 1,1 .<br />
Dänemark 40.936 48.642 0,8 0,7 164,8 -2,8 9,9 .<br />
Indien 36.055 65.657 0,7 1,0 308,7 14,9 13,6 .<br />
Finnland 29.264 33.368 0,5 0,5 184,8 -4,8 2,2 22,6<br />
Polen 37.137 55.069 0,7 0,8 292,4 2,7 9,6 .<br />
Vereinigte<br />
Arab. Emirate<br />
22.638 30.353 0,4 0,5 155,5 16,3 2,5 .<br />
Tschech. Rep. 30.685 39.947 0,6 0,6 289,4 13,0 11,7 54,3<br />
Philippinen 31.756 35.398 0,6 0,5 200,7 -5,8 19,8 45,4<br />
Türkei 42.463 50.820 0,8 0,8 173,1 -24,1 22,8 27,8<br />
Ungarn 16.209 37.313 0,3 0,6 301,2 4,0 11,5 56,7<br />
1) Importe in Relation zum BIP.<br />
Quelle: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Handelsbilanz ausgewählter Länder Tab. 3.8<br />
1996 2001 2002 1996 2002 2001 2002 2002<br />
Mio. USD In % der Exporte<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in Mio. USD<br />
Offenheit 1)<br />
USA -194.869 -449.204 -509.237 -31,3 -73,5 17.005 -60.033 18,1<br />
Deutschland 68.286 77.684 117.980 13,3 19,5 29.177 40.296 48,8<br />
Japan 61.705 54.327 79.483 15,0 19,1 -44.312 25.156 18,9<br />
Frankreich 11.553 -5.708 2.785 4,0 0,8 2.673 8.493 41,0<br />
China 12.216 23.131 30.271 8,1 9,3 -968 7.140 50,2<br />
Großbritannien -25.313 -54.289 -59.170 -9,8 -21,4 -2.132 -4.881 .<br />
Kanada 13.104 17.668 8.202 6,5 3,3 5.206 -9.466 67,5<br />
Italien 43.853 8.022 8.154 17,5 3,2 6.740 132 37,1<br />
Niederlande 16.442 22.195 24.408 9,3 10,0 8.170 2.213 103,9<br />
Belgien . 9.613 15.985 . 7,5 -1.858 6.372 149,4<br />
Hongkong -18.021 -11.627 -7.562 -10,0 -3,8 -298 4.065 252,6<br />
Korea -12.744 8.740 9.357 -9,3 5,8 -2.607 617 65,8<br />
Mexiko -2.418 -26.793 -24.784 -2,5 -15,4 -1.344 2.009 54,3<br />
Singapur -6.204 5.699 8.605 -5,0 6,9 2.397 2.906 277,8<br />
Spanien -19.775 -33.673 -36.537 -19,4 -30,9 2.821 -2.864 37,1<br />
Russland 39.475 45.646 61.717 47,0 57,6 -23.499 16.070 44,1<br />
Malaysien -227 14.847 13.881 -0,3 14,9 -1.111 -966 182,2<br />
Irland 12.407 32.273 36.359 26,2 41,4 6.578 4.086 101,7<br />
Schweiz 1.214 -2.027 4.033 1,5 4,6 -11 6.060 63,8<br />
Schweden 17.888 13.778 15.708 21,2 19,7 -2.048 1.930 59,7<br />
Österreich -9.500 -3.905 439 -16,4 0,6 757 4.344 67,8<br />
Thailand -17.593 3.055 4.130 -31,6 6,0 -3.984 1.075 105,6<br />
Saudi Arabien 32.933 25.710 19.198 54,3 28,8 -17.862 -6.512 60,6<br />
Australien -7.456 -3.494 -11.347 -12,4 -17,4 7.643 -7.853 35,5<br />
Norwegen 14.724 25.634 26.303 30,3 43,5 -166 669 49,7<br />
Brasilien -11.144 -2.567 8.205 -23,3 13,6 3.170 10.772 24,3<br />
Indonesien 6.971 25.343 25.859 14,0 45,3 -3.249 516 .<br />
Dänemark 6.178 6.691 7.308 13,1 13,1 1.467 617 .<br />
Indien -3.730 -12.569 -15.136 -11,5 -30,0 -4.858 -2.567 .<br />
Finnland 9.170 10.605 11.468 23,9 25,6 -957 864 52,9<br />
Polen -12.697 -14.219 -14.083 -52,0 -34,4 3.077 135 .<br />
Vereinigte<br />
Arab. Emirate<br />
5.053 10.051 8.418 18,2 21,7 -4.686 -1.633 .<br />
Tschech. Rep. -8.553 -2.479 -1.867 -38,6 -4,9 243 612 106,1<br />
Philippinen -11.213 2.582 -213 -54,6 -0,6 -4.094 -2.795 90,5<br />
Türkei -19.363 -10.073 -15.762 -83,8 -45,0 16.660 -5.689 46,9<br />
Ungarn -3.064 -3.321 -3.338 -23,3 -9,8 780 -17 108,3<br />
1) Exporte plus Importe in Relation zum BIP.<br />
Quellen: IWF Direction of Trade Statistics, wiiw-Berechnungen.<br />
161
Entwicklung der Dienstleistungsexporte für ausgewählte Länder Tab. 3.9<br />
162<br />
1996 2002 1996 2001 2002 2001 2002<br />
Mio. USD Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
USA 236.890 288.722 18,0 19,1 157,3 -3,3 1,1<br />
Großbritannien 87.342 125.464 6,6 7,5 201,9 -4,3 12,2<br />
Deutschland 85.408 105.999 6,5 6,1 163,7 5,8 16,1<br />
Frankreich 83.529 86.745 6,3 5,4 100,4 -0,5 7,7<br />
Japan 67.712 65.712 5,1 4,3 123,5 -6,8 1,9<br />
Spanien 44.387 62.757 3,4 3,9 206,1 8,7 7,8<br />
Italien 65.660 60.251 5,0 3,9 115,2 2,0 4,5<br />
Belgien+Luxemburg 34.702 57.777 2,6 3,4 173,2 1,1 14,8<br />
Niederlande 47.237 56.011 3,6 3,4 147,7 3,8 9,4<br />
Hongkong . 45.159 . 2,8 . 1,6 9,0<br />
China 20.601 39.745 1,6 2,2 355,1 9,5 19,2<br />
Kanada 29.243 37.195 2,2 2,5 170,1 -3,6 -2,2<br />
Österreich 33.977 35.198 2,6 2,2 131,7 6,4 5,5<br />
Singapur 30.453 29.702 2,3 1,9 159,7 -0,8 2,9<br />
Schweiz 26.250 29.378 2,0 1,9 136,8 -4,1 6,1<br />
Irland 5.749 28.339 0,4 1,6 751,8 39,8 20,8<br />
Korea 23.412 28.143 1,8 1,9 217,3 -4,8 -3,1<br />
Dänemark 16.502 27.182 1,3 1,7 216,4 5,2 7,2<br />
Indien 7.238 24.859 0,6 1,4 486,8 8,9 19,0<br />
Schweden 16.930 23.760 1,3 1,5 188,7 8,6 8,0<br />
Griechenland 9.348 20.223 0,7 1,3 . 1,1 3,9<br />
Norwegen 14.819 19.294 1,1 1,2 158,7 3,5 8,0<br />
Australien 18.531 17.172 1,4 1,1 143,8 -11,8 5,0<br />
Thailand 17.007 15.319 1,3 0,9 138,5 -6,1 17,6<br />
Malaysia 15.136 14.878 1,1 1,0 232,1 3,7 2,9<br />
Türkei 13.430 14.799 1,0 1,1 138,9 -21,4 -7,8<br />
Russland 13.283 13.042 1,0 0,7 . 12,8 20,9<br />
Mexiko 10.723 12.740 0,8 0,9 133,9 -7,7 0,3<br />
Israel 8.027 10.853 0,6 0,8 181,9 -21,2 -9,2<br />
Polen 9.747 10.035 0,7 0,7 238,9 -6,1 2,9<br />
Portugal 8.040 9.855 0,6 0,6 144,0 4,1 11,5<br />
Brasilien 4.655 9.606 0,4 0,6 242,3 -1,9 3,0<br />
Ungarn 5.866 7.807 0,4 0,5 275,3 23,7 4,4<br />
Slowenien 2.135 2.292 0,2 0,1 164,6 3,8 16,9<br />
Tschech. Rep. 8.181 7.083 0,6 0,5 150,0 3,7 -0,1<br />
Quelle: IWF Balance of Payments Statistics, wiiw-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Entwicklung der Dienstleistungsimporte für ausgewählte Länder Tab. 3.10<br />
1996 2002 1996 2001 2002 2001 2002<br />
Mio. USD Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
USA 150.629 227.380 11,3 14,5 186,2 -0,7 3,6<br />
Großbritannien 72.281 104.254 5,4 6,3 199,3 -3,2 9,1<br />
Deutschland 135.977 150.491 10,2 9,6 146,0 3,2 3,3<br />
Frankreich 67.275 68.951 5,1 4,1 99,2 2,7 10,0<br />
Japan 129.988 107.940 9,8 7,1 112,1 -7,4 -0,3<br />
Spanien 23.979 37.887 1,8 2,2 200,4 8,6 11,5<br />
Italien 57.605 63.542 4,3 3,8 129,8 3,9 10,0<br />
Belgien+Luxemburg 32.070 49.691 2,4 2,9 165,7 3,5 14,7<br />
Niederlande 45.278 57.190 3,4 3,5 150,5 4,6 6,5<br />
Hongkong . 24.204 . 1,6 . -1,1 -0,5<br />
China 22.585 46.528 1,7 2,6 386,6 9,0 18,5<br />
Kanada 35.906 42.481 2,7 2,9 130,9 -0,9 -2,3<br />
Österreich 29.331 34.498 2,2 2,1 179,8 6,0 9,7<br />
Singapur 22.101 27.298 1,7 1,8 241,1 -0,2 1,5<br />
Schweiz 15.691 17.106 1,2 1,1 148,1 5,8 3,8<br />
Irland 13.448 40.454 1,0 2,3 598,4 22,9 14,5<br />
Korea 29.592 35.603 2,2 2,2 236,2 -1,6 8,3<br />
Dänemark 14.771 25.116 1,1 1,5 240,0 4,6 11,7<br />
Indien 11.171 18.691 0,8 1,1 287,7 -2,4 15,0<br />
Schweden 18.755 23.835 1,4 1,5 178,5 -1,8 3,5<br />
Griechenland 4.238 10.677 0,3 0,8 . 2,7 -7,9<br />
Norwegen 13.435 16.597 1,0 1,0 144,7 4,6 9,7<br />
Australien 18.607 17.853 1,4 1,1 133,1 -7,6 6,8<br />
Thailand 19.585 16.722 1,5 1,0 134,1 -5,4 14,4<br />
Malaysia 17.573 16.448 1,3 1,1 172,8 -0,5 -1,3<br />
Türkei 6.773 6.916 0,5 0,5 175,2 -23,5 -0,2<br />
Russland 18.665 22.111 1,4 1,3 . 18,5 15,0<br />
Mexiko 10.817 17.660 0,8 1,1 146,6 -1,0 2,7<br />
Israel 9.107 11.470 0,7 0,8 179,3 -0,0 -8,3<br />
Polen 6.343 9.186 0,5 0,6 253,0 -0,5 2,6<br />
Portugal 6.636 6.733 0,5 0,4 122,8 -4,0 6,2<br />
Brasilien 12.714 14.644 1,0 1,1 153,3 2,5 -14,3<br />
Ungarn 3.979 7.193 0,3 0,4 274,6 22,2 19,6<br />
Slowenien 1.494 1.736 0,1 0,1 170,6 1,4 19,1<br />
Tschech. Rep. 6.264 6.439 0,5 0,4 173,6 2,4 15,7<br />
Quelle: IWF Balance of Payments Statistics, wiiw-Berechnungen.<br />
163
Entwicklung der Dienstleistungsbilanz für ausgewählte Länder Tab. 3.11<br />
164<br />
1996 2001 2002 1996 2002 2001 2002<br />
Mio. USD In % der Exporte<br />
Veränderung zum Vorjahr<br />
in Mio. USD<br />
USA 86.261 66.294 61.342 36,4 21,2 -8.115 -4.952<br />
Großbritannien 15.061 16.286 21.210 17,2 16,9 -1.810 4.924<br />
Deutschland -50.569 -54.419 -44.492 -59,2 -42,0 488 9.927<br />
Frankreich 16.254 17.816 17.794 19,5 20,5 -2.057 -22<br />
Japan -62.276 -43.733 -42.228 -92,0 -64,3 3.893 1.505<br />
Spanien 20.409 24.214 24.870 46,0 39,6 1.957 656<br />
Italien 8.055 -76 -3.290 12,3 -5,5 -1.032 -3.214<br />
Belgien+Luxemburg 2.632 6.998 8.086 7,6 14,0 -923 1.088<br />
Niederlande 1.959 -2.505 -1.179 4,1 -2,1 -486 1.327<br />
Hongkong . 17.114 20.954 . 46,4 . 3.840<br />
China -1.984 -5.933 -6.784 -9,6 -17,1 -333 -851<br />
Kanada -6.664 -5.424 -5.286 -22,8 -14,2 -1.015 138<br />
Österreich 4.646 1.915 700 13,7 2,0 226 -1.215<br />
Singapur 8.351 1.969 2.404 27,4 8,1 -192 435<br />
Schweiz 10.559 11.219 12.273 40,2 41,8 -2.089 1.054<br />
Irland -7.699 -11.874 -12.115 -133,9 -42,7 83 -241<br />
Korea -6.179 -3.828 -7.461 -26,4 -26,5 -938 -3.633<br />
Dänemark 1.731 2.882 2.066 10,5 7,6 263 -816<br />
Indien -3.933 4.633 6.168 -54,3 24,8 2.112 1.535<br />
Schweden -1.825 -1.023 -74 -10,8 -0,3 2.165 949<br />
Griechenland 5.110 7.867 9.546 54,7 47,2 -85 1.679<br />
Norwegen 1.384 2.729 2.697 9,3 14,0 -68 -33<br />
Australien -76 -366 -681 -0,4 -4,0 -802 -315<br />
Thailand -2.578 -1.595 -1.403 -15,2 -9,2 -3 193<br />
Malaysia -2.437 -2.202 -1.570 -16,1 -10,6 605 632<br />
Türkei 6.657 9.130 7.883 49,6 53,3 -2.238 -1.247<br />
Russland -5.382 -8.444 -9.070 -40,5 -69,5 -1.780 -626<br />
Mexiko -94 -4.493 -4.920 -0,9 -38,6 -889 -427<br />
Israel -1.080 -554 -617 -13,5 -5,7 -3.210 -64<br />
Polen 3.404 804 849 34,9 8,5 -589 45<br />
Portugal 1.404 2.497 3.121 17,5 31,7 612 624<br />
Brasilien -8.059 -7.759 -5.038 -173,1 -52,5 -597 2.721<br />
Ungarn 1.887 1.462 613 32,2 7,9 342 -849<br />
Slowenien 641 502 555 30,0 24,2 52 53<br />
Tschech. Rep. 1.917 1.524 643 23,4 9,1 121 -881<br />
Quelle: IWF Balance of Payments Statistics, wiiw-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Bedeutung von FDI für ausgewählte Regionen Tab. 3.12<br />
Passive<br />
FDI-Bestände in % des BIP<br />
1985 1990 1995 2000 2001 2002<br />
Welt 8,4 9,3 10,3 19,6 21,2 22,3<br />
Industrieländer 6,2 8,2 8,9 16,5 17,9 18,7<br />
Westeuropa 9,4 11,0 13,4 28,5 30,4 31,4<br />
EU-15 9,3 10,9 13,2 28,5 30,5 31,4<br />
Nordamerika 5,5 8,0 8,3 13,5 14,2 14,1<br />
Entwicklungsländer 16,4 14,8 16,6 31,1 33,4 36,0<br />
Süd- u. Südostasien 24,9 20,9 21,1 37,0 37,2 37,9<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 0,2 1,3 5,3 18,3 19,1 20,8<br />
Aktive<br />
Welt 6,6 8,6 10,0 19,3 20,4 21,6<br />
Industrieländer 7,3 9,6 11,3 21,4 23 24,4<br />
Westeuropa 10,8 12,1 16,1 39,3 41,3 42,7<br />
EU-15 10,2 11,6 15,1 37,9 40,0 41,0<br />
Nordamerika 6,2 8,1 10,3 14,5 15,1 15,9<br />
Entwicklungsländer 3,8 3,9 5,8 12,9 12,8 13,5<br />
Süd- u. Südostasien 1,0 2,6 6,7 18,9 18,0 18,1<br />
Zentral- und Osteuropa 1) . 0,4 0,9 2,8 3,1 3,3<br />
Passive<br />
FDI-Flüsse in % der Bruttoinvestitionen<br />
1991–1996 2) 1998 1999 2000 2001 2002<br />
Welt 4,4 10,9 16,5 20,8 12,8 12,2<br />
Industrieländer 3,7 10,4 17,1 22,9 12,7 12,3<br />
Westeuropa 5,5 14,8 27,3 41,6 24,0 22,0<br />
EU-15 5,5 14,8 27,5 42,2 24,5 22,5<br />
Nordamerika 4,7 12,4 18,0 20,8 9,7 2,9<br />
Entwicklungsländer 6,5 12,0 14,3 14,6 12,7 10,5<br />
Süd- u. Südostasien 7,4 11,0 12,2 14,8 10,3 7,3<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 5,8 13,6 18,5 17,9 14,6 17,2<br />
Aktive<br />
Welt 5,0 11,0 16,9 18,3 11,3 13,6<br />
Industrieländer 5,7 13,9 21,1 22,4 14,3 15,6<br />
Westeuropa 8,4 24,5 42,4 51,1 28,0 23,7<br />
EU-15 8,1 24,6 42,3 50,5 28,4 23,8<br />
Nordamerika 6,7 10,4 13,3 10,3 7,9 8,6<br />
Entwicklungsländer 2,9 3,1 3,7 6,2 2,9 4,6<br />
Süd- u. Südostasien 4,2 3,9 4,6 9,1 4,1 9,1<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 0,3 1,5 1,8 2,7 2,1 2,7<br />
1) ohne Moldawien. 2) jährlicher Durchschnitt.<br />
Quelle: UNCTAD World Investment Report 2003.<br />
165
Passive FDI-Flüsse ausgewählter Länder Tab. 3.13<br />
166<br />
1998 1999 2000 2001 2002 1996 2002 2002<br />
Veränderung zum Vorjahr in % Mio. USD<br />
In % der<br />
Bruttoanlageinvestitionen<br />
Belgien+Luxemburg 89,1 528,9 50,6 -65,7 95,5 14.064 143.950 171.2*<br />
Frankreich 28,1 58,0 -9,1 30,0 -5,5 21.972 52.020 18,4<br />
China -1,1 -11,4 -0,9 15,2 11,5 40.180 49.308 10.5*<br />
USA 69,6 61,7 11,0 -52,8 -73,9 86.520 39.633 1,9<br />
Deutschland 84,7 135,3 287,1 -84,4 11,2 6.429 37.296 10,4<br />
Niederlande 241,0 9,4 53,7 -18,2 -44,8 16.604 28.534 33,2<br />
Großbritannien 99,7 19,9 34,0 -48,3 -54,6 27.387 28.180 10,1<br />
Irland 302,3 68,7 22,4 -58,0 157,9 2.618 24.697 70,9<br />
Spanien 86,5 30,5 137,6 -24,9 -23,3 6.796 21.284 12,8<br />
Kanada 97,4 9,0 166,8 -56,5 -28,7 9.635 20.501 14,3<br />
Brasilien 62,4 -10,5 14,7 -31,5 -26,2 11.200 16.566 19,6<br />
Australien -20,8 -10,9 139,2 -63,8 236,0 6.181 15.682 15,0<br />
Italien -28,8 163,5 89,8 12,9 -1,2 3.546 14.699 6,2<br />
Mexiko -7,3 9,7 23,1 63,0 -44,2 9.186 14.622 11,3<br />
Hongkong . 66,5 152,0 -61,6 -42,3 . 13.718 35,2<br />
Schweden 89,0 205,9 -62,7 -40,9 -9,6 5.492 11.828 27,0<br />
Tschech. Rep. 187,6 70,6 -21,0 13,1 65,3 1.435 9.323 59,1<br />
Japan 2,1 276,6 -33,2 -24,8 46,8 208 9.087 0.6*<br />
Finnland 465,1 -61,3 96,3 -59,0 118,1 1.118 8.156 35,0<br />
Dänemark 139,1 140,9 123,0 -71,4 -37,4 773 6.410 17,7<br />
Singapur -43,9 74,4 -5,9 -12,2 -44,3 9.303 6.097 43.8*<br />
Portugal 24,0 -60,8 453,4 -14,8 -27,3 1.704 4.235 13,6<br />
Polen 29,7 14,2 28,5 -38,8 -27,7 4.498 4.131 11,4<br />
Schweiz 32,1 27,9 61,1 -52,1 -62,2 4.373 3.599 19,2<br />
Malaysia -57,9 80,1 -2,8 -85,4 478,3 5.078 3.203 2.5*<br />
Indien -26,4 -17,7 22,5 63,1 -30,1 2.426 3.030 3.2*<br />
Russland -43,2 19,7 -18,0 -9,0 21,9 2.579 3.009 3,9<br />
Kasachstan -12,9 37,8 -19,2 121,1 -8,9 1.137 2.583 55.6*<br />
Peru -23,2 18,0 -58,3 41,3 109,0 3.471 2.391 14,9<br />
Österreich 77,6 -35,5 183,3 -30,7 -85,0 4.485 886 13.4*<br />
OECD 1)2)3) 73,8 73,0 44,7 -52,1 -18,7 247.338 504.626 .<br />
EU-15 2) 99,1 93,2 61,9 -54,6 3,7 114.047 382.229 .<br />
Eurozone 2) 98,6 111,9 88,4 -55,4 18,6 80.394 335.811 .<br />
NAFTA 3) 64,4 53,2 23,3 -48,8 -63,8 105.341 74.757 .<br />
ASEAN+3 4) -9,3 15,7 -12,5 -7,4 4,7 67.142 70.165 .<br />
1) 2002 ohne Slowakei. 2)1996 ohne Griechenland. 3) 1996 ohne Mexiko. 4) ohne Myanmar. * 2001.<br />
Quelle: IWF International Financial Statistics, UNCTAD World Investment Report 2003, wiiw-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Aktive FDI-Flüsse ausgewählter Länder Tab. 3.14<br />
1998 1999 2000 2001 2002 1996 2002 2002<br />
Veränderung zum Vorjahr in % Mio. USD<br />
In % der<br />
Bruttoanlageinvestitionen<br />
Belgien+Luxemburg 297,8 350,7 59,6 -58,5 93,8 8.026 166.827 195.4*<br />
Frankreich 28,8 161,5 45,9 -46,5 -32,7 30.361 62.729 22,4<br />
China 2,8 -32,6 -48,4 651,5 -63,4 2.114 2.518 1.5*<br />
USA 36,1 57,7 -29,2 -24,7 14,9 91.880 137.836 7,5<br />
Deutschland 110,5 21,9 -45,3 -30,5 -39,3 50.752 25.298 6,7<br />
Niederlande 50,8 54,8 30,3 -36,7 -28,0 31.937 33.951 29,9<br />
Großbritannien 95,5 65,2 32,1 -74,4 -89,1 34.820 7.461 16,1<br />
Irland 391,5 23,1 -34,7 3,2 -27,8 727 2.969 10,1<br />
Spanien 53,5 119,0 29,0 -39,0 -43,2 5.577 18.660 11,1<br />
Kanada 47,9 -49,4 169,0 -20,8 -21,5 13.107 28.860 19,9<br />
Brasilien 161,1 -37,9 35,0 -198,9 -209,9 -467 2.482 2,9<br />
Australien -47,1 -130,0 -182,1 1375,5 -45,7 7.052 6.637 7,3<br />
Italien 19,1 -45,8 79,7 80,2 -20,7 8.697 17.247 7,3<br />
Mexiko . . . . -78,0 . 969 0,8<br />
Hongkong . 14,0 206,4 -80,9 56,0 . 17.694 45,4<br />
Schweden 87,1 -13,8 104,4 -82,6 35,2 5.112 9.411 26,5<br />
Tschech. Rep. 352,7 -28,2 -52,6 285,7 70,7 155 281 1,8<br />
Japan -5,5 -9,6 41,6 22,1 -16,8 23.447 32.017 3.6*<br />
Finnland 255,5 -64,0 254,6 -64,6 -7,8 3.583 7.801 37,8<br />
Dänemark -3,2 304,3 66,4 -53,0 -61,3 2.511 5.152 14,4<br />
Singapur -95,8 1320,2 12,3 57,5 -57,3 6.234 4.082 38.2*<br />
Portugal 76,1 -21,6 153,6 -0,8 -51,6 972 3.679 11,2<br />
Polen 602,2 -90,2 -41,9 -600,0 -355,6 53 230 0,5<br />
Schweiz 5,8 77,3 34,2 -59,0 -45,0 16.152 10.069 24,3<br />
Malaysia . . 42,4 -86,8 613,9 . 1.905 1.2*<br />
Indien -57,8 66,8 433,5 64,6 -35,1 239 453 0.7*<br />
Russland -60,2 74,0 44,0 -20,3 37,8 922 3.490 5,3<br />
Kasachstan 478,6 -55,6 22,2 -681,8 -1765,2 . 426 0.5*<br />
Peru -27,1 106,5 . . . -17 . 1,6<br />
Österreich 40,9 18,3 69,4 -44,1 75,6 1848 5.501 7.1*<br />
OECD 1)2)3) 57,4 59,6 22,1 -47,0 -11,2 346.010 592.516 .<br />
EU-15 2) 85,5 75,3 32,8 -54,7 -15,6 184.923 367.355 .<br />
Eurozone 2) 83,7 84,1 29,1 -44,6 -0,4 142.480 345.332 .<br />
NAFTA 3) 38,2 37,0 -15,1 -21,6 4,1 104.987 167.665 .<br />
ASEAN+3 4) -23,9 8,3 28,4 27,3 -24,9 38.179 43.387 .<br />
1) 2002 ohne Slowakei. 2)1996 ohne Griechenland. 3) 1996 ohne Mexiko. 4) ohne Myanmar. * 2001.<br />
Quelle: IWF International Financial Statistics, UNCTAD World Investment Report 2003, wiiw-Berechnungen.<br />
167
Passive Portfolioinvestitionen ausgewählter Länder Tab. 3.15<br />
168<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
Mio. USD<br />
Belgien+Luxemburg 54.047 59.253 135.837 132.547 140.588 77.603<br />
Frankreich 35.321 59.747 117.517 132.332 106.903 61.319<br />
China 7.842 98 -699 7.317 1.249 1.752<br />
USA 333.110 187.565 285.596 420.002 425.076 421.442<br />
Deutschland 91.031 150.909 177.857 37.699 137.933 98.696<br />
Niederlande 17.752 30.074 100.103 55.242 74.193 49.954<br />
Großbritannien 43.461 35.279 185.534 255.115 58.458 92.115<br />
Irland -2.505 54.735 67.377 80.255 89.085 66.303<br />
Spanien 11.772 16.736 45.549 58.146 27.246 35.137<br />
Kanada 11.692 16.590 2.653 10.086 22.208 13.450<br />
Brasilien 10.393 19.013 3.542 8.651 872 -4.797<br />
Australien 13.219 6.917 22.523 15.588 20.735 17.002<br />
Italien 73.376 111.987 104.607 57.020 29.329 32.928<br />
Mexiko 6.002 -206 12.005 -1.134 3.882 -726<br />
Hongkong . -3.408 58.526 46.508 -1.161 -906<br />
Schweden -2.384 2.023 1.882 9.017 10.338 -6.691<br />
Tschech. Rep. 1.152 1.146 500 482 798 814<br />
Japan 79.194 56.063 126.929 47.387 60.503 -20.044<br />
Finnland 3.843 3.866 13.550 17.116 5.985 8.899<br />
Dänemark 11.186 -2.598 7.014 5.783 10.510 4.843<br />
Singapur -489 702 3.159 -2.036 187 -1272<br />
Portugal 8.791 5.386 9.945 2.792 9.738 10.173<br />
Polen 1.295 1.827 691 3.422 1.067 2.826<br />
Schweiz 9.033 10.247 5.894 10.548 1.896 7.323<br />
Malaysien -248 283 -892 -2.145 -666 -836<br />
Indien 2.556 -601 2.317 2.774 2.041 967<br />
Russland 17.796 6.293 -1.881 -12.809 -730 3.295<br />
Kasachstan 405 66 -40 31 31 -183<br />
Peru 406 -224 -125 75 -54 1.724<br />
Kolumbien 1.701 916 720 1.350 3.341 -1.013<br />
...<br />
Österreich 10.956 17.942 26.364 30.360 16.699 18.599<br />
OECD 1)2) 829.037 831.720 1.474.229 1.416.701 1.277.302 1.020.680<br />
EU-15 2) 356.646 545.338 999.890 882.686 726.015 562.194<br />
Eurozone 2) 304.383 510.633 805.460 612.770 646.710 471.928<br />
NAFTA 350.804 203.949 300.254 428.954 451.166 434.167<br />
ASEAN+3 3) 102.173 56.055 142.185 61.783 74.107 -12.652<br />
1) 2002 ohne Slowakei. 2)1996 ohne Griechenland. 3) ohne Myanmar.<br />
Quelle: IWF International Financial Statistics.
Statistische Übersichten<br />
Aktive Portfolioinvestitionen ausgewählter Länder Tab. 3.16<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002<br />
Mio. USD<br />
Belgien+Luxemburg 62.657 100.234 161.521 122.814 125.068 -2.618<br />
Frankreich 60.788 105.221 126.809 97.435 85.482 77.371<br />
China 899 3.830 10.535 11.308 20.654 12.095<br />
USA 118.976 124.204 116.236 121.908 84.637 -15.801<br />
Deutschland 90.015 145.494 190.261 191.394 116.166 63.319<br />
Niederlande 38.942 69.294 94.489 65.634 60.994 64.293<br />
Großbritannien 84.987 52.979 34.197 97.673 124.231 -2.455<br />
Irland 716 66.738 82.813 78.817 111.347 106.466<br />
Spanien 16.450 44.193 47.397 59.320 45.042 28.509<br />
Kanada 8.568 15.106 15.579 42.913 24.374 15.841<br />
Brasilien 335 594 -258 1.696 795 321<br />
Australien 79 3.127 9.270 12.465 9.767 15.976<br />
Italien 61.857 109.064 129.624 80.263 36.167 15.265<br />
Mexiko 708 768 836 -1.290 -3.857 -1.134<br />
Hongkong . -25.492 25.440 22.022 40.133 36.375<br />
Schweden 13.818 17.615 36.749 12.772 23.042 4.038<br />
Tschech. Rep. 159 44 1882 2.236 -125 2.373<br />
Japan 47.064 95.236 154.410 83.362 106.788 85.931<br />
Finnland 4.600 3.906 15.699 18.920 11.594 13.432<br />
Dänemark 6.239 7.563 9.719 23.723 14.819 4.362<br />
Singapur 13.872 10.149 12.036 11.482 11.284 11.374<br />
Portugal 8.697 5.997 6.737 4.583 7.504 6.977<br />
Polen -815 130 548 89 -46 1.157<br />
Schweiz 19.739 14.882 46.839 22.309 42.841 29.914<br />
Malaysien . . 133 387 -254 563<br />
Indien . . . 173 70 36<br />
Russland 157 258 -254 411 -77 796<br />
Kasachstan 1 5 6 86 1.349 1.078<br />
Peru 249 136 228 553 278 303<br />
Kolumbien 769 -286 1345 1.173 3.460 -2.029<br />
...<br />
Österreich 10.157 11.210 29.216 27.145 10.955 22.964<br />
OECD 1)2) 668.685 1.006.894 1.319.335 1.194.147 1.074.498 569.082<br />
EU-15 2) 459.925 739.507 966.088 881.679 772.885 403.815<br />
Eurozone 2) 354.880 661.350 885.423 747.510 610.793 397.870<br />
NAFTA 128.252 140.078 132.651 163.531 105.155 -1.094<br />
ASEAN+3 3) 60.839 111.799 176.641 108.031 144.678 116.281<br />
1) 2002 ohne Slowakei. 2)1996 ohne Griechenland. 3) ohne Myanmar.<br />
Quelle: IWF International Financial Statistics.<br />
169
Hauptergebnisse der WIFO-Konjunkturprognose für Österreich Tab. 4.4<br />
Bruttoinlandsprodukt<br />
170<br />
2001 2002 2003 2004*<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
Real + 0,8 + 1,4 + 0,7 + 1,5<br />
Nominell + 2,8 + 2,7 + 2,7 + 3,4<br />
Sachgütererzeugung 1) , real + 1,5 + 0,5 – 0,2 + 2,2<br />
Private Konsumausgaben, real + 1,4 + 0,8 + 1,3 + 1,7<br />
Bruttoanlageinvestitionen, real – 2,3 – 2,8 + 4,3 + 2,7<br />
Ausrüstungen 2) – 2,1 – 5,2 + 6,1 + 3,0<br />
Bauten – 2,5 – 0,7 + 2,8 + 2,5<br />
Exporte insgesamt, real + 7,5 + 3,7 + 1,0 + 4,4<br />
Importe insgesamt, real + 5,9 + 1,2 + 3,0 + 4,0<br />
Leistungsbilanzsaldo, Mrd. Euro – 4,13 + 0,75 – 1,28 – 0,99<br />
in % des BIP – 1,9 + 0,3 – 0,6 – 0,4<br />
Sekundärmarktrendite 3) in % 5,1 5,0 4,2 4,1<br />
Verbraucherpreise + 2,7 + 1,8 + 1,3 + 1,6<br />
Arbeitslosenquote<br />
In % der Erwerbspersonen 4) 3,6 4,3 4,4 4,5<br />
In % der unselbst. Erwerbspersonen 5) 6,1 6,9 7,0 7,2<br />
Unselbständig Beschäftigte 6) + 0,4 – 0,5 + 0,2 + 0,5<br />
Finanzierungssaldo des Staates<br />
lt. Maastricht-Definition, in % des BIP + 0,2 – 0,2 – 1,1 – 1,0<br />
Wechselkurs Dollar je Euro 0,896 0,945 1,131 1,220<br />
Erdölpreis 7) , USD je Barrel 23,6 24,1 28,2 31,0<br />
1) Nettoproduktionswert, einschl. Bergbau. 2) Einschließlich sonstiger Anlagen. 3) Bundesanleihen mit<br />
einer Laufzeit von 10 Jahren (Benchmark). 4) Laut Eurostat. 5) Laut Arbeitsmarktservice. 6) Ohne Bezieher und Bezieherinnen<br />
von Karenz/Kinderbetreuungsgeld, ohne Präsenzdiener. 7) Durchschnittlicher Importpreis der OECD (cif).<br />
* WIFO-Prognose vom April 2004.<br />
Quelle: Statistik Austria.
Statistische Übersichten<br />
Österreichs Exporte lt. VGR Tab. 4.5<br />
Nominell<br />
Insgesamt Waren<br />
Reiseverkehr<br />
Mrd. Euro<br />
Sonstige<br />
Dienstleistungen<br />
Nicht aufteilbare<br />
Leistungen<br />
1993 56,4 34,0 10,8 7,3 4,3<br />
1995 63,4 42,3 9,9 8,3 2,9<br />
2000 103,9 70,2 10,8 14,0 9,0<br />
2002 115,2 78,0 11,9 16,4 8,8<br />
2003 116,2 79,1 12,3 16,4 8,3<br />
2004* 121,5 82,5 12,8 16,9 9,2<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
2002 + 3,2 + 4,4 + 3,7 + 3,5 - 7,9<br />
2003 + 0,9 + 1,4 + 3,7 - 0,4 - 5,3<br />
2004* + 4,6 + 4,3 + 4,0 + 3,4 + 10,3<br />
In Relation zum BIP in %<br />
1993 36,0 21,7 6,9 4,6 2,8<br />
1995 36,8 24,5 5,7 4,8 1,7<br />
2000 50,3 34,0 5,2 6,8 4,3<br />
2002 52,8 35,7 5,4 7,5 4,0<br />
2003 51,8 35,3 5,5 7,3 3,7<br />
2004* 52,4 35,6 5,5 7,3 4,0<br />
Struktur in %<br />
1993 100,0 60,3 19,1 12,9 7,7<br />
2003 100,0 68,1 10,6 14,1 7,2<br />
Real, zu Preisen 1995<br />
Mrd. Euro<br />
1993 58,3 34,7 11,4 7,8 4,4<br />
1995 63,4 42,3 9,9 8,3 2,9<br />
2000 99,7 68,0 9,9 13,1 8,7<br />
2002 111,2 77,0 10,5 15,0 8,7<br />
2003 112,3 78,5 10,7 14,7 8,3<br />
2004* 117,2 82,1 10,9 15,1 9,2<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
2002 + 3,7 + 5,4 + 1,9 + 3,4 - 7,1<br />
2003 + 1,0 + 2,0 + 1,6 - 1,5 - 4,8<br />
2004* + 4,4 + 4,5 + 2,0 + 2,4 + 10,5<br />
Struktur in %<br />
1993 100,0 59,5 19,5 13,4 7,6<br />
2003* 100,0 70,0 9,5 13,1 7,4<br />
* WIFO-Prognose.<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
171
Österreichs Importe lt. VGR Tab. 4.6<br />
Nominell<br />
172<br />
Insgesamt Waren<br />
Reiseverkehr<br />
Mrd. Euro<br />
Sonstige<br />
Dienstleistungen<br />
Nicht aufteilbare<br />
Leistungen<br />
1993 55,7 39,5 6,6 6,6 3,0<br />
1995 64,8 46,8 8,0 7,6 2,4<br />
2000 105,2 72,9 9,2 11,3 11,8<br />
2002 110,4 74,0 9,9 12,9 13,5<br />
2003 112,7 76,6 10,3 12,7 13,1<br />
2004* 117,1 79,3 10,7 13,1 14,0<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
2002 - 0,6 - 2,4 - 1,0 + 4,5 + 6,0<br />
2003 + 2,1 + 3,5 + 3,9 - 1,8 - 3,1<br />
2004* + 3,9 + 3,5 + 4,0 + 3,0 + 6,7<br />
In Relation zum BIP in %<br />
1993 35,5 25,2 4,2 4,2 1,9<br />
1995 37,6 27,2 4,6 4,4 1,4<br />
2000 50,9 35,3 4,5 5,5 5,7<br />
2002 50,6 33,9 4,5 5,9 6,2<br />
2003 50,3 34,2 4,6 5,7 5,9<br />
2004* 50,5 34,2 4,6 5,6 6,0<br />
Struktur in %<br />
1993 100,0 70,9 11,8 11,9 5,5<br />
2003 100,0 68,0 9,2 11,3 11,6<br />
Real, zu Preisen 1995<br />
Mrd. Euro<br />
1993 56,7 40,1 6,5 7,0 3,1<br />
1995 64,8 46,8 8,0 7,6 2,4<br />
2000 98,0 68,5 8,0 10,4 11,1<br />
2002 105,0 72,1 8,1 11,6 13,2<br />
2003 108,1 75,5 8,2 11,4 13,0<br />
2004* 112,4 78,5 8,4 11,6 13,9<br />
Veränderung zum Vorjahr in %<br />
2002 + 1,2 + 0,4 - 4,0 + 1,9 + 9,1<br />
2003 + 3,0 + 4,7 + 1,9 - 1,9 - 1,6<br />
2004* + 4,0 + 4,0 + 2,0 + 1,5 + 7,2<br />
Struktur in %<br />
1993 100,0 70,7 11,5 12,3 5,4<br />
2003 100,0 69,8 7,6 10,5 12,0<br />
* WIFO-Prognose<br />
Quelle: Statistik Austria.
Statistische Übersichten<br />
Der österreichische Außenbeitrag lt. VGR Tab. 4.7<br />
Nominell<br />
Außenbeitrag<br />
Insgesamt<br />
Waren<br />
Reiseverkehr<br />
Mrd. Euro<br />
Sonstige<br />
Dienstleistungen<br />
Nicht aufteilbare<br />
Leistungen<br />
1993 0,7 -5,5 4,2 0,6 1,3<br />
1995 -1,4 -4,5 1,9 0,7 0,5<br />
2000 -1,3 -2,7 1,5 2,7 -2,8<br />
2002 4,8 4,0 2,0 3,5 -4,7<br />
2003 3,4 2,5 2,0 3,7 -4,8<br />
2004* 4,4 3,2 2,1 3,9 -4,8<br />
Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro<br />
2002 + 4,1 + 5,1 + 0,5 + 0,0 - 1,5<br />
2003 - 1,3 - 1,5 + 0,1 + 0,2 - 0,0<br />
2004* + 0,9 + 0,7 + 0,1 + 0,2 - 0,0<br />
In Relation zum BIP in %<br />
1993 0,4 -3,5 2,7 0,4 0,8<br />
1995 -0,8 -2,6 1,1 0,4 0,3<br />
2000 -0,6 -1,3 0,7 1,3 -1,4<br />
2002 2,2 1,8 0,9 1,6 -2,2<br />
2003 1,5 1,1 0,9 1,6 -2,1<br />
2004* 1,9 1,4 0,9 1,7 -2,1<br />
Real, zu Preisen 1995<br />
Mrd. Euro<br />
1993 1,6 -5,4 4,9 0,8 1,3<br />
1995 -1,4 -4,5 1,9 0,7 0,5<br />
2000 1,8 -0,5 2,0 2,7 -2,4<br />
2002 6,2 4,9 2,5 3,4 -4,5<br />
2003 4,2 3,1 2,5 3,4 -4,7<br />
2004* 4,8 3,6 2,5 3,5 -4,8<br />
Veränderung zum Vorjahr in Mrd. Euro<br />
2002 + 2,7 + 3,7 + 0,5 + 0,3 - 1,8<br />
2003 - 2,1 - 1,9 + 0,0 - 0,0 - 0,2<br />
2004* + 0,7 + 0,5 + 0,1 + 0,2 - 0,1<br />
* WIFO-Prognose.<br />
Quelle: Statistik Austria.<br />
173
Beiträge zur Österreichischen Zahlungsbilanz Tab. 4.8<br />
174<br />
Salden in Mio. Euro In % des BIP<br />
1995 2000 2001 2002 2003 1995 2003<br />
Leistungsbilanz -4.490 -5.357 -4.132 366 -2.045 -2,6 -0,9<br />
Güter -4.874 -2.990 -1.403 3.765 1.654 -2,8 0,7<br />
Dienstleistungen 3.379 1.743 2.064 631 824 2,0 0,4<br />
davon Reiseverkehr 1.925 1.536 1.423 1.964 2.038 1,1 0,9<br />
Einkommen -1.741 -2.661 -3.441 -2.229 -2.458 -1,0 -1,1<br />
laufende Transfers -1.254 -1.449 -1.352 -1.801 -2.065 -0,7 -0,9<br />
davon öffentlicher Sektor -1.040 -1.147 -1.162 -941 -1.339 -0,6 -0,6<br />
Vermögensübertragungen -203 -475 -592 -519 -100 -0,1 -0,1<br />
davon unentgeltliche,<br />
öffentlicher Sektor 1) 31 154 -108 -102 76 0,0 0,0<br />
Kapitalbilanz 5.047 4.679 4.183 -3.386 3.106 2,9 1,4<br />
Direktinvestitionen 567 3.365 3.108 -4.568 -203 0,3 -0,1<br />
davon im Ausland -828 -6.230 -3.506 -5.580 -6.276 -0,5 -2,8<br />
davon in Österreich 1.395 9.595 6.615 1.012 6.074 0,8 2,7<br />
Portfolioinvestitionen 7.346 3.229 6.333 -4.227 4.999 4,3 2,2<br />
davon ausl. Wertpapiere -2.073 -29.166 -12.225 -25.045 -15.927 -1,2 -7,1<br />
davon inl. Wertpapiere 9.418 32.395 18.558 20.818 20.926 5,5 9,3<br />
Sonstige Investitionen 2) -2.078 -2.489 -7.256 4.074 -2.795 -1,2 -1,2<br />
Finanzderivate 213 -263 -69 -476 -691 0,1 -0,3<br />
offizielle Währungsreserven -1.001 838 2.067 1.810 1.795 -0,6 0,8<br />
Statistische Differenz -354 1.152 542 3.539 -961 -0,2 -0,4<br />
1) i.W. Rückflüsse aus der EU für Infrastrukturmaßnahmen.<br />
2) enthalten: Handelskredite, Kredite, Sicht- und Termineinlagen, sonstige Forderungen/Verpflichtungen.<br />
Quelle: OeNB.
Statistische Übersichten<br />
Österreichs Warenhandel mit ausgewählten Ländern Tab. 5.7<br />
Export<br />
1995 2002 2003 1996 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in % 1993=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Deutschland 16.168 24.780 25.011 37,4 31,9 188,8 + 2,6 + 0,9<br />
Italien 3.729 6.544 6.903 8,3 8,8 257,5 + 3,5 + 5,5<br />
USA 1.250 4.010 4.084 3,2 5,2 364,0 + 2,0 + 1,9<br />
Schweiz 2.287 4.074 4.060 5,0 5,2 194,0 + 5,5 - 0,3<br />
Frankreich 1.873 3.427 3.490 4,3 4,4 232,0 + 1,1 + 1,8<br />
Großbritannien 1.392 3.608 3.387 3,5 4,3 305,2 + 4,1 - 6,1<br />
Ungarn 1.535 3.336 3.173 4,0 4,0 263,8 + 0,6 - 4,9<br />
Tschech. Rep. 1.154 2.248 2.407 2,9 3,1 292,0 + 4,5 + 7,1<br />
Spanien 884 2.121 1.988 2,2 2,5 281,2 + 14,4 - 6,3<br />
Niederlande 1.203 1.829 1.604 2,6 2,0 159,5 + 3,7 - 12,3<br />
Slowenien 713 1.398 1.549 1,6 2,0 313,0 + 9,0 + 10,8<br />
Polen 574 1.302 1.334 1,5 1,7 285,3 + 7,1 + 2,5<br />
Belgien 788 1.227 1.262 1,9 1,6 208,1 - 4,6 + 2,8<br />
Slowakei 414 1.066 1.187 1,3 1,5 399,0 + 12,6 + 11,4<br />
Russland 617 958 1.132 1,3 1,4 250,8 + 1,7 + 18,2<br />
Kroatien 383 993 1.032 1,0 1,3 500,9 + 12,0 + 3,9<br />
Rumänien 183 817 1.020 0,5 1,3 1.084,4 + 19,1 + 24,8<br />
China 328 1.170 897 0,6 1,1 336,6 + 38,6 - 23,3<br />
Import<br />
Deutschland 21.163 31.086 32.606 42,9 40,8 191,6 - 2,6 + 4,9<br />
Italien 4.252 5.548 5.593 8,8 7,0 151,1 - 1,7 + 0,8<br />
USA 2.059 3.735 3.169 4,5 4,0 175,0 - 11,3 - 15,2<br />
Schweiz 1.858 2.533 2.617 3,5 3,3 156,1 + 0,2 + 3,3<br />
Frankreich 2.386 2.981 3.821 4,8 4,8 212,0 - 6,8 + 28,2<br />
Großbritannien 1.439 2.017 1.794 3,0 2,2 159,9 - 3,1 - 11,0<br />
Ungarn 915 2.557 2.594 2,7 3,2 329,7 - 4,9 + 1,5<br />
Tschech. Rep. 918 2.236 2.626 2,0 3,3 395,7 + 5,5 + 17,4<br />
Spanien 634 1.194 1.370 1,4 1,7 245,2 + 9,7 + 14,8<br />
Niederlande 1.667 2.553 2.424 3,2 3,0 204,1 + 11,0 - 5,0<br />
Slowenien 382 784 859 0,8 1,1 350,0 + 1,9 + 9,5<br />
Polen 463 926 979 0,8 1,2 288,0 - 1,3 + 5,7<br />
Belgien 1.301 1.507 1.380 2,3 1,7 124,8 - 0,1 - 8,4<br />
Slowakei 384 1.200 1.421 0,9 1,8 622,2 + 7,8 + 18,5<br />
Russland 821 1.032 1.321 1,6 1,7 237,2 - 9,9 + 28,0<br />
Kroatien 140 364 402 0,4 0,5 400,8 + 13,2 + 10,4<br />
Rumänien 107 506 558 0,3 0,7 897,9 + 19,9 + 10,3<br />
China 598 1.405 1.762 1,3 2,2 311,5 + 3,3 + 25,4<br />
Länderreihung nach der Rangliste im Export im Jahr 2003.<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.<br />
175
Österreichs Handelsbilanz mit ausgewählten Ländern Tab. 5.8<br />
176<br />
1993 1995 2002 2003 1993 1995 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr in<br />
Mio. Euro<br />
Deutschland -3.775 -4.995 -6.306 -7.595 -28,5 -30,9 -30,4 1.435 -1.289<br />
Italien -1.022 -523 997 1.309 -38,1 -14,0 19,0 316 313<br />
USA -689 -809 274 915 -61,4 -64,7 22,4 551 641<br />
Schweiz 416 429 1.541 1.443 19,9 18,8 35,5 206 -98<br />
Frankreich -298 -514 447 -331 -19,8 -27,4 -9,5 254 -778<br />
Großbritannien -12 -47 1.591 1.593 -1,1 -3,4 47,0 206 1<br />
Ungarn 416 620 779 579 34,6 40,4 18,2 151 -200<br />
Tschech. Rep. 161 236 12 -219 19,5 20,5 -9,1 -21 -230<br />
Spanien 148 251 928 618 21,0 28,3 31,1 162 -310<br />
Niederlande -182 -464 -724 -820 -18,1 -38,6 -51,1 -189 -96<br />
Slowenien 250 331 614 690 50,4 46,4 44,6 100 76<br />
Polen 128 111 375 355 27,3 19,3 26,6 98 -20<br />
Belgien -500 -513 -281 -119 -82,5 -65,1 -9,4 -57 162<br />
Slowakei 69 30 -134 -235 23,2 7,3 -19,8 33 -101<br />
Russland -106 -204 -75 -190 -23,5 -33,0 -16,8 130 -115<br />
Kroatien 106 243 629 630 51,3 63,5 61,0 64 1<br />
Rumänien 32 76 311 462 33,9 41,5 45,3 47 151<br />
China -299 -270 -235 -864 -112,1 -82,4 -96,3 280 -630<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Regionale Gliederung des österreichischen Warenhandels Tab. 5.9<br />
Export<br />
Integrations<strong>politische</strong> Gliederung<br />
1995 2002 2003 1996 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in %<br />
1993<br />
=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
EU-25 32.230 56.211 56.711 75,5 72,3 221,8 + 3,5 + 0,9<br />
EU-15 27.775 46.517 46.729 64,1 59,5 210,0 + 3,0 + 0,5<br />
Eurozone 25.422 41.513 41.941 58,5 53,4 205,9 + 3,0 + 1,0<br />
EU-Beitrittsländer 4.456 9.694 9.982 11,4 12,7 300,3 + 5,9 + 3,0<br />
Extra-EU-25 9.921 21.189 21.760 24,5 27,7 259,7 + 6,2 + 2,7<br />
Extra-EU-15 14.377 30.883 31.742 35,9 40,5 271,2 + 6,1 + 2,8<br />
Regionale Gliederung<br />
Westliche Industriestaaten 33.223 58.144 58.618 77,8 74,7 217,2 + 3,4 + 0,8<br />
Westeuropa 30.663 51.747 52.075 71,0 66,4 210,3 + 3,4 + 0,6<br />
NAFTA 1.559 4.691 4.848 4,1 6,2 343,8 + 0,6 + 3,3<br />
MOEL-27 5.995 13.681 14.652 15,4 18,7 339,7 + 7,1 + 7,1<br />
MOEL-5 4.390 9.348 9.650 11,2 12,3 293,6 + 4,9 + 3,2<br />
SOEL-7 784 2.730 3.014 2,2 3,8 656,7 + 17,8 + 10,4<br />
Entwicklungsländer 2.933 5.576 5.201 6,8 6,6 196,5 + 6,4 - 6,7<br />
OPEC 735 1.118 1.165 1,8 1,5 126,8 - 12,1 + 4,2<br />
NIC-6 957 1.502 1.365 2,2 1,7 178,6 + 9,6 - 9,1<br />
Insgesamt 42.151 77.400 78.471 100,0 100,0 231,1 + 4,2 + 1,4<br />
Import<br />
Integrations<strong>politische</strong> Gliederung<br />
EU-25 38.145 58.465 61.159 78,1 76,6 199,0 - 1,2 + 4,6<br />
EU-15 35.044 50.678 52.579 70,8 65,9 184,8 - 1,5 + 3,7<br />
Eurozone 32.429 47.215 49.280 65,5 61,7 187,3 - 1,4 + 4,4<br />
EU-Beitrittsländer 3.100 7.787 8.580 7,3 10,7 375,4 + 1,0 + 10,2<br />
Extra-EU-25 10.403 18.640 18.673 21,9 23,4 181,0 - 4,6 + 0,2<br />
Extra-EU-15 13.503 26.426 27.253 29,2 34,1 216,3 - 3,0 + 3,1<br />
Regionale Gliederung<br />
Westliche Industriestaaten 41.037 60.585 62.245 83,2 78,0 180,0 - 2,0 + 2,7<br />
Westeuropa 37.299 54.134 56.253 75,2 70,5 184,6 - 1,3 + 3,9<br />
NAFTA 2.302 4.201 3.607 5,2 4,5 179,7 - 11,6 - 14,1<br />
MOEL-27 4.344 10.631 11.727 10,0 14,7 375,1 + 2,3 + 10,3<br />
MOEL-5 3.062 7.702 8.479 7,2 10,6 374,5 + 1,0 + 10,1<br />
SOEL-7 310 1.114 1.259 0,8 1,6 577,5 + 16,1 + 12,9<br />
Entwicklungsländer 3.167 5.888 5.860 6,8 7,3 174,7 - 9,2 - 0,5<br />
OPEC 679 1.060 1.011 1,7 1,3 119,6 - 14,4 - 4,7<br />
NIC-6 1.059 2.064 1.706 2,1 2,1 141,1 - 13,8 - 17,3<br />
Insgesamt 48.548 77.104 79.831 100,0 100,0 194,5 - 2,0 + 3,5<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.<br />
177
Regionale Gliederung der österreichischen Handelsbilanz Tab. 5.10<br />
Integrations<strong>politische</strong> Gliederung<br />
178<br />
1993 1995 2002 2003 1993 1995 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr in<br />
Mio. Euro<br />
EU-25 -5.167 -5.914 -2.253 -4.448 -20,2 -18,4 -7,8 2.614 -2.195<br />
EU-15 -6.205 -7.270 -4.161 -5.850 -27,9 -26,2 -12,5 2.144 -1.689<br />
Eurozone -5.950 -7.007 -5.702 -7.340 -29,2 -27,6 -17,5 1.892 -1.637<br />
EU-Beitrittsländer 1.038 1.355 1.908 1.402 31,2 30,4 14,0 470 -506<br />
Extra-EU-25 -1.936 -482 2.549 3.087 -23,1 -4,9 14,2 2.122 538<br />
Extra-EU-15 -898 873 4.457 4.489 -7,7 6,1 14,1 2.593 32<br />
Regionale Gliederung<br />
Westliche Industriestaaten -7.581 -7.814 -2.441 -3.627 -28,1 -23,5 -6,2 3.134 -1.186<br />
Westeuropa -5.711 -6.636 -2.387 -4.178 -23,1 -21,6 -8,0 2.414 -1.791<br />
NAFTA -597 -743 490 1.241 -42,4 -47,7 25,6 579 751<br />
MOEL-27 1.186 1.651 3.049 2.925 27,5 27,5 20,0 670 -125<br />
MOEL-5 1.023 1.329 1.646 1.171 31,1 30,3 12,1 362 -475<br />
SOEL-7 241 474 1.616 1.756 52,5 60,5 58,2 259 140<br />
Entwicklungsländer -708 -234 -313 -659 -26,7 -8,0 -12,7 933 -346<br />
OPEC 74 56 59 155 8,1 7,6 13,3 24 96<br />
NIC-6 -445 -102 -562 -342 -58,2 -10,6 -25,0 462 220<br />
Insgesamt -7.103 -6.396 296 -1.361 -20,9 -15,2 -1,7 4.736 -1.657<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Sektorale Gliederung des österreichischen Warenhandels Tab. 5.11<br />
Export<br />
1995 2002 2003 1996 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in %<br />
1993<br />
=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Nahrungsmittel 1.719 4.115 4.612 4,4 5,9 392,5 + 7,5 + 12,1<br />
Rohstoffe 1.749 2.511 2.567 3,6 3,3 192,0 + 5,2 + 2,2<br />
Brennstoffe, Energie 423 1.840 1.972 1,2 2,5 518,4 + 26,8 + 7,2<br />
Erdöl, -erzeugnisse 171 402 423 0,5 0,5 319,7 - 10,6 + 5,2<br />
Industriewaren 38.261 68.934 69.320 90,7 88,3 223,2 + 3,5 + 0,6<br />
Chemische Erzeugnisse 3.877 7.929 7.967 9,3 10,2 260,6 + 12,0 + 0,5<br />
Bearbeitete Waren 12.274 17.309 17.848 27,2 22,7 182,3 + 0,7 + 3,1<br />
Stahl 2.405 3.133 3.387 4,8 4,3 193,7 - 1,6 + 8,1<br />
Maschinen, Fahrzeuge 16.447 33.069 32.883 40,6 41,9 248,1 + 2,9 - 0,6<br />
Fahrzeuge 3.067 7.586 7.275 8,8 9,3 336,4 + 3,7 - 4,1<br />
PKW 1.223 3.440 3.067 4,2 3,9 406,5 + 7,9 - 10,8<br />
Konsumnahe Fertigwaren 5.626 10.092 10.221 13,3 13,0 207,5 + 1,8 + 1,3<br />
Insgesamt 42.151 77.400 78.471 100,0 100,0 231,1 + 4,2 + 1,4<br />
Import<br />
Nahrungsmittel 2.845 4.652 4.819 6,0 6,0 219,0 + 3,8 + 3,6<br />
Rohstoffe 2.256 2.960 2.940 3,8 3,7 183,9 + 1,0 - 0,7<br />
Brennstoffe, Energie 2.151 5.731 6.407 5,3 8,0 309,7 + 4,2 + 11,8<br />
Erdöl, -erzeugnisse 1.277 3.262 3.515 3,2 4,4 270,0 - 0,5 + 7,7<br />
Industriewaren 41.295 63.762 65.666 84,9 82,3 186,6 - 3,1 + 3,0<br />
Chemische Erzeugnisse 5.189 8.683 8.929 10,3 11,2 209,0 + 5,5 + 2,8<br />
Bearbeitete Waren 9.385 12.507 12.783 18,2 16,0 168,0 - 5,7 + 2,2<br />
Stahl 1.414 1.706 1.855 2,4 2,3 190,7 - 4,0 + 8,7<br />
Maschinen, Fahrzeuge 17.896 30.020 31.313 37,9 39,2 202,3 - 5,0 + 4,3<br />
Fahrzeuge 5.542 8.643 8.958 12,1 11,2 188,9 - 4,2 + 3,6<br />
PKW 3.142 4.040 4.617 6,9 5,8 161,1 - 1,4 + 14,3<br />
Konsumnahe Fertigwaren 8.515 12.184 12.198 17,8 15,3 156,4 - 2,0 + 0,1<br />
Insgesamt 48.548 77.104 79.831 100,0 100,0 194,5 - 2,0 + 3,5<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.<br />
179
Sektorale Gliederung der österreichischen Handelsbilanz Tab. 5.12<br />
180<br />
1993 1995 2002 2003 1993 1995 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Veränderung<br />
zum Vorjahr in<br />
Mio. Euro<br />
Nahrungsmittel -1.025 -1.126 -537 -207 -87,2 -65,5 -4,5 117 330<br />
Rohstoffe -261 -507 -449 -372 -19,5 -29,0 -14,5 94 76<br />
Brennstoffe,<br />
Energie<br />
Erdöl,<br />
-erzeugnisse<br />
-1.688 -1.729 -3.891 -4.435 -443,9 -409,0 -224,9 158 -544<br />
-1.170 -1.106 -2.861 -3.092 -884,9 -646,8 -731,8 -33 -232<br />
Industriewaren -4.128 -3.035 5.172 3.654 -13,3 -7,9 5,3 4.367 -1.518<br />
Chemische<br />
Erzeugnisse<br />
Bearbeitete<br />
Waren<br />
-1.215 -1.312 -754 -962 -39,7 -33,8 -12,1 397 -208<br />
2.183 2.889 4.803 5.066 22,3 23,5 28,4 880 263<br />
Stahl 776 991 1.427 1.532 44,4 41,2 45,2 22 105<br />
Maschinen,<br />
Fahrzeuge<br />
-2.227 -1.449 3.049 1.571 -16,8 -8,8 4,8 2.524 -1.479<br />
Fahrzeuge -2.580 -2.475 -1.057 -1.683 -119,3 -80,7 -23,1 649 -626<br />
PKW -2.111 -1.919 -600 -1.549 -279,7 -156,9 -50,5 309 -949<br />
Konsumnahe<br />
Fertigwaren<br />
-2.873 -2.889 -2.093 -1.977 -58,3 -51,3 -19,3 428 116<br />
Insgesamt -7.103 -6.396 296 -1.361 -20,9 -15,2 -1,7 4.736 -1.657<br />
Quelle: Statistik Austria, WIFO-Berechnungen.
Österreichischer Handel mit Dienstleistungen nach Sektoren Tab. 6.1<br />
1995 2002 2003 1995 2003 2003 2002 2003<br />
Statistische Übersichten<br />
Veränderung zum<br />
Mio. Euro Anteile in % 1993=100<br />
Vorjahr in %<br />
Exporte<br />
Gesamt 21.369 37.508 38.683 100,0 100,0 171,1 0,8 3,1<br />
Transport 2.735 6.119 6.502 12,8 16,8 246,7 10,5 6,3<br />
Reiseverkehr 9.883 11.887 12.253 46,3 31,7 113,5 3,8 3,1<br />
Kommunikationsdienstleistungen 219 689 558 1,0 1,4 672,3 9,0 -19,0<br />
Bauleistungen 561 687 907 2,6 2,3 182,5 -11,6 32,0<br />
Versicherungsdienstleistungen 466 1.430 1.556 2,2 4,0 351,2 28,6 8,8<br />
Finanzdienstleistungen 451 944 887 2,1 2,3 229,2 -6,3 -6,0<br />
Kommunikationsdienstleistungen 60 148 165 0,3 0,4 423,1 1,4 11,5<br />
Patente und Lizenzen 98 116 136 0,5 0,4 136,0 -24,2 17,2<br />
sonstige unternehmensbez. Dienstleistungen 3.450 5.858 5.790 16,1 15,0 202,9 -5,4 -1,2<br />
Dienstl. f. pers. Zwecke und Kultur u.Freizeit 118 217 233 0,6 0,6 213,8 -8,4 7,4<br />
Regierungsleistungen a. n. g. 381 597 621 1,8 1,6 184,8 53,5 4,0<br />
Nicht aufteilbare Leistungen 2.948 8.816 9.074 13,8 23,5 209,3 -7,9 2,9<br />
Importe<br />
Gesamt 17.991 36.877 37.859 100,0 100,0 233,2 4,9 2,7<br />
Transport 2.398 3.804 4.036 13,3 10,7 177,5 -0,1 6,1<br />
Reiseverkehr 7.958 9.923 10.215 44,2 27,0 155,4 -1,1 2,9<br />
Kommunikationsdienstleistungen 222 472 413 1,2 1,1 286,8 -13,2 -12,5<br />
Bauleistungen 436 583 808 2,4 2,1 236,3 7,2 38,6<br />
Versicherungsdienstleistungen 602 1.551 1.479 3,3 3,9 280,6 38,4 -4,6<br />
Finanzdienstleistungen 526 865 754 2,9 2,0 195,3 -10,3 -12,8<br />
EDV- und Informationsleistungen 110 302 318 0,6 0,8 407,7 19,4 5,3<br />
Patente und Lizenzen 390 1.113 887 2,2 2,3 251,3 32,2 -20,3<br />
sonstige unternehmensbez. Dienstleistungen 2.657 4.057 4.202 14,8 11,1 181,4 1,3 3,6<br />
Dienstl. f. pers. Zwecke und Kultur u.Freizeit 142 226 258 0,8 0,7 230,4 6,1 14,2<br />
Regierungsleistungen a. n. g. 111 87 82 0,6 0,2 93,2 22,5 -5,7<br />
Nicht aufteilbare Leistungen 2.438 13.893 14.407 13,6 38,1 473,8 8,9 3,7<br />
181<br />
Quelle: OeNB.
Österreichische Dienstleistungsbilanz nach Sektoren Tab. 6.2<br />
1995 2001 2002 2003 1995 2002 2003 2002 2003<br />
182<br />
Veränderung zum<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Vorjahr in Mio. Euro<br />
Gesamt 3.379 2.064 631 824 15,8 1,7 2,1 -1.433 193<br />
Transport 337 1.729 2.315 2.466 12,3 37,8 37,9 586 151<br />
Reiseverkehr 1.925 1.423 1.964 2.038 19,5 16,5 16,6 541 74<br />
Kommunikationsdienstleistungen -3 88 217 145 -1,4 31,5 26,0 129 -72<br />
Bauleistungen 125 233 104 98 22,3 15,1 10,8 -129 -6<br />
Versicherungsdienstleistungen -136 -10 -121 77 -29,2 -8,5 4,9 -111 198<br />
Finanzdienstleistungen -75 42 79 134 -16,6 8,4 15,1 37 55<br />
EDV- und Informationsleistungen -50 -107 -154 -153 -83,3 -104,1 -92,7 -47 1<br />
Patente und Lizenzen -292 -688 -997 -751 -298,0 -859,5 -552,2 -309 246<br />
sonstige unternehmensbez. Dienstleistungen 793 2.190 1.800 1.588 23,0 30,7 27,4 -390 -212<br />
Dienstl. f. pers. Zwecke und Kultur u.Freizeit -24 24 -9 -25 -20,3 -4,1 -10,7 -33 -16<br />
Regierungsleistungen a. n. g. 270 317 510 539 70,9 85,4 86,8 193 29<br />
Nicht aufteilbare Leistungen 510 -3.180 -5.077 -5.333 17,3 -57,6 -58,8 -1.897 -256<br />
Quelle: OeNB.
Österreichische Dienstleistungsexporte<br />
nach Haupthandelspartnern<br />
Statistische Übersichten<br />
Tab. 6.3<br />
1995 2002 2003 1995 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in % 1995=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Deutschland 10.066 14.782 15.199 47,1 39,3 151,0 -0,4 2,8<br />
Großbritannien 1.091 2.591 2.869 5,1 7,4 263,0 -4,3 10,7<br />
Schweiz 1) 1.733 2.548 2.491 8,1 6,4 143,7 . -2,2<br />
Italien 956 2.141 2.054 4,5 5,3 214,9 11,6 -4,1<br />
USA 1.359 2.180 1.886 6,4 4,9 138,8 -13,6 -13,5<br />
Niederlande 789 1.418 1.747 3,7 4,5 221,4 4,3 23,2<br />
Frankreich 513 1.125 1.330 2,4 3,4 259,3 -4,9 18,2<br />
Belgien 489 1.176 1.142 2,3 3,0 233,5 22,9 -2,9<br />
Ungarn 550 995 979 2,6 2,5 178,0 0,3 -1,6<br />
Polen 230 608 772 1,1 2,0 335,7 -8,0 27,0<br />
Tschech. Rep. 388 559 586 1,8 1,5 151,0 -7,9 4,8<br />
Schweden 215 479 469 1,0 1,2 218,1 26,7 -2,1<br />
Slowakei 117 458 433 0,5 1,1 370,1 -7,3 -5,5<br />
Slowenien 214 380 390 1,0 1,0 182,2 -1,3 2,6<br />
Spanien 153 341 379 0,7 1,0 247,7 4,3 11,1<br />
Dänemark 139 353 340 0,7 0,9 244,6 32,7 -3,7<br />
Japan 196 327 334 0,9 0,9 170,4 11,6 2,1<br />
Kroatien 106 292 315 0,5 0,8 297,2 7,0 7,9<br />
Irland 38 273 303 0,2 0,8 797,4 24,1 11,0<br />
Luxemburg 26 181 275 0,1 0,7 1057,7 -2,7 51,9<br />
Kanada 79 216 264 0,4 0,7 334,2 -14,3 22,2<br />
Türkei 52 226 259 0,2 0,7 498,1 16,5 14,6<br />
Russland 226 291 252 1,1 0,7 111,5 1,7 -13,4<br />
China 80 177 206 0,4 0,5 257,5 -9,2 16,4<br />
Finnland 64 175 188 0,3 0,5 293,8 13,6 7,4<br />
1) einschließlich Liechtenstein.<br />
Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.<br />
183
Österreichische Dienstleistungsimporte<br />
nach Haupthandelspartnern<br />
184<br />
Tab. 6.4<br />
1995 2002 2003 1995 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in % 1995=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Deutschland 6.038 12.694 13.825 33,6 36,5 229,0 2,2 8,9<br />
Großbritannien 1.363 3.075 2.991 7,6 7,9 219,4 10,9 -2,7<br />
Schweiz 1) 1.448 2.158 2.195 8,1 5,8 151,6 . 1,7<br />
Italien 1.631 2.949 2.847 9,1 7,5 174,6 2,0 -3,5<br />
USA 2.084 3.420 3.044 11,6 8,0 146,1 -4,3 -11,0<br />
Niederlande 468 1.326 1.102 2,6 2,9 235,5 26,4 -16,9<br />
Frankreich 555 1.342 1.453 3,1 3,8 261,8 5,3 8,3<br />
Belgien 375 949 892 2,1 2,4 237,9 13,5 -6,0<br />
Ungarn 510 830 755 2,8 2,0 148,0 -1,9 -9,0<br />
Polen 144 399 511 0,8 1,4 354,9 -1,5 28,1<br />
Tschech. Rep. 384 659 604 2,1 1,6 157,3 20,3 -8,3<br />
Schweden 152 419 476 0,8 1,3 313,2 12,3 13,6<br />
Slowakei 130 225 258 0,7 0,7 198,5 -17,3 14,7<br />
Slowenien 242 379 339 1,3 0,9 140,1 13,8 -10,6<br />
Spanien 328 612 726 1,8 1,9 221,3 14,4 18,6<br />
Dänemark 65 223 174 0,4 0,5 267,7 28,9 -22,0<br />
Japan 154 483 507 0,9 1,3 329,2 5,2 5,0<br />
Kroatien 141 362 570 0,8 1,5 404,3 -5,5 57,5<br />
Irland 52 297 324 0,3 0,9 623,1 22,7 9,1<br />
Luxemburg 36 169 125 0,2 0,3 347,2 50,9 -26,0<br />
Kanada 133 544 482 0,7 1,3 362,4 16,0 -11,4<br />
Türkei 119 279 388 0,7 1,0 326,1 -2,1 39,1<br />
Russland 141 147 153 0,8 0,4 108,5 -3,3 4,1<br />
China 27 152 148 0,2 0,4 548,1 13,4 -2,6<br />
Finnland 44 208 239 0,2 0,6 543,2 0,0 14,9<br />
1) einschließlich Liechtenstein.<br />
Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.
Österreichische Dienstleistungsbilanz<br />
gegenüber den wichtigsten Haupthandelspartnern<br />
Statistische Übersichten<br />
Tab. 6.5<br />
1995 2001 2002 2003 1995 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr<br />
in Mio. Euro<br />
Deutschland 4.029 2.419 2.089 1.375 40,0 9,1 -330 -714<br />
Großbritannien -272 -65 -484 -123 -24,9 -4,3 -419 361<br />
Schweiz 1) 285 573 390 297 16,4 11,9 -183 -93<br />
Italien -675 -973 -808 -792 -70,6 -38,6 165 16<br />
USA -725 -1.054 -1.240 -1.159 -53,3 -61,5 -186 81<br />
Niederlande 321 309 92 645 40,7 36,9 -217 553<br />
Frankreich -43 -91 -216 -123 -8,4 -9,2 -125 93<br />
Belgien 114 122 228 250 23,3 21,9 106 22<br />
Ungarn 41 146 165 224 7,5 22,9 19 59<br />
Polen 86 256 209 262 37,4 33,9 -47 53<br />
Tschech. Rep. 5 59 -100 -18 1,3 -3,1 -159 82<br />
Schweden 62 6 61 -8 28,8 -1,7 55 -69<br />
Slowakei -13 221 233 174 -11,1 40,2 12 -59<br />
Slowenien -27 51 1 51 -12,6 13,1 -50 50<br />
Spanien -176 -208 -271 -347 -115,0 -91,6 -63 -76<br />
Dänemark 74 95 131 166 53,2 48,8 36 35<br />
Japan 42 -165 -156 -173 21,4 -51,8 9 -17<br />
Kroatien -35 -110 -70 -255 -33,0 -81,0 40 -185<br />
Irland -14 -22 -24 -22 -36,8 -7,3 -2 2<br />
Luxemburg -10 74 12 151 -38,5 54,9 -62 139<br />
Kanada -54 -218 -329 -218 -68,4 -82,6 -111 111<br />
Türkei -67 -91 -53 -129 -128,8 -49,8 38 -76<br />
Russland 85 134 144 99 37,6 39,3 10 -45<br />
China 53 63 24 58 66,3 28,2 -39 34<br />
Finnland 20 -54 -33 -52 31,3 -27,7 21 -19<br />
1) einschließlich Liechtenstein.<br />
Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.<br />
185
Der Handel mit Dienstleistungen nach Ländergruppen Tab. 6.6<br />
Exporte<br />
186<br />
1995 2002 2003 1995 2003 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro Anteile in % 1995=100<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr in %<br />
Welt 21.369 37.508 38.683 100,0 100,0 181,0 0,8 3,1<br />
EU-25 16.178 28.376 29.822 75,7 77,1 184,3 1,2 5,1<br />
EU-15 14.645 25.264 26.549 68,5 68,6 181,3 2,2 5,1<br />
Eurozone 13.127 21.830 22.867 61,4 59,1 174,2 2,3 4,8<br />
EU-Beitrtittsländer 1.533 3.112 3.273 7,2 8,5 213,5 -6,3 5,2<br />
Extra-EU-25 5.191 9.132 8.861 24,3 22,9 170,7 -0,4 -3,0<br />
Extra-EU-15 6.724 12.244 12.134 31,5 31,4 180,5 -2,0 -0,9<br />
Westl. Industriestaaten 18.230 31.188 32.210 85,3 83,3 176,7 9,6 3,3<br />
Westeuropa 16.483 28.165 29.415 77,1 76,0 178,5 12,4 4,4<br />
NAFTA 1.445 2.425 2.180 6,8 5,6 150,9 -13,5 -10,1<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 2.008 4.138 4.357 9,4 11,3 217,0 -2,2 5,3<br />
MOEL-5 1.499 3.000 3.160 7,0 8,2 210,8 -4,4 5,3<br />
SOEL-7 228 668 761 1,1 2,0 333,8 2,8 13,9<br />
Entwicklungsländer 1.131 2.182 2.116 5,3 5,5 187,1 -75,1 -3,0<br />
OPEC 194 438 425 0,9 1,1 219,1 -13,8 -3,0<br />
ASEAN 2) 132 197 202 0,6 0,5 153,0 -11,7 2,5<br />
ASEAN+3 463 828 864 2,2 2,2 186,6 -1,7 4,3<br />
Importe<br />
Welt 17.991 36.877 37.859 100,0 100,0 210,4 4,9 2,7<br />
EU-25 12.895 27.405 28.492 71,7 75,3 221,0 5,7 4,0<br />
EU-15 11.387 24.734 25.768 63,3 68,1 226,3 5,9 4,2<br />
Eurozone 9.589 21.018 22.127 53,3 58,4 230,8 4,8 5,3<br />
EU-Beitrtittsländer 1.508 2.671 2.724 8,4 7,2 180,6 4,0 2,0<br />
Extra-EU-25 5.096 9.472 9.367 28,3 24,7 183,8 2,8 -1,1<br />
Extra-EU-15 6.604 12.143 12.091 36,7 31,9 183,1 3,1 -0,4<br />
Westl. Industriestaaten 15.436 31.910 32.660 85,8 86,3 211,6 12,3 2,4<br />
Westeuropa 12.988 27.268 28.446 72,2 75,1 219,0 14,9 4,3<br />
NAFTA 2.222 3.978 3.539 12,4 9,3 159,3 -2,0 -11,0<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 1.810 3.452 3.625 10,1 9,6 200,3 -0,3 5,0<br />
MOEL-5 1.410 2.492 2.467 7,8 6,5 175,0 3,7 -1,0<br />
SOEL-7 216 694 889 1,2 2,3 411,6 -12,6 28,1<br />
Entwicklungsländer 745 1.515 1.574 4,1 4,2 211,3 -77,5 3,9<br />
OPEC 63 106 89 0,4 0,2 141,3 16,5 -16,0<br />
ASEAN 2) 99 227 222 0,6 0,6 224,2 5,1 -2,2<br />
ASEAN+3 317 949 969 1,8 2,6 305,7 6,2 2,1<br />
1) ohne Moldawien. 2) Indonesion, Philippinen, Singapur, Thailand.<br />
Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.
Statistische Übersichten<br />
Österreichische Dienstleistungsbilanz nach Ländergruppen Tab. 6.7<br />
1995 2001 2002 2003 1995 2003 2002 2003<br />
Mio. Euro In % der Exporte<br />
Veränderung zum<br />
Vorjahr<br />
in Mio. Euro<br />
Welt 3.379 2.064 631 824 15,8 2,1 -1.433 193<br />
EU-25 3.285 2.107 971 1.328 20,3 4,5 -1.136 357<br />
EU-15 3.258 1.357 530 780 22,2 2,9 -827 250<br />
Eurozone 3.538 1.284 812 741 27,0 3,2 -472 -71<br />
EU-Beitrtittsländer 27 750 441 548 1,8 16,7 -309 107<br />
Extra-EU-25 94 -43 -340 -504 1,8 -5,7 -297 -164<br />
Extra-EU-15 121 707 101 44 1,8 0,4 -606 -57<br />
Westl. Industriestaaten 2.789 614 -718 -449 15,3 -1,4 -1.332 269<br />
Westeuropa 3.491 1.908 903 971 21,2 3,3 -1.005 68<br />
NAFTA -776 -1.256 -1.552 -1.360 -53,7 -62,4 -296 192<br />
Zentral- und Osteuropa 1) 198 768 686 733 9,9 16,8 -82 47<br />
MOEL-5 92 733 508 693 6,1 21,9 -225 185<br />
SOEL-7 13 -147 -27 -128 5,7 -16,8 120 -101<br />
Entwicklungsländer 392 682 663 540 34,7 25,5 -19 -123<br />
OPEC 131 418 333 336 67,5 79,1 -85 3<br />
ASEAN 2) 34 4 -30 -19 25,8 -9,4 -34 11<br />
ASEAN+3 146 -53 -122 -104 31,5 -12,0 -69 18<br />
1) ohne Moldawien. 2) Indonesion, Philippinen, Singapur, Thailand.<br />
Quelle: OeNB, eigene Berechnungen.<br />
187
Passive Direktinvestionsströme, 1980–2002 (Mrd. USD) Tab. 7.3<br />
188<br />
Welt Entwickelte Länder Entwicklungsländer Mittel- und Osteuropa<br />
1980 55 47 8 0<br />
1981 69 46 24 0<br />
1982 59 32 27 0<br />
1983 51 34 18 0<br />
1984 60 42 18 0<br />
1985 58 43 15 0<br />
1986 86 70 16 0<br />
1987 140 117 23 0<br />
1988 164 133 30 0<br />
1989 193 163 29 0<br />
1990 209 171 37 1<br />
1991 159 113 43 3<br />
1992 167 107 55 5<br />
1993 225 137 81 7<br />
1994 256 145 104 6<br />
1995 334 204 115 15<br />
1996 385 222 150 14<br />
1997 482 270 193 19<br />
1998 686 472 191 22<br />
1999 1.079 825 229 25<br />
2000 1.393 1.121 246 26<br />
2001 824 589 209 25<br />
2002 651 460 162 29<br />
Quelle: UNCTAD Database, Web Download.
Direktinvestitionsbestände nach Regionen, 1980–2002<br />
(in % des BIP)<br />
Statistische Übersichten<br />
Tab. 7.4<br />
Global EU-15 Relation Österreich Relation<br />
passiv aktiv passiv aktiv aktiv/passiv passiv aktiv aktiv/passiv<br />
1980 6,7 5,8 6,1 6,1 1,00 4,0 0,7 0,17<br />
1981 7,0 5,9 6,8 7,3 1,08 4,2 0,9 0,22<br />
1982 7,6 6,0 7,0 7,7 1,11 4,3 1,0 0,23<br />
1983 7,8 6,0 7,2 8,0 1,11 4,0 1,1 0,28<br />
1984 7,9 6,1 7,5 9,1 1,21 3,8 1,1 0,29<br />
1985 8,4 6,6 9,3 10,5 1,14 5,6 2,0 0,36<br />
1986 8,1 6,6 8,3 9,6 1,15 5,5 1,5 0,27<br />
1987 8,3 7,1 8,5 9,8 1,15 5,8 1,3 0,22<br />
1988 8,3 7,2 8,6 9,9 1,15 5,5 1,3 0,23<br />
1989 9,1 8,0 10,4 11,5 1,11 6,4 2,5 0,40<br />
1990 9,3 8,6 10,9 11,6 1,07 6,1 2,6 0,43<br />
1991 9,4 9,0 11,5 12,4 1,08 6,1 3,6 0,58<br />
1992 8,6 8,3 10,5 11,8 1,12 5,9 3,6 0,61<br />
1993 9,6 9,3 12,0 13,7 1,14 6,1 4,4 0,71<br />
1994 10,0 9,8 13,2 14,9 1,12 6,7 4,7 0,71<br />
1995 10,3 10,0 13,2 15,1 1,14 7,5 5,0 0,67<br />
1996 11,2 10,9 13,9 16,1 1,16 7,7 5,4 0,70<br />
1997 12,2 12,4 15,0 18,4 1,22 8,5 6,5 0,76<br />
1998 14,7 14,4 19,0 22,6 1,19 11,2 8,3 0,74<br />
1999 16,9 16,5 21,0 27,8 1,32 11,2 9,1 0,82<br />
2000 19,6 19,2 28,4 37,8 1,33 16,0 13,0 0,82<br />
2001 21,3 20,5 30,6 40,1 1,31 18,1 15,0 0,83<br />
2002* 22,3 21,6 31,4 41,1 1,31 20,6 19,5 0,95<br />
* Schätzung.<br />
Quelle: UNCTAD, FDI database.<br />
189
Aktive Direktinvestitionen: Investiertes Eigenkapital, Anzahl der<br />
Beteiligungen und Beschäftigung, 1991–2001<br />
Eigenkapital in Mio. Euro<br />
190<br />
Tab. 7.5<br />
EU-15 MOEL-19 Restliche Länder Gruppen-Gesamtwert<br />
Summe In % Summe In % Summe In % Summe In %<br />
1991 1.873 50,8 779 21,1 1.033 28,0 3.685 100,0<br />
1992 2.209 50,8 1.057 24,3 1.081 24,9 4.347 100,0<br />
1993 2.747 49,6 1.503 27,1 1.288 23,3 5.538 100,0<br />
1994 2.855 45,4 1.852 29,5 1.581 25,1 6.289 100,0<br />
1995 3.113 44,3 1.971 28,1 1.937 27,6 7.021 100,0<br />
1996 3.893 44,9 2.477 28,6 2.296 26,5 8.666 100,0<br />
1997 4.556 40,5 3.369 30,0 3.311 29,5 11.237 100,0<br />
1998 5.947 44,9 3.765 28,4 3.523 26,6 13.235 100,0<br />
1999 7.629 44,0 4.825 27,8 4.883 28,2 17.337 100,0<br />
2000 10.617 44,5 6.642 27,8 6.612 27,7 23.871 100,0<br />
2001 11.443 39,2 10.104 34,6 7.645 26,2 29.192 100,0<br />
Anzahl der Beteiligungen<br />
1991 522 42,1 414 33,4 303 24,5 1.239 100,0<br />
1992 528 39,4 508 37,9 304 22,7 1.340 100,0<br />
1993 578 37,0 672 43,0 312 20,0 1.562 100,0<br />
1994 571 33,6 816 48,1 311 18,3 1.698 100,0<br />
1995 600 33,4 863 48,1 333 18,5 1.796 100,0<br />
1996 633 33,4 909 47,9 355 18,7 1.897 100,0<br />
1997 643 31,8 1.004 49,7 373 18,5 2.020 100,0<br />
1998 658 31,7 1.044 50,2 376 18,1 2.078 100,0<br />
1999 664 30,6 1.098 50,6 410 18,9 2.172 100,0<br />
2000 682 29,6 1.169 50,8 451 19,6 2.302 100,0<br />
2001 716 29,9 1.218 50,9 459 19,2 2.393 100,0<br />
Beschäftigung in Personen<br />
1991 30.043 47,6 24.681 39,1 8.358 13,2 63.083 100,0<br />
1992 29.450 40,5 33.452 45,9 9.903 13,6 72.805 100,0<br />
1993 31.850 35,0 50.329 55,4 8.702 9,6 90.881 100,0<br />
1994 32.430 30,6 65.085 61,4 8.547 8,1 106.063 100,0<br />
1995 35.625 28,5 78.035 62,4 11.359 9,1 125.019 100,0<br />
1996 39.050 28,8 85.425 63,1 10.955 8,1 135.430 100,0<br />
1997 39.442 24,4 106.190 65,8 15.735 9,8 161.367 100,0<br />
1998 50.550 26,9 121.141 64,6 15.963 8,5 187.654 100,0<br />
1999 50.360 25,3 128.107 64,3 20.696 10,4 199.164 100,0<br />
2000 57.571 23,2 162.406 65,3 28.651 11,5 248.628 100,0<br />
2001 53.071 19,6 190.195 70,4 26.870 9,9 270.136 100,0<br />
Quelle: OeNB.
Passive Direktinvestitionen: Investiertes Eigenkapital, Anzahl der<br />
Beteiligungen und Beschäftigung, 1991–2001<br />
Deutschland EU-15 1) EU-Beitrittsländer 2) Restliche Länder<br />
Statistische Übersichten<br />
Tab. 7.6<br />
Gruppen-<br />
Gesamtwert<br />
Summe In % Summe In % Summe In % Summe In % Summe In %<br />
Eigenkapital in Mio. Euro<br />
1991 3.524 41,1 2.055 23,9 77 0,9 2.926 34,1 8.582 100,0<br />
1992 3.877 43,3 2.135 23,8 98 1,1 2.849 31,8 8.959 100,0<br />
1993 4.109 44,7 2.226 24,2 93 1,0 2.762 30,1 9.189 100,0<br />
1994 4.498 43,7 2.358 22,9 93 0,9 3.342 32,5 10.290 100,0<br />
1995 5.988 45,7 3.208 24,5 91 0,7 3.830 29,2 13.116 100,0<br />
1996 7.114 48,9 3.192 21,9 103 0,7 4.137 28,4 14.546 100,0<br />
1997 8.498 49,7 3.757 22,0 142 0,8 4.716 27,6 17.113 100,0<br />
1998 8.965 45,7 5.537 28,2 192 1,0 4.921 25,1 19.616 100,0<br />
1999 9.129 40,6 6.850 30,5 162 0,7 6.349 28,2 22.490 100,0<br />
2000 15.472 49,7 8.873 28,5 168 0,5 6.645 21,3 31.158 100,0<br />
2001 16.504 47,2 10.758 30,8 165 0,5 7.556 21,6 34.984 100,0<br />
Anzahl der Beteiligungen<br />
1991 1.481 45,9 596 18,5 106 3,3 1.044 32,4 3.227 100,0<br />
1992 1.496 45,9 613 18,8 117 3,6 1.034 31,7 3.260 100,0<br />
1993 1.447 46,8 573 18,5 90 2,9 982 31,8 3.092 100,0<br />
1994 1.414 46,3 587 19,2 93 3,0 962 31,5 3.056 100,0<br />
1995 1.435 46,4 591 19,1 88 2,8 980 31,7 3.094 100,0<br />
1996 1.485 46,6 640 20,1 82 2,6 983 30,8 3.190 100,0<br />
1997 1.499 46,2 648 20,0 82 2,5 1.017 31,3 3.246 100,0<br />
1998 1.519 46,5 671 20,5 77 2,4 999 30,6 3.266 100,0<br />
1999 1.501 46,5 691 21,4 66 2,0 972 30,1 3.230 100,0<br />
2000 1.517 46,1 728 22,1 70 2,1 973 29,6 3.288 100,0<br />
2001 1.541 46,3 767 23,1 71 2,1 948 28,5 3.327 100,0<br />
Beschäftigung in Personen<br />
1991 98.008 46,0 48.511 22,8 836 0,4 65.495 30,8 212.850 100,0<br />
1992 100.132 46,9 49.072 23,0 793 0,4 63.455 29,7 213.453 100,0<br />
1993 98.355 46,9 50.515 24,1 615 0,3 60.044 28,7 209.530 100,0<br />
1994 98.083 47,9 44.367 21,7 677 0,3 61.527 30,1 204.655 100,0<br />
1995 99.089 47,7 43.328 20,9 765 0,4 64.502 31,1 207.684 100,0<br />
1996 103.736 49,0 42.941 20,3 658 0,3 64.391 30,4 211.726 100,0<br />
1997 105.512 49,9 40.515 19,2 761 0,4 64.687 30,6 211.475 100,0<br />
1998 114.838 50,3 48.771 21,3 760 0,3 64.081 28,1 228.450 100,0<br />
1999 115.980 50,8 48.750 21,3 672 0,3 63.024 27,6 228.427 100,0<br />
2000 127.737 50,8 50.785 20,2 666 0,3 72.048 28,7 251.234 100,0<br />
2001 133.792 54,5 50.850 20,7 779 0,3 60.137 24,5 245.559 100,0<br />
1) EU-15 ohne Deutschland und Österreich. 2) ohne Malta und Zypern.<br />
Quelle: OeNB.<br />
191
Passive Direktinvestitionen: Eigenkapital und Beschäftigung pro<br />
Beteiligung, 1991–2001<br />
192<br />
Tab. 7.7<br />
Deutschland EU-15 1) EU-<br />
Beitrittsländer 2) Restl. Länder Insgesamt<br />
Eigenkapital pro Beteiligung in Mio. Euro<br />
1991 2,4 3,4 0,7 2,8 2,7<br />
1992 2,6 3,5 0,8 2,8 2,7<br />
1993 2,8 3,9 1,0 2,8 3,0<br />
1994 3,2 4,0 1,0 3,5 3,4<br />
1995 4,2 5,4 1,0 3,9 4,2<br />
1996 4,8 5,0 1,3 4,2 4,6<br />
1997 5,7 5,8 1,7 4,6 5,3<br />
1998 5,9 8,3 2,5 4,9 6,0<br />
1999 6,1 9,9 2,5 6,5 7,0<br />
2000 10,2 12,2 2,4 6,8 9,5<br />
2001 10,7 14,0 2,3 8,0 10,5<br />
Beschäftigte pro Beteiligung<br />
1991 66,2 81,4 7,9 62,7 66,0<br />
1992 66,9 80,1 6,8 61,4 65,5<br />
1993 68,0 88,2 6,8 61,1 67,8<br />
1994 69,4 75,6 7,3 64,0 67,0<br />
1995 69,1 73,3 8,7 65,8 67,1<br />
1996 69,9 67,1 8,0 65,5 66,4<br />
1997 70,4 62,5 9,3 63,6 65,1<br />
1998 75,6 72,7 9,9 64,1 69,9<br />
1999 77,3 70,5 10,2 64,8 70,7<br />
2000 84,2 69,8 9,5 74,0 76,4<br />
2001 86,8 66,3 11,0 63,4 73,8<br />
1) EU-15 ohne Deutschland und Österreich. 2) ohne Malta und Zypern.<br />
Quelle: OeNB.
Statistische Übersichten<br />
Branchenstruktur der aktiven Direktinvestitionen, 2001 Tab. 7.8<br />
Eigenkapital (in<br />
Mio. Euro)<br />
In % Beteiligungen In % Beschäftigte In %<br />
Bergbau, Energie 894 3,1 40 1,7 4.757 1,8<br />
Sachgütererzeugung<br />
(inkl. Bau)<br />
6.698 22,9 919 38,4 143.275 53,0<br />
Nahrungsmittel, Tabak 383 1,3 55 2,3 8.987 3,3<br />
Textilien, Bekleidung 61 0,2 40 1,7 9.118 3,4<br />
Holzverarbeitung 167 0,6 32 1,3 5.539 2,1<br />
Papier, Druck, Verlage 680 2,3 57 2,4 10.982 4,1<br />
Chemie, Gummi, Min.Öl 1.769 6,1 139 5,8 23.943 8,9<br />
Glas, Steinwaren 814 2,8 103 4,3 11.494 4,3<br />
Metall 626 2,1 113 4,7 12.564 4,7<br />
Maschinenbau 508 1,7 118 4,9 10.730 4,0<br />
Elektro, EDV, Optik 840 2,9 108 4,5 26.331 9,7<br />
Fahrzeugbau 236 0,8 25 1,0 8.263 3,1<br />
Möbel, Sport, Recycl. 61 0,2 32 1,3 6.095 2,3<br />
Bauwesen 553 1,9 97 4,1 9.228 3,4<br />
Dienstleistungen 21.600 74,0 1.434 59,9 122.104 45,2<br />
Handel inkl. KfZ 3.474 11,9 592 24,7 46.853 17,3<br />
Beherbergung 60 0,2 29 1,2 2.193 0,8<br />
Verkehr, Nachrichten 68 0,2 34 1,4 2.735 1,0<br />
Kredit, Versicherung 7.465 25,6 261 10,9 44.879 16,6<br />
Realitäten, untern. bez. DL 10.413 35,7 470 19,6 23.276 8,6<br />
öffentl. u. sonst. DL 120 0,4 48 2,0 2.168 0,8<br />
Insgesamt 29.192 100,0 2.393 100,0 270.136 100,0<br />
Quelle: OeNB.<br />
193
Branchenstruktur der passiven Direktinvestitionen, 2001 Tab. 7.9<br />
194<br />
Eigenkapital<br />
(in Mio. Euro)<br />
In % Beteiligungen In % Beschäftigte In %<br />
Bergbau, Energie 346 1,0 22 0,7 639 0,3<br />
Sachgütererzeugung<br />
(inkl. Bau)<br />
9.349 26,7 860 25,8 115.108 46,9<br />
Nahrungsmittel, Tabak 372 1,1 72 2,2 8.070 3,3<br />
Textilien, Bekleidung 210 0,6 65 2,0 8.641 3,5<br />
Holzverarbeitung 40 0,1 29 0,9 1.845 0,8<br />
Papier, Druck, Verlage 1.061 3,0 72 2,2 5.660 2,3<br />
Chemie, Gummi, Min. Öl 2.304 6,6 140 4,2 16.012 6,5<br />
Glas, Steinwaren 552 1,6 48 1,4 3.854 1,6<br />
Metall 574 1,6 106 3,2 9.000 3,7<br />
Maschinenbau 865 2,5 161 4,8 16.085 6,6<br />
Elektro, EDV, Optik 2.726 7,8 89 2,7 31.075 12,7<br />
Fahrzeugbau 528 1,5 16 0,5 9.205 3,7<br />
Möbel, Sport, Recycl. 75 0,2 17 0,5 1.574 0,6<br />
Bauwesen 42 0,1 45 1,4 4.088 1,7<br />
Dienstleistungen 25.289 72,3 2.445 73,5 129.812 52,9<br />
Handel inkl. KfZ 5.956 17,0 1.351 40,6 69.717 28,4<br />
Beherbergung 274 0,8 102 3,1 6.611 2,7<br />
Verkehr, Nachrichten 1.107 3,2 126 3,8 11.242 4,6<br />
Kredit, Versicherung 6.058 17,3 142 4,3 19.202 7,8<br />
Realitäten, untern. bez. DL 11.825 33,8 671 20,2 21.603 8,8<br />
öffentl. u. sonst. DL 69 0,2 53 1,6 1.436 0,6<br />
Insgesamt 34.984 100,0 3.327 100,0 245.559 100,0<br />
Quelle: OeNB.
Eigenkapitalrentabilität nach Regionen, 1991–2001 Tab. 7.10 a<br />
Insgesamt<br />
Restliche<br />
Länder<br />
sonstige<br />
MOEL<br />
Slowakei Slowenien Polen<br />
Tschech.<br />
Rep.<br />
EU-15 MOEL-19 Ungarn<br />
Nettogewinn in Mio. Euro<br />
1991 -63,95 19,42 20,25 0,94 0,03 1,84 -5,44 1,79 16,43 -28,10<br />
1992 -242,51 -4,05 5,18 0,27 1,51 -2,40 4,75 -13,36 17,10 -229,45<br />
1993 -145,66 -28,19 33,86 -41,27 -4,74 -8,44 -4,20 -3,40 55,07 -118,79<br />
1994 32,51 5,89 29,76 -26,84 -3,84 7,04 -6,86 6,64 150,97 189,37<br />
1995 28,28 -25,89 2,94 -35,27 -0,78 14,81 -7,80 0,20 92,82 95,20<br />
1996 174,00 147,57 104,43 7,77 17,08 17,48 -0,25 1,07 164,00 485,58<br />
1997 178,91 277,63 148,28 14,98 34,94 34,89 30,40 14,14 187,06 643,60<br />
1998 212,26 124,03 162,39 32,12 44,41 33,85 23,64 -172,39 243,31 579,60<br />
1999 334,30 441,38 225,13 38,28 59,10 45,54 48,59 24,73 349,14 1.124,83<br />
2000 403,48 654,08 195,59 181,35 76,03 50,01 75,83 75,27 287,65 1.345,21<br />
2001 -70,29 1.121,77 422,23 212,63 192,09 15,93 56,35 222,54 289,75 1.341,24<br />
Eigenkapital in Mio. Euro<br />
1991 1.873,21 778,87 602,97 37,84 24,41 53,33 12,77 47,54 1.032,92 3.685,00<br />
1992 2.209,02 1.057,36 778,06 120,23 52,93 64,52 21,21 20,41 1.081,07 4.347,46<br />
1993 2.746,64 1.503,28 1.016,60 242,07 69,77 92,98 40,32 41,55 1.288,46 5.538,38<br />
1994 2.855,31 1.852,25 1.039,74 423,77 114,57 118,42 45,52 110,21 1.581,32 6.288,88<br />
1995 3.112,77 1.970,87 990,28 478,83 134,66 186,94 97,30 82,87 1.936,95 7.020,59<br />
1996 3.893,28 2.477,06 1.183,86 613,77 204,17 240,66 137,83 96,78 2.295,92 8.666,27<br />
1997 4.556,10 3.369,09 1.376,15 714,56 355,35 282,78 250,94 389,33 3.311,46 11.236,66<br />
1998 5.946,64 3.765,21 1.326,32 942,31 399,99 382,98 293,00 420,62 3.522,83 13.234,68<br />
1999 7.629,07 4.825,11 1.560,80 1.112,87 487,00 482,01 504,44 677,98 4.883,24 17.337,41<br />
2000 10.617,31 6.641,54 1.737,89 1.908,52 587,17 563,01 793,35 1.051,60 6.611,93 23.870,78<br />
2001 11.443,34 10.103,54 2.609,47 2.420,88 1.074,86 654,45 1.115,62 2.228,26 7.645,33 29.192,22<br />
Statistische Übersichten<br />
195
Eigenkapitalrentabilität nach Regionen, 1991–2001 Tab. 7.10 b<br />
Insgesamt<br />
Restliche<br />
Länder<br />
sonstige<br />
MOEL<br />
Slowakei Slowenien Polen<br />
Tschech.<br />
Rep.<br />
EU-15 MOEL-19 Ungarn<br />
196<br />
Eigenkapitalrentabilität in %<br />
1991 -3,4 2,5 3,4 2,5 0,1 3,4 -42,6 3,8 1,6 -0,8<br />
1992 -11,0 -0,4 0,7 0,2 2,9 -3,7 22,4 -65,4 1,6 -5,3<br />
1993 -5,3 -1,9 3,3 -17,0 -6,8 -9,1 -10,4 -8,2 4,3 -2,1<br />
1994 1,1 0,3 2,9 -6,3 -3,4 5,9 -15,1 6,0 9,5 3,0<br />
1995 0,9 -1,3 0,3 -7,4 -0,6 7,9 -8,0 0,2 4,8 1,4<br />
1996 4,5 6,0 8,8 1,3 8,4 7,3 -0,2 1,1 7,1 5,6<br />
1997 3,9 8,2 10,8 2,1 9,8 12,3 12,1 3,6 5,6 5,7<br />
1998 3,6 3,3 12,2 3,4 11,1 8,8 8,1 -41,0 6,9 4,4<br />
1999 4,4 9,1 14,4 3,4 12,1 9,4 9,6 3,6 7,1 6,5<br />
2000 3,8 9,8 11,3 9,5 12,9 8,9 9,6 7,2 4,4 5,6<br />
2001 -0,6 11,1 16,2 8,8 17,9 2,4 5,1 10,0 3,8 4,6<br />
Quelle: OeNB.
Beschäftigungsentwicklung der aktiven Direktinvestitionen,<br />
1991–2001, Zielregion der Tochterunternehmen<br />
Quelle: OeNB.<br />
Statistische Übersichten<br />
EU-15 MOEL-19 Restliche Länder Summe<br />
1991 30.043 24.681 8.358 63.083<br />
1992 29.450 33.452 9.903 72.805<br />
1993 31.850 50.329 8.702 90.881<br />
1994 32.430 65.085 8.547 106.063<br />
1995 35.625 78.035 11.359 125.019<br />
1996 39.050 85.425 10.955 135.430<br />
1997 39.442 106.190 15.735 161.367<br />
1998 50.550 121.141 15.963 187.654<br />
1999 50.360 128.107 20.696 199.164<br />
2000 57.571 162.406 28.651 248.628<br />
2001 53.071 190.195 26.870 270.136<br />
Tab. 7.11<br />
197
Beschäftigungsentwicklung der passiven Direktinvestitionen,<br />
1991–2001, Herkunftsregion der Mutterunternehmen<br />
198<br />
Tab. 7.12<br />
Deutschland EU-15 1) EU-<br />
Beitrittsländer 2) Restliche Länder Summe<br />
1991 98.008 48.511 836 65.495 212.850<br />
1992 100.132 49.072 793 63.455 213.453<br />
1993 98.355 50.515 615 60.044 209.530<br />
1994 98.083 44.367 677 61.527 204.655<br />
1995 99.089 43.328 765 64.502 207.684<br />
1996 103.736 42.941 658 64.391 211.726<br />
1997 105.512 40.515 761 64.687 211.475<br />
1998 114.838 48.771 760 64.081 228.450<br />
1999 115.980 48.750 672 63.024 228.427<br />
2000 127.737 50.785 666 72.048 251.234<br />
2001 133.792 50.850 779 60.137 245.559<br />
1) EU-15 ohne Deutschland und Österreich. 2) ohne Malta und Zypern.<br />
Quelle: OeNB.
Literaturverzeichnis<br />
Statistische Übersichten<br />
Artikel und Berichte<br />
ABA (2004), Attraktive Steuerreform: Multinationals bevorzugen Österreich, Presseinformation<br />
vom 5. Mai 2004.<br />
Aiginger, K. (1997), The use of unit values to discriminate between price and quality competition,<br />
in: Cambridge Journal of Economics, Vol. 21, S. 571-592.<br />
Breuss, F. (2002), Kosten der Nicht-Erweiterung der EU für Österreich, WIFO-Studie, Wien.<br />
Breuss, F. (2001), Makroökonomische Auswirkungen der EU-Erweiterung auf alte und neue<br />
Mitglieder, WIFO-Monatsberichte, 74(11).<br />
Breuss, F., Schebeck, F. (1998), Kosten und Nutzen der EU-Osterweiterung für Österreich,<br />
WIFO-Monatsberichte, 71(11).<br />
Breuss, F., Schebeck, F. (1996), Ostöffnung und Osterweiterung der EU. Ökonomische Auswirkungen<br />
auf Österreich, WIFO-Monatsberichte, 69(2).<br />
Dell’mour, R. (2003), Direktinvestitionen Österreichs – Ergebnisse der Befragung 2001 und<br />
Entwicklung ausgewählter Indikatoren, in: Berichte und Studien der OeNB, Heft 4, S.73 – 87.<br />
Dulleck, U., Foster, N., Stehrer, R., Wörz, J. (2003), Low quality trap or quality upgrading – Evidence<br />
for CEEC’s, Working Paper No. 0314, Institut für Volks<strong>wirtschafts</strong>lehre, Universität Wien,<br />
2003, auch als wiiw Working Paper Nr. 29, April 2004.<br />
Hunya, G., Stankovsky, J. (2004) WIIW-WIFO Database. Foreign Direct Investment in Central<br />
and Eastern Europe with Special Attention to Austrian FDI Activities in this Region, wiiw und<br />
WIFO, Februar 2004.<br />
Hutschenreiter, G., (2002) Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung, WIFO Monatsbericht<br />
2/2002, S. 121-131.<br />
Hutschenreiter, G., Peneder, M., (1997) Austria’s Technology Gap in Foreign Trade, Austrian<br />
Economic Quarterly, Vol. 2, 2, S. 75-86.<br />
IWF (Hrsg.) (2003), World Economic Outlook – Public Debt in Emerging Markets, September<br />
2003.<br />
Kammer für Arbeiter und Angestellte Wien (2004), Märkte – Wettbewerb – Regulierung, Wettbewerbsbericht<br />
der AK 2004, Wien.<br />
Mayerhofer, P., Wolfmayr-Schnitzer, Y. (1997), Gateway Cities in the Process of Regional Integration<br />
in Central and Eastern Europe: The case of Vienna”, in : Biffl, G., (Hrsg.), Migration,<br />
Free Trade and Regional Integration in Central and Eastern Europe, Schriftenreihe Europa des<br />
Bundeskanzleramtes, Österreichische Staatsdruckerei, Wien.<br />
OECD (Hrsg.) (2003) Economic Outlook; Volume 2003/2, No. 74, Dezember 2003.<br />
OeNB (2004), Die Österreichische Zahlungsbilanz des Jahres 2003, Presseinformation vom<br />
20. April 2004.<br />
199
Peneder, M. (2002), Industrial Structure and Aggregate Growth, WIFO-Working Paper Nr. 182,<br />
Wien.<br />
Podkaminer, L. et al. (2004), Transition Countries on the Eve of EU Enlargement, wiiw Forschungsbericht<br />
Nr. 303, Februar.<br />
Smeral, E., Franz, A., Laimer, P. (2002), Ein Tourismussatellitenkonto für Österreich, WIFO<br />
Monatsbericht 1/2002, S. 29-38.<br />
Stankovsky, J., Wolfmayr-Schnitzer Y. (1995), Der österreichische Außenhandel, Das Jahrbuch<br />
1995, herausgegeben vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wien.<br />
Stankovsky, J., Wolfmayr-Schnitzer, Y. (1996), Österreich als Standort für Ostzentralen, WIFO,<br />
Februar 1996.<br />
UNCTAD (Hrsg.) (2003), Trade and Development Report 2003 – Capital Accumulation, Growth<br />
and Structural Change, New York/Genf.<br />
UNCTAD (Hrsg.) (2003), World Investment Report 2003 – FDI Policies for Development: National<br />
and International Perspectives, New York/Genf.<br />
UNCTAD (2004), New take-off predicted for FDI, Press Release, 14. April 2004.<br />
WIFO (Hrsg.) (2004), Prognose für 2004 und 2005: Konjunkturerholung droht ins Stocken zu<br />
geraten, April 2004.<br />
Wolf, G., (2003), Fahrzeugindustrie – eine Zukunftsbranche“, BA-CA Report 5/2003.<br />
Wolfmayr, Y. (2004), Außenhandelsstruktur der österreichischen Industrie“, in: Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.), Österreichs Außenwirtschaft. Das Jahrbuch 2003/2004.<br />
Wolfmayr, Y., Stankovsky, J. (2003), Interessante Absatzmärkte und Exportpotentiale für die<br />
österreichische Industrie, WIFO-Studie im Auftrag der OeKB, Dezember 2003.<br />
Wolfmayr, Y. (2004), Österreichs Warenaußenhandel mit den EU-Beitrittsländern, WIFO-Mo-<br />
natsberichte, 77(4).<br />
WTO (Hrsg.) (2003), World Trade Report 2003, Genf.<br />
WTO (Hrsg.) (2003), World Trade Statistics 2003, Genf.<br />
Wüger, M. (2004), Der private Konsum entwickelt sich günstig, WIFO-Monatsberichte, 77(4).<br />
Internetlinks<br />
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit:<br />
http://www.bmwa.gv.at/<br />
Europäische Union:<br />
http://europa.eu.int/index_de.htm<br />
http://europa.eu.int/comm/dg10/publications/liens/index_en.html<br />
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm<br />
http://www.euractiv.com<br />
http://europa.eu.int/comm/eurostat/<br />
200
Europäische Zentralbank:<br />
http://www.ecb.int/index.html<br />
Federal Reserve Bank:<br />
http://www.federalreserve.gov/<br />
Internationaler Währungsfonds:<br />
http://www.imf.org/<br />
Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook:<br />
https://secure.vtx.ch/shop/boutiques/wto_index_boutique.html<br />
OECD:<br />
http://www.oecd.org/home/<br />
Oilnergy:<br />
http://www.oilnergy.com/<br />
Österreichische Nationalbank:<br />
www.oenb.co.at<br />
Statistik Austria:<br />
http://www.statistik.at/index.shtml<br />
UNO:<br />
http://www.un.org/<br />
http://www.unctad.org/ldcs<br />
Weltbank:<br />
http://www.worldbank.org/<br />
WTO:<br />
http://www.wto.org<br />
WTO-Jahresberichte:<br />
https://secure.vtx.ch/shop/boutiques/wto_index_boutique.html<br />
wiiw:<br />
http://www.wiiw.ac.at<br />
WIFO:<br />
http://www.wifo.ac.at<br />
Statistische Übersichten<br />
Autoren des Hauptteils:<br />
Ao.Univ.-Prof. Dr. Wilfried Altzinger, Professor am Institut für Volks<strong>wirtschafts</strong>theorie- und -politik<br />
der WU Wien: Kapitel 7 (Österreichische Direktinvestitionen).<br />
Mag. Mario Holzner, wissenschaftlicher Mitarbeiter am wiiw: Abschnitt 1.4.5 (Südosteuropäische<br />
Länder, SOEL).<br />
Univ.-Prof. Dr. Michael Landesmann, wissenschaftlicher Leiter des wiiw: Abschnitte 1.1 (Globale<br />
Konjunkturentwicklung) und 1.2 (Geld- und Fiskalpolitik).<br />
201
Dr. Sandor Richter, wissenschaftlicher Mitarbeiter am wiiw: Abschnitte 2.1 (Die EU), sowie 2.2.1<br />
(Wirtschaftsintegration in Amerika) in Zusammenarbeit mit dem BMWA und Abschnitt 1.4.10<br />
(Argentinien).<br />
Dr. Prof. Jan Stankovsky, wissenschaftlicher Mitarbeiter am WIFO: Kapitel 4 (Wirtschaftsentwicklung<br />
Österreichs im Überblick) und 5 (Österreichs Warenhandel).<br />
Mag. Waltraut Urban, wissenschaftliche Mitarbeiterin am wiiw: Abschnitte 1.4.1 (Europäische<br />
Union), 1.4.2 (USA), 1.4.3 (Japan), 1.4.8 (China), 1.4.9 (Restliches Asien) und 2.2.2 (Regionale<br />
Wirtschaftskooperation in Asien).<br />
Mag. Hermine Vidovic, wissenschaftliche Mitarbeiterin am wiiw, Abschnitt 1.3 (Die Entwicklung<br />
der Arbeitsmärkte).<br />
Mag. Yvonne Wolfmayr, wissenschaftliche Mitarbeiterin am WIFO: Ko-Autorin der Kapitel 4<br />
(Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick) und 5 (Österreichs Warenhandel).<br />
Dr. Julia Wörz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am wiiw: Kapitel 3 (Entwicklung des Welthandels)<br />
und 6 (Der Außenhandel mit Dienstleistungen) sowie die Abschnitte 1.4.7 (Türkei), 1.4.11 (Brasilien),<br />
und 2.3 (Welthandelsorganisation, WTO, in Zusammenarbeit mit dem BMWA).<br />
202
EINE STRATEGISCHE<br />
AUSSENWIRTSCHAFTSPOLITIK FÜR<br />
ÖSTERREICH:<br />
DIE INTERNATIONALISIERUNGS-<br />
OFFENSIVE 2003/2005<br />
203
204
9 EINE STRATEGISCHE AUSSENWIRT-<br />
SCHAFTSPOLITIK FÜR ÖSTERREICH<br />
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin*<br />
9.1 Einleitung<br />
Für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die österreichische sind die wirtschaftlichen<br />
Verflechtungen mit dem Ausland von herausragender Bedeutung. Exporte und Importe<br />
von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Know-how sind entscheidende Bestimmungsfaktoren<br />
der wirtschaftlichen Entwicklung; eine florierende Exportwirtschaft<br />
schafft Arbeitsplätze, Wohlstand und Steuereinnahmen. Der Erhalt und die weitere<br />
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft in einem sich ständig<br />
(aber nicht stetig) ändernden <strong>internationale</strong>n Umfeld sind daher zentrale Aufgaben<br />
der österreichischen Wirtschaftspolitik und erfordert eine umfassende, systematische<br />
und zukunftsorientierte, kurz: eine „strategische” Außen<strong>wirtschafts</strong>politik.<br />
In der Unternehmensführung ist strategische Führung längst zu einem Fixpunkt mit<br />
eigenen Verfahren und Instrumenten geworden: „Strategisches Management ist der<br />
Prozess, mit dem sich ein Unternehmen an die externe Umwelt anpasst. Das Management<br />
muss nicht nur die inneren Unternehmensaktivitäten lenken, sondern sich<br />
auch den dynamischen Entwicklungen der Umwelt stellen. Diese Herausforderungen<br />
entstehen aus Veränderungen im globalen Umfeld oder im direkten Wettbewerbsumfeld.<br />
Die verantwortlichen Führungskräfte müssen diese Entwicklungen antizipieren,<br />
bewerten und im Entscheidungsprozess berücksichtigen.“ (Lombriser, Abplanalp,<br />
1998, S. 15)<br />
Diese Überlegung gilt natürlich nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die<br />
Politikgestaltung und -umsetzung: Auch für die rationale Politikformulierung ist der<br />
Umgang mit knappen Ressourcen essentiell, auch die öffentliche Verwaltung muss<br />
mit der gestiegenen Komplexität und Volatilität gesellschaftlicher, wirtschaftlicher<br />
und technischer Entwicklungen und Prozesse umgehen. Mit „Überraschungen“ muss<br />
jederzeit gerechnet werden, eine „nach innen gerichtete, extrapolierende und auf<br />
bloßer Intuition oder auf Zufall („Management by Fingerspitzengefühl“) basierende …<br />
Führung“ (Lombriser, Abplanalp, 1998, S. 18) reicht nicht mehr aus.<br />
Das gilt in besonderem Maße für den Außen<strong>wirtschafts</strong>bereich: Technologische, <strong>politische</strong><br />
und gesellschaftliche Entwicklungen haben die Rahmenbedingungen grenzüberschreitenden<br />
Wirtschaftens in den letzten 20 Jahren so grundlegend verändert, dass<br />
viele Beobachter von einem neuen – globalen – Zeitalter sprechen. 1 Österreichische<br />
Unternehmen haben sich in diesem turbulenten Umfeld zuletzt hervorragend behauptet:<br />
Die Gesamt- (Waren- und Dienstleistungs-)exporte wuchsen zwischen 1995 und<br />
2003 jährlich um durchschnittlich 8 %, die Exportquote, das ist der Anteil der Waren-<br />
und Dienstleistungsexporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP), stieg im gleichen Zeitraum<br />
205
von 37 auf 53 %. Der Wirtschaftsstandort Österreich erwies sich für ausländische<br />
Unternehmen, die zwischen 1995 und 2003 insgesamt 37,3 Mrd. Euro investierten,<br />
als attraktiv. Gleichzeitig sehen sich immer mehr österreichische Unternehmen in der<br />
Lage, ihre Chancen auch auf ausländischen Märkten zu suchen: Die aktiven österreichischen<br />
Direktinvestitionen beliefen sich in demselben Zeitraum auf 31,2 Mrd. Euro<br />
und erreichten 2003 mit 6,3 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert.<br />
Diese Erfolge dürfen freilich nicht als Einladung, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen,<br />
gesehen werden, sondern im Gegenteil als Auftrag für verstärkte weitere Bemühungen.<br />
„(Die weitere) Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich und der in unserem<br />
Land tätigen Unternehmen im europäischen und globalen Wettbewerb … bleibt das<br />
zentrale Ziel der österreichischen Wirtschaftspolitik“ (Regierungsprogramm für die<br />
XXII. Gesetzgebungsperiode, S. 12), was sich z.B. in der im Herbst 2003 gestarteten<br />
Internationalisierungsoffensive „go international” und in der Einrichtung einer „Stabstelle<br />
für Strategische Außenwirtschaft“ niederschlug. 2<br />
Der vorliegende Beitrag beginnt mit einigen Überlegungen zu den Begriffen „Strategie”<br />
und „strategisches Management” und deren Anwendung im öffentlichen Bereich.<br />
Darauf aufbauend werden die Rahmenbedingungen und Grundelemente einer strategischen<br />
österreichischen Außen<strong>wirtschafts</strong>politik herausgearbeitet. Abschnitt 9.5<br />
zeigt, wie sich diese Grundelemente in „go international” niederschlagen. Der Beitrag<br />
endet mit einigen Überlegungen zur zukünftigen Institutionalisierung des strategischen<br />
Prozesses in der österreichischen Außen<strong>wirtschafts</strong>politik.<br />
9.2 Strategisches Denken und strategisches<br />
Management<br />
Das Wort „Strategie” geht auf die griechischen Worte „stratos” (Heer) und „agein”<br />
(führen) zurück – Strategie als Kunst der Heerführung. Heute werden die Begriffe<br />
„Strategie” und „strategisch” alltagssprachig für fast alles, was etwas wichtiger ist und<br />
einen etwas längerfristigen Zeithorizont hat, verwendet. Auch in der wissenschaftlichen<br />
Aufbereitung fehlt bislang eine einheitliche Definition, doch hat sich in der Literatur<br />
ein weitgehender Konsens hinsichtlich der konstituierenden Begriffsmerkmale entwickelt:<br />
Stark an der Alltagssprache orientiert ist der Ansatz von Thomas Bichsel (1994,<br />
S. 122ff.), der drei Merkmale strategischer Führung unterscheidet:<br />
• Wesentlichkeit: Sie konzentriert sich auf „Doing the right things“ (statt „Doing the<br />
things right“).<br />
206
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
• Zukunftsorientiertheit: Sie versucht, zukünftige Chancen, Risken und Potenziale so<br />
früh wie nur irgend möglich zu erkennen und in die Zielbildung einzubeziehen.<br />
• Ungewissheit: Sie hat es daher immer mit Ungewissheit und schlecht definierten<br />
Problemfeldern zu tun.<br />
Walter Schertler (2003, S. 3) kommt auf sechs Charakteristika strategischen Denkens:<br />
• Visionäres Denken: Kreatives, pionierhaftes Auseinandersetzen mit der Zukunft.<br />
• Optionsdenken: Denken in Alternativen für die Zielerreichung.<br />
• Vorteilsdenken: Orientierung an langfristigen Erfolgsfaktoren, selbst wenn das<br />
kurzfristige Nachteile bedeutet.<br />
• Potenzialdenken: Identifizierung von Chancen und Fähigkeiten.<br />
• Ganzheitliches Denken: Systemorientierung, Suche nach Gestalt (Gesamtheit,<br />
Ganzheit) und Selbst (Identität).<br />
• Vernetztes Denken: Beachten von Abhängigkeiten und Wechselwirkungen.<br />
Strategisches Management ist ein eng verzahnter iterativer Prozess mit multiplen<br />
Rückkopplungsschleifen. 3 Der strategische Denkprozess lässt sich auch anhand<br />
folgender Kernfragen beschreiben:<br />
• Wo befinden wir uns jetzt? (Situationsanalyse)<br />
• Wo wollen wir hin? (Zielformulierung)<br />
• Wie kommen wir dorthin? (Strategieformulierung und -umsetzung)<br />
• Wie messen wir unseren Fortschritt? (Strategiecontrolling)<br />
Diese Konzepte wurden zwar in der und für die Privatwirtschaft entwickelt, es spricht<br />
aber nichts gegen ihre Anwendung im öffentlichen Bereich (vgl. Schekulin, 2003, z.B.<br />
S. 36). Auch für die Politikgestaltung und öffentliche Leistungserbringung ist eine<br />
gesamthafte Sicht und der Blick auf das Wesentliche, der strategisches Denken ausmacht,<br />
sinnvoll und sogar notwendig. 4 Auch Regierungen und Verwaltungsführungen<br />
müssen<br />
• „rechtzeitig wesentliche Ereignisse und Entwicklungen für die … Gemeinschaft<br />
erkennen und bewerten;<br />
• regelmäßig die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken … analysieren;<br />
• prüfen, welche Maßnahmen und Programme geeignet und notwendig sind;<br />
• richtungweisende Entscheidungen treffen und deren Umsetzung sicherstellen;<br />
• den Bürgern Rechenschaft über die Verwendung von Mitteln und den damit erzielten<br />
Erfolg geben.“ (KGSt, 2000, S. 7)<br />
207
Auch und gerade für die Politikgestaltung gilt: „Wer keine Strategie hat, wird von<br />
Einzelinteressen getrieben herumirren, Fehlentscheidungen treffen und Ressourcen<br />
verschwenden.“ (KGSt, 2000, S. 8)<br />
Es gibt auch keinen wirklichen Grund, warum der strategische Prozess im öffentlichen<br />
Bereich grundsätzlich anders gestaltet werden sollte als in der Privatwirtschaft. Der<br />
Erklärungswert des Prozessmodells (Situationsanalyse – Zielformulierung – Strategieformulierung<br />
– Strategieumsetzung – Strategiecontrolling) ist im politisch-administrativen<br />
System ebenso gegeben wie im Unternehmensbereich. Und Alfred Chandlers<br />
berühmter Satz „Structure follows strategy“ gilt natürlich auch für die Politikgestaltung<br />
und -umsetzung. 5<br />
9.3 Analyse der strategischen Ausgangssituation<br />
Eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik muss, will sie diesen Namen verdienen,<br />
mit einer gründlichen Analyse der strategischen Ausgangssituation, d.h. der für die<br />
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft relevanten <strong>internationale</strong>n wie<br />
österreichischen Entwicklungen beginnen. Darauf aufbauend können dann Ziele und<br />
Strategien für die zukünftige Gestaltung der österreichischen Außen<strong>wirtschafts</strong>politik<br />
abgeleitet werden.<br />
9.3.1 Umfeldanalyse/Globalisierungstrends<br />
In seiner allgemeinsten Form kann der Globalisierungsprozess als „weltweites<br />
Schrumpfen von Raum und Zeit“ (Schweizer Bundesrat, 2002, S. 105) verstanden<br />
werden. Wann er eingesetzt hat, ist Gegenstand hitziger akademischer Debatten; 6 dass<br />
er sich seit dem 2. Weltkrieg deutlich beschleunigt hat, ist unbestritten und schlägt<br />
sich unter anderem in einem nie vorher gesehenen Anstieg der grenzüberschreitenden<br />
Transaktionen nieder.<br />
Warenhandel<br />
Die Bedeutung des Warenhandels für die Weltwirtschaft hat in den letzten Jahrzehnten<br />
kontinuierlich zugenommen. Während sich das reale Welt-BIP seit 1950 etwa versechsfachte,<br />
stiegen die realen Weltwarenexporte in diesem Zeitraum auf das mehr als<br />
20fache. Machten die Weltwarenexporte anfangs der 1950er-Jahre noch etwas über<br />
5 % des Welt-BIP aus, waren es 2001 bereits fast 21 %. Und der Trend beschleunigte<br />
sich zuletzt deutlich: In den 1990er-Jahren stiegen die Exporte im Schnitt um 5,8 %,<br />
im vorangegangenen Jahrzehnt waren es durchschnittlich 3,9 % gewesen. 7<br />
208
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
Entwicklung der Welt-Warenexporte und des Welt-BIP 1950–2002 Abb. 9.1<br />
Index 1950 = 100<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1951/55<br />
Warenexporte real<br />
1956/60<br />
Quelle: WTO, 2003; eigene Berechnungen.<br />
1961/65<br />
1966/70<br />
1971/75<br />
BIP real<br />
1976/80<br />
1981/85<br />
1986/90<br />
1991/95<br />
1996/02<br />
Dienstleistungshandel<br />
In den 1990er-Jahren wuchs der weltweite Handel mit Dienstleistungen sogar stärker<br />
als der Warenverkehr. Seit Mitte der 1980er-Jahre hatte er sich rund vervierfacht und<br />
erreichte 2002 schließlich 1.511 Mrd. USD. Der Anteil von Dienstleistungen am Gesamtwelthandel<br />
stieg dadurch von rd. 16 % im Jahr 1985 auf rd. 20 % im Jahr 2002,<br />
ist aber, gemessen an ihrem Beitrag zur Gesamtwertschöpfung (fast zwei Drittel), nach<br />
wie vor relativ gering. Darin spiegelt sich neben Schwierigkeiten in ihrer statistischen<br />
Erfassung 8 auch die Tatsache, dass die Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte<br />
erst ein recht junges Phänomen ist, wider. Das und signifikante Innovationen in der<br />
Informations- und Kommunikationstechnologie, die die Handelbarkeit von Dienstleistungen<br />
in einem noch vor kurzem unvorstellbaren Ausmaß erhöhten, sprechen dafür,<br />
dass dieser Trend sich in der absehbaren Zukunft weiter beschleunigen wird (vgl. z.B.<br />
Henneberger, Ziegler, 2001, insbes. S. 39).<br />
209
Entwicklung des Welt-Dienstleistungsexporte 1980–2002 Abb. 9.2<br />
Quelle: WTO, 2003; eigene Berechnungen.<br />
Grenzüberschreitende Investitionen<br />
Die Zeiten, als Auslandsniederlassungen vorwiegend die Sache einiger weniger großer<br />
multinationaler Konzerne waren und in erster Linie der Sicherung des Zugangs<br />
zu Rohstoffen oder der Abwicklung großer Infrastrukturprojekte dienten, sind lange<br />
vorbei. Zwischen 1990 und 2000 versiebenfachten sich die grenzüberschreitenden<br />
Direktinvestitionsströme (die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate lag bei fast<br />
21 %) und wurden zu einer treibenden Kraft der Weltwirtschaft. Die UNCTAD (2003,<br />
S. 223) schätzt, dass es zurzeit rd. 64.000 multinationale Unternehmen mit über<br />
866.000 Auslandsniederlassungen gibt, die rund ein Drittel des Welthandels und<br />
22 % des Welt-BIP erwirtschaften. Und einiges spricht dafür, dass seit einiger Zeit zu<br />
beobachtende neue Formen der Fragmentierung der Wertschöpfungskette, z.B. die<br />
Trennung von Front- und Backofficefunktionen, in den nächsten Jahren zu einer neuen<br />
Investitionswelle, besonders im Dienstleistungsbereich, führen werden.<br />
210<br />
Mrd. USD<br />
Mrd. USD in % d. BIP<br />
%<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
1981/85<br />
1986/90<br />
1991/95<br />
1996/02<br />
5,0<br />
4,5<br />
4,0<br />
3,5<br />
3,0<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
0,5<br />
0,0
Quelle: UNCTAD, 2003.<br />
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
Entwicklung der weltweiten Direktinvestitionsbestände 1980–2002 Abb. 9.3<br />
Mrd. USD Bestände in % d. BIP<br />
%<br />
8000<br />
25<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
0<br />
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002<br />
Die Motoren der Globalisierung: Technologischer Fortschritt und<br />
Liberalisierung<br />
Möglich wurde diese Entwicklung durch ungeahnte Verbesserungen in der Effizienz,<br />
mit der Güter, Dienstleistungen, Kapital, Ideen und Menschen sich auch über große<br />
Distanzen bewegen können. Die Kosten für Seetransport sanken im 20. Jahrhundert<br />
auf weniger als ein Drittel, die für Lufttransport auf weniger als ein Fünftel, die eines<br />
transatlantischen Telefongesprächs auf rd. 1 % (Europäische Kommission, 2002,<br />
S. 22). Noch dramatischer war die Entwicklung zuletzt im Datenverarbeitungsbereich:<br />
Die Kosten für Computer und Peripheriegeräte fielen (relativ zum BIP-Deflator) zwischen<br />
1960 und 2000 um den Faktor 1.800. (Masson, 2001) Und die Internettechnologie<br />
breitet sich auch nach dem Ende der Euphorie der Jahrtausendwende weiter<br />
aus – die Anzahl der Internet-Hosts stieg von Anfang 1995 bis Anfang 2004 um das<br />
47fache auf 233 Millionen 9 – und verändert viele Märkte grundlegend.<br />
Technologischer Fortschritt war eine notwendige, aber keine ausreichende Bedingung<br />
für die fortschreitende Integration der Weltmärkte. Die Zwischenkriegszeit hat gezeigt,<br />
dass (und mit welch katastrophalen Folgen) <strong>politische</strong> Entwicklungen den Welthandel<br />
zumindest vorübergehend stoppen bzw. sogar umkehren können. Erst nach 1945 setzte<br />
sich allmählich wieder die Einsicht durch, dass der Abbau von Handelshemmnissen<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
211
kein Zugeständnis an die Handelspartner, sondern im wohlverstandenen Eigeninteresse<br />
aller Beteiligten sei. 10 Der Erfolg kann sich sehen lassen: Die durchschnittlichen<br />
Zollraten der Industriestaaten sanken in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts von etwa<br />
40 % auf rd. 4 % – und berücksichtigt man den gleichzeitigen Abbau nicht-tarifärer<br />
Handelshemmnisse, war der Liberalisierungseffekt noch größer. Gleichzeitig stieg die<br />
Mitgliedschaft im multilateralen Handelssystem von den 23 „Gründungsmitgliedern”<br />
des GATT 1947 auf derzeit (Stand: April 2004) 147 WTO-Mitglieder bzw. mehr als<br />
95 % des Welthandels.<br />
Importzollentwicklung ausgewählter Länder seit 1875 Tab. 9.1<br />
212<br />
1875 1913 1930 1950 1989<br />
Frankreich 12-15 20 30 18<br />
Deutschland 4-6 17 21 26<br />
Großbritannien 0 0 17 23<br />
Nach der<br />
Uruguay-<br />
Runde<br />
USA 40-50 44 48 14 4,6 3,0<br />
EU 5,7 4,6<br />
Quelle: Crafts 2000 (zitiert nach Europäische Kommission 2002, S. 24).<br />
Aber nicht nur das multilaterale Handelssystem entwickelte sich weiter, auch bilaterale<br />
und regionale Handelsabkommen boomen wie nie zuvor. Ihre Anzahl stieg von 28 im<br />
Jahr 1990 auf 151 im Jahr 2002. 2000 wurden bereits 43 % des Weltwarenhandels im<br />
Rahmen präferenzieller Abkommen abgewickelt und die WTO schätzt, dass es 2005<br />
bereits 51 % sein werden (WTO, 2003, S. 48).<br />
Der Trend zu immer mehr und immer umfassenderen präferenziellen Handelsabkommen<br />
ist ein weltweites Phänomen. 11 Die USA haben ihr Abkommensnetzwerk in<br />
den letzten Jahren sowohl quantitativ wie auch inhaltlich konsequent ausgebaut und<br />
verfolgen weiterhin das Ziel einer den amerikanischen Doppelkontinent umfassenden<br />
Freihandelszone. Und zuletzt haben sich ihm, angeführt von Australien, Japan und<br />
Singapur, auch viele Pazifik-Anrainerstaaten angeschlossen.<br />
Aber nirgends ist der wirtschaftliche Integrationsprozess so weit fortgeschritten wie in<br />
Europa. Der EU-Binnenmarkt macht nach der jüngsten Erweiterungsrunde 28 % des<br />
Welthandels aus, 21 % werden immerhin innerhalb des einheitlichen Währungsraums<br />
abgewickelt. Auch 50 % des externen Handels der Eurozone werden mittlerweile in<br />
Euro fakturiert, mehr als 57 % der Kredite an Nicht-Banken außerhalb der Eurozone<br />
(ohne USA) werden in Euro begeben, über 30 % des weltweiten Bestandes an Anleihen<br />
und rd. 19 % der weltweiten Devisenreserven sind in Euro denominiert (EZB,<br />
2003). Die Ausdehnung und Weiterentwicklung des Binnenmarkts ist mittlerweile für
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
die Arbeitsteilung in Europa von viel größerer Bedeutung als der „klassische“ Außenhandel<br />
mit Drittstaaten.<br />
Aber auch ohne den Intra-EU-Handel kamen bzw. gingen 2002 jeweils rd. 19 %<br />
der Weltexporte und der Weltimporte 12 aus bzw. in die EU, die sich der sich daraus<br />
ergebenden Verantwortung für das Welthandelssystem auch bewusst und eine der<br />
treibenden Kräfte für die Weiterentwicklung des multilateralen Systems ist.<br />
9.3.2 Stärken-/Schwächenprofil der österreichischen Außenwirtschaft<br />
Der externe Sektor der österreichischen Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren<br />
hervorragend entwickelt: Die Anzahl der exportierenden Unternehmen verdoppelte<br />
sich binnen weniger Jahre und erreichte 2002 ca. 20.000; rund ein Drittel der österreichischen<br />
Arbeitsplätze hängt mittlerweile direkt oder indirekt von Exporten ab.<br />
Warenhandel<br />
Die Warenexporte stiegen in den letzten Jahren (1995 – 2003) um durchschnittlich 8,1 %<br />
– und damit deutlich stärker als die Welt- (3,2 %) und EU-Exporte (6,1 %) – die Warenexportquote<br />
(Warenexporte in Prozent des BIP) liegt inzwischen bei über 35 %. 1995<br />
Österreichische Export- und Importquoten (Waren) seit 1995 Abb. 9.4<br />
in %<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
1995<br />
Exportquote Österreich<br />
Exportquote Welt<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
Quelle: WTO, 2003; Statistik Austria, eigene Berechnungen.<br />
1999<br />
2000<br />
Importquote Österreich<br />
Importquote Welt<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
213
waren es gerade 24,5 % gewesen. Die Differenz zwischen der österreichischen und der<br />
Weltexportquote stieg in diesem Zeitraum von rd. 7 auf rd. 15 Prozentpunkte. 13<br />
Dienstleistungsexporte<br />
Die österreichischen Dienstleistungsexporte wuchsen zwischen 1995 und 2003<br />
um durchschnittlich 7,7 % und erreichten 2003 38,7 Mrd. Euro, die Dienstleistungsexportquote<br />
lag bei 17,4 % und damit deutlich über <strong>internationale</strong>n Vergleichswerten.<br />
Zu diesem Spitzenwert trägt der Tourismussektor rund ein Drittel bei, die Wachstumsdynamik<br />
ging zuletzt aber von anderen Sektoren aus: Zwischen 1993 und 2003<br />
verdoppelten sich die Exporte unternehmensbezogener Dienstleistungen, im Versicherungssektor<br />
verdreifachten, im EDV- und Informationsbereich vervierfachten und<br />
bei den Telekommunikationsdienstleistungen verachtfachten sie sich sogar, freilich<br />
ausgehend von einem deutlich niedrigeren Niveau.<br />
Anteil der Dienstleistungsexporte am BIP in ausgewählten Ländern 2002 Abb. 9.5<br />
Quelle: Eurostat; eigene Berechnungen.<br />
214<br />
% des BIP<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
EU-15<br />
Eurozone<br />
BLEU<br />
Dänemark<br />
Deutschland<br />
Griechenland<br />
Spanien<br />
Frankreich<br />
Irland<br />
Italien<br />
Niederlande<br />
Österreich<br />
Portugal<br />
Finnland<br />
Schweden<br />
UK<br />
Japan<br />
USA
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
Mit einer Gesamtexportquote von 52 % liegt Österreich in der EU auf dem 4. Rang.<br />
Mit Irland, Belgien und den Niederlande weisen nur einige kleinere Küstenländer eine<br />
noch höhere Außenhandelsverflechtung auf.<br />
Grenzüberschreitende Investitionen<br />
Die Kapitalverflechtung der österreichischen Wirtschaft entwickelte sich sogar noch<br />
spektakulärer. Die ausländischen Direktinvestitionen in Österreich blieben nach dem<br />
2. Weltkrieg lange Zeit recht gering und machten 1958 gerade einmal 0,8 % des BIP aus.<br />
Die österreichischen Direktinvestitionen im Ausland erreichten einen ähnlichen BIP-Anteil<br />
sogar erst 1980 (Breuss, 1983, S. 619). Noch Anfang der 1990er-Jahre machten die<br />
FDI-Bestände auf der Passivseite rd. 7 % des BIP und auf der Aktivseite gerade einmal<br />
2 % des BIP aus. 2003 erreichten nach vorläufigen Angaben der OeNB die Netto-Flüsse<br />
in beide Richtungen jeweils mehr als 6 Mrd. Euro und der Bestand an Direktinvestitionen<br />
in bzw. aus Österreich liegt mit 46,6 bzw. 44,7 Mrd. Euro knapp über bzw. unter<br />
der 20 %-Marke. Mittlerweile finden rd. 427.000 Österreicherinnen und Österreicher<br />
einen Arbeitsplatz bei im ausländischen Eigentum stehenden Unternehmen. Umgekehrt<br />
beschäftigen österreichische Unternehmen 412.000 Arbeitskräfte im Ausland und sind<br />
besonders in Mittelost- und Südosteuropa zu den wichtigsten Investoren geworden.<br />
Österreichische Direktinvestitionsbestände seit 1980 Abb. 9.6<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Quelle: OeNB, UNCTAD, 2003; eigene Berechnungen.<br />
Aktive DI Österreichs<br />
Passive DI Österreichs<br />
Weltweiter DI Bestand<br />
1980<br />
1981<br />
1982<br />
1983<br />
1984<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
215
Erfolgsfaktoren: Europäische Integration und aktive Außen<strong>wirtschafts</strong>politik<br />
Ohne den Fall des Eisernen Vorhangs und ohne EU-Beitritt wäre diese erfreuliche<br />
Entwicklung nicht möglich gewesen: Gemeinsam brachten sie Österreich aus der<br />
erzwungenen Randlage der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wieder an seinen<br />
angestammten Platz im Herzen Europas – in „Mitteleuropa“ – zurück: 1989 gingen<br />
27 % der österreichischen Exporte in den damaligen Hauptintegrationsraum EFTA, der<br />
überdies „nur“ eine Freihandelszone war und mit dem Österreich gerade einmal 200<br />
Kilometer gemeinsame Außengrenze hatte. Seit dem 1. Mai 2004 bildet Österreich<br />
mit sechs seiner acht Nachbarländer einen vollintegrierten Binnenmarkt, in den 72 %<br />
der Exporte gehen und aus dem 77 % der Importe kommen – und die Hindernisse im<br />
Handel mit den beiden übrigen, Schweiz und Liechtenstein, sind geringer als sie das<br />
während der gemeinsamen EFTA-Mitgliedschaft waren.<br />
Das ist aber auch eine Erfolgsstory der österreichischen (Außen-)Wirtschaftspolitik, die<br />
sich konsequent um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen<br />
Wirtschaft bemühte: Eine wichtige Säule bildet die makroökonomische Stabilität, die<br />
zuletzt wieder der IWF in seinem letzten Österreichbericht hervorhob. Daneben kümmert<br />
sich eine aktive Außen<strong>wirtschafts</strong>politik um die effektive Vertretung der Interessen<br />
der österreichischen Wirtschaft in der EU und im Ausland. Das schlägt sich z.B. in<br />
einem Netzwerk von 54 Investitionsschutz- und rd. 60 Doppelbesteuerungsabkommen<br />
nieder. Dazu kommt ein modernes Exportfinanzierungs- und -garantieinstrumentarium,<br />
das, wo notwendig, ergänzt und an neue Bedürfnisse angepasst wurde. 14 Nicht vergessen<br />
werden darf auch das international anerkannte Dienstleistungsangebot der<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation der WKÖ, mit ihrem weltweiten Netzwerk von 70 Außenhandelsstellen<br />
in 60 Ländern.<br />
Schwächen des externen Sektors<br />
Die Erfolge dürfen aber nicht über die auch bestehenden Schwächen des externen<br />
Sektors hinwegtäuschen. Dabei fällt z.B. auf, dass<br />
• Österreich zu den wenigen hoch industrialisierten Ländern mit einer Tendenz zu<br />
einem strukturellen Defizit in der Warenverkehrsbilanz gehört; 15<br />
• der Anteil arbeitsintensiver Branchen an den Gesamtexporten über dem EU-Durchschnitt,<br />
der Anteil technologieorientierter Branchen hingegen deutlich darunter<br />
liegt; 16<br />
• der Aktionsradius und der Internationalisierungsgrad österreichischer Unternehmen<br />
nach wie vor geringer sind als von Unternehmen in vergleichbaren Ländern; 17<br />
• die Vermögenseinkommensbilanz traditionell negativ ist, 2003 flossen (netto) rd.<br />
3 Mrd. Euro ab, davon 1,6 Mrd. Euro aus Direktinvestitionen;<br />
216
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
• die österreichische Know-how-Bilanz stark negativ ist, d.h. dass Österreich mehr<br />
für Patente etc. an das Ausland zahlt als es aus diesem Titel einnimmt. 18<br />
9.4 Anforderungen an eine strategische<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>politik<br />
„Im Bereich der Ziel- und Strategieorientierung wird von der Politik eine strategische<br />
Prioritätensetzung erwartet, die – soweit wie möglich – in Kenntnis der langfristigen<br />
Wirkungen und Kosten des öffentlichen Handelns erfolgt. Umgesetzt werden diese<br />
Zielsetzungen aber erst dann, wenn die einzelnen Verwaltungseinheiten sie in ihre<br />
eigenen Zielsysteme transformieren, deren Umsetzung initiieren, periodisch messen<br />
und gegebenenfalls korrigieren.“ (Ösze, 2000, S. 28f.)<br />
Im Zentrum der österreichischen Außen<strong>wirtschafts</strong>politik muss die Sicherung und<br />
weitere Steigerung der <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit und des Exportpotenzials<br />
der österreichischen Wirtschaft stehen. Dabei sind sowohl quantitative (Zunahme der<br />
Exportaktivitäten) wie auch qualitative (Verbesserung der Exportstruktur) Faktoren zu<br />
beachten. Das ist nur mit offensiven struktur<strong>politische</strong>n Maßnahmen, die über den<br />
außenwirtschaftlichen Bereich im engen Sinn hinausgehen, erreichbar. Die beste<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>politik ist eine Wirtschafts- und Standortpolitik, die die heimischen<br />
Unternehmen in die Lage versetzt, im In- und Ausland konkurrenzfähige Produkte zu<br />
entwickeln, zu produzieren und abzusetzen. Daneben bleibt freilich Raum für gezielte<br />
Maßnahmen, z.B. die Vermittlung von Export-Know-hows für Erstexporteure 19 bzw.<br />
zur Erleichterung der Marktdurchdringung in (regionalen und sektoralen) Schlüsselmärkten.<br />
20<br />
Daraus lassen sich einige grundsätzliche Anforderungen an eine strategische österreichische<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>politik ableiten:<br />
• Sie darf nicht strukturkonservierend, sondern muss wettbewerbsstärkend und<br />
marktorientiert sein, einen Abbau staatlicher Interventionen anstreben und auf<br />
eine Minimierung der Budgetbelastung achten. Selbstverständlich müssen alle<br />
Maßnahmen mit den <strong>internationale</strong>n Verpflichtungen Österreichs (vor allem in der<br />
EU, der OECD und der WTO) im Einklang stehen.<br />
• Sie muss integrativ und umfassend sein und alle für die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
der österreichischen Wirtschaft relevanten Politikbereiche – von der<br />
Außen- bis zur Verkehrs- und von der Bildungs- bis zur Umweltpolitik – berücksichtigen.<br />
Die Senkung des Körperschaftssteuersatzes und die Einführung der<br />
Gruppenbesteuerung im Rahmen der Steuerreform 2005 stellen wesentliche<br />
Schritte in diese Richtung dar.<br />
217
• Sie muss auf einer eingehenden Informationsaufbereitung und -analyse beruhen.<br />
Hinsichtlich der dafür notwendigen Infrastruktur, z.B. spezialisierter Universitäts-<br />
oder Forschungseinrichtungen für <strong>internationale</strong> Wirtschaftsfragen, hat Österreich<br />
nicht nur gegenüber großen Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich<br />
und Deutschland, sondern auch gegenüber vergleichbaren Ländern wie Finnland,<br />
Schweden und der Schweiz Nachholbedarf. 21<br />
• Sie kann nicht von oben angeordnet werden, sondern muss den Kooperationsaspekt<br />
in den Mittelpunkt stellen. Das gilt für die Unternehmen, bei denen teilweise<br />
immer noch eine Einzelkämpfermentalität vorherrscht, obwohl erfolgreiche<br />
Cluster-Initiativen, z.B. im Automobilbereich, das Potenzial gut strukturierter Partnerschaften<br />
zeigen. 22 Das gilt aber natürlich auch für Interessensvertretungen<br />
und öffentliche Stellen, z.B. bei der Vertretung österreichischer Interessen in<br />
EU-Gremien und <strong>internationale</strong>n Institutionen oder bei der Koordinierung von<br />
Auslandskontakten. In vielen Fällen wird nur die Zusammenarbeit öffentlicher und<br />
privater Stellen (Public Private Partnerships) zum Erfolg führen.<br />
• Sie muss die Effizienz der Vertretung handels<strong>politische</strong>r Themen auf EU-Ebene<br />
thematisieren. In dem Maß, in dem die Übertragung von Kompetenzen an die<br />
EU voranschreitet, wird es immer wichtiger, österreichische Interessen frühzeitig,<br />
koordiniert und auf allen Ebenen in den europäischen Entscheidungsprozess<br />
einzubringen, auch wenn dieser in Gremien stattfindet, die sich nicht vorrangig<br />
mit Außen<strong>wirtschafts</strong>fragen beschäftigen.<br />
• Sie muss Dienstleistungsexporte gezielt fördern. Einerseits ist davon auszugehen,<br />
dass die Wachstumsdynamik des Dienstleistungshandels sich in Folge technologischer<br />
Entwicklungen und weiterer Liberalisierungsschritte weiter beschleunigen<br />
wird, andererseits haben Dienstleistungsexporte auch eine wichtige Rolle als<br />
Türoffner und Wertschöpfungsfaktor: Kunden suchen immer mehr nicht nach<br />
Produkten, sondern nach „Lösungen“. Nur wer intelligente Produkt/Dienstleistungs-Kombinationen<br />
(Consulting, Finanzierung, Training, etc.) anbietet, hat auf<br />
„high end”-Märkten eine Chance. Wer „nur“ Güter anbietet, verzichtet nicht nur<br />
auf Wertschöpfungspotenziale, sondern kommt auch unter Kostendruck durch<br />
„Niedriglohnkonkurrenz“. In diesem Licht sind z.B. die Überlegungen zur Einrichtung<br />
von „technischen Handelsdelegierten“ bzw. von „Wirtschaftsräten“ in<br />
„Consulting-Hochburgen“ wie Brüssel oder Washington zu sehen. 23<br />
• Sie muss einen Investitionsschwerpunkt setzen. In Ost- und Südosteuropa gehören<br />
österreichische Unternehmen mittlerweile zu den wichtigsten Investoren, der<br />
Internationalisierungsgrad der österreichischen Wirtschaft ist aber immer noch<br />
unterdurchschnittlich. Vor allem im außereuropäischen Raum sind die räumlichen<br />
und kulturellen Distanzen und die damit verbundenen (Markterschließungs- und<br />
218
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
Etablierungs-)Kosten bzw. Risken besonders für mittelständische Unternehmen<br />
trotz des in den 1990er-Jahren aufgebauten Finanzierungs- und Garantiesystems<br />
mitunter immer noch prohibitiv hoch. 24<br />
• Sie muss eine Technologiekomponente aufweisen. Auf welcher Seite der „digital<br />
divide“ sich ein Land positioniert, wird über die Sieger und Verlierer der Globalisierung<br />
entscheiden. Als Beispiel kann die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen<br />
dem BMWA, dem Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und Technologie<br />
(BMVIT), dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst (BMBWK)<br />
und der WKÖ im Büro für Internationale Forschungs- und Technologiekooperation<br />
(BIT) dienen.<br />
• Sie muss einen Bildungsschwerpunkt setzen. Gut ausgebildete und motivierte Arbeitskräfte<br />
sind zu einem der wichtigsten Standortvorteile geworden. Investitionen<br />
in die Aus- und Weiterbildung sind Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit der<br />
österreichischen Wirtschaft – und die beste Arbeitsplatzgarantie, die es gibt. Die<br />
Einrichtung von exportorientierten Fachhochschullehrgängen (auf Initiative bzw.<br />
mit Unterstützung des BMWA) war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung,<br />
weitere, z.B. bei den Sprachkenntnissen von Lehrlingen und Facharbeitern, müssen<br />
folgen. 25<br />
• Sie darf die Öffentlichkeitsarbeit nicht vergessen, sondern muss sich gezielt den<br />
weit verbreiteten Ängsten vor befürchteten negativen Folgen der Globalisierung<br />
stellen und die Notwendigkeit einer an wirtschaftlichen Gegebenheiten orientierten<br />
(Außen-)Wirtschaftspolitik für die österreichische Beschäftigungs- und Wohlstandsentwicklung<br />
vermitteln.<br />
• Sie muss Organisationsfragen thematisieren, um<br />
• die Effizienz der Vertretung handels<strong>politische</strong>r Interessen zu erhöhen, Doppelgleisigkeiten<br />
zu vermeiden, Synergiepotenziale zu nutzen und Kosten zu<br />
senken;<br />
• das Leistungsangebot zu optimieren, die Benutzung für Unternehmen zu<br />
erleichtern und Suchkosten zu reduzieren und<br />
• die Präsenz der österreichischen Wirtschaft im Ausland zu erhöhen.<br />
9.5 Die Internationalisierungsoffensive<br />
„go international“<br />
Diese Überlegungen flossen auch in die Ausarbeitung der Internationalisierungsoffensive<br />
„go international“, die die Bundesregierung gemeinsam mit der WKÖ im vergangenen<br />
Jahr startete und für die in den kommenden Jahren insgesamt 50 Mio. Euro an<br />
219
Budgetmitteln zur Verfügung stehen werden, ein. Als Ziele gaben Bundesminister<br />
Dr. Bartenstein und Wirtschaftskammerpräsident Dr. Leitl anlässlich der Präsentation<br />
von „go international” am 2. Februar 2004 26 vor, „das Außenhandelsvolumen weiter<br />
zu steigern, die Zahl der exportierenden Betriebe zu verdoppeln, den geografischen<br />
Radius der außenwirtschaftlichen Aktivitäten zu erweitern, den Dienstleistungsexport<br />
auch abseits des Tourismus zu forcieren und die Direktinvestitionen im Ausland zu<br />
verstärken. Vor allem außerhalb Europas sollten neue Märkte und Absatzchancen<br />
erschlossen werden.“<br />
„Go international“ beschränkt sich nicht darauf, bestehende Märkte zu sichern und<br />
neue zu öffnen, sondern bemüht sich, die Grundfundamente einer dynamischen, global<br />
orientierten und wissensbasierten Außen<strong>wirtschafts</strong>struktur zu schaffen. Bewusstseinsbildung,<br />
Wissenstransfer und Netzwerkbildung bilden die zentralen Bausteine eines<br />
ressort- und institutionenübergreifenden 27 Maßnahmenkatalogs.<br />
• Bewusstseinsbildung: Für die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung<br />
breites Verständnis zu schaffen und die österreichische Wirtschaft darauf vorzubereiten,<br />
erfordert ein Maßnahmenpaket, das bei der Jugend ansetzt, und über<br />
die Aus- und Weiterbildung hinein in alle Unternehmensebenen, vom Mitarbeiter<br />
bis zum Eigentümer führt.<br />
• Wissenstransfer: Umfassend aufbereitete, laufend aktualisierte und vernetzte<br />
außenwirtschaftlich relevante Informationen und Analysen sind für eine strategische<br />
Ausrichtung der Außen<strong>wirtschafts</strong>politik ebenso notwendig wie für rationale<br />
Unternehmensentscheidungen.<br />
• Netzwerkbildung: Im globalen Zeitalter hängt die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend<br />
von flexiblen Kontaktnetzwerken ab. Das stellt gerade Klein- und Mittelbetriebe,<br />
welche die österreichische Wirtschaftsstruktur prägen, vor große Herausforderungen.<br />
„Go international“ knüpft an die Erfahrungen mit früheren Initiativen, vor allem der<br />
„Exportoffensive 1997“ an. 28 Die Initiative ist um die drei Säulen Warenexport, Dienstleistungsexport<br />
und Direktinvestitionen konzipiert und umfasst insgesamt 30 Maßnahmenpakete<br />
in vier Strategiefeldern:<br />
• Marktzugang und -erschließung,<br />
• Strategien zur Geschäftsanbahnung,<br />
• Know-how und Human Resources,<br />
• Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 29<br />
220
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
9.6 Ein „Außenwirtschaftliches Leitbild“ für Österreich<br />
Eine erfolgreiche Außen<strong>wirtschafts</strong>politik hat notwendigerweise viele Akteure und<br />
stellt hohe Anforderungen an deren Koordinations- und Kommunikationsfähigkeit. Das<br />
BMWA hat diesem Querschnittcharakter und dem sich daraus ergebenden erhöhten<br />
Koordinationsbedarf in der großen Organisationsreform 2002 Rechnung getragen.<br />
Seither ist der Bereich „Außenwirtschaft und Europäische Integration“ als horizontales<br />
„Center“ organisiert. 30 Im Zuge der Vorbereitung von „go international“ fanden,<br />
abgesehen von zahlreichen „bilateralen“ Kontakten, im vergangenen Jahr auch zwei<br />
Workshops statt, zu denen neben den unmittelbar betroffenen Stellen und Institutionen<br />
auch Unternehmen und externe Experten eingeladen wurden. Für vier Themenkreise<br />
(Wirtschaft und Entwicklung, Ausbildung, analytische Informationsaufbereitung und Corporate<br />
Social Responsibility) wurden spezielle ressort- und institutionenübergreifende<br />
Arbeitsgruppen eingerichtet.<br />
Die Bedeutung der Sicherung und weiteren Steigerung der <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit<br />
sowie des Exportpotenzials der österreichischen Wirtschaft für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung Österreichs ist heute ebenso unbestritten wie die Notwendigkeit<br />
einer umfassenden, systematischen und zukunftsorientierten Außen<strong>wirtschafts</strong>politik.<br />
Die Internationalisierungsoffensive „go international“ setzt wesentliche Impulse in diese<br />
Richtung. Weitere müssen folgen.<br />
Den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer „strategischen“ Außen<strong>wirtschafts</strong>politik<br />
könnte die Erarbeitung eines „außenwirtschaftlichen Leitbilds“ Österreichs bilden.<br />
Hauptaufgabe eines Leitbildes ist das Entwickeln einer gemeinsamen Vision „auf welches<br />
Ziel (die) Organisation hinarbeiten soll und wie die Zukunft (noch) erfolgreicher<br />
und wünschenswerter als bislang gestaltet werden kann.“ (Burt Nanus zitiert nach<br />
Lombriser, Abplanalp, 1998, S. 214) Das Leitbild bildet dann die Grundlage für die<br />
Formulierung operativer Ziele und der zu deren Erreichung notwendigen Maßnahmen.<br />
Die entscheidenden Fragen lauten: Wo wollen wir hin? Was soll erreicht werden? Wie<br />
kann es erreicht werden? Wie soll das finanziert werden? (Schekulin, 2003, S. 30)<br />
Im Zentrum eines „außenwirtschaftlichen Leitbilds” könnten folgende Fragen stehen:<br />
Von welchen Kernkompetenzen (d.h. beeinflussbaren Bestimmungsfaktoren) wird die<br />
<strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit Österreichs bzw. österreichischer Unternehmen<br />
in Zukunft (in zehn/…) Jahren abhängen? Welche Maßnahmen sind notwendig/möglich,<br />
um den Erhalt bzw. Aufbau dieser Kernkompetenzen sicherzustellen bzw. zu<br />
ermöglichen? Ein solches Leitbild kann nicht „von oben” verordnet, sondern muss in<br />
einem breiten und transparenten Diskussionsprozess erarbeitet werden. Die Beiträge<br />
in diesem Band verstehen sich als Anstoß zu dieser Diskussion.<br />
221
Literaturverzeichnis<br />
Berger-Boyer, G.; Dernoscheg, K.-H.; Pühringer, O. (1997), Ausgangslage, Zielsetzung und<br />
Maßnahmen der Exportoffensive 1997 der Bundesregierung, in: Bundesministerium für wirtschaftliche<br />
Angelegenheiten (Hrsg.), Der österreichische Außenhandel, Das Jahrbuch 1997,<br />
Wien, S. 353 – 365.<br />
Bichsel, T. (1994), Die strategische Führung der öffentlichen Verwaltung: Grundzüge eines Verfahrens<br />
zur Bestimmung und Einführung einer strategischen Führungskonzeption, Chur/Zürich.<br />
Breuss, F. (1983), Österreichs Außenwirtschaft 1945 – 1982, Wien.<br />
Crafts, N. (2000), Globalisation And Growth In The Twentieth Century, IMF Working Paper,<br />
WP/00/44.<br />
De Mooij, R.; Tang, P. (2003), Four Futures of Europe, CPB Netherlands Bureau for Economic<br />
Policy; Part I.<br />
Europäische Kommission (2002), Responses to the Challenges of Globalisation, A Study on<br />
the International Monetary and Financial System and on Financing for Development, Working<br />
Document SEC (2002)185 final, Brüssel.<br />
EZB (2003), Review of the international role of the Euro, Frankfurt a. M.<br />
Frankel, J. A., Romer, D. (1999), Does Trade Cause Growth? In: American Economic Review,<br />
89 (3), S. 379 – 399.<br />
Helmstedt, K. (1997), Trends und Perspektiven der exportorientierten Aus- und Weiterbildung in<br />
Österreich, in: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (Hrsg.), Der österreichische<br />
Außenhandel, Das Jahrbuch 1997, Wien, S. 387 – 408.<br />
Henneberger, F.; Ziegler, A. (2001), Internationalisierung der Dienstleistungserstellung: Konsequenzen<br />
für den schweizerischen Arbeitsmarkt, HWWA Discussion Paper 149, Hamburgisches<br />
Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA), Hamburg<br />
Hinterhuber, H. H. (1989a), Strategische Unternehmensführung. Band I. Strategisches Denken,<br />
4. Auflage, Berlin/New York.<br />
Hinterhuber, H. H. (1989b), Strategische Unternehmensführung. Band II. Strategisches Handeln,<br />
4. Auflage, Berlin/New York.<br />
Igler, W.; Schekulin, M. (2003), Von Doha nach Cancùn: Die Aussichten für WTO-Investitionsregeln,<br />
in: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (Hrsg.), Der österreichische<br />
Außenhandel, Das Jahrbuch 2003, Wien, S. 301 – 325.<br />
Joyce, P. (2000), Strategy in the Public Sector: A Guide to Effective Change Management,<br />
Chichester.<br />
KGSt (Hrsg.) (2000), Strategisches Management: Leitbericht für Politik und Verwaltungsführung,<br />
KGSt-Bericht 08, Köln.<br />
Lombriser, R.; Abplanalp, P. (1998), Strategisches Management: Visionen entwickeln, Strategien<br />
umsetzen, Erfolgspotentiale aufbauen, 2. Auflage, New York.<br />
Masson, P. (2001), Globalisation: Facts And Figures, IMF Policy Discussion Paper.<br />
222
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
Monahan, K. E. (2000), Balanced Measures for Strategic Planning: A Public Sector Handbook,<br />
Vienna/VA.<br />
Moore, M. (1995), Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge/<br />
Mass.<br />
Mussa, M. (2000), Factors Driving Global Economic Integration, abrufbar unter:<br />
http://www.kc.frb.org/PUBLICAT/SYMPOS/2000/mussa.pdf. (Zugriff erfolgte am 20. April<br />
2004)<br />
Ösze D., (2000), Managementinformationen im New Public Management, Bern/Stuttgart/<br />
Wien.<br />
Reeh, K. (1997), Die Erfassung des <strong>internationale</strong>n Handels mit Dienstleistungen: Am Ende<br />
nicht nur eine Herausforderung für die Statistik, in: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten<br />
(Hrsg.), Der österreichische Außenhandel, Das Jahrbuch 1996, Verlag Österreich,<br />
Wien 1997<br />
Schekulin, M. (2003), Strategische Führung in der Öffentlichen Verwaltung (Diplomarbeit),<br />
Wien.<br />
Schertler, W. (2003), Strategisches Management (Vorlesungsunterlage), Wien.<br />
Schweizer Bundesrat (2002), Herausforderungen 2003 – 2007, Trendentwicklungen und mögliche<br />
Zukunftsthemen für die Bundespolitik, Bericht des Perspektivstabs der Bundesverwaltung,<br />
Bern.<br />
Simon, H.; von der Gathen, A. (2002), Das große Handbuch der Strategieinstrumente: Werkzeuge<br />
für eine erfolgreiche Unternehmensführung, Frankfurt a.M./New York.<br />
UNCTAD (2003), World Investment Report. FDI Policies for Development: National and International<br />
Perspectives, Genf.<br />
Weltbank (1995), World Development Report, Workers in an Integrating World, Washington<br />
D.C.<br />
Wolfmayr-Schnitzer, Y.; Falk, R.; Kletzan, D.; Köppl, A.; Stankovsky, J.; Url, T. (2003), Evaluierung<br />
von interessanten Absatzmärkten und Exportpotentialen für die österreichische Wirtschaft.<br />
Zusammenfassung und Wirtschaftliche Schlussfolgerungen, Studie im Auftrag des Bundesministeriums<br />
für Finanzen, WIFO, Wien.<br />
WTO (2003), World Trade Report 2003, Genf.<br />
Anmerkungen<br />
* Sektionschef Mag. Josef Mayer ist Leiter des Centers 2 Außen<strong>wirtschafts</strong>politik und Europäische<br />
Integration im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit in Wien.<br />
Dr. Manfred Schekulin ist Leiter der Abteilung Export- und Investitionspolitik im Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Arbeit in Wien.<br />
Dr. Franz Müller ist Mitarbeiter der Abteilung Export- und Investitionspolitik im Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Arbeit in Wien.<br />
1 Vgl. z.B. Schweizer Bundesrat, 2002, S. 105.<br />
223
2 Vgl. den Beitrag von Ceska, Kapitel 10, in diesem Band.<br />
3 Grundlegend im deutschsprachigen Raum Hinterhuber (1989a und 1989b).<br />
4 Im angelsächsischen Bereich hat sich seit Anfang der 1990er-Jahre der Begriff Strategic<br />
Public Management (SPM) eingebürgert (grundlegend Moore, 1995) und ist zu einem festen<br />
Bestandteil der akademischen Diskussion geworden (z.B. Monahan, 2000, Joyce, 2000).<br />
5 Etwas differenzierter stellt sich die Situation hinsichtlich des Einsatzes der in der Managementliteratur<br />
entwickelten strategischen Instrumente (für einen Überblick s. z.B. Simon,<br />
Gathen, 2002) dar: Manche lassen sich ohne weiteres auf den Nonprofit-Bereich übertragen,<br />
andere, vor allem kapitalmarktorientierte (Shareholder Value-)Ansätze, hingegen kaum.<br />
Wieder andere, zu denen Portfolioanalyse und Balanced Scorecard gehören, müssen auf<br />
die Bedürfnisse des öffentlichen Sektors angepasst werden – was ihrer Popularität freilich<br />
keinen Abbruch getan hat (vgl. Schekulin, 2003, insbes. S. 37).<br />
6 Mussa (2000), setzt den Beginn auf die Renaissance.<br />
7 Das 19. Jahrhundert war übrigens von einer ähnlichen „Globalisierungswelle“ geprägt: Zwischen<br />
1820 und 1913 stieg das Verhältnis der Weltexporte zur Produktion von etwa 1 % auf<br />
rd. 9 %, bevor es in Folge von zwei Weltkriegen und einer von Rezession und Protektionismus<br />
geprägten Zwischenkriegszeit bis 1950 auf rd. 5 % zurückfiel. (Vgl. De Mooij, Tang, 2003,<br />
S. 27f.)<br />
8 Vgl. dazu Reeh, K. (1996), sowie den Beitrag von Kronberger, Wörz, Kapitel 14, in diesem<br />
Band, insbes. Abschnitt 14.2.2.<br />
9 Quelle: Internet Systems Consortium, http://www.isc.org<br />
10 Zu den Wachstumseffekten des Außenhandels siehe z.B. Frankel, Romer (1999).<br />
11 Zur Tendenz, in präferenzielle Handelsabkommen auch Investitionsregeln aufzunehmen s.<br />
z.B. Igler, Schekulin, 2003, insbes. S. 313f.<br />
12 Jeweils ohne EU-Binnen-Handel.<br />
13 Kleine Volkswirtschaften haben wegen der kleineren nationalen Beschaffungs- und Absatzmärkte<br />
mehr oder weniger zwangsläufig eine überdurchschnittliche Handelsverflechtung mit<br />
dem Ausland.<br />
14 Vgl. die Beiträge von Moser, Kapitel 13, und Nowotny, Kapitel 15, in diesem Band.<br />
15 Von den kleineren Mitgliedern der EU-15 haben neben Österreich nur Luxemburg und Griechenland<br />
auch ein Defizit in der Warenverkehrsbilanz.<br />
16 Vgl. den Beitrag von Wolfmayr, Kapitel 11, in diesem Band, insbes. Abschnitt 11.4.1.<br />
17 2002 blieben 62 % der österreichischen Extra-EU-15-Exporte in Europa. Das war (vor Griechenland<br />
mit 60 %) der höchste Wert aller EU-Mitgliedsländer, der EU-Durchschnittswert lag<br />
bei 32 %. Umgekehrt machte Nordamerika 15 % der österreichischen Exporte aus, damit lag<br />
Österreich (vor Griechenland mit 11 %) EU-weit auf dem vorletzten Rang; der EU-Durchschnitt<br />
lag bei 27 %.<br />
224
Josef Mayer, Franz Müller, Manfred Schekulin<br />
18 Österreichs Ausgaben für Patente und Lizenzen lagen 2003 bei 887 Mio. Euro, denen Einnahmen<br />
von 136 Mio. Euro gegenüber standen. Die Deckungsquote betrug 15 %. Dem steht<br />
eine Deckungsquote der EU-15 von 63 % (2002) gegenüber.<br />
19 Vgl. den Beitrag von Koren, Kapitel 12, in diesem Band.<br />
20 Zur Definition von Schwerpunktmärkten siehe z.B. Wolfmayr et al. (2003).<br />
21 Vgl. den Beitrag von Landesmann, Wörz, Kapitel 17, in diesem Band.<br />
22 Vgl. den Beitrag von Hochgatterer, Pöchhacker, Kapitel 16, in diesem Band.<br />
23 Vgl. den Beitrag von Nowotny, Kapitel 15, in diesem Band.<br />
24 Vgl. den Beitrag von Moser, Kapitel 13, in diesem Band.<br />
25 Vgl. Helmstedt (1997) sowie den Beitrag von Steindl, Kapitel 18, in diesem Band.<br />
26 Ein erstes Maßnahmenpaket („Quick-Start-Package“) war noch im September 2003 fertig<br />
gestellt worden.<br />
27 Weitere Kooperationspartner sind z.B. die Austrian Development Agency (ADA), die Austria<br />
Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (AWS), die Industriellenvereinigung (IV), die Kontrollbank<br />
(OeKB) und die Österreich Werbung (ÖW).<br />
28 Die Exportoffensive 1997 war Gegenstand des Jahresthemas des Außen<strong>wirtschafts</strong>jahrbuchs<br />
1997; zu Zielsetzung und Maßnahmen vgl. z.B. Berger-Boyer et al. (1997).<br />
29 Vgl. den Beitrag von Ceska, Kapitel 10, in diesem Band, insbes. Abschnitt 10.2.; für weitergehende<br />
Informationen einschließlich einer Liste aller Maßnahmen s. http://www.go-international.<br />
at.<br />
30 Gleichzeitig wurde eine Zuständigkeit für „Grundsätzliche und <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Fragen<br />
der Außenwirtschaft“ eingerichtet.<br />
225
10 DIE STABSSTELLE FÜR STRATEGISCHE<br />
AUSSENWIRTSCHAFT<br />
Franz Ceska*<br />
Das Regierungsprogramm der österreichischen Bundesregierung sieht eine Internationalisierungsoffensive<br />
für die österreichische Wirtschaft vor, welche Warenexporte,<br />
Dienstleistungsexporte und Direktinvestitionen forcieren soll. Im Rahmen dieser Internationalisierungsoffensive<br />
wurde eine „Stabsstelle für Strategische Außenwirtschaft“<br />
im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) eingerichtet. Aufbauend<br />
auf große Erfolge der österreichischen Außenwirtschaft in den letzten Jahren, wie<br />
sie in den Kapiteln vier bis acht dargestellt wurden, stellt sich die Ausgangslage für<br />
die Stabsstelle für Strategische Außenwirtschaft samt ihren volkswirtschaftlichen<br />
Prämissen wie folgt dar:<br />
Österreichs Außenwirtschaft (Warenexporte, Dienstleistungsexporte, ausländische<br />
Direktinvestitionen) ist im <strong>internationale</strong>n Vergleich hervorragend positioniert. Das<br />
Warenexportvolumen steigt weiter an – nach einem flacheren Wachstum 2003 prognostiziert<br />
das IHS für das Jahr 2004 einen Zuwachs von 5,1 %, und das bei einem<br />
EU-Durchschnitt von zuletzt minus 3 % und trotz weltweiter Konjunkturschwäche und<br />
starkem Euro gegenüber dem Dollar.<br />
Die Dienstleistungsexporte erreichten 2002 mit über 36 Mrd. Euro fast das halbe<br />
Niveau der Warenexporte; der österreichische Weltmarktanteil an den Dienstleistungsexporten<br />
ist mit über 2 % doppelt so hoch wie im Warenexportbereich – Österreich ist<br />
damit auf Platz 13 unter den Welt-Dienstleistungsexporteuren.<br />
Die Direktinvestitionsentwicklung erreichte 2002 mit ausländischen Direktinvestitionen<br />
von 6 Mrd. Euro und einem Plus von 71 % gegenüber dem Vorjahr den zweithöchsten<br />
je verzeichneten Wert, dies gegen <strong>internationale</strong>n Trend (laut UNCTAD-Studie<br />
Rückgang 25 %).<br />
Beim BIP-Anteil der Außenwirtschaft übertrifft Österreich mit rd. 53 % die meisten<br />
EU-Länder vergleichbarer Größe (Dänemark: 45 %, Finnland: 39 %, Portugal: 30 %,<br />
Schweden: 43 %). Nur Belgien (84 %), Irland (94 %) und die Niederlande (63 %)<br />
weisen noch höhere Werte auf.<br />
Ein Prozent Warenexportsteigerung bedeutet 10.000 neue Arbeitsplätze. Dienstleistungsexporte<br />
für 1.000 Euro ziehen Warenexporte für rund 7.000 Euro nach sich.<br />
Direktinvestitionen, sowohl aktiv als auch passiv, schaffen und sichern Arbeitsplätze<br />
sowohl in Österreich als auch im Ausland.<br />
Ziel muss es sein, diese Wettbewerbsposition der österreichischen Außenwirtschaft<br />
zu festigen und weiter auszubauen und die Internationalisierung der österreichischen<br />
Wirtschaft weiter voranzutreiben. Daher startete die österreichische Bundesregierung<br />
in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Internationalisierungs-<br />
226
Franz Ceska<br />
offensive. Diesen Prozess strategisch auszurichten, zu begleiten und, wo nötig, zu<br />
koordinieren, ist Aufgabe der Stabsstelle für Strategische Außenwirtschaft.<br />
10.1 Die Aufgaben der Stabsstelle<br />
Türöffnerfunktion:<br />
Als Anlaufstelle für außen<strong>wirtschafts</strong>orientierte Unternehmen wird die Stabsstelle<br />
österreichische Unternehmen für Exporte in Zielländer, in denen eine entsprechende<br />
<strong>politische</strong> Flankierung notwendig und sinnvoll ist, entsprechend unterstützen. Außen<strong>wirtschafts</strong>bezogene<br />
Unternehmensanliegen sollen in Kontakt mit den zuständigen<br />
<strong>politische</strong>n Entscheidungsträgern im Ausland und im Inland einer erfolgreichen Lösung<br />
zugeführt werden.<br />
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik:<br />
Die Stabsstelle nützt Synergien mit bestehenden Institutionen wie der erfolgreichen<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation (AWO) der WKÖ und bietet ein ergänzendes Service<br />
an.<br />
Zielmarktdefinition:<br />
Potenzielle Zukunfts- und Wachstumsmärkte sollen definiert und ausgelotet werden,<br />
die Unternehmen sollen bei der Erschließung dieser Märkte begleitet werden. Dabei<br />
wird eine Bestandsaufnahme potenzieller Märkte durchzuführen und mit den Erwartungshaltungen<br />
der Unternehmen abzugleichen sein, um entsprechende Empfehlungen<br />
für Markterschließungsstrategien erarbeiten und zielgerichtete Instrumentarien<br />
anbieten zu können. In diesem Zusammenhang soll ein strategisches Programm für<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>missionen erstellt werden.<br />
Strategische Definition von Internationalisierungsmaßnahmen:<br />
Im Zuge der Ausgestaltung von Maßnahmen und Instrumenten der Internationalisierungsoffensive<br />
ist es Aufgabe der Stabsstelle, ein strategisches Konzept zu erstellen,<br />
das die <strong>politische</strong>n Zielsetzungen und die Interessen der Unternehmen strategisch<br />
bündelt, um auf der Grundlage eines breiten Dialogs mit möglichst allen Stakeholdern<br />
der österreichischen Außenwirtschaft ein optimales Design dieser Instrumentarien<br />
und ihren bestmöglichen Einsatz im Interesse der österreichischen Außenwirtschaft<br />
zu gewährleisten.<br />
227
10.2 „Go international“ –<br />
Die Internationalisierungsoffensive<br />
Die Internationalisierungsoffensive unter dem Titel „go international“ ist zwar als<br />
Nachfolgeprojekt der Exportoffensive anzusehen, unterscheidet sich jedoch allein in<br />
quantitativer Hinsicht nachhaltig von dieser: Für „go international“ werden allein an<br />
Bundesmitteln 50 Mio. Euro aufgewendet. Diese neue quantitative Dimension erfordert<br />
auch einen anderen qualitativen Zugang.<br />
10.2.1 „Go international“ – Hintergrund<br />
Dementsprechend waren für die strategische Entwicklung von Instrumenten im Rahmen<br />
von „go international“ folgende Überlegungen maßgeblich:<br />
• Drei-Säulen-Approach: Warenexporte, Dienstleistungsexporte und ausländische<br />
Direktinvestitionen, sowohl aktiv als auch passiv, bilden die drei Säulen der österreichischen<br />
Außenwirtschaft. Maßnahmen im Rahmen von „go international“<br />
müssen über den reinen Warenexport hinaus in allen drei Bereichen spürbar<br />
wirksam werden.<br />
• Stakeholder Value: Besonders wichtig erscheint es, Ideen und Interessen aller<br />
beteiligten Gruppen von Wirtschaft über Wirtschaftsforschung, Interessensvertretungen<br />
und öffentliche Verwaltung bestmöglich in den Prozess einzubringen.<br />
• Markterschließung: Alle Instrumente müssen letztlich zum Ziel haben, bestehende<br />
Marktzutrittshindernisse überwinden und Markterschließungskosten senken zu<br />
helfen.<br />
• Flexibilität: Die zu definierenden Maßnahmen müssen die erforderliche Flexibilität<br />
aufweisen, um<br />
• spezifische Stärken der österreichischen Außenwirtschaft (z.B. Marktanteil auf<br />
bestimmten Zielmärkten v.a. in Osteuropa, starke Stellung auf Nischenmärkten)<br />
zu unterstützen und strukturelle Schwächen (z.B. zuwenig Weltmarken,<br />
mangelnde Präsenz auf Hoffnungsmärkten) beseitigen zu helfen.<br />
• sowohl Kleinunternehmen, die erstmals in den Export gehen wollen, als auch<br />
Exportprofis, die neue Märkte erschließen wollen, entsprechend Unterstützung<br />
anbieten zu können.<br />
• für Zielmärkte mit besonderem Potenzial länder- oder regionenspezifische<br />
Maßnahmenpakete anbieten zu können.<br />
• Hebelwirkung: Die Maßnahmen sind so angelegt, dass sie über ihren eigentlichen<br />
Wirkungsbereich hinaus Folgewirkungen für die österreichische Wirtschaft haben,<br />
welche die eingesetzten Mittel weiter verstärken. Statt Einmaleffekten sollen<br />
228
Franz Ceska<br />
vielschichtige außenwirtschaftliche Effekte auch struktureller Natur generiert werden.<br />
• Nachhaltigkeit: Die Wirkung der Instrumentarien der Internationalisierungsoffensive<br />
soll nicht kurzfristig und punktuell, sondern nachhaltig, langfristig und weiterwirkend<br />
sein, so dass sie in Verbindung mit der erhofften Hebelwirkung für die österreichische<br />
Volkswirtschaft von dauerhaftem Nutzen ist.<br />
• Strukturelle Wirkung: Es geht beim Instrumentarium der Internationalisierungsoffensive,<br />
so wie es als Ergebnis des breiten Dialoges und insbesondere der<br />
Verhandlungen mit der WKÖ formuliert wurde, nicht um punktuelle Projektförderungen,<br />
sondern um Maßnahmen mit weitreichenden Struktureffekten. Demgemäß<br />
wurde insbesondere auch auf Aus- und Weiterbildung größter Wert gelegt.<br />
• Prinzip der Kofinanzierung: Österreichische Unternehmen, welche ihre außenwirtschaftlichen<br />
Aktivitäten, Exporte oder Direktinvestitionen beginnen oder weiterentwickeln<br />
wollen, werden in diesem Bemühen durch Kofinanzierung unterstützt,<br />
müssen allerdings Eigenmittel einbringen und somit einen Teil des Risikos übernehmen.<br />
Dies ist nach Auffassung der Stabsstelle eine Grundvoraussetzung dafür,<br />
dass wohlüberlegte und chancenreiche außenwirtschaftliche Aktivitäten zustande<br />
kommen.<br />
10.2.2 Strategiefelder von „go international“<br />
Die Maßnahmen von „go international“ umfassen im Wesentlichen vier Strategiefelder.<br />
Wirksame Unterstützung von Unternehmen bei Marktzugang und Markterschließung:<br />
• Durch spezielle Incentives für Erstexporteure, die in einem dreistufigen Prozess<br />
begleitet werden: Branchenfokussierte Marktinformationsveranstaltungen im Inland<br />
werden durch gezielte Geschäftsanbahnungsmissionen im Ausland ergänzt<br />
und durch unternehmensspezifische Beratungsleistungen im Zielland komplettiert.<br />
(Siehe dazu auch Kapitel 12)<br />
• Durch Senkung der Markterschließungskosten für alle Unternehmen durch Kofinanzierung<br />
unternehmens- und sektorspezifischer Markterschließungsstudien<br />
und die Sicherung eines effizienten und international kompetitiven Exportfinanzierungssystems<br />
ebenso wie etwa die Fertigstellung einer Business to Business<br />
(B2B)-Plattform als unmittelbare Geschäftsanbahnungsdrehscheibe.<br />
• Durch branchenspezifische Komplettpakete für Zielmärkte mit besonderem Potenzial:<br />
„Go international“ enthält mehrere solche für Branchen und Zielmärkte<br />
maßgeschneiderte Full Service-Angebote; im Quick-Start-Package ist etwa be-<br />
229
eits ein „Aktionsschwerpunkt Infrastruktur- und Umwelttechnologie für Ost- und<br />
Südosteuropa“ verwirklicht. Dies umfasst sektorspezifische Markterschließungsstudien,<br />
Informationsveranstaltungen im Inland und B2B-Veranstaltungen in den<br />
Zielländern, abgerundet durch eine Kommunikationsstrategie und Betreuung durch<br />
Branchenkoordinatoren und Key Accountants im Zielland.<br />
• Durch spezielle Schwerpunkte in den Bereichen Dienstleistungsexport und Direktinvestitionen.<br />
Intelligente Strategien zur Geschäftsanbahnung:<br />
• Messebeteiligungen werden neu strukturiert. Eine regionenspezifische Staffelung<br />
der Kofinanzierung stellt sicher, dass dieses Instrument vermehrt zur Bearbeitung<br />
neuer Märkte eingesetzt werden wird.<br />
• Verstärkung alternativer Strategien und Vorfeldmaßnahmen zur Geschäftsanbahnung.<br />
So werden die Teilnahme österreichischer Unternehmen an wissenschaftlichen<br />
Fachkongressen und Symposien unterstützt und die Kooperation mit<br />
<strong>internationale</strong>n Forschungseinrichtungen und multilateralen Entwicklungsbanken<br />
mit Blick auf Auftragsakquisitionen verstärkt. Besonders aktuelle Schwerpunkte<br />
sind Kyoto und Projekte mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit.<br />
Maßnahmen im Bereich Human Resources und Know-how:<br />
• Unterstützung innerbetrieblicher Weiterbildungsprogramme mit außenwirtschaftlichem<br />
Schwerpunkt ebenso wie die Inanspruchnahme externen Know-hows, sei<br />
es individuelle Exportberatung im Inland oder Export-Coaching im Ausland, da<br />
außenwirtschaftliche Kompetenz ein ebenso entscheidender Erfolgs- wie Kostenfaktor<br />
für Unternehmen ist. Export Angels werden Unternehmen bei ihren ersten<br />
Internationalisierungsschritten begleiten.<br />
• Internationale Vermarktung von Forschungsergebnissen und Produktinnovationen<br />
als eigener Schwerpunkt.<br />
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen:<br />
• Absatz-, Image- und Standortförderungsmaßnahmen im Ausland, jedoch auch eine<br />
umfassende Aufbereitung und Darstellung aller außenwirtschaftlich relevanten<br />
Informationen und eine professionelle, effiziente Begleitung der Unternehmen<br />
durch Marketingkleinbüros in Hoffnungsmärkten sowie verbesserter Zugang zu<br />
Aufträgen aus EU-Projekten durch Informationsvernetzung und Aufstockung des<br />
nationalen Kofinanzierungsanteils.<br />
230
10.2.3 Die Umsetzung<br />
Franz Ceska<br />
Finanzierung und Konstituierung<br />
Da die Bundesmittel für „go international“ im Doppelbudget der Jahre 2003 und 2004<br />
mit jeweils 25 Mio. Euro angesetzt waren, war die vordringliche Aufgabe der Stabsstelle<br />
im Jahre 2003 die Erarbeitung – auf der Grundlage eines breiten Dialogs mit<br />
allen Stakeholdern – eines Instrumentariums zum optimalen Einsatz der vorhandenen<br />
finanziellen Mittel.<br />
Eile war geboten: Das Doppelbudget wurde im Frühsommer 2003 vom Parlament beschlossen.<br />
Aus finanztechnischen und budgetären Gründen musste jedenfalls noch im<br />
Jahre 2003 mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen werden, welche im Sommer<br />
2003 definiert worden waren. Dementsprechend führte die Stabsstelle mit zahlreichen<br />
<strong>politische</strong>n Entscheidungsträgern, angefangen vom Bundespräsidenten über den Präsidenten<br />
und die Vizepräsidenten des Nationalrates, die Ressortchefs und Spitzenbeamten<br />
der für die Außenwirtschaft besonders relevanten Ministerien, insbesondere dem<br />
Bundesminister und dem Staatssekretär für Finanzen, der Bundesministerin für auswärtige<br />
Angelegenheiten, den Bundesministern für Inneres, für Justiz etc. ausführliche<br />
Gespräche. Besonders intensiv gestaltet sich der laufende Dialog mit der WKÖ, vor allem<br />
deren Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation, der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB),<br />
der Industriellenvereinigung (IV) und der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH<br />
(AWS). Ausführliche Kontakte mit den für die österreichischen Unternehmen in der Regel<br />
ersten Anlaufstellen für außenwirtschaftliche Aktivitäten, den Banken, erwiesen sich als<br />
besonders wichtig und fruchtbar. Strukturierte Gespräche mit den Landeshauptleuten<br />
und Wirtschaftsressortchefs der Bundesländer Wien, Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich,<br />
denen Gespräche mit den übrigen Bundesländern folgen werden, lieferten<br />
bedeutende Informationen über die außenwirtschaftlichen Instrumentarien der Länder,<br />
wodurch bei der Gestaltung des Maßnahmenpakets von „go international“ einerseits<br />
Doppelgleisigkeiten vermieden und andererseits sinnvolle komplementäre Maßnahmen<br />
definiert werden konnten. Am 3. Juli 2003 und auch am 16. Dezember 2003 veranstaltete<br />
die Stabsstelle im BMWA Workshops, zu denen neben den oben erwähnten<br />
Stellen auch außenwirtschaftlich besonders aktive und erfahrene Unternehmen sowie<br />
Wirtschaftsforschungsinstitute eingeladen wurden.<br />
Maßnahmen im Jahre 2003<br />
Diese intensiven Konsultationen bildeten gemeinsam mit dem Fundus an Expertise<br />
des BMWA die Grundlage für die Erarbeitung des Maßnahmenpaketes von „Go International“,<br />
von dem ein Teilpaket, das sogenannte „Quick-Start-Package“ am 8. September<br />
2003 vom Herrn Bundeskanzler, Herrn Bundesminister Bartenstein und Herrn<br />
231
Präsidenten Leitl der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dieses Quick-Start-Package<br />
umfasst Maßnahmen im Ausmaß von etwa 17 Mio. Euro.<br />
Die Instrumente zur Unterstützung der österreichischen Außenwirtschaft in diesem<br />
Paket mussten mehrere Kriterien erfüllen:<br />
• Die Maßnahmen mussten rasch anwendbar sein, da noch im Jahre 2003 mit ihrer<br />
Umsetzung begonnen werden musste.<br />
• Es wurden nur Maßnahmen aufgenommen, die sich auch im Gesamtpaket wieder<br />
finden würden.<br />
• Daher mussten die Instrumente des Quick-Start-Package auch den oben angeführten<br />
Kriterien entsprechen.<br />
Wichtig ist ein geeignetes Informationskonzept, welches die interessierten beziehungsweise<br />
in Frage kommenden österreichischen Unternehmen auf die Möglichkeiten und<br />
Instrumentarien von „go international“ aufmerksam macht. Dazu war es und ist es einerseits<br />
erforderlich, das Quick-Start-Package – und in weiterer Folge das Gesamtpaket<br />
– durch das BMWA sowie durch die WKÖ im Internet zu präsentieren. Entscheidend<br />
ist jedoch eine Kommunikationsstrategie, welche aktiv auf die Unternehmen zugeht<br />
und sie veranlasst, sich konkret des angebotenen Instrumentariums zu bedienen.<br />
Dem Zweck der Information dienten auch Vorträge der Stabsstelle gemeinsam mit<br />
Referenten der WKÖ, vor Landeskammern, regionalen Unternehmerverbänden und<br />
diversen anderen Wirtschaftsforen.<br />
Das Gesamtpaket der Internationalisierungsoffensive wurde nach dem bereits oben<br />
erwähnten abschließenden Workshop noch im Dezember 2003 fertig gestellt und<br />
von Herrn Bundesminister Bartenstein sowie dem Präsidenten der WKÖ, Dr. Leitl, in<br />
einer Pressekonferenz am 2. Februar 2004 präsentiert. Unter Einschluss des Quick-<br />
Start-Package stehen für die Maßnahmen des Gesamtpakets insgesamt 100 Mio.<br />
Euro zur Verfügung – 50 Mio. Euro Bundesmittel und 50 Mio. Euro aus den laufenden<br />
Initiativen der WKÖ.<br />
10.3 Ausblick<br />
Um ihrer Aufgabe der Erstellung einer Zielmarktdefinition nachzukommen, führt die<br />
Stabsstelle umfangreiche Vorarbeiten durch, die es ihr ermöglichen sollen, Prioritäten<br />
bei der Definition außenwirtschaftlich besonders bedeutsamer Regionen und Länder<br />
zu erstellen, in denen besondere Bemühungen, auch <strong>politische</strong>r Natur, sinnvoll<br />
erscheinen, um das noch unausgeschöpfte Potenzial dieser Märkte für Österreichs<br />
Außenwirtschaft zu nutzen. So werden, in intensiver Zusammenarbeit mit dem Netz<br />
der österreichischen Botschaften und den Außenhandelsdelegationen, das Potenzial,<br />
232
Franz Ceska<br />
die <strong>politische</strong>n und rechtlichen Rahmenbedingungen, die wirtschaftliche Präsenz<br />
vergleichbarer EU-Staaten in diesen Ländern und Ähnliches erhoben.<br />
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang eine Studie des Österreichischen<br />
Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) im Auftrag der OeKB im Namen<br />
des Bundesministeriums für Finanzen betreffend interessante Absatzmärkte und<br />
Exportpotenziale für die österreichische Industrie, welche der Stabsstelle für ihre<br />
Zielmarktdefinition zur Verfügung steht.<br />
Bei der schwierigen Aufgabe, sinnvolle Prioritäten bezüglich Marktpotenziale vorzuschlagen,<br />
wird einerseits auf die kurz- und mittelfristigen Wünsche der österreichischen<br />
außenwirtschaftlich interessierten Unternehmen, gleichzeitig aber auch auf die langfristigen<br />
Potenziale künftiger Wachstumsmärkte einzugehen sein.<br />
Die laufende <strong>politische</strong> Unterstützung konkreter österreichischer Unternehmensanliegen<br />
im Ausland ist eine Aufgabe der Stabsstelle, welche von österreichischen Firmen<br />
zunehmend in Anspruch genommen wird. Die Stabsstelle arbeitet hier direkt und<br />
unbürokratisch mit dem weltweiten Netzwerk, vor allem den österreichischen Botschaften<br />
und Handelsdelegationen zusammen. Sie führt aber auch direkte Interventionen<br />
zugunsten der österreichischen Wirtschaft durch, wie dies zum Beispiel im Rahmen<br />
des offiziellen Besuches des Präsidenten des österreichischen Nationalrates, Univ.<br />
Prof. Dr. Andreas Khol in Syrien und Saudi Arabien der Fall war, welcher zu diesem<br />
Zweck von mir als Leiter der Stabsstelle begleitet wurde. Ebenfalls beispielhafte Erwähnung<br />
finden soll in diesem Zusammenhang ein bilateraler Besuch der Stabsstelle<br />
in Kasachstan, wo neben <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Gesprächen unter anderem mit dem<br />
Premierminister und dem Außenminister die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der<br />
Flugverbindungen durch die AUA erläutert wurde.<br />
Zusammenfassend lassen sich die wesentlichen Aufgaben der Stabsstelle für das<br />
Jahr 2004 wie folgt resümieren:<br />
• Umsetzung und strategische Begleitung des Maßnahmenpakets von „Go International“,<br />
• Erarbeitung der Zielmarktdefinition prioritärer potenzieller Märkte und entsprechende<br />
Erstellung eines strategisch außenwirtschaftlich relevanten Besuchsprogramms<br />
im Ausland sowie<br />
• laufende, sich verstärkende Betreuung österreichischer Unternehmen auf Auslandsmärkten,<br />
wo eine <strong>politische</strong> Begleitung sinnvoll ist.<br />
Anmerkungen<br />
* Botschafter Dr. Franz Ceska, ehemaliger Generalsekretär der Industriellenvereinigung, ist<br />
Sonderbeauftragter des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und Leiter der Stabsstelle<br />
für Strategische Außenwirtschaft.<br />
233
11 AUSSENHANDELSSTRUKTUR DER<br />
ÖSTERREICHISCHEN INDUSTRIE<br />
Yvonne Wolfmayr*<br />
11.1 Einleitung<br />
Das Spezialisierungsmuster im <strong>internationale</strong>n Handel ist ein Spiegel des technologischen<br />
Entwicklungsstandes eines Landes. Unterschiede im technologischen Profil<br />
einzelner Länder begründen nationale Wettbewerbsvorteile und haben damit unmittelbare<br />
Auswirkungen auf die erzielbaren Einkommen einer Volkswirtschaft. Die<br />
Beobachtung von Spezialisierungsmustern im <strong>internationale</strong>n Handel liefert damit<br />
einen wichtigen Befund über die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische<br />
Leistungsfähigkeit eines Landes. Peneder (2002) weist nach, dass zwischen<br />
den einzelnen Wirtschaftszweigen systematische Unterschiede sowohl in Bezug auf<br />
die Einkommenselastizität der Nachfrage und damit der durchschnittlichen Wachstumsperformance,<br />
die qualitative Differenzierbarkeit der angebotenen Waren als auch<br />
hinsichtlich der Arbeitsproduktivität bestehen. Für technologieorientierte, humankapital-<br />
und wissensintensive Industrien lässt sich ein überdurchschnittliches Wachstum<br />
der Arbeitsproduktivität beobachten. Weiters ist in Ländern mit überdurchschnittlich<br />
hohem Anteil von Industrien dieser Art das BIP-Wachstum pro Kopf höher.<br />
Seit den 1980er-Jahren deuten verschiedene Untersuchungen der strukturellen Position<br />
der österreichischen Industrie – des dem <strong>internationale</strong>n Wettbewerb am stärksten<br />
ausgesetzten Sektors – auf eine Reihe von Schwächezeichen bezüglich einer Spezialisierung<br />
auf moderne, wachstumsorientierte und technologisch anspruchsvolle<br />
Produktionszweige hin (Aiginger, 1987; Hutschenreiter - Peneder, 1997; Peneder,<br />
2002). Im Vergleich der Industrieländer sind die österreichischen Produktionsstrukturen<br />
von einer zu großen Spezialisierung auf Branchen mit mittlerem bis niedrigem<br />
Technologieniveau geprägt.<br />
Der folgende Beitrag setzt hier auf, beschreibt die Entwicklung seither und gibt einen<br />
neuerlichen Befund zur Brachenstruktur der österreichischen Industrie. Kapitel 11.2<br />
gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten theoretischen Ansätze zur Erklärung<br />
<strong>internationale</strong>r Spezialisierungsmuster in der Außenhandelsliteratur. Danach werden<br />
die methodischen Grundlagen zur Analyse des österreichischen Branchenprofils<br />
beschrieben. In Kapitel 11.4 werden die sektorale Position Österreichs sowie deren<br />
Veränderung im Zeitraum 1995 bis 2002 analysiert. Kapitel 11.5 beschreibt die besondere<br />
Rolle der Ostöffnung für den Strukturwandel. Kapitel 11.6 fasst zusammen<br />
und versucht Herausforderungen für die Strukturpolitik zu skizzieren.<br />
234
11.2 Theoretische Ansätze<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
Die Außenhandelstheorie bietet unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der Spezialisierungsmuster<br />
von Ländern im <strong>internationale</strong>n Handel.<br />
Die Traditionelle Außenhandelstheorie erklärt unterschiedliche Spezialisierungsmuster<br />
aus den spezifischen Standortvorteilen von Ländern, die zu Kostenvorteilen in der<br />
Produktion, den so genannten komparativen Vorteilen führen. Diese relativen Kostenvorteile<br />
können auf Unterschieden in den verfügbaren Technologien und somit der<br />
Arbeitsproduktivität (Ricardo-Modell) oder der Faktorausstattung (Heckscher-Ohlin-<br />
Modell) bzw. sektorspezifischen Produktionsfaktoren (Ricardo-Viner-Modell) beruhen.<br />
Jedes Land spezialisiert sich entsprechend seinen komparativen Vorteilen und importiert<br />
Waren, die es selbst teuer produzieren müsste. Dieser traditionelle Ansatz erklärt<br />
das Spezialisierungsmuster des inter-industriellen Handels.<br />
Im Gegensatz dazu erklärt die so genannte Neue Außenhandelstheorie im Wesentlichen<br />
das Phänomen des intra-industriellen Handels – des Handels zwischen Ländern<br />
ähnlicher Faktorausstattung mit differenzierten Gütern der gleichen Produktkategorie.<br />
Größenvorteile in der Produktion (economies of scale), Produktdifferenzierung und<br />
unvollkommener Wettbewerb sind die wesentlichen Elemente der Neuen Außenhandelstheorie.<br />
Durch Produktdifferenzierung versuchen die Unternehmen sich zum einen<br />
von den Konkurrenten zu unterscheiden, zum anderen den immer differenzierteren<br />
Geschmack der Konsumenten zu treffen, um so ihre Marktposition zu halten bzw.<br />
auszubauen. Größenvorteile in der Produktion der differenzierten Produkte begründen<br />
weitere Spezialisierungsvorteile durch <strong>internationale</strong> Arbeitsteilung: Jedes Land<br />
beschränkt sich auf die Herstellung und den Export einer begrenzten Zahl von Gütern<br />
in genügend großer Menge, während Konsumenten Größenvorteile in der Produktion<br />
anderer Länder über den Import von Waren nutzen. Das Spezialisierungsmuster ist<br />
in diesen Modellen zunächst unbestimmt und kann nur durch zusätzliche Annahmen<br />
erklärt werden. Diese Annahmen können – ähnlich zu den traditionellen Modellen<br />
– Unterschiede in den Produktionsbedingungen oder der Faktorausstattung betreffen,<br />
aber auch auf Unterschieden in den Nachfragebedingungen, <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Eingriffen<br />
(Betriebsansiedlungen usw.) oder auch auf historischen Zufällen beruhen oder,<br />
wie in den so genannten Economic Geography-Modellen, auf der Existenz von Transportkosten<br />
im <strong>internationale</strong>n Handel. Wesentliches Merkmal dieser letztgenannten<br />
Modelle ist die Interaktion zwischen Skalenerträgen und den Transportkosten zwischen<br />
Ländern. Produktgruppen mit Größenvorteilen in der Produktion werden aufgrund der<br />
Transportkosten im Land mit dem größeren Heimmarkt (Heimmarkteffekt) produziert.<br />
Die Größe des Marktes wird damit zum entscheidenden Erklärungsfaktor für das Entstehen<br />
<strong>internationale</strong>n Handels und für Unterschiede in der Produktionsstruktur.<br />
235
Bis in die frühen 1980er-Jahre nahm das Heckscher-Ohlin-Modell, das von unterschiedlichen<br />
Faktorausstattungen von Ländern bei gegebener und identischer Technologie<br />
(Produktivität) ausgeht, den zentralen Platz in der Außenhandelstheorie ein. Erst mit<br />
der Formalisierung der Produktzyklustheorien von Vernon (1966) und Hirsch (1967) und<br />
dem Technologielückenmodell von Posner (1961) durch Krugman (1979) begann sich<br />
eine neue Generation von technologieorientierten Modellen zu entwickeln (Grossman,<br />
Helpman, 1991a, 1991b, 1991c). In gewisser Weise ist die Außenhandelstheorie damit<br />
wieder mehr zur ursprünglichen Ricardianischen Idee zurückgekehrt, die Handelsmuster<br />
vornehmlich durch Unterschiede in der Technologie der Länder begründet sieht.<br />
Während im Ricardo-Modell jedoch von exogen gegebenen, fixierten Unterschieden<br />
in der Produktivität von Ländern ausgegangen wird, ergeben sich diese in den neuen<br />
technologieorientierten Modellen endogen. Technologie wird nicht mehr als Teil<br />
der gegebenen Faktorausstattung eines Landes gesehen, sondern ist das Ergebnis<br />
von Innovationsprozessen, Entdeckung, des Lernens und der Imitation (man-made).<br />
F&E-Investitionen gewinnorientierter Unternehmen, die Innovationen hervorbringen,<br />
spielen in diesen Modellen die zentrale Rolle. Innovationen verändern ständig die<br />
Liste von Produkten oder Prozessen, bei denen innovierende Länder temporäre<br />
komparative Vorteile bilden. Nationale Vorteile weisen daher dynamische Eigenschaften<br />
auf. Sie sind aufgrund der <strong>internationale</strong>n Diffusion vormals exklusiven Wissens<br />
(Imitation) einem ständigen Produktzyklus unterworfen, bzw. einem kontinuierlichen<br />
Wettlauf um neue Innovationen (Qualitätsleiter). Konkrete Spezialisierungsmuster im<br />
Außenhandel folgen damit der ökonomischen Aneigenbarkeit von technologischem<br />
Wissen und werden letztlich durch die unterschiedliche Fähigkeit, selbst Innovation<br />
hervorzubringen, oder fremdes technologisches Wissen aufzunehmen, bestimmt.<br />
Spezialisierungsmuster hängen von der Geschwindigkeit der Innovationen in einem<br />
Land und der Geschwindigkeit mit der diese Innovationen in anderen Ländern imitiert<br />
werden ab. (Ausführlicher behandelt Wolfmayr-Schnitzer (1998, 1999) die theoretischen<br />
Grundlagen.)<br />
11.3 Methodische Grundlagen<br />
Aus den verschiedenen theoretischen Erklärungsansätzen heraus sind für Österreich<br />
vor allem bei technologie- und humankapitalintensiven sowie informations- und<br />
wissensintensiven Produkten Wettbewerbsvorteile zu erwarten. Gleichzeitig ist aber<br />
auch die Positionierung im Qualitätswettbewerb (Qualitätsleiter) entscheidend. Für ein<br />
Hochlohnland ist eine höhere Qualität der angebotenen Produkte im <strong>internationale</strong>n<br />
Wettbewerb eine der Voraussetzungen um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Aufsteigen<br />
in der Qualitätsleiter ist eine Alternative oder Ergänzung zu Produktivitätssteigerungen<br />
236
Yvonne Wolfmayr<br />
in der Industrie. Qualität und Profitabilität der Unternehmen stehen dabei in engem<br />
Zusammenhang: Höhere Qualität der Produkte senkt den Konkurrenzdruck und erhöht<br />
die Bereitschaft der Konsumenten mehr zu zahlen. In der Folge steigt die Profitabilität.<br />
In diesem Zusammenhang ist zu erwarten, dass gerade für Österreich die Ostöffnung<br />
Anfang der 1990er-Jahre von entscheidender Bedeutung war. Diese schuf neue Wettbewerber<br />
am internatonalen Markt, die zu bedeutend niedrigeren Kosten produzieren<br />
und drängte auch Österreich durch die intensivere Arbeitsteilung stärker in Produktionen,<br />
die humankapitalintensiv erzeugt werden und qualitativ höherwertig sind.<br />
Empirisch liegen die Grenzen einer sektoralen Analyse darin, dass die Sektoren sehr<br />
heterogen sind und es einzelnen Ländern gelingen könnte, sich innerhalb einzelner<br />
Sektoren auf hochwertige Produkte zu spezialisieren. Sektorale Aussagen sollten daher<br />
nicht ohne Beachtung der im Produktionsprozess verwendeten Technologien und<br />
nicht ohne Daten über den Verarbeitungsgrad einzelner Sparten innerhalb des Sektors<br />
gemacht werden. Methodisch wird daher auf Industrietaxonomien zurückgegriffen, die<br />
vom WIFO im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte entwickelt wurden (Peneder,<br />
2001; Wolfmayr-Schnitzer, 1998; Aiginger, 2000). Die dort entwickelten Taxonomien<br />
sind ein kohärentes Instrument zur Untersuchung einzelner Wirtschaftsbereiche im<br />
Hinblick auf immaterielle und qualitative Wettbewerbsvorteile. Alle nach der NACE-<br />
Güterklassifikation erfassten Wirtschaftsbereiche der Sachgütererzeugung werden auf<br />
niedrigem Aggregationsniveau (NACE 3-Steller- Ebene) mittels statistischer Clusteranalyse<br />
nach vier unterschiedlichen Kriterien eingeteilt (siehe Tabelle 11.1).<br />
Die ersten drei Kriterien stützen sich auf die im Produktionsprozess verwendeten<br />
Faktorinputs. Das erste Kriterium vergleicht dabei die Zusammensetzung der eingesetzten<br />
Produktionsfaktoren im Produktionsprozess der einzelnen Wirtschaftszweige<br />
und unterscheidet zwischen fünf Industrietypen: traditionelle Sachgüterproduktion,<br />
arbeitsintensive, kapitalintensive, marketingorientierte und technologieorientierte<br />
Industrien. Das zweite Kriterium unterscheidet zwischen der Qualifikationsstruktur<br />
der Arbeitsnachfrage einzelner Branchen. Das dritte Kriterium bezieht sich auf die<br />
nachgefragten Vorleistungen (informations- und wissensintensive Dienstleistungen,<br />
Einzelhandels- und Werbedienstleistungen, Transportdienstleistungen und andere<br />
Industrien).<br />
Das vierte Kriterium klassifiziert Industrien nach der unterschiedlichen Rolle der Qualität,<br />
von den im <strong>internationale</strong>n Wettbewerb angebotenen Produkten. Die Typologie<br />
ergibt sich dabei aus folgenden Überlegungen. Eine hohe Qualität der Güter erlaubt<br />
höhere Preise ohne dabei Marktanteile zu verlieren. Je höher demnach die Rolle von<br />
Qualität im <strong>internationale</strong>n Wettbewerb, desto höher die erzielten Preise einer Branche<br />
bei gleichzeitig hohen Verkaufsmengen. 1 Qualität ist dabei ein komplexer Begriff, zu<br />
dem alle Charakteristika eines Produktes gezählt werden können, die einen zusätz-<br />
237
Taxonomien der Sachgüterproduktion Tab. 11.1<br />
Taxonomie I: Kombination des Faktoreinsatzes<br />
238<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion<br />
Arbeitsintensive Industrien<br />
Kapitalintensive Industrien<br />
Marketingorientierte Industrien<br />
Technologieorientierte Industrien<br />
Taxonomie II: Voraussetzungen an das nachgefragte Humankapital<br />
Industrien mit vornehmlich niedriger Qualifikation<br />
Industrien mit vornehmlich mittlerer Qualifikation (Arbeiter)<br />
Industrien mit vornehmlich mittlerer Qualifikation (Angestellte)<br />
Industrien mit vornehmlich hoher Qualifikation<br />
Taxonomie III: Nachgefragte Vorleistungen<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach wissensintensiven Dienstleistungen<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach Marketing und Handel<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach Transportdienstleistungen<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach Sonstigem<br />
Taxonomie IV: Qualitätswettbewerb, “RQE” (revealed quality elasticity)<br />
Industrien mit hoher RQE<br />
Industrien mit mittlerer RQE<br />
Industrien mit niedriger RQE<br />
Quelle: Peneder (2001) und Aiginger (2000).<br />
lichen Wert beim Konsumenten erzeugen. Diese Charakteristika können messbar<br />
sein, wie Geschwindigkeit, Größe, Haltbarkeit, Kapazität, oder intangibel sein, wie<br />
Zuverlässigkeit, Design, „good will“ und Vertrauen. Qualität kann sich auch in flexibler<br />
Nutzbarkeit und Einsetzbarkeit des Produktes oder Garantien usw. begründen. Zu<br />
einer Verbesserung der Qualität kann es durch mehr Forschung und Entwicklung,<br />
durch den Einsatz höher qualifizierten Personals, durch technologisch anspruchsvollere<br />
materielle Inputs oder auch durch verbesserte organisatorische Strukturen auf<br />
Unternehmensebene kommen. Die einzelnen Wirtschaftsbereiche unterscheiden sich<br />
in der qualitativen Differenzierbarkeit der angebotenen Güter.<br />
Basierend auf diesen Überlegungen werden die verschiedenen Industriesektoren in<br />
drei Klassen eingeteilt, die Unterschiede in der qualitativen Differenzierbarkeit und der<br />
sich daraus ergebenden unterschiedlichen Intensität und Rolle von Qualitätswettbewerb<br />
widerspiegeln (revealed quality elasticity - RQE).
Yvonne Wolfmayr<br />
Nach diesem Konzept würde ein positiver Strukturwandel im Sinne eines Aufsteigens<br />
in der Qualitätsleiter einen Übergang zu anderen – qualitätsorientierteren – Industrien<br />
bedeuten (inter-industrieller Strukturwandel). Eine alternative Strategie für Unternehmen<br />
ist, sich auf das höchste Qualitätssegment bzw. Preissegment einer spezifischen<br />
Industrie zu spezialisieren (intra-industrieller Strukturwandel). Ein Indikator,<br />
der diesen Aspekt teilweise widerspiegeln kann, ist der Unit Value der Exporte (Erlös<br />
je Werteinheit).<br />
Die Analyse auf Basis dieser Taxonomien erfolgt mittels folgender Indikatoren:<br />
• Exportspezialisierung: Anteil der Exporte eines Branchentyps am gesamten Industriewarenexport;<br />
• RCA-Werte (revealed comparative advantage): Verhältnis der Exporte zu den<br />
Importen einer spezifischen Produktgruppe in Relation zum Verhältnis der Exporte<br />
und Importe im gesamten Industriewarenhandel; 2<br />
• Marktanteil: Anteil der österreichischen Exporte an den EU-Exporten;<br />
• Unit Values: Erlöse je Mengeneinheit.<br />
11.4 Branchenprofil des österreichischen<br />
Außenhandels<br />
11.4.1 Exportspezialisierung<br />
Vergleicht man die österreichische Exportstruktur nach den unterschiedlichen Branchentypen<br />
in Tabelle 11.2 mit jener der EU, zeigt sich auch für 2002 im Export ein<br />
höherer Anteil von Waren der traditionellen Sachgüterproduktion von mittlerem bis<br />
niedrigem Technologieniveau sowie arbeitsintensiver Branchen (26,5 % gegenüber<br />
21,7 % bzw. 14 % gegenüber 10,4 %) dem ein markant niedrigerer Anteil in der Gruppe<br />
technologieorientierter Branchen (30,4 % gegenüber 38,5 %) gegenübersteht.<br />
Auch bei einem Vergleich nach Qualifikationstypen ist in der österreichischen Exportindustrie<br />
die Spezialisierung auf Industrien mit einem hohen Anteil von mittelqualifizierten<br />
Arbeitern ausgeprägter als im EU-Durchschnitt, während der Exportanteil von<br />
Branchen mit großem Anteil hochqualifizierter Beschäftigter (20,8 %) geringer als in<br />
der EU (25,1 %) ist.<br />
Die Taxonomie der Branchen nach Art der nachgefragten Vorleistungen vermittelt<br />
das gleiche Bild. Einem zum EU-Durchschnitt relativ geringeren Exportanteil von<br />
Bereichen mit hoher Nachfrage nach wissensintensiven Dienstleistungen (15,9 %<br />
vs. 21,4 %) steht ein relativ höherer Anteil von Branchen mit großer Nachfrage nach<br />
Transportdienstleistungen (23,9 % vs. 17,5 %) gegenüber.<br />
239
Exportspezialisierung Österreichs und der EU, Branchentypen und Regionen, 2002 Tab. 11.2<br />
Österreich EU<br />
240<br />
Extra-EU<br />
Intra-<br />
EU<br />
Extra-EU Welt<br />
Intra-<br />
EU<br />
Welt<br />
Sonstige<br />
Länder<br />
Oststaaten<br />
OECD-<br />
Übersee<br />
Insgesamt<br />
Sonstige<br />
Länder<br />
Oststaaten<br />
OECD-<br />
Übersee<br />
Insgesamt<br />
Anteile am Industriewarenexport in % Anteile am Industriewarenexport in %<br />
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 26,5 23,5 31,3 27,6 31,6 32,8 21,7 20,0 24,2 17,9 29,9 26,3<br />
Arbeitsintensive Industrien 14,0 14,9 12,5 12,8 12,5 12,5 10,4 9,2 12,1 10,3 13,2 12,9<br />
Kapitalintensive Industrien 17,2 20,1 12,7 9,9 13,8 12,9 16,6 18,1 14,2 14,2 14,2 14,3<br />
Marketingorientierte Industrien 11,9 12,1 11,5 10,3 14,3 9,0 12,9 14,1 11,2 10,5 12,6 11,1<br />
Technologieorientierte Industrien 30,4 29,4 31,9 39,4 27,9 32,7 38,5 38,6 38,3 47,2 30,1 35,5<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation 23,6 24,7 22,0 13,6 25,4 22,4 23,4 25,5 20,2 16,4 27,1 20,1<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 28,5 32,2 22,7 33,9 21,6 18,2 22,3 23,1 21,0 23,8 21,6 18,8<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) 27,1 26,8 27,5 20,2 33,1 24,6 29,2 28,9 29,7 27,3 29,3 31,5<br />
hoher Qualifikation 20,8 16,4 27,8 32,3 19,8 34,8 25,1 22,6 29,0 32,5 21,9 29,5<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen 15,9 15,0 17,2 15,9 15,4 20,0 21,4 19,7 23,9 28,6 14,1 24,5<br />
Marketing und Handel 27,9 24,6 33,1 37,1 29,2 35,6 29,1 27,4 31,7 31,8 28,8 32,8<br />
Transportdienstleistungen 23,9 24,4 23,1 17,4 25,5 23,3 17,5 19,2 14,9 10,9 20,0 15,6<br />
Sonstigem 32,3 36,0 26,6 29,6 29,9 21,2 32,0 33,6 29,5 28,8 37,2 27,0<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE 46,6 45,8 47,9 56,6 41,3 51,3 50,9 48,1 55,3 61,9 49,9 52,9<br />
mittlerer RQE 25,2 25,0 25,5 18,0 31,2 22,8 24,8 25,9 23,3 18,3 27,7 24,9<br />
niedriger RQE 28,2 29,2 26,5 25,4 27,5 25,9 24,2 26,0 21,5 19,9 22,5 22,1<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).
Yvonne Wolfmayr<br />
Anteil anspruchsvoller Produktgruppen am Industrie- Abb. 11.1<br />
warenexport, Österreich und EU im Vergleich, 2002<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
A<br />
Österreich<br />
EU<br />
Qelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).<br />
B<br />
A Technologieorientierte Industrien<br />
B Industrien mit vornehmlich hoher Qualifikation<br />
C Industrien mit hoher Nachfrage nach wissensintensiven Dienstleistungen<br />
D Industrien mit hoher RQE<br />
Erfolgt eine Einteilung der Exportindustrien nach der unterschiedlichen Rolle von<br />
Qualitäts- und Preiswettbewerb in der Branche, so zeigt sich auch hier relativ zum<br />
EU-Durchschnitt eine stärkere Spezialisierung der österreichischen Industrie auf besonders<br />
preissensible Bereiche, jedoch eine geringere Ausprägung auf Industrien, in<br />
denen die Qualität der Produkte der dominante Wettbewerbsfaktor ist.<br />
Tabelle 11.3 zeigt den Anteil anspruchsvoller Produkttypen im österreichischen Export<br />
im Vergleich zu einzelnen EU-Ländern. Nur Griechenland und Portugal weisen in allen<br />
dieser Industrietypen niedrigere Anteile als Österreich auf, zum Teil auch Dänemark,<br />
Italien, Spanien sowie Finnland. Dominiert wird das Feld innerhalb der EU-Länder von<br />
Irland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland.<br />
Wird die Exportstruktur Österreichs nach obigen Taxonomien auch nach einzelnen<br />
Regionen analysiert und mit dem EU-Durchschnitt verglichen, zeigen sich im Bild der<br />
österreichischen Strukturschwäche teilweise regionalspezifische Unterschiede. So ist in<br />
der Klassifikation der Industrien nach der Zusammensetzung der Produktionsfaktoren<br />
im Produktionsprozess die relativ starke Spezialisierung auf arbeitsintensive Bereiche<br />
C<br />
D<br />
241
Anteil anspruchsvoller Produktgruppen am Industriewarenexport,<br />
Österreich und EU-Länder im Vergleich, 2002<br />
242<br />
Technologieorientierte<br />
Industrien<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
hoher<br />
Qualifikation<br />
Industrien mit hoher<br />
Nachfrage nach<br />
wissensintensiven<br />
Dienstleistungen<br />
Anteile am Industriewarenexport in %<br />
Tab. 11.3<br />
Industrien<br />
mit hoher RQE<br />
EU 38,5 25,1 21,4 50,9<br />
Österreich 30,4 20,8 15,9 46,6<br />
Belgien 36,2 21,7 17,8 49,9<br />
Dänemark 26,3 23,5 16,2 41,7<br />
Deutschland 40,1 24,4 19,9 55,5<br />
Finnland 29,9 13,3 29,4 38,3<br />
Frankreich 43,4 28,5 27,0 57,3<br />
Griechenland 12,9 11,0 13,8 37,9<br />
Großbritannien 50,5 30,5 31,1 54,4<br />
Irland 65,7 43,0 35,5 41,2<br />
Italien 18,4 24,9 12,9 50,6<br />
Luxemburg 36,8 25,5 10,5 28,7<br />
Niederlande 41,9 26,7 22,9 37,1<br />
Portugal 25,3 7,6 9,7 46,6<br />
Schweden 34,5 22,5 17,3 47,8<br />
Spanien 32,5 12,5 13,3 50,6<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).<br />
im Vergleich mit dem EU-Durchschnitt im Intra-EU-Handel stärker ausgeprägt als im<br />
Extra-EU-Handel, wo Österreich mit einem hohen Anteil an Gütern der traditionellen<br />
Sachgüterindustrie vertreten ist. In einer weiteren regionalen Untergliederung des<br />
Extra-EU-Handels zeigt sich, dass das Strukturdefizit bezüglich einer im Vergleich<br />
zum EU-Durchschnitt zu geringen Spezialisierung auf technologisch anspruchsvolle<br />
Produktionszweige sowie solchen mit einer hohen Nachfrage nach wissensintensiven<br />
Dienstleistungen im Osthandel (und mit der Gruppe, die die restlichen Länder zusammenfasst)<br />
deutlich weniger ausgeprägt ist, als im Handel mit den OECD-Staaten in<br />
Übersee und im Intra-EU-Handel. Ein Ergebnis, das auf die Nachfragestruktur dieser<br />
Länder zurückzuführen ist. Die Importstruktur der osteuropäischen Länder ist weniger<br />
auf technologieorientierte und anspruchsvollere Industrien spezialisiert. Frühere<br />
Analysen bestätigen dies und haben zudem aufgezeigt, dass die Übereinstimmung<br />
der Warenstruktur der österreichischen Exporte mit jener der Importstruktur der Partnerländer<br />
für die osteuropäischen Staaten besonders hoch ist (Breuss et al., 1997;<br />
Stankovsky - Wolfmayr-Schnitzer, 2003). Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass sich
Yvonne Wolfmayr<br />
durch den Osthandel ungünstige Strukturen verfestigt haben, der Einfluss war vielmehr<br />
positiv. Der Beitrag des Osthandels zum Strukturwandel wird im Kapitel 11.5<br />
näher analysiert.<br />
Wird indessen nach der Rolle der Qualität als Wettbewerbsfaktor differenziert, zeigt<br />
sich in Bezug auf Osteuropa der größte Unterschied zur EU im Exportanteil der stark<br />
qualitätsorientierten Industrien. Österreich spezialisiert sich in dieser Region deutlich<br />
weniger auf Produkte mit intensivem Qualitätswettbewerb als der Durchschnitt der<br />
EU-Länder (41,3 % gegenüber 49,9 %).<br />
Das Strukturdefizit Österreichs nach Qualifikationstypen ist im Extra-EU-Handel weniger<br />
ausgeprägt. Ähnlich wie im Intra-EU-Handel fällt beim Export in die OECD-<br />
Übersee der hohe Anteil österreichischer Exporte aus dem Bereich mittelqualifizierter<br />
Arbeiter auf. Industrien mit starker Nachfrage nach hochqualifiziertem Personal sind<br />
bei EU-Exporten und österreichischen Exporten in die OECD-Übersee gleich stark<br />
vertreten. Deutlich höher ist im EU-Export der Anteil der Branchen, die vorwiegend<br />
mittelqualifizierte Angestellte im Produktionsprozess einsetzen.<br />
11.4.2 Komparative Vorteile (RCA-Werte)<br />
Die Berechnung von RCA-Werten ermöglicht eine verdichtete Darstellung des Spezialisierungsprofils<br />
eines Landes und Rückschlüsse auf komparative Handelsvorteile,<br />
da die Export- und die Importseite gleichzeitig in die Analyse eingehen (vgl. Fußnote<br />
2). Sie verstärken das Bild der strukturellen Schwächen (Tabelle 11.4).<br />
Komparativen Vorteilen (positiven RCA-Werten) in der – vorwiegend auf mittlerer<br />
Technologie basierenden – traditionellen Sachgüterproduktion und in den arbeitsintensiven<br />
Branchen stehen komparative Nachteile in den restlichen Branchentypen,<br />
so insbesondere auch bei den Technologiebranchen, gegenüber. Im Vergleich dazu<br />
ergeben sich auch für die EU komparative Vorteile in der traditionellen Sachgüterproduktion<br />
und ein negativer RCA-Wert bei den Technologiebranchen, der jedoch weniger<br />
negativ als im österreichischen Ergebnis ist.<br />
Die restlichen Typologien ergeben ein ähnliches Bild. Komparative Nachteile im österreichischen<br />
Gesamtaußenhandel ergeben sich in den Industrien mit hoher Nachfrage<br />
nach wissensintensiven Dienstleistungen sowie in den eher dem Qualitätswettbewerb<br />
ausgesetzten Branchen. Nur in der Gliederung der Industrie nach Qualifikationstypen<br />
ergeben sich für Österreich auch komparative Vorteile in den Industriegruppen mit hohem<br />
Einsatz mittelqualifizierter Arbeiter und im Handel von Industrien mit einem hohen<br />
Anteil hochqualifizierten Personals. Für die EU insgesamt zeigt sich in der Analyse des<br />
Gesamthandels nach diesen Typologien dagegen ein recht positives Bild komparativer<br />
Vorteile in den Branchen mit hohem Einsatz hochqualifizierter Arbeitskräfte, wissen-<br />
243
Tab. 11.4<br />
RCA-Werte im Außenhandel mit Industriewaren nach Branchentypen und Regionen,<br />
Österreich und die EU im Vergleich, 2002<br />
Österreich EU<br />
244<br />
Extra-EU<br />
Intra-<br />
EU<br />
Extra-EU Welt<br />
Intra-<br />
EU<br />
Welt<br />
Sonstige<br />
Länder<br />
Oststaaten<br />
OECD-<br />
Übersee<br />
Insgesamt<br />
Sonstige<br />
Länder<br />
Oststaaten<br />
OECD-<br />
Übersee<br />
Insgesamt<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 0,119 -0,060 0,432 0,621 0,420 0,370 0,170 0,040 0,374 0,075 0,395 0,527<br />
Arbeitsintensive Industrien 0,022 0,160 -0,240 1,038 -0,576 -0,058 -0,086 0,108 -0,304 0,558 -0,636 -0,448<br />
Kapitalintensive Industrien -0,041 0,087 -0,281 -0,886 -0,219 0,024 -0,092 -0,102 -0,053 0,148 -0,428 -0,015<br />
Marketingorientierte Industrien -0,053 -0,138 0,210 1,235 0,400 -0,327 -0,044 -0,015 -0,088 0,504 0,293 -0,420<br />
Technologieorientierte Industrien -0,062 -0,021 -0,163 -0,307 -0,083 -0,175 -0,007 0,011 -0,038 -0,223 0,237 0,074<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation -0,066 -0,093 0,045 0,648 0,070 -0,107 -0,104 0,003 -0,287 0,559 -0,237 -0,570<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 0,098 0,203 -0,089 0,078 -0,332 0,277 0,027 -0,029 0,147 0,447 -0,362 0,183<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) -0,093 -0,029 -0,229 -0,230 -0,129 -0,355 0,014 0,016 0,011 -0,226 0,195 0,115<br />
hoher Qualifikation 0,079 -0,152 0,352 -0,111 0,851 0,286 0,064 0,007 0,129 -0,237 0,740 0,357<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen -0,113 0,007 -0,349 -0,698 -0,357 -0,169 0,033 0,055 -0,007 -0,266 0,269 0,200<br />
Marketing und Handel 0,031 -0,123 0,271 0,458 0,408 0,038 0,040 -0,010 0,108 0,058 0,338 0,085<br />
Transportdienstleistungen 0,194 0,164 0,288 0,705 0,139 0,421 -0,019 -0,004 -0,031 -0,036 -0,166 0,026<br />
Sonstigem -0,093 -0,015 -0,218 -0,194 -0,196 -0,236 -0,046 -0,021 -0,084 0,292 -0,195 -0,245<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE -0,002 0,005 -0,029 -0,192 -0,022 0,047 0,085 -0,004 0,222 0,095 0,233 0,324<br />
mittlerer RQE -0,071 -0,119 0,039 -0,010 0,151 -0,087 -0,064 0,033 -0,218 -0,290 0,103 -0,284<br />
niedriger RQE 0,072 0,106 0,016 0,652 -0,117 -0,011 -0,098 -0,025 -0,222 0,026 -0,458 -0,256<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).
Yvonne Wolfmayr<br />
sintensiver Dienstleistungen und den Qualitätsbranchen. Getrübt wird dieses Bild in<br />
einer Analyse der sektoralen Außenhandelsstrukturen auf regionaler Ebene, denn im<br />
Handel mit der OECD-Übersee ergeben sich auch für die EU deutlich negative RCA-<br />
Werte bei den technologie- und humankapitalintensiven Industrien. Auch für Österreich<br />
ergeben sich im Handel mit den Industriestaaten außerhalb Europas die deutlichsten<br />
Defizite in diesen wichtigen Branchen. Auch die sektorale Position Österreichs in den<br />
restlichen Ländern und den Oststaaten entspricht nicht ganz den Erwartungen. Als<br />
hoch entwickeltes Industrieland sollte Österreich gegenüber den meisten Ländern<br />
dieser Regionen Wettbewerbsvorteile (komparative Vorteile), vor allem bei den anspruchsvollen<br />
Produkten, aufweisen. Im Jahr 2002 war dies nicht mehr der Fall. Die<br />
komparativen Vorteile Österreichs verringerten sich auch in diesen Industriebereichen<br />
im Zuge des Aufholprozesses der Oststaaten stetig. Allerdings ist dies in Bezug auf<br />
Osteuropa vor allem eine Folge des stark gestiegenen Vorleistungsbezugs aus diesen<br />
Ländern zum Zwecke der Kostenreduktion und Wettbewerbssteigerung der heimischen<br />
Industrie (ausführlicher in Kapitel 11.5).<br />
11.4.3 Unit Values im Export<br />
Unit Values im Außenhandel (Exporterlös je Mengeneinheit) bzw. deren Änderung<br />
stellen wichtige Erfolgsindikatoren dar, die „Qualität“ der Exportwaren und auch Marktstärke<br />
des Exportlandes widerspiegeln. Bei hoch aggregierten Daten (z.B. Gesamtexport)<br />
zeigt allerdings der Unit Value nicht (nur) die „Qualität“ der Exportwaren bzw.<br />
die Position eines Landes in verschiedenen Preis-/Qualitätssegmenten an, sondern<br />
auch die sektorale Außenhandelsspezialisierung. Auch Änderungen der Unit Values<br />
im Zeitverlauf werden durch zahlreiche Faktoren – neben einer Veränderung der<br />
angebotenen Qualität – bestimmt: etwa durch die Entwicklung des Wechselkurses,<br />
die Konjunkturlage und durch Änderungen in der Exportstruktur. Eine ausführliche<br />
Darstellung der Unit Values als Qualitätsmaß bietet Aiginger (1997).<br />
Wie in Tabelle 11.5a und 11.5b ersichtlich, weisen insbesondere technologieorientierte<br />
Branchen sowie jene mit großem Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte die höchsten<br />
Unit Values auf. Österreichs Unit Value im gesamten Handel mit Industriewaren belief<br />
sich 2002 auf 2,19 Euro je kg. Mit diesem Wert erreicht Österreich im Vergleich zum<br />
EU-Durchschnitt ein relativ gutes Ergebnis. Der Durchschnittswert im EU-Außenhandel<br />
lag bei 2,70 Euro je kg. Deutliche Unterschiede in den Unit Values zwischen<br />
Österreich und der EU innerhalb der einzelnen Industrieklassen ergeben sich nur in<br />
der Klassifikation der Industrien nach dem Qualifikationsgrad der Beschäftigten, bei<br />
den restlichen Klassifikationen sind die Unterschiede auch innerhalb der einzelnen<br />
Klassen der jeweiligen Typologien weniger ausgeprägt. Ein Indiz, dass der Unter-<br />
245
schied im Export-Unit Value zwischen Österreich und der EU im Gesamthandel eher<br />
auf die relativ ungünstigere Warenstruktur zurückzuführen ist (technologisch weniger<br />
entwickelte und daher relativ billige Produkte haben im österreichischen Export ein<br />
größeres Gewicht als im Durchschnitt der EU), als auf unterschiedliche (geringere)<br />
Produktqualität innerhalb der einzelnen Technologieklassen.<br />
Zwischen 1995 und 2002 stiegen die Erlöse je Mengeneinheit der einzelnen Warengruppen<br />
umso stärker, je technologieintensiver und humankapitalintensiver diese<br />
erzeugt wurden. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass der Spielraum für Qualitätssteigerungen<br />
bzw. Neuentwicklungen bei anspruchsvollen Produkttypen wesentlich größer<br />
ist. Die Unit Values dieser Produktkategorien sind in Österreich auch jeweils stärker<br />
als im Durchschnitt der EU angestiegen.<br />
Neben dem vorhin beschriebenen inter-sektoralen Wandel ist somit auch ein intrasektoraler<br />
Wandel zu höheren Qualitätsstufen, vor allem bei Produkten mittlerer und<br />
hoher Technologie sowie in den skill-intensiven Bereichen im Gang. Die im Vergleich<br />
zum EU-Durchschnitt deutlich niedrigere Veränderungsrate der österreichischen Unit<br />
Values im Gesamtexport (Österreich: 2,5 % gegenüber EU: 4 %) ist daher auch eher<br />
als Ergebnis der strukturellen Defizite in der sektoralen Struktur der österreichischen<br />
Exportindustrie (niedrigere Anteile bei technologieintensiven und skill-intensiven Warengruppen<br />
sowie bei Industrien mit Qualitätswettbewerb mit jeweils größeren Möglichkeiten<br />
qualitativer Differenzierbarkeit) gegenüber dem Durchschnitt aller EU-Länder<br />
zu sehen.<br />
11.4.4 Strukturwandel<br />
Im Zeitablauf zeigt sich für Österreich jedoch ein deutlich positiver Strukturwandel zugunsten<br />
höherwertiger, technologisch anspruchsvolleren und humankapitalintensiven<br />
Produkten, der sich in den Jahren 1995 bis 2002 weiter fortsetzte. Der Exportanteil<br />
dieser Produkte in Österreich hat etwas stärker zugenommen, als der EU-Anteil und<br />
hat somit die strukturelle Position in dieser Hinsicht verbessert. Der Strukturwandel<br />
in der österreichischen Exportindustrie geht insbesondere zu Lasten der traditionellen<br />
Sachgüterproduktion, aber auch der arbeitsintensiven und der kapitalintensiven<br />
Industrien (Tabelle 11.5a).<br />
Dieser positive Strukturwandel zeigt sich auch in der Analyse der restlichen Branchentypen.<br />
Im Vergleich zum Durchschnitt der EU fällt bei der Gliederung der Industrien<br />
nach Qualifikationstypen der Aufholprozess bei Industrien mit hohem Einsatz mittelqualifizierter<br />
Angestellter auf. In den Bereichen der Industrie mit einem hohen Anteil<br />
hochqualifizierter Arbeitnehmer vollzieht sich dieser Prozess schleppend und auch im<br />
Vergleich zur EU langsamer. Der Strukturwandel geht hier nur zu Lasten der Industrien<br />
246
Strukturwandel im Außenhandel mit Industriewaren,<br />
Österreich, 1995 und 2002<br />
Exportspezialisierung<br />
2002<br />
Anteile<br />
in %<br />
1995/<br />
2002<br />
Ø jährl.<br />
Veränderung<br />
in %<br />
RCA-Werte<br />
1995 2002 2002<br />
Export-Marktanteile<br />
Anteile<br />
am EU-<br />
Export<br />
in %<br />
1995/<br />
2002<br />
Ø jährl.<br />
Veränderung<br />
in %<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
Tab. 11.5 a<br />
Export-Unit<br />
Values<br />
2002<br />
Euro je<br />
kg<br />
1995/<br />
2002<br />
Ø jährl.<br />
Veränderung<br />
in %<br />
Insgesamt 100,0 - - - 3,4 2,2 2,19 2,5<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 26,5 -2,4 0,197 0,119 4,1 1,1 3,94 3,9<br />
Arbeitsintensive Industrien 14,0 -2,0 0,059 0,022 4,5 1,9 1,23 0,4<br />
Kapitalintensive Industrien 17,2 -2,1 0,063 -0,041 3,5 2,2 0,86 0,1<br />
Marketingorientierte Industrien 11,9 0,2 -0,111 -0,053 3,1 4,3 1,99 -1,5<br />
Technologieorientierte Industrien 30,4 5,7 -0,271 -0,062 2,7 4,6 18,65 6,5<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation 23,6 -3,1 0,025 -0,066 3,4 1,9 1,25 -0,1<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 28,5 0,9 0,048 0,098 4,3 2,4 2,28 2,8<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) 27,1 1,3 -0,093 -0,093 3,1 3,3 2,11 3,7<br />
hoher Qualifikation 20,8 1,1 0,022 0,079 2,8 1,4 14,89 5,0<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen 15,9 4,9 -0,252 -0,113 2,5 5,4 3,27 4,7<br />
Marketing und Handel 27,9 1,6 -0,051 0,031 3,2 3,0 6,22 1,3<br />
Transportdienstleistungen 23,9 -3,7 0,321 0,194 4,6 0,7 0,79 -0,2<br />
Sonstigem 32,3 0,0 -0,117 -0,093 3,4 2,7 5,42 0,2<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE 46,6 1,9 -0,047 -0,002 3,1 2,5 - -<br />
mittlerer RQE 25,2 -1,1 0,002 -0,071 3,4 1,9 - -<br />
niedriger RQE 28,2 -1,7 0,062 0,072 3,9 2,7 - -<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).<br />
247
Strukturwandel im Außenhandel mit Industriewaren,<br />
EU, 1995 und 2002<br />
248<br />
Tab. 11.5 b<br />
Exportspezialisierung RCA-Werte Export-Unit Values<br />
2002<br />
Anteile<br />
in %<br />
1995/<br />
2002<br />
Ø jährl.<br />
Veränderung<br />
in %<br />
1995 2002 2002<br />
Euro je kg<br />
1995/<br />
2002<br />
Ø jährl.<br />
Veränderung<br />
in %<br />
Insgesamt 100,0 - - - 2,70 4,0<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 21,7 -1,3 0,186 0,170 4,05 1,4<br />
Arbeitsintensive Industrien 10,4 -1,7 -0,019 -0,086 2,85 1,2<br />
Kapitalintensive Industrien 16,6 -2,1 -0,147 -0,092 0,89 2,2<br />
Marketingorientierte Industrien 12,9 -1,8 -0,010 -0,044 1,77 3,0<br />
Technologieorientierte Industrien 38,5 3,3 -0,020 -0,007 18,20 4,5<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation 23,4 -2,7 -0,088 -0,104 1,26 2,1<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 22,3 0,8 0,069 0,027 4,41 2,4<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) 29,2 0,3 -0,043 0,014 2,38 3,9<br />
hoher Qualifikation 25,1 1,9 0,118 0,064 21,47 4,1<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen 21,4 1,8 -0,013 0,033 3,01 6,6<br />
Marketing und Handel 29,1 0,8 0,080 0,040 5,74 5,6<br />
Transportdienstleistungen 17,5 -2,3 -0,076 -0,019 0,94 1,4<br />
Sonstigem 32,0 -0,4 -0,007 -0,046 5,14 2,4<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE 50,9 1,6 0,111 0,085 - -<br />
mittlerer RQE 24,8 -0,8 -0,059 -0,064 - -<br />
niedriger RQE 24,2 -2,2 -0,108 -0,098 - -<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).
Yvonne Wolfmayr<br />
mit einem hohen Anteil niedrigqualifizierter Arbeitnehmer. Nur langsam und ohne den<br />
Rückstand zur EU aufzuholen, kommt auch der Strukturwandel hin zu Industrien mit<br />
starkem Qualitätswettbewerb voran.<br />
Zwei weitere Beobachtungen untermauern den Strukturwandel zugunsten anspruchsvoller<br />
Produkte und zeigen, dass dieser Wandel nicht ausschließlich von der größeren<br />
Wachstumsdynamik technologisch anspruchsvoller und wissensintensiver Waren<br />
getragen wird. Zum einen zeigt die Entwicklung der RCA-Werte, dass der Beitrag der<br />
technologieorientierten Industrien zum österreichischen Export rascher als ihr Beitrag<br />
zum Import wächst. Der RCA-Wert, als Maßzahl für den Grad der Außenhandelsspezialisierung,<br />
stieg entsprechend von -0,271 (1995) auf -0,062 (2002). Der RCA-Wert<br />
für Industrien mit hoher Nachfrage nach wissensintensiven Dienstleistungen verbesserte<br />
sich ebenfalls von -0,252 auf -0,113. Verbesserungen zeigen sich auch in den<br />
anspruchsvollen Produktgruppen der restlichen Typologien.<br />
Zum anderen zeigt sich auch, dass der Exportanteil technologisch anspruchsvoller<br />
Produkte in Österreich rascher als im Durchschnitt der EU wächst. Österreich verzeichnet<br />
daher im Außenhandel mit technologieintensiven Waren Marktanteilsgewinne<br />
von 4,6 %. 3 Der Marktanteil von Produktgruppen mit hohem Einsatz wissensintensiver<br />
Dienstleistungen verbesserte sich ebenfalls von 1,7 % auf 2,5 %. Verbesserungen<br />
des Marktanteils zeigen sich auch bei den anspruchsvolleren Produkten nach Qualifikationstypen<br />
und nach Wettbewerbstypen (Preis vs. Qualität), allerdings stiegen hier<br />
die Marktanteile von Produktgruppen, die hauptsächlich auf mittlere Qualifikationen<br />
basieren und von Industrien, die hauptsächlich dem Preiswettbewerb ausgesetzt sind<br />
etwas rascher.<br />
11.5 Die Bedeutung des Osthandels für den<br />
Strukturwandel<br />
In den 1990er-Jahren war es vor allem die Ostöffnung, die den Außenhandel Österreichs<br />
nachhaltig beeinflusste. Der Zuwachs bei den Ostexporten war in den 1990er-<br />
Jahren mehr als doppelt so hoch wie bei den Gesamtexporten. Die Ostexporte verdreifachten<br />
sich innerhalb dieser Zeitspanne und der Anteil der Oststaaten an den<br />
gesamten österreichischen Exporten stieg von 9,9% (im Jahr 1989) auf 17,7% (im<br />
Jahr 2002). Ausgelöst wurden die kräftigen Exportsteigerungen durch das Wachstum<br />
der Ostmärkte und die Wettbewerbsgewinne, die Österreich vor allem in den ersten<br />
Jahren nach der <strong>politische</strong>n Wende erzielte. Der Außenhandel mit den Oststaaten<br />
hat darüber hinaus maßgeblich zur Dämpfung des Defizits in der österreichischen<br />
Handelsbilanz beigetragen. Österreich erzielte 2002 gegenüber den Oststaaten einen<br />
249
Handelsbilanzüberschuss von mehr als 0,6 Mrd. Euro. Der österreichische Osthandel<br />
konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die mehr oder weniger unmittelbaren Nachbarstaaten<br />
Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien, mit denen ungefähr<br />
zwei Drittel des österreichischen Osthandels abgewickelt werden.<br />
Auf der sektoralen Ebene zeigt sich, dass der Osthandel in den 1990er-Jahren den<br />
Strukturwandel, der in der österreichischen Industrie durch die Änderung verschiedener<br />
Rahmenbedingungen (Globalisierung, EU-Beitritt Österreichs, etc.) ausgelöst<br />
wurde, nicht verzögerte, sondern in eine strukturpolitisch wünschenswerte Richtung<br />
unterstützte. Branchengruppen, die in einer Integration zwischen Ländern mit unterschiedlichem<br />
Entwicklungsniveau Vorteile zu erwarten haben, haben sich besser durchgesetzt<br />
als jene, die in entwickelten Ländern komparative Standortvorteile an weniger<br />
entwickelte Beitrittsländer verlieren. Die WIFO-Industrietaxonomien können auch hier<br />
als Grundlage für die sektorale Wirkungsanalyse dienen. Dabei zeigt sich, dass vor<br />
allem Branchen benachteiligt (negative RCA-Werte) waren, in denen die Konkurrenz<br />
zumeist über den Preis entschieden wird, in denen geringe Ausbildungsansprüche<br />
für Arbeitskräfte bestehen sowie arbeits- oder kapitalintensive Produktionsverfahren<br />
eingesetzt werden. 4 Gewinner im Osthandel waren dagegen jene Branchen, die hohe<br />
bis höchste Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitskräfte stellen, bei denen<br />
die Produktqualität entscheidend ist und die stark technologieorientiert sind (Tabelle<br />
11.6). 5<br />
Allerdings haben sich die österreichischen Vorteile im Zuge des wirtschaftlichen Aufholprozesses<br />
der Oststaaten (insbesondere der fünf mittel- und osteuropäischen<br />
Staaten in unmittelbarer Nähe zu Österreich) etwas verringert. So stiegen in den letzten<br />
Jahren auch bei den begünstigten Branchentypen im österreichischen Außenhandel<br />
die Importe zumeist stärker als die Exporte und bewirkten so eine Verschlechterung<br />
der Handelsbilanzsalden und der RCA-Werte. Dies zeigt sich insbesondere in den<br />
Branchen mit großer Bedeutung des Qualitätswettbewerbs, bei technologieintensiven<br />
Industrien sowie Branchen mit hohem Einsatz wissensintensiver Dienstleistungen. Das<br />
ist wiederum vor allem eine Folge des gestiegenen Vorleistungsbezugs sowie einer<br />
weiter fortschreitenden vertikalen Arbeitsteilung mit diesen Staaten und ist gleichzeitig<br />
ein Indiz für einen weiteren Strukturwandel: Ein inter-industrieller Handel, in dem sich<br />
einzelne Länder je nach Ausstattung mit Produktionsfaktoren und Ressourcen auf<br />
einzelne Branchen spezialisieren, wird zugunsten eines intra-industriellen Handels mit<br />
Spezialprodukten (innerhalb derselben Branchen) zurückgedrängt. Mit Ausnahme der<br />
skill-intensiven Branchentypen folgte der anfänglichen Exportoffensive der technologie-<br />
und wissensintensiven sowie qualitätsorientierten Industrien eine Intensivierung<br />
des Importbezugs aus den mittel- und osteuropäischen Ländern zur Kostenreduktion<br />
und damit besseren Durchsetzung auf den Weltmärkten. Obwohl damit kein kausaler<br />
250
Struktur der komparativen Vorteile Österreichs im Osthandel,<br />
1995 und 2002<br />
Österreich<br />
Welt Oststaaten<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
Tab. 11.6<br />
1995 2002 1995 2002<br />
RCA-Werte<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 0,197 0,119 0,412 0,420<br />
Arbeitsintensive Industrien 0,059 0,022 -0,849 -0,576<br />
Kapitintensive Industrien 0,063 -0,041 -0,524 -0,219<br />
Marketingorientierte Industrien -0,111 -0,053 0,115 0,400<br />
Technologieorientierte Industrien -0,271 -0,062 0,862 -0,083<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation 0,025 -0,066 -0,397 0,070<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 0,048 0,098 -0,255 -0,332<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) -0,093 -0,093 0,268 -0,129<br />
hoher Qualifikation 0,022 0,079 0,809 0,851<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen -0,252 -0,113 0,088 -0,357<br />
Marketing und Handel -0,051 0,031 0,474 0,408<br />
Transportdienstleistungen 0,321 0,194 -0,311 0,139<br />
Sonstigem -0,117 -0,093 -0,078 -0,196<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE -0,047 -0,002 0,541 -0,022<br />
mittlerer RQE 0,002 -0,071 0,125 0,151<br />
niedriger RQE 0,062 0,072 -0,581 -0,117<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).<br />
Zusammenhang beschrieben werden kann, zeigt die Entwicklung der österreichischen<br />
Handelsbilanz dieser Branchen in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre, dass<br />
die Verschlechterung der Handelsbilanz mit den Oststaaten mit einer Verbesserung<br />
der Salden mit der Welt verbunden war. Etwas anders agierten die österreichischen<br />
Unternehmen mit einem hohen Einsatz hochqualifizierter Arbeitskräfte sowie der<br />
werbeintensiven Branchen, die auf dem Weltmarkt wettbewerbsstärker wurden, ohne<br />
die Produktionskosten durch besonders viele zusätzliche Importe aus den Oststaaten<br />
verbilligt zu haben.<br />
Auch die indirekten Handelseffekte der Ostöffnung – durch den Wettbewerb auf Drittmärkten<br />
– haben den positiven Strukturwandel der österreichischen Exportindustrie<br />
unterstützt. Der Außenhandel der Oststaaten mit der EU war in den frühen 1990er-<br />
Jahren durch eine besonders starke Konzentration auf arbeits- und kapitalintensive<br />
Industrien, Sektoren mit niedriger Qualifikation der Arbeitskräfte sowie Industrien mit<br />
hohem Preiswettbewerb gekennzeichnet. Als neue Wettbewerber am <strong>internationale</strong>n<br />
251
Markt, die zu bedeutend niedrigeren Kosten produzierten, drängten sie damit die höher<br />
entwickelten Länder aus diesen Produktionen hinaus. Allerdings zeigt sich auch hier der<br />
Aufholprozess der Oststaaten, insbesondere der osteuropäischen Beitrittskandidaten.<br />
Vergleicht man die Exportstrukturen der österreichischen und der osteuropäischen<br />
Beitrittsländer in die EU nach Industrietypen, zeigt sich ein eindrucksvoller Strukturwandel<br />
der östlichen Nachbarn in Richtung höherwertiger Branchen (Tabelle 11.7). 6<br />
Der Anteil dieser Sektoren an den Gesamtexporten in die EU kam 2002 teilweise sehr<br />
nahe an das österreichische Niveau heran. Allerdings sind die Exporte österreichischer<br />
Unternehmen in die EU innerhalb der einzelnen Industrietypen qualitativ höherwertiger:<br />
Die Unit Values der österreichischen EU-Exporte liegen noch deutlich über denen der<br />
osteuropäischen Beitrittsländer.<br />
Exportspezialisierung und Export-Unit Values, Österreich und osteuropäische<br />
Beitrittskandidaten im EU-Export nach Branchentypen im<br />
Zeitvergleich, 1995 und 2002<br />
252<br />
Österreich<br />
Osteuropäische<br />
Beitrittskandidaten<br />
Österreich<br />
Tab. 11.7<br />
Osteuropäische<br />
Beitrittskandidaten<br />
1995 2002 1995 2002 1995 2002 1995 2002<br />
Anteile am Industriewarenexport<br />
in %<br />
Export-Unit Value in Euro je kg<br />
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 1,62 1,95 0,79 1,78<br />
Traditionelle Sachgüterproduktion 29,5 23,5 21,9 23,0 2,55 3,86 1,48 2,58<br />
Arbeitsintensive Industrien 16,5 14,9 30,0 22,4 1,05 1,17 1,12 1,38<br />
Kapitalintensive Industrien 22,0 20,1 24,4 16,6 0,81 0,85 0,33 0,69<br />
Marketingorientierte Industrien 11,5 12,1 10,3 7,9 2,15 1,74 1,23 1,69<br />
Technologieorientierte Industrien 20,5 29,4 13,4 30,0 11,06 18,07 7,26 13,13<br />
Industrien mit vornehmlich<br />
niedriger Qualifikation 31,3 24,7 41,7 24,0 1,18 1,13 0,60 1,09<br />
mittlerer Qualifikation (Arbeiter) 28,8 32,2 27,9 36,4 1,69 2,22 1,01 1,91<br />
mittlerer Qualifikation (Angestellte) 23,8 26,8 22,5 27,1 1,49 1,98 0,81 2,06<br />
hoher Qualifikation 16,0 16,4 7,9 12,4 8,45 12,62 3,51 6,76<br />
Industrien mit hoher Nachfrage nach<br />
wissensintensiven Dienstleistungen 10,7 15,0 11,0 11,0 2,11 2,77 0,47 1,24<br />
Marketing und Handel 21,4 24,6 18,1 23,6 5,24 5,41 2,02 3,66<br />
Transportdienstleistungen 33,4 24,4 29,3 18,4 0,73 0,71 0,35 0,58<br />
Sonstigem 34,5 36,0 41,6 47,0 5,09 5,12 3,45 5,10<br />
Industrien mit<br />
hoher RQE 38,7 45,8 33,9 41,2 - - - -<br />
mittlerer RQE 27,4 25,0 24,3 27,4 - - - -<br />
niedriger RQE 33,9 29,2 41,9 31,4 - - - -<br />
Quelle: WIFO, COMEXT, Klassifikation nach Peneder (2001) und Aiginger (2000).
11.6 Schlussfolgerungen<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
Die Strukturanalyse der österreichischen Exportindustrie zeigte auf, dass der Anteil<br />
technologisch anspruchsvoller, humankapitalintensiver und innovations- bzw. qualitätsorientierter<br />
Produktgruppen im Vergleich zur EU weiterhin unterdurchschnittlich<br />
ist. Die Schwächezeichen sind dabei im Intra-EU-Handel und im Handel mit den<br />
Industriestaaten in Übersee deutlich stärker ausgeprägt. Frühere Untersuchungen<br />
zeigten weiters, dass die österreichische Exportstruktur auch zu wenig an die Nachfragestruktur<br />
rasch wachsender Märkte (z.B. in Asien) angepasst ist.<br />
Die Struktur der nationalen Produktionskapazitäten hat unmittelbaren Einfluss auf die<br />
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, die mittel- bis langfristig nur durch einen Strukturwandel<br />
zugunsten moderner, innovativer und technologisch anspruchsvoller Produkte<br />
erhalten bzw. gesteigert werden kann. Weiters kann die sektorale Struktur der Industrie<br />
einen wichtigen Einfluss auf die Wachstumsaussichten einer Volkswirtschaft ausüben<br />
(Peneder, 2002). Der sich in der Außenhandelsspezialisierung widerspiegelnde hohe<br />
Anteil traditioneller Branchen im mittleren Technologiebereich dämpft in dieser Hinsicht<br />
die Wachstumsaussichten Österreichs. Gleichzeitig zeigt jedoch die Analyse,<br />
dass sich der Aufholprozess im Strukturwandel zugunsten höherwertiger Produkte im<br />
österreichischen Export fortsetzt und zu Marktanteilsgewinnen in diesen Segmenten<br />
der Industrie führt. Vor allem die Ostöffnung in den 1990er-Jahren beeinflusste den<br />
österreichischen Außenhandel nachhaltig und unterstützte den Strukturwandel in<br />
wünschenswerter Weise.<br />
Dem beobachteten Strukturwandel auf aggregierter Ebene liegt letztlich eine Vielzahl<br />
unternehmerischer Entscheidungen zugrunde, die primär Marktsignalen folgt. Primäre<br />
Aufgabe der Wirtschaftpolitik ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen und Anreize<br />
zu schaffen, die den Strukturwandel erleichtern und die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit<br />
der heimischen Unternehmen verbessern. Dabei ist insbesondere die Technologiepolitik<br />
gefordert, denn gerade die Unterschiede im technologischen Entwicklungsniveau<br />
sind eine wichtige Quelle nationaler Wettbewerbsvorteile. Branchenspezifische<br />
(vertikale) Politikmaßnahmen werden dabei auf breiter Ebene eher zurückgewiesen.<br />
Darüber hinaus ließe sich eine sektorale Industriepolitik auch kaum mit den Grundsätzen<br />
der Wirtschaftsförderung der Union in Einklang bringen. Aber auch horizontale<br />
Maßnahmen aus verschiedenen Politikfeldern wirken auf unterschiedliche Branchen<br />
in verschiedener Weise: Liberalisierung im Telekombereich, verstärkte Ausbildung<br />
im Informatikbereich kommt informations- und wissensintensiven Bereichen zugute,<br />
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur begünstigen transportintensive Branchen<br />
usw. Eine Vielzahl horizontaler Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Politikbereichen<br />
setzt damit die Rahmenbedingungen, die Art und Ausmaß des Strukturwandels<br />
253
estimmen. Eine bessere strategische Orientierung der Strukturpolitik bedarf einer<br />
besseren wechselseitigen Abstimmung und Ergänzung einzelner Politikfelder, die<br />
einem gemeinsamen übergeordneten Ziel folgen sollten.<br />
Literaturverzeichnis<br />
Aiginger, K. (1987), Die <strong>internationale</strong> Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, Österreichische Strukturberichterstattung<br />
– Kernbericht 186, Bände I bis III, WIFO, Wien.<br />
Aiginger, K. (1997), The use of unit values to discriminate between price and quality competition,<br />
Cambridge Journal of Economics, Vol. 21, S. 571-592.<br />
Aiginger, K. (2000), Europe’s position in quality competition, WIFO Background report, European<br />
Commission - DG Enterprise.<br />
Breuss, F., Egger, P., Stankovsky, J. (1997), Die Übereinstimmung der österreichischen Exportstruktur<br />
mit der Dynamik der Exportmärkte, WIFO, Wien.<br />
Grossman, G. M., Helpman, E. (1991a), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT<br />
Press, Cambridge, Mass.<br />
Grossman, G. M., Helpman, E. (1991b), Endogenous Product Cycles, The Economic Journal,<br />
Vol. 101, 408, S. 1214-1229.<br />
Grossman, G. M., Helpman, E. (1991c), Quality Ladders and Product Cycles, Quarterly Journal<br />
of Economics, Vol. 106, 2, 1991, S. 557-586.<br />
Hirsch, S. (1967), Location of Industry and International Competitiveness, Oxford.<br />
Hutschenreiter, G., Peneder, M. (1997), Austria’s Technology Gap in Foreign Trade, Austrian<br />
Economic Quarterly, Vol. 2, 2, S. 75-86.<br />
Krugman, P. R. (1979), A model of innovation, technology transfer, and the world distribution of<br />
income, Journal of Political Economy, 87, S. 253-266.<br />
Peneder, M. (2001), Entrepreneurial Competition and Industrial Location, Edward Elgar, Cheltenham.<br />
Peneder, M. (2002), Industrial Structure and Aggregate Growth, WIFO-Working Papers, 182,<br />
Wien.<br />
Posner, M. (1961), International trade and technological change, Oxford Economic Papers, 13,<br />
S. 232-341.<br />
Stankovsky, J., Wolfmayr-Schnitzer, Y. (2003), Interessante Absatzmärkte und Exportpotentiale<br />
für die österreichische Industrie, WIFO, Wien (erscheint 2004).<br />
Vernon, R. (1966), International investment and international trade in the product cycle, The<br />
Quarterly Journal of Economics, 80, S. 190-207.<br />
Wolfmayr-Schnitzer, Y. (1998), (Coordination), The Competitiveness of Transition Countries,<br />
OECD-Proceedings.<br />
Wolfmayr-Schnitzer, Y. (1999), Economic integration, specialisation and the location of industries.<br />
A survey of the theoretical literature, WIFO-Working Papers, 120, Wien.<br />
254
Anmerkungen<br />
Yvonne Wolfmayr<br />
* Mag. Yvonne Wolfmayr ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für<br />
Wirtschaftsforschung in Wien<br />
1 In der Einteilung der Industrien nach unterschiedlicher Intensität des Qualitätswettbewerbs<br />
werden die relativen Außenhandelspreise (Unit Values der Exporte in Relation zu Unit Values<br />
der Importe) mit den realen Außenhandelsströmen verglichen. Industrien, bei denen höhere<br />
relative Preise zu relativ höheren Importen als Exporten führen, werden als preiselastisch<br />
eingestuft. Umgekehrt haben in den qualitätsorientierten Branchen relative Außenhandelspreise<br />
und die Handelsbilanz das gleiche Vorzeichen (ausführlicher in Aiginger, 2000).<br />
2 Der RCA-Wert ist für eine spezifische Produktgruppe (Industrieklasse) i folgendermaßen<br />
definiert:<br />
Diese Maßzahl stellt somit die Export-Import-Relation einer bestimmten Produktgruppe in<br />
Relation zu jener im Gesamthandel. Der RCA-Wert kann auch als das Verhältnis zwischen<br />
Exportquote (Xi/X) und Importquote (Mi/M) interpretiert werden. Sind beide Quoten gleich<br />
hoch und liegt somit keine Spezialisierung auf die entsprechende Produktgruppe vor, so ist<br />
der RCA-Wert Null (aufgrund der Logarithmierung). Ein positiver RCA-Wert weist demnach<br />
auf komparative Handelsvorteile in dieser Produktgruppe hin, ein negativer Wert auf Wettbewerbsnachteile.<br />
3 Am EU-Außenhandel mit Industriewaren hielt Österreich 2002 einen Marktanteil von<br />
3,4 %.<br />
4 Dazu zählen die Bekleidungs-, Baustoff- und Holzindustrie sowie die Herstellung von Metallstoffen<br />
und -waren.<br />
5 Dazu zählten insbesondere die Elektroindustrie, Maschinenbau, chemische Industrie zum<br />
Teil auch Fahrzeug- und Papierindustrie, Verlagswesen/Druckereien.<br />
6 Da in der für diesen Beitrag verwendeten Außenhandelsdatenbank der EU (COMEXT) nur<br />
EU-Länder als Berichtsländer aufscheinen, wurden die Exporte der osteuropäischen Beitrittsländer<br />
mit den Importen der EU aus den betreffenden Ländern gleichgesetzt.<br />
255
12 DER ERSTE SCHRITT – MOTIVATION<br />
UND BETREUUNG VON EXPORTEUREN<br />
Walter Koren*<br />
12.1 Exportförderung und ihr Adressatenkreis<br />
Exportförderung als Summe aller Maßnahmen zur mengen- bzw. erlösmäßigen Steigerung<br />
des Exportvolumens wendet sich prinzipiell an zwei Zielgruppen:<br />
• Nichtexportierende Unternehmen, die in exportierende umgewandelt werden<br />
sollen.<br />
• Bereits exportierende Unternehmen, die zu einer Intensivierung ihrer Auslandsaktivitäten<br />
veranlasst werden sollen, in dem sie neue Produkte auf bereits bestehenden<br />
Märkten einführen, neue, zusätzliche Märkte erschließen oder ganz<br />
allgemein ihr Exportmarketing verstärken.<br />
Der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und ihrer Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation<br />
(AWO) sowie den entsprechenden Abteilungen der Landeskammern liegen aus strategischen<br />
Gründen die nicht exportierenden Unternehmen, die potenziellen „Neuexporteure“<br />
besonders am Herzen.<br />
Eine ebenfalls förderungswürdige Zwischengruppe bilden die Gelegenheitsexporteure.<br />
Sie reagieren sporadisch auf zufällig einlangende Anfragen aus dem Ausland,<br />
betreiben aber kein konsequentes Exportmarketing und sind sich meist nicht des Gefahrenumfeldes<br />
bewusst, innerhalb dessen sie agieren. Nehmen sie nicht rechtzeitig<br />
fachmännisches Exportcoaching in Anspruch, kommen sie leicht zu Schaden und sind<br />
dann vielleicht für immer demotiviert.<br />
12.2 Das fremde Marketingumfeld im Export<br />
Die Aufnahme von Exportaktivitäten kostet den Unternehmer selbst bei fachlicher Betreuung<br />
in jedem Fall Überwindung, denn er verlässt sein vertrautes Umfeld und begibt<br />
sich auf fremdes Terrain. Fremd ist ihm das <strong>politische</strong> Umfeld mit seiner Gefahr der<br />
Instabilität des <strong>politische</strong>n Systems sowie von Konflikten wie Aufruhr oder Bürgerkrieg,<br />
von Verstaatlichung und Enteignung, fremd auch das rechtlich-wirtschaftliche Umfeld<br />
und in besonderem Maße das kulturelle Umfeld mit seiner Sprache, der andersgearteten<br />
Mentalität und allen übrigen Besonderheiten fremder Völker im Alltags- und<br />
Geschäftsleben.<br />
Hauptprobleme des Exportmarketings<br />
Auslandstätigkeit ist somit weit mehr als die bloße Ausdehnung des Geschäfts über<br />
die nationalen Grenzen hinaus. Mit der Entscheidung zum Exportmarketing tritt nicht<br />
nur ein gradueller, sondern ein prinzipieller Situationswandel für das Unternehmen<br />
256
Walter Koren<br />
ein: Alle Marketingaktivitäten werden nun komplexer und vielfältiger, die Koordinierungsfunktionen<br />
intensiviert.<br />
Der Eintritt in eine heterogene Marketingumwelt beinhaltet:<br />
• höheren Informationsbedarf bei schwierigerer Informationsbeschaffung,<br />
• höhere Risiken,<br />
• höheren Kapitalbedarf.<br />
Dem höheren Informationsbedarf stehen die Schwierigkeiten bei der Sekundärmarktforschung<br />
und erst recht bei der Primärmarktforschung gegenüber. Das Sekundärmaterial<br />
ist von sehr unterschiedlicher Qualität und Quantität, über manche Länder gibt es überhaupt<br />
keine brauchbaren Daten. Hier springt die AWO nicht nur mit ihren Publikationen<br />
ein, sondern liefert österreichischen Unternehmen – über ihren Zugang zu <strong>internationale</strong>n<br />
Datenbanken – auf Anforderung Marktanalysen und Außenhandelsstatistiken.<br />
Das gesteigerte Ausmaß an Ungewissheit im Export ist dadurch bedingt, dass im<br />
Auslandsgeschäft sämtliche Inlandsrisiken verstärkt auftreten (man denke nur an das<br />
Transport- oder Dubiosenrisiko), darüber hinaus aber noch zusätzliche Risiken wie<br />
Währungs-, Transfer- und Konvertierungsrisiko hinzutreten, die es nur im ausländischen<br />
Kontext gibt.<br />
Höherer Kapitalbedarf ergibt sich allein schon aus der Herstellung von fremdsprachigem<br />
Unterlagenmaterial und den Mailingkosten, in der Folge aus der Reise- und Messetätigkeit.<br />
Die finanzielle Belastung ist noch schwerwiegender, wenn eine Produktadaptierung<br />
oder die Einstellung zusätzlichen Personals vorgenommen werden muss. Auch ist nicht<br />
zu vergessen, dass die Markterschließung nicht (immer) sofort Früchte trägt, in manchen<br />
Fällen ist mit einer Durststrecke von ein bis zwei Jahren zu rechnen. Export ist hierbei<br />
mit einer Investition vergleichbar, an deren Anfang Kosten und Aufwendungen stehen<br />
und der Break Even Point erst nach einiger Zeit erreicht wird.<br />
12.3 Unternehmensinterne und -externe Exportbarrieren<br />
Exportförderung unterstützt die Unternehmen in der Absicht, ihnen die im Inlandsgeschäft<br />
nicht oder nur in geringerem Ausmaß auftretenden Schwierigkeiten des Auslandsgeschäftes<br />
zu erleichtern. Die Förderung hilft also, Exportbarrieren zu überwinden.<br />
Dabei unterscheidet man unternehmensinterne und unternehmensexterne Faktoren.<br />
Unternehmensinterner Bereich<br />
Barrieren innerhalb von Unternehmen sind:<br />
• Mangelnde Exportfähigkeit: Zu geringe Betriebsgröße, Mangel an Kapital und<br />
geeignetem Personal, keine freien Produktionskapazitäten, eine nur auf den<br />
Inlandsmarkt ausgerichtete Produktpalette.<br />
257
• Mangelndes Exportwissen: Keine Kenntnisse der praktischen Exportabwicklung,<br />
daher Probleme der Exportorganisation und Exportdurchführung.<br />
• Mangelnde Exportgesinnung: Keine Exportbereitschaft auf Grund schlechter<br />
Erfahrungen, Angst vor der Konkurrenz und den Risiken im Auslandsgeschäft,<br />
Befürchtungen wegen der <strong>politische</strong>n Unsicherheit auf Auslandsmärkten, ihrer<br />
schlechten Zahlungsmoral, ihres niedrigen Preisniveaus und der daraus resultierenden<br />
geringeren Gewinnspanne, Überschätzung des Aufwandes beim Markteintritt<br />
durch kostspielige Auslandsreisen und Messebeteiligungen, Zufriedenheit<br />
mit den laufenden Geschäften am Inlandsmarkt, Überzeugung, dass Export nur<br />
für kapitalstarke Unternehmen in Frage komme.<br />
Bei allen drei Typen dieser Hemmnisse setzt die Exportförderung ein. In der Regel<br />
erfolgt dies durch Information, Beratung und Schulung. Durch Wissensvermittlung<br />
können die typischen Probleme der Exportorganisation und -durchführung als wichtigste<br />
Zugangsschranke zu Auslandsmärkten abgebaut werden. Erst mit ausreichender<br />
Kenntnis der operativen und technischen Besonderheiten des Exports ist die Bereitschaft<br />
zu wecken, diesen als unternehmerische Wachstumsstrategie zu begreifen.<br />
Ohne Basiswissen können unternehmensexterne Anstöße etwa durch unerwartet<br />
einlangende Bezugswünsche oder gar Aufträge aus dem Ausland keine grundlegende<br />
Hinwendung zum Exportgeschäft auslösen.<br />
Unternehmensexterner Bereich<br />
Während prinzipiell alle unternehmensinternen Barrieren überwindbar sind, ist der unternehmensexterne<br />
Bereich der klassischen Exportförderung weit weniger zugänglich.<br />
Unternehmensexterne Exportbarrieren können sein:<br />
• Staatliche: Exportverbot im Heimatland, tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse<br />
oder Importverbot im Zielland.<br />
• Konzernbedingte: Innerhalb des Konzerns ist den Töchtern nur die Bearbeitung<br />
des Binnenmarktes gestattet, der Export erfolgt ausschließlich über die Zentrale.<br />
• Vertragsbedingte: Lizenz- oder Franchisenehmer sowie andere Vertragspartner<br />
sind einvernehmlich von Exportaktivitäten ganz oder teilweise ausgeschlossen.<br />
Fremdstaatliche Barrieren wie Importverbote oder Importkontingente unterbinden<br />
bzw. behindern zwar den direkten oder indirekten Export, lassen aber andere Markteintrittsvarianten<br />
wie Lizenzvergabe, Joint Venture oder Produktionsniederlassung<br />
durchaus zu. Konzern- und vertragsbedingte Barrieren bieten der Exportförderung<br />
dann Einsatzmöglichkeiten, wenn Ausfuhraktivitäten nicht zur Gänze ausgeschlossen<br />
wurden. So hat etwa der deutsche Konzern „Teekanne“ seiner österreichischen Tochter<br />
die Bearbeitung der Märkte Mittel- und Osteuropas überlassen.<br />
258
Walter Koren<br />
12.4 Exportmotive: Aktive und reaktive Strategien im<br />
Export<br />
Warum setzt sich nur ein Unternehmer überhaupt all den Schwierigkeiten des Exportgeschäfts<br />
aus?<br />
Die Erklärung liegt in seiner Motivation, seiner Einstellung zum Geschäft, wobei diese<br />
Einstellung aktiv oder reaktiv sein kann.<br />
Die aktive Haltung<br />
Bei der aktiven Haltung ergreift der Unternehmer selbst die Initiative: Er steigt offensiv<br />
in die Auslandsmarktbearbeitung ein. Dabei können folgende Ziele im Vordergrund<br />
stehen:<br />
• Umsatzsteigerung,<br />
• Rentabilitätserhöhung,<br />
• Verbesserung des Marktanteils,<br />
• Auslastung der Produktionskapazitäten,<br />
• Risikostreuung,<br />
• Absatzsicherung auf lange Sicht (Festigung der Marktposition).<br />
Expansive Strategien sind in der Regel auf Umsatz- oder Rentabilitätssteigerung sowie<br />
auf eine Erhöhung des Marktanteils ausgerichtet. Hier kann Exportförderung helfend<br />
eingreifen, indem sie über die Handelsdelegierten Marktnischen im Auslandsmarkt<br />
oder Möglichkeiten einer nachhaltigeren Marktpräsenz etwa durch Schaffung eines<br />
Auslieferungslagers, eines Servicestützpunktes oder einer Vertriebsniederlassung<br />
aufzeigt.<br />
Die Verbesserung der Kapazitätsauslastung bezieht sich zunächst auf die bestehende<br />
Kapazität, bei entsprechenden Exporterfolgen kann eine Kapazitätserweiterung<br />
mit verbesserten Skalenerträgen vorgenommen werden: Durch Vergrößerung der<br />
Produktionsmenge verteilen sich die Fixkosten auf mehr Produkte, es kommt zur<br />
Stückkostendegression.<br />
Vielseitige Aktivität auf Auslandsmärkten bedeutet Streuung der Risiken und damit<br />
geringere Abhängigkeit von der Entwicklung des Binnenmarktes. Allfällige Konjunkturschwankungen<br />
im Inland sind nun besser zu verkraften.<br />
Neben betrieblicher Expansion kann schließlich auch die langfristige Erhaltung des<br />
Absatzniveaus, also die Festigung der eigenen Marktposition ein strategisches Ziel<br />
sein.<br />
259
Die reaktive Haltung<br />
Reaktiv ist die Haltung des Unternehmers dann, wenn er nicht von sich aus die Initiative<br />
ergreift, sondern durch äußere Umstände zum Handeln veranlasst wird. Derartige<br />
Umstände können sein:<br />
• Absatzrückgang auf dem Binnenmarkt,<br />
• Absatzrückgang auf bestehenden Auslandsmärkten,<br />
• saisonale Verkaufsschwankungen,<br />
• Überproduktion auf Grund unternehmensexterner Faktoren,<br />
• nicht auf eigenen Marketingaktivitäten basierende Geschäftschancen.<br />
Marktrückgänge im Binnen- und Auslandsmarkt können durch Marktsättigung, zunehmenden<br />
Konkurrenzdruck, Ausfall von Kunden oder administrative Hemmnisse wie<br />
Normen oder Umweltschutzauflagen entstehen. Es kann auch sein, dass das eigene<br />
Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist und entweder einen Relaunch<br />
oder den Ersatz durch eine Neuentwicklung erfordert.<br />
Mehr oder weniger zufällige Geschäftschancen ergeben sich aus unerwarteten Anfragen<br />
aus dem Ausland, einer spontanen Vermittlung durch Geschäftspartner oder durch das<br />
Mitziehen mit Kunden z.B. als Zulieferant für einen inländischen „General Contractor“ im<br />
Rahmen eines größeren Auslandsprojektes. Auch der Internetauftritt eines Unternehmens<br />
kann zu gelegentlichen Anfragen aus dem Ausland führen. Derartige Reaktionen auf<br />
äußere Anstöße können natürlich nicht einem systematischen Exportmarketing gleichgesetzt<br />
werden. Man schlittert gewissermaßen ins Auslandsgeschäft und tut gut daran,<br />
rechtzeitig professionelle Exportberatung in Anspruch zu nehmen, um in der nächsten<br />
Konsequenz eine systematische Auslandsmarktbearbeitung zu gewährleisten.<br />
12.5 Das Förderinstrumentarium der Kammerorganisation<br />
Die Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation (AWO) der WKÖ und Landeskammern als Träger<br />
der funktionellen (im Gegensatz zur finanziellen) Exportförderung setzen im Wesentlichen<br />
folgende Instrumente ein:<br />
• Publikationen in Print- und elektronischen Medien,<br />
• Informationsveranstaltungen,<br />
• Schulungsveranstaltungen,<br />
• PR- und Aufklärungskampagnen in Presse, Rundfunk und Fernsehen,<br />
• Gruppenbeteiligung an <strong>internationale</strong>n Messen, Katalogausstellungen,<br />
• Wirtschaftsmissionen, Technisch-Wissenschaftliche Symposien,<br />
• Exportberatung und -coaching.<br />
260
Walter Koren<br />
Zuschüsse<br />
In der Vergangenheit (bis 1995) wurden auch verschiedene finanzielle Anreize geboten:<br />
Zuschüsse zu Reisekosten und Messebeteiligungen, zur Prospektherstellung, Marktforschung<br />
und Inseratenwerbung, zu Übersetzungen und Sprachstudien. Hievon ist nach<br />
Wegfall des Außenhandelsförderungsbeitrages (AF-Beitrages) als Konsequenz des<br />
Beitritts Österreichs zur EU lediglich die Förderung von Gruppenausstellungen übrig<br />
geblieben. Dabei wird den teilnehmenden Firmen gegen Bezahlung einer ermäßigten<br />
Gebühr der Großteil der Organisation abgenommen.<br />
Information<br />
So wie die Exportförderungsorganisationen anderer Länder stellt auch die AWO Informationen<br />
sowohl für inländische Exporteure als auch für ausländische Interessenten<br />
zur Verfügung: Inländischen Adressaten sind Länder-, Fach- und Brancheninfos<br />
über Märkte des Auslands, die AWO-News und die sechsmal jährlich erscheinende<br />
Zeitschrift „Exporter‘s“ gewidmet, im Ausland wird über das e-Bulletin (elektronisches<br />
Bulletin zusätzlich zum Wirtschaftsbulletin der Außenhandelsstellen), den branchenbezogenen<br />
„Austria Export“-Publikationen und den „Directory of Austrian Consultants“<br />
auf die Leistungskraft österreichischer Unternehmen hingewiesen.<br />
Veranstaltungen<br />
Die Veranstaltungen im Inland umfassen Länder-, Branchen- und Fachforen bzw.<br />
-seminare, Kooperationsbörsen und -foren, Außenhandelstagungen und Vorträge im<br />
Rahmen der Abendveranstaltung „AWO-Horizonte – Export verbindet Welten“. Bei<br />
den Foren und Seminaren werden Schwerpunktthemen von Regierungsvertretern,<br />
Experten und ausländischen Wirtschaftsrepräsentanten behandelt, in Kooperation<br />
mit <strong>internationale</strong>n Finanzinstitutionen, der EU-Kommission oder anderen offiziellen<br />
Stellen des Auslands werden Informationen über Projekte und Finanzierungs-,<br />
Garantie- und Abwicklungsfragen gegeben. Bei Außenhandelstagungen haben die<br />
österreichischen Firmen, auch Exportneulinge, Gelegenheit, mit den Handelsdelegierten<br />
einer bestimmten Region zu direkten Gesprächen zusammenzutreffen und<br />
erste Anknüpfungspunkte für die gemeinsame Arbeit im Zielmarkt zu erarbeiten bzw.<br />
Informationen über Marktchancen einer ganzen Region oder Kontinents zu erhalten.<br />
In der Veranstaltung „AWO-Horizonte – Export verbindet Welten“ kommen in- und<br />
ausländische Spitzenreferenten aus Wirtschaft und Politik zu Wort, wobei eine <strong>internationale</strong><br />
Diskussionsplattform geboten wird.<br />
261
Lehrgänge an Schulen und Universitäten<br />
Im Schulungsbereich wurden neben den traditionellen WIFI-Kursen auf Initiative der<br />
1981 gegründeten „Exportakademie“ Lehrgänge zur Ausbildung von Exportkaufleuten<br />
an allen österreichischen Universitäten mit <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftlicher Fakultät (Wien,<br />
Linz, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg) eingerichtet. Als besonders erfolgreich<br />
(mit über 1.100 Absolventen) erwies sich dabei das an der Linzer Johannes-Kepler-<br />
Universität von Professor Gerhard Wührer eingeführte dreistufige Ausbildungsmodell,<br />
das über einen Grund- und einen Aufbaulehrgang nach insgesamt sechs Semestern<br />
zum „Master of Advanced Studies (MAS)-Global Marketing Managment“ führt.<br />
Mit finanzieller Unterstützung der WKÖ wurde an der Wirtschaftsuniversität Wien der<br />
Lehrstuhl „Betriebs<strong>wirtschafts</strong>lehre des Außenhandels“ (Leitung Professor Reinhard<br />
Moser), für Handelsakademien wurde ein Lehrbuch über „Marketing und <strong>internationale</strong><br />
Geschäftstätigkeit“ erarbeitet und für den Fachhochschullehrgang des „International<br />
Management Center (IMC) Krems“ mit der Bezeichnung „Export-oriented Management<br />
EU-ASEAN-NAFTA“ eine Bedarfsanalyse erstellt.<br />
Kampagnen – Preise<br />
Wie kein anderer Förderungsmodus fallen Schulungsmaßnahmen in eine frühe Phase<br />
des „Präexports“. Dies gilt auch für PR- und Aufklärungskampagnen in Presse, Rundfunk<br />
und Fernsehen, wobei die Aktion „Pro Export“ eine besondere Rolle spielte. Diese<br />
über drei Jahre laufende Kampagne umfasste u.a. Pressekonferenzen in sämtlichen<br />
Bundesländern, Informationstage, die Präsentation erfolgreicher Exporteure („Exporteure<br />
vor den Vorhang“) und Gratulations-Mailings.<br />
Auch die (seit 1994 alljährlich in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium<br />
zelebrierte) Verleihung von Exportpreisen verfolgt die Absicht, aus den besonderen<br />
Exporterfolgen der prämierten Unternehmen Motivationsimpulse für Neuexporteure<br />
abzuleiten. Neben der positiven Beeinflussung des Vorexportverhaltens werden darüber<br />
hinaus die Unterstreichung der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung des Exports<br />
und die Bewusstmachung der Vielfalt des angebotenen Förderungsinstrumentariums<br />
angestrebt.<br />
Sicherlich geben Motivationskampagnen allein noch nicht den entscheidenden Anstoß<br />
zur Aufnahme der Exporttätigkeit, sie können jedoch zur Bewusstseinsbildung beitragen,<br />
also eine positive Grundhaltung zu derartiger Aktivität herbeiführen.<br />
Anstöße für Exportaktivitäten<br />
Mitunter sind Exportdebüts gar nicht das Ergebnis rationaler Entscheidungsprozesse,<br />
sondern unternehmensextern über Zufallsanfragen oder -aufträge stimulierte, durch<br />
Marktinformationen nur mangelhaft fundierte Reaktionen, über die kleine und mittlere<br />
262
Walter Koren<br />
Unternehmen, wie bereits erwähnt, in eine Phase des experimentellen Exportierens<br />
hineinstolpern.<br />
In der Regel freilich ist Exportaktivität das Resultat einer Interaktion zwischen Exportanreiz<br />
und der adäquaten Einschätzung jener Faktoren, die beim Export eine Rolle<br />
spielen, also etwa der angemessenen personellen und kapitalmäßigen Ausstattung.<br />
Dies bedeutet, dass Unternehmen dann in den Export einsteigen, wenn der Anreiz<br />
als Beitrag zur Erreichung eines bestimmten Unternehmensziels (z.B. Umsatz- und<br />
Gewinnsteigerung) groß genug ist und die Realisierbarkeit in ihren Grundzügen positiv<br />
beurteilt wird. Der Exporterfolg hängt dann davon ab, wie gründlich die Fragen des Beitrags<br />
zur Zielerreichung und der hiefür aufzuwendenden Mittel durchdacht wurden.<br />
Den Exportberatern ist selbstverständlich klar, dass der Hinweis auf die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung des Exports und seinen Beitrag zum Bruttosozialprodukt auf<br />
den Unternehmer keinen nachdrücklichen Motivationseffekt hat. In jedem Fall müssen<br />
plausible einzelbetriebliche Argumente wirksam eingesetzt werden.<br />
Gruppenausstellungen<br />
Für den kostengünstigen Markteinstieg bieten sich Gruppenbeteiligungen an <strong>internationale</strong>n<br />
Messen, Katalogausstellungen, Technisch-Wissenschaftlichen Symposien<br />
und Wirtschaftsmissionen an.<br />
Gruppenausstellungen sind von der AWO organisierte Gemeinschaftsbeteiligungen<br />
an <strong>internationale</strong>n Messen oder Ausstellungen mit repräsentativen Österreich-Ständen<br />
oder -Pavillons. Die AWO übernimmt dabei die Organisation und Logistik des<br />
Messeauftritts, den Aufbau des Messestandes innerhalb des Gemeinschaftsauftritts,<br />
Marketingaktivitäten auf der Messe und gewährt darüber hinaus eine dreimonatige<br />
Einschaltung im e-Bulletin. Hiefür wird ein pauschaler Kostenbeitrag pro m² Ausstellungsfläche<br />
verrechnet, der vom Preisniveau der Veranstaltung des Landes abhängt.<br />
Für die ersten beiden Teilnahmen gibt es besonders attraktive Konditionen.<br />
Katalogausstellungen<br />
Bei Katalogausstellungen werden Exportunternehmen mit Broschüren und Katalogen<br />
sowie Videos meistens ohne persönliche Anwesenheit im Rahmen von thematisch<br />
ausgerichteten Kleinständen von der regional zuständigen Außenhandelsstelle präsentiert.<br />
Technisch-Wissenschaftliche Symposien<br />
Bei Technisch-Wissenschaftlichen Symposien handelt es sich um Vortrags- und Diskussionsrunden,<br />
bei denen österreichische Unternehmen ihre technologischen Neuheiten<br />
einem von der Außenhandelsstelle eingeladenen Fachpublikum vorstellen können.<br />
263
Wirtschaftsmissionen<br />
Wirtschaftsmissionen sind Gemeinschaftsreisen österreichischer Unternehmer, die<br />
der Markterkundung, dem Verkauf oder der Kooperation dienen. Für jeden Teilnehmer<br />
werden von der Außenhandelsstelle individuelle Gesprächstermine vereinbart.<br />
Diese Wirtschaftsmissionen schaffen einen gewissen Synergieeffekt, wenn mehrere<br />
Unternehmer einer Branche zusammentreffen.<br />
12.6 Das Gewinnen potenzieller Neuexporteure<br />
Eruierung<br />
Ein gravierendes, in der Fachliteratur vernachlässigtes, Problem bei allen erwähnten<br />
Instrumenten der Exportmotivation ist die Schwierigkeit, an potenzielle Neuexporteure<br />
heranzukommen. Denn im Exportgeschehen haben sie sich ja bisher in keiner Weise<br />
manifestiert, keine Publikationen bezogen und an keiner Veranstaltung teilgenommen.<br />
Will man nicht sämtliche Nichtexporteure anschreiben, muss nach Branche, Unternehmensgröße,<br />
Stellung am Inlandsmarkt oder Standort selektiert werden.<br />
Anbieten konkreter Geschäfte an potenzielle Exporteure<br />
Einen interessanten Ansatz zur Feststellung potenzieller Exporteure lieferte die Kammer<br />
Oberösterreich, indem sie nicht exportierende Unternehmen unter Bekanntgabe<br />
einer konkreten Geschäftsmöglichkeit im Ausland kontaktierte. So wurden beispielsweise<br />
Möbelhersteller auf einen Bezugswunsch in Frankreich oder Motorenerzeuger<br />
auf einen Bedarf in Mexiko hingewiesen. Diese Aktion wurde durch ein telefonisches<br />
Nachfassen seitens der Kammer untermauert. Wurde in der Folge noch ein Exportberater<br />
entsandt, so war damit zweifellos ein kräftiger Impuls zum Einstieg ins Exportgeschäft<br />
gegeben.<br />
Das Verfahren ist allerdings aufwändig. Es erfordert eine sorgfältige Auswahl der<br />
„angedienten“ Geschäftschancen aus einer Vielzahl von Anfragen ebenso wie genaue<br />
Firmen- und Produktkenntnis. Dennoch stellte sich nicht in allen Fällen der<br />
erhoffte Erfolg ein. Entweder war der Zeitpunkt ungünstig, der Markt zu exotisch, die<br />
Auftragslage im Inland ausreichend oder generell keinerlei Exportneigung seitens der<br />
Unternehmensführung gegeben.<br />
Gezielte Ansprache<br />
Seitens der AWO wurde für die gezielte Ansprache dieser Kundengruppe für 2003 ein<br />
eigenes Marketing- und Kommunikationskonzept gestaltet. Durch eine Kommunikati-<br />
264
Walter Koren<br />
onslinie in Printmedien, Exportinformations- und -motivationsveranstaltungen sowie Publikationen<br />
(u.a. in Kooperation mit anderen Abteilungen der WKÖ – Junge Wirtschaft<br />
und EU-Stabsabteilung) sollen Unternehmen zum Export motiviert, Hemmschwellen<br />
abgebaut sowie Chancen und Wege in die Märkte aufgezeigt werden.<br />
In Ergänzung zu der von WKÖ-Präsident Christoph Leitl kommunizierten volkswirtschaftlichen<br />
Bedeutung von Export wurde von der AWO die betriebswirtschaftliche<br />
Komponente – Export bedeutet für das Unternehmen eine Streuung des Marktrisikos,<br />
durch Economies of Scale eine Stückkostendegression sowie ggf. durch den Imagegewinn<br />
auch steigende Chancen im Inland – betont.<br />
Medienkooperationen<br />
Die zweigleisige Linie (Exportmotivation und Exportinformation) wurde im Rahmen<br />
von Medienkooperationen mit einer Tageszeitung sowie einem Monatsblatt in Form<br />
von Advertorials und auch klassischen Werbesujets kommuniziert und durch rund 20<br />
„Neue Nachbarschaft“-Veranstaltungen begleitet. Ziel von Medienkooperationen und<br />
Veranstaltungen war es, Interesse zu wecken und darauf aufbauend an Hand erster<br />
Marktinformationen und dem Aufzeigen von Marktchancen zum Agieren zu motivieren.<br />
(Die Aktivitäten wurden durch das Förderprogramm „Neue Nachbarschaft“ vom<br />
BMWA unterstützt.)<br />
Förderprogramm „Neue Nachbarschaft“<br />
Im Rahmen des AWO-Konzepts der konzentrischen Kreise wird der interessierte Neuexporteur<br />
zunächst an die Märkte in der unmittelbaren Nachbarschaft herangeführt und<br />
dann erst im zweiten Schritt an weiter entfernt gelegene. Um konkret neue Firmen für<br />
ein Auslandsengagement zu gewinnen wurde die Veranstaltungsserie in Kooperation<br />
mit zwei Bankengruppen durchgeführt. Durch die Einbindung der Banken und deren<br />
Geschäftskundenbetreuer wurde sichergestellt, dass eine zielgruppengerechte Ansprache<br />
jener Unternehmen, die als potenzielle Exporteure in Frage kommen, erfolgt.<br />
In Anbetracht der unmittelbar bevorstehenden EU-Erweiterung erfolgte auf Grund des<br />
öffentlichen Interesses und der Nachfrage seitens der österreichischen Wirtschaft eine<br />
gewisse Schwerpunktsetzung auf die zukünftigen EU-Länder. Hier wurde insbesondere<br />
aufgezeigt, dass es gilt, schon jetzt – vor dem offiziellen Beitritt und dem damit<br />
verbundenen steigendem Interesse von Unternehmen aus dem gesamten EU-Raum<br />
– Marktpositionen zu besetzen und somit bessere Ausgangssituationen zu erarbeiten.<br />
Österreichischer Exporttag<br />
Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms mit Exportmotivations- und -informationsveranstaltungen<br />
war der erstmalig am 1. Juli abgehaltene 1. Österreichische Exporttag´03.<br />
265
Dieser auf drei Säulen (Informationsstände exportnaher Dienstleister, Workshops und<br />
individuelle Gespräche mit den Handelsdelegierten) basierende Event wurde von rund<br />
600 Exporteuren und zukünftigen Exporteuren besucht. Was für den Exportprofi ein Tag<br />
zu Erfahrungsaustausch, Networking und für die Beantwortung der einen oder anderen<br />
Frage, die zu stellen man sich noch nicht die Zeit genommen hatte, war, war für den<br />
Neuexporteur ein Tag der Informationsbeschaffung sowie ein Tag zum Kennenlernen<br />
exportnaher Dienstleister, die ihn mit ihrem Serviceangebot in neue Märkte begleiten<br />
können bzw. zum Teil sogar schon vor Ort sind.<br />
Begleitet wurden diese Aktivitäten von der Herausgabe des Exportleitfadens „Welcome<br />
to New Neighbours“, der neuen Exporteuren in konziser Form die wichtigsten Punkte<br />
der Exportabwicklung in die Nachbarländer näher bringt.<br />
Die Außenhandelsstellen<br />
Für die Außenhandelsstellen ist die Kontaktierung von Unternehmen unter Hinweis<br />
auf bestehende Geschäftsmöglichkeiten Teil der ihnen auferlegten „initiativen Marktbearbeitung“.<br />
Sie reagieren nicht nur auf ihnen aus Österreich zugehende Anfragen,<br />
sondern gehen von sich aus auf Firmen zu, wobei zwischen Exporteuren und Nichtexporteuren<br />
kein Unterschied gemacht wird. Stoßen sie dabei auf gänzlich unerfahrene<br />
Unternehmen, dann weisen sie auf die Zweckmäßigkeit einer Erstberatung durch<br />
AWO-Experten hin.<br />
Möglichkeiten zur Kontaktnahme für die Erstberatung sind:<br />
• Exportfit-Test im Internet unter wko.at/awo/exportfit/,<br />
• Kostenfreie Serviceline 0800-397678,<br />
• Außen<strong>wirtschafts</strong>abteilungen der Landeskammern als First-Stop-Shop in enger<br />
Abstimmung mit der AWO.<br />
Plattform Außenwirtschaft<br />
In ihrer Exportförderung treten AWO, die Landeskammern und die Experten für Handelspolitik<br />
und Integration unter dem gemeinsamen Erscheinungsbild der „Plattform<br />
Außenwirtschaft“ auf, setzten das First-Stop-Shop-Prinzip gegenüber den Mitgliedsfirmen<br />
um und sind in den Leistungsbereichen „Service und Beratung“, „Publikationen und<br />
Veranstaltungen“ sowie „Europa-Aktivitäten und <strong>internationale</strong> Interessenvertretung<br />
(Lobbying und Kooperation)“ um eine exakt koordinierte Vorgangsweise bemüht.<br />
Je nach ihrer Intensität der Ausführung werden die Leistungen in zwei „Linien“ angeboten:<br />
Business Line und Executive Line.<br />
Die Business Line bietet Basisunterstützung und ist kostenlos. Die kostenpflichtige<br />
Executive Line dagegen ist individuelle Exportunterstützung auf höherem Niveau. Hier<br />
werden maßgeschneiderte Konzepte erarbeitet, die gemeinsam – unter Einschaltung<br />
266
Walter Koren<br />
der Außenhandelsstellen – umgesetzt werden. Die Executive Line umfasst Projektbetreuung<br />
beim Markteintritt und bei der Marktbearbeitung sowie die Organisation<br />
von Wirtschaftsmissionen, Gruppenausstellungen und fachbezogenen Inlandsveranstaltungen.<br />
12.7 Die Prüfung der Exportfähigkeit<br />
Erstberatungen von Exportneulingen durch Experten der AWO haben zunächst das<br />
Ziel einer richtigen Einschätzung der Exportfähigkeit des beratenen Unternehmens.<br />
Die Exportfähigkeit des Betriebes wird nach folgenden Kriterien geprüft:<br />
• Welche freien Produktionskapazitäten stehen zur Verfügung? Gibt es derzeit<br />
Engpässe in der Produktion (personell, maschinell, beschaffungs- oder lagerungsmäßig),<br />
die zu Lieferschwierigkeiten führen könnten?<br />
• Ist genügend für den Export geschultes Personal vorhanden (Fremdsprachenkenntnisse,<br />
Beherrschung der Exporttechniken)?<br />
• Ist die Finanzierung der zusätzlichen Aufwendungen (Marktforschung, Reisekosten,<br />
Messebeschickung, maschinelle Verbesserungen, erhöhte Vorräte, zusätzliches<br />
Personal) gesichert?<br />
• Sind Informationsquellen bezüglich der Auslandsmärkte bekannt?<br />
Wird mangelnde „Exportfitness“ festgestellt, werden Maßnahmen überlegt, die einem<br />
Exporteinstieg vorangehen müssten.<br />
12.8 Marktselektion und Marktsegmentierung<br />
Gemeinsam werden danach Ziel- oder Testmärkte ausgewählt und unter Bedachtnahme<br />
auf die vorhandenen Unternehmensressourcen Exportstrategien erarbeitet. Das<br />
auf diese Grundsatzstrategien abgestimmte Maßnahmenpaket wird im Detail von den<br />
zuständigen Außenhandelsstellen ausgearbeitet.<br />
Marktselektion<br />
Bei der Marktselektion gilt als Grundregel, sowohl für Produkte als auch Unternehmensressourcen,<br />
am besten geeignete Märkte zu finden. Für den Exportneuling<br />
gilt als Grundregel, dass sprach- und mentalitätsmäßig nahe liegende Märkte das<br />
geringste Risiko beinhalten und daher als erste bearbeitet werden sollten. Daher gilt<br />
Bayern traditionell als Test- und Einstiegsmarkt. Mitunter kann hier sogar das Marketinginstrumentarium<br />
unverändert über die Grenze ausgedehnt werden: z.B. wird der<br />
Salzburger Vertreter einer Bettdeckenfabrik in Vorarlberg zusätzlich mit der Bearbeitung<br />
des oberbayrischen Marktes betraut.<br />
267
Die individuelle Vorgangsweise ist indessen von den Ergebnissen einer über die<br />
Handelsdelegierten eingeholten Marktanalyse abhängig. So war es etwa für einen<br />
Fleisch verarbeitenden Betrieb Oberösterreichs zweckmäßig, den Raum Norditalien<br />
dem bayrischen Markt auf Grund andersgearteter Konkurrenzverhältnisse vorzuziehen.<br />
Manche Neuexporteure aus dem Agrarbereich und der Investitionsgüterindustrie<br />
präferieren dagegen ein Joint Venture in Ungarn oder der Slowakei.<br />
Marktsegmentierung<br />
In vielen Fällen ist die Bearbeitung eines gesamten Ländermarktes gegenüber einer<br />
Marktsegmentierung zurückzustellen. Die Aufspaltung in Teilmärkte mit einem hohen<br />
Grad an Homogenität ermöglicht den Einsatz eines einheitlichen Marketinginstrumentariums,<br />
was die innerbetrieblichen Koordinierungsfunktionen wesentlich vereinfacht.<br />
Je nach Produkt und personeller Ausstattung kann die Segmentierung regional (z.B. in<br />
Frankreich wird nur der Elsass auf Grund seines hohen Anteils an Deutschsprachigen<br />
bearbeitet) oder kundenspezifisch (z.B. für einen Energy-Drink werden in Deutschland<br />
nur Jugendliche unter 25 Jahren angesprochen) gestaltet werden.<br />
12.9 Markteintrittsvarianten<br />
Auf die Marktselektion bzw. Marktsegmentierung folgt die Festlegung der Markteintrittsstrategie.<br />
Dabei stehen grenzüberschreitende Absatzbemühungen eines Unternehmens je nach<br />
der Rolle des Stammhauses und seiner Kapital- und Management-Leistung Varianten<br />
des Markteintritts bereit, die als stammlandorientiert oder als zielmarktorientiert<br />
bezeichnet werden können.<br />
Stammlandorientiert (ohne Kapitalinvestition) im Zielland sind:<br />
• Direkter und indirekter Export,<br />
• Lizenzvergabe,<br />
• Franchising.<br />
Zielmarktorientiert (mit Kapital- und Managementeinsatz im Zielland) sind:<br />
• Gründung von Alleinunternehmen für Vertrieb oder Produktion (Neugründung oder<br />
Erwerb),<br />
• Gründung von Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture).<br />
Obwohl bei den einleitenden Exportberatungsgesprächen grundsätzlich alle Varianten<br />
des Markteintritts berücksichtigenswert sind, können doch einzelne Umstände bewirken,<br />
dass von vornherein nicht das gesamte Spektrum zur Auswahl steht: Ein Importverbot<br />
im Zielland schließt den direkten und indirekten Export aus. Dienstleistungen,<br />
ihrer Natur nach weder transportier- noch lagerbar, können nur über Franchising, Joint<br />
268
Walter Koren<br />
Venture oder eigener Niederlassung vertrieben werden. Mangels adäquater Vertriebspartner<br />
im Gastland (unzureichende Vertreter- oder Distributionsstruktur) kann nur<br />
über Joint Venture oder Vertriebsniederlassung gearbeitet werden. Transportkostensensible<br />
Produkte werden im Überseegeschäft wahrscheinlich nicht im Exportweg<br />
abgesetzt werden können.<br />
12.9.1 Indirekter Export<br />
In der Regel wird dem Exportneuling als Einstiegsvariante der indirekte oder direkte<br />
Export empfohlen.<br />
Beim indirekten Export bedient sich der inländische Erzeuger eines heimischen Außenhandelsunternehmens<br />
und überträgt diesem Absatzorgan sämtliche aus dem Auslandsgeschäft<br />
resultierende Funktionen, Kosten und Risiken. Der Erzeuger tritt also<br />
mit dem Ausland überhaupt nicht in Kontakt, für ihn liegt ein reines Inlandsgeschäft<br />
vor. Die speziellen Länder- und Branchenkenntnisse des Exporthändlers lassen dessen<br />
Einsatz auch für größere Unternehmen zweckmäßig erscheinen, insbesondere<br />
wenn es sich um exotische oder nur mit einem geringen Absatzpotential ausgestattete<br />
Auslandsmärkte handelt.<br />
Im Bundesgremium des Außenhandels der WKÖ sind 4.700 Außenhandelsfirmen<br />
registriert, wovon sich 1.200 mit ihrer Länder- und Branchenspezialisierung im Internet<br />
präsentieren (www.foreign-trade.at)<br />
12.9.2 Direkter Export<br />
Bei der Entscheidung zum direkten Export finden die Außenhandelsstellen in der<br />
Unterstützung des exportwilligen Unternehmens ihren größten Aktionsradius.<br />
Der Handelsdelegierte vermittelt den Kontakt zu ausländischen Endkunden, sofern dieser<br />
Vertriebstyp gewählt wird, andernfalls zu Vertriebspartnern im Ausland: Importeure,<br />
Distributeure, Großhändler, Einzelhändler, Agenten, Handelsvertreter, Handelshäuser.<br />
Dabei schafft der Handelsdelegierte „qualifizierte Kontakte“, also nicht bloß Adressenmaterial,<br />
das auch im Internet abgerufen werden könnte, sondern es werden speziell<br />
auf die Bedürfnisse des österreichischen Exporteurs abgestimmte, grundsätzlich an<br />
einer Kontaktnahme interessierte Firmen von einwandfreier Bonität empfohlen.<br />
Für den in Aussicht genommenen Markteintritt erarbeiten die Außenhandelsstellen<br />
eine Entscheidungsgrundlage über Erfolgsaussichten und Ressourcenaufwand auf<br />
Grund der Analyse der<br />
• Importe und Exporte des Produkts (Eruierung des Inlandsbedarfs),<br />
• Konkurrenzsituation,<br />
269
• Importbestimmungen,<br />
• gesetzlichen Rahmenbedingungen,<br />
• Vertriebsstruktur,<br />
• sozio-kulturellen Besonderheiten des Landes, insbesondere im Hinblick auf die<br />
Konsumgewohnheiten,<br />
• nationalen Fachmessen,<br />
• geplanten österreichischen Gruppenausstellungen und anderer Veranstaltungen.<br />
Zur Erstellung des Idealprofils des gesuchten Geschäftspartners benötigt die Außenhandelsstelle<br />
präzise Informationen über das exportwillige Unternehmen und dessen<br />
Produkt- und Leistungsangebot, um folgende Aufgaben effizient übernehmen zu<br />
können:<br />
• Selektion des Adressmaterials,<br />
• Mailing mit persönlichem Schreiben des Handelsdelegierten, eventuell mit beigefügtem<br />
Unterlagenmaterial zur Präsentation des österreichischen Anbieters,<br />
• Telefonmarketing bzw. telefonische Kontaktaufnahme nach erfolgtem Mailing,<br />
• Persönliche Unterredung des Handelsdelegierten mit dem Partner in seinem Betreuungsbereich,<br />
etwa bei einem Besuch im Unternehmen oder bei einem Meeting<br />
(anlässlich einer Dienstreise, eines Messebesuches, eines Vertretertreffens oder<br />
einer anderen Veranstaltung).<br />
Diese Dienstleistungen zur Ermöglichung des Markteintritts sind als Teil der „Business<br />
Line“ der Außenhandelstellen bis zu einem Ausmaß von acht Stunden kostenlos, lediglich<br />
eventuelle Fremdkosten werden in Rechnung gestellt. Werden jedoch pro Projekt<br />
acht Personenstunden überschritten, dann kommt die „Executive Line“ zur Anwendung,<br />
bei der ein fixer Stundensatz verrechnet wird (derzeit 100 Euro pro Stunde).<br />
12.9.3 Andere Formen der Marktbearbeitung<br />
Investitionsberatung der Außenhandelsstellen ist dann gefragt, wenn der Markteintritt<br />
nicht über den herkömmlichen Export, sondern über eine intensivere Form der Internationalisierung<br />
erfolgt.<br />
Die Außenhandelsstelle hilft bei der Gründung von Vertriebs- oder Produktionsniederlassungen,<br />
bei Joint Ventures und Kapitalbeteiligungen sowie bei der Vergabe oder<br />
Hereinnahme von Lizenzen und Know-how. Hauptfunktionen des Handelsdelegierten<br />
sind dabei die Identifikation geeigneter Standorte, die Partnersuche und die Rechts-<br />
und Finanzberatung.<br />
270
12.9.4 Exportkooperation<br />
Walter Koren<br />
Cluster<br />
Im Rahmen der „Exportoffensive der Bundesregierung“ von 1998 bis 2000 wurden<br />
zahlreiche kooperative Formen des Markteintritts und der Marktbearbeitung unter dem<br />
Stichwort „Exportcluster“ ins Leben gerufen. Die Besonderheit dieser aus Bundesmitteln<br />
unterstützten und von der AWO betreuten, strategischen Allianzen besteht in ihrer<br />
Ausrichtung auf Erhöhung der <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit. Da es für einzeln<br />
operierende Unternehmen zunehmend schwieriger wird, im globalen Wettbewerb<br />
zu bestehen, kam es zu Zusammenschlüssen von rechtlich unabhängig bleibenden<br />
Unternehmen, die durch Bündelung der gemeinsamen Ressourcen eine Steigerung<br />
ihrer Konkurrenzfähigkeit anstreben (siehe dazu auch Kapitel 16).<br />
Im Regelfall schließen sich die Anbieter komplementärer Produkte zu derartigen<br />
Exportgemeinschaften zusammen, was diese in die Lage versetzt, ein breites Angebotsprogramm<br />
zu bieten. Dies ist etwa bei den Lebensmittelclustern der Fall. Wird<br />
dagegen eine besondere Sortimentstiefe angestrebt, kommt es zur Allianz aktueller<br />
oder potenzieller Konkurrenten, z.B. im Vorarlberger „Exportcluster Holzbau“.<br />
Ein Sonderfall des „Exportcluster“ ist die auf eine bestimmte Marktregion ausgerichtete<br />
Kooperationsform: „Almako – Austrian Regional Business Cooperation Cluster“<br />
umfasst Teilnehmer verschiedenster Branchen zur Bearbeitung der Märkte Albanien,<br />
Mazedonien und Kosovo.<br />
Andere Formen der Kooperation<br />
Im Rahmen der <strong>internationale</strong>n Marketingkooperation sind neben den als „Cluster“<br />
bezeichneten Exportgemeinschaften auch Exportringe und Formen der Projektkooperation<br />
für den Einstieg ins Exportgeschäft hilfreich.<br />
Unter einem Exportring versteht man die Kooperation von Herstellerfirmen mit einem<br />
Exporthandelsbetrieb. Dabei führt der Handelsbetrieb sämtliche Exportgeschäfte für<br />
die Hersteller durch, betreibt selbst aber keinen Eigenhandel.<br />
Projektkooperation ist eine vorübergehende Zusammenarbeit zur Realisierung gemeinsamer<br />
Projekte. Derartige Ad-hoc-Kooperationen sind vor allem im Anlagengeschäft<br />
häufig. In der Projektgemeinschaft übernimmt der Partner mit der größten Erfahrung<br />
die Führung als Generalunternehmer, die „Subcontractors“ fungieren als seine Zulieferanten.<br />
Hierdurch ist eine abgewandelte Form des indirekten Exports gegeben.<br />
271
12.10 Ausblick<br />
Die WKÖ setzt sich als mittelfristiges Ziel, die Zahl der Exporteure von 15.000 im Jahr<br />
2001 auf 30.000 im Jahre 2007 zu verdoppeln. Dieses Ziel ist ehrgeizig, aber nicht<br />
unrealistisch.<br />
Schwieriger wird es sein, den Überseeanteil auf 20 % der Gesamtexporte zu erhöhen.<br />
Hiezu bedarf es besonderer Anstrengungen in Kooperation mit allen außenhandelsrelevanten<br />
Institutionen Österreichs. Im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „go<br />
international“, einer Initiative des BMWA und der WKÖ, trägt ein eigenes Maßnahmenpaket<br />
mit den Schwerpunkten Neuexporteure, Fernmärkte, Internationalisierungsberatung,<br />
Dienstleistungsexporte und KMUs zur Erreichung dieser Ziele bei.<br />
Literaturverzeichnis<br />
Apfelthaler, G. (1999), Internationale Markteintrittsstrategien, Manz Verlag Schulbuch, Wien.<br />
Engelhard, J. (1992), Exportförderung, Wiesbaden.<br />
Meffert, H., Bolz, J. (1998), Internationales Marketing-Management, Stuttgart.<br />
Schnitt, P. (2000), Funktionelle Exportförderung in Österreich und anderen europäischen Ländern,<br />
Wirtschaftskammer Österreich, Wien.<br />
Anmerkungen<br />
* Dr. Walter Koren ist Leiter der Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation der Wirtschaftskammer Österreich<br />
in Wien.<br />
272
13 DIREKTINVESTITIONS-FÖRDERUNG<br />
HEUTE UND MORGEN<br />
Reinhard Moser*<br />
13.1 Zielvorgabe und Aufbau des Beitrages<br />
Stellt man die Analyse der unterschiedlichen Maßnahmen, mit denen Direktinvestitionen<br />
in Österreich gefördert werden, in den Mittelpunkt, gilt es zunächst, die Sichtweise<br />
zu präzisieren: Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Beitrages sind aktive<br />
Auslandsinvestitionen (outgoing foreign direct investment), die von österreichischen<br />
Unternehmen im Ausland getätigt und die durch öffentliche Institutionen in Österreich<br />
unterstützt werden.<br />
Ergänzend treffen diese Investitionen in vielen Fällen auf eine Förderung in den<br />
jeweiligen Zielländern, deren Ausmaß die Direktinvestitions-Entscheidung eines<br />
Unternehmens wesentlich beeinflussen kann. In weiter Auslegung kann man sogar<br />
Maßnahmen eines Landes zur Attrahierung von Direktinvestitions-Zuflüssen auch<br />
als gleichzeitiges Angebot an inländische Unternehmen deuten, den Inlandsstandort<br />
nicht aufzugeben, womit sich eine Gegenbewegung zur Förderung aktiver Auslandsinvestitionen<br />
ergeben kann. 1 Auf diesen Aspekt wird im gegebenen Zusammenhang<br />
hingewiesen, aber in diesem Beitrag nicht näher eingegangen. Vielmehr werden in<br />
einer kurzen Zusammenfassung der Ausgangssituation im folgenden Abschnitt 13.2<br />
nach einer inhaltlichen Abgrenzung zum Direktinvestitions-Begriff die Problemfelder<br />
auf der Unternehmensebene und die daraus erwachsenden Förderungsansätze beleuchtet.<br />
Ein kurzer Hinweis thematisiert die Frage der Zulässigkeit derartiger nationaler<br />
Förderungsansätze im <strong>internationale</strong>n Kontext.<br />
Den Kern der Analyse bildet die Präsentation der wesentlichen österreichischen<br />
Förderungsmaßnahmen hinsichtlich der jeweiligen Anwendungsbereiche im Abschnitt<br />
13.3. Als Resümee beleuchtet sodann der abschließende Abschnitt 13.4 die Zukunft<br />
der Förderungsaktivitäten im Direktinvestitions-Bereich und formuliert ausgewählte<br />
Desiderate für deren zukünftige Ausgestaltung.<br />
13.2 Ausgangssituation<br />
13.2.1 Inhaltliche Abgrenzung<br />
Wenngleich nach wie vor um einen einheitlichen Direktinvestitions-Begriff gerungen<br />
wird, hat sich in der <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftlichen Literatur weitgehend durchgesetzt,<br />
dass es sich bei ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment – FDI)<br />
um Kapitalanlagen im Ausland handelt, die vom Investor in der Absicht vorgenommen<br />
werden,<br />
273
(1) Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des kapitalempfangenden Unternehmens zu<br />
gewinnen oder zu verstärken,<br />
(2) die Kapitalbasis eines bereits kontrollierten Unternehmens zu erweitern oder<br />
(3) ein neues Unternehmen zu gründen. 2<br />
Die Abgrenzung des Direktinvestitions-Begriffs ist zunächst aus dem Blickwinkel der<br />
statistischen Erfassung von hohem Interesse. In diese Richtung zielt die OECD-<br />
Benchmark-Definition von Foreign Direct Investment:<br />
„Foreign direct investment reflects the objective of obtaining a lasting interest by a<br />
resident entity in one economy (‚direct investor’) in an entity resident in an economy<br />
other than that of the investor (‚direct investment enterprise’). The lasting interest<br />
implies the existence of a long-term relationship between the direct investor and the<br />
enterprise and a significant degree of influence on the management of the enterprise.<br />
Direct investment involves both the initial transaction between the two entities and all<br />
subsequent capital transactions between them and among affiliated enterprises, both<br />
incorporated and unincorporated.” 3<br />
Betrachtet man die gesamtwirtschaftlichen Daten aus österreichischer Sicht, ergibt<br />
sich zum Stand der österreichischen Direktinvestitionen in den Jahren 1990 –2002<br />
das folgende Bild:<br />
Österreichische Direktinvestitionen 1990 bis 2002 Abb. 13.1<br />
Quelle: OeNB.<br />
274<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1990<br />
1991<br />
Aktive Direktinvestitionen<br />
1992<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
Passive Direktinvestitionen<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002
Reinhard Moser<br />
In Ergänzung zu den Makrodaten eröffnet sich ein unterschiedlicher Zutritt zum Thema<br />
unternehmerischer Direktinvestitionen 4 im Rahmen der betriebswirtschaftlichen<br />
Untersuchung des Internationalisierungspfades von Unternehmen. Folgt man dem<br />
klassischen Muster, dass der Internationalisierungsprozess ein schrittweises Lernen<br />
beinhaltet, 5 stellen die Direktinvestitions-Varianten als Joint Ventures bzw. 100 %-<br />
Tochtergesellschaften eine fortgeschrittene Stufe <strong>internationale</strong>r Unternehmensaktivität<br />
dar, wie dies die folgende Abbildung 13.2 zeigt:<br />
Stufenschema <strong>internationale</strong>r Unternehmenstätigkeit Abb. 13.2<br />
Leistungserstellung im Inland<br />
indirekter Export<br />
Exportkooperation<br />
direkter Export<br />
direkter Export mit<br />
Vertriebs-Direktinvestitionen<br />
Leistungserstellung im Ausland<br />
ohne<br />
Kapitalbeteiligung<br />
Lizenzvergabe/<br />
Franchising<br />
Vertragsfertigung<br />
Managementvertrag<br />
mit<br />
Kapitalbeteiligung<br />
Joint Venture<br />
100 %-Tochtergesellschaft<br />
Eine gerade aus österreichischer Sicht besonders wichtige Anmerkung gilt es abrundend<br />
anzubringen: Während im Bereich großer, transnational tätiger Unternehmen<br />
die Strategien der Marktbearbeitung in hohem Ausmaß Direktinvestitionen umfassen,<br />
resultiert aus der zunehmenden Komplexität <strong>internationale</strong>r Verflechtungen gerade für<br />
das Unternehmenssegment der Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) eine Reihe<br />
spezifischer Problemfelder, die identifiziert werden müssen und schlussendlich auch<br />
Ansatzpunkte für einschlägige Unterstützungsmaßnahmen liefern können.<br />
13.2.2 Problemfelder<br />
Im Mittelpunkt vieler Literaturaussagen über die unternehmerischen Direktinvestitions-<br />
Aktivitäten steht häufig eine Auseinandersetzung mit den Gründen, die zur Vornahme<br />
von ausländischen Direktinvestitionen geführt haben bzw. führen. Hier ist es in den<br />
letzten Jahren zu einer Erweiterung der traditionellen Bestimmungsgründe, die vor<br />
allem auf die Absatzmöglichkeiten im Zielland bzw. auf Beschaffungsaktivitäten aus<br />
dem Zielland abstellen, gekommen. 6 Im Zuge der fortschreitenden Globalisierung geht<br />
es heute oftmals stärker um die effizienzorientierte Neugestaltung der Wertschöp-<br />
275
fungskette unter Ausnutzung spezifischer Vorteile unterschiedlicher Standortländer.<br />
Die Motive für Direktinvestitionen haben sich damit von einer starken Orientierung auf<br />
die Märkte der Gastländer zu einer Weltmarkt- oder Effizienzorientierung verschoben; 7<br />
anders formuliert: Das ausländische Direktinvestitions-Unternehmen dient zunehmend<br />
als Plattform für Exportaktivitäten in Drittländer. 8<br />
Dass bei dieser Ausweitung auch eine Fülle von Problemfeldern zu Tage getreten<br />
sind, belegt beispielsweise die – auf einen ursprünglich bereits aus dem Jahre 1976<br />
stammenden Ansatz zurückgehende – Formulierung von OECD-Leitsätzen für multinationale<br />
Unternehmen in der Neufassung 2000, die auf dem Prinzip der Freiwilligkeit<br />
Regelungen für ein verantwortungsvolles und dem geltenden Recht entsprechendes<br />
unternehmerisches Verhalten bei Auslandsinvestitionen postulieren. 9<br />
Wie bereits erwähnt, spielen neben den üblicherweise betrachteten Großunternehmen<br />
gerade auch dem Bereich der KMU zuzurechnende Direktinvestoren eine wichtige<br />
Rolle, welche die Chancen aus der intensiven Erschließung neuer Märkte bzw. die<br />
kostenseitigen Vorteile, die sich aus Verlagerungsprozessen ergeben können, mit<br />
dem Ziel einer Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit vermehrt nutzen. Dies betrifft<br />
besonders deutlich die Zielregion der Transformationsländer; eine Befragung des<br />
Instituts für Mittelstandsforschung Bonn ermittelte für die Region der Visegrad-Länder<br />
einen Anteil der mittelständischen Investoren von mehr als 50 % (im Vergleich zum<br />
üblicherweise angesetzten Wert von rund einem Drittel, das mittelständische Investoren<br />
zum Gesamt der deutschen Auslands-Direktinvestitionen weltweit beitragen). 10<br />
Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit den Hemmnissen, die einer zunehmenden<br />
Direktinvestitions-Tätigkeit aus Unternehmenssicht im Wege stehen, lassen sich – aufbauend<br />
auf den Problemfeldern der Exporttätigkeit, die schon frühzeitig zur Kreation<br />
entsprechender Exportförderungsmaßnahmen geführt haben, – die entsprechenden<br />
Schwachpunkte bei Direktinvestitionen in drei wichtigen Bereichen orten: 11<br />
• Problemfeld Informationsgewinnung/Erlangung von Marktkenntnissen<br />
(Kernfragen betreffen die Marktauswahl, die Ermittlung des Marktpotentials und<br />
die Kenntnis über mögliche Zielobjekte.)<br />
• Ressourcen-Probleme<br />
(Neben dem Schwerpunkt der Personalrekrutierung steht vor allem die Frage<br />
der Bereitstellung des für Direktinvestitionen erforderlichen Risikokapitals im<br />
Mittelpunkt.)<br />
• Problemfeld Direktinvestitions-Risiken<br />
(Hier treten alle drei Risikoarten der <strong>internationale</strong>n Geschäftstätigkeit, die <strong>politische</strong>n,<br />
wirtschaftlichen und Wechselkursrisiken in einer besonderen Qualität<br />
auf.)<br />
276
13.2.3 Förderungsarten und Förderungszulässigkeit<br />
Reinhard Moser<br />
Aus dem Grundgedanken, dass ausländische Direktinvestitionen aus einem betriebswirtschaftlichen<br />
Blickwinkel eine wichtige Markteintrittsstrategie darstellen und daraus eine<br />
vorteilhafte Situation nicht nur in Richtung auf verstärkte Exportaktivitäten entsteht,<br />
sondern auch gesamtwirtschaftlich positive Effekte Platz greifen, resultiert die Bereitstellung<br />
effizienter Fördermöglichkeiten, damit Unternehmen auf dem Direktinvestitionsweg<br />
die identifizierten Hemmnisse bewältigen können. Dabei wird stets davon<br />
ausgegangen, dass die wirtschaftliche Bedeutung der Direktinvestitions-Tätigkeit in<br />
ihrer Komplementarität zu Exportaktivitäten liegt 12 und Unternehmen bei der Verbesserung<br />
ihrer <strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit unterstützt werden sollen.<br />
Eine sinnvolle Förderpolitik hat bereits frühzeitig mit ihrem Instrumentarium genau<br />
an der Bewältigung der im vorigen Abschnitt aufgelisteten Problemfelder angesetzt.<br />
Die Maßnahmen werden daher üblicherweise auch in vier Ansatzpunkte unterschieden.<br />
13<br />
• Unterstützung im Bereich der Informationsgewinnung<br />
• Unterstützung im Bereich der Risikoabsicherung<br />
• Unterstützung im Bereich der Kapitalaufbringung<br />
• Steuer<strong>politische</strong> Maßnahmen<br />
Bevor auf den Status quo in diesem Bereich in Österreich eingegangen und die Frage<br />
nach der Effizienz der Direktinvestitions-Förderung gestellt wird, ist noch ein Blick<br />
auf die <strong>internationale</strong>n Rahmenbedingungen zu werfen, welche die Zulässigkeit von<br />
Förderaktivitäten stark reglementieren. Diese werden gerade im Feld grenzüberschreitender<br />
Transaktionen besonders genau überprüft.<br />
Analog zum weiten Feld von Maßnahmen auf dem Sektor der Exportförderung 14<br />
unterliegt auch die Direktinvestitions-Förderung strengen Regelungen und Beschränkungen,<br />
die sich einerseits aus den entsprechenden GATT/WTO-Normen 15 ergeben,<br />
andererseits aus den wettbewerbsrechtlichen Regelungen und dem Beihilfenrecht der<br />
Europäischen Union. 16 Nur wenn die entsprechenden Instrumentarien kostendeckend<br />
kalkuliert sind und keine Beihilfenelemente enthalten, wird den EU-Bestimmungen<br />
entsprochen.<br />
Eine Sonderstellung kommt dabei allen Förderungen zu, die sich an KMU richten. 17<br />
In diesem Falle wird akzeptiert, dass Beihilfen bis zu einer bestimmten Obergrenze<br />
nicht dazu geeignet sind, den grenzüberschreitenden Wettbewerb zu verzerren („De<br />
Minimis”-Regel). In diesem Sinne wird eine Reihe der Förderungsaktionen, die für<br />
Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen existieren, als geringfügige Beihilfe<br />
gemäß Wettbewerbsrecht der EU eingestuft.<br />
277
13.3 Förderung ausländischer Direktinvestitionen in<br />
Österreich – Status quo<br />
13.3.1 Übersicht<br />
Der in der Literatur vorherrschenden Gliederung unterschiedlicher Förderungsmaßnahmen<br />
folgend, wird nachstehend der Status quo bedeutender Unterstützungs-<br />
Instrumente für österreichische Unternehmen, die eine Direktinvestition durchführen,<br />
exemplarisch dargestellt. Die vorangestellte Synopse (Abbildung 13.3) soll den Überblick<br />
erleichtern.<br />
Direktinvestitions-Förderung für österreichische Unternehmen Abb. 13.3<br />
Für die genannten Förderungsbereiche gilt:<br />
• Betrachtet man vorweg Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der<br />
Informationsgewinnung, stehen hier Aktivitäten der Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation<br />
der Wirtschaftskammer Österreich traditionell an erster Stelle, wenn es<br />
um eine auslandsbezogene Geschäftstätigkeit österreichischer Unternehmen<br />
geht. Dies beinhaltet in vielen Fällen auch die Einschaltung der Handelsdelegierten<br />
mit ihrer Vor-Ort-Expertise in der Frühphase von Direktinvestitions-Ent-<br />
278<br />
Informationsgewinnung<br />
Wirtschaftskammer<br />
Österreich - AWO<br />
G11 und<br />
Markterschließungsfinanzierung<br />
AWS-<br />
Studienfonds<br />
Förderungsbereiche<br />
Risikoabsicherung<br />
Beteiligungs-<br />
Garantien G4<br />
(<strong>politische</strong>s Risiko)<br />
Garantien der AWS<br />
(wirtschaftliches Risiko)<br />
Kapitalaufbringung<br />
Beteiligungsfinanzierung<br />
(EFV/OeKB)<br />
ERP-Internationalisierungsprogramm<br />
Starthilfekredite<br />
Steuer<strong>politische</strong><br />
Maßnahmen
Reinhard Moser<br />
scheidungsprozessen und damit zusammenhängenden Beratungsleistungen.<br />
In dieser Phase der Investitionsvorbereitung fallen in der Regel Vorlaufkosten<br />
an, beispielsweise für in Auftrag gegebene Marktstudien, Beraterhonorare etc.<br />
KMUs können sich in dieser Startphase in Form der Markterschließungsgarantie<br />
G11 auf Basis des Ausfuhrförderungsgesetzes (AFG) 1981 dagegen absichern,<br />
dass sie das Umsatzziel im neuen Markt innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht<br />
erreichen, und in diesem Fall einen Teil der getätigten Aufwendungen für die<br />
Markterschließung ersetzt erhalten. Parallel dazu besteht die Möglichkeit der<br />
Markterschließungsfinanzierung, wobei die Kredithöhe durch die projektierten<br />
Aufwendungen für den Auslandsmarkteintritt bestimmt wird. Die Abwicklung<br />
beider Programme erfolgt über die Österreichische Exportfonds Ges.m.b.H. 18<br />
Förderungszuschüsse für externe Beratungsleistungen – beispielsweise Feasibility-Studien,<br />
Geschäftsplanerstellung, Gutachten etc. – im Zusammenhang<br />
mit österreichischen Auslands-Direktinvestitionen können aus dem bei der Austria<br />
Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (AWS) eingerichteten Studienfonds bis zu<br />
bestimmten Höchstgrenzen gewährt werden. Die AWS berät österreichische<br />
Direktinvestoren auch im Hinblick auf das teilweise sehr unübersichtlich gewordene<br />
Instrumentarium, das Internationale Finanzinstitutionen für die Vorbereitung<br />
von Internationalisierungsaktivitäten und im Rahmen konkreter Risikoabsicherungs-<br />
und/oder Finanzierungsmaßnahmen bereitstellen. Dabei stellt auch die<br />
Mitgliedschaft bei den European Development Finance Institutions (EDFI) einen<br />
bedeutenden Faktor dar, der eine Vielzahl von Kooperationen der AWS mit Internationalen<br />
Finanzinstitutionen ergänzt.<br />
• Das im Brennpunkt stehende Instrumentarium in den Bereichen Risikoabsicherung<br />
und Kapitalaufbringung wird in einem höheren Detaillierungsgrad in den<br />
Abschnitten 13.3.2 und 13.3.3 behandelt.<br />
• Hinsichtlich der für den Direktinvestitions-Bereich relevanten steuer<strong>politische</strong>n<br />
Maßnahmen, mit denen gezielt Anreize für österreichische Direktinvestoren gesetzt<br />
werden, ist im Zuge der Steuerreform 2005 19 auf die an die Stelle der bestehenden<br />
Organschaftsregelung tretende Neuregelung der Gruppenbesteuerung hinzuweisen.<br />
Diese enthält starke Anreize, Konzernzentralen und regionale Headquarters<br />
in Österreich besser zu stellen, womit gleichzeitig auch ein Ansporn für die<br />
Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Österreich bezweckt wird. Innovativ<br />
ist dabei die Möglichkeit einer Gruppenbildung zwischen in- und ausländischen<br />
Unternehmen, die bereits ab einer mehr als 50 %igen Kapitalbeteiligung möglich<br />
ist und im Rahmen von Joint Ventures auch „Mehrmüttergruppen” zulässt.<br />
279
13.3.2 Unterstützung im Bereich der Risikoabsicherung<br />
Unternehmen, die Direktinvestitionen im Ausland vornehmen, sehen sich in Ergänzung<br />
zu klassischen Risikoarten des Auslandsgeschäfts zusätzlichen Risiken ausgesetzt.<br />
Diese betreffen auf dem Feld <strong>politische</strong>r Risiken primär alle Tatbestände im Bereich<br />
von Enteignung, schleichender Enteignung (creeping expropriation), Gewinntransferverboten<br />
und vergleichbaren Maßnahmen der Gastlandregierung. Zusätzlich ergibt<br />
sich auch ein breites Feld wirtschaftlicher Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit,<br />
das weit über die Risikobelastung bei Exportgeschäften hinausreicht. Eine eigene<br />
Dimension stellt das Feld von Wechselkursrisiken dar. 20<br />
Eine generelle, als indirekt anzusprechende Unterstützung im Sektor ausländischer<br />
Direktinvestitionen ergibt sich durch bilateral abgeschlossene Investitionsförderungs-<br />
bzw. Investitionsschutzverträge. Diese zielen auf die Schaffung rechtlich stabiler<br />
Rahmenbedingungen für die Investoren ab und sollen ihnen Rechtsschutz bieten.<br />
Angesprochen sind dabei vorrangig die Garantien des freien Verkehrs von Kapital<br />
und Erträgen, der Eigentumsschutz mit entsprechenden Entschädigungsregeln für<br />
den Fall von Enteignungen und die Installierung einer Schiedsgerichtsregelung für<br />
den Fall von Streitigkeiten zwischen dem Investor und dem Gastland. 21<br />
Geht man auf die Ebene einzelner Direktinvestitions-Fälle, werden österreichische<br />
Unternehmen im Rahmen der Absicherung auftretender Direktinvestitions-Risiken<br />
• auf nationaler Ebene im Wege der Beteiligungsgarantien nach dem AFG 1981<br />
bzw. des Förderinstrumentariums der AWS,<br />
• im Rahmen unterschiedlicher Programme auf europäischer Ebene und<br />
• durch die MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) als supranationale<br />
Institution<br />
unterstützt. Das dabei zur Verfügung stehende Instrumentarium auf nationaler Ebene<br />
wird in der Folge kurz umrissen.<br />
Beteiligungsgarantien nach dem AFG 1981<br />
Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) bietet als Bevollmächtigte des Bundes<br />
Haftungen in Form von Beteiligungsgarantien zur Absicherung <strong>politische</strong>r Risiken an.<br />
Die Beteiligungsgarantie (Bundesgarantie G4 auf Basis des AFG 1981) deckt den<br />
aufrechten Bestand der Rechte des Investors aus seiner Beteiligung bis zu einem<br />
festgelegten Höchstbetrag zuzüglich Erträge sowie Zinsen bis maximal 20 % p.a. 22<br />
Wesentliche Voraussetzung für die Garantieerteilung ist ein positiver Leistungsbilanzeffekt,<br />
der sich beispielsweise aus einer Ausweitung der Absatzorganisation (Gründung<br />
einer Vertriebs-Tochtergesellschaft im Ausland) für in Österreich erzeugte Produkte<br />
ergibt, aus Lizenzvergaben an das Direktinvestitions-Unternehmen zukünftige Einnah-<br />
280
Reinhard Moser<br />
men erwarten lässt oder aber daraus resultiert, dass der österreichische Direktinvestor<br />
in die Lage versetzt wird, einen Teil der Fertigungsschritte (Wertschöpfungskette)<br />
zwecks Erlangung <strong>internationale</strong>r Wettbewerbsfähigkeit ins Ausland auszulagern. 23<br />
Die von der Beteiligungsgarantie G4 gedeckten <strong>politische</strong>n Risiken umfassen:<br />
• Die direkte oder indirekte, gänzliche oder teilweise Entziehung von Beteiligungsrechten<br />
oder Rechten aus beteiligungsähnlichen Rechtsgeschäften (beispielsweise<br />
im Zuge einer Verstaatlichung oder Enteignung);<br />
• die Zerstörung oder Entziehung eines so wesentlichen Teils der Vermögenswerte,<br />
dass das Unternehmen ohne Verlust nicht mehr weitergeführt werden kann;<br />
• die länger als drei Monate dauernde Beschränkung oder Behinderung des Transfers<br />
oder der Verfügung über folgende Vermögenswerte: Erträge aus Beteiligungen<br />
(Gewinnanteile, Dividenden), Kapitalrückzahlungen und Zinsendienst auf<br />
beteiligungsähnliche Darlehen bzw. Erlös aus dem Verkauf oder der Abwicklung<br />
der Beteiligung. 24<br />
Derzeit werden je nach Bonität des Ziellandes der Direktinvestition zwischen 95 % und<br />
100 % des Risikos gedeckt; die Laufzeit der G4-Beteiligungsgarantie wird den Erfordernissen<br />
des konkreten Projektes angepasst und kann bis zu 25 Jahre währen.<br />
Da die G4-Beteiligungsgarantie auf die Abdeckung <strong>politische</strong>r Risiken ausgelegt ist, findet<br />
sie vorrangig bei Direktinvestitions-Projekten in Ländern außerhalb der OECD Anwendung.<br />
Dies erklärt auch, warum in einem Vergleich zwischen den österreichischen<br />
Brutto-Neuinvestitionen einerseits und den Neuzusagen für G4-Beteiligungsgarantie<br />
in der selben Periode der Anteil der durch G4-Beteiligungsgarantien gedeckten, neu<br />
vorgenommenen Brutto-Direktinvestitionen in den letzten Jahren stark abgesunken<br />
ist. Die Entwicklung über den Zeitraum 1995 bis 2003, für den Detaildaten vorliegen,<br />
zeigt Tabelle 13.1, aus der auch hervorgeht, dass die (zuletzt verfügbare) aktuelle<br />
Deckungsquote für das Jahr 2003 rd. 4 % beträgt.<br />
Österreichische Direktinvestitionen, Brutto-Neuinvestitionen und<br />
Neuzusagen von G4-Beteiligungsgarantien<br />
Brutto-Neuinvestitionen (in Mio. Euro) Neuzusagen G4 (in Mio. Euro)<br />
1995 1504 155<br />
1996 1796 211<br />
1997 2046 300<br />
1998 3330 969<br />
1999 3607 478<br />
2000 6634 449<br />
2001 6000 498<br />
2002 5974 470<br />
2003 6300 249<br />
Quelle: OeNB, OeKB.<br />
Tab. 13.1<br />
281
In graphischer Form präsentiert die Abbildung 13.4 den Zusammenhang zwischen der<br />
Neu-Investitionstätigkeit österreichischer Unternehmen und den dafür übernommenen<br />
Haftungen für <strong>politische</strong> Direktinvestitions-Risiken.<br />
Gegenüberstellung der Brutto-Neuinvestitionen und der G4-Neuzusagen Abb. 13.4<br />
Quelle: OeNB, OeKB.<br />
282<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
Neuzusagen G4 (in Mio. Euro) Brutto-Neuinvestition (in Mio. Euro)<br />
Was die regionalen Schwerpunkte im Einsatz von G4-Beteiligungsgarantien betrifft,<br />
zeigt die folgende Tabelle 13.2 die konkrete Situation in den wichtigsten Zielländern<br />
im Fünfjahres-Vergleich für den Zeitraum 1993 – 1998 – 2003:
Reinhard Moser<br />
Regionale Aufschlüsselung gewährter G4-Beteiligungsgarantien Tab. 13.2<br />
Land 1993 1998 2003<br />
Tschechische Republik 34 113 44<br />
Ungarn 145 112 39<br />
Kroatien 3 29 33<br />
Rumänien 2 12 26<br />
Slowakei 16 39 22<br />
Polen 14 20 15<br />
China 1 15 12<br />
Bosnien-Herzegowina - - 11<br />
Indien 4 6 8<br />
Russland 9 10 8<br />
Slowenien 16 22 8<br />
Libyen 5 1 1<br />
übrige Länder 58 66 83<br />
Summe gesamt 307 445 299<br />
Quelle: OeKB.<br />
Förderinstrumentarium der AWS<br />
Die AWS zielt in den von ihr gestionierten Internationalisierungsprogrammen darauf<br />
ab, das Engagement der österreichischen Wirtschaft im <strong>internationale</strong>n Kontext zu<br />
stärken und die <strong>internationale</strong> Präsenz österreichischer Unternehmen auszubauen.<br />
Konkret bietet sie Garantien zur Absicherung des wirtschaftlichen Risikos im Zusammenhang<br />
mit ausländischen Direktinvestitionen österreichischer Unternehmen an,<br />
wobei konzeptionell zwischen zwei Garantiearten zu unterscheiden ist:<br />
(1) Direktgarantien bzw. Projektgarantien<br />
Diese sichern dem Investor das wirtschaftliche Risiko von ausländischen Direktinvestitionen<br />
bis zu maximal 50 % der eingesetzten Projektmittel ab.<br />
(2) Finanzierungsgarantien<br />
Diese dienen zur Absicherung des Kreditinstituts, das gegenüber dem inländischen<br />
Direktinvestor Kreditmittel zur Finanzierung des Internationalisierungsprojektes zur<br />
Verfügung gestellt hat. Den Haftungsfall bildet somit die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens<br />
über das Vermögen des österreichischen Direktinvestors als Kreditnehmer.<br />
Eine Besonderheit stellen Finanzierungsgarantien mit Risk-Sharing dar, bei denen<br />
zusätzlich zu den Finanzierungsrisiken des Kreditinstituts auch das Misserfolgsrisiko<br />
des Direktinvestitions-Projekts als besonderer Garantiefall in die Deckung miteinbezogen<br />
wird.<br />
Die Abwicklung der Risikoübernahme funktioniert in zwei Programmen, die in der<br />
folgenden Abbildung 13.5 zugeordnet werden:<br />
283
• Aktion „Förderung der Internationalisierung von KMUs durch Garantien“ (maximale<br />
Projektkosten1 Mio. Euro; maximale Laufzeit: 10 Jahre)<br />
• Garantien im Rahmen des Ost-West-Fonds (Projektvolumen soll den Betrag von<br />
1 Mio. Euro nicht unterschreiten; maximale Laufzeit: 12 Jahre)<br />
Garantie-Angebot der AWS im Internationalisierungsbereich Abb. 13.5<br />
284<br />
Aktion „Förderung der<br />
Internationalisierung von KMUs<br />
durch Garantien“<br />
Instrumentarium<br />
der AWS<br />
Direktgarantien bzw.<br />
Projektgarantien<br />
Finanzierungsgarantien<br />
Finanzierungsgarantien<br />
mit Risk-Sharing<br />
Garantien im Rahmen des<br />
Ost-West-Fonds<br />
Förderung der Internationalisierung von KMUs durch Garantien<br />
Im Rahmen der Aktion „KMU-Internationalisierung“ bildet die Verminderung des wirtschaftlichen<br />
Risikos von Auslandsinvestitionen den Fördergegenstand. Unterstützt werden<br />
Internationalisierungsprojekte österreichischer KMUs, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit<br />
des österreichischen Unternehmens beitragen und direkt oder indirekt positive<br />
Auswirkungen auf die österreichische Wertschöpfung haben werden. 25<br />
Als Garantiearten sind Projektgarantien, die das Auslandsrisiko abdecken, und Finanzierungsgarantien<br />
für das Inlandsrisiko des österreichischen Kreditgebers vorgesehen.<br />
Ansprüche aus Projektgarantien entstehen bei Insolvenz des Internationalisierungsprojektes<br />
bzw. bei wirtschaftlich oder rechtlich vergleichbaren Ereignissen, die zu einem<br />
nachhaltigen Schaden für das österreichische KMU führen, sofern der Haftungsfall<br />
durch wirtschaftliche Faktoren hervorgerufen wird. Hingegen ergeben sich Ansprüche<br />
aus Finanzierungsgarantien im Falle der Insolvenz des österreichischen KMU.
Reinhard Moser<br />
Im Rahmen der Garantieentgelte ist anzumerken, dass für Vorhaben mit besonders hohem<br />
Risiko höhere fixe oder erfolgsabhängige Entgelte festgesetzt werden können.<br />
Die folgende Tabelle 13.3 präsentiert eine Zusammenstellung des per 31. Dezember<br />
2002 aushaftenden Obligos aus Aktivitäten der AWS im Zusammenhang mit der Förderung<br />
der Internationalisierung von KMUs durch Garantien. Neben der regionalen<br />
Aufschlüsselung sind daraus auch die jeweiligen Investitionsvolumina und die Zahl<br />
der laufenden Verträge ersichtlich.<br />
KMU-Internationalisierung, Aushaftendes Obligo nach Zielländern<br />
per 31. Dezember 2002<br />
Land Laufende Verträge Investitionsvolumen Aushaftendes Obligo in %<br />
in 1.000 Euro<br />
Ungarn 23 4.210 2.748 11,9<br />
Tschech. Rep. 16 2.421 1.603 7,0<br />
USA 12 3.194 2.117 9,2<br />
Slowakei 10 1.747 1.335 5,8<br />
Deutschland 9 2.883 2.227 9,7<br />
Polen 8 1.399 847 3,7<br />
Russland 6 1.456 824 3,6<br />
Kroatien 6 1.040 520 2,3<br />
Großbritannien 4 1.848 1.478 6,4<br />
Rumänien 4 739 470 2,0<br />
Singapur 3 1.309 1.047 4,6<br />
Italien 3 747 480 2,1<br />
China 3 694 555 2,4<br />
Brasilien 3 614 348 1,5<br />
Israel 3 470 376 1,6<br />
Slowenien 3 267 201 0,9<br />
Schweiz 2 815 494 2,2<br />
Japan 2 711 535 2,3<br />
Australien 2 707 354 1,5<br />
Türkei 2 581 465 2,0<br />
Iran 2 529 402 1,8<br />
Südafrika 2 362 181 0,8<br />
Bosnien-Herzegowina 2 339 272 1,2<br />
Neuseeland 2 334 167 0,7<br />
Bulgarien 2 158 126 0,5<br />
übrige Länder 19 4.942 2.835 12,3<br />
insgesamt 153 34.516 23.007 100,0<br />
Quelle: AWS.<br />
Tab. 13.3<br />
285
Garantien im Rahmen des Ost-West-Fonds<br />
Im Falle von Garantien im Rahmen des Ost-West-Fonds zielt die Förderung auf die<br />
Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen vor allem mit Ländern im Übergang zur<br />
Marktwirtschaft und die Erleichterung der Internationalisierung inländischer Unternehmen<br />
ab. 26 Österreichische Direktinvestoren sollen bei der Umsetzung ihrer Auslands-<br />
Investitionen durch die Absicherung der damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken<br />
unterstützt werden.<br />
Als Garantiearten sind einerseits Direktgarantien, die bei Eintritt eines Misserfolges<br />
beim Beteiligungsprojekt einen bestimmten Kapitalbetrag zur Verfügung stellen, und<br />
andererseits Finanzierungsgarantien vorgesehen, die entweder das Inlandsrisiko des<br />
österreichischen Kreditgebers abdecken oder aber im Falle von Finanzierungsgarantien<br />
mit Risk-Sharing ergänzend zum Garantiefall der Insolvenz des Kreditnehmers<br />
einen besonderen Garantiefall bei Misserfolg des Beteiligungsprojektes festlegen.<br />
Ansprüche aus Direktgarantien – und analog dazu aus Finanzierungsgarantien mit<br />
Risk-Sharing – ergeben sich aus der Verpflichtung der AWS, bei Eintritt des Garantiefalls<br />
(d.h. Misserfolg des Beteiligungsprojektes) einen bestimmten Kapitalbetrag bis<br />
zur Höhe der maximal 50 % betragenden Risk-Sharing-Quote zu leisten. Die für den<br />
Eintritt des Garantiefalles maßgeblichen Tatbestände werden in der Garantieerklärung<br />
für den Einzelfall so festgelegt, dass der aus einem allenfalls eintretenden nachhaltigen<br />
Projektmisserfolg resultierende Schaden für den Direktinvestor substantiell vermindert<br />
werden kann. Die Richtlinien nennen als Beispiele die Insolvenz des Beteiligungsunternehmens,<br />
nachhaltige Betriebsverluste oder ein mehrjähriges Nichterreichen von<br />
Produktionszielen.<br />
Im Rahmen der Garantieentgelte ist auch für Garantien im Rahmen des Ost-West-<br />
Fonds anzumerken, dass in Einzelfällen oder für einzelne Projektkategorien aufgrund<br />
des besonders hohen Risikos höhere Entgeltsätze festgelegt werden können. Eine<br />
bemerkenswerte Bestimmung betrifft auch den „Risikenausgleich” in beide Richtungen:<br />
Gemäß Garantievertrag kann der Direktinvestor dazu verpflichtet werden, zusätzlich<br />
zum fixierten Garantieentgelt bei positiver Entwicklung des Beteiligungsunternehmens<br />
im Ausland einen bestimmten Teil des ausgeschütteten Gewinns oder des Verkaufserlöses<br />
der Beteiligung der AWS zu vergüten oder in entsprechender Höhe Anteilsrechte<br />
am Beteiligungsunternehmen abzutreten. Derartige Bedingungen können auch für<br />
den Fall der Inanspruchnahme der Garantie vorgesehen werden. Diese Bestimmung<br />
ermöglicht eine hohe Flexibilität hinsichtlich der zukünftigen Vorgangsweise und kann<br />
als ein Musterbeispiel moderner Garantieentgelt-Gestaltungsvarianten angesehen<br />
werden.<br />
Die folgende Tabelle 13.4 gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ost-West-<br />
Fonds-Projekte im Zeitraum 1990 bis 2002 auf Jahresbasis, die in den letzten Jahren<br />
286
Reinhard Moser<br />
eine deutliche Aufwärtsbewegung im Obligo der AWS ausweist und die hohe Bedeutung<br />
dieser Haftungsübernahme im Internationalisierungsprozess österreichischer<br />
Unternehmen belegt.<br />
Entwicklung der Ost-West-Fonds-Projekte, 1990–2002 Tab. 13.4<br />
Quelle: AWS.<br />
Jahr Anzahl der Verträge Garantievolumen Obligo<br />
in 1.000 Euro<br />
1990–93 69 452.592 219.530<br />
1994 24 93.966 65.551<br />
1995 19 56.539 38.735<br />
1996 16 72.964 40.915<br />
1997 19 48.909 29.505<br />
1998 23 68.967 37.790<br />
1999 19 36.264 32.485<br />
2000 39 168.165 94.111<br />
2001 37 203.199 107.746<br />
2002 38 166.375 115.936<br />
Eine regionale Aufschlüsselung aller seit dem Start des Ost-West-Fonds im Jahr 1990<br />
garantierten Projekte ist in der folgenden Tabelle 13.5 ausgewiesen. Sie zeigt eine<br />
ausgeprägte Komplementarität zur Entwicklung der österreichischen Direktinvestitions-<br />
Ströme.<br />
Regionale Verteilung der Ost-West-Fonds-Projekte, 1990–2002 Tab. 13.5<br />
Beteiligungsvolumen<br />
in 1.000 Euro<br />
Zentral- und Südosteuropa 1.005.992<br />
Ungarn 263.352<br />
Tschechische Republik 214.191<br />
Slowakei 74.842<br />
weitere EU-Beitrittskanditaten 186.271<br />
Rest Zentral-Südosteuropa 267.336<br />
EU + USA 339.472<br />
Asien 135.165<br />
Lateinamerika 47.782<br />
Subsahara 25.260<br />
Rest der Welt 14.996<br />
Quelle: AWS.<br />
287
13.3.3 Unterstützung im Bereich der Kapitalaufbringung<br />
Generell gilt als Grundregel im Bereich der betrieblichen Finanzwirtschaft, dass die<br />
Finanzierung von ausländischen Direktinvestitionen, die einem hohen Risiko ausgesetzt<br />
sind, mit risikotragfähigem Kapital bewerkstelligt werden muss. Hier eignen sich<br />
natürlich vorrangig Finanzierunginstrumente aus dem Bereich des Eigenkapitals, was<br />
sich beispielsweise in Form von Kapitalerhöhungen bei Aktiengesellschaften manifestieren<br />
kann. 27 Als neuere Ansätze findet sich auch der Einsatz von Private Equity bzw.<br />
Venture Capital, wobei zur Unterstützung der Risikokapitalaufbringung entsprechende<br />
Kapitalgarantieprogramme – beispielsweise im Angebot der AWS – herangezogen<br />
werden können. 28<br />
Wenn es dem Direktinvestor gelingt, wesentliche Risiken seines Auslandinvestments<br />
– beispielsweise durch die oben beschriebenen Garantiezusagen im Wege einer G4-<br />
Beteiligungsgarantie bzw. die Nutzung des Instrumentariums der AWS – zu bewältigen,<br />
wird auch die Finanzierung mittels Kreditaufnahme überlegenswert. Im Rahmen des<br />
österreichischen Systems ist im Falle einer derartigen Risikoabsicherung der Zutritt<br />
zum Exportfinanzierungsverfahren der OeKB mit seinen zinsgünstigen und zinsstabilen<br />
Konditionen möglich, um eine Refinanzierung der Mittel für die Auslandsbeteiligung<br />
durchzuführen.<br />
Ein besonderer Weg in das Exportfinanzierungsverfahren eröffnet sich auch durch die<br />
Einholung einer Wechselbürgschaftszusage für Beteiligungen und beteiligungsähnliche<br />
Rechtsgeschäfte auf Basis des AFG 1981. Im Gegensatz zu den im vorigen Absatz<br />
erwähnten Instrumenten erfolgt hiermit aber keinerlei Haftungsübernahme der Republik<br />
Österreich für Risiken im Zusammenhang mit dem ausländischen Direktinvestitions-<br />
Unternehmen, sondern es liegt – analog zu den Finanzierungsgarantien der AWS ohne<br />
Risk-Sharing – eine reine Wechselbürgschaft vor, die den Fall der Insolvenz des inländischen<br />
Direktinvestitions-Unternehmens gegenüber dem kreditgewährenden Institut<br />
abdeckt. Das Ziel einer zinsgünstigen und zinsstabilen Finanzierung wird hier ohne<br />
gleichzeitige Absicherung des Direktinvestitions-Risikos erreicht; die Risikotragfähigkeit<br />
der Finanzierungskonstruktion insgesamt muss im Einzelfall auf ihre Angemessenheit<br />
für eine Direktinvestitions-Finanzierung analysiert werden.<br />
Begibt man sich auf die Ebene einzelner Direktinvestitions-Fälle, stehen somit<br />
österreichischen Unternehmen zur Finanzierung ihrer Direktinvestitionen neben allen<br />
Angeboten von Kreditinstituten als besondere Maßnahmen<br />
• auf nationaler Ebene die Beteiligungsfinanzierung im Exportfinanzierungsverfahren<br />
der Oesterreichischen Kontrollbank sowie als Programme mit Regionalschwerpunkt<br />
das ERP-Internationalisierungsprogramm und das Starthilfe-Kreditverfahren<br />
für Entwicklungsländer,<br />
288
Reinhard Moser<br />
• unterschiedliche Programme auf europäischer Ebene und<br />
• Aktionen von Internationalen Finanzinstitutionen<br />
zur Verfügung. Das auf nationaler Ebene angebotene Instrumentarium wird in der<br />
Folge kurz umrissen.<br />
Kapitalbereitstellung zur Finanzierung österreichischer Direktinvestitionen Abb. 13.6<br />
Beteiligungsfinanzierung<br />
im EFV/OeKB<br />
Kapitalaufbringung<br />
für Direktinvestitionen<br />
Programme mit<br />
Regionalschwerpunkt<br />
ERP-Internationalisierungsprogramm<br />
Starthilfe-Kreditverfahren<br />
für Entwicklungsländer<br />
Beteiligungsfinanzierung im Rahmen des Exportfinanzierungsverfahrens der<br />
OeKB<br />
Die Zugangsvoraussetzungen zu Mitteln aus dem Exportfinanzierungsverfahren der<br />
OeKB, nämlich das Vorliegen einer<br />
• G4-Beteiligungsgarantie,<br />
• AWS-Garantie,<br />
• Garantie einer <strong>internationale</strong>n Organisation, bei der die Republik Österreich Mitglied<br />
ist oder die im Finanzierungsbereich oder in der Entwicklungshilfe tätig ist,<br />
• Haftungsübernahme eines Kreditversicherers bzw.<br />
• Wechselbürgschaft des Bundes gemäß AFG 1981 (ohne Abdeckung des Direktinvestitions-Risikos)<br />
wurden bereits erwähnt. Die Verzinsung erfolgt zu einem günstigen Mischzinssatz,<br />
der sich aus einer fest verzinsten Tranche („Sockel”) und einem variablen Teil zusammensetzt,<br />
dessen Verzinsung von der OeKB je nach Marktbedingungen variiert<br />
werden kann. 29<br />
289
Die Kredithöhe orientiert sich am Ausmaß der übernommenen Haftung; die Kreditlaufzeit<br />
kann bis zu 25 Jahre betragen.<br />
ERP-Internationalisierungsprogramm<br />
Im Rahmen der Geschäftsfelder des ERP-Fonds werden unter dem ERP-Internationalisierungsprogramm<br />
Direktinvestitionen in den europäischen Reformstaaten und EU-<br />
Kandidatenländern unterstützt, wenn sich dadurch die strategische Position des antragstellenden<br />
Unternehmens verbessert. Gemäß den Richtlinien richtet sich das<br />
zinsgünstige Kreditgewährungsangebot an kleine und mittelständische Unternehmen,<br />
die entweder erstmals eine Direktinvestition in diesen Ländern tätigen oder eine wesentliche<br />
Expansion ihres Tochterunternehmens/Joint Ventures realisieren wollen. 30<br />
Konkret werden als förderfähige Internationalisierungsprojekte die Errichtung bzw.<br />
Erweiterung von Produktionsniederlassungen, Produktionstochterfirmen und Produktions-Joint-Ventures<br />
sowie die Übernahme einer qualifizierten Beteiligung (mindestens<br />
25 %) genannt. Die Errichtung/Erweiterung und der Betrieb einer Vertriebsniederlassung<br />
bzw. Vertriebstochter werden hingegen als nicht förderungsfähig eingestuft.<br />
Die Verzinsung der Kreditmittel orientiert sich an den günstigen ERP-Kreditkonditionen.<br />
Die Kredithöhe liegt in der Regel zwischen 0,35 Mio. Euro und 7,5 Mio. Euro pro<br />
Projekt und Jahr. Die Gesamtlaufzeit beträgt sechs Jahre.<br />
Aufgrund der Angaben in den Jahresberichten wurden im Rahmen des ERP-<br />
Internationalisierungsprogramms<br />
• 1999/2000 vier Kredite in Höhe von 3 Mio. Euro zugesagt, was geförderten Projektkosten<br />
von rd. 9 Mio. Euro entsprochen hat;<br />
• 2000/2001 zwei Kredite in Höhe von 1 Mio. Euro zugesagt, was geförderten<br />
Projektkosten von rd. 2 Mio. Euro entsprochen hat; und<br />
• 2001/2002 sechs Kredite in Höhe von 4 Mio. Euro zugesagt, was geförderten<br />
Projektkosten von rd. 12 Mio. Euro entsprochen hat.<br />
Damit machen die Zusagen aus dem ERP-Internationalisierungsprogramm nur rd.<br />
1 % aller bereitgestellten ERP-Fonds-Mittel aus.<br />
Starthilfe-Kreditverfahren für Entwicklungsländer<br />
Starthilfekredite zur Finanzierung exportfördernder Investitionen in Entwicklungsländern<br />
– insbesondere in der Form von Joint-Ventures – sollen österreichische Unternehmen<br />
unterstützen, die Niederlassungen, Servicestationen, Reparaturwerkstätten<br />
errichten, das Assembling österreichischer Produkte vor Ort durchführen wollen bzw.<br />
Personaleinsatz für Schulungs- und Servicezwecke vornehmen.<br />
Starthilfekredite werden aus Mitteln der Wirtschaftskammer Österreich und des ERP-<br />
Fonds zu günstigen Zinssätzen in zwei Varianten bereitgestellt:<br />
290
Reinhard Moser<br />
• Liegt eine Risikoabsicherung der Direktinvestition im Entwicklungsland (beispielsweise<br />
durch eine G4-Beteiligungsgarantie oder eine Haftung der AWS) vor, können<br />
50 % der Projektkosten (maximal 436.000 Euro) aus Mitteln der Wirtschaftskammer<br />
Österreich und des ERP-Fonds finanziert werden. Für die darüber hinausgehenden<br />
Beträge erfolgt eine Ergänzungsfinanzierung im Rahmen des<br />
Exportfinanzierungsverfahrens der OeKB.<br />
• Ist keine Absicherung der Direktinvestition vorgenommen worden, können 80 %<br />
der Projektkosten (maximal Euro 436.000) zu einem höheren Zinssatz ausschließlich<br />
aus Mitteln der Wirtschaftskammer Österreich und des ERP-Fonds finanziert<br />
werden.<br />
Die Laufzeit von Starthilfe-Krediten ist mit zehn Jahren, im Falle von außereuropäischen<br />
Entwicklungsländern mit 20 Jahren begrenzt, wovon bis zu fünf Jahre tilgungsfrei<br />
gestaltet werden können. Das Starthilfe-Kreditverfahren für Entwicklungsländer wird<br />
von der OeKB betreut.<br />
13.4 Zukunft – Desiderate<br />
Die vorausgehenden Ausführungen haben belegt, dass in der gegenwärtigen Situation<br />
neben allen klassischen Varianten der Exportförderung diejenigen <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n<br />
Maßnahmen, die auf eine Unterstützung von Direktinvestitions-Aktivitäten im<br />
Zuge der Unternehmensinternationalisierung abzielen, stark an Bedeutung hinzugewonnen<br />
haben. Wenngleich alle derartigen Internationalisierungsschritte genuine<br />
Unternehmensentscheidungen darstellen, liefert das zur Verfügung gestellte Förderinstrumentarium<br />
naturgemäß zusätzliche Anreize und Impulse, die mit Direktinvestitionen<br />
verbundenen Chancen wahrzunehmen. Dies hat für Österreich eine besondere<br />
Bedeutung im klein- und mittelbetrieblichen Umfeld, wo vielfach mangels ausreichend<br />
vorhandenen eigenen Risikokapitals die Aufbringung der erforderlichen Finanzmittel<br />
nur bei Abdeckung wesentlicher Risiken des Auslandsengagements sichergestellt<br />
werden kann.<br />
Im Gegensatz dazu ergibt sich im Rahmen von Großunternehmen eine gewisse Ambivalenz,<br />
weil diese in ihrem Direktinvestitions-Prozess nicht nur durch die Heimatländer<br />
unterstützt werden, sondern gleichzeitig das umfangreiche Instrumentarium von<br />
Ansiedlungsunterstützungen in den Zielländern ausnützen können. Damit stellt sich die<br />
Frage, inwieweit entsprechende Förderprogramme für Auslands-Direktinvestitionen in<br />
diesem Falle tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielen können. Hier ist ein sorgfältiges<br />
Abwägen sinnvoller Förderungserfordernisse für ausländische Direktinvestitionen<br />
angebracht und auf dieser Basis einzelfallspezifisch zu entscheiden. 31<br />
291
Was die Förderinhalte betrifft, wird in Österreich derzeit das gesamte Spektrum von<br />
Maßnahmen in den Bereichen Informationsgewinnung und Beratung, Risikoabsicherung,<br />
Kapitalaufbringung und Steuern abgedeckt und von den Unternehmen auch<br />
ausgenützt. 32 Überlegungen zu Veränderungen – und auch Vereinfachungen – in der<br />
Förderlandschaft sind stets angebracht; konkret können dabei im Umfeld der österreichischen<br />
Direktinvestitions-Förderung folgende Punkte angesprochen werden:<br />
• Die Übernahme direktinvestionsspezifischer Risiken stellt eine zentrale Größe der<br />
Förderungsmaßnahmen dar. Dementsprechend wäre eine Zusammenführung der<br />
beiden auf den Bereich der wirtschaftlichen Risiken abstellenden Instrumentarien<br />
KMU-Internationalisierung und Ost-West-Fonds-Garantien, die ja bereits unter<br />
dem gemeinsamen Dach der AWS angeboten werden, für einen klar strukturierten<br />
Außenauftritt zweckmäßig.<br />
• Während G4-Beteiligungsgarantien mit ihrem Fokus auf <strong>politische</strong> Risiken eine<br />
Sonderstellung zukommt, erscheint für den Bereich der auf das inländische Direktinvestitions-Unternehmen<br />
bezogenen Wechselbürgschaften nach dem AFG 1981,<br />
die von der OeKB gestioniert werden, wegen der Parallelität mit den Finanzierungsgarantien<br />
der AWS eine Abstimmung erforderlich.<br />
• Eine besondere Hervorhebung verdient das flexible Entgeltsystem bei den<br />
Garantieprodukten der AWS für Direktinvestitionen, das auf der Grundlage der<br />
bestehenden Richtlinien eine Reihe innovativer Lösungsansätze ermöglicht, beispielsweise<br />
in Form von kombinierten Put- und Call-Optionen mit den entsprechenden<br />
Anreizmechanismen.<br />
• Einer Überprüfung sind im Finanzierungsbereich die beiden kleineren Kreditaktionen<br />
ERP-Internationalisierungsprogramm und Starthilfe-Kreditverfahren für<br />
Entwicklungsländer zu unterziehen. Das Volumen der bereitgestellten Finanzierungsmittel<br />
kann derzeit nicht klar nachweisen, inwieweit diese beiden Verfahren<br />
konkrete Erfordernisse der angesprochenen Zielgruppe abzudecken vermögen.<br />
Setzt man die vor 15 Jahren massiv einsetzenden österreichischen Direktinvestitionen<br />
im Ausland und ihre Entwicklung in den letzten Jahren mit dem parallel dazu stark<br />
angewachsenen Ausnützungsstand der zugehörigen Förderungsinstrumente in Bezug,<br />
so zeigt sich, dass die begleitenden Maßnahmen hervorragend gegriffen haben. Dies<br />
gilt nicht nur für die quantitative Dimension, sondern auch für die ländermäßige Fokussierung:<br />
Hier spiegelt sich die wichtige Position österreichischer Direktinvestitionen<br />
im zentral- und osteuropäischen Bereich exakt in einem entsprechenden Fokus der<br />
Förderinstitutionen wider, die damit ein <strong>wirtschafts</strong>konformes Angebot bereitgestellt<br />
haben. Für zukünftige neue Destinationen der Internationalisierung österreichischer<br />
Unternehmen ist es aber von großer Bedeutung, dass die wesentlichen Förderprogramme<br />
keine regionale Einschränkung vorsehen, sondern in Übereinstimmung mit<br />
292
Reinhard Moser<br />
der Entwicklung der österreichischen Auslandsmärkte auch in der Zukunft flexibel die<br />
erforderliche Unterstützung gewährleisten.<br />
Literaturverzeichnis<br />
Austria Wirtschaftsservice Ges.m.b.H. (AWS) (2002), AWS-Lagebericht (Geschäftsbericht).<br />
Bagwell, Kyle; Staiger, Robert W. (2004), Subsidy Agreements, Working Paper 10292, National<br />
Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.<br />
Ekholm, Karolina; Forslid, Rikard; Markusen, James (2003), Export-Platform Foreign Direct<br />
Investment, Discussion Paper 3823, Centre for Economic Policy Research, London.<br />
Gumpold, Jutta (1996), Die Konfrontation des österreichischen Exportförderungssystems mit<br />
der Wettbewerbskonzeption der EU, Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien.<br />
Hayden, Christoph (1992), Die Finanzierung der Unternehmensinternationalisierung und deren<br />
Ausdruck in der Bilanz, Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien.<br />
Heiduk, Günter; Kerlen-Prinz, Jörg (1999), „Direktinvestitionen in der Außen<strong>wirtschafts</strong>theorie“,<br />
in: Döhrn, Roland; Heiduk, Günter (Hrsg.), Theorie und Empirie der Direktinvestitionen, Berlin,<br />
S. 23-54.<br />
Johanson, Jan; Vahlne, Jan-Erik (1990), The Mechanism of Internationalisation, in: International<br />
Marketing Review, Vol. 7, Nr. 4/1990, S. 11-24.<br />
Jost, Thomas; Nunnenkamp, Peter (2002), Bestimmungsgründe deutscher Direktinvestitionen<br />
in Entwicklungs- und Reformländern – Hat sich wirklich etwas verändert?, Kieler Arbeitspapier<br />
Nr. 1124, Institut für Weltwirtschaft, Kiel.<br />
Jungnickel, Rolf (1989), Direktinvestitionen, <strong>internationale</strong>, in: Macharzina, Klaus; Welge, Martin<br />
(Hrsg.), Handwörterbuch Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart, Sp. 308-315.<br />
Kaufmann, Friedrich; Menke, Andreas (1997), Standortverlagerungen mittelständischer Unternehmen<br />
nach Mittel- und Osteuropa. Eine empirische Untersuchung am Beispiel der vier<br />
Visegrád-Staaten, Schriften zur Mittelstandsforschung Nr. 74, Bonn.<br />
Moser, Reinhard (1996), Exportkreditversicherung in Österreich im Lichte <strong>internationale</strong>r Regelungen,<br />
in: Mugler, Josef; Nitsche, Michael (Hrsg.), Versicherung, Risiko und Internationalisierung.<br />
Herausforderungen für Unternehmensführung und Politik, Wien, S. 409-431.<br />
Mühleck, Ralph (1996), Zur Effektivität der Förderung von Direktinvestitionen in Entwicklungsländern.<br />
Wirkungspotentiale von Investitionsanreizen der DEG, Frankfurt/Main.<br />
Nunnenkamp, Peter (2002), Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization<br />
Changed the Rules of the Game?, Working Paper Nr. 1122, Institut für Weltwirtschaft, Kiel.<br />
OECD (Hrsg.) (1996), OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 3. Aufl., Paris.<br />
OECD (Hrsg.) (2000), Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, Neufassung Paris.<br />
OECD (Hrsg.) (2003), International Investment Perspectives, 2003 Edition, Paris.<br />
Oesterreichische Kontrollbank, Geschäftsbericht 2002.<br />
293
Oesterreichische Kontrollbank (Hrsg.) (2003), Auslandsinvestitionen. Bewährte Instrumente für<br />
Ihre Internationalisierung, Wien.<br />
Oesterreichische Nationalbank (Hrsg.) (2002), Österreichische Direktinvestitionen im Ausland<br />
und ausländische Direktinvestitionen in Österreich, Statistisches Monatsheft 6/2002.<br />
Pfaffermayr, Michael; Stankovsky, Jan (1999), Internationalisierung Österreichs durch Direktinvestitionen,<br />
Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Wien.<br />
Reker, Christoph (2001), Ursachen und Verflechtung deutscher Direktinvestitionen, Frankfurt/<br />
Main.<br />
Satzinger, Günther (1999), Absicherung und Finanzierung österreichischer Direktinvestitionen in<br />
Zentral- und Osteuropa mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Förderinstrumente,<br />
Diplomarbeit, Wirtschaftsuniversität Wien.<br />
Schäfer, Thomas (1995), Auslandsinvestitionen und Währungsrisiken, Wiesbaden.<br />
Scharrer, Hans-Eckart (Hrsg.) (1972), Förderung privater Direktinvestitionen: Eine Untersuchung<br />
der Maßnahmen bedeutender Industrieländer, Hamburg.<br />
UNCTAD (Hrsg.) (2003), World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National<br />
and International Perspectives, New York & Genf.<br />
Zauner, Wolfgang (1997), Wachstumsfinanzierung internationalisierender Unternehmen. Analyse<br />
der Implikationen von Direktinvestitionen für die Ableitung einer Finanzierungsstruktur im<br />
Internationalisierungsprozess, Dissertation, Wirtschaftsuniversität Wien.<br />
Anmerkungen<br />
* Univ.-Prof. Dr. Reinhard Moser ist Professor für Betriebs<strong>wirtschafts</strong>lehre des Außenhandels<br />
an der Wirtschaftsuniversität Wien.<br />
1 Ein entsprechender Hinweis auf die Wirkung „attraktiver“ Körperschaftssteuersätze als<br />
Direktinvestitions-Anreiz, der gleichzeitig inländische Unternehmen zu halten angelegt ist,<br />
findet sich in OECD (2003), Chapter 3: Policies and Incentives for Attracting Foreign Direct<br />
Investment, S. 102.<br />
2 Jungnickel (1989), Sp. 308.<br />
3 OECD (1996), S. 7f. Weitgehend angepasst an diese Richtlinien versteht die Oesterreichische<br />
Nationalbank (OeNB) unter ausländischen Direktinvestitionen Kapitalanlagen, die Investoren<br />
in der Absicht vornehmen, mit einem Unternehmen in einem anderen Land eine dauernde<br />
Wirtschaftsbeziehung herzustellen und aufrecht zu erhalten, wobei gleichzeitig die Absicht<br />
besteht, auf das Management dieser Firma einen spürbaren Einfluss auszuüben. Dabei wird<br />
zwischen drei Formen unterschieden:<br />
(1) Beteiligungen an bestehenden oder neu gegründeten Unternehmen durch Bareinlagen,<br />
durch Aufrechnung von Forderungen sowie durch Einbringung von Sachen und Rechten;<br />
(2) Reinvestition von Gewinnen, indem der erzielte Gewinn (zumindest teilweise) nicht ausgeschüttet<br />
wird, sondern im Direktinvestitions-Unternehmen verbleibt;<br />
294
Reinhard Moser<br />
(3) Gewährung von Krediten und sonstigen Zuschüssen, die von den Investoren neben ihren<br />
Beteiligungsquoten dem Unternehmen zur Stärkung der Kapitalkraft zur Verfügung gestellt<br />
werden. (OeNB (2002), S. 6).<br />
4 Die unterschiedlichen Sichtweisen arbeiten Heiduk–Kerlen–Prinz (1999), S. 24, in übersichtlicher<br />
Form heraus.<br />
5 Auf Basis des klassischen Internationalisierungsmodells von Johanson–Vahlne (1990).<br />
6 Vgl. Nunnenkamp (2002), S. 4 ff.<br />
7 Vgl. Jost, Nunnenkamp (2002), S. 66. Für den von ihnen untersuchten regionalen Untersuchungsraum<br />
finden die beiden Autoren allerdings keine markante Unterstützung der erwarteten<br />
Verschiebung der Direktinvestitions-Bestimmungsgründe.<br />
8 Vgl. hierzu beispielsweise Ekholm, Forslid, Markusen (2003).<br />
9 Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD, 2000).<br />
10 Vgl. Kaufmann, Menke (1997).<br />
11 Vgl. Satzinger (1999), S. 26 ff.<br />
12 Vgl. Pfaffermayr, Stankovsky (1999), S. 4.<br />
13 Die Klassifikation geht zurück auf Scharrer (1972), S. 62.<br />
14 Vgl. Moser (1996).<br />
15 Eine systematische ökonomische Analyse der GATT/WTO-Beihilfenregelungen bieten Bagwell,<br />
Staiger (2004).<br />
16 Vgl. Gumpold (1996).<br />
17 Hier sieht die ab 1. Jänner 2005 geltende KMU-Definition einen Personalstand unter 250<br />
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern einerseits sowie einen Umsatz unter 50 Mio. Euro oder eine<br />
Bilanzsumme unter 43 Mio. Euro andererseits als Abgrenzungskriterium vor.<br />
18 Im Exportservice-Jahresbericht der OeKB sind per 31. Dezember 2002 insgesamt nur zwei<br />
übernommene Haftungen aus der G11 ausgewiesen.<br />
19 Hier wird auf die am am 6. Mai 2004 vom Nationalrat beschlossene Steuerreform 2005 Bezug<br />
genommen.<br />
20 Vgl. Schäfer (1995) zu einer Darstellung der spezifischen Problematik.<br />
21 Zu bilateralen, regionalen und multilateralen Investitionsschutzabkommen vgl. UNCTAD<br />
(2003), Kapitel III: Key National FDI Policies and International Investment Agreements,<br />
S. 85 ff.<br />
22 AGB betreffend Beteiligungsgarantien (G4), § 2.<br />
23 Vgl. OeKB (2003), Broschüre Auslandsinvestitionen, S. 2 .<br />
24 AGB betreffend Beteiligungsgarantien (G4), § 6.<br />
25 Richtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Aktion „Förderung der<br />
Internationalisierung von Klein- und Mittelbetrieben durch Garantien, Version 9. Oktober<br />
2002.<br />
26 Richtlinien für Garantien im Rahmen des Ost-West-Fonds, Ausgabe September 2003.<br />
295
27 Zur Kapitalbedarfs-Charakteristik von Direktinvestitionen vgl. Hayden (1992), S. 123 ff.; zur<br />
Frage der Komplexität der Finanzierungsstruktur im Internationalisierungsprozess vgl. Zauner<br />
(1997), S. 134 ff.<br />
28 Die von der AWS gewährten Kapitalgarantien zielen darauf ab, Risikokapital zu mobilisieren,<br />
das im Wege von Private Equity Fonds österreichischen KMUs als Beteiligungskapital oder<br />
Mezzaninkapital zur Verfügung gestellt wird und damit auch für die Aufbringung des erforderlichen<br />
Risikokapitals bei Direktinvestitions-Projekten zur Verfügung steht.<br />
29 Die OeKB arbeitet hier in einem so genannten „market window”, was bedeutet, dass keinerlei<br />
Zinsstützungen seitens der öffentlichen Hand in Anspruch genommen werden.<br />
30 Richtlinien 2004 – ERP-Internationalisierungsprogramm.<br />
31 Spezifische Forschungsergebnisse zu diesem Bereich sind abschließend noch nicht vorhanden.<br />
Derzeit ist noch nicht einmal die Frage geklärt, ob ausländische Direktinvestitionen<br />
eher „durch stärkere Regulierungen (z.B. Subventionen, Einfuhrzölle („tariff-jumping“), „localcontent“-Auflagen)“<br />
oder aber „durch deregulierende Maßnahmen (z.B. niedrigere Steuern,<br />
geringere arbeits-, verbraucher- oder umweltschutzrechtliche Auflagen)“ angezogen werden.<br />
Reker (2001), S. 187.<br />
32 Mühleck (1996), S. 99 f., betrachtet allerdings das Kriterium der Inanspruchnahme von<br />
Förderungsinstrumenten als unzulänglich für eine Beurteilung des jeweils bereitgestellten<br />
Instrumentariums.<br />
296
14 DIENSTLEISTUNGEN: EXPORT IST<br />
MEHR ALS WARENVERKEHR<br />
Ralf Kronberger, Julia Wörz*<br />
Die österreichischen Dienstleistungsexporte beliefen sich im Jahr 2002 auf 37,3 Mrd.<br />
Euro, das sind mit 47,6 % knapp die Hälfte der Warenexporte. Die Beachtung, die die<br />
Wirtschaftspresse und <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Entscheidungsträger den Dienstleistungsexporten<br />
zukommen lassen, wird der tatsächlichen Bedeutung dieser Exportkategorie<br />
nicht immer gerecht. Zumeist werden bei der Analyse der Leistungsbilanz und deren<br />
Teilbilanz, der Dienstleistungsbilanz, die grenzüberschreitenden Transaktionen im<br />
Reiseverkehr hervorgehoben. Der Tourismussektor spielt in der Dienstleistungsbilanz<br />
zwar eine bedeutende Rolle 1 –Transaktionen im Reiseverkehr stellen mit knapp 32 %<br />
etwas weniger als ein Drittel der gesamten Dienstleistungsexporte –, dennoch ging<br />
seine relative Bedeutung für die Dienstleistungsexportwirtschaft während der letzten<br />
Jahre stark zurück. 1993 hatte dieser Anteil noch 47,7 %, also knapp die Hälfte der<br />
gesamten österreichischen Dienstleistungsexporte betragen. Weit stärker als die Exporte<br />
im Reiseverkehr stiegen die Exporte moderner, komplexer, unternehmensnaher<br />
Dienstleistungen an. Im Beobachtungszeitraum 1993 bis 2002 stiegen die Exporte im<br />
Reiseverkehr nominell lediglich um 10,1 %. In den Sektoren Versicherung, Kommunikation,<br />
EDV und Informationsdienstleistungen sowie sonstige unternehmensbezogene<br />
Dienstleistungen hingegen betrugen die Wachstumsraten ein Mehrfaches und lieferten<br />
damit einen deutlich höheren Beitrag zum Wachstum der gesamten Dienstleistungsexporte<br />
als die Reiseverkehrsexporte. 2<br />
In Abschnitt 14.1 wird auf mögliche Erklärungen für Wachstum und Strukturveränderungen<br />
beim <strong>internationale</strong>n Dienstleistungshandel eingegangen. In Abschnitt 14.2 werden<br />
Vorarbeiten für die Sektoranalyse der österreichischen Dienstleistungswirtschaft in<br />
Abschnitt 14.3 erbracht, indem der theoretische Hintergrund zu Wettbewerbsfähigkeit<br />
und Spezialisierung der österreichischen Dienstleistungsexporteure erläutert und der<br />
statistische Rahmen diskutiert wird. Abschnitt 14.3 zeigt die Ergebnisse der Analyse der<br />
<strong>internationale</strong>n Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Dienstleistungssektoren, eine<br />
kurze qualitative Betrachtung dreier ausgewählter Sektoren sowie die Spezialisierung<br />
des österreichischen Handels gegenüber seinen Handelspartnern. Der letzte Abschnitt<br />
diskutiert <strong>politische</strong> Handlungsfelder an, die potenziell zu einer weiteren Stärkung des<br />
Dienstleistungshandels beitragen können.<br />
14.1 Die zunehmende Globalisierung des Dienstleistungshandels<br />
Weltweit stieg das Volumen des Dienstleistungshandels in der Periode 1995 bis<br />
1999 um 12,82 %. Das Wachstum lag damit sogar noch leicht über dem Wachstum<br />
297
des Güterhandels von 10,54 % (Daniels, 2002). 3 Trotzdem ist der Anteil der <strong>internationale</strong>n<br />
Dienstleistungstransaktionen gemessen an der nationalen Wertschöpfung<br />
in den Dienstleistungsproduktionen verhältnismäßig gering. Der Anteil der Dienstleistungsproduktion<br />
an der Bruttowertschöpfung belief sich in Österreich zwischen<br />
1999 und 2002 je nach Betrachtungsweise auf knapp über 66 % bzw. 70 %. 4 Im<br />
Vergleichszeitraum schwankte der Anteil der Dienstleistungsexporte am BIP zwischen<br />
14,9 % und 17,5 %. Der verhältnismäßig niedrige Anteil ist jedenfalls auf die geringere<br />
Handelbarkeit von Dienstleistungen zurückzuführen, die zudem erklärt, warum<br />
der Dienstleistungshandel zu einem großen Teil mittels Niederlassungen im Zielland<br />
abgewickelt wird. Das Wachstum des Dienstleistungshandels während der letzten<br />
Jahre ging mit einer zunehmenden Öffnung der Dienstleistungsmärkte einher. Zwei<br />
Hauptursachen können für diese Entwicklung genannt werden. Erstens führten die<br />
Strukturveränderungen hochentwickelter Wirtschaften zu einer gestiegenen Nachfrage<br />
nach unternehmensnahen Dienstleistungen (Francois, Reinert, 1995) und zweitens<br />
trieben die nationalen Regierungen in den jüngsten Jahren ihre Anstrengungen zu<br />
einem liberalen Regulierungsrahmen in der Dienstleistungswirtschaft voran. Veränderte<br />
Regulierungen schufen Raum für die Expansion des Dienstleistungshandels und<br />
regten die Liberalisierung von Sektoren wie beispielsweise Telekommunikation und<br />
Transportwesen ebenso an wie das Outsourcing von Dienstleistungsaktivitäten. Eine<br />
weitere Spezialisierung sowie Differenzierung von Dienstleistungsaktivitäten waren<br />
die Folge dieser Entwicklungen. Die Internationalisierung in der Dienstleistungserbringung<br />
lässt sich letztendlich auf zwei in engem Zusammenhang stehende Phänomene<br />
zurückführen: den technologischen Fortschritt in der Güterproduktion sowie in der<br />
Informations- und Kommunikationstechnologie. Das erste Phänomen erhöhte die<br />
Komplexität in der Güterproduktion und ermöglichte eine verbesserte Nutzung der<br />
Skalenerträge. Die Nachfrage nach Dienstleistungen, die diesen „neuen“ Produktionsprozess<br />
unterstützen und koordinieren, stieg an. Das zweite genannte Phänomen, der<br />
Einsatz moderner Formen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT),<br />
erleichterte die Aufbereitung und Verarbeitung von Informationen. Zudem ermöglichte<br />
der IKT-Einsatz eine erheblich raschere und hochwertigere Kommunikation. Moderne<br />
IKT-Formen stellen nicht nur an sich einen bedeutenden Dienstleistungszweig dar,<br />
der direkt Leistungen für Produktionsprozesse und Konsumenten bereitstellt, sondern<br />
unterstützen auch die so genannten koordinierenden Dienstleistungen. IKT-Dienstleistungen<br />
stellen eine entsprechende Infrastruktur in Form von Netzwerkkapazität und<br />
Kommunikationsverbindungen bereit, die der Bildung und dem Absatz unterstützender<br />
und koordinierender Dienstleistungen zu substanziellem Wachstum verhalfen. Es sind<br />
also die koordinierenden Dienstleistungen, die Infrastruktur bzw. Transportdienstleis-<br />
298
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
tungen, die eine stärkere Spezialisierung und Internationalisierung der Güter- wie der<br />
Dienstleistungsproduktion zulassen. Schnellere Kommunikation, moderne Datenverarbeitung<br />
und kostengünstigere Transportleistungen ermöglichen darüber hinaus<br />
eine erhöhte Handelbarkeit der unternehmensnahen Dienstleistungen. Verstärkter<br />
<strong>internationale</strong>r Wettbewerb, stärkere Spezialisierung und verbesserte Nutzung von<br />
Skalenerträgen sind also letztendlich Triebfeder für den Handel von Dienstleistungen<br />
selbst (Janders, 2001).<br />
Die zuvor angesprochene Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte, die ebenfalls<br />
einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum des Dienstleistungshandels liefern dürfte, 5<br />
wurde sowohl im Rahmen multilateraler Abkommen – wie dem General Agreement on<br />
Trade in Services (GATS) unter dem Regelwerk der WTO – als auch im Rahmen bilateraler<br />
Abkommen zwischen der EU und Drittländern bzw. Wirtschaftsblöcken vertraglich<br />
fixiert. Das GATS-Abkommen wurde von 146 WTO-Mitgliedstaaten unterzeichnet. 6<br />
Jedes Mitglied ging dabei im Rahmen des so genannten Positivlisten-Ansatzes selektiv<br />
Verpflichtungen in den einzelnen Sektoren ein. Die hoch entwickelten Industrieländer<br />
haben über dieses Abkommen in der Regel weitaus mehr Sektoren frei gegeben, als<br />
dies bei den Schwellen- und Entwicklungsländern der Fall ist. So ist beispielsweise<br />
Österreich – 1995 noch als eigenständiges WTO-Mitglied unmittelbar vor dem EU-<br />
Beitritt – Liberalisierungsverpflichtungen in über 100 Dienstleistungssektoren gemäß<br />
der CPC-Klassifikation eingegangen. Neben dem GATS-Abkommen ging und geht<br />
die EU bilaterale Koordinations- und Kooperationsabkommen mit Drittstaaten ein, in<br />
denen ebenfalls Liberalisierungsverpflichtungen in den Dienstleistungssektoren vereinbart<br />
werden. Jüngstes Beispiel für ein solches Abkommen ist der Abschluss eines<br />
Assoziationsabkommen zwischen der EU und Syrien mit dem Ziel der Errichtung<br />
einer Freihandelszone, die die EU und die Maghreb/Mashrek-Staaten umfassen wird. 7<br />
In diesem wie auch in weiteren Drittstaatenabkommen finden üblicherweise eigene<br />
Kapitel über GATS-konforme Dienstleistungsliberaliserung Eingang.<br />
Grundsätzliches zur Bestimmung und Handelbarkeit von Dienstleistungen<br />
In der Literatur findet sich eine ausführliche Diskussion zur Definition von Dienstleistungen.<br />
8 Vielen Ansätzen zur Bestimmung dessen, was eine Dienstleistung ist,<br />
ist die Nennung zweier Kriterien gemeinsam: Dienstleistungen sind immateriell<br />
und Produktion und Konsum der Dienstleistung finden gleichzeitig und am selben<br />
Ort statt. Diese beiden Charakteristika greifen allerdings in der Praxis zu kurz. Um<br />
nur zwei Beispiele zu nennen: Elektronische Daten können sowohl gespeichert als<br />
auch an von der Produktionsstätte unterschiedlichen Orten „konsumiert“ werden.<br />
299
Weiters können Dienstleistungen in Gütern enthalten sein, wie an Hand der Güterveredelung<br />
deutlich wird.<br />
Bhagwati (in: Mayerhofer, 2000) trägt dieser zuvor aufgezeigten Unschärfe Rechnung,<br />
indem er das Konzept der gebundenen und ungebundenen Dienstleistungen<br />
einführt. Unter gebundenen Dienstleistungen sind jene Dienstleistungen zu<br />
verstehen, die die persönliche Interaktion von Dienstleistungsproduzenten und<br />
Konsumenten bei der Leistungserstellung voraussetzen. Ein Beispiel dafür sind<br />
Gesundheitsdienste. Ungebundene Dienstleistungen hingegen zeichnen sich<br />
dadurch aus, dass der direkte und persönliche Kontakt zwischen Anbieter und<br />
Nachfrager entfallen kann und die Leistung an sich speicherbar ist. Genau diese<br />
Eigenschaften sind es, die den <strong>internationale</strong>n Handel von Dienstleistungen ermöglichen.<br />
Beispiele dafür sind elektronische Dienste, wie E-Learning, E-Commerce,<br />
Nachrichtendienste, etc.<br />
Im Rahmen der Verhandlungen zur Schaffung des multilateralen Abkommens über<br />
den <strong>internationale</strong>n Dienstleistungshandel (GATS) wurde ein sehr breiter Begriff<br />
von Dienstleistungen geschaffen, der den Handel von gebundenen und ungebundenen<br />
Dienstleistungen erfasst. Im GATS werden vier Erbringungsarten (Englisch:<br />
Modes) unterschieden:<br />
• Grenzüberschreitender Handel (Mode 1): Dienstleistungen, die nicht die gleichzeitige<br />
physische Anwesenheit von Dienstleistungserbringer und Konsumenten<br />
verlangen, können analog zum Güterhandel international ausgetauscht werden.<br />
Diese Erbringungsart entspricht den zuvor angeführten ungebundenen<br />
Dienstleistungen.<br />
• Konsum im Ausland (Mode 2): Diese Form des <strong>internationale</strong>n Dienstleistungshandels<br />
stellt darauf ab, eine Dienstleistung im Ausland nachzufragen und dort<br />
zu konsumieren. In diesem Fall findet eine vorübergehende Wanderung des<br />
Konsumenten zum Dienstleistungsanbieter statt (z.B. Konsum von Tourismusdienstleistungen).<br />
• Kommerzielle Präsenz (Mode 3): Gebundene Dienstleistungen können nur<br />
grenzüberschreitend angeboten werden, wenn der Anbieter die Möglichkeit<br />
erhält, im Gastland eine Tochterfirma bzw. eine Niederlassung zu gründen oder<br />
Anteile an einem im Gastland ansässigen Unternehmen zu erwerben.<br />
• Anwesenheit natürlicher Personen (Mode 4): Die Erbringung der Dienstleistung<br />
erfordert die vorübergehende physische Anwesenheit von natürlichen Personen,<br />
die nur zum Zweck der Dienstleistungserbringung die Grenze überschreiten<br />
und nach Abschluss der Leistung wieder in das Ursprungsland zurückkehren. 9<br />
In der Praxis sind Mode 3 und Mode 4 oft verknüpft.<br />
300
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
14.2 Vorüberlegungen für die empirische Analyse des<br />
Dienstleistungshandels<br />
Im ersten Teilabschnitt wird der theoretische Hintergrund zur Stärke-Schwächen-<br />
Analyse der österreichischen Dienstleistungswirtschaft im Außenhandel behandelt.<br />
Ein zweiter Teilabschnitt wird der statistischen Erfassung von Dienstleistungsexporten<br />
und -importen gewidmet. Wie es grundsätzlich schwierig ist, den Handel von<br />
Dienstleistungen zu erfassen (siehe Textbox), ist auch die statistische Erfassung von<br />
Dienstleistungen mit großen Problemen behaftet. Diese Problematik muss bei der<br />
Interpretation des empirischen Materials jedenfalls beachtet werden.<br />
14.2.1 Theoretischer Hintergrund<br />
Eine Analyse der Stärken und Schwächen eines Landes in Bezug auf seine Außenhandelsperformance<br />
setzt einen Vergleich des jeweiligen Landes mit all seinen Handelspartnern<br />
voraus. Der folgende Abschnitt analysiert den österreichischen Dienstleistungshandel<br />
entlang zweier unterschiedlicher Dimensionen. Zum einen wird die<br />
Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, gemessen am Marktanteil österreichischer Exporte<br />
im gemeinsamen Markt mit den wichtigsten Handelspartnern, untersucht. Zum anderen<br />
werden auf Basis der Regionalauswertung der österreichischen Zahlungsbilanz<br />
die Stärken und Schwächen Österreichs in den einzelnen Dienstleistungskategorien<br />
gegenüber den wichtigsten Handelspartnern dargestellt. Diese zweite Analyse bezieht<br />
sich also ausschließlich auf die Auswertung österreichischer Daten und stellt somit<br />
eine Stärken-Schwächen-Analyse aus österreichischer Sicht dar. Im positiven Sinn<br />
kann man ebenso von einem Vergleich der Spezialisierung Österreichs gegenüber<br />
unterschiedlichen Handelspartnern sprechen.<br />
Komparative Wettbewerbsvorteile, also relative Kostenvorteile in der Produktion von<br />
Gütern – sei es aufgrund der Faktorausstattung des Landes, aufgrund unterschiedlicher<br />
Technologien oder anderer Kostenfaktoren – bestimmen gemäß der klassischen<br />
Handelstheorie Spezialisierungsmuster im Außenhandel. Dieses Prinzip der komparativen<br />
Vorteile wird in der vorliegenden Analyse auf den Dienstleistungshandel und<br />
somit auf Kostenvorteile in der Erbringung unterschiedlicher Leistungen übertragen. So<br />
spielen zum Beispiel die Ausstattung mit Humankapital, rechtliche Rahmenbedingen<br />
etc., eine wesentliche Rolle in der Frage ob und auf welche Dienstleistungen sich ein<br />
Land spezialisiert. Da die Bestimmungsgründe der Spezialisierung (Faktorausstattung,<br />
Technologie, etc.) in der Praxis oft nicht oder nur schwer messbar sind, verwendete<br />
Balassa (1965) die für den Güterhandel relativ gut messbaren Außenhandelsströme,<br />
um davon ausgehend Rückschlüsse auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes zu<br />
301
ziehen. Sein Konzept der „revealed comparative advantages“ (RCA) – durch die<br />
Handelsströme aufgedeckte komparative Vorteile – erlangte große Bedeutung in der<br />
empirischen Forschung. Im vorliegenden Abschnitt verwenden wir die Dienstleistungsströme<br />
aus der Zahlungsbilanz zur Berechnung des folgenden Spezialisierungsindezes<br />
nach Balassa (1965):<br />
RCA ik =RXA ik – RMA ik<br />
Dieser setzt sich aus einer Exportkomponente und einer Importkomponente zusammen,<br />
wobei X ik die Dienstleistungsexporte des Landes i in Kategorie k laut Zahlungsbilanz<br />
darstellen. Die Importkomponente, RMA ik , ist analog definiert. Der so berechnete<br />
Spezialisierungsindex entspricht der Repräsentation der Exporte eines Landes in<br />
einer bestimmten Kategorie im Vergleich zur durchschnittlichen Repräsentation dieser<br />
Kategorie im Gesamthandel abzüglich der relativen Repräsentation der Importe. Somit<br />
gibt er Aufschluss über die Weltmarktposition des Landes in der entsprechenden<br />
Dienstleistungskategorie in Verhältnis zur Bedeutung dieser Kategorie und kann als<br />
ein Indikator für Wettbewerbsfähigkeit interpretiert werden. Ein positiver Wert stellt<br />
einen Wettbewerbsvorteil dar, während ein negativer Wert auf eine schwache Weltmarktposition<br />
schließen lässt.<br />
14.2.2 Statistische Erfassung von Dienstleistungen<br />
Die statistische Erfassung von Dienstleistungen ist grundsätzlich sehr problematisch,<br />
da das verfügbare Datenmaterial einer anderen Datenbasis als jener des Warenhandels<br />
entstammt. Der Warenhandel wird sehr genau im Rahmen der Zollabwicklung<br />
in einer eigens dafür vorgesehenen Handelsstatistik erfasst. Die Dienstleistungen<br />
hingegen werden über die Zahlungsbilanzstatistik erfasst, die weniger der Erfassung<br />
von Dienstleistungstransaktionen als vielmehr der Erfassung von grenzüberschreitenden<br />
Zahlungsströmungen dient (Reeh, 1996). Dadurch ergeben sich Unschärfen<br />
in vielerlei Hinsicht:<br />
• In der österreichischen Dienstleistungsbilanz (Zahlungsbilanzstatistik) wird nur der<br />
Zahlungsgrund von Transaktionen, die einen Wert von Euro 12.500 überschreiten,<br />
erfasst. Transaktionen von kleinerem Volumen werden nach einem historischen<br />
Schlüssel hochgerechnet.<br />
302
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
• Im GATS kommt eine sehr breite Definition von Dienstleistungen zur Anwendung,<br />
die jedoch von der Dienstleistungsbilanz nicht vollständig abgebildet wird.<br />
Die Grundlage der Dienstleistungsbilanz sind Zahlungsbilanzdaten gemäß der<br />
statistischen Definition der fünften Fassung des IMF-Manual zur Zahlungsbilanz<br />
(BPM5). 10 Der in der Zahlungsbilanz erfasste Dienstleistungshandel ist schwerpunktmäßig<br />
jener der Erbringungsarten grenzüberschreitender Handel, Konsum<br />
im Ausland und Präsenz natürlicher Personen. Die Erbringungsart Kommerzielle<br />
Präsenz ist in der Zahlungsbilanz deutlich unterrepräsentiert (Cave, 2002). 11<br />
• Die Tiefe der Unterteilung nach Dienstleistungsarten erfüllt bei weitem nicht jene<br />
Standards, wie man sie beispielsweise aus der traditionellen Außenhandelsstatistik<br />
über den Warenverkehr kennt.<br />
• Wie bereits angedeutet, werden jene Dienstleistungstransaktionen, die über die<br />
Erbringungsart Kommerzielle Präsenz abgewickelt werden, nur zu einem kleinen<br />
Teil in der Zahlungsbilanz abgebildet. Wenn eine Transaktion über eine ausländische<br />
Niederlassung stattfindet, ist zwischen Warenhandel, ausländischer Direktinvestition<br />
und Verkauf einer Dienstleistung über eine ausländische Niederlassung<br />
nicht einwandfrei zu unterscheiden. Es kann Unklarheit darüber herrschen, wo die<br />
Dienstleistung tatsächlich verrichtet wurde, und ob tatsächlich ein Ausländer an<br />
einen Inländer geleistet hat, insbesondere dann, wenn es sich um elektronische<br />
Leistungen handelt. Dienstleistungsdaten sind also räumlich und zeitlich weitaus<br />
weniger zuverlässig als Warenhandelsdaten.<br />
• Bei Betrachtung der Position Nicht aufteilbare Leistungen in der Dienstleistungsbilanz<br />
wird ein weiteres Problem deutlich. Diese überaus große Position entsteht<br />
aus der Differenz der Cash-Bilanz des Warenverkehrs, die tendenziell zu hoch<br />
ausgewiesen wird, und der von Statistik Austria ausgewiesenen Handelsbilanz. In<br />
dieser Position sind beispielsweise Ingenieur-Leistungen, Ausbildung, Anlagenbau<br />
wie auch Fehlkodierungen enthalten.<br />
Die nachfolgende empirische Analyse stützt sich auf Zahlungsbilanzdaten der Oesterreichischen<br />
Nationalbank sowie Zahlungsbilanzdaten aus der BOP-Statistik des<br />
IWF.<br />
14.3 Sektorbetrachtungen<br />
Im ersten Teilabschnitt 14.3.1 erfolgt eine Analyse der Struktur und Wettbewerbsfähigkeit<br />
österreichischer Dienstleistungsexporte gemäß der theoretischen Aufbereitung<br />
in 14.2.1. In 14.3.2 werden die drei Sektoren Versicherung, EDV- und Informationsdienstleistungen,<br />
Telekommunikation etwas eingehender teils qualitativ betrachtet.<br />
Diese Auswahl wurde getroffen, da es sich einerseits um moderne, komplexe<br />
303
Dienstleistungen handelt und andererseits diese Sektoren in den letzten Jahren ein<br />
außerordentliches hohes Wachstum aufwiesen. Abschnitt 14.3.3 analysiert die Spezialisierung<br />
österreichischer Dienstleistungsexporteure gegenüber unterschiedlichen<br />
Handelsnationen, westlichen Industriestaaten sowie den Mittel- und Osteuropäischen<br />
Ländern (MOEL).<br />
14.3.1 Österreichs Dienstleistungshandel im <strong>internationale</strong>n Vergleich<br />
Abbildung 14.1 zeigt die Struktur der österreichischen Dienstleistungsexporte im Jahr<br />
2002 im Vergleich zu Deutschland, den Niederlanden und den USA. Deutschland wurde<br />
gewählt, weil es den mit Abstand bedeutendsten Handelspartner Österreichs darstellt<br />
(siehe auch Kapitel 6). Die Niederlande wurden als ein weiteres kleines offenes Land<br />
Exportstruktur der Dienstleistungen, 2002 Abb. 14.1<br />
304<br />
Transport<br />
Reiseverkehr<br />
Kommunikation<br />
Bauleistungen<br />
Versicherung<br />
Finanzdienste<br />
EDV<br />
Pat.u.Lizenzen<br />
sonstige u.bez.<br />
Österreich<br />
Niederlande<br />
Deutschland<br />
USA<br />
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
zum Vergleich herangezogen. Wie aus der Abbildung ersichtlich, unterscheidet sich die<br />
österreichische Struktur nicht wesentlich von jener der angeführten Vergleichsländer.<br />
Die mit Abstand wichtigsten Kategorien stellen die sonstigen unternehmensbezogenen<br />
Dienstleistungen, Reiseverkehr und Transportwesen dar. In Österreich ist die<br />
Bedeutung des Reiseverkehrs naturgemäß höher als in den Vergleichsländern. Zu<br />
erwähnen ist auch der im <strong>internationale</strong>n Vergleich wesentlich geringere Anteil der<br />
Kategorien Patente und Lizenzen sowie EDV.<br />
Abbildung 14.2 zeigt dieselbe Struktur in Relation zur allgemeinen Bedeutung der<br />
jeweiligen Kategorie innerhalb der Haupthandelspartner Österreichs und gibt somit<br />
Aufschluss über die Exportspezialisierung des jeweiligen Landes. 12 Übersteigt die<br />
Länge des Balkens den Wert Eins so entspricht das einer Spezialisierung des entsprechenden<br />
Landes in der jeweiligen Position. Anders ausgedrückt weist das Land<br />
Exportspezialisierung bei Dienstleistungen, 2002 Abb. 14.2<br />
Transport<br />
Reiseverkehr<br />
Kommunikation<br />
Bauleistungen<br />
Versicherung<br />
Finanzdienste<br />
EDV<br />
Pat.u.Lizenzen<br />
sonstige u.bez.<br />
AT<br />
NL<br />
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5<br />
DE<br />
US<br />
305
überdurchschnittlich hohe Exporte in der jeweiligen Kategorie auf. Umgekehrt bedeutet<br />
ein Wert unter Eins einen unterdurchschnittlichen Exportanteil. Interessanterweise<br />
fällt der Tourismus in dieser Darstellung nicht durch besonders starke Exporte auf,<br />
wenngleich seine Bedeutung für Österreich groß ist. Das heißt, im <strong>internationale</strong>n<br />
Vergleich ist Österreich nicht besonders ausgeprägt auf Reiseverkehrsexporte spezialisiert.<br />
Hingegen zeigt sich eine deutlich ausgeprägtere Spezialisierung auf den<br />
Export von sonstigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Der Anteil dieser<br />
Dienstleistungsexporte liegt bei weitem über dem <strong>internationale</strong>n Durchschnitt, ebenso<br />
liegt der Anteil an Versicherungsleistungen merklich über dem allgemeinen Niveau.<br />
Deutschland weist in dieser Kategorie relativ gesehen sehr hohe Exporte auf, auch bei<br />
den EDV- und Informationsleistungen erweist sich Deutschland als starker Exporteur.<br />
Die USA hingegen dominieren den Markt mit Exporten von Patenten und Lizenzen.<br />
Im Gegensatz dazu bleiben die Dienstleistungsexporte der USA in allen anderen Kategorien<br />
unter dem Gesamtdurchschnitt zurück. 13 Die Niederlande, welche aufgrund<br />
der Größe des Landes ein gutes Vergleichsland darstellen, zeigen im Vergleich mit<br />
Österreich dennoch eine recht unterschiedliche Spezialisierung. In den Positionen<br />
Patente und Lizenzen, EDV- und Informations-, sowie Kommunikationsleistungen,<br />
Bauleistungen, und Transportleistungen ergibt sich eine weitaus stärkere Spezialisierung<br />
als in Österreich.<br />
Die bisherigen Beobachtungen bezogen sich ausschließlich auf die Exportseite. Für<br />
die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit ist es jedoch unerlässlich, auch die Importseite<br />
in Betracht zu ziehen. Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs wurde aufgrund des<br />
Dienstleistungshandels zwischen Österreich und seinen Haupthandelspartnern mit<br />
Hilfe des oben beschriebenen Spezialisierungsindex nach Balassa (1965) ermittelt. Die<br />
Spezialisierungsindizes für die einzelnen Kategorien sind in Abbildung 14.3 abgebildet.<br />
Wie bereits erwähnt wird ein positiver Wert als Wettbewerbsvorteil und ein negativer<br />
Wert als eine schwache Marktposition interpretiert. Aus der Abbildung ist ersichtlich,<br />
dass Österreich in relativ wenigen Kategorien einen Wettbewerbsvorteil aufweist. Die<br />
Stärken des österreichischen Dienstleistungshandels liegen im Transportwesen, 14 im<br />
Reiseverkehr und in den Kommunikationsleistungen. In allen übrigen Kategorien (mit<br />
Ausnahme der Versicherungsleistungen und der nicht abgebildeten Kategorie Regierungsleistungen<br />
a.n.g.) hat Österreich eine eher schwache Marktposition, besonders<br />
in den Kategorien Patente und Lizenzen, EDV-Leistungen und Finanzdienstleistungen.<br />
Die Bedeutung der österreichischen Importe übersteigt also in diesen Kategorien jene<br />
der Exporte. Österreich weist einen Grad an Spezialisierung auf, der in etwa zwischen<br />
jenem der anderen drei Länder liegt.<br />
Die USA weisen in den meisten Kategorien eine starke Wettbewerbsposition auf. Mit<br />
Ausnahme der Versicherungsleistungen und des Transportwesens ist der Spezialisie-<br />
306
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
Spezialisierungsindex nach Balassa, 2002 Abb. 14.3<br />
Transport<br />
Reiseverkehr<br />
Kommunikation<br />
Bauleistungen<br />
Versicherung<br />
Finanzdienste<br />
EDV<br />
Pat.u.Lizenzen<br />
sonstige u.bez.<br />
AT<br />
NL<br />
-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5<br />
rungsindex für die USA immer positiv. In Übereinstimmung mit den vorhergehenden<br />
Ergebnissen (siehe Abbildung 14.2) ergibt sich für Deutschland eine starke Wettbewerbsposition<br />
im Versicherungswesen. Ansonsten entspricht die Spezialisierung<br />
Deutschlands im Dienstleistungshandel ziemlich stark dem Durchschnitt der hier betrachteten<br />
17 Länder. Mit dieser einen Ausnahme und einer relativ schwachen Position<br />
im Reiseverkehr weist Deutschland weder nennenswerte Wettbewerbsvorteile noch<br />
-nachteile auf. Die Niederlande ergeben ein etwas differenzierteres Bild: Vorteilen in<br />
den Bereichen Bauleistungen, Kommunikation und Transport stehen Nachteile bei<br />
den Patenten und Lizenzen, EDV, Finanzdiensten, Versicherung und Reiseverkehr<br />
gegenüber.<br />
DE<br />
US<br />
307
14.3.2 Die Betrachtung ausgewählter Sektoren<br />
Die österreichische Versicherungswirtschaft<br />
Die private Versicherungswirtschaft stellt mit einem Anteil von 1,5 % an der realen<br />
gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung einen vergleichsweise kleinen Wirtschaftssektor<br />
dar. Gemäß der Geldvermögensrechnung halten die Versicherungsunternehmen etwa<br />
5 % bis 10 % der Finanzanlagen in Österreich (Url, 2002). Die Versicherungsdichte<br />
(Prämienvolumen pro Kopf) betrug im Jahr 2001 in Österreich 1.349 Euro. Verglichen<br />
zu den großen Dienstleistungsnationen Deutschland (1.484 Euro), Frankreich (1.899<br />
Euro), Großbritannien (3.394 Euro) und den USA (3.266 Euro) ist der österreichische<br />
Markt nicht nur verhältnismäßig klein, sondern weist auch eine geringere Pro-Kopf-<br />
Nachfrage auf. Der relative kleine Markt dürfte die größeren Versicherungsunternehmen<br />
dazu veranlasst haben, sich stärker in Zentral- und Osteuropa zu engagieren. Im<br />
Jahr 2002 trugen die Auslandsbeteiligungen bereits 28 % zum gesamten Prämienvolumen<br />
bei (OeNB, 2003, 45). Die noch vergleichsweise niedrige Versicherungsdichte<br />
in den östlichen Nachbarländern zeigt – die gewahrte Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen<br />
Versicherungsunternehmen vorausgesetzt – noch Potenzial für zukünftig<br />
weiter steigende Nachfrage nach österreichischen Versicherungsdienstleistungen im<br />
Ausland (OeNB, 2002, 64f.). Die entsprechenden Werte für die Pro-Kopf-Nachfrage<br />
in den MOEL-5 bewegen sich in einer Bandbreite zwischen 123 Euro (Ungarn) und<br />
476 Euro (Slowenien). 15<br />
Der österreichische EDV-Sektor<br />
Der Wettbewerbsnachteil im österreichischen EDV-Sektor dürfte vor allem dadurch<br />
begründet sein, dass primär Standardsoftware nach Österreich importiert wird, während<br />
Individualsoftware von in Österreich ansässigen Anbietern ausreichenden Absatz durch<br />
heimische Unternehmen finden dürfte. Eine bereits länger zurückliegende Umfrage des<br />
Industriewissenschaftlichen Institutes (IWI) (Hammerer, Putschek, 1996, 67f.) konstatiert,<br />
dass der Wettbewerbsdruck international zwar hoch sei, die Konkurrenz aus den<br />
Billiglohnländern (z.B. östliche Nachbarstaaten und Indien) bislang nur marginale Auswirkungen<br />
auf den österreichischen Markt haben würde. Österreichische Unternehmen<br />
wie in Österreich ansässige ausländische Tochterunternehmen bedienen erfolgreich<br />
die Märkte der östlichen Anrainerstaaten, wie dies aus der aggregierten Dienstleistungsbilanz<br />
für Zentral- und Osteuropa für das Jahr 2002 hervorgeht. Österreichische<br />
Unternehmen erwirtschafteten einen Überschuss von 7 Mio. Euro bei den EDV- und<br />
Informationsexporten in die zentral- und osteuropäischen Staaten. Die österreichische<br />
Globalstatistik zeigt ein Defizit von 151 Mio. Euro, das hauptsächlich auf Importe aus<br />
Deutschland, Großbritannien, Irland und die Niederlande zurückgeht. Positiv wird in<br />
308
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
der IWI-Studie angemerkt, dass auch kleine EDV-Unternehmen eine hohe Exportquote<br />
aufwiesen. Die hohe Vernetzung und hoch entwickelte Kommunikation böten <strong>internationale</strong><br />
Chancen. Outsourcing in Billiglohnländer in die dritte Welt spielt gemäß der<br />
IWI-Studie und auch nach Betrachtung der Dienstleistungsbilanz 2002 keine wesentliche<br />
Rolle für den österreichischen Dienstleistungsverkehr. Beispielsweise mit China<br />
wurden keinerlei EDV-Dienstleistungen ausgetauscht. Die EDV-Importe aus Indien<br />
beliefen sich auf 2 Mio. Euro. Gemessen an den österreichischen Gesamteinfuhren<br />
im EDV-Sektor von 298 Mio. Euro ist dies eine vernachlässigbare Größe.<br />
Der österreichische Telekom-Sektor<br />
Bei den Kommunikationsdienstleistungen erwirtschaftete Österreich im Jahr 2002<br />
einen Überschuss von 215 Mio. Euro bei einem Exportvolumen von 672 Mio. Euro.<br />
Knapp die Hälfte der Kommunikationsdienstleistungen wird von Deutschland abgenommen.<br />
Der Überschuss gegenüber den zentral- und osteuropäischen Staaten<br />
belief sich lediglich auf 12 Mio. Euro. Bedeutende Direktinvestitionen österreichischer<br />
Telekomunternehmen in den zentral- und osteuropäischen Staaten konzentrierten sich<br />
auf Slowenien sowie auf Bulgarien. 16 Dachs, Leo (1999) haben in einer von Eurostat<br />
beauftragten Studie unter Fernmeldedienst-Unternehmen eine zu anderen Sektoren<br />
vergleichsweise hohe Innovationstätigkeit erhoben. 81,3 % der befragten Unternehmen<br />
gaben an, innovative Aktivitäten zu entfalten, während hingegen der Durchschnitt<br />
für den gesamten Dienstleistungssektor 56,6% betrug. Leo (2002) konstatiert, dass<br />
die vor vier Jahren getätigte Marktöffnung den Wettbewerb im österreichischen Telekommunikationssektor<br />
substanziell erhöht hat. 17 Dies ist an der gestiegenen Zahl<br />
der Marktteilnehmer wie auch an den gesenkten Tarifen für traditionelle Telekommunikationsdienstleistungen<br />
erkennbar. Zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit im<br />
österreichischen Telekommunikationssektor gelte es aber nun verstärkt in die Telekommunikationsinfrastruktur<br />
zu investieren, insbesondere in Breitbandtechnologien.<br />
14.3.3 Stärken und Schwächen aus österreichischer Sicht<br />
Der oben beschriebene Spezialisierungsindex wird hier in abgeänderter Form unter<br />
Verwendung der Regionalauswertung der österreichischen Zahlungsbilanz berechnet.<br />
X ik steht nun für die österreichischen Exporte in Kategorie k in das Partnerland i (analog<br />
verwendet die Importkomponente die österreichischen Importe aus Partnerland i<br />
in Kategorie k). Somit ergibt der Index nun nicht mehr ein Maß für die <strong>internationale</strong><br />
Wettbewerbsfähigkeit sondern ein Maß für die unterschiedliche Spezialisierung des<br />
österreichischen Handels gegenüber verschiedenen Handelspartnern. Aufgrund des<br />
nach wie vor unterschiedlichen Entwicklungsniveaus der Handelspartner im Osten<br />
309
und im Westen ist eine starke Differenzierung im Handel zwischen diesen Partnern zu<br />
erwarten. Weiters spielt die räumliche Entfernung für verschiedene Dienstleistungen<br />
(gebundene versus ungebundene) eine große Rolle. Daher lässt sich auch eine unterschiedliche<br />
Spezialisierung im Handel mit Nachbarländern und anderen, räumlich<br />
weiter entfernten Partnern (USA, Großbritannien), erwarten. Abbildung 14.4 stellt die<br />
Spezialisierungsmuster der österreichischen Dienstleistungsexporte gegenüber zehn<br />
Ländern in den Jahren 1995 und 2002 dar. Von rechts nach links ergibt sich ein Vergleich<br />
zwischen westlichen Partnern (Deutschland, Italien, Schweiz, Großbritannien<br />
und den USA) und östlichen Partnern (Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien und der<br />
Slowakei), von oben nach unten kann man die Veränderung dieser Spezialisierungsmuster<br />
zwischen 1995 und 2002 ablesen. 18<br />
Betrachtet man den Grad der Spezialisierung gegenüber EU-15 im Vergleich zu den<br />
MOEL-5 zusammengenommen (Ergebnisse sind hier nicht dargestellt), so lassen sich<br />
drei wesentliche Aussagen machen: Erstens zeigt sich eine deutlich ausgeprägtere<br />
Spezialisierung auf der Exportseite, während die Importstruktur gegenüber östlichen<br />
und westlichen Partnern eine größere Ähnlichkeit aufweist. Zweitens kann exportseitig<br />
eine leichte Abnahme der Differenzierung zwischen Osten und Westen beobachtet<br />
werden, besonders in den Bereichen Bau- und Versicherungsleistungen näherten<br />
sich die jeweiligen Anteile der Exporte stark an. In diesen Kategorien kam es zwar<br />
auch zu einer Angleichung auf der Importseite, dem standen jedoch zunehmende<br />
Unterschiede im Reiseverkehr, bei den Kommunikations- und Finanzleistungen gegenüber.<br />
Drittens weist die Dynamik der Spezialisierung unterschiedliche Trends im<br />
Osten und im Westen auf.<br />
Sieht man zum Beispiel Abbildung 14.4 an so ergibt sich gegenüber einzelnen Ländern<br />
im Westen im Jahr 2002 eine deutlich homogenere Exportstruktur als noch 1995.<br />
Hingegen nahm der Spezialisierungsgrad gegenüber einzelnen Partnern im Osten<br />
zu. Importseitig (siehe Abbildung 14.5) lassen sich geringere Veränderungen im Grad<br />
der Spezialisierung feststellen. Im Handel mit den MOEL-5 kam es eher zu einer<br />
Angleichung der Exportmuster, jedoch standen sich im Einzelnen auch gegenläufige<br />
Entwicklungen gegenüber.<br />
Im Folgenden sollen in aller Kürze einzelne interessante Beobachtungen für das<br />
Jahr 2002 beschrieben werden. Die oben erwähnte Exportspezialisierung zwischen<br />
Ost- und Westhandel ist in bestimmten Kategorien besonders stark ausgeprägt. So<br />
wurden – wenig überraschend – überdurchschnittlich geringe Reiseexporte in den<br />
Osten getätigt, 19 während überdurchschnittlich viele Bauleistungen dorthin exportiert<br />
wurden. Sieht man sich die unternehmensnahen Dienste genauer an, so fällt auf, dass<br />
diese Dienste überdurchschnittlich stark nach Osteuropa exportiert werden. Vor allem<br />
310
311<br />
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
Österreichisches Exportspezialisierungsmuster, 1995 und 2002 Abb. 14.4<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
1995<br />
1995<br />
2002<br />
2002
312<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
Österreichisches Importspezialisierungsmuster, 1995 und 2002 Abb. 14.5<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
����<br />
����<br />
���<br />
���<br />
���<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
��<br />
untern.-bez.<br />
Patente<br />
EDV<br />
Finanzleistungen Versicherung<br />
Bau<br />
Kommunikation<br />
Reise<br />
Transport<br />
1995<br />
1995<br />
2002<br />
2002
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
Tschechien und Slowenien nahmen gemessen an ihrem Anteil im Handel mit Österreich<br />
überdurchschnittlich viele Leistungen aus den Kategorien Versicherung, Finanz, EDV,<br />
Patente, Kommunikation und sonstige unternehmensbezogene Leistungen ab. Der<br />
Anteil der Exporte im Bereich EDV, Patente sowie sonstige unternehmensbezogene<br />
Leistungen lag sogar in allen MOEL deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. 20<br />
Interessant erscheint auch die Tatsache, dass Versicherungs-, Finanz- und EDV-<br />
Leistungen ebenfalls überdurchschnittlich stark in die USA exportiert wurden. Dies<br />
dürfte vermutlich auf das Vorhandensein großer Finanzzentren in den USA und der<br />
sich daraus ergebenden starken Nachfrage nach Finanzleistungen zurückzuführen<br />
sein. Ebenso dürfte der Markt für EDV-Leistungen in den USA größer als anderswo<br />
sein. Positiv für Österreich ist anzumerken, dass der Saldo in allen drei genannten<br />
Positionen – wenn auch relativ gering – positiv war (80 Mio. Euro im Bereich Versicherungen,<br />
45 Mio. bei den Finanzleistungen und 5 Mio. Euro im Bereich EDV- und<br />
Kommunikationsleistungen).<br />
Vergleicht man die Spezialisierungsmuster im Export mit jenen auf der Importseite so<br />
zeigt sich eine weitere wichtige Unterscheidung zwischen westlichen und östlichen<br />
Handelspartnern. Während der intra-industrielle Handel mit den Partnern im Westen<br />
mit wenigen Ausnahmen eine große Rolle spielt, sind die Handelsbeziehungen mit<br />
den Partnern in Osteuropa noch stark durch inter-industriellen Handel geprägt. Daraus<br />
lässt sich auf nach wie vor bestehende unterschiedliche Determinanten der jeweiligen<br />
Handelsbeziehungen schließen. Der Handel mit den östlichen Partnern resultiert noch<br />
zu einem stärkeren Grad aus unterschiedlichen komparativen Vorteilen, bzw. Unterschieden<br />
in der Resourcenausstattung. So weisen die überdurchschnittlich hohen<br />
Importe von Bauleistungen aus Osteuropa seit 1995 – im Jahr 2002 nur mehr aus<br />
Polen – auf die relativ niedrigen Lohnkosten, bzw. die gute Ausstattung der MOEL-5<br />
– und insbesondere Polens – mit entsprechend ausgebildeten Arbeitskräften hin.<br />
Hingegen wird der Mangel im Vergleich zu Österreich an modernen, marktgerechten<br />
Technologien durch die überdurchschnittlich hohen Exporte von Patenten und Lizenzen<br />
sowie EDV-Leistungen in diese Länder deutlich. 21 Zu erwähnen sind hier jedoch<br />
auch jene Länder, für die der intra-industrielle Handel in einzelnen Positionen bereits<br />
eine große Rolle spielt. Diese sind Tschechien in den Bereichen Versicherungs- und<br />
Finanzleistungen, Ungarn und die Slowakei im EDV-Bereich, sowie Slowenien am<br />
Kommunikationsmarkt. In diesen Fällen zeigt sich gemäß den Handelsmustern ein<br />
ähnlicher Entwicklungsstand in Österreich und dem jeweiligen Handelspartner. Anders<br />
ausgedrückt dürften die klassischen Bestimmungsfaktoren für Handel in diesen<br />
Kategorien, nämlich Unterschiede in der Technologie oder in der Faktorausstattung,<br />
bereits deutlich an Bedeutung verloren haben.<br />
313
Zusammenfassend kann man aufgrund der hier durchgeführten Analyse der österreichischen<br />
Spezialisierungsmuster im Dienstleistungshandel feststellen, dass sich<br />
Österreichs Stärken im Handel mit seinen Partnern in Osteuropa im Wesentlichen in<br />
den unternehmensnahen Dienstleistungen finden lassen, insbesondere in den Finanz-,<br />
EDV-Leistungen und dem Bereich Patente und Lizenzen. Im Transportwesen hingegen<br />
weist Österreich im Handel mit jenen Ländern eine schwache Position mit relativ hohen<br />
Importen auf, ebenso im Reiseverkehr, der gegenüber Osteuropa sogar defizitär<br />
ist. Gegenüber westlichen Handelspartnern ergibt sich ein weniger differenziertes<br />
Bild, hier spielt der intra-industrielle Handel eine wesentlich größere Rolle. In zwei<br />
Kategorien zeigt sich eine besonders ausgeprägte Differenzierung zwischen Ost- und<br />
Westhandel: Einerseits weist Österreich gegenüber westlichen Partnern (mit Ausnahme<br />
Italiens) eine ausgeprägt starke Position im Reiseverkehr auf, andererseits zeigt sich<br />
gegenüber diesen Ländern (hier mit Ausnahme Großbritanniens) auch eine relative<br />
Wettbewerbsstärke bei den Bauleistungen. Von diesen Kategorien abgesehen ergibt<br />
sich ein, je nach Handelspartner im Westen, sehr individuelles Bild.<br />
Aus institutioneller Sicht ist zu beachten, dass ein Großteil des Dienstleistungshandels<br />
im Binnenmarkt der EU abgewickelt wird. Rund 67 % der österreichischen Dienstleistungsimporte<br />
und -exporte werden innerhalb des Binnenmarkts abgewickelt. Nach dem<br />
Beitritt der MOEL steigt der Anteil exportseitig auf ca. 77 % und importseitig auf ca.<br />
75 % an. Der bevorstehende Beitritt der MOEL zur EU wird einerseits beträchtliche<br />
Veränderungen der Dienstleistungsregime in den Beitrittsländern bringen und andererseits<br />
den Zugang der MOEL auf die Märkte der EU-15 im Sinne des Binnenmarktes<br />
nach Ablauf aller Übergangsfristen erheblich erleichtern. Weitere maßgebliche Veränderungen<br />
der Handelsstrukturen mit den MOEL sind kurz- und mittelfristig jedenfalls<br />
zu erwarten und nicht zuletzt durch ihre geographische Nähe bedeutsam. Bereits jetzt<br />
zeichnet sich eine zunehmende Konvergenz der Struktur des Dienstleistungshandels<br />
gegenüber alten und neuen Mitgliedsländern ab. Diese Tendenz dürfte sich aufgrund<br />
der Erleichterungen für den Marktzutritt nach dem Beitritt noch verstärken und zu<br />
weitaus homogeneren Handelsmustern führen.<br />
14.4 Politische Handlungsfelder<br />
Die Dienstleistungserbringung gewann über den Zeitverlauf beständig an Komplexität.<br />
Ebenso komplex und vernetzt sind die Politikfelder, mit denen sich die <strong>politische</strong>n<br />
Entscheider auseinandersetzen müssen. In der Folge werden dazu die Handlungsfelder<br />
statistische Grundlagen, Regulierung, Standortpolitik und Internationalisierungs-<br />
offensive kurz behandelt.<br />
314
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
Dienstleistungen galten auf Grund der Ansicht, dass Konsum und Produktion unmittelbar<br />
aneinander geknüpft sind, lange Zeit nicht als handelbar. Unter anderem machte<br />
die im Rahmen des GATS breit etablierte Definition über die vier Erbringungsarten<br />
Grenzüberschreitender Handel, Konsum im Ausland, Kommerzielle Präsenz und Anwesenheit<br />
natürlicher Personen das Potenzial deutlich, das im Dienstleistungshandel<br />
steckt. Problematisch dabei ist, dass das aktuell verfügbare statistische Instrumentarium<br />
für die Erfassung von grenzüberschreitendem Dienstleistungshandel stark verbesserungswürdig<br />
ist. In Unkenntnis der genauen Volumina der Dienstleistungsströme<br />
sind beispielsweise Stärke-Schwäche-Analysen der österreichischen Import- und<br />
Exportwirtschaft nur in unzureichendem Maße möglich. Besseres statistisches Material<br />
würde eine optimalere Politikgestaltung als die derzeit mögliche erlauben.<br />
Bei der Harmonisierung von Regulierungen im Dienstleistungssektor ist noch ein weiter<br />
Weg zurückzulegen, nicht zuletzt wegen der zu Grunde liegenden Komplexität der<br />
Regulierung. Fortschritte bei einer ausgewogenen Harmonisierung stellen jedenfalls<br />
eine wichtige Stütze für den Dienstleistungshandel dar. Freier Warenverkehr in den<br />
Gütermärkten ist prima vista verhältnismäßig leicht zu realisieren, indem Zolltarife und<br />
Quoten aufgehoben werden. Marktöffnungen im Dienstleistungsbereich sind wesentlich<br />
schwieriger zu verwirklichen, da die Erbringung der Dienstleistung meist an eine<br />
Vielzahl von Regeln und Vorschriften gebunden ist. Politisch heikel ist insbesondere<br />
die Dienstleistungserbringung, die an die Präsenz natürlicher Personen geknüpft<br />
ist. Beispielsweise die wechselseitige Anerkennung von Qualifikationen stellt bereits<br />
innerhalb des Binnenmarkts einen langwierigen Prozess dar. Die wechselseitige<br />
Anerkennung von Qualifikationen über die europäischen Grenzen hinaus ist noch<br />
wesentlich problematischer, da das Verständnis von Qualifikationen hochentwickelter<br />
Industrienationen von jenem der Schwellenländer und der Entwicklungsländer stark<br />
abweicht.<br />
Die Erbringung von Dienstleistungen und deren Handel sind eng mit der Standortfrage<br />
verknüpft. Das gesamte Spektrum der Standortpolitik hat also mittelbare und<br />
unmittelbare Auswirkungen auf die Dienstleistungserbringung in Österreich. Bei der<br />
Sektoranalyse wurde bereits auf die Zusammenhänge zwischen der Dienstleistungserbringung<br />
und Infrastrukturinvestitionen im Telekommunikationssektor verwiesen.<br />
Einen weiteren wesentlichen Input für Dienstleistungserbringung und -handel stellt<br />
die Verfügbarkeit hochqualifizierter Arbeit dar, insbesondere im Bereich komplexer<br />
Dienstleistungen. Die Erhaltung und der Ausbau dieses Standortvorteils z.B. durch<br />
eine stärker nachfrageorientierte Erstausbildung sowie laufende Weiterbildung müssen<br />
weiter im Fokus der Wirtschaftspolitik bleiben. 22<br />
Die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit und der Wirtschaftskammer<br />
Österreich gestartete Internationalisierungsoffensive (siehe dazu Kapitel 9) stellt<br />
315
die jüngste Maßnahme zur Förderung der Exportwirtschaft mit Berücksichtigung von<br />
Dienstleistungen dar. Sie enthält wesentliche Elemente zur Förderung des Dienstleistungshandels,<br />
die in der Literatur häufig genannt werden: Die Exportquote besonders<br />
von KMU soll durch eine entsprechende Erstberatung gehoben werden. Spezialisierungsvorteile<br />
im Infrastruktur- und Umwelttechnologiebereich sollen durch Maßnahmenpakete<br />
weiter verstärkt werden. Grenznahe Dienstleistungserbringer werden dazu<br />
angeregt, sich mit den Regulierungen der angrenzenden Nachbarländer vertraut zu<br />
machen, um so das Know-how für die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung<br />
zu erwerben. Ebenso wird eine stärkere Vernetzung und Koordination im Bildungs-,<br />
Forschungs- und Finanzierungsbereich forciert. Diese Maßnahmen stellen auf jeden<br />
Fall einen Schritt in die richtige Richtung dar.<br />
Literatur<br />
Balassa, B. (1965) Trade Liberalization and ‚Revealed‘ Comparative Advantage, The Manchester<br />
School of Economic and Social Studies, Vol. 32, pp. 99-123.<br />
BMWA (1999), (Hrsg.), Jahrbuch der Österreichischen Außenwirtschaft 1998/99, Wien.<br />
Cave, W. (2002), Measuring international trade in services and new demands on the family of<br />
classifications, paper prepared for the IAOS, London, August 27-29.<br />
Dachs, B., Leo, H. (1999), Die Innovationsaktivitäten der österreichischen Wirtschaft, Band 2:<br />
Dienstleistungssektor, Studie des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag<br />
von Eurostat und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wien.<br />
Daniels, P. (2002), EU service trade, with particular reference to business and professional<br />
services, in: Cuadrado-Roura, et al. (Hrsg.), Trading Services in the Global Economy, Edward<br />
Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton.<br />
Francois, J., Reinert, K. (1995), The Role for Services in the Structure of Production and Trade:<br />
Stylized Facts from a Cross-Country Analysis, CEPR Discussion Paper No. 1228, London.<br />
Hammerer, G., Putschek, M. (1996), Industrienahe Dienstleistungen, IWI-Studie 41, Industriewissenschaftliches<br />
Institut, Wien.<br />
IBM (2003), 3rd Report on Monitoring of EU Candidate Countries - Telecommunication Services<br />
Sector, im Auftrag der EU Kommission, Generaldirektion Informationsgesellschaft, Brüssel.<br />
Karsenty, G. (2002), Trends in Services Trade under GATS Recent Developments, presentation<br />
prepared for the Symposium on Assessment of Trade in Services, WTO, 14-15 March 2002,<br />
(16.12.03)<br />
Kronberger, R. (2003), Internationaler Dienstleistungshandel und temporäre Migration, Wirtschafts<strong>politische</strong><br />
Blätter 4/2003, Wirtschaftsverlag, Wien.<br />
Leo, H. (2002), Bisher zuwenig Anreize für Aufbau von innovativer Telekom-Infrastruktur in<br />
Österreich, Wifo Pressenotizen 24.4.2002, <br />
(23.12.03).<br />
316
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
Linders, G. (2001), Theory, Methodology and descriptive Statistics on Services and Services<br />
Trade, Master‘s Thesis, Tilburg University.<br />
Mattoo, A., Rathindran, R., Subramanian, A. (2001), Measuring Services Trade Liberalization<br />
and Its Impact on Economic Growth: An Illustration, World Bank Working Papers No. 2655,<br />
Washington D.C.<br />
Mayerhofer, P. (2000), Regionale Effekte der Tertiärisierung in Österreich. Wachstumsgewinne<br />
vor allem für die Zentren?, in: Schmee, J., Mesch, M. (Hrsg.), Dienstleistungsstandort Wien<br />
- Beschäftigung - Innovation - Wettbewerbsfähigkeit, Lang, Frankfurt am Main.<br />
OeNB (2002), Andere Finanzintermediäre, Finanzmarktstabilitätsbericht 4, Oesterreichische<br />
Nationalbank, Wien.<br />
OeNB (2003), Versicherungen, Finanzmarktstabilitätsbericht 6, Oesterreichische Nationalbank,<br />
Wien.<br />
Reeh, K. (1996), Die Erfassung des <strong>internationale</strong>n Handels mit Dienstleistungen: Am Ende nicht<br />
nur eine Herausforderung für die Statistik, in: Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten,<br />
Der österreichische Außenhandel 1996, Verlag Österreich, Wien.<br />
RTR (2002), Kommunikationsbericht 2001, Wien, (23.12.03).<br />
Schmee, J., Mesch, M. (Hrsg.) (2000), Dienstleistungsstandort Wien - Beschäftigung - Innovation<br />
- Wettbewerbsfähigkeit, Lang, Frankfurt am Main.<br />
UNDESA - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division (2002),<br />
Manual on statistics of international trade in services, Series M, No. 86, Geneva, Luxembourg,<br />
New York, Paris, Washington D.C.<br />
Url, T. (2002), Finanzdienstleistungen in der VGR: Die Versicherungswirtschaft, Wifo Monatsberichte<br />
2/2002, 99-106.<br />
Welsum, D. van (2003), International Trade in Services: Issues and Development, Economics Working<br />
Paper, 04/03, School of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College, London.<br />
(3.12.03).<br />
Anmerkungen<br />
* Dr. Ralf Kronberger ist Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Julia Wörz ist<br />
Mitarbeiterin am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, beide in Wien.<br />
1 Für eine ausführliche Beschreibung der Struktur des österreichischen Dienstleistungshandels<br />
siehe Kapitel 6.<br />
2 Von 1993 bis 2002 stiegen die Exporte im Versicherungssektor um 220,3 %, im Telekommunikationssektor<br />
um 710,8 %, bei EDV und Informationsdienstleistungen um 279,5 % und<br />
die unternehmensbezogenen Dienstleistungen um 102 % ausgehend von einem deutlich<br />
geringeren Niveau.<br />
317
3 Die Entwicklung der Waren- und Dienstleistungsexporte in Österreich widersetzte sich diesem<br />
Trend. Im Vergleichszeitraum (1995-1999) wuchsen die Güterexporte um 43,2 % und die<br />
Dienstleistungsexporte um 37,5 %.<br />
4 Die Berücksichtigung nachfolgender Sektoren ergibt einen knapp 66%igen Anteil der Dienstleistungswirtschaft<br />
an der österreichischen Wertschöpfung: Handel, Beherbergungs- und<br />
Gaststättenwesen, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kreditinstitute und Versicherungen,<br />
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, Öffentliche Verwaltung, Sonstige Dienstleistungen.<br />
Die zusätzliche Berücksichtigung der Sektoren Energie- und Wasserversorgung sowie<br />
Bauwesen hebt diesen Anteil auf knapp 70 %.<br />
5 Ökonometrische Studien, die den Zusammenhang zwischen (Wirtschafts-)Wachstum und<br />
Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte umfassend abbilden, sind in der Regel auf einige<br />
Sektoren wie beispielsweise Telekom und Finanzdienstleistung beschränkt. Vgl. dazu auch<br />
Mattoo, Rathindran, Subramanian (2001).<br />
6 Für eine aktuelle Liste der WTO-Mitglieder siehe: <br />
(16.1.2004).<br />
7 Für weitere Information zum EU-Syrien-Abkommen siehe <br />
(16.1.2004).<br />
8 Für einen rezenten Literaturüberblick zu theoretischen, konzeptionellen und statistischen<br />
Betrachtungen zum Dienstleistungshandel siehe beispielsweise van Welsum (2003).<br />
9 Für eine ökonomische Diskussion zu Mode 4 siehe Kronberger (2003).<br />
10 Eine ausführliche Beschreibung des BPM5-Standards findet sich in UNDESA (2002). Siehe<br />
dazu auch auch Jahrbuch der Österreichischen Außenwirtschaft 1998/99, Kapitel 5.<br />
11 Vergleiche dazu auch Karsenty (2002): Schätzungen aus den Zahlungsbilanzdaten für den<br />
weltweiten Dienstleistungshandel ergeben für die Erbringungsarten Grenzüberschreitender<br />
Handel ein Volumen in der Höhe von ca. 1.000 Mrd. USD, für den Konsum im Ausland einen<br />
Wert von ca. 500 Mrd. USD und für die Präsenz natürlicher Personen Zahlungen in der Höhe<br />
von ca. 50 Mrd. USD. Dem stehen Schätzungen aus der sogenannten FATS-Statistik (Foreign<br />
Affiliate Trade in Services) von 2.000 Mrd. USD für die Erbringungsart Kommerzielle Präsenz<br />
gegenüber. Die FATS-Statistik wird beispielsweise in den USA geführt.<br />
12 In den Berechnungen wurden jene 16 Länder berücksichtigt, welche gemeinsam mehr als<br />
85 % der österreichischen Dienstleistungsexporte erhalten. Das sind: Deutschland, Großbritannien,<br />
USA, Schweiz, Italien, Niederlande, Frankreich, Belgien, Ungarn, Polen, Tschechien,<br />
Slowakei, Slowenien, Schweden, Spanien, und Japan sowie Österreich selbst.<br />
13 In dieser Darstellung wurden die Kategorien Kultur und Freizeit, Regierungsleistungen a.n.g.<br />
und Nicht aufteilbare Leistungen aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen. In allen<br />
diesen Positionen liegen die US-amerikanischen Exporte über dem Durchschnitt.<br />
14 Der <strong>internationale</strong> Personentransport ist seit 1995 in der Position Transport verbucht. Somit<br />
ist ein Teil der österreichischen Wettbewerbsstärke in dieser Kategorie wohl auch dem Reiseverkehr<br />
zuzuschreiben.<br />
318
Ralf Kronberger, Julia Wörz<br />
15 Die Daten zur Versicherungsdichte entstammen dem österreichische Versicherungsverband:<br />
(21.12.03).<br />
16 Für Details siehe IBM (2003).<br />
17 Für eine detaillierte Analyse des österreichischen Telekommunikationsmarktes siehe Kapitel<br />
„Entwicklung der österreichischen Medien- und Telekommunikationsmärkte“ in RTR<br />
(2002).<br />
18 Die Export- und Importkomponente des modifizierten Balassa-Index wurden hier getrennt<br />
und in logarithmierter Form dargestellt. Ein positiver Wert ergibt sich daher aufgrund von<br />
überdurchschnittlich hohen Exporten (bzw. Importen) in das jeweilige Land, ein negativer Wert<br />
entspricht unterdurchschnittlich geringen Exporten (Importen) in das Partnerland gemessen<br />
an der allgemeinen Struktur des österreichischen Dienstleistungshandels.<br />
19 Nachdem der Handel mit den fünf hier berücksichtigten Partnern im Westen 71 % der österreichischen<br />
Dienstleistungsexporte ausmacht – wobei die Exporte nach Deutschland allein<br />
47 % darstellen – , wird der Durchschnitt selbstverständlich durch diese Länder und vor allem<br />
durch Deutschland wesentlich geprägt. Daher ergibt sich auch keine überdurchschnittliche<br />
Spezialisierung auf den Reiseverkehr im Handel mit dem Westen aus österreichischer Sicht,<br />
obwohl diese Spezialisierung im <strong>internationale</strong>n Vergleich (siehe Abschnitt 1.4.1) durchaus<br />
besteht.<br />
20 Der Ordnung halber seien hier die zwei Ausnahmen angeführt: Slowenien fragte unterdurchschnittlich<br />
wenige Patente nach und die Exporte an sonstigen unternehmensbezogenen<br />
Leistungen nach Ungarn lagen ebenfalls unter dem Durchschnitt unter Berücksichtigung der<br />
Größe des jeweiligen Landes.<br />
21 Es ist hier nochmals zu betonen dass dieser Abschnitt eine Evaluierung aus österreichischer<br />
Sicht darstellt. Wie zuvor erwähnt weist Österreich im <strong>internationale</strong>n Vergleich ein überaus<br />
niedriges Niveau bei den Exporten von Patenten und Lizenzen auf. Weiters war der Saldo im<br />
Jahr 2002 mit 994 Mio. Euro beinahe ebenso hoch wie die Importe von 1,1 Mrd. Euro.<br />
22 Für eine ausführliche Analyse der Standortthematik bezogen auf den Dienstleistungsstandort<br />
Wien siehe Schmee, Mesch (2000).<br />
319
15 IFIS ALS AUSSENWIRTSCHAFTS-<br />
PARTNER FÜR ÖSTERREICH<br />
Ewald Nowotny*<br />
15.1 Die für Österreichs Außenwirtschaft wichtigsten<br />
Finanzinstitutionen<br />
Für eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik Österreichs sind Internationale Finanzinstitutionen<br />
(IFIs) von vielfacher Bedeutung:<br />
• Bei der Projektentwicklung – speziell bei Großprojekten – sind IFIs initiativ und/<br />
oder beratend tätig, so dass eine rechtzeitige Kenntnis entsprechender Planungen<br />
von größter Bedeutung für interessierte Unternehmen ist. Die Wirtschaftskammer<br />
Österreich (WKÖ) kann über ihre Dienste entsprechende Informationen weitergeben<br />
– vielfach ist es aber angesichts der weltweiten Vielzahl von Projektideen<br />
auch nützlich, durch direkte Kontakte mit den IFIs abschätzen zu können, wie<br />
realistisch eine konkrete Projektidee in technischer und finanzieller Hinsicht ist.<br />
In der Phase der Projektentwicklung sind IFIs auch in großem Umfang Initiatoren<br />
und z.T. Auftraggeber von Feasibility-Studien, Consulting- und Prüfungsanträgen.<br />
Zum einen ist dies ein wichtiger Markt hochwertiger Dienstleistungen, der gerade<br />
für ein Land mit hohem technischem Standard, wie Österreich, von Interesse ist.<br />
Zum anderen können sich aus solchen Studien bereits wichtige Voraussetzungen<br />
für nachfolgende Aufträge ergeben.<br />
• Bei der Projektfinanzierung ist die Mitwirkung einer IFI oft entscheidend für die<br />
Chance der Realisierung. Soweit mit der IFI-Finanzierung Finanzierungsvorteile<br />
verbunden sind, wird es für die Wirtschaftlichkeitsrechung speziell bei Infrastrukturprojekten<br />
von erheblichem Einfluss sein. Mindestens ebenso wichtig ist aber<br />
der Umstand, dass private Finanziers oft nur bereit sind, zu sich engagieren,<br />
wenn auch eine IFI am Paket der Gesamtfinanzierung teilnimmt, da mit dieser<br />
Teilnahme höhere Sicherheit und Seriosität erreicht werden kann.<br />
• Die Rolle von IFIs als – oft entscheidendes – Element der Verstärkung der Sicherheit<br />
und Korrektheit der Projektdurchführung ist von massiver Bedeutung in diesbezüglich<br />
„schwierigen“ Staaten. Die zunehmende Bedeutung, die IFIs dem Kampf<br />
gegen Korruption beimessen, verstärkt die Stellung aller an entsprechenden Projekten<br />
beteiligten Unternehmen (bedeutet freilich auch eine „Disziplinierungs-Funktion“<br />
gegenüber Unternehmern). Ebenso sind Projekte mit IFI-(Teil)Finanzierung<br />
im Fall von Finanzierungsproblemen öffentlicher Auftraggeber in einer besseren<br />
Verhandlungsposition.<br />
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die für Österreichs Außenwirtschaft<br />
wichtigsten IFIs gegeben.<br />
320
Ewald Nowotny<br />
15.1.1 Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB, EIF), Luxemburg<br />
Die Europäische Investitionsbank (EIB) 1 hat als Hausbank der EU die Aufgabe, die<br />
Politik der EU insbesondere in Bezug auf Wirtschaft- und Regionalpolitik zu unterstützen.<br />
Mit einem Grundkapital von 150 Mrd. Euro steht sie im direkten Eigentum<br />
der (ab Mai 2004) 25 Mitgliedstaaten der EU (Anteil Österreichs: 2,4 %). Die Organe<br />
sind die Gouverneure (=EU-Finanzminister), der Verwaltungsrat (Österreichs Vertreter<br />
nominiert vom BM für Finanzen, SC Dr. Wieser) und der Vorstand (Präsident und<br />
Vizepräsidenten).<br />
Mit einem Volumen an ausstehenden Darlehen von 271 Mrd. Euro (Jahresvolumen<br />
2003: 41,7 Mrd. Euro) 2 ist die EIB volumenmäßig die weltweit größte <strong>internationale</strong><br />
öffentliche Investitionsbank (und entspricht mit dieser Größe etwa der im Eigentum<br />
der Bundesrepublik Deutschland stehenden, auch international tätigen, Kreditanstalt<br />
für Wiederaufbau - KfW). Die EIB selbst vergibt, mit Ausnahme von Sonderprogrammen<br />
für den AKP-Raum und den Mittelmeer-Raum (siehe unten), nur Kredite. Die<br />
Tochtergesellschaft European Investment Fund (EIF), Luxemburg, 3 stellt dagegen<br />
Eigenkapital für Beteiligungen an Venture Capital Fonds zur Verfügung, agiert demnach<br />
als „Fund of Funds“ um mitzuhelfen, den Rückstand, den Europa gerade im Bereich<br />
Wagnisfinanzierung aufweist, aufzuholen.<br />
Die Kreditvergabe durch EIB erfolgt in Form langfristiger Darlehen (Laufzeit bis 30<br />
Jahre, bis sieben Jahre tilgungsfrei), mit denen bis 50 % der Gesamtinvestitionskosten<br />
von Projekten finanziert werden können. Es handelt sich nicht um subventionierte<br />
Kredite, doch kann die EIB von einer Abgeltung ihrer Verwaltungskosten absehen und<br />
die günstigen Konditionen, die sie als großer AAA-Schuldner auf den <strong>internationale</strong>n<br />
Kapitalmärkten erhält, unmittelbar ihren Kreditnehmern weitergeben. Die Besicherung<br />
erfolgt durch Staats- oder Bankgarantien, es ist aber auch eine direkte Projektfinanzierung<br />
möglich, für die entsprechende Risikozuschläge eingehoben werden.<br />
Eine Sonderform stellen Globaldarlehen dar, die die EIB an lokale Kreditunternehmen<br />
zur Weiterleitung an kleinere Kreditnehmer (Gesamtprojekt-Volumen zwischen 40.000<br />
und 25 Mio. Euro) vergibt. Alle größeren österreichischen Kreditunternehmen verfügen<br />
über solche „Globaldarlehen-Vereinbarungen“ mit der EIB, sowohl für Projekte in<br />
Österreich, wie v.a. für Investitionsprojekte in den neuen EU-Mitgliedstaaten.<br />
Die geographische Struktur der Vergabe vom EIB-Darlehen (unterzeichnete Verträge)<br />
zeigt als überwiegende Schwerpunkte die EU-Staaten, mit besonderer Berücksichtigung<br />
regionaler Entwicklungsgebiete (Tabelle 15.1).<br />
Die Struktur nach Mittelverwendung zeigt den traditionellen Schwerpunkt der EIB<br />
als Langfrist-Finanzier von Infrastrukturinvestitionen, insbesondere in den Bereichen<br />
Transport und Telekommunikation. In der EU und in den Beitrittsstaaten spielen wei-<br />
321
Geographische Struktur der EIB-Darlehen 2003, Mrd. Euro Tab. 15.1<br />
Europäische Union 34,3<br />
Beitrittsländer 4,3<br />
Partnerländer 4 3,1<br />
Quelle: EIB Jahresbericht 2003.<br />
ters Globaldarlehen als ein Instrument zur Förderung regional breit gestreuter kleiner<br />
privater und öffentlicher (kommunaler) Investitionen eine besondere Rolle. Speziell<br />
außerhalb der bisherigen EU-Staaten setzt die EIB aber verstärkt auf die Finanzierung<br />
von Investitionen im Unternehmensbereich und hat ein eigenes Schwerpunkt-Programm<br />
für Foreign Direct Investment aufgebaut:<br />
Sektorale Struktur der EIB-Finanzierungen 1 nach Sektoren,<br />
1998–2002, Mrd. Euro<br />
322<br />
Europ. Union Beitrittsstaaten<br />
Euro-Med-<br />
Partnerstaaten<br />
Tab. 15.2<br />
AKP-Staaten<br />
Energie 12,3 0,7 1,2 0,7<br />
Kommunikation 49,5 8,3 1,3 0,3<br />
Wasser/Abwasser 14,3 2,1 1,5 0,2<br />
Industrie u. Dienstleistungen 2 19,5 1,7 1,0 0,3<br />
Globaldarlehen 51,6 1,8 1,0 0,7<br />
Insgesamt 147,2 14,0 5,9 2,1<br />
1) Die angegebenen Summen beziehen sich auf unterzeichnete Darlehensverträge.<br />
2) Einschließlich Gesundheit und Erziehung.<br />
Quelle: EIB Jahresbericht 2003.<br />
In Bezug auf Österreich belief sich das Kreditvolumen der EIB 2003 auf etwa 1 Mrd.<br />
Euro. Neben Globaldarlehen und Infrastrukturinvestitionen (Bahn, Ver- und Entsorgungseinrichtungen,<br />
öffentlicher Wohnbau) wurden Private Public Partnerships im<br />
Bereich Krankenhausbau (nach einem auch für Drittstaaten interessanten Modell) und<br />
im Transportwesen (Güterterminal Graz-Werndorf) (mit-)finanziert, sowie im Rahmen<br />
der „Europäischen Wachstumsinitiative“ betriebliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.<br />
Noch wichtiger für österreichische Unternehmen ist aber die Möglichkeit von EIB-<br />
Finanzierungen auf Auslandsmärkten. Praktisch alle österreichischen Banken, die in<br />
Ost- und Zentraleuropa tätig sind, haben mit der EIB Vereinbarungen über Globaldarlehen<br />
abgeschlossen, mit denen sie Kredite an lokale Klein- und Mittelbetriebe<br />
refinanzieren. Österreichische Bauunternehmen und Anlagelieferanten sind massiv<br />
in Verkehrs-, Energie- und Umweltprojekten tätig, für die EIB-Finanzierungen<br />
bereitgestellt wurden. Verstärkt werden EIB-Darlehen auch für Direktinvestitionen<br />
österreichischer Unternehmen in Anspruch genommen, wobei die EIB nicht den Er-
Ewald Nowotny<br />
werb von Unternehmern finanzieren kann, wohl aber die meist nötigen zusätzlichen<br />
Erneuerungs- und Ausbauinvestitionen.<br />
15.1.2 Weltbank-Gruppe (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID)<br />
Die International Bank of Reconstruction and Development (IBRD-World-Bank) 5 mit<br />
Sitz in Washington ist mit dem Internationalen Währungsfonds (International Monetary<br />
Fond - IMF) Teil der Bretton-Woods-Institutionen, den 1945 als wirtschaftliche Entsprechung<br />
zur UNO geschaffenen weltumspannenden Internationalen Finanzinstitutionen.<br />
Die Weltbank ist heute das wichtigste Instrument einer <strong>wirtschafts</strong>bezogenen Hilfe<br />
für die ärmsten Staaten der Welt, insbesondere in Afrika, und wird darüber hinaus<br />
im Rahmen von Anpassungsprogrammen („adjustment lending“) bei der Bewältigung<br />
makroökonomische Krisensituationen – meist in Kooperation mit dem IMF – aktiv.<br />
In den letzten Jahren hat sich die Weltbank einem massiven Strukturwandel unterzogen.<br />
Von generellen Finanzierungsaufgaben, speziell in Bezug auf Infrastruktur, hat<br />
eine Schwerpunktverlagerung stattgefunden zu Projekten der gezielten Armutsbekämpfung<br />
durch Finanzierungen in den Bereich Unterrichts- und Gesundheitswesen<br />
und eine stärkere Betonung der Beratungs- und Kontrollfunktion („good governance“)<br />
gegenüber Finanzierungsaufgaben. Dem entsprechend haben sich die Kreditzusagen<br />
vom Fiskaljahr 1999 zum Fiskaljahr 2003 von 22,2 auf 11,2 Mrd. USD fast halbiert.<br />
Weltbank-Finanzierungen, 2003, Mrd. USD Tab. 15.3<br />
Kreditzusagen 11,2<br />
davon „adjustment lending“ 4,2<br />
Ausstehendes Kreditvolumen 116,2<br />
Quelle: Weltbank Jahresbericht 2003.<br />
Größere Weltbank-Finanzierungen, speziell im Infrastruktur-Bereich, werden meist<br />
gemeinsam mit anderen IFIs durchgeführt, wobei die Konditionen der einzelnen IFIs<br />
etwa vergleichbar sind, soweit nicht, wie etwa bei EIB-Mandaten, spezielle Garantie-<br />
Übernahmen (z.B. durch die EU) bestehen. Vielfach wird an der Zusammenarbeit mit<br />
nationalen (speziell US-) Hilfsorganisationen auch eine Kombination von Darlehen<br />
(loans) und Zuschüssen (grants) angestrebt.<br />
Das größte Engagement der Weltbank liegt traditionell in Süd-Amerika. Dies ist (auch)<br />
Ausdruck des dominierenden Einflusses der USA auf die Politik der Weltbank, ist<br />
aber auch für europäische – und damit österreichische – Exporteure von Interesse,<br />
da die starke Intervention von Weltbank und Währungsfonds zur Stabilisierung dieses<br />
zunehmend interessanten Exportmarktes beigetragen hat – und auch künftiges<br />
Interesse signalisiert.<br />
323
Die Verfahrensweise der Weltbank ist stark dezentralisiert. In allen Staaten, in denen<br />
sie Aktivitäten entwickelt, verfügt die Weltbank über regionale Büros, die intensiven<br />
Kontakt mit den jeweiligen Regierungen halten und kompetente Ansprechpartner für<br />
die Beurteilung der wirtschaftlichen und <strong>politische</strong>n Entwicklungen darstellen. Größere<br />
Kreditvergaben, wie auch grundsätzliche Politikentscheidungen, sind Kompetenz der<br />
Verwaltungsräte (board of directors) mit hauptberuflichen Mitgliedern. Das österreichische<br />
Mitglied des Verwaltungsrates (dzt. Dr. Kurt Baier) wird vom Bundesminister für<br />
Finanzen nominiert.<br />
Die International Development Association (IDA), gegründet 1960, vergibt auf der<br />
Basis direkter Zuwendungen zinsfreie Kredite und zum Teil auch Zuschüsse an die 81<br />
ärmsten Staaten der Welt (in denen 2,5 Mrd. Menschen leben). Das Vergabevolumen<br />
im Finanzjahr (FJ) 2003 betrug 7,3 Mrd. USD und wurde für spezifische Programme<br />
der Armutsbekämpfung, insbesondere im Bezug auf Erziehung und Gesundheit eingesetzt.<br />
In der Gesamtstruktur ergibt sich für die Weltbank/IDA-Kredite 2003 folgende Aufteilung<br />
nach Sektoren:<br />
Weltbank/IDA-Kredite nach Sektoren, Fiskaljahr 2003, Mrd. USD Tab. 15.4<br />
Rechtswesen und öffentl. Verwaltung 3,9<br />
Gesundheitswesen 3,4<br />
Transport 2,7<br />
Erziehung 2,3<br />
Finanzierung (Klein-Darlehen) 1,5<br />
Wasser, Kanalisation 1,4<br />
Energie, Landwirtschaft, u.ä. 3,3<br />
Insgesamt 18,5<br />
davon IBRD 11,2<br />
davon IDA 7,3<br />
Quelle: Weltbank Jahresbericht 2003.<br />
Hinsichtlich der geographischen Aufteilung ergibt sich folgende Struktur:<br />
IBRD/IDA-Kredite nach Regionen, Fiskaljahr 2003, in Prozent Tab. 15.5<br />
324<br />
IBRD IDA<br />
Latein Amerika 50 2<br />
Europa und Zentral Asien 19 8<br />
Ost Asien und Pazifik 16 7<br />
Mittlerer Osten und Nordafrika 8 3<br />
Südasien 7 29<br />
Afrika 1 51<br />
Quelle: Weltbank Jahresbericht 2004.
Ewald Nowotny<br />
Im Rahmen der Weltbank Gruppe kommt der International Finance Corporation (IFC),<br />
Washington 6 , die Rolle zu, im Tätigkeitsgebiet der Weltbank privatwirtschaftliche<br />
Projekte auf kommerzieller Basis (und zu kommerziellen Konditionen) zu finanzieren.<br />
Die IFC verfügt dabei über das gesamte Instrumentarium einer Kommerz- und Investitionsbank,<br />
d.h. neben Krediten können auch Formen der Beteiligungsfinanzierung,<br />
Garantien und Riskmanagement-Produkte bereitgestellt werden.<br />
IFC-Kredite, Fiskaljahr 2003, Mrd. USD Tab. 15.6<br />
Neue Finanzierungsverpflichtungen 2003 5,0<br />
Insgesamt bereitgestellte Darlehen 11,9<br />
Beteiligungskapital 3,6<br />
Quelle: Weltbank Jahresbericht 2003.<br />
Von speziellem Interesse für Direktinvestitionen in „Risiko-Staaten“ ist die 1988 gegründete<br />
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). MIGA vergibt (entgeltliche) Garantien<br />
für Auslandsinvestoren zur Abdeckung nicht kommerzieller Risiken wie Enteignung,<br />
Restriktionen im Kapitaltransfer, Krieg, Bürgerkrieg. Insgesamt hat MIGA Garantien im<br />
Ausmaß von 12,4 Mrd. USD (2003 1,4 Mrd.) übernommen. Als weiteres Instrument zur<br />
Förderung von ausländischen Direktinvestitionen dient das International Centre for Settlement<br />
of Investment Disputes (ICSID), das als Schiedsinstanz bei Konflikten zwischen<br />
Auslandsinvestoren und Nationalstaaten herangezogen werden kann.<br />
15.1.3 Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD)<br />
Als Reaktion auf den Zusammenbruch der kommunistischen Wirtschaftssysteme<br />
wurde 1991 die EBRD 7 mit Sitz in London gegründet. Ihre Aufgabe war und ist zum<br />
wirtschaftlichen Wiederaufbau der entsprechenden Staaten unter besonderer Betonung<br />
der Entwicklung eines privatwirtschaftlichen Sektors beizutragen. Derzeit ist die EBRD<br />
in 27 Staaten tätig. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist dabei Russland, sowie die anderen<br />
Staaten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS), eine wichtige Rolle spielt die<br />
EBRD auch am Balkan. In den Staaten Zentral- und Osteuropas, die nun Mitglieder<br />
der Europäischen Union werden, zieht sich die EBRD aus dem Aufgabenbereich der<br />
Kreditvergabe tendenziell zurück (wird aber wohl auf absehbare Zeit weiterhin eine<br />
wichtige Rolle im Bereich der Beteiligungsfinanzierung spielen). Dagegen wurden der<br />
EBRD neue Aufgaben in Bezug auf die Staaten der Kaukasus-Region und Zentralasien<br />
übertragen. Seit 1991 hat die EBRD insgesamt Finanzierungen im Ausmaß von<br />
21,6 Mrd. Euro durchgeführt, im Jahr 2002 davon 3,9 Mrd. Von den Finanzierungen<br />
des Jahres 2002 erfolgten 33 % in Russland, 32 % im Zentraleuropa und den balti-<br />
325
schen Staaten, 22 % im Süd-Ost-Europa, 7 % in Osteuropa und Kaukasus, 6 % in<br />
Zentralasien.<br />
Die EBRD steht im Eigentum der Geberländer (EU-Staaten, USA, Kanada, Japan),<br />
der EU, der EIB und der Empfängerländer. Die Entscheidungsorgane der EBRD sind<br />
neben dem Gouverneursrat (Finanzminister) ein hauptberuflich tätiger Verwaltungsrat<br />
und der Vorstand. Gemäß dem <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Entwicklungsauftrag zur „Transformation“<br />
ist die EBRD in allen Staaten, in denen sie operativ tätig ist, durch eigene<br />
Büros vertreten, die auch interessante Anlaufstellen für potentielle Exporteure oder<br />
Investoren aus Österreich darstellen.<br />
Österreich ist am Gesamtkapital von knapp 20 Mrd. Euro mit 456 Mio. Euro beteiligt<br />
und am Sitz der EBRD durch ein ständiges Mitglied des Verwaltungsrates vertreten<br />
(dzt. Dr. Michael Neumayr).<br />
Gemäß ihrem Entwicklungsauftrag hat die EBRD die Staaten, in denen sie tätig ist, bei<br />
der Durchführung wirtschaftlicher Reformen zu unterstützen, sowie den Wettbewerb,<br />
die Privatisierung und das Unternehmertum zu fördern. Neben Kreditvergaben ist dabei<br />
vor allem das zeitlich begrenzte Eingehen direkter Beteiligungen von Bedeutung.<br />
Hier ist die EBRD bereit, volles unternehmerisches Risiko zu tragen (was etwa im Fall<br />
Russland auch schlagend wurde) und engagiert sich aktiv in den Aufsichtsgremien<br />
der entsprechenden Gesellschaften. Als strategischer Sektor für den Transformationsprozess<br />
wird dabei der Finanzsektor gesehen. Dem entsprechend weist die EBRD in<br />
diesem Bereich auch eine besonders große Zahl von (jeweils Minderheits-) Beteiligungen<br />
auf. Hier hat sich auch eine enge Kooperation mit den Aktivitäten österreichischer<br />
Kreditunternehmen in Zentral- und Südost-Europa entwickelt.<br />
Die EBRD verfügt auch über ein Programm für „Global-Darlehen“, d.h. Kredite an lokale<br />
Banken zur Weiterleitung an kleine und mittlere Unternehmen. So wie im analogen<br />
Fall der EIB wird auch dieses Programm der EBRD von Töchtern österreichischer<br />
Banken in der entsprechenden Region massiv in Anspruch genommen. Indirekt für<br />
österreichische Exporteure interessant ist auch das Trade Facilitation-Programm, das<br />
vor allem den Außenhandel innerhalb der EBRD-Region fördern soll. In Kooperation<br />
mit lokalen Banken (darunter prominent österreichische Töchter) werden im Rahmen<br />
dieses Programmes Garantien für Handelsfinanzierungen bereitgestellt.<br />
Die Sektorenstruktur der EBRD-Aktivitäten im Jahre 2002 wird in Tabelle 15.7 dargestellt.<br />
326
Ewald Nowotny<br />
EBRD-Finanzierungen nach Sektoren, 2002, Mrd. Euro Tab. 15.7<br />
Energie 0,6<br />
Kommunale und Umweltinfrastruktur 0,5<br />
Transport 0,5<br />
Agrarindustrie, Tourismus 0,5<br />
Telekommunikation 0,2<br />
Finanzinstitutionen 1,2<br />
Industrie 0,4<br />
Insgesamt 3,9<br />
Quelle: EBRD Jahresbericht 2003.<br />
15.1.4 Asian Development Bank (ADB)<br />
Die Asian Developement Bank (ADB) mit Sitz in Manila 8 steht im Eigentum von 44<br />
asiatischen und pazifischen und von 17 weiteren Staaten, zu denen auch Österreich<br />
gehört. Die ADB vergibt Darlehen, Garantien und stellt auch auf Zuschuss-Basis<br />
technische Hilfe und Beratung zur Verfügung.<br />
Insgesamt betrug das aushaftende Kreditvolumen per Ende 2002 98,8 Mrd. USD, das<br />
Volumen an Technical Assistance-Projekten 2,2 Mrd. USD.<br />
Im Jahre 2002 wurden Kredite im Ausmaß von 5,7 Mrd. USD und Technical Assistance-Zuschüsse<br />
im Ausmaß von 179 Mio. USD vergeben. Haupteinsatzbereiche sind<br />
Transport und Kommunikation, Energie und Umwelt, wobei zunehmendes Gewicht<br />
auf die Entwicklung der privaten Sektoren gelegt wird.<br />
Die ADB administriert auch den Asian Development Fund (ADF), der zinsbegünstigte<br />
Darlehen vergibt und den Technical Assistance Special Fund (TASF). Für beide Fonds<br />
hat Österreich Beiträge geleistet. Die ADB hat ein spezielles Programm für Projekt-<br />
Kofinanzierungen entwickelt, das neben öffentlichen und kommerziellen Kreditgebern<br />
auch Exportkredit-Finanzierungen umfaßt. Österreich hat sich bis jetzt unter diesem<br />
Programm an einer Exportfinanzierungs-Fazilität in Thailand beteiligt. Ab dem Jahr<br />
2004 wird auch ein spezielles ADB-Garantieprogramm für Exportfinanzierungen zur<br />
Verfügung stehen.<br />
Die Entscheidungsgremien in der ADB sind der Gouverneursrat (=Finanzminister), ein<br />
Verwaltungsrat mit hauptberuflich tätigen Mitgliedern und der Vorstand. Im Verwaltungsrat<br />
sind die einzelnen Mitgliedstaaten nach Stimmrechts-Gruppen organisiert. Im<br />
Rahmen der Österreich umfassenden Gruppe vertritt Herr Marcus Heinz die speziellen<br />
Interessen Österreichs.<br />
Im Rahmen von ADB-finanzierten Projekten erfolgten von österreichischen Exporteuren<br />
Lieferungen im Bereich Eisenbahnwesen und bei Wasser- und Abwasseranlagen. Ebenso<br />
wurden einzelne österreichische Konsulenten für ADB-Projekte herangezogen.<br />
327
15.1.5 Council of Europe Development Bank (CEB)<br />
Die CEB mit Sitz in Paris steht im Eigentum der (meisten) Mitgliedstaaten des Europarates.<br />
Österreich hat sich an der CEB nicht beteiligt, österreichische Unternehmen<br />
können aber an Ausschreibungen CEB-finanzierter Projekte teilnehmen. Das gesamte<br />
Kreditvolumen der CEB beträgt 9,4 Mrd. Euro (Neuvergaben 2002: 1,6 Mrd.). Das<br />
Schwergewicht liegt bei Projekten des Sozialen Wohnbaus (35 % der Kreditvergaben<br />
2002), Hilfe und Wiederaufbau nach Naturkatastrophen (20 %) und Umweltmaßnahmen<br />
(13 %). Die Schwerpunkte der Vergabe liegen regional in Italien (19 %), Frankreich<br />
(16 %), Polen und Türkei.<br />
15.1.6 Nordic Investment Bank (NIB)<br />
Zu den größeren IFIs zählt auch die Nordic Investment Bank (NIB), mit Sitz in Helsinki,<br />
die sich im Eigentum der skandinavischen Staaten befindet. Das Volumen aushaftender<br />
Darlehen belief sich Ende 2003 auf 11,7 Mrd. Euro, das jährliche Darlehensvolumen<br />
betrug 2,1 Mrd. Die NIB ist auch außerhalb des skandinavischen Raumes tätig, mit<br />
einem Schwergewicht auf Asien (wo sie auch über ein Büro verfügt), Baltische Staaten<br />
und Polen. Primär ist die NIB bestrebt, skandinavische Exporteure zu unterstützen.<br />
In Fällen von Mitfinanzierung, wo <strong>internationale</strong> Ausschreibungen erforderlich sind,<br />
bestehen jedoch auch Chancen für österreichische Exporteure an entsprechenden<br />
Projekten teilzunehmen.<br />
15.2 Bereiche der Partnerschaft<br />
15.2.1 Regionale Aspekte<br />
Die einzelnen Internationalen Finanzinstitutionen (IFIs) weisen sehr unterschiedliche<br />
regionale Schwerpunkte in ihrem Tätigkeitsprofil auf, so dass sich unter Aspekten einer<br />
strategischen Außen<strong>wirtschafts</strong>politik je nach Region unterschiedliche Perspektiven<br />
einer Kooperation ergeben:<br />
Neue EU-Mitgliedsstaaten<br />
Mit dem Beitritt sind die bisherigen Beitrittswerber volle EU-Mitglieder mit allen Rechten<br />
und Pflichten, wobei sich im wirtschaftlichen Bereich Akzentuierungen (z.B. Übergangsfristen)<br />
auf der Basis der jeweiligen Beitrittsverträge ergeben. Vom Finanzierungsvolumen<br />
her stellt die EIB die bei weitem wichtigste IFI in dieser Region dar,<br />
speziell für Beteiligungsfinanzierungen bleibt die EBRD weiterhin ein interessanter<br />
potentieller Partner.<br />
328
Ewald Nowotny<br />
In der Vorbereitungsphase zum Beitritt ging es vor allem darum, die technischen Voraussetzungen<br />
für eine möglichst rasche Integration in den europäischen Binnenmarkt<br />
zu schaffen. Dem entsprechend standen von Seiten der IFIs Finanzierungen im Bereich<br />
Transport und Kommunikation im Vordergrund. Hier bestanden und bestehen weiterhin<br />
gewaltige Investitionspotenziale, die von österreichischen Unternehmen, speziell im<br />
Bereich der Bauwirtschaft auch massiv genutzt werden.<br />
Mit dem Beitritt kommen die neuen Mitgliedstaaten in den Genuss von Mitteln aus<br />
Struktur- und Kohäsionsfonds. Wie Tabelle 15. 8 zeigt, bedeutet dies gegenüber den<br />
bisherigen Förderungsmitteln bereits für den Zeitraum 2004–2006 eine gewaltige<br />
Erhöhung. Die Strukturfonds-Mittel für die nächste Finanzierungsperiode 2007–2013<br />
stehen noch nicht fest und werden wohl erst nach äußerst schwierigen Verhandlungen<br />
festgelegt werden.<br />
Die in Zukunft verfügbaren erheblichen Mittel stellen ein bedeutsames Marktpotenzial<br />
dar, das nach EU-Vergaberichtlinien von den nationalen Behörden zu vergeben ist.<br />
Österreichische Unternehmen haben angesichts ihrer bereits starken Marktpräsenz in<br />
den neuen Mitgliedsstaaten beste Chancen, für entsprechende Projekte herangezogen<br />
zu werden. Da mit Ausnahme der Hauptstadt-Regionen das gesamte Gebiet der<br />
neuen Mitgliedstaaten als „Ziel-1-Gebiet“ eingestuft ist, kommen die Mittel der Strukturfonds<br />
flächendeckend zum Einsatz. Wichtige Investitionsbereiche sind Transport,<br />
Stadterneuerung und vor allem kommunale und regionale Umweltinvestitionen, um<br />
die Aufforderungen, die sich aus dem EU-Recht (acquis communautaire) ergeben,<br />
erfüllen zu können.<br />
Das Verfahren zur Bereitstellung von Mitteln aus Struktur- und Kohäsionsfonds ist freilich<br />
kompliziert und langwierig, so dass – auch unter Berücksichtigung der Notwendigkeit<br />
nationaler Kofinanzierung – die Gefahr besteht, dass die „Absorptionsgrade“ speziell<br />
in Staaten wie Polen, Tschechien und Slowakei zunächst eher gering sein werden.<br />
EU-Förderungen 2000/02 und 2004/06, Mio. Euro Tab. 15.8<br />
Förderungen 2000/02<br />
(Phare,Ispa,Sapard)<br />
Förderungen 2004/06<br />
(Struktur- und Kohäsionsfonds)<br />
Zuwachs<br />
Tschech. Rep. 579 2,418 418 %<br />
Estland 219 648 296 %<br />
Ungarn 741 2,817 380 %<br />
Lettland 312 1,045 335 %<br />
Litauen 507 1,394 275 %<br />
Polen 2,886 12,333 427 %<br />
Slovakei 420 1,577 375 %<br />
Slovenien 177 404 228 %<br />
Total 5,841 22,636 388 %<br />
Quelle: EU-Commission, Copenhagen European Council, Information note 30/01/2002.<br />
329
Basis der Mittelvergabe ist ein mit den EU-Behörden abgestimmter regionaler Entwicklungsplan,<br />
auf dessen Basis dann wieder gemeinsam Prioritäten und entsprechende<br />
Projekte festzulegen sind. Es ist für österreichische Unternehmen wichtig, rechtzeitig<br />
über die entsprechenden Planungen und die damit verbundenen Studien unterrichtet<br />
zu werden.<br />
Dies kann einerseits durch Kontakt mit den nationalen Planungsstellen geschehen,<br />
andererseits durch Kontakte mit den EU-Stellen in den jeweiligen Staaten und mit der<br />
EIB, die auf Basis eines Dienstleistungs-Abkommens die EU-Kommission bei den<br />
Planungen im Bereich Infrastruktur unterstützt.<br />
Es besteht sowohl seitens der neuen Mitgliedsstaaten als auch seitens der EU-<br />
Kommission vehementes ökonomisches und <strong>politische</strong>s Interesse den absehbaren<br />
„time-lag“ bei den Strukturfonds möglichst zu verkürzen. Im finanziellen Bereich hat<br />
sich die EIB bereit erklärt, bei Projekten, wo in Finanzierung durch Strukturfonds<br />
absehbar ist, die Vorfinanzierung durchzuführen, um einen rascheren Projektstart zu<br />
ermöglichen. In diesen Fällen können neben den EIB-Mitteln (langfristige Darlehen<br />
für maximal 50 % der Investitionssumme) zusätzlich kurzfristige EIB-Darlehen in die<br />
Finanzierungsplanung aufgenommen werden, die die Zeitdauer bis zur Bereitstellung<br />
der Strukturfondsmittel überbrücken. Das langfristige EIB-Darlehen kann Teil der nationalen<br />
Kofinanzierung werden und muss daher mit der nationalen Finanzierungs- und<br />
– vor allem – Verschuldungsstrategie übereinstimmen, was in Staaten mit tendenziell<br />
hohen Budgetdefiziten Probleme bringen kann.<br />
Süd-Ost Europa und Türkei<br />
In den Staaten Süd-Ost-Europas, die nicht EU-Kandidaten-Staaten sind (in EU-Terminolgie<br />
„Western Balkans“) sind eine Vielzahl von <strong>internationale</strong>n Organisationen und<br />
IFIs tätig, wobei versucht wird, im Rahmen des „Stabilitätspaktes für den westlichen<br />
Balkan“ eine gewisse Koordinierung zu erreichen. Dies ist angesichts der Kleinheit<br />
dieser Staaten speziell bei Infrastrukturprojekten nötig, die unter regionalen und nicht<br />
unter nationalen Gesichtspunkten zu betrachten sind. So wurde im Rahmen des<br />
Stabilitätspaktes ein gesamtregionales Programm für den Energiesektor (Erzeugung<br />
und Netze) entwickelt um dem Wildwuchs nicht koordinierter nationaler Projekte zu<br />
begegnen. Die in der Region tätigen IFIs haben sich verpflichtet, nur solche Projekte<br />
zu finanzieren, die in diesem gesamtregionalen Programm enthalten sind. Für österreichische<br />
Exporteure, die in dieser Region sehr aktiv sind, ist es daher wichtig, dieses<br />
Kriterium der regionalen Relevanz zu beachten, um nicht – wie z.T. schon geschehen<br />
– kostspielige Fehlplanungen vorzunehmen.<br />
Im Rahmen der Staaten des „West Balkans“ hat Kroatien beste Chancen einer EU-<br />
Mitgliedschaft in absehbarer Zeit – unter Umständen (bei Verzögerung des Beitritts<br />
330
Ewald Nowotny<br />
Rumäniens und Bulgariens auf etwa 2009) gemeinsam mit diesen Staaten. Für die<br />
übrigen Staaten des „West-Balkans“ besteht eine prinzipielle, zeitlich aber nicht fixierbare<br />
Perspektive der EU-Mitgliedschaft, wobei in diesen Staaten direkte Hilfszahlungen<br />
weiter eine zentrale Rolle neben ausländischen Direktinvestitionen und Darlehen<br />
spielen werden. Wenn es im Zuge einer drohenden „aid fatigue“ zu einer Reduzierung<br />
dieser Zahlungen kommen sollte, können sich für diese Staaten sehr schwierige<br />
Finanzierungsprobleme ergeben. Für österreichische Exporte in dieser Region bleibt<br />
daher die Verfügbarkeit von entsprechenden österreichischen oder <strong>internationale</strong>n<br />
Absicherungen und Garantien weiterhin von zentraler Bedeutung.<br />
Die Türkei ist angesichts ihrer strategischen und wirtschaftlichen Bedeutung Tätigkeitsbereich<br />
einer Vielzahl von IFIs. Da sich die Weltbank aber auch in diesem Land tendenziell<br />
auf Maßnahmen der direkten Armutsbekämpfung und des „institution-building“<br />
konzentriert, wird die Rolle der EIB als „Hausbank der EU“ tendenziell ansteigen. Die<br />
EIB ist in der Türkei auf Basis eines speziellen „Türkei-Mandates“ und im Rahmen der<br />
„Euro Mediterranean Partnership“ (FEMIP) tätig. Österreichische Exporteure haben die<br />
Chancen, die sich hier im Infrastrukturbereich, wie auch bei der Mitfinanzierung (Kredite<br />
und auch Beteiligungen) von Direktinvestitionen ergeben, bisher vergleichsweise wenig<br />
genützt. Hier besteht Nachholbedarf, da die EU-Märkte im nicht-agrarischen Bereich<br />
bereits jetzt im Rahmen der Assoziierungsabkommen für die Türkei offen stehen. Dies<br />
hat bereits zu entsprechenden exportorientierten Investitionen geführt, wobei vor allem<br />
die Autoindustrie und damit verbunden die Auto- Zulieferungsindustrie eine erhebliche<br />
Rolle spielen. Die Einbindung in das EU-Regelwerk bedeutet aber auch das Ende<br />
bisher bestehender spezieller bilateraler Regelungen, von denen z.B. österreichische<br />
Lieferanten im Kraftwerksbau profitieren konnten. Hier gelten nun die generellen EU-<br />
Wettbewerbs- und Ausschreibungsregelungen, die etwa auch von Seiten der EIB bei<br />
der Beurteilung der Finanzierbarkeit eines Projektes zu beachten sind.<br />
„Emerging Markets“ – AKP-Staaten<br />
Im Bereich der „Emerging Markets“ sind österreichische Exporteure vergleichsweise<br />
stark in den GUS-Staaten vertreten, wobei insbesondere in Russland und in den Kaukasus-Republiken<br />
die Zusammenarbeit mit der EBRD von Interesse ist. 2004 hat der<br />
EU-Rat auch das „Russland-Mandat“ der EIB auf 500 Mio. Euro ausgeweitet, um die<br />
Finanzierung von Infrastrukturprojekten im gemeinsamen Interesse zu erleichtern.<br />
Ein Markt von wachsender Bedeutung sind die südlichen Anrainerstaaten des Mittelmeeres.<br />
Im Rahmen der Euro-Mediterranen Partnerschaft hat die EIB gemeinsam<br />
mit der EU-Kommission die FEMIP-Initiative ins Leben gerufen mit einem Finanzierungsvolumen<br />
von rund 1,5 Mrd. Euro pro Jahr. Für österreichische Exporteure ist<br />
dies einerseits interessant in Bezug auf Lieferungen bei EIB- finanzierten Infrastruktur-<br />
331
projekten, zum anderen besteht hier aber auch die Möglichkeit, dass sich die EIB an<br />
privaten Unternehmen eigenkapitalmäßig beteiligt. In diesen schwierigen, aber rasch<br />
wachsenden Märkten kann die Errichtung von Tochtergesellschaften oft ein zentrales<br />
strategisches Element der Markterschließung sein.<br />
Eine bisher nur geringe Präsenz weist Österreichs Exportwirtschaft im Bereich der<br />
AKP-Staaten (Afrika-Karibik-Pazifik) auf. Auch hier bietet sich aber die strategische<br />
Möglichkeit, als Mitgliedstaat der EU über EU-Programme in Märkte vorzustoßen,<br />
die bisher weitgehend von den ehemaligen Kolonialmächten – und z.T. den USA<br />
– dominiert sind. Im Rahmen des Cotonou-Abkommens zwischen der EU und den<br />
AKP-Staaten sind für den Zeitraum 2003-2008 erhebliche Geldmittel vorgesehen,<br />
deren effiziente Verwendung, wie sich im vorhergehenden Lomé-Abkommen gezeigt<br />
hat, eine erhebliche Herausforderung dargestellt. Im Wege der EU-Kommission werden<br />
Hilfszahlungen (grants) im Gesamtvolumen von 11,3 Mrd. Euro bereitgestellt. Im<br />
Rahmen der EIB wurde die „Investment Facility“ eingerichtet, die mit 2,2 Mrd. Euro<br />
dotiert ist und die vor allem durch Darlehen, Beteiligungen und Garantien für Projekte<br />
des privaten Sektors genutzt werden soll. Darüber hinaus stellt die EIB einen Betrag<br />
von 1,7 Mrd. Euro für „konventionelle“ langfristige Infrastrukturdarlehen zur Verfügung.<br />
Speziell für Projekte im Energiebereich, der Rohstoff-Erschließung und im Transportwesen<br />
(einschließlich Flughäfen und Flugsicherung) bedeuten dies Programme<br />
für österreichische Interessenten nicht nur, dass durch die EIB eine Sicherheit der<br />
Zahlungsströme sichergestellt ist, sondern auch, dass transparente Vergabeverfahren<br />
(mehr oder weniger) sichergestellt sind, so dass sich hier größere Chancen öffnen<br />
als in der Vergangenheit.<br />
15.2.2 Sektorale Aspekte<br />
Infrastruktur<br />
Sowohl in den bisherigen, wie in den neuen EU-Staaten ist weiterhin eine erhebliche<br />
Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen zu erwarten. Dies betrifft neben Umweltinvestitionen<br />
vor allem Energieinvestitionen, wo sich nach Jahren niedriger Investitionen ein<br />
massiver Aufholbedarf zeigt. Besondere <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Bedeutung kommt Verkehrsinvestitionen<br />
zu. Ein Funktionieren des EU-Binnenmarktes setzt eine leistungsfähige<br />
Verkehrsinfrastruktur voraus. Das EU-Weißbuch zur Verkehrsinfrastruktur hat<br />
hier den Weg zu tiefgreifenden Reformen speziell für den Eisenbahnbereich geöffnet.<br />
Neben organisatorischen und institutionellen Neuerungen wird mit der geplanten<br />
Wegekosten-Richtlinie auch die Möglichkeit einer Querfinanzierung von der Straße zur<br />
Schiene eröffnet. Insgesamt gilt jedenfalls, dass ein leistungsfähiges Verkehrssystem<br />
für ein erweitertes Europa massive Investitionen im Verkehrsbereich erfordern wird.<br />
332
Ewald Nowotny<br />
Die EU hat entsprechend im Sommer 2003 eine Neufassung des Konzeptes der<br />
„Transeuropäischen Netze“ (TENs) vorgenommen. Die darin enthaltenen grenzüberschreitenden<br />
Projekte werden bis zum Jahr 2020 einen Gesamtinvestitionsaufwand<br />
von 235 Mrd. Euro erfordern. Für Österreich relevante Beispiele von TENs sind etwa<br />
der Ausbau der Bahnstrecke Paris-Straßburg-München-Wien-Budapest zu einem<br />
europäischen Hochleistungskorridor (für Personen- und Güterverkehr), die Strecke<br />
München-Verona (via Brenner), Hochleistungs-Verkehrsverbindungen (Straße und<br />
Schiene) zwischen Wien und Prag, bzw. Pressburg und der Ausbau der Donau für<br />
den Frachtverkehr.<br />
Zusammen mit den innenstaatlichen Projekten ergeben sich hier gewaltige Finanzierungsaufgaben<br />
für die öffentliche Hand und die IFIs. Angesichts der Finanzierungsengpässe<br />
des öffentlichen Sektors werden Private-Public-Partnerships (PPPs) als<br />
Organisations- und Finanzierungsform eine immer größere Rolle spielen. Exportanstrengungen<br />
in diesen wichtigen Infrastrukturbereichen werden daher eng mit der<br />
rechtzeitigen und intensiven Mitwirkung an der Erstellung entsprechender Konzepte<br />
für Projektfinanzierungen und PPPs verbunden sein. Das setzt erhebliche Kenntnisse<br />
und Fähigkeiten im bezug auf Risikotragung voraus, sowie entsprechendes Know-how<br />
in Bezug auf hoch entwickelte Finanzierungsformen.<br />
In Europa ist die EIB der größte Einzelfinancier von PPP-Projekten und hat hierfür auch<br />
eine eigene Projekt-Direktion geschaffen (Leitung: Dir. Tom Barrett). Rechtzeitige und<br />
intensive Kontakte können hier helfen, fundierte und erfolgversprechende Formen der<br />
Beteiligung an großen europäischen Infrastrukturprojekten zu entwickeln. Gerade auch<br />
in den neuen EU-Mitgliedstaaten geht es dabei oft nicht nur um die technische Durchführbarkeit,<br />
sondern auch um den gesamtwirtschaftlichen und <strong>politische</strong>n Rahmen.<br />
Österreichische Projektträger haben etwa in Ungarn schmerzlich erfahren müssen,<br />
dass Projekte an diesen „Makro-Bedingungen“ scheitern können. Eine enge Kooperation<br />
mit IFIs, und hier insbesondere der EIB, bedeutet in solchen Konstellationen<br />
über den Finanzierungsaspekt hinaus auch eine erhöhte Sicherheit in Bezug auf die<br />
Verlässlichkeit <strong>politische</strong>r und rechtlicher Rahmenbedingungen.<br />
15.2.3 Industriell-gewerblicher und Dienstleistungs-Bereich<br />
Sowohl in den neuen EU-Mitgliedstaaten, als auch im Mittelmeer- und im AKP-Raum<br />
liegt ein Schwergewicht der nationalen und multilateralen Wirtschaftspolitik in einer<br />
Förderung des Unternehmenssektors. Eine Politik des „export-led growth“ soll Wachstumsdynamik<br />
durch den Ausbau eigener Exportindustrien erreichen. Dies geschieht<br />
primär durch ausländische Direktinvestitionen, die vielfach freilich auch mit der Verlegung<br />
von Produktionsstätten aus Hochlohn- in Niedriglohnstaaten verbunden sind.<br />
333
Für Österreichs Exportwirtschaft können sich daraus Probleme, aber auch Chancen<br />
ergeben. Chancen bestehen vor allem für die Investitionsgüterindustrie, aber auch in<br />
Form von Betriebsgründungen, die Märkte durch Importsubstitution verteidigen oder<br />
neu erobern (was z.B. in der Baustoffindustrie erreicht werden konnte).<br />
Die Rolle von IFIs kann hier in der Mitfinanzierung der auf neuen Märkten nötigen<br />
Investitionen liegen. Die EBRD hat darüber hinaus die Möglichkeit, etwa im Rahmen<br />
von Privatisierungen, über (Minderheits-) Beteiligungen auch Eigenkapital für neu<br />
gegründete oder übernommene Unternehmen bereitzustellen, was eine erhebliche<br />
Zahl österreichischer Unternehmen, auch im Bereich der Kreditwirtschaft, nutzen<br />
konnte. Es ist wichtig, darauf hinweisen, dass sich die Mitwirkung der IFIs in diesen<br />
neuen Märkten nicht nur auf Großunternehmen beschränkt. Auch kleine und mittlere<br />
Unternehmen können (z.B. via Globaldarlehen) Kredite oder Beteiligungen in Anspruch<br />
nehmen. Strategisch bedeutsam ist dabei, dass durch eine solche Auslandsexpansion<br />
eine bestehende technische und kommerzielle Know-how-Basis breiter genutzt und<br />
damit oft erst das langfristige Überleben leistungsfähiger Unternehmen gesichert<br />
werden kann. Dieser Aspekt „indirekter Exporte“ ist angesichts der großen Zahl hoch<br />
qualifizierter österreichischer Mittelbetriebe und der Chancen durch die räumliche Nähe<br />
von erheblicher strategischer Bedeutung für Österreich, was sowohl für technologie-<br />
wie auch dienstleistungsbezogene Bereiche gilt.<br />
15.3 Kooperation mit IFIs – Erfahrungen und Chancen<br />
Die Erfahrungen österreichischer Exporteure mit IFIs beziehen sich vor allem auf die<br />
Kooperation bei Projekten in den neuen EU-Mitgliedstaaten und in Süd-Ost-Europa.<br />
Dies gilt insbesondere für die Bauwirtschaft, wo große Unternehmen mit den Anforderungen<br />
und Verfahren der IFIs vertraut sind und österreichische Unternehmen den<br />
Ruf verlässlicher und kompetenter Partner haben. Ebenfalls von Bedeutung in dieser<br />
Region ist die enge Zusammenarbeit von IFIs mit österreichischen Banken, sei es über<br />
Globaldarlehen-Vereinbarungen (v.a. EIB), sei es über Kapitalbeteiligungen (EBRD).<br />
Vergleichsweise wenig genutzt wurden bis jetzt die Chancen, über IFI-finanzierte<br />
Projekte auf außereuropäischen Märkten, insbesondere im südlichen Mittelmeerraum,<br />
Afrika und Asien, Fuß zu fassen.<br />
Entwicklungsfähig ist auch die Rolle österreichischer Consulting-Unternehmen, sowohl<br />
direkt im Rahmen von IFIs, wie auch bei IFI-finanzierten Projekten. Bei der Zusammenarbeit<br />
mit IFIs ist es wichtig, die meist sehr formalisierten Verfahren, die hier für den<br />
„Projekt-Zyklus“ gelten, zu kennen und zu berücksichtigen. Ausgangspunkt ist jeweils<br />
ein spezielles Projekt, das vom „Promotor“ an die IFI herangetragen wird. Promotor<br />
kann dabei, speziell bei Infrastrukturprojekten, eine staatliche Stelle sein, ebenso aber<br />
334
Ewald Nowotny<br />
auch ein privater Projektträger. Vielfach wird der Kontakt auch durch private Banken,<br />
die das Finanzierungspaket arrangieren, hergestellt. Kein Gesprächspartner für IFIs<br />
sind in diesem Stadium potenzielle Lieferanten. Für sämtliche IFIs gilt, daß speziell<br />
öffentliche Projekte offenen <strong>internationale</strong>n Ausschreibungen zu unterwerfen sind<br />
und daher keine Festlegung in Bezug auf Lieferanten erfolgen darf. Wohl aber ist<br />
es möglich und vielfach auch sinnvoll, dass Unternehmen aus technisch relevanten<br />
Bereichen – wie etwa dem Anlagebau, der Energietechnik und dem Eisenbahnwesen<br />
– generelle Gespräche mit den technischen Abteilungen und Projektdirektionen von<br />
IFIs führen, um technische Entwicklungen, Qualitätsstandards und Leistungsfähigkeit<br />
aufzuzeigen. Gerade für international gesehen kleinere und mittlere Unternehmen,<br />
die nicht zum Kreis großer „etablierter“ Anbieter gehören, können solche Kontakte in<br />
Hinblick auf spätere Phasen des Projektzyklus sinnvoll sein.<br />
Der erste Schritt der konkreten Projektprüfung besteht in der Analyse, ob überhaupt<br />
ein prinzipiell „bankfähiges“ Projekt vorliegt. Hier geht es zum Beispiel bei Infrastruktur-<br />
und Energieprojekten um die Frage, ob und wie dieses Projekt gesamtregionalen<br />
bzw. gesamtwirtschaftlichen Perspektiven (z.B. TENs, EU-Regionalplanungen,<br />
regionalen Entwicklungsplänen) entspricht. Hierfür werden oft Pre-Feasibility- und<br />
Feasibility-Studien herangezogen, die vom Projektwerber oder auch von der IFI in<br />
Auftrag gegeben werden und für die vielfach auch direkte Fördermittel (grants) von<br />
der EU oder nationalen Institutionen in Anspruch genommen werden können (wobei<br />
im ersteren Fall wieder eine <strong>internationale</strong> Ausschreibung zu erfolgen hat). Bei positivem<br />
Ergebnis kann es dann zur technischen und wirtschaftlichen Feinplanung des<br />
Projektantrages kommen.<br />
Diese Feinplanung wird dann von den zuständigen Abteilungen der IFI überprüft. Für<br />
die EIB gilt dabei etwa, dass die Übereinstimmungen mit den Rechtsnormen der EU,<br />
insbesondere auch in Bezug auf Umweltschutz, zu prüfen seien. Analoges gilt für die<br />
von Weltbank und EBRD vorgegebenen Standards. In der ökonomischen Analyse<br />
werden sowohl volkswirtschaftliche Kriterien (economic rate of return) wie auch die<br />
betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit herangezogen. Für die spezifisch bankwirtschaftliche<br />
Betrachtung ist vor allem der Aspekt der Bonität des Projektwerbers von Bedeutung<br />
(Rating, Staats- oder Bankgarantien, sonstige Sicherheiten-Arrangements).<br />
Wird das auf diese Weise vorbereitete Projekt dann von den Entscheidungsgremien<br />
der IFI akzeptiert, kann auf dieser Basis dann mit dem Projektwerber ein Kreditvertrag<br />
abgeschlossen werden. Damit kann die Ausschreibung der mit dem Projekt verbundenen<br />
Arbeiten erfolgen. Die Ausschreibung erfolgt durch den Projektträger, der Ausschreibungstext<br />
und das Ergebnis der Ausschreibung sind jedoch der finanzierenden<br />
IFI zur Bewilligung vorzulegen. Dies ist selbstverständlich eine sehr sensible Phase<br />
des Verfahrens, die vielfach zu Interventionen und Streitigkeiten führen kann. Die<br />
335
Verantwortung liegt dabei aber stets beim Projektträger, die Sanktionsmöglichkeit der<br />
IFIs besteht nur darin, die Finanzierung zu verweigern, wenn die Ausschreibung nicht<br />
vereinbarungsgemäß erfolgte oder es zu Unregelmäßigkeiten im Ausschreibungsverfahren<br />
gekommen ist, keinesfalls aber kann eine IFI direkt den Auftragnehmer<br />
bestimmen. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausschreibung erfolgt dann die Finanzierung<br />
in einer dem Kreditvertrag entsprechenden Form, die meist laufende Kontrollen<br />
vorsieht. Für IFIs, die ja öffentliche Aufgaben zu erfüllen haben, ist wesentlich, dass<br />
für den Projektabschluss nicht nur ein technischer „Completion-Report“ erforderlich<br />
ist, sondern auch eine Evaluierung hinsichtlich des Erreichens der angestrebten gesamtwirtschaftlichen<br />
Zielsetzungen erfolgt. Bei öffentlichen Projekten, z.B. im Bereich<br />
der Infrastruktur, ist das Ergebnis der Evaluierung auch öffentlich zugänglich und<br />
damit unter Umständen auch Gegenstand der Diskussion interessierter Gruppen. Bei<br />
privatwirtschaftlichen Projekten (z.B. bei der Mitfinanzierung ausländischer Direktinvestitionen)<br />
gelten selbstverständlich die <strong>internationale</strong>n Normen der bankmäßigen<br />
Verschwiegenheitspflichten.<br />
Insgesamt zeigt schon diese kurze Darstellung, dass die Welt der IFIs entsprechend<br />
ihrem Auftrag in mancher Hinsicht eine andere und manchmal kompliziertere ist als<br />
die der kommerziellen Finanzierung. Es ist aber unter vielen Aspekten von Interesse,<br />
diese Welt zu kennen und mit ihr Kooperationen zu suchen. Dabei geht es nicht nur<br />
um günstigere Kreditkonditionen. In wichtigen Regionen und Projektformen wird ohne<br />
Mitwirkung einer IFI die Durchführung eines Projektes gar nicht möglich sein und in<br />
vielen Fällen können die <strong>internationale</strong>n Erfahrungen der IFIs zu einer wesentlichen<br />
Verbesserung des Projektes und damit letztlich zu größerer Sicherheit für die beteiligten<br />
Exporteure beitragen.<br />
Was kann nun Österreichs Außen<strong>wirtschafts</strong>politik tun, um österreichischen Unternehmen<br />
diese strategisch wichtigen Kontakte mit den IFIs zu eröffnen und zu erleichtern?<br />
Ein erster Ansatz besteht in verschiedenen Aspekten einer umfassenden und intensivierten<br />
Information. Zum einen geht es dabei um verstärkte Information über die<br />
entsprechenden IFIs, ihre Mandate und ihre Verfahrensweisen. Dazu gehören Fragen<br />
wie die, ob ein geplantes Projekt nach dem Mandat der IFI finanzierbar ist („elegibility“),<br />
ob gesamtwirtschaftliche Finanzierungsbegrenzungen (z.B. durch IMF-Programme)<br />
bestehen und vor allem Fragen in Bezug auf Ausschreibungs- und Wettbewerbserfordernisse.<br />
Eine systematische und aktuelle Beratung und Information kann österreichischen<br />
Unternehmen oft viele und kostspielige „leere Kilometer“ ersparen. Ein bereits<br />
bestehendes Informationssystem wird von Seiten der Wirtschaftskammer Österreich<br />
(WKÖ) in Bezug auf Projektfinanzierungen durch IFIs angeboten (im Fall der EIB z.B.<br />
durch das Büro Brüssel).<br />
336
Ewald Nowotny<br />
In Ergänzung dazu kann es in manchen Fällen bei Projekten, die für österreichische<br />
Unternehmen von besonderem Interesse sein könnten, sinnvoll sein, diese Unternehmen<br />
bereits in einem früheren Zeitpunkt auf entsprechende Diskussionen hinzuweisen.<br />
Gerade unter dem wichtigen Aspekt der frühzeitigen Information kann dabei den<br />
Vertretern Österreichs in den Verwaltungsräten der jeweiligen IFIs eine wichtige Rolle<br />
zukommen. Selbstverständlich sind diese offiziellen Vertreter Österreichs, die für die<br />
meisten IFIs vom Finanzministerium nominiert werden, zur Beachtung der Statuten und<br />
der Verschwiegenheitspflichten der jeweiligen IFIs verhalten. In der Regel endet diese<br />
Verschwiegenheitspflicht aber ab Beschlussfassung im entsprechenden Gremium<br />
(Verwaltungsrat, Board of Directors) und darüber hinaus erscheint es sinnvoll, wenn<br />
Österreichs Vertreter nicht nur ihre „offiziellen“ Aufgaben wahrnehmen, sondern auch<br />
direkte Kontakte mit strategisch wichtigen Mitarbeitern der IFIs halten – was derzeit<br />
in unterschiedlichem Ausmaß geschieht.<br />
Dies, einschließlich der „Rückkoppelung“ in Österreich, ist freilich zeitaufwendig, was<br />
für ein kleines Land mit entsprechend geringerer Personalausstattung in den Ministerien<br />
ein erhebliches praktisches Problem sein kann. In manchen kleineren Staaten<br />
wird dieses Problem dadurch entschärft, dass zumindest Stellvertreter-Positionen mit<br />
Personen besetzt werden, die nicht notwendigerweise aus einem Ministerium kommen<br />
und die die Aufgabe haben, die Kontakte in den Fällen zu pflegen, die nicht politisch<br />
sensibel, aber vielleicht kommerziell interessant sind.<br />
Ein strategisch wichtiger Bereich, wo IFIs nicht „nur“ als Finanzier, sondern vielfach<br />
als direkter Auftraggeber auftreten ist der Bereich von technischen und wirtschaftlichen<br />
Konsulenten und Beratungstätigkeit. Selbstverständlich sind auch hier IFIs<br />
zu Ausschreibungen verpflichtet. Es ist aber verständlich, dass die entsprechenden<br />
Abteilungen in IFIs eine Präferenz für „etablierte“ Beratungsunternehmen haben, mit<br />
denen sie schon früher erfolgreich kooperiert haben. Für Österreich stellt sich hier<br />
das Problem, dass es in dem wichtigen Consulting-Bereich nach wie vor zu wenig<br />
international leistungsfähige Anbieter aufweist – und auch diese Anbieter vielfach noch<br />
als Außenseiter und „newcomer“ gesehen werden. In einer solchen Konstellation ist<br />
manchmal ein gewisses internes Lobbying von Seiten der Vertreter Österreichs nötig,<br />
um auch Chancen für qualifizierte Beratungsanbieter aus Österreich zu eröffnen. Dies<br />
ist nicht nur wichtig angesichts der strategischen Bedeutung von technischen und<br />
ökonomischen Machbarkeits-Studien im Projektzyklus. Wichtig ist auch der Umstand,<br />
dass Aufträge von IFIs auch wichtige <strong>internationale</strong> Referenzaufträge in anderen<br />
Bereichen darstellen.<br />
Neben verstärkter Information ist als zweiter wichtiger strategischer Ansatz eine systematische<br />
und intensivierte Kontaktnahme mit IFIs zu sehen. So ist es sinnvoll,<br />
wenn offizielle österreichische Stellen (Ministerien, WKÖ) kontinuierliche Kontakte<br />
337
mit den Österreicherinnen und Österreichern halten, die an verantwortlicher Stelle<br />
in IFIs arbeiten. Damit in Zusammenhang steht freilich auch die schwierige Aufgabe,<br />
auf eine entsprechende Präsenz von qualifizierten Österreichern im Personalstand<br />
der IFIs hinzuarbeiten. In Österreich wurden lange Zeit die Aufforderungen, die IFIs<br />
stellen, deutlich unterschätzt, insbesondere auch die Notwendigkeit, im Ausbildungs-<br />
und Berufsleben bereits <strong>internationale</strong> Erfahrungen aufzuweisen, um sich überhaupt<br />
für eine IFI zu qualifizieren. Inzwischen gibt es erfreulicherweise eine Vielzahl von<br />
Österreicherinnen und Österreichern, die entsprechende Qualifikationen aufweisen<br />
und es entspricht durchaus <strong>internationale</strong>n Gepflogenheiten, solchen Kandidaten in<br />
geeigneter Weise zu helfen. Legitimiert hierzu sind jeweils Österreichs Vertreter in den<br />
Verwaltungsräten der IFIs, nützliche Informationen können auch von österreichischen<br />
Mitarbeitern der jeweiligen IFI ausgehen.<br />
Für österreichische Exporteure „vor Ort“ kann es wichtig sein, direkte Kontakte mit<br />
den Länder-, bzw. Regions-Verantwortlichen der jeweiligen IFIs aufzubauen, was<br />
wieder durch österreichische Stellen unterstützt werden kann. Solche Kontakte sind<br />
von besonderer Bedeutung in „emerging markets“, sowohl in der Phase des Projektwettbewerbs,<br />
wie der Projektabwicklung. IFIs stellen in diesen Märkten oft den wichtigsten<br />
und effizienten Faktor dar, wenn es gilt, sich „problematischen“ Angeboten zu<br />
widersetzen. Ebenso aber gehören Korruptionsvorwürfe vielfach zur <strong>politische</strong>n und<br />
wirtschaftlichen Taktik in den betroffenen Staaten und es kann wichtig sein, hier eine<br />
IFI als objektiven Beurteiler heranziehen zu können. Aber auch von diesen leider nicht<br />
allzu seltenen Fällen abgesehen, ist es sinnvoll, „vor Ort“ ständig Kontakte und einen<br />
Erfahrungsaustausch zu pflegen, der auch von Seiten der IFIs in Bezug auf technische<br />
und wirtschaftliche Erfahrungen von Interesse ist.<br />
Für alle diese Bereiche gilt freilich, was für die Außen<strong>wirtschafts</strong>politik generell gilt:<br />
Exporterfolge beginnen zu Hause – durch technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.<br />
Die Kooperation mit IFIs kann aber dazu beitragen, leistungsfähigen österreichischen<br />
Unternehmen in schwierigen, aber langfristig wichtigen Märkten zusätzliche<br />
Chancen zu eröffnen.<br />
Anmerkungen<br />
* o. Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny ist Ordinarius am Institut für Volks<strong>wirtschafts</strong>theorie und -politik,<br />
Abteilung für Öffentliche Wirtschaft, Geld- und Finanzpolitik und Vizerektor für Finanzen an<br />
der Wirtschaftsuniversität Wien. Bis September 2003 war er Vizepräsident der Europäischen<br />
Investitionsbank in Luxemburg.<br />
1 Adresse: 100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, www.eib.org<br />
2 Alle Zahlenangaben zu EIB sowie zu anderen IFIs beruhen auf den jeweiligen Jahresberichten.<br />
338
3 Adresse: 43, AV.J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg; www.eif.org<br />
Ewald Nowotny<br />
4 Euro-Mediterranean Partnership; Africa-Caribbean-Pacific (Contonou-Vertrag); Asia, Latin<br />
America (ALA-Mandat), Balkan-Mandat<br />
5 1818, H Street, NW, Washington, DC, 20 433 USA; www.worldbank.org<br />
6 www.1.ifc.org/ar2003<br />
7 Adresse: Exchange Square, London EC2A 2JN, UK; www.ebrd.com<br />
8 Adresse: p.o. Box 789, 0980 Manila, Phillipines; Web Site: www.adb.org<br />
339
16 CLUSTER ALS EXPORTMOTOR<br />
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker*<br />
16.1 Oberösterreich – das führende Exportbundesland<br />
Österreichs<br />
Oberösterreich ist das führende Exportbundesland in Österreich. Die wichtigsten<br />
Exportländer neben Deutschland, Italien und der Schweiz sind die Beitrittsländer im<br />
Rahmen der EU-Erweiterung.<br />
F A C T B O X<br />
EXPORTVOLUMEN<br />
INSGESAMT, 2001:<br />
Österreich: 74,0 Mrd. Euro<br />
Oberösterreich: 18,5 Mrd. Euro<br />
Anteil: 25,0 %<br />
1) Anteil an Österreichs Exporten.<br />
Quelle: Sonderauswertung der Statistik Austria im Auftrag der WKÖ.<br />
340<br />
WICHTIGSTE EXPORTLÄNDER:<br />
Deutschland, Italien, Schweiz, USA,<br />
Ungarn, Frankreich, Großbritannien,<br />
Spanien, Tschechien und Niederlande<br />
Exporte der Bundesländer, produzierender Sektor 2001 Abb. 16.1<br />
Mrd. Euro<br />
15<br />
12<br />
9<br />
6<br />
3<br />
% 1)<br />
13,3<br />
OÖ<br />
9,0<br />
Stmk.<br />
8,9<br />
NÖ<br />
5,5<br />
W<br />
4,0<br />
T<br />
3,2 3,0 3,0<br />
0,8<br />
26,3 17,8 17,5 10,9 7,9 6,3 5,9 5,8 1,6<br />
V<br />
S<br />
K<br />
B
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Die oberösterreichischen Cluster-Initiativen, als wichtige Einrichtung im Technologienetzwerk<br />
OÖ, setzen seit geraumer Zeit Schwerpunkte im Internationalisierungs-<br />
Bereich und erbringen für ihre Partner-Unternehmen branchenspezifische Dienstleistungen.<br />
Derzeit arbeiten 1.500 Unternehmen in Branchen-Netzwerken (siehe Abb.<br />
16.2) wie folgt mit: Der Automobil-Cluster (AC) schließt die Fahrzeughersteller und<br />
automotiven Zulieferbetriebe sowie die relevanten Maschinen- und Anlagenbauer und<br />
Dienstleister zusammen. Der Cluster Drive Technology (CDT) bündelt die Hersteller,<br />
Zulieferer und spezifische Dienstleistungsunternehmen im Bereich des Motoren- und<br />
Antriebsstrangs, der Kunststoff-Cluster (KC) die Hersteller und Verarbeiter von Kunststoffen,<br />
Maschinen-, Formen- und Werkzeugbauer und Dienstleistungsunternehmen.<br />
Daneben gibt es den Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC), der die Hersteller von<br />
Möbeln und Holzbauten sowie deren Zulieferbetriebe und spezifischen Dienstleister<br />
vereinigt, den Ökoenergie-Cluster (OEC) mit Unternehmen im Bereich der erneuerbaren<br />
Energien und Energieeffizienztechnologien sowie den Lebensmittel-Cluster<br />
(LC). Der Gesundheits-Cluster (GC) mit Unternehmen aus dem Bereich Medizin-<br />
und Rehatechnik sowie der Mechatronik-Cluster (MC) mit Unternehmen aus dem<br />
Maschinen- und Anlagenbau, dem Geräte- und Apparatebau und den spezifischen<br />
Technologie-Lieferanten machen die Cluster-Familie komplett.<br />
Clusterland Oberösterreich, Zahlen & Daten Abb. 16.2<br />
Träger Start Partner<br />
Umsätze<br />
Mrd. Euro<br />
Mitarbeiter<br />
Automobil TMG 07/1998 304 16,20 81,332<br />
Drive Technology TMG 03/1999 80 9,40 26,862<br />
Kunststoff TMG 04/1999 300 7,46 38.013<br />
Möbel und Holzbau TMG 01/2000 196 2,44 18.200<br />
Ökoenergie ESV 01/2000 133 0,23 2.100<br />
Lebensmittel WK OÖ 09/2000 146 1,55 9.894<br />
Gesundheitstechnologie TMG 03/2002 202 4,33 29.304<br />
Mechatronik TMG 01/2003 139 3,90 17.850<br />
Summen (kum.) 1.500 45,51 223.555<br />
Quelle: TMG Archiv.<br />
Die OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbH (TMG) 1 koordiniert sechs dieser<br />
acht Cluster-Initiativen: AC, CDT, KC, MHC, GC und MC. Die entsprechenden Abteilungen<br />
sind im Bereich Cluster-Management organisiert. Der O.Ö. Energiesparverband<br />
(ESV) ist Träger des OEC, die Wirtschaftskammer OÖ (WK OÖ) betreut den LC.<br />
Wie sehr exportorientiert die Partner-Unternehmen der Cluster-Initiativen sind, zeigen<br />
die Exportquoten (in Prozent, Stand 8/2003):<br />
341
AC 58<br />
KC 56<br />
OEC über 50<br />
CDT 45<br />
MHC 38<br />
GC 7<br />
MC k.A.<br />
LC k.A.<br />
Im Folgenden werden die Schwerpunktaktivitäten der einzelnen Cluster-Initiativen im<br />
Bereich der Internationalisierung und Exportunterstützung anhand der nachstehenden<br />
Punkte dargestellt:<br />
1. Erhebung von branchenspezifischen Experten-Informationen<br />
2. Vermittlung von potenziellen <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
3. Direkte Kontaktherstellung mit ausländischen Geschäftspartnern<br />
4. Initiierung, Begleitung und Förderung von Kooperationsprojekten zur Markterschließung<br />
5. Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
16.2 Export-Aktivitäten des Automobil-Clusters<br />
Erhebung von branchenspezifischen Experten-Informationen<br />
Ein wichtiges Informationsmedium des Automobil-Clusters (AC) 2 ist die viermal im<br />
Jahr erscheinende Zeitung „AC-quarterly“. Darin wurden u.a. Fachbeiträge über die<br />
Automobilindustrie in Brasilien, in Kanada, im Iran, in der Slowakei und in Tschechien<br />
veröffentlicht und so den Partner-Unternehmen viele nützliche Informationen zur Verfügung<br />
gestellt. Weitere branchenrelevante Daten und Fakten werden im monatlichen<br />
E-Mail-Newsletter und auf der AC-Website (www.automobil-cluster.at) veröffentlicht.<br />
Auch der jährlich erscheinende Zulieferkatalog mit allen wichtigen Kontaktdaten der<br />
Partner-Unternehmen ist ein wichtiges Informationsmedium. Seit 2003 ist dieser in<br />
elektronischer Form über die Website abrufbar.<br />
Fachveranstaltungen<br />
Zusätzlich organisiert der AC Fachveranstaltungen, zu denen namhafte Experten<br />
aus dem In- und Ausland eingeladen werden. So wurden bei der Jahrestagung des<br />
ACs, im Rahmen von Clusterland 2003, die Möglichkeiten der oberösterreichischen<br />
Unternehmen am tschechischen Markt diskutiert. Diese Veranstaltung stand ganz im<br />
342
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Zeichen von Vertriebsunterstützung – Schaffung von Marktzugängen – Automotiven<br />
Erfahrungsberichten. Höhepunkt war dabei die Präsentation der Einkaufsstruktur bei<br />
Skoda Auto, Mlada Boleslav, von Frau DI Hana Cejnarova, der Leiterin Forward and<br />
Global Sourcing bei Skoda Auto.<br />
Teilnahme an Messen – Studienreisen<br />
Um den Kontakt seiner Partner-Unternehmen mit <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
zu ermöglichen, nimmt der AC auch an in- und ausländischen Messen teil. Im letzten<br />
Jahr waren dies die Zuliefermesse Z 2003 in Sachsen, die Internationale Automobil<br />
Ausstellung Pkw in Frankfurt am Main und das Internationale Automobil-Forum in Graz.<br />
Zu den Aktivitäten in diesem Bereich zählen aber auch Delegations- und Studienreisen,<br />
wie zum Beispiel eine Delegationsreise nach Sachsen im Rahmen der Z 2003 und die<br />
AC-Technologiepräsentation in Kanada im Jahr 2002. Bei dieser gemeinsam mit der<br />
kanadischen Botschaft in Wien organisierten Reise konnten zehn AC-Partner ausgewählten<br />
nordamerikanischen Unternehmen und Forschungsstellen ihre innovativen<br />
Produkte und Verfahren zu den drei Technologiethemen „Leichtmetall“, „Kunststoff“<br />
und „Autoelektronik“ präsentieren. Mit den erfolgreichen Technologiepräsentationen<br />
wurde der Grundstein für künftige Geschäftskontakte gelegt.<br />
Kosequente Fortsetzung der Anstrengungen zur <strong>internationale</strong>n Vernetzung<br />
Der AC bemüht sich vermehrt Kontakte zu Organisationen, aber auch Unternehmen in<br />
den osteuropäischen Ländern aufzubauen. Denn dieser Markt birgt für österreichische<br />
Unternehmen ein großes Potenzial, da viele Automobilkonzerne sich dort niederlassen,<br />
um an diesen Standorten ihre Fahrzeuge für den EU-Raum zu fertigen. Im Rahmen<br />
dieser Bemühungen fand am 8. Januar 2003 eine Präsentation des AC bei der Automotive<br />
Industry Association (AIA), dem tschechischen Herstellerverband, in Prag<br />
statt. Gemeinsam mit dem österreichischen Außenhandelsdelegierten in Prag wurde<br />
auf die Stärken der österreichischen Unternehmen des automotiven Sektors sowie<br />
auf die Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten hingewiesen.<br />
Einen Tag später stand der Erstkontakt zu japanischen Unternehmen im Vordergrund.<br />
Derzeit befinden sich etwa 140 japanische Unternehmen in der Tschechischen Republik,<br />
eine Vielzahl davon ist im automotiven Bereich tätig. Die Präsentationen bei den<br />
Handelshäuser-Giganten Sumitomo und Toyota Tsusho waren erfolgreich und konnten<br />
ein umfassendes Bild über das Leistungsspektrum der Cluster-Partner vermitteln. Mit<br />
diesen Erstkontakten ist ein wichtiger Schritt getan. Ziel ist es nun, die Beziehungen<br />
zu intensivieren und in der Folge gute Kontaktmöglichkeiten für Partner-Unternehmen<br />
zu schaffen.<br />
343
Zulieferbörse in Stuttgart<br />
Eine ideale Möglichkeit, um <strong>internationale</strong> Partner zu finden, bot sich auf der Kfz-Zulieferbörse<br />
der DaimlerChrysler AG im Juli 2003 in Stuttgart. Der AC fungierte dabei<br />
als Länderkoordinator für Österreich. Insgesamt nahmen elf heimische Unternehmen<br />
an dieser Zulieferbörse teil. Der Schwerpunkt lag bei den Ländern der nächsten EU-<br />
Erweiterung.<br />
Ausbau der direkten Kontakte<br />
Oberösterreich hat viele innovative Unternehmen im Zulieferbereich. Was diese brauchen<br />
sind direkte, effektive Kontakte. Der AC baut daher seine „Türöffnerfunktion“<br />
für seine Partner-Unternehmen bei <strong>internationale</strong>n Fahrzeugherstellern und Systemlieferanten<br />
Schritt für Schritt aus. Technologiepräsentationen und den Vertrieb<br />
unterstützende Maßnahmen stehen dabei im Mittelpunkt. So hatte etwa die MAN<br />
Steyr AG einen Lkw in seine kleinsten Einzelteile zerlegt. Diese wurden von innovativen<br />
Cluster-Unternehmen unter die Lupe genommen und sollen besser, schneller,<br />
billiger oder leichter werden. Die verbesserten Produkte werden in einer neuen Truck-<br />
Generation zum Einsatz kommen. Die Vorteile der Technologie-Präsentationen auf<br />
den Punkt gebracht: Die Hersteller erhalten innovative Ideen von ihren potenziellen<br />
Partnern für genau die Teile, die verbessert werden sollen. Eine Win-Win-Situation,<br />
die die gesamte Branche stärkt. Für 2004 wird vor allem versucht, Kontakte zu Tier<br />
1-Zulieferunternehmen 3 zu schließen.<br />
Kooperationsprojekte zur Markterschließung<br />
Der AC initiierte u. a. zwei Kooperationsprojekte zum Thema „Automotive English“,<br />
die im Nachfolgenden näher erläutert werden.<br />
Kooperationsprojekt „Present in English“<br />
Ein Sprachtraining für leitende Angestellte zum Thema „Integration innovativer Managementsysteme<br />
in der Automobilindustrie“ in englischer Sprache förderte einschlägiges<br />
Vokabular und bereitete die Teilnehmer auf die Abwicklung <strong>internationale</strong>r Geschäftsbeziehungen<br />
vor. Höhepunkt dabei: Eine Exkursion nach Detroit mit Kontaktgesprächen<br />
zu dort ansässigen Firmen.<br />
Kooperationsprojekt „Automotive English for Engineers“<br />
Profunde Fremdsprachenkenntnisse ebnen den Weg in <strong>internationale</strong> Märkte. Das<br />
AC-Projekt „Automotive English for Engineers“ konzentrierte sich auf automotive<br />
Anforderungen und kombinierte den Ausbau des Fachvokabulars mit grundlegendem<br />
Präsentationswissen.<br />
344
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Teilnahme an EU-Projekten mit Schwerpunkt F&E<br />
Weiters wird die aktive Teilnahme des AC an EU-Projekten, wo der F&E-Bereich im<br />
Mittelpunkt steht, in Zukunft stark forciert. Bereits jetzt nimmt der AC an derartigen EU-<br />
Projekten wie SCIFI (Science Communication and Involvement - Following Integrated<br />
Strategies) und CrossWork teil. Das EU-Projekt SCIFI etabliert Informations- und<br />
Kommunikationsstrukturen in den Regionen Oberösterreich, Stuttgart und Mailand.<br />
Im Mittelpunkt steht dabei die Bewusstseinsbildung für neue Energien, insbesondere<br />
die Brennstoffzellentechnologie. Unter anderem wurden Fachveranstaltungen sowie<br />
ein Schulwettbewerb zum Thema Brennstoffzelle organisiert.<br />
Im Zuge des 6. Rahmenprogramms der EU arbeiten der AC und die Produktionsforschungsgesellschaft<br />
Profactor in Steyr mit <strong>internationale</strong>n Partnern an einer elektronischen<br />
Arbeitsplattform im Rahmen des Projekts CrossWork.<br />
16.2.1 Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Der AC eröffnet seinen Partner-Unternehmen den Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken.<br />
Die Aktivitäten in den einzelnen Ländern im Detail:<br />
Slowenien<br />
Bei der Gründung des Automobil-Clusters in Slowenien 2001 wurde der AC als Vorbild<br />
angesehen. 2003 fand ein Treffen zwischen dem Automotive Cluster of Slovenia (ACS)<br />
und dem AC in Linz statt. Ziel war es, die möglichen Aktivitäten für die Zukunft zu<br />
diskutieren. Aufbauend auf diesen Kontakt hat der ACS bei der größten Veranstaltung<br />
des AC, der automotive.2003, und auch bei der Jahrestagung 2003 teilgenommen.<br />
Ungarn<br />
Seit 1999 gibt es enge Kontakte mit dem ungarischen Automobil-Cluster PANAC. Unter<br />
anderem fand ein ungarisch-österreichischer Zuliefertag mit über 80 Teilnehmern<br />
statt. Ziel dieser Aktivitäten ist es, Kontakte und Geschäftsbeziehungen zwischen den<br />
Unternehmen der beiden Länder herzustellen.<br />
Bayern<br />
Der AC arbeitet bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit der bayerischen Zulieferinitiative<br />
BAIKA zusammen und veranstaltete u.a. das Expertenforum Dieseltechnologie<br />
im November 2003.<br />
345
16.3 Export-Aktivitäten des Kunststoff-Clusters<br />
Bereitstellung von Experteninformation<br />
Der Kunststoff-Cluster (KC) 4 stellt seinen Partner-Unternehmen relevante, branchenspezifische<br />
Informationen zur Verfügung. Neben der Quartalszeitschrift KC-aktuell und<br />
dem monatlichen Newsletter (per E-Mail) zählt auch die Homepage des KC zu den<br />
umfangreichen Informationsangeboten. In dem jährlich erscheinenden zweisprachigen<br />
(d/e) Leistungskatalog des KC wird das gesamte Produkt- und Dienstleistungsspektrum<br />
der Partner-Unternehmen dargestellt. Der Katalog wird international vertrieben.<br />
Durch die großteils technologisch orientierten Fachveranstaltungen werden überdies<br />
wichtige Impulse und Qualifizierungsschübe ausgelöst.<br />
Vermittlung von Kontakten zu potenziellen <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
Kontakte des KC zu <strong>internationale</strong>n Kunststoff-Experten und <strong>internationale</strong>n Kunststoff-Forschungseinrichtungen<br />
ermöglichten den oberösterreichischen Betrieben einen<br />
Benchmark in den Bereichen Werkzeug- und Formenbau und Spritzgießen. Ein<br />
Benchmark zum Thema Extrusion ist in Vorbereitung. Dieser <strong>internationale</strong> Vergleich<br />
ermöglicht den Betrieben eine Standortbestimmung und zeigt Verbesserungspotenziale<br />
auf.<br />
Ausstellung bei K in Düsseldorf<br />
Der KC stellt auf der K 2004, der weltweit bedeutendsten Fachmesse für Kunststoff<br />
und Kautschuk, aus. Beim sehr erfolgreichen Auftritt auf der letzten K, im Jahr 2001,<br />
wurden zahlreiche Kontakte zu <strong>internationale</strong>n Unternehmen und Unternehmensnetzwerken<br />
geknüpft und bei Anfragen (sehr fachspezifisch) oberösterreichische<br />
Unternehmen vermittelt.<br />
Präsentation bei ausländischen Delegationsbesuchen<br />
Der KC wird und wurde bei Delegationsbesuchen aus dem Ausland präsentiert (z.B:<br />
Delegationen aus Brandenburg, Slowenien, Niedersachsen).<br />
Direkte Kontaktherstellung mit ausländischen Geschäftspartnern<br />
Der KC plante für Juni 2004 eine Studienreise nach Slowenien, deren Ziel es war,<br />
konkrete Geschäftskontakte zwischen oberösterreichischen und slowenischen Unternehmen<br />
herzustellen. Die ersten Gespräche mit slowenischen Partnern fanden zu<br />
Jahresbeginn statt.<br />
346
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Bei zahlreichen Anfragen aus dem Ausland an den KC (durch Pressearbeit und Inserate<br />
in <strong>internationale</strong>n Medien, Quartalszeitung KC-aktuell) werden direkt Kontakte zu den<br />
entsprechenden Partner-Unternehmen hergestellt.<br />
Kooperationsprojekt „Internationalisierung und Markterweiterung“<br />
Im November 2003 startete das einjährige Kooperationsprojekt „Internationalisierung<br />
und Markterweiterung“. Ziel des Kooperationsprojekts ist eine Steigerung des Exportumsatzes<br />
der beteiligten Unternehmen durch eine systematische und methodische<br />
Vorgehensweise unter Nutzung von gemeinsamen Erfahrungsmeetings.<br />
Die Projektteilnehmer sind: Kunststoffwerk Zitta GmbH, Ludwig Praher Kunststofftechnik<br />
GmbH, Haratech Haiberger & Rapperstorfer OEG.<br />
Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Der KC ebnet seinen Partner-Unternehmen den Weg zu <strong>internationale</strong>n Branchen-<br />
Netzwerken. Besonders enge Kontakte bestehen zu Kunststoff-Netzwerken in Niedersachsen,<br />
Baden Württemberg und Slowenien. Mit ersterem ist auch ein gemeinsames<br />
EU-Projekt in Planung.<br />
16.4 Export-Aktivitäten des Möbel- und Holzbau-<br />
Clusters<br />
Bereitstellung von Branchenwissen<br />
Über den Möbel- und Holzbau-Cluster (MHC) 5 stehen seinen Partnern Ergebnisse<br />
von Studien und Marktanalysen zur Verfügung. Dieses Branchenwissen wird über die<br />
Homepage, im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops und Stammtischen sowie<br />
im MHC-Monatsmail und in Form von persönlichen Gesprächen bei Firmenbesuchen,<br />
verbreitet.<br />
Workshops<br />
Der MHC veranstaltete Anfang Juni 2003 zwei Exportworkshops. Im Vorfeld wurden<br />
dazu Unternehmen mittels Fragebogen zu exportrelevanten Daten und Interessen<br />
beziehungsweise Absichten befragt. Die Workshops fanden am 4. Juli 2003 und 19.<br />
August 2003 gemeinsam mit dem Fachverband der Holzindustrie statt. Insgesamt<br />
waren 17 Firmen aus ganz Österreich mit 23 Teilnehmern vertreten.<br />
347
Exportstammtische<br />
Am 9. Oktober 2003 fand ein Exportstammtisch zum Thema Slowenien, aufbauend<br />
auf einer Studie der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) „Exportchancen für Möbelindustrie<br />
und -handel in den EU-Beitrittsländern Slowenien, Ungarn, Slowakei<br />
und Tschechien“ statt. Daraus entwickelte sich ein gemeinsamer Messebesuch in<br />
Laibach bei der <strong>internationale</strong>n Möbelmesse. Das Ziel: Neue Verbindungen und Exportmöglichkeiten<br />
aufzubauen. Dabei wurden Gespräche mit den Geschäftsführern<br />
der Handelshäuser vor Ort geführt.<br />
Ebenfalls auf diese OeKB-Studie aufbauend wurde am 25. November 2003 ein Exportstammtisch<br />
zum Thema Tschechien abgehalten. Ziele waren die Auslotung und<br />
Koordinierung von Kooperationsmöglichkeiten bezüglich Möbelmessen in Tschechien<br />
im Frühjahr 2004 und der Kontakt- und Erfahrungsaustausch bezüglich in Prag ansässiger<br />
Möbelstudios.<br />
Weitere Stammtische im Frühjahr 2004 dienten den exportinteressierten österreichischen<br />
Möbelbetrieben als Branchentreff, boten die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch<br />
und fungierten als Kooperations- und Synergiebörsen. Die Kooperationsbereitschaft<br />
der Teilnehmer war, genauso wie der Wunsch nach Kooperationsbörsen und<br />
Insiderwissen aus der Branche, sehr groß. Eine Gruppenbildung für weiterführende<br />
Kooperationsprojekte ist möglich und wird durch den MHC unterstützt. Tagesthemen<br />
und Termine für die weiteren Exportstammtische werden in der Gruppe ausdiskutiert<br />
und festgelegt. Für die Organisation und Koordination ist das MHC-Team verantwortlich.<br />
Ressourcenbörse<br />
Zusätzlich soll 2004 eine Ressourcenbörse eingerichtet werden. Dabei wird bestehende<br />
Infrastruktur von Partnern im Ausland für Partner vermittelt. Beispiele dafür sind<br />
Schauräume, Vertriebspersonal, Logistik oder Montageteams, die in einer Firma im<br />
Ausland bereits existieren und gemeinsam mit einem weiteren Unternehmen genutzt<br />
werden könnten.<br />
Interessenbörse<br />
Auch eine Interessenbörse, eine Sammlung von konkreten Unternehmensinteressen<br />
im Internationalisierungsbereich, soll installiert werden. Der MHC versucht, Betriebe<br />
die ins Ausland expandieren wollen, mit anderen in Kontakt zu bringen, damit diese<br />
gemeinsam den Markt bearbeiten können. Dabei geht es vor allem um den Aufbau von<br />
Adressen aus dem Objektbereich und darum, den Kontakt zu potenziellen Partnern im<br />
Ausland aufzubauen. Hier wird verstärkt mit der Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation (AWO)<br />
der WKÖ zusammengearbeitet.<br />
348
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Andere exportfördernde Aktivitäten sind Studienreisen beziehungsweise Messeteilnahmen:<br />
Der MHC führte z.B. eine in das „Sesseldreieck“ Manzano durch. Für 2004<br />
sind weitere Studienreisen geplant.<br />
Kooperationsprojekt „Strapamo“<br />
Das laufende Kooperationsprojekt „Strapamo‘‘ ist die Vertiefung einer österreichisch-<br />
ungarischen Partnerschaft zur Errichtung eines Netzwerkes für Forschung, Entwicklung,<br />
Technologieaustausch und Qualitätsförderung im Bauwesen.<br />
Ziel des Projekts ist, ein Firmennetz für die Koordinierung des Qualitätsüberwachungssystems<br />
im Bereich des Hoch-, Tief- und Verkehrsbaus in Ungarn und Österreich<br />
aufzubauen. Dieses Firmennetz soll nicht die Rolle der in beiden Ländern bereits<br />
vorhandenen Institute mit ähnlichen Zielen übernehmen, sondern im Interesse der<br />
kleineren und mittleren Unternehmen bei der Aufklärung und Informationsverteilung<br />
als Katalysator und Beschleuniger ergänzend wirken.<br />
Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Der MHC tauscht sich mit den Holz-Clustern in Ungarn und Südtirol aus. Für die<br />
Partner-Unternehmen ergeben sich daraus Synergieeffekte und direkte Geschäftskontakte.<br />
Darüber hinaus ist der MHC im interregionalen Projekt „Value Added Wood“ involviert.<br />
Dabei arbeiten Cluster aus Finnland, Lettland, Schweden und Österreich zusammen.<br />
Der Kern des Projektes ist die Entwicklung von Problemlösungen für die Holzindustrie<br />
auf Clusterebene. In weiterer Folge werden Tools geschärft, die für die Clusterbildung<br />
in den einzelnen Regionen nötig sind. Somit können bessere Dienstleistungen für<br />
KMUs angeboten werden.<br />
16.5 Export-Aktivitäten des Lebensmittel-Clusters<br />
Erhebung von branchenspezifischen Experteninformationen<br />
In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Außenhandelsstellen sowie den jeweiligen<br />
Länderexperten liegen dem Lebensmittel-Cluster (LC) OÖ 6 Übersichten über die Nahrungsmittel-<br />
und Getränkemärkte in Ländern wie beispielsweise Italien, Deutschland,<br />
Belgien, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, Tschechien, Slowenien, Ungarn,<br />
Polen, Kroatien, Serbien aber auch Kanada, Iran und Japan vor.<br />
Die Analyse von Trends erfolgt auch regelmäßig durch den Besuch von <strong>internationale</strong>n<br />
Lebensmittelmessen, wie z.B. der ANUGA in Köln (weltgrößte Lebensmittelmesse) bzw.<br />
der Biofach in Nürnberg (größte europäische Gesamtschau für Bio-Lebensmittel).<br />
349
Im Rahmen der „Grenzüberschreitenden Technologieplattform Oberösterreich-Niederbayern-Südböhmen“<br />
wurden unterschiedliche Aktivitäten, wie z.B. Veranstaltungen,<br />
Expertenrunden etc., geplant, um die drei Landesteile als Life-Science-Region<br />
(Schwerpunkte: Biotechnologie, Functional Food, Bionik, molekulargenetische Analysen,<br />
etc.) zu positionieren.<br />
In diesem Zusammenhang wurde am 26. Juni 2003 gemeinsam mit der WK OÖ, der<br />
Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau und der Südböhmischen<br />
Wirtschaftskammer eine Veranstaltung zum Thema „Functional Food“ abgehalten, bei<br />
der sich Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und Tschechien über dieses aktuelle<br />
Thema informierten und grenzüberschreitende Kontakte knüpften.<br />
Ebenso wurde in den Medien des LC OÖ der für das Jahr 2004 festgelegte Internationalisierungsschwerpunkt<br />
aufgegriffen, indem speziell im Dezember 2003 im<br />
Quartalsmedium LC-Updates über Chancen der EU-Erweiterung und der daraus<br />
resultierenden neuen Absatzmärkte berichtet wurde.<br />
Vermittlung von Kontakten zu potenziellen <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
Der LC OÖ unterstützte die Veranstaltung „Fit in die Zukunft“, die im Rahmen der<br />
ARGE 28 durchgeführt wurde. Die am Workshop bzw. der Exkursion nach Tschechien<br />
teilnehmenden Personen informierten sich dabei über den tschechischen Markt und<br />
mögliche grenzüberschreitende Kooperationen.<br />
Im Oktober 2004 findet weiters eine Veranstaltung im Rahmen einer <strong>internationale</strong>n<br />
Kooperationsbörse zur Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft statt.<br />
Vermehrt sollen in Zusammenarbeit mit der Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation der WKÖ<br />
auch Lebensmittelpräsentationen organisiert werden, um heimische Lebensmittel und<br />
deren Qualität bei <strong>internationale</strong>n Handelsketten zu positionieren.<br />
Direkte Kontaktherstellung mit ausländischen Geschäftspartnern<br />
Im September 2002 fand eine „Informations- und Präsentationsreise zum Thema<br />
Lebensmittel-Technologien“ nach Kanada statt. Das Programm bestand aus einem<br />
Mix von Firmen- und Institutsbesuchen, Präsentationen der österreichischen Firmen<br />
und individuellen Geschäftskontakten. Hier konnten Einblicke in die kanadische Lebensmittelwirtschaft<br />
gewonnen und viele Kontakte geknüpft werden. Bereits in Kanada<br />
wurden sehr konkrete Gespräche über mögliche Kooperationen geführt.<br />
Der LC OÖ wurde von der Außenhandelsstelle Shanghai informiert, dass eine der<br />
größten Supermarktketten in Shanghai, „Hua Lian“, österreichische Lebensmittel in<br />
ihr Produktsortiment aufnehmen möchte. Am 25. August 2003 fanden daher in der WK<br />
OÖ Listungsgespräche mit dem General Management der Supermarktkette statt. An<br />
den Produkten von Cluster-Firmen wurde bereits großes Interesse gezeigt.<br />
350
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Zwei LC-Partner nutzten von 3. bis 5. Oktober 2003 die Gelegenheit, ihre Produkte<br />
auf dem „Asso di Gusto“ – einem italienischen Lebensmittelfestival – zu präsentieren<br />
und Vertriebspartner zu finden.<br />
Kooperationsprojekte zur Markterschließung<br />
Im Rahmen eines LC-Kooperationsprojektes mit dem Titel „Exportkooperation oberösterreichischer<br />
Brauereien“ wurden die Premiummarken von vier Brauereien „exportfit“<br />
gemacht. Das betrifft zuallererst die Haltbarkeit. Die dementsprechend angepassten<br />
Bierflaschen werden unter dem Namen „birre del austria“ vermarktet. Die viersprachig<br />
bedruckten Exportkartons zu je 24 Flaschen (sechs pro Brauerei) werden in Norditalien<br />
via Handelsagent vertrieben.<br />
Dem Trend zur Internationalisierung folgend, haben es sich drei LC-Partner zum<br />
Ziel gesetzt, durch ein Kooperationsprojekt mit regionsspezifischen Getreideprodukten<br />
einen Schritt in neue Exportländer zu wagen. Die ersten Schritte sind eine<br />
Sortimentabstimmung zwischen den beteiligten Partnern und eine umfangreiche<br />
Marktforschung. Die nächsten Schritte sind die Optimierung bestehender Produkte<br />
und die Weiterentwicklung neuer Produkte, insbesondere im Convenience-, Snack-<br />
und Tiefkühlbereich.<br />
Auf Wunsch der Teilnehmer der Veranstaltung „Grenzüberschreitende Technologieplattform<br />
Oberösterreich-Niederbayern-Südböhmen“ wurde am 11. September 2003<br />
ein erstes Arbeitsgruppentreffen zum Thema „Produktentwicklung Functional Food“<br />
abgehalten, dessen Ziel es war, konkrete Projektideen zu erarbeiten und Firmen über<br />
Landesgrenzen hinweg zu vernetzen.<br />
Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Hier besteht vor allem eine Zusammenarbeit mit Initiativen der EU, wie Flair Flow<br />
Europe, aber auch Kontakte mit anderen <strong>internationale</strong>n Lebensmittelnetzwerken<br />
sollen zunehmend forciert werden.<br />
16.6 Export-Aktivitäten des Gesundheits-Clusters<br />
Bereitstellung von branchenspezifischen Experteninformationen<br />
Der Gesundheits-Cluster (GC) 7 informiert seine Partner-Unternehmen regelmäßig über<br />
<strong>internationale</strong> Trends und Entwicklungen im Gesundheitsmarkt. Die Informationen werden<br />
über die GC-Medien verbreitet: das monatliche Infomail (wird an 1.700 Adressen<br />
versendet), die Homepage (Rubrik News) sowie über die GC-Quartalszeitschrift.<br />
351
Weiters werden bei den GC-Fachveranstaltungen anerkannte Experten aus dem<br />
Ausland als Referenten eingeladen. Bei der GC-Jahrestagung 2003 referierte z.B.<br />
Corinna Mühlhausen, Mitarbeiterin des Zukunftsforschers Matthias Horx, über die<br />
<strong>internationale</strong>n Trends im Gesundheitsmarkt. Immer wieder werden Internationalisierungsaktivitäten<br />
als Themen bei den Fachveranstaltungen des GC aufgegriffen: Z.B.<br />
„Amerika, Asien, Europa: Medizinprodukte international vertreiben – So geht´s!“ im<br />
Dezember 2003, „EU-Erweiterung“ im März 2004.<br />
Vermittlung von Kontakten zu potenziellen <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
Der GC legt jedes Jahr ein zweisprachiges Leistungsverzeichnis der GC-Partner-<br />
Unternehmen auf (Deutsch/Englisch). Der Katalog mit einer Auflage von 5.000 Stück<br />
wird international vertrieben und liegt insbesondere bei den österreichischen Außenhandelsstellen<br />
auf.<br />
Weiters nutzt der GC intensiv die IRC-Datenbank (Innovation Relay Centre Austria).<br />
Unter http://www.irca.at findet man <strong>internationale</strong> Kooperationsangebote, die der GC<br />
an seine Partner weitervermittelt.<br />
Spezielle Kooperationsangebote aus dem Gesundheitsbereich werden in Zusammenarbeit<br />
mit CATT Innovation Management GmbH. ausgewählt und regelmäßig im<br />
Monatsmail und auf der Homepage (Forum) veröffentlicht – es wurden bereits einige<br />
Kontakte vermittelt.<br />
Der Nutzen für die Unternehmen liegt auf der Hand:<br />
• Suche und Verwertung von innovativen Technologien und Forschungsergebnissen<br />
in Europa<br />
• Suche neuer Absatzmärkte und Anwendungsmöglichkeiten für innovative Technologien<br />
oder F&E-Ergebnisse<br />
Direkte Kontaktherstellung mit ausländischen Geschäftspartnern<br />
Um einen direkten Kontakt mit ausländischen Geschäftspartnern zu ermöglichen,<br />
organisiert der GC für seine Partner Studienreisen (Firmenbesuche) und One-toone-Gespräche:<br />
• Im März 2003 führte eine Studienreise nach Baden-Württemberg. Die Unternehmen<br />
konnten dort an der Innovationsbörse „Gesundheitstechnologien“ teilnehmen:<br />
Durch Unternehmenspräsentationen und Gespräche wurden neue Kontakte zu<br />
europäischen Firmen geknüpft.<br />
• Für die GC-Partner, die im Pharmabereich tätig sind, wurden im September 2003<br />
One-on-one-Gespräche beim Forum MedTech in München organisiert.<br />
• Im Februar 2004 fanden im Forum der Generationen in Bad Tölz Kooperationsgespräche<br />
statt, die vom GC organisiert wurden. Zielgruppen sind hier Unternehmen,<br />
352
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
die Produkte und Dienstleistungen für ältere Menschen sowie für Personen mit<br />
Handicap anbieten.<br />
Kooperationsprojekte zur Markterschließung<br />
Durch den erfolgreichen Abschluss des ersten Kooperationsprojekts des GC (Entwicklung<br />
eines Blutanalysegerätes zur Serienreife) konnten anschließend <strong>internationale</strong><br />
Märkte erschlossen werden. Mittels intensiver Medienarbeit stieg der Bekanntheitsgrad<br />
des Gerätes – mittlerweile wird der Eurolyser international vertrieben (USA, Spanien,<br />
Irland, China usw.).<br />
Der GC bereitet weiters mit befreundeten Regionen die Teilnahme an zwei Interreg-IIIc-Projekten<br />
vor. Dabei handelt es sich um geförderte EU-Projekte, an denen sich mehrere<br />
EU-Länder beteiligen. Hierbei arbeitet der GC mit Institutionen bzw. Netzwerken<br />
aus Deutschland (Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen<br />
Kreis), Polen (Pro Europa Ratibor) und Italien (Ervet) zusammen. Ziel der Projekte<br />
ist die Vernetzung der Regionen und damit der Unternehmen und die Erschließung<br />
neuer Märkte für die GC-Partner.<br />
Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Der GC hat bereits intensive Kontakte zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken aufgebaut:<br />
• Stadt Leipzig: Der GC wird Leipzig beim Aufbau eines Clusters im Gesundheitsbereich<br />
unterstützen.<br />
• Bayern innovativ: Es werden laufend gemeinsame Veranstaltungen mit dem GC<br />
organisiert.<br />
• Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS):<br />
Ein Gemeinschaftsstand bei der MEDTEC in Stuttgart wird vorbereitet.<br />
• Neue Kontakte zu anderen europäischen Institutionen wurden über die One-onone-Gespräche<br />
bei der Medica angebahnt (Finnland, Schweiz, Spanien usw.)<br />
sowie über das Kooperationsforum Biotech for Pharma.<br />
16.7 Export-Aktivitäten des Mechatronik-Clusters<br />
Branchenspezifische Experteninformation<br />
Der Mechatronik-Cluster (MC) 8 wird 2004 vermehrt den Kontakt zu Netzwerken in<br />
Nachbarregionen (vor allem Bayern, Tschechien und Slowenien) pflegen und will<br />
damit den oberösterreichischen Unternehmen als Brücke in andere Regionen dienen.<br />
353
Dieser Kontakt und diese Unterstützung der Unternehmen sollen unter Einsatz aller<br />
Medien erfolgen.<br />
Besonders der Leistungskatalog mit einer Auflage von 3.000 Stück und der monatliche<br />
Newsletter werden an alle Partner sowie an interessierte Unternehmen in Oberösterreich,<br />
Österreich und den angrenzenden Nachbarländern verschickt. Auch die<br />
Homepage informiert über Aktuelles aus dem MC.<br />
Im Zuge einer Fachveranstaltung im Herbst 2003 konnten interessierte Unternehmen<br />
Einblick in die Möglichkeiten von Beteiligungen an EU-Projekten gewinnen. Der MC<br />
konnte in Kooperation mit CATT Innovation Management GmbH nationale und <strong>internationale</strong><br />
Vortragende gewinnen, die den Teilnehmern wichtige Informationen und Tipps<br />
gaben, um den ersten Schritt in <strong>internationale</strong> Projekte zu erleichtern.<br />
Vermittlung von potenziellen <strong>internationale</strong>n Geschäftspartnern<br />
Auf zahlreichen Veranstaltungen wurden 2003 Kontakte zu ausländischen Unternehmen<br />
angebahnt und gepflegt. Der Mechatronik-Kongress in Düsseldorf im März bot<br />
die Möglichkeit zur Kontaktherstellung zu einer Vielzahl von Mechatronik-orientierten<br />
Unternehmen aus Deutschland. Auf der MSV in Brünn/Tschechien im September und<br />
der EMO in Mailand/Italien im Oktober wurden neue Kontakte geknüpft.<br />
In den angrenzenden Regionen sind gemeinsame Messebesuche mit den MC-Partnern<br />
geplant. Darüber hinaus sind auch Messeauftritte auf Fachmessen vorgesehen.<br />
Auch Studienreisen zu Best-Practise-Mechatronikbetrieben und F&E-Einrichtungen<br />
sind in Vorbereitung. Das rege Interesse von ausländischen Unternehmen zeigt sich<br />
auch darin, dass im MC nach einem Jahr Laufzeit bereits sieben Partner aus dem<br />
angrenzenden Ausland mitwirken.<br />
Direkte Kontaktherstellung mit ausländischen Geschäftspartnern<br />
Im vergangenen Jahr gab es bereits zahlreiche Anfragen von ausländischen Unternehmen<br />
zum Thema Partnerschaft im MC, zur Akquisition von Technologiepartnern oder<br />
zur Knüpfung von Kontakten mit anderen Unternehmen, die entweder direkt an den<br />
MC gestellt wurden oder über die Außenhandelsstellen erfolgten. Dieser Kontakt zu<br />
interessierten Unternehmen aus den Nachbarregionen soll 2004 noch verstärkt werden.<br />
Darüber hinaus beteiligte sich der MC an der grenzüberschreitenden Technologieplattform<br />
Oberösterreich-Niederbayern-Südböhmen, die von den Wirtschaftskammern<br />
der drei Regionen initiiert wird. Im März präsentierte der MC sein Netzwerk auf der<br />
Kontaktbörse in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und trat auch als Teilnehmer an<br />
der Kontaktbörse auf. Im Zuge der grenzüberschreitenden Technologieplattform fand<br />
im Herbst 2003 die Besichtung des Unternehmens Parat Automotive Schönenbach<br />
GmbH in Neureichenau/Deutschland statt.<br />
354
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Kooperationsprojekte zur Markterschließung<br />
Bis dato wurden keine EU-Projekte mit Partnern in Nachbarregionen initiiert, für 2004<br />
sind jedoch gemeinsame Maßnahmen geplant.<br />
Zugang zu <strong>internationale</strong>n Branchen-Netzwerken<br />
Im November 2003 gab es bereits Gespräche des Cluster Managers, Mag. Weinberger,<br />
mit dem Bayerischen Kompetenznetzwerk für Mechatronik und im Dezember<br />
2003 konnte der MC Vertreter von Netzwerken aus der Region Moravian-Silesian,<br />
Tschechien sowie aus der Region Gorenjska, Slowenien begrüßen.<br />
Im März 2004 fand eine Studienreise nach Baden-Württemberg statt, bei der der<br />
MC seinen Partnern beispielgebende Mechatronik-Betriebe und F&E-Einrichtungen<br />
präsentierte.<br />
Der Kontakt zu ausländischen F&E-Einrichtungen soll 2004 verstärkt werden.<br />
16.8 Export-Aktivitäten des Ökoenergie-Clusters<br />
Der Ökoenergie-Cluster (OEC) 9 ist ein Netzwerk von Unternehmen und Institutionen,<br />
die im Bereich Ökoenergie tätig sind – das sind unter anderem Technologien zur<br />
Nutzung von Sonnenenergie, Biomasse (Holz), Wind und Wasserkraft – und wird<br />
vom O.Ö. Energiesparverband (ESV) gemanagt. Derzeit hat der OEC 134 Partner.<br />
Die Exportquote der Partner-Unternehmen beträgt über 50 %. Einen entsprechend<br />
hohen Stellenwert haben Internationalisierungsaktivitäten seit dem Start des OEC im<br />
Jahr 2000.<br />
Dementsprechend sind sämtliche wichtige Informationsmedien, wie die Homepage<br />
oder der Cluster-Katalog (in dem die Produkte und Dienstleistungen der OEC-Partner<br />
detailliert beschrieben sind) in Englisch und Deutsch verfasst.<br />
Die Trägerorganisation des OEC, der ESV, arbeitet in einer Reihe von EU-Projekten<br />
mit, und der Know-How-Transfer im Rahmen dieser Projekte kommt den oberösterreichischen<br />
Unternehmen zugute. So koordiniert der ESV das europäische Ökostrom-<br />
Technologie-Netzwerk mit 18 Partnern aus elf europäischen Ländern sowie Indien und<br />
China. Dieses Netzwerk dient der Unterstützung erneuerbarer Energietechnologien<br />
zur Stromerzeugung. OEC-Partner haben damit direkten Zugang zu Marktpartnern<br />
in all diesen Ländern.<br />
Einmal pro Jahr organisiert der OEC eine Exporttour, die Länder mit potenziell interessanten<br />
Exportmärkten zum Ziel hat, 2003 war dies Frankreich. Ebenso der Unterstützung<br />
konkreter Exportaktivitäten dienen OEC-Gemeinschaftsstände, 2003 war<br />
dies die „Solar-Expo“ in Verona, bei der v.a. Kontakte zu künftigen Vertriebspartnern<br />
geknüpft wurden.<br />
355
Intensiv ist auch die Zusammenarbeit mit Südböhmen im Nachbarland Tschechien,<br />
neben der gegenseitigen Teilnahme an Veranstaltungen wurden 2003 sogar vier<br />
tschechische Unternehmen Partner des OEC.<br />
Der OEC unterstützt seine Partner auch bei der konkreten Suche nach Handelspartnern,<br />
Investoren oder auch Fachexperten im Ausland. Ebenso organisiert er Besuchsreisen<br />
ausländischer Delegationen, die die Ökoenergieunternehmen in Oberösterreich<br />
kennen lernen wollen. 2003 waren unter anderem Wirtschaftsdelegationen aus Japan,<br />
Deutschland, Südtirol, Großbritannien und Finnland zu Gast in Oberösterreich.<br />
All diese Aktivitäten zielen darauf, die Markt- und Technologieführerschaft der OEC-<br />
Partner abzusichern, sowie die Position Oberösterreichs als führende Ökoenergietechnologie-Region<br />
in Europa auszubauen.<br />
16.9 Die Zeit ist reif für Europäische Unternehmens-<br />
Netzwerke<br />
Die Cluster-Initiativen sind zurzeit regional ausgerichtet. Jetzt gilt es, die Zeichen der<br />
Zeit zu erkennen und Europäische Unternehmens-Netzwerke zu forcieren.<br />
Die Cluster-Philosophie – ursprünglich regional ausgerichtet – wird zunehmend <strong>internationale</strong>r.<br />
Die Europäische Kommission, die UNIDO und die OECD setzen in einem<br />
immer höheren Ausmaß auf Vernetzung und sehen in dieser zukunftsorientierten<br />
Wirtschaftspolitik große Potenziale. Jetzt gilt es, die Zeichen der Zeit zu erkennen<br />
und konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu setzen.<br />
Wachstum durch Innovation<br />
Die Cluster-Politik ist ein relativ junges Gebiet der Wirtschaftspolitik. Durch dynamische<br />
Unternehmensnetzwerke werden dabei Wachstum und Innovation erzielt. Die<br />
Cluster-Philosophie ist mittlerweile in den meisten europäischen Staaten ein wichtiges<br />
Thema. An die 200 organisierte Cluster-Initiativen haben bewiesen, dass durch<br />
gezielte Zusammenarbeit wichtige Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Doch<br />
das Potenzial ist noch viel größer: Experten gehen von bis zu 500 möglichen Cluster-<br />
Initiativen aus. Diese Netzwerke könnten sich an der in Oberösterreich erprobten und<br />
bewährten Cluster-Methodik orientieren, denn dieses Bundesland hat sich zu einer<br />
wahren Modellregion entwickelt. Die Erfahrungen haben aber auch gezeigt, dass die<br />
Vernetzung weiter voranschreiten muss. „Go international“ ist dabei das Gebot der<br />
Stunde. Angesichts immer stärker international ausgerichteter Märkte, der steigenden<br />
Bedeutung der Exporttätigkeit und einer durch die Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
ausgelösten allgemeinen Zunahme der Geschwindigkeit im Wirtschaftsleben<br />
erhält der Netzwerkgedanke eine zusätzliche Dimension.<br />
356
Harald Hochgatterer, Gerlinde Pöchhacker<br />
Europa ist gefragt<br />
Einzelne Unternehmen werden langfristig nur dann überleben können, wenn sie sich<br />
mit anderen zusammenschließen und so eine Größe erreichen, die sie am <strong>internationale</strong>n<br />
Markt bestehen lässt. Das ist auch angesichts der verschwindenden nationalen<br />
Grenzen von zunehmender Bedeutung. Die nationalen Identitäten und Gepflogenheiten<br />
werden zunehmend mit einer europäischen Identität ergänzt. Diese Entwicklung gilt es<br />
jetzt vehement zu unterstützen, weiter zu entwickeln und vor allem auch geeignete Unterstützungsmaßnahmen<br />
für die Unternehmen anzubieten. Gefragt ist dabei natürlich<br />
die Europäische Union. Durch ein Europäisches Cluster-Netzwerk als eine Innovations-<br />
und Kooperationsplattform könnte etwa die Basis für einen branchenspezifischen<br />
und methodischen Know-how-Austausch geschaffen werden. Durch die Kooperation<br />
von Branchen-Netzwerken könnte die kleinstrukturierte europäische Wirtschaft mehr<br />
Schlagkraft im Wettbewerb mit Amerika und Asien erhalten.<br />
Europäisches Cluster-Netzwerk forcieren<br />
Die Richtung dabei ist klar: Durch die projekthafte Zusammenarbeit und die Bündelung<br />
von europäischen Netzwerken können globale Projekte angegangen werden,<br />
die ein Cluster allein nicht bewältigen könnte. Dadurch werden für die Partner neue<br />
Marktzugänge erschlossen, der Zugang zu Forschungswissen verbreitert und eine<br />
Stärkung der europäischen Identität erreicht. Realisieren ließe sich ein Europäisches<br />
Branchen-Netzwerk relativ rasch und ohne nennenswerten finanziellen Aufwand.<br />
Die Zeichen der Zeit stehen ganz eindeutig auf Fortschritt durch Vernetzung. Jetzt gilt<br />
es darauf entsprechend zu reagieren.<br />
Anmerkungen<br />
* Mag. Harald Hochgatterer ist zuständig für Unternehmenskommunikation bei der OÖ. Technologie-<br />
und Marketinggesellschaft mbH in Linz. Mag. Gerlinde Pöchhacker ist Prokuristin<br />
und Leiterin Cluster-Management bei der OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbH.<br />
in Linz.<br />
1 Alle Informationen zum Clusterland OÖ:<br />
Prok. Mag. Gerlinde Pöchhacker<br />
OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbH<br />
Telefon: 070-79810-5063<br />
E-Mail: clusterland@tmg.at<br />
Homepage: www.clusterland.at, www.tmg.at<br />
2 Informationen: www.automobil-cluster.at<br />
3 Tier 1-Zulieferunternehmen sind Zulieferunternehmen der obersten Ebene (=Systemlieferanten).<br />
357
4 Informationen: www.kunststoff-cluster.at<br />
5 Informationen: www.m-h-c.at<br />
6 Informationen: www.lebensmittel-cluster.at<br />
7 Informationen: www.gesundheits-cluster.at<br />
8 Informationen: www.mechatronik-cluster.at<br />
9 Informationen: www.oec.at<br />
358
17 BEDEUTUNG DER ANALYSE INTERNATI-<br />
ONALER WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN<br />
Michael Landesmann, Julia Wörz*<br />
Die Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen wandelte sich historisch gesehen<br />
sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht: In theoretischer Hinsicht<br />
wurde das Fachgebiet der Wachstums- und Entwicklungstheorie zunehmend in die<br />
Handelstheorie und in jüngerer Zeit auch in die Analyse von Firmenstrategien und<br />
Marktstrukturen integriert. Empirisch betrachtet bildete sich eine systematische Form<br />
der Analyse erst in der Zwischenkriegszeit heraus und erfuhr mit der umfassenderen<br />
und systematischen Erstellung von Statistiken (u.a. auch durch <strong>internationale</strong> Organisationen)<br />
und der starken qualitativen Verbesserung der Methodik der quantitativen<br />
Analyse einen Aufschwung, der sich auch in der Gründung von wirtschaftlichen Forschungsinstitutionen<br />
niederschlug. Für den vorliegenden Beitrag wurden quantitative<br />
Input-Maßzahlen zur Beurteilung der österreichischen Expertise im Bereich der empirischen<br />
Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen im Vergleich zu anderen,<br />
kleinen, westeuropäischen Ländern erhoben. In Österreich sind überdurchschnittlich<br />
viele empirische Wirtschaftsforscher tätig, gleichzeitig ergibt sich jedoch eine relativ<br />
starke Inlandsorientierung in der Forschung. Weiters zeichnet sich Österreich durch<br />
eine geringe Vernetzung mit der Grundlagenforschung an den Universitäten aus.<br />
Angesichts der derzeitigen globalen und v.a. der europäischen Integrationsprozesse<br />
sowie der besonderen geographischen Lage erscheint das Know-how der <strong>internationale</strong>n<br />
Wirtschaftsbeziehungen gerade für Österreich von besonderer Bedeutung zur<br />
Nutzung der sich bietenden wirtschaftlichen Chancen zu sein.<br />
17.1 Einleitung<br />
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle von Know-how im Bereich der wissenschaftlichen<br />
Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen sowie mit Institutionen, die<br />
dieses Know-how besitzen und auch in Beratungstätigkeit zur Anwendung bringen.<br />
Im Detail werden folgende Fragestellungen behandelt:<br />
• Worin besteht dieses Know-how und ist dieses in den jetzigen historischen und<br />
geographischen Umständen besonders wichtig?<br />
• Welche Institutionen braucht man um dieses Know-how zu besitzen und es nützlich<br />
einzusetzen?<br />
• Wie sind die Institutionen in unterschiedlichen Ländern organisiert, besonders in<br />
europäischen Kleinstaaten?<br />
• Was sind die besonderen Aufgaben in diesem Bereich in Österreich?<br />
359
17.2 Zur Entwicklung der Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen<br />
Die Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen ist wohl einer der ältesten Zweige<br />
der Wirtschaftstheorie. Schon sehr früh gab es eine starke Beziehung zwischen Außen<strong>wirtschafts</strong>-<br />
und Wachstumstheorie (siehe A. Smith’s „Wealth of Nations” aber auch<br />
Beiträge von James Steuart, David Ricardo, etc.). Die Fragen, welche immer wieder<br />
gestellt wurden, bezogen sich besonders auf die Beziehungen zwischen <strong>internationale</strong>m<br />
Handel (und damit verbunden handels<strong>politische</strong>n Regimes) und strukturellen<br />
wirtschaftlichen Entwicklungen bzw. Wohlfahrts- und Wachstumseffekten. Mit der<br />
Entwicklung der statischen (neoklassischen) Allokationstheorie im späten 19. Jahrhundert<br />
(L. Walras, C. Menger, A. Marshall) wurde einerseits das Studium <strong>internationale</strong>r<br />
Handelsbeziehungen von der Analyse von Wachstums- und Entwicklungsprozessen<br />
etwas losgelöst, andererseits wurden wichtige Effekte <strong>internationale</strong>r wirtschaftlicher<br />
Integration auf Verteilungsstrukturen herausgearbeitet; diese wurden auch in der jüngsten<br />
Debatte bezüglich der Effekte der „Globalisierung” zur Anwendung gebracht (siehe<br />
z.B. Feenstra und Hanson, 2001). Es wurde gezeigt, dass Strukturwandel, welcher<br />
durch <strong>internationale</strong> Produktionsspezialisierung bedingt ist, sehr wohl zu dramatischen<br />
Effekten („Vergrößerungseffekten”) in der funktionalen Einkommensverteilung<br />
führen kann. Anders ausgedrückt, es gibt Gewinner und Verlierer von <strong>internationale</strong>n<br />
Integrationsprozessen und das nicht nur relativ, sondern auch absolut (siehe Stolper-Samuelson<br />
Theorem) – auch wenn die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt durch<br />
derartige Integrations- und Spezialisierungsprozesse gesteigert wird (und daher die<br />
Mittel existieren, um die „Verlierer” zu kompensieren).<br />
Ab etwa 1970 gab es eine rapide Entwicklung „neuerer Handelstheorie” (sie wird mit<br />
den wichtigen Beiträgen von Krugman, Helpman, und Ethier begründet), die neue<br />
analytische Bausteine, insbesondere die Betrachtung unvollkommenen Wettbewerbs,<br />
zunehmender Skalenerträge und intra-industrieller Produktdifferenzierung in die Analyse<br />
von Handelsbeziehungen einbaute. Dies erlaubte eine viel stärkere Betonung der<br />
Determinanten von Handelsströmen zwischen entwickelten Wirtschaften (intra-industrieller<br />
Handel), welche empirisch einen Großteil der <strong>internationale</strong>n Handelströme bilden.<br />
Das neue analytische Instrumentarium eröffnete – verglichen mit der klassischen<br />
Handelstheorie – ein viel breiteres Spektrum von handels<strong>politische</strong>n Implikationen.<br />
Es lieferte auch fundierte Argumente zur wohlfahrtsökonomischen Untermauerung<br />
bestimmter handels<strong>politische</strong>r und auch industrie<strong>politische</strong>r Interventionen (siehe<br />
z.B. Brander, 1995).<br />
360
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
Mit der sich parallel entwickelnden, „endogenen Wachstumstheorie” – so genannt, weil<br />
sie die Determinanten von technologischem Fortschritt und daher von Produktivitätswachstum<br />
endogenisiert – ergab sich wieder verstärkt die Möglichkeit, Wachstums-<br />
und Entwicklungstheorie in die Handelstheorie zu integrieren (siehe insbesondere das<br />
synthetische Werk von Grossman und Helpman, 1991). Gleichzeitig gab es starke<br />
Fortschritte in der empirischen und letztendlich auch theoretischen Analyse von <strong>internationale</strong>n<br />
Direktinvestitionen und den Hauptträgern dieser Investitionsströme, den<br />
multinationalen Unternehmen (siehe die Beiträge von Markusen, 1995, 2002).<br />
Diese theoretischen Entwicklungen erlaubten nun nicht mehr nur die getrennte Analyse<br />
des <strong>internationale</strong>n Austausches von Gütern und Dienstleistungen (Produktmarktintegration),<br />
sondern auch die gleichzeitige Analyse der Determinanten und Effekte von<br />
Direktinvestitionen (<strong>internationale</strong> Kapitalmarktintegration) sowie – in weiterer Folge<br />
– von Migrationsströmen (i.e. direkte Arbeitsmarktintegration) und der wechselseitigen<br />
Beziehungen zwischen diesen drei Dimensionen <strong>internationale</strong>r wirtschaftlicher<br />
Integration. Man kann somit im jetzigen Stadium davon sprechen, dass in den letzten<br />
Jahrzehnten große Fortschritte in der Entwicklung einer Synthese von analytischem<br />
und empirischem Verständnis unterschiedlicher Bereiche <strong>internationale</strong>r Integrationsprozesse<br />
gemacht wurden. Ein zusätzliches und für das Verständnis globaler Entwicklungsprozesse<br />
wichtiges Anwendungsgebiet dieser Erkenntnisse ist die Analyse von<br />
regional beschränkten Integrationsprozessen („Regionalismus”). Hier geht es darum,<br />
die Effekte einer verstärkten regionalen Integration (z.B. EU, NAFTA, ASEAN+3,<br />
Mercosur, etc.) auf globale und regionale Entwicklungen zu verstehen. Diese werden<br />
oft nicht nur von handels<strong>politische</strong>n Präferenzen getragen, sondern können auch von<br />
weitergehenden <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Maßnahmen wie Abstimmung bzw. Koordination<br />
von Wettbewerbs-, Steuer-, Währungspolitik etc. getragen werden (siehe z.B. die<br />
Überblicksartikel von Panagariya, 2000, Baldwin und Venables, 1995).<br />
Im Bereich der normativen Analyse der Handelspolitik wurden die Entwicklungen im<br />
Bereich der „neueren Handelstheorie” bereits erwähnt. Ein zusätzliches dynamisches<br />
Forschungsgebiet ist die Analyse der <strong>politische</strong>n Mechanismen, welche die Formulierung<br />
nationaler und <strong>internationale</strong>r Wirtschaftspolitik bestimmen. Dieses Gebiet,<br />
welches zu einer Integration von politik- und <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftlichen Ansätzen<br />
im Bereich der „neuen <strong>politische</strong>n Ökonomie” geführt hat (siehe insbesondere das<br />
Werk von Grossman und Helpman, 2002), erlaubt ein Verständnis der tatsächlichen<br />
handels<strong>politische</strong>n Positionen von Ländern und Ländergruppen und deren strategischer<br />
interaktiver Dynamik.<br />
Die letzten beiden Gebiete, die wir in diesem kurzen Abriss der Entwicklung der Analysen<br />
<strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen erwähnen wollen, sind einerseits die<br />
verstärkte Analyse von Firmenstrategien, Marktstrukturen und <strong>internationale</strong>r Verflech-<br />
361
tung (siehe Marin und Verdier, 2002, Neary, 2003), andererseits die Entwicklungen im<br />
Bereich der „Neuen Wirtschaftsgeographie” (siehe Fujita, Krugman, Venables, 1999).<br />
In letzterem Gebiet, welches wiederum durch Beiträge von Krugman wiederbelebt<br />
wurde, geht es um die wichtige Frage der Lokation von ökonomischen Aktivitäten,<br />
der Determinanten von Agglomerations- bzw. Peripherisierungstendenzen. Dieser<br />
Forschungsbereich versucht eine umfassende Analyse der regionalen Entwicklung<br />
in größeren Wirtschaftsräumen, wie z.B. in der erweiterten EU, zu geben. In diesem<br />
Bereich ist <strong>internationale</strong> Wirtschaftsanalyse ganz eng mit Regionalökonomie zusammengewachsen<br />
und erlaubt die Analyse wichtiger standort<strong>politische</strong>r Fragestellungen<br />
(ein wichtiger jüngerer Beitrag auf diesem Gebiet ist Fujita und Thisse, 2002).<br />
17.3 Theorie und Empirie – die Rolle von Datenbanken<br />
und Forschungsinstituten<br />
Während klassische <strong>wirtschafts</strong>analytische Studien empirische Beobachtungen eher<br />
in der Form qualitativer und <strong>wirtschafts</strong>historischer Beispiele anstellten, entwickelte<br />
sich eine systematische empirische Wirtschaftsforschung erst in der Zwischenkriegszeit<br />
und erfuhr dann eine explosive Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg. Der Grund<br />
für diese Entwicklung liegt in der umfassenderen und systematischen Erstellung von<br />
Statistiken und der starken qualitativen Verbesserung der Methodik der quantitativen<br />
Analyse (siehe z.B. Morgan, 1990). Durch Bemühungen <strong>internationale</strong>r Organisationen<br />
(z.B. Vereinheitlichung der statistischen Erfassung der Volkseinkommensrechnung)<br />
wurden Datensätze zunehmend nach einheitlichen Kriterien erfasst und waren daher<br />
für vergleichende <strong>internationale</strong> Studien geeignet. Natürlich führte auch die „Internationalisierung”<br />
von ökonomischer Theorieentwicklung und die nun weit verbreitete Kenntnis<br />
ökonometrischer Methoden dazu, dass sich Studien zunehmend auf einheitliche<br />
theoretische und statistisch-methodische Fundamente stützten. Dies ist in anderen<br />
Bereichen der Wirtschaftsanalyse (z.B. Makro-, Arbeitsmarkt-, Industrieökonomie)<br />
ebenso der Fall wie in den Bereichen <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen.<br />
Die Entwicklung von wirtschaftlichen Forschungsinstitutionen, welche die Möglichkeit<br />
bieten, die Vorteile interner Projektzusammenarbeit und die Zusammenlegung unterschiedlicher<br />
Kompetenzen auszunützen, ist ebenfalls eine historische Erscheinung,<br />
die auf die Zwischenkriegszeit zurückgeht. Im Bereich der Konjunkturanalyse (Harvard<br />
Barometer, Berliner Institut für Konjunkturanalyse), aber auch schon im Bereich der<br />
Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen (z.B. Kieler Institut für Weltwirtschaft;<br />
Hamburger Institut für Seeverkehr, etc.), wurde damals die Notwendigkeit erkannt, dass<br />
die Erstellung solider Datensätze und deren kontinuierliche Analyse die Zusammen-<br />
362
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
legung von größeren administrativen und persönlichen Ressourcen erfordert. Nach<br />
dem 2. Weltkrieg gab es eine dramatische Entwicklung der Techniken quantitativer<br />
empirischer Wirtschaftsforschung sowie eine starke Zunahme von Datenerfassung,<br />
welche auch durch die Aktivitäten einer Vielzahl <strong>internationale</strong>r Organisationen (UN,<br />
OECD, ILO, IWF, Weltbank, UNCTAD, etc.) begünstigt wurde. Die jüngsten Entwicklungen,<br />
besonders informationstechnologischer Art, haben es mit sich gebracht, dass<br />
auch der Zugang von Einzelwissenschaftern zu <strong>internationale</strong>n Datenbanken und<br />
<strong>internationale</strong>n Forschungsergebnissen viel leichter geworden ist. Dies impliziert,<br />
dass auch Kontakte von Forschungszentren mit Einzelforschern intensiviert werden<br />
können und Arbeitsbeziehungen nicht nur mit Mitarbeitern, welche direkt in den<br />
Forschungszentren angestellt sind, entstehen. Internationale Forschungsnetzwerke,<br />
welche Einzelwissenschaftler und Forschungsinstitute inkorporieren, sind jetzt viel<br />
üblicher und werden auch von den Forschungsprogrammen der EU stark gefördert.<br />
Wichtig ist dabei, dass Infrastrukturkosten (Zugang zu Datenbanken, buchhalterische<br />
Administration, etc.) die Bildung derartiger Netzwerke nicht behindern. Der Zugang<br />
auch für nicht-kommerzielle Forschungsinstitute zu <strong>internationale</strong>n Datenbanken<br />
(inklusive EU-Statistiken) sind immer noch sehr teuer (für Einzelforscher meist unerschwinglich)<br />
und macht eine Vernetzung von nationalen Forschungseinrichtungen zur<br />
gemeinsamen Benutzung, Betreuung (Schreiben von benutzerfreundlicher Software,<br />
akkurates Updaten, Bereitstellen von Basisindikatoren und graphischen Darstellungen)<br />
und Kosteneinsparung sinnvoll.<br />
In dem jetzigen <strong>internationale</strong>n Kontext gibt es eine erhöhte Nachfrage nach wissenschaftlich<br />
gut abgestützter Politikberatung. Internationale Integration führt zu einer<br />
stärkeren qualitativen Herausforderung in der Politikformulierung. Die Interaktion mit<br />
<strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Entscheidungsträgern anderer Länder sowie mit <strong>internationale</strong>n<br />
Institutionen (IWF, Weltbank, OECD, etc.) und den Koordinationsinstitutionen der<br />
regional integrierten Wirtschaftsräume (EU, NAFTA, ASEAN, etc.) hat sich in den<br />
letzten Jahrzehnten stark intensiviert. Dies stellt einen wichtigen Impetus dar, die<br />
Formulierung von <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Strategien und von Verhandlungspositionen<br />
auf nationaler und regionaler Ebene auf eine rigorosere, wissenschaftlich fundiertere<br />
Basis zu stellen als dies früher der Fall war, als die <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Diskussion<br />
noch vorwiegend auf nationaler Ebene geführt wurde. Dazu kommt noch, dass in<br />
der jetzigen Phase die EU noch als Staatenbund und nicht als föderalistische Einheit<br />
agiert. In diesem Kontext ist der Druck auf Kleinstaaten besonders hoch, die Qualität<br />
der Beiträge nicht hinter der größerer Staaten nachhinken zu lassen, um nicht<br />
Einbußen in der wissenschaftlichen Untermauerung ihrer Positionen und in ihrer<br />
Verhandlungsmacht hinnehmen zu müssen. Da die Mittel von Kleinstaaten jedoch<br />
absolut limitierter sind, ist es besonders wichtig, diese Mittel effizient einzusetzen, um<br />
363
das Qualitäts-Ressourceneinsatz-Verhältnis zu maximieren. Natürlich bildet sich eine<br />
Agglomeration von statistischer, analytischer und <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>r Kompetenz in<br />
den Institutionen und Entscheidungsgremien der über-regionalen Entscheidungsträger<br />
(EU) heran, welche einerseits eine Asymmetrie zu den Möglichkeiten auf nationaler<br />
Ebene schafft (besonders in Kleinstaaten), aber andererseits auch Zugang zu Knowhow<br />
bringt (besonders auf dem Gebiet von Vergleichsstudien), welches vordem national<br />
kaum aufzubauen war. Daher ist es wichtig, die Kompetenz auf nationaler und<br />
regionaler Ebene zu haben, dieses Know-how zu absorbieren und für eigene Zwecke<br />
verwenden zu können.<br />
Im Rahmen der Prozesse <strong>internationale</strong>r Integration partizipieren <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftliche<br />
Forschungsinstitutionen zunehmend in international koordinierten Großprojekten,<br />
für die ein laufender Zugang zu <strong>internationale</strong>n Statistiken und eine starke<br />
Vernetzung der wissenschaftlichen Kapazitäten der partizipierenden Institutionen<br />
eine absolute Notwendigkeit darstellen. Die beste Forschung – das gilt sowohl im<br />
Grundlagenbereich als auch in der angewandten Forschung – wird jetzt in einem<br />
stark internationalisierten Kontext betrieben, im Rahmen von rigorosen <strong>internationale</strong>n<br />
Ausschreibungsverfahren, „peer-group reviews” und einem starken qualitativen<br />
<strong>internationale</strong>n Wettbewerb. Die Präsenz von Centres of Excellence auf nationaler<br />
Ebene ist eminent wichtig, um hier auf dem Gebiet der international anerkannten<br />
Forschung mithalten zu können. Von der Existenz derartiger Zentren profitiert dann<br />
wiederum ein Umfeld von Forschern in Universitäten, Studenten in post-gradualer<br />
Ausbildung und auch Forschergruppen in Nachbarländern, welche von der regionalen<br />
Vernetzung profitieren.<br />
17.4 Besondere Aspekte der Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen in Österreich<br />
In Österreich verdient in der jetzigen historischen Situation die Analyse <strong>internationale</strong>r<br />
Wirtschaftsbeziehungen ganz besondere Aufmerksamkeit: Österreich befindet sich<br />
an der Schnittstelle des „Erweiterungsprozesses” der EU, d.h., es muss sich ganz<br />
besonders mit der Frage der Integration von Wirtschaftsregionen mit sehr unterschiedlichen<br />
Einkommens-, Lohn- und Produktivitätsniveaus beschäftigen. Zusätzlich<br />
ist die jetzige Integrationsphase in der EU ein Fall von „deep integration” (Lawrence<br />
et al, 1996), sprich nicht nur eine Integration von Produkt-, Kapital- und (letztendlich<br />
auch) Arbeitsmärkten, sondern auch eine starke Adaptation von institutionellen und<br />
<strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Rahmenbedingungen. Es ist daher eine Situation gegeben, in<br />
der alle Bereiche der <strong>internationale</strong>n Integrationsanalyse (siehe oben) stark gefordert<br />
364
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
sind, um das regionale wirtschaftliche Umfeld Österreichs und dessen Wirkung auf<br />
die nationalen und regionalen Entwicklungen in Österreich analytisch und empirisch<br />
erfassen zu können. Eine gut fundierte <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Agenda kann daher nicht<br />
ohne sehr gute Kenntnis international vergleichender Wirtschaftsforschung und des<br />
Standes und der Dynamik eben dieser Integrationsprozesse auskommen.<br />
Im Folgenden nur ein kurzer Überblick der wichtigen außenwirtschaftlichen Themenbereiche,<br />
die für die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs mittel- bis längerfristig<br />
besonders relevant sein werden:<br />
• Monitoring der Entwicklung und der Effekte der auf EU-Ebene betriebenen oder koordinierten<br />
Wirtschaftspolitik (Geld- und Fiskalpolitik, Wettbewerbs-, Forschungs-,<br />
Regionalpolitik, etc.): Die Analyse der unterschiedlichen Effekte der Handhabung<br />
dieser <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n Instrumente in verschiedenen nationalen und regionalen<br />
Kontexten ist ein wichtiges Forschungsgebiet, das natürlich auch die nationalen<br />
Standpunkte bezüglich der weiteren Entwicklungen von EU- und (verbliebener)<br />
nationaler Wirtschaftspolitik mitdefinieren kann.<br />
• Vergleich Österreichs mit erfolgreichen EU-Ländern: Vergleiche <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>r<br />
Strategien innerhalb der EU in wichtigen Bereichen der Standortpolitik<br />
(Steuersystem, wohlfahrtsstaatliche Institutionen, Entwicklung von Marktstrukturen,<br />
Arbeitsmarktorganisation, etc.) ist ein in den letzten Jahren intensivierter<br />
Themenbereich vergleichender Wirtschaftsanalyse, der für die Formulierung österreichischer<br />
Wirtschaftspolitik von großer Bedeutung ist.<br />
• Integrationsprozesse der neuen Mitgliedsländer in die EU: Hier wird es wichtig<br />
sein, die makroökonomischen und strukturellen Adaptationsprozesse mitzuverfolgen,<br />
welche die neuen Mitglieder der EU nach ihrem Beitritt durchlaufen. Diese<br />
Prozesse werden Österreich als direktes Nachbarland ganz besonders betreffen<br />
sowohl was die Wachstumsentwicklungen dieser Region anlangt als auch in<br />
Bezug auf die strukturellen und standort<strong>politische</strong>n Implikationen, welche sie für<br />
die österreichische Wirtschaft haben werden.<br />
Bevor wir zu weiteren geographischen Bereichen kommen, welche für österreichische<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>interessen von Bedeutung sind, noch kurz und selektiv zu einigen<br />
Themenbereichen, welche in mittlerer und längerer Frist mit Expertise zu verfolgen<br />
sein werden:<br />
• Entwicklungen in der handels<strong>politische</strong>n Agenda: Obwohl die Europäische Kommission<br />
die Vertretung der handels<strong>politische</strong>n Interessen der Mitgliedsländer<br />
übernommen hat, ist es im Interesse jedes EU-Landes, die Entwicklung der WTO<br />
und der EU-handels<strong>politische</strong>n Agenda (auch in bilateralen Verträgen) genau<br />
mitzuverfolgen: Erstens, weil diese Agenda Bereiche enthält, welche viel tiefer<br />
ins Wirtschaftsgeschehen eingreifen (Dienstleistungsbereiche, Liberalisierung<br />
365
vormals staatlich betriebener Bereiche, <strong>internationale</strong> Patentrechte, etc.) als dies<br />
in früheren Liberalisierungsrunden der Fall war, und zweitens, weil die Effekte der<br />
handels<strong>politische</strong>n Entwicklungen auf Drittstaaten (z.B. auf Ost- und Südosteuropa,<br />
auf die Mittelmeerregion) von unterschiedlichem Interesse für EU Mitglieder<br />
sind und diese unterschiedliche Interessenslagen auch in der Ausarbeitung der<br />
EU-Positionen artikuliert werden müssen.<br />
• Sektorale Entwicklungen: Internationale Integrationsprozesse betreffen verschiedene<br />
Sektoren in unterschiedlicher Weise und hier ist eine Verknüpfung von sektoralem<br />
Know-how und den Gegebenheiten <strong>internationale</strong>r Rahmenbedingungen<br />
und Wettbewerbsstrukturen geboten. Solch spezifische sektorale Expertise ist<br />
besonders notwendig im Agrarbereich, in Hightech-Bereichen, wo die Fragen<br />
<strong>internationale</strong>r Forschungsstandortpolitik besonders wichtig sind, sowie im Finanzbereich<br />
und in Bereichen produktionsnaher Dienstleistungen, in denen die<br />
<strong>internationale</strong> Vernetzung rapid zugenommen hat.<br />
• Preisentwicklungen, Wechselkursentwicklungen und umweltökonomische Verpflichtungen:<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>beziehungen sind immer auch maßgeblich von<br />
Preis- und monetären Entwicklungen geprägt. Wiederum betreffen Wechselkursentwicklungen<br />
(z.B. zu neuen Mitgliedsländern, solange diese nicht Vollmitglieder<br />
der Europäischen Währungsunion sind) nicht alle EU Mitgliedsstaaten in gleicher<br />
Weise, da die realwirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Verknüpfung unterschiedlich<br />
ist. Ebenso ist der Einfluss von Schlüsselpreisen im Rohmaterialbereich<br />
(besonders des Rohölpreises) auf nationale und regionale Wirtschaftsgeschehen<br />
aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftsstrukturen genau und spezifisch mitzuverfolgen.<br />
Dasselbe gilt für Kosten-/Nutzenimplikationen von international verhandelten<br />
umweltökonomischen Verpflichtungen.<br />
Kehren wir noch kurz zu anderen geographischen Fokusbereichen zurück, in denen<br />
Österreich spezifisches Know-how zur Untermauerung seiner <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>n<br />
Interessen weiterentwickeln sollte:<br />
• Entwicklungsprozesse in Südosteuropa: Der südosteuropäische Raum beinhaltet<br />
sowohl Länder, die bereits Kandidatenstatus erreicht haben (Bulgarien, Rumänien),<br />
als auch solche, welche darum angesucht haben (Kroatien, Mazedonien,<br />
Türkei) und/oder noch mit großen wirtschaftlichen und <strong>politische</strong>n Integrationsproblemen<br />
zu kämpfen haben (die Länder Ex-Jugoslawiens, Albanien). Die geographische<br />
Nähe Österreichs zu diesem Raum bedeutet ein hohes wirtschaftliches<br />
Interesse, die Entwicklungen mitzuverfolgen und auch aktiv an der Formulierung<br />
der nächsten EU-Erweiterungsstrategie beteiligt zu sein.<br />
• Geschäftsmöglichkeiten in Russland, Ukraine und anderen CIS-Ländern: In diesem<br />
Raum gibt es keine mittelfristigen Chancen der EU-Mitgliedschaft, wohl aber ein<br />
366
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
starkes Interesse an verstärkten wirtschaftlichen Beziehungen mit dem EU-Raum.<br />
Mit der graduellen Bewältigung der Transformationsprobleme in diesen Ländern<br />
ist das Wachstumspotenzial in diesem Raum hoch und die Komplementarität mit<br />
den EU-Wirtschaftsstrukturen gegeben.<br />
• Wichtigkeit asiatischer Märkte und Produktionsstandorte: Die starke Wirtschaftsdynamik<br />
Südostasiens und jetzt auch Südasiens (Indien) bedeutet, dass österreichische<br />
Wirtschaftsinteressen (Exporte, Direktinvestitionen) zunehmend auch<br />
in diesem Raum liegen werden und ein Monitoring der Wachstumsdynamiken, der<br />
Spezialisierungs- und Wachstumstendenzen sowie von potenziellen Instabilitäten<br />
daher von Interesse ist.<br />
• Investitionsbedingungen in anderen globalen Regionen: Während die oben genannten<br />
Regionen aus unterschiedlichen Gründen (geographische Nähe, Vergleichsländer,<br />
Wachstumsdynamiken) für Österreichs außenwirtschaftliche Interessen<br />
und die Formulierung <strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong>r Strategien von besonderer<br />
Wichtigkeit sind, sollte auch ein gewisses Maß an Know-how bezüglich anderer<br />
geographischer Bereiche (Lateinamerika, Naher Osten, Afrika) in Österreich bestehen,<br />
da die weltwirtschaftliche Vernetzung sich auch auf diese Regionen bezieht<br />
und auch mit diesen Außen<strong>wirtschafts</strong>beziehungen bestehen und weitere<br />
Potenziale erschlossen werden können.<br />
17.5 Österreichische <strong>wirtschafts</strong>wissenschaftliche<br />
Institute im Internationalen Vergleich<br />
In diesem Abschnitt wird der Versuch unternommen, die österreichische Expertise im<br />
Bereich der empirischen Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen im Vergleich<br />
zu anderen kleinen europäischen Ländern zu beurteilen. Konkret erhoben wir folgende<br />
Daten bezüglich empirischer Wirtschaftsforschungsinstitute in Österreich, der Schweiz,<br />
den Niederlanden, Dänemark und Schweden: Zahl der Mitarbeiter und Zahl der Ökonomen,<br />
Art des Instituts (Forschung, Lehre, Politikberatung/Consulting), inhaltliche<br />
Spezialisierung (siehe dazu die Tabellen im Anhang dieses Kapitels) und nationale<br />
und <strong>internationale</strong> Kooperationen. Relevant für die vorliegende Analyse waren nur<br />
jene Institute, die sich auch explizit mit <strong>internationale</strong>n Wirtschaftsangelegenheiten<br />
befassten. D.h., all jene Institute, die sich ausschließlich mit der nationalen Konjunktur,<br />
mit spezifischen Themen wie z.B. Arbeitsmarkt, Umwelt, Klein- und Mittelbetrieben, etc.<br />
auseinander setzen, wurden nicht in die Berechnungen bzw. Betrachtungen aufgenommen.<br />
Das niederländische Forschungsinstitut für Agrarökonomie (LEI), das eine eigene<br />
Abteilung für Internationale Ökonomie hat, wurde hingegen sehr wohl berücksichtigt.<br />
367
Die Auswahl der Institute erfolgte aufgrund der persönlichen Einschätzung einzelner<br />
Wirtschaftsforscher in den jeweiligen Ländern. Dadurch ergab sich selbstverständlich<br />
eine subjektive Auswahl an Forschungseinrichtungen, die jedoch qualitativ zufriedenstellend<br />
sein dürfte, auch wenn die jeweilige Erfassung aller relevanten Institutionen<br />
nicht exakt dieselbe in allen fünf Ländern ist.<br />
Vorbehaltlich dieser Erfassungsproblematik ist die Anzahl der Institute je nach Land<br />
sehr verschieden. Österreich liegt mit fünf Forschungseinrichtungen (IHS, WIFO, wiiw,<br />
Institut für Europafragen IEF, IWI) gleichauf mit Schweden. In Dänemark konnten sechs<br />
Wirtschaftsforschungsinstitute identifiziert werden, in der Schweiz sieben und für die<br />
Niederlande ergaben sich acht relevante Einrichtungen (siehe dazu Tabelle 17.1). Bei<br />
der Zahl der Gesamtmitarbeiter liegt Österreich mit rd. 260 Mitarbeitern deutlich über der<br />
Schweiz (128), Dänemark (160) und Schweden (161). In den Niederlanden hingegen<br />
arbeiten rd. 638 Personen in den acht Instituten. Daraus lässt sich eine überdurchschnittliche<br />
Größe für österreichische und niederländische Institute ableiten. Mit teilweise nur<br />
drei bis fünf Mitarbeitern ist die durchschnittliche Institutsgröße vor allem in Dänemark<br />
und der Schweiz besonders klein. Diese besonders kleinen Institute sind häufig private<br />
Consulting-Unternehmen oder in Universitäten eingebundene Forschungszentren.<br />
Der Vergleich anhand der Zahl der Mitarbeiter ist gerade aufgrund der unterschiedlichen<br />
Administration der Forschungseinrichtungen (eigenständig versus in Universitäten<br />
eingebunden, öffentlich versus rein privatwirtschaftlich finanziert) mit einer Reihe von<br />
Problemen behaftet. Zum Beispiel sind in Schweden, Dänemark und der Schweiz<br />
jeweils drei bis fünf der berücksichtigten Institute innerhalb eines Universitätsinstituts<br />
eingerichtet und können daher auf die administrativen Einrichtungen der Universität<br />
zurückgreifen, während die vorwiegend eigenständigen Forschungsinstitute (z.B.<br />
in Österreich und den Niederlanden) ihre Administration selber bestreiten müssen.<br />
Weiters zeichnen sich einzelne Institute (WIFO und wiiw in Österreich, Central Planning<br />
Bureau in den Niederlanden) durch relativ große statistische Abteilungen aus,<br />
während in anderen Instituten die Datensammlung durch das wissenschaftliche Personal<br />
erfolgt. Eingedenk dieser Probleme in der Vergleichbarkeit ergibt sich folgendes<br />
Bild, wenn man nur das wissenschaftliche Personal der betrachteten Forschungsinstitute<br />
berücksichtigt: Mit rd. 110 Wirtschaftswissenschaftern liegt Österreich immer<br />
noch gut im absoluten Vergleich, allerdings sind die Unterschiede zu den anderen<br />
Vergleichsländern wesentlich geringer. In Dänemark arbeiten in den ausgewählten<br />
Instituten 67 Ökonomen, 85 in der Schweiz, 96 in Schweden und mehr als 400 in<br />
den Niederlanden.<br />
Für diesen Beitrag versuchten wir darüber hinaus die Zahl der Experten auf dem<br />
Gebiet Internationale Wirtschaftsbeziehungen zu ermitteln. Sofern diese Information<br />
nicht direkt aus den Internet-Seiten der einzelnen Institute hervorging, wurde folgender<br />
368
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
Berechnungsschlüssel angewandt: Die Zahl der Spezialisierungsgebiete im Bereich<br />
Internationale Wirtschaftsanalysen (hierzu zählten wir Bereiche wie: Außenwirtschaft,<br />
Handel, EU-Integration und -Erweiterung, Globalisierung, Wettbewerbsfähigkeit, etc.)<br />
wurde durch die Gesamtzahl der Spezialisierungsgebiete der einzelnen Forschungseinrichtungen<br />
dividiert. Die Zahl der Experten auf dem Gebiet Internationale Volkswirtschaft<br />
ergab sich dann durch Multiplikation der Gesamtzahl der wissenschaftlichen<br />
Mitarbeiter mit diesem Gewicht.<br />
Internationaler Vergleich der Wirtschaftsforschungsinstitute Tab. 17.1<br />
Österreich Schweiz Niederlande Dänemark Schweden<br />
Zahl der Institute 5 8 8 6 5<br />
davon an einer Universität 1 5 5 3 3<br />
Zahl der Mitarbeiter (insgesamt) 261 128 638 160 161<br />
Zahl der Ökonomen 109 85 408 67 96<br />
Zahl der <strong>internationale</strong>n Ökonomen 30,5 38,3 51,8 25,9 34,1<br />
Anteil int. Ökonomen an Ökonomen 0,37 0,38 0,16 0,35 0,37<br />
Ökonomen pro Mio. Einwohner 13,5 11,8 25,3 12,4 10,8<br />
Int. Ökonomen pro Mio. Einwohner 3,8 5,3 3,2 4,8 3,8<br />
Bevölkerung (in Mio.) 8,1 7,2 16,1 5,4 8,9<br />
Es zeigt sich, dass die Reihung der Vergleichsländer nach der Zahl der Experten 1 pro<br />
Kopf der Bevölkerung wesentlich anders ausfällt als nach der absoluten Anzahl an<br />
Experten, auch wenn Österreich in beiden Fällen auf Platz vier unter den fünf Ländern<br />
rangiert. Im Wesentlichen bestätigt sich hier die negative Beziehung zwischen der<br />
Größe eines Landes und seiner Offenheit: In diesem Fall ergibt sich ein negativer<br />
Zusammenhang zwischen der Größe eines Landes und dessen Interesse an der<br />
Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen. Auch die Zahl der empirisch arbeitenden<br />
<strong>internationale</strong>n Ökonomen 2 nimmt relativ gesehen mit der Größe des Landes<br />
ab. Die beiden kleinsten Länder, Dänemark und die Schweiz, erreichen den größten<br />
Pro-Kopf-Durchschnitt an <strong>internationale</strong>n Ökonomen. Dänemark, welches aufgrund<br />
seiner geringen Größe (5,4 Mio. Einwohner) nur knapp 26 <strong>internationale</strong> Ökonomen<br />
aufweist, kommt mit einem Schnitt von 4,8 Experten pro Million Einwohner auf den<br />
2. Rang hinter der Schweiz (5,3 <strong>internationale</strong> Ökonomen pro Million bei 7,2 Mio.<br />
Einwohnern). Österreich und Schweden liegen sowohl bei der Einwohnerzahl mit 8<br />
bzw. 9 Mio. als auch bei den <strong>internationale</strong>n Ökonomen mit jeweils rd. 3,8 Experten<br />
pro Million Einwohner in etwa in der Mitte der Stichprobe. Österreich (siehe Tabelle<br />
17.2 im Anhang) weist also sowohl absolut als auch relativ gesehen ein hohes Ausmaß<br />
an Inlandsorientierung auf. Dies, obwohl zwei der fünf Institute (wiiw und Institut<br />
für Europafragen) den Schwerpunkt ihrer Forschung auf Fragen der <strong>internationale</strong>n<br />
369
Wirtschaftsbeziehungen bzw. <strong>internationale</strong> Vergleichsstudien richten. Dabei handelt<br />
es sich allerdings auch um relativ kleine Institute. In den beiden größten Instituten (IHS<br />
und WIFO) ergab sich hingegen aufgrund unserer Schätzungen ein relativ geringer<br />
Prozentsatz an <strong>internationale</strong>n Ökonomen.<br />
Die Niederlande, mit rd. 16 Mio. Einwohnern bei weitem das größte der fünf Länder,<br />
erreichen mit 3,2 <strong>internationale</strong>n Ökonomen pro Million Einwohner den geringsten<br />
Durchschnittswert. Wenig überraschend nehmen die Niederlande jedoch absolut<br />
gesehen mit rd. 52 <strong>internationale</strong>n Ökonomen den ersten Rang ein. So gesehen ist<br />
die empirische Wirtschaftsforschung in den Niederlanden ebenso wie in Österreich<br />
relativ stark auf das Inland konzentriert. Das mit Abstand größte Forschungsinstitut,<br />
das Central Planning Bureau in Den Haag, beschäftigt 101 Wissenschafter, davon<br />
17 <strong>internationale</strong> Ökonomen.<br />
Eine etwas genauere Analyse des erhobenen qualitativen Datenmaterials macht darüber<br />
hinaus deutlich, dass Österreich das einzige Land ist, in welchem die empirische<br />
Wirtschaftsforschung relativ getrennt von der Grundlagenforschung an den Universitäten<br />
erfolgt. Mit Ausnahme des Instituts für Europafragen an der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien sind alle vier übrigen Institute eigenständig organisiert. In dieser Gruppe unterhält<br />
das IHS als einziges rechtlich eigenständiges Institut formelle Beziehungen zur<br />
Universität Wien und widmet darüber hinaus einen großen Teil seiner (personellen)<br />
Ressourcen der Grundlagenforschung sowie der postgradualen Ausbildung. Im Gegensatz<br />
dazu stehen die Schweiz und Schweden, wo beinahe zwei Drittel der betrachteten<br />
empirischen Wirtschaftsforschungsinstitute an einer Universität eingerichtet sind. In<br />
Schweden nimmt auch der wissenschaftliche Output in Form von Publikationen in<br />
anerkannten Fachzeitschriften einen hohen Stellenwert ein. 3<br />
Ein wesentlicher Aspekt dieser institutionellen Unterschiede liegt einerseits in der<br />
unterschiedlichen administrativen Infrastruktur, wobei eigenständige Forschungsinstitute<br />
hier durch eigene Statistikabteilungen und vor allem gut ausgebildete Statistiker<br />
bevorzugt sein dürften. Häufig ist auch der Zugang zu <strong>internationale</strong>n Datenbanken<br />
in eigenständigen Forschungsinstituten besser ausgebaut und effizienter organisiert.<br />
Andererseits ist die Zahl der Mitarbeiter in Instituten innerhalb einer Universität de<br />
facto durch Doktoratsstudenten sowie durch international renommierte, assoziierte<br />
wissenschaftliche Mitarbeiter meist höher als im obigen Vergleich angenommen.<br />
Zusätzlich ist innerhalb der Universität die Möglichkeit einer stärkeren Vernetzung mit<br />
Grundlagenforschung und neuesten theoretischen Erkenntnissen gegeben.<br />
In den Niederlanden lassen sich ebenfalls viele Institute finden, die als eigene Kompetenzzentren<br />
(„Centres“) an den Universitäten beheimatet sind. Alleine die Universität<br />
Tilburg beherbergt 18 solcher Institute, davon drei, die sich mit Internationaler<br />
Ökonomie teilweise oder schwerpunktmäßig befassen (Center Applied Research,<br />
370
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
GLOBUS – Schwerpunkt Globalisierungsfragen, IVO Development Research Institute).<br />
Zusätzlich sind gerade die Niederlande durch einige sehr große empirische Wirtschaftsforschungsinstitute<br />
gekennzeichnet, wie das bereits erwähnte, von Tinbergen<br />
gegründete, Central Planning Bureau mit 196 Mitarbeitern (davon 101 Ökonomen)<br />
oder das Agrarinstitut LEI in Wageningen (mit 300 Mitarbeitern). Weiters gibt es in den<br />
Niederlanden eine Reihe sehr eng spezialisierter Institute (im Arbeitsmarktbereich,<br />
für Kleine und Mittlere Unternehmen – KMU, etc.), welche hier nicht berücksichtigt<br />
wurden.<br />
In Dänemark sind in vieler Hinsicht ähnliche Beobachtungen zu machen. Einerseits gibt<br />
es eine starke Einbindung von empirischen Forschungsinstituten an den Universitäten,<br />
andererseits gibt es ebenfalls hochspezialisierte Institute, vor allem in den Bereichen<br />
Arbeitsmarkt, Sozialsysteme, Wohlfahrtsökonomie und Technologie/Forschung und<br />
Entwicklung. Hier sind die einzelnen Institute darüber hinaus noch im Inland relativ eng<br />
innerhalb von formellen Netzwerken wie z.B. DRUID, das verschiedene Universitäten<br />
umfasst, miteinander verbunden. Andererseits gibt es gerade in Dänemark besonders<br />
viele kleine private Forschungsinstitute mit einer starken Ausrichtung auf Consulting<br />
und Politikberatung (Copenhagen Economics, Oxford Research).<br />
Gemessen an quantitativen Input-Maßstäben (Zahl der Wissenschafter pro Kopf der<br />
Bevölkerung) erscheint die empirische Wirtschaftsforschung in Österreich durchaus gut<br />
vergleichbar mit der Situation in anderen, kleinen europäischen Ländern. Mit Ausnahme<br />
der Niederlande, welche – verglichen mit Österreich – bei doppelt soviel Einwohnern<br />
beinahe viermal so viele Ökonomen (in empirischen Wirtschaftsforschungsinstituten)<br />
aufweisen, liegt die Zahl der Ökonomen pro Million Einwohner in Österreich mit 13,5<br />
über dem Wert für Dänemark, der Schweiz und Schweden. Betrachtet man jedoch<br />
den geschätzten Wert der Experten auf dem Gebiet <strong>internationale</strong> Ökonomen, so liegt<br />
Österreich im Vergleich an vorletzter Stelle vor den Niederlanden. Die hier angestellte,<br />
vorläufige Analyse zeigt, dass Österreich durch einige wenige, dafür jedoch relativ<br />
große Institute charakterisiert ist. Entsprechend der auch in Deutschland vorherrschenden<br />
Tradition sind diese Institute meist als eigenständige Forschungseinrichtungen<br />
außerhalb der Universitäten eingerichtet. Daraus ergeben sich Vorteile bezüglich der<br />
administrativen Infrastruktur sowie des Zugangs, der fachgemäßen Aufbereitung sowie<br />
des Aufbaus nationaler und <strong>internationale</strong>r Datenbanken. Andererseits ist innerhalb<br />
der Universität die Vernetzung und Integration der jüngsten Erkenntnisse der Grundlagenforschung<br />
in die empirische Forschung u.U. besser gegeben.<br />
Es sei an dieser Stelle explizit darauf hingewiesen, dass die vorliegende Beurteilung<br />
der österreichischen Expertise alleinig auf Input-Messungen beruht und keine Indikatoren<br />
für die Quantität und Qualität des Outputs (Einfluss auf die Wirtschaftspolitik,<br />
Zahl und Art der Veröffentlichungen, etc.) erhoben wurden. Dies ist verständlicher-<br />
371
weise schwieriger zu erheben und würde wiederum ein hohes Maß an subjektiver<br />
Bewertung beinhalten. Gemessen am Input an Humankapital schneidet die empirische<br />
Wirtschaftsforschung in Österreich im <strong>internationale</strong>n Vergleich relativ gut ab, 4<br />
jedoch zeigt sich gleichzeitig eine überdurchschnittlich hohe Inlandorientierung in der<br />
empirischen Wirtschaftsforschung.<br />
In Anbetracht der EU-Erweiterung zusammen mit der besonderen, sich nun verändernden<br />
geographischen Position Österreichs – welches vom Rand des integrierten Europas<br />
in die Mitte rückt – sowie in Anbetracht des allgemeinen Globalisierungsprozesses<br />
ergibt sich gerade für Österreich eine besondere wirtschaftliche Situation, in der das<br />
Know-how der <strong>internationale</strong>n Wirtschaftsbeziehungen sowie dessen Entwicklung zur<br />
Nutzung der sich daraus bietenden Chancen von besonderer Bedeutung ist. Daher ist<br />
eine verstärkte Ausrichtung auf <strong>internationale</strong> ökonomische Zusammenhänge, gerade<br />
in der Forschung, von besonderem Interesse.<br />
17.6 Abschließende Betrachtungen<br />
In diesem kurzen Essay wurde zunächst die Wichtigkeit eines gezielten Ausbaus von<br />
Know-how im Bereich Außen<strong>wirtschafts</strong>beziehungen (oder: <strong>internationale</strong>r Integrationsprozesse)<br />
hervorgehoben. Besonders die Position Österreichs an der Schnittstelle<br />
von sich schnell integrierenden, aber – vom Entwicklungsniveau her – sehr heterogenen<br />
Wirtschaftszonen verlangt nach einer vertieften Kenntnis dieser Prozesse.<br />
Es wurde kurz dargestellt, dass jüngere analytische Entwicklungen zu einer starken<br />
Reintegration von Wachstums- und Integrationsanalyse, von Regional- und Außen<strong>wirtschafts</strong>forschung<br />
und zu einer synthetischen Betrachtung von Produkt-, Kapital-<br />
und Arbeitsmarktintegration geführt haben. Qualitativ stark verbesserte statistische<br />
Datensätze erlauben verbesserte Einsichten durch vergleichende Wirtschaftsforschung,<br />
die auch die Formulierung von „best practice”-Wirtschaftspolitik stark positiv<br />
beeinflussen kann.<br />
Es wurde hervorgehoben, dass Forschungsinstitutionen in Kleinstaaten besonderes<br />
Augenmerk auf die Qualität und Effizienz des Ressourceneinsatzes Wert legen<br />
müssen, um eine schlechtere Startposition in <strong>internationale</strong>n Verhandlungen auszugleichen.<br />
Die Spin-off-Effekte von international anerkannten Forschungszentren<br />
im Bereich der Analyse regionaler und <strong>internationale</strong>r Integrationsprozesse können<br />
besonders hoch sein, da diese nicht nur die nationale sondern auch die <strong>internationale</strong><br />
<strong>wirtschafts</strong><strong>politische</strong> Diskussion beeinflussen können.<br />
In einer ersten quantitativen Analyse zeigt sich, dass Österreich, verglichen mit anderen<br />
europäischen Kleinstaaten, ganz gut mit empirischen Wirtschaftswissenschaftern<br />
ausgestattet ist, in der Ausstattung mit Experten im Bereich <strong>internationale</strong>r Wirtschafts-<br />
372
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
beziehungen jedoch eher im unteren Drittel liegt. Österreich hat auch – ähnlich wie<br />
Deutschland – eine institutionelle Forschungsstruktur, die viele Ressourcen in außeruniversitäre<br />
wirtschaftwissenschaftliche Institute investiert, was gewisse Vorteile, aber<br />
auch Nachteile mit sich ziehen kann; in diesem Fall muss besonderes Augenmerk<br />
auf eine intensive Interaktion mit Universitätsinstituten und mit wissenschaftlichem<br />
Universitätspersonal gelegt werden.<br />
Außerdem sollte der für den Forschungsprozess notwendige freie Zugang zu <strong>internationale</strong>n<br />
Datenbanken für die in diesem Bereich tätigen Forscher und Forschungsinstitute<br />
durch öffentliche Unterstützung und Netzwerkeinrichtungen gewährleistet sein.<br />
Anhang<br />
Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht über die Größe und Ausrichtung empirischer<br />
Wirtschaftsforschungsinstitute in Österreich und in vergleichbaren, kleineren<br />
Ländern.<br />
373
Vergleich der österreichischen Institutionen Tab. 17.2<br />
IHS<br />
WIFO<br />
WIIW<br />
IEF<br />
IWI<br />
Institut für Höhere Österreichisches Institut Wiener Institut f. Int. Institut für Europafragen Industriewissenschaft-<br />
Studien<br />
für Wirtschaftsforschung Wirtschaftsvergleiche (Universität)<br />
liches Institut<br />
Mitarbeiter 94 100 36 19 12<br />
Ökonomen 35 41 17 7 9<br />
Internationale Ök. 5,8 8,2 9,6 4,7 2,3<br />
Art/Ausrichtung Grundlagenforschung, Empirie, Politikbera- Empirie, Politikbera- Wirtschaftsforschung, Empirie, Politik- und<br />
Empirie, Lehre tung,Grundlagenfortung,Grundlagenfor- Lehre<br />
UnternehmensberaschungschungtungSpezialisierungs-<br />
Gesundheitsökonomie Makroökonomie und Makroökonomische Zukunft der EU (Ver- Innovationsökonomie<br />
gebiete<br />
und -politik<br />
europäische Wirt- Studien<br />
fassungsentwicklungschaftspolitik<br />
und Erweiterung)<br />
Finanzwirtschaft Arbeitsmarkt, Ein- Ökonomische Inte- Außenbeziehungen Internetökonomie<br />
kommen und soziale gration<br />
der EU<br />
Sicherheit<br />
Internationale Wirt- Industrieökonomie, EU-Erweiterung Wirtschafts- und Wäh- Internationale Wirtschaft<br />
Innovation und int.<br />
rungsunionschaft<br />
Wettbewerb<br />
Arbeitsmarkt und Strukturwandel und Industrie und Handel Kapitalmarkt<br />
Sozialsysteme Regionalentwicklung<br />
Finanzwissenschaft Umwelt, Landwirt- Ausländ. Direktinves-<br />
und -politik<br />
schaft und Energie titionen<br />
374<br />
Arbeitsmärkte und<br />
Sozialsysteme<br />
Strukturwandel und<br />
neue Technologien<br />
Landwirtschaft<br />
Regionale Entwicklung
Vergleich der Schweizer Institutionen Tab. 17. 3<br />
Graduate Institute<br />
for International<br />
Economics<br />
Genf<br />
(Universität)<br />
SIAW St. Gallen<br />
- Schweizer<br />
Institut für die<br />
Außenwirtschaft<br />
CREA - Institute<br />
of Applied Macroeconomics<br />
Lausanne<br />
BAK Basel<br />
Economics<br />
Econcept Zürich KOF Zürich<br />
Konjunkturforschungsstelle<br />
der ETH<br />
(Universität)<br />
World Trade<br />
Institute Bern<br />
(Universität)<br />
(Universität)<br />
(Universität)<br />
Mitarbeiter 11 14 42 20 5 25 11<br />
Ökonomen 8 2 32 13 3 22 8<br />
Internationale Ök. 4,0 0,3 10,7 6,5 1,5 7,3 8,0<br />
Lehre<br />
Forschung und<br />
Consulting<br />
Wirtschaftsforschung<br />
Wirtschaftsforschung<br />
Wirtschaftsforschung<br />
Forschung,<br />
Beratung,<br />
Projektmanage-<br />
Art/Ausrichtung Forschung und<br />
Lehre<br />
ment<br />
Aussenwirtschaft<br />
Regionale und<br />
<strong>internationale</strong><br />
Analysen und<br />
Prognosen<br />
Branchenprognosen<br />
für<br />
Triade<br />
Gesamtwirtschaftliche<br />
Modelle und<br />
Analysen<br />
Energie, Verkehr,<br />
Umwelt<br />
Internationales<br />
Handelsrecht<br />
Spezialisierunggebiete<br />
Schweiz<br />
Wirtschaftspolitik<br />
und<br />
Ökonometrie<br />
Makroökonomie<br />
und Angewandte<br />
Quantitative<br />
Regionen in<br />
Europa<br />
Internationale<br />
Wirtschaft<br />
Ökonomie Public Management<br />
Methoden<br />
LINK-Modell Arbeitsmarkt<br />
und Ökonometrie<br />
Wirtschafts-,<br />
Finanz- und<br />
Sozialpolitik<br />
Arbeits- und<br />
Wohnungsmarkt,Wettbe-<br />
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
werbsfragen<br />
Auftragsforschung<br />
Innovation,<br />
Wachstum und<br />
Beschäftigung<br />
Soziale Sicherheit,<br />
Integration<br />
und Beteiligung<br />
Wissenschaftsmanagement<br />
Marktdynamik<br />
und WettbewerbKonjunkturumfragen<br />
375
Vergleich der niederländischen Institutionen Tab. 17.4<br />
LEI - Agricultural<br />
economics<br />
research<br />
Institute Wageningen<br />
ESI-VU - Economic<br />
and<br />
Social Institute<br />
of the Free<br />
University<br />
IVO - Development<br />
Research<br />
Insitute<br />
(Universität)<br />
GLOBUS - Institute<br />
for Globalization<br />
and<br />
Sustainable<br />
Development<br />
CentER Applied<br />
Research<br />
(Universität)<br />
OCFEB -<br />
Research<br />
Centre for Economic<br />
Policy<br />
(Universität)<br />
SEO -<br />
Amsterdam<br />
Economics<br />
CPB -<br />
Central Planning<br />
Bureau<br />
376<br />
Mitarbeiter 196 41 27 14 14 11 35 300<br />
Ökonomen 101 34 23 13 12 8 15 210<br />
Internationale Ök 17 3,4 2,3 0,5 4,0 5,3 4,3 15<br />
Art/Ausrichtung Forschung Forschung/ Forschung Forschung Forschung Forschung Forschung/ Forschung<br />
Consulting<br />
Consulting<br />
Spezialisierung Arbeitsmärkte Arbeitsmarkt- Märkte und 13 Gebiete Globalisie- Arbeit Ländl. Agro-Busi-<br />
und Sozialökonomie Wettbewerb<br />
rung<br />
Haushalte in nessstaat<br />
und Bildung<br />
Entwicklungsländern<br />
Kurzfristige Soziale Umweltöko- darunter: NachhaltigEinkommens- Firmen und Soziale und<br />
Analysen und Sicherheit nomieInvestitionsrikeitverteilung Arbeiter im wirtschaftli-<br />
Steuerfragen<br />
sikeninternationache<br />
Studien<br />
len Umfeld in der Landwirtschaft<br />
Wachstum, Regionen und Wissen und<br />
New GoverGlobalisie- KMUs in<br />
Struktur- Transport Innovation<br />
nancerungEntwicklungswandel und<br />
ländernWissensöko-<br />
(Universität)<br />
(Universität)<br />
nmie<br />
Ursachen von<br />
Produktivitäts-<br />
Europäische<br />
Integration<br />
Regulierung<br />
und Wettbe-<br />
Wettbewerb<br />
und Regulie-<br />
wachstum<br />
werbspolitik<br />
rung<br />
Altern Risikomanagement<br />
im<br />
Primärgüterbereich<br />
Amsterdam<br />
Aviation<br />
Economics<br />
Physische<br />
Aspekte<br />
(Mobilität,<br />
Infrastruktur,<br />
etc.)<br />
Armut, Schulbildung<br />
und<br />
Gesundheit<br />
Internationale<br />
Wirtschaft<br />
Bildung
Vergleich der dänischen Institutionen Tab. 17.5<br />
CBS - Dep. of<br />
Industrial Economics<br />
and Strategy,<br />
Copenhagen<br />
Business School<br />
(Universität)<br />
IKE - Innovation,<br />
Knowledge and<br />
Economic Dynamics<br />
Aalborg<br />
(Universität)<br />
Danish Insitut for<br />
Studies in Research<br />
and Research Policy<br />
(Universität)<br />
Oxford Research CEBR - Centre for<br />
Economic and<br />
Business Research<br />
Copenhagen<br />
Economics<br />
Mitarbeiter 3 44 25 20 29 39<br />
Ökonomen 3 6 16 7 15 20<br />
Internationale Ök. 1,2 1,5 6,4 1,8 5,0 10,0<br />
Art/Ausrichtung Consulting Consulting Forschung Forschung Forschung und Forschung und<br />
Lehre<br />
Lehre<br />
Spezialisierung Klimapolitik Wohlfart und Wirtschaftswachs- Forschung über Evolutionäre Wirt- Technologie und<br />
Kompetenz tum<br />
Forschung schaftsmodelle Strategie<br />
Wettbewerbs- Industrialisierung HumankapitalbilForschungssta- Theorie der Firma Organisation<br />
politik<br />
und Regionalentdungtistiken wirtschaftlicher<br />
wicklung<br />
Aktivitäten<br />
Umweltökonomie Benchmarking Innovation and F&E Messungen Nationale Innovati-<br />
von dänischen Unternehmertum<br />
onssysteme<br />
und europäischen<br />
Arbeitsplätzen<br />
Internationaler<br />
Handel<br />
Wissenschaft und<br />
Gesellschaft<br />
Corporate Governance<br />
Regional-öknomie Nachhaltige<br />
Entwicklung und<br />
Corporate Governance<br />
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
Wettbewerbsfähigkeit<br />
Globalisierung<br />
und Europäische<br />
Regulierungsfragen<br />
Integration<br />
Soziale Sicherheit Ökonomische<br />
und ökologische<br />
Themen<br />
377
Vergleich der schwedischen Institutionen Tab. 17.6<br />
Konjunkturinstitutet Institute for Internatio- Trade Union Institute SITE - Stockholm IUI - Research Institute<br />
nal Economic Studies (Universität) School of Economics of Industrial Economics<br />
(Universität)<br />
(Universität)<br />
Mitarbeiter 60 39 14 18 30<br />
Ökonomen 36 15 11 8 26<br />
Internationale Ök. 9,0 7,5 4,1 4,8 8,7<br />
Art/Ausrichtung Forschung Forschung Forschung Forschung/Politikbe- Forschung<br />
ratung<br />
Spezialisierung Prognosen Makroökonomische Arbeitsmarktstudien TransformationslänWissensakkumulie- Analyse offener Volks- (17 Projekte)<br />
der: Institutionelle rung, Humankapital<br />
wirtschaften<br />
Herausforderungen und Wirtschaftswachstum<br />
378<br />
Unternehmensorganisation<br />
und Internatio-<br />
Außenhandel Makroökonomische<br />
Studien (2 Projekte)<br />
Geschäftsklima-<br />
Erhebungen<br />
nale Spezialisierung<br />
Ökonomie des Wohlfartsstaats<br />
Änderungen in Strukturwandel<br />
und Wachs-<br />
Makroökonomie Allgemeine Wirtschaftstheorie<br />
und<br />
tum (3 Projekte)<br />
Methodologie<br />
Umweltökonomie Einkommensverteilungs-<br />
und Vermögensstudien<br />
(2 Projekte)
Literaturverzeichnis<br />
Michael Landesmann, Julia Wörz<br />
Baldwin, R., Venables, A. (1995), Regional Economic Integration, Ch. 31, in: Handbook of International<br />
Economics, hrsg. von Grossman, G., Rogoff, K., North Holland Elsevier.<br />
Brander, J. A. (1995), Strategic Trade Policy, Ch.27, in: Handbook of International Economics,<br />
hrsg. von Grossman, G., Rogoff, K., North Holland Elsevier.<br />
Feenstra, R., Hanson, G. (2001), Globalisation, Production Sharing and Rising Inequalities, A<br />
Survey of Trade and Wages, NBER, WP 8377.<br />
Fujita, M., Krugman, P., Venables, A. (1999), The Spatial Economy, Cities, Regions and International<br />
Trade, MIT Press, Cambridge Mass.<br />
Fujita, M., Thisse, J-F. (2002), Economics of Agglomeration, Cities, Industrial Location and<br />
Regional Growth, Cambridge Univ. Press.<br />
Grossman, G., Helpman, E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press,<br />
Cambridge Mass.<br />
Grossman, G., Helpman, E. (2002), Interest Groups and Trade Policy, Princeton University<br />
Press.<br />
Marin, D., Verdier, T. (2002), Globalisation and the ‚New Enterprise’, CEPR Discussion Paper<br />
3640, London.<br />
Lawrence, R., Bressand, A., Ito, T. (1996), A Vision for the Economy: Openness, Diversity and<br />
Cohesion, Brookings, Washington.<br />
Markusen, J. (1995), The boundaries of multinational enterprises and the theory of international<br />
trade, Journal of Economic Perspectives, vol. 9 (2).<br />
Markusen, J. (2002), Multinational Firms and the Theory of International Trade; MIT Press.<br />
Morgan, M.S. (1992), The History of Econometric Ideas, Cambridge Univ. Press.<br />
Neary, P. (2003), Globalisation and market structure, in: Journal of the European Economic<br />
Association, April-May 2003, S. 245-271.<br />
Panagariya, A. (2000), Preferential Trade Liberalization: The Traditional Theory and New Developments,<br />
in: Journal of Economic Literature, Vol. 38 (2) S. 287-331.<br />
Anmerkungen<br />
* Univ.-Prof. Dr. Michael Landesmann ist wissenschaftlicher Leiter des Wiener Instituts für<br />
Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) und Professor für Volks<strong>wirtschafts</strong>lehre an der<br />
Johannes Kepler Universität Linz, Dr. Julia Wörz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am wiiw<br />
und Lehrbeauftragte an der Universität Wien.<br />
1 Die Bezeichnung Experten bzw. <strong>internationale</strong> Ökonomen erfasst lediglich jene Wissenschaftler,<br />
welche in den ausgewählten Instituten tätig sind. Daher werden all jene Experten,<br />
welche ausschließlich an den Universitäten forschen – somit der Großteil der <strong>internationale</strong>n<br />
Ökonomen, welche Grundlagenforschung betreiben – hier nicht berücksichtigt. Würde man<br />
379
den Vergleich weiter ziehen und Universitätsinstitute ebenfalls hereinnehmen, ergäbe sich<br />
vermutlich ein anderes Bild.<br />
2 Die Bezeichnung <strong>internationale</strong> Ökonomen wird stellvertretend für Wissenschaftler verwendet,<br />
welche in empirischen Forschungsinstituten im Bereich Internationale Wirtschaftsbeziehungen<br />
wie oben definiert arbeiten.<br />
3 Im Rahmen dieses Artikels war es nicht möglich, vergleichendes Datenmaterial über den<br />
Output der einzelnen Institute zu recherchieren.<br />
4 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Autoren dieses Beitrags mit der österreichischen<br />
Situation am besten vertraut sind. Genau genommen müsste ein gewisser Verzerrungsfaktor<br />
in Abzug gebracht werden, welcher die Tatsache reflektiert, dass die Wahrscheinlichkeit, alle<br />
relevanten Forschungseinrichtungen erfasst zu haben, für Österreich höher ist. Aufgrund der<br />
Tatsache, dass auch ohne Berücksichtigung dieses Faktors die Ergebnisse für Österreich<br />
nicht übermäßig gut waren, wurde von einer derartigen zusätzlichen Korrektur Abstand<br />
genommen.<br />
380
18 DAS „KLEINE“, DAS „GROSSE“ UND<br />
DAS „NEUE LERNEN“<br />
Harald Steindl*<br />
Der Weg des Daxue 1 besteht darin, die klare moralische Kraft zum Strahlen zu<br />
bringen, das Volk zur moralischen Erneuerung zu bewegen und beim Guten in<br />
seiner höchstvollendeten Form zu verharren. (Konfuzius)<br />
Zukunft beginnt in den Schulen. Diese schlichte Feststellung enthält nicht erst seit der<br />
Veröffentlichung der „PISA-Studie“ der OECD unglaubliche Sprengkraft. Während in<br />
Deutschland der nationale Notstand ausgerufen wurde, verfiel Österreich dem „Cordoba-Syndrom“.<br />
2 Obgleich die nackten Zahlen in allen Kategorien einen deutlichen<br />
Abstand zu den Punktbesten signalisierten, brach dank der klaren Distanzierung<br />
beinahe aller deutschen Bundesländer schriller Jubel aus. 3 Von New York bis Tokio<br />
überraschte die Fallhöhe der Neugriechen Hölderlins 4 . Das idealistische Bildungspathos<br />
war im harten Widerspruch mit den Erziehungswirklichkeiten zerstoben. 5 Wie<br />
konnte das großartige Erbe der Gebrüder Humboldt und der Weimarer Klassik so rasch<br />
verspielt werden, der geistige Humus für Legionen von Dichtern, Denkern, Musikern,<br />
Pädagogen, Juristen, Technologen und Erfindern 6 im Wechselspiel der Bonner und<br />
Berliner Republik so jäh veröden?<br />
Gerade Österreich hatte seit dem Vormärz voller Bewunderung gen Norden geblickt<br />
und seine Universitäten, Gymnasien, gewerblichen Lehranstalten, Grundschulen<br />
und Kindergärten immer wieder an deutschen Vorbildern orientiert. 7 Die gemeinsame<br />
Geschichte, Sprache und Kultur hatte die intensive Zusammenarbeit der Unterrichtsbehörden<br />
und Kultusministerien bis hin zu den Rechtschreibreformen und der gegenseitigen<br />
Anerkennung von Abschlüssen gefördert. Die bayrische Staatskanzlei sorgte<br />
für die Vermittlung. Das behutsame Nachahmen und Agieren im Windschatten des<br />
„Wirtschaftswunders“ und in den Spuren Ludwig Erhards war lange Zeit bequem und<br />
risikolos. Die Erkenntnis „Deutschland ist kein Bildungsland mehr.“ 8 ist eine Hiobsbotschaft<br />
für ganz Mitteleuropa, ein Fanal für Wissenschaft und Forschung. Nach dem<br />
ersten Schrecken dämmert das wahre Ausmaß der Misere: Wo liegen – jenseits des<br />
Desasters der Bundesrepublik und der Schweizer Eigenbrötelei 9 – unsere ureigenen<br />
Perspektiven?<br />
18.1 Schlüsselqualifikationen für die Wissensgesellschaft<br />
Die Brisanz von PISA 2000 10 und ihren Folgestudien verbirgt sich hinter der Fragestellung.<br />
Die Testreihe überprüft nicht die Erfüllung der Vorgaben aus Lehrplänen,<br />
Verordnungen für das Unterrichtswesen und Gesetzen, wie sie von Schulbehörden<br />
381
traditionell überwacht werden. Die OECD will wissen, „wie gut die Schüler/innen in den<br />
drei getesteten Kompetenzbereichen jene allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten<br />
erworben haben, die sie später als Erwachsene benötigen werden.“ 11 Den zentralen<br />
Referenzpunkt liefert ein dynamisches Modell des lebenslangen Lernens. Welche<br />
Basisqualifikationen sind erforderlich, damit eine erfolgreiche Anpassung an veränderte<br />
Gegebenheiten, Arbeitsbedingungen, Zeitumstände und kritische Herausforderungen<br />
gelingt. Was braucht ein 15/16-Jähriger, um im realen Leben, in Staat, Wirtschaft und<br />
Gesellschaft bestehen zu können – und nicht nur unmittelbar nach seinem Abschluss,<br />
sondern nach Möglichkeit bis ins hohe Alter?<br />
Dieser ambitionierte Ansatz für eine weltweit angelegte, vergleichende Untersuchung<br />
verdient nach Inhalt und Methode höchste Anerkennung. OECD-Koordinator Schleicher<br />
und seinen Länderteams kommt das Verdienst zu, im Feld der empirischen Sozialforschung<br />
eine Pionierleistung vollbracht zu haben. Die Konzeption widerlegt im Keim<br />
die Unterstellung, die Tests verfolgten nur den Zweck, den Leistungsdruck zu erhöhen<br />
und die ökonomische Verwertbarkeit von Bildung zu erzwingen. Zur Illustration:<br />
„Lesekompetenz“ bedeutet, „geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über<br />
sie zu reflektieren, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial<br />
weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.“ 12 Der bekannte<br />
Spruch aus dem Zitatenlexikon für akademische Zeremonien und Abschlussfeiern:<br />
„Non scholae sed vitae discimus“ sollte auf seinen Realitätsgehalt hin überprüft werden.<br />
„Quod erat demonstrandum!“<br />
18.1.1 Zur Leistungsfähigkeit des Schulsystems<br />
Österreich konnte sich in der Punktetabelle zu PISA 2000 jeweils über dem OECD-<br />
Durchschnitt einreihen und landete in den Rankings am zehnten Platz bezüglich<br />
Lesekompetenz, am elften hinsichtlich mathematischer Grundbildung und im naturwissenschaftlichen<br />
Feld am achten Platz, d.h. in Summe jeweils am Ende des obersten<br />
Drittels. Die Ernüchterung kam mit der Lektüre des Kleingedruckten. 13 Unsere Schulen<br />
bieten mittlere Qualitäten zu exorbitanten Preisen. Österreich liegt bei den Ausgaben<br />
pro Schüler an der Spitze, beschäftigt ein Heer von teuren Beamten in der Schulaufsicht,<br />
leistet sich bei sinkenden Schülerzahlen eine nach dem Anciennitätsprinzip gut<br />
besoldete, in Summe überalterte Lehrerschaft, deren Pensionsbezüge noch Jahrzehnte<br />
die Haushalte belasten werden. Am Aufwand gemessen fallen die Ergebnisse eher<br />
bescheiden aus und auch die Qualität des Unterrichts gilt als dürftig.<br />
Die systembedingten Mängel sind in der Analyse der Zukunftskommission des Bundesministeriums<br />
für Bildung, Wissenschaft und Kunst (BMBWK) pointiert aufgelistet. 14<br />
Heterogene Angebote, suboptimale Schulwahl, schwierige Rahmenbedingungen (hohe<br />
382
Harald Steindl<br />
Regelungsdichte, geringe Autonomie, starre Strukturen) und bescheidene Professionalität<br />
der Lehrer/innen werden als Ursachen genannt. Die Fragen einer gerechten<br />
Leistungsbeurteilung seien ebenso ungelöst, wie die Dominanz der Noten ein nachhaltiges<br />
Lernen unterlaufe. Abweichend von den meisten OECD-Ländern zeigen sich<br />
bei den heimischen Schülern starke Einflüsse des kulturellen Milieus, der sozialen<br />
Herkunft und des Geschlechts. Besonders auffällig seien die großen Leistungsunterschiede<br />
innerhalb gleicher Schularten in Verbindung mit regionalen Differenzen. „Diese<br />
Ungleichheiten begünstigen in Summe Kinder aus Großstädten und aus höheren<br />
soziokulturellen Milieus.“ 15 Bis zum Ende der Volksschule dominiere eine positive<br />
Grundstimmung. Ab dem 10. Lebensjahr machen sich negative Entwicklungen im<br />
Bereich Motivation (Rückgang der Freude am Lernen) und Befinden (Angst, Stress,<br />
psychosomatische Beschwerden, Nachhilfe) immer stärker bemerkbar. Frustration,<br />
Verhaltensauffälligkeiten und Burn-out-Phänomene breiten sich aus.<br />
18.1.2 Mehr als ein Armutszeugnis<br />
Besondere Sorgen muss die erschreckende Leseschwäche unter den 15-Jährigen<br />
wecken, rund 4 % sind nach neun Jahren Schulpflicht Analphabeten geblieben, über<br />
10 % sind nicht in der Lage, zusammenhängende Texte in ihrem Sinn zu erfassen und<br />
zu verstehen. Die Zukunftskommission geht davon aus, dass „etwa 18 – 20 % der 16-<br />
Jährigen als schlechte Leser/innen einzustufen sind, die aufgrund ihrer eingeschränkten<br />
Lesekompetenz kaum zu einem selbstständigen Bildungserwerb in der Lage sind.“ 16<br />
Daraus resultiere eine „große Zahl von Jugendlichen, die jährlich mit fehlenden oder<br />
unzureichenden Basisqualifikationen einen Einstieg in den Arbeitsmarkt versuchen<br />
und häufig daran scheitern.“ 17 Von „Chancengleichheit und Privilegienabbau“ – den<br />
Lieblingsvokabeln der 68er-Generation – keine Spur.<br />
Unter Otto Glöckels 18 ideologischen Nachfahren wirken sich die sozialen Unterschiede<br />
besonders gravierend aus. Die gesellschaftlichen Benachteiligungen von Kindern aus<br />
Arbeiterhaushalten oder von Alleinerzieher/innen, von Flüchtlingen und Asylanten,<br />
von Schüler/innen nichtdeutscher Muttersprache werden weder durch städtische<br />
Sozialprojekte noch durch Integrationsprogramme bzw. durch gezielte Förderungen<br />
des Wiener Stadtschulrats in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern abgebaut. Wer<br />
in eine Sonderschule verschlagen wird, der gerät in einen Teufelskreis aus Defiziten<br />
und Kompetenzmängeln, die sein gesamtes Fortkommen überschatten: Ein Stigmatisierungsprozess,<br />
der durch die Selektionsmechanismen auf allen Ebenen noch<br />
verstärkt wird. Das soziale Milieu und die familiären Beziehungen entscheiden über<br />
Lebenschancen und beruflichen Werdegang.<br />
383
Wenn ein Schulsystem bei mehr als einem Zehntel – nach PISA-Kriterien sogar bei<br />
rund einem Sechstel – seines Klientels mit dem primären Auftrag, die wichtigsten<br />
Kulturtechniken zu vermitteln, versagt, dann hat dies nicht nur für die Betroffenen<br />
und ihr persönliches Umfeld, sondern für das gesamte Gemeinwesen langfristige<br />
Konsequenzen. Jugendliche Analphabeten finden kaum eine Lehrstelle, sie haben<br />
damit auch auf den Arbeitsmärkten im Wandel keine Perspektive. Wer den Einstieg<br />
in eine geregelte Berufsausbildung nicht schafft, ist für die Arbeitswelt fast schon<br />
verloren. Ein Leben von der Sozialhilfe, am Tropf der Ämter und Behörden, ist vorgezeichnet.<br />
Stimmt die Einschätzung 19 , dass die Pflichtschulen derzeit per anno mehr<br />
als 3.000 Absolvent/innen ohne das notwendigste Rüstzeug und knapp 10.000 mit<br />
einem äußerst dürftigen Fundament entlassen, dann summiert sich die Zahl der für die<br />
Volkswirtschaft nur schwer Beschäftigungsfähigen in 40 Jahren des durchschnittlichen<br />
Erwerbslebens auf über eine halbe Million Menschen. Eine erbärmliche Lage, die<br />
sich, wie die Sozialforschung diagnostiziert, von Generation zu Generation milieuhaft<br />
vererbt, ist vorgezeichnet.<br />
Ohne energische Gegenmaßnahmen dürfte es an die 250.000 Mitbürger/innen auf<br />
Dauer verwehrt sein, jemals einen eigenen Beitrag zur Sicherung eines ausreichenden<br />
Einkommens zu leisten; sie sind – und das macht mehr als betroffen – von Geburt an<br />
von staatlicher Unterstützungen abhängig. Eines der wichtigsten Menschenrechte, das<br />
Grundrecht auf Erwerbsfreiheit, d.h. sich durch eigene Arbeit Unterhalt verschaffen<br />
zu können, wird durch ein öffentliches Schulwesen nicht befestigt, sondern – wie die<br />
Kritiker betonen – ausgehöhlt, in Summe ein skandalöser Zustand, eines sozialen<br />
und demokratischen Rechtsstaats unwürdig. Wie kann dieser Verwahrlosung und<br />
Marginalisierung begegnet werden?<br />
Eklatante Mängel in den Schlüsselqualifikationen zeigen sich bereits beim Einstieg in<br />
einen Lehrberuf. Wenn Jugendliche Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz<br />
zu finden, dann liegen die Gründe nicht nur in der lauthals beklagten, sinkenden<br />
Bereitschaft der Unternehmen, Lehrlinge überhaupt zu beschäftigen und sich den<br />
Mühen des Berufsbildungsrechts zu unterziehen, immer öfter wird von Unternehmerseite<br />
über unzureichende Kenntnisse und gravierende Defizite berichtet. Das Institut<br />
für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) hat in Verbindung mit dem nationalen<br />
PISA-Zentrum jüngst eine Studie über Eingangsqualifikationen von Lehranfängern 20<br />
veröffentlicht und deutlich gemacht, dass gerade drei Viertel der Mädchen und nur<br />
zwei Drittel der männlichen Pflichtschulabsolventen über ein ausreichendes Wissen<br />
und Können verfügen, um die gestiegenen Anforderungen einer Lehre zu bewältigen.<br />
42 % der Jugendlichen mit Laufbahnverzögerungen (Repetenten) sind sehr schwache<br />
Leser und kommen damit für viele ihrer Wunschberufe nicht in Betracht. Wissens- und<br />
informationsbasierte Tätigkeiten sind ihnen ohne gezielte Förderungen und Kurse<br />
384
Harald Steindl<br />
völlig verwehrt. Während der Bedarf der Wirtschaft an gut qualifizierten Arbeitskräften<br />
kontinuierlich steigt 21 , drohen Arbeitslose ohne Abschluss jede Einstiegsmöglichkeit<br />
zu verlieren.<br />
Die Autoren der ibw-Studie setzen daher auf die „Verdeutlichung der wesentlichen<br />
Standards“ an den „institutionellen Nahtstellen“ der Bildungslaufbahnen. Um die Ergebnisse<br />
zu verbessern, sollten die seit Jahren praktizierten „Auffangnetze“ evaluiert<br />
und bewährte Modelle „auf Dauer gestellt“ werden. Entscheidend dürfte jedoch sein,<br />
„ob und in welchem Ausmaß man vor der Ausbildung ausreichend Motivation erreichen<br />
kann, um Bildungsdefizite (z.B. Rechnen und Deutsch mündlich) nachzuholen oder ob<br />
nur in integrierter Form ausreichend Lernmotivation aufzubauen ist.“ 22 Die Befragung<br />
der Lehrbetriebe und Berufsschüler/innen weist auf die entscheidenden Prägungen<br />
in Kindheit und Adoleszenz zurück. Ohne Neugierde, Freude am Unterricht, Lust<br />
auf Lernen und einer spielerischen Annäherung an Kommunikation und Information<br />
endet schulische Erziehung in schweren Frustrationen, psychischen Störungen und<br />
sozialer Verweigerung. 23<br />
18.1.3 Nachdenken statt Nachsitzen<br />
Die OECD-Diagnose hat die Verantwortlichen im Bund und in den Ländern alarmiert.<br />
Die zuständige Bundesministerin Elisabeth Gehrer rief im Oktober 2002 die<br />
Aktion „LESEFIT“ mit dem Ziel aus, bis zum Jahr 2010 die Zahl der 15-Jährigen mit<br />
Leseschwierigkeiten um 20 % zu senken. Über 60.000 Buben und Mädchen in der<br />
dritten Schulstufe wurden Tests unterzogen, um Schwächen zu erkennen und mittels<br />
Förderunterricht Freude am Lesen zu wecken. 24 Im Frühjahr 2003 wurde die bereits<br />
mehrfach zitierte Zukunftskommission mit dem Auftrag eingesetzt, Eckpunkte eines<br />
Innovationskonzepts für das österreichische Schulwesen zu erarbeiten. Sie stellte im<br />
Herbst 2003 ihre Empfehlungen für eine umfassende strategische Neuausrichtung<br />
zur Diskussion: Österreich befinde sich auf dem Weg in die „Wissensgesellschaft“<br />
in einer Phase schnellen strukturellen Wandels in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher<br />
und kultureller Hinsicht. Im Zeichen der europäischen Integration habe ein scharfer<br />
Wettbewerb auch die Institutionen des Bildungswesens erfasst. Unternehmen sehen<br />
in der Qualität und Vielfalt des Angebots einen wichtigen Standortfaktor. „Die Schule<br />
muss die Basis legen, um mit diesem Wandel, der alle Lebens- und Arbeitsbereiche<br />
erfasst, erfolgreich umgehen zu können – sowohl in der eigenen Lebensplanung als<br />
auch als Bürger und als Bürgerin eines Landes. Gerade in der Wissensgesellschaft<br />
ist Bildung ausschlaggebend für die Zukunft der Kinder.“ 25<br />
„Employability” lässt sich nicht allein über Auflagen an das „duale System“ sichern,<br />
wie sie von Gewerkschaftsseite immer wieder gefordert werden. Weder Quotenrege-<br />
385
lungen noch Fonds und Abgaben können jene Zugangskriterien, die der Arbeitsmarkt<br />
setzt, mit bürokratischen Mitteln überwinden. Wer erkennbare Schwächen in der Berufsausbildung<br />
als Vorwand nimmt, um eine Verstaatlichung zu propagieren, hat die<br />
Grundvoraussetzungen des österreichischen Modells, das EU-weit als vorbildlich gilt,<br />
nicht verstanden. Der Praxisbezug sichert nicht nur <strong>wirtschafts</strong>nahe Erfahrungen und<br />
realistisches Lernen im sozialen Kontext, er stiftet die entscheidende Eigenmotivation<br />
zur besseren (Selbst-)Orientierung in der Arbeitswelt. Je früher diese Zusammenhänge<br />
den Schulalltag prägen, desto größere Chancen bestehen für benachteiligte Gruppen.<br />
In der didaktischen Brücke zum gesellschaftlichen Umfeld liegt auch der Schlüssel<br />
zur Professionalisierung der Lehrerschaft. 26<br />
18.1.4 Das neue Fundament: Lernen lernen<br />
In der wissenschaftlichen Diskussion herrscht von Neuseeland über Kanada, die<br />
Niederlande und Frankreich bis nach Skandinavien ein erstaunlicher Gleichklang.<br />
Obzwar Fragen der Sprachvermittlung, Schulerziehung, Bildung und Kultur zu den<br />
Kernbereichen nationaler Identität zählen, hat sich bei aller Betonung der Eigenständigkeit<br />
und Verantwortung die Meinung durchgesetzt, dass moderne Gemeinwesen<br />
– gerade aus dem Respekt vor den historischen Wurzeln, spezifischen Entwicklungen<br />
und Prägungen heraus – verpflichtet sind, ihren Bürger/innen ein Höchstmaß an<br />
Lebenschancen zu bieten, d.h. freien Zugang zu den Möglichkeiten einer globalen<br />
Wissensgesellschaft zu gewährleisten. Die „Millenium-Declaration“ der UNO vom<br />
8. September 2000 hat die Regierungen der Welt aufgerufen, „to ensure that, by the<br />
year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full<br />
course of primary schooling and that girls and boys will have equal access to all levels<br />
of education.“ 27 Denn die Chancen der Globalisierung können nur genutzt werden,<br />
wenn die Potenziale der Informationstechnologien ungehindert verfügbar sind.<br />
Nach den Vorstellungen der Zukunftskommission kommt es vor allem darauf an, Schule<br />
und Unterricht systematisch zu verbessern, klare Ziele und sichtbare Orientierung zu<br />
geben, Handlungs- und Entscheidungsspielräume zu schaffen, insbesondere den<br />
schulorganisatorischen Rahmen zu straffen, die Professionalisierung (Didaktik, Methodenvielfalt)<br />
des Lehrberufs zu stärken und seine Attraktivität zu erhöhen, Qualität<br />
auf allen Ebenen zu prüfen und nachhaltig zu sichern und nicht zuletzt Unterstützungssysteme<br />
im Umfeld einzurichten, d.h. ein Vertrauensverhältnis zu Eltern, Behörden,<br />
lokalen Vereinen, sozialen Initiativen, Betrieben etc. zu pflegen und Partnerschaft zu<br />
leben.<br />
Die PISA-Studie belegt, dass die „positive Einstellung der Schülerinnen und Schüler<br />
eine notwendige Voraussetzung für schulischen Erfolg“ darstellt. Sie müssen „über<br />
386
Harald Steindl<br />
Motivation und Selbstvertrauen verfügen und Lernstrategien beherrschen, die sie<br />
befähigen, ihre eigene Lerntätigkeit zielbewusst zu verfolgen und zu regulieren.“ 28 Die<br />
Lernansätze haben einen „noch größeren Einfluss auf die Leistung als der familiäre<br />
Hintergrund.“ 29 Für Bildungssysteme lohne es generell, die Fähigkeit zu effektivem<br />
und selbst reguliertem Lernen zu fördern. Besonderes Gewicht komme verstehensorientierten<br />
Lernstrategien zu. Im Feld der instrumentellen Motivation sei nachweisbar,<br />
dass sich Jugendliche, die durch Faktoren wie berufliche Aussichten geleitet werden,<br />
eher Lernziele setzen und deren Realisierung überwachen, „womit sie sich selbst<br />
eine bessere Chance für die Erzielung guter Leistungen geben.“ 30 „Deshalb sollten<br />
Schulen und Lehrer sorgfältig evaluieren, wo das größte Potenzial für die Förderung<br />
einer stärkeren Motivation besteht und welche Art von Motivation am ehesten geeignet<br />
ist, die Lernaussichten und -leistungen jedes einzelnen Schülers wirklich positiv zu<br />
beeinflussen.“ Die Techniken zur Bewältigung von Aufgaben können unterstützt und<br />
verändert werden. Diese Erkenntnis ist die wichtigste Botschaft, um die familiär und<br />
sozial bedingten Abstände zu verringern.<br />
Wie man eigenständig lernt, – so lautet die Kernaussage – werde nur selten vermittelt.<br />
31 Auf professionelle Hilfen sind in jedem Fall Jugendliche mit schwächeren<br />
Lernmerkmalen angewiesen. PISA zeigt, wie diese identifiziert werden können. Die<br />
Entwicklung geeigneter Instrumentarien und adaptiver Förderungen zählt zu den<br />
zentralen Aufgaben einer Bildungspolitik der Zukunft. Großer Nachholbedarf herrsche<br />
auch in der Forschung. Jede Reform benötige einen breit angelegten Dialog mit der<br />
Öffentlichkeit: „Über Bildung reden!“ sei daher das Gebot der Stunde. 32<br />
18.2 Wa(h)re Bildung<br />
Am 2. April 2004 demonstrierten hunderte Schüler/innen in Wien gegen „neoliberale<br />
Reformen“ und Studiengebühren. Die Losung: „Unsere Bildung ist keine Ware“ zeugt<br />
allerdings von erheblichen, nicht nur ideologischen bedingten Fehleinschätzungen.<br />
Wer sich implizit auf Schleiermachers Traktat „Über den Beruf des Staates zur Erziehung“<br />
aus 1814 stützt, sollte sich nicht nur die Legitimation obrigkeitlicher Züchtigung<br />
und Drills bewusst sein, sondern auch die Konsequenzen für das Unterrichtswesen<br />
bedenken. 33 Öffentliche Anstalten werden durch Normen beherrscht und nach deren<br />
Vorgaben beaufsichtigt. Selbst die Einführung der Schulpflicht unter Maria Theresia<br />
verfolgte militärische Ziele. Im Heerwesen wurden Soldaten gebraucht, die schriftliche<br />
Befehle lesen und Meldungen weitergeben konnten. Diese Intention wird auch aus<br />
der Anweisung an die Gemeinden deutlich, als Lehrer in erster Linie Militärinvalide<br />
zu beschäftigen.<br />
387
Bildung wird üblicher Weise als die Form definiert, in der sich der Mensch selbst<br />
versteht, sein Leben und Wirken in Auseinandersetzung mit der Umwelt einordnet,<br />
seine Fähigkeiten und Talente voll entwickelt – in letzter Konsequenz ein normativer,<br />
theologisch oder philosophisch fundierter Begriff. Heinz von Foerster hat in seiner Kritik<br />
der traditionellen Pädagogik, die das Kind wie eine triviale Maschine beschreibt und<br />
daher mit dem Rohrstock und Nürnberger Trichter traktiert, den Nagel auf dem Kopf<br />
getroffen. Bildung für die Wissensgesellschaft heißt in seinem Sinn, für eine Vielzahl<br />
von Optionen zu sorgen, Chancen zu eröffnen, Talente zu fördern, Abschied vom standardisierten<br />
Massenunterricht in geregelten und genormten Curricula zu nehmen. 34<br />
18.2.1 Everything – Anything for Sale?<br />
Individuelle Fähigkeiten sind wesentliche Elemente der Persönlichkeit und stehen<br />
unter dem Schutz der Grund- und Freiheitsrechte. Sie sind im Selbstverständnis der<br />
Aufklärung angeboren und unveräußerlich (§ 16 ABGB). Wissen und Können benötigen<br />
jeweils spezifische Bedingungen zur vollkommenen Entfaltung. Ob die Ausprägung<br />
einer unverwechselbaren Persönlichkeit gelingt oder scheitert hängt sehr häufig von<br />
frühkindlichen Erlebnissen ab. Erfinder und Urheber können andererseits die Früchte<br />
ihrer Talente nur genießen, wenn ihnen die Rechtsordnung die Möglichkeiten zur<br />
Verwertung und damit auch zur Kommerzialisierung verleiht. Wie das Verbot des<br />
Nachdrucks ohne ausdrückliche Genehmigung den Autoren erst ab der Mitte des<br />
19. Jahrhunderts die Sicherung ihrer Existenz ermöglicht hat, so stellt die staatliche<br />
Anerkennung von Schul- und Universitätsabschlüssen die Voraussetzung zur Professionalisierung<br />
vieler, insbesondere akademischer, Qualifikationen dar. Kurz gesagt:<br />
Bildung ist eine Investition, im Zeichen der „Knowledge Economy“ die wichtigste Form<br />
einer nachhaltigen Wertschöpfung. Berufliche Aus- und Weiterbildung dient aber nicht<br />
nur der umfassenden Entwicklung jedes Einzelnen, es schafft als „kollektives Kapital“<br />
die Voraussetzungen für Wohlstand, soziale Sicherheit und kulturelle Leistungen.<br />
Dieses „Intelectual Capital“ ist vielen Gefährdungen ausgesetzt. Denn die neuen<br />
Informationstechnologien machen Wissen jederzeit, allerorts und in vielfältiger Weise<br />
verfügbar. Die explosionsartige Vermehrung der Angebote beunruhigt und irritiert. Am<br />
Widerstreit um die Bedeutung des neuen Produktionsfaktors scheiden sich die Geister.<br />
Für die Pioniere der „Knowledge Economy“ gewinnt die Frage, wie sich Zukunft durch<br />
Innovation erringen und auf welchen verschlungenen Wegen sich menschliche Phantasie<br />
managen lässt, an Stringenz. Descartes „cogito ergo sum“ begründet Freiheit<br />
und Autonomie, stiftet Identität und Selbstwertgefühle, es verpflichtet aber auch zur<br />
<strong>politische</strong>n Gestaltung, zur Überwindung des von der Kirche im Mittelalter geprägten<br />
religiös bestimmten Bildungsbegriffs. Lernen wird unter dem Einfluss der Aufklärung<br />
388
Harald Steindl<br />
mit dem Leisten verknüpft und kann zur Grundlage eines Berufes gemacht werden. 35<br />
Doch eine Aufgabe bleibt: „Kenntnisse sind nicht Bildung; Bildung macht reif und frei,<br />
Kenntnisse nicht; sie sind Werkzeuge, die jedes für sich und alle zusammen nichts<br />
Tüchtiges vermögen, aber von der Bildung dem Schaffen dienstbar gemacht werden:<br />
Sie sind Knechte und ihr Herr ist die Bildung.“ 36<br />
Die Explosion des Wissens und die Flut an Informationen stellen nur auf dem ersten<br />
Blick eine Gefährdung der alteuropäischen Traditionen dar. Je drängender Fragen<br />
einer sinnvollen Auswahl und begründeten Selektion werden, desto wichtiger wird<br />
die Fähigkeit zur Unterscheidung und Orientierung, zur Entwicklung von Sichtweisen,<br />
Blickrichtungen und Standpunkten. Im Gegensatz zum Neuhumanismus kann es nicht<br />
(mehr) darum gehen, einen Idealzustand losgelöst von den Mühen des Alltags anzustreben.<br />
In Zeiten tief greifenden Wandels hilft nur das engagierte Ringen um stützende<br />
Koordinatensysteme und auch in Zukunft tragfähige Perspektiven. Während sich in<br />
den Medien die Kulturpessimisten austoben und zur Beschwörung des Untergangs<br />
des Abendlandes versammeln oder als Spähtrupp durch das Niemandsland streifen 37 ,<br />
fürchten die Mitgliedsstaaten der EU, den Anschluss an die Entwicklung in den USA<br />
zu verlieren und mit hoher Arbeitslosigkeit, sozialen Konflikten, Stagflation, Staatsverschuldung<br />
sowie explodierenden Gesundheitskosten den Preis für Überalterung,<br />
versteinerte Strukturen, Mangel an Innovation und Unternehmergeist zu bezahlen. Die<br />
Botschaft an die traditionellen Institutionen des Bildungswesens, an Kultusbehörden,<br />
Schulträger, Lehrer, Universitäten und Weiterbildungseinrichtungen ist unmissverständlich:<br />
Wer sich dem Auftrag verweigert, versündigt sich an den Lebensperspektiven<br />
der Jugend, sabotiert den Zusammenhalt, torpediert die Wirtschaftsentwicklung. Eine<br />
unerträgliche Zumutung an eine humanistische Pädagogik ? Homo non nascitur, sed<br />
fit – fit für die Wissensgesellschaft?<br />
18.2.2 McKinsey kommt – und bildet 38<br />
Im Juni 2001 reagierte das berühmt-berüchtigte Beratungsunternehmen mit einer ungewöhnlichen<br />
Initiative auf die deutschen Jeremiaden: „McKinsey bildet“ ist von dem<br />
Anspruch getragen, nicht länger über Mängel und Fehlentwicklungen zu klagen und<br />
an den Rändern des Systems herumzudoktern, sondern durch beherztes Umsetzen<br />
von Veränderungen zu handeln und zu gestalten. „Wir brauchen eine Blaupause für<br />
ein Bildungssystem der Zukunft und einen Masterplan“ lautete die Botschaft. „Der<br />
Anspruch: Wir wollen die eigene Kompetenz nutzen, die wir sonst als Dienstleistung<br />
unseren Klienten anbieten, um konkrete, berechenbare und umsetzbare Vorschläge<br />
zu Verbesserungen des Bildungssystems zu entwickeln.“ Aus einer Reihe von Werkstattgesprächen<br />
und Kongressen entstanden ein Vier-Punkte-Plan und ein Manifest.<br />
389
Als Resümee präsentierte der McKinsey-Deutschland-Chef Jürgen Kluge ein konkretes<br />
Sanierungskonzept mit dem Titel: „Schluss mit der Bildungsmisere“. 39 Seine Diagnose:<br />
„Deutschland verspielt seine Zukunft, wenn wir es nicht schaffen, das Bildungswesen<br />
durch eine Qualitätsoffensive grundlegend zu erneuern.“ ... Wenn „wir nicht das Tor<br />
zur Zivilisation schließen wollen,“ ... „brauchen wir eine Bildungsexplosion.“ Der Fokus<br />
liegt auf vier Stoßrichtungen:<br />
• Früh investieren, anstatt spät reparieren – am Beispiel der frühkindlichen Bildung;<br />
• konsequente Qualitätsmessung und -sicherung – am Beispiel der Schule;<br />
• mehr Freiräume für Bildungsinstitutionen, ebenfalls am Beispiel der Schule;<br />
• Bildung als Investition verstehen und Investitionen fördern – am Beispiel der<br />
Hochschule. 40<br />
Besonders erstaunlich ist der Schwerpunkt in der Kleinkindphase. Der McKinsey-Chef<br />
sieht hier „überraschende und nicht zu verantwortende Defizite“: Das Angebot im<br />
Vorschulbereich ist unzureichend. Nur für 25 % gibt es eine ganztägige Betreuung,<br />
nur für 7 % der Unter-Dreijährigen Krippenplätze. Die Bildungsbeteiligung der Kinder<br />
aus sozial schwachen Familien ist dramatisch gering. Sind Eltern mehr als drei Jahre<br />
arbeitslos, dann sinkt der Kindergartenbesuch unter 45 %. Obwohl die frühkindliche<br />
Bildung entscheidend für die spätere Entwicklung ist, fehlt es in den Einrichtungen an<br />
qualifiziertem Personal und gesellschaftlicher Wertschätzung.<br />
Zur Verbesserung der Situation schlägt McKinsey die Bereitstellung von 2,2 Mrd. Euro<br />
zur Schaffung von mehr Krippen- und Ganztagsplätzen vor. 41<br />
Furore machten aber nicht nur die Initiativen von McKinsey, der Bertelsmann- und<br />
der Körber-Stiftung, die sich dem Schulmanagement und der Leseförderung widmeten.<br />
42 Der deutsche Bundeskanzler Gerd Schröder verkündete am 14. März 2003 im<br />
Rahmen der Agenda 2010 einen Schwerpunkt zur Bildungsförderung. „Wir sollten<br />
zu einer nationalen Gesamtanstrengung kommen, um Standards zu setzen und die<br />
Defizite zu überwinden. Wir brauchen das Angebot einer Ganztagsbetreuung“, welche<br />
die pädagogischen Chancen dieser Schulform wirklich nutzt. Wir brauchen – nicht<br />
zuletzt aus ökonomischen Gründen – ein neues Interesse an naturwissenschaftlichmathematischen<br />
Fächern.“ „Wir werden unser Wohlstandsniveau nur dann halten<br />
können, wenn wir in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation verstärkt in Bildung<br />
und Forschung investieren.“ 43 Klare Worte, die sich wie ein Nachruf auf das Modell<br />
Deutschland anhören. 44<br />
390
18.2.3 „School Governance“ auf dem Prüfstand<br />
Harald Steindl<br />
Schule beginnt in den Köpfen. Reichen unsere pädagogischen Vorstellungen und<br />
Managementkonzepte, um den großen Herausforderungen entsprechen zu können?<br />
Ohne Vision, keine Strategie, ohne Mission, keine Steuerung. Im Herbst 2003 stellte<br />
die Zukunftskommission des BMBWK folgende Reformziele zur Diskussion:<br />
• Leistungsförderung, damit ein möglichst hohes Niveau an Wissen, Kenntnissen,<br />
Kompetenzen und Qualifikationen in der Gesamtbevölkerung erreicht wird;<br />
• Chancenausgleich, um Leistungsunterschiede zwischen unterschiedlichen Schülergruppen<br />
möglichst gering zu halten, d.h. das Entstehen von Scheren der Kompetenzentwicklung<br />
zu vermeiden;<br />
• Integration: Jede Form des sozialen Ausschlusses beim Zugang zu Bildung ist zu<br />
vermeiden, d.h. den Anteil der Risikogruppen minimieren;<br />
• Gerechtigkeit: Die Vergabe von Berechtigungen an Schnittstellen des Schulwesens<br />
ist an objektiven Leistungsstandards zu orientieren. 45<br />
Im Kapitel 11 des Regierungsprogramms vom 28.2.2003 (Kabinett Schüssel II) sind<br />
die Aufgaben abgesteckt: „Das große Ziel von Bildung ist nicht die Reproduktion von<br />
Wissen, sondern die Anwendung von Wissen zur Lösung von neuen Herausforderungen.<br />
Durch beste Bildung und Ausbildung erhalten die jungen Menschen unseres<br />
Landes die Grundlagen zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit, für ein sinnerfülltes Leben<br />
und für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Die österreichische Bundesregierung<br />
wird im Rahmen einer Bildungsoffensive die Qualität der Bildungsangebote im <strong>internationale</strong>n<br />
Vergleich weiter steigern, die Vielfalt fördern und neue Entwicklungen in<br />
die Angebote aufnehmen.“<br />
An der Spitze der Agenda findet sich die Erarbeitung von Leistungsstandards. Bundesministerin<br />
Gehrer konnte dazu im Ministerrat vom 14. April 2004 einen Bericht<br />
über die Entwicklungs- und Durchführungsschritte vorlegen. 46 Der Vortrag betont ihre<br />
Funktion als „wichtige Rückmeldung zur Unterrichtsarbeit“, die zu Veränderungen in<br />
der methodischen und didaktischen Gestaltung führen soll. Die Standards legen fest,<br />
welche Kompetenzen in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch von Schülerinnen<br />
und Schüler bis zu den Nahtstellen vierte Klasse Volksschule und vierte Klasse<br />
Hauptschule oder Gymnasium zu erwarten sind. Sie konzentrieren sich auf fachliche<br />
und fachübergreifende Basisqualifikationen, die für die weitere schulische Bildung bzw.<br />
berufliche Ausbildung von Bedeutung sind. Nach einer ersten Erprobungsphase sollen<br />
ab dem Schuljahr 2008 jährlich verbindliche Überprüfungen in der vierten und achten<br />
Schulstufe stattfinden, die in ein breit angelegtes Bildungsmonitoring einfließen. Ziel<br />
sei die Erweiterung der Evaluierungsgrundlagen von Bildungseinrichtungen von einer<br />
ausschließlichen Inputorientierung zur Bewertung des Outputs.<br />
391
Österreich greift mit dem Konzept der Qualitätssicherung nicht nur Empfehlungen der<br />
OECD auf, es folgt damit jenen Vorgaben, welche die EU im Jahre 2000 unter dem<br />
Stichwort „Lissabon-Strategie“ beschlossen hat. Denn das ehrgeizige Vorhaben, bis<br />
zum Jahr 2010 zur global wettbewerbsfähigen, nachhaltig wachsenden, wissensbasierten<br />
Volkswirtschaft zu werden und die USA bzw. NAFTA zu überholen, kann nur über<br />
entscheidende Verbesserungen in den nationalen Schulsystemen, insbesondere aber<br />
durch eine Fokussierung der Anstrengungen auf die Weiterbildung gelingen. Leider<br />
sind fast alle Mitgliedsländer der Union mit der Umsetzung in wichtigen Feldern in<br />
Verzug. 47 Die mittelfristige Entwicklung der Wissensgesellschaft werde nur gelingen,<br />
wenn die Angebote des lebenslangen Lernens intensiviert und die Wirksamkeiten der<br />
nationalen Bildungs- und Ausbildungssysteme erhöht werden. Nach Einschätzung des<br />
Europäischen Rates sind mehr und effektivere Investitionen in das Humankapital und<br />
energische Reformen erforderlich. 48<br />
18.2.4 Kindheit ist Lernen – Die neurobiologische Revolution<br />
Zukunft beginnt im Kindergarten. Denn der Einstieg in eine Kultur des lebenslangen<br />
Aus- und Weiterbildens sollte spielend und möglichst früh gelingen, damit die Berufschancen<br />
nicht verbaut sind. Was kann angesichts der hohen Zahl so genannter<br />
„Low-Performer“ getan werden, um die berühmt-berüchtigte „Digitale Kluft“, den Zerfall<br />
der Gesellschaft in zwei Drittel Aktive, welche die technologischen Möglichkeiten voll<br />
nutzen und einem Drittel Deprivierte, denen der Zugang zur Information verwehrt ist, im<br />
Ansatz zu bekämpfen? In einer flächendeckenden Vorschulerziehung, die auch Kinder<br />
mit einer fremden Muttersprache erfasse, liegt nach Meinung der Bildungsforscher der<br />
Schlüssel. Diese Erkenntnis stützt sich auf Einsichten der Entwicklungspsychologie<br />
und Neurobiologie. Die <strong>politische</strong>n Konsequenzen sind noch zu ziehen. Als vor mehr<br />
als 12 Jahren Wissenschaftler der Universität Mainz feststellten, dass rund 25 % der<br />
Drei- bis Fünfjährigen an Sprachstörungen litten, wurden diese Befunde von den Pädagogen<br />
stark bezweifelt. 49 Heute liegen ihre Zahlen, nicht zuletzt dank verbesserter<br />
Diagnosetechniken, bei über 30 % und die Kultusbehörden in den deutschen Ländern<br />
haben begonnen, mit einem umfassenden Screening (Erfassung von Kindern mit einem<br />
Risiko für Sprach- und Schriftsprachenerwerbsprobleme) zu reagieren. In Österreich<br />
hat das Land Salzburg bereits mit einer Testserie begonnen.<br />
Mag das tatsächliche Ausmaß durch die hohe Zahl fremdsprachlicher Kleinkinder<br />
verzerrt sein, physisch und psychisch begründete Kommunikationsdefizite haben in<br />
den letzten Jahren zugenommen. Spezifische Sprachentwicklungsstörungen 50 bewegen<br />
sich in einer Größenordnung unter 10 %. Wenn Verständigungsprobleme erst in<br />
den Grundschulen entdeckt werden, dann sind Therapien besonders aufwendig und<br />
392
Harald Steindl<br />
schwierig. Da die Prägung der Hirnfunktionen mit Sprachbezug zwischen dem zweiten<br />
und fünften Lebensjahr erfolgt, müssen gezielte Aufklärung der Bezugspersonen,<br />
Behandlungen und Fördermaßnahmen so früh wie möglich einsetzen. Je länger abgewartet<br />
wird, desto geringer sind die Chancen, den Kampf gegen einen funktionalen<br />
Analphabetismus zu gewinnen. Vorschulischer Unterricht und Ganztagesbetreuung<br />
sind nicht nur für Kinder von Zuwanderern vordringliche Anliegen. In der Steiermark<br />
gehen die Uhren erfreulicher Weise bereits anders. 51 Grundschüler sollen ab kommenden<br />
Herbst nach einem ganzheitlichen Ansatz unterrichtet, gefördert, zu sportlicher<br />
Betätigung angeleitet und verpflegt werden. 52<br />
Zukunft beginnt in den Geburtsstationen. Dieser Satz erhält durch die demographische<br />
Entwicklung ein besonderes Gewicht. Die Überalterung ist nicht mehr zu stoppen.<br />
Sollten nach 2010 alle negativen Faktoren (Innovationsschwäche, Arbeitskräfte- und<br />
Jungunternehmermangel, steigender Sozialaufwand, Überschuldung der Haushalte,<br />
hohe Staatsquote, geringe Investitionsbereitschaft) zusammen kommen, dann stellt<br />
sich die entscheidende Frage, wie Österreichs Wirtschaft jene höhere Produktivität<br />
erreichen will, damit das BIP trotz sinkender Beschäftigung noch ordentlich zunehmen<br />
kann. Um ein nachhaltiges Wachstum um 3 % zu sichern, sind in den kommenden<br />
Monaten die Grundlagen zu legen und die Weichen zu stellen. Wer die Produktivität um<br />
4 – 5 % p.a. zu erhöhen hat, sollte nicht auf den Import von Innovationen und Knowhow<br />
setzen, sondern auf Nutzung aller nur erdenklichen Optimierungsmöglichkeiten in<br />
Staat und Wirtschaft drängen. Das „Neue Europa“ der 25 kann es sich weder leisten,<br />
auf Begabungsreserven zu verzichten, noch damit begnügen, sein bescheidenes<br />
Nachwuchspotenzial nur rudimentär zu nutzen. Im <strong>internationale</strong>n Wettbewerb wird<br />
es darauf ankommen, die Beschäftigungsquote in allen Teilen der Bevölkerung zu<br />
erhöhen und die Nachwuchstalente besonders anzuspornen.<br />
Wenn Frühförderung die wirksamste Form darstellt, die Probleme zu minimieren,<br />
soziale Defizite auszugleichen und die Pflichtschulen zu entlasten, dann sind die<br />
vorhandenen Ressourcen zu bündeln, um bei stark gesunkenen Kinderzahlen ein<br />
Optimum an Betreuung für jeden Einzelnen durch exzellent qualifizierte Lehrer zu<br />
garantieren.<br />
18.2.5 Im Netzwerk des Wissens<br />
Während der Streit zwischen den Anhängern der reinen Erziehungslehre(n) und<br />
hemdsärmeligen Schulpraktikern tobt, die sich mit Zähnen und Klauen gegen Evaluierung,<br />
Standards, hoheitliche Bevormundung, Einmischung der Eltern und störrische<br />
Kinder wehren, sind die Europäischen Institutionen – und in ihrem Geleitzug die<br />
nationalen Schulbehörden – längst zu neuen Ufern unterwegs. Im März 2000 stellte<br />
393
der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon fest, dass die Union mit einem<br />
„Quantensprung“ konfrontiert sei, „der aus der Globalisierung und der wissensbestimmten<br />
Wirtschaft resultiert“. Man habe sich deshalb auf ein strategisches Ziel<br />
für das Jahr 2010 geeinigt: Europa zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten<br />
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.“<br />
Obwohl in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften seit über 30 Jahren über den<br />
qualvollen Abschied von der Industriegesellschaft und der Übergang zur „Knowledge<br />
Society“ diskutiert wird, sind die Schlüsselbegriffe dieses Transformationsprozesses<br />
nur sehr zögerlich in den Wortschatz der Politiker und Journalisten eingesickert. Besonders<br />
grotesk sind die Missverständnisse, wie sie seitens der Vertreter traditioneller<br />
Träger der so genannten „Scientific Community“, wie Universitäten, Akademien der<br />
Wissenschaften etc., kolportiert werden. Die Tatsache, dass Wissen und fachliches<br />
Können in den Rang der führenden Produktionsressource aufgerückt ist, hat gerade<br />
nichts mit dem institutionellen Selbstverständnis der Hohen Schule, mit „Lehre und<br />
Forschung“ im überkommenen Sinn zu tun. Völlig verfehlt ist die gängige Unterstellung,<br />
bei der Implementierung von Strukturelementen der Wissensgesellschaft sei die<br />
Kommerzialisierung der Universitäten, der Verkauf ihrer geistigen Schöpfungen und<br />
die Verschleuderung der leitenden Ideen an neoliberale Profitgier das Ziel. Im Kern<br />
geht es um die Frage, wie Wissen zu organisieren, zu kommunizieren, zu vernetzen,<br />
zu verteilen und zu generieren ist, damit es sich wirksam entfalten kann und zwar innovativ<br />
in jeder Hinsicht, d.h. sozial, politisch, kulturell. Dass dabei emotionale Aspekte,<br />
Sensibilität und Respekt eine wichtige Rolle spielen, ist mit Nachdruck zu betonen. Die<br />
alten Unterrichtsmethoden haben ausgedient, neue Lernmodelle sind erforderlich!<br />
Wer vor ökonomischen Reduktionismen warnt, beweist nicht nur den Hang zum lieb<br />
gewonnenen Vorurteil, sondern auch die Unfähigkeit zur Phantasie. Markt und Wettbewerb<br />
sind mühsam errungene Leistungen der Zivilisation, für führende Köpfe der<br />
Aufklärung gilt die komplexe Steuerung der Versorgung der Bevölkerung durch eine<br />
funktionsfähige Marktwirtschaft als die größte soziale Errungenschaft schlechthin.<br />
Konkurrenz stimuliert nicht nur den Fortschritt, fördert Experimente und belohnt den<br />
wagemutigen Unternehmer, sie bündelt die Anstrengungen, Produkte und Dienstleistungen<br />
zu verbessern, ermöglicht den ständigen Vergleich mit dem Mitbewerber. In<br />
dieser von der <strong>politische</strong>n Ordnung zu garantierenden Transparenz der Verhältnisse<br />
verbirgt sich die zentrale Funktion der Märkte, sie sind Kommunikationsforen, Ideenbörsen,<br />
Testfelder, Lernplätze und Erfahrungsräume – in Summe Wissensbasen. In<br />
ihrer Digitalisierung, Vernetzung und Verschmelzung, wie sie die Globalisierung des<br />
Finanzsystems seit der Abschaffung des Bretton-Woods-Standards vorgeführt hat,<br />
liegt die revolutionäre Dimension: Die Eroberung eines neuen Kontinents (K. Ohmae),<br />
unermesslich reich an Wissens-Werten, ein „El Dorado“ für Jäger nach verborgenen<br />
394
Harald Steindl<br />
Talenten, kreativen Geschäftsmodellen, lernenden Organisationen und „Intellectual<br />
Capital“ in allen seinen Formen. Den Weg dorthin wird uns ein vollkommen „neues“<br />
Bildungssystem weisen!<br />
18.2.6 Jedem sein Ariadnefaden<br />
Wer in turbulenten Zeiten zu neuen Ufern aufbricht, braucht nautischen Spürsinn,<br />
Selbstvertrauen, unternehmerischen Mut, Risikobereitschaft, Zivilcourage, Sensibilität<br />
und eine breite, historisch und philosophisch fundierte Allgemeinbildung. Nicht zuletzt<br />
die Fähigkeit zum Lernen und „Ent-Lernen“, die Lust an der Veränderung. Die Förderung<br />
der berufsbegleitenden Weiterbildung ist daher auch das Gebot der Stunde.<br />
Denn sie vermag in ihrer besten Ausgestaltung jene Schlüsselfertigkeiten zu vermitteln,<br />
die helfen, den sozialen, gesellschaftlichen, <strong>politische</strong>n und technologischen Wandel<br />
zu begreifen, Umbrüche zu meistern, Zukunft zu erfinden. Wer in chaotischen Zeiten<br />
Orientierung sucht, sollte sich an der unstillbaren Sehnsucht und radikalen Neugierde<br />
der „alten Griechen“ ein Beispiel nehmen. Friedrich Hölderlin hat in der Vorrede zum<br />
„Hyperion“ die Anleitung geliefert:<br />
„Wer blos an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflükt, blos, um<br />
daran zu lernen, kennt sie auch nicht.“<br />
Die Mühe einer umfassenden Auseinandersetzung mit den Fragen der Zeit lohnt !<br />
18.3 Fabula docet: Navigare necesse est (et non vivere)<br />
Im äußersten Südwesten, an den Gestaden des Atlantiks sind die Wurzeln für den<br />
Aufstieg der europäischen Mächte und die Anfänge der Globalisierung zu besichtigen.<br />
Der portugiesische Infant Heinrich der Navigator (1394 – 1460) träumte von fernen<br />
Ländern, sammelte kartographische Darstellungen arabischer Provenienz und schickte<br />
seine Kapitäne auf Erkundungsreisen. 1415 gründete er in Sagres eine Sternwarte,<br />
ein nautisches Kolleg, eine Musterwerft und eine Art meereskundliches Institut. Unter<br />
größter Geheimhaltung wurde die Basis für die Erforschung der Ozeane und die<br />
Eroberung gewaltiger Kolonien rund um den Erdball gelegt. Methodisches Vorgehen,<br />
mit Wagemut und seemännischem Geschick gepaart, sollte das Jahrhundert der Entdeckungen<br />
einleiten und dem Umbruch des Weltbildes 53 vorauseilen. Die systemische<br />
Auswertung von Beobachtungen und Erfahrungen schuf nicht nur die Voraussetzungen<br />
für die „Europäische Expansion“, sie erzwang die „Kopernikanische Wende“ und lieferte<br />
damit die erkenntnistheoretischen Grundlagen für die modernen Naturwissenschaften<br />
und ihre experimentellen Verfahren.<br />
395
Zur gleichen Zeit segelte der chinesische Admiral Zheng He (1371 – 1433) mit einer<br />
mächtigen Flotte mehrmals durch das malaysische Archipel und den Küsten Südostasiens<br />
und Indiens entlang. Als Kind armer Moslems geboren und in Gefangenschaft<br />
kastriert, gelang ihm unter der Ming-Dynastie eine atemberaubende Karriere. Er forcierte<br />
den Werftbau und die Sicherung der Küsten, über 300 Großsegler und mehr als<br />
37.000 Soldaten standen in seinen Diensten. Von seinen Reisen bis an das Horn von<br />
Afrika brachte er nicht nur reiche Schätze, exotische Tiere und seltene Gewürze mit,<br />
er ließ die Routen dokumentieren und detaillierte Karten anfertigen. Sein 150 Meter<br />
langes Flaggschiff mit neun Masten beeindruckte ungeheuer.<br />
Der Drang gen Westen – nach den Spekulationen des englischen Hobbyhistorikers<br />
Gavin Menzies 54 soll Zheng He 1421 Amerika entdeckt und durch die Magellan-Straße<br />
via Australien 1423 heimgekehrt sein – fand jäh ein fatales Ende. Trotz der großen<br />
Erfolge und des gewaltigen technologischen Potenzials gewannen gegen Ende des<br />
15. Jahrhunderts isolationistische Tendenzen die Oberhand. Die Reiseberichte wurden<br />
vernichtet, Werften und Marinestützpunkte geschlossen und die kaiserliche Flotte stark<br />
reduziert. Ab dem Jahr 1500 waren Seereisen außerhalb der Küsten unter Androhung<br />
der Todesstrafe verboten und 1525 wurden mit den letzten meerestauglichen Schiffen<br />
auch die Hafenanlagen zerstört. China zog sich vom Überseehandel zurück und<br />
konzentrierte seine Kräfte auf die Sicherung der staatlichen Einheit nach innen. Eine<br />
blühende Zivilisation entschied, die Organisation des Welthandels, den Einfluss auf<br />
ferne Länder und Kontinente den christlichen Seefahrern, Konquistadoren, Merchant<br />
Adventures, Glücksrittern und Pfeffersäcken zu überlassen.<br />
Die Gründe dieses historischen „Opting-Out“ (Lester Thurow) 55 sollen in der konfuzianischen<br />
Ideologie der höfischen Würdenträger liegen, die sich in Krisenzeiten gegen<br />
mächtige Eunuchen in der Staatsverwaltung durchsetzten. Obwohl das Reich der<br />
Mitte über alle notwendigen Ressourcen und Kenntnisse verfügte, um Wasserenergie<br />
zu nutzen, Maschinen zu bauen, Schießpulver zu produzieren, Nachrichten zu<br />
übermitteln und ein modernes Wirtschaftssystem einzuführen, unterblieb jede soziale<br />
und ökonomische Innovation. Denn das traditionelle Bildungsideal verhinderte, durch<br />
kaiserliche Autorität abgestützt, die eigenständige Entwicklung bzw. die Übernahme<br />
fremder Vorstellungen und Ideen. Dem Reich der Mitte blieben seine Küsten, Inseln,<br />
Grenzen, Hochgebirge und Vorposten immer ein Rätsel. Die Sehnsucht nach dem<br />
freien Meer fühlten dagegen Portugiesen, Spanier, Niederländer, Franzosen und<br />
Briten. Sie sollten die Wellen der Ozeane regieren, den Welthandel beherrschen,<br />
neue Kontinente entdecken. Heute führt ihr Weg ins All, in den Mikrokosmos und ins<br />
Gen-Labor.<br />
396
18.3.1 Eipeldauer im Tschad: 21 Thesen zum „Neuen Lernen“ 56<br />
Harald Steindl<br />
1. Bildung wird zumeist als jene Form definiert, in der sich der Mensch selbst versteht,<br />
sein Leben und Wirken in Auseinandersetzung mit der Umwelt einordnet, seine<br />
Fähigkeiten und Talente voll entwickelt. Moderne Medien und Lerntechnologien<br />
haben an diesem Prägungsprozess steigenden Anteil.<br />
2. Die neuen Informationstechnologien machen Wissen jederzeit, allerorts und in<br />
vielfältiger Weise verfügbar. Sie lösen die klassischen Bildungsinstitutionen auf,<br />
schaffen alternative Foren des Lernens und der Kommunikation. Die explosionsartige<br />
Vermehrung der Angebote beunruhigt und irritiert: „To be or not to be digital?“<br />
3. Wissen ist nicht nur der entscheidende, sondern auch der einzige Schlüssel zum<br />
Können. In der „Knowledge Society“ geht es im Kern um die Frage, wie Wissen<br />
zu organisieren, zu kommunizieren, zu vernetzen, zu verteilen und zu generieren<br />
ist, damit es sich wirksam entfalten kann, d.h. im optimalen Moment ökonomische,<br />
soziale, <strong>politische</strong>, kulturelle Innovationen evoziert.<br />
4. Im Lernen erfolgt die individuelle Konstruktion von Wissen. Dieser Akt gewinnt<br />
an intellektueller Qualität, wenn es dem Lernenden gelingt, bisher unbekannte<br />
Informationen aufzunehmen und kreativ in den Schatz seiner Erfahrungen und<br />
Erkenntnisse zu integrieren.<br />
5. In den letzten 25 Jahren hat sich unser Verständnis von individuellen und kollektiven<br />
Lernprozessen radikal verändert. Erkenntnisse der Hirnforschung, Cognitive Science<br />
und Sozialanthropologie haben auf das Design von Curricula, auf Lernarchitektur<br />
und Unterrichtsmethoden, auf Lehrmittel und Motivation erheblichen Einfluss.<br />
6. Kindheit ist Lernen – unsere Zukunft beginnt in den Kindergärten und im Vorschulunterricht.<br />
Frühförderung und Begabungstests sind der beste Weg, um Defizite<br />
auszugleichen, den Zugang zu Lehrberufen und Arbeitsmärkten zu sichern und<br />
die Fundamente für die richtige Motivation zum lebenslangen Lernen zu legen.<br />
7. Der Erwerb anspruchsvoller Kompetenzen wie analytisches Denken, Ausdrucksfähigkeit,<br />
Mehrsprachigkeit, aber auch in Mathematik, Naturwissenschaften, Technik,<br />
Medizin, Recht, Kunst und Kultur ist ein mühseliges Unterfangen. Komplexe<br />
Herausforderungen sind nur durch Ausdauer, Übung und hohe Ansprüche bereits<br />
in früher Kindheit zu bewältigen.<br />
8. Institutionen der Aus- und Weiterbildung haben für die Verfügbarkeit stabiler<br />
Studienbedingungen und einer breit gefächerten, intelligenten Wissensbasis zu<br />
sorgen, die es jedem Bürger/jeder Bürgerin ermöglicht, sich neuen Situationen<br />
flexibel anzupassen. Erfahrungsorientiertes Lernen (Fallstudien, Selbst-Reflexion,<br />
Coaching, Supervision) und multimediale Angebote gewinnen an Gewicht.<br />
397
9. Schule bzw. Bildung für die Wissensgesellschaft heißt, für eine Vielzahl von Optionen<br />
zu sorgen, Alternativen zu bieten, Chancen zu eröffnen, in Talente zu investieren,<br />
aber auch Abschied vom standardisierten Massenunterricht in geregelten<br />
und genormten Curricula zu nehmen. Den persönlichen Fächerkombinationen<br />
gehört die Zukunft.<br />
10. Diese Einschätzung wird durch zahlreiche <strong>internationale</strong> Studien zum Unterrichtsvergleich<br />
(PISA, TIMMS) belegt. Länder, die auf Wissensreproduktion setzen (wie<br />
Deutschland, Frankreich, Italien) schneiden erheblich schlechter ab als Länder<br />
mit Schulsystemen, welche Freiheiten bei der Entwicklung von Lösungsansätzen<br />
zulassen und das Denken in alternativen Strategien fördern.<br />
11. Der Einsatz von E-Learning bzw. standardisierten Programmen birgt die Gefahr in<br />
sich, Pauktechniken zu forcieren und damit auf bequemem Weg vielen Schülern<br />
das Erreichen eines Klassenziels bzw. einer Punktzahl zu ermöglichen, ohne<br />
die Gewähr zu haben, diese hätten wirklich etwas verstanden und könnten im<br />
Bedarfsfall auf eine intelligente Wissensbasis zurückgreifen.<br />
12. Video-Clips, Instant-Quickies, Management-Summeries, Powerpoint-Präsentationen,<br />
Flip-Charts, Skripten und Folien können die intensive, zeitraubende<br />
Beschäftigung mit schwierigen Fragen niemals ersetzen. Crash-Kurse führen<br />
zum Crash! Mitarbeiterführung lässt sich nicht auslagern.<br />
13. Automatisiertes Wissen und Können, wie es für erprobte Autofahrer/innen, Dolmetscher/innen,<br />
Spitzensportler/innen prototypisch ist, muss daher immer wieder<br />
in sinnstiftendes Lernen, d.h. in Verstehen und Begreifen, eingebettet sein, damit<br />
auch kritische Situationen bewältigt werden können.<br />
14. Nachhaltig wirkendes Training im kreativen Umgang mit den wissenschaftlichen<br />
Werkzeugen der „Knowledge Economy“ hat im Mittelpunkt einer „neuen Lehr- und<br />
Lernkultur“ zu stehen. Massenmedien sollten dafür die Neugierde wecken. Dieses<br />
Bildungssystem der Zukunft ist uns erst in vagen Ansätzen bekannt.<br />
15. Berufsbegleitende Lehrgänge sind besonders erfolgreich, wenn sie kunden- bzw.<br />
klientenzentriert organisiert sind. Eine Potenzialanalyse (Stärken/Schwächen-<br />
Profil) bildet die Grundlage eines auf die Erwartungen aber auch Defizite des(r)<br />
Teilnehmers/in maßgeschneiderten Kurses. In einer detaillierten Vereinbarung sind<br />
Lernschritte, Leistungskontrollen, Studienphasen etc. festzuhalten. Je nach den<br />
persönlichen Anforderungen und Präferenzen werden unterschiedliche Lernmodelle<br />
(One-to-One, Community Learning, Computer-based Training, Classroom<br />
Discussion, Case-Study-Method etc.) angeboten. Diesen Weg gehen weltweit<br />
nicht nur renommierte Executive MBA-Programme, sondern auch zahlreiche<br />
WIFI-Kurse in Österreich.<br />
398
Harald Steindl<br />
16. „Duale Ausbildungen“ haben den Vorteil, dass das Erlernte unmittelbar ge- und<br />
erprobt werden kann. Arbeitgeber, Kollegen und das private Umfeld sehen sofort,<br />
ob und welche Fortschritte erzielt worden sind, ob sich die Investition an Zeit<br />
und Geld lohnen wird. Das entscheidende Plus liegt in der Motivation und in der<br />
Entwicklung einer realitätsnahen Lernstrategie.<br />
17. EDV-Kompetenz, wie sie im Europäischen Computer-Führerschein dokumentiert<br />
ist, oder ein Wirtschaftsverständnis, wie dies der bereits erfolgreich erprobte<br />
„Unternehmer-Führerschein“ signalisieren will, eröffnen berufliche Perspektiven<br />
im weiten Feld der Informationsgesellschaft und stiften zum Unternehmertum<br />
an. Derartige Angebote sollten bereits in den Grundschulen um ökonomische<br />
Fragen, regionale und europäische Belange, <strong>internationale</strong> Beziehungen und<br />
grenzüberschreitende Kontakte angereichert werden.<br />
18. „Go international“ ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie einst „Reisen bildete“, so<br />
kommt es im Vorzeichen von EU-Erweiterung und Globalisierung darauf an, Offenheit,<br />
Sensibilität und multikulturelle Kompetenz zu entwickeln, damit Österreich<br />
als Drehscheibe, Wissensplattform, Experimentierraum und „Center of Excellence“<br />
zu fungieren und die Zwillingsstadt Wien-Bratislava in den Rang einer Metropole<br />
des 21. Jahrhunderts aufzusteigen vermag.<br />
19. Der Zugang zu Informationen und zur Weiterbildung steigert nicht nur die so<br />
genannte „Employ-Ability“. Vorstellungen, Sichtweisen, Problembeschreibungen,<br />
Deutungen, kulturelle Codes werden produziert, bestimmen die Strategien großer<br />
Organisationen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. In den Medien liegt Definitionsmacht<br />
und doppelte Verantwortung (ORF-Gesetz).<br />
20. Europäische Studiengänge, Austauschprogramme für Lehrlinge, Schüler, Studenten,<br />
Lehrer, Wissenschaftler und Beamte eröffnen verheißungsvolle Perspektiven.<br />
Gemischte Klassen diesseits und jenseits der alten Grenzlinien machen Hoffnung,<br />
dass der Brückenschlag nicht nur zwischen den Völkern sondern auch in<br />
Richtung zukunftsweisender Standortqualitäten gelingen wird. Das Mitteleuropa<br />
der Regionen wird sich rund um innovative Cluster, wie Creative Industries, Biotechnologie,<br />
revolutionäre Werkstoffe und Lernsysteme bilden. Die Pforten zur<br />
Knowledge-Economy liegen an der Donau.<br />
21. Wer in Zeiten des Niedergangs der überkommenen Industriegesellschaft zu neuen<br />
Ufern aufbricht, muss nicht nur die „Fesseln alter Denkweisen“ abwerfen, er<br />
braucht nautischen Spürsinn, Selbstvertrauen, unternehmerischen Mut, Risikobereitschaft,<br />
Zivilcourage, Sensibilität und eine breite, historisch und philosophisch<br />
fundierte Allgemeinbildung – und: Märkte als Lernplätze!<br />
Exportare necesse est!<br />
399
Literaturverzeichnis<br />
Achs, Oskar; Krassnig, Albert (1974), Drillschule-Lernschule-Arbeitsschule: Otto Glöckel und<br />
die österreichische Schulreform in der ersten Republik, Wien.<br />
Angerer, Paul (Hrsg) (1998), Briefe eines Eipeldauers an seinen Vetter in Kakran, über<br />
d´Wienstadt“, Wien.<br />
Biffl, Gudrun; Kratena, Kurt (2001), Die Zukunft der österreichischen Berufs- und Qualifikationslandschaft<br />
bis 2005, Wien.<br />
Bräuer, Gerd (2004), Schreiben(d) lernen, Ideen und Projekte für die Schule, Hamburg.<br />
Fischer, Ernst Peter (2003), Die andere Bildung. Was man von den Naturwissenschaften wissen<br />
sollte, Berlin.<br />
Foerster, Heinz von (1993), Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke, Frankfurt am Main.<br />
Foerster, Heinz von; Glasersfeld, Ernst von; Hejl, Peter (2000), Einführung in den Konstruktivismus,<br />
München.<br />
Fried, Johannes; Süßmann, Johannes (Hrsg.) (2001), Revolutionen des Wissens. Von der<br />
Steinzeit bis zur Moderne, München.<br />
Friedrichs, Werner; Sanders, Olaf (Hrsg.) (2002), Bildung/Transformation. Kulturelle und gesellschaftliche<br />
Umbrüche aus bildungstheoretischer Perspektive, Bielefeld.<br />
Fuhrmann, Manfred (2002), Bildung. Europas kulturelle Identität, Stuttgart.<br />
Haider, Günter; Reiter, Claudia (Hrsg.) (2001), PISA 2000. Nationaler Bericht, Innsbruck.<br />
Haider, Günter (Hrsg.) (2001), PISA 2000. Technischer Report, Innsbruck.<br />
Haider, Günter; Lang, Birgit (Hrsg.) (2001), PISA Plus 2000. Nationaler Bericht, Innsbruck.<br />
Haider, Günter; Eder, Ferdinand; Specht, Werner; Spiel, Christiane (2003), Zukunft: Schule<br />
– Strategien und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. Das Reformkonzept der österreichischen<br />
Zukunftskommission, Wien.<br />
Hochhuth, Rolf (2003), McKinsey kommt, München.<br />
Hölderlin, Friedrich, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, erschienen in zwei Bänden,<br />
1797 – 1799.<br />
Killius, Nelson; Kluge, Jürgen; Reisch, Linda (2003), Die Bildung der Zukunft, Frankfurt am<br />
Main.<br />
Kluge, Jürgen (2003), Manifest zur Bildung, Berlin 6. September 2002, Manuskript, abgedruckt<br />
in: Killius, Nelson; Kluge, Jürgen; Reisch, Linda (Hrsg.), Die Bildung der Zukunft, Frankfurt am<br />
Main.<br />
Kluge, Jürgen (2003), Schluss mit der Bildungsmisere. Ein Sanierungskonzept, Frankfurt am<br />
Main.<br />
Koselleck, Reinhart (2000), Zeitschichten. Studien zur Historik, Frankfurt am Main.<br />
Koselleck, Reinhart (1995) Geist und Bildung – zwei Begriffe kultureller Innovation zur Zeit<br />
Mozarts, in: Csaky, Moritz; Pass, Walter (Hrsg.), Europa im Zeitalter Mozarts, Wien – Köln.<br />
400
Harald Steindl<br />
Krautkrämer, Ursula (1979), Staat und Erziehung. Begründung öffentlicher Erziehung bei Humboldt,<br />
Kant, Fichte, Hegel und Schleiermacher, München.<br />
Kuhn, Thomas S. (1973), Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt am Main.<br />
Kuhn, Thomas S. (1977), Die Entstehung des Neuen, Frankfurt am Main.<br />
Kuhn, Thomas S. (2000), The Road Since Structure: Philosophical Essays, 1970 –1993, Chicago.<br />
Lepenies, Wolf (2003), Bildungspathos und Erziehungswirklichkeit, in:<br />
Killius, Nelson; Kluge, Jürgen; Reisch, Linda (Hrsg.), Die Bildung der Zukunft, Frankfurt am<br />
Main.<br />
Lentze, Hans (1962), Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein, Wien.<br />
Liessmann, Konrad Paul (2004), Spähtrupp im Niemandsland, Wien.<br />
Luhmann, Niklas (2002), Das Erziehungssystem der Gesellschaft, Frankfurt am Main.<br />
Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich (2003) (Hrsg.), Sozialwort des Ökonomischen<br />
Rates der Kirchen in Österreich, Wien.<br />
Ohmae, Kenichi (2001), Der unsichtbare Kontinent. Vier strategische Imperative für die New<br />
Economy, Wien.<br />
Menzies, Gavin (2003), 1421. Als China die Welt entdeckte, München.<br />
Moritz, Ralf (2003), Das Große Lernen (Daxue), Leipzig.<br />
Reisch, Linda (2002), Deutschland ist kein Bildungsland mehr, in: Terhart, Ewald, Nach PISA,<br />
Bildungsqualität entwickeln, Hamburg.<br />
Reiter, Claudia; Haider, Günter (Hrsg.) (2002), PISA 2000 – Lernen für das Leben. Österreichische<br />
Perspektiven des <strong>internationale</strong>n Vergleichs, Innsbruck.<br />
Schneeberger, Arthur; Kastengruber, Bernd (1998), Weiterbildung der Erwerbsbevölkerung in<br />
Österreich, Wien.<br />
Schneeberger, Arthur; Petanovitsch, Alexander (2004), Eingangsqualifikationen von Lehranfängern.<br />
Analysen und Schlussfolgerungen, Wien.<br />
Schnider, Andreas (2003), Schul- und Bildungsreform. Miteinander zum Bildungskonsens, in:<br />
Steirisches Jahrbuch für Politik 2003.<br />
Schöler, Hermann (20.1.2004), Zur „Sprachstandsmessung“. Ein Vorschulscreening zur Erkennung<br />
von Risikokindern für Sprach- und Schriftspracherwerbsprobleme, Gastvortrag an der<br />
Universität Köln.<br />
Schöler, Hermann; Fromm, Waldemar; Kany, Werner (1998), Spezifische Sprachentwicklungsstörung<br />
und Sprachlernen, Heidelberg.<br />
Schönbach, Anton (1907), Über Lesen und Bildung, 7. Aufl. Graz.<br />
Schurr, Johannes (1975), Schleiermachers Theorie der Erziehung, Düsseldorf.<br />
Schwanitz, Dietrich (1999), Bildung. Alles, was man wissen muß, Frankfurt am Main.<br />
Steindl, Harald (1997), Am Vorabend der Lernrevolution, in: BMwA (Hrsg.), Der österreichische<br />
Außenhandel 1997, Wien.<br />
401
Steindl, Harald (1998), Von der Kunst, den Markt zu lieben, in: Mitterlehner, Hammerer (Hrsg.),<br />
Marktwirtschaft 2000, Wien.<br />
Steindl, Harald (2001), Wissen ist Markt, in: Österreichische Monatshefte 5/2001.<br />
Steindl, Harald (2002), Das Leitbild des Unternehmers im 21. Jahrhundert – eine Spurensuche,<br />
in: Baudenbacher, Carl; Busek, Erhard (Hrsg.), Europa und die Globalisierung, Wien.<br />
Ders. (2002), Sternzeit 0X050.1: „Creativity-Day“ in: Kopf, Karlheinz; Hammerer, Gerhard (Hrsg.),<br />
Unternehmerisches Österreich, Wien.<br />
Steinhart, Gabor (2004), Deutschland, Der Abstieg eines Superstars, München.<br />
Terhart, Ewald (2001), Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen,<br />
Reformkonzepte, Weinheim – Basel.<br />
Thurow, Lester (2004), Die Zukunft der Weltwirtschaft, Frankfurt am Main.<br />
Watzlawick, Paul (2002), Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben?<br />
München.<br />
Willke, Helmut (1997), Dumme Universitäten intelligente Parlamente, in: Grossmann, Ralph<br />
(Hrsg.), Wie wird Wissen wirksam? Wien – New York.<br />
Willke, Helmut (1998), Systemisches Wissensmanagement, Stuttgart.<br />
Willke, Helmut (2001), Atopia, Frankfurt am Main.<br />
Willke, Helmut (2002), Dystopia. Studien zur Krisis des Wissens, Frankfurt am Main.<br />
Willke, Helmut (2003), Heterotopia, Frankfurt am Main.<br />
Wittmann, Walter (2002), Der helvetische Filz. Eine geschlossene Gesellschaft, Frauenfeld.<br />
Anmerkungen<br />
* Dr. Harald Steindl ist Referent in der Abteilung für Rechtspolitik der Wirtschaftskammer<br />
Österreich in Wien.<br />
1 Vgl. Moritz, Ralf (Hrsg.), Das Große Lernen (Daxue), Leipzig 2003, 7, 48: Die kleine Schrift<br />
ist „das Tor, durch das jener, der zu lernen beginnt, zu moralischer Kraft für die Ordnung<br />
der Welt gelangt.“ Sie „zeigt den Pfad und mithin die Richtung, in die das Lernen führt.“ Die<br />
konfuzianische Erziehung ist handlungsorientiert und hat die Verinnerlichung der Normen<br />
zum Ziel. Denn mit dem Lernen fängt alles an: „Je mehr die Fähigkeit zum verantwortlichen<br />
Handeln für die Gemeinschaft ausgeprägt ist, desto höher kann das Amt sein, das der Einzelne<br />
zu übernehmen vermag, denn desto größer ist der Radius potentieller Ordnungsstiftung.“<br />
(49). Von 1313 bis 1905 bildete der zentrale Traktat des Staatskonfuzianismus die Grundlage<br />
der zivilen Beamtenexamina. Die Bewahrung der Tradition, der Dienst an der gottgegebenen<br />
natürlichen Ordnung und die Kanonisierung kultureller Werte stehen im Mittelpunkt. Das<br />
„Große Lernen“ ist als „Prozess moralischer Qualifizierung und sittlicher Vervollkommnung<br />
und in diesem Sinn als Persönlichkeitsbildung und Menschenformung“ (61) zu verstehen.<br />
Der Verfasser des „da xue“, der Philosoph Zhu Xi (1130 – 1200), stellte seiner Synthese ein<br />
Kompendium des „Kleinen Lernens“ (xiao xue – Lernen des Heranwachsenden) zur Seite.<br />
Denn der moralische Lernprozess des Erwachsenen bedürfe frühzeitig einer im Kindesalter<br />
402
Harald Steindl<br />
einsetzenden Vorbereitung. (67) In Dorf- und Clanschulen wurde so die Gewöhnung der<br />
Kinder und Jugendlichen an „Selbst-Zurücknahme, an Ein- und Unterordnung“ und an die<br />
Integration in die Gemeinschaft vermittelt. (68) Dem Schüler soll durch eigene Erfahrungen<br />
der Weg gewiesen werden, wie er sein Mensch-Sein verwirklicht, zum moralischen Schöpfer<br />
seiner Selbst werden kann. (79). „Das im Sein der Welt ruhende Gute entfaltet sich über die<br />
Strahlkraft des ordnenden Beispiels.“<br />
2 21. Juni 1978 Fußballweltmeisterschaft in Argentinien: Deutschland gegen Österreich 2:3.<br />
Das Siegestor durch Hans Krankl fällt in der 88. Minute. Krankl versetzt seinen Bewacher<br />
Rüßmann, geht am Libero Manfred Kaltz vorbei und lässt Torwart Sepp Maier keine Chance.<br />
Erstmals nach 47 Jahren konnte das ÖFB-Team den Nachbarn besiegen. ORF-Reporterlegende<br />
Edi Finger sen.: „I werd narrisch!“<br />
3 Habsburg vor Hohenzollern, Grillparzer vor Goethe, Raimund vor Schiller, Anzengruber vor<br />
Hauptmann, Freud vor Marx, Thomas B. vor Thomas M. frohlockte nicht nur das Wiener<br />
Kleinformat.<br />
4 Hölderlin, Friedrich, Hyperion oder der Eremit in Griechenland, erschienen in zwei Teilen,<br />
1797 – 1799.<br />
5 Vgl. mit weiterführenden Hinweisen Lepenies, Wolf, Bildungspathos und Erziehungswirklichkeit,<br />
in: Killius, Nelson; Kluge, Jürgen; Reisch, Linda (Hrsg.), Die Bildung der Zukunft,<br />
Frankfurt am Main 2003, S. 13 – 31.<br />
6 „Der Schelling und der Hegel, der Uhland und der Hauff, das ist bei uns die Regel. Das fällt<br />
bei uns nicht auf.“ (Volksmund).<br />
7 Der Bogen lässt sich von den Thun-Hohenstein‘schen Reformen nach 1850 über die Umwandlung<br />
der Polytechnischen Anstalten in Hochschulen, die enge Kooperation am Vorabend<br />
des 1. Weltkriegs sowie im Zeichen der pädagogischen Aufbruchsstimmung der Weimarer<br />
Republik und des „Roten Wien“, die Ausstrahlung der Studentenrevolte 1968 und Herta Firnbergs<br />
Demokratisierungsversuche bis zum verspäteten Aufbau eines Fachhochschulsektors<br />
spannen. Vgl. Lentze, Hans, Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein,<br />
Wien 1962.<br />
8 So die ehemalige Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt am Main Linda Reisch, in: Terhart,<br />
Ewald, Nach PISA. Bildungsqualität entwickeln, Hamburg 2002, S. 7 –16.<br />
9 Wittmann, Walter, Der helvetische Filz. Eine geschlossene Gesellschaft, Frauenfeld 2002.<br />
10 „PISA 2000“ stellt den ersten Zyklus der PISA-Studie dar. Im Mai 2000 wurden in 32 Ländern<br />
mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler getestet. Die österreichische Stichprobe<br />
umfasste ca. 6.000 Schüler/innen aus verschiedensten Schultypen. Im Mittelpunkt des Interesses<br />
dieses Zyklus (PISA 2000) stand die Lese-Kompetenz 15-/16-jähriger Schüler/innen.<br />
Untergeordnete Testgebiete waren Mathematik- und Naturwissenschafts-Kompetenz. Zudem<br />
wurden von Schüler/innen und Schulen umfangreiche Kontextinformationen erhoben, welche<br />
die Grundlage für die Interpretation der Ergebnisse bilden.<br />
11 Vgl. Reiter, Claudia; Haider, Günter (Hrsg.), PISA 2000. Lernen für das Leben. Österreichische<br />
Perspektiven des <strong>internationale</strong>n Vergleichs, Innsbruck 2002, S.145.<br />
403
12 Reiter, Haider (2000), S. 146. Vgl. dort auch die weiteren Definitionen:<br />
„Mathematik-Kompetenz ist die Fähigkeit einer Person, die Rolle zu erkennen und zu verstehen,<br />
welche die Mathematik in der Welt spielt, fundierte mathematische Urteile abzugeben<br />
und sich auf eine Weise mit der Mathematik zu befassen, die den Anforderungen des<br />
gegenwärtigen und künftigen Lebens dieser Person als konstruktivem, engagiertem und<br />
reflektierendem Bürger entspricht.“<br />
„Naturwissenschaftskompetenz“ wird als Fähigkeit beschrieben, „die Kapazität naturwissenschaftlichen<br />
Wissens anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus<br />
Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu treffen,<br />
die die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr vorgenommenen Veränderungen<br />
betreffen.“<br />
13 Im Dezember 2001 legte der Österreich-Koordinator Günter Haider drei nationale PISA-<br />
Berichte vor.<br />
Haider, Günter (Hrsg.), PISA 2000. Technischer Report, Innsbruck 2001;<br />
Haider, Günter; Lang, Birgit (Hrsg.), PISA Plus 2000. Nationaler Bericht, Innsbruck 2001;<br />
Haider, Günter; Reiter, Claudia (Hrsg.), PISA 2000. Nationaler Bericht, Innsbruck 2001.<br />
Zur Analyse der Defizite vgl. Reiter, Claudia; Haider, Günter (Hrsg.), PISA 2000 – Lernen für<br />
das Leben. Österreichische Perspektiven des <strong>internationale</strong>n Vergleichs, Innsbruck 2002,<br />
insbes. LOW 10 – Analyse der unteren 10 %, S. 47 – 54.<br />
14 Haider, Günter; Eder, Ferdinand; Specht, Werner; Spiel, Christiane, Zukunft: Schule. Strategien<br />
und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung. Das Reformkonzept der österreichischen<br />
Zukunftskommission, Wien 2003, S. 11 – 33; vgl. www.klassezukunft.at sowie die Homepage<br />
des BMBWK: www.bmbwk.gv.at.<br />
15 Haider, Eder, Specht (2003), S. 15.<br />
16 Haider, Eder, Specht (2003), S. 13.<br />
17 Haider, Eder, Specht (2003), S. 14.<br />
18 Vgl. Achs, Oskar; Krassnig, Albert, Drillschule-Lernschule-Arbeitsschule: Otto Glöckel und<br />
die österreichische Schulreform in der ersten Republik, Wien 1974.<br />
19 Schneeberger, Arthur; Petanovitsch, Alexander, Eingangsqualifikationen von Lehranfängern.<br />
Analysen und Schlussfolgerungen, Wien 2004, S. 65.<br />
20 Schneeberger, Arthur; Petanovitsch, Alexander, Eingangsqualifikationen von Lehranfängern.<br />
Analysen und Schlussfolgerungen, Wien 2004.<br />
21 Vgl. Biffl, Gudrun; Kratena, Kurt, Die Zukunft der österreichischen Berufs- und Qualifikationslandschaft<br />
bis 2005, Wien 2001.<br />
22 Schneeberger, Petanovitsch, S.13.<br />
23 Dieser Hinweis sollte nicht als Plädoyer für „lustbetonten Event-Unterricht“ missverstanden<br />
werden. Kuschelecken bringen keine Kompetenz. Ohne Einsatz der pädagogischen Autorität<br />
lässt sich der Wert der intellektuellen Anstrengungen, die Bedeutung von Disziplin, Ernsthaftigkeit,<br />
Ausdauer und Mühe nicht vermitteln.<br />
404
Harald Steindl<br />
24 Bei allen Anstrengungen des Bildungsministeriums, der Landesschulbehörden, der Bibliotheken<br />
und Schulverlage darf die problematische Rolle von Radio, Fernsehen und der<br />
Musikindustrie nicht übersehen werden. Leider wird diese wichtige Kulturtechnik in der<br />
Freizeit kaum noch benötigt und trainiert. Man kann mit dem Lesen – so klagen unbedarfte<br />
Grundschüler – kaum etwas anfangen, es ist nur mühsam und lästig. Aus den Leseratten<br />
von früher sind heute Fernsehsüchtige und Internetfreaks geworden. Da es mittlerweile<br />
Sprachprogramme gibt, die Texte akustisch darbieten, ist zu befürchten, dass demnächst<br />
auch der Computer über Symbole voll und ganz ohne intensives Lesen genutzt werden<br />
kann. Das Elend der Gutenberg-Galaxis. Was werden wohl Lehrer anstellen müssen, um<br />
Lust auf Lesen zu wecken?<br />
25 Mandat der Zukunftskommission.<br />
26 Terhart, Ewald, Lehrerberuf und Lehrerbildung. Forschungsbefunde, Problemanalysen,<br />
Reformkonzepte, Weinheim – Basel 2001.<br />
27 Resolution adopted by the General Assembly 55/2. Die Staaten betonen ihre „collective<br />
responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global<br />
level“.<br />
28 OECD 2003, S. 80.<br />
29 Zur Verringerung der in Österreich sehr ausgeprägten „sozial bedingten Leistungsdifferenzen“<br />
wird empfohlen, die „Unterschiede bei den Lernansätzen zu reduzieren, die offenbar zu einem<br />
großen Teil für diese sozialen Disparitäten verantwortlich sind.“ Im <strong>internationale</strong>n Vergleich<br />
fällt auf, dass es „nur relativ wenigen Schulen“ gelingt, „besonders starke Lernansätze zu<br />
fördern. Daher sollte sich die Aufmerksamkeit gezielt auf die Lehrpraktiken in den Schulen<br />
und auf systemweite Änderungen zur Verbesserung dieser Unterrichtspraktiken richten.“ Kein<br />
Land könne die „Existenz von Schülerinnen und Schülern mit vielfachen Schwächen ignorieren“.<br />
Diese Gruppe „benötige zweifellos eine gezielte Unterstützung – nicht nur um ihnen zu<br />
schulischem Erfolg zu verhelfen, sondern auch um ihre Einstellungen und Gewohnheiten in<br />
Bezug auf das Lernen zu vermitteln, die für ihr späteres Leben wichtig sind.“<br />
30 OECD 2003, 83.<br />
31 „Ein Strategierepertoire entwickelt sich zusammen mit anderen lernfördernden Attributen<br />
nach und nach durch Lehrer, die effektives Lernverhalten modellieren und die Verantwortung<br />
für den Lernprozess nach und nach dem Lerner übertragen sowie durch eine Analyse der<br />
Gründe für den akademischen Erfolg oder Misserfolg.“<br />
32 Vgl. dazu die Statements auf der Homepage: www.klassezukunft.at<br />
33 Vgl. Schurr, Johannes, Schleiermachers Theorie der Erziehung, Düsseldorf 1975.<br />
34 Die Forcierung von Wahlmöglichkeiten wird gerne als Beliebigkeit missverstanden. Nicht<br />
bequeme Lösungen sind das Ziel, sondern anspruchsvolle Fächerkombinationen und Aufgaben,<br />
welche mit realen Problemen aus dem persönlichen Umfeld verknüpft sind. Der Schüler<br />
sollte erkennen, wie sehr er mit anspruchsvollen Vorgaben seinen eigenen Lernfortschritt<br />
bestimmen kann.<br />
35 Schönbach, Anton, Über Lesen und Bildung, 7. Aufl. Graz 1907, S. 5.<br />
405
36 Schönbach, S. 10.<br />
37 Liessmann, Konrad Paul, Spähtrupp im Niemandsland, Wien 2004, auf der Suche nach<br />
spirituellen Substanzen.<br />
38 Vgl. dazu Hochhuth, Rolf, McKinsey kommt, München 2003, 48: „Wenn man vor hundert<br />
Jahren Gründerzeit sagte – so heute McKinsey-Zeit!“<br />
39 Kluge, Jürgen, Schluss mit der Bildungsmisere. Ein Sanierungskonzept, Frankfurt am Main,<br />
2003.<br />
40 Einführung von Studiengebühren: Durch Studiengebühren beteiligt man Hochschüler, die in<br />
Form höherer Gehälter später maßgeblich vom Studium profitieren, auch an der Finanzierung<br />
der Investition Bildung. Die Studiengebühren machen aus Konsumenten Kunden, die eine<br />
Gegenleistung für ihre Zahlung verlangen. So können Gelder nachfrageorientiert dorthin<br />
fließen, wo das Angebot auf Grund hoher Qualität seinen Preis wert ist. Entscheidungsfreiheit<br />
der Hochschulen über Verwendung der Studiengebühren. Reform des Förderungssystems:<br />
Parallel zur Einführung von Studiengebühren muss ein neues Bildungsdarlehen mit Rückzahlung<br />
über die Einkommenssteuer eingeführt werden.<br />
41 Vgl. Kluge, Jürgen, Manifest zur Bildung, Berlin 6. September 2002, Manuskript, abgedruckt<br />
in: Killius, Nelson; Kluge, Jürgen; Reisch, Linda (Hrsg.), Die Bildung der Zukunft, Frankfurt<br />
am Main 2003, S. 321 - 335. Im Detail:<br />
• Umstellung der finanziellen Förderung von Kindertagesstätten zur Förderung eines qualitativ<br />
hochwertigen und vielfältigen Angebots: Jede Kindertagesstätte, die bestimmte,<br />
einheitliche Qualitätskriterien erfüllt, sollte unabhängig von der Trägerschaft die gleiche<br />
Förderung erhalten. Dann wäre es auch für private Anbieter und Arbeitgeber attraktiv,<br />
Kindertagesstätten zu betreiben. Parallel sollte der Einfluss auf der Nachfrageseite gestärkt<br />
werden, indem die Betriebskosten zukünftig nach tatsächlich nachgefragten Plätzen<br />
gefördert werden und nicht – wie heute – nach der Anzahl der angebotenen Plätze.<br />
• Aufwertung des Berufsstands der Erzieherinnen und Erzieher: Etwa ein Viertel der Erzieherinnen<br />
sind heute über 50 Jahre alt, in den neuen Bundesländern liegt der Anteil sogar<br />
bei knapp 40 %. Die anstehende altersbedingte Fluktuation bietet gleichermaßen Gelegenheit<br />
und Notwendigkeit, die Ausbildung zu reformieren. Künftig sollten Erzieherinnen<br />
und Erzieher an der Fachhochschule zu einem Master of Education mit Schwerpunkt auf<br />
frühkindlicher Pädagogik ausgebildet werden. Entscheidend ist, die Reform der Ausbildung<br />
mit einer Reform des Berufsbildes und der Gehaltsstrukturen zu verbinden, will<br />
man genügend Interessenten finden. Für die bessere Ausbildung und eine Erhöhung der<br />
Gehälter entsteht ein zusätzlicher Finanzbedarf von etwa 1,5 Milliarden Euro jährlich.<br />
• Gezielte Förderung von Kindern und Eltern aus sozial schwachem Umfeld: Das Bewusstsein<br />
für die Bedeutung frühkindlicher Erziehung muss insbesondere bei Eltern aus sozial<br />
schwachen Verhältnissen gestärkt werden. Vorbild kann hierfür Großbritannien sein. Hier<br />
werden Familien und Kinder zumeist aus sozialen Brennpunkten in heute über 50 Early-<br />
Excellence-Centern gezielt und gemeinsam gefördert. Mit Erfolg, wie erste Ergebnisse<br />
zeigen: So erzielten die Kinder eines solchen Centers in der Grundschule signifikant bes-<br />
406
Harald Steindl<br />
sere Ergebnisse als der Durchschnitt – und das bei nachteiligen Startbedingungen. Eine<br />
solche Förderung für Deutschland hat ihren Preis: So würde ein Aufbau von integrierten<br />
Angeboten zur Unterstützung von 60.000 sozial schwachen Kindern mitsamt ihren Eltern<br />
nach britischem Vorbild in Deutschland etwa 400 Mio. Euro jährlich kosten.<br />
Der Finanzbedarf des McKinsey-Reformpakets beläuft sich auf insgesamt etwas mehr als<br />
4 Mrd. Euro. Nach dem Motto „Lieber früh investieren, anstatt spät reparieren“ entspricht<br />
dies einer deutlichen Steigerung der bisherigen staatlichen Mittel um ca. 50 %. Hätte man<br />
auf die Kindergelderhöhung im Jahr 1999 verzichtet, würde dieses Geld zur Verfügung<br />
stehen. Und es rechnet sich: Untersuchungen aus der Schweiz und den USA zeigen,<br />
dass diese Investitionen mit einem Faktor 3 bis 4 volkswirtschaftlich zurückfließen.<br />
42 Bräuer, Gerd (Hrsg.), Schreiben(d) lernen. Ideen und Projekte für die Schule, Hamburg<br />
2004.<br />
43 Wir haben die Pflicht, den nachfolgenden Generationen die Chancen auf ein gutes Leben in<br />
einer friedlichen und gerechten Welt nicht durch Unbeweglichkeit zu verbauen. Das ist der<br />
Grund dafür, dass wir den Mut zu Veränderungen brauchen. Unser Land muss wieder zu einem<br />
Zentrum der Zuversicht in Europa werden – unsertwegen, aber auch Europas wegen.<br />
44 Steinhart, Gabor, Deutschland. Der Abstieg eines Superstars, München 2004.<br />
45 Zukunftskommission, S. 35 – 36.<br />
46 BMBWK GZ 11.012/34-I/2c/2004: Vortrag an den Ministerrat „Bildungsstandards. Ein weiterer<br />
Qualitätssprung für das österreichische Schulwesen“.<br />
47 Vgl. Bericht der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäisches Rates 2004: Die<br />
Lissabon Strategie realisieren. Reformen für die erweiterte Union, KOM (2004) 29.<br />
48 Europäischer Rat (Brüssel) 25./26. März 2004: Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 7: „Soll die<br />
EU weltweit zum führenden wissensbasierten Wirtschaftsraum werden, so wird die allgemeine<br />
und berufliche Bildung eine Schlüsselrolle spielen.“<br />
49 Guter Überblick bei Schöler, Hermann, Zur „Sprachstandsmessung“. Ein Vorschul-Screening<br />
zur Erkennung von Risikokindern für Sprach- und Schriftspracherwerbsprobleme, Gastvortrag<br />
an der Universität Köln, 20.1.2004. In Heidelberg wird der so genannte HASE-Test (Heidelberger<br />
Auditives Screening in der Einschulungsuntersuchung) eingesetzt. Vgl. ferner Schöler,<br />
Hermann; Fromm, Waldemar; Kany, Werner, Spezifische Sprachentwicklungsstörung und<br />
Sprachlernen, Heidelberg 1998. In Österreich finden ähnliche Tests bereits in Salzburg statt.<br />
Vgl. dazu den Vortrag an den Ministerrat vom 14.4.2004: BMBWK GZ 11.012/34-I/2c/2004.<br />
50 Das sind erwartungswidrige Minderleistungen im sprachlichen Können, vor allem bei der<br />
Äußerungsproduktion ohrenfällig.<br />
51 Vgl. Schnider, Andreas, Schul- und Bildungsreform. Miteinander zum Bildungskonsens, in:<br />
Steirisches Jahrbuch für Politik 2003, S. 77 – 81, zur „steirischen Tagesschule“.<br />
52 Dieses Modell verknüpft sinnvoll drei Koordinaten im System Schule: Ziele und Standards,<br />
Zeit und biologischen Rhythmus, Raum und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt jedoch steht die<br />
soziale Gemeinschaft von Lehrern, Schülern und Eltern in ihrem kulturellen, sprachlichen<br />
und spirituellen Zusammenwirken. Ausgehend von diesen Parametern stellt sich die Frage<br />
407
sinnvoller und effektiver ganzheitlicher Wissensvermittlung. Informationen sollen am Vormittag<br />
gesammelt und diese am Nachmittag vernetzt werden. An den Rändern dieses Schultages,<br />
der von 9.00 bis 16.00 Uhr dauert, sind Betreuungsmöglichkeiten angesiedelt, die in der<br />
Früh Ankommen und auf die Schule Einstimmen beinhalten sollten und am Nachmittag, nach<br />
16.00 Uhr, als Phase des Wartens und Abholens angelegt sind. Die steirische Tagesschule<br />
dauert von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr und schließt am Freitag mit der<br />
Mittagsgemeinschaft.<br />
53 Damit ist nicht nur der Paradigmenwechsel vom ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild<br />
gemeint, sondern auch die Frage nach Ursprung und Sinn der Welt. Die Natur, nicht die<br />
Heilige Schrift, liefert die Antwort.<br />
54 Menzies, Gavin, 1421. Als China die Welt entdeckte, München, 2003.<br />
55 Thurow, Lester, Die Zukunft der Weltwirtschaft, Frankfurt am Main 2004, S. 20 - 25.<br />
56 Vulgo: Chat – frei nach: Anno Domini 1802: „Von ein Studiplan wird jetzt stark gredt, und<br />
da soll d´Jugend ein ganz andre Erziehung kriegen, und das kommet ja grad so heraus, als<br />
wenn d´jetzige Jugend schlecht erzogen würd; das laß ich aber in Ewigkeit nicht zu; denn<br />
wenn d´jetzige Erziehung nicht so gut wär, wie könnten denn die 12jährigen Töchter schon<br />
mehr wissen, als ihr Mama?“ Aus: Briefe eines Eipeldauers an seinen Vetter in Kakran, über<br />
d´Wienstadt“, zitiert nach der Edition von Paul Angerer, Wien 1998, S. 285.<br />
408
19 VERZEICHNIS DER TABELLEN UND<br />
ABBILDUNGEN<br />
WELTWIRTSCHAFT UND WELTHANDEL 13<br />
1 Lage der Weltwirtschaft 2003 und Ausblick 2004 15<br />
Abb. 1.1 Konjunkturverlauf in den wichtigsten OECD-Regionen 16<br />
Abb. 1.2 „Zwillings-Defizit“ in den USA 17<br />
Tab. 1.1 Budgetdefizit / -überschuss (Gesamter Staatshaushalt)<br />
in % des BIP/ des potenziellen BIP 20<br />
3 Entwicklung des Welthandels 57<br />
Abb. 3.1 Exporte, Produktion und globales BIP, reales Wachstum, 1995–2002 58<br />
Tab. 3.1 Entwicklung des Warenhandels, 2001–2003 59<br />
Tab. 3.2 Die 10 wichtigsten Handelsnationen 2003 (exklusive Intra-EU-Handel) 63<br />
Abb. 3.2 Entwicklung der wichtigsten Wechselkurse zum Euro<br />
(jeweilige Währungseinheit pro Euro) 68<br />
Abb. 3.3 Entwicklung der wichtigsten Weltmarktpreise (1995=100) 69<br />
Tab. 3.3 Sektorale Gliederung des Welthandels 70<br />
ÖSTERREICHS AUSSENWIRTSCHAFT 77<br />
4 Wirtschaftsentwicklung Österreichs im Überblick 79<br />
Abb. 4.1 Entwicklung des realen BIP<br />
Veränderung zum Vorjahr/Vorquartal (in %) 80<br />
Tab. 4.1 Beiträge zum realen Wirtschaftswachstum 81<br />
Abb. 4.2 Wirtschaftswachstum in Österreich und in der EU-15 82<br />
Tab. 4.2 Indikatoren zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs 88<br />
Abb. 4.3 Nominelle Exportquoten lt. VGR 90<br />
Abb. 4.4 Nominelle Importquoten lt. VGR 90<br />
Abb. 4.5 Außenbeitrag, nominell 91<br />
Tab. 4.3 Transferzahlungen Österreichs an die EU und Rückflüsse (in Mio. Euro) 94<br />
5 Österreichs Warenhandel 96<br />
Tab. 5.1 Österreichs Außenhandel: Überblick 97<br />
Abb. 5.1 Österreichs Export: Quartale nominell 98<br />
Tab. 5.2 Österreichs Export-Marktanteile: Real und nominell 100<br />
Tab. 5.3 Handelsbilanz: Preis- und Mengeneffekte 101<br />
Tab. 5.4 Österreichs Energieimporte 106<br />
409
Abb. 5.2 Standardisierte Marktanteile in MOEL-5 und Estland 20021:<br />
Österreich und Vergleichsländer 109<br />
Abb. 5.3 Österreichs Handelsbilanz, Saldo in % des BIP 112<br />
Tab. 5.5 Handelsbilanzsalden nach Warengruppen 1993–2003 113<br />
Tab. 5.6 Österreichs Fahrzeug-Außenhandel 2003 117<br />
6 Der Außenhandel mit Dienstleistungen 119<br />
Abb. 6.1 Entwicklung der Dienstleistungsbilanz 121<br />
Abb. 6.2 Struktur der Dienstleistungseinnahmen 122<br />
Abb. 6.3 Struktur der Dienstleistungsausgaben 122<br />
7 Grenzüberscheitende Direktinvestitionen 130<br />
Abb. 7.1 Globale FDI-Ströme, 1980–2002 (Mrd. USD) 131<br />
Tab. 7.1 Desinvestitionen nach Übernahmen und Fusionen: Änderungen<br />
in der Anzahl der Tochterunternehmen und Gastländer<br />
(ausgewählte Fälle) 132<br />
Abb. 7.2 Regionale Verteilung der FDI-Ströme, 1980–2002 (in %) 133<br />
Abb. 7.3 Direktinvestitionsbestände 1980–2002 (in % des BIP) 134<br />
Abb. 7.4 Aktive FDI: Anteile der MOEL-19 an Eigenkapital, Anzahl<br />
Tochterunternehmen und Beschäftigung (in %) 1991–2001 137<br />
Abb. 7.5 Arbeitsintensität der Tochterunternehmen, 1991–2001 138<br />
Abb. 7.6 Eigenkapitalrentabilität nach Regionen, 1991–2001 141<br />
Abb. 7.7 Eigenkapitalrentabilität einzelner MOEL, 1991–2001 141<br />
Tab. 7.2 Eigenkapitalrentabilität in % (unterschieden nach verschiedenen<br />
Kriterien – Medianwert), 2001 142<br />
Abb. 7.8 Beschäftigungsentwicklung der aktiven und<br />
passiven Direktinvestitionen, 1991–2001 144<br />
Statistische Übersichten 149<br />
Tab. 1.2 Reales BIP-Wachstum 151<br />
Tab. 1.3 Wachstum der Verbraucherpreise 152<br />
Tab. 1.4 Arbeitslosenrate (standardisiert) 153<br />
Tab. 1.5 Budgetdefizit/-überschuss in % des nominellen BIP 154<br />
Tab. 1.6 Wirtschaftslage in den MOEL (2002–2003)<br />
und Prognose (2004–2005) 155<br />
Tab. 1.7 Wirtschaftslage in den SOEL (2002–2003) und wiiw-Prognose (2004–2005) 156<br />
410
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen<br />
Tab. 3.4 Außenhandelsströme ausgewählter Ländergruppen 157<br />
Tab. 3.5 Handelsbilanzen ausgewählter Ländergruppen 158<br />
Tab. 3.6 Entwicklung der Warenexporte (fob) für ausgewählte Länder 159<br />
Tab. 3.7 Entwicklung der Warenimporte (cif) für ausgewählte Länder 160<br />
Tab. 3.8 Handelsbilanz ausgewählter Länder 161<br />
Tab. 3.9 Entwicklung der Dienstleistungsexporte für ausgewählte Länder 162<br />
Tab. 3.10 Entwicklung der Dienstleistungsimporte für ausgewählte Länder 163<br />
Tab. 3.11 Entwicklung der Dienstleistungsbilanz für ausgewählte Länder 164<br />
Tab. 3.12 Bedeutung von FDI für ausgewählte Regionen 165<br />
Tab. 3.13 Passive FDI-Flüsse ausgewählter Länder 166<br />
Tab. 3.14 Aktive FDI-Flüsse ausgewählter Länder 167<br />
Tab. 3.15 Passive Portfolioinvestitionen ausgewählter Länder 168<br />
Tab. 3.16 Aktive Portfolioinvestitionen ausgewählter Länder 169<br />
Tab. 4.4 Hauptergebnisse der WIFO-Konjunkturprognose für Österreich 170<br />
Tab. 4.5 Österreichs Exporte lt. VGR 171<br />
Tab. 4.6 Österreichs Importe lt. VGR 172<br />
Tab. 4.7 Der österreichische Außenbeitrag lt. VGR 173<br />
Tab. 4.8 Beiträge zur Österreichischen Zahlungsbilanz 174<br />
Tab. 5.7 Österreichs Warenhandel mit ausgewählten Ländern 175<br />
Tab. 5.8 Österreichs Handelsbilanz mit ausgewählten Ländern 176<br />
Tab. 5.9 Regionale Gliederung des österreichischen Warenhandels 177<br />
Tab. 5.10 Regionale Gliederung der österreichischen Handelsbilanz 178<br />
Tab. 5.11 Sektorale Gliederung des österreichischen Warenhandels 179<br />
Tab. 5.12 Sektorale Gliederung der österreichischen Handelsbilanz 180<br />
Tab. 6.1 Österreichischer Handel mit Dienstleistungen nach Sektoren 181<br />
Tab. 6.2 Österreichische Dienstleistungsbilanz nach Sektoren 182<br />
Tab. 6.3 Österreichische Dienstleistungsexporte<br />
nach Haupthandelspartnern 183<br />
Tab. 6.4 Österreichische Dienstleistungsimporte<br />
nach Haupthandelspartnern 184<br />
Tab. 6.5 Österreichische Dienstleistungsbilanz<br />
gegenüber den wichtigsten Haupthandelspartnern 185<br />
Tab. 6.6 Der Handel mit Dienstleistungen nach Ländergruppen 186<br />
Tab. 6.7 Österreichische Dienstleistungsbilanz nach Ländergruppen 187<br />
Tab. 7.3 Passive Direktinvestionsströme, 1980–2002 (Mrd. USD) 188<br />
Tab. 7.4 Direktinvestitionsbestände nach Regionen, 1980–2002 (in % des BIP) 189<br />
411
Tab. 7.5 Aktive Direktinvestitionen: Investiertes Eigenkapital, Anzahl der<br />
Beteiligungen und Beschäftigung, 1991–2001 190<br />
Tab. 7.6 Passive Direktinvestitionen: Investiertes Eigenkapital, Anzahl der<br />
Beteiligungen und Beschäftigung, 1991–2001 191<br />
Tab. 7.7 Passive Direktinvestitionen: Eigenkapital und Beschäftigung pro -<br />
Beteiligungen, 1991–2001 192<br />
Tab. 7.8 Branchenstruktur der aktiven Direktinvestitionen, 2001 193<br />
Tab. 7.9 Branchenstruktur der passiven Direktinvestitionen, 2001 194<br />
Tab. 7.10 a Eigenkapitalrentabilität nach Regionen, 1991–2001 195<br />
Tab. 7.10 b Eigenkapitalrentabilität nach Regionen, 1991–2001 196<br />
Tab. 7.11 Beschäftigungsentwicklung der aktiven Direktinvestitionen, 1991–2001,<br />
Zielregion der Tochterunternehmen 197<br />
Tab. 7.12 Beschäftigungsentwicklung der passiven Direktinvestitionen, 1991–2001,<br />
Herkunftsregion der Mutterunternehmen 198<br />
Eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik für<br />
Österreich: Die Internationalisierungsoffensive<br />
2003/2005 203<br />
9 Eine strategische Außen<strong>wirtschafts</strong>politik für Österreich 205<br />
Abb. 9.1 Entwicklung der Welt-Warenexporte und des Welt-BIP 1950–2002 209<br />
Abb. 9.2 Entwicklung des Welt-Dienstleistungsexporte 1980–2002 210<br />
Abb. 9.3 Entwicklung der weltweiten Direktinvestitionsbestände 1980–2002 211<br />
Tab. 9.1 Importzollentwicklung ausgewählter Länder seit 1875 212<br />
Abb. 9.4 Österreichische Export- und Importquoten (Waren) seit 1995 213<br />
Abb. 9.5 Anteil der Dienstleistungsexporte am BIP in ausgewählten Ländern 2002 214<br />
Abb. 9.6 Österreichische Direktinvestitionsbestände seit 1980 215<br />
11 Außenhandelsstruktur der österreichischen Industrie 234<br />
Tab. 11.1 Taxonomien der Sachgüterproduktion 238<br />
Tab. 11.2 Exportspezialisierung Österreichs und der EU,<br />
Branchentypen und Regionen, 2002 240<br />
Abb. 11.1 Anteil anspruchsvoller Produktgruppen am Industrie-<br />
warenexport, Österreich und EU im Vergleich, 2002 241<br />
Tab. 11.3 Anteil anspruchsvoller Produktgruppen am Industriewarenexport,<br />
Österreich und EU-Länder im Vergleich, 2002 242<br />
412
Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen<br />
Tab. 11.4 RCA-Werte im Außenhandel mit Industriewaren nach Branchentypen und<br />
Regionen, Österreich und die EU im Vergleich, 2002 244<br />
Tab. 11.5 a Strukturwandel im Außenhandel mit Industriewaren,<br />
Österreich, 1995 und 2002 247<br />
Tab. 11.5 b Strukturwandel im Außenhandel mit Industriewaren, EU, 1995 und 2002 248<br />
Tab. 11.6 Struktur der komparativen Vorteile Österreichs im Osthandel,<br />
1995 und 2002 251<br />
Tab. 11.7 Exportspezialisierung und Export-Unit Values, Österreich<br />
und osteuropäische Beitrittskandidaten im EU-Export nach<br />
Branchentypen im Zeitvergleich, 1995 und 2002 252<br />
13 Direktinvestitions-Förderung heute und morgen 273<br />
Abb. 13.1 Österreichische Direktinvestitionen 1990 bis 2002 274<br />
Abb. 13.2 Stufenschema <strong>internationale</strong>r Unternehmenstätigkeit 275<br />
Abb. 13.3 Direktinvestitions-Förderung für österreichische Unternehmen 278<br />
Tab. 13.1 Österreichische Direktinvestitionen, Brutto-Neuinvestitionen und<br />
Neuzusagen von G4-Beteiligungsgarantien 281<br />
Abb. 13.4 Gegenüberstellung der Brutto-Neuinvestitionen und der G4-Neuzusagen 282<br />
Tab. 13.2 Regionale Aufschlüsselung gewährter G4-Beteiligungsgarantien 283<br />
Abb. 13.5 Garantie-Angebot der AWS im Internationalisierungsbereich 284<br />
Tab. 13.3 KMU-Internationalisierung, Aushaftendes Obligo nach<br />
Zielländern per 31. Dezember 2002 285<br />
Tab. 13.4 Entwicklung der Ost-West-Fonds-Projekte, 1990–2002 287<br />
Tab. 13.5 Regionale Verteilung der Ost-West-Fonds-Projekte, 1990–2002 287<br />
Abb. 13.6 Kapitalbereitstellung zur Finanzierung österreichischer Direktinvestitionen 289<br />
14 Dienstleistungen: Export ist mehr als Warenverkehr 297<br />
Abb. 14.1 Exportstruktur der Dienstleistungen, 2002 304<br />
Abb. 14.2 Exportspezialisierung bei Dienstleistungen, 2002 305<br />
Abb. 14.3 Spezialisierungsindex nach Balassa, 2002 307<br />
Abb. 14.4 Österreichisches Exportspezialisierungsmuster, 1995 und 2002 311<br />
Abb. 14.5 Österreichisches Importspezialisierungsmuster, 1995 und 2002 312<br />
15 IFIs als Außen<strong>wirtschafts</strong>partner für Österreich 320<br />
Tab. 15.1 Geographische Struktur der EIB-Darlehen 2003, Mrd. Euro 322<br />
Tab. 15.2 Sektorale Struktur der EIB-Finanzierungen nach Sektoren,<br />
1998–2002, Mrd. Euro 322<br />
Tab. 15.3 Weltbank-Finanzierungen, 2003, Mrd. USD 323<br />
413
Tab. 15.4 Weltbank/IDA-Kredite nach Sektoren, Fiskaljahr 2003, Mrd. USD 324<br />
Tab. 15.5 IBRD/IDA-Kredite nach Regionen, Fiskaljahr 2003, in Prozent 324<br />
Tab. 15.6 IFC-Kredite, Fiskaljahr 2003, Mrd. USD 325<br />
Tab. 15.7 EBRD-Finanzierungen nach Sektoren, 2002, Mrd. Euro 327<br />
Tab. 15.8 EU-Förderungen 2000/02 und 2004/06, Mio. Euro 329<br />
16 Cluster als Exportmotor 340<br />
Abb. 16.1 Exporte der Bundesländer, produzierender Sektor 2001 340<br />
Abb. 16.2 Clusterland Oberösterreich, Zahlen & Daten 341<br />
17 Bedeutung der Analyse <strong>internationale</strong>r Wirtschaftsbeziehungen 359<br />
Tab. 17.1 Internationaler Vergleich der Wirtschaftsforschungsinstitute 369<br />
Tab. 17.2 Vergleich der österreichischen Institutionen 374<br />
Tab. 17. 3 Vergleich der Schweizer Institutionen 375<br />
Tab. 17.4 Vergleich der niederländischen Institutionen 376<br />
Tab. 17.5 Vergleich der dänischen Institutionen 377<br />
Tab. 17.6 Vergleich der schwedischen Institutionen 378<br />
414
20 STICHWORTVERZEICHNIS<br />
A<br />
AFTA-ASEAN Free Trade Area ...........49f<br />
Arbeitslosenquote ................................21<br />
Beitrittsländer ......................................22<br />
Österreich ......................................82,86<br />
Arbeitslosigkeit<br />
Deutschland ........................................21<br />
MOEL ............................................22, 30<br />
SOEL ..................................................31<br />
USA ....................................................21<br />
Arbeitsmarkt<br />
Österreich ..................................80f, 84ff<br />
ASEAN ...................................................49<br />
ASEM .....................................................47<br />
Asian Development Bank ..................327<br />
Asien<br />
regionale Integration ...........................60<br />
-krise ...................................................35<br />
Ausfuhrförderungsgesetz (AFG 1981)<br />
............................................279f, 288f, 292<br />
Außenbeitrag ........................................98<br />
Österreich ...................79, 80, 83, 91, 95<br />
Außenhandelspreise<br />
Österreich ...........................................89<br />
außenwirtschaftliches Leitbild ..........221<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>politik<br />
strategische ..............................205, 217<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>theorie ...................360<br />
Außenhandelstheorie .........................235<br />
neue ..................................................235<br />
technologieorientierte Modelle ..........236<br />
traditionelle .......................................235<br />
klassische .........................................301<br />
Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation (AWO)<br />
..............................216, 227, 231, 256, 260<br />
B<br />
Bildungsoffensive ..............................391<br />
Binnennachfrage<br />
Asien ...................................................34<br />
Deutschland ........................................23<br />
BIP-Wachstum<br />
Asien ..................................................34f<br />
EU ......................................................22f<br />
Japan ..................................................27<br />
MOEL ..................................................28<br />
OECD-Länder .....................................16<br />
Österreich .............79, 83, 84, 85, 91, 95<br />
SOEL ..................................................30<br />
Türkei ..................................................33<br />
USA ...............................................15,18<br />
Welt .....................................................57<br />
C<br />
Cluster<br />
oberösterreichische Initiativen ..........341<br />
Schwerpunktaktivitäten .....................342<br />
-Philosophie ......................................356<br />
Politik ................................................356<br />
Clusterland OÖ ...........................341, 357<br />
D<br />
Deep integration .................................364<br />
Deflation<br />
Japan ..................................................27<br />
Bosnien-Herzegowina ........................32<br />
Dienstleistungen<br />
Exporte, Anteil am BIP ......................298<br />
Exporte, Bedeutung ..........................218<br />
Globalisierung ...................................297<br />
koordinierende ..................................298<br />
Österreich-MOEL ..............................128<br />
Reiseverkehr, weltweit ........................70<br />
statistische Erfassung ...............302, 315<br />
Transportleistungen, weltweit .............70<br />
unternehmensnahe, weltweit ..............70<br />
Dienstleistungshandel<br />
Österreich ......................................... 119<br />
Österreich-China ..............................128<br />
Österreich-SOEL ..............................128<br />
415
Dienstleistungshandel<br />
Bauleistungen ...................................127<br />
EDV- und Informationsleistungen .....125<br />
EU .......................................................62<br />
Exportstruktur ...................................125<br />
intra-industrieller Handel ...................313<br />
Kommunikationsdienstleistungen .....126<br />
Lateinamerika .....................................65<br />
Liberalisierung ..................................298<br />
MOEL ..................................64, 310, 314<br />
NAL ...........................................121, 303<br />
Patente und Lizenzen<br />
................................121, 217, 306f, 313f<br />
Regulierung ..............................298, 315<br />
Reiseverkehr ....................................123<br />
Spezialisierung, international ............305<br />
Spezialisierung, Österreich ...............310<br />
Struktur, international ........................304<br />
unternehmensbezogene ...........121, 124<br />
Wettbewerbsfähigkeit .......................306<br />
wissensbasierte ................................124<br />
Direktinvestitionen ...............................72<br />
aktive ..................................................73<br />
China ..........................................74, 133<br />
Fusionen ...........................................144<br />
MOEL ..................................................73<br />
passive ...............................................73<br />
weltweite .............................................72<br />
Direktinvestitionen Österreich<br />
aktive, Branchen ...............................139<br />
Anlaufverluste ...................................143<br />
Arbeitsintensität ................................137<br />
Beschäftigung ...........................139, 143<br />
Branchen ..........................................139<br />
Eigenkapitalrentabilität .....................140<br />
ERP-Internationalisierungsprogramm<br />
..........................................................290<br />
Förderungszuschüsse ......................279<br />
MOEL ................................................137<br />
Medianwert Eigenkapitalrentabilität ..142<br />
416<br />
passive .............................................135<br />
passive, Branchen ............................140<br />
regionale Verteilung .........133, 136f, 138<br />
Rentabilität ........................................140<br />
Starthilfekredite .................................290<br />
Direktinvestitions-Risiken<br />
Absicherung ......................................280<br />
Beteiligungsgarantien .....................280ff<br />
creeping expropriation ......................280<br />
Deckung wirtschaftliches Risiko .......283<br />
<strong>politische</strong> Absicherung ......................281<br />
Risk-Sharing .....................................283<br />
Doppelbesteuerungsabkommen .........75<br />
E<br />
EBRD<br />
Aufgaben ..........................................325<br />
Finanzierungen .................................325<br />
Trade Facilitation-Programm ............326<br />
EIB<br />
Darlehen ...........................................322<br />
Globaldarlehen .................................321<br />
Kreditvergabe ...................................321<br />
Kreditvolumen ...................................322<br />
Emerging Markets ..............................331<br />
Employability ......................................385<br />
ERP-Kreditkonditionen ......................290<br />
EU<br />
acquis communautaire .................29, 73<br />
Agenda 2007 ......................................42<br />
Assoziationsabkommen EU-Chile ......46<br />
Binnenmarkt .......................................43<br />
Cotonou-Abkommen ...................46, 332<br />
Doppelnull-Abkommen EU-MOEL ......46<br />
Erweiterung ......................................107<br />
Kopenhagener Kriterien ................43, 44<br />
Lissabon-Strategie ............................392<br />
MEDA .................................................47<br />
Mehrjähriges Strategieprogramm .......42<br />
EU-Arbeitsgruppe Beschäftigung .......41
EU-Beitritt ..............................................28<br />
Migration .............................................30<br />
EU-Beitrittsverhandlungen ..................44<br />
EU-Beitrittsvertrag ...............................40<br />
EU-Defizitverfahren ..............................45<br />
EU-Erweiterung .....................40, 127, 364<br />
EU-Transfers .........................................28<br />
Europa-Abkommen ............................127<br />
Europäische Kommission<br />
Fortschrittberichte ...............................44<br />
Monitoring-Berichte ............................43<br />
Europäischer Konvent .........................40<br />
Europäischer Stabilitäts- und<br />
Wachstumspakt ........................19, 21, 45<br />
Europäisches Cluster-Netzwerk .......357<br />
Europäisches Patentübereinkommen .43<br />
Europäische Investitionsbank . siehe EIB<br />
Europäische Sicherheits- und<br />
Verteidigungspolitik (ESVP) ................42<br />
Europäische Wachstumsinitiative ......41<br />
Europäische Währungsunion (EWU) ..20<br />
Europäische Zentralbank (EZB) ..........17<br />
European Development Finance<br />
Institutions ..........................................279<br />
Euro Mediterranean Partnership .......331<br />
EU Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess<br />
(SAP) .......................................46<br />
export-led growth ...............................333<br />
Exportbarrieren ..................................257<br />
unternehmensexterne ...............257, 258<br />
unternehmensinterne ........................257<br />
Exporte ............. siehe auch Warenhandel<br />
Beitrittsländer ............ 103, 104, 107, 115<br />
Deutschland ......................................102<br />
direkte ...............................................269<br />
Entwicklungsländer ................... 103, 110<br />
EU ...............................................99, 102<br />
Fahrzeugindustrie ............................. 116<br />
Fernost ..................................... 103, 110<br />
indirekte ....................................269, 334<br />
Stichwortverzeichnis<br />
Maschinen ................................ 104, 112<br />
Mittel- und Osteuropa .......................108<br />
MOEL ........................................104, 108<br />
Nordamerika .....................................103<br />
Österreich .....................80ff, 96, 99, 102<br />
Preise .........................................99, 102<br />
Südosteuropa .....................99, 103, 108<br />
Schwerpunktländer ........................... 114<br />
Spezialisierung ................................. 116<br />
Ungarn ..............................................104<br />
Warenstruktur ................................... 112<br />
Exporte laut VGR<br />
Österreich .....................................86, 87<br />
Exportförderung .................256, 257, 291<br />
funktionelle .......................................260<br />
Exportkooperation<br />
Cluster .............siehe auch unter Cluster<br />
Exportringe .......................................271<br />
Projektkooperation ............................271<br />
Exportmarketing .................................256<br />
Hauptprobleme des ..........................256<br />
Exportoffensive ..........................220, 228<br />
Exportpolitik, Österreich ...................277<br />
Exportquote<br />
Österreich .....................................89, 91<br />
Welt ...................................................214<br />
Exportworkshops ...............................347<br />
F<br />
F&E-Projekte<br />
CrossWork ........................................345<br />
SCIFI ................................................345<br />
FDI-Flüsse ..........siehe Direktinvestitionen<br />
Feasibility-Studien ......................320, 335<br />
Federal Reserve Bank ..........................17<br />
Finanzierungssaldo des Staates<br />
Österreich ...............................82, 84, 86<br />
Fiskal- und Geldpolitik<br />
MOEL ..................................................28<br />
USA ....................................................25<br />
417
Flair Flow Europe ...............................351<br />
Förderpolitik<br />
KMU ..........................................275, 284<br />
Freihandelsabkommen<br />
EU-SOEL ............................................32<br />
EU-Mexiko ..........................................46<br />
FTAA ..................................................48<br />
G<br />
Geldpolitik<br />
Brasilien ..............................................38<br />
Japan ..................................................27<br />
GATS ....................................................299<br />
„go international”<br />
.............206, 219f, 228, 231, 233, 356, 399<br />
H<br />
Handelsabkommen, regionale ...62, 212<br />
Handelsbilanz ..80, 92, 96f, 99ff, 110f, 113<br />
Überschuss Österreich .......................80<br />
Handelstheorie, neuere .....................360f<br />
I<br />
Importe<br />
Energie .............................................105<br />
gesamt ..................................97, 99, 100<br />
Maschinen ........................................105<br />
Österreich ...............................80, 85, 87<br />
Preise .......................................102, 105<br />
Importe laut VGR<br />
Österreich .....................................86, 87<br />
Importquote<br />
Österreich ...........................................91<br />
Importzölle auf Stahlprodukte<br />
USA ....................................................66<br />
Industrietaxonomien ..........................237<br />
Inflation<br />
Österreich ...............................81, 84, 85<br />
Argentinien .........................................37<br />
Inflation targeting .................................20<br />
418<br />
Informationstechnologien ...................34<br />
Infrastrukturinvestitionen ..........321, 332<br />
Innovation Relay Centre Austria<br />
(IRC) .....................................................352<br />
Intellectual Capital ......................388, 395<br />
Internationalisierung<br />
Österreich ....................89,130, 135, 146<br />
Internationalisierungsgrad ........216, 218<br />
KMU ..................................................284<br />
Internationalisierungsoffensive<br />
.....................................206, 226, 228f, 316<br />
IBRD .....................................................323<br />
ICSID ....................................................325<br />
IDA .......................................................324<br />
Interreg-III-c-Projekte .........................353<br />
Intra-EU-Handel ....................................62<br />
Intra-Firmen-Handel ........................... 110<br />
Investitionen<br />
Österreich ...............................79, 83, 94<br />
Investitionsabkommen ........................75<br />
Investitionsschutzabkommen<br />
österreichische .................................145<br />
bilaterale ...........................................145<br />
Irakkrieg ....................................15, 25, 34<br />
K<br />
Kapitalflucht<br />
Russland .............................................33<br />
Knowledge Economy .........................388<br />
Knowledge Society.............................397<br />
Konjunktur<br />
Europa ................................................23<br />
global ..................................................15<br />
USA ....................................................25<br />
Konsum<br />
Österreich ...............................80, 83, 84<br />
Kunststoff-Netzwerke .........................347
L<br />
Leistungsbilanz<br />
Österreich ........... 80, 91, 93, 94, 95, 119<br />
Leistungsbilanzdefizit<br />
USA ..............................................15, 61<br />
Life-Science-Region ...........................350<br />
Lohnkosten<br />
MOEL ..........................................73, 313<br />
Lohnstückkosten<br />
MOEL ..................................................29<br />
Österreich ...................................88f,102<br />
M<br />
Marktanteile Österreich<br />
..........................96, 99, 100, 102, 104, 108<br />
Markteintrittsstrategie ........................268<br />
Markterschließung<br />
......................228, 257, 344, 351, 353, 355<br />
Marktsegmentierung ..........................268<br />
kundenspezifische ............................268<br />
regionale ...........................................268<br />
Mercosur ...............................................48<br />
Messen<br />
ANUGA .............................................349<br />
K 2004 ..............................................346<br />
MIGA ....................................280, 323, 325<br />
N<br />
Neue Politische Ökonomie ................361<br />
Neue Wirtschaftsgeografie ................362<br />
O<br />
OECD<br />
Leitsätze ...........................................276<br />
P<br />
PISA-Studie ................................381f, 386<br />
Preisentwicklung<br />
Energie ...............................................32<br />
Öl ............................................15, 60, 69<br />
Stichwortverzeichnis<br />
Private Public Partnership ..........322,333<br />
Privatisierungen<br />
China ..................................................36<br />
SOEL ..................................................31<br />
Transformationsländer ........................72<br />
Türkei ..................................................34<br />
Privatisierungsprogramme ................133<br />
Q<br />
Qualitätswettbewerb ..................236, 237<br />
Quick-Start-Package ..................231, 232<br />
S<br />
SARS...............................................34f, 59<br />
Spezialisierungsindex nach Balassa<br />
.............................................302, 306f, 309<br />
Spezialisierungsmuster .....................234<br />
Dienstleistungen ......................310f, 314<br />
Exportstruktur ...........................239, 246<br />
Marktanteil ........................................249<br />
RCA-Werte .......................239, 243, 249<br />
Theorie .............................................235<br />
Unit Value .................................239, 245<br />
Stabilitätspakt für den<br />
westlichen Balkan ..............................330<br />
Stabilitätsprogramm<br />
Türkei ..................................................33<br />
Standortpolitik Österreich .........217, 315<br />
Steuerreform 2005 ......................217, 279<br />
Strategisches Management .............205ff<br />
Struktur- und Kohäsionsfonds .........329f<br />
T<br />
Terms of Trade ..........................61, 96, 98<br />
Österreich .........................88, 89, 92, 97<br />
Tourismus<br />
Österreich .................................123, 306<br />
Transeuropäische Netze ..............41, 333<br />
419
U<br />
Übernahmen und Fusionen ......131, 144f<br />
V<br />
Value Added Wood .............................349<br />
Venture Capital Fonds ........................321<br />
Vermögenseinkommensbilanz<br />
Österreich .........................................216<br />
VPI……………………………siehe Inflation<br />
W<br />
Warenhandel ........siehe auch Ex-/Importe<br />
Bedeutung ........................................208<br />
Österreich .............................91, 93, 213<br />
Welt .....................................................57<br />
Wechselkurs<br />
USD/Euro .......................59, 61, 67, 124<br />
USD/Yen .............................................67<br />
Weltbank<br />
Finanzierungen ...............................323ff<br />
Weltmarktpreise ..............................60, 69<br />
Wettbewerbsfähigkeit<br />
MOEL ..................................................29<br />
Lohnstückkosten ...............85, 88, 89, 95<br />
Österreich .........................87, 88, 92, 95<br />
Wirtschaftsentwicklung<br />
Japan, Bilanz-Rezession ....................27<br />
Argentinien .........................................37<br />
Wirtschaftsforschung ................362, 370<br />
Grundlagenforschung .......................370<br />
<strong>internationale</strong> Integration ..................364<br />
Wirtschaftsforschungsinstitute<br />
<strong>internationale</strong>r Vergleich ...................367<br />
Wirtschaftswachstum .. s. BIP-Wachstum<br />
WTO<br />
5. Ministerkonferenz, Cancún .............51<br />
China ..................................................36<br />
TRIPs-Übereinkommen ......................54<br />
Doha-Runde .......................................52<br />
420<br />
WTO-Verhandlungen<br />
Dienstleistungen .................................53<br />
Landwirtschaft ....................................53<br />
Marktzugang .......................................52<br />
Singapur-Themen ...............................53<br />
Umwelt ................................................54<br />
Y<br />
Yukos Affäre ..........................................33<br />
Z<br />
Zahlungsbilanz<br />
Österreich ...............................92, 93, 94<br />
Zahlungsbilanzstatistik ......................121<br />
Zinssätze<br />
kurzfristige ..........................................20<br />
Zukunftskommission .......382f, 385f, 391<br />
Zwillingsdefizit ......................................16<br />
Großbritannien ....................................25<br />
USA ....................................................26
21 VERZEICHNIS DER LÄNDER-<br />
AGGREGATE UND ABKÜRZUNGEN<br />
21.1 Länderaggregate<br />
Die Ländergruppen in den Statistischen Übersichten sind folgendermaßen definiert:<br />
Afrika Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorial Guinea, Äthiopien,<br />
Benin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’ Ivoire,<br />
Djibuti, Dem. Republik Kongo, Gabun, Gambia, Ghana,<br />
Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Liberia,<br />
Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marokko, Mauretanien,<br />
Mosambik, Niger, Nigeria, Republik Kongo,<br />
Ruanda, Sambia, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe,<br />
Somalia, Südafrika, Sudan, Tansania, Togo, Tschad,<br />
Tunesien, Uganda, Zentralafrikanische Republik<br />
ASEAN Indonesien, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur,<br />
Thailand<br />
ASEAN+3 ASEAN, China, Japan, Republik Korea<br />
Asien ASEAN+3, Afghanistan, Arabische Halbinsel, Bangladesch,<br />
Hongkong, Indien, Macao, Mongolei, Naher<br />
Osten, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Volksrepublik<br />
Korea<br />
EFTA Island, Norwegen, Schweiz<br />
Entwicklungsländer Welt ohne Westliche Industriestaaten, ohne Oststaaten,<br />
bzw. in Tabelle 3.8: Welt ohne Industrieländer,<br />
ohne Oststaaten<br />
EU-15 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,<br />
Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,<br />
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal,<br />
Schweden, Spanien<br />
EU-Beitrittsländer Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien,<br />
Tschechische Republik, Ungarn, Zypern<br />
EU-25 EU-15, Beitrittsländer<br />
Europa EU-15, EFTA, MOEL-5, Südosteuropa, Estland, Lettland,<br />
Litauen<br />
Eurozone EU-15 ohne Großbritannien, Dänemark, Schweden<br />
Extra-EU Welt ohne EU-15, bzw. ohne EU-25<br />
421
G-7 Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,<br />
Japan, Kanada, USA<br />
Industrieländer EU-15, Australien, Island, Israel, Japan, Kanada,<br />
Malta, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, USA<br />
MOEL-5 Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik,<br />
Ungarn<br />
MOEL-19 MOEL5, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien,<br />
Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien,<br />
Moldawien, Rumänien, Russland, Serbien und Montenegro,<br />
Ukraine, Weißrussland<br />
MOEL-27 MOEL-5, SOEL-7, Armenien, Aserbaidschan, Belarus,<br />
Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Lettland,<br />
Litauen, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan,<br />
Ukraine, Usbekistan<br />
NAFTA Kanada, Mexiko, USA<br />
NIC-6 Hongkong, Malaysia, Republik Korea, Singapur, Taiwan,<br />
Thailand<br />
Nordamerika Kanada, USA<br />
OECD EU-15, NAFTA, Australien, Island, Japan, Korea,<br />
Neuseeland, Norwegen, Polen, Schweiz, Tschechische<br />
Republik, Türkei, Ungarn<br />
OPEC Algerien, Indonesien, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Libyen,<br />
Nigeria, Saudi Arabien, Venezuela, Vereinigte Arabische<br />
Emirate<br />
SOEL-7 Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien,<br />
Mazedonien, Rumänien, Serbien-Montenegro<br />
Südamerika Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Guyana,<br />
Französisch-Guayana, Kolumbien, Paraguay,<br />
Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela,<br />
Süd- und Südostasien Bangladesch, Bhutan, China, Hongkong, Indien,<br />
Indonesien, Kambodscha, Laos, Macao, Malaysia,<br />
Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Pakistan,<br />
Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan,<br />
Thailand, Vietnam<br />
422
Verzeichnis der Aggregate und Abkürzungen<br />
Westeuropa EU-15, Island, Norwegen, Schweiz, Türkei<br />
Westliche Industriestaaten OECD ohne Tschechische Republik, Polen, Ungarn<br />
Zentral- und Osteuropa MOEL-5, SOEL-7, Estland, Lettland, Litauen, Russland,<br />
Ukraine, Weißrussland<br />
21.2 Abkürzungen<br />
ADB Asian Development Bank<br />
AEC ASEAN Economic Community<br />
AFG Ausfuhrförderungsgesetz<br />
AFTA ASEAN Free Trade Area<br />
AKP Afrikanische, Karibische und<br />
Pazifische Staaten<br />
ANDEAN ANDEAN Gemeinschaft,<br />
besteht aus Bolivien,<br />
Kolumbien, Ecuador, Peru<br />
und Venezuela<br />
APEC Asia Pacific Economic<br />
Cooperation<br />
ASEAN Association of South-East<br />
Asian Nations<br />
ASCM Agreement on Subsidies and<br />
Countervailing Measures<br />
ASEM Asia Europe Meeting<br />
AWO Außen<strong>wirtschafts</strong>organisation<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
BITs Bilateral Investment<br />
Promotion and Protection<br />
Treaties<br />
BNP Bruttonationalprodukt<br />
BOP Balance of Payments<br />
CEB Council of Europe<br />
Development Bank<br />
DIW Deutsches Institut für<br />
Wirtschaftsforschung<br />
EBRD Europäische Bank für<br />
Wiederaufbau und<br />
Entwicklung<br />
EFTA European Free Trade Area<br />
EIB Europäische Investitionsbank<br />
ESVG Europäisches System<br />
der Volkswirtschaftlichen<br />
Gesamtrechnung<br />
ESVP Europäische Sicherheits-<br />
und Verteidigungspolitik<br />
EU Europäische Union<br />
EVF Exportfinanzierungsverfahren<br />
EWR Europäischer<br />
Wirtschaftsraum<br />
EZB Europäische Zentralbank<br />
FDI Foreign Direct Investment<br />
423
FTAA Free Trade Area of the<br />
Americas<br />
GATS General Agreement on Trade<br />
in Services<br />
GATT General Agreement on Trade<br />
Tariffs<br />
GSP Generalized System of<br />
Preferences<br />
GUS Gemeinschaft Unabhängiger<br />
Staaten<br />
IACS Integrated accounting and<br />
controlling system<br />
IFC International Finance<br />
Corporation<br />
IFIs Internationale<br />
Finanzinstitutionen<br />
IBRD International Bank of<br />
Reconstruction and<br />
Development<br />
ibw Institut für Bildungsforschung<br />
der Wirtschaft<br />
ICSID International Centre for the<br />
Settlement of Investment<br />
Disputes<br />
IDA International Development<br />
Association<br />
IFC International Finance<br />
Corporation<br />
ILO International Labour<br />
Organisation<br />
IMF International Monetary Fund<br />
424<br />
IT Informationstechnologie<br />
IWF Internationaler<br />
Währungsfonds<br />
MAI Multilateral Agreement on<br />
Investment<br />
MEA Multilateral Environmental<br />
Agreement<br />
MEDA Programm für finanzielle<br />
und technische<br />
Begleitmaßnahmen zur<br />
Reform der wirtschaftlichen<br />
und sozialen Strukturen im<br />
Rahmen der Partnerschaft<br />
Europa-Mittelmeer<br />
(Verordnung [EG]<br />
Nr. 1488/96)<br />
M&As Mergers and Acquisitions<br />
MIGA Multilateral Investment<br />
Guarantee Agency<br />
MOEL Mittel- und Osteuropäische<br />
Länder<br />
NACE Nomenclature statistique des<br />
Activités économiques dans<br />
la Communauté Européenne<br />
NAFTA North American Free Trade<br />
Area<br />
NAL Nicht aufteilbare Leistungen<br />
NATO North Atlantic Treaty<br />
Organisation<br />
NIB Nordic Investment Bank<br />
NIC Newly Industrialised<br />
Countries
NOVA Normverbrauchsabgabe<br />
NTC Non-Trade Concerns<br />
OECD Organisation of Economic<br />
Co-operation and<br />
Development<br />
OeKB Oesterreichische<br />
Kontrollbank<br />
OeNB Oesterreichische<br />
Nationalbank<br />
OPEC Organization of the<br />
Petroleum Exporting<br />
Countries<br />
OSZE Organisation für Sicherheit<br />
und Zusammenarbeit in<br />
Europa<br />
PPP Private-Public-Partnership<br />
SAA Stabilisierungs- und<br />
Assoziierungsabkommen<br />
SAP Stabilisierungs- und<br />
Assoziierungsprozess<br />
SARS Severe Acute Respiratory<br />
Syndrom<br />
SOEL Südosteuropäische Länder<br />
TENs Transeuropäischen Netze<br />
TOT Terms of Trade<br />
TRIPs Trade-Related Aspects of<br />
Intellectual Property Rights<br />
UNCTAD United Nations Conference<br />
on Trade and Development<br />
UNO United Nations Organisation<br />
Verzeichnis der Aggregate und Abkürzungen<br />
VGR Volkswirtschaftliche<br />
Gesamtrechnung<br />
WIFO Österreichisches Wirtschaftsforschungsinstitut<br />
wiiw Wiener Institut<br />
für Internationale<br />
Wirtschaftsvergleiche<br />
WKÖ Wirtschaftskammer<br />
Österreich<br />
WPA Wirtschaftspartnerschafts-<br />
abkommen<br />
WTO World Trade Organisation<br />
425
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
A-1011 Wien · Stubenring 1<br />
www.bmwa.gv.at