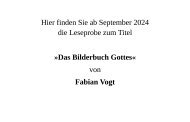Ulrike Peisker | Konstantin Funk (Hrsg.): Ich sehe was, was du nicht siehst (Leseprobe)
Der interdisziplinäre Band versammelt Beiträge zu moralischer, ästhetischer und religiöser Phänomenologie aus Perspektive der Theologie, Philosophie, Psychologie und Musikwissenschaft und fragt nach Verwandtschaftsmomenten der jeweiligen Wirklichkeitszugänge und Disziplinen. In Ethik, Ästhetik und Religion hat man es allesamt mit »Bedeutungen« zu tun, die sich mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden in ihrem Wesen nicht recht fassen lassen. Wir scheinen uns in Fragen des Schönen, Grausamen und Erhabenen auf unsere rezeptiven Fähigkeiten verlassen zu müssen: Sie alle explizieren sich im sinnlichen Erleben. Was macht der Rückgriff auf unsere Erfahrung und Lebenspraxis mit den Geltungsansprüchen der Phänomene und dem Erkenntnischarakter der Disziplinen?
Der interdisziplinäre Band versammelt Beiträge zu moralischer, ästhetischer und religiöser Phänomenologie aus Perspektive der Theologie, Philosophie, Psychologie und Musikwissenschaft und fragt nach Verwandtschaftsmomenten der jeweiligen Wirklichkeitszugänge und Disziplinen. In Ethik, Ästhetik und Religion hat man es allesamt mit »Bedeutungen« zu tun, die sich mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden in ihrem Wesen nicht recht fassen lassen. Wir scheinen uns in Fragen des Schönen, Grausamen und Erhabenen auf unsere rezeptiven Fähigkeiten verlassen zu müssen: Sie alle explizieren sich im sinnlichen Erleben. Was macht der Rückgriff auf unsere Erfahrung und Lebenspraxis mit den Geltungsansprüchen der Phänomene und dem Erkenntnischarakter der Disziplinen?
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Theologie| Kultur | Hermeneutik<br />
<strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong> | <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong> (<strong>Hrsg</strong>.)<br />
<strong>Ich</strong> <strong>sehe</strong> <strong>was</strong>, <strong>was</strong> <strong>du</strong> <strong>nicht</strong> <strong>siehst</strong><br />
Fragen moralischer, ästhetischer<br />
und religiöser Phänomenologie
Inhalt<br />
<strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong> und <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Einleitung ................................................ 7<br />
Michael Roth<br />
Moralische Wahrnehmung<br />
Über den Zusammenhang von Tatsachen und Wertungen ............ 21<br />
Andreas Mayer<br />
Kreative Wahrnehmung, illusionäre Allmacht und die Anerkennung des<br />
Anderen<br />
Überlegungen zu Winnicotts Theorie der frühen Entwicklung ......... 45<br />
<strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Moral ist für Gefühlsblinde oder: Wer<strong>nicht</strong> fühlen will, muss hören! .... 63<br />
<strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong><br />
Zwischen Subjektivität und Objektivität<br />
Der Kontingenzbegriff als modale Figur in Ethik und Ästhetik ........ 91<br />
Magdalena Zorn<br />
Weniger attunement, mehr dizziness<br />
Ästhetische und ethische Bedeutung in der akustischen Umwelt ....... 119<br />
Birger Petersen<br />
Kirchenmusik als Verkündigung<br />
Ontologische Perspektiven im frühen 21. Jahrhundert ............... 139<br />
Olaf L. Müller<br />
VomVerdacht zur Verunstaltung<br />
Moralpredigt gegen die moralische Überschreibung großer Kunstwerke<br />
am Beispiel von Botticelli, Bach und Tolstoi ....................... 155<br />
Olaf L. Müller<br />
»Mein Freund, warum bist Du kommen?«<br />
Zur Ehrenrettung einer Bach-Passion ............................ 175
6 Inhalt<br />
Jochen Schmidt<br />
Hybris und Hochmut<br />
Über die (Un )Anschaulichkeit der Sünde ........................ 201<br />
Klaas Huizing<br />
Scham-Offensive<br />
Ein Frühjahrsputz .......................................... 219<br />
Bernd Harbeck-Pingel<br />
Für sich, nebenbei, unter anderem<br />
Topologie des Verstehens ..................................... 231<br />
Thorben Alles<br />
Kants Ende aller Dinge<br />
Bedeutungen religiöser Vorstellungen für die praktische Vernunft ..... 239<br />
Verzeichnis der Beiträgerinnen und Beiträger ..................... 261
Einleitung<br />
<strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong> und <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
1. »<strong>Ich</strong> <strong>sehe</strong> <strong>was</strong>, <strong>was</strong> <strong>du</strong> <strong>nicht</strong> <strong>siehst</strong>…« –<br />
Annäherung an das Thema des Sammelbandes<br />
Kann man die Frage nach moralischer, ästhetischer und religiöser Phänomenologie<br />
überhaupt sinnvollerweise gesammelt stellen? Was hat die phänomenologischeVerfasstheit<br />
von Werten und Normen, von ethischen Phänomenen mit<br />
ästhetischen und religiösen Kategorien wie schön und hässlich, erhaben oder<br />
anrührend zu tun? Gibt es eine Verwandtschaft der seit der Neuzeit zumindest<br />
akademisch getrennten Disziplinen oder bedingen sie sich gar einander?<br />
Auffälligist, dass es Ethik, Ästhetikund Religionals »Ganzheitssemantiken« 1<br />
mit Bedeutungen zu tun haben, die sich (natur-)wissenschaftlich <strong>nicht</strong> ohne<br />
größte Einbußen auf den Begriff bringen lassen, die sich also phänomenologisch<br />
nur verkürzt in der wissenschaftlichen Analyse darstellen. Denn die genannten<br />
Disziplinen interessieren sich weniger für die zweifelsfrei zu fassenden Fakten<br />
einer moralisch aufgeladenen Situation, einer Symphonie oder religiöser Erfahrung<br />
– das tun sie aber ohne Frage auch! –, als vielmehr für die sinnlich<br />
wahrgenommenen Gehalte innerhalb der jeweiligen Untersuchungsgegenstände:<br />
Schön ist, <strong>was</strong> schön anzuhören oder anzu<strong>sehe</strong>n ist, also unter bestimmten<br />
Umständen als schön erfahren werden kann; in vergleichbarer Weise zeigt sich<br />
1<br />
Zur Terminologie der »Ganzheitssemantiken« vgl. Schramm, Kontingenzeröffnung und<br />
Kontingenzmanagement, 91: »Nun sind in diesem Prozess der Herausdifferenzierung<br />
positiver Einzelwissenschaften Theologie und Philosophie als Ganzheitssemantiken u brig<br />
geblieben. Als ›Ganzheitssemantiken‹ kann man rationale Diskursarten bezeichnen, aus<br />
denen erstens die vielfa ltigen Kompetenzen fu rEinzelfragen herausdifferenziert und<br />
den positiven Einzelwissenschaften u bertragen worden sind – im Bild gesprochen: die<br />
›Ganzheitssemantiken‹ wurden ›entkernt‹ –,die sich aber zweitens nach wie vor dem<br />
›Ganzen‹ des menschlichen Daseins widmen. Das heißt, dass die <strong>Funk</strong>tion von Ganzheitssemantiken<br />
<strong>nicht</strong> darin besteht, fu ralles zusta ndig zu sein, wohl aber fu r ›das<br />
Ganze‹« (unsere Hervorh.).
8 <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong> und <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Grausames als Grausames überhaupt erst, wenn es auch als grausam (nach-)<br />
empfunden wird. Jene Angewiesenheit auf Aisthesis, auf menschliche Empfin<strong>du</strong>ng<br />
und Wahrnehmung (oder empfindende Wahrnehmung), lässt bereits erahnen,warum<br />
sich ethische, religiöseund ästhetische Phänomene in aller Regel<br />
der Abstraktion und Re<strong>du</strong>ktion auf Unstrittiges und Regelhaftes verweigern.<br />
»[W]as bedeutet die Abstraktion anderes als einen Verlust?« 2 fragt schon der<br />
Begründer der Ästhetik 3 Alexander Gottlieb Baumgarten in §560 seiner »Aesthetica«<br />
und verweist auf die differenten Re<strong>du</strong>ktionsverfahren von »Welt« in<br />
Ästhetik und Logik: »Man kann, um einen Vergleich heranzuziehen, aus einem<br />
Marmorblock von unregelmäßiger Gestalt nur dann eine Marmorkugel herausarbeiten,<br />
wenn man einen Verlust an materialer Substanz in Kauf nimmt, der zum<br />
mindesten dem höheren Wert der regelmäßig runden Gestalt entspricht«. 4 Wie<br />
Hans Rudolf Schweizer in der Einführung zu Baumgartensgrundlegendem Werk<br />
schreibt, sei die Marmorkugel »zugleich Sinnbild für die logische Präzision und<br />
für die Prägnanz der ästhetischen Darstellung.« 5 Sowohl die Klarheit logischer<br />
oder rationaler Re<strong>du</strong>ktion, als auch das Herstellen eines (kunst-)ästhetischen<br />
Pro<strong>du</strong>kts sind nur zu erreichen unter Bearbeitung, d. h. unter Aufgabe »materialer<br />
Substanz« (des Marmorblocks als Sinnbild eines metaphysischen Ganzen).<br />
Keiner der beiden (sich bedingenden!) Erkenntniswege, so Baumgarten, bekomme<br />
die ganze Wirklichkeit in den Blick und bleibe daher ergänzungsbedürftig.<br />
Die Ästhetik und die sinnlichen Erkenntnisvermögen hätten daher die<br />
Aufgabe, »ihren Kräften entsprechend die abstrakten Allgemeinbegriffe, die<br />
formale Vollkommenheit wissenschaftlicher Resultate erreicht haben, <strong>du</strong>rch<br />
diejenige Wahrheit zu ergänzen und zu vervollständigen, die <strong>du</strong>rchdie materiale<br />
Vollkommenheit gekennzeichnet ist.« 6 Die ästhetische Anschauung und das<br />
sinnliche Erkenntnisvermögen nehmen also gerade jenen materialen Rest (des<br />
Marmorblocks) in den Blick, den die logische Abstraktion mit guten Gründen<br />
zurückgelassen hat (vgl. §562). Will man eine Ahnung der ursprünglichen<br />
»materialen Substanz« des Ganzen bekommen, also die (ontologischen) Bedingungen<br />
der Möglichkeit der schönen runden Marmorkugel verstehen,braucht es<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Baumgarten, Theoretische Ästhetik, 145: »Und doch stellt sich die Frage, ob die metaphysische<br />
Wahrheit diesem Allgemeinbegriff äquivalent sei, so wie sie dem indivi<strong>du</strong>ellen<br />
Gegenstand entspricht, der in dem Allgemeinbegriff enthalten ist. <strong>Ich</strong> wenigstens glaube,<br />
es müßte den Philosophen völlig klar sein, daß nur mit einem großen und bedeutenden<br />
Verlust an materialer Vollkommenheit all das hat erkauft werden müssen, <strong>was</strong> in der<br />
Erkenntnis und in der logischen Wahrheit an besondrer [sic] formaler Vollkommenheit<br />
enthalten ist. Denn <strong>was</strong> bedeutet die Abstraktion anderes als einen Verlust?«<br />
Im Sinne einer wissenschaftlichen Disziplin.<br />
Baumgarten, Theoretische Ästhetik, 145.<br />
Schweizer, Einführung, XV.<br />
Baumgarten, Theoretische Ästhetik, 147 (§ 562), (unsere Hervorh.).
Einleitung 9<br />
unabdingbar auch den ästhetischen Erkenntnisweg. Ästhetik und Logik sind für<br />
Baumgarten sich komplementierende, aber grundlegend verschiedene Erkenntniswege.<br />
Eine (methodologische) Angleichung des einen an das andere läge<br />
ihm fern; esbraucht beides: »das eine in knapper Form, das andere in reicherer<br />
Ausmalung« 7 .Schweizers Differenzierung zwischen logischer Präzision und ästhetischer<br />
Prägnanz im Anschluss an Baumgartens Aufgabenbestimmung der<br />
Disziplinen ist erhellend: Die Ästhetik – bei Baumgarten noch »Wissenschaftder<br />
sinnlichen Erkenntnis« als Ganze und <strong>nicht</strong> bloß Theorie des Schönen und Erhabenen<br />
wie später bei Kant, Schiller und v.a. Hegel – hat es als analogon rationis,<br />
als jüngere Schwester der Logik, 8 mit dem Verworrenen und Vielschichtigen zu<br />
tun, das »eine unerlässliche Voraussetzung für die Entdeckung der Wahrheit« 9<br />
sei. Denn die Wirklichkeit, so Baumgarten, sei nun einmal verworren (§ 7) und<br />
eine Re<strong>du</strong>ktion auf das Eindeutige angesichts dessen unlauter. Ästhetische Begriffe<br />
– zu denen wir im breiten Ästhetikverständnis Baumgartens probehalber<br />
auch religiöse und ethische Begriffe zählen wollen –, sind in dem Sinne also<br />
prägnant,weil sie eine immense Bedeutungsfülle in sich aufnehmen, die sich aus<br />
der Erfahrung einer Praxis speist. In ihr subsumiert sich bedeutender und bedeuteter<br />
Erfahrungsgehalt, der den Begriff zum einen immer reicher werden<br />
lässt, zum anderen unabschließbar neu formt und aktualisiert. Ihre Explikation<br />
müsste also jenen in den Begriff geflossenen Erfahrungsgehalt nachvollziehbar,<br />
seine »reichere Ausmalung« sinnlich zugänglich machen. Damit stellt der ästhetische<br />
Begriff geradezu das Gegenteil zum präzisen Begriff der Logik dar, der<br />
sich »in knapper Form« eindeutig definieren, und zeit-, orts- und erfahrungsunabhängig<br />
logisch-rational begreifen lässt: Mit dem »abstrakten Allgemeinbegriff«<br />
müssten alle Nutzer:innen dasselbe meinen; eine Bedeutungs- und Verwen<strong>du</strong>ngsvielfalt<br />
wäre wenig wünschenswert.<br />
Wenn man diesem Befund et<strong>was</strong> abgewinnen kann, 10 ist deutlich, warum die<br />
Disziplinen auf eine bestimmte Praxis verwiesen sind, von der aus religiöse,<br />
ästhetische und ethische Begriffe sowie propositionale Einstellungen an Format<br />
gewinnen. Weil wir in Ethik, Ästhetik und Religion et<strong>was</strong> als et<strong>was</strong> wahrnehmen,<br />
sich ästhetischer, ethischer und religiöser Gehalt also erst auf propositionaler<br />
Wahrnehmungsebene entscheidet, sind die Fragen des Sammelbands nach<br />
Voraussetzungen jenes prägnanten Wahrnehmens-als so komplex wie grundlegend:<br />
Sehe ich,<strong>was</strong> mein mit mir streitendes Gegenüber sieht?Höre ich,<strong>was</strong> meine<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
A.a. O., 157 (§ 572).<br />
Vgl. a. a. O., §13.<br />
Die Verworrenheit, so Baumgarten, sei »conditio, sine qua non,inveniendae veritatis, ubi<br />
natura non facit saltum ex obscuritate in distinctionem« (a.a. O., 4[§7]).<br />
Womit <strong>nicht</strong> bestritten sein soll, dass es auch gute Gründe dafür geben mag, religiöse wie<br />
ethische Begriffe <strong>nicht</strong> als ästhetische Begriffe verstanden wissen zu wollen – selbst<br />
wenn Baumgartens weiter Ästhetikbegriff zugrunde gelegt wird.
10 <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong> und <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Nachbarin im Konzert oder im wortgewaltigen Streit versteht?Empfinde ich, <strong>was</strong> es<br />
zu empfinden benötigt, um moralisch handeln, um ästhetisch begreifen, um religiös<br />
verstehen zukönnen?<br />
Vielleicht am deutlichsten wird die Baumgarten’sche Differenzierung der<br />
beiden Wirklichkeitszugänge am Beispiel musiktheoretischer Analyse: Eine<br />
Symphonie lässt sich musiktheoretisch präzise analysieren; Streitpunkte hierüber<br />
sind Streitpunkte über wissenschaftlich feststellbare Fakten, esgibt zweifelsohne<br />
ein richtig analysiertes Musikwerk und ein falsches. Der wertneutrale,<br />
fachkundige Blick in die Partitur wird Klärung bringen. Doch streiten wir über<br />
den ästhetischen Wert der Komposition, haben wir vor allem die klingende<br />
Partitur als Gegenstand der Diskussion im Ohr; die Partitur wird erst zu Musik,<br />
wenn sie als solche erklingt. Erst in dieser Charakter gebenden phänomenalen<br />
Gestaltwird ihr prägnanter Bedeutungsgehalt hörbar 11 – der gleichzeitig auf die<br />
Partitur angewiesen bleibt. Was das richtig Analysierte bedeutet, ist eine Frage,<br />
die eine andereEbene markiert und differente hermeneutische Bedingungen mit<br />
sich bringt.<br />
Parallelen in Ethik und Religion liegen auf der Hand. Der Psychologe und<br />
Menschenrechtler Kenneth B. Clark behauptet in »Schwarzes Ghetto« 1967 (!)<br />
etwa,<br />
»es könnte in Wirklichkeit so sein, daß dort, wo grundlegende psychologische und<br />
moralische Fragen zur Debatte stehen, das Unbeteiligtsein und der Ausschluß gefühlsmäßiger<br />
Reaktionen weder besonders intelligent noch objektiv, sondern naiv<br />
sind und den Geist der Wissenschaftinseinem besten Kern kränken. Wo menschliche<br />
Gefühle Teil der Beweisführung sind, dürfen sie <strong>nicht</strong> unbeachtet bleiben. Wo Zorn<br />
eine angemessene Reaktion ist, heißt es der Wahrheit selbst Grenzen zu setzen, wenn<br />
man den Zorn <strong>nicht</strong> feststellen und akzeptieren will und sogar dem Gefühl ausweicht,<br />
als wäre es unvermeidlich ansteckend. Wenn ein Wissenschaftler, der die Konzentrationslager<br />
der Nazis studierte, sich <strong>du</strong>rch das vorkommende Beweismaterial <strong>nicht</strong><br />
in Aufregung versetzt fühlte, so würde niemand sagen, er sei objektiv, sondern man<br />
würde vielmehr um seine geistige Gesundheit und sein moralisches Empfinden besorgt<br />
sein. Gefühle können ein Urteil verzerren, aber Gefühllosigkeit kann es noch<br />
mehr entstellen.« 12<br />
Clark glaubt also, dass der desengagierte Blick auf die Fakten den Blick auf das<br />
Wesentliche auch verstellen kann. Um zu einem ethischen Urteil zu kommen, so<br />
Clark, ist der reflektierte Rekurs auf emotionale Innenwelten »Teil der Beweisführung«,<br />
weil <strong>nicht</strong> bloß das Wissen um die Fakten, sondern die emotionale<br />
Aisthesis derselben handlungsleitend und begrün<strong>du</strong>ngsgrundlegend ist. Solche<br />
11<br />
12<br />
Einmal davon abge<strong>sehe</strong>n, dass die fachkundige, geübte Musikerin schon beim Studieren<br />
der Partitur eine ziemlich klare Klangvorstellung des Werks »im Ohr« haben wird.<br />
Clark, Schwarzes Ghetto, 111, zit. nach Cone, Schwarze Theologie, 10.
Einleitung 11<br />
Stellungnahmen stehen im Kontrast zu aktuellen ethischen Positionen wie etwa<br />
der Dieter Birnbachers, der davon spricht, dass Handlungsbewertungen nur dann<br />
möglich sind, wenn sie »<strong>du</strong>rch Ausdrücke von logisch allgemeiner Form ausgedrückt<br />
werden können« 13 .Obwohl solche Forderungen nach rationaler Begrün<strong>du</strong>ng<br />
in der akademischen Ethik breite Zustimmung genießen, scheint die<br />
lebensweltliche moralische Orientierung dem Vorschlag Clarks näher. Im Alltag<br />
explizieren wir narrativ zu Tuendes und laden in Erzählungen zum Nachempfinden<br />
bestimmter Handlungssituationen ein 14 : »Kannst <strong>du</strong> nachempfinden,<br />
warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe?« Eine narrative Ethik, die<br />
jener genuin lebensweltlichen Moralreflexion nachempfunden ist, findet sich<br />
auch in der christlichen Tradition wieder, komprimiert z.B. in der vielleicht bekanntestenParabel<br />
des Neuen Testaments. Die erstaunlich kurze Geschichte um<br />
den Barmherzigen Samariter als Inbegriff christlichen Handelns platziert den<br />
moralischen Handlungsimpuls ganz und gar im »und als er ihn sah, jammerte es<br />
ihn« 15 und findet im Mitleid(en) seine hinreichende Begrün<strong>du</strong>ng. Die anderen<br />
hoch ange<strong>sehe</strong>nen Figuren der Geschichte, Priester und Levit, <strong>sehe</strong>n <strong>nicht</strong>, <strong>was</strong><br />
der geschmähte Samariter sieht; weil sie sich <strong>nicht</strong> anrühren lassen, entdecken<br />
sie auch keine Handlungsgründe in der Szene.<br />
DiekurzangesprochenenBeispiele ausethischen,religiösenund ästhetischen<br />
Kontextenverweisen zumeinen aufihren umstrittenen Verwandtschaftsgrad,auf<br />
ihre jeweilige Verwobenheit. Man wird – mit Blick auf Baumgartens breites Ästhetikverständnis<br />
– danach fragen können, ob dieethische undreligiöse Erfahrung<br />
inhärent immer schon ästhetische Erfahrung ist, weil religiöser und ethischer<br />
Gehalt nur <strong>du</strong>rch eine bestimmte körperlich-sinnliche Rezeptivität vermag entdeckt<br />
zuwerden, der dem desengagierten logisch-rationalen Zugang abgeht.<br />
Gleichwohl wird mindestens die Kunstästhetik zu Recht über solche Vereinnah-<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, 13.<br />
Vgl. hierzu ausführlich Fischer, Verstehen statt Begründen, 9–71.<br />
Auf die Frage »Werist denn mein Nächster?«antwortet Jesus: »Es war ein Mensch, der ging<br />
von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und<br />
schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber,<br />
dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen<br />
auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter<br />
aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn; und er<br />
ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein<br />
Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei<br />
Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn <strong>du</strong> mehr<br />
ausgibst, will ich dir’sbezahlen, wenn ich wiederkomme. Wervon diesen dreien, meinst<br />
<strong>du</strong>, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die<br />
Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!«<br />
(Lk 10,29–37 [unsere Hervorh.]).
Moralische Wahrnehmung<br />
Über den Zusammenhang von Tatsachen und<br />
Wertungen<br />
Michael Roth<br />
Der sog. »naturalistische Fehlschluss«, also der Versuch, normativ-moralische<br />
Aussagen von deskriptiven Aussagen, die den Naturzusammenhang beschreiben,<br />
abzuleiten, gilt gemeinhin als ein schwerwiegender Fehler innerhalb ethischen<br />
Urteilens. Mit dem Begriff »naturalistischer Fehlschluss« verbindet sich<br />
die Behauptung, dass es eine (<strong>nicht</strong> zu schließende) Lücke zwischen der Beschreibung<br />
und der Bewertung von Tatsachen gibt, also zwischen der Feststellung,<br />
dass et<strong>was</strong> der Fall ist, und der Behauptung, dass das, <strong>was</strong> der Fall ist, gut<br />
oder schlecht sei und man dementsprechend handeln müsse. Nun ist allerdings<br />
festzustellen, dass man in unserer Wahrnehmung und Beschreibung der Wirklichkeit<br />
<strong>nicht</strong> zwischen beschreibenden und bewertenden Ausdrücken trennen<br />
kann. Neben rein bewertenden Begriffen wie »gut« und rein beschreibenden<br />
Begriffen wie »grün« gibt es auch Begriffe wie »grausam«, »geizig« oder »großzügig«<br />
(in der analytischen Philosophie »dichte Begriffe«/»thick concepts« genannt),<br />
die einen bewertenden und deskriptiven Bedeutungsanteil haben. Solche<br />
Begriffe und die für sie stehenden Wörter überbrücken die Kluft zwischen Beschreiben<br />
und Vorschreiben. Mit dem Verweisauf die Wahrnehmung ist <strong>nicht</strong> die<br />
Brücke zwischen zwei bereits getrennt unterstellten Bereichen hergestellt,<br />
sondern die angenommene Trennung in Bezug auf unsere Erfahrung der Wirklichkeit<br />
selbst in Frage gestellt. Damit aber ist <strong>nicht</strong> bestritten, dass sich aus rein<br />
beschreibenden Begriffen keine wertenden Begriffe ableiten lassen, noch behauptet,<br />
dass gezeigt werden könne, dass objektive Werte zur Natur der Dinge<br />
gehören. Allerdings ist damit das enge Beieinander der beschreibenden und<br />
bewertenden Dimension aufgetaucht, dem ich im Folgenden nachgehen möchte.<br />
In einem ersten Schritt werde ich mich der Frage nach dem Wort »gut« in moralischen<br />
Kontexten widmen, in einem zweiten Schritt der Frage nach der Objektivität<br />
der Werte. Vonhier aus will ich dann abschließend versuchen, Tatsachen<br />
und Wertungen einander zuzuordnen.
22 Michael Roth<br />
1. Das Wort »gut« in moralischen Kontexten<br />
Die wirkmächtigste sprachanalytische Untersuchung des Wortes »gut« hat<br />
George Edward Moore in seinem Werk »Principia Ethica« unternommen. 1 Moore<br />
versteht »gut« als eineeinfache, <strong>nicht</strong> definierbare Eigenschaft. Wenn »gut« <strong>nicht</strong><br />
einfach hypothetisch als Mittel für et<strong>was</strong> bezeichnet wird (Bsp.: »Wenn <strong>du</strong> <strong>nicht</strong><br />
frieren willst, ist es gut, sich Handschuhe anzuziehen.«), zeigt sich nach Moore,<br />
dass »gut« <strong>nicht</strong> definiert werden kann. In diesem Sachverhalt gleiche der Umstand<br />
des Wortes »gut« den Farbnamen wie »gelb«. Der Grund dafür, dass sich<br />
diese Eigenschaften <strong>nicht</strong> definieren lassen, liege darin, dass sie »einfach« seien. 2<br />
Daher – so Moore – lassen sich diese Eigenschaften <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rch die Angabe<br />
von Eigenschaften oder Aufzählung von Eigenschaften definieren. Gut sei – wie<br />
der Begriff »gelb« – <strong>nicht</strong> komplex, sondern einfach und undefinierbar 3 ,das Wort<br />
lasse sich <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rchandereWorte ausdrücken. Weil sich »gut« wie »gelb« <strong>nicht</strong><br />
definieren lasse, ist nach Moore die einzig mögliche Bestimmung von beiden<br />
ostentativ: »Das ist gelb!«; »Das ist gut!«.<br />
Werden nun alle gewöhnlichen Eigenschaften wie Farben, Formen und Töne<br />
von Moore als natürliche Eigenschaften beschrieben, so ist »gut« für Moore eine<br />
<strong>nicht</strong>-natürliche Eigenschaft, eine Eigenschaft also, deren Vorhandensein oder<br />
Nichtvorhandensein <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rch empirische Beobachtungen festgestellt werden<br />
kann. Für die Erkenntnis von »gut« bedarf es daher eines anderen Erkenntniszugangs.<br />
Moore spricht indiesem Zusammenhang von intuitivem Erkennen. 4<br />
Moores Analyse von »gut« als eine <strong>nicht</strong>-definierbare und <strong>nicht</strong>-natürliche<br />
Eigenschaft wendet sich polemisch gegen den Naturalismus des 19. Jahrhunderts,<br />
für den ethische Begriffe auf die natürliche Ausrüstung des Menschen<br />
zurückzuführen sind. Dies kann geschehen, indem man sich beispielsweise an<br />
den menschlichen Bedürfnissen orientiert und das für ethisch richtig ansieht,<br />
<strong>was</strong> der Bedürfnisbefriedigung dient. Gegen diese Auffassung führt Moore das<br />
später sog. »Argument der offenen Frage« ins Feld. 5 Es besagt, dass auch dann,<br />
wenn alle deskriptiven Eigenschaften einer Sache, einer Person oder einer<br />
Handlung, die mit dem Prädikat »gut« ver<strong>sehe</strong>n werden, vollständig aufgezählt<br />
sind, sich immer noch die Frage stellen lässt: »Ist es auch wirklich gut?« Eine<br />
angenommene Bestimmung des Wortes »gut« ist nie in der Lage, dies abschließend<br />
zu tun. Wenn man beispielsweise das Gutemit »die Lebensfreude fördern«<br />
bestimmt, dann kann man immer noch sinnvoll fragen: »<strong>Ich</strong> gebe zu, dass dieses<br />
oder jenes die Lebensfreude fördert; aber ist es auch gut?« Auch wenn man nun<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Vgl. Moore, Principia Ethica, 34 ff.<br />
Vgl. a. a. O., 36.<br />
Vgl. a. a. O., 36 f.<br />
Vgl. a. a. O., 204 ff.<br />
Vgl. a. a. O., 46 ff.
Moralische Wahrnehmung 23<br />
den Versuch unternimmt, »die Lebensfreude fördern« <strong>du</strong>rch eine andere Definition<br />
zu ersetzen, etwa »höher entwickelt«, ist die Frage »Ist es auch gut?«<br />
weiterhin sinnvoll. In einem unendlichen Prozess von Fragen können die Versuche,<br />
das Gute zu bestimmen, immer wieder aufgehoben werden.Daher können<br />
noch so viele deskriptiv-naturalistische Charakterisierungen den Bedeutungsgehalt<br />
bewertender Ausdrücke <strong>nicht</strong> erschöpfen; denn es bleibt ein irre<strong>du</strong>zibles<br />
bewertendes Element.<br />
Prüfen wir die Argumentation von Moore: Wenn dieser behauptet, dass »gut«<br />
wie »gelb« eine einfache (wenn auch im Unterschied zu »gelb« <strong>nicht</strong> natürliche)<br />
Eigenschaft bezeichnet, so müsste dies implizieren, dass das logische Verhalten<br />
von »gut« und »gelb« dasselbe ist. Dies scheint aber <strong>nicht</strong> der Fall zu sein. Peter T.<br />
Geach unterscheidet zwischen attributiven und prädikativen Adjektiven und<br />
zeigt damit, dass die Begriffe »gelb« und »gut« <strong>nicht</strong> auf die gleiche Weise<br />
funktionieren. 6 »Gelb« ist ein prädikatives Adjektiv. 7 Aus den Sätzen<br />
I. »Hansi ist ein gelber Vogel« und<br />
II. »Ein Vogel ist ein Tier« folgt<br />
III. »Hansi ist ein gelbes Tier«.<br />
In dieser Weise funktioniert der Begriff »gut« aber <strong>nicht</strong>. Denn aus den Sätzen<br />
I. »Peter ist ein guter Tennisspieler« und<br />
II. »Ein Tennisspieler ist ein Mensch« folgt <strong>nicht</strong><br />
III. »Peter ist ein guter Mensch«.<br />
Offensichtlich »klebt« 8 das Adjektiv »gut« stärker an dem Substantiv als das<br />
Adjektiv »gelb«, sodass keineswegs davon gesprochen werden kann, dass »gelb«<br />
und »gut« auf die gleiche Weise funktionieren.<br />
Der Blick auf andere attributive Adjektive, wie etwa »groß«, erlaubt es, die<br />
Attributivität von »gut« noch genauer zuverstehen. Auch »groß« ist ein attributives<br />
Adjektiv; denn aus den Sätzen<br />
I. »Hermann ist eine große Maus« und<br />
II. »Eine Maus ist ein Tier« folgt <strong>nicht</strong><br />
III. »Hermann ist ein großes Tier«.<br />
Die Unzulässigkeit dieser Schlussfolgerung lässtsich aus der Komparativität des<br />
Adjektivs »groß« erklären. 9 Daher bedeutet (I) »Hermann ist eine große Maus«<br />
nur so viel wie: »Hermannist größer als die meisten Mäuse« und (III) »Hermann<br />
ist ein großes Tier« bedeutet so viel wie »Hermann ist größer als die meisten<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Geach, Good and Evil, 32–42.<br />
Zum Folgenden vgl. Williams, Begriff der Moral, 47 ff.<br />
A.a. O., 48.<br />
Vgl. a. a. O., 49 f.
24 Michael Roth<br />
Tiere«. Dieser Schluss ist offensichtlich falsch; denn Mäuse sind verhältnismäßig<br />
kleine Tiere und eine große Maus zu sein bedeutet <strong>nicht</strong> – im Vergleich zu den<br />
anderen Tieren – groß zu sein. Man kann daher aus Iund II nur schließen:<br />
IV. »Hermann ist ein Tier, das größer ist als die meisten Mäuse«.<br />
Allerdings lässt sich die Attributivität von »gut« <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rchseine Komparativität<br />
erklären. Aus den Sätzen<br />
I. »Peter ist ein guter Tennisspieler« und<br />
II. »Ein Tennisspieler ist ein Mensch« folgt <strong>nicht</strong><br />
III. »Peter ist ein besserer Mensch als die meisten Tennisspieler«.<br />
Offensichtlich beruht die Attributivität von »gut« »auf einer noch engeren Verknüpfungmit<br />
seinem Substantiv […]als die der bloß komparativen Adjektive wie<br />
›groß‹« 10 .Esmacht für die Bedeutung von »gut« einen Unterschied, ob wir »gut«<br />
in Bezug auf einen guten Fußballspieler, ein gutes Musikstück oder einen guten<br />
Wein verwenden. 11 »Gut« hat in den unterschiedlichen Verwen<strong>du</strong>ngszusammenhängen<br />
keinen gemeinsamen Bedeutungskern. Das Wort »gut« lässt sich<br />
<strong>nicht</strong> unabhängig von dem Kontext, in dem es gebraucht wird, analysieren. Wenn<br />
daher das Wort »gut« mit dem von ihm qualifizierten Substantiv unauflöslich eng<br />
verknüpftist, scheint <strong>nicht</strong>s anderes übrig zu bleiben, als die Wen<strong>du</strong>ng »ein gutes<br />
x« im Ganzen zu analysieren, wobei die Bedeutung von »gut« <strong>du</strong>rch das bestimmt<br />
wird, <strong>was</strong> für xeingesetzt wird. 12<br />
Am einfachsten lässt sich nun die Bedeutung des Wortes »gut« bei einer<br />
Klasse von Worten analysieren, die allgemein als »<strong>Funk</strong>tionsworte« bezeichnet<br />
werden. 13 Um die Bedeutung solcher Worte zu erklären, müssen wir angeben,<br />
wozu der so bezeichnete Gegenstand da ist. Wir müssen fragen: Zu welchem<br />
Zweck wird er gebraucht? Für welchen Zweck ist er gedacht? Wenn wir bei<br />
solchen <strong>Funk</strong>tionsausdrücken herausgefundenhaben, zu welchem Zweck sie da<br />
sind, können wir auch dieKriterien bestimmen, die diesen Gegenstand zu einem<br />
guten Gegenstandmachen.Ein Luftfeuchtigkeitsmesser, der die <strong>Funk</strong>tion hat, die<br />
Luftfeuchtigkeit so exakt wie möglich zubestimmen, ist genau dann ein guter<br />
Luftfeuchtigkeitsmesser, wenn er in der Lage ist, die Luftfeuchtigkeit so exakt wie<br />
möglich zubestimmen.<br />
Nun zeigt Mackie, dass sich die Überlegungen zu den <strong>Funk</strong>tionsausdrücken<br />
auch im weiteren Sinn verwenden lassen. Zwar ist ein Bergsteiger (anders als ein<br />
Luftfeuchtigkeitsmesser) zu keinemZweck da, doch gibt es et<strong>was</strong>, <strong>was</strong> man von<br />
dem Bergsteiger zu Recht erwarten kann: nämlich dass er gut Berge besteigen<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
A.a. O., 50 f.<br />
Vgl. Tugendhat, Probleme der Ethik, 67.<br />
Vgl. Williams, Begriff der Moral, 51.<br />
Vgl. Mackie, Ethik, 64 ff.
Moralische Wahrnehmung 25<br />
kann. »Wo das Wort ›gut‹ in Zusammenhang mit <strong>Funk</strong>tionswörtern gebraucht<br />
wird, besagt es demnach, daß der in Frage stehende Gegenstand solche Eigenschaften<br />
aufweist, die ihn zu der entsprechenden <strong>Funk</strong>tion befähigen« 14 .Dies ist<br />
bei dem Luftfeuchtigkeitsmesser wie bei dem Bergsteiger gleichermaßender Fall.<br />
Nun gibt es allerdings das Wort »gut« <strong>nicht</strong> ausschließlich im Zusammenhang<br />
mit <strong>Funk</strong>tionsausdrücken. Zu denken ist etwa an dieRede von einer »guten<br />
Fahrt«. All diesen Verwen<strong>du</strong>ngsweisen ist gemeinsam, dass bei ihnen »in irgendeiner<br />
Form eine Reihe von Erfordernissen, Wünschen oder Interessen<br />
vorausgesetzt wird und daß man von dem, <strong>was</strong> man ›gut‹ nennt, behauptet, es<br />
würde diesen Erfordernissen, Wünschen oder Interessen genügen«. Vondaher<br />
schlägt Mackie eine allgemeine Definition von »gut« vor: »›Gut‹ bedeutet ›et<strong>was</strong><br />
ist von der Art, daß es den in Fragestehenden Erfordernissen usw. genügt‹« 15 .Der<br />
jeweilige Kontext gibt eine Antwort auf die Arten der in Frage stehenden Erfordernisse.<br />
Diese Verwen<strong>du</strong>ng von »gut« scheint auch auf seine Verwen<strong>du</strong>ngsweise in<br />
moralischen Kontexten zuzutreffen. Die Frage ist nur, um welche Erfordernisse<br />
es sich dabei handelt: Handelt es sich um die des Sprechers, einer Gruppe von<br />
Menschen oder aller Menschen?Gerade an diesem Punkt – so Mackie – bekommt<br />
Moores Argument der offenen Frage seine Bedeutung 16 :Die Unbestimmtheit des<br />
Begriffs des Guten (Ist es auch wirklich gut?) spiegelt sich wider in dem unbestimmten<br />
Ausdruck»dieinFragestehenden Erfordernisse« (s. o.). Allerdings – so<br />
Mackie – irrt Moore, wenn er auch in moralischen Kontexten »gut« als undefinierbar<br />
bezeichnet. In der Tat: Unsere Überlegungen machen deutlich, dass eine<br />
strikte Trennung zwischen Tatsachen und Wertungen falsch ist. Natürlich stellt<br />
die in dem Wort »gut« enthaltene Billigung ein wesentliches Moment dar. Andererseits<br />
aber ist die Bedeutung zugleich auch deskriptiv, insofern essich auf<br />
Merkmale des betreffenden Gegenstands bezieht; »denn es wird mit ausgesagt,<br />
daß der empfohlene Gegenstand die Merkmale besitzt, die – gleichgültig welcher<br />
Art – ihn dazu geeignet machen, diesen Erfordernissen – gleichgültig welcher<br />
Art – zu genügen, und daß er daher in einer solchen Beziehung zu den in Frage<br />
stehenden Erfordernissen steht« 17 . Moralische Wertungen beziehen sich auf<br />
Tatsachen, allerdings nötigen uns die Tatsachen <strong>nicht</strong> zu den Wertungen, wir<br />
müssen sie »mitbringen«. Ausschließlich deskriptiv scheint die Verwen<strong>du</strong>ngsweise<br />
von »gut« nur innerhalb von <strong>Funk</strong>tionsausdrücken zu sein.<br />
Gerade weil der Ausdruck »gut« in Bezug auf <strong>Funk</strong>tionsausdrücke rein deskriptiv<br />
ist, stellt sich die Frage, ob <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rch die Zuweisung von festgelegten<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
A.a. O., 65.<br />
A.a. O., 68.<br />
Vgl. a. a. O., 74 f.<br />
A.a. O., 76.
26 Michael Roth<br />
Rollen die gewünschte Eindeutigkeit von »gut« zu erreichen ist. 18 Wir haben<br />
bereits – im Blick auf die <strong>Funk</strong>tionsausdrücke – ge<strong>sehe</strong>n, dass die <strong>Funk</strong>tionsbezeichnungen<br />
im weiteren Sinne verwendet werden können: Der Bergsteiger ist<br />
dann ein guter Bergsteiger, wenn er die Rolle (»<strong>Funk</strong>tion«) des Bergsteigers erfüllt:<br />
nämlich möglichst gut Berge zu besteigen. Allerdings stellt sich die Frage,<br />
ob Rollentitel so unauflöslich mit dem Rollenträgerverbunden sind, wie dies bei<br />
<strong>Funk</strong>tionsausdrücken der Fall ist. Es gibt Rollenzuschreibungen, bei denen dies<br />
ganz offensichtlich <strong>nicht</strong> der Fall ist. Wenn jemand in seiner Freizeit Tennis spielt,<br />
wird er sich kaum da<strong>du</strong>rchinseiner ganzen Person in Fragegestellt <strong>sehe</strong>n, wenn<br />
ihm ein Sportfachmann attestiert, ein schlechter Tennisspielerzusein, etwa weil<br />
er <strong>nicht</strong> ausreichend hart trainiert und sich falsch ernährt. 19 Er würde zu Recht<br />
einwenden, dass der Rollenzuschreibung ein Missverständnis zugrunde liegt;<br />
denn er verstehe sich <strong>nicht</strong> von seinem gelegentlichen Tennisspiel her, sodass er<br />
auch seine Ernährung <strong>nicht</strong> an dem möglichen Erfolgals Tennisspielerorientiert.<br />
Et<strong>was</strong> anders ist der Fall bei einem Bankkassierer gelagert. Ähnlich wie bei dem<br />
Tennisspieler wird die Rolle des Bankkassierers mit Bezug auf eine Institution<br />
erklärt, die dem Träger dieser Rolle bestimmte <strong>Funk</strong>tionen und Pflichten auferlegt.<br />
Anders als der Amateur-Tennisspieler kann der Bankkassierer eine Kritik<br />
an seiner Tätigkeit <strong>nicht</strong> einem Missverständnis seiner Rolle zuschreiben, er<br />
kann <strong>nicht</strong> sagen, dass er in Wahrheit kein Bankkassierer sei oder kein »richtiger<br />
Bankkassierer«. Allerdings ist auch der Bankkassierer <strong>nicht</strong> gezwungen, sich mit<br />
seiner Rolle zu identifizieren. Er könnte sagen, dass er zwar in einer Bank arbeitet,<br />
dies aber nur für seinen Lebensunterhalt tue, ihm selbst aber mehr an<br />
seinem Hobbyund seiner Familie liegt und er sich daher auch von beiden letzten<br />
her versteht. 20<br />
Diese Beispiele illustrieren, »wie sich Menschen von den Rollen, deren Träger<br />
sie sind, lösen können – von Rollen, aus denen sich eine bestimmte Art von<br />
Bewertung dessen, <strong>was</strong> sie tun, ergibt. Je nach Sachlage kann diese Lösung<br />
vertretbar oder unvertretbar, nobel oder unwürdig, klug oder unklug sein; in<br />
jedem Fall aber ist es verstehbar, und in jedem Fall kann man begreifen, wie ein<br />
Mensch ein kohärentes Bild von sich selbst im Verhältnis zu einer Rolle haben<br />
kann, die er ausfüllt, ausgefüllt hat oder von der andere meinen, daß er sie<br />
ausfüllt, nach dem die Maßstäbe der Rolle für ihn bei der Bewertungdes Erfolgs<br />
oder Werts seines Lebens <strong>nicht</strong> fundamental oder auch nur besonders wichtig<br />
sind« 21 .Kurz: Der Rollentitel hängt <strong>nicht</strong> unauflöslich mit dem Träger der Rolle<br />
zusammen und daher ist der Träger der Rolle <strong>nicht</strong> notwendig an die Maßstäbe,<br />
die die Rolle vorschreibt, gebunden. Der Mensch kann sich also eines zuge-<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
Vgl. Williams, Begriff der Moral, 57 ff.<br />
Vgl. a. a. O., 61.<br />
Vgl. ebd.<br />
Ebd.
Kreative Wahrnehmung, illusionäre<br />
Allmacht und die Anerkennung des<br />
Anderen<br />
Überlegungen zu Winnicotts Theorie der frühen<br />
Entwicklung<br />
Andreas Mayer<br />
Weraus psychologischer Perspektive über Ethik, Ästhetik und etwaige Zusammenhänge<br />
nachdenken möchte, dem macht es die eigene Disziplin <strong>nicht</strong> gerade<br />
leicht. Die methodischen und theoretischen Scheuklappen der akademischen<br />
Psychologie, einer den Naturwissenschaften und empirischen Evidenzen nacheifernden<br />
Disziplin, lassen so manch interessantes Phänomen imweiten Feld<br />
des Seelischen aus dem Blick geraten. Empirische Tatsachen konstituieren noch<br />
keine Ethik und esliegt in der Natur des Ästhetischen und der ästhetischen<br />
Erfahrung, experimentelle Designs in ihrem Angewiesensein auf eine überschaubareund<br />
operationalisierbare Anzahl von Variablen zu überfordern. 1 Auch<br />
Bedeutungen lassen sich experimentell <strong>nicht</strong> ergründen, und weder Ethik noch<br />
Ästhetik sind sinnvoll denkbar, ohne einen zentralen Fokus auf das zu richten,<br />
<strong>was</strong> Menschen et<strong>was</strong> bedeutet. Die Psychoanalyse gibt aufgrund ihrer Subjektorientierung<br />
und ihrer Nähe zuphänomenologischen und hermeneutischen<br />
Ansätzen in diesem Fall den wohl besseren Gesprächspartner ab und wohl eignet<br />
sich in diesem Zusammenhang niemand besser als der britische Kinderarzt<br />
und Psychoanalytiker Donald W. Winnicott. Bekannt für seine Gedanken zum<br />
Übergangsobjekt und den Übergangsphänomenen, findet seine Theorie der<br />
frühkindlichen Entwicklung immer wieder Anklang in Arbeiten zu ästhetischen<br />
und künstlerischen Fragestellungen. 2 Darüber hinausspielt Winnicott auch eine<br />
wichtige Rolle in Axel Honneths Theorie der Anerkennung 3 und daher scheint<br />
Winnicott besonders geeignet, den möglichen Zusammenhängen zwischen diesen<br />
Themen nachzugehen.<br />
Im Folgenden skizziere ich daher zunächst Winnicotts Entwicklungstheorie<br />
der frühen Kindheit in aller Kürze. In einem nächsten Schritt soll es um Honneths<br />
RezeptionWinnicotts sowie um Kritik an dieser Rezeption gehen. Hier möchteich<br />
mich auf einen spezifischen Aspekt fokussieren, nämlich auf die Frage, ob das<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Vgl. Allesch, Einführung, 21.<br />
Vgl. Christian-Widmaier, Einführung; Niederreiter, Überlegungen; Soldt, Spiel.<br />
Honneth, Kampf.
46 Andreas Mayer<br />
frühe Erleben des Säuglings besser als eine Erfahrung von Fusion oder Omnipotenz<br />
zu beschreiben ist. Dabei soll verdeutlicht werden, dass die Antwort auf<br />
diese Frage <strong>nicht</strong> nur ethische Implikationen hat, sondern auch Auswirkungen<br />
auf das Verständnis von Kreativität sowie auf die zeitliche Einordnung ihrer<br />
Entstehung in der Entwicklung des Kindes hat. Der Beitrag schließt mit einer<br />
Zusammenfassung und einem Ausblick.<br />
1. Frühe Entwicklung nach Winnicott<br />
»Thereʼs nosuch thing as ababy« 4 – mit diesem oft zitierten Satz machte Winnicott<br />
die absolute Abhängigkeit des Säuglings von der ihn versorgenden Person<br />
deutlich. Im Gegensatz zu Melanie Klein betonte Winnicott die Bedeutung der<br />
Umwelt, also die emotionale Fürsorge und Pflege <strong>du</strong>rch das Objekt 5 .Winnicott<br />
geht von einer Phase der sogenannten primären Mütterlichkeit aus, einer seelischen<br />
Einstellung, die mit einer nahezu krankhaft erhöhten Sensibilität für die<br />
Bedürfnisse des Kindes einhergehe und es so dem Kind erlaube,sich der Illusion<br />
von Omnipotenz hinzugeben. 6 Diese »fast hundertprozentige Anpassung« 7 an die<br />
Bedürfnisse des Kindes ermögliche dem Kind etwa beim Stillen die Illusion, die<br />
Brust der Mutter unterliege der eigenen omnipotenten Kontrolle. Das Kind erlebe<br />
sich als Schöpfer der Brust, als Schöpfer seiner eigenen Bedürfnisbefriedigung 8 ,<br />
auch wenn diese Illusion von der Mutter abhängig sei, die im richtigen Augenblick<br />
zu stillen bereit sein muss. Das Kind erlebt sich aus dieser Perspektive<br />
heraus als kreativ im ursprünglichsten Sinnedes Wortes (lat. creare =erschaffen,<br />
hervorbringen), da es der Illusion unterliegt, das eigene Bedürfnis (Hunger)<br />
schaffe dessen Befriedigung (die stillende Brust). Es ist, als kommunizierte die<br />
Mutter im Zustand der primären Mütterlichkeit an ihr Kind: »Come at the world<br />
creatively; create the world; it is only what you create that has meaning for you.« 9<br />
Für diesen kindlichen Impuls, kreativ zu sein, benutzt Winnicott auch den Begriff<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Winnicott zitiert nach Abram, Language, 6.<br />
Mit dem Wort Objekt war im Rahmen der Freudschen Triebtheorie zunächst einmal das<br />
Triebobjekt gemeint. Im weiteren Gebrauch des Wortes konnte ein inneres Objekt gemeint<br />
sein, aber auch ein äußeres, also ein konkreter Beziehungspartner (Storck, Objekte,<br />
18). Im vorliegenden Beitrag bezieht sich der Begriff dort, wo <strong>nicht</strong> vom Übergangsobjekt<br />
die Rede ist, auf die primäre Bezugsperson; im Winnicottschen Schreiben<br />
und Denken ist das vor allem die Mutter. Vgl. hierzu Abram, Language, 6.<br />
Winnicott, Kinderheilkunde, 157ff.<br />
A.a. O., 313.<br />
A.a. O., 314.<br />
Winnicott zitiert nach Abram, Language, 117.
Kreative Wahrnehmung, illusionäre Allmacht und Anerkennung 47<br />
der »primary psychic creativity« 10 .Erbezeichnet eine Form der Kreativität, die<br />
überhaupt nur <strong>du</strong>rch die Anpassung der Mutter an die Bedürfnisse des Kindes<br />
ermöglicht wird.<br />
Im Laufe der Entwicklung muss die Illusion omnipotenter Kontrolle jedoch<br />
nach und nach aufgegeben werden. Etwa zwischen dem vierten und zwölften<br />
Lebensmonat vollziehen sich erste Trennungsschritte, es entsteht ein erstes<br />
Bewusstsein dafür, von der Mutter getrennt zu sein. Die ausreichend gute<br />
Mutter, um eineFormulierung Winnicotts zu gebrauchen,ist dabei <strong>nicht</strong> jene, die<br />
die Illusion omnipotenter Kontrolle möglichst lange aufrechterhält, sondern<br />
»eine Person, die sich aktiv an die Bedürfnisse des Kleinkindes anpaßt unddiese<br />
Anpassung allmählich gemäß der parallel dazu wachsenden Fähigkeit des<br />
Kleinkindes zurücknimmt, ausbleibende Anpassung zu berücksichtigen und die<br />
Folgen von Versagungen zu ertragen.« 11<br />
In diesem Zeitraum treten Übergangsphänomene wie etwa der Gebrauch<br />
eines Übergangsobjektes auf, zum Beispiel eines alten Teddys oder eines Stofftuchs.<br />
Diese Objekte werden einerseits heiß geliebt, aber auch leidenschaftlich<br />
gehasst. Übergangsobjekte hat Honneth treffend als »Ersatzbil<strong>du</strong>ngen für die<br />
an die äußere Realität verlorengegangene Mutter« 12 bezeichnet. In Winnicotts<br />
Worten: »Das Übergangsobjekt vertritt die Brust oder das Objekt der ersten Beziehung«<br />
13 .Das vom Kind selbst erwählte Übergangsobjekt repräsentiert damit<br />
auch den Übergang des Kindes von einer frühen Beziehungsform mit dem Objekt<br />
in eine andere, reifere und der Realität angemessenere. Übergangsobjekte sind<br />
Winnicott zufolge weder rein im Inneren noch rein im Äußeren anzusiedeln;sie<br />
sind also keine psychischen Einbil<strong>du</strong>ngen, keine Halluzinationen 14 ,dasie auf<br />
einen real vorhandenen Gegenstand angewiesen sind. Sie sind aber auch <strong>nicht</strong><br />
bloß Teil einer äußeren, von der Subjektivität des Kindes losgelösten Realität.<br />
Ihnen komme laut Honneth »eine Art von Zwitternatur« zu und das Kind könne<br />
sie in Abwesenheit oder auch Gegenwart der Eltern dazu benutzen, »seine ursprünglichen<br />
Allmachtphantasien über das Trennungserlebnis hinaus weiterleben<br />
zu lassen und zugleich kreativ an der Realität zu erproben« 15 .Der Säugling<br />
sei demnach fähig, »ein Objekt zu schaffen, sich auszudenken, zu erfinden, zustande<br />
zu bringen, hervorzubringen« 16 ,mit anderen Worten: Er wird kreativ, um<br />
mit Trennungserfahrungen umgehen zu können und den damit einhergehenden<br />
Kontrollverlust ein Stück weit unter eigene Kontrolle zu bringen. Das Kind, das<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
Abram, Language; Winnicott, Kinderheilkunde, 314.<br />
Winnicott, Kinderheilkunde, 312.<br />
Honneth, Kampf, 165.<br />
Winnicott, Kinderheilkunde, 311.<br />
A.a. O., 306.<br />
Honneth, Kampf, 165.<br />
Winnicott, Kinderheilkunde, 301.
48 Andreas Mayer<br />
sich des eigenen Getrenntseins zunehmend bewusst wird, beginnt also nun, die<br />
frühe Illusion von omnipotenter Kontrolle des Objekts aktiver und bewusster zu<br />
gebrauchen: »Die Übergangsphänomene stellen die Frühstadien im Gebrauch<br />
der Illusion dar.« 17 Die Betonung liegt hier auf dem Wort Gebrauch. Während bei<br />
frühen Omnipotenzerfahrungen noch <strong>nicht</strong> von einem Gebrauch die Rede sein<br />
kann, weil es noch kein Bewusstsein von einem getrennten Selbst gibt, das in der<br />
Lage wäre, et<strong>was</strong> zu gebrauchen, ist dies nun möglich:<br />
»Die zunächst mit Hilfe der hinreichend einfühlsamen mütterlichen Aktivität aufrecht<br />
erhaltene vollkommene Illusion, selbst Schöpfer seiner eigenen Welt, omnipotenter<br />
Ermöglicher der eigenen Bedürfnisstillung zu sein, wird auf dieser Stufe zu einer<br />
eingeschränkten Illusion, von der das Kind aktiv Gebrauch macht.« 18<br />
Die mit zunehmenden Trennungserfahrungen einhergehenden Frustrationen<br />
sind für die Entwicklung notwendig: »Wenn alles gut geht, kann der Säugling<br />
tatsächlich aus dem Erleben der Frustration einen Gewinn ziehen, da die unvollständige<br />
Anpassung an seine Bedürfnisse Objekte real werden läßt, d. h.<br />
sowohl gehaßt als auch geliebt.« 19<br />
Die Aufgabe der Illusion von Omnipotenz und ihre Kompensation über<br />
Übergangsphänomene lässt also <strong>nicht</strong> nur das Objekt realer werden, sondern<br />
ermöglicht dem Kind auch einen Übergangsbereich oder Zwischenbereich des<br />
Erlebens:<br />
»Der Zwischenbereich, von dem ich spreche, ist der Bereich, der dem Säugling zwischen<br />
primärer Kreativität und objektiver, auf Realitätsprüfung beruhender Wahrnehmung<br />
gewährt wird.« 20<br />
Winnicott nimmt an, dass <strong>nicht</strong> nur das kindliche Spiel, sondern auch die kulturellen<br />
Erfahrungen des Erwachsenen in direkter Entwicklungslogik zu diesen<br />
frühen Prozessen stehen:<br />
»<strong>Ich</strong> gehe hier von der Annahme aus, daß die Aufgabe der Annahme der Realität<br />
niemals zu Ende geführt wird, daß kein Mensch der Anstrengung enthoben ist, die<br />
innere und die äußere Realität zueinander in Beziehung zu setzen, und daß ein<br />
Zwischenbereich des Erlebens, der <strong>nicht</strong> in Frage gestellt wird (Kunst, Religion usw.),<br />
Befreiung von dieser Anstrengung bietet.« 21<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
A.a. O., 314.<br />
Soldt, Spiel, 46.<br />
Winnicott, Kinderheilkunde, 313.<br />
A.a. O., 314.<br />
A.a. O., 316.
Kreative Wahrnehmung, illusionäre Allmacht und Anerkennung 49<br />
Daher verliert zwar das Übergangsobjekt irgendwann an Bedeutung, die Übergangsphänomene<br />
seien allerdings verstreut über »das ganze Zwischenterritorium<br />
zwischen der ›innerseelischen Realität‹,und der ›Außenwelt, wie sie von zwei<br />
Menschen gemeinsam wahrgenommenwird‹ […], d. h. über das Gesamtgebiet der<br />
Kultur« 22 .<br />
Winnicott geht wie bereits gesagt davon aus, dass eine ausreichend gute<br />
Anpassung der Mutter an die Bedürfnisse des Säuglings ihm die Illusion verschaffe,<br />
»es existiere eine äußere Realität, die der eigenen schöpferischen Fähigkeit<br />
des Säuglings entspricht« 23 .Diese Erfahrung machen zu können, ist für<br />
Winnicott eng mit einer gesunden psychischen Entwicklung verbunden. Sein<br />
Begriff der Kreativität ist demnach wesentlich weiter gefasst als der gängige<br />
Kreativitätsbegriff, er bezieht sich auf eine bestimmte Haltung der Welt gegenüber<br />
und beeinflusst, ob ein Mensch das Leben als lebenswert und gestaltbar<br />
empfindet. 24<br />
Es lassen sich bei Winnicott also zwei Formen der Kreativität und, logisch<br />
damit verbunden, auch der kreativen Wahrnehmung unterscheiden. Eine primäre,<br />
die mit der <strong>du</strong>rch die Anpassung der Mutter an die Bedürfnisse des<br />
Säuglings verbundenen Omnipotenzillusion verbunden ist und es ermöglicht, die<br />
Welt als eine wahrzunehmen, die den ureigensten kreativen Impulsen entgegen<br />
kommt, und eine zweite, ontogenetisch später zuverortende, die mit der Desillusionierung<br />
und dem Eintritt in die Welt der Übergangsphänomene verbunden<br />
ist und inder Welt einen intermediären Bereich zwischen innerer Realität und<br />
äußerer Realität aufspannt, in welchem auch das Erleben kultureller Phänomene<br />
anzusiedeln sei. So kann etwa auch das Musikhören zueinem Übergangsobjekt<br />
werden, und zwar deshalb, weil hier ein Erfahrungsbereich betreten wird, in<br />
dem die Unterschei<strong>du</strong>ng zwischen einer objektiven, von der eigenen Wahrnehmung<br />
unabhängigen Welt, und der eigenen, subjektivenWelt, <strong>nicht</strong> mehr einfach<br />
möglichist. 25 Aus dieser Perspektive herauserlauben auch Kunstwerke »in ihrem<br />
Angeschautwerden das Spiel mit ihnen als Übergangsobjekte« 26 ,das Bild wird<br />
zum »Möglichkeitsraum« 27 .<br />
Winnicotts Theorie erlaubt es damit, so unterschiedliche Phänomene wie den<br />
Umgang mit Übergangsobjekten, das Spiel der Kinder und die ästhetischen Erfahrungen<br />
mit Musikstücken oder Kunstobjekten im selben Erfahrungsraum zu<br />
verorten:<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
A.a. O., 306.<br />
A.a. O., 315.<br />
Winnicott, Creativity.<br />
Vgl. Honneth/Whitebook, Fusion, 49.<br />
Soldt, Spiel, 52.<br />
A.a. O., 67.
50 Andreas Mayer<br />
»Wenn Spielen wesentlich über Phänomene des Übergangs konstituiert ist und<br />
gleichzeitig das Spiel die Grundform kreativer Kulturteilhabe darstellt, dann ergibt<br />
sich daraus die Schlussfolgerung, dass der Raum der Kultur, zu dem ja die Wahrnehmung<br />
von Kunst als vorzügliche, verdichtete Situation gehört, dass also ästhetisches<br />
Erleben in einem psychologischen Sinn an der Innen-Außen-Grenze des<br />
Subjekts arbeitet und Subjektivität ›erzeugt‹,indem es diese für das Realitätsprinzip<br />
an sich unverzichtbare Grenze ›übergangsweise <strong>du</strong>rchlässig‹ macht und damit das<br />
Subjekt zum spielerischen Vollzug aufruft, sie allererst und immer wieder neu zu<br />
ziehen.« 28<br />
Beide Formen der Kreativität bzw. der kreativen Wahrnehmung sind inWinnicotts<br />
Theorie der frühen Entwicklung<strong>nicht</strong> losgelöst vom Beziehungsgeschehen<br />
zu begreifen. Während die erste mit dem Erleben von Omnipotenz, man könnte<br />
also sagen mit der Nicht-Anerkennung des Anderen als unabhängige Person<br />
einhergeht, ist die zweite Form mit der Aufgabe der Omnipotenzillusion verbunden<br />
und damit mit der Anerkennung des Anderen als eine Person, die unabhängig<br />
von den Wünschen und Bedürfnisse des Säuglings existiert und sich<br />
diesen gegenüber auch widerständig zeigen kann.<br />
2. Alex Honneths Rekurs auf Winnicott<br />
In seinem Buch »Kampf um Anerkennung – Zur moralischen Grammatik sozialer<br />
Konflikte« widmet Axel Honneth Winncott gleich mehrere Seiten. Dessen<br />
Objektbeziehungstheorie erscheint ihm »für die Zwecke einer Phänomenologie<br />
von Anerkennungsbeziehungen« 29 als besonders geeignet. Die Liebe werde bei<br />
Winnicott als ein Interaktionsverhältnis verständlich, »dem ein besonderes<br />
Muster der reziproken Anerkennung zugrunde liegt« 30 .Die Fähigkeit zur »Balance<br />
zwischen Symbiose und Selbstbehauptung« 31 entscheide dabei über das<br />
Gelingen von affektiven Bin<strong>du</strong>ngen. Die Entwicklung hinaus aus einem »Zustand<br />
undifferenzierten Einsseins« 32 hin zur Akzeptanz und Liebe zueinander als unabhängige<br />
Personen werde bei Winnicott als ein Prozess beschrieben, der in<br />
Interaktion stattfindet. Im Laufe dieses Prozesses geschehe es nun, dass dem<br />
Kind »diebislang als Teil seiner subjektivenWelt phantasierte Personallmählich<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
A.a. O., 47 f.<br />
Honneth, Kampf, 157.<br />
A.a. O., 154.<br />
A.a. O., 157.<br />
A.a. O., 159.
Moral ist für Gefühlsblinde oder:<br />
Wer<strong>nicht</strong> fühlen will, muss hören!<br />
<strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Die Frage, ob Moral ein rational oder emotional fundiertes Phänomen sei, ist alt<br />
und verbindet sich klassischerweise etwa mit Namen wie Kant auf der einen und<br />
Hume auf der anderen Seite. Durch eine 2007 veröffentlichte Studie verschiedener<br />
Neurowissenschaftler und Psychologen gewann die Frage jedoch neue<br />
Aufmerksamkeit, die über die Fachkreise von Moralphilosophen und Ethikern<br />
hinausreichte, wo sie im Laufe der Jahre zwar <strong>nicht</strong> an Bedeutung, wohl aber<br />
an Kontroverse verloren hatte. 1 Verschiedene populärwissenschaftliche Medien<br />
griffen die Ergebnisse einer Studie von Michael Koenigs et al. auf und titelten<br />
etwa »Erst das Gefühl, dann die Moral?« 2 oder »Moral braucht Gefühl« 3 sowie<br />
»Moral kommt <strong>nicht</strong> ohne Gefühl aus« 4 – <strong>was</strong> hatten die Wissenschaftler um<br />
Koenigs herausgefunden? Koenigs et al. verglichen in ihrer Studie die Angaben,<br />
die Probanden mit Schäden am präfrontalen Kortex machten (einer Hirnregion,<br />
die für das Generieren und Regulieren von [sozialen] Emotionen zuständig ist)<br />
mit Angaben, die gesunde Kontrollgruppen machten in Bezug auf Entschei<strong>du</strong>ngen,<br />
die sie in einer vorgelegten Dilemmasituation treffen würden. Das Ergebnis<br />
der Studie zeigte, dass Menschen, die unter einer Läsion des präfrontalen<br />
Kortex litten, zueiner utilitaristischen Entschei<strong>du</strong>ngsfin<strong>du</strong>ng neigten und moralische<br />
Hemmschwellen eher zu übergehen bereit schienen als die gesunden<br />
Kontrollgruppen. Während die Mehrheitder Kontrollgruppenetwa angab, einen<br />
schwergewichtigen Menschen <strong>nicht</strong> von einer Brücke stoßen zu wollen, um einen<br />
Güterwagen aufzuhalten, der ansonsten eine größere Zahl von Menschen überfahren<br />
würde (sog. »Footbridge Dilemma« oder »Fat Man Dilemma« 5 ), gab die<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Vgl. zusammenfassend Fischer, Verstehen statt Begründen, 9–71; Frankfurt, Gründe der<br />
Liebe, 10–13.<br />
Schleim/Walter, Erst das Gefühl.<br />
Breuer, Moral braucht Gefühl.<br />
Spiegel Wissenschaft, Moral kommt <strong>nicht</strong> ohne Gefühl aus.<br />
Damit steht das »Footbridge-Dilemma« bzw. »Fat-Man-Dilemma« im Gegensatz zum<br />
klassischen »Trolley-Dilemma«, bei dem der Tod eines Menschen <strong>du</strong>rch die eigene
64 <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Mehrheit der Probanden mit den entsprechenden Gehirnschäden an, bereit zu<br />
sein, die schwergewichtige Person eigenhändig von der Brücke zu stoßen. 6 Anders<br />
als die Befunde bildgebender Verfahreninden Neurowissenschaften, die in<br />
Bezug auf die Rolle von Emotionen bei moralischen Entschei<strong>du</strong>ngen lediglich<br />
deren Involviert-Sein nachzuweisen vermögen, <strong>nicht</strong> aber ob sie Grundlage oder<br />
Folge der Entschei<strong>du</strong>ngen sind, konnte die Studie von Koenigs et al. zeigen,dass<br />
Emotionen bereits beim Treffen der Entschei<strong>du</strong>ng maßgeblich relevantsind und<br />
<strong>nicht</strong> erst <strong>du</strong>rch sound so geartete Entschei<strong>du</strong>ngen hervorgerufen werden. 7<br />
Derlei Befunde aus den Neurowissenschaften haben solche Tendenzen in der<br />
Moralphilosophie und akademischen Ethik erstarken lassen, die der mehrheitlich<br />
vertretenen und daher nur mäßig kontrovers diskutierten Annahme kritisch<br />
gegenüberstanden, Moral sei rational begründbar und entsprechend auch<br />
rational begründet. 8 Die Erkenntnisse der Neurowissenschaften legen eine rationale<br />
Entschei<strong>du</strong>ngsfin<strong>du</strong>ng bei moralischen Fragen gerade <strong>nicht</strong> nahe. Es<br />
scheint, als würde in moralischen Fragen vor allem emotional entschieden.<br />
Braucht eine rational begründete Moral also nur, wer zu fühlen <strong>nicht</strong> angemessen<br />
in der Lage ist?<br />
Um dieser als vorsichtige Frage formulierten These nachzugehen, möchte ich<br />
zunächst der Rolle nachspüren, die einer rational begründeten Moral in unserer<br />
Lebenswirklichkeit zugeschrieben wird und prüfen, inwiefern sie tatsächlich<br />
relevant für die Ausrichtung unseres Handelns ist (1). Die Überlegungen werden<br />
zeigen, so hoffe ich, dass eine rational begründete Moral unser Zusammenleben<br />
zwar <strong>nicht</strong> mehrheitlich und primär bestimmt, aber ggfs. eine marginale Relevanz<br />
hat. Daher möchte ich in einem zweiten Schritt betrachten, <strong>was</strong> es ist, das<br />
unser Handeln tatsächlich mehrheitlich orientiert (2), um von dort aus den<br />
marginalen Ort einer rational begründeten Moral zu bestimmen, von dem ich<br />
meine, ihn dort zu finden, wo Menschen <strong>nicht</strong> imstande sind, sich <strong>du</strong>rch Emotionen<br />
orientiert sein zu lassen bzw. keinen Zugang zu ihren Emotionen zu finden<br />
scheinen (3). Abschließend ziehe ich ein kurzes Fazit in Bezug auf den Ort, den<br />
»Sitz im Leben« einer rational begründeten Moral (4).<br />
6<br />
7<br />
8<br />
Weichenumstellung lediglich ein <strong>nicht</strong> unmittelbar selbst bewirkter Tod ist und in<br />
Studien von Probanden eher in Kauf genommen wird.<br />
Vgl. Koenigs u.a., Damage to the Prefrontal Cortex.<br />
Vgl. a. a. O., 908.<br />
Vgl. zusammenfassend Fischer, Verstehen statt Begründen, 25–71; Eine solche Kritik<br />
wurde prominent vorgetragen etwa von Prichard, Beruht die Moralphilosophie auf einem<br />
Irrtum? oder Williams, Begriff der Moral.
Moral ist für Gefühlsblinde oder: Wer <strong>nicht</strong> fühlen will, muss hören! 65<br />
1. Ohne Moral wären wir verloren –oder?<br />
Moral hat in den Augen vieler Menschen einen hohen Stellenwert – und zwar<br />
<strong>nicht</strong> nur bei Moralphilosophen und Berufsethikern, die das Fragen nach der<br />
Moral in Lohn und Brot bringt, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit sowie<br />
im Privatleben der meisten Menschen. Moral wird für das Zusammenleben als<br />
unverzichtbar erachtet, orientiert sie doch dahingehend, wie Menschen handeln<br />
sollten und wie <strong>nicht</strong>. Eine Welt ohne Moral, so scheint es, kann niemandes<br />
Begehr sein. Bei unserem Alltagsverständnis davon, <strong>was</strong> Moral ist, scheinen<br />
dabei vor allem Gesichtspunkte eine Rolle zu spielen,die in der Moralphilosophie<br />
und akademischen Ethik mit der rational begründeten Moralvorstellung einer<br />
normativen Ethik zusammenhängen. So verbindet sich mit einem alltäglichen<br />
Verständnis von Moral in der Regel zunächst die Vorstellung von bestimmten<br />
allgemeinen Werten und Normen, auf Grundlage derer Handlungsweisen als<br />
moralisch gut oder schlecht zu beurteilen sind, sowie die Auffassung, die Moral<br />
gewinne genau daraus ihre orientierende Kraft. Sofern ich nur weiß, wie vom<br />
Standpunkt der Moral aus das Lügen zu beurteilen ist, habe ich auch Kenntnis<br />
darüber, obich nun lügen sollte oder <strong>nicht</strong>.<br />
Diese Art und Weise, moralische Orientierung per se mit der Orientierung an<br />
moralischen Urteilen und Bewertungen gleichzusetzen, ist ein Zug, den der<br />
evangelische Theologe und Ethiker Johannes Fischer eben denjenigen Ansätzen<br />
attestiert, die meinen, Moral sei rational begründet. 9 Da<strong>du</strong>rch nämlich, so Fischer,<br />
dass moralisch wertende Urteile dabei gebraucht werden wie Behauptungen,<br />
erhalten diese einen Status, der insinuiert, ihre Richtigkeit wäre <strong>du</strong>rch<br />
rationale Argumente beweisbar, wo<strong>du</strong>rch einer solchen Moralvorstellung ebenfalls<br />
der Anspruch auf Allgemeingültigkeit eigne. 10 Die Vorstellung sei, dass<br />
moralische Urteile <strong>nicht</strong> bloß subjektives Empfinden oder situativ kontingente<br />
Bewertungen ausdrücken, sondern intersubjektiven, allgemeinen Geltungsanspruch<br />
haben, der daher rührt, dass ihre Wahrheit <strong>du</strong>rch Argumente bewiesen<br />
werden kann, die vernünftig denkende Menschen gewissermaßen zur Einsicht<br />
nötigen müssen. 11 Daher spricht Fischer mit Jürgen Habermas von einem<br />
»zwanglosen Zwang« 12 ,der rationalen Argumenten bei Konzeptionen einer rationalen<br />
Moralbegrün<strong>du</strong>ng zugesprochen werde. Damitkorrespondiere, dass die<br />
wesenhafte Ausdrucksform einer solchen Moralvorstellung die Formulierung<br />
allgemeingültiger, normativer moralischer Regeln sei, anstatt sich auf situationsspezifische<br />
Beurteilungen zu beschränken.<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
Vgl. Fischer, Verstehen statt Begründen, 29 f.<br />
Vgl. a. a. O., 26 f.<br />
Vgl. a. a. O., 25–35.<br />
Jürgen Habermas zitiert nach Fischer, a.a. O., 27.
66 <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Dass eine solche Vorstellung einer rational begründeten Moral einer, wie<br />
Fischer sagt, »vordergründigen Plausibilität« <strong>nicht</strong> entbehrt, zeigt sich schon<br />
allein darin,dass – wie bereits erwähnt – unsere Alltagstheorie davon, <strong>was</strong> Moral<br />
ist, im Wesentlichen die genannten Gesichtspunkte einer rational begründeten<br />
Moralvorstellung umfasst: die Orientierung an moralisch wertenden Urteilen<br />
und die Formulierung allgemeingültiger, normativer Regeln. 13 Ein solches Alltagsverständnis<br />
davon, <strong>was</strong> Moral ist und leistet, zeigt sich etwa in den Erwartungen,<br />
die an die Arbeit von Ethikkommissionen und -Ausschüssen gestellt<br />
werden, wie sie beispielsweise Krankenhäuser und Unternehmen zur Beratung<br />
etablieren oder in Form des Deutschen Ethikrats, der der Orientierung von Politik<br />
und Gesellschaft insgesamt dienen sollen. 14 In seinen sogenannten Adhoc-<br />
Empfehlungen macht es sich der Deutsche Ethikrat etwa zur Aufgabe, in Bezug<br />
auf gesellschaftlich strittige Fragen »basale Handlungsge- und verbote« darzustellen<br />
und damit »normative Vorgaben« 15 zu machen. Sogehörten die Äußerungen<br />
des Ethikrats zur Frageder Triage oder der Impfstoffverteilung während<br />
der Corona Pandemie zu den normierenden Stellungnahmen in der Krise undvon<br />
den Empfehlungen zur Regelung der geschäftsmäßigen Sterbehilfe seit dem<br />
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 erhofften sich viele Orientierung.<br />
Wenn im Folgenden nun verkürzt von Moral die Rede ist, dann ist damit in<br />
diesem Zusammenhang also eine rational begründete Moral in einem normativen,<br />
allgemeine Regeln formulierenden Sinn gemeint, wie oben beschrieben. Eine<br />
solche Moralvorstellung scheint es zu sein, die uns – zumindest vordergründig –<br />
als elementar und für unser Zusammenleben unentbehrlich scheint. Damit sich<br />
<strong>nicht</strong> Kontingenz und Willkür in unserem Handeln unter- und aneinander Bahn<br />
brechen, gehen wir davon aus, allgemeiner moralischer Grundsätze zu bedürfen,<br />
die uns zu gutem Handeln anleiten. Die Moral gebietet es uns, <strong>nicht</strong> zu lügen und<br />
zu betrügen, einander <strong>nicht</strong> auszunutzen, zu beleidigen und zu verletzen – wo<br />
wären wir also ohne Moral?<br />
Nun, möglicherweise wären wir ohne Moral genau dort, wo wir auch mit<br />
Moral sind. Der US-amerikanische Philosoph Harry G. Frankfurt meint zumin-<br />
13<br />
14<br />
15<br />
Ausführlich zu unserer Alltagstheorie von Moral vgl. Michael Roths Beitrag in diesem<br />
Band.<br />
Vgl. dazu den kritischen Kommentar zu derlei Erwartungshaltungen von Reiner Anselm,<br />
Beraten oder Entscheiden? Anselm plädiert hier dafür, dass Ethikkommissionen <strong>nicht</strong><br />
dazu da seien, <strong>du</strong>rch Entschei<strong>du</strong>ngen einen Konsens herbeizuführen, sondern der<br />
Pluralität in den fraglichen Debatten Raum und den unterschiedlichen Stimmen Gehör<br />
und eine Plattform zu schenken. Daher spricht Anselm in Anlehnung an Luhmann<br />
davon, dass Ethikkommissionen »Einrichtungen zur Vermei<strong>du</strong>ng von Moral« (a. a. O.,<br />
165) seien.<br />
So etwa in seiner 2020 veröffentlichten Ad-hoc-Empfehlung zur Solidarität und Verantwortung<br />
in der Coronakrise, 2.
Moral ist für Gefühlsblinde oder: Wer <strong>nicht</strong> fühlen will, muss hören! 67<br />
dest, die Moral spiele eine weitaus weniger gewichtige Rolle im menschlichen<br />
Miteinander, als man zunächst anzunehmen geneigt ist. Zwar möchteFrankfurt<br />
<strong>nicht</strong> bestreiten, dass moralische Erwägungen ernst zu nehmen seien, aber er hält<br />
dieser Feststellung entgegen:<br />
»Dennoch denke ich, dass die Relevanz, die der Moral für unsere Lebensführung<br />
zukommt, tendenziell überbewertet wird. Die Moral ist weniger einschlägig für die<br />
Bil<strong>du</strong>ng unserer Präferenzen und die Orientierung unseres Verhaltens, sie gibt uns<br />
weniger Auskunft über die Fragen, <strong>was</strong> wir schätzen und wie wir leben sollen, als<br />
man gemeinhin annimmt. Außerdem kommt ihr <strong>nicht</strong> so viel Autorität zu, wie man<br />
meint. Selbst wenn sie Wichtiges mitzuteilen hat, hat sie <strong>nicht</strong> notwendigerweise das<br />
letzte Wort. Und mit Blick auf unser Interesse an einem sinnvollen Umgang mit den<br />
normativ relevanten Aspekten unseres Lebens spielen moralische Vorschriften <strong>nicht</strong><br />
die umfassende Rolle und sind auch weniger bestimmt, als man uns häufig glauben<br />
machen will.« 16<br />
Dementsprechend meint Frankfurt, die Moral gebe uns »bestenfalls eine äußerst<br />
begrenzte und unzureichende Antwort auf die Frage, wie eine Person leben<br />
soll« 17 .Gleichzeitig möchte Frankfurt <strong>nicht</strong> dem weit verbreiteten Argwohn das<br />
Wort reden, die einzige Alternative zur moralischen Orientierung unseres Handelns<br />
seien unsere jeweiligen Eigeninteressen. Frankfurt analysiert: »Zögert<br />
jemand, sein Verhalten moralischen Vorschriften zu unterwerfen, dann nur, so<br />
die Annahme, weil <strong>nicht</strong>s Bedeutenderes ihn antreibt als der engstirnige Wunsch,<br />
sich selbst Vorteile zu verschaffen.« 18 Mit dieser Annahme sitze man allerdings<br />
einem Irrtum auf. Schließlich gebe es <strong>du</strong>rchaus »recht vernünftige und ange<strong>sehe</strong>ne<br />
Menschen«, soFrankfurt, »die der Meinung sind, dass ihnen andere Dinge<br />
gelegentlich mehr bedeuten und auch stärkere Ansprüche an sie stellen als die<br />
Moral oder ihr Selbst. Es gibt Modi der Normativität, die im vollen Sinne des<br />
Wortes zwingend sind, aber weder in moralischen noch in egoistischen Überlegungen<br />
gründen.« 19 In ähnlicher Weise meint der englische Moralphilosoph<br />
Bernard Williams, es sei absurd anzunehmen, unser Handeln könne ausschließlich<br />
entweder moralisch oder eigennützig motiviert sein. Vielmehr seien<br />
in unseren tatsächlichen lebensweltlichen Zusammenhängen häufig Faktoren<br />
wie Liebe, Respekt u. ä. ausschlaggebend dafür, wie wir handeln. 20 Und dies sei,<br />
so Williams, »zum Glück für die Menschheit« 21 der Fall. Zum Glück für die<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
Frankfurt, Gründe der Liebe, 10 f.<br />
A.a. O., 11.<br />
A.a. O., 12.<br />
A.a. O., 12 f.<br />
Vgl. Williams, Begriff der Moral, 80 f.<br />
A.a. O., 81.
68 <strong>Ulrike</strong> <strong>Peisker</strong><br />
Menschheit sei es bspw. so, dass »[m]anche unserer anständigen Handlungen[…]<br />
<strong>nicht</strong>, wie die Christen fälschlicherweise meinen, <strong>du</strong>rch allgemeine Menschenliebe<br />
motiviert [sind], sondern einfach <strong>du</strong>rch unsere Liebe zu bestimmten Personen.«<br />
22 Im Folgenden wollen wir dieser Vermutung nachgehen, dass Liebe und<br />
Respekt in unseren konkreten Beziehungen es sind, die unser Handeln tatsächlich<br />
überwiegend orientieren und <strong>nicht</strong> etwa in erster Linie allgemeine<br />
moralische Grundsätzeund in gewissem Sinne soll auch die Behauptung geprüft<br />
werden, dies sei zum Glück für die Menschheit der Fall.<br />
2. Liebe als orientierende Kraft?<br />
Ähnlich wie Bernard Williams nimmt auch Harry G. Frankfurt die Liebe als das<br />
grundlegende orientierende Moment unseres Handelns an. Dabei versteht<br />
Frankfurt Liebe sehr niederschwelligals »care« und zwar in erster Linie <strong>nicht</strong> als<br />
»care for something«, als Fürsorge, sondern v. a. als »caring about something«,<br />
man könnte sagen: als das Sich-um-et<strong>was</strong>-Scheren, das Sich-et<strong>was</strong>-aus-et<strong>was</strong>-<br />
Machen. Something that you care about is something that you do not not care<br />
about – et<strong>was</strong> also, ganz unemphatisch übersetzt, das einem <strong>nicht</strong> egal und in<br />
diesem Sinne in gewisser Weise wichtig ist. 23 Daher plädiert Frankfurt dafür, das<br />
»Repertoire, auf das sich die praktische Vernunftbezieht, auszuweiten«, nämlich<br />
auf die »zusätzlichen Begriffe: worum wir uns sorgen, <strong>was</strong> uns wichtig ist und <strong>was</strong><br />
wir lieben.« 24 Dementsprechend könne die »zentrale und wesentliche Frage, die<br />
sich mit Blick auf die Führungdes eigenen Lebensfür einePerson stellt, […]<strong>nicht</strong><br />
die normative Frage danach sein, wie sie leben soll. Diese Frage kann sinnvollerweise<br />
erst dann gestellt werden«, so Frankfurt, »wenn vorher die faktische<br />
Frage geklärt ist, worum sie sich tatsächlich sorgt.« 25<br />
Um dies zu verdeutlichen, greift Frankfurt ein Beispiel von Bernard Williams<br />
26 auf: Williams gibt zubedenken, dass in einer Situation, in der ein Mann<br />
vom Ufer aus zwei Personen gegen das Ertrinken kämpfen sieht und eine der<br />
beiden Personen seine Frau ist, der Gedanke, wie zu rechtfertigen sei, seine Frau<br />
zu retten, anstatt die andere Person, bereits ein Gedanke zu viel sei. Vielmehr<br />
<strong>sehe</strong> der Mann die beiden Menschen unddenke: Das eine ist meine Frau, der helfe<br />
ich. In dieser Sache präzisiert Frankfurt Williamsnoch und meint: jeder Gedanke<br />
sei in dieser Situationeiner zu viel. Wirmüssten viel eher davon ausgehen, dass<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
Ebd.<br />
Vgl. Frankfurt, Gründe der Liebe, 15 f.<br />
A.a. O., 16.<br />
A.a. O., 32.<br />
Bernard Williams wiederum übernimmt das Beispiel von Charles Fried; vgl. Williams,<br />
Personen, 25 f.
Zwischen Subjektivität und<br />
Objektivität<br />
Der Kontingenzbegriff als modale Figur in Ethik<br />
und Ästhetik<br />
<strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong><br />
1. Hinführung<br />
»<strong>Ich</strong> spielte. Es fiel mir ein, Bülow anzu<strong>sehe</strong>n, und da <strong>sehe</strong> ich, wie er sich mit beiden<br />
Händen die Ohren zuhält. <strong>Ich</strong> halte im Spiel inne. Der am Fenster stehende Bülow<br />
bemerkt es sofort und fordert mich auf, fortzufahren. <strong>Ich</strong> spiele. Nach einiger Zeit<br />
wende ich mich wieder um. Bülow sitzt mit zugestopften Ohren am Tisch […]. Als ich<br />
zu Ende war, wartete ich schweigend das Urteil ab. Aber mein einziger Zuhörer<br />
verharrte an seinem Tisch lange und regungslos. Plötzlich deutete er eine energische<br />
Ablehnung an und sagte: ›Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich überhaupt <strong>nicht</strong>s<br />
von Musik.‹ Wirschieden dann in voller Freundschaftvoneinander, ich freilich mit der<br />
Überzeugung, dass Bülow mich für einen fähigen Dirigenten, aber für einen hoffnungslosen<br />
Komponisten hält.« 1<br />
So schildert Gustav Mahler dem Prager Komponisten Josef Bohuslav Foerster<br />
ein Zusammentreffen mit dem Stardirigenten Hans von Bülow im Herbst 1891.<br />
»Bülow [hat] beinahe seinen Geist aufgegeben, während ich ihm daraus vorspielte«<br />
2 ,schreibt Mahlerwenig später auch an Richard Strauss.Was war das für<br />
ein Stück aus Mahlers Feder, dem Bülow <strong>nicht</strong> nur kompositorische Qualität,<br />
sondern gar ganz das Musik-Sein abspricht? Es war wohl der 1. Satz der c-Moll-<br />
Symphonie – seinesogenannte »Todtenfeier« –,die heutzutage weltberühmt und<br />
ein Standardwerk des klassischen Konzertbetriebs ist. Bülows Entsetzen ist dem<br />
heutigen Ohr <strong>nicht</strong> mehr verständlich. Die »Todtenfeier« beeindruckt, fesselt und<br />
fordert zwar mit imposanter Besetzung noch immer – Mahler glaubt (ganz zu<br />
Recht!)nach diesem ersten Satz fünf Minuten Erholungspause für das Publikum<br />
in der Partitur einfordern zu müssen, bevor es mit dem zweiten Satz weiter gehen<br />
1<br />
2<br />
Entnommen dem CD-Heft der Münchner Philharmoniker, die Mahlers Auferstehungssymphonie<br />
2015 aufführte. Online unter: https://www.orso.co/wp-content/uploads/<br />
2018/10/Mphil_Gergiev1_www.pdf, 5(Stand: 25.05. 2023) (Meine Hervorh.).<br />
A.a. O. und Blaukopf, Mahler Strauss Briefwechsel, 16.
92 <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong><br />
kann –, doch kommt uns das Gehörte heutzutage weder sonderlich revolutionär<br />
vor, noch käme jemand auf die Idee, diesem Meisterwerk die Qualitätoder gar das<br />
Genre gänzlich absprechen zu wollen. Gleichzeitig kennt man vergleichbare<br />
Situationen aus dem eigenen Konzertbesuch: Während der Sitznachbar auf die<br />
Uhr schauend das Ende des Konzertes herbeisehnt und offensichtlich weder<br />
et<strong>was</strong> empfindet, noch diese Empfin<strong>du</strong>ng auslösende musikalische Inhalte entdeckt,<br />
ist man selbst zuTränen gerührt und wünscht sich, die Symphonie oder<br />
das Chorkonzert möge ewig weiter gehen. Kaum wechselt man das Genre, mutiert<br />
man aber selbst zum Auf-die-Uhr-Schauenden und hört, sieht und empfindet<br />
– <strong>nicht</strong>s. Freilich wird der unempfängliche Zuhörer in der Regel <strong>nicht</strong> geneigt<br />
sein dem unverstandenen Stück das Musik-Sein abzusprechen, aber doch bleibt<br />
ihm der wesentliche Inhalt verschlossen. Warum ist das so? Was braucht es,<br />
um Musik gehaltvoll erfassen zu können? Ist meine Rührung beim Hören der<br />
Symphonie eine angemessene Reaktion, die von Musikverständnis zeugt oder<br />
doch bloße subjektive Projektion? Ganz offensichtlich sind die ästhetischen<br />
Qualitäten von Mahlers Symphonie <strong>nicht</strong> bedingungslos erfahrbar; sie sind<br />
mindestens angewiesen auf ein Zusammenwirken von Aufmerksamkeit und<br />
Konzentration, von Auffassungsvermögen, vielleicht einer bestimmten Bil<strong>du</strong>ngsgeschichte,<br />
vor allem aber von einem bestimmten Ort und einer bestimmten<br />
Zeit, wie Bülows Reaktion zeigt: 1891 scheinen er und Gustav Mahler<br />
schon <strong>nicht</strong> mehr derselben Epoche, derselben Zeit anzugehören, die den jeweiligen<br />
Musikbegriff mit Inhalt füllt und rahmt. Bülows Gütekriterien für<br />
»Musik« verhindern das verstehende Hören des Neuen und Unbekannten: Die<br />
harsche Kritik Bülows – »Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich überhaupt<br />
<strong>nicht</strong>s von Musik« – ist womöglich ein Hinweis darauf, dass seine <strong>nicht</strong> zu bezweifelnde<br />
Musikexpertise genau hier, in Mahlers neuer, unbekannter und<br />
deshalb unverstandener Tonsprache, an ein Ende kommt. Vielleicht versteht der<br />
große Kapellmeister undDirigent von dieser Musik tatsächlich überhaupt <strong>nicht</strong>s –<br />
auch wenn der Szene sicherlich eine gehörige Portion Polemik <strong>nicht</strong> abgesprochen<br />
werden kann.<br />
Ein musikästhetischer Realismus steht damit vor ganz ähnlichen Herausforderungen<br />
wie ein ethischer Realismus – wenn auch mit gänzlich anderen<br />
Konsequenzen. Der Schweizer Theologe Christoph Ammann erzählt inseinem<br />
Buch »Emotionen – Seismographen der Bedeutung« folgende Geschichte: Man<br />
solle sich vorstellen, zwei Bekannte, ein »<strong>was</strong>chechter« Spanier und ein <strong>nicht</strong>spanischer,<br />
kulturfremder Freund sitzen in einer Stierkampfarena und beobachten<br />
das Spektakel. Während der Spanier die Anmut des Tieres und des Toreros<br />
lobt, kann sein ausländischer Freund das Grauen kaum fassen. Beim Anblick des<br />
blutenden Stiers wird ihm speiübel, beim Hören des aufgeregten Publikums<br />
empfindet er Wut: »Wie kann man so et<strong>was</strong> gutheißen?« 3<br />
3<br />
In Anlehnung an Ammann, Emotionen, 113.
<strong>Ich</strong> <strong>sehe</strong> <strong>was</strong>, <strong>was</strong> <strong>du</strong> <strong>nicht</strong> <strong>siehst</strong><br />
Zwischen Subjektivität und Objektivität 93<br />
Die Parallele zwischen der Szene in der Stierkampfarena und dem Konzertsaal<br />
liegt darin, dass jeweils das gleiche bedeutungsgeladene Phänomen perzipiert,<br />
aber gänzlich unterschiedliche Inhalte rezipiert werden. Innerhalb einer vergleichbaren<br />
sinnlichen Episode wird doch anderes gehört, gefühlt oder ge<strong>sehe</strong>n;<br />
der Erkenntnisgewinn des jeweiligen Wahrnehmungsakts steht diametral dem<br />
des anderen gegenüber. Dabei streiten Bülow und Mahler wie auch die beiden<br />
Besucher in der Stierkampfarena über divergierende propositionale Wahrnehmungsebenen.<br />
Sie nehmen das gleiche »Et<strong>was</strong>« als anderes »Et<strong>was</strong>« wahr.<br />
Schnell werden die einen sich einigen, dass sie einen Stier, eine Arena, einen<br />
Torero, Blut, Messer, Sand und Staub ge<strong>sehe</strong>n haben, aber nur einer der beiden<br />
rezipiert bei der Beobachtung von alledem »Grausamkeit«, der Freund vielmehr<br />
»Erhabenheit«. Bülow und Mahler kämenebenfalls zum gleichen Ergebnis, wenn<br />
sie die »Todtenfeier« musikanalytisch auswerteten: Der Satz steht in der Tonart c-<br />
Moll, das Hauptthemaerstrecktsich über den Ambitus einer Noneund orientiert<br />
sich lose an der Sonatensatzform etc. Uneinig sind sie sich darüber, <strong>was</strong> dieses<br />
Analysierte bedeutet. 4 Das titelgebende »<strong>Ich</strong> <strong>sehe</strong> <strong>was</strong>, <strong>was</strong> <strong>du</strong> <strong>nicht</strong> <strong>siehst</strong>« des<br />
Sammelbandes ist hier also kein Aufruf zum Vergleich bestimmter physiologischer<br />
Dispositionen sinnlich konstituierter Wesen, die uns sogenannte sekundäre<br />
Qualitäten wie Farben <strong>sehe</strong>n und Klänge hören lassen, sondern vielmehr der<br />
Hinweis auf die divergierenden propositionalen Gehalte derselben, die uns in<br />
Ethik und Ästhetik interessieren. Hier wurzelt auch das Problem jeweiliger<br />
geltungstheoretischer Begrün<strong>du</strong>ngsfiguren. In Fragen nach »Sein und Existenz«<br />
nämlich, so Dieter Mersch,<br />
»versagt [et<strong>was</strong> …] im Begriffsschema der klassischen Metaphysik, <strong>was</strong> augenscheinlich<br />
damit zu tun hat, dass die Erfahrung des Kontingenten allein auf das binäre<br />
Repertoire der Logik zurückgeführt wird. Sie kontaminiert die Problematik des<br />
Ontologischen […] mit den Kategorien formaler Rationalität, die einzig Beweis und<br />
Begrün<strong>du</strong>ng suchen. Wird in der Tradition der Metaphysik <strong>du</strong>rchgängig Sein auf<br />
4<br />
Der in der Ethik wie Ästhetik umstrittene Wertbegriff wird in diesem Aufsatz – wenn<br />
auch <strong>nicht</strong> konsequent – <strong>du</strong>rch den Begriff der Bedeutung (meaning) ersetzt. So wird die<br />
Verwandtschaftzwischen Ethik und Ästhetik noch einmal deutlicher: Beide haben es mit<br />
Bedeutsamem zu tun, also mit et<strong>was</strong>, das <strong>du</strong>rch Deute- und Zeigeprozesse in einer Lebenswelt<br />
entsteht und in Kunstwerk oder ethischer Maxime haltbar gemacht wird. Es<br />
wird <strong>du</strong>rch den Bedeutungsbegriff auch darauf hingewiesen, dass die Explikation unverstandener<br />
Kunstwerke oder divergierender ethischer Maßstäbe jene in sie hineingeflossene<br />
Lebenswelt(en) wieder vor Augen führen muss, um verstanden werden zu<br />
können. Diesen Lebensweltbezug will so manche moderne Kunst freilich gerade kappen;<br />
sie will sich damit mitunter aber auch der Bedeutung und Deutung verwehren. Dazu<br />
später mehr.
94 <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong><br />
Grund zurückgeführt, welcher die Wahrheit des Satzes garantiert, erfahren wir von<br />
der Gegenwart des Wirklichen und seiner Bedeutung ausschließlich <strong>du</strong>rch seine<br />
Bestimmung als et<strong>was</strong>, wie sie <strong>du</strong>rch die Prädikation ausgesagt wird – Existenz aber<br />
<strong>du</strong>ldet weder Aussage noch Begrün<strong>du</strong>ng.« 5<br />
In dem von uns oben beschriebenen »Et<strong>was</strong>« als »Et<strong>was</strong>« sieht Mersch »de[n]<br />
Schlüssel der Diskurse der Metaphysik, zugleich die erste Spaltung, de[n] Riss,<br />
der Sinn gewährt« 6 .Alles <strong>was</strong> hinter dem als genanntwerde, sei klassischerweise<br />
das zu Vernachlässigende und Unbestimmte:»Vonder Existenz gibt es kein ›Als‹,<br />
weder Eigenschaft noch Prädikat, vielmehr bezeichnet sie im abendländischen<br />
Diskurs das Nichtige, dem kein eigener Status zukommt, […] weil sie sich den<br />
Verallgemeinerungen <strong>du</strong>rch Begriffe entzieht […].« 7<br />
(Musik )Ästhetik und Ethik eint also, dass sich ihre Untersuchungsgegenstände<br />
– Kunst und Moral – nur äußerst sperrig mithilfe klassischer wissenschaftlicher<br />
Methoden oder formal rationalen Gütekriterien in ihrem Wesen<br />
einfangen lassen: Während die Richtigkeit einer naturwissenschaftlichen oder<br />
logischen These in aller Regel zeit- und ortsungebundene Allgemeingültigkeit<br />
meint, so wird Schönes, Hässliches, Grausamesoder Erhabenes – als Mischform<br />
des Ästhetischen und Ethischen – aus einer <strong>Ich</strong>-Perspektive undinemotionalem<br />
und affektivem Beteiligtsein als richtig oder wirklich begriffen. Mit Blick auf den<br />
Alltag lässt sich <strong>nicht</strong> leugnen, dass sich unser ästhetisches wie moralisches<br />
Bewusstsein kaum beeindrucken lässt vom Skeptizismus eines philosophischen<br />
Rationalismus oder der Naturwissenschaften, die beiderseits aus der Irrtums-,<br />
bzw. Täuschungsanfälligkeit unseres Sinnesapparats methodologische Schlussfolgerungen<br />
ableiten. 8 Moralische wie ästhetische Orientierung konstituiert sich<br />
hingegen weniger <strong>du</strong>rch erfahrungsbereinigte notwendige Fakten, die wir lernen,<br />
als vielmehr <strong>du</strong>rch sinnliche Erfahrungen, die wir machen. Jener Erkenntnisweg<br />
trägt der Phänomenologie von meaning/Bedeutungsvollem selbst<br />
Rechnung, die in pluralen Praxiskontexten wurzelt und ebendort an ausdifferenzierter<br />
Kontur gewinnt: Ob et<strong>was</strong> tatsächlich schön oder hässlich ist, verwerflich<br />
oder tugendhaft, wird hier überprüft und aktualisiert, mitunter auch<br />
verworfen. 9 Wenn wir über ein moralisches Dilemma nachdenken oder nach<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Mersch, Kontingenz, Zufall und ästhetisches Ereignis, 26 f. (Hervorh. i. O.).<br />
A.a. O., 27.<br />
Ebd.<br />
Das tut ein strenger ethischer Rationalismus oder ästhetischer Formalismus auch, <strong>was</strong><br />
allerdings zur Folge hat, dass die Alltagsphänomene »Moral« und »Ästhetik« zuweilen<br />
nur noch wenig Verwandtschaftsmomente mit den Ergebnissen jener akademischen<br />
Untersuchungen aufweisen.<br />
Dabei fällt auf, dass musikontologische Behauptungen oft vorsichtiger formuliert sind,<br />
als so manche (re<strong>du</strong>ktionistische) Naturalismen innerhalb der Philosophie. Die (Musik )
Zwischen Subjektivität und Objektivität 95<br />
Argumentenineinem ethisch aufgeladenen Streit suchen, so kommen wir <strong>nicht</strong><br />
umhin, Beispielgeschichten zu erzählen, in denen wir unsere These in einer lebensnahenUmgebung<br />
einbetten und illustrieren: »Stell dir vor, dass …«. Statt der<br />
Verfrachtung des zu untersuchenden Phänomens in laborhafte Sterilität, betten<br />
wir es erzählerisch in Bedeutungskontexte ein, die unsere Vorstellungskraft<br />
beanspruchen. Dazu verwenden wir ein narratives alltagspsychologisches Vokabular,<br />
das sich radikal von naturwissenschaftlichem Sprech unterscheidetund<br />
materielle Prozesse und Sachverhalte beschreibt. 10<br />
»Bedeutungen« sind wandelbar und trotz der Behauptung unseres ästhetischen<br />
wie moralischen Bewusstseins, man habe es hier mit kategorischer Geltung<br />
zu tun – die Mahlerʼsche Symphonie ist schön, Stierkampf ist verwerflich –,<br />
auf eine involviert-engagierte <strong>Ich</strong>-Perspektive angewiesen, sowie an eine bestimmte<br />
Zeit, einen bestimmten Ort gebunden. Wollen wir dem empfundenen<br />
kategorischen Anspruch jener Phänomene gerecht werden, ohne ihre Zeit- und<br />
Ortsgebundenheit zu untergraben, haben wir also »Kultur« als Ort ihrer Genese<br />
und Anwen<strong>du</strong>ng aufzuwerten. Umdas Perspektivische, bzw. die genannte Positionalität<br />
<strong>nicht</strong> als Argument für einen ethischen wie ästhetischen Subjektivismus,<br />
Kulturrelativismus oder Projektivismus zu hören, muss der Zeit- und<br />
Ortsstempel des ästhetischen oder ethischen Urteils als notwendige Bedingung<br />
gelingenden Lebens verstanden werden, der »Wirklichkeit(en)« pro<strong>du</strong>ziert. Von<br />
diesem Gedanken aus kann verdeutlicht werden, warum eine empfundene<br />
ethische oder ästhetische Wertigkeit keine Frage subjektiver Geschmackssache<br />
ist, sondern zutreffend erkannter Teil von Wirklichkeit. Eine informierte sinnliche<br />
Erfahrung, die komplexe kulturelle Phänomene <strong>du</strong>rchdringt, wird deshalb<br />
als Ergebnis eines kulturellen Bil<strong>du</strong>ngsprozesses beschrieben, der Deute- und<br />
Zeigebewegungen einübt, bis sich Gedeutetes und Bedeutendes expliziert. Das<br />
10<br />
Psychologen Steven Malloch und Colwyn Trevarthen schreiben z. B. am Ende ihrer<br />
Studie »The neuroscience of emotion in music«: »Musical meaning is eventually embedded<br />
in these cultural creations and the neuro-affective structures of our minds. Any<br />
attempt to understand music in either evolutionary or neurophysiological terms will, of<br />
course, be re<strong>du</strong>ctive approximations and fall short of explaining the wealth of musical sound<br />
constructed in the diverse sociocultural dimensions of aesthetics. If we are to establish a<br />
basic psychobiological knowledge for this difficult field, we must be content, first, with<br />
provisional simplifications of the natural complexities.« Siehe: Panksepp/Trevarthen,<br />
The neuroscience of emotion in music, 133 (Meine Hervorh.). Vgl. zur Diskussion philosophischer<br />
Naturalismen z.B. Tetens, Gott denken, 1. Kapitel.<br />
Vgl. Tetens, Der Naturalismus, 10. Die Ebene der materiellen Prozesse war die, auf der die<br />
beiden Besucher der Stierkampfarena wie auch Bülow und Mahler ohne Frage Einigkeit<br />
erlangen. Ästhetische und ethische Wirklichkeitsbehauptungen müssen auf dieser<br />
Grundlage aber über diese hinaus. Auf der deskriptiv-messbaren Ebene (allein!) wird<br />
weder das Musik-Sein, noch das Grausam-Sein thematisch.
96 <strong>Konstantin</strong> <strong>Funk</strong><br />
verlagert Wert oder Bedeutung von einem sie empfindenden »Innen« in ein<br />
»Außen«, etwa in das vom Musikkritiker geschmähte musikalische Werk selbst.<br />
Ihr ontologischer Anspruch gründet hiernach in der Potentialität, unter bestimmten<br />
Umständen sinnlich entdeckt werden zu können. Das heißt, die<br />
Schönheit der Mahler-Symphonie wäre auch dann der Fall, wenn sie von niemandem<br />
begriffen oder gehört worden wäre, etwa weil Mahler sie nach der erschütternden<br />
Erfahrung mit dem strengen Kritiker in der Schublade beließe. 11<br />
Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich zwei Aufgaben: Erstens sollte<br />
probehalber ein Kulturbegriff vorgestellt werden, der Kultur als Wirkraum von<br />
Ethik und Ästhetik <strong>nicht</strong> als Gegenbegriff zu (statischer) Natur versteht, <strong>nicht</strong><br />
als et<strong>was</strong> dem menschlichen Dasein beliebig Hinzugefügtes, das ein »Eigentliches«<br />
überblendet. Als anthropologische Konstanten werden Ästhetik und Ethik<br />
im Folgenden als Kulturphänomene verstanden, die als Fortsetzung, bzw. Verwirklichung<br />
menschlicher Natur beschrieben werden. Sie sind <strong>nicht</strong> bloß Bestandteile<br />
eines gelingenden Lebens, das dank Kunst undKultur an Qualität und<br />
Muße gewinnt, sondern überlebensnotwendig, worauf etwa der Biologe Andreas<br />
Elepfandt hinweist:<br />
»Während bei Tieren Kulturphänomene als Rand- oder Zusatzleistungen des Lebensbezugs<br />
gefunden wurden, ohne welche die betreffenden Tiere meist auch weiterleben<br />
könnten (<strong>nicht</strong> immer!), ist bei uns Kultur zu unserer zentralen Natur geworden.<br />
VomSäuglingsalter an erleben wir Natur kaum mehr unvermittelt, sondern<br />
in zunehmendem Ausmaß sprachlich und <strong>du</strong>rch das Aufwachsen in kultureller<br />
Umgebung kulturell interpretiert. Ein Zurück zur Natur geht <strong>nicht</strong>. Insofern sind wir<br />
<strong>nicht</strong> nur ganz Tier, sondern eben auch ganz Kulturwesen.« 12<br />
Dieser erste Schritt soll mithilfe von John McDowells neoaristotelischem Vorschlag<br />
geleistet werden, Kultur als zweite Natur zu begreifen. McDowell will unter<br />
Rückgriff auf aristotelische Anleihen an einen vormodernen Naturbegriff erinnern,<br />
der über das präzise Mess- und Beschreibbare hinausdeutet.<br />
11<br />
12<br />
Dass diese Möglichkeit nach sich wiederholenden Zurückweisungen <strong>du</strong>rchaus bestand,<br />
zeigt sich ebenfalls im Briefwechsel mit Richard Strauss. An diesen schreibt Mahler<br />
resigniert: »Meine ›Partituren‹,lieber Freund, bin ich dran in den Pult zu thun. Sie wissen<br />
<strong>nicht</strong>, welche unausgesetzte Zurückweisungen ich mit ihnen erfahre. – Jedesmal zu<br />
<strong>sehe</strong>n, wie die Herren vom Sessel fallen, […] das ist auf die Dauer unerträglich. […] Vor<br />
8Tagen hat Bülow beinahe seinen Geist aufgegeben, während ich ihm daraus vorspielte.<br />
– Sie haben so <strong>was</strong> <strong>nicht</strong> <strong>du</strong>rchgemacht, und können <strong>nicht</strong> begreifen, daß man<br />
anfängt den Glauben daran zu verlieren. Mein Gott! Die Weltgeschichte wird auch ohne<br />
meine Compositionen weitergehen!« Siehe: Blaukopf, Gustav Mahler, Richard Strauss,<br />
Briefwechsel 1888–1911, 16.<br />
Elepfandt, Ganz Tier und ganz Kulturwesen, 58 (Meine Hervorh.).
Gedruckt mit der freundlichen Unterstützung der Evangelischen Landeskirche<br />
in Baden, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Kulturhermeneutischen<br />
Sozietät e.V.<br />
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der<br />
Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten<br />
sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.<br />
© 2024 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig<br />
Printed in Germany<br />
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.<br />
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne<br />
Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für<br />
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung<br />
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Das Buch wurde auf alterungsbeständigem Papier gedruckt.<br />
Cover: Friedrich Lux, Halle (Saale)<br />
Satz: 3w+p, Rimpar<br />
Druck und Binden: BELTZ Grafische Betriebe, Bad Langensalza<br />
ISBN 978-3-374-07481-5 eISBN (PDF) 978-3-374-07482-2<br />
www.eva-leipzig.de