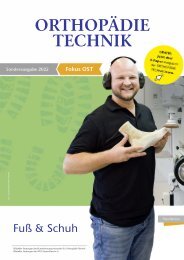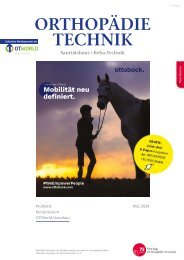Aktuelle Sonderausgabe
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Die Fachzeitschrift ORTHOPÄDIE TECHNIK ist die maßgebliche Publikation für das OT-Handwerk und ein wichtiger Kompass für die gesamte Hilfsmittelbranche.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ORTHOPÄDIE<br />
TECHNIK<br />
Sanitätshaus<br />
<strong>Sonderausgabe</strong> 2024<br />
AktiVen ® Intense<br />
Medizinische Kompressionsstrümpfe<br />
Neu: BORT AktiVen® Intense<br />
Kompressionsversorgungen<br />
für die Therapie von Lip- und<br />
Lymphödemen.<br />
Jetzt vormerken:<br />
Besuchen Sie uns auf der<br />
OT World:<br />
Halle 1, C22 / D21<br />
OTWorld-Workshops:<br />
Praxisnaher<br />
Erfahrungsaustausch<br />
Brustversorgung:<br />
Beratung mit Empathie<br />
und Expertise<br />
Ladenbau und -gestaltung:<br />
Wie der Einkauf zum<br />
Erlebnis wird<br />
Peer-Review<br />
Offizielles Fachorgan des Bundesinnungsverbandes für Orthopädie-Technik<br />
Offizielles Fachorgan der ISPO Deutschland e. V.
BIV Café<br />
Kaffee und Faktensnacks<br />
im BIV Café auf der<br />
OTWorld<br />
Genießen<br />
und informieren<br />
in Halle 3<br />
Stand D20/E21<br />
Wir laden ein zu Kaffeegenuss<br />
und Informationshäppchen,<br />
präsentiert von den Experten<br />
des deutschen Spitzenverbandes<br />
der Orthopädie-Technik,<br />
die über die heißen<br />
Themen der<br />
Branche<br />
berichten.<br />
Telematik<br />
Kalkulationsdatenbank<br />
E-Verordnung<br />
Hilfsmittelreform<br />
Zulassung<br />
Online-Versorgung<br />
Präqualifizierung Hilfsmittelverzeichnis<br />
Absetzung vermeiden<br />
Digitalisierung<br />
Herzlich willkommen im BIV Café<br />
auf der OTWorld 2024.
Editorial<br />
Mit Herz und Verstand<br />
Für einen ersten Eindruck braucht es nur eine Zehntelsekunde.<br />
Zu wenig Zeit, um mit handwerklichen Fähigkeiten<br />
oder Fachwissen überzeugen zu können. Aber<br />
genug Zeit, um die Wohlfühlatmosphäre beim Betreten<br />
des Geschäfts wahrzunehmen oder das freundliche Lächeln<br />
der Mitarbeiter:innen am Empfang. Mehr und<br />
mehr Sanitätshäusern werden diese Mechanismen heutzutage<br />
bewusst. Sie trennen sich von ihrem angestaubten<br />
Image und hauchen den Räumlichkeiten neues Leben<br />
ein. Und: Sie investieren in das Gesicht ihres Betriebs –<br />
in die Fortbildung ihrer Fachkräfte. Dazu gehören in den<br />
Werkstätten die Techniker:innen und im Verkaufsraum<br />
die Sanitätshausfachangestellten.<br />
Auch die OTWorld hat diese Zielgruppe für sich erkannt<br />
und bietet innerhalb des Kongressprogramms<br />
2024 erstmals Workshops an, die sich speziell an die<br />
Mitarbeiter:innen im Sanitätshaus richten. Für alle relevanten<br />
Berufsgruppen in der Branche ist damit ein Programm<br />
konzipiert worden, das aus dem Versorgungsalltag<br />
heraus entstanden ist und praxisnah umgesetzt<br />
wird. Petra Menkel, Vorstandsmitglied des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik (BIV-OT), und<br />
Prof. Dr. Gerd Lulay, Chefarzt der Chirurgischen Klinik II<br />
am Klinikum Rheine, haben als Chairs sieben verschiedene<br />
Workshops erarbeitet und Referent:innen mit hoher<br />
Fachexpertise im Gepäck. Einen Einblick in das, was<br />
die Teilnehmenden erwartet, geben die beiden ab Seite<br />
6. Auf den folgenden Seiten haben wir zudem eine<br />
Übersicht mit allen Workshops zusammengestellt. Wir<br />
hoffen, diese bietet Ihnen eine gute Orientierungs- und<br />
Entscheidungshilfe. Über ein sehr sensibles (Workshop-)<br />
Thema, das neben viel Fachwissen vor allem auch Empathie<br />
benötigt, haben wir mit Petra Menkel ausführlicher<br />
gesprochen. Lesen Sie im Interview ab Seite 10, welche<br />
Herausforderungen die Brustversorgung an das Versorgerteam<br />
stellt.<br />
Eine Frau, die ebenfalls weiß, worauf es dabei ankommt,<br />
ist Anke Prüstel. Und das aus gleich zwei Perspektiven.<br />
In Berlin hatte sie ein auf Brustversorgung<br />
spezialisiertes Geschäft. Vor einigen Jahren erhielt sie<br />
selbst die Diagnose Brustkrebs. Im Gespräch mit der OT-<br />
Redaktion (ab Seite 12) erläutert Prüstel, welche Voraussetzungen<br />
ein Sanitätshaus erfüllen muss, damit sich<br />
Brustkrebspatientinnen wohl fühlen, und warum man in<br />
diesem Beruf in mehrere Rollen schlüpfen muss – in die<br />
als Psycholog:in, Krankenpfleger:in und Modeberater:in.<br />
Wohlfühlen ist auch ein wichtiges Stichwort für Ladenbauer<br />
Christoph Hafemeister und Raumplanerin Elke<br />
Park. Die beiden unterstützen Sanitätshäuser dabei, einen<br />
Ort zu erschaffen, in dem sich die Kund:innen gut aufgehoben<br />
fühlen und in dem zugleich auch die Kompetenzen<br />
des Hauses nach außen sichtbar werden. Welche gestalterischen<br />
Elemente können genutzt werden? Wie steht es um<br />
das Thema Digitalisierung? Und in welche Fallen können<br />
Inhaber:innen bei der Umgestaltung tappen? Antworten<br />
auf diese und weitere Fragen geben Christoph Hafemeister<br />
ab Seite 38 und Elke Park ab Seite 40.<br />
Gute Gesprächsführung ist eine Kunst – und die will<br />
gelernt sein. Denn so schön es auch wäre: Nicht immer<br />
sind die Kund:innen zufrieden oder sprechen dieselbe<br />
Sprache wie die Mitarbeiter:innen. Was also tun, wenn<br />
ein Gespräch zu scheitern droht, der Kunde oder die Kundin<br />
womöglich frustriert von dannen zieht? Coach Michael<br />
Gischnewski weiß Rat und verrät, wie erfolgreiche<br />
Gesprächsführung gelingen kann. Ab Seite 15 öffnet er<br />
seinen Werkzeugkoffer.<br />
Mit Herz und Verstand – wer die vorliegende <strong>Sonderausgabe</strong><br />
liest, wird feststellen, dass es genau das ist, was<br />
es für die Arbeit im Sanitätshaus braucht. Das klingt<br />
vielleicht etwas kitschig oder wie der Titel einer altbackenen<br />
Frauenzeitschrift auf dem Tisch eines Wartezimmers,<br />
macht es aber nicht weniger wahr. Außen und<br />
Innen(einrichtung) müssen gemeinsam überzeugen.<br />
Und das ab der ersten Zehntelsekunde. Die Sanitätshausfachangestellten<br />
sind die ersten, auf die die Kund:innen<br />
treffen, wenn sich die Ladentür öffnet. Und die letzten,<br />
wenn sich die Tür wieder schließt. Was bleibt, ist der erste<br />
Eindruck – und ein Abschied mit hoffentlich baldigem<br />
Wiedersehen.<br />
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!<br />
Pia Engelbrecht,<br />
Redakteurin<br />
Foto: BIV-OT/Engelbrecht<br />
Offizielles Fachorgan des Bundesinnungs -<br />
verbandes für Orthopädie-Technik<br />
Offizielles Fachorgan der ISPO<br />
Deutschland e. V. 3
Inhalt<br />
Editorial<br />
3 Mit Herz und Verstand<br />
40<br />
OTWorld<br />
6 Workshops bieten Raum für offenen Erfahrungsaustausch<br />
8 Sanitätshausfachangestellte im Fokus: Workshops auf der OTWorld<br />
10 Beratung erfordert hohes Maß an Empathie<br />
Interview mit Petra Menkel<br />
10<br />
38<br />
Brustversorgung<br />
12 Diagnose Brustkrebs – und dann?<br />
Interview mit Anke Prüstel<br />
Beratung und Verkauf<br />
15 Das Leid mit der Verständigung<br />
Interview mit Michael Gischnewski<br />
Fachartikel<br />
Kompression<br />
18 Therapie mittels IPK plus definierte Polsterungen (IPK+) bei<br />
posttraumatischen bzw. postoperativen Ödemen unter Berücksichtigung<br />
der biochemischen und biophysikalischen Eigenschaften<br />
M. Morand<br />
26 Anwendung von Kompression gegen Müdigkeit, Übelkeit und<br />
Erbrechen in der Frühschwangerschaft<br />
E. Mendoza<br />
32 Selbstmanagement in der Lymphologie<br />
H. Schulze<br />
Ladenbau und -gestaltung<br />
38 Was Sanitätshäuser für einen modernen Auftritt beachten müssen<br />
Interview mit Christoph Hafemeister<br />
40 Kompetenzen sichtbar machen<br />
Interview mit Elke Park<br />
42 Abstracts<br />
FOLGEN SIE UNS<br />
AUCH AUF:<br />
8
NFC TECHNIK<br />
DIGITAL SIGNAGE<br />
KOMPRESSION<br />
GANGANALYSE<br />
FUßSCANNER<br />
EINLAGEN<br />
ROLLATOREN<br />
HALLE 3, STAND B10<br />
STOREDESIGN & NETZWERKPARTNER LIVE ERLEBEN! WIR FREUEN UNS!<br />
ORTHOPÄDIE I REHA I PHYSIO I ARZTPRAXEN I SANITÄTSHÄUSER<br />
FULL-SERVICE LADENBAU<br />
IMPRESSUM<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK:<br />
Offizielles Fachorgan des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik und<br />
des ISPO Deutschland e. V.<br />
ISSN 0340-5591<br />
Herausgeber:<br />
Bundesinnungsverband<br />
für Orthopädie-Technik<br />
Postfach 10 06 51, 44006 Dortmund<br />
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund<br />
Phone +49 231 55 70 50-0, Fax -40<br />
www.biv-ot.org<br />
Geschäftsführung: Georg Blome<br />
Verleger:<br />
Verlag Orthopädie-Technik<br />
Postfach 10 06 51, 44006 Dortmund<br />
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund<br />
Phone +49 231 55 70 50-50, Fax -70<br />
info@biv-ot.org, www.360-ot.de<br />
Verlagsleitung:<br />
Susanne Böttcher,<br />
Michael Blatt (Programmleitung; V. i. S. d. P.)<br />
Redaktion:<br />
Pia Engelbrecht (Leitung), Anja Knies,<br />
Brigitte Siegmund<br />
Gestaltung:<br />
Miriam Klobes, Marcus Linnartz<br />
Druckvorstufe/Druck:<br />
Silber Druck oHG<br />
Otto-Hahn-Straße 25<br />
D - 34253 Lohfelden<br />
www.silberdruck.de
OTWorld<br />
Atmosphäre wie im Sanitätshaus – Workshops<br />
bieten Raum für offenen Erfahrungsaustausch<br />
Theorie ist gut – und mit zusätzlicher Praxis noch besser. Das<br />
gilt nicht nur in der Werkstatt, sondern auch im Sanitätshaus.<br />
Täglich treffen die Fachangestellten auf Kund:innen<br />
mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen. Und<br />
die gilt es bestmöglich zu erfüllen. Wie das gelingen kann,<br />
möchte die OTWorld aufzeigen. 2024 richten sich erstmals<br />
Workshops gezielt an Sanitätshausfachangestellte.<br />
Nach der vergangenen Ausgabe im Jahr 2022 haben sich<br />
die Initiatoren auf die Fahne geschrieben, die OTWorld<br />
künftig noch praxisorientierter zu gestalten. Der Grund:<br />
Eine von den Veranstaltern durchgeführte Branchenumfrage<br />
zeigt, dass Grundlagenwissen und Praxisinformationen<br />
zu den gefragtesten Inhalten des Weltkongresses<br />
zählen. Das ist in das Konzept 2024 eingeflossen. „Diese<br />
Workshops sind in der Planung und Durchführung natürlich<br />
sehr aufwendig und werden in der Regel auf Kongressen<br />
weniger angeboten, aber wir haben uns entschieden,<br />
dass gerade dieser Erfahrungsaustausch einen entscheidenden<br />
Unterschied macht“, betont Antje Feldmann, Projektleiterin<br />
der für die Kongressorganisation zuständigen<br />
Confairmed GmbH. Und: Die Workshops haben ab diesem<br />
Jahr ein neues Zuhause: Erstmals sind sie unter dem Dach<br />
des Weltkongresses vereint.<br />
In den knapp 30 Workshops bekommen Besucher:innen<br />
aus Handwerk, Medizin, Therapie und Sanitätshaus die Gelegenheit,<br />
vom Wissen der Referent:innen zu profitieren,<br />
selbst Hand anzulegen und diese Erfahrungen in ihren<br />
Berufsalltag zu integrieren. Für die Programmgestaltung<br />
zeichnet das Workshopkomitee verantwortlich, bestehend<br />
aus Vertreter:innen der Orthopädie-Technik und Orthopädie-Schuhtechnik,<br />
der Medizin und des Sanitätsfachhandels.<br />
Seit März 2023 trafen sich die Mitglieder regelmäßig<br />
und tauschten sich aus, um Workshops zu den verschiedensten<br />
Themen und mit namenhaften Expert:innen auf<br />
die Beine zu stellen. Diese Verbindung der Professionen<br />
macht das Programm zu dem, was es ist: vielfältig, aktuell<br />
und nah am Versorgungsalltag.<br />
Fortbildung für alle Berufsgruppen<br />
Für die Sanitätshausfachangestellten gibt es sieben thematisch<br />
unterschiedliche Workshops, die das breite Spektrum<br />
der Versorgung aufzeigen. Schwerpunkte bilden die<br />
Themen Brustversorgung, Schlaganfall, Lymphödem und<br />
die Abgrenzung zwischen konfektionierter Versorgung<br />
und Maßanfertigung. „In einem eigenen Raum schaffen<br />
wir die Atmosphäre wie in einem Sanitätshaus. Hier steht<br />
das gesamte Sortiment der Hilfsmittel bereit, das dann in<br />
der Sanitätshaus-Kulisse für die Demonstration der Versorgung<br />
an den Patient:innen in die Hand genommen werden<br />
kann“, berichtet Feldmann.<br />
Die Mitarbeiter:innen im Sanitätshaus haben bei vielen<br />
Versorgungen den ersten Kontakt zu den Patient:innen,<br />
wenn diese mit einer Verordnung das Geschäft betreten.<br />
„Eine gute Fortbildung ist bei ihnen daher ebenso unerlässlich<br />
wie bei Gesell:innen und Meister:innen“, betont<br />
Feldmann. Die Erweiterung des Kongressprogramms um<br />
spezielle Workshops für Sanitätshausfachangestellte sei<br />
eine logische Folge dieser Branchenentwicklung, die schon<br />
sehr lange von einem starken Fachkräftemangel geprägt<br />
ist. „In Leipzig sollen alle Berufsgruppen der Hilfsmittelversorgung<br />
Erkenntnisse für den beruflichen Alltag gewinnen,<br />
aber auch Motivation und Tatendrang für die Umsetzung<br />
erhalten. Schließlich sichert eine zielgerichtete Fortbildung<br />
die Versorgungsqualität und sorgt ganz nebenbei<br />
für zufriedene Mitarbeitende.“<br />
Interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
Nie müde wird die Branche zu betonen, dass interdisziplinäre<br />
Zusammenarbeit für eine erfolgreiche Versorgung<br />
von Nöten ist. Aus diesem Grund sind bei den Workshops<br />
Expert:innen aus Medizin, Technik, Physiotherapie und<br />
Fachhandel vor Ort, die ihr Wissen vereinen und aufzeigen,<br />
wie das Ineinandergreifen der Professionen aussehen kann<br />
und sollte. Fragen und Diskussionen sind bei diesem Format<br />
nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. „Zur OTWorld<br />
schaffen wir im Workshop – ähnlich wie im Beratungszimmer<br />
im Sanitätshaus – einen Raum für einen offenen Erfahrungsaustausch“,<br />
betont Petra Menkel, Geschäftsführerin<br />
und Bandagistenmeisterin der Paul Schulze Orthopädie &<br />
Bandagen GmbH sowie Vorstandsmitglied des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik (BIV-OT), die als<br />
Chair dreier Workshops fungiert. „Hier können und sollen<br />
die Teilnehmenden auch über Versorgungen sprechen,<br />
die nicht so optimal gelaufen sind. Insbesondere von diesen<br />
Fällen können wir am meisten lernen.“ Und nicht nur<br />
fachliches Wissen ist im Alltag der Sanitätshausfachange-<br />
6<br />
Sanitätshaus 2024
OTWorld<br />
Foto: Lulay<br />
Prof. Dr. Gerd Lulay,<br />
Klinikum Rheine, widmet<br />
sich als Chair von vier<br />
Workshops dem Thema<br />
Lymph versorgung.<br />
Foto: BIV-OT / Ebbert<br />
Antje Feldmann, Projektleiterin<br />
der Confairmed<br />
GmbH, freut sich, bei der<br />
OTWorld 2024 ein<br />
Programm für alle Berufsgruppen<br />
der Hilfsmittelversorgung,<br />
inklusive der<br />
Sanitätshausfachangestellten,<br />
anbieten zu<br />
können.<br />
stellten gefragt. Ebenso kommt es auf den richtigen Umgang<br />
mit den Patient:innen an. „Jede Patientin ist anders<br />
und geht auch anders mit ihrer Erkrankung um. Hier ist ein<br />
hohes Maß an Empathie unserer Mitarbeitenden gefragt“,<br />
findet Menkel, insbesondere mit Blick auf den Workshop<br />
rund ums Thema Brustversorgung.<br />
Was genau geht im Körper vor sich? Warum zählt jede<br />
Minute? Antworten auf diese und weitere Fragen geben die<br />
Referent:innen in ihren Vorträgen zum Thema Schlaganfall.<br />
Zudem lernen die Teilnehmer:innen die wichtigsten<br />
Hilfsmittel kennen, die einige Folgen des Schlaganfalls abmildern.<br />
Bei einem weiteren Workshop werden anhand<br />
von Fallbeispielen die Möglichkeiten und Grenzen einer<br />
konfektionierten Versorgung aufgezeigt.<br />
Fokus Lymphversorgung<br />
Prof. Dr. med. Gerd Lulay, Chefarzt der Chirurgischen Klinik<br />
II: Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Klinikum<br />
Rheine, hat für die OTWorld vier Workshops konzipiert,<br />
die die wichtigsten Fragestellungen und Herausforderungen<br />
im Bereich der Lymphversorgung abbilden. Während<br />
ein Workshop die Besonderheiten bei der Behandlung des<br />
sekundären Lymphödems – genauer gesagt des onkologischen<br />
tumor-assoziierten Lymphödems – in den Blick<br />
nimmt, widmet sich ein weiterer der Versorgung des primären,<br />
also angeborenen Lymphödems. Offene Beine<br />
und Wundrosen sind Gegenstand des dritten Workshops.<br />
„Noch werden diese nur in der Phlebologie verortet, dabei<br />
muss es das zunehmend auch in der Lymphologie“, findet<br />
Lulay. „Wenn die beiden Fachgesellschaften schon zusammengewachsen<br />
sind, so müssen die Krankheitsentitäten<br />
auch zusammengefasst und differentialdiagnostisch voneinander<br />
getrennt abgebildet werden.“<br />
Der vierte Workshop greift den Zusammenhang von<br />
Adipositas und Lymphödemen auf. „Das ist ein riesiges Thema,<br />
das uns demnächst erschlagen wird, wenn wir keine<br />
Konzepte entwickeln, wie wir dieser Zivilisationskrankheit<br />
Herr werden können“, betont Lulay. „Bis vor ein paar Jahren<br />
war das Thema noch nicht en vogue. Jetzt müssen wir<br />
es in den Fokus nehmen und uns positionieren.“ Sowohl<br />
für Ernährungsberater:innen als auch für Internist:innen,<br />
die sich mit den Komorbiditäten auseinandersetzen müssen,<br />
sowie für Orthopäd:innen und Lympholog:innen<br />
werde die Adipositas mehr und mehr zur Herausforderung.<br />
Und auch für die Mitarbeiter:innen im Sanitätshaus.<br />
„Adipositas stellt besondere Anforderungen an das<br />
Personal“, sagt Lulay. Die Kompressionsstrümpfe müssen<br />
immensen Druck aushalten, dadurch seien allein schon<br />
die Materialien zunehmend gefordert. Die Bestrumpfung<br />
selbst stelle dann oftmals ein „halbes Kunstwerk“ für die<br />
Mitarbeiter:innen dar. „Es wird sich ein großer Markt eröffnen.<br />
Wobei ich diesen Ausdruck ungern benutze, denn<br />
auf diesen Markt kann man wirklich verzichten.“ Am Rande<br />
und im Vergleich zum Lymphödem wird im Workshop<br />
auch das Thema Lipödem gestreift – insbesondere die Abgrenzung<br />
bei der Diagnose.<br />
Interdisziplinäre Zusammenarbeit erachtet Lulay als<br />
dringend notwendig in der Behandlung und blickt daher<br />
wehmütig auf die Jahre zurück, als genau diese innerhalb<br />
seiner Lymphklinik in Ochtrup gelebt wurde. Und nicht<br />
nur das: „In den zwölf Jahren, in denen wir die Klinik betrieben<br />
haben, mussten wir feststellen, dass sich überall in<br />
Deutschland Netzwerke bildeten, die Therapeuten, Ärzte<br />
und Sanitätshäuser zusammengefasst haben“, berichtet<br />
Lulay. Der Vorteil: Die Wege waren kürzer, die Ziele konnten<br />
gemeinsam definiert und die Behandlungspfade besser<br />
eingehalten werden. „Denn wenn die einzelnen Player<br />
nicht ausreichend miteinander kommunizieren, ist die<br />
Gefahr groß, dass in der Folge Behandlungskonzepte unzureichend<br />
oder falsch durchgeführt werden“, so der Mediziner.<br />
Heutzutage seien solche Lymph-Netzwerke nur noch<br />
vereinzelt in Deutschland zu finden. „Die Krankenkassen<br />
haben es hinbekommen, die Strukturen im Keim zu ersticken“,<br />
erklärt Lulay, mit der Folge, dass in Deutschland eine<br />
Versorgungslücke entstanden sei. „Umso wichtiger ist eine<br />
Messe wie die OTWorld, die diese Situation in das Bewusstsein<br />
aller Beteiligten rückt.“<br />
Take-Home-Message zur<br />
Vor- und Nachbereitung<br />
Zu jedem Workshop haben die Referent:innen eine Take-<br />
Home-Message verfasst – eine Neuerung bei der OTWorld<br />
2024. Das soll einerseits eine Entscheidungshilfe bei der<br />
Vorbereitung bieten und andererseits dabei unterstützen,<br />
im Nachgang die Essenz des Gelernten im Kopf zu<br />
verankern und mit nach Hause zu nehmen.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
7
OTWorld<br />
Sanitätshausfachangestellte im Fokus:<br />
Workshops auf der<br />
Während der OTWorld 2024 haben Sanitätshausfachangestellte<br />
an allen Tagen die Möglichkeit, sich praxisnah<br />
weiterzubilden. Sieben verschiedene Workshops bilden<br />
das breite Spektrum der Versorgungsmöglichkeiten im<br />
Sanitätshaus ab. Besonderes Augenmerk liegt auf der<br />
lymphologischen Versorgung. In Kooperation mit der<br />
Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie<br />
(DGPL) werden täglich zwei Workshops angeboten,<br />
die sich mit der leitliniengerechten Versorgung im Team<br />
mit Ärzt:innen und Therapeut:innen beschäftigen. Drei<br />
weitere Workshops widmen sich den Themen Brustprothetik,<br />
Maßanfertigung und Schlaganfall. Auf einen Blick<br />
finden Sie hier das Programm.<br />
Onkologische tumor-assoziierte<br />
Lymp hödeme mit Beteiligung der<br />
unteren Extremitäten<br />
Chair: Prof. Dr. Gerd Lulay<br />
Diagnose Lymphödem – Welche Verfahren werden<br />
in der Medizin eingesetzt? Was sind mögliche<br />
Differenzialdiagnosen?<br />
Referent: Peter Nolte<br />
Die Grundzüge der manuellen Lymphdrainage bei<br />
Lymphödemen. Vorstellung und Durchführung von<br />
physiotherapeutischen Maßnahmen am Patienten<br />
Referent: Henry Schulze<br />
Wirkungsvolle und qualifizierte orthopädietechnische<br />
Kompressionsversorgung – Beratung und<br />
Behandlungs empfehlung, Ausmessen, Kompressionsdruck<br />
und -materialien, Zusatzprodukte, Tipps und<br />
Tricks<br />
Referent:innen: Petra Menkel / Stephan Klör<br />
Datum: 14.05.2024, 10:30 bis 11:30 Uhr<br />
15.05.2024, 15:15 bis 16:15 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Adipositas und Lymphödem<br />
Chair: Prof. Dr. Gerd Lulay<br />
Diagnose Lymphödem – Welche Verfahren werden<br />
in der Medizin eingesetzt? Was sind mögliche<br />
Differenzialdiagnosen?<br />
Referentin: Dr. med. Gabriele Färber<br />
Die Grundzüge der manuellen Lymphdrainage bei<br />
Lymphödemen. Vorstellung und Durchführung von<br />
physiotherapeutischen Maßnahmen am Patienten<br />
Referent: Henry Schulze<br />
Wirkungsvolle und qualifizierte orthopädietechnische<br />
Kompressionsversorgung – Beratung und Behandlungsempfehlung,<br />
Ausmessen, Kompressionsdruck und<br />
-materialien, Zusatzprodukte, Tipps und Tricks<br />
Referent:innen: Petra Menkel / Stephan Klör<br />
Datum: 14.05.2024, 13:15 bis 14:15 Uhr<br />
15.05.2024, 10:30 bis 11:30 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Wenn einen der Schlag trifft – Eine Einführung<br />
in das Krankheitsbild, physiotherapeutische<br />
Frühbehandlung und die orthopädietechnische<br />
Versorgung der Folgen<br />
Chair: Petra Menkel<br />
Medizinische Einführung in das Thema<br />
Referent: Dr. Rupert Sandbrink<br />
Physiotherapeutische Frührehabilitation bei<br />
Schlaganfall-Patienten<br />
Referentin: Fabienne Grugel<br />
Anwendung in der Praxis: Welche Hilfsmittel gibt es?<br />
Wo liegen ihre Grenzen? Was ist die Maximalversorgung?<br />
Referentin: Fabienne Grugel<br />
Datum: 15.05.2024, 14 bis 15 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
8<br />
Illustration: freepik /<br />
vectorjuice<br />
Hier geht es zum Ticket-Shop:<br />
www.ot-world.com/de/tickets-preise<br />
Sanitätshaus 2024
OTWorld<br />
Brustprothesen im Spannungsfeld<br />
zwischen Diagnose Krebs, Kostendruck und<br />
psychischer Belastung aller Beteiligten<br />
Chair: Petra Menkel<br />
Lymphödem und Ulcera crurum –<br />
offene Beine und Wundrosen<br />
Chair: Prof. Dr. Gerd Lulay<br />
Medizinische Einführung in das Thema:<br />
Fakten zum Brustkrebs, aktuelle OP-Methoden<br />
Referent:in: N.N.<br />
Welche Hersteller gibt es? Wo liegen die<br />
Unterschiede? Wo sind die Grenzen einer vorgefertigten<br />
prothetischen Versorgung? Ab wann müssen<br />
Maßprothesen hergestellt werden?<br />
Referentin: Kristina Böhm<br />
Psychoonkologischer Einblick in beide Seiten der<br />
Versorgung: Patientin und Sanitätshausangestellte<br />
Referent:in: N.N.<br />
Datum: 16.05.2024, 9:15 bis 10:15 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Primäres Lymphödem<br />
Chair: Prof. Dr. Gerd Lulay<br />
Diagnose Lymphödem – Welche Verfahren<br />
werden in der Medizin eingesetzt? Was sind mögliche<br />
Differenzialdiagnosen?<br />
Referentin: Dr. med. Erika Mendoza<br />
Die Grundzüge der manuellen Lymphdrainage<br />
bei Lymphödemen. Vorstellung und Durchführung<br />
von physiotherapeutischen Maßnahmen am<br />
Patienten<br />
Referent: Henry Schulze<br />
Wirkungsvolle und qualifizierte orthopädietechnische<br />
Kompressionsversorgung – Beratung<br />
und Behandlungsempfehlung, Ausmessen,<br />
Kompressionsdruck und -materialien, Zusatzprodukte,<br />
Tipps und Tricks<br />
Referent:innen: Stephan Klör / Petra Menkel<br />
Datum: 16.05.2024, 13:30 bis 14:30 Uhr<br />
17.05.2024, 10:30 bis 11:30 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Diagnose Lymphödem – Welche Verfahren werden in<br />
der Medizin eingesetzt? Was sind mögliche Differenzialdiagnosen?<br />
Referent: Dr. Dr. René Hägerling<br />
Die Grundzüge der manuellen Lymphdrainage bei<br />
Lymphödemen. Vorstellung und Durchführung von<br />
physiotherapeutischen Maßnahmen am Patienten<br />
Referent: Henry Schulze<br />
Wirkungsvolle und qualifizierte orthopädietechnische<br />
Kompressionsversorgung – Beratung und Behandlungsempfehlung,<br />
Ausmessen, Kompressionsdruck und -materialien,<br />
Zusatzprodukte, Tipps und Tricks<br />
Referent:innen: Stephan Klör / Petra Menkel<br />
Datum: 16.05.2024, 10:30 bis 11:30 Uhr<br />
17.05.2024, 12 bis 13 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Wie erkenne ich die Grenzen<br />
einer Versorgung mit konfektionierten<br />
Orthesen und ab wann geht nur noch<br />
Maßanfertigung?<br />
Chair: Petra Menkel<br />
Vorgefertigte Orthopädie-Technik: Grenzen und<br />
Möglichkeiten<br />
Referent: Stephan Schildhauer<br />
Fallbeispiel: Versorgung eines Patienten mit<br />
Multipler Sklerose<br />
Referent:innen: Stephan Schildhauer / Annette Küntzel<br />
Datum: 17.05.2024, 9:15 bis 10:15 Uhr<br />
Ort: Saal 5<br />
Sanitätshaus 2024<br />
9
OTWorld<br />
Beratung erfordert hohes Maß an Empathie<br />
Foto: BIV-OT<br />
Sanitätshausfachangestellte werden bei der OTWorld<br />
2024 erstmals gesondert angesprochen – und zwar mit<br />
eigens für diese Zielgruppe konzipierten Workshops.<br />
Petra Menkel, Geschäftsführerin und Bandagistenmeisterin<br />
der Paul Schulze Orthopädie & Bandagen GmbH<br />
und Mitglied im Vorstand des Bundesinnungsverbandes<br />
für Orthopädie-Technik (BIV-OT), wird sich in einem dieser<br />
Workshops u. a. dem Thema Brustversorgung widmen.<br />
Im Gespräch mit der OT-Redaktion verrät sie, was<br />
die Teilnehmenden erwartet und warum dieses Thema<br />
– auch für sie persönlich – Aufmerksamkeit verdient.<br />
OT: Sie bieten bei der OTWorld einen Workshop zum Thema<br />
Brustversorgung explizit für Sanitätshausfachangestellte an.<br />
Warum ist Ihnen das Thema ein besonderes Anliegen?<br />
Petra Menkel: Als Frau lebe ich in dem Bewusstsein, dass die<br />
Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, bei 1 zu 8<br />
liegt. Das heißt, jede achte Frau bekommt im Laufe ihres<br />
Lebens Brustkrebs. Wenn ich nur in unsere Firma schaue,<br />
bedeutet das, dass zwei Kolleginnen erkranken. Erweitert<br />
man den Kreis auf Freunde und Bekannte, dann kennt jeder<br />
jemanden mit dieser Diagnose. Auch ich könnte dazu<br />
gehören. Deshalb betrifft mich dieses Thema selbst ganz<br />
direkt. Daher ist es mir wichtig, im Workshop die Sensibilität<br />
nicht nur für unsere Kundinnen, sondern auch für<br />
uns selbst zu entwickeln und eine Lanze für die Vorsorge<br />
zu brechen. Wird ein Brustkrebs im Stadium I entdeckt,<br />
liegt die Heilungsquote statistisch bei 100 Prozent. Das<br />
sollte doch jede Frau zur Selbstvorsorge treiben. Auf der<br />
OTWorld sprechen wir aber gezielt Sanitätshausfachangestellte<br />
an, weil die betroffenen Frauen in der Regel für<br />
eine fachgerechte Beratung in ein Sanitätshaus gehen und<br />
dort auf die Sanitätshausfachangestellten treffen. Die Kolleginnen<br />
aus der Werkstatt sind ja bei der Beratung nach<br />
einer Brust-Operation seltener involviert. Im Gegensatz<br />
zu den vielen Weiterbildungsmöglichkeiten einzelner<br />
Hersteller möchten wir in Leipzig firmenübergreifend informieren.<br />
So können wir uns ganz auf die Notwendigkeiten<br />
des Versorgungsalltags jenseits eines besonderen<br />
Produkts konzentrieren. Denn ein Problem hat viele Lösungswege<br />
und diese wollen wir aufzeigen. Wir wollen<br />
aber auch für mehr Aufmerksamkeit für diesen wichtigen<br />
Bereich sorgen.<br />
OT: In Deutschland erhalten jedes Jahr 69.000 Frauen die<br />
Diagnose Brustkrebs, von denen 27 Prozent eine Mastektomie<br />
benötigen. Im Sanitätshaus ist die Versorgung also Alltag – und<br />
dennoch kein alltägliches Thema, oder?<br />
Veranstaltet bei der OTWorld einen<br />
Workshop rund ums Thema Brustversorgung:<br />
Petra Menkel.<br />
Menkel: Die Mastektomie ist auf dem Rückzug. Es wird immer<br />
mehr brusterhaltend operiert. Das ist auf der einen Seite<br />
für die Betroffenen tröstlicher, weil noch ein Stück ihres<br />
eigenen Gewebes erhalten bleibt. Auf der anderen Seite<br />
birgt es viele andere Probleme: ungleich große Seiten, „verrutschtes“<br />
Dekolleté, Narben, Beulen, empfindliche Stellen<br />
– um nur einige Beispiele zu nennen. Wenn die Brust ganz<br />
entfernt wurde, ist die Versorgung einfacher. In dem Fall<br />
ermitteln wir die Größe anhand der erhaltenen Seite, suchen<br />
eine passende Form und den bestsitzenden BH sowie<br />
– wenn möglich – eine Haftepithese aus. Bei einer brusterhaltenden<br />
Versorgung ist der Beratungsaufwand hingegen<br />
deutlich höher. Hier müssen wir, wie gerade gesagt, viel<br />
mehr Faktoren beachten. In jedem Fall beinhaltet die Beratung<br />
auch die Besprechung psychologischer Probleme der<br />
Patientinnen. Auch vor diesem Hintergrund glaube ich,<br />
dass jede Fachkraft, die Brustkrebspatientinnen betreut,<br />
zwar professioneller im Umgang und in der Versorgung<br />
wird, aber Alltag wird es für sie nie.<br />
OT: Essenziell ist bei der Versorgung eine ganzheitliche Betrachtung.<br />
Was genau bedeutet für Sie ganzheitlich?<br />
Menkel: Jede Patientin ist anders und geht auch anders<br />
mit ihrer Erkrankung um. Hier ist ein hohes Maß an Empathie<br />
unserer Mitarbeitenden gefragt. Wo steht die Kundin?<br />
Ist sie schon gut über ihren Arzt informiert, oder hat<br />
Dr. Google die Beratung übernommen? Ist sie über Spätfolgen<br />
wie lymphatische Probleme in Kenntnis gesetzt, oder<br />
sollten wir hier Hinweise geben? Wir müssen zudem rausfinden,<br />
was der Bedarf der Kundin ist. Geht es um einen<br />
kosmetischen Ausgleich oder um Funktionalität? Wird die<br />
Epithese zum Sport oder zum Ausgehen genutzt? Soll die<br />
Epithese dauerhaft getragen werden oder nicht? Fragen<br />
über Fragen, die wir aber oft nicht direkt stellen können.<br />
Daher müssen wir nicht selten zwischen den Zeilen lesen,<br />
um kundenbezogen zu versorgen. Im Workshop legen wir<br />
zudem einen Fokus auf die Selbstfürsorge der Versorgenden,<br />
denn die mentalen Belastungen sind doch sehr groß.<br />
Zumal sie zwischen den Stühlen stehen. Zeit ist Geld und<br />
Regelversorgungen sind nicht immer die beste Lösung.<br />
OT: Im Umgang mit den Kundinnen ist besondere Sensibilität<br />
und Empathie gefragt. Wie spiegelt sich das in der Atmosphäre<br />
und den Inhalten des Workshops wider?<br />
10<br />
Sanitätshaus 2024
OTWorld<br />
Menkel: Zur OTWorld schaffen wir im Workshop – ähnlich<br />
wie im Beratungszimmer im Sanitätshaus – einen Raum für<br />
einen offenen Erfahrungsaustausch. Hier können und sollen<br />
die Teilnehmenden auch über Versorgungen sprechen,<br />
die nicht so optimal gelaufen sind. Insbesondere von diesen<br />
Fällen können wir am meisten lernen.<br />
OT: Ein Workshop verfolgt den Anspruch, praxisnah<br />
gestaltet zu sein. Die Teilnehmer:innen sollen in<br />
Interaktion mit den Patientinnen kommen.<br />
Wie kann das bei einem solch sen siblen Thema wie der<br />
Brustversorgung gelingen?<br />
Menkel: Für den Workshop stehen uns hoch motivierte betroffene<br />
Patientinnen als Models zur Verfügung. Unseren<br />
Models ist es ein Anliegen, über Brustkrebs und die Folgen<br />
zu informieren. Infolgedessen sind sie die Öffentlichkeit<br />
gewohnt und können mit ihnen unbekannten Menschen<br />
offen über ihre Versorgung und ihre Erkrankung sprechen.<br />
Zugleich ist unser Workshop mit einer begrenzten Anzahl<br />
von Teilnehmenden ein geschützter Raum.<br />
OT: Bis zu 20 Prozent aller Frauen entwickeln nach einer Brustkrebsbehandlung<br />
ein Arm-Lymphödem. Welche Rolle kommt<br />
hier im Speziellen der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie<br />
(KPE) zu?<br />
Menkel: Die komplexe Entstauungstherapie ist ein wichtiges<br />
Thema, welches leider von vielen Ärzten nicht<br />
grundsätzlich besprochen wird. Ich würde mir wünschen,<br />
dass es zur Grundberatung eines Arztbesuches gehört,<br />
auf die Möglichkeit der Entwicklung eines Lymphödems<br />
nach Brustoperationen hinzuweisen. Dieses kann<br />
auch Jahre nach der Operation noch auftreten und wird<br />
dann oftmals nicht in Zusammenhang mit der Grunderkrankung<br />
gesetzt. Die Kundinnen kommen dann zu<br />
uns und wissen gar nicht, warum der Arm plötzlich dick<br />
wird. Gemeinsam mit unseren Kollegen aus der Physiotherapie<br />
können wie den Frauen mithilfe der KPE zum<br />
Glück helfen.<br />
OT: Wird dem Thema Brustversorgung bereits in der<br />
Aus bildung genug Aufmerksamkeit geschenkt?<br />
Menkel: Hier ist in jedem Fall noch Luft nach oben. In der<br />
Ausbildung zum Orthopädietechnik-Mechaniker wird das<br />
Thema zwar behandelt, aber nicht sehr tiefgehend. Was die<br />
Sanitätshausfachverkäufer betrifft, sieht es noch düsterer<br />
aus, in der Berufsschule wird das Thema in Berlin zumindest<br />
nur gestreift. Die gesamte fachliche Ausbildung liegt<br />
also im Sanitätshaus, und wenn eine Firma keine Brustprothetik<br />
anbietet, fehlt das Thema völlig. Auch deshalb<br />
wünsche ich mir, dass die Ausbildung zum Fachverkäufer<br />
dem Handwerk angegliedert wird – aber das bleibt wohl ein<br />
Wunsch.<br />
OT: Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kundin, die Sie in<br />
diesem Bereich versorgt haben? Was wissen Sie heute, was Sie<br />
damals schon gern gewusst hätten?<br />
Menkel: Oh je. Meine erste Versorgung in diesem Bereich<br />
war ehrlich gesagt eine „volle Katastrophe“. Damals war<br />
ich noch sehr jung, aber mit viel Enthusiasmus ausgestattet<br />
und im festen Glauben, in meiner Ausbildung richtig<br />
viel gelernt zu haben. Gleichzeitig war meine Kundin psychisch<br />
labil. Kein Wunder, denn die Amputation war bei<br />
ihr sehr radikal mit Narbengewebe bis weit in die Achsel<br />
durchgeführt. Da trafen zwei Menschen aufeinander, die<br />
beide nicht wussten, ob das gut geht. Aber: Wir haben uns<br />
aufeinander eingelassen und die Versorgung ist gut geworden.<br />
Allerdings hätte ich mir eine bessere Vorbereitung<br />
in der Ausbildung auf die psychologischen Fallstricke einer<br />
Brustversorgung gewünscht. Ein unbedachtes Wort<br />
oder ein missverständlicher Blick hätten große emotionale<br />
Wellen schlagen können, mit denen ich damals nicht<br />
hätte umgehen konnen. Hinzu kam, dass ich nur die Epithesen<br />
kannte, die wir in unserer Firma vorrätig hatten.<br />
Wenn man sich einmal für eine Sortimentsauswahl entschieden<br />
hat, verliert man nach einer gewissen Zeit den<br />
Überblick über neue Entwicklungen. Dass jeder Hersteller<br />
aber seine Besonderheiten hat und diese auch weiterentwickelt,<br />
muss man sich immer wieder aktiv vor Augen<br />
führen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es mir<br />
sehr unangenehm war, anzusprechen, dass die Krankenkasse<br />
gemäß Wirtschaftlichkeitsgebot nur die Kosten für<br />
eine ausreichende und zweckmäßige Versorgung erstattet<br />
– es allerdings so viel mehr an höherwertigen Versorgungen<br />
gibt, die die Frauen allerdings aus eigener Tasche<br />
zahlen müssen. Nicht jede Frau kann sich das leisten. Das<br />
war schon schwer. Damals wie heute wäre zum Einstieg in<br />
das Thema eine Brustversorgung gemeinsam mit einer erfahrenden<br />
Kollegin toll. Dann könnten Berufseinsteiger<br />
und eine erfahrene Fachkraft gemeinsam die Versorgung<br />
besprechen. Einsteiger könnten sich etwas vom Verhalten<br />
der Kolleginnen abschauen und dennoch ihren eigenen<br />
Weg ausprobieren.<br />
OT: Zum ersten Mal verfassen die Referent:innen zu jedem<br />
Workshop auf der OTWorld eine „Take-Home-Message“.<br />
Worüber sollten sich Interessierte bereits im Vorfeld Gedanken<br />
machen, um sich proaktiv mit Fragen oder Ideen in den<br />
Workshop einzubringen?<br />
Menkel: Ich würde mich freuen, wenn die Teilnehmenden<br />
von ihren Erfahrungen berichten, schwierige Versorgungen<br />
inklusive Fotos mit in den Workshop bringen und dort<br />
unter anderem erzählen, was bei einzelnen Versorgungen<br />
nicht geklappt hat. Mich interessiert: Wie gehen sie mit<br />
den Emotionen der Kundinnen und mit den eigenen um?<br />
Was tun sie, wenn die Krankenkasse die Versorgung ablehnt?<br />
Wie kriegen sie den Spagat zwischen optimaler Versorgung<br />
und Wirtschaftlichkeit hin? Der Workshop soll<br />
für uns alle eine Chance sein, voneinander und miteinander<br />
zu lernen. Beides gilt übrigens auch für meine anderen<br />
Workshopthemen: Lymphatische Versorgungen, Abgrenzung<br />
Standard- und Maßversorgung sowie Versorgungen<br />
bei Schlaganfall.<br />
Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
11
Brustversorgung<br />
Diagnose Brustkrebs – und dann?<br />
69.000 Frauen erhalten jährlich in Deutschland die Diagnose<br />
Brustkrebs. Das sind so viele Menschen, wie zum<br />
Beispiel Fulda, Landshut oder Tübingen Einwohner:innen<br />
haben. Damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste<br />
Krebserkrankung in der Bundesrepublik. Neben Operationen<br />
und Therapie steht meist auch eine Hilfsmittelversorgung<br />
für die betroffenen Frauen an. Eine Versorgung<br />
mit Brustprothesen bzw. entsprechender Wäsche<br />
steht den Frauen nach PG 37 alle zwei Jahre zu. Neben<br />
der technischen Versorgung besteht bei den Frauen<br />
auch der Wunsch nach einem entsprechenden Versorgungsumfeld,<br />
das ihre spezielle Situation berücksichtigt.<br />
Aus diesem Grund hatte sich Anke Prüstel mit ihrem<br />
Sanitätshaus auf die Versorgung von Brustkrebspatientinnen<br />
spezialisiert. Eine Entscheidung, die aus der<br />
eigenen Erfahrung als Brustkrebsbetroffene resultierte<br />
und aus dem Ansporn, es besser zu machen. Aus privaten<br />
Gründen musste sie ihr Geschäft übergeben, die<br />
Leidenschaft, für die Versorgung von Brustkrebspatientinnen<br />
zu streiten, ist geblieben. Im Gespräch mit der<br />
OT-Redaktion berichtet sie von ihren Erfahrungen, darüber,<br />
was Sanitätshäuser beachten sollten und wo ihr die<br />
Perspektive als Brustkrebspatientin geholfen hat, nicht<br />
nur eine gute Versorgung zu leisten, sondern das Leben<br />
ihrer Kundinnen besser zu machen.<br />
Anke Prüstel hatte in Berlin ein<br />
auf Brustversorgung spezialisiertes<br />
Geschäft. Ihre Erfahrungen<br />
hat sie im Gespräch mit<br />
der OT-Redaktion geteilt.<br />
OT: Frau Prüstel, jedes Jahr erkrankt eine Kleinstadt voller<br />
Frauen an Brustkrebs. Da müsste man davon ausgehen, dass<br />
die Versorgung derer ein Schwerpunkt in jedem Sanitätshaus<br />
ist. Wie sind Ihre Erfahrungen?<br />
Anke Prüstel: Versorgung nach Brustkrebs ist, nach meiner<br />
Erfahrung, bundesweit eher Teil des Vollsortiments.<br />
Es haben sich bei mir Frauen aus nah und fern gemeldet<br />
und sich über mangelnde Auswahl oder das Bestellen aus<br />
Katalogen mit Abnahmepflicht, mangelnde Fachberatung<br />
und leider fehlende Empathie oder zumindest Verständnis,<br />
dass es sich nicht um eine Kniebandage handelt, beklagt.<br />
Außerdem war es für viele Frauen eine große Hürde,<br />
ihr Anliegen in einem mit Kundinnen und Kunden gut besuchten<br />
Sanitätshaus vorzutragen, da die notwendige Diskretion<br />
für diese sensible Versorgung nicht gegeben war.<br />
Es gibt natürlich auch positive Beispiele, bei denen sich ein<br />
Sanitätshaus spezialisiert hat, so wie es bei mir selbst auch<br />
der Fall war.<br />
OT: Sie haben vor mehr als einem Jahrzehnt selbst die Diagnose<br />
Brustkrebs erhalten. Wie haben Sie die Versorgung im Sanitätshaus<br />
erlebt?<br />
Prüstel: Ich habe zu dieser Zeit im Sanitätshaus und auch<br />
viel mit Brustkrebskundinnen gearbeitet, deshalb war ich<br />
schon etwas besser vorbereitet. Allerdings traf es mich<br />
hinterher mit Wucht, dass ich meine so geliebten bunten,<br />
farblich passenden Spitzensets nicht mehr tragen konnte<br />
und dass es nur sehr wenig und für mich als nicht optimal<br />
empfundene Alternativen gab. Ich habe dann angefangen<br />
selbst Dessous und Bademode zu nähen und letztlich<br />
war das auch mein Antrieb zu meinem Geschäft. Mein<br />
erster Armstrumpf war zudem hautfarben, was ich als sehr<br />
furchtbar empfunden habe. Heute trage ich wieder schöne<br />
bunte Wäsche, eine relativ angenehme Teilprothese und<br />
ausschließlich bunte Armstrümpfe. Ich konnte stets mitbestimmen,<br />
das wird vielen Frauen nach der Operation einfach<br />
verwehrt.<br />
Sich in die Rolle der Patientin einfühlen<br />
OT: Welche Voraussetzungen muss man als Sanitätshaus<br />
mindestens schaffen, damit Brustkrebspatientinnen sich wohlfühlen<br />
und auch versorgen lassen?<br />
Foto: Prüstel<br />
Prüstel: Auch da kann ich nur bitten, sich in die Kundinnen<br />
hineinzuversetzen und nachzudenken: Ich muss jetzt<br />
in diesen Laden – da stehen Rollatoren und Bandagen, alles<br />
ist so steril und dann ist da auch noch ein Herr hinter<br />
dem Tresen. Die fast schon logische Konsequenz ist es, dass<br />
sich die Frauen umdrehen und unversorgt das Sanitätshaus<br />
12<br />
Sanitätshaus 2024
Brustversorgung<br />
verlassen. Die Frauen brauchen: Diskretion – also im besten<br />
Fall einen abgetrennten Eingang oder zumindest eine<br />
sichtbare Einladung, dass ich als Frau mit Brustkrebs willkommen<br />
bin, also z. B. durch entsprechende Deko. Zudem<br />
wäre es wichtig, dass sich eine empathische, fachkundige<br />
und geschulte Sanitätshausmitarbeiterin um die Frauen<br />
kümmert und diese in ihrer Situation nicht mit Besserwisserei<br />
belehrt werden. Wichtig sind auch ausreichend Zeit<br />
bei der Beratung und eine wirkliche Auswahl vor Ort. Auch<br />
wenn die passende Größe nicht da ist, nimmt es den Betroffenen<br />
die Angst, die Brustprothesen und die Wäsche in die<br />
Hand zu nehmen. Es reicht nicht nur das Versprechen auf<br />
der Homepage, eine empathische Versorgung zu gewährleisten.<br />
OT: Sind Ihnen Beispiele Ihrer Patientinnen bekannt, die sich<br />
in anderen Sanitätshäusern falsch verstanden oder nicht gut<br />
beraten gefühlt haben und deshalb eher auf eine Versorgung<br />
verzichten würden, statt noch einmal in ein Sanitätshaus zu<br />
gehen?<br />
Prüstel: Leider sehr viele. Ich hatte mir den Ruf bei Ärzten<br />
erarbeitet, eine sehr gute Versorgung anzubieten. Das hatte<br />
zur Folge, dass ich sehr viele Kundinnen hatte, die sich<br />
für eine Erstversorgung zu mir trauten – Jahre nach der<br />
eigentlichen Erkrankung. Es kamen aber auch Kundinnen,<br />
die nach einem einmaligen Schockerlebnis im Sanitätshaus<br />
bei mir nach Jahren wieder eine Versorgung erhalten<br />
haben. Die Gründe dafür habe ich im Prinzip schon genannt:<br />
Katalogbestellung, Wäsche zwischen den anderen<br />
Sanitätshausartikeln, meist in einer Ecke, sowie Mitarbeiterinnen<br />
mit wenig Interesse. Es war für mich immer toll<br />
zu erleben, wie Kundinnen mit ängstlichem Gesicht und<br />
Aura mein Geschäft betreten und mit lächelndem Gesicht<br />
wieder verlassen haben. Durch meinen Onlineshop kamen<br />
solche Kundinnen aus ganz Deutschland.<br />
Eigener Raum für die nötige<br />
Privatsphäre<br />
OT: Nach den Mindestanforderungen haben wir Sie schon<br />
gefragt. Wie sieht es am anderen Ende der Anforderungsskala<br />
aus – sprich: Wie sieht das „optimale“ Sanitätshaus für eine<br />
Versorgung von Brustkrebspatientinnen aus?<br />
Prüstel: Als Grundvoraussetzung gilt ein extra Ladenraum<br />
bzw. Geschäft. Dann kann ich mich nur immer wiederholen:<br />
gut geschulte Mitarbeiterinnen, die Lust auf diese<br />
Arbeit haben und ohne Fingerzeig auf Zeitoptimierung arbeiten<br />
können, weil eine BH-Beratung auch mal eine Stunde<br />
oder länger dauern kann und die Marge dann nicht ausreichend<br />
ist, aber der Mehrwert durch Empfehlung und<br />
zeitlich schnellere Folgegeschäfte gegeben ist. Sowie eine<br />
gute Auswahl an Brustprothesen, Wäsche und Bademode.<br />
Da sind auch die Hersteller in meinen Augen mehr gefordert,<br />
Konzepte zu entwickeln, um den Warenbestand optimal<br />
zu gestalten. Konkret meine ich z. B. bessere Rücknahmemöglichkeiten,<br />
mehr NOS (Never out of stock – ständig<br />
auf Lager, Anm. d. Red.) auch im modischen Bereich. Leider<br />
ist es so, dass überall Personalmangel herrscht und es deswegen<br />
insgesamt schwierig ist, sich zusätzlich noch zu spezialisieren.<br />
Allerdings denke ich, da in diesem Bereich eine<br />
engagierte Verkäuferin mehr Sinn ergibt als eine klassische<br />
Sanitätshausmitarbeiterin, kann das auch eine Chance<br />
sein.<br />
OT: Können Sie eine Entwicklung in den Anforderungen der<br />
Patientinnen erkennen?<br />
Prüstel: Die Weiterentwicklung der OP-Techniken verlangt<br />
immer speziellere Versorgungen. Einige Hersteller sind darin<br />
sehr fortschrittlich, bei anderen hat man das Gefühl,<br />
noch zehn Jahre zurück zu sein. Ich persönlich glaube an<br />
mehr individuelle Lösungen, d. h. Maßprothesen. Die Patientinnen<br />
kommen auch öfters besser informiert, das<br />
heißt, ich muss mitreden können. Nichts ist kundenfeindlicher<br />
als das Gefühl, dass die Kundin besser informiert ist<br />
über z. B. die Kollektionen oder in Social Media beworbene<br />
Produkte wie Brustprothesen.<br />
OT: Wie hat die Corona-Pandemie die Arbeit verändert?<br />
Prüstel: Corona hatte zur Folge, dass die Betreuungsleistungen<br />
im Rahmen der Behandlungen abnahmen und<br />
ich dafür viele offene Fragen rund um das Thema Brustkrebs<br />
beantworten musste. Nicht zu vergessen ist dabei,<br />
dass auch die psychologische Behandlung nicht mehr so<br />
war bzw. ist wie vorher. Die Frauen sind noch ängstlicher<br />
und leiden unter Ungewissheit zum Beispiel über die Folgen<br />
einer Coronainfektion während der Chemotherapie.<br />
Dies alles führte dazu, dass mein Arbeitspensum immer<br />
mehr stieg, da sich die Frauen auch nach Feierabend<br />
und am Wochenende an mich wandten und meinen Rat<br />
suchten. Die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmt<br />
mehr.<br />
OT: Die Frauen, die zu Ihnen kommen, haben ja auch eine<br />
Lebens- und Leidensgeschichte hinter sich. Welche Rolle spielt<br />
das bei der Versorgung?<br />
Prüstel: Da kann ich aus eigener Erfahrung berichten.<br />
Nachfragen und Interesse zeigen ist genauso wichtig wie<br />
eine gute Versorgung abzuliefern. Sich auf dieser Ebene<br />
zu engagieren, hat den Vorteil, dass sich die Patientinnen<br />
auf den nächsten Termin bereits freuen und mit einem<br />
positiven Gefühl zu mir in den Laden kommen. Ich wiederum<br />
habe viel von den Frauen gelernt, habe von den mir<br />
berichteten Erfahrungen profitiert und konnte das Wissen<br />
auch an andere Frauen weitergeben. Eine – wie sagt man<br />
so schön – Win-win-Situation. Außerdem spricht sich eine<br />
gute Atmosphäre bei der Versorgung bei Ärzten und Patientinnen<br />
schnell rum und sorgt in der Folge für weitere Aufträge<br />
– eine gute und preiswerte Werbung.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
13
Brustversorgung<br />
Mit Herzblut und Leidenschaft engagiert sich<br />
Anke Prüstel auch heute noch – nach ihrer<br />
Geschäftsaufgabe – für Brustkrebspatientinnen.<br />
„Ich stehe – trotz meines Engagements im<br />
Unternehmen meines Mannes – immer noch<br />
mit Rat und Tat parat“, so Prüstel.<br />
Psychologin, Krankenschwester<br />
und Modeberaterin<br />
OT: Vom Versorger werden verschiedene Kompetenzen<br />
erwartet, die über die technische Expertise hinausgehen.<br />
In welche Rollen mussten Sie in Ihrer Berufslaufbahn schon<br />
schlüpfen während einer Versorgung?<br />
Prüstel: Allen voran als – ungelernte – Psychologin, auch<br />
mit der Aufgabe, evtl. geduldig darauf hinzuweisen, Hilfe<br />
zu holen. Als Krankenschwester, also um auch mal ein<br />
neues Pflaster anzubringen oder den Hinweis zu geben<br />
evtl. zum Arzt zu gehen, wenn mir etwas aufgefallen ist.<br />
Und meine Lieblingsrolle – als modische Beraterin und<br />
Tipp geberin. Ich habe immer gesagt, ich habe die beste<br />
Rolle bei der Versorgung, ich darf den Frauen mit Brustprothesen,<br />
Wäsche und Bademode ein bisschen Lebensqualität<br />
zurückgeben. Ich habe mich immer sehr für die<br />
Kundin interessiert, das hatte viele schöne Erlebnisse zur<br />
Folge. Darunter waren Betreuungen in der Schwangerschaft/Stillzeit<br />
mit einer Brust, Beratung zum Brautkleid<br />
oder wenn eine Kundin mit einer Brust einen Partner gefunden<br />
hat. Es gab auch die Schattenseiten: Wenn eine<br />
Kundin gestorben ist, dann habe ich z. B. die Entsorgung<br />
der Brustprothesen angeboten und oft nicht einfache Gespräche<br />
führen müssen.<br />
OT: Wie haben Sie sich fortgebildet?<br />
Prüstel: Durch Schulungen der Hersteller. Darüber hinaus<br />
habe ich immer das Gespräch mit Ärzten und Krankenschwestern<br />
gesucht und nicht zu vergessen durch die<br />
tägliche Arbeit. Ärztekongresse sind auch eine sehr gute<br />
Möglichkeit zur Weiterbildung sowie die Lektüre zu den<br />
Themen Verkauf, Warenpräsentation, Kataloge und Homepages<br />
der Hersteller. Außerdem sollte man immer im Blick<br />
behalten, was es bei „normalen“ BH-Herstellern gibt. Ich<br />
habe mich und mein Geschäft immer wieder hinterfragt<br />
und überlegt, ob die Versorgung ausreichend war.<br />
OT: Fühlten Sie sich mit den Aus- und Fortbildungsmaßnahmen<br />
gut informiert oder hätten Sie sich da mehr gewünscht?<br />
Prüstel: Von den Herstellern hätte ich mir mehr gewünscht.<br />
Letztlich war es immer mehr oder weniger dasselbe. Dabei<br />
ist das Thema sehr umfassend. Persönlich habe ich die psychologischen<br />
Aspekte bei der Versorgung als unzureichend<br />
empfunden. Bei Schulungen, die nicht aus dem Brustkrebsbereich<br />
kamen, gab es mehr Tipps. Und es geht außerdem<br />
in meinen Augen viel zu wenig konkret um die Hilfe für<br />
den eigentlichen Verkauf/Zusatzverkauf.<br />
OT: Stichwort Kosten. Welche Erfahrungen haben Sie mit<br />
Kostenträgern gemacht und sehen Sie die Beratungsleistung<br />
von Brustkrebspatientinnen in den verhandelten Verträgen<br />
angemessen abgebildet?<br />
Prüstel: Ein klares Nein! Wie schon angeführt ist eine Beratung<br />
für zwei Prothesenhalterungen mit dem Zuschuss<br />
deutlich unterbezahlt, es sollte bei jeder Versorgung eine<br />
pauschale Stundenvergütung mit dabei sein. Des Weiteren<br />
der tägliche Kampf mit den Kostenträgern, allen voran<br />
um die Maßprothesen. Dabei habe ich mich gefragt: „Warum<br />
darf ein Kostenträger oder der Medizinische Dienst<br />
entscheiden, wie die optimale Versorgung für die Brustkrebspatientinnen<br />
aussieht, aus der Ferne, eben ohne Ahnung<br />
von dem Leben und der Leidensgeschichte sowie<br />
ohne ausreichende Produktkenntnis?“. Oder die Frage<br />
nach der Schwimmprothese. Welche Mitarbeiterin eines<br />
Kostenträgers würde sich z. B. am öffentlichen Strand mit<br />
Kindern ohne Kabinen beim Umziehen mit einer Brust zeigen<br />
wollen? Und dann die noch feuchte Prothese wieder<br />
vor allen anderen in den BH fummeln?<br />
OT: Wenn Sie drei Ratschläge an andere Sanitätshausinhaber:innen<br />
geben dürften bezüglich der Versorgung von<br />
Brustkrebspatientinnen, welche wären das?<br />
Prüstel: Mut, die Aufgabe anzugehen. Gut geschulte Mitarbeiterinnen<br />
in diesem Bereich, die Lust darauf haben<br />
und in anderen Bereichen entlastet werden. Es ist etwas<br />
völlig anderes, einen BH oder eine Brustprothese zu verkaufen.<br />
Es hat in meinen Augen nichts mit dem klassischen<br />
Sanitätshaus zu tun. Das zu verstehen, ist der Weg zum Erfolg.<br />
Und das Wichtigste: Mitarbeiterinnen gut zu bezahlen<br />
und für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen und nicht zu<br />
vergessen, dass es belastend sein kann, mit krebskranken<br />
Menschen zu arbeiten.<br />
Die Fragen stellte Heiko Cordes.<br />
Foto: Prüstel<br />
14<br />
Sanitätshaus 2024
Beratung und Verkauf<br />
Gespräche erfolgreich führen – eine<br />
Kunst, die Coach Michael Gischnewski<br />
Sanitätshaus-Mitarbeitenden<br />
vermittelt.<br />
Das Leid mit der Verständigung<br />
Foto: privat<br />
Welche Zutaten braucht ein gutes (Kunden-)Gespräch?<br />
Dieser Frage geht Personal- und Business-Coach sowie<br />
Hypno-Master-Coach Michael Gischnewski im Gespräch<br />
mit der OT-Redaktion nach. Denn schon viele Mitarbeitende<br />
im Sanitätshaus haben die Erfahrung gemacht,<br />
dass sowohl Versorger:innen als auch Kund:innen aus<br />
einem Gespräch gekommen sind und vor allem eins gefühlt<br />
haben: Frust. Darüber, nicht verstanden worden zu<br />
sein, dass man aneinander vorbeigeredet hat, oder dass<br />
die Zeit nicht sinnvoll für die Versorgung genutzt wurde.<br />
Alles Erfahrungen, die nicht vollständig verhindert,<br />
aber mit den richtigen Werkzeugen für eine erfolgreiche<br />
Gesprächsführung in vielen Fällen doch vermieden<br />
werden können.<br />
OT: Herr Gischnewski, schön, dass Sie heute Zeit für<br />
uns haben. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen?<br />
Michael Gischnewski: Michael Gischnewski, 58 Jahre alt,<br />
gebürtiger Schwabe und seit zwölf Jahren wohnhaft in Kassel.<br />
Ich bin ausgebildeter Personal- und Business-Coach,<br />
Hypno-Master-Coach und psychologischer Berater; außerdem<br />
bin ich ehrenamtlich im Team der Krisenintervention<br />
im Rettungsdienst tätig. Ich habe über 25 Jahre Erfahrung<br />
im Vertrieb und Verkauf, davon 22 Jahre als Trainer und<br />
Coach. Seit über neun Jahren bin ich nun als Sales Coach<br />
und Kommunikationstrainer bei Topro Mobility und biete<br />
Kommunikations- und Verkaufstrainings im gesamten<br />
DACH-Raum für Mitarbeiter:innen ausschließlich im Sanitätsfachhandel<br />
für den Innen- und Außendienst sowie im<br />
Verkauf. Über 7.500 erfolgreiche Teilnehmer:innen haben<br />
bereits von meinen Trainings und Coachings profitiert.<br />
OT: Sie sind also seit fast einem Jahrzehnt Personal- und<br />
Business-Coach und einer von wenigen, vielleicht sogar der<br />
Einzige, der sich mit den besonderen Situationen im<br />
Umgang mit eher schwierigen Kund:innen speziell im Sanitätshaus<br />
auseinandersetzt. Nehmen Sie uns mal mit: Was macht<br />
Ihren Job aus und wieso ist aus Ihrer Sicht ein Coaching für<br />
Mitarbeitende im Sanitätshaus besonders wertvoll?<br />
Gischnewski: Es ist eine große Herausforderung – und deshalb<br />
auch eine sehr schöne Aufgabe –, mit den vielfältigen<br />
Anforderungen des Sanitätsfachhandels umzugehen. Dies<br />
gilt für die umfangreichen Aufgaben des Personals glei-<br />
chermaßen wie für den professionellen Umgang mit den<br />
nicht immer einfachen Kunden. Ich habe mir am Anfang<br />
als Laie auch überlegt: Sanitätshaus, da gibt es Windeln, da<br />
gibt es komische Strümpfe, alles Sachen, die nicht so toll<br />
sind, und da muss man mit Rezept hin – was soll ich denn<br />
da als Trainer machen? Und dann habe ich relativ schnell<br />
festgestellt: Es ist ein riesiger Bedarf da. Weil das Personal<br />
nicht nur fachlich fit sein muss, sondern auch Fähigkeiten<br />
benötigt, mit den unterschiedlichsten Situationen professionell<br />
umgehen zu können. Das fängt bei der Begrüßung<br />
an, geht über empathisches Verhalten sowie die eigene Kritikfähigkeit,<br />
über eine lösungsorientierte Beratung bis hin<br />
zum erfolgreichen Verkaufsabschluss und der gewinnbringenden<br />
Verabschiedung. Und genau aufgrund dieser vielfältigen<br />
Anforderungen ist ein motivierendes Coaching<br />
gepaart mit spezifischen Trainings und einem erarbeiteten<br />
Gesprächsleitfaden aus der Praxis für die Praxis so wichtig<br />
und wertvoll.<br />
OT: Wir wollen uns heute besonders auf den Umgang mit<br />
den eher „schwierigen“ Kund:innen konzentrieren. Die<br />
Fachberater:innen im Sanitätshaus treffen ja oft auf das<br />
sprichwörtliche Ende des Geduldsfadens. Sind Kund:innen im<br />
Sanitätshaus Ihrer Meinung nach generell weniger geduldig?<br />
Oder beobachten Sie allgemein einen Rückgang der Geduld?<br />
Gischnewski: Es ist ja so, dass uns Kund:innen im Sanitätshaus<br />
in den meisten Fällen aufgrund einer Diagnose und<br />
daraus resultierend mit einem entsprechenden Rezept für<br />
ein Hilfsmittel aufsuchen. Das heißt, sie sind in den seltensten<br />
Fällen freiwillig da, sondern wurden „geschickt“.<br />
Mangelhafte Informationen und auch die fehlende ausführliche<br />
Aufklärung der Patienten bzgl. der Diagnose tun<br />
oft ihr Übriges dazu. Und das löst immer Unsicherheit und<br />
Unwohlsein beim Kunden aus. Dazu kommt dann noch<br />
die Ungeduld, weil die meisten Menschen das Sanitätshaus<br />
eher schnell wieder verlassen wollen. Hier treffen also<br />
gleich mehrere ungünstige Faktoren zusammen. Ich beobachte<br />
allerdings darüber hinaus tatsächlich seit der Coronapandemie<br />
einen allgemein merklichen Rückgang der<br />
Geduld. Diese Zeit hat sehr viele Menschen verändert.<br />
OT: Was sollten Fachberater:innen grundsätzlich mitbringen,<br />
um dieser – manchmal sicherlich auch verständlichen –<br />
Ungeduld zu begegnen?<br />
Sanitätshaus 2024<br />
15
Beratung und Verkauf<br />
Gischnewski: Ein gesundes Selbstbewusstsein wie auch<br />
Selbstsicherheit sind wichtige Standbeine, um ungeduldigen<br />
Kunden freundlich begegnen zu können. Von großer<br />
Bedeutung ist auch das eigene Grundverständnis für die Situation<br />
sowie für das Verhalten des Kunden, die Empathie<br />
eben. Und eine intrinsische Motivation. Das heißt, aus echter<br />
Neugierde und der Bereitschaft, neue Herausforderungen<br />
anzunehmen, zu handeln und mit dem Willen, Menschen<br />
gerade in schwierigen Lebenslagen hilfreich zur Seite<br />
stehen zu wollen.<br />
OT: Spannend. Das heißt, wenn ich meinem Gegenüber von<br />
Anfang an mit dieser Haltung begegne, kann ich ihn/sie schon<br />
abholen, bevor es zum Riss des Geduldsfadens kommt?<br />
Wieso funktioniert das?<br />
Gischnewski: Eine empathische Grundeinstellung,<br />
Freundlichkeit, Kritikfähigkeit, Ehrlichkeit und lösungsorientiertes<br />
Handeln sind ganz elementare Faktoren für<br />
eine deeskalierende Handlung. Wenn man den Menschen<br />
auf dieser Ebene begegnet und den Sachverhalt erklärt,<br />
dann verstehen es die meisten auch. Auf eine Kommunikation<br />
„auf Augenhöhe“ zu achten, das ist wertschätzend und<br />
verständnisvoll zugleich.<br />
OT: Und ist das etwas, das man hat oder eben nicht?<br />
Oder kann das jede:r lernen?<br />
Gischnewski: Der eine hat’s – mehr oder weniger –, der<br />
andere nicht. Allerdings können diese Fähigkeiten durch<br />
gezieltes Coaching und definierte Trainings gut erlernt<br />
und ausgebaut werden. Wer die Werkzeuge professioneller<br />
Kommunikation kennt und diese auch situativ anzuwenden<br />
weiß, der wird auch selbstbewusster in herausfordernden<br />
Situationen und gewinnt hierdurch automatisch mehr<br />
Selbstsicherheit.<br />
OT: Man hat als Mensch so eine Art Radar – auch schon beim<br />
ersten Kontakt. Ein Gefühl dafür, wie denn der oder die andere<br />
gerade gestimmt ist. Kann ich ihm oder ihr vielleicht erst einmal<br />
mit einem Scherz begegnen, oder sind schon Alarm und<br />
Habachtstellung von vornherein angebracht? Wie kann ich in<br />
einem Gespräch Klippen umschiffen und tatsächlich deeskalieren,<br />
bevor es eskaliert, wenn ich den Eindruck habe, dass mir<br />
hier jemand mit kurzer Zündschnur gegenübersteht?<br />
Gischnewski: Ja, das ist eine große Herausforderung. Man<br />
muss sich halt immer mal in die Situation des Gegenübers<br />
hineinversetzen und sich überlegen: Wie würde es<br />
mir denn jetzt gehen? Ich habe Schwierigkeiten, ich habe<br />
Schmerzen, ich muss zum Arzt. Das ist grundsätzlich<br />
keine angenehme Situation. Und dann bekommen Sie –<br />
überspitzt gesagt – irgendeine Diagnose um die Ohren gehauen,<br />
ein paar Rezepte in die Hand gedrückt und das war<br />
es. In dem Moment fühlen sich diese Menschen oft sehr<br />
allein gelassen mit einer Diagnose, die sie vielleicht gar<br />
nicht verstehen. Da kommt dann der psychologische Aspekt<br />
ins Spiel, der unheimlich wichtig ist: Was mache ich<br />
jetzt daraus? Was bedeutet das für mein künftiges Leben?<br />
Was bedeutet das für mein Umfeld, für meine Familie?<br />
Alles, was eben auf einen einstürzt. Und dann habe ich<br />
maximal 28 Tage Zeit, das irgendwie auch nur annähernd<br />
zu verarbeiten und anzunehmen. Anschließend stehe ich<br />
bei Ihnen im Geschäft und wir schauen uns an. Ich mit<br />
meinem Rezept in der Hand und im ersten Kontakt bereits<br />
auf 180.<br />
Was ich den Leuten immer versuche beizubringen, ist:<br />
Schau, der, der dich da anbrüllt, ist nicht nur wütend und<br />
ungeduldig, sondern auch in höchstem Maße verunsichert.<br />
Und jeder Mensch zeigt seine Verunsicherung auf<br />
eine andere Art und Weise. Der eine wird halt leise, der<br />
andere wird laut, wieder ein anderer fängt vielleicht an zu<br />
weinen. Es ist sehr individuell, wie die Menschen in einer<br />
belastenden Situation reagieren. Aber ich finde auch, das<br />
ist ein bisschen das Salz in der Suppe. Wenn ich meinen<br />
Job richtig verstehe und erkenne: Ich habe eine sehr große<br />
Verantwortung diesem Menschen gegenüber und ich<br />
habe jetzt 10, 20 vielleicht 30 Minuten Zeit, mich intensiv<br />
um genau diesen Menschen zu kümmern. Mit all meinem<br />
Fachwissen, mit all meinem sozialen Tun.<br />
OT: Gibt es vielleicht eine Art Strategie oder einen Kniff, um<br />
der Ungeduld direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen?<br />
Angenommen, ich stehe hinter dem Tresen, mir wird ein Rezept<br />
gereicht und ich weiß direkt: Das muss ich erst bestellen. Oder<br />
(noch schlimmer) das Rezept ist so nicht richtig ausgestellt.<br />
Dann weiß ich als Fachberater:in schon im ersten Augenblick,<br />
diesem Kunden oder dieser Kundin kann ich nicht sofort helfen.<br />
Wie kann ich das von vornherein deeskalierend transportieren?<br />
Gischnewski: Die eigene innere Einstellung muss passen.<br />
Wenn eine Situation so ist, wie sie ist, und ich es partout<br />
nicht ändern kann, dann muss ich das erstmal selbst genau<br />
so akzeptieren. Und jetzt ist eine ungezwungene, offene<br />
Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber sehr wichtig.<br />
Wenn ich hier unsicher agiere, biete ich dem aufgebrachten,<br />
ungeduldigen Kunden nur eine unnötige Angriffsfläche.<br />
Selbstbewusst die Fakten nennen und – wenn möglich<br />
– Lösungsvorschläge anbieten, dabei freundlich und<br />
ehrlich lächeln, Punkt. Es ist nämlich ein Phänomen, das<br />
ich in den gesamten neun Jahren meiner Tätigkeit in der<br />
Sanitätshaus-Branche beobachten darf, dass die Kunden<br />
ihrer Verärgerung und Ungeduld oft freien Lauf lassen.<br />
Überall werden mittlerweile lange Wartezeiten akzeptiert,<br />
wie z. B. beim Arzt oder beim Handwerkertermin<br />
zu Hause. Nur im Sanitätshaus, da darf es keine Wartezeiten<br />
geben. Dieses Verhalten vieler Kunden hat vielfältige<br />
Gründe, die es eben zu verstehen und professionell damit<br />
umzugehen gilt. Ja, ich möchte sogar behaupten, dass wir<br />
hier unsere Kunden auch ein wenig erziehen müssen. Das<br />
ist erlern- und trainierbar und funktioniert tatsächlich<br />
auch.<br />
16<br />
Sanitätshaus 2024
Beratung und Verkauf<br />
OT: Und wie lernt man das?<br />
Gischnewski: Bei mir sind das immer modular aufgebaute<br />
Ganztagsschulungen. Es gibt zunächst ein Basistraining,<br />
da lernen die Teilnehmer:innen wirklich von der Begrüßung<br />
bis zur Verabschiedung anhand eines Verkaufsleitfadens,<br />
den ich über die Jahre erarbeitet habe, die verschiedenen<br />
Phasen direkt mit dem Kunden gemeinsam durchzugehen.<br />
Bis hin zur Bedarfsermittlung, um festzustellen, wie<br />
sieht denn der Alltag meines Kunden aus? Was wünscht er<br />
oder sie sich denn? Wo gibt es Bedenken, was fällt im Moment<br />
schwer? Damit der Kunde überhaupt erstmal bereit<br />
ist, sich einem fremden Menschen gegenüber zu öffnen.<br />
Dafür bedarf es hochkomplexer Prozesse. Da muss ich Empathie<br />
entwickeln und brauche die innere Motivation: „Ja.<br />
Mein Job ist wichtig und ich möchte den Menschen helfen,<br />
und es geht nicht darum, den Leuten das teuerste Produkt<br />
zu verkaufen, sondern wirklich um bedarfsgerechte Beratung.“<br />
Dann findet auch automatisch ein Verkauf statt.<br />
OT: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man als Prellbock für<br />
Ungeduld und Ärger auch selbst in eine emotionale und<br />
defensive Haltung gerät. Was kann mir in diesem Fall helfen,<br />
selbst auf der sachlichen Ebene zu bleiben?<br />
Gischnewski: Um auf der sachlichen Ebene zu bleiben, weil<br />
man vielleicht gerade selbst sehr gereizt oder gestresst ist,<br />
kann es sehr hilfreich sein, sich mal eben selbst zu reflektieren.<br />
Da kann ein kleiner Trick sehr hilfreich sein: einfach<br />
ganz kurz die Helikopter-Position einnehmen. Das bedeutet,<br />
sich vorzustellen, man schwebt in einem Helikopter<br />
über der Situation und schaut von oben auf sich und den<br />
Kunden. Das sorgt für einen wertvollen Perspektivwechsel.<br />
Währenddessen ein-, zweimal ganz tief in den Bauch<br />
atmen und lange ausatmen, das sorgt für (Sauerstoff-)Power<br />
im Gehirn, dauert übrigens nur wenige Sekunden und<br />
wird vom Kunden nicht wirklich bemerkt.<br />
OT: Mal angenommen, das Kind ist schon in den Brunnen<br />
gefallen. Der Frust bricht sich Bahn und das Gespräch wechselt<br />
von der sachlichen auf die emotionale Ebene – wie sollte ich<br />
mich jetzt verhalten? Welche Tipps geben Sie Ihren Trainees<br />
dazu?<br />
Gischnewski: Es hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an,<br />
aber wenn ich es verstehe, mich gekonnt auf der emotionalen<br />
Ebene zu bewegen, dann habe ich wesentlich größere<br />
Chancen, den Kunden abzuholen und gegenseitiges<br />
Verständnis aufzubauen, als wenn ich mich ausschließlich<br />
auf der sachlichen Ebene bewege. Schließlich verlaufen<br />
rund 80 Prozent der zwischenmenschlichen Kommunikation<br />
auf der emotionalen Ebene. Mein Tipp in einer<br />
solchen Situation ist, mit „guten“ Fragen zu arbeiten. Also<br />
offene Fragen, sogenannte „W“-Fragen, stellen sowie aktiv<br />
zuhören und so das Gespräch gekonnt steuern. Eine<br />
wertvolle Regel: Reagiere auf eine Äußerung nicht mit<br />
ebenso einer Äußerung, also im Stile Argument – Gegenargument,<br />
sondern reagiere mit einer gut gestellten „W“-<br />
Frage. Das will gut gelernt sein und muss permanent trainiert<br />
werden.<br />
OT: Okay. Und gibt es eine Art „Notfallplan“, falls ich merke,<br />
dass ich trotz allem gerade ebenfalls die Geduld verliere?<br />
Das kann uns allen ja passieren, je nachdem, welche Knöpfe<br />
man bei uns drückt. Ist es in Ordnung, eine Diskussion dann<br />
auch zu verlassen oder an eine vielleicht gerade weniger<br />
involvierte Person zu übergeben?<br />
Gischnewski: Ein Gespräch kann durchaus auch mal scheitern<br />
und zum Abbruch führen. Ein solcher Gesprächsabbruch<br />
sollte aber niemals das Ende der Kundenbeziehung<br />
sein. Wenn es tatsächlich nicht anders zu lösen sein sollte,<br />
dann ist die Übergabe des Gesprächs an eine Kollegin oder<br />
einen Kollegen denkbar. Es sollte allerdings das allerletzte<br />
Mittel sein, quasi der Notausgang.<br />
OT: Sollte man sich dazu im Team abstimmen? Also vielleicht<br />
eine Art Zeichen vereinbaren, an dem die Kolleg:innen merken,<br />
okay, bei dem Tanz ist jetzt ein Partnerwechsel angesagt?<br />
Gischnewski: Eine verabredete Geste kann die Übergabe<br />
erleichtern, muss allerdings sicher kommuniziert und<br />
verlässlich umsetzbar sein. Schließlich soll der Kunde auf<br />
keinen Fall das Gefühl bekommen, „weitergeschoben“ zu<br />
werden.<br />
OT: Abschließende Frage – gibt es eine Art Faustformel, an der<br />
man sich in schwierigen Situationen orientieren kann?<br />
Gischnewski: Erstens: gut und aktiv zuhören. Dem Kunden<br />
deutlich signalisieren, dass man echtes Interesse an seinem<br />
Anliegen hat. Zweitens: mit dem Kunden mitfühlen und<br />
Verständnis zeigen. Drittens: immer davon ausgehen, dass<br />
man beobachtet wird. Andere Kunden im Sanitätshaus hören<br />
sich Konfliktgespräche sehr gerne mit an. Immer auch<br />
an die Außenwirkung denken. Viertens: langsam und mit<br />
leicht gesenkter Stimme reden. Fünftens: nur Versprechungen<br />
machen, die man auch tatsächlich einhalten kann. Das<br />
ist Ehrlichkeit. Sechstens: Beschwerden niemals persönlich<br />
nehmen. Siebtens: schwierige Kunden als potenzielle Gelegenheiten<br />
betrachten. Achtens: das Gespräch immer positiv<br />
beenden. So kann man neben dem eigenen Ausdruck<br />
für das Verständnis der Verärgerung des Kunden auch anbieten,<br />
in Zukunft persönlich für den Kunden da zu sein.<br />
Neuntens: wissen, wann es genug ist. Grenzen ziehen und<br />
wenn nötig, diese dem Kunden auch aufzeigen. Achtung:<br />
das eigene Ego beiseite lassen.<br />
OT: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch und<br />
Ihre Zeit.<br />
Die Fragen stellte Alexandra Klein.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
17
Kompression<br />
M. Morand<br />
Therapie mittels IPK plus<br />
definierte Polsterungen (IPK+)<br />
bei posttraumatischen bzw.<br />
postoperativen Ödemen unter<br />
Berücksichtigung der bio chemischen<br />
und biophysikalischen<br />
Eigenschaften<br />
Treatment with IPC Plus Defined Pads (IPC+) for Post-Traumatic<br />
or Postoperative Oedema, Taking into Account Biochemical and<br />
Biophysical Properties<br />
Hintergrund: Auch innerhalb der<br />
Sportphysiotherapie kommt der<br />
kombinierten Entstauungstherapie<br />
(KET) eine bedeutende Rolle zu.<br />
Längst wurden die Vorteile erkannt,<br />
die es ab bestimmten Schweregraden<br />
sinnvoll erscheinen lassen, ein<br />
posttraumatisches Ödem zu behandeln.<br />
Der Einsatz der Intermittierenden<br />
Pneumatischen Kompressionstherapie<br />
(IPK) als ein wichtiges<br />
Modul neben anderen Maßnahmen<br />
kann dabei als etabliert angesehen<br />
werden. Vorgestellt wird das von<br />
dem Autor entwickelte IPK+-Verfahren,<br />
bei dem additiv definierte Multifunktionspolsterungen<br />
unter der IPK<br />
mit zum Einsatz kommen [1, 2]. Nach<br />
mehreren Jahren bereits veröffentlichter<br />
Erfahrung in der praktischen<br />
Anwendung der IPK+-Therapie zeigen<br />
nun auch Ergebnisse einer klinischen<br />
Studie aus der Universitätsmedizin<br />
in Greifswald die Überlegenheit<br />
der IPK+ gegenüber der IPK in traditioneller<br />
Anwendung [1, 3].<br />
Einleitung: Bei der Behandlung<br />
posttraumatischer Ödeme erreicht<br />
man über entödematisierende Therapien<br />
eine Verbesserung der Weichteilheilung<br />
und Schmerzhaftigkeit<br />
[4]. Weiterhin wird das Risiko des<br />
Entstehens möglicher Komplikationen<br />
reduziert. Darüber hinaus nutzen<br />
Sportler:innen solche Behandlungsangebote<br />
zur Regeneration.<br />
Sehr gut lässt sich damit in Verbindung<br />
mit anderen Maßnahmen wie<br />
Luftsprudelbädern, Kältetherapie<br />
(z. B. Eisbäder) und Ruhehalten etc.<br />
ein „Muskelkater“ und die damit<br />
häufig einhergehenden „schweren<br />
Beine“ therapieren [5], eine gute Indikation<br />
für die KET.<br />
Zielsetzung: Neu ist eine interdisziplinäre<br />
Herangehensweise bei<br />
der Betrachtung rheologischer Eigenschaften<br />
proteinreicher Ödemflüssigkeiten,<br />
aus deren Verständnis<br />
sich in Zukunft innovative Therapiemodelle<br />
entwickeln lassen könnten.<br />
Daher macht es Sinn, zunächst eine<br />
Betrachtung zu Ursache, Entstehung<br />
und den physikalischen Eigenschaften<br />
entzündungsbedingter Schwellungen<br />
vorwegzunehmen.<br />
Schlüsselwörter: proteinreiche<br />
Ödeme, Viskosität, IPK+-Therapie,<br />
Scherkraft, nicht Newton‘sche Fluide<br />
mit strukturviskosem Fließverhalten<br />
Background: Combined decongestive<br />
therapy (CDT) also plays an important<br />
part in sports physiotherapy.<br />
The benefits have long been recognised,<br />
suggesting it could be useful<br />
for treating post-traumatic oedema<br />
above certain levels of severity. The<br />
use of intermittent pneumatic compression<br />
(IPC) as an important module<br />
in addition to other measures<br />
is considered to be an established<br />
therapy. The article presents the IPC+<br />
method developed by the author, in<br />
which defined multifunctional pads<br />
are used in addition to IPC [1, 2].<br />
Following several years of published<br />
experience in the practical use of<br />
IPC+ therapy, results of a clinical trial<br />
conducted at Greifswald University<br />
Hospital now show the superiority<br />
of IPC+ compared with conventional<br />
IPC [1, 3].<br />
Introduction: In post-traumatic<br />
oedema treatment, oedema-reducing<br />
therapies lead to improved soft<br />
tissue healing and pain relief [4]. The<br />
risk of developing potential complications<br />
is also reduced. Furthermore,<br />
athletes utilise such treatment programmes<br />
for regeneration. Along<br />
with other measures such as air<br />
bubble baths, cold therapy (e.g. ice<br />
baths), rest and the like, muscle soreness<br />
and the often associated “heavy<br />
legs” can be treated very well [5], a<br />
good indication for CDT.<br />
Objective: This is a new interdisciplinary<br />
approach to viewing the<br />
rheological characteristics of protein-rich<br />
oedema fluids, the understanding<br />
of which could lead to the<br />
development of new therapy models<br />
in the future. It is therefore useful to<br />
18<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23
Kompression<br />
first observe the cause, development,<br />
and physical properties of swelling<br />
due to inflammation.<br />
Key words: protein-rich oedema,<br />
viscosity, IPC+ therapy, shearing force,<br />
non-Newtonian fluids with shear<br />
thinning flow behaviour<br />
Das Ödem der akuten<br />
Entzündung<br />
Kommt es als Folge von Überbeanspruchung<br />
zu Mikroläsionen in der<br />
Muskulatur, einem sogenannten<br />
„Muskelkater“, oder haben wir es mit<br />
Verletzungen bzw. mit postoperativen<br />
Zuständen zu tun, wird die monotone<br />
Antwort des Organismus auf jegliche<br />
Zellschädigung die Ingangsetzung<br />
einer akuten Entzündungsreaktion<br />
sein. So kommt es unter dem Einfluss<br />
von Entzündungsmediatoren zu Erweiterungen<br />
von Blutkapillaren mit<br />
einem erhöhten Flüssigkeitsaustritt.<br />
Die Permeabilität der Blutkapillaren<br />
ist erhöht, sodass entgegen der Norm<br />
vermehrt biologische Polymere wie<br />
Proteine etc. die Endstrombahn verlassen.<br />
Wiederum andere Fraktionen<br />
von Entzündungsmediatoren sind für<br />
begleitende Schmerzzustände mitverantwortlich<br />
[6].<br />
Eine weitere Schmerzursache erklärt<br />
sich durch schnell entstandene<br />
Schwellungen, bei denen die Gewebe<br />
der raschen Volumenzunahme nur<br />
unzureichend folgen können; hierbei<br />
kommt es zu Druck- und Spannungsentwicklungen,<br />
unter welche die Gewebe<br />
geraten [7].<br />
Im Normalfall sollte das Lymphgefäßsystem<br />
(LGS) einer Ödembildung<br />
über eine Steigerung der Lymphangiomotorik<br />
entgegenwirken (Sicherheitsventilfunktion<br />
des LGS). Eine Hemmung<br />
der Lymphgefäßbewegung erklärt<br />
sich durch das Wirken von sofort<br />
ausgeschütteten Gewebemediatoren<br />
und durch Schmerzen verursachende<br />
Spasmen in den Wandungen der<br />
Lymphgefäße [8]. Nach Traumen können<br />
aber auch Lymphgefäße lokal und<br />
auf Zeit verletzungsbedingt geschädigt<br />
sein und somit ihre Aufgaben<br />
nicht ausreichend erfüllen. Sehen wir<br />
nach den oben dargestellten Szenarien<br />
Schwellungen, sind dies Ödeme<br />
der akuten Entzündung, wobei noch<br />
nicht erwähnt wurde, dass als Folge<br />
von Traumen in aller Regel auch Hämatome<br />
nach Blutgefäßzerreißungen<br />
mit in Betracht gezogen werden müssen.<br />
In einem solchen „Entzündungscocktail“<br />
befinden sich dann die oben<br />
bereits genannten Biopolymere und<br />
Entzündungsmediatoren und zusätzlich<br />
wässrige Bestandteile, die in diesem<br />
Kontext als Lösungsmittel betrachtet<br />
werden. Die Veränderungen<br />
sind zum einen Voraussetzung für<br />
eine Regeneration geschädigter Gewebestrukturen,<br />
die aber auch in Form<br />
von überschießenden Reaktionen<br />
entgleiten können und somit als eine<br />
Ursache für ein Voranschreiten weiterer<br />
Komplikationen gesehen werden.<br />
In einem solchen Fall spricht man von<br />
einem Circulus vitiosus, der in eine<br />
folgenreiche Abwärtsspirale münden<br />
kann. Ein vermeidlich harmloser<br />
„Muskelkater“, in erster Linie als Folge<br />
von Mikroläsionen, sollte zwar nicht<br />
zu den eben beschriebenen Komplikationen<br />
führen; wenn aber vor nicht<br />
ausreichender Regeneration weitere<br />
Belastungen stattfinden, besteht die<br />
Gefahr einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit<br />
und eines Leistungsabfalls<br />
bis hin zu einem vorübergehenden<br />
Unvermögen, weiter Leistungen<br />
erbringen zu können [9]. Sofern man<br />
die soeben genannten Schilderungen<br />
berücksichtigt, ist es nicht verwunderlich,<br />
dass den pathophysiologischen<br />
Prozessen über ödemreduzierende<br />
Maßnahmen und damit der Reduktion<br />
von Protein, Zelltrümmern,<br />
Entzündungsmediatoren und weiteren<br />
exsudativen Stoffen gut entgegnet<br />
werden kann [10]. Da der Schmerz für<br />
sich alleine schon als Auslöser für eine<br />
akute Entzündungsreaktion gesehen<br />
wird, sind alle Maßnahmen, die den<br />
Schmerz senken, von beträchtlichem<br />
therapeutischem Wert.<br />
Therapie und deren Ziele<br />
Gemäß der Leitlinie der Deutschen<br />
Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie<br />
wird speziell über eine Ödemreduktion<br />
bei posttraumatischen<br />
Ödemen mittels Manueller Lymphdrainage<br />
(MLD) – gegebenenfalls in<br />
Kombination mit leichter Kompression<br />
– der Heilungsverlauf beschleunigt<br />
und die Häufigkeit von Komplikationen<br />
wie Lymphozelen, Seromen und<br />
Keloidnarben reduziert. Der über die<br />
Therapie erlangten Schmerzreduktion<br />
wird eine gewichtige Rolle bei der<br />
Unterstützung des Heilungsprozesses<br />
zugeschrieben [11]. Tierexperimentelle<br />
Untersuchungen zeigten, dass nach<br />
Traumen über einen frühen 3-wöchigen<br />
Einsatz von MLD-Behandlungen<br />
eine vermehrte Regeneration von<br />
Lymphgefäßen im Narbengebiet erreicht<br />
wurde [12]. Gestützt wird diese<br />
Erkenntnis auch durch jüngere prospektiv<br />
randomisierte Studien, bei denen<br />
ein signifikanter Vorteil bzgl. der<br />
Prävention sekundärer Lymphödeme<br />
nachgewiesen wurde, nachdem zeitnah<br />
nach Brustkrebs-Operationen<br />
über 3 Wochen MLD-Behandlungen<br />
erfolgten [13].<br />
Therapieregime: Nach Erste-Hilfe-<br />
Maßnahmen wie Hochlagerung, Kühlung<br />
und leichter Kompression sollte<br />
mit einer KET möglichst frühzeitig ca.<br />
3 Stunden nach Stillstand etwaiger<br />
Blutungen begonnen werden. Zuvor<br />
erfolgt eine ärztliche Untersuchung.<br />
Zu Beginn der Therapie erfolgt diese<br />
in der Entzündungsphase über 7 Tage<br />
hochdosiert mit bis zu 4 Anwendungen<br />
täglich. Vom 7. bis zum 15. Tag,<br />
d. h. in der Proliferationsphase, werden<br />
3 Anwendungen pro Woche als<br />
ausreichend angesehen. Pritschow et<br />
al. empfehlen eine Durchführung der<br />
KET mittels MLD und Kompression [7].<br />
Auf die Darstellung der Kombination<br />
mit anderen begleitenden therapeutischen<br />
Maßnahmen wird in dieser Abhandlung<br />
verzichtet.<br />
Kommentar: Die positive Wirkung<br />
einer hochdosierten Anwendung<br />
ist nicht von der Hand zu weisen,<br />
allerdings dürften Patienten im<br />
Normalfall kaum in den Genuss einer<br />
solchen Zuwendung gelangen, wenn<br />
solche Leistungen nur durch speziell<br />
ausgebildetes Personal erbracht werden<br />
können. Abgesehen davon ist –<br />
global und wirtschaftlich betrachtet<br />
– eine nicht gerade kostengünstige,<br />
qualitätsgesicherte MLD und Komplexe<br />
Physikalische Entstauungstherapie<br />
(KPE) weltweit nur einer sehr kleinen<br />
Minderheit zugänglich, und noch geringer<br />
ist die Zahl derjenigen, welche<br />
die Kosten dafür von einer Krankenversicherung<br />
erstattet bekommen.<br />
Als ein möglicher Beitrag zur Verbesserung<br />
dieser Probleme wird nun das<br />
von dem Autor entwickelte, klinisch<br />
erprobte IPK+-Verfahren vorgestellt,<br />
das hochwirksam, wenig personalintensiv,<br />
kostengünstig und auch<br />
von Laien nach umfassender Aufklärung<br />
und Schulung durch dafür ausgebildetes<br />
medizinisches Personal<br />
anwendbar ist. Nach Ausschluss von<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23<br />
19
Kompression<br />
Abb. 1 Zu der IPK+-<br />
Methode gehörige Polsterung<br />
mit einer Wandstärke<br />
von mind. 7 cm;<br />
rundum können Extremitäten<br />
mittels solcher<br />
Muffen versorgt werden.<br />
Kontraindikationen, beschwerdefreier<br />
Durchführung sowie korrekter Geräteanwendung<br />
handelt es sich sowohl<br />
bei der IPK wie auch der IPK+ um<br />
eine sichere Therapiemaßnahme [14].<br />
Arbeitsweise der mit definierten<br />
Multifunktionspolsterungen<br />
durchgeführten<br />
Form der<br />
IPK = IPK+-Methode<br />
Bei der erstmals 2018 veröffentlichten<br />
apparativen IPK+-Methode verwendet<br />
man handelsübliches IPK-Equipment,<br />
d. h. mit einer Vielzahl von<br />
Kammern aus Kunststoff ausgestatteten<br />
Manschetten, die steuerbar von<br />
Geräten mit Druckluft befüllt werden.<br />
Die Manschetten liegen, über Reißverschlüsse<br />
verschlossen, rund um die zu<br />
behandelnden Körperregionen. Die<br />
Drücke, die auf den Hautmantel wirken,<br />
nehmen von Zelle zu Zelle ab, um<br />
so die im Gewebe krankhaft angesammelte<br />
Ödemflüssigkeit abzudrainieren.<br />
Diese schon lange bekannte Behandlungsmethode<br />
wird im Weiteren<br />
als Intermittierende Pneumatische<br />
Kompressionstherapie in traditioneller<br />
Arbeitsweise (IPK itA) bezeichnet.<br />
Bei der IPK+-Methode werden zu dem<br />
soeben beschriebenen Prozedere unter<br />
den Manschetten reichlich mit 0,5<br />
bis 1 cm großen Schaumstoffwürfeln<br />
gefüllte Polsterungen in Form von<br />
Kissen oder Rundumversorgungen<br />
der Extremitäten mittels Muffen mitverwendet,<br />
deren Wandstärke mindestens<br />
7 cm beträgt [2] (Abb. 1). Gut<br />
gepflegt halten solche Polsterungen,<br />
die auch einer Kochwäsche standhalten,<br />
selbst bei täglicher Anwendung<br />
bis zu ca. 3 Jahre. Durch jahrelanges<br />
Experimentieren mit verschiedenen<br />
Materialien festigte sich bei dem<br />
Anwender die Erkenntnis, dass mit<br />
Stoffen, die elektrostatische Eigenschaften<br />
aufweisen, signifikant bessere<br />
Resultate erzielt werden als mit<br />
antistatischen. Die Gründe für diese<br />
unterschiedlichen Reaktionsweisen<br />
sind bislang nicht geklärt [15]. Bei der<br />
Durchführung einer IPK+-Anwendung<br />
wird die untenliegende Würfelschicht<br />
unter Druck in den epifaszialen<br />
Gewebezylinder mobilisiert, während<br />
nachfolgende Würfel der darüber<br />
befindlichen Ebenen dehnend in<br />
viele verschiedene Richtungen wirken.<br />
Nach erfolgten Anwendungen<br />
sehen wir ein typisches Hautbild, das<br />
vorübergehend eine Unzahl an kleinen<br />
Vertiefungen aufweist. Hieraus<br />
kann u. a. auf eine Vergrößerung der<br />
Behandlungsfläche um mindestens<br />
das Doppelte geschlossen werden<br />
(Abb. 2). Sofern vor solchen auch gewebemobilisierenden<br />
Anwendungen<br />
palpatorisch ein indurierter Zustand<br />
bestand, kann zum Ende der Therapie<br />
eine deutliche Lockerung festgestellt<br />
werden.<br />
Erst über das Unterpolstern mit<br />
dickwandigen, elastischen und unebenen<br />
Oberflächen werden Effekte<br />
ermöglicht, über die sich Scherkräfte<br />
induzieren lassen. Hingegen werden<br />
solche Wirkungen nicht erzielt,<br />
wenn wie bei der IPK itA im luftgefüllten<br />
Zustand feste, glatte Flächen<br />
auf den epifaszialen Hautmantel<br />
treffen. Gut verträglich kann IPK+<br />
bei posttraumatischen Zuständen<br />
angewendet werden. Freiäugig und<br />
palpatorisch kann schon nach einer<br />
Anwendung eine außergewöhnlich<br />
starke ödemverdrängende Wirkung<br />
festgestellt werden; teilweise ist es<br />
möglich, Schwellungen innerhalb einer<br />
Sitzung vollständig zu eliminieren.<br />
Expert:innen aus dem Bereich<br />
der Gefäßmedizin, denen die Wirkung<br />
an Patient:innen demonstriert<br />
wurde, bestätigen dies ausnahmslos.<br />
Möglicherweise finden sich über bisher<br />
noch nicht ausreichend beachtete<br />
wissenschaftliche Erkenntnisse Erklärungen.<br />
Abb. 2 Nach einer IPK+-Anwendung erkennt man vorübergehend ein Hautbild,<br />
das unzählige kleine Vertiefungen aufweist.<br />
20<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23
Kompression<br />
Quelle: Thermo Fisher Scientific<br />
Rheologische Grundlagen:<br />
chemische und<br />
physikalische Eigenschaften<br />
nicht Newton‘scher<br />
Fluide<br />
a. b.<br />
a. b.<br />
Fließkurven<br />
Rheologie – dieser aus dem Griechischen<br />
stammende Begriff bedeutet<br />
„die Lehre des Fließens“ [16]. Als Teil<br />
der Wissenschaft beschäftigt sie sich<br />
mit der Gestaltveränderung und dem<br />
Fließverhalten von Stoffen. Dieses bereits<br />
sehr alte Fachgebiet wurde als eigenständige<br />
Disziplin um 1930 von<br />
E. C. Bingham und M. Reiner in Easten<br />
(USA) begründet [17]. Umfangreiche<br />
Recherchen des Autors ergaben,<br />
dass vor ihm wohl noch nie eine Verbindung<br />
zwischen Lymphologie und<br />
Rheologie hergestellt wurde. Dies erscheint<br />
insofern interessant, als proteinreiche<br />
Ödeme eine den Abtransport<br />
hemmende Viskosität (Zähigkeit)<br />
aufweisen; je geringer diese ist, desto<br />
dünnflüssiger und daher fließfähiger<br />
wird ein Fluid. Da der bereits beschriebene<br />
„Entzündungscocktail“ reichlich<br />
biologische Polymere enthält, ist<br />
es naheliegend, dass eine solche Flüssigkeit<br />
sich in Bezug auf das Fließverhalten<br />
anders als ein Newton‘sches<br />
Fluid wie z. B. Wasser verhält [18]. In<br />
der Rheologie bezeichnet man eine<br />
solche als ein nicht Newton‘sches Fluid<br />
mit einem strukturviskosen Fließverhalten.<br />
Dies bedeutet: Wird die<br />
Flüssigkeit Scherkräften ausgesetzt,<br />
verringert sich deren Viskosität, synonymhaft<br />
spricht man dann von<br />
Strukturviskosität oder „pseudoplastic“<br />
[25]. Scherkräfte, die z. B. durch<br />
Rühren oder ein Durchwalken herbeigeführt<br />
werden, führen zu Veränderungen<br />
in solchen dann aufgebrochenen<br />
Strukturen. Polymere bestehen<br />
aus langkettigen Molekülen, die<br />
unter Ruhebedingungen eine knäuelartige<br />
Struktur einnehmen. In einer<br />
Strömung werden die Polymerketten<br />
orientiert, und die Anzahl der Verschlaufungen<br />
kann reduziert werden.<br />
Über einen solchen Vorgang erklärt<br />
sich letztlich die Reduktion der Viskosität<br />
[18] (Abb. 3). Ausgehend von der<br />
Erkenntnis, dass die Viskosität eines<br />
Fluides hauptsächlich von der inneren<br />
Reibung zwischen den Molekülen<br />
abhängt, spielen auch thermische<br />
Einflüsse eine gewichtige Rolle. Wärme<br />
verringert die Zähigkeit und führt<br />
darüber hinaus zu einer erhöhten Kinetik<br />
der Moleküle [19]. Zum Ende<br />
dieser Betrachtung muss noch festgestellt<br />
werden, dass sich unser Fluid<br />
unter Ruhebedingungen allmählich<br />
wieder in den ursprünglichen Zustand<br />
zurückbewegt, diesen Vorgang<br />
bezeichnet man in der Rheologie als<br />
Thixotropie [25]. Noch erwähnt sei,<br />
Abb. 3a – b Verzweigte oder ineinander verschlungene Molekülketten nach Schramm<br />
2004 [25], a) vor der Scherung, b) während der Scherung.<br />
Schubspannung<br />
Geschwindigkeitsgefälle<br />
➊ Newtonsche<br />
Flüssigkeit<br />
➌<br />
➊<br />
➍<br />
➋<br />
Viskosität η<br />
➋ Strukturviskose Flüssigkeit<br />
➌ Dilatante Flüssigkeit<br />
➍ Strukturviskose Flüssigkeit mit<br />
Fließgrenze = plastisches Fluid<br />
Viskositätskurven<br />
Geschwindigkeitsgefälle<br />
}<br />
➌<br />
➊<br />
➍<br />
dass es nicht Newton‘sche Fluide gibt,<br />
die gänzlich andere Reaktionsmuster<br />
aufzeigen, so z.B. dilatante Fluide,<br />
die sich unter dem Einfluss von Scherung<br />
verfestigen. Im Kontext dieser<br />
Abhandlung spielen diese aber keine<br />
Rolle [26] (Abb. 4).<br />
Nach Betrachtung der theoretischen<br />
Grundlagen erfolgt nun der Versuch,<br />
diese auf die Praxis zu übertragen,<br />
denn aus der Erfahrung heraus lassen<br />
sich weiche Ödeme immer deutlich<br />
schneller beseitigen als schwer dellbare,<br />
d. h. feste Schwellungen.<br />
Die Ödemreduktion unter Zuhilfenahme<br />
von IPK+: Betrachtet<br />
man, was unter einer Ödemtherapie<br />
mittels IPK+ geschieht, zeigt sich zunächst,<br />
dass unter einer Unzahl von<br />
fortlaufend auf den Hautmantel treffenden<br />
Schaumstoffwürfeln Scherkräfte<br />
induziert werden. Unter dieser<br />
dickwandigen Polsterung wird zudem<br />
Körperwärme zurückgehalten, die der<br />
Ödemflüssigkeit zugeführt wird. Der<br />
unter den Manschetten nach zentralwärts<br />
abnehmende Druck bewirkt<br />
eine starke, kontinuierliche Verdrängung<br />
der Ödemflüssigkeit, in deren<br />
Strömung es zur Streckung und Orientierung<br />
der Kettenmoleküle, verbunden<br />
mit reichlich Reibung zwischen<br />
diesen, kommt. Der Weg führt<br />
dabei durch die im lockeren Bindegewebe<br />
befindlichen Interzellularräume,<br />
die extrem enge Spalten aufwei-<br />
Nicht-Newtonsche<br />
Flüssigkeit<br />
Abb. 4 Fließ- und Viskositätskurve nach Schramm 2004 [25]. Newtonsche (links) und<br />
zum Vergleich (rechts) nicht-Newtonsche Flüssigkeiten mit strukturviskosem Fließverhalten.<br />
Für Geschwindigkeitsgefälle wird auch der Begriff Schergeschwindigkeit verwendet.<br />
Das Verhalten dilatanter Flüssigkeiten (3) und plastischer Flüssigkeiten (4)<br />
kann im Kontext dieser Abhandlung vernachlässigt werden.<br />
➋<br />
Quelle: Thermo Fisher Scientific<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23<br />
21
Kompression<br />
sen [20, 21]. Beim Hindurchzwängen<br />
kommt es abermals zur Scherung,<br />
und Abrisse in den Molekularketten<br />
wären durchaus denkbar. Die Summe<br />
all dieser Faktoren sollte somit zu<br />
verbesserten Fließeigenschaften der<br />
Ödemflüssigkeit beitragen und solange<br />
das Fluid unter der Anwendung<br />
gewärmt und im Fluss gehalten wird,<br />
wird sich kein thixotropes Verhalten<br />
ergeben [25]. In therapeutisch sinnvoller<br />
Weise wird das Ödem zu Körperbereichen<br />
mit intakten Lymphgefäßen<br />
geführt, wodurch dort die Sicherheitsventilfunktion<br />
des Lymphgefäßsystems<br />
(LGS) aktiviert wird.<br />
Schlussendlich verläuft dadurch die<br />
Drainage über aktivierte Lymphgefäße<br />
bis hin zum Ziel einer nahegelegenen<br />
regionären Lymphknotengruppe<br />
[8]. IPK+ unterstützt dabei insofern,<br />
als die Manschetten möglichst nahe<br />
an die anzusteuernde Lymphknotengruppe<br />
heranreichen oder diese im<br />
Optimalfall miteinschließen. Somit<br />
kann z. B. mittels einer entsprechend<br />
unterpolsterten Hosenmanschette,<br />
die bis über den Bauchnabel reicht,<br />
nicht nur auf die inguinalen Lymphknoten<br />
eingewirkt werden, sondern<br />
auch Ödemflüssigkeit aus der unteren<br />
Körperhälfte in das Tributargebiet der<br />
axillären Lymphknoten verschoben<br />
werden (Abb. 5).<br />
Weitere Vorteile der IPK+ bestehen<br />
darin, dass über Polsterungen<br />
anatomische Strukturen bewusst<br />
morphologisch verändert werden,<br />
da anwendende Personen nur so Einfluss<br />
auf die Druckübertragung von<br />
der luftgefüllten Manschette auf die<br />
Haut nehmen können. Über diesen<br />
Weg lassen sich dann Regionen behandeln,<br />
die ansonsten mit der klassischen<br />
IPK nicht erreicht werden. Bekannte<br />
Schwachstellen in der Knieund<br />
Leistenregion [22] sowie der unteren<br />
Rumpfquadrante, die ebenfalls<br />
von der IPK itA nur schlecht erfasst<br />
werden, sind hingegen durch Polsterungen<br />
gut in den Griff zu bekommen<br />
[1, 23]. Veröffentlicht wurden über<br />
Handmessungen und Fotografien gewonnene<br />
Ergebnisse aus Praxistests<br />
des Autors und seines Teams. Bei Patienten<br />
mit Lymphödemen an den Extremitäten<br />
wurden dabei nach 60-minütigen<br />
IPK-itA- und IPK+-Anwendungen<br />
gewonnene Entstauungsergebnisse<br />
verglichen. Auffällig waren<br />
milde Ödemzunahmen im Kniebereich<br />
und proximal am Oberschenkel.<br />
Abb. 5 IPK+-Anwendung in einer entsprechend unterpolsterten Hosenmanschette, die<br />
bis über den Bauchnabel reicht. So kann nicht nur auf die inguinalen Lymphknoten eingewirkt<br />
werden, sondern auch Ödemflüssigkeit aus der gesamten unteren Körperhälfte in<br />
das Tributargebiet der axillären Lymphknoten verschoben werden, siehe auch [24].<br />
Hingegen war die ödemverdrängende<br />
Wirkung unter IPK+ weitaus stärker<br />
und auch durchgängig feststellbar. In<br />
einer im Dezember 2022 veröffentlichten<br />
Studie der Universitätsmedizin<br />
Greifswald wird dies bestätigt [1].<br />
In dieser Studie waren 18 Patienten<br />
mit Lymphödemen der Beine eingeschlossen<br />
und erfuhren eine Komplexe<br />
Physikalische Entstauungstherapie<br />
bis zu einem Volumenminimum<br />
und einer nachweisbaren Ödemreduktion.<br />
Hierfür wurden die Patienten<br />
täglich mit Hilfe 3D-gestützter<br />
Volumenrekonstruktion vermessen.<br />
Nach dem Eintreten des Volumenminimums<br />
erfolgte eine weitere Entstauungstherapie;<br />
verglichen wurden<br />
dabei Ergebnisse nach erfolgten IPKund<br />
IPK+-Anwendungen. Über IPK+<br />
konnte eine signifikant stärkere Volumenreduktion<br />
insbesondere auch<br />
in der Knieregion gezeigt werden als<br />
vergleichsweise mittels IPK itA. In der<br />
Erhaltungsphase wurden die Patienten<br />
mit medizinischen Kompressionsstrümpfen<br />
versorgt. Diese zeigten<br />
sich nach Entlassung geeignet, das<br />
Wiederanschwellen der Beine nach<br />
KPE in den Follow-up-Visiten bis zu 6<br />
Wochen zu konservieren.<br />
Bei Patient:innen mit Schwellungen<br />
im Genitalbereich wird in der<br />
Leitlinie von einer Therapie mittels<br />
IPK itA abgeraten. Eine sehr gute<br />
ödemverdrängende Wirkung im<br />
Rumpf- und Genitalbereich kann<br />
aber nach regelgerechtem Aufbringen<br />
von Polsterungen erreicht werden.<br />
In bisher noch jedem Fall gelang<br />
dies unabhängig vom Geschlecht. Fotografien,<br />
die den Zustand vor und<br />
nach solchen IPK+-Therapien zeigen,<br />
wurden bereits veröffentlicht [9, 24].<br />
Bisweilen noch hypothetisch, aber<br />
durchaus vorstellbar wäre, dass unter<br />
IPK+-Anwendungen, die wie auch bei<br />
der MLD nur mit leichtem Druck ausgeführt<br />
werden, eine Steigerung der<br />
Lymphangiomotorik erzielt wird, da<br />
die unebenen Oberflächen die Wandungen<br />
der epifaszialen Lymphgefäße<br />
erreichen müssten. Selbst zu den<br />
reichlich zwischen den derb strukturierten<br />
Lymphknoten liegenden<br />
Lymphgefäßen, die über MLD kaum<br />
erreicht werden, sollten die über die<br />
kleinen Schaumstoffwürfel ausgeübten<br />
Druckreize auch dort gut appliziert<br />
werden können.<br />
Erfahrungen<br />
1. Zustand nach Liposuktion: Bei<br />
dieser Patientinnen-Gruppe verfügt<br />
der Anwender in enger ärztlicher<br />
Kooperation seit 2017 über<br />
Erfahrung aus der Therapie von<br />
weit mehr als 30 Fällen. Bei den Betroffenen<br />
Frauen imponieren postoperativ<br />
in der gesamten unteren<br />
Körperhälfte ausgeprägte posttraumatische<br />
von Hämatomen begleitete<br />
Ödeme. Die Patientinnen sind 24<br />
Stunden postoperativ und daher zu<br />
Beginn der ersten Therapiesitzungen<br />
sehr berührungsempfindlich;<br />
die Bewegung ist deutlich einge-<br />
22<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23
Kompression<br />
schränkt; starke Schmerzzustände<br />
sind die Regel. Auch wenn ein<br />
solcher Zustand nicht in einen direkten<br />
Bezug zu posttraumatischen<br />
Zuständen, wie sie bei Athletinnen<br />
und Athleten vorkommen, gestellt<br />
werden kann, sind die gesammelten<br />
Erfahrungen übertragbar, weil<br />
es letztendlich in der Therapie<br />
nicht auf die Ursache einer Traumatisierung<br />
ankommt. Interessant ist,<br />
dass IPK+-Behandlungen selbst bei<br />
einem solch hohen Schweregrad an<br />
Traumatisierung in bisher jedem<br />
Fall gut verträglich, d. h. schmerzfrei<br />
und ohne Komplikationen mit<br />
guten Endresultaten, durchgeführt<br />
werden konnten. Mehrheitlich sind<br />
die Rückmeldungen der Patientinnen<br />
u. a. im Hinblick auf die Reduktion<br />
von Schmerz und die Verbesserung<br />
der Beweglichkeit sehr<br />
erfreulich. Unter den IPK+-Anwendungen<br />
kommt es verglichen mit<br />
MLD zu einer erheblich stärkeren<br />
sicht- und tastbaren Ödemreduktion.<br />
Ab einem bestimmten Schweregrad<br />
gelingt es sogar, die passager<br />
wiederkehrenden Schwellungen<br />
innerhalb einer Sitzung vollständig<br />
zu eliminieren. Palpatorisch stellen<br />
sich die entstauten Bereiche letztendlich<br />
meist als ein gut gelockertes<br />
und unauffälliges Hautbild dar.<br />
Unerlässlich ist eine begleitende<br />
Therapie mittels qualitativ hochwertiger<br />
medizinischer Kompressionsstrumpfversorgung<br />
(KSV).<br />
2. Zustand nach operativen Eingriffen<br />
im Bereich der Knieregion:<br />
In enger Analogie zu dem vorangegangenen<br />
Bericht bestehen ebenso<br />
gute Erfahrungen auch bei dieser<br />
Patientengruppe und der Durchführung<br />
eines solchen Therapieregimes:<br />
Patient:innen erhalten<br />
auch hier präoperativ eine KSV<br />
und werden im Optimalfall zusammen<br />
mit einer weiteren Person<br />
aus dem häuslichen Umfeld durch<br />
eine Fachkraft in der Anwendung<br />
von IPK+ unterwiesen, die auch<br />
die erste Anwendung überwacht.<br />
Weitere IPK+-Behandlungen können<br />
Patient:innen, begleitet von<br />
Visiten im Haus oder einer Klinikeinrichtung,<br />
stets in Verbindung<br />
mit der bereits vorhandenen<br />
KSV, selbstständig ausführen.<br />
Leihweise steht die Technik den<br />
Patient:innen rund um die Uhr<br />
zur Verfügung, so ist jede von<br />
Ärzt:innen, Therapeut:innen und<br />
Patient:innen als sinnvoll zu erachtende<br />
Dosierung gewährleistet.<br />
Die Therapieziele sind auch<br />
hier die Vermeidung möglicher<br />
Komplikationen, die Verringerung<br />
der Schmerzhaftigkeit und die Beschleunigung<br />
des Heilungsverlaufs.<br />
3. Regeneration: IPK+-Behandlungen<br />
wurden auch mit einer Sportlerin<br />
(Leichtathletin) und einer<br />
ebenfalls professionell arbeitenden<br />
Balletttänzerin durchgeführt, die<br />
bereits reichlich Erfahrung mit<br />
IPK itA hatten. Beide begaben sich<br />
regelmäßig über 2 Monate zu IPK+-<br />
Sitzungen nach Training, Auftritten<br />
bzw. Wettkämpfen und schätzen<br />
diese als eine sehr wirkungsvolle<br />
Maßnahme zur Regeneration<br />
ein. Die Anwendungen wurden<br />
mittels Hosenmanschette durchgeführt,<br />
sodass die Unterpolsterung<br />
auch über den inguinalen Lymphknoten<br />
wirken konnte. Übereinstimmend<br />
äußerten sich beide Probandinnen,<br />
dass sie eine Anwendung<br />
mit IPK+ als wirkungsvoller<br />
und angenehmer empfanden als<br />
eine ohne solche Unterpolsterung.<br />
Palpatorisch konnte der Anwender<br />
feststellen, dass sich Schwellungen<br />
der regionären Lymphknoten verminderten<br />
[2].<br />
Wer kann die Methode<br />
anwenden, und wie sollte<br />
diese eingesetzt werden?<br />
Im Idealfall sollte eine Behandlung<br />
von Ärzt:innen und Lymphdrainage-Therapeut:innen<br />
mit bereits bestehender<br />
Erfahrung in der Therapie<br />
von posttraumatischen bzw. postoperativen<br />
Ödemen eingeleitet werden;<br />
denn eine Unterweisung im therapeutischen<br />
Umgang mit dieser Problematik<br />
ist zu dem Zeitpunkt bereits über<br />
einen Ausbildungslehrgang in MLD/<br />
KPE erfolgt. Bezüglich der Intensität,<br />
Zeitdauer etc. orientiert man sich bei<br />
einem Einsatz der IPK+ analog an einer<br />
bereits vermittelten Vorgehensweise.<br />
Grundsätzlich steht der Autor<br />
darüber hinaus gerne beratend zur<br />
Verfügung.<br />
Kontraindikationen: Es gelten bei der<br />
Anwendung der IKP+ die für die MLD/<br />
KPE bekannten und in den Leitlinien aufgeführten<br />
Gegenanzeigen [11, 14].<br />
IPK+-Anwendungen müssen für<br />
die Patienten beschwerdefrei durchgeführt<br />
werden können; ist dies nicht<br />
gegeben, sollte keine IPK+-Behandlung<br />
durchgeführt werden.<br />
Klaustrophobie (Platzangst) macht<br />
ab bestimmten Schweregraden eine<br />
Anwendung unter Umständen nicht<br />
möglich. Sehr selten ereignen sich allergische<br />
Hautreaktionen nach einem<br />
Kontakt mit Schaumstoffen.<br />
Fazit<br />
IPK+ arbeitet, basierend auf Intermittierender<br />
Pneumatischer Kompression<br />
in traditioneller Arbeitsweise, mit<br />
zusätzlichem Einsatz von definierten<br />
Multifunktionsunterpolsterungen.<br />
Im Vergleich zu einer herkömmlichen<br />
Art der IPK-Anwendung ergeben sich<br />
folgende Vorteile:<br />
– Die in einer Zeiteinheit mobilisierte<br />
Flüssigkeitsmenge fällt erheblich<br />
höher aus als mit der klassischen<br />
IPK bzw. mit manueller Lymphdrainage.<br />
Ein in diesem Zusammenhang<br />
neuer hypothetischer<br />
Erklärungsversuch ist, dass es neben<br />
anderen Faktoren über IPK+-<br />
Behandlungen gelingen könnte,<br />
die Viskosität eiweißreicher Ödeme<br />
zu reduzieren, um auf diesem Weg<br />
eine effektivere und schnellere Entstauung<br />
zu erzielen.<br />
– An den Extremitäten wird durchgehend<br />
eine gleichmäßige Ödemreduktion<br />
erreicht. Die bekannten<br />
Schwachstellen im Knie- und Leistenbereich,<br />
wie sie bei der IPK itA<br />
bestehen, können somit überwunden<br />
werden [1, 22, 23].<br />
– War es bisher eine alleinige Domäne<br />
der MLD/KPE, kräftezehrend<br />
und in zeitaufwendiger Handarbeit<br />
krankhaft verfestigtes Gewebe zu<br />
behandeln, gelingt es nun auch,<br />
den epifaszialen Gewebezylinder<br />
großflächig über einen apparativen<br />
Weg effektiv zu erweichen und zu<br />
entstauen.<br />
– Bisher erschien es so, dass eine<br />
entstauende Wirkung genital<br />
und in den unteren Rumpfquadranten<br />
über IPK nicht möglich<br />
ist [14]. Ausschließlich MLD/KPE<br />
wurde innerhalb der konservativen<br />
Therapie zugetraut, dort eine<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23<br />
23
Kompression<br />
Wirkung zu erzielen. Wird jedoch<br />
mittels elastischem Polstermaterial<br />
unter der IPK-Manschette ein<br />
morphologischer Umbau vorgenommen,<br />
ermöglicht diese Maßnahme<br />
eine zielgerichtete Druckübertragung<br />
und somit auch eine<br />
signifikant entstauende Wirkung<br />
auf alle Strukturen innerhalb der<br />
Rumpfquadranten.<br />
– IPK+ ist kostengünstig, schnell<br />
erlernbar und steht Patient:innen<br />
jederzeit an jedem Ort zur Verfügung.<br />
Darüber hinaus wird eine<br />
Anwendung mit Unterpolsterung<br />
signifikant als deutlich angenehmer<br />
empfunden als IPK auf traditionelle<br />
Weise.<br />
Danksagung<br />
Mein besonderer Dank gilt dem Präsidenten<br />
der Deutschen Rheologischen<br />
Gesellschaft, Prof. Dr. Ulrich Handge,<br />
der sich viel Zeit nahm, um sich zum<br />
einen mit dem ihm bisweilen fremden<br />
Thema der Kompressionstherapie zu<br />
befassen und zum anderen den rheologischen<br />
Teil dieser Publikation beratend<br />
zu begleiten. Außerdem danke ich<br />
herzlich Dr. med. Navina Kuß, welche<br />
sich wissenschaftlich u. a. im Bereich<br />
der Rheologie bewegt, mich ebenfalls<br />
gut beriet und mich zu weiterführenden<br />
Literaturquellen führte. Die Bestätigung<br />
beider Wissenschaftler:innen,<br />
dass mein Ansatz in die richtige Richtung<br />
geht, erfreut mich sehr und bedeutet<br />
mir einen großartigen Ansporn.<br />
Der Autor:<br />
Martin Morand<br />
Fachlehrer für Manuelle Lymphdrainage/Komplexe<br />
Physikalische<br />
Entstauungstherapie<br />
morand@t-online.de<br />
www.methode-morand.de<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Morand M.Therapie mittels IPK plus definierte Polsterungen (IPK+) bei posttraumatischen bzw. postoperativen Ödemen unter Berücksichtigung der<br />
bio che mischen und biophysikalischen Eigenschaften. Orthopädie Technik, 2023; 74 (11): 48 – 54<br />
Literatur:<br />
[1] Konschake W et al. Optimisation of intermittent pneumatic Compression<br />
in patients with Lymphoedema of the legs. European Journal<br />
of Dermatology, 2022; 32: 781–792. doi: 10.1684/ejd. 2022.4382<br />
[2] Morand M. Führt eine definierte Abpolsterung unter der Intermittierenden<br />
pneumatischen Kompressionstherapie (IPK-Plus) zu<br />
einer Verbesserung der Entstauung beim Lymphödem? Lymphologie<br />
in Forschung und Praxis, 2019; 2 (23): 108–111<br />
[3] Morand M. Methode IPK +. The IPC + Method. https://www.me<br />
thode-morand.de/ (Zugriff am 15.07.2023)<br />
[4] Schwahn-Schreiber C. IPK-Leitlinie. In: Raabe E, Reich-Schupke<br />
S (Hrsg.). Intermittierende pneumatische Kompressionstherapie.<br />
Ein Leitfaden für Klinik und Praxis. Köln: Wirtschafts- und Praxisverlag,<br />
2020: 35<br />
[5] Lichtenthal A. Regeneration im Sport In: Raabe E, Reich-Schupke<br />
S (Hrsg.). Intermittierende pneumatische Kompressionstherapie.<br />
Ein Leitfaden für Klinik und Praxis. Köln: Wirtschafts- und Praxisverlag,<br />
2020: 113<br />
[6] Basbaum A et al. Cellular and molecular mechanisms of pain.<br />
Cell, 2009; 139 (2): 267–284<br />
[7] Pritschow H et al. Das Lymphödem und die KPE. Ein Handbuch<br />
für die Praxis. Köln: Viavital, 2014: 62<br />
[8] Weissleder H, Schuchhardt C (Hrsg.). Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.<br />
Köln: Viavital, 2015: 47, 269<br />
[9] Morand M. Mobilisierende Gelenkdrainage (Manuelle Lymphdrainage<br />
der Gelenke). In: Raabe E, Reich-Schupke S (Hrsg.). Intermittierende<br />
pneumatische Kompressionstherapie. Ein Leitfaden für<br />
Klinik und Praxis. Köln: Wirtschafts- und Praxisverlag, 2020: 122<br />
[10] Winter J. Mobilisierende Gelenkdrainage (manuelle Lymphdrainage<br />
der Gelenke). In: Földi M, Földi E, Kubik S (Hrsg.). Lehrbuch<br />
der Lymphologie. 6. Auflage. München: Elvisier, 2005: 708<br />
[11] S2k-Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme<br />
[AWMF Reg.Nr. 058-001]. 2017. http://www.awmf.org/leitlinien/<br />
detail/ll/058-001.html<br />
[12] Hutzschenreuter P, Brümmer H, Ebberfeld K. Experimentelle und<br />
klinische Untersuchungen zur Wirkungsweise der manuellen Lymphdrainage-Therapie.<br />
Zeitschrift für Lymphologie, 1989; 13 (1): 62–64<br />
[13] Torres Lacomba M et al. Effectivness of early physitherapy to<br />
prevent lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised,<br />
single blinded, clinical trial. doi: 10.1136/bmj.b5396<br />
[14] Schwahn-Schreiber C et al. S1-Leitlinie Intermittierende pneumatische<br />
Kompression (IPK, AIK) [AWMF Reg.Nr. 037/007]. 2018.<br />
http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/037-007.html (Zugriff am<br />
15.07.2023)<br />
[15] Schrader A. Richtig regenerieren (Teil 1 und Teil 2). https://<br />
www.leichtathletik.de/training/grundlagen/richtig-regenerieren-1,<br />
https://www.leichtathletik.de/training/grundlagen/richtigregenerieren-2<br />
(Zugriff am15.07.2023)<br />
[16] Chemie.de. Rheologie. http://www.chemie.de/lexikon/Rheolo<br />
gie.html (Zugriff am 15.07.2023)<br />
[17] Pahl M, Gleißle W, Laun H-M. Praktische Rheologie der Technopolymere<br />
und Elastomere. 4. überarb. Auflage. Düsseldorf: VDI-<br />
Verlag, 1995<br />
[18] Schröder T. Rheologie der Technopolymere. München: Carl<br />
Hanser, 2020<br />
[19] Mahlet A et al. Temperature Dependence of Protein Solution<br />
Viscosity and Protein-Protein Interactions: Insights<br />
into the Origins of High-Viscosity Protein Solutions. Molecular<br />
Pharmaceutics, 2020; 17 (12): 4473–4482. doi: 10.1021/acs.<br />
molpharmaceut.0c00552<br />
[20] Wilig H, Swartz MA. Interstitial fluidand lymph formationand<br />
transport: physiological regulation and roles in inflammation<br />
and cancer. Physiological Review, 2012; 92 (3): 1005–1060. doi:<br />
10.1152/physrev.00037.2011<br />
[21] Asioli S et al. The pre-lymphatic pathway, the rooths of the<br />
lymphatic system in breast tissue: a 3D study. Virchows Archiv,<br />
2008; 453 (4): 401–406. doi: 10.1007/s00428-008-0657-y<br />
[22] Zaleska M et al. Intermittent Pneumatic Compression Enhances<br />
Formation of Edema Tissue Fluid Channels in Lymphedema of<br />
Lower Limbs. Lymphatic Research and Biologicy, 2015; 13: 146–<br />
153. doi: 10.1089/lrb.2014.0010<br />
[23] Jünger M et al. Evaluation der Intermittierend Pneumatischen<br />
Kompression (IPK) mit berührungsloser Volumenmessung (BT<br />
600). Vortrag auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft<br />
für Lymphologie. Bad Krozingen, Oktober 2019<br />
[24] Morand M. Genitallymphödeme / Lymphödem bds. Beine.<br />
https://www.methode-morand.de/?lang=de&page=methode-mo<br />
rand_ipk-plus&subpage=anwendungsbeobachtungen&article=beis<br />
piel_2 (Zugriff am 15.07.2023)<br />
[25] Schramm G. Einführung in die Rheologie und Rheometrie.<br />
Deutschland: Karlsruhe: Thermo Electron, 2004<br />
[26] Jelzko F, Koslowski B. Viskosität. Versuchsanleitung Ulm: Universität<br />
Ulm, 2023. https://www.uni-ulm.de/fileadmin/website_<br />
uni_ulm/nawi.inst.110/Grundpraktikum/Versuchsanleitungen/<br />
V05_viskositaet.pdf (Zugriff am 15.07.2023)<br />
24<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/23
Wissen, was<br />
los ist – immer<br />
und überall<br />
Der Newsletter<br />
Die Redaktion des Verlages Orthopädie-Technik bereitet wöchentlich die aktuellen<br />
und wichtigsten Meldungen der Branche für Sie im Newsletter auf.<br />
Ihr Extra<br />
Jeden 3. Donnerstag im Monat: Spezielle<br />
Themenschwerpunkte für eine bessere Versorgung.<br />
Jetzt anmelden<br />
Mittwoch<br />
ist<br />
OT-Newsletter-<br />
Tag<br />
ODER UNTER:<br />
www.360-ot.de/<br />
newsletteranmeldung
Kompression<br />
E. Mendoza<br />
Anwendung von Kompression<br />
gegen Müdigkeit, Übelkeit und<br />
Erbrechen in der Frühschwangerschaft<br />
Use of Compression Against Fatigue, Nausea and Vomiting<br />
in Early Pregnancy<br />
Die vorliegende Arbeit beleuchtet<br />
Forschungsergebnisse zur Anwendung<br />
von Kompressionsbestrumpfungen<br />
in der Frühschwangerschaft.<br />
Die Studie schloss 60 Probandinnen<br />
ein, bei denen mittels der Fragebögen<br />
NVPQoL, PUQE und CIVIQ Auskunft<br />
über die Trage erfahrungen<br />
erhoben wurde. Es konnte nachgewiesen<br />
werden, dass die Wirksamkeit<br />
einer Kompressionsversorgung<br />
gegen Müdigkeit, Übelkeit<br />
und Erbrechen in der Frühschwangerschaft<br />
genauso hoch ist wie bei<br />
aktuell zugelassenen Medikamenten<br />
– ohne die damit verbundenen<br />
Nebenwirkungen.<br />
Schlüsselwörter: Kompressionsstrümpfe,<br />
Schwangerschaft, Müdigkeit,<br />
Übelkeit, Erbrechen<br />
This study examines the results of<br />
research on the use of compression<br />
stockings in early pregnancy. The<br />
study included 60 women from<br />
whom information on their experience<br />
with compression was collected<br />
using the NVPQoL, PUQE and CIVIQ<br />
questionnaires. It was shown that<br />
the effectiveness of compression<br />
stockings against fatigue, nausea<br />
and vomiting in early pregnancy was<br />
just as high as for currently approved<br />
medication – without the associated<br />
side effects.<br />
Key words: compression stockings,<br />
pregnancy, fatigue, nausea, vomiting<br />
Einleitung<br />
Eine Schwangerschaft verursacht hormonelle<br />
Veränderungen; im ersten<br />
Drittel werden insbesondere Gestagene<br />
ausgeschüttet, das sogenannte<br />
Gelbkörperhormon, das verhindern<br />
soll, dass das Kind von der Gebärmutter<br />
abgestoßen wird und dass es zu einer<br />
Regelblutung kommt. Zusätzlich<br />
wird das Hormon β-HCG (HCG = Humanes<br />
Choriongonadotropin) ausgeschüttet,<br />
mit dem man die Schwangerschaft<br />
im Blut nachweisen kann.<br />
β-HCG und Gestagene haben eine<br />
ganz wesentliche Wirkung auf glatte<br />
Muskulatur: Sie verhindern, dass die<br />
glatte Muskulatur – die sogenannte<br />
unwillkürliche Muskulatur – sich zusammenzieht.<br />
Glatte Muskulatur befindet<br />
sich in den Wänden der Gefäße,<br />
in der Gebärmutter und auch in<br />
den Wänden des kompletten Magen-<br />
Darm-Trakts. Die Wände von Venen,<br />
Magen und Darm büßen also ihre<br />
muskuläre Wirksamkeit zumindest<br />
teilweise ein.<br />
Außerdem steigt das gesamte Blutvolumen<br />
einer Frau im ersten Drittel<br />
der Schwangerschaft um etwa einen<br />
Liter an. Der Zuwachs an Blut und<br />
die geweiteten Wadenvenen führen<br />
bei frühschwangeren Frauen häufig<br />
zu Problemen beim Stehen: In den<br />
Beinen tritt ein Spannungsgefühl sowie<br />
eine Schwellung auf. Dies erklärt<br />
auch, warum sich häufig Schwindelgefühle<br />
nach schnellem Aufstehen<br />
einstellen; möglicherweise bedingen<br />
diese beiden Effekte auch die für die<br />
Frühschwangerschaft typische Übelkeit<br />
– unmittelbar im Magen-Darm-<br />
Trakt oder indirekt durch einen Blutdruckabfall.<br />
Diese Effekte sind noch nicht abschließend<br />
erforscht. Nachgewiesen<br />
wurde aber bereits folgender Zusammenhang:<br />
Je höher der Blutwert der<br />
Schwangerschaftshormone β-HCG<br />
(und damit auch die Stärke der Übelkeit)<br />
im ersten Drittel der Schwangerschaft,<br />
desto gesünder wird das Kind:<br />
Es wird größer, es wird häufiger zum<br />
regulären Endtermin einer Schwangerschaft<br />
geboren, es stirbt seltener<br />
während der Schwangerschaft. Es<br />
wird vermutet, dass dieser Effekt ein<br />
Schutzmechanismus des Körpers ist,<br />
der dazu dient, Frauen vor schwerer<br />
körperlicher Belastung während der<br />
Schwangerschaft zu schützen [1].<br />
Heute gibt es Medikamente gegen<br />
Übelkeit; wenige davon sind in<br />
der Schwangerschaft zugelassen, einige<br />
erst seit relativ kurzer Zeit [2].<br />
Die Nebenwirkungen dieser Medikamente<br />
– insbesondere die Wirkstoffe<br />
Doxylaminsuccinat und Pyridoxin -<br />
hydrochlorid, enthalten etwa im Medikament<br />
„Cariban® 10 mg/10 mg“ –<br />
sind jedoch nicht unerheblich. Daher<br />
sind nebenwirkungsfreie Alternativen<br />
höchst willkommen.<br />
Stand der Forschung:<br />
Wirksamkeit von Kompression<br />
in der Schwangerschaft<br />
allgemein<br />
In einer groß angelegten italienischen<br />
Studie konnten Allegra und<br />
Kollegen nachweisen, dass venöse<br />
Symptome wie Schweregefühl, Spannung<br />
und Schwellung bei Schwangeren<br />
durch eine Kompressionsbehandlung<br />
nachhaltig gelindert werden<br />
können [3]. In der Studie wurden<br />
Kompressionskniestrümpfe der Klasse<br />
I verwendet, die ohne Einschränkungen<br />
auch in Deutschland verordnet<br />
werden können.<br />
26<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22
Kompression<br />
Für die Studie füllten 100 Frauen<br />
zwischen Woche 6 und Woche 28 ihrer<br />
Schwangerschaft zunächst einen<br />
CIVIQ-Fragebogen (siehe unten) zu<br />
ihren venenbedingten Beschwerden<br />
aus und wurden dann daraufhin befragt,<br />
ob sie Kompressionsstrümpfe<br />
tragen würden. Diese sollten bis zum<br />
Ende der Schwangerschaft so oft wie<br />
möglich tagsüber getragen werden.<br />
Bei denen, die eine Kompressionsversorgung<br />
wünschten, wurde im weiteren<br />
Verlauf erhoben, wie häufig sie diese<br />
trugen. Bei allen Teilnehmerinnen<br />
wurde im weiteren Verlauf der CIVIQ<br />
erneut abgefragt. Die Ergebnisse:<br />
– 30 Probandinnen (30 %) wollten<br />
keine Kompression tragen (ihr mittlerer<br />
CIVIQ-Wert lag bei 37).<br />
– 70 Probandinnen (70 %) wünschten<br />
eine Verordnung; davon trugen<br />
10 Frauen mindestens 2 Tage pro<br />
Woche die Kompressionsbestrumpfung<br />
(ihr CIVIQ-Wert lag zu Beginn<br />
im Mittel bei 44); 60 Frauen trugen<br />
täglich die Kompressionsversorgung<br />
(der CIVIQ-Mittelwert zu Beginn<br />
lag bei 48).<br />
Abb. 1 Ergebnisse der Studie von Allegra et al. [3]: Entwicklung der venösen Beschwerden<br />
während der Schwangerschaft bei Probandinnen, die die Kompression täglich trugen<br />
(gelb), bei denen, die sie 2 Tage pro Woche trugen (blau), und bei denen, die sie<br />
nicht trugen (grün). Die Ausgangswerte unterschieden sich; unter Kompression nahmen<br />
die Beschwerden dosisabhängig ab, ohne Kompression nahmen sie zu.<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Somit war der CIVIQ-Wert bei der<br />
Aufnahme in die Studie bei denjenigen<br />
Frauen deutlich geringer, die keine<br />
Kompressionsversorgung wünschten.<br />
Der während der Schwangerschaft<br />
erneut abgefragte CIVIQ verhielt<br />
sich wie folgt:<br />
– Bei den Frauen mit Kompression<br />
nahm der CIVIQ-Wert kontinuierlich<br />
ab; bei Kompression täglich:<br />
- 14,4 (+/– 9,6) Punkte, und zwar von<br />
48,8 (+/– 15,7) auf 34,4 (+/– 11,5); bei<br />
Kompression zweimal pro Woche:<br />
- 10,7 (+/– 11,3) Punkte, und zwar<br />
von 43,6 (+/– 16,1) auf 32,9 (+/– 8,8).<br />
– Bei den Frauen ohne Kompression<br />
ergab sich eine Erhöhung des<br />
CIVIQ-Werts (und damit eine<br />
Verschlechterung) von 36,6<br />
(+/– 15,6) auf 40,9 (+/– 17,7).<br />
Die Ergebnisse sind in Abbildung 1<br />
dargestellt.<br />
In der Studie konnten die Autoren<br />
feststellen, dass diejenigen Patientinnen,<br />
die keine Strümpfe gewünscht<br />
hatten, zu Anfang auch kaum über<br />
Beschwerden klagten. Die Beschwerden<br />
stiegen bei dieser unbehandelten<br />
Gruppe im Laufe der Schwangerschaft<br />
jedoch langsam an. Jene Patientinnen<br />
wiederum, die die Strümpfe getragen<br />
hatten, teilten sich in die Gruppen<br />
„häufiges Tragen“ und „seltenes Tragen“<br />
auf, und man konnte nachweisen,<br />
dass die Probandinnen mit den<br />
eingangs stärksten Symptomen auch<br />
am häufigsten die Strümpfe trugen.<br />
Die Autoren schlussfolgern daraus,<br />
dass Frauen mit Symptomen einer<br />
chronischen venösen Insuffizienz<br />
eine deutliche Linderung dieser<br />
Symp tome unter einer Kompressionsversorgung<br />
in der Schwangerschaft<br />
erfahren und dass diese Wirkung<br />
dosis abhängig ist, also von der Tragedauer<br />
beeinflusst wird.<br />
Fragestellung<br />
Die Fragestellung der im Folgenden<br />
erörterten Studie ergab sich im Zusammenhang<br />
mit einer Untersuchung<br />
zur Wirkweise von Kompression<br />
auf die Wadenmuskelpumpentleerung<br />
(mittels Luft-Plethysmografie).<br />
Als Zufallsbefund ergab sich<br />
dabei, dass schwangere Probandinnen<br />
von einer Abnahme der Übelkeit<br />
während der Studiendauer berichteten.<br />
Um einen möglichen Zusammenhang<br />
zu erhärten, wurden Patientinnen<br />
der Autorin, die in den darauffolgenden<br />
Monaten in der Frühschwangerschaft<br />
mit Verdacht auf<br />
eine Thrombose vorgestellt wurden,<br />
daraufhin befragt, ob sie Übelkeit<br />
verspürten. Nach dem Beginn der<br />
Kompressionstherapie wurden die<br />
Patientinnen ein bis zwei Wochen<br />
nach der Verordnung telefonisch befragt.<br />
Alle befragten Patientinnen bestätigten,<br />
die Übelkeit habe plötzlich<br />
deutlich abgenommen. Hieraus ergab<br />
sich die Hypothese über einen möglichen<br />
Zusammenhang zwischen einer<br />
Kompressionstherapie und einer Linderung<br />
typischer Beschwerden in der<br />
Frühschwangerschaft, der empirisch<br />
belegt werden sollte.<br />
Die im Folgenden vorgestellte forschungsinitiierte,<br />
prospektive, randomisierte<br />
und per Crossover-Design<br />
kontrollierte Studie wurde nach einer<br />
Unbedenklichkeitserklärung seitens<br />
der Ethikkommission der Ärztekammer<br />
Hannover und mit Unterstützung<br />
durch die Firma Sigvaris durchgeführt,<br />
die die Kompressionsstrümpfe<br />
stellte und die Vergütung des Statistikers<br />
übernahm, der die erhobenen<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22<br />
27
Kompression<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Abb. 2 Auswertung der Ergebnisse zum Fragebogen NVPQoL<br />
während der 4 Studienwochen. In Blau ist die Entwicklung<br />
der Übelkeit nach Lacroix [7] (abnehmend ab Woche 11)<br />
dargestellt, im Vergleich dazu die Entwicklung zwischen Anfangstag<br />
(„Baseline“) und der Kontrolle nach 2 und 4 Wochen.<br />
Die Verläufe ohne Kompression (schwarz) laufen relativ<br />
parallel zur blauen Linie, die Verläufe mit Kompression<br />
(gelb) im Vergleich dazu steil abnehmend.<br />
Abb. 3 Darstellung der Ergebnisse im Vergleich zu den Werten<br />
der Studie von Lacasse [5]); links die Werte der Gruppe mit Kompression<br />
in der 1. Phase, rechts die Gruppe mit Kompression in<br />
der 2. Phase. Der gefüllte Punkt visualisiert die Kontrolle nach<br />
der Phase mit Kompression; der grüne Messwert ist der Ausgangswert;<br />
der Messwert mit dem X in Gelb oder Vio lett betrifft die<br />
Phase ohne Kompression. Auch hier wird deutlich, dass die Werte<br />
des untersuchten Kollektivs leicht über den Werten von Lacasse<br />
liegen (dort wurden aber auch Frauen ohne Beschwerden eingeschlossen)<br />
und dass sich die Beschwerden bei Probandinnen mit<br />
Kompression deutlich besser entwickelt haben.<br />
Daten auswertete. Die Autorin selbst<br />
blieb stets unabhängig und erhielt für<br />
ihre Arbeit keine Vergütung.<br />
Studiendesign<br />
Probandinnen<br />
Das Studienkonzept sah vor, 60 Frauen<br />
während der Frühschwangerschaft<br />
zwei Wochen lang mit Kompressionsversorgung<br />
und zwei Wochen lang<br />
ohne Kompressionsversorgung ihren<br />
täglichen Verrichtungen nachgehen<br />
zu lassen und sie dabei mittels Fragebögen<br />
und Untersuchungen zu begleiten.<br />
Da Übelkeit und Erbrechen ein Maximum<br />
in der 11. Schwangerschaftswoche<br />
aufweisen und dann kontinuierlich<br />
bis zur 20. Woche nachlassen,<br />
wurden zwei Gruppen vorgesehen:<br />
– Die erste Gruppe (30 Probandinnen)<br />
erhielt zu Beginn 2 Wochen<br />
lang eine Kompressionsversorgung<br />
(2 Paar „Sigvaris Cotton 222 knielang“),<br />
um dann 2 Wochen keine<br />
mehr zu tragen.<br />
– Die zweite Gruppe (30 Probandinnen)<br />
startete ohne Kompressionsversorgung,<br />
um dann in der 3. und<br />
4. Woche der Studie Kompressionsstrümpfe<br />
zu tragen.<br />
Die Reihenfolge, sprich die Gruppenzugehörigkeit,<br />
wurde randomisiert;<br />
so wurde vermieden, dass eine<br />
Wirkung durch die natürliche Abnahme<br />
der Symptome vorgetäuscht wurde.<br />
Eingeschlossen wurden Patientinnen,<br />
die milde bis mittelstarke Übelkeit<br />
und Erbrechen zeigten. Frauen mit<br />
schwerer Übelkeit wurden dem Hausarzt<br />
beziehungsweise dem Frauenarzt<br />
zur Therapie zurücküberwiesen; Frauen<br />
ganz ohne Übelkeitssymp tome<br />
konnten nicht aufgenommen werden,<br />
weil kein Symptom zum Beobachten<br />
und Behandeln vorlag. Eingeschlossen<br />
wurden nur Frauen, die kei-<br />
ne Krampfadern oder Schwellungen<br />
aufwiesen; sie mussten mit Serien-<br />
Kompressionsstrümpfen bestrumpfbar<br />
sein, da diese sofort angelegt werden<br />
mussten.<br />
Die Schwangerschaft musste bei<br />
der Aufnahme zwischen Woche 10<br />
und Woche 14 liegen; die Probandinnen<br />
durften keine zusätzlichen Erkrankungen<br />
haben. Die schriftliche<br />
Einwilligung zur Studie war ebenfalls<br />
Voraussetzung (diese konnte jederzeit<br />
ohne Angabe von Gründen zurückgezogen<br />
werden). Ausschlusskriterien<br />
waren ein Alter unter 18 Jahren sowie<br />
das Nichtvermögen, deutsch verfasste<br />
Fragebögen zu lesen und zu verstehen.<br />
Am ersten Untersuchungstag<br />
wurden all diese Kriterien mit einer<br />
körperlichen Untersuchung sowie<br />
einem Gespräch erfasst. Zudem<br />
wurden eine Thrombose oder ein<br />
Zustand danach sowie eine Varikose<br />
mittels Duplex-Sonografie ausge-<br />
28<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22
Kompression<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Abb. 4 Einzelnachweise der<br />
prozentualen Veränderung des<br />
NVPQoL-Wertes im Vergleich<br />
zum Ausgangswert in der Phase<br />
mit (orange) und ohne Kompression<br />
(blau). Oben wird zunächst<br />
der globale Wert („Total“) aufgeführt,<br />
sodann in die verschiedenen<br />
Bereiche aufgegliedert: Einschränkungen<br />
des Alltags, negative Gefühle,<br />
Müdigkeit und Brechreiz.<br />
Darunter sind die Werte zu den<br />
eigenen 4 Fragen über Müdigkeit<br />
und Schwindelgefühle angegeben;<br />
** bedeutet eine Signifikanz von<br />
p < 0,01, *** bedeutet eine<br />
Signifikanz von p < 0,001.<br />
schlossen. Schließlich mussten jene<br />
Patientinnen ausgeschlossen werden,<br />
bei denen die Körpermaße eine<br />
Versorgung mit einem Serienstrumpf<br />
nicht erlaubten, da sie ggf. sofort versorgt<br />
werden mussten.<br />
Waren alle Kriterien erfüllt, zogen<br />
die Patientinnen das Los, ob sie sofort<br />
oder erst nach zwei Wochen Kompressionsstrümpfe<br />
erhielten. In der<br />
Gruppe „Kompression in der 1. Phase“<br />
gab es zwei Schwangerschaftsverluste;<br />
daher mussten hier 32 Frauen<br />
aufgenommen werden, um insgesamt<br />
30 Ergebnisse auswerten zu können.<br />
In der Gruppe „Kompression in<br />
der 2. Phase“ fielen zwei Probandinnen<br />
ebenfalls wegen Kindsverlusts<br />
aus, zudem erschienen zum zweiten<br />
Termin sieben Frauen nicht wieder –<br />
möglicherweise waren sie enttäuscht,<br />
weil sie das Gefühl hatten, es sei<br />
„nichts geschehen“.<br />
Material und Methode<br />
Die Instrumente zur Messung der<br />
Wirksamkeit der Kompression auf<br />
Übelkeit und Erbrechen bestanden in<br />
drei validierten Fragebögen:<br />
1. NVPQoL-Fragebogen (NVPQoL =<br />
Nausea and Vomiting in Pregnancy<br />
Quality of Life), der die Symptome<br />
der letzten 14 Tage und deren<br />
Auswirkung auf die Lebensqualität<br />
abfragt [4];<br />
2. PUQE-Fragebogen (PUQE = Pregnancy-Unique<br />
Quantification of<br />
Emesis and Nausea), der abends<br />
ausgefüllt wird und die Häufigkeit<br />
der Episoden an Übelkeit sowie das<br />
tatsächliche Erbrechen am Tag<br />
erhebt [5].<br />
3. Außerdem wurde der aus der<br />
Venenheilkunde bekannte CIVIQ-<br />
Fragebogen (CIVIQ = Chronic<br />
Venous Insufficiency QoL Questionnaire)<br />
eingesetzt, der die Auswirkungen<br />
der venentypischen<br />
Symptome auf die Lebensqualität<br />
abfragt [6].<br />
Abb. 5 Diagramm über die Veränderung der Müdigkeit durch<br />
das Tragen von Kompressionsbestrumpfung. Die Müdigkeit<br />
nimmt demnach in der Gruppe ohne Kompression in der<br />
1. Phase (gestrichelte Linie) zu und fällt mit Kompression<br />
deutlich ab. In der Gruppe mit Kompression in der 1. Phase<br />
(durchgezogene Linie) fällt sie dementsprechend stark ab und<br />
steigt nach Ablegen der Kompression wieder deutlich an. Auch<br />
die während der Schwangerschaft fortschreitenden venösen<br />
Symptome der Beine wie Schweregefühl und Schwellung konnten<br />
erwartungsgemäß durch die Kompressionsstrümpfe in der<br />
entsprechenden Phase verbessert werden (s. Abb. 6).<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22<br />
29
Kompression<br />
Quelle: Erika Mendoza<br />
Abb. 6 Prozentuale Veränderung des venösen Lebensqualitätsscores (CIVIQ), der sich ohne Kompression insgesamt (s. oben)<br />
und in fast allen Einzelbereichen verschlechtert (bis auf den sozialen Bereich), unter Kompression dagegen deutlich verbessert;<br />
* bedeutet eine Signifikanz von p < 0,05; *** bedeutet eine Signifikanz von p < 0,001.<br />
Aufgrund der eigenen Erfahrungen<br />
der Autorin, die selbst starke Müdigkeit<br />
in der Frühschwangerschaft verspürt<br />
hatte, die sich durch Kompressionsstrümpfe<br />
lindern ließ, wurde der<br />
zuletzt genannte Fragebogen um vier<br />
Fragen zu Müdigkeit und Schwindelgefühl<br />
ergänzt.<br />
Durchführung<br />
Die schwangeren Frauen füllten zu<br />
Beginn, nach zwei Wochen und am<br />
Ende der Untersuchung jeweils einen<br />
validierten Fragebogen zu folgenden<br />
Aspekten aus:<br />
– zur Häufigkeit von Übelkeit und<br />
Erbrechen sowie zu deren Auswirkungen<br />
auf die Lebensqualität<br />
(NVPQoL);<br />
– zu den Beinbeschwerden bei chronischer<br />
venöser Insuffizienz<br />
(CIVIQ).<br />
– Jeden Abend füllten sie zusätzlich<br />
einen PUQE-Fragebogen aus: zur Anzahl<br />
der Stunden mit Übelkeit, zur<br />
Anzahl an wirklichem Erbrechen<br />
und zur Anzahl der Stunden, in denen<br />
die Kompression getragen wurde<br />
(in der Phase, in der sie diese tragen<br />
sollten).<br />
Um das Tragen der Kompressionsstrümpfe<br />
während der Phase ohne<br />
Kompression sicher auszuschließen,<br />
wurden die Strümpfe für diese Zeit zurückgegeben<br />
oder nicht ausgehändigt.<br />
Abgesehen von den Übelkeitssymptomen<br />
wurde der für Venenbeschwerden<br />
konzipierte CIVIQ-Fragebogen den Patientinnen<br />
auch am Tag der Aufnahme<br />
in die Studie sowie an den Tagen 14<br />
und 28 zum Ausfüllen vorgelegt.<br />
Ergebnisse<br />
Die Diagramme in den Abbildungen<br />
2 bis 6 vermitteln die Ergebnisse der<br />
Untersuchungen zu den einzelnen<br />
Aspekten. Zu erkennen ist der natürliche<br />
Abfall der Symptome, der laut<br />
Lacroix und Kollegen [7] ohnehin ab<br />
Woche 11 einsetzt. Es lässt sich beobachten,<br />
dass bei den Patientinnen<br />
in der Gruppe ohne Kompression ein<br />
Symptomverlauf besteht, der fast parallel<br />
zu dieser Kurve verläuft (Abb. 2).<br />
Somit konnte zunächst nachgewiesen<br />
werden, dass das Studienkonzept<br />
stimmig war, da ähnliche Ergebnisse<br />
in der Phase ohne Kompression ermittelt<br />
wurden wie in der kanadischen<br />
Studie in Bezug auf die schwangerschaftsbedingte<br />
Übelkeit unbehandelter<br />
Schwangerer [4, 5, 7].<br />
In der Phase mit Kompression besserten<br />
sich die Symptome der Übelkeit<br />
und des Erbrechens deutlich<br />
(Abb. 2–4), Müdigkeit und Schwindelgefühl<br />
sogar geradezu frappierend<br />
(Abb. 5), die Lebensqualität in Abhängigkeit<br />
von Beinbeschwerden (CIVIQ)<br />
wie zu erwarten (Abb. 6).<br />
30<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22
Kompression<br />
Diskussion<br />
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse<br />
die oben aufgestellte Hypothese: Kompressionsstrümpfe<br />
lindern sowohl<br />
allgemeine Beinsymptome als auch<br />
Übelkeit und Erbrechen in der Frühphase<br />
einer Schwangerschaft, insbesondere<br />
aber Müdigkeit und Schwindelgefühle.<br />
Dies ist umso wertvoller,<br />
als es bei Kompressionsstrümpfen für<br />
junge Frauen so gut wie nie Kontraindikationen<br />
gibt.<br />
Ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen<br />
einschlägiger Studien über<br />
die Wirksamkeit von Medikamenten<br />
gegen Schwangerschaftsbeschwerden<br />
ist zwar angesichts unterschiedlicher<br />
Settings und abweichender Untersuchungszeiträume<br />
nicht zulässig. Allerdings<br />
wurde die Wirkweise der zugelassenen<br />
Medikamente gegen Übelkeit<br />
mit denselben Fragebögen gemessen<br />
wie in dieser Studie. Vergleicht<br />
man die jeweils erzielten Scores, ist<br />
eine Kompressionsversorgung den getesteten<br />
Medikamenten sogar überlegen<br />
[2, 3]. Insofern müsste nach Ansicht<br />
der Autorin ein ärztliches Rezept<br />
über eine geeignete Kompressionsbestrumpfung<br />
Bestandteil des ersten<br />
Informationspakets zur Schwangerschaft<br />
sein, das jede schwangere Frau<br />
erhält.<br />
Weitere Indikationen<br />
Frauen mit Krampfadern sollten während<br />
der Schwangerschaft mindestens<br />
Kompressionskniestrümpfe – bei<br />
Krampfadern besonders im Leistenbereich<br />
auch schenkellange Strümpfe<br />
oder Strumpfhosen – tragen. Patientinnen<br />
mit Thrombosen oder einem<br />
Risiko für Thrombosen müssen<br />
besonders in der Schwangerschaft –<br />
der vulnerabelsten Phase für Thrombosen<br />
im Leben einer Frau – und bis<br />
zum Ende des Kindbetts (6 Wochen<br />
nach der Entbindung) ebenfalls eine<br />
Kompressionsversorgung tragen. Zur<br />
Thromboseprophylaxe genügt immer<br />
ein Kniestrumpf.<br />
Fazit<br />
Kompressionsstrümpfe der Klasse I lindern<br />
die für eine Schwangerschaft typischen<br />
Beinbeschwerden wie Schweregefühl<br />
und Schwellung dosisabhängig<br />
– je länger sie getragen werden, desto<br />
wirksamer sind sie [7]. Kompressionskniestrümpfe<br />
der Klasse II lindern darüber<br />
hinaus, wie gezeigt wurde, aber<br />
auch Symptome der Frühschwangerschaft<br />
wie Übelkeit, Erbrechen und insbesondere<br />
Müdigkeit und Schwindelgefühle<br />
nach dem Aufstehen. Auch hier<br />
reicht nach dem Dafürhalten der Autorin<br />
eine Kompressionsversorgung der<br />
Klasse I aus; es liegen genügend Daten<br />
aus Meta-Analysen vor, die die Gleichwertigkeit<br />
beider Kompressionsklassen<br />
– sogar in der Anwendung bei Pathologien<br />
wie Ulcus cruris – nachweisen.<br />
Darüber hinaus ist es in der Schwangerschaft<br />
für Patientinnen mit Krampfadern,<br />
Thrombosen oder gesteigertem<br />
Thromboserisiko besonders wichtig,<br />
Kompressionsstrümpfe zu tragen.<br />
Es ist angesichts der hier vorgestellten<br />
Forschungsergebnisse zu<br />
wünschen, dass Versorgende im Sanitätsfachgeschäft<br />
sowie Vertreterinnen<br />
und Vertreter von Kompressionsstrumpfherstellern<br />
dazu beitragen,<br />
Gynäkologinnen und Gynäkologen,<br />
aber auch die unmittelbare Zielgruppe<br />
der Frauen in der Frühphase ihrer<br />
Schwangerschaft über diese Zusammenhänge<br />
aufzuklären.<br />
Die Autorin:<br />
Dr. med. Erika Mendoza<br />
Fachärztin für Allgemeinmedizin<br />
Venenpraxis Wunstorf<br />
Speckenstraße 10<br />
31515 Wunstorf<br />
info@venenpraxis-wunstorf.de<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Mendoza E. Anwendung von Kompression gegen Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen in der Frühschwangerschaft. Orthopädie Technik, 2022; 73 (12): 40 – 45<br />
Literatur:<br />
[1] Mendoza E, Amsler F. A randomized crossover trial on the effect of compression stockings on nausea and vomiting in<br />
early pregnancy. International Journal of Women’s Health, 2017; 9: 89–99<br />
[2] Koren G, Clark S, Hankins GD, et al. Effectiveness of delayed-release doxylamine and pyridoxine for nausea and<br />
vomiting of pregnancy: a randomized placebo controlled trial. Am J Obstet Gynecol, 2010; 203 (6): e571–577<br />
[3] Allegra C, Antignani PL, Will K, Allaert F. Acceptance, compliance and effects of compression stockings on venous<br />
functional symptoms and quality of life of Italian pregnant women. Int Angiol, 2014; 33: 357–364<br />
[4] Chandra K. Development of a health-related quality of life (HRQL) instrument for nausea and vomiting in pregnancy<br />
(NVP), 2000<br />
[5] Lacasse A, Rey E, Ferreira E, Morin C, Berard A. Validity of a modified Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and<br />
Nausea (PUQE) scoring index to assess severity of nausea and vomiting of pregnancy. Am J Obstet Gynecol, 2008; 198 (1):<br />
e71–77<br />
[6] Launois R, Reboul-Marty J, Henry B. Construction and validation of a quality of life questionnaire in chronic lower<br />
limb venous insufficiency (CIVIQ). Qual Life Res, 1996; 5 (6): 539–554<br />
[7] Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity,<br />
and patterns of change. Am J Obstet Gynecol, 2000; 182 (4): 931–937<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 12/22<br />
31
Kompression<br />
H. Schulze<br />
Selbstmanagement in der<br />
Lymphologie<br />
Self-Care in Lymphology<br />
Sowohl bei lymphologischen Erkrankungen<br />
als auch bei lymphologischen<br />
Defiziten (ein Ödem ist lediglich ein<br />
Symptom und keine Erkrankung) ist<br />
ein adäquates Selbstmanagement<br />
der Betroffenen unverzichtbar. Denn<br />
ohne zielgerichtetes Selbstmanagement<br />
als fünfte Säule der Komplexen<br />
Physikalischen Entstauungstherapie<br />
(KPE) wird die Therapie nicht<br />
gelingen. In Deutschland wurde in<br />
diesem Zusammenhang bisher allerdings<br />
nur wenig Patientenedukation<br />
betrieben. In der 2017 veröffentlichten<br />
S2k-Leitlinie „Diagnostik<br />
und Therapie der Lymph ödeme“ [1]<br />
erhält die unterstützende Selbstbehandlung<br />
zwar eine größere Bedeutung<br />
– jedoch hat sie erfahrungsgemäß<br />
bisher weniger Augenmerk<br />
erhalten als die vier weiteren Maßnahmen<br />
im Bereich der Komplexen<br />
Physikalischen Entstauungstherapie.<br />
Kompressionstherapie, Bewegungstherapie<br />
(idealerweise in Kompression),<br />
Hautpflege und Manuelle<br />
Lymphdrainage sind nur im Zusammenspiel<br />
mit einem unterstützenden<br />
Selbstmanagement sinnvoll und<br />
führen nur dann zu einer erfolgreichen<br />
Therapie.<br />
Insofern muss die Eigeninitiative<br />
von Betroffenen mit Ödemerkrankungen<br />
hierzulande deutlich mehr<br />
motiviert werden; dazu müssen die<br />
Zusammenhänge erläutert werden.<br />
Das gilt ganz besonders für das ambulante<br />
Versorgungsfeld. Denn dort<br />
können sich Betroffene mehr einbringen<br />
und dadurch den Therapieerfolg<br />
deutlich mitgestalten [2]. Bedeutende<br />
Bausteine eines adäquaten<br />
Selbstmanagements bei lymphologischen<br />
Erkrankungen sind, nach<br />
Wichtigkeit sortiert: Konsequenz im<br />
Tragen der Kompression, geeignete<br />
Bewegungsübungen in Kompression,<br />
eine gut ausgeführte Hautpflege<br />
und eine patientenadaptive Schulung<br />
mit einigen Techniken der Manuellen<br />
Lymphdrainage – dies alles<br />
idealerweise als Rituale in den Alltag<br />
der Betroffenen eingebunden. Das<br />
alles setzt eine gute Patientenedukation<br />
voraus. Diese sollte niederschwellig,<br />
in patientenorientierter<br />
Sprache und partnerschaftlich formuliert<br />
sein. Der Artikel zeigt die<br />
Wichtigkeit des Selbstmanagements<br />
in der KPE auf und erläutert, warum<br />
die Behandlung von Ödemerkrankungen<br />
oft nicht in ausreichender<br />
Weise stattfindet.<br />
Schlüsselwörter: Lymphödem,<br />
Selbstmanagement, Patientenedukation,<br />
Ödemerkrankungen, Komplexe<br />
Physikalische Entstauungstherapie,<br />
Lipödem<br />
For lymphological diseases as well as<br />
for lymphological deficits, (oedema<br />
is only a symptom, not a disease)<br />
proper self-management of those<br />
affected is indispensable. Treatment<br />
will not be successful without specific<br />
self-management as the fifth pillar<br />
of complete decongestive therapy<br />
(CDT). In Germany, very little has<br />
been done in this area with respect<br />
to patient education. In the S2k<br />
guideline on “Diagnostics and Treatment<br />
of Lymphoedema” published<br />
in 2017, [1] more importance is<br />
assigned to supportive self-management<br />
– but unfortunately, experience<br />
shows that far less attention has been<br />
given to it than the other four measures<br />
of complex decongestive therapy.<br />
Compression therapy, movement<br />
therapy (ideally in compression), skin<br />
care and manual lymphatic drainage<br />
are useful, and lead to successful<br />
treatment only in combination with<br />
supportive self-management.<br />
Persons in Germany affected with<br />
oedema diseases must therefore be<br />
motivated to be considerably more<br />
proactive; the correlations must be<br />
explained. This is especially important<br />
in the area of outpatient care.<br />
Persons affected can become more<br />
involved here and contribute significantly<br />
to the success of treatment<br />
[2]. Important components of<br />
proper self-management for lymphological<br />
diseases are listed in order<br />
of importance: consistently wearing<br />
compression, suitable movement exercises<br />
in compression, well executed<br />
skin care and patient-adaptive training<br />
in a few techniques of manual<br />
lymphatic drainage – and all these<br />
should ideally be integrated into the<br />
daily routine of those affected. All of<br />
this requires good patient education,<br />
which should be easily accessible, in<br />
patient-oriented language and based<br />
on partnership. This article points out<br />
the importance of self-management<br />
in CDT and explains why treatment of<br />
oedema diseases is often inadequate.<br />
Key words: lymphoedema, self-management,<br />
patient education, oedema<br />
diseases, complete decongestive<br />
therapy, lipoedema<br />
Einleitung<br />
International spielt das Selbst ma nagement<br />
von Patienten und Patientinnen<br />
bei lymphologischen Defiziten<br />
und Erkrankungen eine große Rolle;<br />
in Deutschland hingegen gewinnt<br />
die Rolle des Selbstmanagements innerhalb<br />
der Therapie vor allem im<br />
ambulanten Bereich nur langsam an<br />
32<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/22
Kompression<br />
Bedeutung [3, 4]. Im internationalen<br />
Vergleich ist in vielen Ländern die Infrastruktur<br />
der Diagnostik und Therapie<br />
von Ödemerkrankungen nicht<br />
ausreichend ausgebaut, wodurch dem<br />
Selbstmanagement von vornherein<br />
eine größere Bedeutung zukommt. In<br />
Deutschland hingegen gibt es eine gut<br />
ausgebaute Therapie-Infrastruktur,<br />
wodurch sich bei Patienten eine gewisse<br />
Erwartungshaltung ergibt: „Da<br />
ich therapiert werde, muss ich nicht<br />
selbst therapieren.“ In der Diagnostik<br />
sieht es hier schon wieder anders aus.<br />
Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich,<br />
dass das Lymphgefäßsystem weltweit<br />
ein „blinder Fleck“ innerhalb der<br />
Medizin und in den ärztlichen Ausbildungen<br />
nahezu nicht vertreten ist [3,<br />
5]. Diese Situation macht die Diagnose<br />
und die bedarfsgerechte Behandlung<br />
lymphologischer Erkrankungen<br />
deutlich komplizierter als beispielsweise<br />
bei klassischen Krankheitsbildern<br />
in der Inneren Medizin. Dabei<br />
ist eine Basisdiagnostik mit Anamnese,<br />
Inspektion und Palpation relativ<br />
einfach durchführbar [6, 7].<br />
Mittlerweile hat sich die Erkenntnis<br />
durchgesetzt, dass das Lymphgefäßsystem<br />
in den Extremitäten ca. 95<br />
bis 98 % der interstitiellen Flüssigkeit<br />
aufnimmt und zum Blutkreislauf<br />
zurückführt [8, 9, 10]. Somit ist<br />
die Starling-Gleichung aus dem Jahr<br />
1896, die den durch hydrostatische<br />
und onkotische Kräfte verursachten<br />
Nettofluss über eine kapilläre Membran<br />
beschreibt, nicht mehr gültig,<br />
auch wenn sie teils immer noch gelehrt<br />
wird. Die neuen Erkenntnisse<br />
belegen deutlich den hohen Stellenwert<br />
des Lymphgefäßsystems beim<br />
Abtransport interstitieller Flüssigkeit<br />
im gesamten Organismus.<br />
Viele Betroffene sind lange Zeit auf<br />
der Suche nach einer adäquaten Diagnose<br />
und haben nicht selten einen<br />
regelrechten „Ärztemarathon“ hinter<br />
sich. In diesem Zusammenhang stellte<br />
man fest, dass nach dem Auftreten<br />
der ersten Symptome bis zur Einleitung<br />
einer adäquaten Behandlung<br />
im Schnitt 4,5 Jahre vergehen [5]. Erst<br />
in jüngerer Zeit scheint sich eine Verkürzung<br />
dieser Zeitspanne anzubahnen<br />
– was wohl auch darauf zurückzuführen<br />
ist, dass Strukturen wie ambulante<br />
Lymphnetze lokal oft gute Arbeit<br />
leisten.<br />
Während der Behandlung in den<br />
lymphologisch ausgerichteten Fachkliniken<br />
werden die Betroffenen im<br />
Selbstmanagement oft gut geschult,<br />
beispielsweise in der Selbstbandagierung.<br />
Im ambulanten Bereich dagegen<br />
wird dieses Wissen oft nicht ausreichend<br />
vermittelt, geschult und somit<br />
auch nicht ausgeführt. Ziel dieses<br />
Artikels ist es, für das Selbstmanagement<br />
in der Lymphologie zu sensibilisieren.<br />
Alle beteiligten Fachkräfte in<br />
der lymphologischen Versorgungskette<br />
(ärztliche Fachkräfte, lymphtherapeutische<br />
Fachkräfte und lymphologisch<br />
arbeitende Fachkräfte aus<br />
dem Sanitätshausbereich) sollten die<br />
Betroffenen motivieren können und<br />
somit eine hohe Therapieadhärenz erzeugen.<br />
Therapieoptionen<br />
Wenn die Diagnose feststeht, ergeben<br />
sich folgende Herausforderungen:<br />
– Wie wird die Therapie am besten<br />
konzipiert?<br />
– Wo findet man entsprechend lymphologisch<br />
geschulte Fachkräfte?<br />
– Wo finden die Betroffenen die<br />
nötigen Informationen zur Aufklärung?<br />
In der im Mai 2017 veröffentlichten<br />
S2k-Leitlinie zur Behandlung von<br />
Lymphödemen wurde eine adäquate<br />
Vorgehensweise festgelegt [1]. Die<br />
KPE, also die Komplexe Physikalische<br />
Entstauungstherapie, wurde als Goldstandard<br />
definiert und 2017 um die<br />
unerlässliche Säule des Selbstmanagements<br />
erweitert; zuvor beruhte die<br />
KPE lediglich auf vier Säulen. In der<br />
aktuellen Leitlinie wird die konservative<br />
Behandlung von Lymph ödemen<br />
wie folgt definiert:<br />
„Die Standardtherapie der Lymphödeme<br />
ist die Komplexe Physikalische<br />
Entstauungstherapie (KPE). Diese besteht<br />
aus folgenden aufeinander abgestimmten<br />
Komponenten:<br />
– Hautpflege und falls erforderlich<br />
Hautsanierung<br />
– Manuelle Lymphdrainage, bei Bedarf<br />
ergänzt mit additiven manuellen<br />
Techniken<br />
– Kompressionstherapie mit speziellen<br />
mehrlagigen, komprimierenden<br />
Wechselverbänden und/oder<br />
lymphologischer Kompressionsstrumpfversorgung<br />
– Entstauungsfördernde Sport-/Bewegungstherapie<br />
– Aufklärung und Schulung zur<br />
individuellen Selbsttherapie“<br />
Diese Zusammenfassung der konservativen<br />
Therapien erhielt 100 % Zustimmung<br />
von allen Mitarbeitenden an der<br />
Leitlinie. In den Jahren zuvor wurde<br />
die KPE ohne Selbstmanagement aufgeführt;<br />
somit erhielten Patientenedukation<br />
und Selbstbehandlung erst<br />
2017 einen hohen Stellenwert.<br />
Ohne sinnvoll angeleitetes Selbstmanagement<br />
ist eine KPE nicht erfolgreich;<br />
nur mit entsprechender<br />
Patientenedukation durch ausgebildete<br />
Fachkräfte kann sie gelingen.<br />
Das gilt im Übrigen auch für alle anderen<br />
Maßnahmen der KPE – einzeln<br />
und isoliert betrachtet sind sie nicht<br />
zielführend, wie es auch Gültig anmerkt<br />
[11]. In einer vom IQWiG initiierten<br />
Auswertung von 23 einschlägigen<br />
Studien über die nichtmedikamentöse<br />
Behandlung fortgeschrittener<br />
Lymphödeme (publiziert 2021)<br />
wurde die Wirksamkeit der einzelnen<br />
Maßnahmen aufgezeigt; dabei<br />
konnte der Nutzen einer Manuellen<br />
Lymphdrainage (MLD) nicht nachgewiesen<br />
werden, sofern sie isoliert<br />
blieb [12]. Auch dies belegt, dass ein<br />
Therapieerfolg nur in adäquater Abstimmung<br />
der Maßnahmen untereinander<br />
erreicht werden kann [6, 7,<br />
11]. Andererseits gibt es dank Schingale<br />
et al. mittlerweile einen Nachweis<br />
über die grundsätzliche Wirksamkeit<br />
der Manuellen Lymphdrainage<br />
[13]. So kann beispielsweise<br />
durch eine Kompressionstherapie das<br />
entstauende Ergebnis einer MLD konserviert<br />
und die Lymphangiomotorik<br />
durch die anschließende Bewegung<br />
in der Kompression noch weiter angeregt<br />
und unterstützt werden. Ohne<br />
eine sinnvoll ausgeführte Hautpflege<br />
schließlich ist die Neigung zu Erysipelen<br />
bei Lymphödemen deutlich erhöht;<br />
somit bildet die Hautpflege als<br />
eine der Säulen der KPE die wichtigste<br />
Prophylaxe gegen die Entstehung<br />
von Erysipelen.<br />
Die Standardtherapie der Lymphödeme<br />
wertet somit die selbst ausgeführten<br />
Maßnahmen der Betroffenen<br />
deutlich auf und bindet sie maßgeblich<br />
in die Abläufe und Handhabung<br />
der Therapie mit ein. Das setzt allerdings<br />
eine gut funktionierende Patientenedukation<br />
voraus, und hier be<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/22<br />
33
Kompression<br />
steht oft die Crux. Patientenschulung<br />
und Selbstmanagement sind in Ländern<br />
wie beispielsweise Kanada, Italien,<br />
Spanien oder auch Mexiko besser<br />
ausgebaut als in Deutschland. In<br />
Gesprächen mit internationalen Kollegen<br />
wird immer wieder aufgezeigt,<br />
wie viel Eigeninitiative der Betroffenen<br />
nötig ist, um Therapieerfolge aufrechterhalten<br />
zu können. Laut den<br />
Kollegen spielen in frastrukturelle<br />
Probleme eine zusätzlich erschwerende<br />
Rolle; insofern ist Selbstmanagement<br />
dort von vornherein von<br />
großer Bedeutung. Die Gegebenheiten<br />
in Deutschland sind vermutlich<br />
darauf zurückzuführen, dass die Versorgungslage<br />
in den physiotherapeutischen<br />
Praxen jahrelang flächendeckend<br />
sehr gut war und dass Therapieplätze<br />
in der Lymphtherapie kein<br />
Problem waren. Dieser Aspekt hat<br />
sich in den letzten Jahren jedoch massiv<br />
verändert; der Fachkräftemangel<br />
in den physiotherapeutischen Berufen<br />
ist eklatant [14]. Umso wichtiger<br />
sollte auch hierzulande eine adäquate<br />
Patientenedukation seitens der Therapeuten<br />
sein. Jedoch herrschen in<br />
Deutschland bei Betroffenen oft eine<br />
gewisse Passivität und eine fehlende<br />
Einsicht in die Notwendigkeit der<br />
Eigeninitiative. Ein solches Problem<br />
ergibt sich im internationalen Raum<br />
nur selten, denn die Betroffenen lymphologischer<br />
Erkrankungen kommen<br />
in vielen Ländern meist vorerst selbst<br />
für die Kosten der Therapie auf – somit<br />
ist auch die Eigenverantwortung<br />
deutlicher ausgeprägt.<br />
Vermittlung von Informationen<br />
zum Selbstmanagement<br />
In diesem Zusammenhang bietet sich<br />
ein Vergleich mit Betroffenen eines<br />
Lipödemsyndroms an. Letztere verfügen<br />
mittlerweile durch öffentliche<br />
Aufklärungsarbeit über eine gewisse<br />
Lobby, die sicherlich noch vergrößert<br />
werden muss; allerdings hat sich<br />
in den letzten Jahren viel an der Bekanntheit<br />
des Lipödemsyndroms zum<br />
Positiven verändert. Viele Kompressionshersteller<br />
gehen mittlerweile speziell<br />
auf die Bedürfnisse von Lipödembetroffenen<br />
ein und versuchen ihre<br />
Produkte entsprechend anzupassen,<br />
um insbesondere bei körperlich aktiven<br />
Betroffenen eine bestmögliche<br />
Bewegungsfreiheit zu erreichen.<br />
Das Lymphödem dagegen hat in der<br />
Öffentlichkeit nur einen geringen Bekanntheitsgrad,<br />
auch wenn es für geschulte<br />
Fachkräfte verhältnismäßig<br />
leicht zu diagnostizieren ist. Die Lobby<br />
der Ödempatienten muss sich noch<br />
deutlich vergrößern. Dafür setzen sich<br />
maßgeblich Organisationen wie Lymphologicum<br />
– Deutsches Netzwerk<br />
Lymphologie e. V. oder die Deutsche<br />
Gesellschaft für Lymphologie e. V.<br />
ein. Die größte Herausforderung dabei<br />
ist die fehlende Vermittlung von<br />
Kenntnissen über das Lymphsystem<br />
an den medizinischen Fakultäten im<br />
ärztlichen Grundstudium.<br />
Andererseits finden seit einigen<br />
Jahren immer mehr Informationsveranstaltungen<br />
für Betroffene mit lymphologischen<br />
Erkrankungen und Defiziten<br />
statt. So organisieren Sanitätshäuser,<br />
lokale Lymphnetze und Organisationen<br />
wie beispielsweise der<br />
Verein Lymphselbsthilfe e. V. Veranstaltungen<br />
für und mit Betroffenen.<br />
Auch dies trägt zu deren Aufklärung<br />
und zur Schulung des Selbstmanagements<br />
bei.<br />
Die moderne Lymphtherapie sollte<br />
zudem auch auf die Schulung von<br />
Betroffenen und deren Angehörigen<br />
eingehen. Unabhängige Vereine, aber<br />
auch Hersteller von Kompressionsbestrumpfung<br />
geben ihr Wissen in ansprechenden<br />
Broschüren weiter. Mittlerweile<br />
gibt es sogar komplette Ratgeber<br />
in Buchform, die sich ausschließlich<br />
mit Selbstmanagement befassen,<br />
denn nur mit der fachlichen Aufklärung<br />
über Ödemerkrankungen kann<br />
ein sinnvolles Selbstmanagement<br />
stattfinden.<br />
Daneben hat sich durch den Generationswechsel<br />
und die höhere technische<br />
Affinität der Betroffenen mittlerweile<br />
eine ganz andere Art der Patientenaufklärung<br />
entwickelt: Viele<br />
Betroffene informieren sich heute im<br />
Internet – insbesondere auf Social-<br />
Media-Plattformen und in verschiedenen<br />
Foren – über ihre lymphologischen<br />
Erkrankungen und Symptome.<br />
So sorgen in verschiedenen Social-<br />
Media-Kanälen engagierte Menschen<br />
für Aufklärung – sei es von Betroffenen<br />
für Betroffene oder von medizinischen<br />
Fachkräften für Betroffene. Dies hat allerdings<br />
nicht nur positive Auswirkungen,<br />
denn vor allem im Social- Media-<br />
Bereich geben oft Betroffene ihre eigenen<br />
Erfahrungen ungefiltert weiter.<br />
Häufig ist die Differenzierung zwischen<br />
seriösen und unseriösen Informationsanbietern<br />
schwierig; ein Qualitätsmerkmal<br />
kann darin bestehen,<br />
dass eine Zusammenarbeit mit Herstellern<br />
von Kompressionsbestrumpfung<br />
besteht.<br />
Grundsätzlich ist es bei der Patientenedukation<br />
wichtig, nicht ausschließlich<br />
auf soziale Medien zu setzen.<br />
Etliche Fachbücher, die teilweise<br />
auch digital verfügbar sind, vermitteln<br />
wertvolle Informationen und Anwendungsempfehlungen<br />
für Betroffene<br />
und sind häufig das Mittel der Wahl<br />
bei der Schulung des Selbstmanagements.<br />
Auch bieten Patientenzeitschriften<br />
von gemeinnützigen Vereinen<br />
wie z. B. das Magazin „Lympholife“<br />
des Lymphologicum e. V. seriöse<br />
Informationen für Betroffene.<br />
Kompression als<br />
Schlüssel zum<br />
Selbstmanagement<br />
Bei einer Kompressionstherapie müssen<br />
Kontraindikationen wie Entzündungen<br />
mit pathogenen Keimen,<br />
schwere Herzerkrankungen, fortgeschrittene<br />
arterielle Verschlusskrankheiten<br />
oder auch schwere Neuropathien<br />
im Vorfeld ausgeschlossen werden<br />
[6, 15, 16].<br />
Die Hauptrolle beim Selbstmanagement<br />
spielt eine konsequente<br />
Kompression und die zusätzliche Bewegung<br />
darin. Bewegung wird in diesem<br />
Zusammenhang oft unterschätzt<br />
und vernachlässigt; jedoch hat die<br />
muskuläre Aktivität einen großen<br />
Einfluss auf das Immunsystem. Des<br />
Weiteren haben die durch Bewegung<br />
ausgelösten Myokine einen entzündungshemmenden<br />
Effekt [17]. Diesen<br />
Effekt gilt es bei Ödemerkrankungen<br />
zu nutzen, stehen interstitielle Entzündungen<br />
doch im Zusammenhang<br />
mit der Schmerz entstehung beim Lipödemsyndrom<br />
[18]. Entzündungen<br />
erzeugen auch immer eine Leistungsminderung<br />
in den Lymphgefäßen;<br />
die Lymph angiomotorik wird durch<br />
die inflammatorischen Vorgänge gehemmt<br />
[6].<br />
Ein weiterer Effekt von Bewegung<br />
in Kompression ist das Widerlager für<br />
die Muskulatur von außen – das Ödem<br />
liegt zwischen diesen beiden und wird<br />
sozusagen von zwei Seiten bearbeitet<br />
und regelrecht ausgewalzt. Übungen<br />
34<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/22
Kompression<br />
im Wasser wie beispielsweise beim<br />
Aquacycling oder mittels Wassergymnastik<br />
sind durch den hydrostatischen<br />
Druck gleichzeitig Bewegungsübungen<br />
in Kompression. Insgesamt sollte<br />
in der Anleitung zum Selbstmanagement<br />
ein großes Gewicht auf Bewegungsübungen<br />
gelegt werden.<br />
Varianten der<br />
Kom pression<br />
Die lymphologische Kompressionsbandagierung<br />
sowie adaptive<br />
Velcro-Verbände stellen weitere und<br />
sehr flexible Möglichkeiten dar, um auf<br />
dynamische Volumina einzugehen.<br />
Sie werden hauptsächlich in Phase 1<br />
einer KPE (Entstauung) angewandt.<br />
Eine Kompressionsbestrumpfung mittels<br />
Flachstrickware wird auf ein festes<br />
Maß angefertigt und sollte daher<br />
erst nach abgeschlossener Phase 1 der<br />
KPE erfolgen. Die Wahl des geeigneten<br />
und patientenorientierten Materials<br />
ist genauso entscheidend für eine gute<br />
Compliance wie die nötige Erfahrung<br />
der Fachleute, die für eine Kompressionsversorgung<br />
Maß nehmen.<br />
In den letzten Jahren haben die<br />
Hersteller von Flachstrickware immer<br />
wieder neue Gestricke und Faserkombinationen<br />
auf den Markt gebracht;<br />
somit ist für jede Hautbeschaffenheit<br />
und jeden Ödemzustand das adäquate<br />
Material erhältlich. In diesem Zusammenhang<br />
sind Schulungen und<br />
Fachkongresse sinnvoll, damit möglichst<br />
alle geeigneten Materialien bekannt<br />
sind, um die Betroffenen adäquat<br />
beraten und behandeln zu können.<br />
Eine weitere sinnvolle Ergänzung<br />
und ideal für die Selbstanwendung ist<br />
eine maschinelle Kompression mittels<br />
AIK-Geräten (AIK = „apparative intermittierende<br />
Kompression“). Wichtig<br />
hierbei ist eine gründliche Einweisung<br />
der Betroffenen in die Handhabung<br />
der Geräte und vor allem die Vorarbeit,<br />
das sogenannte Anlymphen – also das<br />
Vorbereiten des Lymphgefäßsystems<br />
am Körperstamm und die Herstellung<br />
des zentralen Sogs. Das bedeutet ein<br />
Anregen des Lymphgefäßsystems, beispielsweise<br />
durch Atemübungen oder<br />
auch durch Selbstanwendung einzelner<br />
Techniken der Manuellen Lymphdrainage.<br />
Für Betroffene, die nachts eine<br />
Kompressionsversorgung benötigen,<br />
gibt es verschiedene Arten vorkonfektionierter<br />
und atmungsaktiver<br />
Nachtkompressionsstrümpfe.<br />
Für die Kompressionstherapie der<br />
Extremitäten existiert mittlerweile<br />
ebenfalls eine Leitlinie [19], in der verdeutlicht<br />
wird, welch hohen Stellenwert<br />
und Wirksamkeit die Kompressionstherapie<br />
hat. So heißt es beispielsweise<br />
darin: „Die Therapie mit medizinischen<br />
Kompressionsstrümpfen<br />
(MKS) oder mit phlebologischen Kompressionsverbänden<br />
(PKV) ist in der<br />
Behandlung phlebologischer und lymphologischer<br />
Erkrankungen der Beine<br />
und Arme unverzichtbar.“ Also sollte<br />
auch hier beim Selbstmanagement auf<br />
Kompression gesetzt werden. Voraussetzung<br />
für eine hohe Compliance ist<br />
jedoch eine verständliche Patientenedukation,<br />
sodass die erforderliche Akzeptanz<br />
gegeben ist.<br />
Eine Eigenbehandlung mit ausgewählten<br />
Techniken der Manuellen<br />
Lymphdrainage ist ebenfalls möglich.<br />
Hierzu sollten entsprechende Übungseinheiten<br />
in den Therapiepraxen genutzt<br />
werden, denn anfangs müssen<br />
die palpatorischen Fähigkeiten der Betroffenen<br />
detektiert und geschult werden,<br />
was oft einiger Wiederholungen<br />
bedarf.<br />
Zusätzliche Maßnahmen<br />
fürs Selbstmanagement<br />
Der Bereich der Ernährungsmedizin<br />
ist ein wesentlicher Faktor beim<br />
Selbstmanagement lymphologischer<br />
Erkrankungen. Eine explizite Lymphdiät<br />
gibt es zwar nicht, jedoch hat sich<br />
gezeigt, dass eine Ernährung, die auf<br />
Entzündungshemmung abzielt, bei<br />
jeglichen lymphologischen Erkrankungen<br />
einen positiven Effekt zeigt.<br />
Empfohlen wird eine „mediterrane“<br />
Ernährung [20]. Denn Entzündungen<br />
haben einen ungünstigen Effekt<br />
auf jede Ödemerkrankung, seien es<br />
die entzündlichen Prozesse beim Lipödemsyndrom<br />
oder auch Entzündungen<br />
in bestehenden Lymph ödemen,<br />
wo eiweißreiche Einlagerungen im Interstitium<br />
eine große Gefahr für Entzündungen<br />
darstellen. Dadurch steigt<br />
auch das Erysipel-Risiko im Lymphödemgebiet,<br />
was unbedingt unterbunden<br />
werden muss, um der Gefahr<br />
einer Sepsis entgegenzuwirken. Somit<br />
ist es sinnvoll, schon bei der Ernährung<br />
auf Entzündungshemmung zu<br />
setzen.<br />
Darüber hinaus sollte die Hautpflege<br />
im Selbstmanagement eine große<br />
Rolle spielen, ist sie doch die wichtigste<br />
Prophylaxe gegenüber Infektionen<br />
und auch Erysipelen. Die Kompression<br />
trocknet die oft schon fragile Haut<br />
zusätzlich aus, somit ist eine adäquate<br />
Hautpflege essenziell. Viele Hersteller<br />
von Kompressionsversorgungen bieten<br />
hochwertige Produkte für die Hautpflege<br />
an; diese sind in der Regel auf<br />
das verwendete Material abgestimmt,<br />
damit die Kompressionsbestrumpfung<br />
im Zusammenspiel mit den Pflegeprodukten<br />
möglichst langlebig bleibt.<br />
Fazit: Lymphologie<br />
funktioniert nur im<br />
Netzwerk<br />
Als alleinig Therapierender lassen sich<br />
die Herausforderungen der Ödemerkrankungen<br />
nicht meistern. Als<br />
wichtigste Partner müssen die Betroffenen<br />
und ggf. ihre Angehörigen in die<br />
Therapie mit einbezogen werden. Nur<br />
so können Einsicht erzeugt, gemeinsame<br />
Ziele formuliert und das Selbstmanagement<br />
sinnvoll angeleitet werden.<br />
Erfahrungsgemäß funktioniert eine<br />
Komplexe Physikalische Entstauungstherapie<br />
nur im Netzwerk. Die entsprechenden<br />
Strukturen – unabhängig<br />
davon, ob sie gerade erst wachsen<br />
oder schon bestehen – müssen jedoch<br />
gepflegt werden. Tragfähige Netzwerkstrukturen<br />
wie auf Klinik niveau<br />
können auch im ambulanten Bereich<br />
funktionieren, wenn sie entsprechend<br />
ausgebaut und genutzt werden.<br />
Geeignete Partner hierbei sind lymphologisch<br />
geschulte ärztliche Kräfte,<br />
Lymphtherapeutinnen und -therapeuten<br />
sowie lymphologisch ausgebildete<br />
Fachkräfte in den Sanitätshäusern. Je<br />
nach Schwerpunkt sollte das Netzwerk<br />
individuell erweitert werden, beispielsweise<br />
um Aspekte wie Psychotherapie,<br />
Ernährungsberatung oder Rehasport.<br />
Der Schlüssel zum Erfolg ist eine adäquate<br />
Kommunikation der einzelnen<br />
Partner untereinander. Die im Netzwerk<br />
tätigen Personen sollten sich als<br />
gleichberechtige Partner betrachten<br />
und auch die Betroffenen als Partner<br />
mit einbeziehen. Denn die beste Netzwerkstruktur<br />
nützt nur wenig, wenn<br />
die Betroffenen sich selbst nicht einbringen<br />
können. Eine einheitliche<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/22<br />
35
Kompression<br />
gemeinschaftliche Dokumentation<br />
ist hier von großem Vorteil. Der<br />
Verein Lymphologicum – Deutsches<br />
Netzwerk Lymphologie e. V. beispielsweise<br />
hat sich die Förderung der ambulanten<br />
Vernetzung der Netzwerkpartner<br />
auf die Fahne geschrieben<br />
und vermittelt Hilfestellung bei der<br />
Gründung lokaler Netzwerke, unter<br />
anderem mit strukturierten Dokumentationsbögen.<br />
Jeder und jede Therapierende sollte<br />
einen gewissen Anteil seines bzw. ihres<br />
lymphologischen Wissens an die<br />
Betroffenen weitergeben [21]. Das Ziel<br />
sollte eine patientenadaptive Therapie<br />
sein. Wenn die Betroffenen ihre<br />
Möglichkeiten kennen, ihre Fähigkeiten<br />
ausbauen und entsprechend geschult<br />
sind, können sie ihr Selbstmanagement<br />
eigenverantwortlich deutlich<br />
besser handhaben.<br />
Der Autor:<br />
Henry Schulze<br />
Lymph- und Ödemtherapeut<br />
Henry Schulze Lymphologie<br />
Gesundheitszentrum Neher<br />
Hauptstraße 52<br />
86494 Emersacker<br />
mail@henry-schulze.de<br />
Begutachteter Beitrag/reviewed paper<br />
Zitation: Schulze H. Selbstmanagement in der Lymphologie. Orthopädie Technik, 2022; 73 (11): 48 – 52<br />
Literatur:<br />
[1] Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen e. V. (GDL). S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie der Lymphödeme“ (AWMF-Leitlinienregister<br />
Nr. 058/001). Stand: 23.05.2017 (in Überarbeitung), gültig bis 22.05.2022. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/058-<br />
001l_S2k_Diagnostik_und_Therapie_der_Lymphoedeme_2019-07-abgelaufen.pdf (Zugriff am 18.10.2022)<br />
[2] Waldvogel-Röcker K. Fallbuch Physiotherapie: Lymphologie. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2021<br />
[3] Mohren E. Bestandsaufnahme zur Diagnostik und Therapie bei Lymphödem, Lipödem und Lipolymphödem in der ambulanten<br />
Versorgung in der Region Bochum. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum, 2018<br />
[4] Herpertz U, Netopil B. Studie über die Qualität der ambulanten Versorgung von Ödempatienten in Deutschland 2007. LymphForsch,<br />
2010; 14: 31–34<br />
[5] Schöhl J, Rössler J, Földi E. Das primäre Lymphödem. Langzeitverlauf und Lebensqualität mit der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie.<br />
LymphForsch, 2013; 17 (2): 88–93<br />
[6] Gültig O, Miller A, Zöltzer H (Hrsg.). Leitfaden Lymphologie. 2., vollst. überarb. und erw. Aufl. München: Elsevier, 2021<br />
[7] Földi M, Földi E. Lehrbuch Lymphologie für Ärzte, Physiotherapeuten und Masseure/med. Bademeister. 7., überarb. Aufl. München:<br />
Elsevier, Urban & Fischer, 2010<br />
[8] Schad H. Gilt die Starling’sche Hypothese noch? LymphForsch, 2009; 13 (2): 71–77<br />
[9] Levick JR, Michel CC. Microvascular fluid exchange and the revised Starling principle. Cardiovasc Res, 2010; 87(2): 198–210<br />
[10] Brenner E. Das Lymphsystem und das Starlingsche Gleichgewicht. LymphForsch, 2018; 22 (1): 9–13<br />
[11] Gültig O. Der Lymphologische Kompressionsverband in der Komplexen Physikalischen Entstauungstherapie – national und<br />
international. LymphForsch, 2021; 25 (2)<br />
[12] Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) (Hrsg.). Fortgeschrittenes Lymphödem. Lassen sich durch<br />
nicht medikamentöse Verfahren die Symptome lindern? Vorläufiger HTA-Bericht HT19-01. https://www.iqwig.de/download/ht19-01_<br />
nicht-medikamentoese-verfahren-bei-lymphoedem_vorlaeufiger-hta-bericht_v1-0.pdf (Zugriff am 18.10.2022)<br />
[13] Schingale FJ, Esmer M, Küpeli B, Ünal D. Investigation of the Less Known Effects of Manual Lymphatic Drainage: A Narrative Review.<br />
Lymphat Res Biol, 2022; 20 (1): 7–10<br />
[14] physiopraxis 2016; 14(06): 8-12 DOI: 10.155/s-0042-106537. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/<br />
abstract/10.1055/s-0035-1564466 (Zugriff am 18.10.2022)<br />
[15] Pritschow H, Schuchardt C. Das Lymphödem und die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie. Ein Handbuch für die Praxis in<br />
Wort und Bild. 5., erw. und vollst. überarb. Aufl. Köln: Wirtschafts- und Praxisverlag, 2018<br />
[16] Weissleder H, Schuchardt C. Erkrankungen des Lymphgefäßsystems. 6., erw. und vollst. überarb. Aufl. Essen: Viavital, 2015<br />
[17] Krenn C. Myokine – Die Skelettmuskulatur als größtes und wichtigstes Stoffwechselorgan des Menschen. Magisterarbeit, Universität<br />
Wien, 2013<br />
[18] Bertsch T, Erbacher G, Elwell R, Partsch H. Lipoedema – a paradigm shift and consensus. Journal of Wound Care, 2020; 29 (Sup11b).<br />
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/jowc.2020.29.Sup11b.1 (Zugriff am 19.10.2022)<br />
[19] Deutsche Gesellschaft für Phlebologie e. V. (DGP). S2k-Leitlinie „Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem<br />
Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen<br />
(MAK)“ (AWMF-Leitlinienregister Nr. 037-005). Stand: 31.12.2018 , gültig bis 31.12.2023. https://www.awmf.org/uploads/tx_<br />
szleitlinien/037-005l_S3k_Medizinische-Kompressionstherapie-MKS-PKV_2019-05.pdf (Zugriff am 19.10.2022)<br />
[20] Lipp AT. Ernährung und Lymphödeme – gibt es die Lymphödem-Diät? LymphForsch, 2022; 26 (1): 23–24<br />
[21] Schulze HA. Der kleine Coach für das Lymphsystem. Schnelle Hilfe bei Lymphödemen, Wassereinlagerungen & Co. Stuttgart: Trias,<br />
2022<br />
36<br />
Erschienen in: ORTHOPÄDIE TECHNIK 11/22
Werden Sie Abonnent der<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK<br />
DIE OT IM ABO<br />
Wer über aktuelle Versorgungsformen und Neuheiten aus Prothetik,<br />
Orthetik, Reha-Technik, Sanitätshaus, Kompressionstherapie und Homecare<br />
auf dem neuesten Stand sein möchte, liest die ORTHOPÄDIE TECHNIK.<br />
Seien Sie mit den Fachartikeln über Entwicklungen und Forschungen in<br />
allen wichtigen Versorgungsbereichen informiert.<br />
Laufzeit 12 Monate;<br />
danach monatlich kündbar<br />
inklusive aller <strong>Sonderausgabe</strong>n<br />
Lieferung frei Haus innerhalb<br />
Deutschlands<br />
monatliche Erscheinungsweise<br />
Weitere Informationen<br />
unter www.360-ot.de<br />
Bestellungen an:<br />
bestellung@biv-ot.org<br />
13,30 €<br />
pro Monat
Ladenbau und -gestaltung<br />
Vorsicht Planungsfalle!<br />
Was Sanitätshäuser für einen modernen<br />
Auftritt beachten müssen<br />
Christoph Hafemeister hilft seinen<br />
Kund:innen dabei, ein gutes<br />
Umfeld für die Versorgung und<br />
den Verkauf zu schaffen.<br />
Fotos [3]: OBV storedesign<br />
Das Image des weißen Arbeitskittels hat die Branche<br />
schon längst abgelegt – zumindest, was die Versorgung<br />
angeht. Der Blick in die Schaufenster und Auslagen sowie<br />
hinter die Türen von Sanitätshäusern offenbart aber<br />
ein breites Spektrum an innenarchitektonischen Höheund<br />
Tiefpunkten. Dabei ist der eigene Blick auf den Betrieb<br />
nicht besonders objektiv. Oftmals wird etwas lange<br />
beschönigt oder vorschnell sehr kritisch gesehen. Da ist<br />
ein Partner von außen in manchen Fällen die richtige Lösung.<br />
Für Menschen wie Christoph Hafemeister, die sich<br />
als „Ladenbauer“ oder „Store-Designer“ verstehen, geht<br />
es darum, die eigenen Erfahrungen aus der (Um-)Gestaltung<br />
von Ladenlokalen mit den Wünschen und Ansprüchen<br />
der Kund:innen zu verbinden und daraus die beste<br />
Lösung zu schaffen. Was es dabei zu beachten gilt, erläutert<br />
Christoph Hafemeister von OBV Storedesign aus<br />
Vreden im Gespräch mit der OT-Redaktion.<br />
OT: Sie arbeiten mit vielen Sanitätshäusern zusammen.<br />
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Wünschen der<br />
Entscheider:innen gemacht?<br />
Christoph Hafemeister: Hier hat sich herauskristallisiert,<br />
dass viele Entscheider:innen bereits eine gute Vorstellung<br />
davon haben, wie die neue Einrichtung aussehen und<br />
funktionieren soll. Sollte es noch keine genaue Vorstellung<br />
geben, kann aber oftmals gesagt werden, wie es nicht sein<br />
soll. Auch dies hilft in der Planungsphase, um schneller<br />
an das optimale Ergebnis zu kommen. Die Wünsche der<br />
Entscheider:innen sind dabei sehr verschieden. Diese unterscheiden<br />
sich regional, nach der Größe des Unternehmens<br />
und auch danach, welche Kundengruppe vorrangig<br />
bedient wird. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen: Je intensiver<br />
sich im Vorhinein Gedanken darüber gemacht<br />
werden, wofür das Unternehmen und die neue Einrichtung<br />
stehen sollen, desto besser werden die Ergebnisse.<br />
OT: Gab es Fälle, in denen Wunsch und Ausgangslage zu weit<br />
auseinanderlagen?<br />
Hafemeister: Es kommt vor, dass vor allem am Anfang der<br />
Projektphase Wünsche geäußert werden, die mit der Ausgangslage<br />
nicht vereinbar sind. Dies betrifft oftmals vor allem<br />
das verfügbare Budget und die Wünsche und Vorstellungen,<br />
wie das Fachgeschäft nachher aussehen soll. Als<br />
Ladenbauer ist es unsere Aufgabe, dann die optimale Mitte<br />
zu ermitteln, um das bestmögliche Ergebnis mit den zu<br />
Verfügung stehenden Mitteln und der Ausgangslage zu erhalten.<br />
Auch der Umbauzeitraum und die Dauer eines Projektes<br />
spielt hier mit rein, vor allem, wenn neben den Möbeln<br />
auch weitere Gewerke mit umgebaut werden sollen.<br />
OT: Welche Planungsfallen gibt es für Inhaber:innen?<br />
Hafemeister: Wichtig ist, dass im Vorhinein klar ist, welches<br />
Budget für welche Teile des Umbaus zur Verfügung<br />
steht. Denn nur so lassen sich eine realistische Einschätzung<br />
und Planung erstellen, die den Wünschen entsprechen.<br />
Darüber hinaus ist es ungemein wichtig, dass der Inhaber<br />
oder die Inhaberin sich seinen oder ihren eigenen<br />
Waren- und Zielgruppen bewusst ist und damit entsprechende<br />
Prioritäten setzen kann. Nur so kann eine Planung<br />
gewährleistet werden, die den Bedürfnissen entspricht und<br />
einen Nutzen bringt. Auch hierbei gilt teilweise „weniger<br />
ist mehr“. Lieber Schwerpunkte setzen und reduziert Ware<br />
präsentieren als alle Produkte in allen Variationen und Farben<br />
zu zeigen, die aktuell am Markt verfügbar sind.<br />
OT: Umbau und Erneuerung sind stets mit Kosten verbunden.<br />
Welche Argumente haben Sie für einen Ladenumbau und die<br />
Investition in einen neuen Auftritt?<br />
Hafemeister: Wenn er richtig gemacht ist, überwiegt der<br />
Nutzen die hineingesteckten Investitionen deutlich. Dieser<br />
Nutzen ist dabei nicht nur umsatzbasiert, sondern viel<br />
breiter gestreut. Durch ein moderneres Auftreten und der<br />
gesteigerten Attraktivität des Geschäftes können neue<br />
Kundengruppen akquiriert und gewonnen werden. Durch<br />
die Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen in der<br />
Umbauphase können zudem Kosten und Zeit eingespart<br />
werden. Zudem können z. B. durch neue Techniken und<br />
Baumaterialien Energiekosten eingespart werden. Daraus<br />
ergibt sich, dass durch einen Umbau sowohl Kosten eingespart<br />
als auch Umsatzpotenziale ausgeschöpft werden können.<br />
Dies sichert die Wettbewerbsfähigkeit und kann auch<br />
der Abwanderung von Kund:innen an Mitbewerber entgegenwirken.<br />
OT: Wie sieht es mit der Benutzung des Ladenlokals während<br />
eines Umbaus aus? Gibt es da Möglichkeiten, den Betrieb<br />
aufrechtzuerhalten, oder ist aus ihrer Erfahrung heraus eine<br />
kurzzeitige – aber dafür vollständige – Schließung die bessere<br />
Alternative?<br />
Hafemeister: Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten,<br />
es kommt darauf an. Aus unserer Sicht als Laden-<br />
38<br />
Sanitätshaus 2024
Sanitätshaus<br />
Dreifach gut: Die Sitzbank ist nicht nur Ruheoase, sondern<br />
auch Sichtschutz und Stauraum zugleich.<br />
Eine runde Sache: Ein moderner Look lässt das „angestaubte<br />
Weißkittel“-Image vergessen.<br />
bauer ist es natürlich immer sinnvoller, wenn es eine Vollschließung<br />
gibt und wir das Objekt in einem umbauen<br />
können, vor allem sobald weitere Gewerke wie Trockenbau,<br />
Elektrik etc. beteiligt sind. Je nach Größe und Umfang der<br />
umzubauenden Fläche ist aber auch ein Umbau während<br />
des laufenden Betriebes möglich, sofern genügend Ausweichflächen<br />
bestehen.<br />
OT: Welche Rolle sollten die Mitarbeiter:innen im Rahmen des<br />
Umbaus bzw. der Neugestaltung einnehmen?<br />
Hafemeister: Wir merken immer wieder, dass es sehr wichtig<br />
ist, dass Mitarbeiter:innen mit einbezogen werden und<br />
Wünsche äußern dürfen. Besonders die Mitarbeitenden<br />
haben oftmals noch eine andere Sichtweise auf das Alltagsgeschäft<br />
und die Abläufe, die tagtäglich vollzogen werden.<br />
Durch die Einbeziehung der Mitarbeiter:innen lassen sich<br />
oft Optimierungen dieser Alltagsabläufe erzielen, dies steigert<br />
nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch<br />
die Effektivität im Alltag. Jedoch sollten diese Anmerkungen<br />
und Wünsche immer noch unter den unternehmerischen<br />
Gesichtspunkten sowie der strategischen Ausrichtung<br />
des Unternehmens bewertet werden.<br />
OT: Viele Hersteller von Hilfsmitteln bieten den Sanitätshäusern<br />
Materialien zur Produktvorstellung an. Wie berücksichtigen<br />
Sie dies bei der Gestaltung eines Objekts?<br />
Hafemeister: Bei der Erstellung unserer Planungen berücksichtigen<br />
wir gerne die Materialien zur Produktvorstellung,<br />
sofern gewünscht. Diese versuchen wir dann mit in das<br />
Konzept einfließen zu lassen, sodass sie nicht als Fremdkörper<br />
wirken und das gesamtheitliche Einrichtungskonzept<br />
stören, sondern im Einklang mit diesem stehen. Dabei<br />
sollten entsprechende Schwerpunkte in den Warengruppen<br />
gesetzt werden.<br />
OT: Gibt es Anfragen zu Serviceleistungen außerhalb des eigenen<br />
Tätigkeitsbereichs? Legen Sanitätshäuser Wert darauf,<br />
dass zum Beispiel in Wartezonen kostenlos das Smartphone<br />
aufgeladen werden kann? Wie sieht es mit E-Bike-Ladestationen<br />
oder mit erfrischenden Getränken aus?<br />
Hafemeister: In den Planungen werden nach Wunsch<br />
auch solche technischen Möglichkeiten mit eingebaut.<br />
Hierzu zählen in den Wartezonen zum Beispiel der Einbau<br />
von kabelgebundenen oder kabellosen Ladegeräten<br />
oder die Möglichkeit, Getränke zu kühlen und Kaffee anbieten<br />
zu können. Durch solche Annehmlichkeiten lassen<br />
sich zudem die Verweildauer der Kund:innen im Geschäft<br />
und die Attraktivität des Geschäftes signifikant erhöhen.<br />
Auch durch eine E-Bike-Ladestation oder eine Ladestation<br />
für elektrische Rollstühle und Scooter lässt sich eine Barrierefreiheit<br />
schaffen, mit der man sich von anderen Geschäften<br />
positiv absetzen kann.<br />
OT: Was war das „verrückteste“ Gimmick, das sich eine Kundin<br />
oder ein Kunde gewünscht hat?<br />
Hafemeister: Wir betreuen die Sanitätshausbranche nun<br />
schon seit über 15 Jahren, in denen uns viele verschiedene<br />
Ideen und Gimmicks entgegengekommen sind. Es wurde<br />
zum Beispiel gewünscht, einen lebensgroßen Baum, einen<br />
Wasserfall oder einen Kamin ins Geschäft zu integrieren.<br />
Doch oft sind es auch auf den ersten Blick verrückte Gimmicks,<br />
die den Unterschied machen. Zum Beispiel haben<br />
wir auf Wunsch ein in der Mitte durchgeschnittenes Auto<br />
mit in das Konzept eingeplant, sodass nur noch Kofferraum<br />
und Rücksitzbank vorhanden waren. Damit konnte<br />
bereits beim Beratungsgespräch demonstriert werden, wie<br />
sich Produkte im Alltag bei reellen Situationen am Auto<br />
verhalten.<br />
OT: Wenn Sie einer Betriebsinhaberin oder einem Betriebsinhaber<br />
drei Ratschläge geben könnten, welche wären das?<br />
Hafemeister: Lieber weniger Ware zeigen und dafür die<br />
Ware, die man zeigt, höherwertig präsentieren, um damit<br />
auch ein Ambiente zu schaffen, welches Beratung signalisiert<br />
und nicht nur bloßen Abverkauf.<br />
Je besser die Vorbereitung und je klarer die Ziele im Vorhinein<br />
sind, desto besser und schneller wird das gewünschte<br />
Ergebnis erreicht und erzielt.<br />
Durch eine modulare Einrichtung in Funktion und Design<br />
ist man nachhaltiger und vor allem langfristiger optimal<br />
aufgestellt, um auf verschiedene Veränderungen wie<br />
Trends oder veränderte Warengruppen zu reagieren.<br />
Das komplette Interview ist im Fachmagazin<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK in<br />
der Ausgabe 12/2022 erschienen<br />
und über den QR-Code abrufbar.<br />
Die Fragen stellte Heiko Cordes.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
39
Ladenbau und -gestaltung<br />
Kompetenzen<br />
sichtbar machen<br />
Die Orthopädie-Technik ist ein so vielfältiges Fach, dass<br />
den meisten Menschen, die erstmals in einem Sanitätshaus<br />
sind, gar nicht klar wird, wie groß die Bandbreite<br />
an Versorgungsmöglichkeiten ist. Aber wie können die<br />
Betriebe die eigenen Kompetenzen besser in den Mittelpunkt<br />
rücken? Zum Beispiel, indem sie ihre Werkzeuge,<br />
Messgeräte und Angebote besser sichtbar machen.<br />
Statt hinter Mauern und abseits der Blicke der<br />
Kund:innen ein fast unsichtbares Dasein zu fristen, müssen<br />
Orthopädietechniker:innen und ihr Können, gepaart<br />
mit modernster Technik zum Beispiel durch mehr gläserne<br />
Elemente sichtbar gemacht werden. Dipl.-Ing. Elke<br />
Park, Inhaberin Planungsbüro Parkraum, sammelt seit<br />
vielen Jahren Erfahrungen in der Gestaltung von Sanitätshäusern<br />
und in der Architektur von Fachbetrieben<br />
und prägt mit ihren Ideen und Umsetzungen das Bild<br />
von OT-Betrieben entscheidend mit. Im Gespräch mit<br />
der OT-Redaktion verrät sie, warum es wichtig ist, die<br />
Arbeit der Gestaltung in fachkundige Hände zu legen,<br />
und wie der Bedarf bei Kund:innen geweckt wird.<br />
OT: Frau Park, die Werkstätten in den OT-Betrieben werden<br />
immer moderner. Wie wichtig ist es, diese Entwicklung auch<br />
für die Patient:innen erlebbar zu machen?<br />
Am Terminal<br />
des Sanitätshauses<br />
Vital<br />
in Hilden können<br />
sich die<br />
Kund:innen<br />
über ihre Versorgung<br />
informieren.<br />
Elke Park: Unsere Gesellschaft hat sich gewandelt und früher<br />
oft tabuisierte Themen werden sichtbarer. Die Menschen<br />
entwickeln sich weiter und erheben einen Anspruch<br />
auf Transparenz. Was gibt es aus Sicht des Versorgers denn<br />
Besseres, wenn mein Kunde Interesse an seiner Versorgung<br />
hat? Das bindet einen<br />
Kunden viel<br />
mehr an „seinen“<br />
Betrieb und schafft<br />
eine Begegnung auf<br />
Augenhöhe. Wenn<br />
ich als Kunde die<br />
Fläche eines Betriebes<br />
betrete, frage<br />
ich mich, wo erkenne<br />
ich diese Versorgungsqualität?<br />
Ich<br />
bin Diplomingenieurin<br />
und habe<br />
deshalb eine starke<br />
Affinität zur Technik.<br />
Ich bedauere<br />
und vermisse es zunehmend,<br />
dass die<br />
Sichtbarkeit dieser<br />
Technik und modernen<br />
Entwicklung<br />
der Versorgung des<br />
Im Sanitätshaus Vital in Hilden gibt es eine Showkabine zur<br />
Pa tientenversorgung. Wenn diese genutzt wird, dann wird aus<br />
Gründen der Privatsphäre ein Sichtschutz (Abb. links) installiert.<br />
Menschen so gering ist. Moderne Laufanalysen, Werkstattmaschinen,<br />
die zeigen, wie eine Einlage geschliffen oder<br />
„meine“ Prothese korrigiert wird – das sind die Dinge, die<br />
mir als Kundin wichtig zu sehen wären. Es ist sehr relevant,<br />
dass die Branche die Chance wahrnimmt, die Kompetenz<br />
und das Handwerk gleichermaßen sichtbar und erlebbar<br />
für die Kunden darzustellen.<br />
OT: Welche Möglichkeiten haben Betriebsinhaber:innen,<br />
um ihren Betrieb entsprechend zu gestalten?<br />
Park: Heutzutage sind den Ideen der Gestaltung eigentlich<br />
keine Grenzen gesetzt. Inspiriert werden wir Innenarchitekten<br />
und Architekten durch die Innovationen der<br />
Branche. Wir hören uns an, welche Entwicklungen es gibt<br />
und geben wird, und beschäftigen uns mit den Prozessen<br />
der Betriebe. Gerade der Einzug der Digitalisierung in die<br />
Werkstätten hat nicht nur das Arbeiten für Orthopädietechniker<br />
verändert, sondern auch für uns. Die Betriebsinhaber<br />
wünschen sich, durch mehr Transparenz und Nähe<br />
als Fachbetrieb wahrgenommen zu werden. Das können<br />
wir als Innenarchitekten mit Flächenkonzepten in der Entwurfsgestaltung<br />
realisieren – beispielsweise mit der gläsernen<br />
Werkstatt oder der Showkabine. Dabei werden betriebliche<br />
Prozesse mit den Ideen der Gestaltung auf eine Handlungsebene<br />
gebracht.<br />
OT: Was steckt hinter der Idee, einen Einblick in die Werkstatt<br />
zu gewähren?<br />
Park: Man kennt es aus dem Bäckerhandwerk. Auf den Monitoren<br />
hinter der Theke bekommt der Kunde einen Einblick<br />
in die Backstube – darf also hinter die Kulissen schauen. Er<br />
sieht also, wie das Produkt – beim Bäcker Brötchen oder Brezel<br />
– erst in den Ofen geschoben wird und dann frisch zubereitet<br />
in der eigenen Brötchentüte landet. Wow! Die Gesundheitshandwerke<br />
brauchen sich mit ihren Leistungen nicht<br />
zu verstecken. Als Kunde möchte ich sehen, wie mein Versorger<br />
bzw. Orthopädietechniker mit meinem Körper und dem<br />
daran angepassten Hilfsmittel umgeht. Aus diversen Gründen<br />
zahle ich einen Aufpreis auf ein Hilfsmittel und möchte<br />
doch wissen, warum. Wenn ich als Kunde wirklich sehe<br />
und erkenne, was sich beispielsweise hinter der Fertigung ei-<br />
40<br />
Sanitätshaus 2024
Ladenbau und -gestaltung<br />
ner Orthese verbirgt, dann schätze ich doch umso mehr den<br />
Kostenaufwand. Das Vertrauen eines Kunden in den Betrieb<br />
steigt und eine Angst vor einer Hilfsmittelversorgung wird in<br />
Zuversicht und positive Gewissheit korrigiert.<br />
OT: Wie nehmen die Mitarbeiter:innen im Sanitätshaus<br />
diese Umgestaltung wahr?<br />
Park: Neue Entwicklungen, das sind wir gewohnt, werden<br />
nicht sogleich mit einem „Hurra“ beantwortet. Vielmehr<br />
ist es wichtig, die Mitarbeiter beim Kreieren der Ideen –<br />
sprich an der Basis einer Neu- oder Umgestaltung – mit ins<br />
Boot zu nehmen. Zu unseren Workshops, die wir zu Beginn<br />
einer Planungsphase anbieten, können individuelle<br />
Impulse eingebracht werden, die später in der Planung berücksichtigt<br />
werden. Uns Gestaltern obliegt die Aufgabe,<br />
die Wünsche und Ideen mit möglichst einfachem Handling<br />
umzusetzen, sodass der Wow-Effekt nicht nur für den<br />
Kunden, sondern vor allem für den Mitarbeiter gewährt ist.<br />
OT: Welche Vorbehalte mussten Sie ausräumen bei<br />
Inhaber:innen wie Mitarbeiter:innen, als Sie Ihr Konzept<br />
vorgestellt haben?<br />
Park: Als ich begann, in der Gesundheitsbranche gestalterisch<br />
tätig zu werden, wollte ich das eher negativ behaftete<br />
Image eines Sanitätshauses grundlegend verändern. Diese<br />
Branche hat keine sexy Produkte zum Verkauf zu bieten,<br />
aber sie unterstützt Menschen in der Verbesserung<br />
ihrer Lebensqualität. Wir versuchen, um diese Produkte<br />
und die Prozesse herum Raumstrukturen zu erarbeiten,<br />
die ein Verkaufserlebnis schaffen, damit sich dieses Image<br />
verbessert und die Wahrnehmung der Branche aufpoliert<br />
wird. Letztendlich sind wir mitverantwortlich, durch unsere<br />
Konzepte noch mehr Kunden auf die Fläche und in einen<br />
Gesundheitsfachbetrieb zu locken. Das beste Ergebnis<br />
entsteht durch das Vertrauen in meine Person und unsere<br />
Fachexpertise. Die Begeisterung seitens der Geschäftsführer<br />
besteht in jedem Fall, der Weg zur Umsetzung ist je nach<br />
Bausituation abwechslungsreich.<br />
OT: Für welche Versorgungsbereiche lohnt es sich, den Einblick<br />
hinter die Kulissen zu gewähren?<br />
Fotos [2]: Heribert Boernichen<br />
Park: Im Bereich der Kompression gibt es Mess- und Analysegeräte,<br />
die viel zu schade dafür sind, vor den Blicken<br />
der Kunden versteckt zu werden. Warum soll diese hochkarätige<br />
Technik nicht allen Kunden zugänglich werden?<br />
Kommt der Kunde ausschließlich wegen einer Einlagenversorgung<br />
in das Sanitätshaus oder benötigt er mehr? Analog<br />
dem Sport- oder Bekleidungsfachhandel werden Waren<br />
präsentiert, die Bedarf wecken sollen. Genauso verhält es<br />
sich im Sanitätshaus: Es müssen Bedürfnisse beim Kunden<br />
geweckt werden. Die Kundenansprache hat sich in jüngster<br />
Zeit verändert, die Tabuisierung der Hilfsmittelversorgung<br />
wird mehr und mehr obsolet. Ich weise darauf hin:<br />
Hilfsmittel werden verkauft – Punkt. Dieses Thema gilt es<br />
mit Verkaufserlebnissen zu „inszenieren“. Den Einblick in<br />
die Werkstätten und Anproben der Kompression oder Bandagenwelt<br />
den Kunden erleben zu lassen, ist ein Weg der<br />
modernen Sichtbarkeit eines Betriebes und bringt nicht<br />
nur bestehende, sondern auch neue Kunden auf eine Sanitätshausfläche.<br />
OT: Wo wird das Konzept der Showkabine schon genutzt?<br />
Park: Es geht nicht ausschließlich um eine Showkabine, es<br />
geht um Prozesse auf der Fläche, die räumlich abgebildet<br />
werden müssen und individuell an den Anforderungen<br />
der Betriebe angepasst sind. So haben wir beispielsweise<br />
zu einem Neubau in Kaarst, Sanitätshaus H&R GmbH, eine<br />
Showkabine und eine Showlaufanalyse konzeptioniert, was<br />
als Anforderung aus einem Workshop resultierte. Bereits<br />
beim Betreten der Ladenfläche werden beide Show flächen<br />
erkennbar und dem Kunden offensichtlich. Die Neugierde<br />
der Kunden erfahren die Mitarbeiter positiv und so kann<br />
eine frei verkäufliche Dienstleistung zusätzlich, über das<br />
Rezept hinaus, angeboten werden. Ein weiteres Beispiel ist<br />
ein Betrieb in Hilden, Vital Sanitätshaus Andreas Wylenzek,<br />
wo der Kunde bereits von außen, ohne das Geschäft<br />
betreten zu haben, ein Kompressionsmess system erblickt.<br />
Die weitere vielversprechende Überraschung erfährt der<br />
Kunde sogleich beim Eintritt in die Verkaufsfläche: Durch<br />
ein großes Sichtfenster wird eine Laufanalyse sichtbar. Diese<br />
gesellt sich geschickt konzipiert zu den Themen rund um<br />
den Fuß. Bereits der wartende Kunde oder derjenige, der einen<br />
Schuh anprobiert, kann sich unmittelbar mit der interessanten<br />
Technik auseinandersetzen. Wir haben durch<br />
unsere Planungskonzeption in beiden Beispielen versucht,<br />
unterschwellig den Kunden während eines Warenkontaktes<br />
zusätzlich mit weiteren Anreizen in Berührung kommen<br />
zu lassen!<br />
Das komplette Interview ist im Fachmagazin<br />
ORTHOPÄDIE TECHNIK in<br />
der Ausgabe 07/2023 erschienen<br />
und über den QR-Code abrufbar.<br />
Die Fragen stellte Heiko Cordes.<br />
Sanitätshaus 2024<br />
41
Abstracts<br />
Lymphologie<br />
R. Hägerling<br />
Die Genetik und Diagnostik<br />
des primären Lymphödems<br />
Das primäre Lymphödem ist eine angeborene, genetisch verursachte<br />
Erkrankung des Lymphgefäßsystems. Diese genetisch bedingten<br />
Abweichungen resultieren aus einer Fehlentwicklung<br />
oder Dysfunktionen im Lymphgefäßsystem, was zu einer Akkumulation<br />
von Flüssigkeit im Gewebe und somit zur Entwicklung eines<br />
Ödems führt. Die häufigste Form dieser Erkrankung manifestiert<br />
sich als peripheres Lymphödem in den unteren Extremitäten. Jedoch<br />
können auch systemische Manifestationen auftreten, darunter<br />
intestinale Lymphangiektasien, Aszites, Chylothorax oder sogar<br />
ein Hydrops fetalis. Das klinische Erscheinungsbild und die Ausprägung<br />
des Lymphödems variieren je nach dem beteiligten Gen und<br />
der vorliegenden Mutation. Die Formen des Lymphödems werden<br />
in fünf Kategorien unterteilt: (1) Erkrankungen mit somatischem<br />
Mosaik und segmentalen Wachstumsstörungen, (2a) syndromale<br />
Krankheitsbilder, (2b) Erkrankungen mit systemischer Beteiligung,<br />
(2c) kongenitale Lymphödeme und (2d) spät auftretende<br />
(late-onset) Lymphödeme nach dem ersten Lebensjahr. Die genetische<br />
Diagnostik erfolgt nach detaillierter Beurteilung der klinischen<br />
Symptome des Patienten und Einordnung in eine der oben<br />
genannten fünf Kategorien. Die Diagnostik erfolgt in der Regel gemäß<br />
einer Stufendiagnostik. Man beginnt typischerweise mit einer<br />
Basisdiagnostik, die zytogenetische und molekularzytogenetische<br />
Untersuchungen umfasst. Anschließend kann eine molekulargenetische<br />
Diagnostik mittels Einzelgen-Analysen, Gen-Panel-Untersuchungen,<br />
Exomsequenzierung oder Ganzgenomsequenzierung<br />
durchgeführt werden. Diese Untersuchungen ermöglichen die<br />
Identifizierung von genetischen Varianten oder Mutationen, die<br />
als Ursache für die vorliegende Symptomatik angesehen werden<br />
können. Die Kenntnis der ursächlichen, genetischen Veränderung<br />
ermöglicht in Verbindung mit einer humangenetischen Beratung<br />
Aussagen über den Vererbungsmodus, das Wiederholungsrisiko<br />
und mögliche Begleitsymptome. In vielen Fällen ist eine präzise<br />
molekulargenetische Diagnostik erforderlich, um die spezifische<br />
Form des primären Lymphödems eindeutig zu identifizieren.<br />
Schlüsselwörter: Genetik, Lymphödem, Molekulargenetik,<br />
Diagnostik, Lymphgefäßerkrankungen<br />
Abstract aus ORTHOPÄDIE TECHNIK 11 / 2023, S. 28 – 37<br />
Kompression<br />
W. M. Strobl<br />
Senso-Orthetik mit Kompression und<br />
Elektrostimulation bei zerebralen<br />
Bewegungsstörungen – was wissen<br />
wir zur Effektivität?<br />
Bei Kindern und Erwachsenen mit zerebralen Bewegungsstörungen<br />
wird die Rolle der Sensorik, die ausreichende zentrale Verarbei-<br />
tung exterozeptiver und propriozeptiver Reize aus der Peripherie<br />
für die Gewährleistung einer angemessenen Haltungs- und Bewegungskontrolle<br />
unterschätzt. Die Folgen sind fortschreitende sekundäre<br />
Effekte des Nicht-Gebrauchs, Schmerzen und muskuloskelettale<br />
Veränderungen. Die Stimulation der Mechanorezeptoren<br />
durch Kompression und Elektrostimulation ermöglicht eine<br />
nicht-invasive Aktivierung des gesamten sensomotorischen Systems<br />
und eine subjektiv und objektiv messbare Verbesserung der<br />
Lebensqualität. Zahlreiche Beobachtungsstudien und Erfahrungen<br />
berichten über positive Effekte. Senso-Orthesen mit Kompression<br />
und/oder Elektrostimulation können Schmerzen reduzieren,<br />
den Tonus regulieren und die physiologisch und psychologisch<br />
wichtige Haltung sowie die Bewegung des Patienten verbessern.<br />
Wie in vielen anderen Fällen multimodaler konservativer Behandlungsmaßnahmen<br />
reicht die wissenschaftliche Evidenz jedoch für<br />
eine abschließende Aussage für die meisten Senso-Orthesen noch<br />
nicht aus. Bei allen Senso-Orthesen mit Kompression und / oder<br />
Elektrostimulation ist eine genaue Diagnostik und Testung durch<br />
ein erfahrenes Team unerlässlich, um die bestmögliche Therapieoption<br />
zu finden.<br />
Schlüsselwörter: Senso-Orthesen, Kompressionsorthesen,<br />
Ganzkörperkompressionsorthese, Elektrostimulation,<br />
Elektrostimulationsorthese, Zerebrale Bewegungsstörung<br />
Abstract aus ORTHOPÄDIE TECHNIK 11 / 2023, S. 38 – 47<br />
Kompression<br />
H. Lötzerich<br />
Kompressionsbekleidung im Sport und<br />
ihre Wirksamkeit bezüglich Leistung,<br />
Regeneration und Propriozeption – ein<br />
Überblick über die Studienlage<br />
Der Einfluss von Kompressionsstrümpfen im Sport wird auf mehreren<br />
Ebenen diskutiert: Sie werden in erster Linie getragen, um<br />
die sportliche Leistung und die Regeneration zu verbessern und<br />
dabei der Müdigkeit entgegenzuwirken. Weiterhin soll die Propriozeption<br />
verbessert werden. Während biologische Grundlagenuntersuchungen<br />
eine deutliche Verbesserung des venösen Abflusses<br />
durch eine Kompressionstherapie nachweisen können, variiert die<br />
Evidenz in vielen Studien aufgrund sehr unterschiedlicher methodischer<br />
Ansätze, verschiedener Probandengruppen und sehr unterschiedlicher<br />
Messparameter. Insgesamt sprechen jedoch etliche<br />
Befunde für eine Verbesserung der Ausdauerleistung und eine verbesserte<br />
Regeneration durch das Tragen von Kompressionsbekleidung<br />
im Sport – zudem verbessert sich dadurch nicht zuletzt auch<br />
die psychische Verfassung der Sportler. Bei den Befunden zeigt<br />
sich eine gewisse Tendenz: Je weniger trainiert, je älter und je übergewichtiger<br />
die Probanden sind, umso deutlicher zeichnen sich die<br />
positiven Effekte einer Kompressionsbestrumpfung ab.<br />
Schlüsselwörter: Kompressionsstrümpfe, sportliche Leistung,<br />
Regeneration<br />
Abstract aus ORTHOPÄDIE TECHNIK 11 / 2022, S. 42 – 47<br />
42<br />
Sanitätshaus 2024
„Improvisation“<br />
Illustration: Karlheinz Baumann
Seit Jahren<br />
Partner der Betriebe<br />
Feiern Sie<br />
mit uns<br />
auf der<br />
OTWorld!<br />
Halle 3<br />
D20/E21<br />
Sie sind<br />
eingeladen.<br />
Holen Sie sich<br />
an unserem Messestand<br />
Ihre Geburtstagsüberraschung<br />
ab<br />
und profitieren Sie<br />
von unseren<br />
Geburtstagsangeboten.<br />
Wir freuen<br />
uns auf Sie.<br />
Diese Anzeige wurde KI-unterstützt erstellt.