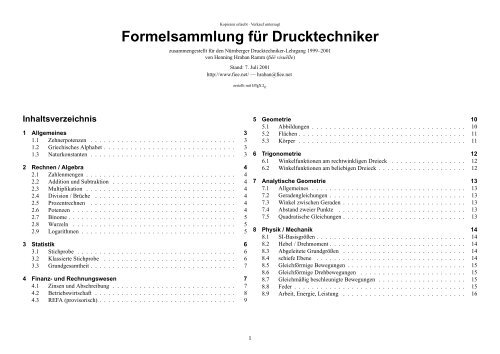Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub
Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub
Formelsammlung für Drucktechniker - bavariansocialclub
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Inhaltsverzeichnis<br />
Kopieren erlaubt · Verkauf untersagt<br />
<strong>Formelsammlung</strong> <strong>für</strong> <strong>Drucktechniker</strong><br />
1 Allgemeines 3<br />
1.1 Zehnerpotenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
1.2 Griechisches Alphabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
1.3 Naturkonstanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
2 Rechnen / Algebra 4<br />
2.1 Zahlenmengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.2 Addition und Subtraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.3 Multiplikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.4 Division / Brüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.5 Prozentrechnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.6 Potenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />
2.7 Binome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2.8 Wurzeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
2.9 Logarithmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />
3 Statistik 6<br />
3.1 Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
3.2 Klassierte Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
3.3 Grundgesamtheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
4 Finanz- und Rechnungswesen 7<br />
4.1 Zinsen und Abschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
4.2 Betriebswirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
4.3 REFA (provisorisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />
zusammengestellt <strong>für</strong> den Nürnberger <strong>Drucktechniker</strong>-Lehrgang 1999–2001<br />
von Henning Hraban Ramm (fiëé visuëlle)<br />
Stand: 7. Juli 2001<br />
http://www.fiee.net/ — hraban@fiee.net<br />
erstellt mit LATEX 2 ε<br />
1<br />
5 Geometrie 10<br />
5.1 Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
5.2 Flächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
5.3 Körper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />
6 Trigonometrie 12<br />
6.1 Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
6.2 Winkelfunktionen am beliebigen Dreieck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
7 Analytische Geometrie 13<br />
7.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
7.2 Geradengleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
7.3 Winkel zwischen Geraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
7.4 Abstand zweier Punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
7.5 Quadratische Gleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />
8 Physik / Mechanik 14<br />
8.1 SI-Basisgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
8.2 Hebel / Drehmoment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
8.3 Abgeleitete Grundgrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
8.4 schiefe Ebene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
8.5 Gleichförmige Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
8.6 Gleichförmige Drehbewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
8.7 Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
8.8 Feder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />
8.9 Arbeit, Energie, Leistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9 Elektrotechnik 16<br />
9.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
10 Wärmelehre 17<br />
10.1 Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
10.2 Wärme-Ausdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
10.3 Wärmemenge und Wärmekapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />
11 Optik / Reproduktion / Messtechnik 18<br />
11.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
11.2 Sensitometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
11.3 Auflösung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
11.4 Spiegel und Linsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />
11.5 Elektromagnetisches Spektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
11.6 Kopiertabellen <strong>für</strong> Positivplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
11.7 Filmempfindlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
11.8 Gradation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
11.9 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
11.10 Rasterwinkelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />
12 Technische Chemie 20<br />
12.1 Kreuzprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
12.2 pH-Wert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
12.3 Gefahrenklassen brennbarer Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
12.4 Viskosität nach DIN 16515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
12.5 Oberflächenspannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />
12.6 Verdunstungszahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
12.7 Umweltbelastung bei der Papierherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
13 Satztechnik 21<br />
13.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />
13.2 Satzspiegel im Werksatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />
13.3 Tabellensatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
13.4 Manuskriptberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
13.5 Reihenfolge der Teile eines Werkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
13.6 Satztechnische Feinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />
13.7 Korrekturzeichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />
14 Informatik 26<br />
14.1 Zahlensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
14.2 Maßeinheiten und Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
14.3 Dateigrößen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />
2<br />
15 Bedruckstoffe 27<br />
15.1 Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
15.2 Einteilung nach m A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
15.3 Papier / Bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
15.4 Papier / Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
15.5 Ausschießen <strong>für</strong> das Einstecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />
15.6 Preisberechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
15.7 Druckbogen-Größe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
15.8 Pappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
15.9 Papierformate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />
15.10 Unterlagebogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
15.11 Qualitätsbezeichnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
15.12 Spezielle Papiersorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />
15.13 Lebensdauerklassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
15.14 Akklimatisierungszeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
15.15 Genormte Papierqualitäten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />
15.16 Papiersorten nach Abkürzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />
16 Drucktechnik 33<br />
16.1 Siebdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
16.2 Farbdichte im Offsetdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
16.3 Farbübertragung einer Rasterwalze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
16.4 Gravierzeit <strong>für</strong> Tiefdruckzylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />
16.5 Offset-Probedrucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
16.6 Längung einer flexiblen Druckform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
16.7 Zahnräder an Flexodruck-Formatzylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
16.8 Formatklassen Bogenoffset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
16.9 Tonwertzunahmen nach Färbungs-Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />
17 Druckweiterverarbeitung 35<br />
17.1 Variablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
17.2 Material-Empfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
17.3 Materialverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />
18 Anhang 36<br />
18.1 Mathematisch-physikalische Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />
18.2 Maßeinheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br />
18.3 Historisches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />
18.4 Normen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br />
18.5 Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />
18.6 Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
1 Allgemeines<br />
1.1 Zehnerpotenzen<br />
Potenz Zahl Vorsilbe Abk.<br />
10 100 Googol<br />
10 24 Quadrillion yotta Y<br />
10 21 Trilliarde zetta Z<br />
10 18 Trillion exa E<br />
10 15 Billiarde peta P<br />
10 12 Billion tera T<br />
10 9 Milliarde giga G<br />
10 6 Million mega M<br />
10 3 Tausend kilo k<br />
10 2 Hundert hekto h<br />
10 1 Zehn deka da<br />
10 0 Eins — –<br />
10 −1 Zehntel dezi d<br />
10 −2 Hunderstel zenti c<br />
10 −3 Tausendstel milli m<br />
10 −6 Millionstel mikro µ<br />
10 −9 Milliardstel nano n<br />
10 −12 Billionstel pico p<br />
10 −15 Billiardstel femto f<br />
10 −18 Trillionstel atto a<br />
10 −21 Trilliardstel zepto z<br />
10 −24 Quadrillionstel yokto y<br />
1.2 Griechisches Alphabet<br />
klein groß Name Lautwert<br />
α A alpha a<br />
β B beta b<br />
γ Γ gamma g<br />
δ ∆ delta d<br />
ε E epsilon e<br />
ζ Z zeta z<br />
η H eta ä<br />
ϑ,θ Θ theta th<br />
ι I iota (jota) i, j<br />
κ K kappa k<br />
λ Λ lambda l<br />
µ M my (mü, mu) m<br />
ν N ny (nü, nu) n<br />
ξ Ξ xi x (ks)<br />
o O omikron o<br />
π Π pi p<br />
ρ P rho r(h)<br />
σ,ς Σ sigma s<br />
τ T tau t<br />
υ ϒ, Y ypsilon y (u, ü, i)<br />
ϕ,φ Φ phi ph (f)<br />
χ X chi ch<br />
ψ Ψ psi ps<br />
ω Ω omega o (ô)<br />
3<br />
1.3 Naturkonstanten<br />
Konstante Bedeutung Wert<br />
c,c0 Lichtgeschwindigkeit<br />
im Vakuum<br />
299792458 m s<br />
e Elementarladung 1,60217646263 · 10−19C e Euler’sche Zahl (nat.<br />
Logarithmus)<br />
2,7182818<br />
f ,G Newton’sche Gravitationskonstante<br />
6,67310 · 10−11 m3<br />
kgs2 LJ Lichtjahr 9,4607304 · 1012 km<br />
me Elektronenmasse 9,10938188 · 1031 kg<br />
NA ,L Avogadro-Konstante 6,0221419947 · 1023 1<br />
u Atomare Masseneinheit<br />
mol<br />
1<br />
N = 1,6605655 · 10<br />
A<br />
−27 kg<br />
ε0 elektrische Konstante<br />
8,854187817... · 10−12 N<br />
A2 µ 0 magnetische<br />
stanteKon-<br />
4π · 10−7 N<br />
A2 π Kreiszahl 3,1415927<br />
Seitenweise Naturkonstanten siehe<br />
http://physics.nist.gov/constants.
2 Rechnen / Algebra<br />
2.1 Zahlenmengen<br />
Name Symbol und Definition<br />
Natürliche Zahlen N = {0,1,2,...}<br />
N ∗ = {1,2,3,...} = N\{0}<br />
Ganze Zahlen Z = {... − 2,−1,0,1,2,...}<br />
Z ∗ = {... − 2,−1,1,2,...} = Z\{0}<br />
Z ∗ + = N ∗<br />
Rationale Zahlen Q = Bruchzahlen<br />
(endliche und periodische Dezimalzahlen)<br />
Irrationale Zahlen z. B. √ 2, π<br />
(unendliche nichtperiodische Dezimalzahlen)<br />
Reelle Zahlen R = rationale + irrationale Zahlen<br />
Komplexe Zahlen C mit Anteil von i = √ −1<br />
2.2 Addition und Subtraktion<br />
Kommutativgesetz: a + b = b + a<br />
Assoziativgesetz: (a + b) + c = a + (b + c)<br />
0 ist das neutrale Element der Addition.<br />
a + 0 = a<br />
Subtraktion: a − b = a + (−b)<br />
Vorzeichen: +(+a) = +a − (−a) = +a<br />
+(−a) = −a − (+a) = −a<br />
2.3 Multiplikation<br />
Kommutativgesetz: a · b = b · a<br />
Assoziativgesetz: a · (b · c) = (a · b) · c<br />
Distributivgesetz: a(b + c) = ab + ac<br />
a(b − c) = ab − ac<br />
1 ist das neutrale Element der Multiplikation.<br />
1 · a = a 0 · a = 0<br />
Vorzeichen: a · (−b) = −(ab)<br />
(−a) · (−b) = ab<br />
4<br />
2.4 Division / Brüche<br />
Die Division ist die Umkehrung der Multiplikation.<br />
1 ist das neutrale Element der Division.<br />
Durch 0 darf nicht dividiert werden!<br />
a : b = a<br />
b<br />
a<br />
= a<br />
1<br />
a x a · x<br />
· =<br />
b y b · y<br />
Zähler<br />
Nenner<br />
0<br />
= 0<br />
a<br />
a x a · y<br />
: =<br />
b y b · x<br />
Kürzen und Erweitern ändern nur die Form, nicht aber den Wert eines Bruches:<br />
a a x<br />
= ·<br />
b b x<br />
2.5 Prozentrechnen<br />
P = %-Wert, p = %-Satz, G = Grundwert<br />
P =<br />
G · p%<br />
100<br />
2.6 Potenzen<br />
G =<br />
P · 100<br />
p%<br />
p% = P<br />
· 100<br />
G<br />
Potenzieren bedeutet, die Basis so oft mit sich selbst zu multiplizieren, wie ihr Exponent<br />
angibt.<br />
Basis Exponent<br />
a m · a n = a m+n<br />
a n · b n = (ab) n<br />
(a n ) m = a n·m<br />
a m : a n = a m−n<br />
a n : b n <br />
a<br />
n =<br />
b<br />
a −n = 1<br />
a n<br />
a 1 = a a 0 = 1 (<strong>für</strong> a = 0)
2.7 Binome<br />
2.7.1 Quadratische Binome<br />
(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2<br />
2.7.2 Binome höheren Grades<br />
(a + b)(a − b) = a 2 − b 2<br />
Die Faktoren der Summanden (Binominalkoeffizienten) kx ergeben sich aus dem Pascalschen<br />
Dreieck (siehe 2.7.3). Ist das Binom eine Subtraktion, wechseln sich die Vorzeichen der<br />
Summanden ab, mit +a n beginnend.<br />
(a ± b) n = a n ± k 2 · a n−1 · b ± ... ± k n−1 · a · b n−1 ± b n<br />
2.7.3 Pascalsches Dreieck<br />
Potenz Binominalkoeffizienten<br />
0 1<br />
1 1 1<br />
2 1 2 1<br />
3 1 3 3 1<br />
4 1 4 6 4 1<br />
5 1 5 10 10 5 1<br />
6 1 6 15 20 15 6 1<br />
7 1 7 21 35 35 21 7 1<br />
8 1 8 28 56 70 56 28 8 1<br />
9 1 9 36 84 126 126 84 36 9 1<br />
5<br />
2.8 Wurzeln<br />
Radizieren (Wurzel ziehen) ist die Umkehrfunktion zum Potenzieren.<br />
n√ a = x ←→ x n = a n √ a = a 1 n<br />
2√ a = √ a<br />
n√ a · n √ b = n√ ab<br />
√ a 2 = ±a<br />
n√ a m = n √ a m = a m n = kn√ a km<br />
<br />
n √m m<br />
a = n √ a = nm√ a<br />
2.9 Logarithmen<br />
n√<br />
a<br />
n√ =<br />
b n<br />
<br />
a<br />
b<br />
n√ 0 = 0<br />
a n√ b = n√ a n b<br />
Der Logarithmus ermittelt den Exponenten zu einer gegebenen Basis.<br />
a = Basis Exponent<br />
←→ Exponent = log Basis a<br />
log 10 x = lgx log e x = lnx log 2 x = lbx = ldx<br />
log(u · v) = logu + logv logu n = n · logu<br />
log u<br />
v = logu − logv log n√ u = logu 1 n = 1<br />
n logu<br />
log 1<br />
u = −logu loga u = logb u<br />
logb a<br />
Achtung: Logarithmische Werte werden nicht mit Komma, sondern mit Punkt geschrieben!
3 Statistik<br />
3.1 Stichprobe<br />
Variable Name Bedeutung Definition<br />
n Anzahl der Messwerte falls errechnet, auf ganze 5 runden!<br />
˜x Median, Zentralwert 50 % der Messwerte liegen oberhalb bzw. unterhalb <strong>für</strong> n gerade: ˜x = x n<br />
2<br />
2<br />
der geordneten Messwrte <strong>für</strong> n ungerade: ˜x = x n+1<br />
2<br />
¯x Arithmetischer Mittelwert der Stichprobe Schwerpunkt der Messwerte ¯x = 1 n ∑i=n i=1 xi = x1 +x2 +...+xn<br />
n<br />
D Modalwert Messwert, der am häufigsten vorkommt<br />
R<br />
s<br />
Spannweite „Breite“ der Messwerte R = xmax − xmin 2 Varianz Streuung s2 = 1<br />
n−1 ∑i=n i=1 (xi − ¯x)2 ≈ 1<br />
<br />
n−1 ∑ i=n<br />
i=1 x2 i − 1 <br />
i=n<br />
n ∑i=1 x s, σn−1 Standardabweichung der Stichprobe<br />
<br />
2<br />
i<br />
s = ± √ s2 z Streuzahl (%) z = R v Variationskoeffizient (%) Abweichung der Messwerte vom Mittelwert<br />
¯x · 100<br />
v = s ¯x · 100<br />
3.2 Klassierte Stichprobe<br />
Variable Name Bedeutung Definition<br />
n Anzahl der Messwerte klassiert wird erst ab 30 Werten n ≥ 30<br />
x u 1 kleinster Messwert abgerundet<br />
x o k größter Messwert aufgerundet<br />
k Anzahl der Klassen Aufteilung der klassierten Stichprobe k = 3√ n... √ n<br />
w, ∆x Klassenbreite Bereich einer Klasse w = x0 k−xu 1<br />
k<br />
x∗ j Klassenmitte Mittlerer Wert zwischen den Grenzen der Klasse<br />
n j Absolute Häufigkeit Wie oft tritt der Messwert auf?<br />
¯x Arithmetischer Mittelwert ¯x = 1 n ∑i=n i=1 x∗j n j<br />
h j Relative Häufigkeit in Prozent h j = n j<br />
n · 100<br />
Fj Relative Häufigkeitssumme in Prozent Fj = ∑ i=n<br />
i=1 h j<br />
6<br />
+x n 2 +1
3.3 Grundgesamtheit<br />
Variable Bezeichung Definition<br />
µ Mittelwert der Grundgesamtheit<br />
σ Standardabweichung der Grundgesamtheit<br />
σ =<br />
<br />
∑x 2 − (∑x)2<br />
n<br />
n<br />
ϕ Gleichung der Normalverteilung ϕ(x) = 1<br />
FG Freiheitsgrade = Zahl der „Zwischenräume“ der Stichprobe (n − 1 bei<br />
1 − α<br />
einer Probenreihe, n1 + n2 − 2 bei zwei usw.)<br />
Aussagewahrscheinlichkeit (AW)<br />
t Kritischer Wert der t-Verteilung, siehe Tabelle 2, REFA-Ordner<br />
µ<br />
abhängig von FG und 1 − α<br />
oben<br />
unten Vertrauensbereich des Mittelwerts,<br />
Näherung <strong>für</strong> µ<br />
ε Relativer Vertrauensbereich des<br />
Mittelwerts in Prozent<br />
n ′ Umfang der Stichprobe bei vorgegebenem<br />
ε ′<br />
Seite 2/78<br />
σ √ 2π · e− 1 2( x−µ<br />
σ ) 2<br />
µ oben<br />
unten = ¯x ± t·s<br />
√ n<br />
ε =<br />
µ− ¯x<br />
¯x · 100 = ± t·v<br />
√ n<br />
n ′ = t·v<br />
ε ′<br />
2 χ2 Kritischer Wert der χ2-Verteilung siehe Tabelle 3, REFA-Ordner<br />
Seite 2/80f.<br />
σ unten<br />
σ oben<br />
unterer Vertrauensbereich der Standardabweichung<br />
oberer Vertrauensbereich der Standardabweichung<br />
sD Standardabweichung der Differenz<br />
zweier Mittelwerte<br />
(µ 2 − µ 1 ) oben<br />
unten Vertrauensbereich<br />
zweier Mittelwerte<br />
der Differenz<br />
σ unten = s<br />
<br />
n−1<br />
χ2 1− α 2 ;n−1<br />
<br />
n−1<br />
σoben = s<br />
χ2 α<br />
2<br />
;n−1<br />
s D =<br />
<br />
(n1−1)s2 1 +(n2−1)s2 <br />
2<br />
n1 +n2 n1 +n2−2 n1 ·n2 (µ 2 − µ 1 ) oben<br />
unten = ( ¯x 2 − ¯x 1 ) ±t · s D<br />
7<br />
4 Finanz- und Rechnungswesen<br />
4.1 Zinsen und Abschreibung<br />
4.1.1 Zinsrechnung<br />
Variable Bezeichnung Definition<br />
z Zins z = K · j · p %<br />
zt Tageszinsen zt = K·t·p %<br />
K Kapital K = z<br />
p· j · 100<br />
p % Zinssatz p % = 100·z<br />
K· j<br />
j,m,t Zeit in Jahren, Monaten, Tagen j = m t<br />
12 = 360<br />
Z Zinszahl Z = K·t<br />
100<br />
d Zinsteiler d = 360<br />
p<br />
4.1.2 Zinseszinsrechnung<br />
360 = Z d<br />
Variable Bezeichnung Definition<br />
q Zinsfaktor q = 1 + p %<br />
K 0 Anfangskapital K 0 = Kn<br />
q n<br />
Kn Endwert (Kapital nach n Jahren) Kn = K 0 · q n<br />
4.1.3 Abschreibung<br />
Variable Name Abschreibungsart Definition<br />
A Abschreibungsbetrag, linear A = W−R<br />
n<br />
Abschreibesumme arithm. degressiv A = (n+1−i)(W0−R) 1+2+...+n<br />
<br />
RW<br />
A % , p % Abschreibesatz geom. degressiv A % =<br />
1 − n<br />
<br />
· 100<br />
W0 W (n)<br />
R<br />
Anschaffungswert<br />
Wiederbeschaffungsneuwert,<br />
Buchwert<br />
Restwert nach n Jahren<br />
linear<br />
arithm. degressiv<br />
Wn = W0 (1 − n · p % )<br />
n Wn = W0 1 − p% = W0 · wn<br />
n Nutzungsdauer<br />
i Jahres-Zähler<br />
wn Abschreibungsfaktor wn =<br />
Index des Bewertungsjahres<br />
Index des Anschaffungsjahres
4.2 Betriebswirtschaft<br />
4.2.1 Zeitarten<br />
Variable Nr. Zeitart Definition<br />
t Rüst 1 Rüstzeit<br />
t sF 2 sonstige Fertigungszeit<br />
t Aus f 3 Ausführungszeit<br />
t F 1–3 Fertigungszeit t F = t Rüst +t Aus f +t sF<br />
t techStör 4 technische Störung<br />
t orgStör 5 organisatorische Störung<br />
t apbH 6 arbeitsplatzbedingte Hilfszeit<br />
t H 4–6 Hilfszeit t H = t techStör +t orgStör +t apbH<br />
t bezAbw 7 bezahlte Abwesenheit<br />
t grRep 8 Großreparatur (über 8 h)<br />
t Still 9 Stillstandzeit<br />
t A 7–9 Ausfallzeit t A = t bezAbw +t grRep +t Still<br />
4.2.2 Betriebswirtschaftliche Größen<br />
4.2.3 Kosten<br />
Variable Name Definition<br />
Kv variable Kosten, Grenzkosten Kv = K2−K1 B2−B =<br />
1<br />
∆K<br />
Kf Kx,e<br />
fixe Kosten, Fixkosten<br />
. . . einzelkosten<br />
∆B<br />
Kf = K − B · Kv<br />
Kx,g . . . gemeinkosten<br />
KF Fertigungskosten<br />
KH KM SF Herstellkosten<br />
Materialkosten<br />
Fertigungskostensatz<br />
KH = KF + KM KM = KM,e + KM,g SF = K ZM,g Materialgemeinkostenzuschlag<br />
F<br />
tF ZM,g = KM,g K · 100<br />
M,e<br />
Variable Name Einheit Erklärung Definition<br />
E Produktivität, Effizienz Leistung im Verhältnis zum Arbeitseinsatz (mengenmäßig) E = P E Wirtschaftlichkeit DM<br />
DM Leistung im Verhältnis zum Einsatz (wert- bzw. kostenmäßig)<br />
W<br />
E = P E % Rentabilität, Rendite % Gewinn im Verhältnis zum eingesetzen Kapital<br />
W > 1<br />
E % = G K · 100<br />
C Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstage mal Arbeitsstunden pro Tag<br />
Ctari f tarifliche Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstag mit 7 h Ctari f = 1757 h a<br />
Cmax maximale Arbeitsplatzkapazität h Arbeitstage mit 24 h Cmax = 6024 h a<br />
Cgen genutzte A.-Kapazität h Cgen = tF +tH B◦ Beschäftigungsgrad % bezogen auf Ctari f oder Cmax B◦ = Cgen<br />
C · 100<br />
N◦ Nutzungsgrad % N◦ = tF · 100 Cgen<br />
t % Zeitanteil % Anteil einer Zeitart an ihrer Zeitarten-Gruppe z. B. t 1% = t 1<br />
t 1 +t 2 +t 3<br />
Mengenausbringung Leistung pro Zeit oder Zeit pro Leistungseinheit<br />
L◦ Leistungsgrad % Ist-Leistung im Verhältnis zur Soll-Leistung L◦ = Ist<br />
Soll · 100<br />
8<br />
Z Vt,g Vertriebsgemeinkostenzuschlag Z Vt,g = K Vt,g<br />
K H · 100<br />
Z V w,g Verwaltungsgemeinkostenzuschlag Z V w,g = K V w,g<br />
K H · 100<br />
· 100
4.3 REFA (provisorisch)<br />
4.3.1 Variablen und Abkürzungen<br />
A Arbeitsgegenstand<br />
B Betriebsmittel<br />
M Mensch<br />
m Menge<br />
K Kosten<br />
te Zeit je Einheit<br />
Rüstzeit<br />
tr<br />
4.3.2 Kennzahlen<br />
t EM,th<br />
Kennzahl<br />
Beobachtungszahl<br />
Bezugszahl<br />
Theoretische Einsatzzeit <strong>für</strong> Menschen Anzahl Menschen · Arbeitszeit · Schichtzahl/Periode<br />
t EM, Soll Soll-Einsatzzeit Planungsfaktor · theoretische Einsatzzeit<br />
t<br />
EB<br />
Einsatzzeit <strong>für</strong> Betriebsmittel Anzahl Betriebsmittel · Arbeitszeit/Schicht<br />
· Schichtzahl/Tag · Tage/Periode<br />
t<br />
EB, Soll<br />
Soll-Einsatzzeit <strong>für</strong> Betriebsmittel Planungsfaktor · theoretische Einsatzzeit<br />
K Krankenstandgrad Krankenstunden<br />
theoretische Einsatzzeit ·100%<br />
F Fertigungsgrad<br />
Fertigungszeiten<br />
Fertigungs- + Hilfszeiten ·100%<br />
Fertigungs- + Hilfszeiten<br />
Theoretische Einsatzzeit ·100%<br />
Σ Vorgabezeiten/Periode<br />
Σ Ist-Zeiten/Periode ·100%<br />
B Beschäftigungsgrad<br />
tM V<br />
Zeitgrad des Menschen<br />
Verrichtungsgrad [%] Zeit <strong>für</strong> das Verrichten ·100%<br />
tR Überwachungsgrad [%]<br />
Rüstzeitgrad [%] Rüstzeiten<br />
N H<br />
N ges<br />
Hauptnutzungsgrad<br />
Gesamtnutzungsgrad<br />
? Arbeitsflussgrad<br />
A Ausbringungsgrad<br />
Auftragszeit<br />
Zeit <strong>für</strong> das Überwachen<br />
Auftragszeit ·100%<br />
Rüst- + Ausführungszeiten ·100%<br />
Hauptnutzungszeit<br />
theoretische Einsatzzeit ·100%<br />
Haupt- + Nebennutzungs- + Unterbrechungszeiten<br />
theoretische Einsatzzeit<br />
·100%<br />
Σ Fertigungszeiten<br />
Durchlaufzeit ·100%<br />
Arbeitsergebnis in Anzahl Gutteile<br />
Anzahl bearbeiteter Teile insgesamt ·100%<br />
Leistungslöhne<br />
Gesamtsumme Löhne ·100%<br />
Instandhaltungskosten/Jahr<br />
kalk. Abschreibung/Jahr ·100%<br />
Ll Leistungslohngrad<br />
KI Instandhaltungskostengrad<br />
KM Materialkostengrad Materialkosten<br />
Herstellkosten ·100%<br />
9<br />
4.3.3 Zuschlagskalkulation<br />
MEK Materialeinzelkosten<br />
MGK Materialgemeinkosten MGK = (1+ MGKZ<br />
100 )<br />
MGKZ Materialgemeinkostenzuschlagssatz<br />
MK Materialkosten MK = MEK + MGK<br />
FLK Fertigungslohnkosten<br />
FGK Fertigungsgemeinkosten FGK =<br />
FGKZ Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz<br />
FK Fertigungskosten FK = FLK + FGK<br />
SEF Sondereinzelkosten der Fertigung<br />
HK Herstellkosten HK = MK + FK + SEF<br />
EK Entwicklungs- u. Konstruktionskosten<br />
VwGK Verwaltungsgemeinkosten<br />
VtGK Vertriebsgemeinkosten<br />
VVGK Verwaltungs- u. Vertriebsgemeinkosten VVGK = VwGK + VtGK<br />
SEV Sondereinzelkosten des Vertriebs<br />
SK Selbstkosten SK = HK + EK + VVGK + SEV<br />
4.3.4 Zuschlagskalkulation mit Maschinenkostenrechnung<br />
K A kalkulatorische Abschreibungskosten K A =<br />
K Z kalkulatorische Zinskosten K Z =<br />
Beschaffungspreis<br />
Nutzungsdauer [a] · Einsatzzeit [h/a]<br />
Beschaffungspreis · Zinssatz [%/a]<br />
2 · 100 · Einsatzzeit [h/a]<br />
K R Raumkosten K R = Flächenbedarf · kalk. Mietpreis pro m2 und a<br />
Einsatzzeit [h/a]<br />
K E Energiekosten K E = Elektr. Leistung [kW] · Strompreis<br />
KI Instandhaltungskosten<br />
[DM/kWh]<br />
KI =<br />
MAK Maschinenkostensatz MAK = KA + KZ + KR + KE + KI 4.3.5 kritische Stückzahl<br />
Gesamtkosten/Jahr = (Fixkosten + variable Kosten · Produktionsmenge)/Jahr<br />
Kges,a = (K f + Kv) · M<br />
M kr = K f 2 −K f 1<br />
K v1 −K v2<br />
Beschaffungspreis · Instandhaltungskostensatz [%/a]<br />
100 · Einsatzzeit [h/a]
5 Geometrie<br />
5.1 Abbildungen<br />
Quadrat Rechteck<br />
a<br />
a<br />
d<br />
Raute<br />
e<br />
a<br />
a a<br />
f<br />
a<br />
a<br />
a<br />
Drachen<br />
Parallelogramm Trapez<br />
d<br />
e<br />
a<br />
f<br />
c<br />
b<br />
h a<br />
f<br />
d<br />
b<br />
a b<br />
d<br />
a<br />
e<br />
m<br />
c<br />
a<br />
b<br />
h<br />
2<br />
h<br />
2<br />
Gleichseitiges Dreieck<br />
Gleichschenkliges Dreieck<br />
Rechtwinkliges Dreieck<br />
b<br />
a<br />
α<br />
α<br />
ρ<br />
a<br />
a<br />
α<br />
a a<br />
hc α α<br />
c<br />
α<br />
h<br />
γ<br />
c<br />
q p<br />
r<br />
10<br />
a<br />
β<br />
Würfel Quader<br />
a<br />
Prisma<br />
h<br />
a<br />
A G<br />
A G<br />
d<br />
Zylinder Kegel<br />
Pyramide Pyramidenstumpf<br />
h<br />
A G<br />
a<br />
s<br />
r<br />
h<br />
b<br />
a<br />
h<br />
d<br />
A G2<br />
s<br />
A G1<br />
r<br />
h<br />
c
5.2 Flächen<br />
Form<br />
Gleichseitiges Dreieck<br />
Beschreibung<br />
α = β = γ = 60<br />
Umfang U Fläche A Diagonale d / Sonstiges<br />
◦ U = 3a A = 1 4a2√3 h = a Umkreisradius r, Inkreisradius ρ r =<br />
√<br />
2 3<br />
a Gleichschenkl. Dreieck a = b, α = β<br />
√<br />
3 3<br />
U = 2a + c<br />
√<br />
a ρ = 6 3<br />
A = 1 2chc <br />
hc = a2 − Rechtwinkliges Dreieck c<br />
<br />
c 2<br />
2<br />
2 = a2 + b2 (Satz des Pythagoras) U = a + b + c A = 1 2ch = 1 2c√ pq = ab<br />
2 h = ab<br />
a<br />
c<br />
2 = cp b2 = cq (Kathetensatz) h2 = pq (Höhensatz)<br />
Beliebiges Dreieck α + β + γ = 180◦ U = a + b + c A = 1 2aha = 1 2bhb = 1 2chc s = U a+b+c<br />
2 = 2 A = s(s − a)(s − b)(s − c) (Satz des Heron)<br />
Quadrat Diagonalen senkrecht zueinander, gleich lang U = 4a A = a2 d = a √ Rechteck Diagonalen gleich lang U = 2(a + b) A = ab<br />
2<br />
d = √ a2 + b2 Raute Diagonalen senkrecht aufeinander U = 4a A = 1 2e f e2 + f 2 = 4a2 Drachen Diagonalen senkrecht aufeinander U = 2(a + b) A = 1 Parallelogramm<br />
Trapez<br />
Diagonalen halbieren sich gegenseitig<br />
ac heißen Grundseiten<br />
U = 2(a + b)<br />
U = a + b + c + d<br />
2e f<br />
A = aha = bhb A = mh m = a+c<br />
2<br />
Kreis U = 2πr = πd A = πr2 = 1 4πd2 Ellipse 2 Radien a, b U ≧ π(a + b) A = πab<br />
32 U ≈ π (a + b) − √ <br />
ab<br />
5.3 Körper<br />
<strong>für</strong> b a > 1 5<br />
Körper Mantelfläche A M Oberfläche A O Volumen V Raumdiagonale d<br />
Würfel A M = 4a 2 A O = 6a 2 V = a 3 d = a √ 3<br />
Quader A O = 2(ab + ac + bc) V = abc d = √ a 2 + b 2 + c 2<br />
Allgemeines Prisma A O = 2A G + A M V = A G h<br />
Allgemeine Pyramide A O = A G + A M V = 1 3 A G h<br />
Pyramidenstumpf A O = A G1 + A G2 + A M V = 1 3 h(A G1 + A G1 A G2 + A G2 )<br />
Zylinder AM = 2πrh AO = 2πr(r + h) V = AGh = πr2h d = √ h2 + 4r2 Kegel AM = πrs AO = πr(r + s) V = 1 3AGh = 1 3πr2 h<br />
Kegelstumpf AM = πs ′ (r1 + r2 ) AO = π r2 1 + s(r1 + r2 ) + r2 <br />
1<br />
2 V = 3πh ′ (r2 1 + r1r2 + r2 2 )<br />
Kugel AO = 4πr2 V = 4 3πr2 VZylinder : VKugel : VKegel = 3 : 2 : 1 <strong>für</strong> h = 2r<br />
A G oder G = Grundfläche (siehe 5.2); s = Mantellinie<br />
11
6 Trigonometrie<br />
6.1 Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck<br />
6.1.1 Definition<br />
sinα = Gegenkathete<br />
Hypotenuse<br />
tanα = Gegenkathete<br />
Ankathete<br />
cosα = Ankathete<br />
Hypotenuse<br />
cotα = Ankathete<br />
Gegenkathete<br />
6.1.2 Beziehungen zwischen den Winkelfunktionen<br />
sinα = cos(90 ◦ − α) cosα = sin(90 ◦ − α)<br />
tanα = sinα<br />
cosα<br />
tanα<br />
sinα =<br />
± 1 + (tanα) 2<br />
sinα<br />
tanα =<br />
± 1 − (sinα) 2<br />
cotα = 1<br />
tanα<br />
1<br />
cosα =<br />
± 1 + (tanα) 2<br />
(cosα) 2 + (sinα) 2 = 1<br />
Weitere Umformungen sind in jeder mathematischen <strong>Formelsammlung</strong> zu finden.<br />
12<br />
6.2 Winkelfunktionen am beliebigen Dreieck<br />
6.2.1 Sinussatz<br />
Die Seiten eines Dreiecks verhalten sich zueinander wie die Sinuswerte der zugehörigen<br />
Gegenwinkel.<br />
a sinα<br />
=<br />
b sinβ<br />
a sinα<br />
=<br />
c sinγ<br />
6.2.2 Kosinussatz<br />
b sinβ<br />
=<br />
c sinγ<br />
a : b : c = sinα : sinβ : sinγ<br />
Das Quadrat über einer Dreiecksseite ist gleich der Summe der Quadrate über den beiden<br />
anderen Seiten,<br />
vermindert um das doppelte Produkt dieser beiden Seiten und des Kosinus des von ihnen<br />
eingeschlossenen Winkels.<br />
a 2 = b 2 + c 2 − 2bc · cosα<br />
b 2 = a 2 + c 2 − 2ac · cosβ<br />
c 2 = a 2 + b 2 − 2ab · cosγ<br />
b<br />
C<br />
❅<br />
❅❅❅❅❅❅❅❅<br />
✡<br />
a<br />
✡<br />
✡ γ<br />
hc<br />
✡<br />
✡<br />
A q p B<br />
c<br />
✡✡✡<br />
α ♣<br />
β<br />
✛ ✲✛ ✲<br />
✛ ✲
7 Analytische Geometrie<br />
7.1 Allgemeines<br />
a x-Achsen-Abschnitt (Schnittpunkt mit der x-Achse)<br />
b y-Achsen-Abschnitt (Schnittpunkt mit der y-Achse)<br />
m Steigung der Geraden<br />
xn, yn Koordinaten eines Punktes<br />
α Winkel der Geraden zur x-Achse (Steigungswinkel)<br />
β Winkel der Geraden zur y-Achse<br />
δ Schnittwinkel zweier Geraden<br />
7.2 Geradengleichungen<br />
7.2.1 Hauptform (allgemeine Form):<br />
y = mx + b m = − b<br />
= tanα<br />
a<br />
7.2.2 Zwei-Punkte-Form:<br />
y − y1 = y2 − y1 (x − x1 )<br />
x2 − x1 7.2.3 Punkt-Steigungs-Form:<br />
y − y 1 = m(x − x 1 ) y = m(x − a)<br />
7.2.4 Achsenabschnittsform:<br />
x y<br />
+ = 1<br />
a b<br />
7.3 Winkel zwischen Geraden<br />
7.3.1 Winkel zwischen Gerade und x-Achse, Steigungswinkel<br />
tanα = m (falls α negativ, + 180 ◦ )<br />
7.3.2 Winkel zwischen Gerade und y-Achse<br />
β = 90 ◦ − α<br />
13<br />
7.3.3 Schnittwinkel zweier Geraden<br />
δ = α 2 − α 1<br />
7.3.4 Orthogonale Geraden<br />
tanδ = m2 − m1 =<br />
1 + m1m2 tanα2 − tanα1 1 + tanα1 tanα2 Zwei Geraden stehen rechtwinklig aufeinander,<br />
wenn m2 = − 1 m bzw. m<br />
1<br />
1 · m2 = −1<br />
7.4 Abstand zweier Punkte<br />
<br />
P1P2 = (x1 − x2 ) 2 + (y1 − y2 ) 2 = (∆x) 2 + (∆y) 2<br />
7.5 Quadratische Gleichungen<br />
7.5.1 Normalform / allgemeine Form:<br />
y = x 2 + px + q y = ax 2 + bx + c<br />
<strong>für</strong> y = 0 gilt: x 1,2 = −b ± √ b 2 − 4ac<br />
2a<br />
7.5.2 Diskriminante:<br />
D = b 2 − 4ac D =<br />
<br />
p<br />
2 − q<br />
2<br />
Ist D < 0, so hat die Gleichung keine Lösung in R.<br />
Ist D = 0, so hat die Gleichung genau eine Lösung.<br />
Ist D > 0, so hat die Gleichung zwei Lösungen (x 1,2 ).<br />
7.5.3 Satz von Vieta:<br />
x1 + x2 = − b<br />
a = −p x1 · x c<br />
2 = = q<br />
a<br />
7.5.4 Scheitelform:<br />
y = a(x − x S ) 2 + y S mit S x S<br />
<br />
yS<br />
<br />
<br />
= S − b<br />
2a<br />
= −p ± p 2 − 4q<br />
2<br />
<br />
<br />
<br />
− b2 <br />
− 4ac<br />
4a
8 Physik / Mechanik<br />
8.1 SI-Basisgrößen<br />
Größe Symbol Einheit<br />
Weg / Länge l,s,r m Meter<br />
Zeit t s Sekunde<br />
Masse m kg Kilogramm<br />
Temperatur T K Kelvin<br />
Lichtstärke I cd Candela<br />
Stromstärke I A Ampére<br />
8.3 Abgeleitete Grundgrößen<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
8.2 Hebel / Drehmoment<br />
Das System befindet sich im Gleichgewicht (Ruhe), wenn. . .<br />
Summe der Summe der<br />
linksdrehenden = rechtsdrehenden<br />
Momente Momente<br />
ΣM = ΣM <br />
ΣM = 0<br />
F 1 · l 1 = F 2 · l 2<br />
Fläche A m2 Quadratmeter Länge mal Breite A = s · s<br />
Volumen V m3 ,l Kubikmeter, Liter Länge mal Breite mal Höhe V = s · s · s<br />
Geschwindigkeit v m/s,km/h Weg pro Zeit v = s Beschleunigung a m/s<br />
t<br />
2 Geschwindigkeit pro Zeit a = v Erdbeschleunigung (Ortsfaktor) g m/s<br />
t<br />
2 = N/kg (Konstante je Ort)<br />
Gewichtskraft F G N = kg · m<br />
Dichte ρ<br />
s 2 Newton Masse mal Ortsfaktor F G = m · g<br />
kg<br />
m 3 Masse pro Volumen ρ = m V<br />
N<br />
Wichte γ<br />
m3 Gewichtskraft pro Volumen γ = FG V<br />
Druck p Pa = N/m 2 Pascal Gewichtskraft pro Fläche p = F G<br />
A<br />
bar = 10 5 Pa bar<br />
8.4 schiefe Ebene<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Normalkraft F N N senkrecht zur Ebene F N = F G · cosα = F G b l<br />
Reibungszahl µ (keine) materialabhängige Konstante<br />
Reibungskraft F R N F R = F N · µ<br />
Hangabtriebskraft F H N parallel zur Ebene F H = F G · sinα = F G h l<br />
14
8.5 Gleichförmige Bewegungen<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Frequenz f Hz = 1 s Anzahl pro Zeit f = 1 T = ω 2π<br />
Geschwindigkeit v m/s,km/h Weg pro Zeit v = s t<br />
Beschleunigung a m/s2 Geschwindigkeit pro Zeit a = v t<br />
Impuls p<br />
= Ns Masse mal Geschwindigkeit p = m · v ∆p = F · ∆t<br />
8.6 Gleichförmige Drehbewegungen<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
kgm<br />
s<br />
Zahl der Umdrehungen N (keine) Zahl der Umdrehungen<br />
Drehfrequenz n 1<br />
s Umdrehungen pro Zeit n = N Umfangsgeschwindigkeit v m/s,m/min Drehweg pro Zeit<br />
t<br />
v = s Drehwinkel ϕ ◦ 360 =<br />
t ◦<br />
2π Kreisabschnitt pro Radius ϕ = b Winkelgeschwindigkeit ω<br />
◦<br />
s Winkel pro Zeit<br />
r<br />
ω = ∆ϕ<br />
Winkelbeschleunigung α 1<br />
s2 Winkelgeschw. pro Zeit α = ∆ω<br />
Drehmoment M Nm = J Kraft mal wirksamer Abstand<br />
∆t<br />
M = F · l<br />
8.7 Gleichmäßig beschleunigte Bewegungen<br />
Größe Symbol Einheit Definition beim Freien Fall<br />
Mittlere Geschwindigkeit vm m/s, km/h vm = 1 2at = s t<br />
vm = 1 2gt = h Endgeschwindigkeit v m/s, km/h v =<br />
t<br />
√ 2as = at v = √ 2gh = gt<br />
Beschleunigung a m<br />
s2 a = ∆v<br />
Beschleunigungsweg s m<br />
∆t<br />
s = 1 2at2 h = 1 2gt2 8.8 Feder<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Federkonstante D N m = kg<br />
s 2 Kraft pro Weg D = F s<br />
Spannkraft Fm N Fm = 1 2 Ds<br />
Potentielle Energie, Spannarbeit W S = W pot J Spannkraft mal Weg W S = Fms = 1 2 Ds2<br />
15<br />
= dπN<br />
t<br />
∆t = v r<br />
= dπn<br />
= 2πn
8.9 Arbeit, Energie, Leistung<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Mechanische Arbeit allgemein W J = Nm (Joule) Kraft mal Weg W = Fs · cosα<br />
Hubarbeit, Lageenergie<br />
Reibungsarbeit<br />
Spannarbeit, Potentielle Energie<br />
WH = Wpot WR WS = Wpot J<br />
J<br />
J<br />
Gewichtskraft mal Höhe<br />
Reibungskraft mal Weg<br />
Spannkraft mal Weg<br />
WH = FGh = mgh<br />
WR = FRs = FN µs<br />
WS = Fms = 1 2Ds2 Beschleunigungsarbeit, Kinetische WB J WB = Fs = 1 2mv2 Energie<br />
Leistung allgemein P W = J s (Watt) Arbeit pro Zeit P = W t<br />
„Bewegungsleistung“ P W Kraft mal Geschwindigkeit P = Fv<br />
Wirkungsgrad η (%) η = Wabgegeben W =<br />
aufgenommen<br />
Pabgegeben Paufgenommen 9 Elektrotechnik<br />
9.1 Grundlagen<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Elektrische Stromstärke I A (Ampére) Basisgröße<br />
Elektrische Ladung Q C (Coulomb) Stromstärke mal Zeit Q = I ·t<br />
Elektrische Spannung U<br />
kg m2<br />
V (Volt) (=<br />
s3A ) U = W Ohmscher Widerstand R Ω (Ohm) Spannung durch Stromstärke<br />
Q<br />
R = U Leitwert G S (Siemens) Kehrwert des Widerstandes<br />
lρ<br />
I = A<br />
G = 1 R = I Spez. Widerstand eines Drahtes ρ Ωm (Ohmmeter) Widerstand mal Querschnitt durch Länge<br />
U<br />
ρ = R A l = 1 Kapazität C F (Farad) Ladung pro Spannung<br />
κ<br />
C = Q<br />
Elektrische Arbeit W J (Joule)<br />
U<br />
W = U · Q = U · I ·t<br />
Bei der Reihenschaltung von Widerständen addieren sich die Widerstände sowie die Spannungen an den Widerständen. Die Stromstärke ist konstant.<br />
Bei der Parallelschaltung von Widerständen addieren sich die Stromstärken an den Widerständen sowie die Kehrwerte der Widerstände ( 1 R = 1 R +<br />
1<br />
1 R ). Die Spannung ist konstant.<br />
2<br />
16
10 Wärmelehre<br />
10.1 Temperatur<br />
Symbol Einheit Größe Nullpunkt Umrechnung<br />
T K Kelvin ∆T = ∆ϑC −273,15 ◦C (absoluter Nullpunkt) T = (273 ◦C + ϑC ) K ◦C ϑC ◦C Grad Celsius ∆ϑC = 5 9∆ϑF 0 ◦C =273,15K =32 ◦F ϑC = 5 <br />
ϑF<br />
9 ◦F − 32 ◦C<br />
ϑ F<br />
◦F Grad Fahrenheit ∆ϑF = 9 5∆ϑC 0 ◦F = − 18 ◦ <br />
9ϑC<br />
C =255,15K ϑF = 5 ◦ <br />
C + 32 ◦F<br />
10.2 Wärme-Ausdehnung<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Ausdehnungskoeffizienten α,β,γ 1 K materialabhängige Konstante β = 2α; γ = 3α<br />
Anfangsgröße l 0 m Länge/Durchmesser vor Ausdehung (z. B. auch Durchmesser)<br />
Endgröße l 1 m Länge/Durchmesser nach Ausdehnung l 1 = l 0 (1 + α · ∆T )<br />
Ausdehnung (Länge, Durchmesser) ∆l m Längen-/Größendifferenz ∆l = l 0 · α · ∆T<br />
Flächenausdehnung ∆A m 2 Flächen-Differenz ∆A = A 0 · β · ∆T<br />
Volumenausdehnung ∆V m 3 Volumen-Differenz ∆V = V 0 · γ · ∆T<br />
V Ausdehnung von Gasen bei gleich bleibendem Druck V0<br />
bei gleichzeitiger Druckänderung<br />
10.3 Wärmemenge und Wärmekapazität<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Spezifische Wärmekapazität c kJ<br />
kg·K materialabhängige Konstante<br />
Wärmemenge Q kJ Q = c · m · ∆T<br />
17<br />
= T T0 p1 T1ρ =<br />
1<br />
p2 T2ρ2 = konstant
11 Optik / Reproduktion / Messtechnik<br />
11.1 Allgemeines<br />
Größe Einheit Definition<br />
Lichtstärke I cd Candela Basisgröße<br />
Raumwinkel Ω sr = m2<br />
m 2 Sterradiant Ω = A<br />
r 2<br />
Lichtstrom Φ lm = cd · sr Lumen Φ = I · Ω<br />
Beleuchtungsstärke E lx = lm<br />
m 2 Lux E = Φ A<br />
E 1<br />
E 2<br />
= r2 2<br />
r 2 1<br />
Belichtung H lxs Luxsekunde H = E ·t<br />
Leuchtdichte — cd<br />
m2 Wellenlänge λ m Meter<br />
I<br />
A<br />
Frequenz f Hz = 1 s Hertz f = 1 Wellenausbreitungsgeschwindigkeit<br />
c m<br />
s<br />
t<br />
c = λ · f<br />
11.2 Sensitometrie<br />
Größe Einheit Definition<br />
durchg. Licht<br />
100<br />
remitt. Licht<br />
100<br />
Transparenz T % Prozent T =<br />
Remission R % Prozent R =<br />
Opazität O O = 1 T = Dichte D<br />
100<br />
durchg. Licht<br />
D = logO = log 1 T<br />
11.3 Auflösung<br />
Eingabe-Auflösung = Rasterweite · Abbildungsfaktor · Qualitätsfaktor<br />
Ausgabe-Auflösung = Rasterweite · √ Graustufen<br />
2 Ausgabe-Auflösung<br />
Graustufen =<br />
Rasterweite<br />
Umrechnung von Inch und cm nicht vergessen (Einheiten siehe 13.1.1)!<br />
Postscript arbeitet mit 256 Graustufen pro Kanal.<br />
Als Qualitätsfaktor sind 1,4 bis 2 üblich; mehr wäre Unsinn.<br />
18<br />
11.4 Spiegel und Linsen<br />
11.4.1 Abbildung<br />
Größe Einheit Definition<br />
Gegenstandsweite g / a m Meter<br />
Bildweite b / a ′ m Meter<br />
Gegenstandsgröße G / y m Meter<br />
Bildgröße B / y ′ m Meter<br />
Brennweite f m Meter 1<br />
f = 1 1<br />
a + a ′<br />
f = a′<br />
v+1<br />
f = a′ a<br />
a ′ +a<br />
Abbildungsmaßstab v (keine) v = y′<br />
y<br />
11.4.2 Brechung<br />
Größe Einheit Definition<br />
= a′<br />
a<br />
= 2 f −a′<br />
a−2 f<br />
Brechkraft D dpt = 1 m Dioptrie D = 1 f<br />
Einfallswinkel ε ◦ Grad vom Einfallslot aus<br />
Brechungswinkel ε ′ ◦ Grad vom Einfallslot aus<br />
Brechung / Richtungsänderung<br />
δ ◦ Grad δ = ε − ε ′<br />
sinε<br />
Brechungsindex n (keine) sinε ′ = n′<br />
n<br />
11.4.3 Blenden<br />
Größe Definition<br />
Belichtungszeit t<br />
t1 t =<br />
2<br />
∅2 1<br />
∅2 2<br />
Blendenzahl ∅ Verhältnis der Brennweite ∅ = f<br />
d<br />
zum Durchmesser der Blendenöffnung<br />
Blendenreihe: 1 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 44<br />
Jede Blendenstufe ändert die Belichtung um den Faktor √ 2.
11.5 Elektromagnetisches Spektrum<br />
Wellenlänge Frequenz Abkürzung Strahlungsart/Lichtfarbe Sammelgruppe<br />
100–10 km 3–30 kHz VLF Myriameter-, Längstwellen<br />
10–1 km 30–300 kHz LF, LW Kilometer-, Langwellen (Radar)<br />
1000–1 m 0,3–3 MHz MF, MW Hektometer-, Mittelwellen<br />
100–10 m 3–30 MHz HF, KW Dekameter-, Kurzwellen Radiowellen<br />
10–1 m 30–300 MHz VHF, UKW Meter-, Ultrakurzwellen<br />
1–0,1 m 0,3–3 GHz UHF Dezimeterwellen (Fernsehen)<br />
10–1 cm 3–30 GHz SHF Zentimeterwellen Mikro-<br />
10–1 mm 30–300 GHz EHF Millimeterwellen wellen<br />
1–0,1 mm 0,3–3 THz Dezimillimeter-, Submillimeterwellen Wärme-<br />
0,1 mm–800 nm 3 · 10 11 –3,75 · 10 14 Hz IR Infrarotstrahlung strahlung<br />
780–590 nm R rotes (+ gelbes) Licht sicht-<br />
590–500 nm G grünes Licht bares<br />
500–380 nm B blaues (+ violettes) Licht Licht<br />
400–10 nm 7,5 · 10 14 –3 · 10 16 Hz UV Ultraviolettstrahlung<br />
60–10 −8 nm 5 · 10 15 –3 · 10 25 Hz γ Röntgen- und Gammastrahlung<br />
Die densitometrischen Messpunkte liegen bei 620 (rot), 530 (grün) und 430 (blau) nm.<br />
Im Rot-Bereich wird Cyan gemessen, im Grün Magenta und im Blau Gelb.<br />
11.6 Kopiertabellen <strong>für</strong> Positivplatten<br />
11.6.1 Auflösung bis 8 µm<br />
Mikro- Flächendeckungsgrad der Rasterfelder<br />
linien 7 % 10 % 40 % 80 %<br />
6 µm ≈ 7,0 ≈ 10,0 ≈ 40,0 ≈ 80,0<br />
8 µm 6,5 9,5 39,5 79,5<br />
10 µm 6,5 9,0 38,5 79,5<br />
12 µm 6,0 8,5 37,5 78,0<br />
15 µm 5,5 8,0 36,0 77,5<br />
20 µm 4,5 7,0 34,5 76,0<br />
25 µm 4,0 6,0 33,0 74,5<br />
11.6.2 Auflösung >8 bis 12 µm<br />
Mikro- Flächendeckungsgrad der Rasterfelder<br />
linien 7 % 10 % 40 % 80 %<br />
10 µm ≈ 7,0 ≈ 10,0 ≈ 40,0 ≈ 80,0<br />
12 µm 6,5 9,5 38,5 79,5<br />
15 µm 6,0 8,5 37,0 78,5<br />
20 µm 5,0 7,5 35,5 77,0<br />
25 µm 4,5 6,5 34,5 76,0<br />
30 µm 3,5 5,5 33,0 75,0<br />
Der Standardbereich ist markiert.<br />
19<br />
11.7 Filmempfindlichkeit<br />
ISO / ASA 25 50 100 200 400 800 1600<br />
DIN ° 15 18 21 24 27 30 33<br />
Von Stufe zu Stufe verdoppelt/halbiert sich die Empfindlichkeit.<br />
11.8 Gradation<br />
11.8.1 Gammawert bei Halbtonfilmen<br />
γ = tanα =<br />
Dichte-Umfang der Repro ∆y<br />
=<br />
Dichte-Umfang der Vorlage ∆x<br />
11.8.2 Gammawert in der elektronischen<br />
Bildbearbeitung<br />
γ =<br />
Ausgabewert (Sollwert)<br />
Eingabewert (Ist-Wert)<br />
11.9 Kontrast<br />
GEin Graustufenwert eines Pixels vor der Kontrast-Änderung<br />
GAus Graustufenwert eines Pixels nach der Kontrast-Änderung<br />
GMittel Mittlerer Graustufenwert des Bildes<br />
K Kontrastfaktor (eingestelltes Maß der Kontraständerung)<br />
K = G Aus − G Mittel<br />
G Ein − G Mittel<br />
11.10 Rasterwinkelung<br />
Rasterform Norm 1-fb. 4-fb.<br />
Schachbrettpunkt DIN 45 ◦ 45 ◦ , 75 ◦ , 15 ◦ , 0 ◦<br />
Kettenpunkt DIN 16547 15 ◦ 15 ◦ , 75 ◦ , 135 ◦ , 0 ◦<br />
FOGRA 45 ◦ 45 ◦ , 105 ◦ , 165 ◦ , 0 ◦<br />
Bildwichtigste Farbe möglichst auf 45 ◦ , Gelb auf 0 ◦ .
12 Technische Chemie<br />
12.1 Kreuzprodukt<br />
Das Kreuzprodukt ist eine einfache Methode zur Berechnung<br />
von Mischungsverhältnissen, z. B. bei Lösungen.<br />
Ausgangs- und Ziel-Konzentration werden in % oder Bé ◦ angegeben.<br />
Die Differenz zwischen Ausgangs- und Zielkonzentration<br />
ergibt die „Teile“ des anderen Ausgangsstoffs. Die Teile<br />
können ggf. miteinander „gekürzt“ werden. Die Zielmenge wird<br />
durch die Summe der Teile geteilt, um die Menge eines Teils zu<br />
bestimmen. Diese Teilmenge mal der Anzahl der Teile ergibt die<br />
Menge des Ausgangsstoffs.<br />
12.2 pH-Wert<br />
A 1<br />
A 2<br />
<br />
Z<br />
<br />
A 2 · Z A 1 · Z<br />
Der pH-Wert ist definiert als negativer Logarithmus der Wasserstoff-Ionen-Konzentration.<br />
pH-Wert Bezeichnung Beispiel<br />
0–3 stark sauer starke Säure, Magensaft<br />
3–7 schwach sauer Getränke, Schweiß, Harn<br />
7 neutral Wasser<br />
7–11 schwach basisch Seifenlauge, Darmsaft, Seewasser<br />
11–14 stark basisch starke Lauge<br />
12.3 Gefahrenklassen brennbarer Flüssigkeiten<br />
Klasse mit Wasser mischbar Flammpunkt ( ◦ C)<br />
A I nicht vollständig < 21<br />
A II nicht 21–55<br />
A III nicht 55–100<br />
– nicht > 100<br />
B vollständig bei 15 ◦ C < 21<br />
– vollständig > 21<br />
20<br />
12.4 Viskosität nach DIN 16515<br />
Die Viskosität (Zähigkeit) ist die Kraft (der Widerstand), die einer Verformung entgegen<br />
gesetzt wird, gemessen in Pascalsekunden (Pa · s). Die Auslaufzeit gilt <strong>für</strong> den<br />
4-mm-DIN-Becher bei 20 ◦ C.<br />
Druckfarben im . . . V. in Pas Auslaufzeit in s<br />
Buchdruck 50–150 ∞<br />
Offsetdruck Bogen 40–100 ∞<br />
Offsetdruck Heatset 20–75 ∞<br />
Offsetdruck Coldset 3–6 ∞<br />
Flexodruck (geliefert) 0,05–0,5 20–100<br />
Flexodruck (verdruckt) ∞ −1 15–25<br />
Stichtiefdruck 5–50 ∞<br />
Rakeltiefdruck (geliefert) 0,05–0,2 20–70<br />
Rakeltiefdruck (verdruckt) ∞ −1 13–17<br />
12.5 Oberflächenspannung<br />
Material mN/m<br />
Quecksilber 480<br />
Kupfer 39<br />
destilliertes Wasser 72,8<br />
Isopropylalkohol 21,7<br />
Wasser mit 20% Alkohol 38<br />
Wasser mit 10% Alkohol 44<br />
Wasser mit 5 % Alkohol 52<br />
Wasser mit 1% Alkohol 37,2<br />
Wasser mit 1% Netzmittel (Spülmittel) 32,0<br />
Bedruckstoff 38–42<br />
Offsetdruckfarbe (nass) 30–36<br />
Offsetdruckfarbe (trocken) 35–40<br />
Diazoschicht (Offset-Kopierschicht) 47<br />
Toray-Silikonschicht (wasserlos) 15<br />
Flexodruckfarbe 28–30<br />
Rasterwalze, verchromt 34<br />
Gummiklischee 36–38
12.6 Verdunstungszahl<br />
Die Verdunstungszahl ist das Verhältnis der Verdunstungszeit eines Stoffes zur<br />
Verdunstungszeit von Ether. Die Messung soll bei 20 ◦ Cund 65 % Luftfeuchte durchgeführt<br />
werden.<br />
Einstufung Verdunstungszahl<br />
leicht flüchtig ≤ 10<br />
mittelflüchtig 10–35<br />
schwer flüchtig 35–50<br />
sehr schwer flüchtig > 50<br />
Stoff Verdunstungszahl<br />
Ether 1<br />
Ethanol 8,3<br />
Wasser 80<br />
12.7 Umweltbelastung bei der Papierherstellung<br />
Abkürzung Einheit Bedeutung Beispiel<br />
AOx<br />
Ox<br />
BSB<br />
CSB<br />
kg<br />
t<br />
mg<br />
kg<br />
kg<br />
t<br />
Summe adsorbierbarer organisch<br />
gebundener Halogene<br />
im Abwasser<br />
Summe organisch gebundenen<br />
Chlors im Papier<br />
Biochemischer<br />
Sauerstoffbedarf (Verbrauch<br />
an Sauerstoff beim biol. Abbau<br />
von Verunreinigungen<br />
im Wasser)<br />
kg<br />
t Chemischer Sauerstoffbedarf<br />
(Verbrauch an<br />
Sauerstoff beim chem.<br />
Abbau)<br />
DEM Deinkbarkeitsmaßzahl,<br />
Grad der Farbentfernung<br />
beim Recycling<br />
AOx ≤ 0,1 kg<br />
t gilt als<br />
chlorfrei; AOx ≤ 0,5 kg<br />
t gilt<br />
als chlorarm<br />
Ox < 100 mg<br />
kg bei chlorfreiem<br />
Papier<br />
300 mg<br />
kg ≤ Ox ≤ 100 mg<br />
kg bei<br />
chlorgebleichtem Papier<br />
bei RC-Papier<br />
0,3 kg<br />
t<br />
3 kg<br />
t<br />
bei RC-Papier; 46 kg<br />
t bei<br />
Z70-Papier; 65 kg<br />
t bei der<br />
Zellstoffherstellung<br />
21<br />
13 Satztechnik<br />
13.1 Allgemeines<br />
13.1.1 Einheiten<br />
Einheit genau Rechenwert<br />
p oder ˙ Didot-Punkt 0,37597 mm 0,375 mm<br />
cic Cicero 12 p 4,5 mm<br />
pt DTP-Punkt,<br />
PostScript-Point<br />
1<br />
72 "<br />
0,35277 mm 0,353 mm<br />
i oder " Inch, Zoll 2,53998 cm 2,54 cm<br />
P/cm Pixel pro cm 0,3937007 dpi 0,4 dpi<br />
dpi od. ppi dots/pixel per inch 2,54 p/cm<br />
L/cm Linien pro cm 0,3937007 lpi 0,4 lpi<br />
lpi lines per inch 2,54 L/cm<br />
13.1.2 verwendete Variablen<br />
Sg Vh Ol Ul Ml<br />
Symbol Bedeutung Hinweis<br />
Sg Schriftgröße, Kegelhöhe Sg[p] = V h[mm] · 4<br />
V h Versalhöhe V h ≈ 2 3 Sg<br />
wL Anzahl der waagerechten Linien in einer Tabelle<br />
Zab Zeilenabstand, Filmvorschub von/zu Schriftlinie, meist Zab = 6 5 Sg<br />
Zl Anzahl der Zeilen (pro Spalte)<br />
h Satzspiegel-Höhe<br />
b Satzspiegel-Breite<br />
y Seiten-Höhe<br />
x Seiten-Breite
13.2 Satzspiegel im Werksatz<br />
Die Angaben zur Satzspiegel-Konstruktion beziehen sich auf den Werksatz, also das Gestalten<br />
von „klassischen“ Büchern. Für den Satz von Akzidenzen oder Periodika gibt es keine<br />
entsprechenden Regeln.<br />
Die Proportionen des Satzspiegels sollten denen der Seite entsprechen. Dann gilt:<br />
b x<br />
=<br />
h y<br />
Die Satzspiegel-Höhe wird nach ganzen Zeilen gerundet (siehe 13.2.2), die Satzspiegel-Breite<br />
auf ganze (oder ganze fünf) Millimeter. Eine Satz-Spalte sollte 36 bis 60 Zeichen breit sein<br />
(bmax = Sg · 30); bei einspaltigem Satz entspricht dies der Satzspiegelbreite.<br />
13.2.1 Randverteilung<br />
Anteile Bund Kopf Außen Fuß Proportion<br />
Goldener Schnitt 2 3 5 8 5 : 8<br />
<strong>für</strong> volle Seiten 2 3 4 5 3 : 4<br />
mittelalterlich<br />
<strong>für</strong> A-Formate<br />
√<br />
2<br />
2<br />
3<br />
2<br />
√<br />
4<br />
2 2<br />
6<br />
4<br />
2 : 3<br />
√<br />
1 : 2<br />
13.2.2 Satzspiegelhöhe nach Zeilen<br />
h = Zab · (Zl − 1) +V h Zl =<br />
h −V h<br />
Zab<br />
+ 1 (aufrunden)<br />
22<br />
13.2.3 n-Teilung / Neuner-Teilung<br />
13.2.4 Diagonal-Verfahren 1<br />
13.2.5 Diagonal-Verfahren 2<br />
2<br />
3<br />
6<br />
4<br />
Höhe und Breite der Seite werden einzeln<br />
durch eine frei gewählte Zahl n geteilt, dabei<br />
muss n mindestens 5 betragen (meist n = 9).<br />
Der Bundsteg ist 1 n der Breite, der äußere Rand<br />
das Doppelte. Der Kopf ist 1 n der Höhe, der<br />
Fuß das Doppelte. Je größer n, desto größer<br />
der Satzspiegel und desto kleiner die Ränder.<br />
Bei gegebener Satzspiegelbreite b gilt:<br />
n = 3x<br />
x − b<br />
Der Satzspiegel hat das gleiche Größenverhältnis<br />
wie die Seite. Die Breite kann im Rahmen<br />
der Konstruktion beliebig festgelegt werden.<br />
Als ideal gilt die konstruierte Breite, wie hier<br />
gezeigt. Das Ergebnis ist dann identisch mit<br />
dem der Neuner-Teilung.<br />
Die Höhe des Satzspiegels entspricht der Breite<br />
der Seite, die Randverteilung ist „mittelalterlich“.<br />
Mit h = x und b h = x x2<br />
y gilt b = y
13.3 Tabellensatz<br />
Tyxt<br />
Tyxt<br />
2 × Zab<br />
Tyxt<br />
≤ Zab – 1/2 Vh<br />
Zab + 1/2 Vh<br />
Zab<br />
≥ Zab – 1/2 Vh<br />
2 × Zab<br />
13.4 Manuskriptberechnung<br />
Gesamthöhe der Tabelle Zab(Zl + wL − 1)<br />
Tabellenlinie–Oberlänge Zab − 1 2V h<br />
(ggf. abrunden)<br />
Schriftlinie–Tabellenlinie Zab − 1 2V h<br />
(ggf. aufrunden)<br />
Tabellenlinie–Schriftlinie Zab + 1 zw. Querlinien (1 Zl. Text)<br />
2V h<br />
2 · Zab<br />
Einzug links (geschl. Tab.) ≈ 1 2Sg Spaltenbreite minimal 1<br />
2Sg(Zeichen + 2)<br />
Die Manuskriptberechnung dient zur Ermittlung des Werkumfangs aus dem<br />
Manuskriptumfang.<br />
13.4.1 Büroverfahren<br />
Das Büroverfahren rechnet mit hoher Genauigkeit nach Buchstaben (entsprechend auch nach<br />
Silben oder Wörtern möglich). Das Produkt von Seiten, Zeilen pro Seite und<br />
durchschnittlicher Buchstabenzahl pro Zeile des Manuskriptes ist gleich dem Produkt von<br />
Druck-Seiten, -Zeilen und -Buchstaben. Die durchschnittliche Buchstabenzahl pro Druckzeile<br />
wird dabei an einem Schriftmuster ausgezählt.<br />
S M · Z M · B M = S D · Z D · B D<br />
13.4.2 Werkstattverfahren<br />
S D = S M · Z M · B M<br />
Z D · B D<br />
Das Werkstattverfahren errechnet einen Umrechnungsfaktor <strong>für</strong> die Zeilenzahl. Dazu wird<br />
zunächst das Layout mit Satzbreite, Schriftart und Schriftgröße im Satzprogramm eingerichtet.<br />
Man tippt das Manuskript so weit ab, bis eine Druckzeile genau so endet wie eine<br />
Manuskriptzeile, daran bestimmt man das Verhältnis der Druckzeilen zu den Manuskriptzeilen.<br />
ZD,ges = ZD · ZM,ges ZM 23<br />
13.5 Reihenfolge der Teile eines Werkes<br />
Teil Erklärung Seite<br />
Schmutztitel enthält Autor und Titel 1<br />
Frontispiz Bild des Autors oder z. B. Landkarte<br />
2<br />
Haupttitel (Buchtitel) Wiederholung aller Angaben des<br />
Umschlags<br />
3<br />
Impressum rechtliche und technische Angaben<br />
zum Buch (Ort, Jahr, Auf-<br />
4<br />
lage, Verlag, Einheitstitel, CIP-<br />
Dedikation<br />
Kurztitelaufnahme, ISBN, . . . )<br />
Widmung, Zueignung rechte<br />
Vorwort, Inhaltsverzeichnis, Prolog s. u.<br />
Textanfang rechte<br />
Nachwort, Epilog s. u.<br />
Anhang s. u.<br />
Rechte Seiten haben grundsätzlich ungerade Seitenzahlen, linke gerade. Kapitel (oder<br />
entsprechende größere Abschnitte) sollten möglichst auf rechten Seiten beginnen.<br />
Kürzere Teile wie Vor- und Nachwort, Verzeichnisse usw. sollten bei gerader Seitenanzahl auf<br />
einer geraden Seite beginnen beginnen, bei ungerader Seitenanzahl auf einer ungeraden Seite.<br />
13.6 Satztechnische Feinheiten<br />
13.6.1 Interpunktionen<br />
Es gibt drei verschieden lange Striche: Divis (Bindestrich) -, Halbgeviertstrich – und<br />
Geviertstrich —. Letzterer wird im Deutschen nicht eingesetzt.<br />
Fall richtiges Zeichen Beispiel<br />
Bindestrich Bindestrich Müller-Lüdenscheid<br />
Trennung Bindestrich (Divis) Diese Zeile wird ge-<br />
Gedankenstrich Halbgeviertstrich So – oder nicht?<br />
Aufzählung Halbgeviertstrich (Spiegelstrich) – Striche<br />
Strecke (von–bis) Halbgeviertstrich (Streckenstrich) München–Hamburg, 11–13 Uhr<br />
Preis Halbgeviertstrich 12,– DM
Abkürzungen: Abkürzungen verwendet man nur, wo sie nötig sind, das heißt, wo der Platz<br />
nicht zum Ausschreiben reicht oder die Abkürzung auch gesprochen wird (wie bei GmbH). So<br />
sollte man Telefon und Straße ausschreiben, wenn der Platz reicht. In literarischen Texten sind<br />
auch übliche Abkürzungen wie z. B., u. a. oder usw. fehl am Platz.<br />
Auslassung (Ellipse): Zwischen die drei Punkte gehören Spatien. . . So wäre es falsch: ...<br />
Apostroph: Die üblichen Fehler lassen sich mit Hilfe eines Rechtschreib-Wörterbuches<br />
vermeiden.<br />
Anführungszeichen: Ganz falsch sind die Schreibmaschinen-Zollzeichen ("). Wenn<br />
innerhalb einer doppelten Anführung angeführt werden muss, verwendet man einfache<br />
Anführungszeichen und umgekehrt. Bei längeren fremdsprachlichen Passagen in einem<br />
deutschen Text sollten die Anführungszeichen der jeweiligen Sprache verwendet werden. Man<br />
beachte die unterschiedliche Anwendung der französischen Anführungszeichen!<br />
Sprache doppelte Anf. einfache Anf. Anmerkung<br />
deutsch (normal) „doppelt“ ‚einfach‘ 99, 66 unten, oben<br />
deutsch (frz.) »doppelt« ›einfach‹ Spitzen nach innen<br />
schweizerdeutsch (frz.) «doppelt» ‹einfach› Spitzen nach außen<br />
englisch “double” ‘single’ 66, 99 oben<br />
französisch « double » ‹ single › nach außen, mit Abstand<br />
13.6.2 Gliederung von Zahlen<br />
Zum Gliedern von Zahlen verwendet man kein ganzes Leerzeichen, sondern ein Spatium, das<br />
entspricht bei QuarkXPress etwa 30 Einheiten, ist aber von der Schrift abhängig.<br />
24<br />
Zahl Gliederungsvorschrift Beispiel<br />
Dezimalzahlen drei von rechts, besser ohne 2 345 800,– DM<br />
Tausenderpunkt<br />
Datum Leerzeichen oder Spatium nach 3. 5. 1999<br />
ISO-Datum<br />
Punkt, besser ohne führende Null;<br />
Jahreszahl ungegliedert<br />
Jahr vierstellig Monat zweistellig<br />
Tag zweistellig mit Bindestrichen<br />
1999-05-03<br />
Telefon, Telefax zwei von rechts Telefon (09 11) 1 23 45 67<br />
Durchwahl bis dreistellig ungegliedert, sonst<br />
zwei von rechts<br />
Zentrale 99-000, Chef 99-12 34<br />
Postfach ungegliedert oder zwei von rechts Postfach 12 34<br />
Bankleitzahl drei drei zwei BLZ 650 501 10<br />
Konto drei von rechts Konto Nr. 1 234 567 890<br />
Postgirokonto (zwei bis vier) Bindestrich zwei<br />
Leerzeichen drei<br />
Konto Nr. 123-56 704<br />
Postleitzahl wird laut Post nicht gegliedert,<br />
sinnvoll wäre zwei drei<br />
ISBN inhaltlich:<br />
Prüfziffer<br />
Gruppe-Verlag-Titel- ISBN 3-473-48380-X<br />
13.6.3 Zusammensetzung bestimmter Nummern<br />
Bankleitzahl: immer achtstellig, bestehend aus dreistelliger Ortsnummer (Bankplatz),<br />
einer Ziffer Bankengruppe (z. B. 0 = Deutsche Bundesbank und LZB, 1 = Postbank, 4 =<br />
Commerzbank, 5 = Sparkassen, 7 = Deutsche Bank, 8 = Dresdner Bank), zweistelliger<br />
Ortsnummer im Bankbezirk, zweistelliger Filialnummer (bei der Postbank erste Ziffern der<br />
alten Postleitzahl).<br />
Postgirokonto: maximal sechsstelliger Stammteil, zweistellige Ortsnummer (erste Ziffern<br />
der alten Postleitzahl des Banksitzes), Prüfziffer (jede Ziffer plus 1, multiplizieren der Reihe<br />
nach mit 1, die nächste mit 2, mit 3, mit 1 usw., diese Produkte durch 11 teilen, die Reste dieser<br />
Division addieren, diese Summe durch 10 teilen – der Rest dieser Division ist die Prüfziffer).<br />
ISBN: (Internationale Standard-Buchnummer) immer zehnstellig, bestehend aus maximal<br />
dreistelliger Gruppennummer (nationale, geographische oder sprachliche Gruppen),<br />
Verlagsnummer, Titelnummer und Prüfziffer. Verlags- und Titelnummer haben zusammen<br />
sechs bis acht Ziffern. Zur Ermittlung der Prüfziffer werden die ersten neun Ziffern der Reihe<br />
nach mit 10, mit 9 usw. multipliziert. Die Summe dieser Produkte wird durch 11 geteilt. 10<br />
minus dem Rest dieser Division ist die Prüfziffer, 10 wird dabei als X geschrieben.
13.7 Korrekturzeichen<br />
Falsche Buchstaben wurden durchgestrichen und am Rand<br />
mit die richtigen ersetzt.<br />
Komnen megrere Fähler in oiner Zeile for, erhalten die<br />
Korrekturzeichen unterschiedliche „Fähnchen“.<br />
Überflüssige Buchstaben oder Wörter werdenn durchgestrichen<br />
und und am Rand mit einem „d“ in deutscher<br />
Schreibschrift (<strong>für</strong> „deleatur“ – es soll gelöscht werden)<br />
angezeichnet.<br />
Fehlende Buchstaben werden angezeichnet, indem der<br />
vorige oder folgende Buchstabe durchgestriche und am<br />
Rand zusmmen mit dem oder den fehlenden wiederholt<br />
wird. Es kann auch das ganze Wort angstrichn und am Rand<br />
berichtigt werden.<br />
Fehlende oder überflüssige; Satzzeichen werden wie<br />
Buchstaben behandelt<br />
Fälschlich aus anderer Schrift gesetzte Zeichen<br />
(Zwiebelfische) werden am Rand zweimal unterstrichen.<br />
Verschmutzte Stellen werden eingeringelt.<br />
Ligaturen werden verlangt, indem man die betreffenden<br />
Buchstaben durchstreicht und am Rand mit einem darunter<br />
befindlichen Bogen wiederholt. Fälschlich gesetzte<br />
Ligaturen werden durchgestrichen und am Rand mit einem<br />
Strich getrennt. (Auflage)<br />
Verstellte Wörter werden das durch Umstellungszeichen<br />
1 4 3 2 5<br />
berichtigt, bei werden Umstellungen größeren sie<br />
nummeriert.<br />
Verstellte oder falsche Zahlen werden immer komplett<br />
durchgestrichen und am Rand berichtigt. (29,79)<br />
e<br />
m h e e v<br />
en<br />
sa<br />
angestrichen<br />
t.<br />
w<br />
fi<br />
f l<br />
1—5<br />
29,99<br />
25<br />
Fehlende Wörter sind durch Winkelzeichen in der Lücke<br />
anzuzeichnen und am anzugeben. Bei größeren Auslassungen<br />
wird auf das Manuskript verwiesen. Die<br />
entsprechende Stelle wird im Manuskript markiert.<br />
Solche erklärenden Vermerke werden durch Doppelklammern<br />
markiert.<br />
Falsche Trennungen werden laut DIN wie überflüssige<br />
bzw. fehlende Buchstaben behandelt. Es ist jedoch eindeutiger,<br />
die Trennstelle anzustreichen und die falsche<br />
Trennung mit „Tr.“ als solche zu markieren.<br />
Fehlender Wortzwischenraum wird durchden Z-Haken,<br />
überflüssiger durch die Binde klammern, zu enger oder zu<br />
weiter Zwischenraum durch „Nadeln“ angegeben.<br />
Zu enger oder zu weiter Zeilenabstand wird in ähnlicher<br />
Weise markiert.<br />
Andere Schrift oder Auszeichnung wird verlangt, indem<br />
man die betreffende Stelle unterstreicht und die<br />
gewünschte Schrift angibt.<br />
Ein Absatz wird durch den Vorwärts-Haken verlangt. Um<br />
einen Absatz anzuhängen,<br />
zeichnet man eine verbindende Schleife ein.<br />
Zu großer oder falscher Einzug wird mit einer Art<br />
liegendem T markiert.<br />
Fehlender oder zu kleiner Einzug erhält ein Winkelprofil,<br />
das auf die gewünschte Größe hinweist.<br />
Irrtümlich …Angestrichenes<br />
(falsche Fehler) werden<br />
unterpunktiert; die Korrektur am Rand wird gestrichen.<br />
(DIN 16511, gekürzt und umformuliert)<br />
Rand<br />
((s. Man. S. 3))<br />
Tr.<br />
a<br />
kursiv<br />
Grundschrift
14 Informatik<br />
14.1 Zahlensysteme<br />
Zahlen können auf verschiedene Weise dargestellt werden. Additive Zahlensysteme sind z. B.<br />
Strichlisten oder Römische Zahlen. Hier geht es jedoch nur um Stellen-Potenz-Systeme wie<br />
das Dezimalsystem.<br />
Solche Zahlensysteme können grundsätzlich auf jeder natürlichen Zahl größer 2 aufgebaut<br />
werden und brauchen eine der Grundzahl entsprechende Anzahl von Symbolen<br />
(Ziffernzeichen). Von rechts nach links werden die Stellen mit „Basis hoch 0“, „Basis hoch 1“<br />
usw. belegt.<br />
14.1.1 Gebräuchliche Zahlensysteme<br />
Basis Bezeichnung Symbole Einsatz Beispiel<br />
2 Dual-, Binärsystem 0, 1 / ○, | Elektronik, Informatik 11110110101<br />
3 Trinärsystem 0–2 / −,0,+ experimentelle Computer 2201002<br />
8 Oktalsystem 0–7 Informatik 3665o<br />
10 Dezimalsystem 0–9 Alltag 1973 / 1973d<br />
16 Hexadezimalsystem 0–9, A–F Informatik 7B5h / $7B5<br />
14.1.2 Umrechnung verschiedener Zahlensysteme<br />
Die Ursprungs-Zahl wird durch die Basis des Ziel-Systems geteilt und der „Rest“ der Division<br />
notiert. Der ganzzahlige Anteil der Division wird weiter geteilt, so dass die Zahl von rechts<br />
nach links „wächst“.<br />
Beispiel: 1973 ins Hexadezimalsystem:<br />
1973÷16 =123 Rest 5 → 5h<br />
123÷16 = 7 Rest 11 → B5h<br />
7÷16 = 0 Rest 7 → 7B5h<br />
14.1.3 Schreibweisen von Dezimalzahlen<br />
Bezeichnung Einsatz Beispiel<br />
Dezimalschreibweise Alltag 1973,65<br />
Potenzschreibweise Wissenschaft 1,97365 · 10 3<br />
Exponentialschreibweise Informatik 1,9736500E03<br />
26<br />
14.2 Maßeinheiten und Abkürzungen<br />
Einheit Bedeutung<br />
Bit Binary Digit kleinste Informationseinheit<br />
B Byte 8 Bit, kleinste Speichereinheit<br />
Bps Bytes/Sekunde Übertragungsrate (Speichermedien, Netzwerke)<br />
Bpi Bytes/Inch Aufzeichnungsdichte (Speichermedien)<br />
Tpi Tracks/Inch Spurdichte (Speichermedien)<br />
MIPS Millionen Instruktionen/s Rechengeschwindigkeit<br />
FLOPS Fließkomma-Operationen/s Rechengeschwindigkeit<br />
lsb least significant bit Einer-Stelle einer Binärzahl<br />
msb most significant bit Stelle einer Binärzahl mit der höchsten Wertigkeit<br />
little endian Bytes werden mit dem lsb zuerst gespeichert,<br />
wie bei Intel-Rechnern (DOS/Win)<br />
big endian Bytes werden mit dem msb zuerst gespeichert,<br />
wie bei Motorola-Rechnern (Mac)<br />
14.3 Dateigrößen<br />
8 Bit = 1 Byte (B)<br />
1024 B = 1 Kilobyte (kB)<br />
1024 kB = 1 Megabyte (MB)<br />
1024 MB = 1 Gigabyte (GB)<br />
usw. siehe auch 1.1<br />
Häufig werden Dateigrößen und Kapazitäten von Speichermedien falsch mit dezimalen<br />
Umrechnungen (1 MB = 1000 kB) angegeben.
15 Bedruckstoffe<br />
15.1 Allgemeines<br />
Symbol Bedeutung Einheit<br />
A Fläche, Oberfläche m2 Bg Bogen(anzahl) —<br />
b Breite mm, cm, m<br />
dE Papierstärke (Dicke Einzelblatt) µm, mm<br />
l Länge m<br />
m Masse (Gewicht) g, kg, t<br />
n<br />
mA Anzahl, Stückzahl<br />
Flächenbezogene Masse<br />
—<br />
g<br />
m2 P Preis DM, . . .<br />
t Ablaufzeit s, min, h<br />
V Papiervolumen m3 v Bahngeschwindigkeit<br />
kg<br />
m<br />
s<br />
Nicht vergessen: Papier hat zwei Seiten!<br />
15.2 Einteilung nach m A<br />
Bezeichnung flächenbezogene Masse in g<br />
m 2<br />
Papier ≤ 225<br />
Karton ≥ 150, 600<br />
Pappe ≥ 225<br />
Maschinenpappe ≤ 1000<br />
Starkpappe ≥ 1000<br />
Wickelpappe ≥ 240, ≤ 3570<br />
27<br />
15.3 Papier / Bogen<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
cm 3<br />
g<br />
Papiervolumen Vspez<br />
Blattdicke dE mm oder µm dE [mm] = V · mA · 10−3 Flächenbezogene Masse m A<br />
g<br />
m2 Vspez = d E [mm]·103<br />
m A<br />
mA = dE [mm]·103<br />
V<br />
= d E [µm]·106<br />
m A<br />
= m Bg<br />
A<br />
Bogenfläche A m 2 A = l · b = mges<br />
m A ·n<br />
Bedruckbare Fläche A D m 2 A D = 2 · l · b (2 Seiten!)<br />
Bogengewicht m Bg g m Bg [g] = m A · A<br />
Bogenzahl n Stück n = mges<br />
m A ·A<br />
1000-Bogen-Gewicht m kBg kg m kBg [kg] = m A · A<br />
Das 1000-Bogen-Gewicht wird auf halbe kg gerundet!<br />
Das „Papier-Volumen“ ist der Kehrwert der Dichte. „Mit Volumen“ bedeutet Dichte < 1.<br />
15.4 Papier / Rolle<br />
Größe Symbol Einheit Definition<br />
Gesamtgewicht einer Rolle mR kg mR [kg] = mA · A<br />
= <br />
1000πb<br />
V r2 außen − r2 <br />
Hülse<br />
Bahngewicht pro laufendem Meter mB g mB = mA · b<br />
1000-Meter-Bahngewicht mB kg mB [kg] = mA · b<br />
Bahnlänge l m l = m<br />
bm =<br />
A<br />
π <br />
d r2 außen − r<br />
E<br />
2 <br />
Hülse<br />
Ablaufzeit einer Papierrolle t s t = l <br />
v r2 außen − r2 <br />
Hülse<br />
15.5 Ausschießen <strong>für</strong> das Einstecken<br />
Kleinere Falzbogen liegen außen!<br />
1. Seite ∗ = 1. Produktseite +<br />
<br />
vorlaufende Falzbogen ·<br />
letzte Seite ∗ <br />
= letzte Prod.S. − vorlaufende Falzbg. ·<br />
∗ ) eines gesuchten Bogens<br />
= π<br />
v·d E<br />
<br />
S. pro Bogen<br />
2<br />
<br />
S. pro Bogen<br />
2
15.6 Preisberechnung<br />
15.6.1 Preis von Bogenpapier<br />
Aus dem gerundeten 1000-Bogen-Gewicht wird der 1000-Bogen-Preis berechnet und<br />
gerundet. Dieser Preis ist allein maßgeblich!<br />
15.6.2 1000-Bogen-Preis<br />
P kBg = P kg · m kBg<br />
15.6.3 Preis einer Papierrolle<br />
Es zählt das Gesamtgewicht der Rolle inklusive Hülse und Verpackung!<br />
15.7 Druckbogen-Größe<br />
Immer zu berücksichtigen: Nutzengröße (Endformat), Anzahl der Formnutzen, Falzart,<br />
Seiten pro Falzbogen, Wendeart, Beschnitt, Greiferkante<br />
Falls erforderlich: druckfreier Raum, Druckkontrollstreifen, Greiffalz, Fräsrand<br />
15.8 Pappe<br />
15.8.1 Einheitsstapel und Pappennummer<br />
Der Einheitsstapel misst 1000 × 700 × 100 mm und wiegt 50 kg.<br />
Die Pappennummer gibt die Anzahl der Papptafeln pro Einheitsstapel an. Sie ist maximal 317.<br />
PappNr. ≈<br />
m A =<br />
100 mm<br />
Dicke [mm]<br />
Dicke =<br />
50000 g<br />
0,7 m2 500 g · Dicke [mm]<br />
=<br />
· PappNr. 0,7 m2 100 mm<br />
PappNr.<br />
28<br />
15.8.2 Wellpappe<br />
Zeichen genormt? Bezeichnung Wellenteilung Wellenhöhe Einzugs-<br />
Frequenz [mm] Amplitude [mm] faktor<br />
A ja Grobwelle 8,0–9,5 4,0–4,8 ca. 1,5<br />
B ja Feinwelle 5,5–6,5 2,2–3,0 ca. 1,4<br />
C ja Mittelwelle 6,8–7,9 3,2–3,9 ca. 1,45<br />
D nein übergrobwelle > 9,5 > 5 > 1,5<br />
E ja Feinstwelle 3,0–3,5 1,0–1,8 ca. 1,25<br />
F nein Mikrowelle 2,4 0,75<br />
G nein Mikrowelle 1,8 0,55<br />
15.9 Papierformate<br />
15.9.1 DIN-Formate<br />
Klasse A-Reihe B-Reihe C-Reihe D-Reihe Benennung<br />
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297 771 × 1090 Vierfachbogen<br />
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771 Doppelbogen<br />
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545 Bogen<br />
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 Halbbogen<br />
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 Viertelbogen<br />
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 Blatt (Achtelbogen)<br />
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 Halbblatt<br />
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96 Viertelblatt<br />
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81 48 × 68 Achtelblatt<br />
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57 34 × 48<br />
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40 24 × 34<br />
11 18 × 26 22 × 31 20 × 28 17 × 24<br />
12 13 × 18 15 × 22 14 × 20 12 × 17<br />
13 9 × 13 11 × 15 10 × 14 8 × 12<br />
1<br />
6 210 × 198 × × × (Sechstelbogen)<br />
lang × 110 × 220 × × (Umschlag)
15.9.2 Traditionelle Papierformate<br />
Benennung Größe (mm) Verwendung<br />
Scheckkarte 86 × 54 Visitenkarten<br />
Berliner Format 315 × 470 Zeitungen<br />
Rheinisches Format 360 × 530 Zeitungen<br />
Nordisches Format 400 × 570 Zeitungen<br />
US Letter 216 × 279 USA, Briefbogen<br />
US Legal 216 × 356 USA, Verträge<br />
Ledger 432 × 279 USA, ?<br />
Executive 190 × 254 USA, ?<br />
10 × 14 " 254 × 356 USA, ?<br />
11 × 17 " 279 × 432 USA, ?<br />
Quart 215 × 305 ?<br />
Quarto 215 × 275 USA, ?<br />
Oktav 140 × 210 Bücher<br />
Statement 140 × 216 USA, ?<br />
Folio 216 × 330 USA, ?<br />
Tabloid 279 × 432 USA, ?<br />
15.9.3 Plakat-Formate<br />
Benennung Größe (mm)<br />
1/4-Bogen (hoch oder quer) 420 × 300<br />
1/2-Bogen (hoch oder quer) 590 × 420<br />
1/1-Bogen (hoch oder quer) 840 × 590<br />
2/1-Bogen (hoch oder quer) 1190 × 840<br />
3/1-Bogen 840 × 1780<br />
4/1-Bogen (breit) 1190 × 1680<br />
4/1-Bogen (schmal) 840 × 2380<br />
6/1-Bogen 1190 × 2520<br />
Großflächenplakat 18/1 3564 × 2523<br />
1 Teil bei 4-er-Teilung 1782 × 1262<br />
1 Teil bei 6-er-Teilung 1188 × 1262<br />
1 Teil bei 8-er-Teilung 891 × 1262<br />
1 Teil bei 9-er-Teilung 1188 × 841<br />
City-Light-Poster 1200 × 1760<br />
Litfass-Säule laut Norm 3,6 m × 2,6 m<br />
Die Formate basieren auf DIN A1.<br />
Die Angabe 18/1 bedeutet „18 mal A1“.<br />
15.9.4 Rohbogen-Formate<br />
Größe (mm) beschnitten<br />
880 × 1240<br />
860 × 1220 A0<br />
700 × 1000<br />
630 × 880<br />
610 × 860 A1<br />
500 × 700<br />
440 × 630<br />
430 × 610 A2<br />
350 × 500<br />
305 × 430 A3<br />
215 × 305 A4<br />
15.10 Unterlagebogen<br />
Farbe Stärke (mm)<br />
zimtbraun 0,015<br />
weiß 0,023<br />
elfenbein 0,035<br />
lachs 0,05<br />
hellblau 0,075<br />
kornfarben 0,1<br />
hellbraun 0,125<br />
braun 0,15<br />
rosa 0,175<br />
grün 0,2<br />
goldgelb 0,25<br />
zitronengelb 0,3<br />
blau 0,4<br />
grau 0,5<br />
Filz 0,18<br />
29<br />
15.11 Qualitätsbezeichnungen<br />
Bezeichnung Eigenschaften<br />
Hn n% Hadern, Rest Zellstoff<br />
Zn n% Zellstoff, Rest verholzte Fasern<br />
ZVF < 30 % Zellstoff<br />
h’f holzfrei, Z100<br />
f’h’f, f’h’h, l’h’h fast holzfrei, fein/leicht holzhaltig, Z70<br />
m’f mittelfein, Z50<br />
h’h holzhaltig, Z30<br />
grau Altpapier-Faserstoff, teilw. mit Zusatz von ungebleichtem Holzstoff<br />
hell ungebleichter Halbstoff<br />
weiß gebleichter Halbstoff<br />
siehe auch 15.16.<br />
15.12 Spezielle Papiersorten<br />
Bezeichnung Eigenschaften<br />
Kunstdruckpapier gestrichen, Strich > 20 g<br />
m 2 je Seite<br />
Normkunstdruckpapier 150 g<br />
m 2 , holzfrei (Scheufelen APCO II/II)<br />
Naturpapier nicht gestrichen, teilw. pigmentiert<br />
Offsetdruckpapier h’f, satiniert<br />
Umdruckpapier h’h, satiniert, ca. 70 g<br />
m 2<br />
Zeitungsdruckpapier ca. 40 g<br />
m 2 , siehe AZB, AZO, AZT, C<br />
Elfenbeinkarton Feinkarton h’f, 150–220 g<br />
m2 , gelblich<br />
Alabasterkarton wie Elfenbeinkarton, aber weiß<br />
Spielkartenkarton 330 g<br />
m2 , mit schwarzer Sperrschicht<br />
Aufzugskarton als Unterlagebogen, kalibrierte Dicke, siehe 15.10
15.13 Lebensdauerklassen<br />
LDK Lebensdauer nach DIN 6738<br />
6–40 mindestens 50 Jahre<br />
6–70 mindestens 100 Jahre<br />
12–80 einige 100 Jahre<br />
24–85 alterungsbeständig<br />
15.14 Akklimatisierungszeit<br />
Bei der Verarbeitung von Papier muss ein papierfreundliches Klima herrschen: 20°C bei<br />
50–55% relativer Luftfeuchtigkeit<br />
Unterschied zwischen Größe des Papierstapels<br />
Papier und Raumklima 0,2 m 3 0,4 m 3 0,6 m 3 1,0 m 3 2,0 m 3<br />
5 °C 6 h 8 h 10 h 11 h 12 h<br />
6 °C 7 h 9 h 11 h 12 h 13 h<br />
7 °C 8 h 10 h 12 h 13 h 14 h<br />
8 °C 9 h 11 h 13 h 14 h 15 h<br />
9 °C 10 h 14 h 17 h 18 h 21 h<br />
10 °C 11 h 15 h 20 h 22 h 24 h<br />
15 °C 16 h 23 h 28 h 32 h 36 h<br />
20 °C 22 h 33 h 45 h 52 h 60 h<br />
25 °C 27 h 43 h 64 h 77 h 100 h<br />
30<br />
15.15 Genormte Papierqualitäten<br />
Behörden-/Büropapiere nach DIN 19307 und 827<br />
Stoffzusammensetzung Reißlänge DIN 19 307. . . –<br />
Urkundenpapiere, satiniert<br />
H100 5000 S 2a – 100<br />
H100 4000 S 2b – 90<br />
Aktenpapiere, satiniert<br />
H50 4000 S 3 – 90<br />
Z100 3000 S 4c – 110<br />
Z100 3000 S 4a – 80<br />
Z100 3000 SWZ 4a – 80<br />
Z100 3000 S 4a – 70<br />
Z50 2500 S 5b – 80<br />
Z50 2500 S 5b – 70<br />
Z30 2200 S 5c – 80<br />
Z30 2200 S 5c – 70<br />
Z30 2200 S 5c – 60<br />
Aktenpapiere, matt<br />
Z50 4000 SM 3 – 50<br />
Z100 3000 SM 4a – 130<br />
Z100 3000 SM 4a – 90<br />
Z100 3000 SM 4a – 80<br />
Z100 3000 SM 4a – 70<br />
Z100 3000 SM 4a – 60<br />
Z100 3000 SM 4a – 40<br />
Z100 3000 SM 4a – 30<br />
Z30 2500 SM 5a – 70<br />
Kartei-/Aktendeckel-Karton<br />
Z100 3000 K 7a – 400<br />
Z100 3000 K 7a – 250<br />
Z100 3000 K 7a – 290<br />
Z30 2700 K 7d – 350<br />
Z30 2700 K 7d – 250<br />
Zulässige Toleranzen<br />
± 5% 10% –2,5–7%<br />
g<br />
m 2
15.16 Papiersorten nach Abkürzung<br />
Abkürzung Papiersorte Eigenschaften<br />
AZB aufgebessertes Zeitungsdruckpapier <strong>für</strong> Buchdruck ungestrichen<br />
AZO aufgebessertes Zeitungsdruckpapier <strong>für</strong> Offsetdruck ungestrichen<br />
AZT aufgebessertes Zeitungsdruckpapier <strong>für</strong> Tiefdruck ungestrichen<br />
B Magazin- oder Illustrationsdruckpapier ungestrichen, superkalandriert, h’h<br />
BD Bilderdruckpapier gestrichen, h’h oder h’f, Strich 5–20 g<br />
m 2 je Seite<br />
C Zeitungsdruckpapier maschinenglatt oder leicht satiniert, ≤ Altpapier<br />
CB Selbstdurchschreibepapier gestrichen, Rückseite beschichtet<br />
CF Selbstdurchschreibepapier gestrichen, Vorderseite beschichtet<br />
CFB Selbstdurchschreibepapier gestrichen, Vorder- und Rückseite beschichtet<br />
D Durchschlagpapier ca. 30–40 g<br />
m 2 , <strong>für</strong> Gebrauch mit Kohlepapier<br />
FC Film Coated (Rollendruckpapier) filmgestrichen<br />
GC1 Chromokarton einseitig gestrichen, Strich > 18 g<br />
m 2 , Decke u. Rückseite h’f weiß, Einlage hell<br />
GC2 Chromokarton einseitig gestrichen, Strich > 18 g<br />
m 2 , Decke und Rückseite h’frei weiß, Einlage hell<br />
GC3 Chromokarton einseitig gestrichen, Strich < 10 g<br />
m 2 , Decke h’f weiß, Einlage hell, Rückseite grau<br />
GD1 Chromo-Duplexkarton einseitig gestrichen, spez. Volumen > 1,5 g<br />
m2 , Strich > 18 g<br />
m2 GD2 Chromo-Duplexkarton<br />
, Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite grau<br />
einseitig gestrichen, spez. Volumen < 1,4 g<br />
m2 , Strich > 12 g<br />
m2 GG1 Gussgestrichener Chromokarton<br />
, Decke h’f oder l’h’h weiß, Einlage und Rückseite grau<br />
Decke und Rückseite h’frei weiß, Einlage hell<br />
GG2 Gussgestrichener Chromokarton Decke h’frei weiß, Einlage und Rückseite hell<br />
GGZ Gussgestrichener Zellstoffkarton komplett h’frei weiß<br />
GK1 feiner Graukarton (Maschinengraukarton) Decke hellgrau, Einlage grau, Rückseite grau<br />
GK2<br />
GT1<br />
einfacher Graukarton (Maschinengraupappe)<br />
Chromo-Triplexkarton<br />
komplett grau<br />
einseitig gestrichen, Strich > 18 g<br />
m2 GT2 Chromo-Triplexkarton<br />
, Decke h’f weiß, Einlage grau, Rückseite hell<br />
einseitig gestrichen, Strich > 12 g<br />
m2 GZ<br />
HWC<br />
Gestrichener Zellstoffkarton<br />
Heavy/High Weight Coated Paper (Rollendruckpapier)<br />
, Decke h’f oder l’h’h weiß, Einlage grau, Rückseite hell<br />
Decke, Einlage und Rückseite h’frei weiß<br />
> 72 g<br />
m2 , gestrichen, Strich > 5 g<br />
m2 K<br />
LLWC<br />
Karton<br />
Light Light Weight Coated Paper<br />
je Seite<br />
≤ 51 g<br />
m2 , gestrichen, Strich 5–9 g<br />
m2 LWC Light Weight Coated Paper<br />
je Seite<br />
≤ 72 g<br />
m2 , gestrichen, Strich 5–10 g<br />
m2 NP Naturpapier<br />
je Seite<br />
nicht gestrichen<br />
RC Recyclingpapier unterschiedlich<br />
31
Abkürzung Papiersorte Eigenschaften<br />
S Schreibpapier satiniert, geleimt<br />
SC Super Calandered Mechanical Printing Paper = B ungestrichen, superkalandriert, h’h<br />
SC Selbstdurschschreibepapier einseitig beschichtet <strong>für</strong> Durchschrift von Naturpapier<br />
SCB Selbstdurschschreibepapier Verbindungsglied zwischen NP und CFB oder CF<br />
SD<br />
SLWC<br />
Selbstdurchschreibepapier<br />
Super Light Weight Coated Paper<br />
unterschiedlich<br />
28–45 g<br />
m2 SM Schreibmaschinenpapier<br />
, gestrichen<br />
maschinenglatt<br />
SWZ Schreibpapier mit Wasserzeichen satiniert, geleimt<br />
UC1 Chromoersatzkarton ungestrichen, Decke und Rückseite h’f weiß, Einlage hell<br />
UC2 Chromoersatzkarton ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite hell<br />
UD1 Duplexkarton ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite grau<br />
UD2 Duplexkarton ungestrichen, Decke l’h’h weiß, Einlage und Rückseite grau<br />
UT1 Triplexkarton ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage grau, Rückseite hell<br />
UT2 Triplexkarton ungestrichen, Decke l’h’h weiß, Einlage grau, Rückseite hell<br />
32
16 Drucktechnik<br />
16.1 Siebdruck<br />
16.1.1 Maße am Sieb<br />
Symbol Bedeutung Einheit Definition<br />
d Fadendurchmesser, Drahtstärke µm<br />
DS n<br />
Siebdicke<br />
Siebfeinheit, Anzahl Maschen<br />
µm<br />
Fäden/cm<br />
DS ≈ 2d<br />
n Mesh Fäden/Inch<br />
w Maschenweite, Lochweite µm<br />
t Gewebe-Teilung µm t = d + w<br />
α0 Sieböffnungsgrad % α0 = w 2<br />
w+d · 100%<br />
cm Vth Theoretisches Farbvolumen 3<br />
m2 V th = D · α 0<br />
σ S Siebspannung N<br />
cm<br />
D ST Schablonendicke µm<br />
D SC Druckformdicke µm D SC = D S + ∆ ST<br />
∆ ST Schablonenaufbaudicke µm ∆ ST = D SC − D ST<br />
16.1.2 Sieb-Dehnung<br />
Symbol Bedeutung Einheit Definition<br />
Lx,y Innenmaß der Druckform cm, mm<br />
sR Rakelstrecke cm, mm<br />
h Absprunghöhe mm Abstand Sieb–Bedruckstoff<br />
∆L Dehnung (Längenänderung) cm, mm ∆L = 2<br />
εS Dehnung %<br />
Lx<br />
4 + h2 − Lx bei s R = Lx<br />
2<br />
33<br />
16.2 Farbdichte im Offsetdruck<br />
Symbol Bedeutung Definition<br />
FA 21<br />
Dn<br />
D1+2 Farbannahme von Farbe 2 auf 1 in Prozent FA 21<br />
Farbdichte Farbe n<br />
Farbdichte im Übereinanderdruck<br />
= D 1+2 −D 1<br />
D 2<br />
· 100<br />
FD Flächendeckung in Prozent FD = 1−10−DR 1−10 −D · 100<br />
V<br />
Krel Relativer Kontrast in Prozent Krel = DV −DR D · 100<br />
V<br />
DV Farbdichte im Vollton<br />
Farbdichte im Raster (meist 80%)<br />
D R<br />
GR Verschwärzlichung (Greyness) in Prozent GR = Dmin · 100<br />
Dmax<br />
HE Farbtonfehler (Hue Error) in Prozent HE = Dmed−Dmin Dmax−D · 100<br />
min<br />
Dmin,med,max unterster, mittlerer, höchster Dichtewert Dmax = DV 16.3 Farbübertragung einer Rasterwalze<br />
16.3.1 Volumen V eines Näpfchens:<br />
(b = Seite der Grundfläche A G1 ; c = Seite der Deckfläche („Spitzfläche“) A G2 (siehe 5.1))<br />
VSpitzpyramide = h<br />
· b2<br />
3<br />
V Pyramidenstumpf = h<br />
3 · (b2 + bc + c 2 )<br />
16.3.2 Farbübertragungszahl und Rasterdichte:<br />
Die Farbübertragungszahl F gibt die Farbaufnahme (Volumen der gesamten Näpfchen) in<br />
ml<br />
m2 = cm3<br />
m2 oder g<br />
m2 an.<br />
Die Rasterdichte n gibt die Zahl der Näpfchen in Millionen pro m 2 an.<br />
F = n · 10 6 ·V [ml]<br />
n = (Rasterweite [L/cm]) 2 · 10 −2 <br />
Rasterweite [lpi]<br />
=<br />
254<br />
16.4 Gravierzeit <strong>für</strong> Tiefdruckzylinder<br />
t [min] =<br />
Strangbreite[cm] · Zyl.-Umfang[cm] · (Rasterweite[cm])2<br />
Frequenz[Hz] · 60<br />
2
16.5 Offset-Probedrucke<br />
Variable Bedeutung Einheit Definition<br />
m Farbmenge (Masse) g gewogen<br />
V Volumen (nach Skala der Pipette) cm3 ρ Farbdichte<br />
g<br />
cm<br />
abgelesen<br />
3 ρ = m G0,1,2 m1 m2 F<br />
Gewicht (Masse) der sauberen/eingefärbten/abgedruckten Druckform<br />
Farbe auf der Druckform<br />
übertragene Farbe (Masse)<br />
Oberfläche der Druckform<br />
g<br />
g<br />
g<br />
cm<br />
V<br />
gewogen<br />
m1 = G1 − G0 m2 = G1 − G2 2 F = 80 cm2 M übertragene Farbe<br />
g<br />
m2 M = m2 ·10000<br />
s Schichtdicke der Druckfarbe auf dem Papier µm<br />
F<br />
s = M f Farbübertragungsfaktor %<br />
ρ<br />
f = m1 m · 100<br />
2<br />
16.6 Längung einer flexiblen Druckform<br />
Eine flach hergestellte Druckform, die um einen Zylinder herum gebogen wird, wird an ihrer Oberfläche gedehnt.<br />
Diese Längung muss in der Formherstellung ausgeglichen werden.<br />
Variable Bedeutung Definition<br />
d Durchmesser des rohen Druckformzylinders<br />
d0 K<br />
R<br />
sD,K sS X %<br />
Gesamt-Durchmesser des Druckformzylinders<br />
Konstante einer Druckplatte<br />
Rapportlänge = Drucklänge = Abschnittslänge<br />
Dicke der Druckplatte/Klebefolie<br />
Dicke des Sleeve (Hülse)<br />
Prozentuale Verkürzung der Vorlage<br />
d0 = d + 2sK + 2sD + 2sS K = 2πsD R = UZylinder = πd0 (wenn kein Sleeve, dann sS = 0)<br />
X % = 100·K<br />
R = 200·sD d0 16.7 Zahnräder an Flexodruck-Formatzylindern<br />
Symbol Bedeutung Definition<br />
d0 Gesamt-Durchmesser des Druckformzylinders d0 = zt<br />
m Modul = Durchmesserteilung<br />
π = zm<br />
m = t U Teilkreis-Umfang<br />
π<br />
Zahnräder greifen bis zum Teilkreis ineinander<br />
z Zähnezahl Anzahl der Zähne am Teilkreis-Umfang<br />
t Teilung (immer ganzzahlig, üblich: 10 mm) t = mπ = Zahnstärke + Zahnlücke = U z<br />
34<br />
16.8 Formatklassen Bogenoffset<br />
Formatklasse Maximalformat (mm) max. DIN<br />
Kleinoffset 343 × 460 A3, B4, C3<br />
00 370 × 530 A3, B3, C3<br />
01 483 × 670 A2, B3, C2<br />
1 520 × 740 A2, B2, C2<br />
2 650 × 940 A1, B2, C1<br />
3 / 3B 720 × 1040 A1, B1, C1<br />
4 820 × 1120 A1, B1, C1<br />
5 / 5W 965 × 1270 A0, B0, C1<br />
6 1020 × 1420 A0, B0, C0<br />
7 / 7B 1200 × 1600 A0, B0, C0<br />
02 390 × 280 A4, B4, C4<br />
03 370 × 520 A3, B3, C3<br />
03 460 × 340 A3, B4, C3<br />
04 480 × 650 A2, B3, C2<br />
1 520 × 740 A2, B2, C2<br />
3 640 × 915 A1, B2, C1<br />
3B 720 × 1020 A1, B1, C1<br />
Die Formatklassen-Einteilung ist nicht verbindlich und wird von allen<br />
Druckmaschinen-Herstellern etwas anders angewendet (die zweite Liste<br />
entspricht den Angaben in den „Kosten- und Leistungsgrundlagen“).<br />
Es ist teilweise üblich, die Formatklassen ohne führende Null mit römischen<br />
Zahlen zu bezeichnen.<br />
16.9 Tonwertzunahmen nach Färbungs-Standard<br />
Pkl. 40 % 80 % 40 % 80 %<br />
Positivkopie Negativkopie<br />
1 11–16–21 9–12–15 18–23–28 13–16–19<br />
2 14–19–24 11–14–17 21–26–31 15–18–20<br />
3 17–22–27 13–16–19 24–29–34 17–20–20<br />
1 glänzend oder halbmatt gestrichen ≥ 70 g<br />
m2 1–2 matt gestrichen je nach Verhalten<br />
2 gestrichen < 70 g<br />
m2 3 ungestrichen (auch pigmentiert oder satiniert)
17 Druckweiterverarbeitung<br />
17.1 Variablen<br />
Symbol Einheit Bedeutung<br />
h Bb mm Höhe des Buchblocks<br />
b Bb mm Breite des Buchblocks<br />
d Bb mm Dicke (Stärke) des Buchblocks<br />
a Stück Auflage<br />
Sig Anzahl der Signaturen (Falzbögen)<br />
l mm Länge<br />
flächenbezogene Masse (Grammatur)<br />
m A<br />
g<br />
m 2<br />
17.2 Material-Empfehlungen<br />
Umschlag von Broschuren<br />
d Bb (mm) m A ( g<br />
m 2 )<br />
3–5 150<br />
6–8 220<br />
9–15 270<br />
über 15 300-400<br />
Schutzumschlag<br />
Art m A<br />
laminiert 80<br />
nicht laminiert 120<br />
35<br />
17.3 Materialverbrauch<br />
17.3.1 Leimverbrauch im Tiefdruck<br />
Verbrauch[kg] = (Höhe + Beschnitt) [mm] · mA · Seiten · Auflage<br />
109 · 2· 1,6 m2 /kg<br />
17.3.2 Fadenverbrauch beim Fadenheften<br />
l F [mm] = 2 · h Bb · (Sig + 1) · a<br />
17.3.3 Länge des Lesebändchens<br />
Diagonale des Buchblocks + 5 cm<br />
<br />
lL [mm] = h2 Bb + b2 + 50 Bb<br />
17.3.4 Prägefolien<br />
Folienvorschub Klischee-Höhe + 15 mm<br />
Folienbreite Klischee-Breite + 5 cm (großzügig)<br />
Länge einer Stammrolle ca. 122 m, bei Echtgold 61 m
18 Anhang<br />
18.1 Mathematisch-physikalische Größen<br />
Symbol Zuordnung<br />
a Beschleunigung, Gegenstandsweite<br />
a’ Bildweite<br />
A Fläche, Abschreibung<br />
b Bildweite (veraltet)<br />
B magnet. Flußdichte, Bildgröße (veraltet)<br />
c spez. Wärmekapazität, Wellenausbreitungsgeschwindigkeit<br />
C Kapazität<br />
d Diagonale, Zinsteiler<br />
D Brechkraft, Dichte, Federkonstante, elektr. Flußdichte, Modalwert<br />
e Elementarladung, EULERsche Zahl 2,7182818...<br />
E Beleuchtungsstärke, elektr. Feldstärke<br />
f Frequenz, Brennweite einer Linse<br />
F Kraft, Farbaufnahme, Häufigkeitssumme<br />
g Erdbeschleunigung, Gegenstandsweite (veraltet)<br />
G Grundfläche (veraltet), elektr. Leitwert, Gewichtskraft (veraltet), Gegenstandsgröße<br />
(veraltet)<br />
h Höhe, Häufigkeit<br />
H<br />
√<br />
Belichtung, magn. Feldstärke<br />
i<br />
−1, Stromstärke (in der Elektrotechnik), Zähler<br />
I<br />
√<br />
Stromstärke, Lichtstärke<br />
j<br />
−1 (in der Elektrotechnik)<br />
J Trägheitsmoment<br />
k Klassenzahl<br />
K Kontrast, Kapital<br />
l Länge<br />
L Drehimpuls<br />
m Masse, Steigung einer Funktion, Modul<br />
n (natürliche) Zahl, Anzahl<br />
M Drehmoment, Mantelfläche (veraltet)<br />
O Opazität, Oberfläche (veraltet)<br />
p Druck, Impuls, Zinssatz<br />
P Leistung<br />
q Zinsfaktor<br />
36<br />
Symbol Zuordnung<br />
Q Wärmemenge, elektr. Ladung<br />
r Radius<br />
R Ohmscher Widerstand, Remission, Rapportlänge, Spannweite, Restwert<br />
s Weg, Seite, Standardabweichung<br />
t Zeit<br />
T Periodendauer, Temperatur, Transparenz<br />
U Umfang, elektr. Spannung<br />
v Geschwindigkeit, Abbildungsmaßstab, Variationskoeffizient<br />
V Volumen<br />
w Abschreibungsfaktor<br />
W Arbeit, Energie, Buchwert<br />
¯x Mittelwert<br />
˜x Zentralwert<br />
y Gegenstandsgröße<br />
y’ Bildgröße<br />
z Streuzahl, Zins<br />
Z Zinszahl<br />
α Winkelbeschleunigung<br />
γ Wichte, Gradation<br />
∆ Differenz<br />
ε elektr. Feldkonstante, rel. Vertrauensbereich<br />
ϑ Temperatur<br />
η Wirkungsgrad<br />
λ Wellenlänge<br />
µ Reibungszahl, Mittelwert<br />
π 3,1415926...<br />
ρ (Inkreis-)Radius, Dichte, spez. Widerstand<br />
σ Flächendichte, Standardabweichung<br />
Σ Summe<br />
ϕ Drehwinkel, Normalverteilung<br />
Φ Lichtstrom<br />
ω Winkelgeschwindigkeit<br />
Ω Raumwinkel
18.2 Maßeinheiten<br />
Symbol Name Zuordnung<br />
a Ar Fläche<br />
a Jahr Zeit<br />
å Ångstrøm Strecke (Atomphysik)<br />
A Ampére Stromstärke<br />
at techn. Atmosphäre Druck (veraltet)<br />
atm physik. Atmosphäre Druck (veraltet)<br />
bar bar Druck<br />
B Byte Datenmenge<br />
Bé° Baumé-Grad Dichte (veraltet)<br />
Bq Bequerel Radioaktivität<br />
brt Bruttoregistertonnen Masse<br />
C Coulomb elektr. Ladung<br />
◦ C Grad Celsius Temperatur<br />
cal Kalorie Arbeit, Energie (veraltet)<br />
cd Candela Lichtstärke<br />
cic Cicero Schriftgröße (veraltet)<br />
Curie Curie Radioaktivität<br />
d Tag Zeit<br />
dpi dots per inch Auflösung<br />
dpt Dioptrie Brechkraft<br />
erg Erg Arbeit, Energie (veraltet)<br />
eV Elektronenvolt Arbeit, Energie<br />
F Farad elektr. Kapazität<br />
°F Grad Fahrenheit Temperatur (veraltet)<br />
G Gauß Magnetismus<br />
Gy Gray Energiedosis<br />
h Stunde Zeit<br />
H Henry Induktivität<br />
ha Hektar Fläche<br />
Hz Hertz Frequenz<br />
37<br />
Symbol Name Zuordnung<br />
i Inch, Zoll Strecke<br />
J Joule Arbeit, Energie<br />
K Kelvin Temperatur<br />
l Liter Volumen<br />
lm Lumen Lichtstrom<br />
lpi lines per inch Rasterweite<br />
lx Lux Beleuchtungsstärke<br />
m Meter Strecke<br />
min Minute Zeit<br />
mol Molekulargewicht Stoffmenge<br />
N Newton Kraft<br />
Oe Oerstedt Magnetismus<br />
p Pond Kraft (veraltet)<br />
p (Didot-)Punkt Schriftgröße<br />
Pa Pascal Druck<br />
PS Pferdestärke Leistung (veraltet)<br />
pt Point, Punkt Schriftgröße<br />
rad Radiant Drehwinkel<br />
rd Rad Energiedosis<br />
Rö Röntgen Ionendosis<br />
s Sekunde Zeit<br />
S Siemens elektr. Leitwert<br />
sr Sterradiant Raumwinkel<br />
Sv Sievert Ionendosis<br />
t Tonne Masse<br />
T Tesla magn. Flussdichte<br />
u Atommasse<br />
V Volt elektr. Spannung<br />
W Watt Leistung<br />
Wb Weber magn. Fluss<br />
Ω Ohm elektr. Widerstand
18.3 Historisches<br />
18.3.1 Alte Maßeinheiten<br />
Größe Symbol Einheit Umrechnung<br />
Länge s " Inch, Zoll 1" = 2,53998 cm<br />
Länge s ft Foot 1 ft = 12 " = 0,3048 m<br />
Länge s yd Yard 1 yd = 3 ft = 0,9144 m<br />
Länge s mile mile 1 mile = 1,609344 km<br />
Länge s M geograph. Meile 1 M = 0,4947 km<br />
Länge s M römische Meile 1 M ≈ 1,480 km<br />
Länge s M dt. Landmeile 1 M = 7,53248 km (Preußen)<br />
Länge s M Postmeile 1 M = 7,500 km (Sachsen)<br />
Länge s sm, NM Seemeile, naut. M. 1 sm = 1,852 km<br />
Länge s Elle, Preußen 1 Elle = 66,69 cm<br />
Länge s Elle, Brabant 1 Elle = 69,5 cm<br />
Länge s Elle, Frankfurt 1 Elle = 54,73 cm<br />
Geschwindigkeit v kn Knoten 1 kn = 1 sm/h = 1,852 km/h<br />
Volumen V rm Raummeter, Ster 1 rm = 1 m 3 gestapeltes Holz<br />
Masse m Ztr Zentner 1 Ztr = 50 kg<br />
Masse m Ztr (Meter-)Zentner 1 Ztr = 100 kg (Österreich)<br />
Masse m DZtr Doppelzentner 1 DZtr = 100 kg<br />
Stück n Dtzd Dutzend 1 Dtzd = 12 Stück<br />
Arbeit W cal Kalorie 1 cal = 4,1868 J<br />
Leistung P PS Pferdestärke 1 PS = 735,50 W<br />
Kraft F kp Kilopond 1 kp = 9,80665 N<br />
Kraft F dyn Dyn 1 dyn = 10 −5 N<br />
Druck p at techn. Atmosphäre 1 at = 98,0665 kPa<br />
Druck p atm physik. Atmosphäre 1 atm = 101,325 kPa<br />
Druck p bar bar 1 bar = 100 kPa<br />
Papiermenge Ries (Verpackungseinheit) 1 Ries = meist 250 Bogen<br />
38<br />
18.3.2 Alte Schriftgrößen-Bezeichnungen<br />
p mm Name<br />
1 0,376 Achtelpetit<br />
2 0,752 Nonplusultra, Viertelpetit<br />
3 1,128 Brillant, Viertelcicero<br />
4 1,504 Diamant, Halbpetit<br />
5 1,880 Perl<br />
6 2,256 Nonpareille<br />
7 2,632 Mignon, Kolonel<br />
8 3,008 Petit<br />
9 3,384 Borgis<br />
10 3,760 Korpus, Garamond<br />
11 4,136 Rheinländer, Maintzer<br />
12 4,512 Cicero<br />
14 5,264 Mittel<br />
16 6,016 Tertia<br />
18 6,767 Parangon<br />
20 7,519 Text, Secunda<br />
24 9,023 Doppelcicero<br />
28 10,527 Doppelmittel<br />
32 12,031 Doppeltertia, kleine Kanon<br />
36 13,535 Kanon, Dreicicero<br />
40–42 ≈ 15,5 Grobe Kanon<br />
48 18,047 Konkordanz, kleine Missal, Viercicero
18.3.3 Historische Rohbogenformate<br />
Benennung Größe [mm] war genormt im<br />
Reichs-Format 330 × 420 Dt. Reich<br />
Kanzlei- (Propatria-)-Format 340 × 430 Dt. Reich<br />
Groß-Propatria-Format 360 × 450 Dt. Reich<br />
Löwen 380 × 480 Dt. Reich<br />
Einhorn 400 × 500 Dt. Reich<br />
Klein-Median 420 × 530 Dt. Reich<br />
Groß-Median 440 × 560 Dt. Reich<br />
Post-Median 460 × 590 Dt. Reich<br />
Royal 480 × 640 Dt. Reich<br />
Super-Royal 500 × 650 Dt. Reich<br />
Noten-Royal 540 × 680 Dt. Reich<br />
Imperial 570 × 780 Dt. Reich<br />
Foolscap 432 × 343 Commonwealth<br />
Crown 508 × 381 Commonwealth<br />
Post 489 × 394 Commonwealth<br />
Demy 571 × 444 Commonwealth<br />
Medium 610 × 483 Commonwealth<br />
Royal 635 × 508 Commonwealth<br />
Double Pott 635 × 381 Commonwealth<br />
Double Foolscap 686 × 432 Commonwealth<br />
Super Royal 686 × 533 Commonwealth<br />
Double Crown 762 × 508 Commonwealth<br />
Imperial 762 × 559 Commonwealth<br />
Double Post 800 × 495 Commonwealth<br />
39<br />
18.4 Normen<br />
Nummer Inhalt<br />
DIN 827 Faserstoffklassen, Faserstoffzusammensetzung der Naturpapiere<br />
DIN 5033, Teil 1–9 Farbmessung / Farbmetrik<br />
DIN 6172 Metamerie-Index<br />
DIN 6174 CIELAB-Formeln<br />
DIN 6737 Bürokarton<br />
DIN 6738 Alterungsbeständigkeit, Lebensdauerklassen (Papier und Karton)<br />
DIN 16511 Korrekturzeichen<br />
DIN 16515 Viskosität von Druckfarben<br />
DIN 16536, Teil 1–3 Farbdichtemessungen an Drucken<br />
DIN 16547 Autotypische Raster<br />
DIN 19307 Papier und Karton <strong>für</strong> Bürozwecke (S, SM, SD)<br />
DIN ISO 5267 Mahlgrad, Entwässerungsfähigkeit von Papier<br />
ISO 9000–9004 Qualitätssicherung<br />
ISO 9706 Alterungsbeständigkeit von Papier
18.5 Quellen<br />
• Bundesverband Druck und Medien: Kosten- und Leistungsgrundlagen <strong>für</strong> Klein- und<br />
Mittelbetriebe der Druckindustrie. Wiesbaden 2000 (Pro Print Forum). ISBN<br />
3-9807202-4-1<br />
• Cockerell, Douglas: Der Bucheinband und die Pflege des Buches. Leipzig 1925, Reprint<br />
Hannover 1998 (libri rari, Th. Schäfer). ISBN 3-88746-382-X<br />
• Druck-Abc. Fachliche Informationen <strong>für</strong> die Ausbildung in der Druckindustrie (versch.<br />
Ausgaben). Heidelberg (Zentral-Fachausschuss <strong>für</strong> die Druckindustrie).<br />
• Farbe & Qualität. Heidelberg 1999/2 (Heidelberger Druckmaschinen).<br />
• Gorbach, Rudolf Paulus: Textgestaltung am PC und Mac. Ravensburg 1995<br />
(Ravensburger Buchverlag). ISBN 3-473-48380-X<br />
• igepa Einkaufs-Handbuch. München/Nürnberg 1998 (2H Papier).<br />
• Luidl, Philipp: Typographie Basiswissen. Ostfildern 1996 (Deutscher Drucker). ISBN<br />
3-920226-75-5<br />
• Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bänden. Mannheim/Wien/Zürich 1981. ISBN<br />
3-411-01920-4 (Es darf mir gerne jemand ein neueres Lexikon schenken!)<br />
• REFA: Lehrgangsunterlagen zum Vertiefungsseminar Statistik. Darmstadt o. J. (1999?).<br />
40<br />
• Schäfer, Robert: Das Buchobjekt. Mainz 2000/2 (Hermann Schmidt). ISBN<br />
3-87439-536-7<br />
• Sieber, Helmut und Huber, Leopold: Mathematische Formeln. Erweiterte Ausgabe E.<br />
Stuttgart 1987/9 (Ernst Klett). ISBN 3-12-717900-6<br />
• Spektralfotometrische Qualitätskontrolle CPC 2-S (<strong>Formelsammlung</strong>). Heidelberg o. J.<br />
(Heidelberger Druckmaschinen)<br />
• Teschner, Helmut: Offsetdrucktechnik. Fellbach 1995/9 (Fachschriften-Verlag). ISBN<br />
3-921217-14-8<br />
• Tschichold, Jan: Erfreuliche Drucksachen durch gute Typographie. Ravensburg 1960<br />
(Otto Maier).<br />
• Ulshöfer, Klaus und Hornschuh, Hermann-Dietrich: Sammlung physikalischer und<br />
astronomischer Daten und Größen. Stuttgart o. J. (Konrad Wittwer). Beilage einer<br />
anderen Ausgabe von (Sieber/Huber).<br />
• Unterrichtsmaterial meiner Lehrer an der Fachschule <strong>für</strong> Drucktechnik: End, Hofmann,<br />
Kammel, Nagel, Schwieger, Wamser, Weigelt<br />
• eigene Recherchen
18.6 Stichwortverzeichnis<br />
1000-Bogen-Gewicht, 27<br />
1000-Meter-Bahngewicht, 27<br />
Abbildung, 18<br />
Abbildungsfaktor, 18<br />
Ablaufzeit, 27<br />
Abschreibung, 7<br />
Absprung, 33<br />
Abweichung, 6<br />
Addition, 4<br />
Alabasterkarton, 29<br />
Algebra, 4<br />
Allgemeinempfindlichkeit, 19<br />
Alphabet, griechisches, 3<br />
Ampére, 14<br />
Anfangskapital, 7<br />
Anhang, 23<br />
Ankathete, 12<br />
Anschaffungswert, 7<br />
ASA, 19<br />
Assoziativgesetz, 4<br />
Aufzeichnungsdichte, 26<br />
Aufzugskarton, 29<br />
Ausdehnung von Gasen, 17<br />
Ausdehung, 17<br />
Ausfallzeit, 8<br />
Aussagewahrscheinlichkeit, 7<br />
Bahngeschwindigkeit, 27<br />
Bahngewicht, 27<br />
Basis, 4, 26<br />
Bedruckstoffe, 27<br />
Belichtung, 18<br />
Belichtungszeit, 18<br />
Beschleunigung, 14, 15<br />
Beschleunigungsarbeit, 16<br />
Beschleunigungsweg, 15<br />
Bewegungsleistung, 16<br />
Bildbearbeitung, elektronische, 19<br />
Bilderdruckpapier, 31<br />
Bildweite, 18<br />
Bindestrich, 23<br />
Binom, 5<br />
Bit, 26<br />
Blattdicke, 27<br />
Blende, 18<br />
Blendenreihe, 18<br />
Blendenzahl, 18<br />
Bogengewicht, 27<br />
Bogenzahl, 27<br />
Brechkraft, 18<br />
Brechung, 18<br />
Brechungsindex, 18<br />
Brechungswinkel, 18<br />
Brennweite, 18<br />
Brüche, 4<br />
Buchwert, 7<br />
Byte, 26<br />
Candela, 14, 18<br />
Celsius, 17<br />
Chemie, 20<br />
chlorfrei, 21<br />
Chromoersatzkarton, 32<br />
Chromokarton, 31<br />
Cicero, 38<br />
Dedikation, 23<br />
Densitometrie, 19<br />
Dezimalschreibweise, 26<br />
Dezimalsystem, 26<br />
Diagonale, 11<br />
Dichte, 14, 18<br />
Didot-Punkt, 21<br />
Differenz zweier Mittelwerte, 7<br />
Dioptrie, 18<br />
Distributivgesetz, 4<br />
Divis, 23<br />
Division, 4<br />
Drachen, 11<br />
41<br />
Drehfrequenz, 15<br />
Drehmoment, 14, 15<br />
Drehwinkel, 15<br />
Dreieck, 11<br />
Dreieck, beliebiges, 12<br />
Dreieck, Pascalsches, 5<br />
Dreieck, rechtwinkliges, 12<br />
Druck, 14<br />
Druckformzylinders, 34<br />
Druckplatte, 19, 34<br />
DTP-Punkt, 21<br />
Duplexkarton, 32<br />
Durchschlagpapier, 31<br />
Effizienz, 8<br />
Einfallslot, 18<br />
Einfallswinkel, 18<br />
Einheitsstapel, 28<br />
Elektrische Arbeit, 16<br />
Element, neutrales, 4<br />
Elfenbeinkarton, 29<br />
Ellipse, 11<br />
Empfindlichkeit, 19<br />
Endgeschwindigkeit, 15<br />
Epilog, 23<br />
Erdbeschleunigung, 14<br />
Exponent, 4<br />
Exponentialschreibweise, 26<br />
Fahrenheit, 17<br />
Falzbogen, 27<br />
Farbannahme, 33<br />
Farbaufnahme, 33<br />
Farbdichte, 33<br />
Farbtonfehler, 33<br />
Federkonstante, 15<br />
Feinstwelle, 28<br />
Feinwelle, 28<br />
Fertigungskosten, 8<br />
Fertigungszeit, 8<br />
Filmempfindlichkeit, 19<br />
Filmvorschub, 21<br />
Fixkosten, 8<br />
Flexodruck, 33<br />
FLOPS, 26<br />
Formatklasse, 34<br />
Formel, Binomische, 5<br />
Freiheitsgrade, 7<br />
Frequenz, 15, 18, 19<br />
Frontispiz, 23<br />
Gammastrahlung, 19<br />
Gedankenstrich, 23<br />
Gefahrenklassen, 20<br />
Gegenkathete, 12<br />
Gegenstandsweite, 18<br />
Geometrie, 10<br />
Geometrie, Analytische, 13<br />
Geradengleichung, 13<br />
Geschwindigkeit, 14, 15<br />
Geviertstrich, 23<br />
Gewichtskraft, 14<br />
Gigabyte, 26<br />
Gleichgewicht, 14<br />
Gleichung, quadratische, 13<br />
Goldener Schnitt, 22<br />
Googol, 3<br />
Gradation, 19<br />
Graukarton, 31<br />
Graustufen, 18, 19<br />
Gravierzeit, 33<br />
Grenzkosten, 8<br />
Griechisch, 3<br />
Grobwelle, 28<br />
Grundgesamtheit, 7<br />
Hadern, 29<br />
Halbgeviertstrich, 23<br />
Halbstoff, 29<br />
Halbtonfilm, 19
Hangabtriebskraft, 14<br />
Haupttitel, 23<br />
Hebel, 14<br />
Heron, 11<br />
Herstellkosten, 8<br />
Hexadezimalsystem, 26<br />
Hilfszeit, 8<br />
holzfrei, 29<br />
Holzstoff, 29<br />
Hubarbeit, 16<br />
Hypotenuse, 12<br />
Illustrationsdruckpapier, 31<br />
Impressum, 23<br />
Impuls, 15<br />
Inch, 21<br />
Informationseinheit, 26<br />
Infrarotstrahlung, 19<br />
Inhaltsverzeichnis, 23<br />
Inkreisradius, 11<br />
Interpunktionen, 23<br />
IR, 19<br />
ISO, 19<br />
ISO-Datum, 24<br />
Kapital, 7<br />
Kapitel, 23<br />
Karton, 27<br />
Kathete, 12<br />
Kathetensatz, 11<br />
Kegel, 11<br />
Kegelstumpf, 11<br />
Kelvin, 14, 17<br />
Kettenpunkt, 19<br />
Kilobyte, 26<br />
Kilogramm, 14<br />
Kinetische Energie, 16<br />
Klassen, 6<br />
Klassenbreite, 6<br />
Klassenmitte, 6<br />
Körper, 11<br />
Kommutativgesetz, 4<br />
Konkordanz, 38<br />
Kontrast, 19, 33<br />
Kontrastfaktor, 19<br />
Koordinaten, 13<br />
Kopiertabelle, 19<br />
Kosinussatz, 12<br />
Kosten, 8<br />
Kreis, 11<br />
Kreuzprodukt, 20<br />
Kugel, 11<br />
Kunstdruckpapier, 29<br />
Ladung, 16<br />
Lageenergie, 16<br />
Lebensdauer, 30<br />
Lebensdauerklassen, 30<br />
Leistung, 16<br />
Leistungsgrad, 8<br />
Leitwert, 16<br />
Leuchtdichte, 18<br />
Licht, 19<br />
Lichtstrom, 18<br />
Linien, 21<br />
Linse, 18<br />
Logarithmus, 5<br />
Lumen, 18<br />
Lux, 18<br />
Luxsekunde, 18<br />
Mantellinie, 11<br />
Manuskriptberechnung, 23<br />
Maschinenpappe, 27<br />
Masse, 14<br />
Masse, flächenbezogene, 27<br />
Materialkosten, 8<br />
Mechanische Arbeit, 16<br />
Median, 6<br />
Megabyte, 26<br />
Mengen, 4<br />
Mengenausbringung, 8<br />
Messtechnik, 18<br />
Messwerte, 6<br />
42<br />
Mikrowelle, 28<br />
MIPS, 26<br />
Mittelwelle, 28<br />
Mittelwert, 6, 7<br />
Modalwert, 6<br />
Modul, 34<br />
Multiplikation, 4<br />
Naturkonstanten, 3<br />
Naturpapier, 29<br />
Normalkraft, 14<br />
Normalverteilung, 7<br />
Normen, 39<br />
Normkunstdruckpapier, 29<br />
Nullpunkt, 17<br />
Nutzungsdauer, 7<br />
Nutzungsgrad, 8<br />
Offsetdruckpapier, 29<br />
Oktalsystem, 26<br />
Optik, 18<br />
Ortsfaktor, 14<br />
Papier, 27<br />
Papierherstellung, 21<br />
Papiervolumen, 27<br />
Pappe, 27<br />
Pappennummer, 28<br />
Papptafeln, 28<br />
Parallelogramm, 11<br />
Parallelschaltung, 16<br />
Pascalsches Dreieck, 5<br />
Pascalsekunden, 20<br />
Petit, 38<br />
pH-Wert, 20<br />
Pixel, 19, 21<br />
Positivplatte, 19<br />
Postscript, 18<br />
PostScript-Point, 21<br />
Potentielle Energie, 15, 16<br />
Potenz, 4<br />
Potenzschreibweise, 26<br />
Preisberechnung, 28<br />
Prisma, 11<br />
Prolog, 23<br />
Prozent, 4<br />
Pyramide, 11<br />
Pyramidenstumpf, 11<br />
Pythagoras, 11<br />
Quader, 11<br />
Quadrat, 11<br />
Quadratwurzel, 5<br />
Qualitätsfaktor, 18<br />
Quellenverzeichnis, 40<br />
Radiowellen, 19<br />
Radizieren, 5<br />
Rakel, 33<br />
Rasterdichte, 33<br />
Rasterweite, 18<br />
Rasterwinkelung, 19<br />
Raumdiagonale, 11<br />
Raumwinkel, 18<br />
Raute, 11<br />
Rechengeschwindigkeit, 26<br />
Rechteck, 11<br />
Recycling, 21<br />
REFA (provisorisch), 9<br />
Reflexion, 18<br />
Refraktion, 18<br />
Reibungsarbeit, 16<br />
Reibungskraft, 14<br />
Reibungszahl, 14<br />
Reihenschaltung, 16<br />
Remission, 18<br />
Rendite, 8<br />
Reproduktion, 18<br />
Restwert, 7<br />
RGB, 19<br />
Ries, 38<br />
Röntgenstrahlung, 19<br />
Rohbogenformate, 39<br />
Ruhe, 14
Satzspiegel, 22<br />
Satztechnik, 21<br />
Sauerstoffbedarf, 21<br />
Schachbrettpunkt, 19<br />
Schichtdicke, 34<br />
Schmutztitel, 23<br />
Schnittpunkt, 13<br />
Schnittwinkel, 13<br />
Schreibmaschinenpapier, 32<br />
Schreibpapier, 32<br />
Schriftgröße, 38<br />
Schwerpunkt, 6<br />
Sekunde, 14<br />
Sensitometrie, 18<br />
Siebdruck, 33<br />
Sinussatz, 12<br />
Sleeve, 34<br />
Spannarbeit, 15, 16<br />
Spannkraft, 15<br />
Spannung, 16<br />
Spannweite, 6<br />
Spatium, 24<br />
Speichereinheit, 26<br />
Spektrum, elektromagnetisches, 19<br />
Spiegel, 18<br />
Spiegelstrich, 23<br />
Spielkartenkarton, 29<br />
Spurdichte, 26<br />
Standardabweichung, 6, 7<br />
Starkpappe, 27<br />
Statistik, 6<br />
Steigung, 13<br />
Steigungswinkel, 13<br />
Sterradiant, 18<br />
Stichprobe, 6, 7<br />
Stichprobe, klassierte, 6<br />
Stillstandzeit, 8<br />
Streckenstrich, 23<br />
Streuung, 6<br />
Streuzahl, 6<br />
Subtraktion, 4<br />
Tabellensatz, 23<br />
Tageszinsen, 7<br />
Tausenderpunkt, 24<br />
Teilkreis, 34<br />
Temperatur, 14<br />
Tiefdruck, 33<br />
Tonwertzunahme, 34<br />
Transparenz, 18<br />
Trapez, 11<br />
Trennung, 23<br />
Trigonometrie, 12<br />
Triplexkarton, 32<br />
Ultraviolettstrahlung, 19<br />
Umdrehungen, 15<br />
Umdruckpapier, 29<br />
Umfang, 11<br />
Umfangsgeschwindigkeit, 15<br />
Umkreisradius, 11<br />
Umweltbelastung, 21<br />
Unterlagebogen, 29<br />
UV, 19<br />
Varianz, 6<br />
Variationskoeffizient, 6<br />
Verdunstungszahl, 21<br />
Vertrauensbereich, 7<br />
Vollton, 33<br />
Volumen, 11, 14<br />
Volumen, Papier-, 27<br />
Volumenausdehnung, 17<br />
Vorsilben, 3<br />
Vorwort, 23<br />
Vorzeichen, 4<br />
Wärme, 17<br />
Weiterverarbeitung, 35<br />
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit, 18<br />
Wellenteilung, 28<br />
Wellpappe, 28<br />
Werkstattverfahren, 23<br />
Werkstoffe, 27<br />
43<br />
Wichte, 14<br />
Wickelpappe, 27<br />
Widerstand, 16<br />
Widmung, 23<br />
Wiederbeschaffungsneuwert, 7<br />
Winkelbeschleunigung, 15<br />
Winkelfunktionen, 12<br />
Winkelgeschwindigkeit, 15<br />
Wirkungsgrad, 16<br />
Wirtschaftlichkeit, 8<br />
Wurzel, 5<br />
x-Achsen-Abschnitt, 13<br />
y-Achsen-Abschnitt, 13<br />
Zahlenmengen, 4<br />
Zahlensysteme, 26<br />
Zehnerpotenzen, 3<br />
Zeilenabstand, 21<br />
Zeit, 14<br />
Zeitanteil, 8<br />
Zeitarten, 8<br />
Zeitungsdruckpapier, 29, 31<br />
Zellstoff, 29<br />
Zentralwert, 6<br />
Zins, 7<br />
Zinseszins, 7<br />
Zinsfaktor, 7<br />
Zinssatz, 7<br />
Zoll, 21<br />
Zylinder, 11