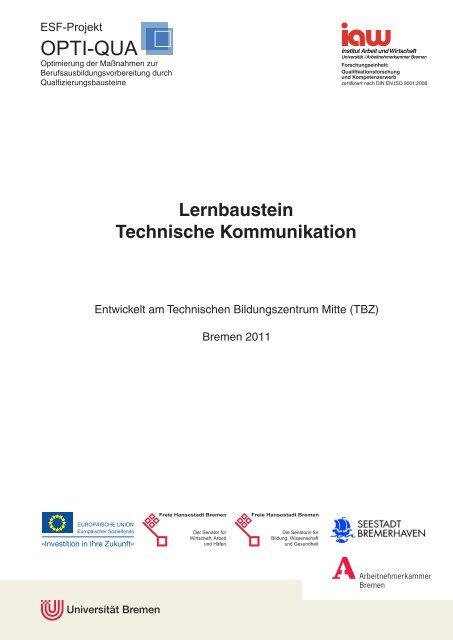Lernbaustein Technische Kommunikation - am Institut Arbeit und ...
Lernbaustein Technische Kommunikation - am Institut Arbeit und ...
Lernbaustein Technische Kommunikation - am Institut Arbeit und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ESF-Projekt<br />
OPTI-QUA<br />
Optimierung der Maßnahmen zur<br />
Berufsausbildungsvorbereitung durch<br />
Qualfizierungsbausteine<br />
<strong>Lernbaustein</strong><br />
<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Entwickelt <strong>am</strong> <strong>Technische</strong>n Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Bremen 2011<br />
Der Senator für<br />
Wirtschaft, <strong>Arbeit</strong><br />
<strong>und</strong> Häfen<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Die Senatorin für<br />
Bildung, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>Institut</strong> <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
Universität / <strong>Arbeit</strong>nehmerk<strong>am</strong>mer Bremen<br />
Forschungseinheit:<br />
Qualifikationsforschung<br />
<strong>und</strong> Kompetenzerwerb<br />
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
2 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
<strong>Lernbaustein</strong>e für die Berufsfachschule für Technik<br />
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> <br />
entwickelt <strong>am</strong><br />
<strong>Technische</strong>n Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
An der Weserbahn 4<br />
28195 Bremen<br />
Beteiligte Lehrkräfte:<br />
• Claudia Froböse (<strong>Lernbaustein</strong> Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit)<br />
• Christian Haak (<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> Mathematik II – Mechatronik Lernfeld 2)<br />
• Dirk Jacobs (<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>)<br />
• Oliver Pruschitzki (<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> Mathematik I – Mechatronik Lernfeld 1)<br />
Projektte<strong>am</strong> IAW:<br />
• Ulf Benedix<br />
• Bernd Feldmann<br />
Herausgeber:<br />
<strong>Institut</strong> <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
Universität / <strong>Arbeit</strong>nehmerk<strong>am</strong>mer Bremen (IAW)<br />
Forschungseinheit: Qualifikationsforschung<br />
<strong>und</strong> Kompetenzerwerb<br />
Postfach 33 04 40<br />
28334 Bremen<br />
http://www.optiqua.de<br />
Das Projekt OptiQua wird vom Europäischen Sozialfonds,<br />
vom Senator für Wirtschaft, <strong>Arbeit</strong> <strong>und</strong> Häfen, von<br />
der Senatorin für Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit,<br />
vom Magistrat der Stadt Bremerhaven sowie von der<br />
<strong>Arbeit</strong>nehmerk<strong>am</strong>mer Bremen gefördert.<br />
Kooperationspartner: <strong>Arbeit</strong>nehmerk<strong>am</strong>mer Bremen<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Der Senator für<br />
Wirtschaft, <strong>Arbeit</strong><br />
<strong>und</strong> Häfen<br />
Freie Hansestadt Bremen<br />
Die Senatorin für<br />
Bildung, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 3<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Vorwort ............................................................................................................................................5<br />
1 Bildungsgang <strong>und</strong> Zielgruppe ..........................................................................................................6<br />
1.1 Die Berufsfachschule für Technik (BFS Technik) ....................................................................6<br />
1.2 Zus<strong>am</strong>mensetzung der Lerngruppen (2010/2011)......................................................................7<br />
2 <strong>Lernbaustein</strong>e als Strukturprinzip zur Optimierung der Berufsausbildungsvorbereitung an der<br />
BFS Technik.....................................................................................................................................9<br />
2.1 <strong>Lernbaustein</strong>e .............................................................................................................................9<br />
2.2 Integration der <strong>Lernbaustein</strong>e in den Bildungsgang („Säulenmodell“) ...................................11<br />
2.3 Umsetzung <strong>und</strong> Perspektive im Bildungsgang ........................................................................13<br />
3 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>.....................................................................................15<br />
3.1 Im <strong>Lernbaustein</strong> vermittelte Kompetenzen ..............................................................................16<br />
3.2 DidaktischMethodische Anmerkung.......................................................................................17<br />
4 Durchführung des <strong>Lernbaustein</strong>s in Lerneinheiten.........................................................................18<br />
4.1 Einheit: Hinführung zum Thema – was bedeutet technische <strong>Kommunikation</strong>?.......................18<br />
4.2 Einheit: Der etwas andere Einstieg Ein nachdenkliches Spiel...............................................19<br />
4.3 Einheit: Erster Versuch eines fächerübergreifenden Unterrichts: Zus<strong>am</strong>menführung von<br />
Lerninhalten..............................................................................................................................20<br />
4.4 Einheit: Ohne Regeln geht es nicht...........................................................................................23<br />
4.5 Einheit: Rückgriff auf Bekanntes: Die Mathematik im Lernfeld sowie erste technische<br />
Zeichnungen..............................................................................................................................24<br />
4.6 Einheit: Wiederholung <strong>und</strong> Vertiefung der Praxisarbeit...........................................................26<br />
4.7 Einheit: <strong>Arbeit</strong>splan, Stückliste <strong>und</strong> deren Zus<strong>am</strong>menhänge...................................................28<br />
4.8 Einheit: Hinweise zur Erstellung von <strong>Arbeit</strong>smappen..............................................................29<br />
Projekt 1: N<strong>am</strong>ensschild planen <strong>und</strong> anfertigen.......................................................................31<br />
4.9 Einheit: Geometrische Gr<strong>und</strong>konstruktionen............................................................................32<br />
4.10 Einheit: Zeichnen von Werkstücken mit R<strong>und</strong>ungen...............................................................34<br />
4.11 Einheit: Bedeutung von Toleranzen, Fachbegriffe...................................................................36<br />
4.12 Einheit: Zeichnen von ersten Körpern in drei Ansichten – Übungen zum räumlichen Sehen. 38<br />
4.13 Einheit: Weitere Zeichnungen in drei Ansichten, Tabellenbucharbeit, Wiederholungen Vorbereitung<br />
auf 2. Klassenarbeit...................................................................................................40<br />
Klassenarbeit.............................................................................................................................41<br />
4.14 Einheit: Weitere Zeichnungen in drei Ansichten......................................................................44<br />
4.15 Einheit: Projekt 2: Besprechung des Projekts Maschinenschraubstock....................................45<br />
Projekt: Herstellung eines Maschinenschraubstocks................................................................46<br />
4.16 Einheit: Schnittdarstellungen....................................................................................................47<br />
4.17 Einheit: Wahre Größen.............................................................................................................49<br />
4.18 Einheit: Planung <strong>und</strong> Umsetzung eines Projekts für einen Mitschüler.....................................50<br />
Schlussbetrachtung....................................................................................................................51<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
4 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
5 Übersicht über die curriculare Durchführung / <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>..........52<br />
6 Bezüge zu für den Bildungsgang relevanten Ausbildungsordnungen ...........................................80<br />
7 Nachweis der erworbenen Kompetenzen ......................................................................................81<br />
8 Literaturnachweise .........................................................................................................................82<br />
9 Materialanhang...............................................................................................................................83<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 5<br />
Vorwort<br />
Die schulische Berufsausbildungsvorbereitung stellt alle Beteiligten vor anspruchsvolle Aufgaben.<br />
Steigende Anforderungen in technischen Berufen haben auch die Anforderungen an die Auszubildenden<br />
stetig wachsen lassen. Jugendliche, die sich aus dem Übergangsystem heraus für Ausbildungsplätze<br />
bewerben, müssen sich dabei oft gegen Wettbewerberinnen <strong>und</strong> Wettbewerber behaupten,<br />
die eine geradlinigere Schulbiografie als sie vorweisen können.<br />
Das Angebot, im ESFProjekt OptiQua <strong>Lernbaustein</strong>e zu entwickeln, wurde <strong>am</strong> TBZ gerne aufgegriffen.<br />
Unter hohem Engagement der beteiligten Lehrkräfte <strong>und</strong> mit Unterstützung des Projekts<br />
wurde der Fachunterricht im Bildungsgang auf Basis von drei <strong>Lernbaustein</strong>en neu strukturiert.<br />
Mit den Bausteinen „<strong>Technische</strong> Mathematik“, „<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>“ <strong>und</strong> „Sozialkompetenz<br />
<strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit“ wurde in einem integrierten Ansatz die Vermittlung wichtiger<br />
berufsbezogener Gr<strong>und</strong>lagenkompetenzen im Bildungsgang gestärkt. Mit den qualitativen<br />
schulischen Nachweisen über die erworbenen Kompetenzen können die Jugendlichen in Bewerbungsgesprächen<br />
„punkten“ <strong>und</strong> so ihre Chancen auf einen Übergang in Ausbildung verbessern.<br />
Die entwickelten Bausteine werden auch nach Ende des OptiQuaProjekts an der Schule eingesetzt,<br />
weiterentwickelt <strong>und</strong> ggf. auf weitere Fachrichtungen ausgedehnt.<br />
Jörg Metag<br />
Schulleiter<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
6 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
1 Bildungsgang <strong>und</strong> Zielgruppe<br />
Das <strong>Technische</strong> Bildungszentrum Bremen Mitte (TBZ) ist ein Schulzentrum mit einem allgemeinbildenden<br />
<strong>und</strong> einem beruflichen Zweig: Die zwei allgemeinbildenden Abteilungen vorberufliche<br />
<strong>und</strong> voruniversitäre Bildung werden um den beruflichen Bereich einer technischen<br />
Berufsschule ergänzt.<br />
Vom TBZ Mitte werden<br />
• berufsvorbereitende Vollzeitbildungsgänge,<br />
• berufsqualifizierende Teilzeitbildungsangebote im Rahmen einer dualen Berufsausbildung,<br />
• studienvorbereitende Vollzeitbildungsgänge <strong>und</strong> zusätzliche Fort <strong>und</strong> Weiterbildungsangebote<br />
bereit gehalten <strong>und</strong> unterstützt.<br />
Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist das TBZ Mitte die zentrale Bildungseinrichtung für alle<br />
industriellen Elektro <strong>und</strong> Metallausbildungsberufe in Bremen. Die industrielle Produktionstechnik<br />
verschiedenster Schwerpunkte steht im Mittelpunkt der technologischen Ausrichtung der Schule.<br />
Darüber hinaus finden die in Bremen vertretenen dualen Ausbildungsberufe der Bereiche Verkehrs<br />
<strong>und</strong> Fahrzeugtechnik <strong>am</strong> TBZ Mitte ihre Heimat.<br />
Die Bildungsangebote des TBZ Mitte werden gegenwärtig von mehr als 2500 Lernenden genutzt.<br />
Hierunter befinden sich zirka 2000 Auszubildende, die im Rahmen ihrer dualen Berufsausbildung<br />
in einem Ausbildungsbetrieb die Berufsschule im TBZ Mitte besuchen. 1<br />
1.1 Die Berufsfachschule für Technik (BFS Technik) 2<br />
Die Entwicklung von <strong>Lernbaustein</strong>en im Projekt OptiQua in der Ausbildungsvorbereitung erfolgte<br />
in der einjährigen Berufsfachschule für Technik. Die BFS ist ein beruflicher Vollzeitbildungsgang,<br />
die in den Berufsfeldern<br />
• Metall <strong>und</strong> Fahrzeugtechnik<br />
• Elektrotechnik<br />
• Mechatronik<br />
angeboten wird.<br />
Die BFS Technik ist einer doppelten Zielsetzung verpflichtet:<br />
Als schulische Berufsausbildungsvorbereitung sollen die Jugendlichen Gr<strong>und</strong>lagen für den Erwerb<br />
von beruflicher Handlungsfähigkeit erwerben. Durch eine breite berufliche Gr<strong>und</strong>bildung, die auf<br />
die Anforderungen der Ausbildungsrahmenpläne anerkannter technischer Ausbildungsberufe Bezug<br />
nimmt, sollen sie auf eine entsprechende Ausbildung vorbereitet werden.<br />
Zweitens ist eine vertiefte Berufsorientierung zu leisten. Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen in den<br />
Stand versetzt werden, sich mit den verschiedenen Berufsbildern auseinanderzusetzen <strong>und</strong> ihren<br />
Berufswahlprozess mit einer f<strong>und</strong>ierten selbstbestimmten Berufswahlentscheidung abzuschließen. 3<br />
Eingangsvoraussetzungen <strong>und</strong> Bildungsabschlüsse<br />
Zugangsvoraussetzung zu diesem Bildungsgang ist die einfache Berufsbildungsreife. Die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler sollen schulpflichtig sein. Ziel des Bildungsganges ist der Erwerb des<br />
1 Vgl. http://www.tbzbremen.de/index.php?id=10<br />
2 Vgl. Jacobs 2010.<br />
3 Vgl. VO BFS Technik, §1.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 7<br />
Abschlusses der Berufsfachschule, der der erweiterten Berufsbildungsreife gleichgestellt ist. Durch<br />
den freiwilligen Besuch von Zusatzkursen können die Schüler, wenn sie bereits den erweiterten<br />
Hauptschulabschluss haben, den Mittleren Schulabschluss erwerben. 4<br />
1.2 Zus<strong>am</strong>mensetzung der Lerngruppen (2010/2011)<br />
Größe der Lerngruppen <strong>und</strong> Verteilung auf die Berufsfelder<br />
Im genannten Schuljahr wurden insges<strong>am</strong>t 83 Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen in die BFS aufgenommen.<br />
Sie verteilen sich auf die Fachrichtungen wie folgt:<br />
a) Metall <strong>und</strong> Fahrzeugtechnik: Schüler: 21 Schülerinnen: 1<br />
b) Elektrotechnik: Schüler: 21 Schülerinnen: 1<br />
c) Mechatronik (2 Klassen) Schüler: 41 Schülerinnen: 1<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen waren <strong>am</strong> Beginn des Schuljahrs in der Regel 1617 Jahre alt, in<br />
Ausnahmefällen 18 Jahre alt, hatten dann jedoch noch Anspruch auf ein vollschulisches Schuljahr<br />
<strong>und</strong> wollten dieses nutzen.<br />
Der Bildungsabschuss bei Eintritt in die BFS verteilt sich in einer Durchschnittsschätzung über die<br />
letzten Jahre wie folgt: ca. 75 % Erweiterte Berufsbildungsreife, ca. 25% Mittlerer Schulabschluss;<br />
vereinzelt liegt auch ein Förderschulabschluss oder die Einfache Berufsbildungsreife vor. Die<br />
Jugendlichen, die mit der Erweiterten Berufsbildungsreife 5 in die BFS Technik eintreten, erhoffen<br />
sich von der beruflichen Gr<strong>und</strong>qualifizierung in der BFS eine Verbesserung ihrer Ausbildungschancen.<br />
Die Option, sich mit einem Mittleren Bildungsabschluss weitere Möglichkeiten zu eröffnen,<br />
können r<strong>und</strong> 30% dieser Jugendlichen erfolgreich für sich nutzen.<br />
Migrationshintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Zus<strong>am</strong>mensetzung nach Geschlechtern<br />
Insges<strong>am</strong>t 16 der Schüler <strong>und</strong> keine der Schülerinnen haben eine nichtdeutsche Staatsbürgerschaft.<br />
Nach Schätzung der Lehrkräfte haben jedoch etwa 40% der aufgenommenen Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen einen Migrationshintergr<strong>und</strong> 6 .<br />
In den oben genannten Zahlen wird deutlich, dass sich der Bildungsgang als „männlich dominiert“<br />
präsentiert. Schülerinnen sind in den Bildungsgängen weiterhin eine Ausnahme.<br />
Das Ziel, die Vertretung von jungen Frauen im Bildungsgang zu steigern, findet zunächst im<br />
Bildungsgang selbst wenig praktikable Ansatzpunkte. Ihre geringe Anzahl im Bildungsgang begründet<br />
sich aus im Vorfeld gefallenen Entscheidungen <strong>und</strong> bringt insofern zum Ausdruck, dass<br />
technische Berufe weiterhin in die Berufswahlperspektive von Mädchen <strong>und</strong> weiblichen Jugendlichen<br />
(insbesondere in der Zielgruppe der „bildungsbenachteiligten“ Jugendlichen) nur <strong>am</strong> Rand<br />
eingehen. 7<br />
4 Vgl. Details: VO BFS Technik, §5, §18b.<br />
5 Es handelt sich in vielen Fällen um „schlechte“ Abschlüsse.<br />
6 Da die Schulstatistik lediglich nach Staatsbürgerschaft differenziert, kann das Kriterium des Migrationshintergr<strong>und</strong>s<br />
mit ihrer Hilfe nur unzulänglich abgebildet werden. Für die Einschätzung des Migrationshintergr<strong>und</strong>s<br />
im weiteren Sinn muss daher auf Schätzungen der Lehrkräfte zurückgegriffen werden.<br />
Nach der für die Datenerfassung in ESFProjekten relevanten Definition liegt ein Migrationshintergr<strong>und</strong> vor,<br />
wenn mindestens ein Elternteil Deutsch nicht als Muttersprache spricht, oder mindestens ein Elternteil nicht in<br />
Deutschland geboren wurde, eine nichtdeutsche Nationalität hat oder eingebürgert wurde.<br />
7 Die Gründe dafür können in dem Rahmen dieser <strong>Lernbaustein</strong>dokumentation nicht angemessen dargestellt werden.<br />
Als Einstieg vgl. Alexandra Uhly: Strukturen <strong>und</strong> Entwicklungen im Bereich technischer Ausbildungsberufe des<br />
dualen Systems der Berufsausbildung. Empirische Analysen auf der Basis der Berufsbildungsstatistik. Studien zum<br />
deutschen Innovationssystem, Nr. 22007. Hrsg. B<strong>und</strong>esinstitut für Berufsbildung, Bonn 2007, Kapitel 4. Download:<br />
http://www.bmbf.de/pubRD/sdi0207.pdf (letzer Zugriff: 20111028)<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
8 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Eine Änderung muss (leider) als langfristiger gesellschaftlicher Prozess begriffen werden. Dabei<br />
muss aus einem „negativen Zirkel“ ein „positiver Zirkel“ werden: Je mehr die Beschäftigung von<br />
Frauen in technischen Berufen zur Normalität wird, um so selbstverständlicher werden auch weibliche<br />
Heranwachsende diese Möglichkeit in den Rahmen ihrer Berufswahlentscheidung einbeziehen.<br />
Die weiblichen Jugendlichen, die sich an der BFS Technik bewerben, tun dies in der Regel bewusst:<br />
Sie wollen sich eine berufliche Perspektive im technischen Bereich erschließen. Insofern sie es<br />
dabei – <strong>und</strong> davon ist auszugehen – auch auf Mitschüler treffen, die technische Berufe als weiterhin<br />
ihre Domäne betrachten <strong>und</strong> diesen Standpunkt in ihrem Verhalten gegenüber den Schülerinnen<br />
auch praktizieren, ist von den Lehrkräften eine besondere Sensibilität aufzubringen, um daraus<br />
erwachsende potenzielle Beeinträchtigungen der Erfolgschancen der Schülerinnen frühzeitig zu erkennen<br />
<strong>und</strong> gegenzusteuern.<br />
Beratung der Bewerberinnen <strong>und</strong> Bewerber vor der Aufnahme in die BFS<br />
Alle Bewerber <strong>und</strong> Bewerberinnen wurden in einem aufwendigen Aufnahmeverfahren nach ihrer<br />
Berufswahl <strong>und</strong> den zugr<strong>und</strong>e liegenden Entscheidungsgründen befragt. Die darauf folgende Beratung<br />
musste sich häufig auf die Minimierung der Versagenserlebnisse beschränken. Von den etwa<br />
220 Schülern, die 2009 beraten wurden 8 ,<br />
• gaben 82 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler als Gr<strong>und</strong> für den nicht erworbenen Ausbildungsplatz<br />
die schlechten Schulnoten an,<br />
• hatten 42 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler Fehlzeiten im Halbjahreszeugnis,<br />
• hatten 32 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler deshalb gar nicht begonnen, sich zu bewerben,<br />
• konnten nur 45 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ihren Berufswunsch begründen,<br />
• gaben 86 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler an, den mittleren Bildungsabschluss erwerben zu<br />
wollen, da sie dann größere Chancen <strong>am</strong> Ausbildungsmarkt hätten. (Vgl. Jacobs 2010)<br />
Insges<strong>am</strong>t ist mit Hinblick auf Bildungsgang <strong>und</strong> Zielgruppe von folgenden Rahmenbedingungen<br />
in der BFS Technik auszugehen:<br />
• Ein gewisser Teil der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen will in erster Linie den Mittleren Schulabschluss<br />
erwerben – der Bewerbung <strong>am</strong> TBZ liegt daher unter Umständen kein Interesse an<br />
Technik bzw. an der Vorbereitung auf einen technischen Ausbildungsberuf zugr<strong>und</strong>e. Der<br />
Bildungsgang ist aber auf das Berufsfeld Technik ausgerichtet.<br />
• Auch diejenigen Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen, die sich für einen Ausbildungsplatz im Berufsfeld<br />
qualifizieren wollen, wissen meist noch nicht so genau, welcher Beruf der richtige für<br />
sie ist; sie kennen zunächst nur wenige Berufsbilder. Ihre Unterstützung bei einer passenden<br />
<strong>und</strong> chancenreichen Entscheidungsfindung kann nicht als nachgeordnetes Ziel begriffen<br />
werden.<br />
• Defizite im Bereich gr<strong>und</strong>legender Kompetenzbereiche (Deutsch, Mathematik, soziale<br />
Kompetenzen) <strong>und</strong> d<strong>am</strong>it wichtige Elemente von „Ausbildungsfähigkeit“ sind nicht selten<br />
bei den Jugendlichen anzutreffen <strong>und</strong> müssen in der BFS Technik aufgefangen werden.<br />
• Andererseits ist der Rahmen für die Erreichung der Ziele eng gesteckt: Die Berufsfachschule<br />
hat einen zeitlichen Rahmen von 30 Unterrichtswochen, nämlich 40 Unterrichtswochen pro<br />
Schuljahr, abzüglich 4 Wochen Praktikum sowie etwa 6 Wochen Prüfungszeit.<br />
8 2010 <strong>und</strong> 2011 wurden jeweils etwa 200 Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler beraten.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 9<br />
2 <strong>Lernbaustein</strong>e als Strukturprinzip zur Optimierung der<br />
Berufsausbildungsvorbereitung an der BFS Technik<br />
Der Zugang zur Berufsfachschule Technik wird in der Hauptsache nicht durch eine Eignungsfeststellung<br />
erworben; vielmehr steht der Wunsch der Jugendlichen im Vordergr<strong>und</strong>, etwas Handwerkliches<br />
<strong>und</strong> <strong>Technische</strong>s im Berufsalltag zu machen <strong>und</strong> auch über diesen „handwerklichen“ Zugang<br />
zu Erfolgserlebnissen <strong>und</strong> Wertschätzung zu kommen. 9 Dabei ist die Selbsteinschätzung bei diesen<br />
Jugendlichen im Ausgangspunkt häufig von Selbstüberschätzung <strong>und</strong> einem Mangel an Selbstreflektion<br />
geprägt. Es fällt ihnen oft noch schwer, das eigene Können <strong>und</strong> die betrieblichen Anforderungen<br />
realistisch aufeinander zu beziehen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Entscheidungsfindung der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler zu verbessern <strong>und</strong> deren<br />
handlungswirks<strong>am</strong>e Umsetzung zu unterstützen.<br />
Dieser Prozess hat zunächst seine fachliche Komponente. Diese bedarf jedoch der Ergänzung durch<br />
soziale Komponenten wie Selbsteinschätzung, Te<strong>am</strong>fähigkeit, Zuverlässigkeit, <strong>Kommunikation</strong>sfähigkeit,<br />
Kritikfähigkeit, Toleranz usw., die eine Entscheidung für einen Beruf <strong>und</strong> generell<br />
„Ausbildungsfähigkeit“ nachhaltig beeinflussen. Nicht zuletzt ist im Rahmen eines handlungsorientierten<br />
Unterrichts die Kompetenz zu selbst reguliertem Lernen zu entwickeln.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage beider Komponenten lassen sich realistische Berufsziele erarbeiten, <strong>und</strong> die<br />
Jugendlichen werden nachhaltig in die Lage versetzt, eigenständig <strong>und</strong> zielbewusst ihre Berufswahlentscheidung<br />
umzusetzen. D<strong>am</strong>it werden zugleich auch die Chancen dafür verbessert, dass<br />
zunächst nicht ausreichend f<strong>und</strong>ierte Berufswahlentscheidungen in eine Neuorientierung münden<br />
können, womit Ausbildungsabbrüchen entgegengewirkt wird.<br />
Es kommt also in der Berufsausbildungsvorbereitung darauf an, die Jugendlichen beim Erlernen der<br />
technischen <strong>und</strong> sozialen Regeln zu unterstützen, d<strong>am</strong>it sie ihre Chancen im Wettbewerb um Ausbildungsplätze<br />
wahren <strong>und</strong> in Ausbildung <strong>und</strong> Beruf bestehen können.<br />
Der vorliegende <strong>Lernbaustein</strong> „Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit“ ist Teil eines Ges<strong>am</strong>tkonzepts,<br />
diese Ziele durch eine Neustrukturierung des Bildungsgangs mit mehreren <strong>Lernbaustein</strong>en<br />
besser zu erreichen.<br />
2.1 <strong>Lernbaustein</strong>e<br />
<strong>Lernbaustein</strong>e zielen auf den Erwerb abgrenzbarer <strong>und</strong> qualitativ dokumentierbarer Kompetenzen<br />
im Bereich der Berufsausbildungsvorbereitung. 10<br />
<strong>Lernbaustein</strong>e streben eine Verbesserung des Übergangs in Ausbildung darüber an, dass die<br />
Jugendlichen gegenüber potenziellen Ausbildungsbetrieben nachweisen können, dass sie ihr Jahr in<br />
der BFS erfolgreich für den Aufbau ausbildungsrelevanter Gr<strong>und</strong>lagenkenntnisse genutzt haben.<br />
Die Nachweise, die die Zeugnisse ergänzen, machen die erworbenen Kompetenzen für den Betrieb<br />
inhaltlich nachvollziehbar <strong>und</strong> d<strong>am</strong>it transparent. Für die Jugendlichen bedeuten sie einen<br />
kompensatorischen Vorteil bei Bewerbungen aus dem Übergangsystem <strong>und</strong> d<strong>am</strong>it aus einer<br />
schlechteren „Startposition“ heraus gegenüber Wettbewerbern <strong>und</strong> Wettbewerberinnen, die mit<br />
einer geradlinigeren Schulbiografie <strong>und</strong> ggf. besseren Abschlüssen aufwarten können.<br />
9 Von der oben erwähnten Tatsache, dass ein Teil der Jugendlichen ohne persönliche Affinität zu technischen Berufen<br />
mit dem primären Ziel des Mittleren Bildungsabschlusses in den Bildungsgang eintritt, wird hier abgesehen.<br />
10 Zur Abgrenzung zu Qualifizierungsbausteinen hat OptiQua einen Bericht vorgelegt; Download unter<br />
http://www.iaw.unibremen.de/optiqua/download_log.php?dl=berichtoptiquaonline20110803.pdf..<br />
Insbesondere zielen <strong>Lernbaustein</strong>e nicht darauf ab, Teile der Ausbildung „anrechnungsfähig“ vorwegzunehmen,<br />
sondern betonen den ausbildungsvorbereitenden, auf Ausbildung hinführenden Charakter.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
10 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Die Identifizierung der Inhalte, die den hier erarbeiteten <strong>Lernbaustein</strong>en zugr<strong>und</strong>e liegen, erfolgte in<br />
der Diskussion mit den beteiligten Lehrkräften, z. T. unter Beteiligung von Vertretern der<br />
K<strong>am</strong>mern, <strong>und</strong> auf Basis von Expertengesprächen mit Betriebsvertretern. 11<br />
Im Resultat wurden <strong>Lernbaustein</strong>e für drei Kompetenzfelder entwickelt <strong>und</strong> umgesetzt:<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>:<br />
Ausgangspunkt war die Anregung von betrieblicher Seite, dass ein nachweisbares Gr<strong>und</strong>verständnis<br />
für technische Zeichnungen als „länderübergreifende Sprache“, in der sich die an technischen<br />
Produktionsprozessen Beteiligten verständigen, für Betriebe bei der Auswahl ihrer Auszubildenden<br />
interessant sein dürfte. Dieses Konzept wurde dahin gehend erweitert, dass <strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong> als integrierendes Konzept verstanden wurde, das dem Prozesscharakter<br />
industrieller <strong>und</strong> handwerklicher Produktion entspricht <strong>und</strong> im Rahmen der schulischen Berufsausbildungsvorbereitung<br />
daher gut geeignet ist als Rahmen für den Unterricht, der sich als Projektunterricht<br />
<strong>am</strong> Konzept der vollständigen Handlung orientiert.<br />
<strong>Technische</strong> Mathematik:<br />
Solide mathematische Gr<strong>und</strong>lagenkompetenzen sind für eine Ausbildung in <strong>Technische</strong>n Berufen<br />
unverzichtbar; Defizite in diesem Bereich sind umgekehrt ein wichtiges Ausschlusskriterium der<br />
Betriebe bei der Auswahl von Auszubildenden. Viele Jugendliche treten mit Defiziten in den<br />
Bildungsgang ein, die daher im Laufe des Schuljahres aufgearbeitet werden müssen. Der dabei erreichte<br />
Leistungsstand in Mathematik taucht nun allerdings im Zeugnis der BFS als solcher nicht<br />
auf, da Mathematik nicht mehr als Fach, sondern in die Lernfelder integriert vermittelt wird. 12<br />
Ein <strong>Lernbaustein</strong> zur Entwicklung der mathematischen Gr<strong>und</strong>lagenkompetenzen mit einem Anwendungsbezug<br />
auf den Einsatz in der Technik erschien somit aus zwei Gründen interessant:<br />
Für die schwierige Aufgabe, bei einem Teil der Jugendlichen zunächst mathematische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
aufarbeiten zu müssen, die eigentlich für den Bildungsgang als vorhanden unterstellt sind, wurde<br />
der Versuch gemacht, einen verbesserten Ablauf der Vermittlungsschritte zu finden, der trotz<br />
knappem Zeitrahmen Raum für die Aufarbeitung von Defiziten schaffen soll, um die Jugendlichen<br />
„dort abzuholen, wo sie stehen.“ Insofern darüber hinaus in der Anlage des <strong>Lernbaustein</strong>s der<br />
Bezug zu den Anforderungen, die sich in einer technischen Ausbildung täglich stellen, unterstrichen<br />
wird, sollte der Nachweis über diesen <strong>Lernbaustein</strong> auch ein positives Datum für potenzielle Ausbildungsbetriebe<br />
sein.<br />
Soziale Kompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit:<br />
Das Konstrukt der „Ausbildungsfähigkeit“ hat nicht nur eine fachliche, sondern auch eine soziale<br />
Seite. In den Gesprächen mit den Betrieben wurde dieser Gesichtspunkt sogar stets an erste Stelle<br />
gestellt: Soziale Kompetenzen seien – neben Mathematik <strong>und</strong> Deutsch die wichtigste „Eintrittskarte“<br />
in eine Ausbildung, wichtiger jedenfalls als technische Vorqualifikationen. Dass das Jahr in<br />
der BFS von den Jugendlichen auch zum Erwerb bzw. zur Verbesserung ihrer Sozialkompetenz<br />
genutzt werden sollte, kann insofern als unumstritten gelten.<br />
Darauf bezogen gingen die Überlegungen im Lehrkräftete<strong>am</strong> dahin, dass soziale Kompetenz nicht<br />
„abstrakt“ vermittelt oder nachgewiesen werden kann, sondern sich in einem konkreten (beruflichen)<br />
Handlungszus<strong>am</strong>menhang entwickelt <strong>und</strong> bewährt. Die Kompetenzen auf dem Feld der<br />
<strong>Arbeit</strong>ssicherheit, die im Baustein erworben werden, stehen insofern einerseits für sich als qualitativ<br />
dokumentierbares, im Praxisbezug bereits angewendetes Gr<strong>und</strong>lagenwissen. Andererseits dient die<br />
Auseinandersetzung mit dem <strong>Arbeit</strong>sschutz als Material für das Training sozialer <strong>und</strong> insbesondere<br />
11 Vgl. auch hierzu den eben genannten OptiQuaBericht.<br />
12 Es ist geplant, bei der nächsten Änderung der Verordnung über die Berufsfachschule für Technik das Fach<br />
Mathematik wieder in die St<strong>und</strong>entafel aufzunehmen (ab Schuljahr 2013/14). In diesen Rahmen wird sich der<br />
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> Mathematik einfügen können.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 11<br />
kommunikativer Kompetenzen. Der <strong>Lernbaustein</strong> „Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit“ erschließt<br />
den Zus<strong>am</strong>menhang von verantwortungsbewusstem Verhalten <strong>und</strong> arbeitsprozessualen<br />
Anforderungen im Berufsalltag. Sozialkompetenz bedeutet in diesem Zus<strong>am</strong>menhang, das<br />
individuelle Verhalten an den Anforderungen des Umfelds zu überprüfen. Hierbei ist die Reflexion<br />
des eigenen Anteils zum Gelingen einer Aufgabe oder zum zielorientierten <strong>Arbeit</strong>en in einer<br />
Gruppe der Ausgangspunkt.<br />
2.2 Integration der <strong>Lernbaustein</strong>e in den Bildungsgang („Säulenmodell“)<br />
Die Bausteine realisieren im Bezug auf die Lernfelder verschiedene Konzepte: Sie sind<br />
• lernfeldübergreifend: Z. B. verknüpft „<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>“ Inhalte der verschiedenen<br />
Lernfelder miteinander.<br />
• aggregierend: Z. B. fasst „<strong>Technische</strong> Mathematik“ diejenigen Inhalte, die in einem Lernfeld<br />
vermittelt werden, unter dem Gesichtspunkt des mathematischen Kompetenzerwerbs<br />
zus<strong>am</strong>men.<br />
• fachübergreifend: Z. B. bindet sich „Sozialkompetenz“ unter dem Aspekt der<br />
kommunikativen Kompetenzen an das Fach „Deutsch“ an.<br />
Die <strong>Lernbaustein</strong>e sind somit nicht als isolierte Bausteine zu verstehen. Sie sind keine „Module“,<br />
die unabhängig voneinander oder vom Bildungsgang getrennt vermittelt werden. Sie verstehen sich<br />
als integrale Elemente des Bildungsgangs <strong>und</strong> ordnen sich somit in die vorhandenen Lernfelder ein.<br />
Andererseits etablieren sie jedoch auch neue, zusätzliche Strukturelemente <strong>und</strong> verändern d<strong>am</strong>it<br />
auch den Lernfeldunterricht im Bildungsgang. Betrachtet man die Lernfelder als „horizontale“<br />
Struktur, wird mit den <strong>Lernbaustein</strong>en gleichs<strong>am</strong> eine „vertikale“ Struktur hinzugefügt.<br />
Fachpraxis<br />
Pneumatik<br />
PC-Anwendungen<br />
Technologie<br />
Sozialkompetenz <strong>und</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>ssicherheit<br />
<strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong><br />
<strong>Technische</strong> Mathematik<br />
Betriebliche Praktika<br />
Deutsch<br />
Englisch<br />
Politik<br />
Als solche bilden die <strong>Lernbaustein</strong>e auch eine Einheit. Zwischen den <strong>Lernbaustein</strong>en existieren<br />
deutliche Querverbindungen, in denen sich die <strong>Lernbaustein</strong>e auf die Inhalte der anderen Bausteine<br />
beziehen, insbesondere zwischen „<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>“ <strong>und</strong> „<strong>Technische</strong> Mathematik" <strong>und</strong><br />
zwischen „<strong>Technische</strong>r <strong>Kommunikation</strong>“ <strong>und</strong> „Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit“. Die in den<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
Sport<br />
Bewerbungstraining Sozialkompetenz
12 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
zugr<strong>und</strong>e liegenden <strong>Lernbaustein</strong>en erworbenen Kompetenzen bilden eine Kl<strong>am</strong>mer, mit der die<br />
Gr<strong>und</strong>lagen für eine Ausbildungsaufnahme mit Erfolgsperspektive in vielen technischen Berufen<br />
geschaffen werden.<br />
Die drei <strong>Lernbaustein</strong>e bilden somit eine „zentrale Säule“, um die herum sich die übrigen berufsfeldbezogenen<br />
<strong>und</strong> berufsfeldübergreifenden Elemente des Bildungsgangs gruppieren <strong>und</strong> sich<br />
miteinander verknüpfen lassen. Am folgenden Beispiel soll verdeutlicht werden, wie diese Verknüpfung<br />
erfolgen könnte.<br />
Als Beispiel soll hier das Projekt „Schutzbacke“ aus dem <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
dienen. Die Schutzbacke als Bauteil kann in fast jedem Fach Teil der Ausbildung sein:<br />
Fachpraxis<br />
Pneumatik<br />
PC Anwendungen<br />
Technologie<br />
Bewerbungstraining<br />
Sozialkompetenz<br />
• Schutzbacke wird hergestellt<br />
• Werkzeuge werden kennengelernt<br />
• <strong>Arbeit</strong>splan wird erstellt<br />
• Pneumatische Werkstückspannungen werden durchgeführt<br />
• Kräfteermittlung<br />
• Die Schutzbacke wird mit einem Zeichenprogr<strong>am</strong>m gezeichnet<br />
• Eine Stückliste wird erstellt<br />
Im fachtheoretischen Unterricht werden<br />
• Werkstoffeigenschaften behandelt<br />
• die physikalischen Eigenschaften von verschiedenen Werkstoffen<br />
ermittelt<br />
• Maßeinheiten wiederholt<br />
• Messwerkzeuge behandelt<br />
• Fertigungsverfahren erläutert<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen können im Bewerbungstraining <strong>und</strong> in<br />
ihrem Lebenslauf vermerken, dass sie den Projektunterricht erfolgreich<br />
absolviert haben.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen können gemeins<strong>am</strong> überlegen, ob die Art<br />
der Schutzbacke, wie sie vorgegeben wird, überhaupt Stand der Technik<br />
ist, ob es nicht andere Möglichkeiten der Spannung von Werkstücken<br />
gibt, welche weiteren Alternativen es gibt. Der Te<strong>am</strong>gedanke steht im<br />
Vordergr<strong>und</strong>.<br />
Sport Krafttraining zum Anziehen des Schraubstocks<br />
Politik<br />
Englisch<br />
Im Politikunterricht könnte die Frage der Metallvorkommen von<br />
Interesse sein:<br />
• Welche Metalle kommen woher?<br />
• Unter welchen Bedingungen werden sie gefördert?<br />
• Was kosten sie?<br />
• Wie ist die Entsorgung geregelt?<br />
• Gibt es Ges<strong>und</strong>heitsgefahren?<br />
Für ausländische Gäste in der Schule können Beschreibungen der<br />
<strong>Arbeit</strong>sschritte vorgenommen werden, d<strong>am</strong>it bei einem R<strong>und</strong>gang der<br />
genaue Ablauf der Fertigung dargelegt werden kann <strong>und</strong> bei eventuellen<br />
Reparaturen ein Handbuch dazu vorliegt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 13<br />
Deutsch<br />
Sozialkompetenz <strong>und</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>ssicherheit<br />
<strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong><br />
<strong>Technische</strong><br />
Mathematik<br />
Praktikum<br />
Die erarbeiteten <strong>Arbeit</strong>spläne <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sberichte müssen auf formale<br />
<strong>und</strong> gr<strong>am</strong>matikalische Richtigkeit kontrolliert werden.<br />
Bedeutung der Schutzbacke für den <strong>Arbeit</strong>s <strong>und</strong> Bauteilschutz, Austausch<br />
der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen über die richtigen Schutzbacken<br />
bei einem entsprechenden Werkstück, weitere Möglichkeiten von<br />
sicheren Spannvorrichtungen können ausgetauscht werden<br />
Erstellung einer einfachen Zeichnung der Schutzbacke mit dem<br />
Kennenlernen der Begriffe Maßstab <strong>und</strong> Linienarten<br />
Berechnung der Masse der Schutzbacke, eventuell Ermittlung der gestreckten<br />
Länge<br />
Beim Praktikum besteht die Möglichkeit, die Erfahrungen aus der<br />
Te<strong>am</strong>arbeit des Projektunterrichts an weiteren Bauteilen anzuwenden.<br />
Das heißt, nicht immer nur das zu tun, was gefordert ist, sondern über<br />
die Anforderungen kritisch nachzudenken <strong>und</strong> eventuell zu hinterfragen<br />
<strong>und</strong> Veränderungen anzuschieben. Der Umgang mit einer fremden<br />
Situation <strong>und</strong> mit fremden Menschen wird geübt.<br />
Diese thematischen Anregungen zeigen, dass die Möglichkeit einer Verknüpfung von Inhalten in<br />
fast allen Unterrichtsanteilen besteht. Ausgangspunkt hierfür ist die Projektorientierung des Unterrichts.<br />
Die Umsetzung dieser Möglichkeiten setzt allerdings voraus:<br />
• Austausch der Lehrkräfte über die Inhalte des Unterrichts,<br />
• gemeins<strong>am</strong>e Planung des Unterrichts <strong>am</strong> Anfang eines Bildungsganges mit allen Beteiligten,<br />
• regelmäßige Abstimmung zwischen den Lehrkräften während des Schuljahrs.<br />
Sie bedarf daher einer strukturellen Verankerung dieser <strong>Kommunikation</strong>. Das „Säulenmodell“ kann<br />
dazu beitragen, die vorhandenen Te<strong>am</strong>strukturen in diesem Sinn zu stärken, auszubauen <strong>und</strong> zu<br />
unterstützen.<br />
2.3 Umsetzung <strong>und</strong> Perspektive im Bildungsgang<br />
Insges<strong>am</strong>t zielt die Strukturierung des Bildungsgangs mit <strong>Lernbaustein</strong>en auf Verbesserungen<br />
• für die Jugendlichen, die ergänzend zum Zeugnis aussagefähige Nachweise erhalten, mit<br />
denen sie ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt verbessern können,<br />
• für die Betriebe, denen mit inhaltlich transparenten Kompetenznachweisen ein ergänzendes<br />
Datum zu den „abstrakten“ Zeugnisnoten für ihre Entscheidungsprozesse an die Hand gegeben<br />
wird,<br />
• für den Bildungsgang, in dem durch die <strong>Lernbaustein</strong>struktur ein projektorientierter,<br />
lernfeldübergreifender <strong>und</strong> fächerverbindender Unterricht gestärkt wird.<br />
Die <strong>Lernbaustein</strong>e wurden zunächst nicht für alle Fachrichtungen des Bildungsgangs entwickelt <strong>und</strong><br />
erprobt, sondern auf die Fachrichtungen wie folgt verteilt:<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
14 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
• der <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> in der Fachrichtung Metall <strong>und</strong> Fahrzeugtechnik,<br />
• die <strong>Lernbaustein</strong>e <strong>Technische</strong> Mathematik in der Fachrichtung Mechatronik, differenziert<br />
für die Lernfelder 1 <strong>und</strong> 2,<br />
• der <strong>Lernbaustein</strong> Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit in den Fachrichtungen Metall <strong>und</strong><br />
Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> Mechatronik.<br />
Es besteht die Absicht, die <strong>Lernbaustein</strong>e in den Lernmittelbestand eingehen zu lassen. Sie sollen<br />
von den Lehrkräften auch der jeweils anderen Fachrichtungen aufgegriffen, angepasst <strong>und</strong> ggf.<br />
variiert werden, wenn dies vor dem Hintergr<strong>und</strong> einer veränderten Klassenzus<strong>am</strong>mensetzung erforderlich<br />
oder möglich ist.<br />
Der im Sommer 2011 abgeschlossene Durchgang wird von den beteiligten Lehrkräften als „Feldversuch“<br />
positiv bewertet. Die Zus<strong>am</strong>menarbeit mit den übrigen Lehrkräften <strong>am</strong> TBZ schließt den<br />
Transfer der <strong>Lernbaustein</strong>e ein.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 15<br />
3 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Im Rahmen der Dualen Berufsausbildung in technischen Berufen ist mit dem Thema „<strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong>“ ein zentraler, berufsübergreifender Kompetenzbereich benannt.<br />
Ein Maler muss lesen können, welche Farbe zu welchem Untergr<strong>und</strong> gehört, eine Metallbauerin im<br />
Tabellenbuch die richtige Schnittgeschwindigkeit herausfinden können, <strong>und</strong> Elektriker/innen<br />
müssen aus der Bauzeichnung herausfinden, wo welchen Schalter <strong>und</strong> welche Steckdose zu setzen<br />
ist. Sich mithilfe unterschiedlicher Medien arbeitsprozessrelevante Informationen zu verschaffen,<br />
bildet daher eine zentrale <strong>und</strong> berufsübergreifende Kompetenz von Facharbeitern <strong>und</strong> Facharbeiterinnen<br />
in technischen Berufen. Im Rahmen der beruflichen Ausbildung wird diese<br />
Kompetenz in Projektarbeiten in den Lernfeldern vermittelt.<br />
Hier setzt der <strong>Lernbaustein</strong> „<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>“ für die Berufsausbildungsvorbereitung<br />
an. Lernfeldübergreifend sollen die Gr<strong>und</strong>lagen für die spätere Bearbeitung von Lernfeldprojekten<br />
gelegt <strong>und</strong> angewandt werden. Dazu ist es notwendig, sowohl die theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen<br />
„manuell“ <strong>am</strong> Zeichenbrett zu erlernen als auch im Weiteren diese theoretischen Gr<strong>und</strong>lagen mit<br />
elektronischen Hilfsmitteln <strong>am</strong> PC zu vertiefen.<br />
Der <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> wurde zunächst für die Fachrichtung Metall <strong>und</strong><br />
Fahrzeugtechnik“ entwickelt.<br />
Für diese Einheit stehen insges<strong>am</strong>t 30 Wochen à 3 St<strong>und</strong>en sowie 30 Wochen à 1 St<strong>und</strong>e <strong>am</strong> PC zur<br />
Verfügung; sie umfassen das Lernfeld 1+2.<br />
Folgender Unterricht ist in der Berufsfachschule, Fachrichtung Metall <strong>und</strong> Fahrzeugtechnik,<br />
obligatorisch:<br />
• Fertigung (Lernfeld 1+2) 120h<br />
• Montieren (Lernfeld 3) 120h<br />
• Instandhalten (Lernfeld 4) 80h<br />
◦ Lernfeld 1: Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen<br />
◦ Lernfeld 2: Fertigen von Bauelementen mit Maschinen<br />
◦ Lernfeld 3: Herstellen von einfachen Baugruppen<br />
◦ Lernfeld 4 : Warten technischer Systeme<br />
Der Zeitbedarf für den <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> umfasst 120 St<strong>und</strong>en, zuzüglich<br />
der Anwendung im Werkstattbereich von etwa 30 St<strong>und</strong>en.<br />
Die Notengebung erfolgt über die Lernfeldgruppe Fertigen, die die Lernfelder 1+2 beinhalten, in<br />
diesem Fall den <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> mit entsprechenden Ergänzungen.<br />
Im Lernfeld 3 Montage werden die mathematischen <strong>und</strong> elektrotechnischen Gr<strong>und</strong>kenntnisse zum<br />
Inhalt gemacht <strong>und</strong> bewertet.<br />
Im Lernfeld 4 Instandhalten werden kleine Baugruppen montiert.<br />
Im Wahlpflichtbereich werden EDV Gr<strong>und</strong>lagen erarbeitet <strong>und</strong> Zeichnungen, die zunächst von<br />
Hand skizziert wurden, werden mit einem Zeichenprogr<strong>am</strong>m erstellt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
16 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
3.1 Im <strong>Lernbaustein</strong> vermittelte Kompetenzen<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen dazu befähigt werden, sich auf verschiedenen Wegen<br />
Informationen in unterschiedlichen Formaten zu beschaffen <strong>und</strong> diese zu bearbeiten <strong>und</strong> zu bewerten.<br />
Die selbstständige Informationsbeschaffung erzeugt bei den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
Selbstsicherheit <strong>und</strong> beugt Fehlern vor. Gleichzeitig wird die Fähigkeit geschult, Informationen auf<br />
andere Art als in der Form der Sprache weiterzugeben.<br />
Folgende Kompetenzbereiche werden im Rahmen des <strong>Lernbaustein</strong>s bearbeitet: 13<br />
1. Probleme von <strong>Kommunikation</strong> <strong>und</strong> ihre Lösung: Animationsspiel „Ich schmiere ein<br />
Brötchen“ sowie Regelverständnis (Beispiel Kartenspiel); Skizzierübung, d. h. die<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, handschriftliche Notizen anzufertigen 1,2<br />
2. Möglichkeiten von <strong>Kommunikation</strong>: Tabellen, Bücher, PC, Schrift, Radio,<br />
Fernsehen, Sprache etc.; erneut: Notizen anfertigen (Skizzierübung) 1,2<br />
3. Zeichnung als Mittel <strong>und</strong> Methode der weltweiten <strong>Kommunikation</strong>, Skizzierübung 1,2<br />
4. Gr<strong>und</strong>sätzliche Regeln: Papierformate, „Werkzeuge“ zum Zeichnen, Linienarten <strong>und</strong><br />
deren Bedeutung, Maßstäbe, Rechenübungen zu Maßstäben, Einheiten <strong>und</strong> Größen 1,2,4<br />
5. Flache Werkstücke zeichnen im Maßstab 1:1 3,5<br />
6. Parallel: Wiederholung in der Werkstatt mit Anreißübungen (Lehrwerkstatt)<br />
7. Darstellung von Maßen in Tabellenwerken 3,4,5<br />
8. Übung zum räumlichen Sehen<br />
9. Bedeutung von Maßbezugskanten<br />
10. Flache Werkstücke bemaßen 5<br />
11. Schriftfelder <strong>und</strong> Stücklisten 6,8<br />
12. Geometrische Gr<strong>und</strong>übungen 7,9<br />
13. Flache r<strong>und</strong>e Werkstücke zeichnen im Maßstab 1:1 10<br />
14. Flache r<strong>und</strong>e Werkstücke bemaßen im Maßstab 1:1 10<br />
15. Zeichnen von flachen Werkstücken in anderen Maßstäben 10<br />
16. Bedeutung von Toleranzen <strong>und</strong> Allgemeintoleranzen 11<br />
17. Dreitafelprojektion eckiger Werkstücken 12, 13<br />
18. Abwicklung von eckigen Werkstücken, 9<br />
19. Dreitafelprojektion eckiger Werkstücke 9, 12, 13,14<br />
20. Abwicklung von Werkstücken, 9<br />
21. Abwicklung von r<strong>und</strong>en Werkstücken 9<br />
22. Schnittdarstellung 16<br />
23. Bedeutung der „wahren“ Größe von Teilen 17<br />
24. Zus<strong>am</strong>menbauzeichnungen 15<br />
25. Bedeutung der Zeichnung als Gr<strong>und</strong>lagen für die Kostenermittlung des Bauteils 15<br />
26. Bedeutung <strong>und</strong> Zus<strong>am</strong>menhang zwischen <strong>Arbeit</strong>splan, Zeichnung <strong>und</strong> Stückliste 15<br />
27. Die Zeichnung: Gr<strong>und</strong>lage der ges<strong>am</strong>ten Fertigung 15<br />
28. Umsetzung von exemplarischen Zeichnungen <strong>am</strong> PC (parallel im Wahlpflichtkurs)<br />
29. Erstellung einer Zeichnung für eine Mitschülergruppe, die anhand dieser Zeichnung<br />
das Bauteil herstellen soll, mit <strong>Arbeit</strong>splan, Stückliste <strong>und</strong> Zeitschätzung 18<br />
13 Die Zahlen rechts beziehen sich auf die folgende Darstellung der Durchführung des <strong>Lernbaustein</strong>s in 18 Einheiten.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 17<br />
30. Bau der geplanten Einheit<br />
3.2 DidaktischMethodische Anmerkung<br />
Als Sozialform ist <strong>Arbeit</strong> in Vierergruppen die Regel; alle Aufgaben werden gemeins<strong>am</strong> erledigt,<br />
die Abgabe der <strong>Arbeit</strong> erfolgt durch die ganze Gruppe.<br />
Hinweise <strong>und</strong> Anregungen zur didaktischmethodischen Gestaltung sind zum einen der Vorstellung<br />
der Durchführung des <strong>Lernbaustein</strong>s (Kapitel 4, Seite 18) wie auch der Übersicht über seine<br />
curriculare Umsetzung (Kapitel 5, Seite 52) zu entnehmen. Dort finden sich auch viele Hinweise<br />
auf empfohlene Materialquellen, die hier aus Gründen des Urheberrechts nicht mit dokumentiert<br />
werden konnten („Lektüreempfehlungen“).<br />
Das dokumentierbare Material ist ebenfalls zum einen in den Text (Kapitel 4, Seite 18) eingeflossen<br />
bzw. als Materialanhang (Kapitel 9, Seite 83) angefügt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
18 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4 Durchführung des <strong>Lernbaustein</strong>s in Lerneinheiten<br />
4.1 Einheit: Hinführung zum Thema – was bedeutet technische <strong>Kommunikation</strong>?<br />
In der ersten Einheit werden die Probleme der <strong>Kommunikation</strong> dargelegt. Die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen lernen die Begriffe Sender <strong>und</strong> Empfänger kennen, erfassen die Bedeutung von<br />
technischer <strong>Kommunikation</strong> <strong>und</strong> die Darstellung von Informationen in Zeichnungen, als Ausdruck<br />
einer allgemeinen Sprache, die Menschen sowohl hier wie auch in Großbritannien, Indien oder<br />
Japan verstehen. Dazu bedarf es genauer Regeln beim Zeichnen, die weltweit festgelegt<br />
(„normiert“) <strong>und</strong> deshalb verstanden werden.<br />
Mittel der <strong>Kommunikation</strong> sind zurzeit:<br />
• Zeichnungen (Zeichenregeln)<br />
• Telefon (Sprache)<br />
• Internet (Lesen <strong>und</strong> Schreiben)<br />
• Tabellen (Zahlen)<br />
Selbst Zeichnungen zu erstellen, ist eine Methode, Zeichnungen lesen zu lernen. Dazu benötigen die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
• Bleistifte unterschiedlicher Härte<br />
(3B →HB→3H)<br />
• Lineal<br />
• Zirkel<br />
• Dreiecke<br />
• Zeichenplatte<br />
• Hilfsmittel wie Radiergummi, Anspitzer,<br />
Handfeger<br />
Im Anschluss an die Einführung werden Skizzierübungen durchgeführt, d<strong>am</strong>it die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen wieder ein Gefühl dafür bekommen, mit einem „traditionellen“ Zeicheninstrument,<br />
dem Bleistift, zu arbeiten. Seine Vorteile liegen in der einfachen Handhabung, der Möglichkeit,<br />
auch mit der Spitze nach oben zu schreiben, einer vergleichsweise hohen Lichtechtheit, der<br />
relativen Wischfestigkeit sowie der Möglichkeit, das Gezeichnete mit einem Radiergummi wieder<br />
zu entfernen. (Die Verbesserung der manuellen Feinmotorik wird mit den späteren Anreißübungen<br />
in Verbindung gebracht.) Folgende Übungen können durchgeführt werden 14 :<br />
Zeichnen einer geraden Linie: Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen zeichnen zunächst drei parallele<br />
Linien auf ein Blatt A4quer im Abstand von etwa 5 cm. Danach<br />
werden 4 Linien ergänzt, möglichst parallel <strong>und</strong> mit möglichst<br />
gleichem Abstand zu den vorhandenen Linien. Anschließend 8<br />
Linien, weiter geht es mit 16 Linien <strong>und</strong> dann mit 32 Linien, wenn<br />
es zuvor gut gelungen ist. Mindestanforderung ist, dass sich die<br />
Linien nicht berühren.<br />
Zeichnen einer Wellenlinie Die gleiche<br />
Übung wie im<br />
vorherigen Absatz,<br />
als Ausgang<br />
dient jedoch eine<br />
Wellenlinie.<br />
14 Alle Bilder im Folgenden, soweit nicht anders angemerkt, von Dirk Jacobs.<br />
Zeichnen einer Schnecke Die erste Schnecke<br />
wird gezeichnet, in<br />
diese zeichnet man<br />
die nächste<br />
Schnecke <strong>und</strong> die<br />
nächste Schnecke<br />
usf.…<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 19<br />
4.2 Einheit: Der etwas andere Einstieg Ein nachdenkliches Spiel<br />
N<strong>am</strong>e „Frühstück“<br />
Dauer 15 bis 20 Minuten, ohne Schülerversuch<br />
Material Zutaten für ein Frühstück<br />
Akteure ein „Außerirdischer“<br />
Kurzbeschreibung / Ziel der Übung<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen erkennen, dass Erklärungen viel genauer sein müssen als sie<br />
denken, weil bei jeder Erklärung von einem Vorwissen des Gegenübers ausgegangen wird, das<br />
er/sie aber vielleicht nicht hat. Präzise Anleitungen sollen geübt werden, um Fehler <strong>und</strong> Missverständnisse<br />
zu vermeiden, z. B. im Beruf.<br />
Vorbereitung<br />
A) Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erstellen eine Einkaufsliste für ein Frühstück. Die Einkaufsgruppe<br />
sorgt dafür, dass alle Bestellungen ausgeführt werden <strong>und</strong> nichts fehlt.<br />
B) Die Lehrkraft bringt Brötchen, Butter, Aufstrich seiner Wahl, Teller, Messer, ggf. Tasse <strong>und</strong><br />
Getränk mit.<br />
Durchführung<br />
Die Lehrkraft stellt sich als „Außerirdische/r“ vor, der/die Hunger hat, aber nicht weiß, was ein<br />
Brötchen ist, wie es zu belegen ist, wie man mit dem Besteck <strong>und</strong> den anderen Dingen umgeht, was<br />
essbar ist <strong>und</strong> was nicht, z. B. die Verpackung der Butter <strong>und</strong> des Aufschnitts etc.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen ihm/ihr nun genaue Anweisungen geben, wie er/sie das<br />
Brötchen zu belegen hat <strong>und</strong> es essen kann. Nach dieser Vorführung findet ein gemeins<strong>am</strong>es Frühstück<br />
des/der „Außerirdischen“ <strong>und</strong> den Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen <strong>und</strong> Schülerinnen in Kleingruppen<br />
statt.<br />
Reflexion: Fragen zur Auswertung<br />
Missverständnisse kommen zustande, weil Dinge als selbstverständlich erscheinen <strong>und</strong> bei den Erklärungen<br />
weggelassen werden, kulturelle Unterschiede werden deutlich.<br />
Anmerkung<br />
Diese Übung sollte zuerst von der Lehrkraft vorgeführt werden, d<strong>am</strong>it die möglichen Ungenauigkeiten<br />
bei den Erklärungen deutlich werden. Bei der Aufforderung das Messer in die Hand zu<br />
nehmen, sollte es bewusst falsch, z. B. an der Klinge angefasst werden usw.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
20 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.3 Einheit: Erster Versuch eines fächerübergreifenden Unterrichts: Zus<strong>am</strong>menführung<br />
von Lerninhalten<br />
Nach der 2. Einheit ist den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen genauer bewusst, wie schwierig<br />
<strong>Kommunikation</strong> ist, wenn sie ihr Ziel erreichen bzw. ihren Zweck erfüllen soll. Der Unterschied<br />
zwischen Sender <strong>und</strong> Empfänger einer Nachricht wird ihnen bewusst. Als Einstieg in das eigene<br />
Handeln wird jetzt das erste Projekt, das sie in der Werkstatt bereits gefertigt haben, aufgegriffen:<br />
Ausgangssituation<br />
Wenn die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen in einem technischen Bereich arbeiten, benötigen sie häufig<br />
einen Schraubstock. Er dient dazu Werkstücke festzuklemmen, um diese bearbeiten zu können. Die<br />
sogenannten Backen des Schraubstocks, also die Flächen, mit denen die zu bearbeitenden Werkstücke<br />
eingeklemmt werden, haben kleine harte Nasen. Sie haben den Zweck zu verhindern, dass<br />
das Werkstück bei der Bearbeitung verrutscht.<br />
Klemmfläche Schutzbacken auf Schraubstock<br />
Diese „Nasen“ können jedoch die Oberfläche des Werkstücks beschädigen. Um das zu vermeiden,<br />
muss sich der Mechaniker etwas einfallen lassen. Die gebräuchlichste Lösung sind „Schutzbacken“.<br />
Schutzbacken dienen also dem Schutz der Werkstücke, die in einen Schraubstock eingespannt<br />
werden.<br />
Die Schutzbacke muss nach dem Zuschnitt an den<br />
Biegelinien gebogen werden <strong>und</strong> sieht danach ungefähr<br />
so aus, wie rechts dargestellt.<br />
Die Schutzbacken können sowohl aus Aluminium<br />
als auch aus Kupfer hergestellt werden.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 21<br />
Zeichnung nicht<br />
maßstäblich!<br />
Anhand dieser ersten Zeichnung werden wichtige erste Regeln technischer Zeichnungen erklärt:<br />
Zunächst kann die Gr<strong>und</strong>struktur einer Zeichnung dargestellt<br />
werden, das Zeichenblatt, das Schriftfeld, die Linienarten sowie die<br />
Bemaßung.<br />
Das Schriftfeld mit den Begrifflichkeiten<br />
wird erklärt.<br />
Alle Maße in mm!!!<br />
65<br />
45<br />
• Benennung der Zeichnung<br />
• Maßstab<br />
• Ersteller der Zeichnung<br />
• Datum der Erstellung<br />
• Organisation, die die Zeichnung erstellt hat<br />
Das Tabellenbuch als Hilfsmittel wird eingeführt. Den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen wird der Unterschied<br />
von Inhaltsverzeichnis <strong>und</strong> Stichwortverzeichnis erklärt. Indem nach der Norm des Schriftfeldes<br />
gefragt wird <strong>und</strong> danach, welche Maßstäbe genormt sind, lernen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen, dass allen technischen Zeichnungen ein Regelwerk zugr<strong>und</strong>e liegt, das in einem<br />
„Normenverzeichnis“ aufgeschrieben ist.<br />
Anmerkung I:<br />
Dieser Zus<strong>am</strong>menhang ist gut dafür geeignet, das Thema Normen mit dem Fach Deutsch zu verknüpfen:<br />
Es gibt nicht nur technische Normen (Regeln), sondern auch soziale Regeln (Normen), die<br />
im Umgang von Menschen miteinander gelten.<br />
Anmerkung II:<br />
25<br />
Im Unterrichtsgespräch wurden verschiedene Sprichworte benutzt, deren Sinn sich den Schülern<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen nicht immer <strong>und</strong> eindeutig erschließt, da ihnen einerseits das Erfahrungswissen<br />
darüber fehlt, sie andererseits aus Kulturräumen kommen, in denen die hier geläufigen Sprichwörter<br />
unbekannt sind <strong>und</strong> vice versa.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
110<br />
165<br />
130<br />
Biegelinien t = 1
22 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Die im deutschen Sprach <strong>und</strong> Kulturraum gängigen Redewendungen<br />
• „Eine Eselbrücke bauen“<br />
• „Auf dem falschen Fuß erwischt werden“<br />
• „Die Kuh vom Eis holen“,<br />
sind den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen häufig nicht bekannt, mit ihnen werden keine Assoziationen<br />
verb<strong>und</strong>en. Dies gilt umgekehrt für Sprichwörter aus dem türkischen Kulturkreis, wie z. B.<br />
• "Das ist wie das Ohr <strong>am</strong> K<strong>am</strong>el“ (im Original: "Devede kulak")<br />
Sinngemäß bedeutet es: "Das ist eine unwichtige Kleinigkeit." Begründung: Das K<strong>am</strong>el hat für ein<br />
Tier dieser Größe sehr kleine Ohren.<br />
Erfolgreiche <strong>Kommunikation</strong> setzt voraus, dass Sprecher <strong>und</strong> Hörer einander „verstehen“ oder das<br />
NichtVerstandene infrage stellen bzw. erklären. Ohne diese Übereinstimmung entstehen Missverständnisse.<br />
Die Klärung dieser Fragen ist Hausaufgabe.<br />
Klärung der Begriffsherkunft an folgenden Beispielen:<br />
1. „Eine Eselsbrücke bauen“: Esel sind sehr wasserscheu <strong>und</strong> weigern sich beharrlich, auch<br />
kleinste Wasserläufe zu durchwaten, obwohl sie diese physisch leicht bewältigen könnten<br />
(„sturer Esel“). Begründung: Der Esel kann durch die spiegelnde Wasseroberfläche nicht<br />
erkennen, wie tief der Bach ist, weshalb er zurückweicht. Er überquert nur eine Brücke, die<br />
ihm Sicherheit bietet. Daher baut/e man ihnen in Furten kleine Brücken, die sogenannten<br />
Eselsbrücken. Somit steht die „Eselsbrücke“ auch für die Sicherheit.<br />
2. „Auf dem falschen Fuß erwischt werden“ bedeutet: jemanden unvorbereitet überraschen /<br />
ertappen / erwischen; zu einer ungünstigen Zeit erscheinen.<br />
3. „Die Kuh vom Eis holen“ bedeutet: sich aus einer unangenehmen Situation befreien; eine<br />
schwierige Lage entschärfen; eine Lösung finden.<br />
4. „Da habe ich mit Zitronen gehandelt“ bedeutet: keinen Erfolg haben; falsch kalkuliert<br />
haben; sich geirrt haben; Pech haben.<br />
Analog dazu ist eine sprichwörtliche Eselsbrücke ein Umweg oder besonderer Aufwand, der<br />
dennoch schneller – oder überhaupt erst – zum Ziel führt. Um sich z. B. einen Begriff oder einen<br />
Sachverhalt zu merken, verbindet man ihn mit einem anderen Begriff, man baut sich eine gedankliche<br />
Brücke, wofür die folgenden Beispiele taugen:<br />
5. Reihenfolge der Planeten des Sonnensystems (von innen nach außen): Merkur, Venus, Erde,<br />
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun (Pluto gilt seit September 2006 nicht mehr als<br />
Planet). Die Eselsbrücke lautet: „Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.“<br />
(Veraltet: „... unsere neun Planeten“.)<br />
6. Reihenfolge der Himmelsrichtungen Norden, Osten, Süden, Westen (mit Norden angefangen<br />
– im Uhrzeigersinn). Die Eselsbrücke lautet: „Nie ohne Seife waschen“ oder „Nie ohne<br />
Schuhe wandern“ oder „Nur Ochsen saufen Wasser“.<br />
Abschließend wurde die Aufgabe des Tages vorgestellt, das Zeichnen der Schutzbacke.<br />
Mit jedem/r Schüler <strong>und</strong> Schülerin wurden die Zeichenregeln besprochen. Nach dem ersten Versuch<br />
ist das Gleiche als Hausaufgabe in der kommenden St<strong>und</strong>e abzugeben.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 23<br />
4.4 Einheit: Ohne Regeln geht es nicht<br />
Um nun die Zeichnung zu lesen, müssen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen noch lernen, was welche<br />
Linie bedeutet:<br />
lfd. - Nr. Linienart Darstellungsbeispiel Beispiele der Anwendung<br />
1 Volllinie breit<br />
2 Volllinie schmal<br />
3<br />
Strichpunktlinie,<br />
schmal<br />
Sichtbare Kanten <strong>und</strong> Umrisse,<br />
Gewindespitzen<br />
Maßlinien, Maßhilfslinien, Biegelinien,<br />
Schraffuren, Gewindegr<strong>und</strong><br />
Mittellinien, Symmetrielinien, Lochkreise<br />
4 Gestrichelte Linie verdeckte Kanten <strong>und</strong> Umrisse<br />
Die Zeichnung der Schutzbacke wird von den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen gezeichnet, dabei geht es<br />
zunächst um die Außenkontur. Anschließend erhalten die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen die Aufgabe,<br />
andere Zeichnungen nach Vorgaben zu erstellen. Vorrangig geht es um die Benutzung der<br />
Zeichenmaterialen wie Lineal, Dreieck <strong>und</strong> Bleistift. Es werden weitere Skizzierübungen angeboten<br />
sowie das Umrechnen von Einheiten, das Berechnen von Maßen in anderen Maßstäben.<br />
Die Einbindung von Allgemeinkommunikation wird der Situation angemessen fortgesetzt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
24 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.5 Einheit: Rückgriff auf Bekanntes: Die Mathematik im Lernfeld sowie erste<br />
technische Zeichnungen<br />
Flächen <strong>und</strong> Volumenberechnung<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage technischer Zeichnungen können durch Einsatz mathematischer Verfahren<br />
weitere Eigenschaften von Werkstücken ermittelt werden. Bevor weitere Zeichnungen erstellt<br />
werden, sollen daher zunächst die Fläche, das Volumen <strong>und</strong> das Gewicht der bereits gezeichneten<br />
Schutzbacke berechnet werden. Werkstoffeigenschaften werden anhand des Tabellenbuchs<br />
thematisiert <strong>und</strong> weitere Formen <strong>und</strong> Arten von Schutzbacken mithilfe eines Fachbuchs ermittelt<br />
(Fachpraxis Metall, CornelsenVerlag).<br />
Als weiterer <strong>Arbeit</strong>sschritt ist es nun notwendig, einen ersten <strong>Arbeit</strong>splan über die Herstellung der<br />
Schutzbacke zu erstellen. Hierbei lernen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen, ihre eigenen <strong>Arbeit</strong>sschritte<br />
zu reflektieren <strong>und</strong> in eine den Anforderungen im technischen Bereich entsprechende Form zu<br />
bringen.<br />
Im weiteren Verlauf des Unterrichts wird nach zwei Vertiefungszeichnungen das erste Projekt<br />
durchgeführt. Als Unterrichtsprojekt wird das Teil bearbeitet, das zu dem Zeitpunkt gerade in der<br />
Werkstatt hergestellt worden ist. Hierbei kann es sich um eine Anreißplatte, das N<strong>am</strong>ensschild oder<br />
auch ein Passstück handeln.<br />
Zeichnen von weiteren flachen Werkstücken<br />
Um die Fähigkeiten im Zeichnen zu vertiefen, sollen noch zwei weitere Zeichnungen angefertigt<br />
werden. Hierbei geht es vor allem um das Zeichnen <strong>und</strong> Bemaßen der Zeichnung <strong>und</strong> die dabei anzuwendenden<br />
Regeln.<br />
• Abstand der ersten Maßlinie von der Körperkante etwa 10mm<br />
• Abstand der zweiten Maßlinie von der ersten Maßlinie 7mm<br />
• Die Pfeile sind lang <strong>und</strong> schlank zu zeichnen<br />
• Die Maßlinien <strong>und</strong> die Maßhilfslinien sind dünn zu zeichnen<br />
• Die Mittellinien sind 12mm über die Körperkante hinaus zu zeichnen<br />
• Die Maßhilfslinien sind 12mm über die letzte Maßlinie hinaus zu zeichnen<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 25<br />
1. Vertiefungsbeispiel:<br />
Zeichnung nicht<br />
maßstäblich!<br />
2. Vertiefungsbeispiel<br />
Beim zweiten Beispiel geht es um die Symmetrie an Werkstücken sowie um die Darstellung in<br />
einem anderen Maßstab.<br />
Zeichnung nicht<br />
maßstäblich!<br />
70<br />
30<br />
t= 8<br />
50<br />
t= 10<br />
50<br />
70<br />
15<br />
100<br />
35<br />
Zeichne das<br />
Stufenblech im<br />
Maßstab 1:1<br />
Zeichne die Formlehre<br />
im Maßstab 2:1<br />
Jede dieser Zeichnungen ist ist im Unterricht zu erstellen sowie als Hausaufgabe auszuführen <strong>und</strong><br />
abzugeben. Ergänzend sollen die Flächen <strong>und</strong> Massen der Werkstücke berechnet werden.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
15<br />
30<br />
10<br />
50<br />
25<br />
40
26 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.6 Einheit: Wiederholung <strong>und</strong> Vertiefung der Praxisarbeit<br />
Im Rahmen des fächerübergreifenden Unterrichts wird in den nächsten Unterrichtsst<strong>und</strong>en ein<br />
Projekt im Mittelpunkt der <strong>Arbeit</strong> stehen. Die einzelnen Elemente des Projekts sind bereits in<br />
anderen Zus<strong>am</strong>menhängen erarbeitet worden.<br />
• <strong>Arbeit</strong>splan<br />
• Zeichnung<br />
• Mathematische Berechungen<br />
• Stückliste (Das Thema wird im Zus<strong>am</strong>menhang mit den entsprechenden Teilen erarbeitet.)<br />
Zur Auswahl stehen:<br />
• N<strong>am</strong>ensschild<br />
• Anreißblech<br />
• Formblech<br />
• Kreuzpuzzle<br />
• Bohrübung 1<br />
• Bohrplatte 2<br />
• Würfelplatte<br />
N<strong>am</strong>ensschild Formblech<br />
Anreißblech Kreuzpuzzle<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 27<br />
Bohrübung 1 Bohrplatte 2<br />
Würfelplatte<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
28 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.7 Einheit: <strong>Arbeit</strong>splan, Stückliste <strong>und</strong> deren Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen haben im Rahmen des Unterrichts bis jetzt folgende Schritte unternommen:<br />
• Berechnung des Volumens mithilfe des Tabellenbuches Metall, Europa Verlag, 39. Auflage,<br />
Seite 106107.<br />
• Erarbeitung der Materialen von Schutzbacken, mithilfe des Fachk<strong>und</strong>ebuchs Fachpraxis<br />
Metall, Cornelsen Verlag, Seite 96: Blei, Holz, Kupfer, Leichtmetall, Kunststoff, also<br />
weicher als das zu bearbeitende Werkstück.<br />
• Zeichnen eines Bauteils, in diesem Fall des Stufenblechs als Hausaufgabe.<br />
• Erstellung eines <strong>Arbeit</strong>splans für die Herstellung der Schutzbacke als Hausaufgabe.<br />
• In der Werkstatt Herstellung weiterer von Bauteilen aus den oben abgebildeten Figuren, in<br />
deren Zus<strong>am</strong>menhang auch die fachsprachlichen Begriffe wiederholt werden: Anreißnadel,<br />
Reifkloben, Feilenarten, usw.<br />
In der Werkstatt wird das nächste Bauteil gefertigt, das für unseren weiteren Lernschritt erforderlich<br />
ist: Würfel mit Gr<strong>und</strong>platte. In diesem Zus<strong>am</strong>menhang wird der Begriff Stückliste erläutert <strong>und</strong> der<br />
Zus<strong>am</strong>menhang zwischen <strong>Arbeit</strong>splan, Stückliste, Zeichnung verdeutlicht.<br />
(In diesem Kontext sei angemerkt, dass die Zeichnungen später im Rahmen der Einführung in die<br />
EDV noch <strong>am</strong> Computer gezeichnet werden.)<br />
Der Konstrukteur bzw. die Konstrukteurin eines Bauteils hat vom K<strong>und</strong>en den Auftrag bekommen<br />
für eine Ausstellung ein Bauteil zu zeichnen, das folgenden Anforderungen erfüllt:<br />
• Es soll kostengünstig zu fertigen <strong>und</strong> schön anzusehen sein<br />
• Es soll den guten K<strong>und</strong>en einen nützlichen Dienst erweisen (Briefbeschwerer)<br />
• Es soll als Werbegeschenk auf die Firma hinweisen (Das „Spieleparadies“, Spiele für<br />
große <strong>und</strong> kleine Menschen) <strong>und</strong> den/die Betrachter/in dazu motivieren, mit der Firma auch<br />
weiterhin Geschäfte abzuschließen.<br />
So überlegt sich der Konstrukteur bzw. die Konstrukteurin das gezeichnete Bauteil: Würfel auf<br />
Gr<strong>und</strong>platte. In die Stückliste werden drei Teile aufgenommen:<br />
Position Menge Einheit Benennung Rohmaß Halbzeug / Norm Werkstoff<br />
3 1 Stück Zylinderschraube<br />
DIN EN ISO 4762 M5x15 –<br />
8.8<br />
Ersatz für DIN 912<br />
2 1 Stück Würfel 30x30x30 DIN EN 7544 10mm,<br />
gezogene Aluminium Vierkantstangen<br />
1 1 Stück Würfelplatte,<br />
Gr<strong>und</strong>platte<br />
81x81x10<br />
Ersatz für DIN 1798<br />
DIN EN 485, 10mm AlMg3<br />
nichtrostender<br />
Stahl A270<br />
AlMg3<br />
Für jede Position ist eine Zeichnung anzufertigen, ausgenommen sind die Normteile. Die Normteile<br />
sind im Tabellenbuch nachzuschlagen, die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erstellen die Zeichnung der<br />
Gr<strong>und</strong>platte sowie den <strong>Arbeit</strong>splan dafür. Im Unterrichtsgespräch wird auf den Zus<strong>am</strong>menhang<br />
zwischen <strong>Arbeit</strong>splan, Zeichnung <strong>und</strong> Stückliste hingewiesen. Der erste Versuch einer Darstellung<br />
in zwei Ansichten wird vorgenommen.<br />
In der nächsten Woche wird eine erste Klassenarbeit geschrieben <strong>und</strong> gezeichnet.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 29<br />
4.8 Einheit: Hinweise zur Erstellung von <strong>Arbeit</strong>smappen<br />
Im Anschluss an die gr<strong>und</strong>sätzliche Bestimmung der Begrifflichkeiten Zeichnung, <strong>Arbeit</strong>splan <strong>und</strong> Stückliste<br />
sollen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen jetzt ihr erstes Projekt bearbeiten. Dazu erhalten sie die folgenden<br />
Hinweise:<br />
1. Mappe<br />
• Es sollte sich um eine neue Mappe mit einwandfreien Seiten handeln.<br />
• Einsteckfolien in der Mappe sind nicht erforderlich, sondern eher hinderlich.<br />
2. Deckblatt<br />
• Auf einem Deckblatt sollen die wesentlichen Informationen über den Inhalt einer<br />
Mappe stehen, also zum Beispiel „Herstellung <strong>und</strong> Bedeutung eines N<strong>am</strong>enschilds“.<br />
Die Form sollte ansprechend sein für den K<strong>und</strong>en, der die Anfrage gestellt hat.<br />
• Das Deckblatt sollte den N<strong>am</strong>en der Herstellerfirma (= des Schülers/der Schülerin)<br />
tragen sowie<br />
• das Datum der Erstellung.<br />
3. Aufgabenstellung (wird in der Regel von der Lehrkraft ausgegeben!)<br />
• Beschreibung der Aufgabe<br />
• Was soll…<br />
• Wie soll…<br />
• Wann soll…<br />
• Wo soll…<br />
• Wer soll…<br />
4. Inhaltsverzeichnis<br />
• Das zweite Blatt soll die Inhaltsangabe für die Mappe erhalten, mit Seitenzahlen.<br />
• Hier können auch eventuell weiterführende Hinweise gegeben werden, z. B. auf benutzte<br />
Nachschlagewerke <strong>und</strong> Fachbücher.<br />
5. Zeichnungen<br />
• Die Zeichnungen sollen aus einer Ges<strong>am</strong>tzeichnung <strong>und</strong> den Einzelteilzeichnungen<br />
bestehen.<br />
• Die Positionen sollen mit der Stückliste übereinstimmen.<br />
6. Stückliste<br />
• In der Stückliste sollten die Positionen wieder auftauchen, die auch in der Zeichnung<br />
benutzt werden.<br />
• Die Positionen erhalten einen N<strong>am</strong>en (Benennung), eine DIN, die Menge oder die<br />
Maße<br />
7. <strong>Arbeit</strong>splan<br />
• Der <strong>Arbeit</strong>splan wird wie ein Inhaltsverzeichnis angelegt in 3 Spalten:<br />
• Spalte 1: <strong>Arbeit</strong>sgangsnummer (eine Positionsnummer).<br />
• Spalte 2: <strong>Arbeit</strong>sgang, was zu tun ist.<br />
• Spalte 3: Werkzeuge <strong>und</strong> Vorrichtungen, die benötigt werden <strong>und</strong> eventuelle weitere<br />
Hinweise.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
30 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
8. Werkzeugliste<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Werkzeuge aufgeführt sein<br />
(H<strong>am</strong>mer, Meißel, Schraubendreher, ...)<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Hilfsmittel aufgeführt sein<br />
(Leiter, Gerüst, Öl, Fett, ...)<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Messzeuge aufgeführt sein<br />
(Gliedermaßstab, Stahlmaß, Messschieber, ...)<br />
9. Berechnungen<br />
• Berechnungen müssen nachvollziehbar sein, Gewichte können eventuell in der<br />
Stückliste eingetragen werden.<br />
• Es wird empfohlen, die Mappe handschriftlich zu erstellen. Die Mappe mit dem<br />
Computer zu erstellen, könnte nur Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler empfohlen werden, die<br />
bereits über erweiterte Computerkenntnisse verfügen.<br />
10. Informationen<br />
• Sollen zu einzelnen Fragen Texte erstellt werden (z. B. zum Korrosionsverhalten, zur<br />
Materialauswahl, zur Stabilität ...), so sollen diese übersichtlich <strong>und</strong> in einfachem<br />
Deutsch geschrieben werden, sodass ein Laie es verstehen kann.<br />
• Wenn der K<strong>und</strong>e oder die K<strong>und</strong>in Vorgaben genannt hat, wie das Bauteil aussehen<br />
soll, sollte begründet werden, warum von diesen Vorgaben abgewichen wurde.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen im Rahmen dieser ersten Übung einer Projektmappenerstellung<br />
die verschiedenen, bisher erarbeiteten Elemente technischer <strong>Kommunikation</strong> anwenden:<br />
• Zeichnung<br />
• Stückliste<br />
• <strong>Arbeit</strong>splan<br />
• Berechnung<br />
• Textbearbeitung<br />
Beim ersten Projekt handelt es sich um ein kleines Produkt, ein N<strong>am</strong>ensschild. In der Umsetzung<br />
sollen die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler entlang der folgenden Aufgabenstellung vorgehen (Projekt 1).<br />
Die Aufgabe darf in Te<strong>am</strong>arbeit erstellt werden <strong>und</strong> wird in der nächsten Unterrichtsst<strong>und</strong>e ausführlich<br />
gemeins<strong>am</strong> besprochen <strong>und</strong> mit einem Kurztest zu dem N<strong>am</strong>ensschild kontrolliert. Dies<br />
dient dazu zu erkennen, wer von den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen tatsächlich die Aufgabe zu Hause<br />
bearbeitet hat. Die Punkte hinter den Aufgaben geben an, welche Frage wie viele Punkte gibt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 31<br />
Projekt 1: N<strong>am</strong>ensschild planen <strong>und</strong> anfertigen<br />
Hintergr<strong>und</strong>:<br />
„Am 5. August 20xx sind Sie an Ihrem neuen <strong>Arbeit</strong>splatz angekommen <strong>und</strong> jetzt mit Kollegen zus<strong>am</strong>men,<br />
die Sie nicht kennen. Es ist unhöflich einen fremden Menschen mit „Hallo, du da …!“<br />
anzusprechen; man selbst möchte auch nicht so angesprochen werden. Aus diesem Gr<strong>und</strong> benötigen<br />
Sie ein N<strong>am</strong>ensschild für Ihren <strong>Arbeit</strong>sanzug, für Ihren Pullover oder Hemd“.<br />
Die Vorgabe vom Auftraggeber ist, dass das Schild für Ihren <strong>Arbeit</strong>sanzug aus Metall bestehen soll.<br />
Aufgabe: Fertigen Sie eine Projektmappe (DIN A4) an<br />
31. Ein selbst gestaltetes Deckblatt. (Bilder, Skizzen, etc.) 5P<br />
32. Ein Inhaltsverzeichnis (zum Schluss anfertigen). 5P<br />
33. Überlegen Sie <strong>und</strong> schreiben auf, welche Aufgaben N<strong>am</strong>ensschilder haben.<br />
Was verbinden sie d<strong>am</strong>it, wenn Menschen ein N<strong>am</strong>ensschild tragen? (Text) 5P<br />
34. Erstellen Sie eine Skizze für Ihren Entwurf mit Größenangaben. (Zeichnung) 10P<br />
35. Erstellen Sie eine Stückliste für die Materialien, die Sie benötigen.<br />
(Position, N<strong>am</strong>e, Werkstoff, Norm, Rohmaße …) 10P<br />
36. Überlegen <strong>und</strong> begründen Sie, wie Sie die Befestigung vornehmen können.<br />
(Text, mehr als eine Möglichkeit) 10P<br />
37. Erstellen Sie einen <strong>Arbeit</strong>splan. (<strong>Arbeit</strong>sgang, N<strong>am</strong>e, Werkzeuge) 20P<br />
38. Stellen Sie eine Liste mit Werkzeugen zus<strong>am</strong>men, die Sie benötigen. (Werkzeugliste) 5P<br />
39. Welches Material wollen Sie einsetzen <strong>und</strong> warum nicht ein anderes? (Werkstoffk<strong>und</strong>e) 10P<br />
40. Wie schwer ist das N<strong>am</strong>ensschild aus Aluminium? (Fertige Form, Rechenübung) 10P<br />
41. Welche Gefahren können bei der Herstellung auftreten? (Unfallverhütung) 5P<br />
42. Erklärung von Ihnen, woher Sie Ihre Informationen haben, <strong>und</strong> ihre Unterschrift, dass Sie<br />
die Mappe eigenständig angefertigt haben. (Text) 5P<br />
43. Ihre Meinung zu dieser Art des Unterrichts (positiv oder negativ die schriftliche<br />
Antwort geht nicht in die Bewertung ein). 0P<br />
Ges<strong>am</strong>t 100 Punkte<br />
Abgabe: Mittwoch, 29.09.20xx<br />
Viel Erfolg<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
32 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.9 Einheit: Geometrische Gr<strong>und</strong>konstruktionen<br />
Der Übergang von geraden zu gebogenen <strong>und</strong> r<strong>und</strong>en Werkstücken erfordert, den Umgang mit dem<br />
Zirkel zu üben <strong>und</strong> verschiedene Gr<strong>und</strong>konstruktionen einzuüben. Diese Konstruktionen werden<br />
von den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen auf Papierbogen übertragen.<br />
Folgende Gr<strong>und</strong>konstruktionen werden vermittelt:<br />
Parallelverschiebung<br />
Teilen einer Strecke<br />
Teilen einer Strecke in Anzahl bestimmter Teile<br />
1. Parallelverschiebung<br />
2. Teilen einer Strecke<br />
3. Kreisteilung<br />
4. Winkelteilung<br />
Teilen eines Winkels<br />
Herstellung eines Sechs <strong>und</strong> Zwölfecks<br />
R<strong>und</strong>ung an einen Winkel<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 33<br />
5. R<strong>und</strong>ung an einen Winkel, ohne dass<br />
eine Kante entsteht.<br />
Hierbei wird das Wort „straken“<br />
eingeführt, womit der kantenlose<br />
Übergang von einer Linie in einen<br />
Radius gemeint ist.<br />
Straken müssen vor allem Schiffsrümpfe,<br />
d<strong>am</strong>it der Widerstand im<br />
Wasser möglichst gering ist.<br />
6. Abwicklung eines Würfels:<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
34 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.10 Einheit: Zeichnen von Werkstücken mit R<strong>und</strong>ungen<br />
Zur Vertiefung der <strong>Arbeit</strong> mit dem Zirkel sollen wenigstens zwei Werkstücke mit R<strong>und</strong>ungen gezeichnet<br />
werden.<br />
Das erste Teil ist eine reine Zeichenübung. Dabei wird die Tabellenbucharbeit <strong>und</strong><br />
„Katalogarbeit“ 15 wieder aufgenommen. Außerdem wird auf die Bezeichnung M5 <strong>und</strong> auf die<br />
Regeln beim Schneiden von Gewinden eingegangen. Erklärt werden die folgenden Begriffe, die<br />
beim Gewindeschneiden wichtig sind:<br />
• Steigung<br />
Achtung: Zeichnung<br />
nicht maßstäblich<br />
R 40<br />
30<br />
• Kernlochdurchmesser<br />
• Schlüsselweite<br />
• Schneideisen<br />
• Schnittgeschwindigkeit<br />
• Windeisen<br />
R 20<br />
100<br />
t = 10<br />
15 Katalogarbeit ist gleichbedeutend mit dem Nachschlagen von Werkzeugen in Lieferantenkatalogen.<br />
70<br />
R 20<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)<br />
40<br />
R 30<br />
120<br />
Zeichne das<br />
Formstück im<br />
Maßstab 1:1
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 35<br />
• Schneideisenhalter<br />
• Gewindebohrer werden erläutert.<br />
Das zweite Teil gehört zum Projekt Maschinenschraubstock, der später im Unterricht geplant <strong>und</strong> in<br />
der Werkstatt erstellt wird. Der Unterricht bezieht sich daher immer wieder auf die Tätigkeiten an<br />
diesem Maschinenschraubstock. An dieser Stelle wird insbesondere auf bestimmte Bemaßungsregeln<br />
hingewiesen (Allgemeintoleranzen, H7) <strong>und</strong> das Werkzeug Reibahle erläutert.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
36 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.11 Einheit: Bedeutung von Toleranzen, Fachbegriffe<br />
Beginn mit einer Wiederholung:<br />
Aus dem Zeichnen des zweiten Teils in Einheit 10 ergeben sich allgemeine Fragen zu Eintragungen<br />
in Zeichnungen. Diese werden hier bearbeitet. Mithilfe des Tabellenbuchs wird das <strong>Arbeit</strong>en mit<br />
Normen <strong>und</strong> dem Tabellenbuch erneut aufgegriffen <strong>und</strong> der Umgang mit den Begriffen<br />
vertieft.<br />
• Toleranz<br />
• Allgemeintoleranzen<br />
• Höchstmaß<br />
• Nennmaß<br />
• Mindestmaß<br />
• Abmaß<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 37<br />
Fragen der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, zu denen diese ermutigt werden, decken nicht selten auf, dass<br />
es den ihnen noch schwerfällt, die eingesetzten Bücher zweckmäßig zu nutzen <strong>und</strong> sich die<br />
Informationen zu beschaffen, die sie für ihre <strong>Arbeit</strong> an den Projekten <strong>und</strong> ihren Lernfortschritt benötigen.<br />
Ein (Fach)Buch wird oft noch nicht als Hilfsmittel <strong>und</strong> Informationsquelle verstanden. Es<br />
ergibt sich daher die Notwendigkeit, bei Bedarf weitere wiederholende Sequenzen in den Unterricht<br />
einzufügen. Dies erfordert eine sehr flexible Zeitplanung der Einheiten.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
38 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.12 Einheit: Zeichnen von ersten Körpern in drei Ansichten – Übungen zum räumlichen<br />
Sehen<br />
Beispielhaft ist hier ein Auszug aus einem <strong>Arbeit</strong>sblatt mit Aufgaben gezeigt, mit denen die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen zum räumlichen Denken angeregt werden sollen. Die Aufgaben auf den nächsten<br />
Seiten gehen von Körpern aus, die die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen in die Hand nehmen können <strong>und</strong><br />
dann abzeichnen sollen. Anhand dieser Aufgabe soll das Verhältnis von Vorderansicht, Seitenansicht<br />
<strong>und</strong> Draufsicht vermittelt werden.<br />
Schiff:<br />
Im ersten Schritt muss den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen vermittelt werden, dass es keine Möglichkeit<br />
gibt, <strong>am</strong> Körper selbst zu entscheiden, welche Ansicht eines Körpers als seine Vorderansicht bezeichnet<br />
wird.<br />
Das „Schiff“ (s.o.) eignet sich gut, dies zu verdeutlichen. In „provokativer“ Absicht versieht die<br />
Lehrkraft diejenige Ansicht mit dem Titel Vorderansicht, die im Alltagsverständnis in Bezug auf<br />
richtige Schiffe üblicherweise die Seitenansicht ist, was zur Folge hat, dass die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen protestieren. Bei der technischen Zeichnung eines Körpers handelt es sich aber nur um<br />
eine reine Festlegung, um ein Übereinkommen / Konvention. Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen be<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 39<br />
greifen hier die Bedeutung von Konventionen <strong>und</strong> Normen als wesentliche Elemente von<br />
(technischer) <strong>Kommunikation</strong>.<br />
Körper1: Körper 1 an der Tafel:<br />
Körper 2: Körper3:<br />
Nach dieser Hinführung wird anhand von Körper 1 die sogenannte „Dreitafelprojektion“ erläutert.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen zeichnen im Anschluss die Körper 1 3. Auch die zusätzlichen Ansichten<br />
wie Rückansicht <strong>und</strong> Unteransicht werden thematisiert.<br />
Die Unterschiede zwischen europäischer <strong>und</strong> <strong>am</strong>erikanischer Projektionsart werden angesprochen<br />
<strong>und</strong> vertiefen das zur Bedeutung von Konventionen in der <strong>Kommunikation</strong> gesagte.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
40 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.13 Einheit: Weitere Zeichnungen in drei Ansichten, Tabellenbucharbeit, Wiederholungen<br />
Vorbereitung auf 2. Klassenarbeit<br />
In der folgenden St<strong>und</strong>e: Klassenarbeit zu den behandelten Themen.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 41<br />
Klassenarbeit<br />
Lernfeld 1 Fertigung, <strong>Lernbaustein</strong> technische <strong>Kommunikation</strong><br />
N<strong>am</strong>e:<br />
Zugelassene Hilfsmittel: Tabellenbuch, Taschenrechner<br />
Erreichbare Punktzahl: 114 (+5) Punkte; 57 Punkte ausreichend<br />
Fertigungstechnik<br />
1. Wir haben in den letzten Wochen unter anderem auch <strong>Arbeit</strong>spläne erstellt. Welche<br />
drei Spalten sind in einem <strong>Arbeit</strong>splan mindestens erforderlich? Schreiben Sie die<br />
die Überschriften auf. 6P<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
2. Schreiben Sie nun einen <strong>Arbeit</strong>splan für das Bohren einer Bohrung Durchmesser<br />
8mm in ein Stück Flachstahl. Denken Sie genau darüber nach, welche Tätigkeiten mit<br />
welchen Vorrichtungen <strong>und</strong> Hilfsmitteln von Ihnen erledigt wurden. 30P<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
42 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
3. Erklären Sie die Begriffe: 9P<br />
1. spitzer Winkel:<br />
2. rechter Winkel:<br />
3. stumpfer Winkel:<br />
4. Was verstehen Sie unter einer Maßbezugskante: 6P<br />
5. Was verstehen Sie im Zus<strong>am</strong>menhang mit Gewinde unter den Begriffen: 9P<br />
• Steigung:<br />
• Kernlochdurchmesser:<br />
• Schlüsselweite:<br />
6. Wie heißen die vier folgenden Gegenstände, die Sie auf den zwei Bildern sehen? 12P<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
7. Auf welche drei Punkte müssen Sie beim Zeichnen von Mittellinien achten: 9P<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 43<br />
8. Was verstehen Sie unter folgenden vier Begriffen: 12P<br />
1. Nennmaß:<br />
2. Allgemeintoleranz:<br />
3. Abmaß:<br />
4. Istmaß:<br />
9. Welche Steigung hat das Gewinde M36? 3P<br />
10. Welchen Längenausdehnungskoeffizienten hat Stahl? (mit Einheit) 3P<br />
11. Welche Dichte hat Aluminium? (mit Einheit) 3P<br />
12. Unten sehen Sie sechs Schrägbilder. Ordnen Sie den Schrägbildern jeweils die<br />
Vorderansicht <strong>und</strong> die Seitenansicht zu! 12P<br />
Schrägbild a b c d e f<br />
Vorderansicht<br />
Seitenansicht<br />
Hier 6 Schrägbilder (af) mit Vorder <strong>und</strong> Seitenansichten (16) einfügen.<br />
Zusatz: Was war <strong>am</strong> 28.12.1979 in Lübeck, als eine Frau mit langen blonden Haaren in<br />
einem weißen Kleid mit einem Schornsteinfeger im Schnee tanzte? 5P<br />
Fach<br />
Fertigungstechnik, <strong>Lernbaustein</strong><br />
technische <strong>Kommunikation</strong><br />
Erreichbare<br />
Punktzahl<br />
114+5<br />
Erreichte Punktzahl<br />
Prozentsatz Note<br />
Prozentzahl Note Prozentzahl Note Prozentzahl Note<br />
0 < 30 6 50 < 67 4 81 < 92 2<br />
30 < 50 5 67 < 81 3 ≥ 92 1<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
44 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.14 Einheit: Weitere Zeichnungen in drei Ansichten<br />
Nach dem Zeichnen anhand von Körpern, die die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen in die Hand nehmen<br />
können, sollen im nächsten Schritt Zeichnungen in drei Ansichten erstellt werden, von denen<br />
jeweils zwei Ansichten gegeben sind. Von diesen liegt jedoch nur eine Papiervorlage vor. Aus<br />
dieser soll die dritte Ansicht abgeleitet werden. (In Beispiel 2 sollen aus dem Schrägbild drei Ansichten<br />
erstellt werden.)<br />
Beispiel 1 Beispiel 2<br />
Beispiel 3<br />
Beispiel 4<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 45<br />
4.15 Einheit: Projekt 2: Besprechung des Projekts Maschinenschraubstock<br />
Der Maschinenschraubstock wurde bzw. wird von den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen in der Metallwerkstatt<br />
selbstständig gefertigt. Es beinhaltet den Übergang zu einem Produkt, das aus mehreren<br />
Einzelteilen erstellt wird. Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen werden mit einer Zus<strong>am</strong>menbauzeichnung<br />
<strong>und</strong> mit Einzelteilzeichnungen ausgestattet, anhand derer sie die Projektaufgabe lösen können.<br />
Somit erleben sie im Unterricht einen (fast) kompletten Planungsablauf; sie befassen sich mit:<br />
• Zeichnung<br />
• <strong>Technische</strong> Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
• Berechnungen<br />
• Erzeugen des Produkts<br />
• (Eventuell): Optimierung des Produkts.<br />
In der Begleitung des Projekts, das sich über mehrere Wochen hinziehen wird, werden die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen die Zus<strong>am</strong>menhänge zwischen Theorie <strong>und</strong> Praxis, zwischen Planung <strong>und</strong><br />
Zeichnung, zwischen Einzelteil <strong>und</strong> Zus<strong>am</strong>menbauzeichnung noch einmal vor Augen geführt.<br />
Auch die Tabellenbucharbeit wird im Zus<strong>am</strong>menhang mit den gestellten Aufgaben eine Rolle<br />
spielen. Die Schnittdarstellungen werden im weiteren Verlauf in ihrer Bedeutung bzw. Funktion<br />
erklärt.<br />
Das erworbene Wissen über die verschiedenen Seiten <strong>und</strong> Aspekte der technischen <strong>Kommunikation</strong><br />
wird Schritt für Schritt in einen systematischen Zus<strong>am</strong>menhang überführt <strong>und</strong> ein zentraler Anspruch<br />
des <strong>Lernbaustein</strong>s eingelöst. Indem die zuvor „isoliert“ nebeneinanderstehenden (An)Teile<br />
technischer <strong>Kommunikation</strong> prozessual miteinander verknüpft werden, erhalten die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen einen zunehmenden Ein <strong>und</strong> Überblick über das betriebliche Geschehen.<br />
In der Phase, in der die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler ihre Projektmappen erarbeiten, kann die Lehrkraft<br />
erneut auf die Schwierigkeiten der einzelnen Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen eingehen <strong>und</strong> versuchen,<br />
individuelle Wissenslücken zu schließen.<br />
Der zum Projekt gehörende Zeichnungssatz findet sich im Materialanhang (Anhang 3).<br />
Im Anschluss an die Fertigstellung der Projektmappe, die wie eine Klassenarbeit gewertet wird,<br />
schreiben die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen eine Klassenarbeit, in der die Erreichung der Einzelkompetenzen<br />
überprüft wird (vgl. Anhang 4 – die <strong>Arbeit</strong> wird mit Lösungen dargestellt).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
46 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Projekt: Herstellung eines Maschinenschraubstocks<br />
(Lernfeld 1 + 2 + 3: Fertigung <strong>und</strong> Montage)<br />
Hintergr<strong>und</strong>:<br />
„Für Ihre Tätigkeit in der Werkstatt benötigen Sie einen Maschinenschraubstock, d<strong>am</strong>it Sie die<br />
Einzelteile unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften herstellen können. Der Zeichnungssatz<br />
mit fünf Blättern ist Bestandteil der Aufgabe. Sollten Sie bei der Fertigung Veränderungen in<br />
der Ausführung vornehmen, ist dies gestattet <strong>und</strong> gewünscht, solange die Funktion des Schraubstocks<br />
gewährleistet bleibt.“<br />
Achtung: Die in den Zeichnungen angegebene Werkstoffbezeichnung <strong>und</strong> die Normen sind teilweise<br />
veraltete Bezeichnungen. Erk<strong>und</strong>en Sie die neuen Bezeichnungen!<br />
Aufgabe: Fertigen Sie eine Projektmappe (DIN A4) an<br />
1. Ein selbst gestaltetes Deckblatt 5 P<br />
2. Ein Inhaltsverzeichnis 5 P<br />
3. Erstellen Sie die Stückliste für das Material, das Sie benötigen 15 P<br />
4. Erstellen Sie eine normgerechte Zeichnung der Gr<strong>und</strong>platte mit Maßangaben<br />
in drei Ansichten 20 P<br />
5. Erstellen Sie eine Liste mit Werkzeugen, die Sie zur Fertigung des<br />
Maschinenschraubstocks benötigen, inklusive Anreißzeuge 5 P<br />
6. Erstellen Sie eine Liste mit Messzeugen, die Sie für die Herstellung <strong>und</strong> Kontrolle<br />
benötigen, aufgeteilt nach Messzeugen <strong>und</strong> Lehren 5 P<br />
7. Erstellen Sie <strong>Arbeit</strong>spläne für folgende Einzelteile: Teil 1, 2, 3, 5 40 P<br />
8. Berechnen Sie die Masse der in der Stückliste angegebenen Fertigteile (ρ=7,85kg/dm³),<br />
Bohrungen, Radien <strong>und</strong> Nuten bleiben unberücksichtigt 10 P<br />
9. Wenn ein kg Stahl 1,20€/kg kostet, was kosten die Werkstücke dann insges<strong>am</strong>t?<br />
Rechnen Sie 25% Verschnitt dazu!!! 10 P<br />
10. Zum Bohren setzen Sie einen Bohrer aus Schnellarbeitsstahl ein. In einer Tabelle im<br />
Tabellenbuch finden Sie die Schnittgeschwindigkeit vc in m/min.<br />
Wie groß sind die maximalen Drehzahlen der Bohrer einzustellen für die zu bohrenden<br />
Bohrungsdurchmesser von 13mm, 9mm, 7,0mm, 6,5mm, 6,0mm, 5,0mm? 10 P<br />
11. Sie müssen Gewinde schneiden: M16, M5, M6. Mit welchen Bohrern müssen Sie vorbohren?<br />
10 P<br />
12. Wie ist der <strong>Arbeit</strong>sablauf beim Gewindeschneiden? Erstellen Sie einen <strong>Arbeit</strong>splan. 10 P<br />
13. Welche Unfallgefahren sollen mit der Verwendung eines Maschinenschraubstocks<br />
reduziert werden? 10 P<br />
14. Welche Gefahren können bei der Herstellung des Maschinenschraubstocks auftreten? 10 P<br />
15. Wie kann die Gefahr des Verrostens reduziert werden? Nennen <strong>und</strong> beschreiben Sie<br />
Methoden des Korrosionsschutzes. 10 P<br />
16. Welche Methoden zur Verbindung von Werkstücken werden bei dem Maschinenschraubstock<br />
angewandt? Nennen Sie weitere zwei mit deren Vor <strong>und</strong> Nachteilen. 20 P<br />
17. Erklärung von Ihnen, woher Ihre Informationen st<strong>am</strong>men.<br />
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Mappe eigenständig angefertigt haben. 5 P<br />
Ges<strong>am</strong>tzahl: 200 Punkte<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 47<br />
4.16 Einheit: Schnittdarstellungen<br />
In der jetzt folgenden Einheit beschäftigen sich die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen weiter mit dem<br />
Thema der „DreiTafelProjektion“, es kommt jedoch eine neue Sichtweise hinzu: die Schnittdarstellung.<br />
Bei der Schnittdarstellung wird ein vorhandenes Werkstück gedanklich so geschnitten, dass die<br />
Vorstellung, wie das Werkstück aussieht, besser verdeutlicht werden kann (siehe die zwei Beispiele<br />
auf dieser Seite 16 ):<br />
Beide Teile lassen von außen nicht erkennen, wie ihr „Innenleben“ aussieht. Zwar ist die<br />
zeichnerische Darstellung mit unsichtbaren Kanten machbar, klarer ist jedoch eine Schnittdarstellung.<br />
Beim „Zeichnen im Schnitt“ sind einige Bedingungen zu beachten, die sich die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen notieren sollten:<br />
• Schnittlinien sind schmale Volllinien (wie auch Maßlinien <strong>und</strong> Maßhilfslinien).<br />
• Schnittlinien sind im gleichen Abstand zu zeichnen.<br />
16 Bilder von D. Jacobs<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
48 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
• Schnitte sind nur da zu schraffieren, wo ein Messer oder eine Säge die Köpert tatsächlich<br />
zerschneiden würde.<br />
• In Schnittzeichnungen sind möglichst keine unsichtbaren Kanten zu zeichnen.<br />
• Die Schraffur läuft (in der Regel) unter 45°.<br />
• Schraffuren enden immer in einer breiten Volllinie.<br />
• Großflächige Schnitte erhalten Schraffuren mit einem größeren Abstand als kleine Schnittflächen.<br />
• Schmale Flächen können geschwärzt werden.<br />
• Normteile wie Schrauben <strong>und</strong> Stifte werden nicht geschnitten.<br />
• In Zus<strong>am</strong>menbauzeichnungen erhält jedes der Teile eine eigene Schraffur.<br />
• Geschnittene Ansichten werden möglichst nicht bemaßt.<br />
Vollschnitt<br />
In der nebenstehenden Zeichnung wurde versucht,<br />
die Schraffur regelgerecht anzudeuten. Es<br />
handelt sich um das zweite oben fotografisch<br />
dargestellte Werkstück.<br />
Halbschnitt oder Teilschnitt<br />
Beim Halbschnitt wird nur eine Seite im Schnitt<br />
gezeichnet. Die andere Seite wird in einer<br />
normalen Ansicht dargestellt, jedoch ohne unsichtbare<br />
Linien.<br />
Bei einem Teilschnitt werden nur einzelne Bereiche<br />
eines Körpers im Schnitt dargestellt, um<br />
die Lesbarkeit der Zeichnung zu vereinfachen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erkennen, dass<br />
die Verständlichkeit einer Zeichnung mit<br />
Schnittdarstellungen verbessert werden kann.<br />
Allerdings ist die Anzahl der hierbei einzuhaltenden Regeln wesentlich größer als bei einer<br />
„normalen“ Zeichnung in drei Ansichten.<br />
Im Unterrichtsprozess werden anhand von Modellen <strong>und</strong> Zeichnungsvorlagen diese Regeln eingeübt.<br />
Parallel werden diese Zeichnungen auch <strong>am</strong> PC im technischen Informatikunterricht erstellt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 49<br />
4.17 Einheit: Wahre Größen<br />
<strong>Technische</strong> Zeichnungen sind rechtwinklige Parallelprojektionen. In der Projektion erscheinen<br />
Längen, die nicht in den Ebenen liegen, daher verkürzt.<br />
Vorderansicht Seitenansicht<br />
Wahre Größe der<br />
Fläche mit den<br />
Pfeilen, senkrechter<br />
Blick auf die Fläche<br />
In dieser Einheit geht es darum, den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen klar zu machen, dass in einer<br />
Zeichnung manchmal die tatsächlichen = wahren Größen nur dann zu ermitteln sind, wenn spezielle<br />
Zeichenverfahren angewendet werden. In diesem Fall kommen die geometrischen Gr<strong>und</strong>konstruktionen<br />
aus den früheren Einheiten wieder zum Tragen. Durch Hilfskonstruktionen in<br />
mehreren Ansichten kann die tatsächliche Größe ermittelt werden.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen werden in mehreren Übungen an diese Problematik herangeführt.<br />
Dabei geht es um Linien <strong>und</strong> Punkte im Raum.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
50 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
4.18 Einheit: Planung <strong>und</strong> Umsetzung eines Projekts für einen Mitschüler<br />
In einem alle bisherigen Lernschritte resümierenden Lehrervortrag werden die Zus<strong>am</strong>menhänge von<br />
<strong>Arbeit</strong>splan, Zeichnung <strong>und</strong> Stückliste noch einmal in den Mittelpunkt gestellt. Entscheidend ist<br />
dabei, dass die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erkennen, dass durch die auf diesen Positionen basierende<br />
Konstruktion eines Bauteils auch die Kosten seiner Fertigung bestimmt. Werden in der Abfolge<br />
dieser <strong>Arbeit</strong>sschritte Fehler begangen <strong>und</strong> nicht beseitigt, kann dies schlimmstenfalls zum Ausschuss<br />
führen – ein kostspieliger Fehler.<br />
Den Abschluss des <strong>Lernbaustein</strong>s <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> bildet die Aufgabe für die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, ein Bauteil zu konstruieren, zu zeichnen <strong>und</strong> das Ergebnis ihrer <strong>Arbeit</strong> an<br />
einen Mitschüler zu übergeben, der es nach den Vorgaben fertigt.<br />
Als Vorgabe erhalten die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen eine entsprechende Aufgabe (siehe Beispiel in<br />
Anhang 5).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 51<br />
Schlussbetrachtung<br />
Der <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> setzt in der Berufsvorbereitung an <strong>und</strong> dient zugleich<br />
einer vertieften Berufsorientierung. Welcher der Metallberufe der richtige für jeden Einzelnen/jede<br />
Einzelne ist, hängt u. a. von den Eigenschaften <strong>und</strong> Anforderungen ab, die in jedem der folgenden<br />
Berufsausbildungen <strong>und</strong> Berufe verlangt werden: als Konstruktions oder Industriemechaniker/in<br />
oder als Zerspanungs oder Werkzeugmechaniker/in 17 .<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage der im <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong>n <strong>Kommunikation</strong> erfolgten praktischen <strong>und</strong><br />
theoretischen Heranführung an die Anforderungen der Berufe im Bereich der Metall <strong>und</strong> Fahrzeugtechnik<br />
sollten die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler für sich entscheiden können, ob ein Beruf im<br />
Berufsfeld Metall für sie in Betracht kommt oder ob sie diese Perspektive aus Gründen, nach denen<br />
zu fragen wäre, verneinen.<br />
Dabei ist im speziellen Fall eines nur partiellen Interesses die Möglichkeit zu beachten, ob sie für<br />
den Beruf des technischen Zeichners bzw. der technischen Zeichnerin geeignet sind. Genauigkeit<br />
<strong>und</strong> Sauberkeit sind unabdingbare für eine erfolgreiche Ausbildung <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong> insbesondere in<br />
diesem Beruf. Wie wichtig diese Anforderungen sind, sollte den Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler gerade<br />
in der letzten Einheit bewusst geworden sein.<br />
Unabhängig von seinen berufsausbildungsvorbereitenden <strong>und</strong> berufsorientierenden Funktionen<br />
versteht sich der <strong>Lernbaustein</strong> jedoch auch als Beitrag zur Allgemeinbildung für diejenigen<br />
Jugendlichen, die möglicherweise ihre Perspektive doch in einem ganz anderen Berufsfeld suchen<br />
wollen: ihnen wurden gr<strong>und</strong>legende technische <strong>und</strong> betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt.<br />
Denn das zu Beginn dargestellte Säulenmodell lässt sich auch <strong>und</strong> gerade in der Form lesen <strong>und</strong><br />
interpretieren, dass ohne (technische) <strong>Kommunikation</strong> <strong>Arbeit</strong>en in einer hoch spezialisierten,<br />
arbeitsteiligen Welt nicht möglich ist.<br />
17 Hier wurden exemplarisch nur die Industrieberufe benannt.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 52<br />
5 Übersicht über die curriculare Durchführung / <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
LE Ziele / Inhalte 18 Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
1 Hinführung zum Thema – was bedeutet technische <strong>Kommunikation</strong>?<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• worauf <strong>Kommunikation</strong> basiert,<br />
• welche Interaktionsformen von<br />
<strong>Kommunikation</strong> bestehen;<br />
• die Begriffe SenderEmpfänger kennen <strong>und</strong><br />
erfassen die Bedeutung von technischer<br />
<strong>Kommunikation</strong> ebenso wie die Darstellungsweise<br />
von technischen Zeichnungen<br />
als Ausdruck einer allgemeinen (universellen)<br />
Sprache;<br />
• die Vielfalt von <strong>Kommunikation</strong>smitteln <strong>und</strong><br />
methoden <strong>und</strong> ihren zweckmäßigen, sachgerechten<br />
Einsatz kennen;<br />
• dass der Anfertigung technischer<br />
Zeichnungen genaue, universell geltende<br />
Regeln zugr<strong>und</strong>e liegen;<br />
• die Bedeutung von Maßen, Maßeinheiten,<br />
Maßstäben kennen;<br />
• die drei Dimensionen Länge, Fläche <strong>und</strong><br />
Raum grafisch darzustellen;<br />
• die den drei Dimensionen zugehörigen Maße<br />
<strong>und</strong> Maßeinheiten umzurechnen.<br />
A. Zu den <strong>Kommunikation</strong>smitteln zählen<br />
a) Zeichnungen, denen Zeichenregeln zugr<strong>und</strong>e<br />
liegen; Zeichnungen lesen zu lernen ist eine<br />
Methode, selbst Zeichnungen erstellen <strong>und</strong><br />
erklären zu können;<br />
b) das Telefon als sprachliches Medium;<br />
c) das Internet, was das Lesen <strong>und</strong> Schreiben<br />
von Informationen ermöglicht;<br />
d) Tabellen, basierend auf der Anordnung von<br />
Zahlen.<br />
B. Skizzierübungen<br />
Geübt wird das Zeichnen einer geraden Linie, einer<br />
Wellenlinie <strong>und</strong> einer Schnecke mit traditionellen<br />
Zeichenwerkzeugen <strong>und</strong> Hilfsmitteln.<br />
Visuelle <strong>und</strong> feinmotorische Kompetenzen der<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler werden verbessert,<br />
wenn/wo nur rudimentär vorhanden.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Bleistifte unterschiedlicher Härte (3B, HB, 3H)<br />
Lineal<br />
Zirkel<br />
Dreiecke<br />
Zeichenplatte<br />
Diverse Hilfsmittel<br />
(Radiergummi, Anspitzer, Handfeger)<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Tabellenbuch Metall, 39. Auflage 1994,<br />
EuropaVerlag, ISBN 3808511095<br />
Dobler, Doll, Fischer u.a: Fachk<strong>und</strong>e Metall, Verlag<br />
EuropaLehrmittel, Haan Gruiten, Kapitel: Gr<strong>und</strong>lagen<br />
der Messtechnik; Längenprüfmittel<br />
Jung, Heinz; Pahl, JörgPeter; Schröder, Werner:<br />
Fachpraxis Metall, Cornelsen Verlag,<br />
ISBN: 9783464420508<br />
18 Die Lerneinheiten (LE) sind als übergeordnete, thematisch ausgerichtete Kapitel zu verstehen, denen Kompetenzbereiche (KB) zugeordnet sind. Ihrer Kombination in (Lern) Einheiten<br />
liegt die pädagogische Intention zugr<strong>und</strong>e, den individuellen Lernfortschritten der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen genügend Zeit einzuräumen. Darin ist eingeschlossen, dass Themen<br />
wiederholt, ergänzt, vertieft oder übersprungen werden können, wenn sich dies aus inhaltlichen Gründen als notwendig bzw. zweckmäßig in Hinsicht auf die Berufsvorbereitung der<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erweist. Auch auf eine St<strong>und</strong>envorgabe zu den einzelnen LE wurde daher verzichtet.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 53<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
2 Der etwas andere Einstieg: Ein nachdenkliches Spiel<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Verständigung: Präzise Erklärungen,<br />
sachgemäße Informationen <strong>und</strong> angemessene<br />
Anleitungen sind erforderlich, um<br />
Fehler <strong>und</strong> Missverständnisse zu vermeiden,<br />
insbesondere in Hinsicht auf die zukünftige<br />
Berufsausbildung <strong>und</strong> spätere Berufstätigkeit.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sollen erkennen,<br />
• dass Erklärungen viel genauer sein müssen<br />
als sie denken, weil bei jeder Erklärung von<br />
einem Vorwissen des Gegenübers ausgegangen<br />
wird, dass er/sie aber vielleicht<br />
nicht hat;<br />
• dass das Gelingen sprachlicher<br />
<strong>Kommunikation</strong> von der individuellen Bereitschaft<br />
<strong>und</strong> Fähigkeit zum verständigen Zuhören<br />
abhängt,<br />
• dass die Interaktion von Personen <strong>und</strong><br />
Gruppen auf dem Austausch vollständiger<br />
Informationen <strong>und</strong> ihrem Verständnis basiert.<br />
In einer Spielsituation – Mitglieder unterschiedlicher<br />
Kulturkreise treffen sich anlässlich eines gemeins<strong>am</strong>en<br />
Frühstücks werden die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen animiert, sich mit den gr<strong>und</strong>legenden<br />
Elementen von <strong>Kommunikation</strong> (verbal, mimisch,<br />
gestisch) zu befassen.<br />
Die in diesem Kulturkreis als selbstverständlich<br />
unterstellte Kompetenz, ein „Brötchen schmieren“<br />
zu können, muss der fremden Person in allen<br />
Schritten erklärt <strong>und</strong> vorgemacht werden.<br />
Im ersten Durchgang des Spiels übernimmt der/die<br />
Lehrer/in die Rolle der fremden Person, die von den<br />
Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen genau instruiert wird<br />
<strong>und</strong> eine (vollständige) Handlungsanleitung erhält.<br />
Die Vorführung wird von den Schülern <strong>und</strong><br />
Schülerinnen in Kleingruppen wiederholt, Beobachtungen<br />
werden von den Schülern <strong>und</strong><br />
Schülerinnen notiert <strong>und</strong> in der Gruppe anschließend<br />
diskutiert.<br />
1 Bestandteile eines Frühstücks<br />
(diverse Lebensmittel, Besteck, Geschirr);<br />
Kartenspiel<br />
Skizzierübungen zur Unterrichtsauflockerung<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 54<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
3 Erster Versuch eines fächerübergreifenden Unterrichts: Zus<strong>am</strong>menführung von Lerninhalten<br />
Im Mittelpunkt der 3. Lerneinheit steht die Umsetzung<br />
der erworbenen theoretischen Kenntnisse<br />
(Maße, Maßeinheiten) in die Praxis der<br />
vorbereitenden Bearbeitung von Werkstücken.<br />
In der Werkstatt werden die theoretischen<br />
Kenntnisse praktisch zur Anwendung gebracht.<br />
Zeichnungsmaße werden im Maßstab 1:1 auf<br />
flache Werkstücke mit verschiedenen Mitteln<br />
(Stift, Kreide, Reißnadel, Höhenreißer) aufgetragen.<br />
Dabei lernen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen,<br />
• dass die Übertragung von Maßen auf Werkstücke<br />
unterschiedlich gravierende Spuren<br />
auf den Werkstückoberflächen hinterlässt<br />
<strong>und</strong><br />
• dass je nach Auswahl des technischen<br />
Hilfsmittels (Kreide oder Reißnadel) die<br />
Korrektur falscher Anrisse einfach oder<br />
arbeitsaufwendig ist;<br />
• dass die Einhaltung der Maße sowie die<br />
Auswahl der angemessenen Linienarten<br />
gr<strong>und</strong>legende Bedingungen für alle weiteren<br />
<strong>Arbeit</strong>sschritte sind;<br />
• dass die einwandfreie <strong>Arbeit</strong>svorbereitung/<br />
planung ein Qualitätsmerkmal von <strong>Arbeit</strong> ist.<br />
Die bestimmenden Merkmale von technischen<br />
Zeichnungen sind den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
bekannt, auch wie sie angefertigt werden müssen,<br />
um den formalen Anforderungen zu entsprechen.<br />
In der 3. Lerneinheit wird das theoretische Gr<strong>und</strong>wissen<br />
zunächst mit der Fragestellung verknüpft,<br />
wie ein Werkstück zwecks Bearbeitung fixiert<br />
werden kann.<br />
Die Anwendung eines Schraubstocks beinhaltet die<br />
Klärung seiner Funktionsweise sowie seiner Bestandteile.<br />
Die raue Beschaffenheit der Schraubstockbacken<br />
führt zu der Frage, wodurch die Beschädigung der<br />
Oberfläche von zu bearbeitenden Werkstücken, die<br />
zwischen den Backen eingeklemmt werden, verhindert<br />
werden kann.<br />
Schutzbacken erfüllen den Zweck, die Oberfläche<br />
der Werkstücke zu schützen, indem sie als Puffer<br />
zwischen den Schraubstockbacken <strong>und</strong> dem<br />
Werkstück funktionieren; der durch die Spindeldrehung<br />
zunehmende (Anpress)Druck bewirkt die<br />
Fixierung z. B. eines Rohrs, ohne Narben auf seiner<br />
Oberfläche zu hinterlassen.<br />
Der Einsatz materialschonender Hilfsmittel wird im<br />
Kontext des betrieblichen Qualitätsmanagements<br />
behandelt (Ausschuss = Kosten).<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Tabellenbuch Metall, s.o.<br />
Lektüreempfehlung:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/ Schraubstock<br />
http://commons.wikimedia.<br />
stock800.jpg<br />
org/wiki/File:Schraub<br />
http://commons.wikimedia.<br />
org/wiki/File:ViceBenchinsetSoftJaws.jpg<br />
http://www.download.etmedien.de/texte/der_schraubstock_<strong>und</strong>_seine_herst<br />
ellung.pdf<br />
http://www.europalehrmittel.de/titel311<br />
311/tabellenbuch_metall330/<br />
Anschauungsmaterial: Parallel / Maschinenschraubstock,<br />
Schutzbacken<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 55<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
...<br />
(3)<br />
{Verknüpfung mit dem allgemeinbildenden Bereich,<br />
hier: Deutsch, i.e Sozialkompetenz <strong>und</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>ssicherheit}<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, sich mittels<br />
eines Fachbuches Informationen zu beschaffen:<br />
Wo finde ich was?<br />
Thematisiert wird die Systematik des Tabellenbuches,<br />
hier bezogen auf den Unterschied<br />
zwischen Inhalts, Sachwort (oder Stichwort) <br />
<strong>und</strong> Normenverzeichnis.<br />
• Als Stichwort wird ein Wort bezeichnet, das<br />
zum Auffinden oder Anzeigen einer<br />
relevanten Stelle verwendet werden kann;<br />
• unter dem Stichwort „Schutzbacken“ sind in<br />
der Fachliteratur oder im Internet Erklärungen<br />
zu finden.<br />
{Erneut: Verknüpfung mit dem allgemeinbildenden<br />
Bereich, hier: Deutsch, d. h.<br />
Sozialkompetenz <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>ssicherheit}<br />
Um sich das Stichwort merken zu können, wird<br />
nach einer begrifflichen „Eselsbrücke“ gesucht,<br />
was wiederum die Erklärung des Begriffs<br />
„Eselsbrücke“ <strong>und</strong> der mit ihm verb<strong>und</strong>enen<br />
Redewendungen zur Folge hat.<br />
Den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen soll vermittelt<br />
werden, dass<br />
a) der nachlässige Umgang mit Werkzeugen <strong>und</strong><br />
Hilfsmitteln einerseits, mit dem Werkstück<br />
andererseits zeitaufwendige Nacharbeiten erfordert,<br />
was eine Kostensteigerung bewirken<br />
kann;<br />
b) durch die wechselseitige Unterstützung<br />
(Partner/ Gruppenarbeit) Fehler entdeckt <strong>und</strong><br />
korrigiert werden können. Die Vorteile der<br />
Te<strong>am</strong>arbeit werden diskutiert.<br />
Siehe Anmerkung II im Modul, S. 12:<br />
Kleiner Exkurs in die interkulturelle Semantik: Am<br />
Beispiel verschiedener Redewendungen, die in den<br />
Kulturkreisen existieren, aus denen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen kommen, kann die Entstehung von<br />
Missverständnissen verdeutlicht werden. Zu erklären<br />
ist, dass Begriffen, Symbolen <strong>und</strong> Handlungen<br />
in den verschiedenen Kulturkreisen unterschiedliche<br />
Bedeutungen zukommen. Wird der<br />
Bedeutungsgehalt ignoriert, sind Probleme <strong>und</strong><br />
Konflikte in der Regel vorprogr<strong>am</strong>miert. Die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen werden aufgefordert, Redewendungen<br />
aus ihrem (ehemaligen) Kulturkreis<br />
anzuführen <strong>und</strong> ihre Bedeutung zu erklären.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 56<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
4 Ohne Regeln geht es nicht<br />
In dieser Lerneinheit werden die Kenntnisse <strong>und</strong><br />
Fertigkeiten des Anreißens <strong>am</strong> Gegenstand einer<br />
Schutzbacke vorbereitet <strong>und</strong> geübt.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• welche Bedeutung den einzelnen Linienarten<br />
zukommt <strong>und</strong> in welchem technischen<br />
Kontext sie stehen bzw. „zu lesen sind“;<br />
• mit Lineal, Dreieck <strong>und</strong> Bleistift geometrische<br />
Zeichnungen nach Vorgabe zu erstellen;<br />
• die Außenkontur einer Schutzbacke nach<br />
Vorgabe (Tafelbild) unter Berücksichtigung<br />
von Maßen zu zeichnen;<br />
• Einheiten umzurechnen, Maße in anderen<br />
Maßstäben zu berechnen <strong>und</strong> auf weitere<br />
technische Skizzen anzuwenden.<br />
• dass einer technischen Zeichnung <strong>und</strong> den<br />
darauf notierten weiteren Angaben ein verbindlicher<br />
Auftrag unterliegt.<br />
{Verknüpfung mit dem allgemeinbildenden Bereich,<br />
hier: Deutsch, i.e. Einbindung von Allgemeinkommunikation}<br />
Die Vorbereitung der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
auf eine Ausbildung im (metall) technischen<br />
Berufsfeld beinhaltet, dass sie sich mit der<br />
Geschichte der Metallgewinnung <strong>und</strong> Metallverarbeitung<br />
sowie der Entwicklung des Hüttenwesens<br />
in Deutschland befassen.<br />
Während „Skizzen“ einen Eindruck oder eine Idee<br />
in einer vorläufigen Form festhalten bzw. einen<br />
ersten Entwurf darstellen, bilden technische<br />
Zeichnungen die Gr<strong>und</strong>lage für manuelle oder<br />
maschinelle <strong>Arbeit</strong>sprozesse. Das eine ist die Idee,<br />
das andere der Plan, nach dem zweckmäßig vorgegangen<br />
wird.<br />
Abweichungen von den selbst ermittelten oder<br />
vorgeschriebenen Maßen führen in der Regel zu<br />
mangelhaften <strong>Arbeit</strong>sergebnissen. Die Genauigkeit<br />
von Maßen <strong>und</strong> deren Einhaltung in allen folgenden<br />
<strong>Arbeit</strong>sschritten soll als wesentliche Bedingung aller<br />
<strong>Arbeit</strong>s <strong>und</strong> Produktionsprozesse begriffen werden.<br />
Im Rahmen der Lerneinheit sollte die Bedeutung<br />
einer sachgerechten Anwendung von Zeichengeräten<br />
<strong>und</strong> Prüfmitteln hervorgehoben werden.<br />
Hausaufgabe: Zeichnen der Schutzbacke<br />
Begriffsgeschichtlich wird die Entstehung <strong>und</strong> Bedeutung<br />
des Wortes „Hütte“ erarbeitet. Dazu<br />
können Texte aus den nebenstehenden Quellen<br />
genutzt werden.<br />
4,5 Fachk<strong>und</strong>e Metall, Kapitel Gr<strong>und</strong>lagen der Messtechnik,<br />
Längenprüfmittel<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Fachpraxis Metall, s.o.<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<br />
Eisen#Gewinnung_<strong>und</strong>_Darstellung<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<br />
Metallurgie#Der_lange_Weg_in_die_Eisenzeit<br />
Zum Thema Hüttenwerk siehe:<br />
http://deu.archinform.net/stich/1884.htm<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 57<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
5 Rückgriff auf Bekanntes: die Mathematik im Lernfeld sowie erste technische Zeichnungen<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, unter Anwendung<br />
mathematischer Formeln die Fläche<br />
sowie das Volumen <strong>und</strong> Gewicht von Werkstücken<br />
zu berechnen.<br />
Sie lernen<br />
• unter Anwendung des Tabellenbuches das<br />
Gewicht der von ihnen gezeichneten <strong>und</strong> in<br />
der Werkstatt aus Stahlblech hergestellten<br />
Schutzbacke zu berechnen. Diese Berechnungen<br />
werden erweitert, indem alternative<br />
Materialien wie Blei, Kupfer,<br />
Aluminium oder Kunststoff (Polyurethan)<br />
herangezogen werden, aus denen ebenfalls<br />
Schutzbacken gefertigt werden können;<br />
• unter Zuhilfenahme des Lehrbuchs, dass in<br />
der Form identische, in den Materialeigenschaften<br />
unterschiedene Schutzbacken eingesetzt<br />
werden <strong>und</strong> dass d<strong>am</strong>it den Formen<br />
<strong>und</strong> Oberflächeneigenschaften der zu bearbeitenden<br />
Werkstücke entsprochen wird.<br />
Erläutert wird die Festigkeit diverser<br />
Materialien.<br />
Der Wiederholung, Prüfung <strong>und</strong> Festigung<br />
mathematischer Gr<strong>und</strong>lagenkenntnisse folgt eine<br />
Einführung in das Thema <strong>Arbeit</strong>splanung.<br />
Da neben der technischen <strong>Kommunikation</strong> auch die<br />
anderen Fächer (im Kontext der Lernfelder) der<br />
Technologie zu berücksichtigen sind, sollen vor<br />
weiteren Zeichenübungen Fläche, Volumen <strong>und</strong><br />
Gewicht von Schutzbacken aus unterschiedlichen<br />
Materialien ausgerechnet werden.<br />
Aufgaben aus dem Bereich der technischen<br />
Mathematik zu wiederholen, dient der Festigung<br />
gr<strong>und</strong>legender Kenntnisse über Länge, Fläche,<br />
Volumen, Oberfläche <strong>und</strong> Masse, da es sich um<br />
Themen handelt, die in allen technischen Berufen<br />
sicher beherrscht sein müssen.<br />
Dass jeder Handlung im Idealfall eine Planung<br />
vorausgeht bzw. zugr<strong>und</strong>e liegt, aus der ein<br />
<strong>Arbeit</strong>splan resultiert, ist als bestimmendes<br />
Merkmal von <strong>Arbeit</strong>sprozessen zu begreifen.<br />
Der Stellenwert der <strong>Arbeit</strong>splanung im Prozess<br />
einer vollständigen Handlung kann anhand einer in<br />
4 Schritten bestehenden Folge verdeutlicht<br />
werden:<br />
1. Aufgabenanalyse, 2. <strong>Arbeit</strong>splanung, 3. <strong>Arbeit</strong>sdurchführung,<br />
4. Aufgabenauswertung<br />
Variante in 6 Schritten:<br />
1. Informieren, 2. Planen, 3. Entscheiden, 4. Ausführen,<br />
5. Kontrolle, 6. Bewerten<br />
5,<br />
6<br />
Tabellenbuch Metall, s.o., Kapitel 1: <strong>Technische</strong><br />
Mathematik; Kapitel 4: Werkstofftechnik, i.e. Stoffwerte<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Fachpraxis Metall, s.o.<br />
Stichwort: Vollständige Handlung, siehe:<br />
http://www.komnetzglossar.de/typo3temp/pics/e7c704fc9b.jpg<br />
siehe: http://www.lmha.de/1101.html<br />
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/ <strong>Arbeit</strong>splan<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 58<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
5<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• dass <strong>Arbeit</strong>splanung ein unerlässlicher Bestandteil<br />
in der Abfolge von <strong>Arbeit</strong>sschritten<br />
ist.<br />
Sie reflektieren zum einen die eigenen<br />
<strong>Arbeit</strong>sschritte, die zur Herstellung der<br />
Schutzbacke erforderlich sind, zum anderen<br />
die formalen Kriterien (= Anforderungen), die<br />
im Bereich der Technik gelten. In Hinsicht<br />
auf das geplante Unterrichtsprojekt (alternativ:<br />
Schutzbacke, Anreißplatte, N<strong>am</strong>ensschild,<br />
Passstück) konzentrieren sich die<br />
Vorarbeiten in der Werkstatt auf die sichere<br />
Beherrschung manueller / handwerklicher<br />
Fertigkeiten <strong>und</strong> Techniken.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• dass die technische Zeichnung mit Maßen<br />
<strong>und</strong> Maßbezugslinien/kanten <strong>und</strong> deren<br />
Übertragung auf ein Werkstück mittels Anreißen<br />
wesentliche Bedingung für alle<br />
folgenden <strong>Arbeit</strong>sschritte ist.<br />
Mit dem Zeichnen von weiteren flachen<br />
Werkstücken ist das Lernziel verb<strong>und</strong>en, die<br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen, im Fachbuch definierten<br />
Regeln zu internalisieren. Am 2. Vertiefungsbeispiel<br />
lernen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen, die Symmetrie von Werkstücken<br />
zu erkennen sowie die Darstellung in<br />
anderen Maßstäben.<br />
Um die Entstehung <strong>und</strong> Wirkung von Fehlern zu verdeutlichen,<br />
werden in der Systematik der vollständigen Handlung<br />
Elemente vertauscht oder entnommen.<br />
Welche Konsequenzen entstehen, wenn z. B. die Kontrolle <strong>und</strong><br />
Bewertung eines Werkstückes unterbleiben, wird anhand<br />
fehlerhafter Produkte <strong>und</strong> der ihnen zugr<strong>und</strong>e liegenden<br />
<strong>Arbeit</strong>splanung versucht zu analysieren.<br />
An verschiedenen arbeitsbezogenen Aktivitäten kann das<br />
UrsacheWirkungsVerhältnis durchgespielt werden.<br />
Um die Fähigkeiten im Zeichnen zu vertiefen, sollen 2 weitere<br />
Zeichnungen angefertigt werden. Dabei geht es vor allem um<br />
das Zeichnen <strong>und</strong> Bemaßen der Zeichnung <strong>und</strong> die dabei anzuwendenden<br />
Regeln:<br />
1. Abstand der ersten Maßlinie von der Körperkante ca. 10<br />
mm;<br />
2. Abstand der zweiten Maßlinie von der ersten Maßlinie 7<br />
mm;<br />
3. die Pfeile sind lang <strong>und</strong> schlank zu zeichnen;<br />
4. die Maßlinien <strong>und</strong> Maßhilfslinien sind dünn zu zeichnen;<br />
5. die Mittellinien sind 12 mm über die Körperkante hinaus<br />
zu zeichnen;<br />
6. die Maßhilfslinien sind 12 mm über die letzte Maßlinie<br />
hinaus zu zeichnen.<br />
Hausaufgabe:<br />
Beide Zeichnungen sind als Hausaufgabe zu wiederholen <strong>und</strong><br />
abzugeben. Hinzu kommen die Berechnungen von Fläche <strong>und</strong><br />
Masse jedes Werkstücks.<br />
Vertiefungsbeispiel 1: Stufenblech,<br />
Vertiefungsbeispiel I2: Formlehre<br />
(siehe Kapitel 4.5, Seite 25).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 59<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
6 Wiederholung <strong>und</strong> Vertiefung der Praxisarbeit<br />
Anhand von sieben zur Auswahl stehenden Bauteilen<br />
werden die jedem <strong>Arbeit</strong>svorhaben zugr<strong>und</strong>e<br />
liegenden systematischen <strong>Arbeit</strong>sschritte:<br />
1. <strong>Arbeit</strong>splan,<br />
2. Zeichnung,<br />
3. mathematische Berechnungen,<br />
4. Stückliste<br />
erneut <strong>und</strong> vertiefend geübt.<br />
Das Ziel dieser Lerneinheit besteht vorrangig<br />
darin, die Zyklen der vollständigen Handlung gedanklich<br />
zu durchdringen <strong>und</strong> zu verankern.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sind anschließend<br />
imstande,<br />
• geeignete <strong>Arbeit</strong>stechniken auszuwählen<br />
<strong>und</strong> zweckmäßig <strong>und</strong> zielorientiert anzuwenden;<br />
• auftragsbezogene Informationen zu erschließen,<br />
zu verarbeiten, zu strukturieren<br />
<strong>und</strong> auszuwerten;<br />
• ihren eigenen Lern <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sprozess zu<br />
organisieren, zu steuern, zu bewerten <strong>und</strong><br />
veränderten Rahmenbedingungen ggf. anpassen<br />
zu können;<br />
• auch im Te<strong>am</strong> Lern <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>sprozesse zu<br />
planen, zu strukturieren, umzusetzen <strong>und</strong> zu<br />
reflektieren.<br />
Lernkontext: <strong>Arbeit</strong>splanung, siehe LE 5<br />
Vor Beginn jeder praktischen Handlung werden die <strong>Arbeit</strong>sschritte<br />
gedanklich vorweggenommen: „Was muss ich tun,<br />
um ...?“<br />
Die Phasen des Fertigungsprozesses werden reflektiert, im<br />
<strong>Arbeit</strong>splan notiert (dokumentiert) <strong>und</strong> geprüft.<br />
Indem die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen sowohl wiederkehrende,<br />
vergleichbare <strong>Arbeit</strong>saufträge (Anfertigung der Bauteile<br />
N<strong>am</strong>ensschild, Anreißblech, Formblech, Kreuzpuzzle, Bohrübungen<br />
I+II, Würfelplatte) als auch Projekte (siehe LE 7)<br />
planen, durchführen <strong>und</strong> bewerten, entwickeln sie Routine <strong>und</strong><br />
Sicherheit.<br />
Dies bezieht sich auch auf den Einsatz des Tabellenbuches,<br />
ggf. eines vorbereiteten Rasters zur Zeitplanung <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>saufteilung.<br />
In den Flächenberechnungen der Bauteile liegt eine besondere<br />
Anforderung an die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen insofern, als sie<br />
die Aussparungen / R<strong>und</strong>ungen des N<strong>am</strong>ensschildes, des<br />
Formbleches <strong>und</strong> des Kreuzpuzzles berücksichtigen müssen.<br />
Gr<strong>und</strong>kenntnisse der Geometrie von Flächen werden trainiert.<br />
Die Umrechnung der ermittelten Flächenmaße in<br />
Volumenmaße findet zu Beginn der folgenden Lerneinheit 7<br />
statt.<br />
6 <strong>Arbeit</strong>sblätter Nr. 1 – 7 (für alle<br />
Bauteile), siehe S. 26.<br />
Tabellenbuch Metall, s.o., Kapitel 1:<br />
<strong>Technische</strong> Mathematik<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 60<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
7 <strong>Arbeit</strong>splan, Stückliste <strong>und</strong> deren Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
Teil I: Wiederholung:<br />
Basierend auf den LE 5 + 6 führen die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen einen aus 3 Lernschritten bestehenden<br />
<strong>Arbeit</strong>sauftrag durch, indem sie<br />
a) das Volumen der Schutzbacke <strong>und</strong><br />
b) die Massen (= Volumen x Dichte) der für<br />
Schutzbacken verwendbaren, unterschiedlichen<br />
Materialien wie Blei, Holz, Kupfer, Leichtmetall,<br />
Kunststoff berechnen.<br />
Teil II: „Bau eines Würfels auf Gr<strong>und</strong>platte“<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erhalten <strong>und</strong><br />
realisieren einen Auftrag, der mehrere vom<br />
K<strong>und</strong>en definierte Anforderungen erfüllen muss.<br />
In der Rolle des Konstrukteurs/der Konstrukteurin<br />
diskutieren <strong>und</strong> entscheiden sie (über)<br />
die kostengünstige Herstellung,<br />
den Anspruch an ein schönes Design,<br />
die funktionale Verwendung (Briefbeschwerer),<br />
den Werbeeffekt („eyecatcher“) beim beschenkten<br />
K<strong>und</strong>en.<br />
Dem ständigen Wechsel von Theorie <strong>und</strong> Praxis liegt der<br />
Zweck zugr<strong>und</strong>e, die im Unterricht angeeigneten Kenntnisse in<br />
der Praxis anzuwenden, wobei der Fokus auf der Genauigkeit<br />
des Zeichnens <strong>und</strong> des Anreißens liegt.<br />
Die Fachsprache bzw. Begriffe wie z. B. Anreißnadel, Reifkloben,<br />
Schruppfeile, Rauhtiefe etc. werden in das Vokabular<br />
übernommen.<br />
Bei den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen sollte sich als wichtige Erkenntnis<br />
dieses Lernschrittes einprägen, dass mit zunehmender<br />
Komplexität die Anforderung an die Genauigkeit<br />
der einzelnen <strong>Arbeit</strong>sschritte zunimmt. Der Fortschritt von der<br />
Herstellung der „Schutzbacke“, die wesentlich durch Säge <strong>und</strong><br />
Biegearbeiten entsteht, zur Herstellung der Figur „Würfel auf<br />
Gr<strong>und</strong>platte“ liegt auf der konstruktiven Ebene: Der Würfel wird<br />
mittig auf der Gr<strong>und</strong>platte verbohrt <strong>und</strong> verschraubt, Bau <strong>und</strong><br />
Normteile werden miteinander verb<strong>und</strong>en.<br />
Die Reihenfolge der <strong>Arbeit</strong>en <strong>und</strong> der Bearbeitung unterschiedlicher<br />
Metalle, der zweckmäßige Einsatz verschiedener<br />
spanabhebender Werkzeuge <strong>und</strong> Prüfmittel, der Einbau eines<br />
Normteils in Hinsicht auf die Herstellung einer kraftschlüssigen<br />
Verbindung ist im <strong>Arbeit</strong>splan systematisch festgelegt.<br />
Fehler können dadurch verhindert werden, dass jedes Teilarbeitsergebnis<br />
geprüft wird, bevor der nächste <strong>Arbeit</strong>sschritt<br />
daran anknüpft. Gr<strong>und</strong>legende Einsicht bei den Schülern <strong>und</strong><br />
Schülerinnen: Weisen die Vorarbeiten gravierende Fehler auf,<br />
führen die anschließenden <strong>Arbeit</strong>en notwendig zu mangelhaften<br />
Ergebnissen, i.d.R. zu Ausschuss.<br />
24<br />
26<br />
Tabellenbuch Metall, s.o., Kapitel W:<br />
Technologie der Werkstoffe; Kapitel M:<br />
Mathematische Gr<strong>und</strong>lagen, Seite 26 f.<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Fachk<strong>und</strong>ebuch „Fachpraxis Metall“, s. o.,<br />
S. 96<br />
Würfelplatte siehe Seite 27.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 61<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
7<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• dass eine Stückliste ein technisches<br />
Dokument ist, dem ein besonderer Stellenwert<br />
zukommt,<br />
• dass eine Stückliste in technischer Hinsicht<br />
die vollständige Übersicht aller für den Bau<br />
eines Teils erforderlichen Einzelteile enthält,<br />
• dass die Stückliste festgelegte formale<br />
Kriterien erfüllen muss<br />
• dass die Anordnung bzw. Reihenfolge der<br />
aufgelisteten Stücke (Bau <strong>und</strong> Normteile)<br />
das Zus<strong>am</strong>menfügen einzelner Bauteile erleichtert,<br />
• dass die Stückliste für die Kalkulation des<br />
Stückpreises eine Voraussetzung ist,<br />
• dass Normteile nicht gezeichnet werden<br />
müssen, da sie im Tabellenbuch exakt beschrieben<br />
<strong>und</strong> abgebildet sind.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen erstellen die<br />
Zeichnung der Gr<strong>und</strong>platte <strong>und</strong> den <strong>Arbeit</strong>splan.<br />
Der erste Versuch einer Darstellung in zwei Ansichten<br />
wird vorgenommen.<br />
Besteht ein Bauteil aus mehreren Einzelteilen, wird dies in der<br />
technischen Zeichnung sichtbar (Ges<strong>am</strong>tzeichnung). Die<br />
Stückliste enthält technische Informationen <strong>und</strong> Mengenangaben,<br />
die für den Konstrukteur <strong>und</strong> die Konstrukteurin wie für<br />
den Einkäufer <strong>und</strong> die Einkäuferin wichtig sind.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage von technischer Zeichnung, <strong>Arbeit</strong>splan <strong>und</strong><br />
Stückliste – sie bilden in der Regel eine Einheit – werden Herstellungsprozesse<br />
organisiert.<br />
Im Unterrichtsgespräch werden folgende Fragen behandelt:<br />
• was ist <strong>und</strong> wozu benötigt der Konstrukteur eine Stückliste;<br />
• wodurch unterscheiden sich Bau <strong>und</strong> Normteile;<br />
• in welcher Beziehung stehen <strong>Arbeit</strong>splan, Zeichnung <strong>und</strong><br />
Stückliste zueinander?<br />
Hausaufgaben:<br />
a) Zeichnen des Stufenbleches,<br />
b) Erstellung des <strong>Arbeit</strong>splans zur Herstellung der Schutzbacke<br />
(Anmerkung dazu: Die Zeichnungen werden im Rahmen der<br />
späteren Einführung in die EDV <strong>am</strong> Computer nochmals erstellt.)<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 62<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
8 Hinweise zur Erstellung von <strong>Arbeit</strong>smappen<br />
Teil I: Projektplanung → <strong>Arbeit</strong>smappe<br />
Das erste vollständige Projekt „Anfertigung eines<br />
N<strong>am</strong>ensschildes“ stellt die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen vor die Anforderung, die bisherigen<br />
Lernschritte, die sich auf technische Sachverhalte<br />
<strong>und</strong> Hinweise zur <strong>Arbeit</strong>ssystematik<br />
konzentrierten, in formaler Hinsicht darzustellen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen dokumentieren<br />
mittels einer <strong>Arbeit</strong>smappe, deren formale <strong>und</strong><br />
inhaltliche Gestaltung wie<br />
• Beschriftung des Deckblatts<br />
• Inhaltsverzeichnis<br />
zuvor festgelegt worden ist, alle <strong>Arbeit</strong>sschritte,<br />
die zur Durchführung ihres Projekts <strong>und</strong> d<strong>am</strong>it<br />
zukünftiger Projekte – erforderlich sind. Dazu<br />
zählen des Weiteren<br />
• die Zeichnung/en<br />
• die Stückliste <strong>und</strong><br />
• der <strong>Arbeit</strong>splan<br />
sowie<br />
• die Werkzeugliste<br />
• die Berechnungen <strong>und</strong><br />
• ergänzende Informationen.<br />
Die Begriffe Zeichnung, <strong>Arbeit</strong>splan <strong>und</strong> Stückliste sind gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
geklärt; die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen kennen den<br />
Verwendungskontext der drei Begriffe.<br />
Eine <strong>Arbeit</strong>saufgabe als vollständige Handlung zu begreifen,<br />
wurde bereits in der 5. Lerneinheit thematisiert. Die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen kennen die Schritte Informieren, Planen,<br />
Entscheiden, Ausführen, Kontrolle <strong>und</strong> Bewerten <strong>und</strong> haben<br />
dies ansatzweise bei den praktischen Übungen trainiert.<br />
Die Aufgabe, eine <strong>Arbeit</strong>smappe zu erstellen, die neben der<br />
Zeichnung, dem <strong>Arbeit</strong>splan <strong>und</strong> der Stückliste weitere Hinweise<br />
enthält, die für die Herstellung eines Bauteils (Projekts)<br />
relevant sind, nämlich die:<br />
Werkzeugliste<br />
Berechnungen<br />
Anmerkungen/Informationen,<br />
ist für die Lernenden neu <strong>und</strong> ungewohnt: Sie sollen ihre Überlegungen<br />
(Plan) <strong>und</strong> realisierten <strong>Arbeit</strong>sschritte (Handlung)<br />
schriftlich formulieren.<br />
Als Hausarbeit vorgestellt, sollen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen innerhalb von 14 Tagen die Aufgabe lösen, die<br />
zuvor in allen Einzelheiten besprochen wurde.<br />
26<br />
29<br />
30<br />
Anhang 6:<br />
Hinweise zur Erstellung einer <strong>Arbeit</strong>s<br />
bzw. Projektmappe<br />
Anhang 1:<br />
Projekt 1: N<strong>am</strong>ensschild planen <strong>und</strong> anfertigen<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 63<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
8<br />
Mit der Erstellung der vorstrukturierten <strong>Arbeit</strong>smappe<br />
trainieren die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
das jeder (beruflichen) <strong>Arbeit</strong> zugr<strong>und</strong>e liegende<br />
systematische Vorgehen. Indem sie lernen, die<br />
Rang <strong>und</strong> Reihenfolge ihrer auf ein konkretes<br />
Projekt gerichteten Überlegungen zu reflektieren,<br />
aufzuschreiben <strong>und</strong> dann Schritt für Schritt (nach<br />
Plan) in die Praxis umzusetzen, entwickeln sie<br />
Sicherheit in der Durchführung von <strong>Arbeit</strong>saufgaben<br />
im Sinne der vollständigen Handlung.<br />
Teil II: Projektrealisierung<br />
Projekttitel: „N<strong>am</strong>ensschild planen <strong>und</strong> anfertigen“<br />
Am Gegenstand einer von ihnen vollständig herzustellenden<br />
Projektmappe sollen die Schüler<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen trainieren, die wesentlichen<br />
Aspekte der technischen <strong>Kommunikation</strong> miteinander<br />
zu verbinden:<br />
• Zeichnung<br />
• Stückliste<br />
• <strong>Arbeit</strong>splan<br />
• Berechnung<br />
• Textbearbeitung<br />
Die Aufgabe darf in Te<strong>am</strong>arbeit bearbeitet werden. Die Lösung<br />
wird in der in der nächsten Unterrichtsst<strong>und</strong>e ausführlich besprochen;<br />
die dem N<strong>am</strong>ensschild zuzuordnenden Überlegungen,<br />
Berechnungen <strong>und</strong> Textpassagen werden<br />
kontrolliert. Kontrolliert wird weniger die Qualität des Resultats<br />
als vielmehr die Bereitschaft der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen, die<br />
<strong>Arbeit</strong> als Hausarbeit zu erledigen.<br />
Mit der Gewichtung der Punkte wird anerkannt, ob bzw. wie<br />
weit sich die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen theoretisch mit dem<br />
Thema „<strong>Arbeit</strong>splanung“ beschäftigt haben.<br />
In diesem Kontext ist die Frage an die Lernenden von Bedeutung,<br />
wie sie diese Art des projektorientierten Unterrichts<br />
bewerten.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 64<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
9 Geometrische Gr<strong>und</strong>konstruktionen<br />
Um von den geraden Werkstücken auch zu den gebogenen<br />
<strong>und</strong> r<strong>und</strong>en Werkstücken zu kommen, ist es<br />
notwendig verschiedene Gr<strong>und</strong>konstruktionen einzuüben.<br />
In diesem Zus<strong>am</strong>menhang wird zudem der Umgang mit<br />
Zirkel <strong>und</strong> Lineal trainiert.<br />
Folgende Konstruktionen werden an der Tafel entwickelt:<br />
• Parallelverschiebung<br />
• Teilung einer Strecke<br />
• Teilung einer Strecke in Anzahl n bestimmter Teile<br />
• Teilung eines Winkels<br />
• Symmetrisches Vieleck (Sechs <strong>und</strong> Zwölfeck)<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen<br />
• mit einfachen Hilfsmitteln geometrische Figuren zu<br />
entwerfen,<br />
• den Figuren im Tabellenbuch die entsprechenden<br />
Formeln zuzuordnen,<br />
• Berechnungen dieser <strong>und</strong> daraus abgeleiteter<br />
Figuren durchzuführen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen des Weiteren, aus<br />
geometrischen Gr<strong>und</strong>konstruktionen, z. B. dem Sechseck,<br />
a) ein gleichschenkeliges, b) ein rechtwinkeliges Dreieck<br />
zu entwickeln <strong>und</strong> die für die Berechnung der Fläche angemessene<br />
mathematische Formel zu benennen (ohne<br />
Berechnung, da keine Maßangaben vorliegen).<br />
Gr<strong>und</strong>lagen der Geometrie:<br />
In der Geometrie versteht man unter einer<br />
Konstruktion, insbesondere mit Zirkel <strong>und</strong> Lineal, die<br />
Entwicklung der exakten zeichnerischen Darstellung<br />
einer Figur auf der Gr<strong>und</strong>lage vorgegebener Größen.<br />
In der Regel ist dabei die Beschränkung auf die Verwendung<br />
der „Euklidischen Werkzeuge“ Zirkel <strong>und</strong><br />
Lineal gefordert. Das Lineal hat keine Markierungen;<br />
man kann d<strong>am</strong>it also nur Geraden zeichnen, aber<br />
keine Strecken abmessen.<br />
Die Sicht auf, das Verständnis von <strong>und</strong> die Modifikation<br />
geometrische/r Gr<strong>und</strong>figuren steht im Mittelpunkt<br />
dieser Lerneinheit. An einigen von den<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler herzustellenden<br />
technischen Zeichnungen, z. B. N<strong>am</strong>ensschild <strong>und</strong><br />
Formblech, können die Aussparungen <strong>und</strong><br />
R<strong>und</strong>ungen dargestellt, die jeweiligen Flächen aber<br />
(noch) nicht berechnet werden.<br />
Am Beispiel der R<strong>und</strong>ung eines Winkels (Zeichnung<br />
5) wird demonstriert, wie ein Radius an einen<br />
(spitz)winkeligen Körper gezeichnet werden kann,<br />
ohne dass eine Kante entsteht. Der im Boots <strong>und</strong><br />
Schiffbau für diese <strong>Arbeit</strong> verwendete Begriff „straken“<br />
wird erklärt.<br />
12 Lektüreempfehlung:<br />
http://schuelerseite.ottotriebes.de/Mathe/Geometrie/Ebene/geo_<br />
gr<strong>und</strong>.htm<br />
oder<br />
http://www.geogebra.org/de/upload/files/d<br />
yn<strong>am</strong>ische_arbeitsblaetter/lwolf/gr<strong>und</strong>kon<br />
struktionen/streckenhalb.html<br />
<strong>und</strong><br />
http://www.geogebra.org/de/upload/files/d<br />
yn<strong>am</strong>ische_arbeitsblaetter/lwolf/gr<strong>und</strong>kon<br />
struktionen/winkelhalb.html<br />
Tabellenbuch Metall, s.o., S.26 f.<br />
Tafelbilder 1 – 5, jeweils neu zu<br />
skizzieren, siehe Seiten 32f.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 65<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
10 Zeichnen von Werkstücken mit R<strong>und</strong>ungen<br />
Die Lernziele der LE 10:<br />
• Festigung der Kompetenz, technische Zeichnungen<br />
normgerecht anzufertigen <strong>und</strong><br />
• die jeweiligen Vorgaben dem Tabellenbuch zu entnehmen<br />
<strong>und</strong> zeichnerisch umzusetzen<br />
werden mit den<br />
Lernzielen der LE 11<br />
• Erklärung des Begriffs (ISO)Toleranzen im Zus<strong>am</strong>menhang<br />
der Fertigung <strong>und</strong> Montage von<br />
(Maschinen)Bauteilen, z. B. an der Bezeichnung H7<br />
• Erklärung des Begriffs Reiben im Zus<strong>am</strong>menhang der<br />
Herstellung passgenauer Bohrungen. Beispielhaft<br />
wird dies <strong>am</strong> Aufbau <strong>und</strong> der Funktionsweise einer<br />
Handreibahle 25 H8.<br />
verb<strong>und</strong>en.<br />
Die Lerneinheiten 10 <strong>und</strong> 11 können miteinander verknüpft<br />
werden, da die inzwischen bei den Schülern<br />
<strong>und</strong> Schülerinnen vorhandenen theoretischen Kenntnisse<br />
im Bereich technischer Zeichnungen auch<br />
praktisch zur Anwendung kommen sollten.<br />
Weiter wird auf die Bezeichnung M5 <strong>und</strong> die Regeln<br />
beim Schneiden von Gewinden eingegangen; es<br />
werden Begriffe erläutert, die im Zus<strong>am</strong>menhang des<br />
Gewindeschneidens vorkommen, wie z. B.<br />
• Steigung<br />
• Schnittgeschwindigkeit<br />
• Kernlochdurchmesser<br />
• Schlüsselweite<br />
• Schneideisen <strong>und</strong> Schneideisenhalter<br />
• Gewindebohrer <strong>und</strong> Windeisen<br />
Der Einsatz technischer Mittel kann als bekannt <strong>und</strong><br />
beherrscht unterstellt werden, sodass das 2. Teil, die<br />
Gr<strong>und</strong>platte des Schraubstocks, angefertigt werden<br />
kann. Die Inhalte des Unterrichts in beiden (<strong>und</strong> den<br />
folgenden) LE werden auf den Maschinenschraubstock<br />
fokussiert, der in den kommenden Wochen gefertigt<br />
werden soll.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 66<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
11 Bedeutung von Toleranzen im Zus<strong>am</strong>menhang der Herstellung von Bohrungen <strong>und</strong> Gewinden<br />
Zur Vertiefung der <strong>Arbeit</strong> mit dem Zirkel werden 2 Werkstücke<br />
mit R<strong>und</strong>ungen gezeichnet.<br />
Am Werkstück Nr. 1 lernen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen<br />
• mit dem Zirkel <strong>und</strong> mit einer Schablone (oder Lehre)<br />
Radien zu zeichnen,<br />
• wodurch sich Prüfen von Messen unterscheidet <strong>und</strong><br />
welche Mittel dafür jeweils zur Verfügung stehen,<br />
• worin der Vor bzw. Nachteil beider Verfahren besteht,<br />
• wodurch sich Formlehren von Maßlehren unterscheiden,<br />
• was das Lichtspaltverfahren bedeutet <strong>und</strong> wie es angewandt<br />
wird,<br />
• wie Prüf <strong>und</strong> Messmittel korrekt angewendet <strong>und</strong><br />
behandelt werden.<br />
Am Werkstück 2 lernen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
• das Auftragen von Maßen mittels der vorher besprochenen<br />
Methoden,<br />
• die Übertragung bestimmter Bemaßungsregeln im<br />
Zus<strong>am</strong>menhang der Anfertigung von Kernlochbohrungen,<br />
in die in einem späteren <strong>Arbeit</strong>sschritt<br />
Innengewinde geschnitten werden,<br />
• die Bedeutung von Passungen <strong>und</strong> Toleranzen, wie<br />
z. B. H7,<br />
Mit der Wiederholung von Zeichenübungen wird<br />
einerseits das exakte, dem angegebenen Maßstab<br />
entsprechende Übertragen von Maßen geübt.<br />
Unterschiedliche Radien können entweder mit einem<br />
Zirkel oder Formverkörperungen aufgetragen werden.<br />
Während ein Zirkel verstellbar ist, verkörpert eine<br />
Schablone oder Lehre ein festgelegtes, unveränderbares<br />
Maß. Um den Lernenden die Eigenarten <strong>und</strong><br />
spezifischen bzw. typischen Einsatzbereiche der<br />
Prüfmittel zu demonstrieren, werden im Unterricht<br />
gezeigt:<br />
• Lehren, die dazu dienen, eine bestimmte Form<br />
nachzuprüfen; (Fachbegriff: Formlehren).<br />
• Lehren, mit denen man prüfen kann, ob das<br />
Werkstück zu groß oder klein ist (Fachbegriff:<br />
Maßlehren).<br />
• Radien oder Formlehren, die die Prüfung von<br />
Winkeln, Radien oder Profilen nach dem Lichtspaltverfahren<br />
ermöglichen. Wird z. B. ein (bearbeitetes)<br />
Werkstück mit dem Radius r = 20mm<br />
mittels einer Lehre / Schablone, die den<br />
identischen Radius besitzt, vor einem hellen<br />
Hintergr<strong>und</strong> verglichen, kann durch die Größe des<br />
Lichtspalts die Übereinstimmung oder Abweichung<br />
vom Maß festgestellt werden.<br />
Werkstück 1: Flaches Werkstück mit<br />
R<strong>und</strong>ungen (siehe Seite 34).<br />
Werkstück 2: Gr<strong>und</strong>platte mit Bohrungen<br />
<strong>und</strong> Toleranzangaben (siehe Seite 34<br />
sowie Anhang 3, Teil 1).<br />
Tabellenbuch Metall, s.o.<br />
Werkzeugkataloge von Lieferanten<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Umfangreiche Erklärung <strong>und</strong> Darstellung<br />
von Gewinden, siehe:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewinde<br />
Umfangreiche Erklärung <strong>und</strong> Darstellung<br />
von Toleranzen, siehe:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz_<br />
%28Technik<br />
%29#Allgemeintoleranzen_f.C3.BCr_L.C<br />
3.A4ngen_<strong>und</strong>_Winkel<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 67<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien<br />
/<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
11<br />
• was Reibahlen sind,<br />
wodurch sich die<br />
Bauweisen unterscheiden<br />
<strong>und</strong> wofür<br />
sie jeweils benutzt<br />
werden,<br />
• die Eigenarten von<br />
isometrischen Gewinden(Außen/Innengewinde),<br />
• wie <strong>und</strong> mit welchen<br />
Hilfswerkzeugen<br />
Gewinde hergestellt<br />
werden.<br />
• dass die Verwendung<br />
von Fachbegriffen im<br />
Kontext des Gewindeschneidens<br />
jeweils spezifische<br />
<strong>Arbeit</strong>sschritte <strong>und</strong><br />
verfahren beschreiben.<br />
Ein Messmittel ist ein Messgerät, eine Messeinrichtung, ein Normal, ein Hilfsmittel oder Referenzmaterial, das<br />
zur Ausführung einer Aufgabe in der Messtechnik notwendig ist. Diese Bezeichnung wird in der Norm DIN<br />
13192 definiert.<br />
Wichtige Erkenntnis:<br />
Im Unterschied zu Prüfmitteln werden Messmittel zur genauen Feststellung von Maßen in Maßeinheiten benutzt.<br />
Mit dem zweiten Werkstück wird der im „Säulenmodell“ formulierte Anspruch eingelöst, an einem Gegenstand<br />
verschiedene technische Aspekte, die in den Lernfeldern 1+ 2 aufgelistet sind, im Zus<strong>am</strong>menhang zu behandeln.<br />
Aus dem Zeichnen des zweiten Werkstücks ergeben sich allgemeine Fragen zu Eintragungen in Zeichnungen.<br />
Erklärt werden die Begriffe<br />
• Toleranz: Die Toleranz bzw. „zulässige Abweichung“ vom Nennmaß ist eine konstruktions <strong>und</strong> fertigungsbedingte<br />
Maßgröße <strong>und</strong> bezeichnet die Differenz zwischen dem oberen <strong>und</strong> dem unteren Grenzmaß.<br />
Innerhalb der Toleranz darf das Istmaß eines Werkstücks bzw. Bauteils vom jeweiligen Nennmaß (Null<br />
Linie) abweichen<br />
• Maßtoleranzen begrenzen die zulässige Abweichung der Bauteilabmessungen<br />
• Allgemeintoleranzen: Die Allgemeintoleranzen werden in Klassen unterteilt. Im Schriftfeld einer<br />
technischen Zeichnung wird mit dem Kürzel:ISO 2768m (mittel) die Toleranz für die ges<strong>am</strong>te Zeichnung<br />
festgelegt. Darüber hinaus können dann innerhalb der technischen Zeichnung weiter Toleranzen für bestimmte<br />
Maße eingetragen werden<br />
• Nennmaß: darunter versteht man das in der Zeichnung gegebene Maß<br />
• Abmaß: zulässige Abweichung<br />
Die Bedeutung des Tabellenbuches als theoretisches <strong>Arbeit</strong>smittel erschließt sich den Lernenden darüber, dass<br />
sie alle <strong>am</strong> 2. Werkstück bzw. an der technischen Zeichnung vorkommenden Fachbegriffe in dem „Nachschlagewerk“<br />
entdecken. Die Erklärungen werden im Dialog mit den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen besprochen.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 68<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
12 Zeichnen von Körpern in drei Ansichten – Übungen zum räumlichen Sehen<br />
Thema „Raumgeometrie“:<br />
Übergeordnetes Lernziel ist, die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
in die Raumgeometrie einzuführen <strong>und</strong> ihr räumliches<br />
Vorstellungsvermögen durch verschiedene Aufgabenstellungen<br />
zu schulen. An einem einfachen Körper, dem<br />
Würfel oder Kubus, wird zunächst das Wissen über<br />
dessen Eigenschaften <strong>und</strong> deren Ausdruck in Formeln<br />
abgerufen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen definieren den Würfel als<br />
einen regelmäßiger geometrischen Körper mit sechs<br />
quadratischen Flächen, die im Winkel von 90° zueinander<br />
stehen <strong>und</strong> dessen 12 Kanten alle dieselbe Länge, bezeichnet<br />
mit a, haben.<br />
Sie benennen als weitere Eigenschaft des Kubus<br />
• die 8 Ecken, die jeweils den Endpunkt von 3 Kanten<br />
bilden<br />
• von den 12 Kanten befinden sich jeweils 4 Kanten<br />
parallel zueinander<br />
• die Kantenlänge a gibt an, wie weit die Ecken auseinander<br />
liegen.<br />
Die Größe des Oberflächeninhalts Ages errechnen die<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen aus der Summe aller Seitenflächen<br />
des Würfels <strong>und</strong> wenden dafür die Formeln<br />
1) a * a = a²; 2) Ages = 6 ∙ a² an. Das Volumen eines<br />
Würfels gibt den räumlichen Inhalt des Körpers im dreidimensionalen<br />
Raum an <strong>und</strong> errechnet sich aus den<br />
Kantenlängen a ∙ a ∙ a = a³ = V<br />
Um den Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern den Einstieg in<br />
das Thema Abwicklungen zu erleichtern, sollte ggf. mit<br />
einem Würfel begonnen werden, da sich dessen<br />
Symmetrie grafisch einfacher darstellen lässt.<br />
Spielerisch kann das Thema aufbereitet werden, indem<br />
die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen auf einem Bogen<br />
Papier den Würfel über alle punktierten Seiten abrollen<br />
<strong>und</strong> dabei prüfen, dass alle 6 Seiten (Flächen)<br />
abgebildet werden.<br />
{Verknüpfung mit dem Modul <strong>Technische</strong> Mathematik<br />
II, LF 2 Metalltechnik, Lerneinheit 2}<br />
Nach diesem Einstieg werden <strong>Arbeit</strong>sblätter verteilt,<br />
die Bauteile nicht nur in komplexer geometrischer<br />
Form abbilden, sondern zusätzlich in deren Vorderansicht,<br />
Seitenansicht <strong>und</strong> Draufsicht. Das räumliche<br />
Denken der Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen soll dadurch<br />
angeregt werden, dass sie die abgebildeten Modelle<br />
einer Auswahl an Ansichten richtig zuordnen müssen.<br />
Die Identifizierung einer Ansicht als Vorder oder<br />
Seitenansicht bereitet den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
erfahrungsgemäß Probleme, wenn die geometrische<br />
Konstruktion des Gegenstandes gleichgültig gegen die<br />
Zuordnung ist, z.B. bei einem Würfel oder einem<br />
Quader. Welche Ansicht einer Seite zugeordnet wird,<br />
mündet in die Frage, wie der Betrachter dies entscheiden<br />
will.<br />
Tafelbild Spielwürfel<br />
Würfelmodell<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Abwicklung gekanteter Bleche:<br />
a) http://www.schaeferlochbleche.de/de/angebot/service/formelr<br />
echner/berechnungderabwicklung/<br />
b) http://robertmades.de/pdf/klasse8/prisma.pdf<br />
c)<br />
http://www.lernselbst.ch/Lernselbst/stufe<br />
07/mathe/712714quaderkubus/quaderkubusabwicklung.html<br />
d) http://www.mathematischebasteleien.de/wuerfel.htm<br />
Tafelbild Schiff (VA + SA + DS),<br />
Modelle (Körper) 1 – 3 (s. Seite 38).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 69<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
12<br />
Nach der Rekapitulation der bestimmenden Eigenschaften<br />
eines Kubus wird das Thema Abwicklung angesprochen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Gleichseitigkeit des Würfels wird der Begriff<br />
Würfelnetz eingeführt <strong>und</strong> erklärt.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• dass, je nach Richtungsverlauf der Abwicklung des<br />
Würfels, 11 verschiedene Netzvarianten entstehen.<br />
Indem sie ihr Papiermodell zeichnen, ausschneiden,<br />
punktieren <strong>und</strong> die gegenüberliegenden Seiten bzw.<br />
Kanten farbig markieren, erhalten sie ein Modell in 2<br />
Dimensionen;<br />
• durch die Auffaltung ein 3DModell zu bauen;<br />
Thema „Dreitafelprojektion“:<br />
Um räumliche Objekte in verschiedenen Ansichten darstellen<br />
zu können, wird das Verfahren der darstellenden<br />
Geometrie angewandt, benannt als „Normal – oder Dreitafelprojektion“.<br />
Im Rückbezug auf die vorangegangenen Lerneinheiten, in<br />
denen die Gr<strong>und</strong>lagen/regeln der Bemaßung vermittelt<br />
<strong>und</strong> eingeübt wurden, lernen die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen,<br />
Am Gegenstand „Schiff“ wird diese Problematik besprochen:<br />
Die Seitenansicht des Schiffes wird im<br />
Tafelbild als Vorderansicht, die Vorderansicht als<br />
Seitenansicht benannt, was den Widerspruch der<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen hervorruft.<br />
In ihrer Wahrnehmung fällt die Seitenlinie eines<br />
Schiffes mit der Zuordnung Seitenansicht zus<strong>am</strong>men;<br />
den Begriff Vorderansicht wählen sie, wenn der von<br />
vorne betrachtete Bug eines Schiffes zu sehen ist<br />
bzw. gezeichnet werden soll (Alltagskonventionen).<br />
Was den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen zu vermitteln ist,<br />
sind einerseits Konventionen, andererseits international<br />
verbindlich festgelegte Regeln <strong>und</strong> Normen<br />
(ISO), nach denen in technischen Zeichnungen die<br />
Ansichten von Gegenständen definiert sind.<br />
Darstellungstechnik – Projektion<br />
„Ein Körper schwebt in der Ecke eines Raumes <strong>und</strong><br />
seine drei von den Wänden abgewandten Seiten<br />
werden an die Wände projiziert, so, als ob dieser<br />
Körper aus Glas wäre <strong>und</strong> das Licht seine Kanten an<br />
die Wand werfen würde. Diese imaginäre Projektion<br />
gilt zumindest für die Hauptansichten, nämlich die<br />
Vorder, Seiten <strong>und</strong> die Draufsicht.<br />
Tafelbild Projektionsmethode 1:<br />
• Darzustellender Körper im<br />
Projektionsquader<br />
• Projektion nach hinten auf den<br />
Quader<br />
• Entfaltung nach hinten<br />
• die sechs Ansichten<br />
Lektüreempfehlung:<br />
zitiert nach:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/Normalprojektion<br />
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co<br />
mmons/0/0d/Dreitafelprojektion.svg<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Ausführungen zur Darstellungstechnik –<br />
Projektion, siehe www.technischeszeichnen.net<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 70<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
12<br />
• dass Gr<strong>und</strong>risse, Schnitte <strong>und</strong> Ansichten messbare<br />
Zeichnungen sind,<br />
• dass an bzw. mit ihnen Maße oder Maßstäbe<br />
(Größenverhältnisse) dargestellt werden, die, in<br />
technische Zeichnungen überführt, die Gr<strong>und</strong>lage für<br />
Planung / Entwurf <strong>und</strong> Ausführung / Konstruktion<br />
bilden,<br />
• dass in Europa die Projektionsmethode 1 zur Anwendung<br />
kommt, die die Ansichten <strong>und</strong> Positionen<br />
wie folgt festlegt:<br />
Vorderansicht links von der Mitte<br />
Seitenansicht von links rechts von der Mitte<br />
Draufsicht (Aufsicht) unten<br />
Rückansicht ganz rechts<br />
Seitenansicht von rechts ganz links<br />
Untersicht oben<br />
• dass zur Unterscheidung der europäischen von der<br />
<strong>am</strong>erikanischen Darstellungsvariante ein Symbol<br />
(nach DIN 6) in den Zeichnungskopf integriert wird:<br />
werden die Vorderansicht des Kegelstumpfs <strong>und</strong> die<br />
Seitenansicht von links gezeichnet, liegt die<br />
Projektionsmethode 1, die europäische Variante,<br />
vor.<br />
In der Zeichnung (siehe: www.technischeszeichnen.net)<br />
(unten) ist die Projektion eines einfachen<br />
Körpers (…) verbildlicht. Die drei typischen<br />
Ansichten, die bei dieser Projektion entstehen, werden<br />
beim technischen Zeichnen in einem sog. DreiTafel<br />
Bild dargestellt. Das DreiTafelBild ist im Prinzip eine<br />
Abwicklung des Körpers.<br />
Nach dieser Hinführung zur perspektivischen Betrachtung<br />
<strong>und</strong> Darstellung von (geometrischen)<br />
Körpern <strong>und</strong> der Erklärung der gr<strong>und</strong>legenden Regeln<br />
der Projektion wird anhand von Körper 1 die „Dreitafelprojektion“<br />
geübt; anschließend zeichnen die<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler Körper 2 <strong>und</strong> 3 nach dieser<br />
P.methode.<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 71<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
13 Fortsetzung von LE 12: weitere Zeichnungen in drei Ansichten, Tabellenbucharbeit, Wiederholungen, Vorbereitung der 2. Klassenarbeit<br />
Zu Beginn dieser Lerneinheit werden die Überlegungen<br />
rekapituliert, die vor Beginn einer Zeichnungserstellung<br />
wichtig sind.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen wissen, dass in der<br />
Projektionsmethode 1<br />
die Seitenansicht von links rechts von der Vorderansicht<br />
liegt,<br />
dass die Draufsicht unterhalb der Vorderansicht liegt <strong>und</strong><br />
durch welches Symbol diese Methode der Darstellung<br />
gekennzeichnet ist.<br />
Die Vertiefung des Unterrichtsthemas Drei Ansichten<br />
erfolgt an weiteren Modellen, dabei werden die Erkenntnisse<br />
aus vorangegangenen Lerneinheiten (i.e. LE 5), in<br />
denen die unterschiedlichen Linienarten <strong>und</strong> stärken<br />
thematisiert wurden, einbezogen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, an den in drei Ansichten<br />
dargestellten Körpern die Linienarten:<br />
Die fortgesetzte Beschäftigung mit den Eigenarten der<br />
drei Ansichten geometrischer Körper gründet auf der<br />
Erfahrung im berufsausbildungsvorbereitenden Unterricht,<br />
dass Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen Probleme mit<br />
dem räumlichen Vorstellungsvermögen haben.<br />
{Anmerkung:<br />
Auch in der mathematischen Berechnung von<br />
Volumina unterschiedlicher geometrischer Körper<br />
zeigen die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen im berufsvorbereitenden<br />
Unterricht häufig erhebliche Lücken im<br />
Verständnis der zus<strong>am</strong>mengehörenden Längen a*b*c<br />
oder H*B*T <strong>und</strong> ihren Maßeinheiten. Im <strong>Lernbaustein</strong><br />
<strong>Technische</strong> Mathematik wird versucht, die Wissenslücken<br />
auf diesem Feld zu schließen.}<br />
Im Bereich des technischen Zeichnens zeigt sich das<br />
Unverständnis in der Darstellung der 3. Dimension,<br />
der Tiefe, in der sich Körper ausdehnen.<br />
An einfachen Modellen <strong>und</strong> Bauteilen aus der<br />
(schulischen) Lehrwerkstatt werden die drei Ansichten<br />
dargestellt <strong>und</strong> die jeweils sichtbaren sowie unsichtbaren<br />
Kanten in/mit den Linienarten versehen.<br />
Tafelbilder Ansichten / Gewinde<br />
Modelle<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Eine sehr ausführliche, mit Illustrationen<br />
angereicherte Darstellung der<br />
Geschichte des technischen Zeichnens,<br />
der Anwendungsbereiche <strong>und</strong> regeln<br />
(Normen) sowie der Schnitte <strong>und</strong><br />
Durchdringungen ist zu finden unter:<br />
http://de.wikipedia.org/wiki/<strong>Technische</strong>s_<br />
Zeichnen<br />
Anhang 4: Klassenarbeit 2<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 72<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
13<br />
breite Volllinie sie definiert im Allgemeinen<br />
sichtbare<br />
Körperkanten <strong>und</strong> Umrisse<br />
sowie bestimmte teile eines<br />
Gewindes<br />
schmale Volllinie sie wird für Lichtkanten,<br />
Maß – <strong>und</strong> Maßhilfslinien,<br />
Schraffuren, Biegekanten,<br />
etc. angewendet<br />
schmale Strichpunktlinie sie wird für Symmetrieachsen,<br />
Mittellinien, Teilkreise<br />
von Verzahnungen,<br />
etc. angewendet<br />
breite Strichpunktlinie sie kennzeichnet Schnitt<br />
ebenen<br />
schmale Strichlinie sie kennzeichnet nicht<br />
sichtbare, verdeckte<br />
Körperkanten <strong>und</strong> Umrisse<br />
zu bestimmen <strong>und</strong> ihnen die definierten Linienstärken<br />
bzw. breiten zuzuordnen.<br />
Der zunehmenden Komplexität der Bauteile <strong>und</strong> ihrer<br />
Darstellung sowohl im Dreitafelbild als auch in der<br />
dreidimensionalen Gestalt liegt der Bef<strong>und</strong> zugr<strong>und</strong>e,<br />
dass die Beherrschung beider Darstellungsarten die<br />
Gr<strong>und</strong>pfeiler des technischen Zeichnens bilden <strong>und</strong><br />
von den Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen verinnerlicht<br />
werden sollten.<br />
Vorbereitung der 2. Klassenarbeit:<br />
Lernfeld 1 / <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong><br />
Aufgaben aus dem Bereich Fertigungstechnik<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 73<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
14 Fortsetzung von LE 13, <strong>Arbeit</strong>en zum Perspektivenwechsel<br />
Der Übergang vom Gegenständlichen zum Abstrakten<br />
vollzieht sich im Wechsel von der Handhabung eines abwickelbaren<br />
Objekts zum Lesen <strong>und</strong> Interpretieren einer<br />
technischen Zeichnung.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen wenden das bisher Gelernte<br />
<strong>und</strong> Verstandene an, indem sie mittels Zeichenbrett<br />
<strong>und</strong> utensilien die gegebenen Ansichten in einer Darstellung<br />
miteinander verbinden <strong>und</strong> darüber die fehlende<br />
Ansicht identifizieren <strong>und</strong> zeichnen können.<br />
Nach dem Zeichnen anhand von Körpern, die die<br />
Lernenden in die Hand nehmen konnten, sollen in<br />
diesem Schritt Zeichnungen, in denen 2 Ansichten<br />
gegeben sind, um die dritte Ansicht ergänzt werden.<br />
Die Anforderung an die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen<br />
besteht in der Abstraktionsleistung, den in zwei Ansichten<br />
gezeichneten Körper „gedanklich“ in die dritte<br />
Ansicht zu projizieren oder abzuwickeln.<br />
Über welche Hilfsmittel verfügen sie, um (einerseits)<br />
die gezeichneten Ansichten zu identifizieren <strong>und</strong><br />
(andererseits) die fehlende Ansicht zu „entwickeln“<br />
<strong>und</strong> abzubilden?<br />
Hilfreich kann die Erinnerung an Übung 1 in der 12.<br />
LE sein.<br />
Beispiele 1 – 4 (Vervollständigung von<br />
Ansichten, siehe Seite 44).<br />
Tafelbild Übung 1 (VA + SA + DS) (siehe<br />
Seite 38).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 74<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
15 Projekt 2: Besprechung des Projekts Maschinenschraubstock<br />
In der Lerneinheit steht die Realisierung des 2. Projekts im<br />
Vordergr<strong>und</strong>. Alle Schritte, die erforderlich sind, um einen<br />
Maschinenschraubstock herzustellen, werden von den<br />
Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen reflektiert.<br />
Da das Projekt den vorläufigen Abschluss ihrer<br />
theoretischen <strong>und</strong> praktischen Ausbildung an der BFS<br />
darstellt, werden sie aufgefordert, alle bisherigen Lernschritte<br />
gedanklich zu rekapitulieren <strong>und</strong> den<br />
systematischen Bezug der einzelnen Unterrichtsthemen<br />
herzustellen.<br />
Der gedankliche Brückenschlag geht über WFragen; die<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen werden z. B. angeregt,<br />
• was bei der Anfertigung technischer Zeichnungen zu<br />
berücksichtigen ist,<br />
• warum das Anreißen von Werkstücken erforderlich<br />
ist,<br />
• wozu ein <strong>Arbeit</strong>splan benötigt wird,<br />
• wie Toleranzen berechnet <strong>und</strong> eingezeichnet werden,<br />
• welche DINNorm die Darstellung der 3 Ansichten<br />
regelt, etc.<br />
Der Maschinenschraubstock wurde bzw. wird von den<br />
Schülern <strong>und</strong> Schülerinnen in der Metallwerkstatt<br />
selbst gefertigt. Es ist der erste Schritt hin zu einem<br />
Produkt, das aus mehreren Einzelteilen erstellt wird.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen werden mit einer Zus<strong>am</strong>menbauzeichnung<br />
<strong>und</strong> mit Einzelteilzeichnungen<br />
ausgestattet, anhand derer sie die Projektaufgabe erarbeiten<br />
können. Sie führen einen fast kompletten<br />
Planungs <strong>und</strong> Fertigungsablauf durch, der sich aus<br />
den Schritten<br />
• Anfertigung der Zeichnung(en)<br />
• Berechnung der Maße<br />
• Erfassung der technischen Zus<strong>am</strong>menhänge<br />
• Anfertigung der Stückliste<br />
• Herstellung des Produkts<br />
• Produktprüfung (Sicht <strong>und</strong> Funktionsprüfung)<br />
• Reflexion: Optimierungsüberlegungen<br />
Mit dieser Aufgabenstellung wird der Anspruch des<br />
Säulenmodells für die Planung <strong>und</strong> Durchführung des<br />
Unterrichts eingelöst.<br />
Anhang 3, Projekt 2: Herstellung eines<br />
Maschinenschraubstocks:<br />
Teil 1: Gr<strong>und</strong>platte<br />
Teil 2: Gleitleiste<br />
Teil 3: Gegenbock<br />
Teil 4: Haltestück<br />
Teil 5 + 9: Backenplatte<br />
Teil 6: Gleitbock<br />
Teil 7: Führungsplatte<br />
Teil 8 + 10: Druckplatte<br />
Teil 11: Führungsbock<br />
Teil 12: Gewindespindel<br />
Teil 13: Griff<br />
Drehzahldiagr<strong>am</strong>m, siehe Tabellenbuch<br />
S.230<br />
Werkzeugliste<br />
Anhang 4: Klassenarbeit 2<br />
Projekt: Herstellung eines Maschinenschraubstocks<br />
(Lernfelder 1 – 3:<br />
Fertigung <strong>und</strong> Montage)<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 75<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen K<br />
B<br />
…<br />
15<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen,<br />
• alle <strong>Arbeit</strong>sschritte, die zur Herstellung des<br />
Maschinenschraubstocks erforderlich sind,<br />
systematisch in einem <strong>Arbeit</strong>splan zu notieren;<br />
• die Ergebnisse ihrer Planungsarbeit in einer<br />
<strong>Arbeit</strong>smappe zu dokumentieren.<br />
Die in der Klassenarbeit enthaltenen Fragen zum Gleitbock,<br />
einem Bauteil des Maschinenschraubstocks, zielen<br />
darauf, die fachtheoretischen <strong>und</strong> mathematischen<br />
Kenntnisse zu belegen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> dieses Projekts, das sich über mehrere Wochen hinzieht, werden die<br />
Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen die Zus<strong>am</strong>menhänge zwischen Theorie <strong>und</strong> Praxis,<br />
zwischen Planung <strong>und</strong> Zeichnung, zwischen Einzelteil – <strong>und</strong> Zus<strong>am</strong>menbauzeichnung<br />
in Erfahrung bringen.<br />
Auch die <strong>Arbeit</strong> mit dem Tabellenbuch gewinnt im Kontext der gestellten Aufgaben<br />
an Bedeutung; die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, es als unentbehrliches<br />
Hilfsmittel zu nutzen.<br />
Die Schnittdarstellungen erhalten im weiteren Verlauf eine zunehmende Bedeutung,<br />
sodass die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen schrittweise mit den Details<br />
technischer Planung, die in Zeichnungen enthalten sind, vertraut gemacht<br />
werden. Welcher Stellenwert der technischen <strong>Kommunikation</strong> im Betriebsalltag<br />
zukommt, erschließt sich den Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen aus der zweckmäßigen<br />
Erstellung <strong>und</strong> Zus<strong>am</strong>menfügung technischer Komponenten, u.a. der<br />
Darstellung von Schnitten.<br />
Das Wissen geht von der „Hand in den Kopf“; die zuvor behandelten Teil<br />
Aspekte in einem technischen Prozess werden „im Kopf“ aggregiert <strong>und</strong> zu<br />
einem einheitlichen Bild zus<strong>am</strong>mengefügt.<br />
In der Erarbeitungsphase der Projektmappe kann die Lehrperson individuell auf<br />
die Schwierigkeiten der einzelnen Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen eingehen <strong>und</strong><br />
versuchen, partielle Wissenslücken zu schließen.<br />
Im Anschluss an die Projektmappe (Bewertung als Klassenarbeit), schreiben<br />
die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen eine Klassenarbeit, die sich auf ein Bauteil des<br />
Maschinenschraubstocks, den Gleitbock bezieht (16 Fragen).<br />
Unterrichtsmaterialien<br />
/<br />
<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 76<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
16 Schnittdarstellungen<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen ergänzen ihr Wissen um die<br />
3 Ansichten (Parallelprojektion; DreiTafelDarstellung)<br />
durch die Schnittdarstellung.<br />
Sie reflektieren, dass die Darstellung des Innenraums von<br />
Körpern zwar mithilfe unsichtbarer Linien gezeichnet<br />
werden kann, dass d<strong>am</strong>it aber die Beschaffenheit des<br />
Innenlebens von Hohlkörpern nicht eindeutig darzustellen<br />
ist.<br />
Sie lernen für bei der Darstellung von Schnitten, dass<br />
• die Schnittlinien schmale Volllinien sind (wie<br />
Maßlinien <strong>und</strong> Maßhilfslinien)<br />
• Schnittlinien im gleichen Abstand zu zeichnen sind<br />
• Schnitte nur da zu schraffieren, wo der Körper von<br />
einer Säge oder einem Messer tatsächlich zerschnitten<br />
worden wäre<br />
• in Schnittzeichnungen möglichst keine unsichtbaren<br />
Kanten gezeichnet werden<br />
• die Schraffur in der Regel unter 45° verläuft<br />
• Schraffuren immer in einer breiten Volllinie enden<br />
• Schraffuren bei großflächigen Schnitten einen<br />
größeren Abstand erhalten als bei kleinflächigen<br />
Schnitten<br />
• schmale Flächen geschwärzt werden können<br />
• Normteile wie Schrauben <strong>und</strong> Stifte nicht geschnitten<br />
werden<br />
• in Zus<strong>am</strong>menbauzeichnungen jedes Teil eine eigene<br />
Schraffur erhält<br />
• geschnittene Ansichten möglichst nicht bemaßt<br />
werden.<br />
Im Anschluss an die <strong>Arbeit</strong>en zur Herstellung des<br />
Maschinenschraubstocks werden die Regeln <strong>und</strong><br />
Normen im technischen Zeichnen, die sich bislang auf<br />
die DreiTafelProjektion bezogen, um den Punkt der<br />
Schnittdarstellung erweitert.<br />
Als Erkenntnis aus der Darstellung der Parallelprojektion<br />
wurde festgehalten (<strong>und</strong> an die Lernenden<br />
vermittelt), dass immer genau so viele Ansichten zu<br />
zeichnen sind, wie dies zum eindeutigen Erkennen,<br />
Bemaßen <strong>und</strong> Herstellen von Körpern erforderlich ist.<br />
Die Schnittdarstellung wird den Lernenden wie folgt<br />
erklärt:<br />
Bei Werkstücken mit komplizierten Durchdringungen,<br />
wie z. B. bei Hohlkörpern (siehe Voll <strong>und</strong> Schnittbilder<br />
A + B) ist es wichtig, dass alle Hohlräume eindeutig<br />
erkennbar sind. Diese können durch eine einfache<br />
Parallelprojektion nicht immer oder nur sehr aufwendig<br />
gezeichnet werden. Sollen die innen liegenden<br />
Formen sichtbar werden, verwendet man die Schnittdarstellung.<br />
Man denkt sich das Werkstück in einer Ebene<br />
„durchgeschnitten“. Der vordere Teil wird entfernt, so<br />
dass die Schnittflächen <strong>und</strong> die Hohlräume erkennbar<br />
werden. Dargestellt werden die Schnittflächen <strong>und</strong><br />
Hohlräume des hinteren Teils.<br />
Schnittbild A, Teil 1 + 2: Tonröhre<br />
(Reduzierstück);<br />
Schnittbild B, Teile 1 + 2: Buchse mit<br />
Kragen<br />
siehe Seite 47.<br />
Lektüreempfehlung:<br />
ITUnterricht – Teilbereich: <strong>Technische</strong>s<br />
Zeichnen/CAD Gr<strong>und</strong>wissen<br />
http://www.realschule.bayern.de/nb/it/jgst<br />
8/8cad/gr<strong>und</strong>lag/IT8IGr<strong>und</strong>lagTZ03<br />
8_0.pdf<br />
<strong>und</strong>/oder<br />
http://www.rs1kronach.de/cad/fortbildung<br />
en/Gr<strong>und</strong>wissenTZ.pdf<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 77<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
…<br />
16<br />
Im Unterschied zum Vollschnitt wird nur eine Seite im<br />
Schnitt gezeichnet. Die andere Seite wird in einer<br />
normalen Ansicht dargestellt, jedoch ohne unsichtbare<br />
Linien. Bei einem Teilschnitt werden nur einzelne Bereiche<br />
eines Körpers im Schnitt dargestellt, um die<br />
Lesbarkeit der Zeichnung zu vereinfachen.<br />
Die Lernenden können die Vorteile der Schnittdarstellung<br />
daran erkennen, dass mitunter nur ein Schnitt<br />
genügt, um die Form eines komplizierten Werkstücks<br />
aufzudecken <strong>und</strong> alle Maße auf den nun sichtbaren<br />
Flächen aufzutragen. Der positive Effekt der Schnittdarstellung<br />
– dies können sie an den Modellen erkennen<br />
– besteht in der Verbesserung der Verständlichkeit<br />
einer Zeichnung. Der negative Effekt besteht in<br />
der wesentlich größeren Anzahl der dabei einzuhaltenden<br />
Regeln als dies bei einer „normalen“<br />
Zeichnung in 3 Ansichten der Fall ist.<br />
Im Unterrichtsprozess werden anhand von Modellen<br />
<strong>und</strong> Zeichnungsvorlagen die Regeln eingeübt.<br />
Gleichzeitig werden die Zeichnungen auch <strong>am</strong> PC im<br />
technischen InformatikUnterricht gezeichnet ( siehe<br />
dazu: www.realschule.bayern.de).<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 78<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
17 Wahre Größen<br />
Ausgangspunkt:<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen wissen, dass<br />
Raumkörper im Schrägbild verzerrt dargestellt<br />
werden. In der Vorstellung ist es zwar möglich,<br />
die Form <strong>und</strong> Lage von Schnittflächen zu entwerfen,<br />
es bleibt allerdings die praktische<br />
Schwierigkeit, die wahre Form der Schnittflächen<br />
zeichnerisch darzustellen.<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen lernen, was sie<br />
bei der Anfertigung bzw. der Ermittlung der<br />
wahren Größe Schritt für Schritt zu berücksichtigen<br />
haben, dass<br />
• die Ansicht nicht der tatsächlichen Größe<br />
entspricht,<br />
• man die wahre Größe nur erhält, indem<br />
man senkrecht auf ein Teil schaut,<br />
• sich durch Drehen der Punkte in einer<br />
Ansicht die wahre Größe darstellen lässt.<br />
<strong>Technische</strong> Zeichnungen werden immer so gefertigt, dass der<br />
Zeichner senkrecht auf einen Körper blickt. In vielen Fällen ist<br />
dies aber nicht möglich, sodass die Darstellung der tatsächlichen<br />
Größe nur durch die Anwendung eines speziellen Zeichenverfahrens<br />
gelingt.<br />
Unter Rückbezug auf die Lerneinheit 13, in der die räumliche<br />
Darstellung sowie Abwicklungen behandelt wurden, werden erneut<br />
geometrische Gr<strong>und</strong>konstruktionen thematisiert. Im Anschluss<br />
daran werden die Zeichnungen 1 – 3 über die<br />
Konstruktion von Hilfsschnittlinien weiter entwickelt:<br />
„Zur Konstruktion der Schnittkurve eines schräg geschnittenen<br />
Zylinders sowie zur Ermittlung der wahren Größe der Schnittfläche<br />
ist es zweckmäßig, zuerst den Zylindermantel in der<br />
Draufsicht gleichmäßig zu unterteilen. Die Teilungspunkte erhalten<br />
fortlaufende Ziffern. Man denkt sich Hilfsschnitte parallel<br />
zur Zylinderachse durch entsprechende Teilungspunkte der<br />
Draufsicht, z. B. 4 <strong>und</strong> 8, gelegt. Dort, wo sich in der Seitenansicht<br />
die Umrisslinien der entsprechenden Hilfsschnittfläche mit<br />
der Körperschnittfläche schneiden, liegen Punkte der Schnittkurve.<br />
Die Umrisslinien der Hilfsschnittfläche ermittelt man durch<br />
senkrechte <strong>und</strong> waagrechte Projektionsstrahlen.<br />
Zum Bestimmen der wahren Größe der Deckfläche errichtet man<br />
in der Vorderansicht auf der Schnittgeraden in den Teilungspunkten<br />
Senkrechte <strong>und</strong> überträgt die in der Draufsicht abgegriffenen<br />
halben Sehnenlängen (z. B. a) beiderseits der Mittellinie<br />
auf die zugehörigen Senkrechten.“ Vgl.<br />
http://www.donchunior.at/konstrukteur/zwischenpruefung/html_file<br />
s/zw_prf_1110.html#zylinderschnitte, letzer Zugriff: 20111030<br />
Zeichnungen 1 3: Wahre Größe der<br />
Fläche mit den Pfeilen, siehe Seite 49.<br />
Lektüreempfehlung:<br />
Zum besseren Verständnis der wahren<br />
Größe kann die folgende Darstellung<br />
verwendet werden:<br />
www.donchunior.at/.../zw_prf_1110.html<br />
http://www.rs1kronach.de/cad/aufgaben/I<br />
T9ILehrplan9_1.pdf<br />
Aufgaben dazu, siehe auch:<br />
http://www.andiraez.ch/schule/DossierWu<br />
erfel<strong>und</strong>Quader.pdf<br />
Erklärung anhand des Quaders von<br />
http://www.andiraez.ch/schule/DossierWu<br />
erfel<strong>und</strong>Quader.pdf, Seite 15 (siehe<br />
Kopiensatz)<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 79<br />
LE Ziele / Inhalte Didakt. meth. Anregungen KB Unterrichtsmaterialien /<strong>Arbeit</strong>smittel<br />
18 Planung <strong>und</strong> Umsetzung eines Projekts für einen Mitschüler<br />
Die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen reflektieren alle Lernschritte<br />
auf dem Weg von<br />
• den Gr<strong>und</strong>lagen der <strong>Kommunikation</strong> über<br />
• den <strong>Arbeit</strong>splan, die Zeichnung <strong>und</strong> die Stückliste,<br />
• den jeweils dazu stattgef<strong>und</strong>enen praktischen<br />
Übungen,<br />
• den Regeln der räumlichen Darstellung von Körpern<br />
<strong>und</strong> ihren Schnitten bis zur<br />
• Fertigung <strong>und</strong> Funktionsprüfung eines Bauteils<br />
(Projekt NN).<br />
In einem Lehrervortrag werden die Lerneinheiten abschließend<br />
in ihrem systematischen Zus<strong>am</strong>menhang<br />
dargestellt. <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong>, so wie sie<br />
in ihren einzelnen Lerneinheiten erklärt wurde, bildet<br />
als <strong>Lernbaustein</strong> ein essenzielles Element in der<br />
Orientierung <strong>und</strong> Vorbereitung auf technische Berufsfelder.<br />
Der sich durch alle 17 LE ziehende „rote<br />
Faden“ strukturiert alle Schritte in einem Planungs,<br />
Fertigungs <strong>und</strong> Konstruktionsprozess. Fehler <strong>und</strong><br />
Mängel, die innerhalb dieser Prozesskette entstehen<br />
<strong>und</strong> nicht beseitigt werden, erzeugen Probleme, die in<br />
einem entscheidenden Punkt zus<strong>am</strong>menlaufen: den<br />
Kosten.<br />
Zum Abschluss des <strong>Lernbaustein</strong>s <strong>Technische</strong><br />
<strong>Kommunikation</strong> steht die Aufgabe für die Schüler <strong>und</strong><br />
Schülerinnen, ein Bauteil zu zeichnen <strong>und</strong> zu<br />
konstruieren <strong>und</strong> diesen Entwurf dann an einen Mitschüler<br />
zu übergeben, der das Bauteil herstellt. Als<br />
Vorlage erhalten die Lernenden eine entsprechende<br />
Aufgabe (Vorschlag: Anhang 5)<br />
Anhang 5: Bauteilskizze Winkelverbindung<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
80 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
6 Bezüge zu für den Bildungsgang relevanten Ausbildungsordnungen<br />
Die <strong>Lernbaustein</strong>e sind Element der Berufsausbildungsvorbereitung. Durch den Berufsfeldbezug<br />
des Bildungsgangs sind Bezüge auf die Inhalte <strong>und</strong> Anforderungen technischer Ausbildungsberufe<br />
inplizit angelegt.<br />
Die Palette der Berufe, in die die Jugenlichen nach Abschluss ihres Jahrs an der BFS einmünden,<br />
ist breit. Da in erster Linie Gr<strong>und</strong>lagen vermittetl werden, sind die im <strong>Lernbaustein</strong> vermittelten<br />
Kompetenzen jedoch als Vorbereitung auf die Anforderungen dieser Palette von Nutzen. Die im<br />
Folgenden gegebene Darstellung in Bezug auf einen ausgewählten möglichen Zielberuf ist insofern<br />
lediglich exemplarisch.<br />
Es versteht sich von selbst, dass der Bezug auf die genannten Berufsbildpositionen nicht in dem<br />
Sinn zu verstehen ist, dass die jeweiligen in der Ausbildung zu vermittelnden Kompetenzen im<br />
Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung bereits in entsprechender Breite <strong>und</strong> Tiefe erworben<br />
wurden.<br />
Bezug:<br />
Verordnung über die Ausbildung zum Metallbauer/zur Metalbauerin vonm 25.07.2008<br />
Der <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> bezieht sich auf folgende Berufsbildpositionen:<br />
• Betriebliche, technische <strong>und</strong> k<strong>und</strong>enorientierte <strong>Kommunikation</strong><br />
(§ 4 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 5)<br />
• Planen <strong>und</strong> Steuern von <strong>Arbeit</strong>sabläufen; Kontrollieren <strong>und</strong> Beurteilen der <strong>Arbeit</strong>sergebnisse<br />
(§ 4 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 6)<br />
• Prüfen <strong>und</strong> Messen (§ 4 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 8)<br />
• Manuelles Spanen <strong>und</strong> Umformen (§ 4 Abs. 2 Abschnitt A Nr. 10)<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 81<br />
7 Nachweis der erworbenen Kompetenzen<br />
Berufsfachschule für Technik – An der Weserbahn 4 - 28195 Bremen - Telefon 0421 - 361 181 46 - dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Bescheinigung als Anlage zum Zeugnis<br />
Wir wünschen Frau / Herrn XXXXXX alles Gute <strong>und</strong> viel Erfolg auf ihrem<br />
weiteren Berufs- <strong>und</strong> Lebensweg.<br />
Bremen, 10. Juli 2012<br />
Frau / Herr XXXXXX besuchte im Schuljahr 201X/201Y die<br />
einjährige Berufsfachschule für Technik. Neben den<br />
bescheinigten Unterrichtsfächern nahm der Lernende<br />
erfolgreich an der Vermittlung des folgenden <strong>Lernbaustein</strong>es<br />
teil:<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Die vermittelten Inhalte beziehen sich auf die Lernfelder 1-4<br />
des Ausbildungsrahmensplans der industriellen Metallberufe.<br />
� Bedeutung der <strong>Kommunikation</strong> n der Technik<br />
� Elemente einer Zeichnung<br />
� Darstellungsarten<br />
� Stücklisten<br />
� <strong>Arbeit</strong>spläne<br />
� Maßeintragungen<br />
� Geometrische Gr<strong>und</strong>konstruktionen<br />
� Wahre Größen<br />
Schulleiterin / Schulleiter Abteilungsleiterin / Abteilungsleiter<br />
<strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Bremen- Mitte – An der Weserbahn 4 - 28195 Bremen - Telefon 0421 - 361 16770 www.tbz-bremen.de<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
82 <strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
8 Literaturnachweise<br />
Jacobs 2010<br />
Jacobs, Dirk: Vertiefte Berufsorientierung Vermittlung von Schlüsselqualifikationen : Ergebnisbeobachtung,<br />
Abschlussbericht <strong>und</strong> Ausblick. <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte, Bremen<br />
November 2010.<br />
LPRP 1999<br />
Ministerium für Bildung, Wissenschaft <strong>und</strong> Weiterbildung RheinlandPfalz (Hrsg.): Lehrplan<br />
Wahlpflichtfach <strong>Technische</strong>s Zeichnen, Realschule 7. <strong>und</strong> 8. Klasse. Grünstadt (SOMMER Druck<br />
<strong>und</strong> Verlag) 1999.<br />
Download: http://lehrplaene.bildungrp.de/nocache/lehrplaenenachfaechern.html?<br />
tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid<br />
%5D=236&tx_abdownloads_pi1%5Bcid%5D=5786 (letzter Zugriff: 20111027).<br />
VO BFS Technik<br />
Verordnung über die Berufsfachschule für Technik vom 7. November 2000, zuletzt geändert 19. 5.<br />
2011. [TkBFSchVO] [TechnikBerufsfachschulverordnung] Download:<br />
http://712.joomla.schule.bremen.de/gesetze/html/439_01.htm<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
<strong>Lernbaustein</strong> <strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong> 83<br />
9 Materialanhang<br />
ESFProjekt OptiQua <strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Mitte (TBZ)
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 1<br />
Projekt 1: N<strong>am</strong>ensschild planen <strong>und</strong> anfertigen<br />
Am 5. August 2010 sind Sie an Ihrem neuen <strong>Arbeit</strong>splatz angekommen <strong>und</strong> mit Kollegen<br />
zus<strong>am</strong>men, die Sie nicht kennen. Sie möchten nicht gerne mit „Hallo, du da...“<br />
angesprochen werden. Auch Ihr Kollege würde sich über diese Anrede nicht freuen, weshalb<br />
es sinnvoll <strong>und</strong> zweckmäßig ist, wenn man sich durch ein N<strong>am</strong>ensschild, auf dem der Vor-<br />
<strong>und</strong> Nachn<strong>am</strong>e steht, zu erkennen gibt. Aus diesem Gr<strong>und</strong> benötigen Sie ein N<strong>am</strong>ensschild<br />
für Ihren <strong>Arbeit</strong>sanzug, für Ihren Pullover oder Ihr Hemd.<br />
Die Vorgabe vom Auftraggeber ist, dass das Schild für Ihren <strong>Arbeit</strong>sanzug aus Metall<br />
bestehen soll.<br />
Aufgabe: Fertigen Sie eine Projektmappe (DIN A4) an<br />
1. Ein selbstgestaltetes Deckblatt (Bilder, Skizzen…) 5P<br />
2. Ein Inhaltsverzeichnis (zum Schluss anfertigen) 5P<br />
3. Überlegen <strong>und</strong> schreiben Sie auf, welche Aufgaben N<strong>am</strong>ensschilder haben. Was<br />
verbinden Sie d<strong>am</strong>it, wenn Menschen ein N<strong>am</strong>ensschild tragen? (Text) 5P<br />
4. Erstellen Sie eine Skizze für Ihren Entwurf mit Größenangaben (Zeichnung) 10P<br />
5. Erstellen Sie eine Stückliste für die Materialien, die Sie benötigen (Position, N<strong>am</strong>e,<br />
Werkstoff, Norm, Rohmaße…) 10P<br />
6. Überlegen <strong>und</strong> begründen Sie, wie Sie die Befestigung vornehmen können (Text,<br />
mehr als eine Möglichkeit) 10P<br />
7. Erstellen Sie einen <strong>Arbeit</strong>splan (<strong>Arbeit</strong>sgang, N<strong>am</strong>e, Werkzeuge) 20P<br />
8. Stellen Sie eine Liste mit Werkzeugen zus<strong>am</strong>men, die Sie benötigen (Werkzeugliste) 5P<br />
9. Welches Material wollen Sie einsetzen <strong>und</strong> warum nicht ein anderes?<br />
(Werkstoffk<strong>und</strong>e) 10P<br />
10. Wie schwer ist das N<strong>am</strong>ensschild aus Aluminium? (fertige Form, Rechenübung) 10P<br />
11. Welche Gefahren können bei der Herstellung auftreten? (Unfallverhütung) 5P<br />
12. Erklären Sie, aus welcher Quelle Ihre Informationen st<strong>am</strong>men <strong>und</strong> bestätigen Sie<br />
durch Ihre Unterschrift, dass Sie die Mappe eigenständig angefertigt haben.(Text) 5P<br />
13. Äußern Sie Ihre Meinung zu dieser Art des Unterrichts – die positive oder negative<br />
Beurteilung geht nicht in die Bewertung ein. (Text) 0P<br />
Ges<strong>am</strong>t: 100 Punkte<br />
Abgabe: Mittwoch, 29.09.2010<br />
Viel Erfolg
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 2<br />
Lernfeld 1 Fertigung, <strong>Lernbaustein</strong> technische <strong>Kommunikation</strong><br />
Klassenarbeit<br />
N<strong>am</strong>e:<br />
Zugelassene Hilfsmittel: Tabellenbuch, Taschenrechner<br />
Erreichbare Punktzahl: 114 (+5) Punkte, 57 Punkte = ausreichend<br />
Fertigungstechnik<br />
1. Sie haben in den letzten Wochen unter anderem auch <strong>Arbeit</strong>spläne erstellt.<br />
Welche drei Spalten sind in einem <strong>Arbeit</strong>splan mindestens erforderlich? Schreiben<br />
Sie die Überschriften auf. 6P<br />
1.______________________________________________<br />
2.______________________________________________<br />
3.______________________________________________<br />
2. Schreiben Sie einen <strong>Arbeit</strong>splan für die Anfertigung einer Bohrung mit dem<br />
Durchmesser 8mm in ein Stück Flachstahl. Denken Sie genau darüber nach, welche<br />
Tätigkeiten Sie mit welchen Vorrichtungen <strong>und</strong> Hilfsmitteln erledigt haben. 30P<br />
_______________________________________________________________________
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
3. Erklären Sie die Begriffe: 9P<br />
1. spitzer Winkel__________________________________________________________<br />
2. rechter Winkel _________________________________________________________<br />
3. stumpfer Winkel ________________________________________________________<br />
4. Was verstehen Sie unter einer Maßbezugskante? 6P<br />
_______________________________________________________________________<br />
5. Was verstehen Sie im Zus<strong>am</strong>menhang mit dem Begriff Gewinde unter den<br />
Bezeichnungen? 9P<br />
• Steigung _____________________________________________________________<br />
• Kernlochdurchmesser __________________________________________________<br />
• Schlüsselweite ________________________________________________________<br />
6. Wie heißen die vier folgenden Gegenstände, die Sie auf den zwei Bildern sehen?<br />
12P<br />
• 1. ____________________________________<br />
• 2. ____________________________________<br />
• 3. ____________________________________<br />
• 4. ____________________________________<br />
7. Auf welche drei Punkte müssen Sie beim Zeichnen von Mittellinien achten? 9P<br />
1.______________________________________________<br />
2.______________________________________________<br />
3.______________________________________________<br />
8. Was verstehen Sie unter folgenden vier Begriffen? 12P<br />
1. Nennmaß _____________________________________<br />
2. Allgemeintoleranz_______________________________<br />
3. Abmaß _______________________________________<br />
4. Istmaß________________________________________
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
9. Welche Steigung hat das Gewinde M36? 3P<br />
_______________________________________________________________________<br />
10. Welchen Längenausdehnungskoeffizienten (mit Einheit) hat Stahl? 3P<br />
_______________________________________________________________________<br />
11. Welche Dichte hat Aluminium (mit Einheit)? 3P<br />
_______________________________________________________________________<br />
12. Unten sehen Sie sechs Schrägbilder. Ordnen Sie den Schrägbildern jeweils die<br />
Vorderansicht <strong>und</strong> die Seitenansicht zu! 12P<br />
Schrägbild<br />
Vorderansicht<br />
Seitenansicht<br />
a b c d e f<br />
Hier Abbildung von sechs Schrägbildern (a-f) <strong>und</strong> deren nicht zugeordnete Vorder-<br />
<strong>und</strong> Seintenansichten (1-6) einfügen.<br />
Zusatzfrage: Was war <strong>am</strong> 28.12.1979 als in Lübeck, als eine Frau mit langen blonden<br />
Haaren in einem weißen Kleid mit einem Schornsteinfeger im Schnee tanzte? 5P<br />
Fach<br />
Fertigungstechnik,<br />
<strong>Lernbaustein</strong><br />
<strong>Technische</strong> <strong>Kommunikation</strong><br />
Erreichbare<br />
Punktzahl<br />
114 (+5)<br />
Erreichte<br />
Punktzahl<br />
Prozentsatz Note<br />
Prozentzahl Note Prozentzahl Note Prozentzahl Note<br />
0 - < 30 6 50 - < 67 4 81 - < 92 2<br />
30 - < 50 5 67 - < 81 3 ≥ 92 1
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 3<br />
Projekt 2 Herstellung eines Maschinenschraubstocks<br />
Lernfeld 1 + 2 + 3 Fertigung <strong>und</strong> Montage<br />
Für Ihre Tätigkeit in der Werkstatt benötigen Sie einen Maschinenschraubstock, d<strong>am</strong>it Sie<br />
die Bauteile unter Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften herstellen können. Der<br />
Zeichnungssatz mit fünf Blättern ist Bestandteil der Aufgabe. Sollten Sie bei der Fertigung<br />
Veränderungen in der Ausführung vornehmen, so ist dies gestattet <strong>und</strong> gewünscht, solange<br />
die Funktion des Schraubstocks gewährleistet bleibt.<br />
Achtung: Die in den Zeichnungen angegebene Werkstoffbezeichnung <strong>und</strong> die Normen sind<br />
teilweise veraltet. Erk<strong>und</strong>en <strong>und</strong> verwenden Sie die neuen Bezeichnungen!<br />
Aufgabe: Fertigen Sie eine Projektmappe (DIN A4) an: Punkte:<br />
1. Ein selbstgestaltetes Deckblatt 5<br />
2. Ein Inhaltsverzeichnis 5<br />
3. Erstellen Sie die Stückliste für das Material, das Sie benötigen 15<br />
4. Erstellen Sie eine normgerechte Zeichnung der Gr<strong>und</strong>platte mit Maßangaben in drei<br />
Ansichten 20<br />
5. Erstellen Sie eine Liste mit Werkzeugen, die Sie zur Fertigung des Maschinenschraubstocks<br />
benötigen, inklusive Anreißzeuge 5<br />
6. Erstellen Sie eine Liste mit Messzeugen, die Sie für die Herstellung <strong>und</strong> Kontrolle benötigen,<br />
aufgeteilt nach Messzeugen <strong>und</strong> Lehren 5<br />
7. Erstellen Sie <strong>Arbeit</strong>spläne für folgende Einzelteile: Teil 1, 2, 3, 5 40<br />
8. Berechnen Sie die Masse der in der Stückliste angegebenen Fertigteile (ρ=7,85kg/dm³),<br />
Bohrungen, Radien <strong>und</strong> Nuten bleiben unberücksichtigt 10<br />
9. Wenn ein kg Stahl 1,20 €/kg kostet, was kosten die Werkstücke dann insges<strong>am</strong>t? Rechnen<br />
Sie 25% Verschnitt dazu! 10<br />
10. Zum Bohren setzen Sie einen Bohrer aus Schnellarbeitsstahl ein. In einer Tabelle im<br />
Tabellenbuch finden Sie die Schnittgeschwindigkeit vc in m/min. Wie groß sind die maximalen<br />
Drehzahlen der Bohrer einzustellen für die zu bohrenden Bohrungsdurchmesser von 13mm,<br />
9mm, 7,0mm, 6,5mm, 6,0mm, 5,0mm? 10<br />
11. Sie müssen Gewindeschneiden: M16, M5, M6. Mit welchen Bohrern müssen Sie vorbohren?<br />
10<br />
12. Wie ist der <strong>Arbeit</strong>sablauf beim Gewindeschneiden? Erstellen Sie einen <strong>Arbeit</strong>splan. 10<br />
13. Welche Unfallgefahren sollen mit der Verwendung eines Maschinenschraubstocks reduziert<br />
werden? 10
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
14. Welche Gefahren können bei der Herstellung des Maschinenschraubstocks auftreten? 10<br />
15. Wie kann die Gefahr des Verrostens reduziert werden? Nennen <strong>und</strong> beschreiben Sie<br />
Methoden des Korrosionsschutzes? 10<br />
16. Welche Methoden zur Verbindung von Werkstücken werden bei dem Maschinenschraubstock<br />
angewandt? Nennen Sie weitere zwei mit deren Vor- <strong>und</strong> Nachteilen? 20<br />
17. Erklärung Sie, woher Ihre Informationen st<strong>am</strong>men. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass<br />
Sie die Mappe eigenständig angefertigt haben. 5<br />
Ges<strong>am</strong>t: 200 Punkte
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Zeichnungssatz:
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Stückliste:
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Einzelteilzeichnungen:<br />
Teil 1 Gr<strong>und</strong>platte<br />
Teil 2 Gleitleiste<br />
Teil 3 Gegenbock<br />
Teil 5 <strong>und</strong> Teil 9 Backenplatte<br />
Teil 4 Haltestück
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Teil 6 Gleitbock<br />
Teil 7 Führungsplatte Teil 8 Druckplatte<br />
Teil 10 Druckplatte
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Teil 11 Führungsbock<br />
Teil 12 Gewindespindel<br />
Teil 13 Griff
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Drehzahldiagr<strong>am</strong>m (Tabellenbuch S. 239)
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
4,00 Spiralbohrer 1990 1/min vc =25m/min<br />
4,20 Spiralbohrer für M5 1896 1/min vc =25m/min<br />
4,80 Spiralbohrer Reiben 5,0 1659 1/min vc =25m/min<br />
5,00 Spiralbohrer für M6 1592 1/min vc =25m/min<br />
5,50 Spiralbohrer 1448 1/min vc =25m/min<br />
6,60 Spiralbohrer 1206 1/min vc =25m/min<br />
8,00 Spiralbohrer 995 1/min vc =25m/min<br />
8,20 Spiralbohrer 971 1/min vc =25m/min<br />
10,00 Spiralbohrer 796 1/min vc =25m/min<br />
14,00 Spiralbohrer für M16 569 1/min vc =25m/min<br />
15,00 Spiralbohrer 531 1/min vc =25m/min<br />
20,00 Kegelsenker 90° 159 vc =10m/min<br />
11,00 Plansenker 290 vc =10m/min<br />
5,00 Reibahle H7 von Hand 510 vc =8m/min<br />
M16 Satz Gewindeschneidebohrer<br />
M5 Satz Gewindeschneidebohrer<br />
M6 Satz Gewindeschneidebohrer<br />
Windeisen Schraubendreher<br />
Meißel Innensechskantschlüssel<br />
Bügelsäge H<strong>am</strong>mer<br />
Flachfeile, grob R<strong>und</strong>feile<br />
Flachfeile, fein<br />
Anreißplatte Schlagstempel<br />
Schutzbacken Körner<br />
Schraubstock Reißnadel<br />
Zirkel<br />
Parallelreißer<br />
Grenzlehrdorn 5 H7 Messschieber<br />
Radienlehre Stahlmaß 300mm<br />
Flachwinkel 90°<br />
Anschlagwinkel 90°<br />
Menge Benennung <strong>und</strong> Bemerkungen lfd.Nr. Werkstoff<br />
Datum N<strong>am</strong>e Hinweise<br />
gezeichnet 02.01.2010 Jacobs übertragen<br />
geprüft vom 10.9.82<br />
Berufsfachschule für Technik Meyerdierks Blattnummer Werkzeugliste
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 4 Klassenarbeit zum Maschinenschraubstock<br />
Lernfeld 1 + 2 + 3 Fertigung <strong>und</strong> Montage<br />
Zugelassene Hilfsmittel: Tabellenbuch, Taschenrechner<br />
Aufgabe: Herstellung eines Maschinenschraubstocks<br />
Sie haben in den letzten Wochen eine Projektmappe erstellt. In dieser Projektmappe waren<br />
verschiedene Aufgaben zu lösen. Dieser Test ist die Prüfung Ihrer Kenntnisse, die Ihnen im<br />
Unterricht vermittelt wurden <strong>und</strong> bei Ihnen nun als Wissen über die Eigenarten eines<br />
technischen Gegenstandes vorliegen. An einem Teil des Schraubstocks, der aus den<br />
Zeichnungen herausgezogen wurde, können Sie Ihre erworbenen Kenntnisse unter Beweis<br />
stellen.<br />
Gleitbock, S235 JR<br />
Alle nicht tolerierten Maße<br />
nach Allgemeintoleranz<br />
mittel<br />
Lösen Sie folgende Aufgaben; alle Aufgaben beziehen sich auf den Gleitbock<br />
Punkte<br />
1. Erstellen Sie eine Liste mit Werkzeugen, die Sie zur Fertigung des Gleitbocks<br />
benötigen: 10<br />
a. Bohrer 4,2 + 15, Zapfensenker 11,0 + 6,6 Gewindebohrersatz M5, Feile,<br />
Senker zum Entgraten
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
2. Erstellen Sie eine Liste der Anreißzeuge: 10<br />
a. H<strong>am</strong>mer, Körner, Stahlmaß, Höhenreißer, Anschlagwinkel, Flachwinkel<br />
3. Erstellen Sie eine Liste mit Messzeugen, die Sie für die Herstellung <strong>und</strong> Kontrolle<br />
benötigen, aufgeteilt nach Messzeugen <strong>und</strong> Lehren 10<br />
a. Stahlmaß, Mess-Schieber<br />
b. Flachwinkel, Anschlagwinkel, 45°Winkel<br />
4. Wie groß ist die Toleranz des Maßes 22mm <strong>und</strong> 60mm? 10<br />
a. 60mm±0,3mm; 22mm±0,2mm<br />
5. Erstellen Sie den <strong>Arbeit</strong>splan (in Stichworten) 30<br />
a. Material 20*25 aus dem Lager holen,<br />
b. auf Länge 81 absägen,<br />
c. Teil winklig auf Maß feilen 80±0,3mm; 20±0,2; 25±0,2<br />
d. vier Bohrungen 4,2mm anreißen<br />
e. zwei Flachsenkungen 11mm <strong>und</strong> Bohrungen anreißen<br />
f. eine Bohrung 15mm anreißen<br />
g. Bohren<br />
h. viermal Gewindeschneiden M5<br />
i. alle Bohrungen entgraten<br />
j. Phase 45° dreiseitig anbringen<br />
6. Berechnen Sie die Rohmasse des Gleitbocks (ρ=7,85kg/dm³), Bohrungen, Radien<br />
<strong>und</strong> Nuten bleiben unberücksichtigt. 10<br />
a. m = l x b x h x ρ<br />
b. m = 8,0cm * 2cm * 2,5cm * 7,85g/cm³<br />
c. m = 314g<br />
7. Wenn ein kg Stahl 1,25 €/kg kostet, was kostet dann der Gleitbock? 10<br />
a. Kosten = m * Kosten / kg<br />
b. K = 0,314kg * 1,25 €/kg<br />
c. K = 0,40€<br />
8. Rechnen Sie 40% Verschnitt dazu! Was kostet der Gleitbock incl. Verschnitt? 10<br />
a. K = 0,40€ * 1,4 = 0,56€<br />
9. Zum Bohren setzen Sie einen Bohrer aus Schnellarbeitsstahl ein. In einer Tabelle im<br />
Tabellenbuch finden Sie die Schnittgeschwindigkeit vc in m/min. Wie groß sind die<br />
maximalen Drehzahlen der Bohrer einzustellen für die zu bohrenden<br />
Bohrungsdurchmesser von 15mm / 11mm / 6,6mm / 4,0mm? 10<br />
a. n = vc / (d x π) vc = 20 m/min (Tb Seite 241)<br />
b. n15 = 424 u/min n11 = 579 u/min n6,6 = 965 u/min n4= 1592 u/min<br />
10. Sie müssen Gewinde schneiden: M5, Mit welchen Bohrer müssen Sie vorbohren? 10<br />
4,2mm (Tabellenbuch Seite 172)
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
11. Erstellen Sie (in Stichworten) einen <strong>Arbeit</strong>splan für den Vorgang Gewindeschneiden.<br />
10<br />
a. Loch Anreißen<br />
b. Loch vorbohren<br />
c. mit Gewindebohrer Satz, Vorbohren<br />
d. Gewinde fertig schneiden<br />
e. Entgraten<br />
12. Welche Funktion hat der Gleitbock? Wie wird er bewegt? 10<br />
a. Er wird mit der Gewindespindel vor- <strong>und</strong> zurückgeschoben <strong>und</strong> dient zum<br />
Einklemmen des Werkstücks.<br />
13. Was zählt zu ihrer PSA (Persönlichen Schutzausrüstung) in der Werkstatt 10<br />
a. Sicherheitsschuhe<br />
b. Handschuhe<br />
c. Schutzbrille<br />
d. Lärmstopp für Ohren<br />
e. <strong>Arbeit</strong>skleidung<br />
14. Wie kann die Gefahr des Verrostens reduziert werden? Nennen Sie zwei Methoden<br />
des Korrosionsschutzes? 10<br />
a. Lackieren<br />
b. Verzinken<br />
c. Verchromen<br />
d. Vergolden<br />
15. Mit welcher Fügemethode wird der Gleitbock mit dem Rest des Maschinenschraubstocks<br />
verb<strong>und</strong>en? 10<br />
a. Mit einer Schraubverbindung<br />
16. Nennen Sie Vor- <strong>und</strong> Nachteile der Verbindungsmethode, mit der der Gleitbock mit<br />
dem Maschinenschraubstock verb<strong>und</strong>en ist. 10<br />
a. Schrauben hat den Vorteil, das die Teile demontiert werden können<br />
b. Schrauben hat den Nachteil, das es sich lösen kann <strong>und</strong> man eine<br />
Schraubensicherung einrichten muss<br />
Ges<strong>am</strong>t 180 Punkte<br />
Fach<br />
Erreichbare<br />
Punktzahl<br />
Fertigungstechnik 180<br />
Erreichte<br />
Punktzahl<br />
Prozentsatz Note<br />
Prozentzahl Note Prozentzahl Note Prozentzahl Note<br />
0 - < 30 6 50 - < 67 4 81 - < 92 2<br />
30 - < 50 5 67 - < 81 3 ≥ 92 1
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 5<br />
Erstellen einer Winkelverbindung: planen, berechnen <strong>und</strong> anfertigen<br />
Ausgangssituation Vorbemerkung<br />
Sie, die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler der Berufsfachschule für Technik haben in ihrer<br />
Schulausbildungszeit <strong>am</strong> <strong>Technische</strong>n Bildungszentrum Bremen-Mitte (TBZ) die Chance, sich<br />
intensiv mit dem <strong>Arbeit</strong>sfeld vertraut zu machen. Ziel ist die erweiterte Berufsbildungsreife mit<br />
dem möglichen Übergang in eine duale Ausbildung. Um dies zu erreichen, müssen Sie in Ihre<br />
bis hierher erworbenen Fertigkeiten <strong>und</strong> Fähigkeiten darlegen. Dieser <strong>Lernbaustein</strong> soll Ihnen<br />
als Beispiel für eine Projektaufgabe helfen sich auf die Anforderungen der Dualen Ausbildung<br />
vorzubereiten.<br />
Berufsfeldbezug<br />
Bei der vorliegenden Aufgabe handelt es sich um ein typisches Bauteil aus dem Bereich der<br />
Metallverbindungen, das Sie sowohl im Containerbau, Brückenbau oder Rahmenbau vorfinden.<br />
Wir haben daraus ein Teil gewählt, d<strong>am</strong>it der Aufwand nicht zu groß wird. Sie sollen in der<br />
Werkstatt dieses Teil nicht nur herstellen, sondern sollen dieses Teil auch planen, berechnen<br />
<strong>und</strong> zeichnen. Bei der Planung sollen Sie sich gerne mit Ihren Mitschülern besprechen. Bauen<br />
sollen Sie diese Einheit jedoch nach den Zeichnungen, Stücklisten <strong>und</strong> <strong>Arbeit</strong>splänen eines<br />
anderen Schülers aus Ihrer Lerngruppe.<br />
Auftrag<br />
Stellen Sie die im Bild festgehaltene lösbare Eckverbindung<br />
her. Dieses Bauteil braucht der Containerhersteller<br />
„EUROCARGO“ in großer Stückzahl. Bei diesem Auftrag<br />
geht es um die Erstellung eines Musters, d<strong>am</strong>it ein<br />
Festigkeitstest gemacht werden kann. Aus diesem Gr<strong>und</strong><br />
sollen verschiedene Schrauben Verwendung finden. Um<br />
den Auftrag fachgerecht zu erledigen brauchen Sie Ihre<br />
Kollegen, d<strong>am</strong>it Sie gemeins<strong>am</strong> herausfinden, wie dieses<br />
Bauteil <strong>am</strong> einfachsten zu fertigen ist. Bei der <strong>Arbeit</strong> ist eine<br />
permanente Eigenkontrolle <strong>und</strong> sorgfältiges <strong>Arbeit</strong>en<br />
notwendig. Da der K<strong>und</strong>e auch im englischen Sprachraum<br />
Auftraggeber für diesen neuen Containertyp hat, ist eine<br />
kurze Beschreibung auf Englisch notwendig. Zum Schluss<br />
müssen Sie dem K<strong>und</strong>en Ihr Produkt präsentieren.<br />
Folgende Vorgaben sind zu beachten<br />
1. Erstellen Sie Zeichnungen für die drei Einzelteile.<br />
2. Erstellen Sie eine Zus<strong>am</strong>menbauzeichnung.<br />
3. Die Winkellänge soll 100 Millimeter nicht überschreiten.<br />
4. Die Verbindungselemente sollen normgerecht aus dem<br />
Tabellenbuch herausgesucht werden <strong>und</strong> mit den Einzelteilen<br />
in die Stückliste übertragen werden.<br />
5. Beachten Sie bei der Konstruktion, dass etwa 10.000 Teile<br />
hergestellt werden sollen. Somit ist eine einfache Konstruktion<br />
für die Kosten von besonderer Bedeutung.<br />
6. Erstellen Sie die <strong>Arbeit</strong>spläne.
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 6: Hinweise zur Erstellung einer <strong>Arbeit</strong>smappe<br />
1. Mappe<br />
Es sollte sich um eine neue Mappe ohne Eselsohren handeln<br />
Einsteckfolien in der Mappe sind nicht erforderlich, sondern eher hinderlich<br />
2. Deckblatt<br />
• Auf einem Deckblatt sollen die wesentlichen Informationen über den Inhalt einer Mappe<br />
stehen also zum Beispiel „Herstellung <strong>und</strong> Bedeutung eines N<strong>am</strong>enschilds“. Die Form sollte<br />
ansprechend sein für den K<strong>und</strong>en, der die Anfrage gestellt hat.<br />
• Das Deckblatt sollte den N<strong>am</strong>en der Herstellerfirma (des Schülers) haben <strong>und</strong><br />
• das Datum der Erstellung<br />
3. Aufgabenstellung (Wird in der Regel vom Lehrer ausgegeben!)<br />
• Beschreibung der Aufgabe<br />
• Was soll<br />
• Wie soll<br />
• Wann soll<br />
• Wo soll<br />
• Wer soll<br />
4. Inhaltsverzeichnis<br />
• Das zweite Blatt sollte die Inhaltsangabe für die Mappe erhalten, mit Seitenzahlen<br />
• Eventuell weiterführende Hinweise können hier auch gegeben werden, z.B.<br />
Nachschlagewerke, Fachbücher die benutzt wurden<br />
5. Zeichnungen<br />
• Die Zeichnungen sollten aus einer Ges<strong>am</strong>tzeichnung <strong>und</strong> den Einzelteilzeichnungen<br />
bestehen<br />
• Die Positionen sollten mit der Stückliste übereinstimmen<br />
6. Stückliste<br />
• In der Stückliste sollten die Positionen wieder auftauchen, die auch in der Zeichnung benutzt<br />
werden.<br />
• Die Positionen erhalten einen N<strong>am</strong>en (Benennung), eine DIN, die Menge oder die Maße<br />
7. <strong>Arbeit</strong>splan<br />
• Der <strong>Arbeit</strong>splan wird wie ein Inhaltsverzeichnis angelegt in 3 Spalten:<br />
Spalte 1 eine <strong>Arbeit</strong>sgangsnummer (eine Positionsnummer)<br />
Spalte 2 den <strong>Arbeit</strong>sgang, was zu tun ist<br />
Spalte 3 Werkzeuge <strong>und</strong> Vorrichtungen, die benötigt werden <strong>und</strong> eventuelle<br />
weitere Hinweise<br />
8. Werkzeugliste<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Werkzeuge aufgeführt sein (H<strong>am</strong>mer, Meißel,<br />
Schraubendreher.....)<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Hilfsmittel aufgeführt sein (Leiter, Gerüst, Öl, Fett.....)<br />
• In der Werkzeugliste müssen alle Messzeuge aufgeführt sein(Gliedermaßstab, Stahlmaß,<br />
Messschieber .....)<br />
9. Berechnungen<br />
• Berechnungen müssen nachvollziehbar sein, Gewichte können eventuell in der Stückliste<br />
eingetragen werden<br />
• Wenn Sie Ihre Mappe auf dem Computer erstellen, ist es unter Umständen umständlich.<br />
Machen Sie von daher hier vielleicht nicht vom Computer Gebrauch, sondern von Ihrer<br />
Handschrift<br />
10. Informationen<br />
• Sollen zu einzelnen Fragen Texte erstellt werden (z.B. zum Korrosionsverhalten, zur<br />
Materialauswahl, zur Stabilität......), schreiben Sie diese übersichtlich, in einfachem Deutsch,<br />
so das es der Laie verstehen kann<br />
• Wenn Ihnen der K<strong>und</strong>e Vorgaben gegeben hat, wie das Bauteil aussehen soll, begründen<br />
Sie, warum Sie von diesen Vorgaben abweichen mussten.<br />
<strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Bremen Mitte, Dirk Jacobs 11.6.2011
Berufsfachschule für Technik ☺ An der Weserbahn 4 ☺ 28195 Bremen ☺ Dirk Jacobs � 0421 361 18 146 ☺ dirk.jacobs@schulverwaltung.bremen.de<br />
Anhang 7: Schnittmodelle<br />
<strong>Technische</strong>s Bildungszentrum Bremen Mitte, Dirk Jacobs 11.6.2011