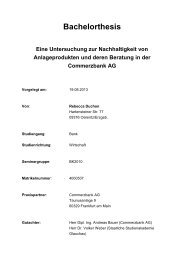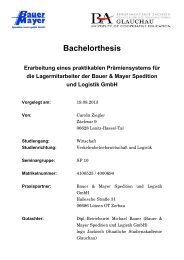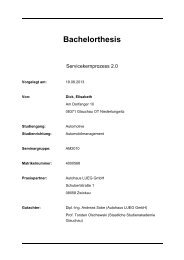Bachelor Thesis - OPUS-Datenbank
Bachelor Thesis - OPUS-Datenbank
Bachelor Thesis - OPUS-Datenbank
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Bachelor</strong> <strong>Thesis</strong><br />
Die Veränderung des Stellenwertes<br />
personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen in<br />
Verbindung mit den Chancen der Einführung eines<br />
Personalmanagement-tools bei der Firma Pabst<br />
Transport GmbH & Co. KG<br />
Vorgelegt am: 20.08.2012<br />
Von: Menzel Philipp<br />
An der Laushecke 6<br />
97456 Hambach<br />
Studiengang: Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik<br />
Studienrichtung: Wirtschaft<br />
Seminargruppe: SP09<br />
Matrikelnummer: 4090319<br />
Praxispartner: Pabst Transport GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 15<br />
97469 Gochsheim<br />
Gutachter: Dipl. - Kfm. Franz Klahold (Pabst Transport GmbH & Co. KG)<br />
Prof. Dr. phil. Annett Heinze (Berufsakademie Glauchau)
Freigabeerklärung<br />
Hiermit erklären wir uns einverstanden/nicht einverstanden*, dass die <strong>Bachelor</strong>thesis<br />
der/des Studenten/in<br />
Name, Vorname: Menzel, Philipp SG: SP 2009<br />
zur öffentlichen Einsichtnahme durch den Dokumentenserver der Bibliothek der<br />
Staatlichen Studienakademie Glauchau bereitgestellt wird.<br />
Thema der Arbeit:<br />
Die Veränderung des Stellenwertes personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen in<br />
Verbindung mit den Chancen der Einführung eines Personalmanagement-tools bei<br />
der Firma Pabst Transport GmbH & Co. KG<br />
Ort, Datum<br />
Unterschrift Student/in<br />
*) Nichtzutreffendes bitte streichen<br />
Stempel, Unterschrift Bildungsstätte<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel II
Themenblatt <strong>Bachelor</strong>thesis<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel III
Inhaltsverzeichnis<br />
Freigabeerklärung ................................................................................................................. II<br />
Themenblatt <strong>Bachelor</strong>thesis ..................................................................................................III<br />
Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... VI<br />
Abkürzungsverzeichnis........................................................................................................ VII<br />
Abstract .............................................................................................................................. VIII<br />
1. Einleitung ....................................................................................................................... 1<br />
1.1 Vorüberlegungen ........................................................................................................ 2<br />
1.2 Der theoretische Rahmen der Arbeit ........................................................................... 2<br />
1.3 Abgrenzung des Themas und Ableitung der Ziele ....................................................... 3<br />
1.4 Untersuchungsdesign ................................................................................................. 5<br />
2. Die theoretischen Grundlagen ........................................................................................ 7<br />
2.1 Die Personalwirtschaft ................................................................................................ 7<br />
2.2 Das Personalmanagement ......................................................................................... 7<br />
2.2.1 Geschichte des Personalmanagements ............................................................... 8<br />
2.2.2 Definition des Begriffes Personalmanagements ..................................................10<br />
2.2.3 Aufgaben des Personalmanagements ................................................................ 11<br />
2.2.4 Systematik des Personalmanagements ..............................................................16<br />
2.2.5 Ziele des Personalmanagements ........................................................................17<br />
2.3 Das Personalmanagement-tool ..................................................................................19<br />
2.3.1 Geschichtliche Entwicklung ................................................................................20<br />
2.3.2 Definition des Begriffes Personalmanagement-tool .............................................21<br />
2.3.3 Aufgaben von Personalmanagement-tools .........................................................21<br />
2.3.4 Ziele von Personalmanagement-tools .................................................................23<br />
2.3.5 Struktur eines Personalmanagement-tools .........................................................24<br />
2.3.6 Voraussetzungen für den Einsatz von Personalmanagement-tools .....................26<br />
3. Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst ............................................................28<br />
3.1 Analyse der aktuellen Situation ..................................................................................28<br />
3.2 Das Unternehmen nimmt Fahrt auf ............................................................................29<br />
3.3 Die Personalabteilung ................................................................................................30<br />
3.4 Darstellung ausgewählter Prozesse im Personalbereich ............................................31<br />
3.4.1 Änderung von Stammdaten ................................................................................32<br />
3.4.2 Bewerbungseingang ...........................................................................................33<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel IV
3.4.3 Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten bei Pabst ...........................35<br />
4. Chancen durch ein entsprechendes Personalmanagement-tool ...................................37<br />
4.1 Änderung von Stammdaten .......................................................................................37<br />
4.2 Eingang von Bewerbungen ........................................................................................38<br />
4.3 Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten ..................................................40<br />
5. Risiken/mögliche Schwierigkeiten ..................................................................................41<br />
5.1 Pabst muss sich einen Überblick über mögliche Partner verschaffen ........................41<br />
5.2 Gesamtprozesse sind noch nicht definiert..................................................................41<br />
5.3 Fehlendes Wissen muss kompensiert werden ...........................................................42<br />
5.4 Anforderungsprofil über ein Personalmanagement-tool fehlt ......................................42<br />
5.5 Fehlende Anbindung der IT-Struktur ..........................................................................43<br />
6. Lösungsansätze ............................................................................................................45<br />
6.1 Marktüberblick verschaffen ........................................................................................45<br />
6.2 Gesamtprozesse definieren .......................................................................................45<br />
6.3 Fehlendes Wissen durch Expertenwissen kompensieren ..........................................47<br />
6.4 Anforderungskatalog erstellen ...................................................................................48<br />
6.5 IT-Struktur anpassen .................................................................................................49<br />
7. Zusammenfassung der Ergebnisse ...............................................................................51<br />
7.1 Resümee der Arbeit ...................................................................................................51<br />
7.2 Ausblick über das Projekt nach Abgabe der <strong>Bachelor</strong>thesis .......................................52<br />
Literaturverzeichnis ..............................................................................................................54<br />
Anhangsverzeichnis .............................................................................................................58<br />
Ehrenwörtliche Erklärung .....................................................................................................61<br />
Thesen zur <strong>Bachelor</strong>arbeit ...................................................................................................62<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel V
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Eingliederung der <strong>Bachelor</strong>thesis ..................................................................... 5<br />
Abbildung 2: Untersuchungsdesign der <strong>Bachelor</strong>thesis ......................................................... 6<br />
Abbildung 3: Die Veränderung des Personalmanagements ................................................... 8<br />
Abbildung 4: Personalmanagement im Wandel ....................................................................10<br />
Abbildung 5: Aufgaben des Personalmanagements ............................................................. 11<br />
Abbildung 6: Ziele des Aufgabenfeldes Personalförderung ...................................................14<br />
Abbildung 7: Direkter und indirekter Personalabbau im Vergleich .........................................15<br />
Abbildung 8: Systematik zum Personalmanagement ............................................................17<br />
Abbildung 9: Ziele des Personalmanagements .....................................................................19<br />
Abbildung 10: Personalspezifische Aufgaben eines PM-tools ...............................................22<br />
Abbildung 11: Struktur eines PM-tools ..................................................................................24<br />
Abbildung 12: Mitarbeiterentwicklung bei der Firma Pabst (1995 - 2012) .............................29<br />
Abbildung 13: Die Personalabteilung in der Firma Pabst ......................................................31<br />
Abbildung 14: Ablauf der Stammdatenänderung bei Pabst ...................................................33<br />
Abbildung 15: Prozessablauf einer Bewerbung bei Pabst .....................................................34<br />
Abbildung 16: Stammdatenänderung mit PM-tool .................................................................37<br />
Abbildung 17: Prozess Bewerbungseingang mit PM-tool ......................................................39<br />
Abbildung 18: Softwareverbund bei der Firma Pabst ............................................................44<br />
Abbildung 19: Zielorientierte Prozessoptimierung .................................................................47<br />
Abbildung 20: Anforderungsprofil an ein PM-tool bei Pabst ..................................................49<br />
Abbildung 21: Rationalisierung von Hauptprogrammen bei Pabst .......................................50<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel VI
Abkürzungsverzeichnis<br />
IT Informationstechnik<br />
DMS Dokumentenmanagementsystem<br />
PM Personalmanagement<br />
PM-tool Personalmanagement-tool<br />
REWE Rechnungswesen<br />
TQM Total – Quality – Management<br />
UM Umweltmanagement<br />
QM Qualitätsmanagement<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel VII
Abstract<br />
Der Titel der vorliegenden <strong>Thesis</strong> ist inhaltlich sehr umfangreich, daher bietet es sich<br />
an, das Thema in die zwei folgenden Halbthemen zu trennen:<br />
die Veränderung des Stellenwertes personalwirtschaftlicher Aufgabenstellun-<br />
gen und<br />
die Chancen der Einführung von einem Personalmanagementtool (PM-tool).<br />
Die gesamte Firma Pabst Transport (im folgenden Pabst), befindet sich in einer Art<br />
Aufbruchsstimmung. Der innovative Transport- und Logistikdienstleister deckt hierbei<br />
alle Teilbereiche innerhalb dieser Wertschöpfungskette ab. Von der Verladung, über<br />
die termingerechte Auslieferung, bis hin zu kundenspezifischen Qualitätssicherungs-<br />
programmen stehen weitere Dienstleistungen, wie System-, Linien-, und Expressver-<br />
kehr, sowie Projektgeschäfte im Direkt- und Großkundenbereich im Leistungsspekt-<br />
rum des Unternehmens. Umsatz und Mitarbeiterzahl konnten in den letzten Jahren<br />
überdurchschnittlich gesteigert werden. Heute beschäftigt das Unternehmen mit Sitz<br />
im unterfränkischen Gochsheim über 400 Mitarbeiter, davon 300 gewerbliche und<br />
100 kaufmännische. Der Anstieg bleibt jedoch nicht ohne Folgen und fordert auch<br />
eine neue Denkweise im Bereich von personalwirtschaftlichen Aufgabenstellungen.<br />
Bisher wurde die Verwaltung des Personals dezentral gesteuert. Das bedeutet, dass<br />
Personalmanagement (PM) in Insellösungen betrieben wurde. In Zukunft ist ange-<br />
dacht, die Verwaltung und Organisation der Belegschaft durch ein entsprechendes<br />
Softwaretool zentral zu gestalten. In diesem Zuge hatte man die Idee, ein PM-tool<br />
einzuführen. Hierunter hat man sich ein computergestütztes Programm vorzustellen,<br />
welches sich mit der Verwaltung und der Organisation des Personals beschäftigt.<br />
Doch in der Vergangenheit haben sich Probleme, gerade bei der Umsetzung von<br />
Projekten ergeben. Man erkennt zwar, dass man aus den Ergebnissen zusätzliches<br />
Wissen erlangt und das Unternehmen vorantreiben kann. Andererseits geht man<br />
diese Pläne oftmals falsch an, da das nötige Wissen über die genaue Durchführung<br />
fehlt. Angefertigte Konzepte haben sich dadurch meist im Sande verlaufen, da eine<br />
entspreche Informationsphase über die Thematik entweder zu kurz gehalten wurde,<br />
oder erst gar nicht stattgefunden hatte. Durch die anstehende <strong>Bachelor</strong>thesis soll<br />
nun die Zweckmäßigkeit eines entsprechenden PM-tools untersucht werden. Sie<br />
dient der Geschäftsleitung als eine gut strukturierte Handlungsempfehlung.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel VIII
1. Einleitung<br />
Die Aussage des Bayerischen Staatsministers Martin Zeil aus seiner Danksagungs-<br />
rede bei der Preisverleihung der Auszeichnung Bayern´s Best 50 spiegelt die derzei-<br />
tige Situation der Firma Pabst wieder: „Unbeeindruckt von der Finanz- und Eurokrise<br />
und den konjunkturellen Auf und Ab, tragen unsere Preisträger dazu bei, dass unser<br />
Wachstum im Freistaat dynamisch bleibt und die Arbeitslosigkeit auf historisch nied-<br />
rigem Stand ist. Die Bilanz unterstreicht eindrucksvoll, der Mittelstand ist und bleibt<br />
die Triebfeder des wirtschaftlichen Erfolges und des Wohlstands unseres Landes“ 1 .<br />
Eine Entwicklung, die es gilt, auch in Zukunft fortzusetzen. Dafür sind zwei Aspekte<br />
von großer Bedeutung. Zum einen die Kundenaufträge, die für das Bestehen des<br />
Unternehmens notwendig sind. Zum anderen gut funktionierende betriebsinterne<br />
Abläufe. Der rasante Anstieg des Personals fordert die Geschäftsleitung an diesem<br />
Punkt zu einem Umdenken hinsichtlich des PM. Heutzutage existiert in Unternehmen<br />
eine regelrechte Datenflut. Pabst stellt hierbei keine Ausnahme. So werden Informa-<br />
tionen häufig ohne System an versteckten Stellen im internen Laufwerk des Unter-<br />
nehmens abgespeichert. Dadurch entstehen vermehrt Wissensinseln. Die Sachbear-<br />
beiter verschwenden unnötige Zeit für die Suche relevanter Daten und stoßen oft auf<br />
veraltete Informationen. Diese Probleme erschweren die Personalarbeit. An diesem<br />
Punkt setzt die vorliegende <strong>Thesis</strong> an. Sie zeigt auf, welche Chancen sich hinsicht-<br />
lich der angesprochenen Schwierigkeiten ergeben könnten, wenn ein PM-tool einge-<br />
führt wird. Dazu ist es notwendig, ein grundlegendes Verständnis im Bereich des<br />
Personalwesens zu erhalten. Dem Leser sollen die Fragen<br />
Wie hat sich allgemein der Stellenwert personalwirtschaftlicher Aufgabenstel-<br />
lungen im Laufe der Zeit geändert?<br />
Hat sich dieser Stellenwert auch bei Pabst geändert?<br />
Welche Verbindung besteht zwischen dieser Veränderung und einem PM-<br />
tool?<br />
Welche Chancen/Risiken bestehen wenn man ein PM-tool einführt?<br />
Was gibt es für Lösungsansätze?<br />
beantwortet werden.<br />
In den folgenden Unterpunkten des Kapitels eins, wird der theoretische Rahmen der<br />
Arbeit aufgezeigt. Anschließend wird das Thema genau abgegrenzt und die Ziele<br />
abgeleitet. Das Kapitel schließt mit dem Untersuchungsdesign der Arbeit.<br />
1 Online: ZEIL, 2012, S. 3<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 1
1.1 Vorüberlegungen<br />
Einleitung<br />
Pabst erwägt die Einführung eines modernen Softwaretools für das zukünftige PM.<br />
Ein Projekt in dieser Größenordnung muss gründlich geplant und analysiert werden.<br />
Dabei kann es zu folgenden Schritten kommen:<br />
Rekrutierung eines neuen Mitarbeiters, der das Projekt zum Erfolgt führt.<br />
Beauftragung eines externen Dienstleisters für ein PM-tool.<br />
Aufarbeitung des Projektes im Zuge der <strong>Bachelor</strong>thesis eines Studenten.<br />
Projekt starten und abwarten, Ziel und Ausgang sind dabei ungewiss.<br />
Die erste Möglichkeit ist dabei schwer zu realisieren, da durch die Komplexität des<br />
Projektes kaum ein neu eingestellter Mitarbeiter in der Lage sein wird, dieses umzu-<br />
setzen. Es ist ein Höchstmaß an firmeninternem Wissen notwendig. Auch kennt ein<br />
neuer Mitarbeiter die einzelnen Prozesse und Abläufe nicht. Eine Voraussetzung, die<br />
für die Einführung eines PM-tools von großer Bedeutung ist. Ferner müsste die neue<br />
Arbeitskraft ein sehr fundiertes Wissen über die bereits benutzten Softwareprogram-<br />
me im Unternehmen besitzen. Ein Minimalerfolg der Implementierung eines solchen<br />
Tools sollte zumindest die Reduzierung von Personal und damit Kosten sein. Dies<br />
soll nicht heißen, dass durch die Einführung Angestellte freigesetzt werden müssen.<br />
Vielmehr ist durch dieses Tool eine Aufstockung der Belegschaft möglicherweise<br />
nicht mehr nötig, da heutige und zukünftige Aufgaben in der Expansionsphase durch<br />
das Tool zu bewerkstelligen sind.<br />
Das Projekt ohne strukturierte Vorgehensweise „blind“ zu starten ist die voraussicht-<br />
lich ungünstigste Lösung. Das Vorhaben ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt.<br />
Somit bleiben die Varianten zwei und drei. Durch die Aufarbeitung des Themas im<br />
Zuge einer <strong>Bachelor</strong>arbeit, bleibt das erarbeitete Wissen in der Firma und kann die-<br />
ser zur Verfügung gestellt werden. Ferner besitzt der Student durch seine bereits<br />
abgeschlossene Berufsausbildung im Unternehmen ein fundiertes Grundwissen über<br />
die internen Prozesse und Abläufe. Die Vorgehensweise, festgelegte Ziele, sowie<br />
eine exakte Abgrenzung der Arbeit beschreiben die nächsten Kapitel.<br />
1.2 Der theoretische Rahmen der Arbeit<br />
Ein Ansatzpunkt des Projektes liegt in der Veränderung des Stellenwertes personal-<br />
wirtschaftlicher Aufgabenstellungen. Die Auseinandersetzung mit dem ersten theore-<br />
tischen Begriff liegt daher nahe, der Personalwirtschaft bzw. dem Personalmanage-<br />
ment. Diese befassen sich mit den arbeitenden Menschen in Unternehmen. In die-<br />
sem müssen die Menschen geführt werden. Der Abstract erwähnte bereits die Auf-<br />
bruchsstimmung in der sich die Firma befindet. Dieser ist im ganzen Unternehmen<br />
spürbar. Die kontinuierlich steigende Belegschaft zwingt dazu, dass Prozesse neu<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 2
Einleitung<br />
definiert werden müssen. In diesem Zuge sind bereits neue Abteilungen (Personalab-<br />
teilung, Marketing) geschaffen worden.<br />
Aufgrund verschiedener spezifischer Anwendungssysteme in den einzelnen Abtei-<br />
lungen werden die Daten bei Pabst redundant, d. h. doppelt verwaltet. Des Weiteren<br />
werden nicht aktuelle Excel - Listen geführt, was das Problem der Unübersichtlichkeit<br />
weiter verstärkt. Es ist angedacht, sowohl die existierenden Listen, als auch die dop-<br />
pelte Verwaltung der Daten in Zukunft über ein zentral gesteuertes PM-tool abzude-<br />
cken. Weiterhin ist das Unternehmen daran interessiert, für zukünftige personalwirt-<br />
schaftliche Angelegenheiten gut aufgestellt zu sein. Auf Grund dessen liegt ein weite-<br />
rer Schwerpunkt der Arbeit im Bereich von PM-tools. Dieses sollte in der Lage sein,<br />
die Anforderungen der Firma zu erfüllen.<br />
Die theoretischen Gebiete sind sehr komplex und umfangreich. Sie werden deshalb<br />
nicht in ihrer vollen Breite und Tiefe erörtert. In einzelnen Stellen wird daher mehr<br />
und an anderen weniger auf die Sachverhalte eingegangen, je nachdem, ob das<br />
Wissen für die Arbeit nötig ist, oder nicht.<br />
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die <strong>Bachelor</strong>thesis nur ein Teil eines komple-<br />
xen Unternehmensprojektes darstellt 2 . Es werden in diesem Zuge Folgearbeiten<br />
entstehen, die für eine endgültige Umsetzung und Einführung Sorge tragen müssten.<br />
Welche Ziele die Arbeit verfolgt, zeigt der nächste Abschnitt.<br />
1.3 Abgrenzung des Themas und Ableitung der Ziele<br />
Der Focus der <strong>Thesis</strong> liegt darin, der Geschäftsleitung eine Handlungsempfehlung zu<br />
geben. Eine Empfehlung darüber, ob im Zuge der Veränderung der personalwirt-<br />
schaftlichen Aufgabenstellungen in Verbindung mit der Entfaltung der Firma Pabst<br />
ein PM-tool eingeführt werden soll. Dabei soll aufgezeigt werden, was sich überhaupt<br />
hinter diesen modernen Softwares verbirgt. Der Geschäftsleitung soll eindeutig dar-<br />
gelegt werden, welche Abläufe im jetzigen Ist - Zustand optimiert werden können und<br />
ob es möglich ist, diese mit einem entsprechenden Softwaretool abzubilden. Dabei<br />
werden sowohl die Chancen solch einer Einführung, als auch die Probleme analy-<br />
siert und Lösungen dafür aufgezeigt. Die <strong>Thesis</strong> soll erreichen, dass<br />
der Geschäftsleitung ein fundiertes Basiswissen vermittelt wird.<br />
eine Analyse erstellt wird, welche Prozesse Potenzial zur Optimierung besit-<br />
zen.<br />
Lösungsansätze vorgeschlagen werden.<br />
2 Siehe Abbildung 1<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 3
die Arbeit ein Basiswerk für weiterführende Projekte ist.<br />
Einleitung<br />
Die oben aufgezeigten Ziele stehen in keiner Konkurrenz zueinander. Sie bauen<br />
vielmehr aufeinander auf. So können die Lösungsansätze erst gegeben werden,<br />
wenn entsprechendes Wissen in diesen Gebieten erlangt und eine ausführliche Ist-<br />
Analyse ausgewählter Prozesse erstellt wurde. Auf Basis der Ergebnisse kann es<br />
somit zu folgenden Erkenntnissen kommen:<br />
Das Projekt wird kurzfristig realisiert.<br />
Das Projekt wird mittelfristig realisiert.<br />
Das Projekt wird langfristig realisiert.<br />
Das Projekt wird nicht realisiert.<br />
Pabst definiert aktuell interne Abläufe neu. So beschäftigen sich zurzeit zwei Studen-<br />
ten im Rahmen einer Projektarbeit mit den Abläufen in den Bereichen Abrechnung,<br />
Lademittel und Controlling und vorliegende <strong>Thesis</strong> mit entsprechenden Vorgehens-<br />
weisen in der Abteilung Personal. So sind Schnittstellen unter allen Bereichen zu<br />
prüfen und Verantwortlichkeiten zu kontrollieren, um wiederholende Arbeiten mög-<br />
lichst zu vermeiden. Auch das Thema Qualitätsmanagement (QM) und Umweltma-<br />
nagement (UM) wird zurzeit neu überdacht. Dies verdeutlicht den angesprochenen<br />
Umschwung, der sich gerade im Unternehmen vollzieht. Die Vision ist, langfristig ein<br />
sogenanntes Total Quality Management 3 (TQM) einzuführen. Die <strong>Bachelor</strong>arbeit<br />
liefert hierfür einen Baustein auf dem Weg zu einem TQM. Um dies zu erreichen, hat<br />
man sich dazu entschieden, Projektgruppen zu bilden. Jedes Team behandelt ein<br />
entsprechendes Thema. Folgende Abbildung (Abbildung 1) verdeutlicht die Stellung<br />
der Arbeit innerhalb dieses Prozesses in Form einer grafischen Darstellung:<br />
3 Total Quality Management (TQM): Managementmethode, die sich auf die Mitwirkung aller Mitglieder<br />
(Mitarbeiter) einer Organisation stützt. Sie stellt Qualität in den Vordergrund und zielt auf die Zufriedenheit<br />
des Kunden sowie auf den Nutzen der Mitglieder (Mitarbeiter) ab. Kurz gesagt, handelt es sich<br />
um ein umfassendes Qualitätsmanagement im gesamten Unternehmen.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 4
1.4 Untersuchungsdesign<br />
Einleitung<br />
Die Arbeit ist systematisch aufgebaut. Das bedeutet, dass mit dem folgenden Kapitel<br />
(Kapitel 2) zuerst die theoretischen Grundlagen des Themas Personalwirtschaft<br />
erläutert werden. Anschließend wird auf die Begriffe PM und PM-tools eingegangen.<br />
Die theoretischen Grundlagen werden mit Hilfe der dafür vorhanden Fachliteratur<br />
aufgearbeitet. Kapitel drei schließt eine Bestandsaufnahme ausgewählter Abläufe im<br />
Bereich Personalwesen an. Welche Voraussetzungen und Probleme bestehen, ein<br />
PM-tool einzuführen, wird ebenfalls in diesem Kapitel erörtert. Durch die vielen und<br />
umfangreichen Prozesse im Unternehmen ist anzumerken, dass die Arbeit sich an<br />
dieser Stelle auf die essentiellen Abläufe in diesem Bereich fokussiert. Die Analysen<br />
des Abschnittes drei bilden somit die Grundlage für die im Kapitel vier folgende Dar-<br />
stellung, welche Chancen für Pabst bestehen, wenn man ein PM-tool einführen wür-<br />
de. Welche Risiken bzw. Schwierigkeiten zu beachten sind, erläutert Abschnitt fünf.<br />
Anschließendes Kapitel (Kapitel sechs) gibt eine Antwort darauf, wie die genannten<br />
Schwierigkeiten gelöst werden können.<br />
Abbildung 1: Eingliederung der <strong>Bachelor</strong>thesis<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 5
Einleitung<br />
Die Zusammenfassung im letzten Kapitel zeigt zum Schluss auf, ob die verfolgten<br />
Ziele der Arbeit erreicht wurden. Des Weiteren wird ein Ausblick über den Fortgang<br />
des Projektes nach Abgabe dieser <strong>Thesis</strong> vorgenommen.<br />
Die folgende Abbildung 2 gibt das beschriebene Untersuchungsdesign der <strong>Bachelor</strong>-<br />
thesis noch einmal grafisch wieder:<br />
Das Schaubild verdeutlicht den systematischen Aufbau und Zusammenhang der<br />
einzelnen Kapitel.<br />
Abbildung 2: Untersuchungsdesign der <strong>Bachelor</strong>thesis<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 6
2. Die theoretischen Grundlagen<br />
Das vorliegende Kapitel unterteilt die Begriffe Personalwirtschaft, PM und PM-tool in<br />
verschiede Abschnitte. So veranschaulicht der erste Unterpunkt, was unter dem<br />
Thema der Personalwirtschaft zu verstehen ist. Der zweite beschäftigt sich mit dem<br />
Begriff des PM. Es werden Fragen über Gegenstand, Inhalt, Systematik und Zielset-<br />
zung beantwortet. Auf Basis dieses Gerüstes, wird im nächsten Abschnitt aufgezeigt,<br />
was generell unter einem PM-tool zu verstehen ist und wie es in bestehende Abläufe<br />
integriert werden kann. Das Kapitel geht dabei auf die Geschichte, Voraussetzungen,<br />
Ziele und die Strukturen solcher modernen Tools ein.<br />
2.1 Die Personalwirtschaft<br />
Dieser Begriff setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, Personal und Wirtschaft. Bei-<br />
de Wörter lassen sich inhaltlich voneinander trennen. Das Personal beschreibt jeden<br />
Arbeitnehmer des Unternehmens. Der Begriff Wirtschaft hingegen umfasst alle Ein-<br />
richtungen und Vorgänge, die ihren Fokus auf eine Zielgröße festlegt, den Gewinn 4 .<br />
Dieser ist Grundvoraussetzung für das wichtigste strategische Ziel jeder Geschäfts-<br />
leitung, den Fortbestand des Unternehmens. Unternehmen haben erkannt, dass<br />
hierfür das Personal eine essentielle Rolle spielt. Es hat sich ein Wertewandel erge-<br />
ben, der eine strategisch ausgerichtete Personalarbeit der Geschäftsleitung fordert 5 ,<br />
um Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Handlungsansätze, die<br />
sich mit dem Wirtschaften des Personals beschäftigen. Darunter sind alle Aufgaben<br />
zu verstehen, die sich mit der Gestaltung und Verwaltung bezüglich des Mitarbeiters<br />
befassen 6 . Diese Tätigkeiten stellen den Grundsatz der Personalwirtschaft dar. Heute<br />
spricht man von dem moderneren Begriff des PM. Der folgende Abschnitt geht näher<br />
auf diesen zeitgemäßen Begriff ein.<br />
2.2 Das Personalmanagement<br />
In der Literatur wird eine Vielzahl von Begriffen für das PM verwendet. So ist oftmals<br />
auch vom Personalwesen, der Personalwirtschaft oder dem eingedeutschten Begriff<br />
„Human - Ressources“ die Rede. 7 Es ist an dieser Stelle festzuhalten, dass für die<br />
Arbeit der Begriff Personalmanagement verwendet wird.<br />
Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über anschließende Leitfragen:<br />
4 Vgl. JUNG, 2011, S. 1<br />
5 Vgl. JUNG, 2011, S. 2<br />
6 Vgl. OLFERT, 2003, S. 24<br />
7 Vgl. HILB, 2008, S. 12<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 7
Wie hat sich das Personalwesen im Laufe der Zeit verändert?<br />
Definition des PM?<br />
Welche Aufgaben zählen zum PM?<br />
Systematik des PM?<br />
Ziele des PM?<br />
2.2.1 Geschichte des Personalmanagements<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Die historische Entwicklung des PM lässt sich in fünf Phasen verdeutlichen. Jede<br />
dieser Phasen ist durch unterschiedliche Philosophien geprägt. Abbildung 3 verdeut-<br />
licht dies:<br />
Abbildung 3: Die Veränderung des Personalmanagements<br />
(eigene Darstellung in Anlehnung an SPRINGER; STEMANN, 2006, S. 7)<br />
Im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte hat sich das Verständnis des PM grundle-<br />
gend gewandelt. In den Jahren bis ca. 1960 wurden unter personalwirtschaftlichen<br />
Aufgabenstellungen lediglich rein administrative Tätigkeiten verstanden. Der kauf-<br />
männische Leiter war für diesen Bereich zuständig. Die Hauptarbeit stellte die Ver-<br />
waltung von Personalakten dar. Ab ca. 1960 kam es vermehrt zu einer Institutionali-<br />
sierung vom PM, welches die Belegschaft an organisatorische Anforderungen an-<br />
passte. Die Verantwortlichkeit übernahm in dieser Zeit der Personalleiter. Sein Auf-<br />
gabengebiet erweiterte sich um die Einstellung und den Einsatz der Mitarbeiter, so-<br />
wie Fragen bezüglich der Entgeltzahlung. Anfang der 70-er Jahre war von der Hu-<br />
manisierung geprägt. Der Focus lag dabei auf der Anpassung der Angestellten an die<br />
Organisation. Aus- und Weiterbildung, Personalbetreuung und Mitarbeiterführung<br />
erhielten einen neuen Stellenwert in den Firmen. Verantwortlich zu dieser Zeit war<br />
die Geschäftsleitung bzw. das Personalressort. Durch die Ökonomisierung innerhalb<br />
der 80-er Jahre verstärkte sich dieser Trend weiter. Im Vordergrund dieser Phase<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 8
Die theoretischen Grundlagen<br />
stand, dass Unternehmen flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen und externe<br />
Umwelteinflüsse reagieren konnten. Zu den Hauptaufgaben zählten unter anderem<br />
die Flexibilisierung der Arbeitsplätze sowie die Bewertung des Arbeits- und Entwick-<br />
lungspotenzials der Angestellten. Die Geschäftsleitung und das Personalwesen<br />
überwachten die Prozesse. Spätestens seit den 90-er Jahren ist der Mitarbeiter die<br />
Wichtigste und Wertvollste Ressource jedes Unternehmens. Durch den Wandel hat<br />
sich bei Ihnen auch die Denkweise geändert. Analysen haben gezeigt, dass der<br />
Mensch dabei von psychischen und sozialen Faktoren gesteuert wird 8 .<br />
Diese Erkenntnisse waren:<br />
Beruf und Arbeitsbeziehungen sind zentraler Bestandteil jedes Einzelnen. Sie<br />
haben einen großen Anteil an der Lebensgestaltung.<br />
Der Lohn ist nicht mehr ausschlaggebendes Kriterium bei der Einstellung. Der<br />
Mensch trägt den Wunsch nach Anerkennung, Sicherheit und Zugehörigkeit.<br />
Der Arbeitnehmer will sich mit der übertragenen Arbeit identifizieren.<br />
Die Beziehungen innerhalb der Belegschaft nehmen eine immer wichtigere<br />
Rolle ein. Sie stärkt das Arbeitsklima und sorgt für eine innere Zufriedenheit<br />
jedes Mitarbeiters.<br />
Die Veränderung des Stellenwertes personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen war<br />
vollzogen. Unternehmen stellten sich diesem Wandel und legten den Focus gezielt<br />
auf den Mitarbeiter. So wurde beispielsweise die Betreuung und Weiterbildung der<br />
Angestellten automatisiert. 9<br />
Die Rede vom einstigen Produktionsfaktor Mensch ist Vergangenheit. Vielmehr trägt<br />
der Mitarbeiter heute das Prädikat „entscheidender Erfolgsfaktor zu sein“. 10<br />
Abbildung vier veranschaulicht die veränderten Rahmenbedingungen und Anforde-<br />
rungen des PM in Form einer grafischen Darstellung:<br />
8 Vgl. HERMANN & PIFKO, 2009, S. 12<br />
9 Vgl. STIEFEL, 2004, S. 2<br />
10 Vgl. SCHOLZ, 2011, S. 11<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 9
Die theoretischen Grundlagen<br />
Die aufgezeigten Veränderungen verlangen vom Unternehmer eine neue Qualität<br />
entlang des Denkens und Handelns im PM 11 . Die Geschäftsleitung muss mit gutem<br />
Beispiel vorangehen und die Personalpolitik verinnerlichen und leben. Das PM sollte<br />
Bestandteil der Unternehmensphilosophie 12 , -politik und -strategie sein 13 und dabei<br />
den Faktor Mensch und Arbeit berücksichtigen.<br />
2.2.2 Definition des Begriffes Personalmanagements<br />
Eine exakte Definition von PM zu geben ist schwierig. Die fachspezifische Literatur<br />
gibt zu diesem Thema unterschiedliche Interpretationen wieder. Interpretationen von<br />
Begriffen, die unterschiedliche Aspekte dieses Terminus aufzeigen.<br />
Doch die vielen Umschreibungsversuche gelangen im Kern immer auf das gleiche<br />
Ergebnis. Gemeinsamer Nenner sind stets der Mensch und seine Arbeit. 14 Im Fokus<br />
11 Vgl. HILB, 2008, S. 25<br />
12 Unternehmensphilosophie: beeinflusst maßgeblich die Strategien, Pläne und Ziele sowie die grundlegenden<br />
Überzeugungen, Prinzipien, Visionen und Werte der Organisation, oftmals ist auch von der<br />
Unternehmensvision- oder Leitbild die Rede.<br />
13 Vgl. KOLB, 2002, S. 12<br />
14 Vgl. KOLB, 2002, S. 12<br />
Abbildung 4: Personalmanagement im Wandel<br />
(HILB, 2008, S. 25)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 10
Die theoretischen Grundlagen<br />
steht der wichtigste Faktor eines Unternehmens, der Mitarbeiter. 15 Die vorangegan-<br />
gene Definition wird als Grundlage dieser <strong>Thesis</strong> verstanden. In der Literatur sind<br />
weitaus kompliziertere Bezeichnungen des Begriffes PM zu finden. Für die Notwen-<br />
digkeit und das Ziel der <strong>Bachelor</strong>arbeit ist sie ausreichend.<br />
2.2.3 Aufgaben des Personalmanagements<br />
War früher noch die Rede vom Lohnbüro oder der Personalverwaltung, spricht man<br />
heute von Personalmanagement. Lange Zeit war die Personalarbeit nur ein Neben-<br />
produkt innerhalb der Geschäftsprozesse 16 . Heute umfasst dieser Bereich vier<br />
Hauptaufgaben. Die Personalgewinnung, -erhaltung, -förderung und -<br />
verabschiedung. Bereiche, die nicht singulär agieren. Jede Abteilung ist eng ver-<br />
knüpft mit der Anderen. Diese Abhängigkeit voneinander zeigt Abbildung fünf:<br />
Abbildung 5: Aufgaben des Personalmanagements<br />
(eigene Darstellung)<br />
15 Vgl. Grundlagen des Personalmanagements, 2011, S. 4<br />
16 Vgl. HERMANN; PIFKO, 2009, S. 12<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 11
Die theoretischen Grundlagen<br />
Durch den stetigen Wandel des PM, existieren in der Fachliteratur mittlerweile viele<br />
Unterfunktionen, wie z. B. das Arbeitszeitmanagement der Mitarbeiter oder das Per-<br />
sonalcontrolling 17 .<br />
Die <strong>Thesis</strong> beschränkt sich im Folgenden auf die theoretischen Grundlagen der vier<br />
genannten Hauptaufgaben.<br />
2.2.3.1 Personal gewinnen<br />
Zu den Aufgaben der Personalgewinnung zählen sämtliche Prozesse und Maßnah-<br />
men, die mit der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern zusammenhängen 18 . Mehr<br />
denn je ist es von besonderer Bedeutung, das richtige, gut aus- und weitergebildete<br />
Personal einzustellen. Dabei werden nur die Personen ausgewählt, deren Eignungs-<br />
profile den Anforderungsprofilen am Besten entsprechen 19 . Dies ist Voraussetzung,<br />
um die richtigen Mitarbeiter zu finden und langfristig an das Unternehmen zu binden.<br />
Moderne Personalabteilungen setzen auf Strategien in Form einer attraktiven Arbeit-<br />
gebermarke, das sogenannte „Employer Branding“ 20 . Eine attraktive Arbeitgebermar-<br />
ke ist sehr werbewirksam und kann zur erfolgreichen Einstellungen von geeigneten<br />
Mitarbeitern führen 21 . Diese Mitarbeiter unterteilt KNOBLAUCH in seinem Buch „die<br />
Personalfalle“ folgendermaßen 22 :<br />
A - Mitarbeiter (Top - Arbeitnehmer):<br />
o identifiziert sich mit dem Unternehmen.<br />
o strebt ein eigenverantwortliches und transparentes Arbeitsumfeld an.<br />
o erbringt Höchstleistungen.<br />
o benötigt Perspektiven und eine vertrauensvolle Beziehung.<br />
o will gestalten.<br />
o will neue Lösungen finden.<br />
B - Mitarbeiter:<br />
o erbringt die von ihm geforderte Leistung.<br />
C - Mitarbeiter:<br />
o „Leistungsverweigerer“.<br />
o unmotiviert.<br />
o wird vom Unternehmen mitgetragen.<br />
17 Vgl. BÜHNER, 2005, S. 28<br />
18 Vgl. PIFKO; ZÜGER, 2007, S. 20<br />
19 Vgl. HILB, 2008, S. 15<br />
20 Employer Branding: eine markenstrategisch fundierte, interne wie externe Positionierung eines<br />
Unternehmens als Arbeitgebermarke.<br />
21 Vgl. PFEIFFER, 2011, S. 10<br />
22 Vgl. KNOBLAUCH, 2010, S. 2<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 12
Die theoretischen Grundlagen<br />
Ziel eines jeden Unternehmens sollte es sein, so viele Top - Arbeitnehmer in seinen<br />
Reihen vorweisen zu können wie möglich, denn nur die „exzellenten Fachkräfte zieht<br />
es genau dort hin, wo die Besten arbeiten“ 23 . Mit diesen Angestellten sind Unterneh-<br />
men in der Lage erfolgreich zu agieren. Hat man das erreicht, ist ein fundamentales<br />
Grundgerüst geschaffen, um in Zeiten des demografischen Wandels 24 dem Fachkräf-<br />
temangel entgegenzuwirken.<br />
2.2.3.2 Personal erhalten<br />
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Bindung von Mitarbeitern. Das vorangegan-<br />
gene Kapitel zeigte auf, welche Bedürfnisse und Ziele diese besitzen und von der<br />
Geschäftsleitung beachtet werden müssen, um Arbeitnehmer an das Unternehmen<br />
zu binden. Ein weiterer Faktor, der beachtet werden muss, ist das steigende Selbst-<br />
bewusstsein des Personals. Dies hat zur Folge, dass Arbeitnehmer mittlerweile sehr<br />
wählerisch sind und zunehmend Werte wie z. B. einer entsprechenden „Work – Life -<br />
Balance“ 25 Beachtung schenken. 26 Attraktive Arbeitsbedingungen wie<br />
leistungsgerechte Löhne<br />
großzügige Sozialleistungen<br />
flexible Arbeitszeitregelungen sowie<br />
Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte<br />
tragen dazu bei, dass die Beschäftigten an das Unternehmen gebunden werden<br />
können. 27<br />
2.2.3.3 Personal fördern<br />
Diese Maßnahme beschreibt die planmäßige Erweiterung der fachlichen, methodi-<br />
schen, sozialen und persönlichen Qualifikation 28 . Ähnlich der Personaleinstellung,<br />
verfolgt auch die Personalförderung wirtschaftliche und soziale Ziele gleicherma-<br />
ßen 2930 . Das Schaubild sechs veranschaulicht diese Absichten des Bereiches Perso-<br />
nalförderung und verdeutlicht die Notwendigkeit, bei jeder Hauptaufgabe des PM, die<br />
Anliegen gleichermaßen zu betrachten.<br />
23<br />
Vgl. KNOBLAUCH, 2010, S. 4<br />
24<br />
Demografischer Wandel: Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur einer Gesellschaft.<br />
25<br />
Work-Life-Balance: Zustand, indem Arbeits- und Privatleben im Einklang stehen.<br />
26<br />
Online: SICKING, 2011<br />
27<br />
Vgl. PIFKO; ZÜGER, 2007, S. 20<br />
28<br />
Vgl. BERTHEL; BECKER, 2003, S. 38, S.46, S. 56<br />
29<br />
Vgl. HENTZE, 2001, S.347 f.<br />
30<br />
Vgl. KOLB, 2002, S. 216<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 13
2.2.3.4 Personal verabschieden/freisetzen<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Die letzte Hauptaufgabe und einer der schwierigsten im Bereich des PM stellt die<br />
Verabschiedung des Personals dar. Bestehende Arbeitsverhältnisse werden z. B.<br />
durch strategischen Personalabbau der Geschäftsführung oder durch Kündigungen<br />
und natürliche Abgänge aufgelöst. Entlassungen verursachen oftmals schwerwie-<br />
gende Einschnitte bei den betroffenen Arbeitnehmern. Vom Arbeitgeber sind dabei<br />
arbeitsrechtliche Bestimmungen jederzeit einzuhalten 3132 . Negativer Aspekt seitens<br />
des Unternehmens ist nicht zuletzt das abfließende Wissen durch die ausscheidende<br />
Fachkraft.<br />
Nicht zu den Hauptaufgaben des PM zählt die Personalfreisetzung. Sie ist eine<br />
Querschnittsfunktion. Dennoch muss sie von den Verantwortlichen des PM beachtet<br />
werden. Die Freisetzung ist dabei der Verabschiedung nicht gleichzusetzen. Die<br />
Freisetzung umfasst die indirekte Reduzierung der Ressource „Personal“ 33 . Ziel ist<br />
es, Mitarbeiter nicht vorzeitig entlassen zu müssen wie es bei der Verabschiedung<br />
der Fall ist. Vielmehr werden Maßnahmen (Kurzarbeit, Teilzeitarbeit) getroffen, die<br />
einem direkten Abbau vorbeugen. Schlagen diese Schritte fehl oder sind aussichtlos,<br />
so wird aus der Freisetzung eine Verabschiedung. Die beschriebenen Varianten<br />
unterscheiden sich nicht nur bezüglich der Veränderungen beim Personalbestand.<br />
Die Freisetzung ohne Verringerung des Personalbestandes ist für die Geschäftslei-<br />
31 arbeitsrechtliche Bestimmungen (im Sinne von Kündigungsfristen) werden nicht erläutert, da nicht<br />
zielbringend für die Arbeit.<br />
32 Vgl. PIFKO; ZÜGER, 2007, S. 21<br />
33 Vgl. WUNDERER; DICK, 2001, S.147<br />
Abbildung 6: Ziele des Aufgabenfeldes Personalförderung<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 14
Die theoretischen Grundlagen<br />
tung kurz- bis mittelfristig planbar. Man spricht hier von antizipativen Maßnahmen 34 ,<br />
z. B. wenn ein befristeter Arbeitsvertrag nicht verlängert werden kann 35 .<br />
Von reaktiven Maßnahmen ist die Rede, wenn ein geringerer planerischer Aufwand<br />
entsteht und oftmals aus dem Bauch heraus entschieden werden muss. Kündi-<br />
gungswellen und Massenentlassungen schlagen sich negativ auf die Stimmungslage<br />
des Mitarbeiters. Folglich leidet das Betriebsklima. Folgende Abbildung (Abbildung 7)<br />
dient zum Verständnis der unterschiedlichen Begriffe Personalverabschiedung und<br />
Personalfreisetzung:<br />
Abbildung 7: Direkter und indirekter Personalabbau im Vergleich<br />
Welchen Anteil der Mensch an der Wertschöpfung jedes Unternehmens mittlerweile<br />
genießt wurde bereits mehrfach verdeutlicht. Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden<br />
haben sich zu Schlagwörtern der Unternehmen entwickelt. Firmen müssen auf sich<br />
34 Vgl. HOLTBRÜGGE, 2007, S. 132<br />
35 Vgl. HOLTBRÜGGE, 2007, S. 132<br />
(eigene Darstellung in Anlehnung an RKW, 1990, S. 206)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 15
Die theoretischen Grundlagen<br />
aufmerksam machen und ein attraktiver Arbeitgeber sein 36 . Dadurch haben sie die<br />
Möglichkeit, das richtige fachkundige Personal an Land zu ziehen und dieses ent-<br />
sprechend zu halten. Diese Maßnahmen wirken gegen Kündigungen seitens des<br />
Arbeitnehmers vor.<br />
Die theoretischen Grundlagen des PM sind somit geschaffen. Das nächste Kapitel<br />
baut auf diesen Grundlagen auf. Die Systematik des PM wird veranschaulicht. Au-<br />
ßerdem erfolgt eine grafische Darstellung, in der die Beziehung zwischen den<br />
Hauptaufgaben und den Instrumenten dargestellt wird.<br />
2.2.4 Systematik des Personalmanagements<br />
Die Systematik des PM stellt die Aufgaben den Instrumenten gegenüber. Was für<br />
Tätigkeiten verfolgt werden, ist durch die vorangegangenen Kapitel bekannt. Dieser<br />
Abschnitt befasst sich mit der Frage, womit diese Aufgaben umgesetzt werden kön-<br />
nen und welche Systematik sich dahinter verbirgt. Es gibt verschiedene Möglichkei-<br />
ten, die Hautaufgaben des PM zu realisieren. Man spricht hier von Instrumenten.<br />
Dabei handelt es sich um Methoden, die in den Haupt- und Querschnittsfunktionen<br />
des PM eingesetzt werden. So kann z. B. durch ein attraktives Arbeitgeberimage<br />
Personal gewonnen werden und dazu beitragen, ein Alleinstellungsmerkmal zu erhal-<br />
ten und sich von der Konkurrenz abzuheben. Überwacht werden die Maßnahmen<br />
durch die Leiter des PM. Diese sind je nach Betriebsgröße unterschiedlich. In Klein-<br />
betrieben übernimmt z. B. die Unternehmensleitung selbst diese Verantwortung, mit<br />
zunehmender Größe verlagert sich diese mehr auf spezialisierte Funktionsberei-<br />
che 37 . Dennoch ist das PM Teilaufgabe jedes Einzelnen. Angefangen von der Ge-<br />
schäftsleitung, betrifft sie jede Führungskraft oder jeden Bereichsleiter. Sie sind die-<br />
jenigen, die die Ziele der Firma und grundlegende Strategien bzw. Entscheidungen in<br />
den einzelnen Bereichen umsetzten und vorleben. Abbildung acht veranschaulicht<br />
die Systematik in Form einer grafischen Darstellung:<br />
36 Lektor ZUKUNFTFESTES PERSONALMANAGEMENT, 2011<br />
37 Vgl. KLIMECKI; GMÜR, 2005, S. 431<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 16
2.2.5 Ziele des Personalmanagements<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Die Konzentration liegt auf den Hauptzielen des PM. Sie unterscheiden sich in den<br />
wirtschaftlichen Absichten des Unternehmens (Gewinn, Umsatz) und den sozialen<br />
Vorstellungen des Mitarbeiters (Verwirklichung, Freiheit). Rechtliche und volkswirt-<br />
schaftliche Aspekte bilden dabei Nebenabsichten 38 und sind von sekundärer Bedeu-<br />
tung.<br />
Die wirtschaftlichen Ziele bilden das erste Hauptanliegen des PM. Darunter ist zu<br />
verstehen, dass der Bereich des PM einen wertschöpfenden Anteil am Unterneh-<br />
menserfolg leistet 39 . Voraussetzung hierfür ist eine Ausstattung des Unternehmens<br />
mit qualifiziertem Personal. Die Geschäftsleitung hat Prinzipien, wie die Entfaltung<br />
38 Vgl. BÖCK, 2002, S. 3<br />
39 Vgl. BÖCK, 2002, S. 5<br />
Abbildung 8: Systematik zum Personalmanagement<br />
(eigene Darstellung in Anlehnung an KOLB, 2004, S.16)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 17
Die theoretischen Grundlagen<br />
der Kreativität bzw. Produktivität jedes Mitarbeiters zu beachten, sowie die richtige<br />
Anzahl an Bediensteten mit geeigneter Qualifikation einzustellen 4041 . Dies ist nötig,<br />
um das langfristige Ziel jeder Geschäftsleitung zu gewährleisten, der Fortbestand<br />
des Unternehmens.<br />
Die sozialen Ziele bilden das zweite Hauptziel des PM. Sie befassen sich mit der<br />
Interessenlage des einzelnen Mitarbeiters 42 , wie z. B. die individuellen Bedürfnisse<br />
und Wünsche (Karriereplanung oder regelmäßig stattfindende Feedbackgespräche).<br />
Die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter unterteilt man in sogenannte mittelbare<br />
und unmittelbare Faktoren 43 . Mittelbare Faktoren verbessern die Arbeitsumstände<br />
des Mitarbeiters. Dies wird beispielsweise durch gerechte Bezahlung oder einem<br />
sicheren Arbeitsplatz garantiert. Unmittelbare Faktoren bezeichnen dagegen die<br />
Situation, wenn sich der Arbeitnehmer in seinem Arbeitsumfeld wohl fühlt und er sich<br />
mit seinen Tätigkeiten und der Organisation identifizieren kann. Wo der Fokus jedes<br />
Einzelnen liegt, ist abhängig von der individuellen Situation, in der er sich befindet.<br />
So wird z. B. ein angehender Jurist eher auf ein hohes Gehalt achten, als ein Ar-<br />
beitssuchender. Für diesen ist ein sicherer Arbeitsplatz das Wichtigste.<br />
Kapitel 2.3.2 zeigte bereits auf, dass sich die sozialen Ziele der Gesellschaft im Lau-<br />
fe der Zeit geändert haben. Begriffe wie eine gerechte „Work-Life-Balance“ und Mit-<br />
spracherechte seitens der Angestellten nehmen immer mehr an Bedeutung zu.<br />
Durch diesen Wandel können die wirtschaftlichen und sozialen Visionen teilweise<br />
konträr zueinander stehen 44 . Aufgabe der Geschäftsleitung ist es, beide Ziele ent-<br />
sprechend aufeinander anzupassen. Abbildung neun stellt die beiden Begriffe noch-<br />
mals gegenüber:<br />
40<br />
Vgl. DAUM; PETZOLD; PLETKE, 2007, S. 296<br />
41<br />
Vgl. LINDNER-LOHMANN; LOHMANN; SCHIRMER, 2008, S. 1<br />
42<br />
Vgl. KOLB, 2002, S. 31<br />
43<br />
Vgl. LINDNER-LOHMANN; LOHMANN; SCHIRMER, 2008, S. 3<br />
44<br />
Vgl. LINDNER-LOHMANN; LOHMANN; SCHIRMER, 2008, S. 4<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 18
Die theoretischen Grundlagen<br />
Der erste große theoretische Rahmen ist somit abgesteckt. Die Arbeit betrachtete die<br />
Geschichte, Definition, Hauptaufgaben, sowie die Systematik und die Ziele des PM.<br />
Dabei ist die <strong>Thesis</strong> immer soweit in die Tiefe gegangen, wie es für das Ergebnis der<br />
Arbeit notwendig war. Der nächste Absatz befasst sich mit dem Begriff PM-tool.<br />
2.3 Das Personalmanagement-tool<br />
In den nächsten Abschnitten werden folgende Fragen bezüglich dieses Begriffes<br />
geklärt:<br />
Geschichtliche Entwicklung<br />
Definition des Begriffes<br />
Aufgaben<br />
Ziele<br />
Struktur<br />
Voraussetzungen<br />
Abbildung 9: Ziele des Personalmanagements<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 19
2.3.1 Geschichtliche Entwicklung<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Ein definierter Startschuss für solche Programme lässt sich aus der Literatur nicht<br />
entnehmen. Man geht davon aus, dass bereits Anfang der 60-er Jahre Programme<br />
erstellt wurden, die zur Unterstützung im Bereich des PM dienten. Festzuhalten ist,<br />
dass früher wie heute, bei der Beschäftigung von Arbeitspersonal an unterschiedli-<br />
chen Stellen Daten anfallen 45 . Daten, für die Einstellung von Mitarbeitern, die Entloh-<br />
nung oder die Versicherung. Die Dokumente mit den jeweiligen Informationen fielen<br />
dabei in Papierform an. Gesammelt wurden sie in Personalakten. Dies hatte zum<br />
Vorteil, dass alle relevanten Nachweise eines Mitarbeiters zusammengefasst waren.<br />
Heute werden die Personalakten durch sogenannte digitalen Akten 46 ersetzt. Seit fast<br />
einem halben Jahrhundert werden Informationstechniken im Bereich des PM einge-<br />
setzt 47 und entwickeln sich stets weiter. Nach JUNG unterteilt sich diese Entwicklung<br />
in vier verschiedene Phasen 48 :<br />
In Phase eins lag der Fokus darauf, die Lohn- und Gehaltsabrechnung in<br />
Form einer entsprechenden technischen Lösung zu unterstützen. Grund hier-<br />
für waren sehr große Datenmengen (vor allem Stammdaten 49 ) von Mitarbei-<br />
tern, die verwaltet werden mussten.<br />
Die nächste Phase wurde bereits für administrative Zwecke genutzt. Dies er-<br />
folgte durch den in Phase eins angelegten Stammdatensatz.<br />
Phase drei baute den Anwendungsbereich weiter aus. Dadurch war es mög-<br />
lich, Reisekosten der Angestellten abzurechnen. Auch konnte die Arbeitszeit<br />
der Belegschaft erfasst werden 50 .<br />
In der aktuellen Phase, Phase vier, wächst die Bedeutung der dispositiven 51<br />
Aufgaben. Der Fokus der PM-Tools liegt aber weiterhin im administrativen 52<br />
Bereich.<br />
Diese Softwarelösungen wurden in den vergangenen Jahren preiswerter. Gestützt<br />
durch diesen Preisverfall, liegt der Trend dahingehend, dass Unternehmen vermehrt<br />
solche Tools einführen. Der nächste Abschnitt veranschaulicht, was man heute unter<br />
diesem Begriff versteht.<br />
45 Vgl. HAUBRUCK, 2009, S. 216<br />
46 Wird in Kapitel 4.3 beschrieben<br />
47 Vgl. STROHMEIER, 2000, S. 90 f.<br />
48 Vgl. JUNG, 1995, S. 680 f.<br />
49 Stammdaten: z. B. Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum eines Angestellten.<br />
50 heutiger, modernerer Begriff: Zeitwirtschaft<br />
51 dispositiv: entscheidende, anordnende, anweisende Maßnahmen, wird in Kapitel 2.3.3 beschrieben.<br />
52 administrativ: Organisation, Verwaltung, wird in Kapitel 2.3.3 beschrieben.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 20
2.3.2 Definition des Begriffes Personalmanagement-tool<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Ein PM-tool ist eine computergestützte Software. Es unterstützt den Anwender bei<br />
der Verwaltung und Verarbeitung von Informationen. Beide Faktoren sind wichtig für<br />
ein erfolgreiches Unternehmen. Ein PM-tool hilft dabei, eine Vielzahl an Daten zu<br />
steuern und zu organisieren. Es besteht aus einer Hardware 53 , <strong>Datenbank</strong>en, einer<br />
Software, sowie aus den Daten und Anwendungen, die dazu notwendig sind, das<br />
Personal zu verwalten 54 . Ist in der Literatur oftmals noch von Personalinformations-<br />
systemen die Rede, so spricht man heute von einem moderneren Begriff, dem Begriff<br />
des Human Ressource Information Systems oder von PM-tools. Die Arbeit hat sich<br />
dabei auf den zeitgemäßen Terminus des PM-tools festgelegt. Diese helfen dem<br />
Anwender, Daten geordnet zu erfassten, zu speichern und umzuwandeln und alle<br />
relevanten Informationen zügig an die entsprechenden Personen auszugeben 55 .<br />
Dabei werden alle Prozesse entlang des PM erfasst. Von der Personalbeschaffung, -<br />
einsatz, -entwicklung, bis hin zur Verabschiedung. Ein PM-tool zeigt diese Prozesse<br />
klar und übersichtlich mit Hilfe seiner Bestandteile wie z. B. der<br />
Personalabrechnung<br />
Zeitermittlung<br />
Stammdatenverwaltung<br />
Administration<br />
Personalberichterstattung<br />
Personalplanung<br />
in übersichtlichen Masken 56 am Computer an. Dem Anwender fällt es somit leicht,<br />
wichtige Kennzahlen verlässlich und schnell abzurufen. Die Tools lassen sich dabei<br />
individuell auf jeden Betrieb zuschneiden und nachträglich aktualisieren. Bestandteil<br />
sind die oben genannten Module. Diese spezialisieren sich auf ihr jeweiliges Teilge-<br />
biet. Zusammen ergeben sie zum Schluss ein in sich geschlossenes PM-tool. Wel-<br />
che Aufgaben die Programme verfolgen, erläutert der nächste Abschnitt.<br />
2.3.3 Aufgaben von Personalmanagement-tools<br />
Ein PM-tool beschäftigt sich mit personalspezifischen Aufgaben. Die Tätigkeitsfelder<br />
unterscheiden sich dabei in administrative und dispositive Aufgaben, was Abbildung<br />
zehn verdeutlicht:<br />
53<br />
Hardware: Rechner oder Rechnerverbund<br />
54<br />
Vgl. SCHLESE, 2007, S. 2<br />
55<br />
Vgl. SCHRÖDER, 2009, S. 10<br />
56<br />
Siehe Anlage 1 - 3<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 21
Die theoretischen Grundlagen<br />
Der Begriff administrativ leitet sich aus dem lateinischen „administrare“, zu deutsch<br />
„verwalten“, ab. Damit sind häufig wiederkehrende Tätigkeiten wie die monatliche<br />
Lohn- und Gehaltserstellung gemeint. Aufgabe und Ziel von PM-tools ist es, an die-<br />
ser Stelle den organisatorischen Aufwand zu reduzieren, indem sie Daten und Infor-<br />
mationen schneller, aktueller und in gesteigerter Qualität zur Verfügung stellen 57 .<br />
Folglich kann sich der Mitarbeiter auf seine eigentlichen Tätigkeiten konzentrieren.<br />
Dispositive Aufgaben des PM dienen überwiegend der strategischen Entscheidungs-<br />
hilfe. Deshalb sind sie oft in geistigen – schöpferischen Bereichen zu finden. Es wer-<br />
den Daten aufbereitet, die eine verbesserte Informationsgrundlage und Entschei-<br />
dungshilfe liefern. Dadurch lassen sich zukünftige Probleme, wie z. B. die Planung<br />
des Personals, frühzeitig erkennen. Entsprechend zeitnah kann die Geschäftsleitung<br />
auf die Probleme reagieren und Gegenmaßnahmen einleiten.<br />
57 Vgl. SCHLESE, 2007, S. 9<br />
Abbildung 10: Personalspezifische Aufgaben eines PM-tools<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 22
2.3.4 Ziele von Personalmanagement-tools<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Der Trend hin zu computergestützten Softwarelösungen im Bereich des PM steigt.<br />
Die Gründe solch ein Tool einzusetzen, können unterschiedlicher Art sein:<br />
Das Unternehmen möchte die Ressource Personal optimal nutzen.<br />
Das Unternehmen möchte die Leistung und das Verhalten des Arbeitnehmers<br />
kontrollieren.<br />
Das Unternehmen möchte doppelte Datenpflege reduzieren.<br />
Das Unternehmen möchte klar strukturierte Prozesse.<br />
Das PM-tool soll der Geschäftsleitung wichtige und aussagefähige Kennziffern<br />
liefern.<br />
Das PM-tool soll die Mitarbeiter in ihrer täglichen Arbeit unterstützen.<br />
Das PM-tool soll zu transparenten Vorgängen im Unternehmen führen.<br />
Je nachdem, welche Ziele ein Unternehmen hinsichtlich seines PM verfolgt, legt es<br />
bei der Auswahl seinen Schwerpunkt anders. Im Kern gelangen die oben genannten<br />
Ziele jedoch allesamt zu einem Hauptziel. PM-tools sollen mit Hilfe der zur Verfügung<br />
gestellten Daten zielorientiert das PM unterstützen 58 . Heute werden von potentiellen<br />
Bewerbern und Mitarbeitern wesentlich mehr Informationen benötigt als noch vor<br />
vielen Jahren. Eine Verwaltung von unzeitgemäßen Personalakten führt zu einem<br />
hohen administrativen Aufwand. Ein PM-tool kann im Vergleich hierzu, eine wesent-<br />
lich größere Anzahl an Daten abspeichern 59 . Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten,<br />
werden die ermittelten Daten analysiert, ausgewertet und an die entsprechenden<br />
Personen wie z. B. dem Personalleiter oder dem Geschäftsführer weitergeleitet. Bei<br />
diesen Auswertungen hat der Unternehmer sowohl die wirtschaftlichen Zielen, als<br />
auch die sozialen Ziele des Mitarbeiters zu beachten. Dies stellt viele Firmen in der<br />
Praxis vor ein Problem. Einerseits befürchten die Angestellten im Zuge der Einfüh-<br />
rung eines PM-tools den sogenannten „gläsernen Mitarbeiter“. Andererseits sind sie<br />
daran interessiert, bei Entscheidungen der Geschäftsleitung gleich behandelt zu<br />
werden. PM-tools sind in der Lage, diese Restriktionen zu beachten. Diese Situation<br />
führt zu einem Bedürfnisausgleich beider Parteien 60 .<br />
58 Vgl. BRANDL, 2002, S. 43<br />
59 Vgl. BÖCK, 2006, S. 235<br />
60 Vgl. BÖCK, 2006, S. 235<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 23
2.3.5 Struktur eines Personalmanagement-tools<br />
Abbildung 11 gibt einen Überblick, wie ein PM-tool aufgebaut ist:<br />
Die theoretischen Grundlagen<br />
Die einzelnen Funktionen und Aufgaben sind bereits im letzten Abschnitt beschrie-<br />
ben. Um diese zu erfüllen, greift das PM-tool auf eine <strong>Datenbank</strong> zurück. In dieser<br />
werden alle relevanten Informationen eingepflegt. Die <strong>Datenbank</strong> selbst enthält ver-<br />
schiedene Dateien. Zum einen die Personalstammdatei, zum anderen die Arbeits-<br />
platzstammdatei 61 .<br />
Die Personalstammdatei befasst sich mit personenbezogenen Daten, die im Interes-<br />
se des Unternehmens liegen. Diese Basis wird dafür benutzt, das Personal zu ver-<br />
walten. Bereits vor 18 Jahren umfasste der Mindest-stammdatenbestand im Regelfall<br />
100 bis 300 Datenfelder pro Mitarbeiter 62 . Die Arbeitsplatzstammdatei ist ähnlich<br />
aufgebaut wie die Personalstammdatei. Sie speichert aber keine personenbezoge-<br />
61 Vgl. OLFERT, 2003, S. 562 f.<br />
62 Vgl. MÜLDER, 1994, S. 156<br />
Abbildung 11: Struktur eines PM-tools<br />
(OECHSLER, 2006, S. 140)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 24
Die theoretischen Grundlagen<br />
nen Daten ab, sondern Daten in Bezug auf den Arbeitsplatz, dem Tätigkeitsbereich<br />
oder der Position im Unternehmen. Dabei können folgende Attribute eine Rolle spie-<br />
len:<br />
allgemeine Kennzeichen um Personal und Arbeitsplatz zu bestimmen.<br />
Kenntnisstand des Mitarbeiters, der für einen benötigten Arbeitsplatz voraus-<br />
gesetzt wird.<br />
berufsspezifische Kriterien eines Arbeitsplatzes (erforderliche Bildungsvoraus-<br />
setzungen, benötigte Berufserfahrung, Spezialaufgaben).<br />
physische Merkmale eines Arbeitsplatzes (Arbeitsplatzanforderungen, Umge-<br />
bungseinflüsse).<br />
Beide Dateien können miteinander verknüpft werden. Somit lassen sich einerseits<br />
die Anforderung an einen Arbeitsplatz, als auch die hierfür benötigte fachliche Quali-<br />
fikation des Arbeitnehmers vergleichen. Verarbeitet und ausgewertet werden die<br />
einzelnen <strong>Datenbank</strong>en mit Hilfe von Berechnungsverfahren und Algorithmen 6364 . Die<br />
Ergebnisse werden anschließend in Methoden- und Modellbanken gespeichert. Hier-<br />
zu zählen z. B.<br />
Berechnungen<br />
Analyseverfahren<br />
Statistische Aufbereitungen<br />
Profilabgleiche<br />
Auswertungen<br />
Um die große Menge an vorhandenen Daten abzuspeichern, ist eine technische<br />
Unterstützung notwendig. Dies erfolgt in Form einer leistungsfähigen und auf das<br />
Unternehmen zugeschnittenen EDV-Anlage 6566 .<br />
Die Komponenten <strong>Datenbank</strong>, Methoden- und Modellbank und die EDV-Anlage stel-<br />
len das Grundgerüst von PM-tools. Sie legen den Grundstein, um Daten geeignet zu<br />
verarbeiten, auszuwerten oder miteinander zu verknüpfen 67 . Mit Hilfe dieser Elemen-<br />
te sind Tools in der Lage, die gesamte Kette entlang personalwirtschaftlicher Aufga-<br />
benstellungen abzudecken.<br />
Welche Bedingungen weiterhin geschaffen werden müssen, werden im folgenden<br />
Abschnitt näher betrachtet.<br />
63<br />
Algorithmus: eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems<br />
64<br />
Vgl. OECHSLER, 2006, S. 198<br />
65<br />
EDV: Elektronische- Daten-Verarbeitung<br />
66<br />
Vgl. OECHSLER, 2006, S. 196<br />
67<br />
Vgl. OECHSLER, 2006, S. 196<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 25
Die theoretischen Grundlagen<br />
2.3.6 Voraussetzungen für den Einsatz von Personalmanage-<br />
ment-tools<br />
Der Einsatz von PM-tools bietet dem Unternehmen viele Möglichkeiten. So können<br />
Entscheidungen schnell und objektiv entschieden werden, um einen qualifizierten<br />
und ausreichenden Personalbestand aufzubauen oder zu sichern 68 . Neben den<br />
Hauptvoraussetzungen sind weitere Bedingungen notwendig, damit ein PM-tool<br />
sinnvoll im Unternehmen eingesetzt werden kann. Diese lassen sich in fünf Themen-<br />
gebiete unterscheiden 69 .<br />
Sicherheit:<br />
Integration:<br />
Flexibilität:<br />
Die Frage wer, was, wo und wie erfasst, muss geklärt sein. Sämtliche Daten-<br />
änderungen sind zu protokollieren.<br />
Daten sind täglich auf externen Speichermedien zu sichern um eventuellen<br />
Verlust vorzubeugen.<br />
Es muss gewährleistet sein, dass die Daten geschützt sind, d. h. unberechtig-<br />
ten Lesern muss durch Vergabe von Passwörtern und Zugangsberechtigun-<br />
gen der Einblick in sensible Daten verweigert werden 70 .<br />
Um ganze Vorgänge im Bereich des PM zu bearbeiten, muss das System de-<br />
zentral aufgestellt sein. Dies ist notwendig, damit mehrere Personen zur sel-<br />
ben Zeit einen kompletten Vorgang bearbeiten können.<br />
Die Module müssen in der Lage sein, sich stets auf die zukünftigen Verände-<br />
rungen anzupassen. Sie müssen zudem erweiterbar sein.<br />
Wirtschaftlichkeit:<br />
Für den Unternehmer muss und soll sich die Einführung eines solchen Tools<br />
rechnen. Folglich ist eine Break-Even-Analysen anzustellen. Diese bestimmt,<br />
welcher Umsatz erzielt werden muss, damit gerade die Kosten gedeckt sind.<br />
Wird diese Schwelle überschritten, so erzielt das Unternehmen ab diesem<br />
Zeitpunkt Gewinn. Für den Unternehmer stellt diese Größe ein wichtiges<br />
Werkzeug für die Planung von Investitionen dar. In diesem Zuge sind ebenfalls<br />
68 Vgl. JUNG, 2011, S. 707<br />
69 Vgl. OECHSLER, 2006, S. 198<br />
70 Vgl. MÜLDER, 2000, S. 102<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 26
Die theoretischen Grundlagen<br />
die Amortisationszeit 71 der Anschaffungskosten und die Effizienz 72 solcher<br />
Programme zu beachten.<br />
Benutzerfreundlichkeit:<br />
Die Benutzeroberfläche muss unkompliziert sein. Der Anwender sollte das<br />
System einfach erlernen können und bereits nach kurzer Zeit damit vertraut<br />
sein. Einfach gehaltene Handbücher erleichtern dem Anwender z. B. mögliche<br />
Startschwierigkeiten.<br />
Somit ist ein Grundverständnis geschaffen, wie PM-tools aufgebaut sind und welche<br />
Voraussetzungen beachtet werden müssen.<br />
Im nächsten Schritt soll untersucht werden, wie die derzeitigen Abläufe im Bereich<br />
des PM bei der Firma Pabst abgebildet sind. Nur so ist eine klare und strukturierte<br />
Handlungsempfehlung an die Geschäftsleitung zu geben, ob solch ein Tool die be-<br />
stehen Prozesse im Unternehmen abbilden kann. Es wird dabei aufgezeigt, welche<br />
Vorgänge Potenzial haben, optimiert zu werden. Diese Analyse ist von besonderer<br />
Bedeutung, da alleine die Verfügbarkeit von einem PM-tool noch keine Verbesserung<br />
darstellt. Ziel muss es sein, dass nicht veraltete, sondern optimierte Prozesse in ein<br />
Expertensystem integriert werden.<br />
71 Amortisationszeit: Zeit, in der das in einer Investition gebundene Kapital zurückgeflossen ist.<br />
72 Effizienz: Verhältnis zwischen einem definierten Nutzen und dem Aufwand, der zur Erreichung<br />
eines Ziels notwendig ist.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 27
3. Darstellung der Abläufe im Unternehmen<br />
Pabst<br />
Das folgende Kapitel umfasst zwei Schwerpunkte. Zunächst liegt der Fokus auf dem<br />
Unternehmen Pabst. Dabei wird die Firma in seinem Umfeld eingeordnet. Darauf<br />
aufbauend, werden die derzeitigen personalwirtschaftlichen Prozesse innerhalb der<br />
Personalabteilung analysiert. Die <strong>Thesis</strong> geht darauf ein, ob diese Vorgänge dabei<br />
durch ein PM-tool verbessert werden können. Dieser Schritt ist notwendig, da die<br />
Abläufe vor der Einführung solch einer Software strukturiert ablaufen müssen. Nur<br />
die bloße Verfügbarkeit eines PM-tools stellt noch lange keine Verbesserung. Auf<br />
Basis dieser Untersuchung, kann der Geschäftsleitung eine Handlungsempfehlung<br />
gegeben werden, ob solch ein Tool sinnvoll für zukünftige Aufgaben im Bereich des<br />
PM ist.<br />
3.1 Analyse der aktuellen Situation<br />
Die Firma Pabst Transport GmbH & Co. KG ist ein Transportunternehmen. Das<br />
Hauptgeschäft des mittelständischen Firmenbetriebes ist der Transport von Waren im<br />
Teil- und Komplettladungsverkehr. Durch die gute geografische Anbindung an gleich<br />
drei wichtige Autobahnen (BAB 7, BAB 70, BAB 71) in Deutschland ist der Familien-<br />
betrieb den schnellen und spezifischen Anforderungen und Wünschen der Kunden<br />
gewachsen. Das Unternehmen hat sich in dieser Branche zu einem der bekanntes-<br />
ten Frachtführer innerhalb der Bundesrepublik entwickelt. Es kann auf ein Fahrzeug-<br />
pool von mittlerweile 250 Fahrzeugen zurückgegriffen werden. Dieser besteht aus<br />
einer Vielfalt an unterschiedlichen Typen von Lastkraftwagen wie z. B. Hängerzügen,<br />
Wechselbrückenfahrzeugen oder Sattelzugmaschinen (unterschiedliche Kunden<br />
fordern unterschiedliches Equipment). Eine eigene Werkstatt, Betriebstankstelle und<br />
eine Lagerfläche von 25.000 qm 2 runden die Ausstattung ab. Die Firma beschäftigt<br />
heute 400 Mitarbeiter, 100 kaufmännische und 300 gewerbliche. Eine Zahl, die ne-<br />
ben dem Umsatz im Laufe der Jahre stets zugenommen hat. Der Anstieg des Um-<br />
satzes hat für diese <strong>Thesis</strong> aber keinen relevanten Stellenwert. Viel interessanter ist<br />
die Veränderung im Verlauf des Personalbestandes und welche Folgen sich im Zuge<br />
der Expansion der Firma für das PM ergeben haben. Folgender Abschnitt betrachtet<br />
dies genauer.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 28
3.2 Das Unternehmen nimmt Fahrt auf<br />
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
Dieser Unterpunkt nimmt Bezug auf das Wachstum der Firma Pabst. Wachstum lässt<br />
sich in verschiedene Quellen spalten z. B. der Zunahme an:<br />
Arbeitnehmern<br />
Umsatz<br />
Kapital<br />
Bildung<br />
Wissen<br />
technischem Fortschritt<br />
Für das Ziel der Arbeit ist es relevant, den Focus auf die zunehmenden Faktoren<br />
Personal, Bildung und Wissen zu legen. Bestandteile, wie die Entwicklung des Um-<br />
satzes und des Kapitals sind von sekundärer Bedeutung. An dieser Stelle sei er-<br />
wähnt, dass Pabst hier ein überdurchschnittliches Wachstum in den letzten Jahren<br />
verzeichnen konnte 73 . Ist die Gewinnung an Wissen und Bildung noch schwer in<br />
Zahlen auszudrücken, so kann der Anstieg an Mitarbeitern in Form der folgenden<br />
Abbildung (Abbildung 12) verdeutlicht werden.<br />
Abbildung 12: Mitarbeiterentwicklung bei der Firma Pabst (1995 - 2012)<br />
(PABST: Unternehmenspräsentation 2012)<br />
73 Pabst konnte seinen Umsatz in den letzten drei Jahren um 35 % steigern.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 29
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
Durch die Zunahme des Personals steigt auch die administrative Arbeit. Die Beleg-<br />
schaft muss betreut werden, Daten und wichtige Informationen sind auf dem aktuells-<br />
ten Stand zu halten. Es muss gewährleistet sein, dass der Geschäftsleitung schnelle<br />
und präzise Kennzahlen (z. B. Krankenstand der Mitarbeiter am Tag X) geliefert<br />
werden können.<br />
Die spätere Analyse beleuchtet die vorhandenen personalwirtschaftlichen Prozesse<br />
der Firma. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf ausgewählte Abläufe der Personalab-<br />
teilung. Die Untersuchung soll aufzeigen, wie die verschiedenen Prozesse gestaltet<br />
sind und ob Potenzial zu Verbesserung besteht. Des Weiteren wird geklärt, ob die<br />
vorhandenen Abläufe mit Hilfe eines PM-tools verbessert und effizienter gestaltet<br />
werden können - eine Grundvoraussetzung für die mögliche Einführung eines PM-<br />
tools.<br />
3.3 Die Personalabteilung<br />
Die Untersuchung findet in der Personalabteilung statt. Eine Abteilung, die es in<br />
dieser Form bei Pabst noch nicht gab. Vielmehr wurde PM im Unternehmen in Insel-<br />
lösungen betrieben, d. h. die Organisation und Verwaltung wurde dezentral ausge-<br />
führt. In Folge des Anstiegs der Belegschaft musste nun auch die Frage nach der<br />
zukünftigen Organisation der Arbeitnehmer überdacht werden. Somit wurde Anfang<br />
2012 die Personalabteilung gegründet. Bereits ein halbes Jahr nach der Einführung<br />
nimmt sie einen hohen Stellenwert ein und regelt folgende Aufgaben:<br />
alle personalwirtschaftlichen Aktivitäten und Aufgaben strukturieren und ver-<br />
walten.<br />
Aufgaben auf die Mitarbeiter verteilen und priorisieren.<br />
Bewerber betreuen.<br />
Gespräche mit den Mitarbeitern führen.<br />
den Krankenstand der Belegschaft verwalten.<br />
die Urlaubsplanung koordinieren.<br />
Befragungen durchführen.<br />
Kündigungen aussprechen.<br />
Gespräche bei der Wiedereingliederung von Langzeitkranken führen.<br />
Es bestehen Schnittstellen zu fast allen Abteilungen in der Firma. Dies zeigt, dass<br />
sich PM mit dem ganzen Unternehmen befasst und kein Selbstzweck darstellt. Fol-<br />
gende Abbildung (Abbildung 13) zeigt auf, wie die Personalabteilung bei Pabst ein-<br />
gegliedert ist und zu welchen Abteilungen direkte Verbindungen bestehen:<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 30
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
Die grafische Darstellung veranschaulicht, dass die Personalabteilung direkt oder<br />
indirekt zu jeder Abteilung im Unternehmen Schnittstellen besitzt. Häufig benötigen<br />
die Mitarbeiter beispielsweise eine wichtige Information von einem Kraftfahrer oder<br />
möchten diesen zu einem Gespräch einladen. So braucht der Sachbearbeiter die<br />
Auskunft von einem Disponenten, wann dieser zu erreichen ist 74 . Dies ist wichtig, um<br />
den Fahrer nicht in seiner gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepause zu stören oder<br />
aufzuwecken. Eine wichtige Schnittstelle besteht daher zur Disposition. Aber nicht<br />
nur zu diesem Bereich muss eine enge Verbindung vorhanden sein. Auch zu den<br />
Abteilungen Fuhrpark, Service, Rechnungswesen und den Leitungsebenen ist eine<br />
kontinuierliche Zusammenarbeit notwendig. Nur eine funktionierende Kommunikation<br />
zwischen den einzelnen Bereichen und strukturierte Vorgehensweisen gewährleisten<br />
einen reibungslosen Ablauf im Unternehmen. Nächster Abschnitt betrachtet ausge-<br />
wählte Vorgänge innerhalb der Personalabteilung genauer.<br />
3.4 Darstellung ausgewählter Prozesse im Personalbe-<br />
reich<br />
Abbildung 13: Die Personalabteilung in der Firma Pabst<br />
(eigene Darstellung)<br />
Um aufzuzeigen, ob ein PM-tool bei zukünftigen Aufgaben in der Personalabteilung<br />
eine Hilfe darstellt, ist eine Analyse aufzustellen. Eine Analyse, die aufzeigt, wie die<br />
74 In der Praxis existieren verschiedene Touren für Berufskraftfahrer. Je nach Kundenanforderungen<br />
kann er am Tag oder in der Nacht fahren, deshalb halten die Fahrer auch zu unterschiedlichen Zeiten<br />
ihre gesetzlichen Ruhezeiten von neun bzw. elf Stunden ein.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 31
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
derzeitigen Vorgänge bearbeitet und bewerkstelligt werden. Durch das gewonnene<br />
Wissen über die Funktionalität solcher Tools, kann schließlich zu einem späteren<br />
Zeitpunkt eine fundierte Empfehlung gegeben werden, ob solch eine Einführung<br />
sinnvoll ist. Anschließend werden ausgewählte Abläufe genauer beschrieben.<br />
3.4.1 Änderung von Stammdaten<br />
Die Pflege von Stammdaten erfolgt bei Pabst sehr kompliziert. Die Datensätze wer-<br />
den aufgrund der unterschiedlichen Systeme in den Abteilungen doppelt verwaltet<br />
und gepflegt. Folgender Sachverhalt behandelt den Fall einer Stammdatenänderung<br />
am Beispiel einer Wohnsitzänderung eines Arbeitnehmers. Dieser informiert die Ab-<br />
teilung Rechnungswesen (REWE) über diesen Umstand. Das kann in Form eines<br />
Telefonats, per Post oder durch eine E-Mail geschehen. Die Daten werden von ei-<br />
nem Mitarbeiter des REWE aufgenommen und in das System Datev eingepflegt.<br />
Datev ist ein spezielles Programm für die Abrechnung der Löhne und Gehälter der<br />
Belegschaft. Es wird nur in der Abteilung REWE verwendet. Nach der Eintragung in<br />
das System, erfolgt der nächste Schritt. Die gleichen Informationen werden nun vom<br />
selben Sachbearbeiter in dem Programm ZMI registriert. Diese Software ist für die<br />
Zeitwirtschaft 75 im Unternehmen zuständig. Nachdem die Informationen erfolgreich<br />
eingetragen wurden, wird eine E-Mail mit den Änderungen des Angestellten an die<br />
zuständige Person im Bereich Fuhrpark gesendet. Sie ergänzt die Meldung in dem<br />
Programm Fleet. Ein System, was vorrangig von dem Bereich Fuhrpark genutzt wird<br />
und für die Organisation rund um diese Abteilung zuständig ist. Dieselbe Person<br />
übernimmt auch den letzten Schritt, die Eingabe der Daten in das Hauptprogramm,<br />
M3. Eine Speditionssoftware von Dr. Malek. Hierüber werden die meisten Prozesse<br />
in der Firma abgedeckt. So arbeitet die Disposition, der Service, die Abrechnung, die<br />
Lademittelabteilung oder auch das Controlling mit diesem Tool.<br />
Schaubild 14 veranschaulicht das beschriebene Beispiel:<br />
75 Das Programm ZMI ist eine Software, welches die An-/Abwesenheiten der Mitarbeiter in Form von<br />
Zeitterminals verfolgt. Die Angestellten erhalten dafür einen Transponder mit dem sie sich an diesen<br />
Terminals an-/abmelden.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 32
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
Abbildung 14: Ablauf der Stammdatenänderung bei Pabst<br />
Abbildung 14 verdeutlicht, dass insgesamt neun Schritte notwendig sind, bis der<br />
neue Datensatz in vier verschiedene Softwareprogramme eingepflegt ist.<br />
3.4.2 Bewerbungseingang<br />
(eigene Darstellung)<br />
Als einer der führenden Transportunternehmen in Deutschland hat Pabst eine große<br />
Anzahl an Bewerbungen zu bearbeiten. Arbeitnehmer aus der ganzen Bundesrepub-<br />
lik bewerben sich als Berufskraftfahrer, kaufmännische Angestellte oder möchten<br />
eine Berufsausbildung starten. Die Anwärter reichen ihre Unterlagen dabei zum größ-<br />
ten Teil in postalischer Form ein. Im Sekretariat der Firma angekommen, werden die<br />
Unterlagen den zuständigen Sachbearbeitern in der Personalabteilung zugewiesen.<br />
Die Bearbeitung erfolgt von zwei Angestellten. Eine klare Zuweisung, wer welche<br />
Anfragen bearbeitet, gibt es nicht. Vielmehr wird nach dem Zufallsprinzip gehandelt.<br />
Wer gerade freie Ressourcen besitzt, vertraut sich den Bewerbungsunterlagen an.<br />
Der Mitarbeiter begutachtet und prüft die Dokumente und pflegt danach die Daten<br />
der Kandidaten in Excel - Listen ein. Je nachdem, um welche Art es sich bei der<br />
Bewerbung handelt (kaufmännisch, gewerblich, Ausbildung), wird eine entsprechen-<br />
de Liste gepflegt (Liste “ kaufmännische Bewerbungen“, Liste „gewerbliche Bewer-<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 33
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
bungen“, Liste „Bewerbungen Auszubildende“). Es existieren somit drei verschiedene<br />
Übersichten über die eingegangenen Unterlagen. Nachdem die zuständige Sachbe-<br />
arbeiterin der Personalleiterin Bericht erstattet hat, gibt diese ein entsprechendes<br />
Feedback, ob der Kandidat für das Unternehmen interessant ist. Kommt es zu einer<br />
Zusage, so wird die Person zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Von Fall zu<br />
Fall ist es möglich, dass der Geschäftsführer an diesen Gesprächen teilnimmt. Des-<br />
halb wird vorab ein kurzes Profil der Person erstellt, welches die wichtigsten Fakten<br />
des potenziellen Arbeitnehmers auflistet. Den genauen Ablauf veranschaulicht fol-<br />
gende grafische Darstellung (Abbildung 15):<br />
Abbildung 15: Prozessablauf einer Bewerbung bei Pabst<br />
(eigene Darstellung)<br />
Ein klares Konzept, wann der Geschäftsführer an diesen Gesprächen teilnimmt, ist<br />
nicht ersichtlich. Ein auftretendes Problem für die Abteilung Personal, da in manchen<br />
Fällen die Abarbeitung zügiger ablaufen könnte. Ist es zu einer Einstellung des Be-<br />
werbers gekommen, erfolgt der erste Arbeitstag. Es wird eine Vielzahl an Dokumen-<br />
ten vom Kandidaten benötigt. Wie redundant hierbei die Daten der Mitarbeiter geführt<br />
werden, zeigt der Prozess „Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten“,<br />
welcher im nächsten Abschnitt näher betrachtet wird.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 34
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
3.4.3 Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten bei<br />
Pabst<br />
Mitarbeiterbezogene Dokumente werden im Unternehmen unstrukturiert und unüber-<br />
sichtlich verwaltet. Viele Prozesse gestalten sich langwierig. Der Kandidat aus oben<br />
genanntem Beispiel hat sich als Berufskraftfahrer beworben und wurde eingestellt.<br />
Die Person aus der Personalabteilung, die sich den Unterlagen des Fahrers bei der<br />
Bewerbung angenommen hat, schickt nun eine angefertigte Personalakte per Haus-<br />
post an den Bereich Fuhrpark. Diese ist chronologisch aufgebaut und enthält die bis<br />
dato zugegangenen Dokumente des Bewerbers (Bewerbung, Lebenslauf, Zeugnis,<br />
Lichtbild, usw.). Im Fuhrpark erhält der Berufskraftfahrer eine Erstunterweisung.<br />
Inhalte sind z. B. die Arbeitssicherheit und generelle Vereinbarungen. Weiterhin wer-<br />
den der Personalakte Dokumente wie<br />
eine Empfangsbestätigung der Tankkarten für den Kraftfahrer<br />
Dokumente über Hinweise zur Lohnabrechnung<br />
eine Aufgabenbeschreibung und<br />
sonstige Vereinbarungen<br />
beigefügt. Diese Unterlagen sind alle in Papierform vorhanden. Anschließend werden<br />
weitere Daten und Informationen in das Hauptprogramm M3 und Fleet von der<br />
Sachbearbeiterin eingepflegt. Dies sind z. B.:<br />
die Personalnummer<br />
die Sozialversicherungsnummer<br />
Nachnahme und Vornahme des Bewerbers<br />
Anschrift<br />
Lediglich Dokumente wie der Führerschein oder der ADR-Schein 76 werden bereits<br />
eingescannt. Nachdem diese Punkte mit dem Fahrer besprochen sind, wird die voll-<br />
ständige Akte wieder per internen Postboten in den Bereich Personal gesendet 77 .<br />
Dort erfolgt die Ablage. Eine Schnittstelle besteht hier zu dem Bereich REWE. Do-<br />
kumente, die in der Personalabteilung anfallen (wie z. B. Protokolle über Gespräche<br />
mit den Kraftfahrern) werden in Kopie an das REWE gesendet. Somit besitzen beide<br />
Abteilungen oftmals identische Dokumente. Im REWE erfolgt schließlich die Ablage<br />
in der eigentlichen Personalakte. Gesammelt werden in dieser alle Dokumente, die<br />
76<br />
ADR-Schein: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter<br />
auf der Straße.<br />
77<br />
Die Abteilungen teilen sich am Standort der Firma Pabst auf drei Gebäude auf. Trotz geografischer<br />
Nähe bilden sie eine räumliche Barriere. Diese muss im täglichen Geschäft überwunden werden.<br />
Manche Prozesse gestalten sich dadurch sehr lang, da die entsprechenden Dokumente erst per<br />
interner Hauspost an den Empfänger gelangen.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 35
Darstellung der Abläufe im Unternehmen Pabst<br />
etwas mit dem Angestellten zu tun haben. Jede Person im Unternehmen erhält sein<br />
eigenes Register und ist berechtigt, sich einen Einblick zu verschaffen. Zusätzlich zu<br />
der Personalakte besteht noch die Lohnakte. Sie führt hauptsächlich relevante Infor-<br />
mationen und Daten, die mit der Gehaltsabrechnung zu tun haben.<br />
Es ist zu erkennen, dass Pabst seine Daten rund um den Mitarbeiter doppelt verwal-<br />
tet. Das Problem liegt hauptsächlich darin, dass sich die Programme in den einzel-<br />
nen Bereichen nicht miteinander verknüpfen lassen.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 36
4. Chancen durch ein entsprechendes<br />
Personalmanagement-tool<br />
Diese Kapitel zeigt auf, wie ein PM-tool zukünftige personalwirtschaftliche Aufgaben-<br />
stellungen erleichtern könnte. Die Ergebnisse nehmen dabei Bezug auf die im Ab-<br />
schnitt zuvor beschriebenen Ist-Prozesse.<br />
4.1 Änderung von Stammdaten<br />
Die Abbildung 14 in Kapitel drei zeigt auf, wie viele Schritte bei Pabst benötigt wer-<br />
den, bis eine Änderung in den Stammdaten in allen Systemen erfolgt ist. Mit Hilfe<br />
eines PM-tools kann dieser Vorgang wesentlich vereinfacht und verkürzt werden.<br />
Diese Programme stellen eine einzige <strong>Datenbank</strong> zur Verfügung. Somit kann garan-<br />
tiert werden, dass Informationen über den Mitarbeiter nur einmal erfasst werden<br />
müssen und die gesamte Belegschaft auf dieses Expertensystem zurückgreift. Sich<br />
wiederholende Arbeit wird dadurch entgegengewirkt. Der Anwender hat die Möglich-<br />
keit, über die sehr einfachen und überschaubaren Masken dieser Programme alle<br />
relevanten Daten, wie die Qualifikations- oder die Aus- und Weiterbildungsdaten,<br />
einzusehen. Folglich erleichtern diese Softwares die gesamte Arbeit im Unterneh-<br />
men. Wie viele Schritte mit Hilfe eines PM-tools eingespart werden können, zeigt<br />
Abbildung 16:<br />
Abbildung 16: Stammdatenänderung mit PM-tool<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 37
Chancen durch ein entsprechendes<br />
Personalmanagement-tool<br />
Das Schaubild verdeutlicht, dass nur noch drei Schritte benötigt werden, um die<br />
Informationen in die <strong>Datenbank</strong> des Expertensystems einzutragen. Weitere Vorteile<br />
sind nachfolgend aufgelistet:<br />
Zeitersparnis<br />
Mitarbeiter können sich ihren Hauptaufgaben widmen<br />
Sich wiederholende Arbeit wird vermieden<br />
Die Aktualität der Daten ist garantiert<br />
Flexibilität<br />
Schneller Zugriff auf relevante Daten und Informationen<br />
Grafische Darstellungen in Form von Tabellen oder Statistiken sind möglich<br />
Es ist deutlich zu erkennen, dass ein PM-tool eine hilfreiche Unterstützung für Pabst<br />
wäre, um der redundanten Datenpflege im Unternehmen entgegenzuwirken und den<br />
Prozess der Stammdatenänderung zu verbessern.<br />
4.2 Eingang von Bewerbungen<br />
Der Ablauf eines Bewerbungseinganges ist in Kapitel drei geschildert worden. Dabei<br />
geht die Bewerbung durch sehr viele Hände (Mitarbeiter im Sekretariat, Sachbearbei-<br />
ter in der Personalabteilung, Personalleiterin, evtl. Geschäftsführer). Eine klare Auf-<br />
gabenverteilung innerhalb der Abteilung scheint es bei diesem Prozess noch nicht zu<br />
geben, was den Ablauf langwierig und daher ineffizient erscheinen lässt. Dieser<br />
Vorgang könnte durch ein PM-tool in Zukunft effektiver und einfacher angegangen<br />
werden, indem eingehende Bewerbungen direkt eingescannt 78 werden. Durch vorher<br />
klar vereinbarte Strukturen, verringert sich der Wechsel der Sachbearbeiter. Eine<br />
Erfassung in verschieden Excel - Listen ist nicht mehr nötig, da die Benutzer die<br />
Daten einmalig in die übersichtliche Maske des Programmes einpflegen. Die zuvor<br />
gescannten Dokumente, werden per Workflow 79 an die nun digitale Akte 80 des Be-<br />
werbers angefügt.<br />
Die Erfassung der Daten erfolgt viel schneller und bildet somit keine Haupttätigkeit<br />
mehr, wie in der Vergangenheit. Folglich lässt sich auch dieser Prozess durch ein<br />
PM-tool wesentlich vereinfachen. Abbildung 17 verdeutlicht dies in Form einer grafi-<br />
schen Darstellung:<br />
78 Dies wäre problemlos durch den bereits vorhandenen Scanplatz im Unternehmen möglich. Dieser<br />
wurde im Zuge der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) von der Firma ELO<br />
eingeführt. Ein DMS ist ein Programm, welches Daten elektronisch verwaltet.<br />
79 Workflow: vordefinierte Abfolge von Arbeitsschritten<br />
80 Siehe Anlage 1 - 3<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 38
Chancen durch ein entsprechendes<br />
Personalmanagement-tool<br />
Hat Pabst eine freie Stelle zu vergeben, so ist das PM-tool in der Lage, alle einge-<br />
henden Bewerbungen zu registrieren. Je nachdem ob diese Bewerbungen postalisch<br />
oder in Form einer E-Mail in das Unternehmen gelangen, werden automatisch Emp-<br />
fangsbestätigungen versandt. Dies gibt den Bewerber zumindest eine Vorinformati-<br />
on, dass seine Unterlagen geprüft werden und sie sich nicht im Sande verlaufen<br />
haben. Anhand des Qualifikationsprofils des Bewerbers werden mittels der PM-tools<br />
die Anforderungen, die die Stelle mit sich bringt, miteinander verglichen. Diese An-<br />
forderungen werden, wie in Kapitel 2.3.5 beschrieben, einmalig in die Arbeitsplatzda-<br />
tenbank eingepflegt. Deckt der Kandidat die Voraussetzungen ab, wird eine Einla-<br />
dung zu einem Vorstellungsgespräch verschickt. Andernfalls erfolgt eine Absage. Die<br />
Abbildung verdeutlicht die entstandene Effizienz des Prozesses, die durch die Nut-<br />
zung eines PM-tools entsteht.<br />
Abbildung 17: Prozess Bewerbungseingang mit PM-tool<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 39
Chancen durch ein entsprechendes<br />
Personalmanagement-tool<br />
4.3 Verwaltung von mitarbeiterbezogenen Dokumenten<br />
Kapitel 3.4.1 zeigt auf, wie viele Dokumente von einem Mitarbeiter bei Pabst vorhan-<br />
den sein können. Weiterhin wird veranschaulicht, dass diese Informationen zum Teil<br />
in bis zu drei Bereichen (Personalabteilung, Fuhrpark, Rechnungswesen) verwaltet<br />
werden. Durch die räumliche Trennung der Abteilungen, verzögert sich der Prozess,<br />
da die Akte erst durch eine interne Hauspost an den jeweiligen Empfänger gelangen<br />
muss. Es ist zu erkennen, dass der Vorgang langwierig ist und bereits Benjamin<br />
Franklin wusste: „Zeit ist Geld“ 81 .<br />
Ein PM-tool schafft in dieser Situation Abhilfe in Form einer digitalen Akte der Beleg-<br />
schaft. Hierunter hat man sich einen Speicher vorzustellen, der alle relevanten Daten<br />
und Informationen der Belegschaft in elektronischer Form aufbewahrt. Die Daten<br />
werden zuvor mit Hilfe eines Scanners in elektronische Formate umgewandelt. Wie<br />
bei dem Prozess des Bewerbungseingangs kann mit Hilfe des neuen DMS von ELO<br />
an dieser Stelle der bereits vorhandene Scanner genutzt werden. Man muss keine<br />
Dokumente wie Unterweisungen, Zertifikate oder Zeugnisse mehr kopieren und in<br />
einem Ordner ablegen. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:<br />
Der Papierbedarf reduziert sich<br />
Das Umweltbewusstsein steigt<br />
Zeitersparnis entsteht<br />
Klare Strukturen werden geschaffen<br />
Klare Berechtigungen werden festgelegt<br />
Die digitale Personalakte enthält alle relevanten Daten der Mitarbeiter. Jede Abtei-<br />
lung ist in der Lage, sich notwendige Information zu beschaffen. Zuvor festgelegte<br />
Strukturen garantieren, dass auch datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten<br />
werden. So hat beispielsweise die Personalabteilung und das Rechnungswesen die<br />
Möglichkeit, Löhne und Gehälter einzusehen. Der Sachbearbeiter im Fuhrpark hin-<br />
gegen hat keinen Zugriff. Dies ist aber auch nicht nötig, da diese Information für<br />
seine Arbeit keine Bedeutung darstellt.<br />
Ein PM-tool reduziert bei diesem Prozess nicht nur den Zeit- und Papieraufwand,<br />
sondern legt auch klare Berechtigungen und Zugriffsrechte fest. Die Benutzer werden<br />
nicht mehr durch die Datenflut abgelenkt. Sie können sich auf ihre Arbeit konzentrie-<br />
ren, da ihnen durch ein PM-tool ohnehin nur die Informationen zur Verfügung stehen,<br />
die sie für ihre Tätigkeiten auch benötigen.<br />
81 Online: FRANKLIN, 1748<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 40
5. Risiken/mögliche Schwierigkeiten<br />
Über die Möglichkeit, ein PM-tool einzuführen, wurde in der Vergangenheit bereits<br />
häufiger diskutiert. Welche Chancen sich dabei für ausgewählte Prozesse ergeben<br />
könnten, veranschaulichte der vorige Abschnitt. Dieses Kapitel zeigt Schwierigkeiten<br />
auf, die von Pabst beachtet werden müssen, bevor ein solches Tool eingeführt wird.<br />
5.1 Pabst muss sich einen Überblick über mögliche<br />
Partner verschaffen<br />
Pabst hat sich mit Themen moderner Softwarelösungen in der Vergangenheit eher<br />
bedeckt gehalten. Doch im Zuge der Aufbruchsstimmung öffnet sich die Firma ge-<br />
genüber Veränderungen. So wurde vor kurzer Zeit in das angesprochene DMS von<br />
ELO investiert. Der Gedanke über die Einführung eines PM-tools reifte, indem die<br />
Belegschaft stetig anstieg, sich das Bewusstsein der Mitarbeiter veränderte und eine<br />
neue Personalabteilung bei Pabst entstand. Über die Notwendigkeit, ein Mittel gegen<br />
die oftmals redundante Datenhaltung zu finden, ist man sich bewusst. Auch die feh-<br />
lende Verknüpfung der Programme innerhalb der Informationstechnik (IT) - Struktur<br />
ist bei Pabst bekannt.<br />
Den Grundstein für den Projektstart legte der kaufmännische Leiter des Unterneh-<br />
mens Pabst. Diesem waren die Chancen solcher Tools teilweise bekannt. Eine Aus-<br />
wahl an potenziellen Anbietern gab es jedoch nicht. Es war auch nicht möglich, da<br />
man sich mit diesem Thema in der Vergangenheit einfach nicht beschäftigt hatte.<br />
Der Markt bietet eine große Auswahl an modernen PM-tools. Jeder Anbieter preist<br />
sein System als das Bedienungsfreundlichste und Unkomplizierteste an. Hinzu<br />
kommt, dass Tools in der IT-Branche sehr schnelllebig sind und stets weiter entwi-<br />
ckelt werden. Ein Vergleich unter den einzelnen Anbietern ist sehr schwierig durchzu-<br />
führen. So legt ein Hersteller seinen Focus z. B. mehr auf das Thema Personalpla-<br />
nung, der andere mehr auf die Personalabrechnung. Viele Softwares bieten auch die<br />
gesamte Produktpalette an. Dadurch, dass sich Pabst in der Vergangenheit nicht mit<br />
potenziellen Tools und entsprechenden Anbietern auseinander gesetzt hat, fehlt die<br />
klare Übersicht über diesen Markt.<br />
5.2 Gesamtprozesse sind noch nicht definiert<br />
In welchem Aufschwung sich Pabst befindet verdeutlichten die vorangegangen Kapi-<br />
tel. Umsatz und Mitarbeiterwachstum stiegen die letzten Jahre überproportional an.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 41
Risiken/mögliche Schwierigkeiten<br />
Dieser Einsatz des Unternehmens wurde vor kurzem vom Bayerischen Staatsminis-<br />
ter mit der Auszeichnung des „Bayern´s Best 50“ Awards honoriert. Diese Ehrung<br />
würdigt Firmen im Freistaat Bayern, die ihren Umsatz und Mitarbeiterzahl gegenüber<br />
der Konkurrenz deutlich vergrößern konnten. Der neue Slogan der Firma, „Wir liefern<br />
Bestleistung“, soll auch in Zukunft gelebt und garantiert werden. Grundvorausset-<br />
zung sind neben den Aufträgen der Kunden eine stimmige Unternehmenskommuni-<br />
kation und klare Abläufe interner Prozesse. Wie eingangs erwähnt, werden diese<br />
Vorgänge gerade von Projektgruppen analysiert. Dies fordert seine Zeit, welche sich<br />
das Unternehmen auch nehmen muss und kann.<br />
5.3 Fehlendes Wissen muss kompensiert werden<br />
Projekte in dieser Größenordnung wurden in der Vergangenheit mehr oder weniger<br />
planlos durchgeführt. Durch die klare und strukturierte Vorgehensweise nach den<br />
Maßnahmen des Projektmanagements, schaffte es der erste Student bei der Firma<br />
Pabst, ein Umdenken im Unternehmen zu vollziehen. Er zeigte im Rahmen seiner<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis auf, welche Schritte abzuarbeiten sind, um erfolgreich ein Dokumen-<br />
tenmanagementsystem einzuführen. Dieses wird in Kürze abgeschlossen sein. Dank<br />
des logischen Handelns des Studenten ist es auf dem Weg zur Implementierung des<br />
Tools zu keinerlei Komplikationen gekommen. Das Wissen, wie Projekte solcher<br />
Größenordnungen zu stemmen sind, ist aber dennoch sehr frisch und noch nicht<br />
fundiert. Außerdem besitzt nur eine Person das gesamte theoretische Wissen. Zwar<br />
ist das angesprochene Projekt kurz vor seinem erfolgreichen Abschluss, dennoch<br />
fehlt es dem Unternehmen hinsichtlich solcher Aufgaben an Erfahrung. Wie wichtig<br />
die Informationsphasen und die Aufbereitung der theoretischer Grundlagen für Auf-<br />
gaben dieser Größenordnung sind, ist Pabst heute aber bewusst. Im Rahmen dieser<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis werden deshalb die Grundlagen geschaffen, um ein vorzeitiges<br />
Scheitern des Projektes von Anfang an zu verhindern.<br />
5.4 Anforderungsprofil über ein Personalmanagement-<br />
tool fehlt<br />
Personalarbeit ist auch immer Teil der Unternehmenskultur. Sie wird von der Ge-<br />
schäftsleitung vorgelebt und jeder Angestellte sollte sich mit der Philosophie des<br />
Arbeitgebers identifizieren. Pabst vollzog im letzten Jahr einen Imagewandel, verän-<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 42
Risiken/mögliche Schwierigkeiten<br />
derte seinen Claim 82 und designte sein Logo neu. Aus „Pabst - Wir liefern punktge-<br />
nau…“, wurde „Pabst - Wir liefern Bestleistung“. Der neue Claim wurde geradezu<br />
penetriert und soll in den Köpfen der Belegschaft fest verankert werden. Man möchte<br />
in jedem Gebiet und in jedem Prozess „Bestleistung“ für den Kunden und den Mitar-<br />
beitern liefern. Diese Aufbruchsstimmung findet derzeit im ganzen Team statt. Man<br />
öffnet sich neuen Projekten und Vorgehensweisen. So überlegt man auch, ob ein<br />
PM-tool für die vor kurzem entstandene Personalabteilung eingeführt werden soll. An<br />
dieser Stelle darf Pabst aber nicht wieder in alte Verhaltensmuster fallen und Projek-<br />
te zu schnell angehen. Es muss eine verlängerte Informationsphase eingeräumt<br />
werden. In dieser hat sich die Firma vor allem Gedanken darüber zu machen, was für<br />
Anforderungen sie an ein PM-tool stellt. Diese Fragen wurden bisher nicht geklärt.<br />
5.5 Fehlende Anbindung der IT-Struktur<br />
Die Firma Pabst ist ein Transport- und Logistikdienstleister. Als Kernprogramm setzt<br />
das Unternehmen eine Speditionssoftware namens M3 ein. Eine Softwarelösung, die<br />
von Dr. Malek angeboten wird. Durch die schnelllebigen Veränderungen und Anfor-<br />
derungen in diesem Markt, ist M3 in der Lage, die Software mit Modulen wie einem<br />
Lager-tool, Lademittel-tool oder einem Schadensmanagement-tool zu erweitern. Der<br />
Bereich Fuhrpark verwendet als spezifische Software Fleet, ein von Hiepler und<br />
Partner entwickeltes Modul. Abbildung 18 zeigt weitere Programme wie ZMI, Datev,<br />
MS-Office, ZAArc und kleine Inselprogramme die im Unternehmen bestehen:<br />
82 Definition Claim (in Anlehnung an www.wikipedia.org): bezeichnet einen fest mit dem Unternehmens-<br />
oder Markennamen verbunden Satz oder Teilsatz, der untrennbarer Bestandteil des Unternehmenslogos<br />
oder Markenzeichens sein kann (z. B. „Freude am Fahren“).<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 43
Abbildung 18: Softwareverbund bei der Firma Pabst<br />
(PABST: Schnittstellenplan Software)<br />
Risiken/mögliche Schwierigkeiten<br />
Schnittstellen zwischen den einzelnen Softwares sind bedingt vorhanden. Die unter-<br />
schiedlichen Programme wählt die Belegschaft über das Internet an 83 . Dort greifen<br />
sie auf einen virtuellen Desktop zurück und sind in der Lage, diese zu nutzen.<br />
Dadurch, dass verschiedene Systeme in den Bereichen verwendet werden, kommt<br />
es zu Redundanzen. Das bedeutet, dass Vorgänge doppelt ausgeführt werden, was<br />
einen erheblichen Mehraufwand nach sich zieht.<br />
83 Cloud-Computing: Gewährleistet, dass auch die Mitarbeiter im Außendient weltweiten Zugriff auf die<br />
Unternehmensdaten besitzen. Dazu wählen sie sich von einem beliebigen Standort auf einer Maske<br />
im Internet in das Pabst-Netzwerk ein.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 44
6. Lösungsansätze<br />
Auftretende Probleme bei der Einführung eines PM-tools sind nun bekannt. Folgen-<br />
der Abschnitt greift diese Schwierigkeiten auf und gibt Lösungsansätze vor. Dabei<br />
werden die beschriebenen Umstände in chronologische Reihenfolge zum vorange-<br />
gangenen Kapitel abgearbeitet.<br />
6.1 Marktüberblick verschaffen<br />
Die Informationsphase über potenzielle Anbieter von PM-tools ist lange zu gestalten.<br />
Das Angebot ist sehr vielfältig und unüberschaubar. Die Auswahl des richtigen Part-<br />
ners benötigt seine Zeit. Da sich Pabst mit diesem Thema in der Vergangenheit nicht<br />
beschäftigt hat, ist eine umso größere Zeitspanne für diese Informationsphase ein-<br />
zuplanen. Messen wie die „Personal-Süd“ in Stuttgart, die „Zukunft Personal“ in Köln<br />
oder die „Cebit“ in Hannover bieten einen guten Marktüberblick der verschiedenen<br />
Anbieter von PM-tools. Ein guter Zeitpunkt, um die ersten Kontakte aufzunehmen,<br />
Gespräche zu führen und vor Ort die Programme live zu sehen. Messen wie die<br />
„transportlogistic“ in München sind zwar für Pabst als ein Transportunternehmer<br />
interessant, im Hinblick auf personalwirtschaftliche Aufgabenstellungen aber eher<br />
von geringer Bedeutung, da die Hersteller nicht in der Bandbreite auftreten wie auf<br />
den angesprochenen Messen. Dennoch hat man hier die Möglichkeit, sich über die<br />
stets wandelnden Veränderungen in der Transportbranche zu informieren und einen<br />
weiteren Eindruck über moderne PM-tools zu gewinnen. Die Teilnahme an Referenz-<br />
besuchen oder Fachkongressen bietet eine zusätzliche Chance, sich über die Anbie-<br />
ter und ihrer Produkte zu informieren. Die Systeme werden vor Ort direkt vorgeführt<br />
und es kann gezielter auf die Fragen und Anregungen der teilnehmenden Personen<br />
eingegangen werden. Es können Kontakte zu anderen Unternehmen aufgenommen<br />
werden, die schon Erfahrung im Umgang mit PM-tools haben. Somit erhält man<br />
zusätzlich zu dem aus den Fachmessen gewonnen Wissen, hilfreiche Eindrücke von<br />
den Teilnehmern. Auf dieser Basis ist es möglich, zumindest zwischen den großen<br />
Herstellern, Branchenspezialisten und eher uninteressanten Anbietern zu differenzie-<br />
ren. Durch den direkten Kontakt auf den Fachmessen oder den Vertriebspersonen<br />
der Softwares lässt sich erkennen, welcher Partner am Besten zu Pabst passt.<br />
6.2 Gesamtprozesse definieren<br />
Der Weg zu einem TQM ist lang und mühselig. Trotz alledem, hat sich Pabst ent-<br />
schlossen, diesen Weg zu gehen. Zurzeit werden die Abläufe verschiedener Abtei-<br />
lungen (Controlling, Lademittel, Abrechnung) reorganisiert und optimiert. Dies stellt<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 45
Lösungsansätze<br />
allerdings nur den Anfang eines komplexen Unternehmensprojektes dar. Weitere<br />
Analysen, wie die in den Abteilungen Service, Disposition, Fuhrpark, Sekretariat und<br />
Rechnungswesen müssen folgen. Auch das QM und UM sind in diesem Zuge zu<br />
überdenken 84 . Die Firma ist seit 2001 nach den aktuellen Richtlinien der DIN EN ISO<br />
9001 85 und der DIN EN ISO 14001 86 zertifiziert. Im Zuge dessen existieren viele<br />
Formulare (z. B. die Stellenbeschreibung eines Disponenten), weil es die Norm in<br />
ihren Richtlinien so vorgegeben hatte. Gelebt und aktualisiert werden diese aber nur<br />
selten. Folglich sind sie oftmals veraltet. Das Problem besteht darin, dass das Unter-<br />
nehmen in der Vergangenheit an die DIN-Norm 87 angepasst wurde und nicht die<br />
DIN-Norm an das Unternehmen 88 . Pabst war sich einfach nicht bewusst, was für das<br />
Unternehmen überhaupt wichtig ist und was zu beachten ist (Formulare wie oben<br />
genannte Stellenbeschreibung wurden erstellt, nur, weil es so in der entsprechenden<br />
Norm empfohlen wurde). Ob diese Dokumente letztendlich sinnvoll für einzelne Pro-<br />
zesse sind oder eher eine sekundäre Rolle spielen, wurde nicht hinterfragt. Ziel sollte<br />
zukünftig sein, sowohl QM, UM und PM im gleichen Maße zu verbinden und diese<br />
nicht in „Parallelwelten“ zu realisieren.<br />
Pabst ist ein Dienstleister in der Transport- und Logistikbranche. Die wichtigsten<br />
Prozesse im Betrieb laufen auf zwei Zielgrößen hinaus, den Mitarbeiter und den<br />
Kunden. Ohne die Angestellten kann keine Ware von A nach B gefahren werden oder<br />
Sendungen der Kunden eingelagert werden. Und ohne Kunden hat man keine Auf-<br />
träge, keinen Umsatz und folglich keinen Gewinn bzw. Deckungsbeitrag, um laufen-<br />
den Kosten des Unternehmens zu decken. Jeder Prozess sollte deshalb auf diese<br />
beiden essentiellen Größen abgestimmt sein. Dienen Vorgänge auf direktem Weg<br />
diesen Zielen, so spricht man von Hauptprozessen. Stellen die Vorgänge nur eine<br />
Unterfunktion dar, so ist von Nebenprozessen die Rede. Auf dem Weg zu einem<br />
TQM sollte die Firma Pabst auf diese Unterscheidung Rücksicht nehmen und Vor-<br />
gänge folgendermaßen prüfen:<br />
Was sind Hauptprozesse im Unternehmen?<br />
Was sind Nebenprozesse?<br />
Welche Vorgänge machen Sinn und müssen eventuell ausgebaut werden?<br />
Welche Prozesse machen keinen Sinn?<br />
84<br />
In diesem Zuge muss ein neuer Zertifizierer ausgewählt werden. Man befindet sich gerade auf der<br />
Suche nach geeigneten Partnern, um das neue Qualitätsmanagement und Umweltmanagement zu<br />
realisieren.<br />
85<br />
DIN EN ISO 9001: QM-Norm, die Anforderungen an ein Kunden- und Prozessorientiertes QM-<br />
System definiert<br />
86<br />
DIN EN ISO 14001: ermöglicht Unternehmen ihr UM zertifizieren zu lassen<br />
87<br />
DIN-Norm: vom deutschen Institut für Normung e.V. aufgestellte wirtschaftliche und technische<br />
Empfehlungen, deren Anwendung der Entscheidung des Einzelnen unterliegt.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 46
Erfolgt eine redundante Datenhaltung?<br />
Wo befinden sich Schnittstellen zu anderen Bereichen?<br />
Lösungsansätze<br />
Die Fragen können hierbei als eine Art Leitlinien für anstehende Untersuchungen<br />
dienen.<br />
Abbildung 19 veranschaulicht, wie wichtig es ist, nicht einfach nur Prozesse zu opti-<br />
mieren, sondern sie vielmehr zielorientiert zu verbessern.<br />
6.3 Fehlendes Wissen durch Expertenwissen kompen-<br />
sieren<br />
Abbildung 19: Zielorientierte Prozessoptimierung<br />
(eigene Darstellung)<br />
Um PM-tools in Unternehmen einsetzen zu können, erfordert es eine Grundlage an<br />
technischem Verständnis. Dieses ist bei Pabst nur bedingt vorhanden. 2008 ent-<br />
schloss man sich dazu, große Teile der IT outzusourcen. Im Falle der Einführung<br />
eines Tools muss aber gewährleistet sein, dass die Schnittstellen zu den Hauptpro-<br />
grammen (M3, Fleet) reibungslos funktionieren. Bei Pabst gibt es zwei IT-<br />
Koordinatoren. Sie kennen die technische Struktur im Unternehmen. Mit dem Anfor-<br />
derungsprofil eines PM-tools ist Pabst bisher nicht vertraut. Entscheidet sich das<br />
Unternehmen für die Einführung, so muss mindestens eine von diesen Personen als<br />
Experte in das zukünftige Projektteam aufgenommen werden. Zusammen mit dem<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 47
Lösungsansätze<br />
Anbieter moderner Software kann so garantiert werden, dass die technischen Vo-<br />
raussetzungen solcher Programme mit der IT-Struktur des Unternehmens kompatibel<br />
sind. Pabst ist nicht die erste Firma, die verschiedene Expertensysteme benutzt und<br />
Schnittstellen untereinander ermöglicht werden müssen. Hersteller von PM-tools<br />
nehmen sich der Probleme an und sind in der Lage, die IT-Struktur anforderungs-<br />
genau anzupassen. Mithilfe eines ausgewählten Spezialisten steht der Pabst einem<br />
modernen PM nichts mehr im Wege.<br />
Natürlich besteht die Möglichkeit, dass einzelne Programme nicht miteinander ver-<br />
knüpft werden können. Dies gilt es herauszufinden, indem man Termine mit potentiel-<br />
len Partnern vereinbart.<br />
6.4 Anforderungskatalog erstellen<br />
Wie bereits erwähnt, stellt die bloße Verfügbarkeit eines modernen PM-tools noch<br />
keinen zählbaren Nutzen für das Unternehmen dar. In vielen Firmen sind diese hilf-<br />
reichen Systeme zwar eingeführt, in den wenigsten werden sie aber produktiv ge-<br />
nutzt. Die Folge ist, dass die Software zur Schrankware wird, die keiner nutzt. 89 . Es<br />
ist eine genaue Beschreibung festzulegen, was man für Ansprüche an ein PM-tool<br />
hat und welche Aufgaben es erfüllen soll. Dies ist notwendig, um potenziellen Anbie-<br />
tern klare Aussagen geben zu können. Die Zusammenarbeit kann so von Anfang an<br />
erleichtert werden. Abbildung 20 verdeutlicht, welche Anforderungen Pabst an ein<br />
modernes PM-tool haben sollte:<br />
89 Vgl. RINGLING, 2001, S. 18 ff.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 48
Abbildung 20: Anforderungsprofil an ein PM-tool bei Pabst<br />
Lösungsansätze<br />
Die allgemeinen Voraussetzungen sind durch das Kapitel 2.3.6 bereits bekannt. Die<br />
Abbildung verdeutlicht, welche speziellen Anforderungen Pabst an ein PM-tool hat.<br />
Folgeprojekte haben sich damit zu beschäftigen, welcher Anbieter zu Pabst passt<br />
und die Bedürfnisse abdecken kann. Einen Kostenrahmen gibt es vorerst nicht.<br />
6.5 IT-Struktur anpassen<br />
(eigene Darstellung)<br />
Dies ist einer der schwierigsten Aufgaben im Unternehmen. Gerade im Bereich des<br />
PM werden in den einzelnen Abteilungen Insellösungen praktiziert. Das Problem ist<br />
in der Firma bekannt. Es stellt sich die Frage, wie in Zukunft das Thema PM behan-<br />
delt werden soll und wie diese Insellösungen aufzubrechen sind. Ein Ansatz könnte<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 49
Lösungsansätze<br />
sein, dass zukünftig personalwirtschaftliche Aufgabenstellungen nur noch von einem<br />
spezifischen Tool abgebildet werden. Dazu sind die Tools in der Lage. So greifen sie<br />
nur noch auf eine große <strong>Datenbank</strong> zurück und garantieren, dass die Daten schnell<br />
abgerufen werden können und aktuell sind. Dadurch wird vermieden, dass die Infor-<br />
mationen mehrmals in den verschiedenen Programmen der Abteilungen eingepflegt<br />
werden müssen. Moderne Tools sind sehr vielfältig und decken die Gesamtbreite im<br />
Bereich des PM ab. Ein entsprechendes Expertensystem könnte auch eingesetzt<br />
werden um z. B. die Arbeitszeiten der Belegschaft zu erfassen. Setzt man solch ein<br />
Tool zukünftig ein, ist es möglich, bestehende Softwares bei Pabst zu ersetzen. Das<br />
bisher benutzte Programm ZMI könnte somit ausgetauscht werden. Auch das vom<br />
REWE benutzte Datev ist zu überdenken, da PM-tools mittlerweile die Abrechnung<br />
von Lohn- und Gehalt übernehmen können. Die IT-Struktur würde sich somit um<br />
mindestens zwei bestehende Softwares reduzieren, was das vereinfachte Schaubild<br />
(Abbildung 21) verdeutlicht:<br />
Abbildung 21: Rationalisierung von Hauptprogrammen bei Pabst<br />
(eigene Darstellung)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 50
7. Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
Dieses Kapitel gibt einen Rückblick auf die Arbeit. Der erste Abschnitt beschäftigt<br />
sich damit, inwieweit die geplanten Ziele erreicht wurden oder nicht erreicht werden<br />
konnten. Danach wird ein Ausblick darüber gegeben, wie das Projekt nach Abgabe<br />
dieser <strong>Bachelor</strong>thesis weiter verläuft. Den Abschluss bildet die Beantwortung der<br />
Frage, welchen Nutzen die Firma Pabst aus dieser Arbeit ziehen kann.<br />
7.1 Resümee der Arbeit<br />
Wie eingangs erwähnt, gab die Initialzündung für die vorliegende <strong>Bachelor</strong>thesis der<br />
kaufmännische Leiter von Pabst. Ein Unternehmen, welches sich in einer Aufbruchs-<br />
stimmung befindet. Durch die stetig wachsende Belegschaft bei Pabst war man sich<br />
einig, dass die Organisation des Personals überdacht werden musste. Die Abbildung<br />
12 in Kapitel 3.2 veranschaulicht diesen Anstieg der Belegschaft in Form einer grafi-<br />
schen Darstellung. Verschiedene Prozessanalysen brachten hervor, dass Daten und<br />
Dokumente im Unternehmen doppelt gepflegt werden. Das QM und das UM wird bei<br />
Pabst nicht mehr gelebt. In diesem Zuge hat sich das Unternehmen für einen neuen<br />
Auditor zu entscheiden. All diese Faktoren gaben dem kaufmännischen Leiter das<br />
Signal, dass in Zeiten des demografischen Wandels und des Employer Brandings<br />
personalwirtschaftliche Aufgabenstellungen überdacht werden müssen. Das Ziel<br />
eines TQM war geboren. Voraussetzung, um dieses Vorhaben zu realisieren, ist die<br />
zielorientierte Optimierung von internen Abläufen. Es wurden kleine Projektgruppen<br />
gebildet, um diese in unterschiedlichen Bereichen zu analysieren. Auch in der Perso-<br />
nalabteilung werden Daten oftmals doppelt verwaltet. Um diesen Aufwand zu redu-<br />
zieren und klare Kompetenzen sowie Berechtigungen zu schaffen, stieß Pabst auf<br />
den Begriff des PM-tools. Was darunter zu verstehen ist, war aber niemandem be-<br />
kannt. Folglich musste ein Projekt entstehen, welches sich mit diesem Thema be-<br />
fasst. Aufgearbeitet wurde es anstehend im Zuge der <strong>Bachelor</strong>thesis eines Studen-<br />
ten.<br />
In der Vergangenheit hat Pabst Projekte oftmals falsch angegangen. Informations-<br />
phasen über Vorhaben dieser Größenordnung fanden gar nicht erst statt oder wur-<br />
den viel zu kurz gehalten. Das Unternehmen befindet sich bei dem Thema PM-tool<br />
am Beginn. Es musste eine theoretische Basis geschaffen werden. Daher war es<br />
notwendig, die Begrifflichkeiten zu erläutern, die wichtig sind, um ein PM-tool zu<br />
verstehen. Das Kapitel zwei widmete sich daher der Personalwirtschaft und dem PM<br />
in ausreichendem Maße. Dabei ist die <strong>Thesis</strong> immer so weit in die Tiefe der Themen<br />
eingegangen, wie es für die Arbeit notwendig war. Neben den entsprechenden Defi-<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 51
Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
nitionen sind die Aufgaben, Ziele, Strukturen und Systematiken der Gebiete in die-<br />
sem Abschnitt erläutert worden. Der Begriff des PM-tools rundet dieses Kapitel und<br />
damit die theoretischen Grundlagen ab. Der Leser erhielt dadurch das nötige Hinter-<br />
grundwissen, welches die Voraussetzung für das anschließende Kapitel drei bildet.<br />
Dieser Abschnitt stellt in Form einer IST-Analyse ausgewählte Prozesse im Bereich<br />
des Personalwesens dar und schließt damit den Kreis zum vorangegangen Kapitel.<br />
Durch den Umfang der Arbeit konnte hierbei aber nicht jeder Prozess berücksichtigt<br />
werden. Es müssen weitere Projekte folgen, um alle Vorgehensweisen im Unterneh-<br />
men zu überprüfen und zu optimieren. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die er-<br />
folgreiche Einführung eines PM-tools dar.<br />
Das erste Ziel, ein theoretisches Grundverständnis zu schaffen, ist durch diese Arbeit<br />
erreicht worden. Auf Basis dieses Wissen und den praktischen Untersuchungen aus<br />
Abschnitt drei, konnte das zweite Ziel erlangt werden. Die <strong>Thesis</strong> zeigt auf, welche<br />
Prozesse Potenzial haben, verbessert zu werden. Weiterhin sind die Chancen be-<br />
schrieben, die entstehen, wenn man ein entsprechendes PM-tool in Zukunft einset-<br />
zen würde. Aufgrund der Ergebnisse, kann der Geschäftsleitung abschließend fol-<br />
gende Handlungsempfehlung gegeben werden.<br />
Die Einführung eines neuen PM-tools ist sinnvoll. Die Vorteile einer solchen Software<br />
wurden verdeutlicht und an praktischen Beispielen aufgezeigt. Dennoch ist von einer<br />
kurzfristigen Implementierung abzuraten. Es ist eine mittelfristige Realisierung anzu-<br />
denken. Die Analyse aller Prozesse im Unternehmen fordert Zeit. Auch die Personal-<br />
abteilung besteht erst seit einem halben Jahr. Es würde zum jetzigen Zeitpunkt noch<br />
keinen Sinn machen, den Mitarbeitern einfach ein PM-tool vorzulegen. Die bloße<br />
Verfügbarkeit eines solchen Systems bedeutet noch keinen Vorteil. Bis alle Prozesse<br />
richtig definiert und strukturiert sind, dauert es mindestens noch ein halbes Jahr. Erst<br />
dann sollte über die Einführung eines PM-tool nachgedacht werden.<br />
Nächster Abschnitt zeigt einen Ausblick über den Fortgang des Projekts nach der<br />
Abgabe der <strong>Bachelor</strong>thesis.<br />
7.2 Ausblick über das Projekt nach Abgabe der Bache-<br />
lorthesis<br />
Die Arbeit enthält Ergebnisse, welche für Pabst in zweierlei Hinsicht wichtig sind.<br />
Zum einen ist nun das theoretische Grundgerüst geschaffen, um das Thema PM-tool<br />
zu verstehen. Das gewonnen Wissen dient als Hilfestellung für die entstehenden<br />
Folgeprojekte (Anpassung der IT-Struktur, Auswahl potenzieller Partner). Aufgabe ist<br />
es nun, unter Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse, diese auch umzusetzen. Ist<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 52
Zusammenfassung der Ergebnisse<br />
dies erreicht und Pabst hat den richtigen Partner gefunden, steht einem modernen<br />
PM nichts mehr im Wege.<br />
Zum anderen stellt diese <strong>Thesis</strong> eine weitere Form dar, auf welche Weise Vorhaben<br />
dieser Größenordnung zu bewerkstelligen sind. So wird das Projekt Schritt für Schritt<br />
angegangen, um ein Scheitern im Voraus zu verhindern. Dieses Wissen bleibt Pabst<br />
erhalten und wird auf diese Weise sogar erweitert.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 53
Literaturverzeichnis<br />
AFW Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH: Grundlagen des Personal-<br />
managements, Bad Harzburg, 2011<br />
BERTHEL, Jürgen; BECKER, Fred: Personalmanagement, Stuttgart, 2003<br />
BÖCK, Ruth: Personalmanagement, München, 2002<br />
BÖCK, Ruth: Personalwirtschaft, 3. Auflage, Karlsruhe, 2006<br />
BRANDL, Julia: Die Problematik der Kennzahlen in Personalinformationssystemen,<br />
in: Personalführung, (09/2002), S. 43<br />
BRÖCKERMANN, Reiner; PEPELS, Werner: Die Personalfreisetzung – betriebswirt-<br />
schaftlich – gesellschaftspolitisch – menschlich, Renningen, 2005<br />
BÜHNER, Rolf: Personalmanagement, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Mün-<br />
chen, 2005<br />
DAUM, Andreas; PETZOLD, Jürgen; PLETKE, Matthias: BWL für Juristen – Eine<br />
praxisnahe Einführung in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Wiesbaden,<br />
2007,2012<br />
FRANKLIN, Benjamin: „Zeit ist Geld“ (1748), in:<br />
http://www.wirtschaftszitate.de/autor/franklin_benjamin.php, (06.08.2012)<br />
GABLER Verlag [Hrsg.], Gabler Wirtschaftslexikon: Stichwort DIN EN ISO 14001, in:<br />
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/222011/din-en-iso-14001-v3.html,<br />
(01.08.2012)<br />
GABLER Verlag (Hrsg.), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: deutsche Normen, in:<br />
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/72529/deutsche-normen-v5.html,<br />
(01.08.2012)<br />
HAUBROCK, Alexander; HAUBROCK, Sonja: Personalmanagement, 2. vollständig<br />
überarbeitete Auflage, Greven, 2009<br />
HERMANN, Marc; PIFKO, Clarisse: Personalmanagement, Zürich, 2002<br />
HILB, Martin: Integriertes Personalmanagement, Ziele - Strategien – Instrumente, 17.<br />
durchgesehene Auflage, Köln, 2008<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 54
HENTZE, Joachim: Personalwirtschaftslehre 1, Bern, Stuttgart, 2001<br />
HOLTBRÜGGE, Dirk: Personalmanagement, 3. Auflage, Heidelberg, 2007<br />
JUNG, Hans: Personalwirtschaft, München, Wien, Oldenburg, 1995<br />
JUNG, Hans: Personalwirtschaft, 9. Auflage, München, 2011<br />
KLIMECKI, Rüdiger; GMÜR, Markus: Personalmanagement, 3. Auflage, Stuttgart,<br />
2005<br />
KNOBLAUCH, Jörg: Die Personalfalle – Schwaches Personalmanagement ruiniert<br />
Unternehmen, Frankfurt; 2010<br />
KOLB, Meinulf: Personalmanagement, 3. neu bearbeitete Auflage, Berlin; 2002<br />
LINDNER-LOHMANN, Doris; LOHMANN, Florian; SCHIRMER, Uwe: Personalma-<br />
nagement, Heidelberg; 2008<br />
MÜLDER, Wilhelm: Zehn Forderungen an computergestützte Personalinformations-<br />
systeme, in: Wirtschaftsinformatik (2000) , 42. Jg., Sonderheft IT & Personal,<br />
S. 98 - 106<br />
MÜLDER, Wilhelm: Personalinformationssysteme – Entwicklungsstand, Funktionali-<br />
tät und Trends, in: Personalführung, Technik, Organisation, 46. Jg., 1994, Nr.<br />
4, S. 156 - 162<br />
OECHSLER, Walter: Personal und Arbeit – Einführung in die Personalwirtschaft<br />
unter Einbeziehung des Arbeitsrechts, 8. Auflage, München, 2006<br />
OLFERT, Klaus: Personalwirtschaft, 10. Auflage, Ludwigshafen, 2003<br />
O.V. (2007) Gefahrgut – Begriffe und Abkürzungen, in: http://www2.fz-<br />
juelich.de/gs/gefahrgut_begriffe/ (26.07.2012)<br />
O.V. (2012) Claim (Werbung), in: http://de.wikipedia.org/wiki/Claim_(Werbung),<br />
(02.08.2012)<br />
O.V. (2012): 20 Jahre ISO 9001, in: http://www.din.de/cmd?level=tpl-<br />
akel&menuid=47392&cmsareaid=47392&cmsrubid=47533&menurubricid=475<br />
33&cmstextid=67956&3&languageid=de, (01.08.2012)<br />
O.V. (1995) DIN ISO 8402 – Qualitätsmanagement – Begriffe<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 55
O.V.: Zukunftsfestes Personalmanagement, Handlungsmöglichkeiten für Unterneh-<br />
men, in: Zeitschrift der Industrie- und Handelskammer Würzburg – Schwein-<br />
furt, 2011, S. 1<br />
O.V.: BITE Personalmanager, in: http://manual.b-ite.de/media/pm-<br />
screens/Mitarbeiter/Mitarbeiterdetailansicht.PNG, (09.08.2012)<br />
O.V.: REXX Dashboard, in<br />
http://www.rexxsystems.com/bewerbermanagement.php?cp=BM&kw=software<br />
%20bewerbermanagement, (10.08.2012)<br />
O.V.: HEROES Bewerberverwaltung, in: http://www.he-roes.de/wp-<br />
content/uploads/2011/11/bewerber.png, (09.08.2012)<br />
PABST Transport GmbH & Co. KG: Unternehmenspräsentation, 2012<br />
PABST Transport GmbH & Co. KG: Schnittstellenplan Software, 2012<br />
PIFKO, Clarisse; ZÜGER, Rita-Maria: Personalmanagement – Management-<br />
Basiskompetenz, 2. überarbeitete Auflage, Zürich, 2007<br />
PFEIFFER, Reinhard: Mitarbeiter gewinnen leichtgemacht, in: DVZ Nr. 48/49 (2011),<br />
S. 10<br />
RINGLING, Sven: Toolgestützte Optimierung von Personalmanagementprozessen,<br />
in: CoPers (2001), S. 18 ff.<br />
RKW [Hrsg.]: RKW - Handbuch Personalplanung, 2. Auflage, Neuwied/Frankfurt,<br />
1990<br />
SCHLESE, Michael: Personalinformationssysteme, Hamburg, 2007<br />
SCHOLZ, Christian: Grundzüge des Personalmanagements, München, 2011<br />
SCHRÖDER, Olaf: Gestaltungsfragen eines Personalinformationssystems, Nor-<br />
derstedt, 2009<br />
SICKING, Marzena: Arbeitswelt 2020, Arbeitnehmer werden immer selbstbewusster,<br />
2011, in: http://www.heise.de/resale/artikel/Arbeitswelt-2020-Arbeitnehmer-<br />
werden-immer-selbstbewusster-1226561.html, (11.07.2012)<br />
SPRINGER, Johannes; STEMANN, Marie-Christine: Personalmanagement – Einfüh-<br />
rung in das Personalmanagement, Aachen, 2006<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 56
STIEFEL, Rolf Th.: Personalentwicklung KMU, 4. Auflage, Leonberg, 2004<br />
STROHMEIER, Stefan: Informatisierung der Personalwirtschaft als Forschungsauf-<br />
gabe, in: Wirtschaftsinformatik, 2000, Sonderheft 42, S. 90 – 96<br />
TRIADIS, Vasilios: Mehr wert für die Personalwirtschaft, in: Broschüre Personal &<br />
Informatik, Wiesbaden, 2011, S.8<br />
WALTER, Henry: Handbuch Führung, der Werkzeugkasten für Vorgesetzte, 3. über-<br />
arbeitete und erweiterte Auflage, Frankfurt, 2005<br />
WOLF, Mareike Ulrike: Employer-Branding, Bedeutung für die strategische Marken-<br />
führung, Hamburg, 2010<br />
WUNDERER, Rolf; DICK, Petra: Personalmanagement – Quo vadis ?, 2. Auflage,<br />
Neuwied, 2001<br />
ZEIL, Martin (2012): Statement des Bayerisches Staatsministers für Wirtschaft, Infra-<br />
struktur, Verkehr und Technologie, in:<br />
http://www.stmwivt.bayern.de/fileadmin/Web-, Datei-<br />
en/Dokumente/reden/2012/12-07-02_PK_Bayerns_Best_50.pdf, (03.07.2012)<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 57
Anhangsverzeichnis<br />
Anhang 1<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 58
Anhang 2<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 59
Anhang 3<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 60
Ehrenwörtliche Erklärung<br />
"Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich",<br />
1. dass ich meine <strong>Bachelor</strong>thesis mit dem Thema<br />
„Die Veränderung des Stellenwertes personalwirtschaftlicher Aufgabenstellun-<br />
gen in Verbindung mit den Chancen der Einführung eines Personalmanage-<br />
ment-tools bei der Firma Pabst Transport GmbH & Co. KG“<br />
ohne fremde Hilfe angefertigt habe,<br />
2. dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung<br />
der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb<br />
der Arbeit gekennzeichnet habe und<br />
3. dass ich meine <strong>Bachelor</strong>thesis bei keiner anderen Prüfung vorgelegt<br />
habe.<br />
Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.<br />
____________________________ ___________________________<br />
Gochsheim, den 17.08.2012 Unterschrift<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 61
Thesen zur <strong>Bachelor</strong>arbeit<br />
„ Die Veränderung des Stellenwertes personalwirtschaftlicher Auf-<br />
gabenstellungen in Verbindung mit den Chancen der Einführung<br />
eines Personalmanagement-tools bei der Firma Pabst Transport<br />
GmbH & Co. KG“<br />
von Philipp Menzel<br />
1.) Der Stellenwert personalwirtschaftlicher Aufgabenstellungen hat sich geän-<br />
dert.<br />
2.) Eine neue Denkweise hinsichtlich des PM ist von Unternehmen gefordert.<br />
3.) PM-tools stellen eine hilfreiche Unterstützung im Bereich personalwirtschaftli-<br />
cher Aufgabenstellungen dar.<br />
4.) Risiken bei der Einführung von PM-tools sind dabei nicht außer Acht zu las-<br />
sen.<br />
<strong>Bachelor</strong>thesis Philipp Menzel 62