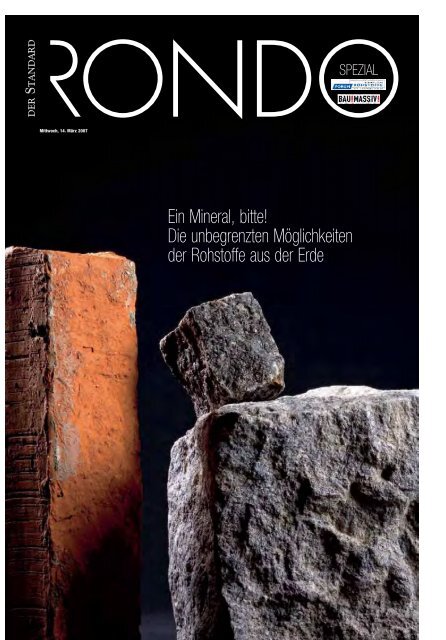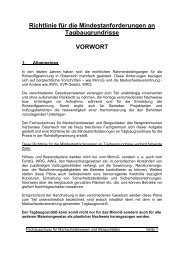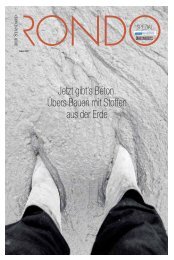Beilage RONDO zur Tageszeitung "Der Standard" - Fachverband ...
Beilage RONDO zur Tageszeitung "Der Standard" - Fachverband ...
Beilage RONDO zur Tageszeitung "Der Standard" - Fachverband ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Mittwoch, 14. März 2007<br />
Ein Mineral, bitte!<br />
Die unbegrenzten Möglichkeiten<br />
der Rohstoffe aus der Erde<br />
SPEZIAL
inhalt Schöne<br />
Diese Ausgabe entstand mit finanzieller Unterstützung des Forum Rohstoffe<br />
und Bau Massiv.<br />
Die inhaltliche Verantwortung liegt beim Standard (Bettina Stimeder).<br />
Cover: Maurizio Maier fotografierte Steine und Ziegel<br />
Fotos auf dieser Seite: Lisi Gradnitzer (2), Maurizio Maier, Michaela Pass,<br />
Ignacio Martinez<br />
MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Markus Böhm (Koord.), Wojciech Czaja,<br />
Johannes Lau Thomas Neuhold<br />
Sekretariat: Christa Fuchs, Tel. (01) 53170-285<br />
Fax-Durchwahl: -205, E-Mail: rondo@derStandard.at<br />
Grafisches Konzept: fuhrer<br />
Layout, Produktion: Armin Karner, Petra Strasser<br />
Bildbearbeitung: Otto Beigelbeck, Karl Lux, Michaela Pass<br />
Anzeigen: Christine Nöbauer<br />
2 rondo/14/03/2007<br />
Maschinen<br />
Eine Erdbewegerin im Porträt<br />
Seite 3<br />
Die Kraft des Materials<br />
Leben in und mit Betonwänden<br />
Seiten 4 bis 5<br />
Frauen bauen<br />
Baumeisterinnen erzählen<br />
Seite 6<br />
Mineral überall<br />
<strong>Der</strong> Stein steckt im Detail<br />
Seite 7<br />
Über Wunden reden<br />
Diskussion über Abbau und Natur<br />
Seiten 8 bis 9<br />
Natur aus zweiter Hand<br />
Nachnutzung von Steinbruch & Co<br />
Seiten 12 bis 13<br />
Abbau mit Vorausschau<br />
Über Abbau und Rekultivierung<br />
Seite 14<br />
Betreten verboten<br />
<strong>Der</strong> Reiz von Steinbruchparties<br />
Seite 15<br />
editorial<br />
Steinzeit ist heute. <strong>Der</strong> Pro-Kopf-Verbrauch von<br />
Kies, Sand und Co beläuft sich hierzulande<br />
jährlich auf rund zwölf Tonnen. Ein Einfamilienhaus<br />
allein benötigt 450, ein Kilometer<br />
Autobahn sogar 18.000 Tonnen<br />
Material. Ganze Wirtschaftszweige sind<br />
auf die Versorgung mit mineralischen<br />
Rohstoffen angewiesen. Also werden Jahr<br />
für Jahr Tonnen an Gestein aus hunderten<br />
Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben<br />
gesprengt, gebrochen und abgebaggert.<br />
Jede Gewinnungsstätte hinterlässt<br />
Spuren in Landschaft und Natur. Paradox<br />
erscheint, dass gerade in diesen Industrielandschaften<br />
bedrohte Tier- und<br />
Pflanzenarten jene Bedingungen vorfinden,<br />
die außerhalb des „Archipels Steinbruch“<br />
durch Menschenhand längst verloren<br />
gegangen sind. Dass es in diesem<br />
Zusammenhang zwischen Unternehmern<br />
und Naturschützern oft genug zu<br />
Reibereien kommt, verwundert nicht.<br />
Dennoch ist man dabei, ein Miteinander<br />
zu erarbeiten.<br />
Nicht nur auf Naturschützer übt der<br />
Steinbruch eine gewisse Anziehungskraft<br />
aus. So manche Kondomverpackung<br />
und Bierdose zeugt davon, dass<br />
sich dort offenbar nicht nur Fuchs und<br />
Hase gute Nacht sagen. red Q
Schöne<br />
Maschinen<br />
Die Filzmooserin<br />
Katharina<br />
Gappmaier, Chefin<br />
einer kleinen<br />
Erdbaufirma,<br />
ist als Frau immer<br />
noch eine Exotin<br />
in ihrer Branche.<br />
Als Nachteil<br />
sieht sie das nicht.<br />
Von Thomas<br />
Neuhold<br />
„Forst- und Güterwegebau, Abbrucharbeiten, Aufschließungsstraßen,<br />
der Bau von Skipisten<br />
und Speicherteichen“, so umschreibt Katharina<br />
Johanna Gappmaier, Inhaberin<br />
einer Erdbaufirma im Salzburger Eben im<br />
Pongau sowie in Filzmoos, nahe der steirischen<br />
Grenze, ihr Tätigkeitsfeld. Acht<br />
bis zehn Mitarbeiter – je nach Auftragslage<br />
– arbeiten im Familienbetrieb, in<br />
dem neben Chefin Katharina als technischer<br />
Leiter auch Ehemann Josef und<br />
die beiden erwachsenen Söhne Josef und<br />
Rupert beschäftigt sind. Im Umkreis von<br />
etwa einer Stunde Fahrzeit arbeiten die<br />
Gappmaiers und ihr Team im Auftrag<br />
von Baumeistern, Bauern und öffentlicher<br />
Hand. Jahresumsatz: rund eine Million<br />
Euro.<br />
„Bei einem Hausbau beispielsweise<br />
sind wir die Ersten und die Letzten“, erzählt<br />
sie. Begonnen wird mit einer Aufschließungsstraße,<br />
abgeschlossen wird<br />
mit der Rekultivierung. Sechs Bagger,<br />
zwei Lkws, ein allradgetriebener Muldenkipper,<br />
ein Kombiwalzenzug und ein<br />
Radlader für den Winterdienst stehen im<br />
Fuhrpark.<br />
Im Pongauer Eben unterhält Gappmaier<br />
einen Bauhof samt Aushubdeponie für<br />
etwa 30.000 Kubikmeter. Jährlich werden<br />
etwa 3000 Tonnen Wasserbausteine <strong>zur</strong><br />
Sicherung von Hängen und Böschungen<br />
verbaut. Ein typischer Erdbaubetrieb –<br />
nur dass die Chefin eben eine Frau ist.<br />
Als Nachteil habe sie das nie empfunden,<br />
lacht sie im Gespräch mit dem<br />
Standard. Auch wenn sie einräumt, dass<br />
es, als sie vor achtzehn Jahren den Betrieb<br />
eröffnet hat, doch etwas seltsam war: Immerhin<br />
sei sie bei allen Anbotseröffnungen<br />
als einzige Frau dabei gesessen.<br />
Heute habe sie in der Region den Ruf,<br />
qualitativ gut zu arbeiten, und werde akzeptiert.<br />
Reagieren ihre männlichen Kollegen<br />
und Auftraggeber anders, wenn sie<br />
auf Baustellen oder bei Verhandlungen<br />
mit von der Partie ist? „Ja doch“, die Erdbauchefin<br />
lacht erneut, „es geht etwas gesitteter<br />
zu.“<br />
Und auch wenn Wirtschaftskammerfunktionärin<br />
Gappmaier eigentlich lieber<br />
über andere Probleme ihres Berufsstandes<br />
referiert, mit einen kleinen Unterschied<br />
zu ihren männlichen Kollegen<br />
rückt sie nach einigem Zögern dann doch<br />
heraus: „Beim Kauf einer neuen Maschine<br />
muss diese nicht nur technisch auf<br />
dem neuesten Stand sein, sie muss mir<br />
auch optisch gefallen.“ Weil „der Baggerfahrer<br />
braucht eine schöne Maschine“.<br />
Das mache auf der Baustelle einfach „ein<br />
anderes Bild“ und die Arbeiter würden<br />
auch besser aufs Gerät Acht geben.<br />
Die Liebe zum optisch ansprechenden, nicht<br />
völlig zerkratzten, dreckigen Gerät schlägt sich<br />
bei der Firma Gappmaier im Maschinenpark<br />
auch deutlich nieder. Denn bereits<br />
nach vier Saisonen oder rund 6000 Betriebsstunden<br />
wird ein Bagger ausgemustert<br />
und verkauft. Das sei in der Branche<br />
nicht immer üblich, andere würden ihre<br />
Maschinen doppelt so lange laufen lassen.<br />
Wenn sie aber einen neuen Bagger bekomme,<br />
„schlägt mein Herz schon höher“.<br />
Obwohl sie selbst die Raupenfahrzeuge<br />
nie bedient, ja nicht einmal einen Lkw-<br />
Führerschein besitzt, sondern nur für das<br />
Kaufmännische im Betrieb verantwortlich<br />
ist. Dass sie in der Wirtschaftskammer<br />
Funktionen bekleide, hat etwas mit<br />
„der Quote“ zu tun, ist sie ganz realis-<br />
tisch. Aber das kümmert sie wenig, sie<br />
will als Standesvertreterin die Qualität<br />
ihrer Branche heben und den Beruf aufwerten.<br />
Etwa indem man den Baggerfahrer<br />
zum Lehrberuf mache. <strong>Der</strong>zeit sei alles<br />
reine Erfahrungssache der „Angelernten“:<br />
Es brauche viel Praxiswissen, dass<br />
eine Steinschlichtung auch nach zwanzig<br />
Jahren noch halte und nicht nach<br />
zwei, drei Jahren zusammenfällt.<br />
Ein erster Schritt in Richtung einer verbesserten<br />
Ausbildung: In Lehrbauhöfen<br />
werde ein fünfwöchiger Erdbaukurs angeboten.<br />
Ihre zwei Söhne haben diesen<br />
bereits absolviert. Wichtig wäre zudem<br />
die Aufwertung der Baggerfahrer – auch<br />
um sie von den reinen „Erdbewegern“ abzugrenzen.<br />
Diese dürften nämlich streng<br />
genommen eigenständig nicht einmal<br />
eine Baustelle führen, sondern nur als<br />
Subunternehmer von Baufirmen agieren.<br />
Reine Erdbeweger sollten nur Material<br />
von einer Stelle <strong>zur</strong> anderen befördern.<br />
Grabungs- und Sicherungsarbeiten sind<br />
eigentlich verboten. Gappmaier: „Selbst<br />
vielen Auftraggebern ist dieser Unterschied<br />
allerdings nicht bekannt.“ Q<br />
Fotos: Gianmaria Gava<br />
rondo/14/03/2007 3
4 rondo/14/03/2007<br />
Die Kraft<br />
des Materials<br />
spüren<br />
Wenn Vorarlberger Architekten<br />
auf Klischees pfeifen, kommt<br />
schon mal ein Haus aus<br />
massivem Beton dabei heraus.<br />
Bei einem haben sich die Brüder<br />
Marte besonders angestrengt,<br />
wohnt einer der beiden mit<br />
seiner Familie doch selbst darin.<br />
Von Wojciech Czaja<br />
Denkt man an Vorarlberg, kommt einem neben Bergkäse wohl auch<br />
der Satz „Schaffe, schaffe, Hüsle baue“ in den Sinn – und damit<br />
zwangsläufig der Holzbau. Ist dieser doch das stolze<br />
Aushängeschild der modernen Architektur im Ländle.<br />
Nirgendwo ist die Dichte an Holzkisten in der Landschaft<br />
so groß wie in Vorarlberg, nirgendwo sonst trifft<br />
man auf so viele Einfamilienhäuser, die nach allen Regeln<br />
der Baukunst erbaut sind.<br />
Die beiden Architektenbrüder Bernhard und Stefan<br />
Marte zeigen den Vorarlberger Klischees die lange Nase.<br />
Anstatt sich auf die traditionellen Holzkisten zu stürzen,<br />
bevorzugen sie die Freiheit der Materialvielfalt.<br />
„Bei der Wahl des Materials kommt es ganz und gar auf<br />
die Grundidee des Konzeptes an“, erklärt Bernhard Marte,<br />
„außerdem entwickeln wir gerne Raumabfolgen fernab<br />
stringenter Raster oder einer statisch optimierten<br />
Form.“<br />
Und so gelangt man immer wieder zum rauen und unbehandelten<br />
Beton, denn das vor Ort gegossene Material<br />
entspreche diesen Anforderungen wie kaum ein anderes.<br />
„Beton ist ein frei formbarer Baustoff, der dem<br />
Entwurf keine Grenzen setzt. Doch im Wesentlichen<br />
möchten wir uns nicht festlegen. Wir suchen den Beton<br />
nicht, meist finden wir ihn.“<br />
Beton auf vorarlbergerisch – das ist wahrscheinlich<br />
die radikalste Art des österreichischen Massivbaus. In<br />
den letzten Jahren sind im Ländle einige Betongebäude<br />
– vom Einfamilienhaus bis hin <strong>zur</strong> Firmenzentrale im<br />
Gewerbepark – entstanden. Das Headquarter der Firma<br />
SIE System Industry Electronic in Lustenau etwa wurde<br />
2004 in der Kategorie Industrie und Gewerbe mit dem<br />
Österreichischen Staatspreis für Architektur ausgezeichnet.<br />
Überzeugt hatte die Jury damals vor allem der<br />
Nutzungsmix sowie die landschaftlich wirksame Großform:<br />
ein turmartiges Betongebäude, das nahezu einem<br />
Würfel gleicht. Ungewöhnlich ist nicht nur die surreale<br />
Wirkung der Betonskulptur, sondern auch die vertikale<br />
Stapelung der Funktionen. Auf relativ geringer Fläche<br />
wurde ein sechsgeschoßiges und dennoch hierarchieloses<br />
Gebäude errichtet.<br />
Weitaus schwieriger ist es da schon ein Haus für sich<br />
selbst und die eigene Familie zu erbauen. Stefan Marte<br />
wagte diesen Schritt und startete ein Projekt, bei dem er<br />
Bauherr und Architekt zugleich war. Es verwundert
kaum, dass bei seinem Privatrefugium im kleinen Örtchen<br />
Dafins ebenfalls Beton zum Einsatz kam. „Wir hatten<br />
Angst, für uns selbst etwas zu bauen. Denn wenn es<br />
einmal steht, kann man sich nie mehr davon abwenden.<br />
Man entwickelt sich als Person hoffentlich weiter, doch<br />
wenn das Haus einmal steht, muss man sein Leben lang<br />
darin ein- und ausgehen“, erklärt Stefan Marte.<br />
<strong>Der</strong> Architekt setzte auf absolute Reduktion, gemäß<br />
dem Motto: „Alles, was nicht da ist, kann mich später<br />
auch nicht aufregen.“ Und so wurden Fensteröffnungen<br />
nach Möglichkeit eliminiert, Materialien aufs Wesentliche<br />
beschränkt, Türklinken, Lichtschalter, Steckdosen<br />
und anderer technischer „Unrat“ vermieden – oder auch<br />
versteckt. Übrig blieb eine Skulptur aus nacktem Beton,<br />
die im Dickicht der umgebenden Holzschindelhäuser am<br />
Hang auffällig hervorsticht. Das Haus ist wie ein Gruß<br />
aus Fernost, unterschrieben vom japanischen Architekten<br />
Tadao Ando.<br />
DemHauseingangnähertmansichaufeinemKiesweg.Esknirscht<br />
unter den Füßen. <strong>Der</strong> gedeckte Zugang zum Haus befindet sich<br />
in einer Aushöhlung, die bei Bedarf mit einem riesigen<br />
Aluminium-Drehtor geschlossen werden kann. Während<br />
das Gebäude außen in reinem Beton erstrahlt, ist<br />
die Eingangsnische an Wand und Decke mit Birkensperrholz<br />
verkleidet.<br />
Die Eingangstüre öffnet sich. Was danach folgt, ist<br />
eine komplexe, labyrinthische Raumabfolge mit vielen<br />
Stufen und Deckensprüngen, die ein wenig an den<br />
Raumplan von Adolf Loos erinnert.<br />
Im Untergeschoß befinden sich zwei Kinderzimmer,<br />
das Schlafzimmer der Eltern sowie die Sanitärbereiche.<br />
Jedes Zimmer für sich ist eine mit Sperrholz verkleidete<br />
Schatulle. Das Material hüllt den gesamten Raum an<br />
Boden, Wand und Decke ein, selbst die grifflosen<br />
Schranktüren sind aus Birkensperrholz gefertigt. Die<br />
Vorhangschiene ist als dünne Fuge in die Decke eingelassen.<br />
Nichts stört das Auge. „Ein Raum oder ein Haus<br />
kann nicht reduziert genug sein kann“, meint der Bauherr,<br />
„die Kraft und Ausstrahlung eines Raumes wird<br />
durch die Reduktion in Detail und Material um vieles<br />
verstärkt.“ Technische Notwendigkeiten wie Schalter,<br />
Steckdosen und Schrankbeschläge müsse man dem direkten<br />
Blickfeld des Betrachters entziehen. Erst dadurch<br />
gelinge es, dass der Raum nicht aus seiner irrealen<br />
Schönheit auf einen Schlag wieder in die Realität <strong>zur</strong>ückholt<br />
wird.<br />
Die Fenster in den Schlafzimmern reichen bis zum<br />
Boden, der Fenstersturz jedoch liegt sehr niedrig. So<br />
bleibt der Raum intim und in sich geschlossen. Ganz anders<br />
im Obergeschoß: Stufen mit einem Zwischenpodest<br />
führen ins Wohnzimmer – wiederum eine Schatulle<br />
aus Birkensperrholz, einziges Möbel darin ist ein für<br />
Vorarlberger Verhältnisse recht unschlicht geschnörkeltes<br />
Sofa. Hier brechen Strenge und Askese aus ihrem<br />
Korsett und erkämpfen sich ihre Freiheit. Hier ist Platz<br />
für Romantik.<br />
Man ist verdutzt. <strong>Der</strong> Raum ist zu Ende, bevor man<br />
überhaupt Küche und Essplatz entdeckt hat. <strong>Der</strong> Blick<br />
schweift <strong>zur</strong> Terrasse. Am gegenüberliegenden Ende<br />
taucht ein weiterer Betonkörper auf. Glaswände sorgen<br />
für Transparenz. Küche und Esstisch tauchen auf. Stefan<br />
Marte entschied sich sichtlich dazu, Wohn- und Essbereich<br />
räumlich und akustisch voneinander zu trennen.<br />
Im Winter jedenfalls ist Stiegensteigen angesagt: <strong>zur</strong>ück<br />
aufs Zwischenpodest, dann wieder einen Halbstock<br />
hinauf. Ein unorthodoxer Lösungsansatz, doch genau das<br />
macht maßgeschneiderte Wohnkonzepte eben aus.<br />
Bei so viel Beton drängt sich die Frage des ökologischen und ressourcenschonenden<br />
Bauens auf. Bernhard Marte antwortet:<br />
„Wenn man sich das Bauen mit Ortbeton einmal vergegenwärtigt,<br />
ist es eine sehr aufwändige Art zu bauen. Im<br />
Grunde baut man zuerst ein komplettes Haus aus Holz<br />
auf, danach wird das Eisen gebunden und die Schalung<br />
mit Beton ausgefüllt, um anschließend das Holzhaus<br />
wieder ab<strong>zur</strong>eißen.“<br />
<strong>Der</strong> Einsatz von Arbeitszeit und materiellen Ressourcen<br />
sei dabei sehr groß. Und weiter: „Vielleicht ist es<br />
das, was uns von einem klassischen Vorarlberger unterscheidet:<br />
die teilweise Akzeptanz des Unwirtschaftlichen<br />
und die Komponente von Poesie und Emotionalität<br />
statt beinharter Rationalität und konsequenter Pragmatik.“<br />
Das Schlusswort gebührt dem Bewohner. „Es gibt<br />
kaum etwas Schöneres als eine gegossene Wand aus<br />
Sichtbeton“, erklärt Stefan Marte. „Wenn man die schalglatte,<br />
fast spiegelnde Oberfläche berührt, kann man die<br />
Kraft des tonnenschweren Materials förmlich spüren –<br />
einfach Stein, Zement und Wasser.“ Q<br />
Leben in und mit massiven Betonwänden.<br />
Das Haus von Stefan Marte in Vorarlberg<br />
ähnelt von außen einem Bunker und hat<br />
doch romantische Seiten. So bricht<br />
etwa das ganz und gar nicht schlicht<br />
geschnörkelte Sofa die Strenge und Askese<br />
des Raumes, Holzvertäfelungen sorgen<br />
optisch für Wärme.<br />
Fotos: Albrecht Schnabel, Ignacio Martinez (3)<br />
rondo/14/03/2007 5
Raus<br />
auf den Bau<br />
„Immer wenn ich zum Frauenthema in der Architektur<br />
befragt werde, bekomme ich diese leichte<br />
Gänsehaut“, erklärt Elsa Prochazka, Universitätsprofessorin<br />
und Architektin, die<br />
unter anderem an der Themensiedlung<br />
Frauen-Werk-Stadt mitarbeitete, „es ist, als<br />
ob man sein ganzes Leben lang einen Befähigungsnachweis<br />
erbringen müsste, nur<br />
weil man eine Frau ist. Ich bin diese Frage<br />
leid.“ Prochazka erinnert sich <strong>zur</strong>ück: „Als<br />
ich 1973 mein Diplom gemacht habe, war<br />
ich die einzige Frau des gesamten Jahrgangs.<br />
Doch meine anfänglichen Erfahrungen<br />
waren durchwegs sehr positiv, denn<br />
ich war in einer derartigen Minderheitsposition,<br />
dass meine Situation eigentlich gar<br />
nicht thematisiert wurde.“ Im Zuge der<br />
Emanzipationswelle wurde auch Prochazka<br />
sensibilisiert: „Wenn ich <strong>zur</strong>ückblicke,<br />
bin ich froh, dass ich nicht weiß,<br />
welche Aufträge mir vorsätzlich oder unbewusst<br />
vorenthalten wurden – nur weil<br />
ich eine Frau bin.“<br />
Unter den technisch orientierten Studien<br />
führt die Architektur die Statistik<br />
mit den meisten Studentinnen an. Im<br />
Verlauf der letzten Jahre kann für die<br />
Technische Universität Wien gesagt werden,<br />
dass etwa ein Drittel aller Architekturinskribierten<br />
weiblich ist. Ein bisschen<br />
anders scheint das Verhältnis bei<br />
den Raumplanerinnen gelagert zu sein<br />
(Anteil ca. 25 Prozent), Schlusslicht bilden<br />
die Bauingenieurinnen mit gerade<br />
einmal 15 Prozent.<br />
Nach dem Studium ändert sich dann<br />
sichtlich einiges: <strong>Der</strong> Anteil der in der Architekturbranche<br />
beschäftigten Frauen<br />
beträgt 31,7 Prozent. Bei den Betriebsinhaberinnen<br />
schlägt der weibliche Anteil<br />
mit 13,4 Prozent zu Buche. Unter den<br />
6 rondo/14/03/2007<br />
Frauen sind auf<br />
Baustellen nach wie<br />
vor eher selten<br />
anzutreffen.<br />
Wojciech Czaja sprach<br />
mit jenen, die ihren<br />
Weg dorthin gefunden<br />
haben, über ihren<br />
Werdegang und ihre<br />
Erfahrungen in einer<br />
von Männern<br />
dominierten Branche<br />
Kammermitgliedern mit aufrechter Planungsbefugnis<br />
sinkt das Verhältnis gar<br />
auf sieben Prozent. Noch weitaus unproportionaler<br />
als bei den Architektinnen<br />
fällt der weibliche Anteil jedoch in jedem<br />
Fall in der praxisorientierten Baubranche<br />
aus, vor allem bei den Baumeisterinnen<br />
und Bauingenieurinnen. Bis heute zeigt<br />
sich das Gewerbe der Bauausführenden<br />
männlich dominiert.<br />
„Ich habe zwar einige Zeit in einem Architekturbüro<br />
gearbeitet, doch ich habe<br />
relativ bald erkannt, dass ich auf die Baustelle<br />
hinaus möchte“, sagt Baumeisterin<br />
Renate Scheidenberger, die in Wien das<br />
Managementbüro „Baukultur“ betreibt,<br />
„daher habe ich zu einer ausführenden<br />
Firma gewechselt und daraufhin die Baumeisterprüfung<br />
absolviert.“ Nach siebzehn<br />
Jahren Berufserfahrung ist Scheidenberger<br />
heute auf der Bauherrenseite<br />
tätig und koordiniert Baustellen von der<br />
Planung bis <strong>zur</strong> Schlüsselübergabe.<br />
Mit dem vor vier Jahren gegründeten Unternehmen<br />
„Baukultur“, das hauptsächlich im Bereich<br />
von Althaussanierung und Dachgeschossausbau<br />
tätig ist, habe sie bisher nur<br />
positive Erfahrungen gemacht. „Das liegt<br />
einerseits am technischen Wissen, andererseits<br />
aber gewiss auch an der Tatsache,<br />
dass ich einen ungeheuren Respekt vor<br />
Bauarbeitern und deren Leistung habe.“<br />
Acht Stunden täglich in Lärm und Staub<br />
zu stehen und nebenbei auch noch Lasten<br />
zu schleppen, das sei schon ein Knochenjob,<br />
erklärt die Baumeisterin. Deshalb<br />
lehne sie auch jegliche Arroganz gegenüber<br />
Bauarbeitern ab.<br />
Für Baumeisterin Maria Epple beispielsweise<br />
war der Weg ins Baugewerbe<br />
sozusagen vorgezeichnet. „Mein Vater<br />
hat eine Firma gehabt und da ich keinen<br />
Bruder habe, war es für ihn vorstellbar<br />
und sogar wünschenswert, dass ich in<br />
seine Fußstapfen trete“, erklärt Epple.<br />
„Dass ich Baumeisterin werden will,<br />
wusste ich also schon mit vierzehn Jahren.“<br />
Zusätzlich zu ihrem Beruf als Baumeisterin<br />
ist Epple seit zwei Jahren Landesinnungsmeisterin<br />
des Burgenlandes. Es sei<br />
wie in jedem anderen Beruf auch: Wenn<br />
man sich engagiert und ein bisschen über<br />
den Dingen steht, dann falle man mit der<br />
Zeit schon auf. „Und so bin ich eines Tages<br />
darauf angesprochen worden, den<br />
Posten in der Bauinnung zu übernehmen.<br />
Dass ich eine Frau bin, spielte dabei überhaupt<br />
keine Rolle.“<br />
Im Augenblick ist Epple gerade damit<br />
beschäftigt, ein Forschungsprojekt<br />
durchzuboxen, das zum Ziel hat die Koordinationsabläufe<br />
auf der Baustelle zu<br />
optimieren – dadurch soll in Zukunft ein<br />
Großteil der Baumängel ausgeschlossen<br />
werden können.<br />
Langfristig setzt sie sich für einen wirksamen<br />
Niedrigenergie-Standard und damit<br />
verbunden für erhöhte Wärmedämmung<br />
bei Häusern ein – und das mit hohem<br />
persönlichen Einsatz. Denn: „Viele<br />
sind der Meinung, dass die Baumeister<br />
durch ihre Baumaschinen den Großteil<br />
des Feinstaubaufkommens verantworten.<br />
Doch das ist nicht wahr“, erklärt Epple,<br />
„die Menschen müssen<br />
nur ihre Häuser korrekt<br />
dämmen. Dann müssten<br />
sie auch weniger heizen.“<br />
Damit könnte schon ein<br />
großer Teil des Feinstaubs<br />
vermieden werden. Q<br />
Fotos: Epple, Maurizio Maier
Fotos: Renée Cuhaj (2), Robert Bosch AG, EPA<br />
Mineral überall<br />
Mineral im Tank<br />
Wer sich automobil vorwärts<br />
bewegt, ahnt gar<br />
nicht, wie viele Mineralien<br />
ihn dabei umgeben: Dass die<br />
Karosserie aus zahlreichen<br />
Erzen gefertigt wird, dürfte<br />
allgemein bekannt sein, aber<br />
auch in der Elektronik kann man<br />
inzwischen auf die kleinen Steinchen<br />
nicht mehr verzichten, die man hier vor<br />
allem in Keramikform einsetzt:<br />
Zündkerzen werden z.B. aus Aluminiumoxid-Keramik<br />
gefertigt, und die Lambda-<br />
Sonde besteht aus Zirkoniumoxid. Sie sorgt<br />
für die richtige Mischung aus Benzin<br />
und Luft im Tank – auch nicht ganz unwichtig.<br />
Kristalline Störgeräusche<br />
Manchmal wünscht man sich, dass er<br />
weniger gut funktioniert: der Wecker.<br />
Aber dennoch piept so ein Wecker mit<br />
grausamer Verlässlichkeit. Und hinter<br />
diesem nervtötenden Geräusch stecken<br />
tatsächlich auch Mineralien:<br />
Die Piezo(nicht Piepso)-Kristalle erzeugen<br />
durch eine angelegte<br />
Wechselspannung<br />
eine Schwingung mit<br />
einer leider oft allzu<br />
deutlich hörbaren<br />
Frequenz: Wenn<br />
man also am Samstag<br />
einen Stein nach<br />
dem Weckgerät<br />
wirft, bekämpft man<br />
Feuer mit Feuer.<br />
Keep smiling!<br />
Bei Mineralien im Mundraum denkt<br />
man eher an unangenehm sandige<br />
Strandgeschmäcke und hässliches<br />
Knirschen. Das Gegenteil aber ist der<br />
Fall: Wenn sich bei der morgendlichen<br />
Zahnpflege die weiße Paste geschmeidig<br />
um die Zähne legt, kommen dabei auch<br />
Mineralien zum Einsatz: Rutil und Anatas<br />
erzeugen die weiße Farbe und Calcit<br />
sorgt dafür, dass der Belag unbemerkt<br />
von den Zähnen<br />
geschmirgelt wird.<br />
Heute sind wir abhängiger von<br />
Steinen, als unsere Urahnen es<br />
je waren: Minerale sind nicht bloß<br />
die Angelegenheit verschrobener<br />
Geologen und absonderlicher<br />
Hobbyisten – sie sind im Alltag oft<br />
präsenter, als man denkt und<br />
bemerkt. Eine kleine Aufzählung<br />
von Johannes Lau<br />
JUNGv.MATT/Donau<br />
Schlucken und strahlen<br />
Selbst die Halbgötter in<br />
Weiß würden ohne Mineralien<br />
ganz schön alt<br />
aussehen. Deshalb findet<br />
man sie hier an jeder<br />
klinischen Ecke:<br />
Prothesen werden aus<br />
Titan und Keramik gefertigt.<br />
Aber nicht nur als Werkstoff,<br />
sondern auch als<br />
schluckbares Präparat<br />
finden Mineralien ihre<br />
Verwendungsmöglichkeit:<br />
Wer Magen- und Darmprobleme<br />
hat, der muss<br />
das Kontrastmittel Bariumsulfat<br />
schlucken. Das ist<br />
zwar kein Medikament,<br />
aber damit behält der<br />
Onkel Doktor beim<br />
Röntgen den Überblick.<br />
Und wie wohnen Sie?<br />
Holen Sie sich jetzt bis zu 700,– Euro WünscheFörderung.<br />
Wie Sie sich ganz einfach ein gemütliches Zuhause finanzieren, erfahren Sie unter 05 05 05-24 oder<br />
finanzierung.ba-ca.com
Hier wächst<br />
ein Gras<br />
mehr – eine<br />
Nachrede<br />
Natur nützen, aber auch<br />
schützen. Darüber sind sich<br />
Rohstoffbranche und Naturschützer<br />
einig.<br />
Die Art und Weise, wie das<br />
geschehen soll, sorgt jedoch<br />
für Diskussionen<br />
Standard: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen<br />
rohstofffördernden Unternehmen und Naturschutz aussehen?<br />
Bernd Wanivenhaus: Wir haben bereits seit mehreren Jahren<br />
eine Partnerschaft mit dem WWF, im Zuge derer bereits<br />
viel geschehen ist. Wir wollen aber nicht nur nach<br />
außen zeigen, was sein kann, sondern auch die Unternehmen<br />
motivieren, etwas zu tun.<br />
Johannes Gepp: Voraussetzung für eine gute Partnerschaft<br />
ist, dass man dort, wo man etwas nutzt, auch etwas<br />
weitergibt, etwa im Zuge einer Abgabe.<br />
Wie könnte eine solche Abgabe gestaltet sein?<br />
Gepp: <strong>Der</strong> erste Schritt wäre, österreichweit gleiche Standards<br />
zu schaffen. Bis jetzt gibt es so etwas wie die Landschaftsschutzabgabe<br />
nicht in jedem Bundesland. Man<br />
sollte diese bei fünfzig Cent pro Tonne ansetzen.<br />
Wanivenhaus: Grundsätzlich ist eine allgemeine und einheitliche<br />
Lösung fair, weil dadurch der Wettbewerb über<br />
Ländergrenzen hinweg nicht mehr verfälscht wird.<br />
Allerdings sind fünfzig Cent sehr hoch.<br />
Gepp: Dem Naturschutz könnte man am schnellsten<br />
helfen, wenn diese Gelder zudem zweckgebunden<br />
wären, also dem Naturschutz zugute kommen und<br />
nicht, wie es manchmal der Fall ist, <strong>zur</strong> Deckung irgendwelcher<br />
Defizite missbraucht werden.<br />
Wanivenhaus: Sie müssen aber bedenken, dass eine solche<br />
Abgabe direkt an den Konsumenten weiterverrechnet<br />
wird. Die Rohstoffindustrie würde es zudem gerne<br />
sehen, wenn die Menschen in jener Gemeinde, wo abgebaut<br />
wird, mehr vom Kuchen bekommen, weil diese<br />
ja die negativen Auswirkungen wie erhöhtes Verkehrsaufkommen,<br />
Staubbelastung etc. am meisten spüren.<br />
Gepp: Ein gewisser Prozentsatz könnte bei der jeweiligen<br />
Gemeinde bleiben. Dort, wo die Sünden passieren.<br />
Die da wären?<br />
Gepp: Ich meine damit die Altlasten, die es hie und<br />
da noch gibt. Früher hat man beispielsweise aufgelassene<br />
Schottergruben als Mülldeponien benutzt.<br />
Was <strong>zur</strong> Folge hatte, dass das Grundwasser verschmutzt<br />
wurde. Heute gibt es nur mehr ganz<br />
kleine Sünden – das muss man ehrlicherweise<br />
auch dazusagen.<br />
Wanivenhaus:So etwas gibt es zum Glück nicht<br />
mehr, weil man auch vonseiten der Behörden<br />
viel strenger darauf schaut. Außerdem<br />
hat das Grundwasser heute<br />
höchste Priorität. Es hat in den vergangenen<br />
Jahren auch ein Umdenken<br />
vonseiten der Rohstoffunternehmen<br />
gegeben, da man<br />
mit dem alten Image als Landschaftszerstörer<br />
zu kämpfen<br />
hatte.<br />
Gepp: Es müsste noch viel mehr vonseiten der Industrie<br />
kommen – und was kommt, müsste noch überzeugender<br />
sein. Es sollte eben nicht nur PR-Gags geben,<br />
sondern mehr Arbeit sozusagen in die Breite.<br />
Wanivenhaus: <strong>Der</strong> <strong>Fachverband</strong> sagt ja auch: Die schwarzen<br />
Schafe müssen angeprangert werden. Hier geht es<br />
schließlich um unser Image. Man will zeigen, dass man<br />
umdenkt, dass man sich bemüht. Die Rohstoffbranche<br />
hat einen sehr guten Weg gefunden – was sogar auf<br />
europäischer Ebene Anerkennung findet. Ich sage nicht,<br />
dass alles perfekt ist, aber der Dialog ist ehrlich gemeint.<br />
Gepp: Dennoch: <strong>Der</strong> Dialog und die Aktionen müssen<br />
breiter angelegt sein. Zwei, drei Einzelbeispiele und<br />
Vorzeigeprojekte – zu denen ich herzlich gratuliere – genügen<br />
nicht. Hier geht es auch um Freiwilligkeit.<br />
Die Gewinne sind ja da. Ich glaube nämlich, dass die<br />
Branche in den meisten Fällen immer noch ganz gut an<br />
der Natur verdient.<br />
Wanivenhaus: In Zukunft muss ein verstärkter Dialog zwischen<br />
den Unternehmen, den NGOs und den Behörden<br />
geführt werden. Die NGOs müssen die Branche verstehen<br />
und umgekehrt. In erster Linie muss der Naturschutz<br />
begreifen, dass beim Abbau eben eine Wunde in<br />
der Natur entsteht. Die Unternehmer wiederum müssen<br />
verstehen, dass diese Wunde mit Renaturierungsmaßnahmen<br />
wieder geschlossen werden kann. Man
kann auch schon während des Abbaus Maßnahmen für<br />
die Natur setzen, indem man zum Beispiel während der<br />
Brutzeit nicht baggert. Das sind alles Dinge, die schon<br />
ins Bewusstsein der Betreiber gedrungen sind.<br />
Gepp: Gefühlsmäßig könnte allerdings noch viel mehr<br />
geschehen.<br />
Wie können die angesprochenen Wunden in der Natur<br />
geschlossen werden?<br />
Gepp: Schon beim Abbau sollte man vor Augen haben:<br />
Man nimmt von der Natur und gibt ihr nachher wieder<br />
etwas <strong>zur</strong>ück. Alle machen es so: die Landwirtschaft,<br />
die Forstwirtschaft.<br />
Wanivenhaus: Man darf nicht die Sünden der Vergangenheit<br />
heranziehen, sondern muss in die Zukunft blicken.<br />
Gepp: Ja. Deshalb meine berechtigte Forderung: Die<br />
Kiesgrubenbetreiber müssen noch viel mehr auf eine<br />
sinnvolle Nachnutzung hinarbeiten.<br />
Wanivenhaus: Es ist klar, dass ein Steinbruch oder eine<br />
Kiesgrube kein schöner Anblick ist. Aber mit etwas Ge-<br />
Auf schnellstem Weg. JetztistdierichtigeZeit,den<br />
WünschenTatenfolgenzulassenundsicheinenlang<br />
gehegten Traum zu erfüllen. Mit einer perfekt zugeschnittenen<br />
Finanzierungslösung, die ein Höchstmaß<br />
an Flexibilität und Sicherheit gewährleistet. <strong>Der</strong> Erfolgs-<br />
Kredithilftschoninnur15MinutenbeiWunsch-Erfüllungen<br />
bis 50.000,- Euro. Gemeinsam mit Ihnen erstellt<br />
Ihr BA-CA Betreuer in einem einzigen Beratungsgespräch<br />
einen individuellen Finanzierungsplan. Sollte<br />
sich während der Laufzeit etwas ändern, bleiben Sie<br />
dennoch ganz entspannt – denn die Flexibilität und<br />
eine Versicherung sorgen für den nötigen Freiraum.<br />
Lassen Sie Ihre Wohnträume frei. DieBA-CAunterstütztSieaberauchbeiderRealisierungIhresWohnprojektesbeijedemSchritt.Manchmalhelfenbereits<br />
kleine Veränderungen, um sich sein Nest gemütlicher<br />
zu machen, manchmal ist es aber auch ein Neubau oder<br />
eine umfassende Renovierung. Mit den Finanzierungen<br />
ADVERTORIAL ...<br />
Bernd Wanivenhaus<br />
(li.) und Johannes<br />
Gepp (re.) diskutieren<br />
über Abbau mit oder<br />
gegen die Natur.<br />
Fotos: Andi Urban,<br />
Maurizio Maier<br />
fühl und den Vorgaben der Naturschutzbehörden kann<br />
durch Renaturierung sogar etwas Besseres entstehen als<br />
vorher. Aber gerade hier gibt es auch unterschiedliche<br />
Ansätze unter den Ökologen. Manche sagen: Macht am<br />
besten gar nichts – die Natur holt sich eh alles wieder.<br />
Andere wiederum behaupten das Gegenteil.<br />
Gepp: Welche Methode man vorzieht, ist letztendlich<br />
egal. Aber das Wesentliche ist, dass es<br />
überall angestrebt werden sollte – und zwar<br />
ganz selbstverständlich.<br />
Wanivenhaus: Tatsächlich hat sich herausgestellt,<br />
dass sich die Natur die Sandgruben <strong>zur</strong>ückholt<br />
und dass dort oft die interessantesten<br />
Tierarten ein Zuhause finden, seien das nun seltene Vogelarten<br />
oder irgendwelche Insektenarten. Auf der anderen<br />
Seite könnte man aber auch ein bisschen weiter<br />
gehen und der Natur sozusagen Starthilfe geben, etwa<br />
indem man eine Böschung so abbaggert, dass darin Vögel<br />
brüten können.<br />
Gepp: Ja, bei manchen Abbaustätten ist das möglicherweise<br />
schon der Fall. Wenn ich mir allerdings die Situation<br />
rund um Graz anschaue, dann sind dort vielleicht<br />
fünf Prozent der Abbauflächen naturgerecht wiederhergestellt<br />
worden. Die Mehrzahl der Abbauflächen entspricht<br />
jedenfalls nicht den Standards.<br />
Was schlagen Sie vor?<br />
Gepp: Bei jeder neuen Baggerung sollte von vornherein<br />
der Naturschutz das erste Ziel einer Nachnutzung sein.<br />
Nur in Ausnahmefällen, wenn es dem Gemeinwohl<br />
FürgroßeundkleineTräume:DieErfolgsFinanzierungen mit<br />
bis zu 700,– Euro WünscheFörderung.<br />
ErgreifenSiejetztIhreChanceundträumenSienichtlänger!Dennmit<br />
den ErfolgsFinanzierungenderBankAustriaCreditanstalt (BA-CA)<br />
werdenIhreWünscheWirklichkeit–obHausimGrünen,Altbauwohnung<br />
inderCity,neuesAutooderberuflicheWeiterbildung.DieBA-CAgeht<br />
schnellundunbürokratischaufIhrepersönlichenBedürfnisseein.Und:<br />
WennSiesichbiszum27.April2007füreineWunsch-Finanzierungsamt<br />
einer Lebensversicherung der BA-CA entscheiden, bekommen Sie sogar<br />
bis zu 700,- Euro WünscheFörderung*. Da bleibt noch genügend Raum für<br />
einen kleinen Extra-Wunsch.<br />
derBA-CAlässtsichbeidesumsetzen,vomWohnungskauf<br />
bis zu neuen Möbeln.<br />
Bleiben Sie flexibel. Eine gute langjährige Partnerschaft<br />
braucht Spielraum. Schließlich kann niemand<br />
sagen, was in ein paar Jahren sein wird. Die BA-CA ist<br />
damitihrenflexiblenFinanzierungengenauderrichtigePartner,denndiesepassensichjederzeitanIhre<br />
aktuelle Lebenssituation an. So können Sie etwa mit der<br />
Rückzahlung Ihres Kredites bis zu einem Jahr später anfangen.DenngeradeinderheiklenStartphasekanneinrückzahlungsfreierZeitraumdasLebenumeinVielfaches<br />
einfacher machen. Oder genießen Sie die Freiheit,<br />
mal höhere und mal niedrigere Raten zu bezahlen<br />
oder über einen vereinbarten Zeitraum auch ganz mit<br />
den Zahlungen auszusetzen.<br />
WennIhnendurcheineSchenkungoderdurchdieAuszahlung<br />
einer Lebensversicherung unerwartet ein grö-<br />
dient, kann man über eine andere Art von Nachnutzung<br />
nachdenken.<br />
Wanivenhaus: <strong>Der</strong> Naturschutz muss sich aber auch im<br />
Klaren darüber sein, was er will. Dazu gehört beispielsweise<br />
auch die Diskussion, ob es wichtiger ist, Straßen<br />
zu bauen, damit die Menschen schneller zu<br />
ihrer Arbeit kommen, oder ob der Vogel,<br />
der auf dem Gebiet der geplanten Straße<br />
brütet, geschützt wird.<br />
Gepp: Es sollte schließlich beides möglich<br />
sein. Im Zusammenhang mit Nachnutzung<br />
muss die Natur allerdings immer an erster<br />
Stelle stehen. Es muss auch ein gewisser Grad<br />
an Freiwilligkeit vorhanden sein. Es hätte schon viel<br />
mehr Geschenke an die Natur und damit an die Gesellschaft<br />
in Form von renaturierten Flächen geben können.<br />
Nützen, aber auch schützen sollte die Prämisse sein. Es<br />
muss ja nicht unbedingt dort sein, wo man den nächsten<br />
Badeteich errichten will. Es gibt schließlich auch<br />
entlegene Schottergruben en masse.<br />
Wanivenhaus: Obwohl wir in verschiedenen Bereichen<br />
tätig sind, herrscht doch Einigkeit darüber, dass wir<br />
unsere Landschaft, unsere Natur erhalten müssen.<br />
Aufgezeichnet von Markus Böhm Q<br />
Bernd Wanivenhaus ist Prokurist von Cemex Austria, zuständig für Umweltmanagent<br />
und zudem Vorstandsmitglied des Forum Rohstoffe.<br />
Johannes Gepp ist Leiter des Instituts für Naturschutz, Obmann des Naturschutzbundes<br />
Steiermark und Vizepräsident des Naturschutzbundes<br />
Österreich.<br />
ßerer Geldbetrag <strong>zur</strong> Verfügung steht, können Sie den<br />
Kredit selbstverständlich auch vorzeitig <strong>zur</strong>ückzahlen.<br />
BeizusätzlichemGeldbedarfwährendderKreditlaufzeitwendenSiesichwiederumeinfachanIhrenBetreuerbeiderBA-CA.<strong>Der</strong>findetdiepassendeZusatzfinanzierung<br />
für Sie. Außerdem können Sie mit Ihrem<br />
ErfolgsKonto jederzeit Ihre individuelle EinkaufsReserve<br />
nutzen. Auf Wunsch wechseln Sie auch von einer<br />
Fremdwährungsfinanzierung auf einen Euro-Kredit.<br />
Mit einer maßgeschneiderten Versicherungslösung im<br />
RückensichernSiezudemnichtnursichselbstundIhre<br />
Lieben ab, sondern Sie bauen auch Vermögen auf. Flexible<br />
Finanzierungen und Versicherungslösungen – alles<br />
aus einer Hand.<br />
NähereInformationenerhaltenSiebeiIhremBetreuerinjederFiliale<br />
der Bank Austria Creditanstalt, unter http://finanzierung.ba-ca.com<br />
im Internet oder telefonisch bei der InfoLine unter 05 05 05–24.<br />
*)DieWünscheFörderungsetztsichauseinerGratis-Kreditratebiszu500,-EuroundeinerGratis-Versicherungsprämie(kapitalbildendeLebensversicherungmitAblebensschutzundlaufenderPrämienzahlung;<br />
giltfürCapitalClassicwahlweisemiterhöhtemAblebensschutz,SinfonieInvestundLifeInvest)biszu200,-EurozusammenunderfolgtalsGutschrift auf eine ErfolgsCard!
Raue<br />
Schönheit<br />
Lisi Gradnitzer hat die Ästhetik<br />
der Industrielandschaft eines<br />
Steinbruchs bei Deutsch-<br />
Altenburg und einer Kiesgrube<br />
bei Markgrafneusiedl mit ihrer<br />
Kamera eingefangen<br />
Winzig, geradezu verloren wirkt jener Arbeiter, der mit weit<br />
ausladenden Schritten auf sein Arbeitsgerät zumarschiert.<br />
Kaum zu glauben, dass die Reifen seines Radladers mannshoch<br />
sind, denn selbst die riesenhafte Maschine erscheint in<br />
den Weiten des Steinbruchs, der einer Mondlandschaft ähnelt,<br />
nicht viel größer als ein Kinderspielzeug in einem Sandkasten.<br />
Dass eine Kiesgrube allerdings kein Spielplatz ist, konnte<br />
Fotografin Lisi Gradnitzer am eigenen Leib erfahren: Denn<br />
bei dem – letztendlich erfolgreichen – Versuch die Dynamik<br />
der herumwirbelnden Kieselsteine festzuhalten, die scheinbar<br />
aus dem Nichts kommend auf einen Haufen rieseln, hätte<br />
sie beinahe die Linse ihres Objektivs eingebüßt. Verständlich<br />
also, dass auf dem Betriebsgelände Helmpflicht herrscht.<br />
Ein moderner Steinbruch ist heute ein weit gehend automatisierter<br />
Betrieb. Meterlange Förderbänder transportieren<br />
das Gestein <strong>zur</strong> Zwischenlagerung auf einzelne Haufen. Die<br />
Endprodukte sind, von Ausnahmen abgesehen, Baustoffe, die<br />
man nach ihrer Korngröße unterteilt in: Brechsand, Splitt,<br />
Schotter, Gleisschotter und Wasserbausteine. Diese Baustoffe<br />
werden später weiterverarbeitet, um zum Beispiel Beton<br />
oder Asphalt herzustellen. Abtransportiert wird das tonnenschwere<br />
Material mit Lastwägen, deren Reifen schließlich<br />
zentimetertiefe Spuren im fein gemahlenen Material hinterlassen.<br />
10 rondo/14/03/2007
ondo/14/03/2007 11
Hier wohnt die Unke<br />
Dort, wo schwere<br />
Maschinen die Erde<br />
aufreißen und ganze<br />
Berge abgetragen<br />
werden, blüht das<br />
Leben. Denn viele<br />
bedrohte Pflanzen<br />
und Tiere finden in<br />
Abbaustätten<br />
Lebensräume vor,<br />
die es in der Form<br />
hierzulande nirgends<br />
mehr gibt. Über die<br />
„Natur aus zweiter<br />
Hand“<br />
Von Weitem ist das Brummen schwerer Radlader zu hören, Staub<br />
wirbelt auf, als das in verschiedenste Körnungen gebrochene<br />
Gestein auf die wartenden Lastwagen verladen wird.<br />
Unbeeindruckt von dieser hektischen Betriebsamkeit<br />
des nahen Steinbruchs, hat es sich etwas abseits eine<br />
Gelbbauchunke in einer Baggerspur gemütlich gemacht.<br />
Mit weit von sich gestreckten Hinterbeinen und gut getarnt<br />
durch ihre lehmfarbene Oberseite sonnt sich die<br />
Amphibie im flachen Wasser. „Dort, wo immer wieder<br />
Bagger fahren, ist der Boden stark verdichtet und so können<br />
sich Wasserpfützen bilden“, erklärt Gerald Pfiffinger,<br />
Geschäftsführer der Naturschutzorganisation Bird-<br />
Life Österreich. „Mehr brauchen bestimmte Arten oft gar<br />
nicht.“ So wie eben die Gelbbauchunke und ihre Verwandte,<br />
die Rotbauchunke.<br />
Die Amphibien haben allerdings meist gar keine andere<br />
Wahl, als auf wassergefüllte Spurrinnen <strong>zur</strong>ückzugreifen:<br />
Die Klein- und Kleinstgewässer, ihre typischen<br />
Lebensräume und Laichplätze, wurden in den letzten<br />
Jahrzehnten zunehmend zerstört. Die veränderte Nutzung<br />
von Grünland, das Trockenlegen von sauren Wiesen,<br />
die Regulierung und Verbauung kleiner Bäche und<br />
Gräben sind denn auch die Gründe, warum die Unke<br />
auf der roten Liste der gefährdeten heimischen Tierarten<br />
steht. Überhaupt haben sich die Überlebensbedingungen<br />
vieler Tiere und Pflanzen in den letzten Jahrzehnten<br />
durch Flussregulierungen, Flächenversiegelungen,<br />
Städtebau und Wasserkraftwerke kontinuierlich<br />
verschlechtert.<br />
Die Unken haben in Lehmgruben und Steinbrüchen<br />
Zufluchtstätten gefunden. „<strong>Der</strong> Mensch schafft so Ersatz<br />
für die von ihm zerstörten Lebensräume“, beschreibt<br />
Ornithologe Pfiffinger dieses Phänomen, „Na-<br />
tur aus zweiter Hand sozusagen“. Rund 180 Steinbrüche<br />
und etwa neunhundert Sand- und Kiesgruben gibt<br />
es in Österreich. Und der Hunger nach mineralischen<br />
Rohstoffen ist groß: <strong>Der</strong> Pro-Kopf-Verbrauch beträgt<br />
hierzulande rund zwölf Tonnen pro Jahr. Ganze Wirtschaftszweige,<br />
wie etwa die Bauwirtschaft, die immerhin<br />
7,5 Prozent des Brutto-Inlandproduktes erwirtschaftet,<br />
sind auf die Versorgung mit Sand, Kies, Stein und<br />
Co angewiesen.<br />
Dass die Wirtschaft sowohl Teil des Problems als auch<br />
Teil der Lösung ist, ziehen Naturschützer mittlerweile<br />
ins Kalkül: „Unsere Einstellung hat sich geändert“, erklärt<br />
der Nachhaltigkeitsexperte des WWF, Thomas<br />
Kaissl, „von Ablehnung hin zu Akzeptanz. Wir reden<br />
mit allen.“ Man kooperiere mit der Branche, wo auch<br />
immer es geht. Denn nur durch Zusammenarbeit sei es<br />
möglich, die für die Gewinnungsstandorte charakteristischen,<br />
gefährdeten Arten zu schützen und Lebensräume<br />
zu ihrer Erhaltung zu schaffen.<br />
„Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Spezies, die<br />
nicht nur von Steinbrüchen, sondern vom Rohstoffabbau<br />
generell profitieren“, schildert Pfiffinger. Als Beispiel<br />
nennt er den Flussregenpfeifer, einen braun und<br />
weiß gefiederten Vogel, der früher an dynamischen Flüssen<br />
vorkam, welche im Regelfall sehr viel Geschiebe hatten<br />
und sehr große Schotterbänke anlandeten. Heute findet<br />
er ähnliche Bedingungen nur noch in Kiesgruben.<br />
Ein Indikator, dass die Branche umdenkt, mag auch<br />
die Kooperation verschiedener NGOs mit dem <strong>Fachverband</strong><br />
der Stein- und keramischen Industrie sein, die bereits<br />
seit mehreren Jahren läuft. „Die Schottergrube hat<br />
ja vielfach das Image einer Ödlandschaft, einer Mondlandschaft“,<br />
meint Gerald Pfiffinger, „und die Schotter-
arone haben das Image der Landschaftszerstörer, die<br />
sich auf Kosten der Natur bereichern.“ Gut vorstellbar<br />
also, dass die Grubenbetreiber diesen Ruf loswerden<br />
wollen (siehe auch Diskussion Seiten 8 und 9).<br />
Zu neunzig Prozent habe man es aber mit Klein- und<br />
Mittelbetrieben zu tun, meint WWF-Mann Kaissl: „Die<br />
brauchen in erster Linie unsere Unterstützung, weil sie<br />
nicht über die nötigen Ressourcen und Mittel verfügen,<br />
um alleine Projekte auf den Weg zu bringen.“ Naturschutz<br />
muss aber nicht unbedingt mit hohem finanziellen<br />
oder personellen Aufwand verbunden sein. Oftmals<br />
genügt es schon, während der Brutzeit nicht zu baggern<br />
oder kleine Gewässer stehen zu lassen, damit sich Libellenarten<br />
darin ansiedeln können. Nur müsse das den<br />
handelnden Personen erst einmal bewusst gemacht werden.<br />
„Viele Betreiber sind schließlich richtiggehend<br />
stolz auf das Erreichte“, weiß Pfiffinger.<br />
In erster Linie geht es um die Nachnutzung. Denn obwohl die Rohstoffgewinnung<br />
immer auch einen Eingriff in die Natur bedeutet,<br />
können in aufgelassenen Gewinnungsstätten<br />
ökologische Nischen und neue Lebensräume für bedrohte<br />
Tierarten entstehen. „Eine Einsicht, die in zunehmenden<br />
Maße auch in der Bevölkerung Anhänger findet“,<br />
sagt Gerald Pfiffinger. Vielfach tut sich aber gerade<br />
im Zusammenhang mit der Nachnutzung ein neues<br />
Spannungsfeld auf: „<strong>Der</strong> Betreiber ist vielfach nicht der<br />
Grundeigentümer“, erklärt Thomas Kaissl, „sondern<br />
vielleicht ein Bauer, der das Land dann wieder bewirtschaften<br />
will.“ Dadurch würde Natur verloren gehen. Mit<br />
Unverständnis reagieren die Naturschützer auch, wenn<br />
eine stillgelegte Schottergrube in ein Industriegebiet umgewidmet<br />
wird, „nur weil die Behörde der Meinung ist,<br />
dass es sich noch um Ödland handle“. max Q<br />
Tierarten wie Uhu oder<br />
Gelbbauchunke, die in<br />
Österreich auf der roten<br />
Liste stehen, finden in aufgelassenen<br />
Steinbrüchen,<br />
Kies- oder Sandgruben<br />
einen Ersatzlebensraum.<br />
Fotos Seiten 12 bis 14: Heribert<br />
Proepper, Lisa Maire, Patrick<br />
Pleul; Montage: Michaela Pass<br />
Intelligent<br />
Bauen mit dem<br />
Isotropie-Effekt<br />
Entdecken Sie das Geheimnis der Isotropie<br />
YTONG ist ein Baustoff den man kennt – oder besser: zu<br />
kennen glaubt. Oder warum sonst ist dieser neu entdeckte<br />
Baustoff speziell für Niedrigenergie- und Passivhäuser<br />
jetzt so interessant? Was steckt hinter dem<br />
Geheimnis der Isotropie? Überragender Wärmeschutz<br />
oder behagliches Wohnklima? Mit YTONG heißt die<br />
Antwort: sowohl als auch! Denn nur YTONG zeigt mit seiner<br />
durchgehenden Porenstruktur in alle Richtungen die<br />
gleich günstigen Eigenschaften. Alle Informationen zum<br />
wohl intelligentesten aller Baustoffe finden Sie unter<br />
www.ytong.at/isotropie.<br />
Info-Hotline 0800/10 11 13<br />
®<br />
®<br />
rondo/14/03/2007 13
„Keine Steine auf den Kopf“<br />
Schon bei der Gewinnung an die Rekultivierung denken – Thomas Oberndorfer vom Institut für<br />
Bergbaukunde der Montanuniversität Leoben im Gespräch über Tagbautechniken, Sicherheitsaspekte<br />
und die Renaturierung von Steinbrüchen<br />
Standard: „Heutzutage ist die Tagbautechnik in hohem<br />
Maße mit Gesichtspunkten der Umwelttechnik verbunden“,<br />
steht in Kapitel fünf Ihres Skriptums „Bergkunde für<br />
Gesteinshüttenleute“. Was ist darunter zu verstehen?<br />
Thomas Oberndorfer: Damit ist vor allem die Schonung der<br />
Natur während des Abbaus gemeint. Aber auch, dass die<br />
soziologischen und psychologischen Auswirkungen auf<br />
den Menschen während des Abbaus zu minimieren<br />
sind. Und schließlich sollte man auch die in Anspruch<br />
genommenen Flächen einer sinnvollen Nachnutzung<br />
zuführen.<br />
Im Sinne einer Renaturierung?<br />
Oberndorfer: Genau. Schon beim Abbau sollte man an die<br />
Rekultivierung denken.<br />
Welche Abbauarten gibt es?<br />
Oberndorfer: Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten.<br />
Nimmt man etwa einen Abbau in einem hügeligen Gelände,<br />
so kann man den Abbau frontal „in den Berg“ fortschreiten<br />
lassen, wodurch eine ständig höher werdende<br />
Abbauwand entsteht. Oder man arbeitet sich scheibchenweise<br />
von oben nach unten. Beide Methoden haben<br />
ihre Vor- und Nachteile.<br />
Welche ist für eine spätere Rekultivierung am besten geeignet?<br />
Oberndorfer: Vonseiten der Rekultivierung ist das Vonoben-runter-Arbeiten<br />
sicher die bessere Methode, weil<br />
man von außen nicht sieht, wo gearbeitet wird. Außerdem<br />
greift man den Bereich, den man hinter oder ober<br />
sich <strong>zur</strong>ücklässt, später nicht mehr an. Das heißt, dass<br />
dort bereits rekultiviert werden kann. <strong>Der</strong> eigentliche<br />
Abbaubereich, also dort wo die Maschinen arbeiten, ist<br />
dagegen relativ versteckt.<br />
Welche Faktoren bestimmen die Rekultivierung?<br />
Oberndorfer: Da gibt es sehr vielfältige Gesichtspunkte –<br />
das Gestein selbst, die Höhenlage oder die Ausrichtung<br />
<strong>zur</strong> Sonneneinstrahlung, um nur einige zu nennen. Ein<br />
ganz wichtiges Kriterium ist aber die Gestaltung des vom<br />
Bergbau geschaffenen Geländes. Denn: Je steiler, desto<br />
schwieriger ist es, beispielsweise Humus aufzutragen,<br />
weil dieser nicht hält.<br />
Ein flacher Abbau wäre demnach besser?<br />
Oberndorfer: Ja, nur hat eine flachere Gestaltung aus Sicht<br />
des Naturschutzes den Nachteil, dass man mehr Platz<br />
braucht. Hinzu kommt, dass aus rein technischen Gründen<br />
ein Abbau immer in Etagen erfolgen sollte, damit<br />
die Maschinen leichter herumfahren können. Schon<br />
rein optisch wirken diese Terrassen dann aber unnatürlich.<br />
Ein Spannungsfeld tut sich hier auch in Bezug auf<br />
die Sicherheit auf.<br />
Welchen Sicherheitsvorteil bringen Etagen?<br />
Oberndorfer: Einen ganz eminenten: Sie fangen Steine, die<br />
sich immer wieder durch Frost oder Alterung des Gebirges<br />
lösen können, auf. Es macht schließlich einen Unterschied,<br />
ob ein Stein fünf oder hundert Meter in die<br />
Tiefe fällt. Und genau diese Gefahr besteht, wenn <strong>zur</strong><br />
Verbesserung des visuellen Eindrucks die Etagen am<br />
Ende aufgelöst werden. Wir in der Technik versuchen<br />
außerdem die Wand so glatt wie möglich zu halten, damit<br />
uns ja kein Steinchen auf den Kopf fällt. Das ist aber<br />
genau das Gegenteil dessen, was die Pflanze benötigt.<br />
Diese braucht nämlich Ritzen oder Spalten, um sich festklammern<br />
zu können. Unebenheiten begünstigen somit<br />
die Vegetation, sind aber auf der anderen Seite ein Sicherheitsrisiko.<br />
Welche Möglichkeiten der Wiederherstellung gibt es?<br />
Oberndorfer: Die Bandbreite ist sehr vielfältig. Das geht im<br />
Prinzip vom massiven Humusaufbringen, um dort wieder<br />
Pflanzen anzusiedeln, bis hin zum Belassen des<br />
nackten Fels. Die Frage ist: Was will ich mit dem Ding<br />
nachher machen? Soll, wo einmal Wald war, wieder<br />
Wald sein? Oder lässt man der Natur freien Lauf? Letzteres<br />
ist vor allem auch ein Anliegen des Naturschutzes.<br />
Das ist vielleicht optisch nicht ganz so schön, aber für<br />
die Tiere und Pflanzen ist es viel günstiger, wenn sie einen<br />
langsam wachsenden und sich heranbildenden Bereich<br />
haben. Erwiesenermaßen ist in solchen Fällen<br />
auch die Artenvielfalt besonders hoch.<br />
Man verzichtet sozusagen einfach darauf, der Natur<br />
Starthilfe zu geben?<br />
Oberndorfer: Genau. Sehr drastisch ausgedrückt heißt das:<br />
Man tut gar nichts. Dieses Nichtstun hat enorme Nachteile<br />
für das Landschaftsbild – sprich: Die Leute aus der<br />
Region sehen das meistens nicht so gern. Aber es hat<br />
Riesenvorteile für die Natur, weil sie Zeit hat, genau das<br />
zu bilden, was eben hingehört. Die Entwicklung der Humusdecke<br />
lässt sich schließlich nicht erzwingen. Das<br />
dauert eben seine Zeit – dreißig, vierzig Jahre. Auf der<br />
anderen Seite kann man durch massiven technischen<br />
Einsatz auch sehr schnelle Begrünungserfolge erzielen<br />
– was zum Beispiel im Straßenbau häufig erfolgreich<br />
praktiziert wird. Allerdings erfordern diese Flächen<br />
meist langfristige Pflege, was dem im Bergbau verfolgten<br />
Ziel der Nachhaltigkeit widerspricht. In der Praxis<br />
kommen diese Extreme aber eher selten vor. Das Spannende<br />
in diesem Bereich ist ja gerade, den besten Kompromiss<br />
zwischen den Interessen des Bergbaus, des Naturschutzes<br />
und der Anrainer zu finden – zugegebenermaßen<br />
in zum Teil recht emotionsgeladenen Diskussionen.<br />
Was spricht dagegen, der Natur freien Lauf zu lassen?<br />
Oberndorfer: Zum einen die Auswirkungen auf das Landschaftsbild,<br />
zum anderen ist es eine Frage der Sicherheit.<br />
Man muss den ehemaligen Abbaubereich de facto<br />
absperren, damit niemand den nach wie vor gefährlichen<br />
Steinbruch betritt. Im Bergbau ist die Rechtslage<br />
so, dass der Steinbruch, solange er unsicher ist, als Abbaugebiet<br />
gehandelt wird. Dementsprechend ist auch<br />
der vormals Bergbautreibende dafür verantwortlich.<br />
Auch hier stehen sich also Interessen des Naturschutzes<br />
und der Anrainer gegenüber.<br />
Wobei das auch sehr von der Lage<br />
des Bergbaus abhängt. Wenn es<br />
wenige Menschen im Gebiet gibt,<br />
ist der Gedanke, die Natur dort frei<br />
walten zu lassen, ein sehr verlockender.<br />
Foto: privat<br />
Interview: Markus Böhm Q
Kleine<br />
Flecken<br />
Freiheit<br />
Wie eine aufgelassene<br />
Schottergrube<br />
eine Jugend rettete.<br />
Ein Essay von<br />
Josef Herbert<br />
Staatsfeind schien einem an der oberösterreichischen<br />
Peripherie aufgewachsenen 15-Jährigen<br />
Ende der 1980er ein erstrebenswerter<br />
Beruf; ein allein dem Ruf der Gegend<br />
geschuldeter Umstand. Auflehnung gegenüber<br />
Autoritäten, staatlich beglaubigten<br />
wie erdachten, hatte da oben, wo der<br />
Inn das Bayerische vom Österreichischen<br />
trennt, schließlich zu allen Zeiten das Gebot<br />
der Stunde gebildet. Aber die Zeiten<br />
waren auch im Innviertel nicht stehen geblieben.<br />
Das Establishment hatte im Laufe<br />
der Jahrhunderte Wege und Mittel ersonnen,<br />
die Rebellion im Keim zu ersticken<br />
beziehungsweise ihr revolutionäres<br />
Potenzial für seine Zwecke einzuspannen.<br />
So mühte sich die örtliche Landjugend<br />
redlich, die Unsicherheiten zu kanalisieren,<br />
welche einen jungen Menschen<br />
zwischen dem ersten Bier und dem<br />
Abschluss der Lehre respektive der Matura<br />
beuteln.<br />
Es wollte nicht nutzen. Die Mitarbeit<br />
bei der Organisation des jährlichen<br />
Stadlfests und regelmäßige Ausflüge in<br />
niederbayrische Partnerdörfer erkannte<br />
man als bei der Mannsbildwerdung nicht<br />
behilflich an. Die Alternative in Form der<br />
lokal üblichen schlagenden Burschenschaften<br />
schien ebenfalls keine Alternative:<br />
Man hatte die erste Pickelkrise<br />
schließlich nicht bewältigt, um sich<br />
gleich darauf mit rostigen Säbeln die<br />
Brust aufschneiden zu lassen. Man war<br />
zwar noch zu jung, um ein Mofa fahren<br />
zu dürfen, aber bereits alt genug, um über<br />
Dr. Sommer zu lachen, schließlich wusste<br />
man ja längst, wie, wo, was. Aber was<br />
tun, um die alltägliche Tristesse zwischen<br />
Goldhaubenstickerei und Setzkastenfigurensammlung<br />
erträglich zu machen?<br />
Die Antwort lag in der Gruabn. Die<br />
Gruabn war eine irgendwann Mitte der<br />
1970er aufgelassene Schottergrube, gelegen<br />
abseits der Bundesstraße zwischen<br />
Altheim und Kirchdorf/Inn: Fernab vom<br />
Schuss, aber über einen überwucherten<br />
Feldweg leicht zugänglich. Die Natur hatte<br />
die Gruabn im Laufe der Jahre langsam<br />
<strong>zur</strong>ückerobert, was dem Flair des Ortes<br />
nicht abträglich gewesen war: Ein riesiges<br />
Loch mitten in der Pampa, rundum<br />
geschützt von steilen Abhängen, über die<br />
man a) locker hinabklettern konnte und<br />
b) sich vor Zugriffen der Staatsgewalt sicher<br />
wusste. Letzteres begann eine Rolle<br />
zu spielen, je später der Abend wurde, als<br />
die ersten Joints die Runde machten und<br />
der harte Gangsta-Rap der „Niggaz with<br />
Attitude“ langsam aber sicher von den<br />
umnebelten Klängen von Cypress Hill abgelöst<br />
wurde („Hits from the Bong“).<br />
Für uns bildete die Gruabn nicht nur einen unbesetzten<br />
Ort, den es mit (HipHop-)Kultur zu<br />
überziehen galt, sondern ein nahezu metaphysisches<br />
Konzept: einen rechtsfreien<br />
Raum, einen kleinen Flecken Freiheit inmitten<br />
des Provinzwahnsinns. Weil wir<br />
von unseren Idolen „Public Enemy“ gelernt<br />
hatten, dass man sich niemals und<br />
von niemandem erzählen lassen durfte,<br />
was ging und was nicht, machten wir uns<br />
ans Werk: Wir besorgten Fässer, keine<br />
Ahnung mehr, woher, wir besorgten<br />
Baseballkappen, auf deren Vorderseite<br />
schlecht bezahlte Taiwanesen die Initialen<br />
großer amerikanischer Städte genäht<br />
hatten, wir besorgten Getränke, die heutzutage<br />
unter dem Sammelbegriff „Alkopops“<br />
firmieren und Namen wie „Ice<br />
Breaker“ tragen; wir besorgten Papiers-<br />
ackerl für die Getränke und wir besorgten<br />
einen überdimensionierten Kassettenrekorder,<br />
aus dem die Musik der Zeit<br />
kam. Wenn man ihn anwarf, begann der<br />
Restschotter, den man aus welchen Gründen<br />
immer <strong>zur</strong>ückgelassen hatte, zu den<br />
Klängen von „Gang Starr“ und den „Boogie<br />
Down Productions“ zu vibrieren; wir<br />
soffen, rappten, schrien „Wave your<br />
hands in the air like you just don’t care“<br />
und kamen uns unglaublich cool vor. Die<br />
Fässer hatten wir mit allerlei brennbarem<br />
Material befüllt, das so in der Grube herumlag,<br />
sie angezündet und anschließend<br />
wohlwollend das Feuer betrachtet.<br />
Das selbst kreierte Ambiente erzeugte ein<br />
Zusammengehörigkeitsgefühl – wir in da<br />
Gruabn, die da draußen in den Dorfkneipen<br />
und auf den Stadlfesten – und wies<br />
so bald auch anderen den Weg. Obwohl<br />
wir wirklich nicht auf Missionierung aus<br />
waren. Weil uns Orthodoxie im Allgemeinen<br />
und in der Musik im Besonderen<br />
fremd war, zogen die Partys immer mehr<br />
Leute an, hinab in die Gruabn. So hallte<br />
die gescheite Reimkunst von De La Soul<br />
gleichberechtigt neben dem Funk von Ca-<br />
Es ist der Reiz des<br />
Verbotenen, der eine<br />
Steinbruchparty nochmal<br />
so schön macht.<br />
Foto: Lisi Gradnitzer<br />
meo und The Time durch das Loch in<br />
Erde. Selbstredend loud as hell. Und obwohl<br />
das obere Innviertel mit der South<br />
Bronx ungefähr so viel gemeinsam hatte<br />
wie Udo Jürgens mit Grandmaster Flash,<br />
war so doch eine Zeit lang das Gefühl entstanden,<br />
dass das Getto nichts rein physisch<br />
Erfahrbares war, sondern etwas, das<br />
sich im Inneren abspielt.<br />
Die Partys in der Gruabn fielen bald der Kälte des<br />
nahenden Herbstes zum Opfer und im darauf<br />
folgenden Sommer hatten wir schon den<br />
nächsten Ort gefunden, an dem wir uns<br />
austoben konnten: Einen gottverlassenen<br />
Baggersee nicht unweit davon, den wir<br />
auf den schönen Namen Lago di Pago<br />
tauften und an dessen Stränden wir weiter<br />
dem Wirklichkeitsentzug frönten.<br />
Vergessen haben wir die Gruabn trotzdem<br />
nie: Sie hatte uns das erste Mal gezeigt,<br />
dass es trotz allem noch Plätze im<br />
Leben gibt, die wir besetzen können. Einfach<br />
so. Q<br />
rondo/14/03/2007 15
Wer macht dem Zahn der Zeit am meisten Angst?<br />
An einem Massivhaus beißt sich<br />
der Zahn der Zeit die Zähne aus!<br />
Denn Ihr Baumeister garantiert Ihnen<br />
konkurrenzlose Langlebigkeit und Wertbeständigkeit.<br />
Und das mit mineralischen<br />
Baustoffen wie Ziegel, Beton und Naturstein!<br />
Für ein gesundes Raumklima<br />
sowie beste Wärme- und Schallschutz-<br />
Eigenschaften.<br />
Überzeugen Sie sich selbst!<br />
www.baumassiv.at<br />
Rahofer.