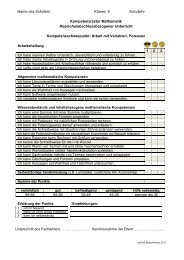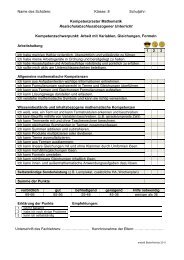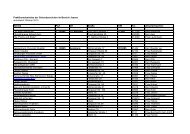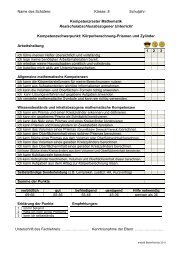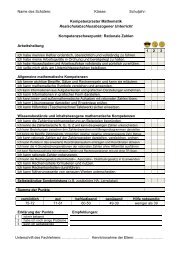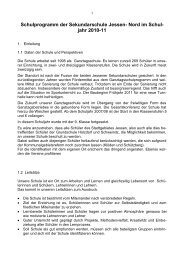Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...
Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...
Abschlussbericht der Evaluationsgruppe - Sekundarschule Jessen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1. Angaben zur Schule<br />
Schülerzahl 270<br />
Anzahl <strong>der</strong> Klassen bzw.<br />
Lerngruppen<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> über den Schulbesuch<br />
vom 09. 11. bis 11. 11. 2010<br />
an <strong>der</strong><br />
<strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord<br />
13<br />
Lehrkräfte/PM männlich: 5 / 0 weiblich: 24 / 2<br />
Schulträger Landkreis Wittenberg, Verwaltung: Stadt <strong>Jessen</strong><br />
schulspezifische<br />
Beson<strong>der</strong>heiten<br />
2. Vorbereitung<br />
Ganztagsschule<br />
Teamvorstellung in <strong>der</strong> Schule am 08.11.2010<br />
3. Durchführung<br />
Zeitraum vom 09.11. bis 11.11.2010<br />
Interviews mit 2 Mitglie<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Schulleitung<br />
Übersicht über die durchgeführtenUnterrichtsbeobachtungen<br />
7 Lehrkräften<br />
6 Elternvertretern<br />
6 Schülervertretern<br />
Schuljahrgang Fächer<br />
5 Deu (2), Mat (2), Eng, Geo (2), HWi<br />
6 Deu, Mat (2), Eng, Geo<br />
7 Deu (2), Mat, Bio, HWi, Spo (2), Ges, Wir,<br />
Frz, Che, Eth, SOL (För)<br />
8 Deu, Mat, Eng, Tec, Phy (2), EvR, Bio, Ges,<br />
Soz, Mus, SOL (För)<br />
9 Mat (2), Eng, Kun, Tec, Ges, Bio, EvR<br />
10 Mat, Eng, Ast, Wir, HWi, Ges, Phy
4. Erkenntnisse und Beobachtungen über die Qualitäts- bzw. Untersuchungsbereiche<br />
4.1 Rahmenbedingungen<br />
Seite 2 von 19<br />
Die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord ging aus <strong>der</strong> Fusion von zwei <strong>Sekundarschule</strong>n <strong>der</strong> Stadt hervor.<br />
Sie befindet sich im gleichnamigen Stadtteil, <strong>der</strong> sowohl von mehrgeschossigen Wohnhäusern<br />
als auch von Einfamilienhäusern geprägt ist. Die Schule liegt in einer landschaftlich ansprechenden<br />
Umgebung und grenzt teilweise an Flächen mit dichtem Baumbestand. Das Schulgebäude<br />
wurde im Januar 1980 eingeweiht und beherbergt die einzige noch existierende <strong>Sekundarschule</strong><br />
<strong>der</strong> Stadt. Seit 1998 bietet die Schule als Ganztagsschule ein breites Spektrum schulischer<br />
und außerschulischer Angebote für die Schülerinnen und Schüler an.<br />
Das Schulgebäude präsentiert sich heute von außen in einem guten und überwiegend sanierten<br />
Zustand. Seit 2005 wird das Schulgebäude saniert und renoviert. Zum Einsatz kamen bisher<br />
hauptsächlich Mittel aus dem Ganztagsschulprogramm. Die Bauarbeiten fanden bei laufendem<br />
Schulbetrieb statt. Trotz <strong>der</strong> sehr langen Bauphase ist ein Ende noch nicht abzusehen.<br />
Der gesamte Schulkomplex besteht aus dem Schulhaus, dem Schulhof und <strong>der</strong> Sportanlage.<br />
Hier soll mit geplantem Baubeginn im Frühjahr 2011 eine neue Zweifel<strong>der</strong>sporthalle für die Schule<br />
errichtet werden.<br />
Das Schulgebäude ist ein dreigeschossiger, nicht barrierefreier Plattenbau. Frontseitig führt <strong>der</strong><br />
Schulhof zum Haupteingang <strong>der</strong> Schule. Das Schulgelände ist durch einen Zaun abgesichert.<br />
Der Hof vor dem Schulhaus ist durch eine dichte Hecke von <strong>der</strong> Straße zum Wohngebiet abgegrenzt.<br />
Im weiteren Verlauf wird <strong>der</strong> teilweise gepflasterte Hof durch Bänke, Sitzgruppen, Bäume<br />
und Sträucher sowie Sport- und Spielgeräte immer stärker aufgelockert und grenzt auf <strong>der</strong> Rückseite<br />
des Gebäudes an den zur Schule gehörenden Sportplatz. Aufgestellte Papierkörbe tragen<br />
dazu bei, die Freiflächen sauber zu halten. Auf dem Schulhof gibt es überdachte Fahrradstän<strong>der</strong>.<br />
Parkplätze für die Lehrer stehen im Umfeld in ausreichendem Maß zur Verfügung.<br />
Das Schulgebäude ist über drei Treppenaufgänge vom Kellergeschoss bis zur dritten Etage begehbar.<br />
Im Eingangsbereich sowie an den Wänden <strong>der</strong> Flure in <strong>der</strong> ersten und zweiten Etage<br />
werden die Angebote und Ergebnisse <strong>der</strong> Schule für Schülerschaft und Gäste präsentiert. Hier<br />
befinden sich auch das von den Lernenden entworfene Schullogo und die Information, dass sich<br />
die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord erfolgreich im Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit<br />
Courage“ engagiert. An einer Schautafel können sich die Schülerinnen und Schüler über aktuelle<br />
organisatorische Verän<strong>der</strong>ungen informieren. Weiterhin haben alle an <strong>der</strong> Schule Beteiligten, wie<br />
z. B. Schülerrat o<strong>der</strong> die pädagogischen Mitarbeiterinnen (PM), die Möglichkeit, ihre Arbeitsergebnisse<br />
auf Ausstellungsflächen an den Wänden zu präsentieren. Die Wände <strong>der</strong> Flure in <strong>der</strong><br />
ersten und zweiten Etage sind ansprechend in den Schulfarben gestaltet. In <strong>der</strong> zweiten Etage<br />
sind neben den Unterrichtsräumen auch das Sekretariat, die Schulleitung und das Lehrerzimmer<br />
untergebracht.<br />
Mit Beginn des Treppenaufgangs zur dritten Etage fehlt die malermäßige Instandsetzung. Die<br />
Wände sind we<strong>der</strong> vollständig tapeziert noch gestrichen und tragen den Charakter einer Baustelle.<br />
Die <strong>Sekundarschule</strong> nutzt für 13 Klassen 13 allgemeine Unterrichtsräume als Klassenräume.<br />
Außerdem stehen den Lernenden elf Fachräume und zwei Computerkabinette zur Verfügung.<br />
Den Fachräumen angeglie<strong>der</strong>t sind Vorbereitungsräume für die entsprechenden Unterrichtsmaterialien.<br />
Die Unterrichtsräume sind meist mit frontal zur Tafel ausgerichteten Bank- und Stuhlreihen ausgestattet.<br />
Neben Schränken gibt es teilweise Magnettafeln an den Seitenwänden <strong>der</strong> Räume<br />
sowie an <strong>der</strong> Frontseite eine weiße Fläche als Projektionsfläche für einen Overhead-Projektor<br />
(OHP). In jedem Raum ist ein Waschbecken vorhanden. Weiterhin verfügt je<strong>der</strong> Unterrichtsraum<br />
über einen Internetanschluss. Vereinzelt befinden sich auch Rechner in den Räumen. Die Unterrichtsräume<br />
lassen sich verdunkeln.<br />
Nach Aussagen des Schulleiters haben einige Eltern <strong>der</strong> unteren Klassen in Eigeninitiative die
Seite 3 von 19<br />
Klassenräume renoviert und so ansprechend und freundlich gestaltet. An<strong>der</strong>e Unterrichtsräume<br />
zeigen mit stellenweise fehlen<strong>der</strong> Farbe o<strong>der</strong> Tapete deutliche Spuren <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>nisierungsarbeiten<br />
im Sanitär- und Elektrobereich, die auch Monate nach Abschluss dieser Arbeiten noch<br />
nicht behoben sind. Neben den fehlenden Malerarbeiten in einzelnen Räumen und <strong>der</strong> gesamten<br />
dritten Etage besteht Handlungsbedarf für die Erneuerung <strong>der</strong> Fußböden in mehreren Unterrichtsräumen.<br />
Außer Unterrichts- und Fachräumen können die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von<br />
Räumen im Ganztagsschulbetrieb nutzen. So gibt es beispielsweise Räume für die Streitschlichter,<br />
für die Schülerfirma, die Schulsozialarbeit, eine Bibliothek, Freizeiträume für Tischtennis und<br />
Billard sowie das Schwarzlichttheater und eine Mediothek, die für Präsentationen und als Beratungsraum<br />
genutzt wird. Geplant ist außerdem ein Schulmuseum zur Schulgeschichte <strong>der</strong> Stadt<br />
<strong>Jessen</strong>. Hier haben die Renovierungsarbeiten gerade begonnen. Auch das Kellergeschoss wird<br />
im Schulalltag genutzt. Hier befinden sich sowohl Fachräume für den Bereich Technik und<br />
Hauswirtschaft als auch für den Ganztagsbetrieb genutzte Räume und <strong>der</strong> mit freundlichen Möbeln<br />
ausgestattete Speiseraum <strong>der</strong> Schule.<br />
Die Sportanlage entstand im Rahmen <strong>der</strong> Umbauarbeiten und bietet mit einem Kleinfeldrasenplatz,<br />
einer 250 Meter langen Rundbahn aus Tartan, in <strong>der</strong> auch eine 100-Meter-Strecke integriert<br />
ist, sowie einer Weitsprunggrube und einem weiteren Kleinspielfeld aus Tartan sehr gute<br />
Bedingungen für Freiluftsportarten.<br />
Seit dem Abriss <strong>der</strong> alten Sporthalle findet <strong>der</strong> Sportunterricht in <strong>der</strong> Dreifel<strong>der</strong>halle des städtischen<br />
Gymnasiums statt. Diese Sporthalle ist mo<strong>der</strong>n ausgestattet.<br />
4.2 Schülerleistungen<br />
Laut Erfassungsbogen absolvierten im Schuljahr 2009/2010 insgesamt 57 Schülerinnen und<br />
Schüler den 10. Schuljahrgang. Von diesen erreichten 32 den Realschulabschluss und 25 den<br />
erweiterten Realschulabschluss.<br />
Zwei Lernende erreichten am Ende des 9. Schuljahrganges den Hauptschulabschluss. Kein<br />
Schüler bzw. keine Schülerin verließ die Schule ohne Abschluss.<br />
Übergänge zum Gymnasium o<strong>der</strong> vom Gymnasium an die <strong>Sekundarschule</strong> erfolgten im vergangenen<br />
Schuljahr nicht. Die Anzahl <strong>der</strong> Nichtversetzungen bzw. Überweisungen ohne Versetzungsentscheidung<br />
fiel laut Erfassungsbogen mit sechs Lernenden eher gering aus.<br />
Unentschuldigtes Fehlen stelle an <strong>der</strong> Schule kein Problem dar, war in den Interviews zu erfahren.<br />
Insgesamt wurden durch die Schule im vergangenen Schuljahr bei elf Lernenden Fehltage<br />
ohne Entschuldigung registriert.<br />
In den schriftlichen Abschlussprüfungen konnten die Absolventen des 10. Schuljahrganges folgende<br />
Notendurchschnitte in den Kernfächern erreichen:<br />
Abschlussprüfungen Durchschnitt <strong>der</strong> Jahresnoten<br />
Fach Deutsch: 2,7 2,5<br />
Fach Mathematik: 2,5 2,6<br />
Fach Englisch: 3,0 2,8<br />
Der Vergleich mit den Durchschnitten <strong>der</strong> Jahresnoten zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler<br />
die Durchschnitte <strong>der</strong> Jahresnoten bestätigen konnten. Dies gilt auch für die Ergebnisse <strong>der</strong><br />
zentralen Klassenarbeiten, bei denen sich die Ergebnisse wie folgt darstellen:<br />
zentrale Klassenarbeiten Durchschnitt <strong>der</strong> Jahresnoten<br />
Fach Deutsch: 3,0 3,1<br />
Fach Mathematik: 3,3 3,1<br />
Fach Englisch: 2,8 3,0
Seite 4 von 19<br />
Die Lehrkräfte informierten mit Stolz über diese Ergebnisse, die die Schülerinnen und Schüler<br />
ihrer Schule, „die im letzten Jahr die beste Schule im Landkreis und die fünftbeste Schule im<br />
Land Sachsen-Anhalt im Bereich Naturwissenschaften gewesen ist“, erreichten. Letzteres bezieht<br />
sich auf die Vergleichsarbeiten im Bereich Naturwissenschaften.<br />
Die Vermittlung <strong>der</strong> Fähigkeiten schätzten die Lernenden positiv ein und verwiesen auf die Integration<br />
<strong>der</strong> Schulung von Methodenkompetenz in den Unterricht. Die Anfor<strong>der</strong>ungen seien hoch,<br />
Schülerinnen und Schüler könnten jedoch bei Problemen auf Hilfsangebote <strong>der</strong> Lehrkräfte zurückgreifen.<br />
Die Lehrkräfte konstatierten im Interview, dass Partner- und Gruppenarbeit ein großer<br />
Gewinn für die Lernenden seien und sich eine gute Kompetenzentwicklung zeige. Die Schulleitung<br />
äußerte sich im Interview zufrieden über Schülerleistungen und verwies auf die hohe<br />
Quote <strong>der</strong> erweiterten Realschulabschlüsse. Insbeson<strong>der</strong>e im sozialen Bereich sehe man Stärken<br />
bei den Lernenden <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong>. Auch die Ergebnisse in den Leistungsvergleichen<br />
bestätigten die guten Leistungen.<br />
In den beobachteten Sequenzen wurde deutlich, dass die Lernenden vermittelte Fachkenntnisse<br />
reproduzieren und ihre Lernfortschritte bewusst reflektieren konnten.<br />
Zu den herausragenden Schülerleistungen befragt, verwiesen die Interviewpartner u. a. auf den<br />
Vorlesewettbewerb, die Auftritte <strong>der</strong> AG Theater, sportliche Erfolge bei „Jugend trainiert für<br />
Olympia“, Mathematikolympiaden, den Erdgaspokal und darauf, dass viele Schülerinnen und<br />
Schüler an das Fachgymnasium wechselten.<br />
Während des dreitägigen Schulbesuchs war zu erleben, dass sich die Schülerinnen und Schüler<br />
an allgemeine Regeln des Umgangs hielten. Sie zeigten eine gut entwickelte Sozialkompetenz<br />
und gingen rücksichtsvoll sowie freundlich miteinan<strong>der</strong> um. Ihren Lehrerinnen und Lehrern begegneten<br />
sie mit Respekt. Auf einen verantwortungsvollen Umgang miteinan<strong>der</strong> lege man an <strong>der</strong><br />
Schule großen Wert, konstatierten die Lehrkräfte im Interview. In den Pausen seien Schüleraufsichten<br />
eingeteilt und eine Streitschlichtergruppe, besetzt mit Schülern <strong>der</strong> Klassenstufen 7 bis<br />
10, erfülle ihre Aufgabe mit großem Engagement. Sozialkompetenzen werden täglich gefor<strong>der</strong>t<br />
und geför<strong>der</strong>t, bestätigten auch die Eltern im Interview. Positiv wurde in diesem Zusammenhang<br />
hervorgehoben, dass zu Beginn <strong>der</strong> Klasse 5 viele Projekte durchgeführt werden, die dem Zusammenfinden<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> dienen. Übereinstimmend gaben die Interviewpartner an, dass Regeln<br />
und Normen an <strong>der</strong> Schule eingehalten werden. Die Hausordnung war in den Dokumenten einsehbar<br />
und im Schulgebäude ersichtlich, in einzelnen Klassenräumen waren darüber hinaus<br />
Regeln formuliert.<br />
In etwa vier Fünfteln <strong>der</strong> Sequenzen wurde frontal gelenkter Unterricht beobachtet. In Phasen<br />
von Partner- o<strong>der</strong> Gruppenarbeit, die in etwa <strong>der</strong> Hälfte des beobachteten Unterrichts zur Anwendung<br />
kamen, zeigten die Lernenden ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zu unterstützen und<br />
eine vorgegebene Aufgabenstellung gemeinsam umzusetzen. Aktive Teilnahme <strong>der</strong> Lernenden<br />
am Unterricht, motiviert durch die persönliche Ansprache <strong>der</strong> Lehrkraft, konnte in mehr als etwa<br />
zwei Dritteln des Unterrichts beobachtet werden. Selbstständiges Auswählen von Themen aus<br />
unterschiedlichen Aufgabenstellungen o<strong>der</strong> die eigenständige Planung, Organisation und Reflexion<br />
des Lernprozesses konnten bei den Lernenden teilweise wahrgenommen werden.<br />
Hilfen zum selbstständigen Lernen konnten die Schülerinnen und Schüler in etwa zwei Dritteln<br />
des beobachteten Unterrichts in Anspruch nehmen. Die Lehrkräfte wirkten unterstützend, wenn<br />
Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten zeigten. In einigen Sequenzen konnten die Lernenden<br />
aus unterschiedlichen Aufgaben selbst auswählen.
4.3 Lehr- und Lernbedingungen<br />
Seite 5 von 19<br />
An <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord lernen 270 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen<br />
Orten einschließlich <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong>.<br />
Nach <strong>der</strong> Situation im Einzugsbereich befragt, stellte die Schulleitung dar, dass <strong>der</strong> Einzugsbereich<br />
über 400 km 2 groß sei und 30 Orte bzw. Ortsteile umfasse. Es gebe Schülerinnen und<br />
Schüler, die als einzige Kin<strong>der</strong> eines Ortes zur Schule kämen. Man vermute bei einigen wenigen<br />
Kin<strong>der</strong>n sehr schwierige soziale Hintergründe. Etwa 25 Prozent <strong>der</strong> Schülerschaft hätten Anspruch<br />
auf Ermäßigung <strong>der</strong> Ausleihgebühr für Lehrbücher. Dies zeige die soziale Situation an.<br />
Die Dunkelziffer schätze man höher ein. Probleme mit <strong>der</strong> Schülerschaft existierten generell jedoch<br />
nicht.<br />
Schülerinnen o<strong>der</strong> Schüler, <strong>der</strong>en Muttersprache nicht Deutsch ist, werden <strong>der</strong>zeit nicht beschult.<br />
Im Evaluationszeitraum fand das Lernen unter folgenden Bedingungen statt:<br />
� In ca. vier von fünf besuchten Sequenzen wurde frontale Unterrichtsführung anteilig o<strong>der</strong><br />
durchgängig beobachtet. Hier kamen sowohl abfragendes als auch entwickelndes Unterrichtsgespräch<br />
(56,6% bzw. 14,2%), Lehrervortrag/Lehrerdemonstration (8,5%) und<br />
Schülervortrag/Schülerdemonstration (21,7%) zum Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler<br />
lösten ihre Arbeitsaufträge in Einzelarbeit (52,8%), Gruppenarbeit (20,8%), Partnerarbeit<br />
(27,4%) o<strong>der</strong> Stationenarbeit (3,8%). In den Phasen des entwickelnden Unterrichtsgesprächs<br />
und bei Schülervorträgen wurden fachliche und sprachliche Kompetenzen <strong>der</strong><br />
Lernenden gefor<strong>der</strong>t. Während <strong>der</strong> Gruppen-, Partner- und Stationenarbeit hatten die<br />
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, auch methodische und soziale Kompetenzen<br />
zu entwickeln.<br />
� In etwa drei Viertel <strong>der</strong> besuchten Unterrichtsabschnitte variierten die Lehrenden die Unterrichtsmethoden,<br />
so dass ein sinnvoller Wechsel zwischen angeleitetem und selbstständigem<br />
Lernen stattfand. Die eingesetzten Methoden wurden dabei passend zur Umsetzung<br />
<strong>der</strong> angegebenen Ziele und Inhalte gewählt.<br />
� In den besuchten Unterrichtssequenzen kamen u. a. die Tafel (65,1%), Arbeitsblätter<br />
(41,5%), das Lehrbuch (36,8%) und OHP-Folien (31,1%) zum Einsatz. Eine Vielzahl weiterer<br />
Medien (z. B. Nachschlagewerke, Quellenmaterial, Applikationen, Realobjekte,<br />
Tonband/CD, PC, didaktische Materialien) unterstützte ebenfalls die Veranschaulichung<br />
<strong>der</strong> Lerngegenstände.<br />
Zur Unterrichtsgestaltung gaben die Lernenden im Interview an, dass an ihrer Schule viele Projekte,<br />
Stationsarbeit, Gruppen- o<strong>der</strong> Partnerarbeit stattfinden. Durch die Lehrerinnen und Lehrer<br />
werde nicht nur Standardunterricht erteilt, son<strong>der</strong>n auch praxisbezogen unterrichtet. Man könne<br />
vielfältig zusammenarbeiten. Der Unterricht sei abwechslungsreich und anschaulich.<br />
Von Seiten <strong>der</strong> Lehrkräfte war zu erfahren, dass es gemeinsame Vorstellungen von Unterricht<br />
gebe und ein reger Austausch stattfinde. Man sei sich einig über die Normen und über die Bewertung.<br />
Regeln und Normen werden zum Teil im Klassenverband erarbeitet, die Hausordnung<br />
werde immer zu Schuljahresbeginn besprochen. Ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis sei die<br />
Grundlage erfolgreichen Lernens. Auf Jahrgangsstufenbasis finden Absprachen zu Unterrichtsinhalten<br />
statt.<br />
Die Schulleitung sprach im Interview davon, dass versucht werde, „den Frontalunterricht zurückzufahren“,<br />
und führte an, dass die Anzahl <strong>der</strong> gelebten Projekte dies beweise. „Mehr geht nicht<br />
mehr.“ Ziel sei nun, Inhaltliches weiter zu verbessern, „feinzuschleifen“. Angeführt wurde die<br />
Teilnahme <strong>der</strong> Schule an den Modellversuchen KALSA und SENTA.<br />
Zur Hausaufgabenpraxis an <strong>der</strong> Schule erläuterten die Interviewpartner, dass im Rahmen des<br />
Ganztagsschulbetriebes Hausaufgaben in den SOL-Stunden bearbeitet werden.<br />
Im Schülerinterview wurde herausgestellt, dass Hausaufgaben <strong>der</strong> Übung und Festigung dienten<br />
und SOL dazu günstige Bedingungen biete. Der Umfang <strong>der</strong> Hausaufgaben sei angemessen,<br />
meinten sie.
Seite 6 von 19<br />
Die Lehrkräfte erläuterten zur Hausaufgabenpraxis, dass sie sich auf die zwei SOL-Stunden pro<br />
Woche konzentriere. Hier könnten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Räumen arbeiten<br />
und die PC nutzen. Die mündliche Vorbereitung auf den Unterricht erfolge zu Hause. Dies<br />
wie<strong>der</strong>um stelle ein Problem für die Fahrschülerinnen und Fahrschüler dar, die spät nach Hause<br />
kämen.<br />
Die Schulleitung sprach auch von <strong>der</strong> Nutzung des Hausaufgabenzimmers und <strong>der</strong> Unterstützung<br />
durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen.<br />
Die interviewten Elternvertreter äußerten, dass die Hausaufgaben manchmal ziemlich umfangreich<br />
seien. Die Geräuschkulisse in <strong>der</strong> Schule wäre für eine konzentrationsbedürftige Hausaufgabe<br />
zu hoch. Allerdings gaben sie auch an, dass sich die Kin<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Schule verteilen könnten,<br />
wenn sie Ruhe brauchten. Kritik übten sie daran, dass Aufgaben oft auch zu Hause o<strong>der</strong><br />
über das Wochenende zu erledigen seien. Die Zeit <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> müsse dann für die Schule verplant<br />
werden.<br />
Im Evaluationszeitraum wurden in ca. drei von vier Beobachtungssequenzen die Lernfortschritte<br />
erfasst und gewürdigt. Leistungsbewertung durch Noten konnte in den besuchten Unterrichtsabschnitten<br />
mitverfolgt werden.<br />
Die interviewten Schülerinnen und Schüler sprachen von gerechter Bewertung durch ihre Lehrerinnen<br />
und Lehrer. Als Maßstab für ihre Leistungen sehen sie die Vergleichsarbeiten und die<br />
Prüfungen. Bei schriftlichen Arbeiten würden Fehlerquellen benannt, so dass man sich orientieren<br />
könne.<br />
Die interviewten Eltern meinten zur Leistungsbewertung, dass sich die Lehrkräfte ein höheres<br />
Niveau <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler wünschten. Dies werde <strong>der</strong> Schülerschaft aber nicht reflektiert.<br />
Positiv fanden sie, dass bei schriftlichen Arbeiten zu einer Zensur immer noch ein Satz formuliert<br />
sei.<br />
Im Lehrkräfteinterview wurde dargelegt, dass die Leistungsbewertung den zentralen Vorgaben<br />
folge. Der einheitliche Bewertungsmaßstab sei für die Schüler- und Elternschaft transparent. Die<br />
Funktion <strong>der</strong> Klassenarbeiten sehen sie kritisch. Die Schülerinnen und Schüler würden hierfür<br />
meist kurzfristig lernen.<br />
Die Schulleitung führte zur Leistungsbewertung ergänzend aus, dass z. B. die Festlegungen zu<br />
den Kurzvorträgen, bereits 2004 durch das Kollegium getroffen, einheitlich für alle Fächer umgesetzt<br />
werden.<br />
In den eingesehenen Protokollen <strong>der</strong> Fachkonferenzen Naturwissenschaften, Mathematik,<br />
Deutsch und Fremdsprachen, die in diesem Schuljahr tagten, waren als Festlegungen zur Leistungsbewertung<br />
u. a. nachzulesen:<br />
� Anzahl und Bewertung <strong>der</strong> Klassenarbeiten gemäß Erlass,<br />
� Berücksichtigung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche,<br />
� Differenzierung von Klassenarbeiten nach Realschul- und Hauptschulniveau,<br />
� schulinterne Vergleichsarbeiten in Mathematik,<br />
� integrative Klassenarbeiten im Fach Deutsch in den Klassenstufen 7 bis 9,<br />
� nach Absprache <strong>der</strong> Fachlehrkräfte gleiche Klassenarbeiten in den naturwissenschaftlichen<br />
Fächern sowie<br />
� Anwendung von Nachteilsausgleich.<br />
Zur Dokumentation <strong>der</strong> Klassenarbeiten wird das einheitliches Formblatt „Spiegel <strong>der</strong> Klassenarbeit“<br />
als Berichtsbogen mit Bewertungsskala, Zuordnung <strong>der</strong> Aufgaben zu den Anfor<strong>der</strong>ungsbereichen<br />
und Notenverteilung verwendet. Aufgabenblatt und Erwartungshorizont sind als Anlagen<br />
beizufügen.<br />
In den vorgelegten Klassenarbeiten wurde u. a. eine Differenzierung in den Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen<br />
innerhalb <strong>der</strong> kombinierten Klassen z. B. durch Aufgabenreduzierung, durch unterschiedliche<br />
Aufgabenstellung o<strong>der</strong> durch unterschiedliche Punktbewertung bei gleicher Aufgabenstellung<br />
vorgenommen. Die Zuordnung <strong>der</strong> Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche erfolgte häufig auf dem Aufgabenblatt.<br />
Vom Evaluationsteam wurde festgestellt, dass eine Kennzeichnung von Anfor<strong>der</strong>ungsbereichen<br />
vorgenommen wurde, <strong>der</strong>en Zuordnung teilweise nicht den Inhalten entsprach.<br />
Aus den eingesehenen Klassen- und Notenbüchern konnte entnommen werden:<br />
� Ergebnisse schriftlicher Arbeiten waren durchgängig dokumentiert.
Seite 7 von 19<br />
� Klassenarbeiten wurden spätestens nach zwei Wochen zurückgegeben.<br />
� Die Anzahl <strong>der</strong> geschriebenen Klassenarbeiten entsprach den Vorgaben im Leistungsbewertungserlass.<br />
Im Evaluationszeitraum konnte in ca. drei von fünf Unterrichtssequenzen eine individuelle För<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Lernenden beobachtet werden.<br />
An <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord lernen in den Schuljahrgängen 7 bis 9 alle Schülerinnen<br />
und Schüler in kombinierten Klassen. Eine äußere Differenzierung findet im 9. Schuljahrgang im<br />
Fach Mathematik durch Unterricht in zwei auf den Realschulabschluss bezogenen Klassenverbänden<br />
und in einem auf den Hauptschulabschluss bezogenen Klassenverband Anwendung.<br />
Die Differenzierung im Unterricht erfolge nach Aussage <strong>der</strong> interviewten Lehrkräfte durch eine<br />
Differenzierung in den Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen und in <strong>der</strong> Bewertung. In einer Klasse wurde<br />
beispielsweise eine Klassenarbeit in vier verschiedenen Ausführungen erarbeitet, wurde berichtet.<br />
Es existiere bei vielen Schülerinnen und Schülern ein erhöhter För<strong>der</strong>bedarf. Hier wirkten die<br />
Son<strong>der</strong>schullehrerin und die pädagogischen Mitarbeiterinnen unterstützend. Man arbeite nach<br />
För<strong>der</strong>plänen und schreibe sie fort. Man fühle sich in diesem Zusammenhang jedoch allein gelassen,<br />
war <strong>der</strong> Tenor.<br />
Die interviewten Schülerinnen und Schüler sprachen davon, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer<br />
das Lernen för<strong>der</strong>ten, sie Unterstützung erhielten. Teilweise fehle jedoch die For<strong>der</strong>ung an die<br />
Leistungsspitze, weil die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt ständen.<br />
Es gebe auch Kooperationsformen im Unterricht, in denen die Leistungsstarken zur Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Leistungsschwachen eingesetzt würden.<br />
Die Eltern beantworteten die Frage, ob ihre Kin<strong>der</strong> geför<strong>der</strong>t werden, unterschiedlich. Zum einen<br />
wurde geäußert, dass die Leistungsstarken z. B. durch Zusatzaufgaben im Unterricht und in Extrastunden<br />
beson<strong>der</strong>s geför<strong>der</strong>t würden, zum an<strong>der</strong>en, dass diese sich langweilten. Es würden<br />
auch Stipendien vermittelt. Generell werde jedoch keiner auf <strong>der</strong> Strecke gelassen. „Es wird erklärt,<br />
bis es <strong>der</strong> Letzte begriffen hat.“ Der Schulleiter habe initiiert, dass die Schule über Lehrerfortbildung<br />
auf die Aufnahme eines autistischen Kindes vorbereitet wurde. Ein Lernbegleiter für<br />
dieses Kind werde über die Jugendhilfe finanziert. Es sei zu spüren, dass die Schule alles möglich<br />
machen will, was irgendwie geht. Man finde für alle Probleme Gehör. Hier werde Schule<br />
erlebt. Als Beispiel wurde das Thema „Fliegen“ angeführt. „Das Thema wurde behandelt und<br />
dann <strong>der</strong> Flughafen besucht.“ Dies weise auf sehr viel Engagement <strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer<br />
über die Unterrichtsverpflichtung hinaus hin.<br />
Die Schulleitung informierte im Interview über den gemeinsamen Unterricht (GU), ein autistisches<br />
Kind, „Traumakin<strong>der</strong>“ und Kin<strong>der</strong> mit diagnostizierten Lernstörungen wie LRS, ADHS und<br />
Dyskalkulie. Die große Anzahl sei eine neue Herausfor<strong>der</strong>ung. Die für Dyskalkulie und LRS ausgebildete<br />
För<strong>der</strong>schullehrerin helfe den Lehrkräften und berate die Eltern. Im Stundenplan seien<br />
sowohl För<strong>der</strong>stunden als auch klassenübergreifende Übungsstunden in einer Kernfachstunde<br />
<strong>der</strong> Woche fest verankert. Hier müssten sich auch die Lehrkräfte untereinan<strong>der</strong> abstimmen. Arbeitsgemeinschaften<br />
dienten ebenfalls <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung. Begabtenför<strong>der</strong>ung sei jedoch noch ein<br />
Problem bei <strong>der</strong> Bandbreite, die eine Lehrkraft abdecken müsse, wurde mitgeteilt.<br />
Im Erfassungsbogen wurde angegeben, dass <strong>der</strong>zeit 26 Schülerinnen und Schüler mit diagnostizierten<br />
Lernstörungen und fünf mit son<strong>der</strong>pädagogischem För<strong>der</strong>bedarf beschult werden; die<br />
Anzahl <strong>der</strong> individuellen För<strong>der</strong>pläne für versetzungs- und abschlussgefährdete Schülerinnen<br />
und Schüler beträgt 41.<br />
Die Schule arbeitet mit einem För<strong>der</strong>konzept, das Bestandteil des Schulprogramms ist.<br />
Als Ziele sind formuliert:<br />
„a) Alle Schüler erreichen einen Schulabschluss.<br />
b) Schüler mit Teilleistungsstörungen erhalten eine optimale För<strong>der</strong>ung. Das trifft auch auf die<br />
Schüler im gemeinsamen Unterricht zu.“<br />
Zur Umsetzung dieser Ziele wurden die Aufgaben <strong>der</strong> Schulleitung, <strong>der</strong> Klassen- und <strong>der</strong> Fachlehrkräfte,<br />
<strong>der</strong> Eltern sowie <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler beschrieben und konkrete Maßnahmen<br />
festgelegt.<br />
Der Schulleiter stellte dar, dass För<strong>der</strong>pläne für die Schülerinnen und Schüler im GU sowie mit<br />
diagnostizierten Lernstörungen durch die För<strong>der</strong>schullehrerin in Form und Inhalt erarbeitet wer-
Seite 8 von 19<br />
den. Die För<strong>der</strong>pläne von versetzungsgefährdeten Schülerinnen und Schülern müssen erstellt<br />
werden und liegen in <strong>der</strong> Hand <strong>der</strong> Fach- bzw. Klassenlehrkräfte. Es existiere eine Empfehlung<br />
des Schulleiters zur Form.<br />
Die vorgelegten För<strong>der</strong>pläne wurden auf unterschiedlichen Formblättern erstellt. Ein Formblatt<br />
enthielt die Angaben För<strong>der</strong>bedarf, För<strong>der</strong>ziel, För<strong>der</strong>maßnahmen, Verantwortung. Bestandteil<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>pläne war hier <strong>der</strong> Beschluss <strong>der</strong> Klassenkonferenz vom 28.09.2010 auf Gewährung<br />
von Nachteilsausgleich. Das zweite Formblatt glie<strong>der</strong>te sich in För<strong>der</strong>schwerpunkte, Maßnahmen<br />
<strong>der</strong> Schule, Maßnahmen <strong>der</strong> Eltern und Unterschrift Klassenlehrer/Fachlehrer/Eltern. Auch hier<br />
war jeweils die Gewährung von Nachteilsausgleich z. B. „wegen diagnostizierter LRS“ o<strong>der</strong> „bei<br />
Dyskalkulie“ o<strong>der</strong> „… erhält son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>bedarf wegen LRS“ Bestandteil.<br />
Auf die För<strong>der</strong>ung des sozialen Lernens und die Entwicklung von Verhaltensnormen nahm die<br />
Schulleitung im Interview Bezug. Es gebe Schul- und Klassenregeln, die es einzuhalten gelte.<br />
Das Unterrichtsklima war im überwiegenden Teil <strong>der</strong> Beobachtungssequenzen durch gegenseitigen<br />
Respekt, einen freundlichen Umgangston und eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens<br />
geprägt. Die Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden war in neun<br />
von zehn beobachteten Unterrichtsabschnitten entspannt und ergebnisorientiert. Die Schülerinnen<br />
und Schüler gingen freundlich miteinan<strong>der</strong> um und verhielten sich rücksichtsvoll. Unterrichtsstörungen<br />
konnten selten beobachtet werden. Die Lernenden machten im Interview darauf<br />
aufmerksam, dass sie überwiegend gute Möglichkeiten haben, die Zeit im Unterricht voll zum<br />
Lernen zu nutzen. Störungen seien die Ausnahme.<br />
Die Interviewpartner verwiesen auf die vielfältigen Maßnahmen <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-<br />
Nord zur Berufsorientierung und –beratung. Benannt wurden zum Beispiel, dass es für jede<br />
Klasse einen Berufsfahrplan gebe, <strong>der</strong> in <strong>der</strong> 7. Klasse den Eltern vorgestellt werde und bis<br />
Klasse 10 gelte. Weiterhin war von Kontakten zu Betrieben <strong>der</strong> Region und zum BIZ, dem Besuch<br />
<strong>der</strong> Berufsfindungs- und Ausbildungsmessen, dem BRAFO-Projekt, den Betriebserkundungen<br />
und -praktika sowie vom Bewerbungstraining zu hören. Diese Maßnahmen spiegeln sich<br />
ebenfalls im Schulprogramm, Punkt Berufsfindung/Berufsberatung, wi<strong>der</strong>.<br />
Die interviewten Schülerinnen und Schüler hoben beson<strong>der</strong>s die Bedeutung und den Anteil des<br />
Wirtschaftsunterrichts bei <strong>der</strong> Berufsvorbereitung hervor. Hier erfolgten intensiv das Bewerbertraining<br />
sowie die Vorbereitung auf den Berufswahlpass und die Praktika. Im Schulleitungsinterview<br />
wurde von <strong>der</strong> fächerübergreifenden und praxisnahen Berufsberatung berichtet. Unter an<strong>der</strong>em<br />
machte man darauf aufmerksam, dass ein Video über Bewerbergespräche gedreht werde.<br />
Die Lehrkräfte gaben an, dass die erstellten Bewerbungsmaterialien einschließlich einer CD<br />
an jede Schülerin und jeden Schüler ausgehändigt werden. Von den Elternvertretern war zu erfahren:<br />
„Die Schule ist mit ihrem Engagement auf diesem Gebiet im Vergleich zu an<strong>der</strong>en ein<br />
absoluter Vorreiter.“<br />
4.4 Professionalität <strong>der</strong> Lehrkräfte<br />
Befragt nach <strong>der</strong> Kooperation im Kollegium, berichtete die Schulleitung im Interview von fünf<br />
Kolleginnen im Team GU, die einmal pro Woche mit <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schullehrerin zusammenarbeiteten.<br />
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer stimmten sich in Bezug auf Klassenarbeiten und Projekte<br />
ab. Eine Steuergruppe existiere zum „Alltagsgeschäft“ <strong>der</strong> Schule im Allgemeinen und zum<br />
Schwerpunkt Schulprogramm und dessen Fortschreibung im Beson<strong>der</strong>en. Insgesamt sei die<br />
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, PM und <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin gut. Die Lehrkräfte für<br />
die Kernfächer arbeiteten mit den <strong>Sekundarschule</strong>n Annaburg und Elster zusammen.<br />
Die befragten Lehrkräfte erläuterten im Interview, dass sie in Teams arbeiten und sich bzgl. des<br />
Methodeneinsatzes und –wechsels absprechen würden. Es gebe feste Teams in den verschiedenen<br />
Jahrgangsstufen, die sich regelmäßig träfen, um ihre Arbeit zu koordinieren und Ideen<br />
auszutauschen. Diese Jahrgangsteams seien fächerbezogen, so bildeten z. B. drei Deutschlehrkräfte<br />
<strong>der</strong> 5. Klassen ein Team. Es finde auch ein fächerübergreifen<strong>der</strong> Austausch statt. Bereits
Seite 9 von 19<br />
im Vorfeld des Übergangs von <strong>der</strong> Grundschule zur <strong>Sekundarschule</strong> komme es zur Kommunikation<br />
zwischen den Lehrkräften bei<strong>der</strong> Schulformen. Die Sekundarschullehrerinnen und –lehrer<br />
hospitierten in den 4. Klassen <strong>der</strong> drei Grundschulen des Einzugsbereiches. Die Grundschülerinnen<br />
und -schüler würden zum Tag <strong>der</strong> offenen Tür eingeladen, an dem sie ihre neuen Klassenleiterinnen<br />
bzw. -leiter kennenlernten.<br />
Die interviewten Schülerinnen und Schüler brachten zum Ausdruck, dass ihrer Meinung nach<br />
das Handeln <strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer von Einheitlichkeit geprägt sei.<br />
Im Elterninterview wurde ein einheitliches Handeln <strong>der</strong> Lehrkräfte insbeson<strong>der</strong>e in Bezug auf den<br />
son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>bedarf deutlich. Die Lehrkräfte signalisierten immer ihre Gesprächsbereitschaft.<br />
Die meisten Lehrkräfte seien telefonisch, einige per E-Mail erreichbar. Bisher<br />
seien alle auftretenden Probleme geklärt worden.<br />
Die Arbeit <strong>der</strong> Fachkonferenzen ist im vom Evaluationsteam eingesehenen „Schulprogramm <strong>der</strong><br />
<strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord im Schuljahr 2010-11“ geregelt. Folgende Schwerpunkte stehen<br />
dabei im Mittelpunkt:<br />
� die Organisation <strong>der</strong> Fortbildung,<br />
� Absprachen zur Planung und Organisation des Unterrichts,<br />
� Absprachen zur Beschaffung von Unterrichtsmitteln und Lernmitteln,<br />
� Festlegungen von Kriterien zur Leistungsbewertung.<br />
Das o. g. Schulprogramm sieht weiterhin die Bereitstellung einer verbindlichen Sammlung von<br />
Kompetenzbereichen sowie Arbeitstechniken und Methoden, die an geeigneten Inhalten <strong>der</strong> jeweiligen<br />
Fächer eingeführt und geübt werden, durch die Fachkonferenzen vor. Letztere empfehlen<br />
dabei Lernstrategien und -techniken.<br />
Dem Evaluationsteam lagen für das Schuljahr 2009/2010 die Protokolle ff. Fachkonferenzen vor:<br />
Deutsch, Wirtschaft/Technik/Hauswirtschaft/Werken, Sport, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften,<br />
Mathematik, Kunst/Musik und Fremdsprachen. Die genannten Fachkonferenzen<br />
hatten mindestens zweimal getagt. Das Thema <strong>der</strong> Leistungsbewertung war auf allen<br />
Fachkonferenzen erörtert worden. Von <strong>der</strong> Fachkonferenz Fremdsprachen wurde eine theoretisch<br />
fundierte Handreichung zur „Vorbereitung und Einschätzung von Klassenarbeiten“ einschließlich<br />
<strong>der</strong> jeweiligen Anfor<strong>der</strong>ungsbereiche erarbeitet. Als weitere Beratungsschwerpunkte<br />
waren u. a. ausgewiesen:<br />
� die neuen Lehrpläne,<br />
� inhaltliche Schwerpunkte für die weitere Arbeit,<br />
� schriftliche Prüfungen und die Struktur mündlicher Prüfungen,<br />
� Fortbildungen,<br />
� zentrale Klassenarbeiten sowie<br />
� die Analyse ausgewählter Klassenarbeiten.<br />
Laut vorliegenden Protokollen hatten im Schuljahr 2010/2011 die folgenden Fachkonferenzen<br />
einmal getagt: Naturwissenschaften, Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen. Dabei wurden u.<br />
a. erörtert:<br />
� die Thematik <strong>der</strong> Leistungsbewertung,<br />
� die Einführung <strong>der</strong> neuen Lehrpläne,<br />
� die Gestaltung <strong>der</strong> Klassenarbeiten,<br />
� die Auswertung <strong>der</strong> Prüfungen,<br />
� Festlegungen <strong>der</strong> Fachkonferenz Deutsch zur Lektüre von Ganzschriften und zu auswendig<br />
zu lernenden Gedichten bzw. Balladen sowie<br />
� Festlegungen zum Nachteilsausgleich im Fach Englisch.<br />
Die z. T. sehr ausführlich gestalteten Protokolle spiegeln eine intensive Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />
inhaltlichen Aspekten <strong>der</strong> jeweiligen Fächer, insbeson<strong>der</strong>e mit den neuen Lehrplänen, wi<strong>der</strong>. Die<br />
Teilnahme <strong>der</strong> Elternvertreterinnen bzw. -vertreter war nicht erkennbar. Vergleichbares gilt für<br />
die Fachkonferenzarbeit im Schuljahr 2008/2009.
Seite 10 von 19<br />
Die Schulleitung führte im Interview aus, dass auf <strong>der</strong> ersten Dienstberatung des Schuljahres<br />
Schwerpunkte gesetzt würden, die dann den Ausgangspunkt <strong>der</strong> Fachkonferenzarbeit bildeten.<br />
Die diesjährigen Schwerpunkte seien <strong>der</strong> GU, die Berufswahl und die Abschlussprüfungen. Der<br />
Umgang mit zentralen Leistungserhebungen, <strong>der</strong>en Ergebnisse auf allen Lehrkräften zugänglichen<br />
PCs gespeichert seien, stehe in jedem Jahr im Mittelpunkt. Insgesamt trügen die Fachkonferenzen<br />
eine große Eigenverantwortung. Zu den schulinternen Lehrplänen führte die Schulleitung<br />
aus, dass seit diesem Schuljahr an <strong>der</strong>en Erstellung gearbeitet werde. Die genannten Lehrpläne<br />
seien in Mathematik und Deutsch fertig erstellt, in Englisch befinde man sich noch im Prozess<br />
<strong>der</strong> Erarbeitung. Die an<strong>der</strong>en Fächer arbeiteten mit den Fachkonferenzen zusammen. Des<br />
Weiteren sei eine Stunde Berufskunde geplant.<br />
Die befragten Lehrkräfte erläuterten im Interview, dass sich die Fachkonferenzen mindestens<br />
einmal im Halbjahr treffen würden. Ein enger Austausch mit den an<strong>der</strong>en <strong>Sekundarschule</strong>n <strong>der</strong><br />
Region und z. T. mit dem Gymnasium <strong>Jessen</strong> finde statt. In den regelmäßig tagenden Fachkonferenzen<br />
würden u. a. die Prüfungsergebnisse ausgewertet, Projekte beratschlagt, die neuen<br />
Lehrpläne erarbeitet und Fortbildungen multipliziert. Die Eltern hätten früher an den Fachkonferenzen<br />
teilgenommen. Gegenwärtig sei dies nicht mehr <strong>der</strong> Fall.<br />
Zur Arbeit <strong>der</strong> Klassenkonferenzen befragt, führten die Lehrerinnen und Lehrer im Interview aus,<br />
dass diese sehr ausführlich gestaltet würden. Sie dauerten ca. 45 bis 60 Minuten. Vertreterinnen<br />
und Vertreter aus Eltern- und Schülerschaft nähmen teil.<br />
Die Analyse ausgewählter Versetzungskonferenzen des Schuljahres 2009/2010 ergab, dass<br />
dafür Formblätter mit <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> Anträge, den Entscheidungen <strong>der</strong> jeweiligen Klassenkonferenz<br />
und dem Abstimmungsverhältnis verwendet werden. Auf den Klassenlisten mit den<br />
Noten zum Lern- und Sozialverhalten sind Bemerkungen zur Versetzung <strong>der</strong> einzelnen Schülerinnen<br />
und Schüler ausgewiesen. Die Elternvertreterinnen bzw. -vertreter hatten immer, die<br />
Schülervertreterinnen bzw. -vertreter nur z. T. teilgenommen.<br />
Die Analyse von zwei Klassenkonferenzen des Schuljahres 2010/2011 ergab, dass Festlegungen<br />
zum Nachteilsausgleich getroffen wurden. Für Schülerinnen bzw. Schüler mit För<strong>der</strong>bedarf<br />
wegen Dyskalkulie, LRS, ADHS und ADS wurden individuelle Festlegungen getroffen und als<br />
Beschluss gefasst. Die Teilnahme <strong>der</strong> Eltern- und Schülervertreterinnen bzw. -vertreter war dokumentiert.<br />
Aus den Protokollen ist zu entnehmen, dass die dritten Klassenkonferenzen auch in<br />
den vergangenen Schuljahren für Festlegungen zum Nachteilsausgleich genutzt wurden. Diese<br />
Konferenzen werden als Klassen- o<strong>der</strong> Jahrgangskonferenzen durchgeführt.<br />
Im vom Evaluationsteam besuchten Unterricht war das Handeln <strong>der</strong> Lehrkräfte vor allem gekennzeichnet<br />
durch:<br />
� eine wirkungsvolle und auf das Alter und die Fähigkeiten <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler<br />
eingehende Klassenführung mit effektiver Nutzung <strong>der</strong> zur Verfügung stehenden Lernzeit<br />
in ca. neun von zehn Sequenzen,<br />
� eine deutlich wahrnehmbare zielorientierte Gestaltung des Unterrichtsgeschehens in ca.<br />
neun von zehn Beobachtungssequenzen,<br />
� Maßnahmen zur Motivation <strong>der</strong> Lernenden in ca. acht von zehn <strong>der</strong> gesehenen Sequenzen,<br />
� einen deutlich strukturierten Unterricht, in dem Lernschritte lernwirksam aufeinan<strong>der</strong> aufbauten<br />
und Teilergebnisse einprägsam gesichert wurden, in ca. neun von zehn Unterrichtssequenzen,<br />
� das Wahren von Anschaulichkeit des Unterrichtsgegenstandes durch verständliche und<br />
eindeutige Formulierungen <strong>der</strong> Lehrkräfte sowie den lernanregenden und effektiven Einsatz<br />
von Medien in ca. acht von zehn Beobachtungssequenzen,<br />
� sinnvolle Angebote zur Übung und Festigung von Gelerntem in ca. neun von zehn Sequenzen,<br />
� einen nicht durchgängig einsprachig geführten Fremdsprachenunterricht.<br />
Die interviewten Schülerinnen und Schüler berichteten von regelmäßigen Rückmeldungen über<br />
Lernfortschritte und den Leistungsstand. Sie fühlten sich durch die Lehrkräfte überwiegend gerecht<br />
behandelt. Jedoch schätzten sie Vergleiche mit Parallelklassen als negativ ein.
Seite 11 von 19<br />
Die befragten Eltern brachten im Interview zum Ausdruck, dass die Lehrerinnen und Lehrer die<br />
Kin<strong>der</strong> gerecht behandelten. Die interviewten Eltern fühlten sich ausreichend beraten. Sie erhielten<br />
den Zensurenspiegel ohne Anfor<strong>der</strong>ung einmal im Halbjahr, weiterhin auf Anfor<strong>der</strong>ung und<br />
zu den Elternsprechtagen.<br />
Das Fortbildungskonzept <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord ist im o. g. Schulprogramm enthalten.<br />
Es stützt sich auf Angebote aus folgenden Bereichen:<br />
� Angebote <strong>der</strong> regionalen und überregionalen Fortbildung,<br />
� Angebote auf schulischer Ebene sowie<br />
� die individuelle Fortbildung.<br />
Laut Schulprogramm werden durch den Schulleiter für die Schule Fortbildungsschwerpunkte<br />
festgelegt, die sich nach den Notwendigkeiten im schulischen Bereich und zentralen Vorgaben<br />
richten. Die Schwerpunkte <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung werden in den persönlichen Gesprächen<br />
zwischen Lehrkraft und Schulleiter besprochen und festgeschrieben. Diese Gespräche finden<br />
aller zwei Jahre statt und folgen einer Unterrichtsberatung. Das o. g. Fortbildungskonzept enthält<br />
die Schwerpunkte <strong>der</strong> Schuljahre 2009/2010 bis 2013/2014. Im Schuljahr 2010/2011 sind dies:<br />
� gemeinsamer Unterricht,<br />
� Einführung neuer Lehrpläne sowie<br />
� verbesserte Berufsvorbereitung <strong>der</strong> Absolventen (SENTA).<br />
Die Inhalte bzw. Schwerpunkte <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung <strong>der</strong> Lehrkräfte für die Schuljahre<br />
2009/2010 und 2010/211 sind in einer tabellarischen Übersicht erfasst. Laut Fortbildungskonzept<br />
werden die besuchten Fortbildungen in den zuständigen Fachkonferenzen ausgewertet und<br />
nachbereitet. Die Teilnahme und die Inhalte <strong>der</strong> Fortbildungen werden in einer Datenbank gespeichert.<br />
Die Lehrkräfte geben hierzu die Teilnahmebestätigung als Kopie ab. Der Steuergruppe<br />
obliegt in diesem Zusammenhang die Beobachtung und Kontrolle <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> gesetzten<br />
Ziele und ggf. eine Modifizierung <strong>der</strong> Planung.<br />
Dem Evaluationsteam lagen die Übersichten <strong>der</strong> persönlichen Fortbildung <strong>der</strong> einzelnen Lehrerinnen<br />
bzw. Lehrer für das Schuljahr 2009/2010 vor. Für jede Lehrkraft wird ein standardisiertes<br />
Formblatt verwendet, das die Fortbildungsthemen und den zeitlichen Umfang <strong>der</strong> jeweiligen Veranstaltung<br />
enthält. Fortbildungsthemen im Schuljahr 2009/2010 waren u. a.:<br />
� neue Lehrpläne in Ethik, Biologie, Mathematik, Chemie, Französisch, Geografie und Geschichte,<br />
� Kompetenzentwicklung im Deutschunterricht,<br />
� das BRAFO-Projekt,<br />
� Lernmethoden sowie<br />
� Stressfrei Kommunizieren.<br />
Die genannten Übersichten enthalten weiterhin die geplanten Fortbildungen in den Schuljahren<br />
2009/2010 und 2010/2011 sowie die Erfassung des Bedarfs an Fortbildungen. Insgesamt spiegeln<br />
sie ein großes Interesse an den neuen Lehrplänen wi<strong>der</strong>. Den Dokumenten war des Weiteren<br />
zu entnehmen, dass im Mai 2010 eine Fortbildung „Thematisches Begegnungsforum: Ansätze<br />
für Schule und Jugendhilfe im Umgang mit Gewalt und Mobbing“ mit externen Referenten<br />
stattgefunden hatte.<br />
Im Schulleitungsinterview wurde auf das Fortbildungskonzept <strong>der</strong> Schule verwiesen. Transparenz<br />
und Effizienz würden erzeugt, indem die Lehrkräfte ihre Fortbildungen in die o. g. Datenbank<br />
eintrügen, sodass sich je<strong>der</strong> einen Überblick über das im Hause vorhandene Wissen verschaffen<br />
könne. Bis August 2012 liege ein zentraler Schwerpunkt auf SENTA. Dafür stünden<br />
insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung. In diesem Zusammenhang nannte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview<br />
eine Fortbildung nach Vera F. Birkenbihl und die Kleeblattarbeit mit Schulen aus Schönebeck<br />
und Roitzsch.<br />
Im Lehrkräfteinterview wurde <strong>der</strong> Fortbildungsschwerpunkt <strong>der</strong> neuen Lehrpläne deutlich.<br />
Jedoch fänden viele Veranstaltungen weit entfernt von <strong>Jessen</strong> statt.
Seite 12 von 19<br />
Dem Evaluationsteam lagen für das Schuljahr 2009/2010 die Nachweise kollegialer Unterrichtsbesuche<br />
von fünf Lehrkräften vor. Daraus ging hervor, dass die jeweiligen Lehrerinnen bzw. Lehrer<br />
zwischen ein- und viermal im Halbjahr hospitiert hatten. Nach Aussage des Schulleiters befinden<br />
sich die weiteren Nachweise bei den Lehrkräften. Im Schulleitungsinterview wurde erläutert,<br />
dass gegenseitige Unterrichtsbesuche pro Lehrkraft einmal im Halbjahr stattfänden.<br />
Die interviewten Lehrerinnen bestätigten dies. Die Unterrichtsbesuche fänden interessen- und<br />
schülerbezogen statt. Auch ganztägige Unterrichtsbesuche würden durchgeführt. Die Lehrkräfte<br />
dokumentierten diese in eigener Verantwortung.<br />
4.5 Schulorganisation<br />
In diesem Schuljahr werden an <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord 270 Schülerinnen und Schüler<br />
in 13 Klassen von 29 Stamm- und zwei Gastlehrkräften unterrichtet. Zum Kollegium gehören<br />
außerdem zwei pädagogische Mitarbeiterinnen.<br />
Die Schulleitung informierte im Interview über die Organisation <strong>der</strong> Einsatzplanung. Die dafür<br />
geltenden Eckpunkte wurden von den interviewten Lehrkräften bestätigt:<br />
� Jede Klasse wird durch einen Klassenlehrer und einen Stellvertreter geführt.<br />
� Die Klassenlehrerauswahl in den 5. Klassen erfolgt durch ein Bewerbungsverfahren. Der<br />
Wunsch <strong>der</strong> feststehenden Klassenlehrer für eine Stellvertretung wird i. d. R. berücksichtigt.<br />
� Die Klassenlehrer sollen möglichst ihre Klassen weiterführen.<br />
� Am Ende eines jeden Schuljahres arbeiten die Fachkonferenzen zu, was die Lehrkräfte<br />
auf jeden Fall weitermachen möchten. Der fachgerechte Einsatz hat Priorität.<br />
Die beratende Funktion <strong>der</strong> Fachkonferenzen und die Realisierung von Wünschen, wenn es die<br />
schulischen Erfor<strong>der</strong>nisse ermöglichen, wurden von den Lehrkräften beson<strong>der</strong>s hervorgehoben.<br />
Das Schulgebäude gehört nicht dem Landkreis als Schulträger, berichtete die Schulleitung. Der<br />
Landkreis habe einen Verwaltungsvertrag mit <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong> geschlossen. Die Schule bekomme<br />
so aus dem Verwaltungshaushalt quartalsmäßig Geld. Mit den finanziellen Mitteln sei<br />
man relativ zufrieden. Während des Schulbesuchs erhielt die Schule die Mitteilung, dass 2011<br />
mit dem Bau <strong>der</strong> neuen Sporthalle begonnen werde.<br />
Im Erfassungsbogen wurde die gegenwärtige Unterrichtsversorgung mit 107 Prozent und die<br />
Anzahl <strong>der</strong> Reservestunden mit 16 angegeben. Die Transparenz bei <strong>der</strong> Führung von Mehr- und<br />
Min<strong>der</strong>zeiten ist gegeben, wurde von <strong>der</strong> Schulleitung geäußert und durch die Lehrkräfte bestätigt.<br />
Laut eingesehenen Unterlagen erfolgt ein planmäßiger Abbau <strong>der</strong> aus dem letzten Schuljahr<br />
übernommenen Mehr- bzw. Min<strong>der</strong>zeiten. Die Vertretungspläne enthalten auch zusätzliche<br />
schulorganisatorische Informationen.<br />
Von den 23 möglichen Stunden für ergänzende schulische Angebote sind alle 23 verfügbar. Der<br />
Gesamtbedarf enthält auch 37,5 Stunden für die Ganztagsschule, 10 Stunden „Bedarf GU“, 5<br />
Stunden Einzelunterricht, 10,5 Stunden „Differenzierung und individuelle För<strong>der</strong>ung“ sowie 4<br />
Stunden „För<strong>der</strong>ung abschlussgefährdeter Schüler“, war vom Schulleiter zu erfahren. Die Stunden<br />
für ergänzende schulische Angebote werden u. a. für Übung, För<strong>der</strong>unterricht, Arbeitsgemeinschaften<br />
und SOL verwendet. Im Schulprogramm war nachzulesen, dass für die differenzierte<br />
Übungsarbeit in einem Kernfach eine zusätzliche Lehrkraft eingesetzt wird. Im Rahmen<br />
<strong>der</strong> Stunden für „Differenzierung und individuelle För<strong>der</strong>ung“ för<strong>der</strong>n die Lehrkräfte in einem vorher<br />
festgelegten, abgesprochenen Rahmen. Die Stunden für GU werden durch eine Lehrkraft <strong>der</strong><br />
För<strong>der</strong>schule erteilt.<br />
Die Lehrkräfte sprachen im Interview von einer gerechten Aufgabenverteilung im Kollegium. Kritik<br />
übten sie an <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Schule praktizierten dreifachen Buchführung bei Noten. „Eine Übersicht<br />
muss handschriftlich sein“, äußerten sie, und das sei zu viel Bürokratie. Zur Frage des effektiven<br />
Zeitumganges stellten sie dar, dass ein hoher Zeitaufwand bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> neuen<br />
Lehrpläne existiere. Hier seien vor allem die Klassenlehrer gefor<strong>der</strong>t, in dieser Beziehung
Seite 13 von 19<br />
sollten die Aufgaben gerechter verteilt sein. Zum gemeinsamen Unterricht meinten sie, dass<br />
mehr Unterstützung von übergeordneten Stellen notwendig sei.<br />
Von den gegenwärtig 270 Lernenden <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> sind 135 auf die Beför<strong>der</strong>ung mit öffentlichen<br />
Verkehrsmitteln angewiesen. Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Organisation <strong>der</strong> Ganztagsschule<br />
und des Schulalltags durch die umfangreiche Schülerbeför<strong>der</strong>ung bestünden im Großen und<br />
Ganzen nicht, äußerten die Eltern und die Schülervertreter. Frühere Probleme wurden durch den<br />
Schulleiter gelöst, gaben die Elternvertreter an. Die Schülervertreter berichteten von kurzen<br />
Übergangszeiten, aber auch von sehr kleinen Bussen auf einigen Linien. Die Lehrkräfte merkten<br />
im Interview an, dass lediglich ein Bus nach <strong>der</strong> 8. Stunde eingesetzt sei. Die Schulleitung<br />
sprach von fast gar keiner Auswirkung <strong>der</strong> Schülerbeför<strong>der</strong>ung auf den Schulalltag. Es gebe drei<br />
Abfahrtszeiten, nach <strong>der</strong> 6., 7. und 8. Stunde. Außerdem existiere ein Rufbussystem. Ab einer<br />
Stunde nach Abfahrt des letzten Busses könne ein Bus o<strong>der</strong> ein Taxi gerufen und mit dem Schülerausweis<br />
genutzt werden.<br />
Der Tagesablauf <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord erstreckt sich von <strong>der</strong> 1. bis zur 8. Unterrichtsstunde<br />
im 45-Minuten-Rhythmus. Doppelstunden für die Kernfächer und für einige sonstige<br />
Fächer konnten den Stundenplänen auch entnommen werden. Unterrichtsbeginn ist 7.25 Uhr,<br />
Unterrichtsende 15.05 Uhr. Zum Raumwechsel bzw. zwischen den Doppelstunden sind sowohl<br />
fünf- als auch zehnminütige Pausen eingeplant. Zwei größere Pausen, die erste umfasst 25 Minuten<br />
nach <strong>der</strong> 2. Stunde und die zweite 35 Minuten nach <strong>der</strong> 5. Stunde, dienen <strong>der</strong> aktiven Erholung<br />
und <strong>der</strong> Einnahme eines warmen Mittagessens.<br />
In <strong>der</strong> Zeit von 7:00 Uhr bis 7:25 Uhr findet die offene und betreute Eingangsphase statt, ist dem<br />
Schulprogramm zu entnehmen, an die sich ein Unterrichtsblock, meist in den Kernfächern und<br />
durch ein gemeinsames Frühstück unterbrochen, anschließt.<br />
Die interviewten Lehrkräfte berichteten, dass sie ab 7:00 Uhr in <strong>der</strong> Schule seien, da zu diesem<br />
Zeitpunkt die Schule geöffnet werde. Die Kernfächer werden als Block in den ersten beiden<br />
Stunden unterrichtet und durch eine Frühstückspause unterbrochen. Diese Pause sei wichtig, da<br />
viele Kin<strong>der</strong> zu Hause nicht frühstückten.<br />
Schülerinnen und Schüler merkten im Interview zur Schulorganisation an, dass sie einen langen<br />
Schultag absolvieren müssten. För<strong>der</strong>stunden, SOL und AG-Angebote seien im Stundenplan<br />
enthalten. Anfänglich habe es Probleme bei <strong>der</strong> Essenversorgung gegeben, diese seien weitestgehend<br />
geregelt. Die 5. und 6. Klassen nehmen zuerst ihr Mittagessen ein. Bezüglich <strong>der</strong> Pausenregelung<br />
wurde mitgeteilt, dass die 5-Minuten-Pausen für einen Raumwechsel als zu kurz<br />
empfunden werden. Der Tagesablauf werde trotzdem positiv gesehen.<br />
Die interviewten Elternvertreter äußerten ihre Zufriedenheit mit dem für ihre Kin<strong>der</strong> organisierten<br />
Tagesablauf. Es gebe keine Freistunden, die Kin<strong>der</strong> seien immer beschäftigt.<br />
Der Schulleiter berichtete beim Schulrundgang von <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Situation des Sportunterrichts.<br />
Auf Grund des ca. 25-minütigen Fußweges zur Sporthalle des Gymnasiums werde <strong>der</strong><br />
Sportunterricht generell als Doppelstunden geplant. Für die Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> 5. und<br />
6. Klassen liegen diese Stunden am Beginn des Schultages, damit <strong>der</strong> Fußweg nur einmal absolviert<br />
werden muss.<br />
An <strong>der</strong> Schule existiert das Klassen- und Fachraumprinzip. Der Unterricht ist so organisiert, dass<br />
<strong>der</strong> Hauptanteil des Unterrichts in den Klassenräumen stattfindet. Während des dreitägigen<br />
Schulbesuchs wurde in etwa zwei Dritteln <strong>der</strong> besuchten Sequenzen in Klassenräumen und in<br />
etwa einem Drittel in Fachräumen unterrichtet.<br />
Zu den Unterrichtsbesuchen in den Jahrgangsstufen 7 – 10 können folgende Aussagen getroffen<br />
werden:<br />
� 77,9 Prozent <strong>der</strong> Unterrichtssequenzen wurden in kombinierten Klassen,<br />
� 19,5 Prozent wurden in den auf den Realschulabschluss bezogen unterrichteten 10.<br />
Klassen sowie<br />
� 2,6 Prozent in <strong>der</strong> auf den Hauptschulabschluss bezogen unterrichteten Lerngruppe im<br />
Fach Mathematik beobachtet.<br />
Im gesamten Evaluationszeitraum waren im Unterricht in den Lerngruppen und Klassen 3 bis 22
Seite 14 von 19<br />
Schülerinnen und Schüler anzutreffen.<br />
Das gebundene Ganztagsschulangebot wird im Schuljahr 2010/2011 für alle Lernenden <strong>der</strong><br />
Schuljahrgänge 5 bis 9 vorgehalten, war in den Interviews zu erfahren und im Schulprogramm<br />
nachzulesen. Dabei sind die Ganztagsangebote als SOL-Stunden o<strong>der</strong> Arbeitsgemeinschaften<br />
im Stundenplan ausgewiesen. Die zwei SOL-Stunden pro Woche in je<strong>der</strong> Klasse dienen <strong>der</strong> Erledigung<br />
von mündlichen und schriftlichen Hausaufgaben. Während des Evaluationszeitraumes<br />
wurde diese Form des Lernens unter Anwesenheit einer Lehrkraft beobachtet.<br />
Im Schulprogramm wurde weiterhin festgeschrieben, dass jede Schülerin und je<strong>der</strong> Schüler mindestens<br />
drei Tage von 7:00 Uhr bis 14:30 Uhr in <strong>der</strong> Schule verbringen soll. Den Lernenden stehen<br />
an mindestens zwei unterschiedlichen Tagen Arbeitsgemeinschaften (AG) zur Auswahl. Als<br />
Beispiele sind zu nennen: Streitschlichterausbildung, Programmgestaltung, Alte Handwerkstechniken,<br />
Kochen und Backen, Biologie, Physik, Schülerfirma, Schulchronik, Schulhausgestaltung,<br />
Mathematik, Künstlerisches Gestalten, Schwarzlichttheater, Lesen macht Spaß, vielfältige Angebote<br />
auf sportlichem Gebiet und vieles mehr. Diese AGs sind in vier Blöcke eingeteilt (AG-Block<br />
für Klasse 5, für Klasse 6/7, für Klasse 8/9 und für Klasse 10). Die Schülervertreter sprachen von<br />
<strong>der</strong> Verpflichtung, an zwei AGs teilzunehmen.<br />
Den Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> 10. Klassen stehen För<strong>der</strong>kurse in den Fächern Deutsch,<br />
Mathematik und Englisch zur Verfügung.<br />
Im zur Stundentafel gehörenden Wahlpflichtbereich besteht für die Schülerschaft die Möglichkeit,<br />
einen <strong>der</strong> Wahlpflichtkurse Lebenswelten, Informatik, PBG, AnN, MM und KuK zu besuchen o<strong>der</strong><br />
eine zweite Fremdsprache zu erlernen.<br />
Übereinstimmend äußerten Schulleitung und Lehrkräfte in den Interviews, dass <strong>der</strong> Zugriff auf<br />
Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Lehrerzimmer und über die internetfähigen PC möglich<br />
sei. Die Lehrkräfte ergänzten, dass jede neue Vorschrift in den Dienstberatungen thematisiert<br />
und <strong>der</strong>en Kenntnisnahme durch Unterschrift bestätigt werde.<br />
Die Führung <strong>der</strong> eingesehenen Dokumente wie Klassen- und Notenbücher sowie Protokolle zu<br />
den Konferenzen erfolgte nicht durchgängig den Vorschriften entsprechend. So waren u. a. die<br />
Noten für das Lern- und Sozialverhalten in den Notenheften nicht ausgewiesen, ebenso fehlte<br />
die Gesamtnotenübersicht. In den Protokollen <strong>der</strong> Fachkonferenzen war die Teilnahme von Elternvertretern<br />
nicht erkennbar.<br />
Die Inhalte <strong>der</strong> Gesamt-, Fach- und Klassenkonferenzen entsprechen den Aufgaben laut Konferenzverordnung.<br />
Die Durchsicht <strong>der</strong> Klassenbücher ergab, dass Belehrungen und Nachbelehrungen<br />
<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler durchgeführt und alle notwendigen Angaben vorgenommen<br />
wurden.<br />
4.6 Leitungsgeschehen und Schulmanagement<br />
Die Schulleitung brachte im Interview zum Ausdruck, dass inhaltliche Schwerpunktsetzungen,<br />
Impulse für die Schulentwicklung und programmatische Arbeit permanenter Bestandteil ihrer und<br />
<strong>der</strong> Tätigkeit aller an <strong>der</strong> Schule Beteiligten seien. Für das Schuljahr 2010/2011 habe sie sich ff.<br />
Arbeitsschwerpunkte gesetzt:<br />
� die neuen Lehrpläne,<br />
� den GU,<br />
� die Abschlussprüfungen,<br />
� die Berufswahl in dem Sinne, dass die Absolventen in <strong>der</strong> Region bleiben sowie<br />
� die Weiterarbeit am schulischen Schwerpunkt <strong>der</strong> Sozialkompetenz.<br />
Befragt nach <strong>der</strong> Einbeziehung des Kollegiums, berichtete <strong>der</strong> Schulleiter von <strong>der</strong> Vorbereitung<br />
<strong>der</strong> Versetzungskonferenzen. Die Schulleitung leiste immer Unterstützung bei „schwierigen“ Eltern-<br />
und Schülergesprächen. Mitarbeitergespräche mit je<strong>der</strong> Lehrkraft würden einmal aller zwei<br />
Jahre angestrebt und i. d. R. auch so durchgeführt.
Seite 15 von 19<br />
Diese persönlichen Gespräche sind im Schulprogramm festgeschrieben.<br />
Die interviewten Lehrkräfte brachten zum Ausdruck, dass sie sich durch den Schulleiter und die<br />
stellvertretende Schulleiterin in je<strong>der</strong> Beziehung unterstützt fühlten.<br />
Auch die befragten Elternvertreterinnen bestätigten im Interview, dass sie stets „ein offenes Ohr“<br />
finden würden. Sie würden an grundsätzlichen Entscheidungen <strong>der</strong> Schule beteiligt, z. B. durch<br />
Informations- und Elternabende, an denen sie Vorschläge unterbreiten könnten. Sie berichteten<br />
von einem weitgehenden Mitspracherecht. Als Beispiel nannten sie die Beantragung und zügige<br />
Aufstellung <strong>der</strong> Schließfächer in Zusammenhang mit <strong>der</strong> Durchführung des Ganztagsschulkonzeptes.<br />
Im Interview <strong>der</strong> Schülervertreterinnen bzw. -vertreter wurde das Mitspracherecht bei <strong>der</strong> Ausgestaltung<br />
<strong>der</strong> Schule bestätigt.<br />
Im Schulprogramm <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord sind Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung<br />
in den Monaten Oktober/November und März vorgesehen. Die Schulleitung bestätigte im<br />
Interview diese Praxis und erläuterte ihr Ziel, bei je<strong>der</strong> Lehrkraft einmal in zwei Jahren zu hospitieren.<br />
Die Lehrerinnen berichteten im Interview, dass <strong>der</strong> Schulleiter mindestens einmal im Jahr den<br />
Unterricht je<strong>der</strong> Lehrkraft besuchen würde.<br />
In Bezug auf die Motivierung <strong>der</strong> Lehrkräfte zur Weiterentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen<br />
ging <strong>der</strong> Schulleiter im Interview auf die von allen einsehbare o. g. Datenbank ein, in <strong>der</strong> alle<br />
Lehrerinnen und Lehrer ihre besuchten Fortbildungsveranstaltungen eintragen würden.<br />
Grundlage <strong>der</strong> Arbeit <strong>der</strong> Schulleitung sind folgende vom Evaluationsteam eingesehenen Dokumente:<br />
� das Schulprogramm <strong>der</strong> <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord im Schuljahr 2010/2011,<br />
� <strong>der</strong> im Schulprogramm enthaltene Arbeitsplan für das Schuljahr 2010/2011 und<br />
� <strong>der</strong> ebenfalls im Schulprogramm enthaltene Geschäftsverteilungsplan.<br />
Im Schulprogramm werden explizite Aussagen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung<br />
getroffen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Transparenz dieser Maßnahmen gegenüber Schülerinnen,<br />
Schülern, Eltern und Lehrkräften.<br />
In diesem Zusammenhang wurde vom Evaluationsteam Einblick in die Protokolle <strong>der</strong> Gesamtkonferenzen<br />
vom Juni 2010 und Oktober 2010 genommen. Als Vorhaben <strong>der</strong> Qualitätsentwicklung<br />
wurden die Teilnahme an KALSA und das Niveau <strong>der</strong> Abschlüsse thematisiert.<br />
Der o. g. Arbeitsplan geht von dem Konzept „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und<br />
folgenden Zielen <strong>der</strong> Schule aus: Ehrlichkeit, Vertrauen, Zusammenarbeit, Disziplin, Streitkultur,<br />
Höflichkeit, Sauberkeit, Normen und Eigenverantwortung. In diesem Zusammenhang regelt er<br />
Veranstaltungen und Aktivitäten, die sowohl alle Klassen als auch einzelne Klassenstufen umfassen,<br />
sowie die entsprechenden Verantwortlichkeiten.<br />
Der Geschäftsverteilungsplan erfasst sowohl die Verantwortlichkeiten des Schulleiters, <strong>der</strong> stellvertretenden<br />
Schulleiterin und <strong>der</strong> Fachkonferenzleiterinnen bzw. -leiter als auch die Aufgaben<br />
je<strong>der</strong> einzelnen Lehrkraft. Im Interview erläuterte <strong>der</strong> Schulleiter die Motivierungsfunktion dieser<br />
transparenten Aufgabenverteilung. Sie ermögliche einen Vergleich aller Lehrerinnen und Lehrer<br />
untereinan<strong>der</strong>. Somit erfolge eine automatische Wertschätzung <strong>der</strong> Lehrkräfte, <strong>der</strong>en Aufgaben<br />
über dem Durchschnitt lägen.<br />
Im Lehrkräfteinterview wurde deutlich, dass <strong>der</strong> Jahresplan im Lehrerzimmer ausliege und regelmäßig<br />
aktualisiert werde.<br />
Befragt nach <strong>der</strong> Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsvorschriften, brachte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview zum<br />
Ausdruck, dass es eine bestellte Sicherheitsbeauftragte, eine Strahlenschutzbeauftragte und<br />
eine Chemikalienbeauftragte gebe. In den Aktivpausen seien drei Lehreraufsichten sowie die<br />
Schulsozialarbeiterin im Einsatz. Jährlich werde eine Belehrung zu einer möglichen Amoksituation<br />
durchgeführt. Es gebe einen ständig aktualisierten und für alle zugänglichen Kriseninterventionshefter.<br />
Mit <strong>der</strong> Polizei fänden halbjährliche Abstimmungen statt. Auch die Lagepläne <strong>der</strong><br />
Schule befänden sich dort.<br />
Im Lehrkräfteinterview wurde die Einhaltung <strong>der</strong> Sicherheitsstandards bestätigt.<br />
Weiterhin erläuterte <strong>der</strong> Schulleiter im Interview die Zusammenarbeit mit dem Schulträger. Die<br />
Kontakte zum Landkreis seien sehr begrenzt. Die Schule nehme jedoch an Tagungen teil, um
Seite 16 von 19<br />
Präsenz zu zeigen. Unproblematisch gestalte sich die Kooperation mit <strong>der</strong> Kommune. Diese sei<br />
bestrebt, die Wünsche <strong>der</strong> Schule zu erfüllen. Allerdings sei sie noch nicht bereit, die Trägerschaft<br />
zu übernehmen.<br />
Die demokratische Mitwirkung des Schüler- und Elternrates ist im Schulprogramm erfasst. In<br />
diesem Zusammenhang legte die Schulleitung im Interview dar, dass sich die Eltern in den<br />
Fachkonferenzen „zurückhielten“. Eine intensive Beteiligung gebe es jedoch in den Klassenelternschaften<br />
und in <strong>der</strong> Gesamtkonferenz. Der Schülerrat habe sich einen Arbeitsplan erstellt<br />
und treffe sich monatlich. Dabei werde er von <strong>der</strong> stellvertretenden Schulleiterin unterstützt. Einmal<br />
im Schuljahr finde ein Schülerratsseminar statt. Hier arbeiteten die Schülervertreterinnen<br />
und -vertreter in Gruppen und erhielten Informationen zum Schulrecht. Die Ergebnisse dieser<br />
Arbeit spiegelten sich auch in <strong>der</strong> Schule wi<strong>der</strong>. So sei z. B. ein Antiaggressionsraum eingerichtet<br />
worden.<br />
Die befragten Schülerinnen und Schüler bestätigten diese Praxis und sprachen von einer guten<br />
Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> stellvertretenden Schulleiterin. Die Zusammenarbeit <strong>der</strong> Schülervertreterinnen<br />
und -vertreter mit den Klassenleiterinnen und -leitern schätzten sie differenziert, jedoch<br />
überwiegend positiv ein.<br />
Die Elternvertreterinnen und -vertreter berichteten im Interview, dass sie an den Klassen- und<br />
Gesamtkonferenzen teilnähmen. Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Elternschaft für die Fachkonferenzen würden<br />
gewählt und könnten sich auch daran beteiligen.<br />
Laut Schulprogramm liegt die Zuständigkeit für die Zusammenarbeit mit den Medien beim Schulleiter.<br />
Durch eine Arbeitsgemeinschaft von Schülerinnen und Schülern <strong>der</strong> Klassenstufe 10 werden<br />
Artikel verfasst, die im Mitteilungsblatt <strong>der</strong> Stadt <strong>Jessen</strong> veröffentlicht werden.<br />
4.7 Schulklima/Schulkultur<br />
Die Eltern berichteten im Interview über ein gutes Schulklima. Sie zeigten sich sehr zufrieden mit<br />
<strong>der</strong> geleisteten Arbeit <strong>der</strong> Lehrkräfte, die oftmals über das Erwartete hinausginge. Man achte an<br />
<strong>der</strong> Schule auf die sozialen Beziehungen, war zu erfahren und es wurde berichtet, dass es auch<br />
schon vorkam, dass Schüler vom Gymnasium wegen des Schulklimas zurückwechselten, obgleich<br />
die Leistungen für das Gymnasium vorhanden waren. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis sei<br />
geprägt von wechselseitiger Achtung. Dies entsprach auch den Beobachtungen des Evaluationsteams<br />
während des Schulbesuchs. Schulzufriedenheit und Identifikation mit <strong>der</strong> Schule wurden<br />
in allen Interviews deutlich. Die Schulleitung informierte, dass die Auswertungen bisheriger Evaluationen<br />
(StEG, SEIS) einen hohen Grad an Schulzufriedenheit ergaben und eine Beschwerdepraxis<br />
an <strong>der</strong> Schule existiere, die eine hohe Elternzufriedenheit zeige. Das Verhältnis Lehrer-<br />
Schüler-Eltern sei ihrer Meinung nach sehr entspannt.<br />
Die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong> wird als Ort des Lernens, aber auch als Lebensort von Schülerinnen<br />
und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern verstanden. Im Schulprogramm sind folgende Leitsätze<br />
formuliert:<br />
� Die Schule ist bestimmt vom Miteinan<strong>der</strong> nach verabredeten Regeln.<br />
� Ziel <strong>der</strong> Erziehung ist es, Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit und zum friedlichen<br />
Miteinan<strong>der</strong> zu erziehen.<br />
� Lernbereite Schülerinnen und Schüler tragen zur positiven Atmosphäre genauso bei wie<br />
motivierte Lehrerinnen und Lehrer.<br />
� Guter Unterricht wird geprägt durch Projekte, Methodenvielfalt, Kreativität und Einbeziehung<br />
aller Schüler in den Lernprozess.<br />
� Soll Schule als gut empfunden werden, müssen sich alle beteiligten Gruppen einbringen<br />
und sich mit <strong>der</strong> Schule identifizieren können.<br />
Die Schulleitung informierte, dass nach <strong>der</strong> Verständigung <strong>der</strong> Lehrerschaft über die Inhalte des
Seite 17 von 19<br />
Schulprogramms im Jahr 2005 entschieden wurde, ein umfängliches Papier zu entwickeln, das<br />
gleichzeitig einem Arbeitsplan entspreche und im zweijährigen Turnus aktualisiert werde. Das<br />
vorliegende 68 Seiten umfassende Schulprogramm beschreibt alle Arbeitsbereiche und <strong>der</strong>en<br />
konkrete Umsetzung. Entsprechend werden Terminsetzungen und Verantwortlichkeiten ausgewiesen.<br />
Das Programm behandelt u. a. ausführlich die Bereiche Erziehung, Unterricht, Evaluation<br />
<strong>der</strong> schulischen Erfolge, Berufswahlvorbereitung, Gestaltung des Schullebens und Öffnung<br />
<strong>der</strong> Schule nach außen.<br />
Die Analyse des Schulprogramms ergab, dass die Schule sich an externen Evaluationen beteiligt<br />
und folgende Möglichkeiten genutzt wurden und weiterhin genutzt werden sollen:<br />
a) Befragungen durch das Land Sachsen-Anhalt<br />
b) Befragungen im Rahmen von SEIS<br />
c) Befragungen im Rahmen von StEG.<br />
Die Mittel zur internen Evaluation sind u. a.:<br />
a) Ergebnisse von Klassenarbeiten<br />
b) Analyse <strong>der</strong> Klassensituationen durch Klassen- und Schulleitung<br />
c) Gespräche mit Eltern- und Schülervertretern<br />
Das Schulprogramm entstand durch Mitwirkung von Schulleitung und Lehrkräften. Für die Arbeit<br />
am Schulprogramm existiere eine Steuergruppe, die auch für die Fortschreibung verantwortlich<br />
zeichne, informierten die Lehrkräfte im Interview. Eltern- und Schülerschaft, so die Informationen<br />
aus den Interviews, sind in die Schulprogrammentwicklung nicht involviert.<br />
An <strong>der</strong> Schule finden regelmäßige Elternversammlungen statt, informierten die Eltern im Interview.<br />
Ferner gebe es in unregelmäßigen Abständen Elternstammtische, die vor allem anlassbezogen<br />
seien und etwa vier- bis fünfmal im Jahr organisiert werden. Die Eltern berichteten über<br />
ihre Beteiligung am schulischen Leben und verwiesen in diesem Zusammenhang auf den Tag<br />
<strong>der</strong> offenen Tür, den Sponsorenlauf, den Chor, die AG Theater, Weihnachtsauftritte und weitere<br />
Projekte, die ins Leben gerufen werden (z. B. Afrika-Tag), in die „…man immer einbezogen wird.“<br />
Die Organisation laufe über die Klassen, wobei die Initiative von beiden Seiten ausgehe, informierte<br />
die Schulleitung.<br />
Den Dokumenten war zu entnehmen, dass die <strong>Sekundarschule</strong> <strong>Jessen</strong>-Nord auf <strong>der</strong> Schulpartnerschaftsbörse<br />
am 10.02.2009 Kontakte in den osteuropäischen Raum anbahnte und sich seit<br />
dieser Zeit im Aufbau einer Schulpartnerschaft mit einer Schule in Sibirien befindet. Unterstützung<br />
erfährt sie durch einen Fremdsprachenassistenten aus Omsk, <strong>der</strong> seit diesem Schuljahr an<br />
<strong>der</strong> Schule arbeitet.<br />
Um die Zukunftschancen für die Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, hat die Schule vielfältige<br />
Kooperationen initiiert. Möglichkeiten <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit externen Partnern werden dabei<br />
grundsätzlich in den Bereichen<br />
a) Schülerbetriebspraktikum,<br />
b) Berufserkundungsprojekt,<br />
c) Berufsfindung,<br />
d) Fachprojekte,<br />
e) AG „Soziales Lernen“ und WpK „Soziales Lernen“<br />
gesehen und Kooperationsverträge mit folgenden Partner angestrebt:<br />
� Stadtverwaltung <strong>Jessen</strong> mit ihren Einrichtungen,<br />
� Grundschulen des Einzugsbereiches, Horte sowie Kin<strong>der</strong>tagesstätten,<br />
� Buchhandlung Fischer,<br />
� Seniorenwohnheim, Betreutes Wohnen (Pflegedienst Petra Schulze),<br />
� AWO, Rotes Kreuz, Volkssolidarität,<br />
� Freiwillige Feuerwehr <strong>Jessen</strong>,
� Firmen des Bereiches (Intersport Klöpping, Stanztechnik, Preuss-Gruppe ...),<br />
� Sportvereine, Freizeittreff,<br />
� Private Bildungsträger (IB, SBO, BWSA),<br />
� Waldpädagogik vom Forstamt Annaburg sowie<br />
� Bundeswehrstandort Holzdorf.<br />
Seite 18 von 19<br />
Die den Dokumenten zu entnehmenden Vereinbarungen setzten die Schwerpunkte in den Bereichen<br />
soziales Lernen (Kin<strong>der</strong>tagesstätte "Knuds Kin<strong>der</strong>land", Hort <strong>der</strong> Grundschule "Max Lingner“,<br />
Tagespflege <strong>der</strong> DRK, Feierabendheim GmbH <strong>Jessen</strong>, Tiergehege "Am Schwanenteich")<br />
und Berufswahl (Bildungswerk <strong>der</strong> Wirtschaft Sachsen-Anhalt e.V., Match Meeting, Wir e. V.<br />
<strong>Jessen</strong>, DRK-Kreisverband Wittenberg, Häusliche Krankenpflege Petra Schulze, Volksbank Elsterland<br />
eG).<br />
Zu den Traditionen <strong>der</strong> Schule befragt, verwies die Schulleitung auf Leistungsvergleiche (intern<br />
und mit benachbarten Schulen), Sportfeste, Sponsorenläufe, Tage <strong>der</strong> offenen Tür, die Patenschaft<br />
von Landrat und Superintendent für die Schule als „Schule ohne Rassismus – Schule mit<br />
Courage“, das Servicelearning und die Schülerzeitung „Feuerwerk“. In diesem Zusammenhang<br />
konnten vom Evaluationsteam CDs/DVDs eingesehen werden, die ff. Veranstaltungen dokumentieren:<br />
das Weihnachtsprogramm, alljährliche Benefizveranstaltungen sowie Medienprojekte, z.<br />
B. Kurzfilme und Hörspiele.<br />
Die Schule verfügt über eine übersichtliche und ansprechend gestaltete Internetpräsenz. Umfangreiche<br />
Auskünfte über die Schule sind hier bereit gestellt und ermöglichen dem Leser dank<br />
<strong>der</strong> intuitiv gestalteten Bedienung das schnelle Auffinden <strong>der</strong> gewünschten Informationen.<br />
Die Eltern informierten, dass man nahezu wöchentlich Beiträge über die Schule in <strong>der</strong> Presse<br />
lesen könne, die auch von Kin<strong>der</strong>n geschrieben seien. Die hohe Präsenz in <strong>der</strong> Presse wurde im<br />
Lehrkräfte- und Schulleitungsinterview bestätigt und es wurde darauf verwiesen, dass es eine<br />
AG „Pressearbeit/Mitteilungsblatt“ gebe.
5. Den Schulbesuch führten durch:<br />
Herr Eisemann Referent LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen<br />
Herr Liebers Referent LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen<br />
Frau Römmling Referentin LISA, Qualitätsfeststellungen an Schulen<br />
Frau Usener Referentin LISA, FB3<br />
Magdeburg, 20.12.2010 Liebers<br />
Ort, Datum Teamleiter<br />
Seite 19 von 19