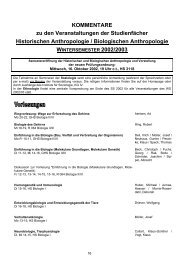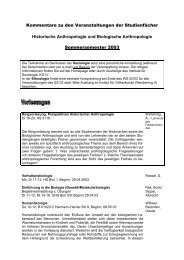Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Kommentiertes</strong> <strong>Vorlesungsverzeichnis</strong><br />
<strong>der</strong> Studiengänge<br />
Historische Anthropologie<br />
und<br />
Biologische Anthropologie<br />
Sommersemester 2009
Redaktion und Vervielfältigung:<br />
Johannes Bernhardt<br />
Stand 10.02.2009
Inhalt<br />
An die Studierenden <strong>der</strong> Historischen Anthropologie Seite 2<br />
Zu den Studiengängen Seite 3<br />
Themenfel<strong>der</strong> Seite 8<br />
Studienpläne Seite 10<br />
Studienberatung Seite 14<br />
Prüfungsberechtigte für die Fächer Historische und Biologische<br />
Anthropologie Seite 15<br />
Überblick über die Lehrveranstaltungen Seite 16<br />
Kommentare zu den Lehrveranstaltungen Seite 19<br />
Die Fachschaft Anthropologie stellt sich vor Seite 32
Liebe Studierende <strong>der</strong> Historischen Anthropologie,<br />
in diesem Semester möchten wir Sie innerhalb des Programms des kommentierten<br />
<strong>Vorlesungsverzeichnis</strong>ses beson<strong>der</strong>s auf das Hauptseminar zu Theorie und Praxis<br />
historisch-anthropologischer Forschung: „Galen - Medizin, Gesellschaft und Mentalität<br />
in <strong>der</strong> Hohen Kaiserzeit“ von Frau Bernett und Herrn Leven hinweisen. Passend zu<br />
diesem Seminar wird es im Rahmen des althistorischen Kolloquiums einen Vortrag<br />
„Galen und die Geschichte <strong>der</strong> Emotionen“ von Herrn Schlange-Schöningen geben<br />
(18.06. 18 Uhr, Bibliothek des SAG). Frau Bernett wird Examenskandidaten zudem<br />
wie<strong>der</strong> in einem Kolloquium die Möglichkeit bieten, ihre Arbeit o<strong>der</strong><br />
Prüfungsschwerpunkte zu präsentieren und zu diskutieren (Do 14-16 Uhr, Wilhelmstr.<br />
26, HS 00 016). Ferner wird Frau Pusch eine Übung "Anthropologische Muster <strong>der</strong><br />
Fremdwahrnehmung" anbieten (Mo 10-12 Uhr, Sedanstraße 6, HS 1). Schließlich ist<br />
ein Workshop mit einem renommierten historischen Anthropologen geplant, dessen<br />
Thema und Termin wir noch bekannt geben werden.<br />
Wie in den vergangenen Semestern werden wir Ihnen auch wie<strong>der</strong> einen Termin für<br />
einen gemeinsamen Abend vorschlagen. Ein Termin wird wie gehabt Anfang des<br />
Semesters per Rund-Mail bzw. Aushang bekanntgegeben, Sie sind aber bereits jetzt<br />
herzlich eingeladen! Bitte informieren Sie sich auch selbst und halten Sie sich auf dem<br />
Laufenden über Neuigkeiten (http://www.zag.uni-freiburg.de/anthro/fs_anthro/fs.html).<br />
Ich wünsche Ihnen ein gutes Sommersemester 2009,<br />
Ihr<br />
Johannes Bernhardt<br />
2
Zu den Studiengängen<br />
Historische Anthropologie - Biologische Anthropologie<br />
Die Studiengänge entsprechen dem Bemühen, naturwissenschaftlich-medizinische, sozial- und<br />
geisteswissenschaftliche Fragestellungen zu einer Lehreinheit zu verbinden, weil <strong>der</strong> Mensch<br />
einerseits Teil <strong>der</strong> Natur ist, an<strong>der</strong>erseits die Fähigkeit besitzt, sich zur Natur und zu sich selber zu<br />
verhalten, sein Umfeld in einem umfassenden Sinne zu gestalten, Kultur hervorzubringen.<br />
Getragen werden die Studiengänge von den Fächern von den Fächern Biologische Anthropologie,<br />
Ur- und Frühgeschichte, Alte Geschichte, Geschichte, Medizingeschichte, Soziologie, Ethnologie,<br />
Philosophie, Provinzialrömische Archäologie und Orientalistik. Lehrveranstaltungen, die auf den<br />
Studiengang angerechnet werden können, bietet außerdem das Fach Psychologie an.<br />
Der Begriff Anthropologie ist nach seiner wörtlichen Bedeutung vage und viel zu wenig abgegrenzt,<br />
um eine ausreichende inhaltliche Präzision zu liefern. Daher bemüht man sich seit jeher,<br />
durch Präzisierungen deutlich zu machen, von welcher wissenschaftlichen Seite her man sich mit<br />
dem Menschen beschäftigt. In Mitteleuropa versteht man unter <strong>der</strong> Fachdisziplin Anthropologie in<br />
<strong>der</strong> Regel die Wissenschaft von <strong>der</strong> biologischen Variabilität des Menschen. Die Biologische<br />
Anthropologie ist dabei diejenige wissenschaftliche Disziplin, die sich primär mit <strong>der</strong> physischen<br />
Seite des Menschen, aber auch <strong>der</strong>en kultureller Überformung beschäftigt. Die „Lehre vom Menschen“,<br />
wie die biologische Richtung <strong>der</strong> Anthropologie auch traditionell genannt wird, beinhaltet<br />
so unterschiedliche Bereiche wie die Suche nach dem evolutionsbiologischen Ursprung des<br />
Menschen, bis hin zum Homo sapiens, dessen geographische Differenzierung und heutige<br />
Verbreitung über die Kontinente, aber auch die Beschäftigung mit seiner physischen Gestalt, den<br />
körperlichen Funktionen und <strong>der</strong>en Störungen in ihrem umweltbedingten Kontext.<br />
In England, den USA und an<strong>der</strong>en Län<strong>der</strong>n mit englischer Sprache o<strong>der</strong> Kultureinfluss ist mit <strong>der</strong><br />
Biological Anthropology (o<strong>der</strong> Physical Anthropology, Human Biology), nur ein Teil <strong>der</strong> dortigen<br />
Anthropologie abgedeckt. Die umfassen<strong>der</strong>e Sichtweise <strong>der</strong> Anthropologie drückt sich in <strong>der</strong><br />
Fachrichtung <strong>der</strong> Cultural Anthropology aus, wobei Anthropologie umfassend als Überbegriff für all<br />
das verstanden wird, was man bei uns den Humanwissenschaften zuschreibt, d.h. neben <strong>der</strong><br />
biologischen Anthropologie gehören dazu auch die Kultur- und Sozialwissenschaften (z.B. Ethnologie,<br />
Ur- und Frühgeschichte, Archäologie, Volkskunde, Soziologie, Linguistik). Auch in Mitteleuropa<br />
ist die Biologische Anthropologie keine isolierte Disziplin, son<strong>der</strong>n hat vielseitige Beziehungen<br />
zu Nachbardisziplinen, vor allem zur Humangenetik. Die Biologische Anthropologie kooperiert<br />
auch hier eng mit den Kultur- und Sozialwissenschaften, doch stellen diese vollständig<br />
selbständige Disziplinen dar.<br />
Die Biologische Anthropologie beschäftigt sich mit dem Menschen als lebendem Teil <strong>der</strong> Natur<br />
in seiner Abhängigkeit von seinen genetischen Anlagen und modifizierend wirkenden Umweltfaktoren<br />
und kann damit definiert werden als "Biologische Variabilität des Menschen in seiner<br />
zeitlichen und räumlichen Ausdehnung". Ein klassisches Thema <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie<br />
ist die<br />
1. Erforschung <strong>der</strong> menschlichen Stammesgeschichte (Paläoanthroplogie)<br />
Es wird <strong>der</strong> Weg nachvollzogen, „wie <strong>der</strong> Mensch zum Menschen wurde“. Dies beinhaltet die Rekonstruktion<br />
<strong>der</strong> Fossilgeschichte <strong>der</strong> Hominiden, um die rein physischen Verän<strong>der</strong>ungen zu erkennen.<br />
Um sie aber erklären zu können, bedarf es eines Wissenschaftskonzeptes, das die beobachteten<br />
anatomischen Konstruktionen in einen zeitlichen und räumlichen Kontext stellt. Dazu<br />
wird untersucht, unter welchen Umweltbedingungen sich bestimmte Verän<strong>der</strong>ungen etablieren<br />
konnten (Konzept <strong>der</strong> biologischen Adaptation). Vor allem <strong>der</strong> Weg des Menschen „out of africa“ in<br />
<strong>der</strong> Hominidenevolution ist hier zentraler Forschungsgegenstand. Dabei beschränkt sich die<br />
Anthropologie nicht auf den Menschen allein, son<strong>der</strong>n bezieht die systematisch nahestehenden<br />
höheren Affen (Primaten) und <strong>der</strong>en Stammesgeschichte ein. Die Bearbeitung <strong>der</strong> Fossilfunde –<br />
<strong>der</strong>en Anzahl in den beiden letzten Jahrzehnten stark zugenommen hat – verlangt zwingend die<br />
Integration weiterer Fachgebiete wie <strong>der</strong> vergleichenden Anatomie, Botanik, Geologie, Klimatologie<br />
und Ökologie. Bessere Methoden zur absoluten Altersbestimmung und innovative Denkansätze<br />
führten seit den siebziger Jahren hier zu komplexen Modellbildungen (z.B. zur Out-of-Africa-<br />
Theorie, die von einem uniregionalen Ursprung des mo<strong>der</strong>nen Menschen [H. sapiens] ausgeht;<br />
dazu im Gegensatz steht das multiregionale Modell von <strong>der</strong> Entstehung des mo<strong>der</strong>nen Menschen).<br />
Die Informationen aus den kooperierenden Fachgebieten dienen dabei u.a. dazu,<br />
mögliche Faktoren zu erkennen, die zufällig entstandene genetische Verän<strong>der</strong>ungen selektiert<br />
bzw. den Prozess <strong>der</strong> Menschwerdung an<strong>der</strong>weitig beeinflusst haben. In ihren jüngeren Epochen<br />
3
wird die Paläoanthropologie zur Bevölkerungsgeschichte und mündet in die Prähistorische Anthropologie.<br />
2. Prähistorische Anthropologie<br />
Der Übergang in die Prähistorische Anthropologie ist fließend. Von ihr spricht man in <strong>der</strong> Regel im<br />
Anschluss an die Fossilgeschichte, die mit dem Auftreten des neuzeitlichen Menschen (Homo sapiens)<br />
endet. Die Prähistorische Anthropologie beschäftigt sich mit jüngeren Skelettfunden, die<br />
zeitlich bis in historische Zeiten und sogar bis in die Frühe Neuzeit reichen. Kooperationen mit<br />
Nachbardisziplinen betreffen – im weitesten Sinne – Grundlagenfächer wie die Klimatologie, Bodenkunde<br />
und Anthropogeographie, Historische Biowissenschaften wie die Paläoethnobotanik,<br />
Archäozoologie und Medizingeschichte, Historische Sozial- und Kulturwissenschaften wie die Urund<br />
Frühgeschichte, die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Soziologie, Ethologie, Linguistik,<br />
Demographie sowie die Archäometrie. Unter dem Begriff Archäometrie sind diejenigen naturwissenschaftliche<br />
Methoden systematisiert, die zur Untersuchung von Sachüberresten im Sinne <strong>der</strong><br />
allgemeinen historischen Quellenkunde herangezogen werden. Zu Sachüberresten zählen körperliche<br />
und organische Überreste, Bauwerke, Gerätschaften, Kunst- und Gewerbeerzeugnisse,<br />
aber auch Landschaftselemente, Böden und Landschaftsformen (B. Herrmann). Zu den Gegenständen<br />
<strong>der</strong> Prähistorischen Anthropologie gehören nicht nur Fragen <strong>der</strong> Bevölkerungsgeschichte,<br />
son<strong>der</strong>n auch solche <strong>der</strong> Ethnogenese (Untersuchung regionaler Bevölkerungen<br />
[Ethnien], die sich einer biologischen Abstammungsgemeinschaft zurechnen, unter dem Aspekt<br />
ihrer Herkunft und Ausbreitung, dazu kommt die demographische Rekonstruktion früherer Bevölkerungen<br />
(Paläodemographie) und die Erschließung <strong>der</strong> Krankheitsbelastung des Menschen in<br />
früheren Zeiten (Paläopathologie). Ein Ziel <strong>der</strong> Prähistorischen Anthropologie ist die Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Frage, inwieweit Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Umwelt auf die untersuchten Populationen differenzierend<br />
wirken, wie die jeweiligen Lebensbedingungen die biologische Natur des Menschen<br />
prägen und wie Umweltverän<strong>der</strong>ungen den Menschen prägen. Eine <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nsten Arbeitsrichtungen<br />
<strong>der</strong> (Prä)Historischen Anthropologie stellt damit zweifellos die Umweltforschung dar.<br />
Die körperlichen Überreste des Menschen, welche die Prähistorische Anthropologie untersucht,<br />
sind ein bedeutendes Quellenmaterial. Aus ihnen lassen sich u.a. individuelle biologische Daten<br />
wie Alter, Geschlecht, Körperhöhe, Krankheiten und beson<strong>der</strong>e Merkmale erschließen. Werden<br />
diese Individualdaten miteinan<strong>der</strong> verbunden, ergeben sich daraus Aussagen über die biologischen<br />
Marker einer ehemaligen Bevölkerung. Die aus den Individualdaten auf <strong>der</strong> Bevölkerungsebene<br />
ableitbaren Aussagen zum Altersaufbau, zur Geschlechterrelation, zur Kin<strong>der</strong>sterblichkeit<br />
und zur Krankheitsbelastung sind zugleich auch fundamentale sozialgeschichtliche Daten. In<br />
jüngster Zeit haben sich die methodischen Möglichkeiten <strong>der</strong> Prähistorischen Anthropologie durch<br />
die Einbeziehung <strong>der</strong> molekularen Ebene stark erweitert. Damit gewann die Rekonstruktion von<br />
Lebensgewohnheiten des Menschen anhand <strong>der</strong> Analyse von Spurenelementen und stabilen<br />
Isotopen an Gewicht (damit werden Aussagen zu lokalen ökologischen Gegebenheiten [Ressourcen],<br />
Subsistenzstrategien, zu differentieller Ernährung, Migration, Handelsbeziehungen u.a.<br />
möglich) und hat sich durch die aDNA-Analyse (Analyse alter DNA) das methodische Spektrum<br />
und die Sicherheit von Aussagen zur individuellen Geschlechtsbestimmung, zur Verwandtschaft<br />
von Individuen (Familienanalyse) und Gruppen (Interpopulationsanalyse) sowie die Identifizierung<br />
von Krankheiten (z.B. Tuberkulose) erheblich verbessert.<br />
Auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong> Merkmalsvariabilität einschließlich ihrer genetischen Basis fußen weitere<br />
Gebiete aus <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie, mit denen wir uns im Rahmen <strong>der</strong> neuen Studiengänge<br />
u.a. beschäftigen: Geographische Anthropologie, vergleichende Bevölkerungsbiologie und<br />
Soziobiologie. Die Geographische Anthropologie (o<strong>der</strong> Ethnische Anthropologie) widmet sich in<br />
ihrer heutigen Bedeutung Fragen nach <strong>der</strong> regionalen Differenzierung ethnischer Gruppen, d.h. sie<br />
untersucht die geographische Merkmalsverteilung und fragt nach <strong>der</strong>en Ursachen. In <strong>der</strong> Bevölkerungsbiologie<br />
werden z.B. biologische und demographische Aspekte <strong>der</strong> Bevölkerungsentwicklung<br />
im Verlauf <strong>der</strong> Geschichte bis zur Gegenwart betrachtet, also etwa <strong>der</strong> Aspekt <strong>der</strong> Migration,<br />
<strong>der</strong> schon für den frühen Homo sapies Bedeutung hat. Die Soziobiologie untersucht die<br />
evoluierten Mechanismen, die tierisches und menschliches Sozialverhalten bestimmen. Einsichten<br />
aus Genetik, Verhaltensforschung und Ökologie werden dabei zu einem aktuellen Bild von <strong>der</strong><br />
Biologie des sozialen Miteinan<strong>der</strong>s zusammengefügt. Es ist dies ein sehr mo<strong>der</strong>nes, wenn auch<br />
kontrovers diskutiertes Arbeitsgebiet <strong>der</strong> Anthropologie. Gerade hier werden aber auch die für<br />
unseren Studiengang so relevanten Wechselwirkungen zwischen Natur und Kultur beson<strong>der</strong>s<br />
deutlich, etwa in <strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Kooperation und <strong>der</strong> Konflikt in sozialen Gruppen, in <strong>der</strong><br />
Beziehung <strong>der</strong> Geschlechter und im Eltern-Kind-Verhältnis.<br />
3. Aktuelle anwendungsorientierte Arbeitsgebiete <strong>der</strong> biologischen Anthropologie<br />
Beson<strong>der</strong>e anwendungsbezogenen Fragestellungen haben sich in den letzten Jahren entwickelt.<br />
Die entsprechenden Forschungsfel<strong>der</strong> betreffen u.a. die Forensische Anthropologie (z.B. Taphonomie,<br />
Identifizierung, Verifizierung), die Industrieanthropologie (z.B. Gestaltung <strong>der</strong> körpernahen<br />
4
Umwelt), Somatologie (Variabilität körperlicher Merkmale), Humanphysiologie (Biomechanik,<br />
Hormonhaushalt), Alternsforschung (z.B. Biogerontologie) und die Biodemographie (z.B. Morbiditäts-,<br />
Mortalitätsstrukturen, Sterblichkeitsdisparitäten, Migration). In den genannten Bereichen<br />
gibt die biologische Anthropologie häufig konzeptionelle Anregungen und bringt fachspezifische<br />
Forschungsansätze in die interdisziplinären Forschung ein.<br />
Eine Son<strong>der</strong>stellung im Rahmen <strong>der</strong> Naturwissenschaften kommt <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie<br />
dadurch zu, dass sie auf Beobachtungen des Menschen angewiesen ist und nicht in <strong>der</strong> Lage ist,<br />
reproduzierbare Ergebnisse in Form von naturwissenschaftlichen Experimenten aufzustellen.<br />
Dadurch hat sich ein spezielles Methodenspektrum ausgebildet, das einerseits sehr genau potentielle<br />
Einflussfaktoren auf die biologische Variabilität des Menschen erkennt und diese an<strong>der</strong>erseits<br />
mit speziellen mathematisch-statistischen Methoden auf ihre Wirkung testet.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Kulturwissenschaften ist die Frage danach, was den Menschen als Menschen<br />
ausmacht, was ihn also z. B. vom Tier unterscheidet, schon früh reflektiert worden. Historiker haben<br />
sich diese Frage kaum explizit gestellt, obwohl sie in ihren Erklärungen immer von Annahmen<br />
darüber ausgingen, was das Handeln des Menschen bestimmt, und in diesem Sinne auch Lehren<br />
für zukünftige Generationen vermitteln wollten. Eine „historische Anthropologie“ ist erst spät<br />
entstanden, in Deutschland seit den 60er Jahren unseres Jahrhun<strong>der</strong>ts, aber je nach Ausrichtung<br />
kann man verschiedene „Vorläufer“ ausmachen. Die philosophische Anthropologie stützte sich seit<br />
<strong>der</strong> frühen Neuzeit entwe<strong>der</strong> auf Beobachtungen von Reisenden o<strong>der</strong> auf naturwissenschaftlichmedizinische<br />
Untersuchungen und erfasste vor daher das „Wesen“ des Menschen; eine an<strong>der</strong>e<br />
Richtung ging von geschichtsphilosophischen Konstruktionen aus; in unserem Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
schließlich haben Philosophen wie Plessner beide Ansätze zu vereinigen gesucht, indem sie den<br />
Menschen einerseits durch seine „Positionalität“ in <strong>der</strong> Natur, an<strong>der</strong>erseits durch seine<br />
„Exzentrizität“ kennzeichneten, d.h. durch seine Fähigkeit, einen Standpunkt außerhalb seiner<br />
natürlichen Positionalität einzunehmen. - Die medizinische Anthropologie vor allem des 18.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts war durch die Schädelforschung bestimmt, auf <strong>der</strong>en Basis sowohl die Geschlechter<br />
als auch Rassen voneinan<strong>der</strong> unterschieden wurden. Die Kulturanthropologie amerikanischer<br />
Prägung, in <strong>der</strong> Ethnologie, prähistorische Archäologie und Ethnolinguistik zusammenflossen,<br />
zielte darauf, menschliche Universalia zu konstituieren. Die französische Schule <strong>der</strong> Annales<br />
setzte sich von <strong>der</strong> traditionellen Ereignisgeschichte ab, propagierte statt dessen eine histoire<br />
totale de l’homme und wollte diese beson<strong>der</strong>s in von „langer Dauer“ geprägten Phänomenen<br />
verwirklichen.<br />
Für jeden empirischen Zugang zur Geschichte und zur menschlichen Lebenswelt kann nicht <strong>der</strong><br />
Mensch als solcher unmittelbar Gegenstand <strong>der</strong> Erkenntnis sein. Historiker, Soziologen, Ethnologen,<br />
Volkskundler haben es immer mit Frauen und Männern, mit Kin<strong>der</strong>n, Jugendlichen, Erwachsenen<br />
und Alten, mit Angehörigen verschiedener Stämme, Völker, mit Repräsentanten unterschiedlicher<br />
Kulturen zu tun. Für die <strong>Freiburg</strong>er Studiengänge wird folgende Annäherung an das<br />
Problemfeld „Historische Anthropologie“ zugrundegelegt:<br />
1. Historische Anthropologie zielt auf Grundphänomene menschlichen Lebens. Was solche<br />
Grundphänomene sind, liegt nicht ein für allemal fest. Sicher dazu gehören alle die Erscheinungen,<br />
die mit <strong>der</strong> biologischen Natur des Menschen, dessen Körperlichkeit zusammenhängen,<br />
also z.B. die Differenz zwischen den Geschlechtern, Geburt, Lebenszyklen, Krankheit, Sterben,<br />
Tod, aber auch die Sinneswahrnehmungen und Emotionen des Menschen. Alle diese<br />
Erscheinungen sind uns nicht in einer biologischen Reinform gegeben, son<strong>der</strong>n immer schon<br />
als kulturell interpretierte. Zu menschlichen Grundphänomenen gehören weiter Formen <strong>der</strong><br />
sozialen Organisation, so Inzest- und Heiratsregeln, Familie und Verwandtschaft, Besitzübertragung,<br />
normative Ordnungen, Legitimation und Ausübung von Macht, ferner Sinnstrukturen und<br />
Weltbil<strong>der</strong>.<br />
2. Historische Anthropologie untersucht solche Erscheinungen in ihrer Zeitlichkeit und damit auch<br />
Verän<strong>der</strong>barkeit. Ob es so etwas wie anthropologische Konstanten gibt, ist umstritten. Aber es<br />
gibt Herausfor<strong>der</strong>ungen an Menschen und menschliche Gruppen, die, auch wenn sie jeweils<br />
unterschiedlich wahrgenommen und formuliert werden, immer auftreten und miteinan<strong>der</strong><br />
vergleichbar sind: so das Verhältnis des Menschen zu seiner Körperlichkeit, seiner Physis; die<br />
Konstitution von Wir-Gruppen und <strong>der</strong>en Ordnung; die Frage nach <strong>der</strong> Begründung ethischer<br />
For<strong>der</strong>ungen und dem Sinn menschlichen Handelns etc. Grundsätzlich ist kein Bereich<br />
menschlichen Lebens aus <strong>der</strong> historisch-anthropologischen Forschung ausgeschlossen.<br />
3. Für die konkrete wissenschaftliche Arbeit ergeben sich daraus folgende For<strong>der</strong>ungen:<br />
a) Es wird davon ausgegangen, dass je<strong>der</strong> Studierende sich die Standards wissenschaftlichen<br />
Arbeitens in mindestens einem Fachgebiet (also z.B. Ethnologie, Geschichte, Soziologie)<br />
von Grund auf aneignet.<br />
5
6<br />
b) Im Hinblick auf historisch-anthropologische Fragestellungen müssen Probleme so formuliert<br />
werden, dass sie als generelle Probleme erkennbar werden. Das bedeutet nicht, dass jede<br />
Lehrveranstaltung im Rahmen <strong>der</strong> Historischen Anthropologie vergleichend o<strong>der</strong> universalhistorisch<br />
angelegt sein muss. Man kann also auch das Sterben im Mittelalter o<strong>der</strong> die<br />
normative Ordnung im republikanischen Rom behandeln. Dies sollte aber so geschehen,<br />
dass die Fragestellungen im Rahmen vergleichen<strong>der</strong> o<strong>der</strong> theoretischer Betrachtungen<br />
gewonnen und die Ergebnisse so gefasst werden, dass sie wie<strong>der</strong>um dem Vergleich mit<br />
an<strong>der</strong>en Gesellschaften o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Theoriebildung dienen. Das Vergleichen ist ein wesentliches<br />
Mittel historisch-anthropologischer Forschung.<br />
c) Was die Methoden des Vergleichens angeht, so lassen sich grundsätzlich zwei Formen<br />
unterscheiden. Die eine besteht darin, dass bestimmte Gegenstandsbereiche wie z.B. Familie,<br />
das Geschlechterverhältnis, Formen religiöser Betätigung, die Konstitution normativer<br />
Ordnungen, die Ausübung von Macht etc. über verschiedene Kulturen hinweg miteinan<strong>der</strong><br />
verglichen werden. Die Ratio dieses Vergleichens liegt in <strong>der</strong> Setzung, dass 1. die genannten<br />
Gegenstandsbereiche, wie schon ausgeführt, auf gemeinsame Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />
zurückgehen, und dass 2. den „Antworten“ auf die Herausfor<strong>der</strong>ungen eine gewisse<br />
„Sachlogik“ zugrunde liegt, an<strong>der</strong>s ausgedrückt: es gibt nicht beliebig viele „Antworten“, und<br />
diese lassen sich - ebenso wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen eines Problems -<br />
wesentlich im Rahmen <strong>der</strong> Entfaltung des Problemfeldes verstehen. - Die zweite Form des<br />
Vergleichens muss nicht im Wi<strong>der</strong>spruch zur ersten stehen; faktisch werden beide aber nur<br />
selten kombiniert. Diese Form beruht auf <strong>der</strong> Annahme, dass sich sowohl Wahrnehmungsweisen<br />
als auch Problemlösungen nur im Rahmen eines kulturellen Zusammenhangs voll<br />
verstehen lassen, dass also z.B. Verwandtschaftsformen auf die gesellschaftliche Organisation<br />
insgesamt und diese wie<strong>der</strong>um auf die Ausübung von Macht bezogen sind; o<strong>der</strong> dass<br />
philosophische Reflexionen abhängig sind von den Formen, in denen in einer Gesellschaft<br />
Wirklichkeit wahrgenommen wird. Geht man von diesen Voraussetzungen aus, dann lassen<br />
sich Vergleiche sinnvoll nur dann durchführen, wenn jeweils <strong>der</strong> Gesamtkontext <strong>der</strong><br />
betroffenen Gesellschaften berücksichtig wird. - Es gibt keinen Königsweg des Vergleichens.<br />
Für die Annahme von „Sachlogiken“ sprechen ebenso gute Gründe wie für die Notwendigkeit<br />
von tendenziell holistischen, d.h. ganzheitlichen Analysen von Gesellschaften.<br />
Beide Verfahren sollen in den anthropologischen Studiengängen ihren Platz haben.<br />
d) Da historische Anthropologie, wenn auch mittelbar, auf die Erkenntnis des Menschen zielt,<br />
müssen ihre Methoden <strong>der</strong>art sein, dass sie nicht nur <strong>der</strong> Erhellung von „Strukturen und Prozessen“<br />
(J. Kocka) dienen, son<strong>der</strong>n dass auch die handelnden Personen selber in den Blick<br />
kommen. Es gilt also Praxis zu untersuchen, Mentalitäten, Dispositionen, „Habitus“ in den<br />
Handlungen aufzusuchen. Das ist z.B. ein Ziel <strong>der</strong> an <strong>der</strong> Ethnologie ausgerichteten<br />
Alltagsgeschichte. Deren Repräsentanten haben kritisiert, dass Historiker ihre Aussagen<br />
über Mentalitäten häufig aus hochkulturellen Objektivationen, also z.B. aus <strong>der</strong> Literatur und<br />
<strong>der</strong> Philosophie, gewinnen, ohne zu kontrollieren, ob so eruierte Mentalitäten tatsächlich die<br />
Praxis einzelner o<strong>der</strong> von Gruppen bestimmen. Diese Problematik hat zu <strong>der</strong> For<strong>der</strong>ung<br />
geführt, Aussagen über Mentalitäten überhaupt nur „praxeologisch“, d.h. durch Reihenuntersuchungen<br />
von Handlungen, zu gewinnen. Dabei wird <strong>der</strong> Unterschied zwischen<br />
Mentalität und Praxis aufgehoben, weil sich eben Mentalitäten in den Praktiken zeigen. - So<br />
berechtigt die Einsprüche <strong>der</strong> Alltagsgeschichte sind, so wenig einsehbar ist es, Historische<br />
Anthropologie auf Alltagsgeschichte festzulegen. Denn zum einen ist es methodisch<br />
fragwürdig zu glauben, durch „dichte Beschreibung“ ließen sich alle Determinanten einer<br />
Praxis gewinnen; zum an<strong>der</strong>en gibt es keinen Grund, warum nicht kulturelle Objektivationen<br />
als Zuspitzungen, gegebenenfalls auch als „Transgressionen“ einer bestimmten Wirklichkeit<br />
für <strong>der</strong>en Rekonstruktion herangezogen werden sollten. Es bleibt die For<strong>der</strong>ung, im Handeln<br />
von Personen und Personengruppen die Verarbeitung von Wahrnehmungsweisen,<br />
Deutungsmustern, biographischen Erfahrungen deutlich zu machen. Wenn „Strukturen und<br />
Prozesse“ nicht mehr mit dem Handeln von Personen o<strong>der</strong> Gruppen vermittelbar sind, hat<br />
eine Historische Anthropologie ihr Recht verloren.<br />
e) Historische Anthropologie hat es schließlich auch mit <strong>der</strong> Frage zu tun, wie die<br />
Handlungskompetenzen des Menschen entstanden sind. Dafür sind Übergangssituationen<br />
beson<strong>der</strong>s aufschlussreich, also z.B. die Entstehung <strong>der</strong> produzierenden Wirtschaftsweise,<br />
die Entstehung <strong>der</strong> frühen Hochkulturen und politisch organisierter Gemeinschaften<br />
(„Staaten“), die Entstehung eines apersonalen Konzepts von Herrschaft etc. Im Hintergrund<br />
steht dabei nicht die Vorstellung einer linearen o<strong>der</strong> gar teleologisch bestimmten Entwicklung<br />
<strong>der</strong> Menschheit. Es geht vielmehr um die Bedingungen, unter denen menschliche<br />
Gruppen bestimmte Kompetenzen gewonnen - und ggf., wie z.B. beim Übergang von <strong>der</strong><br />
Spätantike zum Frühmittelalter, auch wie<strong>der</strong> verloren - haben. Unmittelbar relevant werden<br />
genetische Fragen auch beim Übergang von <strong>der</strong> Naturgeschichte zur prähistorischen Ge-
schichte <strong>der</strong> Menschheit (vgl. oben). In einem systematischen Sinn ist die Frage aber bis<br />
heute präsent: nämlich als Frage danach, wie die im Rahmen <strong>der</strong> Naturgeschichte des<br />
Menschen, <strong>der</strong> Phylogenese, entstandenen Selektionen den Raum menschlicher Möglichkeiten<br />
determinieren (o<strong>der</strong> ob solche Selektionen vielleicht sogar in historischer Zeit modifiziert<br />
wurden). Beson<strong>der</strong>s heftig diskutiert wird die Frage z.B. im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis,<br />
aber auch im Rahmen bioethischer und sozio-biologischer Problemstellungen.<br />
Kürzlich wurde sogar die Behauptung aufgestellt, auch das religiöse Verhalten<br />
des Menschen sei von biologischen Faktoren abhängig (W. Burkert).<br />
Die beson<strong>der</strong>en Chancen <strong>der</strong> <strong>Freiburg</strong>er Studiengänge bestehen darin, dass solche Fragen (und<br />
an<strong>der</strong>e, die teilweise in den Ausführungen zur biologischen Anthropologie angesprochen sind) aus<br />
<strong>der</strong> Perspektive sowohl <strong>der</strong> Natur- als auch <strong>der</strong> Kulturwissenschaften angegangen werden<br />
können, dass ferner durch die beteiligten Fächer auch günstige Voraussetzungen für vergleichende<br />
Fragestellungen bestehen. Die beste Form für die Behandlung solcher Probleme wären<br />
gemeinsame Veranstaltungen <strong>der</strong> Repräsentanten verschiedener Fächer; sie scheitern aber oft an<br />
den an<strong>der</strong>weitigen Verpflichtungen <strong>der</strong> Dozentinnen und Dozenten, die ja nicht für die Anthropologie-Studiengänge<br />
freigestellt sind. Ein gewisser Ersatz dafür könnte es sein, dass häufiger die<br />
Möglichkeit wahrgenommen wird, Dozentinnen und Dozenten für eine o<strong>der</strong> zwei Sitzungen als<br />
Gäste einzuladen.<br />
Unabhängig davon sollten aber anthropologische Veranstaltungen grenzüberschreitend angelegt<br />
sein. Die Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse <strong>der</strong> verschiedenen Disziplinen dürfen nicht<br />
nebeneinan<strong>der</strong> stehen bleiben, die Integration nicht allein den Studierenden überlassen werden.<br />
7
Themenfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Historischen und Biologischen Anthropologie<br />
Die mitwirkenden Fächer werden jeweils nach den Themen genannt:<br />
AO = Alter Orient B = Biologie<br />
G = Geschichtswissenschaft E = Ethnologie<br />
GM = Geschichte <strong>der</strong> Medizin MS= Medizinische Soziologie<br />
H = Institut f. Humangenetik und Ph = Philosophie<br />
Anthropologie Ps = Psychologie<br />
S = Soziologie<br />
U = Ur- und Frühgeschichte<br />
Achtung:<br />
Die Themenfel<strong>der</strong>n müssen nicht wörtlich in den Veranstaltungsangeboten wie<strong>der</strong>kehren.<br />
Es handelt sich um Bereiche, aus denen Veranstaltungsangebote gemacht<br />
werden.<br />
I. Grundlagen<br />
− Theorie und Methode anthropologischer Forschung (alle Disziplinen)<br />
− Geschichte anthropologischer Forschung (alle Disziplinen)<br />
− Einführung in die Biologie (B)<br />
− Einführung in die Biologische Anthropologie (Humangenetik, Entwicklungsanthropologie,<br />
Paläoanthropologie, Geographische Anthropologie, Bevölkerungsbiologie, Humanethologie,<br />
Prähistorische Anthropologie) (H)<br />
− Einführung in die Historische Anthropologie (G, GM, S, U)<br />
− Einführung in die Psychologie (Ps)<br />
II. Biologische Anthropologie<br />
− Biologie des Menschen (B)<br />
− Neurogenetik (B)<br />
− Neurobiologie (B)<br />
− Hirnforschung (B)<br />
− Verhaltensbiologie des Menschen (B, H)<br />
− Verhaltensbiologie <strong>der</strong> Tiere (B)<br />
− Anatomie (M)<br />
− Stammesgeschichte des Menschen (Fossilkunde) (Grundlagen, Primatenradiation, Herkunft<br />
und Entwicklung <strong>der</strong> Hominiden, Migration, Evolutionsökologie, Entwicklung von Gehirn,<br />
Sprache, aufrechtem Gang, Paläogenetik) (H)<br />
− Geographische Differenzierung des Menschen - Bevölkerungsentwicklung und -dynamik<br />
(Populationsgenetik), geographische und ethnische Variabilität von Populationen,<br />
Bevölkerungsgeschichte, Ethnogeneseprozesse, Demographie mo<strong>der</strong>ner Populationen,<br />
Wachstum und Entwicklung von Bevölkerungen) (H)<br />
− Cytogenetik, Immungenetik, biochemische und molekulare Genetik (H)<br />
− Anthropologische Untersuchungsmethoden (H)<br />
− Anatomische Bestimmung von Skelettresten, Präparation und Rekonstruktion von<br />
Skelettresten, Alters- und Geschlechtsbestimmungen an Skelettresten, Bestimmungen <strong>der</strong><br />
morphologischen Variabilität (H)<br />
− Spezielle Methoden <strong>der</strong> Anthropologie und Paläopathologie<br />
− Epidemiologie<br />
III. Der Mensch zwischen Natur und Kultur<br />
− Naturevolution und Totalisierungen (Haeckel, Sozialdarwinismus, Soziobiologie) (GM, H, S)<br />
− Ethnien (H, S)<br />
− Prozesse <strong>der</strong> Ethnogenese (G, H)<br />
− Lebensalter (G, GM, H, S, Ps)<br />
− Geburt (G, GM, H, M)<br />
− Die Konstitution <strong>der</strong> Person (S, Ps)<br />
− Ontogenese (H, S, Ps)<br />
− Intelligenz, Begabung, Kreativität (S, Ps)<br />
− Mimik, Gestik, Affektivität (S, Ps)<br />
− Die Sinneswahrnehmungen und Emotionen des Menschen (S, H, M, Ps)<br />
− Sprache (H, S, Ps)<br />
− Sozialisation (G, S, Ps)<br />
− Sterben und Tod (G, GM, H, S)<br />
− Sex und Gen<strong>der</strong> (B, G, GM, H, Ps, S)<br />
− Gesundheit und Krankheit (G, GM, H)<br />
− Medizingeschichte, Wissenskonstruktion in <strong>der</strong> Medizin (G, GM)<br />
8
− Vorstellungen vom Menschen in <strong>der</strong> Medizin (G, GM)<br />
− Biologie <strong>der</strong> Krankheiten (B, GM, H)<br />
− Der Patient (G, GM)<br />
− Konzepte <strong>der</strong> Heilung (G, GM)<br />
− Medizinethik (G, GM)<br />
− Medizinische Soziologie, Public Health (MS)<br />
− Der Mensch und sein Körper (G, GM)<br />
− Körpererfahrungen (G, GM)<br />
− Leugnung, Abtötung <strong>der</strong> Körperlichkeit (Askese) (G)<br />
− Der verhüllte Körper (Kleidung) (G)<br />
− Humanethologie (H)<br />
− Bioethik (B, H)<br />
IV. Der Mensch und die äußere Natur<br />
− Naturvorstellungen (G, Ph, S)<br />
− Der Mensch in <strong>der</strong> Natur (G, Ph, S)<br />
− Beherrschung <strong>der</strong> Natur und Technik (G, S, U)<br />
− Raumerfahrung und die Glie<strong>der</strong>ung des Raumes (G, S)<br />
− Ökologie (G, H, S, U)<br />
− Wirtschaftsanthropologie (G, S, U)<br />
− Phasen <strong>der</strong> Wirtschaftsgeschichte unter anthropologischen Gesichtspunkten (unter<br />
genetischen und systematischen Gesichtspunkten, z.B.: Gabentausch; Gabe und<br />
Redistribution; Entstehung <strong>der</strong> produzierenden Wirtschaftsweise; Bedingungen <strong>der</strong><br />
industriellen Revolution) (G, S, U)<br />
− Homo oeconomicus (G, S)<br />
− Ökonomische Rationalität (G, S)<br />
V. Die soziale und politische Ordnung<br />
− Die soziokulturelle Evolution (G, H, S)<br />
− Theorien sozialen Handelns (S)<br />
− Die Konstitution von Wir-Gruppen (Identität) (G, S)<br />
− Fremde, Barbaren, Wilde (Alterität) (G, S, U)<br />
− Phasen <strong>der</strong> Geschichte sozialer Organisation (insbeson<strong>der</strong>e in traditionalen Gesellschaften)<br />
− Formen menschlicher Gemeinschaftsbildung I: Familie, Verwandtschaft, Patronage, Klientel<br />
(AO, G, S, U)<br />
− Formen menschlicher Gemeinschaftsbildung II: Dorf, Stadt, Stamm, Staat, Nation etc.<br />
(AO,G,S,U)<br />
− Die normative Ordnung <strong>der</strong> Gesellschaft (Verhaltenserwartungen, Konventionen, Sitte,<br />
Brauch, Werte, Regeln, Recht, Gesetze) (AO, G, S, U)<br />
− Strafe, Rache, Vergeltung, Sühne (G)<br />
− Die politische Ordnung <strong>der</strong> Gesellschaft (Macht) (AO, G, S, U)<br />
− Formen <strong>der</strong> Politik<br />
− Unterdrückung und Sklaverei<br />
− Abweichungen von <strong>der</strong> Ordnung (Agression, Gewalt, Krieg) (AO, G, S, U)<br />
− Formen <strong>der</strong> Kommunikation (einschl. Medien, Geld etc.)<br />
VI. Kulturelle Äußerungsformen, Formen kultureller Zugehörigkeit<br />
− Konzeptionen von Kultur (G, S, U)<br />
− Vorstellungen von <strong>der</strong> Person (Subjekt, Rolle) (G, S, Ph)<br />
− Persönlichkeitsforschung (Ps)<br />
− Scham und Schuld (G, S)<br />
− Erinnern, Vergessen, Gedächtnis (AO. G, S)<br />
− Tradition (AO, G)<br />
− Mythos (AO, G)<br />
− Die Ordnung <strong>der</strong> Zeit (Jahreszyklen, soziale, religiöse Zeit) (AO, G, S, U)<br />
− Spiel und Arbeit (G, S)<br />
− Alltag und Fest (G, S, U)<br />
− Symbolische Repräsentation (G, S, U)<br />
− Das Heilige (AO, G, S, U)<br />
− Ritus (AO, G, S, U)<br />
− Opfer (AO, G, S, U)<br />
− Zauber und Magie (AO, G, GM, S, U)<br />
− Grenzerfahrungen des Menschen und Antworten darauf (G, GM, Ph, S)<br />
− Weltbil<strong>der</strong> und Sinnstrukturen, Zukunftshoffnungen und -entwürfe (G, Ph, S)<br />
− Kulturbegegnungen, Interkulturalität, Migration (G, GM, S)<br />
− Probleme <strong>der</strong> Globalisierung (S)<br />
9
Studienpläne für die Studienfächer<br />
Historische Anthropologie und Biologische Anthropologie (Auszug)<br />
Die Verantwortung für die Koordination und Organisation <strong>der</strong> Lehrveranstaltungen liegt im<br />
Fach „Historische Anthropologie“ beim Lehrstuhl für Alte Geschichte und Historische<br />
Anthropologie (momentan vertreten durch PD Dr. Monika Bernett), im Fach „Biologische<br />
Anthropologie“ beim Institut für Humangenetik und Anthropologie (Prof. Dr. Ursula Wittwer-<br />
Backofen).<br />
Am 01.10.2002 traten die neuen Prüfungsordnungen <strong>der</strong> Studienfächer Historische<br />
Anthropologie und Biologische Anthropologie (Orientierungs- und Zwischenprüfungsordnung<br />
und Magisterprüfungsordnung) in Kraft.<br />
Die alten und neuen Prüfungsordnungen hängen aus am schwarzen Brett (<strong>ZAG</strong>,<br />
Koordinierungsstelle Anthropologie, Belfortstrasse 20) und sind bei den Studienberatern<br />
einzusehen. Die kompletten Studienpläne zu den neuen Prüfungsordnungen können bei <strong>der</strong><br />
Koordinierungsstelle käuflich erworben werden (0,30 €).<br />
Über die allgemeinen Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Prüfungen innerhalb <strong>der</strong> Philosophischen<br />
Fakultät informieren die „Orientierungs- und Zwischenprüfungsordnung“, die „Ordnung für die<br />
akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) <strong>der</strong> Albert-Ludwigs-<strong>Universität</strong> zu <strong>Freiburg</strong><br />
im Breisgau“ und die „Promotionsordnung <strong>der</strong> Philosophischen Fakultät’. Alle Ordnungen<br />
liegen in den Instituten/Seminaren <strong>der</strong> beteiligten Fächer zur Einsicht aus und können im<br />
Internet unter www.uni-freiburg.de/ga eingesehen werden.<br />
10
Studienplan Historische Anthropologie<br />
Hauptfach<br />
Tab. 1: Studienplan Grundstudium Historische Anthropologie (Hauptfach)<br />
Semester Pflichtbereich Wahlbereich<br />
1 Proseminar zur Einführung in die<br />
Historische Anthropologie (2-stündig); AO,<br />
E, G, GM, S<br />
2 Proseminar zu BiologischanthropologischenUntersuchungsmethoden<br />
(2-stündig); H<br />
3 Biologisch-anthropologisches Praktikum<br />
(2-stündig); H<br />
Proseminar/Übung zur Historischen<br />
Anthropologie (2-stündig); AO, E, G, GM,<br />
S, U<br />
4 Proseminar aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
Historischen Anthropologie<br />
(2-stündig); AO, E, G, GM, S, U<br />
− Vorlesungen:<br />
− Fragestellungen <strong>der</strong> Historischen und<br />
Biologischen Anthropologie (2-stündig);<br />
alle Fächer<br />
− Einführungen in einzelne Fächer (z.B.<br />
Psychologie) o<strong>der</strong> Teilbereiche von<br />
Fächern (z.B. Entwicklungspsychologie)<br />
(2-stündig); betr. Fach<br />
− Darstellungen einer Kultur o<strong>der</strong><br />
Gesellschaft (2-stündig): AO, E, G, S, U<br />
− Vorlesungen zu historischanthropologischen<br />
Themen<br />
(Themenfel<strong>der</strong> III-VI) (6 Stunden); AO,<br />
E, G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
− Vorlesung zur Biologischen<br />
Anthropologie (2-stündig); H<br />
− Verhaltensbiologie von Menschen<br />
und/o<strong>der</strong> Tieren (2-stündig); B, Ps.<br />
Proseminare o<strong>der</strong> Übungen:<br />
− Zu einzelnen Kulturen o<strong>der</strong> historischanthropologischen<br />
Themen (insgesamt<br />
6 Stunden); alle Fächer<br />
Insgesamt: 32 SWS<br />
Tab. 2: Studienplan Hauptstudium Historische Anthropologie (Hauptfach)<br />
Semester Pflichtbereich Wahlbereich<br />
5 Hauptseminar zur Theorie und Praxis<br />
historisch-anthropologischer Forschung<br />
(2-stündig); AO, E, G, GM, S<br />
6 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
Historischen Anthropologie (2-stündig);<br />
AO, E, G, GM, S, U<br />
7 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
Biologischen Anthropologie o<strong>der</strong><br />
biologisch-anthropologisches Praktikum<br />
(2-stündig); B, H<br />
Vorlesungen:<br />
− Wissenschaftsgeschichte und<br />
Wissenschaftstheorie (4 Stunden); AO,<br />
E, G, GM, Ph, S, U<br />
− Biologische und historisch-soziale<br />
Bedingungen anthropologischer<br />
Phänomene (2-stündig; alle Fächer<br />
− Vorlesungen zu Kulturen und historischanthropologischen<br />
Phänomenen (8<br />
Stunden);<br />
AO, E, G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
− Vertiefungsvorlesung zur Biologischen<br />
Anthropologie (2 Stunden); B, H<br />
Seminare und Übungen:<br />
− Seminare/Übungen zu Problemen <strong>der</strong><br />
Historischen Anthropologie (6 Stunden);<br />
AO, E, G, GM, Ph, S, U<br />
8 − Seminare und Übungen zu Problemen<br />
<strong>der</strong> Biologischen Anthropologie (4<br />
Stunden); B, H<br />
Insgesamt: 32 SWS<br />
11
12<br />
Studienplan Historische Anthropologie<br />
Nebenfach<br />
Tab. 3: Studienplan Grundstudium Historische Anthropologie (Nebenfach)<br />
Semest<br />
er<br />
Pflichtbereich Wahlbereich<br />
1 Proseminar zur Einführung in die Vorlesungen:<br />
Historische Anthropologie (2-stündig); AO, − Fragestellungen <strong>der</strong> Historischen und<br />
E, G, GM, S<br />
Biologischen Anthropologie (2-stündig);<br />
alle Fächer<br />
− Biologische Anthropologie (2-stündig); H<br />
2 Proseminar zu Biologisch-<br />
− Darstellung einer Kultur o<strong>der</strong><br />
Anthropologischen Untersu-<br />
Gesellschaft<br />
chungsmethoden (2-stündig); H<br />
(2-stündig); AO, E, GH, S, U<br />
− Historisch-anthropologische Themen<br />
(Themenfel<strong>der</strong> II-VI) (2-stündig); AO, E,<br />
G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
3 Proseminar/Übung aus dem Bereich <strong>der</strong> Proseminar o<strong>der</strong> Übung:<br />
Historischen Anthropologie (2-stündig); − Zu einzelnen Kulturen o<strong>der</strong> historisch-<br />
4<br />
AO, E, G, GM, S, U<br />
anthropologischen Themen (2-stündig);<br />
AO, E, G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
Insgesamt: 16 SWS<br />
Tab. 4: Studienplan Hauptstudium Historische Anthropologie (Nebenfach)<br />
Semest<br />
er<br />
Pflichtbereich Wahlbereich<br />
5 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong> Vorlesungen:<br />
Historischen Anthropologie (2-stündig); − Wissenschaftsgeschichte und<br />
AO, E, G, GM, S, U<br />
Wissenschaftstheorie (2-stündig); AO,<br />
E, G, GM, Ph, S, U<br />
6 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong> − Biologische und historisch-soziale<br />
Biologischen Anthropologie (2-stündig), B, Bedingungen anthropologischer<br />
H<br />
Phänomene (2-stündig); alle Fächer<br />
7 − Vorlesungen zu Kulturen und historischanthropologischen<br />
Phänomenen (4<br />
Stunden); AO, E, G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
− Vertiefungsvorlesung zur Biologischen<br />
Anthropologie (2-stündig); B, H<br />
8 Seminare und Übungen:<br />
− Seminar / Übung zu Problemen <strong>der</strong><br />
Historischen Anthropologie (2 Stunden);<br />
AO, E, G, GM, Ph, S, U<br />
Insgesamt: 16 SWS
Studienplan Biologische Anthropologie<br />
Nebenfach<br />
Tab. 5: Studienplan Grundstudium Biologische Anthropologie (Nebenfach)<br />
Semest<br />
er<br />
Pflichtbereich Wahlbereich<br />
1 Proseminar zu Biologisch-<br />
Vorlesungen:<br />
anthropologischenUnter- − Einführungsvorlesung zur Biologischen<br />
suchungsmethoden (2-stündig); H<br />
Anthropologie (2-stündig); H<br />
− Fragestellungen <strong>der</strong> Historischen und<br />
Biologischen Anthropologie (2-stündig);<br />
alle Fächer<br />
2 Biologisch-anthropologisches Praktikum − Verhaltensbiologie von Menschen<br />
(2-stündig); H<br />
und/o<strong>der</strong> Tieren (2-stündig); B, Ps<br />
− Vorlesung zu historisch-<br />
3 Proseminar aus dem Bereich <strong>der</strong><br />
anthropologischen Themen (2-stündig);<br />
AO, E, G, GM, Ph, Ps, S, U<br />
Proseminare, Übungen, Praktika<br />
Historischen Anthropologie (2-stündig); − Proseminar / Übung / Praktikum zu<br />
AO, E, G, GM, Ph, S, U<br />
biologisch-anthropologischen<br />
(2-stündig); H<br />
Themen<br />
4<br />
Insgesamt: 16 SWS<br />
Tab. 6: Studienplan Hauptstudium Biologische Anthropologie (Nebenfach)<br />
Semest<br />
er<br />
Pflichtbereich Wahlbereich<br />
5 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong> Vorlesungen:<br />
Biologischen Anthropologie (2-stündig); H − Wissenschaftsgeschichte und<br />
Wissenschaftstheorie (2-stündig); AO,<br />
E, G, GM, Ph, S, U<br />
6 Biologisch-anthropologisches Praktikum − Biologische und historisch-soziale<br />
(2-stündig); H<br />
Bedingungen anthropologischer<br />
Phänomene (2-stündig), alle Fächer<br />
7 Hauptseminar aus dem Bereich <strong>der</strong> − Vertiefungsvorlesung zur Biologischen<br />
Historischen Anthropologie (2-stündig); Anthropologie (2-stündig); B, H<br />
AO, E, G, GM, Ph, S, U<br />
− Vorlesung zu Kulturen und historischanthropologischen<br />
Phänomenen (2stündig);<br />
AO, E, G, GM, Ps, S, U<br />
8 Seminar / Übung / Praktikum:<br />
− Seminar/Übung/Praktikum zu<br />
Problemen <strong>der</strong> Biologischen<br />
Anthropologie (2-stündig); B, H, U<br />
Insgesamt: 16 SWS<br />
13
Studienberatung im Fach Biologische Anthropologie<br />
Prof. Dr. Ursula Wittwer-Backofen<br />
Institut für Humangenetik und Anthropologie<br />
Arbeitsgruppe Anthropologie<br />
Albertstr. 7/9<br />
Tel. 203-6896 e-mail: ursula.wittwer-backofen@uniklinik-freiburg.de<br />
Die Termine <strong>der</strong> Sprechzeiten in <strong>der</strong> vorlesungsfreien Zeit und während des Wintersemesters<br />
2008/09 entnehmen Sie bitte den Aushängen bzw. <strong>der</strong> Homepage <strong>der</strong> Biologischen<br />
Anthropologie:<br />
Alle aktuellen Ankündigungen <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie wie Sprechzeiten, Informationen<br />
zu Prüfungen, Veranstaltungen, Vorträge etc. sind ab sofort auch <strong>der</strong> neuen Homepage<br />
www.anthropologie.uniklinik-freiburg.de zu entnehmen!<br />
Studienberatung im Fach Historische Anthropologie<br />
<strong>ZAG</strong>, Koordinierungsstelle Anthropologie, Belfortstr. 20, EG Raum 00 003<br />
Die Termine <strong>der</strong> Sprechzeiten in <strong>der</strong> vorlesungsfreien Zeit und während des Wintersemesters<br />
2008/09 entnehmen Sie bitte den Aushängen bzw. <strong>der</strong> Homepage <strong>der</strong> Biologischen<br />
Anthropologie:<br />
14<br />
Dirk Schnurbusch<br />
Tel.: 203 – 3398 Dirk.Schnurbusch@geschichte.uni-freiburg.de<br />
• Anmeldung zur Zwischenprüfung Historische Anthropologie und Biologische<br />
Anthropologie<br />
• Studienberatung Historische Anthropologie<br />
• Anerkennung von Studienleistungen<br />
Än<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Sprechzeiten werden am Schwarzen Brett <strong>der</strong> Anthropologie<br />
(<strong>ZAG</strong>, Koordinierungsstelle Anthropologie, Belfortstrasse 20) angeschlagen.<br />
Bitte Aushänge beachten!!
Prüfungsberechtigte<br />
für die Fächer Historische Anthropologie und Biologische Anthropologie<br />
Zwischenprüfung (Magisterstudiengang, Promotionsstudiengang)<br />
( 1) Hauptfach/Nebenfach Historische Anthropologie<br />
Prof. Dr. Ronald G. Asch<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Leven<br />
PD Dr. Monika Bernett<br />
PD Dr. Christian Mann<br />
Prof. Dr. Baldo Blinkert<br />
Prof. Dr. Hans Ulrich Nuber<br />
Dr. Andreas Bihrer PD Dr. Willi Oberkrome<br />
PD Dr. Cornelia Brink<br />
Prof. Dr. Sylvia Paletschek<br />
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier PD Dr. Axel Paul<br />
Juniorprof. Dr. Sabine Dabringhaus<br />
PD Dr. Cay-Rüdiger Prüll<br />
Prof. Dr. Nina Degele PD Dr. Boike Rehbein<br />
PD Dr. Jens Ivo Engels<br />
Prof. Dr. Judith Schlehe<br />
Prof. Dr. Wolfgang Eßbach<br />
Dr. Dirk Schnurbusch<br />
Prof. Dr. Hans-Helmuth Gan<strong>der</strong><br />
Prof. Dr. Prof. Dr. Stefan Seitz<br />
PD Dr. Svenja Goltermann<br />
Prof. Dr. Hermann Schwengel<br />
Prof. Dr. Mark Häberlein<br />
Dr. Michael Stadelmaier<br />
Dr. Ann-Cathrin Har<strong>der</strong>s<br />
Prof. Dr. Heiko Steuer<br />
Prof. Dr. Marlies Heinz<br />
Prof. Dr. Christian Strahm<br />
Prof. Dr. Maarten Hoenen<br />
Prof. Dr. Birgit Studt<br />
Prof. Dr. Lore Hühn<br />
PD Dr. Patrick Wagner<br />
Prof. Dr. Christoph Huth<br />
Dr. Christian Wieland<br />
PD Dr. Volkhard Huth<br />
Prof. Dr. Christian Windler<br />
Prof. Dr. Regine Kather<br />
Prof. Dr. Aloys Winterling<br />
PD Dr. Stefan Kaufmann Prof. Dr. Thomas Zotz<br />
(2) Nebenfach Biologische Anthropologie<br />
Prof. Dr. Werner Schempp Prof. Dr. Ursula Wittwer-Backofen<br />
Magisterprüfung/Promotion<br />
(1) � Hauptfach Historische Anthropologie/Magisterstudiengang<br />
Prüfung im Fachgebiet Historische Anthropologie (Kollegialprüfung)<br />
� Hauptfach Historische Anthropologie/Promotionsprüfung<br />
� Nebenfach Historische Anthropologie/Magisterprüfung, Promotionsprüfung<br />
Prof. Dr. Ronald G. Asch<br />
PD Dr. Stefan Kaufmann<br />
PD Dr. Monika Bernett<br />
Prof. Dr. Karl-Heinz Leven<br />
Prof. Dr. Baldo Blinkert<br />
Prof. Dr. Hans Ulrich Nuber<br />
Prof. Dr. Sebastian Brather<br />
PD Dr. Willi Oberkrome<br />
PD Dr. Cornelia Brink<br />
Prof. Dr. Sylvia Paletschek<br />
Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Brüggemeier<br />
PD Dr. Axel Paul<br />
PD Dr. Peter Burschel<br />
PD Dr. Cay-Rüdiger Prüll<br />
Juniorprof. Dr. Sabine Dabringhaus<br />
PD Dr. Boike Rehbein<br />
Prof. Dr. Nina Degele<br />
PD Dr. Michael Schetsche<br />
PD Dr. Jens Ivo Engels<br />
Prof. Dr. Judith Schlehe<br />
Prof. Dr. Wolfgang Eßbach<br />
Prof. Dr. Hermann Schwengel<br />
Prof. Dr. Hans-Helmuth Gan<strong>der</strong><br />
Prof. Dr. Stefan Seitz<br />
PD Dr. Svenja Goltermann Prof. Dr. Heiko Steuer<br />
Prof. Dr. Mark Häberlein<br />
Prof. Dr. Christian Strahm<br />
Prof. Dr. Marlies Heinz<br />
Prof. Dr. Birgit Studt<br />
Prof. Dr. Lore Hühn<br />
PD Dr. Patrick Wagner<br />
Prof. Dr. Maarten Hoenen<br />
Prof. Dr. Christian Windler<br />
Prof. Dr. Christoph Huth<br />
Prof. Dr. Aloys Winterling<br />
PD Dr. Volkhard Huth<br />
Prof. Dr. Regine Kather<br />
Prof. Dr. Thomas Zotz<br />
(2) � Hauptfach Historische Anthropologie/Magisterprüfung<br />
Prüfung im Fachgebiet Biologische Anthropologie (Kollegialprüfung)<br />
Erst- und Zweitbegutachtung <strong>der</strong> Magisterarbeit im Fach Historische Anthropologie<br />
� Nebenfach Biologische Anthropologie/Magisterprüfung, Promotionsprüfung<br />
Prof. Dr. Werner Schempp Prof. Dr. Ursula Wittwer-Backofen<br />
15
16<br />
Historische Anthropologie/Biologische Anthropologie<br />
Sommersemester 2009<br />
Übersicht <strong>der</strong> Veranstaltungen<br />
Die Lehrveranstaltung werden angeboten von einem Fächerverbund, an dem beteiligt sind: B = Biologie, M = Medizin,<br />
H = Humangenetik und Anthropologie, G = Geschichte, GM = Institut für Ethik und Geschichte <strong>der</strong> Medizin, U = Ur- und<br />
Frühgeschichte, E = Ethnologie, AO = Altorientalistik, S = Soziologie, PH = Philosophie, PS = Psychologie.<br />
ACHTUNG:<br />
Die Teilnahme an Hauptseminaren zu Theorie und Praxis historisch-anthropologischer Forschung setzt eine<br />
Anmeldung im Sekretariat des Seminars für Alte Geschichte bis zum 17.04.2009 voraus. Die Anmeldung erfolgt im<br />
Sekretariat des Seminars für Alte Geschichte, die Zahl <strong>der</strong> Plätze ist begrenzt.<br />
Für die Teilnahme an Veranstaltungen <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie ist eine Anmeldung erfor<strong>der</strong>lich! Hierfür werden<br />
in den Räumen <strong>der</strong> Biol. Anthropologie gegen Ende des Sommersemesters Listen zum Eintragen aushängen. Der<br />
Eintrag gilt als verbindlich.<br />
Die Teilnahme an Seminaren <strong>der</strong> Soziologie setzt eine persönliche Anmeldung (während <strong>der</strong> Sprechzeiten o<strong>der</strong> per email)<br />
vor Beginn <strong>der</strong> Veranstaltung voraus. Die nötigen Informationen finden Sie auf <strong>der</strong> Homepage o<strong>der</strong> durch<br />
Aushänge des Instituts für Soziologie, KG IV.<br />
In den beteiligten Fächern finden z.T. Vorbesprechungen statt. Bitte beachten Sie die Aushänge <strong>der</strong> Institute sowie die<br />
entsprechenden Internetseiten.<br />
Vorlesungen<br />
B Ringvorlesung: 150 Jahre Darwin: Mo<strong>der</strong>ne<br />
biologische Erkenntnisse zur Evolution<br />
Mo 20-22; ab 20.04.09<br />
Biologie II/III/GHS<br />
B Verhaltensbiologie Mo 11-12; ab 20.04.09<br />
Biologie I/HS<br />
Di 11-12<br />
Biologie I/HS<br />
H Humanökologie Do 9-11; ab 23.04.09, Anmeldung<br />
erfor<strong>der</strong>lich, SR Hebelstr. 29<br />
E Aktuelle Theorienbildung Di 10-12<br />
KG I/HS 1023<br />
E Einführung in die Wirtschaftsethnologie Mi 10-12<br />
KG I/HS 1228<br />
E Einführung in die Ozeanistik 2 - Mikronesien Di 14-16<br />
KG I/HS 1023<br />
S Ungeliebte Mo<strong>der</strong>ne. Theoretischer<br />
Radikalismus im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mo und Di 12-13<br />
KG I/HS 1098<br />
AG Römische Gesellschaftsgeschichte Mi 14-16<br />
KG I/HS 1199<br />
G Überblicksvorlesung Neuere Geschichte Do 10-12<br />
KG II/HS 2006<br />
G Geschichte des europäischen Kolonialismus Do 14-16<br />
KG II/HS 2006<br />
G Die Gesellschaft und ihre Außenseiter -<br />
Deutschland im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mi 10-12<br />
KG III/HS 3219<br />
Koordinator, Driever, Fischbach,<br />
Hertel, Müller<br />
Rossel<br />
Wittwer-Backofen<br />
Schlehe<br />
Seitz<br />
Käser<br />
Eßbach<br />
Bernett<br />
Emich<br />
Lingelbach<br />
Brink
Hauptseminare zu Theorie und Praxis historisch-anthropologischer Forschung<br />
G/GM Galen - Medizin, Gesellschaft und Mentalität<br />
in <strong>der</strong> Hohen Kaiserzeit (Theorie und Praxis<br />
historisch-anthropologischer Forschung)<br />
Weitere Hauptseminare<br />
Fr 10-12<br />
KG I/HS 1224<br />
H Biologische Anthropologie Do 14-16, 23.04.2009 Anmeldung<br />
erfor<strong>der</strong>lich, SR Hebelstr. 29<br />
E Raumbegriff und Territorialverständnis Do 18-20<br />
Werthmannstraße 4/HS 01 024a<br />
(Belchen)<br />
E Medizinethnologie - aktuelle Fel<strong>der</strong> und<br />
Ansätze<br />
PH ”Beschreibung des Menschen” - Blumenbergs<br />
Anthropologie im Spannungsfeld <strong>der</strong><br />
Phänomenologie Husserls und Heideggers<br />
PH ’Der Mensch wird erst am Du zum Ich’. Die<br />
Begründung einer dialogischen Anthropologie<br />
in <strong>der</strong> Philosophie <strong>der</strong> Gegenwart<br />
PH Gehirn und Beziehung - Philosophie,<br />
Neurobiologie, Ethik<br />
Mo 14-16<br />
KG II/HS 2121<br />
Mo 18-20<br />
Sedanstr. 6/Raum 2<br />
Di 14-16<br />
KG I/HS 1234<br />
Do 12-14<br />
KG I/HS 1016<br />
S Embodying - Anwendungen eines<br />
Mi 16-18<br />
transdisziplinären Konzeptes in <strong>der</strong><br />
Geschlechterforschung (Strukturprobleme <strong>der</strong><br />
Geschlechterverhältnisse)<br />
KG IV/Übungsraum 1<br />
S Soziologie <strong>der</strong> Zukunft: Futurologie,<br />
Trendforschung, Prognostik , Teil II<br />
(Kernseminar)<br />
AO Theorie: “Archeology is Anthropology - or<br />
nothing!”<br />
Do 14-16<br />
Wilhelmstr. 3a/Seminarraum des<br />
IGPP<br />
Mi 10-12; ab 22.04.09-22.07.09<br />
KG III/ÜR 3101<br />
AG Der Blick auf Sparta - Diskurs und Realität Mi 10-12<br />
Wilhelmstr. 26/HS 00 006<br />
G Genealogie - Formen, Mythen und Methoden<br />
eines historischen Denkmusters<br />
Mi 14-16<br />
Breisacher Tor/Raum 107<br />
G Calvinismus in Europa (mit Exkursion) Do 14-16<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
G Sklavenhandel und Sklaverei auf dem<br />
nordamerikanischen Kontinent<br />
G Soziale Ungleichheiten in intersektionaler<br />
Perspektive - Frauenbewegungen in<br />
Deutschland und den USA im 19. und 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
G Cowboys, Bauern, Soziologen. Soziale<br />
Ordnung, Lebensführung und<br />
Deutungsmuster ländlicher Gesellschaften<br />
1850-1950<br />
GM Der Contergan-Skandal und die<br />
bundesdeutsche Gesellschaft<br />
Fr 13-16<br />
Breisacher Tor/Raum 201<br />
Mo 14-18 14tgl.<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
Mi 8-10<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
Do 14-16; ab 23.04.09, Beginn:<br />
23.04.2009<br />
Stefan-Meier-Str. 26/HS 02 009<br />
Bernett, Leven<br />
Wittwer-Backofen<br />
Seitz<br />
Eeuwijk van<br />
Espinet, Müller<br />
Kather<br />
Dornberg<br />
Degele, Schmitz<br />
Schetsche<br />
Heinz<br />
Gengler, Möller<br />
Huth<br />
Emich<br />
Lingelbach<br />
Paletschek, Lemke, Degele<br />
Oberkrome<br />
Eschenbruch<br />
17
Übungen<br />
Praktika<br />
18<br />
AG Systemtheorie und Geschichtswissenschaft Mo 14-16<br />
Peterhof/HS 1<br />
G Vetternwirtschaft - soziale Verflechtungen im<br />
Adel des späten Mittelalters<br />
G Zivilisierung und Disziplinierung - Entstehung<br />
und Kritik eines historischen Paradigmas<br />
G Rassenpolitik und antirassistischer Protest -<br />
Die USA und Südafrika nach 1945<br />
G Disability Studies / Studien zur Geschichte <strong>der</strong><br />
geistigen und körperlichen Behin<strong>der</strong>ung<br />
G Schriftgut beson<strong>der</strong>er Art militärischer<br />
Herkunft (1867-1945) - Karten, Vorschriften,<br />
Funksprüche, Telegramme, Kriegstagebücher<br />
Di 16-18<br />
KG IV/HS 4450<br />
Fr 10-12<br />
Breisacher Tor/Raum 106<br />
Di 10-13<br />
Peterhof/HS 3<br />
Do 10-12<br />
KG IV/HS 4429<br />
Mi 16-18<br />
KG III/HS 3117<br />
H Anthropologisches Praktikum I: Osteologie Vorbesprechung 23.04.2009, 13:ct,<br />
Termine für Blockpraktikum werden<br />
noch bekannt gegeben, SR Hebelstr.<br />
29<br />
H Anthropologisches Praktikum II:<br />
Forschungspraktikum<br />
Vorlesungen aus dem Wahlbereich Psychologie<br />
Kolloquien<br />
Do 16-18; ab 23.04.09, SR Hebelstr.<br />
29<br />
PS Kulturpsychologie Di 10-12<br />
Engelbergerstr. 41/SR 2003<br />
AG Examenskurs Historische Anthropologie Do 14-16<br />
Wilhelmstr. 26/HS 00 016<br />
PH Grundprobleme <strong>der</strong> philosophischen<br />
Anthropologie und <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
Naturphilosophie<br />
Di 18-20<br />
KG I/HS 1023<br />
Schnurbusch<br />
An<strong>der</strong>mann<br />
Wieland<br />
Eckel<br />
Lingelbach<br />
Menzel<br />
Wittwer-Backofen<br />
Wittwer-Backofen<br />
Linster, Lucius-Hoene<br />
Bernett<br />
Kather
Historische Anthropologie/Biologische Anthropologie<br />
Sommersemester 2009<br />
Kommentare zu den Veranstaltungen<br />
Die Lehrveranstaltung werden angeboten von einem Fächerverbund, an dem beteiligt sind: B = Biologie, M<br />
= Medizin , H = Humangenetik und Anthropologie, G = Geschichte, GM = Institut für Ethik und Geschichte<br />
<strong>der</strong> Medizin, U = Ur- und Frühgeschichte, E = Ethnologie, AO = Altorientalistik, S = Soziologie, PH =<br />
Philosophie, PS = Psychologie.<br />
ACHTUNG:<br />
Die Teilnahme an Hauptseminaren zu Theorie und Praxis historisch-anthropologischer Forschung<br />
setzt eine Anmeldung im Sekretariat des Seminars für Alte Geschichte bis zum 17.04.2009 voraus. Die<br />
Anmeldung erfolgt im Sekretariat des Seminars für Alte Geschichte, die Zahl <strong>der</strong> Plätze ist begrenzt.<br />
Für die Teilnahme an Veranstaltungen <strong>der</strong> Biologischen Anthropologie ist eine Anmeldung erfor<strong>der</strong>lich!<br />
Hierfür werden in den Räumen <strong>der</strong> Biol. Anthropologie gegen Ende des Wintersemesters Listen zum<br />
Eintragen aushängen. Der Eintrag gilt als verbindlich.<br />
Die Teilnahme an Seminaren <strong>der</strong> Soziologie setzt eine persönliche Anmeldung (während <strong>der</strong><br />
Sprechzeiten o<strong>der</strong> per e-mail) vor Beginn <strong>der</strong> Veranstaltung voraus. Die nötigen Informationen finden Sie<br />
auf <strong>der</strong> Homepage o<strong>der</strong> durch Aushänge des Instituts für Soziologie, KG IV.<br />
In den beteiligten Fächern finden z.T. Vorbesprechungen statt. Bitte beachten Sie die Aushänge <strong>der</strong><br />
Institute sowie die entsprechenden Internetseiten.<br />
Zu einigen Veranstaltungen lagen bei Redaktionsschluß die Kommentare nicht vor. Bitte konsultieren Sie<br />
die Aushänge <strong>der</strong> jeweiligen Seminare bzw. die Homepages o<strong>der</strong> das zentrale elektronische<br />
<strong>Vorlesungsverzeichnis</strong> <strong>der</strong> <strong>Universität</strong> <strong>Freiburg</strong> (www.studium.uni-freiburg.de/de/lehrveranstaltungen).<br />
Vorlesungen<br />
B Ringvorlesung: 150 Jahre Darwin: Mo<strong>der</strong>ne<br />
biologische Erkenntnisse zur Evolution<br />
Mo 20-22; ab 20.04.09<br />
Biologie II/III/GHS<br />
B Verhaltensbiologie Mo 11-12; ab 20.04.09<br />
Biologie I/HS<br />
Di 11-12<br />
Biologie I/HS<br />
H Humanökologie Do 9-11; ab 23.04.09, Anmeldung<br />
erfor<strong>der</strong>lich, SR Hebelstr. 29<br />
E Aktuelle Theorienbildung Di 10-12<br />
KG I/HS 1023<br />
(Modul: Theorien und Methoden <strong>der</strong> Ethnologie) 10 ECTS-Punkte<br />
Koordinator, Driever, Fischbach,<br />
Hertel, Müller<br />
Rossel<br />
Wittwer-Backofen<br />
Schlehe<br />
In <strong>der</strong> Vorlesung zur aktuellen Theoriebildung werden theoretische Richtungen <strong>der</strong> Ethnologie ab den 70er Jahren des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts bis<br />
zur Gegenwart vorgestellt, kritisch besprochen und in interdisziplinären Zusammenhängen verortet. Zu Beginn wird ein knapper,<br />
systematischer Gesamtüberblick über die wichtigsten Forschungsansätze und theoretischen Entwicklungen im Fach gegeben, um dann<br />
einige ausgewählte Bereiche vertiefend zu behandeln. Dazu gehören die Debatten um den Kulturbegriff, Globalisierungs- und<br />
Migrationsforschung, Cyberanthropologie u.a. sowie auch damit verbundene methodische Neuansätze, etwa multilokale Forschung. Damit<br />
verknüpfte Kernkonzepte, <strong>der</strong>en Implikationen sowie die wesentlichen aktuellen Kontroversen und Debatten werden vorgestellt und anhand<br />
verschiedener Praxisfel<strong>der</strong> veranschaulicht. In die Vorlesung werden auch Gastvorträge integriert. Integraler Bestandteil <strong>der</strong> VL sind die<br />
Probevorträge zur Stellenbesetzung Prof. Seitz, die am 21.4.2009 statt finden (Raum und Zeit werden noch bekannt gegeben).<br />
Einführende Literatur:<br />
• Bachmann-Medick, Doris: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2006<br />
• Moore, Henrietta/Todd San<strong>der</strong>s (ed.): Anthropology in theory. Issues in epistemology. London: Blackwell 2006<br />
• Begleitend zur Vorlesung wird ein Rea<strong>der</strong> mit Pflichttexten herausgegeben.<br />
Studienleistungen:<br />
• Regelmäßige Anwesenheit<br />
• Pflichtlektüre<br />
19
20<br />
• Kurzpräsentation<br />
als Prüfungsleistung zusätzlich:<br />
• Klausur<br />
E Einführung in die Wirtschaftsethnologie Mi 10-12<br />
KG I/HS 1228<br />
(Modul: Sachgebiete - Wirtschaftsethnologie) 6 ECTS-Punkte<br />
Die Vorlesung führt ein in die verschiedenen Arbeitsfel<strong>der</strong> <strong>der</strong> Wirtschaftsethnologie. Sie vermittelt die wichtigsten Ansätze <strong>der</strong><br />
ökonomischen Anthropologie, die wirtschaftswissenschaftliche Theorien mit ethnologischen Konzeptionen verbinden (formalistischer,<br />
substantivistischer, neomarxistischer Ansatz). Sie stellt Modelle zur Analyse des wirtschaftlichen Handelns vor (z.B. Peasant-Theorie,<br />
Optimal-Foraging-Strategie, Theorie <strong>der</strong> Original Affluent Society, Institutionenökonomie) und demonstriert ihre Anwendungsmöglichkeit<br />
an Subsistenzsicherungsstrategien indigener Gemeinschaften. Die Wirtschaftssysteme, <strong>der</strong> Umgang mit den verfügbaren Ressourcen, die<br />
Umsetzung des lokalen Wissens und <strong>der</strong> technologischen Kenntnisse bei <strong>der</strong> Nahrungsproduktion werden an regionalen Beispielen<br />
veranschaulicht. Bei <strong>der</strong> Darstellung des ökonomischen Verhaltens beim Planen und Handeln in Wildbeuter-, Agrar- und<br />
Nomadengesellschaften werden die sozialen, politischen und religiösen Kontex-te miteinbezogen. Neben den Produktionsformen werden<br />
die verschiedenen Formen <strong>der</strong> Güterakkumulation und des Gütertransfers, des reziproken und redistributiven Güteraus-tauschs sowie des<br />
Marktwesens behandelt und Aspekte <strong>der</strong> Konsumption, <strong>der</strong> Nutzung <strong>der</strong> Güter angesprochen.<br />
Die Vorlesung geht sowohl auf Entstehungsprozesse <strong>der</strong> Wirtschaftsformen, wie auch auf die heutigen Anpassungsprozesse unter<br />
Einwirkung <strong>der</strong> globalen ökonomischen Entwicklungen ein. Eine Literaturliste wird mit dem Rea<strong>der</strong> ausgegeben.<br />
Einführende Literatur:<br />
• Carrier, J. G. (Hg.) 2005. A Handbook of Economic Anthropology. Cheltenham, UK: Edward Elgar.<br />
• Plattner, Stuart (Hg:) Economic Anthropology. Stanford: Stanford University Press. 1989.<br />
• Rössler, Martin (2005) Wirtschaftsethnologie. Berlin: Reimer.<br />
• Wilk, Richard (1997) Economies and Cultures: Foundations of Economic Anthropology. Boul<strong>der</strong>: Westview Press.<br />
Studien- und Prüfungsleistungen:<br />
• Regelmäßige Anwesenheit<br />
• Pflichtlektüre<br />
• Kurzreferat<br />
• Klausur<br />
E Einführung in die Ozeanistik 2 - Mikronesien Di 14-16<br />
KG I/HS 1023<br />
(Modul: Regionalgebiete - Ozeanien) 6 ECTS - Punkte<br />
Die Vorlesung „Ethnologie von Mikronesien“ bildet den 2. Teil <strong>der</strong> Einführung in die Ozeanistik, die im im WS 2009/10 mit Polynesien zu<br />
Ende geführt wird. Mikronesien wurde über längere Zeit hinweg von <strong>der</strong> Ethnologie weniger intensiv bearbeitet als Melanesien o<strong>der</strong><br />
Polynesien. Seine Kulturen rücken in letzter Zeit mehr und mehr in den Blick <strong>der</strong> westlichen Öffentlichkeit, seit sich in Mikronesien<br />
Bestrebungen nach politischer Selbständigkeit durchgesetzt haben, und seit sich <strong>der</strong> Ferntourismus auch diese Gebiete erschließt.<br />
Die Vorlesung gibt einen Überblick über Geographie und Geologie des Gebiets, soweit diese für die Ethnologie wichtig sind, eine<br />
Darstellung <strong>der</strong> mikronesischen Teilkulturen und Sprachen, einen Überblick über die Besiedelungs, Entdeckungs- und Kolonialgeschichte<br />
<strong>der</strong> mikronesischen Inseln und eine Einführung in die wichtigsten wissenschaftlichen Hilfsmittel für die Beschäftigung mit Mikronesien.<br />
Einführende Literatur:<br />
• Wilpert, Clara B.: Südsee. Inseln, Völker und Kulturen. Hamburg 1987. (UB: GE 87/7630)<br />
• Alkire, William H.: An introduction to the peoples and cultures of Micronesia. Menlo Park, CA 1977 (in FR nicht vorhanden,<br />
wird als Kopie zur Verfügung gestellt)<br />
• Oliver, Douglas L.: Oceania. The native cultures of Australia and the Pacific Islands. Honolulu 1989. (UB: GE 92/7939)<br />
Studien- und Prüfungsleistung:<br />
• regelmäßige Anwesenheit<br />
• Pflichtlektüre<br />
• zweistündige schriftliche Klausur<br />
S Ungeliebte Mo<strong>der</strong>ne. Theoretischer<br />
Radikalismus im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mo und Di 12-13<br />
KG I/HS 1098<br />
AG Römische Gesellschaftsgeschichte Mi 14-16<br />
KG I/HS 1199<br />
Seitz<br />
Käser<br />
Eßbach<br />
Bernett
Kommentar:<br />
Im Gegensatz zur griechischen ist die römische Gesellschaft von einer ungewöhnlichen politischen Stabilität geprägt. Selbst in den<br />
„Ständekämpfen“ wurde die führende soziale und politische Stellung des Adels vom „Volk“ anerkannt. Die Plebs erhob nie die For<strong>der</strong>ung<br />
nach gleichen politischen Rechten, im Gegenteil: <strong>der</strong> Wunsch nach gesellschaftlicher und politischer Rangabstufung wurde von Hoch und<br />
Niedrig offenbar geteilt. Die Vorlesung will dieser eigentümlichen Sozialordnung mit Wi<strong>der</strong>hall im Politischen auf die Spur kommen.<br />
Themen sind die Herausbildung wesentlicher Elemente und Strukturen <strong>der</strong> römischen Gesellschaft von <strong>der</strong> Frühzeit bis in die Hohe<br />
Kaiserzeit sowie die sich wandelnden Formen <strong>der</strong> soziopolitischen Integration (Klientel, Patronage; Freundschaft).<br />
Literatur:<br />
Alföldy, G., Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 31984 (11975); Alföldy, G., Ausgewählte Beiträge, Stuttgart 1986 [darin bes. 42–81];<br />
Bleicken, J., Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreichs, Pa<strong>der</strong>born, Bd. 1, 41995, Bd. 2, 31994 [11978]; Christ, K.,<br />
Grundfragen <strong>der</strong> römischen Sozialgeschichte, in: W. Eck u.a. (Hg.), Studien zur Sozialgeschichte, Köln/Wien 1980, S. 197–228; Jacques,<br />
F./Scheid, J., Rom und das Reich in <strong>der</strong> hohen Kaiserzeit 44 v. Chr.–260 n. Chr., Stuttgart/Leipzig 1998 [darin: S. 317–411]; Rilinger, R.,<br />
Ordo und dignitas: Beiträge zur römischen Verfassungs- und Sozialgeschichte, Stuttgart 2007 [darin: 95–104 (1991); 152–180 (1985)];<br />
Veyne, P., Die römische Gesellschaft, München 1995 [frz. 1991]; Vittinghoff, F., Gesellschaft, in: <strong>der</strong>s. (Hg.), Europäische Wirtschaftsund<br />
Sozialgeschichte in <strong>der</strong> römischen Kaiserzeit (Handbuch <strong>der</strong> europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1), Stuttgart 1990, S. 161-<br />
369; Winterling, A., «Staat», «Gesellschaft» und politische Integration in <strong>der</strong> römischen Kaiserzeit, Klio 83 (2001), 93–112.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Alte Geschichte; 4 ECTS<br />
Grundlagen <strong>der</strong> Alten Geschichte; Vertiefung Alte Geschichte I; Ergänzung Alte Geschichte und Archäologie; Ergänzung Klassische<br />
Philologie und Alte Geschichte; 4 ECTS<br />
Leistungsnachweis:<br />
Studienleistungen:<br />
- regelmäßige Teilnahme<br />
- Vor- und Nachbereitung<br />
- Klausur o<strong>der</strong> mündliche Prüfung (wird von dem/<strong>der</strong> Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong> ersten Sitzung bekannt gegeben)<br />
G Überblicksvorlesung Neuere Geschichte Do 10-12<br />
KG II/HS 2006<br />
Kommentar:<br />
Die Frühe Neuzeit ist das Aschenputtel <strong>der</strong> Weltgeschichte. Zu dynamisch, sagen die Mediävisten und verweisen auf Umbrüche wie die<br />
Reformation, die die universale Ordnung des Mittelalters gesprengt haben. Zu statisch, zu traditional, heißt es in <strong>der</strong> Neuesten Geschichte,<br />
für die die „richtige“ Mo<strong>der</strong>ne erst mit <strong>der</strong> Französischen Revolution beginnt. Derart ausgegrenzt, wurden die Jahrhun<strong>der</strong>te zwischen 1500<br />
und 1800 kurzerhand zu einer eigenen Epochen erklärt und „Frühe Neuzeit“ getauft. Dass diese Epoche dennoch weit mehr ist als eine<br />
Phase des Übergangs ohne eigenes Profil, will die Vorlesung zeigen. Sie richtet sich an Studierende aller Semester, die vielleicht keine<br />
Vorkenntnisse haben, aber bereit sind, sich auf eine eher an Strukturen als an Ereignissen orientierte Einführung in diese scheinbar fremde<br />
Welt einzulassen.<br />
Literatur:<br />
P. Münch, Lebensformen in <strong>der</strong> Frühen Neuzeit. 1500 - 1800, Frankfurt a. M. 1992, Neuausgabe Berlin 1998. W. Schulze, Einführung in<br />
die Neuere Geschichte, 4., völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage, Stuttgart 2002. A. Völker-Rasor (Hg.), Frühe Neuzeit<br />
(Oldenbourg Geschichte Lehrbuch), München 2000, 2. Auflage München 2006.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Geschichte im Überblick; 6 ECTS<br />
Leistungsnachweis:<br />
(1) Studienleistungen: - regelmäßige Teilnahme, einschließlich Vor- und Nachbereitung (2) Studienleistung o<strong>der</strong> Prüfungsleistung (nach<br />
Wahl des/<strong>der</strong> Studierenden): - Abschlussklausur (90 Minuten) mit Vorbereitung<br />
G Geschichte des europäischen Kolonialismus Do 14-16<br />
KG II/HS 2006<br />
Emich<br />
Lingelbach<br />
Kommentar:<br />
Diese Veranstaltung soll einen Überblick über die Entwicklung kolonialistischer Herrschaft von ihren Anfängen im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t bis zur<br />
Dekolonisation im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t geben. Zum einen werden die kolonisierenden Gesellschaften dahingehend untersucht, welche Interessen<br />
mit <strong>der</strong> Kolonisierung verfolgt wurden, welche unterschiedlichen Herrschaftsstrukturen aufgebaut wurden, wie sich die europäischen<br />
Gesellschaften selbst durch die Kolonisierung verän<strong>der</strong>ten. Zum an<strong>der</strong>en sollen die kolonisierten Gesellschaften in den Blick genommen<br />
werden, welche Folgen die koloniale Expansion auf sie hatte, aber auch, welche Wi<strong>der</strong>stands- bzw. Reaktionsformen und<br />
Anpassungsstrategien sie entwickelten. Die koloniale Vergangenheit Europas wird somit aus politik-, wirtschafts-, sozial-, ideen-,<br />
mentalitäts- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive heraus betrachtet.<br />
Literatur:<br />
Eckert, Andreas: Kolonialismus, Frankfurt/M. 2006; Osterhammel, Jürgen: Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 1995;<br />
Reinhard, Wolfgang: Kleine Geschichte des Kolonialismus, Stuttgart 2008; Speitkamp, Winfried: Deutsche Kolonialgeschichte, Stuttgart<br />
2005.<br />
Bemerkung:<br />
21
22<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit I (1500-1850) und Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 4 ETCS<br />
Leistungsnachweis:<br />
Studienleistungen: - regelmäßige Teilnahme - Vor- und Nachbereitung - Klausur o<strong>der</strong> mündliche Prüfung (wird von dem/<strong>der</strong><br />
Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong> ersten Sitzung bekannt gegeben)<br />
G Die Gesellschaft und ihre Außenseiter -<br />
Deutschland im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mi 10-12<br />
KG III/HS 3219<br />
Kommentar:<br />
Sich an die sozialen Rän<strong>der</strong> einer Gesellschaft zu begeben heißt, etwas über die Gesellschaft selbst in Erfahrung zu bringen. Bei <strong>der</strong><br />
Bestimmung von An<strong>der</strong>ssein (an<strong>der</strong>s als wer?) und Abweichung (abweichend wovon?) sind Beschreibung und Wertung untrennbar<br />
miteinan<strong>der</strong> verbunden. Mit den Wertungen kommt die Zeitgebundenheit <strong>der</strong> Zuschreibungen ins Spiel: Welche Eigenschaften,<br />
Verhaltensweisen o<strong>der</strong> Ansichten Individuen o<strong>der</strong> Gruppen zu sozialen Außenseitern machen, ist abhängig davon, was in einer Gesellschaft<br />
als „normal“ o<strong>der</strong> wünschenswert gilt. Wer ist in Deutschland nach 1945 als Außenseiter wahrgenommen worden? Schaffen erst politische,<br />
juristische, medizinische Definitionen und Praktiken den Außenseiterstatus o<strong>der</strong> bestätigen sie im Nachhinein verbreitete Einstellungen?<br />
Welche Rolle spielen die Medien? Warum wird die „Randgruppenproblematik“ in den 1960er Jahren zum Gegenstand wissenschaftlichen<br />
Interesses und politischer Aktionen? Wo werden Umcodierungen vom unfreiwillig erfahrenen Ausschluss zur Selbststilisierung als<br />
Außenseiter erkennbar? Die Vorlesung zielt darauf, die Integrationsfähigkeit <strong>der</strong> Bundesrepublik seit 1945/49 wie auch <strong>der</strong>en Grenzen zu<br />
beschreiben und zu analysieren. Wo nötig, wird <strong>der</strong> Blick zurück bis ins späte 19. Jahrhun<strong>der</strong>t und über die nationalen Grenzen hinaus<br />
reichen.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 4 ECTS<br />
Leistungsnachweis:<br />
Studienleistungen: - regelmäßige Teilnahme - Vor- und Nachbereitung - Klausur o<strong>der</strong> mündliche Prüfung (wird von dem/<strong>der</strong><br />
Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong> ersten Sitzung bekannt gegeben)<br />
Hauptseminare zu Theorie und Praxis historisch-anthropologischer Forschung<br />
G/GM Galen - Medizin, Gesellschaft und Mentalität<br />
in <strong>der</strong> Hohen Kaiserzeit<br />
Fr 10-12<br />
KG I/HS 1224<br />
Brink<br />
Bernett, Leven<br />
Kommentar:<br />
Galen aus Pergamon (129–ca. 210 n.Chr.), einer <strong>der</strong> einflußreichsten Ärzte <strong>der</strong> Medizingeschichte überhaupt, wirkte im kaiserzeitlichen<br />
Rom des 2. und beginnenden 3. Jahrhun<strong>der</strong>ts; sein Werk, das umfangreichste erhaltene aus <strong>der</strong> Antike, umfaßt medizinische Fachtexte,<br />
Fallschil<strong>der</strong>ungen, philosophische Erörterungen, biographische Skizzen und Kommentare. Galen, <strong>der</strong> zeitweise Kaiser Marc Aurel (161-<br />
180 n. Chr.) behandelte, sah sich selbst als größten aller lebenden und toten Ärzte, im Rang gleich dem Hippokrates – nach seiner<br />
Selbsteinschätzung „unter den Ärzten <strong>der</strong> erste, unter den philosophischen Ärzten einzig“ (K 14, 660). Im Seminar werden Leben und<br />
Werke Galens anhand <strong>der</strong> reichlich vorhandenen Quellen (in neusprachlicher Übersetzung, engl., frz., dt.) analysiert. Themen sind seine<br />
medizinischen Konzepte, seine Praxis, sein philosophisches Denken, seine Beziehungen zu Zeitgenossen. Aus Sicht <strong>der</strong> historischen<br />
Anthropologie interessieren beson<strong>der</strong>s Galens Körperwahrnehmung, sein Menschenbild und seine Vorstellungen von Gesundheit und<br />
Krankheit. In einem Ausblick geht es um das Phänomen <strong>der</strong> Galen-Rezeption seit dem 4. Jahrhun<strong>der</strong>t, den Galenismus in <strong>der</strong><br />
byzantinischen Zeit und in <strong>der</strong> arabisch-islamischen Kultur.<br />
Literatur:<br />
Hankinson, R.J. (Hg.): Cambridge Companion to Galen, Cambridge 2008; Leven, K.-H. (Hg.): Antike Medizin – Ein Lexikon, München<br />
2005; Mattern, S.P.: Galen and the Rhetoric of Healing, Baltimore 2008; Schlange-Schöningen, H.: Die römische Gesellschaft bei Galen.<br />
Biographie und Sozialgeschichte, Berlin 2003.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Alte Geschichte; 10 ECTS<br />
Vertiefung Alte Geschichte II; 10 ECTS In diesem Seminar kann auch ein EPG II-Schein erworben werden. · Voraussetzungen für die<br />
Teilnahme: abgeschlossenes Grundstudium · Leistungsanfor<strong>der</strong>ungen: Regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit an den Sitzungen;<br />
Übernahme eines Impulsreferats, eines Protokolls und einer schriftlichen Hausarbeit. · Pflichtlektüre zur Einführung: Hankinson, R.J.: The<br />
Man and His Work, in: Hankinson (Hg.): Cambridge Companion to Galen, 1-33 [wird in <strong>der</strong> ersten Sitzung verteilt]. · Anmeldung bis zum<br />
17. April per E-Mail o<strong>der</strong> persönlich im Seminar für Alte Geschichte bzw. – für Studierende <strong>der</strong> Medizin, die im Rahmen des Wahlfachs<br />
Vorklinik o<strong>der</strong> Klinik einen Schein erwerben möchten – unter leven@egm.uni-freiburg.de.<br />
Leistungsnachweis:<br />
(1) Studienleistungen:<br />
- regelmäßige Teilnahme<br />
- intensive Vor- und Nachbereitung <strong>der</strong> Sitzungen, einschließlich <strong>der</strong> Aufgaben, die von dem/<strong>der</strong> Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong> ersten<br />
Sitzung bekannt gegeben werden (z.B. Referat, Essay, Sitzungsprotokoll, schriftliche Quelleninterpretation, Bibliographie, ...)<br />
- Klausur und/o<strong>der</strong> Essays<br />
(2) Prüfungsleistung (schriftliche Modulteilprüfung):<br />
- Hausarbeit o<strong>der</strong> Literaturbericht jeweils im Umfang von 15-20 Seiten als Vorarbeit für die B.A.-Abschlussarbeit<br />
Voraussetzung für den Besuch eines Hauptseminars <strong>der</strong> Alten Geschichte ist außer <strong>der</strong> erfolgreich absolvierten Zwischenprüfung <strong>der</strong><br />
Nachweis des Latinums (Beim Prüfungsamt eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses einreichen!) bzw. des erfolgreichen Abschlusses des<br />
Moduls “Grundkenntnisse Latein” im BOK-Bereich.
Weitere Hauptseminare<br />
H Biologische Anthropologie Do 14-16, 23.04.2009 Anmeldung<br />
erfor<strong>der</strong>lich, SR Hebelstr. 29<br />
Bemerkung:<br />
Termin wird noch bekannt gegeben<br />
E Raumbegriff und Territorialverständnis Do 18-20<br />
Werthmannstraße 4/HS 01 024a (Belchen)<br />
(Modul: Sachgebiete - Sozialethnologie)10 ECTS – Punkte<br />
Wittwer-Backofen<br />
In diesem Seminar wird das Territorialitätsverständnis in mobilen und sesshaften Gesellschaften untersucht, die Anpassung des territorialen<br />
Verhaltens an ökologische Konditionen und soziale Konstellationen. Es werden die verschiedenen Erklärungsversuche für Entstehung von<br />
Territorialitätsverhalten behandelt und die Beiträge zur Territorialitätsforschung aus den Nachbardisziplinen, insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong><br />
Ethologie, <strong>der</strong> Psychologie und <strong>der</strong> Ökologie aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> ethnologischen Forschung bewertet. Der Raumbegriff wird unter dem<br />
Aspekt <strong>der</strong> Wechselwirkungen von Raum und Kultur untersucht. Neben <strong>der</strong> Theoriendiskussion werden anhand regionaler Fallbeispiele das<br />
Territorialverhalten und die Konsequenzen erörtert, so beispielsweise die kosmologische Bindung, die ressourcenbezogene Nutzung,<br />
Vorstellungen von Eigentums- und Nutzungsrechten sowie von Werten, Kontrolle über Territorien und Räume als Machtsphäre, räumliche<br />
Abgrenzung und Determinierung von sozia-len Gruppen, Territorialität und Mobilität, Ethnizität und räumliche Identität.<br />
Themenvorschläge und Literatur können per e-mail angefor<strong>der</strong>t werden: Stefan.Seitz@ethno.uni-freiburg.de<br />
Erfor<strong>der</strong>lich für die erfolgreiche Teilnahme und für den Erhalt <strong>der</strong> Ergänzungs- und Prüfungsleistung sind:<br />
• regelmäßige Teilnahme<br />
• Pflichtlektüre<br />
• Referatsvortrag<br />
• Koordination und Mo<strong>der</strong>ation eines Themenfeldes mit Kurzreferat zur Einführung in die Thematik<br />
• schriftliche Ausarbeitung des Referats mit Abgabetermin<br />
• mündliche Prüfung<br />
E Medizinethnologie - aktuelle Fel<strong>der</strong> und<br />
Ansätze<br />
(Modul: Sachgebiete - Interkulturalität) 10 ECTS – Punkte<br />
Mo 14-16<br />
KG II/HS 2121<br />
Seitz<br />
Eeuwijk van<br />
Diese Veranstaltung ist sowohl als eine kürzere generelle Einführung als auch als eine thematische Vertiefung in das noch relativ junge<br />
Gebiet <strong>der</strong> Medizinethnologie aufgebaut. In einem ersten (kürzeren) Teil bietet das Hauptseminar einen Ein- und Überblick über die<br />
bedeutendsten jüngeren Schulen und <strong>der</strong>en wichtigste Ansätze innerhalb <strong>der</strong> Medizinethnologie. Der Blick auf die kulturellen, sozialen und<br />
politischen Dimensionen von Gesundheit und Krankheit? sowohl im europäisch-nordamerikanischen Kontext als auch in nichtwestlichen<br />
Kulturen? am Ende <strong>der</strong> 1980er Jahre bedeutete eine Abkehr von <strong>der</strong> fast ausschliesslich lokal verorteten Ethnomedizin. Dieser<br />
Perspektivenwechsel öffnete zugleich das Feld von ‚globaler Gesundheit’ und gesamtgesellschaftlichen Gesundheitstransformationen, die<br />
Netzwerke von weltweiten, nationalen und lokalen medizinischen ‚Landschaften’ auf dynamische Weisen umfassen. Wir befassen uns<br />
dabei beispielsweise mit <strong>der</strong> Schule <strong>der</strong> ‚Critical Medical Anthropology’ und den Ansätzen von ‚Global Health’. Neue und neuere Ansätze<br />
wie etwa ‚Gesundheit im Wandel’ (‚Health Transition’), Gesundheit und Salutogenese, ‚Vulnerability and Resilience’, ‚Political Economy<br />
of Health’ und Globalisierung und Gesundheit werden angesprochen. Alle diese Konzepte und Modelle eröffneten und eröffnen neue<br />
Perspektiven in <strong>der</strong> wissenschaftlichen Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Gesundheit und Krankheit weltweit.<br />
Im zweiten (längeren) Hauptteil des Hauptseminars wenden wir uns ausgesuchten wichtigen und aktuellen Themenfel<strong>der</strong>n innerhalb <strong>der</strong><br />
Medizinethnologie zu. Sie lassen sich aufgrund einer grossen Literaturfülle an konkreten Anwendungen aus allen Kontinenten darstellen.<br />
Die Themenwahl orientiert sich inhaltlich an den drei wichtigen Forschungsperspektiven innerhalb dieses Fachgebietes:<br />
Krankheit/Gesundheit als A) kulturelle Konstruktion, B) als sozialer Prozess und C) als Folge gesellschaftlicher Verän<strong>der</strong>ungen und<br />
globaler Vorgänge. Diese Bereiche umfassen konkrete Themen wie zum Beispiel ‚Migration und Gesundheit’, ‚Die Konstruktion und<br />
Repräsentation des Körpers’, ‚Women, Gen<strong>der</strong> and Health’, ‚Nutzung von Komplementär- und Alternativmedizin’, ‚Alte, Alter, Altern und<br />
Gesundheit’, ‚HIV/AIDS-SIDA in Län<strong>der</strong>n des Südens’, ‚Urban Health: eine neue Herausfor<strong>der</strong>ung’ und ‚Mental Health: die<br />
vernachlässigte Dimension’.<br />
Ziel <strong>der</strong> Veranstaltung ist das Erlangen A) eines ersten vertieften Verständnisses bezüglich grundlegen<strong>der</strong> neuerer Ansätze, Modelle und<br />
Konzepte in <strong>der</strong> Medizinethnologie und B) eines Überblickes über aktuelle und wichtige Themenfel<strong>der</strong> und <strong>der</strong>en kritischen Diskurse und<br />
Debatten innerhalb dieses Fachgebietes.<br />
Einführende Literatur:<br />
• Greifeld, Katarina (Hrsg.). 2003. Ritual und Heilung: eine Einführung in die Medizinethnologie. Berlin: Dietrich Reimer. (Frei<br />
2: 1632/50; LB 73/8601)<br />
• Helman, Cecil G. 2007. Culture, Health and Illness. London: Hod<strong>der</strong> Arnold (5th Edition). (Frei 2: 1632/53; nur ältere Ausgabe<br />
von 2001 erhältlich)<br />
• Janzen, John M. 2001. The Social Fabric of Health: An Introduction to Medical Anthropology. New York: McGraw-Hill. (Frei<br />
2: 1632/54)<br />
23
24<br />
• Lux, Thomas (Hrsg.). 2003. Kulturelle Dimensionen <strong>der</strong> Medizin. Ethnomedizin – Medizinethnologie – Medical Anthropology.<br />
Berlin: Dietrich Reimer. (Frei 2: 1632/52; GE 2004/8398)<br />
• Strathern, Andrew and Pamela J. Stewart. 1999. Curing and Healing: Medical Anthropology in Global Perspective. Durham<br />
(N.C.): Carolina Academic Press.<br />
• Whitaker, Elisabeth D. (Ed.). 2006. Health and Healing in Comparative Perspective. Upper Saddle River (N.J.): Pearson Prentice<br />
Hall.<br />
• Winkelman, Michael. 2009. Culture and Health. Applying Medical Anthropology. San Francisco: Jossey-Bass.<br />
Erfor<strong>der</strong>lich für die erfolgreiche Teilnahme und für den Erhalt <strong>der</strong> Ergänzungs- und Prüfungsleistung sind:<br />
• regelmässige Teilnahme<br />
• Pflichtlektüre<br />
• Abfassen eines Stundenprotokolls<br />
• Kurzreferat (mit Handout und mit schriftlicher Ausarbeitung des Referats mit Abgabetermin)<br />
• mündliche Prüfung<br />
PH ”Beschreibung des Menschen” - Blumenbergs<br />
Anthropologie im Spannungsfeld <strong>der</strong><br />
Phänomenologie Husserls und Heideggers<br />
Mo 18-20<br />
Sedanstr. 6/Raum 2<br />
Espinet, Müller<br />
Kommentar:<br />
Hans Blumenbergs entfaltet seine Anthropologie in Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Husserl und Heidegger. Das ist auf den ersten Blick<br />
erstaunlich, denn Husserl und Heidegger lehnten ein anthropologisches Verständnis ihrer Phänomenologie vehement ab. Blumenberg setzt<br />
bei dieser „Anthropologie-Phobie“ an und gewinnt Blumenberg in einem kritischen und produktiven Umgang mit Husserl und Heidegger<br />
zentrale Bestimmungsmomente des Menschseins. Wie diese sich ausformulieren – insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Kerngedanke von <strong>der</strong> eigentümlichen<br />
Sichtbarkeit des Menschen –, in welcher Hinsicht Blumenbergs Ansatz neue Möglichkeiten <strong>der</strong> Phänomenologie auszuloten vermag, die in<br />
Husserls und Heideggers Blickwinkel unerkannt bleiben, und wo Blumenbergs Vorgehen an seine Grenzen stößt, soll Gegenstand des<br />
Seminars sein. Textlicher Mittelpunkt ist Blumenbergs Fragment gebliebene, auf Vorlesungen basierende philosophisch-anthropologische<br />
Grundlegung: H. Blumenberg, „Beschreibung des Menschen“. Frankfurt am Main 2006. Für die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Husserl wird<br />
darüber hinaus wichtig sein: H. Blumenberg, „Zu den Sachen und zurück“. Frankfurt am Main 2002. Zu Beginn des Seminars wird es einen<br />
Rea<strong>der</strong> mit für die Fragestellung relevanten Texten von Husserl und Heidegger geben.<br />
Bemerkung:<br />
Praktische und theoretische Philosophie; Neuzeit/Mo<strong>der</strong>ne<br />
Ethik; Philosophische Anthropologie; Phänomenologie; Interdisziplinarität <strong>der</strong> Wissenschaften<br />
EPG 2<br />
ECTS-Punkte (B.A.): 10 (HF)<br />
Leistungsnachweis:<br />
Referat und Hausarbeit<br />
PH ’Der Mensch wird erst am Du zum Ich’. Die<br />
Begründung einer dialogischen<br />
Anthropologie in <strong>der</strong> Philosophie <strong>der</strong><br />
Gegenwart<br />
Di 14-16<br />
KG I/HS 1234<br />
Kommentar:<br />
Während für Aristoteles <strong>der</strong> Mensch als ‘Gemeinschaftswesen’ bestimmt wurde, setzte sich seit Descartes’ Suche nach einem sicheren<br />
Fundament des Wissens die Überzeugung durch, die menschliche Identität könne allein im sich selbst denkenden Ich gegründet werden.<br />
Doch kann sich das Ich ohne ein Du, ein personales Gegenüber überhaupt selbst verstehen? Erst im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t entsteht explizit eine<br />
dialogisch orientierte Anthropologie. In unterschiedlicher Weise bemühen sich Buber, Jaspers, Löwith und Sartre darum, die Bedeutung<br />
des An<strong>der</strong>en für die Konstitution <strong>der</strong> eigenen Identität zu erarbeiten. Nicht rein formale Argumente, son<strong>der</strong>n existentielle Erfahrungen, so<br />
die These <strong>der</strong> genannten Autoren, führt dazu, dass <strong>der</strong> An<strong>der</strong>e nicht als bloße Projektion o<strong>der</strong> Konstruktion angesehen werden kann. In<br />
seiner Analyse des ‘Blicks’ entwickelt Sartre eine auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht bedeutsame Begründung für die unhintergehbare<br />
Subjektivität des An<strong>der</strong>en. Dennoch hängt für ihn das Gelingen des Lebensentwurfs davon ab, ob <strong>der</strong> Mensch mit sich selbst identisch sein<br />
kann. Buber, Jaspers und Löwith dagegen bewerten die Begegnung mit dem An<strong>der</strong>en positiv: Die eigene Identität ist relational bestimmt.<br />
Im Seminar wollen wir relevante Texte <strong>der</strong> einzelnen Autoren interpretieren und sie auf die ihnen zugrunde liegenden Beobachtungen hin<br />
befragen.<br />
Literatur:<br />
M.Buber: Das Problem des Menschen, Heidelberg 1982; M. Theunissen: Der An<strong>der</strong>e. Studien zur Sozialontologie <strong>der</strong> Gegenwart, Berlin/<br />
New York 19812.<br />
Bemerkung:<br />
Theoretische Philosophie; Neuzeit/Mo<strong>der</strong>ne<br />
Anthropologie; Metaphysik; Ethik<br />
ECTS-Punkte (B.A.): 10 (HF)<br />
Leistungsnachweis:<br />
Abhängig vom Studiengang: Bachelor- und Nebenfach-Studierende: eine mündliche Prüfung, die in Form einer Präsentation im Seminar<br />
absolviert werden kann o<strong>der</strong> ein schriftliches Protokoll zu einer Sitzung; Hauptfachstudierende: Ausarbeitung einer Präsentation o<strong>der</strong><br />
Hausarbeit.<br />
Kather
PH Gehirn und Beziehung - Philosophie,<br />
Neurobiologie, Ethik<br />
Do 12-14<br />
KG I/HS 1016<br />
Dornberg<br />
Kommentar:<br />
Denkt das Gehirn? Ist es Schöpfer <strong>der</strong> erlebten Welt, <strong>der</strong> Konstrukteur des Subjekts? O<strong>der</strong> ist es vor allem ein Vermittlungsorgan des<br />
Organismus zur Umwelt und für unsere Beziehungen zu an<strong>der</strong>en Menschen und den Dingen? Ist es das Gehirn o<strong>der</strong> <strong>der</strong> lebendige Mensch,<br />
<strong>der</strong> fühlt, denkt und handelt? Neurobiologie und Neurowissenschaften beeinflussen heute in starkem Ausmaß unser Menschenbild und die<br />
aktuelle Diskussion über Bewusstsein, freien Willen usf. . In Auseinan<strong>der</strong>setzung mit einigen Ansätzen aus diesem Bereich sollen<br />
Grundzüge einer Position erarbeitet werden, die Beiträge philosophischer, insbeson<strong>der</strong>er phänomenologischer,<br />
entwicklungspsychologischer und neurobiologischer bzw. psychosomatischer Provenienz integriert. Dabei werden auch neuere<br />
kognitionswissenschaftliche und embodiment-bezogene philosophische Ansätze gestreift.<br />
Literatur:<br />
Fuchs, Th.: Das Gehirn - ein Beziehungsorgan. Eine phaenomenologisch-oekologische Konzeption, Stuttgart 2008 (Kohlhammer)<br />
Ders. : Leib und Lebenswelt, Kusterdingen 2008 (graue Edition)<br />
Jonas, H.: Organismus und Freiheit. Ansaetze einer philosophischen Biologie, Goettingen 1973 (V&R)<br />
Metzinger, T.: Subjekt und Selbstmodell, Pa<strong>der</strong>born 1999 (Mentis)<br />
Rinofer-Kreidl, S.: Das „Gehirn-Selbst“. Ist die Erste-Person-Perspektive naturalisierbar? Phaenomenologische Forschungen 2004 (219-<br />
252)<br />
Gugutzer, R.: Leib, Koerper und Identitaet. Eine phaenomenologisch-soziologische Untersuchung zur personalen Identitaet, Wiesbaden<br />
2002 (Westdeutscher Verlag)<br />
Roth G.: Fuehlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, FfM 2001 (Suhrkamp)<br />
Thompson E.: Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind , Cambridge (2007), (Harvard Univ. Press)<br />
Barkhaus A., Mayer M., Roughley N., Thürnau D. (Hg.).: Identität, Leiblichkeit, Normativität. Neue Horizonte anthropologischen Denkens,<br />
FfM (1999) (Suhrkamp)<br />
Schlimme J.E.: Wollen wir uns unserer selbst vergewissern? Zur Debatte um die menschliche Willensfreiheit und den neuronalen<br />
Determinismus; Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 3/2007; 158 (97-106)<br />
Brücher K., Gonther U.: Zum Verhältnis von Willnsfreiheit und Neurobiologie; Fortschr Neurol Psychiat 2006; 74 (194-202)<br />
Ein Rea<strong>der</strong> mit den neben <strong>der</strong> Hauptlektüre (Fuchs, Stuttgart 2008) ergänzend zugrundegelegten Texten wird zu Semesterbeginn in <strong>der</strong><br />
Bibliothek des philosophischen Seminars bereitgestellt.<br />
Bemerkung:<br />
praktische Philosophie; Neuzeit/Mo<strong>der</strong>ne<br />
EPG 2<br />
ECTS-Punkte (B.A.): 10 (HF)<br />
Philosophie des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts, Wissenschaftstheorie, Phänomenologie, Ethik<br />
Leistungsnachweis:<br />
Teilnahmevoraussetzungen: Bereitschaft zur Textlektüre und zur Übernahme eines Impulsreferates; für Scheinerwerb zusätzlich:<br />
qualifizierte Hausarbeit, für Scheinerwerb EPG und Philosophie: zwei schriftliche Arbeiten<br />
S Embodying - Anwendungen eines<br />
transdisziplinären Konzeptes in <strong>der</strong><br />
Geschlechterforschung (Strukturprobleme<br />
<strong>der</strong> Geschlechterverhältnisse)<br />
Mi 16-18<br />
KG IV/Übungsraum 1<br />
Degele, Schmitz<br />
Kommentar:<br />
Unter dem Stichwort Embodiment finden sich Ansätze aus unterschiedlichsten Disziplinen <strong>der</strong> Psychologie (embodied cognition), <strong>der</strong><br />
Naturwissenschaften (Neurotechnologien, Epigenetik), <strong>der</strong> Technik Robotik) und ebenso aus <strong>der</strong> Soziologie (Gesellschaftsdiagnose und<br />
Körpersoziologie). Auch wenn je nach Dispziplin mit dem Begriff Embodiment häufig Unterschiedliches gemeint ist, vereint doch alle<br />
Ansätze die Auffassung, dass Körperprozesse und nicht Körpermaterie im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Analyse stehen sollten. Wir wollen in diesem<br />
Seminar eine Definition von Embodying erarbeiten, die zwischen den Wissenschaftskulturen vermittelt und diesem Prozesscharakter<br />
Rechnung trägt. Dabei werden wir Fragen zu Geschlechterkonstruktionen und Geschlechterkörpern analysieren und an konkreten<br />
Beispielen ausloten, wie weit Embodying (schon) geht, gehen sollte und wo Grenzen liegen o<strong>der</strong> sein sollten.<br />
S Soziologie <strong>der</strong> Zukunft: Futurologie,<br />
Trendforschung, Prognostik , Teil II<br />
(Kernseminar)<br />
Do 14-16<br />
Wilhelmstr. 3a/Seminarraum des IGPP<br />
Schetsche<br />
Kommentar:<br />
Im Anschluss an die im vergangenen Wintersemester erarbeiteten theoretischen und methodischen Grundlagen werden die Studierenden im<br />
zweiten Teil <strong>der</strong> Veranstaltung exemplarische futurologische Projekte durchführen. Inhaltlich wird es etwa um die Zukunft des Internet o<strong>der</strong><br />
um die Folgen des Klimawandels gehen; methodisch reicht die Spannbreite von <strong>der</strong> Szenario-Analyse über das Wild-Card-Paradigma bis<br />
hin zu narrativ-fiktionalen Techniken.<br />
Literatur:<br />
Literatur: Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.<br />
Bemerkung:<br />
Voraussetzungen: Eine Teilnahme an Teil II <strong>der</strong> Veranstaltung ist aus inhaltlichen wie strukturellen Gründen prinzipiell nur nach<br />
erfolgreicher Teilnahme am Teil I möglich.Kontakt: schetsche@igpp.de<br />
25
26<br />
Leistungsnachweis:<br />
Scheinerwerb: Teilnahme an einem studentischen Projekt, mündliche und schriftliche Präsentation <strong>der</strong> Ergebnisse.<br />
AO Theorie: “Archeology is Anthropology - or<br />
nothing!”<br />
Mi 10-12; ab 22.04.09-22.07.09<br />
KG III/ÜR 3101<br />
AG Der Blick auf Sparta - Diskurs und Realität Mi 10-12<br />
Wilhelmstr. 26/HS 00 006<br />
Heinz<br />
Gengler, Möller<br />
Kommentar:<br />
Unser Bild des archaischen und klassischen Spartas ist durch Quellen geprägt, die bereits in <strong>der</strong> Antike den spartanischen Stadtstaat<br />
idealisierten. Diese Idealisierung setzte sich in <strong>der</strong> neuzeitlichen Forschung fort, die, dem Wandel des Zeitgeists folgend, entwe<strong>der</strong> Sparta<br />
zum Prototyp des Polizeistaats machte und sein strenges Erziehungssystem bewun<strong>der</strong>te, o<strong>der</strong> seine vollendete Mischverfassung betonte. Im<br />
Allgemeinen wird Sparta in <strong>der</strong> Forschung wie in den antiken Quellen vorwiegend als Gegenbild zum demokratischen Athen konstruiert.<br />
Der Versuch, die Geschichte Spartas zu schreiben, erfor<strong>der</strong>t mithin beson<strong>der</strong>e methodologische Überlegungen. Nur eine genaue Analyse <strong>der</strong><br />
Quellen und die Berücksichtigung ihrer jeweiligen historischen Kontexte erlaubt es uns, hinter dem Mythos Sparta eine Realität zu<br />
erblicken.<br />
Literatur:<br />
P. Cartledge: Sparta and Lakonia, London 22002; K. Christ: Spartaforschung und Spartabild, in: <strong>der</strong>s. (Hg.): Sparta, Darmstadt 1986, 1-72;<br />
E. Rawson: The Spartan Tradition in European Thought, Oxford 1969; E.N. Tigerstedt: The Legend of Sparta in Classical Antiquity, 3<br />
Bde., Stockholm 1965-1978.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Alte Geschichte; 10 ECTS<br />
Vertiefung Alte Geschichte II; 10 ECTS<br />
Vor Semesterbeginn ist eine Anmeldung im Sekretariat des Seminars für Alte Geschichte erfor<strong>der</strong>lich.<br />
Leistungsnachweis:<br />
(1) Studienleistungen:<br />
- regelmäßige Teilnahme<br />
- intensive Vor- und Nachbereitung <strong>der</strong> Sitzungen, einschließlich <strong>der</strong> Aufgaben, die von dem/<strong>der</strong> Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong> ersten<br />
Sitzung bekannt gegeben werden (z.B. Referat, Essay, Sitzungsprotokoll, schriftliche Quelleninterpretation, Bibliographie, ...)<br />
- Klausur und/o<strong>der</strong> Essays<br />
(2) Prüfungsleistung (schriftliche Modulteilprüfung):<br />
- Hausarbeit o<strong>der</strong> Literaturbericht jeweils im Umfang von 15-20 Seiten als Vorarbeit für die B.A.-Abschlussarbeit<br />
Voraussetzung für den Besuch eines Hauptseminars <strong>der</strong> Alten Geschichte ist außer <strong>der</strong> erfolgreich absolvierten Zwischenprüfung <strong>der</strong><br />
Nachweis des Latinums (Beim Prüfungsamt eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses einreichen!) bzw. des erfolgreichen Abschlusses des<br />
Moduls “Grundkenntnisse Latein” im BOK-Bereich.<br />
G Genealogie - Formen, Mythen und Methoden<br />
eines historischen Denkmusters<br />
Mi 14-16<br />
Breisacher Tor/Raum 107<br />
Kommentar:<br />
Im Blickpunkt des Seminars stehen Ursprung und charakteristische Ausprägungen genealogischen Denkens in <strong>der</strong> Geschichte des<br />
vormo<strong>der</strong>nen Europa. Dazu werden wir eine repräsentative Auswahl von Schrift- und Bildzeugnissen interpretieren und so <strong>der</strong> Frage<br />
nachgehen, wie und warum es zu typischen Vorstellungen von Abstammungsgemeinschaften wie ›Familie‹, ›Geschlecht‹ o<strong>der</strong> ›Haus‹<br />
kommen konnte. Sie haben soziale Strukturen und politisches Handeln in <strong>der</strong> europäischen Geschichte bis in die jüngere Vergangenheit<br />
hinein maßgeblich mitbestimmt.<br />
Literatur:<br />
Otto Forst de Battaglia: Wissenschaftliche Genealogie. Eine Einführung in ihre wichtigsten Grundprobleme, Bern 1948; Karl Schmid:<br />
Geblüt, Herrschaft, Geschlechterbewußtsein. Grundfragen zum Verständnis des Adels im Mittelalter, Sigmaringen 1998; Kilian<br />
Heck/Bernhard Jahn (Hg.): Genealogie als Denkform in Mittelalter und früher Neuzeit, Tübingen 2000<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Mittelalterliche Geschichte; 10 ECTS Seminaranmeldung bitte bis einschließlich 1.4. 2009<br />
unter: volkhard.huth@geschichte.uni-freiburg.de<br />
Huth
G Calvinismus in Europa (mit Exkursion) Do 14-16<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
Kommentar:<br />
2009 ist Calvin-Jahr! Spötter meinen zwar, <strong>der</strong> Jurist und Theologe Johannes Calvin (1509-1564) sei zum Lachen in den Keller gegangen.<br />
Warum es sich aber dennoch lohnen könnte, auch diesen Reformator in den Blick zu nehmen, soll im Hauptseminar geklärt werden: in<br />
gesamteuropäischer Perspektive, unter Fragestellungen, die neben <strong>der</strong> Geschichte von Staat, Kirche und Frömmigkeit auch<br />
kulturgeschichtliche Aspekte umfassen, und nicht zuletzt im Rahmen einer Exkursion zur Ausstellung „Calvinismus in Europa“ im<br />
Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die Teilnahme an <strong>der</strong> Exkursion ist obligatorisch.<br />
Literatur:<br />
Georg Plasger: Johannes Calvins Theologie. Eine Einführung, Göttingen 2008. Adaptations of Calvinism in Reformation Europe. Essays in<br />
Honour of Brian G. Armstrong, hrsg. von Mack P. Holt, Al<strong>der</strong>shot u.a. 2007. Philip Benedict: Christ’s Churches Purely Reformed. A Social<br />
History of Calvinism, New Haven 2002. Calvinism in Europe, 1540-1620, hrsg. von Andrew Pettegree, Cambridge u.a. 1994.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit I (1500-1850); 10 ECTS Anmeldung per email an: birgit.emich@geschichte.unifreiburg.de<br />
G Sklavenhandel und Sklaverei auf dem<br />
nordamerikanischen Kontinent<br />
Fr 13-16<br />
Breisacher Tor/Raum 201<br />
Emich<br />
Lingelbach<br />
Kommentar:<br />
Das Hauptseminar behandelt zum einen den sogenannten Slave Triangle, also die Versklavung auf dem afrikanischen Kontinent und den<br />
Transport in Richtung <strong>der</strong> Amerikas. Dabei sollen sowohl die Folgen für die betroffenen afrikanischen Gesellschaften, die Rolle <strong>der</strong><br />
europäischen Mächte im Sklavenhandel als auch die Erfahrung von Gefangennahme und Transport analysiert werden. Zum an<strong>der</strong>en wird<br />
die Sklaverei in den amerikanischen Kolonien seit dem frühen 17. Jahrhun<strong>der</strong>t, später in den USA thematisiert: Analysiert werden das<br />
Plantagensystem, die Arbeits- und Lebensbedingungen daselbst, Familienstrukturen und kulturelle Entwicklungen, Anpassungs- und<br />
Wi<strong>der</strong>standsformen. Ebenso wird die Debatte zwischen Sklavereianhängern und -gegnern analysiert.<br />
Literatur:<br />
Halpern, R. / DalLago, E. (Hg.): Slavery and Emancipation, Oxford 2002; Kolchin, P.: American Slavery: 1619-1877, New York 2003;<br />
Malden, M: Slavery in colonial America 1619-1776, Blackwell Publ., 2002. Meissner, J. et al. Schwarzes Amerika, München 2008; Miller,<br />
R.M. / Smith, J.D. (Hg.): Dictionary of African-American Slavery, New York 1988.<br />
Voraussetzung:<br />
Gute Englischkenntnisse sind unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit I (1500 bis 1850); 10 ECTS Die Anmeldung erfolgt per email über das Sekretariat<br />
des Lehrstuhls Leonhard (sabine.schmidt@geschichte.uni-freiburg.de). Für den Fall, dass in <strong>der</strong> Veranstaltung zwei Scheine erworben<br />
werden sollen - ein Fach- und ein EPG-Schein - ist für den EPG-Schein eine deutlich erkennbare zusätzliche Leistung in Absprache mit <strong>der</strong><br />
Dozentin zu erbringen.<br />
Leistungsnachweis:<br />
Leistungsnachweis: Während des Semesters sind zwei Essays zu verfassen, außerdem werden eine Hausarbeit und die Beteiligung an einer<br />
Sitzungsgestaltung verlangt.<br />
G Soziale Ungleichheiten in intersektionaler<br />
Perspektive - Frauenbewegungen in<br />
Deutschland und den USA im 19. und 20.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t<br />
Mo 14-18 14tgl.<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
Paletschek, Lemke, Degele<br />
Kommentar:<br />
Mit dem Konzept <strong>der</strong> Intersektionalität werden Wechselwirkungen zwischen Ungleichheit generierenden Kategorien wie Klasse,<br />
Geschlecht, Rasse, Religion, aber auch Alter, Ethnie/Nation o<strong>der</strong> körperliche Verfasstheit untersucht. Es analysiert das komplexe<br />
Zusammenspiel zwischen Identität und agency im Verhältnis zu Gesellschaftsstrukturen sowie zu symbolischen Repräsentationen (z.B. in<br />
kulturellen und ästhetischen Formationen o<strong>der</strong> auf <strong>der</strong> Werte- und Normebene). Das Konzept <strong>der</strong> Intersektionalität ist über die Analyse<br />
gegenwärtiger Gesellschaftsverhältnisse insbeson<strong>der</strong>e aus den Gen<strong>der</strong> Studies heraus entwickelt worden. In diesem interdisziplinären und<br />
theoriegeleiteten Hauptseminar soll nun untersucht werden, wie sich dieses Konzept anwenden lässt o<strong>der</strong> inwiefern es modifiziert werden<br />
muß, wenn man es in historischer und kulturwissenschaftlicher Perspektive auf die Entstehung und Entwicklung sozialer Bewegungen<br />
bezieht. Im Seminar soll das in vergleichen<strong>der</strong> und transnationaler Perspektive am Beispiel <strong>der</strong> deutschen und amerikanischen<br />
Frauenbewegungen des 19. und 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts geschehen, wobei wir uns schwerpunktmäßig mit drei Zeitschnitten – 1840er-1860er<br />
Jahre, mit den Jahrzehnten um 1900 sowie den 1970er/80er Jahren – beschäftigen werden. Folgende Fragen werden u.a. dabei leitend sein:<br />
Sind soziale Bewegungen homogen? Vertreten sie einheitliche und einende Ziele? Welche Ungleichheitsdimensionen, Interessen und<br />
Solidaritäten sind bei <strong>der</strong> Konstituierung und gesellschaftlichen Sichtbarkeit sozialer Bewegungen zu beobachten?<br />
Literatur:<br />
Dietze, Gabriele, Race Class Gen<strong>der</strong>. Differenzen und Interdependenzen am Amerikanischen Beispiel, in: Die Philosophin 23 (2001), S.30-<br />
50. Knapp, Gudrun-Axeli, „Intersectionality“ – ein neues Paradigma feministischer Theorie? Zur transatlantischen Reise von „Race, Class,<br />
Gen<strong>der</strong>“, in: Feministische Studien 23 (2005), S.68-81. Knapp, Gudrun-Axeli / Wetterer, Angelika (Hg.), Achsen <strong>der</strong> Differenz.<br />
27
28<br />
Gesellschaftstheorie und feministische Kritik II, Münster 2003. Lenz, Ilse (Hg.), Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom<br />
kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung, Wiesbaden 2008. Paletschek, Sylvia / Pietrow-Ennker, Bianka (Hg.), Women’s Emancipation<br />
Movements in the 19th Century. A European Perspective, Stanford 2004.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 10 ECTS Anmeldung für das Hauptseminar (15 Plätze) bitte per email<br />
an: Sekretariat.Paletschek@geschichte.uni-freiburg.de<br />
G Cowboys, Bauern, Soziologen. Soziale<br />
Ordnung, Lebensführung und<br />
Deutungsmuster ländlicher Gesellschaften<br />
1850-1950<br />
Mi 8-10<br />
KG IV/Übungsraum 2<br />
Oberkrome<br />
Kommentar:<br />
Die Veranstaltung verfolgt drei Ziele. Erstens sollen anhand einiger, im Seminar festzulegen<strong>der</strong> nationaler – in Mitteleuropa regionaler –<br />
Beispiele agrarsoziale Arbeits- und Existenzbedingungen während des Untersuchungszeitraums identifiziert und ansatzweise verglichen<br />
werden. Zweitens ist nach den Ursachen und den Mechanismen einer nicht lediglich Deutschland und die USA betreffenden Mythisierung<br />
o<strong>der</strong> wenigstens Verklärung des ‚Landvolks’ bzw. mancher seiner Repräsentanten zu fragen. Drittens tritt das wissenschaftliche, vor allem<br />
das soziologische Interesse am primären Sektor in den Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Diskussion. Dabei wäre u. a. dem Mischungsverhältnis von<br />
Ideologieproduktion und empirischer Exaktheit in <strong>der</strong> frühen, auf <strong>der</strong> disziplinären Schnittstelle von Volkskunde, Nationalökonomie und<br />
Geschichte angesiedelten und transnational verflochtenen Agrarsoziologie nachzugehen.<br />
Literatur:<br />
Die ‚landwirtschaftlichen’ Kapitel in den letzten drei Bänden von Hans-Ulrich Wehlers Gesellschaftsgeschichte; Stanley Corkin, Cowboys<br />
as cold warriors. The Western and U.S. history, Philadelphia 2004; zum Hintergrund allgemein Mark Mazower, Der dunkle Kontinent.<br />
Europa im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t, Berlin 2000.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 10 ECTS Anmeldung per email erfor<strong>der</strong>lich an:<br />
Willi.Oberkrome@geschichte.uni-freiburg.de<br />
GM Der Contergan-Skandal und die<br />
bundesdeutsche Gesellschaft<br />
Do 14-16; ab 23.04.09, Beginn: 23.04.2009<br />
Stefan-Meier-Str. 26/HS 02 009<br />
Eschenbruch<br />
Kommentar:<br />
Die Contergan-Katastrophe Anfang <strong>der</strong> 1960er Jahre war ein Wendepunkt im Medizinverständnis <strong>der</strong> bundesdeutschen Gesellschaft. Sie<br />
hat auch die pharmazeutische Forschung, den Umgang mit Medikamenten und die Auffassungen von Körperbehin<strong>der</strong>ung, Schwangerschaft<br />
und Abtreibung in <strong>der</strong> BRD stark beeinflusst. Ziel des Seminars ist es, sich systematisch mit den damaligen Ereignissen, ihrer<br />
Vorgeschichte und ihren Hintergründen auseinan<strong>der</strong>zusetzen, und sie in ihre weiteren gesellschafts-, medizin- und<br />
wissenschaftshistorischen Kontexte einordnen zu lernen. Das Seminar wird in einem referatsbasierten Modus ablaufen, Bedingung für den<br />
Scheinerwerb sind somit Referat und Hausarbeit. Voraussetzung für die Teilnahme sind Vertrautheit mit den Grundlagen historischen<br />
Arbeitens, gute passive Englischkenntnisse und die Bereitschaft zu eigenständigen Quellenrecherchen, etwa in Zeitungen <strong>der</strong> damaligen<br />
Zeit.<br />
Literatur:<br />
Steinmetz, Willibald (2003): Ungewollte Politisierung durch die Medien? Die Contergan-Affäre. In: Bernd Weisbrod (Hg.), Die Politik <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit - Die Öffentlichkeit <strong>der</strong> Politik, Göttingen: Wallstein, 195-228; Kirk, B. (1999): Der Contergan Fall: eine unvermeidbare<br />
Arzneimittelkatastrophe? Zur Geschichte des Arzneistoffes Thalidomid. Stuttgart; Eckart, Wolfgang U., Jütte, Robert (2007):<br />
Medizingeschichte: eine Einführung. Köln et al., Böhlau (UTB 2903)<br />
Bemerkung:<br />
Keine B.A.-Veranstaltung.
Übungen<br />
AG Systemtheorie und Geschichtswissenschaft Mo 14-16<br />
Peterhof/HS 1<br />
Schnurbusch<br />
Kommentar:<br />
Über lange Jahre galt die Systemtheorie als ein sozialwissenschaftliches Paradigma, das aufgrund ihrer Charakteristika für die<br />
Geschichtswissenschaft nicht fruchtbar gemacht werden könnte. Hierzu hat nicht nur die Komplexität <strong>der</strong> Systemtheorie selbst beigetragen,<br />
son<strong>der</strong>n auch die Hermetik ihrer Sprache. Erst in jüngster Zeit sind einzelne Studien erschienen, die sich in Konzeption und Fragestellung<br />
von <strong>der</strong> Systemtheorie anregen ließen: Sie sollen im Vor<strong>der</strong>grund <strong>der</strong> Lektüre <strong>der</strong> Übung liegen. Rekonstruiert werden sollen zum einen die<br />
Grundprinzipien <strong>der</strong> Systemtheorie und zum zweiten die Erkenntnismöglichkeiten einer systemtheoretisch fundierten<br />
Geschichtswissenschaft.<br />
Literatur:<br />
Frank Buskotte, Resonanzen für Geschichte. Niklas Luhmanns Systemtheorie aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, Berlin und<br />
Münster 2006; Frank Becker, Geschichte und Systemteorie. Exemplarische Fallstudien, Frankfurt am Main u.a. 2004.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Praxis und Interdisziplinarität; Praxisorientierte Übung in Geschichte; 4 ECTS<br />
Leistungsnachweis:<br />
Studienleistungen:<br />
- regelmäßige Teilnahme;<br />
- Vor- und Nachbereitung;<br />
- Referat und/o<strong>der</strong> schriftliche Studienleistung (z. B. Klausur, kurze Hausarbeit, Essays) (wird von dem/<strong>der</strong> Veranstaltungsleiter/in in <strong>der</strong><br />
ersten Sitzung bekannt gegeben)<br />
G Vetternwirtschaft - soziale Verflechtungen<br />
im Adel des späten Mittelalters<br />
Di 16-18<br />
KG IV/HS 4450<br />
An<strong>der</strong>mann<br />
Kommentar:<br />
Sozialer Erfolg und politischer Einfluß setzen die Teilhabe an vielfältigen Beziehungsgeflechten voraus. Das war schon immer so.<br />
Überlieferungsbedingt sind entsprechende Strukturen für das späte Mittelalter und die beginnende Neuzeit beson<strong>der</strong>s gut beim Adel zu<br />
erkennen. Anhand ausgewählter Texte aus dem südwestdeutschen Raum will die Übung einen quellennahen Eindruck vermitteln, welche<br />
Bedeutung diesbezüglich fürstlichen Höfen, Dom- und Stiftskapiteln sowie dem Konnubium und ganz allgemein <strong>der</strong> „adligen Freundschaft“<br />
zukam. Im Rahmen <strong>der</strong> Übung ist eine zweitägige Exkursion vorgesehen.<br />
Literatur:<br />
Wolfgang Reinhard, Freunde und Kreaturen. „Verflechtung“ als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen. Römische<br />
Oligarchie um 1600, München 1979; Gerhard Fouquet, Verwandtschaft, Freundschaft, Landsmannschaft, Patronage um 1500: Das Speyerer<br />
Domkapitel als Instrument politischer und sozialer Integration, in: Europa 1500. Integrationsprozesse im Wi<strong>der</strong>streit: Staaten, Regionen,<br />
Personenverbände, Christenheit, hg. von Ferdinand Seibt und Winfried Eberhard, Stuttgart 1987, S. 349-367; Kurt An<strong>der</strong>mann,<br />
Gemmingen-Michelfeld. Eine personengeschichtliche Fallstudie zum Themenkreis Patronage – Verwandtschaft – Freundschaft -<br />
Landsmannschaft, in: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. von Paul-Joachim Heinig,<br />
Sigrid Jahns u.a., Berlin 2000, S. 459-477.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Mittelalterliche Geschichte; 4 ECTS<br />
G Zivilisierung und Disziplinierung -<br />
Entstehung und Kritik eines historischen<br />
Paradigmas<br />
Fr 10-12<br />
Breisacher Tor/Raum 106<br />
Wieland<br />
Kommentar:<br />
Lange Zeit gab es die Vorstellung, daß die Menschen während <strong>der</strong> Frühen Neuzeit von einem chaotischen und wilden Haufen zu einer<br />
geordneten und zivilisierten Gesellschaft gemacht wurden – und in gewisser Hinsicht existieren Geschichtsbil<strong>der</strong> dieser Art nach wie vor,<br />
wenn auch wesentlich subtiler und differenzierter. Dennoch hat sich in den vergangenen fünfzig Jahren die Bewertung <strong>der</strong> frühneuzeitlichen<br />
Geschichte gerade hinsichtlich <strong>der</strong> Frage nach dem „Zivilisationsprozeß“ in wesentlichen Punkten geän<strong>der</strong>t, und es dürfte reizvoll sein, den<br />
Schritten dieser Umdeutung im Detail nachzugehen. Dabei sollen am Beginn <strong>der</strong> Übung zunächst die Klassiker <strong>der</strong> Disziplinierungsthese<br />
stehen – Norbert Elias und Gerhard Oestreich –, im Anschluß werden wir uns mit <strong>der</strong> fundamentalen Erweiterung dieser Theorie durch das<br />
Konfessionalisierungsparadigma beschäftigen, um schließlich <strong>der</strong> schrittweisen Dekonstruktion dieses imponierenden Theoriegebäudes<br />
durch beispielsweise die „neue Kriminalitätsgeschichte“ auf die Spur zu kommen. Dabei werden einerseits die großen theoretischen<br />
Entwürfe gelesen und interpretiert, an<strong>der</strong>erseits soll jedoch auch die Quellenlektüre nicht zu kurz kommen – denn alle untersuchten<br />
Historiker und Soziologen beriefen sich für ihre Deutung selbstverständlich auf Quellen, jedoch sehr unterschiedliche und unterschiedlich<br />
gedeutete.<br />
29
30<br />
Literatur:<br />
Claudia Opitz (Hrsg.), Höfische Gesellschaft und Zivilisationsprozeß. Norbert Elias’ Werk in kulturwissenschaftlicher Perspektive,<br />
Köln/Weimar/Wien 2005; Heinz Schilling (Hrsg.), Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung im frühneuzeitlichen Europa (mit einer<br />
Auswahlbibliographie) (= ZHF. Beiheft 16), Berlin 1994; Schmid, Heinrich Richard, Konfessionalisierung im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t (= EdG 12),<br />
München 1992.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit I (1500-1850); 4 ECTS<br />
G Rassenpolitik und antirassistischer Protest -<br />
Die USA und Südafrika nach 1945<br />
Di 10-13<br />
Peterhof/HS 3<br />
Kommentar:<br />
Die USA und Südafrika wurden nach 1945 international zu den am stärksten beachteten Beispielen für die politische Unterdrückung<br />
„schwarzer“ Bevölkerungsgruppen durch die Herrschaft von „Weißen“. Beide Län<strong>der</strong> hatten unterschiedliche, historisch weit<br />
zurückreichende Traditionen <strong>der</strong> Diskriminierung von Afroamerikanern bzw. indigenen Afrikanern. Während die Praktiken <strong>der</strong> Segregation<br />
in den USA nach 1945 am ausgeprägtesten in den Südstaaten fortbestanden, systematisierte und verschärfte die südafrikanische Regierung<br />
von 1948 an die rassistische Unterdrückung im System <strong>der</strong> „Apartheid“. In <strong>der</strong> amerikanischen Bürgerrechtsbewegung bildete sich seit den<br />
fünfziger Jahren eine neue Form des Protests heraus, die an<strong>der</strong>s als zuvor primär auf direkten, gewaltfreien Aktionen beruhte und ihren<br />
Höhepunkt in den sechziger Jahren erleben sollte. In Südafrika formierte sich etwa gleichzeitig eine zunächst ebenfalls friedliche<br />
Wi<strong>der</strong>standsbewegung, die aber angesichts des Gewaltkurses <strong>der</strong> Regierung bald zum bewaffneten Kampf überging. Seit den fünfziger<br />
Jahren entstand zudem in <strong>der</strong> westlichen Welt eine von privaten Organisationen getragene Anti-Apartheid-Bewegung, die sich um die<br />
internationale Isolierung des südafrikanischen Regimes bemühte. Der Kampf um die Bürgerrechte in den USA gelangte in den späten<br />
sechziger Jahren an sein Ende; das südafrikanische Apartheidsregime bestand bis in die frühen neunziger Jahre fort.<br />
Ziel <strong>der</strong> Übung ist es, die Rassenpolitik wie auch den nationalen und internationalen antirassistischen Protest in beiden Fällen auf ihre<br />
Motive, Formen und Effekte zu untersuchen. Anschließend sollen die beiden Beispiele aufeinan<strong>der</strong> bezogen werden, indem erstens gefragt<br />
wird, inwiefern Vergleiche sinnvoll und möglich sind; und indem zweitens konkreten Verbindungen zwischen beiden Situationen<br />
nachgegangen wird (Beziehungen zwischen dem civil rights movement und <strong>der</strong> afrikanischen Befreiungsbewegung, Rolle des<br />
internationalen Protests für die Politik <strong>der</strong> Regierungen, Einfluß <strong>der</strong> „Black Consciousness“-Bewegung).<br />
Literatur:<br />
Einführende Literatur: Bruce Dierenfeld: The Civil Rights Movement, Harlow 2008; Albrecht Hagemann: Kleine Geschichte Südafrikas,<br />
München 2001.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 4 ECTS<br />
G Disability Studies / Studien zur Geschichte<br />
<strong>der</strong> geistigen und körperlichen Behin<strong>der</strong>ung<br />
Do 10-12<br />
KG IV/HS 4429<br />
Eckel<br />
Lingelbach<br />
Kommentar:<br />
Die Forschungen zur ‚Behin<strong>der</strong>ung’ befinden sich seit einiger Zeit im Umbruch. Lange Zeit herrschte das individuelle o<strong>der</strong> auch<br />
medizinische Modell vor, das die Ursachen für die Behin<strong>der</strong>ung im betroffenen Individuum verortete und Behin<strong>der</strong>ung als Defekt definierte.<br />
Seit einiger Zeit aber wird diesem Modell ein an<strong>der</strong>es gegenübergestellt: das soziale. Dieses Modell verortet die Ursachen für Behin<strong>der</strong>ung<br />
in <strong>der</strong> Gesellschaft. Gefragt wird danach, wie die gesellschaftlichen Strukturen Menschen mit bestimmten Merkmalen ‚behin<strong>der</strong>n’,<br />
marginalisieren. Hier nehmen neben sozialwissenschaftlichen Perspektiven auch kulturwissenschaftliche einen immer breiteren Raum ein,<br />
bei denen genauer danach gefragt wird, wie Behin<strong>der</strong>ung konstruiert wird, welche Bil<strong>der</strong> und Vorstellungen von Behin<strong>der</strong>ung existieren und<br />
welche Akteure für diese Konstruktionen verantwortlich sind. In <strong>der</strong> Übung sollen zunächst einige <strong>der</strong> grundlegenden theoretischen Texte<br />
aus dem amerikanischen und deutschen Kontext <strong>der</strong> disability studies/disability history erarbeitet werden, um dann anhand von Fallstudien<br />
einige <strong>der</strong> vielen möglichen Facetten dieses Themas vorzustellen.<br />
Literatur:<br />
Albrecht, Gary L. / Seelman, Katherine D. / Bury, Michael (Hg.): Handbook of Disability Studies, Thousand Oaks / London / New Delhi<br />
2000; Fandrey, Walter: Krüppel, Idioten, Irre. Zur Sozialgeschichte behin<strong>der</strong>ter Menschen in Deutschland, Stuttgart 1990; Longmore, Paul<br />
K. / Umansky, Lauri (Hg.): The New Disability History. American Perspectives, New York / London 2001; Poore, Carol: Disability in<br />
Twenties-Century German Culture, Ann Arbor 2007; Waldschmidt, Anne (Hg.): Kulturwissenschaftliche Perspektiven <strong>der</strong> Disability<br />
Studies. Tagungsdokumentation, Kassel 2003; Weisser, Jan / Renggli, Cornelia (Hg.): Disability Studies. Ein Lesebuch, Luzern 2004.<br />
Voraussetzung:<br />
Gute Englischkenntnisse<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Vertiefung Neuzeit I (1500-1850); Vertiefung Neuzeit II (ab 1850); 4 ECTS Die Anmeldung erfolgt per<br />
email über das Sekretariat des Lehrstuhls Leonhard (sabine.schmidt@geschichte.uni-freiburg.de).
Praktika<br />
G Schriftgut beson<strong>der</strong>er Art militärischer<br />
Herkunft (1867-1945) - Karten,<br />
Vorschriften, Funksprüche, Telegramme,<br />
Kriegstagebücher<br />
Mi 16-18<br />
KG III/HS 3117<br />
Menzel<br />
Kommentar:<br />
Karten, Dienstvorschriften, Funksprüche, Telegramme, Kriegstage- und Logbücher sind schriftliche Quellen, die sich zum einen bereits rein<br />
optisch stark vom üblichen schriftlichen Quellenmaterial unterscheiden und zum an<strong>der</strong>en aber auch ganz eigenen Entstehungsbedingungen<br />
unterworfen waren, die für ihre korrekte Interpretation durchaus wesentlich sein können. Die Teilnehmer <strong>der</strong> Übung sollen anhand von<br />
Kopien aus Akten des Bundesarchiv-Militärarchivs mit diesen Überlieferungsformen, die vor allem im militärischen Kontext von Bedeutung<br />
sind, vertraut gemacht werden. Zusätzlich sollen die Teilnehmer Kenntnisse über Geschäftsgangprozesse und auch Fertigkeiten im Umgang<br />
mit Originalakten gewinnen. Da ein Teil <strong>der</strong> Unterlagen handschriftlich vorliegt, dient die Übung zudem <strong>der</strong> Erwerbung, bzw. Erhaltung <strong>der</strong><br />
Lesebefähigung zeitgenössischer Handschriften und Geschäftsgangkürzel. Es werden amtliche Dokumente militärischer Dienststellen aus<br />
dem Zeitraum von 1867 bis 1945 behandelt. Ein Sitzungstermin wird im Bundesarchiv-Militärarchiv in <strong>Freiburg</strong> stattfinden, incl. Führung.<br />
Bemerkung:<br />
Zuordnung für BA-Studiengänge: Praxis und Interdisziplinarität; 4 ECTS Anmeldungen bitte vorab an: t.menzel@barch.bund.de<br />
H Anthropologisches Praktikum I: Osteologie Vorbesprechung 23.04.2009, 13:ct,<br />
Termine für Blockpraktikum werden noch<br />
bekannt gegeben, SR Hebelstr. 29<br />
Bemerkung:<br />
Zeit wird noch bekannt gegeben<br />
H Anthropologisches Praktikum II:<br />
Forschungspraktikum<br />
Vorlesungen aus dem Wahlbereich Psychologie<br />
Kolloquien<br />
Do 16-18; ab 23.04.09, SR Hebelstr. 29<br />
PS Kulturpsychologie Di 10-12<br />
Engelbergerstr. 41/SR 2003<br />
AG Examenskurs Historische Anthropologie Do 14-16<br />
Wilhelmstr. 26/HS 00 016<br />
Bernett<br />
Wittwer-Backofen<br />
Wittwer-Backofen<br />
Linster, Lucius-Hoene<br />
Kommentar:<br />
Wie schon in den beiden vergangenen Semestern biete ich ein Kolloquium zur Examensvorbereitung in <strong>der</strong> Historischen Anthropologie an,<br />
in dem entstehende Magisterarbeiten sowie Themen <strong>der</strong> mündlichen Prüfung vorgestellt und diskutiert werden können.<br />
PH Grundprobleme <strong>der</strong> philosophischen<br />
Anthropologie und <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
Naturphilosophie<br />
Di 18-20<br />
KG I/HS 1023<br />
Kommentar:<br />
Das Kolloquium ist für Examenskandidaten und Promovierende gedacht, um ihre Arbeiten vorzustellen und gezielt in einem kleinen Kreis<br />
ausgewählte Texte und Probleme diskutieren zu können. Thematisiert werden u.a. Probleme zum Verhältnis von Körper und Geist, <strong>der</strong><br />
Begründung menschlicher Identität (u.a. im interkulturellen Kontext) und unterschiedlicher Konzeptionen von Metaphysik.<br />
Bemerkung:<br />
Theoretische Philosophie; Neuzeit/Mo<strong>der</strong>ne<br />
Kather<br />
31
Fachschaft Anthropologie<br />
Wir sind Studierende <strong>der</strong> Fächer Biologische und Historische<br />
Anthropologie und als u-Fachschaft vertreten wir eure Interessen an<br />
<strong>der</strong> Uni.<br />
Außerdem:<br />
• treffen wir uns einmal wöchentlich zum Anthro-Stammtisch zu<br />
dem ihr alle herzlich eingeladen seid<br />
• leisten wir Hilfestellung bei Referaten, Hausarbeiten, Literatursuche<br />
usw.<br />
• und beantworten eure Fragen zu Studienbedingungen und<br />
Studienordnung<br />
• stellen wir die Kopiervorlage des Rea<strong>der</strong>s „Historische<br />
Anthropologie – Basistexte“ zur Verfügung.<br />
• organisieren wir eine Anthropologen-Hütte für Euch<br />
Neuigkeiten und Infos bekommt ihr am schwarzen Brett im <strong>ZAG</strong><br />
und in unserem Fachschaftsraum in <strong>der</strong> Belfortstr. 24 (2. Stock<br />
im u-asta-Gebäude).<br />
Dort findet ihr auch:<br />
� unsere Sprechzeiten ab Semesterbeginn<br />
� die Liste für den email-Verteiler (wichtig für Infos,<br />
Termine, Aktuelles...tragt euch ein!)<br />
� Zeit und Ort unseres Stammtisches<br />
Email Fachschaft: fs-anthro.freiburg@gmx.net<br />
(Weitere Kontaktmöglichkeiten stehen auf <strong>der</strong> nächsten Seite)<br />
Viele Infos und Neuigkeiten findet ihr auf unserer Fachschaftsseite:<br />
http://www.zag.uni-freiburg.de/anthro/fs_anthro/fs.html<br />
Ansonsten wünschen wir Euch viel Spaß, auch im Studium! ;-)<br />
32
Christine<br />
Scheufele<br />
Daniel<br />
Möller<br />
Antonio<br />
Nogales<br />
Florian<br />
Kühnel<br />
Jan<br />
Constantin<br />
Maya<br />
Uramowicz<br />
Thomas<br />
Wittkamp<br />
Kerstin Pannhorst<br />
Christine Pusch<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Anglistik<br />
NF Germanistik<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Biologie<br />
NF Geschichte <strong>der</strong> Medizin<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Anglistik<br />
NF Soziologie<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Urgeschichtl. Archäologie<br />
NF Alte Geschichte<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Anglistik<br />
NF Ethnologie<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Frühgeschichtl. Archäologie<br />
NF Klassische Archäologie<br />
HF Historische Anthropologie<br />
HF Neuere u. Neuste Geschichte<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Germanistik<br />
NF Biologie<br />
HF Historische Anthropologie<br />
NF Ethnologie<br />
NF Romanistik (Spanisch)<br />
chrisfele@gmx.de<br />
0761/2148895<br />
daniel.moeller@unifreiburg.de<br />
0761/7048721<br />
nogales@uni-freiburg.de<br />
0761/4011855<br />
kuehnelf@yahoo.de<br />
0761/2852066<br />
blauer.kauz@gmx.net<br />
0761/2047197<br />
crossaway@web.de<br />
0761/7695394<br />
thomas.wittkamp@web.de<br />
0761/4013734<br />
koerschtin@gmx.de<br />
0761/1376804<br />
tinepusch@gmx.de<br />
0761/7049979<br />
33