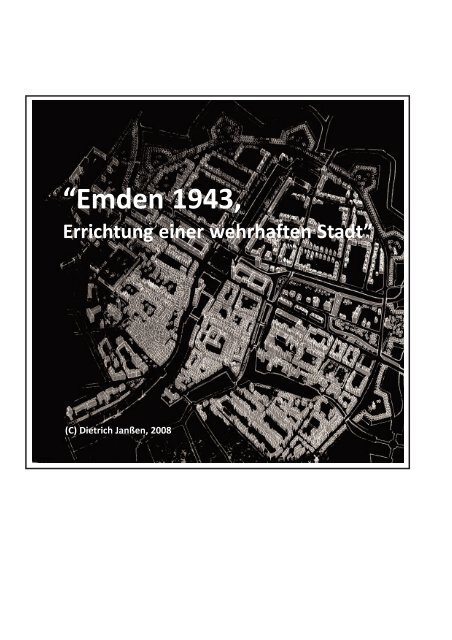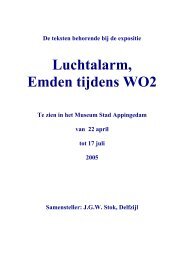Emden 1943, Errichtung einer wehrhaften Stadt
Emden 1943, Errichtung einer wehrhaften Stadt
Emden 1943, Errichtung einer wehrhaften Stadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
“<strong>Emden</strong> <strong>1943</strong>,<br />
<strong>Errichtung</strong> <strong>einer</strong> <strong>wehrhaften</strong> <strong>Stadt</strong>”<br />
(C) Dietrich Janßen, 2008
Vortrag gehalten am 3.12.2008, 19:00 Uhr, in der Kulturbrücke Ems-Delta e.V. in Verbindung mit dem Kulturbunker,<br />
Geibelstraße 30a, <strong>Emden</strong><br />
<strong>Emden</strong> <strong>1943</strong>, <strong>Errichtung</strong> <strong>einer</strong> <strong>wehrhaften</strong> <strong>Stadt</strong>,<br />
© Dietrich Janßen, 26721 <strong>Emden</strong>, eMail: bunkeremd@aol.com, überarbeitet 11.12.2008<br />
Im Rahmen m<strong>einer</strong> Arbeit im <strong>Stadt</strong>planungsamt der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> fiel mir eine isometrische Darstellung unserer <strong>Stadt</strong><br />
in die Hände, die mich in Erstaunen setzte. In den Kartenschränken waren keine weiteren Pläne oder in den Emder<br />
Archiven keine sonstigen Fotografien zu den Planungen vorhanden. In einigen Aktenstücken fand ich Hinweise,<br />
dass neben dem Plan aus dem Jahre 1942/43 von Dr. Hans-Friedrich Eschebach noch ein Modell im Bunker<br />
Emsmauerstraße und Detailpläne vorhanden waren, die Dr. Peter Diedrichs bei Vorträgen beim Gauleiter Paul<br />
Wegener zur <strong>Errichtung</strong> <strong>einer</strong> <strong>wehrhaften</strong> <strong>Stadt</strong> nach Bremen vorführte. Bis auf den einen Plan und der dazugehörende<br />
Schriftverkehr sind alle anderen Detailplanungen sowie das Modell nach dem 2. Weltkrieg vernichtet worden.<br />
Zu diesem Teil komme ich später.<br />
Dieser Vortrag befasst sich mit den Nahtstellen zwischen dem Bauen der 20er Jahre und 30er Jahre und der<br />
Architektur sowie des Städtebaues des NS-Regimes an ausgesuchten Emder Beispielen. Wesentlichen Einfluss hatten<br />
besonders die städtischen Architekten, die die städtebauliche Entwicklung besonders während der Kriegs- und<br />
Nachkriegszeit prägten. Ohne diese wäre die Planung <strong>einer</strong> <strong>wehrhaften</strong> <strong>Stadt</strong> nicht möglich gewesen und auch nicht<br />
die Zeit des Übergangs nach 1945 zum Städtebau der 50er Jahre. Das NS-System verpflichtete die Fachleute aus<br />
allen möglichen Regionen des Reiches und der besiegten Länder, zum größten Teil gegen ihren Willen, zu<br />
Erfüllungsgehilfen in den Büros und auf den Großbaustellen des Bunkerbaues.<br />
Im Jahre 1916 erhielt der freiberufliche Städteplaner Hermann Jansen aus Berlin vom<br />
Magistrat der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> den Auftrag zur Aufstellung eines Generalbebauungsplanes,<br />
den er am 20. September 1916 hier in <strong>Emden</strong> vorstellte. Neben der geplanten<br />
Umgehungsbahn um <strong>Emden</strong>, wurden auch Teilbebauungspläne für den Bereich Herrentor<br />
und Friesland sowie Planungen in Verbindung der Erweiterung der Emder Straßenbahn bis<br />
zur Kaserne und zum Neuen Binnenhafen aufgestellt. Auch beinhaltete der Generalbebauungsplan<br />
von Jansen eine Planung von neuen Straßen und wesentliche<br />
Straßendurchbrüche, auf die später der <strong>Stadt</strong>planer Dr. Eschebach zurückgriff. Der <strong>Stadt</strong>planer<br />
Hermann Jansen wurde am 28. Mai 1869 geboren und er verstarb am 20. Februar<br />
1945. Studiert hat dieser an der Technischen Hochschule in Aachen.<br />
In den zwanziger Jahren waren namhafte Architekten wie Walter Heim und bei der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Emden</strong> Walter Luckau tätig, die noch heute stehende expressionistische Bauten entwarfen<br />
und auch die Bauleitung führten. Walter Heim war unter anderen der Architekt der AOK, der<br />
Norder Bank und des Geschäftshauses Steffens inStädtebauplaner<br />
Architekt Walter Heim<br />
der Straße Zwischen beiden Sielen. Luckau entwarfHermann<br />
Jansen, Berlin<br />
die Brücke an der Boltentorstraße mit dem "Chinesentempel" nebst<br />
Straßenlaterne, die Herrentorschule, den Kiosk an der Nordertorstraße, die<br />
Anlagen Schwanenteich sowie den Burgplatz und war in der Bauberatung<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> tätig. Als Sachbearbeiter hatte er wesentlichen Einfluss auf<br />
die Architektur im <strong>Stadt</strong>bild, wie viele Korrekturen an Entwurfsplänen in den<br />
Bauakten belegen. Luckau war vom 1. August 1926<br />
- 3. März 1931in <strong>Emden</strong> tätig. Versuche, seinen weiteren<br />
Lebensweg ausfindig zu machen, haben kein<br />
Ergebnis ergeben. Sein letzter Wohnort war 1937<br />
Dortmund. Besonders eindrucksvoll ist ebenfalls die<br />
Umgestaltung der Schalterhalle der Sparkasse <strong>Emden</strong>, die von dem Architekten Karl<br />
Siebrecht aus Hannover entworfen wurde.<br />
Auch im Geschossbau wurden weitere Gebäude südlich der Ringstraße durch den<br />
Beamten-Bau- und Wohnungsverein errichtet, die von eigenen Architekten, wie Diedrich<br />
Janssen, entworfen wurden. Walter Luckau war auch hier korrigierend im Rahmen der<br />
Bauberatung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> tätig, so dass sich ein in sich geschlossenes Viertel entwickeln<br />
konnte, das auch heute noch immer eine hohe Wohnqualität besitzt. Der hier aufgeführte<br />
Diedrich Janssen war neben Franz Latta der Architekt des "Neptunhauses", welches<br />
in diesem Jahr abgebrochen wurde.<br />
Unmittelbar nach der "Machtübernahme" erfolgte keine Übernahme der Kompetenzbereiche<br />
der Baubehörden. Die eigentliche Planungshoheit verblieb nach wie vor bei der zustän-<br />
Student Walter Luckau<br />
1921 an der TU Dresden<br />
digen Gemeinde, wie auch die Zuständigkeit der Baupolizei bei Baugenehmigungen vorerst uneingeschränkt beibehalten<br />
wurde. Allein die personelle Besetzung dieser Dienststellen erfuhr - wie überall - einen Austausch, der im<br />
Zuge der Verfolgung und Ausschaltung oppositioneller Kräfte seine Erklärung und politische Motivation fand (juristische<br />
Handhabe: "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" - Ausschaltung progressiver Architekten,<br />
2
d. h. der Anhänger des "Neuen Bauens"). In <strong>Emden</strong> wurde der <strong>Stadt</strong>baurat Hassis aufgrund des vorgenannten<br />
Gesetzes vom 7. April 1933 aus dem Dienst entlassen, weil er nach s<strong>einer</strong> bisherigen poltischen Betätigung nicht<br />
die Gewähr dafür bot, dass er rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten werde.<br />
Das "Dritte Reich" versuchte nach 1933, sich nicht nur der Kleinsiedlungsbewegung zu bemächtigen, sondern auch<br />
des ganz alltäglichen genossenschaftlichen Wohnungsbaues. Hier insbesondere durch die "Neue Heimat", die im<br />
Wesentlichen Geschosswohnungen für Unteroffiziere errichtete, die ihren<br />
Dienst in der inzwischen erweiterten Kasernenanlage an der Admiral-<br />
Scheer-Straße verrichteten. Auch an der Nordermeedenstraße wurden<br />
im ersten Bauabschnitt 100 Volkswohnungen durch die<br />
NS.Volkswohlfahrt und Wohnungshilfe in sehr schlichter Bauweise<br />
errichtet, um Arbeiter am <strong>Stadt</strong>rand von Wolthusen unterzubringen. Nach<br />
einem Bericht von Oberbürgermeister Carl Renken an den Gauleiter Carl<br />
Röver vom 1. Januar 1942 fehlten vor dem Kriegsbeginn in <strong>Emden</strong> 5.000<br />
Wohnungen, davon 1.000 allein für den dringenden Bedarf.<br />
Volkswohnungen am Nordermeedenweg<br />
Eine weitere Kolonie für kinderreiche Arbeiterfamilien entstand als<br />
Kleinsiedlung am Conrebbersweg. Dort wurden bis 1938 als<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 54 Doppel- und 61 Einzelhäuser in bodenständiger Bauweise auf Grundstücken mit<br />
<strong>einer</strong> jeweiligen Gartenfläche von 1.500 m² errichtet, um dort einen kleinen Nebenerwerb zu ermöglichen. Auf<br />
schwerem Kleiboden entstand die neue Kolonie, um der Bevölkerungspolitik des Führers Adolf Hitler zu dienen.<br />
“Schwer und hart wie der Bau des Dritten Reiches sollte der Aufbau der neuen Siedlung sein, die von nun ab eigene<br />
Scholle sein sollte für viele Familien. Mit Schweiß sollte der Boden gedüngt werden, aber in der Zukunft wird er<br />
einst reiche Früchte tragen. Der frische Wind, der hier<br />
über die Felder weht, wird keine internationalen<br />
Gedanken aufkommen lassen.” Hier sollte der Mensch<br />
wieder den tiefen reinen Segen der Verbundenheit zwischen<br />
Blut und Boden kennen und erleben lernen. Der<br />
Architekt Hans Niederstraßer und das Hochbauamt<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> entwarfen einfache Doppel- und<br />
Einzelziegelhäuschen mit Satteldächern und<br />
Stallanbauten nach dem Reichssiedlungsgesetz von 1919. Der Erschließungsaufwand war möglichst gering zu halten,<br />
so dass vorerst keine festen Straßen angelegt wurden.<br />
Auch im privaten Einfamilienhausbau wurde in besonderen Wohnbereichen im Rahmen des Arbeitsbeschaffungsprogrammes<br />
unauffällig für privilegierte Bevölkerungsschichten Wohnraum geschaffen. Der hierarchische<br />
Bevölkerungsaufbau (Gefolgschafts-Führer) war im "Dritten Reich" allgegenwärtig. Trotzdem sollte sich jeder als<br />
"Volksgenosse" in der "Volksgemeinschaft" fühlen. Die Klassenunterschiede waren zwar offiziell abgeschafft, nicht<br />
aber der von den Nationalsozialisten gewünschte organische Bevölkerungsaufbau mit Rangunterschieden. So entstanden<br />
an der Auricher Straße gegenüber den Wohnblocks des Beamten-Bau- und Wohnungsvereins einige villenartige,<br />
zweigeschossige Wohngebäude auf großen Grund-stücken entlang des Hinter Tiefs, in der Douwestraße, am<br />
Treckfahrtstief und am Bolardusfriedhof. Die Entwerfer bedienten<br />
sich noch der traditionellen Formensprache der 20ger<br />
Jahre, jedoch traten hier werksteinumrandete Öffnungen, steile<br />
Walmdächer und großzügige, zentrale Freitreppen in den<br />
Vordergrund.<br />
In der Zeit bis 1939 wurde neben den Erweiterungsanlagen<br />
der Kaserne das neue Postamt an der Cirksenastraße, das<br />
Bahnhofsgebäude <strong>Emden</strong>-West, das Bürogebäude der<br />
Industrie- und Handelskammer und das Wöchnerinnenheim an<br />
der Ringstraße errichtet. Das neue Postamt weist alle<br />
Merkmale des offiziellen "monumentalen und richtungsweisen-<br />
den" Stils des neuen Reiches durch seine deutliche Betonung<br />
des horizontalen unteren Baukörpers auf. Die Gliederungselemente<br />
wurden auf wenige Formen beschränkt. Lediglich die<br />
Fenster im Erdgeschoss sollen durch die angeschrägten<br />
Leibungen dickes Mauerwerk vorspielen. Der zentrale<br />
Eingangsbereich erhielt einen aus Naturstein gefertigten<br />
Hoheitsadler mit angelegten Flügeln und auf dem Gebäude<br />
befand sich ein 6,0 m hoher Fahnenmast, der an bewährte traditionelle<br />
Darstellung der Herrschersymbolik anknüpft und die<br />
imperiale Macht des NS-Staates verkörpern soll. Diese<br />
Formensprache gilt auch für den 1936 erbauten Bahnhof<br />
<strong>Emden</strong>-West, der jedoch über eine zweigeschossige<br />
Doppelhäuser am Westerweg, erbaut 1935, Architekt Hans<br />
Niederstraßer<br />
Das neue Postamt an der Cirksenastraße, erbaut 1935<br />
Bahnhof <strong>Emden</strong>-West 1936<br />
Wartehalle verfügte, die von den umlaufenden Fenstern im zurückliegenden Geschoss belichtet wurde. Während<br />
beim Postamt auf breite Abschlussgesimse verzichtet wurde, erhielt der neue Bahnhof profilierte weiße Gesimse<br />
3
und der zentrale Eingangsbereich zu dessen Betonung breite gemauerte Pfeilervorlagen und ein vorkragendes<br />
Abschlussgesims.<br />
Während das hier ebenfalls abgebildete Finanzamt noch die Formensprache der expressionistischen Baukunst verkörpert,<br />
wurde das von dem Architekten Karl Siebrecht 1938 entworfene Gebäude der IHK bereits der neuen<br />
Formensprache des "Dritten Reiches" angepasst. Der Baukörper<br />
wurde von der öffentlichen Verkehrsfläche abgerückt, um Platz zu<br />
schaffen für eine breite Treppenanlage, die zum zurückliegenden<br />
Eingangsbereich führt. Zwei Natursteinsäulen mit Schmuckelementen<br />
tragen die drei Rundbögen in der Eingangsfront. Die Reihung der<br />
Hochrechteckfenster im Obergeschoss verleiht dem Gebäude einen<br />
soldatischen, nordischen Charakter. Über dem Gebäude erhebt sich<br />
ein steiles Walmdach mit aufgesetztem Dacherker nebst Uhr, die<br />
den Betrachter daran erinnern soll, in welcher heroischen Zeit er<br />
lebt.<br />
Ringstraße, Industrie- und Handelskammer, 1938<br />
Es ist auch für <strong>Emden</strong> wie im übrigen Reich auffallend, dass bis 1936<br />
fast keine öffentlichen Bauten erstellt wurden. Bis dahin dominierte<br />
als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Wohnungsbau, der zugunsten öffentlicher Großbauvorhaben zurückgedrängt<br />
wurde. In dieser Zeit stieg der Anteil der öffentlichen Bauten (u.a Verwaltungsbauten des Staates bzw. der<br />
Partei, Kultbauten, Kasernen) auf 70%, während der Wohnungsbau nur noch zu 20% beteiligt war, wuchs bis 1939<br />
der Prozentsatz der öffentlichen Bauten auf 90% an. Auch die Planung <strong>einer</strong> Sanierung der Altstadt durch die<br />
Deutsche Arbeitsfront (DAF) kam nicht voran, weil die öffentlichen Gelder dafür fehlten.<br />
Mit dem Angriff deutscher Truppen am 1. September 1939 auf Polen endete schlagartig auch in <strong>Emden</strong> jede<br />
Bautätigkeit, die nicht militärischen Charakter hatte. Im Bereich des Zivilschutzes wurden die notwendigen<br />
Maßnahmen zur Schaffung öffentlicher Schutzräume im gewissen Umfang vorgenommen. Bei Kriegsbeginn standen<br />
70 öffentliche Luftschutzräume lt. <strong>einer</strong> Bekanntmachung vom<br />
1. September 1939 den Einwohnern zur Verfügung. Darüberhinaus<br />
mussten Anträge zur Absteifung von Keller etc. zu Luftschutzzwecken<br />
bei der Baubehörde gestellt werden, um die notwendigen<br />
Baumaterialien zu erhalten. Der Reichsluftschutz-bund<br />
war beratend tätig.<br />
Nach den ersten vereinzelten Bombenangriffen auf das<br />
Reichsgebiet und hier insbesondere nach dem ersten geschlossen<br />
Bombenangriff in der Nacht vom 25. auf den 26. August 1940<br />
auf Berlin ordnete Adolf Hitler am 10. Oktober 1940 das<br />
"Sofortprogramm" für das Luftschutzwesen an. Bunker gegen<br />
Eine seltene Innenaufnahme: Rathaussaal mit obligatorischem<br />
Führerbild und Fahnenschmuck<br />
Bomben, ein Programm, das unser <strong>Stadt</strong>bild grundlegend verändern<br />
sollte. Kurze Zeit später erschien am 15. November 1940 ein<br />
Erlass zur Vorbereitung des Wohnungsbaues nach dem Kriege,<br />
mit dem sich das Amt für Wiederaufbau und Planung in <strong>Emden</strong> beschäftigte. <strong>Emden</strong> wurde das erste Mal am 13.<br />
Juli 1940 angegriffen und die Bombenschäden beseitigt.<br />
Im Bereich der <strong>Stadt</strong>planung nahm Dr. Wilhelm Ohm am 1. August 1939 seinen Dienst auf. Er wurde kurz darauf zur<br />
Wehrmacht eingezogen und am 12. Juni 1940 dienstverpflichtet nach <strong>Emden</strong> versetzt und ab dem 1. Oktober 1941<br />
beurlaubt. Leider gibt es keine Fotografie von Dr. Ohm, sondern in den Akten fand sich nur eine als “Geheim” eingestufte<br />
Dienstanweisung vom 29. Oktober 1940.<br />
Carl Renken, geboren am 31. März 1893, gestorben am 12. November 1954, war <strong>Emden</strong>s Oberbürgermeister von<br />
20. Juli 1937 - 10. Mai 1945. Vorher, ab 1933 war er Oberbürgermeister von Wilhelmshaven.<br />
Dr. Peter Diedrichs, geboren am 2. September 1904, gestorben am 12. September 1985, wurde bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong><br />
Oberbürgermeister Carl Renken<br />
Dr. Peter Diedrichs<br />
4<br />
Städt. Baurat Alfred Langeheine<br />
Dr. Hans-Friedrich Eschebach,<br />
1942
dienstverpflichtet am 1. Mai 1941 im Luftschutzbauamt, <strong>Stadt</strong>baurat seit dem 15. Oktober 1942, ausgeschieden im<br />
April 1968.<br />
Alfred Langeheine, geboren am 12. August 1907, gestorben am 17. April 2001, wurde dienstverpflichtet im<br />
Luftschutzbauamt am 1. April 1941, ausgeschieden am 12. August 1972.<br />
Dr. Hans-Friedrich Eschebach, geboren am 24. April 1909, gestorben am 10. April 1982, wurde dienstverpflichtet<br />
vom Reichsminister des Inneren Frick am 20. September 1942 zum Emder Leiter des Amtes für Wiederaufbau<br />
ernannt, am 20. Dezember <strong>1943</strong> als Zeichner zum SS-Baubataillon in Krakau einberufen.<br />
Es begann im Emder Luftschutzbauamt nach dem Soforterlass eine fieberhafte Planungstätigkeit und die<br />
Ausschreibung der Bunkerbauten der 1. Welle. In der Ratsherrensitzung am 07. November 1940 unterrichtete Karl<br />
Renken die Ratsherren vertraulich über das beabsichtigte<br />
Bunkerbauprogramm. Der Oberbürgermeister äußerte: "In<br />
Rücksicht auf die besondere Vertraulichkeit der Angelegenheit<br />
könne er weitere Ausführungen nicht machen." Die erste<br />
Baustelle für den Krankenhausbunker richtete das neu gegründete<br />
Luftschutzbauamt <strong>Emden</strong> unter der Leitung des<br />
<strong>Stadt</strong>oberbaurats Dr. Dr. Wilhelm Ohm am 22. November 1940<br />
ein. Bis der erste Bunker in der Lienbahnstraße am 27. Juni 1941<br />
fertiggestellt war, flogen die englischen Bomber 28 Angriffe auf<br />
die <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong>, bei denen insgesamt 33 Tote und 73 Verletzte<br />
zu beklagen waren.<br />
Dass in <strong>Emden</strong> mehr als die ersten neun Bunker der ersten Welle<br />
errichtet wurden, ist dem energisch auftretenden Oberbürgermeister<br />
Renken zu verdanken, der persönlich gute Kontakte zu<br />
dem Gauleiter Carl Röver besaß. Dieser wieder besaß persönliche Beziehungen zum Propagandaminister<br />
Goebbels. Renken äußerte in der Ratsherrensitzung am 18. Dezember 1941: "Die Bevölkerung sei heroisch in der<br />
Haltung, aber auch die eingesetzten Männer erfüllen alle ihre Pflicht. Das müsse dankbar zum Ausdruck gebracht<br />
werden". Weiter führt der Oberbürgermeister Renken aus, dass er einen Aufruf zum Weihnachtsfest herausgegeben<br />
habe, der jetzt dem Kreisleiter noch vorliege. Er wolle in diesem Aufruf seinen<br />
Dank an die Bevölkerung zum Ausdruck bringen. Auch von den höchsten<br />
Reichsbehörden in Berlin werde die fabelhafte Haltung der Emder<br />
Bevölkerung bestätigt, denn Reichsminister Goebbels habe ihn in den letzten<br />
Tagen fragen lassen, ob er aufgrund der neueren Angriffe noch nach<br />
<strong>Emden</strong> kommen solle. Also, in Berlin erkenne man die Lage der <strong>Stadt</strong> an,<br />
und gerade das Propagandaministerium wisse genau Bescheid über die<br />
Emder Verhältnisse.<br />
Seit Beginn der Zerstörungen ist der Wiederaufbau dauernd im Gange.<br />
Materialschwierigkeiten bestanden eigentlich nicht, jedoch noch immer ein<br />
erheblicher Mangel an Facharbeitern. Durch das Arbeitsamt wurden den<br />
Baufirmen in der Hauptsache holländische Facharbeiter zugewiesen. Den<br />
wesentlichen Anteil am Wiederaufbau leisteten die örtlichen Handwerker<br />
sowie die aus der weiteren Umgebung von <strong>Emden</strong> dienstverpflichteten<br />
Handwerker, die zum großen Teil aus Hildesheim kamen. Um bis zum<br />
Herbst 1942 die Teilbeseitigung von Schäden vornehmen zu können, sind<br />
Bunkerbaustelle Krankenhaus Am Burggraben April<br />
1941<br />
Große Brückstraße Mai 1941<br />
mindestens 200 Maurer, 100 Zimmerer und 100 Hilfsarbeiter notwendig. Weitere 280 Bauhandwerker sind für die<br />
angefangenen Bauten der "Neuen Heimat" nach <strong>Emden</strong> zu dirigieren.<br />
In der Hauptsache wurde jedoch der fortlaufende Wiederaufbau verzögert durch die in<br />
mehr oder weniger kurzen Zeitabständen wiederkehrenden Bombenangriffen. Es gab, wie<br />
auch aus dem hier gezeigten Plan ersichtlich, Häuser und Häusergruppen, die schon zum<br />
zweiten oder dritten Mal oder noch öfter wieder instandgesetzt und wieder zerstört wurden.<br />
Nach den Bombenangriffen wurde sofort am anderen Tage mit zunächst provisorischen<br />
Instandsetzungen von Häusern oder deren völligen Beseitigung begonnen, wobei in der<br />
Hauptsache Kriegsgefangene, Emder Handwerker aber auch Soldaten der Kriegsmarine<br />
herangezogen wurden.<br />
Am 27. Juli 1942 berichtete der Oberbürgermeister Renken an die Gauleitung Weser-Ems<br />
in Oldenburg, dass 1.220 Wohnungen total zerstört, 2.050 sind beschädigt und davon 350<br />
wieder hergestellt worden.<br />
Daneben lief der Bunkerbau, für den insgesamt 1.300 Handwerker eingesetzt wurden. Im<br />
Luftschutzbauamt lief das Bunkerbauprogramm auf Hochtouren. Es wurden besondere<br />
Grundstücke ausgesucht, die städtebaulich bedeutsam und im Übrigen von der<br />
Bevölkerung schnell erreichbar waren. Insbesondere griff die Baubehörde auf Grundstücke<br />
zurück, deren Häuser inzwischen zerstört waren oder diese wurden nach dem Reichsleistungsgesetz enteignet.<br />
Für den Bunkerbau wurden bereits am 11. November 1940 die technischen Einzelheiten festgelegt, die in <strong>einer</strong><br />
Anweisung für den Bau bombensicherer Luftschutzräume niedergeschrieben wurden. Die Bauverwaltungen wurden<br />
5<br />
Zwischen beiden Sielen,<br />
1942
im Dezember 1940 vom Reichsarbeitsministerium mit vom Oberregierungsrat Nicolaus entworfenen Typenplänen<br />
versorgt, nach denen die Bunker errichtet werden sollten. Auch der Tessenow-Schüler Alexander Herde im<br />
Reichsarbeitsministerium (RAM) beschäftigte sich in Berlin<br />
mit der gestalterischen Aufgabe, Luftschutzbunker städtebaulich<br />
einzubinden. Alexander Herde schrieb seine Doktorarbeit<br />
1941 über den Luftschutzbunker im Wohngebiet, seine<br />
Grundrissgestaltung und städtebauliche Einordnung. Heinrich<br />
Tessenow lehrte in Berlin an der Technischen Hochschule<br />
Berlin von 1926 - 1941. Albert Speer war sein Assistent.<br />
Die Planung der Hochbunker im Emder <strong>Stadt</strong>gebiet sollten<br />
den <strong>wehrhaften</strong> Willen <strong>einer</strong> verbunkerten <strong>Stadt</strong> nach außen<br />
zeigen, da für die Nationalsozialisten der Luftschutz einen Teil<br />
der militärischen Reichsverteidigung darstellte. Dieses wird<br />
Entwurf Dr. Alexander Herde, 1941<br />
besonders an dem LS-Bunker beim Gymnasium (Thiele-Tee<br />
Bunker) sichtbar, der wie der Oberbürgermeister am 18.<br />
Dezember 1941 in <strong>einer</strong> Sitzung berichtete, einen schönen Anblick bei der Einfahrt in die <strong>Stadt</strong> geben werde. Es sollte<br />
noch ein 60 m hoher Bunkerturm errichtet werden, von dem ein schöner Blick über die <strong>Stadt</strong> möglich sein werde.<br />
Nach dem Kriege sollte dort ein Glockenspiel hineinkommen. Die Entwürfe zum Bunkerbau wurden im Wesentlichen<br />
von Alfred Langeheine, während die Gründungen und später auch die Flachgründung mit Spundwänden, wie z.B.<br />
für diesen LS-Bunker, von Dr. Peter Diedrichs ausgeführt wurden.<br />
Auch der LS-Bunker An der Bonnesse, der noch unter dem<br />
<strong>Stadt</strong>baurat Dr. Ohm entworfen wurde, sollte den<br />
Wehrcharakter zum Ausdruck bringen. Die Hochbunker sollten<br />
nach Meinung der Planer "nicht als Fremdkörper wirken,<br />
sondern viel mehr in Harmonie, mit ihrer Umgebung die Kraft<br />
und Stärke des deutschen Volkes in s<strong>einer</strong> Gesamtheit zum<br />
Ausdruck bringen."<br />
Aus diesem Grunde gab der Oberbürgermeister Renken dem<br />
Bremer Kunstprofessor Willy Menz Ende 1942 den Auftrag zur<br />
Schaffung von <strong>wehrhaften</strong> Kunstwerken zur Ausschmückung<br />
von städtischen Diensträumen, da viele der dort vorhandenen<br />
Bilder verloren gegangen waren. Willy Menz, geboren am 16.<br />
Februar 1890, gestorben am 10. Februar 1969, hat u.a. auch<br />
Ein wehrhaftes Kunstwerk von Willy Menz, <strong>1943</strong><br />
in Bremen, Bunkerbau auf dem Domshof 1941 Öl auf<br />
Leinwand, gemalt.<br />
Desweiteren einige Bilder und Pläne zum Bunker <strong>Stadt</strong>garten, der in der <strong>Stadt</strong>planung von Dr. Hans-Friedrich<br />
Eschebach an zentraler Stelle gegenüber dem Parteihaus und dem Forum im <strong>Stadt</strong>gebiet stehen sollte.<br />
Ein besonderer LS-Bunker, der nicht ausgeführt wurde, plante Alfred Langeheine auf dem Grundstück der<br />
<strong>Stadt</strong>werke <strong>Emden</strong> an der späteren Friedrich-Ebert-Straße. Ein<br />
wahrhaft wehrhaftes Gebilde für 1.600 Schutzplätze. Die Planung<br />
begann am 23. August 1941 und wurde am 5. Februar 1942 vorläufig<br />
durch Erlass des Reichsministers Dr.-Ing. Todt zurückgestellt, da<br />
die Bauzeit zu lange dauert und der hohe Turm als<br />
Markierungspunkt für Bombenflugzeuge gelten konnte.<br />
Andere Planungen hatten nicht diese Größenordnung, sondern die<br />
LS Bunker ragten, wie zum Beispiel die LS-Bunker Boltentorstraße<br />
oder Lienbahnstraße, nicht über die vorhandene Bebauung hinaus.<br />
Trotzdem hatten diese aufgrund der geschlossenen Wände einen<br />
<strong>wehrhaften</strong> Charakter.<br />
Dieses gilt auch für den LS-Bunker Bahnhof <strong>Emden</strong>-Süd, dessen<br />
massive Kantenstruktur (Eckquaderung) an den Seiten, sein blockhafter<br />
Charakter und dessen schmales Gesims schließt ein steiles<br />
Walmdach den Baukörper nach oben ab. Auf der an sich schmuck-<br />
Ausschnitt aus der Bauzeichnung für den LS-Bunker<br />
Bahnhof <strong>Emden</strong>-Süd, Entwurf Alfred Langeheine<br />
vom 27. August 1942<br />
losen Oberfläche wurde am Eingangsbauwerk nur die Anbringung<br />
des Hoheitsadlers erlaubt. Nach dem Endsieg sollten die Emder<br />
Luftschutzbunker verblendet und entsprechend den Forderungen<br />
nach Bodenständigkeit, Schlichtheit, Dauerhaftigkeit, Größe und<br />
Macht sowie nach der Versinnbildlichung der "unerschütterlichen Kraft und Wehrhaftigkeit der nationalsozialistischer<br />
Weltanschauung" über Jahrhunderte hinweg das "Dritte, tausendjährige Reich" symbolisieren.<br />
Am 26. August 1942 war in <strong>Emden</strong> der Reichsminister für Bewaffnung und Munition Albert Speer, der sich vom<br />
Kreisleiter Bernhard Horstmann, dem Oberbürgermeister Karl Renken und dem städtischen Baurat Dr. Peter<br />
Diedrichs über den Fortschritt des Bunkerbaues, der <strong>Stadt</strong>planung im Allgemeinen und über die weiteren<br />
6
Zerstörungen der <strong>Stadt</strong> unterrichten ließ. Hierbei wurden besonders die Fragen des Wiederaufbaues und die<br />
Weiterführung der <strong>Stadt</strong>planung besprochen, die zum Erliegen gekommen sei. In anderen Städten wurde jedoch,<br />
wie Kreisleiter Horstmann anmerkte, weitergeplant. So könne es in <strong>Emden</strong> aufgrund der Zerstörungen nicht weiter<br />
gehen. Zur Frage der Planung erklärte Reichsminister Speer, "dass es selbstverständlich sei, dass <strong>Emden</strong> planen<br />
müsse. Der Oberbaurat Ohm sei dem Reichsminister bekannt. Der Gauleiter solle durch schriftlichen Antrag beim<br />
Reichsminister Speer die Genehmigung zur Vergebung der <strong>Stadt</strong>planung einholen." Im Anschluss der Sitzung fand<br />
eine Fahrt durch die Trümmerstätten statt. Auch besichtige Albert Speer die<br />
Nordseewerke.<br />
Am 20. September 1942, einen Monat nach dem Gespräch mit Albert Speer, wurde Dr.<br />
Hans-Friedrich Eschebach von Dresden nach <strong>Emden</strong> durch den Reichsminister des<br />
Inneren dienstverpflichtet, um sich in erster Linie um die Fliegerschäden, die Herstellung<br />
von Notunterkünften und den Wiederaufbau zu kümmern.<br />
Wie aus einem Aktenvermerk des städtischen Baurates Dr. Peter Diedrichs vom 6.<br />
November 1946 ersichtlich ist, "gelang es ihm, unter schwierigsten Verhältnissen ein<br />
<strong>Stadt</strong>planungsamt mit Hilfe von ausländischen Angestellten und französischen<br />
Kriegsgefangenen ins Leben zu rufen. Unter s<strong>einer</strong> Leitung wurden die Voruntersuchungen<br />
für eine Neuplanung des <strong>Stadt</strong>gebietes <strong>Emden</strong> durchgeführt, die die Grundlage für<br />
die Neuplanung darstellten. Auch auf dem Gebiete der Wirtschafts- und Verkehrsplanung<br />
war er tätig. Bei der städtebaulichen Einordnung der Luftschutzbunker wirkte er beratend<br />
mit und veranlasste die zeichnerische Inventarisierung des historisch wertvollen<br />
Baubestandes der Altstadt von <strong>Emden</strong>.<br />
Der Gedanke der Planung beinhaltete die politische und weltanschauliche Forderung des<br />
nationalsozialistischen Staates an den Wiederaufbau <strong>einer</strong> <strong>Stadt</strong> mit einem <strong>wehrhaften</strong> Gepräge, das durch die<br />
Bunkerturmbauten an markanter Stelle geschaffen werden sollte. Dabei ist es ganz klar, dass die<br />
Gemeinschaftsbauten die bevorzugte Stellung im <strong>Stadt</strong>gebiet erhalten sollen. Hierbei sind die Lehren des luftschutzmässigen<br />
Verhaltens bei feindlichen Fliegerangriffen zu beachten und eine Auflockerung der Bebauung muss jetzt<br />
beibehalten werden. Eine dichte Bebauung, wie in der Altstadt wird es in der neuen <strong>Stadt</strong> nicht mehr geben. Wo noch<br />
keine Zerstörungen vorliegen, ist eine Sanierung des <strong>Stadt</strong>bereiches geboten.<br />
Bei der gewählten Anordnung der LS-Bauten, als Torplätze an Kreuzungen oder den Einfallstraßen, wird der<br />
7<br />
Dr. Hans-Friedrich Eschebach<br />
1944
Gedanke der festen <strong>Stadt</strong> stilisiert. Hinzu kommt die Planung <strong>einer</strong> Ost-West-Achse, die bei dem LSB Wolthusen<br />
begann und die fast geradlinig beim LSB Bahnhof <strong>Emden</strong>-West endete. Dazu sollte eine neue Straße durch den<br />
Wall hindurchgeführt werden und zwar in der Höhe der Osterstraße (unterhalb des Doeletiefs). Dann weiter durch<br />
die Osterstraße mit einem 30 Meter breiten Straßendurchbruch<br />
durch die Bebauung bis zur Straße Zwischen beiden Sielen. Von dort<br />
durch die Bismarckstraße über die Pottebacker Straße gerader Linie<br />
zum LS-Bunker Bahnhof <strong>Emden</strong>-West.<br />
Nordöstlich des "Karl-Röver-Bunkers" (LS-Bunker <strong>Stadt</strong>garten),<br />
benannt nach dem 1942 verstorbenen Gauleiter Weser-Ems, sollte<br />
der <strong>Stadt</strong>garten als Verlängerung des Ratsdelftes ausgegraben und<br />
daran anschließend das Forum als Aufmarschplatz der NS-<br />
Formationen für die Totenehrungen nach dem ‚Endsieg' beginnen.<br />
Der Aufmarschplatz sollte eine Größe von 80 mal 60 Meter erhalten,<br />
um etwa 1.000 - 2.000 Mann in Formationen aufmarschieren zu lassen.<br />
Oberhalb des Platzes, durch den Alten Graben getrennt, die<br />
Totenehren- und Feierhalle, auf der linken und rechten Seite<br />
‚Monumentalbauten' mit Glockenturm, dem dreigeschossigen<br />
Dienstgebäude der NSDAP. Des Weiteren sollten die Aufmarschstraßen<br />
für die Parteiformationen und die Wehrmacht als Ringstraße<br />
durch die Wilhelmstraße bis zum Wall und von dort zurück über die<br />
Straße Am Hinter Tief zum Forum führen. Baumalleen entlang der<br />
Wilhelmstraße und des Hinter Tiefs sollten den Grünzug Wall zum<br />
neuen <strong>Stadt</strong>mittelpunkt, dem NS-Parteihaus führen. Zu beiden<br />
Seiten der Wilhelmstraße und der Straße Am Hinter Tief sollte das<br />
Das geplante Forum, rechts das Parteihaus, links<br />
unten der “Karl-Röver-Bunker”<br />
durch eine Brücke zum Schreyers Hoek vorgesehen. Dort war auf<br />
deren Spitze ein Restaurant mit kleinem Forum nebst Brunnen geplant.<br />
Mit dem Erlass Hitlers über die Vorbereitung des Wiederaufbaues bombengeschädigter<br />
Städte vom 11. Oktober <strong>1943</strong> und der Einrichtung des<br />
Arbeitsstabes Speer sollte die Wiederaufbauplanung zerstörter Städte<br />
umgesetzt werden. Am 17. Januar 1944 besprach der Gauleiter Paul<br />
Wegener und Oberbaurat Wilhelm Wortmann die Wiederaufbauplanungen<br />
mit den Oberbürgermeistern der Städte Bremen, <strong>Emden</strong> und<br />
Wilhelmshaven. Speer erklärte in einem persönlichen Schreiben am<br />
25. Februar 1944 an den Gauleiter Wegener Bremen, Wilhelmshaven<br />
und <strong>Emden</strong> aufgrund der schweren Fliegerschäden zur Wiederaufbaustadt<br />
und er schlug für die Ausführung der planerischen Arbeiten für<br />
<strong>Emden</strong> den <strong>Stadt</strong>baurat Dr. Ohm vor. Den Städten sei es freigestellt,<br />
eigene Architekten zu verpflichten. Als seinen Referenten und Berater<br />
für die genannten Städte benannte Speer den Architekten Ministerialrat<br />
Klaje, Berlin. Der Regierungspräsident Aurich berichtete am 30. März<br />
neue Geschäftszentrum der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> angesiedelt werden. Die<br />
Herausnahme des Kraftfahrzeugver-kehrs aus der Faldernstraße /<br />
Kettenbrücke war<br />
Planung Schreyers Hoek<br />
1944, dass "die Wiederaufbauplanungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong> soweit fortschritten seien, dass sie dem Herrn<br />
Reichsminister Speer vorgelegt werden könnten." Eine Zuweisung von technischen Dienstkräften sei nicht mehr<br />
nötig.<br />
Am 10. Mai 1944 besichtigte der Gauleiter Paul Wegener in Bremen das <strong>Stadt</strong>modell, einmal Zustand 1939 und das<br />
Neugestaltungsmodell von Dr. Eschebach. Dr. Diedrichs hielt darüber einen kurzen Vortrag über die Neuplanung der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong>. Der Gauleiter bemerkte u.a. kritisch, dass er die Planung für <strong>Emden</strong> grundsätzlich als zu weitgehend<br />
Beispielplanung Hamm 1942 Beispielplanung Hamm 1944<br />
8
und zu großzügig halte. "In der nicht unterbrochenen Ost-West-Straße würde der Wind bei <strong>einer</strong> Straßenbreite von<br />
25 m und <strong>einer</strong> Straßenlänge von 1,6 km störend wirken." Auch der vom Reichsminister Albert Speer eingesetzte<br />
Architekt Klaje, dem die Planung am 16. Mai 1944 in der Berlin vorgestellt wurde, hielt die Planung als zu großzügig<br />
und <strong>einer</strong> Gauhauptstadt angemessen. Die Planung sei, so <strong>Stadt</strong>baurat Diedrichs, auf eine Einwohnerzahl von<br />
200.000 ausgelegt worden. Nach <strong>einer</strong> Prüfung der Planung hatte der Gauleiter Wegener entschieden, so der<br />
Regierungspräsident Aurich in einem Schreiben vom 25. Mai 1944 an den Reichsminister des Inneren, dass noch<br />
einige Änderungen und Ergänzungen an dem Entwurf der "Neuen <strong>Stadt</strong>" vorgenommen werden müssten.<br />
Der Oberbaurat Wilhelm Wortmann, der als Planer in Wilhelmshaven bereits länger tätig war, schrieb am 1. Juni<br />
1944 an die <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong>, dass der Gauleiter ihn am 20. Mai 1944 mit der Wiederaufbauplanung für <strong>Emden</strong> beauftragt<br />
hätte, um die notwendigen Umplanungen einzuleiten. Am 23. August 1944 bestätigte der Reichsminister Albert<br />
Speer die Einsetzung des Oberbaurates Wortmann als verantwortlicher Architekt für die vorläufige städtebauliche<br />
Wiederaufbauplanung der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong>. Einen Tag später schrieb der Oberbürgermeister Renken an den Planer<br />
Wortmann, dass die Planungen infolge des totalen Kriegseinsatzes eingestellt werden müssten. Der <strong>Stadt</strong>baurat<br />
Diedrichs sei bereits bei der Organisation Todt zum Einsatz gekommen.<br />
Dieses galt ebenso für Alfred Langeheine, der bereits am 27. März <strong>1943</strong> als Kanonier zur Wehrmacht und für Dr.<br />
Hans-Friedrich Eschebach, der am 20. Dezember <strong>1943</strong> zum 2. SS-Pionier-Ausbildungs-Batl. 3 in Krakau einberufen<br />
wurde. Danach war er als Zeichner in einem Baubataillon der Waffen-SS nach Ohrdruf versetzt worden. Dr.<br />
Eschebach war während s<strong>einer</strong> Dienstzeit in <strong>Emden</strong> mit dem französischen Architekten Henry Gelee befreundet,<br />
dem er sehr oft Lebensmittel etc. zukommen ließ. Aus diesem Grunde wurde er von einem städtischen Mitarbeiter<br />
denunziert und Eschebach eingezogen.<br />
Am 6. September 1944 wurde <strong>Emden</strong> durch einen Großangriff in der Innenstadt zu fast 80 % zerstört. Der<br />
Oberbaurat Wortmann schrieb am 30. September 1944 an den Oberbürgermeister Renken, da die <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong><br />
nunmehr fast völlig zerstört worden sei, gebe es jetzt ganz andere Voraussetzungen für eine Planung. Er berichtete<br />
weiter, dass Albert Speer entschieden habe, dass die Wiederaufbauplanungen unter den heutigen Verhältnissen<br />
in gewissem Umfang aufrecht erhalten werden sollte. "Der Führer hat die Absicht, die ersten Wiederaufbaustädte<br />
jetzt förmlich zu ernennen. Es ist sicher anzunehmen, dass <strong>Emden</strong> in die Reihe dieser Städte kommen wird."<br />
Angriff auf <strong>Emden</strong> am 6. September 1944, gesehen von der<br />
Flakstellung Groß Midlum aus<br />
Das Emder Rathaus, September 1944<br />
Bildnachweis:<br />
Johannes a Lasco Bibliothek <strong>Emden</strong><br />
Dietrich Janßen<br />
<strong>Stadt</strong>archiv <strong>Emden</strong><br />
Literatur:<br />
Ulrich Höhns, Expressionistische Architektur in <strong>Emden</strong>, 2002<br />
Joachim Petsch, Baukunst und <strong>Stadt</strong>planung im Dritten Reich, 1976<br />
Ingo Sommer, Die <strong>Stadt</strong> der 500 000, NS-<strong>Stadt</strong>planung und Architektur in Wilhelmshaven, 1993<br />
Karl Wulf, Hamm – Planen und Bauen 1936- 1945, 2002<br />
Ungedruckte Quellen:<br />
<strong>Stadt</strong>planung <strong>Emden</strong>, Aktenstück 1937 – 1944<br />
Verschiedenes zur Beachtung der <strong>Stadt</strong>planung 1938 - 1949<br />
Wiederaufbauplanung der <strong>Stadt</strong> <strong>Emden</strong>, Aktenstück Januar 1944 - Dezember 1944