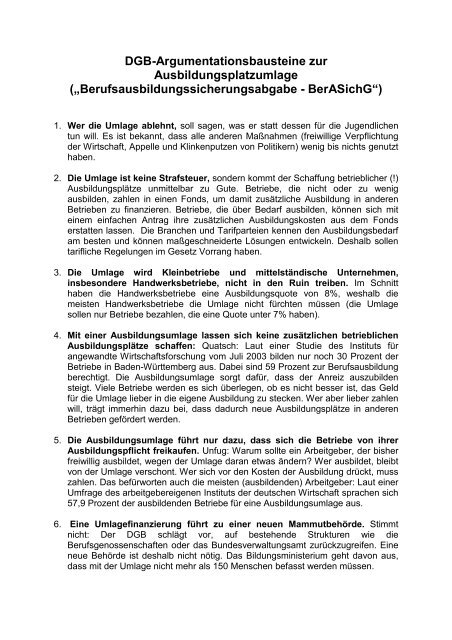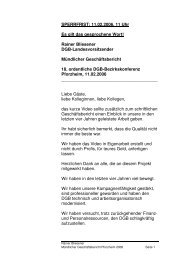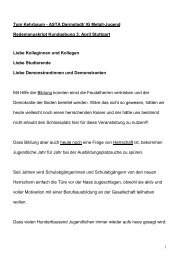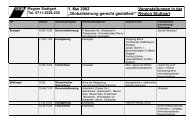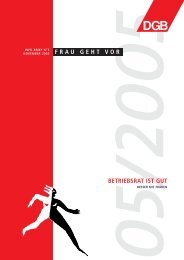DGB-Argumentationsbausteine zur Ausbildungsplatzumlage ...
DGB-Argumentationsbausteine zur Ausbildungsplatzumlage ...
DGB-Argumentationsbausteine zur Ausbildungsplatzumlage ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>DGB</strong>-<strong>Argumentationsbausteine</strong> <strong>zur</strong><br />
<strong>Ausbildungsplatzumlage</strong><br />
(„Berufsausbildungssicherungsabgabe - BerASichG“)<br />
1. Wer die Umlage ablehnt, soll sagen, was er statt dessen für die Jugendlichen<br />
tun will. Es ist bekannt, dass alle anderen Maßnahmen (freiwillige Verpflichtung<br />
der Wirtschaft, Appelle und Klinkenputzen von Politikern) wenig bis nichts genutzt<br />
haben.<br />
2. Die Umlage ist keine Strafsteuer, sondern kommt der Schaffung betrieblicher (!)<br />
Ausbildungsplätze unmittelbar zu Gute. Betriebe, die nicht oder zu wenig<br />
ausbilden, zahlen in einen Fonds, um damit zusätzliche Ausbildung in anderen<br />
Betrieben zu finanzieren. Betriebe, die über Bedarf ausbilden, können sich mit<br />
einem einfachen Antrag ihre zusätzlichen Ausbildungskosten aus dem Fonds<br />
erstatten lassen. Die Branchen und Tarifparteien kennen den Ausbildungsbedarf<br />
am besten und können maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Deshalb sollen<br />
tarifliche Regelungen im Gesetz Vorrang haben.<br />
3. Die Umlage wird Kleinbetriebe und mittelständische Unternehmen,<br />
insbesondere Handwerksbetriebe, nicht in den Ruin treiben. Im Schnitt<br />
haben die Handwerksbetriebe eine Ausbildungsquote von 8%, weshalb die<br />
meisten Handwerksbetriebe die Umlage nicht fürchten müssen (die Umlage<br />
sollen nur Betriebe bezahlen, die eine Quote unter 7% haben).<br />
4. Mit einer Ausbildungsumlage lassen sich keine zusätzlichen betrieblichen<br />
Ausbildungsplätze schaffen: Quatsch: Laut einer Studie des Instituts für<br />
angewandte Wirtschaftsforschung vom Juli 2003 bilden nur noch 30 Prozent der<br />
Betriebe in Baden-Württemberg aus. Dabei sind 59 Prozent <strong>zur</strong> Berufsausbildung<br />
berechtigt. Die Ausbildungsumlage sorgt dafür, dass der Anreiz auszubilden<br />
steigt. Viele Betriebe werden es sich überlegen, ob es nicht besser ist, das Geld<br />
für die Umlage lieber in die eigene Ausbildung zu stecken. Wer aber lieber zahlen<br />
will, trägt immerhin dazu bei, dass dadurch neue Ausbildungsplätze in anderen<br />
Betrieben gefördert werden.<br />
5. Die Ausbildungsumlage führt nur dazu, dass sich die Betriebe von ihrer<br />
Ausbildungspflicht freikaufen. Unfug: Warum sollte ein Arbeitgeber, der bisher<br />
freiwillig ausbildet, wegen der Umlage daran etwas ändern? Wer ausbildet, bleibt<br />
von der Umlage verschont. Wer sich vor den Kosten der Ausbildung drückt, muss<br />
zahlen. Das befürworten auch die meisten (ausbildenden) Arbeitgeber: Laut einer<br />
Umfrage des arbeitgebereigenen Instituts der deutschen Wirtschaft sprachen sich<br />
57,9 Prozent der ausbildenden Betriebe für eine Ausbildungsumlage aus.<br />
6. Eine Umlagefinanzierung führt zu einer neuen Mammutbehörde. Stimmt<br />
nicht: Der <strong>DGB</strong> schlägt vor, auf bestehende Strukturen wie die<br />
Berufsgenossenschaften oder das Bundesverwaltungsamt <strong>zur</strong>ückzugreifen. Eine<br />
neue Behörde ist deshalb nicht nötig. Das Bildungsministerium geht davon aus,<br />
dass mit der Umlage nicht mehr als 150 Menschen befasst werden müssen.
7. Die Ausbildungsumlage zerstört die duale Berufsausbildung. Quark mit<br />
Soße: Durch die Ausbildungsumlage soll ja gerade der Trend aufgehalten<br />
werden, dass immer weniger junge Menschen einen betrieblichen<br />
Ausbildungsplatz erhalten. Von den 81.846 Jugendlichen, die sich im Jahr 2003<br />
bei den baden-württembergischen Arbeitsämtern meldeten, bekamen nur noch<br />
42,7 Prozent einen Ausbildungsplatz. Die Ausbildungsumlage wird für<br />
ausreichend Mittel sorgen, um mehr Ausbildungsplätze in den Betrieben zu<br />
schaffen.<br />
8. Betriebe werden unzumutbar belastet. Denkste: Ausbildung hat für die Betriebe<br />
zahlreiche Vorteile. Die Auszubildenden bringen bereits während der Ausbildung<br />
Erträge und müssen danach nicht erst lange eingearbeitet werden. Von der<br />
Abgabe befreit werden Betriebe, die weniger als durchschnittlich zehn<br />
sozialversicherungspflichtige Personen beschäftigt haben. Die Ausnahme für<br />
diesen Kreis ist im Hinblick auf deren regelmäßig geringere finanzielle<br />
Leistungsfähigkeit und häufig nur eingeschränkt bestehenden<br />
Ausbildungsmöglichkeiten angemessen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass<br />
Arbeitgeber, wenn besondere Umstände des Einzelfalls dies rechtfertigen, auf<br />
Antrag von der Entrichtung der Abgabe befreit werden können. Als Beispiel wird<br />
der Fall genannt, dass die Höhe des Abgabebetrags unter Berücksichtigung der<br />
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers eine unzumutbare Härte<br />
darstellen würde. Als Härtefallklausel bleibt der Anwendungsbereich der<br />
Vorschrift auf Einzelfälle beschränkt und ist restriktiv auszulegen. 1<br />
9. Viele Betriebe können gar nicht ausbilden oder bekommen keine<br />
geeigneten Bewerberinnen und Bewerber. Von wegen: Die Zahl der Betriebe,<br />
die ausbilden können, aber nicht wollen, liegt bundesweit bei rund 700.000 (in<br />
BaWü bei ca. 80.000). Es gibt also noch Kapazitäten für Ausbildungsplätze.<br />
Außerdem ist es nicht unbillig, dass Betriebe, die nicht ausbilden können,<br />
zahlen. Schließlich profitieren sie davon, dass andere Betriebe diejenigen<br />
Mitarbeiter ausgebildet haben, die sie nun brauchen. Die Behauptung, es gebe<br />
nicht genug geeignete Bewerber, ist häufig vorgeschoben. Die Auswahl unter<br />
den Bewerbern war selten so hoch wie <strong>zur</strong> Zeit. 1992 konnten 100 Anbieter von<br />
Ausbildungsplätzen unter 108 Schulabgängern auswählen. Im Jahr 2002 unter<br />
158 (bundesweit). Dass auch Schüler/innen, die als nicht ausbildungsfähig<br />
galten, eine 3 ½-jährige Ausbildung im Betrieb erfolgreich bestehen können,<br />
wenn die Rahmenbedingungen stimmen, zeigen die Erfolge in Offenburg. Die<br />
Umlagefinanzierung bietet die Möglichkeit, dass betrieblich integrierte Projekte<br />
wie PIA (Projekt von IG Metall und Südwestmetall) stärker gefördert werden<br />
können.<br />
10. Der Nutzen einer Ausbildungsumlage steht in keinem Verhältnis zum<br />
Aufwand. Träumt weiter: Die Bundesagentur für Arbeit spricht von 35.000 (Bawü:<br />
1.266) Menschen, die im Herbst 2003 keinen Ausbildungsplatz hatten. In<br />
Wirklichkeit lag der Bedarf an zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen bei<br />
200.000 (Bawü: ca. 20 000). Die Differenz kommt dadurch zustande, dass die<br />
Bundesagentur diejenigen nicht mitzählt, die sich mit „Ersatzmaßnahmen“<br />
============================== =================<br />
1 Aus dem Papier: Entwurf für eine Formulierungshilfe des „Entwurfs eines Gesetzes <strong>zur</strong> Sicherung<br />
und Förderung des Fachkräftenachwuchses und der Berufsausbildungschancen der jungen<br />
Generation (Berufsausbildungssicherungsgesetz – BerASichG“, § 9 Abs. 1 u. 2. Befreiung von der<br />
Abgabepflicht, Teil 3, S. 5, sowie in der Begründung des Gesetzes S. 22.
abgefunden haben, wie berufsvorbereitenden Maßnahmen, oder ihre Suche<br />
gleich ganz aufgegeben haben. Insgesamt haben etwa 600.000 junge Menschen<br />
im Alter von 20 bis 25 Jahren keinen Berufsabschluss. Vor diesem Hintergrund<br />
scheint kein Aufwand zu groß, mehr Ausbildungsplätze zu schaffen.<br />
Quelle Zahl Beschreibung<br />
BIBB für 2003 603.000 Ausbildungssuchende 2003<br />
<strong>DGB</strong> 678.375 Notwendiges Ausbildungsangebot<br />
(112.5%)<br />
Destatis für 2001 1.684.669 Gesamtzahl<br />
Auszubildende 2001<br />
BIBB für 2001 14.66 Mrd. € Netto-Ausbildungskosten<br />
Destatis für 2001 904.14 Mrd. € Brutto-Lohnsumme<br />
BIBB 8705,- durchschnittliche Netto-Ausbildungskosten<br />
pro Person (für die gesamte Ausbildung), also<br />
Bruttokosten abzgl. der Wertschöpfung pro<br />
Azubi.<br />
BIBB 5,5% betriebliche Ausbildungsquote 2003<br />
<strong>DGB</strong> 7% derzeit nötige Untergrenze der betrieblichen<br />
Ausbildungsquote (Ziel)<br />
Umlagevorbilder<br />
Berufsbildungsfinanzierung im Baugewerbe<br />
Grundlage für die Finanzierung der Berufsausbildung im Baugewerbe ist der<br />
„Tarifvertrag über die Berufsbildung im Baugewerbe (BBTV)“ in der Fassung vom 19.<br />
April 2000. Dieser Tarifvertrag trat erstmals im Jahre 1976 in Kraft. Zielsetzung: die<br />
Sicherung des Nachwuchses der Bauwirtschaft: Einerseits sollten die Betriebe eine<br />
ausreichende Anzahl von Ausbildungsplätzen bereitstellen, andererseits die<br />
Ausbildung so qualifiziert wie möglich sein.<br />
Alle erfassten Arbeitgeber haben <strong>zur</strong> Aufbringung der Mittel für die tarifvertraglich<br />
festgelegte Erstattung von Kosten der Berufsausbildung als Beitrag einen<br />
Gesamtbetrag von 1,2 v.H. der Summe der Bruttolöhne aller gewerblichen<br />
ArbeitnehmerInnen des Betriebes (Bruttolohnsumme) an die Einzugsstelle<br />
abzuführen.<br />
Die Sozialkassen des Baugewerbes erstatten dem ausbildenden Arbeitgeber<br />
teilweise die tariflichen Ausbildungsvergütungen. Für die vom Arbeitgeber zu<br />
leistenden Sozialaufwendungen werden 16% erstattet.<br />
Berufsbildungsfinanzierung in Frankreich und Dänemark<br />
In Frankreich sind die Betriebe verpflichtet, 1,5% ihrer Bruttolohn- und<br />
Gehaltssumme für eigene Berufsbildungsmaßnahmen nachzuweisen bzw. an<br />
Fonds zu überweisen. Hinzu kommt das Geld aus der „Lehrlingssteuer“, und eine<br />
Umlage für Weiterbildung. Die positive Gesamtwirkung der Umlagefinanzierung in<br />
Frankreich ist auch von den Arbeitgebern unbestritten.
Anders als im französischen Modell ist die dänische Umlagefinanzierung AER nur<br />
auf die Berufsausbildung bezogen. Dabei werden festgelegte<br />
Ausbildungsabschnitte aus Beiträgen der Unternehmen und staatlichen Zuschüssen<br />
finanziert. Die Unternehmen entrichten immerhin pro Beschäftigten derzeit rund 400<br />
DKK jährlich, was zu einem Fondsvolumen von knapp 3 Mrd. DKK führt. Auch in<br />
Dänemark funktioniert die Umlagefinanzierung bereits 25 Jahre lang, ohne jemals<br />
ernsthaft in Frage gestellt worden zu sein.<br />
Dimitrios Galagas<br />
<strong>DGB</strong>-Landesjugendsekretär<br />
März 2003