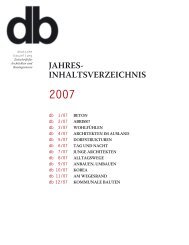Otto Hetzer - db deutsche bauzeitung
Otto Hetzer - db deutsche bauzeitung
Otto Hetzer - db deutsche bauzeitung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ingenieurporträt<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong><br />
Begründer des Holzleimbaus<br />
Text: Christian Müller<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> war zwar kein<br />
Bauingenieur (<strong>Hetzer</strong> war Zimmermann),<br />
doch reicht seine<br />
Bedeutung als Konstrukteur weit<br />
über seinen Lehrberuf hinaus:<br />
<strong>Hetzer</strong> gilt als Begründer des Holzleimbaus.<br />
Kurz vor seinem<br />
Tod konnte er 1910 noch den<br />
technischen Durchbruch dieser<br />
Bauweise auf der Weltausstellung<br />
in Brüssel erleben: Die Reichsbahnhalle<br />
setzte dort mit 43 Metern<br />
Spannweite für lange Zeit<br />
Maßstäbe.<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> was a carpenter,<br />
not a structural engineer, but his<br />
significance as a designer of<br />
buildings reached far beyond his<br />
trade qualifications. <strong>Hetzer</strong><br />
is regarded as the founder of<br />
laminated wood construction.<br />
In 1910, shortly before his death, he<br />
was able to experience the<br />
breakthrough of this method of<br />
construction at the World<br />
exhibition in Brussels: there the<br />
state railway depot with<br />
spans of 43 meters set for a long<br />
time new standards.<br />
Im 19. Jahrhundert wurde der Baustoff<br />
Holz immer mehr von Stein, Stahl und<br />
Stahlbeton verdrängt. Die zimmermannsmäßige<br />
Verarbeitung von Holz<br />
galt zunehmend als veraltete, billige<br />
Bauweise, mit der man nur noch<br />
Schalungen für Betonkonstruktionen<br />
oder Dachstühle baute. Dabei ließ sich<br />
schon damals die statische Berechenbarkeit<br />
der Stahlkonstruktionen ebenso<br />
auf den Holzbau übertragen.<br />
Für den Ausbau der Eisenbahn in Nordamerika<br />
brauchte man Mitte des<br />
19. Jahrhunderts viele Brücken, die aus<br />
Kostengründen häufig aus Holz gebaut<br />
wurden. Für die bautechnische Entwicklung<br />
dieser Brücken ist besonders<br />
der von William Howe im Jahr 1840<br />
entwickelte Howe'sche Träger hervorzuheben,<br />
an dem die Hauptprobleme<br />
des damaligen Holzbaus deutlich werden:<br />
Howe entwickelte einen doppelt<br />
ausgekreuzten Fachwerkträger, der<br />
durch die Vorspannung der Zugvertikalen<br />
vorgespannt war und so alle<br />
Diagonalen auf Druck beanspruchte.<br />
Um einfache Verbindungspunkte zu<br />
erhalten, wurden die Vertikalen als<br />
Stahlstäbe ausgeführt, durch deren<br />
Vorspannung die Holzdiagonalen mit<br />
einem Druckstoß angeschlossen werden<br />
konnten. Alle Stäbe besaßen die<br />
gleiche Länge und konnten so von<br />
angelernten Hilfskräften aufgebaut<br />
werden. Wenn das Holz zu schwinden<br />
begann, konnten die Zugstäbe immer<br />
wieder nachgezogen werden.<br />
Auch im Hallenbau gab es um 1890<br />
ingenieurmäßige Entwicklungen für<br />
Tragwerke, die allesamt aus Brettlamellen<br />
zusammengesetzte Bogentragwerke<br />
waren, deren mechanische<br />
Verbindungspunkte wegen ihrer Nachgiebigkeit<br />
den Schwachpunkt darstellten<br />
(»Stephan'scher Bohlenbinder«,<br />
»Melzer-Bogen«, »Tuchscherer-Bogen«).<br />
Bereits 1809 empfahl der bayerische<br />
Brückenbaumeister Carl Friedrich<br />
Wiebeking deshalb in seinen »Beyträgen<br />
zur Brückenbaukunde« das<br />
Verleimen stark gekrümmter Bauhölzer:<br />
»Solche Verbindung der kleinen Bretter<br />
zu einem ganzen Baustücke, deren<br />
Stoßfuge abwechseln müssen, kann ich<br />
nicht genug beym Bau der Bogenbrücken<br />
und bey Treppen, kurz überall,<br />
wo man stark gekrümmte Bauhölzer<br />
nöthig hat empfehlen. Die einzelnen<br />
Bretter lassen sich nämlich nach der<br />
Lehre, selbst in Windungen krümmen;<br />
folglich ist eine Zusammensetzung<br />
davon zu Bogenbrücken und Treppenträgern<br />
sehr geschickt« [1].<br />
An diesem Punkt setzte die durch <strong>Otto</strong><br />
<strong>Hetzer</strong> vorangetriebene Entwicklung<br />
ein, die das vom Tischlerhandwerk her<br />
altbekannte Verleimen von Hölzern auf<br />
große Tragwerke übertrug.<br />
1 <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> (1846 – 1911)<br />
<strong>db</strong> 8/2000 105<br />
1
Ingenieurporträt <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> (1846 – 1911)<br />
Vom Zimmermann zum Konstrukteur<br />
Karl Friedrich <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> wurde 1846<br />
in Kleinobringen bei Weimar geboren.<br />
Seine Lehrzeit als Zimmermann verbrachte<br />
er von 1860 bis 1863 in<br />
Apolda. Nach dem deutsch-französischen<br />
Krieg gründete er 1872 ein<br />
Dampfsägewerk und Zimmereigeschäft<br />
in Weimar. Der wirtschaftliche Aufschwung<br />
der Stadt in der Gründerzeit<br />
führte zur raschen Expansion des<br />
Betriebs, der 1883 in »Weimarische<br />
Bau- und Parkettfußbodenfabrik«<br />
umbenannt wurde. Im Jahr 1891<br />
wurde <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> zum Großherzoglichen<br />
Hofzimmermeister ernannt.<br />
Bis 1910 erwarb er fünf Deutsche<br />
Reichspatente. Auf Grundlage dieser<br />
Patente entwarf <strong>Hetzer</strong> Dach- und Hallentragwerke<br />
und führte so den Holzleimbau<br />
zu seinem industriellen Durchbruch.<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> erlebte kurz vor seinem<br />
Tod (1911) noch den technischen<br />
Durchbruch dieser Bauweise auf der<br />
Weltausstellung in Brüssel (1910) mit<br />
dem Bau der Reichseisenbahnhalle, die<br />
mit einer Spannweite von 43 Metern<br />
für lange Zeit Maßstäbe setzte (Bild 2).<br />
3<br />
Vom Fußboden zum Verbundträger<br />
Entsprechend der Firmengeschichte<br />
stellte sich auch die Entwicklung der<br />
einzelnen Patente dar.<br />
<strong>Hetzer</strong>s erstes Patent (DRP No. 63018)<br />
beschreibt einen unterlüfteten Dielenfußboden<br />
(Bild 3), der bei Bedarf (wenn<br />
das Holz schwindet) in den vorhandenen<br />
Richtleisten nachträglich zusammengeschoben<br />
werden konnte [2].<br />
Schon sein zweites Patent von 1900<br />
(DRP No. 125895) stellte einen zusammengesetzten,<br />
kastenförmigen Holzträger<br />
dar, der dem Momentenverlauf<br />
parabelförmig angepasst wurde (Bild 4).<br />
Die einzelnen Querschnittsteile wie<br />
Obergurte, Untergurte und Stege wurden<br />
durch ein nicht näher benanntes<br />
Klebemittel kraftschlüssig miteinander<br />
verleimt. Die beiden grundlegenden<br />
Probleme der belastungsabhängigen<br />
Querschnittsoptimierung und der Wahl<br />
des Verbindungsmittels wurden hier<br />
erstmals gelöst. Die Verleimung mehrerer<br />
Einzelquerschnitte stellt ebenso ein<br />
Mittel gegen das Verdrehen und Reißen<br />
dünnwandiger Holzquerschnitte dar.<br />
Die rege Bautätigkeit um die Jahrhundertwende<br />
führte bei sechs Meter<br />
weit gespannten Balken für die damals<br />
üblichen Holzdecken schließlich zu<br />
106 <strong>db</strong> 8/2000<br />
2<br />
2 Die Deutsche Eisenbahnhalle für die Weltausstellung<br />
1910 in Brüssel setzte mit einer Spannweite<br />
von 43 Metern für lange Zeit Maßstäbe<br />
3 Patent No 63018, Fußboden, 1892<br />
4 Patent No 125895, 1900, zusammengesetzter<br />
Holzbalken<br />
4
einer Verknappung und Verteuerung<br />
großer Holzquerschnitte [3].<br />
So wird das Patent Nummer 163144<br />
für einen Verbundträger von 1903<br />
genau zum richtigen Zeitpunkt erteilt.<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> beschreibt darin die<br />
Herstellung eines Trägers mit großem<br />
Querschnitt aus einem der Länge nach<br />
parabelförmig zersägten Balken, zwischen<br />
dessen Schnittflächen ein Brett<br />
unter hohem Druck eingeleimt wird<br />
(Bild 5). Die Verleimung mit dem ent-<br />
5 Patent No 163144, 1903, parabelförmig zusammengesetzter<br />
Balken<br />
6 Patent No 225687,1907, Fachwerkträger aus<br />
Holz, bei denen die Diagonalen aus einem zickzackförmigen<br />
Holzstab bestehen<br />
5<br />
6<br />
gegen der zu erwartenden Durchbiegung<br />
eingedrückten Brett verhindert<br />
eine bleibende Verformung des Trägers<br />
unter Belastung beziehungsweise<br />
Eigengewicht. Über die Verwendung<br />
von Hölzern verschiedener Festigkeiten<br />
je nach Querschnitt sagt das Patent<br />
allerdings nichts aus. Die Sägeschnittführung<br />
war trotz geringen Verschnittes<br />
relativ aufwendig in der Herstellung.<br />
Eine verbreitete Anwendung dieses Patents<br />
konnte nicht nachgewiesen werden.<br />
Der Übergang zum Brettschichtträger<br />
mit mehreren Schichten ließ den<br />
parabelförmig verleimten Träger wieder<br />
in Vergessenheit geraten.<br />
Brettschicht- und Fachwerkträger<br />
1906 erwarb <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> das Patent<br />
DRP No. 197773 für gebogene, verleimte<br />
Brettschichtträger aus zwei und<br />
mehr Lamellen, die auch unter Feuchtigkeit<br />
unlöslich miteinander verbunden<br />
sind. Der verwendete Leim wurde in<br />
der Patentschrift nicht genau bezeichnet.<br />
In der Regel verwendete <strong>Hetzer</strong><br />
einen Kaseinleim, dessen Rezept er mit<br />
den Patentrechten weitergab. In der<br />
Patentschrift wird die Verwendung der<br />
Brettschichtträger für gebogene Sparrendächer<br />
empfohlen. Obwohl auch<br />
hier nicht ausdrücklich von Lamellen<br />
verschiedener Festigkeiten die Rede ist,<br />
ermöglicht ihre Verwendung eine<br />
weitere Querschnittsoptimierung.<br />
Abgeschlossen wird die Reihe der<br />
<strong>Hetzer</strong>'schen Patente mit dem DRP No.<br />
225687 von 1907 für »Fachwerkträger<br />
aus Holz, bei denen die Diagonalen aus<br />
einem zickzackförmigen Holzstab<br />
bestehen« (Bild 6). Besonders bei der<br />
Konstruktion von Bogentragwerken<br />
größerer Spannweite führte die geringere<br />
Steifigkeit der Vollholzquerschnitte<br />
bei wechselnden Lasten zu hoher<br />
Biegebeanspruchung und damit zur<br />
Schwingungsanfälligkeit.<br />
7 Tragwerk aus einfach gevouteten Trägern<br />
8 Gerader Dreigelenkbinder mit Zugband<br />
9 Abgewinkelter Dreigelenkbinder mit<br />
angehobenem Zugband<br />
10 Abgewinkelter Dreigelenkbinderr mit<br />
angehobenem Zugband und Satteldach<br />
11 Gebogener Zweigelenkbinder mit Zugband<br />
<strong>db</strong> 6/2000 107<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11
Ingenieurporträt <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> (1846 – 1911)<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
<strong>Hetzer</strong>s Ziel war es daher, Teile der<br />
Stegkonstruktion in Richtung der<br />
Hauptspannungstrajektorien als Druckoder<br />
Zugstreben auszubilden. Eine<br />
hohe Schubbeanspruchung der Vollholzquerschnitte<br />
parallel zur Holzfaser<br />
und zur Leimfuge konnte dadurch umgangen<br />
werden. Bisher wurde allerdings<br />
kein von <strong>Hetzer</strong> ausgeführtes<br />
Bauwerk dieser Art gefunden.<br />
Seine Patente wurden auf der Grundlage<br />
von Lizenzen vergeben, die von<br />
verschiedenen Ingenieuren und Holzbaufirmen<br />
in ganz Europa übernommen<br />
wurden. Bereits 1909 übernahm<br />
das Ingenieurbüro Terner und Chopard<br />
in Zürich die Patentrechte und baute<br />
auf deren Grundlage eine große Anzahl<br />
bemerkenswerter Gebäude. Seit 1921<br />
stellt auch die Firma Nemaho in<br />
Doetinchem Holzleimbinder her und<br />
exportiert diese heute noch weltweit.<br />
Dach- und Hallentragwerke <strong>Otto</strong><br />
<strong>Hetzer</strong> entwickelte zur besseren Vermarktung<br />
der Holzleimbinder Dachund<br />
Hallentragwerke, die er in der<br />
Firmenschrift von 1908 veröffentlichte<br />
(Bilder 7–16). Die Tragwerke zeigen die<br />
Vielfalt der im Holzleimbau nun möglich<br />
gewordenen freien Form, die sich<br />
den statischen und gestalterischen<br />
Erfordernissen anpassen konnte.<br />
»Im Gegensatz zu den bisherigen,<br />
nur auf reinen Erfahrungsgrundsätzen<br />
12 Tragwerk mit Zweigelenkfachwerkträger<br />
mit angehobenem Zugband<br />
13 Dreigelenkrahmen<br />
14 Dreigelenkbogen mit Satteldach<br />
15 Dreigelenkbogen mit runder Dachhaut<br />
16 Dreigelenkspitzbogen<br />
17 18<br />
beruhenden Holzkonstruktionen, die<br />
unnötig viel Material erforderten und<br />
trotzdem nur geringe Tragfähigkeit aufwiesen,<br />
haben wir unser besonderes<br />
Augenmerk darauf gerichtet, klare und<br />
theoretisch richtige Tragwerke zu konstruieren,<br />
deren Berechnung sich nach<br />
den neuen Methoden der Statik einwandfrei<br />
durchführen läßt. Unsere<br />
Systeme besitzen eine ungewöhnliche<br />
erhöhte Tragfähigkeit und sind dabei<br />
unter vollständiger Ausnutzung des<br />
Materials besonders sparsam konstruiert.«<br />
Mit der gleichen Sparsamkeit, mit der<br />
Stahl im Stahlbau verwendet wurde,<br />
wurde nun auch mit Holz gearbeitet.<br />
Dies führte zu den Doppel-T-förmigen<br />
Querschnitten in Holz. Dabei bestanden<br />
in der Regel die zwanzig Zentimeter<br />
breiten Ober- und Untergurte aus vier<br />
Lamellenlagen, die ungestoßen bis zu<br />
15 Meter lang waren. Im Stegbereich<br />
war der Querschnitt auf sechs Zentimeter<br />
reduziert und die Lamellenstöße<br />
als Vollstoß ausgebildet.<br />
Sparrendächer und Zweigelenkbögen<br />
Ein schönes Beispiel einer gebogenen<br />
Sparrendachkonstruktion mit angehobenem<br />
Zugband ist der Dachstuhl im<br />
1906 erbauten Naturhistorischen Museum<br />
in Altenburg. Die Sparren haben<br />
dort einen rechteckigen Querschnitt<br />
und sind im Abstand von etwa einem<br />
17, 18 Museum für Naturkunde in Altenburg,<br />
erbaut 1906<br />
108 <strong>db</strong> 8/2000
Meter angeordnet. Mit der angehobenen<br />
hölzernen Zange konnte der Saal in<br />
einer Höhe von vier Metern frei überspannt<br />
werden, ohne die Dachkonstruktion<br />
mit ihren acht Metern Spannweite<br />
übermäßig hoch werden zu<br />
lassen. Da die Zangen nicht überall<br />
durchgängig erforderlich waren, kam<br />
das Oberlicht noch ausreichend zur<br />
Geltung. Die geringen Horizontalkräfte<br />
am Auflager, die infolge eines höher<br />
gelegten Zugbands auftreten, wurden<br />
vom Mauerwerk aufgenommen [4].<br />
Eine Sonderform der Zweigelenkbogen-<br />
Kuppel auf ovalem Grundriss entstand<br />
1909 für die Stadtgartenhalle in Hagen.<br />
Sie überspannte eine Fläche von 12,30<br />
auf 17 Metern. Drei Zweigelenkbinder<br />
mit angehobenem Zugband und vier<br />
Gratbinder ergaben mit ringförmigen<br />
Pfetten die Auflager für die gebogenen<br />
Sparren. An der Unterspannung war<br />
eine Putzdecke abgehängt. Am Ende<br />
des Zweiten Weltkrieges wurde die<br />
Kuppel durch Bran<strong>db</strong>omben zerstört.<br />
Hallen aus Rahmenbindern mit Zugband<br />
Eine der Hallen in <strong>Hetzer</strong>-Bauweise<br />
entstand 1910 als Deutsche<br />
Eisenbahnhalle für die Weltausstellung<br />
in Brüssel (Bild 2). Sie bestand zwar nur<br />
als temporäres Gebäude, hatte aber mit<br />
ihren 43 Metern Spannweite ein erst<br />
sehr viel später wieder erreichtes Ausmaß.<br />
Der Zweigelenkrahmen mit<br />
14 Metern Scheitelhöhe hatte in 8,20<br />
Metern Höhe ein eisernes Zugband.<br />
Die im Querschnitt vorhandenen<br />
Spannungen wurden mit 136 kg/cm 2<br />
(1,36 KN/cm 2 ) angegeben, die auch<br />
heute mit Brettschichtholz BS14 zulässig<br />
wären. Aufgrund der Bindergröße<br />
waren für den Transport fünf Montagestöße<br />
erforderlich, die biegesteif ausgebildet<br />
waren.<br />
Der Entwurf der Halle stammt von Peter<br />
Behrens und lässt äußerlich wenig von<br />
der Leichtigkeit der Konstruktion, geschweige<br />
denn seine außerordentliche<br />
Spannweite vermuten. Die Statik des<br />
zweifach statisch unbestimmten<br />
Systems wurde von Hermann Kügler<br />
aus München berechnet und aufgrund<br />
der erstmaligen Verwendung im Holzbau<br />
vollständig veröffentlicht [5]. Die<br />
Form der Rahmen-Binder übernahm die<br />
<strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong> AG 1912 beim Bau der<br />
Flugzeughallen in Weimar.<br />
Resümee Auch wenn <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong><br />
nicht als erster auf die Idee kam, Holzlamellen<br />
zu gebogenen Tragwerken<br />
miteinander zu verleimen, so hat er<br />
doch dem Holzleimbau durch eine<br />
statisch sinnvolle und wirtschaftliche<br />
Bauweise zum Durchbruch verholfen.<br />
Mit Entwicklung der statischen Grundlagen<br />
war nun der Weg frei für bis zu<br />
100 Meter weit gespannte Bogenbinder,<br />
über 160 Meter weit gespannte<br />
Kuppeln und ebenso weit gespannte<br />
Hängerippenschalen [6]. C.M.<br />
<strong>db</strong> 8/2000 109<br />
Literatur<br />
19<br />
19 Stadtgartenhalle<br />
in Hagen in Westfalen,<br />
erbaut 1909,<br />
Längsschnitt<br />
20 Die Zweigelenkbogen-Kuppel<br />
der<br />
Stadtgartenhalle<br />
in Hagen während<br />
des Aufbaus<br />
[1] Wiebeking, Carl Friedrich, Beyträge zur Brückenbaukunde,<br />
München 1809<br />
[2] Haarmann, A., Fußböden aus Rotbuchenholz,<br />
Centralblatt der Bauverwaltung, 1894/H. 7 S. 69<br />
[3] <strong>Hetzer</strong>, <strong>Otto</strong> (Sen.), <strong>Otto</strong> <strong>Hetzer</strong>, Weimar –<br />
Neue Holzbauweisen, Weimar 1908<br />
[4] Kersten, Christian, Freitragende Holzbauten,<br />
2. Auflage, Berlin 1926<br />
[5] Mannheimer; Franz, Eisenbahnhalle, Der Industriebau,<br />
1910, H. 8, S. 206–216<br />
[6] Müller, Christian, Holzleimbau, München 2000<br />
20