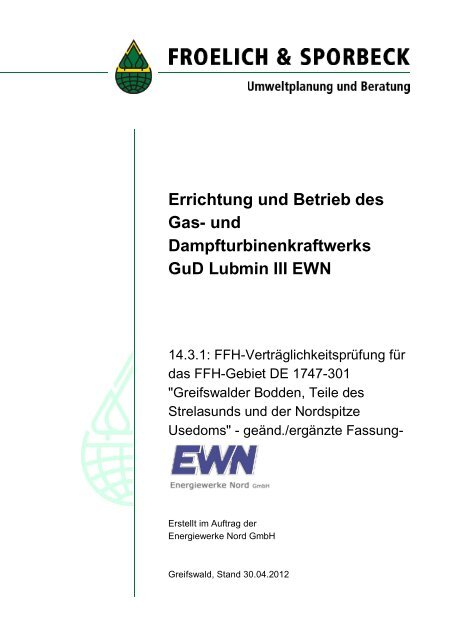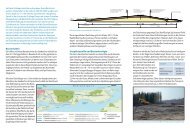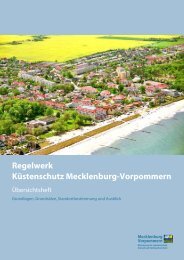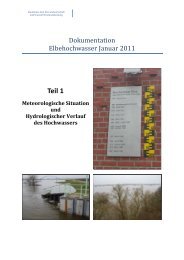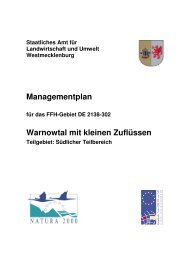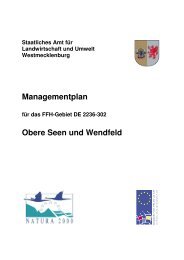und Dampfturbinenkraftwerks GuD Lubmin III EWN
und Dampfturbinenkraftwerks GuD Lubmin III EWN
und Dampfturbinenkraftwerks GuD Lubmin III EWN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des<br />
Gas- <strong>und</strong><br />
<strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong><br />
<strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> <strong>EWN</strong><br />
14.3.1: FFH-Verträglichkeitsprüfung für<br />
das FFH-Gebiet DE 1747-301<br />
"Greifswalder Bodden, Teile des<br />
Strelas<strong>und</strong>s <strong>und</strong> der Nordspitze<br />
Usedoms" - geänd./ergänzte Fassung-<br />
Erstellt im Auftrag der<br />
Energiewerke Nord GmbH<br />
Greifswald, Stand 30.04.2012
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 1<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Seite<br />
1 Anlass <strong>und</strong> Aufgabenstellung, rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen 1<br />
1.1 Anlass <strong>und</strong> Aufgabenstellung 1<br />
1.2 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen 2<br />
2 Beschreibung des Schutzgebietes <strong>und</strong> der für seine Erhaltungsziele<br />
maßgeblichen Bestandteile 5<br />
2.1 Übersicht über das Schutzgebiet 5<br />
2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 7<br />
2.2.1 Verwendete Quellen 7<br />
2.2.2 Ermittlung der Erhaltungsziele 11<br />
2.2.3 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 19<br />
2.2.4 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 21<br />
2.3 Managementpläne/Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen 23<br />
2.4 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes zu anderen Natura 2000-<br />
Gebieten 23<br />
2.4.1 Beitrag des Gebietes zur biologischen Vielfalt 23<br />
2.4.2 Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten 24<br />
3 Beschreibung des Vorhabens 25<br />
3.1 Übersicht über das Gesamtvorhaben 25<br />
3.2 Maßnahmen zur Minderung <strong>und</strong> Vermeidung von Beeinträchtigungen 29<br />
3.3 Wirkfaktoren 31<br />
3.3.1 Baubedingte Wirkungen 32<br />
3.3.2 Anlagebedingte Wirkungen 33<br />
3.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen 34<br />
4 Untersuchungsraum der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 39<br />
4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 39<br />
4.2 Datenlücken 40<br />
4.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches 40<br />
4.3.1 Übersicht über die Landschaft, Arten <strong>und</strong> Biotope 40<br />
4.3.2 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im detailliert untersuchten<br />
Bereich 42<br />
4.3.3 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im detailliert untersuchten Bereich 86
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 2<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
4.3.4 Derzeitige Vorbelastungen des detailliert untersuchten Bereiches 104<br />
5 Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des<br />
Schutzgebietes 115<br />
5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 115<br />
5.2 Wirkprozesse <strong>und</strong> Wirkprozesskomplexe 130<br />
5.2.1 Kollisionsrisiko 130<br />
5.2.2 Barriereeffekte, Zerschneidung von Funktionsbeziehungen 132<br />
5.2.3 Optische Störungen / Veränderung des Sichtfeldes 132<br />
5.2.4 Lärmimmissionen 135<br />
5.2.5 Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung 138<br />
5.2.6 Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge 154<br />
5.2.7 Schadstoffimmissionen 164<br />
5.3 Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 166<br />
5.3.1 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code<br />
1110) 166<br />
5.3.2 Ästuarien (EU-Code 1130) 175<br />
5.3.3 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140) 186<br />
5.3.4 Strandseen der Küste (EU-Code 1150*) 190<br />
5.3.5 Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160) 195<br />
5.3.6 Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten (EU-Code 1210) 207<br />
5.3.7 Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-Code<br />
1230) 210<br />
5.3.8 Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong><br />
Sand (Queller-Watt) (EU-Code 1310) 212<br />
5.3.9 Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwadenrasen (EU-<br />
Code 1330) 215<br />
5.3.10 Primärdünen (EU-Code 2110) 218<br />
5.3.11 Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120) 220<br />
5.3.12 Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation (EU-Code 2130*) 224<br />
5.3.13 Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region<br />
(EU-Code 2180) 227<br />
5.3.14 Feuchte Dünentäler (EU-Code 2190) 232<br />
5.3.15 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder<br />
Hydrocharition (EU-Code 3150) 235
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 3<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.16 Artenreiche Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan auf dem europäischen<br />
Festland) (EU-Code 6230*) 237<br />
5.3.17 Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Code 6410) 240<br />
5.3.18 Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (EU-Code 7140) 243<br />
5.3.19 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code 9110) 245<br />
5.3.20 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen (EU-Code<br />
9190) 248<br />
5.4 Beeinträchtigung von Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie 250<br />
5.4.1 Kegelrobbe (Halichoerus grypus) (EU-Code 1364) 250<br />
5.4.2 Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) (EU-Code 1365) 252<br />
5.4.3 Fischotter (Lutra lutra) (EU-Code 1355) 254<br />
5.4.4 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318) 256<br />
5.4.5 Großes Mausohr (Myotis myotis) (EU-Code 1324) 258<br />
5.4.6 Meerneunauge (Petromyzon marinus) (EU-Code 1095) <strong>und</strong> Flussneunauge<br />
(Lampetra fluviatilis) (EU-Code 1099) 260<br />
5.4.7 Rapfen (Aspius aspius) (EU-Code 1130) 262<br />
5.4.8 Atlantischer Stör (Acipenser sturio) (EU-Code 1101*) 264<br />
5.4.9 Finte (Alosa fallax) (EU-Code 1103) 267<br />
5.4.10 Bitterling (Rhodeus sericeus) (EU-Code 1134) 269<br />
5.4.11 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) (EU-Code 1014) 270<br />
5.4.12 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) (EU-Code 1014) 271<br />
5.4.13 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (EU-Code 1042) 273<br />
5.4.14 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) (EU-Code 1060) 274<br />
5.4.15 Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii) (EU-Code 1060) 275<br />
6 Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 277<br />
7 Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes durch andere<br />
zusammenwirkende Pläne <strong>und</strong> Projekte 278<br />
7.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne <strong>und</strong> Projekte 278<br />
7.2 Beschreibung der Pläne <strong>und</strong> Projekte sowie der möglichen kumulativen<br />
Beeinträchtigungen 284<br />
7.2.1 Umspannwerk der AWE Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft GmbH<br />
einschließlich des Erdkabels 284<br />
7.2.2 Kabeltrasse Offshore-Windpark „Ventotec Ost 2“ 286<br />
7.2.3 EWE Erdgasspeicher Moeckow 291<br />
7.3 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen 305
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 4<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
8 Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen durch das Vorhaben <strong>und</strong> andere<br />
zusammenwirkende Pläne <strong>und</strong> Projekte 306<br />
9 Zusammenfassung 309<br />
Literatur- <strong>und</strong> Quellenverzeichnis 311<br />
Glossar <strong>und</strong> Abkürzungsverzeichnis 344<br />
Anhang<br />
Zugehörige Planunterlagen<br />
Tabellenverzeichnis<br />
Tab. 1: FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ 19<br />
Tab. 2: Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ 22<br />
Tab. 3: Wesentliche Kraftwerksparameter 25<br />
Tab. 4: FFH-Lebensraumtypen des FFH-Gebietes im detailliert untersuchten Bereich 43<br />
Tab. 5: Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die im detailliert untersuchten<br />
Bereich (duB) vorkommen bzw. ein Vorkommenspotenzial aufweisen 88<br />
Tab. 6: Orientierungswerte für Flächenverlust in marinen FFH-Lebensraumtypen 117<br />
Tab. 7: Ausgewählte charakteristische Arten 120<br />
Tab. 8: Durch Kühlwassereinleitung betroffene Flächen <strong>und</strong> ermittelte Äquivalenzwerte<br />
(betroffene Fläche x gradueller Funktionsverlust) für den Vergleich mit dem<br />
lebensraumspezifischen Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner<br />
(2007B) für die Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 124<br />
Tab. 9: Beschreibung der Lärmszenarien nach Lober (2011c) 136<br />
Tab. 10: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen bei den Lastfällen 11 <strong>und</strong> 12 am<br />
Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) 143<br />
Tab. 11: Vergleich der betrieblichen Kühlwasserparameter 143<br />
Tab. 12: Flächenberechnung der Salzkonzentrationsänderungen bei den Lastfällen 11<br />
<strong>und</strong> 12 am Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) 145<br />
Tab. 13: Berechnete „Critical Loads“ für stickstoffempfindliche FFH-Lebensraumtypen<br />
sowie für die Art Liparis loeselii im potenziellen Wirkbereich des Vorhabens 157<br />
Tab. 14: Berechnete Critical Loads für versauernde Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong><br />
Schwefel für ausgewählte Lebensraumtypen <strong>und</strong> die Pflanzenart Liparis loeselii 161<br />
Tab. 15: Beeinträchtigung der „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit<br />
Meerwasser (EU-Code 1110) 166<br />
Tab. 16: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1110 168<br />
Tab. 17: Empfindlichkeit von charakteristischen Fisch- , Makrozoobenthos- <strong>und</strong><br />
Makrophytenarten des LRT 1110 gegenüber Temperatur- <strong>und</strong><br />
Salzgehaltsänderungen 173<br />
Tab. 18: Beeinträchtigung der „Ästuarien (EU-Code 1130) 175<br />
Tab. 19: Beeinträchtigung des „Vegetationsfreien Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatts (EU-<br />
Code 1140) 186<br />
Tab. 20: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1140 188
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 5<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 21: Beeinträchtigung der „Strandseen der Küste (EU-Code 1150*) 190<br />
Tab. 22: Empfindlichkeit von Makrophytenarten des Freesendorfer Sees gegenüber<br />
Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen 194<br />
Tab. 23: Beeinträchtigung der „Flachen großen Meeresarme <strong>und</strong> –buchten<br />
(Flachwasserzonen)“ (EU-Code 1160) 195<br />
Tab. 24: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1160 198<br />
Tab. 25: Beeinträchtigung der „Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen<br />
Arten (EU-Code 1210) 207<br />
Tab. 26: Beeinträchtigung der „Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit<br />
Vegetation (EU-Code 1230)“ 210<br />
Tab. 27: Beeinträchtigung der „Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen<br />
Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt) (EU-Code 1310) 212<br />
Tab. 28: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 1310 214<br />
Tab. 29: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 1310 214<br />
Tab. 30: Beeinträchtigung des „Salzgrünlands des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit<br />
Salzschwadenrasen (EU-Code 1330) 215<br />
Tab. 31: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 1330 217<br />
Tab. 32: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 1330 217<br />
Tab. 33: Beeinträchtigung der „Primärdünen (EU-Code 2110) 218<br />
Tab. 34: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2110 219<br />
Tab. 35: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2110 220<br />
Tab. 36: Beeinträchtigung der „Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120) 220<br />
Tab. 37: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2120 222<br />
Tab. 38: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2120 223<br />
Tab. 39: Beeinträchtigung der „Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation (EU-<br />
Code 2130*) 224<br />
Tab. 40: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2130 226<br />
Tab. 41: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2130 226<br />
Tab. 42: Beeinträchtigung der „Bewaldeten Küstendünen der atlantischen, kontinentalen<br />
<strong>und</strong> borealen Region (EU-Code 2180) 227<br />
Tab. 43: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für die Bestände des LRT<br />
2180 auf Nord-Usedom <strong>und</strong> dem Ruden 228<br />
Tab. 44: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2180 232<br />
Tab. 45: Beeinträchtigung der „Feuchten Dünentäler (EU-Code 2190)“ 232<br />
Tab. 46: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2190 234<br />
Tab. 47: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2190 234<br />
Tab. 48: Beeinträchtigung der „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ<br />
Magnopotamion oder Hydrocharition (EU-Code 3150)“ 235
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 6<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 49: Beeinträchtigung der „Artenreichen Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan auf<br />
dem europäischen Festland)“ (EU-Code 6230*) 237<br />
Tab. 50: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 6230* 239<br />
Tab. 51: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 6230 240<br />
Tab. 52: Beeinträchtigung der „Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong><br />
Lehmboden (EU-Code 6410)“ 240<br />
Tab. 53: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 6410 242<br />
Tab. 54: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 6410 242<br />
Tab. 55: Beeinträchtigung der „Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (EU-Code 7140)“ 243<br />
Tab. 56: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 7140* 244<br />
Tab. 57: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 7140 245<br />
Tab. 58: Beeinträchtigung der „Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code<br />
9110)“ 245<br />
Tab. 59: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 9110* 247<br />
Tab. 60: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 9110 247<br />
Tab. 61: Beeinträchtigung der „Alten bodensauren Eichenwälder mit Quercus robur auf<br />
Sandebenen (EU-Code 9190) 248<br />
Tab. 62: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 9190 249<br />
Tab. 63: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 9190 250<br />
Tab. 64: Beeinträchtigungen der Kegelrobbe (Halichoerus grypus) 250<br />
Tab. 65: Beeinträchtigungen des Seeh<strong>und</strong>s (Phoca vitulina) 252<br />
Tab. 66: Beeinträchtigungen des Fischotters (Lutra lutra) 254<br />
Tab. 67: Beeinträchtigungen der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318) 256<br />
Tab. 68: Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs (Myotis myotis) (EU-Code1324) 258<br />
Tab. 69: Beeinträchtigungen des Meerneunauges (Petromyzon marinus) <strong>und</strong> des<br />
Flussneunauges (Lampetra fluviatilis) 260<br />
Tab. 70: Beeinträchtigungen des Rapfens (Aspius aspius) 262<br />
Tab. 71: Beeinträchtigungen des Atlantischen Störs (Acipenser sturio) 264<br />
Tab. 72: Beeinträchtigungen der Finte (Alosa fallax) 267<br />
Tab. 73: Beeinträchtigungen des Bitterlings (Rhodeus sericeus) 269<br />
Tab. 74: Beeinträchtigungen der schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) 270<br />
Tab. 75: Beeinträchtigungen der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) 271<br />
Tab. 76: Beeinträchtigungen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 273<br />
Tab. 77: Beeinträchtigungen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) 274<br />
Tab. 78: Beeinträchtigungen des Sumpfglanzkrauts (Liparis loeselii) 275<br />
Tab. 79: <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>: Räumlich <strong>und</strong> zeitliche Ausschlussfaktoren für kumulative<br />
Beeinträchtigungen durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte 280<br />
Tab. 80: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen <strong>und</strong> Salzkonzentrationsänderungen<br />
bei den Lastfällen 7 <strong>und</strong> 8 am Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) 295<br />
Tab. 81: Durch Kühlwassereinleitung betroffene Flächen <strong>und</strong> ermittelte Äquivalenzwerte<br />
(betroffene Fläche x gradueller Funktionsverlust) für den Vergleich mit dem
FROELICH & SPORBECK Inhalt - Seite 7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
lebensraumspezifischen Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner (2007B)<br />
für die Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8 298<br />
Tab. 82: Kumulative Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des FFH-<br />
Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte 301<br />
Tab. 83: Zusammenfassung der Beurteilung der kumulativen Beeinträchtigungen von<br />
Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte 303<br />
Tab. 84: Zusammenfassung der vorhabensbedingten <strong>und</strong> kumulativen<br />
Beeinträchtigungen der maßgeblichen Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des<br />
Schutzgebietes sowie der evtl. notwendigen „Maßnahmen zur<br />
Schadensbegrenzung“ 306<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Abb. 1: FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom" (DE 1747-301) 6<br />
Abb. 2: 3D-Darstellung des geplanten Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerkes <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> 29<br />
Abb. 3: Phytoplanktonkohlenstoff-Konzentrationen am Einleitpunkt im IST-Zustand <strong>und</strong><br />
unter Kühlwassereinfluss (Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12). Daten: TÜV Nord 2011, eigene<br />
Darstellung 146<br />
Abb. 4: Veränderungen des Chlorophyll-a Gehalts unter Kühlwassereinfluss (Lastfälle<br />
11 <strong>und</strong> 12, Monat April) 147<br />
Abb. 5: Wirkzonen der Kühlwassereinleitung (Enveloppe aus Lastfall 7 <strong>und</strong> 8,<br />
Buckmann 2011) 297<br />
Anhang<br />
Anhang 1: Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-301)<br />
Anhang 2: Abschichtungstabellen zur Auswahl der prüfungsrelevanten charakteristischen Arten<br />
der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie<br />
Anhang 3: Tabellen zur Ableitung der graduellen Funktionsverluste mariner Lebensraumtypen<br />
Zugehörige Planunterlagen<br />
Karte 1: Übersichtskarte M: 1:65.000<br />
Karte 2: Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten / Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele M: 1:20.000<br />
(Detailkarten: 1:10.000/1:150.000)
FROELICH & SPORBECK Seite 1<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
1 Anlass <strong>und</strong> Aufgabenstellung, rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
1.1 Anlass <strong>und</strong> Aufgabenstellung<br />
Die <strong>EWN</strong> – ENERGIEWERKE NORD GMBH beabsichtigt, auf Flächen des B-Plans Nr. 1 „Industrie-<br />
<strong>und</strong> Gewerbegebiet <strong>Lubmin</strong>er Heide“ in der Planungshoheit des Zweckverbandes „<strong>Lubmin</strong>er<br />
Heide“, die Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung <strong>und</strong> Betrieb eines Gas- <strong>und</strong><br />
Dampfturbinenkraftwerk zu erreichen.<br />
Das Vorhabensgebiet hat eine Fläche von 13,6 ha. Darüber hinaus sind angrenzend an das<br />
Vorhabensgebiet Baustelleneinrichtungsflächen mit einer Größe von max. 17 ha ausgewiesen.<br />
Die Versiegelung durch Gebäude <strong>und</strong> Anlagen sowie Vorplätze, Umfahrungen, etc. wird ca.<br />
6,5 ha (Versiegelungsgrad 0,48) betragen <strong>und</strong> überschreitet damit die Vorgaben des Bebauungsplans<br />
Nr. 1 (GRZ 0,8) nicht.<br />
Das geplante Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> (<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>) liegt in der Nähe des FFH-<br />
Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-<br />
301), wobei der minimale Abstand zum Schutzgebiet etwa 600 Meter beträgt. Die Kühlwasserfahne<br />
des <strong>GuD</strong>-Kraftwerkes sowie sonstige Einträge aus dem Kraftwerk befinden sich innerhalb<br />
des Schutzgebietes - Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele können nicht ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Der Artikel 6, Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der<br />
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere <strong>und</strong> Pflanzen, zuletzt geändert durch<br />
RL 2006/105/EG (= Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie) bestimmt, dass Pläne <strong>und</strong> Projekte,<br />
die ein Natura 2000-Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen <strong>und</strong> Projekten<br />
erheblich beeinträchtigen können, auf die Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten<br />
Erhaltungszielen überprüft werden müssen (vgl. auch § 34 Abs. 1 des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes<br />
in der Fassung vom 1. März 2010). Im Gegensatz zum projektbezogenen<br />
Ansatz der Umweltverträglichkeitsprüfung steht bei einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)<br />
der gebietsbezogene Ansatz, das heißt im Falle eines FFH-Gebietes die Lebensraumtypen des<br />
Anhangs I <strong>und</strong> die Vorkommen der Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie,<br />
für die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes festgelegt wurden, im Vordergr<strong>und</strong>.<br />
In der vorliegenden Untersuchung wird auf der Gr<strong>und</strong>lage der vorhandenen ökologischen <strong>und</strong><br />
technischen Daten (u. a. Standard-Datenbogen zum Gebiet DE 1747-301) geprüft, ob <strong>und</strong><br />
wenn in welchem Maße das betrachtete Kraftwerk das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile<br />
des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ bzw. die Erhaltungsziele bzgl. der vorkommenden<br />
Lebensraumtypen des Anhangs I <strong>und</strong> der Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-<br />
Richtlinie beeinträchtigen kann.
FROELICH & SPORBECK Seite 2<br />
1.2 Rechtliche Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie<br />
der wildlebenden Tiere <strong>und</strong> Pflanzen, zuletzt geändert durch RL 2006/105/EG, kurz FFH-<br />
Richtlinie genannt, hat zum Ziel, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere <strong>und</strong> Pflanzen im europäischen Gebiet der<br />
Mitgliedstaaten beizutragen. Die aufgr<strong>und</strong> der Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf<br />
ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume <strong>und</strong> der wildlebenden<br />
Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen.<br />
Die aufgr<strong>und</strong> dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforderungen von<br />
Wirtschaft, Gesellschaft <strong>und</strong> Kultur sowie den regionalen <strong>und</strong> örtlichen Besonderheiten Rechnung<br />
(Art. 2 FFH-Richtlinie).<br />
Zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume <strong>und</strong> der Habitate der Arten soll aufgr<strong>und</strong> der Richtlinie<br />
ein europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura<br />
2000” errichtet werden. Dieses Netz besteht aus den von den Mitgliedsstaaten aufgr<strong>und</strong> der<br />
Vogelschutz-Richtlinie (2009/147/EG) ausgewiesenen besonderen Schutzgebieten (Art. 3 FFH-<br />
Richtlinie) sowie aus Gebieten, welche die natürlichen Lebensraumtypen des Anhanges I sowie<br />
die Habitate der Arten des Anhanges II der Richtlinie umfassen.<br />
Für die FFH-Gebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest<br />
(Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie). Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in<br />
den FFH-Gebieten die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume <strong>und</strong> der Habitate der<br />
Arten sowie Störungen von Arten, für welche die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden,<br />
insofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken<br />
könnten (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie).<br />
Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen,<br />
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder im Zusammenwirken<br />
mit anderen Plänen <strong>und</strong> Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine<br />
Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung<br />
der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung stimmen die zuständigen einzelstaatlichen<br />
Behörden dem Plan oder Projekt nur zur, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet<br />
als solches nicht beeinträchtigt wird, <strong>und</strong> nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört<br />
haben (Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie).<br />
Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden<br />
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein<br />
Plan oder ein Projekt durchzuführen <strong>und</strong> ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift<br />
der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die globale<br />
Kohärenz von „NATURA 2000” geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über<br />
die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen (Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie). Ist das betreffende<br />
Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp <strong>und</strong>/oder eine prioritäre<br />
Art einschließt <strong>und</strong> ist davon auszugehen, dass diese Lebensräume <strong>und</strong> Arten in Mitleidenschaft<br />
gezogen werden, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Ges<strong>und</strong>heit
FROELICH & SPORBECK Seite 3<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
des Menschen oder der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen<br />
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder, nach Stellungnahme der Kommission, andere<br />
zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht werden (Art. 6<br />
Abs. 4 FFH-Richtlinie, EU-KOMMISSION 2000).<br />
B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz<br />
Im B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5<br />
des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S.148). geändert worden ist, dienen die §§ 31 - 36<br />
BNatSchG dem Aufbau <strong>und</strong> dem Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“,<br />
insbesondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung <strong>und</strong> der Europäischen<br />
Vogelschutzgebiete.<br />
Demnach sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den<br />
Erhaltungszielen eines Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen<br />
Vogelschutzgebiets zu überprüfen. Ein Projekt darf trotz negativem Ergebnis der FFH-<br />
Verträglichkeitsprüfung zugelassen oder durchgeführt werden, soweit es aus zwingenden<br />
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer Art oder<br />
wirtschaftlicher Art, notwendig ist <strong>und</strong> zumutbare Alternativen nicht gegeben sind (§ 34<br />
BNatSchG).<br />
Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natürliche Lebensraumtypen oder<br />
prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen<br />
Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Ges<strong>und</strong>heit des Menschen, der öffentlichen<br />
Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung <strong>und</strong> des Schutzes der Zivilbevölkerung,<br />
oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht<br />
werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 BNatSchG können nur berücksichtigt<br />
werden, wenn die zuständige Behörde zuvor über das B<strong>und</strong>esministerium für Umwelt, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat.<br />
Naturschutzausführungsgesetz – Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V)<br />
Im Naturschutzausführungsgesetz – Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) vom 23. Februar<br />
2010, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S.<br />
383, 395), werden in § 21 Ergänzungen zu den §§ 32 bis 34 BNatSchG gegeben.<br />
In § 21 Absatz 5 NatSchAG M-V wird darauf hingewiesen, dass bei Gebieten, die bereits zu<br />
geschützten Teilen von Natur <strong>und</strong> Landschaft erklärt sind, als jeweiliger Schutzzweck auch der<br />
in der Rechtsverordnung nach den Absätzen 2 <strong>und</strong> 3 genannte Schutzzweck gilt, soweit es sich<br />
um Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete handelt.<br />
Abweichend von § 34 Absatz 1 Satz 2 des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes ergeben sich die Maßstäbe<br />
für die Verträglichkeit auch aus der Rechtsverordnung nach Absatz 2 <strong>und</strong> 3 (vgl. § 21<br />
Absatz 6 NatSchAG M-V).<br />
Nach § 21 Absatz 7 NatSchAG M-V erfolgen das Einholen der Stellungnahme der Kommission<br />
nach § 34 Absatz 4 Satz 2 des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes <strong>und</strong> die Unterrichtung der Kommission<br />
nach § 34 Absatz 5 Satz 2 des B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes durch die für die Genehmi-
FROELICH & SPORBECK Seite 4<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
gung des Projektes zuständige Genehmigungsbehörde über die fachlich zuständige oberste<br />
Landesbehörde.
FROELICH & SPORBECK Seite 5<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
2 Beschreibung des Schutzgebietes <strong>und</strong> der für seine Er-<br />
haltungsziele maßgeblichen Bestandteile<br />
2.1 Übersicht über das Schutzgebiet<br />
Das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
(DE 1747-301) weist eine Größe von 59.970 ha auf. In diesem FFH-Gebiet sind zahlreiche<br />
FFH-Gebiete bzw. Teile von Gebietsvorschlägen der Tranchen 1 bis 3 aufgegangen. Dies betrifft<br />
die früheren FFH-Vorschlagsgebiete „Insel Koos, Kooser See <strong>und</strong> Wampener Riff“<br />
(DE 1846-301), „Insel Vilm“ (DE 1647-301), „Schoritzer Wiek <strong>und</strong> Ostufer Zudar“ (DE 1746-<br />
301), „Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden, Peenestrom <strong>und</strong> Kleines Haff“ (DE 2049-301),<br />
„Wreechener See“ (DE 1646-301), „Puddeminer <strong>und</strong> Glewitzer Wiek“ (DE 1745-301), „Deviner<br />
See“ (DE 1744-302), „Gustower Wiek“ (DE 1745-302), „Wampener Wiek” (DE 1644-301) sowie<br />
die früheren Nachmelde- <strong>und</strong> Ergänzungsgebiete „Greifswalder Bodden“ (N081), „Erweiterung<br />
Peenemünde“ (E054-1), „Erweiterung Peenestrom“ (E054-3) <strong>und</strong> „Dünengebiet Nord-Usedom“<br />
(N060). Große Teile des FFH-Gebietes sind deckungsgleich mit dem Europäischen Vogelschutzgebiet<br />
„Greifswalder Bodden <strong>und</strong> südlicher Strelas<strong>und</strong>“ (DE 1747-402). Das Gebiet umfasst<br />
zentrale Teile der vorpommerschen Boddenlandschaft mit dem Greifswalder Bodden, dem<br />
südlichen Teil des Strelas<strong>und</strong>es, dem Mündungsbereich des nördlichen Peenestroms sowie<br />
zahlreichen Buchten <strong>und</strong> Wieken. Innerhalb des Gebietes liegen Küstenüberflutungsräume <strong>und</strong><br />
Küstenabschnitte mit aktuellen Prozessen der Küstendynamik. Die Abgrenzung des Schutzgebietes<br />
<strong>und</strong> die geplante Lage des Vorhabens <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> werden in der folgenden Karte dargestellt.
FROELICH & SPORBECK Seite 6<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Abb. 1: FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom"<br />
(DE 1747-301)<br />
Die folgenden nationalen Schutzgebiete liegen innerhalb bzw. zum Teil innerhalb des FFH-<br />
Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-<br />
301).<br />
� NSG „Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“ (N 1)<br />
� NSG „Lanken“ (N 39)<br />
� NSG „Insel Koos, Kooser See, Wampener Riff“ (N 250)<br />
� NSG „Kormorankolonie bei Niederhof“ (N 62)<br />
� NSG „Vogelhaken Glewitz“ (N 130)<br />
� NSG „Goor-Muglitz“ (187)<br />
� NSG „Insel Vilm“ (N 3)<br />
� NSG „Mönchgut“ (N 189)<br />
� NSG „Halbinsel Fahrenbrink“ (N 249)<br />
� NSG „Schoritzer Wiek“ (N 128)<br />
� NSG „Wreechener See“ (N 192)
FROELICH & SPORBECK Seite 7<br />
� NSG „Halbinsel Devin“ N (273)<br />
� LSG „Usedom mit Festlandsgürtel“<br />
� LSG „Mittlerer Strelas<strong>und</strong>“<br />
� LSG „Greifswalder Bodden“<br />
� Naturpark Insel Usedom<br />
� Biosphärenreservat „Südost-Rügen“<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für das NSG „Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“ wurde am 10.12.2008 eine Schutzgebietsverordnung<br />
erlassen. Bestandteil des Naturschutzgebietes sind der Struck, die Insel<br />
Ruden, die Freesendorfer Wiesen, der Peenemünder Haken sowie Teilbereiche des Greifswalder<br />
Boddens <strong>und</strong> der Ostseeküste im Landkreis Ostvorpommern. Die Vorhabensfläche liegt am<br />
Südwestrand dieses Schutzgebietes. Im Kapitel 2.2.2 wird näher auf die einzelnen Teile des<br />
NSG eingegangen. In südlicher <strong>und</strong> südöstlicher Richtung gliedert sich an das NSG das Landschaftsschutzgebiet<br />
Nr. 82 „Insel Usedom mit Festlandsgürtel“ an. Der Struck liegt auch im<br />
„Naturpark Insel Usedom“.<br />
2.2 Erhaltungsziele des Schutzgebietes<br />
2.2.1 Verwendete Quellen<br />
Als Datengr<strong>und</strong>lage für die vorliegende FFH-VU werden zum einen Gutachten herangezogen,<br />
die im Rahmen des ehemals geplanten Vorhabens Steinkohlekraftwerk Greifswald sowie des<br />
geplanten Vorhabens <strong>GuD</strong>-Kraftwerk <strong>Lubmin</strong> II erstellt wurden. Zum anderen werden die im<br />
Auftrag des Landes erstellten Kartierungen <strong>und</strong> Bewertungen der FFH-Lebensraumtypen des<br />
Schutzgebietes, die als Gr<strong>und</strong>lage für die FFH-Managementplanung dienen sollen, verwendet.<br />
Zur Ermittlung, Beschreibung <strong>und</strong> Analyse der Bestandssituation gemäß der FFH-Richtlinie,<br />
also der Lebensräume des Anhang I der FFH-Richtlinie inklusive ihrer charakteristischen Arten<br />
<strong>und</strong> der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, deren günstiger Erhaltungszustand erhalten<br />
oder wiederhergestellt werden soll, werden im Wesentlichen die folgenden Unterlagen herangezogen<br />
<strong>und</strong> ausgewertet:<br />
Lebensraumtypen des Anhangs I:<br />
Die Benennung der Lebensraumtypen richtet sich nach SSYMANK et al. (1998). Die textlich <strong>und</strong><br />
kartographisch dargestellten (vgl. Karte 2 im Anhang) FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes<br />
beziehen sich auf die im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommerns erstellte Kartierung<br />
von I.L.N. (2007). Die Abgrenzungen der marinen Lebensraumtypen werden der Kartierung von<br />
IFAÖ (2005) entnommen. Da die Ergebnisse einer aktuellen, im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
erstellten Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der Wald-Lebensraumtypen des<br />
Schutzgebietes noch nicht verfügbar sind, wurden die Wald-Lebensraumtypen des Untersuchungsgebietes<br />
2009 im Rahmen eigener Geländekartierungen erfasst (FROELICH & SPORBECK<br />
2009A). Die Ergebnisse dieser Kartierung sind in Karte 2 enthalten. Zur genaueren Beschreibung<br />
der einzelnen Lebensraumtypen werden die Ergebnisse von VOIGTLÄNDER (1999A <strong>und</strong><br />
2007) hinzugezogen.
FROELICH & SPORBECK Seite 8<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wesentliche Quellen, die für die Abgrenzung der Lebensräume verwendet werden:<br />
� INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2005): Marine FFH-Lebensraumtypen der Ostsee<br />
im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern.<br />
� I. L. N. (2007): Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes –<br />
FFH-Managementplanung für die FFH-Gebiete „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ sowie „Altwarper Binnendünen, Neuwarper See <strong>und</strong><br />
Riether Werder“. Gutachten im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur<br />
Ueckermünde.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2009A): Fachgutachten Vegetation – Wald-Lebensraumtypen der<br />
Halbinsel Struck, die Vegetation der Nordspitze Usedoms <strong>und</strong> Vorkommen des Sumpf-<br />
Glanzkrautes (Liparis loeselii) im Bereich Nord-Usedom. Greifswald.<br />
Darüber hinaus wird für verbleibende Restflächen die „Vorläufige Binnendifferenzierung der<br />
FFH-Lebensraumtypen in FFH-Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern" des LUNG aus dem<br />
Jahr 2004 herangezogen (LUNG MV 2004A).<br />
Für die Beschreibung der Lebensräume werden weiterhin folgende Quellen verwendet:<br />
� GOSSELCK, F. & J. KUBE (2004): Süß bis salzig – Marine FFH-Lebensraumtypen in der Ostsee<br />
am Beispiel des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> der Pommerschen Bucht. In: Naturmagazin,<br />
Heft 3, S. 4-9.<br />
� INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007A): Bestandsbeschreibung – Beschreibung<br />
von marin-biologischen Tätigkeiten im Raum <strong>Lubmin</strong>, Struck <strong>und</strong> Spandowerhagener<br />
Wiek – unveröff. Fachgutachten im Auftrag von FROELICH & SPORBECK Schwerin.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2009B): Fachgutachten Vegetation – Vegetationserfassung <strong>und</strong><br />
FFH-Lebensraumtypen im terrestrischen Teil des FFH-Gebietes DE 1747-301 westlich<br />
des <strong>GuD</strong> II-Standortes. Greifswald<br />
� BERG, C., DENGLER, J., ABDANK, A. & M. ISERMANN (HRSG.) (2004): Die Pflanzengesellschaften<br />
Mecklenburg-Vorpommerns <strong>und</strong> ihre Gefährdung. Herausgegeben vom Landesamt für<br />
Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern.<br />
� VOIGTLÄNDER, U. (1999A): Realnutzungs-/ Biotoptypenkartierung im Bereich der Freesendorfer<br />
Wiesen, des Struck <strong>und</strong> in Teilen der <strong>Lubmin</strong>er Heide. Erstellt im Auftrag des Büros<br />
FROELICH & SPORBECK. SALIX - Büro für Landschaftsplanung. Waren (Müritz).<br />
� VOIGTLÄNDER, U. (2007): Ergebnisse einer Nachkartierung von FFH-Lebensraumtypen im<br />
Bereich der zum FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong> <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ gehörenden Flächen der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Struck. Erstellt im Auftrag<br />
des Büros FROELICH & SPORBECK. SALIX - Kooperationsbüro für Umwelt- <strong>und</strong> Landschaftsplanung.<br />
Waren (Müritz), Oktober 2007.<br />
Arten des Anhangs II sowie charakteristische Arten:<br />
Wesentliche Quellen, die für die Ermittlung, Beschreibung <strong>und</strong> Analyse der Bestandssituation<br />
der Arten verwendet werden:
FROELICH & SPORBECK Seite 9<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� DIERSCHKE, V. (2010): Einschätzung der Bedeutung des Greifswalder Boddens im Abschnitt<br />
Ludwigsburg – <strong>Lubmin</strong> – Freest für Wasser- <strong>und</strong> Seevögel – unveröff. Fachgutachten<br />
im Auftrag von Froelich & Sporbeck, München.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2008L): Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Fledermauskartierung<br />
– Vorhabensstandort <strong>und</strong> Umfeld des geplanten Kraftwerks <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong><br />
II EnBW. Greifswald.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2008P): Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Libellenkartierung<br />
– Vorhabensstandort <strong>und</strong> ausgesuchte Probegewässer. Greifswald.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2009C): Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Reptilienkartierung<br />
– Vorhabensstandort <strong>und</strong> Umfeld des geplanten Kraftwerks <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II<br />
EnBW. Greifswald.<br />
� FROELICH & SPORBECK (2009D): Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Insekten<br />
– Offenland-Lebensraumtypen des FFH-Gebietes DE 1747-301 im Bereich Freesendorfer<br />
Wiesen, Struck <strong>und</strong> Nordspitze Usedom. Greifswald.<br />
� GOSSELCK, F. & J. KUBE (2004): Süß bis salzig – Marine FFH-Lebensraumtypen in Ostsee<br />
am Beispiel des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> der Pommerschen Bucht. In: Naturmagazin,<br />
Heft 3, S. 4-9.<br />
� HAMMER ET AL. (2009): Begutachtung der Relevanz der Auswirkung des Kühlwassers des<br />
geplanten Steinkohlekraftwerks in <strong>Lubmin</strong> auf die fischereilich genutzten marinen Fischbestände<br />
der westlichen Ostsee (Hering, Dorsch, Fl<strong>und</strong>er, Scholle, Hornhecht). Endbericht<br />
für das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt <strong>und</strong> Verbraucherschutz Mecklenburg-<br />
Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Umwelt- <strong>und</strong> Naturschutz Strals<strong>und</strong><br />
(StAUN Strals<strong>und</strong>). Johann-Heinrich von Thünen-Institut, B<strong>und</strong>esforschungsinstitut für<br />
Ländliche Räume, Wald <strong>und</strong> Fischerei/Institut für Ostseefischerei Rostock.<br />
� I.L.N. (1999A): Otterkartierung Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> Struck im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
für das <strong>GuD</strong>-Kraftwerk der VASA Energy bei <strong>Lubmin</strong>. Institut<br />
für Landschaftsökologie <strong>und</strong> Naturschutz Greifswald Juli 1999.<br />
� IFAÖ (2007A): Bestandsbeschreibung – Beschreibung von marin-biologischen Tätigkeiten<br />
im Raum <strong>Lubmin</strong>, Struck <strong>und</strong> Spandowerhagener Wiek. – unveröff. Fachgutachten im Auftrag<br />
von Froelich & Sporbeck. Schwerin.<br />
� IFAÖ (2007B): Mögliche Auswirkungen von Temperaturerhöhungen auf benthische Lebensgemeinschaften<br />
im südlichen Greifswalder Bodden (Raum <strong>Lubmin</strong>, Struck). Broderstorf.<br />
Unveröff.<br />
� IFAÖ (2008E): Darstellung der Daten- <strong>und</strong> Informationsgr<strong>und</strong>lage zum Wanderverhalten der<br />
Finte, Neunaugen <strong>und</strong> Störe im Peenestrom. Neu Broderstorf. Mai, 2008.<br />
� IFAÖ (2008I): Fischereigutachten Greifswalder Bodden. Neu Broderstorf. Mai, 2008.<br />
� IFAÖ (2009A): Auftreten von Fischlarven sowie Jung- <strong>und</strong> Kleinfischen im Bereich der modellierten<br />
Kühlwasserfahnen vor <strong>Lubmin</strong>. – unveröff. Fachgutachten im Auftrag von FROE-<br />
LICH & SPORBECK, Greifswald.<br />
Darüber hinaus wurden folgende Gutachten <strong>und</strong> Unterlagen herangezogen:
FROELICH & SPORBECK Seite 10<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� BIOM MARTSCHEI (2008): Brutvogelkartierung Baufeld Steinkohlekraftwerk Greifswald <strong>und</strong><br />
Umgebung. – unveröff. Kartendarstellung im Auftrag von FROELICH & SPORBECK.<br />
� Daten des Landschafts-Informationssystems LINFOS des Landes Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
� I.L.N. (1999C): Erfassung der Fledermäuse im Bereich des geplanten Standortes <strong>und</strong> der<br />
näheren Umgebung des <strong>GuD</strong>-Kraftwerks der VASA Energy bei <strong>Lubmin</strong>. Institut für Landschaftsökologie<br />
<strong>und</strong> Naturschutz Greifswald Juli 1999.<br />
� IFAÖ (2001A): Ichthyofauna Greifswalder Bodden, Literaturstudie, bearbeitet von Dr. R.<br />
Borchert & Dr. H. M. Winkler. Neu-Broderstorf.<br />
� IFAÖ (2001B): Voruntersuchungen für ein fischereibiologisches Monitoring im Wirkraum des<br />
<strong>GuD</strong>-Kraftwerks <strong>Lubmin</strong>, Neu-Broderstorf.<br />
� IFAÖ (2007F): Nord Stream Gas-Pipeline, Landanbindung <strong>Lubmin</strong> – Fachgutachten Brutvögel.<br />
– unveröff. Fachgutachten im Auftrag der Nord Stream AG. Broderstorf.<br />
� SCHELLER, DR. W. (2007): Selektive Brutvogelerfassung der Zielarten der Vogelschutzgebiete<br />
DE 1747-401 „Greifswalder Bodden“ bzw. Nr. 34 „Greifswalder Bodden <strong>und</strong> südlicher<br />
Strelas<strong>und</strong>“<br />
� SELLIN, D. (2003-07): Betreuungsberichte 2003-2007 zum NSG Struck, Ruden <strong>und</strong><br />
Peenemünder Haken, Teilbereich Struck <strong>und</strong> Freesendorfer Wiesen, Berichte 22 – 26, unveröff.,<br />
Greifswald.<br />
� UMWELTPLAN (2005): Netzanbindung des Offshore-Windparks Arkona-Becken Südost –<br />
Ergebnisse der Brutvogelkartierung. – unveröff. Fachgutachten im Auftrag der AWE Arkona-Windpark-Entwicklungs-GmbH.<br />
� UMWELTPLAN (2008): Anlandestation Greifswald, Untersuchungen nach § 34 (Hauptuntersuchung),<br />
FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom (DE 1747-301), Stand März 2008. – unveröff. Gutachten im Auftrag der WINGAS<br />
GmbH.<br />
Die Methodik der Bestandserfassungen ist der UVU „Bau <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerks<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>“ (FROELICH & SPORBECK 2011A) sowie den Fachgutachten zu entnehmen.<br />
Zusätzliche Datengr<strong>und</strong>lagen wurden den FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen zu anderen<br />
ehemals <strong>und</strong> aktuell geplanten Vorhaben am Standort <strong>Lubmin</strong> entnommen.<br />
Zu den hydrologischen <strong>und</strong> hydrobiologischen Untersuchungen sowie zu Stoffausträgen <strong>und</strong><br />
akustischen Auswirkungen liegen zudem Sondergutachten vor, die als Anlagen der Verträglichkeitsuntersuchung<br />
nach § 34 BNatSchG den Antragsunterlagen zum Vorhaben <strong>GuD</strong>-Kraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> beigefügt sind:<br />
� BUCKMANN, K. (IFGDV) (2011): Prognose der Ausbreitung von Kühlwasser <strong>und</strong> Sole-<br />
Spülwasser aus geplanten Betriebsansiedlungen am Industriestandort <strong>Lubmin</strong>. Untersuchung<br />
im Auftrag der <strong>EWN</strong> GmbH <strong>Lubmin</strong>, in Zusammenarbeit mit Hydromod. In der Fassung<br />
vom März 2011. Hinrichshagen.
FROELICH & SPORBECK Seite 11<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� LOBER, T. (2011A): Immissionsprognose Luftschadstoffe für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In der Fassung vom 25.03.2011. Penzlin.<br />
� LOBER, T. (2011B): Schallimmissionsprognose für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In der Fassung vom 28.03.2011. Penzlin.<br />
� LOBER, T. (2011C): Schallimmissionsprognose für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> - Gesamtlärmbetrachtung zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. In der Fassung<br />
vom 21.03.2011. Penzlin.<br />
� LOBER, T. (2011D): Ermittlung der Schornsteinhöhe für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>, in der Fassung vom 21.03.2011. Penzlin.<br />
� LOBER, T. (2011E): Immissionsprognose Schwefel- <strong>und</strong> Stickstoffdepositionen für das Gas-<br />
<strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In der Fassung vom 04.04 2011. Penzlin.<br />
� TÜV NORD GMBH (2011): Auswirkungen der Einleitung von Kühlwasser am Standort <strong>Lubmin</strong><br />
in den Greifswalder Bodden auf dessen Hydrochemie <strong>und</strong> Phytoplanktonproduktion.<br />
Erweiterter Entwurf vom 04.01.2011.<br />
Die hydrographisch-hydrodynamischen Untersuchungen als Gr<strong>und</strong>lage einer Wirkkettenbetrachtung,<br />
bei der die Auswirkungen der Veränderungen im marinen Ökosystem auf die<br />
Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten der FFH-RL sowie der charakteristischen Arten prognostiziert <strong>und</strong><br />
die daraus resultierenden Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes ermittelt werden, erstrecken<br />
sich auf ein Areal, das durch die Kühlwassereinleitung <strong>und</strong> -entnahme definiert wird. Eine Prognose<br />
der Wirkungen innerhalb dieses Areals wird mit einem hydrodynamischen 3-D-Modell<br />
ermittelt. Die durch die Kühlwassereinleitung mittelbar <strong>und</strong> unmittelbar betroffenen abiotischen<br />
<strong>und</strong> biotischen (Makrophyten, Makrozoobenthos, Fische) Kenngrößen werden untersucht. Die<br />
Ausbreitung der Kühlwasserfahnen im Greifswalder Bodden wurde von BUCKMANN (2011) anhand<br />
der aktuellen Eckwerte mit einer Kühlwassermenge von 320.000 m 3 pro St<strong>und</strong>e (gemeinsamer<br />
Betrieb der beiden <strong>GuD</strong>-Kraftwerke <strong>und</strong> des EWE Gasspeichers Moeckow) berechnet.<br />
2.2.2 Ermittlung der Erhaltungsziele<br />
Erhaltungsziele sind nach § 7 Abs. 1 Satz 9 BNatSchG die Ziele, die im Hinblick auf die Erhaltung<br />
oder Wiederherstellung (Entwicklung) eines günstigen Erhaltungszustands der in Anhang I<br />
der FFH-Richtlinie aufgeführten natürlichen Lebensräume <strong>und</strong> der in Anhang II dieser Richtlinie<br />
aufgeführten Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung<br />
vorkommen, festgelegt sind. Diese Erhaltungsziele ergeben sich im Wesentlichen aus dem<br />
Standard-Datenbogen, der für FFH-Gebiete ausgefüllt wurde. Alle im Standard-Datenbogen als<br />
signifikant, d. h. nicht in der Kategorie „D“ des Kriteriums ‘Repräsentativität’ vermerkten Lebensraumtypen<br />
des Anhangs I der FFH-Richtlinie, sind die Gr<strong>und</strong>lage für die Festlegung von Erhaltungszielen<br />
für FFH-Gebiete. Gleiches gilt für die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie in<br />
Natura 2000-Gebieten.<br />
Für das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
liegen vom Land derzeit Erhaltungsziele in Form eines Standard-Datenbogens für das Gebiet<br />
DE 1747-301 (vgl. Anhang 1) vor. Ergänzend wurden Schutz- <strong>und</strong> Entwicklungsziele für die im<br />
Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten von gemeinschaftlichem Interesse (Anhän-
FROELICH & SPORBECK Seite 12<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ge I <strong>und</strong> II der FFH-RL) dem Formblatt zur Gebietscharakterisierung zum FFH-<br />
Nachmeldegebiet „Greifswalder Bodden“ vom 07.03.2003 (UM MV 2003) entnommen.<br />
Konkretisiert auf die Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten der FFH-Richtlinie <strong>und</strong> im Hinblick auf die<br />
Errichtung eines kohärenten Netzes ergeben sich folgende Schutz- <strong>und</strong> Entwicklungsziele:<br />
Die Bewahrung <strong>und</strong> Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes für die im Gebiet vorhandenen<br />
Lebensraumtypen nach Anhang I inklusive deren charakteristischen Arten <strong>und</strong> für die<br />
Populationen <strong>und</strong> Habitate der Arten nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom<br />
21. Mai 1992 (bzw. der Änderungsrichtlinie 97/43/62/EG vom 27. Oktober 1997)<br />
(FFH-Richtlinie). Das sind insbesondere folgende Lebensraumtypen:<br />
� Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser, EU-Code 1110<br />
� Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt, EU-Code 1140<br />
� Strandseen der Küste (Lagunen), EU-Code 1150*<br />
� Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen <strong>und</strong> Seegraswiesen), EU-<br />
Code 1160<br />
� Riffe, EU-Code 1170<br />
� Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten, EU-Code 1210<br />
� Geröll- <strong>und</strong> Kiesstrände mit Vegetation aus mehrjährigen Arten, EU-Code 1220<br />
� Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels <strong>und</strong> –Steilküsten mit Vegetation, EU-Code 1230<br />
� Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwaden-Rasen, EU-Code 1330<br />
� Primärdünen, EU-Code 2110<br />
� Weißdünen mit Strandhafer, EU-Code 2120<br />
� Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation, EU-Code 2130*<br />
� Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region, EU-Code<br />
2180<br />
� Feuchte Dünentäler, EU-Code 2190<br />
� Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition,<br />
EU-Code 3150<br />
� Dystrophe Seen, EU-Code 3160<br />
� Juniperus communis-Formationen auf Zwergstrauchheiden oder Kalktrockenrasen, EU-<br />
Code 5130<br />
� Trespen-Schwingel Kalk-Trockenrasen (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit<br />
bemerkenswerten Orchideen als prioritärer FFH-LRT), EU-Code 6210 (*)<br />
� Artenreiche Borstgrasrasen submontan auf dem europäischen Festland, EU-Code 6230*<br />
� Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Molinion), EU-Code 6410
FROELICH & SPORBECK Seite 13<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe (Arrhenatherion, Brachypodio-<br />
Centaureion nemoralis), EU-Code 6510<br />
� Kalkreiche Niedermoore, EU-Code 7230<br />
� Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), EU-Code 9110<br />
� Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum), EU-Code 9130<br />
� Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum), EU-Code 9160<br />
� Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen, EU-Code 9190<br />
� Moorwälder, EU-Code 91DO*<br />
� Erlen- <strong>und</strong> Eschenwälder <strong>und</strong> Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-Padion, Alnion<br />
incanae, Salicion albae), EU-Code 91E0*<br />
(* kennzeichnet prioritäre Lebensraumtypen)<br />
<strong>und</strong> der Lebensraumfunktionen für die Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten<br />
� Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), EU-Code 1903<br />
� Fischotter (Lutra lutra), EU-Code 1355<br />
� Kegelrobbe (Halichoerus grypus), EU-Code 1364<br />
� Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina), EU-Code 1365<br />
� Großes Mausohr (Myotis myotis), EU-Code 1324<br />
� Teichfledermaus (Myotis dasycneme), EU-Code 1318<br />
� Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), EU-Code 1134<br />
� Finte (Alosa fallax), EU-Code 1103<br />
� Rapfen (Aspius aspius), EU-Code 1130<br />
� Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), EU-Code 1099<br />
� Meerneunauge (Petromyzon marinus), EU-Code 1095<br />
� Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), EU-Code 1014<br />
� Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana), EU-Code 1016<br />
� Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), EU-Code 1042<br />
� Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), EU-Code 1060<br />
Zusätzlich wurde bei den Kartierarbeiten (IFAÖ 2005) folgender, nicht im Standard-<br />
Datenbogen aufgeführter FFH-Lebensraumtyp erfasst, der aber in der vorliegenden FFH-VU<br />
dennoch aus Gründen der Verfahrenssicherheit als maßgeblicher Bestandteil des Schutzgebietes<br />
berücksichtigt wird.<br />
� Ästuarien, EU-Code 1130
FROELICH & SPORBECK Seite 14<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Darüber hinaus wurden 2007 bei der Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der FFH-Lebensraumtypen des<br />
Offenlandes (I.L.N. 2007) im detailliert untersuchten Bereich des FFH-Gebietes folgende, nicht<br />
im Standard-Datenbogen aufgeführte FFH-Lebensraumtypen festgestellt, die in der vorliegenden<br />
FFH-VU ebenfalls aus Gründen der Verfahrenssicherheit als maßgebliche Bestandteile<br />
betrachtet werden:<br />
� Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand<br />
(Queller-Watt), EU-Code 1310<br />
� Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore, EU-Code 7140<br />
Die prioritäre Art des Anhangs II<br />
� Stör (Acipenser sturio), EU-Code 1101* bzw. Acipenser oxyrinchus<br />
wurde 2007 im Rahmen eines gemeinsamen Wiederbesiedlungsprojektes von Deutschland <strong>und</strong><br />
Polen im Bereich der Oder ausgesetzt <strong>und</strong> kann somit heute auch potenziell im Untersuchungsraum<br />
vorkommen. (Anmerkung: Nach genetischen Untersuchungen ist der früher in der Ostsee<br />
vorkommende Stör mit dem Nordamerikanischen Stör (Acipenser oxyrinchus) identisch. Die Art<br />
Acipenser oxyrinchus wird daher ebenso wie die Art Acipenser sturio als Anhang II-Art behan-<br />
delt.)<br />
Im provisorischen Formblatt zur Gebietscharakterisierung zum FFH-Nachmeldegebiet „Greifswalder<br />
Bodden“ vom 07.03.2003 (UM MV 2003) sind folgende Erhaltungsziele genannt:<br />
� Erhalt von Sandbänken mit schwacher ständiger Überspülung durch Meereswasser <strong>und</strong><br />
regelmäßig trockenfallenden (Wind-) Wattflächen mit ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar<br />
insbesondere durch Vermeidung von Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie gefährdender<br />
Nutzungen (u. a. Sandabbau, Gr<strong>und</strong>schleppnetzfischerei) (1110, 1140),<br />
� Erhalt flacher großer Meeresbuchten <strong>und</strong> von vom Meeresboden aufragenden Hartsubstraten<br />
mit ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar insbesondere durch Vermeidung von<br />
Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie gefährdender Nutzungen (1160, 1170),<br />
� Erhalt von vom offenen Meer weitestgehend abgetrennten Strandseen, Lagunen <strong>und</strong> Bodden<br />
mit sporadischem oder aufgr<strong>und</strong> spezifischer geomorphologischer Verhältnisse dauerhaft<br />
geringem Einstrom von Meerwasser mit ihrem charakteristischen Arteninventar insbesondere<br />
durch Vermeidung von Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie gefährdender<br />
Nutzungen (1150*),<br />
� Erhalt von einjährigen Spülsäumen, von Geröll- <strong>und</strong> Kiesstränden mit andauernder salztoleranter<br />
nitrophiler Vegetation des Meeres mit ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar<br />
insbesondere durch Vermeidung von Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie gefährdender Nutzungen<br />
(u. a. Vertritt, Strandberäumungen) (1210, 1220),<br />
� Erhalt von Fels- <strong>und</strong> Steilküstenkomplexen der Ostseeküste mit ihrem charakteristischen<br />
Gesamtarteninventar durch Vermeidung von gefährdenden Nutzungen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
(u. a. Bebauung Küstenschutzmaßnahmen, Inanspruchnahme durch Nutzungen bis an die<br />
Abbruchkante); Besucherlenkung erforderlich (1230),<br />
� Erhalt von Salzgrünland der Ostsee mit ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar insbesondere<br />
durch Sicherung bzw. Wiederherstellung der natürlichen Überflutungsdynamik,
FROELICH & SPORBECK Seite 15<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vermeidung von Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag, Pflegenutzungsmanagement i. d. R. erforderlich<br />
(1330),<br />
� Erhalt von natürlichen <strong>und</strong> naturnahen Wäldern auf Küstendünen der Ostseeküsten <strong>und</strong><br />
ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar insbesondere durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung<br />
natürlicher Bestandsstrukturen mit hohen Altbaum- <strong>und</strong> Totholzanteilen <strong>und</strong> charakteristischem<br />
Arteninventar (2180),<br />
� Erhalt feuchter Dünentäler <strong>und</strong> ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar insbesondere<br />
durch Ausschluss von Entwässerung <strong>und</strong> Nährstoffeintrag, Besucherlenkung ggf. erforderlich<br />
(2190),<br />
� Erhalt artenreicher magerer Flachland-Mähwiesen mit charakteristischem Gesamtarteninventar<br />
insbesondere durch Fortsetzung traditioneller zweischüriger Mahd bzw. extensiver<br />
Beweidung, Ausschluss von weiteren Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen auf Niedermoorböden,<br />
keine oder geringe Düngung, ggf. sukzessionshemmende Maßnahmen (6510),<br />
� Erhalt <strong>und</strong> Förderung des charakteristischen rotbuchendominierten Baumartenspektrums<br />
<strong>und</strong> der typischen Bodenvegetation auf kalkhaltig-neutralen, mittleren bis reichen Standorten<br />
insbesondere durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung natürlicher Bestandsstrukturen mit<br />
hohen Altbaum- <strong>und</strong> Totholzanteilen <strong>und</strong> charakteristischem Arteninventar sowie von<br />
Naturverjüngung (9130),<br />
� Erhalt <strong>und</strong> Förderung (ggf. auch durch historische Nutzungsformen) des charakteristischen<br />
eichendominierten Baumartenspektrums <strong>und</strong> der typischen Bodenvegetation, insbesondere<br />
durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung natürlicher Bestandsstrukturen mit hohen Altbaum- <strong>und</strong><br />
Totholzanteilen <strong>und</strong> charakteristischem Arteninventar sowie Naturverjüngung (9190),<br />
� Erhalt des charakteristischen Baumartenspektrums <strong>und</strong> Gesamtarteninventars naturbelassener<br />
nährstoffärmer Moorstandorte mit hohen Gr<strong>und</strong>wasserständen, Erhalt oder Wiederherstellung<br />
natürlicher hydrologischer Verhältnisse sowie der Nährstoffarmut, Einrichtung<br />
von Pufferzonen, i. d. R keine forstliche Bewirtschaftung (91D0*),<br />
� Erhalt <strong>und</strong> Verbesserung der Gewässergüte <strong>und</strong> Gewässerstruktur; Sicherung bzw. Wiederherstellung<br />
der Durchgängigkeit der Gewässer für die Arten Lachs, Finte, Flussneunauge,<br />
Rapfen, Steinbeißer, Schutz der Vorkommen durch Einhaltung der Mindestmaße sowie<br />
Umsetzung der Fisch- <strong>und</strong> Laichschonbezirke <strong>und</strong> Schonzeiten,<br />
� Erhalt bzw. Wiederherstellung optimaler Lebensbedingungen für den Bitterling durch die<br />
Sicherung pflanzenreicher Uferzonen langsam fließender Gewässer mit einem sandigen<br />
Sedimentgr<strong>und</strong> (Lebensraum) <strong>und</strong> die Sicherung der Vorkommen von Großmuscheln als<br />
Voraussetzung für die Reproduktion des Bitterlings (Symbiose) Schutz der Vorkommen<br />
durch Umsetzung der Schonzeiten, Erhalt bzw. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der<br />
Gewässer,<br />
� Erhalt bzw. Wiederherstellung optimaler Lebensbedingungen für den Fischotter insbesondere<br />
durch die Sicherung nahrungsreicher, schadstoff- <strong>und</strong> störungsarmer, unverbauter, naturnaher<br />
Gewässer <strong>und</strong> Uferbereiche sowie störungs- <strong>und</strong> gefahrminimierter Wanderkorridore,<br />
� Erhalt <strong>und</strong> Wiederherstellung der Anzahl <strong>und</strong> Ausprägung der Sommerlebensräume, Überwinterungsplätze<br />
<strong>und</strong> Wanderwege des Kammmolchs insbesondere durch eine für diese
FROELICH & SPORBECK Seite 16<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Art optimale Gestaltung der Gewässer <strong>und</strong> Gewässerufer als Sommerlebensraum (u. a.<br />
Wasserstand, Trophie, Vegetationsausprägung, Beschattungsgrad) <strong>und</strong> der für die Überwinterung<br />
geeigneten Strukturelemente (u. a. Wald- <strong>und</strong> Gehölzstreifen mit Totholzstrukturen<br />
sowie Laub-, Reisig- <strong>und</strong> Lesesteinhaufen) sowie der Verbindung beider Lebensräume,<br />
� Erhalt <strong>und</strong> Wiederherstellung optimaler Lebensbedingungen für Kegelrobbe <strong>und</strong> Seeh<strong>und</strong><br />
insbesondere durch die Sicherung störungsarmer Küstengewässer, störungsfreier Block-<br />
<strong>und</strong> Sandstrände, sonstiger Uferbereiche <strong>und</strong> Sandbänke; Minimierung der Gewässerverschmutzung<br />
<strong>und</strong> von Beifängen.<br />
Für den Lebensraumtyp Ästuarien (EU-Code 1130) wird darüber hinaus gutachterlicherseits<br />
folgendes Erhaltungsziel formuliert:<br />
� Erhalt von Flussmündungen ins Meer mit regelmäßigem Brackwassereinfluss <strong>und</strong> deutlichem<br />
süßwasserbeeinflussten Wasserdurchstrom sowie ihren weitläufigen Überschwemmungsgebieten<br />
mit ihren vielfältigen Austauschfunktionen <strong>und</strong> ihrer in Teilbereichen hohen<br />
Bedeutung als Nahrungs- <strong>und</strong> Laichgebiet für Fische sowie für überwinternde Rastvögel<br />
durch Vermeidung von Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie gefährdenden Nutzungen (1130)<br />
Das FFH-Gebiet 1747-301 umfasst nahezu das gesamte Naturschutzgebiet „Peenemünder<br />
Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“, nur die Bereiche des NSG, die unmittelbar an den Industriehafen<br />
<strong>und</strong> den Einlaufkanal anschließen sind nicht Teil des FFH-Gebietes. Die Verordnung für das<br />
Naturschutzgebiet „Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“ vom 10.12.2008 ergänzt den<br />
Schutzzweck für den südöstlichen Teil des FFH-Gebietes wie folgt:<br />
1. Erhaltung <strong>und</strong> ungestörte Entwicklung ausgedehnter Flachwasserbereiche <strong>und</strong> Windwatte<br />
sowie von Strandseen <strong>und</strong> Röhrichtbeständen mit dem jeweils charakteristischen Arteninventar<br />
durch Zulassung einer ungestörten Küstendynamik <strong>und</strong> Vermeidung von Schadstoff- <strong>und</strong> Nährstoffeinträgen.<br />
2. Erhaltung großer unzerschnittener, störungsarmer Land- <strong>und</strong> Wasserflächen in naturnaher<br />
Ausprägung mit dem jeweils charakteristischen Arteninventar.<br />
3. Sicherung einer natürlichen Entwicklung von Küstenbiotopen, insbesondere von Dünen <strong>und</strong><br />
Strandwällen durch Zulassung der Küstenausgleichsprozesse.<br />
4. Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung störungsarmer, artenreicher Salzwiesen als Lebensraum einer<br />
Vielzahl gefährdeter Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten durch extensive Pflegenutzung <strong>und</strong> Sicherung der<br />
natürlichen Küstenüberflutung.<br />
5. Erhaltung artenreicher Borstgrasrasen, Sandpionierfluren, Sandmagerrasen <strong>und</strong> Wacholderheiden<br />
auf nährstoffarmen Standorten, insbesondere durch Sicherung der Nährstoffarmut <strong>und</strong><br />
extensive Pflegenutzung.<br />
6. Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung der Waldbereiche mit dem jeweils charakteristischen Arteninventar<br />
durch teilweisen Nutzungsausschluss, Fortführung historischer Bewirtschaftungsformen<br />
(Hudewälder) sowie durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung natürlicher Bestandsstrukturen.<br />
7. Erhaltung <strong>und</strong> Förderung der Ruhe <strong>und</strong> Ungestörtheit des Gebietes durch gezielte Besucherlenkung<br />
<strong>und</strong> Ausschluss gefährdender Nutzungen.<br />
8. Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung des Gesamtgebietes als Lebensraum einer Vielzahl von Tier- <strong>und</strong><br />
Pflanzenarten <strong>und</strong> mit besonderer Bedeutung als Brut-, Rast-, Mauser- <strong>und</strong> Nahrungsraum<br />
arten- <strong>und</strong> individuenreicher Vogelansammlungen.
FROELICH & SPORBECK Seite 17<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für die einzelnen Naturräume des Naturschutzgebietes, die im bzw. zum Teil im Wirkraum des<br />
Vorhabens innerhalb des FFH-Gebietes liegen, bestimmt sich der Schutzzweck wie im Folgenden<br />
beschrieben. Der Bereich des FFH-Gebietes der von den maximalen Wirkreichweiten des<br />
Vorhabens abgedeckt wird, wird als detailliert untersuchter Bereich (duB) definiert. Eine Beschreibung<br />
der Abgrenzung des duB wird in Kap. 4 gegeben:<br />
� Flachwassergebiet Freesendorfer Haken: Erhaltung eines großen Schaargebietes mit einem<br />
günstigen ökologischen Zustand von Flachwasserzonen, Sandbänken <strong>und</strong> Windwatten<br />
zur Sicherung der ökologischen Funktionalität als Laich- <strong>und</strong> Aufwuchsareal für Fische <strong>und</strong><br />
ganzjähriges Rast-, Nahrungs- <strong>und</strong> Ruhegewässer verschiedenster Vogelarten,<br />
� Flachwassergebiet Peenemünder Haken: Erhaltung eines großen, zusammenhängenden<br />
Flachwasserbereiches an der Nordspitze der Insel Usedom mit einem günstigen ökologischen<br />
Zustand von Flachwasserzonen, Sandbänken <strong>und</strong> Windwatten zur Sicherung der<br />
ökologischen Funktionalität als Sedimentationsgebiet, überregional bedeutsames Rast- <strong>und</strong><br />
Nahrungsgewässer verschiedenster Vogelarten sowie als ganzjährigen Aufenthaltsraum für<br />
Meeressäuger,<br />
� Seegebiet um die Insel Ruden: Erhaltung eines Ausschnittes einer submarinen Rifflandschaft<br />
mit einem günstigen ökologischen Zustand von Flachwasserzonen, Sandbänken <strong>und</strong><br />
Geschiebemergel-Riffen zur Sicherung der ökologischen Funktionalität als Abrasions- <strong>und</strong><br />
Sedimentationsgebiet <strong>und</strong> ganzjähriges Rast-, Nahrungs- <strong>und</strong> Ruhegewässer verschiedenster<br />
Vogelarten (von diesem Gebiet liegt nur der südliche Teil im duB),<br />
� Insel Struck <strong>und</strong> Freesendorfer Wiesen: Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung eines großflächigen,<br />
größtenteils vermoorten Anlandungsgebietes mit Salzwiesen, Borstgrasrasen, Wacholderheiden,<br />
Strandwällen, natürlichen Dünen, Strandseen, schütteren Schilf- <strong>und</strong> Großseggenbeständen<br />
sowie einem alten Birken-Eichenwald als Hudewald zur Sicherung der ökologischen<br />
Funktionalität als Standort einer spezifischen Flora, als Brut-, Rast- <strong>und</strong><br />
Nahrungsgebiet verschiedenster Vogelarten sowie als Lebensraum einer spezialisierten<br />
Wirbellosenfauna,<br />
� Insel Ruden: Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung einer kleinen Insel mit Strandwällen, natürlichen<br />
Dünen, eines Dünenkiefernwaldes als Hudewald sowie des künstlichen Riffes zur Sicherung<br />
der ökologischen Funktionalität als Brut- <strong>und</strong> Rastgebiet verschiedenster Vogelarten<br />
sowie als ganzjährigen Aufenthaltsraum für Meeressäuger,<br />
� Peenemünder Haken: Erhaltung eines ausgedehnten Strandwallsystems mit einem günstigen<br />
ökologischen Zustand von Salzwiesen, Röhrichten, natürlich bewaldeten Reffen <strong>und</strong><br />
Riegen sowie Dünenkiefernwäldern zur Sicherung der ökologischen Funktionalität, insbesondere<br />
als Standort einer an diese Bedingungen angepassten, spezifischen Flora sowie<br />
als Brut- <strong>und</strong> Nahrungsgebiet verschiedenster Vogelarten.<br />
In der Verordnung wird darauf verwiesen, dass insbesondere folgende Lebensräume <strong>und</strong> Zustände<br />
für die Zielstellungen des NSG <strong>und</strong> somit auch für die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes<br />
bedeutsam sind:<br />
1. ein gut durchlichteter Wasserkörper mit ungestörter Sedimentations- <strong>und</strong> Stoffhaushaltsdynamik,
FROELICH & SPORBECK Seite 18<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
2. eine gut ausgebildete Unterwasservegetation mit einer dort <strong>und</strong> auf dem Meeresboden reichhaltigen<br />
Tierwelt, insbesondere einer artenreichen <strong>und</strong> standorttypischen Unterwasserbodenfauna<br />
sowie einer vielfältigen Fischfauna,<br />
3. lange störungsarme Uferlinien, große unzerschnittene <strong>und</strong> störungsarme Wasserflächen,<br />
störungsarme Verlandungsbereiche, Still- <strong>und</strong> Seichtwassergebiete sowie störungsarmer Luftraum,<br />
4. Land- <strong>und</strong> Wasserflächen <strong>und</strong> Sedimente, die arm an anthropogen freigesetzten Stoffen<br />
sind,<br />
5. eine natürliche Küstendynamik in größtmöglichem Umfang zur Gewährleistung spezifischer<br />
Habitatvoraussetzungen,<br />
6. eine natürliche Überflutungsdynamik,<br />
7. Flachwasserzonen mit ausgeprägter Submersvegetation <strong>und</strong> der dazu erforderlichen Wasserqualität,<br />
8. störungsarme Flachküsten <strong>und</strong> Salz-Vegetation,<br />
9. störungsarme Sand- oder Kiesstrände,<br />
10. wüchsige Brackwasserröhrichte,<br />
11. Salzgrünlandflächen (Küstenüberflutungsmoore) mit extensiver Nutzung <strong>und</strong> funktionsfähiger<br />
Küstenüberflutung,<br />
12. bereichsweise schüttere Schilf-Röhrichte oder Großseggenbestände mit einer späten <strong>und</strong> in<br />
der Intensität angepassten Viehbeweidung ab Mitte Juni,<br />
13. Kleingewässersysteme in den Salzgrünlandflächen,<br />
14. große unzerschnittene <strong>und</strong> störungsarme Grünlandflächen,<br />
15. ein Prädatorenbestand, der einer Dichte entspricht, die insbesondere Bodenbrütern ausreichende<br />
Bruterfolgschancen lässt,<br />
16. störungsarme Wälder mit einem größtmöglichen Altholzanteil,<br />
17. insektenreiche Offenlandbereiche auf Sandböden,<br />
18. halboffene Bereiche mit einem hohen Anteil an Verbuschungszonen,<br />
19. störungsarme Moore <strong>und</strong> Sümpfe mit möglichst natürlichen Wasserständen.<br />
Entsprechend der oben genannten Verordnung dient das Naturschutzgebiet der dauerhaften<br />
Erhaltung, Pflege <strong>und</strong> Entwicklung verschiedenster Lebensräume (vgl. oben) einschließlich der<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Entwicklung des charakteristischen Arteninventars der aufgeführten Biotope. Die<br />
besondere Bedeutung als Brut-, Rast-, Mauser- <strong>und</strong> Nahrungsraum arten- <strong>und</strong> individuenreicher<br />
Vogelansammlungen wird herausgestellt.<br />
Insgesamt entsprechen die zahlreichen, in der NSG-Schutzgebietsverordnung aufgeführten<br />
Erhaltungsziele in ihrer Summe weitgehend den aufgeführten Zielen des Formblatts zur Gebietscharakterisierung<br />
zum FFH-Nachmeldegebiet „Greifswalder Bodden“ vom 07.03.2003 (UM<br />
MV 2003).
FROELICH & SPORBECK Seite 19<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
In der Verordnung vom 10. Dezember 2008 über das Landschaftsschutzgebiet „Greifswalder<br />
Bodden“ wird folgender Schutzzweck genannt: Das LSG dient der Erhaltung, Wiederherstellung<br />
<strong>und</strong> Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Nutzungs- <strong>und</strong> Regenerationsfähigkeit<br />
der Naturgüter. Die genannten Erhaltungsziele für das LSG zielen vor allem auf<br />
den Schutz <strong>und</strong> den Erhalt von Vogellebensräumen ab. In der LSG-Verordnung werden keine<br />
weiteren auf das FFH-Gebiet zu beziehenden Erhaltungsziele aufgeführt, die über die Erhaltungsziele,<br />
die in der NSG-Verordnung genannt werden, hinausgehen.<br />
2.2.3 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie<br />
Für das FFH-Gebiet sind entsprechend des Standard-Datenbogens (DE 1747-301) (vgl. Anhang<br />
1) 28 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie, davon sechs prioritäre nachgewiesen.<br />
Darüber hinaus wurden für das Schutzgebiet bei der Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der<br />
FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes (I.L.N. 2007) vier weitere LRT erfasst, die nicht im<br />
Standard-Datenbogen angegeben sind (LRT 1310, 2160, 2330 <strong>und</strong> 7140). Der Lebensraumtyp<br />
1130 (Ästuarien) ist nach BALZER et. al. (2002) ebenfalls im Schutzgebiet vertreten. In der folgenden<br />
Tabelle werden die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I<br />
aufgelistet. Für die im Standarddatenbogen (DE 1747-301) aufgeführten LRT wird ihre dort<br />
angegebene gebietsbezogene Bewertung angegeben. Eine genaue Beschreibung der im detailliert<br />
untersuchten Bereich des Vorhabens vorkommenden Lebensraumtypen erfolgt in Kapitel 4.<br />
Tab. 1: FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
EU-<br />
Code<br />
1110<br />
Lebensraumtyp nach Anhang I<br />
der FFH-Richtlinie<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger<br />
Überspülung durch Meerwasser<br />
Flächenanteil<br />
im<br />
Gebiet [%]<br />
1130 Ästuarien k. A.<br />
1140<br />
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong><br />
Mischwatt<br />
Repr.<br />
Bewertung der Vorkommen (1)<br />
Rel. Fläche<br />
EH<br />
Z<br />
Gesamt<br />
10 A C B A<br />
2 A C B A<br />
1150* Strandseen der Küste (Lagunen) 3 A B C B<br />
1160<br />
Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -<br />
buchten (Flachwasserzonen)<br />
75 A B B A<br />
1170 Riffe 3 A C B A<br />
1210<br />
1220<br />
1230<br />
Spülsäume des Meeres mit Vegetation<br />
aus einjährigen Arten<br />
Geröll- <strong>und</strong> Kiesstrände mit Vegetation<br />
aus mehrjährigen Arten<br />
Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels-<br />
<strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation<br />
1310 Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> k. A.<br />
< 1 A B B A<br />
EU-<br />
Code<br />
1330<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 20<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp nach Anhang I<br />
der FFH-Richtlinie<br />
anderen einjährigen Arten auf<br />
Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt)<br />
Salzgrünland des Atlantiks, der Nord-<br />
<strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwaden-Rasen<br />
Flächenanteil<br />
im<br />
Gebiet [%]<br />
Repr.<br />
Bewertung der Vorkommen (1)<br />
Rel. Fläche<br />
EH<br />
Z<br />
Gesamt<br />
2 A B B B<br />
2110 Primärdünen < 1 B C B C<br />
2120 Weißdünen mit Strandhafer < 1 B C C C<br />
2130*<br />
Graudünen der Küsten mit krautiger<br />
Vegetation<br />
2160 Sanddorngebüsche k. A.<br />
2180<br />
Bewaldete Küstendünen der atlantischen,<br />
kontinentalen <strong>und</strong> borealen<br />
Region<br />
< 1 B C C C<br />
< 1 B A C B<br />
2190 Feuchte Dünentäler < 1 B C B B<br />
2330<br />
3150<br />
Dünen mit offenen Grasflächen mit<br />
Corynephorus <strong>und</strong> Agrostis (Dünen im<br />
Binnenland)<br />
Natürliche eutrophe Seen mit einer<br />
Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydrocharition<br />
k. A.<br />
< 1 C C C C<br />
3160 Dystrophe Seen
EU-<br />
Code<br />
9130<br />
9160<br />
9190<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 21<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp nach Anhang I<br />
der FFH-Richtlinie<br />
Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-<br />
Fagetum)<br />
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald<br />
(Stellario-Carpinetum),<br />
Alte bodensaure Eichenwälder mit<br />
Quercus robur auf Sandebenen<br />
Flächenanteil<br />
im<br />
Gebiet [%]<br />
Repr.<br />
Bewertung der Vorkommen (1)<br />
Rel. Fläche<br />
EH<br />
Z<br />
Gesamt<br />
< 1 A C A B<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 22<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 2: Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im FFH-Gebiet<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
EU-Code Art nach Anhang II der FFH-RL Bewertung der Vorkommen (1)<br />
Säugetiere<br />
Pop.-Gr. Rel.<br />
Pop.<br />
Erh.-<br />
Zu.<br />
Isol.-<br />
Gr.<br />
1355 Fischotter (Lutra lutra) Rnz C B C C<br />
1364 Kegelrobbe (Halichoerus grypus) Vz C B B C<br />
1365 Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) Vz C B B B<br />
1318 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) C B C C<br />
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis) C B B C<br />
Fische/R<strong>und</strong>mäuler<br />
Gesamt<br />
1095 Meerneunauge (Petromyzon marinus) Pz B B C C<br />
1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) Pz C B C C<br />
1103 Finte (Alosa fallax) z D<br />
1130 Rapfen (Aspius aspius) Vz C B C C<br />
1134 Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) Pnz C B C C<br />
1101 Stör (Acipenser sturio) k. A.<br />
Wirbellose<br />
1014 Schmale Windelschnecke (Vertigo<br />
angustior)<br />
1016 Bauchige Windelschnecke (Vertigo<br />
moulinsiana)<br />
1042 Große Moosjungfer (Leucorrhinia<br />
pectoralis)<br />
Pnz C B C C<br />
Pnz C B C C<br />
Pnz C C C C<br />
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) Vnz C C A C<br />
Pflanzen<br />
1903 Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) 51-100 C C C C
FROELICH & SPORBECK Seite 23<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
EU-Code Art nach Anhang II der FFH-RL Bewertung der Vorkommen (1)<br />
Legende:<br />
* = prioritäre Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie<br />
Pop.-Gr. Rel.<br />
Pop.<br />
(1) = Bewertung nach Standard Datenbogen Nr. DE 1747-301<br />
k.A = Art ist nicht im Standard Datenbogen Nr. DE 1747-301 angegeben<br />
Erh.-<br />
Zu.<br />
Isol.-<br />
Gr.<br />
Pop.-Gr. = Populationsgröße (C= common, häufig, R= rare, selten, V = vulnerable, sehr selten, P=<br />
present, vorhanden, 1-5= Anzahl der Individuen); nz= nicht ziehend, z=ziehend<br />
Gesamt<br />
Rel.-Pop. = Relative Populationsgröße (A = > 15 %, B = 2-15 %, C = < 2 % des Bestandes im B<strong>und</strong>esland<br />
/ in der naturräuml. Haupteinheit; D = nicht signifikantes Vorkommen)<br />
Erh.-Zu. = Erhaltungszustand (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht)<br />
Isol.-Gr. = Isolierungsgrad (A = Population (beinahe) isoliert; B = Population nicht isoliert, aber am Rande<br />
des Verbreitungsgebietes; C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes;<br />
„-“ = keine Angabe)<br />
Gesamt = Gesamtbewertung (A = sehr hoher Wert, B = hoher Wert, C = mittlerer Wert des Gebietes für<br />
die Erhaltung der Art)<br />
2.3 Managementpläne/Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
Ein Managementplan für das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
Nordspitze Usedom“ (DE 1747-301) liegt derzeit nur als unveröffentlichter Entwurf vor <strong>und</strong><br />
konnte daher noch nicht als Gr<strong>und</strong>lage für die Bearbeitungen im Rahmen der FFH-VU genutzt<br />
werden.<br />
Im Auftrag des ehemaligen Staatlichen Amtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur (StAUN) Ueckermünde<br />
wurde von I.L.N. 2007 die Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes<br />
im FFH-Gebiet durchgeführt. Die Auswertung dieser Kartierung bildet eine Gr<strong>und</strong>lage für<br />
die FFH-Managementplanung im Gebiet. Bezüglich der Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der Wald-<br />
Lebensraumtypen des Schutzgebietes liegen derzeit noch keine offiziellen Ergebnisse vor, die<br />
als Gr<strong>und</strong>lage dieses Gutachtens verwendet werden könnten.<br />
2.4 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes zu anderen Natu-<br />
ra 2000-Gebieten<br />
2.4.1 Beitrag des Gebietes zur biologischen Vielfalt<br />
Das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ weist<br />
mit 28 FFH-Lebensraumtypen sowie 15 Tierarten <strong>und</strong> einer Pflanzenart des Anhangs II der<br />
FFH-Richtlinie eine sehr hohe Anzahl <strong>und</strong> Vielfalt an FFH-Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des<br />
Anhangs II auf. Laut Standard-Datenbogen beinhaltet das FFH-Gebiet den zentralen Teil der<br />
vorpommerschen Boddenlandschaft mit dem Greifswalder Bodden, dem südlichen Teil des<br />
Strelas<strong>und</strong>es, zahlreichen Buchten <strong>und</strong> Wieken, Küstenüberflutungsräumen sowie eingelagerten<br />
Inseln mit aktiven Landbildungs- <strong>und</strong> Erosionsprozessen. Repräsentative Vorkommen von
FROELICH & SPORBECK Seite 24<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
FFH-LRT <strong>und</strong> FFH-Arten, Schwerpunktvorkommen von FFH-LRT <strong>und</strong> Häufung von FFH-LRT<br />
werden im Standard-Datenbogen als Kriterien für die Güte <strong>und</strong> Bedeutung des Gebietes genannt.<br />
Darüber hinaus werden das Vorkommen von prioritären FFH-LRT <strong>und</strong> FFH-Arten sowie<br />
großflächige Komplexbildung als wertgebende Merkmale des FFH-Gebietes hervorgehoben.<br />
Insbesondere die marinen LRT weisen Schwerpunktvorkommen im Gebiet auf. Der<br />
FFH-Lebensraumtyp „Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen)“, EU-Code<br />
1160, nimmt mit 75 % den größten Teil des FFH-Gebietes ein. Auch der FFH-Lebensraumtyp<br />
„Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“, EU-Code 1110, ist<br />
mit 10 % des Schutzgebietes flächenmäßig sehr stark vertreten. Die übrigen Lebensraumtypen<br />
nehmen 3 bis < 1 % des Gebietes ein.<br />
Das FFH-Gebiet bildet den Zentralbereich des mit Abstand bedeutendsten Überwinterungsgebietes<br />
für Wasservögel im gesamten Ostseeraum (DURINCK et al. 1994), weshalb es u. a. auch<br />
als EU-Vogelschutzgebiet (SPA) gemeldet ist. Dieses gesamte Überwinterungsgebiet besteht<br />
aus einem Biotopverb<strong>und</strong> verschiedener Küstenlebensräume, der sich von der Darß-Zingster<br />
Boddenkette über die Rügenschen Boddengewässern, den Greifswalder Bodden <strong>und</strong> die<br />
Pommerschen Bucht bis zum Oderhaff erstreckt. Am Zuggeschehen der Wasservögel im Bereich<br />
des FFH-Gebietes sind mehr als 80 Arten beteiligt, von denen ca. 20 Arten zumindest<br />
zeitweise in Rastbeständen von international bedeutsamer Größe hier verweilen. Das Rast- <strong>und</strong><br />
Zuggeschehen der Wasservögel beschränkt sich überwiegend auf den küstennahen Bereich.<br />
Zeitlich konzentriert sich das Zuggeschehen während der Heimzugperiode auf den Zeitraum<br />
Mitte März bis Anfang Juni <strong>und</strong> während der Wegzugperiode auf den Zeitraum Mitte Juli bis<br />
Ende Oktober. Einige Arten nutzen den Greifswalder Bodden während der Monate Juni / Juli für<br />
die Mauser. Bedeutsam ist der Greifswalder Bodden auch für Wintergäste wie Zwerg- <strong>und</strong> Gänsesäger,<br />
Eiderente, nordische Gänse <strong>und</strong> Seeadler.<br />
2.4.2 Beziehungen zu anderen Natura 2000-Gebieten<br />
Es besteht das Erfordernis nach einer möglichst gleichmäßigen geografischen Verteilung der zu<br />
meldenden Gebiete. Durch das hier betrachtete Gebiet wird die Kohärenz der Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung entlang der Küstenlandschaft Rügens <strong>und</strong> des Greifswalder Boddens<br />
(betrifft die Nummern DE 1344-301, DE 1446-302, DE 1447-302, DE 1447-303, DE 1544-<br />
302, DE 1547-303, DE 1645-302, DE 1646-302, DE 1647-303, DE 1648-302) hergestellt. Des<br />
Weiteren bestehen Verbindungen zum angrenzenden FFH-Gebiet in der Pommerschen Bucht<br />
„Greifswalder Boddenrandschwelle <strong>und</strong> Teile der Pommerschen Bucht“ (DE 1749-302). Zu den<br />
genannten FFH-Gebieten bestehen vor allem Beziehungen über die marinen Lebensraumtypen<br />
(FFH-LRT 1110, 1140, 1150, 1160 <strong>und</strong> 1170) <strong>und</strong> über die Küsten-Lebensraumtypen wie z.B.<br />
die FFH-LRT 1210, 1220 sowie 1230. Für die Populationen der marinen Tierarten (Fisch- <strong>und</strong><br />
R<strong>und</strong>maularten, marine Säuger) bestehen Austauschmöglichkeiten zu den angrenzenden Gebieten.<br />
Der Verb<strong>und</strong> mit dem Oderästuar <strong>und</strong> der Oder über das FFH-Gebiet „Peeneunterlauf,<br />
Peenestrom, Achterwasser <strong>und</strong> Kleines Haff“ ist für die wandernden Fischarten, die Laichgebiete<br />
in Binnengewässern aufsuchen, von besonderer Bedeutung.<br />
Aus den genannten Gründen stellt das hier behandelte Gebiet einen wichtigen Baustein <strong>und</strong><br />
eine wichtige Verb<strong>und</strong>achse des kohärenten Netzes „NATURA 2000“ dar.
FROELICH & SPORBECK Seite 25<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
3 Beschreibung des Vorhabens<br />
3.1 Übersicht über das Gesamtvorhaben<br />
Die Vorhabensfläche befindet sich am Standort der <strong>EWN</strong> GmbH bzw. im westlichen Teil des<br />
Industriegebietes „Synergiepark <strong>Lubmin</strong>er Heide“. Die Anlage ist innerhalb des Geltungsbereiches<br />
des Bebauungsplans Nr. 1 „Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebiet <strong>Lubmin</strong>er Heide“ geplant. Östlich<br />
folgen unmittelbar die Flächen des ehemaligen Kernkraftwerks „Bruno Leuschner“. Weiter<br />
im Südwesten liegt das Seebad <strong>Lubmin</strong> <strong>und</strong> im Süden das Waldgebiet der <strong>Lubmin</strong>er Heide.<br />
Nördlich bzw. westlich liegt der Greifswalder Bodden. Nordöstlich des Untersuchungsraumes<br />
befinden sich die Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> weiter im Osten die Spandowerhagener Wiek.<br />
Die Siedlungsstruktur im Umland wird durch das Seebad <strong>Lubmin</strong>, welches in ca. 2 km Entfernung<br />
in westlicher Richtung zum geplanten Vorhabensstandort zu finden ist, <strong>und</strong> die Ortslage<br />
Spandowerhagen, die in ca. 2 km Entfernung in östlicher Richtung zum Vorhabensstandort<br />
liegt, bestimmt. Die Hansestadt Greifswald liegt in einer Entfernung von ca. 17,5 km, die Stadt<br />
Wolgast in 11 km Entfernung. Das Umland dominieren die Waldflächen der <strong>Lubmin</strong>er Heide <strong>und</strong><br />
der Greifswalder Bodden.<br />
Der geplante Standort ist von weiteren Anlagen zur Energiegewinnung bzw. von industriellen<br />
Nutzungen des B-Plangebietes umgeben.<br />
Bei dem Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> (<strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>) der Energiewerke Nord<br />
GmbH (<strong>EWN</strong>) handelt es sich um ein Kraftwerk zur Stromerzeugung auf der Basis moderner<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinen-(<strong>GuD</strong>)-Kraftwerkstechnik. Das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> besteht insgesamt aus<br />
drei baugleichen <strong>GuD</strong>-Kraftwerksblöcken der 600-MW-Leistungsklasse. Die elektrische Gesamtleistung<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> beträgt damit r<strong>und</strong> 1.800 MW (brutto) - bezogen auf die jahresmittleren<br />
Umgebungsbedingungen.<br />
Das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> wird im ganzjährigen Betrieb eingesetzt, mit täglichen An- <strong>und</strong> Abfahren.<br />
Daraus ergibt sich ein Einsatzbereich des Kraftwerks von ca. 8.760 St<strong>und</strong>en jährlich. Der elektrische<br />
Nettowirkungsgrad beträgt bei Erdgas-Betrieb > 58 % im Jahresmittel. Die wesentlichen<br />
Anlagenparameter als Summe aller drei <strong>GuD</strong>-Kraftwerksblöcke sind in der nachfolgenden Tabelle<br />
abgebildet.<br />
Tab. 3: Wesentliche Kraftwerksparameter<br />
Einheit Erdgas-Betrieb<br />
Winter<br />
-15 °C<br />
Feuerungswärmeleistung MW 3.360 3.210<br />
Elektrische Leistung (brutto)<br />
Jahresmittel<br />
+8 °C<br />
MW ~1.900 ~1.840<br />
Kühlwasserbedarf t/h 140.000 140.000<br />
Brennstoffverbrauch t/h 230 220<br />
Folgende Anlagen sind die wesentlichen Einrichtungen des neuen Kraftwerkes:
FROELICH & SPORBECK Seite 26<br />
� die drei <strong>GuD</strong>-Blöcke, jeweils mit<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� einer einwelligen Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenanlage, angeordnet in einem eigenen, separaten<br />
Maschinenhaus<br />
� einem Abhitzekessel mit eigenem Kesselhaus (Höhe 39 m) <strong>und</strong> freistehendem Schornstein<br />
(Höhe 89 m)<br />
� den elektrischen Anlagen <strong>und</strong> einem örtlichen Leitstand, zusammen angeordnet in<br />
Schaltanlagencontainern<br />
� die Einrichtungen der Brennstoffversorgung Erdgas, überwiegend angeordnet in einem<br />
eigenen Gebäude<br />
� die Wasserversorgungs- <strong>und</strong> –aufbereitungsanlage inkl. Labor, angeordnet in einem eigenen<br />
Gebäude, sowie im Freien Bevorratungstanks für Betriebswasser (inkl. Löschwasser)<br />
sowie für vollentsalztes Wasser<br />
� Kühlwasserentnahmebauwerk mit den Einrichtungen zur Kühlwasserreinigung <strong>und</strong><br />
Kühlwassereinleitbauwerk.<br />
� Hilfskesselanlage, in Containeraufstellung<br />
� Dieselstromaggregate, jeweils angeordnet vor den Maschinenhäusern der <strong>GuD</strong>-<br />
Anlagen<br />
� die zentrale Leitwarte <strong>und</strong> Leittechnik, angeordnet in einem eigenen Gebäude, welches<br />
gleichzeitig ein Verwaltungsgebäude mit Büro-, <strong>und</strong> Sozialräumen ist<br />
� ein Gebäude für Werkstatt <strong>und</strong> Lager<br />
� 400-kV-Kabeltrasse zu einer bestehenden 400 kV-Schaltanlage<br />
� unterirdische Erdgas-Anschlussleitung an die Gasanlandestation<br />
Das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> besteht aus drei Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenanlagen <strong>und</strong> erzeugt unter Anwendung<br />
moderner Kraftwerkstechnik Strom mit höchstem Wirkungsgrad. Hauptstromerzeuger<br />
sind die hocheffizienten Gasturbinen, die ca. 2/3 der elektrischen Energie liefern. Kennzeichnend<br />
für die zum Einsatz kommende Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenanlage ist, dass Gasturbine, Generator<br />
<strong>und</strong> Dampfturbine auf einer gemeinsamen Welle angeordnet sind (Einwellenanlage).<br />
Die Gasanbindung erfolgt über eine Erdleitung, die vollständig außerhalb des FFH-Gebietes<br />
liegt.<br />
Um die Wärmeenergie der heißen Abgase aus den Gasturbinen zu nutzen <strong>und</strong> damit den Wirkungsgrad<br />
<strong>und</strong> die Brennstoffausnutzung zu erhöhen, ist jeder Gasturbine ein ungefeuerter<br />
Abhitzekessel nachgeschaltet. In den Abhitzekesseln werden die heißen Abgase zur Dampferzeugung<br />
verwendet. Durch die Dampferzeugung auf mehreren, unterschiedlichen Druckniveaus<br />
erfolgt eine optimale Ausnutzung der Gasturbinenabgaswärme. Die in den Abhitzekesseln auf<br />
r<strong>und</strong> 90°C (bei Erdgasbetrieb) abgekühlten Gasturbinenabgase werden über Schornsteine ins<br />
Freie abgeleitet. Der Solobetrieb der Gasturbinen unter Umgehung des Abhitzekessels, d. h.<br />
ohne Dampferzeugung, ist nicht vorgesehen.
FROELICH & SPORBECK Seite 27<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Eine nachgeschaltete Abgasreinigung (Sek<strong>und</strong>ärmaßnahme) ist aufgr<strong>und</strong> des zum Einsatz<br />
kommenden Brennstoffes <strong>und</strong> der Primärmaßnahmen nicht erforderlich. Der Dampf aus den<br />
Abhitzekesseln wird den mehrstufigen Dampfturbinen zugeführt <strong>und</strong> zur Stromerzeugung mit<br />
den Generatoren genutzt.<br />
Jeder <strong>GuD</strong>-Block hat einen eigenen Blocktransformator, der auf die Spannung von 400 kV<br />
transformiert. Die Ableitung der im <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> erzeugten elektrischen Energie zum überregionalen<br />
Energieversorgungsunternehmen erfolgt über eine bestehende 400-kV-Schaltanlage.<br />
Die Schaltanlage gehört nicht zum Kraftwerk. Sie ist im Eigentum des überregionalen Energieversorgungsunternehmens<br />
<strong>und</strong> wird von diesem betrieben. Die Anbindung des Kraftwerkes an<br />
die bestehende Schaltanlage erfolgt über eine 400-kV-Kabeltrasse, die als Erdleitung verlegt<br />
wird <strong>und</strong> vollständig außerhalb des FFH-Gebietes verläuft.<br />
Die Bedienung <strong>und</strong> Beobachtung des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> geschieht von einer zentralen Warte aus.<br />
In der zentralen Warte sind alle für die Bedienung, Beobachtung, Meldung <strong>und</strong> Registrierung<br />
erforderlichen Systeme, die zur Prozessführung gebraucht werden, zusammengefasst.<br />
Als Brennstoff für das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> kommt Erdgas zum Einsatz. Der Anschluss an das Erdgasnetz<br />
erfolgt über eine Gasleitung zur Gasanlandestation nördlich des Industriehafens. Die<br />
Leitung quert den Industriehafen durch bestehende Leerrohre, wird auf einer Strecke von etwa<br />
400 m parallel zum Lärmschutzwall (Lärmschutzwall <strong>und</strong> Straße) verlegt, biegt rechtwinklig in<br />
den bestehenden Waldbereich ab <strong>und</strong> schließt im nördlichen Vorhabensbereich an das Kraftwerk<br />
an. Sie verläuft vollständig unterirdisch <strong>und</strong> innerhalb des B-Plan-Gebietes Nr. 1 <strong>und</strong> außerhalb<br />
des FFH-Gebietes.<br />
Hauptabnehmer des Brennstoffs sind die drei <strong>GuD</strong>-Blöcke, d. h. deren jeweilige Gasturbine. Die<br />
Brenner der Gasturbinen sind die wesentlichen Feuerungsanlagen des Kraftwerkes. Außerdem<br />
werden noch je eine Hilfskesselanlage pro Block <strong>und</strong> die Gebäudeheizungen mit Erdgas versorgt.<br />
Des Weiteren werden geringe Mengen an Erdgas in den Erdgasvorwärmern verfeuert.<br />
Eine Versorgung der Dampferzeuger mit Brennstoff ist - mit Ausnahme des Hilfskessels – nicht<br />
erforderlich, da ungefeuerte Abhitzekessel verwendet werden.<br />
Die Abfuhr der im Kraftwerk anfallenden nicht weiter nutzbaren Abwärme erfolgt über das Kühlwassersystem.<br />
Das Kühlwassersystem des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> ist als offenes System mit Durchlaufkühlung<br />
konzipiert. Als Kühlwasser dient Wasser aus der Spandowerhagener Wiek (insgesamt<br />
max. 140.000 m³/h). Jeder <strong>GuD</strong>-Block besitzt sein eigenes, geschlossenes Wasser-<br />
Dampf-System <strong>und</strong> jeweils sein dazugehöriges unabhängiges Haupt-, Neben- <strong>und</strong> Zwischenkühlwassersystem.<br />
Die Ableitung des erzeugten Stromes zum östlich des ehemaligen KKW gelegenen Umspannwerk<br />
der 50 Hertz Transmission GmbH erfolgt über eine 400-kV Erdkabelleitung, die teilweise in<br />
einem bestehenden Kabelkanal verläuft.<br />
Die Kühlwasserentnahme erfolgt über den bestehenden, <strong>EWN</strong>-eigenen <strong>und</strong> von der <strong>EWN</strong> betriebenen<br />
Kühlwassereinlaufkanal des stillgelegten Kernkraftwerkes. Die Kühlwasserrückleitung<br />
erfolgt über das Kühlwassereinleitbauwerk in das Hafenbecken. Die Verbindung zwischen
FROELICH & SPORBECK Seite 28<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Kühlwasserentnahme bzw. -einleitbauwerk <strong>und</strong> dem Kraftwerk stellen 6 parallel laufende Rohrleitungsstränge<br />
von je ca. 630 m Länge <strong>und</strong> 2 m Breite her.<br />
Das vom Kraftwerk benötigte Betriebswasser (Trinkwasser, Sanitärwasser, Rohwasser u. a. für<br />
die Wasseraufbereitungsanlage, etc.) wird von der <strong>EWN</strong> aus dem <strong>EWN</strong> eigenem Wasserwerk<br />
Lodmannshagen zur Verfügung gestellt. Dazu wird eine Wasserleitung vom Gelände der <strong>EWN</strong><br />
zum Kraftwerksgelände gelegt. Das Wasser wird von der <strong>EWN</strong> aus vorhandenen Tiefbrunnen<br />
entnommen. Mit den vorhandenen technischen Einrichtungen der <strong>EWN</strong> zur Entnahme von<br />
Gr<strong>und</strong>wasser kann der Bedarf des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> sicher gedeckt werden.<br />
Der überwiegende Teil des Wassers geht als Betriebswasser zur Wasseraufbereitungsanlage,<br />
die zur Bereitstellung von vollentsalztem Wasser dient. Das vollentsalzte Wasser wird in erster<br />
Linie als Zusatzwasser für den Ausgleich von Wasserverlusten in den Wasser-Dampf-<br />
Kreisläufen der <strong>GuD</strong>-Blöcke gebraucht. Zur Bevorratung von vollentsalztem Wasser werden<br />
zwei Speicher (Tanks) errichtet.<br />
Im Kraftwerksbetrieb fallen insgesamt 448.833 m³ Abwasser aus Betriebsabwasser <strong>und</strong> Niederschlagswasser<br />
pro Jahr (ohne Kühlwasser) an. Diese werden entsprechend ihrer Inhaltsstoffe<br />
versickert, extern entsorgt, in die Abwasseranlage der <strong>EWN</strong> oder über das Kühlwasserbauwerk<br />
in den Industriehafen eingeleitet. Die Betriebsabwässer aus Wasseraufbereitung, Kesselabsalzung,<br />
Behälterüberläufe etc. werden entweder über das Kühlwassersystem direkt in den<br />
Greifswalder Bodden eingeleitet oder über die vorhandenen Abwasserpfade (Abwassersystem<br />
der <strong>EWN</strong> für Abwässer mit erhöhten CSB- oder Ammoniumwerten) abgeleitet. Im Bedarfsfall ist<br />
für einzelne Betriebsabwässer eine externe Entsorgung über Tankwagen vorgesehen. Sanitär-<br />
<strong>und</strong> Fäkalienabwässer werden dem <strong>EWN</strong> Abwassersystem zugeleitet.<br />
Bei Kesselentleerung (max. 150 m 3 /h, max. 300 m³/a) <strong>und</strong> Kesselabsalzung (max. 45 m³/h, ca.<br />
102.930 m³/a) fallen ca. 3-mal pro Jahr ammoniakhaltige Abwässer (max. 5 mg NH3/l) an, die in<br />
den Industriehafen <strong>und</strong> damit in den Bodden geleitet werden (vgl. Ordner 2, Kap. 11.2 der Antragsunterlagen).<br />
Daraus ergibt sich eine ammoniakhaltige Abwassermenge von 103.230 m³/a,<br />
welche teils kontinuierlich, vorwiegend jedoch diskontinuierlich über die Kühlwasserbauwerke in<br />
den Industriehafen entsorgt wird. Im Mittel werden weniger als 50 m³/h eingeleitet. Durch die<br />
gleichzeitige Kühlwassereinleitung (im Mittel 100.000 m³/h) ist von einer hohen Verdünnung der<br />
Abwässer auszugehen. Diese Verdünnung ist auch bei Kesselentleerungen, Notablässen oder<br />
Abschlämmungen gegeben, da die Einleitung in das Hafenbecken stets an die Kühlwassernutzung<br />
gekoppelt ist. Eine weitere Verdünnung ist in dem als Auslaufkanal wirkenden Industriehafen<br />
gegeben, bevor die Abwässer den Greifswalder Bodden erreichen.<br />
Auf Dachflächen <strong>und</strong> befestigten Flächen anfallende Niederschlagswässer werden über das<br />
Kühlwassersystem direkt in den Greifswalder Bodden geleitet. Eine teilweise Versickerung von<br />
unbelastetem Niederschlagswasser auf dem <strong>EWN</strong> Gelände wird realisiert. Sanitär- <strong>und</strong> Fäkalienabwasser<br />
aus dem Kraftwerk werden dem <strong>EWN</strong> Abwassersystem zugeleitet.<br />
Das im Falle eines eventuellen Brandes anfallende Löschwasser innerhalb der Gebäude wird<br />
im Kraftwerksbereich zurückgehalten, analysiert <strong>und</strong> dann auf dem jeweils notwendigen Entsorgungsweg<br />
(Ableitung, Kläranlage oder separate Entsorgung) abgegeben.
FROELICH & SPORBECK Seite 29<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Kraftwerk beinhaltet noch zusätzlich folgende Einrichtungen, die zum Teil schon im Vorhergehenden<br />
erwähnt wurden:<br />
� Druckluftanlage<br />
� Bevorratungseinrichtungen für Chemikalien<br />
� Werkstätten, Lager <strong>und</strong> Labor<br />
� Büro- <strong>und</strong> Sozialräume.<br />
Eine Übersicht über das Anlagenlayout vermittelt Abb. 2. Die Anlage wird in kompakter Bauweise<br />
errichtet. Die Maschinenhäuser sind max. 37,70 m breit <strong>und</strong> 70,40 m lang. Die höchsten<br />
Bauwerke sind ebenfalls die Maschinenhäuser mit max. 39 m sowie die Schornsteine mit<br />
89,00 m. Die Gesamtlänge eines Kraftwerksblocks beträgt ca. 137 m.<br />
Abb. 2: 3D-Darstellung des geplanten Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerkes <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong><br />
3.2 Maßnahmen zur Minderung <strong>und</strong> Vermeidung von Beeinträchti-<br />
gungen<br />
Im Laufe der Planungen zum Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> wurden verschiede-<br />
ne Lösungsmöglichkeiten sowie Minderungs- <strong>und</strong> Vermeidungsmaßnahmen geprüft, um die<br />
Umweltauswirkungen, insbesondere auch die Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten zu<br />
minimieren.<br />
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung <strong>und</strong> Minderung werden durchgeführt, um Gefährdungen<br />
von Lebensräumen nach Anhang I inklusive ihrer charakteristischen Arten <strong>und</strong> Arten nach<br />
Anhang II zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Beeinträchtigung erfolgt unter Berücksichtigung<br />
dieser Vorkehrungen.
FROELICH & SPORBECK Seite 30<br />
Beleuchtungsmanagement<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Zur Vermeidung von optischen Störungen von charakteristischen Vogel-, Fledermaus- <strong>und</strong> Insektenarten<br />
von LRT nach Anhang I erfolgt ein Beleuchtungsmanagement der Betriebsbeleuchtung.<br />
- Beschränkung der Schornsteinbeleuchtung auf die Flugsicherheitsbeleuchtung<br />
- Abschirmung von Lichtquellen (z. B. Baustellenbeleuchtung) in Richtung sensibler Räume<br />
(insbes. im FFH-Gebiet), Reduzierung des Einsatzes von Suchscheinwerfern an Baumaschinen<br />
auf das notwendige Minimum<br />
- Verwendung von Natriumdampf-Lampen zur Vermeidung einer anziehenden Wirkung der<br />
Beleuchtung auf Insekten (vgl. EISENBEIS & HASSEL 2000)<br />
Bauzeitenregelung beim Rammen<br />
Das Einbringen der Betonpfähle findet während nur einer Brutperiode statt. Durch die Maßnahme<br />
wird in erster Linie eine erhebliche Störung von besonders lärmempfindlichen Vogelarten<br />
(Sandregenpfeifer <strong>und</strong> Wachtel) vermieden. Eine Brutplatzaufgabe ist bei Durchführung der<br />
Maßnahme nur für eine Brutperiode denkbar. In der folgenden Brutperiode ist eine Wiederbesiedlung<br />
möglich. Die Rammarbeiten der Sp<strong>und</strong>wände an den Entnahme- <strong>und</strong> Einleitbauwerken<br />
wird auf die Zeit außerhalb der Brutzeit von Wachtel <strong>und</strong> Sandregenpfeifers beschränkt.<br />
Beschränkung der Kühlwasser-Einleittemperatur<br />
Die in den Industriehafen <strong>Lubmin</strong> durch das Kühlwasser eingeleiteten Wärmemenge wird auf<br />
eine Aufwärmspanne von 0,3 m/s (Empfehlung DWA 2005),<br />
2. Installation eines Grobrechens mit einer Stabweite von 80 bis 110 mm im Bereich des<br />
Einlaufkanals,<br />
3. Entnahmebauwerke mit Mittelrechen <strong>und</strong> Siebbandanlagen: Zur Gewährleistung der<br />
Passierbarkeit von Fischen ist für den Mittelrechen eine Stabweite von 40 mm vorgesehen,<br />
so dass kleinen bis mittelgroßen Fischen bis zu einer Länge von 400 mm die Passierbarkeit<br />
gewährleistet wird.
FROELICH & SPORBECK Seite 31<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
4. Installation einer Siebbandanlage mit einer Filterweite von �3 mm, so dass alle Fische<br />
mit einer Länge von �30 mm vom Kühlkreislauf ferngehalten werden. Die Siebbänder<br />
werden mit Fischbechern kombiniert, welche die Fische aus dem Entnahmewasser abgreifen<br />
<strong>und</strong> nach oben heben. Dabei erfolgt die Trennung von Fischen <strong>und</strong> Rechengut<br />
über verschiedene Spüleinrichtungen.<br />
5. Rückführung der Fische in die Spandowerhagener Wiek über einen Transportbehälter<br />
mit Hilfe von Spezialfahrzeugen mit diskontinuierlichem Transport nach Hälterung in einem<br />
Hälterungsbecken,<br />
Eine detaillierte Beschreibung der Anlage erfolgt in IMS & IBL (2010).<br />
V 2 - Vogelschutzgitter<br />
Vor dem Ansaugluftsystem am Filterhaus wird jeweils ein Vogelschutzgitter installiert, um mögliche<br />
Tierverluste (Kleinvögel <strong>und</strong> Fledermäuse mit geringer Körpergröße) durch Ansaugen zu<br />
vermeiden. Die Maschenweite des Schutzgitters beträgt 20 mm.<br />
„Best Verfügbare Techniken“<br />
Einsatz der „Best Verfügbaren Techniken“ zur Reduzierung der Schadstoff- <strong>und</strong> Schallemissionen<br />
<strong>und</strong> -immissionen.<br />
3.3 Wirkfaktoren<br />
Die von dem jetzt geplanten Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk ausgehenden Projektwirkungen, die<br />
unter Beachtung der gebietsspezifischen Funktionszusammenhänge zu negativen Auswirkungen<br />
auf das FFH-Gebiet führen können, lassen sich differenzieren in:<br />
� baubedingte Wirkungen<br />
� anlagebedingte Wirkungen<br />
� betriebsbedingte Wirkungen<br />
Unmittelbare anlagebedingte Verluste im FFH-Gebiet sind vollständig ausgeschlossen, da sich<br />
das geplante Vorhaben einschließlich Gaszuleitung, Stromableitung <strong>und</strong> Kühlwasserentnahme-<br />
<strong>und</strong> -einleitbauwerk vollständig außerhalb des FFH-Gebietes befindet. Ebenso sind baubedingte<br />
Lebensraumverluste ausgeschlossen, da das Baufeld <strong>und</strong> die Baueinrichtungsflächen außerhalb<br />
des FFH-Gebietes liegen.<br />
Während die in der Bauphase verursachten Wirkungen / Beeinträchtigungen vorübergehend<br />
sind, jedoch auch über die Bauphase hinaus längerfristig wirken können, verursacht der Betrieb<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> <strong>EWN</strong> am Standort ausschließlich dauerhafte Wirkungen<br />
/ Beeinträchtigungen.<br />
Mögliche, von dem Vorhaben ausgehende, Vorgänge bzw. Wirkfaktoren, die sich auf das<br />
Schutzgebiet auswirken können, sind nachstehend aufgelistet. Dabei handelt es sich um Arbeitshypothesen,<br />
d. h., die Nennung eines Wirkfaktors bedeutet zunächst nicht, dass dieser
FROELICH & SPORBECK Seite 32<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
tatsächlich relevant ist. Diese Frage wird abschließend in der Auswirkungsprognose im Kapitel<br />
5 geklärt.<br />
3.3.1 Baubedingte Wirkungen<br />
Mögliche baubedingte Auswirkungen resultieren normalerweise aus der zeitlich begrenzten<br />
Flächeninanspruchnahme durch u. a. die Baustelleneinrichtung, infrastrukturelle Einrichtungen,<br />
Lagerflächen, Zufahrten <strong>und</strong> Arbeitsstreifen. Da das Baufeld <strong>und</strong> die Baueinrichtungsflächen<br />
außerhalb des FFH-Gebietes liegen (s. o.), werden nachfolgend Wirkfaktoren wie Flächenverbrauch/-beanspruchung<br />
<strong>und</strong> Bodenverdichtung/-veränderung nicht weiter berücksichtigt.<br />
Die Bauzeit umfasst einen Zeitraum von 4,5 (ca. 55 Monate) Jahren. Geplant ist es, die Bauarbeiten<br />
Ende 2012/ Anfang 2013 beginnen zu lassen, im Jahr 2017 soll die Errichtung abgeschlossen<br />
sein.<br />
Als Maßnahme zur Schadensminderung <strong>und</strong> Schadensvermeidung ist die Installation einer<br />
Fischscheuchanlage am oder vor dem Einlaufkanal geplant. Eine Darstellung der Anlage ist im<br />
Gutachten IMS & IBL (2010) zu finden. Die geplante Anlage hat eine Gesamtbreite von etwa<br />
130 m <strong>und</strong> liegt vollständig innerhalb des bestehenden Einlauftrichters. Unter Berücksichtigung<br />
der Ausdehnung der Scheuchzone von mindestens 5 m sollte die Scheuchanlage z.B. in einem<br />
Viertelkreis mit einem Abstand von etwa 50 m zum Einlaufrechenbauwerk konzipiert werden.<br />
Bei der Einhaltung dieses 50 m-Abstandes, ist gewährleistet, dass die Installation der Scheuchanlage<br />
außerhalb des FFH-Gebietes liegt. Bei der Installation der kompakten akustischen<br />
Scheuchanlage kann es zu kurzzeitigen baubedingten akustischen <strong>und</strong> optischen Störungen<br />
kommen. Da die Anlage außerhalb des FFH-Gebietes liegt, können anlagebedingte Beeinträchtigungen<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Wirkfaktoren:<br />
� Lärm- <strong>und</strong> Schadstoffemissionen, Erschütterungen durch Baustellenbetrieb,<br />
� Beunruhigungen durch Baustellenbetrieb (u. a. Vibrationen),<br />
� optische Störwirkungen durch Licht <strong>und</strong> Bewegung,<br />
� temporäre Trennwirkungen / Zerschneidung von Funktionsbeziehungen,<br />
� temporäre Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung, Gr<strong>und</strong>wasserstau durch temporäre Gr<strong>und</strong>wasserhaltung,<br />
� Gefahr von Schadstoffeinträgen bei Unfällen, Anschnitt oder Freilegung von Gr<strong>und</strong>wasserleitern.<br />
Die bauzeitlichen Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen werden nach URST (2011) das großräumige<br />
Gr<strong>und</strong>swasserfließgeschehen nicht beeinträchtigen. Auswirkungen auf den Gr<strong>und</strong>wasserleiter<br />
ergeben sich lokal durch die Ausbildung eines Absenktrichters, der sich jedoch in seiner Ausdehnung<br />
auf das Gelände des B-Plangebietes <strong>und</strong> den Bereich um das Entnahmebauwerk<br />
beschränkt <strong>und</strong> damit keine empfindlichen Biotope innerhalb des FFH-Gebietes erreicht. Beein-
FROELICH & SPORBECK Seite 33<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
trächtigungen durch baubedingte Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen können daher im Vorhinein ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Wie bereits oben dargestellt wird das Risiko von Havarien (Schadstoffeinträge bei Unfällen)<br />
durch technische, bauliche <strong>und</strong> organisatorische Maßnahmen minimiert, so dass die Wahrscheinlichkeit<br />
solcher Zustände nicht bestimmungsgemäßen Betriebes äußerst gering ist. Auf<br />
eine nähere Betrachtung dieses Wirkfaktors wird daher verzichtet.<br />
3.3.2 Anlagebedingte Wirkungen<br />
Die anlagebedingten Auswirkungen resultieren aus der dauerhaften Inanspruchnahme <strong>und</strong><br />
Veränderung von Flächen/Flächennutzungen, der Versiegelung sowie den neuen Trenn-, Zerschneidungs-<br />
<strong>und</strong> Barrierewirkungen. Sie werden nach Art, Intensität <strong>und</strong> räumlicher Ausdehnung<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage der Anlagenbeschreibung aus den Unterlagen zum Genehmigungsantrag<br />
entsprechend § 4 BImSchG (vgl. Anlage 4.2 der UVU – Anlage- <strong>und</strong> Betriebsbeschreibung)<br />
ermittelt. Daraus ergibt sich folgender Bedarf an Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden: die für das Vorhaben vorgesehene<br />
Gr<strong>und</strong>stücksfläche beträgt ca. 13,6 ha. Im B-Plan sind auf den Vorhabensflächen ausschließlich<br />
Industrieflächen ausgewiesen.<br />
Die dauerhafte Flächeninanspruchnahme bezieht sich auf Baukörper, infrastrukturelle Einrichtungen<br />
(Wege, Verkehrsflächen etc.) <strong>und</strong> geplante Grün- <strong>und</strong> Freiflächen im Rahmen der Grünordnungsplanung.<br />
Da das Vorhaben vollständig <strong>und</strong> deutlich (ca. 600 m) außerhalb des FFH-<br />
Gebietes liegt (s. o.), spielen Lebensraumverluste für die Beurteilung der Auswirkungen auf das<br />
FFH-Gebiet keine Rolle. Der gleiche Sachverhalt trifft auch für mikroklimatische Effekte, beispielsweise<br />
hervorgerufen durch Gebäudebeschattung, zu.<br />
Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind nur anlagebedingten Wirkfaktoren relevant,<br />
die einen signifikanten Einfluss auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes haben können. Da<br />
die Anlage mindestens 600 m vom Schutzgebiet entfernt liegt, sind nur einzelne anlagebedingte<br />
Wirkungen wie Zerschneidung von Funktionsbeziehungen <strong>und</strong> Barrierewirkungen untersuchungsrelevant.<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgebietes durch die Gasanbindung des Kraftwerks können im<br />
Vorhinein ausgeschlossen werden, da die Zuleitung über eine Erdleitung erfolgen wird, die außerhalb<br />
des Schutzgebietes verläuft.<br />
Wirkfaktoren:<br />
Nachfolgend sind qualitativ <strong>und</strong> quantitativ erfassbare Wirkfaktoren angegeben:<br />
� Zerschneidung von Funktionsbeziehungen <strong>und</strong> Barrierewirkungen durch Biotopveränderungen<br />
(kann Wirkungen auf das Schutzgebiet haben),<br />
� Optische Störungen, Veränderung des Sichtfeldes (evtl. Meidungsverhalten)<br />
� Kollisionsrisiken an hoch aufragenden Gebäuden.
FROELICH & SPORBECK Seite 34<br />
3.3.3 Betriebsbedingte Wirkungen<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Betriebsbedingte Wirkprozesse <strong>und</strong> Beeinträchtigungen ergeben sich aus der Nutzung <strong>und</strong><br />
dem Betrieb sowie der Unterhaltung der geplanten Anlagen. Die wesentlichen betriebsbedingten<br />
Projektwirkungen werden insbesondere durch die notwendige Kühlwasserentnahme <strong>und</strong><br />
Kühl- <strong>und</strong> Abwassereinleitung auf die marinen Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL mit<br />
ihren charakteristischen Arten <strong>und</strong> die Arten des Anhangs II des Greifswalder Boddens verursacht.<br />
Wirkfaktoren:<br />
� Auswirkungen durch Schallemissionen /-immissionen,<br />
� Veränderung der marinen Biozönosen durch die Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung mit<br />
ggf. thermischen <strong>und</strong> chemischen Belastungen <strong>und</strong>/oder Austrag aquatischer Organismen<br />
sowie Veränderungen des Strömungsregimes <strong>und</strong> damit Qualitätsveränderung für FFHrelevante<br />
Lebensräume <strong>und</strong> Arten des FFH-Gebietes,<br />
� visuelle Störwirkungen (z. B. durch Licht), Beunruhigung <strong>und</strong> Barrierewirkungen, Störung<br />
weiträumiger Sichtbeziehungen<br />
� Geruchsemissionen/-immissionen,<br />
� Luftschadstoffimmissionen i. V. m. dem Kraftwerksbetrieb (Eutrophierung <strong>und</strong> Versauerung<br />
durch Luftschadstoffe),<br />
� Abwassereinleitung in den Greifswalder Bodden<br />
� Gefahr von Schadstofffreisetzungen bei evtl. Unfällen, Leckagen oder Handhabungsverlusten<br />
beim Einsatz wassergefährdender Stoffe während des Kraftwerksbetriebs,<br />
� Wärmeemissionen,<br />
� Störung weiträumiger Sichtbeziehungen <strong>und</strong> von Sichtachsen durch Schornsteinkondensate.<br />
Emissionen/ Immissionen<br />
Entsprechend § 3 Abs. 2 BImSchG werden als Immissionen alle auf Tiere, Pflanzen <strong>und</strong> Lebensräume<br />
einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme,<br />
Strahlen <strong>und</strong> ähnliche Erscheinungen betrachtet. Im Rahmen des Vorhabens sind insbesondere<br />
die betriebsbedingten Emissionen/ Immissionen von Luftschadstoffen <strong>und</strong> Lärm relevant. Der<br />
Wärmeeintrag in den Greifswalder Bodden infolge der Durchlaufkühlung wird nachfolgend gesondert<br />
betrachtet.<br />
Luftschadstoffe<br />
Betriebsbedingte Schadstoffemissionen resultieren aus der industriellen Nutzung des Kraftwerks,<br />
den Materialtransporten <strong>und</strong> Arbeitsstättenverkehren. In der Schadstoffimmissionsprognose<br />
(vgl. Anhang der UVU) werden die folgenden potenziellen Quellen berücksichtigt:<br />
� E 1-3: Betrieb der Gasturbinen (kontinuierlicher Dauerbetrieb 8760 h/a)
FROELICH & SPORBECK Seite 35<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� E 4-6: Betrieb der Hilfskessel (temporärer Betrieb beim Anfahren des Kraftwerkes)<br />
� E7: Gebäudeheizung (temporärer Betrieb)<br />
� E8: Erdgasvorwärmung (temporärer Betrieb)<br />
� E9:-11:Notstromaggregate (nur in Ausnahmefällen in Betrieb)<br />
Die bestimmende Emissions- bzw. Immissionsquelle wird der Rauchgasausstoß der Emissionsquelle<br />
E1 bis E3 sein. Die Gasturbinenabgase werden über drei, jeweils 89 m hohe Abgaskamine<br />
ins Freie abgeleitet. Diese setzen sich aus den Stoffgruppen NOx, CO, SOx <strong>und</strong> Stäuben<br />
zusammen.<br />
Folgende potenziell nachteilige Auswirkungen auf Lebensräume <strong>und</strong> Arten können durch die<br />
von der Anlage emittierten Luftschadstoffe gr<strong>und</strong>sätzlich hervorgerufen werden <strong>und</strong> sich mittelbar<br />
auf andere FFH-relevante Arten auswirken:<br />
� Veränderung der Standortbedingungen durch Nähr- <strong>und</strong> Schadstoffeinträge,<br />
� Auswirkungen auf Wachstum, Vitalität, Konkurrenzkraft, Samenproduktion <strong>und</strong> Toleranz<br />
gegenüber Stressfaktoren von Organismen,<br />
� Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung, Bestandsstruktur, das Nahrungsnetz<br />
(Folgewirkungen auf die weiteren Glieder der Nahrungskette) <strong>und</strong> die Stabilität bzw.<br />
Regulierungsmechanismen von Pflanzengemeinschaften <strong>und</strong> Ökosystemen.<br />
Der Eintrag von Stickstoffverbindungen kann eine Eutrophierung von Ökosystemen bewirken.<br />
Neben der allgemeinen Wachstumssteigerung von Pflanzen werden durch Stickstoffeinträge<br />
weitere Prozesse hervorgerufen. Nährstoffungleichgewichte, Verschiebungen in der Artenzusammensetzung<br />
aufgr<strong>und</strong> der unterschiedlichen Empfindlichkeit sowie eine Erhöhung der<br />
Stoffausträge in benachbarte Gewässer oder ins Gr<strong>und</strong>wasser (Nitrat-Belastung) können die<br />
Folgen sein. Durch den kombinierten Eintrag von Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefelverbindungen können<br />
Böden <strong>und</strong> Gewässer versauern, sofern deren Pufferkapazität erschöpft ist. In der Folge von<br />
Versauerung können Schwermetalle mobilisiert, Bodenlebewesen geschädigt, die Bodenstruktur<br />
verschlechtert <strong>und</strong> mit der Bodenlösung ins Gr<strong>und</strong>wasser oder in andere Ökosysteme ausgewaschen<br />
werden.<br />
Bei Einhaltung einschlägiger Grenz-, Richt- <strong>und</strong> Schwellenwerte für die entsprechenden Stoffe<br />
sind die beschriebenen nachteiligen Auswirkungen weitestgehend auszuschließen.<br />
Lärm<br />
Zu Lärmemissionen/ -immissionen kommt es während des Kraftwerksbaus <strong>und</strong> -betriebs, wobei<br />
Belastungen durch Schallimmissionen vorwiegend in der Bauphase durch Baumaschineneinsatz<br />
sowie An- <strong>und</strong> Abtransport von Material zu erwarten sind. Die lautesten Aktivitäten werden<br />
am Anfang der Bauphase aufgr<strong>und</strong> der Anwendung einer größeren Menge von Baumaschinen<br />
bei den Erdarbeiten <strong>und</strong> dem Rohbau der Gebäude stattfinden.<br />
Als Lärmbelastungen, die während der Betriebsphase auftreten, kommen der An- <strong>und</strong> Auslieferungsverkehr<br />
sowie interne Fahrten innerhalb des Kraftwerksgeländes (evtl. Bahntransporte
FROELICH & SPORBECK Seite 36<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
inkl. Rangierarbeiten), das Anfahren der Kessel sowie bei seltenen Betriebsstörungen die Öffnung<br />
der Sicherheitsventile in Betracht.<br />
Der vorhabensspezifische Lärm wird durch einen höheren Anteil an starken <strong>und</strong> kurzzeitigen<br />
Schallereignissen gekennzeichnet sein.<br />
Durch Schallausbreitung können potenziell die folgenden Wirkungen hervorgerufen werden:<br />
Wärme<br />
� Verlärmung von Lebensräumen FFH-relevanter Arten/ Schreckreaktionen, Beunruhigungen<br />
<strong>und</strong> Scheuchwirkung auf Individuen störungsempfindlicher Arten,<br />
� Verschiebungen im faunistischen Arteninventar soweit besonders störungsempfindliche<br />
Arten verdrängt werden,<br />
� etwaige Beeinträchtigungen von lokalen Populationen aufgr<strong>und</strong> Scheuchwirkung in der<br />
Brutphase (Prädatorendruck etc.) bei kurzfristigen Einzelschallereignissen.<br />
Die Emission bzw. Immission von Wärme tritt während der Betriebsphase des Kraftwerks auf.<br />
Relevante Änderungen der Lufttemperatur im Anlagenumfeld über das Abgas oder Strahlungs-<br />
<strong>und</strong> Kondensationsverluste sind nicht zu erwarten, da dafür die Abwärmeleistung zu gering ist.<br />
Als wesentlicher Wirkpfad der Wärmeemission bzw. -immission ist die Kühlwassereinleitung in<br />
den Bodden zu nennen. Die Abfuhr der im Kraftwerk anfallenden <strong>und</strong> am Standort nicht weiter<br />
nutzbaren Abwärme erfolgt über das Kühlwassersystem. Eine nähere Betrachtung dieses Wirkfaktors<br />
erfolgt nachfolgend (Kühlwassereinleitung).<br />
Geruch<br />
Aufgr<strong>und</strong> der baulichen Gestaltung des Brennstofflagers <strong>und</strong> der Verbrennungsanlage wird in<br />
Übereinstimmung mit vergleichbaren Anlagen davon ausgegangen, dass relevante Geruchsemissionen/-immissionen<br />
nicht zu erwarten sind.<br />
Licht<br />
Die Beleuchtung der Anlage erfolgt unter Beachtung der relevanten Sicherheitsvorschriften <strong>und</strong><br />
der betrieblichen Erfordernisse. Diese Vorgaben gelten unter Beachtung der Festlegungen der<br />
Arbeitsstättenverordnung auch für die temporäre Beleuchtung während der Bauphase.<br />
Von Lichtemissionen können optische Störwirkungen ausgehen, die:<br />
� das Kollisionsrisiko mit Gebäuden <strong>und</strong> Maschinen, insbesondere für die Avifauna, erhöhen,<br />
� Anlockwirkung auf Nachtfalter (u.a. Nahrungstiere von Fledermäusen).<br />
Erschütterungen<br />
Zu kurzeitigen Vibrationen <strong>und</strong> Erschütterungen kann es in der Bauphase kommen. Diese werden<br />
durch die Wahl der technischen Verfahren auf ein Minimum begrenzt. Signifikante Erschüt-
FROELICH & SPORBECK Seite 37<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
terungen durch den Anlagenbetrieb werden aufgr<strong>und</strong> der Errichtung nach dem diesbezüglichen<br />
Stand der Technik ausgeschlossen.<br />
Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek<br />
Die betriebsbedingte Entnahme des Kühlwassers erfolgt aus der Spandowerhagener Wiek,<br />
wobei der maximale Kühlwasserbedarf bei 140.000 m³/h liegt. In der Folgewirkung kommt es<br />
möglicherweise zu den nachstehend aufgeführten Beeinträchtigungen, die sich unmittelbar <strong>und</strong><br />
mittelbar auf FFH-relevante Arten <strong>und</strong> Lebensräume auswirken können:<br />
� Verlusten von Gewässerorganismen, wie z. B. freischwebenden Plankton <strong>und</strong> Fischen,<br />
<strong>und</strong><br />
� Eingriffen in die Nahrungspyramide,<br />
� Barrierewirkungen, die eine Behinderung des Fischzuges diadromer Arten (wandernde<br />
Arten mit regelmäßigem Lebensraumwechsel zwischen Salz- <strong>und</strong> Süßwasser) bedingen,<br />
� Regimeverschiebungen im Wasserkörper der Spandowerhagener Wiek (Nährstoff- <strong>und</strong>/<br />
oder Salzgehalt) durch Veränderung der Strömungsverhältnisse (infolge einer verstärkten<br />
Wasserzufuhr entweder aus dem Peenestrom oder Greifswalder Bodden),<br />
� Verdriftung von Sedimenten.<br />
Kühl- <strong>und</strong> Abwassereinleitung in den Greifswalder Bodden<br />
Betriebsbedingt sollen diverse Abwässer über den Industriehafen <strong>Lubmin</strong> (ehemaliger Kühlwasserauslaufkanal<br />
des stillgelegten Kernkraftwerkes) in den Greifswalder Bodden eingeleitet werden.<br />
Dazu zählen:<br />
� im Kraftwerk anfallende Betriebsabwässer (neutralisierte Abwässer aus der Wasseraufbereitung,<br />
Behälterüberläufe, Entleerungen usw.),<br />
� von befestigten Flächen anfallende Niederschlagswässer,<br />
� aus der Spandowerhagener Wiek entnommenes Kühlwasser.<br />
Die Einleitung der Betriebsabwässer (ca. 416.000 m³/a) <strong>und</strong> Niederschlagswässer<br />
(32.400 m³/a) erfolgt in Abhängigkeit von deren stofflicher Belastung. Sie werden entsprechend<br />
ihrer Inhaltsstoffe versickert, extern entsorgt, in die Abwasseranlage der <strong>EWN</strong> oder über das<br />
Kühlwasserbauwerk in den Industriehafen eingeleitet. Im Bedarfsfall ist für einzelne Betriebsabwässer<br />
eine externe Entsorgung über Tankwagen vorgesehen. Sanitär- <strong>und</strong> Fäkalienabwässer<br />
werden dem <strong>EWN</strong> Abwassersystem zugeleitet.<br />
Die Wiedereinleitung des entnommenen Kühlwassers aus der Spandowerhagener Wiek in den<br />
Industriehafen erfolgt mit einer maximalen Aufwärmspanne von ��7,0 K.<br />
Durch die stofflichen <strong>und</strong> thermischen Immissionen in den Greifswalder Bodden können unter<br />
Umständen verschiedene, miteinander in Wechselwirkung stehende Prozesse ausgelöst werden:
FROELICH & SPORBECK Seite 38<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Eutrophierung des Gewässerkörpers durch temperaturbedingte Beschleunigung von<br />
Stoffumsatz <strong>und</strong> somit Zunahme der Biomasse,<br />
� Vermehrtes Auftreten von Planktonarten mit toxischer Wirkung (Blaualgen),<br />
� Sauerstoffmangelsituationen durch thermohaline Schichtungen bei geringem Strömungsaustausch<br />
(wenig Windbewegung) <strong>und</strong> hohen Temperaturen sowie bei starkem<br />
Süß- bzw. Brackwasserabfluss (aus der Spandowerhagener Wiek),<br />
� Auswirkungen auf die Entwicklung von Organismen (Hemmung von Sprossentwicklung<br />
bei Makrophyten, verringerte Fertilität etc.),<br />
� zeitweiliges <strong>und</strong> partielles Absterben von Organismen bei Erreichen oder Überschreitung<br />
von Letalgrenzen (Temperatur, Sauerstoff, Salzgehalt),<br />
� Rückgang der regionalen typischen Biodiversität/ Veränderungen des Artenspektrums<br />
<strong>und</strong> der Dominanzstruktur der Artengemeinschaft durch Verdrängung empfindlicher Arten,<br />
� Einwandern invasiver, an die veränderten Rahmenbedingungen angepasste Arten wie<br />
z. B. Mnemiopsis leidyi,<br />
� Erhöhung des Fraßdrucks auf die Benthosfauna durch Arten, die im Winter durch das<br />
erwärmte Wasser angezogen werden,<br />
� zeitliche Dissonanzen biologischer Prozesse („biological mismatch“) wie z. B. verfrühte<br />
Laichaktivitäten/ Schlüpfen oder auch Larvenfall bei noch geringer planktischer Nahrung,<br />
� Anstieg des Botulismusrisikos,<br />
� Veränderung des Mikroklimas durch Erhöhung der Verdunstungsfahnen <strong>und</strong> der Wärmeabstrahlung<br />
in Flachwasserbereichen, bspw. erhöhte Luftfeuchte, Nebelbildung, verändertes<br />
Lufttemperaturregime (Verringerung der abkühlenden Funktion des Greifswalder<br />
Boddens).<br />
Durch betriebsbedingte Projektwirkungen können unmittelbare <strong>und</strong> mittelbare Beeinträchtigungen<br />
von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten hervorgerufen werden. Untersuchungsrelevante<br />
Wirkfaktoren sind Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung, Eintrag von Stickstoffverbindungen<br />
sowie Schadstoffimmissionen, optische Störungen sowie Lärmimmissionen durch den<br />
Betrieb des Kraftwerkes.
FROELICH & SPORBECK Seite 39<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
4 Untersuchungsraum der FFH-<br />
Verträglichkeitsuntersuchung<br />
4.1 Begründung für die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens<br />
Der Untersuchungsraum (=Referenzraum) ist der Raum, der zur Beurteilung der Auswirkungen<br />
des Vorhabens auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes herangezogen werden muss.<br />
Er umfasst das gesamte durch das Vorhaben betroffene FFH-Gebiet <strong>und</strong> darüber hinaus die<br />
Strukturen, Funktionen <strong>und</strong> funktionalen Beziehungen außerhalb des Schutzgebietes, die für<br />
einen günstigen Erhaltungszustand der relevanten Lebensraumtypen <strong>und</strong> Tierarten unerlässlich<br />
sind. Der Untersuchungsraum ist zu unterscheiden vom detailliert untersuchten Bereich<br />
(duB), mit dem der Bereich zu fassen <strong>und</strong> zu untersuchen ist, der von den maximalen Wirk-<br />
reichweiten des Vorhabens abgedeckt wird.<br />
Der in Karte 2 dargestellte detailliert untersuchte Bereich (duB) der vorliegenden FFH-VU<br />
umfasst im Hinblick auf Luftschadstoffe die Flächen des FFH-Gebietes, die in einem Kreis mit<br />
Radius von ca. 7,25 km um den Vorhabensstandort liegen. In östliche Richtung wird der duB<br />
erweitert <strong>und</strong> schließt die gesamte Nordspitze Usedoms sowie die angrenzenden Küstengewässer<br />
ein. Die Flächen der höchsten Immissionskonzentrationen sind somit im detailliert untersuchten<br />
Bereich enthalten. Für den Wirkpfad „Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge“ wird der untersuchte<br />
Bereich in der Form erweitert, dass alle von vorhabensbedingten Depositionen<br />
betroffenen Lebensraumtypen eingeschlossen sind. Diese Bereiche gehen zum Teil über die<br />
detailliert kartierten Bereiche hinaus.<br />
Abweichend davon wird für den marinen Bereich der duB so begrenzt, dass alle durch BUCK-<br />
MANN (2011) prognostizierten messbaren Änderungen eines Parameters (Temperaturänderung,<br />
Salzgehaltsänderung) innerhalb des duB liegen. Als Grenze der Nachweisbarkeit für die einzelnen<br />
Parameter werden dabei angenommen:<br />
� Temperaturänderungen � 0,2 K<br />
� Salzgehaltsänderungen � 0,5 PSU<br />
Um die Auswirkungen der Kühlwasserentnahme zu erfassen, wird der duB im marinen Bereich<br />
auf die gesamte Spandowerhagener Wiek erweitert.<br />
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Abgrenzung des duB keine starre Grenze darstellt.<br />
Sollte sich im Laufe der Untersuchung zeigen, dass bestimmte Prozesse darüber hinaus wirksam<br />
sind, erfolgt eine entsprechend erweiterte Betrachtung.<br />
Das geplante Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk liegt vollständig außerhalb des FFH-Gebietes „Greifswalder<br />
Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“. Die gesamte Kühlwasserfahne<br />
des Kraftwerkes befindet sich jedoch innerhalb des Schutzgebietes.<br />
Nach § 34 BNatSchG wird die Prüfung der Verträglichkeit eines Projektes oder Planes durch die<br />
Feststellung oder Nicht-Feststellung erheblicher Beeinträchtigungen eines Natura 2000-<br />
Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen<br />
bestimmt. Zu berücksichtigen ist, dass die maßgeblichen Bestandteile auf die Erhaltungsziele
FROELICH & SPORBECK Seite 40<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
oder den Schutzzweck zu beziehen sind, die auf Vorkommen von Lebensraumtypen sowie von<br />
FFH-relevanten Arten (Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie) mit signifikanter<br />
1 Bedeutung beruhen.<br />
Um die voraussichtlich betroffenen Erhaltungsziele feststellen zu können, werden die Empfindlichkeiten<br />
der für das Gebiet genannten Lebensraumtypen sowie der Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten<br />
des Anhangs II mit den für sie relevanten Wirkprozessen des Vorhabens verknüpft. Daraus<br />
lässt sich die Abgrenzung des vertieft zu untersuchenden Bereiches ableiten. Da die im Gebiet<br />
entsprechend des Standard-Datenbogens vorkommenden Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten unterschiedliche<br />
Empfindlichkeiten, insbesondere hinsichtlich der Beeinträchtigungen aufweisen, wurden<br />
die Untersuchungskorridore auf die hoch empfindlichen Arten abgestimmt.<br />
4.2 Datenlücken<br />
Zur Bestandsbeschreibung wurden überwiegend vorhandene Unterlagen mit unterschiedlichen<br />
Aufnahmedaten heran gezogen. Im Rahmen des ehemals geplanten Steinkohlekraftwerkes <strong>und</strong><br />
des geplanten Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerkes <strong>Lubmin</strong> II erfolgte für maßgebliche Untersuchungsbestandteile<br />
die gutachterliche Nach- bzw. Neuaufnahme des Bestandes. Die vorhandenen<br />
Daten (Kartierungen, sonstige Daten) sind somit für die Durchführung der<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung <strong>und</strong> damit für die Abschätzung der vom Projekt ausgehenden<br />
Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen inklusive ihrer charakteristischen Arten sowie der<br />
Anhang II Arten der FFH-Richtlinie, ausreichend.<br />
4.3 Beschreibung des detailliert untersuchten Bereiches<br />
Die Abgrenzung des detailliert untersuchten Bereiches wird in Kap. 4.1 beschrieben <strong>und</strong> in Karte<br />
1 <strong>und</strong> 2 dargestellt.<br />
4.3.1 Übersicht über die Landschaft, Arten <strong>und</strong> Biotope<br />
Die Boddengewässer des detailliert untersuchten Bereiches befinden sich im Süden des ca.<br />
510 km 2 umfassenden Greifswalder Boddens. Östlich der Halbinsel Struck / Freesendorfer Wiesen<br />
sind die Boddengewässer Bestandteil der Spandowerhagener Wiek.<br />
Der Greifswalder Bodden ist morphologisch reich in Becken, Untiefen, Buchten <strong>und</strong> Randseen<br />
gegliedert. Sie sind in unterschiedlichem Maße der Exposition ausgesetzt. So entsteht eine<br />
Vielfalt von Substraten, die von verschiedenen benthischen Lebensgemeinschaften besiedelt<br />
werden. Schlick- <strong>und</strong> Sandböden unterschiedlicher Körnung, Riffe <strong>und</strong> Windwatten sowie Phytalzonen<br />
wechseln oft kleinflächig miteinander ab. Die Gliederung der marinen Lebensraumtypen<br />
erfolgt u. a. auf der Basis der Substratstrukturen, des Salzgehaltes <strong>und</strong> des Makrophytenbewuchses.<br />
Die Spandowerhagener Wiek besteht aus Flachwasserzonen, die von Fahrrinnen<br />
<strong>und</strong> der Rinne zum Einlaufkanal für das Kühlwasser des ehemaligen Kernkraftwerks durchzogen<br />
sind. Bis auf einige exponierte ufernahe Gebiete sind die Substrate sehr stark schlickhaltig.<br />
1 Einstufungskategorie der Rubrik Repräsentanz bzw. Population im Standard-Datenbogen
FROELICH & SPORBECK Seite 41<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Der Meeresgr<strong>und</strong> ist an der Südküste des Greifswalder Boddens vom Spülsaum bis in etwa 2<br />
bis 3 Meter Tiefe zum Teil dicht mit submersen Blütenpflanzen <strong>und</strong> Makroalgen bedeckt. Vereinzelte<br />
Makrophytenvorkommen sind in Tiefen von 6 bis 8 m zu finden. Die Bedeckungsgrade<br />
<strong>und</strong> das Artenspektrum des Makrophytobenthos sind räumlich sehr verschieden ausgeprägt. Im<br />
Ausbreitungsbereich der Kühlwasserfahne treten die Makrophyten nicht gleichmäßig verteilt auf.<br />
Die „Hot-Spots“ der Vegetation konzentrieren sich auf den Gahlkower <strong>und</strong> den Freesendorfer<br />
Haken während in der direkten Umgebung von <strong>Lubmin</strong> nur geringe Makrophytenflächen <strong>und</strong><br />
z. T. auch Flächen ohne Makrophytenbewuchs vorkommen (HAMMER et al. 2009).<br />
Die dominierenden Pflanzenbestände des Greifswalder Boddens werden von submersen Blütenpflanzen<br />
gestellt. In den Flachwasserbereichen kommen Meer-Salde (Ruppia maritima),<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus), Teichfaden (Zannichellia palustris) vor. In den nur<br />
gering exponierten Flachwasserbereichen kommen zudem Armleuchteralgen (Chara baltica, C.<br />
canescens) vor. In exponierteren Bereichen ab 0,6 m Wassertiefe tritt das Seegras (Zostera<br />
maritima) verstärkt hinzu. Hartsubstrate sind mit Darm- (Enteromorpha compressa, E. intestinalis)<br />
<strong>und</strong> Fadenalgen (Cladophera glomerata) bewachsen.<br />
Ökologisch wertvolle, störungsarme Flachwasserzonen mit sehr geringen Tiefen sind vor allem<br />
der Halbinsel Struck / Freesendorfer Wiesen vorgelagert. Bei geeigneten Windverhältnissen<br />
fallen insbesondere die sehr niedrigen strömungsberuhigten Flachwasserzonen bis etwa 0,75 m<br />
Wassertiefe MW trocken. Die zeitweilig trockenfallenden Flächen bestehen aus Sanden mit<br />
Schlickbeimengungen <strong>und</strong> sind überwiegend vegetationslos. Sie stellen bedeutsame Nahrungshabitate<br />
dar, insbesondere für Schnepfenvögel (Limikolen). Der Freesendorfer Haken<br />
<strong>und</strong> der Seebereich bis Ruden <strong>und</strong> Peenemünder Haken sind als Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheraum für<br />
Wasservögel aller Familien, Möwen, Seeschwalben <strong>und</strong> Watvögel, einer der wichtigsten Bereiche<br />
des Greifswalder Boddens. Hier befinden sich auch Mauserplätze von Höckerschwänen.<br />
Die Tauchenten, insbesondere die Eisenten, nutzen den in diesem Bereich im Frühjahr regelmäßig<br />
in größeren Mengen anzutreffenden Heringslaich.<br />
Der Sandstrand nahe bei <strong>Lubmin</strong> wird durch einen starken Badebetrieb belastet. Aufgr<strong>und</strong> dessen<br />
fehlen hier eine Spülsaumvegetation sowie weitestgehend auch andere Pflanzen. Auf der<br />
Halbinsel Struck / Freesendorfer Wiesen befinden sich hingegen vergleichsweise störungsarme,<br />
naturnahe Sandstrände. Soweit Spülsaumvegetation vorhanden ist (insbesondere im Norden),<br />
tritt hier insbesondere Strand-Melde (Atriplex littoralis) <strong>und</strong> Meersenf (Cakile maritima) auf.<br />
Durch die künstliche Anlage von Dünen <strong>und</strong> der Strandaufspülung wurden die Spülsäume südwestlich<br />
des Industriehafens <strong>Lubmin</strong> vorübergehend wesentlich reduziert.<br />
Die Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> der Struck sind überwiegend von Salzwiesen geprägt, die im<br />
Bereich der deutschen Ostseeküste eine der bedeutendsten halophilen Grünlandflächen darstellen.<br />
In Abhängigkeit von Überflutungsdauer <strong>und</strong> Nutzungsintensität lassen sich unterschiedliche<br />
Ausprägungen der Salzwiesen feststellen. Neben weitgehend intakten Salzgrasbeständen<br />
findet sich auch verarmtes bzw. verändertes sowie versumpftes <strong>und</strong> verschilftes Salzgrasland.<br />
Im Bereich der Küstenlinie des Struck, der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Freesendorfer Sees<br />
kommen salzwasserbeeinflusste Röhrichte vor. Sie sind Teil eines Standortmosaiks aus Salzwiesen,<br />
Röhrichten <strong>und</strong> Wasserflächen. Hier befinden sich auch vergleichsweise störungsarme,<br />
naturnahe Sandstrände. Typische Dünengebüsche oder -gehölze befinden sich ausschließlich<br />
auf naturnahen Dünenabschnitten des Struck <strong>und</strong> der Freesendorfer Wiesen. Die Biotope sind
FROELICH & SPORBECK Seite 42<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
sowohl durch eine reiche Vegetationsstruktur als auch durch ein heterogenes <strong>und</strong> dynamisches<br />
Standortmosaik gekennzeichnet. Sie weisen einen hohen Strukturreichtum auf. Die Freesendorfer<br />
Wiesen <strong>und</strong> der Struck haben eine sehr hohe Bedeutung als Brutvogellebensraum. Hervorzuheben<br />
sind hier die stabile Brutpopulation der Brandgans, die Brutvorkommen von Rotschenkel<br />
<strong>und</strong> Kiebitz <strong>und</strong> das exponierte Brutvorkommen des Seeadlers.<br />
Der durch eine strukturreiche Uferlinie <strong>und</strong> Wasservegetation gekennzeichnete Freesendorfer<br />
See zählt zu den Strandseen. Dieser ist mehr oder weniger flächendeckend von submersen<br />
Makrophyten bewachsen. Der Freesendorfer See ist Nahrungsraum für Schwimmenten sowie<br />
Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheraum für Tauchenten <strong>und</strong> Säger. In den ufernahen Bereichen des<br />
Freesendorfer Sees konnte die Brandgans als Brutvogel nachgewiesen werden.<br />
Die Spandowerhagener Wiek hat eine wichtige Funktion als Nahrungsraum für Schwimmenten<br />
(u. a. Schnatterenten <strong>und</strong> Krickenten) sowie als Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheraum für Tauchenten <strong>und</strong><br />
Säger.<br />
Die Nordspitze Usedoms ist teils anthropogen stark überprägt, teilweise befinden sich dort<br />
jedoch auch große naturnahe Räume mit typischen Dünenlebensräumen. Der Westteil zum<br />
Peenestrom hin ist durch zahlreiche Spülfeldsandgebiete überformt. Der Nordwestteil wurde mit<br />
Sand überschichtet, offengehalten <strong>und</strong> als Flugplatz genutzt. Alte militärische Anlagen sind zum<br />
Teil zertrümmert über den mittleren <strong>und</strong> den Ostteil des Untersuchungsgebietes verteilt zu finden.<br />
Das gesamte Gebiet ist übersäht mit Einschlagtrichtern aus dem 2. Weltkrieg. Der Wald<br />
brannte bei dem Bombenangriff zum größten Teil ab <strong>und</strong> wuchs danach wieder neu auf bzw.<br />
wurde aufgeforstet. Die Vegetation Nordusedoms wird stark durch Oberflächensubstrate <strong>und</strong><br />
Wasserversorgung beeinflusst. In der Regel sind die Standorte gr<strong>und</strong>wassernah. Im unmittelbaren<br />
Küstenbereich ist auch der Salzeinfluss spürbar. Je nach Auflagestärke von sandigen Substraten<br />
sind jedoch schnell trockene Habitate ausgebildet. Die Substrate des Nord- <strong>und</strong> Westteiles<br />
des Gebietes werden von Moorerde <strong>und</strong> Niedermoortorfen gebildet. Zentral befindet sich<br />
Geschiebelehm. An der Ostseite dominieren Dünensande. Innerhalb des FFH-Gebietes auf<br />
Nordusedom stellen die Lebensraumtypen „Atlantische Salzwiesen“ <strong>und</strong> „Bewaldete Küstendünen“<br />
den größten Flächenanteil an den kartierten LRT-Flächen. Große Flächenanteile nimmt<br />
auch der LRT „3150- Eutrophe Seen“ ein. Bemerkenswert ist auch das Vorkommen von Übergangs-<br />
<strong>und</strong> Schwingrasenmooren (LRT 7140) auf etwa 4,5 ha.<br />
4.3.2 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie im detailliert unter-<br />
suchten Bereich<br />
Die Lage der FFH-LRT innerhalb des duB kann der Karte 2 der FFH--VU (siehe zugehörige<br />
Planunterlagen) entnommen werden. Dabei beziehen sich die dargestellten LRT im Offenlandbereich<br />
auf die Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes – FFH-<br />
Managementplanung für das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
Nordspitze Usedom“ von I.L.N. Greifswald aus dem Jahr 2007. Die Abgrenzungen der marinen<br />
Lebensraumtypen wurden aus IFAÖ (2005) entnommen, die Waldlebensraumtypen wurden von<br />
FROELICH & SPORBECK (2009A UND B) abgegrenzt. Nach Auswertung dieser vorliegenden Kartierungen<br />
kommen im detailliert untersuchten Bereich 20 Lebensraumtypen vor.
FROELICH & SPORBECK Seite 43<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
In der folgenden Tabelle sind alle im detailliert untersuchten Bereich erfassten Lebensraumtypen<br />
aufgeführt.<br />
Tab. 4: FFH-Lebensraumtypen des FFH-Gebietes im detailliert untersuchten Bereich<br />
EU-Code FFH-Lebensraumtyp (Bezeichnung nach BFN 1998a)<br />
1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser<br />
1130 Ästuarien<br />
1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt<br />
1150* Strandseen der Küste (Lagunen)<br />
1160 Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen)<br />
1210 Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten<br />
1230 Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation<br />
1310 Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt)<br />
1330 Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwaden-Rasen<br />
2110 Primärdünen)<br />
2120 Weißdünen mit Strandhafer<br />
2130* Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation<br />
2180 Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region<br />
2190 Feuchte Dünentäler<br />
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition<br />
6230* Artenreiche Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan auf dem europäischen Festland)<br />
6410 Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden<br />
7140 Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore<br />
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)<br />
9190 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen<br />
Auswahl der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen nach Anhang I<br />
Nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007A) können „als charakteristische Arten nach Art. 1 e) FFH-<br />
RL alle Arten innerhalb ihres natürlichen Areals gelten, die in den Lebensraumtypen typischer<br />
Weise, das heißt mit hoher Stetigkeit oder Frequenz vorkommen <strong>und</strong> /oder dort einen gewissen<br />
Vorkommensschwerpunkt aufweisen.“ Das BMVBS (2008) definiert die charakteristischen Arten<br />
(Art. 1 e) FFH-RL) wie folgt: Es „handelt sich um Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten, anhand derer die<br />
Ausprägung eines Lebensraums an einem konkreten Ort (<strong>und</strong> nicht nur ein Lebensraumtyp im<br />
Allgemeinen) charakterisiert wird. Die Arten müssen einen deutlichen Vorkommensschwerpunkt
FROELICH & SPORBECK Seite 44<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
im jeweiligen Lebensraumtyp aufweisen bzw. die Erhaltung ihrer Population muss unmittelbar<br />
an den Erhalt des jeweiligen Lebensraumtyps geb<strong>und</strong>en sein.“<br />
Die verwendete Auswahlmethodik für diejenigen charakteristischen Arten, die für die Fragestellungen<br />
der FFH-Verträglichkeitsprüfung relevant sind, orientiert sich an den Vorgaben aus dem<br />
"Merkblatt 19" des "Gutachten zum Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im B<strong>und</strong>esfernstraßenbau"<br />
(MIERWALD et al. 2004) <strong>und</strong> den Hinweisen des „Leitfadens zur FFH-<br />
Verträglichkeitsprüfung an B<strong>und</strong>eswasserstraßen“ (BMVBS 2008) sowie an TRAUTNER (2010).<br />
Für die Zusammenstellung der zu betrachtenden Arten wurden zunächst für die Lebensraumtypen<br />
des detailliert untersuchten Bereiches, die in den beiden folgenden Literaturquellen genannten<br />
charakteristischen Arten aufgeführt (vgl. Anhang 2).<br />
� SSYMANK et al. (1998): Das Europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. BfN-<br />
Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) <strong>und</strong> der Vogelschutz-Richtlinie<br />
(79/409/EWG). - B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.) (1998) -<br />
Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz, H. 53, Bonn-Bad Godesberg.<br />
� The Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 27, July 2007 (European<br />
Commission, DG Umwelt).<br />
Darüber hinaus wurden Arten, die bei den Kartierungen im Gebiet als besonders bedeutend<br />
eingeschätzt wurden, berücksichtigt. Da im EU-Interpretation Manual charakteristische, lebensraumtypische<br />
Arten(-gruppen) für die unterschiedlichen geographische Regionen angegeben<br />
werden, wurden aus dieser Literaturquelle nur diejenigen Arten übernommen, die für die betreffende<br />
großräumige Region, in der das Untersuchungsgebiet liegt, aufgeführt sind (z.B. Baltic<br />
Sea).<br />
Bei den Aufzählungen der typischen Arten eines LRT sind in der Literatur teilweise nur Gattungen<br />
oder auch nur Artengruppen (z. B. typische Artengemeinschaften des sandigen Sublitorals)<br />
angegeben. In einem solchen Fall wurden regional vorkommende bzw. potenziell vorkommende<br />
Arten herausgesucht, die der jeweiligen Artengruppe zugeordnet werden können.<br />
Die Abschichtung der Arten erfolgt gemäß MIERWALD et al. (2004) <strong>und</strong> BMVBS (2008) in der<br />
folgenden Weise:<br />
1. Schritt<br />
Zum Erkennen <strong>und</strong> Bewerten von Beeinträchtigungen in der FFH-VP werden unter den in der<br />
Literatur genannten charakteristischen Arten eines Lebensraums diejenigen Pflanzen- <strong>und</strong><br />
Tierarten ausgewählt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:<br />
� Die Art hat innerhalb der kontinentalen biogeographischen Region einen gewissen Verbreitungsschwerpunkt<br />
in diesem Lebensraumtyp.<br />
� Die Art ist ein typisches Element des naturnah ausgeprägten Lebensraumtyps in der<br />
Region bzw. des Naturraums.
FROELICH & SPORBECK Seite 45<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Das Vorkommen der Art deutet auf einen günstigen Erhaltungszustand der konkreten<br />
Bestände des LRT im Schutzgebiet hin. Im Schutzgebiet zeigt die Art keine Degradation<br />
des Lebensraumtyps an.<br />
Als zeitlicher Bezugsrahmen wird der Zeitraum von heute bis 1950 angesetzt, d. h. dass Art-<br />
Nachweise bis zum Jahr 1950 berücksichtigt werden. Frühere Artnachweise für das Untersuchungsgebiet<br />
sind bei der Auswahl der charakteristischen Arten nicht von Relevanz.<br />
Arten, die aus Artenschutzsicht besonders wertvoll sind (z. B. Arten des Anhangs IV, Rote Liste<br />
Arten oder Arten, für deren Erhaltung Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Verantwortlichkeit<br />
besitzt), werden dabei besonders berücksichtigt, soweit sie den oben genannten Bedingungen<br />
entsprechen.<br />
Durch die Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Fokussierung auf Arten, die für den Zustand<br />
des Lebensraums aussagefähig sind, gewährleistet. Viele der ausgewählten Arten sind<br />
Spezialisten mit enger ökologischer Amplitude, bei denen davon ausgegangen werden kann,<br />
dass sie zu den empfindlichsten Elementen der Lebensgemeinschaft gehören.<br />
Darüber hinaus werden auch weit verbreiteten Arten berücksichtigt, die eine Schlüsselfunktion<br />
im Ökosystem einnehmen, in dem sie z. B. eine wichtige Nahrungsgr<strong>und</strong>lage für andere Tierarten<br />
darstellen.<br />
Durch die hier beschriebene Auswahlmethode wird die Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse<br />
im Schutzgebiet gewährleistet <strong>und</strong> zudem das Entwicklungspotenzial des Lebensraums<br />
im Schutzgebiet berücksichtigt.<br />
2. Schritt<br />
In einem zweiten Auswahlschritt findet eine weitere Fokussierung auf diejenigen Arten statt, die<br />
im Kontext der konkreten Prüfung besonders aussagefähig sind. Die Arten, die in der FFH-VP<br />
von Relevanz sind <strong>und</strong> näher betrachtet werden sollten, müssen daher zusätzlich den folgenden<br />
Kriterien genügen:<br />
� Im Hinblick auf die Beurteilung des Erhaltungszustandes des Lebensraumtyps liefert die<br />
Art zusätzliche Informationen zu den Bearbeitungen <strong>und</strong> Bewertungen der standörtlichen<br />
Parameter.<br />
� Die ökologischen Ansprüche <strong>und</strong> Verhaltensweisen der Art sind ausreichend bekannt,<br />
so dass eine nachvollziehbare Herleitung der Erheblichkeit möglich ist.<br />
� Die Art besitzt eine aussagekräftige Empfindlichkeit für die Wirkprozesse, die vom Vorhaben<br />
ausgehen. Dabei ist die Toleranz der Art gegenüber einzelnen Wirkprozessen<br />
geringer, als die Toleranz des gesamten LRT gegenüber den Wirkprozessen.<br />
Die Auswahl der zu betrachtenden charakteristischen Arten, die eine besondere Relevanz für<br />
die Verträglichkeitsprüfung besitzen, wurde mittels einer Tabelle, in der alle Abschichtungskriterien<br />
enthalten sind, durchgeführt.
FROELICH & SPORBECK Seite 46<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im Folgenden werden die im detailliert untersuchten Bereich vorkommenden<br />
FFH-Lebensraumtypen beschrieben. Die Hauptgefährdungsfaktoren für die jeweiligen Lebensraumtypen<br />
werden genannt <strong>und</strong> das Vorkommen der LRT im FFH-Gebiet <strong>und</strong> im detailliert zu<br />
untersuchenden Bereich wird erläutert. Darüber hinaus werden für die einzelnen Lebensraumtypen<br />
charakteristische Arten beschrieben, die planungsrelevante Erkenntnisse erwarten lassen<br />
(vgl. TRAUTNER 2010). Da die vorhabensspezifische Empfindlichkeit einiger Lebensraumtypen<br />
bereits umfassend durch die Empfindlichkeit ihrer Vegetation abgebildet wird, wird bei diesen<br />
Lebensraumtypen auf die zusätzliche Auswahl von charakteristischen Tierarten verzichtet. Bei<br />
den folgenden Erläuterungen werden neben den im Standard-Datenbogen aufgeführten Lebensraumtypen<br />
(LRT) auch die zusätzlich bei den Kartierarbeiten im Jahr 2007 (I.L.N. 2007)<br />
sowie bei den Kartierungen im Jahr 2009 (FROELICH & SPORBECK 2009A <strong>und</strong> B) erfassten LRT<br />
berücksichtigt. Im marinen Bereich stützt sich die Zuordnung <strong>und</strong> Abgrenzung der Lebensraumtypen<br />
auf IFAÖ (2005: Marine FFH-Lebensraumtypen der Ostsee im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern).<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code 1110)<br />
Sandbänke sind Erhebungen des Meeresgr<strong>und</strong>es im Sublitoral, die bis dicht unter die Meeresoberfläche<br />
reichen können, aber bei Niedrigwasser nicht frei fallen. Der Lebensraumtyp umfasst<br />
ständig von Meerwasser überspülte Sandbänke der Nord- <strong>und</strong> Ostsee ohne oder mit nur spärlicher<br />
Vegetation von Wasserpflanzen <strong>und</strong> Algen. Sie liegen überwiegend im Flachwasser können<br />
aber auch bis in tiefere durchlichtete Bereiche reichen (BFN 2010). Das Makrozoobenthos<br />
setzt sich aus einer arten- <strong>und</strong> individuenreichen Sandbodenfauna zusammen. Den Muscheln<br />
kommt mit 90-95 % der Biomasse eine besondere Bedeutung als Nahrung für Fische <strong>und</strong><br />
benthophage Meeresenten zu (IfAÖ 2005). Sandbänke besitzen eine besondere Attraktivität als<br />
Überwinterungsplatz für Wasservögel, da sie ein biomassereiches Benthos aufweisen <strong>und</strong> für<br />
die Nahrungssuche der Vögel nur geringe Tauchtiefen erforderlich sind (ebd.).<br />
Nach IFAÖ (2005) sind exponierte, schluffarme Sande, die von arten- <strong>und</strong> individuenreichen<br />
Sandbodengemeinschaften besiedelt werden maßgebliche Bestandteile des Lebensraumtyps<br />
„Sandbank“.<br />
Gefährdungen für den LRT gehen von der fischereilichen Nutzung, z. B. Gr<strong>und</strong>netzfischerei,<br />
Sandabbau <strong>und</strong> Schifffahrt aus. Auch der Schadstoffeintrag z. B. durch Ölförderung <strong>und</strong> der<br />
Nährstoffeintrag über Einleitungen <strong>und</strong> Nährstofffracht der Flüsse gefährden den Lebensraumtyp<br />
(BFN 2010). Nach GOSSELCK & KUBE (2004) sind Sandbänke äußerst empfindlich gegenüber<br />
Eingriffen in die Sedimentdynamik. Alle Maßnahmen, die den küstenparallelen Sedimenttransport<br />
unterbrechen oder verstärken, sind daher als Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps<br />
anzusehen. Diese Beeinträchtigungen führen zu einer veränderten Besiedlung durch Pflanzen<br />
<strong>und</strong> Wirbellose.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im Greifswalder Bodden ist der LRT „Sandbänke mit ständiger Überspülung“ im Gebiet von<br />
Hakenbildungen <strong>und</strong> eiszeitlichen Kernen ausgebildet. Sandbänke sind zumeist jenseits der<br />
2 m-Tiefenlinie durch Hänge vom zentralen Schlickbecken abgesetzt (IFAÖ 2005). Im FFH-<br />
Gebiet kommt dieser Lebensraumtyp beispielsweise nördlich <strong>und</strong> nordöstlich von Wampen bei
FROELICH & SPORBECK Seite 47<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Greifswald, auf dem Peenemünder Haken, dem Gahlkower Haken, in der Puddeminer Wiek <strong>und</strong><br />
vor der Schoritzer Wiek vor (I.L.N. 1996, IFAÖ 2005).<br />
In Teilbereichen wird der Lebensraumtyp in Wassertiefen zwischen 0,5 <strong>und</strong> etwa 3,5 m von der<br />
Potamogeton pectinatus-Gesellschaft besiedelt. Als weitere charakteristische Pflanzenarten<br />
können neben der namensgebenden Art auch Zannichellia palustris, Ruppia cirrhosa, Myriophyllum<br />
spicatum, Ranunculus baudotii <strong>und</strong> Chara baltica vorkommen. Eine weitere Gesellschaft<br />
tritt bei weniger Lichteinfall, auch in größerer Wassertiefe (bis 5 m) auf, die Zostera marina-Gesellschaft<br />
(„Seegras-Wiesen“). Seegras besiedelt exponierte Sandflächen, solange die<br />
Sedimente nicht starken Umlagerungen unterliegen.<br />
Nach GOSSELCK & KUBE (2004) werden die Sandbänke im Greifswalder Bodden von einer artenarmen<br />
aber individuenreichen Fauna besiedelt. Die Individuenzahlen liegen zwischen 2000<br />
<strong>und</strong> 3000 pro Quadratmeter; im Lebensraumtyp werden etwa 30 Arten angetroffen, die etwa zur<br />
Hälfte aber für auch angrenzende Lebensraumtypen charakteristisch sind (GOSSELCK & KUBE<br />
2004).<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im duB kommt der Lebensraumtyp in flächigen Ausbildungen auf dem Freesendorfer Haken,<br />
dem Peenemünder Haken <strong>und</strong> dem Gahlkower Haken vor.<br />
Die Flächen des LRT 1110 sowie des LRT 1160 im duB weisen bezüglich ihrer Makrophytenvorkommen<br />
eine hohe Variabilität sowohl im Vorkommen an sich als auch im Bedeckungsgrad<br />
auf. Das Vorkommen wechselt lokal, unter Umständen jedoch auch temporär, zwischen sporadischen<br />
Vorkommen einzelner Pflanzen sowie inselartigen <strong>und</strong> flächigen Pflanzenbeständen.<br />
Im Rahmen eines Gutachtens zur Relevanz der Auswirkung der Kühlwassereinleitungen am<br />
Vorhabensstandort <strong>Lubmin</strong> auf die fischereilich genutzten marinen Fischbestände der westlichen<br />
Ostsee wurden mittels Bildflugdaten, Videographie <strong>und</strong> Tauchuntersuchungen die Makrophyten<br />
des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> des Strelas<strong>und</strong>es lokalisiert <strong>und</strong> quantifiziert (siehe<br />
HAMMER et al. 2009).<br />
Die Analyse <strong>und</strong> Auswertung von 9 Videotransekten im Frühjahr 2009 im Ausbreitungsbereich<br />
der Kühlwasserfahne (Nahbereich nach IOW 2008), belegt einen Bedeckungsgrad von > 10 %<br />
im Mittel bei Wassertiefen zwischen 2 <strong>und</strong> 3 m. Dabei ist zu beachten, dass die Makrophyten<br />
nicht gleichmäßig verteilt auftreten. Vielmehr konzentriert sich die Vegetation auf den Gahlkower<br />
Haken <strong>und</strong> den Freesendorfer Haken. In der direkten Umgebung von <strong>Lubmin</strong> sind nur<br />
geringe Makrophytenflächen kartiert worden. Tauchuntersuchungen im Mai 2009 belegen für<br />
die genannten vegetationsreichen „Hot-Spots“ einen mittleren Bedeckungsgrad von ca. 50 %<br />
(am Freesendorfer Haken) bzw. bis zu rd. 85 % (am Gahlkower Haken). Aber auch für Bereiche<br />
vor <strong>Lubmin</strong> wurden im Rahmen der Tauchuntersuchungen stellenweise Bedeckungsgrade von<br />
20 - 25 % ermittelt (HAMMER et al. 2009).�<br />
Hauptbewuchsarten auf Sandsubstraten im Untersuchungsgebiet bildeten bei dieser Kartierung<br />
das Laichkraut, Seegras sowie fädige Rot- <strong>und</strong> Braunalgen.<br />
Am Gahlkower <strong>und</strong> Freesendorfer befinden sich bedeutende Laichgebiete des Herings (HAM-<br />
MER et al. 2009).
FROELICH & SPORBECK Seite 48<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Der Freesendorfer Haken weist nur geringe Wasserstände auf <strong>und</strong> ist u.a. aufgr<strong>und</strong> dessen<br />
vergleichsweise störungsarm. Er stellt innerhalb des bereits wertvollen Küstenabschnitts einen<br />
Schwerpunktraum für Rastvögel <strong>und</strong> Wintergäste dar.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Arten ausgewählt:<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum)<br />
Die Lagunen-Herzmuschel siedelt bevorzugt in Bereichen bis in etwa 10 m Tiefe. Der Greifswalder<br />
Bodden gilt als ein Konzentrationsgebiet der Art mit bis zu 200 bis 1.000 Individuen pro<br />
m 2 (vgl. LUNG 2004C). Gut sortierte Sandböden werden bevorzugt, doch wird auch schlickiger<br />
Sand als Habitat genutzt. Nach MUUS (1967) werden dagegen alle Untergründe mit Ausnahme<br />
von schwarzem Schlick besiedelt. Insgesamt ist jedoch eine deutliche Präferenz für Fein- bis<br />
Mittelsande mit einem geringen Schluffgehalt (< 15 %) <strong>und</strong> einem geringen Anteil organischen<br />
Materials (Glühverlust < 2 % der Trockenmasse) zu erkennen (IFAÖ 2008M). Die Lagunen-<br />
Herzmuschel kann mit Hilfe sogenannter Byssusfäden an der Vegetation klettern <strong>und</strong> so günstigere<br />
Lebensbedingungen in dichtem Pflanzenbewuchs erlangen. Dies findet hauptsächlich<br />
während der ersten Wachstumssaison statt. Ansonsten lebt sie eingegraben im Sediment (IFAÖ<br />
2008M). Die Reproduktion findet von März bis September statt; die Tiere entwickeln sich über<br />
pelagische Larven (JAGNOW & GOSSELCK 1987). Die Muscheln sind als Larve Bestandteil des<br />
Zooplanktons. So können die Larven der Lagunen-Herzmuschel Konzentrationen im Bereich<br />
von 0,1 bis 1.400 Ind./m 3 erreichen. Im Herbst bleiben diese Larven etwa 6 Wochen in der<br />
Wassersäule <strong>und</strong> ernähren sich mit der Strömung driftend von Phytoplankton, bevor sie sich auf<br />
dem Boden absetzen <strong>und</strong> weiterentwickeln. Sie können jedoch unter Verwendung ihres Gaumensegels<br />
(„Velum“) auch schwimmen. Es wird ein minimaler Salzgehalt von 4 - 4,5 PSU toleriert.<br />
Bei einem Salzgehalt von über 20 PSU wird Cerastoderma glaucum durch Cerastoderma<br />
edule ersetzt (vgl. ebd.).<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus)<br />
Die Fl<strong>und</strong>er ist ein sandbodenbewohnender Gr<strong>und</strong>fisch der Flussunterläufe <strong>und</strong> küstennahen<br />
Flachwassergebieten. Sie ist an die tidebedingten Salinitätsschwankungen ihres Lebensraums<br />
angepasst <strong>und</strong> gilt deshalb als Leitart der Flussunterläufe. Sie ernährt sich von Mollusken,<br />
Kleinkrebsen <strong>und</strong> Würmern sowie von Laich <strong>und</strong> Jungfischen, für die die Boddenregion einen<br />
wichtigen Lebensraum darstellt. Im Untersuchungsraum ist die Fl<strong>und</strong>er, nach dem Hering <strong>und</strong><br />
dem Dorsch, die häufigste Fischart <strong>und</strong> nimmt eine wichtige Rolle als Prädator ein. Nach den<br />
Ausführungen zur Art in HAMMER et al. (2009) bevorzugt die Art Laichhabitate mit höheren Salzgehalten,<br />
so dass der Greifswalder Bodden mit einem Salzgehalt von 5-7 nur eine untergeordnete<br />
Bedeutung für das Laichgeschehen der euryöken Art besitzt.<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatoschistus minutus)<br />
Die Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatoschistus minutus) ist ein am Gewässerboden lebender Fisch auf<br />
Weich- <strong>und</strong> Hartböden im Bereich von Küstengewässern, Ästuarien, Lagunen <strong>und</strong> Salzmarschen.<br />
Die Art lebt in der Regel in sandigen oder schlammigen Böden bis zu einer Tiefe von
FROELICH & SPORBECK Seite 49<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
etwa 20 m, erscheint manchmal aber auch in Tiefen von bis zu 60-70 m. Mit ihren zu einem<br />
„Saugnapf“ zusammengewachsenen Bauchflossen kann sie sich auch bei starker Strömung auf<br />
dem Substrat festhalten.<br />
Zur Nahrung der Sandgr<strong>und</strong>el gehören Jungfische, Kleinkrebse <strong>und</strong> Meeresborstenwürmer. Der<br />
planktische Nahrungsanteil stammt hauptsächlich von Neomysis integer. Die Eiablage erfolgt<br />
unter kleinen Steinen <strong>und</strong> Muscheln. Das Männchen bewacht die Eier für ca. 10 Tage bis die<br />
Larven etwa 3 mm lang sind. Die Larven leben zunächst pelagial (im freien Wasser), erst mit<br />
17-18 mm beginnen die Jungfische mit dem Leben am Gewässerboden.<br />
Gr<strong>und</strong>ellarven sind zahlenmäßig nach den Heringslarven die wichtigste Gruppe im Greifswalder<br />
Bodden. Bei einer Untersuchung von BERNER (1981) wurden Gr<strong>und</strong>ellarven im Mai ausschließlich<br />
an Stationen gefangen, die in unmittelbarer Küstennähe lagen. Im Juni erreichen G<strong>und</strong>ellarven<br />
ihre höchsten Ab<strong>und</strong>anzen. Der Greifswalder Bodden hat eine große Bedeutung für die<br />
Reproduktion dieser Art. Zum Einfluss von Temperatur <strong>und</strong> Salinität auf Gr<strong>und</strong>eln existieren<br />
kaum, bzw. keine Erkenntnisse (IFAÖ 2001A).<br />
Eisente (Clangula hyemalis)<br />
Die Eisente ist eine kleine kurzschnäblige Tauchente, die zum Überwintern in die Ostsee kommt<br />
<strong>und</strong> sich dort überwiegend von Muscheln ernährt. Die Muscheln (v. a. Sandklaffmuscheln <strong>und</strong><br />
ein geringer Anteil Miesmuscheln) gräbt sie aus dem Substrat aus. Im Frühjahr fressen die Eisenten<br />
auch den in größeren Mengen vorkommenden Heringslaich (SELLIN 1990, in SELLIN<br />
1999A). Die Eisente weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Störungen auf. Die Art zeigt<br />
eine starke Fluchtreaktion (häufiges Auffliegen bzw. Abtauchen) bis in eine Entfernung von 1 –<br />
2 km gegenüber Schiffen (GARTHE et al. 2004). Weitere Gefährdungsursachen stellen Ölverschmutzungen,<br />
Nahrungsmangel durch Muschelüberfischung sowie das Ertrinken in Stellnetzen<br />
dar (BAUER et al. 2005).<br />
Die Eisente nutzt die Küste vor <strong>Lubmin</strong> <strong>und</strong> dem Struck im Winterhalbjahr als bevorzugten Nahrungsraum<br />
<strong>und</strong> tritt dort in großen Individuenstärken als Wintergast bzw. auch als Durchzügler<br />
auf. Das Untersuchungsgebiet gehört zusammen mit dem gesamten Bereich nördlich von Usedom<br />
<strong>und</strong> östlich von Rügen mit der Oderbank <strong>und</strong> Adlergr<strong>und</strong> zu den größten zusammenhängenden<br />
Aufenthaltsgebieten innerhalb der deutschen Ostsee (GARTHE et al. 2003). Die von der<br />
Eisente im Winterhalbjahr genutzten Nahrungsräume innerhalb der Flachwasserzonen befinden<br />
sich vor <strong>Lubmin</strong> <strong>und</strong> dem Struck <strong>und</strong> werden von der Schifffahrtsrinne, die vom Industriehafen<br />
ausgeht, gequert.<br />
Ästuarien (1130)<br />
Ästuarien sind Flussmündungen ins Meer, solange noch regelmäßig Brackwasserwassereinfluss<br />
(mit erkennbaren Anpassungen der Pflanzen <strong>und</strong> Tiere) <strong>und</strong> Tideneinfluss (nur<br />
Nordsee) besteht, mit Lebensgemeinschaften des Gewässerkörpers, des Gewässergr<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> der Ufer. Im Gegensatz zu den "flachen Meeresbuchten" besteht ein deutlicher süßwasserbeeinflusster<br />
Wasserdurchstrom. Ufervegetation wird in den Lebensraumtyp mit eingeschlossen.<br />
Der Lebensraumtyp stellt einen Landschaftskomplex dar, der aus zahlreichen Biotoptypen<br />
bestehen kann (BFN 2010). Die EU-Kommission weist darauf hin, dass die Gebietsabgrenzung<br />
das gesamte Ästuar (hydrologische Einheit) umfassen soll (ebd.).
FROELICH & SPORBECK Seite 50<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Nach IfAÖ (2005) sind ein permanenter Süßwasserdurchfluss <strong>und</strong> ein Salzgehaltsgradient von<br />
der Mündung zum limnischen Flussabschnitt sowie eine starke, nicht-periodische Variabilität der<br />
abiotischen Parameter maßgebliche Bestandteile der Ostsee-Ästuare. Für den Erhalt eines<br />
günstigen Zustandes sind primär das Einzugsgebiet der einmündenden Flüsse sowie die Morphologie<br />
im Mündungsbereich zur Ostsee verantwortlich. Von großer ökologischer Bedeutung<br />
sind die Uferstrukturen mit Schilfbeständen, Flachwasserzonen mit submerser Vegetation <strong>und</strong><br />
natürliche Schlickfallen in den Becken. In natürlichen Mündungsbereichen sind Sandbänke<br />
ausgebildet, die das Eindringen von Ostseewasser beschränken (ebd.). Fauna <strong>und</strong> Flora sind<br />
meist überwiegend limnisch geprägt.<br />
Hauptgefährdungsfaktoren für den LRT sind Fließgewässerausbau mit ihren Hafenanlagen,<br />
Wehre, Uferbefestigung, Fahrrinnenvertiefung, Ausdeichungen, Schifffahrt sowie Schad- <strong>und</strong><br />
Nährstoffeintrag.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im Standarddatenbogen ist dieser LRT nicht aufgeführt. Entsprechend der Kartierhinweise des<br />
BFN ist aber die Spandowerhagener Wiek als ein Teilbereich des Peenestromästuars, dem LRT<br />
zuzurechnen.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich wird die Spandowerhagener Wiek diesem Lebensraumtyp<br />
zugeordnet, wobei Teilbereiche der Wiek auch den Lebensraumtypen „Windwatt“ <strong>und</strong> „Sandbänke“<br />
entsprechen. Die seeseitige Abgrenzung dieses Lebensraumtyps ist durch den Süßwassereinfluss<br />
bestimmt. Der Lebensraum zeichnet sich durch stark schwankende Salzgehalte<br />
aus. Die Spandowerhagener Wiek besteht aus Flachwasserzonen, die von Fahrrinnen <strong>und</strong> der<br />
Rinne zum Einlaufkanal für das Kühlwasser des ehemaligen Kernkraftwerks durchzogen sind.<br />
Bis auf einige exponierte ufernahe Gebiete sind die Substrate sehr stark schlickhaltig (vgl. FRO-<br />
ELICH & SPORBECK 2008A).<br />
Die Spandowerhagener Wiek zeichnet sich derzeit durch sehr geringen Makrophytenbewuchs<br />
aus (vgl. KÜSTER 1997, GOSSELCK & SCHABELON 2007). Nach IFAÖ (2005) findet sich Makrophytenbewuchs<br />
in den Flachwassergebieten bis 1 m, stellenweise bis 1,5 m Wassertiefe. In den<br />
Spandowerhagener Wiek dominiert genauso wie in anderen ostseenahen, salzreichen Ästuarbereichen<br />
das Kamm-Laichkraut Potamogeton pectinatus, das von einzelnen Pflanzen des<br />
Ährigen Tausendblatts Myriophyllum spicatum, des Hornblatts Ceratophyllum demersum <strong>und</strong><br />
des Brackwasser-Hahnenfußes Ranunculus peltatus ssp. baudotii (Ranunculetum baudotii,<br />
Brackwasser-Hahnenfuß-Tauchflur) durchsetzt ist. Hartböden in ufernahen Bereichen sind mit<br />
Grünalgen der Gattungen Enteromorpha <strong>und</strong> Cladophora bewachsen (ebd.).<br />
Als lebensraumtypische Arten der ostseenahen, relativ salzreichen Ästuarbereiche werden von<br />
IFAÖ (2005) die benthischen Wirbellosen Arten Hediste diversicolor, Wattschnecke Hydrobia<br />
ventrosa, Schlickkrebs Corophium volutator, R<strong>und</strong>assel Cyathura carinata <strong>und</strong> die Wandermuschel<br />
Dreissena polymorpha genannt.
FROELICH & SPORBECK Seite 51<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Makrozoobenthos wird von Neozoen dominiert, zu dem u.a. der Tigerflohkrebs Gammarus<br />
tigrinus, die Neuseeländische Deckelschnecke Potamopyrgus antipodarum, die Dreiecksmuschel<br />
Dreissena polymorpha, der Keulenpolyp Cordylophora caspia <strong>und</strong> der Polychät Marenzelleria<br />
viridis (IFAÖ 2005). Dreissena polymorpha bildet Bänke, die von einer artenreichen Begleit-<br />
fauna besiedelt werden (ebd.).<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Arten ausgewählt:<br />
Reiherente (Aythya fuligula)<br />
Die Reiherente zählt zu den Tauchenten <strong>und</strong> ernährt sich überwiegend von Muscheln <strong>und</strong><br />
Schnecken. Im Winterhalbjahr dient ihr vor allem die Dreikantmuschel als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage.<br />
Lt. DIERSCHKE (2010) halten sich im Frühjahr keine Reiherenten im Bereich der Kühlwasserfahne<br />
auf. Im Winter wird der Bereich zwar von der Art auch als Nahrungshabitat genutzt, jedoch<br />
weisen diese auch dann regional nur eine geringe Bedeutung auf (ca. 0,5 % des Winterbestandes<br />
an der deutschen Ostsee). Die meisten Reiherenten tauchen in der Spandowerhagener<br />
Wiek nach Nahrung.<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art ist unter dem Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher<br />
ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code 1110)“ zu finden.<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Der Schlickkrebs (Corophium volutator) ist ein kleiner, sechs bis zehn Millimeter langer Floh-<br />
krebs, der vor allem an Küsten die obere Schicht des Schlicks in U-förmigen Gängen bewohnt.<br />
In der Ostsee ist der Schlickkrebs vor allem in den inneren Küstengewässern <strong>und</strong> auf den<br />
Windwatten stark vertreten <strong>und</strong> zählt lokal zu den individuenreichsten Arten überhaupt (IFAÖ<br />
2008M). Die Hauptvorkommen des Schlickkrebses befinden sich in den schlickigen Windwatten<br />
bis in ca. 3 m Tiefe. Im Greifswalder Bodden tritt die Art mit bis zu 4.000 Ind./m 2 auf (vgl. LUNG<br />
2004C). Der Schlickkrebs baut eine 4 bis 8 cm tief in das Substrat reichende U-förmige Röhre.<br />
Er lebt in weichen Schlickböden, in festen <strong>und</strong> weichen Schlicksandböden <strong>und</strong> in reinen Sandböden,<br />
kommt aber auch zwischen Steinen <strong>und</strong> Seegras vor. Der Schlickkrebs ist ein euryhalines<br />
Tier <strong>und</strong> siedelt im euryhalinen bis in den oligohalinen Bereich. In der Ostsee dringt Corophium<br />
volutator bis zu einem Salzgehalt von 3 PSU vor. Als kritische Grenze der Verbreitung<br />
kann ein Salzgehalt des im Schlick enthaltenen Wassers von 2 PSU angenommen werden. Die<br />
Reproduktion erfolgt jedoch erst ab einem Salzgehalt von 7,5 PSU. Im Bereich von 5 bis 30<br />
PSU ist die Häutungsfrequenz <strong>und</strong> die Wachstumsrate am größten (IFAÖ 2008M). Dem Schlickkrebs<br />
kommt eine Schlüsselfunktion als Nährtier für Fische <strong>und</strong> Limikolen zu (vgl. LUNG<br />
2004C).<br />
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
Der Lebensraumtyp umfasst regelmäßig bei Niedrigwasser trockenfallende Wattflächen mit<br />
Sand-, Schlick- oder Mischsubstraten. Als Windwatten werden die zeitweise trockenfallenden
FROELICH & SPORBECK Seite 52<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Flachwasserzonen der Ostsee bezeichnet. Im Unterschied zum periodischen Gezeiten-<br />
Rhythmus der Nordsee unterliegen die Windwatten der Ostsee wetterabhängigen, aperiodischen<br />
Wasserstandsschwankungen (IFAÖ 2005). Sie sind vegetationsfrei oder vegetationsarm<br />
(z. B. mit Seegras) <strong>und</strong> haben eine meist artenreiche Bodenfauna. Daher stellt das Watt für eine<br />
Reihe mariner Fischarten den Lebensraum für ihre Jugendstadien dar (BFN 2010). Es ist ein<br />
wichtiger Nahrungsplatz von Wasservögeln mit besonderer Bedeutung für Zugvögel im Zusammenhang<br />
mit Mauser, Rast <strong>und</strong> Überwinterung (BFN 2010). Vegetationsfreie Schlick-,<br />
Sand- <strong>und</strong> Mischwatten werden von überwinternden <strong>und</strong> ziehenden Wat- <strong>und</strong> Wasservögeln als<br />
Rastgebiete genutzt. Auch von Brutvögeln werden sie als Nahrungshabitat genutzt (GOSSELCK<br />
& KUBE 2004).<br />
Hauptgefährdungsfaktoren für den Lebensraumtypen sind Eindeichungen, Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeinträge,<br />
Gr<strong>und</strong>schleppnetz- <strong>und</strong> Muschelfischerei, Ölförderung, Schifffahrt, Tourismus <strong>und</strong><br />
z. T. auch die militärische Nutzung (ebd.). „Die Windwatten des Greifswalder Bodden befinden<br />
sich größtenteils auf geschützten Flächen <strong>und</strong> sind als naturnah einzustufen. Neben eutrophierungsbedingten<br />
Störungen durch driftende Algenteppiche, die bei Hochwasser die Windwatten<br />
überlagern <strong>und</strong> zu Sauerstoffmangel führen können, gelten zunehmende touristische Aktivitäten<br />
als Bedrohung. Als besonders störend erweist sich dabei das Nachtangeln, da Windwatten<br />
wichtige Schlafplätze vieler Küstenvögel sind“ (GOSSELCK & KUBE 2004: 7). Weitere schwerwiegende<br />
Gefährdungsursachen für den LRT sind Eingriffe in die Küstendynamik <strong>und</strong> Flächenverbrauch<br />
(IFAÖ 2005).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Der Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)“ wird im<br />
FFH-Gebiet durch Windwattflächen repräsentiert, die bei ablandigen Winden zeitweise trockenfallen.<br />
Im Standard-Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von 2 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Beispiele für Vorkommen finden sich in den gleichen Gebietsteilen, die beim Lebensraumtyp<br />
1110 aufgeführt worden sind. Windwatten befinden sich in Flachwasserzonen entlang<br />
der Boddenküste, die bei Niedrigwasser trockenfallen. Der Lebensraumtyp ist meist vegetationsfrei,<br />
in den seltener trockenfallenden Bereichen kann eine spärliche Vegetation mit Zostera<br />
marina auftreten.<br />
„Auf Gr<strong>und</strong> ihres geringen Salzgehaltes <strong>und</strong> der Wasserstandsschwankungen sind Windwatten<br />
ein artenarmer Extremlebensraum. Nur 10 bis 20 Arten wirbelloser Tiere besiedeln diese Gebiete<br />
<strong>und</strong> nur wenige von diesen pflanzen sich dort auch fort. Migrationsprozesse <strong>und</strong> Strömungen<br />
haben einen großen Einfluss auf die Dynamik dieser Tier- <strong>und</strong> Pflanzenwelt des Meeresbodens<br />
(Benthos). Drei Arten dominieren: der Schillernde Meeresringelwurm, der Schlickkrebs <strong>und</strong> die<br />
Wattschnecke Hydrobia ventrosa.“ (GOSSELCK & KUBE 2004: 7)<br />
Zeitweilig trockenfallende Windwattareale sind wertvolle Nahrungshabitate für die Brutpopulationen<br />
der Limikolen des Küstenvogelgebietes Freesendorfer Wiesen/Struck.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert zu untersuchenden Bereich befinden sich großflächige Bereiche dieses Lebensraumtyps<br />
westlich, nördlich <strong>und</strong> östlich des Strucks. Der westlichste Teil dieser Windwattberei-
FROELICH & SPORBECK Seite 53<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
che liegt im Küstenbereich nördlich der Freesendorfer Wiesen, in etwa 1,1 km Entfernung vom<br />
Industriehafen.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Arten ausgewählt:<br />
Rotschenkel (Tringa totanus)<br />
Der Rotschenkel ist eine Watvogelart, die v. a. an den Küsten <strong>und</strong> im küstennahen Binnenland<br />
als Brutvogel vorkommt. Die höchsten Dichten erreicht diese Art in küstennahen, unbeweideten<br />
Grasländern (gerne in Salzmarschen in der Nähe von windgeschützten Schlickflächen) (BAUER<br />
et al. 2005). Der Rotschenkel ernährt sich überwiegend von Kleintieren, der pflanzliche Nahrungsanteil<br />
ist eher unbedeutend. Als Schutzmaßnahmen für Brutgebiete nennen BAUER et al.<br />
(2005) unter anderem die Reduzierung von Nährstoffeintrag <strong>und</strong> die Vermeidung von Störungen.<br />
Die Wattflächen stellen für rastende als auch brütende Rotschenkel wichtige Nahrungshabitate<br />
dar.<br />
Gegenüber optischen <strong>und</strong> akustischen Störungen weist der Rotschenkel eine hohe Empfindlichkeit<br />
auf. Bei stark befahrenen Straßen (> 10.000 PKW pro Tag) weist die Art eine Effektdistanz<br />
von 300 m auf. Des Weiteren wurde ein kritischer Schallpegel bei 55 dB(A) festgestellt<br />
(GARNIEL et al. 2007).<br />
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticulata)<br />
Der Sandregenpfeifer brütet auf offenen, mehr oder weniger vegetationslosen Flächen, bevorzugt<br />
an Küsten. Das Nest befindet sich meist auf Sand- <strong>und</strong> Kiesböden, an Dünenrändern oder<br />
in kurzrasigen Strauchwiesen. Als Durchzügler ist er auf Schlamm- <strong>und</strong> Sandufern an Binnengewässern<br />
aller Art zu finden. An der Küste werden als Beutetiere vor allem kleine Arthropoden,<br />
aber auch Ringelwürmer, <strong>und</strong> Mollusken gefressen. Laut EICHSTÄDT et al. (2006) kommen in<br />
Mecklenburg-Vorpommern 220 bis 240 Brutpaare des Sandregenpfeifers vor. Die Wattflächen<br />
stellen für rastende als auch brütende Sandregenpfeifer wichtige Nahrungshabitate dar.<br />
Im detailliert zu untersuchenden Bereich befand sich 2007 ein Brutplatz des Sandregenpfeifers<br />
im Aufspülungsbereich der östlichen Mole des Industriehafens (SCHELLER 2007).<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Eine Kurzbeschreibung des Schlickkrebses wird unter dem Lebensraumtyp „Ästuarien (EU-<br />
Code 1130)“ gegeben<br />
Strandseen der Küste (Lagunen) (EU-Code 1150*)<br />
Lagunen sind vom Meer ganz oder teilweise abgeschnittene salzige/brackige oder auch bereits<br />
stärker ausgesüßte Gewässer an den Küsten. Salzgehalt <strong>und</strong> Wasserstand der Strandseen<br />
können stark schwanken. Die Vegetation ist je nach Salzgehalt unterschiedlich ausgebildet. Oft<br />
weisen Lagunen aufgr<strong>und</strong> ihrer geringen Wassertiefe <strong>und</strong> ihrer windgeschützten Lage einen
FROELICH & SPORBECK Seite 54<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
dichten Bewuchs mit submerser Vegetation auf (Ruppietea maritimae, Potametea, Zosteretea<br />
oder Charetea).<br />
Zum einen sind Lagunen Lebensraum eines artenreichen Benthos (marin, brackig, limnisch),<br />
zum anderen sind sie aber auch wichtige Rast- <strong>und</strong> Nahrungsgebiete für überwinternde <strong>und</strong><br />
ziehende Wat- <strong>und</strong> Wasservögel. Für Wasservögel bieten sie Bruthabitate <strong>und</strong> für Fische fungieren<br />
sie als Laich- <strong>und</strong> Aufzuchtgebiet. Als Vorfluter erfüllen sie eine wichtige Filterfunktion für<br />
den Bodden. (GOSSELCK & KUBE 2004)<br />
„Lagunen sind erheblichen Beeinträchtigungen durch hohe Trübung <strong>und</strong> den fortgesetzten Eintrag<br />
von Nährstoffen – insbesondere Stickstoff-Verbindungen- ausgesetzt. Eine der wesentlichen<br />
Folgen der Eutrophierung ist ein schlechtes Lichtklima, das das Wachstum der Armleuchteralgen<br />
<strong>und</strong> Blütenpflanzen beeinträchtigt. Aber auch in den Lagunen sind negative<br />
Auswirkungen touristischer Nutzungen zu erkennen: mechanische Schädigungen der Pflanzen<br />
<strong>und</strong> verstärkte Aufwirbelung von Sediment. Dies führt zu einer Verschlechterung der Lichtbedingungen<br />
<strong>und</strong> zu einer zusätzlichen Beschattung durch die Ablagerung von aufgewirbeltem<br />
Substrat auf den Pflanzen selbst.“ (GOSSELCK & KUBE 2004: 8) In IFAÖ (2005) werden Eingriffe<br />
in die Austauschprozesse zwischen Lagune <strong>und</strong> dem vorgelagerten Wasserkörper als wichtigste<br />
Gefährdungsursache genannt.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Für den prioritären Lebensraumtyp „Strandseen der Küste (Lagunen) (EU-Code 1150*)“ wird im<br />
Standard-Datenbogen ein prozentualer Anteil von 3 % am Gesamtgebiet angegeben. Beispiele<br />
für diesen Lebensraumtyp stellen der Freesendorfer See, der Zickersee, der Neuensiener <strong>und</strong><br />
Selliner See sowie der Wreechener See dar.<br />
„Die Lagunen des Greifswalder Boddens sind hinsichtlich ihrer Hydrographie, Morphologie <strong>und</strong><br />
ihren Substraten unterschiedlich ausgebildet. Sie variieren in langen <strong>und</strong> kurzen Zeitintervallen.<br />
Die dichten Pflanzenbestände, Sand- <strong>und</strong> Schlickböden <strong>und</strong> Torfkliffe bieten eine Vielfalt von<br />
Lebensräumen, die von artenreichen Benthosgemeinschaften besiedelt werden. Typische Vertreter<br />
sind die Krallenfüßige Meerassel (Idotea chelipes), verschiedene Flohkrebse <strong>und</strong> die<br />
Vielborster Marenzelleria viridis <strong>und</strong> Hediste diversicolor sowie der Wenigborster (Oligochaet)<br />
Tubifex costatus. Zu den Arten, die vorrangig in den Lagunen <strong>und</strong> kaum im Greifswalder Bodden<br />
bzw. der Pommerschen Bucht vorkommen, gehören die Brackwassergarnele Palemonetes<br />
varians, der Getigerte Flohkrebs sowie die Schlammschnecke.“ (GOSSELCK & KUBE 2004: 7)<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Nach IFAÖ (2005) ist der Freesendorfer See auf der Halbinsel des Struck das einzige größere<br />
Gewässer im duB, das diesem Lebensraumtyp zugeordnet wird. Als echter Strandsee ist er<br />
durch zwei halbnatürliche Rinnen mit der Spandowerhagener Wiek („Peenegraben“) <strong>und</strong> dem<br />
Greifswalder Bodden („Boddengraben“) verb<strong>und</strong>en ist <strong>und</strong> nimmt eine Übergangsstellung zwischen<br />
brackischen <strong>und</strong> limnischen Verhältnissen ein. Der See erreicht eine maximale Tiefe von<br />
2,4 m, die mittlere Tiefe beträgt nach WOHLRAB (1959, in DAHLKE 2002) nur 1,2 m.<br />
Über die Verbindungsarme kommt es zu einem Wasseraustausch mit dem Bodden <strong>und</strong> dem<br />
Peenestrom. Bei Mittelwasser besitzt der Peenegraben einen etwa doppelt so großen Fließ-
FROELICH & SPORBECK Seite 55<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
querschnitt wie der Boddengraben, der wegen des dichten Makrophytenbestands zudem einen<br />
ungleich höheren hydraulischen Fließwiderstand als der Peenegraben bietet. Zusätzlich entwässern<br />
weite Teile der Freesendorfer Wiesen über ein ehemaliges Meliorationsgrabensystem<br />
in den See. Nach 1990 wurden die am See liegenden Deiche geschlitzt <strong>und</strong> die Pflege des<br />
Grabensystems eingestellt.<br />
Die natürliche Fließrichtung wird weitgehend von den Wasserstandsdifferenzen zwischen dem<br />
nördlichen Peenestrom <strong>und</strong> dem Greifswalder Bodden bestimmt. Gegenwärtig wird der<br />
Freesendorfer See auf Gr<strong>und</strong> des vorherrschenden Wasserstandsgefälles tendenziell mehr von<br />
Süden nach Norden durchströmt als in entgegengesetzter Richtung. Hierfür trifft allerdings<br />
nicht, wie eigentlich zu erwarten wäre, das für den nördlichen Peenestrom geltende Fließverhältnis<br />
von 2/3 Ausstromereignisse (von Süd nach Nord) zu 1/3 Einstromereignisse (von Nord<br />
nach Süd) zu. Aufgr<strong>und</strong> häufigen Windstaus im Greifswalder Bodden <strong>und</strong> des flachen Zugangs<br />
von dort zum Freesendorfer See weicht das Verhältnis der Fließrichtungen durch den Freesendorfer<br />
See von den oben genannten Zahlen ab (BUCKMANN 2011).<br />
Der Wasseraustausch wurde mehrere Monate gemessen (MEYER 2002) <strong>und</strong> anhand der Messungen<br />
modelliert (BUCKMANN 2003). Danach wird das Seewasser ca. 80mal im Jahr über die<br />
Verbindungsgräben ausgetauscht, mit einem Austauschverhältnis von 52:48 von Süd nach<br />
Nord. Die Wasserqualität des Freesendorfer Sees wird dem entsprechend von den angrenzenden<br />
Gewässern bestimmt, wobei die Charakteristika des nördlichen Peenestroms geringfügig<br />
dominieren. Bei Überflutungen <strong>und</strong> nach Starkregen kann die Wasserqualität auch kurzfristig<br />
durch den landseitigen Zufluss bestimmt werden. Wegen des regen Wasseraustausches <strong>und</strong><br />
weil die Oberfläche nur Wasser in der Größenordnung von ca. 70 % des Volumens des Sees<br />
zurückhalten kann, stellen sich nach derartigen Ereignissen die mittleren Werte schnell wieder<br />
ein.<br />
Bei Winden aus östlichen <strong>und</strong> nördlichen Richtungen wird hauptsächlich Wasser aus dem Tiefenbereich<br />
des Greifswalder Boddens oder der Pommerschen Bucht in den Freesendorfer See<br />
eingetragen (vgl. BUCKMANN 2003, 2007, DAHLKE 2002). Der Wasseraustausch mit den angrenzenden<br />
Gewässern ist sehr intensiv. Die statistische Verweilzeit des Wassers im Freesendorfer<br />
See beträgt höchstens 3,3 Tage (DAHLKE 2002). Neben Brackwasser erhält der Freesendorfer<br />
See Süßwasser aus den umliegenden Wiesen. Das Süßwassereinzugsgebiet umfasst nach<br />
VOIGTLÄNDER (2001) eine Größe von 302,2 ha <strong>und</strong> liegt im Bereich der Freesendorfer Wiesen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der vorhandenen Meliorationsgräben ist mit gegenüber den natürlichen Verhältnissen<br />
erhöhten Gr<strong>und</strong>wasserabflüssen in den Freesendorfer See bei Niedrigwasser zu rechnen. Der<br />
Freesendorfer See ist nach DAHLKE (2002) als �-oligohalin bis �-mesohalin einzustufen. Wegen<br />
des intensiven Wasseraustausches findet ein bedeutsamer Stickstoffeintrag in den See statt. Im<br />
Zeitraum eines Jahres betrachtet werden dem Freesendorfer See nach den Berechnungen von<br />
DAHLKE (2002) 13,5 t N a -1 aus dem Greifswalder Bodden <strong>und</strong> 58,4 t N a -1 aus dem Peenestrom<br />
resp. Spandowerhagener Wiek, in der Summe also 71,94 t N a -1 zugeführt.<br />
Die Sauerstoffverhältnisse im Freesendorfer See sind als günstig anzusehen. Das flache Gewässer<br />
unterliegt fast immer einer windbedingten Vollzirkulation, die zur Sauerstoffkonzentration<br />
nahe der Sättigungsgrenze führt (vgl. WOHLRAB 1959, SUBKLEW 1986, DAHLKE 2002). Die<br />
Sedimente des Freesendorfer Sees bestehen aus schlickigem Sand <strong>und</strong> in Senken aus Schlick,<br />
die auf Torf aufliegen.
FROELICH & SPORBECK Seite 56<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Durch seine oben dargestellten morphologischen <strong>und</strong> hydrographischen Standortvoraussetzungen<br />
bietet der Freesendorfer See günstige Bedingungen für höhere Wasserpflanzen <strong>und</strong> Characeen<br />
(Armleuchteralgen). Untersuchungen des Freesendorfer Sees in den Jahren 1990 <strong>und</strong><br />
2002 zeigten einen dichten, nahezu flächendeckenden Pflanzenbewuchs. Das Kammlaichkraut<br />
war die dominierende Art, der Teichfaden trat regelmäßig, jedoch in geringen Dichten auf. Innerhalb<br />
dieser Pflanzengemeinschaft kann weiter differenziert werden:<br />
Stellenweise wurden nahezu reine Bestände des Ähren-Tausendblatts (Myriophyllum spicatum)<br />
kartiert. Das Durchwachsenblättrige Laichkraut (Potamogeton perfoliatus) kam selten <strong>und</strong> vereinzelt<br />
vor. Verschiedene Hahnenfußarten (Ranunculus aquatilis, R. trichophyllus, R. fluitans, R.<br />
circinatus, R. baudotii) waren in unterschiedlicher Häufigkeit vertreten. Im Nordwesten <strong>und</strong><br />
Südosten wurden großflächige (bis zu 500 m²) reine Characeenwiesen (Chara aspera, C. canescens)<br />
nachgewiesen. Versteckt zwischen Kammlaichkraut <strong>und</strong> Teichfaden befanden sich bis in<br />
1 m Wassertiefe im gesamten See Characeen. Im Uferbereich kamen an Hartböden Grünalgen<br />
(Enteromorpha linza, E. compressa, E. torta, Cladophora glomerata, C. sericea, Chaetomorpha<br />
linum, Ch. aerea) vor (IFAÖ 2007 A).<br />
Die Makrophytenbestände des Freesendorfer Sees unterliegen einer hohen räumlichen <strong>und</strong><br />
zeitlichen Variabilität. Die Verbreitung der Characeen zeigt alleine aus dem Umstand, dass es<br />
sich nicht um ausdauernde Algen handelt, eine große zwischenjährliche Variabilität (GOSSELCK<br />
& DAHLKE 2005). Zudem nehmen hydrographische Faktoren wie Wasserstandsveränderungen,<br />
das Aufkommen filamentöser Algen oder der Fraßdruck von herbivoren Wasservögeln wie dem<br />
Höckerschwan Einfluss auf das jährlich wechselnde Vorkommen von Armleuchteralgen (vgl.<br />
ebd.). Im Jahr 2003 kam es vor der gesamten mecklenburgisch-vorpommerschen Küste zu<br />
bemerkenswerten <strong>und</strong> auffälligen Bestandsrückgängen submerser Vegetation, die vermutlich<br />
auch den Freesendorfer See betrafen. GOSSELCK & DAHLKE (2005) führen das Phänomen im<br />
Jahr 2003 auf die extreme Trockenheit zurück. Das Jahr 2003 stand an 3. Stelle der trockenen<br />
Jahre seit 1951. Besonders die Frühjahrsmonate Februar <strong>und</strong> März waren extrem niederschlagsarm.<br />
Insgesamt stehen mutmaßliche Bestandsrückgänge von Characeen im Jahr 2003<br />
wiederum in einem großräumigen Kontext mit Bestandsrückgängen, die die gesamte mecklenburgisch-vorpommersche<br />
Küste betrafen. In den Folgejahren kam es zu natürlichen Wiederbesiedlungsprozessen<br />
<strong>und</strong> somit zu Regenerationserscheinungen, so dass die aktuelle Besiedlung<br />
mit Characeen große Ähnlichkeiten mit der Bestandsbeschreibung von WOHLRAB aus dem<br />
Jahr 1959 aufweist <strong>und</strong> keine naturschutzfachlich als nachteilig zu bewertende Vegetationsentwicklung<br />
seit 1959 erkennbar ist. Da nachweislich Regenerationen nach Bestandsrückgängen<br />
erfolgten, ist dieses Phänomen des zeitweiligen Verschwindens <strong>und</strong> Wiederauftretens von Characeen<br />
im Freesendorfer See als ein dynamisches Gleichgewicht zu begreifen. Nach GOSSELCK<br />
(mündl. am 13.01.2010) ist die dargestellte Bestandssituation auch heute noch aktuell. GOS-<br />
SELCK (vgl. ebd.) präzisierte die aktuellen Characeen-Vorkommen folgendermaßen: Die Characeenwiese<br />
im Nordwesten des Freesendorfer Sees befindet sich in einem Flachwasserbereich<br />
in der Nähe des Verbindungsgrabens zum Greifswalder Bodden <strong>und</strong> ist flächig ausgebildet. Die<br />
Tiefengrenze dieser Characeenwiese liegt bei 0,5 m. Die Characeenwiese im Südosten ist stärker<br />
durch größere Vorkommensinseln <strong>und</strong> Einzelpflanzen gekennzeichnet <strong>und</strong> somit nicht flächig<br />
ausgebildet. Ihre Tiefengrenze liegt ebenfalls bei 0,5 m. Einzelpflanzen <strong>und</strong> kleine Inseln<br />
mit Characeen befinden sich zudem überall im unmittelbaren Uferbereich bis etwa 0,2 m Wassertiefe.<br />
Characeen kommen somit im Freesendorfer See fast ausschließlich in Flachwasserzonen<br />
vor.
FROELICH & SPORBECK Seite 57<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im Freesendorfer See wurden in Wassertiefen zwischen 0,5 <strong>und</strong> 1,2 m 28 Makrozoobenthos-<br />
Arten nachgewiesen. Sie setzten sich aus 7 Anneliden (3 Polychaeten, 4 Oligochaeten), 6 Mollusken<br />
(5 Schnecken, 1 Muschel), 7 Krebsen, 4 Insektenlarven sowie Schnurwürmern (Nemertini),<br />
Moostierchen (Bryozoa) <strong>und</strong> Hydrozoen zusammen. Häufigste Arten waren der Schlickkrebs<br />
(Corophium volutator, 35%), der Polychaet (Marenzelleria viridis, 19 %), die<br />
Süßwasserschnecke (Potamopyrgus antipodarum, 10 %), Zuckmückenlarven (7 %) <strong>und</strong> Olig-<br />
ochaeten. Insgesamt weist der Freesendorfer See eine artenreiche, gegenüber dem Greifswalder<br />
Bodden stärker durch Süßwasser geprägte Makrozoobenthosfauna auf (IFAÖ 2007A). Dieses<br />
Ergebnis entspricht den Analysen von WOHLRAB (1959), der ebenfalls eine Dominanz<br />
limnischer Formen gegenüber Arten der marinen- <strong>und</strong> Brackwasserfauna vorfand. WOHLRAB<br />
(vgl. ebd.) führte die Zusammensetzung der Bodenfauna maßgeblich auf den schwankenden<br />
Salzgehalt im Freesendorfer See zurück <strong>und</strong> ermittelte günstige Lebensbedingungen für alle<br />
Arten, die sich an den schwankenden Salzgehalt anzupassen vermögen. Hinweise auf einen<br />
anthropogen verursachten Artenfehlbestand liegen insgesamt nicht vor.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Arten ausgewählt:<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera)<br />
Chara aspera kommt in Mecklenburg-Vorpommern sowohl im Süß- als auch im Brackwasser<br />
vor. An der Küste besiedelt Chara aspera fast sämtliche innere Küstengewässer entlang des<br />
gesamten Salinitätsgradienten von 0,5 – 13 PSU (BLÜMEL 2004). Jedoch sind auch hier lokale<br />
Rückgänge zu verzeichnen. Im potenziellen Wirkraum des Vorhabens wurde die Art im<br />
Freesendorfer See nachgewiesen. In den Boddengewässern ist Chara aspera meist mit Chara<br />
baltica <strong>und</strong> Chara canescens vergesellschaftet (BLÜMEL et al. 2002).<br />
Chara aspera reagiert wie alle Armleuchteralgen empfindlich auf Nährstoffeinträge. Die Tole-<br />
ranzschwelle für Salinität liegt bei 25 PSU, für Temperaturerhöhungen bei 25° C.<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens)<br />
Die Graue Armleuchteralge besiedelt Lagunen, Strandseen <strong>und</strong> andere Stillgewässern in unmittelbarer<br />
Küstennähe. Dabei bevorzugt sie die Ränder von klaren <strong>und</strong> brackischen Gewässern<br />
mit kalkhaltigen Substraten bis zu einer Tiefe von 2,5 m. In der Roten Liste von Mecklenburg-<br />
Vorpommern wird Chara canescens als stark gefährdet eingestuft (SCHMIDT 1993).<br />
Armleuchteralgen sind empfindlich gegenüber den Folgen von Nährstoffeinträgen. Diese wirken<br />
verändernd auf das Lichtklima des Gewässers, da erhöhte Trophiegehalte die planktische Biomasseproduktion<br />
verstärken. Darüber hinaus werden Fadenalgen <strong>und</strong> höhere Pflanzen gefördert,<br />
welche den Armleuchteralgen ebenfalls das Licht nehmen <strong>und</strong> sie damit auskonkurrieren<br />
(YOUSEF et al. 1997, UK BIODIVERSITY GROUP 1999). Die Graue Armleuchteralge ist im Freesendorfer<br />
See nachgewiesen, wo sie im südlichen Flachwasserbereich eine Fläche von über 500<br />
m 2 einnimmt (IFAÖ 2002A). Die Bestände reichen ca. 30 m in den See hinein <strong>und</strong> gehen bis in<br />
eine Tiefe von 40 cm. Der Salz-Toleranzbereich von Chara canescens liegt zwischen 4-20 PSU;<br />
die Toleranzschwelle für Temperaturerhöhungen beträgt etwa 25° C.
FROELICH & SPORBECK Seite 58<br />
Hering (Clupea harengus)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Der Hering ist ein im Freiwasser lebender Schwarmfisch, der sich von Planktontieren ernährt.<br />
Im detailliert zu untersuchenden Bereich laicht v. a. der Rügensche Frühjahrshering in den<br />
Flachwasserbereichen. Neben der dominanten, im Frühjahr laichenden Form sind in geringen<br />
Mengen auch Herbstlaicher vertreten. Diese Form ist nach der Roten Liste für die Ostsee (FRI-<br />
CKE et al. 1996) als gefährdet eingestuft (IFAÖ 2001A). In den Jahren 2002 bis 2007 machte der<br />
Hering mindestens 95 % der Fischerei-Fangzahlen im Greifswalder Bodden aus.<br />
Das Hauptlaichgebiet des Rügenschen Frühjahrsherings liegt im Greifswalder Bodden. Dem<br />
Makrophytenbewuchs kommt dabei eine hohe Bedeutung als Laichsubstrat zu (HAMMER et al.<br />
2009, SKABELL & JÖNSSON 1986 in IFAÖ 2001A). Nach einer relativ kurzen Embryonalentwicklung<br />
schlüpfen die Larven <strong>und</strong> verbleiben zunächst einige Zeit in Bodennähe. Danach steigen<br />
sie ins Pelagial <strong>und</strong> werden passiv mit den Strömungen im Gewässer verdriftet. Die Larvalentwicklung<br />
dauert mehrere Wochen. Die Larven der Fische sind sehr empfindlich <strong>und</strong> während<br />
ihrer planktischen Entwicklungsphase den umgebenen Bedingungen (Temperatur, Salinität,<br />
Sauerstoffbedingungen, pH-Wert) oder Strömungen ausgesetzt (IFAÖ 2001A). Die Heringslarven<br />
halten sich nach THU (1983) (in IFAÖ 2001A) in den Monaten März <strong>und</strong> April in den flachen<br />
Bereichen des Greifswalder Boddens auf. Ab Mai bis Juli sind die Larven im gesamten Greifswalder<br />
Bodden zu finden. Nach IFAÖ (2001A) weisen die Larvenstärken der Heringe bereits<br />
unter natürlichen Bedingungen breite Schwankungen auf. Die natürliche Sterblichkeit der Heringslarven<br />
hängt maßgeblich von den Nahrungsbedingungen ab. Der Schwellenwert von 4<br />
PSU Salzgehalt stellt die untere tolerierbare Salinitätsgrenze für den Heringslaich dar. Unter<br />
diesem kritischen Wert zeigen die Eier überdurchschnittlich hohe Mortalitätsraten, die von Dauer<br />
<strong>und</strong> Stärke der Aussüßung abhängen (KLINKHARDT 1986 in IFAÖ 2001A). Die obere Letaltemperatur<br />
der Entwicklungsstadien der Heringe liegt bei 22-24 ° C (KLINKHARDT 1986 in IFAÖ<br />
2001A).<br />
Ein wichtiges Reproduktionsgebiet des Rügenschen Frühjahrsherings sind die Flachwasserbereiche<br />
am Freesendorfer <strong>und</strong> Gahlkower Haken (HAMMER et al. 2009).<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Lagunen-Herzmuschel wird unter dem Lebensraumtyp „Sandbänke<br />
mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser (EU-Code 1110)“ gegeben<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Eine Kurzbeschreibung des Schlickkrebses wird unter dem Lebensraumtyp „Ästuarien (EU-<br />
Code 1130)“ gegeben<br />
Brandgans (Tadorna tadorna)<br />
Die Brandgans gilt in Mecklenburg-Vorpommern als gefährdet. Die Art lebt vor allem an Meeresküsten,<br />
besonders an Flachküsten mit Schlamm- <strong>und</strong> Sandflächen <strong>und</strong> auch in flachen<br />
Buchten bzw. Flussmündungen sowie z. T. auch an Binnengewässern, wo sie sich v. a. von<br />
Mollusken, Ringelwürmern, Crustaceen <strong>und</strong> Insekten ernährt. Die Brandgans brütet in Höhlen
FROELICH & SPORBECK Seite 59<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
(v. a. in Dünen <strong>und</strong> Dämmen), wobei mehrere Weibchen die Eier in einer Bruthöhle zusammenlegen<br />
können (was die genaue Ermittlung der Anzahl der Brutpaare methodisch erschwert).<br />
Im detailliert zu untersuchenden Bereich nutzt die Brandgans die küstennahen Meeresbereiche<br />
westlich, nördlich <strong>und</strong> östlich des Strucks als bevorzugten Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheraum auf dem<br />
Durchzug. Sie ernährt sich dort von kleineren Wassertieren. In den letzten Jahren wurden maximal<br />
145 Exemplare zwischen der Dänischen Wiek <strong>und</strong> Freest mit Schwerpunkt Struck beobachtet<br />
(vgl. DIERSCHKE 2010). Zwei Brutreviere der Brandgans wurden auch in den ufernahen<br />
Bereichen des Freesendorfer Sees ermittelt (SCHELLER 2007).<br />
Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160)<br />
Zu diesem Lebensraumtyp zählen flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten mit ihren Flachwasserzonen,<br />
insbesondere zwischen den Inselketten der Nordsee <strong>und</strong> dem Festland (soweit nicht<br />
Wattflächen), einschließlich Bodden <strong>und</strong> Haffs der Ostsee (soweit nicht den Ästuaren oder Lagunen<br />
zuzurechnen). Je nach Gebiet kommen unterschiedliche Substrate (Hart-<br />
/Weichsubstrate) vor. Der Lebensraumtyp ist vegetationsfrei oder weist Seegraswiesen auf. In<br />
den Flachwasserbereiche dominieren oft durchlichtete Bereiche, in denen noch Makroalgen<br />
wachsen können (BFN 2010).<br />
Gefährdungen der flachen Meeresbuchten ergeben sich v. a. durch Schad- <strong>und</strong> Nährstoffeintrag,<br />
durch Fischerei, Ölförderung, Schifffahrt, Tourismus, z. T. militärische Nutzung, Offshore-<br />
Windenergieanlagen oder marine Sand- <strong>und</strong> Kiesgewinnung (ebd.).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im FFH-Gebiet wird das gesamte Boddengewässer diesem Lebensraumtyp zugeordnet. Er<br />
nimmt den größten Flächenanteil des FFH-Gebietes ein - im Standard-Datenbogen wird ein<br />
prozentualer Anteil von 75 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Im Schutzgebiet zeichnet sich der Lebensraumtyp zum Teil durch dichte submerse Pflanzenbestände<br />
aus. „In den Flachwasserbereichen sind Meersalden-Tauchfluren (Ruppietum maritimae<br />
GILLNER 1960) mit der Meersalde Ruppia maritima, Potamogeton pectinatus, Zannichellia<br />
palustris <strong>und</strong> Armleuchteralgen (Chara baltica, C. canescens) ausgebildet. An exponierten Küsten<br />
<strong>und</strong> auf der Boddenrandschwelle kommen ab 0,5 bis 1 m Wassertiefe inselartige Bestände<br />
von Seegras Zostera marina zusammen mit Zannichellia palustris <strong>und</strong> Potamogeton pectinatus<br />
vor, die ab etwa 2 m Tiefe in reine Seegraswiesen übergehen (Zosteretum marinae van Goor ex<br />
Pignatti 1953). In unterschiedlicher Dichte bedeckt Chaetomorpha linum den Boden. An Hartböden<br />
befinden sich Grünalgen (Enteromorpha intestinalis, E. compressa, E. linza). Geröll ist<br />
mit Blasentang Fucus vesiculosus <strong>und</strong> Gabeltang Furcellaria lumbricalis sowie fädigen Rotalgen<br />
(Ceramium ssp.) bedeckt. Die Braun- <strong>und</strong> Rotalgen bilden driftende Formen, die stellenweise zu<br />
dichten Matten zusammengetrieben werden.“ (IFAÖ 2005: 69)<br />
Im Greifswalder Bodden siedelt eine marin-euryhalin geprägte Biozönose mit wenigen Einwanderern<br />
aus dem Süßwasser. Entsprechend der verschiedenen Substrattypen zeigt sich ein artenreiches<br />
Benthos der unterschiedlichen Lebensräume: Arten des Phytals, des Aufwuchses,<br />
der Sand- <strong>und</strong> Schlickböden. Die Gesamtartenzahl liegt zwischen 50 <strong>und</strong> 60 Taxa (ebd.).
FROELICH & SPORBECK Seite 60<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die flachen großen Meeresarme <strong>und</strong> -buchten um Rügen zählen zu den fischartenreichsten<br />
Gewässern der gesamten Ostsee (ebd.). Die buchten- <strong>und</strong> makrophytenreichen Flachwasserzonen<br />
werden von vielen Arten zum Laichen aufgesucht. Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Strelas<strong>und</strong><br />
sind bedeutende Laichgebiete für den Hering Clupea harengus <strong>und</strong> den Hornhecht Belone belone.<br />
Die dichte submerse Vegetation wird von vielen Kleinfischen als Lebensraum genutzt<br />
(IFAÖ 2005). Die flachen großen Meeresarme <strong>und</strong> -buchten um Rügen zählen zu den wichtigsten<br />
Überwinterungsplätzen nordischer Wasservögel (ebd.).<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Dieser Lebensraumtyp nimmt den größten Flächenanteil im detailliert untersuchten Bereich der<br />
FFH-VU ein. Die marinen Bereiche im Anschluss an die Windwatten <strong>und</strong> Sandbänke werden<br />
diesem Lebensraumtyp zugeordnet.<br />
An der Südküste des Greifswalder Boddens ist der Hauptanteil des Makrophytenbewuchses in<br />
Wassertiefen zwischen 2 <strong>und</strong> 3 m zu finden (HAMMER et al. 2009). Der Bedeckungsgrad ist örtlich<br />
<strong>und</strong> zeitlich unterschiedlich <strong>und</strong> wechselt zwischen sporadischem Vorkommen einzelner<br />
Pflanzen, inselartigen <strong>und</strong> flächendeckenden Beständen (BARTELS & KLÜBER 1998, GEISEL &<br />
MEßNER 1989, IFAÖ 1999, 2001A u. 2007A).<br />
Die Aufnahmen mit Unterwasservideo <strong>und</strong> Tauchern ergaben folgendes Bild: Westlich des Hafens<br />
kommen inselartige Bestände des Kammlaichkrautes (Potamogeton pectinatus) vor, die im<br />
Flachen von Teichfaden (Zannichellia palustris) durchsetzt sind. Vereinzelt kommen Meersalden<br />
vor (Ruppia maritima). Hartsubstrat (Blöcke, künstliche Hartsubstrate) ist im Flachwasser<br />
mit Darmalgen (Enteromorpha intestinalis, E. compressa, E. linza) <strong>und</strong> Fadenalgen (Cladophora<br />
glomerata, C. sericea) besetzt. Im tieferen Bereich sind Hartböden mit Rotalgen bewachsen<br />
(Polysiphonia nigrescens, P. violacea, Ceramium diaphanum) (vgl. IFAÖ 2007A).<br />
Östlich des Hafens wurde im Flachwasserbereich an Steinen dichter Bewuchs von Grünalgen,<br />
meistens Darmalgen (Enteromorpha compressa, E. intestinalis) <strong>und</strong> Fadenalgen (Cladophora<br />
glomerata) festgestellt. Dazwischen befinden sich auf Sandböden Kammlaichkrautbestände.<br />
Zwischen 30 <strong>und</strong> 60 cm Wassertiefe folgen Sandwälle <strong>und</strong> Senken, von denen vor allem die<br />
Senken zu etwa 80 % mit Teichfaden bedeckt sind. Die Wälle sind makrophytenarm. Innerhalb<br />
dieser Bestände befinden sich einzelne Pflanzen oder kleine Inseln von Kammlaichkraut. Unterhalb<br />
60 cm Tiefe bedeckt Kammlaichkraut den Gewässerboden. Im gesamten Bereich finden<br />
sich driftende Algen (Ceramium, Pilayella), die zusammen mit der Grünalge Chaetomorpha<br />
linum die festsitzenden Makrophyten stellenweise herunterdrücken (vgl. IFAÖ 2007A).<br />
Die der Küste vorgelagerten Flachwasserzonen im duB stellen einen der bedeutsamsten Konzentrationspunkte<br />
für rastende <strong>und</strong> überwinternde Wasser- <strong>und</strong> Küstenvögel im FFH-Gebiet<br />
dar. Hervorzuheben sind insbesondere die individuenreichen Rastvogelbestände von Schwänen,<br />
Gänsen (nur als Schlafplatz), Schwimmenten <strong>und</strong> einige tauchende Entenarten. Höcker-,<br />
Sing- <strong>und</strong> Zwergschwan, Berg-, Eis- <strong>und</strong> Schnatterente, Zwerg- <strong>und</strong> Gänsesäger, Kormoran<br />
<strong>und</strong> Zwergmöwe treten zeitweilig in solch hoher Individuenzahl auf, dass dem Küstenabschnitt<br />
eine internationale Bedeutung zukommt.<br />
In den Flachwassergebieten vor <strong>Lubmin</strong>, dem Struck <strong>und</strong> Spandowerhagen wurden nach IFAÖ<br />
(2007A) insgesamt 27 Fischarten nachgewiesen. Plötze (Rutilus rutilus), Brachsen (Abramis
FROELICH & SPORBECK Seite 61<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
brama), Flussbarsch (Perca fluviatilis), Hering (Clupea harengus) <strong>und</strong> Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus)<br />
waren hinsichtlich der Ab<strong>und</strong>anz in den Aalzeesenfängen die häufigsten Vertreter.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Arten ausgewählt:<br />
Eisente (Clangula hyemalis)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art ist unter dem Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher<br />
ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code 1110)“ zu finden.<br />
Bergente (Aythya marila)<br />
Die Bergente ernährt sich von Fischen, Weichtieren, insbesondere Muscheln <strong>und</strong> anderen<br />
Kleintieren.<br />
Mit bis zu 40.000 auf dem Heimzug rastenden Bergenten (HELBIG et al. 2001) ist der Greifswalder<br />
Bodden eines der wichtigsten Rastgewässer für die Art (MENDEL et al. 2008). Im Bereich der<br />
Kühlwasserfahne halten sich aber nur recht kleine Anteile des Bestandes auf. Von besonderer<br />
Bedeutung sind im Untersuchungsgebiet (UG) der Freesendorfer See <strong>und</strong> die Spandowerhagener<br />
Wiek, die als Tagesschlafplätze dienen. Die Nahrungsgründe, die vor allem nachts aufgesucht<br />
werden, befinden sich weiter von der Küste entfernt, teils ebenfalls im Greifswalder Bodden<br />
(vor allem zur Heringslaichzeit), teils aber auch im Westteil der Pommerschen Bucht<br />
(SCHABELON et al. 2008). Dabei wird auch der östliche Ausläufer der Kühlwasserfahne berührt,<br />
vor allem zwischen Struck <strong>und</strong> Ruden. Quantitative Angaben zur Nutzung dieses Gebietes liegen<br />
jedoch nicht vor. Zu beachten ist, dass die Bestände im UG auch zwischen zeitlich benachbarten<br />
Zählungen stark schwanken können. Dies ist mit der wechselnden, von Eisgang <strong>und</strong><br />
Wellenschlag abhängigen Wahl der verschiedenen Buchten im Greifswalder Bodden zu erklären.<br />
Nur Randbereiche der Kühlwasserfahne berühren die Nahrungsgebiete. Im Frühjahr ernähren<br />
sich Bergenten zeitweise auch von Heringslaich (SELLIN 1990). Eine Gefährdung der Art<br />
besteht in Gebieten mit Stellnetzfischerei, hier kommt es nachweislich zu hohen Verlusten<br />
durch Ertrinken (ERDMANN 2006).<br />
Höckerschwan (Cygnus olor)<br />
Der Lebensraum des Höckerschwans sind eutrophe stehende oder langsam fließende Gewässer<br />
(z. B. Binnenseen, Altwässer, Dorf- <strong>und</strong> Parkteiche). Die Art ernährt sich vegetarisch, wobei<br />
sie auf Grasland äst <strong>und</strong> mit dem langen Hals im Wasser nach Nahrung sucht. Auch abgeerntete<br />
Felder können Nahrungsquellen für die Art darstellen.<br />
Der Höckerschwan brütet an mehreren Orten, verteilt über das Untersuchungsgebiet. Eine Brut<br />
konnte am Westufer des Freesendorfer Sees beobachtet werden, zwei Nester wurden im nördlichen<br />
Teil des Strucks an einer von Wald umgebenen wassergefüllten Senke <strong>und</strong> an einer Lagune<br />
festgestellt. Im Uferbereich südlich des Einlaufkanals wurden zwei weitere Nester des<br />
Höckerschwans gef<strong>und</strong>en (SCHELLER 2007). Als Brutgebiet spielt das Untersuchungsgebiet<br />
aufgr<strong>und</strong> der eher geringen Bestandszahlen eine untergeordnete Rolle. Für Rastbestände hat<br />
das Gebiet dagegen eine große Bedeutung. Bei den Vogelzählungen fällt das Bestandsmaxi-
FROELICH & SPORBECK Seite 62<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
mum in die Sommermonate, wenn bis zu mehrere tausend Höckerschwäne im UG mausern<br />
<strong>und</strong> zeitweise flugunfähig sind. Insgesamt wird überwiegend die Seeseite des UG genutzt, sowohl<br />
zur Nahrungssuche als auch zum Ruhen. Im Winter 2008/09 konzentrierten sich die Höckerschwäne<br />
im Westteil des UG <strong>und</strong> r<strong>und</strong> um den Struck, wobei sich weniger als 20 % der<br />
Vögel im Bereich der Kühlwasserfahne aufhielt. Auch das Mauservorkommen fällt zu einem<br />
großen Teil in den Bereich der Kühlwasserfahne. Insgesamt sind durch Veränderungen der<br />
Makrophytenbestände Beeinträchtigungen möglich.<br />
Seeadler (Haliaeetus albicilla)<br />
Die Brutreviere des Seeadlers befinden sich in Laub-, Misch- <strong>und</strong> Nadelwäldern in der Nähe<br />
von Binnengewässern (Seen, Fischteiche, Flussläufe <strong>und</strong> Bodden). Nahrungsgebiete sind Gewässer<br />
mit einem reichen Bestand an Fischen <strong>und</strong> Wasservögeln (KLAFS & STÜBS 1987, FLADE<br />
1994). Hohe Siedlungsdichten erreicht der Seeadler nur in gering zerschnittenen <strong>und</strong> daher<br />
störungsarmen Landschaften. Sein Raumbedarf für das Brutrevier ist relativ klein, das Nahrungsrevier<br />
kann jedoch bis zu 400 km 2 groß sein (FLADE 1994) An nahrungsreichen Plätzen<br />
(Aas, Ansammlungen von Wasservögel) kann es zu größeren Konzentrationen überwinternder<br />
Seeadler kommen.<br />
Das Wintermaximum von 41 Ind. zeigt, dass das UG zeitweise eine große Bedeutung als Nahrungsgebiet<br />
für Seeadler haben kann, insbesondere bei Eislagen (vgl. DIERSCHKE & HELBIG<br />
2008 für die Boddengewässer bei Hiddensee). Im UG bevorzugten Seeadler den Bereich um<br />
den Struck, kamen aber auch weiter westlich zwischen Dänischer Wiek <strong>und</strong> <strong>Lubmin</strong> vor<br />
(DIERSCHKE 2010).<br />
Zwergsäger (Mergus albellus)<br />
Die Art ernährt sich carnivorisch von Fischen, Krebstieren, Weichtieren <strong>und</strong> anderen Kleintieren.<br />
Der Zwergsäger ist vor allem ein Fischjäger, der seine Beute während des Tauchens erbeutet.<br />
Im südlichen Greifswalder Bodden kommen Zwergsäger im Winter <strong>und</strong> Frühjahr regelmäßig mit<br />
größeren Individuenzahlen vor. Das Vorkommen im Bereich der Kühlwasserfahne ist als international<br />
bedeutend einzustufen. Außer auf der Seeseite im Bereich Spandowerhagener Wiek<br />
ist ein Teil der Zwergsäger auf dem Freesendorfer See zu finden. Beide Gebietsteile werden als<br />
Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheplatz genutzt (DIERSCHKE 2010). Durch Veränderungen der Fischfauna<br />
sind Beeinträchtigungen möglich.<br />
Brandgans (Tadorna tadorna)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art ist unter dem Lebensraumtyp „Strandseen der Küste (Lagunen)<br />
(EU-Code 1150)“ zu finden.<br />
Hering (Clupea harengus)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art ist unter dem Lebensraumtyp „Strandseen der Küste (Lagunen)<br />
(EU-Code 1150)“ zu finden.
FROELICH & SPORBECK Seite 63<br />
Hornhecht (Belone belone)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Der Hornhecht kommt im gesamten Nordostatlantik vor, an der europäischen Westküste von<br />
Marokko bis nach Island, in der Ostsee <strong>und</strong> der Nordsee. Er ist ein pelagisch (freischwimmend)<br />
lebender Schwarmfisch. In der kalten Jahreszeit lebt der Hornhecht in tieferen Bereichen des<br />
offenen Meeres oder wandert südlich in wärmere Gebiete, im Frühjahr <strong>und</strong> Sommer kommt er<br />
dann in die flachere Zonen der Küstennahen Gewässer um hier zu laichen <strong>und</strong> zu jagen. Im Mai<br />
<strong>und</strong> Juni laicht der Hornhecht in den Küstenbereichen ab. Die Laichareale des Hornhechts befinden<br />
sich in den makrophytenreichen Flachwasserzonen des Greifswalder Boddens. Beim<br />
Laichen geben die Hornhecht-Rogner einige tausend etwa 3 Millimeter große Eier ab, die sich<br />
mit ihren langen Haftfäden an Algen, Tang oder Treibgut festhalten. In der ersten Zeit ernähren<br />
sich die Jungfische von Zooplankton <strong>und</strong> sind im ersten Winter schon etwa 25 Zentimeter lang.<br />
Hauptbeute der aktiven Jäger sind Sandaale, kleine Heringe oder andere kleine, junge Fische<br />
die sie dicht unter der Oberfläche erbeuten können.<br />
Heterotanais oerstedi<br />
Die Scherenassel Heterotanais oerstedi ist ein Bewohner des Weichbodens mit assoziierten<br />
Miesmuschelbänken <strong>und</strong> Phytalstandorten, wo sie teils epibenthisch <strong>und</strong> teils endobenthisch (in<br />
Tuben) leben. Dort ernährt sich der Depositfresser von Detritus (KÖHN & GOSSELCK 1989). Die<br />
Art findet sich in allen expositions-geschützten Gewässern mit Salzgehalten zwischen ca. 3 <strong>und</strong><br />
13 PSU <strong>und</strong> ist damit ein echter Brackwasserbewohner. Sie kommt in den Förden <strong>und</strong> Buchten<br />
der Ostseeküste, den Bodden <strong>und</strong> Flussmündungen vor. Auf der Roten Liste der Ostsee wird<br />
die Art als potenziell gefährdet eingestuft (MERCK & NORDHEIN 1996). Als Gefährdungsursache<br />
gilt die Empfindlichkeit gegenüber Eutrophierung als Folge eines erhöhten Nährstoffeintrages.<br />
Die Art vermehrt sich über direkte Entwicklung. Die Eier werden in einer Bruttasche (Marsupium)<br />
abgelegt, wo sie sich direkt zu kleinen Asseln entwickeln. Die Entwicklung bis zum fertigen<br />
Tier geschieht während sich das Weibchen in seiner Röhre, die mit einem Deckel gesichert ist,<br />
einschließt, damit die Larven nicht entweichen können.<br />
Im Untersuchungsraum im südöstlichen Greifswalder Bodden (<strong>Lubmin</strong>, Freesendorfer Haken,<br />
Freesendorfer See, Spandowerhagener Wiek, Ruden) zählte die Art bei Untersuchungen im<br />
Zeitraum 1988 bis 2006 mit einer Präsenz von 1% bei 6 Individuen pro m² zu den häufigsten<br />
Arten (IFAÖ 2007A).<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher<br />
ständiger Überspülung durch Meerwasser (EU-Code 1110)“ gegeben.<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica)<br />
Die Hauptvorkommen der Baltischen Plattmuschel befinden sich vom Spülsaum bis in etwa<br />
15 m Tiefe. In Konzentrationsgebieten wie dem Greifswalder Bodden können Individuenzahlen<br />
bis zu 2.000 Ind./m 2 erreicht werden (vgl. LUNG 2004c). Die Baltische Plattmuschel lebt bevorzugt<br />
in sandigen <strong>und</strong> schlicksandigen Böden <strong>und</strong> seltener in reinem Sand oder reinem schwarzen<br />
Schlick. In der Ostsee werden vor allem feine, schlickige Sande besiedelt. Sie ist sehr tole-
FROELICH & SPORBECK Seite 64<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
rant gegenüber Süßwassereinfluss. Die untere Toleranzgrenze wird im Ästuar bei 1,7 - 2,1 PSU<br />
<strong>und</strong> in der Ostsee bei 1,5 - 2,0 PSU oder 4 PSU angesetzt (IFAÖ 2008M). Durch ihre besondere<br />
Art der Nahrungsaufnahme ist diese Muschel von Überflutungen unabhängig. Der Ausströmsiphon<br />
entleert das über den Einströmsiphon von der Oberfläche aufgenommene Wasser in den<br />
Boden. Dadurch entsteht ein Oxidationshof um das Tier herum, welcher vor giftigem H2S<br />
schützt.<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Eine Kurzbeschreibung des Schlickkrebses wird unter dem Lebensraumtyp „Ästuarien (EU-<br />
Code 1130)“ gegeben<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Strandseen der Küste (EU-<br />
Code 1150)“ gegeben.<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica)<br />
Chara baltica ist in Mecklenburg-Vorpommern an Küstengewässer geb<strong>und</strong>en. Sie kommt dort<br />
nahezu flächendeckend bei Salinitäten von 0,5 – 13 PSU vor (BLÜMEL 2004). Chara baltica ist in<br />
den Boddengewässern meist mit Chara aspera, Chara canescens <strong>und</strong> Chara tomentosa vergesellschaftet,<br />
<strong>und</strong> steht oft in Kontakt zu Meersalden-Gesellschaften. Myriophyllum spicatum,<br />
Zannichellia palustris <strong>und</strong> Potamogeton pectinatus können diese Bestände begleiten.<br />
Die obere Toleranzschwelle für Salinität liegt bei 18 PSU, für Temperaturerhöhungen bei 25° C.<br />
Im Greifswalder Bodden wurden bei Untersuchungen von 1999 bis 2007 Chara baltica, Chara<br />
canescens <strong>und</strong> Chara aspera <strong>und</strong> Zostera marina nachgewiesen (PORSCHE et al. 2008). Konkrete<br />
Nachweise für das Untersuchungsgebiet liegen nicht vor. Chara baltica kann jedoch als<br />
potenzielle Art betrachtet werden.<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Strandseen der Küste (EU-<br />
Code 1150)“ gegeben.<br />
Nest-Armleuchteralge (Tolypella nidifica)<br />
Die Nest-Armleuchteralge Tolypella nidifica zählt ebenfalls zur Familie der Armleuchteralgen.<br />
Tolypella nidifica ist in Mecklenburg-Vorpommern auf die inneren Küstengewässer beschränkt.<br />
Sie hat insbesondere in den östlichen Landesteilen einen stark rückläufigen Bestandstrend<br />
(BLÜMEL 2004). Es ist auffällig, dass die neueren Nachweise von Tolypella nidifica immer unmittelbar<br />
auf starke Eiswinter folgen (ebd. 2004). Deshalb bleibt unklar, ob Tolypella nidifica an den<br />
Standorten, an denen sie bisher als erloschen gilt, tatsächlich ausgestorben ist oder ob die<br />
Nachsuche nur zu einem „ungünstigen Zeitpunkt“ erfolgt.<br />
Wie andere Armleuchteralgen auch, reagiert Tolypella nidifica empfindlich auf den Eintrag von<br />
Nährstoffen. Im UG konnte die Art nicht nachgewiesen werden, sie gilt aber als potenzielle Art.
FROELICH & SPORBECK Seite 65<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Gewöhnliche Seegras (Zostera marina) ist ein Vertreter der Seegrasgewächse (Zoster-<br />
aceae). Es wächst untergetaucht im Küstengewässer der Nord- <strong>und</strong> Ostsee <strong>und</strong> den Ozeanen<br />
in Nähe des Festlandes; dort kommt es bis zu einer Tiefe von 10 m, vereinzelt bis zu 17 m, vor.<br />
Es ist auf der gesamten Nord-Hemisphäre verbreitet. Stellenweise geht seine Verbreitung jedoch<br />
auf Gr<strong>und</strong> anthropogener Einflüsse zurück. Deshalb ist es in Deutschland in der Roten<br />
Liste gefährdeter Farn- <strong>und</strong> Blütenpflanzen als gefährdet eingestuft (Gefährdungskategorie 3).<br />
Seit den 1930er Jahren ist an der deutschen Nord- <strong>und</strong> Ostseeküste ein Rückgang der strukturbildenden<br />
Seegraswiesen von Zostera marina zu beobachten. Als Ursachen für den Rückgang<br />
werden zunehmende Wasserverschmutzung, zunehmender Trübungsgrad des Wassers <strong>und</strong><br />
Eutrophierung vermutet. Seegraswiesen sind ökologisch besonders wertvoll, da sie Schutz für<br />
zahlreiche Tierarten bieten <strong>und</strong> als potenzielle Laichplätze von besonderer Bedeutung sind.<br />
Seegras findet bei einer Salinität von 10-25 PSU <strong>und</strong> 10-20° C optimale Wachstumsbedingungen<br />
vor. Daraus ergibt sich eine Empfindlichkeit gegenüber Erhöhungen der Temperatur <strong>und</strong><br />
einer Verringerung des Salzgehaltes.<br />
Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten (EU-Code 1210)<br />
Bei diesem Lebensraumtyp handelt es sich um junge Spülsäume mit Vegetation aus einjährigen<br />
Arten auf angeschwemmten organischem Material der Hochfluten. Im Bereich der Strände bilden<br />
sich immer wieder Initialstadien von einjährigen Strandmelden-Spülsäumen. Die Spülsäume<br />
werden regelmäßig zerstört, verschoben, umgelagert <strong>und</strong> neu gebildet, da sie Wind, Wellengang,<br />
Sturmfluten <strong>und</strong> Eisgang direkt ausgesetzt sind. Dabei wird neues Material<br />
(anorganisch <strong>und</strong> organisch) herbei transportiert <strong>und</strong> Sand in Richtung Dünen ausgeweht. Auf<br />
den höher gelegenen Strandpartien findet man Meersenf-Spülsäume (I.L.N. 2007, VOIGTLÄNDER<br />
1999A). Zu den typischen Charakterarten gehören nach SSYMANK et al. (1998) Cakile maritima,<br />
Agropyron junceum, Atriplex-Arten, Salsola kali <strong>und</strong> Suaeda maritima.<br />
Als Hauptgefährdungsfaktoren für diesen Lebensraumtyp werden von SSYMANK et al. (1998)<br />
Eindeichung, Wasserbelastung (Ölverschmutzung etc.), Tritt <strong>und</strong> Beräumen von Stränden genannt.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Der Lebensraumtyp tritt im Küstenbereich des FFH-Gebietes häufig auf, wobei es sich meist um<br />
schmale lineare Lebensräume handelt. Im FFH-Gebiet hat der Lebensraumtyp seinen Verbreitungsschwerpunkt<br />
im westlichen <strong>und</strong> südlichen Teil des Greifswalder Boddens (I.L.N. 2007). Im<br />
Standard-Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VP kommt der LRT im Strandbereich westlich von<br />
<strong>Lubmin</strong>, an der Westseite der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Struck sowie am Nordostrand des<br />
Struck vor. Größere Spülsaumbereiche befinden sich auf Nordusedom im Strandabschnitt an<br />
der Kienheide <strong>und</strong> nördlich von Karlshagen. Die Vegetation variiert entsprechend den unter-
FROELICH & SPORBECK Seite 66<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
schiedlichen standörtlichen Verhältnissen. Im Strandbereich sind inselartige Strandmelden-<br />
Spülsäume mit Atriplex littoralis <strong>und</strong> Atriplex prostrata zu finden. Auf den höher gelegenen<br />
Strandpartien am Rand des Dünenwalles bzw. unmittelbar unterhalb der Kliffkante findet man<br />
Ansätze von Meersenf-Spülsäumen <strong>und</strong> Strandroggen-Salzmieren-Fluren sowie Strandquecken-Fluren,<br />
die zur mehrjährigen Vegetation der Strände überleiten (VOIGTLÄNDER 1999A).<br />
Die Erhaltungszustände der Einzelflächen dieses Lebensraumtyps innerhalb des duB wurden<br />
unterschiedlich eingeschätzt. Einzelne Flächen wurden mit A <strong>und</strong> C bewertet, die meisten Flächen<br />
wurden als B eingestuft.<br />
Für den Lebensraumtyp wurde anhand einer Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende charakteristische<br />
Tierarten mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt. Die beiden Arten wurden<br />
im detailliert untersuchten Bereich nachgewiesen <strong>und</strong> nutzen den Lebensraumtyp<br />
potenziell als Nahrungshabitat:<br />
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticulata)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Schlick-,<br />
Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)“ gegeben.<br />
Im detailliert zu untersuchenden Bereich befand sich 2007 ein Brutplatz des Sandregenpfeifers<br />
im Aufspülungsbereich der östlichen Mole des Industriehafens (SCHELLER 2007).<br />
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)<br />
Der Alpenstrandläufer brütet auf feuchten, sumpfigen Flächen mit niedriger Vegetation, die Deckung<br />
bietet. Außerhalb der Brutzeit besiedelt die Art feste <strong>und</strong> feuchte Schlickflächen in der<br />
Gezeitenzone, an Flussmündungen <strong>und</strong> auch an Binnengewässern. Während der Zugzeit ernährt<br />
sich der Alpenstrandläufer im Küstenbereich v. a. von Ringelwürmern, Schnecken, Muscheln<br />
<strong>und</strong> kleinen Krebstieren. In Mitteleuropa tritt die Art vor allem als Nahrungsgast <strong>und</strong><br />
Durchzügler auf, die Unterart schinzii auch als seltener Brutvogel. An der südlichen Ostseeküste<br />
ist die Gesamtsituation für die Unterart Calidris alpina schinzii nach SELLIN 1999A als äußerst<br />
kritisch einzuschätzen, so dass in dieser Region keine Störungen im Bereich der Brutplätze<br />
tolerierbar sind.<br />
Der Alpenstrandläufer kann aktuell im duB nur noch unregelmäßig festgestellt werden (Brutbestands-Meldebogen<br />
2007 des LUNG). Er zählt zu den sehr seltenen Brutvogelarten. Zwischen<br />
2004 <strong>und</strong> 2009 lag das Herbstmaximum der Individuen auf dem Durchzug bei von 1.285<br />
Exemplaren.<br />
Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-Code 1230)<br />
Im FFH-Gebiet gehören die Moränen-Steilküsten mit unterschiedlichen Substraten wie Mergel,<br />
Sand, Kies <strong>und</strong> Geschiebeblöcke zu diesem Lebensraumtyp. Steilküsten sind gekennzeichnet<br />
durch einen meist lockeren Bewuchs von Pionierrasen, Gebüschen <strong>und</strong> Hangwäldern. Aufgr<strong>und</strong><br />
der natürlichen Abbruchdynamik treten aber auch zeitweise größere vegetationsfreie Abschnitte<br />
auf (I.L.N. 2007).
FROELICH & SPORBECK Seite 67<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Als Hauptgefährdungsfaktoren für diesen Lebensraumtyp werden von SSYMANK et al. (1998)<br />
Küstenschutzmaßnahmen, Bebauung, Freizeitnutzung <strong>und</strong> intensive landwirtschaftliche Nutzung<br />
bis an die Abbruchkante genannt.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Der Lebensraumtyp „Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-<br />
Code 1230)“ tritt im FFH-Gebiet vor allem im nördlichen Teil auf (Nordufer des Strelas<strong>und</strong>es).<br />
An der Südküste des Greifswalder Boddens, am Strelas<strong>und</strong> <strong>und</strong> am Peenestrom ist dieser Lebensraumtyp<br />
nur lokal verbreitet. Im Standard-Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von <<br />
1 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Der Lebensraumtyp „Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-<br />
Code 1230)“ tritt im detailliert zu untersuchenden Bereich im Küstenabschnitt zwischen Gahlkow<br />
<strong>und</strong> <strong>Lubmin</strong>, zwischen <strong>Lubmin</strong> <strong>und</strong> dem Industriehafen sowie nordöstlich von Spandowerhagen<br />
auf (I.L.N. 2007). Der Erhaltungszustand der LRT-Bereiche der aktiven Kliffs zwischen<br />
Gahlkow <strong>und</strong> Industriehafen <strong>Lubmin</strong> wurde außer bei einer Fläche (Sandkliff östlich Gahlkow)<br />
als gut bzw. sehr gut eingestuft (I.L.N. 2007). Der Erhaltungszustand der beiden kleineren (inaktiven)<br />
Kliffs bei Spandowerhagen wurde als mittel bis schlecht bewertet.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB keine charakteristischen<br />
Tierarten ausgewählt. Bei der Betrachtung von lebensraumtypischen Tierarten dieses Lebensraumtyps<br />
ist kein Erkenntnisgewinn, der über die Bearbeitung <strong>und</strong> Bewertung der vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen Parameter hinausgeht, zu erwarten.<br />
Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand<br />
(Queller-Watt) (EU-Code 1310)<br />
Das Quellerwatt ist durch einjährige meist lückige Pioniervegetation des Salzgrünlandes (Thero-<br />
Salicornietalia) im Eulitoral der Küsten auf sandigen <strong>und</strong> schlickigen Böden gekennzeichnet.<br />
Die Vorkommen konzentrieren sich auf kleinflächige Bestände innerhalb von Salzgrünland in<br />
abflusslosen Senken (Röten). Wichtigstes Kriterium ist das zumindest lückige Vorkommen des<br />
Gemeinen Quellers (Salicornia europaea agg.). Die Standorte sind geprägt von dem regelmäßi-<br />
gen Wechsel zwischen Überflutung mit Meerwasser <strong>und</strong> Trockenfallen, dadurch besitzen sie<br />
eine ausgesprochene Dynamik der Faktoren Wassertiefe, Strömung, Sauerstoff, Salinität, Temperatur<br />
<strong>und</strong> Sonneneinstrahlung.<br />
Quellerwatt ist v. a. durch Küstenverbau <strong>und</strong> durch Eindeichungen gefährdet. Große Bereiche<br />
mit Quellerwatt sind durch die historischen Eindeichungen verlorengegangen. Weitere Gefährdungen<br />
stellen Schadstoffeinträge (z. B. Ölverschmutzungen, Schwermetalleinträge oder Abwassereinleitungen)<br />
dar. Zur Vorsorge gehören daher auch funktionsfähige Ölsperren <strong>und</strong> Bergungsmöglichkeiten<br />
für havarierte Schiffe in den angrenzenden Seegebieten (I.L.N. 2007).
FROELICH & SPORBECK Seite 68<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Dieser Lebensraumtyp ist nicht im Standard-Datenbogen aufgeführt, wurde aber von I.L.N.<br />
(2007) in Röten innerhalb des Lebensraumtyps Salzwiesen (LRT 1330) auf dem Vogelhaken<br />
Glewitzer Ort, im nördlichen Teil der Insel Koos, im westlicher Teil der Freesendorfer Wiesen<br />
sowie auf dem Struck mit insgesamt 8 Vorkommen nachgewiesen.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Der Lebensraumtyp 1310 wurde von I.L.N. (2007) in Röten innerhalb des Lebensraumtyps<br />
Salzwiesen (LRT 1330), im westlichen Teil der Freesendorfer Wiesen sowie auf dem Struck mit<br />
insgesamt 5 Vorkommen nachgewiesen. Bei der Kartierung von VOIGTLÄNDER (1999A) <strong>und</strong> bei<br />
der alten FFH-Binnendifferenzierung wurden diese Bereiche nicht als eigenständige Lebensraumtypen<br />
aufgenommen. Alle Bestände befinden sich laut Kartierung <strong>und</strong> Bewertung von<br />
I.L.N. (2007) in einem hervorragenden Erhaltungszustand.<br />
Für den Lebensraumtyp wurde mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB der Rotschenkel als zu<br />
betrachtende charakteristische Tierart mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt.<br />
Der Rotschenkel wurde im detailliert untersuchten Bereich als Brutvogel <strong>und</strong> als Nahrungsgast<br />
nachgewiesen. Er nutzt den Lebensraumtyp vor allem als Nahrungshabitat:<br />
Rotschenkel (Tringa totanus)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Schlick-,<br />
Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)“ gegeben.<br />
Im Lebensraumtyp „Salzwiesen“ wurden von SCHELLER (2007) sechs Brutpaare des Rotschenkels<br />
erfasst. Die Art kam in den staunassen Bereichen der Freesendorfer Wiesen (nur im nördlichen<br />
Teil) <strong>und</strong> des Strucks vor.<br />
Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwaden-Rasen (EU-Code<br />
1330)<br />
Das Salzgrünland der Ostseeküste wird entscheidend durch Salz- <strong>und</strong> Brackwasserüberflutungen<br />
bei Hochwasserereignissen geprägt <strong>und</strong> ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von salztoleranten<br />
Pflanzenarten der Salzwiesen (Juncetea maritimi). Oft zeigen Salzwiesen eine ausgesprochene<br />
Zonierung von tief gelegenen halophilen Pionierfluren über mesohaline Salzwiesen<br />
zu höher gelegenen oligohalinen Salzwiesen. Charakteristisch sind eine leichte Reliefierung,<br />
gew<strong>und</strong>ene Priele <strong>und</strong> Röten mit zurückbleibendem Salzwasser, die auch phasenweise austrocknen<br />
können (I.L.N. 2007).<br />
Nach I.L.N. (2007) sind Eindeichung, Entwässerung <strong>und</strong> Nutzungsaufgabe die wesentlichsten<br />
Beeinträchtigungen für sek<strong>und</strong>äre Salzwiesen. Eine zu intensive Bewirtschaftung <strong>und</strong> Düngung<br />
führen zum Verlust des lebensraumtypischen Arteninventars. Nutzungsauflassung bewirkt auf<br />
Salzwiesen der Küstenüberflutungsmoore eine Entwicklung zu Brackwasserröhricht, Hochstaudenfluren<br />
oder Kriechrasen mit Queckendominanz. Als weitere Gefährdungsfaktoren für den
FROELICH & SPORBECK Seite 69<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp Salzwiesen gelten Eutrophierung <strong>und</strong> Schadstoffbelastung (z. B. Ölverschmutzung,<br />
Schwermetalleintrag) (SSYMANK et al. 1998).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Einen der bedeutendsten Lebensraumtypen im FFH-Gebiet stellt das „Salzgrünland des Atlantiks,<br />
der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwaden-Rasen (EU-Code 1330)“ dar. Im Standard-<br />
Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von 2 % am Gesamtgebiet angegeben. Vorkommen<br />
finden sich im Strelas<strong>und</strong> bei Niederhof, auf dem Vogelhaken Glewitzer Ort, Liner Ort, Tannenort<br />
sowie mehrere kleine Vorkommen in der Schoritzer Wiek. Größere Vorkommen in der Gristower<br />
Wiek, auf den Karrendorfer Wiesen, dem Streng, der Ziese, den Freesendorfer Wiesen<br />
<strong>und</strong> auf dem Struck. Weitere kleinere Vorkommen finden sich auf dem Ruden, dem Peenemünder<br />
Haken <strong>und</strong> der Insel Vilm. Auf Rügen bei Wreechen, in der Hagenschen Wiek <strong>und</strong> bei Gager.<br />
Im FFH-Gebiet wurden insgesamt 38 Vorkommen erfasst, damit handelt es sich um den<br />
zweithäufigsten LRT im FFH-Gebiet (I.L.N. 2007).<br />
Der größte Anteil des Salzgrünlandes im Gebiet befindet sich auf Küstenüberflutungsmooren<br />
<strong>und</strong> ist durch Beweidung sek<strong>und</strong>är aus torfbildenden Brackwasserröhrichten entstanden. Die<br />
Beweidung führt ebenfalls zur Torfbildung. Die Torfe sind kompakt <strong>und</strong> weisen in der Regel<br />
hohe Zersetzungsgrade sowie Sand-, Ton- <strong>und</strong> Schlickanteile auf.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VP finden sich sehr ausgedehnte Bestände auf dem<br />
Struck <strong>und</strong> den angrenzenden Freesendorfer Wiesen. Im Bereich der deutschen Ostseeküste<br />
handelt es sich hierbei um eine der bedeutendsten halophilen Grünlandflächen. Es lassen sich<br />
in Abhängigkeit von Überflutungsdauer <strong>und</strong> Nutzungsintensität unterschiedliche Ausprägungen<br />
dieses Lebensraumtyps feststellen. Neben Bereichen mit im Wesentlichen intakten Salzgrasbeständen<br />
finden sich auch Bestände mit verarmtem bzw. verändertem Salzgrasland sowie versumpfte<br />
<strong>und</strong> verschilfte Salzgrasländer. Insgesamt weist dieser Lebensraumtyp im Untersuchungsgebiet<br />
allerdings noch eine sehr hohe Zahl seltener <strong>und</strong> gefährdeter Pflanzenarten (z. B.<br />
Salicornia europaea, Eleocharis uniglumis, Triglochin maritium, Juncus gerardii, Lotus tenuifolium,<br />
Plantago maritima, nach der Kartierung von VOIGTLÄNDER 1999A sowie besonders angepasster<br />
Tierarten auf. An charakteristischen Pflanzengesellschaften sind vor allem die Suaeda<br />
maritima-Spergularia maritima-Gesellschaft <strong>und</strong> das Juncetum gerardii zu nennen. Daneben<br />
findet sich eine Agrostis stolonifera-Gesellschaft, als Besonderheit das Caricetum ripariae <strong>und</strong><br />
Phragmites australis-Röhrichte des versumpften Graslandes (I.L.N. 1994). Der Erhaltungszu-<br />
stand aller Bestände auf dem Struck <strong>und</strong> den Freesendorfer Wiesen wurde als sehr gut eingestuft.<br />
Eine weitere Fläche dieses LRT befindet sich an der Nordspitze von Usedom. Sie wird von<br />
Salzmilchkraut-Straußgrasrasen <strong>und</strong> Rotschwingelrasen geprägt <strong>und</strong> befindet sich in einem<br />
guten Erhaltungszustand (I.L.N. 2007).<br />
Für den Lebensraumtyp wurde mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB drei Vogelarten als zu<br />
betrachtende charakteristische Tierarten mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt.<br />
Alle drei Arten wurden im detailliert untersuchten Bereich als Brutvogel nachgewiesen.
FROELICH & SPORBECK Seite 70<br />
Rotschenkel (Tringa totanus)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Eine Kurzbeschreibung der Art wird unter dem Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Schlick-,<br />
Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)“ gegeben.<br />
Kiebitz (Vanellus vanellus)<br />
Der Kiebitz brütet auf flachen, weithin offenen, baumarmen <strong>und</strong> wenig strukturierten Flächen mit<br />
fehlender oder kurzer Vegetation. Das Nahrungsspektrum des Kiebitzes ist sehr vielseitig,<br />
hauptsächlich ernährt er sich von kleinen Bodentieren, aber auch zusätzlich von pflanzlicher<br />
Nahrung.<br />
Im Lebensraumtyp „Salzwiesen“ kam der Kiebitz als Brutvogel vor. Er war hier mit acht locker<br />
verteilten Brutpaaren im feuchteren Teil der Freesendorfer Wiesen vertreten (SCHELLER 2007).<br />
Brandgans (Tadorna tadorna)<br />
Eine Kurzbeschreibung der Brandgans wird unter dem Lebensraumtyp „Strandsee (EU-Code<br />
1150)“ gegeben.<br />
Von der Brandgans wurden zwei Brutpaare in den ufernahen Bereichen des Freesendorfer<br />
Sees ermittelt (SCHELLER 2007), ein weiteres Brutpaar wurde im Salzgrünlandbereich im Südosten<br />
des Struck erfasst.<br />
Primärdünen (EU-Code 2110)<br />
Bei den Standorten der Primär- oder Vordünen handelt es sich um frisch aufgewehte, meist<br />
kalkreiche Sande, die noch der Umlagerung <strong>und</strong>/oder Übersandung unterworfen sind. Ein<br />
schütterer Bewuchs aus nur wenigen Pflanzenarten ist typisch <strong>und</strong> kleine vegetationsfreie Abschnitte<br />
sind Teil des Lebensraumtyps. Ausschlaggebend für diesen Lebensraumtyp sind das<br />
Vorhandensein der für Vordünen typischen Pflanzenarten der Strandroggen-Dünenqueckenflur<br />
(Elymus arenarii-Agropyretum juncei) wie Strandroggen (Elymus arenarius), Dünen-Quecke<br />
(Elymus farctus) oder Salzmiere (Honckenya peploides). Aufgr<strong>und</strong> der geringen Höhe (ab 30<br />
cm Dünensandauflage bis etwa 1 m) <strong>und</strong> der Nähe zur Wasserlinie ist der Wurzelraum salz-<br />
oder brackwasserbeeinflusst <strong>und</strong> es ist noch keine ausgeprägte Süßwasserlinse vorhanden.<br />
Der Lebensraumtyp ist v. a. durch den Tourismus gefährdet: Trittbelastung <strong>und</strong> eine Störung<br />
empfindlicher Brutvogelarten können zu einer nachhaltigen Schädigung der Primärdünen führen.<br />
Ebenso führen Beeinträchtigungen der natürlichen Küstendynamik durch Planieren <strong>und</strong><br />
Bepflanzen von Strandabschnitten zu einer starken Störung oder sogar zur Zerstörung des<br />
Lebensraums.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im FFH-Gebiet kommt der Lebensraumtyp „Primärdünen (EU-Code 2110)“ regelmäßig, meist<br />
linear <strong>und</strong> kleinflächig im Bereich der Anlandungsküsten am Übergang vom Strand zur Weißdüne<br />
vor. Im Standard-Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet angegeben.
FROELICH & SPORBECK Seite 71<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VU finden sich Primärdünen östlich vom Badestrand<br />
<strong>Lubmin</strong> (sehr guter Erhaltungszustand), am Westrand des Struck (sehr guter Erhaltungszustand)<br />
sowie nördlich von Kienheide auf Usedom (guter Erhaltungszustand) (I.L.N. 2007).<br />
Für den Lebensraumtyp wurde mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung keine lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) ausgewählt. Bei der Betrachtung von lebensraumtypischen Tierarten<br />
dieses Lebensraumtyps ist kein Erkenntnisgewinn, der über die Bearbeitung <strong>und</strong> Bewertung<br />
der vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen Parameter hinausgeht, zu erwarten.<br />
Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)<br />
Weißdünen entwickeln sich aus den Primärdünen <strong>und</strong> stehen am Anfang der Küstendünen-<br />
Entwicklungsreihe. Da die Sukzessionslinie kleinflächig oft unterbrochen <strong>und</strong> rückgängig gemacht<br />
wird (durch Trittschäden, Windanrisse, Sturmflutereignisse, etc.), kommt es oft zur<br />
Durchdringung von unterschiedlichen Dünenstadien. Küstendünen sind Sandaufwehungen im<br />
unmittelbaren Einflussbereich der Ostsee oder Boddengewässer. Weißdünen sind bereits höher<br />
als Vordünen (in der Regel >1 m bis mehrere Meter hoch) <strong>und</strong> es ist ein typisches Dünenrelief<br />
ausgeprägt. Bei den Standorten der Weißdünen handelt es sich um frisch aufgewehte, in Abhängigkeit<br />
vom Ausgangsmaterial meist kalkreiche weiße Sande. Aufgr<strong>und</strong> aktiver Umlagerungsprozesse<br />
<strong>und</strong> anhaltender Sandzufuhr von wenigen Zentimetern bis >1 m/Jahr ist ein<br />
lückiger Bewuchs typisch, vegetationsfreie Abschnitte sind Teil des Lebensraumtyps. Im Bereich<br />
der Weißdünen hat noch keine Humusakkumulation stattgef<strong>und</strong>en. Im Gegensatz zu den<br />
Vordünen ist der Prozess der Aussüßung des Wassers im Boden schon fortgeschritten, in der<br />
Regel hat sich bereits eine Süßwasserlinse gebildet (I.L.N. 2007). Weißdünen werden vor allem<br />
von Strandhafer (Ammophila arenaria), von Strandroggen (Leymus arenarius) oder von<br />
Calammophila baltica dominiert<br />
Die Weißdünen sind durch die gleichen Faktoren wie Primärdünen gefährdet.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
„Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)“ kommen angrenzend an Primärdünen ebenfalls<br />
zerstreut im Bereich der Küstenzone des FFH-Gebietes vor. Im Standard-Datenbogen wird ein<br />
prozentualer Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im duB wurden lineare Weißdünenbereiche am Westrand der Freesendorfer Wiesen (Erhaltungszustand<br />
A), am Westrand des Struck (Erhaltungszustand B) <strong>und</strong> nördlich von Karlshagen<br />
auf Usedom (Erhaltungszustand B) erfasst (I.L.N. 2007). Die Weißdünen werden vor allem vom<br />
Elymo-Ammophiletum arenariae (Strandhafer-Gesellschaft) besiedelt. In dieser Gesellschaft<br />
treten hier der Strandhafer (Ammophila arenaria) <strong>und</strong> der Strandroggen (Elymus arenarius) in<br />
etwa zu gleichen Teilen als beherrschende Arten auf. Daneben finden sich als charakteristische<br />
Arten der Tataren-Lattich (Lactuca tatarica) <strong>und</strong> die Acker-Gänsedistel (Sonchus arvensis).
FROELICH & SPORBECK Seite 72<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB keine charakteristischen<br />
Tierarten ausgewählt. Bei der Betrachtung von lebensraumtypischen Tierarten dieses Lebensraumtyps<br />
ist kein Erkenntnisgewinn, der über die Bearbeitung <strong>und</strong> Bewertung der vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen Parameter hinausgeht, zu erwarten.<br />
Graudünen der Küste mit krautiger Vegetation (EU-Code 2130*)<br />
Graudünen sind ältere Dünen mit weitgehend festliegendem Sand <strong>und</strong> beginnender Humusbildung,<br />
die meist unmittelbar landseitig an die vorgelagerte Weißdünenkette anschließen. Je<br />
nach Kalkgehalt <strong>und</strong> Restsandzufuhr sind Silbergrasrasen, Kleinschmielenrasen, stellenweise<br />
auch flechten- <strong>und</strong> moosreiche Ausbildungen möglich (SSYMANK et al. 1998).<br />
Graudünen sind, wie die Weißdünen aus denen sie entstehen, v. a. durch Eindeichungen, Küstenverbau<br />
<strong>und</strong> Küstenschutzmaßnahmen gefährdet. Weitere Gefährdungen bestehen durch<br />
touristische Nutzung (Trittschäden) sowie durch eingeschleppte Arten (Pflanzung <strong>und</strong> spontane<br />
Ausbreitung der Kartoffelrose) (SSYMANK et al. 1998).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im FFH-Gebiet kommt dieser als prioritär eingestufte Lebensraumtyp regelmäßig im Bereich der<br />
Ausgleichsküsten insbesondere an Haken <strong>und</strong> Nehrungen vor. Insgesamt 20 Vorkommen finden<br />
sich in den folgenden Bereichen: Rügen: Palmer Ort, Nordspitze Zudar, Küstenabschnitt<br />
bei Altkamp <strong>und</strong> bei Wreechen, Muglitzer Ort, Stresower Bucht <strong>und</strong> Thiessower Haken. An der<br />
südlichen Boddenküste: Freesendorfer Haken, Peenemünder Haken sowie auf dem Struck, der<br />
Insel Vilm <strong>und</strong> an der Ostseeküste bei Karlshagen (I.L.N. 2007). Der Lebensraumtyp weist floristisch<br />
bedeutsame Dünenrasen auf. Die höheren, schon relativ festgelegten Graudünen sind<br />
mit von Gräsern dominierten, oft kryptogamenreichen Dünenrasen besiedelt. Die Sandtrockenrasen<br />
der Graudünen erzielen in der Regel keine hohen Deckungsgrade. Es sind sehr verschiedenartige<br />
lückige Pionierrasen, die sowohl in basenreichen als auch in basenarmen Ausbildungen<br />
auftreten (I.L.N. 2007). Im Standard-Datenbogen wird ein prozentualer Anteil von <<br />
1 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich tritt dieser prioritäre Lebensraumtyp am Westrand der<br />
Freesendorfer Wiesen, westlich vom Strandbad Freest, auf der Insel Ruden sowie am Ostrand<br />
von Nord-Usedom auf. Ein Graudünenbestand liegt innerhalb eines Dünenkiefernwaldes östlich<br />
vom Flugplatz Peenemünde. Der Erhaltungszustand der Bestände wurde als gut bis sehr gut<br />
eingestuft (I.L.N. 2007). Nur ein kleiner Graudünenbestand am Hafen der Insel Ruden weist<br />
einen mittleren bis schlechten Erhaltungszustand auf. Bei drei Beständen auf dem Ruden <strong>und</strong><br />
dem Peenemünder Haken sind die Graudünen mit dem LRT Feuchte Dünentäler (LRT 2190)<br />
vergesellschaftet.<br />
Nach VOIGTLÄNDER (2007) werden die Bestände am Westrand der Freesendorfer Wiesen v.a.<br />
durch Drahtschmielen-Sandseggen-Rasen geprägt, die einer nur langsam voranschreitenden<br />
natürlichen Sukzession unterliegen. Für den Zeitraum 1999 bis 2007 konnten kaum Veränderungen<br />
der floristischen Zusammensetzung festgestellt werden (VOIGTLÄNDER 2007). Sandseg-
FROELICH & SPORBECK Seite 73<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
gen-Rasen besitzen eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nährstoffanreicherungen jeglicher<br />
Art. Grasnelken-Schafschwingel-Rasen sind hier nur noch kleinflächig innerhalb des FFH-<br />
Gebietes ausgebildet. Einige Graudünen werden von Silbergrasrasen besiedelt.<br />
Für den Lebensraumtyp wurde anhand der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB der Steinschmätzer, der<br />
Warzenbeißer <strong>und</strong> die Ebenästige Rentierflechte aufgr<strong>und</strong> ihrer projektspezifischen Empfindlichkeit<br />
ausgewählt.<br />
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)<br />
Der Steinschmätzer ist relativ stenök auf offene bis halboffene Landschaften mit Habitaten von<br />
steppenartigem Charakter angewiesen. Er besiedelt trockene Standorte mit vegetationslosen<br />
Stellen oder schütterer, meist xerophiler Gras- bzw. Krautvegetation, z.B. kleinflächige Heiden,<br />
Küsten- <strong>und</strong> Binnendünen, Brachflächen im Bereich von Siedlungen <strong>und</strong> Industrieanlagen, Abtorfungsflächen<br />
in Hochmooren, Rodungen, Brand- <strong>und</strong> Windwurfflächen. Weitere Habitate mit<br />
bekannten Brutvorkommen sind Feuerschutzschneisen, Truppenübungsplätze, Bahndämme,<br />
Sandgruben sowie Ackerflächen in unmittelbarer Waldnähe. Brutplätze befinden sich in Spalten<br />
<strong>und</strong> Höhlungen in Bodennähe. Der Raumbedarf während der Brutzeit beträgt weniger als 0,4<br />
bis mehr als 13 ha. Die Fluchtdistanz der Art schwankt zwischen 10 <strong>und</strong> 30 m (FLADE 1994).<br />
EICHSTÄDT et al. (2006) geben für Mecklenburg-Vorpommern einen Brutbestand von 900 bis<br />
1.000 Paaren an. Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in ganz Deutschland gilt die Art<br />
als stark gefährdet. Ein Gefährdung geht vor allem von einer Intensivierung der Landnutzung<br />
sowie einer Eutrophierung der Landschaft aus (BAUER et al. 2005).<br />
Unter Berücksichtigung der verloren gehenden Lebensräume auf dem Baufeld des <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong><br />
des Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebietes <strong>Lubmin</strong>er Heide befindet sich der einzige bekannte Brutstandort<br />
des Steinschmätzers im Umfeld des FFH-Gebietes nach IFAÖ (2007c) auf dem Gelände<br />
des ehemals geplanten GUD I unmittelbar am Industriehafen. Darüber hinaus ist der Steinschmätzer<br />
ebenfalls als potenzieller Brutvogel im Bereich des Strucks <strong>und</strong> der Freesendorfer<br />
Wiesen anzusehen. Günstige Lebensraumstrukturen bietet der Lebensraumtyp Graudüne (EU-<br />
Code 2130*) der Art. Auf dem Durchzug kommt die Art auch im Bereich des Graslandes vor. Im<br />
Jahr 1999 wurden durch SELLIN (1999B) bis zu 60 Individuen nachgewiesen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der hohen Empfindlichkeit <strong>und</strong> Seltenheit des Steinschmätzers ist dieser besonders<br />
als Stellvertreter für die anderen charakteristischen Vogelarten des LRT 2130 geeignet.<br />
Ebenästige Rentierflechte (Cladonia portentosa)<br />
Die Ebenästige Rentierflechte kommt auf offenen, nährstoffarmen <strong>und</strong> sauren Standorten vor.<br />
Sie besiedelt hauptsächlich Sandmagerrasen, Zwergstrauchheiden, Hochmoorbulte <strong>und</strong> lichte<br />
Kiefernwälder vom Tiefland bis in die subalpine Stufe. Die Art ist in der Roten Liste der Flechten<br />
Mecklenburg-Vorpommerns als „gefährdet“ eingestuft (LITTERSKI & SCHIEFELBEIN 2007).<br />
Im Untersuchungsgebiet wurden Flechten nur auf Gattungsniveau kartiert, dabei wurde Cladonia<br />
im Drahtschmielen-Sandseggenrasen der Graudünen nachgewiesen (VOIGTLÄNDER 2007).<br />
Die Art Cladonia portentosa steht in dieser Betrachtung stellvertretend für die Gattung, da sie<br />
relativ häufig ist <strong>und</strong> potenziell im Gebiet vorkommen kann.
FROELICH & SPORBECK Seite 74<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Flechten haben sich generell als besonders empfindlich gegenüber Einträgen von Schwefelverbindungen<br />
<strong>und</strong> anderen Schadstoffen erwiesen. Diese Organismen sind im Gegensatz zu höheren<br />
Pflanzen den Schadstoffen direkt ausgesetzt, da sie keine Abschlussgewebe mit Schutzfunktion<br />
besitzen. Neben Schwefeldioxid wirken auch Stickoxide schädigend auf das<br />
Wachstum, die Fortpflanzung <strong>und</strong> das symbiotische Gleichgewicht der Flechten (GILBERT 1970,<br />
TÜRK et al. 1974, SCHÖLLER 1997). Stickstoffeinträge bewirken auch indirekt eine Beeinträchtigung<br />
von Flechtenvorkommen, da diese die Konkurrenzkraft der höheren Pflanzen verstärken<br />
<strong>und</strong> die Flechten dadurch am Standort verdrängt werden.<br />
Warzenbeißer (Decticus verrucivorus)<br />
Der Warzenbeißer benötigt offene, warme Lebensräume mit nicht zu geringer Bodenfeuchte<br />
<strong>und</strong> einer abwechslungsreichen Vegetationsstruktur mit Offenstellen <strong>und</strong> dichteren Grasbeständen.<br />
In Mecklenburg-Vorpommern besiedelt er vor allem Trocken- <strong>und</strong> Halbtrockenrasen, Binnendünen<br />
<strong>und</strong> Heiden. Seine Präferenz für lückigere Vegetation kommt auch anderen thermophilen<br />
Arten zugute. Zugleich ist er damit gegenüber einer Eutrophierung <strong>und</strong> zunehmendem<br />
Pflanzenwachstum empfindlich. Der Warzenbeißer ist in Mecklenburg-Vorpommern durch intensive<br />
Grünlandnutzung, Verbuschung <strong>und</strong> Entwässerungsmaßnahmen gefährdet (WRANIK et<br />
al. 2009). Der Warzenbeißer wurde auf den Graudünen im Untersuchungsgebiet in geringer<br />
Dichte, aber stetig nachgewiesen.<br />
Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region (EU-Code<br />
2180)<br />
Dieser LRT umfasst natürliche oder naturnahe Wälder auf Küstendünen. Meist handelt es sich<br />
um bodensaure Laubmischwälder mit Eiche, Birke <strong>und</strong> Buche, im Osten zunehmend auch mit<br />
Kiefer in der Baumschicht. Die Bäume sind durch Windschur oft niedrigwüchsig. In feuchten<br />
Dünentälern sind lokal Bruchwälder mit Schwarzerle möglich (SSYMANK et al. 1998).<br />
Hauptgefährdungsursachen sind bzw. waren die Beweidung der Dünen <strong>und</strong> (insbesondere<br />
früher) auch die Brennholznutzung. Stellenweise führt intensive Forstwirtschaft (Kiefernanpflanzungen)<br />
zu Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im Standard-Datenbogen wird für den LRT ein prozentualer Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet<br />
angegeben, der Erhaltungszustand der Dünenwälder wird mit C (mittel bis schlecht) bewertet.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Auf Nordusedom wurden bei den Kartierungen zum Vorhaben <strong>GuD</strong> II (FROELICH & SPORBECK<br />
2009A) 24 Flächen des LRT erfasst. Dabei waren lediglich die küstennahen Flächen in einem<br />
guten Erhaltungszustand. Landeinwärts gelegene Flächen hatten in der Regel lediglich einen<br />
mäßig bis durchschnittlichen Wert. Kiefernforste ohne naturnahen Unterwuchs (Biotopcodes<br />
WZK, WMC) wurden entsprechend der Kartierungshinweise von SSYMANK et al. (1998) nicht<br />
dem FFH-Lebensraumtyp zugeordnet. In Mecklenburg-Vorpommern werden solche Bestände<br />
allerdings für das Management von FFH-Waldlebensraumtypen mit bewertet (MINISTERIUM FÜR
FROELICH & SPORBECK Seite 75<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2009). Sie wären bei einer Bewertung mit<br />
C klassifiziert worden.<br />
Die alten Eichenwaldreste auf dem Struck wurden entgegen früherer Kartierungen nicht diesem<br />
Lebensraumtyp zugeordnet, da weder die Vorinformationen aus geologischen <strong>und</strong> topographischen<br />
Karten, noch die Prüfung im Gelände ergab, dass es sich hier um Dünenstandorte handelt.<br />
Ein weiterer etwa 11 ha großer Bestand dieses LRT befindet sich auf der Insel Ruden.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB keine charakteristischen<br />
Tierarten ausgewählt. Bei der Betrachtung von lebensraumtypischen Tierarten dieses Lebensraumtyps<br />
ist kein Erkenntnisgewinn, der über die Bearbeitung <strong>und</strong> Bewertung der vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen Parameter hinausgeht, zu erwarten.<br />
Feuchte Dünentäler (EU-Code 2190)<br />
Der Lebensraumtyp umfasst feuchte Senken <strong>und</strong> Ausblasungsmulden in Küstendünenbereichen<br />
auf meist noch basenreichen Sanden. Der Standort kann rein gr<strong>und</strong>- oder brackwasserbeeinflusst<br />
sein. Es kommen sehr unterschiedliche Biotoptypen wie permanente oder temporäre<br />
Gewässer, Vermoorungen, Zwergbinsenvegetation, feuchte Heiden, Röhrichte oder Großseggenrieder<br />
vor. Der Lebensraumtyp kann als Biotopkomplex ausgebildet sein (SSYMANK et al.<br />
1998).<br />
Nach SSYMANK et al. (1998) wird dieser Lebensraumtyp vor allem durch Trinkwasserentnahme,<br />
Entwässerung, Freizeitnutzung <strong>und</strong> Nährstoffeintrag gefährdet.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Im FFH-Gebiet kommt der LRT nur sehr selten im Bereich der Ausgleichsküsten an Haken <strong>und</strong><br />
Nehrungen vor. Nach I.L.N. (2007) befindet sich ein Vorkommen auf dem Ruden <strong>und</strong> zwei weitere<br />
auf dem Peenemünder Haken. Für den Lebensraumtyp „Feuchte Dünentäler (EU-Code<br />
2190)“ wird im Standard-Datenbogen ein prozentualer Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet angegeben.<br />
Der Erhaltungszustand der Dünentäler wird im Standard-Datenbogen des FFH-<br />
Gebietes mit B (gut) bewertet.<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
In einem Waldbereich auf Nord-Usedom östlich des Flugplatzes Peenemünde befinden sich<br />
zwei relativ kleinflächige (0,12 <strong>und</strong> 0,15 ha) Bestände dieses Lebensraumtyps (I.L.N. 2007). Es<br />
handelt sich um ein Torfmoos-Schilfröhricht mit Schilf-Weidengebüsch (Erhaltungszustand C),<br />
<strong>und</strong> einen Bestand der sich aus Pfeifengrasflur, Wollgrasried <strong>und</strong> Schilfröhricht zusammensetzt<br />
(Erhaltungszustand B).<br />
Bei den Kartierungen von FROELICH & SPORBECK (2009A) wurde der Erhaltungszustand dieser<br />
Flächen folgendermaßen beurteilt: Während das stark verbuschte Dünental mit B klassifiziert<br />
wurde, konnte das offene aufgr<strong>und</strong> der hervorragenden Artenausstattung <strong>und</strong> der geringen<br />
Beeinträchtigungen A erreichen. Die offene Fläche unterliegt einer Pflegemahd, so dass der<br />
Zustand nicht als stabil bezeichnet werden kann. Dieses Dünental wird von Torfmoos-
FROELICH & SPORBECK Seite 76<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Pfeifengras-Schilf-Wollgras-Ried eingenommen. Typische Arten des Dünentales sind Schmalblättriges<br />
Wollgras (Eriophorum angustifolium), Gemeiner Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris),<br />
Gemeines Schilf (Phragmites australis) <strong>und</strong> Polytrichum commune.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) die Kreuzkröte <strong>und</strong> die Seidenbienenart Colletes succinctus als zu<br />
betrachtende charakteristische Tierart mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt.<br />
Kreuzkröte (Bufo calamita)<br />
Die Kreuzkröte ist eine Pionierart trockenwarmer Lebensräume in Gebieten mit lockeren <strong>und</strong><br />
sandigen Böden. Das Vorhandensein offener, vegetationsarmer bis freier Flächen mit ausreichenden<br />
Versteckmöglichkeiten als Landlebensraum sowie weitgehend vegetationsfreie Gewässer<br />
(Flach- bzw. Kleinstgewässer) als Laichplätze sind Voraussetzung für die Existenz der<br />
Kreuzkröte. Die Art bevorzugt dabei Flachgewässer, die oft <strong>und</strong> häufig austrocknen. Die Larvenentwicklungszeit<br />
ist verhältnismäßig kurz, so dass sie die Tümpel verlassen können, bevor<br />
diese im Sommer austrocknen. Besiedelt werden Abgrabungsflächen, Binnendünen, Bergbaufolgelandschaften,<br />
Brachen, Baugelände, Truppenübungsplätze, Küstendünen, Salzwiesen<br />
sowie Ruderalflächen im menschlichen Siedlungsbereich.<br />
Die Verbreitung erstreckt sich in West-, Mittel- <strong>und</strong> Nordosteuropa von der Iberischen Halbinsel<br />
über die Südspitze Schwedens bis ins Baltikum <strong>und</strong> nach Weißrussland. In Deutschland kommt<br />
die Kreuzkröte – allerdings zerstreut <strong>und</strong> unstetig – in weiten Teilen vor. An den Küsten der Ost-<br />
<strong>und</strong> Nordsee besiedelt die Kreuzkröte Dünenbereiche, wobei die schwach sauren, nahezu vegetationslosen<br />
Kleingewässer als Laichplätze dienen (PETERSEN et al. 2004). Hinsichtlich des<br />
Wasserchemismus ist eine hohe Plastizität der Art bekannt, die Kreuzkröte toleriert auch<br />
Brackwasserbedingungen (ebd. 2004). Laut Atlas der Herpetofauna Mecklenburg-<br />
Vorpommerns (Stand 2007) gibt es Vorkommensnachweise vom Struck <strong>und</strong> vom Ruden, aber<br />
nicht vom Peenemünder Haken. In der Roten Liste der Lurche Deutschlands (KÜHNEL et al.<br />
2009B) steht die Art auf der Vorwarnliste, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Art als stark gefährdet<br />
eingestuft (BAST et al. 2001). Im duB ist die Kreuzkröte für das Naturschutzgebiet<br />
"Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“ belegt (UM M-V 2003). Hier kommt sie regelmäßig<br />
im Bereich der Nordostspitze des Strucks abseits des LRT 2190 vor. Die Art fehlt in den<br />
Freesendorfer Wiesen. Es ist lediglich von einem potenziellen Vorkommen im LRT 2190 auszugehen.<br />
Colletes succinctus (Seidenbienenart)<br />
Colletes succinctus ist eine charakteristische Sandart, die zudem noch höchste Ansprüche an<br />
ihre Pollenquelle stellt. Sie ist auf Ericaceen spezialisiert <strong>und</strong> die Besenheide Calluna vulgaris<br />
ist ihre Hauptpollenquelle. Sie bewohnt vor allem Sandheiden, aber auch Flugsandfelder, alte<br />
Sandgruben oder besonnte, sandige Waldränder. Die Nester werden im Boden selbst gegraben.<br />
Die Seidenbiene ist eine typische Spätsommerart mit einer Flugzeit von August bis Sep-<br />
tember (WESTRICH 1989).<br />
Die Art ist vom Mittelmeerraum bis nach Skandinavien verbreitet. In Deutschland besteht keine<br />
Verbreitungsgrenze <strong>und</strong> es existieren aus allen B<strong>und</strong>esländern aktuelle Nachweise (DATHE
FROELICH & SPORBECK Seite 77<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
2001). Regional kann die Art aber auch selten sein. In Deutschland wird sie als gefährdet ein-<br />
gestuft (WESTRICH et al. 2008).<br />
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art auf dem feuchten Dünental im Gebiet Nord-Usedom<br />
nachgewiesen. Nur hier gibt es Calluna-Bestände, die als Nahrungshabitat in Betracht kommen.<br />
Auf den übrigen Probeflächen ist die Art nicht zu erwarten (FROELICH & SPORBECK 2009D).<br />
Die Art reagiert empfindlich auf Nährstoffanreicherungen, die zu negativen Veränderungen ihres<br />
Lebensraums führen können.<br />
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition<br />
(EU-Code 3150)<br />
Dieser FFH-Lebensraumtyp umfasst natürliche eutrophe Seen <strong>und</strong> Teiche einschließlich ihrer<br />
Ufervegetation mit Schwimm- <strong>und</strong> Wasserpflanzenvegetation. Kennzeichnende Schwimm- <strong>und</strong><br />
Wasserpflanzengesellschaften sind u. a. Wasserlinsendecken (Lemnetea), Laichkrautgesellschaften<br />
(Potamogetonetea pectinati) sowie Krebsscheren- (Stratiotes aloides) <strong>und</strong> Wasserschlauch-<br />
(Utricularia ssp.) Bestände. Der Lebensraumtyp umfasst neben dem eigentlichen<br />
Wasserkörper auch den amphibischen Bereich mit seinen Röhrichten, Hochstaudenfluren <strong>und</strong><br />
Seggenriedern.<br />
Hauptgefährdungsfaktor für den LRT ist die Eutrophierung der Gewässer. Diese kann u. a.<br />
durch Erweiterung des natürlichen Einzugsgebietes, durch Entwässerung angrenzender Moore,<br />
durch Drainage, durch intensive landwirtschaftliche Nutzung im Einzugsgebiet, durch direkte<br />
Einleitung häuslicher oder landwirtschaftlicher Abwässer, durch intensive fischereiliche Nutzung<br />
mit Besatz benthivorer Fische <strong>und</strong> Zufütterung oder durch Badenutzung erfolgen. Eutrophierung<br />
kann eine Massenentwicklung von Grün- <strong>und</strong>/oder Blaualgen verursachen <strong>und</strong> so zur Wassereintrübung<br />
mit dauerhaft stark eingeschränkten Sichttiefen (< 1 m) <strong>und</strong> damit zu Rückgang<br />
<strong>und</strong> Verdrängung der typischen Pflanzenarten (vor allem der Tauchfluren, Faunenwandel durch<br />
Verlust <strong>und</strong> veränderte Dominanzverhältnisse typischer Fisch- <strong>und</strong> Libellenarten, massive Entwicklung<br />
dichter Röhrichte <strong>und</strong> Großseggenriede, Einwanderung <strong>und</strong> Ausbreitung von Gehölzen)<br />
führen (I.L.N. 2007).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Eutrophe Stillgewässer treten im FFH-Gebiet in der Gr<strong>und</strong>moräne <strong>und</strong> im Küstenbereich auf. Im<br />
FFH-Gebiet kommt der Lebensraumtyp nach I.L.N. (2007) mit 9 erfassten kleineren Vorkommen<br />
vor. Der Kölpiensee auf Usedom wurde allerdings von I.L.N. in 2007 nicht mit erfasst, da Seen<br />
dieser Größe mit der vorgegebenen Kartiermethode von Land her <strong>und</strong> ohne Bootseinsatz nicht<br />
sinnvoll kartiert oder bewertet werden können. Die erfassten Vorkommen des LRT finden sich<br />
auf Rügen östlich Dumsevitz, im NSG Goor, im Nordosten der Insel Vilm, an der südlichen<br />
Boddenküste nördlich Wampen <strong>und</strong> auf dem Struck. Im Standard-Datenbogen wird ein prozentualer<br />
Anteil von < 1 % am Gesamtgebiet angegeben. Der Erhaltungszustand der Seen wird im<br />
Standard-Datenbogen des FFH-Gebietes mit C (mäßig bis durchschnittlich) bewertet, bei den<br />
Kartierungen von I.L.N. (2007) wurde der Erhaltungszustand aller Vorkommen im Gebiet jedoch<br />
mit B oder A bewertet.
FROELICH & SPORBECK Seite 78<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Ein etwa 2 ha großer See in einem Wäldchen auf dem Struck wurde bei der Kartierung von<br />
I.L.N. (2007) diesem Lebensraumtyp zugeordnet. Das Gewässer weist eine Kammlaichkraut-<br />
Tauchflur <strong>und</strong> eine Wasserlinsen-Schwimmdecke auf (I.L.N. 2007). Der Erhaltungszustand des<br />
Gewässers wurde als gut (B) eingestuft (I.L.N. 2007). Auf Nord-Usedom wurden bei den Kartierungen<br />
von FROELICH & SPORBECK in 2008 zusätzlich weitere 8 Vorkommen des LRT 3150 erfasst.<br />
Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der LRT 3150 wesentlich häufiger<br />
vorkommt, da sich aus den unzähligen Bombentrichtern oft naturnahe Kleingewässer entwickelt<br />
haben (diese Flächen liegen aber zum Teil im militärischen Sperrgebiet).<br />
Die Bewertung des Erhaltungszustands mit C aus dem Standarddatenbogen deckt sich in der<br />
Kartierung von FROELICH & SPORBECK (2009A) lediglich mit der Bewertung der Artausstattung<br />
der Kleingewässer (Biotopcode SKW) <strong>und</strong> der eines Torfstiches (Biotopcode STR). Zwei größere<br />
Gewässer (Biotopcodes SVS, SVU) wurden höher bewertet. Viele der Gewässer weisen aber<br />
nur geringe Beeinträchtigungen auf <strong>und</strong> haben gut ausgebildete Habitatstrukturen, so dass sie<br />
insgesamt mit gut bewertet wurden.<br />
Für den Lebensraumtyp wurde mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende Arten als zu<br />
betrachtende charakteristische Tierarten mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt:<br />
Ringelnatter (Natrix natrix)<br />
Die Ringelnatter ist in fast ganz Europa verbreitet. Die Art besiedelt bevorzugt Biotope in Gewässernähe,<br />
wie vegetationsreiche Fluss- <strong>und</strong> Seeufer im Bereich von Feuchtwiesen, Mooren<br />
<strong>und</strong> Sümpfen, aber auch aufgelassene Sand- <strong>und</strong> Kiesgruben sowie Steinbrüche.<br />
Die tagaktive Ringelnatter kann sehr gut schwimmen <strong>und</strong> tauchen. Oft sonnt sie sich lange im<br />
Uferbereich. Das Gelege besteht aus bis zu 30 Eiern, die bevorzugt in Laub-, Mist- oder Komposthaufen<br />
abgelegt werden. Die Ringelnatter ernährt sich überwiegend von Amphibien, wobei<br />
Frösche den Hauptteil der Nahrung stellen.<br />
Laut Atlas der Herpetofauna Mecklenburg-Vorpommerns (Stand 2007) ist die Art im Untersuchungsgebiet<br />
verbreitet.<br />
In der Roten Liste der Kriechtiere Deutschlands (KÜHNEL et al. 2009A) steht die Art auf der Vorwarnliste.<br />
In Mecklenburg-Vorpommern ist die Art als stark gefährdet eingestuft (BAST et al.<br />
2001), obwohl sie hier einen b<strong>und</strong>esweiten Verbreitungsschwerpunkt aufweist. Bei den Reptilien-Kartierungen<br />
in der Nähe des Standorts von FROELICH & SPORBECK in 2007 <strong>und</strong> 2009 konn-<br />
te die Art nachgewiesen werden.<br />
Keilflecklibelle (Aeshna isosceles)<br />
Das Verbreitungsgebiet der Keilflecklibelle umfasst Süd- <strong>und</strong> Mitteleuropa sowie Nordafrika<br />
(GÜNTHER 2005, HÖPPNER & STERNBERG 2000). Der nördlichste F<strong>und</strong>punkt ist Gotland. Im duB<br />
konnte die Art am oben genannten 2 ha großen See auf dem Struck nachgewiesen werden<br />
(FROELICH & SPORBECK 2008P). SIe ist eine Tieflandart <strong>und</strong> besiedelt sich schnell erwärmende
FROELICH & SPORBECK Seite 79<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Gewässer. Bevorzugt werden dicht bewachsene Gewässer mit verschlammtem Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
ausgedehntem Röhrichtgürtel aus Schilf (ABDANK et al. 2004). Die Larven leben soweit bekannt<br />
in wärmebegünstigten Flachwasserbereichen mit Schlammschicht sowie innerhalb von lockeren<br />
Röhrichtbeständen bzw. submersen Matten.<br />
Die Larvalgewässer sind meso- bis eutroph, wobei starke, mit Faulschlammbildung verb<strong>und</strong>ene<br />
Eutrophierung nicht toleriert wird (KUHN 1998). Imaginalhabitate sind Verlandungszonen von<br />
Stillgewässern sowie Gräben mit Röhrichten aus Schilf, Teichsimse etc. Größere Flächenaus-<br />
dehnungen von Rohrkolben werden gemieden.<br />
Artenreiche Borstgrasrasen submontan auf dem europäischen Festland (EU-Code 6230*)<br />
Der prioritäre Lebensraumtyp „Artenreiche Borstgrasrasen submontan auf dem europäischen<br />
Festland (EU-Code 6230*)“ umfasst niedrigwüchsige geschlossene Rasen auf nährstoffarmen,<br />
trockenen bis mäßig feuchten Standorten, die durch das Vorkommen des Borstgrases (Nardus<br />
stricta) geprägt sind. Borstgrasrasen siedeln vorwiegend auf potenziellen Waldstandorten mit<br />
silikatischen <strong>und</strong> sauren Substraten. Ihre Entstehung ist auf extensive Beweidung oder Mahd<br />
zurückzuführen. Sie kommen in Mecklenburg-Vorpommern nur selten <strong>und</strong> überwiegen kleinflächig<br />
sowie in der Regel in verarmter Ausprägung vor. Die bis in die Mitte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
in Mecklenburg-Vorpommern noch relativ weit verbreiteten Borstgrasheiden sind seitdem rasch<br />
<strong>und</strong> weitgehend unbemerkt bis auf einen winzigen Bruchteil ihrer ehemaligen Vorkommen geschrumpft<br />
<strong>und</strong> gehören zu den am stärksten gefährdeten Pflanzengesellschaften Mitteleuropas.<br />
Sie wachsen auf frischen, sehr nährstoffarmen Sandböden. Daher dominieren in ihnen konkurrenzschwache<br />
Arten, die gegenüber Nährstoffanreicherung äußerst empfindlich reagieren <strong>und</strong><br />
an gr<strong>und</strong>wassernahe frische Standorte geb<strong>und</strong>en sind (VOIGTLÄNDER 2007).<br />
Dieser Lebensraumtyp ist vor allem durch folgende Faktoren gefährdet: Nutzungsaufgabe,<br />
Nährstoffeintrag (Düngung, atmogener Eintrag, Gülle), Aufforstung <strong>und</strong> Intensivierung der Beweidung<br />
(SSYMANK et al. 1998).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Laut Standard-Datenbogen nimmt der Lebensraumtyp im FFH-Gebiet nur einen kleinen Flächenanteil<br />
von
FROELICH & SPORBECK Seite 80<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die bestandsbestimmenden Arten sind neben einigen Gräser wie Borstgras (Nardus stricta),<br />
Rot-Schwingel (Festuca rubra), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Ruchgras (Anthoxanthum<br />
odoratum), Dreizahn (Danthonia decumbens), Gemeines Zittergras (Briza media) <strong>und</strong><br />
Pfeifengras (Molinia caerulaea) auch Seggen wie Sandsegge (Carex arenaria), Pillen-Segge<br />
(Carex pilulifera) <strong>und</strong> Wiesen-Segge (Carex nigra) sowie andere Magerzeiger wie Gewöhnliches<br />
Ferkelkraut (Hypochoeris radica), Gewöhnliche Hainbinse (Luzula campestris), Blutwurz<br />
(Potentilla erecta), Färber-Scharte (Serratula tinctoria), Echter Ehrenpreis (Veronica offinzinalis),<br />
H<strong>und</strong>sveilchen (Viola canina), Niedrige Schwarzwurzel (Scorzonera humilis), Prachtnelke<br />
(Dianthus suberbus) <strong>und</strong> Waldläusekraut (Pedicularis sylvatica) (ebd.).<br />
Innerhalb der Borstgras-Weiderasen lassen sich vegetationsk<strong>und</strong>lich zwei Ausbildungsformen<br />
unterscheiden. So tritt neben der Normal-Ausbildungsform auch eine Kammgras-<br />
Ausbildungsform auf. Die Letztere enthält neben den für die Borstgras-Weiderasen charakteristischen<br />
Arten auch noch einige Arten der Kammgras-Weiderasen, verursacht vor allem durch<br />
die örtlich enge Verzahnung beider Vegetationsformen. Außerdem lassen sich ansatzweise drei<br />
Varianten unterscheiden, die als „Fuchsseggen-Variante, als Kleinseggen-Variante <strong>und</strong> als<br />
Normal-Variante bezeichnet werden. In der Fuchsseggen-Variante ist der Anteil der Arten der<br />
Kammgras-Weiden am geringsten. Die Kleinseggen-Variante zeichnet sich insbesondere durch<br />
einen hohen Deckungsgrad <strong>und</strong> eine hohe Stetigkeit einiger Kleinseggen wie Hirse-Segge<br />
(Carex panicea) <strong>und</strong> Wiesen-Segge (Carex nigra) aus. Außerdem haben in ihr Arten wie Gemeines<br />
Zittergras (Briza media) <strong>und</strong> Dreizahn (Danthonia decumbens) ihre höchste Dominanz.<br />
Als Differenzialarten der Variante können auch Gemeine Kreuzblume (Polygala vulgaris), Gemeine<br />
Braunelle (Prunella vulgaris) <strong>und</strong> Tausengüldenkraut-Arten (Centaurium spec.) gelten. In<br />
der Normal-Variante erreicht Nardus stricta die höchste Dominanz. Außerdem kommt in ihr<br />
auch die Besenheide (Calluna vulgaris) vor, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in Torfbinsen-<br />
Borstgras-Weiderasen (die im Anschluss beschrieben werden) besitzt. In der Normal-Variante<br />
kommen auch das in Mecklenburg-Vorpommern vom Aussterben bedrohte Wald-Läusekraut<br />
(Pedicularis sylvatica) sowie die Pillen-Segge (Carex pilulifera) vor (VOIGTLÄNDER 2007).<br />
In zwei Teilflächen sind auf dem Struck <strong>und</strong> den Freesendorfer Wiesen zudem Torfbinsen-<br />
Borstgras-Weiderasen belegt, die ebenfalls dem Lebensraumtyp zuzuordnen sind. Sie wachsen<br />
auf den besonders armen Standorten <strong>und</strong> stehen in ihrer floristischen Zusammensetzung den<br />
echten atlantischen Feuchtheiden am nächsten. In ihnen fehlen Arten der Pfeifengras-<br />
Feuchtwiesen. Auch die Arten der übrigen im Untersuchungsraum vorkommenden Feuchtwiesen<br />
bzw. –weiden fehlen trotz der örtlichen Nähe fast vollständig. Gekennzeichnet sind die<br />
Torfbinsen-Borstgras-Weiderasen durch die Arten Besenheide (Calluna vulgaris), Pillen-Segge<br />
(Carex pilulifera), Sparrige Binse (Juncus squarrosus) <strong>und</strong> Wacholder (Juniperus communis)<br />
(VOIGTLÄNDER 2007). Nach BERG et al. (2004) handelt es sich bei Binsen-Borstgras-Rasen um<br />
eine Übergangsgesellschaft, die in Mecklenburg-Vorpommern floristische Gemeinsamkeiten mit<br />
der Pfeifengras-Ausbildung der Heidekraut-Heide <strong>und</strong> den Juncus squarrosus-reichen Moorhei-<br />
den aufweisen.<br />
VOIGTLÄNDER erstellte 2007 eine Wiederholungskartierung der Borstgrasrasen auf dem Struck<br />
<strong>und</strong> den Freesendorfer wiesen, im Vergleich zu den Bestandserfassungen der Erstkartierung im<br />
Jahr 1999 konnte er kaum Vegetationsveränderungen feststellen. „Negative Entwicklungstendenzen<br />
waren nicht erkennbar. Zu den positiven Veränderungen gehört, dass die Fläche, die<br />
von der namensgebenden <strong>und</strong> bestandsgefährdeten Art Nardus stricta eingenommen wird, sich
FROELICH & SPORBECK Seite 81<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
seit der letzten Untersuchung deutlich ausgedehnt hat. Der Gr<strong>und</strong> dafür scheint in der anhaltenden<br />
Beweidung zu liegen. Außerdem lassen einige in Mecklenburg-Vorpommern sehr selten<br />
gewordene <strong>und</strong> stark gefährdete Arten wie Scorzonera humilis, Polygala vulgaris, Pedicularis<br />
sylvatica, Hordeum secalinum <strong>und</strong> Juncus squarrosus bisher keine Abnahme ihrer Häufigkeit<br />
erkennen“ (ebd. : 9).<br />
Bei der Lebensraumtypenkartierung von I.L.N. (2007) wird 10 % der Vorkommen ein sehr guter<br />
Erhaltungszustand zugewiesen <strong>und</strong> 90 % der Vorkommen ein guter Zustand.<br />
Für den Lebensraumtyp wurde mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB folgende Arten als zu<br />
betrachtende charakteristische Tierarten mit einer projektspezifischen Empfindlichkeit ausgewählt:<br />
Kreuzotter (Vipera berus)<br />
Die Kreuzotter hat ein eurosibirisches Verbreitungsgebiet <strong>und</strong> kommt in ganz Mecklenburg-<br />
Vorpommern zerstreut vor. Schwerpunktvorkommen finden sich u.a. auf Ostrügen bei<br />
Peenemünde sowie der Ueckermünder Heide (ABDANK et al. 2004). Die Kreuzotter besiedelt im<br />
norddeutschen Tiefland primär die verbliebenen Moorgebiete mit ihren Grenzbereichen sowie<br />
im Bereich der Ostseeküste, auf Rügen <strong>und</strong> auf Usedom die Küstenheiden (SCHIEMENZ & GÜN-<br />
THER 1994). Charakteristisch für die einzelnen besiedelten Habitate sind große Tag-Nacht-<br />
Unterschiede in den Temperaturen, eine verhältnismäßig kurze Vegetationsperiode aufgr<strong>und</strong><br />
des vorhandenen Mikroklimas sowie hohe Niederschläge in Verbindung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit<br />
(VÖLKL & THIESMEIER 2002). Hinzu kommen als weitere Charakteristika eine hohe<br />
Anzahl von Randstrukturen, die sich besonders schnell <strong>und</strong> gut erwärmen, ein kleinräumiges<br />
Mosaik mit hochwüchsigen Pflanzen, kurzrasigen Bereichen, niedrigen Gräsern, offenen Flächen<br />
sowie vielen Versteckmöglichkeiten. Eine hohe Dichte an totem organischen Material,<br />
dass sich vor allem im Frühjahr schnell erwärmt, ist ebenfalls entscheidend.<br />
Für Mecklenburg-Vorpommern werden die Biotopansprüche von BAST et al. (1992) <strong>und</strong> ABDANK<br />
et al. (2004) zusammengefasst. Hier werden feuchte, großflächig ausgeprägte windgeschützte<br />
Habitate mit Zonen starker Sonneneinstrahlung <strong>und</strong> Deckungs- <strong>und</strong> Unterschlupfmöglichkeiten<br />
besiedelt. Dies sind z. B. Hochmoore, Heiden, lichte Kiefernwälder, Trockenrasen <strong>und</strong> Dünen.<br />
Im duB findet die Art v. a. auf dem Struck im Bereich der Borstgrasrasen, die an flächige Gehölzstrukturen<br />
angrenzen, gute Habitatbedingungen vor.<br />
Von der Kreuzotter (Vipera berus) gelang bei der Kartierung nördlich des Industrieha-<br />
fens/Einlaufkanals der Nachweis von sechs Exemplaren (FROELICH & SPORBECK 2009C, Anlage<br />
21 der UVU). Die Nachweise konzentrierten sich auf das Gebiet der Erdstoffdeponie auf dem<br />
Baugelände des <strong>GuD</strong> II (also außerhalb des FFH-Gebietes), das möglicherweise eine Funktion<br />
als Überwinterungsgebiet bzw. Herbst-/Frühjahrssonnplatz <strong>und</strong> somit die Rolle eines Schlüsselhabitates<br />
im Sinne von VÖLKL & KORNACKER (2004) bzw. VÖLKL & THIESMEIER (2002) aufweist.<br />
Trotz dieser mehrfachen Nachweise ist die Population nördlich des Industriehafens/Einlaufkanals<br />
aufgr<strong>und</strong> des limitiert zur Verfügung stehenden Lebensraumes individuenarm.<br />
Die Nachweisorte liegen vollständig außerhalb des LRT 6230*, vermutlich werden die
FROELICH & SPORBECK Seite 82<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Borstgrasrasen der Freesendorfer Wiesen aufgr<strong>und</strong> der Beweidungsintensität <strong>und</strong> gering ausgeprägten<br />
Vegetationsstruktur von der Kreuzotter weitgehend gemieden.<br />
Neben den Vorkommen in der <strong>Lubmin</strong>er Heide ist die Kreuzotter seit langem auch auf dem<br />
Struck <strong>und</strong> der Insel Ruden bekannt (vgl. SCHIEMENZ & GÜNTHER 1994, SCHIEMENZ 1995, UM M-<br />
V 1991). Nach SELLIN (mündl.) wird die Kreuzotter noch heute regelmäßig im Bereich der trockenen<br />
Waldränder <strong>und</strong> Wacholdertriften des Struck beobachtet <strong>und</strong> besiedelt hier im Zusammenhang<br />
mit angrenzenden Gehölzbiotopen auch Borstgrasrasen (s. o.).<br />
Die Kreuzotter unterliegt mit ihren hohen Ansprüchen zahlreichen Gefährdungsfaktoren, die<br />
zum Habitatverlust führen. So kann zum Beispiel Stickstoffeintrag aus der Luft zu einem verstärkten<br />
Aufwuchs von Reitgras oder zu Verbuschung führen, wodurch die mikroklimatischen<br />
<strong>und</strong> strukturellen Ansprüche der Art nicht mehr erfüllt werden (Zusammenfassung in VÖLKL &<br />
THIESMEIER 2002).<br />
Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)<br />
Ruderalflächen <strong>und</strong> Aufforstungen im offenen Gelände werden vom Schwarzkehlchen besiedelt.<br />
Wichtig sind eine niedrige Bodenvegetation mit einzelnen Sitzwarten (Büsche, Zaunpfähle<br />
u. a.). In Mecklenburg-Vorpommern brüten 20 bis 50 Paare dieser Art (EICHSTÄDT et al. 2006),<br />
wobei seit den 90er Jahren ein bis heute anhaltend deutlich positiver Bestandstrend festzustel-<br />
len ist.<br />
KIFL (2009) geben für das Schwarzkehlchen eine nur schwache Lärmempfindlichkeit sowie eine<br />
Effektdistanz gegenüber stark befahrenen Straßen von 200 m an. In der Roten Liste der Brutvögel<br />
(SÜDBECK et al. 2009) steht die Art auf der Vorwarnliste. Entsprechend der Bestandsergebnisse<br />
besiedelt das Schwarzkehlchen im duB vor allem Ruderalbiotope <strong>und</strong> langgrasige<br />
Säume, für die Borstgrasrasen ist es als potenzielle Brutvogelart aufzufassen.<br />
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)<br />
Das Braunkehlchen ist ein Charaktervogel offener Agrarflächen, insbesondere in Grünlandgebieten<br />
<strong>und</strong> auf Brachen. Wichtig sind eine niedrige, vielseitig strukturierte Bodenvegetation mit<br />
guter Deckung für die Gelege <strong>und</strong> geeignete Sitzwarten. In Mecklenburg-Vorpommern brüten<br />
zwischen 20.000 <strong>und</strong> 30.000 Paare des Braunkehlchens (EICHSTÄDT et al. 2006). In der Roten<br />
Liste der Brutvögel (SÜDBECK et al. 2009) der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland wird die Art als ge-<br />
fährdet eingestuft.<br />
Direkte Verluste <strong>und</strong> besonders große Beeinträchtigungen des Braunkehlchen entstehen durch<br />
frühe Mahd, starke Beweidung der Grünflächen sowie Beseitigung von Saumstrukturen <strong>und</strong> bei<br />
Pflegearbeiten an Gräben, Wegen <strong>und</strong> Dämmen. KIFL (2009) geben für das Braunkehlchen<br />
eine nur schwache Lärmempfindlichkeit sowie eine Effektdistanz gegenüber stark befahrenen<br />
Straßen von 200 m an.<br />
Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Code 6410)<br />
Der Lebensraumtyp umfasst ungedüngte <strong>und</strong> nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Pfeifengraswiesen<br />
auf basen- bis kalkreichen <strong>und</strong> sauren (wechsel-)feuchten Standorten. Diese Wie-
FROELICH & SPORBECK Seite 83<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
sen sind i. d. R. durch Streumahd (extensive späte Mahd) entstanden <strong>und</strong> meist sehr artenreich.<br />
Zu den Hauptgefährdungsfaktoren für den Lebensraumtyp zählen die Entwässerung der Standorte,<br />
Verbuschung aufgr<strong>und</strong> fehlender Nutzung, Nährstoffeintrag (z. B. durch Düngung), eine zu<br />
intensive Mahd- oder Weidenutzung sowie der Umbruch der Flächen.<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Laut Standard-Datenbogen nimmt der Lebensraumtyp im FFH-Gebiet nur einen kleinen Flächenanteil<br />
von
FROELICH & SPORBECK Seite 84<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Ohrweiden-Faulbaumgebüsch, ein Ohrweiden-Grauweidengebüsch, ein Sumpfreitgras-<br />
Schilfröhricht sowie ein Wasserlinsen-Schilfröhricht (I.L.N. 2007). Auf Teilflächen treten Bulte<br />
<strong>und</strong> Schlenken auf. Der Wasserhaushalt des Übergangsmoors wird durch einen Einzelgraben<br />
<strong>und</strong> auch durch großräumige Entwässerung beeinträchtigt (ebd.). Der Erhaltungszustand der<br />
Fläche wurde als gut eingestuft.<br />
Bei den Kartierungen von FROELICH & SPORBECK im Jahr 2008 wurde der Bestand in vier Einzelflächen<br />
des Lebensraumtyps untergliedert. Das Übergangsmoor ist vermutlich aus einem Komplex<br />
von Torfstichen hervorgegangen. Von FROELICH & SPORBECK (2009A) wurden vier verbuschte<br />
Bestände (Biotopcode MSW) <strong>und</strong> ein offenes Übergangsmoor (Biotopcode MST)<br />
ausgegrenzt. Letzteres hat insgesamt einen hervorragenden Erhaltungszustand, während die<br />
anderen mit gut bewertet wurden (ebd.).<br />
Für den Lebensraumtyp wurde anhand der aktuellen Bestandsdaten im duB die lebensraumtypische<br />
Schwebfliegenart Orthonevra intermedia als charakteristische Art ausgewählt. Da der<br />
LRT mehr als 9 km vom Vorhaben entfernt liegt, sind relevante Beeinträchtigungen ausschließlich<br />
über den Wirkprozess „Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge“ zu erwarten. Die vorhabensspezifische<br />
Empfindlichkeit des Lebensraumtyps gegenüber diesem Wirkprozess wird bereits umfassend<br />
durch die Empfindlichkeit seiner Vegetation abgebildet, so dass hier auf die zusätzliche<br />
Auswahl von charakteristischen Tierarten mit Hilfe der tabellarischen Abschichtung verzichtet<br />
werden kann.<br />
Orthonevra intermedia<br />
Die Art ist in Mittel-, Nord- <strong>und</strong> Osteuropa sowie in Sibirien verbreitet. Sie wird meist nur selten<br />
<strong>und</strong> lokal nachgewiesen. Die Art ist eine Charakterart von Mooren, soll aber auch in Sümpfen<br />
<strong>und</strong> auf feuchten Wiesen vorkommen (RÖDER 1990). Die anspruchsvolle Art wird in der Roten<br />
Liste Deutschlands als stark gefährdet eingestuft (SSYMANK & DOCZKAL 1998).<br />
Orthonevra intermedia ist eine Sommerart mit einer Flugzeit von Juni bis August. Die Larven,<br />
die zu den so genannten Rattenschwanzlarven gehören, ernähren sich saprophag <strong>und</strong> leben in<br />
den Moorgewässern. Die Imagines besuchen gern Doldenblütler <strong>und</strong> Hahnenfußgewächse<br />
(RÖDER 1990).<br />
Die Art war aus Mecklenburg-Vorpommern bekannt. PELLMANN (1996) konnte sie in einem küs-<br />
tennahen Moor in der Nähe von Rostock nachweisen.<br />
Im Untersuchungsgebiet wurde die Art nur im Bereich des Peenemünder Hakens auf Nord-<br />
Usedom nachgewiesen, <strong>und</strong> zwar auf den Flächen U1 (Graudüne), U3 (Übergangsmoor) <strong>und</strong><br />
U6 (ruderalisierter Sandmagerrasen am Salzgrünland) (FROELICH & SPORBECK 2009D). Die Art<br />
reagiert empfindlich auf Stickstoffeinträge.<br />
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code 9110)<br />
Bei dem Lebensraumtyp handelt sich um meist krautarme von Buchen geprägte Laubwälder auf<br />
bodensauren Standorten über silikatischen Sedimenten <strong>und</strong> Gesteinen (z. B. Gr<strong>und</strong>gebirge).<br />
Bodensaure naturnahe Flachland-Buchenwälder, die z.T. als eigene Assoziationen beschrieben<br />
sind, werden ebenfalls dem Lebensraumtyp zugeordnet. Dies schließt auch buchenreiche Ausbildungen<br />
des Fago-Quercetum mit ein (SSYMANK et al. 1998).
FROELICH & SPORBECK Seite 85<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wesentliche Gefährdungen für den LRT sind v. a. Nadelholzaufforstungen, der Nähr- <strong>und</strong><br />
Schadstoffeintrag aus der Luft, zu hohe Wildbestände, zu intensive forstliche Nutzung <strong>und</strong> die<br />
Zerschneidung großflächiger Waldgebiete (ebd.).<br />
Vorkommen des LRT im FFH-Gebiet:<br />
Laut Standard-Datenbogen nimmt der Lebensraumtyp im FFH-Gebiet nur einen kleinen Flächenanteil<br />
von
FROELICH & SPORBECK Seite 86<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Eichen-Birkengehölze auf dem Struck wurden diesem LRT zugeordnet (FROELICH &<br />
SPORBECK 2009 A). Im Rahmen der Altkartierung waren diese Bestände als LRT 2190 „Bewaldete<br />
Küstendünen“ erfasst worden (I.L.N 2004). Diese Zuordnung wurde jedoch bei der Bestandserfassung<br />
2009 revidiert, da weder die Vorinformationen aus den geologischen <strong>und</strong> topographischen<br />
Karten noch die Prüfung im Gelände auf Dünenstandorte schließen ließen.<br />
Insgesamt wurden vier Flächen auf dem Struck mit Eichen-Birkengehölzen (insgesamt r<strong>und</strong><br />
17,5 ha) dem Lebensraumtyp 9190 zugeordnet.<br />
Die Waldfläche auf dem Struck wird vor allem durch alte Stiel-Eichen (Quercus robur) geprägt,<br />
die zum Teil in größerem Abstand zueinander stehen. Die Belastung lässt auf eine frühere<br />
Hudewaldnutzung schließen. Zwischen den Eichen (Quercus robur) wachsen Sand-Birken (Betula<br />
pendula) oder zum Teil auch Ebereschen (Sorbus aucuparia). In der Krautschicht sind Wiesen-Rispengras<br />
(Poa pratensis), Schlängel-Schmiele (Avenella flexuosa) <strong>und</strong> ferner Brombeere<br />
(Rubus fruticosus) prägend. Für den Lebensraum typische Arten wie Rotes Straußgras (Agrostis<br />
capillaris), Heidekraut (Calluna vulgaris), Pillen-Segge (Carex pilulifera), Faulbaum (Frangula<br />
alnus), Deutsches Geißblatt (Lonicera periclymenum), Gemeiner Tüpfelfarn (Polypodium vulgare),<br />
Zitterpappel (Populus tremula), Adlerfarn (Pteridium aquilinum), Europäischer Siebenstern<br />
(Trientalis europaea) <strong>und</strong> Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) wurden nachgewiesen. Insgesamt<br />
wurden 39 Arten aufgenommen, darunter auch die in Mecklenburg-Vorpommern gefährdeten<br />
Arten Holz-Apfel (Malus sylvestris) <strong>und</strong> Wilde-Birne (Pyrus pyraster) (ebd.). Für den LRT 9190<br />
auf dem Struck wurde vom Kartierer im November 2010 nachträglich eine Einschätzung des<br />
Erhaltungszustands vorgenommen. Nach dem Bewertungsschema von MLUV (2009) wird den<br />
Flächen des LRT der Erhaltungszustand A zugewiesen, wobei die lebensraumtypischen Habitatstrukturen<br />
mit B, die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars mit A <strong>und</strong> die<br />
Beeinträchtigungen mit A bewertet wurden (E-Mail von F. Effenberger vom 21.12.2010).<br />
Auf Nord-Usedom wurden sieben Gehölzbestände mit einer Gesamtfläche von etwa 6,9 ha dem<br />
Lebensraumtyp 9190 zugeordnet (FROELICH & SPORBECK 2009 A). Der Erhaltungszustand von<br />
drei feuchteren Eichenwäldern (Biotopcode WQF) wurde als gut (B) bewertet. Vier eher trockene<br />
Eichenwälder (Biotopcode WQT) befinden sich auf dem geschützten Geotop Peenemünder<br />
Haken am nördlichen Rand der Insel auf den alten Strandwällen. Ihr Erhaltungszustand wurde<br />
als hervorragend (A) eingeschätzt.<br />
Für den Lebensraumtyp wurden mit Hilfe der Tabellarischen Abschichtung der lebensraumtypischen<br />
Arten (vgl. Anhang 2) <strong>und</strong> der aktuellen Bestandsdaten im duB keine charakteristischen<br />
Tierarten ausgewählt. Bei der Betrachtung von lebensraumtypischen Tierarten dieses Lebensraumtyps<br />
ist kein Erkenntnisgewinn, der über die Bearbeitung <strong>und</strong> Bewertung der vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen Parameter hinausgeht, zu erwarten.<br />
4.3.3 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie im detailliert untersuchten Be-<br />
reich<br />
Die einzige im detailliert untersuchten Bereich vorkommende Pflanzenart des Anhangs II der<br />
FFH-Richtlinie ist das Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii). Für diese Art existieren gemäß der<br />
floristischen Artdatenbank Mecklenburg-Vorpommerns Nachweise im Bereich der Nord-Spitze
FROELICH & SPORBECK Seite 87<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
von Usedom. Zur Verifizierung <strong>und</strong> Erfassung des Vorkommens dieser Art, erfolgte am<br />
24.06.2009 eine Geländebegehung der Verdachtsflächen r<strong>und</strong> um den Nordhafen auf Usedom<br />
(FROELICH & SPORBECK 2009A). Die Vegetation des Spülpolders wurde zusätzlich am<br />
30.06.2009 sowie am 16.07.2009 erfasst (ebd.) Die Überprüfung der F<strong>und</strong>punkte aus der floristischen<br />
Datenbank <strong>und</strong> die Suche auf den angrenzenden Flächen brachten keine Nachweise<br />
der Art. Infolgedessen wurde der Kartierer der Art, BJÖRN RUSSOW, auf die aktuellen Vorkommen<br />
befragt. Seinen Angaben zu Folge ist die ehemals eingerichtete Monitoringfläche der Art<br />
am Nordhafen seit zwei Jahren verwaist, jedoch konnte der Kartierer in 2009 drei fertile Exemplare<br />
an einer anderen Stelle nördlich des Nordhafens ausmachen. Die Exemplare standen alle<br />
dicht beieinander. Das Sumpf-Glanzkraut wechselt auf den Sandstandorten (Spülpolder) ständig<br />
die Wuchsorte, kommt aber gewöhnlich zur Blüte <strong>und</strong> taucht dann an anderen Stellen wieder<br />
auf. Die Pflanze siedelt immer in den staunassen Senken. Es ist also ohne weiteres möglich,<br />
dass Liparis loeselii ein oder zwei Jahre gar nicht zu finden ist (FROELICH & SPORBECK<br />
2009A). Nach Angaben von FROELICH & SPORBECK (2009A) dürften die halophilen Pionierfluren<br />
die besten Bedingungen für das Sumpf-Glanzkraut bieten, dies kann unter Umständen darauf<br />
zurückzuführen sein, dass das Sumpf-Glanzkraut auf den Sandstandorten (Spülpolder) ständig<br />
die Wuchsorte wechselt.<br />
Nach Auswertung der vorliegenden Untersuchungen, Daten <strong>und</strong> Informationen ist im detailliert<br />
untersuchten Bereich der FFH-VU vom regelmäßigen Auftreten von sechs der im Standard-<br />
Datenbogen genannten Tierarten des Anhangs II der FFH-RL auszugehen (Fischotter, Kegelrobbe,<br />
Meerneunauge, Flussneunauge, Rapfen, Großer Feuerfalter). Für eine weitere Art (Seeh<strong>und</strong>)<br />
scheint eine Wiederansiedlung möglich zu sein. Für die anderen Arten kann ein potenzi-<br />
elles Vorkommen im Gebiet nicht ausgeschlossen werden.<br />
Der Fischotter wurde im Untersuchungsgebiet mehrfach nachgewiesen <strong>und</strong> es ist im Kontext<br />
mit Nachbargebieten von einer reproduzierenden Population auszugehen. Die vier Arten Kegelrobbe,<br />
Meer- <strong>und</strong> Flussneunauge <strong>und</strong> Rapfen kommen gelegentlich im Gebiet vor. Vom<br />
Großen Feuerfalter sind Vorkommen mit Reproduktionsnachweis von Nord-Usedom bekannt.<br />
Der Stör (diese Art ist nicht im Standard-Datenbogen genannt) wurde im Jahr 2007 in der Oder<br />
wieder angesiedelt <strong>und</strong> kann potenziell im duB vorkommen. Auch für die Fledermausarten<br />
Teichfledermaus <strong>und</strong> Großes Mausohr kann ein potenzielles gelegentliches Vorkommen im<br />
duB angenommen werden (Jagdhabitate, Einzelquartiere bei der Teichfledermaus <strong>und</strong> evtl.<br />
Winterquartiere auf Nord-Usedom vom Großen Mausohr), im Rahmen der Fledermauskartierungen<br />
im unmittelbaren Anlagenbereich wurden die beiden Arten jedoch nicht nachgewiesen.<br />
Ein Vorkommen des Bitterlings ist unwahrscheinlich <strong>und</strong> allenfalls in den Standgewässern auf<br />
Nord-Usedom zu erwarten. Die Schmale <strong>und</strong> Bauchige Windelschnecke wurden bei den<br />
bisherigen Molluskenerfassungen nicht im duB nachgewiesen, ein Vorkommenspotenzial für die<br />
beiden Arten besteht v. a. im Bereich verschiedener Feuchtbiotope (Dünental, Gewässerränder)<br />
auf Nord-Usedom. Die Große Moosjungfer konnte bei den Libellenerfassungen zum Vorhaben<br />
im Jahr 2008 nicht auf dem Struck nachgewiesen werden, obgleich die Erfassungsmethodik<br />
insbesondere auf den Nachweis dieser Art abgestimmt war. Für den duB existiert zwar eine<br />
Sichtbeobachtung der Art aus dem Jahr 1999, es ist allerdings nicht von einem bodenständigen<br />
Vorkommen der Art auszugehen.<br />
Die Population der Finte (Alosa fallax) (EU-Code 1103) im FFH-Gebiet wird im Standard-<br />
Datenbogen als nicht signifikant (D) eingestuft. Sie ist daher kein maßgeblicher Bestandteil des<br />
Schutzgebietes <strong>und</strong> wird aber bei der nachfolgenden Beurteilung dennoch betrachtet.
FROELICH & SPORBECK Seite 88<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
In der folgenden Tabelle werden die im duB vorkommenden Tierarten nach Anhang II aufgelistet<br />
<strong>und</strong> ihre Habitatfunktionen im Gesamtgebiet sowie im detailliert untersuchten Bereich kurz<br />
beschrieben.<br />
Im Anschluss wird auf die Tierarten des Anhangs II der FFH-RL eingegangen, die im detailliert<br />
untersuchten Bereich (duB) zumindest temporär vorkommen <strong>und</strong> bei denen Beeinträchtigungen<br />
auftreten können. Anhand von Artensteckbriefen (die vor allem aus PETERSEN et al. 2003 <strong>und</strong><br />
2004 sowie den Internetseiten des BFN: http://www.bfn.de/0316_arten.html (abgerufen am<br />
19.02.2010) entnommen wurden) werden diese Arten zunächst kurz beschrieben. Anschließend<br />
wird auf das Vorkommen der Arten im FFH-Gebiet sowie im duB eingegangen, wobei, soweit<br />
möglich, die Habitatfunktionen des Gebietes für die Arten herausgestellt werden.<br />
Tab. 5: Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie, die im detailliert untersuchten Bereich<br />
(duB) vorkommen bzw. ein Vorkommenspotenzial aufweisen<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Fischotter<br />
(EU-Code 1355)<br />
Kegelrobbe<br />
(EU-Code 1364)<br />
Seeh<strong>und</strong><br />
(EU-Code 1365)<br />
Teichfledermaus<br />
(EU-Code 1318)<br />
Großes Mausohr<br />
(EU-Code 1324)<br />
Meerneunauge<br />
(EU-Code 1095)<br />
Flussneunauge<br />
(EU-Code 1099)<br />
Finte<br />
(EU-Code 1103)<br />
Rapfen<br />
(EU-Code 1130)<br />
Bitterling<br />
(EU-Code 1134)<br />
Stör<br />
(EU-Code 1101)<br />
Schmale Windelschnecke<br />
(EU-Code 1014)<br />
Wissenschaftl.<br />
Artname<br />
Habitatfunktion<br />
im FFH-Gebiet<br />
Lutra lutra Jahreslebensraum, Reproduktionsraum<br />
Halichoerus grypus Jahreslebensraum/<br />
pot. Reproduktionsraum<br />
Phoca vitulina Migrationsraum<br />
Pot. Jahreslebensraum<br />
Myotis dasycneme Jahreslebensraum<br />
/Reproduktionsraum<br />
Habitatfunktion<br />
im duB<br />
Jahreslebensraum, Reproduktionsraum<br />
Liegeplätze<br />
Pot. Liegeplätze<br />
Myotis myotis Pot. Jahreslebensraum Pot. Jagdreviere/<br />
Petromyzon marinus<br />
Durchzugsgebiet, pot.<br />
zeitweiliges Weidegebiet<br />
Lampetra fluviatilis Durchzugsgebiet, pot.<br />
zeitweiliges Weidegebiet<br />
Alosa fallax Durchzugsgebietpot. Nahrungshabitat<br />
Aspius aspius Durchzugsgebiet, pot.<br />
zeitweiliges Weidegebiet<br />
Rhodeus sericeus<br />
amarus<br />
Acipenser sturio<br />
bzw. oxyrinchus<br />
Jahreslebensraum/<br />
Reproduktionsraum<br />
Durchzugsgebiet, pot.<br />
zeitweiliges Weidegebiet<br />
Pot. Jagdreviere, pot. Reproduktionsraum<br />
(Einzelquartiere)<br />
pot. Winterquartiere<br />
Durchzugsgebiet, pot. zeitweiliges Weidege-<br />
biet<br />
Durchzugsgebiet, pot. zeitweiliges Weidegebiet<br />
Pot. Nahrungshabitat, Durchzugsgebiet<br />
Durchzugsgebiet, pot. zeitweiliges Weidegebiet<br />
Pot. Jahreslebensraum/<br />
pot. Reproduktionsraum<br />
Durchzugsgebiet, pot. zeitweiliges Weidegebiet<br />
Vertigo angustior Jahreslebensraum Pot. Jahreslebensraum
Deutscher<br />
Artname<br />
Bauchige Windelschnecke<br />
(EU-Code 1016)<br />
Große Moosjungfer<br />
(EU-Code 1042)<br />
Großer Feuerfalter<br />
(EU-Code 1060)<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 89<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wissenschaftl.<br />
Artname<br />
Habitatfunktion<br />
im FFH-Gebiet<br />
Habitatfunktion<br />
im duB<br />
Vertigo moulinsiana Jahreslebensraum Pot. Jahreslebensraum<br />
Leucorrhinia pectoralis<br />
Jahreslebensraum Pot. Jahreslebensraum, keine Fortpflanzungsgewässer<br />
im Bereich Struck/ Freesen-<br />
Lycaena dispar Jahreslebensraum,. Reproduktionsraum<br />
Fischotter (Lutra lutra) (EU-Code 1355)<br />
dorfer Wiesen<br />
Pot. Jahreslebensraum, pot. Reproduktionsraum<br />
nur im Norden von Usedom<br />
Der vom Aussterben bedrohte Fischotter (Lutra lutra) (EU-Code 1355) ist ein Säugetier der<br />
Familie der Marder. Sein Lebensraum ist der Übergangsbereich vom Wasser zum Land an<br />
sauberen, fischreichen Gewässern, besonders an Uferstreifen von intakten artenreichen Wassersystemen<br />
mit Bäumen <strong>und</strong> Sträuchern sowie angrenzenden Erlenbrüchen. Der Otter kommt<br />
als ufergeb<strong>und</strong>ene Art an stehenden <strong>und</strong> fließenden Gewässern mit reich gegliederter Uferzone<br />
(Buchten <strong>und</strong> Stillwasserbereiche) vor. Er bevorzugt schwer zugängliche Uferpartien mit guter<br />
Deckung. Fischotter sind im Allgemeinen nicht sehr standorttreu <strong>und</strong> wechseln oft ihre Aktivitätsräume,<br />
wozu auch längere Strecken durch stark anthropogen überformtes Gelände in Kauf<br />
genommen werden. Während der Wanderung findet ein ständiger Wechsel von Wasser zu<br />
Land statt. Der Fischotter kann so Strecken von 10 - 20 km zurücklegen.<br />
Als Hauptgefährdungsfaktoren der Art gelten heute v. a. die Zerschneidung <strong>und</strong> Zerstörung von<br />
noch großräumig naturnahen <strong>und</strong> vernetzten Landschaftsteilen, der Einfluss von Umweltschadstoffen<br />
<strong>und</strong> der Tod auf der Straße sowie das Verenden in Fischreusen.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Im Standard-Datenbogen werden keine Angaben zur genaueren Populationsgröße der Art im<br />
FFH-Gebiet gemacht. Der Erhaltungszustand wird mit B (gute Erhaltung) bewertet, die Isolierung<br />
mit C (Population nicht isoliert), die Gesamtbewertung mit C (signifikanter Wert). Vom<br />
Fischotter sind mehrere Vorkommen entlang des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> des Greifswalder Boddens<br />
bekannt. Nachweispunkte liegen neben dem Struck/Freesendorfer Wiesen an der Kemlade, der<br />
Gustower Wiek, dem Deviner See, der Insel Vilm, südlich Prosnitz <strong>und</strong> am südlichen Greifswalder<br />
Bodden (UMWELTPLAN 2005).<br />
Vorkommen im duB<br />
Der Fischotter wurde im Rahmen der Otterkartierung zur UVU <strong>GuD</strong>-Kraftwerk der VASA Energy<br />
bei <strong>Lubmin</strong> (I.L.N. 1999A) im Untersuchungsbereich nachgewiesen. Die LINFOS-Daten des<br />
Landes stellen ebenfalls Nachweise im Bereich des Freesendorfer Sees dar. Bei einer Geländebegehung<br />
im Jahr 2008 wurde im Zulaufbereich zum Freesendorfer See Fischotter-Losung<br />
festgestellt (eigene Beobachtung, nicht veröffentlicht). Von I.L.N. (1999A) wurden alle Gewässer
FROELICH & SPORBECK Seite 90<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
im terrestrischen Untersuchungsraum südlich <strong>und</strong> nördlich (Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> Struck)<br />
auf die Anwesenheit von Otterspuren untersucht. Bei diesen Untersuchungen wurden Trittsiegel<br />
<strong>und</strong> Losungen als eindeutige Nachweise betrachtet. Insgesamt wurden 4 Begehungen im Jahr<br />
1999 durchgeführt (I.L.N. 1999A). Otterspuren (Losung <strong>und</strong>/oder Trittsiegel) konnten sowohl am<br />
Ufer der Spandowerhagener Wiek, am Freesendorfer See als auch an den Gräben in den<br />
Freesendorfer Wiesen gef<strong>und</strong>en werden. Otternachweise fanden sich vor allem am Südwestufer<br />
des Freesendorfer Sees bis zum Greifswalder Boddenufer sowie an Gräben in den<br />
Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> im Ostteil des Struck. Der gesamte Teil der Freesendorfer Wiesen<br />
<strong>und</strong> des Struck wird als regelmäßig genutzter Lebensraum des Otters angesehen. Er findet in<br />
den einzelnen Teillebensräumen zum einen ergiebige Nahrungsquellen (Freesendorfer See)<br />
<strong>und</strong> zum anderen aufgr<strong>und</strong> der relativ hohen Ungestörtheit <strong>und</strong> idealer Versteckmöglichkeiten<br />
in Nähe seiner Futterquellen auch ausreichende Ruheräume (z.B. bewaldete Bereiche auf dem<br />
Struck). Die einzelnen Teillebensräume sind über das ausgedehnte Netz von Gräben <strong>und</strong> Wasserläufen<br />
sehr gut miteinander vernetzt. Im Rahmen des LBP zur OU L 262 Spandowerhagen<br />
wurde im Jahr 2006 Fischotter-Losung an einem Grabenzulauf zur Spandowerhagener Wiek<br />
festgestellt (FROELICH & SPORBECK 2010K). Der außerhalb des FFH-Gebietes gelegene Standort<br />
des geplanten Kraftwerks gehört nicht zum Kernlebensraum des Fischotters, wird aber als Migrationsraum<br />
genutzt.<br />
Kegelrobbe (Halichoerus grypus) (EU-Code 1364)<br />
Die Kegelrobbe (Halichoerus grypus) (EU-Code 1364) kommt an den Küsten der Nord- <strong>und</strong><br />
Ostsee sowie des nördlichen Atlantiks vor. In der Ostsee lebt eine Population, die verschiedentlich<br />
als eigene Unterart balticus betrachtet wird (vgl. SCHWARZ et al. 2003). Sie lebt in<br />
kleineren Verbänden an felsigen Küsten <strong>und</strong> vorgelagerten Inseln. Wurfplätze der Kegelrobbe<br />
sind einsame Felsenriffe, abgelegene Inseln, Sandbänke oder Treibeisschollen. Das eine Junge<br />
der Kegelrobbe wird zwischen Oktober <strong>und</strong> Februar (an der Ostsee im Frühjahr) geboren <strong>und</strong><br />
kann erst nach 2 - 4 Wochen schwimmen. Die Kegelrobbe ist ein guter Schwimmer <strong>und</strong> Taucher<br />
<strong>und</strong> ernährt sich von Fischen, Krabben, Krebsen <strong>und</strong> Mollusken. (GARMS 1985, CORBET &<br />
OVENDEN 1982).<br />
Aufgr<strong>und</strong> der früheren systematischen Verfolgung in der Ostsee waren die reproduktiven Vorkommen<br />
an den Mecklenburg-Vorpommerschen Küsten vollkommen erloschen. Die zunehmende<br />
Meeresverschmutzung verhinderte eine zügige Bestandserholung. Weitere Gefahren<br />
sind u. a. der Mangel an geeigneten Wurfplätzen, Verletzung oder Tötung durch Kollision mit<br />
Wasserfahrzeugen, Verletzung oder Ertrinken durch Verfangen in Netzen bzw. als Beifang.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Das Zentrum der historischen Verbreitung an den Mecklenburg-Vorpommerschen Küsten lag im<br />
Bereich Südostrügens <strong>und</strong> des Greifswalder Boddens, hier v. a. im Bereich des Großen Stubbers.<br />
Nachdem die Art bis zu den 20er Jahren des 20. Jahrh<strong>und</strong>ert in den deutschen Ostseegewässern<br />
ausgerottet wurde (HARDER et al. 1995), trat sie lange Zeit nur noch sporadisch im<br />
Greifswalder Bodden auf. Inzwischen halten sich Kegelrobben wieder ganzjährig im Bereich des<br />
Großen Stubbers auf. In den Wintermonaten waren es seit 2005 in der Regel 5-10 Tiere. In den<br />
Sommermonaten wurden bis zu fünf Kegelrobben gezählt (unveröff. Daten des LUNG/DMM in<br />
IfAÖ 2008A ).
FROELICH & SPORBECK Seite 91<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Ein regelmäßiges Auftreten der Kegelrobbe ist zukünftig zu erwarten. Mit einer dauerhaften<br />
Wieder-Ansiedlung der Art mit Reproduktion kann gerechnet werden, möglicherweise hat sie<br />
auch bereits stattgef<strong>und</strong>en (K. HARDER, Meeresmuseum Strals<strong>und</strong> in Ostseezeitung,<br />
08.01.2007).<br />
Im Standard-Datenbogen werden keine Angaben zur genaueren Populationsgröße gemacht.<br />
Der Erhaltungszustand wird mit B (gute Erhaltung) bewertet, die Isolierung mit B (Population<br />
nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebietes), die Gesamtbewertung mit C (signifikanter<br />
Wert).<br />
Vorkommen im duB<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VP befinden sich gelegentlich aufgesuchte Liegeplätze<br />
am Boddenufer nordöstlich des Industriehafens <strong>und</strong> des Einlaufkanals etwa in Höhe des<br />
Freesendorfer Sees. Der Struck wird als potenzieller Liegeplatz bei einer Wiederansiedlung<br />
eingestuft (SCHWARZ et al. 2003).<br />
In den vergangenen Jahren wurde die Art nur sporadisch mit positiver Tendenz im duB gesichtet.<br />
Aus dem direkten Umfeld der Planung liegen zwei Beobachtungen vor: Am 26.12.1965: 2<br />
Tiere am Strand vor dem Freesendorfer See, D. Sellin <strong>und</strong> am 28.01.1987: 1 Tier auf dem Eis<br />
am Auslaufkanal des Kernkraftwerkes, D. Sellin. Ein totes Tier wurde am 21.12.2003 am<br />
Freesendorfer Strand kurz vor der Insel Struck aufgef<strong>und</strong>en (SELLIN 2004). Inzwischen wurden<br />
aber bereits wieder Gruppen von bis zu sieben Tieren im Umfeld des duB beobachtet (z. B.<br />
Großer Stubber, Freesendorfer Haken) (Ostseezeitung vom 06.12.2006 <strong>und</strong> 08.01.2007).<br />
Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) (EU-Code 1365)<br />
Der Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) (EU-Code 1365) ist an den Küsten Islands, Irlands, Schottlands,<br />
Norwegens <strong>und</strong> an der Nord- <strong>und</strong> Ostsee verbreitet. Die Nominalform des Seeh<strong>und</strong>es (Phoca<br />
vitulina vitulina) erreicht in der südlichen Ostsee ihre östliche Verbreitungsgrenze (HARDER<br />
1996). Die Art lebt gesellig auf kleinen Inseln <strong>und</strong> Sandbänken an der Küste <strong>und</strong> vor Flussmündungen.<br />
Der Seeh<strong>und</strong> bevorzugt flache Meeresufer <strong>und</strong> hält sich gern im seichten Wasser sandiger<br />
Küsten auf. Er wandert in Flüssen <strong>und</strong> wird auch in Binnenseen weit im Landesinneren<br />
angetroffen. Der Seeh<strong>und</strong> wirft zwischen Mai <strong>und</strong> Juli einmal 1 bis 2 Junge. Die Geburt erfolgt<br />
auf Sandbänken oder Felsriffen. Die Jungtiere gehen sofort ins Wasser. Der Seeh<strong>und</strong> ernährt<br />
sich von Fischen, Muscheln <strong>und</strong> Krebsen (GARMS 1985, CORBET et al. 1982).<br />
Der Seeh<strong>und</strong> wurde durch starke Bejagung in der 1. Hälfte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts sowohl in der<br />
Nord- als auch in der Ostsee stark dezimiert. Von 1950 bis 1994 sind aus dem Bereich der<br />
deutschen Ostseeküste nur 50 Nachweise bekannt (HARDER et al. 1995). Der Gesamtbestand<br />
der Art in der Ostsee wird aktuell auf nur 250 Individuen geschätzt (Internetpräsenz der Seeh<strong>und</strong>station<br />
Friedrichskoog, Stand 2006). In den letzten Jahren vermehrten sich die Nachweise,<br />
insbesondere im Bereich Fischland-Darß, aber auch an der Südostküste Rügens (vgl. ABT<br />
2004). Die potenziellen Vorkommen des Seeh<strong>und</strong>es befinden sich entlang der Ostseeküste im<br />
Bereich von Sandbänken sowie auf den vorgelagerten Inseln.<br />
Ehemals bestand die Hauptgefährdung für die Art in der Jagd. Heute stellen v. a. Tourismus,<br />
Fischerei <strong>und</strong> Industrie die Hauptgefährdungen dar. Habitatverluste sind durch Bebauung <strong>und</strong>
FROELICH & SPORBECK Seite 92<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Eindeichung zu verzeichnen. Zudem ist die Art durch Störung der Ruhephasen <strong>und</strong> Jungenaufzucht,<br />
sowie durch Kollisionen mit Wasserfahrzeugen gefährdet.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Im Standard-Datenbogen werden keine Angaben zur genaueren Populationsgröße gemacht.<br />
Der Erhaltungszustand wird mit B (gute Erhaltung) bewertet, die Isolierung mit B (Population<br />
nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebietes), die Gesamtbewertung mit B (guter<br />
Wert). Laut IFAÖ (2008A) sind Seeh<strong>und</strong>e im Greifswalder Bodden inzwischen regelmäßig anzutreffen,<br />
aber seltener als Kegelrobben (Monitoring-Daten von LUNG <strong>und</strong> DMM). Aufgr<strong>und</strong> der<br />
fischreichen Nahrungsgründe <strong>und</strong> ungestörten Ruheplätze entlang der Küsten Mecklenburg-<br />
Vorpommerns scheint eine Wiederbesiedlung von Teilen des historischen Verbreitungsgebietes<br />
des Seeh<strong>und</strong>s hier möglich.<br />
Vorkommen im duB<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VU liegen keine jüngeren Nachweise vor, eine Wiederansiedlung<br />
ist hier jedoch, wie auch bei der Kegelrobbe, möglich.<br />
Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318)<br />
Die Teichfledermaus hat ihr Sommerquartier fast ausschließlich in Gebäuden. Als Jagdhabitat<br />
nutzt die Art insektenreiche Gewässerlandschaften (Flüsse <strong>und</strong> Flussauen, Seen, Teich- <strong>und</strong><br />
andere Feuchtgebiete), die von Wäldern <strong>und</strong> Wiesen dominiert werden. Die Jagdgebiete, die<br />
gern über traditionelle Flugrouten, wie Kanäle <strong>und</strong> kleinere Flüsse oder Hecken, erreicht werden,<br />
liegen regelmäßig 10-15 km (max. 22,5 km) Luftlinie von den Quartieren entfernt (BOYE et<br />
al. 2004).<br />
Als Winterquartier werden Höhlen, Bergstollen, unterirdische Befestigungsanlagen <strong>und</strong> Kellerräume<br />
mit Umgebungstemperaturen von 0,5-8 C aufgesucht. Die Entfernung zwischen Winter-<br />
<strong>und</strong> Sommerquartier können bis zu 300 km betragen.<br />
Bisher gibt es in M-V nur wenige Artnachweise. Einzelne Wochenstuben sind in Mecklenburg-<br />
Vorpommern, Schleswig-Holstein <strong>und</strong> Brandenburg bekannt. Weitere Nachweise werden in den<br />
Küstengebieten <strong>und</strong> den Flusstälern erwartet, denn die Region liegt im Zentrum der nordwestpaläarktischen<br />
Population (BOYE et al. 2004). Innerhalb des Verbreitungsgebietes verteilen sich<br />
die Populationen auf kleine, mehr oder weniger isolierte Vorkommensgebiete (LIMPENS &<br />
SCHULTE 2000). Das Verbreitungs- <strong>und</strong> Fortpflanzungsgebiet der Teichfledermaus scheint sich<br />
in den küstennahen Regionen ohne wesentliche Lücken von Frankreich <strong>und</strong> den Niederlanden<br />
über Norddeutschland <strong>und</strong> Dänemark bis in das Baltikum nach Russland zu erstrecken (HAEN-<br />
SEL 1994, DENSE et al. 1996, GRIMMBERGER 2002).<br />
Hauptgefährdungsursachen sind für die Teichfledermaus die Vernichtung bzw. Pestizidbelastung<br />
(Holzschutzmittel) der Quartiere sowie das Fällen von höhlenreichen Bäumen in Gewässernähe.
FROELICH & SPORBECK Seite 93<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ wurde<br />
die Teichfledermaus überwinternd festgestellt (Quelle: Standard-Datenbogen, Amtsblatt der<br />
Europäischen Gemeinschaften 2008).<br />
Vorkommen im duB<br />
Bei einer Kontrolle von Fledermauskästen in der <strong>Lubmin</strong>er Heide (MTBQ 1848/3) (westlich des<br />
aktuellen Untersuchungsgebietes außerhalb des FFH-Gebietes) konnte am 31.07.2001 GRIMM-<br />
BERGER ein an der Paarung beteiligtes Teichfledermaus-Männchen (Myotis dasycneme) nach-<br />
weisen (GRIMMBERGER 2002). Am 04.09.2001 gelang erneut der Nachweis der Teichfledermaus<br />
mit einer dreiköpfigen Paarungsgruppe <strong>und</strong> einem weiteren einzelnen Männchen.<br />
Alle anderen Fledermaus-Untersuchungen aus dem Raum, auch die Fledermauserfassung aus<br />
dem Untersuchungsgebiet zum <strong>GuD</strong> II (FROELICH & SPORBECK 2008L), erbrachten keine Nachweise<br />
der Art. BERG (2008A) schließt allerdings ein Vorkommen der Art in Gebäuden des Industriegeländes<br />
der <strong>EWN</strong> nicht gänzlich aus, zumal es in der weiteren Umgebung, innerhalb<br />
des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
bekannte Winterquartiere gibt (Quelle: Standard-Datenbogen, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften)<br />
<strong>und</strong> zumindest bedingt geeignete Jagdgebiete im Umfeld (Einlaufkanal, Industriehafen,<br />
Gewässer auf dem Struck, Gewässer auf Nord-Usedom) vorhanden sind. Möglicherweise<br />
stellt das Gebiet nur einen Teil eines Wanderkorridors zwischen Quartieren <strong>und</strong><br />
Jagdrevieren dar. Demzufolge können Einzelquartiere in Baumhöhlen des duB nicht völlig ausgeschlossen<br />
werden, wenn auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist.<br />
Großes Mausohr (Myotis myotis) (EU-Code 1324)<br />
Das Große Mausohr ist eine etwas wärmeliebende Fledermausart, die - insbesondere im Norden<br />
ihres Verbreitungsgebietes - ihre Sommerquartiere fast ausschließlich in Gebäuden, insbesondere<br />
in warmen Dachböden, Kirchtürmen etc. besitzt. Als Jagdlebensräume werden wärmebegünstigte<br />
Wald- <strong>und</strong> strukturreiche Regionen bevorzugt (BOYE et al. 1999). Die Art sucht ihre<br />
Nahrung (Nachtfalter <strong>und</strong> Großkäfer wie z. B. Lauf- <strong>und</strong> Mistkäfer) sowohl im Flug als auch am<br />
Boden. Es ist daher von intensiven Wechselbeziehungen zwischen potenziellen Tagesquartieren<br />
<strong>und</strong> umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen <strong>und</strong> Wäldern für das Große Mausohr<br />
auszugehen.<br />
Laut ABDANK et al. (2004) ist das Große Mausohr in Mecklenburg-Vorpommern lokal verbreitet.<br />
Es liegen Hinweise auf 16 genutzte Winterquartiere vor, doch gibt es nur wenige Vermehrungsnachweise<br />
(ebd). Nach HEISE et al. (2005) sind in Mecklenburg-Vorpommern derzeit nur zwei<br />
Wochenstuben des Großen Mausohrs bekannt, eine in Waren <strong>und</strong> eine in Burg Stargard. Aus<br />
dem weiteren Landschaftsraum liegen nach SIMON & BOYE (2004) für die Art keine Nachweise<br />
vor. Auf Usedom gibt es laut NABU, Regionalverband Mittleres Mecklenburg etwa 25 Winterquartiere<br />
der Art.<br />
Lebensräume, die von der Art als Jagdlebensraum genutzt werden könnten, sind im duB nicht<br />
in großem Umfang vorhanden. Das Große Mausohr nutzt zur Jagd größtenteils hallenartig ausgebildete<br />
Laubwaldbestände. Daneben werden auch Wiesen <strong>und</strong> Weiden genutzt, wenn sie
FROELICH & SPORBECK Seite 94<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
eine nur kurze Vegetation aufweisen (Bef<strong>und</strong>e an 30, bzw. 50 telemetrierten Individuen, GÜT-<br />
TINGER 1997, SIMON & WIDDING 2005).<br />
Für den untersuchten Bereich der FFH-VU konnten bislang keine Nachweise des Großen Mausohrs<br />
(Myotis myotis) (EU-Code 1324) erbracht werden (FROELICH & SPORBECK 2008L). Bei<br />
Fledermauskartierungen im Bereich des nahe gelegenen Cämmerer Sees gab es den Verdacht<br />
auf ein Großes Mausohr im Vorbeiflug. Bei den Fledermausbestandserfassungen im Rahmen<br />
des B-Plans Nr. 1 <strong>und</strong> der UVU zum ehemals geplanten Großkraftwerk <strong>Lubmin</strong> I (Standort der<br />
VASA-Kraftwerke GmbH) wurde die Art nicht festgestellt. (I.L.N. 2000G <strong>und</strong> 2000A). Da der duB<br />
an der nördlichen Verbreitungsgrenze der Art liegt, werden keine Wochenstuben des Großen<br />
Mausohrs in der Umgebung erwartet.<br />
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) (EU-Code 1099)<br />
Das Flussneunauge ist in den Küstengewässern von Nord- <strong>und</strong> Ostsee verbreitet <strong>und</strong> steigt zur<br />
Reproduktion in nahezu alle größeren Fließgewässer auf. Nach zweijährigem Aufenthalt im<br />
Meer steigen die laichreifen Flussneunaugen im Spätsommer <strong>und</strong> Herbst in Flüsse <strong>und</strong> Ströme<br />
auf, um an geeigneten sandig-grobkiesigen Stellen abzulaichen <strong>und</strong> anschließend zu sterben.<br />
Die Larven (Querder) leben 2 - 5 Jahre dort, vergraben im feinsandigen schlickigen Substrat<br />
<strong>und</strong> filtrieren kleine Nahrungspartikel aus dem Süßwasser. Nach der Metamorphose wandern<br />
die Jungtiere ins Meer <strong>und</strong> ernähren sich nun an (Ektoparasit) <strong>und</strong> von Fischen.<br />
Gewässerverschmutzung <strong>und</strong> Flussbegradigungen stellen eine Gefährdung für die Art dar. Die<br />
Larvalhabitate verlieren durch die Erhöhung der Fließgeschwindigkeit ihren Wert. Außerdem<br />
führen Querverbaue in den Gewässern dazu, dass der Laichaufstieg be- <strong>und</strong> z. T. sogar verhindert<br />
wird.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Im Standard-Datenbogen wird diese Art als selten „auf dem Durchzug“ angegeben. Die Bestandsgröße<br />
der Population im FFH-Gebiet wird mit < 2 % der Gesamtpopulation angegeben.<br />
Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente <strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten<br />
werden mit B, d. h. guter Erhaltungszustand, angegeben. Die Isolierung<br />
(Lage der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit C (Population nicht<br />
isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) angegeben. Es ergibt sich bezüglich<br />
des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“.<br />
Der Greifswalder Bodden <strong>und</strong> die vorgelagerten Gebiete der Oderbucht <strong>und</strong> damit auch die<br />
marinen Gewässer im FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ sind nur als Durchzugs- <strong>und</strong> bestenfalls zeitweiliges Weidegebiet zu betrachten.<br />
Die Neunaugen leben im Flachwasser <strong>und</strong> wurden bisher nicht in den tiefen Wasserzonen gefangen.<br />
Im angrenzenden FFH-Gebiet (Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser <strong>und</strong> Kleines Haff –<br />
DE 2049-302) wurde das Flussneunauge mehrmals im Peenestromgebiet nachgewiesen. Nach<br />
THIEL & WINKLER (2007) sind im Peenesystem (Peene <strong>und</strong> Zuflüsse) 5 von insgesamt 9 Laichplätzen<br />
in Mecklenburg Vorpommern beschrieben. Diese Laichplätze scheinen jedoch nicht<br />
regelmäßig zum Laichen genutzt zu werden <strong>und</strong> die Fortpflanzungsgemeinschaften weisen in
FROELICH & SPORBECK Seite 95<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Verbindung mit starken interannuellen Schwankungen sehr geringe Populationsgrößen (10-200<br />
Individuen) auf (WINKLER et al. 2002).<br />
Vorkommen im duB<br />
Nachweise des Flussneunauges in unmittelbarer Nähe des Projektgebietes wurden 1994<br />
(SCHRÖDER 1995) vor der Insel Ruden gemacht, wo 50 Individuen mit bis zu 35 cm Länge gefangen<br />
wurden. Im selben Jahr wurden auch vor Usedom Individuen nachgewiesen. Eine Befischung<br />
vom 17.12.2001 im Bereich der Kühlwasserfahne erbrachte keinen Nachweis aus der<br />
Artengruppe der R<strong>und</strong>mäuler.<br />
Im südlichen Bereich des Peenestroms (außerhalb des duB) wurden im Jahre 2004 in der<br />
Krumminer Wiek 40 Individuen nachgewiesen, sowie 2005 insgesamt 17 Individuen im Achterwasser<br />
<strong>und</strong> ein Individuum in der Krumminer Wiek (THIEL & WINKLER 2007). Es handelte sich<br />
bei den nachgewiesenen Individuen um Tiere im Größenbereich 30-40cm, Jungtiere wurden<br />
nicht gefangen. Der einzige Nachweis eines Jungtieres (15 cm Länge) stammt aus dem Bereich<br />
der geplanten Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> wurde noch zu Zeiten des Betriebes des Kernkraftwerkes<br />
nachgewiesen (SUBKLEW 1981). Dieses Tier wurde an den Siebrechen abgefischt.<br />
Meerneunauge (Petromyzon marinus) (EU-Code 1095)<br />
Meerneunaugen (Petromyzon marinus) (EU-Code 1095) leben in küstennahen Zonen in <strong>und</strong> vor<br />
den Mündungen der großen Flüsse. Das Verbreitungsgebiet der Art reicht nach Norden bis<br />
Süd-Finnland. Die adulten Tiere, die bis zu 1 m lang werden können, wandern im Frühjahr<br />
(März bis Juni) aus dem Meer in die Flüsse, um an sandig-kiesigen, mäßig durchströmten Stellen<br />
oder strömungsberuhigten Buchten ihren Laich abzulegen. Nach dem Laichen sterben die<br />
Adulten, die Larven (Querder) leben dort, vergraben im feinsandigen schlickigen Substrat, 2 - 5<br />
Jahre <strong>und</strong> filtrieren kleine Nahrungspartikel aus dem Süßwasser. Nach der Metamorphose<br />
wandern die Jungtiere für 3 - 4 Jahre ins Meer <strong>und</strong> ernähren sich nun an (Ektoparasit) <strong>und</strong> von<br />
Fischen.<br />
Der Bestand der Meerneunaugen ist durch Wasserbaumaßnahmen sowie durch Gewässerverschmutzung,<br />
insbesondere Eutrophierung stark rückläufig. In Deutschland ist diese Art „stark<br />
gefährdet“ (FRICKE et al. 1998) <strong>und</strong> in Mecklenburg-Vorpommern „vom Aussterben bedroht“<br />
(WINKLER et al. 1991). Für das Meerneunauge stellen nur gering belastete Gewässersysteme,<br />
die nicht oder nur in geringem Maße wasserbaulich beeinträchtigt sind, maßgebliche Bestandteile<br />
dar.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Im Standard-Datenbogen wird diese Art als selten „auf dem Durchzug“ angegeben. Die Bestandsgröße<br />
der Population im FFH-Gebiet beträgt 2 – 15 % der Gesamtpopulation. Der Erhaltungsgrad<br />
der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente <strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten<br />
werden mit B, d. h. guter Erhaltungszustand, angegeben. Die Isolierung (Lage<br />
der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit C (Population nicht isoliert,<br />
innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) bewertet. Es ergibt sich bezüglich des Gesamtwertes<br />
ein C = „signifikanter Wert“. Die Bestandsdichte des Meerneunauges im Ostseebereich<br />
ist insgesamt äußerst gering. Die Art ist nur sehr selten in der Ostsee nachgewiesen wor-
FROELICH & SPORBECK Seite 96<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
den. Der Großteil der Nachweise in Mecklenburg Vorpommern wurde zeitlich vor 1990 gemacht<br />
(IFAÖ 2008E).<br />
Nach THIEL & WINKLER (2007) wurden zwischen 1940 <strong>und</strong> 1989 insgesamt 40 Meerneunaugen<br />
an der deutschen Ostseeküste gezählt, wobei die überwiegende Zahl der Nachweise aus küstennahen<br />
Gewässern stammt. Für diesen Zeitraum liegen auch verschiedene Nachweise für die<br />
Küstengewässer um die Insel Rügen einschließlich dem Greifswalder Bodden vor. Nach 1990<br />
wurden an der deutschen Ostseeküste insgesamt 28 Meerneunaugen gefangen. Für den<br />
Greifswalder Bodden sind nur 3 Nachweise im Zeitraum 1979-1987 verzeichnet (SCHRÖDER<br />
1995). Wenn man der Einschätzung von THIEL (2005, ZITIERT IN THIEL & WINKLER 2007) folgt,<br />
dass im Bereich der in die deutschen Ostseegewässer entwässernden Flüsse gegenwärtig<br />
keine Laichplätze dieser Art zu existieren scheinen, kann eine dauerhafte Nutzung des<br />
Peenestroms als Wanderroute des Meerneunauges weitgehend ausgeschlossen werden.<br />
Der Greifswalder Bodden <strong>und</strong> die vorgelagerten Gebiete der Oderbucht <strong>und</strong> damit auch die<br />
marinen Gewässer im FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ sind nur als Durchzugs- <strong>und</strong> bestenfalls zeitweiliges Weidegebiet zu betrachten.<br />
Die Befischung vom 17.12.2001 im Bereich der Kühlwasserfahne erbrachte keinen Nachweis<br />
aus der Artengruppe der R<strong>und</strong>mäuler.<br />
Vorkommen im duB<br />
Nach THIEL & WINKLER (2007) gibt es einen Artnachweis für die Küstengewässer vor Usedom.<br />
Im an den duB angrenzenden Peenestrom wurde im Jahr 2005 ein F<strong>und</strong> erbracht (THIEL &<br />
WINKLER 2007). Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass sich<br />
Laichgebiete im Peenesystem befinden. F<strong>und</strong>ierte Kenntnisse liegen hierzu nicht vor.<br />
Rapfen (Aspius aspius) (EU-Code 1130)<br />
Der Rapfen (Aspius aspius) (EU-Code 1130) lebt in der Freiwasserregion großer Flüsse <strong>und</strong><br />
ihrer seenartigen Erweiterungen. Er ernährt sich fast ausschließlich von anderen Fischen <strong>und</strong><br />
anderen kleinen Wirbeltieren. Rapfen laichen im März über grobkiesigem Substrat; die schlüpfenden<br />
Larven leben dann bis zu ihrer Fressfähigkeit im Interstitial.<br />
Der Bau von Stauanlagen, Wasserverschmutzung <strong>und</strong> Wasserstandsregulierung stellen die<br />
wesentlichen Beeinträchtigungen für die Art dar.<br />
Der Rapfen ist anhand der Nachweise vor allem im Bereich des Oderhaffs verbreitet (THIEL &<br />
WINKLER 2007) <strong>und</strong> tritt auch vereinzelt im Peenestrom auf. Dabei beschreiben WINKLER et al.<br />
(2002) das Auftreten wie folgt: „Sowohl in der Elbe als auch im Oderhaff scheint die Art nach<br />
wie vor häufig zu sein. Von da aus ziehen sich die Vorkommen in das Elbe- bzw. Peenesystem,<br />
einschließlich durchflossener Seen.“<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Im FFH-Gebiet ist von einem gelegentlichen Einwandern aus dem Peenestromgebiet in den<br />
Greifswalder Bodden auszugehen (WINKLER mdl. Mitt. 2008). Der Greifswalder Bodden <strong>und</strong> die<br />
vorgelagerten Gebiete der Oderbucht <strong>und</strong> damit auch die marinen Gewässer im FFH-Gebiet
FROELICH & SPORBECK Seite 97<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ sind jedoch insgesamt<br />
nur als Durchzugs- <strong>und</strong> bestenfalls zeitweiliges Weidegebiet zu betrachten. Die Bestandsgröße<br />
der Population des Rapfens im FFH-Gebiet wird im Standard-Datenbogen mit < 2 % der Gesamtpopulation<br />
angegeben. Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente<br />
<strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten werden mit B (guter Erhaltungszustand)<br />
bewertet. Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit<br />
C (Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) angegeben. Es<br />
ergibt sich bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“.<br />
Vorkommen im duB<br />
Im an den duB angrenzenden Peenestrom tritt der Rapfen vereinzelt auf (THIEL UND WINKLER<br />
2007). Von einem gelegentlichen Einwandern aus dem Peenestromgebiet in den Greifswalder<br />
Bodden ist auszugehen (WINKLER et al. 2002). Ein gelegentliches Auftreten im duB der FFH-VP<br />
ist möglich, der marine Bereich des duB kann jedoch insgesamt nur als Durchzugs- <strong>und</strong> bestenfalls<br />
zeitweiliges Weidegebiet zu betrachten.<br />
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) (EU-Code 1134)<br />
Der Bitterling (Rhodeus sericeus amarus) (EU-Code 1134) ist eine typische Stillwasserart <strong>und</strong><br />
kommt in stehenden <strong>und</strong> langsam fließenden, sommerwarmen <strong>und</strong> pflanzenreichen Gewässern<br />
vor, in denen Großmuscheln (Najaden) vorzufinden sind (PETERSEN et al. 2004). Bitterlinge legen<br />
ihre Eier zum Schutze vor Fressfeinden in das Innere lebender Muscheln ab (Laichzeit:<br />
April - Juni). Die eigentlich relativ anspruchslose Art reagiert dennoch relativ empfindlich auf<br />
Lebensraumveränderungen, da sie anscheinend stärkere Wasserverschmutzungen nicht toleriert<br />
<strong>und</strong> stenök an das Vorkommen von Muscheln der Gattungen Unio oder Anodonta ange-<br />
wiesen ist.<br />
Hauptgefährdungsursachen liegen daher in Wasserbau- <strong>und</strong> Gewässerunterhaltungsmaßnahmen,<br />
die den Lebensraum sowohl des Bitterlings als auch der Muschel zerstören. Des Weiteren<br />
geht eine Gefährdung von der Verfüllung <strong>und</strong> dem saisonalen Trockenfallen von Kleingewässern,<br />
von Eutrophierung <strong>und</strong> der damit verb<strong>und</strong>enen Verschlammung der Gewässer aus.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Der Bitterling kommt nach Angaben der FFH-Gebietsmeldung Mecklenburg-Vorpommern im<br />
Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Peenestrom vor. Verbreitungsschwerpunkte in Mecklenburg Vorpommern<br />
sind nach Angaben von WINKLER et al. (2002) die Zuflüsse <strong>und</strong> Grabensysteme zum<br />
Kleinen Stettiner Haff bis zum Greifswalder Bodden (Ryck), Tollense, untere Recknitz <strong>und</strong> einige<br />
Bereiche des Warnowsystems. Dabei kommt diese Art vor allem in schwach fließenden bis<br />
stehenden Gewässern vor. Ein Vorkommen dieser Art direkt im Bodden oder Peenestrom ist<br />
nicht zu erwarten (IFAÖ 2008E). Nach aktuellen Untersuchungen sind jedoch Vorkommen im<br />
Bereich des Ryck, der Tollense/Peene <strong>und</strong> im Unterlauf einiger Oderhaffzuflüsse bekannt. Hier<br />
wird eine wesentlich weitere Verbreitung vermutet als es die Erfassungsnachweise andeuten.<br />
Da der Bitterling hauptsächlich schwach fließende <strong>und</strong> stehende Gewässer besiedelt, wird bei<br />
gezielten Erfassungen in Stillgewässern mit weiteren Nachweisen gerechnet (THIEL & WINKLER<br />
2007).
FROELICH & SPORBECK Seite 98<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Nach KRAPPE et al. (2009) befindet sich der Bitterling derzeit (wieder) in Ausbreitung <strong>und</strong> ist in<br />
allen großen Flusssystemen Mecklenburg-Vorpommerns zu finden. Begründet wird dies mit<br />
dem allgemeinen Temperaturanstieg <strong>und</strong> Verschleppung durch Besatz. Die Verbreitungskarte<br />
von KRAPPE et al. (2009) zeigt aktuelle Vorkommen des Bitterlings am Greifswalder Bodden im<br />
Bereich Greifswald.<br />
Im Standard-Datenbogen wird die Bestandsgröße der Population im FFH-Gebiet mit < 2 % der<br />
Gesamtpopulation angegeben. Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente<br />
<strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten werden mit B (guter Erhaltungszustand)<br />
bewertet. Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit<br />
C (Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) angegeben. Es<br />
ergibt sich bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“. Die Befischung vom<br />
17.12.2001 im Bereich der Kühlwasserfahne erbrachte keinen Nachweis des Bitterlings.<br />
Vorkommen im duB<br />
Nach den Verbreitungskarten des Bitterlings in Deutschland in STEINMANN & BLESS (2004) <strong>und</strong> in<br />
KRAPPE et al. (2009) liegen im duB keine Vorkommensnachweise der Art vor. Potenzielle Lebensräume<br />
für die Art stellen die Kleingewässer <strong>und</strong> Seen auf Nord-Usedom dar.<br />
Atlantischer Stör (Acipenser sturio bzw. oxyrinchus) (EU-Code 1101*)<br />
Störe laichen in stark strömenden Flussabschnitten auf kiesigem <strong>und</strong> steinigem Untergr<strong>und</strong>, wo<br />
die Weibchen zwischen 1.000.000 bis 2.500.000 Eier ablegen. Die Eier haften am Untergr<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> auch die Fischlarven nutzen die Bereiche zwischen den Steinen als Lebensraum, bis der<br />
Dottersack aufgebraucht ist. In der folgenden Zeit werden sie dann mit der Strömung Flussabwärts<br />
in Bereiche verdriftet, in denen die erste aktive Nahrungsaufnahme stattfindet. Die Jungfische<br />
wandern in Richtung Flussmündung in den Brackwasserbereich, in dem sie sich bis zu 4<br />
Jahre aufhalten, bevor sie ins Meer abwandern. Erst nach 10-20 Jahren kehren die geschlechtsreifen<br />
Tiere zurück in die Flüsse, um erstmalig die Laichbereiche aufzusuchen.<br />
Wie auch bei den anderen Wanderfischarten wurden die Lebensgr<strong>und</strong>lagen durch Gewässerverbauungen<br />
<strong>und</strong> Umweltverschmutzung weitgehend zerstört. Die Kanalisierung vieler Flüsse<br />
führte zum Verschwinden von wichtigen Laichbereichen.<br />
Die beiden Störarten Atlantischer Stör (Acipenser oxyrinchus) <strong>und</strong> Europäischer Stör (Acipenser<br />
sturio) gelten nach der Roten Liste der R<strong>und</strong>mäuler <strong>und</strong> Süßwasser- <strong>und</strong> Wanderfische Meck-<br />
lenburg-Vorpommerns als ausgestorben oder verschollen (WINKLER et al. 2002).<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Bedeutung des Störs als Leitart für große Fließgewässer (GESSNER & ARNDT<br />
2003) sind in den letzten Jahren Bemühungen zur Wiedereinbürgerung der Arten im deutschen<br />
Ostseeraum angelaufen. Diese betreffen vor allem den Atlantischen Stör (Acipenser oxyrinchus),<br />
nachdem genetische <strong>und</strong> morphometrische Analysen zeigten, dass es sich bei dem<br />
früher in der Ostsee vorkommenden Baltischen Stör nicht um Acipenser sturio sondern um Abkömmlinge<br />
des heute noch in Nordamerika verbreiteten Atlantischen Störs (Acipenser oxyrinchus)<br />
handelt (LUDWIG et al. 2002).
FROELICH & SPORBECK Seite 99<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Erste experimentelle Besatzversuche wurden im Ostseegebiet von 2006 bis 2009 mit ca.<br />
70.000 Acipenser oxyrinchus von 1 cm bis 150 cm Körperlänge durchgeführt (GEßNER et al.<br />
2010). Die Aussetzungen fokussieren sich auf die Flüsse Oder, Drawa <strong>und</strong> Warthe. Gegenwärtig<br />
liegen bereits zahlreiche Rückmeldungen zu Wiederfängen vor. So gab es ca. 1.100 Meldungen<br />
aus der Flussfischerei <strong>und</strong> 148 Meldungen aus der Küstenfischerei. Zudem streuen sich<br />
Wiederfänge über die gesamte Ostsee (GEßNER, mündl. am 30.09.2010). Insgesamt wurden<br />
bisher extrem heterogene Wanderungsbewegungen der ausgesetzten Tiere sowohl in den<br />
Flusssystemen der Oder (einschließlich Peenestrom), Drawa <strong>und</strong> Oder als auch in den Küstengewässern<br />
<strong>und</strong> der Ostsee festgestellt.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Der Peenestrom kann für die Art als Wanderweg in die Ostsee in Frage kommen, über Laichbereiche<br />
gibt es jedoch keine historischen Nachweise <strong>und</strong> diese sind aufgr<strong>und</strong> der Flussstruktur<br />
unwahrscheinlich (mündliche Mitteilung Hr. ARNDT, Fisch <strong>und</strong> Umwelt). Aufgr<strong>und</strong> des frühen<br />
Zeitpunktes im Untersuchungszeitraum des Wiederbesiedlungsprojektes kann derzeit noch<br />
keine genaue Aussage über Wanderwege oder über den Erfolg des Besatzes gemacht werden.<br />
Vorkommen im duB<br />
Für den duB liegen bisher keine Artnachweise für den Stör vor. Eine Einschätzung über die<br />
Nutzung der Gewässer im Bereich des detailliert zu untersuchenden Bereiches ist derzeit nicht<br />
möglich. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist jedoch das zeitweilige Vorkommen von adulten<br />
Tieren bzw. 0,5 - 1 m langen Jungtieren nicht auszuschließen.<br />
Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) (EU-Code 1014)<br />
Die Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) (EU-Code 1014) besiedelt vor allem nasse,<br />
sumpfige, offene, sich unter Sonneneinstrahlung schnell erwärmende Grünlandstandorte auf<br />
kalkreichem Substrat in niedrigen bis höchstens mittleren Lagen. Die schmale Windelschnecke<br />
kommt vorwiegend in durchgehend nassen, naturnahen Wiesen <strong>und</strong> in feuchten bis nassen<br />
Dünenmulden zwischen Moos, an den Rändern stehender Gewässer, in Quellhorizonten an<br />
Berghängen sowie in der Streu von Weiden- <strong>und</strong> Erlengebüschen vor, an der Ostseeküste auch<br />
in Hangwäldern (ABDANK et al. 2004), wo sie zwischen Moos, Gras, Pflanzenresten <strong>und</strong> unter<br />
Steinen lebt. (WIESE 1991, KERNEY et al. 1983, WELLS & CHATFIELD 1992, VAN HELSDINGEN et al.<br />
1996, TURNER et al. 1998).<br />
JUEG & ZETTLER (2000) geben für Mecklenburg-Vorpommern als bevorzugten Lebensraum kalkige<br />
Flachmoorwiesen an, die sich oft auf alten Seeterrassen oder in Flussniederungen befinden.<br />
Die Nachweise in M-V konzentrieren sich in der Mecklenburger Seenplatte <strong>und</strong> auf Rügen.<br />
Im norddeutschen Seengebiet besteht die höchste Konzentration der Vorkommen in Deutschland.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der meist versprengten Vorkommen in Deutschland besitzt Mecklenburg-<br />
Vorpommern eine hohe Verantwortung für den Erhalt der Art (ABDANK et al. 2004).<br />
Als Hauptgefährdungsursache ist in Mitteleuropa die Zerstörung <strong>und</strong> Beeinträchtigung der Lebensräume<br />
der Art anzusehen. So können z. B. Gr<strong>und</strong>wasserabsenkungen, Aufschüttungen,<br />
Überdüngung oder Bebauung Ursachen für ihren Rückgang sein. Sowohl eine einsetzende
FROELICH & SPORBECK Seite 100<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Verbuschung, als auch eine Intensivierung der Nutzung wirken sich negativ auf die Art aus (BFN<br />
2010).<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Die Bestandsgröße der Population im FFH-Gebiet wird im Standard-Datenbogen mit < 2 % der<br />
Gesamtpopulation angegeben. Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente<br />
<strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten werden mit B (gute Erhaltung) bewertet.<br />
Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit C (Population<br />
nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) angegeben. Es ergibt sich<br />
bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“.<br />
Vorkommen im duB<br />
Im duB konnte die Art bisher nicht nachgewiesen werden (vgl. I.L.N GREIFSWALD 1999 – Molluskenerhebung<br />
zur UVU zum <strong>GuD</strong>-Kraftwerk I, JUEG & ZETTLER 2000, COLLING & SCHRÖDER<br />
2003A, ZETTLER et al. 2006). Auch im LINFOS M-V sind für den duB keine Nachweise der Art<br />
angegeben. Ein potenzielles Vorkommen der Art vor allem in Dünentälchen <strong>und</strong> an Gewässerrändern<br />
auf Nord-Usedom kann nicht ausgeschlossen werden.<br />
Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) (EU-Code 1016)<br />
Die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) (EU-Code 1016) ist in ihrer Habitatwahl<br />
offenbar noch anspruchsvoller als die Schmale Windelschnecke <strong>und</strong> kommt fast ausschließlich<br />
in Röhrichten, Seggensümpfen <strong>und</strong> Mooren vor, welche häufig an den Ufern von Niederungsbächen<br />
<strong>und</strong> -seen liegen; dort findet sie sich vor allem auf den Stängeln <strong>und</strong> Blättern höherer<br />
Gräser (Glyceria maxima, Carex acutiformis, Carex paniculata, Carex riparia, Cladium mariscus,<br />
Phragmites australis). Die Art zeigt eine Vorliebe für Bereiche mit höherer Vegetation, an<br />
der sie während der Aktivitätszeit häufig emporklettert <strong>und</strong> ist an Standorten mit ausschließlich<br />
niedrigwüchsigen Pflanzen nur selten zu finden (WIESE 1991, KERNEY et al. 1983, WELLS &<br />
CHATFIELD 1992, VAN HELSDINGEN et al. 1996, TURNER et al. 1998, KERNEY 1999, JUEG & ZETT-<br />
LER 2000). Die Vorkommen von V. moulinsiana nördlich der Alpen werden allgemein als ein<br />
Relikt der nacheiszeitlichen Wärmezeit angesehen, da die Art empfindlich gegen niedrige Wintertemperaturen<br />
ist. Einer der wenigen Verbreitungsschwerpunkte der Art befindet sich in M-V<br />
<strong>und</strong> in Nordost-Brandenburg. Mit 94 rezenten Populationen besitzt M-V die höchste F<strong>und</strong>ortdichte<br />
in Europa <strong>und</strong> daher auch eine überregionale Verantwortung für den Erhalt der Art (JUEG<br />
& ZETTLER 2000).<br />
Die Art reagiert empfindlich auf eine Veränderung des Wasserhaushalts, sowie Mahd oder intensive<br />
Beweidung. Durch die Mahd werden die senkrechten Pflanzenstängel <strong>und</strong> die Blätter<br />
entfernt, die wichtiger Aufenthaltsort der Tiere sind. Mittelfristig kann sich auch Nährstoffanreicherung<br />
durch Verbuschung oder starke Verschilfung negativ auswirken (BFN 2010).<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Die Bestandsgröße der Population im FFH-Gebiet wird im Standard-Datenbogen mit < 2 % der<br />
Gesamtpopulation angegeben. Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente<br />
<strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten werden mit B, d. h. gute Erhaltung, be-
FROELICH & SPORBECK Seite 101<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
wertet. Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit C<br />
(Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes) angegeben. Es ergibt<br />
sich bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“.<br />
Vorkommen im duB<br />
Aus dem duB der FFH-VU gibt es keine Artnachweise für die Bauchige Windelschnecke (vgl.<br />
I.L.N GREIFSWALD 1999, JUEG & ZETTLER 2000, COLLING & SCHRÖDER 2003B, ZETTLER et al.<br />
2006). Auch im LINFOS M-V sind für den duB keine Nachweise der Art angegeben. Ein potenzielles<br />
Vorkommen der Art vor allem an Gewässerrändern auf Nord-Usedom kann nicht ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (EU-Code 1042)<br />
Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (EU-Code 1042) ist ein westsibirisches Fau-<br />
nenelement, welches von Südschweden bis zu den Alpen <strong>und</strong> im Westen bis nach Frankreich<br />
verbreitet ist (BROCK et al. 1997). Sie siedelt in der B<strong>und</strong>esrepublik v. a. in der Norddeutschen<br />
Tiefebene <strong>und</strong> Schleswig-Holstein. In den Mittelgebirgen <strong>und</strong> im Süden ist sie äußerst selten.<br />
Die Große Moosjungfer bewohnt mesotrophe bis eutrophe saure Gewässer der Ebene. Habitatbestimmend<br />
sind zwei Strukturelemente: das Vorhandensein von Schwimmblattpflanzen sowie<br />
lockere Riedstrukturen (WILDERMUTH 1992). Hinzu kommt, dass die kleinen Torfstiche oder<br />
leicht sauren kleinen Weiher von (lockerem) Wald (teil)umstanden sein müssen. Somit sind die<br />
Lebensräume ausgezeichnet durch eine stark überwachsene Wasserfläche, die windgeschützt<br />
<strong>und</strong> überschattet liegt. Die Larven halten sich im Bereich der Wasserriedzone (Flachwasserbereich<br />
bis 50 cm Tiefe) auf. Scheinbar wird die Art nach Osten hin eurytoper, d. h. dort werden<br />
auch eutrophe Kleingewässer besiedelt. Die Große Moosjungfer ist wahrscheinlich in Metapopulationen<br />
organisiert, die in einem Landschaftsraum ausreichend die von der Art benötigten<br />
Strukturen vorfinden müssen (maximal nachgewiesene Wanderdistanzen bis zu 12 km). Die Art<br />
ist gegenüber akustischen Störreizen nicht <strong>und</strong> gegenüber visuellen (z. B. Annäherung eines<br />
Menschen) nur in geringem Maße anfällig. Gegenüber Veränderungen im Wasserchemismus,<br />
insbesondere Eutrophierungen, reagiert die Art ausgesprochen empfindlich.<br />
Durch Vernichtung ihres Lebensraumes ist die Art insgesamt selten <strong>und</strong> fast immer in geringer<br />
Individuenzahl anzutreffen. In Deutschland wird sie zu den stark gefährdeten Arten gezählt (Kategorie<br />
2 nach der Roten Liste Deutschlands (OTT & PIPER 1998; Kategorie A.2 nach der Roten<br />
Liste Mecklenburg-Vorpommerns (UMWELTMINISTERIUM DES LANDES MECKLENBURG-<br />
VORPOMMERN 1993)).<br />
Für die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) ist eine Einschätzung der Bedeutung eines<br />
Vorkommens nur schlecht möglich, weil sich diese Libellenart nur während eines kurzen Zeitraumes<br />
im Jahresverlauf als Imago <strong>und</strong> dann meist auch nur in geringer Individuendichte nachweisen<br />
lässt, ohne dass sich daraus Rückschlüsse auf die tatsächliche Populationsgröße <strong>und</strong><br />
damit ihrer Bedeutung ziehen ließen. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind vergleichsweise zahlreiche<br />
Vorkommen der Art bekannt. Die meisten davon stammen auch aus den letzten 20 Jahren.<br />
So nennt BÖNSEL (2004) für das Land Mecklenburg-Vorpommern 51 Vorkommen. Dennoch<br />
kann davon ausgegangen werden, dass die genaue Bestandssituation nur ungenügend bekannt<br />
ist (MAUERSBERGER 2003). Trotz der ungenauen Kenntnis der tatsächlichen Bestandssi-
FROELICH & SPORBECK Seite 102<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
tuation muss die Art landesweit als stark gefährdet eingestuft werden, da sie als Bewohner von<br />
Mooren <strong>und</strong> Gewässern mit Schwimmblattgesellschaften relativ hohe Ansprüche an ihren Lebensraum<br />
stellt. Die intensive Landnutzung gerade von Niedermoorgrünland, die Entwässerung<br />
der Moore <strong>und</strong> die allgemeine Eutrophierung auch dieser nährstoffärmeren Räume haben zu<br />
starken Verlusten der potenziellen Lebensräume dieser Art geführt (vgl. ebd.). Ausgehend von<br />
der Seltenheit des von der Großen Moosjungfer während der Larvalphase benötigten Gewässertyps,<br />
ist jedoch für den Erhalt der Art jedes Einzelvorkommen von großer Bedeutung.<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Die Bestandsgröße der Population im FFH-Gebiet wird mit < 2 % der Gesamtpopulation angegeben.<br />
Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente <strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten<br />
werden im Standard-Datenbogen mit C (durchschnittlicher oder<br />
beschränkter Erhaltungszustand) bewertet. Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf<br />
das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit C (Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebietes)<br />
angegeben. Es ergibt sich bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter<br />
Wert“.<br />
Vorkommen im duB<br />
Im untersuchten Bereich der FFH-VU konnte die Art im Rahmen der faunistischen Kartierungen<br />
nicht nachgewiesen werden (FROELICH & SPORBECK 2008P), obschon die Kartiermethodik insbesondere<br />
auf die Erfassung dieser Art ausgerichtet war. Vorkommen sind nach der Habitatbeschreibung<br />
in MAUERSBERGER (2003, vgl. hier auch Verbreitungskarte) <strong>und</strong> eigenen Geländekenntnissen<br />
der Kartierer möglich. Im Jahr 1999 gelang der Nachweis einer Imago der<br />
Großen Moosjungfer an einem Gewässer (LRT 3150) auf dem Struck (MEITZNER & MARTSCHEI<br />
2000).<br />
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) (EU-Code 1060)<br />
Der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) (EU-Code 1060) ist vom westlichen, atlantischen Mit-<br />
teleuropa über das Baltikum <strong>und</strong> Südosteuropa bis ins Amurgebiet verbreitet. Er ist allerdings in<br />
weiten Teilen seines früheren Verbreitungsgebietes ausgestorben. In der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland ist die Art nur noch in wenigen reliktartigen Inselpopulationen verbreitet, so in Baden-Württemberg<br />
v. a. in der Oberrheinebene (BINK 1996; EBERT 1991). Restpopulationen existieren<br />
ebenfalls in Hessen, Thüringen, in den östlichen Bereichen von Brandenburg <strong>und</strong> Mecklenburg-Vorpommern<br />
sowie in der Umgebung Berlins. Hauptrückgangsursache ist der<br />
Lebensraumverlust durch Flussbegradigungen <strong>und</strong> die Trockenlegung von Feuchtflächen durch<br />
Drainage, aber auch die Bepflanzung von offenen Flächen mit Bäumen (BINK 1996).<br />
Durch intensive Mahd werden die Futterplätze der Raupen zerstört. Der Falter ist bevorzugt auf<br />
offenen Feuchtwiesen (Binsen- <strong>und</strong> Kohldistelwiesen, Pfeifengras- <strong>und</strong> Flachmoorwiesen, Seggenriede),<br />
in feuchten Gräben, Ton- <strong>und</strong> Kiesgruben, auf Feuchtbrachen, feuchten Gebüsch-<br />
<strong>und</strong> Wegrändern sowie Störstellen im Auenwald anzutreffen. Männliche Falter zeigen ein auffälliges<br />
Revierverhalten: dabei werden auffallende Flecken in der mehr einheitlichen Vegetation<br />
monopolisiert. Da die Art prinzipiell geringe Populationsdichten aufweist (meist unter einem<br />
Falter pro Hektar), dienen solche „Rendezvousplätze“ der Partnerfindung, werden also gewissermaßen<br />
als sek<strong>und</strong>äres sexuelles Signal genutzt (EBERT 1991; WEIDEMANN 1995). Hauptfut-
FROELICH & SPORBECK Seite 103<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
terpflanze der Raupe ist der Riesenampfer (Rumex hydrolapathum), daneben werden aber<br />
auch andere oxalatarme Ampfer-Arten genommen. Die Überwinterung des Feuerfalters erfolgt<br />
als Raupe. Die Falter saugen an einer Vielzahl von Blütenpflanzen Nektar. Als maßgebliche<br />
Bestandteile für den Erhalt dieser Art in Feuchtwiesen <strong>und</strong> -weiden (extensiv genutzt), Feuchtgebieten,<br />
Sümpfen <strong>und</strong> Niedermooren sind ungemähte Ampferbestände von besonderer Bedeutung.<br />
In Mecklenburg-Vorpommern stellt sich die Bestandssituation des Großen Feuerfalters<br />
großräumig gesehen so dar, dass die Art genauso wie in Brandenburg von vielen ihrer früher<br />
bekannten Flugplätze verschw<strong>und</strong>en ist, dafür jedoch an anderen, vorher unbekannten Flugplätzen<br />
neu auftaucht (REINHARD & THUST 1993 zitiert in WEIDEMANN 1995).<br />
WEIDLICH & WEIDLICH (1984) erwähnen ein Zitat von URBAHN (1974), nach dem die Art im NSG<br />
„Gothensee <strong>und</strong> Thurbruch“, einem offenbar aufgr<strong>und</strong> von fortschreitender Austrocknung zunehmenden<br />
Sukzessionserscheinungen (z. B. Verbuschung) unterworfenen Moorgebiet auf<br />
Usedom, von Jahr zu Jahr seltener auftrat; die genannten Autoren konnten sie im Rahmen eigener,<br />
seit 1979 durchgeführter Falterbeobachtungen in diesem Gebiet nicht mehr feststellen.<br />
Trotz einer noch vergleichsweise großen Anzahl aktueller Vorkommen des Großen Feuerfalters<br />
(Lycaena dispar) in Mecklenburg-Vorpommern, darf nicht übersehen werden, dass diese Art<br />
zahlreiche Siedlungsräume verloren hat. Die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Niedermoore,<br />
die mit einer tiefen Entwässerung der Gebiete verb<strong>und</strong>en war <strong>und</strong> ist, hat die meisten<br />
Lebensräume dieser Art zerstört. Nur noch wenige stabile Primärhabitate (stabile, offene Seggenriede<br />
im Überflutungs- bzw. Verlandungsbereich von Gewässern) existieren in Mecklenburg-<br />
Vorpommern für den Großen Feuerfalter. Die Sek<strong>und</strong>ärhabitate wie Feuchtwiesen mit verlandenden<br />
Gräben sowie Ufer von Meliorationsgräben <strong>und</strong> Torfstichen sind sehr abhängig von<br />
einer extensiven Bewirtschaftung bzw. Pflege. Mit den veränderten Bedingungen in der Landwirtschaft<br />
seit Beginn der 1990er Jahre werden gerade diese Standorte aufgegeben, verbuschen<br />
<strong>und</strong> gehen somit als Lebensraum für die Art verloren (KÜHNE et al. 2001).<br />
Bei dieser Art ist jedes Einzelvorkommen von überregional großer Bedeutung für den Erhalt der<br />
Art <strong>und</strong> damit unbedingt schützenswert. Die aktuellen Vorkommen der Art beschränken sich<br />
weitgehend auf den östlichen Landesteil, wobei das vorpommersche Flusstalmoorsystem den<br />
eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt darstellt (FARTMANN et al. 2001).<br />
Vorkommen im FFH-Gebiet<br />
Der Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatelemente <strong>und</strong> die Wiederherstellungsmöglichkeiten<br />
werden im Standard-Datenbogen mit C, d. h. durchschnittlicher oder<br />
beschränkter Erhaltungszustand, angegeben. Die Isolierung (Lage der Population in Bezug auf<br />
das Hauptverbreitungsgebiet) ist mit A (Population (beinahe) isoliert) angegeben. Es ergibt sich<br />
bezüglich des Gesamtwertes ein C = „signifikanter Wert“.<br />
Vorkommen im duB<br />
Der Große Feuerfalter konnte in den Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> auf dem Struck nicht nachgewiesen<br />
werden (FROELICH & SPORBECK 2009D). Neben dem Mangel an unbeweideten Feuchtwiesen<br />
trägt vermutlich auch die Windexposition des Gebiets zum Fehlen der Art bei. Von Usedom<br />
sind Reproduktionsvorkommen der Art im Gebiet des Kölpiensees (innerhalb des duB) <strong>und</strong><br />
des Cämmerer Sees (außerhalb des FFH-Gebietes) bekannt (eigene Erhebungen im Bereich
FROELICH & SPORBECK Seite 104<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Cämmerer See von FROELICH & SPORBECK in 2008) Zusammen mit individuenstärkeren Vorkommen<br />
am Kölpiensee existiert eine größere Feuerfalterpopulation in der Umgebung<br />
Peenemündes.<br />
4.3.4 Derzeitige Vorbelastungen des detailliert untersuchten Bereiches<br />
Als Vorbelastungen des FFH-Gebietes im Wirkraum des Vorhabens sind die vorhandenen,<br />
umfangreichen Gewerbe- <strong>und</strong> Industrieanlagen des ehemaligen Kernkraftwerkes, mit den über<br />
das eigentliche Industrieareal hinausgehenden Infrastruktureinrichtungen (z. B. Industriehafen,<br />
Schaltanlagen, Umspannwerk, Freileitungen) sowie die vorgesehenen <strong>und</strong> hinreichend konkretisierten<br />
Ansiedlungen im B-Plangebiet „<strong>Lubmin</strong>er Heide“ (z. B. <strong>Lubmin</strong> Diesel, Liebherr, EEW)<br />
sowie ebenso das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II EnBW zu nennen. Eine Vorbelastung der Spandowerhagener<br />
Wiek ergibt sich u. a. durch die vorhandene Einlaufrinne <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen wiederkehrenden<br />
Unterhaltungsmaßnahmen. Weitere Vorbelastungen sind durch die derzeitigen Lärm-<br />
<strong>und</strong> Schadstoffimmissionen im Zuge der Maßnahmen zum Rückbau des ehemaligen KKW-<br />
„Bruno Leuschner“ sowie durch die auf dem Gelände der <strong>EWN</strong> ansässigen Industriebetriebe<br />
<strong>und</strong> nachgeordnete Sek<strong>und</strong>ärwirkungen verursacht.<br />
Folgende maßgebliche Vorbelastungen haben Einfluss auf die Vorkommen von Lebensraumtypen<br />
nach Anhang I inklusive ihrer charakteristischen Arten sowie die Arten nach Anhang II der<br />
FFH-RL:<br />
Marine Lebensräume <strong>und</strong> Arten des Schutzgebietes (Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Spandowerhagener<br />
Wiek)<br />
� Nähr- <strong>und</strong> Schadstoffeintrag (überwiegend aus der Landwirtschaft)<br />
Auf Gr<strong>und</strong> anthropogener Nährstoffeinträge (vor allem Stickstoff <strong>und</strong> Phosphor) weisen Wasser,<br />
Sediment <strong>und</strong> Organismen der mit dem Oderhaff in Verbindung stehenden Gewässer wie der<br />
Peenestrom <strong>und</strong> darüber hinaus der Greifswalder Bodden deutliche Vorbelastungen auf. Der<br />
nördliche Peenestrom wird als stark eutroph <strong>und</strong> der Greifswalder Bodden als durchschnittlich<br />
eutroph beurteilt. Trotz deutlicher Reduzierung der Gesamtnährstoffemissionen sind die Küstengewässer<br />
auf einem sehr hohen Trophieniveau, das wesentlich vom natürlichen Zustand<br />
abweicht.<br />
Die zusätzliche anthropogene Eutrophierung war frühzeitig mit einem Verlust der Diatomeendominanz<br />
verb<strong>und</strong>en, die für natürliche Boddengewässer typisch wäre. Diese wurde durch eine<br />
Grünalgen-/Cyanobakterien-Dominanz abgelöst, wodurch eine Verschlechterung der Nahrungsqualität<br />
des Zooplanktons stattgef<strong>und</strong>en hat (SCHIEWER 2001). Organisches Material wurde<br />
zudem in den Sedimentationszonen angereichert, so dass Sauerstoffmangelsituationen begünstigt<br />
werden. Die Eutrophierung führte zu einer Verschlechterung der Sedimentqualität <strong>und</strong><br />
nachfolgend zu einer Artenverarmung des Zoobenthos.<br />
Durch das Überangebot von Nährstoffen kam es zu einer Zunahme der Primärproduktion. Die<br />
hohe Primärproduktion <strong>und</strong> die damit einhergehende Verschlechterung des Lichtklimas waren<br />
Ursache des Rückgangs submerser Pflanzenbestände <strong>und</strong> damit auch des Rückgangs der<br />
Phytalfauna (IFAÖ 2007E). Für den Greifswalder Bodden wird angenommen, dass im Laufe der<br />
Jahre ein Wandel des Ökosystems eingetreten ist, das sich von einem von Makrophyten domi-
FROELICH & SPORBECK Seite 105<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
nierten hin zu einem von Phytoplankton dominierten System entwickelt hat. Trotz deutlicher<br />
Reduzierung der Nährstoffeinträge spätestens seit Anfang der 1990er Jahre blieb die Sichttiefe<br />
gering, <strong>und</strong> eine Regeneration der Makrophytenbestände setzte nicht ein. Dieses Verharren<br />
des Greifswalder Boddens im Zustand eines von Phytoplankton dominierten Systems kann<br />
anhand des “ecosystem shift” Modells von SCHEFFER et al. (1993) beschrieben werden. Das<br />
Modell erklärt den plötzlichen Wechsel eines Ökosystems hin zu einem alternativen stabilen<br />
Zustand bei Erreichen eines kritischen Schwellenwertes der Eutrophierung. Die Prozesse des<br />
„ecosystem shifts“ sind ab einem gewissen Punkt selbst verstärkend <strong>und</strong> führen zu einer Ver-<br />
festigung des neuen Zustandes (MUNKES 2005).<br />
Ein weiterer Gr<strong>und</strong>, der die Verbesserung der Lichtverhältnisse verhindert, ist die mangelnde<br />
Interzeption von schwebenden Trübstoffen bzw. aufgewirbeltem Sediment durch das Phytoplankton.<br />
Dichte Makrophytenbestände dagegen sind in der Lage, strömungs- <strong>und</strong> windinduzierte<br />
sowie durch Schiffverkehr hervorgerufene Suspensionen zu reduzieren. Sie stellen eine<br />
Art Sedimentfalle dar (MUNKES 2005).<br />
Folglich wird der aktuelle Systemzustand des Greifswalder Boddens, der durch Dominanz des<br />
Phytoplanktons <strong>und</strong> starke Trübung charakterisiert ist, durch den geringen Makrophytenbestand<br />
begünstigt. Die Eigenschaften des Planktonsystems stehen wiederum einer Regeneration der<br />
Makrophytenbestände entgegen. Eine Umkehr der Verhältnisse ist nach MUNKES (2005) nicht<br />
zu erwarten. Auch nach Ansicht des LUNG M-V (2008B) wird es äußerst schwierig werden, die<br />
Lichtverhältnisse im Greifswalder Bodden zu verbessern, da diese neben der Beeinflussung<br />
durch das Phytoplankton gegenwärtig auch maßgeblich von den Windverhältnissen gesteuert<br />
werden. Zwischen Schwebstoffgehalt <strong>und</strong> Sichttiefe konnte für die meisten flachen Boddengewässer,<br />
so auch für den Greifswalder Bodden, ein hochsignifikanter Zusammenhang nachgewiesen<br />
werden (BACHOR 2005).<br />
Auch in der Spandowerhagener Wiek führt die hohe Primärproduktion durch die Verschlechterung<br />
des Lichtklimas zum Rückgang der submersen Pflanzenbestände. Das Ausmaß des trophiebedingten<br />
Rückgangs ist jedoch wegen fehlender Daten nicht zu bestimmen (IFAÖ 2007E).<br />
Die Spandowerhagener Wiek zeichnet sich derzeit „durch sehr geringen Makrophytenbewuchs<br />
aus“ (KÜSTER 1997).<br />
Bei einigen Fischarten wie beispielsweise Zander (Sander lucioperca) <strong>und</strong> Weißfischarten führt<br />
die Eutrophierung <strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene hohe Primärproduktion zu Bestandszuwächsen<br />
(vgl. WINKLER 1989).<br />
Nach DUFFEK, SCHLUNGBAUM & BACHOR (2001) gehört der Greifswalder Bodden hinsichtlich der<br />
Schadstoffe zu den kaum belasteten Küstengewässern. Kontaminationen von Organismen sind<br />
nach SCHLUNGBAUM, KWIATKOWSKI & KRECH (2001) ohne Bedeutung. Allerdings deuten Konzentrationserhöhungen<br />
auf verstärkte Abspülungen <strong>und</strong> Einträge von Schadstoffen aus dem<br />
Odereinzugsgebiet bei Hochwasserereignissen hin. Im Hinblick auf die Spurenmetalle kam es<br />
beim Oderhochwasser von 1997 zur kurzzeitigen Erhöhung von Blei, Cadmium <strong>und</strong> Quecksilber.<br />
Bei den Pestiziden wurden erhöhte Werte für Atrazin, Simazin <strong>und</strong> 2,4-D nachgewiesen.<br />
� Kühlwassernutzung durch das <strong>GuD</strong> II (Kühlwassereinleitung <strong>und</strong> -entnahme)
FROELICH & SPORBECK Seite 106<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Genehmigungssituation am Standort wird das derzeit noch nicht errichtete <strong>GuD</strong> II<br />
EnBW als Vorbelastung berücksichtigt. Die nachfolgenden Ausführungen zur Vorbelastung<br />
beziehen sich auf die bisherige, unveröffentlichte Auswirkungsprognose der FFH-VU zum Vorhaben<br />
von FROELICH & SPORBECK (in Bearb.). Bei dieser Prognose wird neben dem Vorhaben<br />
„<strong>GuD</strong> II“ auch das Projekt „Gasspeicher Moeckow“ des Vorhabenträgers EWE mit einbezogen,<br />
das die Ausspülung eines Salzstockes in Moeckow <strong>und</strong> die Soleeinleitung in den Greifswalder<br />
Bodden am Standort <strong>Lubmin</strong> vorsieht.<br />
Ebenso wie beim <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> resultieren aus der Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> der anschließenden<br />
Einleitung des erwärmten Abwassers über den Industriehafen <strong>Lubmin</strong> in den Greifswalder Bodden<br />
unmittelbare <strong>und</strong> mittelbare Auswirkungen durch das Verdriftungs- <strong>und</strong> Wärmeabbauverhalten<br />
der Kühlwasserfahne. Für das Vorhaben <strong>GuD</strong> II ist eine maximale Kühlwasserentnahme<br />
aus der Spandowerhagener Wiek von 105.000 m³/h <strong>und</strong> dessen anschließende Erwärmung um<br />
bis zu 7 K vorgesehen. Auf Gr<strong>und</strong> der Komplexität des Zusammenwirkens der betrachteten<br />
Faktoren Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffversorgung <strong>und</strong> Nährstoffeintrag sowie der unterschiedlichen<br />
Toleranzen von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten <strong>und</strong> -gemeinschaften ist es schwierig genaue<br />
numerisch fassbare Grenzen für gravierende Beeinträchtigungen durch Systemeffekte zu<br />
benennen (vgl. IOW 2008B). Insgesamt können erhebliche Beeinträchtigungen von Lebensräumen<br />
inklusive ihrer charakteristischen Arten der Lebensraumtypen 1110, 1130 <strong>und</strong> 1160 im<br />
Bereich der Kühlwasserfahne nicht ausgeschlossen werden, da die vorhabensbedingten Wirkungen<br />
(insbesondere durch Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen induzierte Prozesse) zu<br />
einem graduellen Funktionsverlust der Lebensräume führen können, durch die es zu einer Verschlechterung<br />
des guten Erhaltungszustandes kommen kann. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen<br />
Fischschutzmaßnahmen, die gewährleisten, dass sich die Verluste von Fischen auf<br />
ein Minimum reduzieren, werden die potenziellen Beeinträchtigungen des LRT 1140 (Ästuarien)<br />
als nicht erheblich eingestuft. Da die zu erwartenden Auswirkungen nicht genau vorhersehbar<br />
sind <strong>und</strong> zudem räumlich <strong>und</strong> zeitlich sehr variabel sein können, bleibt der derzeitige Zustand<br />
mariner FFH-Lebensräume inklusive ihrer charakteristischen Arten auch unter Einfluss der Vorbelastung<br />
durch das <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II (EnBW) die Ausgangsbasis der nachfolgenden Auswirkungsprognose.<br />
Die Auswirkungen der beiden <strong>GuD</strong>s durch Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung sind zudem aufgr<strong>und</strong> derselben Entnahme- <strong>und</strong> Einleitpunkte nicht klar voneinander<br />
abzugrenzen.<br />
� Anthropogene Überprägung <strong>und</strong> Störung des Lebensraums Ästuar durch die Einlaufrinne<br />
in der Spandowerhagener Wiek sowie durch sporadische Instandhaltungsmaßnahmen<br />
der Einlaufrinne<br />
Im Jahr 1971 wurde für den Betrieb des ehemaligen KKW in der Spandowerhagener Wiek die<br />
so genannte Einlaufrinne zwischen dem künstlich angelegten Einlaufkanal <strong>und</strong> dem Fahrwasser<br />
am Peenestrom mit einer Länge von 3,0 km angelegt.<br />
Die Breite der Einlaufrinne beträgt 200 m mit einer Aufweitung bis auf 240 m ab ca. Bau-km 0,7<br />
<strong>und</strong> einer Tiefe von anfangs 5 m <strong>und</strong> 4 m ab Bau-km 0,8. Die Einlaufrinne besitzt die Form eines<br />
Anstromtrichters mit Querschnitten zwischen 829 <strong>und</strong> 925 m 2 . Die Einlaufrinne umfasst<br />
eine Fläche von ca. 69 ha unter Berücksichtigung folgender Genehmigungsparameter von<br />
1971: km 0,0-0,7: Breite 200 m; km 0,7-0,8: Aufweitung von 200 auf 240 m (im Mittel 220 m);<br />
km 0,8-3,0: Breite 240 m.
FROELICH & SPORBECK Seite 107<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Da die Einlaufrinne als „Sedimentfalle“ wirkt, sammeln sich in ihr sukzessiv nicht befestigte Sedimente<br />
an. Zur Aufrechterhaltung der Funktion der Einlaufrinne sind im Rahmen von Bestandserhaltungsmaßnahmen<br />
Sedimententnahmen erforderlich.<br />
Für den Betrieb der Einlaufrinne incl. Instandhaltung liegen der <strong>EWN</strong> eine aktuelle wasserrechtliche<br />
Erlaubnis im Zusammenhang mit der Kühlwasserentnahme- <strong>und</strong> -einleitung vom LUNG M-<br />
V aus dem Jahr 2009 sowie eine wasserrechtliche Zustimmung für die Errichtung/Veränderung<br />
<strong>und</strong> Instandhaltung der baulichen Anlagen (Ein- u. Auslaufkanal, Ein- <strong>und</strong> Auslaufrinne usw.)<br />
vom 27.06.1969 vor. In beiden Bescheiden ist die <strong>EWN</strong> beauflagt worden, die baulichen Anlagen<br />
in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten <strong>und</strong> deren Funktionssicherheit zu gewährleisten.<br />
Die Einlaufrinne ist eine eigenständige Infrastruktur des Industriestandortes <strong>Lubmin</strong>, ihre<br />
Instandhaltung stellt somit keinen Teil des untersuchten Vorhabens <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> dar.<br />
Der <strong>EWN</strong> liegt somit eine Genehmigung für Bestandserhaltungsmaßnahmen der Einlaufrinne<br />
vor. Die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt zeitlich variabel in Abhängigkeit<br />
vom Zustand der Einlaufrinne.<br />
Demzufolge sind sowohl die Einlaufrinne selbst als auch die wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen<br />
als Vorbelastung anzusehen. Es erfolgt somit im Rahmen der FFH-<br />
Verträglichkeitsprüfung keine Betrachtung von Summationseffekten.<br />
� Störungen durch Tourismus <strong>und</strong> Freizeitnutzung<br />
Der dem Strand von <strong>Lubmin</strong> vorgelagerte Boddenabschnitt innerhalb des FFH-Gebietes ist<br />
touristisch stark frequentiert, so dass er im Sommerhalbjahr für störungsempfindliche Wasservögel<br />
ohne Bedeutung ist. Im Sommerhalbjahr ist eine hohe Störungsintensität durch Freizeitboote<br />
<strong>und</strong> Yachten festzustellen, da die Boote aufgr<strong>und</strong> ihres geringen Tiefganges nicht an<br />
vorhandene Fahrwasser geb<strong>und</strong>en sind. Zwischen Naturschutzverbänden, Wassersportlern <strong>und</strong><br />
Anglern wurden für die sensiblen <strong>und</strong> ökologisch bedeutsamen Gewässerbereiche Peenemünder<br />
Haken, Struck, Ruden, Freesendorfer Haken <strong>und</strong> Knaakrücken freiwillige Vereinbarungen<br />
getroffen (WWF DEUTSCHLAND 2005), so dass Störungen empfindlicher Wasservogelarten sowie<br />
perspektivisch Meeressäuger reduziert werden konnten.<br />
� Fahrwasser als Zufahrt zum Industriehafen<br />
Hierbei handelt es sich um eine bis zur 7 m-Isobathe vertiefte Zufahrt zum Industriehafen <strong>Lubmin</strong>,<br />
die regelmäßigen Unterhaltungsbaggerungen unterliegt. Die Vertiefung verb<strong>und</strong>en mit<br />
regelmäßigem Schiffsverkehr sowie Unterhaltungsbaggerungen führten im Fahrwasser zu einem<br />
dauerhaften Verlust der submersen Vegetation als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage für herbivore <strong>und</strong><br />
omnivore Wasservögel, zu einer Beeinträchtigung des Makrozoobenthos als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage<br />
für benthophage Wasservögel <strong>und</strong> zu direkten Störungen von Wasservögeln.<br />
� Störungen durch vorhandene Fahrrinnen <strong>und</strong> die Vertiefung Peenefahrwasser<br />
Die Vertiefung des Peenefahrwassers führt zu einem erhöhten Wasseraustausch zwischen<br />
Spandowerhagener Wiek bzw. nördlichem Peenestrom mit dem Greifswalder Bodden <strong>und</strong> mit<br />
der Ostsee. Die Folgen sind der Anstieg des mittleren Salzgehaltes <strong>und</strong>, ökologisch wichtiger,<br />
extremer Salzgehaltsereignisse. Für die submerse Vegetation, das Phytoplankton sowie das
FROELICH & SPORBECK Seite 108<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Makrozoobenthos ergibt sich daraus eine Verschiebung zugunsten marin-euryhaliner Arten <strong>und</strong><br />
Brackwasserarten, jedoch keine Veränderung der Artenzusammensetzung. Die bisherigen<br />
Auswirkungen sind für die Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> den nördlichen Peenestrom als gering<br />
einzustufen, da die Salzgehaltsdifferenz zwischen Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Spandowerhagener<br />
Wiek verhältnismäßig gering <strong>und</strong> die natürliche Variabilität sehr hoch ist (IFAÖ 2007E). Damit<br />
ist auch keine erhebliche Einschränkung der Nahrungsverfügbarkeit für Wasser- <strong>und</strong> Watvögel<br />
gegeben.<br />
Die Peenefahrrinne selbst ist auf -7,5 m NN vertieft <strong>und</strong> stellt daher keinen Lebensraum für<br />
Makrophyten dar. Auf Gr<strong>und</strong> regelmäßiger Unterhaltungsmaßnahmen <strong>und</strong> des Schiffsverkehrs<br />
ist das ökologische Potenzial des Fahrwassers sehr gering. Gleiches gilt für die Tonnenbankrinne,<br />
welche mit -6,5 m NN das Peenefahrwasser mit dem Osttief verbindet, sowie für die<br />
Knaakrückenrinne <strong>und</strong> die Einlaufrinne in den Einlaufkanal. Auch diese sind makrophytenfrei<br />
<strong>und</strong> teilweise als Falle für Driftalgen am Boden mit abgestorbenem Pflanzenmaterial bedeckt<br />
(vgl. IFAÖ 2007I).<br />
� Änderung küstendynamischer Prozesse<br />
Das Molenbauwerk des Industriehafens ist ca. 700 m in den Flachwasserbereich des Greifswalder<br />
Boddens vorgebaut, so dass die natürlichen geomorphodynamischen Prozesse in diesem<br />
Schorrebereich vollständig unterb<strong>und</strong>en sind <strong>und</strong> beidseitig des Molenbauwerks Sedimentanlagerungen<br />
stattfinden. Insgesamt kommt es zu einer Reduktion von Sedimentablagerungen<br />
im Windwattareal vor dem Struck, die von sehr hoher Bedeutung als Nahrungsgebiet beispielsweise<br />
für Limikolen sind. Ebenso ist ein sukzessiver Küstenrückgang im Bereich der Landschwelle<br />
zwischen Freesendorfer See <strong>und</strong> Greifswalder Bodden festzustellen. Sich dadurch<br />
verändernde Substrateigenschaften haben Einfluss auf die benthischen Pflanzengesellschaften.<br />
� Invasive Neophyten <strong>und</strong> Neozoen<br />
Die aus dem Nordatlantik stammende Braunalge Fucus evanescens wurde erstmals 1924 in der<br />
Ostsee nachgewiesen <strong>und</strong> gilt seitdem als etabliert (JANSSON 1994, zit. in SAGERT et al. 2008).<br />
Gleiches gilt für die Rotalge Dasya baillouviana, die nach NIELSEN et al. (1995, zit. in SCHORIES<br />
& SELIG 2006) durch Schiffsverkehr um 1940 in die deutsche Ostsee eingeschleppt wurde <strong>und</strong><br />
im Pazifik beheimatet ist. Inwieweit beide Arten in den Greifswalder Bodden vorgedrungen sind,<br />
ist nicht beschrieben. Auf Gr<strong>und</strong> der Habitatansprüche der Arten (z. B. keine Reproduktion von<br />
F. evanscens bei unter 10 PSU, WIKSTRÖM 2002) wird der niedrige Salzgehalt des Boddens<br />
jedoch als Hindernis für eine erfolgreiche Etablierung angesehen.<br />
Im Gegensatz dazu ist die aus dem asiatischen Raum stammende Rotalge Gracilaria vermiculophylla<br />
sehr gut an Brackwasserverhältnisse angepasst. In der Ostsee wurde sie 2005 das<br />
erste Mal nachgewiesen, <strong>und</strong> breitet sich seit dem ostwärts aus (SCHORIES & SELIG 2006). Problematisch<br />
wird von den Autoren die Fähigkeit zur Massenvermehrung gesehen, mit der sie derzeit<br />
in der Kieler Bucht bereits Seegrasbestände stark negativ beeinflusst werden.<br />
Das Makrozoobenthos des Greifswalder Boddens wird heute durch einen hohen <strong>und</strong> sukzessiv<br />
zunehmenden Anteil invasiver Neozoen gekennzeichnet, die vermutlich mit Ballastwasser eingeschleppt<br />
wurden. Beispielhaft sind der Polychaet Marenzelleria viridis, der Tigerflohkrebs<br />
(Gammarus tigrinus), die Neuseeländische Deckelschnecke (Potamopyrgus antipodarum) <strong>und</strong>
FROELICH & SPORBECK Seite 109<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
die Dreikantmuschel (Dreissena polymorpha) genannt. Einige Arten wie der Tigerflohkrebs sind<br />
in der Lage, einheimische Arten zu verdrängen.<br />
Die Rippenqualle (Mnemiopsis leidyi) wurde erstmalig im Juni 2006 in der westlichen Ostsee<br />
nachgewiesen. Sie wurde auch im Hafenwasser von Strals<strong>und</strong> festgestellt. Die Rippenqualle<br />
tritt gegenwärtig in Flachwasserzonen nur in einer sehr geringen Dichte auf. In flacheren Küstenbereichen<br />
war die Ab<strong>und</strong>anz von Mnemiopsis leidyi im Winterhalbjahr mit weniger als<br />
4 Ind./m³ (Hafen von Kühlungsborn) generell sehr gering. Im Februar sank die Populationsdichte<br />
bis auf weniger als 1 Ind./m³ <strong>und</strong> verblieb bis Mai auf niedrigem Niveau. Die Populationsdichte<br />
in der Pommerschen Bucht lag im Dezember 2006 bei 0,2 Ind./m³ (KUBE et al. 2007). Aufgr<strong>und</strong><br />
der geringen Nachweise ergeben sich keine Hinweise auf eine Vorbelastung durch das<br />
bisherige Auftreten dieser Neozoen.<br />
� Verlegung der Nord Stream-Pipeline<br />
Von der Nord Stream AG wurde die Verlegung einer Erdgas-Pipeline mit 2 parallelen Leitungssträngen<br />
von Russland nach Deutschland durch die Ostsee fertiggestellt [Stand April 2012]. Die<br />
Leitungen wurden im S-Lay-Verfahren in offener Bauweise in einem gebaggerten Graben am<br />
Meeresboden aufgebracht <strong>und</strong> die Pipeline im Greifswalder Bodden am Standort <strong>Lubmin</strong> angelandet.<br />
Mit der Verlegung der Pipeline sind Bestandsverluste von Biotopen verb<strong>und</strong>en, die zwar kleinflächig<br />
sind, jedoch von hoher Intensität <strong>und</strong> mittelfristiger Wirkdauer eingestuft wurden (vgl.<br />
IFAÖ 2009C). Es wird jedoch von einer Regenerationsfähigkeit innerhalb von 3 Jahren nach<br />
Abschluss der Bauarbeiten ausgegangen. Wesentlich langsamer verläuft die Wiederherstellung<br />
der natürlichen Altersstruktur der beeinträchtigten Teilpopulationen der Makrozoobenthosfauna.<br />
Anfänglich werden ältere Individuen fehlen, erst nach 10 Jahren rechnen die Gutachter mit einer<br />
vollständigen Regeneration. Nicht nur während der Bauphase, auch bei Instandhaltungsmaßnahmen<br />
besteht in Bereichen mit schluffigem Sediment oder Sedimenten mit hohem organischen<br />
Anteil (wie in den Flachwasserzonen vor <strong>Lubmin</strong>) die Gefahr von<br />
Sedimentaufwirbelungen, die mit Trübungsfahnen die Lichtverfügbarkeit für Makrophyten verringern.<br />
Verminderungsmaßnahmen reduzieren diese Auswirkungen auf ein kurzfristiges <strong>und</strong><br />
geringes Minimum. Anlagebedingt stellen die Rohrleitungen das Einbringen von Hartsubstrat<br />
dar, welche die Ansiedlung von Makrophyten begünstigen können (vgl. ebd.).<br />
Mit der Überlagerung der Regenerationsprozesse durch die Projektwirkungen des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong><br />
<strong>III</strong> ist nicht zu rechnen, da zum Zeitpunkt der Umsetzung des Projektes (voraussichtlich<br />
2013) die Regeneration der Makrophytenbestände unter den begrenzenden Bedingungen der<br />
weiteren Vorbelastungen vollständig abgeschlossen sein müsste.<br />
� Ausrottung/Dezimierung typischer Tierarten durch Verfolgung <strong>und</strong> Lebensraumzerstörung<br />
Die Ostseepopulation der Kegelrobbe (Halichoerus grypus) ist im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert in Folge sehr<br />
starker Bejagung zusammengebrochen (ABT 2004). Vor 1914 konnten noch regelmäßig Massenansammlungen<br />
der Art auf den Felsen des Großen Stubber im Greifswalder Bodden beobachtet<br />
werden (HARDER & SCHULZE 1989). Auch der Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) wurde in den<br />
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts durch die intensive Verfolgung an der deutschen Ost-
FROELICH & SPORBECK Seite 110<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
seeküste weitgehend ausgerottet. Wie häufig diese Art vorher war, ist heute kaum einzuschätzen<br />
(vgl. ebd.).<br />
Der Peenestrom ist ein Wanderungsgewässer für diadrome Wanderfischarten, die zum Laichen<br />
ihre Gewässer wechseln. Mit Stör (Acipenser oxyrinchus) <strong>und</strong> Finte (Alosa fallax) sind zwei<br />
typische anadrome Arten in den letzten Jahrzehnten ausgestorben oder verschollen. Als Ursachen<br />
werden für den Stör Flussverbauungen, Störfischerei <strong>und</strong> Schleppnetzfang sowie die drastische<br />
Abnahme der Reproduktionseffizienz in Folge Wasserverschmutzung <strong>und</strong> eingeschränkter<br />
Fließgewässerdynamik angenommen (GEßNER 2004). Ursache des Aussterbens der Finte<br />
war möglicherweise die zunehmende Gewässerverschmutzung, da die Art auf Gewässerverschmutzungen<br />
sehr empfindlich reagiert (vgl. STEINMANN & BLESS 2004B).<br />
In Gebieten mit einer räumlichen Überlappung von Vogelvorkommen mit Stellnetzfischerei<br />
kommt es nachweislich zu hohen Verlusten durch Ertrinken (ERDMANN 2006). Eisenten (Clangula<br />
hyemalis), Trauerenten (Melanitta nigra) <strong>und</strong> Bergenten (Aythya marila), die ihre Nahrung<br />
(Benthos <strong>und</strong> Laich) ausschließlich tauchend erbeuten sind besonders anfällig dafür sich in<br />
Stellnetzen zu verfangen (VAN EERDEN et al. 1999, DAGYS & ZYDELIS 2002). Fisch fressende<br />
Arten, wie z. B. Säger (Mergellus spec.), gehören ebenfalls überdurchschnittlich häufig zu den<br />
Opfern. Die am häufigsten betroffene Art ist die Eisente (zwischen 48 <strong>und</strong> 74 % in der Literatur).<br />
Empirisch wurden teilweise 0,37 tote Eisenten pro 1000 Netzmeter <strong>und</strong> Tag an der Litauischen<br />
Küste ermittelt (DAGYS & ZYDELIS 2002). Bei ausgebrachten 350.000 NMD (net meter per day)<br />
<strong>und</strong> einem mittleren Winterbestand von 3.400 Individuen in dem untersuchten Gebiet ist die<br />
Situation mit dem Greifswalder Bodden durchaus vergleichbar. Beim Übertragen der empirisch<br />
ermittelten Quote von DAGYS & ZYDELIS (2002) auf den Greifswalder Bodden müsste von einer<br />
Sterblichkeitsrate von ca. 130 Eisenten pro Tag ausgegangen werden.<br />
Terrestrische Lebensräume <strong>und</strong> Arten des Schutzgebietes<br />
� Nährstoffeinträge<br />
In Folge von bodenchemischen Prozessen in Reaktion auf anthropogene eutrophierende<br />
<strong>und</strong>/oder versauernde Stoffeinträge wurde das Nährstoffverhältnis in einem großen Teil der<br />
mitteleuropäischen Vegetationsstandorte im Vergleich zum Zeitraum vor etwa 1960 verändert.<br />
Wenn an Standorten aufgr<strong>und</strong> von N-Depositionen weder Stickstoff noch Nährstoffkationen in<br />
der Bodenlösung limitiert sind, können die Pflanzen ihr physiologisch determiniertes Wachstumspotenzial<br />
voll ausschöpfen. Es kann dadurch zu Verschiebungen im Deckungsgrad einzelner<br />
Arten zugunsten konkurrenzstärkerer Arten kommen. Die Folge war in den letzten Jahrzehnten<br />
häufig die Abnahme der Vitalität <strong>und</strong> der ökosystemaren Funktionstüchtigkeit zunächst<br />
einzelner Individuen bis hin zum Absterben der Population <strong>und</strong> letztendlich bis zum Verlust der<br />
über Jahrh<strong>und</strong>erte entwickelten natürlichen Pflanzengesellschaft am Standort. Übrig blieben<br />
polyöke Arten (in Fragmentgesellschaften), so dass Derivatgesellschaften entstanden.<br />
ÖKO-DATA (2011) ermittelte für verschiedene Pflanzengemeinschaften im FFH-Gebiet „Greifswalder<br />
Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ Critical Loads für eutrophierende<br />
Stickstoffeinträge (CLnutN) <strong>und</strong> für versauernde Schwefel- <strong>und</strong> Stickstoffeinträge<br />
CL (S+N). Dabei wurde festgestellt, dass bei Waldgesellschaften der Lebensraumtypen 2180,<br />
9110 <strong>und</strong> 9190 (Bewaldete Küstendünen, Hainsimsen-Buchenwälder, bodensaure Eichenwäl-
FROELICH & SPORBECK Seite 111<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
der) die CL bereits überwiegend durch die vorhandene atmosphärische Hintergr<strong>und</strong>belastung<br />
an eutrophierenden Einträgen deutlich überschritten wird. Auf Gr<strong>und</strong> dieser Vorbelastung sind<br />
insbesondere durch die lang andauernden <strong>und</strong> hohen Überschreitungen der Critical Loads in<br />
diesen Lebensraumtypen bereits Nährstoffungleichgewichte zu erwarten, so dass damit einerseits<br />
eine besondere Empfindlichkeit dieser Lebensraumtypen besteht, andererseits bereits<br />
eine gewisse Anpassung der Vegetation an die geänderten abiotischen Verhältnisse erfolgt ist.<br />
Die Eutrophierung geht häufig einher mit einer Verdichtung der Strauchschicht. Zahlreiche Kiefernbestände<br />
werden heute durch die dort eingedrungene Späte Traubenkirsche (Prunus serotina)<br />
geprägt. Ursprünglich vorhandene unterwuchsarme Kiefernwälder mit bestandsbildender<br />
Drahtschmiele (Avenella flexuosa) oder Blaubeere (Vaccinium myrtillus) sowie einige weiterer<br />
Arten der indigenen Vegetation natürlich auftretender Kiefern-Trockenwälder werden sukzessiv<br />
verdrängt.<br />
In der FFH-VU zum <strong>GuD</strong> II wird festgestellt, dass mit dem Betrieb des <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II zusätzliche<br />
Einträge von eutrophierenden <strong>und</strong> versauernden Depositionen verb<strong>und</strong>en sind, die jedoch<br />
allein betrachtet unterhalb von Irrelevanzschwellen liegen <strong>und</strong> damit nicht als erhebliche Beeinträchtigungen<br />
angesehen werden (FROELICH & SPORBECK in Bearb.).<br />
� Lebensraumverluste durch Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeansiedlungen<br />
Der Bau des Kernkraftwerks „Bruno Leuschner“ <strong>und</strong> des Einlaufkanals in den 60er <strong>und</strong> 70er<br />
Jahren des letzten Jahrh<strong>und</strong>erts sowie die Errichtung des Industriehafens „Synergiepark <strong>Lubmin</strong>er<br />
Heide“ <strong>und</strong> des „Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebietes <strong>Lubmin</strong>er Heide“ in den 2000er Jahren<br />
führten zu unmittelbaren Verlusten von Tierlebensräumen im Übergangsbereich zwischen der<br />
<strong>Lubmin</strong>er Heide <strong>und</strong> dem Gebiet Struck/Freesendorfer Wiesen. Diese Lebensraumverluste, die<br />
außerhalb des Schutzgebietes stattfanden, haben somit auch Auswirkungen auf das FFH-<br />
Gebiet.<br />
Anfang September 2009 wurden im Rahmen der geplanten Gasanlandestation, die im Nordosten<br />
an den Industriehafen angrenzt, umfangreiche Rodungen durchgeführt, die zu einem Verlust<br />
zahlreicher Brutreviere <strong>und</strong> Niststandorte von Vögeln führte. Unmittelbar betroffen waren<br />
u. a. Brutplätze des Mäusebussards <strong>und</strong> des Rotmilans sowie Reviere von Pirol <strong>und</strong> Schwarzspecht.<br />
Es ist davon auszugehen, dass der verbleibende Restwaldbestand nicht mehr als Brutgebiet<br />
vom Seeadler <strong>und</strong> Schwarzspecht angenommen wird. In den Randbereichen der Rodungsfläche<br />
<strong>und</strong> in der Anlandungszone der Ostseepipeline gingen zudem Waldränder,<br />
Brachen <strong>und</strong> Dünenlebensräume verloren, die einen Lebensraum u. a. für Reptilien darstellten.<br />
Die Baufeldfreimachung des <strong>GuD</strong> II führte auf einer Fläche von ca. 9,8 ha zu Lebensraumverlusten.<br />
Bei Fertigstellung des <strong>GuD</strong> II kommt es insgesamt zu Revierverlusten wertgebender<br />
Vogelarten wie Feldlerche, Heidelerche, Neuntöter, Schwarzkehlchen <strong>und</strong> Steinschmätzer. Die<br />
Mehrfachbeobachtung von Kreuzottern auf der ehemaligen Erdstoffdeponie im Bereich des<br />
<strong>GuD</strong> II-Baufeldes weist daraufhin, dass dieses Areal ein Schlüsselhabitat (Überwinterungsquartier,<br />
Frühjahrs- <strong>und</strong> Herbstsonnenplatz) von Kreuzottern darstellen kann. Bei Verlust eines solchen<br />
Schlüssellebensraumes sind Auswirkungen auf die Kreuzotter-Population in den verbleibenden<br />
Habitaten außerhalb des Baufeldes anzunehmen, zumal die Population aufgr<strong>und</strong> der<br />
räumlich limitierten Lebensräume individuenarm <strong>und</strong> somit sehr anfällig gegenüber Lebens-
FROELICH & SPORBECK Seite 112<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
raumverlusten ist <strong>und</strong> bereits durch die benachbarte Gasanlandestation als Lebensraum geeignete<br />
Waldränder <strong>und</strong> Brachen in Anspruch genommen wurden (FROELICH & SPORBECK 2009C).<br />
Im Jahr 2007 wurde die 1. Teilgenehmigung des <strong>GuD</strong> II mit der Rodung des vorhandenen<br />
Waldbestandes auf dem <strong>GuD</strong> II-Baugelände in Teilen umgesetzt. Hierdurch kam es zu einem<br />
Verlust von Waldlebensräumen. Zu Beginn des Jahres 2011 wurde die Baufeldfreimachung<br />
fortgeführt, im April 2011 wurde diese nun vollständig umgesetzte 1. Teilgenehmigung von den<br />
Fachbehörden abgenommen. Die in Folge der Weiterführung der Teilgenehmigung hervorgerufenen<br />
Auswirkungen des Jahres 2011 auf die Fauna sind derzeit noch nicht bekannt.<br />
� Graduelle Beeinträchtigungen durch Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeansiedlungen<br />
In Folge der Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeansiedlungen am Standort <strong>Lubmin</strong> kam es zu zusätzlichen<br />
Licht- Schall- <strong>und</strong> Schadstoffemissionen <strong>und</strong> hierdurch zu graduellen Beeinträchtigungen von<br />
Tierlebensräumen.<br />
Akustische Beeinträchtigungen sind insbesondere für Brutvögel durch die Maskierung von Gesängen<br />
<strong>und</strong> Kontaktlauten möglich. Für den B-Plan Nr. 1 sind die zulässigen Schallemissionen<br />
über einen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel definiert. Dieser bildete<br />
somit die Genehmigungsgr<strong>und</strong>lage für die bereits angesiedelten Unternehmen (z. B. Biodieselanlage,<br />
Ersatzwärmeerzeugungsanlage <strong>EWN</strong>, Korrosionsschutzbetrieb). Zusätzliche<br />
akustische Beeinträchtigungen sind durch die Gasanlandestation <strong>und</strong> das <strong>GuD</strong> II zu erwarten.<br />
Im Rahmen der FFH-VU für das Vogelschutzgebiet zum Vorhaben <strong>GuD</strong> II wird festgestellt, dass<br />
von den wertgebenden Vogelarten Feldlerche, Pirol (bau- <strong>und</strong> betriebsbedingt), Sandregenpfeifer<br />
<strong>und</strong> Wachtel (nur baubedingt) durch akustische Störungen des <strong>GuD</strong> II beeinträchtigt werden.<br />
Für weit verbreitete <strong>und</strong> nicht wertgebende Singvogelarten ergibt sich eine beeinträchtigte Fläche<br />
von ca. 9,6 ha, für die aufgr<strong>und</strong> betriebsbedingter akustischer Störungen (im Kontext mit<br />
visuellen Störungen) eine Abnahme der Habitatqualität erfolgt (FROELICH & SPORBECK in Bearb.).<br />
In Folge der Anlagenbeleuchtungen durch den gesamten Industrie- <strong>und</strong> Gewerbekomplex am<br />
Standort <strong>Lubmin</strong> sind für nachts flugaktive Zugvogelarten in Folge des Lichtkegels geringfügige<br />
lokale vertikale <strong>und</strong> horizontale Ausweichbewegungen zu erwarten.<br />
Die Lichtemissionen am Standort <strong>Lubmin</strong> können zu Beeinträchtigungen von Jagdhabitaten (im<br />
Falle der Mückenfledermaus möglicherweise) lichtempfindlicher Arten wie Braunes Langohr,<br />
Mückenfledermaus <strong>und</strong> Wasserfledermaus führen. Beeinträchtigungen von im Umfeld des Industrie-<br />
<strong>und</strong> Gewerbekomplex nachgewiesenen Fledermausarten durch eine Reduktion der<br />
Nahrungsressourcen (Insekten) sind ebenfalls nicht auszuschließen.<br />
Die Auswirkungen der Lichtemissionen auf nachtaktive Insekten werden für das <strong>GuD</strong> II im<br />
Rahmen der UVU beschrieben (FROELICH & SPORBECK in Bearb.). Demnach sind die negativen<br />
Auswirkungen auf angrenzende Lebensräume nordwestlich des Vorhabens begrenzt. Für<br />
nachtaktive Insekten des küstennahen Dünenzuges mit Vorkommen von Graudünen, die dem<br />
prioritären LRT 2130* zugeordnet werden können, ist von einer starken Betroffenheit durch die<br />
unmittelbar angrenzende, ebenfalls beleuchtete Gasanlandestation auszugehen. Eine darüber<br />
hinausgehende Anlockwirkung für nachtaktive Insekten des Dünenareals durch die Beleuchtung<br />
des <strong>GuD</strong> II-Gelände ist nicht anzunehmen (vgl. ebd.).
FROELICH & SPORBECK Seite 113<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Kollisionsrisiken mit Freileitungen <strong>und</strong> hoch aufragenden Bauwerken<br />
Potenzielle Kollisionsrisiken durch Leitungsanflug ergeben sich insbesondere für Vögel mit den<br />
verschiedenen, im Raum <strong>Lubmin</strong> vorhandenen Freileitungen.<br />
In den Freesendorfer Wiesen (Nähe Einlaufkanal) begann der Rückbau der ehemals zwischen<br />
Kernkraftwerk <strong>und</strong> Freiluftschaltanlage vorhandenen Freileitungen im Jahr 2004 <strong>und</strong> endete im<br />
Jahr 2005, so dass es für Vögel zu einer Reduktion des ehemals hier vorhandenen Kollisionsrisikos<br />
kam.<br />
An dieser Stelle sieht EnBW zur Ableitung des durch das <strong>GuD</strong> II gewonnenen Stroms eine neue<br />
380 kV-Freileitung vor. Kollisionsgefährdend sind besonders die Streckenabschnitte im Offenland<br />
<strong>und</strong> im Bereich des Einlaufkanals (zus. ca. 2.000 m). Im Ergebnis ergibt sich durch die<br />
geplante Freileitung ein erhöhtes Kollisionsrisiko für verschiedene Vogelarten, das durch Markierung<br />
der Erdseile mir Markern reduziert werden soll.<br />
Für die hohen Gebäudeteile des Industriekomplexes sind Kollisionen mit Vögeln, insbesondere<br />
Zugvögeln, denkbar, wie sie weltweit für verschiedene hoch aufragende Bauwerke (insbes.<br />
Brücken, Plattformen auf offener See, Leuchttürme, teilweise auch Hochhäuser) beschrieben<br />
wurden. Für die Schornsteine (n = 3, Bauhöhe jeweils 118,00 m) <strong>und</strong> Maschinenhäuser (n = 3,<br />
Bauhöhe jeweils 30,20 m) des <strong>GuD</strong> II wird im Rahmen der FFH-VU zum Vogelschutzgebiet das<br />
Kollisionsrisiko bewertet (FROELICH & SPORBECK in Bearb.). Die Gefährdung der überregional<br />
ziehenden Artbestände durch Kollision mit den Maschinenhäusern <strong>und</strong> den Schornsteinen ist<br />
demnach nach derzeitiger Analyse des Sachverhaltes bei Berücksichtigung eines Beleuchtungsmanagements<br />
(unterbrochene Lichterführung der Flugsicherungsleuchten mit kurzen An-<br />
<strong>und</strong> lang andauernden Ausphasen, Abschirmung des diffusen Lichtes vom Boden nach oben<br />
hin) gering. Analog hierzu liegen keine Informationen zu einem signifikanten Kollisionsrisikos<br />
durch das ehemalige KKW vor.<br />
� Nutzungsintensität<br />
Insbesondere für einige Vogelarten ist das Nutzungsregime der Salzwiesen im NSG<br />
„Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“ zu intensiv, so dass keine erfolgreichen Reproduktionen<br />
oder diese zu selten stattfinden (LUNG M-V 2003-07). Hieraus resultieren beständige<br />
Bestandsabnahmen bzw. es kam bereits zu Brutplatzaufgaben insbesondere von Limikolen. Im<br />
Naturschutzgebiet war das letzte regelmäßige Vorkommen des weltweit bedrohten Seggenrohrsängers<br />
im Land Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen. Aufgr<strong>und</strong> zu früher <strong>und</strong> unangepasster<br />
Beweidung wurde das Naturschutzgebiet als Brutplatz aufgegeben (EICHSTÄDT et al.<br />
2006, S. 337). Auch für die Artengruppe der Reptilien sowie verschiedene Insektengruppen<br />
konnten negative Auswirkungen des vorhandenen Beweidungsregimes festgestellt werden.<br />
Unbeweidete Flächen waren für Reptilien deutlich wertvoller als benachbarte beweidete Areale<br />
(FROELICH & SPORBECK 2009C). Für die Insektengruppen, die im Rahmen des Vorhabens <strong>GuD</strong> II<br />
im Naturschutzgebiet untersucht wurden (Tagfalter <strong>und</strong> Widderchen, Heuschrecken, Wildbienen,<br />
Wespen, Schwebfliegen), lässt sich auf den bewirtschafteten Untersuchungsflächen ein<br />
starker negativer Einfluss der Beweidung erkennen. Für Blüten besuchende Arten wirkt sich<br />
dieser über den Mangel an Nektar- <strong>und</strong> Pollenquellen aus, für Heuschrecken über die Strukturarmut<br />
des beweideten Graslands. Dementsprechend wird das Salzgrünland in seiner Bedeu-
FROELICH & SPORBECK Seite 114<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
tung für die untersuchten Gruppen als gering eingestuft. Borstgrasrasen <strong>und</strong> eine Pfeifengraswiese<br />
haben ebenfalls eine geringe bis mittlere Bedeutung für diese Tiergruppen (FROELICH &<br />
SPORBECK 2009D).<br />
� Barrierewirkung<br />
Der „Industriehafen <strong>Lubmin</strong>“, der Einlaufkanal <strong>und</strong> der Gebäudekomplex des ehemaligen Kernkraftwerks<br />
„Bruno Leuschner“ bilden eine künstliche Grenze im Untersuchungsraum zwischen<br />
den Freesendorfer Wiesen (innerhalb des FFH-Gebietes) <strong>und</strong> den Lebensräumen der <strong>Lubmin</strong>er<br />
Heide (außerhalb des Schutzgebietes). Eine Beeinträchtigung ergibt sich vor allem für bodenmobile<br />
Tiere wie Reptilien <strong>und</strong> Amphibien. So beschreiben I.L.N. GREIFSWALD (2000F) ein feuchtes<br />
Wiesenstück als potenziellen Kreuzotterlebensraum, der sich entlang eines Grabens durch<br />
die <strong>Lubmin</strong>er Heide zog <strong>und</strong> mit den Weideflächen auf den Freesendorfer Wiesen in Verbindung<br />
stand <strong>und</strong> durch den Bau des Kernkraftwerks „Bruno Leuschner“ verloren ging.
FROELICH & SPORBECK Seite 115<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5 Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen der Erhaltungs-<br />
ziele des Schutzgebietes<br />
5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode<br />
Ziel der FFH-Richtlinie ist nach Art. 2 die Wahrung des günstigen Erhaltungszustands der Arten<br />
<strong>und</strong> Lebensräume der Anhänge I <strong>und</strong> II. Laut Art. 6 Abs. 2 sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet,<br />
in den Schutzgebieten „die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume <strong>und</strong> der<br />
Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind,<br />
zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich<br />
auswirken könnten“.<br />
Ein günstiger Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums liegt gemäß Art. 1 Buchst. e)<br />
der FFH-Richtlinie vor, wenn<br />
� sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt,<br />
beständig sind oder sich ausdehnen <strong>und</strong><br />
� die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur <strong>und</strong> spezifischen Funktionen<br />
bestehen <strong>und</strong> in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen werden <strong>und</strong><br />
� der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Art. 1 Buchst. i)<br />
FFH-Richtlinie günstig ist.<br />
Ein günstiger Erhaltungszustand einer Art liegt gemäß Art. 1 Buchst. i) der FFH-Richtlinie dann<br />
vor, wenn<br />
� auf Gr<strong>und</strong> der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass diese Art<br />
ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet <strong>und</strong><br />
langfristig weiterhin bilden wird,<br />
� das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich<br />
abnehmen wird <strong>und</strong><br />
� ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist <strong>und</strong> wahrscheinlich weiterhin vorhanden<br />
sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern.<br />
Der günstige Erhaltungszustand wird anhand von Struktur- <strong>und</strong> Funktionsmerkmalen sowie<br />
anhand der Wahrung der Wiederherstellungsmöglichkeiten definiert. Den genannten Zielen<br />
entsprechend ist die Verträglichkeit eines Vorhabens an der Wahrung des definierten günstigen<br />
Erhaltungszustandes zu prüfen.<br />
Im Folgenden werden zur Abschätzung der Erheblichkeit die Konflikte bzgl. der vorkommenden<br />
Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten der FFH-Anhänge, die durch das Vorhaben selbst ausgelöst werden,<br />
beschrieben <strong>und</strong> bewertet sowie deren Erheblichkeit abgeleitet. Berücksichtigung finden<br />
dabei die im Rahmen der Projektoptimierung zur Minderung oder Vermeidung von Beeinträchti-<br />
gungen der Erhaltungsziele entwickelten Maßnahmen, die jetzt projektimmanent sind.<br />
Der Kernbegriff „Stabilität des Erhaltungszustandes“ wird zur Bewertung der Erheblichkeit herangezogen.<br />
Die FFH-Richtlinie zieht zur Definition des Erhaltungszustandes (vgl. oben) sowohl<br />
quantitative Kriterien (Flächen- <strong>und</strong> Populationsgrößen) als auch qualitative Merkmale (Struk-
FROELICH & SPORBECK Seite 116<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
tureigenschaften) <strong>und</strong> funktionale Aspekte heran. Das Entwicklungs-Potenzial (Zunahme der<br />
Ausdehnung von Lebensräumen <strong>und</strong> der Populationen von Arten, Verbesserung ihres Erhal-<br />
tungszustandes) ist ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. Art. 2 Abs. 2 FFH-Richtlinie).<br />
Als wertgebend werden gemäß Standard-Datenbogen folgende Kriteriengruppen betrachtet:<br />
Erhaltungsgrad der Struktur (ökologische Parameter, Art- <strong>und</strong> Lebensraumbestand), Erhaltungsgrad<br />
der Funktionen (Faktorengefüge, das für die Selbsterhaltung der Art oder des Lebensraums<br />
im Schutzgebiet sorgt), Wiederherstellungsmöglichkeiten (notwendiger Aufwand zur<br />
Erhaltung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes).<br />
Da Beeinträchtigungen von einzelnen Arten <strong>und</strong> Lebensräumen zu prüfen sind, werden die<br />
Auswirkungen in Abhängigkeit von den spezifischen Eigenschaften der Erhaltungsziele <strong>und</strong> vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> der im Gebiet herrschenden Umweltbedingungen/ Vorbelastungen bewertet.<br />
Das Natura 2000-Gebiet wird als Bezugsraum der Bewertung zugr<strong>und</strong>e gelegt.<br />
Mit einer erheblichen Beeinträchtigung sind Veränderungen verb<strong>und</strong>en, die – nach wissenschaftlichen<br />
Kriterien beurteilt – den langfristig günstigen Erhaltungszustand des untersuchten<br />
Lebensraums oder der untersuchten Art gefährden. Eine „Betroffenheit“ von prioritären Lebensräumen<br />
oder Arten gemäß § 34 Abs. 4 BNatSchG wird dann gesehen, wenn eine erhebliche<br />
Beeinträchtigung dieser Bestandteile des Schutzgebietes vorliegt (vgl. KOHLS 2011). Dies ist nur<br />
dann zu befürchten, wenn sie vorhabensbedingt eine nachhaltige Funktionseinbuße bzw. eine<br />
Verschlechterung des Erhaltungszustands erleiden.<br />
Da die Definition des günstigen Erhaltungszustands eines Lebensraums u. a. darauf abstellt,<br />
dass das natürliche Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt,<br />
beständig sind oder sich ausdehnen, wird von verschiedenen Autoren jede dauerhafte Flächeninanspruchnahme<br />
in nach den Erhaltungszielen eines FFH-Gebietes geschützten Lebensraumtypen<br />
(LRT) als erheblich <strong>und</strong> als nicht verträglich mit den Erhaltungszielen eines FFH-Gebietes<br />
gewertet (vgl. BAUMANN et al. (1999), HALAMA (2001), GELLERMANN (2001) oder KOKOTT (2004)).<br />
Lediglich Flächenverluste, die als Bagatelle betrachtet werden können, da sie für den günstigen<br />
Erhaltungszustand eines Lebensraumes im FFH-Gebiet insgesamt nicht entscheidend sind,<br />
können unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgr<strong>und</strong>satzes ausnahmsweise als unerheblich<br />
bewertet werden (vgl. LAMBRECHT & TRAUTNER (2007A), Urteil BVerwG vom 12.03.2008, Rn.<br />
124 f).<br />
In der Begründung zum Urteil des BVerwG vom 12.03.2008 (Aktenzeichen 9A3.06, Rn. 125)<br />
wird zum Bagatellcharakter von Flächenverlusten ausgeführt: „Eine Orientierungshilfe für die<br />
Beurteilung, ob ein Flächenverlust noch Bagatellcharakter hat, bietet der Endbericht zum Teil<br />
Fachkonventionen des im Auftrag des B<strong>und</strong>esamtes für Naturschutz durchgeführten Forschungsvorhabens<br />
„Fachinformationssystem <strong>und</strong> Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit<br />
im Rahmen der FFH-VP“, Schlussstand Juni 2007 (…). Dem darin unterbreiteten<br />
Fachkonventionsvorschlag (S. 33) liegt die gesetzeskonforme Annahme zugr<strong>und</strong>e, LRT-<br />
Flächenverluste stellten in der Regel eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Ausnahmen von der<br />
Gr<strong>und</strong>annahme knüpft der Konventionsvorschlag an sehr enge Voraussetzungen <strong>und</strong> stellt<br />
dabei kumulativ neben anderen Kriterien auf Orientierungswerte absoluten <strong>und</strong> relativen Flächenverlustes<br />
ab. Die vorgeschlagenen Werte stützen sich auf Analysen der ökologischen Parameter<br />
<strong>und</strong> Eigenschaften der Lebensraumtypen wie Seltenheit, Gefährdung <strong>und</strong> Regenerationsfähigkeit<br />
sowie eine Auswertung der FFH-Gebietskulisse (durchschnittliche Bestandsgröße
FROELICH & SPORBECK Seite 117<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
des Lebensraumtyps in den Gebieten, Gesamtbestandsgröße in Deutschland, Häufigkeit <strong>und</strong><br />
Seltenheit in der deutschen Gebietskulisse usw.; vgl. FuE-Endbericht S. 67 ff.). Die Vorschläge<br />
sind unter breiter Beteiligung der Fachöffentlichkeit erarbeitet worden; die LANA hat den Endbericht<br />
in ihrer Sitzung am 13./14. September 2007 als „wichtigen ersten Schritt“ gebilligt, „um die<br />
Erkenntnislücken bei den naturschutzfachlichen Maßstäben für die Bewertung der Erheblichkeit<br />
von Eingriffen in FFH-Gebieten zu schließen“. Die vorgeschlagenen Werte sind nach eigenem<br />
Anspruch keine Grenzwerte, sondern bloße Orientierungswerte für die Einzelfallbeurteilung<br />
(FuE-Endbericht S. 10). In dieser Funktion können sie nach derzeitigem Wissensstand als Ent-<br />
scheidungshilfe genutzt werden.“<br />
Im „Fachkonventionsvorschlag zur Beurteilung der Erheblichkeit bei direktem Flächenentzug in<br />
Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-RL in FFH-Gebieten“ geben LAMBRECHT & TRAUTNER<br />
(2007B) konkrete lebensraumtypenspezifische Orientierungswerte (Flächengrößenangaben) als<br />
Erheblichkeitsschwellen für den direkten Flächenverlust an. Überschreitet ein vorhabensbedingter<br />
Flächenverlust diesen Orientierungswert, so ist zunächst von einer erheblichen Beeinträchtigung<br />
auszugehen. Bei der Gesamtbeurteilung kommt es jedoch stets auf die Bewertung des<br />
Einzelfalls an. Als Orientierungswerte werden je nach Umfang des relativen Flächenverlustes<br />
(Flächenverlust in Bezug zur Gesamtfläche des LRT im FFH-Gebiet) für jeden Lebensraumtyp<br />
unterschiedliche Flächengrößen angesetzt.<br />
Für die im Einflussbereich der Kühlwasserfahne liegenden marinen Lebensraumtypen geben<br />
LAMBRECHT & TRAUTNER (2007B) die folgenden Orientierungswerte, zur Beurteilung der Erheblichkeit<br />
eines Flächenverlustes an. Dabei werden entsprechend dem prozentualen Anteil des<br />
Verlustes am Gesamtvorkommen im Gebiet drei Stufen definiert:<br />
Tab. 6: Orientierungswerte für Flächenverlust in marinen FFH-Lebensraumtypen<br />
Stufe Relativer Verlust<br />
(prozentualer Anteil des Verlustes<br />
am Gesamtvorkommen im Gebiet)<br />
LRT 1110 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser<br />
Orientierungswerte<br />
„quantitativ-absoluter Flächenverlust“<br />
Stufe I < 1,0 % 0,5 ha<br />
Stufe II < 0,5 % 2,5 ha<br />
Stufe <strong>III</strong> < 0,1 % 5 ha<br />
LRT 1130 Ästuarien<br />
Stufe I < 1,0 % 500 m 2<br />
Stufe II < 0,5 % 2.500 m 2<br />
Stufe <strong>III</strong> < 0,1 % 5.000 m 2<br />
LRT 1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt<br />
Stufe I < 1,0 % 500 m 2<br />
Stufe II < 0,5 % 2.500 m 2<br />
Stufe <strong>III</strong> < 0,1 % 5.000 m 2<br />
LRT 1160 Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen <strong>und</strong> Seegraswiesen)<br />
Stufe I < 1,0 % 500 m 2<br />
Stufe II < 0,5 % 2.500 m 2<br />
Stufe <strong>III</strong> < 0,1 % 5.000 m 2<br />
LRT 1150* Lagune<br />
Stufe I < 1,0 % 100 m 2
FROELICH & SPORBECK Seite 118<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Stufe Relativer Verlust<br />
(prozentualer Anteil des Verlustes<br />
am Gesamtvorkommen im Gebiet)<br />
Orientierungswerte<br />
„quantitativ-absoluter Flächenverlust“<br />
Stufe II < 0,5 % 500 m 2<br />
Stufe <strong>III</strong> < 0,1 % 1.000 m 2<br />
Diese Fachkonventionsvorschläge zur Beurteilung von Beeinträchtigungen von FFH-LRT <strong>und</strong><br />
Arten können nicht nur bei einer vollständigen Flächeninanspruchnahme angewendet werden,<br />
sondern ggf. auch bei anderen Wirkfaktoren, die flächenhafte Auswirkungen auf die Lebensraumtypen<br />
bzw. Habitate der Arten haben <strong>und</strong> nur zu graduellen Funktionsverlusten führen. Ein<br />
solcher Fall ist beim Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> durch die Wirkungen der Kühlwassereinleitung gegeben.<br />
Die Kühlwassernutzung führt nicht zu einem vollständigen Funktionsverlust in den marinen Lebensräumen,<br />
sondern verursacht nur partielle Funktionsverluste innerhalb der Lebensraumflächen<br />
<strong>und</strong> der Habitate von charakteristischen Arten.<br />
Die Umrechnung von Beeinträchtigungen mit partiellem Funktionsverlust zu einem mit den Orientierungswerten<br />
der Fachkonventionen vergleichbaren Äquivalenzwert kann anhand folgender<br />
Formel erfolgen:<br />
ÄW = F x gFV (%)<br />
ÄW = Äquivalenzwert zum Vergleich mit dem lebensraum- bzw. artspezifischen<br />
Orientierungswert (vgl. Tabellen oben)<br />
F = Flächengröße der beeinträchtigten LRT- bzw. Habitat-Fläche<br />
gFV (%) = gradueller Funktionsverlust in %<br />
Der Vorteil einer solchen Herangehensweise liegt darin, dass die Beurteilung anhand der ermittelten<br />
Funktionsverluste zu einer besseren Nachvollziehbarkeit der Beeinträchtigungsbewertung<br />
führt. Die errechneten Flächenäquivalente können mit den lebensraum- bzw. artspezifischen<br />
Orientierungswerten der Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit verglichen werden:<br />
Überschreitet der Äquivalenzwert den Orientierungswert so ist mit erheblichen Beeinträchtigungen<br />
zu rechnen.<br />
Ermittlung der graduellen Beeinträchtigungen<br />
Die Erstellung des folgenden Bewertungsansatzes, die Auswahl der charakteristischen Arten<br />
sowie die artspezifische Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgte in enger Abstimmung <strong>und</strong><br />
mit fachlicher Unterstützung des Büros MariLim – Gesellschaft für Gewässeruntersuchung<br />
mbH, Schönkirchen.<br />
Der graduelle Funktionsverlust wird anhand eines Vergleichs der potenziellen Standorteignung<br />
der einzelnen marinen Lebensräume für lebensraumtypische Arten mit der veränderten Standorteignung<br />
bei Kraftwerksbetrieb abgeschätzt. Positive Effekte, die sich durch die Kühlwassernutzung<br />
ergeben können, bleiben dabei unberücksichtigt. Bei der Betrachtung der charakteristischen<br />
Arten wurden die lebensraumtypischen Vogelarten ausgespart, da nicht zu erwarten<br />
ist, dass sie unmittelbar auf die Parameteränderungen reagieren. Die Bewertung der Auswir-
FROELICH & SPORBECK Seite 119<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
kungen der abiotischen Veränderungen auf die marine Fauna <strong>und</strong> Flora im Greifswalder Bodden<br />
<strong>und</strong> dem Freesendorfer See basiert auf den Veränderungen der zwei Parameter Temperatur<br />
<strong>und</strong> Salzgehalt. Diese beiden Parameter beeinflussen die Physiologie der Organismen (letale<br />
Grenzen, Geschwindigkeit biochemischer Prozesse, Osmoregulation) <strong>und</strong> wirken somit direkt<br />
auf die Fauna <strong>und</strong> Flora. Zudem sind sie wissenschaftlich gut untersucht. Neben den Temperatur-<br />
<strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen sind auch Veränderungen der Trübung, des Chlorophyll-a-<br />
Gehalts <strong>und</strong> des Nährstoffgehalts zu erwarten. Da für diese Parameter jedoch keine genauen<br />
Schwellenwerte existieren, biologische Ab- <strong>und</strong> Umbauprozesse dieser Faktoren in der physikalischen<br />
Modellierung nicht abgebildet <strong>und</strong> somit nicht exakt quantifiziert werden, werden sie<br />
nicht in das Bewertungsmodell mit einbezogen. Zudem wirken die Parameter überwiegend nur<br />
indirekt auf die Organismen. In MARILIM (2011) wird erläutert, warum das allein auf den Parametern<br />
Salz <strong>und</strong> Temperatur beruhende Bewertungsmodell eine umfassende Quantifizierung aller<br />
kühlwasserinduzierten, vorhabensbedingten Beeinträchtigungen ermöglicht.<br />
Um eine nachvollziehbare Bewertung zu gewährleisten, wird im Folgenden die genaue Vorge-<br />
hensweise bei der Ermittlung der graduellen Beeinträchtigungen dargestellt:<br />
1. Für alle marinen Lebensraumtypen im Wirkraum der Kühlwasserfahne wurden lebensraumtypische<br />
Arten ausgewählt, die dort eine hohe Dominanz <strong>und</strong> Stetigkeit aufweisen. Diese Arten<br />
besitzen überwiegend eine große Bedeutung im Nahrungsnetz. Die Auswahl erfolgte auf<br />
Gr<strong>und</strong>lage der folgenden Literaturquellen:<br />
� GOSSELCK, F. & J. KUBE (2004): Süß bis salzig – Marine FFH-Lebensraumtypen in Ostsee<br />
am Beispiel des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> der Pommerschen Bucht. - Naturmagazin,<br />
Heft 3: 4-9.<br />
� IFAÖ (2005): Marine FFH-Lebensraumtypen der Ostsee im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern.<br />
� IFAÖ (2007A): Bestandsbeschreibung Beschreibung von marin-biologischen Tätigkeiten<br />
im Raum <strong>Lubmin</strong>, Struck <strong>und</strong> Spandowerhagener Wiek. Gutachten im Auftrag von<br />
Froelich & Sporbeck. Broderstorf bei Rostock.<br />
� IFAÖ (2009B): Monitoring der Makrophytenbestände im Seegebiet vor dem Industriestandort<br />
<strong>Lubmin</strong> im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Bau <strong>und</strong> Betrieb des<br />
Steinkohlekraftwerks - Ergebnisse der status-quo-ante-Aufnahme im August & September<br />
2008. Gutachten im Auftrag von Froelich & Sporbeck. Broderstorf bei Rostock.<br />
� http://www.ikzm-oder.de/steckbrief_makrozoobenthos.html (KÜSTENINFORMATIONSSYS-<br />
TEM ODERMÜNDUNG); Abfrage am 26.10.2010<br />
2. Darüber hinaus wurden für die marinen Lebensraumtypen des Wirkraums Arten ausgewählt,<br />
die eine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren des Vorhabens aufweisen.<br />
Diese besonders projektrelevanten Arten wurden im Rahmen der Abschichtung der charakteris-<br />
tischen Arten ermittelt (vgl. Anhang 2).<br />
In der folgenden Tabelle sind die ausgewählten charakteristischen Arten (aus 1. <strong>und</strong> 2.) aufgeführt.
FROELICH & SPORBECK Seite 120<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 7: Ausgewählte charakteristische Arten<br />
LRT Charakteristische Arten mit einer<br />
besonderen Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren des Vorhabens<br />
1110<br />
Sandbank<br />
1130<br />
Ästuar<br />
1140<br />
Windwatt<br />
1150*<br />
Lagune<br />
1160<br />
Flache<br />
Meeresbuchten<br />
� Lagunen-Herzmuschel<br />
(Cerastoderma glaucum)<br />
� Fl<strong>und</strong>er<br />
(Platichthys flesus)<br />
� Sandgr<strong>und</strong>el<br />
(Pomatoschistus minutus)<br />
� Fl<strong>und</strong>er<br />
(Platichthys flesus)<br />
� Schlickkrebs<br />
(Corophium volutator)<br />
� Schlickkrebs<br />
(Corophium volutator)<br />
� Graue Armleuchteralge<br />
(Chara canescens)<br />
� Rauhe Armleuchteralge<br />
(Chara aspera)<br />
� Lagunen-Herzmuschel<br />
(Cerastoderma glaucum)<br />
� Hering<br />
(Clupea harengus)<br />
� Schlickkrebs<br />
(Corophium volutator)<br />
� Hering<br />
(Clupea harengus)<br />
� Hornhecht (Belone belone)<br />
� Graue Armleuchteralge<br />
(Chara canescens)<br />
Charakteristische Arten mit hoher<br />
Dominanz <strong>und</strong> Stetigkeit im LRT<br />
� Sandklaffmuschel<br />
(Mya arenaria)<br />
� Baltische Plattmuschel<br />
(Macoma baltica)<br />
� Gemeine Wattschnecke<br />
(Hydrobia ulvae)<br />
� Bathyporeia pilosa<br />
� Kleiner Sandaal<br />
(Ammodytes tobianus)<br />
� Kammlaichkraut<br />
(Potamogeton pectinatus)<br />
� Teichfaden<br />
(Zanichellia palustris)<br />
� Gemeine Wattschnecke<br />
(Hydrobia ulvae)<br />
� Schillernder Borstenwurm<br />
(Hediste diversicolor)<br />
� Zuckmückenlarven<br />
� Kammlaichkraut<br />
(Potamogeton pectinatus)<br />
� Ähriges Tausendblatt<br />
(Myriophyllum spicatum)<br />
� Schillernder Borstenwurm<br />
(Hediste diversicolor)<br />
� Gemeine Wattschnecke<br />
(Hydrobia ulvae)<br />
� Oligochät<br />
(Tubifex costatus)<br />
� Meersalde<br />
(Ruppia maritima)<br />
� Blasentang<br />
(Fucus vesiculosus)<br />
� Wattschnecken<br />
(Hydrobia ventrosa, H. ulvae)<br />
� Scolopus armiger<br />
� Zuckmückenlarven<br />
� Schillernder Borstenwurm<br />
(Hediste diversicolor)<br />
� Kammlaichkraut<br />
(Potamogeton pectinatus)<br />
� Ähriges Tausendblatt<br />
(Myriophyllum spicatum)<br />
� Sandklaffmuschel<br />
(Mya arenaria)<br />
� Schillernder Borstenwurm<br />
(Hediste diversicolor)<br />
� Gemeine Wattschnecke
FROELICH & SPORBECK Seite 121<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
LRT Charakteristische Arten mit einer<br />
besonderen Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren des Vorhabens<br />
� Rauhe Armleuchteralge<br />
(Chara aspera)<br />
� Chara baltica<br />
� Tolypella nidifica<br />
� Zostera marina<br />
� Lagunen-Herzmuschel<br />
(Cerastoderma glaucum)<br />
� Baltische Plattmuschel<br />
(Macoma balthica)<br />
� Heterotanais oerstedi<br />
� Schlickkrebs<br />
(Corophium volutator)<br />
Charakteristische Arten mit hoher<br />
Dominanz <strong>und</strong> Stetigkeit im LRT<br />
(Hydrobia ulvae)<br />
� Baltische Plattmuschel<br />
(Macoma baltica)<br />
� Strand-Salde<br />
(Ruppia maritima/ cirrhosa)<br />
� Kammlaichkraut<br />
(Potamogeton pectinatus)<br />
� Teichfaden<br />
(Zanichellia palustris)<br />
� Darmalge<br />
(Enteromorpha intestinalis)<br />
3. Mit Hilfe von Literaturrecherchen wurden für alle diese charakteristischen Arten (dominante<br />
Arten <strong>und</strong> Arten mit besonderer Empfindlichkeit) soweit möglich ihre Toleranzbereiche gegen-<br />
über den Wirkfaktoren Temperatur <strong>und</strong> Salzgehalt ermittelt.<br />
4. Anhand der Messdaten des LUNG M-V von 1997 bis 2007 wurde die natürliche Schwankungsbreite<br />
der beiden abiotischen Parameter Wassertemperatur <strong>und</strong> Salzgehalt (für unterschiedliche<br />
Zeiträume <strong>und</strong> Teilbereiche des Untersuchungsgebietes) ermittelt. Da keine Messstation<br />
für den Freesendorfer See (LRT 1150, Lagune) existiert, wurde hierfür auf Literaturdaten<br />
zurückgegriffen.<br />
5. Durch einen Vergleich der potenziellen Standorteignung für die einzelnen Arten im derzeitigen<br />
Zustand des marinen Lebensraums (differenziert nach Lebensraumtypen) mit der Standorteignung<br />
bei Kraftwerksbetrieb auf der Gr<strong>und</strong>lage der Kühlwasserprognosen von BUCKMANN<br />
(2011) wird die Veränderung der Lebensraumeignung für die jeweilige Art in diesem konkreten<br />
Bereich ermittelt.<br />
6. Anhand der Veränderung der Standorteignung für jede Art wird ihre potenzielle Beeinträchti-<br />
gung im Bereich der Kühlwasserfahne abgeleitet.<br />
a. Definition des Randbereiches der Toleranzbreite: Zustand der Standortparameter, bei<br />
welchem voraussichtlich die Fitness oder der Reproduktionserfolg der Art vermindert ist. Da nur<br />
für sehr wenige Arten ein Optimalbereich bekannt ist, wird dieser innerhalb der gesamten Toleranzbreite<br />
nicht weiter berücksichtigt. Der Randbereich reicht von einer Einheit unter bis eine<br />
Einheit über dem Minimum/Maximum der Toleranzbreite <strong>und</strong> grenzt damit den Toleranzbereich<br />
nach oben <strong>und</strong> unten vom Außenbereich ab. Sofern für eine Art in der Literatur sehr unterschiedliche<br />
Angaben zur Toleranzbreite vorliegen, werden diese abweichenden Angaben dem<br />
Randbereich zugeschrieben, da geringfügige Beeinträchtigungen nicht vollständig ausge-<br />
schlossen werden können.
FROELICH & SPORBECK Seite 122<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
b. Zur Interpretation der Standorteignung: verschiebt sich der Parameter innerhalb des<br />
Toleranzbereiches, wird keine Beeinträchtigung abgeleitet (-). Bei Verschiebung des Parameters<br />
vom Toleranzbereich in den Randbereich wird angenommen, dass Stressreaktionen nicht<br />
auszuschließen sind, ungünstige Lebensraumbedingungen zunehmen <strong>und</strong> damit eine mittlere<br />
Beeinträchtigung gegeben ist (+). Eben diese Bewertung trifft auch für eine Verschiebung innerhalb<br />
des Randbereiches zu. Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass die Art bereits<br />
in gewisser Weise an die ungünstigen Bedingungen angepasst ist, ist eine Verschärfung der<br />
Situation gegeben. Verursacht der Wirkfaktor eine Verschiebung der Standortparameter vom<br />
Toleranz- oder Randbereich in den Außenbereich, wird auch unter Berücksichtigung der evtl.<br />
gegebenen Adaptionen eine Verschlechterung erreicht, welche als hohe Beeinträchtigung gewertet<br />
wird (x). Da nicht abgeschätzt werden kann, ob davon nur wenige Individuen oder ein<br />
Großteil der (lokalen) Population der Art betroffen ist, muss von einem Totalausfall ausgegangen<br />
werden. Ebenfalls signifikant negativ (x) wird gewertet, wenn die Parameter sich außerhalb<br />
des Toleranzbereiches bewegen <strong>und</strong> damit hohe Empfindlichkeiten gegenüber jeglichen Änderungen<br />
bereits gegeben sind (x). Da sowohl Änderungen von 0 bis 1 K als auch von unter +/-0,5<br />
PSU als methodischer Fehlerbereich <strong>und</strong> innerhalb der natürlichen Schwankungen als nicht<br />
nachweisbar angesehen werden, sind für diese Wirkbereiche keine Beeinträchtigungen (-) mög-<br />
lich.<br />
7. Die Bewertung der flächenbezogenen Beeinträchtigungen der Arten 2 durch die Verschiebung<br />
der Parameter wird lebensraumspezifisch für die einzelnen Wirkklassen (als Kombination aus<br />
Delta-Temperatur <strong>und</strong> Delta-Salzgehalt) ermittelt. Dabei gibt die jeweils höhere Beeinträchti-<br />
gung die Gesamtbeeinträchtigung vor (Bsp. �T + / �S x, Gesamt = x). Zur Ermittlung des Be-<br />
2 Die Armleuchteralgen-Arten werden ausschließlich bei der Bewertung der Standorteignung<br />
des LRT 1150 berücksichtigt, da sie gegenwärtig in den anderen LRT des Untersuchungsraums<br />
nicht vorkommen.
FROELICH & SPORBECK Seite 123<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
troffenheitsgrades (Be <strong>und</strong> Bd) werden den Beeinträchtigungen (aus 6.) Zahlenwerte zugeordnet<br />
(„x“ = 4 „+“ = 2 „-“ = 0) <strong>und</strong> lebensraumspezifisch für die beiden Artengruppen aufsummiert.<br />
Be = Betroffenheitsgrad empfindlicher Arten<br />
Bd = Betroffenheitsgrad dominanter Arten<br />
8. Ermittlung des Betroffenheitsindexes (IB) zur Ableitung der Betroffenheit des Lebensraumtyps<br />
pro Wirkungsklasse: Der Indexwert ergibt sich als Summe aus einem doppelt gewichteten Betroffenheitsgrad<br />
von lebensraumtypischen Arten mit hoher Empfindlichkeit (Be) <strong>und</strong> dem einfachen<br />
Wert der dominanten Arten (Bd). Damit wird der besonders hohen Aussagekraft der lebensraumtypischen<br />
empfindlichen Arten zur Sensibilität des Lebensraums Rechnung getragen.<br />
Der minimal mögliche Indexwert (IBmin) für jeden LRT ist „0“, das Maximum (IBmax) ergibt sich als<br />
Summe aus der doppelten Anzahl empfindlicher Arten <strong>und</strong> der einfachen Anzahl der dominanten<br />
Arten, multipliziert mit 4 (als dem höchsten zu vergebenden Betroffenheitsgrad). Dadurch<br />
wird die unterschiedliche Anzahl betrachteter Arten pro LRT berücksichtigt.<br />
IB = [� (Be) * 2] + � (Bd)<br />
IBmin = 0<br />
IBmax = ((Anzahl empfindliche Arten * 2) + Anzahl dominante Arten) * 4<br />
Im Anhang <strong>III</strong> ist die Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden<br />
der lebensraumtypischen Arten für die einzelnen marinen Lebensraumtypen dargestellt.<br />
9. Gradueller Funktionsverlust: Bei einem kompletten Flächenverlust des Lebensraums würde<br />
man einen Funktionsverlust von 100 % für den Lebensraum ansetzten. Da der marine Lebensraum,<br />
selbst bei einem Totalausfall der ausgewählten charakteristischen Arten noch gewisse<br />
Lebensraumfunktionen für andere Artengruppen übernehmen würde, wird der maximale Betroffenheitsindex<br />
der ausgewählten Arten mit einem Funktionsverlust von 80 % gleich gesetzt. Viele<br />
Arten kommen nicht flächendeckend in der gesamten Kühlwasserfahne vor, da ihr Vorkommen<br />
auf bestimmte Wassertiefen <strong>und</strong>/ oder Substrattypen beschränkt ist. Aus diesem Gr<strong>und</strong> kann<br />
davon ausgegangen werden, dass die Abnahme der Standorteignung für die einzelnen Arten<br />
teilweise deutlich überschätzt wird.<br />
Zwischen Minimum (0 %, entspricht IBmin) <strong>und</strong> Maximum (80 %, entspricht IBmax) können an-<br />
schließend die Indexwerte (IB) linear (in Prozent) abgeleitet werden. Auf diese Weise werden<br />
die graduellen Funktionsverluste der einzelnen betroffenen Flächen des LRT abgeschätzt.<br />
Durch Multiplizieren der beeinträchtigten Flächengröße mit ihren jeweiligen graduellen Funktionsverlusten<br />
wird der Äquivalenzwert errechnet, der mit den Orientierungswerten von LAM-<br />
BRECHT & TRAUTNER (2007B) verglichen werden kann.<br />
Die folgende Tabelle gibt die betroffenen Flächen der einzelnen marinen Lebensraumtypen <strong>und</strong><br />
die nach oben beschriebener Methode errechneten Äquivalenzwerte wieder, die zum Vergleich<br />
mit dem lebensraum- bzw. artspezifischen Orientierungswert nach LAMBRECHT & TRAUTNER<br />
(2007B) verwendet werden.
FROELICH & SPORBECK Seite 124<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 8: Durch Kühlwassereinleitung betroffene Flächen <strong>und</strong> ermittelte Äquivalenzwerte (betroffene Fläche x gradueller Funktionsverlust)<br />
Betroffene Flächen<br />
für den Vergleich mit dem lebensraumspezifischen Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner (2007B) für die Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12<br />
Delta-T Delta – S<br />
(in PSU)<br />
LRT 1110 LRT 1130 LRT 1140 LRT 1150 LRT 1160<br />
LF 11 LF 12 LF 11 LF 12 LF 11 LF 12 LF 11 LF 12 LF 11 LF 12<br />
0-1 K -0,5 - -1 9,8 0 0 0 3,8 0 0 0 87,7 63,1<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
1-2 K 0 - -0,5 1,1 39,8 0 0 0,8 15 0 0 14,8 31,1<br />
-0,5 - -1 32 0 0 0 0,4 0 0 0 88,1 30,1<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
2-3 K -0,5 - -1 10,8 11,8 0 0 0 0 0 0 30,8 25,5<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0<br />
3-4 K -0,5 - -1 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 25,6<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1<br />
4-5 K -0,5 - -1 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 20,6<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2<br />
5-6 K -0,5 - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Anmerkung: Die Verschneidung der Lastfälle (LF) bezieht sich auf diejenige Schicht im dreidimensionalen Modell mit der größten Ausdehnung
Äquivalenzwert<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 125<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anzusetzender Wert LRT 1110 LRT 1130 LRT 1140 LRT 1150 LRT 1160<br />
0-1 K -0,5 - -1 3,43 0 1,14 0 21,925<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0<br />
1-2 K 0 - -0,5 5,97 0 2,25 0 4,665<br />
-0,5 - -1 12,8 0 0,12 0 26,43<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0<br />
2-3 K -0,5 - -1 4,72 0 0 0 9,24<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0,09<br />
3-4 K -0,5 - -1 1,62 0 0 0 10,24<br />
-1 - -2 0 0 0 0 0,05<br />
4-5 K -1 - -2 0,42 0 0 0 11,33<br />
5-6 K -1 - -2 0 0 0 0 0 SUMME<br />
SUMME 28,96 0 3,51 0 83,97 116,44<br />
Aufteilung prozen-<br />
tual 12,4528 16,5072 0,0000 0,0000 1,5093 2,0007 0,0000 0,0000 36,1071 47,8629 116,44<br />
auf Vorhaben GUD II (43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%) GUD II (43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%) GUD II (43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%) GUD II (43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%) GUD II (43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)
FROELICH & SPORBECK Seite 126<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Aufgr<strong>und</strong> der großen natürlichen Schwankungsbreite der Wasserparameter, bedingt durch die<br />
außerordentliche Dynamik der Einstromverhältnisse aus nördlichem Peenestrom, Greifswalder<br />
Bodden <strong>und</strong> Ostsee, lässt sich für die entnahmebürtigen Veränderungen in der Spandowerhagener<br />
Wiek keine ausreichend genaue <strong>und</strong> valide Modellierung, wie es für die Kühlwassereinleitung<br />
möglich ist, erstellen. Die von BUCKMANN (2011, Kap. 9) getroffenen Aussagen zu Veränderungen<br />
im Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsklima als Folge der Änderungen des<br />
Strömungsregimes, welche der nachfolgenden Beurteilung zu Gr<strong>und</strong>e liegen, basieren jedoch<br />
auf umfangreichen Messwertanalysen aus den Monitoringprogrammen des LUNG <strong>und</strong> der <strong>EWN</strong><br />
<strong>und</strong> stellen damit belastbare Prognosen dar.<br />
Dadurch dass eine modellhafte Abbildung hier nicht geleistet werden kann, stößt das gemeinsame<br />
Bewertungsmodell von FROELICH & SPORBECK <strong>und</strong> MARILIM, welches auf einer flächenhaften<br />
Beurteilung der vorhabensbedingten Veränderungen beruht, bei der Beurteilung der Effekte<br />
der Kühlwasserentnahme im LRT 1130 sowie auch bei der Beurteilung der Veränderungen im<br />
Freesendorfer See (LRT 1150) an seine Grenzen. Eine Beurteilung der vorhabensbedingten<br />
entnahmebürtigen Veränderungen in der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> im Freesendorfer See<br />
kann demzufolge nur auf der verbal argumentativen Ebene erfolgen. Aus der Sicht der Gutachter<br />
werden die möglichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen dennoch vollständig analysiert,<br />
so dass eine abschließende Bewertung möglich ist <strong>und</strong> keine Betrachtungslücken mehr<br />
verbleiben.<br />
Abweichend zur beschriebenen Methodik können die Projektwirkungen bewertet werden, wenn<br />
eine Art unterschiedliche Empfindlichkeiten in gewissen Entwicklungsstadien aufweist oder die<br />
Empfindlichkeit von weiteren Parametern abhängt, die als indirekte Effekte von Temperatur-<br />
<strong>und</strong> Salzgehaltsänderung bzw. weiteren Parametern auftreten (Sauerstoffmangel, Abnahme der<br />
Sichttiefe). Ein hohes Regenerationspotenzial oder gute Ausweichmöglichkeiten der Art können<br />
ebenfalls zu einer abweichenden Bewertung führen. Diese abweichenden artspezifischen<br />
Empfindlichkeiten sind im Folgenden dargestellt:<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris), Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum),<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus)<br />
Diese Arten sind salztolerante Süßwasserarten, für welche daher Beeinträchtigungen durch die<br />
vorhabensbedingte Abnahme des Salzgehaltes im Bereich der Kühlwasserfahne ausgeschlossen<br />
werden können (-).<br />
Darmtang (Enteromorpha intestinalis)<br />
Nach EGGERT et al. (2006) in FRÖHLE et al. (2010) weist die sehr häufig im Greifswalder Bodden<br />
vorkommende Art eine sehr hohe Toleranz gegenüber dem Parameter Salinität auf. Es werden<br />
daher keine Beeinträchtigungen durch Salzgehaltsänderungen angenommen (-).<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum), Sandklaffmuschel (Mya arenaria), Baltische<br />
Plattmuschel (Macoma baltica)<br />
Da Muschellarven überwiegend von anderen Orten heran gedriftet werden <strong>und</strong> somit nicht in<br />
der unmittelbaren Nähe ihrer Eltern siedeln, kann davon ausgegangen werden, dass mögliche<br />
verringerte Vermehrungsraten im Bereich der Kühlwasserfahne über die Besiedlung aus ande-
FROELICH & SPORBECK Seite 127<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ren Wasserbereichen wirksam ausgeglichen werden könnte. Auf Gr<strong>und</strong> ihres hohen Wiederbesiedlungspotenzials<br />
werden daher signifikante Beeinträchtigungen (x) durch Temperaturerhöhungen<br />
in der Kühlwasserfahne für die drei betrachteten Muschelarten ausgeschlossen.<br />
Für die Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) können im Bereich der Kühlwasser-<br />
fahne zeitweise anhaltende, erhöhte Wassertemperaturen (v.a. im Winter) lokal zu geringeren<br />
Vermehrungsraten führen. Die Lagunen-Herzmuschel ist besonders temperaturempfindlich, da<br />
sie sich nur 1-2 cm in den Boden eingräbt. Die Daten zur Temperaturtoleranz (vgl. Tab. 14) der<br />
Art deuten darauf hin, dass der Einzelfaktor Temperaturerhöhung nicht zu einer relevanten Beeinträchtigung<br />
der Art führen könnte. Die Art benötigt allerdings Salzgehalte von >4 PSU, so<br />
dass eine lokale Beeinträchtigung der Population im Bereich der Kühlwasserfahne infolge der<br />
Aussüßung zu erwarten ist.<br />
Die Sandklaffmuschel (Mya arenaria) toleriert kurzfristig sehr geringe Salinitäten. Langfristig<br />
werden jedoch mindestens 5 PSU benötigt, um lebenswichtige Prozesse aufrecht zu erhalten.<br />
Die Kühlwasserfahne zeigt nach den Berechnungen (BUCKMANN 2011) eine hohe Variabilität,<br />
wodurch lediglich im direkten Nahbereich der Molenköpfe mit länger anhaltenden Konzentrationsverringerungen<br />
im Salzgehalt zu rechnen ist. Der Randbereich wird daher für die Art bis 2<br />
PSU erweitert, so dass erst bei Salzgehaltsänderungen von >- 3 PSU von signifikanten Beeinträchtigungen<br />
ausgegangen wird.<br />
Andererseits führt eine größere Variabilität des Salzgehaltes dazu, dass die Tiere verstärkt<br />
Energie für ihre Osmoregulation aufwenden müssen, so dass ihr Wachstum bzw. ihre Reproduktion<br />
entsprechend beeinträchtigt werden können.<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa)<br />
Bathyporeia pilosa wird als euryhalin eingestuft <strong>und</strong> kann kurzfristig niedrige Salzgehalte tolerie-<br />
ren (FRÖHLE et al. 2010), signifikante Beeinträchtigungen durch Salzgehaltsveränderungen<br />
werden daher ausgeschlossen. Der Randbereich wird um 1 PSU (auf 4 PSU) erweitert.<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
MOURITSEN et al. (2005) postulieren eine extreme Abnahme der Individuenzahl aufgr<strong>und</strong> eines<br />
erhöhten Parasitenbefalls bei einer prognostizierten Erhöhung der Temperatur im Wattenmeer<br />
um 3,8°C. Temperaturzunahmen von 3-4 K werden daher als geringe Beeinträchtigung (+) gewertet,<br />
Temperaturnahmen ab 4 bis 5 K als signifikante Beeinträchtigung (x).<br />
Schillernder Borstenwurm (Hediste diversicolor)<br />
Der kosmopolitisch verbreitete Schillernde Borstenwurm besitzt eine sehr große Toleranz gegenüber<br />
der Salinität. So wird auch ein sehr geringer Salzgehalt (Süßwassercharakter) vorübergehend<br />
toleriert (IFAÖ 2008M). Die Art kann sich tief in das Sediment eingraben <strong>und</strong> wird<br />
daher voraussichtlich nicht durch kurzfristige oberflächennahe Salzgehaltsänderungen beeinflusst.<br />
Nach FRÖHLE et al. (2010) toleriert Hediste Salzgehalte bis 1 PSU, der Toleranzbereich<br />
wird daher um eine Einheit verschoben.
FROELICH & SPORBECK Seite 128<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Zuckmückenlarven-Populationen in der Spandowerhagener Wiek müssen an extreme Salzgehaltsschwankungen<br />
angepasst sein <strong>und</strong> weisen daher vermutlich eine recht hohe Toleranz<br />
gegenüber den vorhabensbedingten Salzgehaltsänderungen auf. Es werden keine (-) Beeinträchtigungen<br />
durch Salzgehaltsänderungen erwartet.<br />
Im Freesendorfer See siedeln vermutlich mehrere Zuckmückenarten als Larven, einige mit eher<br />
limnischen, andere mit eher brackigen Ansprüchen. Durch eine geringe Abnahme des Salzgehalts<br />
sind keine Beeinträchtigungen für diese Arten zu erwarten (-).<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus)<br />
Die Fl<strong>und</strong>er kann als euryhaline Art bezeichnet werden, die in der Lage ist, sich über die Zeit an<br />
bestimmte Salzgehalte anzupassen. Die Fl<strong>und</strong>er laicht vorwiegend pelagisch oder demersal<br />
<strong>und</strong> bevorzugt Laichhabitate mit einem höheren Salzgehalt (vgl. HAMMER et al. 2009). Nach<br />
ICES (2005) benötigen die Oderbank-Fl<strong>und</strong>ern zum erfolgreichen Laichen einen Salzgehalt von<br />
mindestens 12 PSU gepaart mit einem Sauerstoffgehalt von mindestens 2 ml/l. Als Anpassung<br />
an niedrigere Salzgehalte können größere Eier mit geringerer spezifischer Dichte entwickelt<br />
werden (MIELCK & KÜNNE 1932, LÖNNING & SOLEMDAL 1979, NISSLING et al. 2002). Allerdings ist<br />
die Fl<strong>und</strong>er anscheinend nicht in der Lage, schnell auf wechselnde Salzgehalte durch entsprechende<br />
Dichte- <strong>und</strong> Größenregulation der Eier zu reagieren (NISSLING & WESTIN 1997, NISSLING<br />
et al. 2002). Der Greifswalder Bodden (<strong>und</strong> damit auch der Bereich der Kühlwasserfahne) hat<br />
daher für das Laichgeschehen der Fl<strong>und</strong>er keine maßgebliche Bedeutung. Für adulte Fl<strong>und</strong>ern<br />
kritische Wassertemperaturen von >= 31°C werden nicht in der Kühlwasserfahne erreicht. Im<br />
Bereich der Kühlwasserfahne können zwar kurzfristige Beeinträchtigungen der Art auftreten, da<br />
die adulten <strong>und</strong> juvenilen Individuen aber aktiv diese temporär beeinträchtigten Bereiche verlassen<br />
können, sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art im<br />
Gebiet zu erwarten. Auch HAMMER et al. (2009) kommen bei der Beurteilung der Auswirkungen<br />
der Kühlwasserfahne des SKW zu dem Schluss, dass vor dem weit ausgedehnten Laichgebieten<br />
der Fl<strong>und</strong>er <strong>und</strong> ihrem euryöken Verhalten die Erwärmungen durch die Kühlwassereinleitung<br />
für die Art als unbedeutend bewertet werden können. Die vorhabensbedingte Veränderung<br />
der Standorteignung wird daher abweichend zur dargestellten Methode folgendermaßen beurteilt:<br />
Die euryöke Fl<strong>und</strong>er hat ein großes Verbreitungsgebiet. Im Bereich der Kühlwasserfahne<br />
liegen keine besonders bedeutenden Laichhabitate (vgl. HAMMER et al. 2009), so dass vor allem<br />
die möglichen Beeinträchtigungen von juvenilen <strong>und</strong> adulten Tiere zu prüfen sind. In Stresssituation<br />
können adulte <strong>und</strong> juvenile Tiere kurzfristig ausweichen, so dass letale Effekte (x) weitgehend<br />
ausgeschlossen werden können. Auch geringe Salzgehaltsschwankungen (bis 2 PSU)<br />
sind für die mobilen Individuen vermutlich unbedeutend (-). Als demersale Art lebt die Fl<strong>und</strong>er<br />
vor allem in Bodennähe <strong>und</strong> ist damit in tieferen Wasserbereichen nicht von den maximalen<br />
Salzgehaltsänderungen betroffen, da diese vor allem in der Oberflächenschicht zu spüren sind.<br />
Strandgr<strong>und</strong>el (Pomatoschistus minutus)<br />
Die Art wird von HAMMER et al. (2009) als marin bis euryhalin eingestuft <strong>und</strong> weist daher eine<br />
vergleichsweise hohe Toleranz gegenüber Salzgehaltsschwankungen auf. Die prognostizierten,<br />
vorhabensbedingten Salzgehaltsschwankungen lassen daher keine gravierenden/ letalen (x)
FROELICH & SPORBECK Seite 129<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der Art erwarten. Zudem sind für die am Boden lebende Fischart, vor allem<br />
die bodennahen Salzgehaltsänderungen von Bedeutung. Die stärksten Veränderungen des<br />
Salzgehaltes werden im Bereich der oberen Wasserschicht erwartet. Der Toleranzbereich für<br />
den Salzgehalt für die euryhaline Art wird daher um drei Einheiten erweitert. Hinsichtlich der<br />
Temperaturtoleranz existieren für die Art keine konkreten Angaben, so dass hier vorsorglich von<br />
einer geringen, allgemeinen Beeinträchtigung der Art durch die vorhabensbedingten Temperaturzunahmen<br />
ausgegangen wird. Da adulte <strong>und</strong> juvenile Fische in kurzfristigen Stresssituationen<br />
ausweichen können, wird erst ab Temperaturerhöhungen von 3 K mit signifikanten Beeinträchtigungen<br />
gerechnet.<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus)<br />
Obwohl die letale Obergrenze mariner Organismen bei 28°C liegt, wird für den Kleinen Sandaal<br />
aus Untersuchungen im GWB (MARILIM, schriftl. Mitteilung am 12.11.2010) vermutet, dass bereits<br />
ab 20°C letale Effekte möglich sind. Davon sind besonders Larven betroffen, welche sich<br />
nah der Wasseroberfläche von Plankton ernähren. Der Bereich, in dem Stressreaktionen erwartet<br />
werden (Randbereich), wird daher bereits ab 20°C angesetzt.<br />
Hering (Clupea harengus)<br />
Die Standorteignung zeigt, dass jegliche Temperaturzunahme potenziell den Lebensraum für<br />
die Art ungeeignet macht (x). Da jedoch adulte Tiere sowie Larven >30 mm aktiv schwimmfähig<br />
sind, können die Individuen ungünstigen Bedingungen wie Warm- <strong>und</strong> Süßwasserzellen ausweichen<br />
<strong>und</strong> sind daher von den lokal auftretenden Beeinträchtigungen des Lebensraumes<br />
nicht unbedingt betroffen (+). Der Lebensraum ist zusätzlich für die empfindlichen Ei- <strong>und</strong> Larvalstadien<br />
zu bewerten. Die Abgrenzung der winterlichen Temperaturschwankungen macht<br />
deutlich, dass unter natürlichen Bedingungen (ohne Einfluss des Vorhabens) für die frühen<br />
Entwicklungsstadien ungünstige Temperaturbedingungen auftreten können. Diese werden geringfügig<br />
unter Kraftwerkseinfluss verstärkt (x). Generell ist demnach eine Abnahme der Lebensraumeignung<br />
für den frühjahrslaichenden Hering gegeben, welche die Habitatverfügbarkeit<br />
verringert. Entsprechend werden die Veränderungen der Wassertemperatur als signifikante<br />
Beeinträchtigungen gewertet (x). Ähnliches gilt für eine Abnahme des Salzgehaltes von mehr<br />
als 1 PSU. Adulte Stadien können diesen Süßwasserlinsen ausweichen, für Embryonalstadien<br />
sind jedoch hypotonische Ereignisse möglich, welche den Reproduktionserfolg der Art mindern.<br />
Die Abnahme des Salzgehaltes wird daher als signifikante Beeinträchtigung gewertet.<br />
Hornhecht (Belone belone)<br />
Nach HAMMER et al. (2009) ist der Hornhecht eine thermophile Art, deren Eier an starke Temperaturschwankungen<br />
<strong>und</strong> höhere Temperaturen angepasst sein müssen. Beeinträchtigungen<br />
durch Temperaturzunahmen werden daher nicht erwartet (-), es ist eher davon auszugehen,<br />
dass der Hornhecht von der Temperaturzunahme profitieren wird (vgl. ebd.).<br />
Im Verhältnis zum gesamten Laichgebiet der Art sind die Laichhabitate im Bereich der Kühlwasserfahne<br />
nur klein <strong>und</strong> somit für die Gesamtpopulation der Art eher unbedeutend (ebd.). Da<br />
die Art zudem schnell auf Umweltveränderungen reagieren kann <strong>und</strong> schnell ihre Laichplätze<br />
wechseln kann, sind auch durch Salzgehaltsänderungen keine erheblichen Beeinträchtigungen<br />
der Art zu erwarten. Als höchste Beeinträchtigungsstufe wird daher ein + vergeben.
FROELICH & SPORBECK Seite 130<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Arten mit lediglich potenziellen Vorkommen in einem bestimmten Lebensraumtyp<br />
Für Arten, die aktuell nicht im LRT nachgewiesen sind, weist der LRT in seinem jetzigen Zustand<br />
keine 100%-ige Standorteignung auf. Für diese Arten sind keine maximalen Beeinträchtigung<br />
zu erwarten, da letale Effekte nicht möglich sind, sondern sich an dem derzeit ungünstigen<br />
Standort die Hürde zur Wiederansiedlung erhöht. Eine Verschiebung der Parameter kann<br />
daher lediglich zu geringen Beeinträchtigungen (+) führen.<br />
5.2 Wirkprozesse <strong>und</strong> Wirkprozesskomplexe<br />
Für die FFH-Verträglichkeitsprüfung sind diejenigen Wirkprozesse der „Errichtung <strong>und</strong> des Betriebs<br />
des Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerks <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>“ von Bedeutung, die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes<br />
einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen oder Projekten beeinträchtigen<br />
können. Bei der Ermittlung der Beeinträchtigungen wird unterschieden zwischen<br />
baubedingten, anlagebedingten <strong>und</strong> betriebsbedingten Wirkprozessen.<br />
Bei der Bewertung der vorhabensbedingten Auswirkungen wurde gr<strong>und</strong>sätzlich ein „worst-case-<br />
Szenario“ zu Gr<strong>und</strong>e gelegt. Dies betrifft insbesondere den Betrieb des Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerks.<br />
Für die Immissionsprognosen (LOBER 2011 A <strong>und</strong> E) wurde der ungünstigste Fall hinsichtlich<br />
der Emissionen im Jahresverlauf angesetzt. Es wird ununterbrochener Dauerbetrieb<br />
bei Volllast zugr<strong>und</strong>e gelegt. Mit diesem Ansatz werden von der Anlage verursachte Auswirkungen<br />
unterstellt, die nicht den realen Kraftwerksbetrieb abbilden, die aber Gr<strong>und</strong>lage der Auswirkungsprognose<br />
in dieser Unterlage sind. Dieses Vorgehen entspricht den Gr<strong>und</strong>sätzen der<br />
Umweltvorsorge. Diese Vorgehensweise ist vom Gesetzgeber vorgegeben <strong>und</strong> fachtechnisch<br />
anerkannt.<br />
Folgende Wirkprozesse können Auswirkungen auf die Erhaltungsziele haben <strong>und</strong> zu Beeinträchtigungen<br />
führen:<br />
5.2.1 Kollisionsrisiko<br />
� Gefährdung FFH-relevanter Tierarten durch Kollisionen mit hoch aufragenden<br />
Bauwerken des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> (anlagebedingt)<br />
Die Bauhöhen der markanten, zur Beurteilung des potenziellen Vogelschlags relevanten Gebäude<br />
des geplanten Kraftwerkes betragen:<br />
� 3 Kamine: Bauhöhe jeweils 89,00 m, Durchmesser jeweils ca. 8,0 m,<br />
� 3 Abhitzekessel einschließlich Treppentürme: Bauhöhe jeweils 39,00 m, Länge ca. 45,00 m,<br />
Breite ca. 34,00 m,<br />
� 3 Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinengebäude, Bauhöhe jeweils 31,00 m, Länge ca. 70,00 m, Breite<br />
ca. 52,00 m.<br />
Die Gesamtlänge der aus Kamine, Abhitzekessel <strong>und</strong> Dampfturbinengebäude bestehenden<br />
Linien beträgt ca. 210,00 m (West-Ost-Ausrichtung) bzw. ca. 137,00 m (Nord-Süd-Ausrichtung).
FROELICH & SPORBECK Seite 131<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Alle weiteren Gebäude liegen meist deutlich unterhalb der angegebenen Höhen <strong>und</strong> sind in der<br />
Diskussion um Vogelschlag von nachrangiger Bedeutung.<br />
Insbesondere für diese hohen Gebäudeteile des sind Kollisionen mit Vögeln, insbesondere<br />
Zugvögeln, denkbar. Die Entfernungen der hoch aufragenden Schornsteine, Abhitzekessel <strong>und</strong><br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinengebäude zur als Flugroute genutzten Küstenlinie betragen ca. 1.000 m.<br />
Der Vorhabensstandort wird zu den als Rasthabitat dienenden Freesendorfer Wiesen durch<br />
einen 250 m breiten Waldstreifen sowie die Bauten des <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> der Gasanlandestation abgeschirmt.<br />
Die Entfernung zum Grünlandareal der Freesendorfer Wiesen beträgt 1.100 m.<br />
Es ist mit Ausnahme der Flugsicherungsbeleuchtung auf den Schornsteinen keine Beleuchtung<br />
der Maschinenhäuser <strong>und</strong> der Schornsteine <strong>und</strong> somit der höchsten Bauteile des Kraftwerkes<br />
vorgesehen, die bei schlechter Sicht zu Anlockeffekten von Zugvögeln führen könnte.<br />
Wie die Tagbeobachtungen während der Frühjahrsphase <strong>und</strong> auch während des Winters im<br />
Rahmen der Zugvogelerfassungen des ehemals am selben Standort geplanten Steinkohlekraftwerks<br />
Greifswald zeigten, resultieren die meisten der beobachteten Flugbewegungen aus<br />
lokalen <strong>und</strong> regionalen Wechseln zwischen Nahrungs-, Schlaf- <strong>und</strong> Ruheplätzen - im Frühjahr<br />
auch Brutplätzen - im Greifswalder Bodden <strong>und</strong> den küstennahen terrestrischen Biotopen. Für<br />
Vögel, die sich dauerhaft oder zeitweilig im Untersuchungsraum aufhalten, ist bei Realisierung<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> eine hohe Gewöhnung an die vorhandenen Hindernisse anzunehmen, denen sie<br />
entweder ausweichen oder sie weiträumig umfliegen.<br />
Für verschiedene Wasservögel wurde belegt, dass sie während des Zuges über Land größere<br />
Höhen als über Wasser bevorzugen (beispielsweise BERGMANN & DONNER 1964). Da nächtliche<br />
Zugaktivitäten häufig oberhalb der geplanten Bauwerke stattfinden <strong>und</strong> Kollisionen sich nahezu<br />
auf schlechte Witterungsverhältnisse beschränken, wird unter Berücksichtigung der eingeschränkten<br />
Beleuchtung kein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko für die Bauwerke des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
angenommen. Kollisionen sind auch für die vorhandenen Bauwerke des ehemaligen Kernkraftwerkes<br />
"Bruno Leuschner" nicht bekannt.<br />
Im Ergebnis ist kein wesentliches Kollisionsrisiko beim Vogelzug durch den Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
erkennbar. Es kann angenommen werden, dass dennoch auftretende Vogelverluste durch singuläre<br />
Kollisionen vor dem Hintergr<strong>und</strong> der natürlichen „normalen“ Mortalität während des Zuggeschehens<br />
höchst unbedeutend sind.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der oben genannten Voraussetzungen können signifikante Kollisionsrisiken durch<br />
den zeitlich begrenzten Baustellenbetrieb mit Baggern oder Baukränen von vornherein<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Für andere flugaktive Arten wie Fledermäuse ergibt sich kein potenzielles Kollisionsrisiko.<br />
Für Fledermäuse sind bisher insbesondere Kollisionen mit Rotoren von Windkraftanlagen beschrieben<br />
worden, wobei vor allem ziehende Fledermäuse betroffen sind. Das Kollisionsrisiko<br />
ergibt sich hier durch die sich rasch bewegenden Rotoren, nicht aber durch die feststehenden<br />
Bestandteile der Windkraftanlagen (BRINKMANN et al. 2009). Da Fledermäuse nicht auf Licht zur<br />
Orientierung angewiesen sind, ist für diese Artengruppe zur Verhinderung von Kollisionen weder<br />
eine Beleuchtung notwendig noch besteht durch Beleuchtung ein zusätzliches Kollisionsri-
FROELICH & SPORBECK Seite 132<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
siko. Aufgr<strong>und</strong> ihres spezifischen Ortungssystems ist für Fledermäuse kein Kollisionsrisiko zu<br />
erwarten (vgl. BERG 2008A für das ehemals geplante Steinkohlekraftwerk Greifswald).<br />
5.2.2 Barriereeffekte, Zerschneidung von Funktionsbeziehungen<br />
� Zerschneidung von Lebensräumen <strong>und</strong> Trennung von Teillebensräumen FFHrelevanter<br />
Tierarten <strong>und</strong> somit Ver- bzw. Behinderung von Austauschbewegungen<br />
<strong>und</strong> Wechselbeziehungen, Minderung der Fitness durch Ausweichbewegungen<br />
(bau- <strong>und</strong> anlagebedingt)<br />
Unter dem Wirkprozess Barrierewirkungen/Zerschneidungen werden die vom Kraftwerksneubau<br />
ausgehenden Trennwirkungen zusammengefasst. Dies kann im vorliegenden Fall zu einer<br />
(teilweise bauzeitlich begrenzten) Behinderung der Interaktionen <strong>und</strong> ggf. einer Beeinträchtigung<br />
häufig genutzter Flugkorridore durch die Kraftwerksbauten oder durch Baukräne führen.<br />
So können baubedingt <strong>und</strong> anlagebedingt Trennwirkungen hervorgerufen werden, die bei Vögeln<br />
zu Ausweichflügen führen.<br />
Für Vögel, die sich dauerhaft oder zeitweilig im Wirkraum des Vorhabens aufhalten, ist bei Realisierung<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> eine hohe Gewöhnung an die hohen Gebäude des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> anzunehmen.<br />
Insgesamt dürfte dennoch die gesamte Gebäudekulisse am Standort <strong>Lubmin</strong> als Hindernis<br />
wahrgenommen werden. Der Standort des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> befindet sich nordwestlich des ehemaligen<br />
Kernkraftwerks „Bruno Leuschner“. Nördlich bzw. nordöstlich grenzen die Gasanlandestation<br />
<strong>und</strong> die Vorhabensfläche des <strong>GuD</strong> II an. Das geplante <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> liegt somit zwischen einer hoch<br />
aufragenden Gebäudekulisse. So sind auch bereits ohne Umsetzung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> Ausweichflüge<br />
anzunehmen. Insgesamt sind für verschiedene Vogelarten oder Vogelartengruppen geringfügige<br />
vertikale <strong>und</strong> horizontale Ausweichbewegungen zu erwarten, die allerdings zu keiner<br />
relevante Beeinträchtigung der Artvorkommen führen.<br />
Barrierewirkungen für bodenmobile Tierarten wurden bereits im Rahmen der Genehmigung des<br />
B-Plangebietes Nr. 1 bewertet <strong>und</strong> berücksichtigt.<br />
Mögliche Trennwirkungen, die sich aus der betriebsbedingten Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung ergeben können, werden im Kapitel 5.2.5 (Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung)<br />
dargestellt.<br />
5.2.3 Optische Störungen / Veränderung des Sichtfeldes<br />
� temporäre optische Störungen der Tierwelt (FFH-relevante Arten) durch Bewegung<br />
von Menschen sowie (Bau-)Fahrzeugen <strong>und</strong> (Bau-)Maschinen (bau, betriebsbedingt)<br />
Der Baustellenbetrieb mit dem Einsatz von z. B. größeren Baggern oder Baukränen führt zu<br />
optischen Störungen im Umfeld der Baustelle. Des Weiteren kann eine Scheuchwirkung auf<br />
Vögel durch die Bau- <strong>und</strong> Lieferfahrzeuge ausgelöst werden. Optische Störungen von Lebensräumen<br />
sind entsprechend der unterschiedlichen Ansprüche der Lebewesen an ihre Umwelt<br />
artspezifisch zu betrachten. Zusätzlich zu den durch Lärm ausgelösten Störungen übt vor allem
FROELICH & SPORBECK Seite 133<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
die Anwesenheit von Menschen auf der Baustelle eine starke Scheuchwirkung auf scheue Tiere<br />
aus.<br />
Da die Vorhabensfläche <strong>und</strong> die Baueinrichtungsflächen mindestens 500 m von der Schutzgebietsgrenze<br />
des FFH-Gebietes entfernt liegen <strong>und</strong> das Vorhaben darüber hinaus größtenteils<br />
auch durch die angrenzenden Industrievorhaben sowie durch Waldflächen vom Schutzgebiet<br />
abgeschirmt wird, können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch temporäre, bau- <strong>und</strong><br />
betriebsbedingte optische Störungen von vornherein ausgeschlossen werden.<br />
� optische Störungen von Tieren <strong>und</strong> Tierlebensräumen (FFH-relevante Arten) durch<br />
Lichtimmissionen aufgr<strong>und</strong> der Beleuchtung des Kraftwerkes (betriebsbedingt) <strong>und</strong><br />
der Baustelle (baubedingt)<br />
Die Beleuchtung der Kraftwerksanlagen <strong>und</strong> der Baustelle kann potenziell folgende Auswirkungen<br />
auf Tiere <strong>und</strong> deren Lebensräume haben:<br />
� Lock- <strong>und</strong> Scheuchwirkung mit Auswirkungen auf das Verhalten von Zugvögeln <strong>und</strong><br />
Fledermäusen,<br />
� Störende <strong>und</strong> vertreibende Wirkungen,<br />
� Lichtanflug von Insekten <strong>und</strong> Gefährdung der Insekten an künstlichen Lichtquellen,<br />
� Beeinträchtigung der Nahrungsgr<strong>und</strong>lagen von insektenfressenden Vögeln <strong>und</strong> Fledermäusen,<br />
� Änderung des Artengefüges im Auswirkungsbereich der Lichtemissionen,<br />
� Erhöhung des Prädationsrisikos.<br />
Lichtimmissionen können bei Zugvögeln Schreckreaktionen <strong>und</strong> Ausweichbewegungen auslösen.<br />
Die Auswirkung der Anlagenbeleuchtung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> auf Zugvögel kann nicht isoliert vom<br />
Lichtkegel, der durch den gesamten Industrie- <strong>und</strong> Gewerbekomplex am Standort <strong>Lubmin</strong> hervorgerufen<br />
wird, bewertet werden. Insgesamt sind für nachts flugaktive Zugvogelarten in Folge<br />
des Lichtkegels des gesamten Industrie- <strong>und</strong> Gewerbekomplexes am Standort <strong>Lubmin</strong> geringfügige<br />
lokale vertikale <strong>und</strong> horizontale Ausweichbewegungen zu erwarten.<br />
Zu den Nachtziehern zählen vor allem insektenfressende Kleinvögel wie Grasmücken, Laubsänger,<br />
Fliegenschnäpper, Steinschmätzer, Braun- <strong>und</strong> Schwarzkehlchen sowie Drosseln (vgl.<br />
IFAÖ 2003c). Auch Enten, Gänse, Schwäne, Limikolen <strong>und</strong> Möwen ziehen regelmäßig nachts<br />
(vgl. PETTERSSON & STALIN 2003).<br />
Für Fledermausarten kann Licht einerseits eine störende / vertreibende Wirkung haben, wenn<br />
z. B. Habitate im nahen Umfeld der Straße, die für die nächtliche Jagd genutzt werden, betroffen<br />
sind. Andererseits locken z. B. künstliche Lichtquellen im Straßenbereich Insekten an, die<br />
ihrerseits für Fledermäuse attraktive Nahrungsquellen darstellen können (EISENBEIS & HASSEL<br />
2000).<br />
Da das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 liegt, reichen die vorhabensinduzierten<br />
Lichtimmissionen, die empfindliche Fledermausarten beeinträchtigen können, nicht
FROELICH & SPORBECK Seite 134<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
bzw. nur geringfügig über das B-Plangebiet hinaus. Eine Beeinträchtigung ist nur für Arten möglich,<br />
die den Industriehafen <strong>und</strong>/oder die Waldrandareale, die das B-Plangebiet umgeben, bzw.<br />
den verbliebenen Waldschutzstreifen des B-Plangebietes zur Nahrungssuche nutzen.<br />
Nach KOLLIGS & MIETH (2001) geht von künstlichen Lichtquellen eine Gefährdung von Insektenpopulationen<br />
aus, da teilweise große Individuenzahlen aus ihren Herkunftsbiotopen her-<br />
ausgelockt <strong>und</strong> möglicherweise aus der Reproduktion der Population entnommen werden. Da<br />
der Vorhabensstandort des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 mit sukzessiv<br />
zunehmender weiterer Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeansiedlung <strong>und</strong> somit zwischen einer<br />
ebenfalls nachts beleuchteten Gebäudekulisse befindet <strong>und</strong> zudem im Umfeld der Industriehafen,<br />
die Gasanlandestation <strong>und</strong> das ehemalige KKW angrenzen, werden migrierende <strong>und</strong> dispergierende<br />
Individuen zum großen Teil bereits von den benachbarten beleuchteten Gebäudekomplexen<br />
angezogen. Die durch Lichtemissionen vorhabensinduziert betroffenen<br />
Insektenlebensräume liegen außerhalb des FFH-Gebietes, das mindestens 500 m von der Anlange<br />
entfernt liegt. Damit können Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch optische Störungen<br />
von vornherein ausgeschlossen werden.<br />
� Meidungsverhalten von Vögeln durch Veränderungen des Sichtfeldes durch hohe<br />
Kraftwerkskomponenten, Störung weiträumiger Sichtbeziehungen (anlagebedingt)<br />
In Folge der Gebäude-Silhouette mit Höhen bis zu 89,00 m (Schornsteine), 34,00 m (Abhitzekessel)<br />
<strong>und</strong> 31,00 m (Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinengebäude) sind Beeinträchtigungen auch außerhalb<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>-Geländes von Vogelarten möglich, die offene Lebensräume besiedeln <strong>und</strong> auf<br />
ein weites freies Sichtfeld angewiesen sind. Vertreter anderer Artengruppen, die hohe Ansprüche<br />
an weithin offene Lebensräume mit freiem Sichtfeld stellen, kommen im Untersuchungsraum<br />
nicht vor.<br />
Eine Beeinträchtigung ist besonders für Vogelarten möglich, die einen großen Abstand zu<br />
Landschaftsstrukturen einhalten <strong>und</strong> die daher empfindlich auf Einschränkungen des Sichtfeldes<br />
reagieren <strong>und</strong> für die der Landschaftsraum der Freesendorfer Wiesen zwischen dem kraftwerksvorgelagerten<br />
Wald <strong>und</strong> dem Freesendorfer See ein wichtiger (Teil-)Lebensraum darstellt.<br />
Über die von empfindlichen Vogelarten eingehaltenen Abstände zu höheren Landschaftsstrukturen<br />
liegen keine allgemeingültigen Informationen <strong>und</strong> pauschalen Konventionen vor. Solche<br />
Abstände schwanken in Abhängigkeit von Art <strong>und</strong> Höhe der Landschaftsstrukturen, aber auch<br />
in Abhängigkeit ökologischer Faktoren wie Nahrungsverfügbarkeit, Populationsdichte, Gewöhnungs-<br />
<strong>und</strong> Störungseffekte.<br />
Als Bewertungsmaßstab von Straßen sind für Brutvögel sogenannte Effektdistanzen entwickelt<br />
worden (GARNIEL & MIERWALD 2010). Als Effektdistanz wird die maximale Reichweite des erkennbaren<br />
Einflusses von Straßen auf die räumliche Verteilung einer Vogelart bezeichnet. Die<br />
für den Straßenbau verwendeten Effektdistanzen sind natürlich nur eingeschränkt zur Beurteilung<br />
hoher Gebäudestrukturen geeignet, da sich Einflüsse von Straßen auf Vögel nicht allein<br />
durch das – wesentlich niedrigere - Straßenbauwerk, sondern vor allem auch durch visuelle <strong>und</strong><br />
akustische Störwirkungen des Straßenverkehrs ergeben.<br />
Die nächstgelegenen Offenlandlebensräume für solche Vogelarten außerhalb des genehmigten<br />
B-Plangebietes Nr. 1 befinden sich in den Freesendorfer Wiesen. Die minimale Entfernung zwi-
FROELICH & SPORBECK Seite 135<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
schen den hohen Gebäuden des Vorhabens <strong>und</strong> der Freesendorfer Wiesen beträgt ca.<br />
1.100 m. Aufgr<strong>und</strong> dieser großen Entfernung sind Beeinträchtigungen des Sichtfeldes auszuschließen,<br />
zumal sich zwischen dem <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>-Standort <strong>und</strong> den Freesendorfer Wiesen noch das<br />
Baufeld des geplanten <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> ein vorgelagerter Waldstreifen befinden. VON GARNIEL &<br />
MIERWALD (2010) vorgegebene Effektdistanzen werden nicht unterschritten.<br />
5.2.4 Lärmimmissionen<br />
� temporäre Störung FFH-relevanter Tierarten durch Lärm von Baumaschinen <strong>und</strong><br />
Baufahrzeugen beim Kraftwerksbau (baubedingt)<br />
� dauerhafte Störung FFH-relevanter Tierarten durch den Betrieb des Kraftwerks (betriebsbedingt)<br />
In kraftwerksnahen Ökosystemen kann es durch bau- <strong>und</strong> betriebsbedingte Verlärmung zu<br />
(temporären) Verschiebungen im faunistischen Arteninventar kommen; besonders störungsempfindliche<br />
Arten (z. B. Fledermäuse <strong>und</strong> vor allem bestimmte Vogelarten) werden verdrängt.<br />
Dies gilt insbesondere auch für solche Arten, die durch Beunruhigungen nicht nur in ihrer Verbreitung<br />
eingeschränkt werden, sondern auch in der Ausnutzung ansonsten optimaler Biotope<br />
behindert werden. Bei kurzfristigen Einzelschallereignissen kommt es zu Schreckreaktionen <strong>und</strong><br />
Beunruhigungen.<br />
Bau- <strong>und</strong> betriebsbedingte Lärmimmissionen<br />
Lärmemissionen/ -immissionen entstehen im Planfall während des Kraftwerksbaus <strong>und</strong> Kraftwerkbetriebs,<br />
wobei Belastungen durch Schallimmissionen vorwiegend in der Bauphase durch<br />
Baumaschineneinsatz sowie An- <strong>und</strong> Abtransport von Material zu erwarten sind.<br />
Als Lärmbelastungen, die während der Betriebsphase auftreten, kommen der An- <strong>und</strong> Auslieferungsverkehr<br />
sowie interne Fahrten innerhalb des Kraftwerksgeländes, das Anfahren der Kessel<br />
sowie bei seltenen Betriebsstörungen die Öffnung der Sicherheitsventile in Betracht. Der<br />
vorhabensspezifische Lärm wird durch den konstanten Betriebslärm, <strong>und</strong> ev. durch kurzzeitige<br />
Schallereignisse in Ausnahmefällen, gekennzeichnet sein.<br />
Es ist vorgesehen, dass im Allgemeinen am Tage (bei Bauarbeiten 7-20 Uhr) <strong>und</strong> - soweit in<br />
bestimmten Bauabschnitten erforderlich - auch in der Nacht (20-07 Uhr) gearbeitet wird. Während<br />
der Nacht beschränken sich die Arbeiten auf die unbedingt notwendigen Operationen – so<br />
wird es z. B. keine Ramm- oder Gründungsarbeiten in der Nacht geben. Es ist davon auszugehen,<br />
dass das Emissionsniveau der Baustelle in der Nacht geringer als am Tage sein wird.<br />
Die lautesten Aktivitäten werden am Anfang der Bauphase während der Gründungsarbeiten, bei<br />
gleichzeitigem Tiefbau <strong>und</strong> Betonierungsarbeiten, auftreten. (LOBER 2011C).<br />
Die höchsten Schallemissionen treten bei den Gründungsarbeiten (Rammen oder alternative<br />
Verfahren) auf. Um ein Verfahren zu finden, bei dem insbesondere die Beeinträchtigungen der<br />
Avifauna durch Schallwirkungen möglichst gering sind, wurden im Vorfeld verschiedene Verfahren<br />
im Hinblick auf ihre potentiellen Wirkungen auf die Avifauna untersucht. Um die Beeinträchtigungen<br />
der Avifauna durch Schallwirkungen zu minimieren, wird zur Gründung der Bauwerke
FROELICH & SPORBECK Seite 136<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ein Verfahren mit Bohrpfählen eingesetzt werden. Es sollen dabei maximal drei Geräte gleichzeitig<br />
zum Einsatz kommen. Bei den Wasserbaumaßnahmen zur Errichtung der Kühlwasserentnahme-<br />
<strong>und</strong> Kühlwassereinleitbauwerke ist zudem das Setzen von Sp<strong>und</strong>wänden erforderlich.<br />
Hier sind zwei Rammen (je eine am Entnahme- <strong>und</strong> Einleitbauwerk) vorgesehen (LOBER<br />
2011C).<br />
Beschreibung der untersuchten Lärmszenarien<br />
Gr<strong>und</strong>lage für die Bewertung der Lärmimmissionen bei Tieren sind die von LOBER (2011C) ermittelten<br />
Isophone. Es liegen 52, 55 <strong>und</strong> 58 dB(A)-Isophone vor. Die Untersuchungen wurden in<br />
Anlehnung an GARNIEL & MIERWALD (2010) als flächendeckende Rasterberechnungen in den<br />
Höhen von 1 m bzw. 10 m ausgeführt (vgl. LOBER 2011C).<br />
In LOBER (2011C) wurden insgesamt sechs Lärmszenarien berechnet:<br />
� vier Baulärm Gesamtbelastungen sowie<br />
� zwei Betriebslärm-Gesamtbelastung<br />
basierend auf zwei verschiedenen Vorbelastungs-Szenarien.<br />
Die verschiedenen Vorbelastungs-Szenarien sind folgendermaßen definiert:<br />
� VB1: minimale Vorbelastung = realer Bestand 2011 inkl. Gasanlandestation (GA)<br />
� VB2: maximale Vorbelastung = realer Bestand 2011 inkl. „normale“ 1 Baustelle GUD II<br />
<strong>und</strong> B-Plan Kontingenten, Rest ohne Fläche des GUD <strong>III</strong><br />
Folgende Lärmszenarien liegen der Beurteilung der Beeinträchtigung von Vögeln durch Lärm<br />
zugr<strong>und</strong>e.<br />
Tab. 9: Beschreibung der Lärmszenarien nach Lober (2011c)<br />
Szenario Beschreibung Bemerkung<br />
Betrieb-A Gesamtbelastung Betriebsphase <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> basierend<br />
auf obiger Vorbelastung 1 (minimale<br />
Vorbelastung)<br />
Betrieb-B Gesamtbelastung Betriebsphase <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> basierend<br />
auf obiger Vorbelastung 2 (maximale<br />
Vorbelastung)<br />
Bau-C Gesamtbelastung Bauphase z basierend auf<br />
obiger Vorbelastung 1 (minimale Vorbelastung)<br />
Bau-D Gesamtbelastung Bauphase z basierend auf<br />
obiger Vorbelastung 2 (maximale Vorbelastung)<br />
Bau-E Gesamtbelastung Bauphase y basierend auf<br />
obiger Vorbelastung 1 (minimale Vorbelastung)<br />
Bau-F Gesamtbelastung Bauphase y basierend auf<br />
obiger Vorbelastung 2 (maximale Vorbelastung)<br />
--<br />
--<br />
Bauphase z: allgemeine Baustelle <strong>und</strong><br />
Gründung über Bohrpfähle<br />
Bauphase z: allgemeine Baustelle <strong>und</strong><br />
Gründung über Bohrpfähle<br />
Bauphase y: allgemeine Baustelle <strong>und</strong><br />
Gründung über Bohrpfähle sowie Rammen<br />
von Stahlbohlen am Ein- <strong>und</strong> Auslauf<br />
Bauphase y: allgemeine Baustelle <strong>und</strong><br />
Gründung über Bohrpfähle sowie Rammen<br />
von Stahlbohlen am Ein- <strong>und</strong> Auslauf
FROELICH & SPORBECK Seite 137<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die „allgemeine Baustelle“ beinhaltet Bagger, LKW, Radlader, Betonpumpen, Betonrüttler <strong>und</strong><br />
Mobilkräne (LOBER 2010C).<br />
Empfindlichkeit von Tieren gegenüber Lärm<br />
Als lärmempfindliche Tierartengruppe gelten vor allem die Vögel. Da die „Arbeitshilfe Vögel <strong>und</strong><br />
Straßenverkehr“ von GARNIEL & MIERWALD (2010) die derzeit aktuellste <strong>und</strong> umfangreichste<br />
Bewertungsgr<strong>und</strong>lage für vorhabensinduzierte graduelle akustische Beeinträchtigungen darstellt<br />
<strong>und</strong> zudem auf einem umfangreichen FuE-Vorhaben des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr,<br />
Bau <strong>und</strong> Stadtentwicklung (Quantifizierung <strong>und</strong> Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen<br />
von Verkehrslärm auf die Avifauna) fußt, wird die nachfolgende Beurteilung der betriebsbedingten<br />
akustischen Beeinträchtigungen von Brut- <strong>und</strong> Rastvögeln in der Regel nach<br />
dieser Bewertungsgr<strong>und</strong>lage durchgeführt. Nach MIERWALD (E-Mail vom 24.08.2009) können<br />
die Erkenntnisse aus den Untersuchungen über Lärmbeeinträchtigungen der Vogelwelt an stark<br />
befahrenen Straßen (GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & MIERWALD 2010; KIFL 2009) in gewissem<br />
Rahmen auch auf andere Lärmquellen übertragen werden. Aufgr<strong>und</strong> des Fehlens geeigneter<br />
anderer Bewertungsgr<strong>und</strong>lagen wird GARNIEL & MIERWALD (2010) daher auch zur Bewertung<br />
baubedingter akustischer Beeinträchtigungen des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> herangezogen.<br />
Die von RECK et al. (2001) eingeführte 47 dB(A)-Isophone als Schwellenwert für lärminduzierte<br />
Auswirkungen auf die Qualität von Vogellebensräumen stützte sich auf seinerzeit in den Niederlanden<br />
durchgeführte Untersuchungen <strong>und</strong> Berechnungen der Lärmbelastung an Straßen (REI-<br />
JNEN et al. 1995A, B, 1996, 1997). Die Ergebnisse des hierfür genutzten, inzwischen überholten<br />
Berechnungsverfahrens weichen stark von nach der b<strong>und</strong>esdeutschen Berechnungsvorschrift<br />
RLS-90 gewonnenen Lärmwerten ab. Vielmehr liefern die Lärmberechnungen nach der RLS-90<br />
gemäß der in Deutschland anzuwendenden Methodik mindestens 5 dB(A) (im Extremfall bis zu<br />
20 dB(A)) höhere Werte als die Methodik, die der o. g. niederländischen Untersuchung zu<br />
Gr<strong>und</strong>e gelegt wurde (vgl. LÄRMKONTOR 2009). Das bedeutet, dass der bei REIJNEN et al. gef<strong>und</strong>ene<br />
Lebensraumverlust, der von RECK et al. (2001) übernommen wurde, bei gleicher Verkehrsmenge<br />
mit deutlich höheren Schallimmissionen korreliert.<br />
Wenn in aktuellen Verträglichkeitsprüfungen zur Ermittlung von Auswirkungen auf Veröffentlichungen<br />
von RECK et al. (2001) zurückgegriffen wird, ist der dort genannte Wert von 47 dB(A)<br />
nach derzeitigem Kenntnisstand um wenigstens 5 dB(A) auf 52 dB(A) zu korrigieren (vgl. Niederschrift<br />
der B<strong>und</strong>-Länder-Dienstbesprechung vom 28.09.2005). Als Schwellenwert wird nachstehend<br />
aufgr<strong>und</strong> dessen konsequent die von LOBER (2011C) ermittelte 52 dB(A)-Isophone herangezogen,<br />
die der 47 dB(A)-Isophone innerhalb der von RECK et al. (2001) angewendeten<br />
Skalierung entspricht. Weitere Schwellen, die auf S. 142 bei RECK et al. (2001) angeführt sind,<br />
müssen dann ebenfalls nach oben korrigiert werden.<br />
Lärmwirkungen auf Säugetiere sind bisher kaum untersucht (vgl. HERRMANN 2001). Beeinträch-<br />
tigungen durch akustische Störungen sind potenziell für den Fischotter <strong>und</strong> für Fledermäuse<br />
möglich. Da sich Säuger an extrem hohe Schallpegel in ihrer Umgebung gewöhnen können,<br />
sind die Auswirkungen akustischer Beeinträchtigungen als weniger bedeutsam gegenüber der<br />
Artengruppe der Vögel zu beurteilen. Als bedeutendster Beeinträchtigungsfaktor ist die Maskie-
FROELICH & SPORBECK Seite 138<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
rung von akustischen Orientierungsleistungen <strong>und</strong> Kommunikation anzunehmen. Für den<br />
Fischotter gibt HERRMANN (2001) als bedeutende Lautart Soziallaute an, die eine Reichweite<br />
von ca. 100 m aufweisen. Da bei Beeinträchtigungen diese möglicherweise durch olfaktorische<br />
Sinnesleistungen kompensiert werden, sind Auswirkungen von Lärmimmissionen auf Fischotter<br />
derzeit unklar.<br />
Zu den verschiedenen am Standort nachgewiesenen Fledermausarten liegen kaum Untersu-<br />
chungen zur Lärmempfindlichkeit vor. Im Vergleich zu Vögeln wird eine geringere Empfindlichkeit<br />
vermutet (vgl. HERRMANN 2001), so dass der für die häufigen <strong>und</strong> nicht wertgebenden Vogelarten<br />
ermittelte Beeinträchtigungsraum von 200 m als ausreichend betrachtet werden kann.<br />
Innerhalb der Schutzgebietsgrenzen sind somit keine signifikante Beeinträchtigungen dieser<br />
Artengruppe durch Lärmwirkungen zu erwarten.<br />
5.2.5 Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung<br />
Aus der Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> der anschließenden Einleitung des erwärmten Abwassers<br />
über den Industriehafen <strong>Lubmin</strong> in den Greifswalder Bodden resultieren unmittelbare <strong>und</strong> mittelbare<br />
Auswirkungen durch das Verdriftungs- <strong>und</strong> Wärmeabbauverhalten der Kühlwasserfahne(n),<br />
die in einer separaten Studie modelliert wurden (vgl. BUCKMANN 2011).<br />
Neben dem Vorhaben „<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“ wurde bei den Kühlwasserprognosen stets auch das Projekt<br />
„Gasspeicher Moeckow“ des Vorhabenträgers EWE mit einbezogen, das die Ausspülung eines<br />
Salzstockes in Moeckow <strong>und</strong> die Soleeinleitung in den Greifswalder Bodden am Standort <strong>Lubmin</strong><br />
vorsieht. Hinsichtlich des Brauchwasserbedarfs für die Ausspülung des Salzstockes des<br />
EWE-Projektes wurden bei der Kühlwassermodellierung folgende Annahmen zu Gr<strong>und</strong>e gelegt:<br />
- Entnahme von 75.000 m 3 /h Wasser aus der Spandowerhagener Wiek<br />
- Einleitung der gleichen Wassermenge mit einer Salinität von bis zu 10 PSU <strong>und</strong><br />
ohne zusätzlicher Aufwärmung in den Greifswalder Bodden <strong>und</strong><br />
- synchrone Einleitung von Sole <strong>und</strong> Kühlwasser.<br />
Da im Planfeststellungsbeschluss Moeckow (BERGAMT STRALSUND 2011) eine Frischwasserentnahme<br />
von max. 75.000 m 3 /h festgesetzt ist <strong>und</strong> die Deckung des Wasserbedarfs durch erwärmtes<br />
Kühlwasser („Kühlwasservariante“) lediglich als mögliche Korrekturmaßnahme genannt<br />
wird, wird im Folgenden die Betriebsvariante “Frischwasser“ des Vorhabens als worst<br />
case angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass die Variante „Kühlwasser“ nur dann zum<br />
Einsatz kommt, wenn damit eine Reduzierung der Beeinträchtigungen erzielt werden kann. Eine<br />
Darstellung der möglichen Auswirkungen der Variante „Kühlwasser“ des EWE-Vorhabens wird<br />
in Kap. 7.2.3 gegeben.<br />
Nach BUCKMANN (2012) sprechen mehrere wichtige hydrographische Argumente dafür, dass im<br />
Hinblick auf die Auswirkungen der Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung die kumulativen Wirkungen<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> zusammen mit dem Vorhaben „Gasspeicher Moeckow“ eine worst case-<br />
Situation abbilden. Dies gilt auch unter der Voraussetzung, dass die Soleeinleitung nur zeitweise<br />
vorgenommen werden sollte (vgl. ebd.).
FROELICH & SPORBECK Seite 139<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im Folgenden wird eine zusammenfassende Darstellung dieser Argumente gegeben (eine ausführlichere<br />
Darstellung findet sich bei BUCKMANN 2012):<br />
1. Stoffumleitungen: Im Hinblick auf den Nährstoffeintrag beschreibt die gleichzeitige Einleitung<br />
von Kühlwasser <strong>und</strong> Sole den worst case, da mit der gleichzeitigen Einleitung<br />
von Kühlwasser <strong>und</strong> Sole eine größere Menge an nährstoffreichem Peenestromwasser<br />
umgeleitet wird als bei alleiniger Kühlwassernutzung.<br />
2. Wärmeeintrag: In der warmen Jahreszeit wird aufgr<strong>und</strong> der höheren Wassertemperaturen<br />
in der Spandowerhagener Wiek durch die Wassereinleitung des EWE-Projektes zusätzliche<br />
Wärmeenergie in den Greifswalder Bodden eingetragen. Durch die zusätzlichen<br />
Wassermengen erhöht sich zudem die Größe der Kühlwasserfahne.<br />
3. Dichteangleichung: Die gleichzeitige Sole- <strong>und</strong> Kühlwassereinleitung führt zu einer höheren<br />
Dichte des eingeleiteten Wassers als bei alleiniger Kühlwassereinleitung. Dies<br />
führt zu einer stärkeren Vermischung mit dem Wasser des Greifswalder Boddens,<br />
wodurch gleichzeitig ein effektiver <strong>und</strong> schneller Wärmeabbau an der Wasseroberfläche<br />
verhindert wird.<br />
4. Salzgehalt im Freesendorfer See: Weder bei reinem Kraftwerksbetrieb noch bei Kraftwerksbetrieb<br />
mit gleichzeitiger Soleeinleitung ergeben die Kühlwasserprognosen einen<br />
Hinweis auf signifikante Veränderungen des mittleren Salzgehaltes des Freesendorfer<br />
Sees. Minimum <strong>und</strong> Maximum der natürlich auftretenden Salzgehaltswerte im Freesendorfer<br />
See bleiben bei beiden Betrachtungen unverändert.<br />
5. Verweilzeit der eingeleiteten Wärme: Die gleichzeitige Einleitung von Kühlwasser <strong>und</strong><br />
Sole führt in bestimmten Jahreszeiten zu einem „Abtauchen“ der Kühlwasserfahne <strong>und</strong><br />
dadurch zu einer Erhöhung der Verweilzeit der eingeleiteten Wärmemenge sowie zu einer<br />
Erhöhung der Wärmebelastung.<br />
Um den kompletten Brauchwasserbedarf am Standort abzubilden, wird aufgr<strong>und</strong> der Genehmigungssituation<br />
am Standort <strong>Lubmin</strong> darüber hinaus auch das <strong>GuD</strong> II (EnBW) als Vorbelastung<br />
berücksichtigt. Die Beurteilung <strong>und</strong> Quantifizierung der zu erwartenden Beeinträchtigungen von<br />
FFH-Lebensraumtypen <strong>und</strong> FFH-relevanten Arten erfolgt im Folgenden für die zu erwartende<br />
Gesamtbelastung der drei Vorhaben (<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow) <strong>und</strong> kann<br />
anschließend entsprechend der entnommenen Brauchwassermengen auf die einzelnen Vorhaben<br />
aufgeteilt werden.<br />
Für die Simulation je eines Szenarios unter sommerlichen Bedingungen (Einleitung in bereits<br />
erwärmtes Wasser des Greifswalder Boddens, hohe Vorlauftemperatur; Lastfall 12) <strong>und</strong> unter<br />
winterlichen bzw. frühjährlichen Bedingungen (kühles Wasser im UG während der Heringslaichzeit,<br />
Lastfall 11) werden für die drei Vorhaben (<strong>GuD</strong> II, <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, Gasspeicher Moeckow) die Entnahme<br />
von maximal 320.000 m 3 /h Kühlwasser aus der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> deren<br />
Einleitung über den Industriehafen <strong>Lubmin</strong> in den Greifswalder Bodden mit einer Aufwärmspanne<br />
von maximal 5,36 K sowie mit einem maximalen Salzgehalt von 5,57 PSU angesetzt. Da<br />
zwischen dem Greifswalder Bodden <strong>und</strong> der Spandowerhagener Wieck ein stark schwankender<br />
Salzgehaltsunterschied besteht, der im Mittel 3-4 PSU beträgt, bewirkt die Umleitung von „süßerem“<br />
Wieckwasser auch verringerte Salinitäten im Bereich der Kühlwasserfahne. Aus diesem
FROELICH & SPORBECK Seite 140<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Gr<strong>und</strong> wurden die Berechnungen neben den Temperaturgradienten auch für veränderte Salzgehalte<br />
durchgeführt. Die Ausbreitung weiterer stofflicher Differenzen der beiden Gewässer<br />
sowie von vorhabensbedingten zusätzlichen Wasserinhaltsstoffen mit der Kühlwasserfahne<br />
werden über den Parameter Tracer (konservative Stoffe) abgeschätzt.<br />
Mit Hilfe des Modellsystems HYDROMOD-3D wurde der Einflussbereich der Kühlwassereinleitung<br />
in den Greifswalder Bodden <strong>und</strong> in angrenzende Gewässer mit einem dreidimensionalen<br />
Strömungsmodell in Verbindung mit einem Ausbreitungsmodell für Wärme, Salzgehalt <strong>und</strong><br />
Wasserinhaltsstoffe untersucht. Für die Berechnung wurden unterschiedliche Lastfälle definiert,<br />
welche saisonale Extremfälle beschreiben.<br />
� Lastfall 11 [LF11] Winterszenario mit hoher Aufwärmspanne, Kaltwasser im Untersuchungsgebiet<br />
� Lastfall 12 [LF12] Sommerszenario mit hoher Aufwärmspanne <strong>und</strong> hohen Kühlwasservorlauftemperaturen<br />
Die Modellergebnisse liefern zeitlich differenzierte Aussagen über die räumliche <strong>und</strong> qualitative<br />
Ausbreitung des Kühlwassers in verschiedenen Tiefenschichten (maximal 8 Schichten á 2 m<br />
Tiefe, zusätzlich die bodennahe Schicht) für jeweils 8 Windrichtungen. Damit verb<strong>und</strong>ene Änderungen<br />
in Strömungs- <strong>und</strong> Schichtungseigenschaften der Gewässer sind anhand der berechneten<br />
Parameter ableitbar. Laut IOW (2008B) sind Wasserfahnen unter 0,5 K Differenz sehr instabil<br />
<strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> ihrer geringen Aufwärmspanne <strong>und</strong> der kurzen Einwirkdauer nicht mehr<br />
geeignet, nachweisbare Wirkungen auf Organismen auszulösen. Um sicherzustellen, dass auch<br />
geringste negative Auswirkungen auf Organismen erfasst werden, wird in Bezug auf Temperaturveränderungen<br />
ein Wirkbereich ab der Nachweisgrenze von 0,2 K betrachtet. Bei den Salzgehaltsänderungen<br />
werden bei der Auswirkungsprognose negative Abweichungen ab -0,5<br />
PSU berücksichtigt, so dass der Wirkbereich durch die -0,5 PSU-Isolinie begrenzt wird. Fachlich<br />
begründet wird dieser Wert mit den natürlichen salinen Schwankungsbreiten im Bodden, die im<br />
statistischen Mittel (1966 – 1991) im unmittelbaren Einflussbereich der KWF (Station GB 6), ein<br />
Vielfaches betrugen (LUNG M-V 2008B).<br />
Zur Ableitung von langfristigen Verteilungen der Einwirkungen <strong>und</strong> deren Intensitäten wurden<br />
die Bemessungslasten auf meteorologische Abläufe <strong>und</strong> Besonderheiten von 6,5 real beobachteten<br />
Kalenderjahren (01.01.2000 bis 30.06.2006) übertragen <strong>und</strong> statistisch analysiert. Für<br />
ausgewählte, besonders empfindliche Gewässerbereiche (Laichgebiete des Frühjahrsherings,<br />
Freesendorfer See) wurden die Modellläufe unter Eingrenzung interessierender Zeiträume mit<br />
noch größerer Detailschärfe durchgeführt.<br />
Bei Darstellung einer aus allen Windlagen zusammengesetzten „Einhüllenden“ (Enveloppe) der<br />
Temperaturänderungen erstreckt sich die Kühl- <strong>und</strong> Spülwasserfahne vorwiegend küstenparallel<br />
nach Nordost <strong>und</strong> Südwest. Dabei reicht sie in ihrer größten Ausdehnung (inkl. <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> Kavernenspülung,<br />
im Sommer im Bereich der Bodenschicht) im Nordosten nicht über den Struck hinaus.<br />
Die größte westliche Ausdehnung der Kühlwasserfahne überstreicht den Küstenbereich vor<br />
<strong>Lubmin</strong>. Bei gemeinsamer Betrachtung von <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> II sowie der Kavernenspülung beträgt die<br />
flächenmäßige Ausdehnung der Wasserfahne maximal 742 ha in der Bodenschicht [LF12]: Bei<br />
einer Gesamtfläche von 51.000 ha sind dies ca. 1,5 % des Greifswalder Boddens. Dabei be-
FROELICH & SPORBECK Seite 141<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
schreibt diese Fläche den maximalen kumulativen Einwirkbereich der Kühlwasserfahne in der<br />
Bodenschicht. In der Praxis werden niemals alle in der Simulation betroffenen Bereiche zeitgleich<br />
erreicht. Für die beiden Gaskraftwerke gibt es eine Beschränkung der in den Industriehafen<br />
<strong>Lubmin</strong> durch das Kühlwasser eingeleiteten Wärmemenge auf eine maximale Aufwärmspanne<br />
von 7 K. Mit der Soleeinleitung durch EWE wird für das thermisch belastete Kühlwasser der<br />
Kraftwerke bereits ein leichter Abkühlungseffekt von 1,64 K erzielt (vgl. BUCKMANN 2011), da die<br />
Aufwärmspanne des Kühlwassers durch die nicht erwärmte, mit Frischwasser verdünnte Sole von<br />
maximal 7 K auf maximal 5,36 K abgesenkt wird. Aus genehmigungsrechtlicher Sicht liegen die<br />
Einleitpunkte der betrieblichen Abwässer (Kühlwasser, Niederschlagswasser, Prozesswasser) im<br />
Industriehafen <strong>und</strong> somit außerhalb des FFH-Gebietes. Für das Schutzgebiet erlangen die eingeleiteten<br />
Wassermengen erst am Molenkopf mit dem Eintritt in den Greifswalder Bodden Relevanz.<br />
Der anthropogen stark überprägte Industriehafen übernimmt faktisch die Funktion eines Abwasserkanals,<br />
hier findet bereits eine erste Abkühlung des eingeleiteten Kühlwassers statt. Am Molenkopf<br />
hat sich das bis maximal 5,36 K erwärmte Wasser soweit abgekühlt, dass an dieser Stelle<br />
maximal 2,99 K im winterlichen Szenario <strong>und</strong> max. 4,57°C Aufwärmung im sommerlichen Szenario<br />
möglich sind. Für die weitere Betrachtung wird der Bereich des Industrie- <strong>und</strong> Yachthafens aus<br />
oben genannten Gründen nicht betrachtet <strong>und</strong> die Flächenanteile (ca. 17 ha) vom Einwirkbereich<br />
der Kühlwasserfahne abgezogen. Auf Gr<strong>und</strong> der Flachheit des betroffenen Gewässerbereiches<br />
wird der Wasserkörper ständig durchmischt. Die Verteilung der Temperaturerhöhungen in der<br />
Boden- <strong>und</strong> der Oberflächenschicht geben daher bei den meisten der von BUCKMANN (2011)<br />
betrachteten Lastfälle ein ähnliches Bild. Nur im Sommerlastfall [LF12] zeigen Oberflächen- <strong>und</strong><br />
Bodenschicht eine abweichende Verteilung. Während in der Oberflächenschicht die Kühlwasserfahne<br />
überwiegend küstenparallel ausgebildet ist <strong>und</strong> nur mit etwa 1 km Küstenabstand in<br />
den Greifswalder Bodden hineinreicht, reicht die Kühlwasserfahne der Bodenschicht deutlich<br />
weiter in den Greifswalder Bodden hinein (Küstenabstand bis etwa 2,2 km im Bereich der Mole).<br />
Unter winterlichen Bedingungen [LF11] wird der Temperaturausgleich zwischen Kühlwasser<br />
<strong>und</strong> Vorfluter durch die niedrigen Luft- <strong>und</strong> Boddenwassertemperaturen beschleunigt. Es ist ein<br />
schnellerer Abbau der Temperaturgradienten um die Einleitstelle zu erkennen. Darüber hinaus<br />
verringert sich der Einwirkbereich gegenüber den sommerlichen Bedingungen um 246 ha. Im<br />
Kühlwasser-Gutachten wird weiterhin darauf hingewiesen, dass bei Eisbildung im Winter zur<br />
Befahrbarkeit des Industriehafens stets eine Fahrrinne eisfrei gehalten muss, in welcher das<br />
eingeleitete Kühlwasser kanalisiert <strong>und</strong> durch den Kontakt zur kalten Umgebung schnell abgekühlt<br />
wird.<br />
Im Bereich der Kühl- <strong>und</strong> Spülwasserfahne verringern sich die Salzgehalte in der Oberflächen-<br />
schicht um maximal 1,72 PSU im Winterszenario <strong>und</strong> um maximal 1,65 PSU im Sommerszenario.<br />
Auch die Ausbreitung der Aussüßungsfahnen verläuft überwiegend küstenparallel nach<br />
Westen bis zum Hafen Vierow. Nur ein geringer Teil der Aussüßungsfahne wird etwa 1,7 km<br />
nach Nordosten transportiert. Die Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> den Freesendorfer See erreicht<br />
die Kühlwasserfahne lediglich mit Werten unter –0,5 PSU, so dass für diese Bereiche keine<br />
Beeinträchtigungen abgeleitet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die zusätzliche<br />
Soleeinleitung aus dem Gasspeicher Moeckow bereits eine Erhöhung des negativen Salzgradienten<br />
um bis zu 2 PSU erreicht wird. Auf Gr<strong>und</strong> der erhöhten Temperatur <strong>und</strong> der verringerten<br />
Salinität besitzt das Kühlwasser im Vergleich zum Boddenwasser eine geringere Dichte <strong>und</strong><br />
schichtet sich daher im Wesentlichen in den oberen zwei Metern der Wassersäule ein. Im LF11
FROELICH & SPORBECK Seite 142<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ist die Dichte des Kühlwassers bei der Einleitung um 2,7 kg/m³ geringer als das Boddenwasser,<br />
im LF12 ist die Dichte etwa 1,9 kg/m³ geringer.<br />
Der erhöhte mittlere Abfluss aus dem Peenestrom lässt im Winter die Salzgehalte der Spandowerhagener<br />
Wieck <strong>und</strong> damit im entnommenen Kühlwasser sinken. Damit erhöhen sich die<br />
absoluten Werte des negativen Salzgradienten gegenüber dem Boddenwasser. Da das Meersalz<br />
(vorwiegend NaCl) mit der Kühlwasserfahne bedingt analog zu konservativen Inhaltsstoffen<br />
verteilt wird, decken sich die Flächen, welche das Tracermodell zeigt, weitgehend mit denen der<br />
Salinitätsunterschiede. Differenzen ergeben sich jedoch in den Intensitäten.<br />
Während des Hochsommers bei Schwachwindlagen sind temporäre Schichtungen im südlichen<br />
Greifswalder Bodden auch ohne anthropogenen Einfluss gegeben. Diese bewirken Sauerstoffmangelsituationen<br />
in tiefen Gewässerbereichen <strong>und</strong> damit Nährstoffknappheit <strong>und</strong> -mangel in<br />
der euphotischen Zone. Für die empfindlichen Flachwassergebiete werden diese Verödungszustände<br />
auf Gr<strong>und</strong> der guten Durchmischung ausgeschlossen.<br />
Obwohl Schwachwindlagen <strong>und</strong> Windstille für marine Gewässer eher untypisch sind, traten bei<br />
der Auswertung realer Messreihen über 6,5 Jahre insgesamt 26, davon 3 sommerliche, Ereignisse<br />
auf, für die Windgeschwindigkeiten unter 2 m/s für mehr als 3 Tage, jedoch maximal 9<br />
Tage, anhielten. Unter diesen Bedingungen sind kühlwasserinduzierte Schichtungen möglich,<br />
deren Dauer jedoch kritische Zeiträume nicht überschreitet. Die durch die Soleeinleitung des<br />
EWE-Projektes induzierte Annäherung der Dichteverhältnisse an den Greifswalder Bodden führt<br />
zu einer weiter rückläufigen Gefahr von Schichtungsneigungen im Einwirkbereich des Kühlwassers.<br />
In der Spandowerhagener Wieck <strong>und</strong> im nördlichen Peenestrom sind durch Windeinfluss Ein-<br />
<strong>und</strong> Ausstromlagen natürlich wechselnd. Mit dem Einfluss der Kraftwerkspumpen wird ein<br />
Umschwung vom Ausstrom aus dem Peenestrom zum Einstrom von Boddenwasser in die<br />
Spandowerhagener Wieck hydraulisch erleichtert. Das eingesaugte Boddenwasser führt zu<br />
Veränderungen des Temperaturregimes <strong>und</strong> der Salzgehalte des Wieckwassers. Obwohl auch<br />
mit Kühlwasser gemischtes Boddenwasser die Spandowerhagener Wieck erreicht, wird ein<br />
thermischer Kurzschluss, auch über den Freesendorfer See, ausgeschlossen.<br />
Der Freesendorfer See tauscht sein Wasser über die Verbindungsgräben sowohl mit dem Bodden<br />
als auch mit der Spandowerhagener Wieck bis zu 80 Mal im Jahr aus. Die für Abwassereinträge<br />
in den Freesendorfer See relevanten Windrichtungen Nordwest <strong>und</strong> West treten statistisch<br />
betrachtet an etwa 84 Tagen pro Jahr auf. Damit ist gr<strong>und</strong>sätzlich nicht auszuschließen,<br />
dass auch Kühlwasser den See erreicht.<br />
Teil der Untersuchung waren auch Prognosen zu veränderten Strömungsverhältnissen.<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die ermittelten Kühlwasser-Enveloppen<br />
unter Berücksichtigung des Vorhabens <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> der am Standort geplanten Vorhaben <strong>GuD</strong> II<br />
<strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow. Bei den Enveloppen handelt es sich um eine zusammenfassende<br />
Flächendarstellung aller Kühlwasserfahnen der verschiedenen Windrichtungen, die aber nicht<br />
gleichzeitig auftreten können.
FROELICH & SPORBECK Seite 143<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 10: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen bei den Lastfällen 11 <strong>und</strong> 12 am<br />
Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011)<br />
Temperaturdifferenz<br />
/<br />
Oberflächenschicht<br />
LF 11 in ha LF 12 in ha<br />
Bodenschicht Oberflächenschicht Bodenschicht<br />
0,20 - 1,00 K 288 315 333 431<br />
1,01 - 2,00 K 136 139 113 151<br />
2,01 - 3,00 K 47 (max. 2,9 K) 42 (max. 2,9 K) 65 83<br />
3,01 - 4,00 K - - 42 46<br />
4,01 - 5,00 K - - 27 (max. 4,5 K) 31 (max. 4,5 K)<br />
Summe 472 496 590 742<br />
Anmerkung: Ohne Industriehafen <strong>und</strong> Yachthafen<br />
Bei der Bewertung der Auswirkungen der vorhabensbedingten Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung werden ebenfalls Fachgutachten ausgewertet, die im Rahmen des Vorhabens „Steinkohlekraftwerk<br />
Greifswald (DONG)“ erstellt wurden. Diese Fachgutachten (BUCKMANN 2008,<br />
EDLER 2008, IOW 2008B, TÜV NORD 2008B) gingen vom Betrieb von 2 <strong>GuD</strong> <strong>und</strong> einem SKW<br />
aus <strong>und</strong> beziehen sich somit auf eine deutlich größere Kühlwassermenge als die jetzt beim<br />
Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> in Ansatz gebrachte.<br />
Die in diesen Gutachten beschriebenen Auswirkungen überschätzen damit die Auswirkungen<br />
des derzeitigen Planungsstands (Betrieb von 2 <strong>GuD</strong> <strong>und</strong> EWE). Beim Planfall <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> werden<br />
deutlich geringere Kühlwassermengen benötigt.<br />
Östlich angrenzend an die Vorhabensfläche des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> befindet sich das ehemalige Kernkraftwerk<br />
„Bruno Leuschner“. Bis zum Betriebsende im Jahr 1992 wurde im Rahmen des Kernkraftwerkbetriebs<br />
in etwa eine Kühlwassermenge von 352.000 m 3 /h bei einer Aufwärmspanne von<br />
bis zu 10,0 K (mit der Einschränkung, dass das eingeleitete Wasser nicht wärmer als 30°C sein<br />
durfte) in den Greifswalder Bodden eingeleitet. Aus der damaligen Wärmeeinleitung sind keine<br />
irreversiblen Auswirkungen auf den Greifswalder Bodden bekannt.<br />
Die nachfolgende Tabelle stellt die Unterschiede der drei Vorhaben im Hinblick auf die zu beurteilenden<br />
Kühlwassermengen <strong>und</strong> Aufwärmspannen dar.<br />
Tab. 11: Vergleich der betrieblichen Kühlwasserparameter<br />
Kühlwasserparameter Planfall <strong>GuD</strong><br />
<strong>III</strong> inkl. EWE +<br />
<strong>GuD</strong> II<br />
Planfall SKW KKW Bruno Leuschner<br />
Einleitmengen 320.000 m 3 /h 451.000 m 3 /h 352.000 m 3 /h<br />
Max. Aufwärmspanne 5,36 K 7,55 K 10 K<br />
Fläche KWF dT > 0,2 K 742 ha (Bodenschicht)<br />
1606 ha k.A.<br />
Organismen besitzen durch physiologische Anpassungen unterschiedliche ökologische Resistenzen<br />
gegenüber Schwankungen der Umweltbedingungen. Innerhalb dieser Toleranzbereiche
FROELICH & SPORBECK Seite 144<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ermöglichen standortbedingte Adaptionen, dass Individuen auch am Rande ihrer ökologischen<br />
Grenzen mit verminderter Vitalität vorkommen. Für diese Individuen sind künstlich veränderte<br />
Schwankungsbreiten besonders kritisch. Bei der Überschreitung der physiologischen Toleranzbereiche<br />
sind kurzfristig subletale, bei lang anhaltendem Stress auch letale Effekte auf die Organismen<br />
zu erwarten. Abgestorbene Biomasse löst wiederum sauerstoffzehrende Zersetzungsprozesse<br />
aus, die den beschriebenen Effekt von Sauerstoffmangelsituationen verstärken<br />
können. Da in flachen Gewässerökosystemen Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten an die hohe Variabilität<br />
der Umweltbedingungen weitestgehend angepasst sind, sind relativ hohe Toleranzbereiche<br />
gegenüber Temperaturänderungen zu erwarten.<br />
Im Folgenden werden diejenigen Wirkprozesse der Kühlwassereinleitung <strong>und</strong> -entnahme genannt<br />
<strong>und</strong> erläutert, die Erhaltungsziele des Natura-2000-Gebietes einzeln oder in Zusammenwirkung<br />
mit anderen Plänen oder Projekten potenziell beeinträchtigen können.<br />
Auswirkungen durch die Einleitung von Kühlwasser (betriebsbedingt)<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Arten durch die verstärkte Einleitung von erwärmten<br />
Süßwasser in den Greifswalder Bodden <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Salinitätsänderungen<br />
Da das Boddenwasser gegenüber dem nördlichen Peenestrom einen mittleren Salzgehaltsunterschied<br />
von 3-4 PSU aufweist, entsteht durch das umgeleitete Peenestromwasser ein negativer<br />
Salzgehaltsgradient, der sich mit der Entfernung von der Einleitstelle durch Vermischung<br />
den Werten des Boddenwassers annähert. Für Organismen mit niedriger osmotischer Resistenz<br />
können zu geringe Salzgehalte den Hypotonietod bedeuten. Gleichzeitig steigt die Sauerstoffsättigung<br />
mit abnehmendem Salzgehalt, so dass durch Umleitung salzärmeren Wassers<br />
die temperaturbedingte Sauerstoffzehrung teilweise ausgeglichen werden kann.<br />
Die mittleren natürlichen Salinitätsschwankungen des südlichen Greifswalder Boddens liegen,<br />
den Messdaten des LUNG M-V (1997-2007) folgend, zwischen 5 <strong>und</strong> 7,9 PSU. Der Jahresgang<br />
des Salzgehaltes wird von IOW (2008B) als relativ konstant <strong>und</strong> ohne ausgeprägten Jahresgang<br />
beschrieben. Dennoch sind bei hohen Abflüssen aus dem Peenestrom oder starken östlichen<br />
Winden mit Einstrom von Ostseewasser extreme Salzgehalte möglich, die zwischen 0,8 <strong>und</strong> 9,3<br />
PSU (Messdaten des LUNG M-V, 1997-2007, GB7, 8, 10, 19) liegen. Für die Spandowerhagener<br />
Wiek liegen die Werte, bedingt durch den Einfluss des Peenestroms, etwas niedriger, zwischen<br />
2,2 <strong>und</strong> 7,3 PSU. Mit wechselnden Ein- <strong>und</strong> Ausstromsituationen zwischen Bodden- <strong>und</strong><br />
Peenestromwasser schwanken auch hier die Salzgehalte innerhalb größerer Spannweiten (1,6<br />
bis 7,8 PSU, vgl. ebd., GB10, P20). Ein Jahresgang kann auch hier den Messdaten nicht entnommen<br />
werden. Auf Gr<strong>und</strong> der natürlichen Schwankungsbereiche <strong>und</strong> der methodischen Unsicherheiten<br />
werden für die folgende Betrachtung Salinitätsänderungen von unter 0,5 PSU als<br />
nicht in der Lage angesehen, ökologisch wirksam zu sein. Negative Salzgradienten größer -0,5<br />
PSU können für marine Arten, welche im Untersuchungsgebiet am Rande ihrer ökologischen<br />
Verbreitungsgrenze leben, langfristig eine erhebliche Lebensraumbeeinträchtigung darstellen.<br />
Die folgende Tabelle stellt die Ausdehnung der Aussüßungsfahnen in den betrachteten Prognosen<br />
der Lastfällen 11 <strong>und</strong> 12 dar:
FROELICH & SPORBECK Seite 145<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 12: Flächenberechnung der Salzkonzentrationsänderungen bei den Lastfällen 11<br />
<strong>und</strong> 12 am Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011)<br />
Differenz der<br />
Salzkonzentration<br />
0,50 - 1,00<br />
PSU<br />
1,01 - 1,50<br />
PSU<br />
1,51 - 2,00<br />
PSU<br />
LF 11 (Winterszenario) in ha LF 12 (Sommerszenario) in ha<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht<br />
437 282 (max. -0,72<br />
PSU)<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht<br />
274 225 (max. -0,81<br />
PSU)<br />
0,1 0 0,1 0<br />
0,1 (max. -1,72<br />
PSU)<br />
0 0,1 (max. -1,65<br />
PSU)<br />
Summe 437 282 274 225<br />
Anmerkung: Ohne Industriehafen <strong>und</strong> Yachthafen<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Arten durch die verstärkte Nährstoffeinleitung<br />
Zusätzliche Nährstoffeinträge durch die Einleitung von Betriebsabwässern sind in solch geringen<br />
Mengen zu erwarten, dass sie in dieser Betrachtung vernachlässigt werden können. Kühlwasser<br />
<strong>und</strong> Abwasser werden somit wirkungsbezogen gemeinsam betrachtet.<br />
Die betriebsbedingte Kühlwassereinleitung in den Greifswalder Bodden kann eine Eutrophierung<br />
im Bereich der Kühlwasserfahne(n) zur Folge haben, die auf unterschiedliche Faktoren<br />
zurückzuführen ist. Durch die Erwärmung wird der Stoffumsatz im Wasserkörper <strong>und</strong> am Boddengr<strong>und</strong><br />
beschleunigt, was insgesamt eutrophierend wirkt. Des Weiteren muss die Umleitung<br />
nährstoffreicherem Peenestromwassers berücksichtigt werden.<br />
Eine Eutrophierung wirkt sich auf den Pflanzenbewuchs einerseits durch erhöhten Sauerstoffverbrauch,<br />
vor allem jedoch durch eine Veränderung des Lichtklimas auf Gr<strong>und</strong> erhöhter Phytoplanktonkonzentrationen<br />
aus. Dabei macht das lebende Plankton nur einen geringen Teil der<br />
Trübstoffe aus. In Küstengewässern werden Trübung <strong>und</strong> Sichttiefe hauptsächlich durch mineralische<br />
Bestandteile <strong>und</strong> Huminstoffe bestimmt (XU 2005, zit. in FRÖHLE et al. 2010). Die Primärproduktion<br />
planktonischer Lebewesen wiederum wird aus dem Wechselspiel von Lichtverfügbarkeit<br />
<strong>und</strong> Nährstoffangebot reguliert, so dass die Selbstbeschattung der<br />
Phytoplanktonbiomasse dessen Produktion begrenzt.<br />
Ein wichtiger Indikator der Phytoplanktonbiomasse ist der Gehalt an Phytoplanktonkohlenstoff<br />
(PPC). Hinsichtlich der Konzentrationsänderungen des Phytoplanktons als Folge der Umlei-<br />
tung von Peenestromwasser <strong>und</strong> der thermisch bedingten Extraproduktion wurden vom TÜV<br />
NORD (2011) die Konzentrationen von Phytoplanktonkohlenstoff (PPC) am Einleitpunkt berechnet.<br />
Generell sind die Phytoplanktongehalte über das ganze Jahr erhöht, folgen jedoch demselben<br />
Trend. Ein deutliches Maximum (Konzentrationserhöhung um 3483 mg/m³, siehe Abb. 3)<br />
wird im Spätsommer erreicht. Am Einleitpunkt werden damit die PPC-Konzentrationen gegenüber<br />
den Boddenwerten bis zu 5fach erhöht (im April).<br />
0
FROELICH & SPORBECK Seite 146<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Abb. 3: Phytoplanktonkohlenstoff-Konzentrationen am Einleitpunkt im IST-Zustand <strong>und</strong><br />
unter Kühlwassereinfluss (Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12). Daten: TÜV Nord 2011, eigene<br />
Darstellung<br />
5000,0<br />
4500,0<br />
4000,0<br />
3500,0<br />
3000,0<br />
2500,0<br />
2000,0<br />
1500,0<br />
1000,0<br />
500,0<br />
0,0<br />
1361,8<br />
225,8<br />
4610,6<br />
1135,6<br />
PPC in mg/m³ (LF 11 <strong>und</strong> 12)<br />
PPC in mg/m³ (IST-Zustand)<br />
JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ<br />
Aufsummiert ergeben sich über das Jahr Umleitungen von ca. 2575 t PPC, wovon 10 % als<br />
totes organisches Material eingetragen werden <strong>und</strong> zu vernachlässigbar geringen Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Phosphorfreisetzungen führen (TÜV NORD 2011). Für den Greifswalder Bodden bedeutet<br />
dies lediglich die Umleitung von Phytoplankton, die Verweilzeit im Ökosystem wird dadurch um<br />
bis zu 1 Tag verlängert (TÜV NORD 2008B). Im erwärmten Areal kommt es zudem zu einer<br />
thermisch induzierten Extraproduktion an PPC von 357 t/a. Bei einer Kohlenstoffproduktion des<br />
Greifswalder Boddens von 90.000-180.000 t/a (EDLER 2008) ist mit der Kühlwassernutzung eine<br />
Zusatzproduktion von maximal 0,4 % verb<strong>und</strong>en, welche als sehr gering <strong>und</strong> ökologisch irrelevant<br />
für das Gesamtsystem eingestuft werden kann.<br />
Ein Zusammenhang besteht zwischen Sichttiefe <strong>und</strong> dem Chl-a-Gehalt als Biomasseindikator<br />
lebenden Planktons. Dieser Zusammenhang ist jedoch sehr variabel <strong>und</strong> schlecht korreliert<br />
(FRÖHLE et al. 2010). Im umweltfachlichen Gutachten zum Gasspeicher Moeckow (vgl. ebd.)<br />
bzw. der Präzisierungsunterlage (FRÖHLE et al. 2011) sind vergleichbare Einleitkonzentrationen<br />
mit den Messwerten von Boddenstationen verglichen wurden. Es ergab sich im Nahbereich<br />
eine Verringerung der Sichttiefe im Mittel um 0,3 m. Die im Gutachten in Ansatz gebrachte<br />
Konzentration an Chl-a beträgt 36 µg/l. Die Berechnungen von TÜV NORD (2011) zu den Auswirkungen<br />
der Kühlwassernutzungen am Standort ergeben über das Jahr gemittelte Chl-a-<br />
Konzentration am Einleitunkt von 35,6 µg/l. Die Schlussfolgerungen von FRÖHLE et al. (2011)<br />
sind also vergleichbar. Auf Gr<strong>und</strong> fehlender Berechnungsmethoden, welche auch Abbauprozesse<br />
<strong>und</strong> andere die Trübung beeinflussende Faktoren berücksichtigen, sind die vom TÜV<br />
NORD (2011) ermittelten flächenmäßigen Quantifizierungen anhand des von BUCKMANN (2011)<br />
erstellten Tracermodells nur bedingt belastbar <strong>und</strong> führen zu einer starken Überschätzung.<br />
Nach MARILIM (2011) ist es derzeit zudem nicht möglich für Fische, Makrophyten <strong>und</strong><br />
Zoobenthos konkrete Schwellenwerte für die Parameter Trübung, Chlorophyllgehalt <strong>und</strong> Nährstoffe<br />
anzugeben. Da das ökologische Wissen über die Auswirkungen dieser Parameter zu
FROELICH & SPORBECK Seite 147<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
begrenzt ist, um für eine Lebensgemeinschaft oder einzelne Arten quantitative Grenzwerte <strong>und</strong><br />
Schwellen festzulegen (vgl. ebd).<br />
In der folgenden Abbildung wird dennoch ein Überblick über die prognostizierte Ausbreitung von<br />
Chorophyll-a im Bodden für den Monat April gegeben.<br />
Abb. 4: Veränderungen des Chlorophyll-a Gehalts unter Kühlwassereinfluss (Lastfälle 11<br />
<strong>und</strong> 12, Monat April), Daten: TÜV Nord 2011 <strong>und</strong> Buckmann 2011, eigene Darstellung<br />
Im April sind die Chlorohyll-a-Werte im Bereich der Kühlwasserfahne auf Gr<strong>und</strong> der hohen Primärproduktion<br />
im Peenestrom überdurchschnittlich hoch. Dabei stellt der doppelte Wert der<br />
natürlichen Konzentration des Boddens (im April 11,3 mg/m³, TÜV Nord 2011, also 22,6 mg/m³)<br />
die Relevanzschwelle der Betrachtung dar. Außerhalb des Industriehafens übersteigt die Konzentration<br />
68 mg/m³ nicht. In der Nähe der Molenköpfe können damit kurzzeitige über die Prognosen<br />
von FRÖHLE et al. (2010) hinausgehende Trübungseffekte nicht ausgeschlossen werden.<br />
In diesem Nahbereich, der in der Abbildung in hellbraun dargestellt ist, sind jedoch keine Makrophytenvorkommen<br />
kartiert (vgl. obige Abb.). Verwendet man die von FRÖHLE et al. (2010) in<br />
Ansatz gebrachte Konzentration an Chl-a von 36 µg/l als Signifikanzschwelle, so sind außerhalb<br />
dieses Bereiches (�40 mg/m 3 ) keine signifikanten Trübungseffekte zu erwarten, die sich von der<br />
natürlichen Trübung der Flachwasserbereiche abgrenzen lassen. Eine Verdriftung der Nährstoff-<br />
<strong>und</strong> Trübungsfahne nach Westen wie in obiger Abbildung dargestellt, ist nur bei lang anhaltenden<br />
östlichen <strong>und</strong> nördlichen Winden möglich. Durch diese zeitliche Einschränkung <strong>und</strong><br />
auf Gr<strong>und</strong> des zusätzlichen, bei der Ermittlung der Konzentrationen nicht berücksichtigten Ab-
FROELICH & SPORBECK Seite 148<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
baus von Phytoplankton durch Einbau in die Nahrungskette, kann ausgeschlossen werden,<br />
Analog dazu ist auch in den Phyatalzonen des Freesendorfer Hakens mit keinen relevanten<br />
Veränderungen des Chlorophyll-a-Gehalts zu rechnen.<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Arten durch eine potenzielle Begünstigung<br />
der Rippenqualle (Mnemiopsis leidyi) durch Kühlwassereinwirkungen<br />
Von IFAÖ (2008 D) wurde analysiert, ob die vor wenigen Jahren in die Ostsee eingewanderte<br />
Rippenqualle (Mnemiopsis leidyi), durch Kühlwasserwirkungen begünstigt werden könnte. Die<br />
Rippenqualle gilt im Ostseeraum als Neozoe, die ursprünglich in Brackwasserbereichen der<br />
Ostküste Nord- <strong>und</strong> Südamerikas beheimatet ist. Die Art wurde erstmalig im Jahr 2006 in der<br />
westlichen Ostsee nachgewiesen (KUBE et al. 2007). Seitdem sind Rippenquallen bis in die<br />
Bottnische See dokumentiert (LEHTINIEMI et al. 2007). Ihre schnelle Reproduktionsfähigkeit <strong>und</strong><br />
ihre sehr breite Toleranz gegenüber unterschiedlichen Salzgehalten <strong>und</strong> Temperaturen führten<br />
zu einer zunehmenden Beachtung der sich sukzessiv immer weiter ausbreitenden Art. Da sich<br />
die Rippenqualle von Planktonorganismen einschließlich Fischeiern <strong>und</strong> Fischlarven ernährt,<br />
wird die Besiedlung der Ostsee kritisch im Hinblick auf Auswirkungen auf den Fischbestand<br />
gesehen.<br />
Mnemiopsis leidyi kann nicht aktiv schwimmen, sondern wird durch Strömungen passiv verdrif-<br />
tet. Mit Hilfe des Ostsee-Zirkulationsmodells des Institutes für Ostseeforschung Warnemünde<br />
wurden mit einem Partikel-Verdriftungsversuch mögliche Ausbreitungswege berechnet. Auch<br />
nach einem Jahr simulierter Drift sind keine Partikel in den Greifswalder Bodden <strong>und</strong> in die<br />
Pommersche Bucht verdriftet worden (KUBE et al. 2007). Bis heute konnten, trotz gezielter Suche,<br />
keine Exemplare der Rippenqualle im Greifswalder Bodden gef<strong>und</strong>en werden (vgl. IFAÖ<br />
2008D). Die Möglichkeit des aktiven Eintrages der Rippenqualle in der Zukunft kann jedoch<br />
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.<br />
Um das invasive Potenzial der Art zu bewerten ist es wichtig, die Populationsdynamik in Abhängigkeit<br />
von limitierenden Faktoren zu erfassen. Die Daten des IOW zeigen auf, dass M.<br />
leidyi in den tieferen Becken der zentralen Ostsee im Winter <strong>und</strong> Frühjahr ausschließlich unter-<br />
halb der haloklinen Sprungschicht zu finden ist. Das hängt damit zusammen, dass die Temperaturen<br />
dort nicht unter 4°C sinken. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass die Tiefenzonen<br />
der zentralen Ostsee eine Art Winterrefugium für M. leidyi bilden. Nach bisherigen<br />
Erkenntnissen wird angenommen, dass die Kombination von niedrigen Temperaturen <strong>und</strong> niedrigen<br />
Salzgehalten, wie sie im Greifswalder Bodden vorherrschen, eine höhere Mortalität, reduzierte<br />
Wachstumsraten <strong>und</strong> infolgedessen geringere Populationsdichten der Art verursachen<br />
(KUBE et al. 2007). Zudem ist fraglich, ob die Rippenqualle im vergleichsweise flachen Greifswalder<br />
Bodden (mittlere Tiefe 5,8 m) Turbulenzen im Herbst <strong>und</strong> Winter in Kombination mit<br />
niedrigen Temperaturen überhaupt überdauern kann (vgl. IFAÖ 2008D).<br />
KUBE et al. (2007) sehen eine signifikante Vermehrung der Rippenqualle daher auf die nordöstlichen<br />
Bereiche der Ostsee begrenzt. Diese Annahme wird durch die Forschungsergebnisse<br />
gestützt. In den flacheren Küstenbereichen war die Ab<strong>und</strong>anz von M. leidyi im Winterhalbjahr<br />
mit weniger als 4 Ind./m³ (Hafen von Kühlungsborn) generell sehr gering. Im Februar sank die<br />
Populationsdichte bis auf weniger als 1 Ind./m³ <strong>und</strong> verblieb bis Mai auf niedrigem Niveau. Die
FROELICH & SPORBECK Seite 149<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Populationsdichte in der Pommerschen Bucht lag im Dezember 2006 bei 0,2 Ind./m³ (KUBE et<br />
al. 2007).<br />
Um die Larvenbestände beispielsweise des Herings zu gefährden, müsste die Population der<br />
Rippenquallen im Frühjahr stärker auftreten. Die Populationsdichten im Schwarzen Meer mit<br />
den bekannten Folgen für das Ökosystem lagen bei ca. 300 Ind./m³. Eine Synchronisation zwischen<br />
einem möglicherweise massenhaften Auftreten der Rippenqualle <strong>und</strong> Heringslarven wird<br />
derzeit nicht befürchtet (IFAÖ 2008D). Es wurde nachgewiesen, dass die Biomasse von M. leidyi<br />
mit der Biomasse des Zooplankton <strong>und</strong> den Gewässertemperaturen korreliert (DEASON & SMAY-<br />
DA 1982). In Abhängigkeit der Dynamik des Mesozooplanktons der Ostsee erreicht die Rippenqualle<br />
ihre höchste Populationsdichte demnach in den Sommermonaten August <strong>und</strong> September.<br />
Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass die Ab<strong>und</strong>anz von M. leidyi in der Ostsee im Juli /<br />
August 2007 sprunghaft anstieg. Eine Beprobung in der Nähe des künstlichen Riffs vor Nienhagen<br />
ergab noch im Juni Ab<strong>und</strong>anzen von nur 0.2 Ind./m³, im Juli schon 20 Ind./m³ <strong>und</strong> im August<br />
50 Ind./m³. Auch am Fähranleger in Warnemünde stiegen die Ab<strong>und</strong>anzen erst Ende Juli /<br />
Anfang August an. In der Kieler Bucht trat das bisher beobachtete Populationsmaximum von bis<br />
zu 200 Ind./m³ im August auf (IOW, online a). Zu diesem Zeitpunkt im Jahr sind die Heringslarven<br />
bereits zu groß, um als Nahrung in Frage zu kommen, selbst bei möglichen Verschiebungen<br />
dieser Entwicklung infolge der Erwärmung durch Kühlwasser.<br />
Des Weiteren ist es wahrscheinlich, dass Nahrungskonkurrenten, wie z. B. Sprotten, Heringe<br />
<strong>und</strong> Ohrenquallen, einen limitierenden Faktor für die massenhafte Verbreitung von M. leidyi<br />
darstellen. Andere bereits in der Ostsee beheimateten Rippenquallen-Arten (insgesamt 4) spielen<br />
bislang keine wesentliche Rolle im Ökosystem (IOW, online a).<br />
Die Rippenqualle vermehrt sich bei Temperaturen oberhalb 12° Celsius, massenhafte Vermehrung<br />
findet erst ab einer Temperatur von deutlich über 20° Celsius statt. Die Temperaturen im<br />
Bereich vor <strong>Lubmin</strong> liegen nach milden Wintern im März bis Mai bei durchschnittlich 4 bis 8°<br />
Celsius. Am Industriehafen im Bereich des Kühlwassereintritts mit einer um max. 7 Kelvin erhöhten<br />
Wassertemperatur kann somit die Temperatur von 12° Celsius erreicht werden, jedoch<br />
wird der kritische Wert von 20°Celsius nicht überschritten. Die aufgeführten Frühjahrstemperaturen<br />
im Bereich der Kühlwasserfahne <strong>und</strong> die oben dargestellte fehlende Eignung des Greifswalder<br />
Boddens lassen somit keine signifikante Beeinträchtigung von Planktonorganismen wie<br />
Fischeiern oder Muschellarven durch die Rippenqualle erwarten.<br />
Laut IOW (2008B) ist zudem die Kühlwasserfahne 3 räumlich <strong>und</strong> zeitlich zu variabel, als dass<br />
sie eine Überwinterungszelle für die Rippenqualle darstellen könnte. Sie bildet keine Wirbelstrukturen<br />
aus, in welchen sich treibende Organismen dauerhaft (z. B. über die Wintermonate)<br />
aufhalten können. Da die Fahne stets von der Einleitstelle weg gerichtet ist, würden planktische<br />
Organismen stets innerhalb kurzer Zeit in das sich rasch abkühlende Oberflächenwasser des<br />
zentralen Greifswalder Boddens getragen werden. Des Weiteren wird betont, dass durch die<br />
Kühlwasserfahne nicht die Bedingungen geschaffen werden, die eine Massenvermehrung begünstigen.<br />
3 Die Aussagen von IOW (2008b) wurden für die KWF des damals geplanten Steinkohlekraftwerks Greifswald einschließlich<br />
der beiden Summationsvorhaben <strong>GuD</strong> I <strong>und</strong> II getroffen, die gr<strong>und</strong>sätzlichen Aussagen sind auf die KWF<br />
von <strong>GuD</strong> II, <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> EWE übertragbar.
FROELICH & SPORBECK Seite 150<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die sommerlichen Ab<strong>und</strong>anzen der Rippenqualle im Greifswalder Bodden hängen in erster<br />
Linie von den großräumigen Temperaturverhältnissen im Greifswalder Bodden ab. Die maximalen<br />
Temperaturen im zentralen Greifswalder Bodden liegen derzeit in besonders warmen Jahren<br />
um 23°C. Bei diesen Temperaturen kann es ohne Kühlwassereinfluss im Greifswalder Bodden<br />
zur Vermehrung der Rippenqualle kommen, sofern eine Saatpopulation aus der Ostsee<br />
eingetragen wird. Die Kühlwasserfahne wird nach den Modellergebnissen die Maximaltemperaturen<br />
im Greifswalder Bodden nicht dauerhaft verändern. In den bislang von M. leidyi besiedel-<br />
ten Regionen wie dem Kaspischen <strong>und</strong> Schwarzen Meer liegen die Temperaturmaxima im<br />
Sommer etwas höher, im Bereich von 24-28°C. Temperaturen über 24°C werden im Maximallastszenario<br />
nur im inneren Bereich der Fahne erreicht, <strong>und</strong> dehnen sich nur sporadisch für<br />
einige St<strong>und</strong>en wenige Kilometer in Richtung des Zentralen Boddens aus. Eine deutliche Beeinflussung<br />
der Vermehrungsrate mit einem sichtbaren Effekt auf die Gesamtab<strong>und</strong>anzen ist bei<br />
diesen kurzen Ereignissen kaum zu erwarten (IOW 2008B).<br />
Aus den genannten Gründen wird sowohl für den Heringsbestand als auch für andere Fischbestände<br />
der westlichen Ostsee keine vorhabensbedingte Gefährdung durch die Rippenqualle<br />
prognostiziert (IOW 2008A).<br />
� Beeinträchtigung von Rastvögeln durch verspätete Eisflucht infolge der Einleitung<br />
erwärmten Kühlwassers in den Greifswalder Bodden<br />
In kalten Wintern, in denen die Flachwasserzonen zufrieren, werden Teilbereiche am Industriehafen<br />
<strong>und</strong> im Bodden durch die Temperaturerhöhung der beiden <strong>GuD</strong> freigehalten. Das hat<br />
zunächst einen Anziehungseffekt für piscivore <strong>und</strong> auch pflanzenfressende Vogelarten. Doch ist<br />
der Nahrungsvorrat für die Pflanzenfresser sehr schnell erschöpft <strong>und</strong> eine rechtzeitige Eisflucht<br />
kann dadurch soweit verzögert werden, dass für einige Tiere ein Ausweichen auf eis- <strong>und</strong><br />
schneefreie Nahrungsflächen unmöglich wird.<br />
Auch unter natürlichen Verhältnissen kommt es im Greifswalder Bodden aufgr<strong>und</strong> der Salinität,<br />
der Größe des Wasserkörpers, der Strömungen <strong>und</strong> des Wasseraustausches mit der Ostsee<br />
unregelmäßig zu Vereisungen, die erst nach der Vereisung der inländischen Binnengewässer<br />
einsetzt. Der fehlende Salzgehalt, die deutlich geringere exponierte Lage <strong>und</strong> der zunehmende<br />
kontinentale Einfluss führen dazu, dass die südlich der Küste gelegenen Binnengewässer<br />
Nordostdeutschlands in sehr kalten Wintern vor dem Greifswalder Bodden zufrieren.<br />
Wintergäste müssen an solche Wetterphänomene sehr gut angepasst sein <strong>und</strong> reagieren daher<br />
durch eine sogenannte Eisflucht. Eisfluchtbewegungen werden beispielsweise für die piscivoren<br />
Sägerarten Zwerg- <strong>und</strong> Gänsesäger genannt (GLUTZ VON BLOTZHEIM 1992, Bd. 3, S. 418, 470),<br />
die beide im Bereich <strong>Lubmin</strong> überwintern. Ein analoges Eisfluchtverhalten ist für jede im <strong>Lubmin</strong>er<br />
Raum relevante überwinternde Wasservogelart bekannt.<br />
Eine regelrechte Fallenwirkung ist daher insgesamt unwahrscheinlich <strong>und</strong> kann lediglich für<br />
wenige, möglicherweise aufgr<strong>und</strong> Alter oder Krankheit bereits geschwächte Vogelindividuen<br />
angenommen werden, wie dies natürlicherweise auch ohne eine längere Zeit eisfreie Kühlwasserfahne<br />
der Fall wäre. Einige piscivore Vögel können zudem in starken Wintern unter Reduzierung<br />
ihrer Fluchtdistanzen auch auf eisfrei gehaltene Schifffahrtsrinnen ausweichen, so dass für<br />
sie neben der Eisflucht optional auch ein Verbleiben im Greifswalder Bodden möglich erscheint.
FROELICH & SPORBECK Seite 151<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die pflanzenfressenden Schwäne nutzen als Äsungsfläche Agrarflächen, so dass auch für sie<br />
alternative Nahrungshabitate zur Verfügung stehen.<br />
Insgesamt ist festzustellen, dass das „Eisfluchtproblem“ nur wenige Vogelindividuen betreffen<br />
kann <strong>und</strong> ohne FFH-Relevanz ist.<br />
� erhöhte Gefahr von Krankheitsausbrüchen (Botulismus) bei Vögeln infolge der Einleitung<br />
erwärmten Kühlwassers in den Greifswalder Bodden<br />
Botulismus wird durch die Vergiftung mit dem Botulinum-Toxin hervorgerufen, das von dem<br />
Bakterium Clostridium botulinum gebildet wird. Es handelt sich um eines der wirksamsten von<br />
Bakterien gebildeten Gifte. Das Bakterium ist im Erdreich sowie in Gewässern fast überall verbreitet,<br />
ist allerdings nur unter bestimmten Umständen in der Lage, sich zu teilen <strong>und</strong> Gift zu<br />
bilden. Optimale Temperaturen für die Vermehrung liegen im Bereich von 25 - 30 Grad Celsius.<br />
Voraussetzung ist das Fehlen von Sauerstoff im Bodensubstrat sowie das Vorhandensein von<br />
eiweißhaltigen Nährsubstraten.<br />
In fast allen bekannten Gebieten mit Botulismus-Geschehen bei Vögeln handelt es sich um<br />
flache, stehende oder strömungsarme Gewässer, die stark erwärmt <strong>und</strong> bei denen eine hohe<br />
Biomassebelastung <strong>und</strong> Faulschlammschichten vorhanden waren. Die bislang dokumentierten<br />
Botulismus-Fälle betrafen daher fast ausschließlich eutrophe Binnengewässer, die bei ausgesprochenen<br />
Niedrigwasserständen temporär von Austauschverhältnissen <strong>und</strong> Frischwasserzufuhr<br />
abgetrennt waren.<br />
Als Voraussetzung für das Wachstum von vermehrungsfähigen Bakterien <strong>und</strong> der Bildung von<br />
Toxinen müssen gleichzeitig hohe Temperaturen, anaerobe Verhältnisse <strong>und</strong> eiweißhaltige<br />
Nährsubstrate vorhanden sein.<br />
Da die Produktion von Botulinumtoxinen bei einer Temperatur ab 20°C bereits nach wenigen<br />
St<strong>und</strong>en einsetzt <strong>und</strong> die Konzentration bei längerer Bebrütungsdauer rapide ansteigt, kann das<br />
temperaturabhängige Botulismusrisiko ab 20°C als immanent betrachtet werden. Eine Statusquo-Betrachtung<br />
des Greifswalder Boddens ergibt, dass die Mindest- <strong>und</strong> Optimaltemperaturen<br />
für die Produktion von Botulinumtoxinen auch bereits natürlicherweise auftreten, vor allem in<br />
den Flachwasserbereichen. Bedingt durch die relativ unkritischen Sauerstoffwerte blieben Botulismusausbrüche<br />
im Greifswalder Bodden in der Vergangenheit aus, obwohl die Mindest- <strong>und</strong><br />
auch optimalen Temperaturen für das Wachstum von C. botulinum zeitweise gegeben waren.<br />
Die Kühlwassereinleitung hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die Sauerstoffverhältnisse in<br />
den relevanten Flachwasserbereichen durch eine Ausbildung von Dichtesprungschichten. Sowohl<br />
BUCKMANN (2011) als auch IOW (2008B) schließen eine Schichtung auf den innerhalb der<br />
Kühlwasserfahne ausgedehnten Flachwassergebieten von vornherein aus. Die ablandig blasenden<br />
Winde der Hauptwindrichtung SW bis W sorgen beständig für eine Durchmischung der<br />
Wasserschichten auf den Flachwassergebieten. Im Greifswalder Bodden wirken die geringe<br />
Tiefe, die gute Durchmischung (Turbulenz durch Seegang <strong>und</strong> Wind) <strong>und</strong> der häufige Austausch<br />
mit Oberflächenwasser aus der Pommerschen Bucht (Strömung) begünstigend auf den<br />
Sauerstoffgehalt. Eine vorhabensbedingte Risikozunahme bzw. Eintrittswahrscheinlichkeit von<br />
Anoxie in den relevanten Flachwasserbereichen kann nicht angenommen werden (vgl. auch<br />
TUSCHEWITZKI 2008, BACHOR et al. 2008, VIETTINGHOFF et al. 1991, HÜBEL et al. 1995). Eine
FROELICH & SPORBECK Seite 152<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
signifikante vorhabensbedingte Risikozunahme wird anhand der Parameter Temperatur <strong>und</strong><br />
Sauerstoffverhältnisse daher nicht abgeleitet. Zusammenfassend kann ein Ausbruch von Botulismus<br />
weder aktuell noch bei Betrieb des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> vollkommen ausgeschlossen werden. Die<br />
fachlichen Argumente sprechen jedoch gegen das vorhabensinduzierte massenhafte Auftreten<br />
der Krankheit. Es sind auch bei einer Umsetzung des Vorhabens weiterhin eher suboptimale<br />
Bedingungen für die Entwicklung des Bakteriums Clostridium botulinum gegeben. Vorhabens-<br />
bedingt wird es nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Botulismusrisikos kommen. Erhebliche<br />
Gebietsbeeinträchtigungen können daher ausgeschlossen werden.<br />
Das im Bereich der Fischschutzanlage (vgl. Kap. 3.2) anfallende Rechengut wird abgefiltert <strong>und</strong><br />
umweltgerecht entsorgt. Es gelangt somit keine abgestorbene Biomasse durch Rechengut in<br />
den Industriehafen <strong>und</strong> in den Greifswalder Bodden, die nachfolgend das Botulismusrisiko erhöhen<br />
könnte.<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch Veränderung<br />
der Strömungsverhältnisse <strong>und</strong> dadurch evtl. hervorgerufene Veränderung der Sedimentations-<br />
<strong>und</strong> Erosionsvorgänge<br />
Die Küstendynamik ist im Bereich der Südküste des Greifswalder Boddens durch die Molenbauwerke<br />
des Industriehafens <strong>Lubmin</strong> sowie durch die Verlängerung, Verbreiterung <strong>und</strong> Vertiefung<br />
der Auslaufrinne bis zur 7 m - Isobathe gestört. Die Eingriffe wurden bereits im Rahmen<br />
des Baus <strong>und</strong> Betriebs des ehemaligen Kernkraftwerks vorgenommen <strong>und</strong> sind somit als Vorbelastungen<br />
im Gebiet zu werten (BUCKMANN 2008).<br />
Das Kühlwasser erzeugt außer im Nahbereich des Molenbauwerkes des Industriehafens <strong>Lubmin</strong><br />
sowie im Einflussbereich des Ansaugstromes keine signifikant erhöhten Strömungsgeschwindigkeiten.<br />
Es ergibt sich weder nach dem derzeitigen Stand der Boddenforschung noch<br />
aufgr<strong>und</strong> der Kühlwasserprognosen ein Anhalt auf Auswirkungen auf sedimentologische Prozesse.<br />
Ob die Kühlwasserfahnen zu einer biologisch begründbaren Veränderung der Lagestabilität<br />
von Sedimenten auf den Flachwassergebieten führen können, ist auf dem Stand der meeresbiologischen<br />
Forschung derzeit nicht entscheidbar (vgl. BUCKMANN 2011). Vorhabensbedingt<br />
sind nach derzeitigem Wissensstand somit keine Lebensraumveränderungen durch Sedimentations-<br />
oder Abrasionsvorgänge in Folge veränderter Strömungsverhältnisse zu erwarten.<br />
Durch eine verringerte Schutzfunktion der Vegetation in Folge der Beeinträchtigungen submerser<br />
Makrophyten sind ebenfalls keine Abrasionsvorgänge zu erwarten, die Küstenlebensräume<br />
schädigen können.<br />
Da etwaige Absterbevorgänge von Makrophyten (s. o.) nur partiell <strong>und</strong> zeitlich befristet bei sehr<br />
ungünstigen Witterungsbedingungen zu erwarten sind <strong>und</strong> eine Regeneration der Vegetation im<br />
Folgejahr erfolgen kann, können potenzielle Erosionsvorgänge aufgr<strong>und</strong> fehlender Schutzfunktion<br />
der Vegetation auch nur zeitlich sehr begrenzt stattfinden. Zu berücksichtigen ist, dass die<br />
submerse Vegetation an sich sehr erosionsempfindlich ist. Das Vorhandensein der Vegetation<br />
<strong>und</strong> auch das schlickige Bodensubstrat deuten insgesamt nicht auf Erosionsprozesse hin (GOS-<br />
SELCK, mündl. Auskunft 16.08.2007).
FROELICH & SPORBECK Seite 153<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Beeinträchtigung der Pflanzen- <strong>und</strong> Tierwelt trocken-warmer Standorte durch Veränderung<br />
des Mikroklimas (erhöhte Luftfeuchte, Nebelbildung, Lufttemperaturregime)<br />
aufgr<strong>und</strong> signifikant erhöhter Verdunstungsraten <strong>und</strong> Wärmeabstrahlung in<br />
den Flachwassergebieten<br />
Betriebsbedingt wird das Überstreichen der Flachwasserbereiche des Greifswalder Boddens im<br />
Beurteilungsraum durch erwärmtes Kühlwasser prognostiziert. Ausgehend von der Kühlwasserfahne<br />
ist dort von einer Erhöhung der Verdunstungsfahnen <strong>und</strong> der Wärmeabstrahlung auszugehen,<br />
was zu einer Veränderung des Mikroklimas führen kann (erhöhte Luftfeuchte, Nebelbildung,<br />
Lufttemperaturregime). Diese mikroklimatischen Veränderungen werden auf Gr<strong>und</strong> der<br />
Ausprägung der Flachwasserbereiche in erster Linie vor den Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> dem<br />
Struck wirksam werden, dort aber lokal begrenzt sein. Sie drücken sich in kühl-feuchteren<br />
Standortbedingungen aus. Die veränderten Standortbedingungen sind eher im Winterhalbjahr<br />
<strong>und</strong> in den Übergangszeiten <strong>und</strong> in geringem Maße im Sommerhalbjahr wirksam, also eher<br />
außerhalb der Vegetationsperiode, der jahreszeitlichen Flugphasen wärmeliebender Insekten<br />
bzw. Aktivitätsphasen überwinternder Tiere wie Reptilien.<br />
Für folgende weitere Wirkprozesse erfolgt die arten- bzw. lebensraumspezifische Erläuterung<br />
<strong>und</strong> Bewertung in Kap. 5.3 bzw. 5.4:<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch Temperaturveränderungen<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch Sauerstoffmangelsituationen<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Arten <strong>und</strong> Lebensraumtypen durch das Zusammenwirken<br />
der Faktoren<br />
Auswirkungen durch die Entnahme von Kühlwasser<br />
Wie bereits in Kap. 5.1 dargestellt ist aufgr<strong>und</strong> der großen natürlichen Schwankungsbreite <strong>und</strong><br />
Dynamik der Wasserparameter im Bereich der Spandowerhagener Wiek eine verlässliche Modellierung<br />
der Effekte der Kühlwasserentnahme nicht möglich. Die Prognosen von BUCKMANN<br />
(2011, Kap. 9) zu Veränderungen der Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehalte als Folge der Änderungen<br />
des Strömungsregimes, basieren auf umfangreichen Messwertanalysen aus den Monitoringprogrammen<br />
des LUNG <strong>und</strong> der <strong>EWN</strong> <strong>und</strong> stellen damit dennoch eine belastbare Beurteilungsgr<strong>und</strong>lage<br />
dar.<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch betriebsbedingte<br />
Trübungen, hervorgerufen durch die Saugkraft <strong>und</strong> verstärkte Turbulenzen<br />
Eine relevante Verdriftung von Sedimenten aus der Spandowerhagener Wiek in den Greifswalder<br />
Bodden in Folge der Kühlwasserentnahme ist bei vorheriger Instandsetzung der Einlaufrinne<br />
nicht zu erwarten. Die Ertüchtigung der Einlaufrinne ist nicht Teil des hier untersuchten Vorhabens<br />
<strong>und</strong> wird als standortverbessernde Maßnahme vorausgesetzt. Da<br />
Sedimentationsfahnen auch von Natur aus vorkommen können, sind zeitweilige Verdriftungsvorgänge<br />
relativ harmlos gegenüber einem Dauereintrag, der vorhabensbedingt nicht zu erwarten<br />
ist (GOSSELCK mdl. 2007).
FROELICH & SPORBECK Seite 154<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Weitere Wirkprozesse werden lebensraum- <strong>und</strong> artenbezogen erläutert:<br />
� Verlust von Phyto- <strong>und</strong> Zooplankton (Lebensraumtyp Ästuarien) als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage<br />
von Zielarten des Anhangs II bzw. Verlust von Fischen <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäulern<br />
des Anhangs II der FFH-Richtlinie bzw. charakteristischen Arten des Lebensraumtyps<br />
Ästuarien im Bereich der Spandowerhagener Wiek in Folge der Kühlwasserentnahme<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch betriebsbedingte<br />
Änderungen der Strömungsverhältnisse <strong>und</strong> der Salzkonzentrationen in der<br />
Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> im Peenestrom, hervorgerufen durch die Saugkraft<br />
<strong>und</strong> verstärkte Turbulenzen<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch Barrierewirkungen<br />
durch veränderte Strömungen im Peenestrom bzw. in der Spandowerhagener<br />
Wiek<br />
5.2.6 Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Betriebsbedingte Auswirkungen können durch die Kraftwerksemissionen auftreten, insbesondere<br />
dann, wenn die Luftschadstoffe gasförmig, als Partikel oder in Niederschlag <strong>und</strong> Luftfeuchtigkeit<br />
gelöst in die Ökosysteme eingetragen werden. Veränderungen im Vegetationsbestand der<br />
Lebensraumtypen des Anhangs I bzw. der Tierartenzusammensetzung sind als Folge von Eutrophierung<br />
durch den Eintrag von Nährstoffen (Stickstoff) <strong>und</strong> Versauerungsprozessen durch<br />
Säurebilder (Stickstoff <strong>und</strong> Schwefeldioxid) zu erwarten (mittelbare Beeinträchtigungen). Heute<br />
überwiegt an den meisten Standorten die Problematik der Eutrophierung gegenüber der Versauerung.<br />
In den vergangenen Jahren sind an vielen Standorten die Schwefeleinträge rückläufig,<br />
während die Stickstoffeinträge sich nicht oder nur unwesentlich geändert haben (vgl. NAGEL<br />
et al. 2004). Berücksichtigt werden im Folgenden die vom Kraftwerk emittierten Stoffe Schwefeloxide<br />
als SO2 sowie Stickoxide als NO2 <strong>und</strong> NO.<br />
Gegenüber Nährstoffeinträgen empfindliche Ökosysteme können sehr sensibel auf eine Zunahme<br />
insbesondere von Stickstoffeinträgen reagieren. Dabei wirken die Luftschadstoffe überwiegend<br />
indirekt auf Pflanzen, vor allem über den Wirkpfad Boden. Stickstoffverbindungen sind<br />
primär düngend <strong>und</strong> modifizieren damit Nährstoffbilanzen in Pflanze <strong>und</strong> Boden. Damit einher<br />
geht eine Veränderung der interspezifischen Konkurrenz, was bei N-limitierten Biotopen zum<br />
Verschwinden von konkurrenzschwachen, meist seltenen <strong>und</strong> gefährdeten Arten oder der gesamten<br />
Pflanzengesellschaft führen kann. Zu den stickstoffempfindlichen Ökosystemen zählen<br />
Wälder, Heiden <strong>und</strong> Moore sowie bestimmte Grünland- <strong>und</strong> Gewässertypen (AK ERMITTLUNG<br />
UND BEWERTUNG VON STICKSTOFFEINTRÄGEN 2006, BOBBINK et al. 2011).<br />
Die Wirkintensität der Luftschadstoffe wird sehr stark von der Speicherfähigkeit der Ökosystembestandteile<br />
beeinflusst. Bäume mit langen Umtriebszeiten akkumulieren Schadstoffe über längere<br />
Zeiträume als die meisten krautigen Pflanzen. Waldökosysteme sind daher in der Regel<br />
empfindlich gegenüber Depositionen. In aquatischen Biotopen wirken Verdünnungseffekte der<br />
Schadstoffanreicherung entgegen. In Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität erfolgt eine
FROELICH & SPORBECK Seite 155<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Auswaschung der Schadstoffe mit dem Sickerwasser, so dass hieraus Belastungen für das<br />
Gr<strong>und</strong>wasser entstehen können.<br />
Hinzu kommt, dass die verschiedenen Ökosystemklassen (Wald, Wasser, Offenland) unterschiedliche<br />
Filter für Luftschadstoffe darstellen. Höher in den Luftraum ragende Pflanzen, insbesondere<br />
Bäume, sind anderen mikroklimatischen Bedingungen, u. a. höherem Luftwechsel<br />
<strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en erhöhtem Massenstrom an Schadstoffen ausgesetzt als niedrigwachsende<br />
Pflanzenarten (GUDERIAN 2001). Dementsprechend sind in Wäldern relativ hohe <strong>und</strong> in Offenlandflächen<br />
(z. B. Grünländer) bereits deutlich niedrigere Depositionen zu konstatieren. Im<br />
Vergleich zu terrestrischen Biotopen weisen Gewässerbiotope die geringsten Filtereigenschaften<br />
<strong>und</strong> damit auch deutlich niedrigere Belastungen durch Luftschadstoffe auf.<br />
� Veränderungen im Vegetationsbestand von Lebensraumtypen des Anhangs I <strong>und</strong><br />
infolge dessen Veränderung der Zusammensetzung von Tierartengesellschaften<br />
mit Auswirkungen auf FFH-relevante Arten durch Eutrophierung aufgr<strong>und</strong> von<br />
Nährstoffdepositionen über den Luftpfad (betriebsbedingt)<br />
Zur Bewertung eutrophierender Stickstoffeinträge können so genannte „Critical Loads" (CL)<br />
herangezogen werden. Als „Critical Loads“ werden diejenigen Luftschadstoffdepositionen bezeichnet,<br />
bei deren Unterschreitung nach dem derzeitigen Kenntnisstand auch langfristig keine<br />
signifikant schädlichen Effekte an Ökosystemen <strong>und</strong> Teilen davon zu erwarten sind (LANDES-<br />
UMWELTAMT BRANDENBURG 2008). Sie besitzen damit den Charakter von Effektschwellen, bei<br />
deren Überschreitung langfristig Veränderungen möglich sind, sie definieren aber nicht zwangsläufig<br />
eine Erheblichkeitsschwelle (KIFL 2008). „In der Regel besteht jedoch eine mehr oder<br />
weniger große Sicherheitstoleranz, innerhalb derer auch bei Überschreitungen des Critical<br />
Loads noch nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist. Ob <strong>und</strong> vor allem wann bei<br />
seiner Überschreitung eine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist, ist im Einzelfall gutachterlich<br />
zu bewerten“ (ÖKO-DATA 2011, S. 32). Zur Beurteilung der FFH-Verträglichkeit wird<br />
die zukünftige, nach der Realisierung des Vorhabens zu erwartende Gesamtstickstoffbelastung<br />
im Wirkraum innerhalb des Schutzgebietes mit den jeweiligen Critical Loads verglichen. Da die<br />
Critical Loads auf einem langfristigen, vorsorglichen Stabilitätsansatz basieren, sind sie gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
mit dem Schutzkonzept der FFH-Richtlinie kompatibel (BALLA et al. 2010).<br />
Für die Gesamtbelastung an einem Standort ist dabei neben der vorhabensbezogenen Zusatzbelastung<br />
die Vorbelastung relevant. Diese ergibt sich aus der atmosphärischen Hintergr<strong>und</strong>belastung<br />
sowie den bestehenden Emittenten am Standort. Die atmosphärische Hintergr<strong>und</strong>belastung<br />
kann den Datensätzen des Umweltb<strong>und</strong>esamtes aus dem Jahr 2007 (UBA 2011)<br />
entnommen werden. Obwohl bestehende Emittenten in den Messungen der Hintergr<strong>und</strong>belastung<br />
des UBA prinzipiell enthalten sind, machen sie im Rasterquadrat nur einen winzigen Punkt<br />
aus <strong>und</strong> liegen im Nahbereich wesentlich höher (vgl. LBM 2011). Um sichere Aussagen zur<br />
tatsächlichen Belastung im Untersuchungsgebiet zu erhalten, werden sie der Hintergr<strong>und</strong>deposition<br />
zuaddiert. So wird die Gasanlandestation (WINGAS), welche seit November 2011 in Betrieb<br />
ist, ebenfalls als Vorbelastung berücksichtigt. Entsprechend wird die Vorbelastung als<br />
Summe folgender Stickstoffdepositionen berechnet:<br />
� Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011)<br />
� Ersatzwärmeerzeuger (<strong>EWN</strong>)
FROELICH & SPORBECK Seite 156<br />
� Gasanlandestation (WINGAS).<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Von der bereits in Betrieb befindlichen Biodieselanlage (<strong>Lubmin</strong> Oil) liegen keine Depositionsdaten<br />
vor.<br />
Anlagen, deren Zeitpunkt der Inbetriebnahme nicht abzuschätzen ist, fließen mit ihren gleichartigen<br />
Wirkungen (Wechselwirkungen) als sonstige Quellen in die Zusatzbelastung mit ein. In<br />
dieser Unterlage werden die voraussichtlichen Depositionen durch das Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> II (EnBW) als sonstige Quelle angerechnet <strong>und</strong> somit neben den Depositionen des<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> bei der Zusatzbelastung berücksichtigt. Bei dem Wirkfaktor „Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge“<br />
wird daher das <strong>GuD</strong> II abweichend zur Bewertung der anderen Wirkfaktoren nicht als<br />
Vorbelastung sondern als Zusatzbelastung aufgefasst <strong>und</strong> bewertet. Hiermit wird den strengen<br />
rechtlichen Anforderungen an die summative Betrachtung <strong>und</strong> Beurteilung der Depositionen<br />
Rechnung getragen.<br />
Eine eindeutige Dosis-Wirkungs-Prognose von projektbedingten Einträgen in niedrigen Größenordnungen<br />
ist derzeit nicht verfügbar. Fachlich anerkannt ist das Prüfschema nach UHL et<br />
al. (2009), nach dem eine Bagatellschwelle von 3 % des Critical Loads definiert ist. Ob die Bagatellschwelle<br />
der Erheblichkeitsschwelle gleich zu setzen ist, steht noch zur Klärung aus.<br />
Für die Bewertung der Belastungen von FFH-LRT im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte<br />
Stickstoffdepositionen wird dem Prüfschema von UHL et al. (2009) gefolgt <strong>und</strong> geprüft, ob<br />
� die Gesamtbelastung (GB) am Standort den Critical Load (CL) übersteigt (GB>CL) <strong>und</strong><br />
� die Zusatzbelastung (ZB) mehr als 3 % des betreffenden Critical Loads ausmacht<br />
(ZB>3 % des CL).<br />
Sind beide Kriterien erfüllt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Lebensraumtyp negativ<br />
beeinträchtigt wird <strong>und</strong> Veränderungen der Standortbedingungen mit Auswirkungen auf Vitalität<br />
der Organismen, Artenzahl <strong>und</strong> Artenstruktur auftreten.<br />
Zur Festlegung von relevanten Critical Loads werden europaweit verschiedene Ansätze angewendet.<br />
Auf der einen Seite werden so genannte empirische Critical Loads genutzt, die anhand<br />
von Feld- <strong>und</strong> Laboruntersuchungen ermittelt werden <strong>und</strong> auf der anderen Seite so genannte<br />
modellierte CL, die unter Verwendung von Massen-Bilanz-Modellen standortspezifische Belastungsschwellen<br />
errechnen.<br />
Modellierte Critical Loads lassen sich in Deutschland zum Beispiel mit dem BERN-Modell der<br />
Firma ÖKO-DATA berechnen. Vorteil dieser CL-Berechnung ist der höhere Differenzierungsgrad<br />
gegenüber den empirischen CLs, da die jeweiligen spezifischen Verhältnisse am Standort (Boden-<br />
<strong>und</strong> Vegetationsparameter) berücksichtigt werden.<br />
Um flächenspezifische Critical Loads zu erhalten, wurden daher für empfindliche FFH-<br />
Lebensräume (FFH-LRT) im Bereich des FFH-Gebietes Schwellenwerte mit Hilfe des „Simple<br />
Mass Balance-Modells“ sowie mit einer Kombination der beiden ökologisch-mathematischen<br />
Modelle BERN <strong>und</strong> DECOMP ermittelt (ÖKO-DATA 2011). Die Auswahl stickstoffempfindlicher<br />
Lebensraumtypen erfolgte anhand der in den Vollzugshilfen des LAI (2009) <strong>und</strong> des LANDES-<br />
UMWELTAMTES BRANDENBURG (2008) sowie in BOBBINK et al. (2011) angegebenen stickstoffemp-
FROELICH & SPORBECK Seite 157<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
findlichen Ökosysteme. Als stickstoffunempfindlich eingestufte Lebensraumtypen werden nachfolgend<br />
nicht weiter betrachtet.<br />
Die von ÖKO-DATA ermittelten CL spiegeln den derzeitigen Erkenntnisstand zu den standortspezifischen<br />
Schwellenwerten wider <strong>und</strong> werden daher in der Beurteilung berücksichtigt. Der<br />
Belastungsgrenzwert ist dabei auf die empfindlichste Ausprägung des Lebensraumtyps ausgerichtet.<br />
Bei Einhaltung bleibt das Potenzial zur Selbstregenerierung der natürlichen Pflanzengesellschaft<br />
vollständig erhalten. Diese hervorragenden Erhaltungszustände sind jedoch bei keinem<br />
der untersuchten Lebensraumtypen vorhanden. Entsprechend sind die errechneten<br />
Schwellen als höchst vorsorgliche Belastungsgrenzen zu sehen.<br />
Die nachfolgende Tabelle zeigt die berechneten Critical Loads für die stickstoffempfindlichen<br />
Lebensraumtypen sowie für die Anhang II - Art Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii).<br />
Tab. 13: Berechnete „Critical Loads“ für stickstoffempfindliche FFH-Lebensraumtypen<br />
sowie für die Art Liparis loeselii im potenziellen Wirkbereich des Vorhabens<br />
LRT<br />
Vegetationsgesellschaft im Zielzustand<br />
bzw. Artvorkommen<br />
Bodenform<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Salzgrünland 21,2<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor 21,2<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor 21,2<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor 21,2<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Salzgrünland 21,2<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 20,7<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 20,7<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 20,7<br />
1330<br />
Oenantho-Juncetum maritimi (Potentilla-<br />
Subass.)<br />
Geländeerhebung im Küstenüberflutungsmoor 18,7<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 20,7<br />
2110 Spergularietum salinae Sandstrand 17,9<br />
2110 Spergularietum salinae Boddenstrand 17,9<br />
2110 Spergularietum salinae Primärdüne, Ostseeküste 17,9<br />
2120 Elymo-Ammophiletum arenariae Weißdüne, Ostseeküste 13,4<br />
2120 Spergularietum salinae Boddenstrand 17,9<br />
2120 Spergularietum salinae Boddenstrand 17,9<br />
2130 Polygalacto-Festucetum rubrae Sande sickerwasserbestimmt 8,9<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 19,3<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande sickerwasserbestimmt 13,0<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 19,3<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Niedermoore sandunterlagert 13,4<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 9,7
LRT<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 158<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vegetationsgesellschaft im Zielzustand<br />
bzw. Artvorkommen<br />
Bodenform<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande sickerwasserbestimmt 9,1<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande sickerwasserbestimmt 9,1<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 9,7<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 9,7<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 9,7<br />
2180 Empetro nigri-Pinetum sylvestris Sande sickerwasserbestimmt 5,5<br />
2180 Empetro nigri-Pinetum sylvestris Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 5,4<br />
2180 Pyrolo-Pinetum sylvestris Sande sickerwasserbestimmt 11,7<br />
2180 Pyrolo-Pinetum sylvestris Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 11,2<br />
2180 Cladonio-Pinetum sylvestris (typ. Subass.) Sande sickerwasserbestimmt 4,7<br />
2180 Cladonio-Pinetum sylvestris (typ. Subass.) anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 5,5<br />
2180 Agrostio-Populetum tremulae Sande sickerwasserbestimmt 5,0<br />
2180 Agrostio-Populetum tremulae anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 6,5<br />
2190 Eriophoro-Sphagnetum recurvi Sande sickerwasserbestimmt 8,0<br />
2190 Salicetum auritae Sande sickerwasserbestimmt 16,5<br />
6230 Polygalo-Nardetum strictae Sande sickerwasserbestimmt 10,2<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi Niedermoore sandunterlagert 14,4<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 10,0<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 9,4<br />
6410 Junco-Molinietum Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 9,2<br />
7140 Salicetum auritae Niedermoore sandunterlagert 24,3<br />
7140 Salicetum auritae Niedermoore sandunterlagert 23,6<br />
9110 Holco mollis-Quercetum (robori-petraeae) Niedermoore sandunterlagert 18,5<br />
9110 Holco mollis-Quercetum (robori-petraeae) Sande sickerwasserbestimmt 11,5<br />
9110 Holco mollis-Quercetum (robori-petraeae) Niedermoore sandunterlagert 18,5<br />
9110 Molinio-Fagetum Sande sickerwasserbestimmt 9,2<br />
9110 Molinio-Fagetum Niedermoore sandunterlagert 12,6<br />
9190 Betulo-Quercetum Niedermoore sandunterlagert 19,0<br />
9190 Betulo-Quercetum Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 12,9<br />
9190 Betulo-Quercetum anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 11,6<br />
9190 Molinio-(Betulo-)Quercetum roboris Sande sickerwasserbestimmt 11,9<br />
9190 Molinio-(Betulo-)Quercetum roboris anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 11,6<br />
9190 Molinio-(Betulo-)Quercetum roboris Niedermoore sandunterlagert 19,0<br />
9190 Sambuco-Quercetum roboris Niedermoore sandunterlagert 23,0<br />
9190 Sambuco-Quercetum roboris Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt 14,8<br />
9190<br />
Agrostio-Quercetum roboris (Deschampsia<br />
flexuosa-Subass.)<br />
Sande sickerwasserbestimmt 11,0
LRT<br />
9190<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 159<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vegetationsgesellschaft im Zielzustand<br />
bzw. Artvorkommen<br />
Agrostio-Quercetum roboris (Deschampsia<br />
flexuosa-Subass.)<br />
Bodenform<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 16,1<br />
1903 Liparis loeselii anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig) 18,8<br />
Erläuterung: CLnutN = berechneter Critical Load für eutrophierenden Stickstoffeintrag<br />
Quelle: ÖKO-DATA 2011<br />
Zur Ermittlung der Depositionen, die durch den Betrieb des Vorhabens <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> zu erwarten<br />
sind, wurde von LOBER (2011E) eine Berechnung der nach Inbetriebnahme des <strong>GuD</strong><br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> zu erwartenden N- <strong>und</strong> S-Depositionen (resultierend aus NO-, NO2-Emissionen sowie<br />
SO2- Depositionen) durchgeführt. Die Ausbreitung der emittierten Stickstoffverbindungen<br />
wurde mit dem TA-Luft-Referenzprogramm AUSTRAL2000 nach VDI 3782 Blatt 5 simuliert<br />
(LOBER 2011A). Die Berechnungen wurden für Raster mit einer Zellgröße von 65 m x 65 m<br />
durchgeführt. Um die Übersichtlichkeit in der Kartendarstellung zu erhöhen, werden die interpolierten<br />
Werte im Raster von 500x500m² dargestellt (siehe Karte 2 der FFH-VU). Als Gr<strong>und</strong>lage<br />
für die Bewertung der Auswirkungen wurde jedoch die höhere Auflösung herangezogen.<br />
Als Gr<strong>und</strong>lage für die Darstellung der derzeitigen Hintergr<strong>und</strong>belastung der Stickstoff-<br />
Depositionen im Untersuchungsraum werden die deutschlandweit verfügbaren Depositionsdatensätze<br />
des Umweltb<strong>und</strong>esamtes (UBA 2011) genutzt. 4 In Abhängigkeit von den Rezeptoren<br />
(Wald, Offenland, Gewässer) sind deutliche Unterschiede bei den Stickstoffdepositionen festzustellen.<br />
Die diesen Datensätzen entnommenen Vorbelastungswerte übersteigen bei einigen<br />
Lebensraumtypen (zumindest für bestimmte Bodenformen) bereits die Critical Loads. Nach<br />
NAGEL et al. (2004) zählt Mecklenburg-Vorpommern zu den Regionen in Deutschland, in denen<br />
die atmosphärischen Schadstoffdepositionen die Critical Loads bereits deutlich überschreiten<br />
<strong>und</strong> daher dringend reduziert werden müssen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der in der VDI 3783-5 unterschiedenen drei Bedeckungsarten wurde das Untersuchungsgebiet<br />
für die Rezeptoren Wald, Wasser, Wiese (Offenland) differenziert betrachtet (LO-<br />
BER 2011A). Weitere Angaben zum Modellansatz finden sich bei LOBER (2011A).<br />
Wie bereits oben dargestellt, werden die Vorbelastungen durch andere Projekte am Standort<br />
bei der Beurteilung der Depositionen mit berücksichtigt, um zu verhindern, dass durch eine<br />
Vielzahl bereits vorhandener bzw. genehmigter oder in Planung befindlicher Vorhaben in der<br />
Summe die „Critical Loads“ überschritten werden. Für die weiteren am Standort <strong>Lubmin</strong> genehmigten<br />
oder in Planung befindlichen Vorhaben erfolgte die Depositionsberechnung von LO-<br />
BER (2011E) nach demselben Modell wie bei der Berechnung der vorhabensbedingten Depositi-<br />
onen.<br />
Die Raster der Vorbelastung aus dem Jahr 2007 (UBA 2011) sowie die Raster der Gesamt- <strong>und</strong><br />
Zusatzbelastung wurden mit den kartierten FFH-LRT des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden<br />
Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom (DE 1747-301)“ überlagert, um so die lokal<br />
4 Diese 1x1 km 2 - Datensätze liefern Informationen über die Gesamtdeposition für die Jahre 2004, 2005, 2006 <strong>und</strong><br />
2007.
FROELICH & SPORBECK Seite 160<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
differenzierten Depositionen für jeden stickstoffempfindlichen LRT zu ermitteln. Die Bewertung<br />
der Stickstoffdepositionen anhand der Critical Loads für die einzelnen Lebensraumtypen sowie<br />
für die Anhang II- Art Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii) wird in der Auswirkungsprognose in<br />
Kapitel 5.3 bzw. 5.4 vorgenommen.<br />
� Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen des Anhangs I durch Versauerung von<br />
Böden <strong>und</strong> Gewässern aufgr<strong>und</strong> von Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeldepositionen über<br />
den Luftpfad <strong>und</strong> infolge dessen Veränderung der Vegetation <strong>und</strong> der Zusammensetzung<br />
von Tierartengesellschaften (betriebsbedingt)<br />
Einträge von Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefelverbindungen in Ökosysteme können bei Überschreiten<br />
der Säureneutralisationskapazität eine Abnahme des pH-Wertes (Versauerung) in Böden <strong>und</strong><br />
Gewässern verursachen. Während oxidierter Stickstoff zu großen Teilen von Pflanzen aufgenommen,<br />
durch Denitrifikation in die Atmosphäre zurückgeführt oder durch Immobilisierungsprozesse<br />
im Humus geb<strong>und</strong>en wird, wirken nur wenige kompensatorische Prozesse für versauernde<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge. Auch Schwefel gilt als Makronährstoff für Pflanzen, wird<br />
jedoch lediglich in einem Mengenverhältnis benötigt, das um den Faktor 20 geringer ist als<br />
Stickstoff (GUDERIAN 2001).<br />
Versauernde Wirkungen auf oberirdische Pflanzenorgane treten nur bei solch hohen Konzentrationen<br />
der Luftschadstoffe auf, wie sie bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts nachgewiesen<br />
sind (vgl. ebd.). Heute wirken die permanenten, vorwiegend moderaten Belastungen eher indirekt<br />
<strong>und</strong> lösen sehr differenzierte Reaktionen der Ökosystembestandteile aus. Dabei bewirkt der<br />
Säureeintrag in erster Linie eine abnehmende Bodenreaktion <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>en den Verlust<br />
von Nährstoffen <strong>und</strong> die Freisetzung von Schwermetallen (UBA 2010). Podsolierungsprozesse<br />
werden begünstigt <strong>und</strong> beeinträchtigen das Wachstum von Pflanzen <strong>und</strong> dem Edaphon (GUDE-<br />
RIAN 2001). Dabei übernehmen der Boden <strong>und</strong> dessen Bestandteile eine wichtige Pufferfunktion,<br />
die bewirkt, dass sprunghafte Veränderungen des pH-Wertes <strong>und</strong> damit Verschiebungen in<br />
der Artenzusammensetzung erst nach Überschreiten der Pufferkapazität auftreten.<br />
Für die Beurteilung von versauernden Einträgen liegen keine empirischen Critical Loads vor.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> wurden für die als empfindlich eingestuften Lebensraumtypen analog zu den<br />
Grenzwerten für Eutrophierung auch kritische Belastungsschwellen für Säureeinträge berechnet<br />
(ÖKO-DATA 2011).<br />
Da die Trennung der Immissionen in versauernd <strong>und</strong> eutrophierend wirkende Stickstoffverbindungen<br />
nicht möglich ist, werden für die Beurteilung der Auswirkungen die gesamten emittierten<br />
Stickstoffverbindungen betrachtet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dabei die versauernde<br />
Wirkung überschätzt wird, da basisch wirkende Verbindungen (NO2, NO) enthalten sind. Den<br />
Vorgaben von UHL et al. (2009) folgend, wird auch hier zuerst die Überschreitung der Critical<br />
Loads/Levels durch die Gesamtbelastung geprüft, bevor abgeprüft wird, ob die projektbezogene<br />
Zusatzbelastung mehr als 3% des Critical Loads beträgt.<br />
Folgende Critical Loads für versauernde Wirkungen von Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel (CL S+N) wurden<br />
von ÖKO-DATA (2011) für die im Wirkbereich des Vorhabens liegenden empfindlichen Lebensraumtypen<br />
des Schutzgebietes ermittelt:
FROELICH & SPORBECK Seite 161<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 14: Berechnete Critical Loads für versauernde Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong><br />
Schwefel für ausgewählte Lebensraumtypen <strong>und</strong> die Pflanzenart Liparis loeselii<br />
LRT<br />
Vegetationsgesellschaft im Zielzustand<br />
bzw. Artvorkommen<br />
Bodenform<br />
CL(S+N)<br />
[eq /ha/a]<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Salzgrünland 4104<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor<br />
1310 Salicornietum ramosissimae<br />
Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Küstenüberflutungsmoor<br />
1310 Salicornietum ramosissimae Geländesenke im Salzgrünland 4104<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 4103<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 4103<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 4103<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi<br />
Geländeerhebung im Küstenüberflutungsmoor<br />
1330 Oenantho-Juncetum maritimi Küstenüberflutungsmoor 4103<br />
2110 Spergularietum salinae Sandstrand 2090<br />
2110 Spergularietum salinae Boddenstrand 2090<br />
2110 Spergularietum salinae Primärdüne, Ostseeküste 2090<br />
2120 Elymo-Ammophiletum arenariae Weißdüne, Ostseeküste 2396<br />
2120 Spergularietum salinae Boddenstrand 2090<br />
2120 Spergularietum salinae Boddenstrand 2090<br />
2130 Polygalacto-Festucetum rubrae Sande 1820<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande 2404<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande 1921<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Sande 2404<br />
2130 Airo-Agrostietum tenuis Niedermoore 2431<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 1896<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 2154<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 2154<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 1896<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 1896<br />
2130 Violo-Corynephoretum canescentis Sande 1896<br />
2180 Empetro nigri-Pinetum sylvestris Sande 2242<br />
2180 Empetro nigri-Pinetum sylvestris Sande 1907<br />
2180 Pyrolo-Pinetum sylvestris Sande 2049<br />
2180 Pyrolo-Pinetum sylvestris Sande 1721<br />
2180<br />
Cladonio-Pinetum sylvestris (typ.<br />
Subass.)<br />
4104<br />
4104<br />
4104<br />
3957<br />
Sande sickerwasserbestimmt 1886
LRT<br />
2180<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 162<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vegetationsgesellschaft im Zielzustand<br />
bzw. Artvorkommen<br />
Cladonio-Pinetum sylvestris (typ.<br />
Subass.)<br />
Bodenform<br />
anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig)<br />
CL(S+N)<br />
[eq /ha/a]<br />
2180 Agrostio-Populetum tremulae Sande 1753<br />
2180 Agrostio-Populetum tremulae anmoorige Standorte 1781<br />
2190 Eriophoro-Sphagnetum recurvi Sande 1836<br />
2190 Salicetum auritae Sande 1804<br />
6230 Polygalo-Nardetum strictae Sande 1777<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi Niedermoore 1880<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi Sande 1870<br />
6230 Nardo-Juncetum squarrosi anmoorige Standorte 1638<br />
6410 Junco-Molinietum Sande 1833<br />
7140 Salicetum auritae Niedermoore 2092<br />
7140 Salicetum auritae Niedermoore 2043<br />
9110<br />
9110<br />
9110<br />
Holco mollis-Quercetum (roboripetraeae)<br />
Holco mollis-Quercetum (roboripetraeae)<br />
Holco mollis-Quercetum (roboripetraeae)<br />
1907<br />
Niedermoore sandunterlagert 2147<br />
Sande sickerwasserbestimmt 2365<br />
Niedermoore sandunterlagert 2147<br />
9110 Molinio-Fagetum Sande 2134<br />
9110 Molinio-Fagetum Niedermoore 1625<br />
9190 Betulo-Quercetum Niedermoore 2147<br />
9190 Betulo-Quercetum Sande 2053<br />
9190 Betulo-Quercetum anmoorige Standorte 2006<br />
9190 Molinio-(Betulo-) Quercetum roboris Sande 2255<br />
9190 Molinio-(Betulo-) Quercetum roboris anmoorige Standorte 2006<br />
9190 Molinio-(Betulo-) Quercetum roboris Niedermoore 2147<br />
9190 Sambuco-Quercetum roboris Niedermoore 2449<br />
9190 Sambuco-Quercetum roboris Sande 2157<br />
9190<br />
9190<br />
Agrostio-Quercetum roboris (Deschampsia<br />
flexuosa-Subass.)<br />
Agrostio-Quercetum roboris (Deschampsia<br />
flexuosa-Subass.)<br />
Sande sickerwasserbestimmt 2678<br />
anmoorige Standorte (< 3 dm mächtig)<br />
1903 Liparis loeselii anmoorige Standorte 2858<br />
Erläuterung: CL S+N = berechneter Critical Load für versauernde Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel.<br />
Quelle: ÖKO-DATA 2011<br />
Die in der Tabelle angegebenen Belastungsschwellen verdeutlichen die unterschiedlichen ökologischen<br />
Toleranzbereiche der verschiedenen Lebensraumtypen bzw. Pflanzengesellschaften.<br />
2359
FROELICH & SPORBECK Seite 163<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die prognostizierten Depositionen von Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel können den Berechnungen von<br />
LOBER (2011E) entnommen werden. Die Ausbreitungsmodelle zeigen das zuvor beschriebene<br />
abweichende Depositionsverhalten von Schwefelverbindungen im Vergleich zu Stickstoff. Die<br />
Deposition von Schwefelverbindungen erfolgt entsprechend emittentennah, mit Maximalwerten<br />
im Anlagenumfeld des Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerks <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> rasch abnehmenden Werten<br />
mit zunehmender Entfernung.<br />
Um eine Vergleichbarkeit der berechneten CL (S+N) mit den prognostizierten Depositionswerten<br />
zu erreichen, wurden die Rasterwerte anhand der folgenden Umrechnungsfaktoren in die<br />
entsprechenden Säureäquivalente konvertiert (eq/ha/a):<br />
� 14 g Stickstoff sind 1 Säureäquivalent, daraus folgt, 1 kg N/ha/a entspricht 71,428 eq/ha/a<br />
� 16 g Schwefel sind 1 Säureäquivalent, daraus folgt, 1 kg S/ha/a S entspricht 62,5 eq/ha/a<br />
Nach Addition der Äquivalentwerte kann das Verhältnis zum berechneten CL (S+N) ermittelt<br />
werden.<br />
Die Vorbelastungswerte der versauernden, atmosphärischen Schadstoffdepositionen können<br />
aus den Datensätzen des UBA aus 2007 zu den Schwefel- <strong>und</strong> Stickstoffdepositionen entnommen<br />
werden. Die höchsten Belastungen treten dabei auf Gr<strong>und</strong> der Nähe zu Emittenten (Straßen,<br />
Industriegebiet <strong>Lubmin</strong>er Heide) im äußersten Südwesten des Struck <strong>und</strong> der Freesendorfer<br />
Wiesen auf.<br />
Die Bewertung der versauernden Schadstoffdepositionen (S+N), anhand der Critical Loads für<br />
die einzelnen Lebensraumtypen sowie für die Anhang II- Art Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii)<br />
wird in der Auswirkungsprognose in Kapitel 5.3 bzw. 5.4 vorgenommen. Dabei wird analog zur<br />
Bewertung der eutrophierenden Stickstoffdepositionen vorgegangen. Zunächst wird geprüft ob<br />
die Gesamtbelastung der versauernden Schadstoffdepositionen (S+N) die CL überschreitet.<br />
Falls die Gesamtbelastung höher ist als der standortspezifische CL-Wert, wird im zweiten<br />
Schritt geprüft, ob die Zusatzbelastung mehr als 3 % des betreffenden CL ausmacht <strong>und</strong> somit<br />
oberhalb der Irrelevanzschwelle liegt.<br />
Für alle weiteren Lebensräume des Schutzgebietes, die nicht als empfindlich eingestuft wurden,<br />
wird durch die Einhaltung der Grenzwerte zum Schutz der Vegetation <strong>und</strong> von Ökosystemen<br />
nach TA Luft von keinen weiteren Beeinträchtigungen ausgegangen. Nach LUA Brandenburg<br />
(2008) können die folgenden Beurteilungswerte der TA Luft zur Prüfung der Erheblichkeit bei<br />
FFH-Verträglichkeitsprüfungen herangezogen werden:<br />
� Stickstoffdioxid: 30 µg/m³ (Jahresmittelwert)<br />
� Schwefeldioxid: 20 µg/m³ (Jahresmittelwert <strong>und</strong> gemittelt über Oktober – März)<br />
Die Jahresmittelwerte der unsedimentierten Schadstoffkonzentrationen vorhabensbedingter<br />
Zusatzbelastungen können dem Immissionsgutachten von LOBER (2011A, Anlage 4) entnommen<br />
werden. Die maximalen Konzentrationen von Schwefeldioxid werden in 2 Schwerpunktgebieten<br />
über der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> südlich von Freest mit einer Gesamtbelastung<br />
(inkl. Vorbelastung) von bis zu 3,1 µg/m³ erreicht. Für Stickstoffdioxid sind 3 Konzentrationsbereiche<br />
erkennbar, die mit bis zu 9,2 µg/m³ über dem Freesendorfer Haken <strong>und</strong> Nordusedom,<br />
südlich von Freest <strong>und</strong> südöstlich von <strong>Lubmin</strong> liegen.
FROELICH & SPORBECK Seite 164<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Damit werden die Beurteilungswerte der TA Luft auch unter Berücksichtigung der bestehenden<br />
Vorbelastung nicht überschritten. Beeinträchtigungen für gegenüber Versauerung unempfindliche<br />
Lebensräume können somit ausgeschlossen werden.<br />
Eine lebensraumspezifische Bewertung der Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge erfolgt im nachfolgenden<br />
Kapitel 5.3.<br />
5.2.7 Schadstoffimmissionen<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch luftbürtige<br />
Schadstoffimmissionen des Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> (betriebsbedingt)<br />
Für die Ermittlung der luftbürtigen Schadstoffimmissionen wurde von LOBER (2011A) durch<br />
Computersimulation mit dem TA-Luft-Referenzprogramm AUSTRAL2000 in der Version 2.4.7<br />
eine Immissionsprognose erstellt. Dabei wurden folgende Anlagenteile/ Vorgänge, die mit<br />
Emissionen von Luftschadstoffen verb<strong>und</strong>en sind berücksichtigt:<br />
� Betrieb der Gasturbinen (Erdgasfeuerung)<br />
� Betrieb der Hilfskessel (Erdgasfeuerung)<br />
� Gebäudeheizung (Erdgasfeuerung)<br />
� Erdgasvorwärmer (Erdgasfeuerung)<br />
� Notstromaggregate (Diesel)<br />
Bei der Immissionsprognose wurde ununterbrochener Dauerbetrieb bei Volllast untersucht <strong>und</strong><br />
somit der ungünstigste Fall hinsichtlich der Emissionen im Jahresverlauf angesetzt (LOBER<br />
2011A). Nach LOBER (ebd.) treten durch den Betrieb des Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong><br />
folgende luftbürtige Schadstoffemissionen auf: SO2, NOx, NO2, NO, Staub <strong>und</strong> CO. Eine kartographische<br />
Darstellung der prognostizierten Schadstoffkonzentrationen findet sich bei LOBER<br />
(ebd) in den Anlagen 5 bis 8.<br />
Die vom Kraftwerk verursachten Wirkungen der emittierten Stoffe Schwefeloxide als SO2 sowie<br />
Stickoxide als NO2 <strong>und</strong> NO wurden bereits im Kapitel 5.2.6 diskutiert. LOBER (2011A) stellt in<br />
seiner Immissionsprognose fest, dass alle berechneten Zusatzbelastungen durch das <strong>GuD</strong><br />
Kraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> im Sinne der TA-Luft irrelevant sind <strong>und</strong> somit nach Punkt 4.1 der TA-Luft<br />
davon ausgegangen werden kann, dass keine schädlichen Umweltwirkungen durch Luftschadstoffe<br />
von der geplanten Anlage ausgehen werden. Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele<br />
des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom (DE<br />
1747-301)“ durch luftbürtige Schadstoffimmissionen (ausgenommen Schwefel- <strong>und</strong> Stickoxiden,<br />
die im Kapitel 5.2.6 behandelt werden) kann demnach ausgeschlossen werden.<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch Schadstoffimmissionen<br />
aus der Einleitung von Abwasser <strong>und</strong> sonstigen Betriebswässern<br />
(betriebsbedingt)<br />
Im Kraftwerksbetrieb fallen insgesamt 448.833 m³ Betriebsabwässer <strong>und</strong> Niederschlagswasser<br />
pro Jahr (ohne Kühlwasser) an. Diese werden entsprechend ihrer Inhaltsstoffe versickert, extern
FROELICH & SPORBECK Seite 165<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
entsorgt, in die Abwasseranlage der <strong>EWN</strong> oder über das Kühlwasserbauwerk in den Industriehafen<br />
eingeleitet.<br />
Ökologisch für das FFH-Gebiet relevant sind dabei 409.476 m³/a Prozessabwässer, welche<br />
nach Prüfung direkt in den Industriehafen eingeleitet werden <strong>und</strong> mit geringen Mengen Ammoniak,<br />
Feststoffen <strong>und</strong> Kohlenwasserstoffen belastet sein können. Die Einleitkonzentrationen<br />
entsprechen den Anforderungen der AbwV. Durch die enge Kopplung an die Kühlwassereinleitung<br />
ist stets eine starke Verdünnung gegeben, so dass auch für aquatische Organismen kritische<br />
Konzentrationen sicher unterschritten werden. Im Industriehafen erfolgt eine weitere intensive<br />
Verdünnung mit Boddenwasser, so dass bei Erreichen der Molenköpfe die<br />
Konzentrationen bereits unterhalb der Nachweisgrenze liegen werden <strong>und</strong> damit negative Auswirkungen<br />
auf Pflanzen, Tiere <strong>und</strong> Tierlebensräume ausgeschlossen sind.<br />
Die Nährstoffeinträge durch die Kühlwassereinleitung werden unter dem Wirkfaktor „Kühlwassereinleitung<br />
<strong>und</strong> -entnahme“ behandelt.<br />
� Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten durch Schadstoffimmissionen<br />
von Baumaschinen, Baufahrzeugen (baubedingt)<br />
Verkehrsbedingte Abgas- <strong>und</strong> Staubemissionen entstehen durch die Verbrennung der Antriebsstoffe<br />
mit den verkehrstypischen Komponenten Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe,<br />
Ruß, Benzol <strong>und</strong> Schwermetallverbindungen. Hauptsächlich wirken stoffliche<br />
Emissionen durch den Abrieb von Straßenbelägen, Reifen, Bremsen <strong>und</strong> Kupplungen sowie<br />
durch Tropfverluste (Öl) <strong>und</strong> Rost. Verkehrsbedingte stoffliche Immissionen wirken auf Lebensräume<br />
<strong>und</strong> Arten.<br />
Die Baustelle wird auf dem Landweg über die L 262 aus Richtung <strong>Lubmin</strong>/Vierow oder Kröslin/Freest/Spandowerhagen<br />
angefahren. Während der gesamten Bauphase ist tagsüber mit<br />
einem Lkw-Verkehr von etwa 2 Fahrzeugen/St<strong>und</strong>e zu rechnen, der sich in der Hauptmontagezeit<br />
(6 Monate) auf bis zu 20-30 Lkw/Tag erhöhen kann. Bei der Betonierung der Hauptf<strong>und</strong>amente<br />
wird kurzzeitig an 2-4 Tagen während der gesamten Bauzeit eine Spitzenlast von 10<br />
Transportfahrzeugen pro St<strong>und</strong>e nicht überschritten.<br />
Die Anlieferung von Schwerlastteilen kann per Schiff erfolgen, Kiestransporte für Betonierungsarbeiten<br />
sind per Bahn geplant.<br />
Generell erfolgt die Erschließung des Geländes über bestehende Straßen, Bahnlinien <strong>und</strong><br />
Schifffahrtsrinnen. Die geringfügige Zunahme des Schiffs- <strong>und</strong> Bahnverkehrs entlang dieser<br />
bestehenden Verkehrswege ist auf die Bauphase begrenzt. Vorwiegend aus dem Lkw- <strong>und</strong><br />
Maschineneinsatz entlang der L 262 <strong>und</strong> auf dem Baufeld werden Schadstoff- <strong>und</strong> Staubemissionen/-immissionen<br />
entstehen. In weiterer Entfernung von der Landesstrasse <strong>und</strong> dem Vorhabensstandort<br />
können erhebliche verkehrliche Belastungen ausgeschlossen werden.<br />
Die Schadstoff- <strong>und</strong> Staubemissionen/-immissionen führen demnach zu sehr geringen <strong>und</strong> lokal<br />
<strong>und</strong> zeitlich begrenzten zusätzlichen Beeinträchtigungen entlang der vorhandenen L 262, der<br />
Bahnlinie Richtung <strong>Lubmin</strong> <strong>und</strong> der Schifffahrtsrinne in Richtung Industriehafen, so dass keine<br />
vorhabensinduzierten erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes zu erwarten sind.
FROELICH & SPORBECK Seite 166<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� erhöhte Gefahr der nachhaltigen Beeinträchtigung von FFH-relevanten Lebensräumen<br />
<strong>und</strong> Arten durch mögliche Havarien (bau- <strong>und</strong> betriebsbedingt)<br />
Potenziell kann es zu Havarien <strong>und</strong> damit einhergehend zu deutlichen Beeinträchtigungen von<br />
FFH-relevanten Lebensräumen <strong>und</strong> Arten kommen. Die Wahrscheinlichkeit solcher Zustände<br />
nicht bestimmungsgemäßen Betriebes ist jedoch sehr gering, da technische, bauliche <strong>und</strong> organisatorische<br />
Maßnahmen (z. B. Brandfrüherkennungssysteme, Vorkehrungen zur Inertisierung,<br />
Einbindung in bestehende Strukturen zur Havariebekämpfung, etc.) das Risiko minimieren,<br />
so dass sie nachfolgend nicht weiter betrachtet werden.<br />
5.3 Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des Anhangs I der<br />
FFH-Richtlinie<br />
Im Folgenden werden die Konflikte bzw. Beeinträchtigungen bezüglich der Lebensraumtypen,<br />
die durch den Bau <strong>und</strong> den Betrieb des Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> ausgelöst<br />
werden können, beschrieben, analysiert <strong>und</strong> bewertet.<br />
5.3.1 Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit Meerwasser<br />
(EU-Code 1110)<br />
Tab. 15: Beeinträchtigung der „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung<br />
mit Meerwasser (EU-Code 1110)<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code 1110)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V): Eisente (Clangula hyemalis)<br />
Fische (F): Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus), Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatoschistus minutus),<br />
Wirbellose (W): Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum),<br />
Vorkommen des LRT im duB<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 2,3 km von der Baustelle bzw. 2,7 km von der<br />
Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- -- --
FROELICH & SPORBECK Seite 167<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung mit Meerwasser (EU-Code 1110)<br />
Kollisionsrisiko nicht erheblich -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung erheblich erheblich erheblich erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische. Arten : S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W = Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: - = keine,<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Da die Baustelle mindestens 2,3 km von den Sandbänken entfernt ist <strong>und</strong> sich die Bautätigkeit<br />
nicht auf die marinen LRT erstreckt, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen der<br />
allgemeinen Lebensraumfunktionen sowie der Fischarten <strong>und</strong> des Makrozoobenthos zu erwarten.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle <strong>und</strong> der Abschirmung der Bauflächen durch<br />
die Gasanlandestation sowie das <strong>GuD</strong> II, sind keine baubedingten optischen <strong>und</strong> akustischen<br />
Störungen der charakteristischen Vogelart Eisente gegeben. Bezüglich der Störempfindlichkeit<br />
werden von GARNIEL & MIERWALD (2010) keine artspezifischen Angaben gemacht.<br />
Für auf Wasserflächen rastende Enten wird von GARNIEL & MIERWALD allgemein ein<br />
kritischer Störradius von 150 m angegeben. Die LRT-Flächen liegen weit außerhalb dieser<br />
Distanz.<br />
- Es wird von keinen Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen ausgegangen. Da sich der Standort des<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 <strong>und</strong> unmittelbar am Rand der hoch<br />
aufragenden Gebäudekulisse des früheren KKW „Bruno Leuschner“ sowie am Rand des<br />
Industriehafens, der Gasanlandestation <strong>und</strong> des geplanten <strong>GuD</strong> II befindet, sind Ausweichflüge<br />
auch ohne <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> anzunehmen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT ist davon auszugehen, dass<br />
durch die Anlage die allgemeinen Lebensraumfunktionen der Sandbänke nicht beeinträchtigt<br />
werden.<br />
- Das Kraftwerk kann für die Eisente zu einem leicht erhöhten Kollisionsrisiko führen. Ein<br />
Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks besteht insbesondere bei schlechten<br />
Sichtverhältnissen (nachts <strong>und</strong> bei Nebel). Da unter diesen Bedingungen nicht von häufigen<br />
Flugbewegungen auszugehen ist, führen diese potenziellen Beeinträchtigungen zu keiner
FROELICH & SPORBECK Seite 168<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art im LRT. Sie werden daher als nicht erheblich<br />
eingestuft.<br />
- Ein Meidungsverhalten der Eisenten durch eine Veränderung des Sichtfelds in „vorhabensnahen“<br />
LRT-Teilen kann aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk <strong>und</strong> der Abschirmung durch die Gasanlandestation<br />
<strong>und</strong> das <strong>GuD</strong> II können relevante betriebsbedingte Beeinträchtigungen der charakteristischen<br />
Arten durch optische <strong>und</strong> akustische Störungen ausgeschlossen werden.<br />
Wichtige Nahrungs- <strong>und</strong> Rasthabitate der Eisente befinden sich außerhalb des kritischen<br />
Störradius (vgl. oben).<br />
- Durch die geringen zusätzlichen, betriebsbedingten Stickstoffimmissionen über den Luft-<br />
<strong>und</strong> den Wasserpfad ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten zu erwarten. Für den LRT 1110 sind keine<br />
Critical Loads in den Vollzugshilfen angegeben. Nach KIFL (2008) wird der marine LRT<br />
1110 in Großbritannien eindeutig als nicht empfindlich gegen Stickstoff-Eutrophierung eingestuft.<br />
Da es sich beim Greifswalder Bodden um ein eutrophes, in Perioden hoher Bioproduktion<br />
sogar hypertrophes Gewässer handelt, sind in Verbindung mit den starken Verdünnungseffekten<br />
keine Veränderungen im Lebensraum durch zusätzliche atmosphärische<br />
Stickstoffeinträge zu erwarten. Die prognostizierten zusätzlichen Stickstoffeinträge der beiden<br />
Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> II innerhalb des Lebensraumtyps liegen zwischen 0,0028 <strong>und</strong><br />
0,0137 kg N/ha/a <strong>und</strong> sind somit im Vergleich zur Vorbelastung sehr gering.<br />
Tab. 16: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1110<br />
Temperaturdifferenz<br />
LF 11(Winterszenario) in ha LF 12(Sommerszenario) in ha<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht Oberflächenschicht Bodenschicht<br />
0,20 - 1,00 K 90 90 132 132<br />
1,01 - 2,00 K 33 33 40 40<br />
2,01 - 3,00 K 11 11 19 19<br />
3,01 - 4,00 K 0 0 9 9<br />
4,01 - 5,00 K 0 0 7 7<br />
5,01 - 6,00 K 0 0 0 0<br />
Summe 134 134 207 207<br />
- Temperaturänderungen: Generell ist davon auszugehen, dass in dauerhaft betroffenen<br />
Gebieten mit der Kühlwassereinleitung die Normkurve der Temperatur um einige Tage (< 4)<br />
nach vorn verschoben wird, die Temperaturamplitude zwischen Oberfläche <strong>und</strong> Boden<br />
leicht ansteigt <strong>und</strong> bei Lageveränderungen der Kühlwasserfahne häufige Temperaturwechsel<br />
auftreten (vgl. BUCKMANN 2011). Beim Sommerszenario ergeben sich für den LRT maximale<br />
Aufwärmspannen von bis zu 4,47 K, beim Winterszenario liegt die Temperaturdiffe-
FROELICH & SPORBECK Seite 169<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
renz bei maximal 2,86 K. Die maximalen gemessenen Wassertemperaturen des südlichen<br />
<strong>und</strong> zentralen Greifswalder Boddens (Messstationen GB 7, GB 8, GB 10 <strong>und</strong> GB 19, Messreihen<br />
des LUNG M-V 1997-2007) liegen bei 24,1°C. Zu Temperaturempfindlichkeiten können<br />
anhand der Literatur nur wenige Aussagen getroffen werden. Die allgemeine letale<br />
thermische Obergrenze für marine Organismen beträgt nach IFAÖ (2007B) 28°C. Da Makrophyten<br />
i. d. R. empfindlicher reagieren als die Fauna, ist nach TÜV NORD (2008A) die Toleranzgrenze<br />
bereits bei 25°C anzusetzen. Die in Teilbereichen des Lebensraumtyps dominante<br />
Art Potamogeton pectinatus ist gegenüber den vorhabensbedingten<br />
Temperaturerhöhungen wenig empfindlich (vgl. Tab. 23). Insgesamt ist der LRT überwiegend<br />
als vegetationsarm einzustufen, teilweise ist er spärlich mit Zostera marina bewach-<br />
sen (vgl. IFAÖ 2005). Bei der Auswirkungsprognose stehen daher vor allem die möglichen<br />
Beeinträchtigungen der lebensraumtypischen Tierarten im Vordergr<strong>und</strong>. Die potenziellen<br />
Beeinträchtigungen der Makrophyten werden im Rahmen der Auswirkungsprognose für den<br />
LRT 1160 beschrieben. Auch ohne Kühlwassereinfluss können bei hochsommerlichen<br />
Temperaturen <strong>und</strong> schwachen Windgeschwindigkeiten natürliche, temporäre Stresssituationen<br />
für die lebensraumtypischen Arten in den Flachwasserbereichen auftreten. Die zusätzliche<br />
Erwärmung innerhalb der Kühlwasserfahne ist geeignet, negative Effekte auf die<br />
Artengemeinschaft zu verstärken. Diese wären insbesondere im Nahbereich der Molenköpfe<br />
spürbar. Laut BUCKMANN (2011) werden die kritischen 28°C nur in wenigen Ausnahmefällen<br />
überschritten (die Wahrscheinlichkeit, dass während des Sommerplateaus Werte über<br />
28°C durch die Kühlwassereinleitung erreicht werden, liegt bei
FROELICH & SPORBECK Seite 170<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
verbrauch <strong>und</strong> Temperaturstress, bei längerer Einwirkzeit auch zum Absterben von Organismen<br />
führen (vgl. IOW 2008B), was wiederum Abbauprozesse unter Sauerstoffverbrauch<br />
auslöst. Gleichzeitig sinkt bei steigender Temperatur die Sauerstofflöslichkeit. Diese „[...]<br />
Gegenläufigkeit von Sauerstoffverbrauch <strong>und</strong> Sauerstoffangebot macht die besondere Gefahr<br />
künstlicher Erwärmung aus.“ (vgl. GUDERIAN & GUNKEL 2000). Damit sind bei fehlender<br />
Durchmischung (insbesondere bei Schwachwindlagen bei sommerlichem Volllastbetrieb)<br />
endogen erzeugte kritische Situationen im Sauerstoffgehalt der Wassersäule im Bereich der<br />
Kühlwasserfahne denkbar. Laut TÜV NORD (2011) sind hypoxische Verhältnisse im Kühlwasser<br />
selbst unwahrscheinlich, da die Sauerstoffkonzentrationen des eingeleiteten Wassers<br />
ganzjährig über denen der Boddenwerte liegen (ebd. 2011). Bodennahe Sauerstoffmangelsituationen<br />
können verstärkt werden, wenn durch die leichteren Warmwasserfahnen<br />
Dichteschichtungen auftreten <strong>und</strong> starke Winde zum mechanischen Austausch fehlen. Bei<br />
den Bereichen des LRT 1110, die von der Kühlwasserfahne überstrichen werden, handelt<br />
es sich um Flachwasserbereiche, welche gut durchströmt werden <strong>und</strong> in denen von vornherein<br />
keine stabilen Schichtungen möglich sind. Entsprechend wird davon ausgegangen,<br />
dass im Extremfall eines temporären Schichtungsereignisses nur sehr geringe Beeinträchtigungen<br />
der marinen Flora <strong>und</strong> Fauna möglich sind. Da die Kühlwasserfahne beim Lastfall<br />
12 (vgl. BUCKMANN 2011) nur eine geringe Schichtungsneigung aufweist, ist davon auszugehen<br />
dass es im Sommer vorhabensbedingt nicht zu einer signifikanten Verstärkung von<br />
kritischen Sauerstoffmangelsituationen durch eine Zunahme der Schichtungsneigung<br />
kommt. Sollte es in Folge der zusätzlichen Erwärmung durch die Kühlwasserfahne dennoch<br />
zu partiellen, in Extremfällen vollständigen Absterbeereignissen der benthischen Lebensgemeinschaften<br />
kommen, ist davon auszugehen, dass sich die submerse Vegetation im<br />
Folgejahr wieder regeneriert (GOSSELCK, mündl. Auskunft 16.08.2007) <strong>und</strong> sich auch die<br />
Tierartengemeinschaft wiedereinstellt. Kurzfristige Sauerstoffmangelsituationen (Hypoxie)<br />
können von vielen Arten toleriert werden, wobei die Toleranz der verschiedenen Tiergruppen<br />
(Krebstiere, Ringelwürmer, Schnecken <strong>und</strong> Muscheln) gegenüber Hypoxie in dieser<br />
Reihenfolge zunimmt (GRAY et al. 2002). Als besonders empfindlich gegenüber Sauerstoffmangel<br />
können Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum), Baltische Plattmuschel<br />
(Macoma baltica), die Crustacee Leptocheirus pilosus <strong>und</strong> der Polychaet Streblospio shrubsoli<br />
eingestuft werden. Es ist jedoch bekannt, dass Muscheln wie die Sandklaffmuschel<br />
durchaus mehrere Tage Sauerstoffmangel tolerieren können (DRIES & THEEDE 1974; RO-<br />
SENBERG et al. 1991). In dem seltenen Fall winterlicher Sauerstoffmangelsituationen sind<br />
temporäre Veränderungen in der Individuendichte nicht auszuschließen, welche sich jedoch<br />
auf Gr<strong>und</strong> der Kurzfristigkeit <strong>und</strong> des hohen Regenerations- bzw. Wiederbesiedlungspotenzials<br />
nicht dauerhaft nachteilig auf das Artenspektrum <strong>und</strong> die Dominanzstruktur der Lebensgemeinschaft<br />
auswirken, sofern solche Bedingungen nicht wiederholt eintreten. Damit<br />
sind keine nachhaltigen Beeinträchtigungen des LRT durch Schichtungsereignisse zu erwarten.<br />
- Salinitätsänderungen: Aus den Szenarien von BUCKMANN (2011) ergeben sich negative<br />
Salzgehaltsanomalien im LRT von maximal –0,62 PSU. Für marine Arten, welche im Untersuchungsgebiet<br />
am Rande ihrer ökologischen Verbreitungsgrenze leben, können derartige<br />
Aussüßungsereignisse langfristig eine Lebensraumbeeinträchtigung darstellen (vgl. Ausführungen<br />
zu Salinitätsänderungen im LRT 1160 <strong>und</strong> Tab. 20). Zudem führt eine größere Variabilität<br />
des Salzgehaltes dazu, dass die Tiere verstärkt Energie für ihre Osmoregulation<br />
aufwenden müssen <strong>und</strong> ihr Wachstum bzw. ihre Reproduktion entsprechend beeinträchtigt
FROELICH & SPORBECK Seite 171<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
werden kann. Die in Teilbereichen des Lebensraumtyps dominante Makrophytenart<br />
Potamogeton pectinatus sowie die beiden weiteren Süßwasserarten Zannichellia palustris<br />
<strong>und</strong> Myriophyllum spicatum sind gegenüber den vorhabensbedingten Salzgehaltsveränderungen<br />
wenig empfindlich (vgl. Tab. 25). Die lebensraumtypische Art Bathyporeia pilosa ist<br />
euryhalin <strong>und</strong> kann kurzfristig niedrige Salzgehalte tolerieren (FRÖHLE et al. 2010). Insgesamt<br />
sind keine erheblichen Beeinträchtigungen über diesen Wirkfaktor zu erwarten, da die<br />
vorhabensbedingten Salinitätsschwankungen im Vergleich zu den natürlichen Schwankungen<br />
im südlichen Greifswalder Bodden sehr gering sind <strong>und</strong> nur im Extremfall einen negativen<br />
Salzgradienten von über 0,5 PSU aufweisen.<br />
- Nährstoffeinleitung: Den Berechnungen des TÜV NORD (2011) zufolge beträgt der Eintrag<br />
von pflanzenverfügbaren Nährstoffen mit dem Abwasser, dargestellt als DIN (gelöste anorganische<br />
Stickstoffverbindungen, Summe aus Nitrat-, Nitrit- <strong>und</strong> Ammoniumstickstoff), am<br />
Einleitpunkt im März knapp das fünffache der Boddenkonzentrationen. Von Mai bis September<br />
verhindert dagegen die mit der erhöhten Primärproduktion des Peenestroms verb<strong>und</strong>ene<br />
Nährstoffzehrung, dass noch nennenswerte Mengen an DIN den Bodden erreichen<br />
(vgl. ebd.). Bei den Nährstoffen ist lediglich Nitrat ein zu berücksichtigender Faktor, da<br />
Nitrat am Einleitpunkt bei den Lastfällen 11 <strong>und</strong> 12 im Durchschnitt knapp 2-fach (etwa<br />
180 %) über den Boddenverhältnissen liegt (TÜV NORD 2011). Die größten Nitratmengen<br />
treten dabei in den Wintermonaten auf, wenn das Plankton biologisch verhältnismäßig inaktiv<br />
ist (MARILIM 2011). Dann wird das zusätzliche Nitrat zusammen mit der generellen Wasserzirkulation<br />
in die Ostsee ausgewaschen <strong>und</strong> vermischt sich dort (ebd. 2011, vgl. auch<br />
IOW 2008B). Alle anderen Nährstoffe weisen im Vergleich zu Nitrat nur geringe Zusatzmengen<br />
auf. So sind auch die Phosphateinträge das ganze Jahr im Vergleich zu den Stickstoffkomponenten<br />
gering. Der Eintrag von Gesamtphosphor erreicht im April <strong>und</strong> Mai sein Maximum.<br />
Dies ist nach TÜV NORD (2011) auf die Zwischenprodukte der Remineralisierung<br />
aus der Frühjahrsblüte des Phytoplankton im Nördlichen Peenestrom zurückzuführen. Die<br />
Wirksamkeit von Eutrophierungserscheinungen ist somit zeitlich stark eingeschränkt. Der<br />
Chlorophyllgehalt des Wassers erhöht sich am Einleitpunkt durchschnittlich um etwas mehr<br />
als das Doppelte (230 %). Dies spiegelt den Eintrag von Algenbiomasse aus dem<br />
Peenestrom in den Greifswalder Bodden wider, der über den Industriehafen statt über die<br />
Spandowerhagener Wiek in den Greifswalder Bodden gelangt. Insgesamt bleibt hier die<br />
Chlorophyll-Bilanz neutral. Es handelt sich somit um eine lokale Umleitung des Zuflusses,<br />
die für den Greifswalder Bodden insgesamt keine Bedeutung hat. Die Nährstoffzunahme<br />
führt zu einer Veränderung des Lichtklimas auf Gr<strong>und</strong> erhöhter Phytoplanktonkonzentrationen.<br />
Diese Beeinträchtigungen treten temporär auf, wenn das Phytoplankton im Frühjahr<br />
seine maximalen Konzentrationen erreicht. Mit der Nährstoffeinleitung verb<strong>und</strong>ene Veränderungen<br />
der Sichttiefe sind jedoch nur im Nahbereich der Einleitung zu erwarten. Mit zunehmendem<br />
Abstand vom Einleitpunkt erfolgt eine verstärkte Vermischung mit dem Boddenwasser<br />
<strong>und</strong> damit einhergehend eine Anpassung der veränderten Werte an die natürlich<br />
im Bodden vorkommenden Werte (MARILIM 2011). In bzw. nach eisreichen Wintern kann es<br />
auch unter natürlichen Bedingungen zu reduzierten Sichttiefen kommen. Darüber hinaus<br />
können auch durch die mechanische Beanspruchung beim Aufschieben von Eisschollen<br />
Makrophytenbestände verloren gehen (BARTELS & KLÜBER 1998). Die betroffenen LRT-<br />
Bereiche werden also bereits durch eine hohe Dynamik geprägt. Die lebensraumtypischen<br />
Organismen sind daher entweder an solche Änderungen angepasst oder sie sind in der Lage<br />
die Standorte schnell wiederzubesiedeln. Einige Makrophytenarten besitzen die Fähig-
FROELICH & SPORBECK Seite 172<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
keit mit ausgeprägtem Längenwachstum die individuelle Lichtverfügbarkeit zu verbessern<br />
(PORSCHE et al. 2008). Die eutrophierende Wirkung des eingeleiteten Kühlwassers ist vor<br />
allem mit einer lokalen Erhöhung der Biomasse filtrierender <strong>und</strong> suspensionsfressender<br />
Tierarten verb<strong>und</strong>en. Ursache dafür ist die Erhöhung der planktischen Produktion, die sowohl<br />
auf die Eutrophierung als auch auf die Temperaturerhöhung zurückzuführen ist. Diese,<br />
auf den ersten Blick positive Wirkung der Eutrophierung birgt jedoch die Gefahr eines erhöhten<br />
Sauerstoffverbrauchs der Bodentiere, der unter extremen Bedingungen (Stagnationsphasen)<br />
temporär wiederum zu Sauerstoffmangelsituationen führen kann (ERM LAH-<br />
MEYER INTERNATIONAL 1999), deren Auswirkungen bereits oben beschrieben wurden. Bei<br />
Beeinträchtigung submerser Makrophyten in Folge der Verschlechterung des Lichtklimas<br />
bzw. Sauerstoffmangelsituationen führt dies zu einer Schädigung verschiedener Kleinkrebse<br />
des Phytals (Isopoda, Amphipoda), die im Greifswalder Bodden in hohen Dichten vorhanden<br />
sind. Insgesamt können im Bereich der Kühlwasserfahne graduelle Beeinträchtigungen<br />
von Lebensräumen des LRT 1110, die auf die Ein- <strong>und</strong> Umleitung von Nährstoffen<br />
mit dem Kühlwasser zurückzuführen sind, nicht ausgeschlossen werden. Durch IOW<br />
(2008B) wurde anhand der Analyse von historischen Monitoring-Daten aus der Zeit des<br />
Atomkraftwerks „Bruno Leuschner“ festgestellt, dass die Nährstoffumleitungen durch Kühlwasser<br />
aus der Spandowerhagener Wiek beim Stickstoff vor allem in den Wintermonaten<br />
erheblich sind. IOW (2008B) konstatiert allerdings, dass es im zentralen Bodden zu keinen<br />
erkennbaren Auswirkungen auf Nährstoff- <strong>und</strong> Phytoplanktonkonzentrationen gibt. Darüber<br />
hinaus kann anhand der Monitoring-Daten keine Akkumulation von Stickstoff oder Phosphor<br />
im Bodden im Jahresverlauf festgestellt werden (IOW 2008B). Der starke Austausch des<br />
Boddens mit der Ostsee verhindert eine langfristige Akkumulation von Stickstoff, der durch<br />
die Kühlwassereinleitung eingetragen wird. Wie bereits in Kap. 5.2.5 dargestellt, kann ausgeschlossen<br />
werden, dass relevante Chlorophyll-a-Konzentrationen die Makrophytenvorkommen<br />
am Gahlkower Haken <strong>und</strong> am Freesendorfer Haken erreichen.<br />
- Zusammenwirken der Faktoren: Auf Gr<strong>und</strong> der Komplexität des Zusammenwirkens der<br />
betrachteten Faktoren Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffversorgung <strong>und</strong> Nährstoffeintrag<br />
sowie der unterschiedlichen Toleranzen von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten (vgl. Tab. 20) <strong>und</strong> -<br />
gemeinschaften ist es schwierig, genaue numerisch fassbare Grenzen für gravierende Beeinträchtigungen<br />
durch Systemeffekte zu benennen (vgl. IOW 2008B). Die natürliche Temperaturvariabilität<br />
des südlichen Greifswalder Boddens liegt zwischen 1,1 <strong>und</strong> 21,1°C<br />
(Messdaten des LUNG M-V 1997-2007). Überschreitungen dieses Schwankungsbereiches<br />
traten in den 10 Messjahren siebenmal auf. Wie oben dargestellt sind ab einer dauerhaften<br />
Temperaturerhöhung ab 2 K populationsrelevante Veränderungen der Lebensgemeinschaften<br />
im LRT möglich. Um sicherzustellen, dass auch Systemeffekte, die durch das Zusammenwirken<br />
der einzelnen Faktoren entstehen können ausreichend berücksichtigt werden,<br />
werden bei der Ermittlung der graduellen Beeinträchtigungen bereits die Temperaturveränderungen<br />
ab 0,2 K berücksichtigt.<br />
Die Abschätzung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der charakteristischen Makrophyten-,<br />
Zoobenthos- <strong>und</strong> Fischarten der marinen Lebensraumtypen erfolgt anhand des<br />
Bewertungssystems (vgl. Kap. 5.1 <strong>und</strong> Anhang <strong>III</strong>). Die potenziellen Beeinträchtigungen der<br />
Arten im Bereich der Kühlwasserfahne werden anhand der Veränderung der Standorteignung<br />
für die einzelnen Arten abgeleitet. Dabei wurde gr<strong>und</strong>sätzlich das „worst-case-<br />
Szenario“ der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 zu Gr<strong>und</strong>e gelegt, so dass bei der Beeinträchtigungsbe-
FROELICH & SPORBECK Seite 173<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
wertung die maximalen Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen berücksichtigt wurden. In<br />
der folgenden Tabelle sind die Empfindlichkeiten der lebensraumtypischen Arten gegenüber<br />
Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsveränderungen angegeben.<br />
Die charakteristische Vogelart Eisente kommt im Winter weiträumig verteilt über den<br />
Greifswalder Bodden, aber auch über die benachbarte Pommersche Bucht vor (SONNTAG et<br />
al. 2007). In dieser Zeit liegt das Mittel für die gesamte Kühlwasserfahne bei 205 Individuen,<br />
was 0,07 % des deutschen Winterbestandes entspricht. Es erscheint daher gut möglich,<br />
dass die relativ wenigen im Winter nach Muscheln tauchenden Eisenten des UG in umliegende<br />
Gebiete ausweichen können (vgl. DIERSCHKE 2010). Eine Erhöhung der Eisentendichte<br />
in den Ausweichgebieten ist auch deshalb möglich, weil selbst die große Zahl der in<br />
der Pommerschen Bucht überwinternden Vögel nur 1-2 % der benthischen Biomasse konsumiert<br />
<strong>und</strong> die Ausbeutung des Nahrungsangebotes damit gering ist (KUBE & SKOV 1996).<br />
In Bereichen mit mittlerer Muscheldichte ist die Ausbeutung dagegen deutlich größer, so<br />
dass dort zum Frühjahr hin keine Eisenten mehr auftreten. Gleichzeitig wechselt eine große<br />
Zahl von Eisenten im März <strong>und</strong> April in den Greifswalder Bodden, um den energetisch<br />
hochwertigen Heringslaich zu verzehren (KUBE & SKOV 1996). Die Zunahme der Eisente im<br />
Frühjahr wird auch durch die von DIERSCHKE (2010) zugr<strong>und</strong>e liegenden Zählungen belegt.<br />
Da die Aufnahme von Heringslaich vor allem im April, d. h. unmittelbar vor dem Aufbruch in<br />
Richtung der arktischen Brutgebiete, stattfindet <strong>und</strong> zudem sehr viele Individuen zu betreffen<br />
scheint (SELLIN 1990), könnten durch ansteigende Wassertemperaturen in der Kühlwasserfahne<br />
verursachte Veränderungen für die Eisente von Bedeutung sein. Es hat den<br />
Anschein, dass Heringslaich auf lokaler Ebene sehr schnell von den Eisenten ausgebeutet<br />
wird, so dass es zu vielen kurzfristigen Verlagerungen der Eisenten-Schwärme kommt (LEI-<br />
PE & SCABELL 1990). Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich mittelbar über eine Beeinträchtigung<br />
des Heringslaichs in der Kühlwasserfahne auch eine Schwächung der Fitness<br />
für die im Gebiet rastenden Eisenten ergibt. Es werden daher vorsorglich erhebliche<br />
Beeinträchtigungen angenommen.<br />
Tab. 17: Empfindlichkeit von charakteristischen Fisch- , Makrozoobenthos- <strong>und</strong> Makro-<br />
Wissenschaftlicher<br />
Gattungs- oder<br />
Artname<br />
phytenarten des LRT 1110 gegenüber Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen<br />
Deutscher Gattungs-<br />
oder Artname<br />
Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäuler (Pisces/ Cyclostomata)<br />
Vorkommen Salztoleranz Temperaturtoleranz<br />
Pisces Fische k.A. Mismatch durch verfrühtes<br />
Schlüpfen von<br />
Fischlarven bei gleichzeitigem<br />
Fehlen planktischer<br />
Nahrung 1) , Kälteschäden<br />
bei warmadaptierten<br />
Arten bei plötzlichem<br />
Temperaturabfall um<br />
10°C 8)<br />
Ammodytes tobianus Kleiner Sandaal<br />
(Tobiasfisch)<br />
GB, SW marin 3) , mind. 8 ‰<br />
(11)<br />
Platichthys flesus Fl<strong>und</strong>er GB, SW marin, brackig 3) , zum<br />
Laichen mind. 10-12<br />
PSU in den tieferen<br />
k. A.<br />
Opt: 21-23°C, max.<br />
31°C 8) , empfindlich gegenüber<br />
Kühlwasser, für
Wissenschaftlicher<br />
Gattungs- oder<br />
Artname<br />
Pomatoschistus<br />
minutus<br />
Cerastoderma<br />
glaucum<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 174<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Deutscher Gattungs-<br />
oder Artname<br />
Vorkommen Salztoleranz Temperaturtoleranz<br />
Wasserschichten<br />
nötig 2)<br />
Sandgr<strong>und</strong>el GB, SW marin, euryhalin, 0,9-<br />
45 PSU 3)<br />
Lagunen-Herzmuschel GB >4/4,5-20 PSU, 4/4,5-<br />
60 PSU 6) , 7-84 PSU 3) ,<br />
marin- euryhalin<br />
Macoma balthica Baltische Plattmuschel GB, Sandbank<br />
3)<br />
untere Toleranzgrenze:<br />
Ästuar 1,7-2,1<br />
PSU, Ostsee 1,5-2,0<br />
bzw. 4 PSU 6) , marineuryhalin<br />
Mya arenaria Sandklaffmuschel GB, FS 3) >1-5 PSU, 4- mind.<br />
35 PSU 3) (toleriert<br />
sehr geringe Salzgehalte<br />
zwischen 1-5<br />
PSU 6) , Einstellung<br />
Pumprate
FROELICH & SPORBECK Seite 175<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
case abgeschätzt. Der errechnete Äquivalenzwert liegt bei 28,96 ha (vgl. Tab. 8), wobei bei<br />
einer prozentualen Aufteilung auf beide <strong>GuD</strong>, ein Äquivalenzwert von 16,5072 ha allein dem<br />
Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> zugewiesen wird. Da der errechnete Äquivalenzwert den lebensraumspezi-<br />
fischen Orientierungswert von 5 ha (vgl. Stufe <strong>III</strong> bei LAMBRECHT & TRAUTNER) übersteigt, wird<br />
von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 1110 ausgegangen.<br />
5.3.2 Ästuarien (EU-Code 1130)<br />
Tab. 18: Beeinträchtigung der „Ästuarien (EU-Code 1130)<br />
Ästuarien (EU-Code 1130)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V): Reiherente (Aythya fuligula).<br />
Fische (S) : Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus)<br />
Wirbellose (W): Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Vorkommen des LRT/ der charakteristischen Arten im duB<br />
Im detailliert untersuchten Bereich wird die Spandowerhagener Wiek diesem Lebensraumtyp zugeordnet. Die<br />
nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 2,3 km von der Baustelle bzw. 2,7 km von der An-<br />
lage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der stärksten Beeinträchtigungsintensität)
FROELICH & SPORBECK Seite 176<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
- Da die Baustelle des Kraftwerks mindestens 2,5 km vom LRT Ästuarien entfernt ist <strong>und</strong> sich<br />
die Bautätigkeit zudem nicht auf die marinen LRT erstreckt, sind nur durch den Bau der<br />
Fischschutzanlage kurzzeitige baubedingte optische <strong>und</strong> akustische Störwirkungen zu erwarten.<br />
Da es sich nicht um dauerhafte Störwirkungen handelt, können relevante Beeinträchtigungen<br />
ausgeschlossen werden.<br />
- Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen durch die Baustelle <strong>und</strong> die Baukräne können aufgr<strong>und</strong> der<br />
großen Entfernung zur Baustelle ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT ist davon auszugehen, dass<br />
durch die Anlage die Lebensraumfunktionen der Ästuarien <strong>und</strong> die lebensraumtypischen Arten<br />
nicht beeinträchtigt werden. Die geplante Fischschutzanlage liegt außerhalb des<br />
Schutzgebietes <strong>und</strong> verursacht damit keine anlagebedingten Beeinträchtigungen.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen dem LRT 1130 <strong>und</strong> dem Kraftwerk können Beeinträchtigungen<br />
durch Lärmimmissionen oder optische Störungen weitestgehend ausgeschlossen<br />
werden. Kurzzeitige, temporäre Störungen sind allenfalls bei der Wartung der<br />
Fischschutzanlagen zu erwarten.<br />
- Durch die sehr geringen zusätzlichen, betriebsbedingten Stickstoffimmissionen (0,0052 bis<br />
0,0131 kg N/ha/a) über den Luftpfad ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten zu erwarten. Der LRT 1130 wird<br />
nicht als besonders stickstoffempfindlich eingestuft, daher sind in den Vollzugshilfen auch<br />
keine Critical Loads für den LRT aufgeführt.<br />
- Allgemeine Wirkungen der Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek:<br />
Durch die Kühlwassereinleitung kommt es im Lebensraumtyp 1130 in der Spandowerha-<br />
gener Wiek zu keinen betriebsbedingten Beeinträchtigungen, denn die Modellierungen der<br />
Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 zeigen, dass das erwärmte Kühlwasser nicht die Spandowerhagener<br />
Wiek erreicht. Relevante Auswirkungen ergeben sich durch die Kühlwasserentnahme aus<br />
der Spandowerhagener Wiek, die zum überwiegenden Teil dem LRT Ästuarien zugeordnet<br />
wird. Der gesamte Kraftwerksbetrieb am Standort (mit <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> EWE) erfordert die Entnahme<br />
von max. 320.000 m 3 /h Kühlwasser (88,9 m 3 /s). Davon entfallen auf das Gas- <strong>und</strong><br />
Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> max. 140.000 m 3 /h Kühlwasser (38,9 m³/s). Damit wird der natürliche<br />
Abfluss des Peenestroms (175 m³/s im Winter <strong>und</strong> 75 m³/s in den Sommerextremen,<br />
125 m³/s im Mittel, vgl. BUCKMANN 2011) lediglich bei Niedrigwasser durch die Gesamtbelastung,<br />
nicht jedoch durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> allein, überschritten. Auf der Gr<strong>und</strong>lage der<br />
Hydrologie des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> des nördlichen Peenestroms sowie anhand des<br />
Kühlwasserbedarfs kann die jährliche Variation der Anteile von Wasser aus dem
FROELICH & SPORBECK Seite 177<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Peenestrom am Kühlwasserstrom konservativ dem Intervall von 30% bis 50% zugeordnet<br />
werden. In einem abflussarmen Jahr wird der Anteil im unteren <strong>und</strong> in einem abflussstarken<br />
Jahr im oberen Bereich des Intervalls liegen. Im jeweiligen Jahresgang können alle Mischungsverhältnisse<br />
von 0 % bis 100 % eintreten, wobei im häufigsten Fall kein reines<br />
Peenestromwasser, sondern ein Mischwasser mit erheblicher Zumischung aus dem Bodden<br />
oder der Ostsee ansteht. Die Kühlwasserentnahme führt laut BUCKMANN (2011) dazu,<br />
dass verstärkt Wasser aus Norden, d. h. ein Mischwasser aus der Ostsee <strong>und</strong> dem Greifswalder<br />
Bodden, angesaugt wird. Nach BUCKMANN (2011) wird durch die Kühlwasserentnahme<br />
der natürliche Austausch zwischen den Gewässern (Spandowerhagener Wiek,<br />
nördlicher Peenestrom, Ostsee <strong>und</strong> Greifswalder Bodden) intensiviert. Das macht sich vor<br />
allem in der Verstärkung der Stromgeschwindigkeiten in der durch die Spandowerhagener<br />
Wiek verlaufenden Kühlwasserrinne <strong>und</strong> in der Beeinflussung von Lage <strong>und</strong> Steilheit des<br />
Salzgradienten an der Brackwassergrenze bemerkbar. Die berechneten Kühlwassersimulationen<br />
(vgl. ebd.) zeigen, dass der Kühlwasserstrom durch einen zeitweilig verstärkten Zustrom<br />
aus Norden im Mittel zu ca. 30 % aus Boddenwasser besteht. Insgesamt ist in der<br />
von wechselnden Wasserparametern des Peenestroms <strong>und</strong> des Greifswalder Boddens geprägten<br />
Spandowerhagener Wiek dadurch gr<strong>und</strong>sätzlich temporär <strong>und</strong> geringfügig eine<br />
Veränderung zugunsten der Boddeneigenschaften zu erwarten (vgl. BUCKMANN 2011). Nach<br />
BUCKMANN (2011) werden die geplanten Industrieansiedlungen <strong>und</strong> Kühlwasserentnahmen<br />
zu einer leichten Veränderung des Temperaturregimes, des Salzgehaltes, der Nährstoffverhältnisse<br />
<strong>und</strong> der Sauerstoffkonzentration in der Spandowerhagener Wiek führen. Im Ergebnis<br />
wird das Jahresmittel des Salzgehaltes <strong>und</strong> der Sauerstoffkonzentration in der<br />
Spandowerhagener Wiek aufgr<strong>und</strong> des zunehmenden Ostsee- <strong>und</strong> Boddenwassereinflusses<br />
in Folge der Kühlwasserentnahme leicht ansteigen, die Nährstoffzufuhr <strong>und</strong> die Wassertemperaturen<br />
geringfügig sinken. Mit der geringfügigen Erhöhung der Sauerstoffkonzentration<br />
in der Spandowerhagener Wiek durch den zunehmenden Einfluss von Ostsee- <strong>und</strong><br />
Boddenwasser könnten auch geringfügige positive Effekte auf die Artengemeinschaft verb<strong>und</strong>en<br />
sein. Aus einem Vergleich der Temperatur-Salinität-Diagramme von einer Messstation<br />
im Greifswalder Bodden (LUNG-Station GB19) <strong>und</strong> in der Spandowerhagener Wiek<br />
(LUNG-Station GB9) wird die große Schwankungsbreite dieser Parameter im Bereich der<br />
Spandowerhagener Wiek deutlich. Zudem lässt sich ableiten, dass die Beeinflussung der<br />
beiden Wasserkörper untereinander bereits im Ist-Zustand keinen gerichteten Gradienten<br />
aufweist. Auch bei leicht modifizierten Einstrombedingungen in Folge der Kühlwasserentnahme<br />
würde sich dies nicht ändern. Nach BUCKMANN (2011) können die Temperaturen je<br />
nach Jahreszeit <strong>und</strong> Wetterlage geringfügig zu- oder abnehmen. Der Salzgehalt verändert<br />
sich wenig auffällig <strong>und</strong> ebenfalls in verschiedene Richtungen, stets jedoch um weniger als<br />
0,5 PSU.<br />
- Veränderungen des Strömungsregimes: Nach den Prognosen von BUCKMANN (2011)<br />
sind durch die Kühlwasserentnahme Veränderungen des Strömungsregimes in der Spandowerhagener<br />
Wiek zu erwarten. Mit dem Einfluss der Kraftwerkspumpen wird ein Umschwung<br />
vom Ausstrom aus dem Peenestrom zum Einstrom von Boddenwasser in die<br />
Spandowerhagener Wieck hydraulisch erleichtert. Die Intensität der Wirkungen veränderter<br />
Strömungsbedingungen hängt dabei insbesondere von der Wasserstandshöhe ab. Bei hohen<br />
Wasserständen erhöht sich die Strömungsgeschwindigkeit nur im Bereich des breit<br />
gefassten Einlauftrichters zum Einlaufkanal <strong>und</strong> in der Einlaufrinne sowie in der nordöstlich<br />
angrenzenden Tonnenbankrinne. Eine Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit um bis
FROELICH & SPORBECK Seite 178<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
zu 0,1 m/s kann sich in folgenden Bereichen ergeben: Flachwasserbereiche im engen Umkreis<br />
um das Loch sowie zwischen Knaakrückenrinne <strong>und</strong> Tonnenbankrinne. Bei niedrigen<br />
Wasserständen ist mit einer stärkeren Veränderung der Strömungsgeschwindigkeiten<br />
durch die Kühlwasserentnahme zu rechnen. Eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit<br />
wäre dann nicht nur auf den Bereich der Einlaufrinne beschränkt, sondern könnte sich auch<br />
für einen etwa 750 m breiten Randbereich der Einlaufrinne ergeben. Nach den Prognosen<br />
ist bei niedrigen Wasserständen in den Randbereichen des Anstromtrichters eine Verringerung<br />
der Strömungsgeschwindigkeiten um ca. 0,03 m/s zu erwarten. Dies führt zu einer<br />
Verlangsamung des Wasseraustauschs <strong>und</strong> wäre mit geringfügigen Veränderungen von<br />
Standortparametern wie Sauerstoffgehalt <strong>und</strong> Nährstoffangebot verb<strong>und</strong>en. Im ostseeseitigen<br />
Zulauf über die Tonnenbankrinne können die Strömungsgeschwindigkeiten ebenfalls<br />
um bis zu 0,15 m/s absinken, da die Kühlwasserentnahme in Ausstromsituationen gegenläufig<br />
zur Hauptstromrichtung wirkt. Die Tonnenbankrinne stellt aufgr<strong>und</strong> ihres Ausbaus als<br />
Schifffahrtsrinne ein stark vorbelastetes Areal innerhalb des Peenestroms dar. Aus diesem<br />
Gr<strong>und</strong> liegt im Hinblick auf das Makrozoobenthos nur ein stark eingeschränktes Lebensraumpotenzial<br />
für die Tonnenbankrinne vor. Aufgr<strong>und</strong> des eingeschränkten Lebensraumpotenzials<br />
in der Tonnenbankrinne sind hier keine signifikanten Auswirkungen auf das Makrozoobenthos<br />
zu erwarten. Aufgr<strong>und</strong> der in den Flachwasserbereichen bei Niedrigwasser<br />
bereits herrschenden hohen Reibungskräfte konzentrieren sich die Wassertransporte in der<br />
Spandowerhagener Wiek vor allem auf die tiefen Strömungsrinnen. Insgesamt wird sich<br />
durch die Kühlwasserentnahme die Strömungsgeschwindigkeit daher vor allem in der Einlaufrinne,<br />
also einem anthropogen bereits überprägten <strong>und</strong> vorbelasteten Bereich des LRT<br />
1130 <strong>und</strong> im unmittelbaren Ansaugbereich vor dem Einlaufkanal erhöhen. In der Einlaufrinne<br />
sind zulaufbedingte Strömungsgeschwindigkeiten von weniger als 0,20 m/s, direkt vor<br />
dem Einlaufkanal bis ca. 0,30 m/s zu erwarten. Beiderseits der Einlaufrinne sind die Strömungsänderungen<br />
jedoch sehr gering <strong>und</strong> liegen im Bereich von wenigen cm/s. So sind bereits<br />
am mittig in der Spandowerhagener Wiek gelegenen Strömungspunkt (SP0095, vgl.<br />
BUCKMANN 2011) nur noch geringe Änderungen der Strombeträge (1-2 cm/s) nachweisbar.<br />
Die Veränderungen liegen hier im Rahmen der natürlichen Schwankungsbreite. In den<br />
Flachwasserzonen bleibt die Strömung weitgehend windgesteuert (BUCKMANN, mündl.). Die<br />
gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten bieten demnach auch keinen Anhalt für zusätzliche,<br />
über die sonstigen Prozesse hinaus gehende Auswirkungen auf sedimentologische<br />
Prozesse.<br />
Die vorhandene, im Jahr 1971 errichtete Einlaufrinne stellt, wie bereits in Kap. 4.3.4 dargestellt,<br />
ein vorbelastetes Areal innerhalb der Spandowerhagener Wiek dar. Da die Hauptwasserzufuhr<br />
des Kühlwassers über die Einlaufrinne erfolgt, sind Änderungen des Temperaturregimes,<br />
des Salz- <strong>und</strong> Sauerstoffgehaltes <strong>und</strong> der Nährstoffverhältnisse besonders<br />
innerhalb der Einlaufrinne spürbar. Vor allem hier sind Extremschwankungen der Anteile<br />
von Peenestromwasser <strong>und</strong> Ostsee-Boddenwasser zwischen 0 <strong>und</strong> 100 % möglich. Die<br />
Schwankungsbreite der Anteile beider Gewässer reduziert sich mit zunehmendem Abstand<br />
zur Einlaufrinne. In Konsequenz bedeutet dies, dass sich die aufgeführten Veränderungen<br />
von Temperatur, Salz- <strong>und</strong> Sauerstoffkonzentration <strong>und</strong> Nährstoffen in der Fläche mit zunehmender<br />
Entfernung zur Einlaufrinne reduzieren.<br />
- Salinitätsänderungen: Im Mündungsbereich des Peenestroms, also auch in der Spando-<br />
werhagener Wiek können bereits im derzeitigen Zustand die Salzgehalte zwischen 1 PSU
FROELICH & SPORBECK Seite 179<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
<strong>und</strong> 8 PSU schwanken (LUNG M-V 2008B). Zwischen dem Greifswalder Bodden <strong>und</strong> der<br />
vorgelagerten Ostsee besteht kein gravierender Salzgehaltsgradient. Der Salzgehalt beträgt<br />
jeweils ca. 8 PSU. Der Salzgehalt von 8 PSU stellt somit gleichzeitig den höchstmöglichen<br />
Wert im Mündungsgebiet der Peene dar. Die Schwankungen des Salzgehaltes im Mündungsgebiet<br />
des Peenestroms erfolgen entsprechend der Pegelschwankungen überwiegend<br />
stochastisch, denn der Wasseraustausch zwischen dem Greifswalder Bodden <strong>und</strong> der<br />
Ostsee wird primär durch die meteorologischen Bedingungen (Wind, Luftdruck) gesteuert<br />
(IFAÖ 2007A). Wie bereits oben dargestellt, ist in Folge der Kühlwasserentnahme gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
eine geringfügige Änderung zugunsten der Boddeneigenschaften zu erwarten (vgl.<br />
BUCKMANN 2011). Es können sich demnach die minimalen, die mittleren <strong>und</strong> die maximalen<br />
Salzgehalte im Mittel der langfristigen Zeitreihen des Salzgehaltes der Spandowerhagener<br />
Wiek leicht erhöhen. Durch die Kühlwasserentnahme kann es zu einer Veränderung der<br />
Lage <strong>und</strong> Steilheit des Salzgradienten an der Brachwassergrenze kommen (vgl. BUCKMANN<br />
2011), wobei die Brackwassergrenze auch abhängig vom natürlichen Abflussregime des<br />
Peenestroms variiert. Zur Quantifizierung der Abweichung von Standortbedingungen kann<br />
auch auf das Gutachten von BAW (2008) zurückgegriffen werden, das im Rahmen der Anpassung<br />
der Seewasserstraße Nördlicher Peenestrom erstellt wurde <strong>und</strong> eine kumulierende<br />
Betrachtung von Kühlwasserentnahme (allerdings mit höheren Entnahmemengen) <strong>und</strong><br />
Peenestromvertiefung erstellte. Daraus geht hervor, dass sich mit der Kühlwasserentnahme,<br />
insbesondere bei Einstromlagen, eine verstärkte Stromaufwärtsverschiebung der Mischungszone<br />
im gesamten nördlichen Peenestrom ergibt, was lokal mit der temporären Erhöhung<br />
des Salzgehaltes um bis zu 2 PSU verb<strong>und</strong>en sein kann. Bei Ausstromereignissen<br />
kann sich die Mischungszone durch die Kühlwasserentnahme weiter nach Norden verschieben,<br />
was wiederum die Salzgehalte im Nördlichen Peenestrom <strong>und</strong> der Spandowerhagener<br />
Wiek verringert. Somit sind die Veränderungen jeweils ereignisbezogen <strong>und</strong> als<br />
temporär zu beschreiben.<br />
Die Vegetation <strong>und</strong> Fauna (Fische, Makrozoobenthos) des Lebensraumtyps 1130 in der<br />
Spandowerhagener Wiek ist bereits derzeit an Salzgehaltsschwankungen zwischen 1 <strong>und</strong> 8<br />
PSU angepasst, so dass durch die geringe Zunahme der Zustromereignisse aus Richtung<br />
der Pommerschen Bucht in die Spandowerhagener Wiek keine Auswirkungen auf die Vorkommen<br />
von Tieren <strong>und</strong> Pflanzen erwartet werden. Zudem zeichnet sich die Spandowerhagener<br />
Wiek durch sehr geringen Makrophytenbewuchs aus (vgl. IFAÖ 2007E).<br />
In der Spandowerhagener Wiek wurden 45 benthische wirbellose Arten erfasst. Es dominieren<br />
bereits derzeitig marin-euryhaline <strong>und</strong> Brackwasserarten mit deutlichen Beziehungen<br />
zur Faunenzusammensetzung des Greifswalder Boddens. Unter den zehn häufigsten Arten<br />
befinden sich nur zwei limnische Taxa, die potenziell durch leicht verstärkten Salzeinfluss<br />
beeinträchtigt werden können. Dies sind nach den Bestandsangaben von IFAÖ (2007E) die<br />
Neuseeländische Deckelschnecke (Potamopyrgus antipodarum) <strong>und</strong> nicht determinierte<br />
Zuckmückenarten (Chironomidae). Bei der Neuseeländischen Deckelschnecke handelt es<br />
sich um eine eingeschleppte Art, die auf die schlammigen Substratverhältnisse hinweist. Alle<br />
weiteren dominant auftretenden Arten sind den marin-euryhalinen <strong>und</strong> den Brackwasserarten<br />
zuzuordnen, die auch im Greifswalder Bodden auftreten <strong>und</strong> daher durch die geringfügige<br />
Erhöhung der mittleren Salzkonzentration in Folge der erhöhten<br />
Boddenwasserbeeinflussung nicht beeinträchtigt werden können.
FROELICH & SPORBECK Seite 180<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Durch die geringen, lokalen Salzgehaltsverringerungen bei Ausstromereignissen sind vor<br />
dem Hintergr<strong>und</strong> der natürlichen großen Salzgehaltsschwankungen (s.o.) in der Spandowerhagener<br />
Wiek <strong>und</strong> im Nördlichen Peenestrom ebenso keine signifikanten Auswirkungen<br />
auf Vorkommen von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten zu erwarten. Nach IFAÖ (2007E) wird die<br />
Spandowerhagener Wiek durch eine hohe Bestandsdynamik der vorkommenden Taxa geprägt,<br />
da in Jahren mit hohem Oberwasserabfluss des Peenestroms sich die Zusammensetzung<br />
der benthischen Lebensgemeinschaft zugunsten der Süßwasserfauna durch einen<br />
Rückgang der marin-euryhalinen Arten verschiebt, in Jahren mit niedrigem Oberwasserabfluss<br />
die marin-euryhalinen Arten begünstigt sind. Ökologisch besonders in der Spandowerhagener<br />
Wiek relevant sind demnach die über einen längeren Zeitraum anhaltenden<br />
Maxima <strong>und</strong> Minima der Salzkonzentration. Die Schwankungsbreite verändert sich gegenüber<br />
dem Ist-Zustand jedoch nicht. Der errechnete geringfügige Anstieg der mittleren Salzkonzentration<br />
ändert nichts an den gr<strong>und</strong>sätzlichen Abhängigkeiten der Makrozoobenthoszönose<br />
von den Abflussverhältnissen im Peenestrom. Insgesamt ist daher nicht zu<br />
erwarten, dass die geringfügige mittlere Salzkonzentrationsänderung, die sich vor allem aus<br />
einem leicht verstärkten Einfluss von Ostsee- <strong>und</strong> Boddenwasser ergibt, zu einem signifikanten<br />
Einfluss auf die Benthosfauna führt.<br />
Nach IOW (2008 B) weist die Spandowerhagener Wiek als Bereich mit signifikantem Süßwasserabfluss<br />
durch den Peenestrom bereits ohne Kühlwassereinfluss eine hohe Schichtungsneigung<br />
auf. Nach den Modellierungen des IOW halten in der Spandowerhagener<br />
Wiek ohne Kühlwassereinfluss Schichtungen in einigen Bereichen mehr als sieben Tage<br />
an. In Folge der Kühlwasserentnahme wird die Schichtungsdauer in der Spandowerhagener<br />
Wiek in größeren Bereichen (überwiegend im Bereich der Einlaufrinne) verstärkt, was durch<br />
das Ansaugen von salzhaltigem Boddenwasser <strong>und</strong> einer damit verb<strong>und</strong>enen Erhöhung der<br />
Dichteunterschiede zum Peenestromwasser zu erklären ist (vgl. ebd.). Bei den durch das<br />
Kraftwerk erzeugten Fließgeschwindigkeiten ist jedoch eine Sauerstoffzehrung bis zu kritischen<br />
Werten sehr unwahrscheinlich, da das Wasser die Spandowerhagener Wiek binnen<br />
einiger St<strong>und</strong>en passiert.<br />
- Temperaturänderungen: Vorhabensinduziert werden in der Spandowerhagener Wiek die<br />
Wassertemperaturen bei Kühlwasserentnahme im Winter leicht ansteigen, während sie im<br />
Sommer leicht zurückgehen. Dabei ist der Unterschied zwischen Ist-Status <strong>und</strong> Status mit<br />
Kühlwasserentnahme im Sommer größer als im Winter. BUCKMANN (2011) errechnete so<br />
genannte Normkurven für den gegenwärtigen Ist-Zustand <strong>und</strong> den früheren Kernkraftwerksbetrieb<br />
bei einer Spitzenentnahme von 320.000 m 3 /h Wasser, also einer mit den Lastfällen<br />
11 <strong>und</strong> 12 vergleichbaren Wassermenge. Im Maximum wurde für die Spandowerhagener<br />
Wiek eine Verringerung der Normkurve um bis zu 3 K festgestellt (Normkurve im Juli<br />
bei ca. 21ºC bei Kühlwasserentnahme KKW anstatt 24ºC im Ist-Zustand). Die Temperaturveränderung<br />
ist im Sommer am höchsten, weil aufgr<strong>und</strong> der zumeist geringen Wasserführung<br />
des Peenestroms verstärkt kälteres Ostsee-/Boddenwasser in die Wiek gezogen wird.<br />
Im Winterhalbjahr ermittelte BUCKMANN (vgl. ebd.) nur sehr geringe Unterschiede von max.<br />
ca. 0,5 K zwischen den Normkurven ohne Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> der Normkurve im<br />
Kernkraftwerksbetrieb (Normkurve im Januar bei ca. -1ºC bei Kühlwasserentnahme anstatt<br />
-1,5ºC im Ist-Zustand). Nach BUCKMANN (2011) weicht die Größe der Temperaturunterschiede,<br />
die sich zum gegenwärtigen Zustand durch die Kühlwassermenge bei den Lastfällen<br />
11 <strong>und</strong> 12 aufbauen würde, geringfügig von den Veränderungen bei der Kühlwasser-
FROELICH & SPORBECK Seite 181<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
entnahme des KKW ab. Eine veränderte Ausgangssituation gegenüber dem Verhältnissen<br />
zu Zeiten des KKW ergibt sich durch den mehrfachen Ausbau mit Vertiefung des nördlichen<br />
Peenestroms <strong>und</strong> einer damit verb<strong>und</strong>enen Vergrößerung der Fließquerschnitte <strong>und</strong> einer<br />
Intensivierung des Austausches zwischen Peenestrom <strong>und</strong> Spandowerhagener Wiek.<br />
Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der hohen natürlichen Temperaturschwankungen im Übergangsbereich<br />
zwischen Peenestrom <strong>und</strong> Greifswalder Bodden sind die prognostizierten Temperaturveränderungen<br />
eher als gering einzustufen. Die zu erwartenden, vorhabensbedingten<br />
Temperaturveränderungen führen weder zu einer Erhöhung der absoluten Maximaltemperaturen,<br />
noch zu einer Verringerung der absoluten Minimaltemperaturen in der Spandowerhagener<br />
Wiek. Da die lebensraumtypische Artengemeinschaft an einen hochdynamischen<br />
Lebensraum mit wechselnden Temperaturen angepasst ist, sind durch die vorhabensbedingten<br />
Parameteränderungen keine relevanten Veränderungen mit Auswirkungen auf das<br />
Vorkommen von charakteristischen Arten zu erwarten. Die stärksten Temperaturveränderungen<br />
würden zudem im Bereich der anthropogen stark überprägten Einlaufrinne auftreten,<br />
da hierüber die Hauptwasserzufuhr des Kühlwassers erfolgt. Insgesamt ist daher damit<br />
zu rechnen, dass die vorhabensbedingten Temperaturveränderungen in der Spandowerhagener<br />
Wiek weitgehend ohne negative ökologische Auswirkungen bleiben.<br />
- Änderungen der Nährstoffgehalte: Bezüglich der Nährstoffgehalte wird sich das derzeitige<br />
Mischungsverhältnis bei Kühlwasserentnahme zu Gunsten der Werte der LUNG-Station<br />
GB 8 („Loch“) <strong>und</strong> GB 10 („südlich Ruden“) <strong>und</strong> zu Ungunsten der Station P 20 („südlich<br />
Peenemünde“) verschieben. Daher werden die Nährstoffanteile gegenüber den derzeitigen<br />
Werten im Mittel sinken (BUCKMANN 2011). Mit zunehmendem Einfluss von Ostsee- <strong>und</strong><br />
Boddenwasser in der Spandowerhagener Wiek ist zudem eine geringfügige Erhöhung der<br />
Sauerstoffkonzentration verb<strong>und</strong>en. Laut IFAÖ (2007E) führte die hohe Primärproduktion in<br />
der Spandowerhagener Wiek zu einer Verschlechterung des Lichtklimas <strong>und</strong> zum Rückgang<br />
der submersen Pflanzenbestände <strong>und</strong> damit gleichzeitig zum Rückgang der Phytalfauna.<br />
Auch wenn das Ausmaß des trophiebedingten Rückgangs wegen fehlender Daten<br />
nicht zu bestimmen ist, zeichnet sich die Spandowerhagener Wiek auch noch gegenwärtig<br />
durch einen sehr geringen Makrophytenbewuchs aus (vgl. ebd). Die gegenüber den derzeitigen<br />
Werten ermittelte Nährstoffreduktion <strong>und</strong> Sauerstofferhöhung in Folge zunehmenden<br />
Ostsee-/Boddenwassereinflusses ist daher im Hinblick auf etwaige Wiederbesiedlungen der<br />
Phytalfauna als geringfügig positiv zu bewerten. Insgesamt ist aber aufgr<strong>und</strong> der weiterhin<br />
dominanten Wasserzufuhr aus dem Peenestrom nicht davon auszugehen, dass sich die<br />
anthropogen erhöhten Nährstoffverhältnisse in der Spandowerhagener Wiek durch verstärkte<br />
Zufuhr nährstoffärmeren <strong>und</strong> sauerstoffreicheren Wassers aus dem Bodden bzw.<br />
der Ostsee signifikant verbessern, zumal das saubere Wasser vor allem in der anthropogen<br />
überprägten Einlaufrinne <strong>und</strong> ihren Randbereichen bemerkbar sein wird.<br />
- Verlust von Phyto- <strong>und</strong> Zooplankton: Durch Entnahme von Kühlwasser aus der Span-<br />
dowerhagener Wiek sind Verluste des frei schwebenden Phytoplanktons <strong>und</strong> Zooplanktons<br />
zu erwarten, dass in den Kühlkreislauf hineingerät. Vorhabensbedingt sind innerhalb des<br />
Kühlprozesses Absterbevorgänge von Phyto- <strong>und</strong> Zooplankton anzunehmen. In Bezug auf<br />
Effekte der Passage von Kühlwassersystemen sind nach IOW (2008B) Biomasseverluste<br />
des Phytoplanktons in der Größenordnung von einigen Prozent wahrscheinlich. Diese Absterbeprozesse<br />
sind vor allem auf den Eintritt salzintoleranter Süßwasserarten in den salz-
FROELICH & SPORBECK Seite 182<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
haltigeren Greifswalder Bodden zurückzuführen. Da dieser Effekt auch natürlich bei Erreichen<br />
der Mündung auftritt, ist eine vorhabensbedingte Erhöhung dieser Prozesse unwahrscheinlich.<br />
Auf Gr<strong>und</strong> des zahlreichen Vorkommens von Süßwasserarten im Greifswalder<br />
Bodden wird angenommen, dass die meisten Phytoplanktonarten die Salzgehalte des Boddenwassers<br />
tolerieren. Eine untergeordnete Rolle spielt nach IOW (2008B) die mechanische<br />
Zerstörung bei der Passage des Kühlwassersystems. Nach LANGFORD (1990, in IOW<br />
2008B) sind Langzeitschäden an limnischem <strong>und</strong> marinem Plankton bei Temperaturen<br />
oberhalb von 37°C zu erwarten, darunter ist mit Schockzuständen zu rechnen, von denen<br />
sich das Plankton jedoch innerhalb weniger St<strong>und</strong>en erholt. Bei einer Begrenzung der Aufwärmspanne<br />
auf 7 K sind somit thermisch bedingte letale Effekte auf das Phytoplankton<br />
auszuschließen. Auf Gr<strong>und</strong> der geringen <strong>und</strong> zeitlich begrenzten negativen Auswirkung auf<br />
das Phytoplankton werden keine erheblichen Biomasseverluste mit relevanten Auswirkungen<br />
auf das autochthone Nahrungsnetz durch die Entnahme von Kühlwasser prognostiziert.<br />
Beim Zooplankton (ohne Fischlarven) sind gegenüber dem Phytoplankton höhere Mortali-<br />
täten zu erwarten, da diese Organismen empfindlicher gegenüber mechanischer Belastung<br />
sind <strong>und</strong> ebenfalls ein Teil durch Salzstress absterben wird (IOW 2008B). Die mechanische<br />
Belastung in Kühlwassersystemen verursacht üblicherweise Sterberaten in einer Größenordnung<br />
von 25 – 30 % (vgl. ebd.). Da die kritischen Temperaturen für die meisten<br />
Zooplanktonarten zwischen 32 <strong>und</strong> 38°C liegen (vgl. ebd.), die Aufwärmspanne der eingeleiteten<br />
Wärmemenge aber auf 7 K beschränkt ist, spielen Temperatureffekte beim<br />
Zooplankton (ausgenommen Fischlarven) vorhabensbedingt eine untergeordnete Rolle (I-<br />
OW 2008B). Fischlarven sind gegenüber anderen Organismen des Zooplanktons empfindlicher<br />
gegenüber hohen Temperaturen. Die Kühlwassererwärmung ist für bestimmte Fischarten<br />
kritisch <strong>und</strong> könnte in den Sommermonaten zu einer Abtötung eingesogener Larven<br />
führen (IOW 2008B). Durch den Verlust von Zooplankton aus dem Peenestrom sind eher<br />
geringe negative Auswirkungen zu erwarten, da ein Teil des an Süßwasser geb<strong>und</strong>enen<br />
Planktons auch unter natürlichen Bedingungen im Salzwasser schnell abstirbt. Die Fortpflanzungsstrategien<br />
vieler Benthosarten beruhen auf der Produktion einer extrem großen<br />
Anzahl planktischer Larven, deren erfolgreiche Entwicklung von sehr vielen Faktoren abhängig<br />
ist. Die natürliche Absterberate des Zooplanktons ist in einem offenen System wie<br />
dem Meer oder auch dem Peenestrom weitgehend unbekannt. Zudem ist über die sehr<br />
komplexen Vorgänge im Zooplankton <strong>und</strong> die Interaktionen mit dem Benthos sowie dem<br />
gesamten Nahrungsnetz zu wenig bekannt, um die Auswirkungen der Kühlwasserentnahme<br />
abschätzen zu können. Die gegenwärtige Datenlage <strong>und</strong> der Forschungsstand lassen daher<br />
keine Quantifizierung dieser Auswirkungen zu (GOSSELCK, mündl. am 20.08.2007 zur<br />
Kühlwasserentnahme des ehemals geplanten Steinkohlekraftwerks <strong>Lubmin</strong>). Trotz der hohen<br />
Bestandsdynamik des Zooplanktons können geringe Auswirkungen auf die Nahrungspyramide<br />
in Folge der Absterbevorgänge nicht ausgeschlossen werden. Die Entstehung<br />
von Plankton ist ein hochdynamischer <strong>und</strong> komplexer Vorgang <strong>und</strong> stark abhängig von<br />
Lichteinfall, Verfügbarkeit von Nährstoffen, Temperaturen, Eisgang, etc. Die Pommersche<br />
Bucht ist zudem ein offenes Meeresökosystem, mit zahlreichen weiteren Rahmenbedingungen,<br />
die für die Planktonentwicklung eine Rolle spielen. Sowohl die Menge des entstehenden<br />
Planktons als auch die jahreszeitliche Verfügbarkeit können sehr stark schwanken.<br />
- Auswirkungen der Kühlwasserentnahme auf Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>maularten: Durch Ent-<br />
nahme von Kühlwasser aus der Spandowerhagener Wiek besteht auch für viele Fischarten
FROELICH & SPORBECK Seite 183<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
potenziell das Risiko in das Kühlwassersystem eingesaugt zu werden. Ohne Fischschutzmaßnahme<br />
ist nicht auszuschließen, dass sämtliche der im UG bisher festgestellten Fisch-<br />
<strong>und</strong> R<strong>und</strong>maularten durch die Kühlwasserentnahme eingesaugt werden können. Dies wären<br />
insbesondere die regelmäßig sowie die saisonal häufig auftretenden Arten Hering,<br />
Brachsen (Blei), Ukelei, Güster, Plötze, Aal, Dreistachliger Stichling, Kaulbarsch, Flussbarsch,<br />
Fl<strong>und</strong>er, Scholle, Steinbutt, Schwarzgr<strong>und</strong>el, Sandgr<strong>und</strong>el <strong>und</strong> Kleine Schlangennadel.<br />
Zum Zeitpunkt der Laichzeit <strong>und</strong> beim Austreten der Jungtiere war in den 70er Jahren<br />
des vorangegangenen Jahrh<strong>und</strong>erts vor allem der Neunstachlige Stichling (Pungitius<br />
pungitius) vom Betrieb des Kernkraftwerks betroffen, von dem bis zu 25 kg/h im Einlaufkanal<br />
erfasst wurden (SUBKLEW 1981 in IFAÖ 2008F). Geringe Betroffenheiten sind dagegen<br />
für die selten oder als Einzeltiere auftretenden Arten Stint, Zander, Dorsch <strong>und</strong> Kleiner<br />
Sandaal (Tobiasfisch) anzunehmen. Für das Flussneunauge sind ebenfalls nur einzelne betroffene<br />
Tiere zu erwarten, die Population dieser Art ist jedoch sehr individuenarm, so dass<br />
auch der Verlust einzelner Tiere als bedeutsam einzustufen ist. Zur Vermeidung <strong>und</strong> Minimierung<br />
dieser Beeinträchtigungen sieht <strong>EWN</strong> gemeinsam mit den weiteren relevanten<br />
Vorhabensträgern am Standort <strong>Lubmin</strong> daher eine Fischschutzanlage vor. Einen wesentli-<br />
chen Bestandteil der Fischschutzmaßnahme stellt der Einsatz einer Fischscheuchanlage<br />
dar, die außerhalb des FFH-Gebietes vor den Einlaufkanal installiert wird. Durch die Fischscheuchanlage<br />
soll vermieden werden, dass Fische in den Einlaufkanal geraten. Aufgr<strong>und</strong><br />
der für viele Arten nachweislich guten Scheuchwirkung durch akustische Scheuchsysteme<br />
mit niederfrequentem Schall (20-600 Hz) wird ein solcher Einsatz für den Standort <strong>Lubmin</strong><br />
geplant. Sowohl für das <strong>GuD</strong> II (EnBW) als auch für das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> (<strong>EWN</strong>) ist dies in Form einer<br />
nachgeschalteten modifizierten Siebbandanlage in Kombination mit einer mobilen Rückführung<br />
über Transportbehälter vorgesehen. Nach IMS & IBL (2010) ist zu erwarten, dass<br />
als Hörspezialisten sich vor allem herings- <strong>und</strong> karpfenartige Fischarten erfolgreich durch<br />
die akustische Scheuchanlage scheuchen lassen. Auch für Hörgeneralisten, wie beispielsweise<br />
barsch- <strong>und</strong> forellenartige Fische sowie Gr<strong>und</strong>eln werden Scheucherfolge, allerdings<br />
in einem etwas geringeren Maß, erwartet. Die vorgesehene Einströmgeschwindigkeit im<br />
Wirkbereich der Scheuchanlagen von < 0,3 m/s ermöglicht es auch schwimmschwachen<br />
Individuen, aus dem Gefahrenbereich zu entkommen (vgl. ebd.). Der anschließende Grobrechen<br />
mit einer Spaltweite von 80 - 110 mm ist für Fische mit Körperlängen < 80 cm passierbar.<br />
Vor dem Entnahmebauwerk ist mit dem sogenannten Mittelrechen eine weitere Rechenanlage<br />
vorgesehen. Die Spaltenweite beim Mittelrechen beträgt ca. 40 mm. Alle<br />
hochrückigen, lang gestreckten oder torpedoförmigen Arten bis 40 cm sowie aalförmige Arten<br />
bis 133 cm Länge sind theoretisch in der Lage, einen 40 mm Rechen zu queren, so<br />
dass sie in Richtung der nachgeschalteten Siebbandanlage geführt werden. Die nicht aalförmigen<br />
Fische mit Längen zwischen 40 cm <strong>und</strong> 80 cm werden durch den Mittelrechen<br />
aufgehalten, so dass theoretisch für diese Fische zwischen Grob- <strong>und</strong> Mittelrechen eine<br />
Fallenwirkung entstehen kann. Verschiedene Untersuchungen an anderen Kraftwerksstandorten<br />
haben jedoch gezeigt, dass der Großteil der eingesogenen Fische klein genug<br />
ist, um auch die Mittelrechen mit etwa 40 mm Stababstand zu passieren (z. B. DÄNHARDT &<br />
BECKER 2008, KÖHLER 1981, jeweils in IMS & IBL 2010) <strong>und</strong> dass zudem der Grobrechen<br />
als Verhaltensbarriere für derartige Fischgrößen wirkt, so dass dieser trotz passierbarer<br />
Stababstände zur Verhinderung des Einsaugens <strong>und</strong> der genannten Fallenwirkung beiträgt.<br />
Daher wird die Fallenwirkung von IMS & IBL (2010) nicht als Risiko eingestuft.
FROELICH & SPORBECK Seite 184<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für optimierte Fischschutzsysteme werden von SPRENGEL (1997, in IMS & IBL 2010) Überlebensraten<br />
für Adulte (so genannte 1+-Gruppe) zwischen ca. 40 % für empfindliche Arten<br />
(Hering, Sprotte, Stint) <strong>und</strong> > 80 % für körperlich robustere Arten (Gr<strong>und</strong>eln, Stichling, Plattfische<br />
wie die charakteristische Art Fl<strong>und</strong>er) prognostiziert. Für Jungfische (0-Gruppe) werden<br />
Überlebensraten zwischen ca. 35 <strong>und</strong> 65 % prognostiziert, wobei auch hier die empfindlichen<br />
Arten eher geringe Überlebensraten aufweisen. Für das KKW Brunsbüttel liegen<br />
Untersuchungen zu den Überlebensraten von Fischen bei der Rückführung am Feinrechen<br />
(VOIGT & LÜCHTENBERG 1996, in IMS & IBL 2010). Die mittlere Überlebensrate (bezogen auf<br />
die Individuen) lag hierbei bei 69,3 %. Die Fischrückführung erfolgt am Standort <strong>Lubmin</strong> gegenüber<br />
dem KKW Brunsbüttel durch den geplanten Einsatz von Fischbechern am Siebband<br />
deutlich fischschonender, so dass zu erwarten ist, dass die Überlebensraten über denen<br />
am KKW Brunsbüttel liegen werden (IMS & IBL 2010). Diese Annahme wird dadurch<br />
verstärkt, dass zusätzlich zu den in SPRENGEL (1997, in IMS & IBL 2010) genannten Optimierungsmaßnahmen<br />
zahlreiche weitere Maßnahmen zum Fischschutz geplant sind. So<br />
bleiben z. B. die Fische während des gesamten Aufenthaltes im Kühlsystem immer in ausreichend<br />
Wasser, die Fallhöhen sind gering, die Wasserspülung erfolgt Fisch schonend mit<br />
Niederdruck <strong>und</strong> es werden zur Minimierung von Verletzungen möglichst glatte Rohroberflächen<br />
verwendet. Zudem sind die nicht oder nur schlecht scheuchbaren Arten im Allgemeinen<br />
relativ robust, so dass die meisten Individuen nach einem Einsaugen mit einer<br />
schonenden Fischrückführung weitgehend unbeschadet zurückgegeben werden (IMS & IBL<br />
2010).<br />
Gegenüber adulten Fischen sind generell kleinere Jungfische <strong>und</strong> besonders Eier <strong>und</strong><br />
Larven von der Kühlwasserentnahme besonders betroffen, da Scheucheinrichtungen nicht<br />
wirken bzw. diese Individuen trotz Wahrnehmung der Scheucheinrichtungen aufgr<strong>und</strong> ihrer<br />
geringen Schwimmleistungen oftmals nicht in der Lage sind, der Einsaugströmung zu widerstehen<br />
(IMS & IBL 2010, S. 45). Für die Vermehrung <strong>und</strong> das Aufwachsen von Jungfischen<br />
besonders bedeutsame Fisch- <strong>und</strong> Laichschongebiete werden von der Kühlwasserentnahme<br />
nach den physikalischen Modellergebnissen jedoch nicht beeinflusst (IOW<br />
2008B). Für die Jungfische der charakteristischen Art Fl<strong>und</strong>er sind nur im unmittelbaren Bereich<br />
um die Öffnung des Einlaufkanals negative Auswirkungen durch die Kühlwasserentnahme<br />
zu erwarten, da nur hier kritische Strömungsgeschwindigkeiten von über 0,20 m/s<br />
erreicht werden, bei denen die Jungfische in den Einlaufkanal eingesaugt würden. Da die<br />
potenziellen Beeinträchtigungen der Fl<strong>und</strong>er durch die Kühlwasserentnahme nur in relativ<br />
kleinflächigen Teilhabitaten der Art wirksam wären, kann davon ausgegangen werden, dass<br />
der Erhaltungszustand der Art im Gebiet stabil bleibt.<br />
Nach IMS & IBL (2010) lässt sich die Wirksamkeit der Fischschutzanlage folgendermaßen<br />
zusammenfassend beurteilen: „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der<br />
Schutz des relevanten Fischartenspektrums durch eine Kombination von Fischscheucheinrichtungen<br />
<strong>und</strong> einer in den Entnahmebauwerken der Vorhabensträger nachgeschalteten<br />
modifizierten Siebbandanlage mit Lebendentnahme <strong>und</strong> schonender Fischrückführung gewährleistet<br />
werden kann. […] Es ist davon auszugehen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen<br />
einen umfassenden Schutz der Fische gewährleisten, so dass sich die Verluste der<br />
Fische auf ein Minimum reduzieren.“ Unter Berücksichtigung der Fischschutzanlage können<br />
erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen Fischarten des LRT „Ästuarien“ (EU-<br />
Code 1130) wie beispielsweise der Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus) durch Einsaugen in das
FROELICH & SPORBECK Seite 185<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Kühlwassersystem in Folge der Kühlwasserentnahme im FFH-Gebiet ausgeschlossen werden.<br />
Abgesehen von den Auswirkungen im unmittelbaren Bereich um die Öffnung des Einlaufkanals<br />
sind keine bedeutsamen Beeinträchtigungen für Fische durch Einsaugen in den<br />
Einlaufkanal der <strong>GuD</strong> zu erwarten, da die Strömungsgeschwindigkeiten in der Einlaufrinne<br />
unterhalb des kritischen Geschwindigkeitsbereiches für Jungfische liegen.<br />
Der Peenestrom wird von einigen anadromen Fischarten <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäulern als Wanderroute<br />
genutzt bzw. stellt eine potenzielle Wanderroute dar. Bedeutsam sind insbesondere die<br />
FFH-relevanten Arten Stör (Acipenser oxyrinchus), Finte (Alosa fallax), Meerneunauge (Petromyzon<br />
marinus) <strong>und</strong> Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), die sich ausnahmslos anadrom<br />
verhalten. Für alle wandernden Fischarten stellen neben dem Peenestrom auch die Verbindungen<br />
zwischen Stettiner Haff <strong>und</strong> der Ostsee durch die Meeresarme Dziwna (Dievenow),<br />
Swina (Swine) bzw. Kaiser-Swinekanal mögliche Wanderrouten dar, so dass vermutlich nur<br />
ein Teil der wandernden Fische des Peene-/Odersystems den Peenestrom als Wanderkorridor<br />
nutzt. Nach IOW (2008B) ist eine Beeinträchtigung wandernder Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäuler<br />
durch Veränderungen des Wasserspiegels bei Betrieb der in <strong>Lubmin</strong> geplanten<br />
Kraftwerke im Peenestrom gr<strong>und</strong>sätzlich ausgeschlossen. BUCKMANN (2008) berechnete für<br />
den im FFH-Gebiet DE 2049-302 gelegenen Teil des Peenestroms keine gegenüber dem<br />
jetzigen Zustand erhöhte Fließgeschwindigkeit. Ebenso hat die Kühlwasserentnahme nach<br />
IOW (2008B) keinen signifikant erhöhten nordwärts gerichteten Wassertransport im<br />
Peenestrom zur Folge. An den engsten Stellen des Peenestroms beträgt die Erhöhung der<br />
nordwärts gerichteten Strömungsgeschwindigkeit allenfalls 1 mm/s. Eine Beeinträchtigung<br />
der Funktion des Peenestroms <strong>und</strong> der Spandowerhagener Wiek als Wanderkorridor für<br />
anadrome Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäuler infolge einer veränderten Strömungssituation ist somit<br />
nicht zu erwarten.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der vergleichsweise geringen Auswirkungen der Kühlwasserentnahme auf das<br />
Makrozoobenthos <strong>und</strong> auf die Makrophyten (die bereits im Ist-Zustand weitgehend fehlen),<br />
werden über die Nahrungskette auch nur geringe mittelbare Auswirkungen auf Fische <strong>und</strong><br />
Wasservögel durch die Kühlwasserentnahme erwartet, wie beispielsweise leicht verringerte<br />
Zahlen von Tauchenten wie der Reiherente <strong>und</strong> Tafelente.<br />
Zusammenfassend sind in Folge der Kühlwasserentnahmen Änderungen des Strömungsre-<br />
gimes in der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> somit im LRT 1130 zu erwarten. Da die Artengemeinschaft<br />
des Lebensraumtyps bereits jetzt an stark schwankende abiotische Parameter angepasst<br />
ist, sind insgesamt nur geringe Auswirkungen anzunehmen. Die unmittelbarsten<br />
Auswirkungen werden für die ca. 55 ha große, bereits deutlich überprägte Einlaufrinne prognostiziert,<br />
mit zunehmendem Abstand zur Einlaufrinne minimieren sich die Auswirkungen. Bei niedrigen<br />
Wasserständen sind auch für einen etwa 228 ha großen, an die Einlaufrinne angrenzenden<br />
Pufferbereich, messbare Strömungsveränderungen zu erwarten, die jedoch vor dem<br />
Hintergr<strong>und</strong> der natürlichen Strömungsdynamik nach derzeitiger Einschätzung keine ökologische<br />
Relevanz besitzen. Die vorhabensbedingten Strömungsänderungen in den stark vorbelasteten<br />
Fahrrinnen sowie in der Einlaufrinne führen voraussichtlich zu keinen signifikanten Beeinträchtigungen,<br />
da hier jeglicher Bewuchs fehlt <strong>und</strong> auf Gr<strong>und</strong> der Vorbelastungen<br />
(Unterhaltungsmaßnahmen <strong>und</strong> Schiffsverkehr) die ökologische Wertigkeit sehr gering ist. Insgesamt<br />
sind somit keine Verschlechterungen des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps
FROELICH & SPORBECK Seite 186<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
1130 <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten durch die Wirkungen der Kühlwasserfahne zu erwarten.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Beeinträchtigung<br />
des Lebensraumtyps „Ästuarien (EU-Code 1130)“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar<br />
im Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen zu erwarten. Die Prüfung der potenziellen Beeinträchtigungen der<br />
Wirkungen der Kühlwassereinleitung anhand des Bewertungsmodells ergibt einen Äquivalenzwert<br />
von Null Hektar (vgl. Tab. 8), es sind also keine partiellen Funktionsverluste im LRT zu<br />
erwarten. Durch die Installation der „Fischschutzanlage (V 1)“ können negative Effekte auf die<br />
Fischbestände verhindert werden, so dass auch im Hinblick auf die Kühlwasserentnahme keine<br />
relevanten negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Das Verbreitungsgebiet des LRT<br />
sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen<br />
bleiben nach den derzeitigen Erkenntnissen in vollem Umfang erhalten.<br />
5.3.3 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
Tab. 19: Beeinträchtigung des „Vegetationsfreien Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatts (EU-<br />
Code 1140)<br />
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V): Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula), Rotschenkel (Tringa totanus)<br />
Wirbellose (W): Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Vorkommen des LRT /der charakteristischen Arten im duB<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 1,3 km von der Baustelle bzw. 1,8 km von der<br />
Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- --
FROELICH & SPORBECK Seite 187<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
Kollisionsrisiko -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung erheblich erheblich erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der stärksten Beeinträchtigungsintensität)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Da die Baustelle mindestens 1,3 km von den Windwattflächen entfernt ist <strong>und</strong> sich die Bautätigkeit<br />
nicht auf die marinen LRT erstreckt, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen zu erwarten.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle <strong>und</strong> der Abschirmung der Bauflächen durch<br />
die Gasanlandestation, das <strong>GuD</strong> II sowie die angrenzenden Waldflächen, können baubedingte<br />
optische <strong>und</strong> akustische Störungen der charakteristischen Vogelarten Rotschenkel<br />
<strong>und</strong> Sandregenpfeifer im LRT 1140 ausgeschlossen werden. Vom Rotschenkel ist zwar eine<br />
hohe Störanfälligkeit bekannt (vgl. BAUER & BERTHOLD 1996, BAUER & THIELKE 1982 <strong>und</strong><br />
TUCKER & HEATH 1994), bei einer Distanz von über 1,3 km ist allerdings mit keinen vorha-<br />
bensbedingten Störungen im Lebensraum 1140 zu rechnen. Von GARNIEL & MIERWALD<br />
(2010) wird für die Art eine Effektdistanz von 200 m gegenüber Straßen angegeben. Im Falle<br />
direkter Sichtkontakte mit Menschen (Fußgänger <strong>und</strong> Radfahrer) beträgt diese sogar<br />
300 m (vgl. ebd.). Auch für den Sandregenpfeifer können aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung<br />
zum Vorhaben optische <strong>und</strong> akustische Störungen im LRT 1140 ausgeschlossen werden.<br />
- Da keine Hauptflugzonen der beiden charakteristischen Vogel-Arten durch Baugerüste <strong>und</strong><br />
Baukräne etc. betroffen sind, werden keine relevanten Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkung angenommen.<br />
Auch für Rastvögel können erhebliche Beeinträchtigungen durch diese Wirkfaktoren<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT ist davon auszugehen, dass<br />
durch die Anlage die allgemeinen Lebensraumfunktionen des LRT 1140 Windwatt nicht beeinträchtigt<br />
werden.
FROELICH & SPORBECK Seite 188<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
- Es wird von keinen Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen ausgegangen. Da sich der Standort des<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 <strong>und</strong> unmittelbar am Rand der hoch<br />
aufragenden Gebäudekulisse des früheren KKW „Bruno Leuschner“ sowie am Rand des<br />
Industriehafens, der Gasanlandestation <strong>und</strong> des geplanten <strong>GuD</strong> II befindet, sind Ausweichflüge<br />
auch ohne <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> anzunehmen.<br />
- Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks kann ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.1).<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk sowie der zusätzlichen Abschirmung durch<br />
die Gasanlandestation, das <strong>GuD</strong> II sowie durch Waldflächen ist kein Meidungsverhalten der<br />
beiden Limikolenarten durch eine Veränderung des Sichtfelds in „vorhabensnahen“ LRT-<br />
Teilen zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen dem LRT 1140 <strong>und</strong> dem Kraftwerk können Beeinträchtigungen<br />
durch Lärmimmissionen oder optische Störungen weitestgehend ausgeschlossen<br />
werden.<br />
- Durch die geringen zusätzlichen, betriebsbedingten Stickstoffimmissionen über den Luft-<br />
<strong>und</strong> den Wasserpfad ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten zu erwarten. Für den LRT 1140 sind keine<br />
Critical Loads in den Vollzugshilfen angegeben. Da es sich beim Greifswalder Bodden um<br />
ein eutrophes, in Perioden hoher Bioproduktion sogar hypertrophes Gewässer handelt, sind<br />
in Verbindung mit den starken Verdünnungseffekten keine Veränderungen im Lebensraum<br />
durch zusätzliche atmosphärische Stickstoffeinträge zu erwarten. Die prognostizierten zusätzlichen<br />
Stickstoffeinträge der beiden Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> II innerhalb des Lebensraumtyps<br />
liegen zwischen 0,0038 <strong>und</strong> 0,0134 kg N/ha/a <strong>und</strong> sind somit im Vergleich zur<br />
Vorbelastung sehr gering.<br />
Tab. 20: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1140<br />
Temperaturdifferenz<br />
LF 11(Winterszenario) in ha LF 12(Sommerszenario) in ha<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht Oberflächenschicht Bodenschicht<br />
0,20 - 1,00 K 64 64 89 89<br />
1,01 - 2,00 K 1 1 15 15<br />
2,01 - 3,00 K 0 0 0 0<br />
3,01 - 4,00 K 0 0 0 0<br />
4,01 - 5,00 K 0 0 0 0<br />
5,01 - 6,00 K 0 0 0 0<br />
Summe 65 65 104 104<br />
- Temperaturänderungen: Beim Sommerszenario ergeben sich für den LRT maximale vor-<br />
habensbedingte Aufwärmspannen von bis zu 1,77 K, beim Winterszenario liegt die Temperaturdifferenz<br />
bei maximal 1,04 K. Da die zeitweise trockenfallenden Flachwasserzonen des<br />
Windwatts einen Extremlebensraum darstellen, der sich durch einen ständigen Wechsel
FROELICH & SPORBECK Seite 189<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
wichtiger abiotischer Parameter auszeichnet, spielen die geringen vorhabensbedingten<br />
Temperaturerhöhungen für seine Lebensgemeinschaft nur eine untergeordnete Rolle. Im<br />
Flachwasserbereich bei <strong>Lubmin</strong> (nahe der Ostmole des Industriehafens <strong>Lubmin</strong>) wurden<br />
tageszeitliche Temperaturschwankungen (Tag- Nachtwechsel) von ca. 7 – 15 K gemessen.<br />
Die vorhabensbedingten Temperaturänderungen sind bei dieser natürlichen Schwankungsbreite<br />
der Temperaturen daher kaum registrierbar. Die hoch gelegenen Bereiche des<br />
Windwatts sind zudem kaum mit Pflanzen <strong>und</strong> Tieren besiedelt. Die tiefer gelegenen Senken,<br />
die häufig von Wasser bedeckt sind, werden dagegen von mehreren Arten als Lebensraum<br />
genutzt. Arten, die natürlicherweise im Eulitoral in hoher Bestandsdichte vorkommen,<br />
sind durch sehr hohe Temperaturtoleranzen gekennzeichnet. Beispielsweise tolerieren<br />
Wattschnecken (Hydrobia ulvae, H. ventrosa) im Extremfall Temperaturen bis 38°C. Gewis-<br />
se Stresswirkungen der Artengemeinschaft können nicht ausgeschlossen werden, populationsbestimmende<br />
letale Effekte allein durch die Temperaturerhöhungen sind allerdings sehr<br />
unwahrscheinlich.<br />
- Sauerstoffmangelsituationen: Die Wahrscheinlichkeit von vorhabensbedingten Sauer-<br />
stoffmangelsituationen <strong>und</strong> die potenziellen Beeinträchtigungen durch diese werden bei den<br />
Flachwasserbereichen des Windwatts ähnlich bewertet wie beim LRT 1110 (vgl. oben). Da<br />
der LRT 1140 ausschließlich Flachwasserbereiche umfasst, ist die Ausbildung von stabilen<br />
Schichtungen noch unwahrscheinlicher als im LRT 1110. Es sind somit keine nachhaltigen<br />
Beeinträchtigungen des LRT durch Schichtungsereignisse zu erwarten.<br />
- Salinitätsänderungen: Aus den Szenarien von BUCKMANN (2011) ergeben sich negative<br />
Salzgehaltsanomalien im LRT von maximal –0,52 PSU. Für den größten Flächenanteil des<br />
LRT werden allerdings deutlich geringere Salzgehaltsänderungen erwartet. Salinitätsänderungen<br />
von mehr als 0,5 PSU werden nur im Winterszenario für einen Windwattbereich mit<br />
einer Gesamtgröße (Enveloppe) von maximal 5,16 ha prognostiziert. Im Sommerszenario<br />
liegen die Salzgehaltsänderungen allesamt unter 0,5 PSU. Eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
charakteristischer Arten durch eine langfristige Lebensraumbeeinträchtigung, die allein<br />
auf diesen Wirkfaktor zurückzuführen ist, kann damit ausgeschlossen werden.<br />
- Nährstoffeinleitung: Die zu erwartenden Effekte durch die vorhabensbedingten Nährstoff-<br />
zunahmen sind ähnlich wie im LRT 1110. Da die Windwattbereiche überwiegend vegetationsfrei<br />
sind <strong>und</strong> nur eine geringe Wassertiefe aufweisen, sind die durch Trübungen zu erwartenden<br />
Beeinträchtigungen im Vergleich zum LRT 1110 geringer.<br />
- Zusammenwirken der Faktoren: Analog zu den Aussagen beim LRT 1110 kann es auch<br />
im LRT 1140 durch das Zusammenwirken der verschiedenen Stressoren Temperaturerhöhung,<br />
Verringerung des Salzgehalts <strong>und</strong> zusätzlicher Nährstoffeintrag zu gewissen Beeinträchtigungen<br />
für die Artengemeinschaft des Lebensraumtyps kommen. Da es sich beim<br />
LRT 1140 um einen natürlichen Extremlebensraum handelt, dessen Artengemeinschaft eine<br />
hohe Stresstoleranz aufweist, wird allerdings von geringeren Beeinträchtigungen ausgegangen<br />
als im LRT 1110. Die anhand des Bewertungssystems ermittelten graduellen Funktionsverluste,<br />
die deutlich geringer sind als beim LRT 1110, bestätigen dieses Ergebnis.<br />
Fazit: erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben können Prozesse ausgelöst werden, die zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung<br />
<strong>und</strong> zu einem graduellen Funktionsverlust des Lebensraumtyps „Vegetationsfreies
FROELICH & SPORBECK Seite 190<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt“ mit seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Auf Gr<strong>und</strong>lage des Bewertungsmodells wurden die vorhabensbedingten partiellen<br />
Funktionsverluste im LRT für den worst case abgeschätzt. Der errechnete Äquivalenzwert<br />
liegt bei 3,51 ha (vgl. Tab. 8), wobei bei einer prozentualen Aufteilung auf beide <strong>GuD</strong>, ein Äquivalenzwert<br />
von 2,0007 ha allein dem Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> zugewiesen wird. Da der errechnete<br />
Äquivalenzwert den lebensraumspezifischen Orientierungswert von 0,5 ha (vgl. Stufe <strong>III</strong> bei<br />
LAMBRECHT & TRAUTNER) übersteigt, wird vorsorglich von einer erheblichen Beeinträchtigung<br />
ausgegangen.<br />
5.3.4 Strandseen der Küste (EU-Code 1150*)<br />
Tab. 21: Beeinträchtigung der „Strandseen der Küste (EU-Code 1150*)<br />
Strandseen der Küste (EU-Code 1150*)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V): Brandgans (Tadorna tadorna)<br />
Fische (F) : Hering (Clupea harengus)<br />
Wirbellose (W): Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum), Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Pflanzen (P): Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera), Graue Armleuchteralge (Chara canescens)<br />
Vorkommen des LRT /der charakteristischen Arten im duB<br />
Der Freesendorfer See ist etwa 2,2 km von der Baustelle bzw. 2,5 km von der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält<br />
Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich
FROELICH & SPORBECK Seite 191<br />
Strandseen der Küste (EU-Code 1150*)<br />
Legende:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der stärksten Beeinträchtigungsintensität)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Da die Baustelle mindestens 2,2 km vom Freesendorfer See entfernt ist <strong>und</strong> sich die Bautätigkeit<br />
nicht auf die marinen LRT erstreckt, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen der<br />
Lebensraumfunktionen zu erwarten.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle sind keine baubedingten optischen <strong>und</strong><br />
akustischen Störungen der charakteristischen Vogelarten zu erwarten.<br />
- Die Baustelle des Kraftwerks wird für die Brandgans zu keinen Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen<br />
führen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT ist davon auszugehen, dass<br />
durch die Anlage die Lebensraumfunktionen der Lagunen nicht beeinträchtigt werden.<br />
- Es wird von keinen Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen für die Brandgans ausgegangen. Da sich<br />
der Standort des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 <strong>und</strong> unmittelbar<br />
am Rand der hoch aufragenden Gebäudekulisse des früheren KKW „Bruno Leuschner“ sowie<br />
am Rand des Industriehafens, der Gasanlandestation <strong>und</strong> des geplanten <strong>GuD</strong> II befindet,<br />
sind Ausweichflüge auch ohne <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> anzunehmen<br />
- Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks kann ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.1).<br />
- Ein Meidungsverhalten der Brandgänse durch eine Veränderung des Sichtfelds kann aufgr<strong>und</strong><br />
der großen Entfernung zum Kraftwerk <strong>und</strong> der Abschirmung durch andere Vorhaben<br />
<strong>und</strong> Waldflächen ausgeschlossen werden.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk <strong>und</strong> der teilweisen Abschirmung des Kraftwerks<br />
durch angrenzende Waldflächen können relevante betriebsbedingte Beeinträchtigungen<br />
der charakteristischen Arten durch optische <strong>und</strong> akustische Störungen ausgeschlossen<br />
werden.<br />
- In den Freesendorfer See werden vorhabensbedingt über dem Luftweg maximal<br />
0,009 kg/ha/a Stickstoff eingetragen. Die Stickstoffvorbelastung (Summe aus Hintergr<strong>und</strong>belastung,<br />
vgl. UBA (2011) sowie Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger) liegt
FROELICH & SPORBECK Seite 192<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
bei 11,003 bis 11,004 kg N/ha/a, die Gesamtbelastung bei 11,01 bis 11,013 kg N/ha/a.<br />
Nach HALL (2007) wird dem Freesendorfer See als Strandsee (LRT 1150*) eine Belastungsgrenze<br />
von 30 bis 40 kg N/ha/a zugeordnet. Nach Berner Liste liegt der mittlere Critical<br />
Load bei 15 kg/ha/a. Dieser Wert wird von der ermittelten Gesamtbelastung (maximal<br />
11,01 kg/ha/a) zwar nicht überschritten, allerdings weist der Strandsee auf Nährstoffeintrag<br />
besonders empfindlich reagierende Characeen-Bestände auf, die bei erhöhtem Nährstoff-<br />
gehalt des Sees durch Schwimmblattpflanzen <strong>und</strong> andere Gefäßpflanzen verdrängt werden<br />
können (vgl. BERG et al 2004, POTT 1995). Eine zusätzliche Prüfung der projektbezogenen<br />
Zusatzbelastung wird hier abweichend vom Prüfschema durchgeführt, um jegliche Beeinträchtigungen<br />
auf diesen seltenen <strong>und</strong> hochgradig gefährdeten Lebensraum ausschließen<br />
zu können. Die maximale Zusatzbelastung von 0,009 kg/ha/a Stickstoff entspricht 0,06 %<br />
des CL (15 kg N/ha/a). Da die Zusatzbelastungen durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> das <strong>GuD</strong> II somit<br />
sehr deutlich unter der Irrelevanzschwelle liegen, sind die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen<br />
im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen des Lebensraums zu vernachlässigen.<br />
- Temperaturerhöhungen: Weder der Lastfall 11 noch der Lastfall 12 zeigt einen signifikan-<br />
ten Wärmeeintrag in den See. Die Kühlwassermodellierungen zeigen im Freesendorfer See<br />
keine nachweisbare Restwärme (>0,2 K). Auch bei Kumulation der Werte über 6,5 Jahre für<br />
den detaillierter betrachteten Gewässerabschnitt wird ein Einfluss durch Temperaturaufschläge<br />
ausgeschlossen. Vorhabensbedingte Beeinträchtigungen des LRT inklusive seiner<br />
charakteristischen Arten aufgr<strong>und</strong> von Temperaturerhöhungen durch Kühlwassereinfluss<br />
können daher ausgeschlossen werden.<br />
- Salzgehaltsveränderungen: Aus den Szenarien (Lastfall 11 <strong>und</strong> 12) von BUCKMANN (2011)<br />
ergeben sich negative Salzgehaltsanomalien von bis zu -0,35 PSU im Freesendorfer See<br />
im Sommerszenario über den Wirkpfad der Kühlwassereinleitung. Die folgende Tabelle<br />
zeigt, dass vor allem die Characeen des Freesendorfer Sees, aber auch an marine <strong>und</strong><br />
brackische Verhältnisse angepasste Spermatophyten nur eingeschränkte Toleranzen gegenüber<br />
Salzgehaltsverringerungen aufweisen. Das Vorkommen der Characeen im<br />
Freesendorfer See wird vor allem durch den geringen Expositionsgrad <strong>und</strong> das günstige<br />
Lichtklima bestimmt. Der See weist für die nachgewiesenen Characeen-Arten entsprechend<br />
den oben aufgelisteten Empfindlichkeiten optimale Salzgehalte auf. Messungen ergaben<br />
natürliche Salzgehaltsvariationen in Größenordnungen zwischen 1 <strong>und</strong> 9,5 PSU, mit einem<br />
horizontalen Gradienten innerhalb des Sees zu geringeren Werten nach Südosten hin<br />
(FRÖHLE et al. 2010). Durch die Wirkungen der Kühlwasserentnahme ist dagegen mit einem<br />
leichten Anstieg des mittleren Salzgehalts des Sees zu rechnen, da der mittlere Salzgehalt<br />
in der Spandowerhagener Wiek aufgr<strong>und</strong> des zunehmenden Ostsee- <strong>und</strong> Boddenwassereinflusses<br />
leicht ansteigen wird. Eine leichte Erhöhung des mittleren Salzgehalts ist für<br />
die an marine <strong>und</strong> brackiche Verhältnisse angepasste Artengemeinschaft unproblematisch<br />
(vgl. Tab. 22). Die geringen vorhabensbedingten Veränderungen im Salzgehalt sind nicht<br />
geeignet, natürliche Schwankungen derart zu erhöhen, dass sich das Absterberisiko für den<br />
Pflanzenbewuchs <strong>und</strong> die charakteristische Tierartengemeinschaften des Sees nachhaltig<br />
erhöht. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands des LRT inklusive seiner charakteristischen<br />
Arten durch diese geringfügigen Abweichungen ist daher nicht zu erwarten.
FROELICH & SPORBECK Seite 193<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Bei den Makrozoobenthosarten wird der Freesendorfer See nach den Bestandsergebnis-<br />
sen von WOHLRAB (1959) <strong>und</strong> IFAÖ (2007A) durch das Vorkommen von limnischen Makrozoobenthosarten<br />
gekennzeichnet, die nicht durch Verringerungen des Salzgehalts beeinträchtigt<br />
würden. Als vergleichsweise empfindlich gegenüber zunehmenden<br />
Süßwassereinfluss kann die Sandklaffmuschel (Mya arenaria) eingestuft werden, die die<br />
geringen Salzkonzentrationen im Freesendorfer See noch toleriert. Eine etwas engere<br />
Amplitude weist die Assel Sphaeroma hookeri auf, die zumeist in mittleren Konzentrations-<br />
bereich von ca. 2,5 bis 11 PSU lebt, zeitweilig aber auch bis 0,5 PSU ertragen kann (DEN<br />
HARTOG, o. D.).<br />
Für den Hering hat der Freesendorfer See als Laichgebiet nur eine höchstens untergeord-<br />
nete Bedeutung. In der Untersuchung von IFAÖ (2007A) konnten nur Larven, kein Laich<br />
nachgewiesen werden, daher wird eine erhebliche Beeinträchtigung von Laich ausgeschlossen,<br />
lediglich Stresswirkungen auf Larven sind möglich. Da die Salzgehaltsdifferenzen<br />
des Sees unterhalb von -0,5 PSU liegen, sind keine relevanten Beeinträchtigungen zu<br />
erwarten.<br />
- Nährstoffeinleitung: Durch die Umleitung von nährstoffreicherem Peenestromwasser so-<br />
wie durch die zusätzliche eutrophierende Wirkung aufgr<strong>und</strong> des beschleunigten Stoffumsatzes<br />
im Bereich der Kühlwasserfahne ergeben sich durch die Kühlwassereinleitung auch<br />
im Bereich des Freesendorfer Sees temporär geringe Erhöhungen der Nährstoffkonzentrationen.<br />
Die empfindliche Vegetation des Sees, insbesondere die Armleuchteralgen, reagieren<br />
besonders sensibel auf Veränderungen des Lichtklimas. Für die inneren Küstengewässer<br />
der deutschen Ostsee ermittelten PORSCHE et al. (2008), dass das Salinitätspotenzial<br />
von Characeen auf Gr<strong>und</strong> der Eutrophierung nicht ausgeschöpft wird. Demnach wurden<br />
von den Autoren selbst geringe Nährstoffeinträge als Ursache für den Ausfall der Arten gewertet.<br />
Das Erreichen des Freesendorfer Sees durch Abwässer ist wasserstandsbedingt statistisch<br />
an 84 Tagen im Jahr eingeschränkt. Hinzu kommt, dass lediglich bei westlichen Winden<br />
überhaupt Einstromlagen in den See möglich sind. Diese zeitlichen Begrenzungen des Abwassereintrags<br />
fanden Berücksichtigung in der Berechnung der Konzentrationsveränderungen<br />
im Freesendorfer See. Lediglich in den Wintermonaten ist mit geringfügig erhöhten<br />
DIN-Konzentrationen (maximal 0,076 µM, entspricht 0,5 % der natürlichen mittleren Konzentration)<br />
zu rechnen. Diese Veränderungen werden als nicht ökologisch relevant gewertet.<br />
Weitere Parameter weichen lediglich in geringem Maße von den natürlichen Bedingungen<br />
des Sees ab <strong>und</strong> verursachen damit keine Beeinträchtigungen der empfindlichen<br />
Pflanzengemeinschaft. Eine signifikant negative Beeinträchtigung der Makrophytenbestände<br />
des Freesendorfer Sees durch Nährstoff- <strong>und</strong> Phytoplanktoneinträge ist daher ausgeschlossen.<br />
Mit der Kühlwasserentnahme ist dagegen voraussichtlich eine geringe Verringerung der Eutrophierung<br />
im Freesendorfer See verb<strong>und</strong>en. Die Wasserqualität des Freesendorfer Sees<br />
wird von den angrenzenden Gewässern bestimmt, wobei die Verhältnisse der Spandowerhagener<br />
Wieck leicht dominieren. Mit den Veränderungen der Wassereigenschaften der<br />
Wieck (vgl. LRT 1130) durch die Kühlwasserentnahme (geringe Verringerung der Wassertemperaturen<br />
<strong>und</strong> des Nährstoffgehalts, geringe Zunahme des Salzgehaltes <strong>und</strong> der
FROELICH & SPORBECK Seite 194<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Sauerstoffkonzentration) sind somit auch leichte Veränderungen im Freesendorfer See zugunsten<br />
der Boddenwasserqualität zu erwarten. Durch den zunehmenden Einfluss von Ostsee-<br />
<strong>und</strong> Boddenwasser könnten also auch geringe positive Effekte auf die Artengemeinschaft<br />
verb<strong>und</strong>en sein.<br />
Tab. 22: Empfindlichkeit von Makrophytenarten des Freesendorfer Sees gegenüber<br />
Temperatur- <strong>und</strong> Salzgehaltsänderungen<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Angiospermen<br />
Myriophyllum spicatum Ähriges Tausendblatt FS<br />
Deutscher Artname Vorkommen Salztoleranz Temperaturtoleranz<br />
Potamogeton pectinatus Kamm-Laichkraut FS, SW, GB,<br />
Potamogeton perfoliatus Durchwachsenes Laichkraut FS<br />
Ranunculus aquatilis<br />
Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß<br />
Ranunculus baudotii Brackwasser-Hahnenfuß FS<br />
Ranunculus circinatus<br />
Spreizender Wasserhahnenfuß<br />
3 – 10 PSU²,<br />
0,5 - 10 PSU<br />
0 – 18 PSU³,<br />
0,5 – 15 PSU 4<br />
0 – 1 PSU² / 3<br />
– 5 PSU³<br />
25°C 11<br />
FS 0 PSU² k. A.<br />
FROELICH & SPORBECK Seite 195<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
- Veränderungen des Strömungsregimes: An der Austauschrate <strong>und</strong> am Austauschver-<br />
hältnis des Freesendorfer Sees ändert sich durch die Kühlwasserentnahme gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
nichts (BUCKMANN 2011). Nach BUCKMANN (2011) belegen die Modellierungen ein geringfügig<br />
verändertes Stau- <strong>und</strong> Einschwingverhalten im südlichen Zulauf zum Freesendorfer<br />
See. In Folge der Kühlwasserentnahme können hier, den Modellierungen zufolge, die<br />
Strombeträge bei westlichen Winden leicht zunehmen <strong>und</strong> bei östlichen Winden um einige<br />
Millimeter pro Sek<strong>und</strong>e abnehmen. Vor dem Hintergr<strong>und</strong> der natürlich variablen Strömungsbedingungen<br />
ist nicht damit zu rechnen, dass diese Wirkungen relevante Auswirkungen<br />
auf das charakteristische Arteninventar des Freesendorfer Sees <strong>und</strong> seines Zulaufs<br />
haben werden.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Nach den derzeitigen Erkenntnissen werden durch das Vorhaben keine Prozesse ausgelöst, die<br />
zu einer langfristigen Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps „Strandseen<br />
der Küste“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet führen können.<br />
Auf Gr<strong>und</strong>lage der Aussagen von BUCKMANN (2011) <strong>und</strong> TÜV NORD (2011) werden die möglichen<br />
zusätzlichen Nährstoffeinträge in den See über den Wirkpfad der Kühlwassereinleitung<br />
unter Berücksichtigung der Wasseraustauschverhältnisse als irrelevant für die Artengemeinschaft<br />
der Lagune eingestuft. Die Prüfung der potenziellen Beeinträchtigungen der Wirkungen<br />
der Kühlwassereinleitung anhand des Bewertungsmodells ergibt einen Äquivalenzwert von Null<br />
Hektar (vgl. Tab. 8), es sind also keine partiellen Funktionsverluste im LRT zu erwarten. Mit der<br />
Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wieke ist voraussichtlich eine leichte Verbesserung<br />
der Wasserqualität <strong>und</strong> geringe Verringerung der Eutrophierung im Freesendorfer<br />
See verb<strong>und</strong>en. Insgesamt werden die potenziellen Beeinträchtigungen daher als nicht erheblich<br />
eingestuft.<br />
5.3.5 Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code<br />
1160)<br />
Tab. 23: Beeinträchtigung der „Flachen großen Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen)“<br />
(EU-Code 1160)<br />
Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Bergente (Aythya marila), Eisente (Clangula hyemalis), Höckerschwan (Cygnus olor), Seead-<br />
ler (Haliaeetus albicilla), Zwergsäger (Mergus albellus), Brandgans (Tadorna tadorna),<br />
Fische (F) : Hering (Clupea harengus), Hornhecht (Belone belone),<br />
Wirbellose (W): Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum), Baltische Plattmuschel (Macoma balthica),<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator), Heterotanais oerstedi<br />
Pflanzen : Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera), Chara baltica, Chara canescens, Tolypella nidifica,<br />
Seegras (Zostera marina)<br />
Vorkommen des LRT im duB<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 670 m von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.
FROELICH & SPORBECK Seite 196<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160)<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- nicht erheblich -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
erheblich erheblich erheblich<br />
- Da die Baustelle mindestens 600 m von den Flachwasserbereichen entfernt ist <strong>und</strong> sich die<br />
Bautätigkeit nicht auf die marinen LRT erstreckt, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen für charakteristische Fischarten, Benthosarten sowie für die<br />
Makrophyten zu erwarten.<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle <strong>und</strong> der Abschirmung der Bauflächen durch<br />
angrenzende Waldflächen sowie die Gasanlandestation im Nordosten, können keine relevanten<br />
optischen <strong>und</strong> akustischen Störungen der charakteristischen Vogelarten im Lebensraumtyp<br />
1160 auftreten. Bezüglich der Störempfindlichkeit wird für den Seeadler von GAR-<br />
NIEL & MIERWALD (2010) eine Fluchtdistanz von 500 Metern genannt. Die Arten Brandgans<br />
<strong>und</strong> Höckerschwan gelten als nicht lärmempfindlich. Sie weisen eine Effektdistanz von<br />
100 m auf (GARNIEL & MIERWALD 2010). Bei mausernden Beständen des Höckerschwans,<br />
wie sie im UG vorkommen, ist jedoch eine deutlich höhere Empfindlichkeit anzunehmen, da<br />
die Vögel während dieser Zeit nicht bzw. nur eingeschränkt flugfähig sind. Mausernde Bestände<br />
befinden sich jedoch bereits in großer Entfernung zum Bauvorhaben, so dass keine
FROELICH & SPORBECK Seite 197<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
erheblichen Störungen zu erwarten sind. Auch bei der Brandgans sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung des LRT zum geplanten Vorhaben keine relevanten baubedingten akustischen<br />
<strong>und</strong> optischen Beeinträchtigungen zu erwarten. Für auf Wasserflächen rastende Enten wird<br />
von GARNIEL & MIERWALD allgemein ein kritischer Störradius von 150 m angegeben. Die<br />
LRT-Flächen liegen deutlich außerhalb dieser Distanz, so dass erhebliche Beeinträchtigungen<br />
ausgeschlossen werden können.<br />
- Es wird von keinen relevanten Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen ausgegangen. Da sich der<br />
Standort des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 <strong>und</strong> unmittelbar am<br />
Rand der hoch aufragenden Gebäudekulisse des früheren KKW „Bruno Leuschner“ sowie<br />
am Rand des Industriehafens, der Gasanlandestation <strong>und</strong> des geplanten <strong>GuD</strong> II befindet,<br />
sind Ausweichflüge auch ohne <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> anzunehmen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT ist davon auszugehen, dass<br />
durch die Anlage die Lebensraumfunktionen der Flachwasserbereiche nicht beeinträchtigt<br />
werden.<br />
- Das Kraftwerk führt für die charakteristischen Vogelarten zu keinen relevanten Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen (vgl. oben).<br />
- Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks kann ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.1).<br />
- Ein Meidungsverhalten der charakteristischen Vogelarten durch eine Veränderung des<br />
Sichtfelds in „vorhabensnahen“ LRT-Teilen ist aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk<br />
<strong>und</strong> der Abschirmung durch angrenzende Waldflächen sowie die angrenzenden Vorhaben<br />
östlich des Industriehafens sehr unwahrscheinlich.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
- Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk <strong>und</strong> der Abschirmung durch nördlich angrenzende<br />
Waldflächen sowie die Industrieflächen östlich des Industriehafens (Gasanlandestation,<br />
<strong>GuD</strong> II) können relevante betriebsbedingte Beeinträchtigungen der charakteristischen<br />
Arten durch optische <strong>und</strong> akustische Störungen ausgeschlossen werden. Wichtige<br />
Nahrungs- <strong>und</strong> Rasthabitate der Arten befinden sich außerhalb des kritischen Störradius<br />
(vgl. oben).<br />
- Durch die geringen zusätzlichen, betriebsbedingten Stickstoffimmissionen über den Luft-<br />
<strong>und</strong> den Wasserpfad ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten zu erwarten. Für den LRT 1160 sind keine<br />
Critical Loads in den Vollzugshilfen angegeben. Nach KIFL (2008) wird der marine LRT<br />
1160 in Großbritannien eindeutig als nicht empfindlich gegen Stickstoff-Eutrophierung eingestuft.<br />
Da es sich beim Greifswalder Bodden um ein eutrophes, in Perioden hoher Bioproduktion<br />
sogar hypertrophes Gewässer handelt, sind in Verbindung mit den starken Verdünnungseffekten<br />
keine Veränderungen im Lebensraum durch zusätzliche atmosphärische<br />
Stickstoffeinträge zu erwarten. Die prognostizierten zusätzlichen Stickstoffeinträge der beiden<br />
Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> II innerhalb des Lebensraumtyps liegen zwischen 0,0024 <strong>und</strong><br />
0,0136 kg N/ha/a <strong>und</strong> sind somit im Vergleich zur Vorbelastung sehr gering.
FROELICH & SPORBECK Seite 198<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 24: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen der Lastfälle 11 <strong>und</strong> 12 am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011) im Bereich des LRT 1160<br />
Temperaturdifferenz<br />
LF 11(Winterszenario) in ha LF 12(Sommerszenario) in ha<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht Oberflächenschicht Bodenschicht<br />
0,20 - 1,00 K 136 163 123 224<br />
1,01 - 2,00 K 102 104 58 96<br />
2,01 - 3,00 K 36 31 46 64<br />
3,01 - 4,00 K 0 0 32 37<br />
4,01 - 5,00 K 0 0 21 24<br />
5,01 - 6,00 K 0 0 0 0<br />
Summe 274 298 280 445<br />
- Temperaturänderungen: Beim Sommerszenario ergeben sich für den LRT maximale Auf-<br />
wärmspannen von bis zu 4,51 K in der oberen Wasserschicht (0-2 m Tiefe) <strong>und</strong> von 4,57 K<br />
in der Bodenschicht, beim Winterszenario liegt die Temperaturdifferenz bei maximal 2,99 K<br />
(0-2 m Tiefe). Temperaturerhöhungen von über 4 K können maximal auf einer Fläche von<br />
24 ha auftreten (wobei diese Flächen niemals gleichzeitig durch eine solche Temperaturerhöhung<br />
belastet würden). Unter winterlichen Bedingungen (LF11) wird der Temperaturausgleich<br />
zwischen Kühlwasser <strong>und</strong> Vorfluter durch die niedrigen Luft- <strong>und</strong> Boddenwassertemperaturen<br />
beschleunigt, so dass die Kühlwasserfahne eine geringere Ausdehnung hat. Im<br />
Winterszenario ist ein schnellerer Abbau der Temperaturgradienten um die Einleitstelle zu<br />
erkennen. Die maximalen gemessenen Wassertemperaturen des südlichen <strong>und</strong> zentralen<br />
Greifswalder Boddens (Messstationen GB 7, GB 8, GB 10 <strong>und</strong> GB 19, Messreihen des<br />
LUNG M-V 1997-2007) liegen bei 24,1°C. Für den durch eingeleitetes Kühlwasser induzierten<br />
Anstieg der Temperaturen ist neben der Temperatur des Boddenwassers <strong>und</strong> der Aufwärmspanne<br />
auch die Temperatur im Vorlauf, d. h. in der Spandowerhagener Wiek, von<br />
Bedeutung. Anhand der Daten der Messstationen GB 1-GB 19 (Wassertiefe zwischen 7<br />
<strong>und</strong> 16 m) ist für den Greifswalder Bodden von hochsommerlichen Temperaturmaxima um<br />
ca. 25°C auszugehen. Die Analyse von langjährigen Messreihen der <strong>EWN</strong> am Rechenwerk<br />
<strong>und</strong> von CORRENS an der Station Wolgast/Hafen zeigen, dass Vorlauftemperaturen größer<br />
22°C sehr selten <strong>und</strong> eine Vorlauftemperatur von 24°C nur singulär (ein Messwert am<br />
14.8.1986) auftreten.<br />
Zu Temperaturempfindlichkeiten können anhand der Literatur nur wenige Aussagen getroffen<br />
werden. Die allgemeine letale thermische Obergrenze für marine Organismen beträgt<br />
nach IFAÖ (2007B) etwa 28°C. Da Makrophyten i. d. R. empfindlicher reagieren als die<br />
Fauna, ist nach TÜV NORD 2008A die Toleranzgrenze bereits bei 25°C anzusetzen. Entsprechend<br />
treten auch ohne Kühlwassereinfluss bei extremen sommerlichen Temperaturen<br />
<strong>und</strong> schwachen Windlagen natürlich temporäre Stresssituationen in den Flachwasserbereichen<br />
auf. Die zusätzliche Erwärmung innerhalb der Kühlwasserfahnen kann negative Effekte<br />
auf die lebensraumtypische Artengemeinschaft verstärken <strong>und</strong> im Nahbereich der Molenköpfe<br />
unter hochsommerlichen Bedingungen Absterbeereignisse auszulösen. Nach<br />
einem solchen Ereignis ist bei den Makrophytenbeständen von einer Regeneration im<br />
nächsten Jahr auszugehen (HAMMER et al. 2009). Die Makrozoobenthosarten der Flach-
FROELICH & SPORBECK Seite 199<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
wassergebiete <strong>und</strong> Ästuare besitzen Anpassungsstrategien an den hoch dynamischen Lebensraum<br />
mit schwankenden Temperaturen <strong>und</strong> Salzkonzentrationen. Eurytherme Arten<br />
sind in der Lage große Temperaturschwankungen zu ertragen. Darüber hinaus verfügen<br />
viele Individuen über ein gewisses Anpassungsvermögen <strong>und</strong> können bei ausreichender<br />
Adaptationszeit höhere Temperaturen tolerieren (IFAÖ 2007B). So sind beispielsweise einige<br />
Muschelarten in der Lage, bei Erreichen kritischer Temperaturen in das Bodensubstrat<br />
zurückzuziehen. Auch der Schlickkrebs (Corophium volutator) kann sich bei widrigen Be-<br />
dingungen bis zu 20 cm in seine Bodenröhre zurückziehen (MEADOWS & REID 1966 in IFAÖ<br />
2008M). Zudem weisen viele der Organismen ein hohes Wiederbesiedlungspotenzial auf.<br />
Beispielsweise erfolgt die Entwicklung von Muscheln über pelagische, also frei im Wasser<br />
treibende Larven, die über weite Strecken mit der Strömung verdriftet werden. Für vergleichsweise<br />
empfindliche Arten beginnt die Letalgrenze in der Regel bei ca. 28-32°C (vgl.<br />
IFAÖ 2007B), wie dies beispielsweise bei der Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma<br />
glaucum) <strong>und</strong> Sandklaffmuschel (Mya arenaria) der Fall ist. Die Lagunen-Herzmuschel, die<br />
sich nur 1-2 cm in den Boden eingräbt, ist daher besonders temperaturempfindlich. Sandklaffmuscheln<br />
können sich dagegen bis zu 30 cm im Sediment eingraben <strong>und</strong> sich damit einem<br />
extremen Temperaturstress entziehen. Dies gilt allerdings nur für große, adulte Muscheln.<br />
Die juvenilen Muscheln sind dagegen nur wenige Millimeter bis Zentimeter groß <strong>und</strong><br />
ihr Siphon ist entsprechend kurz. Sie können sich daher nur etwa 5 bis 10 cm in den Boden<br />
eingraben <strong>und</strong> sind entsprechend empfindlicher gegenüber Temperaturveränderungen als<br />
die adulten, tiefer eingegrabenen Exemplare. Mengenmäßig dominieren vor allem die jungen<br />
Muscheln die Populationen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass Muscheln mit<br />
zunehmendem Alter die Fähigkeit verlieren, ihren Standort zu verlagern. Auch die Baltische<br />
Plattmuschel reagiert sehr empfindlich auf Temperaturerhöhungen. Nach VON OERTZEN<br />
(1973) in IOW (2008 B) sind bei Macoma baltica bei einer Temperatur von 33°C nach 8<br />
St<strong>und</strong>en 100 % der Individuen tot. Bei einer maximalen Aufwärmspanne der beiden <strong>GuD</strong>s<br />
von 7 K (nur im Bereich des Industriehafens relevant) wird diese letale Temperaturgrenze<br />
zwar in der Kühlwasserfahne nicht erreicht, mit dem Absterben einzelner Individuen <strong>und</strong> einer<br />
deutlichen Einschränkung der Fitness ist aber zu rechnen. Besonders Arten, die natürlicherweise<br />
im Eulitoral in hoher Bestandsdichte vorkommen, sind durch sehr hohe Temperaturtoleranzen<br />
gekennzeichnet. Beispielsweise ertragen Wattschnecken (Hydrobia ulvae,<br />
H. ventrosa) im Extremfall Temperaturen bis 38°C. Bei hohen Temperaturen sind aber auch<br />
bei diesen Arten deutliche Stressreaktionen zu erwarten.<br />
Neben hochsommerlichen Beeinträchtigungen sind kühlwasserinduzierte Auswirkungen auf<br />
benthische Organismen auch während anderer Jahreszeiten möglich. Beispielhaft werden<br />
nachfolgend aus der Literatur ableitbare Auswirkungen auf Muscheln, Krebse <strong>und</strong> Polychaeten<br />
aufgeführt. Nach kalten Wintern ist der Larvenfall von Muscheln häufig hoch, nach<br />
milden Wintern fällt der Larvenfall dagegen mitunter niedrig aus (IFAÖ 2007B). Die geringe<br />
ständige winterliche Erwärmung in der Kühlwasserfahne kann daher lokal zu einer geringeren<br />
Vermehrungsrate bei Muscheln führen. Muscheln haben wiederum im Nahrungskreislauf<br />
eine entscheidende Bedeutung für Wasservögel <strong>und</strong> Fische (vgl. ebd.). Allerdings können<br />
lokal begrenzte Beeinträchtigungen der Vermehrungsrate, wie dies bei einer<br />
ausschließlich kühlwasserinduzierten Beeinträchtigung der Fall wäre, durch Eindriften pelagischer<br />
Muschellarven während ihrer Planktonphase kompensiert werden. Analoge Unterschiede<br />
in der jährlichen Rekrutierung wurden bei der Wattschnecke Hydrobia ventrosa beobachtet,<br />
deren Reproduktionsrate sich in milden Wintern gegenüber Kältewintern deutlich
FROELICH & SPORBECK Seite 200<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
verringerte (PROBST et al. 2000, in IFAÖ 2007B). Für schwimmfähige Krebse <strong>und</strong> Polychaeten,<br />
die unter regional typischen Bedingungen bei Kälteeinbruch die Flachwasserbereiche<br />
verlassen <strong>und</strong> ins tiefere Wasser abwandern, kann diese winterliche Temperaturwanderung<br />
bei einer kontinuierlichen Wärmezufuhr durch Kühlwassereintrag unterbleiben. Plötzliche<br />
wetterbedingte Veränderungen des Verlaufs der Warmwasserfahne führen zu einem vergleichsweise<br />
starken <strong>und</strong> schnellen Temperaturabfall, der den Kältetod benthischer wirbelloser<br />
Tiere nach sich ziehen kann (vgl. ebd.).<br />
Im Hinblick auf das Phytoplankton ist die Kühlwassereinleitung nach TÜV NORD (2008B)<br />
folgendermaßen zu bewerten: Im Kühlwasser beeinflussten Areal ist unter der thermischen<br />
Belastung sowohl ein ausgeglichenerer Verlauf der Phytoplanktonblüte nach eisreichen<br />
Wintern (früherer Beginn, niedrigeres Maximum <strong>und</strong> früheres Ende) als auch eine Beschleunigung<br />
des Ablaufs nach milden Wintern nicht ausgeschlossen. Auch sind geringfügige<br />
Ab<strong>und</strong>anzverschiebungen zugunsten wärmeliebender Arten (Neophyta) möglich. Diese<br />
Auswirkungen sind jedoch nicht quantifizierbar. Die geringfügigen Verschiebungen<br />
bezüglich der Ab<strong>und</strong>anz des Phytoplankton werden nicht als erheblich nachteilige Beeinträchtigung<br />
gewertet.<br />
Da das Laichen der Fische u. a. durch Temperaturerhöhungen ausgelöst wird, könnte das<br />
erwärmte Wasser bei einigen Arten lokal zu verfrühtem Ablaichen führen. Die Fischlarven<br />
könnten verfrüht schlüpfen <strong>und</strong> eventuell verhungern, da die benötigte planktische Nahrung<br />
noch nicht vorhanden ist. Denn die Primärproduktion setzt erst bei einer bestimmten Sonnenscheindauer<br />
ein. Durch das verfrühte Ablaichen könnten, wenn der Reifeprozess der<br />
Eier <strong>und</strong> Samen noch nicht abgeschlossen ist, zudem auch Fehlentwicklungen eintreten.<br />
So konnten bei Studien in schwedischen <strong>und</strong> litauischen Gewässern durch kühlwasserbedingte<br />
Temperaturerhöhungen eine rückläufige Vermehrungskapazität, eine erhöhte Zwittrigkeitsrate<br />
<strong>und</strong> ein stärkerer Parasitenbefall bei einigen Fischarten beobachtet werden (vgl.<br />
IFAÖ 2007B). In wieweit die Erhöhung der Wassertemperatur im Bereich des Kühlwasserausstromes<br />
zu einer früheren Laichtätigkeit führt, konnte bereits bei der wesentlich größeren<br />
Kühlwasserfahne mit deutlich stärkeren Erwärmungen des ehemals geplanten SKW<br />
nicht genau abgeschätzt werden (IFAÖ 2008 B). Da sich die Kerngebiete der Kühlwasserfahne<br />
<strong>und</strong> damit die Wassertemperaturen bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen<br />
verändern, wird diese Einschätzung zusätzlich erschwert. Auch eine f<strong>und</strong>ierte Einschätzung,<br />
ob zu einem früheren Zeitpunkt des Schlupfes der Fischlarven hinreichend Nahrung<br />
(entsprechende Stadien der Beutetiere) vorhanden ist, ist ohne genauere Untersuchungen<br />
dieses komplexen Sachverhaltes nicht möglich, da auch Zooplanktonorganismen unterschiedlich<br />
auf Erwärmung reagieren (IFAÖ 2008 B). Eine weitere mögliche Wirkung des<br />
Kühlwassers auf die Fische wäre, dass durch das erwärmte Wasser Fische angezogen <strong>und</strong><br />
lokal einen überdurchschnittlich hohen Fraßdruck auf das Benthos ausüben könnten.<br />
Zu potenziellen Beeinträchtigungen aufgr<strong>und</strong> der Temperaturerhöhungen im Bereich der<br />
Kühlwasserfahne der charakteristischen Fischart Hornhecht (Belone belone) schreiben<br />
HAMMER et al. (2009) im Rahmen des SKW-Verfahrens, dass die Art die wärmeren Bereiche<br />
des Litorals mit Wassertemperaturen um 16°C im Mai <strong>und</strong> Juni zum Laichen aufsucht<br />
<strong>und</strong> daher vermutlich an höhere Temperaturen angepasst sei. Da bereits unter der höheren<br />
Belastungssituation des im genannten Gutachten von IOW (2008B) untersuchten Szenarios<br />
der Kühlwassereinfluss als vernachlässigbar, wenn nicht sogar förderlich für die Laich-
FROELICH & SPORBECK Seite 201<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
platzwahl eingeschätzt wurde, sind unter den aktuell anzunehmenden Bedingungen bei<br />
Realisierung der Vorhaben am Standort ebenfalls keine thermisch induzierten direkten negativen<br />
Effekte auf die Hornhechtbestände des Greifswalder Boddens zu erwarten.<br />
Im Gegensatz zum Hornhecht wird der Hering (Clupea harengus), der primär im Frühjahr<br />
die flachen Boddengewässer zum Ablaichen nutzt als kaltstenotherm eingestuft (vgl. HAM-<br />
MER et al. 2009). Er gehört damit zu den Arten, die besonders empfindlich auf Kühlwassereintrag<br />
reagieren können. Da der Hering in Brackwassergebieten laicht, spielen Toleranzwerte<br />
der sensibleren Ei- <strong>und</strong> Larvenstadien eine besonders große Rolle. Heringe<br />
laichen im Winter zwischen Januar <strong>und</strong> April bei Temperaturen von 7 – 15 °C (REID et al.<br />
1999). In diesem Bereich liegen auch Optimum <strong>und</strong> Vorzugstemperatur von Ei- <strong>und</strong> Juvenilstadien<br />
(MACFARLAND 1931, REID et al. 1999). Für Larven können Temperaturen > 16°C<br />
im Winter/Frühjahr schon einschränkend wirken. Temperaturen von >20°C wirken sich auf<br />
die Eier (die Wintermonate betreffend) <strong>und</strong> Juvenile (auch die Sommermonate betreffend)<br />
tödlich aus (MACFARLAND 1931, REID et al. 1999). Die letale Obergrenze für frisch geschlüpfte<br />
Larven ermittelte BLAXTER bei 22-24°C (1956 in HAMMER et al. 2009). Für die adulten<br />
Heringe, deren Verbreitungsgebiet allgemein Temperaturen von 1 bis 18°C aufweist<br />
(FROESE & PAULY 2008), liegen keine maximalen Temperaturen vor. Für Heringslaich ist eine<br />
Erhöhung der natürlichen Wachstumsrate (0,2 mm/d) um 8-24 % bei bereits 1 K Erwärmung<br />
nachgewiesen (vgl. HAMMER et al. 2009). Die Zeitspanne, in welcher die Larven mit<br />
Hilfe des Dottervorrates überleben können, verkürzt sich mit jedem Kelvin. Gleichzeitig wird<br />
von IFAÖ (2001A) auch eine Verschiebung der Kondition der Jungfischstadien in einen ungünstigen<br />
Bereich erwartet. Dabei ist die Dauer der Temperaturänderungen relevant. Nach<br />
HAMMER et al. (2009) sind bei mehr als 3,5 aufeinander folgenden Tagen mit einem Delta<br />
von 1 K nachteilige Auswirkungen auf den Heringslaich nachweisbar. Entsprechend dieser<br />
Schwelle erfolgt die Abgrenzung der Wirkzonen der Kühlwassereinleitung auf die Heringsbestände.<br />
Berücksichtigt man ausschließlich die bodennahe Schicht im Frühjahr (Winterszenario),<br />
so ist auf maximal ca. 134 ha des LRT eine Beeinträchtigung des Heringslaiches<br />
möglich. Beeinträchtigungen sind, als weitere Voraussetzung also ausschließlich in<br />
einem eng begrenzten Bereich südlich des Freesendorfer Hakens in Nähe der Einleitstelle<br />
unter der Voraussetzung möglich, dass submerse Makrophyten als Laichsubstrat vorhanden<br />
sind. Bedeutsame Laichregionen des Herings am Gahlkower Haken <strong>und</strong> bei <strong>Lubmin</strong><br />
werden dagegen durch die bodennahe Kühlwasserfahne >1 K nicht erreicht. Weitere Areale,<br />
die einen besonderen Wert als Heringslaichgebiet aufweisen, befinden sich vor allem im<br />
nördlichen <strong>und</strong> teilweise auch westlichen Greifswalder Bodden in allgemein wenig strömungsexponierten<br />
Buchten, wie z. B. Zickersee, Kooser See, Gristower Wiek, einige Uferbereiche<br />
im Strelas<strong>und</strong> westlich der Insel Riems <strong>und</strong> die Dänische Wiek. Diese Bereiche<br />
werden von der Kühlwasserfahne ebenfalls nicht erreicht (IOW 2008B). Die Daten zur Standorteignung<br />
zeigen beim Hering an, dass jegliche Temperaturzunahme potenziell den Lebensraum<br />
der Art beeinträchtigen kann. Da jedoch adulte Tiere sowie Larven >30 mm aktiv<br />
schwimmfähig sind, können die Individuen ungünstigen Bedingungen wie Warm- <strong>und</strong> Süßwasserzellen<br />
ausweichen <strong>und</strong> sind daher von den lokal auftretenden Beeinträchtigungen<br />
des Lebensraumes nicht unbedingt betroffen. Die Abgrenzung der winterlichen Temperaturschwankungen<br />
macht deutlich, dass im Wirkraum auch ohne Vorhabenseinfluss für die<br />
frühen Entwicklungsstadien ungünstige Temperaturbedingungen auftreten können. Durch<br />
den Einfluss des vorhabensbedingten Kühlwassers kommt es zu einer geringfügigen Ver-
FROELICH & SPORBECK Seite 202<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
stärkung dieses Effektes <strong>und</strong> somit zu einer leichten Abnahme der Lebensraumeignung für<br />
den frühjahrslaichenden Hering.<br />
Neben den oben dargestellten unmittelbaren Auswirkungen durch Temperaturerhöhung<br />
sind auch Sek<strong>und</strong>ärwirkungen nicht auszuschließen. So beschreiben MOURITSEN et al.<br />
(2005, in IFAÖ 2008M) für den Schlickkrebs (Corophium volutator) eine extreme Abnahme<br />
der Individuenanzahl aufgr<strong>und</strong> eines erhöhten Parasitenbefalls bei einer prognostizierten<br />
Erhöhung der Temperatur im Wattenmeer um 3,8°C (vgl. auch IFAÖ 2007B). Im Sommerszenario<br />
können auf insgesamt 61 ha in der Bodenschicht im LRT 1160 Temperaturerhöhungen<br />
über 3 K auftreten, auf diesen Flächen könnten entsprechende Sek<strong>und</strong>ärwirkungen<br />
nicht ausgeschlossen werden.<br />
Die hohe Variabilität der Kühlwasserfahne in Abhängigkeit von Windrichtungen zeigt die<br />
Wechselhäufigkeit, mit denen relevante Einträge Teilflächen des LRT erreichen. Bei südlichen<br />
<strong>und</strong> südöstlichen Windlagen dehnt sich die Kühlwasserfahne vorwiegend nach Osten<br />
aus. Dagegen sorgen nördliche <strong>und</strong> östliche Winde dafür, dass die Wassermassen sich<br />
westwärts bewegen. Die LRT-Bereiche, die im Nordosten in der Nähe des Industriehafens<br />
liegen, werden nach den Prognosen von BUCKMANN (2011) am häufigsten durch die Kühlwasserfahne<br />
beeinflusst (195-208 mal pro Jahr), mit zunehmendem Abstand zum Industriehafen<br />
nimmt die Häufigkeit der Beeinflussung jedoch rasch ab. So werden die LRT-<br />
Bereiche vor <strong>Lubmin</strong> nur noch etwa 78-mal im Jahr durch Kühlwasser beeinflusst <strong>und</strong> die<br />
LRT-Bereiche vor den Freesendorfer Wiesen etwa 98 bis 156-mal. Gerade ein intensiver<br />
<strong>und</strong> häufiger Wechsel der Parameter kann ökologisch relevant sein, da dadurch dauerhafte<br />
Anpassungen der Organismen verhindert werden. Aufgr<strong>und</strong> der natürlichen hohen Variabilität<br />
der Temperatur in den Flachwasserbereichen, kann davon ausgegangen werden, dass<br />
die Lebensgemeinschaft dieser Bereiche eine gewisse Toleranz gegenüber dieser Wechselhäufigkeit<br />
aufweist. Zusätzliche Stressreaktionen durch Temperaturwechsel können<br />
dennoch nicht ausgeschlossen werden.<br />
Mittelbare negative Auswirkungen auf Wasservögel könnten durch eine Beeinträchtigung ihrer<br />
Nahrungsgr<strong>und</strong>lagen (Makrophyten, Makrozoobenthos, Fischlaich) entstehen.<br />
- Sauerstoffmangelsituationen: Die Wahrscheinlichkeit von vorhabensbedingten Sauer-<br />
stoffmangelsituationen <strong>und</strong> die potenziellen Beeinträchtigungen durch vorhabensbedingte<br />
Sauerstoffmangelsituationen werden beim LRT 1160 ähnlich bewertet wie beim LRT 1110<br />
(vgl. oben). Da die Kühlwasserfahne beim Lastfall 12 (vgl. BUCKMANN 2011) nur eine geringe<br />
Schichtungsneigung aufweist, ist davon auszugehen dass im Sommer eine vorhabensbedingte<br />
Verstärkung von kritischen Sauerstoffmangelsituationen durch eine Zunahme der<br />
Schichtungsneigung eher unwahrscheinlich ist. Ein Indiz für die fehlende Schichtungsneigung<br />
ist das Vordringen von Kühlwasserteilströmen bis in Tiefen von 8 m. Hinzu kommt,<br />
dass die Kühlwasserfahne vorwiegend Flachwasserbereiche des Greifswalder Boddens<br />
überstreicht, welche gut durchströmt werden <strong>und</strong> in denen von vornherein keine stabilen<br />
Schichtungen möglich sind. Das IOW (2008B) berechnete anhand von bakteriellen Sauerstoffzehrungsraten,<br />
dass in Schlickgebieten des Greifswalder Boddens auch ohne Kühlwassereinfluss<br />
bei stabilen Schichtungsereignissen im Sommer nach sechs Tagen, im<br />
Frühjahr nach etwa acht Tagen bodennah Hypoxie auftreten kann. In sandigen Bereichen<br />
tritt aufgr<strong>und</strong> der geringeren Sauerstoffzehrungsraten im Sediment vermutlich erst verzögert
FROELICH & SPORBECK Seite 203<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ein Sauerstoffmangel ein. Kurzfristige Sauerstoffmangelsituationen können von vielen Arten<br />
toleriert werden (vgl. oben). In den LRT-Bereichen um die Molenköpfe <strong>und</strong> in den Arealen<br />
außerhalb der Flachwasserzonen führt im worst case- Fall Hypoxie zu einem Rückgang der<br />
Ab<strong>und</strong>anzen <strong>und</strong> Artenzahlen im Spätsommer, so dass in Extremfällen, wie z. B. KITCHING<br />
et al. (1976) <strong>und</strong> LEPPÄKOSKI (1968) von anderen saisonal eintretendem Sauerstoffmangel<br />
betroffenen Regionen beschrieben, in den Herbstmonaten lokal die Makrofauna auf einzelne<br />
Arten reduziert oder vollkommen eliminiert sein kann. In solchen Gebieten mit temporär<br />
wirksamem Sauerstoffmangel findet üblicherweise eine Wiederbesiedlung in den Wintermonaten<br />
statt (vgl. IOW 2008B). Treten solche Absterbevorgänge wiederholt ein, so wird eine<br />
dauerhafte Wiederbesiedlung mit mehrjährigen Arten unterb<strong>und</strong>en. Es kann sich dann<br />
langfristig nur eine verarmte Artengemeinschaft aus Pionierarten ausbilden, die jeweils<br />
nach einem Sauerstoffmangelereignis einwandert (vgl. ebd.). Im Bereich um die Molenköpfe<br />
kann es somit zu einer Verarmung der Artengemeinschaft durch Sauerstoffmangel kommen.<br />
Die charakteristische Art Lagunen-Herzmuschel scheint besonders empfindlich auf<br />
Sauerstoffmangel zu reagieren. So wird angenommen, dass das weitgehende Verschwinden<br />
der Art in der Pommerschen Bucht in den 90er Jahren des vergangenen Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
vor allem mit einer Verschlechterung der bodennahen Sauerstoffsättigungswerte infolge<br />
von Eutrophierungsprozessen zu erklären ist (KUBE 1996). Nach IFAÖ (2008M) besitzt auch<br />
der Schlickkrebs ein großes Sauerstoffbedürfnis. Art-F<strong>und</strong>e von Faulschlammböden deuten<br />
dagegen auf eine gewisse Toleranz gegenüber Sauerstoffarmut hin (BOCHERT 2003). Nach<br />
(MEADOWS & REID 1966) ist das Vorkommen auf sauerstoffarmen Schlickböden wahrscheinlich<br />
abhängig vom Detritusgehalt, von der Korngröße des Sedimentes <strong>und</strong> der Wasserzirkulation.<br />
Anhand dieses Beispiels wird deutlich, dass die artspezifische Toleranz gegenüber<br />
einem Faktor vor dem Hintergr<strong>und</strong> des spezifischen Lebensraums <strong>und</strong> der dort herrschenden<br />
spezifischen Umweltbedingungen betrachtet werden muss.<br />
Bei der charakteristischen Art Hornhecht trifft die Verstärkung der sommerlich natürlich auf-<br />
tretenden Sauerstoffmangelereignisse zeitlich mit seiner Laich- <strong>und</strong> Aufwuchszeit zusammen.<br />
Da der Hornhecht Habitate in sehr flachen Gewässerbereichen bevorzugt, welche<br />
ständig gut durchmischt werden, sind jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Reproduktion<br />
des Hornhechtes durch vorhabensinduzierte Sauerstoffmangelereignisse zu erwarten.<br />
Bei Beeinträchtigungen der Wirbellosenfauna <strong>und</strong> des Heringslaichs durch Sauerstoffzehrung<br />
kann es zu einer lokalen <strong>und</strong> temporären Verschlechterung der Nahrungsgr<strong>und</strong>lage für<br />
Wasservögel <strong>und</strong> Watvögel kommen. Betroffen sind beispielsweise Tauchenten, die sich<br />
überwiegend von der Makrozoobenthosfauna oder im Falle von Eisenten auch von Heringslaich<br />
ernähren (IFAÖ 2007B). Diese vorhabensbedingten Beeinträchtigungen sind aber –<br />
wie oben dargestellt – sehr unwahrscheinlich.<br />
- Salinitätsänderungen: Aus den Szenarien von BUCKMANN (2011) ergeben sich negative<br />
Salzgehaltsanomalien im LRT von maximal –1,65 PSU im Sommer <strong>und</strong> -1,72 PSU im Winter.<br />
Für marine Arten, welche im Untersuchungsgebiet am Rande ihrer ökologischen Verbreitungsgrenze<br />
leben, können derartige Aussüßungsereignisse langfristig eine erhebliche<br />
Lebensraumbeeinträchtigung darstellen. Dies betrifft von marinen Makrophytenarten vor allem<br />
marine Grün- <strong>und</strong> Rotalgen, die Meeres-Salde (Ruppia maritima) sowie den Blasentang<br />
(Fucus vesiculosus). Mit den natürlichen Salinitätsschwankungen treten für diese Arten na-
FROELICH & SPORBECK Seite 204<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
türlich hypertonische Ereignisse auf. Bei Betrieb des Kraftwerkes können die Salinitäten<br />
nahe der Einleitstelle auf lediglich 3 PSU absinken, so dass zusätzlich zu den oben genannten<br />
Arten auch negative Beeinträchtigung einiger Braunalgenarten, des Sumpf-Teichfadens<br />
(Zannichellia palustris) <strong>und</strong> des Echten Seegrases (Zostera marina) möglich sind.<br />
Zahlreiche der im Nahbereich der Einleitstelle häufig vorkommenden, marinen Tierarten leben<br />
hier am Rande ihrer Verbreitungsgrenzen, die maßgeblich durch den mittleren Salzgehalt<br />
<strong>und</strong> die mittlere Temperatur bestimmt werden (z. B. Sandklaffmuschel, Baltische<br />
Plattmuschel, Herzmuschel, Wattschnecke <strong>und</strong> der Borstenwurm Hediste diversicolor).<br />
Nach SCHIEWER (2008) bestimmt vor allem der Salzgehalt die Verbreitungsgrenzen der<br />
Makrofauna in den mecklenburgischen Küstengewässern, da im gesamten Großraum der<br />
ostvorpommerschen Bodden ein ähnliches Temperaturregime herrscht. Aufgr<strong>und</strong> der abnehmenden<br />
Salzgehalte treten große Bestände der im Nahbereich kennzeichnenden Tierarten<br />
wie der Sandklaffmuschel (Mya arenaria), der Baltischen Plattmuschel (Macoma<br />
balthica), der Glatten Wattschnecke (Hydrobia ulvae), des Schillernden Meeresringelwurms<br />
(Hediste diversicolor) <strong>und</strong> des Flohkrebses Bathyporeia pilosa im Peenestrom, dem Achterwasser<br />
<strong>und</strong> dem Oderhaff nicht mehr auf (IOW 2008B). Auch Cerastoderma glaucum ist<br />
eine marine Art (Salzgehalte > 4 bis 4,5 PSU), die aufgr<strong>und</strong> des zu geringen Salzgehaltes<br />
nicht im oligohalinen Oderästuar vorkommt <strong>und</strong> ihre Verbreitungsgrenze bei Freest in der<br />
Spandowerhagener Wiek hat (IKZM-ODER 2010). Bei all diesen Arten sind durch die lokalen<br />
Aussüßungen Stressreaktionen zu erwarten. Mya arenaria toleriert kurzfristig sehr geringe<br />
Salinitäten. Langfristig werden jedoch mindestens 5 PSU benötigt, um lebenswichtige Prozesse<br />
aufrecht zu erhalten. Die Kühlwasserfahne zeigt nach den Berechnungen von BUCK-<br />
MANN (2011) eine hohe Variabilität, wodurch lediglich im direkten Nahbereich der Molenköpfe<br />
relevante Beeinträchtigungen für die Art über diesen Wirkfaktor zu erwarten sind. Als<br />
euryhalines Tier siedelt der Schlickkrebs im euryhalinen bis in den oligohalinen Bereich. In<br />
der Ostsee dringt Corophium volutator bis zu einem Salzgehalt von 3 PSU vor. Als kriti-<br />
sche Grenze der Verbreitung kann ein Salzgehalt des im Schlick enthaltenen Wassers von<br />
2 PSU angenommen werden. Die Reproduktion erfolgt jedoch erst ab einem Salzgehalt von<br />
7,5 PSU. Im Bereich von 5 bis 30 PSU ist die Häutungsfrequenz <strong>und</strong> die Wachstumsrate<br />
am größten (IFAÖ 2008M). Bei dieser Art könnte somit die Reproduktion in Teilbereichen<br />
der Kühlwasserfahne aufgr<strong>und</strong> der Aussüßung zumindest temporär stark eingeschränkt<br />
werden.<br />
Für den Hornhecht konnten Laboruntersuchungen zeigen, dass Temperatur-Salz-<br />
Bedingungen von 3,1 bis 3,7 PSU <strong>und</strong> 17,5 bis 19,5°C maximale Überlebensraten für Laich<br />
<strong>und</strong> Larven bis 40 mm bedeuten (FONDS et al. 1973). Auswirkungen auf die Größe des Dottersacks<br />
konnten erst bei länger anhaltendem Stress von unter 1 PSU bei 14°C bzw. bei 4,1<br />
PSU <strong>und</strong> 21°C nachgewiesen werden. Es zeigt sich, dass mit zunehmender Temperatur die<br />
untere Toleranzgrenze des Salzgehaltes ansteigt. Die zur Laich- <strong>und</strong> Aufwuchszeit des<br />
Hornhechts vorherrschenden Bedingungen im Untersuchungsgebiet entsprechen den Habitatansprüchen<br />
dieser Art <strong>und</strong> werden unter Kühlwassereinfluss nicht nachteilig verändert.<br />
Vom Hering werden hohe Salzgehalte bis 24 PSU ohne erkennbare Schäden verkraftet,<br />
jedoch gelten Salinitäten von 4 PSU als untere Toleranzschwelle für Heringslaich (IFAÖ<br />
2001A). Die ausgesüßte Kühlwasserfahne kann daher bei bestimmten Abfluss- <strong>und</strong> Windbedingungen<br />
(sehr hoher Peenestrom- <strong>und</strong> damit Süßwasserabfluss, Ostwindlagen) natür-
FROELICH & SPORBECK Seite 205<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
lich temporäre hypotonische Ereignisse, die den Heringslaich vor allem in Ästuarnähe treffen,<br />
verstärken. Unter diesen besonderen Bedingungen ist nicht auszuschließen, dass in<br />
Ästuarnähe ein Salzstress für Embryonen verstärkt wird. Der Salzgehalt des Greifswalder<br />
Boddens wird ohne einen ausgeprägten Jahresgang beschrieben (IOW 2008B), so dass die<br />
oben beschriebenen Abfluss- <strong>und</strong> Windbedingungen nur sehr kurzzeitig gemeinsam auftreten.<br />
Die Abschätzung der von der Aussüßung betroffenen Habitate wird auf Gr<strong>und</strong> unzureichender<br />
wissenschaftlicher Untersuchungen zu Schwellenwerten über die Beurteilung<br />
der Temperaturveränderungen abgedeckt (s. u.). Bereits im Larvalstadium sinkt die Empfindlichkeit<br />
gegenüber Salzgehaltsänderungen. Dafür spricht der Nachweis von Heringslarven<br />
in den Laichschongebieten der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> des Peenestroms (IFAÖ<br />
2007H).<br />
- Nährstoffeinleitung: Die potenziellen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen des LRT<br />
1160, die auf die Ein- <strong>und</strong> Umleitung von Nährstoffen mit dem Kühlwasser zurückzuführen<br />
sind, werden ähnlich bewertet wie beim LRT 1110 (vgl. oben). Besonders empfindlich auf<br />
Eutrophierung <strong>und</strong> einer Veränderung der Sichttiefe reagieren die lebensraumtypischen<br />
Armleuchteralgenarten, die allerdings derzeit nicht innerhalb des Wirkraums der Kühlwas-<br />
serfahne im LRT 1160 nachgewiesen werden konnten (IFAÖ 2009B). In einer schriftlichen<br />
Stellungnahme der Fachgutachter des IFAÖ zum Thema „Vorkommenspotenzial für Armleuchteralgen<br />
(Chara baltica, Chara canescens <strong>und</strong> Tolypella nidifica)“ im Wirkraum des<br />
Steinkohlekraftwerks bestätigen die meeresbiologischen Fachgutachter, dass der Bereich<br />
der Kühlwasserfahne für die drei oben genannten Armleuchteralgenarten auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
der historischen Vorkommen <strong>und</strong> auf der Basis der eigenen Untersuchungen des IFAÖ der<br />
letzten 10 Jahre wenig geeignet ist. Dem Bereich kommt den Gutachtern zufolge keine besondere<br />
Potenzialeignung zu. Die Gutachter führen dies vor allem auf die zu starke Exposition<br />
des Küstenbereiches zurück. Denn in geringer exponierten Randseen <strong>und</strong> Buchten<br />
(z. B. Freesendorfer See, Dänische Wiek <strong>und</strong> Schoritzer Wiek) konnten im gleichen Zeitraum<br />
von IFAÖ durchaus Characeen nachgewiesen werden. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte<br />
bezüglich des Vorkommens anderer hoch empfindlicher Makrophytenarten im<br />
Wirkraum der Kühlwasserfahne vor (vgl. FROELICH & SPORBECK 2008A). Aufgr<strong>und</strong> der besonderen<br />
standörtlichen Verhältnisse (s. o.) wird gutachterlicherseits kein Vorkommenspotenzial<br />
solcher Arten angenommen. Bei der Armleuchteralgenart Tolypella nidifica zeigen<br />
historische F<strong>und</strong>e, dass die Art ehemals im südlichen Greifswalder Bodden vorkam. Nach<br />
BLÜMEL et al. (2002) kann aufgr<strong>und</strong> der historischen Verbreitung von Tolypella nidifica <strong>und</strong><br />
ihrer ökophysiologischen Ansprüche davon ausgegangen werden, dass die Art unter den<br />
Bedingungen eines sehr guten ökologischen Zustands im Greifswalder Bodden wieder zu<br />
erwarten ist. Da die Artengemeinschaft des LRT 1160 im Vergleich zum LRT 1110 durchschnittlich<br />
artenreicher <strong>und</strong> individuenreicher ist <strong>und</strong> der LRT insgesamt eine höhere Gesamtbiomasse<br />
aufweist, sind potenziell eher stärkere Beeinträchtigungen durch eine Verschlechterung<br />
des Lichtklimas oder durch Sauerstoffmangelsituationen zu erwarten als im<br />
LRT 1110.<br />
Generell sind die betroffenen Bereiche durch eine natürlich hohe Dynamik geprägt. Sämtliche<br />
Organismen sind daher entweder an Schwankungen angepasst oder stellen in ihrer<br />
Ökologie auf schnelle <strong>und</strong> sofortige Wiederbesiedlungsprozesse ab. Besonders Makrophytenarten<br />
mit ausgeprägtem Längenwachstum besitzen morphologische Akklimatisationsmöglichkeiten,<br />
um die individuelle Lichtverfügbarkeit zu verbessern (PORSCHE et al. 2008).
FROELICH & SPORBECK Seite 206<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Gleichzeitig ist die Kühlwasserfahne sehr variabel, Wind <strong>und</strong> Wasserströmungen sorgen<br />
vor allem in den Flachwasserbereichen für eine schnelle Vermischung der nährstoff- <strong>und</strong><br />
planktonreicheren Wassermassen. Nach Auswertung der Messdaten zu KKW-Zeiten kamen<br />
TÜV NORD (2008B) zu folgendem Ergebnis: „Die Stabilität des Ökosystems wird<br />
dadurch erklärt, dass es sich durch Wasseraustauschprozesse mit weniger belastetem<br />
Wasser der angrenzenden Ostsee immer wieder regeneriert. Der ohne Kühlwasserführung<br />
auch natürlich stattfindende Eintrag von Peenestromwasser in den Greifswalder Bodden relativiert<br />
außerdem die beobachteten Effekte.“ Entsprechend werden lediglich geringe graduelle<br />
Beeinträchtigungen des Lebensraums allein durch diesen Wirkfaktor erwartet. Wie<br />
bereits in Kap. 5.2.5 dargestellt, können relevante vorhabensbedingte Veränderungen der<br />
Chlorophyll-a-Konzentrationen in den Bereichen mit Makrophytenvorkommen am Gahlkower<br />
Haken <strong>und</strong> am Freesendorfer Haken ausgeschlossen werden.<br />
Bei der charakteristischen Scherenasselart Heterotanais oerstedi wird von einer besonde-<br />
ren Empfindlichkeit gegenüber Eutrophierung ausgegangen, da Nährstoffeinträge die Ursache<br />
für die Gefährdung der Arten zu sein scheinen. Beeinträchtigungen des Herings durch<br />
Eutrophierung <strong>und</strong> dem damit verb<strong>und</strong>enen Sauerstoffzehrungen sowie Beeinträchtigungen<br />
des Lichtklimas (Beeinträchtigungspfad submerse Vegetation als Laichsubstrat <strong>und</strong> als Lebensraum)<br />
können nicht genau quantifiziert werden, werden aber über die Beurteilung der<br />
Temperaturveränderungen abgedeckt.<br />
Im Winter können Kotausscheidungen von angelockten Wasservögeln im Bereich der eisfreien<br />
Zonen lokal zu einer zusätzlichen Eutrophierung beitragen.<br />
- Zusammenwirken der Faktoren: Auf Gr<strong>und</strong> der Komplexität des Zusammenwirkens der<br />
betrachteten Faktoren Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffversorgung <strong>und</strong> Nährstoffeintrag<br />
sowie der unterschiedlichen Toleranzen von Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten <strong>und</strong> -gemeinschaften<br />
ist es schwierig genaue numerisch fassbare Grenzen für gravierende Beeinträchtigungen<br />
durch Systemeffekte zu benennen (vgl. IOW 2008B). Die natürliche Temperaturvariabilität<br />
des südlichen Greifswalder Boddens liegt zwischen 1,1 <strong>und</strong> 21,1°C (Messdaten des LUNG<br />
M-V 1997-2007). Überschreitungen dieser Schwankungsbereiches traten in den 10 Messjahren<br />
sieben Mal auf. Wie oben dargestellt sind ab einer dauerhaften Temperaturerhöhung<br />
ab 2 K populationsrelevante Veränderungen der Lebensgemeinschaften im LRT möglich.<br />
Bei einigen, sogenannten warmadaptierten Arten, wie z. B. den Hornhecht kann davon<br />
ausgegangen werden, dass sie durch die vorhabensbedingte Kühlwassereinleitung nicht<br />
beeinträchtigt werden.<br />
Um sicherzustellen, dass auch Systemeffekte, die durch das Zusammenwirken der einzelnen<br />
Faktoren entstehen können ausreichend berücksichtigt werden, werden bei der Ermittlung<br />
der graduellen Beeinträchtigungen bereits die Temperaturveränderungen ab 0,2 K berücksichtigt.<br />
Die Abschätzung der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der<br />
charakteristischen Makrophyten-, Zoobenthos- <strong>und</strong> Fischarten der marinen Lebensraumtypen<br />
erfolgt anhand des Bewertungssystems (vgl. Kap. 5.1 <strong>und</strong> Anhang <strong>III</strong>).<br />
Für die charakteristischen Vogelarten des LRT 1160 können sich durch die Kühlwas-<br />
sereinleitung mittelbare Beeinträchtigungen durch eine (temporäre) Verknappung der Nah-
FROELICH & SPORBECK Seite 207<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
rungsgr<strong>und</strong>lagen ergeben. Diese möglichen Beeinträchtigungen werden vorsorglich als erheblich<br />
eingestuft.<br />
Fazit: erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben können Prozesse ausgelöst werden, die zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung<br />
<strong>und</strong> zu einem graduellen Funktionsverlust des Lebensraumtyps „Flache Meeresbuchten“<br />
mit seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet führen können. Auf Gr<strong>und</strong>lage des<br />
Bewertungsmodells wurden die vorhabensbedingten partiellen Funktionsverluste im LRT für<br />
den worst case abgeschätzt. Der errechnete Äquivalenzwert liegt bei 83,97 ha (vgl. Tab. 8),<br />
wobei bei einer prozentualen Aufteilung auf beide <strong>GuD</strong>, ein Äquivalenzwert von 47,8629 ha<br />
allein dem Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> zugewiesen wird. Da der errechnete Äquivalenzwert den le-<br />
bensraumspezifischen Orientierungswert von 0,5 ha (vgl. Stufe <strong>III</strong> bei LAMBRECHT & TRAUTNER<br />
2007B) übersteigt, wird von einer erheblichen Beeinträchtigung des LRT 1160 ausgegangen.<br />
5.3.6 Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten (EU-Code<br />
1210)<br />
Tab. 25: Beeinträchtigung der „Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen<br />
Arten (EU-Code 1210)<br />
Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten (EU-Code 1210)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula) (NG), Alpenstrandläufer (Calidris alpina) (NG)<br />
Vorkommen des LRT im duB<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 750 m von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Lärmimmissionen -- nicht erheblich<br />
Optische Störungen -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- --<br />
Kollisionsrisiko -- nicht erheblich<br />
Betriebsbedingt<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 208<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten (EU-Code 1210)<br />
Lärmimmissionen -- --<br />
Optische Störungen -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich nicht erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Die Spülsaumbereiche westlich des Freesendorfer Sees, die von den beiden Limikolenarten<br />
potenziell als Nahrungshabitat genutzt werden, können durch baubedingte<br />
Schallimmissionen temporär beeinträchtigt werden. Wie bei anderen Limikolen auch ist<br />
beim Sandregenpfeifer <strong>und</strong> beim Alpenstrandläufer von einer hohen Störanfälligkeit<br />
auszugehen. Da es sich jedoch nur um kleinere Flächenanteile des LRT handelt, bei<br />
denen es zu einer temporären Beeinträchtigung durch Schall für die charakteristischen<br />
Arten kommen könnte, wird nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Arten im<br />
LRT ausgegangen. Es ist anzunehmen, dass diese Standorte aufgr<strong>und</strong> der Störungen<br />
zumindest während der Bauzeit nicht regelmäßig als Nahrungshabitate genutzt werden.<br />
Nach Beendigung der Bauarbeiten ist eine regelmäßige Nutzung der Flächen potenziell<br />
möglich. Eine dauerhafte Verschlechterung des Erhaltungszustandes dieser Arten innerhalb<br />
des LRT ist daher nicht zu erwarten.<br />
� Da die nächstgelegenen Standorte des LRT mindestens 750 m von der Baustelle entfernt<br />
sind, können Beeinträchtigungen der Arten durch optische Störungen ausgeschlossen<br />
werden.<br />
� Es wird von keinen relevanten Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen ausgegangen. Durch die<br />
bereits vorhandenen Gebäude in der Nachbarschaft der Baufläche sind auch ohne die<br />
Baustelle des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> bereits Ausweichflüge anzunehmen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Es sind keine direkten anlagebedingten Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktionen<br />
der Spülsäume zu erwarten.<br />
� Von den Kraftwerksgebäuden geht keine relevante Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkung für die<br />
beiden charakteristischen Arten aus – Hauptflugzonen sind nicht betroffen, die Vögel<br />
können die Barrieren problemlos umfliegen. Durch die bereits vorhandenen Gebäude in<br />
der Nachbarschaft der Vorhabensfläche sind auch ohne <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> bereits Ausweichflüge<br />
anzunehmen.
FROELICH & SPORBECK Seite 209<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT-Flächen sind keine relevanten<br />
Veränderungen des Sichtfeldes für die charakteristischen Vogelarten im LRT zu erwarten.<br />
� Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks kann ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.1).<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen Betriebsgelände <strong>und</strong> Lebensräumen des<br />
LRT sind erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen Vogelarten durch betriebsbedingte<br />
optische <strong>und</strong> akustische Störungen auszuschließen. Eine relevante betriebsbedingte<br />
zusätzliche Verlärmung von Spülsaumbereichen findet nicht statt.<br />
� Es ist zwar ist wie bei anderen Limikolen auch beim Sandregenpfeifer <strong>und</strong> beim Alpenstrandläufer<br />
von einer hohen Störanfälligkeit auszugehen. Die Teilflächen des LRT<br />
liegen jedoch nicht innerhalb der von RECK et al. (2001) allgemein als kritisch definierten<br />
47 dB(A)-Isophone. Es ist anzunehmen, dass diese Standorte aufgr<strong>und</strong> der Störungen<br />
nicht regelmäßig als Nahrungshabitate genutzt werden. Eine dauerhafte Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustandes dieser Arten innerhalb des LRT ist nicht zu<br />
erwarten, weshalb keine erheblichen Beeinträchtigungen gegeben sind.<br />
� Spülsäume zählen zu den Lebensraumtypen, die keine besondere Empfindlichkeit gegenüber<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen aufweisen. Signifikante Beeinträchtigungen<br />
des LRT <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten durch die geringfügigen vorhabensbedingten<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge können daher ausgeschlossen werden.<br />
� Die von BUCKMANN (2011) prognostizierten Veränderungen des Temperaturregimes<br />
sowie der Salzgehalte des Wasserkörpers <strong>und</strong> die dadurch potenziell induzierten, lokalen<br />
Veränderungen der Zusammensetzung der Artdominanzen der angeschwemmten<br />
Algen- <strong>und</strong> Tangwälle, können mittelbaren Auswirkungen im Lebensraum „Spülsäume<br />
des Meeres mit Vegetation aus einjährigen Arten“ führen (vgl. Kap. 5.2.5). Da davon<br />
ausgegangen werden kann, dass die Lebensraumfunktionen der „Spülsäume“ mit ihren<br />
charakteristischen Arten voll gewahrt bleiben <strong>und</strong> der Erhaltungszustand des LRT durch<br />
diesen Wirkfaktor nicht beeinträchtigt wird, werden die betriebsbedingte Beeinträchtigungen<br />
als nicht erheblich eingestuft.<br />
� Da sich beim LRT „Spülsäume“ um einen Extremlebensraum handelt, der gegenüber<br />
Temperaturveränderungen eine hohe Toleranz aufweist, wird keine Beeinträchtigung<br />
der Nahrungstiere der charakteristischen Watvögel im LRT durch die Auswirkungen der<br />
Kühlwasserfahne erwartet. Eine mittelbare, erhebliche Beeinträchtigung der charakteristischen<br />
Vogelarten wird daher ebenfalls nicht angenommen.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch die vorhabensbedingten Wirkprozesse ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des LRT <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten zu erwarten, da durch das Vorhaben keine
FROELICH & SPORBECK Seite 210<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Prozesse ausgelöst werden, die zu einer nachhaltigen Veränderung von Lebensräumen des<br />
LRT führen. Es kann von einem langfristigen Fortbestand der notwendigen Lebensraumstrukturen<br />
<strong>und</strong> spezifischen Funktionen in absehbarer Zukunft ausgegangen werden, obwohl es temporär<br />
<strong>und</strong> lokal zu mittelbaren Beeinträchtigungen des LRT <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten<br />
kommen kann. Vorhabensbedingt sind keine Abnahmen des Verbreitungsgebietes des LRT<br />
sowie der Flächenanteile des LRT im FFH-Gebiet zu erwarten.<br />
5.3.7 Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-<br />
Code 1230)<br />
Tab. 26: Beeinträchtigung der „Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit<br />
Vegetation (EU-Code 1230)“<br />
Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-Code 1230)<br />
Projektrelevante charakteristische im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind 650 m von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Kap. 4.3.2 enthält eine genauere Beschreibung zum Vorkommen des LRT.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge --<br />
LRF<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung --<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 211<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation (EU-Code 1230)<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle werden keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
der allgemeinen Lebensraumfunktionen des LRT erwartet.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage werden keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der allgemeinen Lebensraumfunktionen des LRT erwartet.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch den Betrieb des Kraftwerkes kommt im Vergleich zur bestehenden Vorbelastung<br />
zu keiner relevanten, vorhabensbedingten Zusatzbelastung durch Schallimmissionen.<br />
� Optische Störungen im LRT können aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk<br />
ausgeschlossen werden.<br />
� Der LRT besitzt keine besondere Empfindlichkeit gegenüber atmosphärischen Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Schwefeleinträgen, erhebliche Beeinträchtigungen über diesen Wirkfaktor<br />
können daher mit Sicherheit ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 5.2.6).<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation“ <strong>und</strong><br />
seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten<br />
im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet<br />
des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die<br />
Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 212<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.8 Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf<br />
Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt) (EU-Code 1310)<br />
Tab. 27: Beeinträchtigung der „Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen<br />
Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt) (EU-Code 1310)<br />
Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt)<br />
(EU-Code 1310)<br />
Projektrelevante charakteristische im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Rotschenkel (Tringa totanus)<br />
Vorkommen des LRT im duB<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 1,2 km von der Baustelle bzw. 1,5 km von der<br />
Anlage <strong>und</strong> entfernt. Kap. 4.3.2 enthält eine Beschreibung zum Vorkommen der charakteristischen Art.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Lärmimmissionen -- nicht erheblich<br />
Optische Störungen -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- --<br />
Kollisionsrisiko -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- --<br />
Optische Störungen -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 213<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Teilbereiche des LRT, die im westlichen Teil der Freesendorfer Wiesen liegen, können<br />
durch baubedingte Schallimmissionen temporär beeinträchtigt werden. Wie bei anderen<br />
Limikolen auch ist beim Rotschenkel von einer hohen Störanfälligkeit auszugehen. Da<br />
es sich jedoch nur um kleinere Flächenanteile des LRT handelt, bei denen es nur zu einer<br />
temporären Beeinträchtigung durch Schall kommen könnte, wird nicht von einer erheblichen<br />
Beeinträchtigung der Art im LRT ausgegangen. Es ist anzunehmen, dass<br />
diese Standorte aufgr<strong>und</strong> der Störungen zumindest während der Bauzeit nicht regelmäßig<br />
als Brut- <strong>und</strong> Nahrungshabitate genutzt werden. Nach Beendigung der Bauarbeiten<br />
ist eine regelmäßige Nutzung der Flächen potenziell möglich. Eine dauerhafte Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustandes von charakteristischen Vogelarten innerhalb<br />
des LRT ist daher nicht zu erwarten.<br />
� Da die nächstgelegenen Standorte des LRT mindestens 1,2 km von der Baustelle entfernt<br />
sind <strong>und</strong> zudem durch das <strong>GuD</strong> II sowie durch daran angrenzende Waldflächen<br />
von der Baustelle abgeschirmt werden, können Beeinträchtigungen der Arten durch optische<br />
Störungen sowie durch Barriere-/ Trennwirkungen ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage, sind keine direkten anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen des Lebensraumtyps Pioniervegetation mit<br />
Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand (Queller-Watt) (EU-<br />
Code 1310) zu erwarten.<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT-Flächen sind keine Veränderungen<br />
des Sichtfeldes für die charakteristische Vogelart im LRT, keine relevanten<br />
Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen <strong>und</strong> auch kein erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken<br />
des Kraftwerks zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen Betriebsgelände <strong>und</strong> dem LRT sind erhebliche<br />
Beeinträchtigungen der charakteristischen Vogelart durch betriebsbedingte optische<br />
<strong>und</strong> akustische Störungen auszuschließen. Eine betriebsbedingte zusätzliche Verlärmung<br />
von Teilflächen des LRT 1310 findet nicht statt.<br />
� Beeinträchtigungen durch vorhabensbedingte Stickstoffeinträge über den Luftweg können<br />
für den LRT 1310 ausgeschlossen werden. Von ÖKO-DATA (2011) wurde für den<br />
LRT 1310 ein Critical Load von 21,2 kg N/ha/a errechnet. Die prognostizierte Gesamtbelastung<br />
des LRT, die sich aus der Summe der Vorbelastungen (UBA-Daten aus 2007<br />
+ Gasanlandestation + Ersatzwärmeerzeuger) sowie der projektbezogenen Zusatzbelastung<br />
(<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> + <strong>GuD</strong> II) am Standort <strong>Lubmin</strong> (LOBER 2011E) ergibt, liegt bei 12,21 bis<br />
max. 12,32 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreitet damit deutlich die CL. Es besteht somit langfristig<br />
kein Risiko für Beeinträchtigungen durch eutrophierende Stickstoffeinträge.
FROELICH & SPORBECK Seite 214<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 28: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 1310<br />
LRT (EU-<br />
Code)<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
1310 21,2 0,64 12,21 bis 12,32 0,061 bis 0,259 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei<br />
4104 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (1450 bis<br />
1469 eq/ha/a) deutlich unterschritten.<br />
Tab. 29: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
LRT 1310<br />
CL S+N<br />
[eq /ha/a]<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1310 4104 123,1 1450 bis 1469 18,8 bis 43,2 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen einjährigen Arten auf Schlamm<br />
<strong>und</strong> Sand (Queller-Watt) (EU-Code 1310)“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im<br />
Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im<br />
Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 215<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.9 Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwadenrasen<br />
(EU-Code 1330)<br />
Tab. 30: Beeinträchtigung des „Salzgrünlands des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit<br />
Salzschwadenrasen (EU-Code 1330)<br />
Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee mit Salzschwadenrasen (EU-Code 1330)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Rotschenkel (Tringa totanus),<br />
Vorkommen des LRT im duB<br />
Kiebitz (Vanellus vanellus), Brandgans (Tadorna tadorna)<br />
Im detailliert untersuchten Bereich finden sich sehr ausgedehnte Bestände auf dem Struck <strong>und</strong> den angrenzenden<br />
Freesendorfer Wiesen. Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 800 m von der Baustelle<br />
bzw. 1 km von der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristi-<br />
schen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Lärmimmissionen -- nicht erheblich<br />
Optische Störungen -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- --<br />
Kollisionsrisiko -- nicht erheblich<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- --<br />
Optische Störungen -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine,<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 216<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Geringe baubedingte akustische Störungen der beiden charakteristischen Limikolenarten,<br />
die den LRT als Brut- <strong>und</strong> Nahrungshabitat nutzen, sind nicht auszuschließen: Vom<br />
Kiebitz <strong>und</strong> auch vom Rotschenkel ist ein hohe Störanfälligkeit bekannt (vgl. BAUER &<br />
BERTHOLD 1996, BAUER & THIELKE 1982 <strong>und</strong> TUCKER & HEATH 1994). Da im Vergleich<br />
zum Gesamthabitat der Arten nur kleine Teilbereiche temporär beeinträchtigt werden,<br />
werden die potenziellen Beeinträchtigungen des LRT durch diesen Wirkfaktor als nicht<br />
erheblich eingestuft. Die nächsten Brutstandorte der charakteristischen Vogelarten befinden<br />
sich in einer Entfernung von mehr als 1,5 km Kilometer zur Baustelle des Kraftwerks<br />
<strong>und</strong> somit außerhalb des kritischen Schallbereiches. Es wird daher von keinen<br />
erheblichen Beeinträchtigungen ausgegangen.<br />
� Da die nächstgelegenen Standorte des LRT mindestens 0,8 km von der Baustelle entfernt<br />
sind <strong>und</strong> zudem durch das <strong>GuD</strong> II sowie durch daran angrenzende Waldflächen<br />
von der Baustelle abgeschirmt werden, können Beeinträchtigungen der Arten durch optische<br />
Störungen ausgeschlossen werden.<br />
� Es wird von keinen relevanten Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen ausgegangen. Zum einen<br />
sind durch die bereits vorhandenen Gebäude in der Nachbarschaft der Baufläche auch<br />
ohne die Baustelle des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> bereits Ausweichflüge anzunehmen, zum Anderen liegt<br />
die Baustelle nicht im Bereich der Hauptflugzonen der charakteristischen Vogelarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Anlagebedingt sind keine direkten Beeinträchtigungen der allgemeinen Lebensraumfunktionen<br />
der Salzwiesen zu erwarten.<br />
� Von den Kraftwerksgebäuden geht keine relevante Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkung für die<br />
charakteristischen Vogelarten aus – Hauptflugzonen sind nicht betroffen, die Vögel<br />
können die Barrieren problemlos umfliegen.<br />
� Relevante Beeinträchtigungen durch ein verändertes Sichtfeld für die charakteristischen<br />
Vogelarten können ausgeschlossen werden, da die LRT-Flächen mindestens 1 Kilometer<br />
von der Anlage entfernt liegen.<br />
� Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks kann ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.1).<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zwischen Betriebsgelände <strong>und</strong> Lebensräumen des<br />
LRT 1330 sind erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen Vogelart durch betriebsbedingte<br />
optische <strong>und</strong> akustische Störungen auszuschließen. Eine betriebsbedingte<br />
zusätzliche Verlärmung von Teilflächen des LRT 1330 findet nicht statt.
FROELICH & SPORBECK Seite 217<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Beeinträchtigungen durch vorhabensbedingte Stickstoffeinträge über den Luftweg können<br />
für den LRT 1330 ausgeschlossen werden. Von ÖKO-DATA (2011) wurde für den<br />
LRT 1310 ein Critical Load von 18,7 bzw. 20,7 kg N/ha/a errechnet. Die prognostizierte<br />
Gesamtbelastung des LRT, die sich aus der Summe der Vorbelastungen (UBA 2011 +<br />
Gasanlandestation + Ersatzwärmeerzeuger) sowie der projektbezogenen Zusatzbelastung<br />
(<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> + <strong>GuD</strong> II) am Standort <strong>Lubmin</strong> (LOBER 2011E) ergibt, liegt bei 12,09 bis<br />
max. 12,33 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreitet damit deutlich die CL. Es besteht somit langfristig<br />
kein Risiko für Beeinträchtigungen durch eutrophierende Stickstoffeinträge.<br />
Tab. 31: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 1330<br />
LRT (EU-<br />
Code)<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
1330 18,7<br />
20,7<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,56<br />
0,62<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
12,09 bis 12,33 0,051 bis 0,268 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 3957<br />
bis 4103 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (1446 bis<br />
1472 eq/ha/a) deutlich unterschritten.<br />
Tab. 32: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 1330<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a] entspricht:<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1330 3957 bis 4103 118,7 bis 123,1 1446 bis 1472 18,5 bis 44,3 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Salzgrünland (EU-Code 1330)“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar<br />
im Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands von<br />
Vorkommen des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch<br />
vorhabensbedingte Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die<br />
Flächen, die er im Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben<br />
erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 218<br />
5.3.10 Primärdünen (EU-Code 2110)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 33: Beeinträchtigung der „Primärdünen (EU-Code 2110)<br />
Primärdünen (EU-Code 2110)<br />
Projektrelevante charakteristische im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich der FFH-VU finden sich Primärdünen östlich vom Badestrand <strong>Lubmin</strong> (sehr<br />
guter Erhaltungszustand), am Westrand des Struck (sehr guter Erhaltungszustand) sowie nördlich von Kienheide<br />
auf Usedom (guter Erhaltungszustand) (I.L.N. 2007). Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind<br />
mindestens 650 m von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge --<br />
LRF<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 219<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der Entfernung der nächsten Vorkommen des LRT zur Baustelle von über<br />
650 m <strong>und</strong> der zusätzlichen Abschirmung durch angrenzende Waldbereiche werden<br />
keine baubedingten Beeinträchtigungen der allgemeinen Lebensraumfunktionen des<br />
LRT erwartet. Die charakteristischen Arten des LRT weisen keine besondere Empfindlichkeit<br />
gegenüber optischen <strong>und</strong> akustischen Störungen auf.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage <strong>und</strong> der zusätzlichen Abschirmung durch<br />
angrenzende Waldbereiche werden keine anlagebedingten Beeinträchtigungen der allgemeinen<br />
Lebensraumfunktionen des LRT erwartet.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch den Betrieb des Kraftwerkes kommt es zu keiner gegenüber der Vorbelastung<br />
stärkeren Lärmbelastung.<br />
� Optische Störungen im LRT können aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk<br />
ausgeschlossen werden.<br />
� Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf den Flächen des LRT bei maximal<br />
13,11 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreiten damit deutlich den von ÖKO-DATA (2011) berechneten<br />
CLnutN von 17,9 kg N/ha/a. Durch die geringfügigen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen,<br />
die deutlich unter der Irrelevanzschwelle liegen (vgl. folgende Tabelle), sind<br />
keine signifikanten Beeinträchtigungen des LRT zu erwarten. Eine durch vorhabensbedingte<br />
Stickstoffeinträge verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustands des<br />
LRT kann daher ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 34: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2110<br />
LRT (EU-<br />
Code)<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
2110 17,9 0,54 12,08 bis 13,11 0,034 bis 0,181 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Der von ÖKO-DATA (2011) ermittelte standortspezifische CL liegt bei<br />
2090 eq/ha/a) <strong>und</strong> wird von der prognostizierten Gesamtbelastung (1436 bis<br />
1511 eq/ha/a) deutlich unterschritten.
FROELICH & SPORBECK Seite 220<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 35: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2110<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
2110 2090 62,7 1436 bis 1511 12,3 bis 31,1 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Für den Bereich der Kühlwasserfahne werden Veränderungen des Mikroklimas (erhöhte<br />
Luftfeuchte, Nebelbildung, verändertes Lufttemperaturregime) prognostiziert. Diese<br />
mikroklimatischen Veränderungen könnten sich lokal <strong>und</strong> temporär auf terrestrische<br />
Küstenbereiche auswirken, die an die Kühlwasserfahne angrenzen. Geringe Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktion einzelner Teilbereiche durch mikroklimatische<br />
Veränderungen aufgr<strong>und</strong> der Kühlwassereinleitung können nicht ausgeschlossen werden,<br />
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ist jedoch nicht zu erwarten, die<br />
Beeinträchtigungen werden daher als nicht erheblich eingestuft.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Primärdünen“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte Beeinträchtigungen<br />
zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt,<br />
bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.<br />
5.3.11 Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)<br />
Tab. 36: Beeinträchtigung der „Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)<br />
Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im duB wurden lineare Weißdünenbereiche am Westrand der Freesendorfer Wiesen (Erhaltungszustand A), am<br />
Westrand des Struck (Erhaltungszustand B) <strong>und</strong> nördlich von Karlshagen auf Usedom (Erhaltungszustand B)<br />
erfasst (I.L.N. 2007). Zwei weitere Vorkommen des LRT wurden im Strandbereich westlich des Industriehafens<br />
erfasst. Diese nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 650 m von der Baustelle bzw. der<br />
Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.
FROELICH & SPORBECK Seite 221<br />
Weißdünen mit Strandhafer (EU-Code 2120)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge --<br />
LRF<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der Entfernung der nächsten Vorkommen des LRT zur Baustelle von über<br />
650 m <strong>und</strong> der zusätzlichen Abschirmung durch angrenzende Waldbereiche werden<br />
keine baubedingten Beeinträchtigungen der allgemeinen Lebensraumfunktionen des<br />
LRT erwartet. Die charakteristischen Arten des LRT weisen keine besondere Empfindlichkeit<br />
gegenüber optischen <strong>und</strong> akustischen Störungen auf.
FROELICH & SPORBECK Seite 222<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage <strong>und</strong> der zusätzlichen Abschirmung durch<br />
angrenzende Waldbereiche werden keine anlagebedingten Beeinträchtigungen der allgemeinen<br />
Lebensraumfunktionen des LRT erwartet.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch den Betrieb des Kraftwerkes kommt es zu keiner gegenüber der Vorbelastung<br />
stärkeren Lärmbelastung.<br />
� Optische Störungen im LRT können aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk<br />
ausgeschlossen werden.<br />
� Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf den Flächen des LRT bei maximal<br />
12,26 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreiten damit die von ÖKO-DATA (2011) berechneten CLnutN<br />
von minimal 13,4 kg N/ha/a. Durch die geringfügigen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen,<br />
die deutlich unter der Irrelevanzschwelle liegen (vgl. folgende Tabelle), sind<br />
keine signifikanten Beeinträchtigungen des LRT zu erwarten. Eine durch vorhabensbedingte<br />
Stickstoffeinträge verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustands des<br />
LRT kann daher ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 37: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2120<br />
LRT (EU-<br />
Code)<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
2120 13,4 bis<br />
17,9<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,4 bis<br />
0,54<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
12,16 bis 12,26 0,062 bis 0,181 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 2090<br />
bis 2396 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (1442 bis<br />
1458 eq/ha/a) deutlich unterschritten.
FROELICH & SPORBECK Seite 223<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 38: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2120<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
2120 2090 bis<br />
2396<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
62,7 bis<br />
71,9<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1436 bis 1511 12,3 bis 31,1 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Für den Bereich der Kühlwasserfahne werden Veränderungen des Mikroklimas (erhöhte<br />
Luftfeuchte, Nebelbildung, verändertes Lufttemperaturregime) prognostiziert. Diese<br />
mikroklimatischen Veränderungen könnten sich lokal <strong>und</strong> temporär auf terrestrische<br />
Küstenbereiche auswirken, die an die Kühlwasserfahne angrenzen. Geringe Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktion einzelner Teilbereiche durch mikroklimatische<br />
Veränderungen aufgr<strong>und</strong> der Kühlwassereinleitung können nicht ausgeschlossen werden,<br />
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ist jedoch nicht zu erwarten, die<br />
Beeinträchtigungen werden daher als nicht erheblich eingestuft.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Weißdünen“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte Beeinträchtigungen<br />
zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt,<br />
bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 224<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.12 Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation (EU-Code 2130*)<br />
Tab. 39: Beeinträchtigung der „Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation (EU-Code<br />
2130*)<br />
Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation (EU-Code 2130*)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)<br />
Wirbellose (W): Warzenbeißer (Decticus verrucivorus )<br />
Pflanzen (P): Ebenästige Rentierflechte (Cladonia portentosa)<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Im detailliert untersuchten Bereich tritt dieser prioritäre Lebensraumtyp am Westrand der Freesendorfer Wiesen,<br />
westlich vom Strandbad Freest sowie am Ostrand von Nord-Usedom auf. Ein Graudünenbestand liegt innerhalb<br />
eines Dünenkiefernwaldes östlich vom Flugplatz Peenemünde. Der Erhaltungszustand der Bestände wurde als<br />
gut bis sehr gut eingestuft (I.L.N. 2007). Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 600 m<br />
von der Baustelle bzw. 750 m der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der<br />
charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Flechten, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)
FROELICH & SPORBECK Seite 225<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Die nächstgelegenen Vorkommen des LRT 2130 befinden sich östlich des Industriehafens<br />
<strong>und</strong> grenzen unmittelbar an die Gasanlandestation an. In diesen Teilflächen des<br />
LRT ist somit bereits mit optischen <strong>und</strong> akustischen Störungen durch die unmittelbar<br />
angrenzende Gasanlandestation zu rechnen. Besonders störungsempfindliche Aren,<br />
wie z.B. die charakteristische Vogelart Steinschmätzer, die eine Effektdistanz von<br />
300 m aufweist (GARNIEL & MIERWALD 2010), werden diese Teilflächen des Lebensraumtyps<br />
somit voraussichtlich nicht mehr als Bruthabitat nutzen. Aufgr<strong>und</strong> der bereits<br />
vorliegenden Vorbelastung durch die anderen Industrievorhaben (insbesondere Gasanlandestation<br />
<strong>und</strong> <strong>GuD</strong> II) sind die baubedingten akustischen <strong>und</strong> optischen Störungen<br />
durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> daher als irrelevant einzustufen.<br />
� Der Gesang des Warzenbeißers enthält höherfrequente Anteile, so dass diese mit großer<br />
Wahrscheinlichkeit nicht von der vorhabensinduzierten, überwiegend niederfrequenten<br />
Geräuschkulisse maskiert werden können. Zudem ist die Gasanlandestation,<br />
die sich unmittelbar angrenzend an dem Dünenareal befindet, der Haupt-Schallemittent.<br />
� Da keine Hauptflugzonen des Steinschmätzers durch Baugerüste <strong>und</strong> Baukräne etc.<br />
betroffen sind, werden keine Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen angenommen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Die vorhabensnächsten Standorte des LRT liegen in unmittelbarer Nähe der Gasanlandestation,<br />
diese Bereiche weisen damit bereits eine Vorbelastung auf. Durch die Anlage<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> werden daher keine zusätzlichen relevanten Beeinträchtigungen erwartet.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage sind keine Beeinträchtigungen der allgemeinen<br />
Lebensraumfunktionen der Graudüne zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch den Betrieb des Kraftwerkes kommt es zu keiner gegenüber der Vorbelastung relevanten<br />
stärkeren Lärmbelastung innerhalb von LRT-Flächen (vgl. auch Ausführung zu<br />
den baubedingten Schallimmissionen).<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch vorhabensbedingte optische Störungen innerhalb<br />
der LRT-Flächen können ausgeschlossen werden. Die im Nahbereich der Anlage liegenden<br />
Graudünenbereiche sind bereits durch die unmittelbar angrenzende Gasanlandestation<br />
vorbelastet. Eine darüber hinausgehende Anlock- (für nachtaktive Insekten)<br />
oder Störwirkung von charakteristischen Tierarten des LRT durch die Beleuchtung des<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>-Gelände ist nicht anzunehmen.<br />
� Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf den Flächen des LRT zwischen 12,08 <strong>und</strong><br />
13,25 kg N/ha/a <strong>und</strong> übersteigen damit stellenweise den modellierten, standortspezifischen<br />
Critical Load der Flächen. In Abhängigkeit der standortspezifischen Bodeneigenschaften<br />
<strong>und</strong> Vegetationsausprägungen wurden für den LRT Critical Loads von minimal
FROELICH & SPORBECK Seite 226<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
8,9 kg N/ha/a bis maximal 19,3 kg N/ha/a ermittelt. Durch die geringfügigen vorhabensbedingten<br />
Zusatzbelastungen, die deutlich unter der Irrelevanzschwelle liegen (vgl. folgende<br />
Tabelle), sind keine signifikanten Beeinträchtigungen des LRT <strong>und</strong> auch der besonders<br />
empfindlichen Art Ebenästige Rentierflechte zu erwarten. Eine durch<br />
vorhabensbedingte Stickstoffeinträge verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des LRT kann daher ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 40: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2130<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
2130<br />
[kg N/ha/a]<br />
8,9 bis<br />
19,3<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,27 bis<br />
0,58<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
12,08 bis<br />
13,25<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
0,043 bis 0,21 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ausgeschlossen werden.<br />
Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 1820 bis<br />
2431 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (1442 bis<br />
1531 eq/ha/a) deutlich unterschritten. Die maximalen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen<br />
von 33,4 eq/ha/a entsprechen 1,8 % des unteren CL <strong>und</strong> liegen somit unterhalb<br />
der Irrelevanzschwelle.<br />
Tab. 41: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2130<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
2130 1820<br />
2431<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
54,6<br />
72,9<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1442 bis 1531 18,5 bis 33,4 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Für den Bereich der Kühlwasserfahne werden Veränderungen des Mikroklimas (erhöhte<br />
Luftfeuchte, Nebelbildung, verändertes Lufttemperaturregime) prognostiziert. Diese<br />
mikroklimatischen Veränderungen könnten sich lokal <strong>und</strong> temporär auf terrestrische<br />
Küstenbereiche auswirken, die an die Kühlwasserfahne angrenzen. Geringe Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktion einzelner Teilbereiche durch mikroklimatische<br />
Veränderungen aufgr<strong>und</strong> der Kühlwassereinleitung können nicht ausgeschlossen werden,<br />
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands ist jedoch nicht zu erwarten, die<br />
Beeinträchtigungen werden daher als nicht erheblich eingestuft.
FROELICH & SPORBECK Seite 227<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Graudünen“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Der LRT reagiert sehr sensibel auf die Zunahme von Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen.<br />
In einigen Bereichen übersteigen zwar die prognostizierten Gesamtbelastungen der<br />
Stickstoffeinträge den jeweiligen standortspezifischen Critical Load, da die vorhabensbedingten<br />
Depositionen jedoch deutlich unterhalb der Irrelevanzschwellen liegen, kann eine vorhabensbedingte<br />
Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen<br />
Arten ausgeschlossen werden. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die<br />
er im Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.<br />
5.3.13 Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Re-<br />
gion (EU-Code 2180)<br />
Tab. 42: Beeinträchtigung der „Bewaldeten Küstendünen der atlantischen, kontinentalen<br />
<strong>und</strong> borealen Region (EU-Code 2180)<br />
Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region (EU-Code 2180)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die Standorte des Lebensraumtyps sind mehr als 10 km von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt <strong>und</strong> liegen<br />
auf Nord-Usedom <strong>und</strong> dem Ruden. Lediglich die küstennahen Flächen waren in einem guten Erhaltungszustand<br />
(B). Insgesamt liegen etwa 72 ha des LRT innerhalb des duB (inkl. Ruden).<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
LRF<br />
Optische Störungen --<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 228<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region (EU-Code 2180)<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
des Lebensraumtyps „Bewaldete Küstendünen“ zu erwarten<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen der „Bewaldete Küstendünen“ zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Der Lebensraumtyp „Bewaldete Küstendünen“ weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Stickstoffeinträgen auf. Von ÖKO-DATA (2011) wurden für die Bestände des LRT<br />
auf Nord-Usedom standortspezifische Critical Loads für eutrophierende Stickstoffeinträge<br />
(CLnutN) ermittelt. Die errechneten Critical Loads liegen dabei zwischen 4,7 bis<br />
11,7 kg N/ha/a. Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf diesen Flächen des LRT<br />
zwischen 14,16 <strong>und</strong> 15,18 kg N/ha/a <strong>und</strong> überschreiten somit bereits überall den jeweiligen<br />
standortspezifischen CLnutN. Auf etwa 93 % der Flächen wird der CL sogar um<br />
mehr als das Doppelte überschritten. Für die Bestände der Bewaldeten Küstendünen<br />
auf dem Ruden wird vorsorglich der niedrigste CLnutN von 4,7 kg N/ha/a angesetzt, da<br />
für diese Bereiche keine standortspezifischen Critical Loads vorliegen. Einen Überblick<br />
über die konkreten standortspezifischen Belastungen <strong>und</strong> Critical Loads gibt die folgende<br />
Tabelle:<br />
Tab. 43: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für die Bestände des LRT<br />
2180 auf Nord-Usedom <strong>und</strong> dem Ruden<br />
LRT Bodenform<br />
2180<br />
2180<br />
Sande sickerwasserbestimmt<br />
Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt<br />
Vegetationsgesellschaft<br />
im Zielzustand<br />
CLnutN<br />
(3%)<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
Max. ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
Empetro nigri-Pinetum sylvestris<br />
(Krähenbeeren-Kiefern-<br />
Trockenwald) 5,5 (0,165) 15,16 0,143<br />
Empetro nigri-Pinetum sylvestris<br />
(Krähenbeeren-Kiefern-<br />
Trockenwald) 5,4 (0,162) 15,17 0,145<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
Nein, nicht<br />
relevant<br />
Nein, nicht<br />
relevant
FROELICH & SPORBECK Seite 229<br />
LRT Bodenform<br />
2180<br />
2180<br />
2180<br />
2180<br />
2180<br />
2180<br />
Sande sickerwasserbestimmt<br />
Sande gr<strong>und</strong>wasserbestimmt<br />
Sande sickerwasserbestimmt<br />
anmoorige Standorte<br />
(
FROELICH & SPORBECK Seite 230<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
raussetzung dieses LRT dar. Wälder auf Küstendünen weisen eine relativ hohe Dynamik<br />
auf. So ist nach BERG et. al (2004) davon auszugehen, dass sich auch die Kiefernbestände<br />
des Untersuchungsgebietes langfristig ständig weiter in Richtung bodensaure<br />
Laubwälder entwickeln. Dieser Prozess wird durch Stickstoffeinträge aus der Luft beschleunigt.<br />
Bei den Beerstrauch-Kiefernwäldern zählt die Krähenbeeren-Ausbildung, die<br />
auf den gr<strong>und</strong>wasserfernen Kuppen jüngerer Küstendünen in den holozänen Anlandungsgebieten<br />
wie auf Nordusedom vorkommt, zu der naturnahsten <strong>und</strong> in der Sukzession<br />
stabilsten Kiefernwald-Gesellschaft (ebd.) Auch für die empfindliche Flechten-<br />
Kiefernwald-Ausprägung beschreibt BERG et al. (vgl. ebd), dass sich dieses humusarme<br />
Vorwaldstadium bei dichter werdender Vegetation schnell zum Beerstrauch-Kiefernwald<br />
entwickelt. In diesem Stadium ist bereits von einer geringen Stickstoffempfindlichkeit<br />
auszugehen. In der weiteren Sukzession bildet sich auch hier schließlich eine Laubwaldgesellschaft.<br />
Insgesamt würde bei den Kiefernwäldern auf Küstendünen allerdings<br />
auch bei einer umfassenden Reduzierung der Stickstoffeinträge die Weiterentwicklung<br />
der Gesellschaft nicht beendet, sondern „nur“ verlangsamt werden. Entsprechend wird<br />
bei HEINKEN (2008) - im Gegensatz zu anderen Kiefernwald-LRT (91U0, 91T0, 91D0) -<br />
für den LRT 2180 als Hauptgefährdungsfaktor nicht Nährstoffeintrag angegeben, sondern<br />
ausschließlich Tourismus <strong>und</strong> fehlende Dynamik (ebd.).<br />
Wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt sind für den LRT 2180 des Schutzgebietes verschiedene<br />
Erhaltungsziele formuliert worden, an denen die potenziellen Beeinträchtigungen zu<br />
messen sind. Im vormals gültigen provisorischen Formblatt zur Gebietscharakterisierung<br />
zum FFH-Nachmeldegebiet „Greifswalder Bodden“ vom 07.03.2003 (UM MV<br />
2003) wird das Erhaltungsziel „Erhalt von natürlichen <strong>und</strong> naturnahen Wäldern auf Küstendünen<br />
der Ostseeküsten <strong>und</strong> ihrem charakteristischen Gesamtarteninventar insbesondere<br />
durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung natürlicher Bestandsstrukturen mit hohen<br />
Altbaum- <strong>und</strong> Totholzanteilen <strong>und</strong> charakteristischem Arteninventar“ genannt:<br />
In der Verordnung für das Naturschutzgebiet „Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden“<br />
vom 10.12.2008 sind darüber hinaus folgende allgemeine Erhaltungsziele aufgeführt,<br />
die sich u. a. auf den Lebensraumtyp „Bewaldete Küstendünen“ beziehen: „Sicherung<br />
einer natürlichen Entwicklung von Küstenbiotopen, insbesondere von Dünen <strong>und</strong><br />
Strandwällen durch Zulassung der Küstenausgleichsprozesse“ sowie „Erhaltung <strong>und</strong><br />
Entwicklung der Waldbereiche mit dem jeweils charakteristischen Arteninventar durch<br />
teilweisen Nutzungsausschluss, Fortführung historischer Bewirtschaftungsformen<br />
(Hudewälder) sowie durch Begünstigung <strong>und</strong> Förderung natürlicher Bestandsstrukturen“.<br />
Für das Teilgebiet „Peenemünder Haken“, in dem die zu betrachtenden „Bewaldeten<br />
Küstendünen“ liegen, ist in der Verordnung u. a. folgendes Schutzziel aufgeführt: „Erhaltung<br />
von natürlich bewaldeten Reffen <strong>und</strong> Riegen sowie Dünenkiefernwäldern zur<br />
Sicherung der ökologischen Funktionalität, insbesondere als Standort einer an diese<br />
Bedingungen angepassten, spezifischen Flora“.<br />
Es ist daher damit zu rechnen, dass die geringen projektbedingten Nährstoffeinträge<br />
höchstens zu einer leichten Beschleunigung der natürlichen Sukzessionsprozesse füh-
FROELICH & SPORBECK Seite 231<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ren können, eine damit verb<strong>und</strong>enen Gefährdung der Erhaltungsziele ist eher unwahrscheinlich.<br />
Bei den von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL handelt es sich insbesondere<br />
in Bezug auf den LRT 2180 um eine konservative Berechnung der Belastungsschwelle.<br />
Die errechneten CL sind auf die naturnahe Ziel-Vegetationsgesellschaft<br />
des spezifischen Standorts ausgerichtet, die ausgebildet wäre, wenn der Lebensraum<br />
einen hervorragenden Erhaltungszustand (A) aufweisen würde <strong>und</strong> spiegelt damit eine<br />
entsprechend hohe Empfindlichkeit wider. Bei Einhaltung des Critical Loads bliebe das<br />
Potenzial zur Selbstregenerierung der natürlichen Pflanzengesellschaft vollständig erhalten.<br />
Diese hervorragenden Erhaltungszustände sind jedoch auf keiner Fläche des<br />
LRT 2180 vorhanden. Entsprechend sind die errechneten Schwellen, als höchst vorsorgliche<br />
Belastungsgrenzen zu sehen. Die bewaldeten Küstendünen weisen nach den<br />
Kartierungen von FROELICH & SPORBECK (2009A) ausschließlich auf den küstennahen<br />
Flächen einen guten Erhaltungszustand (B) auf. Bei allen anderen Beständen wurde<br />
der Erhaltungszustand mit C bewertet. Die schlechte Bewertung des Erhaltungszustands<br />
der Flechten-Sandseggen-Silbergras-Kiefernwälder, die im munitionsbelasteten,<br />
eingezäunten Gebiet liegen, ist dabei auf verschiedene Gründe zurückzuführen: Zum<br />
einen weisen die Bestände nur ein Sukzessionsstadium <strong>und</strong> einen Standorttyp auf (geringer<br />
Habitatwert), zum anderen sind Störzeiger wie Brombeere, Landreitgras, Traubenkirsche<br />
<strong>und</strong> Drahtschmiele mit hohen Deckungen vertreten <strong>und</strong> starke Beeinträchtigungen<br />
durch Bodenbearbeitung <strong>und</strong> Entwässerung oder Veränderung des<br />
Dünenreliefs zu verzeichnen. Der ungünstige Erhaltungszustand der Bestände ist somit<br />
nicht vorrangig auf den Stickstoffeintrag über die Luft zurückzuführen.<br />
Bei der Berechnung der CL von ÖKO-DATA (2011) bleibt unberücksichtigt, dass die<br />
wichtigste Voraussetzung für den Lebensraumtyp 2180 der Küstendünenstandort mit<br />
den damit verb<strong>und</strong>enen dynamischen Prozessen ist <strong>und</strong> die beurteilten Ziel-<br />
Pflanzengesellschaften daher nur ein Zwischenstadium des LRT darstellen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der dargestellten, standörtlichen Voraussetzungen der Bestände im Schutzgebiet<br />
<strong>und</strong> der vorsorglich niedrig angesetzten Critical Loads ist es unwahrscheinlich,<br />
dass die geringen vorhabensbedingten Stickstoffeinträge zu einer langfristigen Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustands oder einer Verhinderung der Verbesserung des<br />
Erhaltungszustands des LRT führen werden. Aufgr<strong>und</strong> der formalen Überschreitung der<br />
Irrelevanzschwelle (3 % des CL) werden dennoch höchst vorsorglich erhebliche Beeinträchtigungen<br />
des LRT 2180 „Bewaldete Küstendünen“ unterstellt.<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ausgeschlossen werden.<br />
Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 1721 bis<br />
2242 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (1590 bis<br />
1665 eq/ha/a) nicht überschritten.
FROELICH & SPORBECK Seite 232<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 44: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2180<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq /ha/a]<br />
2180 1721 bis<br />
2242<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
51,6 bis<br />
67,3<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1590 bis 1665 25 bis 44,1 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps durch die Wirkprozesse Kühlwasserentnahme<br />
<strong>und</strong> -einleitung, Lärmimmissionen <strong>und</strong> optische Störungen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Kühlwasserfahne <strong>und</strong> zum Kraftwerk nicht zu erwarten.<br />
Fazit: erheblich beeinträchtigt<br />
Die Stickstoff-Gesamtbelastungen der Flächen des LRT 2180 „Bewaldete Küstendünen“ überschreiten<br />
im gesamten Schutzgebiet die standortspezifisch berechneten Critical Loads. Auf<br />
einer Fläche von etwa 50 ha überschreiten zudem die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen<br />
durch Stickstoffeinträge knapp die Bagatellschwelle von 3 % des CLnutN, so dass formal von<br />
einer erheblichen Beeinträchtigung <strong>und</strong> einem relevanten graduellen Funktionsverlust dieser<br />
Bestände ausgegangen wird. Unter Berücksichtigung der natürlichen Standortdynamik <strong>und</strong> des<br />
sehr geringen Anteils dieser prognostizierten Stickstoff-Zusatzbelastungen an der Gesamtbelastung<br />
ist jedoch eine vorhabensbedingte langfristige Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
oder einer Verhinderung der Verbesserung des Erhaltungszustands des LRT eher unwahrscheinlich.<br />
Höchst vorsorglich werden hinsichtlich der Stickstoffeinträge aber dennoch erhebliche<br />
Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps „Bewaldete Küstendünen“ im Schutzgebiet unterstellt.<br />
Die versauernden Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel-Einträge unterschreiten deutlich die<br />
Irrelevanzschwelle <strong>und</strong> haben somit keine Bedeutung für die Vorkommen der Bewaldeten Küstendünen<br />
des Schutzgebietes.<br />
5.3.14 Feuchte Dünentäler (EU-Code 2190)<br />
Tab. 45: Beeinträchtigung der „Feuchten Dünentäler (EU-Code 2190)“<br />
Feuchte Dünentäler (EU-Code 2190)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Amphibien (A) : Kreuzkröte (Bufo calamita)<br />
Wirbellose (W): Colletes succinctus (Seidenbienenart)<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind etwa 9,5 km von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.
FROELICH & SPORBECK Seite 233<br />
Feuchte Dünentäler (EU-Code 2190)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V A W<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich nicht erheblich nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, A = Amphibien, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
für die Lebensraumfunktionen der feuchten Dünentäler zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen der „Feuchten Dünentäler“ <strong>und</strong> der lebensraumtypischen<br />
Arten zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Der LRT weist eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen auf. Die von<br />
ÖKO-DATA (2011) berechneten CLnutN für die Bestände des LRT liegen bei 8 <strong>und</strong><br />
16,5 kg N/ha/a. Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf den Flächen des LRT zwi-
FROELICH & SPORBECK Seite 234<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
schen 12 <strong>und</strong> 24 kg N/ha/a <strong>und</strong> überschreiten damit bereits die CL. Da jedoch die vorhabensbedingten<br />
Zusatzbelastungen unter der Irrelevanzschwelle liegen (vgl. folgende<br />
Tabelle), sind keine signifikanten Beeinträchtigungen des LRT zu erwarten. Eine durch<br />
vorhabensbedingte Stickstoffeinträge verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des LRT kann somit ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 46: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 2190<br />
LRT (EU-<br />
Code)<br />
CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
2190 8<br />
16,5<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,24<br />
0,5<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
12,24 0,21 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 1804<br />
<strong>und</strong> 1836 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung<br />
(1454 eq/ha/a) deutlich unterschritten.<br />
Tab. 47: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 2190<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
<strong>und</strong><br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
2190 1804<br />
1836<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
54,1<br />
55,1<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1454 31,7 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Da die lebensraumspezifischen Irrelevanzschwellen deutlich unterschritten werden,<br />
können auch erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen Arten durch die vorhabensbedingten<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge ausgeschlossen werden. Alle anderen<br />
Wirkfaktoren sind aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk für die Arten nicht<br />
relevant.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Feuchte Dünentäler“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte Beein-
FROELICH & SPORBECK Seite 235<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
trächtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet<br />
einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.<br />
5.3.15 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydrocharition (EU-Code 3150)<br />
Tab. 48: Beeinträchtigung der „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ<br />
Magnopotamion oder Hydrocharition (EU-Code 3150)“<br />
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition<br />
(EU-Code 3150)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Reptilien (R) : Ringelnatter (Natrix natrix)<br />
Wirbellose (W): Keilflecklibelle (Aeshna isosceles)<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Ein etwa 2 ha großer See in einem Wäldchen auf dem Struck wurde bei der Kartierung von I.L.N. (2007) diesem<br />
Lebensraumtyp zugeordnet. Auf Nord-Usedom liegen 8 weitere Flächen des LRT. Die nächstgelegenen Standorte<br />
des Lebensraumtyps sind etwa 3,6 km von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Be-<br />
schreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V R W<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, R = Reptilien, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)
FROELICH & SPORBECK Seite 236<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle können baubedingte Beeinträchtigungen<br />
der allgemeinen Lebensraumfunktionen <strong>und</strong> der charakteristischen Arten der natürlichen<br />
eutrophen Seen ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der allgemeinen Lebensraumfunktionen der natürlichen eutrophen Seen <strong>und</strong> der<br />
charakteristischen Arten zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Die vorhabensbedingten Stickstoff-Zusatzbelastungen in den Stillgewässer auf Nordusedom,<br />
die dem LRT 3150 (eutrophe Stillgewässer) zugeordnet werden liegen bei ma-<br />
ximal 0,0115 kg/ha/a. Der LRT besitzt keine besondere Empfindlichkeit gegenüber geringen<br />
atmosphärischen Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen. Eutrophe Stillgewässer<br />
(LRT 3150) sind in der Regel phosphorlimitiert <strong>und</strong> sind daher als wenig empfindlich<br />
gegenüber eutrophierenden Stickstoffeinträgen einzustufen (KIFL 2009). Erhebliche<br />
Beeinträchtigungen über diesen Wirkfaktor können daher mit Sicherheit ausgeschlossen<br />
werden (vgl. Kap. 5.2.6).<br />
� Da der LRT keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den geringen Stickstoff- <strong>und</strong><br />
Schwefeleinträgen aufweist, können auch erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen<br />
Arten durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge ausgeschlossen<br />
werden. Alle anderen Wirkfaktoren sind aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum<br />
Kraftwerk für die Arten nicht relevant.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder<br />
Hydrocharition (EU-Code 3150)“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet<br />
führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte Beeinträchtigungen<br />
zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt,<br />
bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 237<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.16 Artenreiche Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan auf dem europäi-<br />
schen Festland) (EU-Code 6230*)<br />
Tab. 49: Beeinträchtigung der „Artenreichen Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan<br />
auf dem europäischen Festland)“ (EU-Code 6230*)<br />
Artenreiche Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan auf dem europäischen Festland) (EU-<br />
Code 6230)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Vögel (V) : Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Braunkehlchen (Saxicola rubetra)<br />
Reptilien (R) : Kreuzotter (Vipera berus)<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Größere Bestände dieses Lebensraumtyps befinden sich im Südwesten der Freesendorfer Wiesen, südwestlich<br />
<strong>und</strong> südöstlich des Freesendorfer Sees <strong>und</strong> im Südosten des Struck. Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps<br />
sind etwa 700 m von der Baustelle bzw. etwa 1,1 km von der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält<br />
Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Arten.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V R W<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- -- --<br />
Kollisionsrisiko -- -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- -- --<br />
Optische Störungen -- -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich -- nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, R = Reptilien, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
--
FROELICH & SPORBECK Seite 238<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Die charakteristischen Vogelarten des LRT weisen nur eine schwache Lärmempfindlichkeit<br />
<strong>und</strong> eine Effektdistanz von 200 m auf (GARNIEL & MIERWALD 2010). In den LRT-<br />
Flächen, die im Nordosten der Freesendorfer Wiesen liegen, ist bereits bezüglich der<br />
Wirkfaktoren Schall <strong>und</strong> optischer Störung von einer Vorbelastung durch die Gasanlandestation<br />
sowie durch das <strong>GuD</strong> II auszugehen. Da die Borstgrasrasen durch diese beiden<br />
anderen Industrievorhaben sowie durch den daran angrenzenden Waldstreifen von<br />
den Bauflächen des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> abgeschirmt werden, ist davon auszugehen, dass die temporären<br />
baubedingten Störungen des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> für die Vorkommen des LRT im Westteil<br />
der Freesendorfer Wiesen nicht von Relevanz sind.<br />
� Da keine Hauptflugzonen der charakteristischen Vogelarten durch Baugerüste <strong>und</strong><br />
Baukräne etc. betroffen sind, werden keine Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen für die Arten<br />
angenommen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch die Anlage des <strong>GuD</strong> II werden keine relevanten optischen <strong>und</strong> akustischen Beeinträchtigungen<br />
von Bereichen des LRT erwartet: Die LRT-Flächen im Westen der<br />
Freesendorfer Wiesen werden durch die Gasanlandestation <strong>und</strong> das <strong>GuD</strong> II sowie die<br />
daran angrenzenden Waldstreifen von der Anlange des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> abgeschirmt. Durch die<br />
Anlage des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> werden daher keine relevanten zusätzlichen Beeinträchtigungen<br />
erwartet. Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage sind keine Beeinträchtigungen<br />
der allgemeinen Lebensraumfunktionen der Borstgrasrasen zu erwarten.<br />
� Eine Verstärkung der Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen durch die Anlage sowie ein erhöhtes<br />
Kollisionsrisiko mit den Bauwerken des Kraftwerks wird aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung<br />
zwischen Anlage <strong>und</strong> LRT-Flächen ausgeschlossen.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Relevante optische <strong>und</strong> akustische Störungen der charakteristischen Vogelarten, die<br />
den LRT potenziell als Brut- <strong>und</strong> Nahrungshabitat nutzen, sind nicht zu erwarten, da die<br />
beiden Arten nur eine Effektdistanz von 200 Metern aufweisen (GARNIEL & MIERWALD<br />
2010) <strong>und</strong> die nächsten LRT-Flächen über 1,1 km von der Vorhabensfläche entfernt<br />
liegen.<br />
� Der prioritäre Lebensraumtyp „Artenreiche Borstgrasrasen montan <strong>und</strong> submontan auf<br />
dem europäischen Festland, EU-Code 6230*) ist besonders empfindlich gegenüber<br />
Stickstoffeinträgen. Bei Eutrophierung kann die Artenvielfalt der Bestände (mit vielen<br />
gefährdeten Arten) schnell zurückgehen <strong>und</strong> die Gesellschaft kann in Frischwiesen oder<br />
gar feuchte Hochstaudenfluren übergehen. Nach I.L.N. (2007) wird derzeit 10 % der<br />
Vorkommen ein sehr guter Erhaltungszustand zugewiesen <strong>und</strong> 90 % der Vorkommen<br />
ein guter Zustand. Von ÖKO-DATA (2011) wurden für den LRT 6230* in den Freesendorfer<br />
Wiesen <strong>und</strong> auf dem Struck standortspezifische Critical Loads für eutrophierende
FROELICH & SPORBECK Seite 239<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Wirkungen von minimal 9,4 kg N/ha/a bis maximal 14,4 kg N/ha/a ermittelt. Aus den Daten<br />
von LOBER (2011E) kann für die Borstgrasrasen des Struck <strong>und</strong> der Freesendorfer<br />
Wiesen eine Gesamtbelastung von 12,17 bis maximal 12,32 kg N/ha/a abgelesen werden,<br />
so dass in vielen Bereichen bereits die CL überschritten sind. Von der Gesamtbelastung<br />
sind allein 12,06 bis 12,16 kg N/ha/a, also mindestens 98,7 %, auf die Vorbelastung<br />
zurückzuführen. Nach VOIGTLÄNDER (2007 <strong>und</strong> 1999a) sind bisher keine<br />
Veränderungen in der Artenzusammensetzung der Vegetation zu erkennen, die auf atmosphärische<br />
Stickstoffeinträge zurückzuführen wären. Im Kontext der Empfindlichkeit<br />
<strong>und</strong> Gefährdungssituation dieser Lebensräume sind jedoch nach VOIGTLÄNDER (2007)<br />
jegliche Zusatzbelastungen kritisch zu werten. Die vorhabensbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastungen (<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> + <strong>GuD</strong> II) des LRT 6230* liegen zwischen 0,053 <strong>und</strong><br />
0,259 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreiten damit in allen Bereichen die lebensraumtypischen<br />
Irrelevanzschwellen (vgl. nachfolgende Tabelle). Es kann daher davon ausgegangen<br />
werden, dass die vorhabensbedingten Stickstoffeinträge nicht zu einer Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustands des LRT führen werden.<br />
Tab. 50: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 6230*<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
6230*<br />
[kg N/ha/a]<br />
9,4 bis<br />
14,4<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,28 bis<br />
0,43<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
12,17 bis<br />
12,32<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,053 bis<br />
0,259<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Nach den Modellierungen von ÖKO-DATA (2011) weist der prioritäre LRT 6230* auch eine<br />
besondere Empfindlichkeit gegenüber versauernden Wirkungen durch Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Schwefeleinträge auf. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen<br />
CL für versauernde Wirkungen liegen bei 1638 bis 1880 eq/ha/a. Da die berechneten<br />
Gesamtbelastungen mit 1450 bis 1474 eq/ha/a noch deutlich unter diesen Belastungsgrenzen<br />
liegen, kann eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
der Borstgrasrasen durch diesen Wirkfaktor ausgeschlossen werden.<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 240<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 51: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 6230<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
6230 1638 bis 1880<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
49,1 bis<br />
56,4<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1450 bis 1474 20,3 bis 44,7 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E) Quelle: ÖKO-DATA 2011<br />
� Für die charakteristischen Vogelarten <strong>und</strong> die Kreuzotter können mittelbare erhebliche<br />
Beeinträchtigungen durch Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge ausgeschlossen werden, da<br />
vorhabensbedingt keine gravierenden Strukturveränderungen in ihrem Habitat erfolgen<br />
werden.<br />
� Da nur kleine Teilbereiche des LRT in der Nähe der Kühlwasserfahne liegen, werden<br />
erhebliche Beeinträchtigungen des LRT durch kühlwasserbeeinflusste Veränderungen<br />
des Mikroklimas ausgeschlossen.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
prioritären Lebensraumtyps Borstgrasrasen <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im<br />
Schutzgebiet führen können. Der LRT reagiert sehr sensibel auf die Zunahme von Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Schwefeleinträgen. Die berechneten Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen zwar teilweise<br />
oberhalb der Critical Loads, da die vorhabensbedingten Depositionen jedoch unterhalb der jeweiligen<br />
Irrelevanzschwellen liegen, kann eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten ausgeschlossen werden.<br />
Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im Gebiet einnimmt, bleiben<br />
nach derzeitiger Einschätzung beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.<br />
5.3.17 Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Code<br />
6410)<br />
Tab. 52: Beeinträchtigung der „Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden<br />
(EU-Code 6410)“<br />
Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Code 6410)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
keine<br />
Vorkommen des LRT Arten im duB:<br />
Nach I.L.N. (2007) kommt der LRT mit nur mit einem 0,1 ha großem Vorkommen auf dem Struck in einem kleinen<br />
Wäldchen vor. Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind mindestens 3,8 km von der Baustelle<br />
bzw. der Anlage entfernt. Kap. 4.3.2 enthält Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Ar-<br />
ten.
FROELICH & SPORBECK Seite 241<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden <strong>und</strong> Lehmboden (EU-Code 6410)<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
LRF<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
� Baubedingte Beeinträchtigungen der Lebensraumfunktionen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Baustelle nicht zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Anlage sind anlagebedingte Beeinträchtigungen<br />
des Lebensraumtyps <strong>und</strong> der charakteristischen Arten nicht zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Der Erhaltungszustand des kleinflächigen Pfeifengrasbestandes der dem LRT 6410 zugeordnet<br />
wurde, wurde mit C (mittel bis schlecht) eingestuft (I.L.N. 2007). Von ÖKO-<br />
DATA (2011) wurde für diese Fläche ein standorttypischer CL für eutrophierende Stickstoffeinträge<br />
von 9,2 kg N/ha/a berechnet. Die prognostizierte Gesamtbelastung der
FROELICH & SPORBECK Seite 242<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Stickstoffdepositionen für diese Fläche liegt bei 12,3 kg N/ha/a <strong>und</strong> überschreitet damit<br />
bereits den CL. Da die vorhabensbedingte Zusatzbelastung (0,221 kg N/ha/a) unterhalb<br />
der Irrelevanzschwelle liegt (vgl. nachfolgende Tabelle) können relevante Beeinträchtigungen<br />
durch eutrophierende Stickstoffeinträge dennoch ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 53: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 6410<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
6410 9,2 0,28 12,3 0,221 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Der von ÖKO-DATA (2011) ermittelte standortspezifische CL liegt bei<br />
1833 eq/ha/a) <strong>und</strong> wird von der prognostizierten Gesamtbelastung (1446 eq/ha/a) deutlich<br />
unterschritten. Die vorhabensbedingten Zusatzbelastungen von 55 eq/ha/a liegen<br />
unterhalb der Irrelevanzschwelle (vgl. folgende Tabelle).<br />
Tab. 54: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 6410<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
6410 1833 55 1465 37,8 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Durch die anderen betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Vorhabensfläche keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zur Störung des Lebensraumtyps<br />
„Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichem Boden“ mit seinem charakteristischen Arteninventar im<br />
Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
<strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die er im<br />
Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.
FROELICH & SPORBECK Seite 243<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.18 Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (EU-Code 7140)<br />
Tab. 55: Beeinträchtigung der „Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (EU-Code 7140)“<br />
Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (EU-Code 7140)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Wirbellose (W) : Orthonevra intermedia<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind über 9 km von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Kap. 4.3.2 enthält eine Beschreibungen zum Vorkommen der charakteristischen Art.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W<br />
Lärmimmissionen -- --<br />
Optische Störungen -- --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes -- --<br />
Kollisionsrisiko -- --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- --<br />
Optische Störungen -- --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge -- --<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung -- --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle, sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
des Lebensraumtyps „Übergangsmoore“ zu erwarten.
FROELICH & SPORBECK Seite 244<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen der „Übergangsmoore“ zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps durch die Wirkprozesse Kühlwasserentnahme<br />
<strong>und</strong> -einleitung, Lärmimmissionen <strong>und</strong> optische Störungen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Kühlwasserfahne <strong>und</strong> zum Kraftwerk nicht zu erwarten.<br />
� Die Stickstoff-Gesamtbelastungen liegen auf den Flächen des LRT bei maximal<br />
12,19 kg N/ha/a <strong>und</strong> unterschreiten damit die von ÖKO-DATA (2011) berechneten CLnutN<br />
von minimal 23,6 kg N/ha/a. Durch die geringfügigen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen,<br />
die deutlich unter der Irrelevanzschwelle liegen (vgl. folgende Tabelle), sind<br />
keine signifikanten Beeinträchtigungen des LRT zu erwarten. Eine durch vorhabensbedingte<br />
Stickstoffeinträge verursachte Verschlechterung des Erhaltungszustands des<br />
LRT kann daher ausgeschlossen werden.<br />
Tab. 56: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 7140*<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
7140 23,6 bis 24,3 0,71 bis 0,72 12,18 bis<br />
12,19<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,159 bis<br />
0,168<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 2043<br />
bis 2092 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (maximal<br />
1448 eq/ha/a) deutlich unterschritten.<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 245<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 57: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 7140<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
7140 2043 bis<br />
2092<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
61,3 bis<br />
62,8<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
1446 bis<br />
1448<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
24,3 bis<br />
25,9<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
� Da die lebensraumspezifischen Critical Loads deutlich unterschritten werden, können<br />
auch erhebliche Beeinträchtigungen der charakteristischen Art Orthonevra intermedia<br />
durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge ausgeschlossen werden.<br />
Alle anderen Wirkfaktoren sind aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zum Kraftwerk für<br />
die Art nicht relevant.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Störung des<br />
Lebensraumtyps „Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar<br />
im Schutzgebiet führen können. Es ist keine Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
des Lebensraumtyps <strong>und</strong> seiner charakteristischen Arten im Schutzgebiet durch vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen zu erwarten. Das Verbreitungsgebiet des LRT sowie die Flächen, die<br />
er im Gebiet einnimmt, bleiben beständig <strong>und</strong> die Lebensraumfunktionen bleiben erhalten.<br />
5.3.19 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code 9110)<br />
Tab. 58: Beeinträchtigung der „Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code<br />
9110)“<br />
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code 9110)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps sind über 8 km von der Baustelle bzw. der Anlage entfernt.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
LRF<br />
Lärmimmissionen --<br />
nein<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 246<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (EU-Code 9110)<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
für die Lebensraumfunktionen der Hainsimsen-Buchenwälder zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen der Hainsimsen-Buchenwälder <strong>und</strong> der lebensraumtypischen<br />
Arten zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps durch die Wirkprozesse Kühlwasserentnahme<br />
<strong>und</strong> -einleitung, Lärmimmissionen <strong>und</strong> optische Störungen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Kühlwasserfahne <strong>und</strong> zum Kraftwerk nicht zu erwarten.<br />
� Beim Waldlebensraumtyp 9110 werden die Critical Loads auf etwa zwei Drittel der Flächen<br />
bereits durch die Vorbelastungen überschritten. In vielen Bereichen zeugt die Bodenvegetation<br />
bereits von der hohen Eutrophierungsrate. Die ursprünglichen Waldtypen<br />
degradieren dadurch immer stärker. Es ist von einer bereits erfolgten Anpassung an die<br />
höhere Nährstoffsituation auszugehen. Es ist nicht zu erwarten, dass die im Vergleich
FROELICH & SPORBECK Seite 247<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
zur Vorbelastung geringen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen von maximal<br />
0,242 kg N/ha/a (vgl. Tabelle), die unter der 3%-Irrelevanzschwelle von 0,28 kg N/ha/a<br />
liegen, signifikante Änderungen auslösen.<br />
Tab. 59: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 9110*<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
9110 9,2 bis 18,5 0,28 bis 0,56 14,22 bis<br />
14,28<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,195 bis<br />
0,242<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Es sind keine erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen zu erwarten. Die<br />
von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen zwischen 1625 <strong>und</strong><br />
2365 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden somit von der prognostizierten Gesamtbelastung nicht überschritten<br />
(vgl. folgende Tabelle).<br />
Tab. 60: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code<br />
LRT 9110<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
9110 1625 bis<br />
2365<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
48,8 bis<br />
70,9<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
1603 bis<br />
1612<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
nein<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
37,1 bis 45,2 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Verschlechterung<br />
bzw. Verhinderung einer Verbesserung des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps<br />
„Hainsimsen-Buchenwald“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet führen<br />
können. Die geringfügigen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen durch Stickstoffeinträge<br />
unterschreiten die Irrelevanzschwelle. Hinsichtlich der versauernden Wirkungen überschreiten<br />
die prognostizierten Gesamtbelastungen nicht die standortspezifischen CL, so dass vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen über diesen Wirkpfad ausgeschlossen werden können.
FROELICH & SPORBECK Seite 248<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.3.20 Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen (EU-<br />
Code 9190)<br />
Tab. 61: Beeinträchtigung der „Alten bodensauren Eichenwälder mit Quercus robur auf<br />
Sandebenen (EU-Code 9190)<br />
Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus robur auf Sandebenen (EU-Code 9190)<br />
Projektrelevante charakteristische Arten im detailliert untersuchten Bereich (duB):<br />
Keine<br />
Vorkommen des LRT im duB:<br />
Die nächstgelegenen Standorte des Lebensraumtyps auf dem Struck sind etwa 3,3 km von der Baustelle bzw.<br />
3,7 km von der Anlage entfernt. Auf Nord-Usedom liegen sieben weitere Bestände dieses Lebensraumtyps.<br />
Wirkfaktor Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung des Sichtfeldes --<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
LRF<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge nicht erheblich<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung --<br />
Legende:<br />
LRF = Allgemeine Lebensraumfunktion<br />
Charakteristische Arten: S = Säugetiere, V = Vögel, F = Fische, W= Wirbellose<br />
Beeinträchtigung: -- = keine<br />
(Darstellung der höchsten Beeinträchtigungserheblichkeit)<br />
Charakteristische Arten<br />
S V F W
FROELICH & SPORBECK Seite 249<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung zur Baustelle sind keine baubedingten Beeinträchtigungen<br />
für die Lebensraumfunktionen der „Alten bodensauren Eichenwälder mit Quercus<br />
robur auf Sandebenen“ zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Distanz zur Anlage sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen<br />
der Lebensraumfunktionen des LRT 9190 <strong>und</strong> der lebensraumtypischen Arten zu<br />
erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Beeinträchtigungen des Lebensraumtyps durch die Wirkprozesse Kühlwasserentnahme<br />
<strong>und</strong> -einleitung, Lärmimmissionen <strong>und</strong> optische Störungen sind aufgr<strong>und</strong> der großen<br />
Entfernung zur Kühlwasserfahne <strong>und</strong> zum Kraftwerk nicht zu erwarten.<br />
� Beim Waldlebensraumtyp 9190 werden die Critical Loads bereits auf über 70 % der<br />
Fläche durch die Vorbelastungen überschritten. In vielen Bereichen zeugt die Bodenvegetation<br />
bereits von der hohen Eutrophierungsrate. Bestände des LRT auf dem Struck<br />
weisen durch das häufige Vorkommen der Brombeere (Rubus fruticosus) auf nährstoff-<br />
reichere <strong>und</strong> damit stark vorbelastete Verhältnisse hin. Es ist somit von einer bereits erfolgten<br />
Anpassung an die höhere Nährstoffsituation auszugehen. Es ist nicht zu erwarten,<br />
dass die im Vergleich zur Vorbelastung geringen vorhabensbedingten<br />
Zusatzbelastungen von maximal 0,252 kg N/ha/a, die unter der 3%-Irrelevanzschwelle<br />
von 0,33 kg N/ha/a liegen, signifikante Änderungen auslösen.<br />
Tab. 62: Bewertung der eutrophierenden Stickstoffeinträge für den LRT 9190<br />
LRT (EU-Code) CLnutN<br />
[kg N/ha/a]<br />
9190 11 bis<br />
23<br />
3 % des CL<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,33 bis<br />
0,69<br />
GB<br />
[kg N/ha/a]<br />
14,24 bis<br />
15,24<br />
ZB<br />
[kg N/ha/a]<br />
0,168 bis<br />
0,252<br />
ZB >3 %<br />
des CL<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung als Summe aus der Vorbelastung (VB) <strong>und</strong> der projektbedingten Stickstoff-<br />
Zusatzbelastung (ZB), wobei VB = Vorbelastung als Summe aus der Stickstoff-Hintergr<strong>und</strong>belastung (UBA 2011) <strong>und</strong><br />
den Stickstoff-Depositionen von Gasanlandestation <strong>und</strong> <strong>EWN</strong>-Ersatzwärmeerzeuger (LOBER 2011E), ZB = projektbezo-<br />
gene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER 2011E)<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Die von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifischen CL liegen bei 2006<br />
bis 2678 eq/ha/a) <strong>und</strong> werden von der prognostizierten Gesamtbelastung (maximal<br />
1678 eq/ha/a) deutlich unterschritten.<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 250<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 63: Bewertung der versauernden Wirkungen durch Stickstoff <strong>und</strong> Schwefel für den<br />
LRT 9190<br />
LRT<br />
(EU-<br />
Code)<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
9190 2006 bis<br />
2678<br />
3 % des<br />
CL S+N<br />
[eq/ha/a]<br />
60,2 bis<br />
80,3<br />
GB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB<br />
[eq/ha/a]<br />
ZB > 3%<br />
des CL<br />
1606 bis 1678 31,9 bis 50,5 nein<br />
Erläuterungen:<br />
CL = Critical Load, GB = Gesamtbelastung, ZB = projektbezogene Zusatzbelastung (<strong>GuD</strong> II + <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, vgl. LOBER<br />
2011E)<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch das Vorhaben werden keine Prozesse ausgelöst, die zu einer signifikanten Verschlechterung<br />
des Erhaltungszustands des Lebensraumtyps „Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus<br />
robur auf Sandebenen“ <strong>und</strong> seinem charakteristischen Arteninventar im Schutzgebiet führen<br />
können. Die geringfügigen vorhabensbedingten Zusatzbelastungen durch Stickstoffeinträge<br />
unterschreiten die Irrelevanzschwelle. Hinsichtlich der versauernden Wirkungen überschreiten<br />
die prognostizierten Gesamtbelastungen nicht die standortspezifischen CL, so dass vorhabensbedingte<br />
Beeinträchtigungen über diesen Wirkpfad ausgeschlossen werden können.<br />
5.4 Beeinträchtigung von Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie<br />
Nachfolgend wird die Auswirkungsprognose für die Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie<br />
durchgeführt, die im detailliert untersuchten Bereich nachgewiesen sind oder von deren Vorkommen<br />
auszugehen ist (vgl. Kap. 4.3.3). Es werden die Konflikte bzw. Beeinträchtigungen<br />
bezüglich des Artenvorkommens, die durch den Bau <strong>und</strong> den Betrieb des Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong><br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> ausgelöst werden können, beschrieben, analysiert <strong>und</strong> bewertet.<br />
5.4.1 Kegelrobbe (Halichoerus grypus) (EU-Code 1364)<br />
Tab. 64: Beeinträchtigungen der Kegelrobbe (Halichoerus grypus)<br />
Beeinträchtigungen der Kegelrobbe (Halichoerus grypus)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmemissionen -- � die Küstenlinie des Greifswalder Boddens liegt mindestens<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
600 m vom Bau- bzw. Anlagenbereich entfernt<br />
� der Küstenstreifen am Struck, der als potenzieller Liegeplatz<br />
bei einer Wiederansiedelung der Art eingestuft wird<br />
(SCHWARZ et al. 2003) ist mind. 2 km vom Bau- bzw. Anla-<br />
genbereich entfernt
FROELICH & SPORBECK Seite 251<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der Kegelrobbe (Halichoerus grypus)<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � s.o.<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfelds<br />
Kollisionsrisiko<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefelein-<br />
träge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
--<br />
--<br />
--<br />
nicht erheblich<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung der potenziellen (Teil-)Lebensräume der Art zur Baustelle<br />
sind keine baubedingten Beeinträchtigungen der Kegelrobben zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung der potenziellen (Teil-)Lebensräume der Art zur Anlage<br />
sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen der Kegelrobben zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Akustische <strong>und</strong> optische Störungen durch den Betrieb des Kraftwerks sind für die Art<br />
nicht zu erwarten. Es werden keine dauerhaft besiedelten Lebensräume beeinträchtigt.<br />
Im Gewässerbereich des Greifswalder Boddens finden keine Störungen statt. Der dem<br />
Struck vorgelagerte Küstenstreifen, für den überwiegend eine Funktion als Ruheraum<br />
erwartet wird, liegt mehr als 2 km vom Kraftwerk entfernt.<br />
� Eine erhebliche Beeinträchtigung der Art durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong><br />
Schwefeleinträge in den Greifswalder Bodden sowie die Strandbereiche des Wirkraums,<br />
als potenzielle Teillebensräume der Art kann ausgeschlossen werden, da diese<br />
Einträge im Vergleich zur derzeitigen Vorbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel sehr<br />
gering sind <strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden. Der Greifswalder Bodden<br />
weist als eutrophes Gewässer keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Schwefeleinträgen auf.<br />
� Einzelne Ostsee-Kegelrobben können in relativ kleinflächigen Teilen ihres potenziellen<br />
Habitats mittelbar durch die Kühlwassereinleitung beeinträchtigt werden. So könnte ei-
FROELICH & SPORBECK Seite 252<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ne temporäre Dezimierung der Benthosorganismen oder Fischbestände durch die Erwärmung<br />
des Boddenwassers im Bereich der Kühlwasserfahne auch einzelne Kegelrobbenindividuen<br />
beeinträchtigen, die diese als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage nutzen. Aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Mobilität könnten diese Kegelrobben, jedoch auf andere nicht beeinträchtigte Teilhabitate<br />
ausweichen. Bei den potenziell betroffenen Gewässerarealen innerhalb der<br />
Kühlwasserfahne handelt es sich nicht um essentiell notwendige Habitatbestandteile.<br />
Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art kann daher<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch die Wirkungen der Kühlwasserfahne können zwar temporäre <strong>und</strong> lokale Beeinträchtigungen<br />
der Nahrungsgr<strong>und</strong>lage einzelner Individuen im Schutzgebiet nicht ausgeschlossen werden,<br />
die Funktionen des Schutzgebietes für die Populationen <strong>und</strong> die Habitate der Art bleiben<br />
jedoch gewahrt. Die Voraussetzungen zur langfristig gesicherten Erhaltung der Art im Schutzgebiet<br />
bleiben erfüllt. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands<br />
der Art werden durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.<br />
5.4.2 Seeh<strong>und</strong> (Phoca vitulina) (EU-Code 1365)<br />
Tab. 65: Beeinträchtigungen des Seeh<strong>und</strong>s (Phoca vitulina)<br />
Beeinträchtigungen des Seeh<strong>und</strong>s (Phoca vitulina)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die Küstenlinie des Greifswalder Boddens liegt mindestens<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfelds<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
--<br />
--<br />
nicht erheblich<br />
600 m vom Bau- bzw. Anlagenbereich entfernt
FROELICH & SPORBECK Seite 253<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung der potenziellen (Teil-)Lebensräume der Art zur Baustelle<br />
sind keine baubedingten Beeinträchtigungen von Seeh<strong>und</strong>en zu erwarten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung der potenziellen (Teil-)Lebensräume der Art zur Anlage<br />
sind keine anlagebedingten Beeinträchtigungen von Seeh<strong>und</strong>en zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Akustische <strong>und</strong> optische Störungen durch den Betrieb des Kraftwerks sind für die Art<br />
nicht zu erwarten. Es werden keine dauerhaft besiedelten Lebensräume beeinträchtigt.<br />
Im Gewässerbereich des Greifswalder Boddens finden keine Störungen statt. Der dem<br />
Struck vorgelagerte Küstenstreifen, für den überwiegend eine Funktion als Ruheraum<br />
erwartet wird, liegt mehr als 2 km vom Kraftwerk entfernt.<br />
� Eine erhebliche Beeinträchtigung der Art durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong><br />
Schwefeleinträge in den Greifswalder Bodden sowie die Strandbereiche des Wirkraums,<br />
als potenzielle Teillebensräume der Art kann ausgeschlossen werden, da diese<br />
Einträge im Vergleich zur Gesamtbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel sehr gering<br />
sind <strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden. Der Greifswalder Bodden weist als<br />
eutrophes Gewässer keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den geringen vorhabensbedingten<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen auf.<br />
� Einzelne Seeh<strong>und</strong>individuen könnten in relativ kleinflächigen Teilen ihres potenziellen<br />
Habitats mittelbar durch die Kühlwassereinleitung beeinträchtigt werden. So könnte eine<br />
temporäre Dezimierung der Benthosorganismen oder Fischbestände durch die Erwärmung<br />
des Boddenwassers im Bereich der Kühlwasserfahne, auch einzelne Seeh<strong>und</strong>individuen<br />
beeinträchtigen, die diese als Nahrungsgr<strong>und</strong>lage nutzen. Aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Mobilität könnten diese Seeh<strong>und</strong>e, jedoch auf andere nicht beeinträchtigte Teilhabitate<br />
ausweichen. Bei den potenziell betroffenen Gewässerarealen innerhalb der<br />
Kühlwasserfahne handelt es sich nicht um essentiell notwendige Habitatbestandteile.<br />
Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art kann daher<br />
ausgeschlossen werden.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Durch die Wirkungen der Kühlwasserfahne können zwar temporäre <strong>und</strong> lokale Beeinträchtigungen<br />
der Nahrungsgr<strong>und</strong>lage einzelner Individuen im Schutzgebiet nicht ausgeschlossen werden,<br />
die Funktionen des Schutzgebietes für die Populationen <strong>und</strong> die Habitate der Art bleiben<br />
jedoch gewahrt. Die Voraussetzungen zur langfristig gesicherten Erhaltung der Art im Schutzgebiet<br />
bleiben erfüllt. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands<br />
der Art werden durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.
FROELICH & SPORBECK Seite 254<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.4.3 Fischotter (Lutra lutra) (EU-Code 1355)<br />
Tab. 66: Beeinträchtigungen des Fischotters (Lutra lutra)<br />
Beeinträchtigungen des Fischotters (Lutra lutra)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>-Gelände ist als Lebensraum für den Fischotter<br />
ohne Bedeutung, da Gewässer fehlen <strong>und</strong> das Gelände<br />
Optische Störungen<br />
--<br />
anthropogen stark überprägt ist<br />
Barriere-/ Trennwirkungen<br />
Anlagebedingt<br />
--<br />
� Die Uferbereiche des Greifswalder Boddens stellen einen<br />
Migrationsraum des Fischotters dar.<br />
� Fischotter besiedelt sowohl Ufer an der Spandowerhagener<br />
Wiek <strong>und</strong> am Freesendorfer See als auch Gräben in<br />
den Freesendorfer Wiesen. Der gesamte Teil der<br />
Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Struck kann als regelmä-<br />
ßig genutzter Lebensraum angesehen werden.<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � eine direkte Nutzung der für den Kühlwassertransport<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -<br />
Optische Störungen -<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
-<br />
-<br />
nicht erheblich<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
bestimmten Kanäle durch den Fischotter ist<br />
auszuschließen, da die Art hinsichtlich ihrer<br />
Nahrungssuche auf naturnahe Uferstrukturen angewiesen<br />
ist<br />
� Während der Bauarbeiten können durch die verstärkte Anwesenheit von Menschen sowie<br />
durch Lärmimmissionen von Baumaschinen <strong>und</strong> Baufahrzeugen <strong>und</strong> optische Reize<br />
(Beleuchtung der Baufahrzeuge <strong>und</strong> der Baustelle) Störwirkungen für Fischotter entstehen.<br />
Für die Art relevante Auswirkungen könnten sich bei Bauarbeiten in den Abend-<br />
<strong>und</strong> Nachst<strong>und</strong>en ergeben. Das als Industriegebiet ausgewiesene Gelände des B-Plans<br />
Nr. 1 ist jedoch als Lebensraum des Fischotters ohne Bedeutung. Die lärmintensivsten<br />
Arbeitsprozesse werden zudem nicht nachts erfolgen (vgl. Kap. 5.2.1). Als Lebensraum<br />
des Fischotters wird der gesamte Teil der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Struck einschließlich<br />
des Grabensystems <strong>und</strong> des Freesendorfer Sees angesehen. Das Gelände<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> wird zu den Kern-Lebensräumen der Art durch den Industriehafen, andere
FROELICH & SPORBECK Seite 255<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Vorhabensflächen <strong>und</strong> durch Waldbestände optisch abgeschirmt (östlich des Industriehafens<br />
zu den Freesendorfer Wiesen verbleiben etwa 290 m breite Gehölzbereiche als<br />
Pufferzonen). Die vorhabensinduzierte betriebsbedingte akustische Beeinträchtigung<br />
der Freesendorfer Wiesen ist so gering, dass eine Maskierung von Soziallauten des<br />
Fischotters auszuschließen ist. Aufgr<strong>und</strong> der Entfernung zum Vorhaben ist ebenso eine<br />
akustische Beeinträchtigung von Fischottern im Bereich der Küstenlinie, die der Fischotter<br />
als Wanderleitlinie nutzt, auszuschließen. Eine nennenswerte Störwirkung auf die<br />
Art ist somit nicht zu erwarten.<br />
� Baubedingte Barrierewirkungen sind nicht zu erwarten, da im Vorhabensbereich nicht<br />
mit dem regelmäßigen Auftreten des Fischotters zu rechnen ist. Kernlebensräume oder<br />
Hauptwanderwege der Art werden nicht geschnitten.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>-Areal stellt keine Wanderleitlinie für den Fischotter dar, so dass Funktionsbeziehungen<br />
zwischen Teillebensräumen nicht beeinträchtigt werden. Zudem sind für<br />
bodenmobile Arten die Funktionsbeziehungen zwischen der <strong>Lubmin</strong>er Heide <strong>und</strong> den<br />
Freesendorfer Wiesen bereits im derzeitigen Zustand durch die anderen Industrieanlangen,<br />
die Bauwerke des Einlaufkanals <strong>und</strong> des Industriehafens sehr stark eingeschränkt.<br />
Eine wesentliche Verschlechterung der Austauschbeziehungen durch die Anlagen<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> ist daher nicht zu erwarten.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Störungen des Fischotters können durch betriebsbedingte Lärmimmissionen <strong>und</strong>/oder<br />
optische Reize (Beleuchtung der Anlage, verstärkte Anwesenheit von Menschen auf<br />
dem Betriebsgelände) insbesondere in der Dämmerung <strong>und</strong> nachts erfolgen. Allerdings<br />
sind die Auswirkungen auf den Fischotter aufgr<strong>und</strong> der Entfernung zu seinen Kernlebensräumen<br />
<strong>und</strong> der Pufferwirkung der Gebäude der anderen Industrievorhaben sowie<br />
die angrenzenden Gehölzbestände vernachlässigbar. Die verbleibende betriebsbedingte<br />
akustische Beeinträchtigung der Freesendorfer Wiesen ist so gering, dass eine Maskierung<br />
von Soziallauten des Fischotters auszuschließen ist. Aufgr<strong>und</strong> der Entfernung<br />
zum Vorhaben ist ebenso eine akustische Beeinträchtigung von Fischottern im Bereich<br />
der Küstenlinie, die der Fischotter als Wanderleitlinie nutzt, auszuschließen.<br />
� Weitere Beeinträchtigungen (Störungen) für den Fischotter wären allenfalls durch die<br />
optischen Lichtreize, die von Beleuchtungsvorrichtungen auf dem Kraftwerksgelände<br />
ausgehen, zu erwarten, da sie während der Dämmerung <strong>und</strong> bei Nacht wirken, also<br />
während der Hauptaktivitätsphase des Fischotters. Diese Störwirkungen reichen jedoch<br />
kaum über das Gelände des B-Plangebietes Nr. 1 hinaus. Zudem befinden sich die für<br />
den Fischotter nutzbaren Gewässer überwiegend mehr als 1,5 Kilometer entfernt vom<br />
geplanten Kraftwerksgelände. Eine erhebliche Störung bzw. Scheuchwirkung, die zu<br />
einer Verdrängung des Fischotters führen würde, ist deshalb äußerst unwahrscheinlich.<br />
� Die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge in die vom Fischotter genutzten<br />
Gewässer sind so gering, dass keine signifikanten Beeinträchtigungen der Lebens-
FROELICH & SPORBECK Seite 256<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
raumqualität für die Art zu erwarten sind (vgl. Kap. 5.2.6). Der zu erwartende zusätzliche<br />
Stickstoffeintrag durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> führt in den Gewässern zu keiner Überschreitung<br />
der kritischen Schwellenwerte.<br />
� Durch den Betrieb des geplanten Kraftwerkes sind Schadstoffeinträge in das nähere<br />
Kraftwerksumfeld zu erwarten. Hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Fischotter sind insbesondere<br />
die Auswirkungen von Schadstoffeinträgen in die vorhandenen Stillgewässer<br />
von Bedeutung. Schadstoffe können sich hier dauerhaft im Sediment anreichern <strong>und</strong><br />
über einen längeren Zeitraum zu Schädigungen der ansässigen Lebewelt führen. Für<br />
Fließgewässer ist eine entsprechende Gefährdung aufgr<strong>und</strong> des kontinuierlichen Abtransportes<br />
von Wasser <strong>und</strong> Schwebstoffen auszuschließen. Beispielhaft wurden von<br />
LOBER im Verfahren zum ehemals geplanten SKW die durch das Vorhaben hervorgerufenen<br />
Schadstoffanreicherungen für den Freesendorfer See berechnet (vgl. FROELICH &<br />
SPORBECK 2008A). Die ermittelten Werte lagen jeweils deutlich unterhalb der maßgeblichen<br />
Beurteilungswerte. Da die Emissionen des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> deutlich geringer als beim SKW<br />
sind, können hier negative Auswirkungen auf den Erhaltungszustand des Fischotters im<br />
FFH-Gebiet ausgeschlossen werden.<br />
� Betriebsbedingt wird nach Fertigstellung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> eine kontinuierliche Einleitung von<br />
Kühlwasser in den Industriehafen erfolgen. Die Erwärmung des Wassers im Bereich der<br />
Kühlwasserfahne kann zur Veränderung des dortigen Artspektrums <strong>und</strong> der Dominanzstruktur<br />
der Artengemeinschaften führen. Dieses kann nachteilige Wirkungen auf potenzielle<br />
Beutetiere des Fischotters haben. Da diese Bereiche der Kühlwasserfahne<br />
aufgr<strong>und</strong> ihrer strukturellen Eigenschaften keine wesentliche Rolle als Nahrungshabitate<br />
für den Fischotter spielen <strong>und</strong> somit kein wesentliches Teilhabitat im Lebenszyklus<br />
des Fischotters darstellen, werden die Beeinträchtigungen als nicht erheblich eingestuft.<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Das Vorhaben kann geringfügige Beeinträchtigungen der Habitatqualität des Fischotters auslösen.<br />
Die Funktionen der Habitate für die Populationen des Fischotters bleiben jedoch gewahrt.<br />
Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Kernbereiche der Fischotterreviere<br />
erwartet. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands der Art werden<br />
durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.<br />
5.4.4 Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318)<br />
Tab. 67: Beeinträchtigungen der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318)<br />
Beeinträchtigungen der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die Art wurde im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen<br />
Optische Störungen --
FROELICH & SPORBECK Seite 257<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (EU-Code 1318)<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � im Wirkraum liegen keine Quartiere der Art, es handelt sich<br />
lediglich um potenzielle Teilhabitate (Jagdhabitate, Wan-<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
--<br />
-<br />
derkorridore)<br />
� Aufgr<strong>und</strong> der Lage des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> innerhalb des genehmigten B-Plangebietes Nr. 1 reichen<br />
die baubedingt hervorgerufenen Lichtimmissionen, die lichtempfindliche Fledermausarten<br />
wie die Teichfledermaus (vgl. hierzu BRINKMANN et al. 2008) beeinträchtigen<br />
können, nicht bzw. nur geringfügig über das B-Plangebiet hinaus <strong>und</strong> erreichen nicht<br />
das FFH-Gebiet. Eine relevante störungsbedingte Verkleinerung potenzieller Jagdreviere<br />
im FFH-Gebiet ist daher nicht zu erwarten. Der Lebensraum der Teichfledermaus<br />
wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Relevante Zerschneidungseffekte, z. B. Trennung von Quartieren <strong>und</strong> Jagdhabitaten,<br />
durch die geplante Bebauung oder durch Lichtimmissionen werden nicht ausgelöst. Eine<br />
Vorbelastung besteht bereits durch die Gasanlandestation, das <strong>GuD</strong> II sowie durch<br />
das ehemalige KKW. Die Fledermäuse sind in der Lage den bebauten Komplex zu umfliegen.<br />
Die mögliche veränderte Raumnutzung (Über- oder Umfliegen) ist hinsichtlich<br />
des Erhaltungszustandes der Art im Schutzgebiet nicht relevant.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Im Planfall entstehen dauerhafte Lichtimmissionen durch die Betriebsbeleuchtung während<br />
der Abend- <strong>und</strong> Nachtst<strong>und</strong>en. Analog zu den baubedingten Lichtimmissionen reichen<br />
die betriebsbedingten Lichtimmissionen nicht bzw. nur geringfügig über das B-<br />
Plangebiet hinaus <strong>und</strong> erreichen nicht das FFH-Gebiet. Es ist davon auszugehen, dass<br />
die Teichfledermaus die Vorhabensfläche <strong>und</strong> deren Umfeld allenfalls sporadisch als<br />
Jagdhabitat oder Wanderkorridor nutzt. Eine relevante störungsbedingte Verkleinerung
FROELICH & SPORBECK Seite 258<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
potenzieller Jagdreviere im FFH-Gebiet ist jedoch nicht zu erwarten, zumal durch die<br />
angrenzenden Industrie- <strong>und</strong> Gewerbeflächen bereits Licht- <strong>und</strong> Lärmimmissionen in<br />
diesem Bereich bestehen. Darüber hinaus profitiert die Art von der Nutzung von Natriumdampflampen,<br />
einer Maßnahme, die für andere Fledermausarten durchgeführt wird.<br />
� Relevante Zerschneidungseffekte, z. B. Trennung von Quartieren <strong>und</strong> Jagdhabitaten,<br />
durch betriebsbedingte Licht- <strong>und</strong> Lärmimmissionen werden ebenfalls nicht ausgelöst.<br />
Die Vorhabensfläche gehört zu einem Komplex aus Gewerbe- <strong>und</strong> Industrieeinrichtungen.<br />
Eine Vorbelastung besteht daher bereits. Die Fledermäuse sind in der Lage den<br />
bebauten Komplex zu umfliegen. Die mögliche veränderte Raumnutzung (Über- oder<br />
Umfliegen) ist hinsichtlich des Erhaltungszustandes Art im Schutzgebiet vernachlässigbar.<br />
Insgesamt ist daher keine störungsbedingte Beeinträchtigung der Art im Schutzgebiet<br />
zu erwarten.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Durch das Vorhaben werden keine relevanten Beeinträchtigungen bezüglich der Habitatqualität<br />
der Teichfledermaus ausgelöst. Die Funktionen der Habitate für die Populationen der Teichfledermaus<br />
bleiben gewahrt. Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Kernbereiche<br />
der Teichfledermaus-Lebensräume erwartet. Der Erhaltungszustand der Art wird durch das<br />
Vorhaben nicht beeinträchtigt.<br />
5.4.5 Großes Mausohr (Myotis myotis) (EU-Code 1324)<br />
Tab. 68: Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs (Myotis myotis) (EU-Code1324)<br />
Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs (Myotis myotis) (EU-Code 1324)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die Art wurde im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen,<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Verän-<br />
derung des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
--<br />
� im Wirkraum liegen keine Quartiere der Art, es handelt sich<br />
lediglich um potenzielle Teilhabitate (Jagdhabitate, Wanderkorridore)
FROELICH & SPORBECK Seite 259<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs (Myotis myotis) (EU-Code 1324)<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
� Es ist davon auszugehen, dass das lichtempfindliche Große Mausohr die Baufläche<br />
<strong>und</strong> deren Umfeld nur sporadisch als Jagdhabitat oder Wanderkorridor nutzt. Eine relevante<br />
störungsbedingte Verkleinerung potenzieller Jagdreviere ist daher nicht zu erwarten.<br />
Der Lebensraum des Großen Mausohrs wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Relevante Zerschneidungseffekte, z. B. Trennung von Quartieren <strong>und</strong> Jagdhabitaten,<br />
durch die geplante Bebauung oder durch Lichtimmissionen werden nicht ausgelöst. Eine<br />
Vorbelastung besteht bereits durch die Gasanlandestation, das <strong>GuD</strong> II sowie durch<br />
das ehemalige KKW. Die Fledermäuse sind in der Lage den bebauten Komplex zu umfliegen.<br />
Die mögliche veränderte Raumnutzung (Über- oder Umfliegen) ist hinsichtlich<br />
des Erhaltungszustandes der Art im Schutzgebiet nicht relevant.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Das Große Mausohr gilt als licht- <strong>und</strong> lärmempfindlich (BRINKMANN et al. 2008). Es ist<br />
anzunehmen, dass die Art starke Lichtfelder bei der Jagd meidet. Im Planfall entstehen<br />
dauerhafte Lichtimmissionen durch die Betriebsbeleuchtung während der Abend- <strong>und</strong><br />
Nachtst<strong>und</strong>en. Es ist davon auszugehen, dass die Große Mausohr die Vorhabensfläche<br />
<strong>und</strong> deren Umfeld allenfalls sporadisch als Jagdhabitat oder Wanderkorridor nutzt. Eine<br />
relevante störungsbedingte Verkleinerung potenzieller Jagdreviere ist daher nicht zu<br />
erwarten. Darüber hinaus profitiert die Art von der Reduzierung der betriebsbedingten<br />
Lichtimmissionen durch Beschränkung der Gebäudebeleuchtung auf Flugsicherheitsbeleuchtung<br />
<strong>und</strong> Nutzung von Natriumdampflampen, einer Maßnahme, die für andere<br />
Fledermausarten durchgeführt wird.<br />
� Relevante Zerschneidungseffekte, z. B. Trennung von Quartieren <strong>und</strong> Jagdhabitaten,<br />
durch betriebsbedingte Licht- <strong>und</strong> Lärmimmissionen werden ebenfalls nicht ausgelöst.<br />
Die Vorhabensfläche gehört zu einem Komplex aus Gewerbe- <strong>und</strong> Versorgungseinrichtungen.<br />
Eine Vorbelastung besteht daher bereits. Die Fledermäuse sind in der Lage<br />
den bebauten Komplex zu umfliegen. Die mögliche veränderte Raumnutzung (Über-<br />
oder Umfliegen) ist hinsichtlich des Erhaltungszustandes Art im Schutzgebiet vernachlässigbar.<br />
Insgesamt ist daher keine störungsbedingte Beeinträchtigung der Art im<br />
Schutzgebiet zu erwarten.
FROELICH & SPORBECK Seite 260<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Durch das Vorhaben werden keine relevanten Beeinträchtigungen bezüglich der Habitatqualität<br />
für das Große Mausohr ausgelöst. Die Funktionen der Habitate für die Populationen des Großen<br />
Mausohrs bleiben gewahrt. Es werden keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Kernbereiche<br />
seiner Lebensräume erwartet. Der Erhaltungszustand der Art wird durch das Vorhaben<br />
nicht beeinträchtigt.<br />
5.4.6 Meerneunauge (Petromyzon marinus) (EU-Code 1095) <strong>und</strong> Flussneunauge<br />
(Lampetra fluviatilis) (EU-Code 1099)<br />
Tab. 69: Beeinträchtigungen des Meerneunauges (Petromyzon marinus) <strong>und</strong> des Flussneunauges<br />
(Lampetra fluviatilis)<br />
Beeinträchtigungen des Meerneunauges (Petromyzon marinus) <strong>und</strong> des Flussneunauges<br />
(Lampetra fluviatilis)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Lärmimmissionen --<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
--<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die marinen Gewässer des FFH-Gebietes sind als Durch-<br />
Optische Störungen --<br />
zugs- <strong>und</strong> bestenfalls als zeitweilige Weidegebiete der<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefelein- -<br />
Neunaugen zu betrachten<br />
träge<br />
� aufgr<strong>und</strong> ihrer Lebensweise kommen beim Flussneunauge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> - nicht erheblich keine Eier bzw. Larven im Wirkbereich der Kühlwasser-<br />
einleitung<br />
fahne vor<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� für das Meerneunauge existiert derzeit noch kein Laichnachweis<br />
für Mecklenburg-Vorpommern. Bisher wurden<br />
ausschließlich solitäre Adulte nachgewiesen (THIEL &<br />
WINKLER 2007), so dass im Wirkbereich der Kühlwasserentnahme<br />
keine Eier, Larven <strong>und</strong> Juvenile zu erwarten<br />
sind.<br />
� Der Lebensraum der Neunaugen wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.
FROELICH & SPORBECK Seite 261<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen für die Neunaugen auf.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Eine erhebliche Beeinträchtigung der Vorkommen der Arten durch die vorhabensbedingten<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge in den Greifswalder Bodden kann ausgeschlossen<br />
werden, da diese Einträge im Vergleich zur Vorbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong><br />
Schwefel sehr gering sind <strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden. Der Greifswalder<br />
Bodden weist als eutrophes Gewässer keine besondere Empfindlichkeit gegenüber<br />
den geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen auf.<br />
� Durch die Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek werden die Strömungsverhältnisse<br />
an der Entnahmestelle verändert, wodurch die Möglichkeit entsteht,<br />
dass Individuen der Arten Fluss- <strong>und</strong> Meerneunauge, die sich der Einsaugströmung<br />
nicht entziehen können, in das Kühlwassersystem gelangen. Bei den Untersuchungen<br />
von SUBKLEW (1981) zu Ansaugverluste am Kernkraftwerk „Bruno Leuschner“ im Zeitraum<br />
1975 bis 1979 wurde einmalig ein juveniles Flussneunauge an den Siebrechen<br />
des Einlaufkanals festgestellt. „Inwieweit der Peenestrom als Wanderroute zu den 5<br />
Laichgebieten im Peenesystem (WAATERSTRAAT & KRAPPE 2000; KRAPPE 2007) genutzt<br />
wird, ist nicht solide einschätzbar. Dies ergibt sich allein schon aus den starken interannuellen<br />
Schwankungen der sehr geringen Populationsgröße (WINKLER et al. 2002) der<br />
Fortpflanzungsgemeinschaft (10-200 Individuen). In diesem Zusammenhang ist auch<br />
die Bewertung des Einzelf<strong>und</strong>es schwierig. Neunaugen nutzen jedoch zumeist die tieferen<br />
stärker beströmten Flussbereiche zur Wanderung (mündliche Mitteilung WINKLER<br />
2008), weshalb es sich bei dem Tier auch um einen „wirklichen“ Einzelf<strong>und</strong> handeln<br />
kann. Bezogen auf mögliche Ansaugphänomene ist auszuführen, dass für adulte Tiere<br />
die kritische Schwimmgeschwindigkeit bei 1,2 m/s (BRUNKE & HIRSCHHÄUSER 2005) liegen<br />
kann. Angaben für Juvenilstadien liegen nicht vor. Sollte ein häufigeres Vorkommen<br />
von Juvenilen im Kühlwasseransaugbereich auftreten, so stellen die Rechenanlagen<br />
alleine auch mit engerem Spaltabstand aufgr<strong>und</strong> der Körperform der<br />
Flussneunaugen keinen hinreichenden Schutz dar. Auch eine effiziente Wirkung durch<br />
den Einsatz von akustischen Scheuchanlagen ist anhand von einer Untersuchung von<br />
MAES et al. 2004 nicht unbedingt zu erwarten. Dort zeigten die Anlagen (20-600Hz) keine<br />
Wirkung auf die Flussneunaugen“ (IFAÖ 2008E: 3-4). Ein wirksamer Schutz von juvenilen<br />
oder adulten Individuen der Neunaugen kann durch die den Scheuchanlagen<br />
nachgeschaltete Siebbandanlage <strong>und</strong> der schonenden Fischrückführung gewährleistet<br />
werden (IMS & IBL 2010). Der Rückführerfolg dieser Arten im Rahmen des geplanten<br />
Fischschutzkonzeptes wird daher von IMS & IBL (2010) als hoch eingestuft. Unter Berücksichtigung<br />
der Fischschutzmaßnahme <strong>und</strong> dem Fehlen von Eiern <strong>und</strong> Larven sind<br />
insgesamt erhebliche Beeinträchtigungen von Meer- <strong>und</strong> Flussneunauge ausgeschlossen<br />
� Da der Wirkraum der Kühlwasserfahne von den Arten allenfalls als Durchzugs- <strong>und</strong><br />
temporäres Weidegebiet genutzt wird, ist durch die prognostizierten vorhabensbedingten<br />
Temperaturveränderungen im Bereich der lokal begrenzten Kühlwasserfahne nicht<br />
mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Arten zu rechnen. Besonders
FROELICH & SPORBECK Seite 262<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
temperaturempfindliche Entwicklungsstadien der beiden Arten (Eier, Larven) kommen<br />
im Gebiet nicht vor.<br />
� Kühlwasserbedingte Auswirkungen durch etwaige Desorientierung der Arten sind nicht<br />
zu erwarten. (zur Begründung vgl. Erläuterungen der Auswirkungen auf die Vorkommen<br />
des Störs)<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Das Vorhaben kann nur geringfügige Veränderungen bzgl. der Habitatqualität in den Durchzugsgebieten<br />
<strong>und</strong> zeitweiligen Weidegebieten für die Neunaugen auslösen. Unter Berücksichtigung<br />
der geplanten Fischschutzanlagen sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung<br />
des günstigen Erhaltungszustands dieser beiden R<strong>und</strong>maularten vollständig gewahrt.<br />
5.4.7 Rapfen (Aspius aspius) (EU-Code 1130)<br />
Tab. 70: Beeinträchtigungen des Rapfens (Aspius aspius)<br />
Beeinträchtigungen des Rapfens (Aspius aspius)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die marinen Gewässer des FFH-Gebietes sind als Durch-<br />
Optische Störungen --<br />
zugs- <strong>und</strong> bestenfalls als zeitweilige Weidegebiete des<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Rapfens zu betrachten<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
-<br />
nicht erheblich<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Der Lebensraum des Rapfens wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.
FROELICH & SPORBECK Seite 263<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen bezüglich des Rapfen-<br />
Vorkommens im Schutzgebiet auf.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Lebensraums des Rapfens <strong>und</strong> der Nahrungstiere (Fische <strong>und</strong><br />
kleine Wirbellose) zu erwarten, da die Einträge im Vergleich zur Vorbelastung mit Stickstoff-<br />
<strong>und</strong> Schwefel sehr gering sind <strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden. Der<br />
Greifswalder Bodden weist als eutrophes Gewässer keine besondere Empfindlichkeit<br />
gegenüber den geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen auf.<br />
� Die möglichen Auswirkungen der Kühlwasserentnahme auf das Vorkommen von Rapfen<br />
müssen vor allem anhand des derzeit bekannten Verbreitungsgebietes der Art in<br />
der näheren Umgebung des duB abgeschätzt werden (vgl. Kap. 2.2.4.). Aufgr<strong>und</strong> des<br />
Verbreitungsgebietes sowie der nur vereinzelten Nachweise im Peenestrom kann davon<br />
ausgegangen werden, dass adulte <strong>und</strong> juvenile Individuen der Art potenziell im<br />
Wirkbereich der Kühlwasserfahne vorhanden sind (IFAÖ 2008E). Ein Vorkommen von<br />
Eiern <strong>und</strong> Larven des Rapfens in der Spandowerhagener Wiek ist allerdings unwahrscheinlich.<br />
Durch die Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek werden<br />
die Strömungsverhältnisse an der Entnahmestelle verändert, wodurch die Möglichkeit<br />
entsteht, dass Individuen der Art, die sich der Einsaugströmung nicht entziehen können,<br />
in das Kühlwassersystem gelangen. Nach IFAÖ (2008E) sind in der Literatur keine genauen<br />
Angaben über die Schwimmgeschwindigkeiten des Rapfens zu finden, die einen<br />
genaueren Hinweis auf das Ansaugrisiko geben könnten. Für die Cyprinidenart „Rapfen“,<br />
die zu den Hörspezialisten zu zählen ist, sind allerdings gute Scheuchwirkungen<br />
durch die akustische Fischscheuchanlage zu erwarten (IMS & IBL 2010). Der Rückführerfolg<br />
dieser Art im Rahmen des geplanten Fischschutzkonzeptes wird von IMS &<br />
IBL (2010) als mittel bis hoch eingestuft. Individuenverluste dieser Art können unter Berücksichtigung<br />
der Fischschutzanlagen daher nur in sehr geringem Umfang auftreten<br />
(ebd. 2010). Eine exakte Prognose der zu erwartenden Wirksamkeit für die FFH-Art<br />
Rapfen kann aufgr<strong>und</strong> der standörtlichen Unterschiede zu bestehenden Installationen<br />
nicht vorgenommen werden, eine gute Scheuchwirkung ist aber bei Einhaltung der wesentlichen<br />
Parameter (u.a. Strömungsgeschwindigkeit von < 0,3 m/s im Wirkbereich der<br />
Scheuchanlage) zu erwarten (IMS & IBL 2010). Die vorgesehene Einströmgeschwindigkeit<br />
im Wirkbereich der Scheuchanlagen von < 0,3 m/s ermöglicht es auch<br />
schwimmschwachen Individuen, aus dem Gefahrenbereich zu entkommen (vgl. ebd.).<br />
� Zur Empfindlichkeit des Rapfens gegenüber Temperaturveränderungen <strong>und</strong> Sauerstoffdefiziten<br />
konnten in der Literatur keine artspezifischen Angaben gef<strong>und</strong>en werden<br />
(IFAÖ 2008E). Es können daher nur die allgemein gültigen Aussagen zu möglichen Beeinträchtigungen<br />
durch Kühlwassereinleitung für Fische betrachtet werden. Da der<br />
Wirkraum der Kühlwasserfahne von der Art allenfalls als Durchzugs- <strong>und</strong> temporäres<br />
Weidegebiet genutzt wird, ist durch die prognostizierten vorhabensbedingten Temperaturveränderungen<br />
im Bereich der lokal begrenzten Kühlwasserfahne nicht mit einer<br />
Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art zu rechnen. Besonders temperatur-
FROELICH & SPORBECK Seite 264<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
empfindliche Entwicklungsstadien der Arten (Eier, Larven) sind im Gebiet nicht wahrscheinlich<br />
(IMS & IBL 2010).<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
Das Vorhaben kann nur geringfügige Veränderungen bzgl. der Habitatqualität in den Durchzugsgebieten<br />
<strong>und</strong> zeitweiligen Weidegebieten des Rapfens auslösen. Unter Berücksichtigung<br />
der geplanten Fischschutzanlagen bleiben die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung des<br />
günstigen Erhaltungszustands des Rapfens vollständig gewahrt.<br />
5.4.8 Atlantischer Stör (Acipenser sturio) (EU-Code 1101*)<br />
Tab. 71: Beeinträchtigungen des Atlantischen Störs (Acipenser sturio)<br />
Beeinträchtigungen des Atlantischen Störs (Acipenser sturio)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � der Peenestrom kann als Wanderweg in die Ostsee in Fra-<br />
Optische Störungen --<br />
ge kommen, über Laichbereiche gibt es jedoch keine his-<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
torischen Nachweise <strong>und</strong> diese sind aufgr<strong>und</strong> der Flussstruktur<br />
unwahrscheinlich.<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Verän-<br />
derung des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
-<br />
nicht erheblich<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
Der Lebensraum des Störs wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen bezüglich des Stör-Vorkommens<br />
im Schutzgebiet auf.
FROELICH & SPORBECK Seite 265<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Lebensraums des Störs <strong>und</strong> seiner Nahrungstiere (hauptsächlich<br />
verschiedene Würmer, Weichtieren, Krebse sowie Mückenlarven <strong>und</strong> kleine Fischen)<br />
zu erwarten (vgl. Kap. 5.3.5), da die Einträge im Vergleich zur Vorbelastung mit<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel sehr gering sind <strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden.<br />
� Es ist davon auszugehen, dass der Stör das Mündungsgebiet des Peenestroms <strong>und</strong><br />
damit ggf. auch die Spandowerhagener Wiek auf der Wanderung zwischen den Laichgebieten<br />
in den Binnengewässern <strong>und</strong> den Nahrungsgebieten in den Küstengewässern<br />
quert. Durch die Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek werden die<br />
Strömungsverhältnisse an der Entnahmestelle verändert, wodurch Fische, die sich der<br />
Einsaugströmung nicht entziehen können, möglicherweise in das Kühlwassersystem<br />
gelangen. Im Hinblick auf den Stör sind daher prinzipiell junge Lebensstadien sowie<br />
kranke <strong>und</strong> verletzte Tiere, d. h. Individuen mit geringen Schwimmleistungen, gefährdet.<br />
Die in der Spandowerhagener Wiek potenziell vorkommenden Störe weisen nach Abwanderung<br />
aus dem derzeitigen Besatzgewässer (Oder) bereits eine Körperlänge von<br />
0,5 bis 1,0 m auf. Aufgr<strong>und</strong> der Lebensweise der Art sind im Wirkbereich der Kühlwasserentnahme<br />
keine Eier- bzw. Larvenvorkommen zu erwarten (IMS & IBL 2010). Die<br />
vorkommenden Individuen von >0,5 m Länge sind aufgr<strong>und</strong> der entwickelten Schwimmfähigkeit<br />
problemlos in der Lage, gegen die geringe Einströmgeschwindigkeit anzuschwimmen,<br />
so dass davon auszugehen ist, dass sie nicht in den Entnahmekanal geraten<br />
(IMS & IBL 2010). Darüber hinaus verhindert die geplante Fischschutzanlage mit<br />
Fischscheucheinrichtung <strong>und</strong> Rechen- bzw. Siebanlage mit Lebendrückführung ein<br />
Einsaugen in das Kühlwassersystem. Prinzipiell ist zwar durch das zeitweilige Verbleiben<br />
von Fischen in den Sieben <strong>und</strong> Rechen die Gefahr einer mechanischen Schädigung<br />
gegeben. Beim Stör ist jedoch davon auszugehen, dass er aufgr<strong>und</strong> seiner Robustheit<br />
eine Rückführung ohne Beeinträchtigung übersteht, falls er überhaupt in den<br />
Bereich der Siebe <strong>und</strong> Rechen gelangt. Eine Gefährdung von adulten Stören bei der<br />
Rückwanderung in ihre Laichgebiete ist aufgr<strong>und</strong> ihrer Größe (> 1,5 – 2,5 m) <strong>und</strong><br />
Schwimmfähigkeit ebenfalls nicht zu erwarten. Zur Wirksamkeit von akustischen<br />
Scheuchanlagen liegen für den Stör keine empirischen Untersuchungen vor; nach Einschätzung<br />
von TURNPENNY & LEE (zit. in IMS & IBL 2010) ist eher von einer schlechten<br />
Scheuchwirkung auszugehen. Beeinträchtigungen von Vorkommen der Art durch Einsaugen<br />
von Individuen aufgr<strong>und</strong> der Kühlwasserentnahme sind wenig wahrscheinlich<br />
<strong>und</strong> werden durch die geplante Fischschutzanlage wirksam vermieden, so dass erhebliche<br />
Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden können.<br />
� Der Stör zählt zu den warmadaptierten Arten. Gegenüber der Kühlwassereinleitung sind<br />
diese Arten vergleichsweise unempfindlich. Starke Temperaturschwankungen, die zu<br />
Schädigungen warmadaptierter Arten führen können, werden von Buckmann (2011)<br />
nicht prognostiziert. Den vergleichsweise geringen Temperaturerhöhungen von maximal<br />
ca. 4,5 K können warmadaptierte Tiere problemlos in kältere Regionen ausweichen.<br />
Da der Wirkraum der Kühlwasserfahne vom Stör allenfalls als Durchzugs- <strong>und</strong><br />
temporäres Nahrungsgebiet genutzt wird <strong>und</strong> besonders temperaturempfindliche Entwicklungsstadien<br />
der Art (Eier, Larven) im Gebiet nicht vorkommen, ist durch die prog-
FROELICH & SPORBECK Seite 266<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
nostizierten vorhabensbedingten Temperaturveränderungen im Bereich der lokal begrenzten<br />
Kühlwasserfahne nicht mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
der Art zu rechnen.<br />
� Störe orientieren sich nach derzeitigem Kenntnisstand erst im Bereich der Flusssysteme<br />
ihrer Laichgewässer olfaktorisch, so dass nicht von einer olfaktorischen Beeinträchtigung<br />
durch die Kühlwasserfahne ausgegangen werden kann. Eine Desorientierung<br />
der Störe durch die veränderten Abflussverhältnisse des Peenestroms ist unwahrscheinlich,<br />
da die Aufstiegszeiten der Art überwiegend mit mittleren bis hohen Abflüssen<br />
korrelieren <strong>und</strong> somit fortwährend ein „Strömungsreiz“ durch Peenestromwasser im<br />
Mündungsgebiet des Peenestroms gegeben ist.<br />
� An den engsten Stellen des Peenestroms beträgt die Erhöhung der nordwärts gerichteten<br />
Strömungsgeschwindigkeit allenfalls 1 mm/s. Eine Beeinträchtigung der Funktion<br />
des Peenestroms als Wanderkorridor für anadrome Fische wie den Stör infolge einer<br />
veränderten Strömungssituation ist somit nicht zu erwarten.<br />
� Nach gegenwärtigem Kenntnisstand liegen Hinweise vor, dass die großräumige Orientierung<br />
von Stören auf dem Erdmagnetfeld basiert. Eine solche Orientierung ist in den<br />
großen Gewässern, d. h. im Meer <strong>und</strong> im Bereich der inneren Küstengewässer, anzunehmen.<br />
Daher ist das Risiko einer Störung der Wanderbewegungen durch die küstennah<br />
ausgebildete Kühlwasserfahne als gering zu bewerten.<br />
� Nach BUCKMANN (2011) liegt der Peenestrom knapp drei Meter tiefer als die Einlaufrinne.<br />
Die Tiefenbereiche des Peenestroms bleiben somit durch die Kühlwasserentnahme<br />
weitgehend unbeeinflusst. Hieraus ergibt sich, dass für den Stör, der sich vermutlich am<br />
Boden oder in Bodennähe des Peenestroms aufhalten würde, Beeinträchtigungen<br />
durch die Kühlwasserentnahme nicht zu erwarten sind.<br />
� Auch hinsichtlich der Abflussverhältnisse im Peenestrom sind nur geringe Auswirkungen<br />
zu erwarten. Für den überwiegenden Zeitraum der (potenziellen) Aufstiegszeiten<br />
besteht potenziell ein Risiko der Desorientierung. Kritischere Zeiträume mit geringeren<br />
Abflussmengen treten beim Stör erst zum Ende seiner mutmaßlichen Aufstiegszeit auf.<br />
Insgesamt kommt es im Übergangsbereich Peenestrom zum Greifswalder Bodden /<br />
Ostsee zu einem regelmäßigen Wechsel von Wasserständen, die durch Peenestromwasser<br />
bzw. durch Einstrom von Ostseewasser gekennzeichnet sind (s. FROELICH &<br />
SPORBECK 2010c). Anadrome Fischarten wie der Stör müssen generell während ihrer<br />
Wanderungszeiten mit diesem stark wechselnden Wasserregime zurechtkommen <strong>und</strong><br />
somit an solche dynamischen Verhältnisse angepasst sein. Das Risiko der Desorientierung<br />
durch die Kühlwasserentnahme erscheint auch unter diesem Aspekt als sehr gering.<br />
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass neben dem Peenestrom auch die<br />
Verbindungen zwischen Stettiner Haff <strong>und</strong> der Ostsee durch die Meeresarme Dziwna<br />
(Dievenow), Swina (Swine) bzw. Kaiser-Swinekanal mögliche Wanderrouten darstellen,<br />
so dass vermutlich nur ein Teil der wandernden Fische des Peene-/Odersystems den<br />
Peenestrom als Wanderkorridor nutzt.
FROELICH & SPORBECK Seite 267<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Vorhaben kann durch Kühlwassereinleitung geringfügige Veränderungen bzgl. der Habitatqualität<br />
für den Stör auslösen. Da aber nur Durchzugsgebiete <strong>und</strong> zeitweilige Weidegebiete<br />
durch das Vorhaben geringfügig beeinträchtigt werden können, sind die Voraussetzungen zur<br />
langfristigen Sicherung eines günstigen Erhaltungszustands dieser Fischart vollständig gewahrt.<br />
5.4.9 Finte (Alosa fallax) (EU-Code 1103)<br />
Tab. 72: Beeinträchtigungen der Finte (Alosa fallax)<br />
Beeinträchtigungen der Finte (Alosa fallax)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � die Art kann potenziell den Greifswalder Bodden bzw. die<br />
Optische Störungen --<br />
Spandowerhagener Wiek auf ihren Wanderungen zwi-<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
schen den Laichgebieten in den Binnengewässern <strong>und</strong><br />
den Nahrungsgebieten in den Küstengewässern queren<br />
Anlagebedingt<br />
� potenziell kann v.a. mit adulten Individuen bzw. Jungtieren<br />
gerechnet werden<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefelein-<br />
träge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
-<br />
nicht erheblich<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Auf ihren Wanderungen bewegen sich Finten vermutlich<br />
eher im Bereich des Freiwassers (WINKLER, mündl.). Finten<br />
orientieren sich dabei nicht olfaktorisch (THIEL,<br />
mündl.).<br />
� Der Lebensraum der Finte wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.
FROELICH & SPORBECK Seite 268<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen bezüglich des Vorkommens der<br />
Finte im Schutzgebiet auf.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Lebensraums der Finte <strong>und</strong> der Nahrungstiere zu erwarten, da<br />
die Einträge im Vergleich zur Vorbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel sehr gering sind<br />
<strong>und</strong> zudem im Bodden stark verdünnt werden. Der Greifswalder Bodden weist als eutrophes<br />
Gewässer keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den geringen vorhabensbedingten<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen auf.<br />
� Durch die Kühlwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek werden die Strömungsverhältnisse<br />
an der Entnahmestelle verändert, wodurch die Möglichkeit entsteht,<br />
dass Individuen der Art, die sich der Einsaugströmung nicht entziehen können, in das<br />
Kühlwassersystem gelangen. Für die Finte, die zu den Hörspezialisten zu zählen ist,<br />
sind allerdings sehr gute Scheuchwirkungen durch die akustische Fischscheuchanlage<br />
zu erwarten (IMS & IBL 2010). O`KEEFE & TURNPENNY (2005, in IMS & IBL 2010) erwähnen<br />
explizit für die Finte, dass diese Art sich gut mit niederfrequentem Schall<br />
scheuchen lässt. Diese Einschätzung wird durch die Erfahrungen an anderen Standorten<br />
gestützt, bei denen die vorkommenden herings- <strong>und</strong> karpfenartigen Fischarten stets<br />
die höchsten Scheuchraten von z. T. bis zu 95 % aufzeigten. Der Rückführerfolg dieser<br />
Art im Rahmen des geplanten Fischschutzkonzeptes wird von IMS & IBL (2010) als gering<br />
eingestuft. Insgesamt betrachtet besteht unter Berücksichtigung der Fischschutzanlagen<br />
nur eine geringe Wahrscheinlichkeit von Individuenverluste durch die Kühlwasserentnahme.<br />
� Finten orientieren sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht olfaktorisch, so dass nicht<br />
von einer olfaktorischen Beeinträchtigung durch die Kühlwasserfahne ausgegangen<br />
werden kann.<br />
� Eine Desorientierung der Finte durch die veränderten Abflussverhältnisse des<br />
Peenestroms ist unwahrscheinlich, da die Aufstiegszeiten der Art überwiegend mit mittleren<br />
bis hohen Abflüssen korrelieren <strong>und</strong> somit fortwährend ein „Strömungsreiz“ durch<br />
Peenestromwasser im Mündungsgebiet des Peenestroms gegeben ist.<br />
� Da der Wirkraum der Kühlwasserfahne von der Finte allenfalls als Durchzugs- <strong>und</strong> temporäres<br />
Nahrungsgebiet genutzt wird, ist durch die prognostizierten vorhabensbedingten<br />
Temperaturveränderungen im Bereich der lokal begrenzten Kühlwasserfahne nicht<br />
mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art zu rechnen. Besonders<br />
temperaturempfindliche Entwicklungsstadien der Art (Eier, Larven) kommen im Gebiet<br />
nicht vor.
FROELICH & SPORBECK Seite 269<br />
Fazit: nicht erheblich beeinträchtigt<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Vorhaben kann nur geringfügige Veränderungen bzgl. der Habitatqualität in den Durchzugsgebieten<br />
<strong>und</strong> zeitweiligen Nahrungsgebieten der Finte auslösen. Unter Berücksichtigung<br />
der geplanten Fischschutzanlagen bleiben die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung des<br />
günstigen Erhaltungszustands der Finte vollständig gewahrt.<br />
5.4.10 Bitterling (Rhodeus sericeus) (EU-Code 1134)<br />
Tab. 73: Beeinträchtigungen des Bitterlings (Rhodeus sericeus)<br />
Beeinträchtigungen des Bitterlings (Rhodeus sericeus)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Ein Vorkommen des Bitterlings ist unwahrscheinlich <strong>und</strong><br />
Optische Störungen --<br />
allenfalls in den Standgewässern auf Nord-Usedom zu er-<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
warten.<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Verän-<br />
derung des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
--<br />
Lärmimmissionen -- � Die eigentlich relativ anspruchslose Art reagiert relativ<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
-<br />
empfindlich auf Lebensraumveränderungen, da sie anscheinend<br />
stärkere Wasserverschmutzungen nicht toleriert<br />
<strong>und</strong> stenök an das Vorkommen von Muscheln der Gattun-<br />
gen Unio oder Anodonta angewiesen ist.<br />
� Der Lebensraum des Bitterlings wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.<br />
� Potenzielle Habitate befinden sich in den Stillgewässern auf Nord-Usedom, in ausreichender<br />
Entfernung zum Bauvorhaben.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen bezüglich des Bitterling-<br />
Vorkommens im Schutzgebiet auf.
FROELICH & SPORBECK Seite 270<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Durch die vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge sind keine Beeinträchtigungen<br />
des Lebensraums des Bitterlings <strong>und</strong> der zur Reproduktion notwendigen Muscheln<br />
der Gattungen Unio oder Anodonta zu erwarten (vgl. Kap. 2.2.4), da die Einträge<br />
im Vergleich zur Gesamtbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel äußerst gering sind. Eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung der Art durch diesen Wirkfaktor (insbesondere durch eine<br />
zunehmende Verschlammung von Gewässern) ist somit nicht zu erwarten.<br />
� Der Lebensraum des Bitterlings wird durch den Betrieb des Kraftwerks nicht beeinträchtigt.<br />
Im Untersuchungsgebiet konnte bisher noch kein Nachweis der Art erbracht werden.<br />
Potenzielle Habitate des Bitterlings befinden sich z.B. im Bereich der pflanzenreichen<br />
Gewässer auf Nord-Usedom in ausreichender Entfernung zum Bauvorhaben.<br />
Diese werden nicht durch die Kühlwassereinleitung oder -entnahme beeinträchtigt. Vorhabensbezogene<br />
Beeinträchtigungen des Erhaltungszustands der Art im Schutzgebiet<br />
können ausgeschlossen werden.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für den Bitterling<br />
aus. Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art im Schutzgebiet<br />
kann ausgeschlossen werden.<br />
5.4.11 Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior) (EU-Code 1014)<br />
Tab. 74: Beeinträchtigungen der schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
Beeinträchtigungen der schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Potenzielle Habitate befinden sich v.a. vor allem in Dünen-<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
--<br />
--<br />
tälchen <strong>und</strong> an Gewässerrändern auf Nord-Usedom
FROELICH & SPORBECK Seite 271<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
-<br />
� Die Baufläche <strong>und</strong> die BE-Flächen befinden sich außerhalb des FFH-Gebietes. Baubedingte<br />
Beeinträchtigungen von Vorkommen der Art können ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Das Vorhaben befindet sich in einem ausgewiesenen Industriegebiet außerhalb des<br />
FFH-Gebietes. Anlagebedingte Wirkungen erreichen das FFH-Gebiet nicht.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Potenzielle Habitate der Schmalen Windelschnecke befinden sich vor allem vor allem in<br />
Dünentälchen <strong>und</strong> an Gewässerrändern auf Nord-Usedom, in ausreichender Entfernung<br />
zum Bauvorhaben. Die Art reagiert empfindlich auf eine Veränderung des Wasserhaushalts,<br />
sowie Mahd oder intensive Beweidung. Vorhabensbedingt treten bezüglich<br />
dieser Faktoren keine Änderungen auf. Relevante Beeinträchtigungen durch die im<br />
Vergleich zur Vorbelastung sehr geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
können ausgeschlossen werden.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für die Windelschneckenart<br />
aus. Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art<br />
im Schutzgebiet kann ausgeschlossen werden.<br />
5.4.12 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) (EU-Code 1014)<br />
Tab. 75: Beeinträchtigungen der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
Beeinträchtigungen der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Potenzielle Habitate befinden sich an den Rändern der<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Gewässer auf Nord-Usedom.
FROELICH & SPORBECK Seite 272<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
--<br />
-<br />
� Die Baufläche <strong>und</strong> die BE-Flächen befinden sich außerhalb des FFH-Gebietes. Baubedingte<br />
Beeinträchtigungen von Vorkommen der Art können ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen bezüglich des Vorkommens der<br />
Bauchigen Windelschnecke auf. Das Vorhaben befindet sich in einem ausgewiesenen<br />
Industriegebiet außerhalb des FFH-Gebietes.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Potenzielle Habitate der Bauchigen Windelschnecke befinden sich vor allem an Gewässerrändern<br />
auf Nord-Usedom, in ausreichender Entfernung zum Bauvorhaben. Die<br />
Art reagiert empfindlich auf eine Veränderung des Wasserhaushalts, sowie Mahd oder<br />
intensive Beweidung. Vorhabensbedingt treten bezüglich dieser Faktoren keine Änderungen<br />
auf. Relevante Beeinträchtigungen durch die im Vergleich zur Vorbelastung<br />
sehr geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge können ausgeschlossen<br />
werden.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für die Windelschneckenart<br />
aus. Eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands der Art<br />
im Schutzgebiet kann ausgeschlossen werden.
FROELICH & SPORBECK Seite 273<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
5.4.13 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) (EU-Code 1042)<br />
Tab. 76: Beeinträchtigungen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
Beeinträchtigungen der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Die Art konnte im Untersuchungsgebiet aktuell nicht nach-<br />
Optische Störungen --<br />
gewiesen werden, es ist nicht von einem bodenständigen<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Vorkommen der Art auszugehen.<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
--<br />
-<br />
� Der Lebensraum der Großen Moosjungfer wird durch die Baumaßnahmen nicht beeinträchtigt.<br />
Im duB wurden keine Fortpflanzungsgewässer der Großen Moosjungfer nachgewiesen.<br />
Baubedingte Störungen mit Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der Art<br />
im Schutzgebiet können daher ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Es treten keine anlagebedingten Beeinträchtigungen für die Moosjungfer auf.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Gegenüber Veränderungen im Wasserchemismus, insbesondere Eutrophierungen, reagiert<br />
die Art ausgesprochen empfindlich. Durch die im Vergleich zur Vorbelastung sehr<br />
geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge in Stillgewässer sind<br />
keine erheblichen Beeinträchtigungen der Art <strong>und</strong> ihres Lebensraums zu erwarten (vgl.<br />
Kap. 5.2.6). Im Untersuchungsraum konnten zudem keine Fortpflanzungsgewässer der<br />
Art festgestellt werden - die geringen Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge sind für die Vorkommen<br />
der Art im Schutzgebiet somit irrelevant.
FROELICH & SPORBECK Seite 274<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für die Moosjungfer<br />
aus. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands der Art werden<br />
durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.<br />
5.4.14 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) (EU-Code 1060)<br />
Tab. 77: Beeinträchtigungen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar)<br />
Beeinträchtigungen des großen Feuerfalters (Lycaena dispar)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Im duB wurden keine geeigneten Habitate für den Großen<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Verän-<br />
derung des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen:<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
--<br />
-<br />
-<br />
Feuerfalter nachgewiesen.<br />
� Es werden keine Lebensräume des Feuerfalters durch die Baumaßnahmen, die außerhalb<br />
des FFH-Gebietes liegen, beeinträchtigt. Baubedingte Störungen mit Auswirkungen<br />
auf den Erhaltungszustand der Art im Schutzgebiet sind daher auszuschließen.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Aufgr<strong>und</strong> des großen Abstandes zwischen Anlage <strong>und</strong> den Vorkommen der Art auf<br />
Nord-Usedom (Kölpiensee), können anlagebedingte Beeinträchtigungen für den Großen<br />
Feuerfalter ausgeschlossen werden.
FROELICH & SPORBECK Seite 275<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Die potenziellen, auf den Norden von Usedom begrenzten Lebensräume der Art (stabile,<br />
offene Seggenriede im Verlandungs- bzw. Überflutungsbereich von Gewässern mit<br />
Beständen der Futterpflanze Rumex hydrolopathum) weisen keine besondere Stickstof-<br />
fempfindlichkeit auf. Durch die geringen vorhabensbedingten Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
sind keine relevanten Beeinträchtigungen des Lebensraums der Art zu erwarten.<br />
Im Vergleich zur Vorbelastung mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel sind die<br />
vorhabensbedingten Einträge nicht relevant.<br />
� Gegenüber den anderen betriebsbedingten Wirkfaktoren sind für die Art keine Empfindlichkeiten<br />
bekannt, erhebliche Beeinträchtigungen können ausgeschlossen werden.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für den Großen<br />
Feuerfalter aus. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten des günstigen Erhaltungszustands der<br />
Art werden durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.<br />
5.4.15 Sumpfglanzkraut (Liparis loeselii) (EU-Code 1060)<br />
Tab. 78: Beeinträchtigungen des Sumpfglanzkrauts (Liparis loeselii)<br />
Beeinträchtigungen des Sumpfglanzkrauts (Liparis loeselii)<br />
Wirkfaktor Beeinträchtigung<br />
Baubedingt<br />
Erläuterungen / Bemerkungen<br />
Lärmimmissionen -- � Die Art kommt auf Nord-Usedom r<strong>und</strong> um den Nordhafen<br />
Optische Störungen --<br />
Barriere-/ Trennwirkungen --<br />
Anlagebedingt<br />
Barriere-/ Trennwirkungen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen/ Veränderung<br />
des Sichtfeldes<br />
Kollisionsrisiko --<br />
Betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen -- � siehe oben<br />
Optische Störungen --<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -<br />
einleitung<br />
--<br />
--<br />
-<br />
bei Peenemünde vor (FROELICH & SPORBECK 2009A).
FROELICH & SPORBECK Seite 276<br />
Bewertung der Beeinträchtigungen<br />
Baubedingte Beeinträchtigungen:<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
� Die Baufläche <strong>und</strong> die BE-Flächen befinden sich außerhalb des FFH-Gebietes. Baubedingte<br />
Beeinträchtigungen von Vorkommen der Art können ausgeschlossen werden.<br />
Anlagebedingte Beeinträchtigungen:<br />
� Das Vorhaben befindet sich in einem ausgewiesenen Industriegebiet außerhalb des<br />
FFH-Gebietes. Anlagebedingte Wirkungen erreichen das FFH-Gebiet nicht.<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen:<br />
� In ÖKO-DATA (2011) wurde für die Wuchsstandorte des Sumpf-Glanzkrauts am Nordhafen<br />
Peenemünde ein spezifischer, standortbezogener Critical Load berechnet. Dieser<br />
liegt bei 18,8 kg N/ha/a. Aus den von LOBER (2011E) für Wiesenökosysteme ermittelten<br />
Daten gehen für die F<strong>und</strong>orte des Sumpf-Glanzkrautes maximale Stickstoffbelastungen<br />
von 12,29 kg/ha/a (auf Wiesen) hervor. Zur Berücksichtigung von Auskämmeffekten an<br />
Gehölzen <strong>und</strong> Waldrändern werden die Belastungsschwellen auch für Rezeptoreigenschaften<br />
von Waldflächen <strong>und</strong> Gebüschstrukturen geprüft. Auch hier werden die kritischen<br />
Belastungsschwellen für die Art durch die Gesamtbelastung (maximal<br />
15,29 kg/ha/a) nicht überschritten. Somit können Beeinträchtigungen der Art durch vorhabensbedingte<br />
Stickstoffeinträge ausgeschlossen werden.<br />
� Erhebliche Beeinträchtigungen durch Versauerungen können ebenfalls ausgeschlossen<br />
werden. Der von ÖKO-DATA (2011) ermittelten standortspezifische CL liegt bei<br />
2858 eq/ha/a) <strong>und</strong> damit deutlich oberhalb der höchsten im Untersuchungsgebiet prognostizierten<br />
Gesamtbelastung von 1745 eq/ha/a (Waldflächen auf Nordusedom).<br />
� Die anderen betriebsbedingten Wirkfaktoren des Vorhabens sind für das Sumpfglanzkraut<br />
irrelevant.<br />
Fazit: keine Beeinträchtigung<br />
Das Vorhaben löst keine signifikanten Beeinträchtigungen der Habitatqualität für das<br />
Sumpfglanzkraut aus. Die standortspezifischen Critical Loads der Art hinsichtlich eutrophierender<br />
<strong>und</strong> versauernder Wirkungen werden deutlich unterschritten. Die Wiederherstellungsmöglichkeiten<br />
des günstigen Erhaltungszustands der Art werden durch das Vorhaben nicht eingeschränkt.
FROELICH & SPORBECK Seite 277<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
6 Vorhabensbezogene Maßnahmen zur Schadensbegren-<br />
zung<br />
„Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“ begrenzen die negativen Auswirkungen von vorhabensbedingten<br />
Wirkprozessen auf Erhaltungsziele eines Schutzgebietes bzw. verhindern ihr<br />
Auftreten. Sie dienen dazu, bestehende Beeinträchtigungen durch die zu erwartenden Projektwirkungen<br />
(möglichst unter die Erheblichkeitsschwelle im Sinne der FFH-Richtlinie) abzumindern.<br />
Durch die zu erwartenden Projektwirkungen kommt es zu erheblichen Beeinträchtigungen von<br />
drei marinen Lebensraumtypen <strong>und</strong> einem terrestrischen Lebensraumtyp des Anhangs I, die<br />
maßgebliche Bestandteile des Schutzgebietes darstellen <strong>und</strong> somit auch zu Beeinträchtigungen<br />
der in Kap. 2.2.2 dieser Unterlage dargelegten Schutzerfordernissen (Erhaltungsziele).<br />
Bei der Analyse <strong>und</strong> Bewertung der Konflikte, die durch das Vorhaben ausgelöst werden können,<br />
wurden im worst case Beeinträchtigungen für 4 Erhaltungsziele ermittelt.<br />
Folgende Lebensraumtypen des Anhangs I werden erheblich beeinträchtigt:<br />
- Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser (EU-<br />
Code 1110)<br />
- Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
- Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160)<br />
- Bewaldete Küstendünen (EU-Code 2180)<br />
Da nach Auskunft des Vorhabensträgers im Hinblick auf die Erreichung der Vorhabensziele alle<br />
Optimierungen der technischen Planung bzgl. der Kühlwasserthematik <strong>und</strong> der Reduzierung der<br />
Depositionen ausgeschöpft sind, ist die Durchführung von „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“,<br />
also von Maßnahmen zur Verminderung oder Begrenzung von Wirkungen, die zu erheblichen<br />
Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen des Anhangs I bzw. der Erhaltungsziele führen<br />
können, nicht möglich.
FROELICH & SPORBECK Seite 278<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
7 Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes<br />
durch andere zusammenwirkende Pläne <strong>und</strong> Pro-<br />
jekte<br />
Nach Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie ist nicht nur zu prüfen, ob ein Projekt - isoliert betrachtet -<br />
ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigt, sondern auch, ob es in Zusammenwirkung mit<br />
anderen Plänen <strong>und</strong> Projekten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele verursachen könnte.<br />
Deshalb werden auf der Gr<strong>und</strong>lage vorliegender Informationen die Pläne <strong>und</strong> Projekte ermittelt,<br />
die das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ebenfalls beeinträchtigen könnten. Bzgl. der ermittelten Vorhaben erfolgt eine Abschätzung der<br />
Synergieeffekte. Für die Vorhaben, für die bislang keine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung<br />
vorliegt, kann lediglich eine Abschätzung der Synergieeffekte erfolgen. Für die Lebensraumtypen<br />
<strong>und</strong> Arten, die durch das geplante Projekt nicht beeinträchtigt werden, erfolgt im Zuge der<br />
Abschätzung von Synergieeffekten keine Auswirkungsprognose.<br />
Es wird im Rahmen der Summationsbetrachtung geprüft, ob die unterhalb der Erheblichkeitsschwelle<br />
liegenden Beeinträchtigungen (nicht erhebliche Beeinträchtigungen) im Zusammenwirken<br />
mit anderen Projekten mit gleichartigen Wirkfaktoren diese Schwelle überschreiten. Dies<br />
betrifft die nicht erheblichen Beeinträchtigungen von für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen<br />
des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“.<br />
7.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne <strong>und</strong><br />
Projekte<br />
Für die Abschätzung der Summations- bzw. Synergieeffekte sind in erster Linie Projekte im<br />
Umfeld des geplanten Vorhabens zu betrachten. Es werden hierbei Projekte <strong>und</strong> Pläne mit<br />
gleichartigen Wirkprozessen sowie solche mit andersartigen, jedoch sich gegenseitig verstärkenden<br />
Wirkprozessen, betrachtet.<br />
Um berücksichtigt werden zu können, müssen die anderen Pläne <strong>und</strong> Projekte einen ausreichenden<br />
planerischen Verfestigungsgrad erreicht haben, da andernfalls keine rechtssicheren<br />
Aussagen über kumulative Beeinträchtigungen formuliert werden können (ARGE KIfL / TGP<br />
2004). Eine Berücksichtigungspflicht von Planungsabsichten Dritter liegt für einen Vorhabenträger<br />
nur dann vor, wenn die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens bzw. des Plans hinreichend<br />
konkret eingeschätzt werden können (vgl. SCHÜTTE 2008).<br />
Eine Berücksichtigung anderer Projekte kommt daher erst dann in Betracht, sollten Antragsunterlagen<br />
dieser Projekte vorliegen bevor die Vollständigkeit der Antragsunterlagen zum geplanten<br />
„Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>“ von der Genehmigungsbehörde bestätigt<br />
sind. Dabei sind Scoping-Unterlagen mangels Verbindlichkeit der Angaben nicht zu berücksichtigen.<br />
Bei der Bewertung der Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes in Kapitel 5<br />
wurde aufgr<strong>und</strong> der Genehmigungssituation am Standort das <strong>GuD</strong> II (EnBW) als Vorbelastung
FROELICH & SPORBECK Seite 279<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
betrachtet <strong>und</strong> somit bereits eine summarische Bewertung der Verträglichkeit der beiden Gas-<br />
<strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerke <strong>Lubmin</strong> II <strong>und</strong> <strong>III</strong> durchgeführt. Daher wird das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> II in diesem Kapitel nicht mehr behandelt.<br />
Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Beurteilung werden zunächst einmal alle 41 zu betrachtenden<br />
Projekte (das <strong>GuD</strong> II EnBW wird hierbei nicht berücksichtigt, da bereits in Kap. 5.3 <strong>und</strong><br />
5.4 behandelt) tabellarisch aufgeführt <strong>und</strong> nach zeitlichen (z. B. keine zeitliche Überschneidungen<br />
mit dem Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>), räumlichen (große Entfernung zum Standort des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong><br />
lokale Begrenzung der Wirkfaktoren) <strong>und</strong> sonstigen Ausschlussfaktoren (z. B. keine FFH-<br />
Betroffenheit) überprüft.
FROELICH & SPORBECK Seite 280<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 79: <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>: Räumlich <strong>und</strong> zeitliche Ausschlussfaktoren für kumulative Beeinträchtigungen durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte<br />
Nr. Name des Projektes<br />
1 Anpassung Seewasserstraße nördlicher Peenestrom<br />
2<br />
Neuverlegung der Erdgas-Fernleitung „OPAL“ <strong>und</strong> Bau<br />
einer Gasanlandestation<br />
3 Kläranlage <strong>Lubmin</strong><br />
4 Erweiterung Marina Kröslin<br />
5 B-Plan Nr. 7 „Nordhafen Peenemünde“<br />
6 Ryck-Sperrwerk<br />
Zeitlicher Ausschlussfaktor<br />
(Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> frühestens<br />
ab 2013)<br />
abgeschlossen, Fertigstellung<br />
Februar 2011<br />
abgeschlossen, Fertigstellung<br />
Mai 2011<br />
abgeschlossen, Fertigstellung<br />
2004<br />
2006 genehmigt, noch keine<br />
Umsetzung<br />
Räumlicher Ausschlussfaktor<br />
Entfernung mind. 6<br />
km<br />
Entfernung ca. 6 km<br />
liegt in ca. 12 km<br />
Entfernung an der<br />
Greifswalder Wiek<br />
Sonstige Ausschlussfaktoren<br />
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen<br />
werden<br />
bereits als Vorbelastung<br />
berücksichtigt<br />
Der Neubau der Kläranlage<br />
vermindert im Vergleich<br />
zur alten Anlage<br />
die Beeinträchtigungen<br />
des Greifswalder Boddens<br />
– eine FFH-<br />
Vorprüfung wurde daher<br />
nicht durchgeführt<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
Keine Betroffenheit des<br />
FFH-Gebietes<br />
Kumulative Beeinträchtigung<br />
möglich<br />
7 Ortsumgehung Spandowerhagen keine FFH-Betroffenheit nein<br />
8 Ortsumgehung Wolgast Entfernung ca. 11 km<br />
9 Rekonstruktion Auslaufkanal <strong>Lubmin</strong><br />
10<br />
11<br />
Ausbau der Hafenzufahrt, Fertigstellung sowie Inbetriebnahme<br />
des Industriehafens <strong>Lubmin</strong><br />
Ausbau der B<strong>und</strong>eswasserstraße im Bereich des Auslaufkanals<br />
<strong>Lubmin</strong><br />
abgeschlossen<br />
Keine Betroffenheit des<br />
FFH-Gebietes<br />
Beeinträchtigungen<br />
werden als Vorbelastung<br />
berücksichtigt<br />
12 B-Pläne Vierow 3 <strong>und</strong> 4 keine FFH-Betroffenheit nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 281<br />
Nr. Name des Projektes<br />
Zeitlicher Ausschlussfaktor<br />
(Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> frühestens<br />
ab 2013)<br />
abgeschlossen, Fertigstellung<br />
2003<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Räumlicher Ausschlussfaktor<br />
Sonstige Ausschlussfaktoren<br />
Kumulative Beeinträchtigung<br />
möglich<br />
13 Yachthafen am Auslaufkanal<br />
wird als Vorbelastung<br />
berücksichtigt<br />
nein<br />
14 B-Plan Nr.1 „Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebiet <strong>Lubmin</strong>“<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> liegt innerhalb Die zu berücksichtigen-<br />
der B-Planfläche den hinreichend konkretisierten<br />
Projekte, die im<br />
B-Plan Gebiet liegen,<br />
nein<br />
15 Änderungen zum B-Plan Nr. 1 <strong>Lubmin</strong><br />
werden bereits einzeln<br />
anhand der vorliegenden<br />
konkreten Planungsunterlagen<br />
berücksichtigt<br />
keine anlage- <strong>und</strong> be-<br />
nein<br />
16 Strandaufspülung <strong>Lubmin</strong> abgeschlossen<br />
triebsbedingtenBeeinträchtigungen nein<br />
17<br />
Photovoltaikanlage der BPsolar auf dem Gelände der<br />
<strong>EWN</strong> GmbH<br />
abgeschlossen, Fertigstellung<br />
Dez. 2004<br />
wird als Vorbelastung<br />
berücksichtigt<br />
nein<br />
18<br />
Ausbau der B<strong>und</strong>eswasserstraße Ostansteuerung<br />
Strals<strong>und</strong><br />
abgeschlossen, nur Unterhaltungsbaggerung<br />
Entfernung über 15<br />
km, keine räumliche<br />
Überschneidung<br />
nein<br />
19<br />
Umspannwerk der Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft<br />
GmbH inkl. Erdkabel<br />
ja<br />
20<br />
Kabeltrasse des Windparks Ventotec Ost 2 <strong>und</strong> Arkonabecken<br />
Südost<br />
ja<br />
21 Umspannwerk der 50 Hertz Transmission GmbH bereits 2010 abgeschlossen nein<br />
22 Biodieselanlage der Firma Ecanol am Standort <strong>Lubmin</strong> keine FFH-Betroffenheit nein<br />
23<br />
Anlage zur Herstellung von BTL Kraftstoffen der Firma<br />
Choren<br />
Planungen eingestellt nein<br />
24<br />
Errichtung <strong>und</strong> Betrieb der Nordstream Gasleitung Gazprom<br />
vor Baubeginn des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
Fertigstellung Oktober 2012<br />
wird als Vorbelastung<br />
berücksichtigt<br />
es werden keine anlagenein<br />
25<br />
Ausbaggerung der Kühlwassereinlaufrinne Spandowerhagener<br />
Wiek<br />
Ausbaggerung liegt zeitlich<br />
vor Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
Planungen eingestellt auf-<br />
<strong>und</strong> betriebsbedingten<br />
Beeinträchtigungen<br />
erwartet<br />
nein<br />
26 Sportboot- <strong>und</strong> Fischereihafen Göhren<br />
gr<strong>und</strong> negativer raumordnerischer<br />
Stellungnahme<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 282<br />
Nr. Name des Projektes<br />
Zeitlicher Ausschlussfaktor<br />
(Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> frühestens<br />
ab 2013)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Räumlicher Ausschlussfaktor<br />
Sonstige Ausschlussfaktoren<br />
Kumulative Beeinträchtigung<br />
möglich<br />
27 Baggergut Aufbereitungsanlage Peenemünde (Balticon) Planungen eingestellt nein<br />
28 Klappstelle 517, Klappstelle 527 <strong>und</strong> Klappstelle 551<br />
29 Erweiterung des Yachthafens Lauterbach<br />
Auswirkungen zeitlich eng<br />
begrenzt<br />
30<br />
FNP der Gemeinde <strong>Lubmin</strong> (landseitiger Ausbau des<br />
Jachthafens)<br />
31<br />
FNP der Gemeinden Peenemünde, Karlshagen, Kröslin,<br />
Freest <strong>und</strong> der Stadt Wolgast<br />
a) Zweite Änderung des Flächennutzungsplans der Ge- a) Planänderung Nr. 2 wurde<br />
meinde Ostseebad Karlshagen<br />
b) Zweite Ergänzung des Flächennutzungsplans der<br />
Gemeinde Peenemünde<br />
von der Behörde zurückgezogen,<br />
da Bedenken der Raumordnungsbehörde<br />
nicht ausgeräumt<br />
werden konnten<br />
c) Flächennutzungsplan der Stadt Wolgast einschließlich c) seit dem 27.10.1998 wirk-<br />
1. Änderung<br />
sam, 2. Änderung seit Ende<br />
März 2006 wirksam<br />
d) Flächennutzungsplan der Gemeinde Kröslin d) seit dem 20.07.2007 wirksam<br />
32<br />
Ausbau der Hafenzufahrt Greifswald Ladebow, Spülfeld<br />
Wampen, Spülfeld Drigge, Klappstelle 527<br />
33 Naturhafen Gustower Wiek<br />
in Realisierung, keine Überschneidung<br />
der Bauzeiten<br />
Klappstellen liegen in<br />
mind. 15 km Entfernung<br />
liegt in ca. 20-25 km<br />
Entfernung<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
seit dem 13.12.2004 wirksam nein<br />
Entfernung ca. 6 –<br />
11 km<br />
Entfernung mind.<br />
11 km<br />
Entfernung mind. 6<br />
km<br />
Entfernung mind.<br />
11 km<br />
Entfernung mind. 6<br />
km<br />
Entfernung über 14<br />
km<br />
Entfernung über 30<br />
km<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
keine FFH-Betroffenheit nein<br />
keine FFH-Betroffenheit nein<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
34 3. Änderung FNP Middelhagen / B-Plan Haus am Meer Entfernung ca. 20 km keine FFH-Betroffenheit nein<br />
35 Flurneuordnungsverfahren Zudar Entfernung ca. 24 km keine FFH-Betroffenheit nein<br />
36<br />
Rahmenbetriebsplan für den Kiesabbau im marinen Bewilligungsfeld<br />
Greifswalder Bodden<br />
(Verlängerung des Hauptbetriebsplanes)<br />
37 Kiesabbau „Landtief“ vor der Küste Südostrügens<br />
Auswirkungen zeitlich eng<br />
begrenzt<br />
bisherige Abbautätigkeit:<br />
1994 bis 1996<br />
Entfernung ca. 10 km<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
Auswirkungen lokal<br />
begrenzt<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 283<br />
Nr. Name des Projektes<br />
38 Regionales Raumentwicklungsprogramm<br />
Zeitlicher Ausschlussfaktor<br />
(Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> frühestens<br />
ab 2013)<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Räumlicher Ausschlussfaktor<br />
Sonstige Ausschlussfaktoren<br />
s. OU Spandowerhagener<br />
Wiek<br />
Kumulative Beeinträchtigung<br />
möglich<br />
39 Gasspeicher Moeckow<br />
Vom Vorhabenträger ist<br />
der Antrag auf Planfest-<br />
ja<br />
40 Erdgasleitung Nordal<br />
stellung zurückgezogen<br />
worden. Die Planungen<br />
sind somit eingestellt.<br />
nein<br />
41 Norddeutsche Erdgasleitung (NEL)<br />
nur baubedingte Summationswirkungen<br />
möglich. Bau<br />
der NEL liegt zeitlich vor dem<br />
Bau des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
liegt komplett außerhalb<br />
des FFH-<br />
Gebietes<br />
nein<br />
nein
FROELICH & SPORBECK Seite 284<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für die folgenden 3 Projekte konnten nach dieser Abschichtung kumulative Beeinträchtigungen<br />
nicht ausgeschlossen werden:<br />
� Umspannwerk der Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft GmbH inkl. Erdkabel<br />
� Kabeltrasse des Windparks Ventotec Ost 2 <strong>und</strong> Arkonabecken Südost<br />
� Gasspeicher Moeckow<br />
7.2 Beschreibung der Pläne <strong>und</strong> Projekte sowie der möglichen ku-<br />
mulativen Beeinträchtigungen<br />
7.2.1 Umspannwerk der AWE Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft<br />
GmbH einschließlich des Erdkabels<br />
Beschreibung des Projektes<br />
Der Offshore-Windpark „ARKONA-BECKEN SÜDOST“ wird von der Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft<br />
AWE projektiert. Der von den Antragstellern vorgesehene Baustandort „AR-<br />
KONA-BECKEN SÜDOST“ liegt in einer Entfernung von mehr als 35 km nordöstlich von Rügen<br />
am Adlergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> in der Pommerschen Bucht <strong>und</strong> im „Besonderen Eignungsgebiet für Windenergieanlagen<br />
Westlich Adlergr<strong>und</strong>". Mit einer Antragskonferenz in Strals<strong>und</strong> wurde im Oktober<br />
2001 das förmliche Planungsverfahren eingeleitet.<br />
Der Standort des Umspannwerkes befindet sich südwestlich von Spandowerhagen zwischen<br />
dem vorhandenen Umspannwerk <strong>und</strong> der Landesstraße am Rand einer vorhandenen Zufahrtsstraße<br />
außerhalb des FFH-Gebietes. Das Vorhaben wurde nach § 4 Abs. 1 Immissionsschutzgesetz<br />
am 19.07.2006 vom StAUN Strals<strong>und</strong> genehmigt.<br />
Vom geplanten Offshore-Windpark Arkona soll ein Erdkabel (Stromkabel) durch den Greifswalder<br />
Bodden zum Umspannwerk verlegt werden.<br />
Ermittelte projektbedingte Beeinträchtigungen<br />
Laut Information der UNB Ostvorpommern (Herr Weier, mündl. am 21.08.2007) kommt es durch<br />
das Umspannwerk anlagebedingt zu einer Inanspruchnahme von Waldflächen <strong>und</strong> ruderalisierten<br />
Trockenstandorten. Aufgr<strong>und</strong> der Lage außerhalb von Schutzgebietsflächen konnten anlagebedingte<br />
Beeinträchtigungen im Vorhinein ausgeschlossen werden. Im Rahmen einer FFH-<br />
Verträglichkeitsvorstudie konnten ebenso bau- <strong>und</strong> betriebsbedingte Beeinträchtigungen auf<br />
LRT <strong>und</strong> Zielarten von Natura 2000-Gebieten ausgeschlossen werden. Summationswirkungen<br />
mit dem Vorhaben sind daher auszuschließen.<br />
Vom geplanten Offshore-Windpark Arkona soll ein Erdkabel (Stromkabel) durch den Greifswalder<br />
Bodden zum Umspannwerk verlegt werden. Landseitig quert das Erdkabel nordöstlich des<br />
Industriehafens das FFH-Gebiet, wobei hier jedoch das Horizontalbohrverfahren angewandt<br />
wird.
FROELICH & SPORBECK Seite 285<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das Kabel wird in den Boddengr<strong>und</strong> verlegt, wodurch es zu einer baubedingten Beeinträchtigung<br />
der marinen FFH-Lebensraumtypen „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung<br />
durch Meerwasser (EU-Code 1110)“, „Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen)<br />
(EU-Code 1160)“ <strong>und</strong> „Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code<br />
1140)“ mit den jeweiligen charakteristischen Arten kommt. Während der Bauarbeiten wird im<br />
Bereich der Kabeltrasse in diese FFH-Lebensraumtypen direkt eingegriffen. Durch Aufwirbelung<br />
des Boddengr<strong>und</strong>es kann es durch Trübung <strong>und</strong> Sedimentation von aufgewirbeltem Schlamm<br />
zur Beeinträchtigung in einem weiteren Umfeld der Kabeltrasse kommen. V. a. der Makrophytenbestand<br />
in den Flachwasserbereichen <strong>und</strong> die charakteristischen Wirbellosen Sandklaffmuschel,<br />
Schlickkrebs, Sandflohkrebs <strong>und</strong> Schillernder Meeresringelwurm sind durch die baubedingten<br />
Flächeninanspruchnahmen <strong>und</strong> die Beeinträchtigungen durch Trübung <strong>und</strong><br />
Sedimentation betroffen. Die Beeinträchtigungen sind jedoch nur temporär. Nach Abschluss der<br />
Bauarbeiten kann sich die Makrophytenvegetation <strong>und</strong> der Bestand der den Boden bewohnenden<br />
Wirbellosen in relativ kurzer Zeit vollständig regenerieren, so dass keine nachhaltigen<br />
Schädigungen zu erwarten sind.<br />
Die Beeinträchtigungen der Fischarten Rapfen, Fluss- <strong>und</strong> Meerneunauge sind ebenfalls nur<br />
temporär <strong>und</strong> werden als gering eingestuft, da die Arten nur sporadisch hier auftreten <strong>und</strong><br />
Laichplätze nicht betroffen sind. Die Wiederansiedlung von Kegelrobbe <strong>und</strong> Seeh<strong>und</strong> wird nicht<br />
beeinträchtigt, da eine dauerhafte Ansiedlung der beiden Arten in den nächsten Jahren bis zum<br />
Abschluss der Bauarbeiten nicht zu erwarten ist <strong>und</strong> die Störungen zudem nur temporär sind.<br />
Landseitig quert das Erdkabel nordöstlich des Industriehafens das FFH-Gebiet. Hier kommt es<br />
im FFH-Gebiet zu keinen betriebs- oder anlagebedingten Flächeninanspruchnahmen, da das<br />
Horizontalbohrverfahren angewandt wird. Es sind jedoch baubedingte Störungen im Umfeld der<br />
Trasse zu erwarten. Betroffen ist hier als charakteristische Art des FFH-Lebensraumtyps „Offene<br />
Grasflächen mit Corynephorus <strong>und</strong> Agrostis auf Binnendünen (EU-Code 2330)“ die Heide-<br />
lerche. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Jahr der Bauarbeiten der Brutplatz verloren geht, wird<br />
als gering eingestuft. Eine Wiederbesiedlung im Jahr danach ist jedoch problemlos möglich.<br />
Zudem ist die Heidelerchenpopulation im Gebiet intakt, so dass eine temporäre Störung nicht zu<br />
einer erheblichen Beeinträchtigung der Population führen kann. Baubedingt kann es auch zu<br />
geringfügigen Beeinträchtigungen des Fischotters kommen, wobei Kernlebensräume nicht betroffen<br />
sind.<br />
Die übrigen FFH-Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sind durch das<br />
Erdkabel nicht betroffen.<br />
Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung der möglichen kumulativen Beeinträchtigungen<br />
Durch Flächeninanspruchnahme <strong>und</strong> Sedimentaufwirbelung verursacht die Kabelverlegung im<br />
Boddengr<strong>und</strong> vor allem für die LRT 1110, 1140 <strong>und</strong> 1160 baubedingte Beeinträchtigungen. Da<br />
diese Lebensraumtypen bereits durch die Projekte „<strong>GuD</strong> II“ <strong>und</strong> „<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“ erheblich beeinträchtigt<br />
werden, ist hier die Betrachtung von kumulativen Beeinträchtigungen nicht relevant.<br />
Synergistische Beeinträchtigungen können für die Meeressäuger sowie für R<strong>und</strong>mäuler <strong>und</strong><br />
Fische zum einen durch die betriebsbedingte Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>
FROELICH & SPORBECK Seite 286<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
<strong>und</strong> zum anderen durch die baubedingte Sedimentaufwirbelung <strong>und</strong> Gewässertrübung aufgr<strong>und</strong><br />
der Verlegung des Erdkabels entstehen.<br />
Die Kühlwassereinleitung betrifft allenfalls einzelne Individuen der Seeh<strong>und</strong>e <strong>und</strong> Kegelrobben<br />
in relativ kleinflächigen Teilen ihres potenziellen Habitats. Ansaugverluste durch Kühlwasserentnahmen<br />
können bei Meer- <strong>und</strong> Flussneunaugen sowie bei den Fischarten Rapfen, Atlantischer<br />
Stör <strong>und</strong> Finte nur in einem sehr geringen Maße auftreten. Da zudem der Wirkraum der<br />
Kühlwasserfahne von den Arten allenfalls als Durchzugs- <strong>und</strong> temporäres Weidegebiet genutzt<br />
wird, ist durch die prognostizierten vorhabensbedingten Temperaturveränderungen im Bereich<br />
der lokal begrenzten Kühlwasserfahne nicht mit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands<br />
der Arten zu rechnen. Besonders temperaturempfindliche Entwicklungsstadien der Arten (Eier,<br />
Larven) kommen im Gebiet nicht vor. Die Verlegung des Erdkabels stellt lediglich eine zeitlich<br />
befristete Belastung dar <strong>und</strong> verursacht keine dauerhaften Wirkungen. Da zudem durch Sedimentaufwirbelungen<br />
lediglich punktuelle, kleinflächige <strong>und</strong> temporäre Beeinträchtigungen zu<br />
erwarten sind, ist auch in Summation mit dem Betrieb des geplanten Kraftwerkes nicht mit erheblichen<br />
Beeinträchtigungen zu rechnen.<br />
Insgesamt betrachtet führen die Summationswirkungen mit dem Umspannwerk <strong>und</strong> dem<br />
Erdkabel des Windparks Arkona nicht dazu, dass die Erheblichkeitsschwelle im Sinne<br />
der FFH-Richtlinie überschritten wird.<br />
7.2.2 Kabeltrasse Offshore-Windpark „Ventotec Ost 2“<br />
Beschreibung des Projektes<br />
ARCADIS Consult GmbH Rostock plant im Auftrag der Gesellschaft für Handel <strong>und</strong> Finanz mbH<br />
Leer <strong>und</strong> der Deutschen Bank AG die Errichtung des Offshore-Windparks "Ventotec Ost 2". Hier<br />
wird die Errichtung der Pilotphase mit 80 Offshore-Windenergieanlagen (OWEA) des Herstellers<br />
VESTAS auf einer Fläche von ca. 30,3 km² geplant. Für diesen Offshore-Windpark wird die<br />
Kabeltrasse von der 12-sm-Grenze bis zum Landeinspeisepunkt am Kraftwerksstandort <strong>Lubmin</strong><br />
betrachtet. Der Kabeltrassenkorridor des Offshore-Windparks „Ventotec Ost 2“ verläuft weitestgehend<br />
in Parallellage mit dem des benachbarten Offshore-Windparks „Arkona-Becken Südost“<br />
des Antragstellers „Arkona-Windpark-Entwicklungs-GmbH“ (AWE). Zumindest für den Verlauf<br />
im Greifswalder Bodden ist ebenfalls ein paralleler Trassenverlauf zur geplanten Nord Stream-<br />
Gas-Pipeline vorgesehen.<br />
Die Anbindung des Offshore-Windparks an das landseitige Netz mittels Seekabel erfolgt mit<br />
speziell hierfür ausgerüsteten Verlegeschiffen. Das Seekabel wird vom Schiff aus mittels besonderer<br />
Verlegetechnik in die See versenkt, in der Regel ein Einspülverfahren, wobei mittels<br />
eines Hochdruck-Wasserstrahls das Kabel etwa 1,5 Meter tief in den Gr<strong>und</strong> eingebracht wird<br />
(Hydro-Trenchen). Um die Sicherheit <strong>und</strong> Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu gefährden, wird bei<br />
einer Querung von Schifffahrtsstraßen (Wasserstraßen, Fahrrinnen) das Kabel bis auf eine<br />
Einspültiefe von 3 m unter ankerfähigem (festem) Gr<strong>und</strong> verlegt. In Bereichen, in denen nicht<br />
genügend spülfähiges Sediment vorhanden ist, werden die Kabel eingepflügt. Für den Anlandungsbereich<br />
ist ggf. auch der Einsatz eines Stelzenbaggers auf einem Ponton vorgesehen, der<br />
schwimmend Baggertätigkeiten ausführen kann.
FROELICH & SPORBECK Seite 287<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Anlandung der Seekabelsysteme <strong>und</strong> die Ummuffung auf Landkabel sollen nördlich des<br />
Hafens <strong>Lubmin</strong> erfolgen. An Land erfolgt die Weiterleitung des Stroms über erdverlegte Kabelsysteme<br />
bis zum Einspeisepunkt des Netzbetreibers auf dem Gelände der Vattenfall Europe<br />
Transmission GmbH. Die Landkabeltrasse verläuft nördlich der Gasverteilerstation sowie nördlich<br />
des geplanten Großkraftwerks <strong>Lubmin</strong> II benachbart zur Nordgrenze des Betriebsgeländes<br />
der Energiewerke Nord GmbH (<strong>EWN</strong>), größtenteils in den südlichen Freesendorfer Wiesen. Die<br />
Trasse wird den ehemaligen Einlaufkanal im Horizontalbohrverfahren unterqueren. Nach der<br />
Unterquerung des Einlaufkanals des ehemaligen KKW „Bruno Leuschner“ <strong>und</strong> der östlichen<br />
Umgehung des Zwischenlagers (ZAB) erfolgt auf dem Gelände der Vattenfall Europe Transmission<br />
GmbH die Einspeisung der offshore-generierten Energie in das 380-kV-Landnetz über ein<br />
noch zu errichtendes Umspannwerk. Die benötigte Regelarbeitsbreite bei der Verlegung der<br />
Kabelsysteme beträgt ca. 12 m <strong>und</strong> setzt sich zusammen aus:<br />
- ca. 6 m breiter Streifen für Kabelgräben mit 3 x 0,6 m breiten <strong>und</strong> 1,2 m tiefen Kabelgräben,<br />
die in einen Abstand von ca. 2 m angelegt werden<br />
- ca. 6 m breiter Fahr- <strong>und</strong> Arbeitsstreifen für Verlege- <strong>und</strong> Montagearbeiten sowie Lagerfläche<br />
für den Bodenaushub<br />
In Fällen, in denen der o.g. Bauraum aus technischen oder Umweltvorsorgegesichtspunkten<br />
nicht zur Verfügung steht, kann dieser in kurzen Teilabschnitten reduziert werden. Nach dem<br />
Einbringen des Kabels werden die Gräben wieder mit dem Bodenaushub verfüllt. Gemeinsam<br />
mit den beiden Kabelsystemen werden Warnbänder bzw. Abdeckplatten verlegt. Zum Schutz<br />
der Hochspannungskabel sind über der Kabeltrasse keine Bautätigkeiten <strong>und</strong> Bepflanzungen<br />
gestattet. In regelmäßigen Intervallen ist eine Inspektion des Seekabels vorgesehen.<br />
Ermittelte projektbedingte Beeinträchtigungen<br />
Zum Projekt „Kabeltrasse Offshore-Windpark „Ventotec Ost 2““ liegt eine FFH-<br />
Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-301) vor.<br />
Beeinträchtigung von LRT im Seegebiet (FFH-LRT 1110, 1140, 1160 <strong>und</strong> 1170)<br />
Von strukturellen Veränderungen des Benthos durch die Kabelverlegung im Bereich der Kabelfurche<br />
(Einspülung/Einfräsung/Auflage der Leitung auf den Meeresboden) sind alle aufgeführten<br />
FFH-LRT 1110, 1140, 1160 <strong>und</strong> 1170 betroffen. Charakterarten dieser FFH-LRT sind vor<br />
allem zoobenthische Arten (z. B. Miesmuschel Mytilus edulis), Makrophyten (z. B. Zostera marina,<br />
Ruppia cirrhosa, Potamogeton pectinatus) <strong>und</strong> Fischarten, die die Habitate als Unterstand<br />
<strong>und</strong> Wanderungsgebiet (z. B. Fl<strong>und</strong>er, Hering) sowie Laich- <strong>und</strong> Aufwuchsgebiet (insbesondere<br />
Hering) nutzen. Für die Riffe (1170) liegt eine erhebliche Beeinträchtigung vor, die durch Vermeidungs-<br />
<strong>und</strong> Minderungsmaßnahmen, sowie durch Maßnahmen zur Schadensbegrenzung<br />
auf ein unerhebliches Maß gesenkt wird.<br />
Durch Einspülung oder Einfräsung der Kabel werden zeitweise Sedimentaufwirbelungen, Trübungen<br />
<strong>und</strong> Ablagerungen des Sedimentes verursacht, die die Lichtbedingungen, die Wasserbeschaffenheit<br />
(Schwebstoffgehalt, Sauerstoffzehrung) <strong>und</strong> damit das Benthos beeinflussen.<br />
Außerdem lagert sich das aufgewirbelte Sediment auf vorhandene Makrophyten ab. Erhebliche
FROELICH & SPORBECK Seite 288<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Beeinträchtigungen der oben aufgeführten FFH-Lebensraumtypen <strong>und</strong> ihrer Charakterarten<br />
treten jedoch nicht auf.<br />
Beim Verlegen der Seekabel kommt es zur Resuspension von Sedimentpartikeln, die je nach<br />
Größe <strong>und</strong> Strömung mehr oder weniger weit entfernt von der Quelle wieder auf den Meeresboden<br />
absinken. Es werden keine weitreichenden Auswirkungen auf die Meeressedimente <strong>und</strong><br />
die morphodynamischen Prozesse beim Verlegen der Seekabel erwartet, da die zu erwartenden<br />
Sedimentumlagerungen im Zuge der Verlegetätigkeiten gegenüber der Intensität von natürlichen<br />
Prozessen (Stürme) zurückstehen.<br />
Veränderungen auf dem Meeresboden durch das Einbringen von künstlichem Hartsubstrat<br />
durch Kabel im Falle einer Kabelauflage auf dem Meeresboden sowie der Veränderung der<br />
Beschaffenheit des Meeresbodens bei Einsatz von Steinschüttungen o.ä. bei Kabelquerungen<br />
vollziehen sich auf kleinflächigen Arealen, sodass die Veränderungen als nicht erheblich eingestuft<br />
werden.<br />
Beeinflussung von Strukturen der Lebensraumtypen bei Reparatur-, Instandhaltungs- <strong>und</strong> Wartungsarbeiten<br />
ist möglich. Instandhaltungs- <strong>und</strong> Wartungsarbeiten haben jedoch fallspezifisch<br />
(punktueller Leitungsdefekt, Freispülung eines Leitungsabschnittes u.a.) unterschiedliche räumliche<br />
Bezüge. Wirkungsspektren treten lediglich punktuell oder abschnittsweise auf (räumlicher<br />
Bezug ist sehr kleinflächig) <strong>und</strong> sind in jedem Fall auf eine kurze Zeit begrenzt. Erhebliche Beeinträchtigungen<br />
von Lebensraumtypen <strong>und</strong> ihrer Charakterarten werden demnach nicht auftreten.<br />
Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen, insbesondere des Benthos <strong>und</strong> der Wasserbeschaffenheit<br />
können im Falle von schwerwiegenden Handhabungsverlusten <strong>und</strong> Havarien auftreten.<br />
Dabei ist zwischen Schiffshavarien <strong>und</strong> Kabeldefekten zu unterscheiden. Bei letzteren sind<br />
erhebliche <strong>und</strong> dauerhafte Auswirkungen bezüglich der Benthoslebensgemeinschaften u.a.<br />
Umweltfaktoren in Anbetracht der geringen Schadstoffmengen, die dabei in das Ökosystem<br />
gelangen können, unwahrscheinlich. Bei Schiffshavarien können jedoch große Schadstoffmengen<br />
in das Gebiet gelangen <strong>und</strong> somit erhebliche <strong>und</strong> nachhaltige Auswirkungen auf Lebensraumtypen<br />
<strong>und</strong> ihre Charakterarten verursachen.<br />
Beeinträchtigungen von landseitigen LRT (FFH-LRT 1210, 2130*, 1330, 6230*)<br />
Für die am südlichsten gelegenen Salzwiesen-Areale kann immer noch ein Abstand von ca.<br />
50 m zur Kabeltrasse festgestellt werden. Da sich großräumige Wirkungen der Kabeltrasse auf<br />
FFH-Lebensraumtypen infolge der möglichen Wirkspektren einer Kabelverlegung nicht vollziehen,<br />
können erhebliche Umweltwirkungen auf den FFH-LRT 1330 „Atlantische Salzwiesen“<br />
ausgeschlossen werden. Der FFH-Lebensraumtyp 6230* „Borstgrasrasen“ wird ebenfalls nicht<br />
von der Kabeltrasse gequert, sodass keine Flächeninanspruchnahmen erfolgen.<br />
Baubedingte Veränderung der Biotopstruktur im Bereich des Kabelgrabens einschließlich Beeinflussung<br />
abiotischer Standortbedingungen (Bodenstruktur, Hydromorphie, Wasserbeschaffenheit)<br />
im Bereich des Arbeitsstreifens, der Bodenablagerungsflächen sowie der Baustelleneinrichtungsfläche<br />
können Auswirkungen auf die FFH-LRT 1210 „Einjährige Spülsäume“ <strong>und</strong> 2130<br />
„Festliegende Küstendünen mit krautiger Vegetation (Graudünen) haben.
FROELICH & SPORBECK Seite 289<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für die Spülsaumgesellschaft kann eine relativ geringe Empfindlichkeit gegenüber den projektbedingten<br />
Bauarbeiten abgeleitet werden, da ständiger Küstenabtrag <strong>und</strong> -anlandung für die<br />
Strandzone charakteristisch ist, sodass eine Sedimentdurchmischung zu keiner Veränderung<br />
der Standortverhältnisse führt. Wenn im Bereich des Strandes keine Nähr- oder Schadstoffeinträge<br />
während der Bauarbeiten erfolgen <strong>und</strong> kein Mutterboden aus anderen Bereichen eingebracht<br />
wird, kann gewährleistet werden, dass nach den Bauarbeiten der jetzt vorhandene Sand-<br />
Rohboden weitestgehend wiederhergestellt wird.<br />
Die Kabeltrasse nutzt einen Bereich der Uferzone, in der nach der Binnendifferenzierung des<br />
LUNG M-V (siehe Abb. 25) kein FFH-LRT „Graudüne“ gegeben ist. Auf der Fläche dominiert<br />
Landreitgras <strong>und</strong> es ist eine Gehölzgruppe sowie eine Teilfläche mit einem kleinen Gebäude<br />
vorzufinden. Demnach ist für die Fläche, die die Kabeltrasse quert, bereits eine deutliche Überprägung<br />
der charakteristischen Vegetation von Graudünen mit Trocken- <strong>und</strong> Magerrasenarten<br />
festzustellen. Bei Anlage eines Kabelgrabens <strong>und</strong> dessen Wiederverfüllung werden wieder<br />
Rohbodenverhältnisse hergestellt, was die Ausbildung einer typischen Dünenvegetation fördert.<br />
Demnach ist der Eingriff als unerheblich zu werten.<br />
Schadstoffeinträge können sich durch Luftschadstoffemissionen der Baufahrzeuge <strong>und</strong> -geräte<br />
vollziehen. Aufgr<strong>und</strong> der überschaubaren Anzahl der eingesetzten Baufahrzeuge <strong>und</strong> -geräte<br />
(geringe Wirkungsintensität) sowie der zeitlichen Begrenzung der Wirkung auf die Bauphase<br />
(sowie „Wander-Baustelle“) wird keine dauerhafte Veränderung der Strukturen der FFH-<br />
Lebensraumtypen durch projektbedingte Luftschadstoff-Immissionen erwartet. Bei Störfällen<br />
<strong>und</strong> Havarien besteht ein hohes Gefährdungspotenzial für verschiedenartige Umweltwirkungen<br />
auf FFH-Lebensraumtypen.<br />
Der in offener Bauweise angelegte Kabeltrassenkorridor wird dauerhaft (Betriebsphase) von<br />
Gehölzbewuchs freigehalten. Der FFH-LRT 1210, der von der Kabeltrasse gequert wird, ist von<br />
Natur aus ein gehölzfreier Biotop. Demnach werden die FFH-Lebensraumtypen der Kabeltrasse<br />
durch das künstliche Freihalten von Gehölzbewuchs nicht beeinflusst.<br />
Mögliche Beeinträchtigungen bei Wartungs- <strong>und</strong> Instandhaltungsmaßnahmen sind von der Art<br />
der erforderlichen Arbeiten abhängig. Falls eine Freilegung des Kabels dazu notwendig ist, sind<br />
ähnliche Wirkungen zu erwarten, wie sie für die baubedingten Beeinflussungen erläutert wurden.<br />
Dabei kann wie oben erläutert, die Anlage von Gräben <strong>und</strong> Gruben innerhalb der vorkommenden<br />
FFH Lebensraumtypen zu deren erheblichen Beeinträchtigung führen. (Maßnahme zur<br />
Vermeidung <strong>und</strong> Verminderung vorgesehen)<br />
Da Reparatur-, Wartungs- <strong>und</strong> Instandsetzungsarbeiten i.d.R. nur sehr kleine Bereiche betreffen<br />
<strong>und</strong> in sehr kurzen Zeiträumen durchgeführt werden, ist das Risiko für betriebsbedingte Havarien<br />
<strong>und</strong> Störfälle deutlich geringer als während der Bauphase.<br />
Beeinträchtigungen von Arten<br />
Hinsichtlich der Meeressäuger Kegelrobbe <strong>und</strong> Seeh<strong>und</strong> sind durch das Projekt keine Beeinträchtigungen<br />
zu erwarten, da sich die geringen Beeinflussungen weitestgehend auf die Bauphase<br />
(sowie die Rückbauphase) beschränken <strong>und</strong> gegenwärtig keine Daueransiedlungen dieser<br />
Arten bekannt sind <strong>und</strong> keine Fortpflanzung im Untersuchungsraum erfolgt.
FROELICH & SPORBECK Seite 290<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Für die FFH-Fischarten wird davon ausgegangen, dass den baubedingten Auswirkungen ausgewichen<br />
wird <strong>und</strong> die Lebensräume nach der Kabelverlegung wieder aufgesucht werden. Aufgr<strong>und</strong><br />
der Kleinflächigkeit der betroffenen Laichareale durch die Kabelverlegung sind die Wirkungen<br />
unerheblich.<br />
Hinsichtlich aktueller Vorkommen im landseitigen Untersuchungsgebiet ist nur der Fischotter als<br />
FFH-Art relevant. Maßgebliche Habitatveränderungen (Vegetationsverhältnisse, Veränderungen<br />
von Gewässern u. ä.) treten für den Fischotter durch die Projektwirkungen nicht auf. Aufgr<strong>und</strong><br />
großräumiger visueller <strong>und</strong> akustischer Wirkräume ist eine Relevanz für den störungsempfindlichen<br />
Fischotter gegeben. Der Untersuchungsraum hat allerdings für den Fischotter mit den<br />
grabendurchzogenen Flächen der südlichen Freesendorfer Wiesen nur eine nachrangige Bedeutung<br />
als Lebensraum. Die Hauptaktivitätszeit des Fischotters liegt in den Dämmerungs- <strong>und</strong><br />
Nachtst<strong>und</strong>en, sodass maßgebliche baubedingte Störwirkungen bei einem nächtlichen Baubetrieb<br />
möglich wären (Maßnahme zur Vermeidung <strong>und</strong> Verminderung vorgesehen). Da die trockene,<br />
fließgewässerarme <strong>Lubmin</strong>er Heide keine geeigneten Wanderkorridore für den Fischotter<br />
bietet, kann angenommen werden, dass sich der Fischotter im betrachteten Raum den<br />
unmittelbaren Uferraum als Wanderkorridor nutzt. Im Untersuchungsgebiet können demnach<br />
baubedingt angelegte Gräben <strong>und</strong> Gruben im Uferbereich zu einer zeitweiligen Beeinflussung<br />
des Wanderverhaltens des Fischotters führen (Maßnahme zur Vermeidung <strong>und</strong> Verminderung<br />
vorgesehen). Für die Wirkungsprognose wird insgesamt davon ausgegangen, dass maßgebliche<br />
Umweltwirkungen nur bei einem Baubetrieb während der Nacht auf den störungsempfindlichen<br />
Fischotter auftreten können <strong>und</strong> sonst der Fischotter die Baustelle <strong>und</strong> deren verlärmtes<br />
Umfeld weitestgehend meiden kann, ohne dass es zu erheblichen Lebensraumeinschränkungen<br />
für diese Art kommt. Die Beeinflussungen werden insgesamt als unerheblich bewertet.<br />
Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung der möglichen kumulativen Beeinträchtigungen<br />
Laut FFH-Verträglichkeitsstudie kommt es durch die Verlegung der Kabeltrasse zum Offshore-<br />
Windpark „Ventotec Ost 2“ für die LRT 1110, 1140 <strong>und</strong> 1160 zu bau- <strong>und</strong> anlagebedingten Beeinträchtigungen.<br />
Da diese Lebensraumtypen bereits durch die Projekte „<strong>GuD</strong> II“ <strong>und</strong> „<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“<br />
erheblich beeinträchtigt werden, ist hier die Betrachtung von kumulativen Beeinträchtigungen<br />
nicht relevant.<br />
Kumulative Beeinträchtigung der Lebensraumtypen „Spülsäume“ (1210), „Salzgrünland“ (1330),<br />
„Graudünen“ (2130*) <strong>und</strong> „Borstgrasrasen“ (6230*) durch Stoffeinträge sind auszuschließen, da<br />
durch die Kraftwerke mit Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträgen zu rechnen ist, während es sich bei<br />
der Kabeltrasse um Luftschadstoffemissionen der Baufahrzeuge <strong>und</strong> -geräte oder mögliche<br />
Schadstoffeinträge durch Kabeldefekte sowie bei den seeseitigen Lebensräumen um mögliche<br />
Schadstoffeinträge durch Schiffshavarien handelt. Als additive Beeinträchtigungen überschreiten<br />
die Stoffeinträge ebenfalls nicht die Erheblichkeitsschwelle, da das Kumulations-Potenzial<br />
mit Ausnahme möglicher Schiffshavarien gering ist.<br />
Für den Fischotter sind kumulative baubedingte Beeinträchtigungen durch Lärm <strong>und</strong> optische<br />
Störungen möglich. Mit kumulativen Beeinträchtigungen ist jedoch nur bei zeitgleichem Bau der<br />
Kabeltrasse <strong>und</strong> des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> zu rechnen. Da die Verlegung der Kabel lediglich eine kurzfristige<br />
Belastung darstellt <strong>und</strong> keine dauerhaften Wirkungen verursacht, ist auch bei zeitgleichem Bau
FROELICH & SPORBECK Seite 291<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
in Summation mit dem zu betrachtenden Projekt nicht von einer erheblichen kumulativen Beeinträchtigung<br />
auszugehen.<br />
Für die FFH-Fischarten können additive Beeinträchtigungen entstehen zum einen durch die<br />
betriebsbedingte Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> -einleitung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> zum anderen durch die<br />
baubedingte Sedimentaufwirbelung <strong>und</strong> Gewässertrübung aufgr<strong>und</strong> der Kabelverlegung. Jedoch<br />
wird für die FFH-Fischarten davon ausgegangen, dass den baubedingten Auswirkungen<br />
ausgewichen wird <strong>und</strong> die Lebensräume nach der Kabelverlegung wieder aufgesucht werden.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Kleinflächigkeit der betroffenen Laichareale durch die Kabelverlegung sind auch<br />
die additiven Wirkungen durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> unerheblich.<br />
Es ist davon auszugehen, dass es nicht zu Summationswirkungen kommt, die die Erheblichkeitsschwelle<br />
überschreiten.<br />
7.2.3 EWE Erdgasspeicher Moeckow<br />
Beschreibung des Projektes<br />
Der Energieversorger EWE plant in Moeckow, in der Nähe von <strong>Lubmin</strong>, einen Gasspeicher zu<br />
bauen. Dazu wird ein bis zu 1.000 Meter tiefer Salzstock mit Wasser ausgespült. Das Unternehmen<br />
EWE will über einen Zeitraum von 15 bis 30 Jahren 24 Kavernen (künstliche unterirdische<br />
Hohlräume) mit einem Hohlraumvolumen von je 500.000 m 3 anlegen. In ihnen soll Erdgas<br />
zwischengespeichert werden. Die Kavernenherstellung im Salz erfolgt durch Auflösung des<br />
Steinsalzes mit Wasser. Für diesen Prozess wird Frischwasser benötigt, welches aus der<br />
Spandowerhagener Wiek über den Kühlwassereinlauf des ehemaligen Kernkraftwerkes entnommen<br />
werden soll. An gleicher Stelle wird Frischwasser zur Konditionierung der Sole entnommen<br />
(Vertosung). Das durch den Konditionierungsprozess entstehende Salzwasser soll<br />
über das Hafenbecken <strong>Lubmin</strong> in den Greifswalder Bodden eingeleitet werden.<br />
Die minimalen Entfernungen des Vorhabensstandortes zum FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden,<br />
Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ betragen ca. 11 km. Die Anlage des eigentlichen<br />
Vorhabensstandortes ist hinsichtlich europäischer Schutzgebiete irrelevant. Problematisch<br />
ist nicht die geplante Ausspülung der Kavernen, sondern die Einleitung des salzhaltigen Spülwassers.<br />
Im Ergebnis einer gutachterlichen Bewertungen der Universität Rostock (FRÖHLE et al. 2010)<br />
können sowohl der Greifswalder Bodden als auch die Pommersche Bucht nur Salzwasser mit<br />
einer Konzentration (Salinität) vertragen, die derjenigen der Küstengewässer nahezu entspricht.<br />
Es wurde ein Wert für die Konzentration der Sole von etwa 10 PSU ermittelt. Dieser Wert bildet<br />
die Schnittmenge zwischen den ökologisch vertretbaren Auswirkungen <strong>und</strong> der zur Konditionierung<br />
erforderlichen Wassermenge von max. 75.000 m 3 /h. Eine weitere Erhöhung der Wassermenge<br />
führt nicht zu einer deutlichen weiteren Absenkung der Salzkonzentration. Nach Voruntersuchungen<br />
verschiedener Standorte besteht ausschließlich am Industriestandort <strong>Lubmin</strong> die<br />
Möglichkeit, umweltneutrales Salzwasser mit Küstenqualität zu erzeugen <strong>und</strong> schadlos einzuleiten.
FROELICH & SPORBECK Seite 292<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Nach den Angaben im Rahmenbetriebsplan (EWE 2011) benötigt die EWE zur Absicherung der<br />
technologischen Prozesse maximal 75.000 m 3 /h Frischwasser. Davon wird für die Solung der<br />
Kavernen kontinuierlich maximal 1.500 m 3 /h Frischwasser entnommen <strong>und</strong> für die Aussolung<br />
genutzt (vgl. BUCKMANN 2011). Nach Gebrauch <strong>und</strong> vor der Einleitung in den Industriehafen<br />
wird dieser mit einer Salzfracht beladene Teilstrom von max. 1.500 m 3 /h wieder mit dem zweiten<br />
Teilstrom vermischt, so dass bei der Einleitung in das Hafenbecken ein Salzgehalt von 10<br />
PSU nicht überschritten wird. Es erfolgt keine Aufwärmung des Wassers.<br />
Ermittelte projektbedingte Beeinträchtigungen<br />
Zum Projekt „Gasspeicher Moeckow. Rahmenbetriebsplan „Frischwasserentnahme <strong>und</strong> Salzwassereinleitung<br />
bei <strong>Lubmin</strong>“ Teil C 2.1“ liegt eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das<br />
FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-<br />
301) vor.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Distanzen zum Schutzgebiet <strong>und</strong> der topografiebedingten Pufferwirkungen werden<br />
Auswirkungen auf die landseitigen Lebensraumtypen des FFH-Gebietes <strong>und</strong> deren charakteristisches<br />
Arteninventar bereits im Vorfeld ausgeschlossen.<br />
Durch die Einleitung des Salzwassers über das Hafenbecken <strong>Lubmin</strong> in das küstennahe Seegebiet<br />
des Greifswalder Boddens sind vor allem Wirkungen auf die Wasserbeschaffenheit<br />
(Salzgehaltsänderungen, Änderung der Schwermetall- <strong>und</strong> Trübstoffgehalte) <strong>und</strong> hydrographische<br />
Systemparameter (Strömungsänderung) sowie damit verb<strong>und</strong>ene Auswirkungen auf die<br />
benthischen Biozönosen zu erwarten. Hinsichtlich der ein- <strong>und</strong> umgeleiteten Stofffrachten wird<br />
vorrangig von einer Betroffenheiten der im direkten Umfeld der Einleitstelle liegenden FFH-LRT<br />
1110 (Sandbank) <strong>und</strong> 1160 (Flache große Meeresarme <strong>und</strong> –buchten) ausgegangen. Negative<br />
Auswirkungen der Salzwassereinleitung auf die benthischen Lebensgemeinschaften dieser<br />
Lebensraumtypen sind für Salzgehaltserhöhungen über 9 PSU nicht völlig auszuschließen.<br />
Salzgehalte über 9 PSU werden jedoch ausschließlich im unmittelbaren Umfeld um die Einleitstelle<br />
erreicht. Diesbezügliche Ereignisse entstehen überwiegend bei Stagnationsphasen, die<br />
zu einem bestimmten Zeitpunkt betroffene Fläche beträgt dabei maximal 20 ha <strong>und</strong> die jeweilige<br />
Expositionsdauer liegt bei maximal 12 St<strong>und</strong>en. Der flächenmäßige Anteil betroffener Bereiche<br />
der jeweiligen FFH-LRT ist als sehr gering zu bezeichnen. Bei der Betrachtung der Salzgehalte<br />
im Freesendorfer See (FFH-LRT „Strandseen“ 1150*) treten maximale Salzgehalte von 8-9<br />
PSU im nordwestlichen Teil des Sees auf. Einstromereignisse aus dem Greifswalder Bodden<br />
beschränken sich jeweils auf maximal einen Tag <strong>und</strong> betreffen eine Fläche von maximal 4,6 ha<br />
(entspricht 10 % der Seefläche). Der Großteil des Lebensraums bleibt unbeeinflusst. Dies bedeutet,<br />
dass sich selbst im worst-case die Bestände sensibler Arten nur kleinräumig verschieben.<br />
Das charakteristische Arteninventar bleibt erhalten. Insgesamt kann eine signifikante Beeinträchtigung<br />
mariner FFH-LRT ausgeschlossen werden. Folglich werden auch keine<br />
relevanten Auswirkungen auf die marinen Zielarten des Schutzgebietes (Meeressäuger, Fische,<br />
Neunaugen) über die Nahrungskette erwartet.<br />
Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung der möglichen kumulativen Beeinträchtigungen<br />
Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Kühlwassernutzung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> wurden bereits abweichend<br />
von den anderen Wirkfaktoren Wechselwirkungen mit Parallelplanungen berücksich-
FROELICH & SPORBECK Seite 293<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
tigt. Als kumulierendes Projekt wurde in diesem Sinne die Nutzung von Frischwasser aus der<br />
Spandowerhagener Wiek zur Kavernenspülung am Gasspeicher Moeckow (EWE) sowie dessen<br />
Einleitung als verdünnte Sole in den Greifswalder Bodden berücksichtigt. Die kumulativen<br />
Auswirkungen auf die marinen LRT 1110, 1140 <strong>und</strong> 1160 wurden dabei als erheblich eingestuft,<br />
alle anderen Beeinträchtigungen liegen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle.<br />
Entsprechend der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden,<br />
Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-301) zum Projekt „Gasspeicher<br />
Moeckow. Rahmenbetriebsplan Frischwasserentnahme <strong>und</strong> Salzwassereinleitung bei <strong>Lubmin</strong>“<br />
(UMWELTPLAN 2010) können die kumulativen Wirkungen wie folgt beurteilt werden:<br />
Die Frischwasserentnahme <strong>und</strong> Salzwassereinleitung für den Bau des Gasspeichers Moeckow<br />
kann zu baubedingten Beeinträchtigungen der Lebensraumtypen 1110 <strong>und</strong> 1160 führen. Da<br />
diese Lebensraumtypen bereits durch die Projekte „<strong>GuD</strong> II“ <strong>und</strong> „<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“ erheblich beeinträchtigt<br />
werden, ist hier die Betrachtung von kumulativen Beeinträchtigungen irrelevant.<br />
Als additive Summationswirkung ist vor allem die Salzgehaltsänderung des Boddenwassers <strong>und</strong><br />
die damit verb<strong>und</strong>ene prognostizierte mögliche Beeinträchtigung des LRT „Strandseen“ (1150*),<br />
der Meeressäuger Kegelrobbe <strong>und</strong> Seeh<strong>und</strong> sowie der R<strong>und</strong>mäuler <strong>und</strong> Fische zu nennen.<br />
Laut FFH-Verträglichkeitsstudie werden aufgr<strong>und</strong> der Verdünnungswirkungen der Kühlwassereinleitung<br />
durch die Kraftwerke die Auswirkungen der Salzwassereinleitung der EWE auf die<br />
marinen Lebensräume des Greifswalder Boddens abgepuffert. Das Zusammenwirken der Vorhaben<br />
führt somit zur Reduzierung der Vorhabenswirkungen der Einzelfallbetrachtung des<br />
Gasspeichers Moeckow. Kumulative Wirkungen im Hinblick auf Wirkungen durch die Salzgehaltserhöhungen<br />
sind im Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Freesendorfer See demnach auszuschließen.<br />
Durch das Zusammenwirken der Frischwasserentnahme durch EWE <strong>und</strong> der Kühlwasserentnahme<br />
für die Kraftwerke werden Strömungsgeschwindigkeiten prognostiziert, die oberhalb der<br />
für Jung- <strong>und</strong> Kleinfische als kritisch erachteten Werte liegen. Um den Verlust von Jung- <strong>und</strong><br />
Kleinfischen im direkten Nahbereich des Einlaufkanals durch Einsaugen zu vermindern <strong>und</strong><br />
somit der Möglichkeit kumulativer Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes<br />
zu begegnen, planen die Vorhabensträger der Kraftwerke ein gemeinsam ausgelegtes Fischschutzkonzept,<br />
an dem sich die EWE beteiligen kann. Vor diesem Hintergr<strong>und</strong> wird eine Erheblichkeit<br />
der sich kumulativ verstärkenden Strömungsgeschwindigkeiten im direkten Nahbereich<br />
des Einlaufkanals im LRT „Ästuarien“ (1130) durch das Zusammenwirken verschiedener Projekte<br />
ausgeschlossen. In Bezug auf den LRT „Ästuarien“ sind nach FRÖHLE et al. (2010) bis auf<br />
den Wirkfaktor Salz alle anderen vorhabensbedingten Wirkfaktoren auf den Nahbereich des<br />
Einlaufkanals beschränkt. Nur dieser Wirkfaktor ist daher für den LRT 1130 von Relevanz. Im<br />
Fachgutachten der Uni Rostock (FRÖHLE et al. 2010) konnte gezeigt werden, dass in der Spandowerhagener<br />
Wiek aus dem Vorhaben keine Erhöhung der Salinität über 8 PSU (sowohl Mittel-<br />
als auch Extremwerte) resultieren kann. Die modellierten Änderungen sind so gering, dass<br />
sie innerhalb des natürlichen Schwankungsbereiches liegen <strong>und</strong> somit im „Hintergr<strong>und</strong>rauschen“<br />
praktisch nicht nachweisbar sind. In der FFH-VU zum Gasspeicher Moeckow wird geschlussfolgert,<br />
dass es keine Indikation dafür gibt, dass die Soleeinleitung zur erheblichen Beeinträchtigung<br />
von marinen Lebensraumtypen <strong>und</strong> deren charakteristischen Arteninventar in
FROELICH & SPORBECK Seite 294<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Folge des Zusammenwirkens mit dem Vorhaben <strong>GuD</strong> II sowie den ehemals geplanten Vorhaben<br />
<strong>GuD</strong> I <strong>und</strong> Steinkohlekraftwerk Greifswald führt:<br />
Nach BUCKMANN (2011) ergeben sich durch den Einfluss des EWE-Projektes aus hydrographischer<br />
Sicht folgende Wirkungen auf die Kühlwasserfahne der Kraftwerke:<br />
� Der Salzgehalt des Kühlwassers wird vor Eintritt in den Greifswalder Bodden durch die<br />
geplante Beimischung von Salz erhöht. Die von der Solewassereinleitung ausgehende<br />
haline Schichtungsneigung wird durch die Kühlwassereinleitung der Kraftwerke reduziert.<br />
� Der erhöhte Salzgehalt erhöht die Viskosität des Wassers <strong>und</strong> reduziert folglich den<br />
Wärmeabbau im Kontakt mit der Atmosphäre.<br />
� Die durch Aufwärmung um 7 K bewirkte Dichtereduzierung des Wassers kann durch eine<br />
Erhöhung des Salzgehaltes um 2 PSU in etwa ausgeglichen werden. Demnach hätte<br />
Kühlwasser, das bei Einleitung mit Salzbeigaben auf einen Gehalt von zusätzlich 2<br />
PSU angehoben wird, etwa die gleiche Dichte wie das Vorlaufwasser der Spandowerhagener<br />
Wiek, das auch ohne Kraftwerkseinfluss natürlicherweise mit dem Peenestrom<br />
in den Greifswalder Bodden gelangt.<br />
� Da der Salzgehalt des zur Spülung genutzten Wassers im Vorlauf saisonal stark<br />
schwankt, schwankt auch der zusätzliche Salzeintrag aus der Sole stark <strong>und</strong> liegt im<br />
Bereich von 400-500 t/h. Die verfahrensgeb<strong>und</strong>ene Salzeinleitung ist auf 10 PSU für<br />
75.000 m 3/ /h begrenzt.<br />
� Die Ausbreitung der Kühlwasserfahnen wird durch die Dichtedifferenzen zwischen den<br />
eingeleiteten Kühlwasserfahnen <strong>und</strong> dem umgebenden Boddenwasser beeinflusst. Bei<br />
den einzelnen Kühlwasserlastfällen ergeben sich unterschiedliche Dichtedifferenzen<br />
zwischen dem Kühlwasser <strong>und</strong> dem Boddenwasser <strong>und</strong> somit auch unterschiedliche<br />
Ausbreitungsmuster der Kühlwasserfahnen.<br />
� In den Salzproben der Kavernen sind 0,0043 % wasserunlösliche Stoffe, hauptsächlich<br />
Anhydrit nachgewiesen worden (MENGEL 2010). Diese Stoffe würden sich rechnerisch,<br />
je nach Salzgehalt des Spülwassers aus der Spandowerhagener Wiek zu Tageswerten<br />
zwischen 4 <strong>und</strong> 5 t summieren. Nach den Antragsunterlagen der EWE verbleiben diese<br />
Stoffe aber im Kavernensumpf <strong>und</strong> gelangen nicht in den Greifswalder Bodden, weshalb<br />
dieser Pfad hier nicht betrachtet werden muss.<br />
Falls die geplanten Kraftwerke zeitgleich mit dem EWE-Projekt in Betrieb sind, kann die Deckung<br />
des Wasserbedarfs teilweise aus erwärmtem Kühlwasser erfolgen. Im Planfeststellungsbeschluss<br />
Moeckow wird eine solche Betriebsvariante als mögliche Korrekturmaßnahme bei<br />
gleichzeitigem Betrieb von Soleeinleitung <strong>und</strong> Kühlwassereinleitungen genannt, aber nicht näher<br />
ausgeführt. In der Betriebsvariante „Kühlwasser“ (EWE_KW) würde nur eine Wassermenge<br />
von max. 1.500 m 3 pro St<strong>und</strong>e als Frischwasser aus der Spandowerhagener Wiek entnommen,<br />
für die Aussolung der Kavernen genutzt <strong>und</strong> anschließend mit 73.500 m 3 /h erwärmten Kühlwasser<br />
verdünnt <strong>und</strong> in den Greifswalder Bodden eingeleitet (vgl. BUCKMANN 2011). Die sum-
FROELICH & SPORBECK Seite 295<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
mativen Auswirkungen bei dieser Betriebsvariante können anhand der Kühlwasserprognosen<br />
der Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8 (vgl. BUCKMANN 2011) abgeschätzt werden. Die potenziellen kumulativen<br />
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes bei der Betriebsvariante „Kühlwasser“<br />
werden im Folgenden vergleichend zur Betriebsvariante „Frischwasser“ dargestellt.<br />
Bei den Kühlwassersimulationen für die Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8 (BUCKMANN 2011) werden die drei<br />
Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow (Kühlwasservariante) berücksichtigt. Bei<br />
diesen Lastfällen wird maximal 260.000 m 3 /h Kühlwasser aus der Spandowerhagener Wiek<br />
entnommen <strong>und</strong> mit einer Aufwärmspanne von maximal 7,0 K sowie einer maximalen Salzgehaltsänderung<br />
von 5,88 PSU über den Industriehafen in den Greifswalder Bodden eingeleitet.<br />
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die ermittelten Kühlwasser-Enveloppen bei<br />
diesen Lastfällen (unter Berücksichtigung der drei am Standort geplanten Vorhaben <strong>GuD</strong> II,<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> <strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow).<br />
Tab. 80: Flächenberechnung der Kühlwasserfahnen <strong>und</strong> Salzkonzentrationsänderungen<br />
bei den Lastfällen 7 <strong>und</strong> 8 am Standort <strong>Lubmin</strong> in ha (nach Buckmann 2011)<br />
Temperaturdifferenz<br />
/<br />
Differenz<br />
Salzkonzentration<br />
LF 7 (Winterszenario) in ha LF 8 (Sommerszenario) in ha<br />
Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht Oberflächenschicht<br />
Bodenschicht<br />
0,20 - 1,00 K 321 302 371 336<br />
1,01 - 2,00 K 119 113 138 128<br />
2,01 - 3,00 K 60 56 77 73<br />
3,01 - 4,00 K 41 39 41 42<br />
4,01 - 5,00 K 35 33 26 24<br />
5,01 - 6,00 K 67 (max. 5,78 K) 67 (max. 5,78 K) 3 (max. 5,49 K) 3 (max. 5,42 K)<br />
Summe 643 610 656 606<br />
0,50 - 1,00 PSU 785 509 701 528<br />
1,01 - 1,50 PSU 158 50 298 (max. -1,41<br />
PSU)<br />
1,51 - 2,00 PSU 25 (max. -1,66<br />
PSU)<br />
181 (max. -1,37<br />
PSU)<br />
9 (max. -1,66 PSU) - -<br />
Summe 968 568 999 709<br />
Anmerkung: Ohne Industriehafen <strong>und</strong> Yachthafen<br />
Betrachtet man die Ausdehnung der Kühlwasserfahnen (Gesamt-Enveloppe für Temperaturerhöhungen<br />
>0,2 K) der Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8 im Vergleich zu den Lastfällen 11 <strong>und</strong> 12, so ergeben<br />
sich nur vergleichsweise geringe Unterschiede. Im Vergleich zu den betrachteten Lastfällen im<br />
EWE-Betriebsfall „Frischwasser“ werden bei den Lastfällen 7 <strong>und</strong> 8 (EWE-Betriebsfall „Kühlwasser“)<br />
jedoch deutlich stärkere Temperaturerhöhungen erwartet, da die abkühlende Wirkung<br />
des nicht erwärmten Frischwasserteilstroms wegfällt. Nach den Prognosen von BUCKMANN<br />
(2011) sind bei diesen Kühlwasser-Lastfällen maximal 5,78 K (zum Vergleich bei LF 11: 2,9 K) im<br />
winterlichen Szenario <strong>und</strong> max. 5,49 K (zum Vergleich bei LF 12: 4,5 K) Aufwärmung im sommerlichen<br />
Szenario möglich. Im Winter-Szenario weist die Kühlwasserfahne (>0,2 K) beim Lastfall 11<br />
eine deutlich geringere Ausdehnung in der Oberflächenschicht auf (472 ha) als beim LF 7<br />
(643 ha). Gleiches gilt für die Bodenschicht. In den Sommerszenarien (LF 12 versus LF 8) sind<br />
die Unterschiede in Bezug auf die Gesamtfläche der Kühlwasserfahne geringer. Während sich
FROELICH & SPORBECK Seite 296<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
das Abwasser im Lastfall 8, das bei der Einleitung eine um ca. 2,0 kg/m 3 geringere Dichte als das<br />
Boddenwasser besitzt, im Wesentlichen in den obersten 2 Metern der Wassersäule einschichtet,<br />
werden beim Lastfall 12 mit einer nur um ca. 1,9 kg/m 3 geringeren Dichte auch größere Mengen<br />
des eingeleiteten Wassers bodennah verdriftet. Dementsprechend sind im LF 12 größere Bereiche<br />
der Bodenschicht durch eine Temperaturerhöhung betroffen als beim LF 8, wobei die Absolutwerte<br />
der Temperaturerhöhung bei der Kühlwasservariante des LF 8 jedoch höher sind. Unter<br />
den von BUCKMANN (2011) untersuchten Lastfällen weisen zwar die Kühlwasserfahnen der LF 11<br />
<strong>und</strong> 12 (EWE-Kühlwasservariante) die geringsten Flächenverbrauche an der Oberfläche auf. Im<br />
Gegensatz zu den meisten anderen Lastfällen dringt die Abwasserfahne dieser Lastfälle jedoch<br />
bis in Tiefen von 8-10 m vor, wobei allerdings nur bis in Tiefen von 4-6 m Temperaturdifferenzen<br />
zum Boddenwasser vorkommen <strong>und</strong> nur bis zu Tiefen von 6-8 m Salzgehaltsveränderungen zu<br />
erwarten sind. Nach BUCKMANN (ebd.) sind die Dichteverhältnisse des eingeleiteten Abwassers,<br />
die der Wasserdichte des Greifswalder Boddens sehr nahe kommen, für dieses veränderte Ausbreitungsverhalten<br />
bestimmend. Dadurch bestimmt der Salzgehalt das Verhalten des einfließenden<br />
Wassers im zeitlichen Ablauf stärker als die Aufwärmspanne. Die Wasserfahne wird vertikal<br />
homogener, dies führt dazu, dass der oberflächennah wirkende Ausbreitungseffekt des Windes<br />
die Kühlwasserfahne weniger stark beeinflusst, als im Fall einer nur oberflächennah aufliegenden<br />
dünnen Wasserschicht. Bei einer stärkeren Vermischung des Kühlwassers mit dem Wasser des<br />
Greifswalder Boddens wird gleichzeitig ein effektiver <strong>und</strong> schneller Wärmeabbau an der Wasseroberfläche<br />
verhindert. Aus den Szenarien von BUCKMANN (2011) ergeben sich bei den Lastfällen<br />
7 <strong>und</strong> 8 negative Salzgehaltsanomalien von maximal -1,66 PSU am Eingang des Industriehafens.<br />
Die Ausbreitung der Aussüßungsfahne erfolgt innerhalb der oberen 2 m der Wassersäule<br />
vorwiegend küstenparallel nach Südwesten bis zur Dänischen Wiek, aber auch in zungenförmigen<br />
Abschnitten nach Norden <strong>und</strong> Osten bis etwa zur Insel Ruden (vgl. Abb. 15 <strong>und</strong> Abb. 18 in<br />
BUCKMANN 2011). Die folgende Abbildung stellt die relevanten Wirkzonen der Kühlwassereinleitung<br />
der Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8 dar. Dabei werden die prognostizierten Änderungen der Parameter<br />
Temperatur <strong>und</strong> Salzgehalt berücksichtigt, die vor dem Hintergr<strong>und</strong> der natürlichen Schwankungen<br />
als nachweisbar angesehen werden (Temperaturänderungen � 1 K, Salzgehaltsänderungen<br />
� ± 0,5 PSU).
FROELICH & SPORBECK Seite 297<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Abb. 5: Wirkzonen der Kühlwassereinleitung (Enveloppe aus Lastfall 7 <strong>und</strong> 8, Buckmann<br />
2011)<br />
Während die Lage <strong>und</strong> Ausdehnung der Wirkzonen relevanter Temperaturänderungen � 1 K bei<br />
den Lastfällen 7/8 <strong>und</strong> 11/12 (vgl. Zugehörige Planunterlagen, Karte 2) in etwa vergleichbar sind,<br />
sind bei der Größe <strong>und</strong> Ausdehnung der Aussüßungsfahne deutliche Unterschiede zwischen den<br />
beiden Lastfallpaaren zu erkennen. Bei den Lastfällen 7/8 reicht der Bereich mit relevanten Salzgehaltsänderungen<br />
� ± 0,5 PSU in nordöstlicher Richtung <strong>und</strong> nordwestlicher Richtung deutlich<br />
über die Ausdehnung der Lastfälle 11/12 hinaus.<br />
Eine Quantifizierung der im worst case zu erwartenden graduellen Beeinträchtigungen der Vorkommen<br />
mariner Lebensraumtypen kann anhand des vorgestellten Bewertungsmodells vorgenommen<br />
werden. Die Ergebnisse werden in der folgenden Tabelle dargestellt:
FROELICH & SPORBECK Seite 298<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 81: Durch Kühlwassereinleitung betroffene Flächen <strong>und</strong> ermittelte Äquivalenzwerte (betroffene Fläche x gradueller Funktionsverlust)<br />
Betroffene Flächen<br />
Delta-T<br />
für den Vergleich mit dem lebensraumspezifischen Orientierungswert nach Lambrecht & Trautner (2007B) für die Lastfälle 7 <strong>und</strong> 8<br />
Delta – S<br />
(in PSU)<br />
LRT 1110 LRT 1130 LRT 1140 LRT 1150 LRT 1160<br />
LF 7 (ha) LF 8 (ha) LF 7 (ha) LF 8 (ha) LF 7 (ha) LF 8 (ha) LF 7 (ha) LF 8 (ha) LF 7 (ha) LF 8 (ha)<br />
0-1 K -0,5 - -1 36 90 0 0 52 84 0 0 108 39<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 93 180<br />
1-2 K 0 - -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
-0,5 - -1 43 43 0 0 22 26 0 0 42 16<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 54<br />
2-3 K -0,5 - -1 21 25 0 0 2 0 0 0 27 18<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33<br />
3-4 K -0,5 - -1 12 12 0 0 0 0 0 0 17 9<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 20<br />
4-5 K -0,5 - -1 9 6 0 0 0 0 0 0 10 8<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12<br />
5-6 K -0,5 - -1 12 0 0 0 0 0 0 0 14 1<br />
Ermittelte Äquivalenzwerte<br />
-1- -2 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1<br />
Anzusetzender Wert LRT 1110 LRT 1130 LRT 1140 LRT 1150 LRT 1160<br />
0-1 K -0,5 - -1 0 0 25,2 0 27<br />
-1- -2 0 0 0 0 72<br />
1-2 K 0 - -0,5 0 0 0 0 0<br />
-0,5 - -1 17,2 0 7,8 0 12,6<br />
-1- -2 0 0 0 0 21,6<br />
2-3 K -0,5 - -1 10 0 0,6 0 8,1
FROELICH & SPORBECK Seite 299<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
-1- -2 0 0 0 0 14,85<br />
Anzusetzender Wert LRT 1110 LRT 1130 LRT 1140 LRT 1150 LRT 1160<br />
3-4 K -0,5 - -1 5,4 0 0 0 6,8<br />
-1- -2 0 0 0 0 10<br />
4-5 K -1- -2 4,05 0 0 0 5,5<br />
5-6 K -1- -2 0 0 0 0 26,65 SUMME<br />
SUMME (ha) 36,65 0 33,6 0 205,1 275,35<br />
Aufteilung<br />
prozentual<br />
(ha) 15,76 20,89 0,00 0,00 14,45 19,15 0,00 0,00 88,19 116,91 156,95<br />
auf Vorhaben<br />
GUD II<br />
(43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)<br />
GUD II<br />
(43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)<br />
GUD II<br />
(43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)<br />
GUD II<br />
(43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)<br />
GUD II<br />
(43%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)<br />
GUD<strong>III</strong><br />
(57%)
FROELICH & SPORBECK Seite 300<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Im Vergleich zu den Lastfällen der Betriebsvariante „Frischwasser“ (Gesamtäquivalenzwert von<br />
126,94 ha) ergibt sich bei den Lastfällen 7 <strong>und</strong> 8 ein deutlich höherer Äquivalenzwert von<br />
275,35 ha. Während die graduellen Beeinträchtigungen des LRT 1110 (Sandbänke) bei beiden<br />
Varianten etwa gleich bewertet werden, sind bei den LRT 1160 <strong>und</strong> 1140 deutliche Unterschiede<br />
zu erkennen. Beim LRT Windwatt (1130) ist der berechnete Äquivalenzwert bei der Kühlwasservariante<br />
knapp 10mal höher als bei der Frischwasservariante, beim LRT Flachwasserbereiche<br />
(1160) ist der Wert etwa 2,4mal so hoch wie der Äquivalenzwert bei der Frischwasservariante.<br />
Entsprechend dem Bewertungsmodell, das auf den Veränderungen der Standortparameter Salzgehalt<br />
<strong>und</strong> Temperaturerhöhung basiert, wäre somit die betrachtete Betriebsvariante „Frischwasser“<br />
mit deutlich geringeren Beeinträchtigungen der Vorkommen mariner Lebensraumtypen<br />
verb<strong>und</strong>en als die Betriebsvariante „Kühlwasser“. Als Korrekturmaßnahme zur Verringerung der<br />
vorhabensbedingten Beeinträchtigungen scheint die Betriebsvariante „Kühlwasser“ daher nicht<br />
geeignet zu sein. Im Hinblick auf die Kühlwasserentnahme <strong>und</strong> die Nährstoffumleitung sind<br />
dagegen geringere Beeinträchtigungen bei der Betriebsvariante „Kühlwasser“ zu erwarten, da<br />
eine geringere Wassermenge aus der Spandowerhagener Wiek entnommen wird. Auch bei<br />
dieser Betriebsvariante würde also die Erheblichkeitsschwelle in Bezug auf Beeinträchtigungen<br />
des LRT Ästuarien nicht überschritten.<br />
In Bezug auf die kumulativen Wirkungen der Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>, <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> EWE können<br />
somit bei beiden Betriebsvarianten bei den Lebensraumtypen 1110, 1140 <strong>und</strong> 1160 erhebliche<br />
Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Die Summationswirkungen wurden<br />
bereits im Rahmen der vorliegenden Unterlage betrachtet.
FROELICH & SPORBECK Seite 301<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 82: Kumulative Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Use-<br />
dom“ durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte<br />
Kumulative <strong>und</strong> additive<br />
Beeinträchtigungen<br />
des FFH-Gebietes<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des<br />
Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
(DE 1747-301)<br />
Lebensraumtypen (incl. ihrer charakteristischen Arten)<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie<br />
1110 Sandbänke<br />
1130 Ästuarien<br />
1140 Watt<br />
1150* Strandseen<br />
1160 Meeresarme<br />
<strong>und</strong> -buchten<br />
1210 Spülsäume<br />
1230 Fels- <strong>und</strong> Steilküsten<br />
1310 Pioniervegetation<br />
Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong><br />
baubedingt<br />
anlagebedingt<br />
betriebsbedingt<br />
Lärmimmissionen x x x<br />
Optische Störungen<br />
Barrierewirkung / Trennwirkung<br />
Barrierewirkung / Trennwirkung<br />
Kollisionsrisiko x x x x<br />
Optische Störungen<br />
Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge<br />
1330 Salzgrünland<br />
2110 Primärdünen<br />
2120 Weißdünen<br />
2130* Graudünen<br />
1) , 2)<br />
2180 Küstendünen<br />
2190 Dünentäler<br />
3150 Natürliche eutrophe<br />
Seen<br />
6230* Borstgrasrasen<br />
6410 Pfeifengras-<br />
Wiesen<br />
7140 Übergangsmoore<br />
9110 Hainsimsen--<br />
Buchenwald<br />
9190 Eichenwälder<br />
x X x x x x x<br />
Arten<br />
nach Anhang II der FFH-RL<br />
Kühlwasserentnahme u. Einleitung X x X x X x x x x x x x x x x x<br />
Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes durch das „Umspannwerk der Arkona Windpark Entwicklungsgesellschaft GmbH inkl. Erdkabel“<br />
bau Flächeninanspruchnahme x x x<br />
bau Sedimentaufwirbelung / Trübung x x x x x x x x x<br />
Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes durch die „Kabeltrasse des Windparks Ventotec Ost 2 <strong>und</strong> Arkonabecken Südost“<br />
Kegelrobbe/ Seeh<strong>und</strong><br />
Fischotter<br />
Teichfledermaus<br />
Großes Mausohr<br />
Meerneunauge<br />
Flussneunauge<br />
Rapfen<br />
Atlantischer Stör<br />
Finte<br />
Bitterling<br />
Große Moosjungfer<br />
Sumpfglanzkraut
FROELICH & SPORBECK Seite 302<br />
Kumulative <strong>und</strong> additive<br />
Beeinträchtigungen<br />
des FFH-Gebietes<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des<br />
Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
(DE 1747-301)<br />
bau<br />
Lärmimmissionen / optische Störungen<br />
Lebensraumtypen (incl. ihrer charakteristischen Arten)<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie<br />
1110 Sandbänke<br />
1130 Ästuarien<br />
1140 Watt<br />
1150* Strandseen<br />
1160 Meeresarme<br />
<strong>und</strong> -buchten<br />
1210 Spülsäume<br />
1230 Fels- <strong>und</strong> Steilküsten<br />
1310 Pioniervegetation<br />
1330 Salzgrünland<br />
2110 Primärdünen<br />
2120 Weißdünen<br />
2130* Graudünen<br />
2180 Küstendünen<br />
2190 Dünentäler<br />
3150 Natürliche eutrophe<br />
Seen<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
6230* Borstgrasrasen<br />
6410 Pfeifengras-<br />
Wiesen<br />
7140 Übergangsmoore<br />
9110 Hainsimsen--<br />
Buchenwald<br />
9190 Eichenwälder<br />
Arten<br />
nach Anhang II der FFH-RL<br />
bau Flächeninanspruchnahme x x x x x x x x x x<br />
bau Sedimentaufwirbelung / Trübung x x x x x x x x<br />
bau Schadstoffimmissionen x x x x<br />
be Sedimentaufwirbelung / Trübung x x x x x x x x<br />
Beeinträchtigung der maßgeblichen Bestandteile des Schutzgebietes durch die „Frischwasserentnahme <strong>und</strong> die Salzwassereinleitung bei <strong>Lubmin</strong>“ durch das Projekt „Gasspeicher<br />
Moeckow“ (Betriebsvariante Frischwasser <strong>und</strong> Betriebsvariante Kühlwasser)<br />
bau Salzgehaltsänderung x x x x x x x x x<br />
bau Schadstoffeintrag (Schwermetalle) x x x x x x x x<br />
bau Trübungsfahnen x x x x x x x x<br />
bau Strömungsänderung x x<br />
Legende<br />
bau = baubedingte Beeinträchtigung<br />
anl = anlagebedingte Beeinträchtigung<br />
be = betriebsbedingte Beeinträchtigung<br />
1) = hinsichtlich der Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge summative Betrachtung mit dem Vorhaben <strong>GuD</strong> II<br />
2) = hinsichtlich der Kühlwassereinleitung <strong>und</strong> -entnahme summative Betrachtung mit den Vorhaben <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow<br />
x = nicht erheblich beeinträchtigt<br />
X = erheblich beeinträchtigt<br />
Kegelrobbe/ Seeh<strong>und</strong><br />
Fischotter<br />
x<br />
Teichfledermaus<br />
Großes Mausohr<br />
Meerneunauge<br />
Flussneunauge<br />
Rapfen<br />
Atlantischer Stör<br />
Finte<br />
Bitterling<br />
Große Moosjungfer<br />
Sumpfglanzkraut
FROELICH & SPORBECK Seite 303<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Tab. 83: Zusammenfassung der Beurteilung der kumulativen Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte<br />
Zusammenfassung der Beurteilung der kumulativen Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte:<br />
Kumulative Beeinträchtigungen<br />
des FFH-Gebietes<br />
„Greifswalder Bodden, Teile<br />
des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ (DE 1747-301)<br />
Lebensraumtypen (incl. ihrer charakteristischen Arten)<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie<br />
1110 Sandbänke<br />
1130 Ästuarien<br />
1140 Watt<br />
1150* Strandseen<br />
1160 Meeresarme<br />
<strong>und</strong> -buchten<br />
1210 Spülsäume<br />
1230 Fels- <strong>und</strong> Steilküsten<br />
1310 Pioniervegetation<br />
1330 Salzgrünland<br />
2110 Primärdünen<br />
2120 Weißdünen<br />
2130* Graudünen<br />
2180 Küstendünen<br />
2190 Dünentäler<br />
3150 Natürliche eutrophe<br />
Seen<br />
6230* Borstgrasrasen<br />
6410 Pfeifengras-<br />
Wiesen<br />
7140 Übergangsmoore<br />
9110 Hainsimsen--<br />
Buchenwald<br />
9190 Eichenwälder<br />
Arten<br />
nach Anhang II der FFH-RL<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> – Kraftwerk 1), 2) X x X x X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x<br />
Umspannwerk der Arkona Windpark<br />
inkl. Erdkabel<br />
Kabeltrasse des Windparks Ventotec<br />
Ost 2 <strong>und</strong> Arkonabecken Südost<br />
Gasspeicher Moeckow<br />
Var. Kühlwasser <strong>und</strong> Var. Frischwasser<br />
x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x x x x x<br />
x x x x x x x x x<br />
Summationswirkungen möglich � � � � � � � � � � � �<br />
Beeinträchtigung in Summation + + + + + + + + + + + +<br />
Schadensbegrenzungsmaßnahme<br />
Beeinträchtigung in Summation<br />
(nach Schadensbegrenzungsmaßnahme)<br />
Kegelrobbe/ Seeh<strong>und</strong><br />
Fischotter<br />
Teichfledermaus<br />
Großes Mausohr<br />
Meerneunauge<br />
Flussneunauge<br />
Rapfen<br />
Atlantischer Stör<br />
Finte<br />
Bitterling<br />
Große Moosjungfer<br />
Sumpfglanzkraut
FROELICH & SPORBECK Seite 304<br />
Zusammenfassung der Beurteilung der kumulativen Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten durch andere Pläne <strong>und</strong> Projekte:<br />
Kumulative Beeinträchtigungen<br />
des FFH-Gebietes<br />
„Greifswalder Bodden, Teile<br />
des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom“ (DE 1747-301)<br />
Lebensraumtypen (incl. ihrer charakteristischen Arten)<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie<br />
1110 Sandbänke<br />
1130 Ästuarien<br />
1140 Watt<br />
1150* Strandseen<br />
1160 Meeresarme<br />
<strong>und</strong> -buchten<br />
1210 Spülsäume<br />
1230 Fels- <strong>und</strong> Steilküsten<br />
1310 Pioniervegetation<br />
1330 Salzgrünland<br />
2110 Primärdünen<br />
2120 Weißdünen<br />
2130* Graudünen<br />
2180 Küstendünen<br />
2190 Dünentäler<br />
3150 Natürliche eutrophe<br />
Seen<br />
6230* Borstgrasrasen<br />
6410 Pfeifengras-<br />
Wiesen<br />
7140 Übergangsmoore<br />
9110 Hainsimsen--<br />
Buchenwald<br />
Legende<br />
1) = hinsichtlich der Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefeleinträge summative Betrachtung mit dem Vorhaben <strong>GuD</strong> II<br />
2) = hinsichtlich der Kühlwassereinleitung <strong>und</strong> -entnahme summative Betrachtung mit den Vorhaben <strong>GuD</strong> II <strong>und</strong> Gasspeicher Moeckow<br />
x = nicht erheblich beeinträchtigt<br />
X = erheblich beeinträchtigt<br />
� = Summationswirkungen die zur Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle führen können, sind nicht auszuschließen.<br />
+ = auch in Summation nicht erheblich beeinträchtigt<br />
+ = in Summation erheblich beeinträchtigt<br />
M = Maßnahme zur Schadensbegrenzung für kumulative Beeinträchtigungen<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
9190 Eichenwälder<br />
Arten<br />
nach Anhang II der FFH-RL<br />
Kegelrobbe/ Seeh<strong>und</strong><br />
Fischotter<br />
Teichfledermaus<br />
Großes Mausohr<br />
Meerneunauge<br />
Flussneunauge<br />
Rapfen<br />
Atlantischer Stör<br />
Finte<br />
Bitterling<br />
Große Moosjungfer<br />
Sumpfglanzkraut
FROELICH & SPORBECK Seite 305<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
7.3 Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für kumulative Beein-<br />
trächtigungen<br />
Bzgl. möglicher kumulativer Wirkungen hinsichtlich der Vorkommen der Lebensraumtypen des<br />
Anhangs I <strong>und</strong> Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit anderen Plänen <strong>und</strong> Projekten<br />
konnten mehrere Projekte ermittelt <strong>und</strong> diesbezüglich geprüft werden. Die kumulativen Beeinträchtigungen<br />
durch das Zusammenwirken mit dem Vorhaben <strong>GuD</strong> II (EnBW), das aufgr<strong>und</strong> der<br />
Genehmigungssituation am Standort als Vorbelastung betrachtet wurde, erfolgte bereits im<br />
Rahmen der Einzelbewertung des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> in den Kapitel 5.3. <strong>und</strong> 5.4. Die kumulative Wirkung<br />
der Stickstoffeinträge der Vorhaben <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> (<strong>EWN</strong>) <strong>und</strong> <strong>GuD</strong> II (EnBW) führt zu einer erheblichen<br />
Beeinträchtigung des LRT 2180 „Bewaldete Küstendünen“. Wie in Kap. 6 dargestellt, ist<br />
nach Auskunft des Vorhabensträgers eine weitere Reduzierung der Depositionen technisch<br />
nicht möglich.<br />
Die Prüfung der weiteren Vorhaben ergab, dass z. T. geringfügige Summations- bzw. Synergieeffekte<br />
nicht ausgeschlossen werden können. Die Erheblichkeitsschwelle für durch das Vorhaben<br />
„Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“ nicht erheblich beeinträchtige maßgebliche Bestandteile<br />
des Schutzgebietes wird allerdings aufgr<strong>und</strong> kumulativer Wirkungen nicht überschritten.<br />
Da keine zusätzlichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen aufgr<strong>und</strong> kumulativer<br />
Wirkungen festgestellt wurden, sind keine Maßnahmen zur Schadensbegrenzung für<br />
kumulative Beeinträchtigungen erforderlich.
FROELICH & SPORBECK Seite 306<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
8 Gesamtübersicht über Beeinträchtigungen durch das<br />
Vorhaben <strong>und</strong> andere zusammenwirkende Pläne <strong>und</strong><br />
Projekte<br />
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der in den Kap. 5 bis 7 durchgeführten<br />
Untersuchungen bzgl. der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen sowie zu Beeinträchtigungen<br />
durch andere zusammenwirkende Pläne <strong>und</strong> Projekte. Die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen<br />
bzgl. der Lebensraumtypen des Anhangs I <strong>und</strong> Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten des Anhangs II<br />
der FFH-Richtlinie (maßgebliche Bestandteile für die Erhaltungsziele) wird daraus abgeleitet.<br />
Tab. 84: Zusammenfassung der vorhabensbedingten <strong>und</strong> kumulativen Beeinträchtigungen<br />
der maßgeblichen Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten des Schutzgebietes sowie<br />
der evtl. notwendigen „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“<br />
Maßgebliche Lebensraumtypen bzw. Arten Erheblichkeit<br />
der<br />
Beeinträchtigung<br />
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger Über-<br />
spülung durch Meerwasser (1110)<br />
Ästuarien (1130) nicht<br />
erheblich<br />
Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong><br />
Mischwatt (1140)<br />
Strandseen der Küste (Lagunen) (1150*) nicht<br />
erheblich<br />
Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten<br />
(Flachwasserzonen) (1160)<br />
Spülsäume des Meeres mit Vegetation aus<br />
einjährigen Arten (1210)<br />
Atlantik-Felsküsten <strong>und</strong> Ostsee-Fels- <strong>und</strong><br />
Steilküsten mit Vegetation (1230)<br />
Pioniervegetation mit Salicornia <strong>und</strong> anderen<br />
einjährigen Arten auf Schlamm <strong>und</strong> Sand<br />
(Queller-Watt) (1310)<br />
Salzgrünland des Atlantiks, der Nord- <strong>und</strong> Ostsee<br />
mit Salzschwaden-Rasen (1330)<br />
M Kumulative<br />
Beeinträchtigung<br />
erheblich -- erheblich 1)<br />
M Erheblichkeit<br />
der Beeinträchtigung<br />
-- erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
erheblich -- erheblich 1) -- erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
erheblich -- erheblich 1) -- erheblich<br />
nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
keine -- keine -- keine<br />
nicht<br />
erheblich<br />
nicht<br />
erheblich<br />
Primärdünen (2110) nicht<br />
erheblich<br />
Weißdünen mit Strandhafer (2120) nicht<br />
erheblich<br />
Graudünen der Küsten mit krautiger Vegetation<br />
(2130*)<br />
nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich
FROELICH & SPORBECK Seite 307<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Maßgebliche Lebensraumtypen bzw. Arten Erheblichkeit<br />
der<br />
Beeinträchtigung<br />
Bewaldete Küstendünen der atlantischen, kontinentalen<br />
<strong>und</strong><br />
borealen Region (2180)<br />
nicht<br />
erheblich<br />
Feuchte Dünentäler (2190) nicht<br />
erheblich<br />
Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation<br />
vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition<br />
(3150)<br />
Artenreiche Borstgrasrasen montan (<strong>und</strong> submontan<br />
auf dem europäischen Festland)<br />
(6230*)<br />
Pfeifengras-Wiesen auf kalkreichen Boden <strong>und</strong><br />
Lehmboden (6410)<br />
M Kumulative<br />
Beeinträchtigung<br />
-- erheblich 2)<br />
M Erheblichkeit<br />
der Beeinträchtigung<br />
-- erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
keine -- keine -- nicht<br />
nicht<br />
erheblich<br />
nicht<br />
erheblich<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
Übergangs- <strong>und</strong> Schwingrasenmoore (7140) keine -- keine -- keine<br />
Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)<br />
(9110)<br />
Alte bodensaure Eichenwälder mit Quercus<br />
robur auf Sandebenen (9190)<br />
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie<br />
nicht<br />
erheblich<br />
nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
-- keine -- nicht<br />
erheblich<br />
Sumpfglanzkraut (1903) keine -- keine -- keine<br />
Fischotter (1355) nicht<br />
erheblich<br />
Kegelrobbe (1364) nicht<br />
erheblich<br />
Seeh<strong>und</strong> (1365) nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
Großes Mausohr (1324) keine -- keine -- keine<br />
Teichfledermaus (1318) keine -- keine -- keine<br />
Bitterling (1134) keine -- keine -- keine<br />
Stör (1101) nicht<br />
erheblich<br />
Finte (1103) nicht<br />
erheblich<br />
Rapfen (1130) nicht<br />
erheblich<br />
Flussneunauge (1099) nicht<br />
erheblich<br />
Meerneunauge (1095) nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
-- geringfügig -- nicht<br />
erheblich<br />
Schmale Windelschnecke (1014) keine -- keine -- keine<br />
Bauchige Windelschnecke (1016) keine -- keine -- keine
FROELICH & SPORBECK Seite 308<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Maßgebliche Lebensraumtypen bzw. Arten Erheblichkeit<br />
der<br />
Beeinträchtigung<br />
M Kumulative<br />
Beeinträchtigung<br />
M Erheblichkeit<br />
der Beeinträchtigung<br />
Große Moosjungfer (1042) keine -- keine -- keine<br />
Großer Feuerfalter (1060) keine -- keine -- keine<br />
Legende:<br />
* = prioritärer Lebensraumtyp<br />
M = Maßnahmen zur Schadensbegrenzung:<br />
1) summativ mit den Wirkungen des <strong>GuD</strong> II (EnBW) <strong>und</strong> des Gasspeichers Moeckow (EWE)<br />
2) summativ mit den Wirkungen des <strong>GuD</strong> II (EnBW)
FROELICH & SPORBECK Seite 309<br />
9 Zusammenfassung<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die <strong>EWN</strong> – ENERGIEWERKE NORD GMBH beabsichtigt, auf Flächen des B-Plans Nr. 1 „Industrie-<br />
<strong>und</strong> Gewerbegebiet <strong>Lubmin</strong>er Heide“ in der Planungshoheit des Zweckverbandes „<strong>Lubmin</strong>er<br />
Heide“, die Genehmigungsvoraussetzungen für die Errichtung <strong>und</strong> den Betrieb eines Gas- <strong>und</strong><br />
<strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> zu erreichen.<br />
Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung betrachtete Maßnahme „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb<br />
eines Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> (<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>)“ liegt in unmittelbarer Nähe (jedoch außerhalb)<br />
des FFH-Gebietes „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
(DE 1747-301). Die Kühlwasserfahne des <strong>GuD</strong>-Kraftwerkes sowie sonstige Einträge aus<br />
dem Kraftwerk befinden sich innerhalb des Schutzgebietes – Beeinträchtigungen im Sinne des<br />
Artikels 6, Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG (bzw. § 34 BNatSchG) konnten auf der Gr<strong>und</strong>lage<br />
der bisher durchgeführten Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage der vorhandenen ökologischen <strong>und</strong> technischen Daten wurde in der vorliegenden<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung geprüft, ob das Vorhaben „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb<br />
des Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>“ das NATURA-2000-Gebiet in seinen für die<br />
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen<br />
kann (§ 34 Abs. 1 BNatSchG).<br />
Bei der Analyse <strong>und</strong> Bewertung der Konflikte, die durch das Vorhaben ausgelöst werden können,<br />
wurden für den worst-case Beeinträchtigungen für 4 Erhaltungsziele ermittelt.<br />
Folgende Lebensraumtypen des Anhangs I werden erheblich beeinträchtigt:<br />
- Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser (EU-<br />
Code 1110)<br />
- Vegetationsfreies Schlick-, Sand- <strong>und</strong> Mischwatt (EU-Code 1140)<br />
- Flache große Meeresarme <strong>und</strong> -buchten (Flachwasserzonen) (EU-Code 1160)<br />
- Bewaldete Küstendünen (EU-Code 2180)<br />
Die erhebliche Beeinträchtigung des LRT 2180 resultiert aus kumulativen Stickstoff-Einträgen<br />
des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> (<strong>EWN</strong>) zusammen mit dem <strong>GuD</strong> II (EnBW). Betroffen ist eine Fläche von 50 ha. Da<br />
die summativen Zusatzbelastungen durch die beiden <strong>GuD</strong> (II <strong>und</strong> <strong>III</strong>) nur geringfügig über der<br />
formalen Irrelevanzschwelle liegen, wird die erhebliche Beeinträchtigung des LRT „Bewaldete<br />
Küstendünen der atlantischen, kontinentalen <strong>und</strong> borealen Region“ (EU-Code 2180) äußerst<br />
vorsorglich konstatiert. Dabei wird die Irrelevanzschwelle von 3 % des CLnutN, die bei den niedrigsten<br />
CLnutN bei 0,141 kg N/ha/a liegt, lediglich um maximal 0,088 kg N/ha/a überschritten.<br />
Die Wirkung der alleinigen Einträge durch das <strong>GuD</strong> <strong>III</strong> (<strong>EWN</strong>) führt nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen<br />
des LRT 2180. Eine Umsetzung geeigneter Kohärenzsicherungsmaßnahmen im<br />
Hinblick auf den LRT 2180 ist somit nur dann erforderlich, wenn beide <strong>GuD</strong> am Standort <strong>Lubmin</strong><br />
realisiert werden.<br />
Da im Hinblick auf die Erreichung der Vorhabensziele alle Optimierungen der technischen Planung<br />
bzgl. der Kühlwasserthematik <strong>und</strong> des Schadstoffausstoßes ausgeschöpft sind, ist die
FROELICH & SPORBECK Seite 310<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Durchführung von „Maßnahmen zur Schadensbegrenzung“, also von Maßnahmen zur Verminderung<br />
oder Begrenzung von Wirkungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen<br />
des Anhangs I bzw. der Erhaltungsziele führen können, nicht möglich.<br />
Bzgl. möglicher kumulativer Wirkungen hinsichtlich der Vorkommen der Lebensraumtypen des<br />
Anhangs I <strong>und</strong> Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mit anderen Plänen <strong>und</strong> Projekten<br />
konnten mehrere Projekte ermittelt <strong>und</strong> diesbezüglich geprüft werden. Die Prüfung ergab, dass<br />
z. T. geringfügige Summations- bzw. Synergieeffekte nicht ausgeschlossen werden können. Die<br />
Erheblichkeitsschwelle für durch das Vorhaben „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des <strong>GuD</strong> <strong>III</strong>“ nicht erheblich<br />
beeinträchtige maßgebliche Bestandteile wird allerdings aufgr<strong>und</strong> kumulativer Wirkungen<br />
nur beim LRT 2180 durch die kumulativen Wirkungen der beiden <strong>GuD</strong> überschritten.<br />
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass durch die geplante „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb<br />
eines Gas- <strong>und</strong> <strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> (<strong>GuD</strong> <strong>III</strong>)“ das FFH-Gebiet „Greifswalder Bodden,<br />
Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-301) in seinen für die Erhaltungsziele<br />
oder für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt werden kann.<br />
Ein Projekt darf trotz negativem Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung zugelassen oder<br />
durchgeführt werden, soweit es aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses,<br />
einschließlich solcher sozialer Art oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist, zumutbare<br />
Alternativen (...) nicht gegeben sind <strong>und</strong> geeignete Kohärenzsicherungsmaßnahmen vorgesehen<br />
sind (§ 34 BNatSchG). Um dies nachzuweisen, wird im weiteren Verfahren die Ausnahmeprüfung<br />
gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG durchgeführt.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 311<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Literatur- <strong>und</strong> Quellenverzeichnis<br />
Gesetze, Verordnungen <strong>und</strong> Richtlinien<br />
GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (BUNDESNATURSCHUTZGESETZ –<br />
BNATSCHG)<br />
vom 29. Juli 2009 (BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom<br />
6. Februar 2012 (BGBl. I S.148).<br />
GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN ZUR AUSFÜHRUNG DES BUNDESNATURSCHUTZ-<br />
GESETZES (NATURSCHUTZAUSFÜHRUNGSGESETZ - NATSCHAG M-V)<br />
vom 23. Februar 2010, zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010<br />
(GVOBl. M-V S. 383, 395).<br />
GESETZ ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN DURCH LUFTVERUNREINIGUNGEN,<br />
GERÄUSCHE, ERSCHÜTTERUNGEN UND ÄHNLICHE VORGÄNGE (BUNDES - IMMISSIONSSCHUTZGESETZ -<br />
BIMSCHG)<br />
in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), das zuletzt<br />
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist.<br />
RICHTLINIE 2009/147/EG<br />
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten; ABl. Nr. L 20/7<br />
vom 26.01.2010.<br />
RICHTLINIE 92/43/EWG<br />
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere<br />
<strong>und</strong> Pflanzen; ABl. Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7, zuletzt geändert durch RL 2006/105/EG<br />
des Rates vom 20.11.2006 (ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006, S. 368).<br />
VDI 3783 BLATT 5, "UMWELTMETEOROLOGIE – MODELLE ZUR GASPHASENCHEMIE DER TROPOSPHÄ-<br />
RE"<br />
November 1999.<br />
VERORDNUNG ÜBER DAS LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET „GREIFSWALDER BODDEN“<br />
vom 10. Dezember 2008. GVOBl. M-V 2008, S. 509.<br />
VERORDNUNG ÜBER DAS NATURSCHUTZGEBIET „PEENEMÜNDER HAKEN, STRUCK UND RUDEN“<br />
vom 10. Dezember 2008. GVOBl. M-V 2008, S. 516.<br />
VERORDNUNG ÜBER ANFORDERUNGEN AN DAS EINLEITEN VON ABWASSER IN GEWÄSSER (ABWAS-<br />
SERVERORDNUNG - ABWV)<br />
vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S.1108) zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 31.<br />
Juli 2009 (BGBl. I. Nr. 51, S. 2585) in Kraft getreten am 1. März 2010.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 312<br />
Verwendete Literatur<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
ABDANK, A., BARTH, A., RUNZE, K. & K. MELZ (2004) (HRSG. LUNG M-V):<br />
Zielarten der landesweiten naturschutzfachlichen Planung – Faunistische Artenabfrage. –<br />
Materialien zur Umwelt Heft 3.<br />
ABE, MAHIKO; KURASHIMA, AKIRA & MAEGAWA, MIYUKI (2008):<br />
High water-temperature tolerance in photosynthetic activity of Zostera marina seedlings from<br />
Ise Bay, Mie Prefecture, central Japan. Fisheries Science Nr. 74/5. S. 1017-1023.<br />
ABT, K. F. (2004):<br />
Phoca vitulina (Linnaeus, 1758) - Seeh<strong>und</strong>. - In: PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.; BLESS, R.;<br />
BOYE, P.; SCHRÖDER, E.; SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura<br />
2000. Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Bd.: Wirbeltiere.<br />
- Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch, 69, Bd. 2: 544 - – 550.<br />
ANDERSON, G. (1978):<br />
Metabolic rate, temperature acclimation and resistance to high temperature of soft-shell<br />
clams, Mya arenaria, as affected by shore level, Comp. Biochem. Physiol., 61A(3), 433 –<br />
438.<br />
ARBEITSKREIS “ERMITTLUNG UND BEWERTUNG VON STICKSTOFFEINTRÄGEN” (2006):<br />
Kurzbericht. – Stand 13.09.2006.<br />
ARGE KIFL / TGP (ARBEITSGEMEINSCHAFT KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE / TRÜPER<br />
GONDESEN PARTNER) (2004):<br />
Gutachten zum Leitfaden für B<strong>und</strong>esfernstraßen zum Ablauf der Verträglichkeits- <strong>und</strong> Ausnahmeprüfung<br />
nach §§ 34,35 BNatSchG.<br />
BACHOR, A. (2005):<br />
Nährstoff- <strong>und</strong> Schwermetallbilanzen der Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns unter<br />
besonderer Berücksichtigung ihrer Sedimente. Herausgegeben vom Landesamt für Umwelt<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern.<br />
BACHOR, A. et al. (2008):<br />
Gewässergütebericht Mecklenburg-Vorpommern 2003/2004/2005/2006: Ergebnisse der Güteüberwachung<br />
der Fließ-, Stand- <strong>und</strong> Küstengewässer <strong>und</strong> des Gr<strong>und</strong>wassers in Mecklenburg-<br />
Vorpommern. Hrsg. LUNG Mecklenburg-Vorpommern<br />
BALLA ET AL. (2010)<br />
Eutrophierende Stickstoffeinträge als aktuelles Problem der FFH-Verträglichkeitsprüfung. –<br />
In: Natur <strong>und</strong> Recht (2010) 32: 616-625<br />
BALZER, S., BOEDEKER, D. & U. HAUKE (2002):<br />
Interpretation, Abgrenzung <strong>und</strong> Erfassung der marinen <strong>und</strong> Küstenlebensraumtypen nach<br />
Anhang I der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Natur <strong>und</strong> Landschaft, 77. Jg., H. 1: 20-28.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 313<br />
BARTELS, S. & U. KLÜBER (1998):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die räumliche Verteilung des Makrophytobenthos <strong>und</strong> seine Akkumulation von Nährstoffen<br />
<strong>und</strong> Schwermetallen. Teil 1: Erfassung des Bedeckungsgrades des Greifswalder Boddens<br />
mit submersen Makrophyten. - Greifswalder Geogr. Arbeiten 16: 316-325.<br />
BAST, H.-D., BREDOW, D., LABES, R., NEHRING, R., NÖLLERT, A. & WINKLER, H. M. (1992):<br />
Rote Liste der gefährdeten Amphibien <strong>und</strong> Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns. 1. Fassung,<br />
Stand: Dezember 1991. Umweltministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Hrsg.), Schwerin.<br />
BATTEFELD (2010):<br />
Critical Loads als Bewertungsmaßstab geeignet? Eine kritische Diskussion – es bleiben Fragen.<br />
– Naturschutz <strong>und</strong> Landschaftsplanung 42 (12): 372-376.<br />
BAUER, H.-G. & BERTHOLD, P. (1996):<br />
Die Brutvögel Mitteleuropas – Bestand <strong>und</strong> Gefährdung. – Aula, Wiesbaden, 715 S.<br />
BAUER, S. & THIELKE, G (1982):<br />
Gefährdete Brutvogelarten in der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland <strong>und</strong> im Land Berlin. – Vogelwarte<br />
31, 183-391.<br />
BAUER, H.-G., BEZZEL, E. & W. FIEDLER (2005):<br />
Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Bände 1 bis 3. , Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel.<br />
Aula-Verlag, Wiebelsheim.<br />
BAUMANN, W., BIEDERMANN, U., BREUER, W., HERBERT, M., KALLMANN, J., RUDOLF, E., WEIHRICH,<br />
D., WEYRATH, U. & A. WINELBRANDT (1999):<br />
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Prüfung von Projekten <strong>und</strong> Plänen nach § 19c<br />
<strong>und</strong> § 19d BNatSchG (Verträglichkeit, Unzulässigkeit <strong>und</strong> Ausnahmen). – Natur <strong>und</strong> Landschaft,<br />
72 (11): 463-472.<br />
BERG, C., DENGLER, J., ABDANK, A. & M. ISERMANN (HRSG.) (2004):<br />
Die Pflanzengesellschaften Mecklenburg-Vorpommerns <strong>und</strong> ihre Gefährdung – Textband. –<br />
Landesamt für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Weißdorn-<br />
Verlag, Jena.<br />
BERG, J. (KOMPETENZZENTRUM FÜR NATURSCHUTZ UND UMWELTBEOBACHTUNG) (2008A):<br />
Kartierungsbericht potenzielle Fledermausquartiere auf dem Baufeld des geplanten SKW.<br />
Görmin.<br />
BERG, J. (KOMPETENZZENTRUM FÜR NATURSCHUTZ UND UMWELTBEOBACHTUNG) (2008B):<br />
Kartierungsbericht potenzielle Fledermausquartiere im Bereich der geplanten Kabeltrasse,<br />
SKW <strong>Lubmin</strong>. Görmin.<br />
BERGAMT STALSUND (2011):<br />
Planfeststellungsbeschluss. Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren für die Errichtung<br />
<strong>und</strong> den Betrieb der Frischwasserentnahme- <strong>und</strong> Soleeinleitungseinrichtungen zur Herstellung<br />
von Kavernen des Untergr<strong>und</strong>gasspeichers (UGS) Moeckow. Az<br />
613/13059/518/14/082.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 314<br />
BERGMANN, G. & K. O. DONNER (1964):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
An analysis of the spring migration of the common scoter and the long-tailed duck in southern<br />
Finland. – Acta zoologica fennica 105: 1-59.<br />
BERNER, A. (1981):<br />
Ab<strong>und</strong>anz <strong>und</strong> Verbreitung von Fischlarven im Ichthyoplankton des Greifswalder Boddens<br />
<strong>und</strong> anderer Rügenscher Gewässer. Diplomarbeit Universität Rostock: 82 S.<br />
BIGONGIARI, N., BRAIDA, T., CARRETTI, F., PELLEGRINI, D. (2004):<br />
Influence of Temperature on the Mortality and Sensitivity of Corophium orientale, Bulletin of<br />
Environmental Contamination and Toxicology [Bull. Environ. Contam. Toxicol.]. Vol. 72, no.<br />
5, pp. 881-887<br />
BIOM MARTSCHEI (2008):<br />
Brutvogelkartierung Baufeld Steinkohlekraftwerk Greifswald <strong>und</strong> Umgebung. – unveröff. Kartendarstellung<br />
im Auftrag von Froelich & Sporbeck.<br />
BINK, F. (1996):<br />
Backgro<strong>und</strong> information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention.<br />
Part 1: Crustacea, Coleoptera and Lepidoptera. Nature and Environment; 79: 150 - 156.<br />
BLAXTER, J. (1956):<br />
Herring Rearing II - The Effect of Temperature and other Factors on Development. Mar.<br />
Res., 5: 2-19.<br />
BLÜMEL, C., DOMIN, A., KRAUSE, J. C., SCHUBERT, M., SCHIEWER, U. & H. SCHUBERT (2002):<br />
Der historische Makrophytenbewuchs der inneren Gewässer der deutschen Ostseeküste.<br />
Sind historische Daten zur Bestimmung der typspezifischen ökologischen Referenzbedingungen<br />
gemäß den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft<br />
geeignet? In: Rostock. Meeresbiolog. Beitr. (2002) 10. 5-111.<br />
BLÜMEL, C. (2004):<br />
Die Characeen in Mecklenburg-Vorpommern. – Rostock. Meeresbiolog. Beitr. 13. 55-72.<br />
BOBBINK, R.; ASHMORE, M.; BRAUN, S.; FLÜCKIGER, W. & VAN DEN WYNGAERT, I. J.J. (2002):<br />
Empirical nitrogen critical loads for natural and semi-natural ecosystems: 2002 update.<br />
BOBBINK ET AL. (2011):<br />
Review and Revision of Empirical Critical Loads. Proceedings of an expert workshop,<br />
Noordwijkerhout, 23-25 June 2010.<br />
BOCHERT, R. (2003)<br />
PCOEKO - Datenbank zur Autökologie der Arten des deutschen Küstenraumes; erstellt im<br />
Auftrag der BfG, Referat Tierökologie. http://www.bafg.de/servlet/is/6055/?lang<br />
=deandhighlight=datenbank. (Stand September 2007).
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 315<br />
BÖNSEL, A. (2004):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Erste Ergebnisse von Kartierung <strong>und</strong> Monitoring der „FFH-Libellenarten“ in Mecklenburg-<br />
Vorpommern. - Kurzfassung des Vortrages von der GdO-Tagung vom 19.- 21.03.2004 in<br />
Oldenburg. veröff. im Internet unter http://www.uni-vechta.de/institute/inu/gdotagung/abstract.html<br />
(Stand: 20.03.2007).<br />
BOYE, P., M. DIETZ & M. WEBER (1999):<br />
Fledermäuse <strong>und</strong> Fledermausschutz in Deutschland. - B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz, Bonn.<br />
BOYE, P., DENSE, C. & U. RAHMEL (2004):<br />
Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Teichfledermaus.- In: PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.;<br />
BLESS, R.; BOYE, P.; SCHRÖDER, E.; SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem<br />
Natura 2000. Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland.<br />
Bd.: Wirbeltiere.- Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch, 69, Bd. 2: 482-487.<br />
BRINKMANN, R., BIEDERMANN, M., BONTADINA, F., DIETZ, M., HINTEMANN, G., KARTS, I., SCHMIDT,<br />
C. & W. SCHORCHT (2008):<br />
Planung <strong>und</strong> Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse. – Ein Leitfaden für Straßenbauvorhaben<br />
im Freistaat Sachsen, Entwurfsfassung. – Sächsisches Staatsministerium für<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Arbeit, 134 S.<br />
BRINKMANN, R., NIERMANN, I., BEHR, O., MAGES, J. & M. REICH (2009):<br />
Erste Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Entwicklung von Methoden zur Untersuchung<br />
<strong>und</strong> Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an On-Shore-Windenergieanlagen“.<br />
– Vortrag gehalten am 09.06.2009 auf der Fachtagung Methoden zur Untersuchung <strong>und</strong> Reduktion<br />
des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen in Hannover,<br />
im Internet unter http://www.umwelt.unihannover.de/fileadmin/institut/Kurzfassungen_<br />
Kollisionsrisiko_Fledermaeuse_WEA.pdf (Stand 17.08.2010).<br />
BROCK, V., HOFFMANN, J., KÜHNAST, O., PIPER, W. & K. VOSS (1997):<br />
Atlas der Libellen Schleswig-Holsteins. - Hrsg. Landesamt für Natur <strong>und</strong> Umwelt des Landes<br />
Schleswig-Holstein: 176<br />
BRUNKE & HIRSCHHÄUSER (2005):<br />
Brunke M, Hirschhäuser T 2005.: Empfehlungen zum Bau von Sohlgleiten in Schleswig-<br />
Holstein. Landesamt für Natur <strong>und</strong> Umwelt des Landes Schleswig-Holstein.<br />
BUCKMANN, K. (2003):<br />
Untersuchung des Wasseraustausches des Freesendorfer Sees mit anliegenden Aquatorien.<br />
Januar 2003.<br />
BUCKMANN, K. (2007):<br />
Prognose der Ausbreitung von Abwärme aus Kraftwerken in den Greifswalder Bodden. Bericht<br />
i. A. der DONG Energy Kraftwerke Greifswald. Hinrichshagen. Unveröff.<br />
BUCKMANN, K. (2008):<br />
Prognose der Ausbreitung von Abwärme aus Kraftwerken in den Greifswalder Bodden. Bericht<br />
i. A. der DONG Energy Kraftwerke Greifswald. Hinrichshagen. Unveröff.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 316<br />
BUCKMANN, K. (2011):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Prognose der Ausbreitung von Kühlwasser <strong>und</strong> Sole-Spülwasser aus geplanten Betriebsansiedlungen<br />
am Industriestandort <strong>Lubmin</strong>. Untersuchung im Auftrag der <strong>EWN</strong> GmbH <strong>Lubmin</strong>,<br />
in Zusammenarbeit mit Hydromod. In der Fassung vom Oktober 2011. Hinrichshagen.<br />
BUCKMANN, K. (2012):<br />
Hydrographische Argumente für eine worst case Definition zur Beurteilung der kumulativen<br />
Auswirkungen der Vorhaben am Standort <strong>Lubmin</strong>. Schriftl. Mitteilung als Antwort auf die Behördenforderung<br />
des StALU VP vom 06.10.2011.<br />
BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (BFN) (2010):<br />
Natura 2000 – Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten. URL http://www.bfn.de/0316_lr_intro.html (abgerufen<br />
am 19.02.2010)<br />
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND STADTENTWICKLUNG (BMVBS) (HRSG.), BUNDESAN-<br />
STALT FÜR GEWÄSSERKUNDE (2008):<br />
Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an B<strong>und</strong>eswasserstraßen. Bonn<br />
BURTON, D. T., CAPIZZI, T. P., MARGREY, S. L., WAKEFIELD, W. W. (1981):<br />
Effects of rapid changes in temperature on two estuarine crustaceans, Mar. Environ. Res.,<br />
4(4), 267-278.<br />
CHMURA, DR. G., POHLE, DR. G., GUELPEN, L. VAN, PAGE, DR. F., COSTELLO, DR. M. (2007)<br />
Climate Change and Thermal Sensitivity of Canadian Atlantic Commercial Marine Species,<br />
Climate Change Impacts and Adaptation Program, Natural Resources Canada, Project<br />
A515, Canada, Internetauftritt: http://www.geog.mcgill.ca/climatechange/index.htm, aufgerufen<br />
am 31.08.2010.<br />
COLLING, M. & E. SCHRÖDER (2003A):<br />
Vertigo angustior (Jeffreys, 1830).- In: PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.; BIEWALD, G.; HAUKE,<br />
U.; LUDWIG, G.; PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK (Bearb.): Das europäische<br />
Schutzgebietssystem Natura 2000 – Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie<br />
in Deutschland, Band 1: Pflanzen <strong>und</strong> Wirbellose.- Bonn – Bad Godesberg: 665 - 676.<br />
COLLING, M. & E. SCHRÖDER (2003B):<br />
Vertigo moulinsiana (Jeffreys, 1830).- In: PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.; BIEWALD, G.; HAUKE,<br />
U.; LUDWIG, G.; PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & A. SSYMANK (Bearb.): Das europäische<br />
Schutzgebietssystem Natura 2000 – Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie<br />
in Deutschland, Band 1: Pflanzen <strong>und</strong> Wirbellose.- Bonn – Bad Godesberg: 694 - 706.<br />
CORBET, G. & D. OVENDEN (1982):<br />
Pareys Buch der Säugetiere. Alle wildlebenden Säugetiere Europas. Hamburg & Berlin.<br />
CORRENS, M. (1979):<br />
Der Wasserhaushalt der Bodden- <strong>und</strong> Haffgewässer der DDR als Gr<strong>und</strong>lage für weitere Erforschung<br />
ihrer Nutzungsfähigkeit zu Trink- <strong>und</strong> Brauchwasserzwecken. Habilschrift, Humboldt-Universität<br />
Berlin, 21.06.1979, 254 S.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 317<br />
COX, T. J. AND J. C. RUTHERFORD (2000):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Thermal tolerances of two stream invertebrates exposed to diumally varying temperature.<br />
New Zealand J. Mar. Freshwat. Res. 34 (2), pp.203-208.<br />
DÄNHARDT, A. & P. H. BECKER (2008):<br />
Die Bedeutung umweltbedingter Verteilungsmuster von Schwarmfischen für Seevögel im<br />
Ökosystem Niedersächsisches Wattenmeer. Abschlussbericht. Niedersächsische Wattenmeer<br />
Stiftung, Projekt Nr. 53-NWS-41/04, 180 S + Anhang.<br />
DAGYS & ZYDELIS (2002):<br />
Bird bycatch in fishing nets in Lithuanian coastal waters in wintering season 2001-2002. Acta<br />
Zoologica Lituanica, 12. 276-282.<br />
DAHLKE, S. (2002):<br />
Einfluss des durch das <strong>GuD</strong>-Kraftwerk CPL verursachten Stickstoffeintrages auf das FFH-<br />
Schutzgebiet „Freesendorfer See“. Erster Zwischenbericht. im Auftrag der <strong>EWN</strong> GmbH.<br />
DATHE, H.H. (2001):<br />
Apidae. S. 143-155. In: H.H. DATHE, A. TAEGER & S.M. BLANK (Hrsg.): Verzeichnis der Hautflügler<br />
Deutschlands (Entomofauna Germanica 4). Entomologische Nachrichten <strong>und</strong> Berichte,<br />
Beiheft 7.<br />
DEASON, E. E. & SMAYDA, T. J. (1982):<br />
Ctenophore-zooplankton-phytoplankton interactions in Narragansett Bay, Rhode Island,<br />
U.S.A., during 1972 – 1977. In: Journal Plankton Research 28: 1099 – 1105.<br />
DELANY, S. & D. SCOTT (2006):<br />
Waterbird population estimates - fourth edition. Wetlands International, Wageningen.<br />
DEN HARTOG, CORNELIS (1936):<br />
Typologie des Brackwassers. Helgoland Marine Research, Vol. 10, Nr. 1-4. S. 377-390.<br />
DENSE, C., TAAKE, K. H. & MÄSCHER, G. (1996):<br />
Sommer- <strong>und</strong> Wintervorkommen von Teichfledermäusen (Myotis dasycneme) in Nord-<br />
deutschland. Myotis 34, 71- 79.<br />
DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR WASSERWIRTSCHAFT, ABWASSER UND ABFALL E. V. (DWA, 2005):<br />
Fischschutz- <strong>und</strong> Fischabstiegsanlagen – Bemessung, Gestaltung, Funktionskontrolle- 2.<br />
Korr. Auflage, Juli 2005.<br />
DIERSCHKE, V. (2010):<br />
Einschätzung der Bedeutung des Greifswalder Boddens im Abschnitt Ludwigsburg – <strong>Lubmin</strong><br />
– Freest für Wasser- <strong>und</strong> Seevögel, Anlage 8 der UVU zum <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II – unveröff. Fachgutachten<br />
im Auftrag von Froelich & Sporbeck, München.<br />
DIERSCHKE, V. & A. J. HELBIG (2008):<br />
Avifauna von Hiddensee. Meer u. Museum 21: 67-202.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 318<br />
DRIES, R.R. & H. THEEDE (1974):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Sauerstoffmangelresistenz mariner Bodenevertebraten aus der westlichen Ostsee. Marine<br />
Biology 25: 327-333.<br />
DUFFEK, A., SCHLUNGBAUM, G. & A. BACHOR (2001):<br />
Die Schadstoffsituation in den Bodden – am Beispiel der Schwermetalle ausgewählter Küstengewässer.<br />
– in: Die Darß-Zingster-Boddenkette, Meer <strong>und</strong> Museum, Bd. 16: 35-38.<br />
EBERT, G. (1991):<br />
Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1: Tagfalter I. Eugen Ulmer, Stuttgart.<br />
EDLER, L. (2008):<br />
Influence of warm water discharge on phytoplankton in the Greifswalder Bodden. - Ängelholm.<br />
Sweden.<br />
EICHSTÄDT, W., SCHELLER, W., SELLIN, D., STARKE, W. & K.-D. STEGEMANN (2006):<br />
Atlas der Brutvögel in Mecklenburg-Vorpommern. - Hrsg.: Ornithologische Arbeitsgemeinschaft<br />
Mecklenburg-Vorpommern (OAMV) e. V., Steffen-Verlag, Friedland.<br />
EISENBEIß, G. & F. HASSEL (2000):<br />
Zur Anziehung nachtaktiver Insekten durch Straßenlaternen.- Natur u. Landschaft, 75: 145 -<br />
156.<br />
ERDMANN, F. (2006):<br />
Beifang von See- <strong>und</strong> Wasservögeln in Stellnetzen der Küstenfischerei der Ostsee. In: BSH<br />
(2007): Meeresumweltsymposium. 101-114.<br />
ERM LAHMEYER (1999):<br />
Großkraftwerk <strong>Lubmin</strong>. Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Gutachten i. A. der VASA<br />
Kraftwerke GmbH & Co. <strong>Lubmin</strong> KG. Hamburg.<br />
EUROPEAN COMMISSION, DG UMWELT (2007):<br />
Interpretation Manual of European Union Habitats - Version EUR 27, Juli 2007. - Brüssel,<br />
144 S.<br />
EU-KOMMISSION (2000)<br />
Natura 2000 – Gebietsmanagement: Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitatrichtlinie<br />
92/43/EWG. Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften.<br />
FARTMANN, T., RENNWALD, E. & J. SETTELE (2001):<br />
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar). - in: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. & E.<br />
SCHRÖDER: Berichtspflichten in Natura 2000-Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten<br />
des Anhangs II <strong>und</strong> Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-<br />
Richtlinie. - Münster (Landwirtschaftsverlag), Schriftenreihe für Angewandte Landschaftsökologie<br />
42: 379-383.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 319<br />
FLADE, M. (1994):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- <strong>und</strong> Norddeutschlands, Gr<strong>und</strong>lagen für den Gebrauch<br />
vogelk<strong>und</strong>licher Daten in der Landschaftsplanung. IHW-Verlag, Echingen.<br />
FRICKE, M., ERGHAHN, R., RECHLIN, O., NEUDECKER, T., WINKLER, H. M., BAST, H.-D. & E. HAHL-<br />
BECK (1996):<br />
Rote Liste <strong>und</strong> Artenverzeichnis der R<strong>und</strong>mäuler <strong>und</strong> Fische (Cyclostomata Pisces) im Bereich<br />
der deutschen Nord- <strong>und</strong> Ostsee. - in: Nowak et al. (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten<br />
Wirbeltiere in Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege <strong>und</strong> Naturschutz, H. 42,<br />
Bonn-Bad Godesberg: 157 -176.<br />
FROELICH & SPORBECK (2008A):<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Steinkohlekraftwerks<br />
Greifswald“. Erläuterungsbericht Schwerin/Greifswald. Stand 15.07.2008.<br />
FROELICH & SPORBECK (2008B):<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 1747-402<br />
„Greifswalder Bodden <strong>und</strong> südlicher Strelas<strong>und</strong>“ zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Steinkohlekraftwerks<br />
Greifswald“. Erläuterungsbericht Schwerin/Greifswald. Stand<br />
FROELICH & SPORBECK (2008L):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Fledermauskartierung – Vorhabensstandort<br />
<strong>und</strong> Umfeld des geplanten Kraftwerks <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II EnBW. Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2008P):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Libellenkartierung – Vorhabensstandort<br />
<strong>und</strong> ausgesuchte Probegewässer. Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2009A):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Vegetation – Wald-Lebensraumtypen<br />
der Halbinsel Struck, die Vegetation der Nordspitze Usedoms <strong>und</strong> Vorkommen des Sumpf-<br />
Glanzkrautes (Liparis loeselii) im Bereich Nord-Usedom. Greifswald. (Anhang II, Anlage 4)<br />
FROELICH & SPORBECK (2009B):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Vegetation – Vegetationserfassung <strong>und</strong><br />
FFH-Lebensraumtypen im terrestrischen Teil des FFH-Gebietes DE 1747-301 westlich des<br />
<strong>GuD</strong> II Standortes. Greifswald. (Anhang II, Anlage 5)<br />
FROELICH & SPORBECK (2009C):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Reptilienkartierung – Vorhabensstandort<br />
<strong>und</strong> Umfeld des geplanten Kraftwerks <strong>GuD</strong> <strong>Lubmin</strong> II EnBW. Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2009D):<br />
Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II. Fachgutachten Insekten – Offenland-Lebensraumtypen<br />
des FFH-Gebietes DE 1747-301 im Bereich Freesendorfer Wiesen, Struck <strong>und</strong> Nordspitze<br />
Usedom. Greifswald.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 320<br />
FROELICH & SPORBECK (2010C):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong> Dampfkraftwerks<br />
<strong>Lubmin</strong> II“. Erläuterungsbericht Potsdam/Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2010K):<br />
LBP zum Neubau der L 262 OU Spandowerhagen, Teil 2 Neubau. – Im Auftrag des Straßenbauamtes<br />
Strals<strong>und</strong> des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2011A):<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) zur Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
<strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> - Erstellt im Auftrag der Energiewerke Nord GmbH.<br />
Potsdam/Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (2011B):<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 1747-402<br />
„Greifswalder Bodden <strong>und</strong> südlicher Strelas<strong>und</strong>“ zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
Dampfkraftwerks <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>“. Erläuterungsbericht. Potsdam/Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (in Bearb.):<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 1747-402<br />
„Greifswalder Bodden <strong>und</strong> südlicher Strelas<strong>und</strong>“ zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
Dampfkraftwerks <strong>Lubmin</strong> II“. Erläuterungsbericht. Potsdam/Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (in Bearb.):<br />
FFH-Verträglichkeitsuntersuchung für das FFH-Gebiet DE 1747-301 „Greifswalder Bodden,<br />
Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ zur „Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
Dampfkraftwerks <strong>Lubmin</strong> II“. Erläuterungsbericht. Potsdam/Greifswald.<br />
FROELICH & SPORBECK (in Bearb.):<br />
Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) zur Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
<strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> <strong>Lubmin</strong> II. Erläuterungsbericht. Potsdam/Greifswald.<br />
FRÖHLE, P., DIMKE, S., FORSTER, S. & POWILLEIT, M. (2010):<br />
Untersuchung zu den großräumigen Auswirkungen einer Frischwasserentnahme aus der<br />
Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> Salzwassereinleitung in den Greifswalder Bodden auf die<br />
Salzverteilung <strong>und</strong> das Ökosystem. Endbericht. Universität Rostock, Institut für Umweltingenieurwesen<br />
- Fachgebiet Küstenwasserbau, Institut für Biowissenschaften - Fachgebiete<br />
Meeresbiologie. Rostock.<br />
FRÖHLE, P., FORSTER, S. & POWILLEIT, M. (2011):<br />
Gasspeicher Moeckow: Präzisierungsunterlage - Untersuchung zu den großräumigen Auswirkungen<br />
einer Frischwasserentnahme aus der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong> Salzwassereinleitung<br />
in den Greifswalder Bodden auf die Salzverteilung <strong>und</strong> das Ökosystem. Präzisierungsunterlage.<br />
Universität Rostock, Institut für Umweltingenieurwesen - Fachgebiet<br />
Küstenwasserbau, Institut für Biowissenschaften - Fachgebiete Meeresbiologie. Rostock.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 321<br />
FROESE, R., PAULY, D. EDITORS. (2008):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
FishBase. World Wide Web electronic publication. Präsentation im Internet unter<br />
www.fishbase.org, Version (02/2008)<br />
GARMS, H. (1985):<br />
Fauna Europas: Ein Bestimmungslexikon der Tiere Europas. - Wiesbaden.<br />
GARNIEL, A., DAUNICHT, W.D., MIERWALD, U. & U. OJOWSKI (2007):<br />
Vögel <strong>und</strong> Verkehrslärm. Quantifizierung <strong>und</strong> Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen<br />
von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007. FuE-<br />
Vorhaben 02.237/2003/LR des B<strong>und</strong>esministeriums für Verkehr, Bau- <strong>und</strong> Stadtentwicklung.<br />
273 S. Bonn, Kiel.<br />
GARNIEL, A. & U. MIERWALD (2010):<br />
Arbeitshilfe Vögel <strong>und</strong> Straßenverkehr. - Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE<br />
02.286/2007/LRB der B<strong>und</strong>esanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung eines Handlungsleitfadens<br />
für Vermeidung <strong>und</strong> Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna“ v.<br />
30.04.2010.<br />
GARTHE, S., ULRICH, N., WEICHLER, T., DIERSCHKE, V., KUBETZKI, U., KOTZERKA, J., KRÜGER, T.,<br />
SONNTAG, N. & A. J. HELBIG (2003):<br />
See- <strong>und</strong> Wasservögel der deutschen Ostsee - Verbreitung, Gefährdung, Schutz. - B<strong>und</strong>esamt<br />
für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg 2003.<br />
GARTHE, S., DIERSCHKE, V., WEICHLER, T., SCHWEMMER, P. (2004):<br />
Rastvogelvorkommen <strong>und</strong> Offshore-Windkraftnutzung: Analyse des Konfliktpotenzials für die<br />
deutsche Nord- <strong>und</strong> Ostsee. Endbericht zum MINOS Teilprojekt 5 im Auftrag des B<strong>und</strong>esministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit.<br />
GEISEL, T. & U. MEßNER (1989):<br />
Flora <strong>und</strong> Fauna des Bodens im Greifswalder Bodden. Meer <strong>und</strong> Museum 5: 44-51. - zitiert<br />
in: GOSSELCK, F. & SCHABELON, H. (2007): Zustand <strong>und</strong> historische Entwicklung des Makrozoobenthos<br />
<strong>und</strong> des Makrophytobenthos des Oderästuars - Ein Überblick. IKZM-Oder-<br />
Berichte, Nr. 36. Neu Broderstorf.<br />
GELLERMANN, M. (2001):<br />
Natura 2000. Europäisches Habitatschutzrecht <strong>und</strong> seine Durchführung in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland. 2., neubearb. u. erw. Aufl. – Schr.R. Natur <strong>und</strong> Recht, 4: 293 S; Berlin, Wien<br />
(Blackwell).<br />
GERSTENMEIER, R. & T. ROMIG (1998):<br />
Die Süßwasserfische Europas. Stuttgart.<br />
GEßNER, J., FREDRICH, F., ARNDT, G.-M. & H. VON NORDHEIM (2010):<br />
Arterhaltung <strong>und</strong> Wiedereinbürgerungsversuche für die atlantischen Störe (Acipenser sturio<br />
<strong>und</strong> A. oxyrinchus) im Nord- <strong>und</strong> Ostseeeinzugsgebiet. – Natur <strong>und</strong> Landschaft, 85. Jg., H.<br />
12: 514-519.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 322<br />
GILBERT, O. L. (1970):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Further studies on the effect of sulphur dioxide on lichens and bryophytes. - New Phytologist<br />
69: 605–627.<br />
GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1992):<br />
Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 3, Anseriformes (1. Teil), Entenvögel: Enten, Säger.<br />
– 2. Aufl., Aula-Verlag.<br />
GOSSELCK, F. & J. KUBE (2004):<br />
Süß bis salzig – Marine FFH-Lebensraumtypen in Ostsee am Beispiel des Greifswalder<br />
Boddens <strong>und</strong> der Pommerschen Bucht. – In: Naturmagazin, Heft 3, S. 4-9.<br />
GOSSELCK, F., & S. DAHLKE (2005):<br />
Die unterseeischen Algen <strong>und</strong> Blütenpflanzen des Meeresbodens (Makrophyten. In: Strelas<strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> Kubitzer Bodden. Meer <strong>und</strong> Museum, 18: 99-103.<br />
GOSSELCK, F. & H. SCHABELON (2007):<br />
Aktueller Zustand <strong>und</strong> historische Entwicklung des Makrobenthos <strong>und</strong> Makrophytobenthos<br />
des Oderästuars – Ein Überblick. . Forschung für ein integriertes Küstenzonenmanagement<br />
in der Odermündungsregion – IKZM-Oder Berichte 36, 1-34.<br />
GRAY, J.S., R. SHIUS & WU & Y.Y. OR (2002):<br />
Effects of hypoxia and organic enrichment on the coastal marine environment. Marine Ecology<br />
Progress Series 238, pp. 249-279.<br />
GRIMMBERGER, E. (2002):<br />
Paarungsquartier der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) in Ostvorpommern. – Nyctalus<br />
(N.F.) 8: 394.<br />
GRÜNKORN, TH., DIEDERICHS, A., STAHL, B., POSZIG, D. & G. NEHLS (2005):<br />
Entwicklung einer Methode zur Abschätzung des Kollisionsrisikos von Vögeln an Windenergieanlagen<br />
(Endbericht). Im Auftrag des Landesamtes für Natur <strong>und</strong> Umwelt Schleswig-<br />
Holstein, 106 S<br />
GUDERIAN, R. (2001):<br />
Handbuch der Umweltveränderungen <strong>und</strong> Ökotoxikologie: Band 2A: Terrestrische Ökosysteme.<br />
Immissionökologische Gr<strong>und</strong>lagen - Wirkungen auf Boden - Wirkungen auf Pflanzen.<br />
Springer. Berlin.<br />
GÜTTINGER, R. (1997):<br />
Jagdhabitate des Großen Mausohrs (Myotis myotis) in der modernen Kulturlandschaft. –<br />
BUWAL.<br />
GUIRY, M.D. & GUIRY, G.M. (2010):<br />
AlgaeBase. World-wide electronic publication. National University of Ireland, Galway.<br />
http://www.algaebase.org, aufgesucht am 17.10.2010.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 323<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
HAENSEL, J. (1994):<br />
Zum F<strong>und</strong> einer Teichfledermaus, Myotis dasycneme (Boie, 1825), in Wildpark West bei<br />
Potsdam (Land Brandenburg). Ibid. 5, 71-73.<br />
HALAMA, G. (2001):<br />
Die FFH-Richtlinie – unmittelbare Auswirkungen auf das Planungs- <strong>und</strong> Zulassungsrecht. –<br />
NVwZ, 20 (5): 506-513.<br />
HALL, J. (2007):<br />
National Focal Centre Report / United Kingdom. – In: Slootweg, J., M. & J.-P. Hettelingh<br />
(Hrsg.): 180-188. Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling –CCE Progress Report<br />
2007. MNP project M/500090. Coordination Centre of Effects (CCE).<br />
HAMMER, C.; ZIMMERMANN, C.; VON DORRIEN, C.; STEPPUTTIS, D. & OEBERST, R. (2009):<br />
Begutachtung der Relevanz der Auswirkung des Kühlwassers des geplanten Steinkohlekraftwerks<br />
in <strong>Lubmin</strong> auf die fischereilich genutzten marinen Fischbestände der westlichen<br />
Ostsee (Hering, Dorsch, Fl<strong>und</strong>er, Scholle, Hornhecht). Endbericht für das Ministerium für<br />
Landwirtschaft, Umwelt <strong>und</strong> Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch<br />
das Staatliche Amt für Umwelt- <strong>und</strong> Naturschutz Strals<strong>und</strong> (StAUN Strals<strong>und</strong>). Johann-<br />
Heinrich von Thünen-Institut, B<strong>und</strong>esforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald <strong>und</strong> Fischerei/Institut<br />
für Ostseefischerei Rostock.<br />
HARDER, K. (1996):<br />
Zur Situation der Robbenbestände. In: LOZAN et al.: Warnsignale aus der Ostsee. Parey<br />
Buchverlag Berlin.<br />
HARDER, K. (2007):<br />
Meeresmuseum Strals<strong>und</strong> in Ostseezeitung, 08.01.2007<br />
HARDER, K. & G. SCHULZE (1989):<br />
Meeressäugetiere im Greifswalder Bodden. - in: Der Greifswalder Bodden, Meer <strong>und</strong> Museum,<br />
Bd. 5: 90-95.<br />
HARDER, K., SCHULTZ, P. & P. BORKENHAGEN (1995):<br />
Zum Vorkommen von Robben (Pinnipedia) an der deutschen Ostseeküste. Säugetierk<strong>und</strong>liche<br />
Informationen; 4, H.19: 3-21.<br />
HEINKEN, T.(2008):<br />
Die natürlichen Kiefernstandorte Deutschlands <strong>und</strong> ihre Gefährdung. Beiträge aus der<br />
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt Nr. 2. S. 19-41.<br />
HEISE, G., BLOHM, T.& HAUF, H. (2005):<br />
Die Wochenstube des Mausohrs (Myotis myotis) in Burg Stargard, Mecklenburg-<br />
Vorpommern – Zwischenbericht nach 25jährigen Untersuchungen. Nyctalus (N.F.), 10 (2), S.<br />
168 – 182.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 324<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
HELBIG, A. J., HEINICKE, T., KUBE, J., ROEDER; J. & J. STEUDTNER (2001):<br />
Ornithologischer Jahresbericht 1998 für Rügen, Hiddensee <strong>und</strong> Greifswalder Bodden. Berichte<br />
der Vogelwarte Hiddensee 16: 77-149.<br />
HÖPPNER, B. & K. STERNBERG:<br />
Anaciaeschna isosceles (Müller, 1767) - Keilflecklibelle. S. 114–125 in: Sternberg/Buchwald<br />
(Hrsg.): Die Libellen Baden-Württembergs. Band 2: Großlibellen (Anisoptera). Ulmer, Stuttgart<br />
2000<br />
HÜBEL, H.-J., VIETINGHOFF, U., HUBERT, M.-L., RAMBOW-BARTELS, S., KORTH, B., WESTPHAL, H.<br />
& B. LENK (1995):<br />
Ergebnisse des ökologischen Monitorings Greifswalder Bodden September 1993 bis März<br />
1995. – Rostock. Meeresbiol. Beitr., 3: 5-67.<br />
IMS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH & IBL UMWELTPLANUNG GMBH (2010):<br />
Erarbeitung eines gemeinsamen Konzeptes für Fischschutzmaßnahmen zur Wasserentnahme<br />
aus der Spandowerhagener Wiek. Konzeptstudie. Hamburg.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (1999):<br />
Umweltauswirkungen der Kühlwasserführung der geplanten <strong>GuD</strong>-Kraftwerke am Standort<br />
<strong>Lubmin</strong> auf die angrenzenden Gewässer - Fachgutachten Makrobenthos (submerse Wasserpflanzen<br />
<strong>und</strong> wirbellose Tiere), Fische. Broderstorf - unveröff. Fachgutachten im Auftrag<br />
von Froelich & Sporbeck Bochum.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2001A):<br />
Ichthyofauna Greifswalder Bodden, bearbeitet von Dr. R. Bochert & Dr. H. M. Winkler. Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2001B):<br />
Voruntersuchung für ein fischereibiologisches Monitoring im Wirkraum des <strong>GuD</strong> Kraftwerks<br />
<strong>Lubmin</strong>. Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IFAÖ) (2002A):<br />
Biologische Untersuchung des Freesendorfer Sees, der Vorfluter <strong>und</strong> eines Referenzgebietes<br />
(NSG Schoritzer Wiek) unter besonderer Berücksichtigung der Armleuchteralgen (Characeae).<br />
Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2003C):<br />
Fachgutachten Vogelzug zum Offshore-Windparkprojekt „Baltic I“, Pilotvorhaben Mecklenburg-Vorpommern.<br />
- Unveröff. Fachgutachten im Auftrag der Offshore Ostsee Wind AG,<br />
Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2005):<br />
Marine FFH-Lebensraumtypen der Ostsee im Hoheitsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 325<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007A):<br />
Bestandsbeschreibung - Beschreibung von marin-biologischen Tätigkeiten im Raum <strong>Lubmin</strong>,<br />
Struck <strong>und</strong> Spandowerhagener Wiek. Broderstorf - unveröff. Fachgutachten im Auftrag von<br />
Froelich & Sporbeck Schwerin.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007B):<br />
Mögliche Auswirkungen von Temperaturerhöhungen auf benthische Lebensgemeinschaften<br />
im südlichen Greifswalder Bodden (Raum <strong>Lubmin</strong>, Struck). Broderstorf. Unveröff.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IFAÖ) (2007C):<br />
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Industrie- <strong>und</strong> Gewerbegebiet <strong>Lubmin</strong>er Heide“.<br />
Umweltbericht zum Vorentwurf der 3. B-Planänderung. Broderstorf. Mai, 2007.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007E):<br />
Aktueller Zustand <strong>und</strong> historische Entwicklung des Makrozoobenthos <strong>und</strong> des Makrophytobenthos<br />
des Oderästuars – ein Überblick. – Forschung für ein integriertes Küstenzonenmanagement<br />
in der Odermündungsregion. – IKZM-Oder-Berichte 36 (2007).<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IFAÖ) (2007F):<br />
Nord Stream Gas-Pipeline, Landanbindung <strong>Lubmin</strong> – Fachgutachten Brutvögel. – unveröff.<br />
Fachgutachten im Auftrag der Nord Stream AG. Broderstorf. Unveröff.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007H):<br />
Gutachten zur Berücksichtigung der fischereiwirtschaftlichen Belange bei der Fortschreibung<br />
des Landesraumentwicklungsprogramms M-V für das Küstenmeer. Im Auftrag des Ministeriums<br />
für Verkehr, Bau <strong>und</strong> Landesentwicklung M-V, Abteilung Raumordnung <strong>und</strong> Landesplanung.<br />
Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2007I):<br />
Anpassung der Seewasserstraße "Nördlicher Peenestrom" - Fachgutachten Makrophyten.<br />
Im Auftrag des Wasser- <strong>und</strong> Schifffahrtsamtes Strals<strong>und</strong>. Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IFAÖ) (2008A):<br />
Forschung für ein integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion. IKZM-<br />
Oder Berichte 41. Kurzbericht zur Evaluierung der Gewässerqualitätsziele. Broderstorf. Februar,<br />
2008.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] 2008B):<br />
Einschätzung der Machbarkeit für Aussagen des Einflusses der Boddenerwärmung <strong>und</strong> der<br />
Kühlwasserentnahme auf geschützte Fische <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäuler. Broderstorf. Mai, 2008.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] 2008D):<br />
Mögliche Auswirkungen auf den Heringsbestand des Greifswalder Boddens durch die Rippenqualle<br />
Mnemiopsis leidyi A. Agassiz 1865, sowie durch den Einfluss der Temperatur.<br />
Broderstorf. Mai, 2008.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 326<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] 2008E):<br />
Darstellung der Daten- <strong>und</strong> Informationsgr<strong>und</strong>lage zum Wanderverhalten der Finte, Neunaugen<br />
<strong>und</strong> Störe im Peenestrom. Broderstorf. Mai, 2008.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] 2008F):<br />
Darstellung von Vermeidungs- <strong>und</strong> Minimierungsmaßnahmen von Ansaugverlusten. Broderstorf.<br />
Mai, 2008.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] 2008I):<br />
Fischereigutachten Greifswalder Bodden. Broderstorf. Mai, 2008.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (HRSG.) (2008M)<br />
Autökologischer Atlas benthischer wirbelloser Tiere in der Deutschen Nord- <strong>und</strong> Ostsee. –<br />
Digitaler Atlas, Stand 24.07.2008, herausgegeben von IfAÖ in Kooperation mit dem Alfred-<br />
Wegener-Institut für Polar- <strong>und</strong> Meeresforschung Bremerhaven.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2009A):<br />
Auftreten von Fischlarven sowie Jung- <strong>und</strong> Kleinfischen im Bereich der modellierten Kühlwasserfahnen<br />
vor <strong>Lubmin</strong>. – unveröff. Fachgutachten im Auftrag von Froelich & Sporbeck,<br />
Greifswald.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2009B):<br />
Monitoring der Makrophytenbestände im Seegebiet vor dem Industriestandort <strong>Lubmin</strong> im<br />
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Bau <strong>und</strong> Betrieb des Steinkohlekraftwerks. -<br />
Ergebnisse der status quo ante-Aufnahme im August <strong>und</strong> September 2008 - im Auftrag von<br />
Froelich & Sporbeck. Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2009C):<br />
Kurzbericht zum Projekt: Nord Stream Pipeline. Makrophytenuntersuchung im Bereich der<br />
Boddenrandschwelle. im Auftrag der Nord Stream AG. Broderstorf.<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE [IFAÖ] (2009D):<br />
Vergleich der makrozoobenthischen Lebensgemeinschaft der Spandowerhagener Wiek <strong>und</strong><br />
nordöstlich von <strong>Lubmin</strong>. – erstellt im Auftrag der Allegro engineering GmbH im Rahmen des<br />
geplanten SKW Greifswald.<br />
INSTITUT FÜR BINNENFISCHEREI E. V. POTSDAM-SACROW (2008):<br />
Literaturrecherche Temperatur- <strong>und</strong> Sauerstoff-Toleranz ausgewählter Wanderfischarten der<br />
Elbe. Gutachten i. A. der Wassergütestelle der Elbe.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. Greifswald) (1994):<br />
Zur aktuellen Vegetation <strong>und</strong> Flora der Freesendorfer Wiesen. Institut für Landschaftsökologie<br />
<strong>und</strong> Naturschutz Greifswald.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 327<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. Greifswald) (1996):<br />
Landschaftsökologische Bewertung des Greifswalder Boddens unter besonderer Berücksichtigung<br />
seiner Bedeutung als Europäisches Vogelschutzgebiet <strong>und</strong> als Feuchtgebiet von<br />
nationaler Bedeutung. Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Abteilung Naturschutz, Institut für Landschaftsökologie <strong>und</strong> Naturschutz<br />
Greifswald.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. Greifswald) (1999A):<br />
Otterkartierung Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> Struck im Rahmen der Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
für das <strong>GuD</strong>-Kraftwerk der VASA Energy bei <strong>Lubmin</strong>. Greifswald. Juli 1999.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. Greifswald) (1999C):<br />
Erfassung der Fledermäuse im Bereich des geplanten Standortes <strong>und</strong> der näheren Umgebung<br />
des <strong>GuD</strong>-Kraftwerks der VASA Energy bei <strong>Lubmin</strong>. Juli 1999.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. GREIFSWALD) (2000A):<br />
Erfassung der Fledermäuse im Bereich des geplanten Standortes <strong>und</strong> der näheren Umgebung<br />
des <strong>GuD</strong>-Kraftwerks der VASA Energy bei <strong>Lubmin</strong>. Greifswald. Oktober 2000.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. GREIFSWALD) (2000F):<br />
Faunistische Sonderuntersuchung B-Plan „<strong>Lubmin</strong>er Heide“. – Reptilienkartierung. Endbericht<br />
bearbeitet von M. Lange. - Unveröff. Fachgutachten zum B-Plan Nr. 1 im Auftrag von<br />
Froelich & Sporbeck.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. GREIFSWALD) (2000G):<br />
Faunistische Sonderuntersuchung B-Plan „<strong>Lubmin</strong>er Heide“, Kartierung der Fledermäuse<br />
(Chiroptera). Greifswald. Oktober 2000.<br />
INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND NATURSCHUTZ (I.L.N. Greifswald) (2007):<br />
Kartierung <strong>und</strong> Bewertung der FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes – FFH-<br />
Managementplanung für die FFH-Gebiete „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es<br />
<strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ sowie „Altwarper Binnendünen, Neuwarper See <strong>und</strong> Riether Werder“.<br />
Gutachten im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umwelt <strong>und</strong> Natur (StAUN) Ueckermünde.<br />
JAGNOW, B. & F. GOSSELCK (1987):<br />
Bestimmungsschlüssel für die Gehäuseschnecken <strong>und</strong> Muscheln in der Ostsee. Mitt. Zool.<br />
Mus. Berlin 63 (2).<br />
JUEG, U. & M. L. ZETTLER (2000):<br />
Die Schnecken <strong>und</strong> Muscheln des Anhangs II der FFH-Richtlinie in Mecklenburg-<br />
Vorpommern. - NABU-Nachrichten Mecklenburg-Vorpommern 2/3: 10-11.<br />
KENNEDY, V. S., MIHURSKY, J. A. (1971):<br />
Upper temperature tolerances of some estuarine bivalves, Chesapeake Sci. Vol. 12, no. 4,<br />
pp. 193-204
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 328<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
KERNEY, M. P., R. A. D. CAMERON & J. H. JUNGBLUTH (1983):<br />
Die Landschnecken Nord- <strong>und</strong> Mitteleuropas. - Hamburg; Berlin: Paul Parey.<br />
KERNEY, M. (1999):<br />
Atlas of the land and freshwater molluscs of Britain and Ireland. - Essex: Harley Books.<br />
KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (KIFL) (2008):<br />
Bewertung von Stickstoffeinträgen im Kontext der FFH-Verträglichkeitsstudie, Kiel, Februar<br />
2008.<br />
KIELER INSTITUT FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (KIFL) (2009):<br />
Arbeitshilfe Vögel <strong>und</strong> Straßenverkehr. Bericht zum Forschungsprojekt FE 02.286/2007/LRB<br />
der B<strong>und</strong>esanstalt für Straßenwesen, Bergisch Gladbach: „Entwicklung eines Handlungsleitfadens<br />
für Vermeidung <strong>und</strong> Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen auf die Avifauna“.<br />
KITCHING, J. A., EBLING, F. J., GABLE, J. C., HOARE, R., MCLEOD, A. A. & T. A. NORTON (1976):<br />
The ecology of Lough Ine. XIX. Seasonal changes in the western trough. Journal of Animal<br />
Ecology 45, pp.731-758.<br />
KLAFS, G. & J. STÜBS (HRSG.) (1987):<br />
Die Vogelwelt Mecklenburgs. - Jena.<br />
KÖHLER, A. (1981):<br />
Fluktuationen der Fischfauna im Elbe-Ästuar als Indikator für ein gestörtes Ökosystem. Helgoländer<br />
Meeresuntersuchungen 34, S. 263-285.<br />
KÖHN, J. & GOSSELCK, F. (1989):<br />
Bestimmungsschlüssel der Malakostraken der Ostsee. Mitteilungen Zoologisches Museum<br />
Berlin 65.<br />
KOHLS, M. (2011):<br />
Zulassung von Projekten in Natura-2000-Gebieten – Zur Frage der Betroffenheit prioritärer<br />
Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten nach § 34 Abs. 4 BNatSchG. NuR 33:161-167.<br />
KOKOTT, J. (2004):<br />
Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 29. Januar 2004 in der Rechtssache<br />
C-127/02 beim EuGH „Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee <strong>und</strong> Nederlandse<br />
Vereniging tot Bescherming van Vogels gegen Staatssecretaris van Landbouw,<br />
Natuurbeheer en Visserij“ (Vorabentscheidungsersuchen des Raad van State).<br />
KOLLIGS, D. & A. MIETH (2001):<br />
Die Auswirkungen kleinflächiger <strong>und</strong> großflächiger Lichtquellen auf Insekten. – Schriftenr.<br />
Landschaftspflege Naturschutz des B<strong>und</strong>esamtes für Naturschutz, H. 67: 53-66.<br />
KRAPPE, M., BÖRST, A. & WATERSTRAAT, A. (2009):<br />
Entwicklung von Erfassungsprogrammen für die Arten Bitterling (Rhodeus amarus), Steinbeißer<br />
(Cobitis app.) <strong>und</strong> Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) zur Umsetzung der FFH-<br />
Richtlinie in Mecklenburg-Vorpommern. Artenschutzreport 24/2009, S. 18-30.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 329<br />
KUBE, J. (1996):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
The ecology of macrozoobenthos and sea ducks in the Pommeranian Bay. Meereswissenschaftliche<br />
Berichte 18. Warnemünde, 128 S.<br />
KUBE, J. & H. SKOV (1996):<br />
Habitat selection, feeding characteristics, and food consumption of long-tailed ducks,<br />
Clangula hyemalis, in the southern Baltic Sea. Meereswiss. Ber. 18: 83-100.<br />
KUBE, S.; POSTEL, L.; HONNEF, C. & C.B. AUGUSTIN, C. (2007):<br />
Mnemiopsis leidyi in the Baltic Sea – distribution and overwintering between autumn 2006<br />
and spring 2007. In: Aquatic Invasions. 2007. Vol. 2, Issue 2: 137 – 145. European Research<br />
Network on Aquatic Invasive Species<br />
KÜHNE, L., HAASE, E., WACHLIN, V., GELBRECHT, J. & R. DOMMAIN (2001):<br />
Die FFH-Art Lycaena dispar (Haworth, 1803) (Großer Feuerfalter) - Ökologie, Verbreitung,<br />
Gefährdung <strong>und</strong> Schutz im norddeutschen Tiefland (Lepidoptera, Lycaenidae). - Märk. Ent.<br />
Nachr. 3 (2): 1-32.<br />
KÜHNEL, K.-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R. & M. SCHLÜPMANN (2009A):<br />
Rote Liste <strong>und</strong> Gesamtartenliste der Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands. Stand Dezember<br />
2008. Naturschutz <strong>und</strong> Biologische Vielfalt 70 (1):231-256.<br />
KÜHNEL, K.-D., GEIGER, A., LAUFER, H., PODLOUCKY, R. & M. SCHLÜPMANN (2009B):<br />
Rote Liste <strong>und</strong> Gesamtartenliste der Lurche (Amphibia) Deutschlands. Stand Dezember<br />
2008. Naturschutz <strong>und</strong> Biologische Vielfalt 70 (1):259-288.<br />
KÜSTENINFORMATIONSSYSTEM ODERMÜNDUNG (IKZM ODER) (2010):<br />
Verbreitung typischer Arten des Makrozoobenthos. – Im Internet unter: http://www.ikzmoder.de/steckbrief_makrozoobenthos.html,<br />
Stand 10.11.2010.<br />
KÜSTER, A. (1997)<br />
Ökophysiologische Charakterisierung der Characeenbestände an der Küste Mecklenburg-<br />
Vorpommerns. – Diplomarbeit. Universität Rostock. 1-76.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 330<br />
LAMBRECHT, H. & J. TRAUTNER (2007A):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Berücksichtigung von Auswirkungen auf charakteristische Arten der Lebensräume nach<br />
Anhang I der FFH-Richtlinie in der FFH-Verträglichkeitsprüfung – Anmerkungen zum Urteil<br />
des B<strong>und</strong>esverwaltungsgerichts vom 16. März 2006 – 4 A 1075.04 (Großflughafen Berlin-<br />
Brandenburg). – Natur <strong>und</strong> Recht 29: 181-186.<br />
LAMBRECHT, H. & J. TRAUTNER (2007B):<br />
Fachinformationssystem <strong>und</strong> Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen<br />
der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007.- FuE-<br />
Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des B<strong>und</strong>esministeriums für Umwelt,<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit im Auftrag des B<strong>und</strong>esamtes für Naturschutz – FKZ 804<br />
82 004.-Hannover, Filderstadt.<br />
LÄNDERAUSSCHUSS FÜR IMMISSIONSSCHUTZ (LAI) (2009):<br />
Arbeitskreis „Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung von Stickstoffeinträgen“. Bericht Stand 25.05.2009<br />
LÄRMKONTOR (2009)<br />
Anwendbarkeit des Schwellenwertes von RECK et al. (2001). - Gutachten im Auftrag von Allegro<br />
engineering GmbH.<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2000):<br />
Gebietsformblatt <strong>und</strong> Standard-Datenbogen (Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden,<br />
Peenestrom, Achterwasser <strong>und</strong> Kleines Haff). Güstrow-Gülzow.<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (1997-2007):<br />
Daten des Gewässermonitorings. 1997-2007<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2003-2007):<br />
Brutbestands-Meldebögen für das NSG Struck, Ruden <strong>und</strong> Peenemünder Haken, Teilbereich<br />
Struck <strong>und</strong> Freesendorfer Wiesen. erstellt von D. SELLIN. Greifswald.<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2004A):<br />
Vorläufige Binnendifferenzierung der FFH-Lebensraumtypen in FFH-Gebieten (inkl. Erläuterung<br />
zur "Identifizierung der FFH-Lebensraumtypen in den vorgeschlagenen FFH-Gebieten<br />
in Mecklenburg-Vorpommern" <strong>und</strong> Statistik FFH-Binnendifferenzierung (2004).<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2004B):<br />
Zielarten der landesweiten naturschutzfachlichen Planung – Faunistische Artenabfrage. –<br />
Materialien zur Umwelt, H. 3 einschl. Anhang.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 331<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2007):<br />
Arbeitsmaterialien zu Tier- <strong>und</strong> Pflanzenarten in Mecklenburg-Vorpommern, Internetpräsentation<br />
unter http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/materialien_3_2004_tabellenneu.pdf,<br />
Stand: 01.08.2007.<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2008B):<br />
Bericht über die Aktuelle Bewertung der Gewässergüte <strong>und</strong> Bewirtschaftungsziele für den<br />
Greifswalder Bodden. Güstrow, 21.04.2008.<br />
LANDESAMT FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG- VORPOMMERN (LUNG M-<br />
V) (2008C):<br />
Bericht über die Aktuelle Bewertung der Gewässergüte des Greifswalder Boddens <strong>und</strong> Bewirtschaftungsziele<br />
<strong>und</strong> mögliche Auswirkungen durch Kühlwassereinleitungen aus geplanten<br />
Kraftwerken am Standort <strong>Lubmin</strong>. Güstrow, 21.04.2008.<br />
LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (LUA) (2008):<br />
Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher <strong>und</strong> irrelevanter Stoffeinträge in Natura 2000-<br />
Gebiete. Stand November 2008.<br />
LANDSCHAFTS-INFORMATIONSSYSTEMS LINFOS DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN<br />
Fachdaten zum Vorkommen von Fischen.<br />
LBM – LANDESBETRIEB MOBILITÄT RHEINLAND-PFALZ (2011):<br />
Auswirkungen von straßenbürtigen Stickstoffdepositionen auf FFH-Gebiete – Leitfaden.<br />
Stand April 2011. Koblenz.<br />
LEHTINIEMI, M., PÄÄKKÖNEN, J.P., FLINKMAN, J.,KATAJISTO, T.,GOROKHOVA, E., KARJALAINEN M.,<br />
VIITASALO, S. & H. BJÖRK (2007):<br />
Distribution and ab<strong>und</strong>ance of the American comb jelly (Mnemiopsis leidyi) – A rapid invasion<br />
to the northern Baltic Sea during 2007. Aquatic Invasions Volume 2 Issue 4: 445-449.<br />
LEIBNITZ-INSTITUT FÜR OSTSEEFORSCHUNG WARNEMÜNDE (IOW) (2007):<br />
Home, Forschung <strong>und</strong> Lehre, Daten <strong>und</strong> Bilder, Und Sie vermehren sich doch. Information<br />
zur Rippenqualle unter http://www2008.io-warnemuende.de/admin/de_index.html. Zugriff am<br />
21.09.2010.<br />
LEIBNITZ-INSTITUT FÜR OSTSEEFORSCHUNG WARNEMÜNDE (IOW) (2008A):<br />
Forschung für ein integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion. IKZM-<br />
Oder Berichte 30. Forschung in der Odermündungsregion: Ergebnisse 2004 bis 2007.<br />
Warnemünde. Februar, 2007.<br />
LEIBNITZ-INSTITUT FÜR OSTSEEFORSCHUNG WARNEMÜNDE (IOW) (2008B):<br />
Physikalische <strong>und</strong> ökologische Auswirkungen einer Kühlwasserausbreitung im Greifswalder<br />
Bodden – Endbericht. – unveröff. Gutachten im Auftrag des StAUN Strals<strong>und</strong>. Rostock,<br />
Warnemünde.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 332<br />
LEIPE, T. & J. SCABELL (1990):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die „Eisentenwalze“ oder eine effektive Strategie der kollektiven Nahrungssuche am Meeresboden<br />
durch Clangula hyemalis. Vogelwelt 111: 224-229.<br />
LEPPÄKOSKI, E. (1968):<br />
Transitory return of the benthic fauna of the Bornholm Basin, after extermination by oxygen<br />
insufficiency. Cahiers de Biologie Marine 10, pp.163-172.<br />
LIMPENS, H. J. G. & SCHULTE, R. (2000):<br />
Biologie <strong>und</strong> Schutz gefährdeter wandernder mitteleuropäischer Fledermausarten am Beispiel<br />
von Rauhhautfledermäusen (Pipistrellus nathusii) <strong>und</strong> Teichfledermäusen (Myotis<br />
dasycneme). – Nyctalus (N.F.) 7: 317-327.<br />
LITTERSKI, M. & SCHIEFELBEIN, U. (2007):<br />
Rote Liste der gefährdeten Flechten Mecklenburg-Vorpommerns, 2. Fassung. – 56 S.,<br />
Schwerin.<br />
LOBER, T. (2011A):<br />
Immissionsprognose Luftschadstoffe für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In<br />
der Fassung vom 01.11.2011. Penzlin.<br />
LOBER, T. (2011B):<br />
Schallimmissionsprognose für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In der Fassung<br />
vom 01.11.2011. Penzlin.<br />
LOBER, T. (2011C):<br />
Schallimmissionsprognose für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong> - Gesamtlärmbetrachtung<br />
zur FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. In der Fassung vom 21.03.2011.<br />
Penzlin.<br />
LOBER, T. (2011D)<br />
Ermittlung der Schornsteinhöhe für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>, in der<br />
Fassung vom 01.11.2011. Penzlin.<br />
LOBER, T. (2011E)<br />
Immissionsprognose Schwefel- <strong>und</strong> Stickstoffdepositionen für das Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk<br />
<strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. In der Fassung vom 04.04 2011. Penzlin.<br />
LUDWIG, G. & SCHNITTLER, M. (1996):<br />
Rote Liste der Pflanzen Deutschlands.<br />
LUDWIG, A., DEBUS, L., LIECKEFELDT, D., WIRGIN, I., BENECKE, N., JENCKENS, I., WILLIOT, P.,<br />
WALDMANN, J.R., PITRA, C. (2002):<br />
When the American sea sturgeon swam east - Nature, vol. 419: 447-448.<br />
MACFARLAND, W. E. (1931):<br />
A study of the Bay of F<strong>und</strong>y herring. Ann. Rept. Biol. Board Canada for 1930: 23-24.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 333<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
MADSEN, JOHN D. & ADAMS, MICHAEL S. (1989):<br />
The light and temperature dependence of photosynthesis and respiration in Potamogeton<br />
pectinatus L.. Aquatic Botany Nr. 36/1. S. 23-31.<br />
MARILIM (2011):<br />
Stellungnahme zum Bewertungsmodell zur Beurteilung von Auswirkungen der Kühlwassereinleitung<br />
auf marine Lebensräume <strong>und</strong> Arten. Errichtung <strong>und</strong> Betrieb des Gas- <strong>und</strong><br />
<strong>Dampfturbinenkraftwerks</strong> <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>. Schönkirchen.<br />
MAUERSBERGER, R. (2003):<br />
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - Große Moosjungfer.- In: PETERSEN, B.; ELL-<br />
WANGER, G.; BIEWALD, G.; HAUKE, U.; LUDWIG, G.; PRETSCHER, P., SCHRÖDER, E. & A.<br />
SSYMANK (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung<br />
von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Bd.: Pflanzen <strong>und</strong> Wirbellose.- Schriftenr.<br />
Landschaftspfl. u. Natursch, 69, Bd. 1: 586 - 592.<br />
MEADOWS, P. S. & REID, A. (1966):<br />
The behaviour of Corophium volutator (Crustacea. Amphipoda). J. Zool. London 150.<br />
MEIßNER, K. & A. BICK (1997):<br />
Population dynamics and ecoparasitological surveys of Corophium volutator in coastal wa-<br />
ters in the Bay of Mecklenburg (southern Baltic Sea). Diseases of Aquatic Organisms [DIS.<br />
AQUAT. ORG.]. Vol. 29, no. 3, pp.169-179.<br />
MEITZNER, V. & T. MARTSCHEI (2000):<br />
Neue F<strong>und</strong>e europäisch geschützter Insektenarten. – In: Naturschutzarbeit in Mecklenburg-<br />
Vorpommern 43 (1): 70-71.<br />
MENDEL, B., SONNTAG, N., WAHL, J., SCHWEMMER, P., DRIES, H., GUSE, N., MÜLLER, S. & S.<br />
GARTHE (2008):<br />
Artensteckbriefe von See- <strong>und</strong> Wasservögeln der deutschen Nord- <strong>und</strong> Ostsee.- Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Biologische Vielfalt. H. 59. B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz. Bonn-Bad Godesberg: S. 40.<br />
MENGEL, K. (2010):<br />
Die Verteilung des Bleis in Salzgesteinen der Bohrung Moeckow K1. Abschlussbericht zum<br />
4. März 2010. TU Clausthal. Fachgebiet Mineralogie-Geochemie-Salzlagerstätten. Institut für<br />
Endlagerforschung. Göttingen.<br />
MERCK, T. & H. VON NORDHEIM (1996):<br />
Rote Listen <strong>und</strong> Artenlisten der Tiere <strong>und</strong> Pflanzen des deutschen Meeres- <strong>und</strong> Küstenbereichs<br />
der Ostsee. - Schriftenreihe für Landschaftspflege <strong>und</strong> Naturschutz 48. 108 S., B<strong>und</strong>esamt<br />
für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.<br />
MEYER, H. (2002):<br />
Messungen zum Wasseraustausch im Freesendorfer See 2001 <strong>und</strong> 2002. Geografisches<br />
Institut der Universität Greifswald, 2002. i. A. <strong>EWN</strong> GmbH <strong>Lubmin</strong>.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 334<br />
MIERWALD et al. (2004):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Merkblatt 19 des "Gutachtens zum Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im B<strong>und</strong>esfernstraßenbau"<br />
MILLS, A., FISH, J. D. (1980):<br />
Effects of salinity and tempterature on Corophium volutator and C. arenarium (Crustacea:<br />
Amphipoda), with particular reference to distrubution. Mar. Biol. 58: 153 - 161<br />
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (MLUV), (HRSG.) (2009):<br />
Arbeitsanweisung zum Management von FFH-Lebensraumtypen. Stand 15.1.2009.<br />
MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (MLUV), (HRSG.) (2011):<br />
Arbeitsanweisung zum Management von FFH-Waldlebensraumtypen. Stand September<br />
2005, i.d.F. vom 23.11.2011(Fortschreibung).<br />
MOURITSEN, K. N., TOMPKINS, D. M. & POULIN, R. (2005)<br />
Climate warming may cause a parasite-induced collapse in coastal amphipod populations.<br />
Oecologia 146, 476 - 483<br />
MUNKES, B. (2005):<br />
Seagrass Systems – stability of seagrass systems against anthropogenic impacts. Diss.,<br />
Christian- Albrechts-Universität Kiel, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät. Kiel<br />
MUUS, B. J. (1967):<br />
The fauna of danish estuaries and lagoons. Meddelelser fra Danmarks Fiskeri-og Hav<strong>und</strong>ersoegelser<br />
5.<br />
NAGEL, HANS-DIETER; BECKER, ROLF; EITNER, HEIKO; HÜBENER, PHILIPP; KUNZE, FRANK; SCHLU-<br />
TOW, ANGELA; SCHÜTZE, GRUDRUN & WEIGELT-KIRCHNER, REGINE (2004):<br />
Critical loads für Säure <strong>und</strong> eutrophierenden Stickstoff. Umweltforschungsplan des B<strong>und</strong>esministeriums<br />
für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Reaktorsicherheit<br />
ÖKO-DATA STRAUSBERG (2011)<br />
Modellierung von Critical Loads für Stickstoff- <strong>und</strong> Schwefel-Depositionen für ausgewählte<br />
FFH-Lebensraumtypen im FFH-Gebiet "Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong><br />
Nordspitze Usedom". Fachgutachten im Auftrag von Froelich & Sporbeck Potsdam. Strausberg.<br />
OTT, J. & W. PIPER (1998):<br />
Rote Liste der Libellen (Odonata), Bearbeitungsstand 1997. - in: B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz:<br />
Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe Landschaftspflege <strong>und</strong> Naturschutz<br />
55: 260-263.<br />
PETERSEN, B. et al. (2003):<br />
Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten<br />
der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 1: Pflanzen <strong>und</strong> Wirbellose, BfN Schriftenreihe für<br />
Landschaftspflege <strong>und</strong> Naturschutz, Heft 69/Band 1. Bonn Bad Godesberg.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 335<br />
PETERSEN, B. et al. (2004):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000, Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten<br />
der FFH-Richtlinie in Deutschland, Band 2: Wirbeltiere, BfN Schriftenreihe für Landschafts-<br />
pflege <strong>und</strong> Naturschutz, Heft 69/Band 2. Bonn Bad Godesberg.<br />
PETTERSSON, J. & T. STALIN (2003):<br />
The influence of offshore windmills on migration birds in southeast coast of Sweden. – GE<br />
Wind Energy.<br />
PORSCHE CH., SCHUBERT H., SELIG, U. (2008)<br />
Rezente Verbreitung submerser Makrophyten in den inneren Küstengewässern der deutschen<br />
Ostseeküste, in: Meeresbiologische Beiträge, Heft 20, S. 109 – 122, Rostock.<br />
POTT, R. (1995):<br />
Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Stuttgart.2. Auflage.<br />
PROBST, S., KUBE, J. & A. BICK (2000):<br />
Effects of winter severity on life history pattern and population dynamics of Hydrobia ventrosa<br />
(Gastropoda: Posobranchia). Arch. Hydrobiol. 148: 383-396.<br />
QUINN, J. M., G. L. STEELE, C. W. HICKEY AND M. L. VICKERS (1994):<br />
Upper thermal tolerances of twelve New Zealand stream invertebrate species. New Zealand<br />
J. Mar. Freshwat. Res. 28 (4), pp.391 - 397.<br />
RECK, H., HERDEN, C. RASSMUS, J. & R. WALTER (2001):<br />
Die Beurteilung von Lärmwirkungen auf frei lebende Tierarten <strong>und</strong> die Qualität ihrer Lebensräume<br />
– Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Konventionsvorschläge für die Regelung von Eingriffen nach<br />
§ 8 BNatSchG. – Angewandte Landschaftsökologie, H. 44: 125-151.<br />
REID, R. N., CARGNELLI, L. M., GRIESBACH, S. J., PACKER, D. B., JOHNSON, D. L., ZETLIN, C. A.,<br />
MORSE, W. W. & P. L. BERRIEN (1999):<br />
Essential Fish Habitat Source Document: Atlantic Herring, Clupea harengus, Life History and<br />
Habitat Characteristics. NOAA Technical Memorandum NMFS-NE-126, U. S. DEPART-<br />
MENT OF COMMERCE, National Oceanic and Atmospheric Administration, Massachusetts,<br />
USA, 48p.<br />
REIJNEN, R., FOPPEN, R., BRAAK, C. TER, THISSEN, J. (1995A):<br />
The effect of car traffic on breeding bird populations in woodland <strong>III</strong>. Reduction of density in<br />
relation to the proximity of main road corridors. – J. Appl. Ecology 32: 187-202<br />
REIJNEN, R. & R. FOPPEN (1995B):<br />
The effects of car traffic on breeding bird populations in woodland. IV. Influence of population<br />
size on the reduction of density close to a highway, Journal of Applied Ecology, 32: 481-491.<br />
REIJNEN, R., FOPPEN, R. AND H. MEEUWSEN (1996):<br />
The effects of traffic on the density of breeding birds in Dutch agricultural grasslands, Biological<br />
Conservation, 75: 255-260.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 336<br />
REIJNEN, R., FOPPEN, R., VEENBAAS, G. (1997):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect and considerations in planning<br />
and managing road corridors – Biodiversity an Conservation 6: 567-581.<br />
ROSEMARIN, A. & NOTINI, M. (1996):<br />
Factors determining the occurrence of bladderwreck (Fucus vesiculosus L.) in the Baltic<br />
Proper and Bothnian Sea. In: Proceedings of the 13th Symposium of the Baltic Marine Biologists.<br />
Pp. 101-112<br />
ROSENBERG, R., HELLMAN, B. & B. JOHANSSON (1991):<br />
Hypoxic tolerance of marine benthic fauna. Mar. Ecol. Prog. Series 79: 127-131.<br />
ROSENTHAL, H. & M. H. FONDS (1973):<br />
Biological observation during rearing experiments with the garfish Belone belone. Marine Biology<br />
21, 203–18.<br />
SAGERT, S., RIELING, T., EGGERT, A., SCHUBERT, H. (2008):<br />
Development of a phytoplankton indicator system for the ecological assessment of brackish<br />
coastal waters (German Baltic Sea coast), Hydrobiologia, 2008.<br />
SCHABELON, H., J. KUBE, M. WENZEL, A. DARR, F. WOLF, J. BELLEBAUM, S. BLEICH, K. BROSDA,<br />
A. SCHULZ, S. FISCHER & R. FÜRST (2008):<br />
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zur Nord Stream Pipeline von der Grenze der deutschen<br />
Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) bis zum Anlandungspunkt. Bericht an Nord Stream,<br />
Institut für Angewandte Ökologie, Neu Broderstorf.<br />
SCHEFFER, M.; HOSPER, S. H.; MEIJER, ;M.-L.; MOSS, B. & JEPPESEN, E. (1993):<br />
Alternative equilibria in shallow lakes. In: Tree, 8: 275-279.<br />
SCHELLER, W. (2007):<br />
Ergebnisse der selektiven Brutvogelrevierkartierung in ausgewählten Bereichen des SPA<br />
Greifswalder Bodden <strong>und</strong> SPA 34. Teterow. Unveröff. Fachgutachten im Auftrag von FROE-<br />
LICH & SPORBECK Schwerin.<br />
SCHIEMENZ, H. (1995):<br />
Die Kreuzotter. - 3. unveränd. Aufl., Nachdruck der 2. Auflage von 1987, Die Neue Brehm-<br />
Bücherei Bd. 332, Westarp Wissenschaften, Magdeburg.<br />
SCHIEMENZ, H. & GÜNTHER, R. (1994):<br />
Verbreitungsatlas der Amphibien <strong>und</strong> Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen<br />
DDR). Natur <strong>und</strong> Text, Rangsdorf.<br />
SCHIEWER, U. (2001):<br />
Phytoplankton, Produktivität <strong>und</strong> Nahrungsnetze. – in: Die Darß-Zingster-Boddenkette, Meer<br />
<strong>und</strong> Museum, Bd. 16: 39-45.<br />
SCHIEWER, U. (2008):<br />
Ecology of Baltic Ecosystems. Springer, Berlin, 428 pp.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 337<br />
SCHMIEDEL, J. (2001):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf die Tierwelt – ein Überblick. – Schriftenr. Landschaftspflege<br />
Naturschutz des B<strong>und</strong>esamtes für Naturschutz, H. 67: 19-51.<br />
SCHMIDT, D. (1993):<br />
Rote Liste der gefährdeten Armleuchteralgen (Charophyten) Mecklenburg-Vorpommerns.1.<br />
Fassung. Schwerin.<br />
SCHÖLLER, H. (HRSG.) (1997):<br />
Flechten - Geschichte, Biologie, Systematik, Ökologie, Naturschutz, kulturelle<br />
Bedeutung. – Kleine Senkenberg-Reihe 27. 246 S.<br />
SCHRAMM, W. (1968):<br />
Ökologisch-physiologische Untersuchungen zur Austrocknungs- <strong>und</strong> Temperaturresistenz<br />
an Fucus vesiculosus L. der westlichen Ostsee<br />
SCHRÖDER, H. (1995):<br />
Meerneunaugen in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns. - Meer <strong>und</strong> Museum<br />
11: 31-40.<br />
SCHÜTTE, P. (2008):<br />
Die Berücksichtigung von Vorhaben Dritter im Anlagenzulassungsrecht. - NuR 30:142-147.<br />
SCHWARZ, J., HARDER, K., VON NORDHEIM, H. & W. DINTER (2003):<br />
Wiederansiedlung der Ostseekegelrobbe an der deutschen Ostseeküste. - Angewandte<br />
Landschaftsökologie, H. 54, B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.<br />
SELLIN, D. (1990):<br />
Fischlaich als Nahrung von Vögeln. – Vogelwelt 111:217-224.<br />
SELLIN, D. (1999A):<br />
<strong>GuD</strong> Vorhaben <strong>Lubmin</strong>. Verträglichkeitsstudie Teilstudie avifaunistische Dokumentation<br />
(Stand Juni/Juli 1999). Unveröff. Gutachten i. A. <strong>EWN</strong> GmbH <strong>Lubmin</strong>.<br />
SELLIN, D. (1999B):<br />
<strong>GuD</strong> Vorhaben <strong>Lubmin</strong>. Verträglichkeitsuntersuchung nach § 19c BNatSchG des EU-<br />
Vogelschutzgebiets „Greifswalder Bodden <strong>und</strong> Strelas<strong>und</strong>“ - Ergänzende Beurteilung der im<br />
Herbst 1999 fortgeführten faunistischen Bestandserfassungen (November 1999). Unveröff.<br />
Gutachten i. A. <strong>EWN</strong> GmbH <strong>Lubmin</strong>.<br />
SELLIN, D. (2004):<br />
<strong>GuD</strong> Vorhaben <strong>Lubmin</strong> - 2. Kraftwerksstandort. Brutvogelerfassung 2001. Gutachten im Auftrag<br />
des Büros Froelich & Sporbeck, Greifswald.<br />
SELLIN, D. (2003-07):<br />
Betreuungsberichte 2003-2007 zum NSG Struck, Ruden <strong>und</strong> Peenemünder Haken, Teilbereich<br />
Struck <strong>und</strong> Freesendorfer Wiesen, Berichte 22 – 26, unveröff., Greifswald.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 338<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
SIMON, M. & P. BOYE (2004):<br />
Myotis myotis (Borkhausen, 1797) - Großes Mausohr.- In: PETERSEN, B.; ELLWANGER, G.;<br />
BLESS, R.; BOYE, P.; SCHRÖDER, E.; SSYMANK, A. (Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem<br />
Natura 2000. Ökologie <strong>und</strong> Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland.<br />
Bd.: Wirbeltiere.- Schriftenr. Landschaftspfl. u. Natursch, 69, Bd. 2: 503 - 511.<br />
SIMON, M. & WIDDIG (2005):<br />
Fledermausk<strong>und</strong>liche Erfassung im Rahmen der Gr<strong>und</strong>datenerfassung im FFH-Gebiet "Werra-<br />
<strong>und</strong> Wehretal" 4825-302.- unveröff. Gutachten i.A. Regierungspräsidium Kassel – Obere<br />
Naturschutzbehörde: 85 S<br />
SONNTAG, N., MENDEL, B. & S. GARTHE (2007):<br />
Erfassung von Meeressäugetieren <strong>und</strong> Seevögeln in der deutschen Ost- <strong>und</strong> Nordsee (EM-<br />
SON): Teilvorhaben Seevögel. Abschlussbericht für das F+E-Vorhaben FKZ: 802 85 260<br />
(B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz).<br />
SPRENGEL, G. (1997):<br />
Verluste an Organismen im Bereich der deutschen Küsten von Nord- <strong>und</strong> Ostsee einschließlich<br />
der Ästuare durch Entnahme von Wasser für großtechnische Kühlsysteme – Bestandsaufnahme,<br />
ökologische Bewertung <strong>und</strong> Vorstellung von Verfahren zur Problemminderung.<br />
Forschungsbericht 202 04 258, im Auftrag des Umweltb<strong>und</strong>esamtes (UBAFB 99-055). 354<br />
S.<br />
SSYMANK, A. & D. DOCZKAL (1998):<br />
Rote Liste der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) (Bearbeitungsstand: 1998). 65-72. In:<br />
B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz (Hrsg.), Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe<br />
für Landschaftspflege <strong>und</strong> Naturschutz, Heft 55; Münster (Landwirtschaftsverlag).<br />
SSYMANK, A., U. HAUKE, C. RÜCKRIEM & E. SCHRÖDER (BEARB.) (1998):<br />
Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. BfN-Handbuch zur Umsetzung der<br />
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) <strong>und</strong> der Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG). -<br />
B<strong>und</strong>esamt für Naturschutz (BfN) (Hrsg.) (1998) - Schriftenr. Landschaftspfl. u. Naturschutz,<br />
H. 53, Bonn-Bad Godesberg.<br />
STEINMANN, I. & R. BLESS (2004):<br />
Lampetra fluviatilis (LINNAEUS, 1758). – in: PETERSEN et al. 2004, S. 276-280.<br />
SUBKLEW, H.J. (1981):<br />
Brackwassertiere als Schädlinge im Kühlwassersystem eines Kraftwerkes. - Acta. hydro-<br />
chim. hydrobiol. 9 (5): S. 511-522.<br />
SUBKLEW, H.-J. (1986):<br />
Strömungsverhältnisse beim NSG Freesendorf-Struck. - Naturschutzarbeit in Mecklenburg<br />
20 (1), 33-37.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 339<br />
THIEL, R. & H. M. WINKLER (2007):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Schlussbericht über das F+E-Vorhaben „Erfassung von FFH-Anhang II-Fischarten in der<br />
deutschen AWZ von Nord- <strong>und</strong> Ostsee (ANFIOS)“,114 S, veröffentlicht im Internet unter<br />
http://www.habitatmare.de/de/downloads/berichte/Erfassung_FFH_Fischarten_Nordsee-<br />
Ostsee_2007.pdf.<br />
TRAUTNER, J. (2010):<br />
Die Krux der charakteristischen Arten. Zu notwendigen <strong>und</strong> zugleich praktikablen Prüfungsanforderungen<br />
im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung. - Natur <strong>und</strong> Recht 32:90-98.<br />
TUCKER, G. M. & HEATH, M. F. (1994):<br />
Birds in Europe: Their conservation status. – Birdlife Conservation Series 3, Cambridge.<br />
TÜRK, R., V. WIRTH & LANGE O. L. (1974):<br />
CO2-Gaswechsel-Untersuchungen zur SO2-Resistenz von Flechten. - Oecologia 15: 33-64.<br />
TÜV NORD GMBH (2011):<br />
Auswirkungen der Einleitung von Kühlwasser am Standort <strong>Lubmin</strong> in den Greifswalder<br />
Bodden auf dessen Hydrochemie <strong>und</strong> Phytoplanktonproduktion. Erweiterter Entwurf vom<br />
04.01.2011.<br />
TURNER, H., J. G. J. KUIPER, N. THEW, R. BERNASCONI, J. RÜETSCHI, M. WÜTHRICH & M. GOSTELI<br />
(1998):<br />
Fauna Helvetica 2: Atlas der Mollusken der Schweiz <strong>und</strong> Liechtensteins. - Neuchâtel: Centre<br />
suisse de cartographie de la faune <strong>und</strong> Schweizerische Entomologische Gesellschaft.<br />
UHL, R., LÜTTMANN, J., BALLA, S., MÜLLER-PFANNENSTIEL, K. (2009):<br />
Ermittlung <strong>und</strong> Bewertung von Wirkungen durch Stickstoffdepositionen auf Natura 2000 Gebiete<br />
in Deutschland. COST 729 Mid-term Workshop 2009 Nitrogen Deposition and Natura<br />
2000 ”Science & practice in determining environmental impacts” on 18-20 May, 2009 Brussels<br />
UK BIODIVERSITY GROUP (1999):<br />
UK Biodiversity Group Tranche 2 Action Plans: Volume 5 - Maritime Species and Habitats.<br />
English Nature, Peterborough, UK.<br />
UMWELTBUNDESAMT FÜR MENSCH UND UMWELT (UBA) (2004):<br />
Handbuch der Emissionen des Straßenverkehrs, HBEFA 2.1, Februar, 2004.<br />
UMWELTBUNDESAMT FÜR MENSCH UND UMWELT (UBA) (2010):<br />
Umweltkernindikatorensysteme: Überschreitung der Critical Loads für Säure (Versauerung).<br />
http://www.umweltb<strong>und</strong>esamt-daten-zurumwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=2871.<br />
Zugriff am 21.06.2010.<br />
UMWELTBUNDESAMT FÜR MENSCH UND UMWELT (UBA) (2011):<br />
Vorbelastungsdaten Stickstoff TA Luft Nr. 4.8 – Genehmigungsverfahren.<br />
http://gis.uba.de/website/depo1/viewer.htm, mehrere Zugriffe.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 340<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
UMWELTMINISTERIUM DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN (UM M-V) (1991):<br />
Rote Liste der gefährdeten Amphibien <strong>und</strong> Reptilien Mecklenburg-Vorpommerns. 1. Fassung,<br />
Stand: Dezember 1991, Schwerin.<br />
UMWELTMINISTERIUM MECKLENBURG-VORPOMMERN (UM M-V) (HRSG.) (1993):<br />
Rote Liste der gefährdeten Libellen Mecklenburg-Vorpommerns.<br />
UMWELTMINISTERIUM DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN (UM-MV) (2003):<br />
Gebietscharakteristik zum FFH-Nachmeldegebiet „Greifswalder Bodden.<br />
UMWELTPLAN (2005):<br />
Netzanbindung des Offshore-Windparks Arkona-Becken Südost – Ergebnisse der Brutvogelkartierung.<br />
– unveröff. Fachgutachten im Auftrag der AWE Arkona-Windpark-<br />
Entwicklungs-GmbH.<br />
UMWELTPLAN (2008):<br />
Anlandestation Greifswald, Untersuchungen nach § 34 (Hauptuntersuchung), FFH-Gebiet<br />
„Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>s <strong>und</strong> Nordspitze Usedom (DE 1747-301), Stand<br />
März 2008. – unveröff. Gutachten im Auftrag der WINGAS GmbH.<br />
UMWELTPLAN (2010):<br />
Gasspeicher Moeckow: Rahmenbetriebsplan „Frischwasserentnahme <strong>und</strong> Salzwassereinleitung<br />
bei <strong>Lubmin</strong>. Teil C 1.1 – Umweltverträglichkeitsstudie. Strals<strong>und</strong>.<br />
UMWELT- UND ROHSTOFF-TECHNOLOGIE GMBH GREIFSWALD (URST 2011):<br />
Geotechnischer Bericht, Berechnung der bauzeitlichen Gr<strong>und</strong>wasserabsenkung. Greifswald.<br />
Juli, 2011.<br />
VAN HELSDINGEN, P. J., L. WILLEMSE & M. C. D. SPEIGHT (1996):<br />
Backgro<strong>und</strong> information on invertebrates of the Habitats Directive and the Bern Convention,<br />
Part II: Mollusca and Echinodermata. - Nature and environment No. 81, Strasbourg: Council<br />
of Europe.<br />
VERHOEVEN, J. T. A. (1979):<br />
The ecology of ruppia-dominated communities in Western europe. I. distribution of Ruppia<br />
representatives in relation to theit autecology. Aquatic Botany, 6: 197-268.<br />
VIETTINGHOFF, U.; HUBER, M.-K.; FRANEK, D. & H. WESTPHAL (1991):<br />
Ökologische Auswirkungen der Veränderung der Betriebsbedingungen des KKW Nord auf<br />
den Greifswalder Bodden. Jahresbericht 1990 zum Fördervorhaben des UBA <strong>und</strong> des BMU.<br />
Hrsg.: BMU-UBA.<br />
VÖLKL, W. & P. M. KORNACKER (2004):<br />
Die traditionelle Nutzung von Schlüsselhabitaten bei der Kreuzotter (Vipera berus berus<br />
[Linnaeus, 1758]): Konsequenzen aus verhaltensökologischen Untersuchungen für Schutzkonzeptionen.<br />
- Mertensiella 15: 221-228.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 341<br />
VÖLKL; W. & B. THIESMEIER (2002):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Kreuzotter. - Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 5, Laurenti-Verlag, Bielefeld.<br />
VOIGT, M. & H. LÜCHTENBERG (1996):<br />
Fischbiologisches Gutachten zur Zusammensetzung <strong>und</strong> Überlebensrate der vom KKB mit<br />
dem Kühlwasser entnommenen Fische <strong>und</strong> Krebse. - Arbeitsgemeinschaft Prof. Dr. H. Möller,<br />
H. Lüchtenberg . Dr. M. Voigt. Im Auftrag der Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH.<br />
VOIGTLÄNDER, U. (1999A):<br />
Biotoptypenkartierung im Bereich der Freesendorfer Wiesen, des Struck <strong>und</strong> in Teilen der<br />
<strong>Lubmin</strong>er Heide. Erstellt im Auftrag des Büros Froelich & Sporbeck. Waren (Müritz).<br />
VOIGTLÄNDER, U. (1999B):<br />
Ergänzende Untersuchung über mögliche Auswirkungen des geplanten VASA Energy Großkraftwerkes<br />
<strong>Lubmin</strong> auf den Freesendorfer See. Erstellt im Auftrag des Büros Froelich &<br />
Sporbeck. Waren (Müritz).<br />
VOIGTLÄNDER, U. (2001):<br />
Untersuchungen zur Stickstoffbelastung der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Freesendorfer<br />
Sees. - erstellt im Auftrag der Energiewerke Nord (<strong>EWN</strong>) - Büro für Landschaftsplanung.<br />
Waren (Müritz).<br />
VOIGTLÄNDER, U. (2007):<br />
Ergebnisse einer Nachkartierung von FFH-Lebensraumtypen im Bereich der zum FFH-<br />
Gebiet „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong> <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ gehörenden<br />
Flächen der Freesendorfer Wiesen <strong>und</strong> des Struck. Erstellt im Auftrag des Büros Froelich &<br />
Sporbeck. SALIX - Kooperationsbüro für Umwelt- <strong>und</strong> Landschaftsplanung. Waren (Müritz),<br />
Oktober 2007.<br />
VON OERTZEN, J. A. (1973):<br />
Abiotic potency and physiological resistance of shallow and deep water bivalves. OIKOS,<br />
Suppl. 15, S..261-266.<br />
WEIDEMANN, H. J. (1995):<br />
Tagfalter beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg.<br />
WEIDLICH, M. & V. WEIDLICH (1984):<br />
Veränderungen im NSG „Gothensee <strong>und</strong> Thurbruch“ <strong>und</strong> ihr Einfluss auf den Rückgang des<br />
Schmetterlingsbestandes. Naturschutzarbeit Meckl.; 27/1, 25-29.<br />
WELLS, S. M. & J. E. CHATFIELD (1992):<br />
Threatened non-marine molluscs in Europe. - Nature and environment No. 64, Strasbourg:<br />
Council of Europe.<br />
WESTRICH, P. (1989):<br />
Die Wildbienen Baden-Württembergs. 2 Bde., 972 S.; Stuttgart (Ulmer).<br />
WESTRICH, P., U. FROMMER, K. MANDERY, H. RIEMANN, H. RUHNKE, C. SAURE & J. VOITH (2008):
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 342<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Rote Liste der Bienen Deutschlands (Hymenoptera, Apidae) (4. Fassung, Dezember 2007).<br />
Eucera 1: 33-87.<br />
WIESE, V. (1991):<br />
Atlas der Land- <strong>und</strong> Süßwassermollusken in Schleswig-Holstein. - Kiel: Landesamt für Naturschutz<br />
<strong>und</strong> Landschaftspflege Schleswig-Holstein.<br />
WIJNHOVEN S, VAN RIEL MC, VAN DER VELDE G (2003):<br />
Exotic and indigenous freshwater gammarid species. Physiological tolerance to water temperature<br />
in relation to ionic content of the water. Aquat Ecol 37: 151 - 158<br />
WILDERMUTH, H. (1992):<br />
Habitate <strong>und</strong> Habitatwahl der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis Charp. 1825) (Odonata,<br />
Libellulidae).- Z. Ök. Naturschutz, 1: 3 - 21.<br />
WINKLER, H.M., WATERSTRAAT, A. & N. HAMANN (2002):<br />
Rote Liste der R<strong>und</strong>mäuler, Süßwasser- <strong>und</strong> Wanderfische Mecklenburg-Vorpommerns,<br />
Schwerin.<br />
WOHLRAB, F. (1959):<br />
Die Bodenfauna des Freesendorfer Sees – Ein Beitrag zur Ökologie der Fauna eines Randgewässers<br />
des Greifswalder Boddens. – Archiv der Fre<strong>und</strong>e der Naturgeschichte in Mecklenburg,<br />
Jahr. 1959 5: 306-422.<br />
WOLFF, W. J. (1973):<br />
The estuary as a habitat an analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine<br />
area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. Zoologische Verhandlingen 126.<br />
WRANIK, W., V. MEITZNER & T. MARTSCHEI (2009):<br />
Verbreitungsatlas der Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommerns. – Landesamt für Umwelt,<br />
Naturschutz <strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern <strong>und</strong> Arbeitskreis Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Hrsg.), Friedland (Verlagsdruckerei Steffen), 273 S.<br />
YOUSEF, M. A. M., NORDHEIM, H., KUESTER, A. & H. SCHUBERT (1997):<br />
Characeae as bioindicators of the water quality of shallow waters at the Baltic Sea coast. Aktuelle<br />
Probleme der Meeresumwelt. Vorträge des 7. Wissenschaftlichen Symposiums 27.<br />
<strong>und</strong> 28. Mai 1997 in Hamburg 7: 173-182.<br />
ZETTLER, M. L. & M. RÖHNER (2004):<br />
Verbreitung <strong>und</strong> Entwicklung des Makrozoobenthos der Ostsee zwischen Fehmarnbelt <strong>und</strong><br />
Usedom - Daten von 1839 bis 2001. In: B<strong>und</strong>esanstalt für Gewässerk<strong>und</strong>e (HRSG.), Die<br />
Biodiversität in der deutschen Nord- <strong>und</strong> Ostsee, Band 3. Bericht BfG 1421, Koblenz.<br />
ZETTLER, M. L., JUEG, U., MENZEL-HARLOFF, H., GÖLLNITZ, U., PETRICK, S., WEBER, E. & R. SEE-<br />
MANN (2006):<br />
Die Land- <strong>und</strong> Süßwassermollusken Mecklenburg-Vorpommerns. - Obotritendruck Schwerin,<br />
318 S.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 343<br />
ZIEGELMEIER, E. (1966):<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Die Schnecken (Gastropoda Prosobranchia) der deutschen Meeresgebiete <strong>und</strong> brackigen<br />
Küstengewässer. Biologische Anstalt Helgoland, Hamburg.<br />
Mündliche Mitteilungen:<br />
GEßNER, J. (LEIBNITZ-INSTITUT FÜR GEWÄSSERÖKOLOGIE UND BINNENFISCHEREI BERLIN, ABT. BIO-<br />
LOGIE UND ÖKOLOGIE DER FISCHE):<br />
Telefongespräch vom 08.10.2008 zur Orientierung des Störs<br />
GEßNER, J. (LEIBNITZ-INSTITUT FÜR GEWÄSSERÖKOLOGIE UND BINNENFISCHEREI BERLIN, ABT. BIO-<br />
LOGIE UND ÖKOLOGIE DER FISCHE):<br />
„Die Rückkehr des Störs in Nord- <strong>und</strong> Ostsee“, Vortrag im Rahmen des 30. Deutschen Naturschutztages<br />
2010 am 30.09.2010 in Strals<strong>und</strong>.<br />
GOSSELCK, F. (16.08.2007)<br />
Mündl. Mitteilung <strong>und</strong> bestätigtes Gesprächsprotokoll vom 16.08.2007 von DR. F. GOSSELCK,<br />
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IfAÖ), Broderstorf.<br />
GOSSELCK, F. (20.08.2007)<br />
Mündl. Mitteilung vom 20.08.2007 <strong>und</strong> bestätigtes Gesprächsprotokoll vom 21.08.2007 von<br />
DR. F. GOSSELCK, INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLOGIE (IfAÖ), Broderstorf.<br />
GOSSELCK, F. (13.01.2010)<br />
Mündl. Mitteilung vom 13.01.2010 von DR. F. GOSSELCK, INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ÖKOLO-<br />
GIE (IfAÖ), Broderstorf.<br />
HÜPPOP, O. (16.10.2008)<br />
Mündl. Mitteilung <strong>und</strong> bestätigtes Gesprächsprotokoll vom 16.10.2008 von DR. O. HÜPPOP,<br />
VOGELWARTE HELGOLAND.<br />
SELLIN, D. (14.09.2009):<br />
Mündl. Mitteilung von Hr. D. Sellin, Gebietsbetreuer NSG Struck, Ruden <strong>und</strong> Peenemünder<br />
Haken, Teilbereich Struck <strong>und</strong> Freesendorfer Wiesen, bzgl. Vorkommen von Amphibien <strong>und</strong><br />
Reptilien im NSG, Gesprächsprotokoll vom 14.09.2009.<br />
THIEL, R. (25.08.2008):<br />
Mündl. Mitteilung von Herrn DR. RALF THIEL, Universität Hamburg, Dept. Biologie, Biozentrum<br />
Grindel <strong>und</strong> Zoologisches Museum, Ichthyologie, bzgl. Vorkommen <strong>und</strong> Verhalten von<br />
Wanderfischarten <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäulern, Gesprächsprotokoll vom 25.08.2008.<br />
WINKLER, H. M. (22.08. UND 25.08.2008):<br />
Mündl. Mitteilung von Herrn DR. HELMUT M. WINKLER, Institut für Biowissenschaften der Universität<br />
Rostock, Allgemeine <strong>und</strong> spezielle Zoologie, bzgl. Vorkommen <strong>und</strong> Verhalten von<br />
Wanderfischarten <strong>und</strong> R<strong>und</strong>mäulern, Gesprächsprotokoll vom 22.08. <strong>und</strong> 25.08.2008.
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 344<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Glossar <strong>und</strong> Abkürzungsverzeichnis<br />
a Jahr<br />
a. auch<br />
Abs. Absatz<br />
anthropogen vom Menschen beeinflusst oder verursacht<br />
BauGB Baugesetzbuch<br />
BGBl. Bürgerliches Gesetzblatt<br />
BImSchG B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz<br />
BNatSchG B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetz<br />
B-Plan Bebauungsplan<br />
bzgl. bezüglich<br />
CL Critical Load<br />
d Tag<br />
dB(A) Dezibel<br />
dm Dezimeter<br />
duB detailliert untersuchter Bereich<br />
EnBW Energie Baden-Württemberg Kraftwerke AG<br />
EWE EWE Energie AG<br />
eq Äquivalente<br />
EU Europäische Union<br />
<strong>EWN</strong> Energiewerke Nord GmbH<br />
ff. folgende<br />
FFH Fauna-Flora-Habitat<br />
FFH-LRT Lebensraumtyp des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie<br />
FFH-VU FFH-Verträglichkeitsuntersuchung<br />
FFH-VP FFH-Verträglichkeitsprüfung<br />
FGE Flussgebietseinheit<br />
FND Flächennaturdenkmal<br />
F-Plan Flächennutzungsplan<br />
FNP Flächennutzungsplan<br />
gem. gemäß<br />
ggf. gegebenenfalls<br />
GIRL-MV Geruchsimmissions-Richtlinie des Landes Mecklenburg-<br />
Vorpommern<br />
GOK Geländeoberkante<br />
GRZ Gr<strong>und</strong>flächenzahl (gibt den Versieglungsfaktor an)<br />
<strong>GuD</strong> I ehemals geplantes Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> I,
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 345<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
E.ON<br />
<strong>GuD</strong> II Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> II, EnBW<br />
<strong>GuD</strong> <strong>III</strong> Gas- <strong>und</strong> Dampfturbinenkraftwerk <strong>Lubmin</strong> <strong>III</strong>, <strong>EWN</strong> GmbH<br />
GWK Gewässerkörper<br />
ha Hektar<br />
i. d. R. in der Regel<br />
IfAÖ Institut für Angewandte Ökologie GmbH<br />
IJW Immissionsjahreswert<br />
IOW Institut für Ostseeforschung Warnemünde<br />
in Bearb. in Bearbeitung<br />
inkl. inklusive<br />
i. S. im Sinne<br />
IW Immissionswert<br />
K Kelvin<br />
kg Kilogramm<br />
KKW Kernkraftwerk, am Standort auf das ehemalige Kernkraftwerk „Bruno<br />
Leuschner“ bezogen, Eigentümer <strong>EWN</strong> GmbH<br />
LAI B<strong>und</strong>/Länder Arbeitsgemeinschaft Immissionen<br />
LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan<br />
LPG Landesplanungsgesetz<br />
LROP Landesraumordnungsprogramm<br />
LRT Lebensraumtyp<br />
LSG Landschaftsschutzgebiet<br />
LUA BB Landesumweltamt Brandenburg<br />
LWaldG M-V Landeswaldgesetz Mecklenburg-Vorpommern<br />
m³ Kubikmeter<br />
Mio. Millionen<br />
mm Millimeter<br />
M-V Mecklenburg-Vorpommern<br />
MW Megawatt<br />
MWel Megawatt elektrische Leistung<br />
NatSchAG M-V Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des<br />
B<strong>und</strong>esnaturschutzgesetzes<br />
Nr. Nummer<br />
NSG Naturschutzgebiet<br />
o. g. oben genannt<br />
PSU Salzgehalt in Promille<br />
REA Rauchgasreinigungsanlage<br />
Rn. Randnummer
FROELICH & SPORBECK Literatur <strong>und</strong> Quellenverzeichnis - Seite 346<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
RROP Regionales Raumordnungsprogramm<br />
s. siehe<br />
s. a. siehe auch<br />
s. o. siehe oben<br />
s. u. siehe unten<br />
SPA EU-Vogelschutzgebiet<br />
StAUN Staatliches Amt für Umwelt <strong>und</strong> Naturschutz<br />
StALU Staatliches Amt für Landwirtschaft <strong>und</strong> Umwelt<br />
t Tonne<br />
TÖB Träger Öffentlicher Belange<br />
u. <strong>und</strong><br />
u. a. unter anderem<br />
u. ä. <strong>und</strong> ähnlichem<br />
UBA Umweltb<strong>und</strong>esamt<br />
UG Untersuchungsgebiet<br />
UQN Umweltqualitätsnorm<br />
usw. <strong>und</strong> so weiter<br />
UVP Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
UVPG Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz<br />
UVU Umweltverträglichkeitsuntersuchung<br />
v. von<br />
v. a. vor allem<br />
VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden<br />
Stoffen <strong>und</strong> über Fachbetriebe<br />
vgl. vergleiche<br />
WBSS Western Baltic Spring Spawners<br />
WHG Wasserhaushaltsgesetz<br />
WRRL Wasserrahmenrichtlinie<br />
µg Mikrogramm<br />
µM/µmol Mikromol<br />
µm Mikrometer<br />
ZAB Zwischenlager für abgebrannte Brennstoffe<br />
z. B. zum Beispiel<br />
ZLN Zentrales Zwischenlager Nord<br />
z. T. zum Teil<br />
zus. zusammen<br />
zzgl. zuzüglich
Anhang<br />
FROELICH & SPORBECK Anhang<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 1: Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet „Greifswalder<br />
Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“ (DE 1747-<br />
301)
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/4<br />
1.1 Typ 1.2. Kennziffer 1.3. Ausfülldatum 1.4. Fortschreibung<br />
K<br />
1.5. Beziehung zu anderen NATURA 2000-Gebieten<br />
NATURA 2000-Kennziffer NATURA 2000-Kennziffer<br />
1.6. Informant<br />
1.7. Gebietsname<br />
1.8. Daten der Gebietsbenennung <strong>und</strong> -ausweisung<br />
Vorgeschlagen als Gebiet, das<br />
als GGB in Frage kommt<br />
Ausweisung als BSG<br />
D E 1 7 4 7 3 0 1<br />
2 0 0 4 0 5<br />
D E 1 7 4 7 4 0 1<br />
STANDARD-DATENBOGEN<br />
für besondere Schutzgebiete (BSG). Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung in Frage<br />
kommen (GGB) <strong>und</strong> besondere Erhaltungsgebiete (BEG)<br />
1. GEBIETSKENNZEICHNUNG<br />
I.L.N. Greifswald<br />
LUNG MV<br />
Landesamt für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Geologie Mecklenburg-Vorpommern<br />
Goldberger Straße 12, 18276 Güstrow<br />
Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom<br />
- Seite 1 von 23 -<br />
Als GGB bestätigt<br />
Ausweisung als BEG<br />
(später auszufüllen)
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/5<br />
2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts<br />
Länge Breite<br />
E 1 3<br />
W / G (Greenwich)<br />
2.2. Fläche (ha)<br />
5 9 9 7 0<br />
2 9 2 4 5 4 1 3 6<br />
2.3. Erstreckung (km)<br />
2.4. Höhe über NN (m):<br />
Min. Max. Mittel<br />
2.5. Verwaltungsgebiet<br />
NUTS-Kennziffer<br />
D E 8 0 1<br />
D<br />
D<br />
D<br />
D<br />
E<br />
E<br />
E<br />
E<br />
8<br />
8<br />
8<br />
8<br />
0<br />
0 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5<br />
D<br />
F<br />
H<br />
2.6. Biogeographische Region<br />
2. LAGE DES GEBIETES<br />
Name des Verwaltungsgebiets Anteil (%)<br />
Greifswald, Hansestadt<br />
Strals<strong>und</strong>, Hansestadt<br />
Nordvorpommern<br />
Ostvorpommern<br />
Rügen<br />
Meeresgebiet außerhalb eines NUTS-Verwaltungsgebiets<br />
X<br />
0<br />
0<br />
0<br />
5<br />
2<br />
9 3<br />
alpin atlantisch boreal kontinental makaronesisch mediterran<br />
- Seite 2 von 23 -
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/6<br />
3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN<br />
3.1. Im Gebiet vorhandene Lebensräume <strong>und</strong> ihre Beurteilung<br />
Anhang I - Lebensräume<br />
Kennziffer Anteil (%) Repräsentativität Relative<br />
1 1 1 0<br />
1 1 4 0<br />
1 1 5 0<br />
1 1 6 0<br />
1 1 7 0<br />
1 2 1 0<br />
1 2 2 0<br />
1 2 3 0<br />
1 3 3 0<br />
2 1 1 0<br />
2 1 2 0<br />
2 1 3 0<br />
2 1 8 0<br />
2 1 9 0<br />
3 1 5 0<br />
3 1 6 0<br />
5 1 3 0<br />
6 2 1 0<br />
6 2 3 0<br />
6 4 1 0<br />
6 5 1 0<br />
7 1 4 0<br />
7 2 3 0<br />
9 1 1 0<br />
9 1 3 0<br />
9 1 6 0<br />
9 1 9 0<br />
9 1 D 0<br />
9 1 E 0<br />
1 0<br />
2<br />
3<br />
7 5<br />
3<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
2<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
< 1<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
Fläche<br />
A<br />
- Seite 3 von 23 -<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
Erhaltungs-<br />
zustand<br />
A<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
Gesamt-<br />
beurteilung<br />
Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
A<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
3.2. Arten, auf die sich Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG bezieht <strong>und</strong> die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind, <strong>und</strong> Gebietsbeurteilung für sie<br />
3.2.a. Vögel, die im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Brütend Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
- Seite 4 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/7
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
3.2.b Regelmäßig vorkommende Zugvögel, die nicht im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Brütend Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
- Seite 5 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/8
DE1747301<br />
3.2.c Säugetiere, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Fortpflanzung Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
1 3 6 4 Halichoerus grypus i V<br />
C B B C<br />
1 3 5 5 Lutra lutra i R<br />
C B C C<br />
1 3 1 8 Myotis dasycneme i P<br />
C B C C<br />
1 3 2 4 Myotis myotis i P<br />
C B B C<br />
1 3 6 5 Phoca vitulina i V<br />
C B B B<br />
- Seite 6 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/9
DE1747301<br />
3.2.d Amphibien <strong>und</strong> Reptilien, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Fortpflanzung Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
- Seite 7 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/10
DE1747301<br />
3.2.e Fische, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Fortpflanzung Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
1 1 0 3 Alosa fallax i P<br />
D<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
1 1 3 0 Aspius aspius i V<br />
C B C C<br />
1 0 9 9 Lampetra fluviatilis i P<br />
C B C C<br />
1 0 9 5 Petromyzon marinus i P<br />
B B C C<br />
1 1 3 4 Rhodeus sericeus amarus i P<br />
C B C C<br />
- Seite 8 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/11
DE1747301<br />
3.2.f Wirbellose, die im Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
Population<br />
Nichtziehend Ziehend<br />
Fortpflanzung Überwinternd<br />
Auf dem<br />
Durchzug<br />
Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
1 0 4 2 Leucorrhinia pectoralis i P<br />
C C C C<br />
1 0 6 0 Lycaena dispar i V<br />
C C A C<br />
1 0 1 4 Vertigo angustior i P<br />
C B C C<br />
1 0 1 6 Vertigo moulinsiana i P<br />
C B C C<br />
- Seite 9 von 23 - Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.<br />
Nr. L 107/12
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/13<br />
3.2.g. Pflanzen, die im Anhang || der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind<br />
Kennziffer Name Population Gebietsbeurteilung<br />
Population Erhaltung Isolierung Gesamt<br />
1 9 0 3 Liparis loeselii i 51-100 C C C C<br />
- Seite 10 von 23 -<br />
Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
DE1747301<br />
3.3. Andere bedeutende Arten der Fauna <strong>und</strong> Flora<br />
Gruppe<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
- Seite 11 von 23 -<br />
Nr. L 107/14<br />
V S A R F W P Wissenschaftlicher Name Population Begründung<br />
(V = Vögel, S = Säugetiere, A = Amphibien, R = Reptilien, F = Fische, W = Wirbellose, P = Pflanzen)<br />
Seite bitte vervielfältigen, falls nötig.
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/15<br />
4.1. Allgemeine Gebietsmerkmale<br />
Meeresgebiete <strong>und</strong> -arme<br />
Salzsümpfe, -wiesen <strong>und</strong> -steppen<br />
Küstendünen, Sandstrände, Machair<br />
Strandgestein, Felsküsten, Inselchen<br />
Binnengewässer (stehend <strong>und</strong> fließend)<br />
Moore, Sümpfe, Uferbewuchs<br />
Andere Gebietsmerkmale:<br />
Lebensraumklassen<br />
Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana<br />
Trockenrasen, Steppen<br />
Feuchtes <strong>und</strong> mesophiles Grünland<br />
Alpine <strong>und</strong> subalpine Rasen<br />
Extensiver Getreideanbau (einschl. Wechselanbau mit regelmäßiger Brache)<br />
Reisfelder<br />
Melioriertes Grünland<br />
Anderes Ackerland<br />
4. GEBIETSBESCHREIBUNG<br />
Gezeiten, Ästuarien, vegetationsfreie Schlick- <strong>und</strong> Sandflächen, Lagunen (einschl.<br />
Salinenbecken)<br />
Laubwald<br />
Nadelwald<br />
Immergrüner Laubwald<br />
Mischwald<br />
Kunstforsten (z. B. Pappelbestände oder exotische Gehölze)<br />
Nicht-Waldgebiete mit hölzernen Pflanzen (Obst- <strong>und</strong> Ölbaumhaine, Weinberge, Dehesas)<br />
Binnenlandfelsen, Geröll- <strong>und</strong> Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee <strong>und</strong> Eis<br />
bedeckten Flächen<br />
Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)<br />
INSGESAMT<br />
Anteil (%)<br />
100 %<br />
Der zentrale Teil der vorpommerschen Boddenlandschaft mit dem Greifswalder Bodden, dem<br />
südlichen Teil des Strelas<strong>und</strong>es, zahlreichen Buchten <strong>und</strong> Wieken,<br />
Küstenüberflutungsräumen sowie eingelagerten Inseln mit aktiven Landbildungs- <strong>und</strong><br />
Erosionsprozessen.<br />
4.2. Güte <strong>und</strong> Bedeutung<br />
Repräsentatives Vorkommen von FFH-LRT <strong>und</strong> -Arten, Schwerpunktvorkommen von FFH-<br />
LRT, Häufung von FFH-LRT, prioritären FFH-LRT <strong>und</strong> FFH-Arten, großflächige<br />
Komplexbildung<br />
- Seite 12 von 23 -<br />
94<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
2<br />
2<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
DE1747301 Nr. L 107/16<br />
4.3. Verletzlichkeit<br />
Nähr- <strong>und</strong> Schadstoffeinträge in den Bodden, Störungen des hydrologischen Systems<br />
(insbesondere Küstenüberflutungsmoore). Intensivierung insbesondere wassergeb<strong>und</strong>ener<br />
Nutzungen (jeweils soweit erheblich wirkend).<br />
4.4. Gebietsausweisung (Bemerkungen zu den nachstehenden quantitativen Angaben)<br />
4.5. Besitzverhältnisse<br />
Privat: 0 %<br />
Kommunen:0 %<br />
Land: 0 %<br />
B<strong>und</strong>: 0 %<br />
sonst.: 0 %<br />
4.6. Dokumentation<br />
Nach Art. 2 Abs. 3 FFH-Richtlinie zu berücksichtigende sozio-ökonomische Belange sind der<br />
den Meldeunterlagen beigefügten Anlage 'Nutzungen <strong>und</strong> Planungen' zu entnehmen.<br />
Literaturliste siehe Anlage<br />
4.7. Geschichte (von der Komission auszufüllen)<br />
Datum Geändertes Feld Beschreibung<br />
- Seite 13 von 23 -
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN<br />
5.1. Schutzstatus auf nationaler <strong>und</strong> regionaler Ebene<br />
Nr. L 107/17<br />
Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%)<br />
D E 0 7<br />
D E 0 5<br />
D E 0 2<br />
5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten<br />
Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen: Überdeckung<br />
Typ<br />
Typenkennziffer<br />
D E 0 7<br />
D E 0 7<br />
D E 0 7<br />
D E 0 7<br />
D E 0 7<br />
D E 0 5<br />
D E 0 2<br />
Auf internationaler Ebene ausgewiesen:<br />
Ramsar-Übereinkommen<br />
Biogenetisches Reservat<br />
Gebiet mit Europadiplom<br />
Biosphärenreservat<br />
Barcelona-Übereinkommen<br />
World Heritage Site<br />
Sonstiger Typ<br />
1 9<br />
7<br />
1 0<br />
Boddenküste am Strelas<strong>und</strong><br />
Biosphärenreservat Südost-Rügen<br />
Insel Usedom mit Festlandgürtel<br />
Mittlerer Strelas<strong>und</strong> (Rügen)<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
Überdeckung<br />
Gebietsname<br />
Mittlerer Strelas<strong>und</strong> (Hansestadt Strals<strong>und</strong>)<br />
Insel Usedom<br />
Vogelhaken Glewitz<br />
Gebietsname<br />
5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten<br />
CORINE-Gebietskennziffer Art Anteil (%)<br />
CORINE-Gebietskennziffer<br />
1 D 1 7 4 5 6 2 3<br />
1 D 1 8 4 6 6 2 5<br />
1 D 1 8 4 8 6 2 7<br />
1 D 1 6 4 6 1 2 7<br />
1 D 1 8 4 6 6 2 4<br />
1 D 1 6 4 8 1 2 4<br />
- Seite 14 von 23 -<br />
Art<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
*<br />
+<br />
Art<br />
Überdeckung<br />
Art<br />
1<br />
Anteil (%)<br />
1 3<br />
Südost-Rügen * 1 3<br />
+<br />
+<br />
*<br />
*<br />
+<br />
*<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1 D 1 6 4 7 1 2 1<br />
1 D 1 7 4 5 6 2 2<br />
1 D 1 6 4 7 1 2 2<br />
1 D 1 7 4 6 6 2 1<br />
+<br />
+<br />
*<br />
+<br />
3<br />
2<br />
1<br />
7<br />
1<br />
Anteil (%)<br />
Überdeckung<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Anteil (%)
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN<br />
5.1. Schutzstatus auf nationaler <strong>und</strong> regionaler Ebene<br />
Nr. L 107/17<br />
Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%)<br />
5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten<br />
Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen: Überdeckung<br />
Typenkennziffer<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
Auf internationaler Ebene ausgewiesen:<br />
Typ<br />
Ramsar-Übereinkommen<br />
Biogenetisches Reservat<br />
Gebiet mit Europadiplom<br />
Biosphärenreservat<br />
Barcelona-Übereinkommen<br />
World Heritage Site<br />
Sonstiger Typ<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
Überdeckung<br />
Gebietsname<br />
Insel Koos, Kooser See <strong>und</strong> Wampener Riff<br />
Schoritzer Wiek<br />
Halbinsel Fahrenbrink<br />
Wreechener See<br />
Kormorankolonie bei Niederhof<br />
Mönchgut: Südperd<br />
Goor - Muglitz: Freetzer Niederung <strong>und</strong> Goor<br />
Gebietsname<br />
5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten<br />
CORINE-Gebietskennziffer Art Anteil (%)<br />
CORINE-Gebietskennziffer<br />
- Seite 15 von 23 -<br />
Art<br />
+<br />
+<br />
+<br />
*<br />
+<br />
*<br />
*<br />
Art<br />
Überdeckung<br />
Art<br />
3<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
Anteil (%)<br />
Anteil (%)<br />
Überdeckung<br />
Anteil (%)
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS UND ZUSAMMENHANG MIT CORINE-BIOTOPEN<br />
5.1. Schutzstatus auf nationaler <strong>und</strong> regionaler Ebene<br />
Nr. L 107/17<br />
Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%) Kennziffer Anteil (%)<br />
5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten<br />
Auf nationaler/regionaler Ebene ausgewiesen: Überdeckung<br />
Typenkennziffer<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
D E 0 2<br />
Auf internationaler Ebene ausgewiesen:<br />
Typ<br />
Ramsar-Übereinkommen<br />
Biogenetisches Reservat<br />
Gebiet mit Europadiplom<br />
Biosphärenreservat<br />
Barcelona-Übereinkommen<br />
World Heritage Site<br />
Sonstiger Typ<br />
Lanken<br />
Halbinsel Devin<br />
Goor - Muglitz: Muglitzer Boddenufer<br />
Insel Vilm<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
---<br />
Überdeckung<br />
Gebietsname<br />
Peenemünder Haken, Struck <strong>und</strong> Ruden<br />
Gebietsname<br />
5.3. Zusammenhang des beschriebenen Gebiets mit CORINE-Biotop-Gebieten<br />
CORINE-Gebietskennziffer Art Anteil (%)<br />
CORINE-Gebietskennziffer<br />
- Seite 16 von 23 -<br />
Art<br />
*<br />
+<br />
+<br />
+<br />
*<br />
Art<br />
Überdeckung<br />
Art<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1<br />
5<br />
Anteil (%)<br />
Anteil (%)<br />
Überdeckung<br />
Anteil (%)
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG<br />
6.1. Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen sowie davon betroffene Fläche<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen im Gebiet<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets Einfluß<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets<br />
1 0 0<br />
1 0 2<br />
1 2 0<br />
1 4 0<br />
1 4 1<br />
1 6 0<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen außerhalb des Gebiets<br />
Kennziffer Intensität Einfluß Kennziffer Intensität Einfluß<br />
1 0 0<br />
1 0 0<br />
1 1 0<br />
1 2 0<br />
4 0 0<br />
4 0 1<br />
6.2. Management des Gebiets<br />
Zuständige Behörde / Organisation<br />
StAUN Ueckermünde [17373 Ueckermünde]<br />
Gebietsmanagement <strong>und</strong> maßgebliche Pläne<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
C<br />
4<br />
1<br />
1<br />
4<br />
1<br />
2<br />
-<br />
0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
+<br />
+<br />
+<br />
0<br />
-<br />
0<br />
4 1 0<br />
5 0 6<br />
6 0 8<br />
6 2 5<br />
8 0 0<br />
Erhalt <strong>und</strong> teilweise Entwicklung des Greifswalder Boddens mit marinen <strong>und</strong> Küstenlebensraumtypen,<br />
Grünland- <strong>und</strong> Wald-LRT sowie mit charakteristischen FFH-Arten<br />
- Seite 17 von 23 -<br />
1 6 2<br />
1 6 4<br />
2 1 0<br />
2 1 1<br />
2 2 0<br />
2 3 0<br />
A<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
B<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0<br />
-<br />
1<br />
1<br />
9 0<br />
4 0<br />
4 0<br />
1 0<br />
Nr. L 107/18<br />
Einfluß<br />
-<br />
0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
0
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG<br />
6.1. Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen sowie davon betroffene Fläche<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen im Gebiet<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets Einfluß<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets<br />
4 0 2<br />
5 0 0<br />
5 0 2<br />
5 0 4<br />
5 2 0<br />
6 2 0<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen außerhalb des Gebiets<br />
Kennziffer Intensität Einfluß Kennziffer Intensität Einfluß<br />
6.2. Management des Gebiets<br />
Zuständige Behörde / Organisation<br />
A<br />
A<br />
StAUN Ueckermünde [17373 Ueckermünde]<br />
Gebietsmanagement <strong>und</strong> maßgebliche Pläne<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
1<br />
2<br />
2<br />
2<br />
4 0<br />
9 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Erhalt <strong>und</strong> teilweise Entwicklung des Greifswalder Boddens mit marinen <strong>und</strong> Küstenlebensraumtypen,<br />
Grünland- <strong>und</strong> Wald-LRT sowie mit charakteristischen FFH-Arten<br />
- Seite 18 von 23 -<br />
6 2 0<br />
6 2 1<br />
6 2 1<br />
6 2 2<br />
7 0 1<br />
7 2 0<br />
A<br />
A<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
9 0<br />
9 0<br />
9 0<br />
2<br />
9 0<br />
1<br />
Nr. L 107/18<br />
Einfluß<br />
0<br />
0<br />
-<br />
0<br />
-<br />
-
DE1747301<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
6. EINFLÜSSE UND NUTZUNGEN IM GEBIET UND IN DESSEN UMGEBUNG<br />
6.1. Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen sowie davon betroffene Fläche<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen im Gebiet<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets Einfluß<br />
Kennziffer Intensität % des Gebiets<br />
8 0 0<br />
8 0 1<br />
8 2 0<br />
8 5 1<br />
8 5 2<br />
8 7 0<br />
Einflüsse <strong>und</strong> Nutzungen außerhalb des Gebiets<br />
Kennziffer Intensität Einfluß Kennziffer Intensität Einfluß<br />
6.2. Management des Gebiets<br />
Zuständige Behörde / Organisation<br />
A<br />
A<br />
StAUN Ueckermünde [17373 Ueckermünde]<br />
Gebietsmanagement <strong>und</strong> maßgebliche Pläne<br />
B<br />
B<br />
C<br />
C<br />
1<br />
1<br />
1 0<br />
1 0<br />
1<br />
2<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Erhalt <strong>und</strong> teilweise Entwicklung des Greifswalder Boddens mit marinen <strong>und</strong> Küstenlebensraumtypen,<br />
Grünland- <strong>und</strong> Wald-LRT sowie mit charakteristischen FFH-Arten<br />
- Seite 19 von 23 -<br />
9 4 1<br />
9 4 7<br />
9 5 2<br />
9 6 5<br />
B<br />
B<br />
B<br />
C<br />
5<br />
5<br />
1 0 0<br />
1 0<br />
+<br />
+<br />
Nr. L 107/18<br />
Einfluß<br />
0<br />
-
DE1747301<br />
Topographische Karte<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
7. KARTE DES GEBIETS<br />
Blattnummer Maßstab Projektion<br />
Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form<br />
Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen<br />
(auf Kartengr<strong>und</strong>lage, die dieselben Merkmale wie die topographische Karte hat)<br />
Luftbild(er) beigefügt:<br />
JA NEIN<br />
Nummer Gebiet Ausschnitt/Thema Copyright Datum<br />
Nummer Ort Gegenstand Copyright Datum<br />
Nr. L 107/19<br />
1644 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1645 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1646 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1647 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1648 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1744 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
(Maßstab 1:0)<br />
8. DIAPOSITIVE<br />
- Seite 20 von 23 -
DE1747301<br />
Topographische Karte<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
7. KARTE DES GEBIETS<br />
Blattnummer Maßstab Projektion<br />
Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form<br />
Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen<br />
(auf Kartengr<strong>und</strong>lage, die dieselben Merkmale wie die topographische Karte hat)<br />
Luftbild(er) beigefügt:<br />
JA NEIN<br />
Nummer Gebiet Ausschnitt/Thema Copyright Datum<br />
Nummer Ort Gegenstand Copyright Datum<br />
Nr. L 107/19<br />
1745 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1746 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1747 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1748 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1845 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1846 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
(Maßstab 1:0)<br />
8. DIAPOSITIVE<br />
- Seite 21 von 23 -
DE1747301<br />
Topographische Karte<br />
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften<br />
7. KARTE DES GEBIETS<br />
Blattnummer Maßstab Projektion<br />
Angaben zur Verfügbarkeit der Gebietsgrenzen in rechnergestützter Form<br />
Karte der unter Abschnitt 5 aufgeführten Gebietsausweisungen<br />
(auf Kartengr<strong>und</strong>lage, die dieselben Merkmale wie die topographische Karte hat)<br />
Luftbild(er) beigefügt:<br />
JA NEIN<br />
Nummer Gebiet Ausschnitt/Thema Copyright Datum<br />
Nummer Ort Gegenstand Copyright Datum<br />
Nr. L 107/19<br />
1847 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1848 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1849 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1946 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
1947 25000 Gauss-Krüger (DE)<br />
(Maßstab 1:0)<br />
8. DIAPOSITIVE<br />
- Seite 22 von 23 -
DE1747301<br />
Weitere Literaturangaben<br />
Anlage<br />
* I.L.N. Greifswald (2004); Erarbeitung der LRT-Binnendifferenzierung in den FFH-Gebieten<br />
Mecklenburg-Vorpommerns.- Gutachten im Auftrag des Umweltministeriums MV.<br />
* Jueg, U. (2004); Die Verbreitung <strong>und</strong> Ökologie von Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849) in<br />
Mecklenburg - Vorpommern (Gastropoda: Stylommatophora: Vertiginidae).; Malakologische<br />
Abh. d. Staatl. Museums f. Tierk<strong>und</strong>e Dresden<br />
* Landesamt für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Geologie M-V; Totf<strong>und</strong>datenbank des Landes<br />
Mecklenburg-Vorpommern.<br />
* Landesamt für Umwelt, Naturschutz <strong>und</strong> Geologie M-V (2000-2003); Monitoring der FFH-<br />
Arten in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
* Meeresmuseum Strals<strong>und</strong> (1991-2000); Datensammlung des Meeresmuseums Strals<strong>und</strong>.<br />
* NABU MV, Landesfachausschuß Fledermausschutz; Sammlung von Beobachtungsdaten<br />
des LFA Fledermausschutz aus den zurückliegenden Jahren.<br />
* NABU MV, Landesfachausschuß Malakologie (1999); Zusammenstellung der Vorkommen<br />
von Molluskenarten des Anhangs 2 der FFH-Richtlinie in den FFH-Gebieten Mecklenburg-<br />
Vorpommerns.<br />
* Winkler, H.; mündl. Mitt.<br />
* ibs Ingenieurbüro Schwerin (2004); Erarbeitung der Wald-LRT-Binnendifferenzierung in den<br />
FFH-Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns.- Gutachten im Auftrag des Umweltministeriums<br />
MV.<br />
- Seite 23 von 23 -
FROELICH & SPORBECK Anhang<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 2: Abschichtungstabellen zur Auswahl der prüfungsrele-<br />
vanten charakteristischen Arten der Lebensraumtypen des Anhangs<br />
I der FFH-Richtlinie
Lebensraum 1110 1. Schritt 2. Schritt<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Überspülung durch Meerwasser vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Säuger<br />
Halichoerus grypus balticus Ostsee-Kegelrobbe<br />
Phoca hispida botnica Ostsee-Ringelrobbe<br />
Phoca vitulina Seeh<strong>und</strong><br />
Vögel<br />
Clangula hyemalis Eisente<br />
Somateria mollissima Eiderente<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
x x x x<br />
x<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
FFH II/ IV, RL D<br />
2, gefährdetes<br />
Wandertier/ Gast,<br />
Alpha-Räuber<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x Ostsee-Kegelrobbe<br />
x x x x<br />
x<br />
EU-VS,<br />
„Schlüsselart“<br />
Natura 2000<br />
x x x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen (Crustaceen,<br />
Mollusken <strong>und</strong> Fischen insb.<br />
Heringslaich) durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
Art wird bereits als Anhang II-Art betrachtet;<br />
seltener Gast (regionaler, lokaler Bezug) <strong>und</strong> damit<br />
nicht typisch<br />
Der Seeh<strong>und</strong> wird vorrangig in der Beltsee (Wismar-<br />
Bucht) beobachtet<br />
große Individuenzahl im Untersuchungsgebiet<br />
(wichtiges Rastgebiet)<br />
Nahrungsgr<strong>und</strong>lagen ähnlich Eisente (Crustaceen,<br />
Mollusken) daher entsprechende Empfindlichkeit<br />
Gavia arctica Prachttaucher beachtenswerte Vorkommen nicht im GB<br />
Gavia stellata Sterntaucher lokale Konzentrationen außerhalb der<br />
Boddenrandschwelle (wichtiges Rastgebiet, v.a. im<br />
Frühjahr)<br />
Melanitta nigra Trauerente<br />
Die Art ist in der Region naturraumtypisch für<br />
Sandbänke im Offshore-Bereich. Sie tritt kaum/nicht<br />
x<br />
im GW Bodden auf, so dass keine weitere<br />
Betrachtung erfolgt.<br />
Aythya marila Bergente<br />
EU-VS,<br />
Nahrungsgr<strong>und</strong>lagen ähnlich Eisente (Crustaceen,<br />
x x x x „Schlüsselart“<br />
Natura 2000<br />
x x x Eisente x Mollusken) daher entsprechende Empfindlichkeit<br />
Aythya fuligula Reiherente x geringes Auftreten im UG<br />
Fische<br />
Ammodytes tobianus Kleiner Sandaal<br />
x x x x N<br />
Sandboden, Hohe Ab<strong>und</strong>anzen, wichtige Funktion im<br />
Nahrungsnetz, Laichgebiet, besitzt aber keine<br />
Relevanz für die FFH-VP<br />
Hyperoplus lanceolatus Großer Sandaal x Sandboden<br />
Nerophis ophidion Kleine Schlangennadel<br />
x x x x<br />
threatened and<br />
declining species<br />
nach HELCOM<br />
lebt in der Makrophytenzone, da LRT 1110 als<br />
makrophytenarm gilt (IfAö 2005, Ssymank 1998),<br />
eignet sich die Art nicht als charakteristische Art.<br />
Platichthys flesus Fl<strong>und</strong>er<br />
x x x x FB, RL MV G, N x x x x<br />
empfindlich gegenüber<br />
Kühlwassereinfluss, oberer<br />
kritischer Temperaturbereich für<br />
Adulte bei 31°C (vgl. IfB 2008)<br />
x<br />
Sandboden, Hohe Ab<strong>und</strong>anzen, wichtige Funktion im<br />
Nahrungsnetz, Laichgebiet<br />
Pomatoschistus minutus Sandgr<strong>und</strong>el<br />
Potamoschistus microps Strandgr<strong>und</strong>el<br />
x x x x N<br />
Psetta maxima Steinbutt x<br />
Gadus morhua Dorsch<br />
Pleuronectes platessa Scholle<br />
x<br />
MZB<br />
Alkmaria romijni Polychaet x x x<br />
Cerastoderma glaucum Lagunen-Herzmuschel<br />
x x x x N x (x) x x<br />
x x x x RL D 2, N, MV 3 x x x x x<br />
empfindlich gegenüber<br />
Kühlwassereinfluss<br />
hat lokal im Greifswalder Bodden<br />
keine Bedeutung, da ist die<br />
Fl<strong>und</strong>er wichtig<br />
bes. Empfindlichkeit gegenüber<br />
Schadstoffeinträgen <strong>und</strong><br />
möglichen Wirkungen der<br />
Kühlwassereinleitung<br />
(Sauerstoffmangel)<br />
x<br />
x<br />
Sandboden, hohe Ab<strong>und</strong>anzen<br />
Sandboden;allerdings nicht für Sandbank spezifisch<br />
hohe Ab<strong>und</strong>anzen, wichtiges Nahrungstier. Störungen<br />
in der Altersstruktur können Hinweise auf veränderte<br />
Umweltparameter geben.<br />
Anhang 2 Seite 1 von 3
Lebensraum 1110 1. Schritt 2. Schritt<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Überspülung durch Meerwasser vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Crangon crangon Nordsee-Garnele<br />
Hediste (Nereis) diversicolor Schillernder<br />
Meeresborstenwurm<br />
Lanice conchilega Polychaet<br />
Macoma balthica Baltische Plattmuschel<br />
Mya arenaria Sandklaffmuschel<br />
Pygospio elegans Polychaet<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
x<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
x x x x N<br />
x x x x N<br />
x x x x N<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
kommt sehr selten vor, keine charakt. Art. Die Art ist<br />
schwimmfähig <strong>und</strong> führt saisonale<br />
(temperaturabhängige) Wanderungen durch.<br />
H. diversicolor ist keine charakt. Art des meistens<br />
exponierten LRT "Sandbank". Die Art bevorzugt<br />
schlickreiche Böden oder Geröllgründe<br />
Sandböden <strong>und</strong> schlickige Sandböden, hohe<br />
Ab<strong>und</strong>anzen, wichtiges Nahrungstier, Störungen in<br />
der Altersstruktur können Hinweise auf veränderte<br />
Umweltparameter geben; rel. tolerant gegenüber allen<br />
gelisteten Faktoren, lediglich Empfindlichkeit<br />
gegenüber stärkerer Sedimentüberschichtung<br />
hohe Ab<strong>und</strong>anzen, wichtiges Nahrungstier. Störungen<br />
in der Altersstruktur können Hinweise auf veränderte<br />
Umweltparameter geben. tolerant gegenüber allen<br />
hier gelisteten Faktoren, lediglich Empfindlichkeit<br />
gegenüber Sedimentumlagerung (nur adulte Tiere)<br />
auf Sandböden <strong>und</strong> schlickigem Sand weit verbreitete<br />
Art, die den LRT 1110 mit hoher Stetigkeit besiedelt<br />
<strong>und</strong> dort einen gewissen Vorkommensschwerpunkt<br />
aufweist. Die Art ist jedoch kein Spezialist mit enger<br />
ökologischer Amplitude <strong>und</strong> gehört nicht zu den<br />
empfindlichsten Elementen der Lebensgemeinschaft.<br />
Saduria entomon Ostsee-Riesenassel Kaltwasserart, die in die Flachwasserzonen der<br />
Pommerschen Bucht <strong>und</strong> des Greifswalder Boddens<br />
nur als Irrgast vereinzelt eindringt.<br />
Scoloplos armiger Polychaet x<br />
Steblospio shrubsoli Polychaet x x x x RL MV P<br />
Travisia forbesii Polychaet x<br />
Bathypopreia pilosa Sandflohkrebs<br />
im UG selten, braucht klaren feinsandigen Untergr<strong>und</strong><br />
x<br />
charakteristisch für LRT 1110, aber nicht in der<br />
Naturregion Greifswalder Bodden<br />
Mytilus edulis Miesmuschel<br />
sehr selten im UG, im LRT 1110 nur als driftene<br />
x<br />
Aggregate, typische Art der Riffe Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Ophelia rathkei x kommt erst ab 10psu vor.<br />
Hydrobia ulvae<br />
Dieses LRT hat eine zu hohe Exposition für die Art<br />
Neanthes succinea braucht als Räuber <strong>und</strong> Weidegänger ein anderes<br />
Habitat<br />
Tubificoides benedii<br />
Tubifex costatus<br />
x x<br />
x (x) (x)<br />
Dort, wo die Art in größeren Mengen vorkommt, ist sie<br />
eher ein Degradationsanzeiger<br />
es ist uns nichts über die Autökologie dieser Art<br />
bekannt<br />
MPB<br />
Verschiedene Makroalgen nur als driftene Aggregate - Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Potamogeton pectinatus Kamm-Laichkraut Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Ruppia maritima/cirrhosa<br />
(Artaufteilung zweifelhaft)<br />
Strand Salde <strong>und</strong><br />
Schraubige Salde<br />
Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Tolypella nidifica Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Zannichellia palustris agg. Teichfaden Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Zostera marina Gemeines Seegras Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Bolboschoenus maritimus Gemeine Strandsimse Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Anhang 2 Seite 2 von 3
Lebensraum 1110 1. Schritt 2. Schritt<br />
Sandbänke mit nur schwacher ständiger 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Überspülung durch Meerwasser vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Chara aspera Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Chara baltica Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Chara canescens<br />
Chara horrida<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek <strong>und</strong> im<br />
Freesendorfer See. Kein Vorkommensschwerpunkt im<br />
LRT 1110<br />
Chara intermedia Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Chara tomentosa Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Ranunculus peltatus ssp. baudotii Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1110<br />
Anhang 2 Seite 3 von 3
Lebensraum 1130 1. Schritt 2. Schritt<br />
Ästuarien 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Vögel<br />
Aythya fuligula Reiherente<br />
Tadorna tadorna Brandgans<br />
Cygnus cygnus Singschwan<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x x (x) x x (x) x x x<br />
x x x x<br />
UG von<br />
intern.<br />
Bedeutung<br />
Cygnus columbianus Zwergschwan x x x<br />
Cygnus columbianus Höckerschwan x x x<br />
Larus minutus Zwergmöwe<br />
Mergus merganser Gänsesäger<br />
x x x x<br />
RL MV 2, RL<br />
D 3<br />
x x (x) x (x) (x) x Reiherente<br />
Podiceps cristatus Haubentaucher x x x x RL MV 3 x x (x) x (x) (x) x Reiherente<br />
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe<br />
Fische<br />
Abramis brama Blei<br />
Alosa alosa Maifisch<br />
Alosa fallax Finte<br />
Anguilla anguilla Aal<br />
x x x x FB<br />
x<br />
x<br />
x x X x<br />
RL D 3, RL<br />
MV 3, FB<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Spandowerhagener Wiek wird als<br />
Nahrungs- <strong>und</strong> Ruheraum genutzt<br />
nahe bewachsenen Uferzonen mit<br />
Weichboden<br />
pelagisch, anadrom, wenige Informationen<br />
da sehr selten, nur 4 Einzelf<strong>und</strong>e in MV<br />
pelagisch, anadrom, wenige Informationen<br />
da sehr selten, mehrere Einzelf<strong>und</strong>e in<br />
MV, ist eine typische Art für Ästuare, aber<br />
sehr selten <strong>und</strong> daher nicht als<br />
Charakterart zu bezeichnen.<br />
Wird bereits über Anhang II FFH<br />
behandelt<br />
kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, katadromer<br />
Wanderer<br />
Blicca bjoerkna Güster x x x<br />
Coregonus albula Kleine Maräne obere Freiwasserzone in oligotrophen bis<br />
mesotrophen Seen, nicht im deutschen<br />
Ostseebereich<br />
Coregonus maraena Ostseeschnäpel<br />
Cyprinus sp Karpfen<br />
Esox lucius Hecht<br />
x x x x<br />
RL D 3, RL<br />
MV V<br />
x x x x FB, RL D 3<br />
pelagisch, anadrom<br />
Der Hecht ist weit verbreitet in den<br />
vorpommerschen Boddengewässern. Er<br />
benötigt ungstörte Seitengewässer zum<br />
Laichen <strong>und</strong> ist gegenüber<br />
Verschlechterung des Lichtklimas z.B.<br />
durch Eutrophierung empfindlich. Als<br />
Indikator für besondere Lebensansprüche<br />
im LRT 1130 eignet er sich nicht.<br />
Anhang 2 Seite 1 von 4
Lebensraum 1130 1. Schritt 2. Schritt<br />
Ästuarien 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling<br />
Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch<br />
Lampetra fluviatilis Flussneunauge<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
x x x x N<br />
x x x<br />
x<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Der in der Ostsee <strong>und</strong> ihren<br />
Randgewässern weit verbreitet<br />
Dreistachlige Stichling eignet sich nicht als<br />
Indikatorart für die den LRT 1130. Zeigt im<br />
LRT die höchsten Ab<strong>und</strong>anzen.<br />
Hohe Ab<strong>und</strong>anzen (Kaulbarsch-Fl<strong>und</strong>er-<br />
Region), wichtige Funktion im<br />
Nahrungsnetz.<br />
Sandboden, wenig über Autökologie<br />
bekannt, eher eine tolerante Art<br />
anadromer Wanderer, kaum information<br />
über die Nutzung von marinen Habitaten;<br />
regelmäßiges Einwandern in Peenestrom<br />
zu Laichgebieten (Bochert, 2001)<br />
verbleibt als Adultes Tier vorwiegend in<br />
Ästuaren u. in küstennähe (Kloppman et<br />
al., 2003)<br />
Leuciscus idus Aland ruhiges, pflanzenreiches Flachwasser,<br />
oberflächennah<br />
Lota lota Quappe klare, kalte, sauerstoffreiche, strömende<br />
Gewässer mit Sand- o. Kiesboden<br />
Osmerus eperlanus Stint x x x küstennah<br />
Pelecus cultratus Ziege<br />
x (x) x x<br />
FFH II / RL D<br />
1<br />
Perca fluviatilis Flussbarsch<br />
Die Süßwasserart hält sich außerhalb der<br />
Laichzeit im Greifswalder Bodden auf <strong>und</strong><br />
benötigt einen barrierefreien Zugang.<br />
x x x x FB<br />
Deutlich höhere Ab<strong>und</strong>anzen als<br />
Kaulbarsch (Bochert,2001), starker<br />
anthropogener Einfluss verursacht<br />
Massenentwicklung<br />
Petromyzon marinus Meerneunauge<br />
x<br />
anadromer Wanderer, kaum Information<br />
über die Nutzung von marinen Habitaten<br />
Pholis gunnellus Butterfisch Algen- u. Seegrasgürtel<br />
Platichthys flesus Fl<strong>und</strong>er<br />
empfindlich<br />
gegenüber<br />
bevorzugt Sandboden<br />
x x x x FB, RL MV G x x x (x) x Kühlwasserein-fluss<br />
<strong>und</strong> Kühlwasserentnahme<br />
x<br />
Pungitius pungitius Neunstachliger Stichling x x x küstenah, phytal<br />
Rutilus rutilus Plötz<br />
x x x<br />
ruhige, tiefe Gewässer, sehr<br />
anpassungsfähige Art<br />
Sander lucioperca Zander<br />
trübes Flachwasser, Bodenformationen<br />
x x x x FB<br />
(Felsen, Wurzeln etc.) geringe<br />
Ab<strong>und</strong>anzen im UG<br />
Vimba vimba Zährte x Uferzone, bodennah<br />
Zoarces viviparus Aalmutter x Algenzone, zeigt Schadstoffbelastung<br />
MZB<br />
Anhang 2 Seite 2 von 4
Lebensraum 1130 1. Schritt 2. Schritt<br />
Ästuarien 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Agonum monachum Salz-Glanzflachläufer nur fünf F<strong>und</strong>stellen in D, nicht<br />
unbedeutendes disjunktes Vorkommen in<br />
MV (Nachweis für Thiessow auf Rügen)<br />
Im Röhricht, nicht im Zoobenthos am<br />
Meeresgr<strong>und</strong><br />
Bithynia tentaculata Gemeine<br />
Schnauzenschnecke<br />
Cerastoderma glaucum Lagunen-Herzmuschel<br />
Dreissena polymorpha Dreiecks-, Zebra- oder<br />
Wandermuschel<br />
x x x<br />
x<br />
x (x) (x)<br />
Die Schnauzenschnecke ist eine<br />
limnische Art, die einen geringen<br />
Salzgehalt toleriert <strong>und</strong> charakteristisch für<br />
das Phytal ist.<br />
Weit verbreitete Art der LRT "Sandbank",<br />
"Lagune" <strong>und</strong> "Meeresbucht", auch an der<br />
Außenküste an zu treffen (Pommersche<br />
Bucht).<br />
Die Wandermuschel ist kein Spezialist<br />
mit enger ökologischer Amplitude <strong>und</strong><br />
gehört nicht zu den empfindlichsten<br />
Elementen der Lebensgemeinschaft. Geht<br />
nur bis 3 psu.<br />
Eristalinus sepulchralis<br />
Gammarus tigrinus Tiger-Flohkrebs x x x Neozoe<br />
Hydrobia ulvae Glatte Wattschnecke<br />
Die Gemeine Wattschnecke ist eine marineuryhaline<br />
Art, die vorrangig die<br />
Außenküste <strong>und</strong> den Greifswalder<br />
x x x<br />
Bodden besiedelt. In geringem Maße<br />
dringt sie in die Mündung des<br />
Peenestroms ein.<br />
Hydrobia ventrosa Bauchige Wattschnecke<br />
H. ventrosa lebt vorrangig in den inneren<br />
Küstengewässern <strong>und</strong> dringt ebenfalls in<br />
x x x<br />
das "Ästuar" ein. Auch diese Art eignet<br />
sich nicht als Charakterart für den LRT<br />
1130.<br />
Lejops vittatus Larven leben aquatisch an<br />
Wasserpflanzen<br />
Lithoglyphus naticoides Fluss-Steinkleber x Geht nur bis 1psu.<br />
Macroplea mutica Langklauen-Rohrblattkäfer<br />
x x x x<br />
RL D 1, RL O<br />
1<br />
Küstenart im Brackwasser an Ruppia<br />
marina, Potamogeton <strong>und</strong> Zanichellia,<br />
extremer Habitatspezialist<br />
Marenzelleria viridis x x x<br />
Potamopyrgus antipodarum Neuseeländische<br />
Zwergdeckelschnecke<br />
x x x<br />
Die Neozoet eignet sich sich nicht als<br />
Indikatorart für LRT 1130<br />
Radix ovata balthica Eiförmige<br />
Schlammschnecke<br />
x x x siehe Bithynia tentaculata<br />
Theodoxus fluviatilis Gemeine Kahnschnecke<br />
Die Art ist östlich der Darßer Schwelle in<br />
der Ostsee weit verbreitet <strong>und</strong> bietet sich<br />
x x x x RL 2<br />
daher nicht als Charakterart für LRT 1130<br />
an.<br />
Valvata cristata Flache<br />
Federkiemenschnecke<br />
x x x<br />
nur Ästuar, Wiek <strong>und</strong><br />
Peenestrom;limnische Art, die einen<br />
geringen Salzgehalt toleriert <strong>und</strong><br />
charakteristisch für das Phytal ist<br />
Anhang 2 Seite 3 von 4
Lebensraum 1130 1. Schritt 2. Schritt<br />
Ästuarien 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Valvata piscinalis Gemeine<br />
Federkiemenschnecke<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
x<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche; limnische Art, die<br />
einen geringen Salzgehalt toleriert <strong>und</strong><br />
charakteristisch für das Phytal ist<br />
Victorella pavida nur im Ästuar, Ryck<br />
Cyprideis torosa Muschelkrebs Ostrakode, gehört damit zum<br />
Makrozoobenthos. Nachweise sind uns für<br />
die innere Ostsee nicht bekannt (nur<br />
Øres<strong>und</strong>).<br />
Corophium volutator Schlickkrebs x x x x N x x x (x) x x wichtiges Nährtier<br />
Cyathura carinata R<strong>und</strong>assel x x x x RL MV 3 x (x) x<br />
Streblospio shrubsoli<br />
Fabricia sabella<br />
x<br />
Alkmaria romijni x<br />
Hediste diversicolor x x x x N<br />
Cordylophora caspia x x x x RL MV P x (x) x<br />
Limnodrillus hoffmeisteri x x x<br />
MPB<br />
Bolboschoenus maritimus Gemeine Strandsimse Das Brackwasserröhricht ist an den<br />
Flachküsten der Ostsee weit verbreitet<br />
<strong>und</strong> bietet sich daher nicht als<br />
Charakterart für LRT 1130 an. Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1130<br />
Carex spp. Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1130<br />
Myriophyllum spicatum Ähren-Tausendblatt<br />
Das Tausendblatt ist in den inneren<br />
Küstengewässern der Ostsee weit<br />
verbreitet <strong>und</strong> bietet sich daher nicht als<br />
Charakterart für LRT 1130 an. Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1130<br />
Phragmites australis Schilf siehe Bolboschoenus maritimus<br />
Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1130<br />
Potamogeton perfoliatus Durchwachsenes<br />
Laichkraut<br />
x x x<br />
Ruppia maritima/cirrhosa<br />
(Artaufteilung zweifelhaft)<br />
Strand Salde <strong>und</strong><br />
Schraubige Salde<br />
x x x<br />
Sarcocornia perennis<br />
Scirpus spp.<br />
Spartina anglica<br />
Spartina maritima<br />
Ceratophyllum dermersum Hornblatt x x x<br />
Elodiea canadensis Wasserpest x x Degradationsanzeiger<br />
Najas marina Nixkraut x x x<br />
Ranunculus peltatus ssp.<br />
baudotii<br />
Brackwasser-Hahnenfuß<br />
x x x<br />
Zannichellia palustris agg. Teichfaden<br />
der Teichfaden kommt nur im nördlichen<br />
Abschnitt des Peenestroms vor, ist aber in<br />
x x x<br />
den Bodden <strong>und</strong> Meeresbuchten weit<br />
verbreitet. Kein Indikator für den LRT<br />
1130.<br />
Zostera noltii<br />
x<br />
charakteristisch für LRT 1130, aber nicht<br />
in der Naturregion Greifswalder<br />
Bodden/Peene<br />
Anhang 2 Seite 4 von 4
Lebensraum 1140 1. Schritt 2. Schritt<br />
Vegetationsfreies Watt 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Halichoerus grypus balticus Ostsee-Kegelrobbe<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
Vögel<br />
Branta bernicla Ringelgans x<br />
Branta leucopsis Nonnengans x<br />
Calidris alpina Alpenstrandläufer<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
x x (x) x<br />
x x x x<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
FFH II/ IV, RL D 2,<br />
gefährdetes<br />
Wandertier/ Gast,<br />
wichtige Funktion<br />
als Alpha-Räuber<br />
VS I, RL MV 1, RL<br />
D 1<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen durch<br />
Kühlwassereinfluss in den<br />
Flachwasser- <strong>und</strong><br />
Windwattbereichen<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
Sandregenpfeifer x<br />
13: Bemerkungen<br />
Art wird bereits als Anhang II-Art betrachtet; EHZ<br />
ist derzeit nicht günstig<br />
Calidris canutus Knutt x<br />
Gallinago gallinago Bekassine<br />
Haematopus ostralegus Austernfischer x<br />
Larus argentatus Silbermöwe x<br />
Larus canus Sturmmöwe x<br />
Larus fuscus Heringsmöwe x Relevant für den LRT an der Nordsee<br />
Larus minutus Zwergmöwe<br />
Larus ridib<strong>und</strong>us Lachmöwe x x x x RL MV 3 x x x x x Sandregenpfeifer x<br />
Numenius arquata Großer Brachvogel x x x x RL MV 1, RL D 2 x x x x x Sandregenpfeifer x<br />
Recurviostra avosetta Säbelschnäbler x x x x VS I, RL MV 2 x x x x x Sandregenpfeifer x<br />
Somateria mollisima Eiderente x im UG nicht relevant<br />
Tadorna tadorna Brandgans x x x x RL MV 3 x x x x x Sandregenpfeifer x<br />
Tringa totanus Rotschenkel<br />
x x x x<br />
RL O 1, RL MV 2,<br />
RL D 2<br />
x x x x x<br />
300 m Effektdistanz<br />
gegenüber stark befahrenen<br />
Straßen, kritischer Schallpegel<br />
55 dB(A) (Garniel et al. 2007),<br />
pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen<br />
(Flohkrebse, Polychäten)<br />
durch Kühlwassereinfluss in<br />
den Flachwasser- <strong>und</strong><br />
Windwattbereichen<br />
x<br />
Vanellus vanellus Kiebitz<br />
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer<br />
Calidris ferruginea Sichelstrandläufer<br />
x x x x RL MV 1, RL D 1 x x x x x<br />
pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen durch<br />
Kühlwassereinfluss in den<br />
Flachwasser- <strong>und</strong><br />
Windwattbereichen<br />
Fische<br />
Agonus cataphractus Steinpicker<br />
Ammodytes tobianus Kleiner Sandaal Sandboden<br />
Anguilla anguilla Aal kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, katadromer Wanderer<br />
Belone belone Hornhecht pelagisch, halten sich als juvenile Tiere häufig<br />
direkt am Ufer auf<br />
Gadus morhua Dorsch demersal<br />
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling küstennah, Phytal<br />
Hyperoplus lanceolatus Grosser Sandaal Sandboden<br />
Anhang 2 Seite 1 von 3<br />
x
Lebensraum 1140 1. Schritt 2. Schritt<br />
Vegetationsfreies Watt 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
Limanda limanda Kliesche Sandboden<br />
Myoxocephalus quadricornis Vierhörniger<br />
Seeskorpion<br />
Nerophis ophidion Kleine Schlangennadel Algenzone<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
östliche Ostsee, benthisch, die Art kommt nicht<br />
im Greifswalder Bodden vor<br />
Pholis gunnellus Butterfisch Algen- u. Seegrasgürtel<br />
Pleuronectes platessa Scholle Die Jungtiere halten sich bei hohem<br />
Wasserstand im Bereich der Windwatten auf.<br />
Pungitius pungitius Neunstachliger Stichling küstenah, phytal<br />
Zoarces viviparus Aalmutter Algenzone, zeigt Schadstoffbelastung<br />
MZB<br />
Angulus tenuis x erst ab 20psu<br />
Arenicola marina x<br />
Bathypopreia pilosa Sandflohkrebs<br />
im UG selten, braucht klaren feinsandigen<br />
x x x X N, RL Ostsee<br />
Untergr<strong>und</strong>. Der Sandflohkrebs eignet sich als<br />
Indikator für hydromorphologische Verhältnisse.<br />
Carcinus maenas x erst ab 10psu<br />
Cerastoderma edule x erst ab 12psu<br />
Corophium volutator Schlickkrebs<br />
x x x x N x x x x<br />
erhöhter Parasitenbefall bei<br />
Temperaturzunahme<br />
x<br />
Crangon crangon x kommt sehr selten vor, keine charakt. Art<br />
Cyathura carinata R<strong>und</strong>assel ist an Phytal geb<strong>und</strong>en<br />
Hediste (Nereis) diversicolor Schillernder<br />
H. diversicolor ist als häufiger Bewohner der<br />
Meeresborstenwurm<br />
Windwatten an starke Schwankungen nahezu<br />
aller abiotische Parameter angepasst. Falls als<br />
Folge der Maßnahme Sauerstoffmangel auftreten<br />
x x x x N<br />
sollte, kann die gut bewegliche Art schwimmend<br />
oder kriechend fliehen. Als Indikator für den<br />
Zustand des LRT "Windwatt" eignet sich die Art<br />
nicht<br />
Heteromastus filiformis x erst ab 10psu<br />
Hydrobia ulvae Gemeine Wattschnecke<br />
bes. Empfindlichkeit gegenüber der<br />
x x x x N<br />
Kühlwassereinleitung besteht nicht, denn die Art<br />
toleriert hohe Temperaturschwankungen.<br />
Lanice conchilega x polyhaline Art<br />
Macoma balthica<br />
Manayunkia aestuarina<br />
Baltische Plattmuschel x x x x N<br />
Marenzelleria viridis<br />
Mya truncata<br />
x<br />
Neanthes succinea<br />
Scrobicularia plana<br />
x x x X N<br />
Tubifex costatus x x x X N<br />
Venerupis senegalensis x kommt nicht in der eigentlichen Ostsee vor<br />
Pygospio elegans<br />
x x x x N<br />
tolerante Art ohne besondere Aussagekraft oder<br />
Sensitivitäten<br />
Chironomidae Zuckmücken Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
Gammarus salinus Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
Anhang 2 Seite 2 von 3
Lebensraum 1140 1. Schritt 2. Schritt<br />
Vegetationsfreies Watt 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Gammarus oceanicus Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
Gammarus zaddachi Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
Idotea chelipes Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
Sphaeroma hookeri Dies ist ein Art aus vegetationsreichen Habitaten,<br />
daher nicht Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1140<br />
MPB<br />
Zostera marina Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Zostera noltii Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Ruppia maritima Meersalde Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Chara baltica Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Chara aspera Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Chara canescens Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Enteromorpha ssp. Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Cladophora ssp. Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Fucus vesiculosus Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Bolboschoenus maritimus Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Salicornia europaeus Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 1140 da<br />
es sich um vegetationsfreies Watt handelt<br />
Anhang 2 Seite 3 von 3
Lebensraum 1150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Strandseen der Küste 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
(Lagunen) vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Vögel<br />
Clangula hyemalis Eisente Lagunen sind kein charakteristischer LRT<br />
für Eisenten.<br />
Cygnus olor Höckerschwan x x x<br />
Gavia arctica Prachttaucher Lagunen sind kein charakteristischer LRT<br />
für Prachttaucher<br />
Gavia stellata Sterntaucher Lagunen sind kein charakteristischer LRT<br />
für Sterntaucher<br />
Larus minutus Zwergmöwe keine Vorkommen an Steilküste<br />
Larus ridib<strong>und</strong>us Lachmöwe x<br />
Mergus serrator Mittelsäger<br />
x<br />
Recurviostra avosetta Säbelschnäbler x<br />
Sterna hir<strong>und</strong>o Flussseeschwalbe x<br />
Tadorna tadorna Brandgans<br />
x x x x RL MV 3 x x (x) x<br />
Branta canadensis Kanadagans (x) (x) (x)<br />
Anas penelope Pfeifente (x) (x) (x)<br />
Anas platyrhynchos Stockente (x) (x) (x)<br />
Aythya ferina Tafelente (x) (x) (x)<br />
Aythya fuligula Bergente (x) (x) (x)<br />
Mergus merganser Gänsesäger (x) (x) (x) x RL MV 2, RL D 3<br />
Mergus albellus Zwergsäger (x) (x) (x) x VS I<br />
Fische<br />
Anguilla anguilla Aal<br />
Clupea harengus Hering<br />
x x x x<br />
RL D 3, RL MV 3,<br />
FB<br />
x x x x FB x x x x x x<br />
Eier <strong>und</strong> Larven reagieren<br />
empfindlich auf<br />
Temperaturerhöhung, Hypoxie <strong>und</strong><br />
Nährstoff- u. Schadstoffeintrag,<br />
Einfluss auf Laichgeschehen;<br />
oberer krit. Temperaturbereich für<br />
Eier 20°C (IULT), für Juvenile 19,5-<br />
21,5°C (IULT) (vgl. IfB 2008)<br />
x<br />
kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel<br />
vor, es existieren von diesem LRT im UG<br />
jedoch keine Brutnachweise<br />
nach Scheller (2007) 2 BP in ufernahen<br />
Bereichen des Freesdendorfer Sees<br />
kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, katadromer<br />
Wanderer<br />
pelagische Art, Larven wurden saisonal<br />
häufig in Ansaugrechen nachgewiesen.<br />
Das Hauptvorkommen befindet sich in<br />
LRT 1160 "Meeresbucht".<br />
Cyprinus sp. Karpfen<br />
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling x x x<br />
Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch Sandboden<br />
Limanda limanda Kliesche Sandboden, diese Art kommt nicht im<br />
Greifswalder Bodden vor.<br />
Mullus barbatus Rote Meerbarbe kein Vorkommen in der Ostsee<br />
Osmerus eperlanus Stint küstennah<br />
Perca fluviatilis Flussbarsch x x x x FB<br />
Platichthys flesus Fl<strong>und</strong>er x x x x FB Sandboden<br />
Pomatoschistus microps Strandgr<strong>und</strong>el x x x (x)<br />
Pungitius pungitius Neunstachliger Stichling x x x<br />
Syngnathus acus Große Seenadel Seegrasgürtel, küstennah<br />
Syngnathus rostellatus Kleine Seenadel Die kleine Seenadel ist eine Art des<br />
Phytals <strong>und</strong> daher empfindlich gegenüber<br />
allen Veränderungen der submersen<br />
Pflanzenbestände.<br />
Syngnathus typhle Grasnadel Seegrasgürtel, küstennah, auch die<br />
Grasnadel ist eine Art des Phytals <strong>und</strong><br />
damit empfindlich gegenüber<br />
Veränderungen der submersen<br />
Pflanzenbestände.<br />
Belone belone Hornhecht x<br />
Spinachia spinachia Seestichling x (x) x<br />
Sander lucioperca Zander x x x x FB<br />
Esox lucius Hecht x x x x FB<br />
Anhang 2 Seite 1 von 4
Lebensraum 1150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Strandseen der Küste 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
(Lagunen) vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
MZB<br />
Abra sp.<br />
Alcyonidium gelatinosum<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Alderia modesta<br />
Armandia cirrohsa<br />
Artema sp.<br />
Assiminea grayana<br />
Cerastoderma glaucum Lagunen-Herzmuschel<br />
Corophium volutator Schlickkrebs<br />
Cyathura carinata R<strong>und</strong>assel<br />
Edwardsia ivelli<br />
Electra crustulenta<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
x x x<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x N, RL D 2, MV 3 x x x x<br />
x x x x N x x x x<br />
x x x RL MV 3 (x) x<br />
x x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
bes. Empfindlichkeit gegenüber<br />
Schadstoffeinträgen <strong>und</strong> möglichen<br />
Wirkungen der<br />
Kühlwassereinleitung<br />
erhöhter Parasitenbefall bei<br />
Temperaturzunahme<br />
Gammarus oceanicus<br />
Gammarus salinus x x x x N Phytal<br />
Gammarus tigrinus x x x Phytal<br />
Gammarus zaddachi x x x Phytal<br />
Gyraulus laevis Glattes Posthörnchen<br />
Hydrobia ventrosa Bauchige Wattschnecke<br />
x x x x N x (x) x<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
x<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
Charakteristische Art des Hartbodens <strong>und</strong><br />
des Phytals im LRT "Lagune",<br />
"Meeresbucht" <strong>und</strong> auch an der<br />
Außenküste in der gesamten Ostsee.<br />
Weit verbreitete Art der LRT "Sandbank",<br />
"Lagune" <strong>und</strong> "Meeresbucht", auch an der<br />
Außenküste an zu treffen (Pommersche<br />
Bucht). Für den LRT "Lagune" eignet sich<br />
die Lagunen-Herzmuschel als<br />
charakteristische Art. Sie ist mehrjährig<br />
<strong>und</strong> mit Hilfe der Alterstruktur kann auf<br />
Störungen hingewiesen werden.<br />
fleckenartige, unregelmäßige Verbreitung<br />
in Zeit <strong>und</strong> Raum. Daher als Indikator nicht<br />
geeignet.<br />
Charakteristische Art des Hartbodens <strong>und</strong><br />
des Phytals im LRT "Lagune",<br />
"Meeresbucht" <strong>und</strong> auch an der<br />
Außenküste in der gesamten Ostsee.<br />
H. ventrosa ist eine typische Art der<br />
Lagunen mit geringer Exposition <strong>und</strong><br />
hohem Schlickgehalt der Böden.<br />
Bestandsschwankungen können u.U. auf<br />
Wirkungen der Maßnahme zurück zu<br />
führen sein.<br />
Manayunkia aestuarina<br />
Marenzelleria viridis<br />
Murex sp.<br />
x x x<br />
Empfindlichkeit gegenüber Exposition<br />
(Veränderungen der Hydrodynamik).<br />
Neanthes succinea x x x x N<br />
Orchestia gammarellus<br />
Ovatella myosotis<br />
Palio dubia<br />
Potamopyrgus antipodarum<br />
im Spülsaum<br />
Radix ovata balthica Eiförmige<br />
Schlammschnecke<br />
Rissoa membranacea<br />
Saduria entomon<br />
sehr selten, Dänische Wiek<br />
Streblospio shrubsoli<br />
x x x x RL G, MV P x (x) x<br />
Empfindlichkeit gegenüber Exposition<br />
(Veränderungen der Hydrodynamik).<br />
Talitrus saltator im Spülsaum<br />
Tubifex costatus x x x<br />
Victorella pavida<br />
Fabricia sabella<br />
nur im Ästuar, Ryck<br />
Palaemonetes varians x x x (x)<br />
Gammarus duebeni x x x x RL MV P<br />
Idotea chelipes x x x<br />
Hediste diversicolor x x x x N<br />
MPB<br />
Anhang 2 Seite 2 von 4
Lebensraum 1150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Strandseen der Küste 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
(Lagunen) vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Bolboschoenus maritimus Gemeine Strandsimse x x x<br />
Callitriche spec. Wasserstern unbestimmt<br />
Ceramium rubrum Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Chara aspera Rauhe Arnleuchteralge<br />
x x x RL MV 2 x x x x<br />
Art reagiert besonders empfindlich<br />
auf eine Verschlechterung des<br />
Lichtklimas (Eutrophierung)<br />
bedingt durch Stickstoffeinträge<br />
oder Kühlwassereinleitung<br />
x<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek <strong>und</strong><br />
im Freesendorfer See<br />
Chara baltica Baltischer Armleuchteralge lebensraumtypische Art der gering<br />
exponierten Lagunen mit schlickreichen<br />
Böden. Kein Vorkommensschwerpunkt im<br />
LRT 1150<br />
Chara canescens Graue Armleuchteralge<br />
Chara connivens<br />
Chara tomentosa<br />
Chorda filum<br />
x x x x RL MV 2 x x x x x<br />
Art reagiert besonders empfindlich<br />
auf eine Verschlechterung des<br />
Lichtklimas (Eutrophierung)<br />
bedingt durch Stickstoffeinträge<br />
oder Kühlwassereinleitung<br />
x<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek <strong>und</strong><br />
im Freesendorfer See<br />
Eleocharis parvula Kleine Sumpfsimse<br />
Fucus vesiculosus Blasentang weit verbreitete Art in den LRT "Lagune",<br />
"Meeresbucht", Mündung der "Ästuare",<br />
nicht als charakteristische Art geeignet.<br />
Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Lamprothamnion papulosum<br />
charakteristisch für LRT 1150, aber nicht<br />
x<br />
in der Naturregion Greifswalder Bodden<br />
Lemna trisulca Dreifurchige Wasserlinse Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Najas marina ssp. marina Großes Nixenkraut Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Phragmites australis Schilf Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Potamogeton pectinatus Kamm-Laichkraut Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Ranunculus peltatus ssp. baudotii Brackwasser-Hahnenfuß<br />
Ruppia maritima/cirrhosa<br />
(Artaufteilung zweifelhaft)<br />
x x x x RL MV 3<br />
Brackwasserhahnenfuß wird vorrangig in<br />
Lagunen oder in gering exponierten<br />
Buchten nachgewiesen. Wahrscheinlich<br />
ist die Art empfindlich gegen Exposition.<br />
Strand-Salde Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Schoenoplectus tabernaemontani Graue Teichbinse Kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1150<br />
Stratiotes aloides Krebsschere<br />
Tolypella nidifica derzeitige Vorkommen beschränken sich<br />
auf das Salzhaff, die Darß-Zingster<br />
Boddenkette <strong>und</strong> die Bodden um<br />
Hiddensee; ursprünglich weit verbreitet;<br />
Entlang der Küste von Mecklenburg-<br />
Vorpommern war die Art ursprünglich<br />
nicht selten <strong>und</strong> konzentrierte sich auf die<br />
Gewässer um Rügen Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1150<br />
Typha angustifolia Schmalblättriger<br />
Rohrkolben<br />
Typha latifolia Breitblättriger Rohrkolben<br />
Anhang 2 Seite 3 von 4
Lebensraum 1150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Strandseen der Küste 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
(Lagunen) vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Zannichellia palustris agg. Teichfaden x x x<br />
Zostera marina Gemeines Seegras findet sich in Lagunen<br />
selten, allenfalls im exponierten<br />
Wasseraustauschbereich zum<br />
vorgelagerten Gewässer. Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT 1150<br />
Myriophyllum spicatum x x x<br />
Enteromorpha intestinalis<br />
Enteromorpha compressa<br />
Enteromorpha linza<br />
Sonstige<br />
Bembidion pallidipenne Lagunen-Ahlenläufer<br />
x x<br />
x<br />
x x<br />
x x x x RL MV 2, RL D 2<br />
Diese Gattung gilt allgemein als<br />
Degradationsanzeiger. Gr<strong>und</strong>sätzlich ist<br />
die Taxonomie dieser Gattung in Revision,<br />
die Gattung ist jetzt „Ulva“.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich ist die Taxonomie dieser<br />
Gattung in Revision, die Gattung ist jetzt<br />
„Ulva“.<br />
Diese Gattung gilt allgemein als<br />
Degradationsanzeiger. Gr<strong>und</strong>sätzlich ist<br />
die Taxonomie dieser Gattung in Revision,<br />
die Gattung ist jetzt „Ulva“.<br />
Küstenart, Empfindlichkeit gegenüber<br />
Habitatzerstörung <strong>und</strong> Nährstoffeinträge<br />
Hyla arborea Laubfrosch<br />
Macroplea mutica Langklauen-Rohrblattkäfer Küstenart im Brackwasser an Ruppia<br />
marina, Potamogeton <strong>und</strong> Zanichellia,<br />
extremer Habitatspezialist<br />
Testudo sp.<br />
Brachionus sp.<br />
Landschildkröte<br />
Anhang 2 Seite 4 von 4
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
Vögel<br />
Anas crecca Krickente x<br />
Anas platyrhynchos Stockente x x x<br />
Aythya fuligula Reiherente<br />
x x x x x (x) x x<br />
Aythya marila Bergente<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x x (x) x x<br />
Branta bernicla Ringelgans<br />
Branta leucopsis Nonnengans x<br />
Bucephala clangula Schellente<br />
x x x x x (x) x x<br />
Clangula hyemalis Eisente<br />
EU-VS,<br />
x x x x „Schlüsselart“<br />
Natura 2000<br />
x x (x) (x) x (x) x<br />
Cygnus bewickii Zwergschwan x<br />
Cygnus cygnus Singschwan x<br />
Cygnus olor Höckerschwan<br />
x x x x x (x) x (x) x<br />
Gavia arctica Prachttaucher<br />
Gavia stellata Sterntaucher<br />
Haliaeetus albicilla Seeadler<br />
x x x x VS I, RL D 3 x x (x) x x<br />
Melanitta nigra Trauerente x<br />
Mergus albellus Zwergsäger<br />
x x x x VS I x x (x) x x<br />
Mergus merganser Gänsesäger<br />
Mergus serrator Mittelsäger<br />
Pandion haliaetus Fischadler<br />
Podiceps cristatus Haubentaucher<br />
x x x x<br />
x x x x<br />
RL MV 2, RL D<br />
3<br />
RL MV 1, RL D<br />
2<br />
x x (x) x<br />
x x (x) x<br />
x x x x RL MV 3 x x (x) x<br />
Somateria mollisima Eiderente x<br />
Sterna hir<strong>und</strong>o Flussseeschwalbe x<br />
Tadorna tadorna Brandgans<br />
x x x x RL MV 3 x x (x) x (x)<br />
Anas penelope Pfeifente<br />
Phalacrocorax carbo Kormoran<br />
Fische<br />
Abramis brama Blei x x x x FB<br />
Agonus cataphractus Steinpicker<br />
Ammodytes tobianus Kleiner Sandaal x x x x N<br />
Anguilla anguilla Aal<br />
x x x x<br />
RL D 3, RL MV<br />
3, FB<br />
Belone belone Hornhecht<br />
x x x x x (x) x<br />
x x x x x (x) x<br />
x x x x FB x x x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
störungsempfindlich am<br />
Brutplatz; pot. Einflüsse auf<br />
die Verfügbarkeit des<br />
Nahrungsangebotes über<br />
Veränderungen der<br />
Nahrungskette<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
mögliche<br />
Nahrungsverknappung durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
pot. Empfindlichkeit<br />
gegenüber<br />
Kühlwassereinfluss<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
Eisente x<br />
Eisente x<br />
Zwergsäger (LRT<br />
1160)<br />
Zwergsäger (LRT<br />
1160)<br />
Zwergsäger (LRT<br />
1160)<br />
Höckerschwan x<br />
Zwergsäger (LRT<br />
1160)<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
große Individuenzahl im<br />
Untersuchungsgebiet (wichtiges<br />
Rastgebiet vor allem im März/April)<br />
kommt im LRT 1230 pot. nur als<br />
Brutvogel vor, es existieren von<br />
diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise<br />
Der Hornhecht nutzt submerse<br />
Pflanzen als Laichsubstrat.<br />
Schädigungen des Phytals wirken<br />
auf den Bestand des Fisches.<br />
Anhang 2 Seite 1 von 6
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Clupea harengus Hering<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
x x x x<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
FB,<br />
Herbstlaicher:<br />
RL D 2, RL O 2<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
x x x x x<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
Eier <strong>und</strong> Larven reagieren<br />
empfindlich auf<br />
Temperaturerhöhung,<br />
Hypoxie <strong>und</strong> Nährstoff- u.<br />
Schadstoffeintrag, Einfluss<br />
auf Laichgeschehen; oberer<br />
krit. Temperaturbereich für<br />
Eier 20°C (IULT), für Juvenile<br />
19,5-21,5°C (IULT) (vgl. IfB<br />
2008)<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
pelagische Art, Larven wurden<br />
saisonal häufig in Ansaugrechen<br />
nachgewiesen, Hering nutzt<br />
submerse Pflanzen als Laichsubstrat.<br />
Schädigungen des Phytals wirken<br />
auf den Bestand des Fisches.<br />
Hauptlaichgebiet im Greifswalder<br />
Bodden.<br />
Coregonus albula Kleine Maräne obere Freiwasserzone in<br />
oligotrophen bis mesotrophen Seen,<br />
nicht im deutschen Ostseebereich<br />
Coregonus maraena Ostseeschnäpel x x x x FB pelagisch<br />
Cyclopterus lumpus Seehase x x x Hartsubstrat<br />
Cyprinus sp Karpfen<br />
Esox lucius Hecht<br />
ruhige, klare Gewässer mit<br />
x x x x FB<br />
Kiesgr<strong>und</strong> u. dichtem, ufernahen<br />
Pflanzenbewuchs<br />
Gasterosteus aculeatus Dreistachliger Stichling<br />
Hartboden <strong>und</strong> submerse<br />
Pflanzenbestände sind die<br />
x x x x N<br />
Lebensräme des Stichlings.<br />
Wichtiges Nährtier für Fische <strong>und</strong><br />
Wasservögel. Keine Charakterart.<br />
Gobiusculus flavescens Schwimmgr<strong>und</strong>el x x x x N<br />
Gymnocephalus cernuus Kaulbarsch x Sandboden<br />
Lampetra fluviatilis Flussneunauge<br />
anadromer Wanderer, kaum<br />
information über die Nutzung von<br />
marinen Habitaten, Adulti verbeliben<br />
x<br />
in Küstennähe, regelmäßiges<br />
Einwandern in Peenestrom<br />
Leuciscus idus Aland ruhiges, pflanzenreiches<br />
Flachwasser, oberflächennah<br />
Limanda limanda Kliesche x Sandboden<br />
Lota lota Quappe<br />
klare, kalte, sauerstoffreiche<br />
x<br />
strömende Gewässer mit Sand- o.<br />
Kiesboden<br />
Myoxocephalus quadricornis Vierhörniger<br />
Seeskorpion<br />
östliche Ostsee, benthisch, diese Art<br />
kommt nicht im Greifswalder Bodden<br />
vor.<br />
Myoxocephalus scorpius Seeskorpion x bevorzugt Hartsubstrat<br />
Nerophis ophidion Kleine Schlangennadel<br />
x x x x<br />
threatened and<br />
declining<br />
species nach<br />
HELCOM<br />
hauptsächlich in der<br />
Makrophytenzone (Seegrasgürtel)<br />
des LRT, küstennah, Schädigung<br />
des Phytals wirkt sich auf Bestand<br />
aus<br />
Perca fluviatilis Flussbarsch x x x x FB ruhige Gewässer mit Hartboden<br />
Pholis gunnellus Butterfisch x Algen- u. Seegrasgürtel<br />
Platichthys flesus Fl<strong>und</strong>er x x x x FB, RL MV G Sandboden<br />
Pleuronectes platessa Scholle<br />
Sandboden, hat hier<br />
Verbreitungsgrenze, d.h. Fischart der<br />
x<br />
westl. Ostsee, meidet geringe<br />
Salzgehalte<br />
Pomatoschistus microps Strandgr<strong>und</strong>el x x x x N Sandboden<br />
Pomatoschistus minutus Sandgr<strong>und</strong>el<br />
Sandgründlinge sind häufige <strong>und</strong><br />
typische Arten der Sandböden von<br />
"Meeresbuchten". Die Art eignet sich<br />
als Indikator für den LRT. Dazu<br />
müssen jedoch ausreichende<br />
x x x x N x<br />
Vorkenntnisse zur Biologie der Art im<br />
UG geschaffen werden (natürliche<br />
Variabilität in Abhängigkeit von<br />
biotischen <strong>und</strong> abiotischen<br />
Faktoren).<br />
Anhang 2 Seite 2 von 6
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Psetta maxima Steinbutt x x x x FB<br />
Pungitius pungitius Neunstachliger Stichling<br />
Hartboden <strong>und</strong> submerse<br />
Pflanzenbestände sind die<br />
x x x x N<br />
Lebensräme des Stichlings.<br />
Wichtiges Nährtier für Fische <strong>und</strong><br />
Wasservögel. Keine Charakterart.<br />
Rutilus rutilus Plötz x x x ruhige, tiefe Gewässer<br />
Spinachia spinachia Seestichling<br />
Phytalbewohner, daher abhängig von<br />
der Entwicklung der submersen<br />
Pflanzenbestände. Ernährt sich von<br />
benthischen Kleinkrebsen <strong>und</strong><br />
x x x x RL D 3, RL O 3<br />
anderen Wirbellosen. Art eignet sich<br />
nicht als charakteristische Art im LRT<br />
"Meeresbucht".<br />
Sander lucioperca Zander<br />
x x x x FB<br />
trübes Flachwasser,<br />
Bodenformationen (Felsen, Wurzeln<br />
etc.), geringe Ab<strong>und</strong>anzen im UG<br />
Syngnathus acus Große Seenadel x Seegrasgürtel, küstennah<br />
Syngnathus rostellatus Kleine Seenadel x Seegrasgürtel, küstennah<br />
Syngnathus typhle Grasnadel<br />
Seegrasgürtel, küstennah,<br />
x x x x RL D 3<br />
Schädigung des Phytals wirkt sich<br />
auf Bestand aus, hohe Ab<strong>und</strong>anzen<br />
im UG<br />
Vimba vimba Zährte x x x x RL D 2 Uferzone, bodennah<br />
Zoarces viviparus Aalmutter<br />
x x x<br />
Algenzone, zeigt<br />
Schadstoffbelastung<br />
MZB<br />
Acentria ephemerella Wassermotte<br />
Alcyonidium gelatinosum<br />
Alkmaria romijni Polychaet x x x<br />
Bathypopreia pilosa<br />
x<br />
Bithynia tentaculata Gemeine<br />
Schnauzenschnecke<br />
Brachionus sp.<br />
Calliopius laeviusculus x<br />
Cerastoderma glaucum Lagunen-Herzmuschel<br />
(=lamarcki)<br />
x<br />
x x x x RL D 2, MV 3 x x x x<br />
Corophium volutator Schlickkrebs<br />
x x x x N x x x x<br />
Cyathura carinata x x x x RL MV 3 x (x) x<br />
Dreissena polymorpha<br />
Electra crustulenta<br />
Dreiecks-, Zebra- oder<br />
Wandermuschel<br />
x x x<br />
Gammarus locusta x x x RL MV P<br />
Gammarus oceanicus<br />
x x x x N<br />
bes. Empfindlichkeit<br />
gegenüber<br />
Schadstoffeinträgen <strong>und</strong><br />
möglichen Wirkungen der<br />
Kühlwassereinleitung<br />
(Sauerstoffmangel)<br />
erhöhter Parasitenbefall bei<br />
Temperaturzunahme<br />
x<br />
x<br />
Charakteristische Art des Hartbodens<br />
<strong>und</strong> des Phytals im LRT "Lagune",<br />
"Meeresbucht" <strong>und</strong> auch an der<br />
Außenküste in der gesamten Ostsee.<br />
Kommt erst ab 12psu vor.<br />
im UG selten, braucht nahzu<br />
schlickfreien Feinsandigen<br />
Untergr<strong>und</strong><br />
Weit verbreitete Art, auch an der<br />
Außenküste an zu treffen<br />
(Pommersche Bucht). Art ist<br />
mehrjährig <strong>und</strong> Veränderungen der<br />
Alterstruktur können Hinweise auf<br />
Störungen geben.<br />
nur in der Spandowerhagener Wiek<br />
Charakteristische Art des Hartbodens<br />
<strong>und</strong> des Phytals im LRT "Lagune",<br />
"Meeresbucht" <strong>und</strong> auch an der<br />
Außenküste in der gesamten Ostsee.<br />
Der Flohkrebs lebt an Pflanzen,<br />
Geröll, Miesmuschelbänken. Die Art<br />
ist weit verbreitet <strong>und</strong> eignet sich<br />
nicht als Indikator für den LRT, da<br />
d B t d i R h i<br />
Anhang 2 Seite 3 von 6
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Gammarus salinus x x x x N Phytal<br />
Gammarus zaddachi Phytal<br />
Hediste (Nereis) diversicolor Schillernder<br />
H. diversicolor ist als häufiger<br />
Meeresborstenwurm<br />
Bewohner des LRT "Meerebuchten"<br />
an starke Schwankungen nahezu<br />
aller abiotische Parameter<br />
angepasst. Falls als Folge der<br />
Maßnahme Sauerstoffmangel<br />
x x x x N<br />
auftreten sollte, kann die gut<br />
bewegliche Art schwimmend oder<br />
kriechend fliehen. Als Indikator für<br />
den Zustand des LRT "Meerebucht"<br />
eignet sich die Art nicht.<br />
Heterotanais oerstedi<br />
x x x RL MV P x (x) x x<br />
besondere Empfindlichkeit<br />
gegenüber Eutrophierung<br />
x<br />
Heteromastus filiformis x x Degradationsanzeiger<br />
Hydrobia ventrosa Bauchige Wattschnecke<br />
Weit verbreitete Art, die sich nicht als<br />
x x x x N<br />
charakteristische Art für den LRT<br />
"Meeresbucht" eignet.<br />
Hydrobia ulvae<br />
Am Rande ihrer Verbreitung in Bezug<br />
x x x x N<br />
auf den Salzgehaltsbereich im<br />
Greifswalder Bodden<br />
Leptocheirus pilosus<br />
Macoma balthica Baltische Plattmuschel<br />
Macroplea mutica Langklauen-<br />
Rohrblattkäfer<br />
Manayunkia aestuarina<br />
x x x x (x) x x<br />
x x x x N x x x x x<br />
x x x x RL D 1, RL O 1<br />
x x x<br />
Marenzelleria viridis (=neglecta)<br />
x<br />
Melita palmata x x x<br />
Mya arenaria Sandklaffmuschel<br />
Mytilus edulis Miesmuschel<br />
Neanthes succinea<br />
x x x x N<br />
x<br />
x x x x N<br />
empfindlich gegenüber<br />
Sauerstoffmangel, der durch<br />
Kühlwasser eintreten könnte<br />
bes. Empfindlichkeit<br />
gegenüber<br />
Schadstoffeinträgen <strong>und</strong><br />
Wirkungen der<br />
Kühlwassereinleitung (z.B.<br />
auf die Reproduktion)<br />
Neomysis integer x x x<br />
Orchestia gammarellus im Spülsaum<br />
Palaemon squilla adspersus x x x x x (x) x<br />
Parvicardium hauniense Muschel x<br />
Potamopyrgus antipodarum Neuseeländische<br />
Deckelschnecke<br />
x x x x N<br />
Cerastoderma<br />
glaucum<br />
x<br />
x<br />
Die mehrjährige Art eignet sich als<br />
Indikator für den LRT.<br />
Küstenart im Brackwasser an Ruppia<br />
marina, Potamogeton <strong>und</strong> Zanichellia<br />
<strong>und</strong> Hartboden, lt. Ssymank et al<br />
1998 in Seegraswiesen<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
Exposition (Veränderungen der<br />
Hydrodynamik).<br />
tolerant gegenüber allen hier<br />
gelisteten Faktoren, lediglich<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
Sedimentumlagerung (nur adulte<br />
Tiere)<br />
sehr selten im UG, Art des LRG "Riff"<br />
Die ökologischen Ansprüche <strong>und</strong> die<br />
natürliche Variabilität der Art liegen<br />
ungenügende Kenntenisse vor. H.<br />
neanthes eignet sich daher nicht als<br />
charakteristische Art.<br />
Die Art eignet sich wegen ihrer<br />
weiten Verbreitung in der Ostsee<br />
nicht als charaktristische Art des LRT<br />
"Meeresbucht".<br />
Radix ovata balthica Eiförmige<br />
Schlammschnecke<br />
Rissoa membranacea x x x x RL MV P sehr selten, Dänische Wiek<br />
Anhang 2 Seite 4 von 6
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Saduria entomon<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
Sphaeroma hookeri x x x<br />
Streblospio shrubsoli<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
x RL MV 2<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x RL G, MV P x (x) x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
empfindlich gegenüber<br />
Sauerstoffmangel, der durch<br />
Kühlwasser eintreten könnte<br />
Talitrus saltator im Spülsaum<br />
Theodoxus fluviatilis Gemeine<br />
Kahnschnecke<br />
x x x x N<br />
Tubifex costatus x x x<br />
MPB<br />
Chara aspera Rauhe Armleuchteralge<br />
Chara baltica<br />
Chara canescens Graue Armleuchteralge<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
Cerastoderma<br />
glaucum<br />
x x x RL MV 2 x (x) x x x x<br />
x x x RL MV 3 x (x) x x x<br />
x x x RL MV 2 x (x) x x x<br />
Art reagiert besonders<br />
empfindlich auf eine<br />
Verschlechterung des<br />
Lichtklimas (Eutrophierung)<br />
bedingt durch<br />
Stickstoffeinträge oder<br />
Kühlwassereinleitung<br />
Art reagiert besonders<br />
empfindlich auf eine<br />
Verschlechterung des<br />
Lichtklimas (Eutrophierung)<br />
bedingt durch<br />
Stickstoffeinträge oder<br />
Kühlwassereinleitung<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
x<br />
x<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
nur an der Außenküste, nicht im<br />
Bodden<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
Exposition (Veränderungen der<br />
Hydrodynamik).<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek<br />
Vorkommen in der Dänischen Wiek<br />
<strong>und</strong> im Freesendorfer See<br />
Fucus serratus Sägetang Sägetang ist nur typisch für Riffe der<br />
Außenküste; Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1160<br />
Fucus vesiculosus Blasentang Blasentang ist an den Riffen des<br />
Rügischen Boddens häufig vertreten,<br />
kommt jedoch im UG selten vor<br />
(mangel an Hartboden) Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1160<br />
Furcellaria lumbricalis Gabeltang Gabeltang ist an den Riffen des<br />
Rügischen Boddens häufig vertreten,<br />
kommt jedoch im UG selten vor<br />
(mangel an Hartboden) Kein<br />
Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
1160<br />
Lamprothamnion papulosum<br />
Potamogeton pectinatus Kamm-Laichkraut<br />
x<br />
x x x x<br />
N, Lebensraum<br />
für marine<br />
Wirbellose,<br />
Laichsubstrat für<br />
Hering<br />
charakteristisch für LRT 1160, aber<br />
nicht in der Naturregion Greifswalder<br />
Bodden<br />
Kamm-Laichkraut bevorzugt<br />
lenitische Lebensräume. Natürliche<br />
annuale Schwankungen, deren<br />
Ursachen nicht ausreichend<br />
untersucht sind. Daher als Indikator<br />
nicht geeignet.<br />
Potamogeton praelongus Gestrecktes Laichkraut Kein Vorkommensschwerpunkt im<br />
LRT 1160<br />
Ranunculus peltatus ssp.<br />
baudotii<br />
Ruppia maritima/cirrhosa<br />
(Artaufteilung zweifelhaft)<br />
Strand-Salde<br />
x x x<br />
Tolypella nidifica x x x x RL MV 1 x (x) x x x x<br />
Zannichellia palustris agg. x x x<br />
Kein Vorkommensschwerpunkt im<br />
LRT 1160<br />
Strandsalden bevorzugen lenitische<br />
Lebensräume. Natürliche annuale<br />
Schwankungen, deren Ursachen<br />
nicht ausreichend untersucht sind.<br />
Daher als Indikator nicht geeignet.<br />
Anhang 2 Seite 5 von 6
Lebensraum 1160 1. Schritt 2. Schritt<br />
Flache große Meeresarme 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
<strong>und</strong> -buchten vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Zostera marina Seegras<br />
Zostera noltii<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
x x x x<br />
x<br />
nicht<br />
östlich<br />
Darßer<br />
Schwelle<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
N, § 20 Biotop M-<br />
V<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
x x x x x x<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
charakteristisch für LRT 1160, aber<br />
nicht in der Naturregion Greifswalder<br />
Bodden<br />
Enteromorpha ssp. x x Degradationsanzeiger<br />
Cladophora ssp.<br />
Degradationsanzeiger, ohne genaue<br />
x x<br />
Artzuordnung ggf. nicht zuzuordnen<br />
Anhang 2 Seite 6 von 6
Lebensraum 1210 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Einjährige Spülsäume 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Nahrunghabitat vieler Vögel<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
folgenden vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer x x x x RL MV 1, RL D 1 x x x x x x pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
Calidris alpina Alpenstrandläufer x x x x VS I, RL MV 1, RL D<br />
1<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
x x x x x x pot. Verknappung der<br />
Nahrungsressourcen durch<br />
Kühlwassereinfluss<br />
Orchestia gammarellus Flohkrebs, Strandfloh x (x) im Spülsaum<br />
Talitrus saltator Gemeiner Strandfloh x (x) im Spülsaum<br />
Cafius xantholoma x (x) An der Küste unter Tang, bei Vorkommen im Gebiet<br />
Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren nicht<br />
einschätzbar<br />
Fucellia spp. Strandfliegen x (x)<br />
Salda littoralis x x (x) (x) (x) nicht uneingeschränkt halophil, nicht häufig, kein<br />
Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Pardosa agricola arenicola x x x x RL MV 3, RL D 3 x x Keine bes. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren. Die<br />
Küstenform arenicola wurde mit agricola synonymisiert.<br />
Schwer von P. agrestis zu unterscheiden.<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
x<br />
x<br />
13: Bemerkungen<br />
Atriplex glabriuscula Kahle Melde x x x x RL MV 2<br />
Atriplex hastata x x x<br />
Atriplex littoralis Strand-Melde x x x<br />
Cakile maritima Europäischer Meersenf x x x x RL MV 3 keine bes. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Elymus repens Kriechende Quecke x x x<br />
Euphorbia peplus x x x<br />
Mertensia maritima x nicht in D<br />
Polygonum oxyspermum<br />
ssp. oxysp.<br />
x ausgestorben<br />
Potentilla anserina Gänse-Fingerkraut x x x<br />
Salsola kali Kali-Salzkraut x x x x RL MV 3<br />
Suaeda maritima x x x x RL MV 3<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1
Lebensraum 1230 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Meles meles Dachs (x)<br />
Motacilla alba Bachstelze (x) kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Carpodacus erythrinus Karmingimpel x x x x x x kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel vor, es<br />
existieren von diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise; da LRT außerhalb der Wirkreichweiten<br />
des vorhabensbedingten Schalls hat Art keine Relevanz<br />
für das Projekt<br />
Corvus corax Kolkrabe (x) kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Lanius collurio Neuntöter (x) kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Mergus merganser Gänsesäger x x x x RL MV 2, RL D 2 x x x kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel vor, es<br />
existieren von diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise<br />
Mergus serrator Mittelsäger x x x x RL MV 1 x x x kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel vor, es<br />
existieren von diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise<br />
Riparia riparia Uferschwalbe x x x x x kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel vor, es<br />
existieren von diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise<br />
Sylvia nisoria Sperbergrasmücke (x) kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Tadorna tadorna Brandgans (x) kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Balea biplicata Gemeine<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
Bulgarica cana (x) (x) (x) (x) (x)<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Catinella arenaria Salz-Bernsteinschnecke (x) selten in Dünentälern, Habitatspezialist; außerhalb des<br />
Verbreitungsgebiets<br />
Clausilia dubia Gitterstreifige<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Columella edentula Zahnlose<br />
Windelschnecke<br />
Euomphalia strigella Große Laubschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Lacinaria plicata Faltenrandige<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
Lauria cylindracea Genabelte<br />
Puppenschnecke<br />
Littorina neritoides<br />
Littorina saxatilis Kleine Strandschnecke<br />
Macrogastra attenuata<br />
lineolata<br />
Mittlere<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
Macrogastra plicatula Gefältelte<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
Macrogastra ventricosa Bauchige<br />
Schließm<strong>und</strong>schnecke<br />
Succinella oblonga Kleine<br />
Bernsteinschnecke<br />
Bembidion bualei<br />
polonicum<br />
(x) überwiegend Bewohner von Mauern <strong>und</strong> Felsen;<br />
äußerster Rand des Verbreitungsgebietes<br />
(x) äußerster Rand des Verbreitungsgebietes<br />
Waldart; am Rande des Verbreitungsgebietes<br />
x x x x RL MV 3 x x<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
In D nur an der Ostseeküste. Tonige Böden an<br />
Steilküsten, Quellhänge.<br />
Bembidion saxatile x x x x x In D nur an der Ostseeküste. Auf Kiesstränden vor<br />
Steilküsten<br />
Nebria livida x x x x RL MV 3 RL D 3 x x lehmige Gewässerufer<br />
Vespidae Faltenwespen,<br />
bodennistende Arten<br />
Pompilidae Wegwespen;<br />
bodennistende Arten<br />
Apidae Bienen, bodennistende<br />
Arten<br />
x x x x teils RL D x x Steilwandbewohner vor allem abhängig von dynamischen<br />
Prozessen, besondere Empfindlichkeit gegenüber den<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen nicht erkennbar<br />
x x x x teils RL D x x Steilwandbewohner vor allem abhängig von dynamischen<br />
Prozessen, besondere Empfindlichkeit gegenüber den<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen nicht erkennbar<br />
Armeria maritima ssp.<br />
elongata<br />
Sand-Grasnelke x x x x RL MV 3<br />
Beta vulgaris x nicht in MV<br />
Brassica oleracea Gemüse-Kohl x nicht in MV<br />
Chrithmum maritimum Meerfenchel x<br />
Cochlearia officinalis Gebräuchliches<br />
Löffelkraut<br />
x Nachweis in 80 km Entfernung<br />
Anhang 2 Seite 1 von 2<br />
Waldart<br />
Waldart
Lebensraum 1230 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Fels- <strong>und</strong> Steilküsten mit Vegetation 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Daucus carota Wilde Möhre x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 6510<br />
Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm x x x<br />
Festuca rubra agg. Rotschwingel Sa. x x x<br />
Inula crithmoides x nicht in D<br />
Lavatera arborea x nicht in D<br />
Limonium ssp. Strandflieder x x x<br />
Plantago maritima Strand-Wegerich x x x x RL MV 3 Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1330<br />
Rhodiola rosea Rosenwurz x nicht in MV<br />
Scilla verna x nicht in D<br />
Sedum anglicum x nicht in D<br />
Silene vulgaris ssp.<br />
maritima<br />
x x x<br />
Spergularia rupicola x nicht in D<br />
Tripleurospermum<br />
maritimum<br />
Küsten-Kamille x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1230<br />
Tussilago farfara Huflattich x x x<br />
Anhang 2 Seite 2 von 2
Lebensraum 1310 - Quellerwatt 1. Schritt 2. Schritt<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
Tringa totanus Rotschenkel x x x x RL O 1, RL MV 2, RL<br />
D V<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit<br />
gegenüber Wirkprozessen<br />
entspricht der bereits<br />
betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
x x x x x x Kühlwasserauswirkung treffen den LRT nur indirekt, da<br />
betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate für<br />
die im LRT brütenden oder rastenden Rotschenkel<br />
darstellen<br />
Assiminea grayana Marschenschnecke (x) an der Nordsee<br />
Hydrobia ulvae Gemeine Wattschnecke (x) (x) (x) Wattenmeere der Nord- <strong>und</strong> westlichen Ostsee<br />
Ovatella myosotis Mäuseöhrchen (x) (x) (x) eher an der Nordsee, an der Ostseeküste nur sehr lokal<br />
Bledius spectabilis Prächtiger Salzkäfer (x) (x) (x) (x) Lebensraumschwerpunkt auf Salzböden, bei<br />
Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
Microcnemum corralloides nicht in D<br />
Sagina maritima Strand-Mastkraut x x x x RL MV 2<br />
Salicornia procumbens Sandwatt-Queller (x) An der Nordsee verbreitet, S: S. dolichostachya ssp.<br />
decumbens<br />
Salicornia stricta Schlickwatt-Queller (x) An der Nordsee, S: S. dolichostachya ssp. strictissima<br />
Salicornia europaea ssp.<br />
europaea<br />
Salicornia europaea ssp.<br />
brachystachya<br />
Zierlicher Kurzähren-<br />
Queller<br />
Gewöhnlicher Kurzähren-<br />
Queller<br />
(x) An der Nordsee<br />
x x x S: S. ramosissima<br />
Suaeda maritima Strandsode x x x x RL MV 3 Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1310<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1
Lebensraum 1330 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Atlantische Salzwiesen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt<br />
des Vorkommens im LRT<br />
(Bezug: kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über<br />
die vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Struk-turen <strong>und</strong><br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
Asio flammeus Sumpfohreule (x) Es exitieren keine Brutnachweise aus dem UG (in ganz<br />
MV lediglich 0-1 Bp nach Eichstädt et al. 2006)<br />
Tadorna tadorna Brandgans x x x RL MV 3 x x x (x) x Effektdistanz 100 m gegenüber stark befahrenen Straßen (KIfL<br />
2009)<br />
Tringa totanus Rotschenkel x x x x RL O 1, RL MV 2, RL<br />
D V<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit<br />
gegenüber Wirkprozessen<br />
entspricht der bereits<br />
betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine<br />
Relevanz für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
x hohe Bedeutung des Gebiets als Bruthabitat, hohe<br />
Empfindlichkeit gegenüber Kühlwassereinfluss<br />
x x x x (x) x x Kühlwasserauswirkung treffen den LRT nur indirekt, da<br />
betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate für<br />
die im LRT brütenden oder rastenden Rotschenkel<br />
darstellen<br />
Vanellus vanellus Kiebitz x x x x RL MV 2 <strong>und</strong> RL D 2 x x x x (x) x x<br />
Cochlicopa lubrica Gemeine Achatschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Deroceras laeve Wasserschnegel häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Deroceras reticulatum Genetzte Ackerschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Oxyloma elegans Schlanke Bernsteinschnecke (x) (x) (x) Art von Feucht- <strong>und</strong> Nasshabitaten, häufig, kein Indikator<br />
für besondere Lebensraumansprüche<br />
Vallonia pulchella Glatte Grasschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Amara ingenua x x x eurytope, samenfressende Art, Halophilie zweifelhaft.<br />
Apion limonii x kein Nachweis in MV<br />
Bembidion aeneum x x x x RL MV V Küstenart, die in verschiedenen Lebensräumen auftritt;<br />
kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
Bembidion fumigatum verbreitete Art von vegetationsreichen Gewässerufern <strong>und</strong><br />
Feuchtgrünland<br />
Bembidion lunulatum keine besondere Bindung an Salzwiesen. Kommt auf<br />
bindigem Boden an Gewässeerufern <strong>und</strong> auf<br />
Feuchtstellen in Äckern vor.<br />
Bembidion maritimum x x Küstenart, auf Tidenhub angewiesen; kein Nachweis in<br />
MV<br />
Bembidion pallidipenne Lagunen-Ahlenläufer Küstenart, auf vegetationslosem, gut durchfeuchtetem<br />
Sediment; charakteristische Art für LRT 1150, 1210<br />
Bembidion minimum<br />
(pusillum)<br />
x x x sehr häufig in Salzwiesen, aber auch in Feuchtgrünland<br />
ohne Salzeinfluß<br />
Bembidion transparens an vegetationsreichen Gewässerufern<br />
Bledius dama (x) (x) (x) (x) (x) bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
Lebensraumschwerpunkt auf Salzböden<br />
Bledius spectabilis (x) (x) (x) (x) (x) bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
Lebensraumschwerpunkt auf Salzböden<br />
Bledius subniger (x) (x) (x) (x) (x) bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
Nur in Küstenhabitaten<br />
Cassida vittata (x) (x) (x) (x) (x) kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
Chaetocnema concinna häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Chrysolina haemoptera häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Chrysolina staphylea häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Dicheirotrichus gustavii x x x x RL MV 2, RL D V bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
halobionter Küstenbewohner<br />
Dyschirius chalceus x x x x RL MV 1, RL D 2 bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
an Meeresküsten <strong>und</strong> anderen Salzstellen<br />
Dyschirius salinus x x x x RL MV 3, RL D V bei Vorkommen im Gebiet Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
an Meeresküsten <strong>und</strong> anderen Salzstellen<br />
Mecinus collaris kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
Phaeodon concinnus (x) (x) (x) (x) (x) kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
eine Rasse diese Art ist auf Plantago maritima in<br />
Küstenhabitaten angepasst<br />
lebt an Cochlearia <strong>und</strong> Triglochin maritima<br />
Philopedon plagiatus Bewohner sandiger Lebensräume: im Osten auf Dünen<br />
der Küste beschränkt, lebt an Ammophila arenaria <strong>und</strong><br />
anderen Gräsern, kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen durch die relevanten Wirkfaktoren<br />
Phyllobius vespertinus häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Phyllobius viridaeris häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Phytobius zumpti (x) an Glaux maritima, kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen durch die relevanten Wirkfaktoren;<br />
kein Nachweis in MV<br />
Phythosus balticus (x) auf Küstenlebensräume angewiesen, kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch die relevanten<br />
Wirkfaktoren; in MV seit 1950 nicht mehr nachgewiesen<br />
Phythosus spinifer (x) kein Nachweis in MV<br />
Pogonus chalceus x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1310; kein Nachweis in<br />
MV<br />
Pogonus luridipennis x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1310; kein Nachweis in<br />
MV<br />
Anhang 2 Seite 1 von 2
Lebensraum 1330 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Atlantische Salzwiesen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt<br />
des Vorkommens im LRT<br />
(Bezug: kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über<br />
die vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Struk-turen <strong>und</strong><br />
standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche<br />
<strong>und</strong> Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
Polydrusus atomarius häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Polydrusus pulchellus (x) an der Nordseeküste auf verschiedenen Pflanzen der<br />
Salzwiesen, kein Nachweis in MV, kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch die relevanten<br />
Wirkfaktoren<br />
Trachyphloeus bifoveolatus kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
Bombus muscorum x x x x RL D 2 x x keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen<br />
Colletes halophilus<br />
Lasioglossum leucozonium<br />
x außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Eristalinus sepulchralis x x<br />
Hydrophorus oceanus Langbeinfliege (x) (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Sphaerophoria rueppellii x<br />
Symplecta stictica (x) (x) (x) (x) (x)<br />
Autographa gamma Gammaeule häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Vanessa cardui Distelfalter Wanderfalter, in unterschiedlichen Offenlandhabitaten<br />
Chiloxanthus pilosus Wanze (x) (x) (x) (x) (x) Quellrasen <strong>und</strong> Salzwiesen, typischer<br />
Salzwiesenspezialist<br />
Conostethus frisicus Wanze (x) (x) (x) (x) (x) halophil<br />
Exolygus maritimus (x) nur an der Nordseeküste<br />
Halosalda lateralis Wanze (x) (x) (x) (x) (x) küstenspezif. / Binnensalzstellen<br />
Orthotylus moncreaffi (x) nur an der Nordseeküste<br />
Plagiognathus litoralis (x) nur an der Nordseeküste<br />
Saldula palustris (x) nur vereinzelte Vorkommen an der Ostsee<br />
Anoscopus limicola x Salzwiesenbesiedler; kein Nachweis in MV<br />
Eupteryx artemisiae Zikade x Lebensraumschwerpunkt in Salzwiesen an Artemsisia; nur<br />
vereinzelte Vorkommen an der Ostsee<br />
Erigone arctica maritima x x x x x halophil (halobiont?), überwiegend an der Küste.<br />
Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren fraglich.<br />
Erigone longipalpis x x x x RL MV 4 x x keine Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Leptorhoptrum robustum x x x x RL MV 3 x x Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren fraglich.<br />
Pardosa agrestis<br />
x x x x RL MV 4 RL D D x x küstentypische Form der Salzwiesen. Taxonomischer<br />
purbeckensis<br />
Klärungsbedarf. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
fraglich.<br />
Baryphyma duffeyi x x in Deutschland nur an Nordseeküste<br />
Silometopus ambiguus x x kaum Nachweise aus MV<br />
Agrostis stolonifera Weißes Straußgras x x x<br />
Armeria maritima agg. Sand-Grasnelke x x x x RL MV 3 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Artemisia maritima Strand-Beifuß x x x RL MV 3 an der Nordsee<br />
Aster tripolium Strand-Aster x x x<br />
Atriplex littoralis Strand-Melde x x x<br />
Atriplex pedunculata Stielfrüchtige Salzmelde x x x RL MV 1 S.: Halimione pedunculata<br />
Atriplex portulacoides Portulak-Keilmelde (x) nicht in MV, S: Halimione portulacoides<br />
Atriplex prostrata Spieß-Melde x x x S: Atriplex hastata<br />
Beta maritima Wile Rübe (x) nicht in MV<br />
Blysmus rufus Rote Quellbinse x x x x RL D 2<br />
Carex distans Entferntährige Segge x x x x RL MV 3<br />
Carex extensa Strand-Segge x x x x RL MV 3<br />
Eleocharis palustris agg. Gemeine Sumpfsimse Sa. x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 2190<br />
Elymus pycnanthus Dünen-Quecke x an der Nordsee<br />
Elymus repens Kriechende Quecke x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1330<br />
Festuca rubra agg. Rotschwingel Sa. x x x<br />
Frankenia laevis Glatte Frankenie (x) nicht in D<br />
Glaux maritima Strand-Milchkraut x x x<br />
Juncus gerardii Bodden-Binse x x x<br />
Limonium vulgare Strandflieder x x x RL MV 2 an der Nordsee<br />
Odontites litoralis Salz-Zahntrost x x x x RL MV 1, RB<br />
Plantago maritima Strand-Wegerich x x x x RL MV 3 Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1330<br />
Potentilla anserina Gänse-Fingerkraut x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1330<br />
Puccinellia distans agg. Gemeiner Salzschwaden Sa. x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1330<br />
Puccinellia fasciculata Büschel-Salzschwaden (x) nicht in D<br />
Puccinellia maritima Andel x x x<br />
Puccinellia retroflexa Zurückgebogener Salzschwaden x<br />
Spergularia salina Salz-Schuppenmiere x x x<br />
Suaeda maritima Strandsode x x x x RL MV 3 Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1310<br />
Trifolium fragiferum Erdbeer-Klee x x x<br />
Triglochin maritimum Salz-Dreizack x x x x RL MV 3<br />
Tripleurospermum<br />
maritimum<br />
Küsten-Kamille x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 1230<br />
Anhang 2 Seite 2 von 2<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit<br />
gegenüber Wirkprozessen<br />
entspricht der bereits<br />
betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine<br />
Relevanz für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen
Lebensraum 2110 - Primärdünen 1. Schritt 2. Schritt<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug: Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere Wertigkeit<br />
der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Struk-turen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen Parameter<br />
hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
Phoca vitulina Seeh<strong>und</strong> x bereits als Anhang II Art geschützt, gefährdetes<br />
Wandertier/ Gast, Keine ungestörten Wurfplätze,<br />
Charadrius alexandrinus Seeregenpfeifer Es exitieren keine Brutnachweise aus dem UG (in ganz MV<br />
lediglich 0-1 Bp nach Eichstädt et al. 2006)<br />
Lariden-Brutkolonien Möwen-Brutkolonien<br />
Larus canus Sturmmöwe x x x x RL MV 3 x x (x) Kühlwasserauswirkungen treffen den LRT nur indirekt, da<br />
betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate für die<br />
potenziell im LRT brütende Sturmmöwen darstellen<br />
Larus argentatus Silbermöwe x x x x x (x) Kühlwasserauswirkungen treffen den LRT nur indirekt, da<br />
betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate für die<br />
potenziell im LRT brütende Silbermöwen darstellen<br />
Larus fuscus Heringsmöwe x<br />
Cassida flaveola x x<br />
Cicindela maritima Küsten-Sandlaufkäfer x x x x RL MV 1 , RL D 1 x x x x x Exklusive Küstenart, besondere Verantwortung des Landes<br />
für den Erhalt. Selten, bisher kein Vorkommen aus dem UG<br />
bekannt. Zielart der landesweiten naturschutzfachlichen<br />
Planung, reagiert empfindlich auf Störungen <strong>und</strong> auf<br />
Veränderungen in der Vegetationsdeckung.<br />
Dyschirius salinus Kommt nur im Nebenvorkommen in 2110 vor. Wird als<br />
Kennart im Bewertungsschema des BfN für LRT 1310 <strong>und</strong><br />
1330 genannt.<br />
Psylliodes marcidus (x) (x) (x) (x) (x) kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
die relevanten Wirkfaktoren<br />
Küstenbewohner; lebt nur auf Cakile maritima<br />
Fucellia spp. Strandfliegen<br />
Pardosa agricola x x x x RL MV 4* RL D 3 x x kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
die relevanten Wirkfaktoren<br />
in MV extrem selten<br />
Cakile maritima Europäischer Meersenf x x x x RL MV 3 keine bes. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Elymus farctus x x x<br />
Honckenya peploides Salz-Miere x x x x RL MV V<br />
Leymus arenarius Strandroggen x x x<br />
Salsola kali Kali-Salzkraut x x x x RL MV 3<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong> Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den LRT<br />
<strong>und</strong> besitzt eine Relevanz für die<br />
FFH-VP<br />
13: Bemerkungen
Lebensraum 2120 1. Schritt 2. Schritt<br />
Weißdünen mit Strandhafer 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Kühlwassereinleitung<br />
8f: Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Lariden-Brutkolonien Möwen-Brutkolonien<br />
Larus canus Sturmmöwe x x x x RL MV 3 x x Kühlwasserauswirkungen treffen den LRT nur indirekt,<br />
da betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate<br />
für die potenziell im LRT brütende Sturmmöwen<br />
darstellen<br />
Larus argentatus Silbermöwe x x x x x Kühlwasserauswirkungen treffen den LRT nur indirekt,<br />
da betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate<br />
für die potenziell im LRT brütende Silbermöwen<br />
darstellen<br />
Larus fuscus Heringsmöwe x<br />
Bodennistende Hymenopteren<br />
Arachnospila consobrina Wegwespe x x x x RL D G x<br />
Bembix rostrata Kreiselwespe x x x x RL MV 1, RL D 3 x x x<br />
Colletes cunicularius Wildbiene x x x x x x Auf Sandboden beschränkt, Pionierart von<br />
Dünengebieten.<br />
Colletes halophilus Wildbiene x<br />
Colletes impunctatus Wildbiene x x x x RL D G x x x<br />
Colletes marginatus Wildbiene x x x x RL D 3 x x x<br />
Crossocerus pullulus Grabwespe x x x x RL MV R, RL D R x x x<br />
Mimumesa littoralis Grabwespe x<br />
Osmia maritima x x x x RL D R x x x<br />
Ischnodemus sabuleti Schmalwanze x x verbreitet, an Leymus arenarius<br />
Trigonotylis elymi Wanze (x) (x) (x) (x) küstenspezifisch an Grasarten<br />
Psammotettix maritimus Zikade x Küstenbesiedler<br />
Psammotettix sabulicola Zikade x x x (x) Küstenbesiedler<br />
Ammophila arenaria Strandhafer x x x keine bes. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Calammophila baltica Baltischer Strandhafer x x x<br />
Calystegia soldanella Vorkommen an der Nordsee<br />
Eryngium maritimum Stranddistel x RL MV 2, RB<br />
Euphorbia paralias Strand-Wolfsmilch<br />
Festuca rubra agg. Rotschwingel Sa. x x x<br />
Lathyrus maritimus Strand-Platterbse x x x<br />
Leymus arenarius Strandroggen x x x<br />
Oenothera oakesiana<br />
Otanthus maritimus<br />
eingebürgerter Neophyt, nicht in MV<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1
Lebensraum 2130* 1. Schritt 2. Schritt<br />
Graudünen mit krautiger Vegetation 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Columba oenas Hohltaube Die Art ist eigentlich eine Waldart <strong>und</strong> brütet vor allem in<br />
Schwarzspechthöhlen, an der Nordsee hat sich die<br />
Tradition herausgebildet, auch Kannichenbauten in den<br />
Dünenbereichen zu nutzen; für M-V gibt es bisher keine<br />
Hinweise auf ein ähnliches Verhalten.<br />
Oenanthe oenanthe Steinschmätzer x x x x RL O 1, RL MV 2,<br />
RL D 1<br />
x x x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 300 m); Art<br />
ist vergleichsweise stark auf<br />
Nährstoffarmut kennzeichnende<br />
Lebensräume angewiesen<br />
Tadorna tadorna Brandgans x x x x RL MV 3 x x x (x) Kühlwasserauswirkungen treffen den LRT nur indirekt, da<br />
betroffene Lebensräume wichtige Nahungshabitate für<br />
die im LRT brütenden Brandgänse darstellen;<br />
Beeinträchtigungen sind daher zumindest im Bezug auf<br />
diesen LRT nicht als erheblich anzusehen<br />
Candidula intersecta Gefleckte Heideschnecke x (x) x (x) (x) Bewohner offener grasiger Sandstandorte<br />
Cochlicopa lubricella Kleine Achatschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Helicella itala Gemeine Heideschnecke x Art der trockenen Magerrasen<br />
Pupilla muscorum Moospuppenschnecke (x) (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Truncatellina costulata Wulstige<br />
Zylinderwindelschnecke<br />
auf Kalk<br />
Vallonia costata Gerippte Grasschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Vallonia excentrica häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Vertigo pygmaea Gemeine Windelschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Art trockener Grasstandorte<br />
Vitrina pellucida<br />
Bombus veteranus<br />
Kugelige Glasschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Colletes impunctatus x x x x RL D G x x x<br />
Colletes marginatus x x x x RL D 3 x x x<br />
Epeolus alpinus x<br />
Lasioglossum prasinum x<br />
Lasioglossum tarsatum x x x x RL D 2 x x x<br />
Megachile maritima x x x x RL D 3 x x x<br />
Osmia maritima x x x x RL D R x x x<br />
Eumerus sabulonum x x x x RL D 2 x x x<br />
Paragus tibialis x<br />
Pelecocera tricincta<br />
Sphaerophoria philantha<br />
x<br />
Sciocoris cursitans Wanze x (x) verbreitet<br />
Anoscopus histrionicus Zweiflügler (x) (x) (x) (x)<br />
Decticus verrucivorus Warzenbeißer x x x x RL D3, RL MV3 x x x (x) x wurde auf den Graudünen des UG in geringer Dichte, aber<br />
stetig nachgewiesen<br />
Cladonia arbuscula x (x) x x RL MV 3 x x x x Sehr empfindlich gegenüber Cladonia<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen portentosa<br />
Cladonia ciliata x (x) x x RL MV 3 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
Cladonia foliacea x (x) x x RL MV 3 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
Cladonia portentosa Ebenästige Rentierflechte x (x) x x RL MV 3 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
Cladonia rangiferina x (x) x x RL MV 2 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
Cladonia uncialis x (x) x x RL MV 3 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
Anhang 2 Seite 1 von 2<br />
Cladonia<br />
portentosa<br />
Cladonia<br />
portentosa<br />
Cladonia<br />
portentosa<br />
Cladonia<br />
portentosa<br />
x<br />
x
Lebensraum 2130* 1. Schritt 2. Schritt<br />
Graudünen mit krautiger Vegetation 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Cladonia zopfii x (x) x x RL MV 2 x x x x Sehr empfindlich gegenüber<br />
Schwefel- <strong>und</strong> Schadstoffeinträgen<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
Brachythecium albicans Weißes Kurzbüchsenmoos x (x) x<br />
Tortula ruraliformis Erd-Bartmoos x (x) x<br />
Aira praecox Frühe Haferschmiele x x x Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Anacamptis pyramidalis Pyramiden-Spitzorchis<br />
Bromus hordeaceus Weiche Trespe x x x<br />
Carex arenaria Sand-Segge x x x Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Cerastium spp. Hornkraut-Arten x x x<br />
Corynephorus canescens Silbergras x x x Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Erodium lebelii Drüsiger Reiherschnabel x S: Erodium glutinosum<br />
Galium verum Echtes Labkraut x<br />
Gentiana cruciata Kreuz-Enzian x<br />
Gentianella campestris Feld-Enzian x Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Hieracium umbellatum Doldiges Habichtskraut x x x Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Jasione montana Berg-Sandknöpfchen x RL MV V Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Koeleria arenaria Sand-Schillergras x<br />
Milium scabrum x<br />
Myosotis ramosissima Rauhes Vergissmeinnicht x x x<br />
Ononis repens Kriechende Hauhechel x x x x RL MV V Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Phleum arenarium Sand-Lieschgras x RL MV 2<br />
Polygala dunensis Spitzflügeliges Kreuzblümche x<br />
Polygala vulgaris agg. Gewöhnliches<br />
Kreuzblümchen<br />
Silene conica Kegel-Leimkraut x<br />
Silene otites Ohrlöffel-Leimkraut x<br />
Trifolium scabrum Rauher Klee x<br />
Tuberaria guttata Geflecktes Sandröschen x<br />
Viola canina H<strong>und</strong>s-Veilchen x x x x RL MV 3<br />
Viola rupestris Sand-Veilchen<br />
Viola tricolor ssp. curtisii Sand-Stiefmütterchen x x x x RL MV R<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
Cladonia<br />
portentosa<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
x x x x RL MV 1-2 Empfindlichkeit gegenüber Stickstoffeinträgen (N-<br />
Zeigerwert 1 oder 2) geht nicht über die Empfindlichkeit<br />
des LRT hinaus.<br />
Anhang 2 Seite 2 von 2
Lebensraum 2180 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Bewaldete Küstendünen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
Columella aspera Rauhe Windelschnecke<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Spermodea lamellata Bienenkörbchen x x x x RL D 1, RL MV R,<br />
ZA<br />
(x) (x) (x) (x) selten, lebt in alten Laub- <strong>und</strong> Laubmischwäldern<br />
Betula pendula Sand-Birke x x x<br />
Carex arenaria Sand-Segge x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 2130, Empfindlich<br />
gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1 oder 2<br />
Fagus sylvatica Rotbuche x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 9130<br />
Leymus arenarius Strandroggen x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 2120<br />
Pinus sylvestris Wald-Kiefer x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 2180<br />
Pyrola ssp. Wintergrün x x x<br />
Quercus petraea Trauben-Eiche x x x<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1
Lebensraum 2190 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Feuchte Dünentäler 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Asio flammeus Sumpfohreule (x) Es exitieren keine Brutnachweise aus dem UG (in ganz<br />
MV lediglich 0-1 Bp nach Eichstädt et al. 2006); als<br />
Durchzügler potentiell möglich<br />
Circus pygargus Wiesenweihe (x) Als Durchzügler pot. möglich; Es exitieren keine<br />
Brutnachweise aus dem UG; Ein Vorkommen würde auch<br />
eher für die Qualität der gesamten offenen bis halboffenen<br />
Küstenlandschaft stehen.<br />
Emberiza schoeniclus Rohrammer kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Numenius arquata Großer Brachvogel x x x x RL MV 1, RL D 2 x Kühlwasser wirkt sich nicht unmittelbar auf diesen LRT aus<br />
Bufo calamita Kreuzkröte x x x x FFH IV, RL D V,<br />
RL MV 2<br />
Catinella arenaria Salz-<br />
Bernsteinschnecke<br />
x x x x x Eutrophierung bedingt dichtere Vegetation, dadurch<br />
empfindlich gegenüber Nährstoffeintrag, Vorkommen der<br />
Art auf dem Struck<br />
(x) selten in Dünentälern, Habitatspezialist; außerhalb des<br />
Verbreitungsgebietes<br />
Anasimyia ssp. x x x x teils RL D x x<br />
Anasimyia lineata x x x x x<br />
Colletes succinctus x x x x RL D V (x) x x x x charakteristische Sandart mit hohen Ansprüchen an ihre<br />
Pollenquellen (v.a. Calluna vulgaris), wurde im UG in<br />
einem feuchten Dünental nachgewiesen<br />
Helophilus spp.<br />
Parhelophilus frutetorum<br />
Platycheirus spp.<br />
Pyrophaena spp.<br />
x x x x x<br />
Agramma laeta Wanze (x) (x) (x) (x) an Sauergräsern<br />
Teratocoris sa<strong>und</strong>ersi Wanze (x) (x) (x) x RL D 3 (x) küstenspezifisch an Phragmites<br />
Kosswigianella exigua (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Paramesus obtusifrons Zikade x x x x RL D 3 x (x) x x Seltener Bewohner von Feuchtgebieten<br />
Carex demissa (flava agg.) Grünliche Gelbsegge x RL MV 3<br />
Carex nigra Braune Segge x x x x RL MV 3<br />
Carex trinervis Dreinervige Segge x nicht in MV<br />
Erica tetralix Echte Glockenheide x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Juncus balticus Baltische Binse x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 1, RB<br />
Liparis loeselii Glanzstendel x (x) (x) x RL MV 2, §§, RL<br />
Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
D 2; Anhang II<br />
oder 2, wird bereits als Anhang II Art betrachtet<br />
Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Schoenus nigricans Schwarzes Kopfried x RL MV 1<br />
Anhang 2 Seite 1 von 1
Lebensraum 3150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Nährstoffreiche Stillgewässer 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
Lutra lutra Fischotter x x x x FFH II/ IV, RL D 1,<br />
RL MV 2<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
x x x x x benötigt störungsarme Reproduktionsräume <strong>und</strong> reich<br />
strukturierte Uferzonen; aufgr<strong>und</strong> der großen Entfernung<br />
zw. LRT <strong>und</strong> Kraftwerk, ist die Art mit ihrer spezifischen<br />
Empfindlichkeit nicht zur Beurteilung der Beeinträchtigungen<br />
geeignet<br />
Bucephala clangula Schellente x x x x x x nur als Rastvogel zu erwarten (keine geeigneten<br />
Bruthabitate) (Ufernahe Baumbestände mit<br />
Höhlenangebot); Kühlwasser wirkt sich nicht unmittelbar auf<br />
diesen LRT aus<br />
Cygnus olor Höckerschwan x x x x x x Kühlwasser wirkt sich nicht auf diesen LRT aus;<br />
vorhabensbedingte Beeinträchtigungen im LRT können<br />
nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Art führen<br />
Fulica atra Bläßhuhn x x x x x x Kühlwasser wirkt sich nicht auf diesen LRT aus;<br />
Beeinträchtigung der Art in diesem LRT daher nicht<br />
erheblich.<br />
Mergus merganser Gänsesäger x x x x RL MV 2, RL D 3 x x x kommt im LRT 1230 pot. nur als Brutvogel vor, es<br />
existieren von diesem LRT im UG jedoch keine<br />
Brutnachweise; Kühlwasser wirkt sich nicht auf diesen LRT<br />
aus; Beeinträchtigung der Art in diesem LRT daher nicht<br />
erheblich.<br />
Podiceps cristatus Haubentaucher x x x x RL MV 3 x x x Kühlwasser wirkt sich nicht auf diesen LRT aus;<br />
Beeinträchtigung der Art in diesem LRT daher nicht<br />
erheblich.<br />
verschiedene Schwimm-<br />
<strong>und</strong> Tauchenten<br />
x x x x einige Arten der RL<br />
MV<br />
x x x Kühlwasser wirkt sich nicht auf diesen LRT aus;<br />
Bombina bombina Rotbauchunke x<br />
Emys orbicularis Europäische Sumpfschildkröte x<br />
Hyla arborea Laubfrosch x x (x) x FFH IV, RL D 3, RL x x x x x ein Fortpflanzungvorkommen im Schutzgebiet im Bereich<br />
MV 3<br />
<strong>Lubmin</strong> fehlt<br />
Natrix natrix Ringelnatter x x x x RL D V, RL MV 2 x x x x x x x<br />
Rana lessonae (Pelophylax Kleiner Wasserfrosch<br />
lessonae)<br />
x<br />
Rana ridib<strong>und</strong>a Seefrosch x<br />
Triturus cristatus Kammolch x x x x FFH IV, RL V, RL MV<br />
2<br />
x x x x x<br />
Abramis brama Blei x x nahe bewachsenen Uferzonen mit Weichboden<br />
Blicca bjoerkna Güster x x<br />
Carassius carassius Karausche x x (x) x RL D 2 x x x<br />
Esox lucius Hecht x x (x) x FB x x x ruhige, klare Gewässer mit Kiesgr<strong>und</strong> u. dichtem,<br />
ufernahen Pflanzenbewuchs<br />
Leuciscus cephalus Döbel<br />
Leuciscus idus Aland (x) ruhiges, pflanzenreiches Flachwasser, oberflächennah<br />
Misgurnus fossilis Schlammpeitziger x x x x RL MV V; RL D 2 x x x kein Nachweis im duB, lt. Winkler et al. 2007 nur geringe<br />
Vorkommensfrequenz in MV<br />
Perca fluviatilis Flussbarsch x x (x) x FB x x x ruhige Gewässer mit Hartboden<br />
Silurus glanis Wels x<br />
Stizostedion lucioperca Zander x x x x trübes Flachwasser, Bodenformationen (Felsen, Wurzeln<br />
etc.)<br />
Tinca tinca Schlei x x<br />
Anodonta cygnea Schwanenmuschel (Große<br />
Teichmuschel)<br />
x x x x RL D 2, RL MV 3 x x x Als Filtrierer empfindliche Art gegenüber allen<br />
Wirkfaktoren, die die Wasserqualität beeinträchtigen;<br />
allerdings relative hohe Toleranz gegenüber Eutrophierung<br />
Pisidium henslowanum Kleine Faltenerbsenmuschel x x<br />
Pisidium nitidum Glänzende Erbsenmuschel x x<br />
Sphaerium corneum Gemeine Kugelmuschel x x<br />
Acroloxus lacustris Teichnapfschnecke x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Anisus leucostoma Weißmündige Tellerschnecke x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Anisus spirorbis Gelippte Tellerschnecke x x x (x) selten<br />
Anisus vortex Scharfe Tellerschnecke x x<br />
Anisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke x x x (x) selten<br />
Gyraulus acronicus Verbogenes Posthörnchen x x x x RL D 1 x nur in Seen des Vereisungsgebietes<br />
Gyraulus riparius Flaches Posthörnchen x x x x RL D 1 x nur in Norddeutschland, sehr selten<br />
Lymnaea stagnalis Spitzschlammschnecke x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Planorbarius corneus Posthornschnecke x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Anhang 2 Seite 1 von 4
Lebensraum 3150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Nährstoffreiche Stillgewässer 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
Planorbis planorbis Gemeine Tellerschnecke x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Radix auricularia Ohrschlammschnecke x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Valvata piscinalis Gemeine Federkiemenschnecke x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Agabus fuscipennis (x) (x) (x) x RL D 2 (x) (x) kein Indikator für Beeinträchtigungen<br />
durch die relevanten Wirkfaktoren<br />
Cybister lateralimarginalis x x x x RL D 3 x (x) kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
sehr seltene Wasserkäferart<br />
Dytiscus latissimus x benötigt größere stehende Gewässer, seltene FFH-Art<br />
großer Gewässer, Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
wäre bei Vorkommen im Gebiet nicht einschätzbar<br />
Gyrinus paykulli x x x x RL D 3 (x) seltener Taumelkäfer, bevorzugt Schilfröhrichte<br />
Gyrinus suffriani x x x x RL D 1 (x)<br />
Haliplus heydeni x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Helochares obscurus x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Hydrochus elongatus x (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Hydrophilus aterrimus x x x x RL D 2 x (x) Art vegetationsreicher Kleingewässer<br />
Hydrophilus piceus x x x x RL D 3 x (x) Art vegetationsreicher Kleingewässer<br />
Hygrobia hermanni x<br />
Hygrotus inaequalis x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Laccophilus minutus x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Noterus clavicornis x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Rhantus bistriatus x x (x) x RL D 3 (x) (x) seltener Wasserkäfer, bei Vorkommen im Gebiet<br />
Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren nicht einschätzbar<br />
Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjungfer x x Besiedelt unterschiedliche auch stark eutrophe<br />
Stillgewässer<br />
Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer x x (x) x x Besiedelt unterschiedliche auch stark Stillgewässer mit<br />
Schwimm- bzw. Tauchblattvegetation<br />
Aeshna isosceles Keilflecklibelle x x x x RL MV 3; RL D 2 x x x x (x) Hypertrophierung <strong>und</strong><br />
Schadstoffeintrag führen zu Verlust<br />
der Habitatstrukturen, Art toleriert<br />
Faulschlammbildung nicht<br />
selten<br />
13: Bemerkungen<br />
(x) Indikator für Still- <strong>und</strong> Fließgewässer mit<br />
Verlandungsvegetation <strong>und</strong> Schilfgürteln, wärmeliebend<br />
Aeshna mixta Herbst-Mosaikjungfer x x (x) x x Besiedelt unterschiedliches Spektrum von Stillgewässern<br />
v.a.mit Röhrichtgürteln<br />
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer x (x) (x) x RL D 1 x x x x Auf Vorkommen Stratiotes angewiesen<br />
Anax imperator Große Königslibelle x x x x RL MV 3 x x wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
Nähr- oder Schadstoffe<br />
häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Brachytron pratense Kleine Mosaikjungfer x x x x RL MV V; RL D 3 x x wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
Nähr- oder Schadstoffe<br />
häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Cercion lindeni x<br />
Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer x x x x RL D 3 x x x x Aeshna<br />
Besiedelt unterschiedliche Typen von Stillgewässern mit<br />
isosceles<br />
reichen Helo- <strong>und</strong> Hydrophytenbeständen<br />
Cordulia aenea Gemeine Smaragdlibelle x x (x) x RL D V (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Epitheca bimaculata Zweifleck x (x) (x) x RL MV 1 x x x Indikatorart für Auengwässer <strong>und</strong> kleine Seen mit<br />
Schwimmblattzonen <strong>und</strong> Unterwasservegetation<br />
Erythromma najas Großes Granatauge x x x x RL D V x x x x Aeshna<br />
isosceles<br />
Besiedelt unterschiedliche Stillgewässer mit<br />
Schwimmblattzone <strong>und</strong> Unterwasservegetation<br />
Erythromma viridulum Kleines Granatauge x mäßig häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, an unterschiedlichen Arten von<br />
Stillgewässern mit reicher Unterwasservegetation<br />
Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer x x (x) x x wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
Nähr- oder Schadstoffe<br />
Lestes viridis Weidenjungfer (x) (x) (x) x RL MV V x x wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
Nähr- oder Schadstoffe<br />
häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
mäßig häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Art kommt an nährstoffärmeren<br />
vegetationsreichen Gewässern vor<br />
Anhang 2 Seite 2 von 4
Lebensraum 3150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Nährstoffreiche Stillgewässer 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
Leucorrhinia caudalis x (x) (x) x RL D 1 x x x<br />
Libellula quadrimaculata Vierfleck x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Orthetrum cancellatum Großer Blaupfeil x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Somatochlora metallica Glänzende Smaragdlibelle x x (x) x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle x x (x) x RL MV V x x mäßig häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Art kommt an unterschiedlichen<br />
Stillgewässertypen vor<br />
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Sympetrum striolatum Große Heidelibelle x x (x) x RL MV 1 x x<br />
Sympetrum vulgatum Gemeine Heidelibelle x x häufig, kein Indikator für besondere Lebensraumansprüche<br />
Acentria ephemerella x x (x) (x) (x)<br />
Archanara algae Teich-Röhrichteule x x (x) x RL D 2 (x) (x)<br />
bewohnt v.a. Rohrkolbenbestände, sehr wahrscheinlich<br />
keine besondere Empfindlichkeit ggüber Wirkfaktoren<br />
Archanara geminipuncta Zweipunkt-Schilfeule x x (x) (x) (x)<br />
Archanara neurica Kleine Röhrichteule x x (x) x RL D 2 (x) (x) toleriert gewisse Nährstoffeinträge<br />
Cataclysta lemnata x x<br />
Elophila nymphaeata x x (x) (x) (x)<br />
Parapoynx stratiotata x x (x) (x) (x)<br />
Nonagria typhae x x (x) (x) (x)<br />
Mythimna obsoleta Röhricht-Weißadereule x x (x) (x) (x)<br />
Mythimna pudorina Moorwiesen-Weißadereule x Nachweis 2001, keine besondere Empfindlichkeit ggüber<br />
Wirkprozessen<br />
Mythimna straminea Uferschilf-Weißadereule x x<br />
Argyroneta aquatica x x x x RL MV 3; RL D 2 x x<br />
keine besondere Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Hylaeus gracilicornis x<br />
Hylaeus moricei x<br />
Hylaeus pectoralis x x x x RL D 3 x x<br />
Hylaeus pfankuchi<br />
Passaloecus singularis<br />
x<br />
Pemphredon fabricii<br />
Pemphredon inornata<br />
x x<br />
Anasimyia spp. x x x x teils RL D x x<br />
Anasimyia lineata x x x x x<br />
Helophilus hybridus x x x x x<br />
Helophilus trivittatus x x<br />
Lejogaster metallina x x x x x<br />
Mesembrius peregrinus x<br />
Neoascia tenur x x<br />
Parhelophilus spp. x x x x teils RL D x x<br />
Platycheirus spp. x x x x teils RL D x x<br />
Pyrophaena spp. x x x x x<br />
Hesperocorixa sahlbergi Wanze x x (x) (x) (x)<br />
Mesovelia furcata Wanze x x (x) (x) (x)<br />
Micronecta minutissima Wanze x x x (x) (x)<br />
Microvelia reticulata Wanze x x<br />
Ranatra linearis Wanze x x<br />
Riccia spp. Teichlebermoos-Arten x x x<br />
Riccia fluitans Flutendes Teichlebermoos x x x<br />
Ricciocarpus spp. Teichlebermoos-Arten x x x<br />
Ricciocarpus natans Breites Teichlebermoos x x x<br />
Aldrovanda vesiculosa Wasserfalle x<br />
Azolla spp. Algenfarn x x x<br />
Ceratophyllum demersum Rauhes Hornblatt x x x<br />
Ceratophyllum submersum Zartes Hornblatt x x x<br />
Hydrocharis morsus-ranae Froschbiss x x x x RL MV V<br />
Lemna spp. Wasserlinsen-Arten x x x<br />
Lemna minor Kleine Wasserlinse x x x<br />
Anhang 2 Seite 3 von 4<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen
Lebensraum 3150 1. Schritt 2. Schritt<br />
Nährstoffreiche Stillgewässer 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der konkreten<br />
Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
Lemna trisulca Dreifurchige Wasserlinse x x x<br />
Myriophyllum spicatum Ähren-Tausendblatt x x x x RL MV V<br />
Myriophyllum verticillatum Quirl-Tausendblatt x<br />
Najas marina ssp. marina Großes Nixenkraut x<br />
Potamogeton acutifolius Spitzblättriges Laichkraut x<br />
Potamogeton compressus Flachstengeliges Laichkraut x x x x RL MV 2<br />
Potamogeton crispus Krauses Laichkraut x x x<br />
Potamogeton lucens Spiegelndes Laichkraut x x x<br />
Potamogeton obtusifolius Stumpfblättriges Laichkraut x<br />
Potamogeton pectinatus Kamm-Laichkraut x x x<br />
Potamogeton perfoliatus Durchwachsenes Laichkraut x x x<br />
Potamogeton praelongus Gestrecktes Laichkraut x<br />
Potamogeton trichoides Haarblättriges Laichkraut x<br />
Potamogeton x zizii Langblättriges Laichkraut x<br />
Ranunculus aquatilis agg. Wasser-Hahnenfuß x x x<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen<br />
Strukturen <strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
Ranunculus circinatus Spreizender Wasserhahnenfuß x x x<br />
Salvinia natans Schwimmfarn x<br />
Spirodela polyrhiza Teichlinse x x x<br />
Stratiotes aloides Krebsschere x x x<br />
Utricularia australis Südlicher Wasserschlauch x Empfindlich gegenüber Eutrophierung, RL MV 1.<br />
Utricularia vulgaris Gewöhnlicher Wasserschlauch x x x x RL MV 3 Empfindlich gegenüber Eutrophierung.<br />
Wolffia arrhiza x x x<br />
Anhang 2 Seite 4 von 4<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen
Lebensraum 6230* - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Artenreiche Borstgrasrasen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
Anthus spinoletta spinoletta Bergpieper x x x x x keine Brutnachweise in MV, als Durchzügler Vorkommen<br />
möglich<br />
Anthus trivialis Baumpieper<br />
Caprimulgus europaeus Ziegenmelker x RL MV 1, RL D 3,<br />
VS I<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
x x x x hohe Lärmempfindlichkeit (kritischer<br />
Schallpegel nach KIfL (2009) 47<br />
dB(A))<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
kommt nicht unmittelbar in FFH-Gebiet vor, eignet sich<br />
daher nicht zur Beurteilung der vorhabensbedingten<br />
Beeinträchtigungen<br />
Lullula arborea Heidelerche kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Saxicola rubetra Braunkehlchen x x x x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 200 m)<br />
x<br />
Saxicola torquata Schwarzkehlchen x x x x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 200 m)<br />
Tetrao tetrix Birkhuhn (x) keine Vorkommen in MV<br />
Lacerta vivipara Waldeidechse x x x x RL MV 3 x x x (x) x Kreuzotter<br />
Vipera berus Kreuzotter x x x x RL O 2, RL D 2, RL<br />
MV 2<br />
x x x (x) x Eutrophierung bedingt dichtere<br />
Vegetation, dadurch empfindlich<br />
gegenüber Nährstoffeintrag<br />
x<br />
x empfindlich gegenüber Nährstoffeinträgen<br />
Arcyptera fusca Große Höckerschrecke außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Chorthippus<br />
albomarginatus<br />
Weißrandiger Grashüpfer häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Chorthippus parallelus Gemeiner Grashüpfer eurytope, häufige Art des mesophilen Graslands<br />
Decticus verrucivorus Gemeiner Warzenbeißer x x RL D 3, RL MV 3 guter Indikator für Nährstoffeintrag<br />
in lückigen Magerrasen<br />
kein Nachweis in den beweideten Borstgrasrasen, aber in<br />
Graudünen <strong>und</strong> Trockenrasen des UG. Als Indikatorart für<br />
Graudünen <strong>und</strong> Trockenrasen geeignet.<br />
Metrioptera brachyptera Kurzflüglige Beißschrecke x RL MV 2 In MV vorwiegend in verheideten Moorflächen, Torfstichen<br />
<strong>und</strong> feuchten Wiesen. Nachweis im feuchtem Dünental<br />
2009.<br />
Metrioptera roeseli Roesels Beißschrecke Bevorzugt Langgrasbestände. Besiedelt breite Palette<br />
unterschiedlicher Habitate.<br />
Miramella alpina außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Myrmeleotettix maculatus Gefleckte Keulenschrecke x Art offener Sandflächen, im UG in Graudünen <strong>und</strong><br />
Trockenrasen, nicht auf Borstgrasrasen.<br />
Stauroderus scalaris Gebirgsgrashüpfer außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Andrena lapponica<br />
Lasioglossum albipes<br />
x x x x RL D V x x<br />
Arctophila bombiformis x<br />
Cheilosia derasa x montane Art<br />
Cheilosia rhynchops x montane Art<br />
Eristalis jugorum x montane Art<br />
Sericomyia lappona x<br />
Sericomyia silentis x x x<br />
Sphaerophoria infuscata x montane Art<br />
Agrotis vestigialis Kiefernsaateule x x (x) (x) x Schädling in Kiefernforsten. Nachweis 2001<br />
Apamea lateritia Ziegelrote Graseule x x (x) (x)<br />
Callophrys rubi Brombeerzipfelfalter (x) (x) (x) relativ häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen eurytop in offenem Grasland<br />
Erebia ligea an Säumen in Mittelgebirgswäldern. Entwicklung an<br />
verschiedenen Gräsern. Kein Vorkommen in MV.<br />
Erebia ligea an Säumen in Mittelgebirgswäldern. Entwicklung an<br />
verschiedenen Gräsern. Kein Vorkommen in MV.<br />
Euxoa tritici Weizeneule x x (x) (x) x häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Hesperia comma Kommafalter x konnte auf den Borstgrasrasen des UG nicht<br />
nachgewiesen werden<br />
Hipparchia semele Rostbinde<br />
Lythria purpuraria Vogelknöterich-<br />
x x (x) x RL MV V; RL D 2 (x) x<br />
Purpurbindenspanner<br />
kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT 6230*<br />
Maniola jurtina<br />
Mesoacidalia aglaja<br />
Großes Ochsenauge reagiert negativ auf intensive<br />
Düngung <strong>und</strong> Nutzung<br />
eurytop in offenem Grasland<br />
Pachygastria trifolii Kleespinner (x) x (x) x RL MV V; RL D 2 (x) x<br />
Polyommatus eros Eros-Bläuling außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Sideridis albicolon Dunkle Ruderalflureule (x) x (x) x RL MV 3; RL D 3 (x) kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 6230*<br />
Anhang 2 Seite 1 von 3
Lebensraum 6230* - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Artenreiche Borstgrasrasen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Thalophila matura Gelbflügel-Wieseneule (x) x RL MV 3 kein Vorkommensschwerpunkt im LRT 6230*<br />
Oncotylus viridiflavus Wanze (x) nur im Südwesten verbreitet<br />
Strongylocoris steganoides Wanze (x) (x) (x) (x) an Campanula-Arten<br />
Acanthodelphax spinosus Zikade x (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Arocephalus punctum Zikade x (x) (x)<br />
Delphacinus mesomelas Zikade x (x) (x)<br />
Turutus socialis Zikade x (x) (x) Trockenrasenart<br />
Dicranum scoparium Moos (x) (x) (x) Verbreitungsschwerpunkt im LRT 6230<br />
Hypnum jutlandicum Moos (x) (x) (x)<br />
Polytrichum juniperinum Moos (x) (x) (x) Verbreitungsschwerpunkt im LRT 2130<br />
Scleropodium purum Moos (x) (x) (x)<br />
Agrostis capillaris Rotes Straußgras x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 6230, empfindlich<br />
gegenüber Eutrophierung<br />
Antennaria dioica Gemeines<br />
x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
Katzenpfötchen<br />
oder 2, RL MV 1<br />
Arnica montana Arnika x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 1, RB<br />
Botrychium lunaria Mondraute x x x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 2<br />
Campanula barbata Bärtige Glockenblume x nicht in MV, empfindlich gegenüber Eutrophierung#<br />
Carex ericetorum Heide-Segge x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 2<br />
Carex pallescens Bleiche Segge x x x empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Carex panicea Hirse-Segge x x x x RL MV 3<br />
Carex pilulifera Pillen-Segge x x x<br />
Danthonia decumbens Dreizahn x x x x RL MV V Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Dianthus seguieri Busch-Nelke x nicht in MV<br />
Euphrasia stricta Steifer Augentrost x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 2<br />
Festuca ovina agg. Schafschwingel Sa. x x x Verbreitungsschwerpunkt im LRT 6230, empfindlich<br />
gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1 oder 2<br />
Galium saxatile Harzer Labkraut x empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Genista anglica Englischer Ginster x Nachweis in 50 km Entfernung<br />
Genista germanica Deutscher Ginster x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 1<br />
Gentiana pneumonanthe Lungen-Enzian x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 1<br />
Hieracium lactucella Geöhrtes Habichtskraut x x x x RL MV 1 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut x x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Hieracium umbellatum Doldiges Habichtskraut x x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Hypericum maculatum Geflecktes Johanniskraut x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Hypochaeris maculata Geflecktes Ferkelkraut x x x x RL MV 1 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Hypochaeris radicata Gemeines Ferkelkraut x x x empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Juncus squarrosus Sparrige Binse x x x x RL MV 2<br />
Lathyrus montanus Berg-Platterbse x x x<br />
Leontodon helveticus Schweizer Löwenzahn x nicht in MV<br />
Leucorchis albida Weißzüngel x nicht in MV<br />
Luzula campestris agg. Feld-Hainsimse Sa. x x x x RL MV V Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Luzula multiflora agg. Vielblütige Hainsimse x x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Meum athamanticum Bärwurz x nicht in MV<br />
Nardus stricta Borstgras x x x x RL MV 3 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Pedicularis sylvatica Wald-Läusekraut x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2, RL MV 1, RB<br />
Platanthera bifolia Weiße Waldhyazinthe x x x x RL MV 1 empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Anhang 2 Seite 2 von 3
Lebensraum 6230* - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Artenreiche Borstgrasrasen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
Polygala serpyllifolia Quendel-Kreuzblümchen x nicht in MV<br />
Polygala vulgaris agg. Gewöhnliches<br />
Kreuzblümchen<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
x x x x RL MV 1-2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Potentilla aurea Gold-Fingerkraut x nicht in MV<br />
Potentilla erecta Blutwurz x x x x RL MV V<br />
Rumex acetosella Gewöhnlicher Kleiner<br />
Sauerampfer<br />
x x x empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Veronica officinalis Wald-Ehrenpreis x x x empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Viola canina H<strong>und</strong>s-Veilchen x x x x RL MV 3 empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Anhang 2 Seite 3 von 3
Lebensraum 6410 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Pfeifengraswiesen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Anthus pratensis Wiesenpieper x x x x RL D V, RL MV V x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 200 m)<br />
Crex crex Wachtelkönig x x x x RL D 2, VS I, RL MV<br />
1<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
x x (x) hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen: kritischer Schallpegel 47<br />
dB(A) nachts in 1,5 m Höhe (KIfL<br />
2009), Fluchtdistanz 50 m<br />
Gallinago gallinago Bekassine x x x x RL MV 2, RL D 1 x (x) pot. Absterben von<br />
Kleinstlebewesen bzw. Makrophyten<br />
durch Kühlwassereinfluss in den<br />
Flachwasser- <strong>und</strong><br />
Windwattbereichen führt zur<br />
Vernichtung einer wichtigen<br />
Nahrungsgr<strong>und</strong>lage der Bekassine<br />
Miliaria calandra Grauammer x x x x RL D 3, RL MV 3 x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 300 m)<br />
(KIfL 2009)<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
LRT wird nicht durch vorhabensbedingten Lärm<br />
beeinträchtigt<br />
Leitart des binnenländischen Feuchtgrünlandes, Indikator<br />
für den Erfolg der extensiven Grünlandbewirtschaftung;<br />
Art besitzt zwar hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
akustiscche Störungen; geeignete Habitate befinden sich<br />
jedoch nicht innerhalb des kritisch verlärmten Bereichs;<br />
die Art brütet aktuell nicht im Gebiet; wegen<br />
Kleinflächigkeit der LRT-Fläche ist diese Art nicht relevant<br />
als Durchzügler pot. möglich; Kühlwasserauswirkungen<br />
treffen den LRT nur indirekt, da betroffene Lebensräume<br />
wichtige Nahungshabitate für die potenziell im LRT<br />
brütende Möwen darstellen; Beeinträchtigungen sind<br />
daher zumindest im Bezug auf diesen LRT nicht als<br />
erheblich anzusehen; wegen Kleinflächigkeit der LRT-<br />
Fläche ist diese Art nicht relevant<br />
MV liegt im Bereich der nördlichen Verbreitungsgrenze,<br />
LRT wird nicht durch vorhabensbedingten Lärm<br />
beeinträchtigt<br />
Motacilla flava Schafstelze Die Schafstelze kommt zwar potenziell im LRT vor, jedoch<br />
besiedelt diese eine Vielzahl an Lebensräumen des<br />
Offenlandes Es ist festzustellen, dass daher der LRT<br />
keine besondere Bedeutung für das Überleben dieser Art<br />
aufweist.<br />
Saxicola rubetra Braunkehlchen x x x x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 200 m)<br />
Vanellus vanellus Kiebitz x RL MV 2 <strong>und</strong> RL D 2 x x x x kritischer Schallpegel 55 dB(A) tags<br />
in 1,5 m Höhe (Garniel et al. 2007)<br />
Carychium minimum Bauchige<br />
Zwerghornschnecke<br />
LRT wird nicht durch vorhabensbedingten Lärm<br />
beeinträchtigt<br />
wegen Kleinflächigkeit der LRT-Fläche ist diese Art nicht<br />
relevant<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Columella edentula Zahnlose<br />
Windelschnecke<br />
(x) (x)<br />
Deroceras laeve Wasserschnegel x (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Deroceras reticulatum Genetzte Ackerschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Deroceras sturanyi Hammerschnegel (x) in Ausbreitung begriffen, nicht im Landschaftsraum<br />
nachgewiesen<br />
Euconulus alderi Dunkles Kegelchen x (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Perforatella bidentata Zweizahnige<br />
Laubschnecke<br />
Indikator für relativ intakte Feuchthabitate; außerhalb des<br />
Verbreitungsgebietes<br />
Perpolita petronella außerhalb des Verbreitungsgebietes<br />
Vallonia pulchella Glatte Grasschnecke (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Vertigo angustior Schmale<br />
Windelschnecke<br />
wird bereits als Anhang II Art behandelt<br />
Vertigo antivertigo Sumpfwindelschnecke (x) (x) x x RL D 3 x (x) (x) x Art feuchter Lebensräume <strong>und</strong> relativ selten<br />
Vitrea crystallina Gemeine<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Kristallschnecke<br />
Lebensraumansprüche, kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen der relevanten Wirkfaktoren<br />
Zonitoides nitidus Glänzende<br />
(x) (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Dolchschnecke<br />
Lebensraumansprüche, kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen der relevanten Wirkfaktoren<br />
Anhang 2 Seite 1 von 3
Lebensraum 6410 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Pfeifengraswiesen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
Acupalpus exiguus x x x x x kein geeigneter Indikator für<br />
Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
Art des Feuchtgrünlands<br />
13: Bemerkungen<br />
Pterostichus nigrita sehr häufige hygrophile Art, Maximum in Feucht- <strong>und</strong><br />
Nasswäldern<br />
Pterostichus rhaeticus häufige hygrophile Art, Maximum in Mooren <strong>und</strong><br />
Morrwäldern<br />
Chorthippus<br />
albomarginatus<br />
Weißrandiger Grashüpfer häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Chorthippus dorsatus Wiesengrashüpfer x x x x RL MV 3 x x x x Reagiert auf starken<br />
Nährstoffeintrag <strong>und</strong> intensive<br />
Nutzung<br />
Im Gebiet nicht in Pfeifengraswiese festgestellt.<br />
Chorthippus montanus Sumpfgrashüpfer Ausgeprägt hygrophil, wechselfeuchte Pfeifengraswiesen<br />
anscheinend nicht feucht genug (s. Fartmann et al. 2001).<br />
Zielart der landesweiten naturschutzfachlichen Planung.<br />
Euthystira brachyptera Kleine Goldschrecke x keine aktuellen Nachweise aus MV<br />
Chrysochraon dispar Große Goldschrecke x x x häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Art des feuchteren Graslandes<br />
Stethophyma grossum Sumpfschrecke Ausgeprägt hygrophil, wechselfeuchte Pfeifengraswiesen<br />
anscheinend nicht feucht genug (s. Fartmann et al. 2001).<br />
Zielart der landesweiten naturschutzfachlichen Planung.<br />
Metrioptera brachyptera Kurzflüglige<br />
Beißschrecke<br />
In MV vorwiegend in verheideten Moorflächen, Torfstichen<br />
<strong>und</strong> feuchten Wiesen. Nachweis in feuchtem Dünental<br />
2009.<br />
Andrena marginata x<br />
Melanostoma scalare x x x<br />
Platycheirus spp. x x x x teils RL D<br />
Pyrophaena rosarum x x x<br />
Sericomyia silentis x x x<br />
Adscita statices Gemeines<br />
Zwei Formen in unterschiedlichen Lebensräumen<br />
Grünwidderchen<br />
(Feuchtwiesen <strong>und</strong> magere Brachen, Ruderalfluren etc.)<br />
mit Vorkommen der Entwicklungspflanze.<br />
Amphipoea lucens Pfeifengras-Stengeleule Leitart der mit Molinia bestandenen Heidemoore<br />
Coenonympha glycerion Rostbraunes<br />
Wiesenvögelchen<br />
In NO-Deutschland auf Trockenrasen, Heiden <strong>und</strong> an<br />
Waldsäumen<br />
Erebia aethiops an Waldrändern <strong>und</strong> auf angrenzenden Wiesen; nicht in<br />
MV<br />
Euphydryas aurinia Goldener Scheckenfalter x In MV nur wenige Vorkommen, v.a. in Flusstalmooren.<br />
Vorkommen im UG sehr unwahrscheinlich.<br />
Hypenodes humidalis Moor-Motteneule (x) (x) x x RL MV 2, RL D 3 (x)<br />
Lycaena dispar Großer Feuerfalter x x x x FFH II/ IV, RL MV 2,<br />
RL D 2, §§<br />
Lycaena helle Blauschillernder<br />
Feuerfalter<br />
x x Primär in Seggenwiesen, sek<strong>und</strong>är in Feuchtwiesen mit<br />
Gräben sowie Meliorationsgräben, sowie an verlandenden<br />
Gewässern jeweils mit Vorkommen von Rumex<br />
hydrolapathum.<br />
x sehr seltene Art vonnährstoffreichen Feuchtwiesen <strong>und</strong> -<br />
brachen; in MV nur noch im Ueckertal<br />
Lycaena hippothoe Rotlila-Feuerfalter x x x x RL MV 2 RL D 2 x x seltene Art von Feuchtwiesen, in feuchtem bis mäßig<br />
feuchtem Grünland, Feuchtwiesen etc., feuchte<br />
Waldränder jeweils mit Vorkommen von Rumex acetosa<br />
Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-<br />
Ameisenbläuling<br />
x Keine Vorkommen im UG<br />
Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-<br />
Ameisenbläuling<br />
x Keine Vorkommen im UG<br />
Melitaea diamina Baldrian-Scheckenfalter x x x x RL MV 2 RL D 3 x x x gegenüber starker Nährstoffzufuhr<br />
in extensiv genutzten Feuchtwiesen. Gefährdung vor<br />
empfindlich<br />
allem durch Trockenlegung <strong>und</strong> Intensivnutzung.<br />
Minois dryas Blauäugiger Waldportier x x x x RL MV 1 RL D 2 x x Verschieden Biotope, Waldlichtungen, verbuschtes<br />
Grasland, Feuchtgebiete wie Pfeifengraswiesen<br />
Mythimna pudorina Moorwiesen-<br />
Weißadereule<br />
x (x) Nachweis 2001, keine besondere Empfindlichkeit ggüber<br />
Wirkprozessen<br />
Orthonama vittata Bitterklee-Blattspanner x x x x<br />
Capsus pilifer Wanze x x (x) (x) an Pfeifengras; Verbreitung nur ungenügend erfasst<br />
Eurygaster testudinaria Wanze x (x)<br />
Monosynamma nigritula Wanze (x) (x) (x) (x) verbreitet<br />
Polymerus carpathicus Wanze x nur südlich der Mainlinie verbreitet<br />
Anhang 2 Seite 2 von 3
Lebensraum 6410 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Pfeifengraswiesen 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
Stenodema calcaratum Wanze x (x) verbreitet<br />
Stenodema laevigatum Wanze x (x) verbreitet<br />
Stenotus binotatus Wanze x (x) verbreitet<br />
Muellerinanella extrusa Zikade x (x)<br />
Hygrolycosa rubrofasciata x x x x RL MV 4 RL D 3 x x die Art ist gegenüber Eutrophierung<br />
empfindlich, das Ausmaß ist aber<br />
unklar<br />
Allium suaveolens Wohlriechender Lauch x nicht in MV<br />
Betonica officinalis Heil-Ziest x<br />
Betula humilis Strauch-Birke x nicht in D<br />
Carex pallescens Bleiche Segge x x x<br />
Cirsium dissectum Englische Kratzdistel x nicht in MV<br />
Cirsium tuberosum Knollen-Kratzdistel x nicht in MV<br />
Colchicum autumnale Herbstzeitlose x<br />
Crepis paludosa Sumpf-Pippau x x x<br />
Dianthus deltoides Heide-Nelke x x x x RL MV 3 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Dianthus superbus Pracht-Nelke x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Galium boreale Nordisches Labkraut x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Galium uliginosum Moor-Labkraut x x x x RL MV V Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Gentiana asclepiadea Schwalbwurz-Enzian x nicht in MV<br />
Gentiana pneumonanthe Lungen-Enzian x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Gladiolus palustris Sumpf-Siegwurz x nicht in MV<br />
Inula britannica Wiesen-Alant x x x x RL MV 3<br />
Inula salicina Weiden-Alant x<br />
Iris sibirica Siberische Schwertlilie x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Juncus conglomeratus Knäuel-Binse x x x x RL MV V<br />
Laserpitium prutenicum Preußisches Laserkraut x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Lotus uliginosus Sumpf-Hornklee x x x<br />
Luzula multiflora agg. Vielblütige Hainsimse x x x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Molinia ar<strong>und</strong>inacea Rohr-Pfeifengras x<br />
Molinia caerulea Pfeifengras x x x<br />
Ophioglossum vulgatum Gemeine Natternzunge x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt x x x x RL MV 2 Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Pedicularis sylvatica Wald-Läusekraut x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Polygala amarella Sumpf-Kreuzblümchen x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Salix repens ssp.<br />
rosmarinifolia<br />
Kriech-Weide x x x<br />
Potentilla anglica Niederliegendes<br />
Fingerkraut<br />
x x x<br />
Potentilla erecta Blutwurz x x x x RL MV V<br />
Sanguisorba officinalis Großer Wiesenknopf x<br />
Scorzonera humilis Niedrige Schwarzwurzel x kommt im UG im LRT 6230 vor, empfindlich gegenüber<br />
Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1 oder 2<br />
Selinum carvifolia Kümmel-Silge x x x x RL MV 3<br />
Serratula tinctoria Gewöhnliche Färber-<br />
Scharte<br />
x x x x RL MV 2<br />
Silaum silaus Wiesen-Silau x<br />
Succisa pratensis Teufelsabbiss x x x x RL MV 2<br />
Tephroseris helenitis Spatelblättriges<br />
Greiskraut<br />
x Nachweis in 90 km Entfernung<br />
Tetragonolobus maritimus Gelbe Spargelerbse x Empfindlich gegenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Veratrum album Weißer Germer x nicht in MV<br />
Viola palustris Sumpf-Veilchen x x x<br />
Viola persicifolia Graben-Veilchen x<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Anhang 2 Seite 3 von 3
Lebensraum 9190 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Bodensaure Stieleichenwälder 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
auf Sand<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer x kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT<br />
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger x x x x x x hohe Empfindlichkeit gegenüber<br />
Lärmwirkungen <strong>und</strong> optische<br />
Störungen (Effektdistanz 300 m)<br />
Picoides medius Mittelspecht x x x x VS I, RL MV 3 x x kritischer Schallpegel gegenüber<br />
Verkehrslärm 58 dB(A) tags; 400 m<br />
Effektdistanz<br />
Große Distanz zw. LRT <strong>und</strong> Vorhaben, so dass keine<br />
akustischen <strong>und</strong> optischen Beeinträchtigungen erwartet<br />
werden<br />
Es exitieren keine Brutnachweise aus dem UG, bei der<br />
Größe der LRT-Flächen ist ein Vorkommen<br />
unwahrscheinlcih<br />
Turdus viscivorus Misteldrossel Die Misteldrossel kommt zwar potenziell im LRT vor,<br />
jedoch besiedelt dieser eine Vielzahl an Lebensräumen.<br />
Es ist festzustellen, dass daher der LRT keine besondere<br />
Bedeutung für das Überleben dieser Art aufweist.<br />
Acanthinula aculeata Stachelschnecke (x) (x)<br />
Columella aspera Rauhe Windelschnecke<br />
Perpolita hammonis<br />
Punctum pygmaeum Punktschnecke häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
Zonitoides excavatus Britische Dolchschnecke (x) selten in nassen Lebensräumen, keine besondere<br />
Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren<br />
Cerambyx cerdo Großer Eichenbock (x) (x) x x FFH II/ IV, ZA, RL<br />
MV 1<br />
x x sehr selten, keine besondere Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
Dorcus parallelipipedus Balkenschröter häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Waldart, Anzeiger von Totholz,<br />
kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch die<br />
relevanten Wirkfaktoren<br />
Lucanus cervus Hirschkäfer x x x x FFH II, ZA, RL MV 2 x x keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den<br />
Wirkfaktoren<br />
Plagionotus arcuatus Eichenwidderbock x x x x x totholzbewohnender Bockkäfer, kein geeigneter Indikator<br />
Plagionotus detritus Hornissenbock x x x x x totholzbewohnender Bockkäfer, kein geeigneter Indikator<br />
für Beeinträchtigungen durch die relevanten Wirkfaktoren<br />
Meconema thalassinum Gemeine Eichenschrecke (x) (x) (x) (x) (x) wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen<br />
durch Nähr- oder Schadstoffe<br />
Drymonia ruficornis Dunkelgrauer<br />
Zahnspinner<br />
häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche<br />
In Laubmischwäldern mit Eichen<br />
Dryobotodes eremita Braungraue Eicheneule x x x x RL MV 3 (x)<br />
Hyppa rectilinea Heidelbeer-Stricheule kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT 9190<br />
Pararge aegeria Waldbrettspiel (x) (x) (x) (x) (x) häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, Nachweis 2001, wahrscheinlich<br />
kein geeigneter Indikator für Beeinträchtigungen durch<br />
Nähr- oder Schadstoffe<br />
Polyploca ridens Moosgrüner Eulenspinner x x x x RL MV 3 (x)<br />
Rhinoprora debilitata Heidelberr-Grünspanner<br />
Scopula ternata Heidelbeer-Kleinspanner<br />
Spudaea ruticilla Graubraune<br />
Eichenbuscheule<br />
Thaumetopoea<br />
processionea<br />
Thecla quercus<br />
(Neozephyrus q.)<br />
Eichen-<br />
Prozessionsspinner<br />
siehe oben Synonym<br />
kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
x x x x RL MV 1, §§ (x)<br />
kein Vorkommensschwerpunkt im LRT<br />
kein Verbreitungsschwerpunkt im LRT, benötigt warme<br />
Eichenwälder<br />
x x<br />
Tortrix viridana Eichenwickler x x gefürchteter Schädling an Eiche, möglicherweise haben<br />
Massenvorkommen auswirkungen auf Population von<br />
Predatoren<br />
Acanthosoma<br />
haemorrhoidale<br />
Wanze verbreitet<br />
Calocoris quadripunctatus Wanze x x verbreitet<br />
Cyllecoris histrionicus Wanze x x verbreitet<br />
Drymus sylvaticus Wanze x x verbreitet<br />
Dryophilocoris<br />
flavoquadrimaculatus<br />
Wanze x x verbreitet<br />
Elasmucha grisea Wanze verbreitet<br />
Harpocera thoracica Wanze x x verbreitet<br />
Kleidocerys resedae Wanze verbreitet<br />
Phylus melanocephalus Wanze x x verbreitet<br />
Anhang 2 Seite 1 von 2
Lebensraum 9190 - 1. Schritt 2. Schritt<br />
Bodensaure Stieleichenwälder 8: Besondere Empfindlichkeit gegenüber folgenden<br />
auf Sand<br />
vorhabensbedingten Wirkprozessen im Untersuchungsgebiet<br />
Wissenschaftlicher<br />
Artname<br />
Deutscher<br />
Artname<br />
1: gewisser<br />
Verbreitungsschwerpunkt des<br />
Vorkommens im LRT (Bezug:<br />
kontinentale Region)<br />
2: naturräumlich typische<br />
Ausprägung (regionaler<br />
Bezug)<br />
3: günstiger EHZ der<br />
konkreten Bestände (Bezug:<br />
Schutzgebiet)<br />
4: Art mit besonderer<br />
Wertigkeit<br />
5: Gr<strong>und</strong> für besondere<br />
Wertigkeit der Art<br />
6: Art liefert Infos, die über die<br />
vegetationsk<strong>und</strong>lichen Strukturen<br />
<strong>und</strong> standörtlichen<br />
Parameter hinausgehen<br />
7: ökologische Ansprüche <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen sind<br />
ausreichend bekannt<br />
8a: Lärm/ Störung<br />
8c: Eutrophierung<br />
8d: Versauerung<br />
8e: Veränderungen durch<br />
Kühlwassereinleitung<br />
8f: Veränderungen durch<br />
Kühlwasserentnahme<br />
8g: Barriere- <strong>und</strong><br />
Trennwirkungen<br />
8h: Kollisionsrisiko<br />
9: Art besitzt eine<br />
aussagekräftige<br />
Empfindlichkeit für die<br />
vorhabensbedingten<br />
Wirkprozesse<br />
10: Genaue Angaben zur<br />
Empfindlichkeit gegenüber<br />
den Wirkfaktoren<br />
11: Empfindlichkeit gegenüber<br />
Wirkprozessen entspricht der<br />
bereits betrachteten Art …<br />
12: Art eignet sich als<br />
charakteristische Art für den<br />
LRT <strong>und</strong> besitzt eine Relevanz<br />
für die FFH-VP<br />
13: Bemerkungen<br />
Eurhadina pulchella Zikade x x häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Idiocerus populi Zikade häufig, kein Indikator für besondere<br />
Lebensraumansprüche, wahrscheinlich kein geeigneter<br />
Indikator für Beeinträchtigungen durch Nähr- oder<br />
Schadstoffe<br />
Idiocerus tremulae Zikade<br />
Agrostis capillaris Rotes Straußgras x x x Empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Betula pendula Sand-Birke x x x<br />
Betula pubescens Moor-Birke x x x keine bes. Empfindlichkeit gegenüber Wirkfaktoren<br />
Calluna vulgaris Besenheide x x x Empfindlich genenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Carex pilulifera Pillen-Segge x x x<br />
Deschampsia flexuosa Draht-Schmiele x x x<br />
Festuca filiformis Haar-Schafschwingel x<br />
Frangula alnus Faulbaum x x x<br />
Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut x x x<br />
Hieracium murorum Wald-Habichtskraut x x x<br />
Hieracium umbellatum Doldiges Habichtskraut x x x Empfindlich genenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Holcus mollis Weiches Honiggras x x x<br />
Ilex aquifolium Stechpalme x x x<br />
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt x x x<br />
Melampyrum pratense Wiesen-Wachtelweizen x x x Empfindlich genenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Molinia caerulea Pfeifengras x x x<br />
Polypodium vulgare Gemeiner Tüpfelfarn x x x Empfindlich genenüber Stickstoffeinträgen, N-Zeigerwert 1<br />
oder 2<br />
Populus tremula Zitter-Pappel x x x<br />
Pteridium aquilinum Adlerfarn x x<br />
Quercus robur Stiel-Eiche x x x<br />
Sorbus aucuparia Eberesche x x x<br />
Teucrium scorodonia Salbei-Gamander x Empfindlich gegenüber Eutrophierung<br />
Trientalis europaea Siebenstern x x x<br />
Vaccinium myrtillus Heidelbeere x x x<br />
Anhang 2 Seite 2 von 2
FROELICH & SPORBECK Anhang<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3: Tabellen zur Ableitung der graduellen Funktionsverluste<br />
für charakteristische Arten der marinen Lebensraumtypen
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 1/6<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3.1: Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden der lebensraumtypischen Arten für<br />
den LRT 1110 (Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser)<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
0 – 1K -0,5 – -1 PSU<br />
0 – 1 K -1 – -2PSU<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) +<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 6<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) +<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 10<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 22<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) +<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 6<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) X<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Bd = 12<br />
Gradueller Funktionsverlust<br />
35%<br />
40 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 2/6<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
1-2 K 0 – -0,5PSU<br />
1-2 K -0,5 – -1PSU<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 26<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) -<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) - Be = 4<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) +<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) -<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) - Bd = 2<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 10<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) +<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 10<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Gradueller Funktionsverlust<br />
15 %<br />
40 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 3/6<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
1-2 K -1 – -2 PSU<br />
2-3 K -0,5 – -1PSU<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 26<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) X<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 28<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) +<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 10<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 26<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Gradueller Funktionsverlust<br />
45 %<br />
40 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 4/6<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
2-3 K -1 – -2 PSU<br />
3-4 K -0,5 – -1PSU<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) x<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 28<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) x<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Bd = 14<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 30<br />
3-4 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit Be = 8 45 %<br />
Gradueller Funktionsverlust<br />
45 %<br />
45 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 5/6<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
4-5 K -1 – -2 PSU<br />
5-6 K -1 – -2 PSU<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) x<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 14<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 30<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) + Be = 8<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) x<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 14<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 30<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platychthys flesus) +<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Gradueller Funktionsverlust<br />
45 %<br />
Be = 8 50 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.1 - Seite 6/6<br />
Wirkklasse<br />
∆ T ∆ S<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Sandbänke mit nur schwacher ständiger Überspülung durch Meerwasser“ (EU-Code 1110) IBmin = 0 IBmax = 52<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung<br />
Sandgr<strong>und</strong>el (Pomatuschistus minutus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) x<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) x<br />
Kleiner Sandaal (Ammodytes tobianus) x<br />
Sandflohkrebs (Bathyporeia pilosa) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 18<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 34<br />
Betroffenheitsgrad/<br />
Betroffenheitsindex<br />
Legende:<br />
Wirkklasse ∆ T = Änderung der Wassertemperatur durch Kühlwassereinleitung in °C, ∆ S Änderung der Salinität durch Kühlwassereinleitung in psu<br />
Beeinträchtigung - keine Beeinträchtigung (innerhalb des Toleranzbereiches) durch ∆T / S:<br />
+ geringe Beeinträchtigungen (an den Rand des Toleranzbereiches, +/- 1) durch ∆T / S<br />
x signifikante Beeinträchtigung (außerhalb des Toleranzbereiches) ∆ T / S<br />
Index Be = Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Bd =Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer dominanter Arten<br />
IB = Betroffenheitsindex des Lebenraumtyps<br />
Gradueller Funktionsverlust
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.2 - Seite 1/2<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3.2: Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden der lebensraumtypischen<br />
Arten für den LRT 1130 (Ästuarien)<br />
Lebensraumtyp „Ästuarien“ (EU-Code 1130) IBmin = 0 IBmax = 36<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
0 – 1K -0,5 – 1 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus) +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) x<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 6<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 4<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 16<br />
0 – 1 K -1 – -2PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus) +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) x<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 6<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 20<br />
1-2 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus) +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be =4<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 4<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 18<br />
1-2 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Fl<strong>und</strong>er (Platichthys flesus) +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) x<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 6<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
35 %<br />
45 %<br />
40 %<br />
45 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.2 - Seite 2/2<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Ästuarien“ (EU-Code 1130) IBmin = 0 IBmax = 36<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 20<br />
Legende:<br />
Wirkklasse ∆ T = Änderung der Wassertemperatur durch Kühlwassereinleitung in °C, ∆ S Änderung der Salinität durch Kühlwassereinleitung in psu<br />
Beeinträchtigung - keine Beeinträchtigung (innerhalb des Toleranzbereiches) durch ∆T / S:<br />
+ geringe Beeinträchtigungen (an den Rand des Toleranzbereiches, +/- 1) durch ∆T / S<br />
x signifikante Beeinträchtigung (außerhalb des Toleranzbereiches) ∆ T / S<br />
Index Be = Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Bd =Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer dominanter Arten<br />
IB = Betroffenheitsindex des Lebenraumtyps<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.3 - Seite 1/3<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3.3: Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden der lebensraumtypischen<br />
Arten für den LRT 1140 (Vegetationsfreies Sand- <strong>und</strong> Schlickwatt)<br />
Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Sand- <strong>und</strong> Schlickwatt“ (EU-Code 1140) IBmin = 0 IBmax = 28<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
0 – 1K -0,5 – -1 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) +<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 6<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 10<br />
0 – 1 K -1 – -2PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 16<br />
1-2 K 0 – -0,5PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) -<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) - Bd =2<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 6<br />
1-2 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) + Be = 2<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Bd =6<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) +<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
30 %<br />
45 %<br />
15 %<br />
30 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.3 - Seite 2/3<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Sand- <strong>und</strong> Schlickwatt“ (EU-Code 1140) IBmin = 0 IBmax = 28<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 10<br />
1-2 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 16<br />
2-3 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be =2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) +<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 6<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 10<br />
2-3 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 16<br />
3-4 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 2<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) +<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Bd = 8<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 12<br />
3-4 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) + Be = 2<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
45 %<br />
30 %<br />
45 %<br />
35 %<br />
45 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.3 - Seite 3/3<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Vegetationsfreies Sand- <strong>und</strong> Schlickwatt“ (EU-Code 1140) IBmin = 0 IBmax = 28<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 16<br />
4-5 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
x Be = 4<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 18<br />
5-6 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
x Be = 4<br />
Wenigborstiger Wurm (Tubifex costatus) x<br />
Meer-Salde (Ruppia maritima) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
Blasentang (Fucus vesiculosus) x<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) + Bd = 14<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 22<br />
Legende:<br />
Wirkklasse ∆ T = Änderung der Wassertemperatur durch Kühlwassereinleitung in °C, ∆ S Änderung der Salinität durch Kühlwassereinleitung inpsu<br />
Beeinträchtigung - keine Beeinträchtigung (innerhalb des Toleranzbereiches) durch ∆T / S:<br />
+ geringe Beeinträchtigungen (an den Rand des Toleranzbereiches, +/- 1) durch ∆T / S<br />
x signifikante Beeinträchtigung (außerhalb des Toleranzbereiches) ∆ T / S<br />
Index Be = Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Bd =Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer dominanter Arten<br />
IB = Betroffenheitsindex des Lebenraumtyps<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
50 %<br />
65%
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.4 - Seite 1/2<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3.4: Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden der lebensraumtypischen<br />
Arten für den LRT 1150 (Lagune)<br />
Lebensraumtyp „Lagune“ (EU-Code 1150) IBmin = 0 IBmax = 60<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
0,2 – 1K -0,5 – -1 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens) +<br />
Hering (Clupea herengus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 10<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) -<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) x<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 28<br />
0,2 – 1K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens) x<br />
Hering (Clupea herengus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) x<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
x Be = 16<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) -<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) x<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 40<br />
1 – 2 K -0,5 – 1 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens) +<br />
Hering (Clupea herengus) X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) + Be = 10<br />
Lebensraumtypische dominante Arten -<br />
Bd = 8<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) -<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
35 %<br />
55 %<br />
35 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.4 - Seite 2/2<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Lagune“ (EU-Code 1150) IBmin = 0 IBmax = 60<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) x<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) -<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 28<br />
1 – 2 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canescens) x<br />
Hering (Clupea herengus) x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) x<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
x Be = 16<br />
Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) -<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) x<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) x<br />
Zuckmückenlarven (Chironomidae) - Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 40<br />
Legende:<br />
Wirkklasse ∆ T = Änderung der Wassertemperatur durch Kühlwassereinleitung in °C, ∆ S Änderung der Salinität durch Kühlwassereinleitung in psu<br />
Beeinträchtigung - keine Beeinträchtigung (innerhalb des Toleranzbereiches) durch ∆T / S:<br />
+ geringe Beeinträchtigungen (an den Rand des Toleranzbereiches, +/- 1) durch ∆T / S<br />
x signifikante Beeinträchtigung (außerhalb des Toleranzbereiches) ∆ T / S<br />
Index Be = Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Bd =Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer dominanter Arten<br />
IB = Betroffenheitsindex des Lebenraumtyps<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
55 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 1/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Anhang 3.5: Ableitung der graduellen Funktionsverluste aus den Betroffenheitsgraden der lebensraumtypischen Arten für den LRT<br />
1160 (Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten)<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
0 – 1K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) +<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) +<br />
Tolypella nidifica +<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus +<br />
Heterotanais oersti -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) +<br />
Lebensraumtypische dominante Arten Be = 18<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) - Bd = 4<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 40<br />
0 – 1 K 1 – 2PSU<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) x<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) x<br />
Tolypella nidifica x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus x<br />
Heterotanais oersti +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) + Be = 28<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
25 %<br />
40 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 2/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/ Gradueller<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex Funktionsverlust<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) + Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 64<br />
1-2 K 0 – -0,5PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) -<br />
Hering (Clupea harengus) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) -<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) -<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) +<br />
Tolypella nidifica -<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) -<br />
Calliopius laeviusculus<br />
Heterotanais oersti<br />
x<br />
-<br />
15 %<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 10<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) -<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) -<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) - Bd = 0<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 20<br />
1-2 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Be = 20 30 %<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) +<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) +<br />
Tolypella nidifica +
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 3/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/ Gradueller<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex Funktionsverlust<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus X<br />
Heterotanais oersti -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) - Bd = 4<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 48<br />
1-2 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) +<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) X<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) X<br />
Tolypella nidifica X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus<br />
Heterotanais oersti<br />
X<br />
+<br />
40 %<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 28<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) + Bd = 8<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 64<br />
2-3 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Be = 22 30 %<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) x<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) +
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 4/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) +<br />
Tolypella nidifica +<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus X<br />
Heterotanais oersti -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) - Bd = 4<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 48<br />
2-3 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) x<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) -<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) x<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) -<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) x<br />
Tolypella nidifica x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus x<br />
Heterotanais oersti +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 30<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) -<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) -<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) + Bd = 8<br />
Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 68<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
45 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 5/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
3-4 K -0,5 – -1PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) X<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) +<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) +<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) +<br />
Tolypella nidifica +<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus X<br />
Heterotanais oersti -<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
+ Be = 26<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) -<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) +<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Bd = 8<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) -<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 60<br />
3-4 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) X<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) +<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) x<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) x<br />
Tolypella nidifica x<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus x<br />
Heterotanais oersti +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) + Be = 34<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Bd = 12<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) +<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
40 %<br />
50 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 6/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) +<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 80<br />
4-5 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) X<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) +<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) X<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) +<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) +<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) X<br />
Tolypella nidifica X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus X<br />
Heterotanais oersti +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator)<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
X Be = 36<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) +<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) +<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) + Bd = 12<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 84<br />
5-6 K -1 – -2 PSU Lebensraumtypische Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Hornhecht (Belone belone) +<br />
Hering (Clupea harengus) X<br />
Rauhe Armleuchteralge (Chara aspera) X<br />
Baltische Armleuchteralge (Chara baltica) X<br />
Graue Armleuchteralge (Chara canascens) X<br />
Baltische Plattmuschel (Macoma baltica) X<br />
Gewöhnliches Seegras (Zostera marina) X<br />
Tolypella nidifica X<br />
Lagunen-Herzmuschel (Cerastoderma glaucum) +<br />
Calliopius laeviusculus X<br />
Heterotanais oersti +<br />
Schlickkrebs (Corophium volutator) X Be = 42<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust<br />
55 %<br />
65 %
FROELICH & SPORBECK Anhang 3.5 - Seite 7/7<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom“<br />
Lebensraumtyp „Flache Meeresarme <strong>und</strong> Buchten“ (EU-Code 1160) IBmin = 0 IBmax = 124<br />
Wirkklasse<br />
Lebensraumtypische Arten im Wirkbereich der KWF Beeinträchtigung Betroffenheitsgrad/<br />
∆ T ∆ S<br />
Betroffenheitsindex<br />
Lebensraumtypische dominante Arten<br />
Kamm-Laichkraut (Potamogeton pectinatus) -<br />
Meeres-Salde (Ruppia maritima/cirrhosa) +<br />
Teichfaden (Zannichellia palustris) x<br />
Darmalge (Enteromorpha intestinalis) x<br />
Sandklaffmuschel (Mya arenaria) +<br />
Gemeine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) +<br />
Schillernder Meeresborstenwurm (Hediste diversicolor) + Bd = 16<br />
GESAMTWERT Wirkklasse IB = 100<br />
Legende:<br />
Wirkklasse ∆ T = Änderung der Wassertemperatur durch Kühlwassereinleitung in °C, ∆ S Änderung der Salinität durch Kühlwassereinleitung in psu<br />
Beeinträchtigung - keine Beeinträchtigung (innerhalb des Toleranzbereiches) durch ∆T / S:<br />
+ geringe Beeinträchtigungen (an den Rand des Toleranzbereiches, +/- 1) durch ∆T / S<br />
x signifikante Beeinträchtigung (außerhalb des Toleranzbereiches) ∆ T / S<br />
Index Be = Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer Arten mit hoher Empfindlichkeit<br />
Bd =Index der Beeinträchtigung lebensraumtypischer dominanter Arten<br />
IB = Betroffenheitsindex des Lebenraumtyps<br />
Gradueller<br />
Funktionsverlust
FROELICH & SPORBECK Anhang<br />
FFH-VU „Greifswalder Bodden, Teile des Strelas<strong>und</strong>es <strong>und</strong> Nordspitze Usedom (DE 1747-301)“<br />
Zugehörige Planunterlagen<br />
Karte 1: Übersichtskarte M: 1:65:000<br />
Karte 2: Lebensraumtypen <strong>und</strong> Arten / Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele M: 1:20.000<br />
(Detailkarten: 1:10.000/1:150.000)