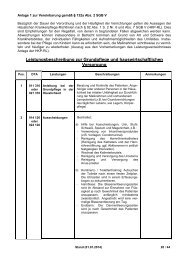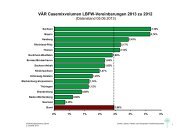Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner
Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner
Mehr Lebensqualität für chronisch Kranke - AOK-Gesundheitspartner
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
SPEZIAL<br />
Das <strong>AOK</strong>-Forum <strong>für</strong> Politik, Praxis und Wissenschaft<br />
Spezial 7 - 8/2002<br />
Disease-Management der <strong>AOK</strong><br />
<strong>Mehr</strong> <strong>Lebensqualität</strong><br />
<strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />
+++ Ziele, Methoden, Erfahrungen
Inhalt<br />
Vorwort<br />
Ein Plus <strong>für</strong> die Patienten<br />
von Rolf Hoberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />
Disease-Management im Überblick<br />
Auf dem Weg zu mehr Gesundheit<br />
von Gabriele Müller de Cornejo und Jens-Martin Hoyer . . . . . . . . . 4<br />
Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />
Informieren statt bevormunden<br />
von Peter Thaddäus Sawicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />
Hausarzt-Praxis<br />
Die stillen Reserven mobilisieren<br />
von der G+G-Redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />
Lese- und Webtipps<br />
■ <strong>AOK</strong> Bundesverband<br />
Disease-Management-Programme im<br />
Rahmen der Reform des Risikostrukturausgleichs,<br />
Beilage zum Deutschen<br />
Ärzteblatt vom 8. März 2002,<br />
Bestelladresse: DMP@bv.aok.de<br />
■ Berger/Sawicki/Schmacke (Hrsg.)<br />
Stichwort: Diabetes. Dokumentation<br />
eines internationalen Symposiums.<br />
G+G Kleine Reihe, Bonn 2002,<br />
Bestell-Fax KomPart: (0228) 84900246<br />
■ Bundesgesundheitsministerium<br />
<strong>Mehr</strong> Gesundheit ist möglich. Disease-<br />
Management-Programme verbessern<br />
die Behandlungsqualität,<br />
Pressemitteilung Nr. 37 vom 27.3.2002<br />
www.bmgesundheit.de<br />
■ Forum <strong>für</strong> Gesundheitspolitik<br />
Disease-Management-Programme<br />
konkret, Berlin 2001<br />
■ Jacobs/Häussler<br />
Disease-Management im künftigen<br />
Kassenwettbewerb; in: G+G-Wissenschaft,<br />
1/2002, S. 24-31<br />
■ Lauterbach, Karl W.<br />
Disease Management in Deutschland –<br />
Voraussetzungen, Rahmenbedingungen,<br />
Faktoren zur Entwicklung, Implementierung<br />
und Evaluation, Köln 2001<br />
■ Müller de Cornejo, G./Linnenbürger, J.<br />
Disease-Management-Programme: Der<br />
erste Schritt ist getan; in: G+G,<br />
6/2002, S. 20-21<br />
■ Nadolski, H.<br />
Disease Management in den USA; in: G+G<br />
Wissenschaft, 1/2002, S. 16-23<br />
■ Sachverständigenrat<br />
<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion<br />
im Gesundheitswesen<br />
Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit.<br />
Band III: Über-, Unter- und<br />
Fehlversorgung, Bonn 2001,<br />
PDF-Datei unter www.svr-gesundheit.de<br />
■ G+G-Spezial zum Risikostrukturausgleich<br />
<strong>Mehr</strong> Gleichgewicht im Wettbewerb.<br />
Der neue Risikostrukturausgleich.<br />
G+G-Spezial 2/2002;<br />
Bestell-Fax: (0228) 84900246<br />
Pilotprojekt in Baden-Württemberg<br />
„DMP“ lernt laufen<br />
von Jürgen Graf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />
DMP-Entstehungsgeschichte<br />
Kritik wider besseren Wissens<br />
von Norbert Schmacke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />
Diabetiker-Versorgung<br />
Zur Debatte um die beste Therapie<br />
von Michael Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />
Fünf Fragen, fünf Antworten<br />
Disease-Management auf einen Blick<br />
von der G+G-Redaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />
■ www.aok.de<br />
<strong>AOK</strong>-Die Gesundheitskasse:<br />
Programme <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />
■ www.aok-presse.de<br />
Hintergrundinformationen zu<br />
Disease-Management und zum RSA<br />
■ www.bmgesundheit.de<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit<br />
■ www.svr-gesundheit.de<br />
Sachverständigenrat <strong>für</strong><br />
die Konzertierte Aktion<br />
im Gesundheitswesen<br />
■ www.leitlinien.de<br />
Leitlinien-Information<br />
der Ärztlichen Zentralstelle<br />
Qualitätssicherung
Vorwort<br />
Ein Plus <strong>für</strong><br />
die Patienten<br />
In anderen Ländern bereits bewährt,<br />
in der Bundesrepublik noch Neuland:<br />
Disease-Management. Warum die<br />
„gemanagte“ Versorgung nicht nur <strong>für</strong><br />
<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong> eine große Chance ist,<br />
erläutert Rolf Hoberg.<br />
Disease-Management in Deutschland – das ist<br />
ein Plus <strong>für</strong> viele! An erster Stelle sind dabei die<br />
Patientinnen und Patienten zu nennen. Nicht<br />
erst seit dem Gutachten des Sachverständigenrates<br />
<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen zur<br />
Über-, Unter- und Fehlversorgung wissen wir, dass die<br />
Versorgung von <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>n hierzulande Mängel<br />
aufweist. Überflüssige Doppeluntersuchungen, unkoordiniertes<br />
Nebeneinander von haus- und fachärztlichem Sektor,<br />
Defizite in der psychosozialen Betreuung und beim<br />
Selbstmanagement der Patienten – das Verbesserungspotenzial<br />
ist erheblich. Und genau dieses Potenzial soll<br />
und kann Disease-Management ausschöpfen. Dabei steht<br />
eine bessere Koordinierung der Behandlungsabläufe im<br />
Mittelpunkt: Es ist eine alte Schwäche des bundesdeutschen<br />
Gesundheitswesens, dass zwar zahlreiche Behandlungsoptionen<br />
und -kapazitäten vorhanden sind,<br />
die Behandlungsabläufe aber teilweise nur mangelhaft<br />
aufeinander abgestimmt werden. Im Disease-Management<br />
der <strong>AOK</strong>, das unter dem Namen Curaplan läuft,<br />
übernimmt darum der behandelnde Arzt die Rolle eines<br />
medizinischen Lotsens.<br />
Disease-Management ist aber nicht nur <strong>für</strong> die Versicherten<br />
ein Pluspunkt. Die neuen Programme tragen<br />
auch dazu bei, Verwerfungen im Wettbewerb abzuflachen.<br />
Bislang ist es <strong>für</strong> eine Kasse eine unternehmenspolitische<br />
Gratwanderung, wenn sie sich stärker als andere<br />
Mitbewerber um ihre <strong>chronisch</strong> kranken Versicherten<br />
kümmert: Folgt sie diesem sozialpolitischen Auftrag, verschlechtert<br />
sie ihre Position im Wettbewerb; versucht sie<br />
dagegen, vor allem junge und gesunde Kunden zu gewinnen,<br />
gerät das Solidarprinzip aus dem Blickfeld. Die Verknüpfung<br />
von Disease-Management-Programmen (DMP)<br />
mit dem Risikostrukturausgleich entschärft diesen Widerspruch:<br />
<strong>Kranke</strong>nkassen, die in DMP investieren, erhalten<br />
künftig mehr Geld aus dem Risikostrukturausgleich als<br />
Kassen, die dies nicht tun. Damit leiten DMP eine Trendumkehr<br />
im Kassen-Wettbewerb ein.<br />
Disease-Management stellt darüber hinaus <strong>für</strong> die Leistungserbringer<br />
im Gesundheitswesen ein interessantes<br />
Feld dar. Zum einen bietet sich engagierten Ärzten Gelegenheit,<br />
durch eine engere Zusammenarbeit mit anderen<br />
Kollegen und medizinischen Einrichtungen mehr als<br />
bisher <strong>für</strong> ihre Patientinnen und Patienten tun zu können.<br />
Zum anderen gewinnen Leistungserbringer-Gruppen, die<br />
hochwertige DMP-Pakete schnüren, im Wettbewerb an<br />
Profil.<br />
Das Disease-Management stellt nicht zuletzt die<br />
Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung im bundesdeutschen<br />
Gesundheitswesen unter Beweis. Zwar waren die<br />
Verhandlungen zwischen Leistungserbringern und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
beileibe nicht immer einfach. Doch unterm<br />
Strich bleibt festzuhalten, dass die Selbstverwaltung im<br />
Koordierungsausschuss zu klaren Anforderungsprofilen<br />
an Disease-Management-Programme gekommen ist. Daran<br />
ändern auch Kampagnen einzelner Interessenvertreter<br />
nichts: DMP sind keine Billigmedizin, sondern <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong><br />
<strong>Kranke</strong> konzipierte Behandlungsprogramme, die sich<br />
im internationalen Vergleich sehen lassen können.<br />
Zugegeben: Es ist noch manche Hürde – insbesondere<br />
im Vertragsbereich – zu nehmen, bevor die Programme<br />
flächendeckend in Deutschland zur Verfügung stehen.<br />
Doch die Reformchancen, die die Politik mit dem Disease-<br />
Management eröffnet hat, sollten die Akteure im Gesundheitswesen<br />
nutzen – im Interesse der Patientinnen<br />
und Patienten.<br />
Dr. Rolf Hoberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender<br />
des <strong>AOK</strong>-Bundesverbandes<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 3
Sieben Meilensteine<br />
01. Januar 2002<br />
RSA-Reform tritt in Kraft<br />
28. Januar 2002<br />
Koordinierungsausschuss<br />
empfiehlt DMP <strong>für</strong><br />
● Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2<br />
● Koronare Herzkrankheiten<br />
● Chronische Atemwegserkrankungen<br />
(Asthma, COPD)<br />
● Brustkrebs<br />
13. Mai 2002<br />
Der Koordinierungsausschuss<br />
einigt sich auf Anforderungen<br />
<strong>für</strong> die Ausgestaltung des DMP<br />
<strong>für</strong> Diabetes Typ 2.<br />
Die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses<br />
dienen dem<br />
Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit<br />
als Grundlage <strong>für</strong> die Verordnung<br />
zum Risikostrukturausgleich.<br />
13. Juni 2002<br />
Der Koordinierungsausschuss<br />
einigt sich auf Anforderungen<br />
an die Ausgestaltung des DMP<br />
<strong>für</strong> Brustkrebs.<br />
1. Juli 2002<br />
Rechtsverordnung <strong>für</strong> DMP<br />
● Diabetes Typ 2<br />
● Brustkrebs<br />
2. Jahreshälfte 2002<br />
DMP-Verträge zwischen<br />
Ärzten und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
Akkreditierung der Verträge durch<br />
das Bundesversicherungsamt<br />
DMP-Start<br />
Versicherte schreiben sich<br />
in <strong>AOK</strong>-Curaplan ein.<br />
Disease-Management im Überblick<br />
Auf dem Weg<br />
zu mehr Gesundheit<br />
Idee und Erfahrungen stammen aus den USA: Chronisch <strong>Kranke</strong> profitieren<br />
von einer strukturierten Betreuung und Therapie. Gabriele Müller de<br />
Cornejo und Jens-Martin Hoyer zeigen Hintergrund und Konzept des<br />
Disease-Managements auf. Die <strong>AOK</strong> setzt die Disease-Management-<br />
Programme unter dem Namen Curaplan in die Praxis um.<br />
Das Gutachten des Sachverständigenrates <strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im<br />
Gesundheitswesen zur Über-, Unter- und Fehlversorgung fiel beschämend<br />
aus. Die Experten mahnen darin insbesondere bei acht Krankheiten<br />
erhebliche Verbesserungen an: Diabetes, Schlaganfall, Asthma und<br />
<strong>chronisch</strong>e Lungenerkrankungen, Krebs, Rückenleiden, Depressionen, Koronare<br />
Herzkrankheit, Zahnerkrankungen und Kieferorthopädie. Bislang sei beispielsweise<br />
in der Diabetikerversorgung kein Durchbruch erzielt worden, obwohl einfache Methoden<br />
<strong>für</strong> Diagnose und eindeutige Erkenntnisse <strong>für</strong> die Behandlung und Erfolgskontrolle<br />
vorliegen: Die Versorgung erfolge vor allem zu unkoordiniert.<br />
Disease-Management hat demgegenüber zum Ziel, die Versorgung von <strong>chronisch</strong><br />
<strong>Kranke</strong>n zu verbessern. Patienten, die langsam sich entwickelnde und andauernde<br />
Krankheiten haben, sollen durch eine gut abgestimmte, kontinuierliche Betreuung<br />
und Beratung mehr <strong>Lebensqualität</strong> erlangen und vor Spätfolgen ihrer Erkrankung<br />
bewahrt werden. Das Disease-Management soll langfristig aber auch Kosten sparen.<br />
Die direkten Kosten beispielsweise von Diabetes in Deutschland wurden 1994 auf<br />
über drei Milliarden Euro geschätzt.<br />
Disease-Management-Programme (DMP) stammen aus den Vereinigten Staaten.<br />
Dort waren regionale DMP sehr erfolgreich, beispielsweise das Diabetes Roadmap<br />
Programm von Group Health Cooperative of Puget Sound. Die Idee ist bestechend:<br />
Für die wirksame Behandlung moderner Volkskrankheiten („disease“ = Krankheit,<br />
Leiden) reicht es nicht aus, wenn der Patient in akut bedrohlichen Situationen zum<br />
Arzt geht. Insbesondere <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong> benötigen vielmehr eine kontinuierliche<br />
Betreuung, die <strong>für</strong> eine stabile körperliche Verfassung sorgt.<br />
Der Begriff „Management“ drückt aus, dass es in den Disease-Management-Programmen<br />
nicht um die traditionelle ärztliche Intervention in Krisensituationen, sondern<br />
um die langfristige Planung und Strukturierung der Patientenbetreuung geht.<br />
Die Ziele von Disease-Management gehören zu den ehrgeizigsten, die sich die<br />
Gesundheitspolitik stellen kann. DMP verbessern die Qualität der medizinischen<br />
Versorgung und vermeiden akute, kostenintensive und den Patienten belastende<br />
Stadien <strong>chronisch</strong>er Erkrankungen. In den Disease-Management-Programmen wird<br />
den Patienten eine Behandlung nach neuesten, gesicherten medizinischen Erkenntnissen<br />
garantiert. Zudem unterstützen DMP die Eigenaktivität und die Gesundheitskompetenzen<br />
der Patienten. Beispielsweise sollen alle im Rahmen von Disease-<br />
Management betreuten Diabetiker Zugang zu strukturierten, evaluierten, zielgruppenspezifischen<br />
und publizierten Schulungsprogrammen erhalten, in denen sie einen<br />
eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Erkrankung trainieren. Auch die Ärzte werden<br />
geschult, damit die vertraglich vereinbarten Versorgungsziele erreicht werden.<br />
Die Inhalte der Leistungserbringer-Schulungen zielen unter anderem auf die sektorenübergreifende<br />
Zusammenarbeit ab.<br />
4 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
Die rot-grüne Bundesregierung schuf mit verschiedenen<br />
Regelungen im Sozialgesetzbuch V, die am 1. Januar<br />
2002 in Kraft traten, die Grundlage <strong>für</strong> die deutschen Disease-Management-Programme.<br />
Der Gesetzgeber koppelt<br />
sie an den Risikostrukturausgleich (RSA): <strong>Kranke</strong>nkassen,<br />
deren Versicherte erfolgreich an DMP teilnehmen, erhalten<br />
zukünftig höhere Ausgleichszahlungen aus dem gemeinsamen<br />
Finanztopf der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung.<br />
Damit wurde auf die sozialpolitische Forderung reagiert,<br />
die hohen Behandlungskosten <strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong><br />
gerechter zu verteilen. Erstmals wird im RSA auf diese<br />
Weise indirekt berücksichtigt, wie häufig, lange und<br />
schwer ein Versicherter krank ist. Der Koordinierungsausschuss<br />
der Ärzte und <strong>Kranke</strong>nkassen, der dem Bundesgesundheitsministerium<br />
die medizinischen und datenrechtlichen<br />
Anforderungen <strong>für</strong> DMP vorschlägt, hat am 28. Januar<br />
2002 folgende <strong>chronisch</strong>e Krankheiten <strong>für</strong> strukturierte<br />
Behandlungsprogramme empfohlen: Diabetes mellitus<br />
(Typ 1 und Typ 2), Chronische Atemwegserkrankungen<br />
(zum Beispiel Asthma und COPD), Brustkrebs und<br />
Koronare Herzkrankheit.<br />
Arzt bekommt Entscheidungshilfen an die Hand<br />
Von großer Bedeutung im Disease-Management sind die<br />
evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen <strong>für</strong> die Therapie<br />
(Evidenz: Deutlichkeit, einleuchtende Erkenntnis,<br />
überwiegende Gewissheit). Evidenzbasierte Medizin führt<br />
das Wissen aus systematischer Forschung und der klinischen<br />
Erfahrung des Arztes zusammen. Laut David<br />
Sackett, ihrem bekanntesten Vertreter, ist evidenzbasierte<br />
Medizin „der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige<br />
Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen<br />
Evidenz <strong>für</strong> Entscheidungen in der medizinischen<br />
Versorgung individueller Patienten.“ Die evidenzbasierten<br />
Entscheidungsgrundlagen im Disease-Management<br />
informieren Arzt und Patient über den neuesten<br />
Stand des medizinischen Wissens zum Beispiel bei der Behandlung<br />
von Diabetes oder Brustkrebs.<br />
Diese Entscheidungsgrundlagen sind keine „Rezeptbücher“<br />
<strong>für</strong> eine „Kochbuchmedizin“, sondern helfen bei<br />
der Orientierung. Denn welche Studien aussagekräftig,<br />
welche Therapien ausreichend erprobt und welche Medikamente<br />
wirksam sind – das ist <strong>für</strong> den einzelnen Arzt häufig<br />
kaum überschaubar. Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />
gehen von der Überlegung aus, das aktuelle<br />
medizinische Wissen in konkrete Vorschläge <strong>für</strong> Prävention,<br />
Diagnostik, Therapie und Nachsorge umzusetzen,<br />
um eine gemeinsame Entscheidung des Arztes und des<br />
informierten Patienten <strong>für</strong> einen Behandlungsplan vorzubereiten.<br />
Kein gläserner Patient durch Disease-Management<br />
In den Verhandlungen zwischen Ärzteschaft und <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
wurde um die Details der Dokumentation zäh gerungen.<br />
Die Ärzte müssen auf allgemein verbindlichen<br />
Formularen die Behandlung innerhalb der DMP dokumentieren.<br />
Die Verhandlungspartner einigten sich im Mai<br />
2002 auf eine zweiteilige Dokumentation <strong>für</strong> Diabetes<br />
mellitus. In einer Teildokumentation erhalten die <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
nur die Daten, die sie <strong>für</strong> die Wahrung ihrer gesetzlich<br />
geregelten Aufgaben bei der Durchführung von<br />
DMP benötigen: allgemeine Daten, wie Stammdaten,<br />
Diagnose, einige allgemeine Statusdaten sowie in begrenztem<br />
Umfang medizinische Angaben, die <strong>für</strong> die Betreuung<br />
der Versicherten wichtig sind (unter anderem die Wahrnehmung<br />
der Arzttermine). Nur die Volldokumentation<br />
enthält die detaillierten Befunde (zum Beispiel Langzeitblutzuckerwert<br />
HbA1c, Body-Mass-Index, Blutdruck). Die<br />
Daten der Volldokumentation gehen an eine gemeinschaftliche<br />
Einrichtung, z. B. der <strong>Kranke</strong>nkassen und der<br />
Kassenärztlichen Vereinigungen. Von dieser Stelle werden<br />
die Daten pseudonymisiert und durch die <strong>Kranke</strong>nkassen<br />
und Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam zur medizinischen<br />
Qualitätssicherung genutzt sowie an Forschungsinstitute<br />
weitergeleitet, die DMP wissenschaftlich<br />
standpunkt<br />
Jörg Wohlhüter, Vorsitzender<br />
des Sozialverbandes VdK in Bayern<br />
Zarte Versuche<br />
nicht niedermachen<br />
■ Sicherlich liefern die Disease-Management-Programme nicht das<br />
ultimative gesundheitspolitische Allheilmittel. Sie könnten jedoch –<br />
ähnlich wie die Fallpauschalen in den Kliniken – einen ersten bescheidenen<br />
Anstoß geben <strong>für</strong> mehr Wirtschaftlichkeit auf dem Gesundheitsmarkt.<br />
Die Art und Weise, wie man diese zaghaften Versuche niedermacht,<br />
ist erschreckend: Man beruft sich auf die letzten abendländischen Werte<br />
und denkt nur an das eigene Geld. Sollte sich diese Methode auch nach<br />
der Bundestagswahl fortsetzen, dann machen sich die Repräsentanten<br />
einer mittelalterlichen Sozialpolitik mitschuldig am Niedergang unseres<br />
Wirtschaftssystems und damit auch einer solidarischen Gesundheitsversorgung.<br />
Im Interesse des Projektes Disease-Management sollte jedoch<br />
der überzogene, schulmeisterliche Ansatz und die sensible Datenschutzlage<br />
überdacht werden. Ein gängigerer Begriff als Disease-Management<br />
wäre hilfreich und kundenfreundlich.<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 5
„Curaplan“ <strong>für</strong> Brustkrebs<br />
Schritt 1: Diagnose<br />
Curaplan Brustkrebs startet, wenn histologisch<br />
gesichert ist, dass ein bösartiger<br />
Tumor in der Brustdrüse besteht. Die Diagnose<br />
erfolgt durch:<br />
● ärztliche Untersuchung,<br />
● Mammographie in zwei Ebenen,<br />
● Gewebeentnahme<br />
Schritt 2: Operation<br />
Bei Tumoren bis vier Zentimeter Größe<br />
ist eine brusterhaltende Operation genauso<br />
erfolgreich wie bei einer Entfernung<br />
des gesamten Brustgewebes. Ziel<br />
der brusterhaltenden Operation ist die<br />
vollständige Entfernung des Karzinoms<br />
bei gleichzeitiger Berücksichtigung des<br />
kosmetischen Ergebnisses.<br />
Schritt 3: Lymphknoten-Kontrolle<br />
Bei Tumoren, die in umliegendes Gewebe<br />
wuchern, sollten mindestens zehn<br />
Lymphknoten entfernt und untersucht<br />
werden.<br />
Schritt 4: Ergänzende Therapie<br />
Die Ärzte besprechen mit der Patientin<br />
zunächst, wie groß das Risiko ist, dass<br />
der Krebs erneut in der Brust oder an anderen<br />
Stellen im Körper entsteht. Die anschließende<br />
Behandlung zielt darauf ab,<br />
möglicherweise vorhandene winzige<br />
Tochtergeschwülste zu zerstören und<br />
damit das Risiko des Rückfalls zu senken.<br />
Zu den Behandlungsvorschlägen gehört<br />
grundsätzlich die Strahlentherapie. Bei<br />
allen Frauen sollte die Option einer Hormon-<br />
und Chemotherapie geprüft werden;<br />
Arzt und Patientin treffen dann unter<br />
Abwägung von Nutzen und Risiko zusammen<br />
die Entscheidung.<br />
Schritt 5: Leben nach dem Krebs<br />
Die Nachsorge ist nicht nur als Verlaufskontrolle<br />
oder Nachbeobachtung zu verstehen,<br />
sondern soll einen Beitrag zur<br />
physischen, psychischen und psychosozialen<br />
Rehabilitation der Patientinnen<br />
leisten. Sie soll sich an den Symptomen<br />
orientieren und ist den individuellen<br />
Bedürfnissen der Frauen anzupassen.<br />
Alle sechs Monate sollten als Mindestbestandteile<br />
einer Nachsorge Anamnese,<br />
körperliche Untersuchung und Aufklärung<br />
und Information erfolgen.<br />
auswerten – vom gläsernen Patienten kann also keine Rede sein. Dieser Kompromiss<br />
der Vertragspartner ist die Grundlage <strong>für</strong> die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums,<br />
mit der die Anforderungen an Disease-Management-Programme<br />
im Detail geregelt werden.<br />
„Curaplan“ der <strong>AOK</strong> zunächst <strong>für</strong> Diabetiker und Brustkrebs-Patientinnen<br />
Das DMP der Gesundheitskasse heißt Curaplan. Im <strong>AOK</strong>-Konzept ist der behandelnde<br />
Arzt der zentrale Disease-Manager. Das Vertrauen, das in regelmäßigen Gesprächen<br />
zwischen Arzt und Patient entsteht, ist eine wichtige Grundlage <strong>für</strong> eine<br />
langfristige und wirksame Betreuung des Patienten. Häufig haben die Patienten mehrere<br />
Erkrankungen gleichzeitig: Der behandelnde Arzt hat den Überblick darüber<br />
und kann die Rolle eines Koordinators zwischen den verschiedenen medizinischen<br />
Disziplinen und Sektoren übernehmen.<br />
Medizinisches Ziel von Curaplan <strong>für</strong> Diabetiker ist unter anderem, die Spätfolgen<br />
der Zuckerkrankheit wie Erblindung und Nierenfunktionsstörungen abzuwenden.<br />
Ist Diabetes Typ 2 diagnostiziert, kann der Patient sich in Curaplan einschreiben. Zu<br />
den Voraussetzungen der Teilnahme gehört außerdem die grundsätzliche Bereitschaft<br />
des Patienten zur aktiven Mitwirkung. Der Arzt klärt den Patienten über Nutzen und<br />
Risiken der möglichen Maßnahmen auf, schlägt ihm eine Therapie vor und vereinbart<br />
mit ihm zusammen Therapieziele. In Schulungen lernt der Diabetiker, sein Leben<br />
und seine Krankheit aufeinander abzustimmen. Dabei geht es zum Beispiel um<br />
eine krankheitsspezifische Ernährung, die Blutdruck- und Blutzucker-Selbstkontrolle,<br />
die Interpretation der Werte und die richtigen Schlussfolgerungen aus den Messungen.<br />
Benötigt der Patient Medikamente, sollte der Arzt vorrangig solche wählen,<br />
deren Nutzen und Sicherheit in prospektiven, randomisierten Langzeitstudien nachgewiesen<br />
worden ist. Je nach dem Gesundheitsrisiko des Patienten erfolgen alle drei<br />
bis sechs Monate weitere Arztkontakte. Der Arzt überprüft medizinische Messwerte<br />
und untersucht den Patienten auf Anzeichen <strong>für</strong> Folgeschäden.<br />
Auch <strong>für</strong> das Disease-Management bei Brustkrebs hat das Bundesgesundheitsministeriums<br />
bereits eine Rechtsverordnung erlassen. Die Brustkrebs-Therapie setzt eine<br />
interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation voraus. Während der gesamten<br />
Behandlung ist eine psychosoziale Betreuung zu sichern, die an die individuelle<br />
Situation der Patientin angepasst ist. Das erfordert kommunikative Kompetenzen<br />
und eine erhöhte diagnostische Aufmerksamkeit gegenüber psychischen Konflikten<br />
und Belastungen bei Patientinnen und deren Angehörigen. Im Rahmen von Curaplan<br />
(siehe Kasten links) wird mit den Brustkrebs-Patientinnen vor Beginn der Therapie<br />
ausführlich über ihre Erkrankung und die Behandlungsalternativen gesprochen.<br />
In einem patientenzentrierten Gespräch spielt die emotionale Befindlichkeit<br />
der Erkrankten eine wichtige Rolle. Jeder Behandlungsschritt sollte zusammen mit<br />
der aufgeklärten Patientin diskutiert und entschieden werden. Alle Patientinnen sollen<br />
insbesondere über die brusterhaltende Therapie, die Brustamputation und die<br />
Möglichkeiten der Wiederherstellung der Brust aufgeklärt werden. Ihnen ist eine angemessene<br />
Zeit <strong>für</strong> die Entscheidungsfindung einzuräumen.<br />
Die <strong>AOK</strong> setzt sich da<strong>für</strong> ein, dass möglichst viele Patienten die Vorteile von Curaplan<br />
nutzen können. Disease-Management stärkt insgesamt den sozialen Aspekt in<br />
der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung. Investitionen in die Versorgung <strong>chronisch</strong><br />
<strong>Kranke</strong>r lohnen sich künftig wieder – ein Sieg <strong>für</strong> das Solidarprinzip. ◆<br />
Dr. Gabriele Müller de Cornejo und Jens-Martin Hoyer leiten das DMP-Projektmanagement des<br />
<strong>AOK</strong>-Bundesverbandes.<br />
<strong>Mehr</strong> Infos<br />
Kontakt zur DMP-Projektleitung des <strong>AOK</strong>-Bundesverbandes per E-Mail: dmp@bv.aok.de;<br />
Hintergrund-Informationen zum DMP im Internet unter: www.aok-presse.de<br />
6 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
Peter Thaddäus Sawicki, Chefarzt<br />
im St. Franziskus-Hospital in Köln<br />
und Vorstandsmitglied des Netzwerkes<br />
Evidenz-basierte Medizin Deutschland<br />
■ G+G: Wie unterscheiden sich die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen<br />
– wie sie <strong>für</strong> Curaplan jetzt vorliegen<br />
– von in anderen Ländern üblichen evidenzbasierten<br />
Leitlinien?<br />
■ Peter Thaddäus Sawicki: Der wesentliche Unterschied zu<br />
den bislang üblichen Leitlinien liegt darin, dass die evidenzbasierten<br />
Entscheidungsgrundlagen keine direkten Handlungsanweisungen<br />
enthalten, sondern konkrete, praxisrelevante<br />
Inhalte vermitteln. Die Entscheidung, ob eine bestimmte<br />
Maßnahme angezeigt ist oder nicht, muss dem Patienten<br />
und seinem Arzt obliegen und nicht einem wissenschaftlichen<br />
Papier. Ich will es an einem Beispiel verdeutlichen:<br />
Die üblichen Leitlinien fordern auf, zum Beispiel:<br />
„Nach einem Herzinfarkt sollen Betablocker gegeben werden“.<br />
Die Entscheidungsgrundlagen informieren dagegen:<br />
„Nach einem Herzinfarkt ist das Risiko innerhalb von zwei<br />
Jahren zu versterben bei Patienten im Alter unter 70 Jahren<br />
mit Betablocker-Therapie elf Prozent und ohne Betablocker-Therapie<br />
19 Prozent.“<br />
■ Wie wird die Brücke geschlagen zwischen der Theorie<br />
der evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen und der<br />
ärztlichen Praxis?<br />
■ Die meisten üblichen Leitlinien evaluieren zunächst die<br />
wissenschaftliche Literatur und stellen sie dann bewertet<br />
dar. Die Entscheidungsgrundlagen gehen von täglichen<br />
praktischen Problemen in der Behandlung und Diagnose<br />
der Patienten aus und beschreiben die relevanten wissenschaftlichen<br />
Inhalte. Nach dem Ansatz der evidenzbasierten<br />
Entscheidungsgrundlagen gibt es keine absolut richtige<br />
oder falsche Entscheidung in der praktischen Medizin, sie<br />
muss immer neu <strong>für</strong> den jeweiligen Fall gefunden werden.<br />
Das bedeutet dann konkret, dass im Gegensatz zu den üblichen<br />
Leitlinien die Entscheidungsgrundlagen weder den<br />
Patienten noch seinen Arzt durch eine allgemeine Vorwegnahme<br />
der Entscheidung bevormunden, sie informieren<br />
lediglich. Der Patient und der Arzt und nicht die Leitlinie<br />
entscheiden dann zusammen individuell nach einer konkreten<br />
Information über die Diagnostik und Therapie.<br />
evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />
Informieren<br />
statt bevormunden<br />
Wichtiges Element der Disease-Management-Programme sind<br />
die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen <strong>für</strong> die Behandlung.<br />
Peter Thaddäus Sawicki erläutert, wie diese Entscheidungshilfen<br />
aufgebaut sind und wie sie die Therapie unterstützen.<br />
■ Die Entscheidung <strong>für</strong> oder gegen eine Behandlung kann<br />
also im Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen?<br />
■ Ja, durchaus. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass ein Patient<br />
sagt: „Die Nebenwirkungen des Betablockers sind <strong>für</strong><br />
mich sehr einschränkend. Wenn ich weiß, dass 13 von 14<br />
Patienten von der Therapie nicht profitieren, verzichte ich<br />
lieber auf Betablocker.“ Ein anderer Patient wird angesichts<br />
des Überlebensvorteils durch diese Präparate die Nebenwirkungen<br />
<strong>für</strong> erträglich halten. Die Entscheidungsgrundlagen<br />
fördern also den mündigen Patienten. – Ein praktisch ganz<br />
wesentlicher Unterschied zu den üblichen Leitlinien ist die<br />
Genauigkeit der Aussagen der Entscheidungsgrundlagen.<br />
„Die evidenzbasierten Entscheidungsgrundlagen<br />
sind konkret und praxisrelevant“<br />
Die üblichen Leitlinien sind häufig pauschal, zum Beispiel:<br />
„Patienten mit Bluthochdruck sollen abnehmen, sich körperlich<br />
betätigen und kochsalzarm ernähren.“ Die Entscheidungsgrundlagen<br />
sind dagegen konkret: „Pro Kilogramm<br />
Gewichtsreduktion sinkt der Blutdruck im Mittel systolisch/diastolisch<br />
um 2,5/1,5 mm Hg. Dynamische körperliche<br />
Betätigung wie Radfahren und Schwimmen mindestens<br />
dreimal pro Woche jeweils 45 Minuten senkt den<br />
Blutdruck um rund vier bis acht Millimeter Quecksilbersäule<br />
systolisch.“<br />
■ Welchen Vorteil bieten evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen<br />
gegenüber üblicher ärztlicher Fortbildung?<br />
■ Leider wird derzeit der überwiegende Teil der ärztlichen<br />
Fortbildung in Deutschland durch Referenten der pharmazeutischen<br />
Industrie durchgeführt. Dies ist <strong>für</strong> die Patienten<br />
gefährlich und <strong>für</strong> die Gesellschaft teuer. Die evidenzbasierten<br />
Entscheidungsgrundlagen bieten eine unabhängige, objektive,<br />
konkrete, praxisbezogene Information, die regelmäßig<br />
aktualisiert wird. Darüber hinaus ist über das allgemeine<br />
Review-Verfahren die Beteiligung aller Ärzte an der<br />
Modifikation der Inhalte vorgesehen. ◆<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 7
Hausarzt-Praxis<br />
Die stillen<br />
Reserven<br />
mobilisieren<br />
Hand auf Herz und Fuß, das Auge im Blick:<br />
Die empfindlichen Stellen der Diabetiker fordern<br />
besondere Aufmerksamkeit. G+G hat einen<br />
Hausarzt im Schwarzwald besucht,<br />
der zuckerkranke Patienten jetzt im Rahmen<br />
des Disease-Managements betreut.<br />
Dass sie Diabetikerin ist, weiß Irma Jäger erst, seit<br />
sie vor zwölf Jahren mal ins <strong>Kranke</strong>nhaus musste.<br />
Bei der Blutuntersuchung wurde ein Zuckerwert<br />
von 290 Milligramm pro Zehntelliter gemessen<br />
– als normal gelten bis zu 110 Milligramm. Ein Befund,<br />
der das Leben der damals 58-Jährigen veränderte. Denn<br />
mit der Einnahme von Medikamenten und dem regelmäßigen<br />
Arztbesuch ist es nicht getan. Mittags gibt es bei Jägers<br />
häufiger als früher Gemüse und Salat. „Ich achte jetzt auch<br />
auf Ballaststoffe,“ sagt Irma Jäger und lacht: „Das muss mein<br />
Mann dann halt auch essen.“ Als sie noch Kassiererin bei Edeka<br />
war, probierte sie jede Süßigkeit, die neu auf den Markt<br />
kam. Die verkneift sie sich nun, weil sie als Diabetikerin auch<br />
auf ihr Gewicht achten muss.<br />
„Ah, das Hühnerauge ist weg.“ Zufrieden betrachtet<br />
Dr. Johannes Probst Irma Jägers rechten Fuß. Die regelmäßige<br />
Untersuchung der Füße gehört wie das Messen von Blutdruck<br />
und Blutzuckerwert zum Programm, <strong>für</strong> das Frau Jäger<br />
alle drei bis vier Wochen die Praxis im Schwarzwald-Städtchen<br />
Sankt Georgen aufsucht. Dr. Probst hält eine schwingende<br />
Stimmgabel an die Fußsohle, um die Vibrationsempfindlichkeit<br />
zu testen: alles in Ordnung. Keine Druckstellen,<br />
keine Verletzungen, kein Haut- oder Nagelpilz – ein vorbildlich<br />
gepflegter Fuß. Die aufmerksame Fußpflege ist <strong>für</strong> Diabetiker<br />
sehr wichtig, damit sich keine schlecht heilenden<br />
Wunden entwickeln.<br />
3.600 <strong>AOK</strong>-versicherte Diabetiker gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis,<br />
und sie alle haben Anfang Mai Post von<br />
ihrer Gesundheitskasse bekommen: Informationen über das<br />
Disease-Management-Pilotprojekt zum Diabetes. Auch auf<br />
der Südwest-Messe in Schwenningen stellte die <strong>AOK</strong> ihr<br />
Projekt vor. Wer den Weg zur Messe scheute, konnte sich bei<br />
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kunden-<br />
Centern der <strong>AOK</strong> zwischen Triberg und Donaueschingen<br />
informieren. Der Regelweg der Information geht allerdings<br />
über den behandelnden Arzt. Die Ärztinnen und Ärzte aren<br />
die ersten, die darüber informiert wurden, dass die <strong>AOK</strong><br />
Baden-Württemberg und die Kassenärztliche Vereinigung<br />
(KV) Südbaden gemeinsam die Versorgung <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r<br />
verbessern wollen und das am Beispiel des Diabetes testen.<br />
Karl Heinrich Behringer, Diplom-Psychologe, Leiter<br />
des Gesundheitszentrums der <strong>AOK</strong> in Villingen-Schwenningen<br />
und verantwortlich <strong>für</strong> das Pilotprojekt, ist stolz auf<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
Fotos: Dieter Reinhardt<br />
„Nur wenn viele Kollegen teilnehmen, können wir Ärzte Einfluss auf die<br />
Entwicklung des Disease-Managements nehmen“<br />
die Resonanz: „159 Hausärzte, hausärztlich tätige Internisten<br />
und Kinderärzte kommen im Schwarzwald-Baar-<br />
Kreis <strong>für</strong> eine Teilnahme in Frage. 138 Ärzte haben an den<br />
Informationsveranstaltungen von <strong>AOK</strong> und KV teilgenommen.“<br />
115 Ärzte und mehrere hundert Patienten haben<br />
sich bis Ende Juni eingeschrieben. Täglich kommen<br />
ungefähr zehn neue Patienten hinzu. Die KV Südbaden<br />
hat sich sehr <strong>für</strong> eine Teilnahme möglichst vieler Kollegen<br />
eingesetzt. „Nur so können wir Einfluss auf die Entwicklung<br />
nehmen“, sagt Dr. Probst. Der Hausarzt von Irma<br />
äger ist Kreisstellenleiter der KV im Schwarzwald-Baar-<br />
Kreis und Mitglied im Vorstand der KV Südbaden.Was ändert<br />
sich denn eigentlich, wenn Arzt und Patient bei dem<br />
Programm mitmachen? „Ja, das haben wir uns auch gefragt“,<br />
sagt Dr. Probst. Im Großen und Ganzen sei die Versorgung<br />
<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r nicht schlecht. Natürlich gebe es<br />
auch hier „stille Reserven“, die mobilisiert werden könnten,<br />
doch wer jetzt schon medizinisch gut versorgt werde, <strong>für</strong> den<br />
ändere sich nichts. Eine der Fragen, die aus Sicht der Kassenärzte<br />
bis zur Zwischenbilanz im Herbst geklärt werden<br />
müssen: Ist der Betrag, mit dem jedes Ausfüllen eines Dokumentationsbogens<br />
extra honoriert wird – 25 Euro gibt es<br />
<strong>für</strong> die Erstdokumentation, 15 Euro <strong>für</strong> jede weitere –, wirklich<br />
angemessen? DMP gelte ohnehin bei vielen Ärzten<br />
nicht nur als Abkürzung <strong>für</strong> „Disease-Management-Programm“,<br />
sondern stehe auch <strong>für</strong> „drastisches <strong>Mehr</strong>arbeits-<br />
Programm“, erzählt Dr. Probst. Die andere Sorge ist: Was<br />
passiert mit den Bogen? Der „gläserne Patient“ wird verhindert,<br />
weil der Arzt den Namen des Patienten vor der<br />
Weitergabe zur wissenschaftlichen Auswertung an <strong>AOK</strong><br />
und KV durch eine fest zugeordnete Nummer ersetzt, also<br />
pseudonymisiert. Der Name des Arztes aber bleibt lesbar,<br />
und die Vorstellung vom „gläsernen Doktor“ empfinden<br />
manche Ärzte als bedrohlich.<br />
Alle drei bis sechs Monate werden die Bogen vom Arzt<br />
ausgefüllt und von ihm und dem Patienten unterschrieben.<br />
Das ist dann doch etwas Neues: Arzt und Patient legen zum<br />
Beispiel Behandlungsziele fest, den angestrebten Blutzuckerwert,<br />
den angepeilten Blutdruck, wenn nötig auch mehr Bewegung<br />
und ein reduziertes Gewicht. Das DIN-A4-Formular<br />
fragt nach Symptomen, Begleiterkrankungen, Laborwerten,<br />
nach Medikamenten und nach Überweisungen an<br />
Fachärzte. Dort wird Dr. Probst vermerken, dass Frau Jäger<br />
wie bisher einmal jährlich den Augenarzt aufsucht, weil zu<br />
den Spätfolgen eines Diabetes nicht nur die Amputation<br />
eines Fußes und Nierenversagen, sondern auch die Erblindung<br />
gehören kann. Er wird den Befund der Fußuntersuchung<br />
eintragen und ankreuzen, dass er Frau Jäger außer<br />
Metformin noch ein weiteres Präparat verschreibt.<br />
Metformin erhöht die Empfindlichkeit der Körperzellen<br />
<strong>für</strong> Insulin und erleichtert damit die Umwandlung von<br />
Blutzucker in Energie. Für Patienten mit Übergewicht gilt<br />
Metformin als Mittel der Wahl und spielt deshalb in den<br />
Entscheidungsgrundlagen, die den Ärzten im Rahmen des<br />
Programms zur Verfügung gestellt werden, eine zentrale<br />
Rolle. Irma Jäger nimmt zusätzlich ein Acarbose-Präparat,<br />
das sie gut verträgt. Bislang ist <strong>für</strong> Acarbose zwar nicht nachgewiesen,<br />
dass es das Risiko verringert, Folgeerkrankungen<br />
zu erleiden oder das Sterberisiko senkt. Dr. Probst hat sich<br />
als ergänzende Therapie trotzdem da<strong>für</strong> entschieden, weil<br />
das Medikament die Aufnahme des Zuckers über den Darm<br />
ins Blut verlangsamt. Zumindest scheint also die Be<strong>für</strong>chtung<br />
vieler Ärzte unbegründet zu sein, Disease Management<br />
bedeute „Kochbuchmedizin“, vorsichtiger ausgedrückt: eine<br />
Einengung der ärztlichen Therapiefreiheit. Die Entscheidungsgrundlagen<br />
argumentieren auf Basis zuverlässiger Studien<br />
und wollen das Expertenwissen des Arztes durch wissenschaftliche<br />
Erkenntnisse auf dem neuesten Stand ergänzen:<br />
„evidence based medicine“. Beim Diabetes Typ 2, dem<br />
so genannten Altersdiabetes, hat sich zum Beispiel gezeigt,<br />
dass die intensive Senkung der Blutzuckerwerte zwar jüngere<br />
Patienten vor den Spätfolgen des Diabetes schützen kann.<br />
Für die Lebenserwartung der älteren Diabetiker und die<br />
Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall ist es aber viel<br />
wichtiger, den Bluthochdruck in den Griff zu bekommen.<br />
Dr. Probst weiß das. Das Programm trägt dazu bei, dieses<br />
Wissen unter Ärzten und Patienten weiterzutragen.<br />
Weil es wichtig ist, dass die Patienten den Umgang mit<br />
ihrem Diabetes lernen, gehören Schulungen zum festen Programm.<br />
Die <strong>AOK</strong> des Schwarzwald-Baar-Kreises bietet seit<br />
1995 einwöchige Schulungen gemeinsam mit dem Klinikum<br />
Schwenningen an. Karl Heinrich Behringer berichtet<br />
von manchem Aha-Erlebnis: „Ich habe schon Patienten sagen<br />
hören: ‚Jetzt habe ich 20 Jahre lang den Diabetes, und<br />
hier habe ich Dinge erfahren, die mir noch nie jemand gesagt<br />
hat.’“ Auch Dr. Probst erwartet, dass die Bedeutung der<br />
Patientenschulung betont wird. Von zentralen Schulungen<br />
wie in Schwenningen hält er dagegen wenig. Er hat einen<br />
gemeinnützigen Verein gegründet, der sich der Prävention<br />
am Ort widmet. Elf Ärzte lassen ihre Patienten gemeinsam<br />
schulen, in kleinen Gruppen an vier Nachmittagen, jeweils<br />
im Wochenabstand. So können die Patienten das Gelernte<br />
in ihren Alltag einfügen und Probleme beim nächsten Treffen<br />
besprechen.<br />
Irma Jäger hat sich längst auf den Alltag mit ihrem Diabetes<br />
eingerichtet. Natürlich haben ihre Schwester und sie<br />
am Anfang gesagt: „Warum trifft es gerade uns?“ Zwar litt<br />
ihre Großmutter an der Zuckerkrankheit, ihre Tante auch,<br />
aber von den sechs Geschwistern hat es nur die beiden<br />
Schwestern erwischt. Dass sie sich trotzdem nicht hängen<br />
lässt, da<strong>für</strong> sorgt die Familie: „Ich habe fünf Kinder und acht<br />
Enkel. Die halten mich in Schwung.“◆<br />
<strong>Mehr</strong> Infos<br />
Dr. Johannes Probst, Hausarzt<br />
Die Pressestelle der <strong>AOK</strong> in Baden-Württemberg gibt Auskunft zum<br />
DMP-Pilotprojekt unter Tel. (07 11) 259 32 31/-234<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 9
Pilotprojekt in Baden-Württemberg<br />
„DMP“ lernt laufen<br />
Bevor es bundesweit richtig ernst wird, testet<br />
die Gesundheitskasse das Disease-Management<br />
auf Landesebene. In Baden-Württemberg sind<br />
bereits rund zweihundert Ärzte und viele Patienten<br />
in das Programm <strong>für</strong> Diabetiker eingestiegen.<br />
Von Jürgen Graf<br />
Die <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg hat die Aufgabe<br />
übernommen, Disease-Management-Programme<br />
(DMP) <strong>für</strong> Diabetes Typ 1 und<br />
Typ 2 in Pilotprojekten zu erproben. Die Gesundheitskasse<br />
erforscht auf diese Weise, wie die Programme<br />
bei Ärzten und Patienten ankommen und wie die Verwaltungsprozesse<br />
möglichst ökonomisch gestaltet werden.<br />
Ein Pilotprojekt zum Disease-Management-Programm<br />
Diabetes ist damit konfrontiert, dass der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung<br />
einerseits aus zahlreichen Diabetes-<br />
Modellversuchen bereits Erfahrungen vorliegen. Auf der<br />
anderen Seite zeigen die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
auf der Basis der Anwendung evidenzbasierter<br />
Medizin Änderungsbedarf bei der Ausgestaltung und der<br />
Schwerpunktsetzung neuer Verträge zur Umsetzung einer<br />
optimierten Diabetikerversorgung auf. Das erzwingt ein<br />
Umdenken bei allen Beteiligten.<br />
Große internationale Langzeitstudien zur Versorgung<br />
von Diabetikern belegen, dass der Blutdruckbehandlung<br />
deutlich mehr Aufmerksamkeit als bisher eingeräumt wer-<br />
Diabetes in Zahlen<br />
Zahl der Diabetiker in der <strong>AOK</strong><br />
(Typ 1 und Typ 2)<br />
<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />
1.504.164<br />
Ost<br />
465.264<br />
West<br />
1.047.900<br />
Anteil der Diabetiker<br />
unter den <strong>AOK</strong>-Versicherten<br />
(in Prozent)<br />
<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />
5,5%<br />
Ost<br />
8,6%<br />
West<br />
4,8%<br />
Durchschnittliche Leistungsausgaben<br />
pro Diabetiker (<strong>AOK</strong>)<br />
(in Euro, im Jahr 2000)<br />
<strong>AOK</strong>-Gesamt<br />
3.626 Ost<br />
3.398<br />
West<br />
3.730<br />
Die Zahl der <strong>chronisch</strong> kranken Diabetiker in der <strong>AOK</strong> wurde mit Hilfe von <strong>Kranke</strong>nhausdiagnosen<br />
und Arzneimittel-Verordnungen ermittelt – und ist deshalb als Annäherung an die<br />
wahre Zahl zu betrachten. Bei den Leistungsausgaben handelt es sich um Ausgaben <strong>für</strong> <strong>Kranke</strong>nhausbehandlung,<br />
Arzneimittel und <strong>Kranke</strong>ngeld; auch die nicht diabetesspezifischen<br />
Ausgaben wurden einbezogen. Quelle: <strong>AOK</strong>-Bundesverband,Stand 2000<br />
den muss: Mit der Blutdrucksenkung verringert sich nachweislich<br />
die Rate von Herzinfarkten und Schlaganfällen bei<br />
Diabetikern. Daneben liegen aus diesen Studien Erkenntnisse<br />
zur Wirksamkeit unterschiedlicher Wirkstoffgruppen<br />
vor, die gegenüber der bisherigen Medikamentenauswahl<br />
teilweise ebenfalls eine Umorientierung nahe legen.<br />
Dezentral Einigung erzielt<br />
Die <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg hat von Beginn an auf die<br />
gute Zusammenarbeit mit den Kassenärztlichen Vereinigungen<br />
gebaut und konnte zwei Kassenärztliche Vereinigungen<br />
<strong>für</strong> die Pilotprojekte gewinnen. Beteiligt sind die<br />
Kassenärztliche Vereinigung Südbaden im Schwarzwald-<br />
Baar-Kreis und im Pforzheim/Enzkreis die Kassenärztliche<br />
Vereinigung Nordbaden. Bei den Gesprächen über die Ausgestaltung<br />
der Pilot-Programme war es sehr hilfreich, dass<br />
die Vertragspartner von Beginn an die Chancen eines<br />
solchen Projekts <strong>für</strong> die Versorgung von Diabetikern in den<br />
Mittelpunkt gestellt haben. Vor diesem Hintergrund konnten<br />
auch <strong>für</strong> die auf Bundesebene strittigen Themen zum<br />
Datentransfer und zu den medizinischen Inhalten pragmatisch<br />
Kompromisse gefunden werden. Auch bei der Frage<br />
der Vergütung wurde ein allseits akzeptables Ergebnis erzielt.<br />
Mit Start des Pilotprojektes waren Ärzte, Patienten und<br />
Mitarbeiter über das DMP Diabetes spezifisch zu informieren.<br />
Dabei haben sich die Vorteile der dezentralen Organisation<br />
der <strong>AOK</strong> Baden-Württemberg gezeigt. Sowohl auf<br />
Seiten der Kreisärzteschaft als auch in den Bezirksdirektionen<br />
der <strong>AOK</strong> konnten mit großem Einsatz vielfältige<br />
Vorbereitungen <strong>für</strong> den Projektstart in enger Abstimmung<br />
untereinander und mit den Projektbeteiligten<br />
auf Landesebene getroffen werden.<br />
Arzthandbuch fasst Informationen zusammen<br />
Die Teilnahme an vierstündigen Informationsveranstaltungen<br />
ist <strong>für</strong> Ärzte eine Voraussetzung <strong>für</strong> die Aufnahme in<br />
das Pilotprojekt. Im Rahmen dieser Veranstaltungen, an denen<br />
zum Teil über 100 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen<br />
haben, wurden die gesetzlichen und versorgungspolitischen<br />
Hintergründe des Disease-Managements, die Grundlagen<br />
der Methodik der evidenzbasierten Medizin und die medizinische<br />
Entscheidungshilfe <strong>für</strong> Diabetes erläutert. Daneben<br />
wurden die praktischen Abläufe zur Teilnahme von<br />
Patienten und Ärzten sowie zur Dokumentation und Ab-<br />
10 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
echnung vorgestellt. Ein übersichtliches Arzthandbuch<br />
fasst all dies zusammen.<br />
Arzt-Patienten-Verhältnis wird aktiviert<br />
Die Vorbereitung und Information der Mitarbeiter der<br />
<strong>AOK</strong> in den Pilotregionen erfolgte in interaktiven Arbeitstreffen<br />
mit engagierter Unterstützung durch <strong>AOK</strong>-<br />
Consult, dem internen Beratungsunternehmen der Gesundheitskasse.<br />
In der Kommunikation mit den Mitarbeitern<br />
spielen außerdem das Intranet der Gesundheitskasse,<br />
Rundmails und die Mitarbeiterzeitschrift WIR<br />
eine wichtige Rolle. Nachdem Ärzte und Mitarbeiter<br />
eingestimmt waren, wurden alle Versicherten der <strong>AOK</strong><br />
in den Pilotregionen angeschrieben, denen diabetesspezifische<br />
Medikamente verordnet wurden. Dem Anschreiben<br />
war ein achtseitiges Faltblatt beigelegt, das den<br />
Patienten das neue Programm ausführlich erläutert.<br />
Das bisherige Ergebnis hat alle Beteiligten positiv<br />
überrascht: Trotz der zum Teil kritischen Äußerungen<br />
zu DMP in der Öffentlichkeit haben nach rund einem<br />
Monat über 260 von 380 eingeladenen Ärzten an den<br />
Informationsveranstaltungen teilgenommen. Annähernd<br />
200 haben sich bereits <strong>für</strong> eine Teilnahme am Programm<br />
entschieden. Auch die ersten Versicherten haben<br />
sich eingeschrieben und täglich kommen neue hinzu.<br />
Insgesamt versichert die <strong>AOK</strong> in den Pilotregionen<br />
rund 8.000 Diabetiker.<br />
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass es richtig war,<br />
die Umsetzung von Disease-Management-Programmen<br />
gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen anzugehen<br />
und dass dieses Vorgehen bei Ärzten und Patienten<br />
auf hohe Akzeptanz stößt. Im Mittelpunkt steht<br />
dabei zum einen das Versprechen, die Behandlung auf<br />
der Grundlage gesicherten medizinischen Wissens<br />
durchzuführen. Zum anderen wird die Arzt-Patient-<br />
Beziehung durch umfangreiche Informationen aktiviert.<br />
Damit verbunden ist ein Dokumentationskonzept,<br />
das eine gemeinsame Therapieplanung von Patient<br />
und Arzt befördert. ◆<br />
Jürgen Graf leitet das DMP-Pilotprojekt Diabetes in Baden-<br />
Württemberg.<br />
<strong>Mehr</strong> Infos<br />
Die Projektleitung des DMP-Piloten der <strong>AOK</strong> in Baden-Württemberg<br />
ist erreichbar unter E-Mail: juergen.graf@bw.aok.de<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang<br />
standpunkt<br />
Prof. Karl Lauterbach, Institut <strong>für</strong> Gesundheitsökonomie<br />
der Universität Köln, Mitglied des<br />
Sachverständigenrates <strong>für</strong> die Konzertierte Aktion<br />
im Gesundheitswesen<br />
Philosophie <strong>für</strong> Qualität<br />
■ In der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung wäre durch die Einführung von Disease-<br />
Management-Programmen mit einem Qualitätsschub zu rechnen. Dazu müssten<br />
sich jedoch Ärzte und <strong>Kranke</strong>nkassen zum ersten Mal gemeinsam auf Programme<br />
verständigen, die eine evidenzbasierte Therapie <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r zum Ziel haben.<br />
Damit würden die von verschiedenen Seiten unternommenen Anstrengungen zur<br />
Schaffung eines einheitlichen evidenzbasierten Therapiestandards in Deutschland<br />
gebündelt und durch den Gesetzgeber aktiv unterstützt.<br />
Die Thesen, dass Umverteilungen über den Risikostrukturvergleich <strong>für</strong> die<br />
<strong>Kranke</strong>nkassen im Vordergrund stünden oder sich die Versorgung von Patienten,<br />
die nicht in Disease-Management-Programme eingeschrieben sind, verschlechtern<br />
würde, sind falsch und teilweise polemisch gemeint. Von der Philosophie des<br />
Disease-Managements, durch einen evidenzbasierten einheitlichen Versorgungsstandard<br />
Transparenz, Qualität und Wirtschaftlichkeit in die Versorgung zu<br />
bringen, und den aktiven Patienten zu stärken, könnte vielmehr das gesamte<br />
deutsche Gesundheitssystem profitieren. Die Denkweise der evidenzbasierten<br />
Medizin, nämlich sich zu fragen, welche Verfahren einen gesicherten Nutzen<br />
haben, würde auf allen Versorgungsebenen gefördert. Echte Innovationen mit<br />
guter Kosten-Nutzen-Relation würden dann schneller in die Regelversorgung<br />
übergehen. Pseudoinnovationen könnten dagegen als solche entlarvt und problematisiert<br />
werden.<br />
standpunkt<br />
Birgit Fischer (SPD), Ministerin <strong>für</strong> Frauen,<br />
Jugend, Familie und Gesundheit des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen<br />
Reformen brauchen<br />
finanzielle Anreize<br />
■ Verschiedene Gutachten bescheinigen dem deutschen Gesundheitswesen bei<br />
höchsten Kosten allenfalls durchschnittlichen Erfolg und insbesondere deutliche<br />
Defizite bei der Versorgung <strong>chronisch</strong> kranker Patientinnen und Patienten. Diese<br />
Aussagen treffen mit den Ergebnissen verschiedener Gutachten zum Risikostrukturausgleich<br />
(RSA) zusammen, die deutlich machen, dass der RSA bisher die Tendenzen<br />
zur Risikoselektion im Kassenwettbewerb nicht ausreichend eindämmen konnte.<br />
Insbesondere die <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>n sind Verlierer des Wettbewerbs. Es lag daher<br />
nahe, die notwendige Verbesserung der Versorgung <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r <strong>für</strong> eine<br />
Übergangszeit bis zur Einführung genauerer Morbiditätsindikatoren mit dem RSA<br />
zu verknüpfen. Die damit verbundenen finanziellen Anreize sollen das Eigeninteresse<br />
der <strong>Kranke</strong>nkassen praktisch umkehren. Auch wenn die Verknüpfung ordnungspolitisch<br />
eher als Sündenfall zu bezeichnen ist, stehe ich diesem Reformelement<br />
im Grundsatz positiv gegenüber. Es hat sich ja leider in der Vergangenheit immer wieder<br />
gezeigt, dass gute Reformansätze ohne finanzielle Anreize ins Leere laufen.<br />
Allerdings sehe ich bei der konkreten Umsetzung der Disease-Management-<br />
Programme noch Gefahren. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen muss das Ziel der<br />
Verbesserung der Versorgungssituation, müssen die Patientin und der Patient<br />
stehen und nicht finanzielle Interessen der <strong>Kranke</strong>nkassen oder der Ärzteschaft –<br />
Disease-Management-Programme sind keine Geldmaschine. Die Akzeptanz und<br />
damit die Zukunft strukturierter Behandlungsprogramme im deutschen Gesundheitswesen<br />
hängen wesentlich von der erfolgreichen Implementierung und Durchführung<br />
der jetzt geplanten Programme ab. Scheitern diese, dürfte das Instrument<br />
der strukturierten Behandlungsprogramme auf absehbare Zeit in Deutschland<br />
„verbrannt“ sein. Alle Beteiligten sollten sich also bewusst machen, dass es nicht<br />
darum geht, partikuläre Eigeninteressen durchzusetzen und Patienteninteressen<br />
nur vorzuschieben.
DMP-Entstehungsgeschichte<br />
Kritik wider besseren Wissens<br />
Die Disease-Management-Programme <strong>für</strong> Typ 2<br />
Diabetiker stärken die Qualität der Versorgung.<br />
Dennoch sprechen einige Kritiker von „Billigmedizin“.<br />
Norbert Schmacke entlarvt ihre Gründe und erhellt<br />
den Hintergrund der aktuellen Diskussion um die<br />
richtige Diagnostik und Therapie.<br />
Die Geschichte des bundesrepublikanischen Gesundheitswesens<br />
ist von Fachleuten immer<br />
wieder als eine Abfolge von Reformblockaden<br />
beschrieben worden. Dies gilt ganz besonders<br />
<strong>für</strong> den Mangel an strukturierten Versorgungskonzepten <strong>für</strong><br />
<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>. Es ist das große Verdienst des Sachverständigenrats<br />
<strong>für</strong> die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen,<br />
mit seinem Gutachten zur Über-, Unter- und Fehlversorgung<br />
noch einmal in einem großen Anlauf die Öffentlichkeit<br />
wachgerüttelt zu haben: Insbesondere bei Erkrankungen<br />
wie dem Diabetes mellitus Typ 2 und dem<br />
Brustkrebs muss gesichertes Wissen wirkungsvoller als bisher<br />
in die Praxis umgesetzt werden.<br />
Diese Analyse hat starken Einfluss darauf genommen,<br />
dass der Koordinierungsausschuss genau diese beiden Diagnosen<br />
in die erste Reihe der geplanten Disease-Manage-<br />
Lob von berufener Seite: Aus einem Brief von Univ. Prof. Dr. Thomas<br />
Pieber, Leiter Diabetes und Stoffwechsel, Med. Univ. Klinik Graz<br />
Präsident der Österreichischen Diabetesgesellschaft, Leiter des<br />
Institutes Medizinische Systemtechnik und Gesundheitsmanagement<br />
des Joanneum Research<br />
ment-Programme (DMP) gestellt hat. Und es ist auch kein<br />
Zufall, dass die größten Anstrengungen unternommen wurden,<br />
in der gemeinsamen Selbstverwaltung der <strong>Kranke</strong>nkassen,<br />
Ärzteschaft und Kliniken die Peinlichkeit zu vermeiden,<br />
zu diesen beiden Erkrankungen nicht zeitnah Konzepte<br />
vorlegen zu können. Wer hat nicht alles geunkt, die<br />
Selbstverwaltung sei unfähig, derart komplexe Probleme an-<br />
zupacken. Doch sie hat es geschafft, im Kontext der Debatte<br />
um Über-, Unter- und Fehlversorgung auf dem Boden<br />
der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse<br />
wichtige Eckpunkte zu beschreiben, mit denen die Versorgung<br />
<strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>r bessere Ergebnisse erzielt und sicherer<br />
wird. Die Patientinnen und Patienten werden nicht<br />
mehr als Objekte von Experten-Verkündigungen begriffen,<br />
sondern als Partner, die über Therapiemöglichkeiten aufgeklärt<br />
werden und über Therapieziele mitentscheiden.<br />
Dieses Ergebnis markiert den Anfang eines grundlegenden<br />
Wandels in der Beziehung zwischen Therapeuten und<br />
Patienten. Offenlegen der vorhandenen Evidenz und Transparenz<br />
der Behandlungsempfehlungen, Einbeziehung der<br />
<strong>Kranke</strong>n in den Behandlungsprozess, Festschreiben individueller<br />
Therapieziele: Dies ist „Sackett pur“, dies ist genau<br />
das, was der „Vater“ der heutigen evidenzbasierten Medizin<br />
als Antwort auf die Intransparenz und mangelnde Qualität<br />
in der Medizin gefordert hat. Wer etwas anderes aus den<br />
Texten herausinterpretiert, die der Koordinierungsausschuss<br />
dem Bundesministerium <strong>für</strong> Gesundheit <strong>für</strong> die Risikostrukturausgleichs-Verordnung<br />
empfohlen hat, der verkauft<br />
der Öffentlichkeit ein X <strong>für</strong> ein U.<br />
Wie ist der Koordinierungsausschuss zu seinen Empfehlungen<br />
<strong>für</strong> die medizinischen Anforderungen an das DMP<br />
Diabetes mellitus Typ 2 gekommen?<br />
● Der Arbeitsausschuss DMP bildete eine Unterarbeitsgruppe<br />
(Sektion), in der Vertreter aller Parteien des Koordinierungsausschusses<br />
vertreten sind (Bundesärztekammer,<br />
Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche <strong>Kranke</strong>nhausgesellschaft<br />
und die Spitzenverbände der <strong>Kranke</strong>nkassen).<br />
Jede der vier Parteien benannte darüber hinaus Sachverständige<br />
ihres Vertrauens, wobei sicher gestellt werden<br />
sollte, dass sowohl methodisch-biometrischer wie klinischer<br />
Sachverstand vertreten ist. Jede Partei war frei in der Benennung<br />
einer selbst gewählten Zahl von Sachverständigen.<br />
Die Ärzteschaft hatte also drei Gelegenheiten, die besten<br />
Wissenschaftler und Kliniker zum Thema Diabetes mellitus<br />
zu benennen. Alle Fachgesellschaften und Vereinigungen,<br />
die sich aufgerufen fühlten, hatten über diese Konstruktion<br />
zudem reichlich Gelegenheit, ihren Sachverstand und ihre<br />
Erwartungen zu artikulieren.<br />
● Bezüglich des Diabetes mellitus kann man davon ausgehen,<br />
dass auch die Debatte, die um die parallel entstandene<br />
so genannte Nationale Versorgungsleitlinie unter Beteiligung<br />
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft geführt wurde,<br />
durch die Mitarbeit prominenter Vertreter der Ärzteschaft<br />
in der Sektion berücksichtigt worden ist.<br />
● Die Spitzenverbände der <strong>Kranke</strong>nkassen waren die einzigen,<br />
die zu Beginn des Prozesses ein geschlossenes Konzept<br />
12 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
„Alle Fachgesellschaften hatten reichlich Gelegenheit, ihren<br />
Sachverstand und ihre Erwartungen zu artikulieren.“<br />
vorlegen konnten. Dies waren die inzwischen legendären<br />
„Sawicki-Papiere“, die eben nicht das Produkt eines einsamen<br />
Kölner Chefarztes waren, sondern von einer kompetenten<br />
Gruppe, in evidenzbasierter Medizin (EbM) erfahrener<br />
Ärzte geschrieben und mit zahlreichen Praktikern abgestimmt<br />
worden waren und dann von allen Spitzenverbänden<br />
als exzellente Ausgangsposition <strong>für</strong> den Koordinierungs-<br />
ausschuss übernommen wurden. Also keine „<strong>AOK</strong>-Papiere“<br />
von „EbM-Extremisten“. Viele kenntnisreiche Vertreter der<br />
Ärzteseite im Koordinierungsausschuss haben ihren Hut vor<br />
der Qualität dieses Ansatzes der Spitzenverbände der gesetzlichen<br />
<strong>Kranke</strong>nversicherung gezogen. Es war unter Insidern<br />
von Anbeginn an klar, dass es aus EbM-Sicht nicht um die<br />
Qualität dieser „Sawicki-Papiere“ ging, sondern um die Eitelkeit<br />
von Schlüsselpersonen in der Ärzteschaft und um die<br />
Angst bestimmter Interessengruppen, dass eine konsequente<br />
EbM-Ausrichtung des Diabetes-DMPs an lieb gewordenen<br />
Besitzständen rütteln könnte.<br />
● Die Arbeit in der Sektion setzte auf einer von Bundesärztekammer,<br />
Kassenärztlicher Bundesvereinigung und<br />
Spitzenverbänden der <strong>Kranke</strong>nkassen konsentierten Methodik<br />
der Suche und Bewertung von wissenschaftlichen Materialien<br />
auf, die internationalen Standards entspricht. Dazu<br />
gehört maßgeblich das Gebot, Studien zugrunde zu legen,<br />
in denen klinisch bedeutsame Behandlungsergebnisse auf<br />
dem Boden von Langzeitstudien gemessen worden sind und<br />
die Qualität der Behandlung nicht an der Veränderung von<br />
Laborwerten festgemacht wird. Erst nach Fertigstellung des<br />
Sektionspapiers zum Diabetes und dem darauf folgenden<br />
Beschluss des Koordinierungsausschusses distanzierte sich<br />
die Bundesärztekammer von dieser Methodik. Fest steht:<br />
Jeder Satz in den Empfehlungen zum DMP Diabetes ist von<br />
allen Parteien des Koordinierungsausschusses einvernehmlich<br />
<strong>für</strong> gut befunden worden – mit der Ausnahme, dass die<br />
Deutsche <strong>Kranke</strong>nhausgesellschaft sich bezüglich der Nennung<br />
von Wirkstoffen und Wirkstoffgruppen im Text der<br />
Stimme enthielt – interessant insofern, als es auf der Welt<br />
bisher noch kein DMP gegeben hat, dass den Bereich der<br />
Prof. Norbert Schmacke, Internist und Gesundheitswissenschaftler<br />
medikamentösen Behandlung ausgeklammert hat.<br />
● Die Kritik der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG)<br />
richtet sich somit gegen die gemeinsame Selbstverwaltung. Es<br />
hat mehrere Versuche unter Moderation des Bundesgesundheitsministeriums<br />
gegeben, den Sprachführern der DDG diesen<br />
Sachverhalt zu erläutern, ohne Erfolg. Es bleibt einer juristischen<br />
und politischen Bewertung vorbehalten, eine Antwort<br />
auf die Frage zu finden, was es bedeutet, wenn prominente<br />
Diabetologen wider besseren Wissens behaupten,<br />
die <strong>AOK</strong> vertrete ein Billigprogramm <strong>für</strong><br />
Diabetiker – und gemeint ist der im Einvernehmen<br />
beschlossene Text des Koordinierungsausschusses.<br />
Vielleicht ist es <strong>für</strong> manche Experten<br />
schwer zu ertragen, dass sie sich im fachlichen<br />
Diskurs argumentativ nicht behaupten konnten.<br />
Damit ist auch die Frage beantwortet, was von den ungeheuerlichen<br />
Unterstellungen der DDG zu halten ist, die<br />
<strong>AOK</strong> nehme in Kauf, dass durch ein inkompetent getextetes<br />
DMP mehr Menschen erblinden, Amputationen erleiden<br />
oder an die künstliche Niere müssten als bisher. Tatsache ist<br />
vielmehr: Erstmals in der Geschichte der Diabetikerversorgung<br />
ist jetzt festgehalten worden, dass Ärzte wie Patienten<br />
mit den Kernergebnissen wissenschaftlicher Studien und,<br />
soweit vorhanden, evidenzbasierten Leitlinien vertraut gemacht<br />
werden müssen, ehe das individuelle Therapieziel vereinbart<br />
wird. Und es wird deutlich, wie entscheidende Fortschritte<br />
entsprechend der St.-Vinzenz-Deklaration erzielt<br />
werden können: Unter anderem mit der Bluthochdruck-Behandlung<br />
und der routinierten Versorgung des diabetischen<br />
Fußes. Die Empfehlungen des Koordinierungsausschusses<br />
sind präzise, an jedem Punkt durch wissenschaftliche Belege<br />
begründet und frei von subjektiven Eindrücken. Es empfiehlt<br />
sich, diesen Text neben die Versorgungsleitlinie der<br />
Bundesärztekammer zu legen und dann die Frage zu beantworten,<br />
womit Ärzten und Patienten besser gedient ist.<br />
Wer trotz dieser klaren Situation dabei bleibt, die Umsetzung<br />
der Ergebnisse des Koordinierungsausschusses zur Verbesserung<br />
der Diabetikerversorgung zu sabotieren, wird in<br />
die Geschichte der Medizin als unbelehrbar eingehen. Jetzt<br />
steht eine ganz andere Aufgabe auf der Tagesordnung: diesen<br />
hervorragenden Text zu nutzen, um akkreditierte DMP zu<br />
praktizieren. ◆<br />
Prof. Dr. Norbert Schmacke leitet den Stabsbereich Medizin im <strong>AOK</strong>-<br />
Bundesverband<br />
<strong>Mehr</strong> Infos<br />
Norbert Schmacke ist erreichbar per E-Mail: norbert.schmacke@bv.aok.de<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 13
Professor Michael Berger ist Direktor<br />
der Klinik <strong>für</strong> Stoffwechselkrankheiten<br />
und Ernährung (WHO Collaborating<br />
Center for Diabetes) an der Heinrich-<br />
Heine Universität Düsseldorf<br />
Diabetiker-Versorgung<br />
■ G+G: Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) hat<br />
Ihnen vorgeworfen, „Extrempositionen“ zu vertreten. An<br />
welchen Punkten hat sich die Debatte entzündet?<br />
■ Prof. Michael Berger: Bezüglich der Therapieziele fordern<br />
Vertreter der DDG <strong>für</strong> Patienten mit Typ 2 Diabetes – von<br />
bestimmten Ausnahmen abgesehen – eine Absenkung des<br />
Blutzuckerwertes HbAIc auf unter 6,5 Prozent. Das ist nach<br />
den vorliegenden Befunden nicht gerechtfertigt. Das klinische<br />
Hauptproblem des Typ 2 Diabetes ist die Makroangiopathie,<br />
die Arteriosklerose, aus der Koronare Herzkrankheit,<br />
Herzinfarkt und Schlaganfall folgen können. In mehreren<br />
Studien konnte übereinstimmend kein Nachweis darüber<br />
geführt werden, dass durch eine Verbesserung der Blutzuckereinstellung,<br />
wie eine Senkung des HbA1c unter acht<br />
Prozent, eine Verringerung von Auftreten oder Fortschreiten<br />
der Makroangiopathie erreicht werden kann. Diesbezüglich<br />
müssen die Therapie eines Bluthochdrucks, die<br />
Raucherentwöhnung, die Behandlung mit Mitteln gegen<br />
Fettstoffwechselstörungen und mit Aspirin im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Für jüngere Patienten mit Typ 2 Diabetes stellt auch die<br />
durch krankhaft erhöhten Blutzucker bedingte Mikroangiopathie<br />
ein Risiko dar. Sie äußert sich in Form von Schäden<br />
an der Netzhaut, den Nieren und Nerven. Bei Typ 2<br />
Diabetikern mit einem durchschnittlichen Alter von 53 Jahren<br />
verringert eine Senkung des HbA1c von im Median 7,9<br />
Prozent auf 7,0 Prozent über zehn Jahre das Mikroangiopathie-Risiko<br />
von 11,4 auf 8,6 Prozent. Das bedeutet, dass man<br />
bei 36 Patienten zehn Jahre lang die genannte Senkung des<br />
HbA1c durchhalten muss, um bei einem einzigen Patienten<br />
eine mikroangiopathische Komplikation zu verhindern.<br />
■ Die überwiegende <strong>Mehr</strong>zahl der Patienten mit<br />
Typ 2 Diabetes in Deutschland ist älter als 60 Jahre. Welche<br />
Grenzwerte gelten <strong>für</strong> diese Altersgruppe?<br />
■ Der Diabetes ist oft nur eine relativ unbedeutende Facette<br />
im Spektrum der Alterskrankheiten. Gefahren durch eine<br />
Hyperglykämie-bedingte Mikroangiopathie bestehen bei<br />
Zur Debatte um<br />
die beste Therapie<br />
Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft und der Deutsche Diabetiker<br />
Bund üben Kritik an den Anforderungen, die der Koordinierungsausschuss<br />
<strong>für</strong> Disease-Management-Programme im Bereich Typ 2<br />
Diabetes formuliert hat. Diabetes-Spezialist Prof. Michael Berger<br />
macht deutlich, worum es in dem Streit geht.<br />
diesen Patienten nicht. Haupt-Therapieziele im Bereich des<br />
Diabetes sind nun die Vermeidung von diabetischen Stoffwechselentgleisungen,<br />
Hyperglykämie-bedingten Symptomen<br />
und Diabetes-bedingten Einschränkungen der <strong>Lebensqualität</strong>.<br />
Dies lässt sich mit einer Senkung des HbA1c-Wertes<br />
auf 8,5 bis 9,0 Prozent sehr gut erreichen. Eine Senkung<br />
des HbA1c-Wertes bei diesen Patienten auf unter 6,5 Prozent<br />
ist durch keinerlei wissenschaftliche Befunde zu belegen<br />
– würde aber eine erhebliche Belastung der Patienten<br />
darstellen und wäre als Folge der Pharmakotherapie potenziell<br />
gefährlich.<br />
■ Die Empfehlungen <strong>für</strong> die Pharmakotherapie sind ein<br />
weiterer Stein des Antoßes <strong>für</strong> die DDG. Um welche Medikamente<br />
geht es in der Kritik?<br />
■ Zufolge der Kriterien der evidenzbasierten Medizin müssen<br />
Medikamente in prospektiv-kontrollierten Langzeitstudien<br />
auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit überprüft werden,<br />
bevor sie außerhalb von klinischen Studien eingesetzt<br />
werden können. Leider werden aufgrund der Zulassungsgesetze<br />
immer wieder Medikamente vermarktet, die nicht entsprechenden<br />
Prüfungen unterzogen worden sind. Erst in<br />
derartigen Langzeitstudien konnten die Schädlichkeit der<br />
Sulfonylharnstoffe Tolbutamid und Chlorpropamid und<br />
die Wirksamkeit und Sicherheit von Glibenclamid nachgewiesen<br />
werden. Erst in einer solchen Studie konnte die Gefährlichkeit<br />
der in Deutschland so populären Kombination<br />
von Sulfonylharnstoff- und Metformin-Therapie aufgedeckt<br />
werden. Liegen derartige Prüfungen nicht vor,<br />
kommt es immer wieder zu Arzneimittelskandalen wie<br />
kürzlich mit „Lipobay“. Mit dem Glitazone-Präparat Troglitazone<br />
sind weltweit bereits 800.000 Typ 2 Diabetiker behandelt<br />
worden, bevor es wegen lebensbedrohlicher Nebenwirkungen<br />
vom Markt genommen werden musste. Für die<br />
überwiegende <strong>Mehr</strong>zahl der in Deutschland verordneten<br />
oralen Antidiabetika fehlen die entsprechenden Nachweise<br />
von Wirksamkeit und Sicherheit, so zum Beispiel <strong>für</strong> Glimepiride,<br />
Acarbose, die Glitazone, die Glinide und alle Sulfonylharnstoffe,<br />
außer Glibenclamid.<br />
14 Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang
„Für die <strong>Mehr</strong>zahl der in Deutschland verordneten oralen Antidiabetika<br />
fehlen die Nachweise <strong>für</strong> ihre Wirksamkeit und Sicherheit“<br />
Nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin kommen<br />
im Rahmen der Pharmakotherapie des Typ 2 Diabetes<br />
mellitus nur Human- und Schweine-Insulin, Glibenclamid-Monotherapie<br />
bei Patienten ohne klinisch apparente<br />
koronare Herzkrankheit, Metformin-Monotherapie bei<br />
übergewichtigen Patienten ohne Kontraindikationen gegen<br />
Biguanide in Frage. Dass nur <strong>für</strong> diese Pharmakotherapien<br />
positive Endpunkt-Studien zum Nachweis der Wirksamkeit<br />
und Sicherheit vorliegen, ist unbestritten und auch in der<br />
Nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 Diabetes vom Mai<br />
2002 dokumentiert. Dass nach den Vorstellungen von Vertretern<br />
der DDG und des DDB trotzdem andere orale Antidiabetika<br />
und Insulin-Analoga eingesetzt und trotz enorm<br />
höherer Preise von der gesetzlichen <strong>Kranke</strong>nversicherung<br />
bezahlt werden sollen, ist vollkommen unverständlich –<br />
und mag die Unabhängigkeit einiger Vertreter von DDG<br />
und DDB in Frage stellen.<br />
■ Umstritten sind außerdem bestimmte Screening-Untersuchungen.<br />
Um welche handelt es sich?<br />
■ Vertreter der Deutschen Diabetes-Gesellschaft fordern<br />
die Verpflichtung der Ärzte zur Durchführung von Screening-Untersuchungen<br />
bei allen Typ 2 Diabetikern, die in<br />
ihrer Validität wissenschaftlich nicht bewiesen sind: zum<br />
Beispiel die Durchführung von jährlichen Mikroalbuminurie-Tests,<br />
Untersuchungen auf autonome Neuropathie,<br />
Screening auf Depression. Ohne wissenschaftliche Belege<br />
<strong>für</strong> den Nutzen und den Ausschluss eines Schadens <strong>für</strong> die<br />
betroffenen Patienten sind derartig aufwändige und kostspielige<br />
Maßnahmen aus meiner Sicht <strong>für</strong> die Routine-Versorgung<br />
des Typ 2 Diabetes abzulehnen.<br />
■ Welche Bedeutung hat die Diskussion mit der DDG, beziehungsweise<br />
dem DDB? Wird sie die Disease-Management-Programme<br />
<strong>für</strong> Diabetiker beeinflussen?<br />
■ Falls (Vorstands-)Mitglieder der Deutschen Diabetes-Gesellschaft<br />
und des Deutschen Diabetiker Bundes von der<br />
Teilnahme an den Disease-Management-Programmen <strong>für</strong><br />
Typ 2 Diabetiker, die auf der Grundlage der oben genannten<br />
Empfehlungen konzipiert werden, abraten sollten, erweisen<br />
sie den Betroffenen einen schlechten Dienst. Denn<br />
mit der Teilnahme an einem derartigen Programm wird den<br />
Betroffenen in Deutschland erstmalig garantiert, dass sie<br />
nach dem neuesten Stand der Wissenschaft im Sinne der<br />
evidenzbasierten Medizin betreut werden. Das schließt ein,<br />
dass ihnen – einschließlich qualitätsgesicherter Therapieund<br />
Schulungsprogramme – alles an diagnostischen und<br />
therapeutischen Maßnahmen angeboten wird, <strong>für</strong> das<br />
Prof. Michael Berger, Universität Düsseldorf<br />
Wirksamkeit und Sicherheit nachgewiesen sind, und dass<br />
sie vor ungeprüften, potenziell gefährlichen und <strong>für</strong> sie lästigen<br />
Maßnahmen, wie zum Beispiel täglichen Blutzuckerselbstkontrollen<br />
bei nicht-insulinpflichtigem Typ 2 Diabetes,<br />
geschützt sind.<br />
■ Ist die Kritik der DDG ein Zeichen <strong>für</strong> eine grundlegende<br />
Spaltung der Fachwelt in Bezug auf die Diabetes-Therapie?<br />
■ Seit über 20 Jahren habe ich auf die drohende Spaltung<br />
der Diabetologie, wie sie jetzt offenbar zu werden scheint,<br />
hingewiesen. Ein kleiner Teil der diabetologischen Meinungsbildner<br />
in Deutschland hat immer wieder darauf gedrungen,<br />
die Therapie mit oralen Antidiabetika auf Präpatate<br />
mit erwiesener Wirksamkeit und Sicherheit zu beschränken.<br />
Das entspricht den heute auch vom Gesetzgeber<br />
anerkannten Prinzipien der evidenzbasierten Medizin.<br />
Diese Forderung ist von der überwiegenden <strong>Mehr</strong>zahl der<br />
Diabetologen und vom Vorstand der Deutschen Diabetes-<br />
Gesellschaft abgelehnt worden; im Gegenteil sind – im<br />
Gleichschritt mit der Pharma-Industrie – immer wieder<br />
neue, enorm teure orale Antidiabetika ohne eine Evidenz-<br />
Basis propagiert worden. Derzeit machen evidenzbasierte<br />
Behandlungen mit oralen Antidiabetika (Glibenclamid-<br />
Monotherapie; Metformin-Monotherapie bei übergewichtigen<br />
Typ 2 Diabetikern) weniger als 15 Prozent an<br />
dem Gesamtumsatz aus, den die gesetzliche <strong>Kranke</strong>nversicherung<br />
aus den Mitteln der Solidargemeinschaft <strong>für</strong> in<br />
ihrer Wirksamkeit und Sicherheit ungeprüfte orale Antidiabetika<br />
bezahlt. Das ist in verschiedener Hinsicht skandalös.<br />
■ Wie begegnen Sie der Kritik der DDG?<br />
■ Die DDG als gemeinnütziger Verein und deren Vorstand<br />
haben keinerlei Legitimation zur Abgabe von verbindlichen<br />
wissenschaftlichen Stellungnahmen. Das wird<br />
aus den Modalitäten <strong>für</strong> die Rekrutierung der Vereinsmitglieder<br />
und <strong>für</strong> die Wahl des Vorstands deutlich. Die diesbezügliche<br />
Legitimation eines Diabetologen ist in seinem/ihrem<br />
wissenschaftlichen œvre durch Publikationen,<br />
wissenschaftliche Auszeichnungen und Führungspositionen<br />
im internationalen Bereich, ausgewiesenen Kenntnissen<br />
in Evidence-based Medicine (Clinical Epidemiology)<br />
sowie durch den Nachweis der Unabhängigkeit von der<br />
Pharma-Industrie und von anderen Profit-orientierten Interessengruppen<br />
begründet. Insofern ergibt sich <strong>für</strong> mich<br />
über die inhaltlichen Argumente hinaus kein Anhalt, der<br />
Kritik seitens einzelner oder mehrerer Vorstandsmitglieder<br />
der DDG zu begegnen.<br />
Gesundheit und Gesellschaft SPEZIAL 7-8/02, 5. Jahrgang 15
Fünf Fragen, fünf Antworten:<br />
Disease-Management auf einen Blick<br />
■ Was sind die Ziele des Disease-Managements?<br />
Das Ziel der Disease-Management-Programme (DMP) ist,<br />
die Versorgung von <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong>n in der gesetzlichen<br />
<strong>Kranke</strong>nversicherung zu verbessern. Patienten, die unter lang<br />
andauernden Krankheiten leiden, sollen durch eine gut abgestimmte,<br />
kontinuierliche Betreuung und Behandlung vor<br />
Folgeschäden, beim Diabetes beispielsweise Amputationen<br />
und Nierenfunktionsstörungen, weitgehend bewahrt werden.<br />
Zu den regelmäßigen Arzt-Patienten-Gesprächen und medizinischen<br />
Kontrollen kommen Informationen <strong>für</strong> den Patienten,<br />
mit denen dieser seine Krankheit besser einschätzen lernt.<br />
Das stärkt die Eigenaktivität und die Gesundheitskompetenzen<br />
des Patienten und verbessert außerdem seine <strong>Lebensqualität</strong>.<br />
■ Wie sind die DMP aufgebaut?<br />
Im Rahmen des Disease-Managements in Deutschland sind<br />
strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramme <strong>für</strong><br />
bisher vier <strong>chronisch</strong>e Krankheiten vorgesehen: Diabetes mellitus<br />
(Typ 1 und Typ 2), <strong>chronisch</strong>e Atemwegserkrankungen<br />
(Asthma und COPD), Brustkrebs und Koronare Herzkrankheit.<br />
Die Teilnahme an einem DMP ist <strong>für</strong> Patient wie Arzt<br />
freiwillig, unterliegt allerdings bestimmten Voraussetzungen,<br />
beispielsweise muss der Patient grundsätzlich zur aktiven Mitwirkung<br />
bereit sein. Diagnostische und therapeutische Maßnahmen,<br />
die auf einer aktuellen und gesicherten Auswertung<br />
medizinischer Forschung (evidenzbasierte Medizin) beruhen,<br />
erfolgen in Abstimmung mit dem Patienten. Nach ausführlicher<br />
Aufklärung über Nutzen und Risiken legt der behandelnde<br />
Arzt gemeinsam mit dem Patienten individuelle Therapieziele.<br />
■ Was sind evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen?<br />
Welche Studien aussagekräftig, welche Therapien ausreichend<br />
erprobt und welche Medikamente wirksam sind – das ist <strong>für</strong><br />
den einzelnen Arzt häufig kaum mehr überschaubar. Medizinische<br />
Leitlinien sind Empfehlungen <strong>für</strong> gutes ärztliches Handeln.<br />
Sie gehen von der Überlegung aus, das aktuelle mediinische<br />
Wissen in konkrete Vorschläge <strong>für</strong> Prävention, Diagnostik,<br />
Therapie und Nachsorge von Krankheiten umzusetzen.<br />
Evidenzbasierte Entscheidungsgrundlagen – im Rahmen<br />
vom Disease-Management der <strong>AOK</strong> vorgesehen – geben sol-<br />
Spezial ist eine Verlagsbeilage von G+G<br />
Impressum: Gesundheit und Gesellschaft,<br />
Kortrijker Str. 1, 53177 Bonn<br />
Redaktion: Änne Töpfer,<br />
Hans-Bernhard Henkel<br />
Grafik: Beatrice Hofmann<br />
che konkreten Handlungsvorschläge, <strong>für</strong> die sich Arzt und Patient<br />
gemeinsam entscheiden können. Sie leiten sich ab aus<br />
der evidenzbasierten Medizin, die Wissen aus systematischer<br />
Forschung und der klinischen Erfahrtung des Arztes zusammenführt.<br />
Die Entscheidungsgrundlagen sind jedoch keine<br />
„Rezeptbücher“ <strong>für</strong> eine „Kochbuchmedizin“, sondern lassen<br />
dem Arzt seine Behandlungs- und dem Patienten seine Entscheidungsfreiheit.<br />
■ Was ist „Curaplan“ der <strong>AOK</strong>?<br />
Curaplan ist das DMP der Gesundheitskasse. Im <strong>AOK</strong>-Konzept,<br />
wie es jetzt <strong>für</strong> Typ 2 Diabetiker in der Praxis getestet<br />
wird, ist der behandelnde Arzt – in der Regel der Hausarzt –<br />
der zentrale Disease-Manager. Chronisch <strong>Kranke</strong> haben meistens<br />
einen Hausarzt, den sie als ersten zu Rate ziehen. Das<br />
Vertrauen, das aufgrund der regelmäßigen Gespräche zwischen<br />
Arzt und Patient entsteht, ist eine wichtige Grundlage<br />
<strong>für</strong> eine langfristige, wirksame, vom Patienten akzeptierte Betreuung.<br />
Häufig haben die Patienten mehrere Erkrankungen<br />
gleichzeitig (Multimorbidität): Der behandelnde Arzt hat den<br />
besten Überblick darüber und kann die Rolle eines Koordinators<br />
zwischen den verschiedenen medizinischen Disziplinen<br />
und Sektoren übernehmen. Curaplan bietet den Patienten<br />
umfangreiche Informationen und Schulungen, die es ihnen<br />
ermöglichen, ihre Erkrankung besser zu verstehen und selbst<br />
den Verlauf zu beeinflussen. Der Patient kann selbst körperliche<br />
Daten ermitteln und lernt, daraus die richtigen Konsequenzen<br />
zu ziehen.<br />
■ Welche Folgen haben DMP <strong>für</strong> den<br />
Risikostrukturausgleich?<br />
Bisher wurde das finanzielle Ungleichgewicht zwischen Kassen<br />
mit vielen jungen, einkommensstarken Versicherten und<br />
Kassen mit vielen alten, <strong>chronisch</strong> krankenVersicherten durch<br />
den Risikostrukturausgleich (RSA) nur ungenügend abgefedert.<br />
Durch die RSA-Reform erhalten jetzt <strong>Kranke</strong>nkassen <strong>für</strong><br />
Versicherte, die in akkreditierte DMP eingeschrieben sind,<br />
mehr Geld aus dem Finanzausgleich als Kassen, die keine Versicherten<br />
in solchen Programmen haben. Damit wurde die sozialpolitische<br />
Forderung berücksichtigt, die hohen Behandlungskosten<br />
<strong>für</strong> <strong>chronisch</strong> <strong>Kranke</strong> gerechter zu verteilen.<br />
Verantwortlich: Stabsbereich Medizin<br />
des <strong>AOK</strong>-Bundesverbandes<br />
Stand: Juli 2002