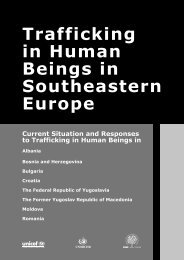Jeder Tropfen zählt: Wasser ist Leben - Unicef
Jeder Tropfen zählt: Wasser ist Leben - Unicef
Jeder Tropfen zählt: Wasser ist Leben - Unicef
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Für Kinder bewegen wir Welten<br />
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen<br />
<strong>Jeder</strong> <strong>Tropfen</strong> <strong>zählt</strong>:<br />
<strong>Wasser</strong> <strong>ist</strong> <strong>Leben</strong><br />
Die Versorgung mit Trinkwasser und hygienischen Sanitäreinrichtungen bleibt<br />
eine der großen Herausforderungen der Menschheit. Noch immer haben rund<br />
1,1 Milliarden Menschen nicht genug sauberes <strong>Wasser</strong> zum <strong>Leben</strong>. 2,4<br />
Milliarden – mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung – müssen ohne Latrinen<br />
und ohne Abwasserentsorgung auskommen. Verunreinigtes <strong>Wasser</strong> und<br />
mangelnde Hygiene zählen zu den Hauptursachen für die in vielen Ländern<br />
noch sehr hohe Kindersterblichkeit. Denn wo sauberes <strong>Wasser</strong> und sanitäre<br />
Einrichtungen fehlen, verbreiten sich Krankheitserreger und Parasiten<br />
besonders schnell. So werden Durchfallerkrankungen, Malaria, Hepatitis A oder<br />
Wurminfektionen durch verseuchtes <strong>Wasser</strong> übertragen. Ein Viertel der<br />
Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren gehen auf diese Krankheiten zurück.<br />
Schätzungen zufolge sterben jährlich mehr als 1,6 Millionen Kinder an<br />
Krankheiten, die mit verschmutztem <strong>Wasser</strong> zusammenhängen - etwa alle 20<br />
Sekunden ein Kind.<br />
Zahlen und Fakten<br />
information<br />
• In den 90er Jahren haben 816 Millionen Menschen zusätzlich Zugang zu sauberem<br />
Trinkwasser erhalten, das sind 224.000 pro Tag. Im gleichen Zeitraum <strong>ist</strong> die Weltbevölkerung<br />
jedoch um 15 Prozent gestiegen.<br />
• Die Länder südlich der Sahara leiden am stärksten unter <strong>Wasser</strong>mangel. Hier verfügt<br />
im Schnitt nur jeder zweite Einwohner über ausreichend Trinkwasser. Die Bewohner<br />
Südasiens haben mit Abstand den schlechtesten Zugang zu sanitären Einrichtungen.<br />
Nur 34 Prozent von ihnen sind an ein Abwassersystem angeschlossen.<br />
• <strong>Wasser</strong>mangel trägt entscheidend dazu bei, dass Mädchen nicht zur Schule gehen<br />
können. Denn die <strong>Wasser</strong>beschaffung <strong>ist</strong> vielerorts traditionell ihre Aufgabe. Jeden<br />
Tag legen sie lange Wege zur nächsten <strong>Wasser</strong>stelle zurück, um ein paar Liter <strong>Wasser</strong><br />
zu besorgen.<br />
• Durch die Verbesserung der <strong>Wasser</strong>versorgung und der hygienischen <strong>Leben</strong>sbedingungen,<br />
insbesondere durch einfaches Händewaschen mit <strong>Wasser</strong> und Seife, ließe<br />
sich die Anzahl der Durchfallerkrankungen um 26 Prozent senken.<br />
• Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) braucht der Mensch mindestens<br />
20 Liter sauberes <strong>Wasser</strong> am Tag, um gesund leben zu können: Drei bis fünf<br />
Liter zum Trinken und Kochen, den Rest für die Hygiene. Für größere Familien<br />
kommen demnach Mindestwassermengen zusammen, die ohne einen <strong>Wasser</strong>anschluss<br />
in der Nähe unmöglich beschafft werden können.<br />
Deutsches Komitee für UNICEF e.V. • Höninger Weg 104 • 50969 Köln • Telefon: 02 21/9 36 50-0 • Telefax: 02 21/9 36 50-279<br />
E-Mail: mail@unicef.de • Internet: www.unicef.de • Spendenkonto Nr. 300 000 • Bank für Sozialwirtschaft Köln (BLZ 370 205 00)
1. Die Hygienekatastrophe<br />
Sauberes Trinkwasser wie auch der Zugang zu Latrinen und Abwasserentsorgung sind<br />
Grundvoraussetzungen für Gesundheit und Entwicklung. Doch während die<br />
Weltbevölkerung weiter wächst, wird das <strong>Wasser</strong> immer knapper. Immer mehr<br />
Regierungen bekennen sich deshalb zu einer nachhaltigen <strong>Wasser</strong>wirtschaft. Zielvorgabe<br />
sind die UN-Millenniumserklärung und der Bericht von UN-Generalsekretär Kofi<br />
Annan zum Weltkindergipfel, nach dem bis zum Jahr 2015 die Anzahl der Menschen<br />
ohne ausreichend sauberes <strong>Wasser</strong> und ohne hygienische Sanitäreinrichtungen halbiert<br />
werden soll. Bis 2025 soll dann jeder Zugang zu sauberem Trinkwasser, Latrinen und<br />
Abwasserentsorgung haben. Dies erfordert verstärkte Anstrengungen, denn bis zum Jahr<br />
2025 wird auch die Weltbevölkerung um voraussichtlich 30 Prozent zunehmen.<br />
Trinkwasser: Einer von sechs Menschen hat nicht genug <strong>Wasser</strong> zum <strong>Leben</strong><br />
In den letzten zehn Jahren haben über 816 Millionen Menschen Zugang zu sauberem<br />
Trinkwasser erhalten. Prozentual gesehen hat sich die weltweite Versorgung mit sauberem<br />
<strong>Wasser</strong> in Folge des Bevölkerungswachstums jedoch kaum verbessert: Sie <strong>ist</strong> um nur drei<br />
Prozentpunkte auf 82 Prozent gestiegen.<br />
Die Mehrzahl der Menschen, die mit weniger als dem Ex<strong>ist</strong>enzminimum von 20 Litern<br />
<strong>Wasser</strong> am Tag auskommen müssen, lebt in den Ländern südlich der Sahara. In Äthiopien<br />
hat zum Beispiel nur jeder vierte Einwohner (24 Prozent) ausreichend Trinkwasser.<br />
Äthiopien führt damit die L<strong>ist</strong>e der Länder an, in denen die <strong>Wasser</strong>versorgung am wenigsten<br />
gewährle<strong>ist</strong>et <strong>ist</strong>, gefolgt von Tschad (27 Prozent) und Mauretanien (37 Prozent).<br />
Besonders benachteiligt <strong>ist</strong> die Landbevölkerung: Mehr als ein Viertel der Menschen, die<br />
auf dem Land leben, haben keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser. In Bolivien zum<br />
Beispiel sind 95 Prozent der Stadtbevölkerung an die <strong>Wasser</strong>versorgung angeschlossen,<br />
2<br />
100<br />
Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Veränderungen beim Zugang zu sauberem Trinkwasser<br />
48<br />
1990<br />
2000<br />
57<br />
Afrika<br />
südl. d.<br />
Sahara<br />
Quelle: UNICEF<br />
70<br />
76<br />
Ostasien<br />
und<br />
Pazifik<br />
91<br />
85 86 87<br />
80 81 83 83<br />
Südasien<br />
Lateinamerika<br />
und Karibik<br />
GUS- und<br />
Baltikumstaaten<br />
Naher<br />
Osten und<br />
Nordafrika<br />
100 100<br />
Industrieländer
während auf dem Land nur jeder zweite Haushalt einen <strong>Wasser</strong>anschluss oder einen<br />
Brunnen in erreichbarer Nähe hat.<br />
Hygienische Sanitäreinrichtungen: Größter Bedarf in Südasien<br />
Dass der Mensch <strong>Wasser</strong> zum <strong>Leben</strong> braucht, <strong>ist</strong> jedem verständlich. Dass aber auch der<br />
Zugang zu hygienischen Sanitäranlagen und Abwasserentsorgung für ein gesundes<br />
<strong>Leben</strong> unabdingbar <strong>ist</strong>, <strong>ist</strong> auf den ersten Blick weniger offensichtlich. Das Problem des<br />
Mangels an hygienischen Sanitäreinrichtungen wurde deshalb lange Zeit als zweitrangig<br />
angesehen. Tatsächlich liegt im Fehlen von ausreichenden Latrinen und<br />
Kanalisationssystemen jedoch eine wesentliche Ursache für zahlreiche Krankheiten.<br />
1990 hatten nur 55 Prozent der Weltbevölkerung die Möglichkeit, eine Toilette zu benutzen.<br />
Inzwischen haben weitere 747 Millionen Menschen Zugang zu Sanitäreinrichtungen<br />
erhalten. Das entspricht einer Verbesserung um fünf Prozentpunkte. Weiterhin<br />
haben jedoch zwei von fünf Menschen keine andere Wahl, als ihre Notdurft an offenen<br />
Kanälen zu verrichten und ihre Abwässer in Flüsse oder andere Gewässer zu leiten.<br />
80 Prozent derjenigen, die ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen auskommen müssen,<br />
leben in Asien. In Kambodscha zum Beispiel sind gerade einmal 17 Prozent der Bevölkerung<br />
an das Abwassersystem angeschlossen. In Indien hat nur jeder dritte Einwohner<br />
Zugang zu einer Latrine.<br />
Die Landbevölkerung <strong>ist</strong> auch im Hinblick auf die sanitären Anlagen schlechter gestellt<br />
als die Stadtbevölkerung: Nahezu zwei Drittel der Menschen, die auf dem Land leben,<br />
müssen ohne Abwasserentsorgung auskommen. Das Gesundheitsrisiko, das durch den<br />
Mangel an Latrinen entsteht, <strong>ist</strong> jedoch in großen Städten und überall dort, wo viele<br />
Menschen auf engem Raum zusammenleben, wesentlich höher. In Flüchtlingslagern<br />
breiten sich zum Beispiel Darmkrankheiten wie Durchfall und Cholera, aber auch<br />
Wurminfektionen in Windeseile aus.<br />
100<br />
Prozent<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Fortschritte bei hygienischen Sanitäreinrichtungen<br />
25<br />
1990<br />
2000<br />
34<br />
Südasien<br />
Quelle: UNICEF<br />
38<br />
48<br />
Ostasien<br />
und<br />
Pazifik<br />
55<br />
53<br />
Afrika<br />
südl. d.<br />
Sahara<br />
67<br />
77<br />
Lateinamerika<br />
und Karibik<br />
76<br />
83<br />
Naher Osten<br />
und<br />
Nordafrika<br />
91<br />
GUS- und<br />
Baltikumstaaten<br />
98 100<br />
Industrieländer<br />
3
2. Verseuchtes <strong>Wasser</strong> macht krank<br />
Im Jahr 2000 sind weltweit knapp elf Millionen Kinder unter fünf Jahren gestorben. Ihr<br />
Tod <strong>ist</strong> in den me<strong>ist</strong>en Fällen nicht auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen, vielmehr<br />
kommen zume<strong>ist</strong> unzureichende medizinische Versorgung, Mangelernährung sowie<br />
verunreinigtes Trinkwasser, mangelnde Hygiene und die dadurch bedingten Krankheiten<br />
zusammen. Unbestritten <strong>ist</strong> jedoch, dass erheblich weniger Kinder sterben, wenn sie<br />
Zugang zu sauberem Trinkwasser und hygienischen Sanitäreinrichtungen haben.<br />
In Südasien hat sich zum Beispiel die Trinkwasserversorgung im Zeitraum von 1990 bis<br />
2000 wesentlich verbessert. Auch die Ausstattung mit sanitären Anlagen <strong>ist</strong> –<br />
wenngleich weltweit weiterhin die niedrigste – um zwölf Prozentpunkte gestiegen. Im<br />
gleichen Zeitraum <strong>ist</strong> die Kindersterblichkeit in Südasien von 128 auf 100 pro 1.000<br />
<strong>Leben</strong>dgeburten gesunken.<br />
Durchfallerkrankungen sind eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Durchfall<br />
entzieht dem Organismus schnell große Mengen an lebenswichtiger Flüssigkeit, so dass<br />
der Körper regelrecht austrocknet. Durchfall wird durch unsauberes <strong>Wasser</strong> und<br />
mangelnde Hygiene ausgelöst, <strong>ist</strong> aber auch Ursache und Folge von Mangelernährung:<br />
Chronisch mangelernährte Kinder sind anfälliger für Durchfallerkrankungen. Ebenso<br />
vermindern wiederholt auftretende Durchfälle den Appetit, hemmen die<br />
Nahrungsaufnahme und entziehen dem Körper wichtige Nährstoffe.<br />
Krankheit und Tod bringen nicht nur unermessliches Leid mit sich, sie verschärfen auch<br />
die Armutssituation der betroffenen Familien: Ein Mitglied der Familie muss sich um<br />
den Kranken kümmern und kann deshalb nicht zur Schule gehen oder zum<br />
Familieneinkommen beitragen. Arztbesuche und Medikamente verursachen hohe<br />
Kosten. Schätzungen zufolge entstehen zum Beispiel in Nepal, wo nur ein Viertel der<br />
Haushalte Zugang zu Latrinen und Abwasserentsorgung haben, jährliche Kosten in Höhe<br />
von rund 150 Millionen Dollar durch Krankheiten, die unter verbesserten hygienischen<br />
Bedingungen in diesem Ausmaß nicht vorkommen würden.<br />
3. <strong>Wasser</strong>mangel: Mädchen und Frauen tragen die Last<br />
In vielen Ländern <strong>ist</strong> <strong>Wasser</strong>holen traditionell Frauensache. Das <strong>Wasser</strong>holen kostet die<br />
Mädchen oft mehrere Stunden am Tag – diese Zeit fehlt häufig für den Schulbesuch.<br />
Viele Schulen verfügen zudem nicht über ausreichende sanitäre Einrichtungen für<br />
Mädchen. Nach Schätzungen von UNICEF besucht jedes zehnte Mädchen in Afrika<br />
während der Menstruation keinen Unterricht oder verlässt die Schule schließlich ganz,<br />
weil saubere und nach Geschlechtern getrennte Sanitäranlagen für Schülerinnen fehlen.<br />
Weltweit werden 65 Millionen Mädchen gar nicht erst eingeschult. In Sierra Leone, wo<br />
nur knapp drei Fünftel der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, können<br />
zum Beispiel 77 Prozent der erwachsenen Frauen nicht lesen und schreiben. Über die<br />
Hälfte der Mädchen gehen nicht zur Schule.<br />
4
Die Folgen von verschmutztem <strong>Wasser</strong> und mangelnder Hygiene –<br />
und was dagegen getan werden kann<br />
Durchfallerkrankungen<br />
(einschließlich Cholera)<br />
Malaria<br />
Sch<strong>ist</strong>osomiasis<br />
(Erkrankung durch<br />
Parasiten)<br />
Typhus<br />
Hepatitis A<br />
(Leberinfektion)<br />
Trachom<br />
(leicht übertragbare<br />
Augeninfektion)<br />
Quelle: WHO, 2001<br />
• 2,2 Mio. Todesfälle pro<br />
Jahr, knapp die Hälfte<br />
davon sind Kinder unter<br />
fünf Jahren.<br />
• 1 Mio. Todesfälle pro<br />
Jahr; überwiegend Kinder<br />
unter fünf Jahren.<br />
• 300 Mio. Menschen erkranken<br />
pro Jahr, 90 Prozent<br />
davon in den Ländern<br />
südlich der Sahara.<br />
• 200 Mio. Erkrankungen<br />
pro Jahr, davon 118 Mio<br />
Kinder und Jugendliche<br />
unter 15 Jahren<br />
• 20 Mio. Menschen leiden<br />
unter schwerwiegenden<br />
Folgen (Wurmbefall<br />
der inneren Organe).<br />
• Schätzungen zufolge 17<br />
Mio. Erkrankungen pro<br />
Jahr, insbesondere in<br />
Ländern ohne flächendeckendeTrinkwasserversorgung.<br />
• 1,5 Mio. klinische Fälle<br />
pro Jahr, überwiegend<br />
ältere Kinder und<br />
Erwachsene.<br />
• Derzeit sind ca. 6 Mio.<br />
Menschen durch das<br />
Trachom erblindet.<br />
• 146 Mio. Menschen sind<br />
in Behandlung.<br />
• Zugang zu sauberem Trinkwasser<br />
und sanitärer Basisausstattung<br />
würde die<br />
Anzahl der Erkrankungen<br />
um 26 Prozent, die der<br />
Todesfälle um 65 Prozent<br />
reduzieren.<br />
• Durch besseres <strong>Wasser</strong>management<br />
ließe sich die<br />
Krankheit erheblich eindämmen<br />
(Übertragung<br />
durch Moskitos, die ihre<br />
Eier in stehendem Gewässer<br />
ablegen).<br />
• Parasiten gelangen über die<br />
Ausscheidungen von<br />
erkrankten Personen in den<br />
<strong>Wasser</strong>kreislauf. Durch<br />
sanitäre Einrichtungen<br />
ließe sich die Krankheit um<br />
77 Prozent reduzieren.<br />
• Sauberes <strong>Wasser</strong>, Hygiene<br />
und Sanitäreinrichtungen<br />
verhindern die Ausbreitung<br />
von Typhus.<br />
• Der Erreger von Hepatitis A<br />
wird im Stuhl ausgeschieden,<br />
Latrinen tragen deshalb<br />
erheblich zur Eindämmung<br />
der Krankheit bei.<br />
• Durch sauberes Trinkwasser<br />
und Hygieneerziehung<br />
kann die Anzahl der Erkrankungen<br />
um mindestens 25<br />
Prozent reduziert werden.<br />
5
Meskerem, 14 Jahre<br />
Die 14-jährige Meskerem hat Glück. Auf ihrem Schulgelände hat UNICEF eine<br />
<strong>Wasser</strong>pumpe errichtet, die von einem Windrad angetrieben wird. In Äthiopien hat<br />
nur ein Viertel der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser. Mädchen und<br />
Frauen werden häufig auf dem Weg zur <strong>Wasser</strong>stelle entführt oder vergewaltigt.<br />
Meskerem muss nun nicht mehr wie viele andere Mädchen im Schulalter mehrere<br />
Stunden am Tag zur nächsten <strong>Wasser</strong>stelle gehen. Außerdem muss sie keine Angst<br />
haben, überfallen zu werden. Dank der <strong>Wasser</strong>pumpe im Dorf hat Meskerem nun<br />
Zeit, in die Schule zu gehen.<br />
4. <strong>Wasser</strong>reserven schützen<br />
<strong>Wasser</strong> bedeckt zwei Drittel der Erdoberfläche. Aber nur 2,5 Prozent davon sind<br />
Süßwasservorkommen. Diese liegen allerdings zum Großteil unerreichbar unter der Erde<br />
oder sind in den polaren Eiskappen gebunden, so dass nur ein Prozent des Süßwassers<br />
(bzw. 0,007 Prozent des weltweiten <strong>Wasser</strong>vorkommens) den Menschen unmittelbar<br />
zugänglich <strong>ist</strong>.<br />
Nach der Definition von Hydrologen besteht <strong>Wasser</strong>mangel, wenn ein Land<br />
weniger als 1.000 Kubikmeter sich erneuerndes Süßwasser pro Kopf und pro Jahr<br />
zur Verfügung hat. Dies <strong>ist</strong> vor allem in Vorderasien (Kuwait, Gaza Streifen und<br />
Vereinigte Arabische Emirate) und in Nordafrika (Libyen und Algerien) der Fall.<br />
Saudi-Arabien hatte zum Beispiel im Jahr 2002 nur 118 Kubikmeter <strong>Wasser</strong> pro<br />
Kopf zur Verfügung. Es <strong>zählt</strong> damit zu den zehn wasserärmsten Ländern der Erde.<br />
Trotzdem haben 95 Prozent der Einwohner Saudi-Arabiens Zugang zu<br />
Trinkwasser. Denn das Land <strong>ist</strong> reich genug, um den <strong>Wasser</strong>mangel durch<br />
Grundwasserbohrungen, Meerwasserentsalzung und Abwasseraufbereitung<br />
auszugleichen. Äthiopien – im Vergleich – gehörte mit 1.749 Kubikmetern <strong>Wasser</strong><br />
pro Kopf im Jahr 2002 zwar noch zu den Ländern mit ausreichender<br />
<strong>Wasser</strong>versorgung. Hier fehlt es jedoch an der nötigen Infrastruktur, um das<br />
vorhandene <strong>Wasser</strong> zu erschließen und gerecht zu verteilen: Drei Viertel der<br />
Einwohner Äthiopiens haben nicht genug <strong>Wasser</strong> zum <strong>Leben</strong>.<br />
Der weltweite <strong>Wasser</strong>verbrauch hat sich innerhalb der letzten 70 Jahre versechsfacht und<br />
<strong>ist</strong> damit überproportional zur Weltbevölkerung gestiegen. Durch Verunreinigung mit<br />
Schadstoffen und Übernutzung nehmen die weltweit verfügbaren <strong>Wasser</strong>ressourcen<br />
immer weiter ab. Im Jahr 2015 werden voraussichtlich 2,7 Milliarden Menschen in<br />
Regionen mit großer <strong>Wasser</strong>knappheit leben. Zwischen Ländern, die ihr <strong>Wasser</strong> aus der<br />
gleichen Quelle beziehen, sind die knappen <strong>Wasser</strong>bestände immer wieder Anlass zu<br />
Konflikten. Schließlich betrifft die Erschöpfung oder Verschmutzung eines<br />
6
grenzüberschreitenden <strong>Wasser</strong>systems jeweils auch die Nachbarstaaten. Weltweit gibt es<br />
über 200 grenzüberschreitende Flüsse und Seen, in deren <strong>Wasser</strong>einzugsgebiet rund 40<br />
Prozent der Weltbevölkerung leben.<br />
Der „Löwenanteil“ des Süßwassers (70 Prozent) fließt in die Landwirtschaft, 20 Prozent<br />
dienen industriellen Zwecken und nur zehn Prozent werden privat genutzt. Schon jetzt<br />
werden über 40 Prozent der Nahrungsmittel weltweit mit künstlicher Bewässerung<br />
erzeugt. Um auf dem internationalen Markt zu bestehen, steigern die Länder ihre<br />
Agrarproduktion selbst dort, wo das Klima den Anbau bestimmter Pflanzen nicht<br />
zulässt. Für die Bewässerung von Tomaten in Spanien oder Baumwollplantagen in<br />
Russland werden zum Beispiel riesige <strong>Wasser</strong>mengen von den Flüssen und Seen<br />
abgezapft und umgeleitet. Die ökologischen Langzeitzeitschäden dieser Praxis nimmt<br />
man zugunsten der internationalen Konkurrenzfähigkeit in Kauf. Immer wieder<br />
gelangen auch Schädlingsbekämpfungsmittel und chemische Zusätze zur Steigung der<br />
Ernteerträge in das Grundwasser.<br />
Megastädte: Immenser <strong>Wasser</strong>bedarf, zu wenig Kläranlagen<br />
Die Zahl der Millionenstädte – gegenwärtig weltweit über 300 – wird sich in den<br />
kommenden Jahrzehnten verdoppeln. Die Städte beziehen ihr <strong>Wasser</strong> größtenteils aus<br />
Grundwasserreserven. Bangkok beispielsweise pumpt täglich eine Million Kubikmeter<br />
<strong>Wasser</strong> aus unterirdischen <strong>Wasser</strong>reservoirs, um seine Bevölkerung zu versorgen. Die<br />
Menge übersteigt bei weitem die natürliche Regeneration der Quellen. Durch die derart<br />
intensive Nutzung der <strong>Wasser</strong>reserven sinkt schon jetzt in zahlreichen Ländern, vor<br />
allem in Mexiko, Indien und China der Grundwasserspiegel jährlich um mehr als einen<br />
Meter. Meereswasser droht in die leeren Grundwasserbecken einzudringen und die<br />
Trinkwasserbrunnen zu verseuchen.<br />
Schätzungen zufolge leben in den Entwicklungsländern bereits jetzt die Hälfte aller<br />
Stadtbewohner in Armutsvierteln. Die Stadtverwaltungen überlassen die Slums oftmals<br />
sich selbst: Viele Familien sind weder an die <strong>Wasser</strong>versorgung noch an die Kanalisation<br />
und Müllentsorgung angeschlossen. Aufgrund der fehlenden Infrastruktur sind Millionen<br />
Menschen auf <strong>Wasser</strong>händler oder <strong>Wasser</strong> in Flaschen angewiesen. Die Preise dafür sind<br />
wesentlich höher als bei einer Versorgung durch die <strong>Wasser</strong>werke. In Lima zahlen die<br />
Familien, die auf <strong>Wasser</strong>verkäufer angewiesen sind, beispielsweise<br />
20 Mal mehr für ihr <strong>Wasser</strong> als eine Mittelschichtfamilie, die an das Trinkwassernetz<br />
angeschlossen <strong>ist</strong>. Dabei können sie noch nicht einmal sicher sein, sauberes <strong>Wasser</strong> zu<br />
erhalten. Es kommt immer wieder vor, dass verschmutztes <strong>Wasser</strong> verkauft wird.<br />
Die ohnehin knappen Süßwasserreserven werden zudem durch die städtischen Abwässer<br />
verschmutzt. In Indien haben zum Beispiel nur zwei Drittel der Stadtbevölkerung<br />
Zugang zu hygienischen Sanitäreinrichtungen. Abwässer und Abfälle werden ungeklärt<br />
in die Kanäle und Flüsse geleitet. Der Jamuna, ein Strom, der durch Neu-Delhi fließt,<br />
besteht im Sommer zu 100 Prozent aus Abwasser. Weltweit sind die Hälfte aller Flüsse<br />
und Seen stark verschmutzt.<br />
7
Arsen: Eine unsichtbare Bedrohung<br />
Die Qualität des Trinkwassers leidet nicht nur unter der Verschmutzung durch den<br />
Menschen, sondern kann auch von Natur aus unzureichend sein. <strong>Wasser</strong>, das durch<br />
arsenhaltiges Gestein geflossen <strong>ist</strong>, we<strong>ist</strong> häufig Bestandteile dieses Gifts auf. In<br />
weiten Teilen Asiens, insbesondere in Bangladesch, Ostindien und Vietnam sind<br />
zahlreiche Brunnen mit Arsen verseucht.<br />
Arsen <strong>ist</strong> unsichtbar, geschmacklos und geruchlos. Es kann nur durch <strong>Wasser</strong>tests<br />
nachgewiesen werden. Der regelmäßige Genuss von mit Arsen verseuchtem<br />
<strong>Wasser</strong> führt zur Vergiftung. Die ersten Symptome – Hautveränderungen und<br />
dunkle Flecken auf Händen und Füßen – treten erst nach fünf bis zehn Jahren auf.<br />
Bleibt dem Menschen keine andere Wahl, als das verseuchte <strong>Wasser</strong> dennoch<br />
weiter zu trinken, kommt es wenige Jahre später zu schwerwiegenden<br />
Erkrankungen, insbesondere dem so genannten Arsenkrebs.<br />
UNICEF hat in den siebziger Jahren Hunderttausende Brunnen in Bangladesch<br />
gebaut. Als 1993 entdeckt wurde, dass große Teile des Grundwassers mit Arsen<br />
verseucht sind, hat UNICEF sofort Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung vor<br />
dem verseuchten Brunnenwasser zu schützen: UNICEF unterstützt die Regierung<br />
bei der flächendeckenden Prüfung der <strong>Wasser</strong>qualität und klärt die Dorfbewohner<br />
über die Symptome einer Arsenvergiftung auf. Inzwischen sind 1,2 Millionen<br />
Brunnen getestet worden: 30 % der getesteten Brunnen sind mit Arsen verseucht.<br />
Hier müssen neue <strong>Wasser</strong>quellen gefunden werden.<br />
5. <strong>Wasser</strong> – Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung<br />
<strong>Wasser</strong> <strong>ist</strong> seit jeher ein zentrales Thema der Entwicklungszusammenarbeit. Während<br />
die <strong>Wasser</strong>knappheit anfänglich jedoch eher als technisches Problem gesehen wurde, das<br />
auf bestimmte Länder begrenzt <strong>ist</strong>, sucht man inzwischen zunehmend nach globalen<br />
Lösungen. Dahinter steht die Erkenntnis, dass ohne einen sinnvollen Umgang mit der<br />
Ressource <strong>Wasser</strong> alle anderen Ansätze der Entwicklungspolitik zum Scheitern verurteilt<br />
sind. Dementsprechend waren die Themen <strong>Wasser</strong> und Hygiene auch<br />
Schwerpunktthemen des Weltumweltgipfels 2002 in Johannesburg. Es müssen Wege<br />
gefunden werden, wie <strong>Wasser</strong> gewonnen und genutzt werden kann, ohne die Ressourcen<br />
zu erschöpfen. Dazu gehören die Abwasseraufbereitung, das Auffangen von<br />
Regenwasser oder die Meerwasserentsalzung.<br />
Anlässlich des Internationalen Jahres des Süßwassers 2003 fand in Kyoto das<br />
Weltwasserforum statt. Der Zusammenhang zwischen <strong>Wasser</strong>versorgung und Armut war<br />
dort ein wichtiges Thema.<br />
Beim Weltwasserforum hat UNICEF seine neue „WASH In Schools“-Kampagne<br />
vorgestellt. UNICEF setzt sich damit dafür ein, weltweit jede Grundschule mit<br />
Trinkwasseranschluss und nach Geschlechtern getrennten Sanitäranlagen auszustatten.<br />
Darüber hinaus sollen <strong>Wasser</strong>- und Hygieneerziehung in die Lehrpläne aufgenommen<br />
werden. „WASH in Schools“ startet zunächst in 25 Ländern, in denen besonders wenige<br />
Mädchen zur Schule gehen. Die Abkürzung WASH steht für „Water, Sanitation and<br />
Hygiene for All“. Anlässlich des Weltwasserforums haben die Vereinten Nationen zudem<br />
erstmals einen Weltwasserentwicklungsbericht veröffentlicht, der künftig alle drei Jahre<br />
erscheinen soll.<br />
8
Trinkwasserversorgung im Haushalt 2000<br />
Durchschnittswerte bezogen auf die <strong>Wasser</strong>abgabe an Haushalte und<br />
Kleingewerbe; insgesamt 129 Liter pro Einwohner pro Tag in Deutschland<br />
Baden/Duschen<br />
/Körperpflege<br />
36%<br />
Essen<br />
und<br />
Trinken<br />
4%<br />
Raumreinigung,<br />
Autopflege,<br />
Garten<br />
6%<br />
Toilettenspülung<br />
27%<br />
Geschirrspülen<br />
6%<br />
Quelle: BGW<br />
Wäschewaschen<br />
12%<br />
Kleingewerbeanteil<br />
9%<br />
Wie viel <strong>Wasser</strong> brauchen wir im Alltag?<br />
Der private <strong>Wasser</strong>verbrauch liegt in Deutschland derzeit bei durchschnittlich<br />
129 Litern pro Tag. Er <strong>ist</strong> damit gegenüber 1990 um knapp 20 Liter gesunken,<br />
was auf die verbesserte Technologie, aber auch auf den zunehmend bewussten<br />
Umgang mit der Ressource <strong>Wasser</strong> zurückzuführen <strong>ist</strong>. Ein US-Bürger<br />
verbraucht im Schnitt 295 Liter am Tag.<br />
(Angaben in Litern)<br />
Essen und Trinken<br />
Kaffeekochen (4 Personen) 1<br />
Kartoffeln kochen (4 Personen) 1<br />
Gemüse waschen 3-5<br />
Obst waschen 2-5<br />
Körperpflege und Hygiene<br />
Vollbad 120-180<br />
Duschen 30-90<br />
Zahnpflege 0,5<br />
Händewaschen 2-3<br />
Morgenwäsche 3-5<br />
Toilette<br />
Spülen mit Spartaste 6<br />
Normalspülkasten 9<br />
Wäsche waschen<br />
Normalprogramm 60-100<br />
Sparprogramm 40-80<br />
Geschirrspülen<br />
Normalprogramm 20-30<br />
Sparprogramm 15-25<br />
Handwäsche 20-40<br />
Quelle: UNICEF/Deutsche <strong>Wasser</strong>werke 1998<br />
9
6. Was tut UNICEF?<br />
• Zugang zu sauberem Trinkwasser: UNICEF fördert den Bau von Brunnen, Leitungen<br />
und <strong>Wasser</strong>reservoirs. Dabei greift UNICEF auf einfache Mittel zurück. Brunnen<br />
werden mit leicht zu wartenden Handpumpen ausgestattet.<br />
• Hygienische Basisausstattung: UNICEF unterstützt den Bau einfacher Latrinen und<br />
öffentlicher Toiletten ebenso wie die Einrichtung von Abwassersystemen und die<br />
regelmäßige Müllbeseitigung. In den großen Städten bringt UNICEF die Bewohner<br />
von Slums und die Stadtverwaltung an einen Tisch, um gemeinsame Lösungen zu finden.<br />
• Beteiligung: UNICEF legt besonderen Wert darauf, die Bevölkerung vor Ort am Bau<br />
und an der Wartung der Brunnen und <strong>Wasser</strong>leitungen zu beteiligen, so dass die Menschen<br />
die Anlagen auch selbst reparieren können.<br />
• Information: Brunnen und Latrinen allein reichen nicht aus. Nur wer weiß, welche<br />
hygienischen Regeln einzuhalten sind und wie Gewässer sauber gehalten werden können,<br />
kann sich wirksam gegen Krankheiten schützen. UNICEF vermittelt dieses Basiswissen<br />
in den Gemeinden und Schulen.<br />
• Nothilfe: Die Bereitstellung von sauberem <strong>Wasser</strong> und einfachen Latrinen <strong>ist</strong> fester<br />
Bestandteil der UNICEF-Nothilfeprogramme, denn gerade in Flüchtlingslagern breiten<br />
sich Krankheiten besonders schnell aus.<br />
Mark II<br />
Klassiker und Symbol für die Einfachheit der UNICEF-<strong>Wasser</strong>programme <strong>ist</strong> die<br />
Mark II, eine Handpumpe aus Schweißstahl, die UNICEF in den siebziger Jahren<br />
in Indien entwickelte. Bis dahin hatte man für das Bohren der Brunnen die neuesten<br />
und modernsten Bohrtürme eingesetzt, als Handpumpen aber schlechte Kopien von<br />
europäischen oder amerikanischen Modellen installiert. Ursprünglich für den<br />
Gebrauch durch eine einzige Familie bestimmt, haben die wenigsten dieser<br />
Pumpen dem Gebrauch durch ein ganzes Dorf standgehalten. Abhilfe schaffte die<br />
Pumpe Mark II, die ausgesprochen stabil, aber dennoch leicht zu bedienen <strong>ist</strong>. Zum<br />
Schutz vor der Abenteuerlust spielender Kinder besitzt sie sogar eine<br />
„Kindersicherung“. Allein in Indien wurden 600.000 dieser Pumpen installiert.<br />
Bereich Grundsatz und Information<br />
I-0086-5.000-01/04