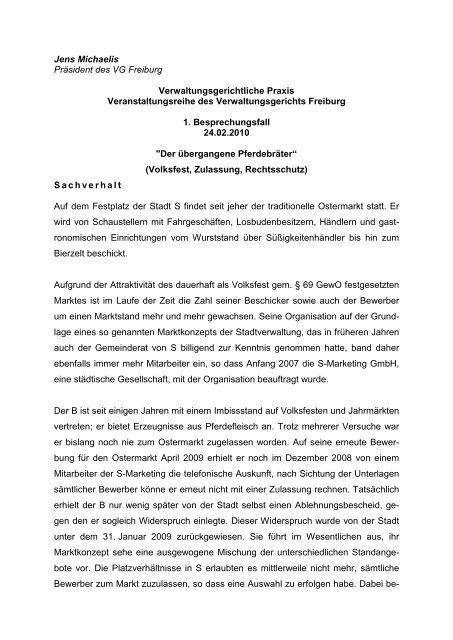Jens Michaelis - Verwaltungsgericht Freiburg
Jens Michaelis - Verwaltungsgericht Freiburg
Jens Michaelis - Verwaltungsgericht Freiburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jens</strong> <strong>Michaelis</strong><br />
Präsident des VG <strong>Freiburg</strong><br />
Sachverhalt<br />
<strong>Verwaltungsgericht</strong>liche Praxis<br />
Veranstaltungsreihe des <strong>Verwaltungsgericht</strong>s <strong>Freiburg</strong><br />
1. Besprechungsfall<br />
24.02.2010<br />
"Der übergangene Pferdebräter“<br />
(Volksfest, Zulassung, Rechtsschutz)<br />
Auf dem Festplatz der Stadt S findet seit jeher der traditionelle Ostermarkt statt. Er<br />
wird von Schaustellern mit Fahrgeschäften, Losbudenbesitzern, Händlern und gast-<br />
ronomischen Einrichtungen vom Wurststand über Süßigkeitenhändler bis hin zum<br />
Bierzelt beschickt.<br />
Aufgrund der Attraktivität des dauerhaft als Volksfest gem. § 69 GewO festgesetzten<br />
Marktes ist im Laufe der Zeit die Zahl seiner Beschicker sowie auch der Bewerber<br />
um einen Marktstand mehr und mehr gewachsen. Seine Organisation auf der Grund-<br />
lage eines so genannten Marktkonzepts der Stadtverwaltung, das in früheren Jahren<br />
auch der Gemeinderat von S billigend zur Kenntnis genommen hatte, band daher<br />
ebenfalls immer mehr Mitarbeiter ein, so dass Anfang 2007 die S-Marketing GmbH,<br />
eine städtische Gesellschaft, mit der Organisation beauftragt wurde.<br />
Der B ist seit einigen Jahren mit einem Imbissstand auf Volksfesten und Jahrmärkten<br />
vertreten; er bietet Erzeugnisse aus Pferdefleisch an. Trotz mehrerer Versuche war<br />
er bislang noch nie zum Ostermarkt zugelassen worden. Auf seine erneute Bewerbung<br />
für den Ostermarkt April 2009 erhielt er noch im Dezember 2008 von einem<br />
Mitarbeiter der S-Marketing die telefonische Auskunft, nach Sichtung der Unterlagen<br />
sämtlicher Bewerber könne er erneut nicht mit einer Zulassung rechnen. Tatsächlich<br />
erhielt der B nur wenig später von der Stadt selbst einen Ablehnungsbescheid, gegen<br />
den er sogleich Widerspruch einlegte. Dieser Widerspruch wurde von der Stadt<br />
unter dem 31. Januar 2009 zurückgewiesen. Sie führt im Wesentlichen aus, ihr<br />
Marktkonzept sehe eine ausgewogene Mischung der unterschiedlichen Standangebote<br />
vor. Die Platzverhältnisse in S erlaubten es mittlerweile nicht mehr, sämtliche<br />
Bewerber zum Markt zuzulassen, so dass eine Auswahl zu erfolgen habe. Dabei be-
- 2 -<br />
diene man sich mit dem Marktkonzept eines ausdifferenzierten Auswahlsystems, das<br />
sämtliche Angebote nach Betriebsart und Attraktivität im Blick auf die festgesetzte<br />
Veranstaltung (vgl. §§ 64 ff. GewO) mit Punkten bewerte. Ob ein Bewerber „bekannt<br />
und bewährt“ sei, spiele gleichfalls eine Rolle. Bei allen Kriterien, die der Auswahl<br />
zugrundegelegt worden seien, habe B nach dem angewendeten Punktesystem zu<br />
wenig Punkte erhalten, um zugelassen werden zu können.<br />
Noch im Februar 2009 hat B Klage erhoben. Er ist der Auffassung, es sei bereits<br />
grundsätzlich rechtlich bedenklich, einzelne Bewerber vom Ostermarkt auszuschließen;<br />
nach Jahren der Nichtberücksichtigung habe er aber jedenfalls jetzt einen An-<br />
spruch auf Zulassung. Weshalb er diese erneut nicht erhalten habe, lasse sich den<br />
Bescheiden nicht entnehmen; sie seien viel zu Allgemein gehalten. Die S-Marketing<br />
sei darüber hinaus nicht befugt gewesen, den Markt zu veranstalten; es gehe nicht<br />
an, dass sie - unstreitig - an die einzelnen Bewerber die Zulassungen zum Markt ver-<br />
sende; die Zulassung sei allein Aufgabe der Beklagten und zwar des Gemeinderats,<br />
der auch über die Zulassungskriterien zu befinden habe; das vorliegende Marktkon-<br />
zept reiche nicht aus. Infolge der bereits erfolgten Zulassungen durch die S-<br />
Marketing sei die Beklagte bzw. der Gemeinderat bei der Frage der Erteilung der Ab-<br />
lehnungsbescheide im Übrigen gar nicht mehr frei. Traditionelle städtische Veranstaltungen<br />
wie der Ostermarkt dürften als öffentliche Einrichtungen darüber hinaus priva-<br />
ten Veranstaltern wie der S-Marketing nicht überlassen werden.<br />
Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie richte trotz der Mitwirkung der S-<br />
Marketing den Markt aus. Die Frage, wer zum Ostermarkt zugelassen werde, sei vor<br />
Zulassung der einzelnen Bewerber durch die S-Marketing eingehend mit dem OB<br />
besprochen worden. § 70 GewO sehe ein Auswahlverfahren vor. Ihr Marktkonzept<br />
sei in keiner Weise zu beanstanden. Das ergebe sich bereits aus den - zwischenzeit-<br />
lich vorgelegten und im Verfahren zusätzlich ausführlich erklärten - Bearbeitungsbögen<br />
zur Vergabe der Punkte für die einzelnen Auswahlkriterien, denen im Einzelnen<br />
entnommen werden könne, weshalb B nicht zum Zuge gekommen sei. Bei der Vielzahl<br />
der Bewerber sei es unzumutbar, die Ablehnungsbescheide noch ausführlicher<br />
als erfolgt zu gestalten.<br />
Hat die Klage Erfolg?
Lösungsskizze<br />
I. Zulässigkeit der Klage<br />
- 3 -<br />
1. Der Verwaltungsrechtsweg ist vorliegend unproblematisch gegeben, § 40 VwGO.<br />
Das ergibt sich allerdings nicht bereits aus § 70 GewO, da Märkte auch von Privaten<br />
veranstaltet werden können (vgl. im Einzelnen Storr in Pielow, GewO, 2009, § 70<br />
RdNrn. 2, 14, 49 ff.).<br />
2. Klageart: Nach Ablehnung des Antrags auf Zulassung durch die Beklagte kommt<br />
eine Verpflichtungsklage in Betracht, die entweder auf unmittelbare Zulassung zum<br />
Ostermarkt oder - als Minus, wenn eine solche Verpflichtung nicht möglich ist - auf<br />
Neubescheidung gerichtet ist.<br />
Problematisch ist, dass das Klageziel wegen Zeitablaufs nicht mehr erreicht werden<br />
kann; der Ostermarkt 2009 hat bereits stattgefunden. In Betracht kommt daher eine<br />
Fortsetzungsfeststellungsklage, § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO analog (vgl.<br />
Kopp/Schenke, VwGO, 16. Aufl., § 113, RdNr. 109).<br />
3. Da B weiterhin an seiner Absicht festhält, jedenfalls in Zukunft am Ostermarkt teil-<br />
zunehmen, ist das Fortsetzungsfeststellungsinteresse wegen Wiederholungsgefahr<br />
unproblematisch.<br />
4. Die Klage ist auch im Übrigen unproblematisch zulässig<br />
II. Begründetheit der Klage<br />
Die Klage wäre begründet, wenn die Versagung der Zulassung rechtswidrig und der<br />
B hierdurch in eigenen Rechten verletzt gewesen wäre, § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO<br />
analog. Das wäre dann der Fall, wenn B einen Anspruch auf Teilnahme oder zumindest<br />
auf Neubescheidung gehabt hätte.
1. Anspruchsgrundlage:<br />
- 4 -<br />
a) Ein Anspruch auf Teilnahme könnte sich aus § 10 Abs. 2 GemO ergeben; denn<br />
der Ostermarkt ist als langjähriges städtisches Volksfest eine öffentliche Einrichtung,<br />
so dass sich die Zulassung nach dem Kommunalrecht richten könnte.<br />
b) Der Ostermarkt ist aber auch als Markt nach Maßgabe der Gewerbeordnung mit<br />
einer eigenen Zulassungsregelung festgesetzt; die bundesrechtliche Regelung des<br />
§ 70 GewO geht der landesrechtlichen Regelung vor (vgl. VGH Baden-Württemberg,<br />
Beschluss vom 19.07.2001 - 14 S 1567/01 -, Gewerbearchiv 2001, 420 = juris,<br />
m.w.N.; Tettinger/Wank GewO, 7. Aufl., 2004, § 70 RdNrn. 3 f., 5; kritisch Storr in<br />
Pielow, a.a.O., § 70 RdNr. 58.1).<br />
Der Anspruch auf Teilnahme richtet sich mithin nach § 70 GewO.<br />
2. § 70 Abs. 1 GewO begründet als Ausdruck der Marktfreiheit grundsätzlich einen<br />
Anspruch auf Marktteilnahme; Beschränkungen können nur nach Maßgabe der in<br />
der Vorschrift getroffenen weiteren Regelungen verfügt werden.<br />
B gehört zum Teilnehmerkreis im Sinne von § 70 Abs. 1 GewO; dafür, dass er nicht<br />
die allgemeinen Bestimmungen für eine Teilnahme erfüllt, ist nichts ersichtlich.<br />
Ebenso gehört er mit seinem Stand zu einer der Anbietergruppen im Sinne von § 70<br />
Abs. 2 GewO. Danach besitzt er grundsätzlich ein Recht auf Teilnahme.<br />
3. Könnte dem Recht auf Teilnahme § 70 Abs. 3 GewO entgegen gehalten werden,<br />
der den Ausschluss einzelner Teilnehmer erlaubt?<br />
B meint, es sei bereits grundsätzlich rechtlich bedenklich, jemanden von der Teilnahme<br />
auszuschließen.<br />
a) Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG?<br />
§ 70 Abs. 3 GemO schränkt die Berufsfreiheit auf der Ebene der Berufsausübung<br />
ein. Eine solche Einschränkung (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG) ist zulässig, wenn ver-
- 5 -<br />
nünftige Erwägungen des Gemeinwohls dies als zweckmäßig erscheinen lassen.<br />
Solche Erwägungen werden bereits in § 70 Abs. 3 selbst genannt. Insbesondere<br />
dient die Beschränkung der Zahl der Teilnehmer auf die vorhandene Kapazität einem<br />
ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung (vgl. auch Tettinger/Wank a.a.O. § 70<br />
RdNrn. 25 m.w.N.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 01.10.2009 - 6 S 99/09 -,<br />
juris); dem Gemeinwohl widerspräche, einen Markt ungeregelt ablaufen zu lassen.<br />
b) § 70 Abs. 3 GewO hinreichend bestimmt?<br />
Mangels hinreichender Bestimmtheit der Ermächtigung zum Ausschluss einzelner<br />
Anbieter aufgrund „sachlich gerechtfertigter Gründe“ könnte die Vorschrift gegen das<br />
Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG, verstoßen. Der genannte unbestimmte<br />
Rechtsbegriff, der immerhin bereits durch eine Fallgestaltung („insbesondere Platzmangel“)<br />
konkretisiert wird, ist jedoch im Wege der Auslegung bestimmbar und mittlerweile<br />
durch die Rechtsprechung hinreichend bestimmt (vgl. Tettinger/Wank<br />
a.a.O.); ein Ausschluss darf danach nicht willkürlich erfolgen und hat sich sowohl am<br />
Grundsatz der Marktfreiheit als auch am Gleichbehandlungsgebot auszurichten.<br />
4. Ist der Ausschluss von B nach § 70 Abs. 3 GemO zu Recht erfolgt?<br />
a) Die tatbestandlichen Voraussetzungen für den Ausschluss sind erfüllt, weil mangels<br />
ausreichender Standplätze nicht alle Teilnehmer, die die Voraussetzungen erfül-<br />
len, berücksichtigt werden können (vgl. Storr in Pielow, a.a.O., 2009, § 70 RdNrn. 21,<br />
23: Der Veranstalter muss seine Kapazitäten zwar nicht erweitern, um mehr Teilnehmer<br />
aufzunehmen, er muss die vorhandenen Kapazitäten allerdings auch im<br />
Blick auf Art. 12 Abs. 1 GG ausschöpfen).<br />
b) Der Ausschluss steht als „Kann-Bestimmung“ im Ermessen des Veranstalters. Zu<br />
fragen ist daher, ob er hier im Blick auf B sein (Auswahl-)Ermessen fehlerfrei ausgeübt<br />
hat.<br />
aa) Der Maßstab für die Prüfung der Ermessensentscheidung ergibt sich aus § 114<br />
Satz 1 VwGO. Vorliegend muss sich das Ermessen am Grundsatz der Marktfreiheit<br />
und am Gleichheitssatz (siehe oben 3b) orientieren.
- 6 -<br />
bb) Laut Sachverhalt hat sich die Entscheidung am Marktkonzept der Stadtverwal-<br />
tung orientiert. Fraglich ist, ob dieses Marktkonzept, das nach Auffassung der Beklagten<br />
einer gleichmäßigen Ermessensausübung (ermessenslenkend) dienen soll,<br />
eine geeignete Grundlage für die Betätigung des Auswahlermessens ist.<br />
- Wegen der großen Bandbreite möglicher Marktveranstaltungen steht dem Veranstalter<br />
grundsätzlich ein breiter Spielraum für ihre Gestaltung im Allgemeinen wie<br />
auch bei der Auswahl im Einzelnen zu.<br />
- Laut Sachverhalt orientiert sich das Konzept an der Art der Veranstaltung und soll<br />
unter Berücksichtigung der Attraktivität der einzelnen Bewerber eine dem Veranstaltungszweck<br />
entsprechende ausgewogene Beschickung erlauben; berücksichtigt wird<br />
auch der Grundsatz „bekannt und bewährt“. Mit einem solchen Inhalt stellt das Kon-<br />
zept grundsätzlich eine geeignete Auswahlgrundlage dar (vgl. im Einzelnen etwa<br />
VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.02.2006 - 6 S 1508/04 -, m.w.N., juris). Da-<br />
von zu unterscheiden ist die weitere - später noch zu prüfende - Frage, ob auch die<br />
im Einzelfall zu treffende Auswahl bzw. - im Falle von B - der Ausschluss rechtmäßig<br />
gewesen ist. Zuvor ist aber zu fragen, ob B zu Recht rügt, die Stadtverwaltung sei für<br />
die Erarbeitung des Marktkonzepts nicht zuständig gewesen:<br />
Das von der Verwaltung erarbeitete und als ermessenslenkende Richtlinie dienende<br />
Konzept wäre dann nicht zu beanstanden, wenn es sich bei der Festlegung allgemeiner<br />
Kriterien für die Vergabe der Marktstandplätze, die i.S. verwaltungsintern bindender<br />
Vorschriften eine gleichmäßige und einheitliche Ermessensausübung ge-<br />
währleisten sollen, um ein Geschäft der laufendenden Verwaltung (§ 44 Abs. 2 Satz<br />
1 GemO) handelte, das vom Bürgermeister bzw. der für ihn handelnden Verwaltung<br />
eigenverantwortlich abgewickelt wird. Das wird wegen der großen rechtlichen und<br />
wirtschaftlichen Bedeutung, die die Veranstaltung von Volksfesten für die Gemeinden<br />
hat, verneint (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.08.1990 - 14 S 2400/88 -,<br />
VBlBW 1991, 185; Urteil vom 01.10.2009 a.a.O.).<br />
Die Aufgabe wurde dem Bürgermeister auch nicht durch Gesetz übertragen, vgl. §<br />
44 Abs. 2 Satz 1 GemO.
- 7 -<br />
Handelt es sich um kein Geschäft der laufenden Verwaltung, so ist es Sache des<br />
Gemeinderats, die Grundzüge der Verwaltung zu regeln (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemO).<br />
Dies ist nur dann anders, wenn der Gemeinderat diese Aufgabe dem Bürgermeister<br />
(der Verwaltung) hätte übertragen können und übertragen hat. Eine solche Übertragung<br />
setzt nach Maßgabe des § 44 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GemO voraus,<br />
- dass die Aufgabe auch einem beschließenden Ausschuss übertragen werden könn-<br />
te (vgl. § 39 Abs. 2 GemO); dies wäre für die Erarbeitung von „Vergaberichtlinien“<br />
nicht ausgeschlossen (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 01.10.2009; a.a.O.).<br />
- dass zusätzlich eine solche Übertragung ausdrücklich in der Hauptsatzung der<br />
Gemeinde (vgl. § 4 Abs. 2 GemO) geregelt sein müsste. Dies ist hier nicht ersichtlich.<br />
Damit war der Gemeinderat für die Erarbeitung eines Marktkonzepts zuständig.<br />
Unzureichend ist, dass der Gemeinderat das Konzept der Verwaltung „billigend in<br />
Kauf“ genommen hat. Dies ersetzt nicht die eigenständige Beschlussfassung (VGH<br />
Baden-Württemberg, Urteil vom 27.08.1990).<br />
Ergebnis:<br />
Der Ausschluss des B von der Teilnahme am Ostermarkt war ermessensfehlerhaft,<br />
und daher rechtswidrig, weil die entsprechende Entscheidung auf der Anwendung<br />
des von der (hierfür unzuständigen) Stadtverwaltung erarbeiteten Marktkonzepts beruhte.<br />
Das <strong>Verwaltungsgericht</strong> würde die Feststellung treffen, dass die Ablehnung<br />
des Antrags des B auf Zulassung zum Ostermarkt 2009 der Beklagten rechtswidrig<br />
war (zur entsprechenden Antragstellung vgl. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom<br />
27.02.2006 a.a.O.).
- 8 -<br />
III. Hilfsgutachten (auf der Grundlage, dass der festgestellte Mangel nicht vor-<br />
lag)<br />
1. Formelle Rechtmäßigkeit des Ablehnungsbescheids<br />
a) Zuständigkeit der Stadtverwaltung oder des Gemeinderats von S für den Erlass<br />
des ablehnenden Bescheids?<br />
B ist der Auffassung, wegen der Bedeutung der Sache müsse der Gemeinderat die<br />
Entscheidung treffen. Der Gemeinderat beschließt jedoch nur allgemein die Vergaberichtlinien<br />
(Marktkonzept), die das Verwaltungsermessen im Interesse einer einheitlichen<br />
und gleichmäßigen Handhabung steuern sollen. Die Umsetzung dieser Richtlinien<br />
im Einzelfall vollzieht die getroffene Gemeinderatsentscheidung lediglich. Es<br />
handelt sich damit um ein Geschäft der laufenden Verwaltung (VGH Baden-<br />
Württemberg, Urteil vom 01.10.2009 a.a.O.; BayVGH, Urteil vom 15.03.2004 - 22 B<br />
03.1362 -, juris, RdNr. 33), für das die Stadtverwaltung zuständig ist.<br />
2. Mit seiner Rüge, den Bescheiden lasse sich nicht entnehmen, weshalb er erneut<br />
abgelehnt worden sei, rügt B, die Begründung sei unzureichend:<br />
§ 39 Abs. 1 Satz 2 LVwVfG schreibt die Mitteilung der wesentlichen tatsächlichen<br />
und rechtlichen Gründe vor, die die Behörde, hier die Stadtverwaltung S, zu ihrer<br />
Entscheidung bewogen haben. Darüber hinaus soll nach § 39 Abs. 1 Satz 3 LVwVfG<br />
die Begründung bei Ermessensentscheidungen auch diejenigen Gesichtspunkte erkennen<br />
lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausge-<br />
gangen ist. Danach muss B in die Lage versetzt werden, die Erfolgsaussichten eines<br />
Rechtsbehelfs ausreichend zu beurteilen. Je weiter dabei der der Behörde zugestandene<br />
Ermessensspielraum ist, desto eingehender ist ihre Begründungspflicht (vgl.<br />
Kopp/Ramsauer, VwVfG 10. Aufl. 2008, § 39, RdNr. 26; VGH Baden-Württemberg,<br />
Urteil vom 27.02.2006 - 6 S 1508/04 -, juris).<br />
Vorliegend wurde dem B im Wesentlichen lediglich mitgeteilt, dass mit dem Marktkonzept<br />
eine ausgewogene Mischung der Stände erreicht werden solle und er in<br />
Anwendung des praktizierten Punktesystems weniger Punkte als seine Mitbewerber
- 9 -<br />
erhalten habe. Dem kann nicht entnommen werden, welche konkreten Umstände zu<br />
seiner Schlechterbewertung gegenüber seinen Mitkonkurrenten geführt haben. Eine<br />
substantiierte Stellungnahme in Wahrung seiner Rechte wird ihm hierdurch nicht ermöglicht.<br />
Die gegebene Begründung ist daher unzureichend.<br />
c) Eine Ausnahme vom Begründungserfordernis (§ 39 Abs. 2 LVwVfG) liegt nicht vor.<br />
Insbesondere ist § 39 Abs. 2 Nr. 3 LVwVfG nicht einschlägig, weil es sich trotz möglicherweise<br />
einer Vielzahl von Ablehnungen stets um individuelle Regelungen han-<br />
delt.<br />
d) Ist der Mangel der unzureichenden Begründung nach § 45 LVwVfG geheilt?<br />
aa) Eine fehlerhafte Begründung führt nicht zur Nichtigkeit des Bescheids.<br />
bb) S hat ihre Entscheidung mittlerweile im Klageverfahren ausführlich erläutert. Der<br />
Mangel könnte demgemäß nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG geheilt sein.<br />
cc) War die nachträglich gegebene Begründung rechtzeitig, § 45 Abs. 2 LVwVfG?<br />
Der Wortlaut des § 45 Abs. 2 LVwVfG legt die Rechtzeitigkeit nahe; denn das verwaltungsgerichtliche<br />
Verfahren ist noch anhängig. Allerdings hat sich der Verwaltungsakt<br />
- die Ablehnung der Zulassung - durch Zeitablauf erledigt. Erst nach Erledigung<br />
wurde die für die Ablehnung erforderliche Begründung gegeben. Eine solche Nach-<br />
holung ist deshalb nicht mehr möglich, weil § 45 LVwVfG voraussetzt, dass der Verwaltungsakt<br />
noch wirksam ist; dies ist bei einem erledigten Verwaltungsakt nicht der<br />
Fall, vgl. § 43 Abs. 2 LVwVfG. Dies steht mit dem Ziel einer Fortsetzungsfeststellungsklage<br />
in Einklang. Es geht bei ihr nicht um die Aufhebung eines Verwaltungsakts<br />
oder um eine Neubescheidung, für die von Bedeutung wäre, ob ein dem Verwaltungsakt<br />
anheftender formeller Mangel noch beseitigt werden kann, sondern allein<br />
um die Feststellung, ob der (mittlerweile erledigte) Verwaltungsakt - gegebenenfalls<br />
in der Fassung des Widerspruchsbescheids - im Zeitpunkt seiner Erledigung rechtswidrig<br />
war (vgl. auch VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.02.2006 a.a.O.,
- 10 -<br />
m.w.N.: „denknotwendig“ keine Heilung; ebenso VGH Baden-Württemberg, Urteil<br />
vom 01.10.2009 a.a.O.).<br />
Ergebnis:<br />
Der Ablehnungsbescheid war formell fehlerhaft, so dass die Feststellung seiner<br />
Rechtswidrigkeit auch aus diesem Grunde zu treffen wäre.<br />
IV. Hilfsgutachten (auf der Grundlage, dass der Ablehnungsbescheid formell<br />
rechtmäßig war).<br />
1. Materielle Rechtmäßigkeit<br />
a) Zu den heranzuziehenden Auswahlkriterien siehe bereits oben II 4b bb). Für eine<br />
eingehende Einzelfallprüfung fehlt es im Sachverhalt an zureichenden Gesichtspunkten.<br />
Maßgebliche Prüfungsgesichtspunkte wären hier zum einen der am Marktzweck<br />
orientierte Gestaltungswille der Stadt im Blick auf diesen Markt und zum Zweiten eine<br />
darauf gegründete nachvollziehbare Bewerberauswahl nach Maßgabe der einzel-<br />
nen Kriterien des Marktkonzepts. Zu weiteren Einzelheiten vgl. etwa VGH Baden-<br />
Württemberg Urteil vom 01.10.2009 a.a.O. mit weiterführenden Hinweisen. Vorlie-<br />
gend soll für die weitere Überprüfung unterstellt werden, dass die konkrete Auswahl<br />
auf der Grundlage eines ordnungsgemäßen Marktkonzepts nicht zu beanstanden<br />
und der Ausschluss der Teilnahme des B grundsätzlich fehlerfrei gewesen wäre.<br />
b) B beanstandet allerdings, dass die S-Marketing bereits für sämtliche ausgewähl-<br />
ten Betriebe Zulassungen ausgesprochen und die Stadt S selbst als Beklagte überhaupt<br />
keinen Einfluss auf die Standvergabe gehabt habe. Damit ist angesprochen,<br />
dass die Beklagte kein Ermessen ausüben konnte, weil sie an bereits erfolgte Zulassungen<br />
durch die S-Marketing gebunden war (vgl. dazu näher Kopp/Ramsauer<br />
a.a.O. § 40 RdNr. 59; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 01.10.2009 a.a.O.).<br />
aa) In welcher rechtlichen Funktion war die S-Marketing tätig?<br />
- Beliehener?
- 11 -<br />
Dann müsste die Stadt der S-Marketing zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben<br />
Hoheitsbefugnisse übertragen haben (durch oder auf Grund Gesetzes, vgl. VGH Baden-Württemberg,<br />
Urteil vom 01.10.2009 m.w.N.); die S-Marketing wäre dann nach<br />
außen wie ein Hoheitsträger aufgetreten.<br />
Vorliegend war die S-Marketing nur mit der Organisation des Volksfestes beauftragt;<br />
eine selbständige hoheitliche Tätigkeit war damit nicht verbunden.<br />
- Verwaltungshelfer?<br />
Der Verwaltungshelfer tritt regelmäßig nicht nach außen auf, sondern ist als Privater<br />
ohne eigene Zuständigkeit und Verantwortung lediglich in den Verwaltungsvollzug<br />
eingeschaltet. Er „hilft“ der Verwaltung (ausführlich Maurer, Allgemeines Verwal-<br />
tungsrecht, 17. Aufl., 2009, § 23 RdNr. 59).<br />
Mit dem Organisationsauftrag erfüllt die S-Marketing eine typisch unterstützende<br />
Verwaltungshelfertätigkeit.<br />
bb) Hätte die S-Marketing die Zulassungen ausschließlich in Eigenregie ausgespro-<br />
chen, könnte sich die Beklagte gehindert gefühlt haben, eine eigenständige Entscheidung<br />
über den Kreis der Teilnehmer zu treffen; der Erlass der Ablehnungsbe-<br />
scheide wäre dann wegen des insoweit maßgebenden Einflusses der S-Marketing<br />
ermessensfehlerhaft gewesen. (Zu unterschiedlichen Fallgestaltungen und der damit<br />
verbundenen Frage, in welchem Umfang eine Gemeinde auf die Wahrnehmung öf-<br />
fentlicher Aufgaben durch einen Verwaltungshelfer Einfluss haben muss vgl. VGH<br />
Baden-Württemberg, Urteil vom 01.10.2009 a.a.O. mit vielen Hinweisen).<br />
Laut Sachverhalt hat die S-Marketing zwar die Zulassungen ausgesprochen; dies ist<br />
allerdings in Absprache mit dem Oberbürgermeister erfolgt. Damit hat der Oberbürgermeister<br />
in eigener Person nicht nur in negativer, sondern auch in positiver Hin-<br />
sicht über den Kreis der Teilnehmer des Volksfestes befunden. Die Ablehnungsbescheide<br />
beruhten daher nicht auf einer vermeintlichen Bindung der zuständigen Verwaltung<br />
an Entscheidungen des Verwaltungshelfers.
Ergebnis:<br />
- 12 -<br />
Bei (unterstellt) ordnungsgemäßem Marktkonzept und formeller Rechtmäßigkeit wäre<br />
der Ablehnungsbescheid zu Recht ergangen; das <strong>Verwaltungsgericht</strong> würde die Klage<br />
abweisen.<br />
Zusatz:<br />
Zur Frage, ob sich eine Gemeinde vollständig aus der Veranstaltung eines traditionellen<br />
Volksfestes, das bislang ausschließlich als kommunale öffentliche Einrichtung<br />
betrieben wurde, zurückziehen und umfassend einem privaten Veranstalter übertragen<br />
könnte, vgl. BVerwG, Urteil vom 27.05.2009, 8 C 10.08, Gewerbearchiv 2009,<br />
484 mit Anm. Schönleiter; juris (verneinend: Die Selbstverwaltungsgarantie begründe<br />
grundsätzlich auch eine Pflicht der Gemeinden zur Wahrung und Sicherung ihres<br />
eigenen Aufgabenbereichs mit der Folge des Verbots einer „materiellen Privatisierung“<br />
eines kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsamen Marktes, der bislang in<br />
alleiniger kommunaler Verantwortung betrieben wurde) ferner Schoch, Das gemeindliche<br />
Selbstverwaltungsrecht gem. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG als Privatisierungsver-<br />
bot? DVBl 2009, 1533 f. (mit eingehender und überzeugender Begründung gegen<br />
BVerwG bejahend: Es sei nicht dargelegt, aufgrund welcher normativer Vorgaben<br />
des Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG das Selbstverwaltungsrecht in eine Selbstverwaltungspflicht<br />
umschlage), Ehlers, DVBl 2009, 1456 (ebenfalls ablehnend).