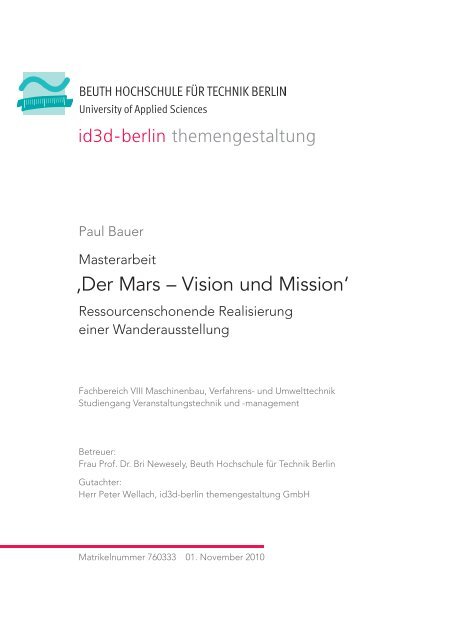Masterarbeit - Paul Bauer
Masterarbeit - Paul Bauer
Masterarbeit - Paul Bauer
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
‚Der Mars – Vision und Mission‘
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
<strong>Masterarbeit</strong><br />
‚Der Mars – Vision und Mission’<br />
Ressourcenschonende Realisierung einer Wanderausstellung
Exposé<br />
In Zusammenarbeit mit der Firma id3d-berlin gesellschaft für themengesaltung GmbH<br />
werden Möglichkeiten für die Umsetzung einer Wanderausstellung am Beispiel des Projektes<br />
‚Der Mars – Vision und Mission‘ erforscht.<br />
‚Der Mars – Vision und Mission‘ erzählt in sieben Modulen über die Erforschung des<br />
Planeten Mars, angefangen bei den Visionen Johannes Kepplers, über Erkenntnisse der<br />
heutigen Expeditionen bis hin zur zukünftigen Mission der bemannten Raumfahrt zum<br />
Mars. Interaktive Exponate, anschauliche Grafiken und mediale Ausarbeitungen machen<br />
das Thema greifbar.<br />
Die Ausstellung wird als Wanderausstellung jeweils 10 Tage lang ein Einkaufscenter<br />
bespielen, danach abgebaut, um in einem anderen Einkaufscenter wieder aufgebaut und<br />
für Besucher geöffnet zu werden.<br />
Ein solcher Auftrag bietet aufgrund seiner komplexen Anforderungen eine vielschichtige<br />
Problemstellung und ist deshalb als Thema einer <strong>Masterarbeit</strong> besonders interessant.<br />
Grundlegend für die in dieser Arbeit angestellten Forschungen ist die fachübergreifende,<br />
ganzheitliche Betrachtung der involvierten Forschungsdisziplinen.<br />
Inhaltlich gliedert sich diese Arbeit deshalb wie folgt:<br />
Zuerst werden die Rahmenbedingungen, welche für dieses Projekt gelten, erläutert. Dazu<br />
zählen die Vorgaben der Gestalter, die technischen und räumlichen Gegebenheiten in den<br />
Centern und gesetzliche Vorschriften. Im Anschluss daran werden die drei Hauptforschungsbereiche<br />
Produktion, Logistik und Personal behandelt. Im Abschnitt Produktion wird<br />
die Herstellung und Handhabung der Ausstellung erörtert. Im Kapitel Logistik werden die<br />
Zusammenhänge hinsichtlich des Transportes außerhalb und innerhalb der Center besprochen<br />
und danach werden Personalbedarfsfragen diskutiert.<br />
Ergänzt werden diese aus der Literatur interdisziplinär erarbeiteten Ergebnisse durch praktische<br />
Untersuchungen. In Feldstudien werden ähnliche Veranstaltungen und Wanderausstellungen<br />
besucht, um an deren Beispiel Erkenntnisse über das Zusammenspiel von<br />
Produktion, Logistik und Personal zu gewinnen, welche sich auf das vorliegende Projekt<br />
übertragen lassen. Darüber hinaus wurden Experten interviewt, deren Erfahrungen aus<br />
der Praxis fließen in die Arbeit mit ein.<br />
Zusammenfassend werden daraus konkrete Anwendungsempfehlungen abgeleitet und<br />
deren Potenzial für die praktische Umsetzung der Ausstellung ‚Der Mars – Vision und<br />
Mission‘ bewertet.<br />
III
Inhaltsverzeichnis<br />
Exposé ............................................................................................................................................. III<br />
Abbildungsverzeichnis..................................................................................................................VII<br />
Tabellenverzeichnis..................................................................................................................... VIII<br />
Abkürzungsverzeichnis ..................................................................................................................IX<br />
1 Einleitung.................................................................................................. 1<br />
1.1 ‚Der Mars – Vision und Mission‘ .............................................................................. 1<br />
1.2 Problemstellung ........................................................................................................... 3<br />
2 gestalterische, technische und regulative Vorgaben des Projekts ........... 6<br />
2.1 Die Module von ‚Der Mars – Vision und Mission‘ ................................................ 6<br />
2.2 Einkaufscenter als Spielorte ....................................................................................... 8<br />
2.2.1 Größen der bespielbaren Flächen ............................................................................. 9<br />
2.2.2 Anfahrt und Ladewege..............................................................................................10<br />
2.2.3 Technische Ausstattung der Center ........................................................................10<br />
2.2.4 Allgemeines.................................................................................................................11<br />
2.3 Richtlinien...................................................................................................................12<br />
2.3.1 Rechtliche Vorgaben .................................................................................................12<br />
2.3.2 Berufsgenossenschaften............................................................................................14<br />
2.3.3 IGVW..........................................................................................................................14<br />
2.3.4 Gewährleistung ..........................................................................................................14<br />
2.3.5 Normen und Nachweise...........................................................................................15<br />
3 Möglichkeiten für Wanderausstellungen.................................................16<br />
3.1 Begriffsdefinitionen...................................................................................................16<br />
3.1.1 Qualitätsmanagement................................................................................................16<br />
3.1.2 Handhabung ...............................................................................................................19<br />
3.1.3 Schnittstellen...............................................................................................................23<br />
3.2 Produktion..................................................................................................................23<br />
3.2.1 Hands-On-Exponate.................................................................................................23<br />
3.2.2 Medien.........................................................................................................................24<br />
3.2.3 Beleuchtung ................................................................................................................26<br />
3.2.4 Elektroverkabelung....................................................................................................27<br />
3.2.5 Datenverkabelung......................................................................................................30<br />
3.2.6 Wartung und Instandhaltung ...................................................................................32<br />
3.3 Transport und Logistik .............................................................................................33<br />
3.3.1 Transportzeiten und Transportziele........................................................................34<br />
3.3.2 Das Transportgut.......................................................................................................35<br />
IV
3.3.3 Externer Transport....................................................................................................35<br />
3.3.4 Verpackung.................................................................................................................39<br />
3.3.5 Ladehilfsmittel............................................................................................................40<br />
3.3.6 Ladungssicherung ......................................................................................................42<br />
3.3.7 Interner Transport.....................................................................................................45<br />
3.3.8 Lagerung......................................................................................................................48<br />
3.3.9 Entsorgungslogistik...................................................................................................50<br />
3.4 Personal.......................................................................................................................51<br />
3.4.1 Personalbedarfsplanung............................................................................................52<br />
3.4.2 Korrekturfaktoren .....................................................................................................55<br />
3.4.3 Personalzusammensetzung.......................................................................................58<br />
3.4.4 Personalführung.........................................................................................................59<br />
3.4.5 Gesundheitsschutz des Personals............................................................................59<br />
4 Lösungsansätze anderer tourender Produktionen ..................................61<br />
4.1 ‚IFA 2010‘ und ‚InnoTrans 2010’ in der Messe Berlin.........................................61<br />
4.2 ‚Deutschland-Tour‘ in Schwerin..............................................................................62<br />
4.2.1 Grundlegendes ...........................................................................................................62<br />
4.2.2 Möbel und Ausstattung.............................................................................................64<br />
4.2.3 Verpackung und Transport ......................................................................................65<br />
4.2.4 Hilfsmittel und Werkzeuge.......................................................................................66<br />
4.2.5 Zusammenfassung.....................................................................................................67<br />
4.3 ‚Cirque du Soleil‘ in der O2-World Berlin ..............................................................68<br />
4.3.1 Grundlegendes ...........................................................................................................68<br />
4.3.2 Verpackung und Ladehilfsmittel .............................................................................70<br />
4.3.3 Transport ....................................................................................................................72<br />
4.3.4 Hilfsmittel und Werkzeuge.......................................................................................73<br />
4.4 ‚Unser Wetter‘ im Gesundbrunnencenter Berlin ..................................................75<br />
4.4.1 Grundlegendes ...........................................................................................................75<br />
4.4.2 Hands-On-Exponate.................................................................................................76<br />
4.4.3 Medien.........................................................................................................................77<br />
4.4.4 Verpackung und Transport ......................................................................................78<br />
4.4.5 Zusammenfassung.....................................................................................................78<br />
5 Ressourcenschonende Lösungsansätze für die Wandersausstellung<br />
‚Der Mars – Vision und Mission‘ ............................................................ 79<br />
V
Literaturverzeichnis.......................................................................................................................... X<br />
A Anhang Gesprächsprotokoll Vorgaben................................................ XVI<br />
A 1 Ruudi Beier ............................................................................................................. XVI<br />
A 2 Peter Waclaw....................................................................................................... XVIII<br />
B Anhang Gesprächsprotokolle Personal..................................................XX<br />
B 1 Thomas Sakschewski...............................................................................................XX<br />
B 2 Bernd Weimer ..................................................................................................... XXIII<br />
B 3 Harry Hauck .....................................................................................................XXVIII<br />
C Anhang Gesprächsprotokolle Medientechnik .................................... XXX<br />
C 1 Boris Balin..............................................................................................................XXX<br />
C 2 Ina Krämer........................................................................................................... XXXI<br />
C 3 Dirk Gottwald....................................................................................................XXXII<br />
D Angang Gesprächsprotokoll Transport ......................................... XXXIII<br />
D 1 Jens Möhler.......................................................................................................XXXIII<br />
E Anhang Fragebogen........................................................................XXXIV<br />
F Anhang Auswertung Fragebogen ..................................................... XLIII<br />
G Anhang Angebote für Container und Ladebrücke ............................. XLV<br />
G 1 Firma Finstenwalder............................................................................................. XLV<br />
G 2 Firma Conainex.................................................................................................. XLVII<br />
G 3 Firma Krone......................................................................................................XLVIII<br />
H Anhang Grundkonzept der Ausstellung ................................................. LI<br />
I Anhang Exemplarisches Praxismerkblatt ....................................... LXXII<br />
VI
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 3-1 Zusammenhänge laut DIN EN ISO 9000........................................................18<br />
Abbildung 3-2 Verschlussspanner horizontal.............................................................................21<br />
Abbildung 3-3 Schematische Stromverkabelung der einzelnen Module.................................28<br />
Abbildung 3-4 Beispielhafter Mehrpinstecker ............................................................................29<br />
Abbildung 3-5 Verkabelung mit Schutzkleinspannung .............................................................30<br />
Abbildung 3-6 RJ-45 Stecker (links einfache Ausführung/rechts verstärkte Ausführung)..31<br />
Abbildung 3-7 Beispiele für Ladungsbeschriftung.....................................................................40<br />
Abbildung 3-8 Verpackung und Ladehilfsmittel zu einem System vereint ............................41<br />
Abbildung 3-9 Ladungssicherung durch Niederzurren.............................................................43<br />
Abbildung 3-10 Ladungssicherung durch Direktzurren............................................................45<br />
Abbildung 3-11 ein genormter lastaufnehmender Wagen ........................................................46<br />
Abbildung 3-12 ein Dolly zum Transport von Scheinwerfern.................................................48<br />
Abbildung 4-1 Übersicht über die Veranstaltung ‚Deutschland-Tour‘ in Schwerin .............62<br />
Abbildung 4-2 Modulbox mit Detaillösungen............................................................................63<br />
Abbildung 4-3 Detail des Aufbaus ...............................................................................................63<br />
Abbildung 4-4 Container mit Medienstation ..............................................................................64<br />
Abbildung 4-5 Verladen von Kleinteilen und Cases..................................................................65<br />
Abbildung 4-6 Verladen der Container........................................................................................66<br />
Abbildung 4-7 Die Show Saltimabaco .........................................................................................68<br />
Abbildung 4-8 Skizze des Aufbaus in der O2-World Berlin .....................................................69<br />
Abbildung 4-9 Traversen mit fest monierten Rollen.................................................................69<br />
Abbildung 4-10 Traversensack innerhalb einer Traverse..........................................................71<br />
Abbildung 4-11 Skizze der Stauung der Ladung im Sattelauflieger.........................................73<br />
Abbildung 4-12 Die Ausstellung ‚Unser Wetter‘........................................................................75<br />
Abbildung 4-13 Interaktivität bei ‚Unser Wetter‘.......................................................................76<br />
Abbildung 4-14 diverse Hands-On-Exponate............................................................................76<br />
Abbildung 4-15 das Medium ‚Nachgespielte Erzählung‘..........................................................77<br />
VII
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 3-1 Beispiel für die Ermittlung der Dauer einer Tätigkeit...........................................54<br />
Tabelle 3-2 Verteilfaktoren für die Personalbedarfsrechnung..................................................55<br />
Tabelle 3-3 Mitarbeiterzusammenstellung an den ersten Spielorten .......................................56<br />
Tabelle 3-4 Mitarbeiterzusammenstellung mit ‚Lehrlingen‘ bei den ersten Spielorten.........57<br />
VIII
Abkürzungsverzeichnis<br />
(M)VkVO (Muster)-Verkaufsstättenverordnung<br />
(M)VStättVO (Muster)-Versammlungsstättenverordnung<br />
ARGEBAU Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen<br />
Minister und Senatoren der Länder (Bauministerkonferenz)<br />
BetrVO Betriebsverordnung<br />
BGI Berufsgenossenschaftliche Informationen<br />
CSC Container Safety Certificate<br />
CSCG Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere<br />
Container vom 10. Februar 1976<br />
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.<br />
EG Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates<br />
EN Europäische Norm<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
igvw Interessensgemeinschaft Veranstaltungswirtschaft<br />
ISO International Organization for Standardization<br />
LKW Lastkraftwagen<br />
mbH mit beschränkter Haftung<br />
NASA National Aeronautics and Space Administration<br />
PKW Personenkraftwagen<br />
PSA Persönliche Schutzausrüstung<br />
StVO Straßenverkehrs-Ordnung<br />
TÜV Technischer Überwachungs-Verein e.V.<br />
FOH Front of House (Technikbereich)<br />
FlBauR Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten<br />
AV Audio-Video<br />
IX
1 Einleitung<br />
1.1 ‚Der Mars – Vision und Mission‘<br />
Die Faszination der Raumfahrt, vor allem die Erforschung und Eroberung des Planeten<br />
Mars, bewegt Menschen seit vielen Jahrhunderten. Schon Johannes Keppler (1571 – 1630)<br />
war fasziniert vom Mars und entwickelte aus dessen Beobachtungen elementare astronomische<br />
Gesetze. Die in den 1960-er Jahren begonnene, unbemannte Raumfahrt zum<br />
Mars liefert immer neue Aufschlüsse und Erkenntnisse über unseren Nachbarplaneten.<br />
Die letzte Mission aus dem Jahr 2008 mit dem Namen ‚Phoenix‘ entdeckte unter einer<br />
steinigen Deckschicht Wassereis, und damit die Grundlage für mögliches Leben. 1<br />
Diese Begeisterung soll auch dem Besucher der Wanderausstellung ‚Der Mars – Vision und<br />
Mission‘ nahe gebracht werden: Interaktive Exponate und informative Medienstationen<br />
zeigen die Geschichte der Marsforschung. Weiterhin wird der heutige Stand der Wissenschaft<br />
beleuchtet, beispielsweise mit dem Projekt ‚Mars 500‘: „Abgeschottet von der<br />
Außenwelt werden drei Russen, ein Franzose, ein Italiener und ein Chinese in einer Raumschiffattrappe<br />
leben“ 2 und eine Raumfahrt zum Mars simulieren. Solche Tests deuten auf<br />
eine mögliche Zukunft hin, nämlich die bemannte Raumfahrt zum ‚roten Planeten‘.<br />
Das facettenreiche Thema der Ausstellung wird auf den Freiflächen und in den Gängen<br />
verschiedener Einkaufscenter in Deutschland inszeniert. Für jeweils zehn Tage wird sie in<br />
unterschiedlichen Städten gastieren. Die gesamte Laufzeit ist auf drei Jahre angesetzt, beginnend<br />
im Juli 2011.<br />
Die Ausstellung wird als Wanderausstellung konzipiert und muss an verschiedenen Orten<br />
mit dem gleichen dramaturgischen und raumbildnerischen Ausdruck wieder aufgebaut<br />
werden können. Dem Spektrum unterschiedlicher Gegebenheiten muss Rechnung getragen<br />
werden, um den Aufwand und eventuelle Nacharbeiten am jeweiligen Spielort möglichst<br />
gering zu halten.<br />
Das Einkaufscenter als Spielort für eine Ausstellung ist untypisch und stellt deshalb<br />
ebenfalls besondere Anforderungen an die Umsetzung des Projektes.<br />
Bei Einkaufscentern handelt es sich um überdachte Ladenstraßen mit einer engen räumlichen<br />
Zusammenstellung verschiedener Einzelhandelsunternehmen. Nach Außen treten<br />
sie als Einheit auf und können an verschiedenen Orten angesiedelt sein: innenstadtnah, in<br />
1 NASA 2010<br />
2 Bidder 2010, Seite 134<br />
1
den Vorstädten oder außerhalb der Siedlungsbereiche der Stadt.<br />
Seit den 1970-er Jahren hat sich die Anzahl der Center vervielfacht. Vor allem nach der<br />
Wiedervereinigung entstand eine Vielzahl neuer Projekte in den neuen Bundesländern. Die<br />
Nutzfläche wurde hingegen kleiner. „Bis 1974 hatten 48 % der Einkaufscentern noch eine<br />
Geschäftsfläche von über 30.000 m², seit 1990 liegt der Anteil bei nur 17 %.“ 3<br />
Früher konnten Verbraucher ihren Bedarf vor allem in den innenstädtischen Geschäften<br />
decken. Heutzutage ändert sich die Ausrichtung hinsichtlich der Wünsche der Konsumenten:<br />
Gute Erreichbarkeit, ein PKW-Parkplatz, eine hohe Spanne an Geschäften und<br />
klimatische Abgeschlossenheit offerieren einen bequemen Einkauf. Gepaart mit der<br />
Dienstleistungserweiterung verschiedener Center, wie der Anbindung von Arztpraxen,<br />
Kinos, Restaurants et cetera, erweitert sich die Nutzungsdauer und -frequenz, aber auch<br />
die Bereitschaft, Freizeit im Einkaufscenter zu verbringen. 4<br />
Eben diese Entwicklungen prädestinieren diesen Ort auch für Ausstellungen: In einem<br />
Einkaufscenter kann ein wesentlich breiteres Publikum erreicht werden. Vor allem die<br />
Zielgruppe derer, die normalerweise nie in ein Museum gehen würden, ist hier besonders<br />
interessant. Im ungezwungenen Rahmen des Einkaufscenters könnten sie durchaus an die<br />
Inhalte herangeführt werden und sich so an einen Museumsbesuch herantasten. Betrachtet<br />
man den Aspekt der Bildung noch etwas weiter, kann die Ausstellung für Kinder eine<br />
sinnvolle Art sein, Wartezeiten zu verbringen, während die Eltern einkaufen.<br />
Die Betreibergesellschaft der Center ECE möchte mit der Ausstellung gestalterisch wie<br />
auch in der Qualität der Vermittlung des Themas einen Unterschied schaffen zu üblichen<br />
Veranstaltungen in den Ladenstraßen der Center. Die mediale Aufmerksamkeit in der<br />
Öffentlichkeit, die Verweildauer der Kunden und somit die Akzeptanz der Center soll<br />
erhöht werden. Der ausschließliche Besuch der Ausstellung ist genauso vorstellbar und<br />
gewünscht wie der Besuch mit einem sich anschließenden Einkaufsbummel.<br />
Konzipiert, inhaltlich entwickelt, gestaltet und ausgeführt wird das Projekt vom Büro<br />
‚id3d-berlin gesellschaft für themengestaltung mbH‘, welches kooperativ diese Abschlussarbeit<br />
betreut. id3d-berlin ist ein Zusammenschluss des Dramaturgen Peter Wellach und<br />
der Künstler Ruudi Beier und Harry Hauck und legt daher besonderen Wert auf die<br />
dramaturgische Herangehensweise bei der Projektentwicklung sowie künstlerische und<br />
gestalterische Ausdruckskraft bei der Ausführung.<br />
3 Popp 2002, Seite 11<br />
4 vgl. Wernheim 2007, Seite 8f<br />
2
Diese Ausarbeitung wird durchgehend in der männlichen Form geschrieben, um umständ-<br />
liche Formulierungen wie ‚Gestalterinnen und Gestalter‘ oder ‚Mitarbeiterinnen und Mit-<br />
arbeiter‘ zu vermeiden. Selbstverständlich sollen sich Frauen wie Männer gleichermaßen<br />
angesprochen fühlen.<br />
Wissensgrundlage und Nomenklaturgrundlage ist das Studium Veranstaltungstechnik und<br />
-management (Master) an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. Die dort vermittelten<br />
Begriffe und Zusammenhänge werden als bekannt vorausgesetzt.<br />
1.2 Problemstellung<br />
Der Realisierung von ‚Der Mars – Vision und Mission‘ als Wanderausstellung in wechselnden<br />
Einkaufscentern liegt eine komplexe Problemstellung zu Grunde:<br />
Die lange Laufzeit des Projektes von drei Jahren und die speziellen Anforderungen, welche<br />
der Transport von Ort zu Ort mit sich bringt, erfordern eine ausführliche und detaillierte<br />
Planung. Ebenso fordern die, für Veranstaltungen und Ausstellungen ungewöhnlichen,<br />
Spielorte mit ihren charakteristischen Anforderungen besondere Aufmerksamkeit. Die<br />
Zeitfenster für das häufige Auf- und Abbauen sind gering bemessen und fordern eine<br />
möglichst fehlerfreie Ausführung.<br />
Entscheidend für die Lösung der Problemstellung ist, die Herstellung und Ausführung der<br />
Wanderausstellung als vielschichtiges System von Anforderungen und Vorgaben zu sehen,<br />
welche miteinander in Beziehung stehen und die sich gegenseitig beeinflussen.<br />
Dies ist der Ausgangspunkt für die im Rahmen dieser Arbeit angestellten Untersuchungen:<br />
Die einzelnen Forschungsdisziplinen werden nicht isoliert betrachtet, sondern miteinander<br />
verbunden und ganzheitlich ausgewertet.<br />
Ein Schlüsselbegriff ist in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Ressource:<br />
Eine allgemeine Definition des Begriffes besagt, dass Ressourcen als „die Gesamtheit der<br />
Faktoren verstanden werden, die dem Unternehmung zur Verfügung stehen“ 5 .<br />
Die Literatur liefert weitere Definitionen für den Begriff. Ganz grundlegend werden „nur<br />
solche materiellen und immateriellen Aktiva als Ressourcen bezeichnet ..., die eine unternehmensspezifische<br />
Komponente aufweisen“ 6 , also direkt mit dem Unternehmen verbunden<br />
sind. Untergliedert werden sie in tangible und intangible Ressourcen. Erstere bezeichnen<br />
physische Möglichkeiten, wie „plant, equipment, land and natural resources, raw<br />
materials, semi finished goods, waste products and by-products, and even unsold stocks of<br />
5 Nolte 1998, Seite 12<br />
6 Raschke 1994, Seite 38<br />
3
finished goods“ 7 . Des Weiteren sind Humanressourcen zu nennen, etwa „unskilled and<br />
skilled labour, clerical, administrative, financial, legal, technical and managerial staff“ 8 sowie<br />
finanzielle Kapazitäten und Liquiditätspotentiale. Intangible Ressourcen sind Wissensansammlungen<br />
und Know-how, die von der Konkurrenz nicht imitiert werden können, im<br />
Gegensatz zu den oben erwähnten physischen Ressourcen.<br />
Ziel ist es, die oben beschriebenen komplexen Problemzusammenhänge anhand einer<br />
ganzheitlicher gefassten Definition des Begriffes ‚Ressource‘, angelehnt an die vorangegangenen<br />
Definitionen, zu betrachten:<br />
Alle zugänglichen Potentiale und Chancen, die einem Nutzen zugeführt werden können,<br />
sollen ermittelt werden! Ebenso müssen die gegebenen Bestandteile bestmöglich aufeinander<br />
abgestimmt werden, wobei auch Faktoren zu berücksichtigen sind, die unabhängig<br />
vom eigenen Unternehmen stehen!<br />
Anhand folgender Beispiele soll dies nochmals verdeutlicht werden: Erfolgt die Ausführung<br />
immer in ausreichend klimatisierten Räumen, welche von Wettereinflüssen unabhängig<br />
sind, muss während der Stand-, Auf- und Abbauzeit auf Spritzwasser, mögliche Verunreinigungen<br />
durch Tiere oder ähnliche Faktoren keine Rücksicht genommen werden.<br />
Ebenso kann es von Vorteil sein, dass nur nachts gebaut wird. Da sich niemand in den<br />
Gebäuden befindet, muss die Baustelle nicht eingefriedet werden, um Passanten zu<br />
schützen oder Diebstahl vorzubeugen. Der personelle und materielle Aufwand muss nicht<br />
aufgebracht werden.<br />
Dem Ressourcenbegriff folgend und um der ganzheitlichen Sichtweise des Themas gerecht<br />
zu werden, stellen Studien sowohl zur Produktion und zur Logistik als auch zum Personalbedarf<br />
die drei Hauptthemengebiete dieser <strong>Masterarbeit</strong>.<br />
Vorausgehend werden die gestalterischen Vorgaben aufgeführt und die Grundlagen und<br />
Rahmenbedingungen beschrieben, welche für die Ausführung einer Wanderausstellung in<br />
Einkaufscentern wichtig sind. Die technischen Gegebenheiten in den Centern wie Anliefermöglichkeiten,<br />
Spielflächen, Strom- und Lichtversorgung werden in einem Fragebogen ermittelt.<br />
Anschließend werden die rechtlichen Vorschriften erläutert.<br />
Im Hauptteil werden die drei Themenschwerpunkte Produktion, Logistik und Personal<br />
behandelt. Mit Produktion ist die Stromverkabelung oder der Medieneinsatz gemeint.<br />
7 Penrose 1995, Seite 24 (Übersetzung: Betriebsgebäude, Materialien, Grundstücke und natürliche<br />
Ressourcen, Rohmaterialien, Halbfabrikate, Wertstoffe und Beiprodukte der Produktion und sogar lagernde<br />
Güter)<br />
8 Penrose 1995, Seite 24f (Mitarbeiter und Hilfskräfte, Büro- und Verwaltungsangestellte, Buchhaltung,<br />
Rechtsberatung, Techniker und Manager)<br />
4
Eventuell auftretende Schwierigkeiten werden beleuchtet. Dem folgend wird die Logistik<br />
beschrieben und Fragen der Transportmöglichkeiten außerhalb und innerhalb der Center,<br />
der Lagergegebenheiten und der Verpackung und Transporteignung erörtert.<br />
Im letzten Teil dieses Kapitels wird diskutiert, welche Personalanforderungen während<br />
eines solchen Projektes entstehen und welche Personalzusammensetzung aus Facharbeitern<br />
und Hilfskräften gewählt werden muss.<br />
Ergänzend werden in Kapitel vier Feldstudien ausgewertet, im Rahmen derer verschiedene<br />
andere, mit ‚Der Mars – Vision und Mission‘ vergleichbare, Veranstaltungen untersucht<br />
wurden. Neben zwei Messen wurde die ‚Deutschand-Tour‘ auf dem Rathausplatz in<br />
Schwerin besucht, der ‚Cirque de Soleil‘ in der O2-World Berlin und die Wanderausstellung<br />
‚Unser Wetter‘ im Gesundbrunnencenter in Berlin. Hier werden je nach Art der Veranstaltung<br />
unterschiedliche Zusammenhänge betrachtet. Die Ergebnisse werden im letzten<br />
Kapitel mit den erarbeiteten Erkenntnissen des Hauptkapitels drei verknüpft und ausgewertet.<br />
Die aus der Literatur erarbeiteten Lösungen werden um praktische Aspekte ergänzt.<br />
Dazu wurden auch Experten interviewt, deren Erfahrungen aus der Praxis in die Betrachtungen<br />
mit einfließen. Praktische Anwendungsempfehlungen bilden das Fazit dieser Arbeit,<br />
deren Potenziale für die Umsetzung der Ausstellung ‚Der Mars – Vision und Mission‘ werden<br />
aufgezeigt und bewertet.<br />
Neben den untersuchten Themenbereichen Personal, Logistik und Produktion gehören<br />
auch die vorbereiteten Tätigkeiten wie Konzeption, Themenentwicklung, Planung und der<br />
erstmalige Zusammenbau der Ausstellungsarchitektur zu einer detaillierten Analyse der<br />
Aufgabe. Gleichermaßen sind Überlegungen für die weitere Verwendung der einzelnen<br />
Bestandteile nach dem letzten Spielort zu machen wie Einlagerung, Umbau in eine weitere<br />
Ausstellung, Verkauf, Entsorgung oder ähnliches.<br />
Diese zusätzlichen Punkte finden jedoch keine Betrachtung. Auch die komplexe Thematik<br />
der Gestaltung und Herstellung der Ausstellungsarchitektur (Vitrinen, Exponattische und<br />
Wände) würde den Rahmen dieser <strong>Masterarbeit</strong> sprengen.<br />
Beginnend bei der fertig gestellten Ausstellung und endend mit dem Abbau am letzten<br />
Ausstellungsort, sind die Studien auf den aktiven Teil des Produktlebenszyklus der Ausstellung<br />
fokussiert.<br />
5
2 gestalterische, technische und regulative Vorgaben des Projekts<br />
2.1 Die Module von ‚Der Mars – Vision und Mission‘<br />
Inhaltlich wird die Ausstellung in sieben einzelne Module eingeteilt. Um den Zusammenhang<br />
zwischen den jeweiligen Modulen herzustellen und um den Besucher auf das Thema<br />
einzustimmen, werden in den Foren und Atrien Mobiles angebracht. Diese zeigen die<br />
Planeten des Sonnensystems. Sie sind nicht plastisch, sondern als Ringe ausgeführt, welche<br />
mit bedrucktem Stoff bespannt werden.<br />
Das erste Themenmodul befasst sich mit den „Entdeckern und Visionären“ 9 , also historischen<br />
Größen wie Kepler und Kopernikus, die schon im Mittelalter den Weitblick hatten,<br />
sich fremde und ferne Welten vorzustellen und sie zu erkunden. In sprechenden Denkmalen,<br />
einer Pepper’s-Ghost Installation, erzählen die Protagonisten von ihren Ideen.<br />
Pepper’s-Ghost ist eine Illusionstechnik, mit welcher man durch besondere Lichttechnik<br />
und eine schräg eingesetzte Glasscheibe Gegenstände oder Personen erscheinen lassen,<br />
verschwinden lassen und sogar ineinander blenden kann. In Modellräumen können die<br />
einzelne Akteure auftreten und, wie im Theater, dem Besucher von ihren ‚Visionen‘<br />
erzählen. Die Audiospur wird über eingebaute Lautsprecher eingespielt.<br />
Im Zusammenspiel mit den Medieninstallationen können Besucher ein begehbares Kreuzworträtsel<br />
lösen, welches aus der gerasterten und mit Grafiken versehenen Bodenstruktur<br />
entsteht.<br />
Im Modul Zwei werden durch plastische Globen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der<br />
Planeten Erde und Mars aufgezeigt. Informationen, wie die Anzahl der Monde, die chemische<br />
Zusammenstellung der Atmosphäre oder die Größe und die Umlaufzeigen um die<br />
Sonne, können abgerufen werden. Auf einem interaktiven Planetentisch werden beide<br />
Planeten in das übrige Sonnensystem eingeordnet. Die Besucher können durch Drehen<br />
der Scheibe die Position aller Planeten und der Sonne zueinander im Verlauf eines Jahres<br />
variieren.<br />
Um die Technik der Raumschiffe geht es in der dritten Themeninsel. Beschrieben werden<br />
die verschiedenen Fähren, Sonden, Raketen und Raumfahrzeuge, die bei der Erkundung<br />
unseres Nachbarplaneten verwendet werden. „Die als abstrahierte Modelle aus Wellpappe<br />
nachgebauten Sonden zeigen sich in der ganzen Schönheit der Technik.“ 10<br />
9 id3d-berlin 2009, Seite 6<br />
10 id3d-berlin 2009, Seite 8<br />
6
Der vierte Bereich inszeniert die Marsoberfläche, welche mit multimedialen Ferngläsern<br />
betrachtet wird. In der Marslandschaft sind Modelle von Fahrzeugen ausgestellt, die auf<br />
Expeditionen verwendet wurden. ‚Viking 1 Lander‘ ist das erste Gerät, das zwischen 1978<br />
und 1982 auf dem Mars im Einsatz war. Ausgestellt werden auch viele weitere Sonden,<br />
welchen in den weiteren Jahrzehnten im Einsatz waren, bis hin zu der 2018 geplanten<br />
‚Mars Sample Return‘ Mission, die Proben der Marsoberfläche zurück zur Erde bringen<br />
soll. Streift der Besucher den Blick, durch das Fernglas schauend, über die Exponate und<br />
die Marsoberfläche, kann er dreidimensionale Bilder der Sonde ‚Opportunity‘ sehen und<br />
weitere Informationen über die Fahrzeuge erhalten.<br />
‚Mars 500‘ ist eine Simulation eines 520 bis 700 Tage dauernden Fluges zum Mars. Freiwillige<br />
Personen leben in einem Raumschiff zusammen und erforschen die Möglichkeiten<br />
des Zusammenlebens während einer so langen Zeit auf einem extrem kleinen Raum. Bei<br />
der Ausstellung wird diese Forschungsstation nachempfunden. Besucher können die Umstände<br />
und die täglichen Aufgaben erleben, welche auf die Test-Astronauten zukommen.<br />
Das Themenmodul Sechs ist der Mittelpunkt der Ausstellung. Kinder ab vier Jahren haben<br />
hier die Möglichkeit, einen Flug zum Mars mitzuerleben, auf der Planetenoberfläche zu<br />
experimentieren, im Weltraumlabor die Proben zu analysieren und den Alltag in der Raumfähre<br />
zu erfahren. Umgeben ist das Marsmodul von innen beleuchteter Gaze, die Erwachsenen<br />
können hineinblicken, die Kinder sind jedoch von der Außenwelt abgetrennt.<br />
Der letzte Teilbereich schafft eine Zusammenfassung des Erlebten. An Computerterminals<br />
werden weitere Informationen zu den erlebten Themen geboten.<br />
Die weiteren Vorgaben wurden ermittelt im Gespräch mit Ruudi Beier ermittelt 11 .<br />
Der Bodenaufbau hat eine Höhe von 4 cm, um die Kabelage unterflur verlegen zu können.<br />
Mit der Annahme einer Fußbodenmaterialstärke von 20 mm bleiben so noch 20 mm für<br />
das Verlegen der Kabel.<br />
Eine einheitliche und vor allem änderbare Bauweise, die sich den jeweiligen Gegebenheiten<br />
in den Centern flexibel anpasst, wird durch ein Raster von 0,5 × 0,5 m erreicht. Dieses<br />
Raster wird auch verwendet für die Verortung und die standsichere und robuste Aufnahme<br />
für weiterer Aufbauten, wie Exponate, Vitrinen und Hands-On-Exponate.<br />
Grafiken auf dem Boden oder auf Vitrinen sollen vollflächig sein und vor Kratzern und<br />
11 vgl. Anlage A 1<br />
7
Vandalismus, wie Schmierereien mit Eddings, geschützt sein. Diesen Schutz bieten Folien,<br />
welche widerstandsfähig gegen Lösemittel sind.<br />
Zwei weitere Vorgaben sind zunächst die möglichst reibungslose Zusammenarbeit der verschiedenen<br />
Gewerke und die genaue Definition der Schnittstellen. Beides muss eindeutig<br />
mit den Geschäftspartnern kommuniziert werden. Ebenso verhält es sich mit Gewährleistungsansprüchen<br />
von ECE und Gewährleistungsforderungen der Subunternehmer<br />
von id3d-berlin.<br />
Weiterhin sind Dokumentationen und Anleitungen notwendig, um im Falle eines Problems<br />
alle wichtigen Informationen vor Ort zu haben. Für die Inbetriebnahme, aber auch für Mitarbeiter,<br />
die das erste Mal diese Veranstaltung aufbauen, ist so eine Anweisung wichtig.<br />
Ganz besonders hilfreich ist es, wenn die Struktur dieser Schriftstücke von id3d-berlin einheitlich<br />
für alle Gewerke vorgegeben ist. So entfällt der Aufwand der Einlesezeit. Jeder Mitarbeiter<br />
weiß, dass die Beschreibung der Inbetriebnahme immer unter einer ganz bestimmten<br />
Überschrift in der Dokumentation erläutert wird.<br />
Eine generelle Aussage zur Licht- und Mediengestaltung kann zum derzeitigen Planungsstand<br />
nicht gemacht werden. Noch stehen alle Möglichkeiten offen.<br />
Eine grundlegende Ausbesserung und technische Überarbeitung der Ausstellung muss<br />
nach jedem fünften Spielort erfolgen. Dies bedeutet, dass danach ein neuwertiges Aussehen<br />
sichergestellt ist, Oberflächen werden erneuert und die Medien werden gewartet. An jedem<br />
Spielort muss eine rudimentäre Reparatur erfolgen. Ein angemessenes Erscheinungsbild ist<br />
die notwendige Forderung.<br />
2.2 Einkaufscenter als Spielorte<br />
„Keine Innenstadt-Galerie gleicht heute der anderen.“ 12 Es gibt keine generellen Daten<br />
über die Ausstattung und die technischen Gegebenheiten der Center. Um diese dennoch<br />
zusammen zufassen und zu bewerten, können die von der ECE GmbH an id3d-berlin zugesandten<br />
Unterlagen verwendet werden. Diese beinhalten Grundrisse der Center und eine<br />
Auflistung und Beschreibung der Aktionsflächen. Zusätzlich wurde im Rahmen dieser Abschlussarbeit<br />
ein Fragebogen 13 entwickelt, der ein weiterführendes Bild über die Bandbreite<br />
der technischen Ausstattung in einem Einkaufscenter zeigt. Dieser wurde über den Koordinator<br />
von ECE GmbH an die jeweiligen Center geschickt.<br />
12 ECE 2010 Nr. 2<br />
13 Anlage C<br />
8
Der Fragebogen klärt Zusammenhänge, wie die Zugangsmöglichkeiten und eventuelle<br />
Schwierigkeiten und Engpässe bei der Durchführung.<br />
Von 27 versendeten Fragebögen wurden 14 beantwortet. Bei der Auswertung wird lediglich<br />
das relevante Maß genannt, so wie die kleinste lichte Breite der Zugangstüren, ohne<br />
dass dies jedes Mal explizit zu nennen. Bei Angaben von Spektren wird jeweils die geringste<br />
Gemeinsamkeit benannt. So wird bei Anlieferzeiten die späteste Anfangszeit und die<br />
früheste Endzeit angeführt.<br />
2.2.1 Größen der bespielbaren Flächen<br />
Die bespielbaren Flächen liegen innerhalb der Gebäude in den Gängen und Gassen der<br />
Center. Sie sind von Wettereinflüssen weitgehend unabhängig, es kann lediglich zu<br />
Luftzug kommen.<br />
Die Atrien und Lichthöfe haben eine Höhe von 10 - 20 m und bieten Platz zum Abhängen<br />
der Fahnen oder der Mobiles. Aufgrund von Linearrauchmeldern, die über Lasertechnik<br />
gesteuert werden, können Einschränkungen auftreten. 14 Hierbei strahlen unsichtbare Laser<br />
von einer Seite der Ladenstraße auf die andere. Werden sie durchbrochen (normalerweise<br />
durch Rauch, in diesem Fall von den Mobiles) wird der Alarm ausgelöst. Statische Fahnen<br />
sind kein Problem, drehende Mobiles müssen jedoch individuell besprochen werden.<br />
Die lichte Bauhöhe der Spielflächen beläuft sich auf 2,90 m, in einem Fall jedoch auf<br />
2,50 m, was aber innerhalb der normal gängigen Messebauhöhe liegt. Die Grundständer<br />
der Messebaufirma Octanorm, ein branchenüblicher Standart, belaufen sich auf 2502 mm<br />
inklusive Fuß. 15<br />
Die Flächenabmaße sind durchaus unterschiedlich. In den meisten Fällen handelt es sich<br />
um rechtwinklige Flächen, nur in wenigen Ausnahmefällen sind sie dreieckig oder organisch<br />
geformt an einer oder mehreren Seiten. An die Spielfläche können Rolltreppen,<br />
Säulen, Geländer, Bepflanzung oder Sitzgelegenheiten anschließen.<br />
Die geringste Breite laut der zugesandten Unterlagen ist 1,70 m, einige Flächen haben eine<br />
Breite von 2,00 m. Die große Mehrheit weist eine Breite von 3,00 oder 4,00 m auf.<br />
Die Längen sind sehr unterschiedlich. Ihre maximale Ausdehnung beträgt 20,00 m. Die<br />
häufigsten Werte hier liegen zwischen 4,00 und 8,00 m.<br />
14 Waclaw 2010<br />
15 Octanorm 2010<br />
9
2.2.2 Anfahrt und Ladewege<br />
Die Anfahrt zu allen Centern ist mit einem großen LKW mit 20 t zulässigem Gesamtgewicht<br />
möglich. Lediglich in einem Fall ist eine Zulieferung auf einen 7,49 t-LKW<br />
eingeschränkt. Die Möglichkeit den LKW während des Aufbaus beim Center zu parken<br />
besteht bei vielen, jedoch nicht bei allen Centern. Wohingegen das Stehenlassen des Fahrzeugs<br />
während der Ausstellungsdauer in sehr wenigen Städten möglich ist, aber es sind in<br />
allen Städten Parkmöglichkeiten in der näheren Umgebung von 3 km gegeben.<br />
Verladerampen sind in 79 % der Center verfügbar. Unverstellbare Rampen haben eine<br />
Höhe von 1,03 m bis 1,60 m. Hydraulisch verstellbare Rampen bedienen das Spektrum<br />
zwischen 0,70 m und 1,30 m. Diese Funktion ist jedoch nur in zwei Centern vorhanden.<br />
An allen Spielorten ist genügend Rangierplatz vorhanden, um den LKW mit einem Gabelstapler<br />
zu entladen, jedoch ist ein Stapler nebst der Dienstleistung eines Staplerfahrers<br />
vom Center nicht buchbar.<br />
Alternative Lademöglichkeiten, wie Kunden- oder sonstige Zugangstüren, bestehen in der<br />
Hälfte der Center. Sie müssen bezüglich eines möglichen Mehraufwandes, wie Straßensperren,<br />
Stufen oder ähnliches in einer Vorbesichtigung genau bewertet werden. Das<br />
Zeitfenster für Ladetätigkeit erstreckt sich von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr, gelegentlich auch<br />
länger. Dies gilt für die Mehrzahl der Center, in zwei Centern hingegen besteht nur die<br />
Möglichkeit nachts zu entladen. Dieses Zeitfenster beläuft sich auf 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr.<br />
Ein weiterer Punkt des Fragebogens ermittelt die Größe der Zugänge und des Liftes. Die<br />
lichte Höhe und Breite aller Türen oder sonstiger Engpässe auf den Wegen ist mit 1,90 m<br />
und 1,50 m angegeben.<br />
Alle mehrstöckigen Center verfügen über Lastenfahrstühle mit einer Nutzlast von 2000 kg.<br />
Die Innenmaße sind 2,40 m in der Länge, 1,63 m in der Breite und 2,10 m in der Höhe,<br />
wobei die Lifttüren hier eingeschlossen sind.<br />
2.2.3 Technische Ausstattung der Center<br />
Die Spannungsversorgung sind sehr vielfältig, wobei sie in vielen Fällen ausreichen. Von<br />
den befragten 14 Centern verfügen elf über ERCO-Schienen, elf über Schuko-Anschlüsse<br />
und elf über Drehstromanschlüsse mit bis zu 63 A. Es taucht hier drei Mal die Zahl elf auf,<br />
dies ist aber reiner Zufall und hat keine weitere Bedeutung. Alle bis auf zwei Center verfügen<br />
über zwei oder mehr unterschiedliche Anschlussarten.<br />
Der Ort der Bereitstellung des Stromes recht unterschiedlich. Alle erdenklichen Optionen<br />
sind gegeben: Bodentank, Wand und Decke.<br />
10
Die Bodenbelastung ist in 100 % der Center mit 500 kg/m² angegeben. Die Bodenbeläge<br />
sind verschieden, verlangen aber alle nach Gummibereifung der Transportwagen.<br />
In fast vier fünftel der Einkaufscenter ist eine Einlagerung des Leergutes realisierbar,<br />
jedoch muss hier beachtet werden, dass hierfür auch das Parkdeck oder die Tiefgarage<br />
angeboten wird. Die Größe der nutzbaren Fläche beläuft sich auf 10 m² bis 50 m².<br />
Auf die Frage, nach einem abschließbaren Raum für wertvolle Werkzeuge oder Exponatteile<br />
(zirka 2 m²) während dem Aufbau und der Veranstaltungsdauer antworteten elf Center<br />
positiv. Steht dieser Raum zur Verfügung, kann er über die ganze Zeit genutzt werden.<br />
Bei den Hängepunkten ergibt sich ein sehr ungenaues Bild, welches in einer Vorbesichtigung<br />
genau geprüft werden muss. Die Belastbarkeit zeigt ein sehr großes Spektrum, beginnend<br />
bei 10 kg bis hin zu 300 kg. Ebenso ist die Erreichbarkeit der Hängepunkte unterschiedlich:<br />
Bei 58 % sind sie über eine Hubarbeitsbühne 16 zu erreichen, bei 21 % über<br />
einen festen Einbau im Center (beispielsweise eine Reinigungsbrücke) und in weiteren<br />
21 % über andere Wege.<br />
Eine metallische Decke ist nur in einer Stadt zu finden, wobei dies auch nur teilweise der<br />
Fall ist. Das horizontale Spannen eines Stahlseils um Kabelführungen oder Hängepunkte<br />
für Dekorationen zu schaffen ist in elf Centern gegeben.<br />
Die Frage nach der Brandsicherheitsklasse für die Ausführung der Elemente ist in allen<br />
Städten auf B1 nach DIN 4102 benannt worden. Ein Center beantwortete die Frage mit<br />
„A1“. Das bedeutet, dass nur Elemente aus nichtbrennbaren Materialien wie Stahl, Sande,<br />
Ziegel, Glas et cetera verwendet werden können. Diese strenge Anforderung kann nicht<br />
auf eine Wanderausstellung übertragen werden. Vermutlich ist diese Antwort ein Fehler<br />
und muss nochmals detailliert bei der Vorplanung beleuchtet werden.<br />
2.2.4 Allgemeines<br />
Die Aufbauzeit ist von 22:00 bis 06:00 Uhr. Zwei Center wünschen einen Tagaufbau<br />
während der Öffnungszeiten.<br />
Ein Aufenthaltsraum für Mitarbeiter mit einfacher Ausstattung wie Sitzgelegenheiten ist in<br />
100 % der Center gegeben, ein Büroarbeitsplatz für administrative Aufgaben der Leitung<br />
vor Ort jedoch nur in 38 % der Fälle. Sanitärräume und Möglichkeit der Wasserentnahme<br />
für Reinigungsarbeiten sind in 13 Centern gegeben, eine Werkstatt nur in vier.<br />
Ausreichend Licht und Strom für den Aufbau kann nur in sechs bis sieben Centern sichergestellt<br />
werden, in drei bis vier weiteren ist dies jedoch auf Anfrage möglich.<br />
16 umgangssprachlich: Steiger<br />
11
In vier Veranstaltungsorten besteht die Möglichkeit nicht. Hier müssen Baufluter mit-<br />
genommen werden.<br />
Zwölf Spielorte sind nachts gesperrt, zwei sind es nicht. Mit Laufpublikum ist während der<br />
ganzen Nacht zu rechnen.<br />
2.3 Richtlinien<br />
Verschiedene Instanzen reglementieren die menschliche Interaktion miteinander und deren<br />
Umgang mit ihrer Umwelt. Es sind nicht nur von der Legislative erlassene Gesetze und<br />
Verordnungen, die Rechte einräumen und Pflichten einfordern. Vor allem im geschäftlichen<br />
Bereich gibt es Auflagen, etwa von Berufsgenossenschaften oder Verbänden. Auch<br />
die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Geschäftspartner oder anderweitig eingegangene<br />
Verträge müssen bedacht werden.<br />
2.3.1 Rechtliche Vorgaben<br />
In dieser Ausarbeitung soll nur der rechtliche Rahmen aufgezeigt werden. Es ist nicht notwendig,<br />
die jeweiligen Center auf Bespielbarkeit zu überprüfen und nach den gesetzlichen<br />
Richtlinien zu bewerten. Dort sind die Spielflächen vom Center-Management ausgewiesen,<br />
abgenommen und feuerpolizeilich geprüft.<br />
Zunächst sollen die relevanten staatlichen Richtlinien betrachtet werden. Eingegliedert sind<br />
sie in eine bestimmten Rangfolge, begonnen beim Grundgesetz über die föderalen Richtlinien<br />
bis zu den von Länderparlamenten erlassenen Verordnungen. „In der Praxis gibt es<br />
keinen Unterschied was die Wertigkeit von Gesetz und Verordnung für den einzelnen<br />
Bürger angeht“ 17 . Besonders hervorzuheben für die Umsetzung der Ausstellung sind die<br />
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) und die Verkaufsstättenverordnung (VkVO).<br />
Da nicht von einem bestimmten Bundesland ausgegangen werden kann, werden jeweils die<br />
Muster-Verordnungen zugrunde gelegt. Die dort erarbeiteten Regelungen sind zumeist<br />
ohne Änderungen in den Verordnungen der einzelnen Bundesländer erlassen worden. Auf<br />
die Besonderheit des Landes Berlins, welches weder über eine VStättVO noch über VkVO<br />
verfügt, sondern lediglich über eine Betriebsverordnung (BetrVO), soll nicht weiter eingegangen<br />
werden.<br />
17 Klaus 2006, Seite 14<br />
12
1. Versammlungsstättenverordnung<br />
Die in der Branche oft zitierte VStättVO kommt hier nicht zur Anwendung. Prinzipiell<br />
schließt sie zwar Ausstellungen in den Geltungsbereich ein, jedoch ergeben sich nicht die<br />
geforderten Mindestgrößen für die Anwendung der Verordnung: Keine 200 Besucher<br />
werden gleichzeitig dasselbe Modul der Ausstellung besuchen. Auch die daraus resultierende<br />
Mindestgröße des Raumes von 200 m² wird nicht erreicht.<br />
Dennoch ist es ratsam, die dort beschriebenen Anforderungen zu beachten und die einzelnen<br />
Elemente danach auszulegen: Die Verordnung gibt eine Auslastung von einer Person<br />
pro Quadratmeter der begehbaren Nutzfläche vor 18 . Beispielsweise ist auch eine Kino-<br />
Installation denkbar, deren Durchgangsbreiten zwischen den Sitzen nach VStättVO zu bemessen<br />
wären. 19 Auch die Beurteilung des Brandverhaltens von eingesetzten Materialen<br />
kann aus der VStättVO zitiert werden.<br />
2. Verkaufsstättenverordnung<br />
Vorwiegend sind die Regelungen der VkVO für den Bau und Betrieb einer Verkaufsstätte<br />
und Ladenstraße über 2000 m² Nutzfläche zu beachten. Vergleicht man beide Verordnungen<br />
sieht man, dass die Unterschiede zur VStättVO sehr gering sind. Die VkVO<br />
fordert, je nach Ausstattung, Brandabschnitte verschiedener Größe und gibt Anforderungen<br />
für Rettungswege. Diese dürfen eine ähnliche Länge haben, wie sie in der VStättVO<br />
gefordert werden. Das sind bei der VkVO 35 m, maximal 70 m bei vorhandenen Rauchabzugsanlagen<br />
20 ; bei der VStättVO 30 m, maximal 60 m bei entsprechend hoher Raumhöhe 21 .<br />
Die Anforderung an die Breiten der notwendigen Flure sind mit 2 m 22 strikter bemessen als<br />
in der VStättVO. Beide Verordnungen verlangen ab bestimmten Flächengrößen automatische<br />
Feuerlöscheinrichtungen 23 , wobei nur die VStättVO die Erfordernis beschreibt, bei<br />
überdeckten oder mehrgeschossigen Ausstellungsständen den wirkungsvollen Einsatz der<br />
Anlagen zu gewährleisten. Auch für den Fall, dass begehbare Räume und Aufbauten die<br />
Wirksamkeit der Sicherheitsbeleuchtung des Centers beeinträchtigen, muss eine gesonderte<br />
Beleuchtung eingebaut werden. Diese Anforderung ist zwar nicht explizit formuliert, aber<br />
sinnvoll. In beiden Gesetzestexten wird eine verantwortliche Person vorgeschrieben,<br />
welche den Betrieb der Einrichtung leitet. Laut der VStättV ist es ein Verantwortlicher für<br />
Veranstaltungstechnik 24 und laut VkVO ist es ein vom Betreiber bestimmter Vertreter 25 .<br />
18 MVStättV § 1 Abs. 2 Punkt 4<br />
19 MVStättV § 10<br />
20 MVkVO § 10 Abs. 2f<br />
21 MVStättV § 7 Abs. 1<br />
22 MVkVO § 13 Abs. 3<br />
23 MVStättV § 19, MVkVO §20<br />
24 MVStättV § 39. Die in MVStättV § 40 beschriebenen Einschränkungen gelten entsprechend.<br />
13
Mit dem Wort „Betriebszeit“ 26 sind nur die üblichen Verkaufszeiten der Läden gemeint. In<br />
den anderen Zeiten wird nur ein Wachschutz vor Ort sein. 27<br />
2.3.2 Berufsgenossenschaften<br />
Die Berufsgenossenschaften sind die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die<br />
Unternehmen und veröffentlichen Schriftenreihen für ihre Mitglieder, die so genannten<br />
Berufsgenossenschaftlichen Richtlinien, Vorschriften oder Informationen. Für jeden Teilbereich<br />
des Arbeitsprozesses gibt es Hilfestellungen.<br />
In dieser <strong>Masterarbeit</strong> sollen sie jedoch an der entscheidenden Stelle weiter zitiert werden.<br />
Eine allgemeine Beschreibung ist an diesem Punkt nicht sinnvoll. Da es dabei um sehr<br />
konkrete und anwendungsbezogene Richtlinien geht so werden zum Beispiel Hinweise zur<br />
persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bei der Handhabung 28 weiter beleuchtet. Ebenso<br />
gibt es zum Thema Ladungssicherung 29 viele unterstützende Hinweise.<br />
2.3.3 IGVW<br />
Die neuen im Jahr 2010 veröffentlichten Branchenstandards ‚SQ – Standards der Qualität‘,<br />
interaktiv erarbeitet zwischen verschiedenen Berufsverbänden (unter dem Dachverband<br />
igvw – Interessensverband Veranstaltungswirtschaft) und der Industrie, geben<br />
Durchführungsanweisungen für die Benutzung und Prüfung von Traversen und Elektrokettenzüge<br />
in der Veranstaltungstechnik.<br />
Hier werden Lastaufnahmemittel beschrieben und deren Verwendung erläutert. Diese<br />
Standards können als anerkannte Regeln der Technik gesehen werden und ermöglichen<br />
nahezu lückenlose Sicherheit<br />
Für die Hängung des Planetenmobiles oder anderer Dekorationen ist es ratsam diese<br />
beschriebenen Richtlinien zu beachten und sinngemäß anzuwenden.<br />
2.3.4 Gewährleistung<br />
Als Hersteller oder Bereitsteller von Produkten ist man zu Gewährleistung verpflichtet.<br />
Dies gilt für id3d-berlin selbst, aber auch für Zulieferer und Subunternehmer von<br />
id3d-berlin. Es gibt zwar rechtlich einen Unterschied zwischen einem Werkvertrag, also die<br />
Herstellung, Wartung und Veränderung von Sachen, und dem Kaufvertrag für bewegliche<br />
Güter, jedoch sind die Fristen für die zu betrachtenden Fällen gleich.<br />
25 MVkVO § 26 Abs. 1<br />
26 MVkVO § 26 Abs. 1<br />
27 vgl. Waclaw 2010<br />
28 Kapitel 3.1.2<br />
29 Kapitel 3.3.6<br />
14
Es ist wichtig diese Gewährleistungsansprüche und -forderungen in Verträgen genau zu be-<br />
nennen und gegen den Sachverhalt des Verschleißes abzugrenzen. Auch die Bereitstellung<br />
des Ersatzes oder die Reparaturdauer (24 Stunden oder 48 Stunden) oder der Ort der<br />
Ausbesserung (vor Ort oder Einsenden) müssen genau benannt werden.<br />
Zwischen Unternehmen gilt eine Gewährleistungspflicht von zwei Jahren, durch Verträge<br />
kann sie aber auf mindestens eine Jahr abgesenkt werden. Eine Verlängerung ist sinnvoll,<br />
da die Ausstellung für einen längeren Zeitraum von zwei Jahren geplant wird. 30<br />
2.3.5 Normen und Nachweise<br />
Von den verwendeten Produkten oder Aufbauten darf nachweislich keine Gefahr für Leib<br />
und Leben des Benutzers ausgehen. Belege hierfür müssen stets mit der Ausstellung mitgeführt<br />
werden, um bei Bedarf den Behörden wie Feuerwehr, Bauamt oder ähnliche vorlegen<br />
zu können.<br />
Vergleichbar mit einem Baubuch für einen fliegenden Bau laut der Richtlinie über den Bau<br />
und Betrieb fliegender Bauten (FlBauR) müssen alle relevanten Bestandteile auf ihre Sicherheit<br />
geprüft und berechnet werden. Vor allem ist hier ein Nachweis der Sicherheit gegen<br />
Kippen hoher Elemente in Verbindung mit dem Boden wichtig.<br />
Die Verwendung von unbedenklichen, speichel- und schweißechten Materialen ist zwingend<br />
notwendig. Es muss davon ausgegangen werden, dass kleine Kinder einzelne Bestandteile,<br />
vor allem bewegte Hands-On-Exponate auch in den Mund nehmen können.<br />
Solche Unbedenklichkeitszertifikate, so genannten Praxismerkblätter, müssen bei der Ausstellung<br />
mitgeführt werden. Genauso verhält es sich mit Zertifizierungen der Baustoffe für<br />
die Brandsicherheit.<br />
Der Hersteller oder der Vertrieb des jeweiligen Produktes verfügt über diese Dokumente.<br />
Entweder sind sie auf den Homepages einzusehen oder werden beim Kauf mitgeschickt.<br />
30 vgl. HWK 2010<br />
15
3 Möglichkeiten für Wanderausstellungen<br />
Das folgende Kapitel, der Hauptteil dieser Arbeit, beschäftigt sich mit den drei Hauptbereichen<br />
Produktion, Logistik und Personal. Grundlegende Begriffe werden definiert,<br />
Zusammenhänge beschrieben und Lösungsmöglichkeiten zu den beschriebenen Vorraussetzungen<br />
dargestellt.<br />
3.1 Begriffsdefinitionen<br />
Begriffsdefinitionen für den Bereich Produktion und Logistik sind nicht nur für das Verfassen<br />
einer Abschlussarbeit erforderlich, sondern auch, um mit Subunternehmern und<br />
Partnern auf einer einheitlichen Ebene zu kommunizieren.<br />
Die Norm DIN EN ISO 9000 kann sowohl auf die industrielle Produktherstellung als<br />
auch auf Dienstleistungen angewendet werden. Die Norm bietet ein Gerüst, um alle wichtigen<br />
Aspekte des fertigen Produktes oder einer Dienstleistung beurteilen zu können.<br />
Ebenso kann man die Instandsetzung und die Wartung bewerten.<br />
3.1.1 Qualitätsmanagement<br />
Um die Zusammenhänge zu erläutern, werden die relevanten Begriffe zuerst benannt und<br />
definiert, später werden sie anhand eines Beispiels veranschaulicht. Die beschriebenen<br />
Zusammenhänge sind ebenfalls in Abbildung 3-1 verdeutlicht. Im Folgenden steht nach<br />
einem fett gedruckten Wort (die Erklärung aus der DIN EN ISO 9000 in Klammern<br />
dahinter). 31<br />
Der Problematik der kundengerechten Anspruchserfüllung nähert man sich über die zwei<br />
großen Grundbegriffe Anforderung (Erfordernis oder Erwartung, welches vorausgesetzt<br />
oder verpflichtend ist) und Qualität (Grad, in dem Anforderungen erfüllt werden).<br />
Die Anforderung muss klar definiert und an alle Beteiligen kommuniziert werden. Dies ist<br />
eine wesentliche Voraussetzung im Qualitätsmanagement und sichert eine hohe Zuverlässigkeit<br />
und Haltbarkeit aller damit zusammenhängenden Operationen.<br />
Das Qualitätsziel (etwas bezüglich Qualität zu Erreichendes) sollte nach Möglichkeit zu<br />
100 % erfüllt sein.<br />
Hierfür ist die ständige Verbesserung (wiederkehrende Tätigkeiten zur Erhöhung der<br />
Eignung, Anforderungen zu erfüllen) notwendig. Es wird also nicht die Anforderung geändert,<br />
sondern versucht, das Produkt durch diverse Tätigkeiten auf einem Niveau zu<br />
halten, auf dem es diese Anforderung weiterhin erfüllt. Die Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit,<br />
Funktionsfähigkeit, Instandhaltbarkeit und Instandhaltungsbereitschaft) muss<br />
31 DIN EN ISO 9000, Seiten 17ff<br />
16
gewährleistet sein. Ein Element muss unter den angeforderten Konditionen zuverlässig<br />
funktionieren. Ist das nicht der Fall, entstehen Fehler (Nichterfüllung einer Anforderung).<br />
Nicht zu verwechseln ist ein Fehler mit einem Mangel (Nichterfüllung einer Anforderung<br />
in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch). Ersterer tritt auf durch eine<br />
Unterdimensionierung oder durch einen elektrischen Defekt. Ein Mangel hingegen resultiert<br />
aus unsachgemäßem Umgang. Hier gibt es viele Möglichkeiten: fehlerhafte Verpackung,<br />
falsche klimatische Verhältnisse, rabiate Handhabung et cetera.<br />
Fehler und Mangel müssen durch die Korrektur (Beseitigung eines erkannten Fehlers)<br />
eliminiert werden. Eine Korrekturmaßnahme (Beseitigung der Ursache eines erkannten<br />
Fehlers) hingegen wird aus einer auf die zukünftige Verwendung des Produktes ausgerichteten<br />
Sichtweise heraus vorgenommen und stellt sicher, dass ein Fehler sich nicht<br />
wiederholt.<br />
Die Korrektur ermöglicht zwei Wege: Einerseits die Nacharbeit (Maßnahme an einem<br />
fehlerhaften Produkt damit es die Anforderungen erfüllt), welche besagt, dass eine Mehraufwand<br />
eingesetzt wird, um das Geforderte zu erfüllen. Die zweite Option ist die Neueinstufung<br />
(Änderung der Anspruchsklasse). Dabei wird die Klassifikation verändert, so<br />
dass nun die Anforderungen dieser neuen Stufe erfüllt wird. Eine Neueinstufung wäre zu<br />
erwägen, wenn das Bauteil zwar die Anforderung aber nicht mehr hundertprozentig das<br />
Qualitätsziel erfüllt. Sinnvoll wäre die Neueinstufung, wenn der Aufwand der Nacharbeit<br />
in keinem angemessenen Verhältnis zur Verbesserung des Qualitätsgrades steht.<br />
Unter Reparatur (Maßnahme an einem fehlerhaften Produkt, um es für den beabsichtigten<br />
Gebrauch annehmbar zu machen) versteht man eine schnelle Nachbesserung, um die<br />
Komponente verwenden zu können. Ein besonderes Augenmerk sollte auf das gewählte<br />
Wort „annehmbar“ gerichtet werden: Hier handelt es sich um eine einfache und schnelle<br />
Überarbeitung, die das jeweilige Element benutzbar macht. Jedoch ist eine grundlegende<br />
Ausbesserung notwendig!<br />
Anhand des Medieneinsatzes werden die Zusammenhänge der DIN EN ISO 9000<br />
exemplarisch aufgezeigt<br />
Im Folgenden werden die erläuterten Begriffe anhand von Beispielen veranschaulicht.<br />
Die Anforderung ist, dass die in der Wanderausstellung verwendeten Fernseher unzerkratzt<br />
und sauber sind, die richtigen Daten immer ruckelfrei wiedergeben und der Ton<br />
unverzerrt zu hören ist. Die Qualität und somit das Qualitätsziel sind zu 100 % zu<br />
erfüllen.<br />
17
Abbildung 3-1 Zusammenhänge laut DIN EN ISO 9000 32<br />
Die ständige Verbesserung würde die Überprüfung der Medienstationen auf neue<br />
Firmware beinhalten, bei welcher alte Softwarefehler ausgebessert wurden. Die Sicherheit,<br />
dass die Anforderung erfüllt werden kann, steigt. Zuverlässigkeit ist gegeben, wenn der<br />
Fernseher problemlos über eine vorher definierte Zeit funktioniert, für Wartungen zugänglich<br />
ist und für den Fall eines Defektes vom Handel oder dem Hersteller für die<br />
Laufzeit der Ausstellung vorgehalten wird. Ein Fehler ist eingetreten, wenn die Medien<br />
32 Bildquelle: DIN EN ISO 9000, Seite 40, Bild A.9<br />
18
eispielsweise aufgrund eines herausgerutschten Steckers kein Bild oder Ton abspielen.<br />
Das Qualitätsziel, der angestrebte Grad der Erfüllung der Anforderung, ist nicht erreicht.<br />
Die Ursache eines Mangels wäre Vandalismus, zum Beispiel wenn Besucher die Displays<br />
beschädigen. Der beabsichtigte Gebrauch war nicht gegeben. Mögliche Korrekturen sind<br />
in diesen Fällen ein Austausch des defekten Gerätes oder das Einstecken eines losen<br />
Steckers. Eine Korrekturmaßname des Fehlers ist das Festkleben des Steckers. Der<br />
Mangel könnte durch eine kratzsichere Scheibe vor den Fernseher unterbunden werden.<br />
Durch Nacharbeit wird die Korrekturmaßnahme nachhaltig erreicht. Eine Reparatur<br />
hingegen ist die schnelle Ausbesserung vor Ort. Eine grundlegende Änderung muss<br />
nachgeholt werden. Das Akzeptieren von kleinen Kratzern auf einem Display, welches<br />
eigentlich hätte sauber und kratzfrei sein sollen, stellt eine Neueinstufung der<br />
Qualitätsanforderung dar.<br />
3.1.2 Handhabung<br />
Um eine erfolgreiche und, wie gefordert, ressourcenschonende Ausstellung zu realisieren,<br />
sind Arbeitsfluss- und Arbeitsstrukturoptimierung unerlässlich. Bereits 1910 verfasste<br />
Frederick Taylor 33 eine wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema verfasst. Hierbei<br />
betrachtete er die Handgriffe, die verwendeten Werkzeuge und die Schulung und<br />
Motivation der Arbeiter, wobei sein Ziel eine Leistungssteigerung der Arbeitskräfte um ein<br />
vielfaches 34 war.<br />
Ähnlich der MTM-Methode 35 beschreibt er zunächst, die einzelnen Handgriffe vieler verschiedener<br />
Arbeiter und ermittelt hieraus die günstigste Art und Weise eine Aufgabe zu<br />
bewerkstelligen. „Diese beste Methode wird zur Norm und bleibt Norm, bis sie ihrerseits<br />
wieder von einer schnelleren und besseren Serie von Bewegungen verdrängt wird.“ 36<br />
Analog dazu betrachtet er die verwendeten Arbeitsgeräte und Werkzeuge und findet Optimierungsmöglichkeiten.<br />
Der letzte Schritt ist die Schulung der Arbeiter: Hier findet er<br />
heraus, dass ein „Arbeitsbureau von vornherein genaue schriftliche Anweisungen ausarbeitet,<br />
wie jede Arbeit am besten auszuführen ist“ 37 und an die Mitarbeiter weitergibt.<br />
Weitere grundlegende Studien zum Thema Handhabung (materials handling) verfasste<br />
John Immer 38 vierzig Jahre später und basierend auf den vier Prinzipien, den Planning<br />
33 vgl. Taylor 1913<br />
34 vgl. Taylor 1913, Seite 42ff. Hier beschreibt der Autor, wie es möglich ist das Tagespensum eines<br />
Stahlverladers von 12,5 t Eisen auf 47 t Eisen zu erhöhen.<br />
35 Kapitel 3.4.1<br />
36 Taylor 1913, Seite 126<br />
37 Taylor 1913, Seite 131<br />
38 vgl. Immer 1953<br />
19
principles, Operating principals, Equipment principles und Costing principles 39 , welche<br />
bestrebt sind, Effizienz zu erhöhen oder Kosten zu sparen.<br />
Unter diesen vier Überschriften finden sich grundlegende Hinweise, welche vor allem, aber<br />
nicht nur, auf die industrielle Produktion angewendet werden. Im Folgenden wird eine<br />
Auswahl daraus dargestellt, da nicht alle Punkte auf eine Wanderausstellung anwendbar<br />
sind. 40 Diese Auswahl wird durch relevante weitere Quellen ergänzt.<br />
1. Eine Flussunterbrechung 41 soll vermieden werden. Es ist wünschenswert, dass ein<br />
Gegenstand, welcher in Bewegung ist, seinem Zielpunkt ohne Unterbrechung erreicht.<br />
Kraft- und somit energieaufwendig ist die Beschleunigung eines Körpers und nicht dessen<br />
kontinuierliches Fortbewegen.<br />
Im Fall von ‚Der Mars‘ kann das bedeuten, dass man Türen für die Zeit der Transportbewegungen<br />
im Haus im offenen Zustand arretiert, um diesen Fluss zu gewährleisten oder<br />
davon absieht, einzelne Elemente von einem Transportsystem auf das andere umzuladen.<br />
2. Systematisierung ist ein sehr wichtiger Faktor: Nur hierdurch kann eine schnelle und<br />
fehlerfreie Arbeitsweise realisiert werden. Der Mitarbeiter muss sich nicht auf viele verschiedene<br />
Gegebenheiten einrichten, sondern kann nach einer kurzen Einweisung ohne<br />
Probleme alleine weiterarbeiten.<br />
Durch eine starke Strukturierung wird auch eine Entscheidungsfindung erleichtert, da nur<br />
wenige diskrete Lösungsmöglichkeiten bestehen. Sind die Aufnahmebuchsen für Aufbauten<br />
in den Bodenteilen in einem Raster von 0,5 × 0,5 m angeordnet, ist die Positionierung<br />
einerseits zwar beschränkt, andererseits aber auch klar definiert. 42<br />
3. „It is quicker to move a number of items as a unit than it is to move them individually.“ 43<br />
Diese Anforderung ist selbsterklärend. Bewegt man die einzelnen Bestandteile, ohne sie<br />
vorher in sinnvolle Einheiten zusammen zu fassen, dauert der Transport viel länger.<br />
4. Wartungsarbeiten sollen an geplanten Zeitpunkten durchgeführt werden und nicht<br />
während der Arbeitszeit. Ein Ausfall der Hilfsmittel kann einen erheblichen Mehraufwand<br />
für die Fertigstellung der Arbeit bedeuten. Fällt beispielsweise einer von zwei Handgabel-<br />
39 vgl. Immer 1953, Seite 23ff<br />
40 Etwa wird der Hinweis gegeben, dass Lagerung und Transport miteinander kombiniert werden können.<br />
Beispielhaft hierfür ist der Import von Bananen zu nennen, welche während des Transports nachreifen.<br />
41 Es wird hier das Wort ‚Rehandling‘ verwendet, also das nochmalige oder mehrmalige Handhaben einer<br />
Ware oder eines Gegenstandes.<br />
42 vgl. Weimer<br />
43 Immer 1953 Seite 26<br />
20
hubwagen 44 aus, dauert das Bereitstellen der Bauteile mindestens doppelt so lange.<br />
Bei den besonders langen Wegen in einem Einkaufscenter ist das ein nicht zu<br />
unterschätzender Faktor.<br />
5. Das richtige und adäquate Werkzeug soll gewählt, bereitgestellt und verwendet werden.<br />
Auch muss das Werkzeug aufeinander abgestimmt und standardisiert sein. Der Begriff<br />
‚Norm‘ oder ‚normiert‘ wird absichtlich nicht verwendet. Es geht nicht darum, genormte<br />
Werkzeuge zu verwenden, sondern nur ein gewisses und übersichtliches Spektrum an<br />
Hilfsmitteln. Verwendet man Holzschrauben sollte man sich auf ein Profil 45 einigen. So<br />
können sich alle Mitarbeiter einiger weniger Werkzeugtypen bedienen. Diese können<br />
meist mitgeführt und müssen nicht zeitaufwendig geholt werden. Auch hier sei wieder auf<br />
die Wege in einem Center verwiesen, welche einen Werkzeugwechsel bis auf eine viertel<br />
Stunde ausdehnen können.<br />
6. Komplizierte Werkzeuge oder Systeme sollen durch einfache ersetzt werden. Eine Handspannvorrichtung,<br />
wie in Abbildung 3-2 gezeigt, kann eine Schraubenverbindung ersetzen.<br />
Ist die Spannvorrichtung permanent an den Ausstellungsstücken angebracht, wird keinerlei<br />
Werkzeug mehr benötigt. Das Aufnehmen von Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben<br />
ebenso zweier Schraubenschlüssel und das Hantieren mit diesen bleiben aus. Außerdem<br />
kann durch eine vorgefertigte Verriegelung eine genau definierte und berechnete Kraft aufgebracht<br />
werden. Ein Zerstören durch falsche Handhabung ist ausgeschlossen.<br />
Abbildung 3-2 Verschlussspanner horizontal 46<br />
Neben Systemen für eine schnelle Befestigung sind auch Vorkehrungen für eine genaue<br />
Passung der Bauelemente zueinander sinnvoll. Möglich sind hier Nut- und Federverbindungen<br />
oder Kegelpassungen, welche bei der Montage ineinander gesteckt werden und<br />
einen sicheren, aber auch definierten, Sitz garantieren. Die Vorteile sind: Bei Grafiken,<br />
welche über mehrere Bauteile angebracht sind, entstehen keine unschönen Versatzkanten.<br />
44 umgangssprachlich „Hubwagen“<br />
45 die unterschiedlichen Aufsätze für Schraubendreher wie Torx, Pozidriv oder Inbus werden als Profil<br />
bezeichnet.<br />
46 Bildquelle: AFM 2010<br />
21
Ebenso ist eine leichtere Montage möglich: Das Positionieren und Halten der Bauteile wird<br />
enorm erleichtert. Nachteilig sind auskragende Bolzen oder Federn, besonders bei Verpackung<br />
und Transport.<br />
7. Um eine angemessene Belastung für den Mitarbeiter zu ermitteln ist die BGI 582 zum<br />
Heben und Halten von Lasten maßgeblich zu Rate zu ziehen. Eine beispielhafte Belastungsrechnung<br />
schafft Klarheit: Nimmt man an, eine Frau hebt 40 bis 200 Mal eine Last von<br />
maximal 15 kg durch tiefes Beugen bei eingeschränkten ergonomischen Bedingungen ergibt<br />
sich ein Punktwert von 32 Punkten. Dies bedeutet eine „wesentlich erhöhte Belastung“<br />
47 , welche auch durchschnittlich belastbare Menschen körperlich überanspruchen. Für<br />
die Berechnung wurde eine Frau als Maßstab herangezogen, da davon ausgegangen wird,<br />
dass auch Frauen mitarbeiten. Die Grenzgewichte für Frauen sind geringer als die für Männer,<br />
für Schwangere und Jugendliche gelten besondere Regelungen.<br />
Um diesen hohen Punktewert zu verkleinern sind verschiedene organisatorische und<br />
mechanische Abhilfen möglich:<br />
a. „Das Aufnehmen und das Ablegen sowie das Bearbeiten der Werkstücke sollte in aufrechter<br />
Körperhaltung möglich sein.“ 48 Ein Vorbeugen oder Strecken zum Aufnehmen der<br />
Last ist ungünstig. Der Schwerpunkt der Last sollte so nah wie möglich am Körper sein.<br />
Ebenso ist ein Heben über Hindernisse zu vermeiden.<br />
b. Handgriffe, Mulden oder ähnliche Möglichkeiten der einfachen manuellen Handhabung<br />
müssen gewährleistet werden. Die Abmaße richten sich nach ergonomischen Grundsätzen.<br />
Betrachtet man einen Handgriff aus Rundmaterial hat dieser eine definierte Mindestbreite,<br />
nach dem 95. Perzentil 49 für Männer (94 mm) 50 und einen Mindestumfang nach dem<br />
5. Perzentil für Frauen (110 mm, entspricht einem Durchmesser von 35 mm) 51 . Der Griff<br />
sollte auf einer gut zugänglichen Höhe angebracht sein, was zwischen dem 5. Perzentil für<br />
Frauen (670 mm) und dem 95. Perzentil für Männer (825 mm) liegt. 52<br />
Der Mittelwert ist 748 mm.<br />
c. Bei großen Gewichten und unhandlicher Ware empfiehlt sich die Zuhilfenahme von<br />
mechanischer Hilfe. Ermüdungen und Überforderung der Mitarbeiter werden unwahr-<br />
47 BGI 582, Seite 18<br />
48 Tiedemann 1995<br />
49 Durch Perzentile wird die Verteilung in 100 gleich große Teile zerlegt.<br />
50 vgl. DIN 33402-2, Tabelle 56 – Handbreite<br />
51 vgl. DIN 33402-2, Tabelle 57 – Griffumfang der Hand<br />
52 vgl. DIN 33402-2, Tabelle 19 – Höhe der Hand (Griffachse) über Standfläche<br />
22
scheinlicher und somit eine kontinuierliche Arbeit gewährleistet. Um solche Hilfsmittel zu<br />
verwenden, müssen Vorkehrungen vorhanden sein, wie die Einschübe für die Zinken des<br />
Handgabelhubwagens oder ähnliches.<br />
Durch die letzten drei Aspekte kann nicht nur eine ergonomische und sichere Arbeitsweise<br />
erreicht werden, sondern auch ein wartungsfreies Arbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass<br />
etwas aus der Hand fällt und dadurch Gegenstände zerstört, ist wesentlich geringer!<br />
Ein weiterer Vorteil ist, dass Mitarbeiter die Flächen, die dem Besucher zugewendet sein<br />
werden, nicht berühren. Das Risiko von Verschmutzungen, Zerstörungen oder Zerkratzen<br />
der Grafiken beim Auf- und Abbau wird verringert.<br />
3.1.3 Schnittstellen<br />
Reibungs- und Anpassungsverluste können viele Ressourcen binden. Als ein Beispiel kann<br />
die Stromversorgung genannt werden: Verwenden nicht alle Partner des Projektes einen<br />
einheitlichen Standard (etwa Schuko-Stecker) entstehen Schnittstellen, an denen man<br />
adaptieren muss. Allerlei weitere nicht nur technische Schnittstellen sind zu bedenken. Ist<br />
gestalterisch ein einheitliches Erscheinungsbild gewünscht, stellt die Oberflächenbeschaffenheit<br />
und die Farbe der verschiedenen Zulieferer auch eine Schnittstelle dar. 53<br />
Die Schnittstellenproblematik kann nur durch eine ausreichend genaue und detaillierte<br />
Vorplanung behoben werden. Jeder Bestandteil muss eindeutig beschrieben werden und<br />
auch mit den ausführenden Partnern abgestimmt werden.<br />
Hierfür ist wieder, wie vorher 54 beschrieben, eine stringente Systematisierung erforderlich.<br />
3.2 Produktion<br />
3.2.1 Hands-On-Exponate<br />
Als Hands-On-Exponate werden Ausstellungsstücke bezeichnet, an denen ein imaginäres<br />
‚Bitte Berühren!‘-Schild steht. Den Besuchern werden durch selbsttätiges und spielerisches<br />
Experimentieren technische und naturwissenschaftliche Phänomene vermittelt.<br />
Hands-On-Exponate dürfen nach den Grundmodulen der Ausstellung ausgelegt werden,<br />
um eine reibungsfreie Wechselwirkung des Grundaufbaus und des Exponats sicher zu<br />
stellen. Strom-, Datenverbindungen oder sonstige Durchlässe müssen aneinander<br />
abgestimmt werden. Ebenso ist die Verpackung zu beurteilen, welche nach den weiter<br />
unten 55 beschriebenen Eigenschaften zu fertigen ist.<br />
53 vgl. Beier 2010<br />
54 Punkt 2. Kapitel 3.1.2<br />
55 Kapitel 3.3.4<br />
23
Die Sicherheit des Bedieners ist wichtig. Es darf keinerlei Verletzungsgefahr durch be-<br />
wegliche Teile entstehen, die Quetschungen oder Stauchungen verursachen könnten. Auch<br />
wenn zwei Kinder gleichzeitig an einem Element spielen, muss der Schutz garantiert sein.<br />
Anhand eines ‚Tisch-Kicker-Spiels‘ lässt sich dies beispielhaft nachvollziehen: Durch das<br />
Drücken des Griffs tritt auf der Gegenseite die Führungsstange der Spielerfiguren aus.<br />
Dies kann zu Verletzungen führen und muss vermieden werden.<br />
Vom Besucher bewegte Einzelteile müssen durch Auffangmechanismen zurückgehalten<br />
werden. Hierbei muss nicht das bewährte Seil verwendet werden: Bestandteile können so<br />
gestaltet werden, dass es nicht möglich ist, sie aus einer Vitrine (oder ähnlichem) zu entfernen.<br />
Sind die Bestandteile größer als der Eingriff, ist dieser Fall gegeben.<br />
Verschleißteile sollten möglichst nicht verwendet werden. Zum Beispiel können zwei aufeinander<br />
reibende Flächen durch abriebfeste Materialien, wie Metall - Metall, geschützt<br />
werden. Noch besser ist eine lagergeführte Ausführung, so wäre die Leichtläufigkeit gesichert<br />
und auch mögliches Quietschen minimal!<br />
Besteht die Notwendigkeit Verschleißteile zu verwenden, müssen bei den entworfenen<br />
Systemen Reparaturen und Nacharbeit mit einfachen Mitteln von einer eingewiesenen<br />
Person zu erledigen sein. In diesem Zusammenhang ist eine beigelegte Bedienungs- und<br />
Inbetriebnahmeanleitung hilfreich. Mitgelieferte Reparaturmaterialien, nach Möglichkeit<br />
auch das zu verwendende Werkzeug, erleichtern die Arbeit sehr. Auch ist eine Fehlanwendung<br />
ausgeschlossen.<br />
Und schlussendlich müssen die Hands-On-Exponate, besonders deren Oberflächen, so<br />
ausgelegt werden, dass sie eine lange Anwendungsdauer neugieriger und wissenshungriger<br />
Menschen überstehen. Die Reinigung darf nicht vergessen werden. In schlecht zugänglichen<br />
Stellen sammeln sich schnell Verschmutzungen, was hier besonders zu bedenken ist,<br />
da es sich ja um ein HANDS-ON-EXPONAT handelt. Ebenso darf die oben erwähnte<br />
Schweiß- und Speichelechtheit nicht außer Acht gelassen werden.<br />
3.2.2 Medien<br />
Beim Einbau und der Verwendung von Mediengeräten sind bestimmte Punkte zu beachten.<br />
Wie oben 56 beschrieben, müssen elektrische Betriebsmittel immer zugänglich<br />
sein, um eine Revision oder Ausbesserung ausführen zu können.<br />
Eine fehlerfreie Fertigstellung erfordert, dass ein defektes Gerät schnellstmöglich ausgewechselt<br />
werden kann. Da in der kurzen Aufbauzeit nicht verantwortet werden kann,<br />
56 Kapitel 0<br />
24
dass ein Ersatzgerät geliefert wird, muss Ersatz für jedes Gerät ständig mitgeführt und<br />
vorgehalten werden.<br />
Möchte man die Anzahl der bereitzuhaltenden Wechselgeräte gering halten, muss man<br />
auch die Anzahl der eingesetzten Gerätetypen klein halten. Verwendet man beispielsweise<br />
drei Displaytypen, mit 40’’, 32’’ und 21’’ Bildschirmdiagonale, ergibt sich bei doppelter<br />
Sicherheit die Notwendigkeit von sechs Ersatzdisplays.<br />
Das defekte Gerät kann während der Spieldauer von zehn Tagen entweder gewartet oder<br />
zum Hersteller gesandt werden.<br />
Es ist von sinnvoll, Produkte zu verwenden, die über die Laufzeit der Ausstellung lieferbar<br />
sind. Auslaufprodukte sind potentiell zwar zu günstigeren Konditionen zu erwerben, wird<br />
aber ein Austausch notwendig, könnte das gleiche Produkt unter Umständen nicht wiederbeschafft<br />
werden. Beim Einsatz eines anderen Gerätes wären der passgenaue Einbau und<br />
die Kabelzuführungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr nutzbar. Sie müssten erneuert<br />
werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutet.<br />
Prinzipiell ist es empfehlenswert, Geräte zu verwenden, die sich beim Herstellen der Spannungsversorgung<br />
selbständig in Betrieb gehen und die gewünschten Inhalte zeigen.<br />
Die Verwendung von Einbaugeräten, vor allem bei Displays, birgt viele Vorteile. Montagevorrichtungen<br />
sind vorhanden und die Bedienelemente sind nicht nach außen gewandt.<br />
Ein optisch einheitlicher Abschluss zur Architektur kann geschaffen werden. Während<br />
des Transportes können die Geräte eingebaut bleiben, ohne dass sich hieraus Probleme<br />
ergeben. Das zeitaufwendige Entnehmen der Geräte beim Abbau und wiederholte Montieren<br />
beim Aufbau entfallen. Sie müssen lediglich fest eingebaut sein und dürfen nicht<br />
aneinander reiben oder schlagen. 57<br />
Bei der Verwendung von elektrischen Geräten entsteht Wärme, welche abgeleitet werden<br />
muss. Bei unzureichender Kühlung werden schnell Temperaturen erreicht, die die Bauteile<br />
zerstören. Schon ab etwa 80°C können irreparable Schäden entstehen oder das Gerät<br />
schaltet sich durch einen Schutzmechanismus selbstständig aus.<br />
Für eine ausreichende Luftzirkulation muss kalte Frischluft zugeführt oder warme Abluft<br />
abgesaugt werden. Im Idealfall sollten beide Systeme gleichzeitig verwendet werden. Wird<br />
bei der Montage die natürliche Zirkulation, also das Aufsteigen von warmer Luft, respek-<br />
57 vgl. Gottwald 2010 und Krämer 2010<br />
25
tiert, erhöht sich der Wirkungsgrad der Anlage. Bei der Installation der Zu- und Abführ-<br />
ungen von Luft, ist darauf zu achten, dass die Lüfter möglichst weit voneinander entfernt<br />
angebracht werden und vor Staub geschützt sind. Ebenso sind die Geräuschemissionen<br />
der Lüfter zu berücksichtigen.<br />
Temperaturunterschiede zwischen Innen und Außen, welche vor allem im Winter auftreten<br />
können, sind nicht problematisch für die elektrischen Geräte. Lediglich ist darauf zu<br />
achten, dass eventuell entstehendes Kondenswasser verdunstet ist, bevor die Geräte angeschaltet<br />
werden. 58<br />
3.2.3 Beleuchtung<br />
Um eine einheitliche und gleichbleibende Ausleuchtung der Ausstellung an den verschiedenen<br />
Spielorten zu realisieren, darf nicht nur auf die fest eingebaute Beleuchtung des jeweiligen<br />
Hauses zurückgegriffen werden. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Gegebenheiten<br />
der Spielorte sollte das Lichtkonzept möglichst autark machen, jedoch auf der<br />
anderen Seite auch so, dass eine Interaktion mit der Lichtsituation des Centers hergestellt<br />
werden kann.<br />
Ladenstraßen mit verglasten Dächern sind tagsüber lichtdurchflutet, eine zusätzliche Beleuchtung<br />
ist überflüssig oder sogar wirkungslos, bei Dämmerung und Nacht jedoch oder<br />
in Untergeschossen wird sie notwendig.<br />
Die Lichtsituation des Centers kann als Grundbeleuchtung der Ausstellung genutzt werden,<br />
sie ist aber naturgemäß für die Nutzung als Einkaufsstrasse ausgelegt, Ausstellungsaufbauten<br />
stehen möglicherweise außerhalb des Lichtkegels.<br />
Detaillicht oder die Unterstützung der Grundbeleuchtung kann erreicht werden, indem<br />
man auf das ERCO-System der Center aufbaut. Wie im Fragebogen 59 ermittelt, sind 79 %<br />
der Center mit Schienen ausgestattet, jedoch kann nicht immer die ideale Position der<br />
Schienen sichergestellt werden. Folglich empfiehlt sich, die Scheinwerfer an der eingebrachten<br />
Architektur zu befestigen.<br />
Wird auf das System von ERCO aufgebaut, ergibt sich eine maximale, komplett autarke<br />
aber auch mit den Centern kompatible Beleuchtungssituation.<br />
Beleuchtungskörper sind in den Centern zwar vorhanden, jedoch sind die Typen, die<br />
Anzahl und Qualität von Spielort zu Spielort unterschiedlich. Deshalb sollte mindestens die<br />
benötigte Grundausstattung an Beleuchtungskörpern bereitgehalten werden, welche durch<br />
die gegebenenfalls vorhandene Centerausstattung ergänzt werden kann.<br />
Die Beleuchtung von Vitrinen muss lediglich transportsicher angebracht sein.<br />
58 vgl. Balin 2010<br />
59 vgl. Kapitel 2.2.3<br />
26
3.2.4 Elektroverkabelung<br />
Neben der Beleuchtung, die mit elektrischer Energie versorgt werden muss, enthält die<br />
Ausstellung eine Vielzahl an interaktiven elektronischen Medien und Exponaten. Mittels<br />
des im Rahmen dieser Arbeit erstellten Fragebogens 60 wurde unter anderem ermittelt, dass<br />
die Möglichkeiten der Stromzufuhr in den Centern jeweils sehr unterschiedlich sind. Die<br />
Entfernung des Moduls von der Stromquelle, die Größen der bespielten Flächen und die<br />
Stellen, an welchen eine Spannungsversorgung gebraucht wird, variieren. Ein flexibler Einsatz<br />
der Elektrotechnik ist deshalb erforderlich.<br />
Die Sicherheit hat bei der elektrischen Verkabelung die allerhöchste Priorität. Dies<br />
bedeutet, dass Montage und alle erforderlichen Prüfungen von einer befähigten Person<br />
durchgeführt werden müssen. Elektrische ortsveränderliche Betriebsmittel, genauso wie<br />
Verlängerungs- und Anschlussleitungen mit Steckern müssen bei Inbetriebnahme, nach<br />
Reparatur und spätestens nach einem Jahr von einer Elektrofachkraft unter Zuhilfenahme<br />
geeigneter Messgeräte geprüft werden. Auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person<br />
darf dieser Tätigkeit nachkommen. 61<br />
Um eine ordnungsgemäße Prüfungsmöglichkeit zu gewährleisten, sollten die Kabel zugänglich<br />
verbaut werden. Nicht nur ein Stecker oder eine Buchse, sondern das ganze Kabel<br />
muss zugänglich, auswechselbar und prüfbar sein. Dies gilt selbstverständlich genauso für<br />
Datenkabel. An Stellen mit starker mechanischer Beanspruchung des Kabels, etwa bei einer<br />
Türdurchführung, muss das Kabel vor jeder Inbetriebnahme durch Sicht prüfen werden.<br />
Prinzipiell, wie im Kapitel Handhabung 62 erläutert, soll auch bei der Stromverkabelung kein<br />
Werkzeug verwendet werden. Alle elektrischen Elemente über Steckverbindungen aufzuführen<br />
sind und nicht über Installationsklemmen. Dies schafft nicht nur eine Zeitersparnis,<br />
sondern vor allem auch einen hohen Sicherheitsstandart.<br />
60 vg. Kapitel 2.2.3<br />
61 vgl. BGV A 3, § 5 Tabelle 1B<br />
62 Kapitel 3.1.2<br />
27
Abbildung 3-3 Schematische Stromverkabelung der einzelnen Module<br />
Die elektrischen Anschlussmöglichkeiten der verschiedenen Center sind sehr unterschied-<br />
lich. 63 CEE-Drehstrom, Schukoanschlüsse mit 10 A und/oder die ERCO-Schiene stehen<br />
zur Verfügung. Die Ausführung der Spannungsversorgung innerhalb der Ausstellung sollte<br />
jedoch immer einheitlich und gleich erfolgen, um gegebenenfalls nur einmal adaptieren zu<br />
müssen und um eine stringente Systematik zu schaffen. Die Auswahl der Quelle erfolgt<br />
mittels eines Um- und Ausschalters in der Zuleitung ebenso die gegebenenfalls nötige Adaptierung.<br />
Selbstverständlich dürfen keine elektronischen Bedienelemente dem Besucher<br />
zugänglich sein und müssen somit verschließbar eingebaut werden.<br />
63 Kapitel 2.2.3<br />
28
Für ein zielorientiertes Arbeiten sind vorgefertigte Kabelbäume notwendig. Ein Kabelbaum<br />
ist ein Bündel aus allen für die jeweilige Anwendung erforderlichen Kabeln. Es wird die<br />
maximale Längenanforderung für alle Spielorte ermittelt und der Baum danach ausgelegt.<br />
Überschüssige Leitungen müssen gegebenenfalls Platz im Bodenaufbau oder in einzelnen<br />
Ausstellungselementen finden. Fällt eine Anwendung weg, so wird der Kabelbaum trotzdem<br />
mit der vollen Kapazität verlegt, die überzähligen Anschlüsse bleiben frei. 64<br />
Ein vorgefertigtes Kabel mit mehreren Litzen ist für lange Zuleitungsstrecken sinnvoll.<br />
Der Außendurchmesser ist geringer und das Erscheinungsbild aufgeräumter. Für die weitere<br />
Verkabelung sollte ein individuell gefertigter Kabelbaum bevorzugt werden, welcher<br />
aus einer Vielzahl von einzelnen unabhängigen Kabeln besteht und dann mit Klebeband<br />
oder Kabelbinder zu einem Strang verknüpft wird. Eine Reparatur oder Neuanpassung ist<br />
möglich, dazu muss nur das Klebeband geöffnet werden. An einer Verzweigung muss<br />
keine Verteilerdose gesetzt werden, sondern es wird das jeweilige Kabel einfach vom<br />
Baum abgeführt.<br />
Viele Kabel können in einen Mehrfachstecker, wie etwa in Abbildung 3-4 gezeigt zusammengefasst<br />
werden. An der Schnittstelle zwischen Schaltkasten und Kabelbaum ist so ein<br />
Stecker denkbar. Dies erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit und eine Verwechslung der<br />
Kabel ist ausgeschlossen.<br />
Abbildung 3-4 Beispielhafter Mehrpinstecker 65<br />
Für jedes Modul muss ein eigenes Kabel vorrätig sein. Ein Vertauschen mit dem Kabel<br />
eines anderen Moduls darf nicht vorkommen, dies lässt sich zum Beispiel durch auffällige<br />
Markierungen verhindern.<br />
Um größtmögliche Sicherheit vor allem im Besucherbereich zu erreichen, kann mit Schutzkleinspannung<br />
gearbeitet werden. Dies bedeutet, dass bis zu 50 V Wechselstrom und 120 V<br />
Gleichstrom 66 verwendet werden, ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen zu<br />
müssen. Bei Fernsehern, Computern oder ähnlichen Geräten, welche mit 5 – 25 V Gleich-<br />
64 vgl. Weimer<br />
65 Bildquelle: Harting 2010<br />
66 DIN VDE 0100-410<br />
29
spannung betrieben werden, ist die Lösung denkbar. Bei Beleuchtung dagegen ist sie nur<br />
eingeschränkt anwendbar.<br />
Der meist externe Trafo für das Gerät wird an einer sicheren Stelle angebracht und von<br />
dort nur die geringe Spannung bis zum Gerät geführt. Hat der Trafo eine ausreichende<br />
Leistung, können sogar mehrere Einheiten betrieben werden. Dargestellt wird dies in<br />
Abbildung 3-5.<br />
Abbildung 3-5 Verkabelung mit Schutzkleinspannung<br />
3.2.5 Datenverkabelung<br />
Eine Kopplung von Strom und Datenleitungen innerhalb eines Kabels ist nicht<br />
empfehlenswert. Es besteht die Gefahr, dass sich Störfelder ausbilden, daraus kann ein<br />
verrauschtes Bild oder ein Brummen auf den Kopfhörern resultieren.<br />
Möchte man trotzdem nur ein Kabel verwenden, besteht die Möglichkeit der Verwendung<br />
von Spezialkabeln, bei welchen die Datenstränge separat geschirmt sind. Hier besteht keine<br />
Gefahr des Übersprechens der Netzfrequenz auf die Datenleitung.<br />
Die Art der Datenverkabelung richtet sich stark nach den verwendeten Bauteilen. Hier ist<br />
es das einfachste, die vorgegebene Struktur aufzugreifen und zu verwenden. Ein AV–<br />
Zuspieler wird eine normierte Auswahl an verschiedenen Video- sowie Audioausgängen<br />
aufweisen.<br />
Für einen unkomplizierten Zusammenbau und eine problemlose Wartung ist es sinnvoll,<br />
diese Verbindungen zu nutzen. Sie sind genormt, gebräuchlich und aufeinander<br />
abgestimmt. Eine Adaption ist in jedem Fall eine mögliche Fehlerquelle und zu vermeiden.<br />
Entwickelt man Bauteile und Anwendungen selbst, steht eine große Bandbreite an verschiedenen<br />
Steckverbindungen zur Verfügung. Um Verwechslungen der verschiedenen<br />
Mediensysteme zu vermeiden, empfiehlt sich die Benutzung anderer Steckverbindungen als<br />
30
der im System verwendeten. Schließt man einen AV-Zuspieler über einen standardisierten<br />
Mini-D-Sub Stecker HD15 mit 15 Polen 67 an, sollte für eine andere Anwendung davon ab-<br />
gesehen werden, diesen Stecker nochmals zu verwenden. Ein D-Sub Stecker DE9 mit<br />
9 Polen oder eine andere Steckverbindung aus der unzählig großen Anzahl der für indu-<br />
strielle Anwendungen angebotenen Steckverinder ist denkbar. Eine Verwechslung wird auf<br />
diese Weise ausgeschlossen.<br />
Wie bei der Stromverkabelung besteht die Möglichkeit, eine Vielzahl von Datensignalen<br />
innerhalb eines Kabels zu senden. Dies ist prinzipiell eine gute Vorgehensweise, sie muss<br />
jedoch auf ihre Wirtschaftlichkeit und ihren Mehrwert hin untersucht werden. Erfahrungsgemäß<br />
sich solche Systeme nur bei Strecken über 15 m Übertragungslänge rentabel oder<br />
bei notwendiger Verlegung im Besucherbereich. Ein Kabel ist leichter zu handhaben und<br />
zu kaschieren als ein Strang von vielen einzelnen Kabeln.<br />
Abbildung 3-6 RJ-45 Stecker (links einfache Ausführung/rechts verstärkte Ausführung 68 )<br />
Möchte man Datensignale über eine weite Entfernung (> 25 m) senden, sind die verschiedenen<br />
Parameter eines Kabels nicht außer Acht zu lassen: Neben der richtigen Wahl des<br />
Wellenwiderstands, bei Videokabeln 75 Ohm, ist die Dämpfung bei hohen Bandbreiten<br />
und großen Längen sowie die Isolierung zu beachten, um Störfaktoren zu minimieren. 69<br />
Für den mehrmaligen Aufbau ist die Verwendung von strapazierfähigen Kabeln und Verbindungen,<br />
welche speziell für einen wiederholten Gebrauch unter anspruchsvollen<br />
Bedingungen gefertigt sind, empfehlenswert. Ein RJ-45 Stecker wird zum Beispiel in einer<br />
normalen und einer widerstandsfähigen Variante geliefert. Die Unterschiede werden in<br />
Abbildung 3-6 gezeigt. Des Weiteren wird die Verwendung von strapazierfähigen und<br />
flexiblen Gummikabeln anstelle von starren Installationskabeln angeregt, nicht nur für die<br />
Datenverkabelung sondern auch für die Stromversorgung.<br />
67 umgangssprachlich ‚VGA-Stecker‘<br />
68 Bildquelle: Neurtrik 2010<br />
69 vgl. Balin 2007, Seiten 9ff<br />
31
Ebenfalls sollte die Funktion der Kabel frühzeitig geprüft werden, da sie Unterflur verlegt<br />
werden. Eine Fehlerdiagnose im Laufe des weiteren Aufbaus ist umständlich und even-<br />
tuelle Fehler aufwendig zu beheben. Bauteile müssen zurückgebaut werden, um an die<br />
defekte Stelle zu gelangen.<br />
3.2.6 Wartung und Instandhaltung<br />
Bei der Verwendung und dem Transport vieler Einzelteile wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
zu Schäden oder Mängeln kommen. Dies komplett zu unterbinden ist sicherlich<br />
möglich aber wirtschaftlich fraglich.<br />
Man muss einen Weg finden, die Bestandteile so widerstandsfähig wie möglich auf der anderen<br />
Seite aber auch so günstig wie möglich zu bauen. Diese beiden Extrema gilt es vor<br />
dem Hintergrund der langen Spielzeit und des häufigen Transportes abzuwägen. Die<br />
Materialauswahl spielt eine wichtige Rolle: Teppich oder Filz ist viel schwieriger auszubessern<br />
als glatte lackierte Materialien. Ein Profi-Display mit einer Glasfront und einer<br />
großen Bandbreite an Anschlüssen ist besser ausgestattet als ein Consumer-Gerät für eine<br />
solche Anwendung.<br />
Ebenfalls muss bestimmt werden, die jeweiligen Elemente gewartet werden. Wechselt man<br />
einzelne Bauteile, zum Beispiel die Seitenverkleidung einer Vitrine oder bessert man das gesamte<br />
Ausstellungselement aus? Unterschiedliche Bauweisen schaffen unterschiedliche<br />
Ausbesserungsmöglichkeiten, welche bei der Konstruktion und Herstellung schon beachtet<br />
werden müssen. Sind Bauteile verleimt oder verklebt ist eine Ausbesserung von Einzelteilen<br />
nicht möglich.<br />
Beim Medieneinsatz ist dies etwas einfacher: Meist muss das Gerät zum Hersteller eingesendet<br />
werden, da bei selbstständigem Reparieren die Gewährleistung erlischt.<br />
Für eine schnelle Revision der Medien müssen Vorrichtungen geschaffen werden, die einen<br />
schnellen und einfachen Zugriff erlauben. Türen, Klappen oder das Öffnen des ganzen<br />
Bauteils machen dies möglich. Außerdem muss beachtet werden, dass es wenig sinnvoll<br />
wäre, wenn die Medien zwar gut zugänglich sind, aber nicht ausreichend Platz zum Hantieren<br />
mit dem Werkzeug vorhanden ist. Die Komponenten müssen also ausreichend groß<br />
ausgelegt werden.<br />
32
3.3 Transport und Logistik<br />
„Im ökonomischen Sinne stellt Logistik eine ganzheitliche Betrachtungsweise aller Faktoren-,<br />
Güter- und Stoffverwertungsströme von der Produktentstehung einschließlich Vorleistungen<br />
bis hin zur Auslieferung an den Endabnehmer dar, ergänzt durch die Wiederverwertung.“<br />
70 Ebenso müssen hier auch die Informations- und Datenströme genannt<br />
werden, diese basieren zumeist auf elektronischer Datenverarbeitung. Logistik bezieht sich<br />
nicht nur auf die Bewegung der einzelnen Elemente, sondern auch auf deren Lagerung.<br />
Das Ziel aller Logistik ist es<br />
„> die richtigen Materialien und Güter[, Daten und Informationen; Anm. d. Verf.]<br />
> in der richtigen Menge<br />
> mit der richtigen Qualität<br />
> zur richtigen Zeit<br />
> am richtigen Ort<br />
> zu minimalen Kosten“ 71<br />
bereitzustellen. Diese Grundanforderungen werden nochmals untergliedert in Beschaffungslogistik,<br />
Produktionslogistik, Distributionslogistik, Entsorgungslogistik und innerbetriebliche<br />
Logistik.<br />
Hier werden die geforderten Punkte speziell für verschiedene Teilbereiche eines Unternehmens<br />
beleuchtet. Beispielsweise befasst sich die Beschaffungslogistik damit, „den<br />
Waren und Materialfluss mit dem dazugehörigen Informationsfluss vom Lieferanten bis<br />
zum Unternehmen zu optimieren“ 72 . Die Entsorgungslogistik ist für alle Aufgaben<br />
bezüglich Abfall und Recycling der natürlichen Rohstoffe zuständig.<br />
Die innerbetriebliche Logistik bezeichnet alle Waren und Informationsbewegungen<br />
innerhalb eines Unternehmens.<br />
Da die oben genannten Begriffe vor allem aus der industriellen Produktion stammen, kann<br />
man sie nicht direkt auf die Anwendung der Wanderausstellung übernehmen.<br />
In Anlehnung an diese Definitionen werden in dieser Ausarbeitung folgende Punkte besprochen:<br />
Zunächst werden die Bewegungen und Lagerlogistik zwischen den einzelnen<br />
Spielorten begutachtet, vergleichbar mit der Beschaffungslogistik. Weiterhin muss auch die<br />
Kommissionierung innerhalb der einzelnen Center betrachtet werden, vergleichbar mit der<br />
Produktionslogistik. Basierend auf der Entsorgungslogistik wird die Lagerung des anfallenden<br />
Leergutes während der Spieldauer und die Entsorgung des Mülls bearbeitet.<br />
70 Aberle 1995, Seite 433<br />
71 Martin 2000, Seite 2<br />
72 Martin 2000, Seite 5<br />
33
Im Folgenden wird der Begriff ‚interne Logistik‘ für Vorgänge benutzt, die im Einkaufs-<br />
center oder in dessen unmittelbarer Nähe stattfinden, also Entladen, Bewegen innerhalb<br />
des Centers, Kommissionieren und Beladen. Als ‚externe Logistik‘ werden die Bewegungen<br />
zwischen den Einkaufscentern und die Lagerung zwischen den Ausstellungen benannt.<br />
Die Logistik von Daten oder die Bereitstellung von Informationen soll nicht weiter beschrieben<br />
werden, da es heute möglich ist, mit sehr geringem Aufwand das Internet zu<br />
nutzen und damit Zugriff auf Datenserver und e-mails zu bekommen. Eine telefonische<br />
Kommunikation ist heutzutage ebenfalls allgegenwärtig und Netzabdeckungsprobleme<br />
können in Innenstädten, den Standorten der Einkaufscenter, ausgeschlossen werden. 73<br />
Lediglich müssen Mitarbeiter mit den entsprechenden Systemen ausgestattet werden und<br />
Subunternehmen bei der Auftragsvergabe darauf hingewiesen werden.<br />
3.3.1 Transportzeiten und Transportziele<br />
Neben den offensichtlichen räumlichen Aspekten der Transportproblematik ist der zeitliche<br />
Gestaltungsspielraum ein kritischer Faktor bei der Durchführung der Wanderausstellung.<br />
74 Aus einer Verspätung der Lieferung entstehen viele zusätzliche Kosten. Es kann,<br />
offensichtlich, der Aufbau nicht beginnen, solange die einzelnen Teile nicht angekommen<br />
sind.<br />
Bei der Planung des Transportes sind neben rein technischen Einschränkungen rechtliche<br />
und ökonomische Restriktionen zu beachten. Technische Einschränkungen sind Defekte,<br />
Baustellen, Witterung, Zufahrten et cetera. Eine rechtliche ist zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit<br />
für LKW auf Autobahnen, welche sich auf 80 km/h 75 beläuft. Dadurch<br />
liegt die realistische Durchschnittsgeschwindigkeit bei 65 – 70 km/h 76 . Ebenfalls müssen<br />
das Sonntagsfahrverbot von 0 Uhr bis 22 Uhr und die maximal zulässige Lenkzeit (unter<br />
gewissen Voraussetzungen) von zehn Stunden eingehalten werden 77 . Des Weiteren gibt es<br />
in den Innenstädten einiger Städte ein Nachtfahrverbot.<br />
Allein aus diesen rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt sich an einem Werktag ein maximaler<br />
Aktionsradius von 650 km für die Transporte. Eine weitere Strecke kann nur mit<br />
Übernachtung oder einem Fahrerwechsel sichergestellt werden.<br />
Ökonomische Einschränkungen sind die wechselseitige Beeinflussung von Transportge-<br />
73 Telekom 2010<br />
74 vgl. Ihde 1991, Seite 150<br />
75 StVO § 18 Abs. 5 Punkt 1<br />
76 vgl. Möhler 2010<br />
77 (EG) 561/2006 Art. 6 Abs. 1 Satz 2<br />
34
schwindigkeit und -kosten. Die Möglichkeit, das Transportgut per Charterflugzeug sehr<br />
kurzfristig zu bewegen, ist zwar gegeben, ihr gegenüber steht aber der große (nicht nur)<br />
monetäre Aufwand.<br />
Bei der Ausführung der Ausstellung ist ein vom Kunden gestalteter Zeitplan vorgegeben,<br />
welcher im Vorfeld nur teilweise planbar ist. Zwischen November und April können keine<br />
Spielorte angefahren werden, da die Weihnachts- und Osterdekorationen aufgebaut sind.<br />
Auch kann nicht gewährleistet werden, dass die Veranstaltung ‚back to back‘ 78 gezeigt<br />
werden kann. So können zwischen den einzelnen Ausstellungsorten verschieden lange<br />
Unterbrechungen und damit die Notwendigkeit zur Lagerung des Transportgutes entstehen.<br />
Außerdem ist nicht sichergestellt, dass die Einkaufscenter in einer geografisch<br />
sinnvollen Reihenfolge bespielt werden, was in Fahrten durch ganz Deutschland resultiert.<br />
Lediglich Sonntagsfahrten können per Vertrag ausgeschlossen werden. 79<br />
3.3.2 Das Transportgut<br />
Das Transportgut, können in Stückgut und in Schüttgut untergliedert werden. Ersteres bezeichnet<br />
Dinge, die als Einheit gehandhabt werden können, Zweiteres hingegen „stückiges,<br />
körniges oder staubiges“ 80 Material. Hierbei sind die Anforderungen an einen Transport<br />
grundlegend verschieden. Bei der Marsausstellung wird vorwiegend Stückgut, also die einzelnen<br />
Elemente der Ausstellung, wie Böden, Vitrinen, Tafeln und Ähnliches transportiert.<br />
Es kann jedoch vorkommen, dass auch Schüttgut verwendet wird, wie zum Beispiel Sande<br />
oder Geröll zur Inszenierung der Marsoberfläche. Im Zusammenhang mit der Wanderausstellung<br />
ist es nicht sinnvoll, diese im gleichen Maß zu betrachten, wie Schüttgut im großindustriellen<br />
Sinne. Diese Güter, wie Erze oder Kohle, werden auf Schiffen oder mit Bahnwagen<br />
transportiert.<br />
Hier nimmt Schüttgut nur einen kleinen Teil zur Gesamtladung ein (< 3,0 m 3 oder < 3,0 t).<br />
Man muss diese mit ihrer Verpackung oder dem Ladehilfsmittel als eine Ladeeinheit und<br />
somit als Stückgut betrachten.<br />
3.3.3 Externer Transport<br />
Als externes Transportmedium stehen prinzipiell vier Möglichkeiten zur Verfügung: der<br />
ISO-Container, die Wechselbrücke, der Sattelauflieger und der Lastkraftwagen (LKW) mit<br />
festem Aufbau.<br />
78 ‚back to back‘ bedeutet, dass die Spielorte ohne Unterbrechnungen und Lagerzeiten bespielt werden. Oft<br />
liegen zwischen dem Abbau und dem erneuten Aufbau nur wenige Stunden.<br />
79 vgl. Beier 2010<br />
80 Martin 2000, Seite 50<br />
35
Für alle der vier genannten Möglichkeiten bietet sich die Option einer offenen Struktur<br />
(Pritsche beim LKW, so genannte Flat-Racks bei den Containern), eines Planenaufbaus,<br />
welcher zum Beladen geöffnet werden kann oder eines festen Aufbaus, den Kofferaufbau.<br />
Die Pritsche bietet keinerlei Schutz und kann für die Ausstellung ausgeschlossen werden.<br />
Die Vor- und Nachteile eines Planenaufbaus gegenüber einem Kofferaufbau müssen<br />
genau erwogen werden.<br />
Die Plane bietet lediglich Schutz vor Wetter und Fahrteinflüssen. Ein formschlüssiges<br />
Laden ist nicht möglich, jedes Teil muss kraftschlüssig zum Boden hin gesichert werden.<br />
Darüber hinaus schafft die Plane kaum Schutz vor Diebstahl und kann mit einem einfachen<br />
Tapetenmesser geöffnet werden. Beim Kofferaufbau ist dies advers: Beim formschlüssigen<br />
Laden kann sich das Transportgut ohne weitere Sicherung gegen die Wand<br />
gestützt werden. Auch ist die Ware gegen Diebstahl besser geschützt. In einem Koffer<br />
besteht die Möglichkeit, ein zweites Stockwerk oder Spezialeinbauten einzubringen. Auf<br />
diese Weise kann ein idealer Schutz des Transportgutes sichergestellt werden. Ungestört<br />
von den Ladegütern im unteren Stock, kann hier das relativ große und empfindliche<br />
Planetenmobile seinen Platz finden. (Die Ladungssicherung wird unten 81 ausführlicher<br />
beschrieben.)<br />
Beim Planenaufbau ist die Ladesituation allerdings vielseitiger als beim Kofferaufbau, da<br />
über die gesamte Länge von zwei Seiten und sogar über das Dach geladen werden kann.<br />
Beim Kofferaufbau kann man lediglich über das Heck laden. Wird ein Stapler verwendet,<br />
kann dieser beim Planenaufbau jedes Teil an die endgültige Stelle im LKW bringen. Beim<br />
Kofferaufbau müssen die Einzelteile per Hubwagen bis zur Position gebracht werden.<br />
Im Folgenden werden die technischen Gegebenheiten der vier eingangs genannten Transportmittel<br />
sowie deren Vor- und Nachteile erläutert.<br />
1. Das erste der vier möglichen Medien ist der ISO-Container 82 . Er wurde seit Mitte des<br />
letzten Jahrhunderts entwickelt und verbreitet und ist vor allem für die Seeschifffahrt von<br />
großer Bedeutung. Vorteilhaft ist seine international anerkannte und normierte Größe, die<br />
verschiedene Längen (unter anderem: 20’ – 6,1 m und 40’ – 12,2 m), die Stapelbarkeit, der<br />
niedrige Preis 83 und das hohe zulässige Ladegewicht von 26 t.<br />
Nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container<br />
81 Kapitel 3.3.8<br />
82 ISO 668<br />
83 vgl. Anlage G 1 und G 2<br />
36
vom 10. Februar 1976 (CSCG) muss ein Container eine CSC-Zulassung 84 haben. Dies ist<br />
vergleichbar mit der Überprüfung eines Autos durch den Technischen Überwachungs-<br />
Verein e. V. (TÜV) und muss alle 24 Monate erneuert werden. 85<br />
Nachteilig ist das amerikanische Innenmaß von 2,35 m, welches nicht mit dem<br />
europäischen Palettennormmaß von 3 × 0,80 m = 2,40 m kompatibel ist. Ein weiterer<br />
Nachteil ist, dass der Container nicht vom Auflieger absetzt werden kann, ohne dafür<br />
vorgesehene, meist stationäre, Krananlagen. Mobile Krane oder Sattelauflieger mit<br />
eingebauten Hubvorrichtungen sind teuer und umständlich.<br />
2. Die mobile Wechselbrücke ist genormt 86 auf das Europäische Palettennormmaß von<br />
2,40 m und kompatibel im innereuropäischen Bahn- und Straßenverkehr. Ein weiterer<br />
Vorteil der Wechselbrücke ist, dass diese auf mitgeführten Stelzen ohne weitere Hilfsmittel<br />
abgestellt und be- und entladen werden kann, während die Zugmaschine anderweitig eingesetzt<br />
wird. Die Abmaße belaufen sich in der Länge auf 7 – 8 m, wobei die gängigste<br />
Größe 7,45 m × 2,55 m × 2,70 m (LBH, Außenmaße) ist und eine zulässige Nutzlast von<br />
12 t aufweist. Eine Wechselbrücke bedarf ebenfalls einer wiederkehrenden Prüfung 87 . Der<br />
Preis ist ähnlich dem eines Containers 88 . Der Nachteil von Wechselbrücken ist, dass sie<br />
nicht stapelbar sind und nur von dafür vorgesehenen LKW aufgenommen werden können.<br />
Außerdem dürfen sie nicht ohne Fahrgestell im öffentlichen Straßenraum aufgestellt werden,<br />
sondern müssen immer innerhalb eingefriedeter Flächen stehen.<br />
Eine Ladebordwand ist möglich, entweder an der Zugmaschine oder an der Ladebrücke<br />
selbst montiert. Die Hubvorrichtung ist aber ein selten angebotenes Ausstattungsmerkmal.<br />
3. Der Sattelauflieger hat eine Nutzlast von maximal 28t und eine Ladebordwand ist möglich.<br />
Ein weiterer Vorteil ist offensichtlich: Das Fahrzeug ist immer einsatzbereit. Es muss<br />
nicht erst der Aufbau aufgenommen werden. Es kann sofort be- oder entladen werden,<br />
lediglich die Zugmaschine muss zugehängt werden. Im öffentlichen Straßenraum kann ein<br />
solcher Anhänger problemlos abgestellt werden.<br />
Die vorteilhafte Tatsache, dass ein Sattelauflieger (fast) problemlos von jeder beliebigen<br />
Zugmaschine aufgenommen werden kann, muss jedoch auch um den negativen Aspekt<br />
des Diebstahls erweitert werden. Ein weiterer Nachteil sind die hohen Kosten, vor allem<br />
während langer Standzeiten.<br />
84 Container Safety Certificate<br />
85 vgl. Möhler 2010<br />
86 DIN EN 284, Bauart B; DIN 15190-101 und 15190-102<br />
87 vgl. Möhler 2010<br />
88 vgl. Anlage G 3<br />
37
4. Die vierte Möglichkeit ist der LKW mit festem Aufbau. Er hat die gleichen Vorteile<br />
und ähnliche Maße wie die Ladebrücke. Nachteilig ist, dass hier immer das gesamte Fahr-<br />
zeug gebunden ist, was wiederum hohe Kosten verursacht.<br />
Besonders nennenswert im Zusammenhang mit der Wanderausstellung ist der LKW mit<br />
einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 t. Gegenüber der sehr geringen Nutzlast von<br />
etwa 2,5 t 89 steht der Vorteil, dass der Führerschein für solch ein Fahrzeug sehr weit verbreitet<br />
ist. Bis zum Ende des Jahres 1998 hat man diesen mit dem normalen Autoführerschein<br />
erworben. Das Aufbauteam kann diesen LKW selbst zum Ausstellungsort bewegen.<br />
Hier muss bedacht werden, dass hierfür mehr Zeit eingeplant werden muss, da der Fahrer<br />
nach der Fahrt die gesetzliche festgelegte Ruhezeit einhalten muss, bevor er mit dem<br />
Aufbau beginnt. Weiterhin berührt das Sonntagsfahrverbot diese Fahrzeuge nicht, ebenso<br />
wie die Mautpflicht. Im Gegensatz zu größeren Fahrzeugen ist die Anfahrmöglichkeit zu<br />
den Centern auf jeden Fall gegeben. Da eine Ladebordwand zur Serienausstattung gehört,<br />
entsteht kein Bedarf für einen Stapler. 90<br />
Eine Langzeitmiete kann durchaus günstiger ausfallen als ein regelmäßiges Anmieten. Die<br />
verschiedenen Möglichkeiten müssen genau miteinander verglichen werden. 91 Vor dem<br />
Hintergrund der langen Laufzeit von drei Jahren kann der Kauf des Transportmittels ebenfalls<br />
eine ökonomisch sinnvolle Option sein.<br />
Die oben genannten Einbauten können problemlos eingebracht werden und ein Werbeschriftzug<br />
für die Ausstellung oder die Firma kann angebracht werden.<br />
Es besteht die theoretische Möglichkeit verschiedene Verkehrsmittel wie Binnenschifffahrt,<br />
Eisenbahnverkehr, Straßenverkehr oder Luftverkehr 92 zu nutzen. Diese ist für die Anwendung<br />
einer Wanderausstellung nicht sinnvoll, da ein Wechsel des Transportmediums<br />
nicht wirtschaftlich ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass beim Aufgabeort und am Aufnahmeort<br />
eine meist kostenpflichtige Umladung von oder auf einen LKW gewährleistet<br />
werden muss. Des Weiteren muss der Fahrplan des Güterzuges oder des Binnenschiffes<br />
beachtet und der zuliefernde oder abholende LKW zeitlich genau bereitgestellt werden. Die<br />
hieraus resultierenden Komplikationen und die Tatsache, dass ein häufiges Neuanmieten<br />
von LKW kompliziert ist, wie im vorherigen Abschnitt erläutert, machen solche Wechsel<br />
89 je nach Ausstattung<br />
90 vgl. Weimer 2010<br />
91 vgl. Möhler 2010<br />
92 Ihde 1991, Seite 49ff<br />
38
sehr uneffizient. 93 Arbeitet man mit einer Spedition als Logistikpartner, welcher Deut-<br />
schlandweit angesiedelt ist, zusammen können solche Überlegungen gemacht werden.<br />
Am ehesten ist die Nutzung der so genannten ‚Rollenden Landstraße‘ denkbar. Hier handelt<br />
es sich um einen Güterzug, welcher den gesamten LKW aufnehmen kann. Die Vorteile<br />
sind Mautersparnis, Staufreiheit und das Umgehen von maximalen Lenkzeiten. Während<br />
der Fahrt des Zuges kann der Fahrer in dem mitgeführten Schlafwagen pausieren.<br />
Die Anwendung der ‚Rollenden Landstraße‘ ist nur in speziellen Fällen denkbar. So muss<br />
der Start- und Zielort günstig liegen, der Fahrplan des Zuges stimmen und die Anforderung<br />
(etwa weite Strecke oder Nachtfahrt) muss gegeben sein. 94<br />
3.3.4 Verpackung<br />
Die Verpackung eines Transportgutes hat verschiedene Funktionen. Primär ist die Schutzfunktion<br />
gegen Mengenverlust, Verunreinigung, Beschädigung und Umwelteinflüsse<br />
(Temperatur, Feuchtigkeit, Sonnenstrahlung) aufzuführen. Darüber hinaus sind Transportund<br />
Lagerfunktion zu nennen wie Handhabung, Stapelbarkeit, Einheitsbildung. Weitere<br />
Merkmale sind die Verwendungsfunktionen wie Bedienung, Widerverwendbarkeit, Kennzeichnung<br />
und Gewicht. Und schlussendlich hat eine Verpackung auch eine Werbe- und<br />
Identifikationsfunktion, welche aber für die Wanderausstellung, im Gegensatz zum Handel,<br />
von untergeordneter Wichtigkeit ist. Dort haben Verpackungen den Zweck, die Vermarktung<br />
gegenüber dem Endverbraucher zu ermöglichen. 95<br />
Die Verpackung muss auch mit Kennzeichen versehen sein, die dem Verlader oder Verwender<br />
symbolisieren, welcher Handhabung gefordert ist oder welche Gefahren davon ausgehen.<br />
96 Beispielhaft sind in Abbildung 3-7 einige Symbole für eine Markierung gezeigt:<br />
Das erste Piktogramm zeigt ein zerbrechliches Gut an, das mittlere bedeutet, dass die Ware<br />
zu jeder Zeit mit den Pfeilen nach oben zu transportieren ist. Das rechte Symbol verweist<br />
auf den notwendigen Schutz vor zu hoher Feuchtigkeit.<br />
Für alle Elemente, die durch unsachgemäße Handhabung zerstört oder beschädigt werden<br />
können, empfiehlt es sich, diese Symbole zu verwenden.<br />
Zur Verpackung gehören auch Packhilfsmittel 97 wie Polster, Zwischenlagen und<br />
Trockenmittel.<br />
93 vgl. Möhler 2010<br />
94 vgl. Aberle 1997, Seite 20f<br />
95 vgl. Martin 2000, Seite 62, Bild 3.7<br />
96 vgl. Großmann 2007, Kapitel 4.1.4.1<br />
97 vgl. Großmann 2007, Kapitel 4.1.1<br />
39
Abbildung 3-7 Beispiele für Ladungsbeschriftung 98<br />
3.3.5 Ladehilfsmittel<br />
Als Transport-, Lager- und Ladehilfsmittel werden „Hilfsmittel zur Bildung uniformierter<br />
logistischer Einheiten“ 99 verstanden. Diese werden unterteilt in unterfahrbare und nicht<br />
unterfahrbare Hilfsmittel. Die wichtigsten Vertreter der ersten Gruppe sind Paletten,<br />
welche mit vielen verschiedenen Merkmalen ausgestattet sein können. Diese sind Material,<br />
Stapelbarkeit, Anzahl der Richtungen zur Aufnahme (Zwei- oder Vierwegpalette)sowie<br />
offene, geschlossene oder klappbare Böden und Wände. Paletten sind meist genormt.<br />
Nicht unterfahrbare Ladehilfsmittel sind Kisten, Säcke, Boxen et cetera.<br />
Solange es sich nicht um eine Palette mit Wandelementen handelt, erfolgt die Sicherung<br />
der Ware auf der Palette durch Umreifen, Schrumpfen oder Stretchen. 100<br />
Beim Umreifen werden Gurte aus Metall oder Plastik, horizontal und vertikal um die<br />
Ladung gespannt. Spanngurte aus Kunstfaser sind ebenso denkbar. Dabei ist auf Kantenschutz<br />
zu achten.<br />
Unter Schrumpfen versteht man die thermische Behandlung einer übergestülpten Folie.<br />
Durch die Wärme zieht sie sich zusammen und es entsteht ein fester Verbund. Ungleiche<br />
oder sperrige Packstücke können so einfach gefasst werden. Nachteilig ist der hohe<br />
maschinelle Aufwand, welcher auf einer Veranstaltung kaum vorgehalten werden kann.<br />
Das Stretchen ist die Applikation einer überdehnten Folie um die Ladung. „Die Folienrückstellkräfte<br />
bewirken die Ladungssicherung.“ 101 Diese meist maschinell angewendete<br />
Methode ist ebenfalls denkbar. Beim Schrumpfen und Stretchen ist ein großer<br />
Rohstoffverbrauch gegeben, da keine Wiederverwendung möglich ist.<br />
98 lt. DIN 55402-1<br />
99 Martin 2000, Seite 54<br />
100 vgl. Großmann 2007, Seite 25ff<br />
101 Großmann 2007, Seite 30<br />
40
Bei der Planung sollten Verpackung und Ladehilfsmittel zusammen betrachtet werden.<br />
Im Zusammenwirken können die jeweils geforderten Eigenschaften erfüllt werden. Ein<br />
Grund hierfür ist die immer gleich bleibende Zusammenstellung von Verpackungseinheit<br />
und Ladehilfsmittel. Adversativ ist eine Palette mit Bierkästen im Einzelhandel zu sehen.<br />
Es wird nur jeweils eine geringe Anzahl der Verpackungseinheiten entnommen, die<br />
restlichen müssen auf dem Ladehilfsmittel bleiben.<br />
Bei ‚Der Mars – Vision und Mission‘ werden immer alle Bestandteile zusammen entnommen<br />
und wieder beladen. Somit ergibt sich keine Erfordernis einer Trennung beider Bereiche.<br />
Anwendungen, bei denen das Verhältnis nicht gleich bleibt, muss man gesondert<br />
betrachten, wie zum Beispiel ein Kabelcase.<br />
Ein mustergültiges Zusammenspiel zwischen Verpackung und Ladehilfsmittel hat die<br />
Firma ‚Logipack‘ für den Transport von Bierflaschen entwickelt, wie in Abbildung 3-8<br />
gezeigt.<br />
Nimmt man das Gebinde aus sechs Bierflaschen als Transportgut, schützen die Zwischenböden<br />
es vor Mengenverlust, Beschädigung zueinander und von außen. Ebenso ermöglichen<br />
sie eine leichte Handhabung und Stapelung. Die Widerverwendbarkeit ist gegeben,<br />
sogar von ‚Logipack‘ erwünscht 102 . Der Wunsch nach Branding ist erfüllt, da das Produkt<br />
innerhalb der Verpackung sichtbar ist.<br />
Abbildung 3-8 Verpackung und Ladehilfsmittel zu einem System vereint 103<br />
102 vgl. Logipack 2010b<br />
103 Bildquelle: Logipack 2010a<br />
41
Ebenso werden die Anforderungen an Ladehilfsmittel, das Schaffen von Einheiten,<br />
bedient: In der Abbildung ist das Bier auf einen selbstfahrenden Wagen aufgestapelt, es<br />
ist aber auch eine unterfahrbare Palette denkbar.<br />
Darüber hinaus bedient sich das System eines weiteren sehr schlauen Kunstgriffes: Das<br />
Transportgut wird zur Verpackung! Durch die hohe Belastbarkeit von Glasflaschen kann<br />
das Gewicht der oberen Schichten über die Flaschen selbst gehalten werden. Die Kräfte<br />
müssen nicht, wie eigentlich üblich, über Bierkästen abgeleitet werden.<br />
Im Folgenden sollen diese Zusammenstellungen aus Verpackung und Ladehilfsmittel den<br />
Begriff ‚Ladeverpackungen‘ erhalten. Sind sie speziell für die Anforderungen und Maße der<br />
Last gefertigt, können sie perfekt vor allen Transporteinflüssen schützen. Für andere Einzelteile<br />
der Ausstellung sind sie nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.<br />
Um ein gegenseitiges Aneinanderstoßen zu verhindern, muss auf die Auspolsterung der<br />
Verpackung oder der Elemente beachtet werden. Hier empfiehlt es sich, definierte Pufferebenen<br />
einzubauen, welche sich an jedem Element in der gleichen Höhe oder Position<br />
befinden. So ist sichergestellt, dass sich Verpackungen nicht ineinander Verzahnen oder<br />
die Kraft nicht effizient abgeleitet werden kann. Diese Pufferebenen sind mit Dämmmaterialien<br />
versehen und schützen das Produkt aber auch das Fahrzeug. 104 Verwendet man<br />
einen Handgabelhubwagen ist die Ausbildung einer breiteren Pufferzone sinnvoll, da bei<br />
der Fahrt des Wagens die Transporteinheit um etwa 5 cm angehoben wird.<br />
Auf Vorrichtungen für die Verwendung eines Fördermittels oder eines Staplers, analog<br />
einer Palette, muss auch hier geachtet werden. Darüber hinaus sollten Anschlagösen für<br />
Krane und Hebezeuge nicht fehlen. Sie machen das Element sogar für mehrere Fördermittel<br />
nutzbar. Um die Einsatzfähigkeit noch zu erhöhen, sollten ebenfalls Vorrichtungen<br />
zur Ladungssicherung an der Ladeverpackung angebracht werden.<br />
3.3.6 Ladungssicherung<br />
„Neben einer belastungsgerechten Verpackung der Güter ist deren Transportsicherung,<br />
d.h. die Erzielung eines zusätzlichen Schutzes vor mechanischen und häufig auch vor<br />
klimatischen Belastungen, ein wichtiger Bestandteil der Schadensprophylaxe.“ 105 Schäden<br />
können nicht nur an der Ladung selbst auftreten, sondern auch am Transportfahrzeug, am<br />
Transportgerät, den Sicherungselementen und im schlimmsten Fall an Personen. Der<br />
Gesetzgeber fordert: „Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen<br />
sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder<br />
104 vgl. Gottwald 2010<br />
105 Großmann 2007, Seite 22<br />
42
plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen<br />
oder vermeidbaren Lärm erzeugen können.“ 106<br />
Rollen tritt auf beim Transport von Rohren oder Kabeltrommeln. Wandern entsteht durch<br />
Vibrationen. Fahrzeugbewegungen wie Anfahren, Spurwechsel, Ausweichmanöver und vor<br />
allem Bremsen erfordern, dass die Ladung gegen Rutschen mit 80 % der Gewichtskraft in<br />
Fahrtrichtung und mit 50 % zur Seite und nach Hinten gesichert wird. Gegen Kippen zur<br />
Seite muss eine Sicherung von 70 % der Gewichtskraft vorliegen. Die zulässige Lastverteilung<br />
über die Ladefläche darf nicht vernachlässigt werden.<br />
Jedes Element des Fahrwerks und der Sicherungsmittel muss die auftretenden Kräfte aufnehmen<br />
können. Die Informationen hierzu finden sich in den Herstellerdokumentationen<br />
und an den Elementen selbst. Die hierfür erforderlichen wiederkehrenden Prüfungen sind<br />
einzuhalten.<br />
Ein einfacher Gedankenversuch verdeutlicht die Notwendigkeit der Ladungssicherung:<br />
Ein rohes Ei liegt in einem fahrenden Fahrzeug bündig gegen eine vertikale Stirnfläche<br />
gelehnt. Beim Bremsvorgang kann dem Ei nichts passieren. Liegt es jedoch frei auf einer<br />
Fläche und rollt beim Bremsvorgang gegen die Stirnfläche, ist eine Verletzung der Schale<br />
wahrscheinlich.<br />
Grundlegend stehen zur Ladungssicherung zwei Möglichkeiten zur Verfügung: der Kraftschluss<br />
und der Formschluss.<br />
Abbildung 3-9 Ladungssicherung durch Niederzurren 107<br />
106 StVO § 22 Abs. 1<br />
107 Bildquelle: Rennie 2010a<br />
43
Eine Ladungssicherung durch Kraftschluss entsteht durch das Niederzurren der Ladung,<br />
wobei diese nicht gehalten wird, sondern lediglich die Normalkraft auf die Ladefläche und<br />
somit die Reibungskraft zwischen Ladung und Ladefläche erhöht wird. In Abbildung 3-9<br />
wird das Niederzurren durch die orangefarbenen Gurte erreicht. Durch die Verwendung<br />
von rutschhemmenden Materialien zwischen Ladung und Ladefläche (schwarze Unterleger)<br />
wird der Wirkungsgrad noch erhöht. Diese Art der Ladungssicherung wird verwendet<br />
wenn ein Formschluss zu den Wänden des LKW-Aufbaus nicht gegeben ist oder es sich<br />
um einen Planenaufbau handelt. Nachteilig ist der Zeit- und Materialaufwand und die<br />
Mehrbelastung der Ladung und der Kanten durch die Spannkräfte der Gurte.<br />
Die Abbildung zeigt ganz deutlich, dass diese durch einen entsprechenden Schutz gemindert<br />
wird. Im Fall der Metallboxen im Bild ist diese Kraft zu vernachlässigen, bei Holzwerkstoffen<br />
oder Papier ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor.<br />
Eine Kippsicherung der Ladung ist durch das Niederzurren formschlüssig gewährleistet.<br />
Durch den dunkelgrünen Gurt und die horizontal gestellte Europalette wird eine weitere<br />
formschlüssige Sicherung erreicht.<br />
Bei der Ladungssicherung durch Formschluss werden die auftretenden Kräfte der Ladung<br />
unmittelbar auf die Transporterwand oder den Aufbau des LKW übertragen. 108 Das Gut<br />
kann auch direkt gezurrt werden. Hier werden die auftretenden Kräfte über die Zurrmittel<br />
‚direkt‘ auf das Fahrwerk des Fahrzeugs übertragen.<br />
Die Ladefläche des LKW wird so ausgefüllt, dass etwa beim Bremsen die resultierenden<br />
Kräfte auf die Stirnwand und dadurch auf das Fahrwerk übertragen werden. Von elementarer<br />
Wichtigkeit ist es, die Ladung bündig in das Fahrzeug zu stauen. Entstehen Leerräume,<br />
kann sich die Ladung sich bewegen und dadurch enorme Kräfte entwickeln, welche<br />
auf das Fahrzeug und die Ladung zerstörerisch wirken. Genauso wird die Sicherung zu den<br />
Seiten realisiert. Nach hinten kann die Ladung entweder bündig abschließen (was jedoch<br />
selten der Fall ist) oder über einen Ladebalken oder eine formschlüssige Zurrung gesichert<br />
werden. Besonders gut anwendbar ist die formschlüssige Sicherung bei einer Ladung, die<br />
nur aus einheitlichen Elementen wie zum Beispiel Europaletten besteht. Der Vorteil der<br />
Methode ist, das der Aufwand für die Sicherung minimal ist und der Materialaufwand gering.<br />
Da lediglich der oben erwähnte Sperrbalken benötigt wird, alle anderen Kräfte werden<br />
von den Wänden aufgenommen. Stellt man die einzelnen Elemente auf rutschhemmende<br />
Matten, kann sogar eine noch höhere Sicherheit erreicht werden.<br />
108 vgl. Strauch 2010, Kapitel 4.3.2 Formschluss durch Container- und Spezialbauteile<br />
44
Das Direktzurren, wie es in Abbildung 3-10 gezeigt wird, nimmt die Kräfte der Ladung auf<br />
und leitet sie in das Fahrwerk ein. Hier wird der Kessel in Fahrtrichtung von je einer Stahlkette<br />
pro Fahrzeugseite gehalten. Gegen die Fahrtrichtung sind es ebenso zwei Ketten.<br />
Diese vier Ketten übernehmen auch die Sicherung zur Seite. Hierbei ist es essentiell, dass<br />
die Ladung Anschlagpunkte für die Zurrmittel hat.<br />
Neben der formschlüssigen Sicherung tritt auch kraftschlüssige Sicherung auf. Durch die<br />
Vorspannkräfte wird das Element zusätzlich auf die Ladefläche gepresst, was die Reibungskräfte<br />
und somit die Ladesicherheit erhöht.<br />
Abbildung 3-10 Ladungssicherung durch Direktzurren 109<br />
Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, ist auch hier das Zusammenwirken von<br />
Verpackung und Ladehilfsmittel von großer Wichtigkeit: Ladeverpackungen müssen so<br />
ausgelegt sein, dass die Zurrkräfte aufgenommen werden können oder mit ausreichend<br />
dimensionierten Anschlagösen versehen sein. Dies minimiert die Gefahr, dass am Transportgut<br />
selbst angeschlagen wird und dadurch Beschädigungen entstehen.<br />
3.3.7 Interner Transport<br />
Zur Betrachtung des internen Transports der Ausstellungselemente gibt es zwei theoretische<br />
Ansätze, nämlich die Stetigförderung und die Unstetigförderung.<br />
Ersteren kann man grob mit dem Begriff Fließbandtransport überschreiben und zeichnet<br />
sich durch einen geringen Energiebedarf bei hoher Transportleistung aus. Fließbänder<br />
werden vor allem für Schüttgut oder für große Mengen an Stückgut verwendet, beispielsweise<br />
in einem Versandhaus. Sie sind für eine Nutzung über einen langen Zeitraum von<br />
109 Bildquelle: Rennie 2010b<br />
45
mehreren Monaten oder Jahren ausgelegt. Beides trifft für Ausstellungen und die Veran-<br />
staltungsbranche im Allgemeinen nicht zu.<br />
Als Unstetigförderer können Hebezeuge, Hängebahnen, Krane und Flurfördermittel betrachtet<br />
werden, welche manuell oder mechanisch angetrieben werden. Die Transportbewegung<br />
erfolgt „diskontinuierlich von der Aufgaben- zur Abgabestelle“ 110 .<br />
Besonders hervorzuheben für die Beförderung der einzelnen Teile der Marsausstellung<br />
sind Flurfördermittel. Hier gibt es unmotorisierte Karren, Wagen und den Handgabelhubwagen<br />
sowie motorisierte Schlepper, Wagen und Stapler, welche die Last lediglich<br />
transportieren aber nicht aufnehmen. Eine andere Möglichkeit sind Behälter, welche die<br />
Last aufnehmen aber auch mit einem Fahrwerk versehen sind. Hier sind geschlossene<br />
Wagen, Cases und Dollies 111 aus der Veranstaltungsbranche aufzuführen.<br />
Abbildung 3-11 ein genormter lastaufnehmender Wagen 112<br />
Eine geschlossene Transportkiste, wie sie in Abbildung 3-11 gezeigt wird, kann mit und<br />
ohne Rollen geliefert werden. Er ist nur eingeschränkt nutzbar, da die einzelnen Ausstellungsteile<br />
meist nicht so angefertigt werden können, dass sie exakt in den Wagen passen.<br />
Für den Schutz muss Garniermaterial oder Füllmaterial verwendet werden oder sie müssen<br />
im Wagen gezurrt werden. Im Fall von Scheinwerfern müsste jeder einzelne verpackt werden,<br />
um einen Schutz der einzelnen Geräte zu gewährleisten. Optional kann der Wagen<br />
umgebaut und mit speziell ausgeformten, gepolsterten Fächern ausgestattet werden, sodass<br />
er den Anforderungen entspricht. Dabei geht allerdings Ladevolumen verloren. Der Ein-<br />
110 Martin 2000, Seite 191<br />
111 als Dolly wird ein (zerlegbarer) Transportwagen bezeichnet, der nur für ein Produkt gebaut ist. Für andere<br />
Produkte ist er nur eingeschränkt oder gar nicht nutzbar.<br />
112 Bildquelle: Auer 2010<br />
46
au wäre eine Sonderanfertigung. Nachteilig sind ebenfalls das hohe Leervolumen und die<br />
schwierige Entnahme, welche immer nach oben erfolgen muss. Für Kleinteile wie Kabel<br />
oder Verbrauchsmaterialien ist ein solcher Wagen kaum nutzbar, da durch das große Volumen<br />
schnell Unordnung entsteht.<br />
Ideal eignet er sich aber für unempfindliche, relativ große Bestandteile wie Holz für die<br />
Unterpallung, Stoffbahnen oder etwa Schüttgut wie Sande und Geröll zur Inszenierung der<br />
Marsoberfläche. Vorteilhaft zeigen sich sein sicherer Verschluss, die Stapelbarkeit, die<br />
Möglichkeit der Aufnahme mit einem Hubwagen (Version ohne Rollen) und die genormten<br />
Abmaße von 1,20 m × 0,80 m.<br />
Ein Flightcase, umgangssprachlich Case genannt, ist für Kleinmaterialien wie Kabel, Werkzeug,<br />
Verbrauchsmaterialien et cetera die bessere Lösung. Diese sind in verschiedenen Abmaßen<br />
lieferbar. Normalerweise sind sie 0,60 m breit, was wiederum exakt einem Viertel<br />
der LKW-Breite von 2,40 m entspricht. Sie sind mit Rollen versehen und durch Einschübe<br />
und Einlagen lässt sich der Innenraum in Fächer einteilen. Vorteile sind die sehr robuste<br />
Bauweise, die hohe Nutzlast und die Stapelbarkeit. Des Weiteren sind die Wagen durch die<br />
eingerückte Anordnung der Rollen, durch ausklappbare Handgriffe und durch den stabilen<br />
Deckel sehr einfach zu tippen. Dies ermöglicht einen sicheren Transport im LKW und ein<br />
schnelles Verladen.<br />
Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Mitarbeiter und Helfer aus der Veranstaltungs- und<br />
Tourbranche vertraut mit der Funktion und vor allem den Lademöglichkeiten von Cases<br />
sind.<br />
Vorteile von Fahrbehältern im Allgemeinen sind der schnelle Transport ohne weitere<br />
Transporthilfsmittels und die Möglichkeit, mittels bestimmter Vorrichtungen mehrere<br />
Wagen zu einem Zug zusammenzuschließen und diese gleichzeitig zu befördern.<br />
Besonders bei den sehr langen Wegen in einem Einkaufscenter ist so eine Möglichkeit<br />
bedenkenswert, da gleichzeitig die doppelte oder sogar dreifache Last bewegt werden kann.<br />
Nachteilig ist der hohe Preis und das höhere Gewicht, da an jedem Element ein ‚Fahrwerk‘<br />
angebaut werden muss.<br />
Ein Dolly ist im Gegensatz zu den Fahrbehältern eine offene Konstruktion, wie in<br />
Abbildung 3-12 gezeigt. Er eignet sich für die Aufnahme von verschiedenen festen Gegenständen,<br />
das bedeutet dass das Ladegut eine steife Struktur haben muss. Kabel etwa sind so<br />
nicht transportierbar. Neben Scheinwerfern, ist er für alle festen Bestandteile wie Traversen,<br />
Bühnenteile, Aufbauten, Schauwände et cetera denkbar.<br />
47
Abbildung 3-12 ein Dolly zum Transport von Scheinwerfern<br />
Bei der Konstruktion der Verpackung müssen ergonomische Gesichtspunkte für die Bestückung<br />
und Entnahme der Waren bedacht werden. Körpermaßbezogene Ausführungen<br />
bestimmter Größen, wie die passende Höhe für die bequeme Entnahme der Waren, erhöhen<br />
die Arbeitsleistung und -sicherheit. Genauso verhält es sich mit Bremsen oder Griffen.<br />
Das Entnehmen der Waren aus einem Dolly ist beispielsweise sehr einfach, da sie in einer<br />
handlichen Position transportiert werden und die Handhabung lediglich durch die Holme<br />
beschränkt wird.<br />
3.3.8 Lagerung<br />
Lagerung ist der gewollte oder ungewollte Aufenthalt von Waren oder Einzelteilen und<br />
wirft in produzierenden Betrieben bei Missmanagement enorme Kosten auf. Entweder ist<br />
bei Überkapazität Kapital gebunden oder aufgrund von Mangel kann der Leistungserstellungsprozess<br />
nicht fortgeführt werden. 113 Lager können nach den oben genannten<br />
Logistikbereichen in verschiedene Untergruppen aufgeteilt werden: Beschaffungslager,<br />
Produktionslager und Distributionslager.<br />
Für die Umsetzung der wandernden Ausstellung ist die Lagerung entsprechend der Gegebenheiten<br />
der jeweiligen Spielorte notwendig. Zunächst wird die interne Lagerung betrachtet,<br />
welche vor allem aus Verpackungen der einzelnen Elemente der Ausstellung besteht.<br />
Zusätzlich müssen Werkzeug, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile gelagert werden. Hier<br />
muss, den ungünstigsten Fall angenommen, ein Volumen gelagert werden, welches dem<br />
113 vgl. Martin 2000<br />
48
transportieren Volumen entspricht. Dieser Fall tritt ein, wenn alle Transporthilfsmittel das<br />
Transportgut einschließen und nicht klappbar sind. Im besten Fall tritt keinerlei Lagergut<br />
auf, da alle transportierten Bestandteile und Hilfsmittel in der Ausstellungsarchitektur inte-<br />
griert sind. Beide Fälle sind Extrema eines möglichen Spektrums an Lageranforderung,<br />
welche wahrscheinlich nicht erreicht werden.<br />
Für die interne Lagerung gibt es verschiedene Möglichkeiten anfallendes Leergut über die<br />
Dauer der Ausstellung aufzubewahren. Zunächst bietet es sich an, alle Elemente im Einkaufscenter<br />
selbst zu lagern. Hier stehen die im Fragebogen ermittelten Möglichkeiten zur<br />
Verfügung: In einer Vielzahl der Einkaufscenter, jedoch nicht allen, ist eine Einlagerung<br />
möglich, jedoch wird hierfür auch das Parkdeck oder die Tiefgarage angeboten. Dies verursacht<br />
bereits einen Mehraufwand, da ein Bauzaun angemietet und aufgebaut werden<br />
muss, um die Fläche einzufrieden um Diebstahl vorzubeugen.<br />
Auch die Lagerfläche von 10 m² im geringsten Fall ist kaum ausreichend. Eine Lösungsmöglichkeit<br />
ist die Anmietung eines externen Lagers. Dies ist nicht nur mit hohem organisatorischen,<br />
sondern auch mit personellem Aufwand verbunden. Das Leergut muss wieder<br />
auf den LKW geladen werden, um es dann im externen Lager wieder zu entladen und an<br />
die endgültige Position zu bringen. Beim Abbau der Wanderausstellung muss die Methode<br />
gleichermaßen rückwärts wiederholt werden. Somit entstehen pro Auf- und Abbau jeweils<br />
drei Ladevorgänge.<br />
Und schließlich bietet sich die Möglichkeit, alles im Transportmittels zu lagern. Hier ergibt<br />
sich nur ein erneuter Ladevorgang. Dazu muss jedoch das Transportmedium für die gesamte<br />
Zeit gemietet oder gekauft werden. Von Vorteil dabei ist, dass eine einheitliche<br />
Struktur geschaffen werden kann, unabhängig von den Möglichkeiten der Center oder der<br />
örtlichen Gegebenheiten. Eine Recherche und zeitaufwendige Neubewertung an jedem<br />
Spielort ist nicht notwendig.<br />
Für die externe Lagerung, also für die Zeit zwischen den Spielorten und in der langen<br />
Winterpause, stehen prinzipiell die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung. Ein separates<br />
Lager kann angemietet werden, was eine hohe Diebstahlsicherheit und Frostschutz gewährleistet.<br />
Alternativ können die Bestandteile zusammen mit dem Transportmedium auf einen eingefriedeten<br />
Stellplatz etwa bei Speditions- oder Logistikunternehmen untergestellt werden.<br />
Die Kosten belaufen sich auf etwa 50 Euro im Monat. 114 Dieses Vorgehen wäre auch für<br />
114 vgl. Lager7 2010<br />
49
die geforderte Ausbesserung nach fünf Spielorten günstig. Die gesamte Ausstellung kann<br />
so beim ausbessernden Betrieb abgestellt werden und dort je nach Bedarf und zeitlicher<br />
Möglichkeit ausgeladen und bearbeitet werden, ganz unabhängig von den Gegebenheiten<br />
des Transportes. Außerdem muss nicht jedes Mal die gesamte Ausstellung entladen werden,<br />
sondern lediglich die entsprechenden Teile. Hierfür ist eine darauf ausgelegte Ladestruktur<br />
erforderlich und auch eine abgestimmte Kommunikation zwischen Abbauteam<br />
und dem Unternehmen, welches die Ausbesserungen vornimmt.<br />
Bei Verwendung dieser Konstellation wird der Vorteil der Verwendung einer unabhängigen<br />
Zugmaschine (Ladebücke, Sattelauflieger) deutlich: Die kostenintensive Zugmaschine ist<br />
nicht gebunden und kann anderweitig genutzt oder zum Vermieter zurückgegeben werden.<br />
3.3.9 Entsorgungslogistik<br />
Die Entsorgungslogistik befasst sich mit dem Entsorgen verschiedener Materialien und<br />
Gegenstände. Dazu gehören Leergut, Reststoffe und Abfall. 115 Der Umgang mit dem<br />
während der Ausstellung anfallenden Leergut wurde schon im vorigen Kapitel diskutiert.<br />
Reststoffe hingegen sind als „produktions- und konsumtionsbedingte Rückstände“ 116 beschrieben<br />
und werden nicht anfallen. Im vorliegenden Fall können also lediglich Abfälle<br />
entstehen und müssen gehandhabt werden.<br />
Grundlegend kann man folgende Strategien zur Behandlung von Müll nutzen: Müll kann<br />
man vermeiden, verwerten oder beseitigen. 117 Das Verwerten und Beseitigen von Müll ist<br />
jeweils mit zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden. Die Problematik ist jedoch nicht<br />
nur aus ökonomischer sondern auch aus ökologischer Sicht und unter Aspekten der Nachhaltigkeit<br />
zu betrachten. Auch das beliebte, scheinbar ökologisch günstigere Recycling von<br />
Wertstoffen bringt stets einen Rohstoff- und Energieverbrauch mit sich. Somit lautet die<br />
vorzuziehende Lösung der Entsorgungsproblematik deshalb immer zuerst: Abfallvermeidung!<br />
Aufgrund der Vielzahl der Auf- und Abbauten während der langen Laufzeit zählt die<br />
Wanderausstellung zu den prädestinierten Anwendungsgebieten für universelle widerverwendbare<br />
Packmittel und Befestigungsutensilien.<br />
Schafft man es, den Transportschutz der einzelnen Bauteile zusammen mit der Ladeverpackung<br />
zu realisieren, entsteht kein Müll. Ist es dennoch notwendig, Bauteile separat zu<br />
schützen, ist die Verwendung von universal einsetzbaren Packdecken anstelle von einmalig<br />
115 vgl. Martin 2000, Seite 8<br />
116 Ihde 2001, Seite 324<br />
117 vgl. Ihde 2010, Figur 90, Seite 326<br />
50
verwendbarer Luftpolsterfolie möglich. Klebeband kann von Faserspanngurten ersetzt<br />
werden. Werkzeuge werden logischerweise in mehrfach nutzbaren Kisten transportiert.<br />
Anstatt Kabelbinder für die Befestigung von Dekorationen und Zuleitungen zu benutzen<br />
können widerverwendbare Klett- oder Gummiverbinder angewendet werden.<br />
Sollte dennoch Müll anfallen, zum Beispiel Ausbesserungsmaterialien, muss dieser entweder<br />
über das Center entsorgt oder mitgenommen und, gemäß der geltenden Richtlinien,<br />
an entsprechender Stelle entsorgt werden.<br />
3.4 Personal<br />
Jede betriebliche Unternehmung ist nur durch die Zusammenarbeit von Menschen zu bewältigen.<br />
Beim Herstellen einer Ausstellung ist die ‚Humanressource‘, wie es der Begriff<br />
schon sagt, einer der wichtigsten Bestandteile und muss wohlbedacht und geplant werden.<br />
Zum Personal gehören Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte, Praktikanten und Auszubildende<br />
118 . Vor allem wegen des Projektcharakters der Ausstellung ist ‚Personal‘ besser<br />
definiert als: „Anzahl der Mitarbeiter einer Aktionseinheit ..., die für eine anforderungsgerechte<br />
Erfüllung des Aufgabenanfalls erforderlich ist“ 119 . Ein klar umrissenes Spektrum<br />
an Aufgaben muss von Menschen erledigt werden.<br />
In der Veranstaltungsbranche liegt zwischen der Arbeit gebenden Instanz und der Arbeit<br />
ausführenden Person nicht immer das Arbeitgeber und Arbeitnehmerverhältnis im Sinne<br />
eines Arbeitsvertrages zu Grunde. Das Auftraggeber und Auftragnehmerverhältnis im<br />
Sinne eines Werk- oder Honorarvertrages ist ebenso üblich.<br />
Obwohl beide Arbeitsverhältnisse unterschiedliche rechtliche Grundlagen haben, wird in<br />
dieser Ausarbeitung nur von ersterer gesprochen, obwohl beide gemeint sind. In dieser<br />
Ausarbeitung sollen nicht die Vor- und Nachteile beider Beschäftigungsmodalitäten diskutiert,<br />
sondern der Bedarf an Arbeitskräften ermittelt werden. Die folgenden Betrachtungen<br />
beziehen sich auf den Bedarf an Arbeitskräften für die Ausführung der Tour.<br />
Die Bedarfsplanung für die Entwicklung der Ausstellung bis hin zu einem erstmaligen<br />
Probeaufbau wird vernachlässigt.<br />
Wie viele Mitarbeiter, leitend, ausführend und helfend, werden benötigt, um ein bestimmtes<br />
Spektrum an Aufgaben gemäß den Qualitätsanforderungen zu erfüllen?<br />
Die Frage nach dem Personalbedarf und der Personalzusammensetzung richtet sich nach<br />
118 vgl. Nicolai 2006, Seite 2<br />
119 Wittlage 1995, Seite 22<br />
51
vier Dimensionen: Zunächst sind der quantitative und der qualitative Faktor zu nennen.<br />
Dabei geht es darum, zu ermitteln, wie viele Personen mit welchem Wissen, Fähigkeiten<br />
und Erfahrungen notwendig sind, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese beiden ersten<br />
Dimensionen sind nicht voneinander zu trennen und werden immer gemeinsam bewertet.<br />
Weiterhin kann man Betrachtungen zum Zeitrahmen, also Beginn, Dauer und Ende, und<br />
dem Ort der Interaktion zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anstellen. 120<br />
3.4.1 Personalbedarfsplanung<br />
Bei der Wanderausstellung sind die Dimensionen Zeit und Ort sehr klar umrissen: Am<br />
Aufbautag der Veranstaltung müssen sich alle Beteiligen am vorher bekannt gegebenen Ort<br />
eingefunden haben und arbeiten nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen<br />
Regelungen bis die Arbeit erfolgreich abgeschlossen ist.<br />
Ein zeitliches Aufschieben oder sogar Speichern von Aufgaben ist ausgeschlossen, anders<br />
als beispielsweise in einer Buchhaltungsabteilung. Dort müssen Belege nicht sofort beim<br />
Eintreffen verbucht, sondern können einige Tage später bearbeitet werden. 121 Bei der Mars-<br />
Ausstellung muss das Aufgabenspektrum in der vorgegebenen Zeit zu lösen sein!<br />
Nach Möglichkeit darf weder Unterauslastung noch Überlastung des Personals entstehen.<br />
Das Erstgenannte resultiert in Leerlaufzeiten und somit Ressourcenverschwendung. Das<br />
Zweitgenannte kann zu Qualitätseinbußen oder sogar Sicherheitsmängeln führen, da nicht<br />
genügend Zeit bleibt, die einzelnen Arbeitschritte gewissenhaft zu beenden.<br />
In der Literatur stehen verschiedene Methoden zur Personalbedarfsplanung zur Verfügung:<br />
Die von Helmut Wittlage beschriebenen Methoden basieren zum großen Teil auf<br />
ermittelten Werten und Kennzahlen, welche im vergangenen Geschäftsprozess gesammelt<br />
wurden und über verschiedene Methoden auf die Zukunft projiziert werden. 122<br />
Summarische Methoden, von Dirk Holtbrügge beschrieben, berücksichtigen „politisch programmatische<br />
Vorstellungen externer Entscheidungsträger“ 123 . So werden unabhängig vom<br />
Arbeitsaufwand Pförtnerstellen oder die Anzahl der Feuerwehrmänner auf der Wache festgelegt.<br />
Die dort ebenfalls beschriebene Leistungsspannungsmethode 124 fußt in der Annahme,<br />
dass eine Führungskraft nur eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern effektiv leiten<br />
120 vgl. Nicolai 2006, Seite 22<br />
121 vgl. Wittlage 1995, Seite 25<br />
122 vgl. Wittlage 1995<br />
123 Holtbrügge 2007, Seite 89<br />
124 vgl. Holtbrügge 2007, Seite 89<br />
52
kann. Diese Zahl liegt etwa bei sechs bis neun. Sie basiert auf Erfahrungen aus tradition-<br />
ellen Leistungserstellungsprozessen aus der industriellen Produktion, welche hier nicht<br />
gegeben sind.<br />
Ein Projekt diesen Ausmaßes und dieser Anforderung wurde bisher bei id3d-berlin nicht<br />
realisiert. Deshalb kann man auf vergangene Kennzahlen nicht zurückgreifen. Auch Erkenntnisse<br />
aus ähnlichen Aufträgen lassen sich hier nicht analog auf die Wanderausstellung<br />
übertragen. Die in der Literatur beschriebenen Methoden lassen sich nur bedingt auf dieses<br />
Projekt anwenden.<br />
Um ein umfangreicheres Bild der Personalsituation zu erhalten und die Literatur zu ergänzen,<br />
wurden zusätzlich drei Vertreter aus der Veranstaltungs- und Ausstellungsbranche<br />
interviewt. 125<br />
Für die Ermittlung des Personalbedarfs stehen folgende Herangehensweisen zur<br />
Verfügung: Zunächst ist die einfache Schätzung 126 zu nennen, welche von einer<br />
subjektiven Sichtweise geleitet wird und lediglich empirisch begründet werden kann. Dies<br />
ist eine sehr ungenaue Möglichkeit, sie lässt ein großes Spektrum an Resultaten zu.<br />
Genauere Angaben erhält man durch die Expertenbefragung 127 , welche eine fundierte<br />
Schätzung von Experten mit qualifiziertem (Fach)Wissen darstellt. Diese Experten<br />
können sowohl Firmenangehörige sein als auch Externe mit sehr guter Kenntnis der<br />
Sachlage 128 oder die jeweils involvierten Verantwortlichen der einzelnen Teilbereiche<br />
Gestaltung, Konstruktion, Produktion und Logistik 129 . Es wird vorgeschlagen, das durch<br />
die Expertenmeinungen ermittelte Gesamtbild den Sachverständigen wiederholt<br />
vorzulegen, um eine gegenseitige Revision und Neubewertung der Ergebnisse zu<br />
erreichen. „Das Verfahren wird wiederholt, bis sich eine einheitliche Tendenz herauskristallisiert<br />
oder die Ergebnisse sich nicht mehr wesentlich ändern.“ 130<br />
Die Genauigkeit der Schätzung betreffend, können für einzelne Bereiche, wie für das Beladen<br />
eines LKW oder bekannte Montagezeiten, relativ genaue Erfahrungswerte angenommen<br />
werden 131 . Neue, nicht ‚standardmäßige‘ Arbeitsvorgänge müssen in kleinere schätzbare<br />
Einheiten untergliedert werden. Je kleiner diese sind und je größer deren Anzahl<br />
125 vgl. Anlage A<br />
126 vgl. Nicolai 2006, Seite 26f<br />
127 vgl. Nicolai 2006, Seite 27<br />
128 vgl. Sakschewski 2010<br />
129 vgl. Weimer 2010<br />
130 Bühner 2005, Seite 60<br />
131 vgl. Weimer 2010<br />
53
innerhalb eines betrachteten Vorgangs ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich Fehleinschätzungen<br />
in der Summe der Schritte ausgleichen. Eine Zeitüberschreitung bei einem<br />
Schritt kann durch eine Zeitunterschreitung beim nächsten wieder ausgeglichen werden.<br />
Zusätzlich ist eine kontinuierliche Beobachtung des tatsächlichen Aufbauverlaufs wichtig,<br />
um durch frühe Intervention, etwa durch mehr Mitarbeiter, Misserfolg abzuwehren. 132<br />
Bei der Modellbildung 133 wird ein Abbild der Realität geschaffen, anhand dessen unter anderem<br />
Arbeitsabläufe simuliert werden können. Auf diese Weise werden Daten gewonnen,<br />
welche in eine fundierte Planung einfließen. Nachteilig ist der zeitliche und monetäre<br />
Mehraufwand für den Aufbau und die Durchführung eines Modells. In engem Zusammenhang<br />
mit der Modellbildung stehen das Multimomentverfahren 134 und das MTM-Verfahren<br />
135 . Beide Verfahren liefern Erkenntnisse über das Verhalten der Mitarbeiter. In<br />
einem Probeaufbau kann man Modellbedingungen schaffen, verschiedene Personen (eingewiesene,<br />
nicht eingewiesene, Techniker, Laien, etc.) um einen Teilaufbau bitten und so zeitlichen<br />
Zusammenhänge messen.<br />
Im Multimomentverfahren wird die ausführende Person an verschiedenen Zeitpunkten des<br />
Arbeitsablaufs beobachtet und eine gemittelte Standartzeit für eine Handlung ermittelt. Die<br />
Betrachtungszeitpunkte bewegen sich im Minutenbereich. Eine Datensammlung kann<br />
folgendermaßen aussehen:<br />
Ein Arbeiter verlegt Bodenplatten, welche er von einer Palette abstapelt:<br />
Zeit verlegte Durchschnitt<br />
Bodenplatten pro Platte<br />
0 s 0<br />
40 s 3 13,4 s<br />
90 s 7 12,5 s<br />
120 s 8 30 s<br />
190 s 12 17,5 s<br />
240 s<br />
et cetera<br />
17 10 s<br />
Mittelwert: 16,68 s<br />
Tabelle 3-1 Beispiel für die Ermittlung der Dauer einer Tätigkeit<br />
Laut dieser Beispielrechnung in der Tabelle 3-1 ergibt sich für das Verlegen einer Platte die<br />
Zeit von 16,68 Sekunden. Selbstverständlich erhöht die Anzahl der Messungen die Genauigkeit<br />
des Durchschnittswertes.<br />
132 vgl. Hauck 2010<br />
133 vgl. Wittlage 1995, Seite 92ff<br />
134 vgl. Wittlage 1995, Seite 218ff<br />
135 Methods-Time-Measurement vgl. Wittlage 1995, Seite 256ff<br />
54
Die MTM-Methode hingegen beschreibt jeden einzelnen Handlungsschritt (Körperdrehung<br />
nach links, Aufnahme Werkzeug mit der rechten Hand, Einführen in die Vorrichtung<br />
et cetera) und verbindet diesen mit einer genauen Zeitmessung im Sekundenbereich. So<br />
kann der Zeitbedarf für wiederkehrende Handlungen genau ermittelt und optimiert<br />
werden. Diese Methode eignet sich vor allem bei Fließbandarbeit oder bei systematisch zu<br />
erledigender Büroarbeit (Buchung von Belegen). Auf den Ausstellungsaufbau in den verschiedenen<br />
Einkaufscentern mit ihren jeweils unterschiedlichen Gegebenheiten ist diese<br />
sehr feingliedrige Aufzeichnung kaum anwendbar. Außerdem ist es schwierig aus einem<br />
derartigen Modell verlässliche Werte zu ermitteln, da die Simulation im Büro oder Lager<br />
immer unbefangener ist, als auf der Baustelle, die Tageszeit ist anders und der Druck des<br />
Fertigwerdens entfällt. 136<br />
So kann man sagen, dass sich lediglich aus dem Expertenurteil und dessen wiederholten,<br />
gegenseitigen Abgleich eine möglichst genaue Anforderung der Mitarbeiteranzahl ergibt.<br />
3.4.2 Korrekturfaktoren<br />
Trotz der Nichtanwendbarkeit vieler Methoden bei Helmut Wittlage wird ein Augenmerk<br />
auf die dort erwähnten so genannten ‚Verteilzeiten‘ gelegt. Dies sind Faktoren, welche mit<br />
dem ermittelten Wert für den Personalaufwand multipliziert werden, um Tätigkeiten zu<br />
bemessen, die nicht direkt mit dem Leistungsprozess in Verbindung stehen.<br />
Verschiedene Werte werden bei den einzeln vorgestellten Verfahren ermittelt.<br />
Verfahren Faktoren multiplizierter<br />
Gesamtfaktor<br />
Rosenkranz/Duschek 1,2 für Nebenarbeiten<br />
1,48<br />
1,12 für Ermüdung und Erholung<br />
1,1 für Ausfall<br />
Heinisch/Sämann 1,3 pauschal<br />
1,43<br />
1,1 für Ermüdung und Erholung<br />
Müller-Pleuss 1,7 pauschal 1,7<br />
REFA 1,2 für Ermüdung und Erholung 1,42<br />
1,18 für Ausfall<br />
Mittelwert: 1,51<br />
Tabelle 3-2 Verteilfaktoren für die Personalbedarfsrechnung137 Zu den Verzögerungen gehören auch Tätigkeiten wie: Besprechungen, Einweisungen,<br />
Besorgungsfahrten, Wege, kleinere Behinderungen und die Baustelleneinrichtung. 138<br />
An den verschiedenen Studienergebnissen kann man sehr deutlich ablesen, dass für eine<br />
realistische Planung der ermittelte Wert nochmals um etwa 50 Prozent nach oben korrigiert<br />
136 vgl. Weimer 2010<br />
137 vgl. Wittlage 1995, Seiten 149, 172, 186, 241f<br />
138 vgl. Hauck 2010<br />
55
werden muss. Dieser Fall muss nicht zwangsläufig eintreten, es wird lediglich darauf hinge-<br />
wiesen, dass eine Unterbesetzung wahrscheinlich ist.<br />
Beim Start des Projektes kann man die ersten Aufbausituationen als Modell ansehen.<br />
Durch eine exakte Betrachtung der ersten Auf- und Abbausituationen können eventuelle<br />
Planungsungenauigkeiten behoben werden. Wird man schneller als geplant fertig, kann<br />
Personal gekürzt werden oder die Personalzusammensetzung geändert werden. Gezeigt<br />
wird eine mögliche Mitarbeiterstruktur in Tabelle 3-1.<br />
1.Spielort MAf MAf MAv MAv MAv MAv HKv HKv<br />
2.Spielort MAf MAf MAv MAv MAv HKv HKv HKv<br />
3.Spielort MAf MAf MAf MAv MAv HKv HKv HKv<br />
4.Spielort MAf MAf MAf MAv HKv HKv<br />
5.Spielort MAf MAf MAf MAv HKv HKv<br />
Legende:<br />
MA – Mitarbeiter HK – Hilfskraft<br />
f – fest beim Projekt v – nicht fest beim Projekt<br />
Tabelle 3-3 Mitarbeiterzusammenstellung an den ersten Spielorten<br />
Durch gute Einarbeitung wird die benötigte Gesamtpersonalstärke reduziert. Jedoch wird<br />
dafür das Stammpersonal erhöht. Drei feste und ein freier Mitarbeiter reisen mit der Ausstellung.<br />
Bei einer solchen Personalanpassung ist darauf zu achten, dass möglichst alle Faktoren<br />
beachtet werden. Ist das Entladen des LKW schnell verlaufen, kann das nicht nur an<br />
einer Unterauslastung des Personals liegen, sondern auch an einer handlichen Ladesituation.<br />
Diese kann im nächsten Einkaufscenter gänzlich anders ausfallen und personalen<br />
Mehraufwand notwendig machen. Hier ist wiederum das Expertenwissen von essentieller<br />
Notwendigkeit für die individuelle Bewertung der verschiedenen Situationen.<br />
Allerdings entsteht aus einer anfänglichen Überbuchung von Personal mit anschließender<br />
Kürzung ein Kommunikations- und Vertrauensproblem zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.<br />
Die Kürzung von Mitarbeitern wird niemals positiv aufgenommen.<br />
Eine Empfehlung ist, das Team nicht zu kürzen nach dem Motto „Never change a winning<br />
team!“ Die Mitglieder haben sich aufeinander eingespielt und kennen ihre gegenseitigen<br />
Stärken und Schwächen. Die Tatsache, dass sie nach einigen Spielorten vor der geforderten<br />
Zeit fertig werden, liegt an der hohen Qualifikation, die sie durch die vielen Auf- und<br />
Abbauten erreicht haben. 139<br />
Eine zweite Möglichkeit dieser Problematik entgegenzusteuern ist folgende: Um die<br />
139 vgl. Weimer 2010<br />
56
Anforderungen zu erfüllen werden fünf feste Mitarbeiter und drei Helfer ermittelt. Nun<br />
werden für den ersten Ort vier feste Mitarbeiter gebucht, welche mit der Ausstellung<br />
vertraut sind. Dies kann eine Mannschaft sein, die schon beim Probeaufbau mitgearbeitet<br />
hat. Hierzu kommt ein fünfter Mitarbeiter als ‚Lehrling‘. Dieser wird angelernt und kann,<br />
wie in Tabelle 3-4 angedeutet, bei der dritten Veranstaltung einen nicht zur Verfügung<br />
stehenden Mitarbeiter ersetzen. Ein neuer Lehrling kommt hinzu und wird angelernt, um<br />
später wieder einen verhinderten Mitarbeiter zu ersetzen.<br />
Vorteil dieses Rotationssystems ist eine Teamdynamik, welche erlaubt, das Team<br />
gegebenenfalls ohne Vertrauensbruch des Arbeitnehmers zu kürzen. Weiterhin entsteht für<br />
die festen Mitarbeiter eine Bereicherung ihrer Tätigkeit, da sie nicht nur ihre Arbeit<br />
erledigen, sondern auch einen weiteren Mitarbeiter anlernen dürfen. Ein so genanntes<br />
motivationssteigerndes ‚Job Enrichment‘ findet statt. 140<br />
Darüber hinaus wird so ein Pool an kompetenten Fachkräften aufgebaut. Da man bei der<br />
langen Laufzeit von drei Jahren nicht damit rechnen kann, immer auf das gleiche Team<br />
zurückgreifen zu können, kann dieser Mitarbeiterpool sehr nützlich sein. 141<br />
1.Spielort MA1f MA2f MA3f MA4f MA5L HKv HKv HKv<br />
2.Spielort MA1f MA2f MA3f MA4f MA5f HKv HKv HKv<br />
3.Spielort MA2f MA3f MA4f MA5f MA6L HKv HKv HKv<br />
4.Spielort MA3f MA4f MA5f MA6f MA7L HKv HKv HKv<br />
5.Spielort MA3f MA4f MA5f MA6f MA7f HKv HKv HKv<br />
Legende:<br />
MA – Mitarbeiter HK – Hilfskraft<br />
L – Lehrling<br />
f – fest beim Projekt v – nicht fest beim Projekt<br />
Tabelle 3-4 Mitarbeiterzusammenstellung mit ‚Lehrlingen‘ bei den ersten Spielorten<br />
Alle drei Interviewpartner stellten fest, dass eine langfristige Zusammenarbeit sich bei<br />
einem solchen Projekt als vorteilhaft erweist. Die Verlässlichkeit beider Geschäftspartner<br />
und ein monetärer Vorteil werden ergänzt durch eine sichere, wartungsarme Ausführung.<br />
Die Motivation der Mitarbeiter ist höher und der Umgang mit Materialien und Werkzeugen<br />
ist schonender.<br />
140 vgl. Sakschewski 2010<br />
141 vgl. Weimer 2010<br />
57
3.4.3 Personalzusammensetzung<br />
In der Literatur 142 wird kein Zusammenhang zwischen der Optimierung des Arbeitsplatzes<br />
beziehungsweise Arbeitsgegenstandes und der Einsparung an Personal aufgezeigt. Es<br />
werden lediglich Anforderungen ermittelt bei konstantem und bekanntem Arbeitspensum.<br />
Ebenso wird nicht beschrieben, wie sich eine Einsparung von vielen Hilfsarbeitern gegenüber<br />
der Einstellung von wenigen gelernten Kräften verhält.<br />
Bei der Betrachtung der Personalzusammensetzung, also dem Verhältnis von Mitarbeitern<br />
mit speziellen Fähigkeiten und Kenntnissen gegenüber Hilfskräften, ist wichtig, ob hieraus<br />
ein ökonomischer Mehrwert entsteht. Nähern sich die Kosten für einen Facharbeiter und<br />
eine Hilfskraft an, entsteht keinerlei Notwendigkeit mit Hilfskräften zusammen zu arbeiten.<br />
143 Hierbei müssen alle in diesem Zusammenhang stehenden Kosten beachtet werden,<br />
wie Kosten für Übernachtung und Anfahrt für mitreisende Fachkräfte.<br />
Theoretisch ist es möglich, die Umsetzung einer Veranstaltung einzig mit Hilfskräften zu<br />
realisieren. Die hierfür erforderlichen Handbücher, Arbeitsanweisungen und Hinweise,<br />
ebenso wie ein strukturierter und nachvollziehbarer Aufbau der einzelnen Bestandteile<br />
machen dies aber wirtschaftlich nicht haltbar. Nur mit Hilfskräften dauert der Aufbau<br />
länger, da sie die Handlungsschritte zunächst ‚üben‘ müssen, diese während der Arbeit<br />
langsamer ausführen und schließlich ihre Tätigkeit auf Richtigkeit prüfen müssen. 144<br />
Herr Weimer sieht hingegen eine große Gefahr in der Buchung von Hilfskräften, da hierdurch<br />
die Qualitätserfüllung nicht zu 100 % ausgeführt werden kann. 145 Lediglich ganz<br />
einfache Tätigkeiten können von Hilfskräften übernommen werden, wobei schon hier<br />
folgende Problematik auftritt: Einfachste Tätigkeiten, wie der Transport einer Ladungskiste<br />
zur besprochenen Position, kann uneffizient ausgeführt werden und erfordert Nacharbeit.<br />
Stellt die Hilfskraft die Kiste am falschen Ende der Baufläche ab, entsteht im<br />
weiteren Verlauf die Notwendigkeit, diese umzusetzen. Gleiches passiert, wenn die Kiste<br />
mit der Öffnung zur falschen Seite abgestellt wird. Eine qualifizierte Arbeitskraft kennt die<br />
einzelnen Elemente und weiß, wie solche scheinbar trivialen Schritte günstig ausgeführt<br />
werden können. 146<br />
142 Bühner 2005, Holtbrügge 2007, Nicolai 2006, Wittlage 1995,<br />
143 vgl. Sakschewski 2010<br />
144 vgl. Sakschewski 2010<br />
145 vgl. Weimer 2010<br />
146 vgl. Weimer 2010<br />
58
Herr Hauck hingegen bewertet die Personalzusammensetzung nachdem er, wie oben<br />
beschrieben, den Arbeitsablauf auf einzelne Handlungsschritte herunter gebrochen hat.<br />
Nun kann man bestimmen, welche Qualifikation ein Mitarbeiter mitbringen muss, um die<br />
geforderte Handlung zu erfüllen. 147<br />
3.4.4 Personalführung<br />
Alle drei Gesprächspartner sind sich einig, dass es eine Person geben muss, die das Team<br />
und die Hilfskräfte einweist und leitet. Diese Person muss vertraut sein mit der Ausstellung<br />
und auch den Einkaufscentern. Dieser Teamleiter steht in direkter Kommunikation mit<br />
weiteren Gewerken wie beispielsweise dem Hersteller der Ausstellungsarchitektur oder<br />
dem Exponatebauer. Bei Problemen kann er im Dialog direkt nach Lösungen suchen, ohne<br />
viele Instanzen zu konsultieren.<br />
Zusammenfassend kann man sagen, dass es keinerlei ‚Formel‘ oder ‚Mechanismus‘ gibt,<br />
welche die Frage des Personals klärt. Lediglich das Wissen und die Erfahrung von Experten<br />
aus vorangegangenen Projekten im Zusammenspiel mit fundierten Schätzungen können<br />
für die Personalplanung genutzt werden.<br />
3.4.5 Gesundheitsschutz des Personals<br />
Es gibt viele Richtlinien der Berufsgenossenschaften für den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter.<br />
Für jede Tätigkeit muss vom Arbeitgeber eine Gefährdungsanalyse gemacht und<br />
entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ist die Gefahr nicht durch technisch/mechanische<br />
Mechanismen zu unterbinden, muss vom Arbeiter eine persönliche Schutzausrüstung<br />
(PSA) getragen werden.<br />
Dazu zwei Beispiele: Ist es nicht möglich, hoch gelegene begehbare Flächen abzuschranken,<br />
müssen Mitarbeiter eine Absturzsicherung tragen. Mitarbeiter müssen eingewiesen<br />
und die Sicherungsausrüstung geprüft und gewartet sein.<br />
Besteht bei einem spanhebenden Werkzeug die Gefahr, dass Späne den Bediener im Gesicht<br />
verletzten, muss eine Schutzvorrichtung angebracht werden. Für den Fall, dass der<br />
Mitarbeiter direkten Zugriff haben muss, ist eine Schutzbrille vorgeschrieben.<br />
Beim Auf- und Abbau der Ausstellung ist Fuß- und Handschutz relevant, da die Gefahr<br />
der Quetschung besteht. Wird staubiges Material ausgebracht und bearbeitet oder mit<br />
Klebstoffen hantiert, muss Atemschutz getragen werden. Bei lauten Arbeiten, etwa dem<br />
Zusammenbau von einzelnen Teilen, ist Gehörschutz zu tragen.<br />
147 vgl. Hauck 2010<br />
59
Eine einfache Lösung ist, derartige Schutzausrüstung prinzipiell vorzuhalten, wie<br />
Einwegmasken und -ohrstöpsel. Dies ist lediglich ein organisatorischer Aufwand, der<br />
finanzielle ist vernachlässigbar klein. Gefahren, welche nur mit spezieller PSA abgewehrt<br />
werden können, müssen gesondert betrachtet werden (Lackierarbeiten, Schweißarbeiten et<br />
cetera).<br />
60
4 Lösungsansätze anderer tourender Produktionen<br />
4.1 ‚IFA 2010‘ und ‚InnoTrans 2010’ in der Messe Berlin<br />
Die Consumer Electronics Messe ‚IFA‘ und die Transportmesse ‚InnoTrans 2010‘ fanden<br />
im Spätsommer auf dem Gelände der Messe Berlin statt.<br />
Beide Veranstaltungen wurden im Rahmen dieser Arbeit zu Recherchezwecken während<br />
des Abbaus besucht und dieser fotografisch dokumentiert. Für die Ausführung der<br />
Wanderausstellung konnten in diesem Fall jedoch keine interessanten oder hilfreichen<br />
Erkenntnisse abgeleitet werden.<br />
Die Architekturen wurden sehr rabiat behandelt, zum Teil in Holzkisten oder andere<br />
Normkisten verpackt, zum Teil einfach nur auf Paletten jeder Größe gezurrt oder mit<br />
Strechfolie gesichert. Möbel wurden nicht auf ihre Praktikabilität oder auf die Möglichkeit,<br />
sie zu verladen ausgelegt, sondern vorwiegend nach rein optischen Gesichtspunkten gestaltet.<br />
Oft wurden die Ausstellungsstücke wieder in die Originalverpackung gepackt,<br />
seltener in Cases oder Dollies aus der Veranstaltungsbrache.<br />
Ein Grund dafür ist, dass es sich bei einer Messe nur in wenigen Fällen, um eine mehrmalige<br />
Ausstellung handelt. Je nach Anforderung der beworbenen Inhalte, wird der Messeauftritt<br />
vor jedem neuen Einsatz überarbeitet. Diese häufige Anpassung der Präsentation ist<br />
gerade für die auf der ‚IFA‘ gezeigten Inhalte typisch, da die Produkte dem rasanten technologischen<br />
Fortschritt unterliegen. Wahrscheinlich werden häufige Anpassungen und<br />
Neuanfertigungen auch deshalb in Kauf genommen, da die Kosten für die Produktion der<br />
Ausstellungsarchitektur im Vergleich zu den sonstigen Kosten wie Standmiete, Personal,<br />
Werbungsbroschüren et cetera relativ gering sind.<br />
61
4.2 ‚Deutschland-Tour‘ in Schwerin<br />
„Mit einer bunten Mischung aus Informationen, Musik, Fotos und Infotainment feiert die<br />
Bundesregierung 20 Jahre Deutsche Einheit.“ 148 Mit diesem Selbstverständnis gastierte die<br />
Deutschland-Tour zwischen dem 1. Juli und dem 3. Oktober in 50 deutschen Städten.<br />
Aufgeführt und konzipiert wurde das Projekt von der Firma mediapool Veranstaltungsservice<br />
GmbH Berlin. Am 14. September 2010 wurde die Veranstaltung vor dem Rathaus<br />
in Schwerin gezeigt.<br />
4.2.1 Grundlegendes<br />
Hauptmerkmal, wie in Abbildung 4-1, Abbildung 4-2 und Abbildung 4-3 zu sehen, war ein<br />
weißer Schirm mit etwa 15 m Durchmesser, welcher über eine Rundtraverse gespannt war.<br />
Diese wiederum stand auf sechs Traversenstehern, einige paarweise ausgeführt. Am Fuß<br />
der jeweiligen Steher befand sich eine Betonplatte, welche als Ballast für die Dachkonstruktion,<br />
Aufnahme für die Steher, Befestigung für Fahnenmasten und als Podest für vier<br />
8’ ISO-Container und zwei modulboxen fungierte. Letztere sind mobile Stände, die für eine<br />
Vielzahl von Anwendungen denkbar sind: Kioske, Imbissstände, Messestände, Informationsstände,<br />
Wahlveranstaltungen und sogar kleine Bühnen. Die Ausstattung ist variabel. 149<br />
Der Niveauunterschied des Platzes wurde durch eine mit Molton verkleidete Unterpallung<br />
aus Holz ausgeglichen.<br />
Abbildung 4-1 Übersicht über die Veranstaltung ‚Deutschland-Tour‘ in Schwerin<br />
148 Bundesregierung 2010<br />
149 vgl. Modulbox 2010<br />
62
Die ISO-Container, zum Teil begehbar, waren die primären Informationsträger. Außen<br />
waren sie mit wetterfesten Grafiken beklebt und im Innenraum waren multimediale Stationen<br />
aufgebaut. Unterhalb des Schirmdaches befand sich eine kleine Bühne für Moderation,<br />
Reden und Musik mit einem etwa 6 m × 4 m großen Bühnenhintergrund. Dieser bestand<br />
aus einem mit einer Grafik bespannten Rahmen. Über der Bühne hing ein LED-<br />
Modul, welches während der Interaktion mit dem Publikum benutzt wurde.<br />
Abbildung 4-2 Modulbox mit Detaillösungen<br />
Abbildung 4-3 Detail des Aufbaus<br />
63
Die Crew setzte sich aus vier festen Mitarbeitern und zwei Fahrern zusammen und wurde<br />
jeweils von drei örtlichen Helfern unterstützt. Als Fahrzeuge sind ein Sattelschlepper mit<br />
Curtainslider und ein Gliederzug mit planenloser Pritsche und fest montiertem 10 t-Kran<br />
zum Einsatz gekommen. Vor Ort wurde ein Gabelstapler gebucht.<br />
4.2.2 Möbel und Ausstattung<br />
Eine der modulboxen war zu einem Informationsstand ausgebaut, welcher durch die zu<br />
allen Seiten zeigende Theke aus Strebenprofilen, wie sie beispielsweise die Firma Bosch Rexroth<br />
AG 150 herstellt, charakterisiert war. Die Beplankung der Theke war mit beschichteter<br />
Multiplexplatte ausgeführt. Aus dem gleichem Material waren die Halter für gedruckte<br />
Informationen. Die Stufen für das Publikum waren aus Siebdruckplatte gefertigt. Als Sitzgelegenheiten<br />
dienten einfache Stühle und Hocker aus industrieller Fertigung. Die Aufnahmen<br />
und Halterungen für die Medienstationen bestanden aus den üblicherweise in der Veranstaltungsbranche<br />
verwendeten Aufbauten und Ständern, vergleichbar mit Abbildung 4-4.<br />
Abbildung 4-4 Container mit Medienstation<br />
Die Bühne ist aus standardisierten 2 m × 1 m Komponenten und individuell gefertigten,<br />
gebogenen Bühnenelementen zusammengesetzt. Der Backdrop ist an einem Leinwandgestell<br />
befestigt.<br />
150 vgl. Bosch Rexroth 2010<br />
64
4.2.3 Verpackung und Transport<br />
Ein großer Teil der verwendeten veranstaltungstechnischen Ausrüstung wurde in branchenübliche<br />
Cases verpackt. Elektrisches Equipment, wie Mischpult und Verstärker,<br />
wurden vorverkabelt in Spezialcases bereit gehalten. Die Bühnenteile wurden aufeinander<br />
gestapelt, das unterste Element war mit Rollen versehen.<br />
In den Containern und modulboxen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, alle kleinteiligen<br />
Materialien gelagert und transportiert. Möbel und Sitzgelegenheiten wurden mit Luftpolsterfolie<br />
geschützt verladen, soweit möglich formschlüssig, ansonsten verzurrt.<br />
Vorinstallierte Regale oder Ablagemöglichkeiten in den Containern dienten der Aufnahme<br />
von Eurokisten mit Kleinstmaterialien und Werkzeug und kartonierten<br />
Informationsmaterialien.<br />
In dem vom Besucher begehbaren Container hatte die Veranstaltungstechnik ihren Platz.<br />
Die Cases wurden jeweils auf ihre Stirnseite getipt und dann verzurrt, wie in<br />
Abbildung 4-5 gezeigt.<br />
Abbildung 4-5 Verladen von Kleinteilen und Cases<br />
Nicht in den Containern waren folgende Elemente: Holz für die Unterpallung wurde in<br />
Kunststoffbehältern, wie in Abbildung 3-11 gezeigt, jedoch ohne Räder, befördert. Die<br />
Betonplatten wurden unverpackt auf die Ladefläche der LKW verladen, ebenso wie die<br />
Traversenkonstruktionen und die Bühnenelemente.<br />
Die Container erhielten zum Verladen einen Kantenschutz, die Grafiken waren zwar mit<br />
Klett befestigt, wurden aber nicht abgenommen. Die modulboxen wurden mit einer passgenau<br />
gefertigten Hülle aus robuster Plane geschützt. Mit dem Kran wurden sie auf die<br />
Zugmaschine des Gliederzuges verladen und niedergezurrt. Dahinter fanden die Bühnenplatten<br />
Platz. Zwei der Betonplatten wurden auf dem Anhänger des Gliederzugs transportiert<br />
ebenso wie das gesamte Traversenmaterial. Zwischen die einzelnen Traversen<br />
waren passgenau gefertigte Schutzvorrichtungen aus Holz gestapelt, diese stabilisieren das<br />
gesamte Traversenpaket und schützen die einzelnen Rohre gegeneinander. Auch hier<br />
wurden alle Elemente niedergezurrt.<br />
65
Der Sattelauflieger wurde mit dem Kran über das offene Dach beladen. Auf der Ladefläche<br />
lagen die vier restlichen Betonplatten, auf ihnen die vier ISO-Container. Zur Stirnseite des<br />
Aufliegers hin standen die Kisten mit dem Holz, auf der Heckseite noch einige Materialien<br />
und Hilfsmittel, wie Paletten und ein Hubwagen. Oben auf den Containern wurden die<br />
Fahnenmasten festgezurrt.<br />
Das Beladen des Sattelzuges erforderte viel Feingefühl: Die lichte Breite der Dachöffnung<br />
war nur um wenige Zentimeter breiter als das Abmaß des ISO-Containers. In Abbildung<br />
4-6 sieht man, wie die Mitarbeiter den Container mit langen Holzstangen auf seine endgültige<br />
Position ‚einweisen‘ mussten. Unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes muss<br />
dieses Vorgehen kritisch bewertet werden.<br />
Abbildung 4-6 Verladen der Container<br />
4.2.4 Hilfsmittel und Werkzeuge<br />
Wie beschrieben war ein Fahrzeug mit einem Kran ausgestattet, welcher eine Nutzlast von<br />
10 t hat. Der ebenfalls zur Verfügung stehende Stapler wurde vor allem genutzt, um die<br />
einzelnen Bestandteile in den Aktionsradius des Kranes zu bringen. Ein Arbeiten unter<br />
alleiniger Verwendung des Kranes wäre möglich jedoch viel zeitintensiver. Das mehrmalige<br />
Umsetzen des Kranfahrzeuges während der Auf- und Abbauarbeiten wäre notwendig<br />
gewesen.<br />
Für das Spannen des Schirms wurden an der Ringtraverse vorinstallierte Spanner, ähnlich<br />
einem Spanngurtspanner, verwendet. Die Traversen wurden mit Bolzen und Federstecker<br />
verbunden. Die Fahnenstangen wurden mit Maschinenschrauben auf einen Kippmechanismus<br />
geschraubt, welcher in die Betonplatte eingegossen ist. Die Steher für den Schirm<br />
sind über Nutenschrauben in eingelassenen Halfenschienen an der Betonplatte montiert<br />
worden.<br />
66
Die auskragenden Dächer der Modulboxen waren über selbstsichernde Bolzen arretiert,<br />
wie in Abbildung 4-2. Drückt man den weißen Knopf, versenkt sich ein Querriegel und der<br />
Bolzen kann entnommen werden. Zur einfachen Bedienung waren die Dächer auch mit<br />
Hydraulikzylindern versehen. Als Transportsicherung wurden Spannklammern gebraucht.<br />
Somit wurden nur metrische Maulschlüssel und ein Hammer für die Montage und<br />
Demontage gebraucht.<br />
4.2.5 Zusammenfassung<br />
Die Verwendung der ISO-Container ist eine sehr vorteilhafte Idee und die sich hieraus ergebende<br />
Vereinfachung der Ladesituation ist eine große Erleichterung. Viele Elemente<br />
konnten im Container fest verbaut bleiben, die sonst mit anderen Systemen hätten verladen<br />
werden müssen.<br />
Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass die Möglichkeiten der Verladung, die<br />
solch ein Container bietet, nicht ausgenutzt wurden. Das Einfädeln über das Dach des<br />
Sattelaufliegers ist ein zeitraubender Vorgang und völlig unnötig, da der Container selbst<br />
Stahlguss-Ecken hat, mit denen er direkt auf einem dafür vorgesehenen LKW befestigt<br />
werden kann.<br />
Auch die Betonplatten sind in ihrer Nutzung vielseitig ausgelegt worden, was ebenfalls<br />
positiv zu bewerten ist. Jedoch war auch hier die Transportfähigkeit ist erheblich eingeschränkt.<br />
Durch die erhabenen Fahnenaufnahmen sind Füllschichten aus Holz notwendig,<br />
um die Container darauf positionieren zu können. Besonders unglücklich ist diese Ausführung,<br />
da wenige Zentimeter weiter eine Halfenschiene für eine sehr ähnliche Anwendung<br />
angebracht ist. Weiterhin bestand keine Möglichkeit, die Ballastplatten mit dem Stapler<br />
aufzunehmen. Einschübe für die Zinken eines Staplers sind nicht vorhanden.<br />
Dies ist besonders unter dem Aspekt der Hilfsmittelbereitstellung interessant: Unter<br />
Umständen hätte die Doppelverwendung von Kran und Gabelstapler vermieden werden<br />
und so ein signifikanter Teil der Kosten eingespart werden können.<br />
67
4.3 ‚Cirque du Soleil‘ in der O 2-World Berlin<br />
Vom 1. September bis zum 4. September 2010 gastierte der Cirque du Soleil, eine kana-<br />
dische Artistikproduktion, mit dem Programm ‚Saltimbanco‘ in der O 2-World in Berlin.<br />
Die Show ist bereits seit einem Jahr auf Europa-, Südafrika-, Australien- und Neuseeland-<br />
tour und wird noch bis August 2011 spielen.<br />
Bei dieser Produktion war es lediglich gestattet, Notizen anzufertigen, Fotos waren untersagt.<br />
Um die Bühnensituation dennoch zu illustrieren, werden in Abbildung 4-7 Fotos der<br />
Show aus dem Internet gezeigt. Diese sind nicht aus der O2-World Berlin.<br />
4.3.1 Grundlegendes<br />
Abbildung 4-7 Die Show Saltimabaco 151<br />
Wie in Abbildung 4-8 skizziert, bestand die Veranstaltung aus einer Centerbühne für die<br />
Artistik und einer gewöhnlichen ‚Frontalbühne‘ für die Band, sehr ähnlich einem Zirkusaufbau,<br />
jedoch ohne den Durchgang für die Artisten unter der Band. Über dem Artistikbereich<br />
war eine Traversenkonstruktion installiert, welche mit sämtlichen Aufnahmen für<br />
die künstlerischen Darbietungen versehen war. Über der Band war ein transluzenter Plafond<br />
abgehängt. Der gesamte Innenbereich der Halle war mit Beleuchtungs- und Dekorationstraversen<br />
ausgestattet.<br />
Die Produktion reist mit 18 Sattelaufliegern, wobei alle Bestandteile der Veranstaltung<br />
mitgenommen werden: Licht, Ton, Bühne, Rigging, Dekorationen und Kostüme, der<br />
Artistenbereich (Aufwärmgeräte, Schminkbereich et cetera), Ausbesserungswerkstätten<br />
(Näherei, Wäscherei, Schreinerei et cetera) und auch das Künstlercatering.<br />
151 Bildquelle: Cirque de Soleil 2010<br />
68
Abbildung 4-8 Skizze des Aufbaus in der O2-World Berlin<br />
Die Bühne ist auf Rollen beweglich gebaut. Dies ermöglicht ihren Aufbau an einer beliebigen<br />
Stelle im Raum, während etwa die Beleuchtungsabteilung gleichzeitig Leuchtkörper<br />
montiert. Wird das Rig hochgezogen, kann die Bühne mit Personenkraft an ihre endgültige<br />
Position gefahren werden. Analog verhält es sich beim Abbau: Die Demontage der Bühne<br />
geschieht parallel zur Demontage der Beschallungsanlage oder der Lichttraversen.<br />
Abbildung 4-9 Traversen mit fest monierten Rollen<br />
69
Alle Traversenstücke sind, wie die Abbildung 4-9 zeigt, mit fest montierten Rollen<br />
vorkonfektioniert. Die Rollenkonstruktion ermöglicht nicht nur die Bewegung der Traverse<br />
im aufgebauten Zustand, sondern auch deren problemlose Stapelung. Die Vorteile sind:<br />
Wie bei der Bühne kann das Trussing an einem beliebigen Ort vormontiert und erst zur<br />
endgültigen Montage auf Position geschoben werden. Die sichere Stapelbarkeit ermöglicht<br />
schnelles Verladen und vereinfacht die Handhabung. Auch die Montage wird durch die<br />
leicht erhöhte Position auf den Rollen erleichtert. Darüber hinaus kann jedes Element der<br />
Traverse während des Transportes unten gestapelt sein, was das Verladen und die<br />
Handhabung nochmals erleichtert.<br />
Jedes Bauteil der Produktion hat seine unikale Nummer, welche auf dem Bauteil selbst,<br />
allen Konstruktionszeichnungen und der Verpackung vermerkt ist.<br />
Kabel sind als Kabelbäume verlegt und auf die richtige Länge vorkonfektioniert.<br />
Auch Zubehör, welches eigentlich vom Haus kommen könnte, wird mitgenommen wie<br />
zum Beispiel die Tische für den FOH-Platz. Dies hat den Vorteil, dass so alle Bestandteile<br />
der Ausrüstung aufeinander abgestimmt werden können. So wird zur Kaschierung der unästhetischen<br />
Technik Molton passend geschneidert. Bei angemieteten Tischen wäre das<br />
nicht möglich.<br />
4.3.2 Verpackung und Ladehilfsmittel<br />
Sämtliche Bestandteile der Produktion werden entweder in rollbare Cases oder auf Dollies<br />
verpackt und befördert. Alle Bauteile haben ihren Platz: Jedes Bühnenelement, jeder<br />
Scheinwerfer, jede Maske und jeder Schminkspiegel ist ein bestimmter Ort zugewiesen. Die<br />
Teile müssen nicht gesucht werden und es muss nicht bei jedem Transportvorgang neu<br />
überlegt und entschieden werden, auf welche Art und Weise etwas gelagert und transportiert<br />
werden soll. Daraus resultiert ebenfalls eine sichere, schnelle und effiziente Handhabung<br />
und garantiert, dass nichts vergessen, verloren oder beschädigt wird.<br />
Dabei werden die Bestandteile nicht in einer beliebigen Kiste verstaut, sondern am Ort der<br />
Verwendung. Beispielsweise sind Säcke für Riggingmaterialien wie Schäkel, Rundschlingen,<br />
Stahlseile et cetera in die Traverseninnenräume eingelassen. Das ‚leere‘ Volumen innerhalb<br />
der Traverse wird nutzbar gemacht, die benötigten Materialien sind sofort griffbereit, wie in<br />
Abbildung 4-10 skizziert.<br />
Die Beschriftung der Verpackung ist wie folgt gelöst: Zunächst ist deutlich die Trucknummer<br />
ersichtlich, welche auch nochmals farblich kodiert ist, sodass jedes Ladegut in den<br />
richtigen LKW geladen wird. Zur weiteren Beschreibung dient eine Zeichnung, welche den<br />
Inhalt jeweils in zwei Ansichten, nämlich im verpackten und aufgebauten Zustand, zeigt.<br />
Die jeweiligen Bauteilnummern sind dort genau vermerkt. Ebenfalls sind Handhabungsan-<br />
70
weisungen wie „bottom stack only“ oder „top stack only“ 152 angebracht.<br />
Das für die Sicherung der Ladung notwendige Zubehör ist einsatzbereit am Transport-<br />
wagen befestigt. Spanngurte sind fest angeschraubt, Bolzen über eine ‚Fangleine‘ gesichert.<br />
Abbildung 4-10 Traversensack innerhalb einer Traverse<br />
Im Folgenden ist beispielhaft die Bühnenbodenverladung beschrieben: Da die Bühne bunt<br />
bemalt ist, müssen die jeweiligen Teile an der richtigen Stelle wieder aufgebaut werden, da<br />
sich andernfalls kein zusammenpassendes Bild ergibt. Somit ist es von großer Wichtigkeit,<br />
dass die Dollies in der richtigen Reihenfolge an der richtigen Stelle be- und entladen<br />
werden. Ein Vertauschen von Bühnenplatten hätte Zeitverzögerungen zur Folge. Um die<br />
richtige Reihenfolge zu gewährleisten, ist eine ausführliche Beschreibung an den Transportwagen<br />
angebracht. Sie zeigt die Position der Bühnenelemente in Relation zum Gesamtaufbau<br />
und weiterhin die genaue Packweise des Wagens. Die Bühnenplatten sind in einer<br />
bestimmten Reihenfolge aufeinander gelegt, welche auch an den Streben des Dollies mittels<br />
der Bauteilnummer vermerkt ist.<br />
Auch die Bühnenbeine haben auffällige Farbmarkierungen und kommen in die dafür<br />
vorgesehenen, farblich markierten Fächer. Zwischen die Bühnenplatten ist jeweils eine<br />
Schutzschicht aus etwa 7 mm Kunststoff gelegt, damit die Bodenplatten während des<br />
Packens und des Transportes nicht aneinander reiben. Zusätzlich wurde auf dem Dollie ein<br />
spezielles Fach geschaffen, um dort die Schutzmatten während des Aufbaus sicher zu<br />
deponieren, ohne dass sie beim Transport ins Leergutlager herunterfallen oder stören.<br />
152 nur unten laden, nur oben lagen<br />
71
Spanngurte sind fest an das Grundgestell montiert und Ösen für den Spanngurthaken<br />
vorgesehen.<br />
Die Beleuchtungstechnik wurde lediglich gegen die beim Transport auftretenden Vibrationen<br />
geschützt, jedoch nicht gegen Spritzwasser und Staub. Der Vibrationsschutz der<br />
Scheinwerfer wird auch nicht über Schaumstoff realisiert, sondern über gefederte Gestelle.<br />
In den Dollies sind für jeden Scheinwerfer Aufnahmevorrichtungen installiert, welche<br />
durch Federn vom Grundgestell entkoppelt sind. Damit sie nicht herausfallen, werden die<br />
Scheinwerfer mit Bolzen arretiert.<br />
Die Dollies sind zwar nicht mit Griffen versehen, wurden aber nie so eng geladen, dass<br />
eine Handhabung unmöglich wäre. Es blieb immer genügend Platz, die Holme sicher zu<br />
umfassen, ohne dass die Gefahr von Quetschungen oder Verletzungen bestand.<br />
Insgesamt wurden die Transportmittel, LKW und Dollies, sehr großzügig beladen. Der<br />
vorhandene Platz wurde nicht voll ausgenutzt, was sich zweifelsohne auf das Ladevolumen<br />
ausgewirkt hat. Auf diese Weise konnte jedoch die Handhabung wesentlich<br />
beschleunigt werden. Die Wagen werden leichter und das Entnehmen und das Packen<br />
werden vereinfacht.<br />
4.3.3 Transport<br />
Die Packmaße des Transportgutes waren nicht auf das Europäische Maß abgestimmt, da<br />
die Veranstaltung für Kanada und das dort gültige Containermaß konzipiert wurde. Da der<br />
kanadische Container schmaler ist als die europäische Norm von 2,40 m, entstehen beim<br />
Beladen Lücken im LKW links und rechts zwischen Wand und Ladeeinheit. Skizziert wird<br />
diese Ladesituation in Abbildung 4-11.<br />
Somit war es notwenig, das Transportgut gegen Bewegungen quer zur Fahrtrichtung mit<br />
Spanngurten zu verzurren. Da die Gurte in der Zurrschiene an der Wand angeschlagen<br />
sind und das Gut horizontal umschlungen ist, bestand auch gleichzeitig eine Sicherung<br />
gegen Verrutschen nach hinten.<br />
Darüber hinaus sind zur nochmaligen Sicherung nach Hinten horizontale Sperrstangen<br />
zum Einsatz gekommen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit beziehungsweise Anforderung<br />
an die Ladeverpackung, dass diese die Zurrkräfte aufnehmen kann und das<br />
transportierte Gut nicht beschädigt wird.<br />
72
Abbildung 4-11 Skizze der Stauung der Ladung im Sattelauflieger<br />
Jeder Sattelauflieger hatte nicht nur bestimmte Teile der Ladung, wie anhand der Trucknummern<br />
beschrieben, aufzunehmen, sondern mittels Zeichnungen und Bauteilnummern<br />
war außerdem festgelegt, in welcher Reihenfolge geladen wird. Diese Anleitung war für alle<br />
ersichtlich im LKW angebracht, ebenso wie die deutliche Kennzeichnung der Trucknummer.<br />
Mit dieser Struktur war es möglich, die Gurte schon an ihrer benötigten Stelle in<br />
der Zurrleiste einzuhaken und dort zu belassen.<br />
Alle Bestandteile wurden auf Rollen geladen. Niedrige Cases wurden unter Zuhilfenahme<br />
von Gabelstaplern aufeinander gestellt. Es entstanden Türme von zwei bis drei Cases übereinander.<br />
Deren jeweilige Deckel haben Aufnahmen für die Rollen des darüber stehenden<br />
Cases, ein Verrutschen oder Herunterfallen ist bei normalem Gebrauch nicht möglich.<br />
Eine weitere Funktion hatten die Stapler nicht, da die Ladesituation in der O2-World Berlin<br />
über eine Rampe ebenerdig ist. Eventuelle Höhendifferenzen zwischen LKW und Boden<br />
werden über hydraulische Ladebühnen überwunden. Ist die Ladesituation nicht so vorteilhaft<br />
wie in Berlin, heben Stapler die einzelnen Teile in den LKW, wo sie von Hand<br />
weiterbefördert werden.<br />
4.3.4 Hilfsmittel und Werkzeuge<br />
Das Spektrum der für den Auf- und Abbau benötigten Werkzeuge ist auf ein Minimum<br />
vermindert: Lediglich werden ein Hammer für das Trussing und ein Imbusschlüssel für die<br />
Arretierung der einzelnen Bühnenplatten verwendet. Schraubverbindungen werden weder<br />
axial belastet noch an bewegten Teilen eingesetzt, somit können ohne Sicherheitsbedenken<br />
Flügelmuttern per Hand angezogen werden.<br />
73
Für die Realisierung der akrobatischen Nummern war eine Vielzahl von Gegengewichten<br />
erforderlich. Diese sind so konstruiert, dass sie nach dem Prinzip eines Wagenhebers,<br />
durch das Herauskurbeln von Gewindestangen, über die Höhe der Transportrollen hinaus<br />
gehoben werden können. Auf diese Weise werden sie fest auf dem Boden platziert.<br />
Die Bühnenverkleidung wird über Klettverbindungen angebracht.<br />
Soweit möglich sind alle Verbindungen über Stecksysteme gelöst. Bühnenbeine werden<br />
über Kegelpassungen festgesetzt. Ebenso werden Notenständer und Mikrofonständer im<br />
Bühnenboden befestigt.<br />
Der Bühnenboden selbst wird mittels Steckverbindungen zusammengesetzt und dann<br />
mittels des erwähnten Imbusschlüssels mit einer Umdrehung verhakt.<br />
Die Bühne ist so konstruiert, dass die Kraft auf das benachbarte Bühnenteil abgeleitet<br />
werden kann. So steht das zuerst aufgebaute Element auf vier Beinen, das daran<br />
anschließende nur noch auf zwei weiteren. Hat ein Bühnenelement zwei benachbarte Teile,<br />
reicht lediglich ein Bein in der äußersten Ecke.<br />
Die Verpackung ist sehr massiv gefertigt. Für die Dollies wurde Stahlprofil verwendet,<br />
wohingegen die Bühne aus Aluminium ist.<br />
74
4.4 ‚Unser Wetter‘ im Gesundbrunnencenter Berlin<br />
Wie entsteht Hagel, warum gibt es Wind, wie wird morgen das Wetter? Diese und andere<br />
Fragen klärt die Ausstellung ‚Unser Wetter – und wie es funktioniert‘, welche beginnend<br />
2010 für drei Jahre durch deutsche Einkaufscenter der ECE GmbH tourt.<br />
Im Zeitraum vom 25. Mai – 06. Juni 2010 war die Ausstellung im Gesundbrunnencenter in<br />
Berlin zu sehen. Weil die Anforderungen sehr ähnlich oder gar gleich sind, ist die Analyse<br />
dieser Ausstellung besonders interessant im Vergleich zu der im Rahmen dieser Arbeit<br />
betrachteten Wanderausstellung ‚Der Mars – Vision und Mission‘.<br />
4.4.1 Grundlegendes<br />
Abbildung 4-12 Die Ausstellung ‚Unser Wetter‘<br />
Auf acht verschiedenen Flächen werden die einzelnen Themenbereiche wie Tornado,<br />
Hagel, Überschwemmung und so weiter vorgestellt. Die etwa 3,00 m breiten und<br />
4,00 - 6,00 m langen Flächen sind in verschiedenen kräftigen Farben gehalten. Die<br />
Architektur ist nach außen, zum Center hin, organisch ausgeführt und mit Filz bespannt.<br />
Innerhalb der so eingefassten Areale bestehen die Aufbauten aus flachen, bedruckten<br />
Holzwerkstoffen. Nach innen gibt es, außer der Kopfhörerhalterung, keine erhabenen<br />
75
Komponenten. Am oberen Abschluss der Bauelemente waren Scharniere zu erkennen.<br />
Zur Revision wird die gesamte Front angehoben, um an die weiteren Bauteile zu gelangen.<br />
Die einzelnen Bauteile sind jeweils 0,80 m breit und etwa halb so tief. Der Filzbezug jedoch<br />
zeigte Ungenauigkeiten an den Stößen. Auch Flecken waren am ersten Spielort schon zu<br />
erkennen. Der Boden bestand nur aus einem flachen, statisch nicht relevanten, Belag aus<br />
Kunststoff. Die Kabel waren in Kabelkanälen darüber geführt.<br />
4.4.2 Hands-On-Exponate<br />
Die Ausstellung war sehr interaktiv angelegt. Information waren nur zu erhalten, wenn<br />
man dafür etwas getan hat. So musste zum Beispiel, wie in Abbildung 4-13 links gezeigt,<br />
eine Metallscheibe beiseite gedreht werden. Durch die Ausfräsung war der Schwerpunkt<br />
azentrisch und sie fiel immer wieder in die ‚verdeckende‘ Position zurück. Rechts sind<br />
Touchscreens gezeigt, an welchen man seinen ‚ökologischen Fußabdruck‘ ermitteln konnte.<br />
Abbildung 4-13 Interaktivität bei ‚Unser Wetter‘<br />
Abbildung 4-14 diverse Hands-On-Exponate<br />
76
Viele weitere Hands-On-Exponate luden den Besucher ein, selbst zu forschen und sein<br />
Wissen zu erweitern. Abbildung 4-14 zeigt links eine Apparatur zum Messen der Kraft des<br />
Vakuums. An der weißen Platte war ein Glassauger angebracht, an dem man über zwei<br />
Umlenkrollen ziehen kann, die aufgebrachte Kraft war auf einer Federwaage abzulesen.<br />
Leider war das Exponat, wie auf dem Foto zu sehen, schon wenige Tage nach der Eröffnung<br />
nicht mehr funktionsfähig. Das Seil war abgerissen. Auf dem Bild rechts ist zu<br />
sehen, wie die Besucher das Gewicht des CO2-Ausstoßes ermitteln, indem sie verschieden<br />
schwere Kanister auf eine Wage stellten.<br />
4.4.3 Medien<br />
Es gab eine Vielzahl von Medienstationen, jedoch ist die Bandbreite der verwendeten<br />
Mediensysteme eher klein. Ein oft wiederkehrendes Element war die ‚nachgespielte<br />
Erzählung‘, vergleichbar mit Abbildung 4-15. Hier sind verschiedene Szenen des Hörspiels,<br />
welches man über die Kopfhörer hört, anhand von Miniaturmodellen nachgestellt. An der<br />
jeweiligen Stelle der Geschichte wird das entsprechende Fenster beleuchtet und die<br />
Szenerie wird sichtbar. Analoges passiert mit den Bildern der Personen, auch sie leuchten<br />
auf, wenn die Person spricht.<br />
Abbildung 4-15 das Medium ‚Nachgespielte Erzählung‘<br />
Außerdem werden viele Informationen über die interaktiven Touch-Screens vermittelt, der<br />
Besucher kann diese selbsttätig abrufen. Große Monitore führten visuell in das jeweilige<br />
Themenmodul ein und sind an der zum Center gewandten Seite der Aufbauten angebracht.<br />
77
Die Stromzufuhr erfolgte immer durch die, in der Decke angebrachte, ERCO-Schiene.<br />
Über die dafür vorgesehenen ERCO-Stromauslässe wurden die Leitungen bis zum Verwendungsort<br />
über Magnete an der metallischen Decke geführt und dann innerhalb der<br />
Architektur weiter verteilt. Für die nebeneinander stehenden Elemente wurde nur jeweils<br />
eine Zuführung benötigt.<br />
Einige wenige Scheinwerfer sind in die Ausstellungsarchitektur integriert. Die weitere, sehr<br />
unregelmäßige Ausleuchtung der Ausstellung wurde über ERCO-Scheinwerfer realisiert.<br />
Als Grundlicht wurde die normale Hausbeleuchtung verwendet.<br />
4.4.4 Verpackung und Transport<br />
Die einzelnen Module werden in Holzkisten verpackt und in zwei Sattelaufliegern transportiert.<br />
Im Fall des Gesundbrunnencenters wird das Leergut, mit einem mobilen Bauzaun<br />
umzäunt, auf dem Parkdeck gelagert.<br />
Die Kisten haben Füße, um sie mit einem Hubwagen aufnehmen zu können.<br />
4.4.5 Zusammenfassung<br />
Positiv zu bewerten ist, dass die Ausstellung, aus sehr starken Farben bestehend, einen<br />
wirkungsvollen Kontrast zum Center dargestellt hat. Vorteilhaft waren auch die einfach<br />
handhabbaren, in die Ausstellungsarchitektur integrierten, Medien. Eine Neuinstallation an<br />
jedem Spielort entfällt.<br />
Nachteilig sind die großen Verpackungsmaße, da für jedes Element eine eigene Kiste<br />
gebraucht wird. Ebenso müssen die verwendeten Materialien kritisch bewertet werden.<br />
Die Bespannung aus Filz ist sehr schwierig zu reinigen. Im Fall einer Verschmutzung oder<br />
Beschädigung muss das ganze Teil neu bezogen werden.<br />
78
5 Ressourcenschonende Lösungsansätze für die Wandersausstellung<br />
‚Der Mars – Vision und Mission‘<br />
Im Folgenden werden noch einmal sämtliche Ansatzpunkte zur Planung und Gestaltung<br />
der Wanderausstellung, welche in den vorherigen Kapiteln herausgearbeitet wurden, zusammengefasst.<br />
Dies erfolgt in Form von konkreten Handlungsempfehlungen für die<br />
Realisierung der Ausstellung.<br />
Dabei werden die Ergebnisse aus Kapitel drei mit den Erkenntnissen aus den Feldstudien<br />
des Kapitels vier und den Interviews verknüpft. Die einzelnen Detaillösungen wurden<br />
immer unter dem Gesichtspunkt der ressourcensparenden Herstellung und Ausführung<br />
bewertet und ausgewählt.<br />
Grundlegend kann gesagt werden, dass Aufgrund der großen Vielfalt der Gegebenheiten in<br />
den verschiedenen Einkaufscentern eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Bestandteile<br />
notwendig ist. Um jedoch ressourcenschonend zu Arbeiten, ist ein hoher Grad<br />
an Systematisierung und Strukturierung notwendig. Im Folgenden werden konkrete<br />
Lösungsvorschläge aufgezeigt, welche diese beiden gegenläufigen Forderungen erfüllen<br />
können. Die Lösung dieses Widerspruchs war nur durch die ganzheitliche Betrachtungsweise<br />
der komplexen Problemzusammenhänge möglich. Dazu wurden, wie eingangs als<br />
Ziel dieser Arbeit formuliert, die drei Hauptsachgebiete Produktion, Logistik und Personal,<br />
fachübergreifend und vernetzt betrachtet.<br />
Die Ergebnisse wurden nach dem derzeitigen Planungsstand erarbeitet. Ändern sich bestimmte<br />
Anforderungen oder Vorgaben, müssen die hier ermittelten Resultate gegebenenfalls<br />
neu bewertet werden.<br />
Grundsätzlich ist eine detaillierte Abstimmung der einzelnen Gewerke, verantwortlich für<br />
Architektur, (Hands-On)-Exponate, Medien, Strom und Logistik, untereinander wichtig.<br />
Schnittstellen müssen vor Projektbeginn genau definiert und im weiteren Verlauf auch<br />
verpflichtend eingefordert werden. Dies ist besonders wichtig, wenn mit vielen Subunternehmen<br />
zusammenarbeitet wird.<br />
Gleiches gilt für die Wartung und Instandhaltung: Auch hier muss schon während der<br />
Planung der Umfang und die Art und Weise der Reparaturen und Nacharbeiten mit einkalkuliert<br />
werden.<br />
Um die Ausstellung extern zu transportieren, empfiehlt sich die Verwendung einer Ladebrücke.<br />
Der Vorteil, dass diese auch als Lager während der Spielzeit und zwischen den<br />
Spielorten, aber auch als Langzeitlager in der Winterpause, genutzt werden kann, ohne die<br />
Zugmaschine zu binden, spricht offensichtlich für dieses Medium. Eine frostsichere<br />
79
Lagerung der Ladebrücke ist ebenfalls möglich. Die hohe Nutzlast und die auf das europäische<br />
Maß genormte Größe sind weitere Argumente für die Verwendung der Ladebrücke.<br />
Die einzige, bei der Planung zu berücksichtigende, Einschränkung wäre, dass die<br />
Brücke ohne Zugfahrzeug nicht im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden kann.<br />
Der Container und der Sattelauflieger haben den Vorteil der enormen Nutzlast, jedoch den<br />
Nachteil, dass ein kostenintensives Fahrzeug gebunden ist, genau wie der LKW mit festem<br />
Aufbau. Bei letzterem muss man entweder hohe Kosten in Kauf nehmen oder die<br />
Zwischenlagerung des Leergutes arrangieren.<br />
Die Wahl des Aufbaus auf dem LKW ist eindeutig: Gegenüber dem Planenaufbau ist der<br />
Kofferaufbau vorzuziehen, nur dieser gewährleistet den sicheren Schutz der Bestandteile<br />
während der Fahrt und ermöglicht eine einfache, effiziente Ladungssicherung.<br />
Ist weder eine Rampe noch eine Ladebordwand vorhanden, muss zum Entladen der LKW<br />
vor Ort ein Stapler zugebucht werden. Innerhalb des Centers werden die Bauteile immer<br />
per Handgabelhubwagen bis zum Ort des Aufbaus transportiert.<br />
Alle Elemente müssen demzufolge Stapler- und Hubwagenkompatibel sein, vergleichbar<br />
mit einer Palette. Es darf nicht die Notwendigkeit wie bei der ‚Deutschland-Tour‘ entstehen,<br />
ein weiteres Ladesystem zu nutzen.<br />
Eine mögliche Alternative wäre, Räder unter jedes Element zu montieren und auf die Hubwagen<br />
für die Disposition im Center zu verzichten. Dies würde die Ladung und Distribution<br />
deutlich beschleunigen und die Handhabung vereinfachen. Die Materialkosten werden<br />
dadurch höher ausfallen. Diese müssen mit den Kosten, die der zeitliche Mehraufwand<br />
verursacht, welcher durch die Arbeit mit einem Hubwagen entsteht, verglichen werden.<br />
Dabei ist nicht nur die Ladesituation, sondern auch der folgende Zusammenbau relevant.<br />
Ergibt sich beispielsweise die Notwendigkeit eine Ladeverpackung umzusetzen, muss jedes<br />
Mal ein Hubwagen benutzt werden.<br />
Wichtig für die ressourcensparende Ausführung ist, wie Eingangs festgestellt, sich für ein<br />
einziges der möglichen Systeme zu entscheiden.<br />
Um Ladevolumen zu sparen können die einzelnen Elemente aufeinander gestapelt werden.<br />
Ist ein Stapler vorhanden, kann er beim Entladen auch die Bestandteile aus der zweiten<br />
Lage heben, wie beim ‚Cirque de Soleil‘. Wird ein Fahrzeug mit Ladebordwand verwendet,<br />
kann diese Funktion auch ein kleiner mitgeführter elektronischer Handstapler 153 erfüllen,<br />
welcher ebenfalls zur Distribution der Ausstellungselemente im Center verwendet wird.<br />
Bei einer vorhandenen Rampe geschieht das Gleiche.<br />
153 umgangssprachlich ‚Ameise‘, Nutzlast etwa 1000 kg<br />
80
Im Sinne einer schnellen und unkomplizierten Handhabung sind Cases für Kleinmaterial-<br />
ien und Kisten für große unförmige Materialien, wie in Abbildung 3-11 empfehlenswert.<br />
Auch Dollies, wie sie bei ‚Cirque de Soleil‘ verwendet werden, schützen das Transportgut<br />
und erleichtern die Handhabung und die Entnahme der Einzelteile. Ebenso ermöglichen<br />
Transporthilfen, wie die Räder an den Traversen, sicheres Arbeiten.<br />
Wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben, wurde per Fragebogen ermittelt, dass die Gegebenheiten<br />
in den Ladehöfen der einzelnen Center sehr unterschiedlich sind. Deshalb wird empfohlen,<br />
eine mobile Ladeüberbrückung mit zuführen, um eventuelle Stufen leicht überbauen zu<br />
können. Sollte die Ladebrücke zu einer festen Rampe hin entladen werden müssen, kann<br />
der Höhenunterschied so ausgeglichen werden. Bei einer Ladebrückenhöhe von 1,10 m,<br />
einer Rampenhöhe von 1,03 m bis 1,60 m und einer Länge der Laderampe von 4 m ist die<br />
maximale Steigung von 7,1° oder 12,5 %. Diese Steigung kann durchaus mit einem Hubwagen<br />
bedient werden. Darüber hinaus muss erwähnt werden, dass das Zugfahrzeug seine<br />
Höhe variieren kann, um die Ladebrücke aufzunehmen und abzustellen. Im geringen Umfang<br />
kann hier auch eine Anpassung erfolgen.<br />
Eine effiziente Ladungssicherung erfolgt durch formschlüssiges Laden. Dafür müssen alle<br />
Bestandteile bestimmte Normmaße aufweisen und mit einheitlichen Pufferebenen, die sich<br />
alle auf gleicher Höhe befinden, ausgestattet sein. Es empfiehlt sich auch Verpackung und<br />
Ladehilfsmittel zu vereinen, wie in Kapitel 3.3.4f ausführlich beschrieben. Da immer das<br />
gleiche Gut transportiert wird, ist Flexibilität hier nicht erforderlich. Für die Breite der<br />
Ladeverpackungen bieten sich die gemeinsamen Teiler der LKW-Breite von 2,40 m an.<br />
Dies sind: 0,60 m, 0,80 m und 1,20 m. Industriell gefertigte Systeme, wie Cases oder<br />
Paletten, weisen meist die gleichen Maße auf und sind somit kompatibel. Von Ladeverpackungseinheiten<br />
mit 2,40 m Breite sollte abgesehen werden, denn die Zargen der Ladetüren<br />
weisen ein kleineres lichtes Maß auf als der LKW.<br />
Sehr sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch die Idee, die Transporteinheit als Ausstellungsarchitektur<br />
zu verwenden, wie bei der ‚Deutschland-Tour‘ gesehen. Dieser Ansatz<br />
sollte weiterverfolgt und dessen volles Potenzial ausgelotet werden.<br />
Die Beschriftung der Elemente und der dazugehörigen Ladeverpackung muss eindeutig<br />
und klar sein. Jedes Bauteil muss seinen Platz haben. Eine zeitraubende Suche nach dem<br />
richtigen Medium darf nicht entstehen. Dies geht einher mit der genauen und einheitlichen<br />
Positionierung der Ladeeinheiten im LKW. Welch großen Einfluss dieses Vorgehen auf<br />
Zeit- und Arbeitskapazitäten hat, hat die Recherche beim ‚Cirque de Soleil‘ eindrucksvoll<br />
gezeigt.<br />
81
Ebenfalls wird empfohlen, die bei dieser Veranstaltung mustergültig gelöste Verwendung<br />
von Werkzeug, analog zu planen. Lediglich ein einheitliches Werkzeug soll für den Aufund<br />
Abbau zur Anwendung kommen. Die Simplizifizierung von Bauteilen und Anwendungen,<br />
zum Beispiel das Arretieren von Bauteilen mit einem selbstsichernden Bolzen, wie<br />
bei den modulboxen in Schwerin, erleichtert das Handling erheblich und sparen Zeit.<br />
Ebenso die Zwischenlagerung von Hilfsmitteln, wie im Falle der Anschlagmittel im<br />
‚Traversensack‘, auch dieser Ansatz sollte unbedingt weiterverfolgt werden. Gleiches gilt<br />
für die schon vormontierten Spanner im Traversenring des Schirmes bei der ‚Deutschland-Tour‘,<br />
dieser Anwendung liegt ein ähnliches Konzept zugrunde.<br />
Weiterhin ist das Zusammenstellen von uniformierten Einheiten für den Schutz der jeweiligen<br />
Güter sinnvoll, dies kann zum Beispiel geschehen durch Schutzmaßnahmen wie die<br />
Holzzwischenlagen zwischen den Traversen bei der ‚Deutschland-Tour‘oder die Kunststofflagen<br />
zwischen den Bodenplatten bei ‚Cirque de Soilei‘.<br />
Ein hoher Systematisierungsgrad und damit eine einfache, effiziente Arbeitsweise wird<br />
durch die Verwendung von fest eingebauten und baugleichen Displays und AV-Zuspielern<br />
erreicht, deren Vorteile wurden ausführlich in Kapitel 3.2.2 erläutert, eine beispielhafte<br />
Ausführung war ansatzweise in ‚Unser Wetter‘ zu sehen. Auch für die Stromverkabelung<br />
gilt: Wird diese in Form von Kabelbäumen vorkonfektioniert bereit gehalten, verringert<br />
sich der Arbeitsaufwand zeitlich wie personell erheblich, dies wurde im Kapitel 3.2.4f eingehend<br />
betrachtet.<br />
Für die Datenverkabelung gilt dies analog. Zudem müssen die verwendeten Steckverbinder<br />
so ausgelegt sein, dass ein Vertauschen nicht möglich ist. Bei großen Längen muss auf die<br />
Qualität der Kabel geachtet werden, damit keine Bild- oder Tonstörungen entstehen.<br />
Bei der Beleuchtung der Ausstellung kann nicht auf die Lichtsituation im Center aufgebaut<br />
werden. Deshalb sollte die Zusammenstellung der Beleuchtungselemente autark erfolgen,<br />
um ein immer gleich bleibendes Beleuchtungschema generieren zu können. Gleichzeitig ist<br />
es aber zweckmäßig, ein mit dem Center kompatibles System zu verwenden, um dadurch<br />
interaktiv die Beleuchtungssituation zu ergänzen. Alle Scheinwerfer müssen mitgeführt<br />
werden, da nicht sichergestellt werden kann, dass die jeweiligen Center Beleuchtungskörper<br />
haben. Die Entsorgungsproblematik sollte immer unter der Prämisse der Müllvermeidung<br />
behandelt werden. Auf wieder verwendbare Verpackungen und reversible Verbindungen<br />
sind bei der Planung zu berücksichtigen.<br />
Nur eine ganzheitliche Betrachtung aller Elemente, beginnend bei der Dramaturgie, der<br />
Konzeption, der Planung, über die Herstellung der Ausstellungsarchitektur, den Einsatz<br />
82
der Medien, die Stromverkabelung, die interne und externe Logistik bis hin zur Betrachtung<br />
der Lagerung, ermöglichen ein, wie im Titel gefordert, ressourcenschonendes<br />
Arbeiten und führen, wie an vielen Beispielen in dieser Arbeit erläutert, zu neuen<br />
effizienten Lösungen.<br />
Besonders interessant sind dabei neue unkonventionell anmutende Ideen wie der<br />
‚Traversensack‘. Diese Idee ist deutlich außerhalb der klassischen Packphilosophie<br />
entstanden durch die ganzheitliche Betrachtung der involvierten Arbeitsprozesse<br />
und ist deshalb hocheffizient.<br />
83
Literaturverzeichnis<br />
561/2006 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments<br />
und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter<br />
Sozialvorschriften im Straßenverkehr<br />
Ihde 2001 IHDE, Gösta B.: Transport, Verkehr, Logistik : gesamtwirtschaftliche<br />
Aspekte und einzelwirtschaftliche Handhabung. München : Vahlen, 2001<br />
Aberle 1997 ABERLE, Gerd: Transportwirtschaft : einzelwirtschaftliche und<br />
gesamtwirtschaftliche Grundlagen. München : Oldenbourg, 1997<br />
AMF 2010 AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG:<br />
URL: http://www.amf.de/de/home/ dann im Online-Katalog<br />
nach Art. Nr: ‚6848H‘ suchen. (08.August 2010)<br />
Auer 2010 AUER PACKAGING GmbH: URL:<br />
http://www.auer-packaging.de/de/bigboxenbbg1208r_6_145.html<br />
(01. August 2010)<br />
Balin 2007 BALIN, Boris: Eigenschaften von elektrischen Leitungen. Berlin,<br />
Technische Fachhochschule, FB VIII, Skript zur Vorlesung<br />
Kommunikationstechnik, 08. November 2007<br />
Balin 2010 BALIN, Boris: Transport von Medientechnik : Telefoninterview. Berlin,<br />
01. September 2010 (Anlage C 1)<br />
Beier 2010 BEIER, Ruudi; id3d-berlin GmbH: Vorgaben der Ausstellung ‚Der<br />
Mars – Vision und Mission‘ : Gespräch. Berlin, 27. September 2010<br />
(Anlage A 1)<br />
BGI 852 VEREINIGUNG DER METALL-BERUFSGENOSSENSCHAFTEN:<br />
Berufsgenossenschaftliche Informationen 852 : Sicherheit und<br />
Gesundheitsschutz bei Transport- und Lagerarbeiten. Köln : Carl<br />
Heymanns, 2007<br />
BGV A 3 VERWALTUNGS-BERUFSGENOSSENSCHAFT: Berufsgenossenschaftliche<br />
Vorschrift A 3: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Köln : Carl<br />
Heymanns, 2005<br />
Bidder 2010 BIDDER, Benjamin: Die Regel des Mannes. In: DER SPIEGEL, 2010,<br />
Ausgabe 22<br />
X
Bosch Rexroth 2010 BOSCH REXROTH AG: Mechanik-Grundelemente :<br />
Aluminium-Profilbaukasten mit über 100 verschiedenen Strebenprofilen .<br />
URL: http://www.boschrexroth.com/business_units<br />
/brl/de/produkte/mge/index.jsp (15. September 2010)<br />
Bühner 2005 BÜHNER, Rolf: Personalmanagement. München : Oldenbourg, 2005<br />
Bundesregierung 2010 PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER BUNDESREGIERUNG:<br />
Deutschland Tour. URL: http://www.bundesregierung.de/Webs<br />
/Breg /mauerfall/DE/Deutschland-Tour/deutschland-tour.html<br />
(15. September 2010)<br />
Cirque de Soleil 2010 URL: http://rojotirandoanegro.files.wordpress.com<br />
/2010/01/dscn2353.jpg<br />
DIN 13051 Norm DIN 13051 Juni 2003. Grundlagen der Instandhaltung<br />
DIN 33402-2 Norm DIN 33402 Teil 2 Dezember 2005. Ergonomie : Körpermaße<br />
des Menschen : Werte<br />
DIN EN 284 Norm DIN EN 284 Januar 2007. Wechselbehälter : Nicht stapelbare<br />
Wechselbehälter der Klasse C : Maße und allgemeine Anforderungen.<br />
DIN EN ISO 9000 Norm DIN EN ISO 9000 Dezember 2005. Qualitätsmanagement :<br />
Grundlagen und Begriffe<br />
DIN VDE 0100-410 Norm DIN VDE 0100-410 Juli 2007. Errichten von<br />
Niederspannungsanlagen<br />
ECE 2010 ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG: URL:<br />
http://www.ece.com/de/geschaeftsfelder/shopping/faktenstattvo<br />
rurteile (24. August 2010)<br />
Gottwald 2010 GOTTWALD, Dirk: Transport von Medientechnik : Telefoninterview.<br />
Berlin/Mainz, 01. September 2010 (Anlage C 3)<br />
DIN 55402-1 Norm DIN 55402-1 April 1988. Markierung für den Versand von<br />
Packstücken; Bildzeichen für die Handhabungsmarkierung<br />
Großmann 2007 GROßMANN, Gerhard; KAßMANN, Monika: Transportsichere<br />
Verpackungen und Ladungssicherung : Ratgeber für Verpacker, Verlader<br />
und Transporteure. Renningen : expert, 2007<br />
XI
Harting 2010 HARTING KGaA: Industrie-Steckverbinder (Han®).<br />
URL: http://www.harting-connectivity-networks.de/<br />
harting_shared/php/popup.php?src=/imperia/md/images/lg/har<br />
tingconnectivitynetworks/products/industrialconnectors/steckver<br />
binder_700_500x325.jpg&base=L2Nu&width=&height<br />
(27. Oktober 2010)<br />
Hauck 2010 HAUCK, Harry; id3d-berlin GmbH: Personalbedarf und<br />
Personalzusammensetzung : Interview. Berlin, 11. August 2010<br />
(Anhang B 3)<br />
Holtbrügge 2007 HOLTBRÜGGE, Dirk: Personalmanagement. Berlin : Springer 2007<br />
HWK 2010 HANDWERKSKAMMER WIESBADEN: Gewährleistungsfriste : im<br />
Werkvertrags- und Kaufrecht nach dem neuen Schuldrecht. Wiesbaden :<br />
27. April 2010<br />
id3d-berlin 2009 ID3D-BERLIN THEMENGESTALTUNG: Der Mars: Vision und Mission :<br />
Eine interaktive Ausstellung für alle Marsastronauten ab vier Jahren.<br />
Grundkonzept zur Ausstellung mit Änderungen, 4. August 2009<br />
(Anhang H)<br />
Ihde 1991 IHDE, Gösta: Transport, Verkehr, Logistik : gesamtwirtschaftliche Aspekte<br />
und einzelwirtschaftliche Handhabung. München : Vahlen, 1991<br />
Immer 1953 IMMER, John R: Materials Handling. New York : McGraw-Hill, 1953<br />
ISO 668 Norm DIN ISO 668 Oktober 1999. Series 1 freight containers :<br />
classification, dimensions and ratings<br />
Klaus 2006 KLAUS, Ludger: Gesetzliche Grundlagen und Kommentare für<br />
Veranstaltungstechniker und Veranstaltungsmanager : Ein Leitfaden.<br />
Berlin, Technische Fachhochschule Berlin, Fachbereich VIII,<br />
<strong>Masterarbeit</strong>, 2006<br />
Krämer 2010 KRÄMER, Ina: Transport von Medientechnik : Telefoninterview.<br />
Berlin/Groß-Gerau, 01. September 2010 (Anlage C 2)<br />
Lager 7 2010 Lager 7. URL: http://lager7.eu/lagerung/containerstellplatz.html<br />
(23. August 2010)<br />
Logipack 2010a LOGIPACK SERVICE GMBH: URL: http://www.logipack.com<br />
/Systemdienstleistungen.html (01. August 2010)<br />
Logipack 2010b LOGIPACK SERVICE GMBH: URL: http://www.logipack.com<br />
/Nachhaltigkeit.html (01. August 2010)<br />
XII
Martin 2000 MARTIN, Heinrich: Transport und Lagerlogistik : Planung, Aufbau und<br />
Steuerung von Transport- und Lagersystemen. Braunschweig : Vieweg,<br />
2000<br />
Modulbox 2010 MODULBOX MO SYSTEME GMBH & CO. KG: modulbox. URL:<br />
http://modulbox.de/mo/1-0-home.html (15. September 2010)<br />
Möhler 2010 MÖHLER, Jens; Dekra e.V.: Containersicherheit : Telefongespräch. Berlin,<br />
14. Juli 2010 (Anlage D 1)<br />
MVkVO Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten :<br />
Muster-Verkaufsstättenverordnung. Erarbeitet von der ARGEBAU.<br />
Fassung vom September 1995<br />
MVStättV Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten :<br />
Muster-Versammlungsstättenverordnung. Erarbeitet von der<br />
ARGEBAU. Fassung vom Juni 2005.<br />
NASA 2010 NASA (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION):<br />
Phoenix Mars Lander : Exploring the Arctic Plain of Mars. URL:<br />
http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/mission/index.ht<br />
ml (05. August 2010)<br />
Neutrik 2010 NEUTRIK VERTRIEBS GMBH: etherCON Kabelsteckerschutz.<br />
URL: http://www.neutrik.com/de/de/audio<br />
/210_1911936599/NE8MC-1_detail.aspx (6. Oktober 2010)<br />
Nicolai 2006 NICOLAI, Christina: Personalmanagement. Stuttgart : Lucius & Lucius,<br />
2006<br />
Nolte 1998 NOLTE, Heike; BERGMANN, Rainer: Ein Grundmodell des<br />
ressourcenorientierten Ansatzes der Unternehmensführung. In: NOLTE,<br />
Heike (Hrsg.): Aspekte ressourcenorientierter Unternehmensführung.<br />
München : Hampp , 1998<br />
Octanorm 2010 OCTANORM-VERTRIEBS-GMBH: Stützen. URL:<br />
http://www.octanorm.de/Pages/Products/ProductFamily.aspx?pf<br />
id=1&lnt=Messebausysteme (4. Oktober 2010)<br />
Penrose 1995 PENROSE, Edith: The theory of the growth of the firm. Oxford : Oxford<br />
Press, 1995<br />
XIII
Popp 2002 POPP, Monika: Innenstadtnahe Einkaufszentren : Besucherverhalten<br />
zwischen neuen und traditionellen Einzelhandelsstandorten. Passau : L.I.S,<br />
2002<br />
Raschke 1994 RASCHKE, Christoph: Wettbewerbsvorteile durch Kernkompetenzen : Ein<br />
ressourcenorientierter Ansatz. Wiesbaden : Deutscher<br />
Universitäts-Verlag, Gabler, 1994<br />
Rennie 2010a RENNIE, Christian: Informationsportal Ladungssicherung. Bild-URL:<br />
http://www.christian-rennie.de/100_0303.JPG (08. August 2010)<br />
Rennie 2010b RENNIE, Christian: Informationsportal Ladungssicherung. Bild-URL:<br />
http://www.christian-rennie.de/HPIM0153.JPG (08. August<br />
Sakschewski 2010 SAKSCHEWSKI, Thomas: Personalbedarf und Personalzusammensetzug :<br />
Interview. Berlin, 14. September 2010 (Anhang B 1)<br />
Strauch 2010 STRAUCH, Winfried: Sicherung der Ware im Container. In:<br />
GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT<br />
e.V.: Containerhandbuch. URL: http://www.containerhandbuch.de<br />
/chb/stra/index.html (04. August 2010)<br />
[Anmerkung des Verfassers: Die online-Version des<br />
Containerhandbuches entspricht vollends der gedruckten Version;<br />
die Seitenzahlen können nicht angegeben werden, lediglich die<br />
Kapitel]<br />
StVO Straßenverkehrs-Ordnung. Fassung vom 01.September 2009, zuletzt<br />
geändert durch sechsundvierzigste Verordnung zur Änderung<br />
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 5. August 2009,<br />
BGBl. I Nr. 52 S. 2631<br />
Taylor 1913 TAYLOR, Frederick Winslow: Die Grundsätze wissenschaftlicher<br />
Betriebsführung (The Principles of Scientific Management). München :<br />
Oldenbourg, 1913<br />
Telekom 2010 TELEKOM DEUTSCHLAND GmbH: Funkversorgung im Inland.<br />
URL: http://www.t-mobile.de/funkversorgung<br />
/inland/0,12418,15400-_,00.html (12.06.2010)<br />
XIV
Tiedemann 1995 TIEDEMANN, Karlheinz: Gesundheitliche Aspekte beim Heben und<br />
Tragen. In: Bullinger, Hans-Jörg (Hrsg.): Manuelle Handhabung von<br />
Lasten. Stuttgart : IRB, 1995, Seiten 25 bis 32<br />
Waclaw 2010 WACLAW: Begehung der Potsdamer Platz Arkaden : Gespräch. Berlin,<br />
4. Oktober 2010 (Anlage A 2)<br />
Weimer 2010 WEIMER, Bernd; Käferstein GmbH: Produktion, Logistik, Personal :<br />
Interview. Fürth, 18. August 2010 (Anhang B 2)<br />
Wernheim 2007 WERNHEIM, Jan: Shopping Malls, eine Hinführung. In: WERNHEIM,<br />
Jan: Shopping Malls : Interdisziplinäre Betrachtungen einen neuen Raumtyps.<br />
Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007<br />
Wittlage 1995 WITTLAGE, Helmut: Personalbedarfsermittlung. München :<br />
Oldenbourg, 1995<br />
Alle nicht beschrifteten Bilder stammen vom Autor!<br />
XV
A Anhang Gesprächsprotokoll Vorgaben<br />
A 1 Ruudi Beier<br />
zur Person Ruudi Beier ist geschäftsführender Gesellschafter von id3d-berlin<br />
GmbH. Er beantwortete grundlegende Fragen.<br />
Thema Vorgaben der Ausstellung ‚Der Mars – Vision und Mission‘<br />
Datum 27. September 2010<br />
Zeit 12:00 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Im Gespräch wurden grundlegende dramaturgischen, gestalterischen oder technischen<br />
Vorgaben zu erörtert:<br />
1. Boden<br />
Der Boden erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Er hebt die Ausstellung von der<br />
Fußbodenebene des Centers ab und schafft so einen eigenen Raum. Er nimmt Aufbauten<br />
jedweder Art auf und schützt sie gegen umfallen, verschieben, ändern und Diebstahl. In<br />
seiner Dicke von 4 cm ist die gesamte Verkabelung vorgesehen. Seine modulare Bauweise<br />
von 0,5 × 0,5 m soll eine einfache Anpassung an die verschiedenen Gegebenheiten der<br />
Center ermöglichen. Eine Behindertenrampe ist vorgesehen.<br />
2. Aufbauten<br />
Es sind keine Materialien als Informationsträger geplant, somit ist diese Frage offen. Die<br />
Größen der Aufbauten richten sich nach dem vom Boden vorgegebenen Raster und nach<br />
der maximal möglichen Bauhöhe von 2,50 m.<br />
3. Grafik<br />
Es werden vollflächige Grafiken gewünscht, nicht nur einzelne punktuelle Grafiken. Diese<br />
müssen geschützt werden gegen zerkratzen und Vandalismus. Hier sind besonders<br />
Schmierereien mit wasserfesten Markern (Edding) zu beachten.<br />
Auch ist denkbar eine auf Stoff gedruckte Grafik, welche dann über Kederschiene<br />
angebracht wird ist denkbar. Auch eine grafische Gestaltung des Bodens ist vorgesehen.<br />
4. Hands-Ons<br />
Die Ausführung der Hands-On-Exponate sollte sich in das Erscheinungsbild der restlichen<br />
Ausstellung eingliedern. Für die einfache Ausführung müssen technische Gegebenheiten<br />
XVI
und Schnittstellen zu andern Gewerken besonders beachtet werden, wie Abmaße,<br />
Oberflächenbeschaffenheit, Farbtöne et cetera ist zu achten. Eine einfache<br />
Revisionierbarkteit und Reparatur muss sichergestellt werden.<br />
5. Medien<br />
Der Medieneinsatz ist sehr unterschiedlich zu handhaben. Je nach Anwendung wird es<br />
verschiedene Anforderungen geben.<br />
Es ist jedoch möglich, dass nur ein diskretes Spektrum an Geräten verwendet wird, um die<br />
Kompatibilität zueinander, eine Nachbestellung und den Austausch zu erleichtern.<br />
6. Licht<br />
Keinerlei Vorgaben werden zu diesem Zeitpunkt gemacht. Lediglich auf Einheitlichkeit<br />
und Wartungarmut wird Wert gelegt!<br />
6. Allgemein<br />
Für eine reibungslose Umsetzung muss die Zusammenarbeit verschiedener Gewerke<br />
gesteuert werden. Hierzu müssen einheitliche Standards definiert und Schnittstellen klar<br />
beschrieben und abgegrenzt werden.<br />
Ebenso müssen mögliche Gewährleistungsansprüche von ECE gegenüber id3d-berlin, aber<br />
auch gleichermaßen die von id3d-berlin gegenüber den beauftragten Subunternehmern.<br />
Damit die Ausstellung problemlos durchgeführt werden kann sind Dokumentationen,<br />
Wartungs- und Instandhaltungsanweisungen und Inbetriebnahmeanweisungen in<br />
schriftlicher Form notwendig. Diese können strukturell nach einem vordefinierten<br />
Formular geschrieben werden um die geforderte Strukturierung zu erreichen.<br />
Eine Dokumentation mit Fotos ist sehr wünschenswert!<br />
XVII
A 2 Peter Waclaw<br />
zur Person Peter Waclaw führte bei der Ortsbegehung der Potsdamer Platz<br />
Arcaden durch das Center. Er ist verantwortlich für die Haustechnik<br />
Thema Technische und logistische Möglichkeiten in den Potsdamer Platz<br />
Aracaden<br />
Datum 4. Oktober 2010<br />
Zeit 10:00 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Der Begriff „Betrieb“ wie er in der VkVO verwendet wird, beinhaltet lediglich die Zeit der<br />
Kernöffnungszeichen der Geschäfte im Center. Somit wird in der nächtlichen Aufbauzeit<br />
keine geforderte verantwortliche Person anwesend sein, lediglich ein Wachdienst.<br />
Detailabsprachen müssen vorher getätigt werden, wer Wachdienst kann sie nicht geben.<br />
Das Center ist 24 Stunden offen, mit Publikumsverkehr ist die ganze Zeit zu rechnen.<br />
Die Ladesituation im Center ist sehr gut. Neben einer nivellierbaren Rampe sind breite<br />
Wege und ausreichend dimensionierte Lifte vorhanden. Während der Nachtstunden kann<br />
der LKW stehen bleiben.<br />
Die Decke weist keine Hängepunkte auf, Hängungen können bei den hauseigenen<br />
Dekorateuren beauftragt werden. Diese haben Erfahrung mit den Gegebenheiten und<br />
können die Arbeit schnell ausführen.<br />
Das Hängen der Mobiles muss genau besprochen werden. Durch Linearrauchmelder sind<br />
die Positionen eingeschränkt. Unsichtbare Strahlen leuchten von der einen auf die andere<br />
Seite der Ladenstraße. Werden sie durchbrochen löst der Alarm aus. Drehende Mobiles<br />
können in den Lichtstrahl gelangen und Probleme verursachen.<br />
XVIII
XIX
B Anhang Gesprächsprotokolle Personal<br />
B 1 Thomas Sakschewski<br />
zur Person Thomas Sakschewski hat etliche Ausstellungsprojekte als Projektleiter<br />
realisiert. Darüber hinaus hat er einen Lehrauftrag für das Fach<br />
‚Veranstaltungsmanagement‘ und ebenfalls einen Forschungsauftrag<br />
der Beuth Hochschule für Technik. Hier erforscht er die praxisnahe<br />
Entwicklung von Werkzeugen zur Analyse und Interpretation von<br />
Planungsprozessen als Wissensprozesse und die Einbindung<br />
bestehender Wissensnetzwerke in die Projektsteuerung.<br />
Thema Personalbedarfsplanung und Personalzusammensetzung<br />
Datum 14. September 2010<br />
Zeit 10:00 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Die Thematik des Personalbedarfs und der Personalzusammensetzung ist äußerst<br />
schwierig, da hierfür kein Modell herangezogen werden kann. Um verwendbare<br />
Kennzahlen zu schaffen, können lediglich Schätzungen aufgrund vergangener Projekte<br />
gemacht werden. Um Schätzungen und keine Mutmaßungen zu machen, müssen hierfür<br />
Experten zu Rate gezogen werden, welche Einsicht und Kenntnis der jeweiligen Sachlage<br />
besitzen. Diese können intern aber auch extern sein.<br />
Aus diesen Schätzungen ermittelte Kennzahlen werden dann wiederum in monetären oder<br />
zeitlichen Aufwand umgerechnet. Betrachtungsfaktoren können das gegebene Zeitfenster,<br />
die Anzahl der Exponate/Aufbauten, die Komplexität oder Einfachheit des Aufbaus, die<br />
centerinterne Logistik et cetera.<br />
Zur Vereinfachung der Schätzung bietet sich die so genannte Analogiemethode an, die<br />
vergleichbare Aufgaben beziehungsweise Vorgaben aussucht und Überlegungen anstellt,<br />
welche Unterschiede dazu bestehen. Die Vereinfachung besteht darin, nicht mehr alle<br />
Faktoren einzeln abschätzen zu müssen, sondern lediglich die Abweichungen wie zum<br />
Beispiel die Anzahl der Exponate bei ungefähr gleichem Aufwand zur Installation, was sich<br />
bei Flachware also Bilder oder Grafiken anbietet oder die größere Beanspruchung durch<br />
höhere Besucherfrequenz bei Hands-On-Exponate zur Abschätzung eines Konstruktionsund<br />
Materialaufwands.<br />
XX
Theoretisch ist eine 100%ige Informationsvermittlung an Hilfskräfte und somit eine<br />
Ausführung ohne qualifiziertes Personal möglich. Jedoch ist hier zu bedenken, dass die<br />
Aufarbeitung der Information in Handbücher, Arbeitsanweisungen und<br />
Handhabungsregeln ebenso wie die Herstellung unkomplizierter und klarer Bauteile sehr<br />
aufwendig und somit von wirtschaftlicher Seite gesehen nicht sinnvoll erscheint.<br />
Auch entsteht ein enormer zeitlicher Mehraufwand, da die ausführenden Mitarbeiter sich<br />
erst in die Handbücher einlesen, den Aufbau ‚üben‘, ihre geleistete Arbeit überprüfen und<br />
zur Not ausbessern müssen.<br />
Weiterhin muss der Mehraufwand für eine qualifizierte Arbeitskraft gegenüber einer<br />
Hilfskraft ermittelt werden. Nähern sich die Werte entsteht keinerlei Mehrwert mit<br />
Hilfskräften zu arbeiten.<br />
Die Empfehlung ist eine Mischung der Arbeitsleistung von qualifizierten Mitarbeitern und<br />
Hilfsarbeitern (Stagehands) zu verwenden. Empfohlen wird ebenfalls die jeweiligen<br />
Mitarbeiter durch Werkverträge über die gesamte Tourneedauer an das Unternehmen zu<br />
binden, da hierdurch eine Verlässlichkeit und monetäre Sicherheit für das Unternehmen<br />
und den Mitarbeiter entstehen. Verantwortung wird auf den Mitarbeiter übertragen und<br />
dieser hierdurch motiviert.<br />
Bei erfolgreich und vorzeitig abgeschlossener Arbeit bei den ersten Spielorten kann man<br />
bei den folgenden Mitarbeiter kürzen. Jedoch entsteht hieraus ein Vertrauensproblem der<br />
Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, eine Kürzung wird niemals positiv<br />
aufgenommen. Auch eine monetäre Aufwertung der übrig bleibenden Mitarbeiter bringt<br />
nicht den gewünschten Erfolg, das Vertrauensproblem bleibt.<br />
Um Interessenskonflikte und Motivationsverluste einzugrenzen, wäre die Strategie eines<br />
quasi ‚Job Enrichments’ denkbar. Da es sich bei dieser Ausstellung um eine sehr lange<br />
Zeiträume handelt, wird es kaum möglich sein Mitarbeiter für den ganzen Zeitraum zu<br />
binden. Auch aufgrund von Krankheit oder Urlaub werden Mitarbeiter ausfallen.<br />
Diese Vorgaben ermöglichen Folgendes (die Zahlen sind rein fiktiv und sollen nur als<br />
Anhaltspunkt verstanden werden):<br />
Man ermittelt für den Aufbau der Ausstellung fünf feste qualifizierte Mitarbeiter, die das<br />
Projekt langfristig betreuen und drei Hilfskräfte.<br />
XXI
Nun bucht man für den ersten Spielort vier qualifizierte Mitarbeiter, welche beispielsweise<br />
den Probeaufbau betreut haben. Hinzu kommt eine ‚auszubildender qualifizierter<br />
Mitarbeiter‘ und drei Hilfskräfte.<br />
Dieser ‚Auszubildende‘ kompensiert dann im weiteren Verlauf den möglichen Wegfall<br />
eines Mitarbeiters bei dritten Spielort. Ein neuer ‚Auszubildender‘ kommt hinzu. Durch<br />
dieses Rotationsprinzip ergibt sich eine Dynamik innerhalb des Teams und die<br />
Kommunikation einer Kürzung ist einfacher umzusetzen. Auch werden Mitarbeiter durch<br />
Wissensweitergabe motiviert. Es entsteht ein ‚Meister- und Schüler Verhältnis‘, was<br />
ebenfalls Unterforderung entgegenwirkt.<br />
Auch hat man nach einiger Zeit einen qualifizierten Mitarbeiterpool geschaffen, auf den<br />
man zurückgreifen kann, um Kapazitätsschwankungen auszugleichen.<br />
XXII
B 2 Bernd Weimer<br />
zur Person Bernd Weimer ist Geschäftsführer der Käferstein GmbH und hat die<br />
Ausstellung ‚Der Mars – Vision und Mission‘ mitentwickelt. Käferstein<br />
GmbH bedient große Teile der TV- und Messebranche.<br />
Thema Produktion, Logistik, Personal<br />
Datum 12. August 2010<br />
Zeit 15:00 Uhr – 17.00 Uhr<br />
Ort Fürth<br />
1. Personalbedarf<br />
Die Ermittlung des Personalbedarfs kann mit einem Versuch oder Modell ermittelt werden,<br />
jedoch ist es schwierig verlässliche Werte zu erhalten. Die Situation im Büro oder im Lager<br />
ist immer eine andere als auf der Baustelle: die Tageszeit, die Unbefangenheit der<br />
Testpersonen und der psychische Druck des Fertigwerdens entfallen.<br />
Besonderes zu beachten hierbei sind die äußeren Umstände des Nachtarbeit. Die<br />
Leistungsfähigkeit von Menschen geringer als tagsüber, ebenso ist die Größe und die<br />
langen Wege nicht zu unterschätzen.<br />
Eine nicht ‚standardmäßige‘ Anforderung benötigt eine exakte Planung hier müssen sich<br />
die involierten Verantwortlichen aus Gestaltung, Konstruktion, Produktion und Montage<br />
besprechen und einen möglichst für alle Seiten komfortablen Lösungsansatz erarbeiten aus<br />
dem hervorgeht:<br />
> Was ist der Bedarf an Material und Qualität<br />
> Wie soll gefertigt werden (Verbindungen, Materialien, Einweg- oder Mehrwegeinsatz)<br />
> Wie soll transportiert werden ?<br />
> Wie soll montiert werden, besonders bedacht wird der Anspruch an Qualität und<br />
Quantität des Montageteams?<br />
Des Weiteren spielen natürlich auch Erfahrungswerte mit in die Bewertung ein, wie zum<br />
Beispiel das Verhalten der verschieden Materialien bei unterschiedlichen Anforderungen,<br />
die Handhabungserfahrung mit Personal und Logistik und mögliche<br />
Produktionsschwerpunkte bei Lieferanten und der Eigenleistung. Erst nach Beurteilung der<br />
einzelnen Positionen, welche von Projekt zu Projekt unterschiedlich Gewichtet sein<br />
können, ist eine abschließende Aufwandsbeurteilung sinnvoll und qualitativ möglich.<br />
XXIII
Es ergibt sich eine Kombination aus verlässlich berechenbaren Größen (Transport und<br />
Wegezeiten, bekannte Montagezeiten) und den Erfahrungswerten der verschiedenen<br />
Kompetenzträger. Je nach Projektanspruch und erreichter Beurteilungsqualität muss dann<br />
noch mit einem individuellen Sicherheitsfaktor gerechnet werden.<br />
Erfahrungsgemäß zahlt man bei einem Projektart, welches in Art, Umfang oder Qualität<br />
noch nicht bearbeitet wurde, meist Lehrgeld. Zusammenfassend kann man sagen: Je<br />
qualifizierter die Kompetenzträger, desto geringer das Schwankungsbreite.<br />
Beispiel: Fünf Personen aus den verschiedenen Bereichen (Gestaltung, Konstruktion,<br />
Produktion, Logistik/Montage, Kalkulation), werden zur Umsetzung eines Vorhabens<br />
benötigt, dann ergäbe sich folgendes Ressourcen-Schema:<br />
5 qualifizierte Kompetenz-Entscheidungsträger – entsprechen 100 % + x Zielerreichung<br />
4 qualifizierte KT + 1 unerfahrener KT – entspricht 50 % Zielerreichung<br />
3 qualifizierte KT + 2 unerfahrene KT – entspricht 0 % Zielerreichung (blaues Auge)<br />
2 qualifizierte KT + 3 unerfahrene KT – entspicht -50 % Zielerreichung (Verlust sowohl<br />
finanziell als auch Image)<br />
1 qualifizierter KT + 4 unerfahren KT – entspricht –100 % Zielerreichung (schlimmer<br />
Verlust, aber der eine KT hat immer noch die Möglichkeit der Regulierung<br />
0 qualifizierte KT + 5 unerfahren KT – entspricht –100 % - x (absoluter Superqau)<br />
Hilfskräfte weisen unterschiedliche Qualifikation und – viel wichtiger – Motivation auf.<br />
Beides sind Variablen, welche von Spielort zu Spielort variieren.<br />
Mitarbeiter (Facharbeiter und Hilfskräfte) mit einem langjährigen Vertrag zum<br />
Unternehmen oder zum Auftraggeber und einer Bindung zum Projekt sind nicht nur<br />
motivierter, sondern können viel schneller agieren, da die Handgriffe schon einstudiert und<br />
die Bauteile bekannt sind. Das Einweisen entfällt und die Fehlerquote sinkt.<br />
Aber auch objektiv gesehene einfachste Tätigkeiten, wie der Transport eines<br />
Ladecontainers zur richtigen Position können unerwünschte Auswirkungen haben, wenn<br />
sie von einem ungelernten Mitarbeiter ausgeführt werden: Der Container muss nicht nur<br />
zur richtigen Seite der zu bebauenden Ausstellungsfläche, sondern auch mit der Öffnung in<br />
die richtige Richtung zeigen. Eine Nachbesserung verbraucht im weiteren Verlauf des<br />
XXIV
Aufbaus Zeit. Auch steigt das Risiko, dass Werkzeuge, etwa ein Bitsatz, in die falsche Kiste<br />
gelegt werden, was wiederum am nächsten Spielort zu Zeitverzug führt.<br />
Auch der Umgang mit Werkzeugen ist bei den verschiedenen Mitarbeitergruppen ein sehr<br />
unterschiedlicher. Während mit dem Projekt verbundene Mitarbeiter die Eigenarten des<br />
Werkzeugs kennen und auch auf den Zustand achten kann die Einstellung der Hilfskräfte<br />
gleichgültig gegenüber den Hilfsmitteln sein. Verschleiß, aber auch Diebstahl, ist gegeben.<br />
Hier wäre auch die Überlegung, ob man die Leistung der Mitarbeiter mit eigenem<br />
Werkzeug einkauft. Zunächst wird der monetäre Aufwand höher ausfallen, aber eine<br />
Bereitstellung und Wartung von Werkzeug entfällt.<br />
Es ist empfehlenswert, die Zusammensetzung des Bauteams mit einer leitenden Position zu<br />
besetzen, den (beispielhaft) vier Mitarbeitern und einem Techniker für die Inbetriebnahme<br />
der Hands-on Exponate und der Medien. Die Qualifikation der Mitarbeiter sollte sehr breit<br />
gefächert sein. Ein sicherer Umgang mit verschiedensten Materialien (Holz, Metall,<br />
Kunststoffe) und Anwendungen (Elektrotechnik, Lichttechnik, Medientechnik) ist<br />
wünschenswert.<br />
Eine weitere Empfehlung ist eine Dopplung des Teams, sodass bei einem Ausfall oder<br />
einer Umbesetzung sofort kompetentes Personal vorhanden ist. Vor allem unter<br />
Berücksichtigung des langen Spielzeitraums ist dieser Punkt wichtig. Mehrkosten entstehen<br />
hierdurch nicht, es muss lediglich gewährleistet werden, dass die Mitarbeiter angelernt<br />
werden.<br />
Für den Fall, dass man ein Bauteam eingespielt ist und die Leistung innerhalb einer<br />
kürzeren Zeit als der ermittelten erfüllt, ist es ungeschickt die Personenzahl zu kürzen. Das<br />
Motto: ‚Never change a winning team!‘ steht hier metaphorisch! Die Routine und<br />
Motivation der Mitarbeiter kann durch eine Änderung auseinander gebracht werden.<br />
Ein Rotationsprinzip für die Mitarbeiter ist sinnvoll. Bei Ausfall kann man auf einen Pool<br />
zurückgreifen und kommt somit nicht in Engpässe.<br />
2. Produktion<br />
Bei der Herstellung der Ausstellungselemente sind die Merkmale Material und<br />
Standardisierung zu beachten.<br />
XXV
Die Oberflächen der Materialien dürfen nicht lackiert sein sondern pulverbeschichtet.<br />
Anstatt Stahl ist Aluminium zu verwenden. Gehrungen sehen zwar gut aus sind aber in der<br />
Handhabung schwierig.<br />
Vielfältigkeit erhöht den Aufwand. Die Ausstellung darf keine diffizilen Feinheiten<br />
enthalten, wie aufwendige zu montierenden Exponate oder komplizierte gestalterische<br />
Elemente. Diese müssen sich dem Wander-Gedanken untergliedern.<br />
Für die Herstellung der Bauelemente bedarf es einer planmäßigen Herangehensweise. Es<br />
müssen alle Bauteile nach einer immer gleichen Fragestruktur bewertet werden. Jedes<br />
Bauteil wird untersucht nach Material, Oberfläche, Verarbeitung, Gewicht, Montage,<br />
Handhabung, Transport und Wartung.<br />
Beispielhaft wird erst der Boden erfasst, hinterher die Vitrinen, dann das Wegeleitsystem et<br />
cetera.<br />
Eine Systematisierung der einzelnen Teile ist erforderlich um einen kontinuierlichen und<br />
schnellen Arbeitsfluss sicher zu stellen. Knifflige Verbindungselemente und mühsame<br />
Anpassungen an die lokalen Gegebenheiten binden Kapazitäten und müssen vermieden<br />
werden. Jede Systemänderung kostet, gleich ob man es mit Zeit, Geld oder Arbeitskraft<br />
aufrechnet.<br />
3. Logistik<br />
Beim Transport muss auf die Lagermöglichkeit, die Handhabung und die Verpackung<br />
geachtet werden, wobei letzte etwa 50 % (beispielsweise ein Touchscreen) des Wertes des<br />
Transportgutes ausmachen kann! Auch hier ist eine Systematisierung von essentieller<br />
Wichtigkeit.<br />
Bei der Bemessung der Packmaße müssen die Zurrschienen oder die Ladetorzargen<br />
bedacht werden. Von der genormten Nettobreite von 2,40 m empfiehlt es sich etwa<br />
2 × 2,5 cm = 5 cm abzuziehen.<br />
Bei den Einkaufscentern richtet man sich nach den minimal gegebenen Möglichkeiten,<br />
etwa bei der Durchfahrtshöhe von Türen oder bei der Belastbarkeit des Bodens.<br />
Entwickelt man die Teile größer und unterschreitet ein Center die ermittelte Türhöhe,<br />
muss das System geändert werden. Dies bedeutet, wie gesagt, einen erheblichen<br />
Mehraufwand.<br />
Hierbei ist zu beachten, das Transportmittel (Hubwagen) und die Verpackung (Palette)<br />
auch eine gewisse Höhe aufweisen, welche von Bruttohöhe abgezogen werden.<br />
XXVI
Angeregt wird die Verwendung von 7,5 t LKW. Die Vorteile sind die Möglichkeit auch am<br />
Sonntag zu fahren, die weite Verbreitung von Führerscheinen gegenüber den großen LKW,<br />
die hohe Flexibilität, problemlose Zufahrtsmöglichkeiten und eine Ladebordwand (kein<br />
Stapler notwendig). Diese Variante ist auch kostengünstiger, da Mitarbeiter (inclusive ihrem<br />
Werkzeug) nicht separat anreisen müssen, sonder die LKW fahren. Durch langfristige<br />
Anmietverträge von LKW (12 Monate oder von April – Oktober) können auch<br />
werbewirksame Drucke auf den LKW platziert werden. Eine Zwischenlagerung auf den<br />
7,49 t ist problemlos möglich.<br />
Eine reine Wechselbrückenlagerung das ganze Jahr über ist aufgrund der klimatischen<br />
Einflüsse nicht ratsam.<br />
4. Allgemeines<br />
Es ist zwingend erforderlich sich ausführliche perfekte Vorplanung zu der Ausstellung zu<br />
machen und diese mit Experten zu diskutieren, da es sich hier um einen langfristigen<br />
Auftrag handelt. Häufige Nacharbeiten sind nicht nur mühsam sondern auch<br />
kostenintensiv.<br />
Plant man Bauteile sollte man immer nach der minimalen Gegebenheit richten, nach dem<br />
Sprichwort: ‚Eine Kette ist so stark, wie ihr schwächstes Glied!‘<br />
XXVII
B 3 Harry Hauck<br />
zur Person Harry Hauck ist geschäftsführender Gesellschafter von id3d-berlin und<br />
vorwiegend verantwortlich für die Objekteinrichtung in Museen und bei<br />
Ausstellungen.<br />
Thema Personalbedarf und Personalzusammensetzung<br />
Datum 11. August 2010<br />
Zeit 11:00 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Anmerkung: Die im Gespräch genannten Beispiele richten sich an dem Geschäftsbereich<br />
der Objekteinrichtung aus.<br />
Eine Planung sollte immer mit dem Teamleiter oder Projektleiter erfolgen.<br />
Die ersten Spielorte des Projektes können einen Modell- oder Testlaufcharakter haben,<br />
welcher genau beobachtet wird. Dies kann mit einem sprichwörtlichen ‚Sprung ins kalte<br />
Wasser‘ verglichen werden, welcher gewagt werden muss, um neue Arbeitsfelder zu<br />
erschließen. Dies kann, im schlimmsten Fall, mit einem finanziellen Misserfolg verbunden<br />
sein, wobei man aber bei guter Aufarbeitung, daraus einen (Wissens)-Vorteil für zukünftige<br />
Aufträge erhält.<br />
Die Bestimmung des Personalbedarfs und der Personalzusammensetzung erfolgt nach der<br />
zeitlichen Aufwandschätzung. Hierzu müssen die einzelnen Arbeitschritte herunter<br />
gebrochen und jeweils bewertet werden.<br />
Bei der Objekteinrichtung kann das so aussehen:<br />
Gegenstand Beschreibung Einrichtungsdauer<br />
Objekt A kleiner Becher 2 pax h<br />
Objekt B Tuch 20 × 20 × 20 cm 2 pax h<br />
Objekt C Fahrzeug, Originalgröße 10 pax h<br />
Summe 14 pax h<br />
Mit pax h ist die Arbeitsstunde eines Mitarbeiters gemeint.<br />
Der Zeitbedarf der Einrichtungsdauer des einzelnen Objektes ist Erfahrung, die im Laufe<br />
des Berufslebens gesammelt wurde. Die sicherlich vorkommenden Fehleinschätzungen<br />
gleichen sich durch die Vielzahl der einzelnen Arbeitsschritte wieder aus.<br />
XXVIII
Dies bedeutet, dass eine Zeitüberschreitung bei einem Objekt durch eine Unterschreitung<br />
bei einem anderen wieder ausgeglichen wird. Die Summe ergibt somit einen relativ<br />
verlässlichen Wert.<br />
Der Arbeitsverlauf muss konstant überwacht werden, um auf Änderungen reagieren und<br />
Maßnahmen ergreifen zu können.<br />
Es muss weiterer Zeitaufwand eingeplant werden für Besprechung, Einweisung,<br />
Besorgungsfahrten, Wege, kleinere Behinderungen und die Baustelleneinrichtung.<br />
Die Personalzusammensetzung kann man bestimmen, indem man die einzelnen<br />
Arbeitsschritte nach der geforderten Qualifikation bewertet. Nun kann eine<br />
Kategorisierung erfolgen, welche Aufgaben von welcher, wie qualifizierten, Person<br />
durchgeführt kann.<br />
Auch ist es in diesem Zusammenhang wichtig, die Prioritäten festlegen, nach welchen der<br />
Erfolgsgrad des Projektes ermittelt wird. Ganz oben auf der Liste steht die Eröffnung der<br />
Ausstellung. Dies muss immer die allerhöchste Prämisse sein! An nächster Stelle ist die<br />
richtige Positionierung der Objekte. Die dritte Stelle besetzt die schöne und ansehnliche<br />
Arbeitsweise und die letzte Stelle die Sauberkeit.<br />
Für den Fall, das Engpässe bestehen, kann die Liste von hinten gekürzt werden. Etwa wird<br />
der Boden der Ausstellungsfläche bei Zeitknappheit nicht mehr gewischt, sondern nur<br />
gefegt.<br />
Diese Vorgehensweise muss aber immer als Ausnahme gesehen werden.<br />
XXIX
C Anhang Gesprächsprotokolle Medientechnik<br />
C 1 Boris Balin<br />
zur Person Boris Balin ist Dipl.- Tonmeister und Professor für Ton-,<br />
Kommunikations- und Videotechnik an der Beuth Hochschule für<br />
Technik.<br />
Thema Telefoninterview zum Thema Transport von Medientechnik<br />
Datum 01. September 2010<br />
Zeit 11:30 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Die Beschleunigungen und Vibrationen abzuschätzen, die während des Transportes auf die<br />
Medientechnik wirken, ist durchaus schwierig.<br />
Hat man Werte ermittelt, kann man sie mit den Herstellerangaben verglichen. Jedoch nicht<br />
alle Hersteller geben hierfür Maximalwerte an. Eine weitere Recherchemöglichkeiten sind<br />
Ausstatter von Übertragungswagen für Radio- und Fernsehproduktionen. Dort wird<br />
Medientechnik fest in die jeweiligen Wagen eingebaut und über weite Strecken transportiert.<br />
Ein Vergleich zur Ausstellung ist durchaus gegeben.<br />
Probleme mit Temperaturschwankungen sind nicht zu erwarten. Bei schnellen<br />
Temperaturübergängen und möglicher Kondenswasserbildung muss eine ausreichend lange<br />
abgewartet werden, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.<br />
XXX
C 2 Ina Krämer<br />
zur Person Ina Krämer ist Geschäftsführerin des Karosseriewerkes Krämer GmbH,<br />
welches Übertragungs- und Funkwagen ausrüstet.<br />
Thema Telefoninterview zum Thema Transport von Medientechnik<br />
Datum 01. September 2010<br />
Zeit 12:30 Uhr<br />
Ort Berlin, Groß-Gerau<br />
In Übertragungswagen des Rundfunk und Fernsehbereichs wird eine Vielzahl elektronischer<br />
Geräte verbaut und diese über eine lange Zeit bewegt. Es werden verschiedene Fahrzeuge<br />
verwendet: Busse, Sattelauflieger und Kastenwagen mit der vom Hersteller eingebauten<br />
Dämpfung.<br />
Die Medientechnik wir in 19“ Gestelle eingebaut, Mischpulte werden auf Tische montiert,<br />
wie sie in einem festen Studio verwendet werden. Sonderanfertigungen oder besondere<br />
Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.<br />
XXXI
C 3 Dirk Gottwald<br />
zur Person Dirk Gottwald arbeitet bei BFE Studio und Medien Systeme GmbH in<br />
Mainz. BFE stattet Studios aber auch Ü-Wagen mit Medientechnik aus.<br />
Thema Telefoninterview zum Thema Transport von Medientechnik<br />
Datum 02. September 2010<br />
Zeit 16:30 Uhr<br />
Ort Berlin, Mainz<br />
Bei der Konstruktion einer mobilen Anwendung ist viel Bauchgefühl notwendig!<br />
Langjährige Erfahrung hilft, den besten Lösungsweg zu finden.<br />
Ein besonderer Schutz der Medien ist jedoch nicht notwendig. In der<br />
Übertragungswagentechnik werden lediglich teure Tonmischpulte gedämpft befestigt, die<br />
restliche Technik wird fest eingebaut.<br />
Bei der Verwendung von Medien bei der Ausstellung ist folgendes zu beachten: Das<br />
Medium muss fest in den Körper montiert werden, sodass ein Schlagen oder Rütteln<br />
unterbunden wird. Die Architektur hingegen muss während des Transportes so gesichert<br />
sein, dass Stöße der Möbel gegeneinander nicht möglich sind. Dies kann durch eine<br />
ausreichende Ladungssicherung oder Puffer zwischen den einzelnen Möbeln ausgeführt<br />
werden. Möglich sind aufgebrachte Puffer am oberen und unteren Ende des<br />
Ausstellungselementes, die sich gegen das benachbarte Werkstück stützen.<br />
XXXII
D Angang Gesprächsprotokoll Transport<br />
D 1 Jens Möhler<br />
zur Person Jens Möhler ist Prüfingenieur bei der Dekra e.V. und ist zuständig für<br />
die Überprüfung von LKW, Ladebrücken und Containern nach dem<br />
CSCG.<br />
Thema Telefoninterview zum Thema Containersicherheit<br />
Datum 17. August 2010<br />
Zeit 12:30 Uhr<br />
Ort Berlin<br />
Bei der Verwendung von Containern und Ladebrücken im öffentlichen Straßenverkehr<br />
müssen diese, ähnlich wie bei Kraftfahrzeugen, mit einer gewissen Frequenz geprüft<br />
werden. Alle zwei Jahre müssen diese Transportmittel auf den Prüfstand, wobei sie auch im<br />
beladenen Zustand geprüft werden können.<br />
Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa je 100 Euro.<br />
Man sollte die Langzeitmiete für ein solches Projekt nicht ausschlagen. Für Vermieter von<br />
LKW kann es durchaus interessant sein einen LKW bei einer geringen Fahrleistung von<br />
etwa 1000 km (zwei Veranstaltungen zu je 500 km) im Monat günstig zu entleihen. Diese<br />
km-Anzahl liegt nur bei etwa 10 % der durchschnittlich Üblichen. Somit fallen ganz<br />
deutlich Wartungs- und Instandhaltungskosten für den Vermieter. Diesen Vorteil kann er<br />
auch an den Mieter weitergeben. Hier sollte man Preise vergleichen!<br />
Die Verwendung von verschiedenen Transportmitteln wie Binnenschiff und Zug ist<br />
sicherlich problematisch, da dann sehr oft ein neuer LKW oder eine Zugmaschine<br />
angemietet werden muss. Oft muss diese dann wieder an den Ursprungsort zurückgebracht<br />
werden, was die sich ergebenden Vorteil des alternativen Transportmittels wieder hinfällig<br />
werden lässt.<br />
Die Zeitpläne der Anmietung der Fahrzeugs und die Fahrpläne des Zuges müssen genau<br />
aufeinander abgestimmt werden, da eine Verspätung eine kostenpflichtige Lagerung von<br />
Seiten der Bahn nach sich zieht.<br />
XXXIII
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
Die Ausstellung „Mars - Mission und Vision“ wird ab dem Jahr 2011 ihr Einkaufscenter bespielen. In sieben<br />
Modulen erhalten Besucher Einblicke in die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Forschung und<br />
Raumfahrt zum Nachbarplaneten Mars.<br />
Viele der Fragen können anhand von Plänen geklärt werden. Wenn Ihnen diese vorliegen, bitten wir um eine<br />
Übersendung. Am besten ist die digitale Form als .pdf, .dwg oder .vwx - Datei. Eine Kopie auf Papier ist<br />
ebenso möglich.<br />
Die Wanderausstellung ist eine hohe logistische Herausforderung. Damit die Realisierung möglichst<br />
reibungsfrei bleibt, möchten wir einige Fragen zu den (bau)technischen Gegebenheiten im Center erfragen.<br />
Der folgende Fragebogen besteht aus 31 Fragen.<br />
Sie können diesen Fragebogen am Computer ausfüllen und bitte möglichst zum 31.August 2010<br />
per .pdf an uns zurücksenden:<br />
bauer@id3d-berlin.de und beier@id3d-berlin.de (Bitte an beide Adressen senden!)<br />
Alternativ ist es auch möglich, diesen Fragebogen auszudrucken und uns per Fax oder Post zu übermitteln:<br />
id3d-berlin gesellschaft für themengestaltung mbH<br />
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Segitzdamm 2<br />
10969 Berlin<br />
Fax: 030 - 616570 -20<br />
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren sie uns bitte per Telefon oder e-mail:<br />
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
bauer@id3d-berlin.de<br />
030 - 616570-0<br />
Vielen Dank für Ihre Kooperation und bis bald auf dem Mars!
A Allgemeine Informationen<br />
Name des Centers<br />
Straße<br />
PLZ<br />
Ort<br />
Ansprechpartner<br />
Telefonnummer<br />
Handynummer<br />
e-mail<br />
Wachdienst<br />
Telefonnummer<br />
Handynummer<br />
B Anfahrt<br />
B1 Mit welcher Größe des LKW ist eine Anfahrt problemlos möglich?<br />
Hinweis: Die Höhe eines LKW ist 4,00m, die Breite 2,50m!<br />
Sattelschlepper 40 t - Länge ca. 18 m<br />
großer LKW 20 t - Länge ca. 10 m<br />
kleiner LKW 7,5 t - Länge ca. 7 m<br />
Sondergenehmigung notwendig<br />
Sonderregelung<br />
B2 Besteht die Möglichkeiten den LKW beim Einkaufszentrum zu parken?<br />
während des AUFBAUs während der VERASTALTUNGSDAUER<br />
ja<br />
nein<br />
B3 Bestehen in nächster Umgebung (ca. 3km) Möglichkeiten einen LKW zu parken?<br />
ja<br />
nein<br />
unbekannt<br />
ja<br />
nein
C Ausladen/Einladen/Verladen<br />
C1 Gibt es eine Verladerampe, wie hoch ist diese (bei variablen Rampen, bitte min. und max. angeben)?<br />
ja<br />
nein Höhe in cm<br />
C2 Welche Einschränkungen bei der Zufahrt zur Rampe können auftreten?<br />
C3 Ist genügend Rangierplatz vorhanden, um den LKW mit einem Stapler zu be- und entladen?<br />
ja<br />
nein Einschränkungen<br />
C4 Besteht die Möglichkeit der Nutzung eines Gabelstaplers vom Center (für Lade- und Entladearbeiten)<br />
und die Dienstleistung eines Staplerfahrers?<br />
ja<br />
Größe<br />
nein<br />
3,5 t<br />
5 t<br />
> 5 t<br />
C5 Besteht eine (alternative) Möglichkeit LKWs zu be- und entladen?<br />
ja<br />
mit folgenden Einschränkungen<br />
nein<br />
unbekannt<br />
Parkplätze sperren<br />
Straße sperren<br />
Fußgängerzone<br />
Stufen im Weg
C6 In welchem Zeitfenster kann be- und entladen werden?<br />
Bitte hier auch Lärmschutzauflagen gegenüber möglichen Anwohnern beachten!<br />
Beginn Uhrzeit<br />
+ / -<br />
Ende Uhrzeit<br />
Beginn Uhrzeit<br />
Ende Uhrzeit<br />
D Transportwege im Haus<br />
D1 Welches ist das kleinste lichte Maß der Zu- und Durchgänge?<br />
Hinweis: bitte alle Türen, Zugänge, Engpässe, etc. beachten<br />
Höhe in cm<br />
Breite in cm<br />
+ / -<br />
D2 Befinden sich Stufen oder steile Rampen auf den Wegen?<br />
ja<br />
nein<br />
D3a Stehen Fahrstühle zur Verfügung?<br />
Lastenfahrstuhl<br />
Personenfahrstuhl<br />
nein<br />
D3b Wie groß sind die Innenmaße der Fahrstühle? Bitte beachten Sie hier, dass die Lichtschranke<br />
frei bleiben muss! Wie groß sind die Türen?<br />
Länge in cm<br />
Breite in cm<br />
Höhe in cm<br />
D3c Welche Nutzlast kann der Fahrstuhl heben?<br />
Last in kg<br />
Breite der Türe in cm<br />
Höhe der Türe in cm
E Technische Ausstattung<br />
E1 Wie wird der Strom bereitgestellt?<br />
ERCO (Decke)<br />
Schuko 10 A<br />
Drehstrom CEE<br />
1 Phase verwendbar (10A)<br />
2 Phasen verwendbar (10A)<br />
3 Phasen verwendbar (10A)<br />
16 A<br />
32 A<br />
63 A<br />
E2 Wo wird der Strom bereitgestellt?<br />
Decke<br />
Wand<br />
Bodentank<br />
unterschiedich<br />
E3 Stehen ERCO Beleuchtungskörper vom Haus zur Verfügung?<br />
ja<br />
nein<br />
folgende Typen (Typbezeihnung, Bestellnummer, Flood/Spot, Leistung, jeweilige Anzahl)<br />
E4 Welche Bodenbelastung ist maximal möglich?<br />
300 kg/m²<br />
500 kg/m²<br />
unbekannt<br />
andere<br />
unterschiedlich
E5 Aus welchem Material besteht der Boden?<br />
Stein<br />
Fliesen<br />
Kunststoff<br />
Estrich<br />
andere<br />
E6 Welche Wagen (Bereifung) dürfen verwendet werden?<br />
E7a Besteht die Möglichkeit im Center Lade- und Leergut für die Dauer der Ausstellung zu lagern?<br />
ja<br />
nein<br />
Lagerräume trocken<br />
Lagerräume abschließbar<br />
Parkdeck/Tiefgarage<br />
überdachter Hof, Außenfläche<br />
E7b Welche Fläche kann hierfür beansprucht werden?<br />
Fläche in m²<br />
E8 Besteht die Möglichkeit Materialien, welche abgeschlossen werden müssen (Werkzeug, etc.), im Center<br />
zu lagern? Volumen: ca. 2 m³<br />
während des AUFBAUs während der VERASTALTUNGSDAUER<br />
ja<br />
nein<br />
ja<br />
nein
E9a Gibt es Hängepunkte mit einer definierten Belastung?<br />
ja, jeweils<br />
nein<br />
unterschiedlich<br />
Belast. unbekannt<br />
E9b Wie erreicht man die Hängepunkte (vor allem im Atrium)?<br />
Steiger/Genie Hublift<br />
fester Einbau im Haus<br />
anders<br />
kg<br />
E10a Ist die Decke metallisch (Anbringen von magnetischen Halterungen)?<br />
ja<br />
nein<br />
teilweise<br />
unbekannt<br />
E10b Bestehen Möglichkeiten ein Stahlseil für Halterungen horizontal zu spannen?<br />
ja<br />
nein<br />
Rohr<br />
Öse<br />
Haken<br />
E10c Welche weiteren Möglichkeiten bestehen Halterungen anzubringen?<br />
E11 Welche Anforderung an das Brandverhalten von Baustoffen werden gestellt?<br />
(z.B. nach: DIN 4102 oder DIN EN 13501)
F Allgemeine Informationen<br />
F1 Zu welchen Tageszeiten sind Arbeiten im Center möglich?<br />
Beginn Uhrzeit<br />
Ende Uhrzeit<br />
F2 Stehen für unsere Mitarbeiter Pausen/Aufenthaltsräume zur Verfügung?<br />
ja<br />
nein<br />
Ausstattung<br />
Tisch/Stuhl<br />
Couch<br />
Küche/Teeküche<br />
abschließbar<br />
Telefon<br />
Internetanschluss<br />
F3 Stehen Büroarbeitsräume oder Büroarbeitsplätze für Koordinationsaufgaben zur Verfügung?<br />
ja<br />
nein<br />
Ausstattung<br />
abschließbar<br />
Telefon<br />
Internetanschluss<br />
F4 Stehen für unsere Mitarbeiter Sanitärräume zur Verfügung?<br />
ja<br />
nein<br />
F5 Besteht die Möglichkeit der Nutzung einer Werkstatt?<br />
ja<br />
nein<br />
extern, Entferung km Art der Werkstatt
F6 Besteht die Möglichkeit einer Wasserentnahme und eines Wasserausgusses (z.B. für Reinigungsarbeiten)?<br />
ja<br />
nein<br />
F7a Ist nachts, während der Auf- und Abbauzeit, eine ausreichende Beleuchtung der Gänge und<br />
Ausstellungsflächen gewährleistet?<br />
ja<br />
nein<br />
auf Anfrage<br />
F7b Ist nachts die Stromversorgung gewährleistet?<br />
ja<br />
nein<br />
auf Anfrage<br />
F8 Ist nachts das Einkaufszentrum für Publikum gesperrt?<br />
Falls nein, besteht die Möglichkeit einzelne Bereiche zu sperren?<br />
ja<br />
nein<br />
Schließzeit<br />
Öffnungszeit<br />
ja<br />
nein<br />
einzelne Geschosse<br />
einzelne Teilbereiche<br />
nach Absprache
Auswertung der Antworten des Fragebogens<br />
Nr Frage Antwort Proz. Antwort Porz. Antwort Proz. Antwort Proz. Antwort Proz.<br />
A Name des Centers<br />
B B1 LKW-Größe 40 t 11 79% 20 t 2 14% 7,5 t 1 7%<br />
B2a Parken während AUFBAU ja 10 71% nein 4 29%<br />
B2b Parken während EVENT ja 2 14% nein 12 86%<br />
B3 Parken in Umgebung ja 11 85% nein 0 0% unbekannt 2 15%<br />
C C1 Verladerampe vorhanden ja 11 79% nein 3 21%<br />
variable Höhe minimal minimal 65 cm maximal 70 cm<br />
variable Höhe maximal minimal 130 cm maximal 150 cm<br />
feste Höhe minimal 103 cm maximal 160 cm Mittelwert 120,89 cm<br />
C3 Rangierplatz für Stapler vorhanden ja 14 100% nein 0 0%<br />
C4 Stapler ausleihen möglich ja 1 7% nein 13 93%<br />
C5 alternative Verlademöglichkeit ja 7 50% nein 5 36% unbekannt 2 14%<br />
C6 Ladebeginn frühestens 5:00 Uhr spätestens 7:00 Uhr<br />
Ladeende frühestens 20:00 Uhr spätestens 0:00 Uhr<br />
Ladebeginn frühestens 18:00 Uhr spätestens 20:00 Uhr<br />
Ladeende frühestens 6:00 Uhr spätestens 6:00 Uhr<br />
D D1 lichte Höhe der Türen minimal 190 cm maximal 245 cm Mittelwert 211,23 cm<br />
lichte Breite der Türen minimal 150 cm maximal 265 cm Mittelwert 203,69 cm<br />
D2 Rampen oder Stufen im Weg ja 0 0% nein 14 100%<br />
D3a Typ Fahrstuhl Lasten 13 100% Personen 0 0% kein 0 0%<br />
D3b Länge des Fahrstuhls minimal 240 cm maximal 341 cm<br />
Breite des Fahrstuhls minimal 163 cm maximal 212 cm<br />
Höhe des Fahrstuhls minimal 210 cm maximal 234 cm<br />
lichte Breite der Fahrstuhltüren minimal 163 cm maximal 210 cm<br />
lichte Höhe der Fahrstuhltüren minimal 210 cm maximal 230 cm<br />
D3c Nutzlast des Fahrstuhls minimal 2000 kg maximal 4050 kg<br />
E E1 Strom ERCO ja 11 79% nein 3 21%<br />
Strom Schuko (10 A) ja 11 79% nein 3 21%<br />
Strom CEE (mind. 16 A) ja 11 79% nein 3 21%<br />
E2 Ort des Stroms Decke 4 29% Wand 2 14% Bodentank 1 7% unterschiedlich 7 50%<br />
E3 Erco Beleuchtungskörper vorhanden ja 10 71% nein 4 29%<br />
E4 maximale Bodenbelastung 300kg/m² 0 0% 500kg/m² 14 100% unbekannt 0 0% andere 0 0% unterschiedlich 0 0%<br />
E5 Fußbodenmaterial Stein 7 50% Fliesen 4 29% Kunststoff 0 0% Estrich 0 0% andere 3 21%<br />
E6 Werkstoff für Reifen für Transportwagen Gummi 13 100% andere 0 0%<br />
E7a Lagerung des Leergutes ja 11 79% nein 3 21%<br />
E7b mögliche Lagerfläche für Leergut minimal 10 m² maximal 50 m²<br />
E8 Werkzeuglagerung während AUFBAU ja 12 86% nein 2 14%<br />
Werkzeuglagerung während VERANSTALTUNG ja 12 86% nein 2 14%<br />
E9a Hängepunkte vorhanden ja 7 50% nein 2 14% unterschiedlich 5 36% unbekannt 0 0%<br />
maximale Last am jeweiligen Hängepunkte minimal 10 kg maximal 300 kg<br />
E9b Erreichbarkeit des Hängepunktes Steiger 8 57% Einbau 3 21% anders 3 21% 0%<br />
E10ametallische Decke ja 0 0% nein 13 93% teilweise 1 7% unbekannt 0 0%<br />
E10bStahlseil horizontal spannbar ja 11 79% nein 3 21%<br />
E11 Brandanforderung für die Ausstellungsarchitektur B1 13 93% A1 1 7%<br />
F F1 täglicher Arbeitsbeginn des Aufbaus frühestens 20:00 Uhr spätestens 22:00 Uhr<br />
tägliches Arbeitsende des Aufbaus frühestens 6:00 Uhr spätestens 10:00 Uhr<br />
F2 Aufenthaltsraum ja 13 100% nein 0 0%<br />
F3 Büroraum ja 5 38% nein 8 62%<br />
F4 Sanitärraum ja 13 93% nein 1 7%<br />
F5 Werkstatt ja 4 29% nein 10 71%<br />
F6 Wasserentnahme möglich ja 13 93% nein 1 7%<br />
F7a Belechtung gewährleistet ja 6 43% nein 4 29% Anfrage 4 29%<br />
F7b Stromversorgung gewährleistet ja 7 50% nein 4 29% Anfrage 3 21%<br />
F8 Nachts gesperrtes Center ja 12 86% nein 2 14%
Antworten<br />
Nr Frage<br />
A Name des Centers Plauen Magdeburg Neukirchen Berlin Ark. Kassel Essen Karlsruhe Schwerin Wetzlar Koblenz Viernheim Ludwigshafen Kempten Leonberg<br />
B B1 LKW-Größe 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3<br />
B2a Parken während AUFBAU 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2<br />
B2b Parken während EVENT 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2<br />
B3 Parken in Umgebung 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1<br />
C C1 Verladerampe vorhanden 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1<br />
variable Höhe minimal 65 70<br />
variable Höhe maximal 150 130<br />
feste Höhe 108 160 113 120 110 160 103 109 105<br />
C3 Rangierplatz für Stapler vorhanden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
C4 Stapler ausleihen möglich 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2<br />
C5 alternative Verlademöglichkeit 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 3 1<br />
C6 Ladebeginn 5:30 6:00 6:00 5:00 6:00 5:00 7:00 6:00 6:00<br />
Ladeende 20:00 20:00 22:00 20:00 20:00 20:00 0:00 22:00 22:00<br />
Ladebeginn 20:00 18:00<br />
Ladeende 6:00 6:00<br />
D D1 lichte Höhe der Türen 190 204 245 225 205 205 220 210 225 195 220 202 200<br />
lichte Breite der Türen 150 182 221 195 185 215 250 180 195 155 265 205 250<br />
D2 Rampen oder Stufen im Weg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
D3a Typ Fahrstuhl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
D3b Länge des Fahrstuhls 240 338 270 270 260 320 341 270 272 252<br />
Breite des Fahrstuhls 200 163 180 210 200 200 210 200 210 212 211<br />
Höhe des Fahrstuhls 215 234 220 220 230 210 220 220 220 226 230<br />
lichte Breite der Fahrstuhltüren 200 163 180 210 200 210 210 200<br />
lichte Höhe der Fahrstuhltüren 215 219 220 220 230 210 220 226<br />
D3c Nutzlast des Fahrstuhls 3000 3100 3000 3000 3000 4050 3000 3850 3000 2000 3000 3000<br />
E E1 Strom ERCO 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1<br />
Strom Schuko (10 A) 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2<br />
Strom CEE (mind. 16 A) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2<br />
E2 Ort des Stroms 4 4 1 2 4 4 4 2 4 1 4 3 1 1<br />
E3 Erco Beleuchtungskörper vorhanden 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1<br />
E4 maximale Bodenbelastung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
E5 Fußbodenmaterial 5 1 1 2 1 5 1 1 2 5 2 1 2 1<br />
E6 Werkstoff für Reifen für Transportwagen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
E7a Lagerung des Leergutes 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1<br />
E7b mögliche Lagerfläche für Leergut 30 10 30 50 50 25 50 30 50<br />
E8 Werkzeuglagerung während AUFBAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2<br />
Werkzeuglagerung während VERANSTALTUNG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2<br />
E9a Hängepunkte vorhanden 3 3 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1<br />
maximale Last am jeweiligen Hängepunkte 10 50 300 50 100 50 32<br />
E9b Erreichbarkeit des Hängepunktes 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2<br />
E10ametallische Decke 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3<br />
E10bStahlseil horizontal spannbar 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1<br />
E11 Brandanforderung für die Ausstellungsarchitektur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1<br />
F F1 täglicher Arbeitsbeginn des Aufbaus 20:00 22:00 20:00 21:00 20:00 20:00 22:00 20:00 06:30:00 05:00:00 20:00 20:00 20:00<br />
tägliches Arbeitsende des Aufbaus 6:00 9:30 6:00 8:00 9:30 10:00 8:00 8:00 20:00:00 00:00:00 8:30 10:00 8:00<br />
F2 Aufenthaltsraum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
F3 Büroraum 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2<br />
F4 Sanitärraum 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1<br />
F5 Werkstatt 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2<br />
F6 Wasserentnahme möglich 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
F7a Belechtung gewährleistet 3 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3<br />
F7b Stromversorgung gewährleistet 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3<br />
F8 Nachts gesperrtes Center 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Finsterwalder Container GmbH - Lindauer Str. 2-4 – D-87600 Kaufbeuren<br />
Ingenieur für Veranstaltungstechnik<br />
Herr <strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Gerhard-Hauptmann-Straße 5<br />
D-90763 Fürth<br />
Angebot 2760/27/2010<br />
Seite 1<br />
Sehr geehrter Herr <strong>Bauer</strong>,<br />
Finsterwalder Container GmbH<br />
Lindauer Str. 2-4<br />
D-87600 Kaufbeuren<br />
Telefon: +49 (0) 8341/80905-0<br />
Telefax: +49 (0) 8341/80905-9<br />
E-Mail: info@finsterwalder.eu<br />
Internet: www.finsterwalder.eu<br />
Ansprechpartner<br />
Heinrich Brell<br />
für Ihre Anfrage bedanken wir uns. Freibleibend können wir Ihnen wie folgt anbieten:<br />
20’ x 8’ x 8’6’’ Seecontainer<br />
Typ : SC 21<br />
Maße / Ausführung : gemäß beiliegender technischer Beschreibung<br />
Zustand : gebraucht, wind- und wasserdicht, mit gültiger CSC-Plakette<br />
Abholung : frei verladen auf geeigneten LKW ab Hamburg<br />
Verfügbarkeit : kurzfristig<br />
Preis : €/St. 1.290,-- inkl. Anlieferung zzgl. MwSt.<br />
Kaufbeuren, den 05.07.2010<br />
20’ x 8’ x 8’6’’ Seecontainer<br />
Typ : SC 20.5<br />
Maße / Ausführung : gemäß beiliegender technischer Beschreibung<br />
Zustand : neuwertig, Gebrauchsspuren durch einen Frachtlauf möglich,<br />
mit gültiger CSC-Plakette<br />
Abholung : frei verladen auf geeigneten LKW ab Hamburg<br />
Verfügbarkeit : kurzfristig<br />
Preis : €/St. 2.390,-- inkl. Anlieferung zzgl. MwSt.<br />
40’ x 8’ x 8’6’’ Seecontainer<br />
Typ : SC 41<br />
Maße / Ausführung : gemäß beiliegender technischer Beschreibung<br />
Zustand : gebraucht, wind- und wasserdicht, mit gültiger CSC-Plakette<br />
Abholung : frei verladen auf geeigneten LKW ab Hamburg<br />
Verfügbarkeit : kurzfristig<br />
Preis : €/St. 1.590,-- inkl. Anlieferung zzgl. MwSt.<br />
40’ x 8’ x 8’6’’ Seecontainer<br />
Typ : SC 40<br />
Maße / Ausführung : gemäß beiliegender technischer Beschreibung<br />
Zustand : neuwertig, Gebrauchsspuren durch einen Frachtlauf möglich,<br />
mit gültiger CSC-Plakette<br />
Abholung : frei verladen auf geeigneten LKW ab Hamburg<br />
Verfügbarkeit : kurzfristig<br />
Preis : €/St. 3.690,-- inkl. Anlieferung zzgl. MwSt.<br />
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer AGB. Hinsichtlich Sitz der Gesellschaft: 87600 Kaufbeuren HypoVereinsbank AG<br />
Lieferung unserer Container sowie der Ausführung von Registergericht Kempten: HRB 6699 Kaufbeuren<br />
Transportaufträgen gilt die ADSp neuester Fassung. Erfüllungsort Geschäftsführer: Eugen Finsterwalder Konto-Nr. 6930448050<br />
und Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist für Steuernummer: 125 80384 BLZ 73420071<br />
beide Vertragsparteien D-87600 Kaufbeuren USt-ID-Nummer: DE813577687
Angebot 2760/27/2010<br />
Seite 2<br />
Wir hoffen unser Angebot ist für Sie von Interesse und stehen Ihnen bei Rückfragen jederzeit gerne zur<br />
Verfügung.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Finsterwalder Container GmbH<br />
i. A. Matthias Schei<br />
Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer AGB. Hinsichtlich Sitz der Gesellschaft: 87600 Kaufbeuren HypoVereinsbank AG<br />
Lieferung unserer Container sowie der Ausführung von Registergericht Kempten: HRB 6699 Kaufbeuren<br />
Transportaufträgen gilt die ADSp neuester Fassung. Erfüllungsort Geschäftsführer: Eugen Finsterwalder Konto-Nr. 6930448050<br />
und Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselklagen, ist für Steuernummer: 125 80384 BLZ 73420071<br />
beide Vertragsparteien D-87600 Kaufbeuren USt-ID-Nummer: DE813577687
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Von: HECHINGER, Diana [hechinger@containex.com]<br />
Gesendet: Montag, 5. Juli 2010 13:34<br />
An: work@paulbauer.eu<br />
Betreff: Ihre Anfrage bezüglich gebrauchter Seecontainer<br />
Guten Tag Herr <strong>Bauer</strong>!<br />
Herzlichen Dank für Ihre Containex Anfrage!<br />
Gerne kann ich Ihnen wie folgt anbieten:<br />
Produkt: 1 Stück gebr. 40' Seecontainer<br />
Zustand: gebraucht, gültige CSC Plakette, wind- und<br />
wasserfest<br />
Nettopreis CPT D-90763, unabgeladen: 2.350,00 Euro / Stk.<br />
Produkt: 1 Stück gebr. 20' Seecontainer<br />
Zustand: gebraucht, gültige CSC Plakette, wind- und<br />
wasserfest<br />
Nettopreis CPT D-90763, unabgeladen: 1.850,00 Euro / Stk.<br />
Produkt: 2 Stück gebr. 20' Seecontainer<br />
Zustand: gebraucht, gültige CSC Plakette, wind- und<br />
wasserfest<br />
Nettopreis CPT D-90763, unabgeladen: 1.750,00 Euro / Stk.<br />
Preis nur bei paarweiser Abnahme gültig!<br />
Zustellung: ca. 1-2 Wochen nach Auftragserhalt<br />
*****************************************************************************************<br />
********<br />
Zollstatus: verzollt<br />
Gültigkeit: Freibleibend bis zum Fixabschluß.<br />
Insbesondere weisen wir auf die derzeit<br />
nicht absehbaren Steigerungen bei den<br />
Stahlpreisen hin.<br />
Es ist die Möglichkeit gegeben, die offerierten Container<br />
vor Bestellung und Ausgang zu besichtigen.<br />
Gewährleistungsansprüche bei gebrauchten Containern sind<br />
ausgeschlossen.<br />
Bitte um baldige Info, ob unser aktuelles Angebot Ihren Erwartungen entspricht und<br />
verbleiben einstweilen<br />
Mit freundlichen Grüßen aus Wien,<br />
Diana Hechinger<br />
CONTAINEX<br />
Container-Handelsgesellschaft m.b.H.<br />
IZ NOE-Sued, Strasse 14, Postfach 36<br />
A-2355 Wiener Neudorf / Austria<br />
Phone: +43 2236 601-1411<br />
Fax: +43 2236 601-51411<br />
mailto:hechinger@containex.com<br />
http://www.containex.com
Fred Dahl * Gluckstraße 19 * 14480 Potsdam<br />
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Herrn <strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
Wilsnacker Straße 39<br />
10559 Berlin<br />
Deutschland<br />
Angebot-Nr.: 294-0710-14<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
KRONE-Vertrieb<br />
Berlin/Brandenburg<br />
Fred Dahl<br />
Gluckstraße 19<br />
14480 Potsdam<br />
Telefon 0331 600 58 66<br />
Telefax 0331 600 61 04<br />
Mobil 0172 232 96 95<br />
eMail fred.dahl@krone.de<br />
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Unter Zugrundelegung unserer<br />
"Allg. Geschäftsbedingungen (Stand August/2003)"bieten wir Ihnen wie folgt, freibleibend an:<br />
KRONE - Stahlbox mit geklinchten Seitenwänden<br />
Menge: 1 Typ: WK 7,3 STG<br />
Technische Beschreibung / Ausstattung<br />
Bodenrahmen<br />
Abstellfüße<br />
Zubehör<br />
Boden<br />
Zulassung Wechselbehälter<br />
für Zulassung/Betrieb höchstzul. Gesamtgewicht: 16.000 kg<br />
KLV-fähig, aber ohne Bahnkodifizierung, ohne Antrag,<br />
ohne Montage der Kodifizierungsschilder<br />
195 mm hohe Bodengruppe incl. Boden; Rechteckrohr-Längs-<br />
träger mit Querträgern und Außenrahmen als Schweißkon-<br />
struktion mit untenliegendem Führungstunnel<br />
4 Container-Eckbeschläge auf 20'-Basis,Überhänge symmetrisch<br />
4 Greiferzangenleisten<br />
für Aufbauabmessungen: ca. 7.300 x 2.470 mm i. L.<br />
4 seitlich auszieh-/klappbare Abstellfüße, 2-fach gesichert<br />
Abstellhöhe 1.320 mm<br />
Stützbeinauflage als Pendelhalter<br />
Schiebetrittleiter hinten<br />
Typ: BO WST<br />
27 mm starker, wasserfest verleimter Siebdruckplattenboden,<br />
Festigkeit nach DIN 283; für Bodenbelastungen bis max.<br />
5.460 kg Staplerachslast<br />
2 Lüftungsöffnungen vorne im Boden (gem. GGVS)<br />
Potsdam, 14.07.2010<br />
Geschäftsführer:<br />
Gero Schulze Isfort, Dipl.-Ing.<br />
Bankkonten:<br />
DZ-Bank Hannover (BLZ 250 600 00) Kto.-Nr. 115 932,<br />
Fahrzeugwerk<br />
Bernard Krone GmbH<br />
Ulrich Knüppel-Gertberg, Dipl.-Ing.(TU)<br />
Uwe Sasse, Dipl.-Ing. (TH)<br />
Beirat:<br />
IBAN DE66 2506 0000 0000 1159 32, SWIFT-BIC:GENODEFF250<br />
Nord LB (BLZ 250 500 00) Kto.-Nr. 101 456 473<br />
IBAN DE59 2505 0000 0101 4564 73<br />
Bernard-Krone-Straße 1,D-49757 Werlte<br />
Telefon + 49(0) 5951/209-0<br />
Fax + 49(0) 5951/24 65<br />
Dr. Ing. E.h. Bernard Krone, Vorsitzender<br />
Dr. Jürgen Föhrenbach<br />
Geschäftsführender Vorsitzender<br />
Volksbank Spelle-Freren (BLZ 280 699 94) Kto.-Nr. 100 455 700<br />
Ust.-Id.-Nr.: DE 812 732 722 Steuer-Nr.: 2361/200/08687<br />
Postfach 1148, D-49753 Internet: www.krone.de Handelsreg:AG Osnabrück HRB 100633 Stammkapital : Euro 18 Mio.
Blatt 2 von 3 zum Angebot Nr. 294-0710-14 vom 14.07.2010<br />
Koffergehäuse<br />
Zubehör<br />
Lackierung<br />
Aufbau TYP AB WST<br />
Innenhöhe: 2525 mm<br />
Portalhöhe i. L. 2.450 mm, Gesamthöhe 2.750 mm<br />
Eckhöhe: 2.750 mm<br />
geschlossener Aufbau<br />
Seitenwände glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten<br />
Dach aus trapezförmig profiliertem Stahlblech<br />
2 Lüftungskiemen je Seitenwand<br />
Stapleranfahrschutz innen, 3-seitig, ca. 300 mm hoch<br />
Stirnwand glatt aus verzinkten Stahlblech-Kassetten,<br />
innen an der Stirnwand mit Holzverkleidung über gesamte Höhe<br />
Rückwand als Stahl-Containertür mit austauschbarer Dichtung<br />
(Breite i. L. ca. 2.470 mm)<br />
Drehstangenverschlüsse innenliegend (Tür außen glatt),<br />
Bedienung unterhalb der Tür<br />
doppelter Drehstangenverschluß bei Containertür<br />
Türfeststeller als Kette<br />
Seitenwände innen ganzflächig mit Schlüssellochblechen<br />
Stahl-Anfahrschutz waagerecht am Heckprofil, links u. rechts<br />
Zollverschluß<br />
Zollplakette<br />
Haltegurt für Aufstieg hinten<br />
Typ Lack WKo<br />
Serien-Lackierung<br />
Stahlteile stahlgestrahlt, KTL-grundiert und pulverbeschichtet<br />
1. Farbgruppe Fahrzeuge: 1<br />
Fahrzeuge<br />
Wechselkoffer kpl. außen RAL 9010 REINWEISS<br />
Fahrzeugpreis je Einheit 8.300,00 EUR<br />
Lieferung: nach Vereinbarung, im Rahmen unserer Liefermöglichkeiten<br />
Preis: ab Werk Kompetenzpartner Brüggen, Herzlake je Einheit, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer<br />
Zahlung: Spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum,<br />
bei vorheriger Abholung in bar bei Übergabe<br />
Geschäftsführer:<br />
Gero Schulze Isfort, Dipl.-Ing.<br />
Bankkonten:<br />
DZ-Bank Hannover (BLZ 250 600 00) Kto.-Nr. 115 932,<br />
Fahrzeugwerk<br />
Bernard Krone GmbH<br />
Ulrich Knüppel-Gertberg, Dipl.-Ing.(TU)<br />
Uwe Sasse, Dipl.-Ing. (TH)<br />
Beirat:<br />
IBAN DE66 2506 0000 0000 1159 32, SWIFT-BIC:GENODEFF250<br />
Nord LB (BLZ 250 500 00) Kto.-Nr. 101 456 473<br />
IBAN DE59 2505 0000 0101 4564 73<br />
Bernard-Krone-Straße 1,D-49757 Werlte<br />
Telefon + 49(0) 5951/209-0<br />
Fax + 49(0) 5951/24 65<br />
Dr. Ing. E.h. Bernard Krone, Vorsitzender<br />
Dr. Jürgen Föhrenbach<br />
Geschäftsführender Vorsitzender<br />
Volksbank Spelle-Freren (BLZ 280 699 94) Kto.-Nr. 100 455 700<br />
Ust.-Id.-Nr.: DE 812 732 722 Steuer-Nr.: 2361/200/08687<br />
Postfach 1148, D-49753 Internet: www.krone.de Handelsreg:AG Osnabrück HRB 100633 Stammkapital : Euro 18 Mio.
Blatt 3 von 3 zum Angebot Nr. 294-0710-14 vom 14.07.2010<br />
Alternativ: Fordern Sie unser KRONE FINANCE Finanzierungsangebot an.<br />
Ansprechpartner : Markus Böhmann<br />
Tel.: 05951 - 209 607<br />
Fax: 05951 - 209 98 607<br />
Fragen Sie nach dem Leistungsprofil des Swap Service, Ihr Anbieter für den Fullservice!<br />
Wir halten uns für einen Zeitraum von 4 Wochen ab Angebotsdatum an dieses Angebot gebunden.<br />
Krone-Nutzfahrzeuge werden auf höchstem Qualitätsniveau gefertigt sämtliche Stahlteile sind<br />
stahlgestrahlt, KTL-grundiert und mit hochwertiger Pulverbeschichtung versehen oder lackiert im<br />
Metallic-Farbton. Das Krone-Qualitätsmanagement zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 garantiert<br />
ein erstklassiges Produkt.<br />
Wir setzen darauf, Sie durch die Lieferung eines Krone-Nutzfahrzeuges von der herausragenden<br />
Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit unserer Qualitätsprodukte zu überzeugen.<br />
Wir werden uns erlauben, kurzfristig mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Fahrzeugwerk<br />
Bernard Krone GmbH<br />
i.A. Fred Dahl<br />
Ihr Regional Vertriebsleiter<br />
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KRONE Gruppe.<br />
Zu finden unter http://www.krone.de<br />
Geschäftsführer:<br />
Gero Schulze Isfort, Dipl.-Ing.<br />
Bankkonten:<br />
DZ-Bank Hannover (BLZ 250 600 00) Kto.-Nr. 115 932,<br />
Fahrzeugwerk<br />
Bernard Krone GmbH<br />
Ulrich Knüppel-Gertberg, Dipl.-Ing.(TU)<br />
Uwe Sasse, Dipl.-Ing. (TH)<br />
Beirat:<br />
IBAN DE66 2506 0000 0000 1159 32, SWIFT-BIC:GENODEFF250<br />
Nord LB (BLZ 250 500 00) Kto.-Nr. 101 456 473<br />
IBAN DE59 2505 0000 0101 4564 73<br />
Bernard-Krone-Straße 1,D-49757 Werlte<br />
Telefon + 49(0) 5951/209-0<br />
Fax + 49(0) 5951/24 65<br />
Dr. Ing. E.h. Bernard Krone, Vorsitzender<br />
Dr. Jürgen Föhrenbach<br />
Geschäftsführender Vorsitzender<br />
Volksbank Spelle-Freren (BLZ 280 699 94) Kto.-Nr. 100 455 700<br />
Ust.-Id.-Nr.: DE 812 732 722 Steuer-Nr.: 2361/200/08687<br />
Postfach 1148, D-49753 Internet: www.krone.de Handelsreg:AG Osnabrück HRB 100633 Stammkapital : Euro 18 Mio.
DER MARS: Vision und Mission<br />
Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren<br />
id3d-berlin themengestaltung
id3d-berlin themengestaltung<br />
„Die Erde ist die Wiege der Menschheit.<br />
Wie jedes Kind wird auch der Mensch seine Wiege verlassen.“<br />
Konstantin Ziolkowski<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 2
Aufgabe<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
ECE beabsichtigt „Space for Kids on Tour“ in ca. 20 Centern für jeweils zehn bis 14 Tage zu präsentieren.<br />
id3d-berlin themengestaltung wurde aufgefordert, hierzu ein Konzept zu entwickeln.<br />
Ziel soll es dabei sein, die Center in ihrer Gesamtheit mit dem Thema Raumfahrt interaktiv und informativ<br />
zu bespielen. ECE möchte sich mit dem Projekt gestalterisch wie auch in der Qualität der Vermittlung des<br />
Themas von „normaler“ Mall-Eventbespielung unterscheiden. Mit der Präsentation von Space for Kids zeigt<br />
ECE auch Engagement im frühkindlichen Bildungsbereich. Daher soll die Ausstellung einen von vergleichbaren<br />
Ausstellungen in Einkaufszentren zu unterscheidenden erzählerisch-didaktischen Standard deutlich<br />
machen.<br />
Zielgruppe ist die „Laufkundschaft“ in den Centern aber auch die jeweilige Stadtgesellschaft soll angesprochen<br />
werden. ECE möchte mit diesem Projekt in die Städte hineinwirken und gesellschaftliches Engagement<br />
zeigen.<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 3
Konzept: Von der Emotion zur Information<br />
DER MARS: Vision und Mission<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Um die repräsentativen Einkaufszentren von ECE adäquat und vor allem in ihrer Gesamtheit bespielen zu<br />
können, schlägt id3d-berlin themengestaltung vor „Space for Kids“ in ein größeres Ausstellungskonzept<br />
einzubinden.<br />
Die zu entwickelnde Ausstellung DER MARS: Vision und Mission macht in den Centern von ECE die<br />
Exploration des Mars und damit das Zukunftsthema der Raumfahrt in seiner Gänze interaktiv erleb- und<br />
verstehbar.<br />
Denn ab 2020 wollen die NASA, Roskosmos und ESA erstmals bemannte Missionen zum Mars senden.<br />
Eine Reise, die über ein Jahr dauern wird. Hierfür werden schon jetzt Versuchsszenarien entwickelt und<br />
durchgeführt. Gerade heute sitzen Wissenschaftler in der Nähe von Moskau für 500 Tage in einem Modell,<br />
das die Auswirkungen einer solchen Reise testen soll und den Marseinsatz simuliert.<br />
Höhepunkt der Ausstellung DER MARS: Vision und Mission ist das Themenmodul „DER MARS for Kids:<br />
Ein Flug zum Mars nur für Kinder von 4 bis 10 Jahren“. Hier machen sich Kinder im fliegenden Klassenzimmer<br />
auf den Weg zum Mars. Ihre Mission: In einer Crew von 30 Kindern und in Begleitung von zwei<br />
erfahrenen Marsonauten untersuchen sie die Planetenoberfläche, arbeiten im Weltraumlabor und erleben<br />
den Alltag in einer Raumstation.<br />
Aber auch für die, die zurückbleiben müssen, bietet die Ausstellung Highlights, die sicherlich die Marsbegeisterung<br />
im Umfeld der jeweiligen Stationen steigen lassen. In sechs bis acht weiteren eigenständigen<br />
Modulen können sich die Besucher der ECE-Center dem Thema Mars hingeben. Interaktive Exponate und<br />
Environments mit hoher Aufenthaltsqualität halten die Flaneure in den Malls fest in ihrem Bann. Höhepunkt<br />
der „Erwachsenenausstellung“ ist das Modul „Mars 500“. Im gemeinsam mit der ESA umgesetzten<br />
Simulationshabitat können die „Alten“ zwar für den Mars üben, zum Mars fliegen, wie ihre Kinder, können<br />
sie allerdings nicht.<br />
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema Mars soll in Modulen erfolgen, die eine in sich geschlossene<br />
Erzählung haben. Durch die geschlossene Thematik können sie unproblematisch an die jeweiligen<br />
örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die inhaltliche und dramaturgisch-raumbildnerische<br />
Ausformulierung zeigt die nachfolgende Übersicht.<br />
Die Themenmodule in der Übersicht<br />
1. DER MARS: Visionäre und Entdecker<br />
2. DER MARS: Die Erde und das Sonnensystem<br />
3. DER MARS: Technik der Erkundung<br />
4. DER MARS: Zum Erforschen freigegeben<br />
5. DER MARS 500: Mission für die Zukunft<br />
6. DER MARS for Kids: Ein Flug zum Mars<br />
nur für Kinder von 4 bis 10 Jahren<br />
7. DER MARS: Zum Vertiefen<br />
ZUSATZMODULE (Falls diese Inhalte nicht<br />
in die anderen Module integriert werden)<br />
DER MARS: Zum Lesen, Schauen und Hören<br />
DER MARS: Zum Spielen und Kaufen<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 4
Der inszenatorische Empfang<br />
Foyers und Artrien<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Sonnensystem-Mobile in den Artrien und Foyers empfangen die Besucher und stimmen die Center wie die<br />
Besucher auf das Thema ein.<br />
Montage: id3d-berlin themengestaltung, 06072009<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 5
Themenmodul 1<br />
DER MARS: Visionäre und Entdecker<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Dieses Ausstellungsmodul beschäftigt sich mit den ersten Entdeckern und Visionären der „Marseroberung“.<br />
Sprechende Denkmäler erzählen ihre Visionen, die Geschichte und Geschichten der Erforschung des Mars<br />
vor dem Raumfahrtzeitalter.<br />
Beispiele:<br />
Nikolaus Kopernikus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Christiaan Huygens, Giovanni Domenico<br />
Cassini, Wilhelm Herschel, Giovanni Schiaparelli, H.G. Wells<br />
Interaktivexponate:<br />
> Sprechende Denkmale<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 6
Themenmodul 2<br />
DER MARS: Die Erde und das Sonnensystem<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Der Ausstellungsbereich zeigt den Besuchern die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Erde und Mars<br />
und ordnet die beiden Planeten in unser Sonnensystem ein. Ein an barocke mechanische Maschinen<br />
erinnerndes Astronarium macht unser Universum beweglich und die Besucher können selbst einmal am<br />
„System“ drehen. Zudem stehen die Erde und der Mars direkt vor ihnen als Modell und können durch<br />
Selbsterkundung entdeckt werden.<br />
Themen:<br />
> Umlauf und Rotation<br />
> Größe<br />
> Atmosphäre und Klima<br />
> Oberfläche<br />
> Wasservorkommen<br />
> Monde<br />
> Wetter<br />
Interaktivexponate:<br />
> Astronarium<br />
> Erde/Mars Globen<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 7
Themenmodul 3<br />
DER MARS: Technik der Erkundung<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Seit den 60er Jahren versucht man den Mars mit Sonden zu erreichen. Sie sollen in der Umlaufbahn den<br />
Mars umkreisen und untersuchen. In der „Allee der Sonden“ können die Besucher durch die „Technik der<br />
Erkundung“ flanieren. Die als abstrahierte Modelle aus Wellpappe nachgebauten Sonden zeigen sich in<br />
der ganzen Schönheit der Technik. Medial und anfassbar werden die jeweilige Technik wie aber auch die<br />
Lebensgeschichten der Erkundungsinstrumente erzählt.<br />
Themen:<br />
> Sonden<br />
Beispiele:<br />
Mariner Sonden, Mars Sonden, Viking Sonden, Fobos Sonden, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 8
Themenmodul 4<br />
DER MARS: Zum Erforschen freigegeben<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
In diesem Ausstellungsmodul können die Besucher nach Herzenslust den Mars untersuchen. Eine Modelllandschaft<br />
liegt ganz plastisch vor Ihnen. Aufgeständerte Ferngläser mit Filmen und Fotos lassen den<br />
Überblick zu. Sie können aber auch auf einzelne Punkte des Planeten oder auf Lander und Orbiter ausgerichtet<br />
werden. Sobald ein Punkt beispielsweise der Olympus Mons anvisiert wird, werden 3D-Filme oder<br />
Foto-Sequenzen im Fernglas ausgelöst, die diesen Ort in seiner Faszination zeigen und mit einer Audiospur<br />
erläutern.<br />
Themen:<br />
> Der Mars in 3D (Überflüge und Fotos)<br />
> Topografie<br />
> Mars 3, Viking Lander, Mars Pathfinder mit Sojourner, Spirit und Opportunity, Phoenix Mars Science<br />
Laboratory, Mars Express, Mars Reconnaissance Orbiter, ExoMars<br />
Interativexponate:<br />
> Marslandschaft als Versuchsstation<br />
> Marsbeobachtung durch 3D-Ferngläser<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 9
Anmutungen aus unserer Raumfahrtausstellung 2006<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 10
Themenmodul 5<br />
DER MARS 500: Mission für die Zukunft<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Mars-500 ist ein Experiment der russischen Weltraumagentur Roskosmos und der europäischen ESA. Das<br />
Projekt simuliert einen bemannten Flug zum Mars, wobei sechs freiwillige Personen während 520 bis 700<br />
Tage in einem Komplex eingeschlossen werden. Die anfallenden Arbeiten und Tagesstrukturen sind so<br />
gewählt, dass es einem Hin- und Rückflug zum Mars möglichst nahe kommt. In diesem Ausstellungsmodul<br />
können die Besucher die Aufgaben und Umstände einer Marsmission erkunden und sich selbst „umsehen“<br />
im abstrahierten Nachbau von Mars 500, der gemeinsam mit der ESA umgesetzt wird. Ist Leben auf dem<br />
Mars möglich?<br />
Themen:<br />
> Bemannte Missionen<br />
>> Die Zukunft: Erster bemannter Flug, Forschungsziele, Missionsplanungen<br />
>> Mars-Raumstationen<br />
> Überleben<br />
>> Die Suche nach Wasser<br />
>> Habitate<br />
>> Terraforming<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 11
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 12
Themenmodul 6<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS for Kids: Ein Flug zum Mars nur für Kinder von 4 bis 10 Jahren<br />
Im Mittelpunkt der Ausstellung „DER MARS: Vision und Mission“ steht der Blick in die Zukunft. Durch die<br />
umgebende Ausstellung erscheint das Ziel ganz nah. Doch nur unsere Kinder werden es erreichen. Ihre<br />
Mission: In einer Crew von 30 Kindern und in Begleitung von zwei erfahrenen Marsonauten untersuchen<br />
sie die Planetenoberfläche, arbeiten im Weltraumlabor und erleben den Alltag in einer Raumstation.<br />
Der Kinderbereich ist umgeben von einer semitransparenten Abtrennung. Die erwachsenen Begleiter können<br />
zwar hindurch sehen aber nicht hinein gehen.<br />
Themen und Ablauf<br />
> Vor dem Start und der Blick von Außen<br />
Die Boardkarten für die Mission zum Mars sind bei den 4 bis 10-Jährigen heiß begehrt. Alle anderen dürfen<br />
von außen „heimlich“ zuschauen. Marsforscher und Zuschauer kommen beide auf ihre Kosten.<br />
> Im Startraum – Vorbereitung auf die Mission<br />
Im Startraum stellen die beiden Mentoren schnell fest, dass die jungen Raumfahrer bereits bestens vorbereitet<br />
sind für unsere Mission zum Mars. Dann kann das Abenteuer ja beginnen.<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 13
Im Startraum – Der Flug zum Mars und umkleiden am Spind<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Dicht gedrängt und mit den Beinen in der Luft startet die 30-köpfige Crew in „ihrer“ Rakete zum fernen<br />
Planeten. Wie anstrengend so ein Flug sein kann, merken auch die Jüngsten schnell.<br />
Vor dem Ausstieg muss natürlich Schutzkleidung angelegt werden. Beim Umkleiden zeigt sich bereits, worauf<br />
es ankommt: nur wenn alle sich gegenseitig helfen kann die Expedition gelingen.<br />
> Auf dem Mars – Sammeln von Gesteinsproben<br />
Die Erkundung des Mars fordert motorische Feinfühligkeit und handwerkliches Geschick von den kleinen<br />
Raumfahrern. Kleine Proben vom harten Marsgestein abzuschlagen und diese in den Gürteltaschen zu<br />
sammeln ist gar nicht so einfach, wenn man dicke Handschuhe und einen Helm trägt.<br />
> Im Labor – Untersuchen der Gesteinsproben<br />
Im Labor der Raumstation zahlt sich die harte Arbeit aus. Das selbst gesammelte Gestein zerkleinern und<br />
untersuchen zu dürfen ist für die jungen Astronauten der Höhepunkt ihrer Mission.<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 14
Die Schleuse – Entdecken der Raumstation<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Wo sind eigentlich die anderen Crewmitglieder? Neugierde wird auf dieser Mission belohnt. Am Ende der<br />
Schleuse verbirgt sich ein weiteres Modul.<br />
> Im Wohnmodul – Leben in der Schwerelosigkeit<br />
Im Wohnmodul ist es nicht weniger spannend. Astronautenzahnbürsten mit integrierter Zahnpasta sind ein<br />
beliebtes Mitbringsel von der Raumstation.<br />
> Die Rückkehr zur Erde – Das Crewfoto<br />
Nach einer Stunde geht es wieder zurück zur Erde,<br />
wo die erfolgreichen Marsonauten sich von ihren<br />
Eltern feiern lassen. Manchen gefällt es so gut, dass<br />
sie uns in den darauf folgenden Tagen gleich noch<br />
einmal besuchen.<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 15
Pressestimmen „Space for Kids“<br />
> Die Zeit<br />
29.05.2008<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 16
Leonberger Kreiszeitung<br />
24.05.2008<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 17
Themenmodul 7<br />
DER MARS: Zum Vertiefen<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Eingestreut in den „Rundgang“ finden die Besucher immer wieder Infoterminals. Hier können sie sich in<br />
die ganze Thematik nochmals ungestört „hineinclicken“.<br />
Themen:<br />
>> Marsbeobachtung<br />
>> Erste Schritte<br />
>> Sojourner<br />
>> Spirit und Opportunity<br />
>> Mars Express<br />
>> Phoenix<br />
>> Leben?<br />
>> geplante Marsmissionen<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 18
ZUSATZMODULE<br />
DER MARS: Zum Lesen, Schauen und Hören<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
> Bücherecken<br />
Belletristik:<br />
> Beispiele: Carl Ignaz Geiger: Reise eines Erdbewohners in den Mars; Kurd Laßwitz: Auf zwei Planeten;<br />
H. G. Wells: Krieg der Welten; Edgar Rice Burroughs: John Carter of Mars; Ray Bradbury: Die Mars-Chroniken<br />
Der Mars in Bildern:<br />
> Beispiele: Jim Bell: Postkarten vom Mars. Der erste Fotograf auf dem Roten Planeten; Olivier de Goursac:<br />
Bilder vom Mars; Guillaume Cannat: Der Mars. Bilder vom Roten Planeten<br />
Sachbücher:<br />
> Beispiele: Robert Henseling: Mars. Seine Rätsel und seine Geschichte; Holger Heuseler u.a.: Die Mars<br />
Mission. Pathfinder, Sojourner und die Eroberung des Roten Planeten; <strong>Paul</strong> Raeburn: Mars. Die Geheimnisse<br />
des Roten Planeten; Wernher von Braun: Die Marsexpedition<br />
> Film- und Hörecken<br />
Filme:<br />
> Beispiele: Kampf der Welten, USA 1953, R: Byron Haskin; Krieg der Welten, USA 2005, R: Steven Spielberg;<br />
Unternehmen Capricorn, USA 1978, R: Elliott Gould; Mars Attacks, USA 1996, R: Tim Burton; Mission<br />
to Mars, USA 2000, R: Brian De Palma<br />
Hörspiele:<br />
> Orson Welles: Krieg der Welten<br />
Musik:<br />
> Gustav Holst: Die Planeten<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 19
DER MARS: Zum Spielen und Kaufen<br />
> Spielecken<br />
zur temporären Bespielung mit Betreuung durch Mentoren:<br />
>> Bastelecke: Bau dein Marsmobil!<br />
>> Fotoecke: Ich war auf dem Mars!<br />
>> Malecke: Marsi – mein Freund vom Mars<br />
> Verkaufsstand<br />
>> Marsroboter und Marsmännchen-Figuren<br />
>> „Mars Mud“ und Mars Sand<br />
>> Marsmurmeln und Mars Spielkarten<br />
>> Weltraumschach<br />
>> Marskissen<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 20
Copyright<br />
id3d-berlin themengestaltung<br />
Die in diesem Konzept enthaltenen Empfehlungen, Anregungen und Aufstellungen sind geistiges Eigentum<br />
von id3d-berlin gesellschaft für themengestaltung, Segitzdamm 2, 10969 Berlin.<br />
Ihre ganze oder teilweise Vervielfältigung und/oder Weitergabe an Dritte ist nach geltenden Urhebergesetzen<br />
nicht gestattet. Es gelten die AVG für Kommunikationsdesign.<br />
© Berlin Oktober 2009, id3d-berlin themengestaltung GmbH<br />
DER MARS Vision und Mission // Eine interaktive Ausstellung für alle Marsonauten ab vier Jahren // Drehbuch von Oktober 2009 // Seite 21
Abschließende Erklärung<br />
Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbstständig und<br />
ohne fremde Hilfe angefertigt und keine andere als die angegebene Literatur benutzt habe.<br />
Berlin, den 01. November 2010<br />
<strong>Paul</strong> <strong>Bauer</strong><br />
LXXIII