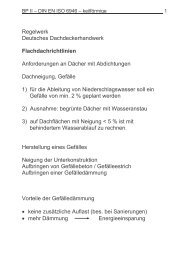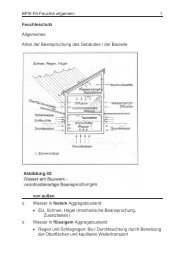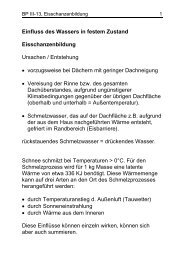F:\Exkursionsführer letzte\Deck
F:\Exkursionsführer letzte\Deck
F:\Exkursionsführer letzte\Deck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Universität Hannover<br />
Exkursion Graubünden<br />
Sommersemester 2002
Programm:<br />
Montag, 20.05.<br />
Anreise<br />
Kunsthaus Bregenz<br />
Chur:<br />
Postautobus-Bahnhof Chur<br />
Bürogebäude Chur<br />
Schutzbauten für römische Funde<br />
Dienstag, 21.05.<br />
Unterwerk Seewis<br />
Gründerzentrum Grüsch<br />
Salginatobel-Brücke Schiers<br />
Sunnibergbrücke Klosters<br />
Davos:<br />
Kirchner Museum<br />
Sportzentrum<br />
Werkhof<br />
Restaurant Vinikus<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
Mittwoch, 22.05.<br />
Brücke Reichenau<br />
Aufbahrungshalle Bonaduz<br />
Haus Truog „Gugalun“ Versam/Safiental<br />
Forstwerkhof Castrisch<br />
Gelbes Haus Flims<br />
Donnerstag, 23.05.<br />
Caplutta da S. Benedegt Sumvitg<br />
Schulerweiterung Vella<br />
Strickbauten Vrin<br />
Valserrheinbrücke Uors - Surcasti<br />
Felsentherme Vals<br />
Freitag, 24.05.<br />
Schulhaus Paspels<br />
Ev. Ref. Kirche Cazis<br />
Brücke Thusis<br />
Punt da Suransuns Viamala<br />
Val-Tschielbachbrücke Donath<br />
Rückreise<br />
Programm
Teilnehmer<br />
Exkursionsteilnehmer:<br />
Beard Adam<br />
Behmann Meike<br />
Böker Annika<br />
Bröcker Isabell<br />
Frerichs Gerd<br />
Frers Sibylle<br />
Fricke Johanna<br />
Furche Alexander<br />
Graff Maren<br />
Hellmers Philipp<br />
Hoffmann Birgit<br />
Janßen Imka<br />
Kalkühler Mirka<br />
Keil Leonie<br />
Kiesrau Grischa<br />
Lokitek Andreas<br />
Monamedi Adel<br />
Mulyanto<br />
von der Osten Peter<br />
Ostermeyer York<br />
Papenberg Gunnar<br />
Petersen Malte<br />
Petters Volker<br />
Raab Alexander<br />
Rau Ulrike<br />
Schmidt Andrea<br />
Schmidt Jan H.<br />
Schmidt Torsten<br />
Schubert Thomas<br />
Speth Martin<br />
Tokarz Bernhard<br />
Voss Jessica<br />
Wehrmann Christian<br />
Wendler Christina<br />
und der Fahrer des Busses
Inhalt:<br />
Graubünden 1<br />
Region, Ort, Architektur - ein Überblick 7<br />
Flims 14<br />
Die Architektur von Rudolf Olgiati 15<br />
Kunsthaus Bregenz 20<br />
Postautostation 27<br />
Verwaltungsgebäude in Chur 31<br />
Schutzbauten für römische Funde 36<br />
Totenhaus / Aufbahrungshalle 38<br />
Haus ´Truog Gugalun´ 41<br />
Forstwerkhof Castrisch 44<br />
´Gelbes Haus´ / Kulturzentrum / Museum 49<br />
Salginatobel-Brücke 54<br />
Gründerzentrum Grüsch 58<br />
Unterwerk Vorderprättigau 61<br />
Sunnibergbrücke 64<br />
Kirchner Museum 72<br />
Sportzentrum Davos 76<br />
Werkhof Davos 78<br />
Um- und Neubau Restaurant Vinikus 79<br />
Schulhaus mit Saal 81<br />
Caplutta Sogn Benedetg 86<br />
Schulanlage Vella 90<br />
Strickbauten Vrin 94<br />
Felsentherme Vals 102<br />
Oberstufenschulhaus Paspels 108<br />
ref. Evangelische Kirche Cazis 113<br />
Spannbandbrücke Pùnt da Suransums 115<br />
Val Tschielbach-Brücke 119<br />
Traversiner Steg 123<br />
Engadiner Nußkuchen 127<br />
Inhalt
Graubünden<br />
Das Land der 150 Täler<br />
Die „Ferienecke der<br />
Schweiz“ lockt mit Superlativen:<br />
150 Täler, 615 Seen,<br />
937 Gipfel. Alleine diese Aufzählung<br />
charakterisiert überdeutlich<br />
den östlichsten der<br />
vier Alpenkantone, der am<br />
Gotthardmassiv mit den anderen<br />
- Wallis, Tessin und<br />
Uri - zusammenstößt: „Eine<br />
eigene Schweiz in der<br />
Schweiz.“ Hier finden sich<br />
Gegensätze, wie sie selbst<br />
die vielfältige Eidgenossenschaft<br />
sonst nicht zu bieten<br />
hat: Ein Höhenunterschied<br />
von fast 3800 m liegt zwischen<br />
dem höchsten und<br />
dem niedrigsten Punkt<br />
Graubündens, der ewig<br />
weissen Spitze des Piz Bernina<br />
(4049 m) und den mediterranenKastanienwäldern<br />
bei San Vittore<br />
(260 m).<br />
Graubündens Enstehung ist<br />
eng mit der der Alpen verknüpft,<br />
die im Tertiär - vor 66<br />
bis 1,5 Mio. Jahren durch<br />
Auffaltung entstanden.<br />
Während der Eiszeiten wurden<br />
die groben Strukturen<br />
feingeschliffen. Bis vor etwa<br />
10.000 Jahren waren praktisch<br />
alle Alpentäler<br />
phasenweise vergletschert,<br />
darunter auch das Rheintal,<br />
dessen Eisstrom sich beim<br />
heutigen Sargans teilte und<br />
in Richtung Bodensee bzw.<br />
Walensee weiterfloss. Hier<br />
entstand ein typisches Trogtal<br />
mit weitem, flachem Boden<br />
und damit die einzige<br />
Stelle des Kantons, die die<br />
Ansiedlung von Industrie ermöglicht<br />
hat (Ems-Chemie<br />
bei Domat/Ems).<br />
Aber auch anderswo läßt<br />
sich die glaziale Vergangenheit<br />
gut erkennen: so z.B. an<br />
Julier- und Flüelapass, die<br />
früher als Transfluenzpässe<br />
die Verbindung zwischen<br />
zwei Gletscherströmen darstellten<br />
und denen die „überfließenden“<br />
Eismassen ihre<br />
charakteristische flache, mit<br />
vielen Seen durchsetzte<br />
Form verliehen. Die Schliffgrenze<br />
der Gletscher - besonders<br />
gut im Oberengadin<br />
am Übergang von rundbuckligen<br />
zu scharfkantigen<br />
Landschaftsformen etwa<br />
1000 m über der Talsohle zu<br />
erkennen - stellt heute meist<br />
Graubünden<br />
die Obergrenze von Skiund<br />
Wandertourismus dar.<br />
Wo früher Gletscher flossen,<br />
bestimmen heute Flüsse<br />
das Bild. Die Lebensader<br />
Graubündens ist der Rhein,<br />
der durch den Zusammenfluss<br />
von Vorder- und Hinterrhein<br />
bei Reichenau entsteht.<br />
Fast zwei Drittel der<br />
Fläche des Kantons liegen<br />
in seinem Einzugsgebiet, lediglich<br />
das Engadin und die<br />
Täler südlich des Alpenhauptkamms<br />
bleiben<br />
außen vor. Dadurch entsteht<br />
die europaweit einmalige<br />
Situation, dass die Gewässer<br />
eines relativ kleinen Gebietes<br />
in drei verschiedene<br />
Meere fließen: der Rhein in<br />
die Nordsee, der Inn (Engadin)<br />
über die Donau ins<br />
Schwarze Meer, Moesa<br />
(Misox), Poschiavino (Puschlav)<br />
und Maira (Bergell)<br />
über den Po und der Rom<br />
(Val Müstair) über die Etsch<br />
in die Adria. In der Nähe des<br />
Septimerpasses kann ein<br />
leichter Windstoß darüber<br />
entscheiden, ob ein Regentropfen<br />
seine Reise zur<br />
Nordsee, zum Schwarzen<br />
Meer oder zum Mittelmeer<br />
antritt.<br />
Über weite Strecken orientiert<br />
sich die politische Grenze<br />
Graubündens an natürlichen<br />
Gegebenheiten: im<br />
Norden an der Gipfelkette<br />
der Glarner Alpen, im Süden<br />
am Alpenhauptkamm. Ausnahmen<br />
bilden Val Müstair,<br />
Puschlav, Bergell und Misox,<br />
die die Südflanken von<br />
Ofen-, Bernina-, Maloja- und<br />
San-Bernardino-Pass sichern.<br />
Ihnen stehen zwei<br />
kleine italienische Enklaven<br />
nördlich der Wasserscheide<br />
gegenüber: das zollfreie Livigno<br />
und das unbesiedelte<br />
Valle di Lei, dessen Gewässer<br />
jedoch mit Hilfe großer<br />
Stauseen seitens der<br />
Schweiz zur Stromerzeugung<br />
genutzt werden. Auch<br />
in anderer Hinsicht spielt der<br />
Alpenhauptkamm für Graubünden<br />
eine entscheidende<br />
Rolle: als Trennlinie zwischen<br />
dem kontinentalen<br />
Klima auf seiner Nord- und<br />
dem mediterran beeinflussten<br />
auf seiner Südseite, der<br />
in diesem Fall auch das Engadin<br />
zuzurechnen ist.<br />
1
Graubünden<br />
2<br />
Durch die inneralpine Lage<br />
sind die Niederschläge insgesamt<br />
relativ niedrig, und<br />
das Unterengadin gehört<br />
neben dem mittleren Rhonetal<br />
zu den trockensten<br />
Regionen der Schweiz. Typisch<br />
für das kontinentale<br />
Klima sind auch die starken<br />
Temperaturunterschiede<br />
zwischen Sommer und<br />
Winter. Für die Temperatur<br />
spielt aber vor allem die<br />
Meereshöhe eine entscheidende<br />
Rolle: Nach einer<br />
Faustregel nimmt sie pro<br />
100 Höhenmeter um ca. 0,5<br />
°C ab. Ein aus dem gesamten<br />
Alpenraum bekanntes<br />
Phänomen ist der Föhn. Er<br />
entsteht, wenn sich die Luftmassen<br />
beim Aufsteigen an<br />
der Südseite der Bergkämme<br />
langsam abkühlen (um<br />
0,5 °C pro 100 m) und dadurch<br />
abregnen. Haben sie<br />
den Kamm überschritten,<br />
erwärmen sie sich auf der<br />
anderen Seite deutlich stärker<br />
(ca. 1 °C pro 100 m) und<br />
bringen trockene Luft und<br />
gute Sicht mit sich. Im Winter<br />
führt ein Föhneinbruch<br />
zum rapiden Abschmelzen<br />
der Schneedecke, doch lassen<br />
die warmen Fallwinde<br />
auch im Domleschg Edelkastanien<br />
wachsen und ermöglichen<br />
in der Bündner<br />
Herrschaft Wein-, Mais- und<br />
Tabakanbau. Chur verdankt<br />
ihnen seine durchschnittlich<br />
nur sieben Nebeltage im<br />
Jahr, die Zürcher oder Berner<br />
vor Neid erblassen lassen<br />
- dort legt sich nämlich<br />
an 34 bzw. 70 Tagen im Jahr<br />
Nebel über die Stadt. Südlich<br />
des Alpenhauptkamms,<br />
so z. B. im Bergell, führt die<br />
Föhnlage aber oft zu starker<br />
Bewölkung, da sich die Luftmassen<br />
an den Bergen<br />
stauen.<br />
Die extreme vertikale Ausdehung<br />
des Kantons - von den<br />
mediterranen Kastanienwäldern<br />
im Misox bis zum ewigen<br />
Eis in der Bernina - zudem<br />
die unterschiedlichen<br />
klimatischen Verhältnisse<br />
bringen es mit sich, dass die<br />
Tier- und Pflanzenwelt<br />
Graubündens sehr vielfältig<br />
ist. Es lassen sich mehr oder<br />
weniger deutlich fünf Vegetationsstufen<br />
unterscheiden:<br />
kolline, montane, subalpine,<br />
alpine und nivale Stufe.<br />
Die kolline Stufe (Hügel-,<br />
untere Waldstufe) unterhalb<br />
800 m macht nur einen sehr<br />
kleinen Bereich Graubündens<br />
aus: Bündner Rheintal,<br />
Domleschg und vorderes<br />
Prättigau sowie die unteren<br />
bis mittleren Regionen<br />
von Misox, Bergell und Puschlav.<br />
Ursprünglich waren<br />
diese Täler von ausgedehnten<br />
Laubmischwäldern bedeckt,<br />
deren Eichen und<br />
Buchen aber größtenteils<br />
der landwirtschaftlichen Nutzung<br />
weichen mussten. So<br />
dominieren heute beispielsweise<br />
in der Bündner<br />
Herrschaft Äcker, Obstgärten<br />
und Weinberge, die<br />
Wälder finden sich nur noch<br />
an den Hängen oder sind zu<br />
Inseln geschrumpft. In den<br />
drei „Südtälern“ nehmen die<br />
Kastanien- und Flaumeichenwälder<br />
immer noch<br />
großen Raum ein. Dies ist<br />
einerseits auf die dünnere<br />
Besiedlung, andererseits auf<br />
die schlechtere Eignung des<br />
Geländes für den Ackerbau<br />
zurückzuführen. Aber auch<br />
die wirtschaftliche Bedeutung<br />
der Edelkastanie als<br />
Nahrungsmittel spielte eine<br />
Rolle.<br />
Die meisten anderen Talund<br />
die unteren Hanglagen<br />
(800-1400 m) gehören der<br />
montanen Stufe (Berg-, mittlere<br />
Waldstufe) an. Die<br />
größtenteils aus Buchen<br />
bestehenden Laubwälder<br />
sind durchsetzt mit Weisstannen<br />
und Föhren. Die<br />
Obergrenze der Höhenstufe<br />
bildet zugleich die Laubwaldgrenze.<br />
Auch hier mussten<br />
die ursprünglichen<br />
Wälder der Landwirtschaft<br />
weichen, wobei mit zunehmender<br />
Höhe immer stärker<br />
die Viehzucht in den Vordergrund<br />
tritt. Nur in günstigen<br />
niedrigeren Lagen - z. B. im<br />
mittleren Prättigau und im<br />
Unterengadin - finden sich<br />
auch heute noch in größerem<br />
Maße Ackerflächen.<br />
Den größten Anteil an der<br />
Fläche des Kantons hat die<br />
subalpine Stufe (Gebirgs-,<br />
obere Waldstufe), der die<br />
mittleren Hanglagen und die<br />
Hochtäler zwischen 1400<br />
und 2400 m wie Engadin,<br />
Landschaft Davos und<br />
Rheinwald angehören. Die<br />
lichten Lärchen- und Arvenwälder<br />
wurden zur Schaffung<br />
von Weideland teil-
weise gerodet, was besonders<br />
deutlich in St. Antönien<br />
und im Rheinwald zu sehen<br />
ist, wo nun der Bannwald als<br />
Lawinenschutz fehlt. Diese<br />
Höhenstufe kann mit der<br />
vielfältigsten Flora aufwarten.<br />
Dazu tragen auch die<br />
von Menschenhand geschaffenen<br />
Fettwiesen bei,<br />
die durch regelmäßiges Mähen<br />
und Düngen entstehen.<br />
Oberhalb von 2400 m ist<br />
kein Wald mehr anzutreffen.<br />
In der alpinen Stufe (Hochgebirgs-,<br />
Rasenstufe) fristen<br />
allenfalls noch einzelne Arven,<br />
Föhren oder Erlen ein<br />
karges Dasein. Aber auch<br />
hier entfaltet sich noch eine<br />
reiche Blütenpracht, deren<br />
prominenteste Vertreter Enzian<br />
und Edelweiss sind. Die<br />
Sommer dauern im<br />
Hochgebirge teilweise nur<br />
drei bis vier Monate. Je weiter<br />
es hinauf geht, desto lükkenhafter<br />
werden die Rasen,<br />
nach und nach finden<br />
sich nur noch kleine Vegetationsinseln<br />
in Schutthalden<br />
und zwischen<br />
Gesteinsblöcken. In den<br />
obersten und exponiertesten<br />
Lagen der alpinen Stufe<br />
können nur noch Flechten<br />
und Moose existieren,<br />
dort dominiert die Hochgebirgstundra.<br />
Oberhalb von 3000 m geht<br />
dann nichts mehr: In der nivalen<br />
Stufe können selbst<br />
die anspruchslosesten und<br />
niedersten Pflanzen nicht<br />
mehr überleben. Hier gibt es<br />
nur noch Fels, Eis und<br />
Schnee.<br />
Insgesamt ist die Tierwelt<br />
Graubündens nicht nur weniger<br />
vielfältig als die Pflanzenwelt,<br />
sondern sie ist<br />
auch weniger auffällig. Zu<br />
den berühmtesten Vertretern<br />
der Tierwelt gehört das<br />
Wappentier Graubündens,<br />
der Steinbock, der in den<br />
unzugänglichen Felsregionen<br />
oberhalb der Baumgrenze<br />
lebt. Sein deutlich<br />
weniger klettergewandtes<br />
Gegenstück in den etwas<br />
tieferen Lagen ist die Gemse.<br />
Alpidylle im Schatten von<br />
Staudämmen - Wirtschaft<br />
Man könnte meinen, Graubünden<br />
habe das industrielle<br />
Zeitalter verschlafen, da<br />
kaum ein anderer Kanton<br />
Graubünden<br />
der Schweiz so wenig industrialisiert<br />
ist, was natürlich<br />
zu einem großen Teil an den<br />
bereits beschriebenen topographischen<br />
Bedingungen<br />
liegt. Der einzige nennenswerte<br />
Industriebetrieb ist die<br />
Ems-Chemie im Bündner<br />
Rheintal, die vor allem Fasern<br />
für die traditionell in der<br />
Ostschweiz (besonders um<br />
St. Gallen) starke Textilbranche<br />
herstellt. Von den mittelständischen<br />
Unternehmen,<br />
die sich größtenteils ebenfalls<br />
um Chur konzentrieren,<br />
ist die zum Heineken-Konzern<br />
gehörende Calanda-<br />
Brauerei eines der bekanntesten.<br />
Die wichtigste ökonomische<br />
Stütze des Kantons ist nach<br />
dem Tourismus die Stromwirtschaft.<br />
Nur in Österreich<br />
und Skandinavien wird ein<br />
ähnlich hoher Anteil des gesamten<br />
Energiebedarfs wie<br />
in der Schweiz (ca. 15 %)<br />
durch Wasserkraft erzeugt.<br />
Die größten und leistungsfähigsten<br />
Kraftwerke<br />
liegen im Wallis und in Graubünden<br />
und erzeugen zusammen<br />
etwa die Hälfte der<br />
hydroelektrischen Energie in<br />
der Schweiz. Die meisten<br />
der insgesamt 36 Speicherseen<br />
Graubündens liegen<br />
versteckt in abgeschiedenen,<br />
hochgelegenen Seitentälern.<br />
Einige andere, wie<br />
z.B. Lago Bianco am Berninapass,<br />
Sufner See im<br />
Rheinwald und Marmorera-<br />
See im Oberhalbstein, wurden<br />
so gut in die Landschaft<br />
eingepasst, dass sie ihr einen<br />
besonderen Reiz verleihen;<br />
der Heidsee auf der<br />
Lenzerheide ist als Freizeitfläche<br />
außerdem für den<br />
Tourismus von Bedeutung.<br />
Die beiden Talsperren mit<br />
dem größten Fassungsvermögen,<br />
Lago di Lei und<br />
Lago di Livigno, liegen zwar<br />
auf italienischem Gebiet, die<br />
Stromerzeugung erfolgt jedoch<br />
in der Schweiz.<br />
Megaprojekte bei Sils und<br />
im Rheinwald in der ersten<br />
Hälfte des 20. Jh. scheiterten<br />
am Widerstand der Bevölkerung.<br />
Teilweise wurden<br />
Täler zerstört oder verschandelt,<br />
wie das Spöltal<br />
Ende der 50er Jahre. Die<br />
ausgeprägte Nutzung regenerativer<br />
Energien leistet einen<br />
wichtigen Beitrag zum<br />
3
Graubünden<br />
4<br />
Umweltschutz. Einen weiteren<br />
Schritt in diese Richtung<br />
stellt das 1993 eröffnete erste<br />
Solarkraftwerk der<br />
Schweiz bei Disentis dar.<br />
Die lila Kuh kommt zwar aus<br />
dem Berner Oberland, doch<br />
auch in Graubünden gehören<br />
glückliche Kühe in einer<br />
idyllischen Alplandschaft<br />
zum Klischee. Immer noch<br />
ist die Viehwirtschaft hier ein<br />
wichtiger Wirtschaftszweig,<br />
in dem gleichwohl nur noch<br />
6 % der Beschäftigten tätig<br />
sind. Der Ackerbau hingegen<br />
konnte mit der ausländischen<br />
Konkurrenz nicht<br />
mithalten. Das Idyll vom heuenden<br />
Senn in der freien<br />
und gesunden Natur ist aber<br />
heute genauso eine Illusion<br />
wie vor 100 Jahren. Die<br />
Mechanisierung, deren Beginn<br />
Ende des 19. Jh. eine<br />
erste Krise und damit eine<br />
große Abwanderungsbewegung<br />
aus den<br />
abgelegenen Tälern auslöste,<br />
hat einiges verändert:<br />
Die Rinder müssen nicht<br />
mehr aufwendig auf den Alpen<br />
gesommert werden,<br />
sondern das Heu kann ins<br />
Tal transportiert werden,<br />
Käse- und Milchproduktion<br />
wurden vielfach rationalisiert.<br />
Dennoch hat sich vielerorts<br />
die traditionelle Alpwirtschaft<br />
erhalten.<br />
Generell sind zwei Trends<br />
zu beobachten. Einerseits<br />
hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe in<br />
den letzten 50 Jahren etwa<br />
halbiert, da sie trotz umfangreicher<br />
Subventionen nur ab<br />
einer gewissen Größe konkurrenzfähig<br />
sind. Andererseits<br />
ist eine immer stärkere<br />
Ablehnung moderner<br />
Errungenschaften in der<br />
Viehhaltung zu spüren. Was<br />
in den 70er Jahren damit<br />
begann, dass Aussteiger für<br />
einen oder zwei Sommer<br />
zum Senn mutierten, hat<br />
sich konsequent<br />
weiterentwickelt: Heute ist<br />
etwa ein Drittel aller landwirtschaftlichen<br />
Betriebe Graubündens<br />
biologisch ausgerichtet.<br />
Der Vergleich mit der<br />
gesamten Schweiz, wo es<br />
nur 5 % sind, verdeutlicht die<br />
Vorreiterrolle des Kantons.<br />
Die Speerspitze des ökologischen<br />
Fortschritts bildet<br />
dabei das Rheinwald, eine<br />
der am stärksten agrarisch<br />
geprägten Regionen, wo<br />
noch etwa ein Fünftel der<br />
Beschäftigten ihren Unterhalt<br />
im Primärsektor verdienen.<br />
Seit 1991 wurden hier<br />
konsequent Milch- und<br />
Fleischproduktion nach biologischen<br />
Kriterien eingeführt.<br />
Andere Gemeinden<br />
folgten dem Beispiel, als sich<br />
zeigte, dass die Konsumenten<br />
für natürlichere Qualität<br />
auch einen höheren Preis<br />
zu zahlen bereit waren.<br />
Doch der moderne Landwirt<br />
ist nicht nur Bauer, sondern<br />
er bekommt auch eine immer<br />
wichtigere Stellung im<br />
Tourismus - sei es als Veranstalter<br />
von Pferde- oder<br />
Maultiertrekking, als Betreiber<br />
einer touristisch erschlossenen<br />
Ziegenalp oder<br />
einfach, indem er Ferien auf<br />
dem Bauernhof anbietet.<br />
Wer neue Wege geht, soll<br />
aber nicht nur durch den<br />
wirtschaftlichen Erfolg belohnt<br />
werden. Einen zusätzlichen<br />
Anreiz stellt der 1995<br />
ins Leben gerufene, alle<br />
zwei Jahre verliehene lnnovationspreis<br />
Landwirtschaft<br />
und Tourismus dar.<br />
Die Entwicklung des Tourismus<br />
Die Wurzeln des Tourismus<br />
im heutigen Graubünden<br />
reichen bis ins 16. Jh. zurück,<br />
als Papst Leo X. allen<br />
Gläubigen beim Besuch der<br />
Quellen von St. Moritz die<br />
„volle Absolution sämtlicher<br />
Sünden“ versprach und der<br />
berühmte Arzt Paracelsus<br />
selbige Quellen sowie die<br />
von Scuol in den höchsten<br />
Tönen lobte. Insofern hat<br />
sich eigentlich bis heute<br />
nichts geändert: Die Mineralbäder<br />
von Scuol werden<br />
mehr denn je zur Steigerung<br />
des Wohlbefindens aufgesucht,<br />
und St. Moritz ist<br />
immer noch Pilgerziel - allerdings<br />
ohne die Absolution<br />
zu bekommen.<br />
Über Jahrhunderte blieben<br />
zunächst die Quellen Hauptanziehungspunkte<br />
in Graubünden.<br />
Neben dem Baden<br />
wurde besonders dem Trinken<br />
des mineral-haltigen<br />
Wassers eine große Bedeutung<br />
zugemessen. Bis Mitte<br />
des 19. Jhr. zog Graubünden<br />
aber insgesamt nur wenige<br />
Gäste an, sondern war<br />
aufgrund seiner Pässe vor
allem ein Transitland. Auch<br />
Goethe hielt sich 1788 auf<br />
seiner Rückreise von Italien<br />
dort nicht länger auf, obwohl<br />
er die Viamala passierte. Die<br />
wenigen frühen Reisenden,<br />
die aus Interesse an Land<br />
und Leuten kamen, waren<br />
zumeist Engländer. Ihrem<br />
Reisedrang ist es zu verdanken,<br />
dass in den 1860er<br />
Jahren in den Alpen überhaupt<br />
ein Tourismus entstand.<br />
Ein Gipfel nach dem<br />
anderen wurde von ihnen<br />
„erobert“. Das Goldene Zeitalter<br />
des Alpinismus, das<br />
auch an Orten wie Davos,<br />
St. Moritz und Pontresina<br />
nicht spurlos vorüberging,<br />
erlebte mit der Erstbesteigung<br />
des Matterhorns<br />
durch Edward Whymper<br />
1865 seinen Höhepunkt. Im<br />
selben Jahr begann in St.<br />
Moritz der Siegeszug des<br />
Wintersports, ausgelöst<br />
durch den Hotelier Johannes<br />
Badrutt.<br />
Um die gleiche Zeit aber<br />
begann es auch wieder vermehrt<br />
Patienten in die Berge<br />
zu ziehen, denn der Arzt<br />
Alexander Spengler hatte<br />
die heilende Wirkung des<br />
trockenen Hochgebirgsklimas<br />
für Tuberkulosekranke<br />
erkannt. Besonders um die<br />
Jahrhundertwende schossen<br />
die Sanatorien in Davos<br />
und Arosa wie Pilze aus<br />
dem Boden, und Thomas<br />
Mann setzte ihnen mit dem<br />
Roman „Zauberberg“ ein<br />
unsterbliches Denkmal.<br />
Bereits um 1900 war so aus<br />
dem Tourismus ein wichtiger<br />
Wirtschaftszweig für den<br />
Kanton geworden, der jedoch<br />
durch die beiden Weltkriege<br />
deutliche Einbrüche<br />
erlitt. In den 50er Jahren<br />
setzte dann der Boom ein:<br />
Das deutsche<br />
Wirtschaftswunder machte<br />
Auslandsreisen erschwinglicher,<br />
in den Bergen<br />
lockte eine vermeintlich<br />
heile Welt, und schließlich<br />
wurde auch der Wintersport<br />
immer populärer. Die folgenden<br />
goldenen Jahrzehnte<br />
verhalfen Graubünden zu<br />
einer guten allgemeinen Infrastruktur,<br />
doch hinterliessen<br />
sie auch tiefe Narben:<br />
Autolawinen schieben sich<br />
vielfach durch die Orte, planierte<br />
Skipisten und zerstörte<br />
Bergflora, Staudämme<br />
Graubünden<br />
riegeln entlegene Täler ab,<br />
historische Bausubstanz<br />
wich neuen Hotel- oder<br />
Apartmentkomplexen. Inzwischen<br />
kommen auf jeden<br />
Bündner sechs Gästebetten.<br />
Doch man hat aus<br />
Fehlern gelernt und versucht<br />
heute mehr Rücksicht<br />
auf die Umwelt zu nehmen.<br />
Natürlich sind nicht alle Sünden<br />
der vergangenen Jahrzehnte<br />
rückgängig zu machen.<br />
Dieser Aufschwung<br />
hat viele Bergdörfer gerettet,<br />
die andernfalls entvölkert<br />
dem Verfall preisgegeben<br />
wären, siehe die wirtschaftlich<br />
bedingte Abwanderungswelle<br />
Ende des 19.<br />
Jhr.. Jahrzehntelang war<br />
Graubünden im Sommer<br />
ein Land der Wanderer und<br />
Bergsteiger, im Winter der<br />
Skiläufer. Dass sich aber mit<br />
einem beschränkten Angebot<br />
immer weniger Menschen<br />
anziehen lassen, war<br />
die bittere Erkenntnis der<br />
späten 80er und frühen<br />
90er Jahre. Es wurde viel<br />
modernisiert, verändert, um<br />
den Gästen zu zeigen, dass<br />
die „Ferienecke der<br />
Schweiz“ mehr zu bieten hat<br />
als schöne Landschaft.<br />
Mountain- und Downhillbiking,<br />
Surfen, Rafting, Canyoning<br />
und Hydrospeed,<br />
Paragliding und Deltafliegen<br />
sind nur einige der angebotenen<br />
Trendsportarten. Im<br />
Winter tummeln sich heutzutage<br />
Snowboarder, Carver<br />
und Skwaler auf den Pisten.<br />
Nicht alles wird schneller<br />
und spektakulärer, sondern<br />
auch eine gegenläufige<br />
Entwicklung ist zu beobachten<br />
- eine Art Entdekkung<br />
der Langsamkeit - des<br />
ruhigen, teils nostalgischen<br />
Genießens. Es entstanden<br />
neue Golfplätze und im Bereich<br />
Wellness haben das<br />
Bogn Engiadina in Scuol<br />
und die Felsen-Therme in<br />
Vals neue Maßstäbe gesetzt.<br />
Die Rhätische Bahn<br />
mit ihrer beeindruckenden<br />
Streckenführung und den<br />
traditionell roten Zügen gewinnt<br />
immer mehr Freunde.<br />
Die Verbindung von<br />
Landwirtschaft und Tourismus<br />
wird auch immer enger,<br />
Ferien auf dem Bauernhof<br />
sind wieder „in“. Die Bauern<br />
verpachten nicht mehr nur<br />
im Winter ihre Wiesen an die<br />
5
Graubünden<br />
6<br />
Bergbahngesellschaften,<br />
sondern sie haben ihre<br />
Chancen entdeckt, schalten<br />
sich immer aktiver in das<br />
Geschehen ein, versuchen<br />
Marktlücken aufzuspüren.<br />
Aber nicht allein das Angebot<br />
wurde erweitert, sondern<br />
auch die Strukturen<br />
mussten sich verändern.<br />
Größere Hotels öffnen teilweise<br />
wegen der immens<br />
hohen Personalkosten ausschließlich<br />
in der rentableren<br />
Wintersaison oder nehmen<br />
zumindest im Sommer nur<br />
die Spitzenzeiten mit. Die<br />
Orte einer Region gehen<br />
eine engere Zusammenarbeit<br />
ein, um ihre Marktposition<br />
zu stärken; die einzelnen<br />
Orte werden immer<br />
mehr als Marken präsentiert.<br />
All diese Anstrengungen<br />
sind notwendig geworden,<br />
um das Überleben zu sichern,<br />
denn kantonsweit<br />
hängen über die Hälfte der<br />
Arbeitsplätze mehr oder<br />
weniger direkt vom Fremdenverkehr<br />
ab - in Arosa<br />
oder St. Moritz sind es sogar<br />
neun von zehn Stellen.<br />
Damit ist der Tourismus zum<br />
Lebenselixier einer ganzen<br />
Region geworden.<br />
Steckbrief Graubünden<br />
Lage:<br />
zwischen 46°10' und 47°4'<br />
nördl. Breite, 8°39' und<br />
10°29' östl. Länge;<br />
Nord-Süd-Ausdehnung 100<br />
km,<br />
Ost-West-Ausdehnung<br />
141km<br />
Fläche:<br />
mit 7106 km² der größte<br />
Kanton der Schweiz<br />
(17,21% der gesamten Landesfläche)<br />
Höchster Punkt:Piz Bernina<br />
(4049 m)<br />
Tiefster Punkt: Grenze<br />
zum Tessin bei San Vittore/<br />
Valle<br />
Mesoicina (260m)<br />
Einwohner:<br />
ca. 186.000; davon ca. 14%<br />
Ausländer<br />
Bevölkerungsdichte:<br />
mit etwa 26 Einwohnern/<br />
km² der am<br />
dünnsten besiedelte Kanton<br />
der Schweiz<br />
Hauptstadt:<br />
Chur (ca. 33 000 Einwohner)<br />
Gliederung:<br />
213 Gemeinden, 39 Kreise,<br />
14 Bezirke<br />
Sprachen:<br />
Deutsch ca. 65 %, Rätoromanisch<br />
ca. 17 %,<br />
Italienisch ca. 11 %, Sonstige<br />
knapp 7 %,<br />
tendenziell deutlicher Rückgang<br />
von Rätoromanisch<br />
und Italienisch<br />
Bodennutzung: landwirtschaftliche<br />
Nutzflächen ca.<br />
31 %,<br />
Wälder ca. 25 %, Siedlungsflächen<br />
knapp 2 %,<br />
unproduktive Flächen ca.<br />
42%<br />
Beschäftigungsstruktur:<br />
Landwirtschaft ca. 6 %,<br />
Industrie ca. 26 %,<br />
Dienstleistungen ca. 64 %<br />
etwa jeder 5. Arbeitsplatz ist<br />
unmittelbar, jeder 2. mittelbar<br />
vom Tourismus abhängig<br />
Tourismus:<br />
jährlich ca. 3,5 Mio. Gäste,<br />
die im Durchschnitt 3- 4<br />
Tage an einem Ort bleiben<br />
Pro-Kopf-Einkommen etwa<br />
37 500 SFr.<br />
(Gesamt-Schweiz: etwa<br />
42500 SFr.)
Region, Ort, Architek-<br />
tur – ein Überblick<br />
In letzter Zeit ist verschiedentlich<br />
von einer Bündner<br />
Architekturszene oder gar<br />
der Bündner Schule die<br />
Rede, die mit den Entwicklungen<br />
im Tessin und in Basel<br />
verglichen wird. Auftrieb<br />
erhielt das Interesse durch<br />
die Auszeichnungen und<br />
Publikationen zum Neuen<br />
Bauen in den AIpen. Tatsächlich<br />
lässt sich in Graubünden<br />
nach den international<br />
ausgerichteten Sechziger-<br />
und Siebzigerjahren<br />
eine wachsende Zahl von<br />
Bauten feststellen, die eine<br />
differenzierte Anknüpfung<br />
an Ort und Geschichte<br />
sucht. Quantitativ immer<br />
noch verschwindend klein,<br />
steht sie der Obermacht einer<br />
nostalgischen<br />
Tourismusarchitektur gegenüber,<br />
die Formen alter<br />
Bauernhäuser imitiert, aufbläst<br />
und verstümmelt. Die<br />
zwischen 1985 und 1988<br />
entstandenen Holzbauten<br />
von Peter Zumthor in Haldenstein,<br />
im Churer Welschdörfli<br />
und vor allem in Sogn<br />
Benedetg sind als Signale<br />
eines neuen Regionalismus<br />
verstanden und aufgenommen<br />
worden. Der Begriff der<br />
Ortsbezogenheit trifft die<br />
Sache allerdings besser, da<br />
nicht Vorstellungen regionaler<br />
Abgeschlossenheit gemeint<br />
sind. Die folgenden<br />
Zeilen möchten den architekturhistorischenHintergrund<br />
aktueller Haltungen<br />
beleuchten. Im Mittelpunkt<br />
steht dabei das Verhältnis<br />
der Architektur zu Region<br />
und Ort.<br />
Heimatstil<br />
Ansätze einer regionalen<br />
Architektur sind in Graubünden<br />
stets auf große Zustimmung<br />
gestossen.<br />
Dies hängt mit dem Geschichtsbewusstseineines<br />
Kantons zusammen,<br />
der bis zur Helvetik einen<br />
eigenen Staat bildete und<br />
als dreisprachiges Land<br />
auf seine Eigenart bedacht<br />
ist. 1905 wurde die<br />
Schweizerische Vereinigung<br />
für Heimatschutz gegründet<br />
und noch im gleichen<br />
Jahr die Bündner<br />
Sektion. Die Anfänge der<br />
Bewegung fielen mit der<br />
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
Blütezeit des Tourismus<br />
vor dem 1. Weltkrieg zusammen.<br />
Im Sinne des<br />
Gesamtkunstwerks entwickelte<br />
sich ein regionaler<br />
Heimatstil, der alle Gattungen<br />
der Bildenden Künste<br />
einbezog. Einflussreichste<br />
Architekten waren<br />
Nicolaus Hartmann jun. in<br />
St. Moritz sowie Otto Schäfer<br />
und Martin Risch in<br />
Chur. Als Vorbilder bevorzugte<br />
man malerische<br />
Beispiele einheimischer<br />
Architektur, in erster Linie<br />
alte Bauernhäuser und<br />
herrschaftliche Barockbauten.<br />
Auch bei den baulichen<br />
Anforderungen des<br />
Tourismus forderte der<br />
Heimatschutz eine Anpassung<br />
an die traditionelle<br />
Baukultur. Gepriesen wurde<br />
die Linienführung der<br />
Albulabahn zwischen Preda<br />
und Bergün, die mit ihren<br />
steinernen Brückenbauten<br />
und Viadukten die<br />
Landschaft nicht störe,<br />
sondern bereichere. Die<br />
stolzen Grand-Hotels der<br />
Gründerzeit, die die Verbreitung<br />
von städtischen<br />
Architekturvorstellungen in<br />
den Bergen repräsentieren,<br />
wurden zum Feindbild<br />
deklariert.<br />
Die auf regionale und nationale<br />
Eigenständigkeit bedachte<br />
romantische Richtung<br />
nach 1900 ist ein internationales<br />
Phänomen.<br />
Grundlage bildete die englische<br />
Kunstgewerbereform<br />
von John Ruskin und William<br />
Morris. Eine entscheidende<br />
Rolle spielte Finnlands<br />
„Nationale Romantik“,<br />
die Formen des Jugendstils<br />
mit solchen eigener Traditionen<br />
verband. Die Bündner<br />
Bewegung stand ideologisch<br />
unter dem Einfluss<br />
deutscher Kunsterziehung.<br />
Martin Risch und Nicolaus<br />
Hartmann waren von süddeutschenHochschullehrern<br />
geprägt: Risch studierte<br />
in München bei Friedrich<br />
von Thiersch, Hartmann in<br />
Stuttgart bei Theodor Fischer.<br />
Der Heimatstil jener Zeit hat<br />
seine schöpferischen und<br />
seine klischeehaften Seiten.<br />
Die Qualitäten zeigen sich<br />
7
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
8<br />
dort, wo freier mit baulichen<br />
Vorbildern umgegangen<br />
wird. Die Problematik<br />
liegt in der Stilisierung alter<br />
Bauernhäuser zum<br />
gültigen Bautypus einer<br />
Region und in der Ablehnung<br />
neuer Formen für<br />
neue Aufgaben. Diese Auffassung<br />
führte bei Hotelbauten<br />
im Engadin zur Kaschierung<br />
der großen Kubaturen<br />
durch hohe Dächer,<br />
Trichterfenster, Erker<br />
und altertümlich wirkende<br />
Unregelmäßigkeit. Die dadurch<br />
erzeugte malerische<br />
Wirkung wird durch das<br />
Vorzeigen einheimischer<br />
Baumaterialien wie Tuffstein,<br />
Granit und Fexer<br />
Steinplatten noch gesteigert.<br />
Der Widerspruch<br />
zwischen alten Formen<br />
und neuen Aufgaben zeugt<br />
von einer Identitätskrise.<br />
Auf der ästhetischen Ebene<br />
ist er Ausdruck der<br />
Sehnsucht nach einheitlichen<br />
Dorfbildern, die in der<br />
Vergangenheit einheitlichen<br />
Wirtschaftsweisen<br />
entsprachen. Auf der gesellschaftlichen<br />
Ebene erinnert<br />
er an verlorenes ursprüngliches<br />
Leben im Zustand<br />
bäuerlicher Selbstversorgung.<br />
Rationalismus in Davos<br />
Im Unterschied zur breiten<br />
Streuung des Heimatstils<br />
konnte sich das international<br />
ausgerichtete Neue Bauen<br />
der Zwischenkriegszeit in<br />
Graubünden nur punktuell<br />
entfalten. Dies hängt einerseits<br />
mit der Wirtschaftskrise,<br />
anderseits wohl mit mangelnder<br />
ästhetischer Annahme<br />
dieser Moderne zusammen.<br />
In Davos ist es dem<br />
Architekten Rudolf Gaberel<br />
zusammen mit dem Kunsthistoriker<br />
Erwin Poeschel<br />
und dem Landammann Erhard<br />
Branger gelungen, die<br />
rationale Richtung heimisch<br />
werden zu lassen. Die Begründungen<br />
für die neue<br />
Architektur erfolgten auf<br />
pragmatischer Ebene. Gaberel<br />
propagierte das durch<br />
einen niedrigen Hohlraum<br />
von der Decke des obersten<br />
Geschosses getrennte<br />
Flachdach als ideale Konstruktion<br />
für das Hochgebirgsklima.<br />
Charakteristikum<br />
seiner Architektur ist eine<br />
additive Gliederung durch<br />
Kuben sowie eine klassizistische<br />
Tendenz zu Symmetrisierung<br />
und Frontalität.<br />
Wahrzeichen der Davoser<br />
Moderne wurden neben<br />
den unterlüfteten Flachdächern<br />
integrierte, stützenlos<br />
durchlaufende Loggien.<br />
Die umfassendste Anwendung<br />
fanden diese Motive<br />
im Bautyp des Sanatoriums;<br />
das am klarsten ausformulierte<br />
Beispiel ist Gaberels<br />
Zürcher Heilstätte in Clavadel<br />
(1931-32). Die Loggien<br />
entsprechen lokaler Sanatoriumstradition.<br />
Als Räume<br />
der Freiluft-Liegekur und<br />
Heliotherapie stehen sie für<br />
den Kampf gegen die Tuberkulose.<br />
In einem direkten<br />
Sinn erfüllen sie die Hygieneforderung<br />
des Neuen<br />
Bauens nach Licht, Luft und<br />
Sonne. Die Berglandschaft<br />
mutiert von der sentimentalen<br />
Kulisse zum nützlichen<br />
Ort der Genesung.<br />
Nachkriegsregionalismus<br />
Im Wirtschaftsaufschwung<br />
der Nachkriegszeit bildete<br />
sich ein Regionalismus aus,<br />
der eine Synthese zwischen<br />
internationaler Moderne und<br />
alter Bauernhausarchitektur<br />
anstrebte. Beiträge dazu leisteten<br />
Ulrich Könz, Bruno<br />
Giacometti und Rudolf Olgiati.<br />
Auf der Suche nach<br />
Referenzbauten holte Olgiati<br />
am weitesten aus. Vorbilder<br />
waren neben der traditionellen<br />
Bauweise Graubündens<br />
die mediterrane Architektur<br />
Griechenlands und die Klassische<br />
Moderne Le Corbusiers.<br />
In der Verbindung dieser<br />
Einflüsse zu einem Individualstil<br />
äußert sich das<br />
Verlangen, das Regionale<br />
mit dem Allgemeinen zusammenzuführen.Während<br />
sich die Hochbauten<br />
der Rhätischen Bahn an die<br />
bäuerliche Bauweise der jeweiligen<br />
Täler halten, zeigen<br />
Olgiatis Bauten diese Unterscheidung<br />
nicht. Regionalismus<br />
bezieht sich hier auf<br />
den Kanton als Ganzes.<br />
Unabhängig vom Standort<br />
wurden traditionelle Elemente<br />
aus der Surselva, aus<br />
dem Engadin und aus den<br />
italienisch-sprachigen Südtälern<br />
eingesetzt.<br />
Gestalterisch ist die Synthe-
se Olgiatis vom Streben<br />
nach körperhafter Individualität<br />
geprägt, die auf unregelmäßigen<br />
Grundrissen<br />
und Massenverteilungen<br />
gründet. Die scharf begrenzten<br />
Mauerteile erscheinen<br />
glatt verputzt und<br />
weiß gekalkt. Das Dach tritt<br />
nur wenig vor oder bleibt<br />
hinter den aufragenden<br />
Fassaden zurück. Die<br />
Fenster variieren in Grösse<br />
und Anordnung, Korbbogen,<br />
Säulen sowie Fassaden-<br />
und Dachausschnitte<br />
tragen zur plastischen<br />
Wirkung bei. Eine<br />
sinnliche Beziehung zum<br />
Material drückt sich im Kalken,<br />
in der Vorliebe für Holzfenster,<br />
Steinplattendächer<br />
und alte Bauteile sowie in<br />
der gelegentlichen Verwendung<br />
von Sichtbeton aus.<br />
Das Dilemma des Heimatstils,<br />
neue Aufgaben in alte<br />
Formen zu hüllen, besteht<br />
auch bei Olgiati. Als Vorwärtsstrategie<br />
kann man die<br />
Unbefangenheit interpretieren,<br />
mit der er Ansprüche<br />
modernen Komforts wie<br />
Garage und Hallenbad integrierte.<br />
Die Wirkung des<br />
Körperhaften ist bei jenen<br />
Bauten am stärksten, die<br />
am zurückhaltendsten instrumentiert<br />
sind. Olgiatis<br />
Bedeutung für die Bündner<br />
Gegenwartsarchitektur liegt<br />
vor allem im Postulat der<br />
Plastizität, in der Betonung<br />
der Sinnlichkeit des Materials<br />
und in der Vermittlung<br />
des Interesses an der alten<br />
Baukultur. Die große Beachtung,<br />
die sein Werk<br />
fand, hat zudem gezeigt,<br />
dass es möglich ist, in<br />
Graubünden zu arbeiten<br />
und doch überregional<br />
wahrgenommen zu werden.<br />
Anschauung und Entwicklung<br />
In neuerer Zeit kann man<br />
eine Abkehr von der Konzeption<br />
der an Regionen<br />
gebundenen Bautypen feststellen.<br />
Neues Stichwort ist<br />
der Ort, der seine Überhöhung<br />
im Begriff des Genius<br />
loci fand. Vorerst mag es<br />
paradox erscheinen, dass<br />
die geographisch engere<br />
Bezeichnung welthaltiger<br />
ist: Ort meint nicht mehr die<br />
Idee des Sonderfalls eines<br />
bestimmten Landesteils,<br />
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
sondern die konkrete, erfahrene<br />
Wirklichkeit. Mit<br />
Region verbindet sich Kollektives,<br />
mit Ort auch Individuelles.<br />
Daraus leitet sich<br />
die Forderung ab, auf den<br />
Ort in seiner Alltäglichkeit<br />
und Erhabenheit einzugehen.<br />
Bedeutsam für diesen<br />
Ansatz waren die Erfahrungen<br />
der Tessiner Tendenza,<br />
die Stadttheorien von<br />
Aldo Rossi und die Analoge<br />
Architektur um Fabio<br />
Reinhart und Miroslav Sik.<br />
Bei den italienischsprachigen<br />
Tälern Graubündens<br />
stehen das Misox und das<br />
Puschlav unter Einfluss<br />
der Tessiner Architektur. Im<br />
nördlichen Graubünden<br />
wurde Peter Zumthor Protagonist<br />
einer phänomenologischen<br />
Auffassung, die<br />
in seinen Werken und Texten<br />
zum Ausdruck kommt.<br />
Zumthors Atelier in Haldenstein<br />
und die Analoge<br />
Schule an der ETH stellten<br />
sich als Ausgangspunkte<br />
für das Schaffen einiger<br />
jüngerer Architekten heraus.<br />
Der architektonischen<br />
Rhetorik hält Peter<br />
Zumthor in seinen Texten<br />
die Gegenwart der Dinge<br />
entgegen. Die Suche gilt<br />
dem Einfachen, Wesentlichen,<br />
Reduzierten. Die Zurückhaltung<br />
will Emotionen<br />
entstehen lassen,<br />
statt sie durch Zeichenhaftigkeit<br />
vorwegzunehmen.<br />
Zumthor scheut sich nicht,<br />
von Gefühlen zu sprechen,<br />
von der Gültigkeit des Subjektiven,<br />
Authentischen. Als<br />
Wurzeln des eigenen Ichs<br />
sind bei ihm Kindheitserinnerungen<br />
Wirklichkeit,<br />
nicht Anekdote. Die Naivität<br />
des Kindes steht für die<br />
entdeckende Neugierde.<br />
Dass die Bereitschaft zur<br />
Offenheit und Entwicklung<br />
kein leeres Wort ist, belegen<br />
die Bauten des Architekten.<br />
Das Interesse an<br />
der Versöhnung von Verstand<br />
und Gefühl drückt<br />
sich in der sinnlichen Beziehung<br />
zu Typologie, Konstruktion<br />
und Material, in<br />
der handwerklichen Umsetzung<br />
und im Blick auf<br />
die benachbarten Künste<br />
aus. Die Gedanken der<br />
Poesie, die der Stille bedarf,<br />
und des Bauwerks<br />
als Ort in der Unendlichkeit<br />
9
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
10<br />
verweisen auf Metaphysisches.<br />
Architektur wird<br />
zum melancholischen Gefäß<br />
für das vorbeiziehende<br />
Leben und zum Widerstand<br />
gegen das Unwesentliche.<br />
Bauen am Ort<br />
Die Anfänge der Architektur<br />
Peter Zumthors führen in<br />
die Val Lumnezia, wo der<br />
damalige Mitarbeiter der<br />
kantonalen Denkmalpflege<br />
in den Siebzigerjahren<br />
das Siedlungsinventar<br />
durchführte. Aus diesen<br />
Kontakten gingen die ersten<br />
Bauaufträge in Lumbrein<br />
(Umbau des Wohnturms<br />
„Chisti“) und in Vella<br />
(Umbau des „Café de<br />
Mont“) hervor. Das 1976<br />
publizierte Siedlungsinventar<br />
von Vrin sollte zum<br />
Grundstein für eine bewusste<br />
bauliche Auseinandersetzung<br />
mit dem Dorf werden,<br />
wie sie auch in Graubünden<br />
einzigartig ist. Die<br />
Bemühungen brachten der<br />
Gemeinde 1998 den Wakkerpreis<br />
des Schweizerischen<br />
Heimatschutzes für<br />
die vorbildliche Integration<br />
neuer landwirtschaftlicher<br />
Ökonomiegebäude ein.<br />
Treibende Kraft der Entwicklung<br />
ist der in Vrin-Cons ansässige<br />
Architekt Gion A.<br />
Caminada. Er versucht das<br />
Ortsbild und die Kulturlandschaft<br />
so unbefangen<br />
weiterzuentwickeln, wie<br />
man das in Vrin früher gemacht<br />
hat - jenseits von Imitation<br />
und Verniedlichung,<br />
jenseits auch der Kontrastidee<br />
der Siebziger- und<br />
Achtzigerjahre. Grundlage<br />
allen Bauens ist die Ökonomie<br />
und die Sozialpolitik. Im<br />
überschaubaren Rahmen<br />
eines Dorfes wirkt der Architekt<br />
auch als Kommunalpolitiker<br />
und Sozialarbeiter. Er<br />
interessiert sich für die Arbeitsmöglichkeiten<br />
und die<br />
Befindlichkeit der Gemeinschaft.<br />
Um einer Zersiedlung entgegenzuwirken,<br />
werden die<br />
Vriner Stallbauten weiterhin<br />
möglichst auf das Dorf und<br />
den Dorfrand konzentriert.<br />
„Den Bauer im Dorf behalten“<br />
heißt die Losung. Durch<br />
Erweiterung können bestehende<br />
Stallbauten in Betrieb<br />
bleiben. Der Bau zweier<br />
neuer, großer Stallbauten<br />
erfolgte in einer eigenen<br />
Stallbauzone unterhalb der<br />
Kirche. Hier wurde vor kurzem<br />
auch das regionale<br />
Schlachthaus „Mazlaria da<br />
Vrin“ eröffnet. Verhältnismäßig<br />
früh schon hat man<br />
in Vrin auf Bioproduktion,<br />
Hausmetzgerei und Direktvermarktung<br />
umgestellt,<br />
wodurch der teure Zwischenhandel<br />
entfällt. Die<br />
Verarbeitung an Ort bringt<br />
den Vrinern neue Verdienstmöglichkeiten.<br />
Zum Sortiment<br />
gehören neben dem<br />
Fleisch auch die Produkte<br />
der Käserei auf der Geisalp<br />
„Parvansauls“.<br />
In der Verwendung des Materials<br />
Holz bleibt Caminada<br />
bei der Tradition. Im Einbezug<br />
von Beton sowie in Anordnung<br />
und in der Konstruktion<br />
der Gebäude entwickelt<br />
er sie weiter. Seit einigen<br />
Jahren arbeitet Caminada<br />
an einem Systembau<br />
für Ställe und Scheunen,<br />
den er aus der Beobachtung<br />
verschalter Rundholzkonstruktionenweiterentwickelte.<br />
Ein Rahmen aus<br />
Holzbalken bildet das<br />
Grundgerüst. Innen wird<br />
dieses mit Spanplatten verkleidet,<br />
außen mit rohen<br />
Brettern. Der aus der Schalung<br />
hervortretende Eckverbund<br />
der überkreuzten Rahmen<br />
erinnert an jenen der<br />
Strickbauten. Damit wird ein<br />
Bild der Kontinuität evoziert:<br />
Vrin wird weitergestrickt. Eigentliche<br />
Bauten der Gemeinschaft<br />
sind das Gemeindehaus,<br />
die Mehrzweckhalle<br />
und die geplante<br />
Totenkapelle. Beim<br />
Gemeindehaus führte das<br />
Thema Alt-Neu zu einem<br />
kleinteiligen Dialog unter einheitlichem<br />
Dach, während<br />
sich die grosse Kubatur der<br />
verschindelten Mehrzweckhalle<br />
(Architekt Gion A. Caminada,<br />
Ingenieur Jürg<br />
Conzett) selbstverständlich<br />
an das gemauerte Schulhaus<br />
aus den frühen Sechzigerjahren<br />
anschließt.<br />
Viel Zeit ließ sich Gion A.<br />
Caminada mit der Totenkapelle,<br />
deren Notwendigkeit<br />
er in der Gemeinde<br />
immer wieder zur Diskussion<br />
stellte. Die bisher geübte<br />
Kultur des Abschiednehmens<br />
von den Toten in
ihren Stuben soll nicht einfach<br />
der städtischen Funktionalität<br />
einer Aufbahrungshalle<br />
geopfert werden.<br />
Große Sorgfalt wurde<br />
auf die Wahl des Bauplatzes<br />
gelegt. Er liegt am<br />
Rande des kirchlichen,<br />
aber innerhalb des dörflichen<br />
Bereichs. Der Abschied<br />
findet auf der Seite<br />
der Lebenden statt.<br />
Brücken<br />
Das Gebirgsland Graubünden<br />
ist ein Land der<br />
Brücken, Galerien, Tunnel<br />
und Kraftwerke. Zu den<br />
Pionieren des Ingenieurwesens<br />
im 19. und frühen<br />
20. Jahrhundert gehören<br />
Richard La Nicca, der Gerüstbauer<br />
Richard Coray,<br />
Robert Maillart sowie die<br />
Konstrukteure der Kunstbauten<br />
der Rhätischen<br />
Bahn. Im Bereich der 1910<br />
eröffneten Berninabahn<br />
entstand nach und nach<br />
ein gestalterisches Ensemble<br />
der malerisch-romantischen<br />
Richtung,<br />
dessen Höhepunkte das<br />
Kreisviadukt von Brusio,<br />
die Hochbauten von Nicolaus<br />
Hartmann in Bernina<br />
Hospiz und Alp Grüm sowie<br />
die Zentralen der Kraftwerke<br />
Brusio des gleichen<br />
Architekten in Palü und<br />
Cavaglia sind. Als bedeutendster<br />
Schweizer Brükkenbauer<br />
der zweiten Hälfte<br />
des 20. Jahrhunderts gilt<br />
Christian Menn, der 1957<br />
in Chur ein Ingenieurbüro<br />
gründete und von 1971 bis<br />
1992 ordentlicher Professor<br />
für Baustatik und Konstruktion<br />
an der ETH Zürich<br />
war. Menn hat in Graubünden<br />
eine Vielzahl von<br />
Stahlbetonbrücken erbaut.<br />
Interessant für den Aspekt<br />
der Ortsbezogenheit ist<br />
sein Gedanke, den Landschaftscharakter<br />
im Tragwerk<br />
zu übernehmen. Mit<br />
den seitlichen Scheiben<br />
und dem versteiften Stabbogen<br />
seiner frühen Bogenbrücken<br />
im Avers<br />
knüpfte er an die Leistungen<br />
Maillarts an. Landschaftsprägend<br />
wirkt die<br />
Rheinbrücke bei Tamins<br />
(1962-63), die den vereinigten<br />
Rhein mit einer Bogenspannweite<br />
von 100 m<br />
überquert. Die Spannweiten<br />
der Aufständerung zwi-<br />
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
schen 12 und 15 m ergeben<br />
ein ausgewogenes<br />
Tragwerk und tragen zur<br />
eleganten Geste des<br />
Flussüberschlags bei.<br />
Eine Neuerung bedeutete<br />
die teilweise Vorspannung<br />
des Fahrbahnträgers. Den<br />
Abschluss im Bau der Bogenbrücken<br />
bilden der<br />
Ponte Nanin (1966-67)<br />
und der Ponte Cascella<br />
(1967-68) an der Südrampe<br />
des San Bernardinos.<br />
Die zweifache Verwendung<br />
des Lehrgerüstes<br />
hatte es noch einmal möglich<br />
gemacht, die angesichts<br />
steigender Lohnkosten<br />
nur noch selten konkurrenzfähigeKonstruktionsweise<br />
anzuwenden.<br />
Die Zukunft gehörte nun<br />
den Balkenbrücken in Vorspanntechnik.<br />
Deren große<br />
Spannweiten und die<br />
damit verbundene Freiheit<br />
bei der Trassierung führten<br />
gemäss Heinrich Figi<br />
vom Tiefbauamt Graubünden<br />
oft zu einer ungenügenden<br />
Beachtung der<br />
Beziehung zur Umgebung.<br />
Gestalterisch bewusst erscheint<br />
demgegenüber<br />
die Sunnibergbrücke der<br />
Umfahrung Klosters konzipiert,<br />
die in ihrem Typus<br />
als Schrägkabelbrücke an<br />
die Spannweiten amerikanischer<br />
Monumente erinnert.<br />
Nicht mehr abstrakt,<br />
sondern sprechend wirken<br />
die nach außen geneigten<br />
Pylone und die Harfenkonfigurationen<br />
der Kabel.<br />
Unter den jüngeren Bauingenieuren<br />
ist Jürg Conzett<br />
einem internationalen<br />
Fachpublikum bekannt geworden.<br />
Conzett wirkt als<br />
Praktiker und auch als Verfasser<br />
historischer Arbeiten<br />
zum Ingenieurbau.<br />
1994 erhielt die Überführung<br />
Landquartlöser eine<br />
Auszeichnung als Guter<br />
Bau im Kanton Graubünden<br />
(Büro Branger und<br />
Conzett). Aufsehen erregte<br />
der Dreigurtträger des<br />
Traversiner Stegs in der<br />
Viamala, der 1999 durch<br />
Steinschlag zerstört wurde<br />
und nun durch eine Art<br />
hängende Treppe ersetzt<br />
werden soll.<br />
Wettbewerb<br />
Einer der Gründe für die<br />
11
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
12<br />
Existenz der viel beachteten<br />
Bündner Architekturszene<br />
liegt im Instrument<br />
des Architekturwettbewerbs.<br />
Wie aus einem<br />
Gespräch mit dem seit<br />
1975 amtierenden<br />
Kantonsbaumeister von<br />
Graubünden Erich Bandi<br />
hervorgeht, setzt dieser mit<br />
der konsequenten Anwendung<br />
des Instruments eine<br />
Politik fort, die bereits sein<br />
Vorgänger Hans Lorenz verfolgt<br />
hatte. Im Wettbewerb<br />
sieht Bandi ein objektives<br />
Verfahren, das dem Kulturauftrag<br />
nachkommt, gestalterisch<br />
und konstruktiv Dauerhaftes<br />
zu errichten. Die<br />
Einführung des GATT/<br />
WTO-Abkommens ist gemäss<br />
Bandi als Fortschritt zu<br />
werten, da es dem Architekturwettbewerb<br />
eine gesetzliche<br />
Grundlage gibt. Die<br />
Durchführung eines Wettbewerbs<br />
ist somit eine der<br />
Voraussetzungen, die die<br />
Gemeinden für den Erhalt<br />
kantonaler Subventionen zu<br />
erfüllen haben. Unter den<br />
Bauaufgaben betrifft es<br />
hauptsächlich Schulhäuser,<br />
Turn- und Mehrzweckhallen,<br />
gelegentlich Altersheime<br />
und eher selten Gemeindehäuser.Rekursmöglichkeiten<br />
bestehen nun nicht<br />
nur gegen den Wettbewerbsentscheid,<br />
sondern<br />
auch gegen die Ausschreibung<br />
und das Programm.<br />
Honorarwettbewerbe werden<br />
vom Kanton nur bei<br />
Umbauten durchgeführt. Im<br />
Vordergrund steht der<br />
Planungswettbewerb und<br />
hier wiederum das offene<br />
oder selektive Verfahren. Bei<br />
letzterem wird die Präqualifikation<br />
in der Praxis des<br />
kantonalen Hochbauamtes<br />
meistens aufgrund von Entwurfskonzeptenentschieden,<br />
die als anonyme Skizzen<br />
einzureichen sind. Für<br />
die Jury werden überwiegend<br />
auswärtige Architekten<br />
empfohlen, die selbst schon<br />
Wettbewerbserfolge zu verzeichnen<br />
haben.<br />
Wettbewerbe bieten jungen<br />
Architekten eine Chance,<br />
sich unabhängig von Seilschaften<br />
profilieren zu können.<br />
Eine weitere Ursache<br />
für das Aufblühen der Architektur<br />
in Graubünden vermutet<br />
Bandi in der flauen<br />
Wirtschaftskonjunktur der<br />
frühen Achtzigerjahre. Er<br />
erinnert an den Spruch,<br />
dass die besten Ideen in der<br />
Not entstehen. Die Bauten<br />
jener Jahre drücken nicht<br />
Wohlstand oder Interesse<br />
an Materiellem, sondern das<br />
Bemühen um Einfachheit<br />
und Zweckmäßigkeit aus.<br />
Dabei entstanden Solitäre,<br />
die in ihrer sozialen Funktion<br />
als öffentliche Bauten mit<br />
den alten Kirchen zu vergleichen<br />
sind. Günstig für<br />
den Start junger Architekten<br />
in Graubünden waren nach<br />
Ansicht von Erich Bandi<br />
aber auch die im Vergleich<br />
zu großstädtischen Agglomerationen<br />
bescheidenen<br />
Bauvolumen. Die oftmals<br />
bedeutend kleineren Bündner<br />
Schulhäuser lassen sich<br />
architektonisch leichter bewältigen<br />
als Großanlagen.<br />
Die Wettbewerbspolitik des<br />
kantonalen Hochbauamtes<br />
bot Architekten wie Peter<br />
Zumthor eine entscheidende<br />
Ausgangslage. Entsprechend<br />
hoch ist der Anteil<br />
öffentlicher Bauten, vor<br />
allem der Schulhäuser, am<br />
Bestand anspruchsvoller<br />
zeitgenössischer Architektur.<br />
Ein weiteres Instrument<br />
zur Thematisierung<br />
architektonischer Qualität ist<br />
die „Auszeichnung Guter<br />
Bauten“ der Bündner Fachverbände,<br />
die bisher 1987<br />
und 1994 durchgeführt wurde.<br />
Dass einige Architekten in<br />
Graubünden empfindsam<br />
auf den Ort und auf Konzeptionen<br />
des Ganzheitlichen<br />
reagieren, muss nicht überraschen.<br />
Motivierend für das<br />
Bauen in den Bergen ist die<br />
dramatische Topographie<br />
der Landschaft, die das Gebaute<br />
weithin sichtbar<br />
macht. In wenig verdorbenen<br />
Dörfern und Tälern, die<br />
es noch gibt, lohnt sich das<br />
Bemühen um Architektur in<br />
besonderem Maß. Breiter<br />
angelegte Arbeitsgebiete<br />
bleiben durch die im Vergleich<br />
zu den Wirtschaftszentren<br />
weniger weit getriebene<br />
Spezialisierung erhalten.<br />
Beschaulichkeit vermag<br />
der Hektik manchmal zu<br />
trotzen.<br />
Das, was man unter gestalterisch<br />
anspruchsvoller Gegenwartsarchitekturver-
steht, spielt sich in Graubünden<br />
hauptsächlich außerhalb<br />
der eigentlichen<br />
Tourismusorte ab. Die<br />
Tendenz zu wichtigen Ausnahmen,<br />
wie man sie in<br />
Davos und Vals vorfindet,<br />
scheint aber doch eher<br />
stärker zu werden. Der<br />
Grund für die im Allgemeinen<br />
schwierige Situation<br />
liegt wohl in der Klischee-<br />
Anfälligkeit des Tourismus.<br />
Die Gefahr historischer Verkürzung<br />
und oberflächlicher<br />
Übernahme von Vorbildern<br />
ist hier ähnlich gross wie bei<br />
der naiven Seite des Heimatstils.<br />
Wo Formen des<br />
Engadiner Hauses über<br />
alle möglichen neuen Aufgaben<br />
gestülpt werden,<br />
hat es die eigenständige<br />
Auseinandersetzung<br />
Graubünden<br />
Region, Ort, Architektur<br />
schwer. Der Gedanke eines<br />
Territorialprinzips der<br />
Formenwelt engt nicht nur<br />
ein, er widerspricht auch<br />
der historischen Realität<br />
der letzten Jahrtausende.<br />
Gerade die Engadiner<br />
Häuser selbst waren stark<br />
von außen beeinflusst;<br />
Kirchen, Herrschaftshäuser<br />
und Hotelbauten orientierten<br />
sich an den Leistungen<br />
der europäischen<br />
Zentren. Vertrautes und<br />
Fremdes standen in einem<br />
spannungsvollen und<br />
offenen Wechselspiel zueinander.<br />
Dieses dialektische<br />
Verhältnis kann auch heute<br />
noch Leitmotiv für eine Architektur<br />
sein, die sich sowohl<br />
dem Ort als auch der<br />
Welt verpflichtet fühlt.<br />
Leza Dosch<br />
13
Flims<br />
14<br />
Flims<br />
Ein paar Worte zu dem Ort<br />
unserer Unterkunft<br />
Der Höhenkurort Flims,<br />
1103 m über dem Meer, ist<br />
eine selbständige politische<br />
Gemeinde und besteht aus<br />
dem eigentlichen Kurzentrum<br />
„Waldhaus“ und dem<br />
Dorf. Die große Route Ostschweiz-Lukmanier-Oberalp<br />
berührt Flims und erschließt<br />
damit den Kurort<br />
dem Automobilverkehr. Ein<br />
direkter Bahnanschluss besteht<br />
nicht.<br />
Der Waldhügel von Flims<br />
entstand auf dem riesigen<br />
Schuttkegel eines voreiszeitlichen<br />
Bergsturzes. Charakteristisch<br />
sind die zahlreichen<br />
kleinen Seen, von denen<br />
die wichtigsten, der Lac<br />
la Cauma und der Lac la<br />
Cresta, beide mit kristallklarem<br />
Wasser und ohne<br />
sichtbaren Zu- und Abfluss,<br />
mitten im Wald liegen. Die<br />
Vegetation ist vielfältig. In<br />
den Wäldern herrschen<br />
Föhre und Lärche vor, gegen<br />
Rens finden sich prächtige<br />
Buchenbestände. Die<br />
lange Besonnungsdauer<br />
verdankt Films seiner Lage:<br />
auf einer nach Osten, Süden<br />
und Westen geöffneten<br />
freien Terrasse. Die Niederschläge<br />
sind gering, die<br />
Windverhältnisse günstig.<br />
Der Flimserstein und der<br />
Hochwald schützen das<br />
Dorf vor dem Nordwind.<br />
Das gemäßigte Hochgebirgsklima,<br />
der Reichtum an<br />
Wäldern, die zahlreichen<br />
ebenen Spazierwege, ein<br />
breites Spektrum von Sportmöglichkeiten<br />
und nicht zuletzt<br />
ein durch Seilbahnen<br />
vorzüglich erschlossenes<br />
Berggebiet machen Flims<br />
zum begehrten Ort für den<br />
Sommer- und Wintertourismus.<br />
Flims besitzt einige bemerkenswerte<br />
historische Bauwerke:<br />
die Alte Post (1588) in<br />
Waldhaus, die Casa Martin<br />
Ping (um 1570) in Fidaz;<br />
die Cas’AIva (um 1530),<br />
das Schlösschen (1682)<br />
und die Martinskirche<br />
(1512), alle in Flims-Dorf.
Die Architektur von<br />
Rudolf Olgiati<br />
Die Architektur von Rudolf<br />
Olgiati erleichtert einerseits<br />
die systematische Betrachtung<br />
durch die Gradlinigkeit<br />
ihrer Entwicklung, die Konsequenz<br />
ihrer Anwendung<br />
und die Beschränkung auf<br />
enge Bereiche. Ihre Intensität,<br />
ihr raffinierter Aufbau<br />
und ihre teilweise subjektive<br />
Grundlage beanspruchen<br />
aber das Mittel der verbalen<br />
Auseinandersetzung bis zur<br />
Grenze des Möglichen.<br />
Die Erkenntnisse über Erscheinung<br />
und Wirkung der<br />
Teile des Bauens und der<br />
Architektur als Ganzes fasst<br />
Olgiati in seiner Theorie der<br />
optischen Sachlichkeit zusammen.<br />
Er geht davon<br />
aus, dass Architektur durch<br />
die Sinne und nicht durch<br />
den Intellekt wahrgenommen<br />
wird. Er ordnet die<br />
Wahrnehmungseindrücke<br />
und baut sie in ein System<br />
ein, das eine Bewertung und<br />
eine rationale Begründung<br />
erlaubt. Damit sucht er Antwort<br />
zu geben auf eines der<br />
schwierigsten Probleme der<br />
Ästhetik, der Frage nach<br />
schön und hässlich. Sein<br />
Ziel ist, seine Formulierungen<br />
so zu präzisieren, dass<br />
ein gültiges theoretisches<br />
Gerüst entsteht, dessen<br />
richtige Anwendung das<br />
Schöne ermöglicht und das<br />
Hässliche vermeidet.<br />
Ein Grundelement seiner<br />
Architektur ist die umgrenzende<br />
Mauerschale, die das<br />
Innere als besonderen Bereich<br />
vom Außen abtrennt,<br />
schützend umschliesst und<br />
durch Bergen wertvoll<br />
macht. Urvorstellung ist der<br />
mauerumschlossene Paradiesgarten,<br />
Geheimnis und<br />
Verlockung zugleich, oder<br />
der Sesam, der ummauerte<br />
Schatz, nur dem Eingeweihten<br />
zugänglich. Der innere,<br />
vom Menschen kontrollierte<br />
und gestaltete Idealbereich<br />
ist Gegenstück zur äußeren,<br />
oft feindlichen oder hässli-<br />
Architektur<br />
Rudolf Olgiati<br />
chen Umwelt und wird so<br />
zum Symbol des geistigen<br />
und seelischen Behaust-<br />
Seins. Durch den Gegensatz<br />
zwischen Innen und<br />
Außen, dem Gehüteten und<br />
dem Preisgegebenen,<br />
schafft Olgiati eine Dimension,<br />
die in der heutigen Architektur<br />
durch die Manie<br />
der Transparenz weitgehend<br />
verloren gegangen<br />
ist.<br />
Die Mauerschale ist - wenn<br />
sie einen Wohnbereich umhüllt<br />
- verputztes und weissgekalktes<br />
Mauerwerk,<br />
gleichsam luxuriöser Mantel,<br />
der den Intimbereich des<br />
Menschen birgt. Sie passt<br />
sich in groben Zügen gestaffelt<br />
dem Terrain an und bildet<br />
durch den oberen horizontalen<br />
Abschluss ein kubisches<br />
Gebilde. Die notwendigen<br />
Öffnungen in der<br />
Schale werden so angeordnet,<br />
dass ihr zusammenhängender<br />
Charakter nicht verletzt<br />
wird. Fenster haben<br />
meist die Form eines dem<br />
Quadrat angenäherten<br />
Rechteckes, niemals werden<br />
sie zu langen Schlitzen,<br />
welche die Schale zerschneiden<br />
würden. Lediglich<br />
an den oberen Rändern<br />
nehmen die Ausschnitte<br />
breite, zinnenartige Form<br />
an. Regelmässige Fensteranordnungen<br />
werden vermieden,<br />
denn sie würden<br />
eine Auflösung der Schale in<br />
vertikale Pfeiler und horizontale<br />
Bänder bewirken. Jede<br />
Öffnung ist ein neues Ereignis<br />
und wird anders behandelt.<br />
Neben der rechteckigen<br />
Öffnung kleiner Dimension<br />
findet das trichterförmig<br />
vertiefte Fenster Anwendung,<br />
sowie die vertiefte Nische,<br />
bei welcher die Mauerschale<br />
gleichsam eingedrückt<br />
wird und sich in<br />
den meist schräg geführten<br />
Leibungen und der oft angeschrägten<br />
Untersicht fortsetzt.<br />
Eingänge als Durchgänge<br />
durch die Schale sind immer<br />
als Wölbungen ausgebildet,<br />
um die Mauerschale ungebrochen<br />
in den Boden führen<br />
zu können. Gleichzeitig<br />
betont der Bogen die Wichtigkeit<br />
des Ortes. Der Bogen<br />
15
Architektur<br />
Rudolf Olgiati<br />
16<br />
hat dabei nie statische, sondern<br />
optische Funktion. Er<br />
erweckt nie den Eindruck,<br />
als stemme er die Fassade<br />
nach oben, sondern er steht<br />
frei in dem durch einen Sturz<br />
entlasteten Mauerfeld. Oben<br />
wird die Mauerschale direkt<br />
mit dem Himmel konfrontiert<br />
und verträgt keine tafelartige<br />
Abdeckung, sei sie auch<br />
noch so dünn. Vor allem die<br />
Giebelfassaden stossen<br />
nach oben, das Dach ist vertieft<br />
und lappt nur dort über<br />
die Traufe, wo es eine<br />
zusätzliche Funktion des<br />
Deckens zu übernehmen<br />
hat. Die beiden Aufgaben<br />
der Schale, das Innen vom<br />
Außen abzutrennen und<br />
gleichzeitig das Innen nach<br />
dem Außen zu öffnen, werden<br />
bei Olgiati verschmolzen<br />
in der plastisch frei gestalteten<br />
Wand mit deutlicher<br />
Erscheinung nach außen<br />
und subtilem Lichtspiel<br />
nach innen.<br />
Ein weiteres Element der<br />
Architektur von Olgiati bilden<br />
die vollplastischen geometrischen<br />
Körper. Olgiati verwendet<br />
vor allem die liegende<br />
Tafel, die stehende Säule,<br />
den schwebenden Architrav<br />
und den kubischen Körper.<br />
Die Tafel dient als Sokkel<br />
oder zurückgestuft zur<br />
optischen Heraushebung<br />
des Objektes. Die Säule als<br />
stehender Zylinder dient der<br />
Zentrierung, der Regulierung<br />
des Raumflusses, zur<br />
Schaffung optischer Bezugspunkte,<br />
zur transparenten<br />
Abgrenzung und zur<br />
Betonung des Wichtigen.<br />
Der Architrav findet sich als<br />
schwebende Platte in Olgiatis<br />
Idealvorstellungen für<br />
Hochhäuser. Die Form des<br />
kubischen Körpers wird für<br />
innere und äußere Gebäudeteile<br />
verwendet, zum Beispiel<br />
als Kaminkörper frei in<br />
den Raum gestellt oder als<br />
prismatischer Kamin, der die<br />
Dachfläche deutlich sichtbar<br />
durchstößt. Die geometrischen<br />
Körper werden durch<br />
Bearbeitung und Unregel-<br />
mäßigkeiten belebt. Bei der<br />
Säule führen die leichte<br />
Schwellung und Verjüngung<br />
nach oben zur Betonung<br />
der harten Kreisform.<br />
Bei den kubischen Umhüllungen<br />
wird durch leichten<br />
Anzug im oberen Drittel die<br />
plastische Wirkung gesteigert.<br />
Das Innere von Olgiatis Häusern<br />
soll als Idealbereich das<br />
seelische Überleben des<br />
Bewohners ermöglichen.<br />
Durch die sorgfältige Auswahl<br />
der Ausschnitte aus<br />
der Außenwelt, die mit dem<br />
Inneren in Verbindung gebracht<br />
werden, wird Hässliches<br />
ferngehalten und<br />
Schönes betont und damit<br />
das Wohlbefinden des Bewohners<br />
gefördert. Die Folge<br />
der Innenräume ist dynamisch<br />
aufgebaut. Der Blick<br />
wird durch geknickte und<br />
geschwungene Mauern geführt,<br />
durch Säulen gebremst,<br />
er streicht an schrägen<br />
Flächen vorbei und wird<br />
in dunklen Nischen aufgesogen.<br />
Beim Durchschreiten<br />
des Hauses erfolgt ein<br />
Wechsel von eng zu weit,<br />
von dunkel zu hell, unerwartete<br />
Ausblicke treten zwischen<br />
ruhige Zonen. Das<br />
Licht dringt vielfältig in den<br />
Raum ein: ungehindert<br />
durch große, fassadenbündige<br />
Fenster, punktlichtartig<br />
gebündelt durch tiefe<br />
Trichter. Treppen haben fließende,<br />
funktionelle Formen,<br />
meist geknickt oder geschwungen<br />
und bestehen<br />
optisch aus übereinandergelegten<br />
Tafeln, also ohne<br />
überstehende Trittkanten.<br />
Ihr Beginn und ihr Ende ist<br />
harmonisch in den Raumfluss<br />
eingebaut.<br />
Die Komposition der raumbegrenzenden<br />
Materialien<br />
erfolgt mit subtilem Raffinement.<br />
Frische Lebendigkeit<br />
und Spannung wird erreicht<br />
durch die optisch richtige<br />
Anwendung von matt und<br />
glänzend, hart und weich,<br />
glatt und porös. Textilien<br />
sind wichtige Gestaltungsmittel.<br />
Gefutterte Vorhänge<br />
begleiten und mildern die<br />
Übergänge von Innen nach<br />
Außen. Farben dienen zur<br />
Schaffung von Schwerpunkten<br />
und werden nach<br />
ihrer Wirkung und Bedeutung<br />
angewendet. Sie be-
schränken sich auf bewegliche<br />
oder vertiefte Teile:<br />
Gegenstände, Textilien,<br />
Auskleidungen von Nischen.<br />
Die Materialklänge<br />
sind raffiniert und entspringen<br />
einem perfekten Geschmack:<br />
matte Säulen stehen<br />
vor glänzenden Nischen,<br />
rustikales Leinen<br />
dient als Träger für schimmernde<br />
Seide. Langfaserige<br />
Wollteppiche liegen auf weißen<br />
Marmorböden. Stumpfes<br />
Arvenholz stößt an geweißelte<br />
Putzflächen.<br />
Einzelne Raumteile erhalten<br />
besondere Bedeutung und<br />
tauchen immer wieder in<br />
leicht variierter Form auf. Die<br />
Feuerstelle ist als einfache,<br />
rechteckig in die Mauer geschnittene<br />
Öffnung um die<br />
rußige Nische ausgebildet.<br />
Sie beginnt unten, damit<br />
sich der Fußboden in die<br />
Feuernische fortsetzen<br />
kann. Sie bildet den Mittelpunkt<br />
des Wohnbereiches<br />
und wird von Sitzmöglichkeiten<br />
begleitet, oft auf einer<br />
Seite durch ein an die Wand<br />
angebautes, im Unterbau<br />
betoniertes Sofa.<br />
Die Kochstelle steht immer<br />
in direkter Beziehung zum<br />
Esstisch im Sinn einer<br />
Wohnküche. Sie ist nicht<br />
funktionell, sondern optisch<br />
konzipiert, das heißt, sie bildet<br />
einen bühnenmäßigen<br />
Rahmen für die Handlung<br />
der Speisenzubereitung, die<br />
dadurch besondere Bedeutung<br />
bekommt. Gleichzeitig<br />
bildet sie durch richtige und<br />
kompakte Anordnung aller<br />
Bereiche ein Optimum für<br />
rationelles Arbeiten. In früheren<br />
Häusern entwickelte Olgiati<br />
die Idee der Kochwand,<br />
eine lineare Anordnung der<br />
Einbauten in eine Nische,<br />
die vom Hauptraum durch<br />
einen schurzartigen Sturz<br />
getrennt ist. In späteren<br />
Bauten übernimmt er mehr<br />
die Form des Feuertisches<br />
und gruppiert die Arbeitsflächen<br />
auf einem harten kubischen<br />
Körper unter einem<br />
pyramidenförmigen Dunstfang.<br />
Olgiatis Innenräume haben<br />
oft Dimensionen, die unter<br />
den Normvorstellungen liegen.<br />
Durch eine intensive<br />
optische Gestaltung und<br />
optimale Ausnutzung wirken<br />
sie trotzdem angenehm und<br />
Architektur<br />
Rudolf Olgiati<br />
generös. Olgiati wendet Unterschiede<br />
im Maßstab von<br />
kleinen zu großen Räumen<br />
an, um die Raumwirkungen<br />
zu steigern. Er ist ein Meister<br />
in der Ausnutzung vorhandenen<br />
Raumes. Dachräume<br />
werden bis in die tiefste<br />
Ecke genutzt. Geschickt<br />
gestellte Brüstungen und<br />
Schranken vergrößern die<br />
Nutzfläche in Bezug auf die<br />
Höhe. Treppen werden so<br />
geschwungen, bis sich die<br />
scheinbar unmögliche Kopfhöhe<br />
ergibt. Böden werden<br />
aufgewölbt, bis darunter der<br />
notwendige Durchgang<br />
möglich wird. Olgiati hat einen<br />
ausgesprochenen Sinn<br />
für Komfort, der aber nie auf<br />
Kosten der Disziplin in der<br />
Materialanwendung erreicht<br />
wird. Seine Häuser sind außerordentlich<br />
bequem und<br />
wirken wohlig entspannend.<br />
Trotz der komplexen Form<br />
liegen die Erstellungskosten<br />
seiner Bauten dank extremer<br />
Raumausnutzung und<br />
einfacher Materialanwendung<br />
unter der Erwartung.<br />
Olgiati sucht in allen Wirkungen<br />
Unmittelbarkeit. Wichtige<br />
Teile werden durch elementar<br />
geometrische Betonung<br />
hervorgehoben, Nebensächliches<br />
wird weggelassen<br />
oder durch zurückweichende<br />
Formgebung<br />
unauffällig gemacht. In der<br />
Praxis ist er äußerst konsequent:<br />
Es gibt keine Rahmen<br />
und Deckleisten, welche<br />
Formen einschnüren,<br />
keine Raster, welche Flächen<br />
zerschneiden, keine<br />
Sockel und Abdeckungen,<br />
welche sich zwischen<br />
Hauptelemente schieben,<br />
auch keine Systeme, welche<br />
sinnliche Wahrnehmung<br />
durch Denkvorgänge ersetzen<br />
würden. Flächen und<br />
Körper werden durch sich<br />
selber begrenzt. Fassaden<br />
stoßen ohne Abdeckung in<br />
den Himmel. Die Reinheit<br />
der Einzelteile und die Unmittelbarkeit<br />
ihrer Beziehung<br />
ist Hauptgrund für das Gefühl<br />
von Eindeutigkeit und<br />
Freiheit, das Olgiatis Bauten<br />
ausstrahlen. Olgiati vermeidet<br />
monotone Wiederholungen.<br />
Jede Fensteröffnung<br />
ist ein neues Ereignis. Dort,<br />
wo Gruppenbildungen angestrebt<br />
werden, wie in den<br />
Säulenreihen seiner Portici,<br />
17
Architektur<br />
Rudolf Olgiati<br />
18<br />
individualisiert er die einzelnen<br />
Säulen - die übrigens<br />
aus der gleichen Schalung<br />
gegossen werden - durch<br />
Nischen wechselnder Form.<br />
Olgiatis Architektur lebt aus<br />
Gegensätzen. Geometrische<br />
Säulen stehen in freigeschnittenenMaueröffnungen.<br />
Weiche dunkle<br />
Dachflächen werden von<br />
den harten weißen Prismen<br />
der Kamine durchstoßen.<br />
Weite Vordächer kragen<br />
über knappe Kuben. Spannung<br />
spricht aus der Gliederung<br />
der Mauern mit ruhigen<br />
Flächen und konzentrierten<br />
Öffnungen. Überraschung<br />
begleitet den Besucher beim<br />
Durchschreiten der Räume.<br />
Nie aber entsteht das Gefühl<br />
der Verkrampfung. Die<br />
Pointierung der Gegensätze<br />
bewirkt im Gegenteil ein<br />
Gefühl von Befreiung, Entspannung,<br />
Lösung.<br />
Die Proportionen werden<br />
nicht nach der klassischen<br />
Methode der mathematischgeometrischenBeziehung<br />
durchgebildet. So<br />
steht die zurückweichende<br />
dunkle Nische im<br />
übersteigerten Verhältnis<br />
zum hervortretenden weißen<br />
Körper.<br />
Durch die konsequente Anwendung<br />
einfacher theoretischer<br />
Grundlagen sind Olgiatis<br />
Bauten ausgesprochen<br />
ganzheitlich, das heißt,<br />
jede Einzelform wird als Teil<br />
eines Ganzen empfunden.<br />
Die Formgebung ist so präzis,<br />
daß Verschiebungen<br />
undenkbar werden. Die starke<br />
Betonung des Ganzheitsaspekts<br />
bewirkt eine gewisse<br />
Empfindlichkeit und Verletzlichkeit<br />
gegenüber unrichtig<br />
vorgenommenen Ergänzungen<br />
und Änderungen<br />
wie unpassende Möblierung<br />
und falsche Bepflanzung.<br />
Alle Bauten von Olgiati basieren<br />
auf den beschriebe-<br />
nen Überlegungen und stellen<br />
damit Variationen eines<br />
Grundthemas dar. Sie erhalten<br />
ihre ausgesprochene<br />
Individualität durch die jeweilige<br />
Anpassung an die Gegebenheit<br />
der Topographie<br />
im weiteren Sinn. Neue Erkenntnisse,<br />
die bei einem<br />
Bau gewonnen werden,<br />
werden laufend in die Theorie<br />
eingebunden und führen<br />
damit zu einer kontinuierlichen<br />
Entwicklung. Diese<br />
zeichnet sich nicht durch<br />
eine Komplizierung aus,<br />
sondern durch eine Vereinfachung<br />
der Konzepte,<br />
durch eine Erhöhung der<br />
Unmittelbarkeit und eine<br />
Steigerung des Raffinements.<br />
Olgiati schöpft die Kraft und<br />
Klarheit seiner Konzepte<br />
zum großen Teil aus der<br />
kontinuierlichen intensiven<br />
Auseinandersetzung mit der<br />
Bautradition, von der griechischen<br />
Klassik über den<br />
Hellenismus bis zur alten<br />
Bündner Architektur. Durch<br />
eine Analyse und eine persönliche<br />
Interpretation gelangt<br />
er dabei zu überraschenden<br />
Resultaten. Er findet<br />
plausible, lebendige Erklärungen<br />
für formales Verhalten<br />
in der Vergangenheit<br />
und wendet die Erkenntnisse<br />
laufend für die<br />
eigene Arbeit an. Es gelingt<br />
ihm so, eine aktuelle Aussage<br />
in einer optischen Tradition<br />
zu verwurzeln. Durch<br />
das Begreifen aller Formen<br />
aus ihrer Wirkung auf den<br />
Menschen heraus rückt dieser<br />
automatisch in den Mittelpunkt<br />
der Architektur. Architektur<br />
wird dadurch nicht<br />
nur Zuflucht, sondern auch<br />
adäquater Rahmen für den<br />
Menschen. Ihre Aufgabe ist<br />
es, ihn zur Geltung kommen<br />
zu lassen, den für seine Erscheinung<br />
optimalen Hintergrund<br />
zu bilden. Sie befriedigt<br />
sein Bedürfnis nach<br />
echter Atmosphäre, körperlichem<br />
und geistigem Wohlbefinden.
Umbau Tschaler/Chur<br />
LasCaglias/Flims<br />
Architektur<br />
Rudolf Olgiati<br />
19
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
20<br />
Kunsthaus Bregenz<br />
Standort: Karl Tizian Platz, Bregenz<br />
Baujahr: 2/1994 – 7/1997<br />
Bauherr: Land Vorarlberg<br />
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein<br />
Ingenieur: Statik – Robert Manahl, Bregenz,<br />
Glas – Ernst Wächli, Langenthal,<br />
Energieplanung – Meierhans & Partner, Fällanden<br />
Literatur: Architektur Aktuell, 207, 1997,<br />
Baumeister, 9/97,<br />
Bauwelt Jg.88, Nr.35, 1997,<br />
Beratende – Ingenieure Jg.88, Nr.7/8, 1998,<br />
Das Architekten-Magazin, 1/98,<br />
Detail, Nr.8, 1997,<br />
Hochparterre Jg.10/9, 1997,<br />
Licht & Architektur, Nr.20, 1997,<br />
Peter Zumthor, Häuser 1979 – 1997, Zement und<br />
Beton, Nr.4, 1997<br />
Der Lichtkörper des Kunsthauses<br />
stellt sich selbstbewusst<br />
in die Reihe öffentlicher<br />
Bauten, welche die<br />
Seebucht säumen. Abgerückt<br />
von den kleinen Bauvolumen<br />
der Altstadt, definiert<br />
er zusammen mit dem<br />
Kornmarkttheater einen<br />
neuen Platzraum zwischen<br />
Altstadt und See. Die Gestaltung<br />
des Platzes arbeitet mit<br />
der Gegenüberstellung der<br />
Maßstäbe, der Kleinteiligkeit<br />
des Altstadtrandes und dem<br />
weiteren Rhythmus der Gebäude<br />
und Freiräume am<br />
See. Die Ausstrahlung und<br />
das Licht des Sees wirken<br />
durch die hohe Lücke zwischen<br />
dem Glaskörper des<br />
Museums und dem steinernen<br />
Bühnenturm des Theaters<br />
hindurch in den Platz<br />
hinein und geben dem Bild<br />
der Annäherung eine besondere<br />
Note.<br />
Das Kunsthaus steht im<br />
Licht des Bodensees. Sein<br />
Körper ist aus Glasplatten,<br />
Stahl und aus einer Steinmasse<br />
aus gegossenem<br />
Beton gebaut, die im Innern<br />
des Hauses Struktur und<br />
Raum bildet. Von außen<br />
betrachtet wirkt das Gebäude<br />
wie ein Leuchtkörper. Es<br />
nimmt das wechselnde Licht<br />
des Himmels, das Dunstlicht<br />
des Sees in sich auf, strahlt<br />
Licht und Farbe zurück und<br />
lässt je nach Blickwinkel,<br />
Tageszeit und Witterung etwas<br />
von seinem Innenleben<br />
erahnen. Denn die Haut des<br />
Gebäudekörpers besteht<br />
aus fein geätztem Glas. Sie<br />
wirkt wie ein leicht gesträubtes<br />
Gefieder oder eine aus<br />
großen gläsernen Tafeln<br />
gefügte Verschuppung. Die<br />
Glastafeln, alle vom gleichen<br />
Format (1,72m x 2,93m),<br />
sind weder gelocht noch<br />
beschnitten. Sie liegen auf<br />
Metallkonsolen auf. Große<br />
Klammern halten sie an ihrem<br />
Platz. Die Kanten der<br />
Gläser sind ungestört und<br />
liegen frei. Durch die offenen<br />
Fugen der Verschuppung<br />
streicht der Wind. Seeluft<br />
dringt in die feinmaschige<br />
Hüllkonstruktion ein, in die<br />
stählerne Struktur der<br />
selbsttragenden Fassade,<br />
die aus der Grube des Untergeschosses<br />
aufsteigt und<br />
die monolithische Raumskulptur<br />
im Innern mit einem<br />
differenzierten System von<br />
Fassadengläsern, Wärmedämmungen<br />
und Verschattungseinrichtungenumschließt,<br />
ohne mit ihr fest<br />
verbunden zu sein.<br />
Die mehrschichtige Fassadenkonstruktion<br />
ist ein auf<br />
das Innere abgestimmtes,<br />
konstruktiv autonomes<br />
Mantelbauwerk, das als<br />
Wetterhaut und Tageslichtmodulator,<br />
Sonnenschutz<br />
und Wärmedämmschicht<br />
funktioniert. Von diesen Aufgaben<br />
entlastet, kann sich
die raumbildende Anatomie<br />
des Gebäudes im Innern<br />
autonom entwickeln. Ein<br />
schmaler Zwischenraum, in<br />
den Stege führen, ermöglicht<br />
die Wartung und Reinigung<br />
der Glasschuppen.<br />
Die Eigenschaften der<br />
Gussmasse Beton, in komplexe<br />
Formen zu fließen,<br />
technische Installationen in<br />
sich aufzunehmen und<br />
schließlich eine monolithische<br />
Großform von annähernd<br />
skulpturalem Charakter<br />
zu bilden, werden ausgeschöpft.<br />
Das heißt, es gibt<br />
keine Verblendungen, Verkleidungen,Verspachtelungen<br />
oder Übermalungen.<br />
Die Entmaterialisierung<br />
der Oberflächen, die man<br />
bei additiven Bauweisen, die<br />
mit der Schichtung von Materialien<br />
arbeiten, häufig feststellen<br />
kann, ist vermieden.<br />
Statisch auf das Notwendige,<br />
von der Nutzung und<br />
Funktion her auf das Erwünschte<br />
und Brauchbare<br />
reduziert, fallen hier Konstruktion,<br />
Material und<br />
Erscheinungsform zusammen.<br />
Das Gebäude ist genau<br />
das, was man sieht, berühren<br />
kann und betritt: eine<br />
steinerne Gussmasse - geschliffen<br />
die Böden und<br />
Treppen, samtig glänzend<br />
die Wände und Decken.<br />
Exkurs Schalungs- und<br />
Betonarbeiten<br />
Um Sichtbetonflächen von<br />
aussergewöhnlicher Quali-<br />
tät zu erhalten, wurden seitens<br />
des Architekten und<br />
Auftraggebers sehr enge<br />
Maßtoleranzen verlangt und<br />
in der Ausschreibung klar<br />
definiert. Ein solches Maß<br />
an Genauigkeit bei den Beton-<br />
und Schalungsarbeiten<br />
konnte nur durch einen<br />
enormen Mehraufwand und<br />
ein speziell geschultes und<br />
eingearbeitetes Fachpersonal<br />
erbracht werden. Zur Erstellung<br />
der Wände im 1.<br />
Untergeschoss innen, im<br />
Erdgeschoss und den<br />
Obergeschossen wurden<br />
DOKA-Großflächenelemente<br />
als Grundschalung verwendet.<br />
Wegen der sehr<br />
dicken (bis zu 72 cm) und<br />
hohen Wandscheiben und<br />
aufgrund der vom Architekten<br />
vorgegebenen Bundstellen<br />
mussten diese Elemente<br />
überdimensioniert<br />
werden. Um ein exaktes,<br />
vom Architekten genau vorgegebenes<br />
Fugenbild zu<br />
erhalten, wurde bei den<br />
Schalungsarbeiten besonderes<br />
Augenmerk auf die<br />
Beplankung mit der<br />
Holzwerkstoffplatte (mit einer<br />
Kunststoffbeschichtung<br />
als eigentliche Schalhaut)<br />
gelegt, wobei alle Platten nur<br />
für einen einzigen Betoniervorgang<br />
verwendet werden<br />
konnten. Sämtliche Stöße<br />
wurden mit Silikon abgedichtet,<br />
um das Austreten<br />
von Zementleim und die daraus<br />
resultierende Bildung<br />
von Nestern zu vermeiden.<br />
Wegen der gewünschten<br />
Scharfkantigkeit belegte<br />
man die Ecken mit Dichtbändern.<br />
Anschließend wurde<br />
die Schalung sauber geschlossen.<br />
Die Ausschalungsfristen<br />
von drei Tagen<br />
für Sichtbeton mussten stets<br />
eingehalten werden. Nach<br />
dem Ausschalen war es notwendig,<br />
die Großflächen-<br />
Elemente der Grundschalung<br />
stehend zwischenzulagern,<br />
da bei einer horizontalen<br />
Lagerung die Gefahr<br />
des Verziehens während<br />
des Wiederaufhebens mit<br />
dem Kran zu groß gewesen<br />
wäre.<br />
Anhand einiger Muster erarbeitete<br />
ein Labor die genaue<br />
Rezeptur für den Beton. Um<br />
einen Beton von durchgehend<br />
gleicher Farbe und<br />
Qualität herstellen zu kön-<br />
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
21
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
22<br />
nen, stellte das Betonwerk<br />
Silos bereit, deren Inhalt genauestens<br />
auf die vorgegebene<br />
Menge an Zement und<br />
Zuschlagstoffen abgestimmt<br />
war. Durch die einmalige<br />
Lieferung der Zuschlagsstoffe<br />
konnte konstant<br />
das gleiche Mischungsverhältnis<br />
garantiert<br />
werden. Folgende, beim<br />
Betonieren maßgebliche<br />
Einflussfaktoren fanden besondere<br />
Beachtung: die<br />
Einbauhöhe des Betons,<br />
der w/z-Wert (< 0,5) sowie<br />
Temperatur und Witterung.<br />
Die Eintauchtiefe und die<br />
Abstände der Betonrüttler<br />
und der Rüttelflaschendurchmesser<br />
wurden auf<br />
die Wanddicken abgestimmt.<br />
Das Trennmittel<br />
wurde nach dem Aufsprühen<br />
auf die Sichtschalung<br />
mit einem Tuch verrieben,<br />
damit es an keiner Stelle zu<br />
dick aufgetragen war. Die<br />
Betoneinbringung geschah<br />
immer fortlaufend, lange<br />
Wartezeiten bei der Betonzufuhr<br />
mussten vermieden<br />
werden. Der Beton wurde in<br />
Lagen von 40 bis 50 cm<br />
eingebracht und anschließend<br />
gerüttelt. Die genaue<br />
Einhaltung der Rüttelzeiten<br />
wurde streng beachtet,<br />
denn eine zu lange<br />
Rüttelphase hätte eine Entmischung<br />
des Betons verursacht.<br />
Die Grobkörnungen<br />
wären dann an den Sichtflächen<br />
durch Schattierungen<br />
sichtbar geworden. Zu kurze<br />
Rüttelphasen dagegen<br />
hätten eine hohe Anzahl an<br />
Lunkern und eine starke Porenbildung<br />
bewirkt. Um eine<br />
zu große Fallhöhe des Betons<br />
zu vermeiden, kamen<br />
da, wo es notwendig war,<br />
Schüttrohre zum Einsatz.<br />
Nach Möglichkeit setzte<br />
man immer dieselbe Mannschaft<br />
beim Betonieren ein.<br />
Nach dem Ausschalen wurde<br />
der Beton lediglich gewaschen;<br />
eine weitere Nachbehandlung<br />
oder Imprägnierung<br />
erfolgte nicht.<br />
Die Terrazzo-Böden werden<br />
nicht in kleinteilige Felder<br />
zerlegt, sondern reichen fugenlos<br />
über 450m² (in verschiedenen<br />
Tonwerten je<br />
Saal). An den Aussenwänden<br />
(auch neben den Treppenläufen)<br />
trennt eine Fuge<br />
den Boden von der aufge-<br />
henden Wand. Dieser<br />
Schlitz dient der unsichtbaren<br />
Belüftung.<br />
Klimatisierung<br />
Die Kunstwerke profitieren<br />
von der sinnlichen Präsenz<br />
der raumbildenden Materialien.<br />
Mit dem Konzept der<br />
hohen Materialpräsenz im<br />
Innern eng verbunden ist<br />
der Umstand, daß die Betonmasse<br />
des Gebäudes<br />
sich gleichsam selbst nach<br />
den Erfordernissen des<br />
Museumsbetriebes richtig<br />
temperiert. Denn in die Massen<br />
der Wände und Decken<br />
sind wasserführende (insgesamt<br />
26 m³) Rohrsysteme<br />
eingegossen, die diese bei<br />
Bedarf abkühlen oder aufheizen,<br />
sowie Rohrsysteme,<br />
mit denen die Atemluft erneuert<br />
wird. Die Absorptions-<br />
und Speicherfähigkeit<br />
der unverkleideten, konstruktiven<br />
Baumasse wird<br />
ausgenutzt, um das Klima<br />
stabil zu halten. Die 25 m tiefen<br />
Schlitzwände werden<br />
als Betonabsorber verwendet,<br />
da in 10 m Tiefe die<br />
Grundwassertemperatur<br />
konstant ca. 12°C beträgt<br />
(diese Technologie wird<br />
„free cooling“ genannt). Als<br />
Wärmequelle dient ein Kondensations-Gasheizkessel.<br />
Voraussetzung für diese träge<br />
Konditionierung ist ein<br />
relativ breites Spektrum akzeptierter<br />
Temperatur- und<br />
Feuchtewerte. Die Klimaanlage<br />
üblichen Zuschnitts, mit<br />
ihren großen Rohren, die<br />
viel Luft transportieren müssen,<br />
um zu heizen oder zu<br />
kühlen, zu entfeuchten oder<br />
zu befeuchten, konnte entfallen.<br />
Die Decken der Ausstellungsräume<br />
in den Obergeschossen-<br />
geschossgroße<br />
Säle, gebaut in der Form<br />
von oben offenen Lichtauffangbehältern<br />
- bestehen<br />
aus Licht, das sich im Glas<br />
verfängt. Offen gefügte<br />
Glastafeln mit freiliegenden<br />
Kanten hängen an Hunderten<br />
von dünnen Stahlstäben<br />
von den Betondecken herunter,<br />
jede Tafel einzeln gehalten.<br />
Ein Meer von Glastafeln,<br />
raumseitig geätzt und<br />
in feinen Nuancen auf den<br />
Flächen und an den Kanten<br />
gläsern schimmernd, verteilt<br />
das Tageslicht im Raum, das
von allen vier Seiten des<br />
Gebäudes in den mannshohen<br />
Hohlraum über der<br />
Glasdecke einfällt. Man<br />
spürt, wie das Gebäude das<br />
Tageslicht in sich aufnimmt,<br />
man ahnt den Sonnenstand,<br />
die Himmelsrichtungen<br />
und erlebt Lichtmodulationen,<br />
verursacht durch<br />
die unsichtbare und doch<br />
spürbare Umgebung draußen.<br />
Und im Innern der Säle<br />
wird das Licht von den drei<br />
Wandscheiben moduliert,<br />
welche die Säle tragen. Die<br />
Konstellation dieser Scheiben<br />
im Raum gibt dem<br />
Lichteinfall unterschiedliche<br />
Richtungen, bewirkt<br />
verschiedenartige Abschattungen<br />
und Reflexionen. Die<br />
Lichtstimmung ist temperiert.<br />
Der Raum gewinnt Tiefe.<br />
Der ständig wechselnde<br />
Lichteinfall erzeugt den Eindruck,<br />
als ob das Gebäude<br />
atme. Alles erscheint durchlässig,<br />
durchlässig für das<br />
Licht, aber auch für den<br />
Wind und für das Wetter, als<br />
käme das Gebäude hier<br />
oben ohne luftdichte Hülle<br />
aus.<br />
Licht<br />
Während bei Tag das Licht<br />
sanft gefiltert in die Räume<br />
strömt, wird bei zunehmender<br />
Dunkelheit die künstliche<br />
Beleuchtung zugeschaltet<br />
und prägt das Erscheinungsbild<br />
des Hauses<br />
am See. Für die Kunstlichtplanung<br />
stellte sich die Aufgabe,<br />
diese Stimmung über<br />
den gesamten Tagesverlauf<br />
beizubehalten. Es galt, das<br />
Tageslichtangebot in den<br />
zentralen Bereichen bei wetter-<br />
und tagesablaufbedingtenHelligkeitsschwankungen<br />
zu ergänzen sowie in<br />
den Nachtstunden optimal<br />
zu ersetzen. Dazu musste<br />
die gläserne Decke möglichst<br />
gleichmäßig mit Licht<br />
bestrahlt werden. Die Lichtplaner<br />
entwickelten hierzu<br />
eine mit einer dimmbaren<br />
Leuchtstofflampe (58W)<br />
bestückte Pendelleuchte mit<br />
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
spezieller Diffusor-Optik, die<br />
die Konturen der Leuchten<br />
verwischt, so dass sie hinter<br />
den Glaselementen<br />
kaum erkennbar sind. Jedem<br />
Glaselement ist jeweils<br />
eine Leuchte zugeteilt (insgesamt<br />
666 Leuchten /<br />
computergesteuertes Lichtmanagement<br />
mit Tageslichtmesskopf<br />
auf dem Dach).<br />
Ihre Anordnung wechselt<br />
zwischen längs und quer,<br />
um eine möglichst gleichmäßige<br />
Lichtverteilung zu<br />
erreichen. Zur Ergänzung<br />
dieser Allgemeinbeleuchtung<br />
erhielten die Ausstellungsräume<br />
unauffällig zwischen<br />
die Glaselemente integrierte<br />
Chromschienen, in<br />
die sich nach Bedarf Strahler<br />
und Fluter als Akzentbeleuchtung<br />
integrieren lassen.<br />
Da in den Hallen nicht einmal<br />
Hängesysteme eingebaut<br />
wurden, die die Klarheit<br />
der Architektur gestört hätten,<br />
müssen die Bilder jedes<br />
Mal mit Dübeln an der Wand<br />
befestigt werden. Löcher<br />
über Löcher könnten so dereinst<br />
wie ein chronologisches<br />
Tagebuch über die<br />
vergangenen Ausstellungen<br />
und ihre Spuren berichten.<br />
Aber Peter Zumthor hat den<br />
Kuratoren und Restauratoren<br />
„einen Sack Zement“<br />
überlassen, dessen Bestandteile<br />
exakt denen des<br />
Wand-Betons entsprechen.<br />
So bleiben auch die originalen<br />
Beton-Farben erhalten<br />
und an der Wand keine einzige<br />
Spur.<br />
Die innere Seite des Fassadenmantels<br />
aus Stahl und<br />
Glas, in die die bautechnisch<br />
notwendigen Dichtungen<br />
und Dämmungen eingearbeitet<br />
sind, ist hier oben<br />
kaum spürbar. Man erlebt<br />
sie im Erdgeschoss, wenn<br />
man durch den tunnelartig<br />
gefassten Haupteingang<br />
hindurch die Foyerplatte<br />
betritt: einen glatten Schaft<br />
aus geätztem Glas, der aus<br />
dem Lichtgraben des Unter-<br />
23
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
24<br />
geschosses hochsteigt und<br />
nach oben verschwindet,<br />
mit einem knappen Abstand<br />
zur monolithischen Betonstruktur,<br />
die er umhüllt und<br />
schützt.<br />
Die massiven Aussenwände<br />
und Glasdecken, welche die<br />
Ausstellungsräume auszeichnen,<br />
fehlen in diesem<br />
Geschoss des Eintritts und<br />
Auftakts. Die drei, aus dem<br />
tief in den Boden eingelassenenFundamentkasten<br />
des zweiten Untergeschossesherauswachsenden<br />
Tragscheiben, die alle<br />
Geschosse durchstoßen<br />
und tragen, stehen hier frei<br />
im Raum. Die glatte Wand,<br />
der glatte Boden, die glatte<br />
Decke. Hier wirkt die Theke<br />
für Kasse und Buchverkauf<br />
wie ein in den feierlichen<br />
Raum hinein gestellter Altar.<br />
Die Wände schirmen die<br />
vertikalen Erschließungen<br />
des Gebäudes - Haupttreppe,<br />
Warenlift, Personenlift,<br />
Nottreppe, Steigleitungen -<br />
vom Hauptraum ab und sind<br />
so in das große Quadrat des<br />
Grundrisses eingeschrieben,<br />
dass sich in den Randzonen<br />
unterschiedliche<br />
räumliche Situationen ergeben.<br />
Es entsteht eine leichte<br />
Dynamik im Raum. Die<br />
Neugier ist geweckt. Sie ist<br />
das auslösende Moment einer<br />
spiralförmigen Bewegung,<br />
die einen durch das<br />
Haus hinaufführt, die einen<br />
erfasst beim Haupteingang<br />
und sanft in den Raum<br />
hineindreht. Jetzt erblickt<br />
man die Tür, den Eingang<br />
zum nächsten Geschoss,<br />
die Kaskade der Treppenflucht<br />
und die strahlende<br />
Tageslichtdecke des oberen<br />
Saales. Sie empfängt den<br />
Besucher gleich hinter der<br />
Tür und führt hinauf ins Licht<br />
der Ausstellung. So geht<br />
man von Geschoss zu Geschoss,<br />
wie von Raum zu<br />
Raum, und erfährt die charakteristische<br />
Stapelung der<br />
Geschosse, das turmartige<br />
des Museums, das sich aus<br />
der städtebaulichen Setzung<br />
ergibt. Dieses Konzept<br />
der „dynamisierten Statik“<br />
(als wollte Zumthor die feierliche<br />
Ruhe seiner Räume<br />
durch eine leichte Bewegung<br />
noch betonen) entspricht<br />
der „Gestimmtheit“<br />
eines Kunsthauses in einem<br />
besonderen Maße. Der<br />
Raum gibt gewissermaßen<br />
den Rhythmus und das<br />
Tempo vor, die beide dem<br />
kontemplativen Durchschreiten<br />
einer Kunstsammlung<br />
entsprechen. Was im<br />
konventionellen Museum<br />
dem Wechsel der Saalgrößen<br />
oder der Richtungsänderung<br />
entspricht, drückt<br />
sich hier in der Behandlung<br />
der Wände und in den Saalhöhen<br />
aus: Dem hohen Eingangsgeschoss<br />
folgen zwei<br />
fast gleiche Säle, deren Wiederholung<br />
durch das „Finale“<br />
eines höheren Saales abgeschlossen<br />
wird, eine subtile<br />
Reihe, die man in der<br />
Poetik mit der Folge a b b c<br />
charakterisieren würde. In<br />
den Obergeschossen ist die<br />
Decke gleich über der Betonwand<br />
am hellsten, dort<br />
wo sie aufliegen müsste, ist<br />
sie offensichtlich am<br />
schwächsten. Die massive<br />
Wand verliert sich in die Helle<br />
und man spürt, dass sie<br />
nicht trägt. Das ganze Gebäude<br />
wirkt trotz seiner<br />
schweren Betonmauern irgendwie<br />
leicht. Es fehlt der<br />
selbstverständliche Eindruck<br />
von übereinandergestellten<br />
Tragmauern. Ein Effekt,<br />
der im Untergeschoss<br />
noch einmal betont wird. Ein<br />
kleiner Veranstaltungssaal<br />
befindet sich im schwarz gehaltenen<br />
ersten Untergeschoss.<br />
Zwei durch Wände<br />
aus Glasbausteinen abgetrennte<br />
Kompartimente enthalten<br />
Sanitärbereiche, Lagerzonen<br />
und Vortragsraum,<br />
während Magazine<br />
und Technik in dem für Besucher<br />
unzugänglichen<br />
zweiten Untergeschoss untergebracht<br />
sind. Die innere
Fassadenschicht steht auf<br />
dem Untergeschossboden,<br />
und das Gestänge des Fassadengerüstes<br />
schiebt sich<br />
zwischen Grundwasserwanne<br />
und Kellerwand.<br />
Man wird irritiert und weiss<br />
nicht genau, worauf das<br />
Haus steht.<br />
Peter Zumthor verwehrt den<br />
Blick auf den See, weil ein<br />
Terrassencafé das Kunsthaus<br />
zu einem touristischen<br />
Aussichtsbau degradieren<br />
und die Allgegenwart des<br />
Bregenzer Seeblicks um<br />
nichts aufwerten würde. Das<br />
Bregenzer Kunsthaus ist ein<br />
Bau, der die Kunst in der<br />
radikalsten Form ernst<br />
nimmt, indem er sich selbst<br />
ihren Gesetzen unterwirft.<br />
Das als selbständiges Haus<br />
konzipierte Verwaltungsgebäude<br />
des Museums, in<br />
dem Räume, die nicht dem<br />
Betrachten von Kunstwerken<br />
dienen, ihren Platz gefunden<br />
haben, spielt im motivischen<br />
Aufbau der Kom-<br />
Schnitt A<br />
position des Platzes eine<br />
wichtige Rolle der Vermittlung.<br />
Die Größe des Gebäudes<br />
und seine Nutzung als<br />
kleines Bürohaus mit Bar<br />
und Museumsshop im Erdgeschoss<br />
passen zur Altstadt.<br />
Ob innen oder außen,<br />
sämtliche Wände bestehen<br />
aus schwarzem Sichtbeton,<br />
zu dem lediglich strahlend<br />
weiße Markisen in Kontrast<br />
treten. Das „Skelett“ des<br />
Verwaltungspavillons ist in<br />
Wirklichkeit eine nach außen<br />
sich abbildende Baustruktur<br />
mit starkem Relief.<br />
Seine Gestaltung dagegen<br />
vermittelt einen Hauch von<br />
überlokalem, urbanem Luxus<br />
und Extravaganz, deren<br />
Bedeutung sich nur aus der<br />
Zugehörigkeit des in vornehmem<br />
Schwarz gehaltenen<br />
Eingangsbauwerkes<br />
zum strahlenden Glaskörper<br />
des Hauptbaus im Hintergrund<br />
erschließt, mit dem es<br />
die Platzfläche teilt und auf<br />
dessen Eingang es mit seiner<br />
Hauptfront hinlenkt.<br />
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
25
Bregenz<br />
Kunsthaus<br />
26<br />
Oberlicht<br />
1.-3.OG<br />
EG
Postautostation<br />
Standort: Chur<br />
Baujahr: 1. Bauabschitt 1993, 2. bis 2005<br />
Bauherr: Schweizerische PTT-Betriebe<br />
Architekt: Richard Brosi, Chur<br />
Obrist & Partner, St. Moritz<br />
Ingenieur: Edy Toscano, Chur<br />
Hegland und Partner, Chur<br />
Tragwerk: Ove Arup & Partners, London<br />
Literatur: Bauwelt Jg. 85/1994, Nr. 23,<br />
Glasforum 3/1994,<br />
Schweizer Ingenieur u. Architekt 25/1993,<br />
Werk, Bauen + Wohnen 11/1993<br />
In der Gesamtüberbauung<br />
„Chur Bahnhofsgebiet“ ist<br />
ein markanter Baukörper<br />
der Nutzung übergeben<br />
worden. Die Architekten<br />
Brosi aus Chur und Obrist<br />
aus St. Moritz gingen 1985<br />
aus einem Wettbewerb mit<br />
ihrem Projekt „Connection“<br />
als Sieger hervor. Im Zentrum<br />
der Überbauung dominiert<br />
ein Glasgewölbe, ähnlich<br />
den Ende des 19.Jahrhunderts<br />
erstellten Bahnhofshallen,<br />
welches im<br />
Endausbau auf 300 m Länge<br />
die Gleisanlagen des<br />
Churer Bahnhofes überspannen<br />
wird. In einer ersten<br />
Etappe wurde von der<br />
PTT das Postautodeck über<br />
den Bahnsteigen erstellt und<br />
zum Schutz der Fahrgäste<br />
mit einer feingliedrigen<br />
Stahlrohrbogenkonstruktion<br />
in Form von zwölf „Zitronen<br />
schnitzen“ und einer<br />
Spezialverglasung auf 90 m<br />
Länge überdeckt. Reisende,<br />
die mit der Bahn ankommen,<br />
erreichen die neue<br />
Postautostation über Rolltreppen<br />
und genießen ungehindert<br />
die Kulisse der<br />
Bündner Bergwelt.<br />
Konzept<br />
und Konstruktion<br />
Eine weitgespannte transparente<br />
Halle überdeckt die<br />
Postautostation über dem<br />
Gleisfeld des Bahnhofs<br />
Chur. Die Haupttragelemente<br />
des Daches bestehen aus<br />
12 zitronenschnitzähnlichen<br />
Rohrbogenkonstruktionen,<br />
die mit Zugstangen unterspannt<br />
sind.<br />
Chur<br />
Postautostation<br />
Sie sind das Ergebnis einer<br />
längeren Entwicklungsarbeit,<br />
die alle denkbaren<br />
Varianten wie Fachwerke,<br />
Dreigurtträger,<br />
Raumfachwerke und Veloradbogen<br />
einschloss.<br />
Entscheidend für die Wahl<br />
war der hohe ästhetische<br />
Wert und die relativ geringen<br />
Mehrkosten gegenüber<br />
einer konventionellen<br />
Lösung. Aus der herstellungstechnischschwierigen<br />
Anordnung der Pfetten<br />
in der Binderebene zusammen<br />
mit den schräggestellten,<br />
gebogenen<br />
Hauptrohren, resultiert<br />
eine optimale räumliche<br />
Tragwirkung, so dass keine<br />
Verbände erforderlich<br />
sind. Damit wird eine klare<br />
gestalterische Lösung<br />
erreicht. Um die Auftriebskräfte<br />
aus Wind mit Eigengewichten<br />
kompensieren<br />
zu können, wurde eine 16<br />
mm dicke Glaseindekkung<br />
gewählt (auch für die<br />
gewählte Spannweite 948<br />
mm erforderlich). Zudem<br />
wurden die Endbogenrohre<br />
zur Gewichtserhöhung<br />
mit größerer Wandstärke<br />
ausgeführt (statt 12,5 mm<br />
20 mm). Zwei Hauptzugstangen<br />
nehmen die horizontalen<br />
Auflagerkräfte<br />
aus der Bogenwirkung auf.<br />
Im leicht erhöhten Zentrum<br />
aus Stahlguss strahlen<br />
zwölf Speichen aus, mit<br />
denen der Rohrbogen reguliert<br />
und den Hauptzugstangen<br />
eine Vorspannung<br />
gegeben wurde. Je-<br />
27
Chur<br />
Postautostation<br />
28<br />
der dieser „Zitronenschnitze“<br />
wurde pro Auflagerseite<br />
lediglich mit einem Bolzen<br />
an die Stützkonstruktion<br />
aufgehängt. Zehn Doppelstützen<br />
mit Dreieck-<br />
Kragarmen übernehmen<br />
die Dachlasten aus den<br />
Bogenträgern und führen<br />
sie in die Parkdeckstützen<br />
ein. Lediglich im östlichen<br />
Bereich leiten zwei freistehende<br />
Stützen von 16m<br />
Länge die Kräfte direkt in<br />
die Fundamente. Später<br />
wird diese freie Stützenkonstruktion<br />
auf über 200 m<br />
Länge im Perronbereich<br />
SBB-RhB die Großzügigkeit<br />
des Tonnengewölbes<br />
erst richtig zur Geltung bringen.<br />
Herstellung des<br />
Postautodecks<br />
Die Stützenstandorte auf<br />
den Bahnsteigen müssen<br />
dem Post- und Bahnbetrieb(Entgleisungsszenarien)<br />
sowie ästhetischen<br />
Ansprüchen Genüge<br />
tragen. Den Doppelstützen<br />
für die Postauto-<br />
Station auf den Mittelperrons<br />
bzw. Einfachstützen<br />
auf den Randperrons<br />
entstprechen doppelte<br />
bzw. einfache, parallel<br />
zu den Perrons verlaufende<br />
Hauptträger für das<br />
Postautodeck, eine reine<br />
Brückenkonstruktion über<br />
den Gleisen. Querträger<br />
sind rechtwinklig zu den<br />
Gleisen alle 2,4 m von<br />
Hauptträger zu Hauptträger<br />
gespannt. Durch<br />
den biegesteifen Stützenanschluss<br />
an die Hauptträger<br />
resultiert ein<br />
Rahmentragwerk, das vor<br />
allem auch in der Lage ist,<br />
die horizontalen Kräfte<br />
aus Wind, Erdbeben, einseitiger<br />
Schneelast aus<br />
dem Hallendach und allen<br />
Asymmetrien der Konstruktion<br />
in die Fundamente<br />
einzuleiten. Die große<br />
Ausdehnung des<br />
Postautodecks von 5000<br />
m² verbietet dessen Fixierung<br />
an Nachbarbauten.<br />
Das Rahmentragwerk ist<br />
schwimmend gelagert,<br />
was entsprechende Maßnahmen<br />
bei den Rolltreppen,<br />
Liften und Fugenübergängen<br />
unausweichlich<br />
macht, bewegen sich die<br />
Ecken des Postautodecks<br />
doch innerhalb eines Jahres<br />
um ± 3 cm. Die<br />
Deckenplatte ist als Beton-<br />
Verbunddecke mit rund 22<br />
cm Dicke auf verlorener<br />
Schalung aus Rippenblechen<br />
ausgeführt.<br />
Das Deck wurde mit einem<br />
Belag aus 14 cm dicken, armierten<br />
und gefugten Beton<br />
versehen. Das notwendige<br />
Gefälle zur Entsorgung des<br />
Meteor-Schnee- und<br />
Waschwassers wurde bereits<br />
in den Sekundär-Stahlträgern<br />
berücksichtigt. Zwischen<br />
Verbundbetondecke<br />
und Betonbelag liegt eine<br />
doppelte vollflächig verklebte<br />
Kunststoffbitumenbahn<br />
und ein Gussasphalt.<br />
Sämtliche Bauteile unter<br />
den Gleisen – das sind der<br />
Gepäcktunnel PTT quer zu<br />
den Gleisen, der Gepäcktunnel<br />
SBB parallel im Perron<br />
1 und die Rampen zu<br />
den Perrons - dienen gleichzeitig<br />
als Fundation für die<br />
Postautostation und das<br />
Hallendach.<br />
Herstellung des Stahlgerippes<br />
Die „Zitronenschnitze“ stellen<br />
große Anforderungen an<br />
die geometrische Systemberechnung:<br />
die dreidimensionale<br />
Darstellung wurde<br />
im CAD mit Zusatzprogrammen<br />
gelöst. Detaillierte<br />
Abklärungen erforderte<br />
die Wahl zwischen Stahlguss<br />
und Schweißkonstruktion<br />
für die Aufhängepunkte<br />
an den Enden<br />
der „Schnitze“. Die<br />
Schweißlösung wurde bevorzugt<br />
wegen besser beherrschbarer<br />
Toleranzen<br />
und Liefertermine sowie aus<br />
wirtschaftlichen Gründen:<br />
erhebliche Kosteneinsparungen<br />
und größere Wertschöpfung<br />
beim Stahlbau-<br />
Unternehmer. Die Maßtoleranzen<br />
der über 2600<br />
Auflager für die Dachverglasung<br />
am fertigen Bauwerk<br />
mussten innerhalb<br />
von ± 4 mm liegen.<br />
Die zwei Hauptzugstangen<br />
M 56 wurden an den Anschlussstellen<br />
mit Gelenken<br />
versehen. Im leicht erhöhten<br />
Zentrum in<br />
Stahlguss strahlen zwei-
mal sechs Speichen aus,<br />
mit denen der Rohrbogen<br />
leicht regulierbar und den<br />
Hauptzugstangen eine<br />
Vorspannung gegeben<br />
wird. Zur Erhöhung des<br />
Brandwiderstandes sind<br />
die Hauptzugstangen mit<br />
einem feuerhemmenden<br />
Anstrich (F30) versehen.<br />
Räumliches Denken war erste<br />
Bedingung, weil im<br />
Gegensatz zu einer konventionellenStahlkonstruktion<br />
für die Fabrikation<br />
keine ebenen oder<br />
rechtwinkligen Anhaltspunkte<br />
vorhanden waren.<br />
Montage des Stahldaches<br />
Als Montagefläche stand<br />
nur das Postautodeck, um<br />
einiges kleiner als die Dachfläche,<br />
zur Verfügung. Das<br />
östlich anschließende<br />
Gleisfeld mit den Fahrleitungen<br />
ließ keine normalen<br />
Baubedingungen<br />
zu, da der Bahnbetrieb<br />
nicht eingeschränkt werden<br />
durfte. Auch die Tivolibrücke<br />
am westlichen<br />
Ende war aus verkehrstechnischen<br />
Gründen nicht<br />
benutzbar. Daraus ergaben<br />
sich zwei unterschiedliche<br />
Arbeitsmethoden.<br />
Acht „Zitronenschnitze“ wurden<br />
etappenweise auf<br />
Hilfsgerüsten zusammengebaut<br />
und über eine Verschubbahn<br />
im Wochentakt<br />
in ihre endgültige Lage<br />
gezogen. Die Korrosionsschutzarbeiten<br />
und die<br />
Dachverglasungen wurden<br />
unmittelbar nach der<br />
Stahlmontage ausgeführt.<br />
Danach erfolgte die Montage<br />
der restlichen Schnitze<br />
am endgültigen Ort,<br />
wozu die Hilfsgerüste umgesetzt<br />
werden mussten.<br />
Die Stützen wurden in zwei<br />
Teilen antransportiert, zusammengebaut<br />
und auf<br />
die vorhandenen Busdeckstützenaufgeschweißt.<br />
Im östlichen Bereich<br />
konnten sie erst nach<br />
dem Verschieben des<br />
Daches montiert werden.<br />
Ein Nachregulieren der<br />
vollverschweißten Dachkonstruktion<br />
war nicht<br />
mehr möglich, und Bautoleranzen<br />
waren zu berücksichtigen,<br />
damit die Aufhängebolzen<br />
an den Stüt-<br />
Chur<br />
Postautostation<br />
zenarmen mühelos durch<br />
die Ösen der Schnitzenden<br />
gesteckt werden konnten.<br />
Zusammenbaulehren<br />
und laufende Maßkontrollen<br />
reduzierten die Abweichungen<br />
auf ein Minimum.<br />
Glaseindeckung<br />
Die aufgeständerte und in<br />
sich schwimmend gelagerte<br />
Glashaut (Verglasungsystem<br />
aus Chromnickelstahl)<br />
übernimmt<br />
keine Lasten der Haupttragkonstruktion.<br />
Die Glasscheiben<br />
der Abmessungen<br />
935 x 2000 mm verlaufen<br />
in polygonaler Anordnung<br />
quer über das Dach.<br />
Die kontinuierliche Auflagerung<br />
auf den alle 940 mm<br />
angeordneten Sprossen erlaubt<br />
die Übertragung der<br />
Schneelast von 2 kN/m². Die<br />
Längsfugen weisen eine<br />
Verkittung aus Silikon auf.<br />
Das Verbundglas Float 8<br />
mm PVB-Folie Float 8 mm<br />
erhöht die Absturzsicherheit<br />
der Einzelglasscheiben.<br />
Auf die Verwendung von<br />
Sicherheitsglas konnte<br />
wegen einer statistisch<br />
geringen Hagelwahrscheinlichkeit<br />
und Hagelintensität<br />
verzichtet werden.<br />
Die Widerstandsfähigkeit<br />
des Glases beim<br />
Begehen des Daches, z.B.<br />
bei der Reinigung, wurde<br />
getestet. Trotz einer unregelmäßigen<br />
Geometrie<br />
wurde Gleichheit in den<br />
Einzelteilen geschaffen,<br />
damit eine optimale Fabrikation<br />
und Montage möglich<br />
wurde. Die Schienen<br />
der maschinell betriebenenDachreinigungsanlage<br />
dienen gleichzeitig als<br />
Schneefänger.<br />
Das Bauwerk wirkt lichtund<br />
luftdurchflutet, leicht,<br />
elegant. Die Transparenz<br />
ermöglicht ein „Hindurchschauen“.<br />
In der Nacht<br />
wirkt die mit einer ausgeklügelten<br />
Beleuchtung versehene<br />
Glashalle als<br />
leuchtendes Wahrzeichen<br />
von Chur. Für den Benutzer<br />
spiegelt sich der Innenraum<br />
an der Glashaut und<br />
verstärkt somit den Hallen-<br />
Eindruck.<br />
29
Chur<br />
Postautostation<br />
30<br />
Schnitt<br />
Ansicht<br />
´Schnitze´
Verwaltungsgebäude in Chur<br />
Standort: Ottostraße 22-24, Chur<br />
Baujahr: 1995-98<br />
Bauherr: Gebäudeversicherung GR,<br />
Familienausgleichskasse GR<br />
Architekt: Dieter Jüngling, Andreas Hartmann<br />
Ingenieur: Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur,<br />
Colenco Straub AG, Chur<br />
Literatur: Baumeister Jg 97, Nr.9 2000<br />
Nähert man sich zum ersten<br />
Mal dem Bürogebäude<br />
am Ottoplatz in dem vorwiegend<br />
mit Wohnhäusern<br />
bebauten Quartier am Rande<br />
der Altstadt, stellt sich<br />
das Gefühl eines Déjà-vu<br />
ein. Man hat diese Art Fassaden<br />
schon gesehen. Das<br />
Schachbrettmuster, das an<br />
verspielte Vorhangwände<br />
der sechziger Jahre erinnert,<br />
weist das Gebäude<br />
als Verwaltungsbau aus.<br />
Es markiert den Übergang<br />
zur Innenstadt und gibt sich<br />
gleichwohl kleinteilig, der<br />
benachbarten Wohnbebauung<br />
angepasst. Nach<br />
außen zeichnen sich vier<br />
prismatische Baukörper ab;<br />
sie staffeln sich in leichtem<br />
Schwung die Ottostraße<br />
entlang, treten auf der<br />
Rückseite am ruhigeren<br />
Calvenweg gar wie Einzelbauten<br />
stärker hervor.<br />
Erst der Grundriss verrät<br />
die Besonderheit dieses<br />
Gebäudes. Das Erdgeschoss<br />
ist zwischen den<br />
Querschotten komplett frei<br />
überspannt: Es gibt weder<br />
Chur<br />
Verwaltungsgebäude<br />
Stützen noch sonstige tragende<br />
Elemente - von den<br />
Kernen abgesehen. In den<br />
oberen Geschossen hingegen<br />
trifft man auf für heute<br />
übliche Bürogrundrisse<br />
stark segmentierte Raumaufteilungen;<br />
quer zu den<br />
Schotts stehende massive<br />
Wandscheiben - jeweils<br />
zwei Außen- und zwei Korridorwände,<br />
im regelmäßigen<br />
Rhythmus durch Fenster-<br />
und Türöffnungen<br />
durchbrochen - gliedern<br />
den Raum. Innenhöfe teilen<br />
die Gebäudetiefe in<br />
zwei jeweils zweihüftige<br />
Trakte.<br />
Dies lässt folgendes Nutzungskonzept<br />
erkennen:<br />
Die Erdgeschosszonen<br />
sind konsequent von jedem<br />
Tragelement freigehalten<br />
worden, um ein Höchstmaß<br />
an Flexibilität für die Raumaufteilung<br />
zu gewährleisten.<br />
Selbst die Fassaden<br />
des Erdgeschosses, wo<br />
Stützen diese Freiheit nicht<br />
eingeschränkt hätten, sind<br />
stützenlos überspannt.<br />
Die Obergeschosse sind in<br />
ihrer Nutzung hingegen als<br />
herkömmliche Einzelbüros<br />
31
Chur<br />
Verwaltungsgebäude<br />
32<br />
festgelegt. Kombi- oder<br />
Großraumlösungen sind für<br />
die Zukunft ausgeschlossen.<br />
Ein gewisser Flexibilitätsgrad<br />
bleibt dennoch erhalten,<br />
indem die leichten<br />
Trennwände zwischen den<br />
Büros beliebig angeordnet<br />
werden können.<br />
Konstruktion<br />
Das Gebäudetragwerk besteht<br />
ausschließlich aus<br />
Scheiben. Einige Scheiben<br />
sind „aufgehängt“ und wirken<br />
wie Balken auf zwei<br />
Auflagern mit großer statischer<br />
Höhe. Sie aktivieren<br />
so eine statische Ressource,<br />
die im Geschossbau in<br />
der Regel ungenutzt bleibt:<br />
die Geschosshöhe.<br />
So einfach und einleuchtend<br />
dies klingt, ist das<br />
Prinzip dennoch mit einigen<br />
Schwierigkeiten behaftet.<br />
Die freitragende Scheibe<br />
muss nutzungsbedingt<br />
durchbrochen sein; je<br />
durchlässiger das Lochgitter,<br />
desto besser. Sie<br />
könnte bei einer regelmäßigen<br />
orthogonalen Anordnung<br />
der Öffnungen ihre<br />
Wirkungsweise als<br />
„Vierendeelträger“ entfalten<br />
(Schema A), vorausgesetzt,<br />
es sind sowohl genügend<br />
breite senkrechte<br />
Streifen verfügbar (hier gegeben<br />
durch die Wandabschnitte),<br />
als auch waagerechte<br />
Stürze (hier nicht<br />
gegeben, da die Deckenstreifen<br />
zu dünn sind, siehe<br />
Schema B). Das Tragverhalten<br />
der perforierten<br />
Scheiben ist in diesem Fall<br />
ein anderes: Es beruht auf<br />
der Abtragung von abwechselnd<br />
Zug- und Druckkräften<br />
in diagonaler Richtung<br />
innerhalb der Wandabschnitte<br />
aus Beton<br />
(Schema C).<br />
Mithin gilt das Prinzip eines<br />
Fachwerkträgers mit diagonalen<br />
Füllstäben. Hieraus<br />
erklärt sich der schachbrettartige<br />
geschossweise<br />
Versatz der Fenster zueinander.<br />
Man kann sagen,<br />
dass die diagonalen Kraftpfade<br />
ihren Weg im zusammenhängenden<br />
Gerüst aus<br />
Wandabschnitten und Geschossdecken<br />
finden. In<br />
den verbleibenden rautenförmigen<br />
Feldern, die frei<br />
von Kraftlinien sind, liegen<br />
die Fensteröffnungen. Dieses<br />
Prinzip ist bei den Mittelflurwänden<br />
als monolithische<br />
Ortbetonkonstruktion<br />
umgesetzt, wobei die übliche<br />
Aufgabenzuweisung<br />
für Stahlbeton gilt: Druckkräfte<br />
werden im Beton,<br />
Zugkräfte in der stählernen<br />
Bewehrung aufgenommen.<br />
Die Außenwände sollten<br />
eine natursteinähnliche<br />
Oberfläche erhalten, die<br />
nur mit Fertigteilen zu verwirklichen<br />
war. Es wurde<br />
ein spezieller Zuschlag aus<br />
Muschelkalk verwendet,<br />
der nach Sandstrahlung<br />
eine angenehme warmgraue<br />
Oberfläche hinterließ.<br />
Hier wurde die Scheibenwirkung<br />
nicht monolithisch,<br />
sondern durch<br />
nachträgliche Vorspannung<br />
der Fertigteile realisiert.<br />
Besonders spektakulär findet<br />
diese Bauweise in der<br />
ebenfalls im Schachbrettmuster<br />
gestalteten Westfassade<br />
zur Hartbertstraße<br />
Anwendung, die über etwa<br />
30 Meter frei spannt.<br />
Form<br />
Das Gebäude gibt dem unkundigen<br />
Betrachter Rätsel<br />
auf: Trotz anderslautender<br />
Absichtserklärungen der<br />
Autoren, das Bild der steinernen<br />
„Lochfassade“ der<br />
umgebenden Bebauung<br />
aus der Jahrhundertwende<br />
übernommen zu haben,<br />
zeigt der Bau ein eigenwilliges<br />
Gesicht. Die Fenster<br />
sind keine Löcher in einer<br />
Mauerfläche. Eher umgekehrt:<br />
Sie sind Restflächen<br />
innerhalb eines Musters<br />
aus einzelnen zusammengesetztenWandabschnitten<br />
und Geschossdecken.<br />
Die Gebäudeansicht ist<br />
deshalb durchaus als „Rasterfassade“<br />
deutbar, wenn<br />
auch mit einem eher unge-
wöhnlichen Schachbrett-<br />
Arrangement. Aber auch<br />
dieses kennt man von<br />
nichttragenden Vorhangfassaden<br />
an Skelettbauten,<br />
provokant „frei“ gestaltet<br />
und bewusst als solche zelebriert.<br />
Gerade der geschossweise<br />
Versatz der Fensteröffnungen<br />
vollzog und proklamierte<br />
im Vokabular der Moderne<br />
ja den eklatanten Verstoß<br />
gegen die streng vertikale<br />
Fassadengliederung<br />
des tradierten Massivbaus.<br />
Was hier in der Tat die<br />
Scheibenwirkung der Außenwände<br />
erst ermöglicht<br />
- der diagonale Versatz -,<br />
entspringt ironischerweise<br />
der Grammatik der spielerisch<br />
frei gestalteten, weil<br />
von statischen Aufgaben<br />
entbundenen Fassade.<br />
Verwirrend auch die Tatsache,<br />
dass die Breiten der<br />
Wandabschnitte und Fensteröffnungen<br />
nach einem<br />
zunächst nicht erkennbaren<br />
Prinzip variieren. Dies<br />
unterstützt das ursprüngliche<br />
Bild des Spielerisch-<br />
Zufälligen. Erst später<br />
leuchtet der Grund hierfür<br />
ein: Der diagonale Verlauf<br />
der versteckt im Betonkörper<br />
geführten Spannstähle<br />
zwingt zu verschiedenen<br />
Breiten, je nachdem, ob sie<br />
im auflagernahen Bereich<br />
verlaufen oder in Feldmitte.<br />
Die Autoren wenden<br />
sich gegen jeden Versuch<br />
einer dogmatischen Klassifizierung<br />
oder zu engen<br />
Deutung ihres Projekts.<br />
Das Gebäude verschleiere<br />
eher bewusst seine strukturelle<br />
Wirkungsweise als<br />
sie zu offenbaren. Dies bewahrheitet<br />
sich in der Tat an<br />
einem anderen, sehr bedeutsamen<br />
Punkt: Kaum<br />
etwas unterscheidet die<br />
Verglasung der Erdgeschosszone<br />
von der eines<br />
konventionellen Skelettbaus<br />
mit Stützen hinter der<br />
Glasfläche. Wir sind es gewohnt,<br />
diese hinter den<br />
streifenförmigen senkrechten<br />
Feldern (hier sind es die<br />
Lüftungsflügel) der Verglasung<br />
zu vermuten. Erst der<br />
nähere Blick zeigt, dass die<br />
dahinterliegenden körperhaften<br />
Figuren keine Stüt-<br />
Chur<br />
Verwaltungsgebäude<br />
zen, sondern zusammengeraffte<br />
Gardinen sind, die<br />
Erdgeschosszone folglich<br />
komplett stützenfrei ist. Wir<br />
finden keine sprossenfreie<br />
Verglasung, die zumindest<br />
einen Hinweis auf diesen<br />
statischen Kraftakt gegeben<br />
hätte.<br />
Einmal auf die Fährte gebracht,<br />
richtet sich der Blick<br />
auf die breite Schattenfuge,<br />
die die Erdgeschossverglasung<br />
als „eingestelltes“ kastenartiges<br />
Element deutlich<br />
zeigt (leider an einigen<br />
Stellen verdeckt durch offenbar<br />
nachträglich montierten<br />
Sonnenschutz). Die<br />
sandgestrahlte „steinerne“<br />
Oberfläche der Fassade<br />
taucht im Innenraum des<br />
Erdgeschosses wieder an<br />
den massiven Wänden und<br />
Decken auf und suggeriert<br />
gleichsam den Außen- oder<br />
Hohlraum-Charakter diese<br />
stützenfreien Geschosses,<br />
verdeutlicht die Zusammengehörigkeit<br />
der darüberliegenden<br />
Stockwerke<br />
im freitragenden<br />
„Geschosskasten“.<br />
Der räumlich stark verschachtelteErdgeschossgrundriss<br />
verwirklicht - trotz<br />
der bewusst als eingestellte<br />
hölzerne Boxen gestalteten<br />
Raumzellen - nichts<br />
von der möglichen räumlichen<br />
Großzügigkeit.<br />
33
Chur<br />
Verwaltungsgebäude<br />
34<br />
Grundriss EG, OG<br />
System<br />
Schnitt
Chur<br />
Verwaltungsgebäude<br />
Längsschnitt<br />
35
Chur<br />
Schutzbauten f. römische Funde<br />
36<br />
Schutzbauten für römische Funde<br />
Standort: Welschdörfli bei Chur<br />
Baujahr: 1985-86<br />
Bauherr: Bundesamt – Amt für Bundesbauten<br />
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein<br />
Ingenieur: Jürg Buchli<br />
Literatur: Peter Zumthor, Häuser 1979 – 1997,<br />
Werk, Bauen + Wohnen 10/1997<br />
Von der römischen Anlage<br />
in der Nähe von Chur blieben<br />
lediglich die Fundamente<br />
und einige Mauerfragmente<br />
erhalten. Die<br />
Bauaufgabe bestand darin,<br />
diese archäologischen Reste<br />
zu schützen und zugleich<br />
ein kleines Museum<br />
zu schaffen. Zumthor verknüpfte<br />
diese zwei Anforderungen<br />
in einer Raumgruppe,<br />
deren Wände entlang<br />
der alten Fundamente verlaufen,<br />
sie zugleich schützen<br />
und darüber hinaus das<br />
ursprüngliche Volumen der<br />
römischen Anlage (als Hypothese)<br />
andeuten. Es handelt<br />
sich um eine abstrakte<br />
Rekonstruktion, die sich<br />
weder auf die Gebäudehöhe<br />
oder -form noch auf die<br />
Materialien bezieht, sondern<br />
lediglich eine Ahnung von<br />
der ursprünglichen Anlage<br />
vermittelt; sie dient als Idee<br />
und Anleitung zum Entwurf.<br />
Das Museum besteht aus<br />
zwei Teilen, aus der Gebäudehülle<br />
und einer Passerelle.<br />
Die Hülle umschliest - mit<br />
kleinem Abstand - die alten<br />
Fundamente und begrenzt<br />
mehrere Räume; durch<br />
schräg versetzte (gelbe)<br />
Holzlamellen dringt diffuses<br />
Licht. Diese halbtransparente<br />
Wand, die in der Nacht<br />
und von innen wie ein<br />
Schleier erscheint, deutet<br />
an, dass es sich nicht um ein<br />
richtiges Haus handelt - eher<br />
um Nippes, in denen sich<br />
etwas Wertvolles befindet.<br />
Mehrere „Schaufenster“ unterstreichen<br />
diesen Ein- und<br />
Ausdruck. Das von allen<br />
Seiten eindringende, gedämpfte<br />
Licht (die Öffnungen<br />
dienen auch dem klimatischen<br />
Gleichgewicht) wird<br />
durch einen Lichtkegel ergänzt,<br />
der von oben in die<br />
Raumzentren strahlt. Die<br />
Reduktion auf wesentliche<br />
architektonische Elemente -<br />
Wand, Raum und Lichtspiel<br />
- ergeben zusammen ein<br />
Ganzes als eine Erzählung,<br />
die vom (heute sehr sorgfältigen)<br />
Bewahren archäologischer<br />
Gegenstände berichtet.<br />
Der Passerelle wird eine rein<br />
funktionelle Aufgabe zugewiesen:<br />
sie ist ein Wanderweg<br />
durch die Archäologie.<br />
Die Distanz der Zeiten und<br />
der Besucher zu den Fundgegenständen<br />
wird durch<br />
die Eisenkonstruktion (die<br />
sowohl die Fundamentsteine<br />
als auch das<br />
sie schützende Holz kontrastiert)<br />
zum Ausdruck gebracht.<br />
Wenn man die Stahlpasserelle<br />
betreten hat, befindet<br />
man sich in einer<br />
ahistorischen Beobachtungssituation.<br />
Auf diesem<br />
Weg tritt man durch dunkle<br />
Verbindungstunnel von<br />
Raumeinheit zu Raumeinheit<br />
und über Treppen hinab<br />
auf das Grabungsniveau,<br />
den römischen Boden. Diese<br />
kleinen „Puffer“, Déjà vus,<br />
erinnern an Verbindungsteile<br />
von Zugwaggons oder -<br />
in allerdings kleineren Dimensionen<br />
- an den Balg<br />
eines Fotoapparates. Über<br />
den unmittelbaren Zweck<br />
hinaus hat Zumthor der<br />
Passerelle auch eine eher<br />
verschlüsselte Bedeutung<br />
gegeben, als Bilder, die ans<br />
Reisen und an Touristen erinnern.<br />
Den römischen Mauerzügen<br />
sind schwarze Tücher<br />
hinterlegt. Durch die Lamellenstruktur<br />
der Wände<br />
dringt der Lärm der Stadt.<br />
Man spürt den Stand der<br />
Sonne und den Wind und<br />
ist doch gleichzeitig eingehüllt<br />
und gefangen in einem<br />
geschichtlichen Raum.
Querschnitte<br />
Längsschnitt<br />
Grundriss<br />
Chur<br />
Schutzbauten f. römische Funde<br />
37
Bonaduz<br />
Totenhaus / Aufbahrungshalle<br />
38<br />
Totenhaus/Aufbahrungshalle<br />
Standort: Bonaduz<br />
Baujahr: 1993<br />
Bauherr: Gemeinde Bonaduz<br />
Architekt: Rudolf Fontana,<br />
Christian Kerez (Entwurf)<br />
Mitarbeiter: Leo Bihler<br />
Literatur: Baumeister 3/1995,<br />
Werk, Bauen + Wohnen 9/1994<br />
In den ländlichen Gemeinden<br />
Graubündens werden<br />
Tote in der Regel noch zu<br />
Hause aufgebahrt. Seit das<br />
Dorf Bonaduz zum Einzugsgebiet<br />
Churs gehört,<br />
sind viele Pendler mit kleinen<br />
Wohnungen hinzugekommen:<br />
eine Aufbahrungshalle<br />
wurde notwendig.<br />
Den ersten Entwurf, ein<br />
Totenhaus im Stil der örtlichen<br />
Wohnhäuser, lehnte<br />
die Gemeinde ab. Damit<br />
war der Weg frei für eine<br />
ungewöhnliche Lösung.<br />
Die Pfarrkirche stößt mit der<br />
Apsis an einen Felssturzhügel<br />
wie sie um Chur nach<br />
der letzten Eiszeit häufig<br />
von Felslawinen zurückgelassen<br />
wurden. Während<br />
sie sonst mit Kirchen oder<br />
Kapellen weithin sichtbar<br />
besetzt sind, liegt er in Bonaduz<br />
wie eine bewaldete<br />
Abraumhalde im Zentrum.<br />
Für eine Bebauung ist er zu<br />
klein. Kirche, Friedhof,<br />
Schule und Turnhalle sind<br />
um das Hindernis<br />
herumgruppiert. Die Gemeinde<br />
wollte diesen Raum<br />
nutzen und machte zur Auflage,<br />
die Aufbahrungshalle<br />
in den Hügel zu bauen. So<br />
hätte auch der Tod aus dem<br />
öffentlichen Gesichtskreis<br />
verdrängt werden können,<br />
wie bisher bei der privaten<br />
Aufbahrung.<br />
Christian Kerez, der mit der<br />
Planung beauftragte Mitarbeiter<br />
des Büros Rudolf<br />
Fontana, drehte mit seinem<br />
Entwurf diese Erwartungen<br />
gewissermaßen um. Die<br />
Totenhalle sollte nicht im<br />
Fels verschwinden, sondern<br />
ihn sichtbar krönen.<br />
Nicht eine Anbiederung, ein<br />
Verschmelzen mit der vorzeitlichen<br />
Natursituation,<br />
ein bewusster Kontrast zur<br />
Umgebung wurde bestimmend.<br />
Wie eine flache<br />
Kappe ragt die Halle aus<br />
dem Hügel hervor. Der<br />
Kranz aus Glasbausteinen<br />
und die Betondeckenplatte<br />
stehen in ihrer industriellen<br />
Nüchternheit in einem<br />
größtmöglichen Gegensatz<br />
zu den Steildächern der<br />
Kirche und dem natürlichen<br />
Bewuchs des Felsens.<br />
Durch die neue Nutzung<br />
scheint der Hügel erst als<br />
der Fremdkörper sichtbar<br />
gekennzeichnet zu sein,<br />
der er inmitten der Bebauung<br />
schon immer war. Es<br />
ist, als wäre ein Ufo gelandet.<br />
Jede Natürlichkeit wurde<br />
vermieden. Die Eingangstür<br />
aus Lärchenholz<br />
ist so ziemlich das einzige<br />
Zugeständnis an das Bedürfnis<br />
nach Heimeligkeit.<br />
Hinter ihr führt ein aufsteigender<br />
schachtartiger
Gang aus Ortbeton ins Hügelinnere.<br />
Die Milchglastür<br />
an seinem Ende scheint<br />
von überirdischem Licht<br />
erhellt. Die eigentliche Aufbahrungshalle<br />
beeindruckt<br />
vor allem als Lichtereignis<br />
- ganz in der Tradition der<br />
Kirchenbauten von Rudolf<br />
Schwarz, der auch Peter<br />
Zumthor, den führenden<br />
Bündner Architekten, immer<br />
wieder inspiriert.<br />
An trüben Wintertagen ist<br />
es im Innern heller als unter<br />
freiem Himmel. Der ovale<br />
Grundriss mit Achslängen<br />
von sechs und zwölf<br />
Metern - aus der Geometrisierung<br />
der Hügelform<br />
gewonnen - entzieht dem<br />
Blick klar bestimmbare Koordinaten.<br />
Das diffuse<br />
Licht, das durch den Kranz<br />
aus Glasbausteinen unterhalb<br />
der Decke nach unten<br />
fällt, löst das weiße Rund<br />
der siebeneinhalb Meter<br />
hohen Wand am Scheitelpunkt<br />
in eine scheinbar unbestimmbare<br />
Ferne auf.<br />
Jede Erdenschwere ist verschwunden.<br />
In der Geschlossenheit<br />
herrscht<br />
Weite. Dass man von Felsmasse<br />
umschlossen ist,<br />
scheint undenkbar.<br />
Da wird keine Trauer illustriert;<br />
vielmehr scheint der<br />
Bonaduz<br />
Totenhaus / Aufbahrungshalle<br />
physische Tod beinahe aufgelöst<br />
in Verklärung und<br />
Himmelfahrt. Einzig die<br />
Bodenplatten aus weißem<br />
Naxosmarmor geben mit<br />
dem klaren Linienmuster,<br />
das die nachgedunkelten<br />
Fugen ziehen, Verankerung.<br />
Gestört wird diese<br />
überirdische Heiterkeit lediglich<br />
durch die beiden<br />
Aufbahrungszellen, die in<br />
eine Bucht des Ovals gestellt<br />
sind, und es vor allem<br />
wegen der Künstlichkeit ihrer<br />
Materialien zum Container<br />
machen. In ihrer Enge<br />
können Angehörige die nötige<br />
Privatheit mit dem Toten<br />
finden. Ein Kühlraum<br />
zur Aufbewahrung weiterer<br />
Leichname ist wie die Anlage<br />
für die künstliche Belüftung,<br />
die Steuerung der<br />
Fußbodenheizung und<br />
eine Toilette in einem Nebenraum<br />
untergebracht,<br />
der durch den breit angelegten<br />
seitlichen Aushub<br />
des Felsmaterials neben<br />
dem Eingangsschacht gewonnen<br />
wurde. Mit 700.000<br />
Franken Baukosten liegt<br />
das ungewöhnliche Gebäude<br />
im üblichen Rahmen.<br />
Mit der Aufbahrungshalle<br />
wird ein durch Bäume gesäumtes<br />
Trottoir geschaffen,<br />
das die neuen Wohnquartiere<br />
im Südosten von<br />
Bonaduz mit dem alten<br />
Dorfkern verbindet.<br />
Der südliche Zugangsweg<br />
zwischen Friedhof und Kirche<br />
erfährt so ebenfalls<br />
eine Verbesserung, weil er<br />
als axiale Erschließung der<br />
geplanten Aufbahrungshalle<br />
eine neue Bedeutung<br />
gewinnt. Die Neugestaltung<br />
dieses Zugangsweges bedingt<br />
eine klare Trennung<br />
zwischen Friedhof und Kirche.<br />
Deshalb wird die alte<br />
Friedhofsmauer im<br />
39
Bonaduz<br />
Totenhaus / Aufbahrungshalle<br />
40<br />
Eingangsbereich korrigiert<br />
und erhält zudem neue<br />
Tore. Die Stützmauer entlang<br />
der Kirchenstraße<br />
wird in der vorhandenen<br />
Weise ergänzt bis hin zum<br />
neuen Kirchenzugang im<br />
Südosten, so dass die<br />
Pfarrkirche auf einem leicht<br />
erhöhten Plateau freigelegt<br />
wird.<br />
Schnitt<br />
Lageplan<br />
Grundriss<br />
Schnitt
Haus «Truog Gugalun»<br />
Standort: Safiental<br />
Baujahr: 1992-93<br />
Bauherr: Fam. Truog<br />
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein<br />
Mitarbeiter: Beat Müller und Zeno Vogel<br />
Literatur: Neues Bauen in den Alpen 1995, Archithese 5.95<br />
Ein kleiner Hof, schmale<br />
Existenzgrundlage einer<br />
Bergbauernfamilie über<br />
Generationen (der Stubenteil<br />
datiert von 1760), war<br />
für die Nachfahren, die das<br />
Gütchen geerbt haben, so<br />
zu erneuern, dass er zeitgemäß<br />
bewohnt werden<br />
kann, ohne seinen Zauber<br />
zu verlieren – den Zauber<br />
seiner abgeschiedenen<br />
Lage am Nordhang (gugalun<br />
= den Mond anschauen)<br />
unter einer baumbestandenen<br />
Krete, die Natürlichkeit<br />
des Fußpfades,<br />
der als einzige Erschliessung<br />
der Krete entlang<br />
zum Haus hinabführt, die<br />
Spuren des Alters: des<br />
schmalbrüstigen, auf<br />
schlechtem Fundament<br />
schief gewordenen Stubenteils<br />
mit seinen zahlreichen<br />
Flickstellen im Holzwerk,<br />
die erkennen lassen,<br />
wie klein die Fenster<br />
und wie niedrig die Dekken<br />
und Türen ursprünglich<br />
waren.<br />
Der Entwurf respektiert diese<br />
Dinge. Unter einem ge-<br />
Versam/Safiental<br />
Haus Truog<br />
meinsamen neuen Dach,<br />
auf das ursprüngliche Niveau<br />
heruntergesetzt, wurde<br />
dem Bestehenden nur<br />
das hinzugefügt, was ihm<br />
aus heutiger Sicht fehlte:<br />
eine moderne Küche, Bad<br />
und Toilette, zwei Kammern<br />
mit größeren Fenstern,<br />
eine zusätzliche Holzfeuerung.<br />
Dabei wurde versucht,<br />
darauf zu achten,<br />
dass eine neue Ganzheit<br />
entsteht, in der Alt und Neu<br />
aufgehen. Jetzt nach fast<br />
zehn Jahren, wenn die<br />
Sonne die neuen Holzbalken<br />
geschwärzt hat, wird<br />
man sehen, wie dieses<br />
Ziel erreicht wurde.<br />
«Strickbauten» heißen in<br />
Graubünden die aus massiven<br />
Holzbalken gefügten<br />
Blockhausbauten. Und<br />
Umstricken oder Weiterstricken<br />
war auch das Thema<br />
dieses Entwurfes.<br />
Der Grundriss ist so angelegt,<br />
dass im neuen Teil die<br />
für die alten Bauernhäuser<br />
41
Versam/Safiental<br />
Haus Truog<br />
42<br />
der Region klassische Abfolge<br />
von Stubenteil (alt),<br />
Quergang mit Treppe<br />
(neu), Küchenteil (neu)<br />
wieder aufscheint. Der<br />
ehemalige Küchenteil war<br />
nach diesem traditionellen<br />
Grundmuster gebaut. Historisch<br />
von geringerer Bedeutung<br />
und in einem<br />
schlechten Zustand wurde<br />
er zum Ort des Eingriffs.<br />
Die notwendige Vergrößerung<br />
des Baukörpers erfolgte<br />
hier, hinten am<br />
Hang. Der talseitige Stubenteil<br />
durfte seinen Ort<br />
behalten.<br />
Eine Wanne aus Beton<br />
fasst den neuen Einschnitt<br />
in den Hang ein. Die Holzschale<br />
der Aussenwände<br />
ist in diesen Einschnitt hineingestellt.<br />
Sie ist selbsttragend,<br />
durch die Dachkonstruktion<br />
gehalten und besteht<br />
aus balkenähnlichen<br />
Hohlkastenelementen,<br />
horizontal geschichtet,<br />
wärmegedämmt, mit abgesperrten<br />
Seitenteilen (keine<br />
Setzungen) und nach aussen<br />
simsartig vorspringenden<br />
Horizontalteilen aus<br />
Massivholz (Haltbarkeit im<br />
Wetter).<br />
Die neue Unterteilung im<br />
Inneren ist gebaut wie ein<br />
Kartenhaus, das in den von<br />
der Außenschale gebildeten<br />
Grossraum hineingestellt<br />
ist. Die «Karten» - vorgefertigte,<br />
abgesperrte<br />
Wand- und Deckenele-<br />
mente, belegt mit Erlenholz,<br />
sind sichtbar gefügt,<br />
so wie es die Raumteilung<br />
und die Statik erfordern.<br />
Sie schließen nahtlos an<br />
einen pilz-förmigen Bauteil<br />
aus Beton an, der in der<br />
hinteren Ecke des neuen<br />
Hausteiles steht.<br />
Dieser Bauteil, seiner<br />
komplexen und homogenen<br />
Form wegen liebevoll<br />
«Betontier» genannt,<br />
schwarz eingefärbt und<br />
eingeölt, ist selbsttragend.<br />
Er wächst aus der Bodenplatte,<br />
ohne die Holzteile<br />
der Außenschale zu berühren,<br />
überdeckt Teile der<br />
Küche und trägt - oder besser:<br />
bildet das Bad im<br />
Obergeschoss.<br />
Die vor Ort gegossene<br />
Konstruktion enthält die<br />
Wasserleitungen, den Kamin<br />
und die Holzfeuerung,<br />
die nach dem Hypokaust-<br />
Prinzip funktioniert. Die<br />
Betonmasse speichert die<br />
Wärme, die im integrierten<br />
System der Luftkanäle zirkuliert.
Versam/Safiental<br />
Haus Truog<br />
43
Castrisch<br />
Forstwerkhof<br />
44<br />
Forstwerkhof<br />
Standort: Castrisch<br />
Baujahr: 1996<br />
Bauherr: Gemeinde Castrisch,<br />
Forstrevierverband Riein<br />
Architekt: Rolf Gerstlauer und Inger Moine,<br />
Chur/Oslo<br />
Ingenieur: Walter Bieler, Bonaduz<br />
Literatur: Mikado Nr.3 1999<br />
Beim Neubau des Forstwerkhofes<br />
in Castrisch<br />
stand der traditionelle Blockholzbau<br />
Pate. Dabei setzten<br />
die Gemeindeväter ausschließlich<br />
Holz aus den<br />
dorfeigenen Wäldern ein.<br />
Die Tragstruktur der Einstellhalle<br />
wurde aus 12x12 cm<br />
messenden Kanthölzern<br />
nach dem „Lego-Prinzip“<br />
zusammengesetzt.<br />
Dank seiner ästhetischen<br />
und ökologischen Qualität<br />
hält der Holzbau auch im<br />
Gewerbebau vermehrt Einzug.<br />
Statt in Stahlbeton und<br />
Massivbauweise errichtete<br />
deshalb die Gemeinde Castrisch<br />
ihren Forstwerkhof<br />
nur unter der Verwendung<br />
des gemeindeeigenen „Kapitals“<br />
Holz. Zusammen mit<br />
der gewerblich genutzten<br />
Halle beauftragten Gemeinde<br />
und Forstrevierverband<br />
ein zweistöckiges, unterkellertes<br />
Aufenthaltsgebäude.<br />
Die gesamte Anlage sollte<br />
Platz bieten für Büros des<br />
Forstamts, Lager für Spitex<br />
und Gasschutz, sowie zwei<br />
große, mehrfach nutzbare<br />
Räume im Ober- und Untergeschoss<br />
sowie einem Saal<br />
für die Gemeindeversamm-<br />
lung und Vereinsräumlichkeiten.<br />
Der Werkhof integriert<br />
drei Bereiche unter einem<br />
Dach: die Gemeindewerkhalle,<br />
einen Trakt für<br />
die Feuerwehr und einen für<br />
die Unterbringung der forstwirtschaftlichen<br />
Maschinen<br />
und Fahrzeuge. Darin befindet<br />
sich zusätzlich ein Serviceraum<br />
und ein Treibstofflager.<br />
Die neue Anlage liegt am<br />
östlichen Dorfrand, an der<br />
Hauptstraße Ilanz-Versam,<br />
neben einer unter Naturschutz<br />
stehenden Wiese<br />
mit hochstämmigen Obstbäumen.<br />
Weil hier eine seltene<br />
Fledermausart beheimatet<br />
ist, durften keine Bäume<br />
gefällt werden, durfte die<br />
Umgebung durch die Neubauten<br />
nicht beeinträchtigt<br />
werden. Die Gebäude sollten<br />
statt dessen das Bebauungsmuster<br />
des angrenzenden<br />
Dorfkernes fortsetzen.<br />
Daher folgen beide Bauten<br />
unabhängig voneinander in<br />
erster Linie ihrer eigenen<br />
konstruktiven Logik. Straße,<br />
Weg und Hof entstehen als<br />
Restfläche. So wird der<br />
Kiesplatz zwischen den Gebäuden<br />
nur durch die auf<br />
ihm vorherrschenden Aktivitäten<br />
und durch wenige Akzente<br />
an den Fassaden der<br />
Gebäude definiert.
Er verbindet die eigenständigen<br />
Neubauten zu einer<br />
ganzheitlichen Komposition.<br />
Eine Hofzufahrt an der Ostseite<br />
des Platzes erschließt<br />
den Gewerbebau. Dieser<br />
verzichtet zur Straßenseite<br />
hin auf größere Attribute wie<br />
Garagentore und passt sich<br />
so in Form und Maßstäblichkeit<br />
dem bestehenden Ortsbild<br />
an.<br />
Der Hauptverkehrsweg liegt<br />
zwei Meter höher als der<br />
Hof, das Gelände steigt zur<br />
Kantonstraße an. Mittels<br />
Stützmauer schiebt sich die<br />
Werkhalle in die Böschung.<br />
Die anthrazitfarbige Stülpschalung<br />
betont die Standfestigkeit<br />
des in den Boden<br />
gedrückten Gewerbetrakts.<br />
Das Bürogebäude hingegen<br />
gibt sich durch ein leichtes<br />
Abheben vom Boden als<br />
eigenständiges pavillonartiges<br />
„Wohnhaus im Grünen“<br />
zu erkennen.<br />
Auf die erste Anfrage des<br />
Gemeindevorstandes arbeitete<br />
das Architekturbüro<br />
Gerstlauer und Moine eine<br />
Machbarkeitsstudie in zwei<br />
Varianten aus. Nachdem die<br />
Gemeindeversammlung<br />
Ende 1993 einen Projektvorschlag<br />
akzeptiert und einen<br />
Projektierungskredit<br />
genehmigt hatte, legten die<br />
Planer Mitte 1994 die Baueingabe<br />
für das Projekt vor.<br />
Es war ursprünglich mit 1,65<br />
Mio. Franken berechnet<br />
worden. Notwendige Kostensenkungen<br />
und damit<br />
verbundene Umplanungen,<br />
Probleme beim Landabtausch<br />
und Unstimmigkeiten<br />
wegen der Dachformen<br />
verzögerten den Baubeginn<br />
schließlich um knapp ein<br />
Jahr. Gut 13 Monate dauerte<br />
es vom ersten Spatenstich<br />
an bis die Gesamtanlage<br />
Ende 1996 bezogen<br />
werden konnte. Kredite von<br />
Bund und Kanton subventionierten<br />
den Bau des<br />
Werkhofes für das Forstrevier<br />
der Gemeinden Castrisch,<br />
Pitasch, Riein und<br />
Seveign. Als Bedingung für<br />
die Unterstützung forderten<br />
die Geldgeber, dass in der<br />
ganzen Anlage fast nur gemeindeeigenes<br />
Holz zur<br />
Anwendung gelangt. Die<br />
gestalterische Lösung der<br />
Castrisch<br />
Forstwerkhof<br />
Architekten sah fünflagige<br />
Gitterroste aus Holzlatten<br />
vor, welche auf Binder mit<br />
einem Abstand von max.<br />
3,30 m aufgelagert werden<br />
sollten. Weil diese Konstruktion<br />
jedoch nur bei quadratischen<br />
Feldern sinnvoll ist -<br />
der Rost trägt jeweils in beide<br />
Richtungen - musste das<br />
System geändert werden.<br />
Der zum Projekt hinzugezogene<br />
Holzbauingenieur<br />
Walter Bieler spielte zehn<br />
Variantenstudien vom Fachwerkbinder<br />
bis zum Sperrholzbinder<br />
durch und gab<br />
alle wieder auf. Sie scheiterten<br />
an der Grundsatzfrage:<br />
Ist es richtig für eine kleine<br />
Gemeinde, die eigenen<br />
Wald besitzt, Halbzeuge aus<br />
Holz für das Tragwerk einzusetzen?<br />
Halbzeuge sind<br />
mit großen Transportwegen<br />
verbunden, also ökologisch<br />
nicht sinnvoll und zudem<br />
teuer. Außerdem erfordert<br />
der Bau des Forstwerkhofes<br />
wegen der geringen Spannweite<br />
von nicht mehr als 10<br />
m keine extrem hochwertigen<br />
Materialien. Schließlich<br />
entschieden sich die Planer<br />
für eine konstruktive Lösung,<br />
die mit Castrischer<br />
Fichtenholz auskam.<br />
Das „Lego-Prinzip“<br />
Der Castrische Wald ist<br />
nicht sonderlich geeignet für<br />
das Erbringen von Konstruktionsholz.<br />
Es genügt<br />
weder den allgemein üblichen<br />
ästhetischen noch den<br />
erforderlichen konstruktiven<br />
Qualitätsanforderungen.<br />
Das Traggerippe der Werkhalle<br />
beruht deshalb auf<br />
sehr kleinen Querschnitten,<br />
um so den Imperfektionen<br />
des Baumes beim Einschneiden<br />
bestmöglich ausweichen<br />
zu können. Dadurch<br />
ist eine bessere Ausbeute<br />
des Rundholzes möglich.<br />
Das additive Prinzip ermöglicht<br />
die Vervielfachung<br />
der Stützungen bei großer<br />
Spannweite. Der strukturelle<br />
Aufbau des Holztragwerkes<br />
ähnelt dem „Lego-Prin-<br />
45
Castrisch<br />
Forstwerkhof<br />
46<br />
zip“. Dabei können die Stäbe<br />
dreidimensional und<br />
rechtwinklig zusammengesteckt<br />
werden. So ergibt<br />
sich eine Vielzahl von Kontaktflächen,<br />
die es erlauben,<br />
mit einfachen Verbindungsmitteln<br />
beachtliche Kräfte<br />
aufzunehmen. Die gesamte<br />
Struktur der Einstellhalle<br />
wurde aus einundderselben<br />
Holzdimension von 12x12<br />
cm und einem vorgebohrten<br />
Verbindungsnagel vom Typ<br />
8,5/300 mm erstellt. Hat die<br />
Struktur größere Lasten zu<br />
bewältigen, so werden keine<br />
stärkeren Bohlen gewählt,<br />
sondern die Zahl der<br />
Stäbe erhöht. Dieses Prinzip<br />
ist nicht neu, es findet bereits<br />
beim Holzrahmenbau seine<br />
Anwendung, stellt aber eine<br />
interessante Variante dar.<br />
Das Traggerippe wurde in<br />
Elementen vorbereitet und<br />
vor Ort mittels einfachem<br />
Gerberstoß verblattet. Ein<br />
umlaufender Frostriegel mit<br />
einbetonierten Stahlkonsolen<br />
dient der Holzkonstruktion<br />
als Auflager bzw. Fundament.<br />
Hangseitig gegen<br />
die Straße hin wurde eine<br />
Stützmauer betoniert. Ein in<br />
sich geschlossener Betonbehälter<br />
umschließt die feuergefährdeten<br />
Zonen wie<br />
Serviceraum und Treibstofflager.<br />
Das Holzgerippe ist<br />
dreiseitig bis 1 m unterhalb<br />
der Dachkonstruktion mit 4<br />
cm dicken Spanplatten verkleidet.<br />
Die Spanplatten<br />
übernehmen zusammen mit<br />
der Dachschalung die Aussteifung<br />
des Gebäudes. Alle<br />
eingebauten Trennwände<br />
sind hingegen verstellbar<br />
und jederzeit auswechselbar.<br />
Sie gehören nicht zur<br />
Tragkonstruktion.<br />
Eine oberhalb der Spanplatten<br />
umlaufende Festverglasung<br />
sorgt für genügend<br />
Tageslicht in der Halle. Um<br />
bei intensiver Sonneneinstrahlung<br />
das Überhitzen<br />
des Gebäudeinneren zu<br />
vermeiden, ist das Fensterband<br />
außen mit dunkelgestrichenen<br />
Fichtenbrettern<br />
verschattet. Die äußere Verkleidung<br />
besteht aus einer<br />
ebenfalls dunkel gestrichenen<br />
hinterlüfteten Stülpschalung<br />
aus Tanne, die auf<br />
Winddichtungspapier montiert<br />
wurde. Auf die mit Kerto-Platten<br />
ausgesteifte Dekkenkonstruktion<br />
ist ein<br />
schwachgeneigtes, durchlüftetes<br />
Satteldach aufgesetzt.<br />
Das Dach ist mit einer<br />
12 cm dicken Dämmung<br />
isoliert und mit verzinktem<br />
Blech gedeckt. Das ursprünglich<br />
vom Architekten<br />
vorgesehene Flachdach<br />
lehnte die Gemeindeversammlung<br />
wegen der Unterhaltskosten<br />
ab. Da bei<br />
dieser Konstruktion auf<br />
Halbzeuge verzichtet wurde,<br />
konnte eine extrem gute<br />
Wertschöpfung zugunsten<br />
der einheimischen Holzkette<br />
erzielt werden. Diese begann<br />
bei der Bereitstellung<br />
des einheimischen Fichtenholzes,<br />
lief über dessen Einschnitt<br />
und endete beim<br />
Abbund in der Zimmerei. So<br />
wurde der Rohstoff in Castrisch<br />
geschlagen und gelagert<br />
und in der benachbarten<br />
Sägerei Fritz Berger AG<br />
in Rhäzüns eingeschnitten.<br />
Das Bauholz aus den nahen<br />
Forstrevieren und dessen<br />
kurze Transportwege ergaben<br />
nicht nur wirtschaftliche,<br />
sondern auch ökologische<br />
Pluspunkte.
Aussenwand<br />
Schnitt<br />
Ansicht<br />
Castrisch<br />
Forstwerkhof<br />
Schnitte<br />
47
Castrisch<br />
Forstwerkhof<br />
48<br />
Grundrisse<br />
Lagepläne
„Gelbes Haus“ / Kulturzentrum / Museum<br />
Standort: Flims<br />
Baujahr: 1997-1999<br />
Bauherr: Politische Gemeinde Flims<br />
Architekt: Valerio Olgiati, Zürich<br />
Ingenieur: Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur<br />
Auf der Durchfahrt durch<br />
Flims bleibt es niemandem<br />
verborgen: Das weiße ´Gelbe<br />
Haus´ ist der neue architektonische<br />
Höhepunkt von<br />
Flims. Mit den starrenden<br />
Lochfenstern, der grell weissen<br />
ruinös geglätteten Fassade<br />
und der monumentalen,<br />
kubischen Erscheinung<br />
bewegt und verwirrt es alle<br />
Sinne der Wahrnehmung.<br />
Mit dem weißen Klotz findet<br />
eine lange Planungsgeschichte<br />
ihr Ende, die gelegentlich<br />
Züge einer Provinzposse<br />
annahm, und zugleich<br />
nimmt hier ein neuer<br />
architektonischer Impetus<br />
seinen Anfang, jenseits alpen-ländischerBergromantik<br />
und jenseits der weißen,<br />
corbusianisch geprägten<br />
Nachmoderne, die in Flims<br />
ein jeder kennt. Die lange<br />
Baugeschichte des neuen<br />
´Gelben Hauses´ ist schnell<br />
erzählt: Es geht in der<br />
Grundsubstanz bis ins 16.<br />
Jahrhundert zurück, wurde<br />
im 19. Jahrhundert komplett<br />
umgebaut und war lange<br />
Zeit unbewohnt bis die Gemeinde<br />
den «Schandfleck»<br />
in den Siebzigerjahren erwarb.<br />
Das damals gelb<br />
gestrichene Haus stand ungefähr<br />
im Dorfzentrum von<br />
Flims, wenn denn Flims ein<br />
Dorfzentrum hätte. Der Skiort<br />
wird durchschnitten von<br />
der Kantonalstraße, einst<br />
willkommener Erschliessungsweg,<br />
heute eher über-<br />
Flims<br />
´Gelbes Haus´<br />
lastetes Dauerärgernis, ein<br />
Schicksal, das Flims mit unzähligen<br />
groß gewordenen<br />
Bergorten teilt. Schon früh<br />
hatte Rudolf Olgiati, der<br />
Grandseigneur des Flimser<br />
Baugeschehens, auf die<br />
städtebauliche Bedeutung<br />
der Lage des ´Gelben Hauses´<br />
hingewiesen. Er beteiligte<br />
sich 1986 an einem<br />
Projektwettbewerb für ein<br />
Kulturzentrum mit einem<br />
Entwurf, der das ´Gelbe<br />
Haus´ neben einem grossen<br />
Saalbau mit Vorhof zu einem<br />
neuen Dorfzentrum<br />
verband. Olgiati erhielt lediglich<br />
einen Ankauf, allerdings<br />
verzögerte sich das Projekt,<br />
weil es Schwierigkeiten mit<br />
dem Erwerb eines fehlenden<br />
Grundstücks gab. Inzwischen<br />
regte sich Widerstand<br />
gegen das erstrangierte<br />
Projekt. Olgiati (der<br />
nie einen öffentlichen Auftrag<br />
erhalten hatte) war nach<br />
einer Publikation mit international<br />
wandernder Ausstellung<br />
mittlerweile zu später<br />
überregionaler Anerkennung<br />
gelangt. Der Protest<br />
gipfelte in einer Petition,<br />
die forderte, Olgiati den Auftrag<br />
zu erteilen. Die Petition<br />
wurde abgelehnt, was zu<br />
einer langjährigen Verstimmung<br />
zwischen Behörden<br />
und Bürgern führte, aber inzwischen<br />
hatte der betagte<br />
Olgiati der Gemeinde seine<br />
große Sammlung von Altertümern,<br />
die er über Jahrzehnte<br />
teils aus Abbruchhäusernzusammengetragen<br />
hatte und die für die<br />
kulturelle und bauhistorische<br />
Geschichte der Region<br />
von unschätzbarem Wert<br />
ist, zu einem Vorzugspreis<br />
angeboten. Das Legat war<br />
aber an die Bedingung geknüpft,<br />
das ´Gelbe Haus´<br />
nach seiner Vorstellung umzubauen<br />
und ein Ortsmuseum<br />
darin einzurichten. Wiederum<br />
tat sich die Gemeinde<br />
schwer und erst als im<br />
Hotel Waldhaus auf Privatinitiative<br />
ein Olgiati-Museum<br />
eingerichtet werden sollte,<br />
49
Flims<br />
´Gelbes Haus´<br />
50<br />
lenkte die Gemeinde ein und<br />
beauftragte 1994 den nunmehr<br />
84-jährigen Olgiati mit<br />
einer erneuten Projektstudie<br />
auf der Grundlage des<br />
früheren Wettbewerbes.<br />
Ende 1995 starb Rudolf Olgiati,<br />
das Museum im Waldhaus<br />
wurde kurze Zeit später<br />
eröffnet, die Gemeinde<br />
erhielt die Sammlung und<br />
an den Sohn Valerio Olgiatti<br />
erging der Auftrag, das Gelbe<br />
Haus für die neue Nutzung<br />
herzurichten - entsprechend<br />
den Vorgaben seines<br />
Vaters.<br />
Wer sich heute dem einst<br />
„Gelben Haus“ nähert, wird<br />
seinen Augen kaum trauen.<br />
Die Folie der alten Strickbau-<br />
Scheunen im Hintergrund<br />
und die gesichtslosen<br />
Touris musbauten der sechziger-<br />
und siebziger Jahre<br />
ringsum lassen den Kontrast<br />
noch deutlicher zutage<br />
treten. Geht man näher heran,<br />
so wird aus der Idee eines<br />
idealen Gebäudes ein<br />
realer Bau; hinter der These<br />
vom zeitlosen Sein schimmert<br />
das historisch Gewordene<br />
hervor. Einem Palimpsest<br />
gleich ist hinter den mit<br />
weißer Mineralfarbe gestrichenen,<br />
unverputzten Fassaden<br />
die Struktur des vorhandenen<br />
Baus erkennbar:<br />
Natursteinmauer in den unteren<br />
Geschossen, eine mit<br />
Steinen ausgefachte<br />
Riegelkonstruktion in der<br />
obersten Ebene. Dass man<br />
das Gelbe Haus „nach meinem<br />
Geschmack umbaut<br />
und von oben bis unten<br />
schneeweiß streicht“, hatte<br />
Rudolf Olgiati im Stiftungsvertrag<br />
ergänzend gefordert.<br />
Sein Sohn Valerio, der<br />
mit dem Schulhaus in Paspels<br />
internationale Anerkennung<br />
erzielt hat, setzte<br />
das Vermächtnis seines Vaters<br />
in die Tat um. Ob in der<br />
Rolle des getreuen Testamentsvollstreckers<br />
oder in<br />
jener des perfiden Vatermörders,<br />
darüber mag man getrost<br />
streiten, erweist sich<br />
doch das Konzept als im<br />
wahrsten Sinne des Wortes<br />
„radikal“. Erhalten blieb lediglich<br />
der Mauerkranz der<br />
Umfassung, der gesamte Innenausbau<br />
wurde ebenso<br />
entfernt wie Portikus und<br />
Balkon: Sprossenfenster<br />
und Fensterläden, Giebel,<br />
Sockelzone und Dach. Der<br />
Eingang, einst in der Mittelachse<br />
der Straßenfront<br />
angeordnet, wurde auf die<br />
östliche Schmalseite verlegt,<br />
wo durch das Abtragen einer<br />
Gartenfläche ein Vorplatz<br />
entstehen konnte.<br />
Schließlich ließ der Architekt<br />
den Putz von den Fassaden<br />
schlagen, so dass nur noch<br />
die rohe Schale aus Bruchsteinmauern<br />
mit ihren gähnenden<br />
Fensteröffnungen<br />
zu sehen war.<br />
Über die Freilegung hinaus<br />
ließ Olgiati den groben<br />
Bruchstein mit dem Hammer<br />
bearbeiten, um die<br />
skulpturale Qualität des rauen<br />
Mauerwerkes noch zu<br />
steigern. So blieb die historische<br />
Substanz zwar erhalten,<br />
aber wohl kaum im Sinne<br />
der Denkmalpflege, die<br />
zumeist eher von historischen<br />
Bildern ausgeht als<br />
von der zeitgenössischen<br />
Auseinandersetzung mit<br />
den unterschiedlichen<br />
Schichten der Historie. Und<br />
genau das hat Olgiati hier<br />
getan, wenn auch in einer<br />
höchst eigenwilligen Weise,<br />
zudem in intimer Kenntnis<br />
des Flimser Umfeldes und<br />
nicht ohne selbstbetroffene<br />
Ironie.<br />
So ist die Erscheinung des<br />
klassizistischen Originals<br />
aufgelöst und ins Gegenteil<br />
gekehrt, und dennoch wird<br />
ständig auf den originalen<br />
Kern verwiesen. Zwar gibt<br />
es in der Architekturgeschichte<br />
viele Beispiele für<br />
diese kontradiktorische<br />
Vorgehensweise, sie wird<br />
aber unweigerlich jene auf<br />
den Plan rufen, die Wahrheiten<br />
und Prinzipien der<br />
Architektur für moralische<br />
Instanzen halten.<br />
Um die ruinöse Erscheinung<br />
des Hauses - die ja eigentlich<br />
von den Handwerkern<br />
erst hergestellt wurde -<br />
wieder aufzufangen, wurde
das enthäutete Haus mit einer<br />
beinahe künstlich wirkenden,<br />
neuen Haut aus<br />
weißer Farbe versehen. An<br />
die testamentarisch verfügte<br />
Vorgabe, dass das Haus<br />
weiß sein sollte, hat sich Valerio<br />
genau gehalten, bis hin<br />
zum flach geneigten Zeltdach,<br />
dessen traditionelle<br />
Schieferdeckung er ebenfalls<br />
- zum Entsetzen der<br />
Handwerker - weiß streichen<br />
liess.<br />
An die Stelle einer<br />
spätklassizistischen Fassadengliederung<br />
trat eine nahezu<br />
serielle Lochfassade:<br />
in Ortbeton entstanden die<br />
neuen, tiefen Laibungen der<br />
quadratischen Fenster: je<br />
drei mal drei an den Stirnseiten,<br />
fünf mal drei an der<br />
Straßenfront, ein vereinzeltes<br />
an der Rückseite. Innen<br />
akkurat umrissen, fransen<br />
die ausbetonierten<br />
Laibungen zum umgebenden<br />
Bruchsteinmauerwerk<br />
hin gleichsam aus und<br />
scheinen einer Rohbauästhetik<br />
verpflichtet. Kleine<br />
PVC-Röhrchen, die unterhalb<br />
der Fensteraussparung<br />
hervortreten, leiten das Regenwasser<br />
aus dem Laibungsbereich<br />
nach außen.<br />
Dadurch, dass Olgiati die<br />
Laibungen weit durch die<br />
Mauerschale hindurchstoßen<br />
ließ und sie an der<br />
Oberseite überdies leicht<br />
anschrägte, verbergen sich<br />
die Rahmen der innen angeschlagenen<br />
und sprossenfreien<br />
Fenster vor den Blikken<br />
der Passanten. Auch<br />
die Scheiben in den verschatteten<br />
Öffnungen sind<br />
kaum erkennbar; die Wände<br />
wirken stärker und mächtiger,<br />
als sie in Wirklichkeit<br />
sind. Zugleich entsteht ein<br />
harter Kontrast zwischen<br />
beinahe schwarzen Öffnungen<br />
und einer gleißend hellen<br />
Wand, welcher das Fassadenbild<br />
prägt. Der Charakter<br />
des Ruinösen bleibt<br />
Flims<br />
´Gelbes Haus´<br />
untergründig bewahrt. Im<br />
Streiflicht wird hinter dem<br />
nivellierenden weißen Anstrich<br />
die rüde Intervention<br />
aus Beton erkennbar: ein<br />
rationalistischer Gestaltungswille<br />
scheint die historische<br />
Konstruktion der Vision<br />
einer puristischen Architektur<br />
unterworfen zu haben.<br />
Die früheren Kelleröffnungen<br />
sind geschlossen,<br />
Eingangs- und Balkontür an<br />
der Straßenfront wurden<br />
entfernt und durch Fenster<br />
ersetzt, die sich dem Raster<br />
anpassen. Über das Mauergeviert<br />
legt sich eine Attika<br />
aus Beton, auf der das<br />
weiße Zeltdach ruht. Das<br />
Dach greift das Volumen<br />
des historischen Gebäudes<br />
auf, kragt aber nicht mehr<br />
vor - die Fassaden geraten<br />
aus der Nahsicht zu reinen<br />
Flächen, das Volumen erscheint<br />
als Kubus. So wird<br />
die plastische, von einer<br />
Tendenz zum Vernakulären<br />
nicht freie Formensprache<br />
von Rudolf Olgiati in der Arbeit<br />
seines Sohnes überspitzt<br />
und zugleich geläutert.<br />
Wenn Valerio Olgiati seine<br />
Vorgehensweise offenlegt<br />
und nicht verschleiert, dann<br />
zeigt sich darin, dass keineswegs<br />
ein antihistoristischer<br />
Impuls den Ausgangspunkt<br />
des Entwurfs<br />
bildete. Im Gegenteil: indem<br />
der Architekt das bauhistorisch<br />
wenig bemerkenswerte<br />
Gebäude auf sein<br />
materielles Substrat reduzierte,<br />
gelang ihm vielleicht<br />
ein ehrlicherer Dialog zwischen<br />
Alt und Neu, als es<br />
manche beschönigende<br />
Rekonstruktion vermag.<br />
Vereinheitlichend legt sich<br />
die weiße Schicht der Farbe<br />
über Schrunde und Brüche,<br />
Narben, Wunden und<br />
Ergänzungen. Die reine<br />
Form enttarnt sich als Flickwerk,<br />
als Resultat von Bricolage.<br />
Beim genauen Hinsehen<br />
indes wird deutlich,<br />
dass die Details keineswegs<br />
einer idealen Geometrie<br />
gehorchen - der Grundriss<br />
ist in Wahrheit ein Trapez,<br />
die Dachkante leicht geneigt.<br />
Ähnlich wie beim<br />
Schulhaus in Paspels besteht<br />
somit eine<br />
spannungsreiche Wechselbeziehung<br />
zwischen dem<br />
monolithisch-rigiden Urbild<br />
51
Flims<br />
´Gelbes Haus´<br />
52<br />
und einer auf Perfektion verzichtenden<br />
Realisierung.<br />
Wie in Paspels sind zudem<br />
Hülle und Kern voneinander<br />
getrennt. Eingestellt in den<br />
massiven Mauerkranz wurde<br />
eine Holzkonstruktion.<br />
Die Massivholzdecken aus<br />
Lärchenholz der geschossfüllenden<br />
Räume ruhen<br />
jeweils auf einem Balkenkreuz,<br />
das von einer<br />
exzentrisch angeordneten<br />
Stütze getragen wird. Im Bereich<br />
des offenen Dachstuhls<br />
ist das Balkenkreuz<br />
bloßgelegt, es hält die horizontalen<br />
Zug- und Druckkräfte<br />
der spektakulär<br />
schräg in die vertikale Stütze<br />
eingeleiteten Auflast des<br />
Firsts. Mit diesem «irrationalen<br />
Knick» - wo findet sich<br />
schon ein tragender, geknickter<br />
Holzbalken? - ist jedermann<br />
klar, wofür die Permanenz<br />
der Irritation letztlich<br />
steht: für die Auflösung der<br />
Prinzipien schlechthin.<br />
Alle Holzelemente sind weiß<br />
gestrichen: nur im Fußboden<br />
blieb die Material-Farbe<br />
der Bretter erhalten. Tischlerplatten<br />
verschleiern die<br />
hinter dem Mauerwerkskranz<br />
gelegene Ständerkonstruktion,<br />
auf der die Last<br />
der Decken ruht.<br />
Das Bekleidungsprinzip wird<br />
hier umgekehrt; während<br />
der ehemalige Kern außen<br />
freigelegt ist, werden die<br />
Räume gleichsam zur innen<br />
liegenden Hülle, als eigenständige<br />
konstruktive Einheit.<br />
Die Fensterrahmen<br />
sind flächenbündig<br />
eingelassen, treten somit<br />
auch hier kaum in Erscheinung.<br />
Inwieweit die durchfensterten,<br />
hell belichteten<br />
Räume sich allerdings als<br />
Ausstellungsflächen eignen,<br />
hängt vom Geschick des<br />
Kurators ab.<br />
Wider den Regionalismus<br />
Das ´Gelbe Haus´ ist dazu<br />
angetreten, einen Dorfkern<br />
zu bilden, wie es Rudolf Olgiati<br />
immer vorgeschwebt<br />
hatte. Eine erste, prägende<br />
Geste ist vorhanden, nun<br />
hängt das Weitere von folgenden<br />
baulichen Maßnahmen<br />
ab, welche die Gemeinde<br />
beschließen muss. Das<br />
neue Kult- und Kulturgebäude<br />
wird sich mit gezielten<br />
Ausstellungen eine Identität<br />
verleihen müssen, und<br />
es dürfte sich zeigen, ob die<br />
Inhalte mit der starken Hülle<br />
in einen sinnvollen Dialog<br />
treten können.<br />
Mit dem Umbau des ´Gelben<br />
Hauses´ hat sich Olgiati<br />
ebenso souverän über die<br />
Gepflogenheiten der illusionistischenBergarchitektur<br />
hinweggesetzt wie über<br />
das «Analogiegeflecht» der<br />
jüngeren Bündner Protagonisten.<br />
Er tut dies allerdings<br />
nicht mit leiser Geste, sondern<br />
mit schweren<br />
architekturtheoretischen<br />
Geschützen, von denen das<br />
Gebäude gelegentlich überfrachtet<br />
erscheint, deren<br />
rhetorische Schärfe jedoch<br />
immer wieder überzeugt. Mit<br />
diesem Kalkül scheint sich<br />
die Rationalität des Bauens<br />
aufzulösen, zugleich aber<br />
reiht sich Olgiati in die Flimser<br />
Tradition, denn auch Rudolf<br />
Olgiati wusste mit uneingeschränkterBeharrlichkeit<br />
immer genau, was er<br />
wollte. So hat nun die Gemeinde<br />
das, was sie jahrelang<br />
zu verhindern suchte:<br />
einen echten Olgiati mitten<br />
im Dorf.<br />
Lageplan
Schnitt, Grundrisse<br />
Detail<br />
Flims<br />
´Gelbes Haus´<br />
53
Schiers<br />
Salginatobel-Brücke<br />
54<br />
Salginatobel-Brücke<br />
Standort: bei Schiers<br />
Baujahr: 1929-30<br />
Bauherr: Kanton Graubünden, Gemeinde Schiers<br />
Ingenieur: Robert Maillart, Lehrgerüst: Richard Coray<br />
Literatur: Vom Holzsteg zum Weltmonument,<br />
Andreas Kessler, ‘96<br />
Robert Maillart – Brückenschläge, Höhere Schule<br />
für Gestaltung Zürich Schriftenreihe, 1990,<br />
Robert Maillart, v. Max Bill, 1949,<br />
Schweizer Baublatt, Jg. 109, Nr. 102, 1998,<br />
Schweizer Ingenieur und Architekt, Jg. 109, Nr.50,<br />
1991<br />
Die 1929/30 erbaute Salginatobel-Brücke<br />
zählt neben<br />
weiteren umgesetzten<br />
Brückenbauten zu den bekannteren<br />
Werken Robert<br />
Maillarts. Diese Brücke<br />
befindet sich in den Davoserbergen,<br />
zwischen den<br />
Ortschaften Schiers und<br />
Schuders. Sie überspannt<br />
eine etwa 90 m tiefe<br />
Schlucht mit einer Spannweite<br />
von 90,04 m. Die<br />
Gesamtlänge der Brükkenkonstruktion<br />
beträgt<br />
133,00 m, ihre Breite 3,80<br />
m an der schmalsten Stelle.<br />
Die Pfeilhöhe misst<br />
12,99 m und der Wert, der<br />
die Kühnheit der Brücke<br />
ausmacht, ist das Verhältnis<br />
von f : l (Stich : Länge)<br />
= 1:6,9.<br />
Nach Maillarts Aussage liegt<br />
folgende Lastannahme<br />
seinen Berechnungen, die<br />
im allgemeinen nur die<br />
notwendigsten Schritte<br />
enthielten, zu Grunde: „für<br />
300 kg/m² Menschengedränge<br />
und einem 7 t Lastwagen...“.<br />
Die Salginatobel-Brücke,<br />
eine Nachfolgerin der eingespannten<br />
Tavanasa-Brücke,<br />
ist eine Dreigelenkbogen-<br />
Brücke, deren Bogen samt<br />
Rippen die Fahrbahn trägt<br />
bzw. die (vertikalen) Auflasten<br />
aus der Fahrbahn aufnimmt<br />
und in die Widerlager<br />
ableitet. Die Fahrbahn ist<br />
biegesteif ausgebildet. Sie<br />
entlastet dadurch die Bogenrippenkonstruktion,<br />
so<br />
dass diese, frei von Biegemomenten,<br />
fast ausschließlich<br />
zentrische Normalkräfte<br />
aufnimmt und<br />
weiterleitet. Die Querschnittshöhe<br />
(ca. 40 cm)<br />
des Bogengewölbes<br />
nimmt vom Kämpfer zum<br />
Viertelpunkt hin ab und<br />
verjüngt sich im Scheitel<br />
bis auf 24 cm. In diesem<br />
Bereich wachsen Bogenund<br />
Fahrbahnquerschnitt<br />
in Form eines Kastenträgers<br />
monolithisch zusammen<br />
und bilden aus der<br />
sich überkreuzenden Bewehrung<br />
das Scheitelgelenk.<br />
Der Kastenträger<br />
wird von zwei parallel verlaufenden<br />
Bogenrippen,<br />
die auf der Bogenplatte liegen<br />
und deren Steifigkeit<br />
gewährleisten, gebildet.<br />
Diese Bogenrippen wiederum<br />
stellen mit etwa 4<br />
m Höhe im Viertelpunkt die<br />
höchste Stelle der Konstruktion<br />
dar. Von diesem<br />
Punkt ausgehend zu den<br />
Widerlagern hin, sind in 6<br />
m Abstand zueinander die<br />
Fahrbahn tragenden Stützen<br />
in Scheibenform senkrecht<br />
zur Bogenlängsachse<br />
angeordnet, welche<br />
den Bogen bei einseitiger<br />
Verkehrslast vertikal halten.<br />
Die Breite der Bogenplatte<br />
beträgt im Scheitelpunkt 3,8<br />
m, verbreitert sich aber zum<br />
Kämpfer auf 6 m, um aus<br />
horizontaler Windlast wirkende<br />
Kräfte aus dem gesamten<br />
Brückenaufbau aufzunehmen.<br />
Wenn man von dem Brükkenbauer<br />
Maillart spricht, so<br />
darf doch nicht die Mithilfe<br />
des Ingenieurs R. Coray vergessen<br />
werden. Corays<br />
Wissen und Können war für<br />
die Realisierung des Vorhabens<br />
genauso wichtig, da<br />
Coray für die Berechnung
und Ausführung des Lehrgerüstes<br />
verantwortlich<br />
war. Dem Lehrgerüst kam<br />
die Aufgabe der Lastaufnahme<br />
und die Erhöhung<br />
der Eigensteifigkeit des zu<br />
bauenden Bogens zu. Maillart<br />
beschreibt in seinem<br />
Aufsatz: „Es ist nämlich<br />
durchaus nicht nötig, das<br />
Lehrgerüst für das ganze<br />
Gewicht des Tragwerkes<br />
zu berechnen, sondern es<br />
genügt die Berücksichtigung<br />
der Gewölbeplatte.<br />
Diese wurde zunächst in<br />
einem Zuge symmetrisch<br />
betoniert, wobei die Kämpfergelenke<br />
mit erstellt wurden.<br />
Das Scheitelgelenk dagegen,<br />
das höher liegt als die<br />
Gewölbeplatte, konnte erst<br />
später fertiggestellt werden<br />
und wurde provisorisch ersetzt<br />
durch ein die untere<br />
Gelenkfuge ausfüllendes<br />
Hartholzbrett, das später,<br />
nach Fertigstellung des Gelenkes<br />
und Ausrüstung automatisch<br />
entlastet wird.<br />
Allerdings ist diese Gewölbeschale<br />
an sich trotz tunlichst<br />
gleichmäßiger Ausführung<br />
des Aufbaues mangels<br />
Eigensteifigkeit nicht ohne<br />
weiteres tragfähig. Aber so-<br />
Schiers<br />
Salginatobel-Brücke<br />
bald die Mehrbelastung auf<br />
eine Vergrößerung der Einsenkung<br />
des Lehrgerüstes<br />
hinwirkt, tritt die Gewölbeschale<br />
unter Aufnahme<br />
von zentrischen Kräften<br />
in Tätigkeit, so dass die<br />
Mehrbelastung des Gerüstes<br />
eine beschränkte und<br />
keinesfalls gefährliche<br />
war. Dem Gerüst kommt<br />
dabei die Rolle des die<br />
Gewölbeplatte versteifenden<br />
Elementes zu, so<br />
dass diese von Biegung<br />
und Knickgefahr verschont<br />
bleibt.“<br />
Die Salginatobel-Brücke<br />
stellte nicht nur mit ihrem<br />
Aussehen eine Neuerung<br />
dar, sondern zeigt in finanzieller<br />
Hinsicht im Vergleich<br />
zu den zeitgenössischen<br />
Brücken mit dem eingesetzten<br />
Materialaufwand neue<br />
Wege auf. Die Gesamtkosten<br />
der Brücke beliefen<br />
sich auf rd. 300 Schweizer<br />
Franken pro m² Grundfläche.<br />
Dies ist nach Maillart<br />
„angesichts der Spannweite,<br />
der Tiefe der Schlucht und<br />
der schwierigen Zufuhrverhältnisse<br />
gewiß ein bemerkenswertes<br />
Ergebnis“, zumal<br />
schon das Lehrgerüst<br />
mit einem Drittel der Gesamtkosten<br />
zu Buche<br />
schlägt. Für die Wirtschaftlichkeit<br />
dieser Brücke können<br />
u.a. die sparsame Konstruktion,<br />
gute Dimensionierung<br />
der einzelnen Bauteile<br />
und der kostengünstige<br />
Baustoff Stahlbeton angeführt<br />
werden.<br />
Stahlbeton ist geeignet für<br />
Gewölbebrücken bzw. Bogenbrücken,<br />
aber erst durch<br />
eine Gliederung des „wirksamen<br />
Querschnittes“ (die statische<br />
Tragfähigkeit betreffend),<br />
in eine Zug-, Druckund<br />
Neutralzone.<br />
Entscheidend kommt die<br />
statisch wirksame Verknüpfung<br />
von Fahrbahn und<br />
Gewölbe hinzu, bei der die<br />
Fahrbahn vom passiven Eigengewichtselement<br />
zum<br />
aktiven Tragwerkselement<br />
wird und zusammen mit<br />
dem Bogen eine Einheit bildet.<br />
Erste Fortschritte in dieser<br />
Art und Weise ergaben die<br />
breite Auflösung des Rechteckgewölbes<br />
in mehrere<br />
schmale Streifen zu Rippen,<br />
die durch bewehrte Riegel<br />
55
Schiers<br />
Salginatobel-Brücke<br />
56<br />
gehalten und deren seitliches<br />
Ausknicken durch Haltekräfte<br />
so vermieden wurden.<br />
Zusätzlich wird der gesamte<br />
Brückenkörper dadurch<br />
auch torsionsteifer.<br />
Durch Einbeziehung der<br />
statischen Wirksamkeit<br />
der sonst nur passiven<br />
Fahrbahn werden die<br />
Spannungen im Bogen reduziert.<br />
Rechnungen und<br />
Versuche sprechen dem<br />
Gewölbe mit Einbeziehung<br />
des „durchbrochenen“ Aufbaus<br />
50% mehr Verkehrslast<br />
zu.<br />
Die Reduzierung der erforderlichen<br />
Querschnitte und<br />
die Aussparungen zwischen<br />
Bogen und Fahrbahn erhöhen<br />
die Wirtschaftlichkeit<br />
durch Vermeiden von Materialverschwendung.<br />
Dies<br />
trifft bei kleineren und mittleren<br />
Brücken weniger zu,<br />
da die Vorteile der seitlichen<br />
Aussparungen durch den<br />
Mehraufwand im Eisenlegen<br />
(Bewehren) und Verschalen<br />
aufgehoben werden.<br />
Die so konstruierten hohlkastenförmigenGewölbequerschnitte<br />
bestehen aus<br />
Gewölbeplatte, Längswänden<br />
und Fahrbahnplatte, die<br />
in ihrer Gesamtheit als ein<br />
steifes Element wirken.<br />
Baugrund-, Temperaturund<br />
Schwindspannungen<br />
verursachen beim eingespannten<br />
Bogen Biegebeanspruchungen,<br />
die Maillart<br />
durch Gelenke im Kämpferbereich<br />
und im Scheitel vermied.<br />
Hierbei kreuzte er, wie<br />
zuvor der französische Ingenieur<br />
Mesnagier, die Stahleinlagen,<br />
um dem Querschnitt<br />
seine Biegefestigkeit<br />
zu nehmen und die Spannungen<br />
in minimale Hebungen<br />
und Senkungen aufzunehmen.<br />
Messungen ergaben<br />
bei einem 20 t schweren<br />
Rollwagenzug eine<br />
Scheitelsenkung von 1,8<br />
mm und eine Viertelsenkung<br />
von 1,2 mm. Dies entspricht<br />
Drehungen im<br />
Scheitel von 29 sec, im Vier-<br />
telbogen von 12 sec. und<br />
an den Kämpfern von 15<br />
sec. Die gekreuzten Armierungseisen<br />
als Gelenke<br />
sind ebenfalls so bemessen<br />
worden, dass die auftretenden<br />
Pressungen alleine<br />
durch den Stahl aufgenommen<br />
werden können.<br />
Die Schubwirkung<br />
des Bogens auf den Baugrund<br />
in den Widerlagern<br />
konnte Maillart durch die<br />
starren Felswände vernachlässigen.<br />
Sanierung<br />
Im Jahre 1991 erhielt die<br />
Salginatobelbrücke die<br />
höchste Auszeichnung, die<br />
einem Bauwerk weltweit verliehen<br />
wird: Die ASCE<br />
(American Society of Civil<br />
Engineers) ernannte sie zu<br />
einem „Internationalen Historischen<br />
Wahrzeichen der<br />
Ingenieurkunst“.<br />
Nach 60 Jahren intensiver<br />
Benutzung der Brücke wurden<br />
bei den periodischen<br />
Kontrollen verschiedene<br />
Schäden festgestellt. Am<br />
offensichtlichsten waren,<br />
neben den zahlreichen Rissen,<br />
die Abplatzungen an<br />
der Betonoberfläche, besonders<br />
an den Brüstungen.<br />
Unter diesen Ausbrüchen<br />
kamen meistens angerostete<br />
Bewehrungsstäbe<br />
zum Vorschein. Trotz regelmässiger<br />
Unterhaltung war<br />
eine Instandsetzung erforderlich.<br />
Das Brückenende<br />
auf der Seite Schiers wurde<br />
schon vorher umgebaut, um<br />
zu verhindern, dass der in<br />
diesem Abschnitt rutschende<br />
Hang nicht mehr als sicheres<br />
Widerlager der Brükke<br />
dient.<br />
Das Erscheinungsbild des<br />
Weltmonumentes sollte<br />
durch die Sanierung nicht<br />
beeinträchtigt werden. Da<br />
die Brücke die einzige Verkehrsverbindung<br />
nach<br />
Schuders ist, mussten alle<br />
Arbeiten so geplant und<br />
ausgeführt werden, dass die<br />
Durchfahrt – nur mit kurzzeitigen<br />
Behinderungen – aufrechterhalten<br />
werden konnte.<br />
Die erste Bauetappe umfasste<br />
einerseits den Ersatz der<br />
beiden Brüstungen und die<br />
komplette Instandsetzung<br />
der 32 m langen Vorlandbrücke<br />
Seite Schiers. Die
alten Brüstungen wurden<br />
mittels Diamantfräsen in<br />
Stücke geschnitten, von<br />
der Fahrbahnplatte abgetrennt<br />
und abtransportiert.<br />
Die entstandene Lücke<br />
wurde eingeschalt, armiert<br />
und betoniert. Für all diese<br />
Arbeiten kam ein speziell<br />
für das Objekt konstruiertes<br />
Gerüst zum Einsatz,<br />
womit pro Woche etwa 20<br />
m neue Brüstungen produziert<br />
wurden. Parallel zum<br />
Brüstungsersatz begann<br />
die Instandsetzung der<br />
Tragkonstruktion. Dabei<br />
wurden 1 bis 2 cm Altbeton<br />
mittels Wasserhöchstdruck<br />
abgetragen.<br />
In der letzten Phase wurden<br />
der ganze Bogenbereich<br />
mit den Stützen,<br />
Scheiben sowie die Fahr-<br />
Schiers<br />
Salginatobel-Brücke<br />
bahnuntersicht saniert.<br />
Das Bogengerüst, diente<br />
zusätzlich auch als „Einhausung“<br />
für die Spritzbetonarbeiten.<br />
Nach dem<br />
Betonabtrag wurden auf<br />
allen Flächen 30 mm<br />
Spritzbeton aufgetragen,<br />
um aber weiterhin den<br />
Charakter einer geschalten<br />
Brücke zu erhalten,<br />
wurde am frischen Spritzbeton<br />
eine Brettschalung<br />
rekonstruiert. Nur wegen<br />
der enormen Bedeutung<br />
habe man eine solche<br />
„denkmalpflegerische“<br />
Maßnahme durchgeführt.<br />
Damit die Maillart-Brücke<br />
auch langfristig gegen das<br />
Eindringen von Wasser<br />
geschützt ist, erhielt die<br />
Fahrbahnplatte ein modernes<br />
Belagsystem mit einer<br />
Abdichtung. Eine Brückenentwässerung<br />
stellt zudem<br />
sicher, dass das<br />
Wasser von der Fahrbahn<br />
rasch abfließen kann.<br />
Markus Menzler,<br />
Silke Wollenweber<br />
57
Grüsch<br />
Gründerzentrum<br />
58<br />
Gründerzentrum<br />
Standort: Grüsch<br />
Baujahr: 2001/02<br />
Bauherr: Trumpf Grüsch AG<br />
Architekt: Barkow Leibinger, Aves Architekturbüro<br />
Ingenieur: Conzett Bronzini Gartmann AG<br />
Literatur: Barkow Leibinger, Werkbericht 1993-2001<br />
Das 3.500 qm große Zentrum<br />
liegt in einem hochgelegenen<br />
Alpental zwischen<br />
Landquart und dem Skiort<br />
Davos in Graubünden. Diese<br />
Landschaft ist in den tieferen<br />
Lagen von Landwirtschaft<br />
geprägt, während die<br />
höheren Lagen, umgeben<br />
von Bergen und Gletschern,<br />
von Skipisten, Wald und<br />
Bergdörfern gekennzeichnet<br />
sind. Die Talsohle bei<br />
Grüsch ist der landwirtschaftlichen<br />
und industriellen<br />
Nutzung vorbehalten.<br />
Robert Maillarts berühmte<br />
Betonbrücke in Schiers ist<br />
nicht weit entfernt.<br />
Das Bauprogramm umfasst<br />
Werkstätten, Büros, Besprechungsräume,<br />
ein Café<br />
und eine Küche. Das neue<br />
Gebäude ist ein freistehender<br />
Pavillon, der durch einen<br />
Tunnel mit der bestehenden<br />
Fabrik für elektrische Werkzeuge<br />
verbunden ist.<br />
Der Entwurf ist von der Geschichte<br />
der Schweizer<br />
Ingenieurbaukunst inspiriert.<br />
Einige der besten Beispiele<br />
Schweizer Bautätigkeit der<br />
letzten 100 Jahre - Tunnel,<br />
Brücken, Stützmauern,<br />
Lawinensperren, Straßen<br />
und Infrastruktur für den<br />
Skitourismus - wurden als<br />
Antwort auf die radikalen<br />
Bedingungen der schweizerischen<br />
Alpentopografie entwickelt.<br />
Das Projekt greift die<br />
tektonische Sprache der örtlichen<br />
Ingenieurbaukunst<br />
auf.<br />
Das Gebäude besteht aus<br />
einem Betonkern mit vorgespannten,<br />
auskragenden<br />
Dachterrassen. Der Beton<br />
ist entweder als Sichtbeton,<br />
an dem man die verspringende,<br />
glatte Schalung ablesen<br />
kann, oder, im Falle<br />
der Stützmauern, als<br />
Waschbeton hergestellt. Die<br />
oberen Büroetagen sind mit<br />
örtlichem Lärchenholz verkleidet,<br />
das rotbraun lasiert<br />
ist. Außenliegende Dachflächen<br />
sind mit Wildblumen<br />
bepflanzt. Die Betonflächen<br />
der Eingangsbrücke zeigen<br />
den Abdruck von Tannenzweigen.<br />
Dieser Raum wird<br />
von den auskragenden Volumen<br />
der darüberliegenden<br />
Büros überdacht. Die angrenzenden<br />
Talwiesen mit<br />
Gras und Blumen falten sich<br />
in die geneigten Rampenräume<br />
hinein, die mit Gletschergeröll<br />
bestückt sind,<br />
das auf dem Gelände vorgefunden<br />
wurden. Ausgangspunkt<br />
für das ganze Gebäude<br />
ist eine ausgeschachtete,<br />
breite Rampe, die Licht<br />
und Zugang in die tiefer gelegene<br />
Tunnel- und Caféebene<br />
bringt. Dieser Einschnitt<br />
liegt parallel zum Tal<br />
und reduziert die Gebäudehöhe,<br />
wie von den Bauvorschriften<br />
gefordert. Der Einschnitt<br />
wird von den Erdgeschossflächen<br />
mit Werkstätten<br />
und dem Eingangsbereich<br />
überbrückt. Das oberste<br />
Gebäudevolumen besteht<br />
aus zwei Etagen mit<br />
Büroräumen.
Grüsch<br />
Gründerzentrum<br />
59
Grüsch<br />
Gründerzentrum<br />
60
Unterwerk Vorderprättigau<br />
Standort: Seewis<br />
Baujahr: 1993-94<br />
Bauherr: AG Bündner Kraftwerke, Klosters<br />
Architekt: Conradin Clavuot<br />
Ingenieure: Jürg Conzett<br />
Literatur: archithese Band 26 Heft 5/96 ,<br />
Neues Bauen in den Alpen 1995<br />
Hrsg. von Christoph Mayr Fingerle,<br />
Junge Schweizer Architekten<br />
Hrsg. Christoph Bürkle u. Architektur Forum<br />
Zürich<br />
Elektrisch:<br />
Für die Übertragung der<br />
elektrischen Energie vom<br />
Erzeuger (Kraftwerkzentrale)<br />
bis zum Verbraucher<br />
sind aus wirtschaftlichen<br />
Gründen verschiedene<br />
Spannungsebenen notwendig.<br />
Die Funktion eines<br />
Unterwerkes besteht darin,<br />
diese elektrische Energie<br />
von einer Spannungsebene<br />
auf eine andere - zumeist<br />
niedrigere - zu transformieren.<br />
Im Unterwerk befinden<br />
sich Schaltanlagen und<br />
Transformatoren, die diese<br />
rein technische Funktion<br />
ausführen. Die elektrische<br />
Energie erreicht mit einer<br />
hohen Spannung das<br />
Unterwerk und verlässt dieses<br />
mit einer niedrigeren<br />
Spannung in Richtung Versorgungsgebiet.<br />
Die Maschinen<br />
werden allesamt<br />
von einer weit entfernt liegenden<br />
Kraftwerkzentrale<br />
aus gesteuert, so dass die<br />
Station weitgehend ohne<br />
menschliche Präsenz auskommt.<br />
Im Bereich Grüsch-<br />
Seewis/Station-Valzeina<br />
musste ein geeigneter<br />
Standort gefunden werden.<br />
Das gewählte Bauland liegt<br />
ideal unter der 50-KV-Leitung<br />
und ebenfalls in einem<br />
Knotenpunkt der 10-KV-Leitung<br />
(Regionalversorgung).<br />
Dieser Punkt befindet sich<br />
im Niemandsland zwischen<br />
den Fahrbahnen einer viel<br />
befahrenen Kreuzung der<br />
Prättigauerstraße. Das Gebäude<br />
wird umfasst von der<br />
Rampe der kreuzungsfrei<br />
abzweigenden Nebenstraße.<br />
Die Bedingungen der<br />
Vorderprättigau<br />
Unterwerk<br />
Bauherrschaft, der AG<br />
Bündner Kraftwerke, Klosters,<br />
waren optimaler<br />
Schutz der Maschinen vor<br />
äußeren Einflüssen (Wasser,<br />
Schnee, Straße) und<br />
Übersichtlichkeit im Verkehrsknotenpunkt.<br />
Monolithisch:<br />
Ein derartiger Ort in einer<br />
Verkehrsschlaufe ist üblicherweise<br />
reserviert für<br />
«straßenbegleitendes<br />
Grün», das bevorzugt mit<br />
einem Findling geschmückt<br />
wird. Einem mächtigen Felsbrocken<br />
gleicht denn auch<br />
das Gebäude aus Sichtbeton,<br />
ein steinernes Zeichen<br />
für die weitgehend unsichtbare<br />
Infrastruktur der Stromversorgung.<br />
Nicht die architektonischen<br />
Uraufgaben<br />
des Schützens und<br />
Schmückens, auch nicht<br />
der Widerstand gegen die<br />
Schwerkraft werden thematisiert,<br />
sondern die exakten<br />
Raumbedürfnisse der umhüllten<br />
Maschinen in ihrer<br />
technisch- ökonomisch optimalen<br />
Disposition. Um sie<br />
schließt sich der Beton «wie<br />
eine Tüte unter Vakuum».<br />
Der Baukörper erhält so<br />
eine charakteristische Form,<br />
die zwingend wirkt, obwohl<br />
ihre Gesetzmäßigkeit nicht<br />
unmittelbar erkennbar ist.<br />
Es fehlen auf den Menschen<br />
zugeschnittene Räume und<br />
somit auch der menschliche<br />
61
Vorderprättigau<br />
Unterwerk<br />
62<br />
Maßstab, wobei diese<br />
Fremdheit durch den Verzicht<br />
auf vertraute Formen<br />
zusätzlich betont wird. Mit<br />
konventioneller Architektur<br />
hat der Bau entsprechend<br />
wenig gemeinsam. Dafür<br />
erinnert er umso mehr an<br />
die eindrucksvollen Räume,<br />
die zum Beispiel in den Bauten<br />
der Kraftwerke quasi beiläufig<br />
und als Nebenprodukte<br />
der Ingenieurskunst entstehen.<br />
Alle Mittel der Architektur<br />
werden genutzt, um<br />
diese Charakteristik zu stärken.<br />
Kein Dachblech und<br />
keine Tropfnase stört die<br />
Kubatur, die mit ihren Abstufungen<br />
in der Horizontalen<br />
und der Vertikalen als<br />
monolithisch, aber auch als<br />
zusammengesetzt gelesen<br />
werden kann. Eine zwar regelmäßige<br />
und sorgfältig<br />
ausgeführte, aber bewusst<br />
rohe Betonschalung - es<br />
wurden aufgequollene<br />
Schalungsbretter verwendet<br />
- und tief eingeschnittene<br />
Lüftungs- und Fensterschlitze<br />
betonen die Massivität<br />
und Schwere des Körpers.<br />
Schwer sind auch die Türen<br />
und die Tore: bündig in die<br />
Fassade eingesetzt sind sie<br />
ebenfalls aus Beton. Sie<br />
werden von einem verdeckten<br />
Stahlrahmen gehalten,<br />
so dass von außen nur ein<br />
schmaler Spalt und die Beschläge<br />
sichtbar sind. Besonders<br />
die zwei riesigen,<br />
mehr als dreieinhalb mal fünf<br />
Meter großen Tore für die<br />
Transformatoren wirken dadurch<br />
trotz ihres Gewichts<br />
von je etwa vier Tonnen wie<br />
Tapetentüren und lassen<br />
den massiven und groben<br />
Beton plötzlich als feine<br />
Membrane erscheinen. Beinahe<br />
ist man erstaunt, wie<br />
enorm schwer sie sind, wo<br />
man doch verblüfft sein<br />
müsste, dass sie sich mühelos<br />
von einer Person bewegen<br />
lassen.
Vorderprättigau<br />
Unterwerk<br />
63
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
64<br />
Sunnibergbrücke<br />
Standort: Umfahrung bei Klosters<br />
Bauherr: Tiefbauamt Graubünden<br />
Architekt: Entwurf: Tiefbauamt Graubünden,<br />
Beratung: Andrea Deplazes, Chur,<br />
Konzept: Christian Menn, Chur<br />
Ingenieur: Christian Menn, Chur<br />
Literatur: db 5/98, Detail, Nr.8, 1999,<br />
Schweizer Ingenieur und Architekt,<br />
Nr.19, 7. Mai, 1998<br />
Die Sunnibergbrücke der<br />
Prättigauerstrasse Landquart-Davos<br />
ist das „sichtbare“<br />
Kernstück der 10 km<br />
langen und 800 Mio. Franken<br />
teuren UmfahrungsstreckeKüblis-Saas-Klosters.<br />
Die 526 m lange<br />
Brücke überquert das Tal in<br />
60 m Höhe in einer Kurve<br />
mit 503 m Radius. Die<br />
Brücke ist sehr exponiert<br />
und von weither sichtbar.<br />
Mit Blick auf die Sensibilität<br />
der Anwohner, insbesondere<br />
jener von Klosters,<br />
die bezüglich Umweltschutz<br />
mit den langen Tunneln<br />
sehr hohe und sehr<br />
teure Forderungen gestellt<br />
hatten, aber auch mit Blick<br />
auf die zahlreichen Benutzer<br />
der Umfahrungsstraße<br />
aus dem In- und Ausland<br />
wurde größter Wert auf<br />
hohe ästhetische Qualität<br />
gelegt. Das als fünffeldrige<br />
Schrägseilbrücke ausgebildete<br />
Tragwerk stellt eine<br />
technisch innovative Konstruktion<br />
dar, die auch in<br />
ästhetischer Hinsicht überzeugt.<br />
Die schlanke Ausbildung<br />
der hohen Pfeiler wird<br />
möglich, weil die Pfeilerköpfe<br />
durch die fugenlos in<br />
die Widerlager eingespannte<br />
Fahrbahnplatte<br />
stabilisiert werden.<br />
Die Brücke sollte das Tal<br />
nicht abriegeln; sie sollte<br />
vielmehr eine hohe Transparenz<br />
aufweisen und da<br />
sie talaufwärts in der Verkürzung<br />
gesehen wird, waren<br />
Spannweiten von deutlich<br />
über 100 m wünschenswert.<br />
Mit einem eleganten,<br />
modernen und originellen<br />
Bauwerk sollte gezeigt<br />
werden, dass in die-<br />
ser Gegend neben Berglandwirtschaft,Massenund<br />
Kongresstourismus<br />
auch technisch und kulturell<br />
hochwertige Leistungen<br />
erbracht werden können.<br />
Das heißt nichts anderes,<br />
als dass - in der Balance<br />
von Wirtschaftlichkeit und<br />
Ästhetik - bei absolut überzeugender<br />
Gestaltqualität<br />
an die Grenze des zulässigen<br />
finanziellen Mehraufwands<br />
von rund 15% gegangen<br />
werden konnte.<br />
Der Auftrag für die Projektierung<br />
und technische<br />
Bauleitung der Sunnibergbrücke<br />
wurde Ende Oktober<br />
1995, das heißt lediglich<br />
7 Monate vor Baubeginn,<br />
erteilt. In kurzer Zeit<br />
mussten nacheinander das<br />
Bauprojekt, die Ausschreibung,<br />
und anschließend<br />
sofort die Bearbeitung der<br />
Ausführungspläne<br />
durchgeführt werden.<br />
Nebst der umfangreichen<br />
Berechnung hat sich die Erarbeitung<br />
der Baupläne infolge<br />
der komplexen<br />
Geometrie als sehr anspruchsvoll<br />
erwiesen.<br />
Da sich Topographie und<br />
Linienführung nicht für ein<br />
Bogentragwerk eignen, ließen<br />
sich die erwünschte<br />
Transparenz und die relativ<br />
großen Spannweiten im<br />
Grunde genommen nur mit<br />
einer mehrfeldrigen<br />
Schrägkabelbrücke befriedigend<br />
erreichen. Mehrfeldrige<br />
Schrägkabelbrücken<br />
auf hohen Pfeilern weisen<br />
ein statisches und ein formales<br />
Problem auf. Das<br />
statische Problem besteht<br />
darin, dass die einzelnen<br />
Kragsysteme in Bezug auf<br />
feldweise Verkehrslast stabilisiert<br />
werden müssen;<br />
das formale Problem liegt<br />
im unharmonischen, wenig<br />
überzeugenden Verhältnis<br />
der hohen Pfeiler zu den<br />
üblichen (statisch effizienten)<br />
ebenfalls hohen Pylonen.
Für das statische Problem<br />
bieten sich drei Lösungen<br />
an:<br />
a) Stabilisierung der Pylonspitzen<br />
mit massiver Reduktion<br />
der Pylonmomente<br />
durch Stabilisierungskabel<br />
zu den benachbartenPylonfüssen.<br />
b) Stabilisierung der Pylonspitzen<br />
mit massiver Reduktion<br />
der Pylonmomente<br />
durch Überspannung<br />
mit Stabilisierungskabeln,<br />
die<br />
hinter den Endwiderlagern<br />
fest verankert sind.<br />
c) Stabilisierung jedes einzelnen<br />
Kragsystems mit<br />
biegesteifen Pylonen.<br />
Die ersten beiden Stabilisierungsvarianten<br />
sind bei<br />
kurzen Pylonen nicht effizient.<br />
Das formale Problem<br />
besteht darin, hohe Pfeiler<br />
und kurze Pylone zu einer<br />
überzeugenden Einheit zu<br />
verbinden.<br />
Bei einem freistehenden<br />
Kragsystem sind die Pylonmomente<br />
infolge einseitiger<br />
Verkehrslast unabhängig<br />
von der Pylonhöhe. Die<br />
reinen Pylonkosten sind<br />
deshalb bei kurzen Pylonen<br />
deutlich kleiner als bei hohen<br />
Pylonen; demgegenüber<br />
sind aber die Kabelkosten<br />
(wegen der höheren<br />
Kabelkräfte) wesentlich<br />
größer. Mit der flacheren<br />
Kabelneigung nehmen natürlich<br />
auch die Druckkräfte<br />
im Träger zu, und dadurch<br />
wird die Spannweite<br />
begrenzt. Das Hauptproblem<br />
der niedrigen Pylone<br />
und flachen Kabel sind<br />
aber die Durchbiegungen.<br />
Die wichtigsten Anteile an<br />
die Durchbiegungen liefern<br />
einerseits die Kabeldehnungen<br />
und andererseits<br />
die Pylon- und Pfeilerbiegung.<br />
Im Prinzip weisen Freivorbau-(Krag-)<br />
Träger eine<br />
noch viel flachere Kabelneigung<br />
auf. Hier dienen aber<br />
die Kabel zur Vorspannung<br />
des Beton-(Zug-)Gurts, der<br />
eine sehr hohe Steifigkeit<br />
und dementsprechend kleine<br />
Dehnungen aufweist.<br />
Das gilt auch, wenn die<br />
Spannkabel nicht im Verbund<br />
wirken. Erst wenn der<br />
Zuggurt dekomprimiert ist,<br />
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
wirkt sich die starke Kabeldehnung<br />
(dann aber massiv)<br />
auf die Durchbiegungen<br />
aus. Ein ähnliches<br />
durchbiegungsunempfindliches<br />
Verhalten (wie Kragträger)<br />
zeigen Zügelgurtbrücken<br />
wie z.B. die Ganterbrücke,<br />
eine Brücke mit<br />
betonummantelten Schrägkabeln.<br />
Bei aller vordergründigen<br />
Ähnlichkeit darf man einen<br />
für die Tragwirkung wesentlichen<br />
Unterschied nicht<br />
übersehen: Die Schrägkabel<br />
der Ganterbrücke dienen<br />
der Vorspannung der<br />
Stahlbeton-Zugscheiben<br />
(Zügelgurtbrücke) und reagieren<br />
daher auf einseitige<br />
Verkehrslasten, die zunächst<br />
nur die Vorspannung<br />
„aufzehren“, nicht so<br />
empfindlich wie offene<br />
Schrägkabel. Um so wichtiger<br />
war es bei der Sunnibergbrücke,<br />
die Durchbiegung<br />
im Feld über einen<br />
anderen Parameter der<br />
Konstruktion zu steuern:<br />
Die Ausbildung der Pylone<br />
und ihre Stabilisierung beeinflussen<br />
die Durchbiegung<br />
im Feld.<br />
Bei normalen Schrägkabelbrücken<br />
ist eine Kabelverstärkung<br />
(über die erforderliche<br />
Sicherheit hinaus)<br />
ausschließlich zur Verminderung<br />
der Durchbiegungen<br />
unwirtschaftlich. Einfach<br />
und sinnvoll ist eine,<br />
soweit formal möglich, Pylon/Pfeiler-Verstärkung.<br />
Man erhält somit die „optimal“<br />
niedrigste Pylonhöhe,<br />
indem man die Kabel<br />
auf Tragsicherheit bemisst<br />
und Pylon und Pfeiler steif,<br />
aber formal überzeugend<br />
gestaltet.<br />
Pfeiler und Pylone<br />
Die Pfeiler stellen die markantesten<br />
Bauteile der<br />
Sunnibergbrücke dar. Die<br />
Formgebung hatte deshalb<br />
nicht nur den technischen,<br />
sondern vor allem auch<br />
den ästhetischen Anforderungen<br />
zu genügen.<br />
In Brückenlängsrichtung<br />
65
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
66<br />
müssen die Pfeiler genügend<br />
steif ausgebildet sein,<br />
damit die Trägerverformungen<br />
bei feldweiser Belastung<br />
in zulässigen Grenzen<br />
bleiben. In Querrichtung<br />
muss der Pfeiler eine<br />
möglichst zwängungsfreie<br />
Längenänderung des als in<br />
den Widerlagern eingespannter<br />
Bogen wirkenden<br />
Brückenträgers ermöglichen.<br />
Trotzdem muss das<br />
Rahmensystem die im<br />
Bauzustand auftretenden<br />
Windbeanspruchungen sicher<br />
abtragen. Die Ausarbeitung<br />
der Feingeometrie<br />
wurde an dem mit 77m<br />
höchsten Pfeiler P2 durchgeführt<br />
und anschließend<br />
auf die übrigen drei Pfeiler<br />
übertragen. Die Neigung<br />
der beiden Pylonflügel wurde<br />
unter Berücksichtigung<br />
der Geometrie der Schrägseile<br />
am gekrümmten<br />
Überbau optimiert. Die definitive<br />
Formfindung erfolgte<br />
an einem speziell<br />
hergestellten räumlichen<br />
Modell im Massstab 1:200.<br />
Die gekrümmten Ecklinien<br />
in der Ansicht längs und<br />
quer wurden anschliessend<br />
in mathematisch geschlossener<br />
Form ausgedrückt<br />
(Parabeln 2. und 3. Ordnung).<br />
Mit diesen Formeln<br />
konnten die Querschnitte<br />
am Ende der durch den<br />
Unternehmer gewählten<br />
Betonieretappen genau definiert<br />
und planlich dargestellt<br />
werden. Die Herstellung<br />
der Pfeiler erfolgte polygonal<br />
zwischen den Betonierfugen.<br />
Wenn der Pfeilerkopf (beim<br />
Trägeranschluss) gehalten<br />
ist, wird der Einfluss auf die<br />
Durchbiegungen viel kleiner<br />
als bei verschieblichem<br />
Pfeilerkopf. Bei der Sunnibergbrücke<br />
ließ sich die Fixierung<br />
der Pfeilerköpfe -<br />
wegen der Brückenkrümmung<br />
im Grundriss - durch<br />
die fugenlose, monolithische<br />
Verbindung des<br />
Trägers mit den Endwiderlagern<br />
sehr einfach realisieren.Temperaturänderungen<br />
wirken sich hauptsächlich<br />
durch horizontale<br />
Trägerverformungen senkrecht<br />
zur Brückenachse<br />
aus, und die Pfeiler erfahren<br />
in dieser Richtung<br />
Zwangsverformungen. Da-<br />
mit der Pfeilerwiderstand<br />
nicht zu groß wird, dürfen<br />
die Pfeiler nicht als Scheiben<br />
in Querrichtung ausgebildet<br />
werden. Durch die<br />
Auflösung der Pfeiler in ein<br />
Vierendeelsystem kann der<br />
Pfeilerwiderstand deutlich<br />
vermindert werden. In der<br />
Brückenansicht sind die<br />
Pfeiler nach unten verjüngt,<br />
was genau dem Kraftfluss<br />
bzw. dem Momentenverlauf<br />
bei einseitiger Verkehrslast<br />
entspricht; die<br />
größte Biegebeanspruchung<br />
tritt am Pfeilerkopf<br />
bzw. Pylonfuß auf. Die sich<br />
nach oben erweiternden<br />
Pfeiler vermitteln den Eindruck,<br />
dass die Brücke<br />
ganz natürlich aus dem Auenwald<br />
herauswächst und<br />
nicht in den Wald hineingestellt<br />
wurde.<br />
Der Pfeilerquerschnitt wird<br />
konsequent in die Pylone<br />
verlängert. Die vierendeelartigen<br />
Pfeiler finden in den<br />
Pylonen eine natürliche<br />
und funktionelle Fortsetzung.<br />
Die Pylone müssen<br />
zur Gewährleistung<br />
des Lichtraumprofils der<br />
gekrümmten Fahrbahn<br />
nach außen geneigt werden;<br />
damit wird aber auch<br />
nach unten die Pfeilerform<br />
(Abstand zwischen den<br />
Pfeilergurtungen) bestimmt.<br />
Die Brük-kenkrümmung<br />
verursacht eine starke<br />
Querbiegung in den Pylonen<br />
mit dem Maximum in<br />
den Fusspunkten.<br />
Überbau<br />
Die Fahrbahnoberfläche<br />
stellt infolge der Kombination<br />
von Krümmung,<br />
Längs- und Quergefälle<br />
eine verwundene räumliche<br />
Fläche dar. Die Hauptschwierigkeit<br />
bestand darin,<br />
die Kabellängen genau<br />
zu bestimmen (Toleranz<br />
der vorgefertigten Schrägkabel<br />
± 5cm) und gleichzeitig<br />
die sich bei jeder Verankerung<br />
ändernden Horizontalwinkel<br />
zwischen der<br />
Projektion der Kabelachse<br />
in die Schalungsfläche und<br />
der Tangente an die Fahrbahnachse<br />
zu ermitteln.<br />
Die Verankerungspunkte<br />
im Pylon liegen auf einer<br />
Geraden und können somit<br />
auf einfache Art konstruiert<br />
werden. Viel schwieriger ist
die Bestimmung der Verankerungspunkte<br />
am Brükkenträger.<br />
Durch einen massiven<br />
Querträger unter dem Fahrbahnträger<br />
wird die Querbiegung<br />
in ein Kräftepaar in<br />
den beiden Pfeilergurtungen<br />
umgewandelt. Die<br />
Fortsetzung des Pfeilerquerschnitts<br />
in die Pylone<br />
ergibt wieder auf natürliche<br />
Art die optimale Gestaltung<br />
für die Kabelverankerung.<br />
Die Schrägkabel bestehen<br />
aus verzinkten Paralleldrähten<br />
in „gefetteten“ Hüllrohren.<br />
Der Brückenträger<br />
ist als Platte mit Randverstärkungen<br />
ausgebildet;<br />
die Querschnitte der Pfeiler,<br />
Pylone und Fahrbahn<br />
weisen somit die gleiche<br />
Querschnittstypologie auf<br />
und unterstreichen damit<br />
die Einheitlichkeit und die<br />
Ganzheitlichkeit des gesamten<br />
Brückentragwerks.<br />
Bemerkungen zur Gestaltung<br />
Die grundlegende Gestaltungsidee<br />
bestand im Entwurf<br />
einer mehrfeldrigen,<br />
(bezüglich Landschaft)<br />
maßstäblichen, topographisch<br />
gut eingepassten<br />
Schrägkabelbrücke mit<br />
möglichst kurzen Pylonen.<br />
Damit ließen sich die erwünschte<br />
Transparenz und<br />
Schlankheit, die eine hohe<br />
technische Effizienz visualisieren,<br />
am besten erreichen.<br />
Die immer wieder<br />
betonten Kriterien für eine<br />
gute formale Gestaltung<br />
wurden konsequent berücksichtigt:<br />
- Visualisierung der ganzheitlichen,monolithischen<br />
und räumlichen<br />
Tragwirkung<br />
- klare Organisation und<br />
Anordnung der Systemelemente<br />
- einheitliche, kohärente<br />
Gestaltung der Tragelemente<br />
und Querschnitte<br />
- Visualisierung des Kraftflusses<br />
und der speziellen<br />
Systemstabilisierung<br />
(insbesondere dank<br />
Pfeilerform)<br />
- künstlerische Ornamentik<br />
durch Verfeinerung<br />
der Form und räumliche,<br />
lichtplastische Querschnittsgestaltung(ins-<br />
besondere Pfeiler).<br />
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
Gründungen<br />
Da die Zufahrtsmöglichkeit<br />
zum Pfeiler P1 für eine<br />
Bohrpfahlmaschine nicht<br />
gegeben war, wurden zwei<br />
Kleinschächte errichtet. Im<br />
Unterfangungsverfahren<br />
wurden die beiden Schächte<br />
(d =3.5 m) parallel zueinander<br />
in Etappen von 1,5<br />
m bis auf 17 bzw. 19 m abgeteuft.<br />
Bis zu einer Tiefe<br />
von rund 10 m konnte der<br />
Aushub mit einem Hydraulikbagger<br />
und Greiferverlängerungen<br />
bewerkstelligt<br />
werden. Ab dieser Kote<br />
kam ein Minibagger zum<br />
Einsatz, der das Aushubmaterial<br />
in einen Erdkübel<br />
lud. Ein Pneukran zog den<br />
Kübel hoch und entleerte<br />
ihn. Vorhandene Blöcke<br />
mussten gespitzt oder gesprengt<br />
werden. In einer<br />
Tiefe von 15 m drang sehr<br />
viel Hangwasser in den<br />
bergseitigen Schacht. Ausschwemmungen<br />
des lehmigen<br />
Erdmaterials waren die<br />
Folge. Das anfallende<br />
Wasser musste sauber gefasst<br />
und in mehreren Stufen<br />
abgepumpt werden.<br />
Die Bohrpfähle als Fundation<br />
von Pfeiler P2, P5 und<br />
P4 (je sechs Stück) wurden<br />
im Trockenbohrverfahren<br />
mit einem kombinierten<br />
Bohr- und Verrohrungsgerät<br />
ausgehoben und im<br />
Kontraktorverfahren ausbetoniert.<br />
Aufgrund des geologischen<br />
Berichts und der Beurteilung<br />
der Situation vor Ort<br />
musste im Bereich der Fundationen<br />
für den Pfeiler P2<br />
mit einem erheblichen Anteil<br />
von mittleren bis großen<br />
Felsblöcken gerechnet<br />
werden, die sich am Fuße<br />
eines Bergsturzhangs angesammelt<br />
hatten. Um zeitaufwendige<br />
und kostspielige<br />
Meißelarbeiten für das<br />
Durchörtern von Felsen<br />
und Blöcken zu minimieren,<br />
und um Stillstandszeiten<br />
der teuren Installationen<br />
und Geräte<br />
während möglicher<br />
Lockerungssprengungen<br />
im Bohrrohr zu vermeiden,<br />
wurde das sogenannte Presplittingverfahrenangewandt.<br />
Mit diesem Verfahren<br />
werden Fels und Blök-<br />
67
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
68<br />
ke vor der eigentlichen Herstellung<br />
des Bohrpfahls im<br />
Bereich des Pfahlumfangs<br />
gezielt gesprengt und somit<br />
zermürbt und gespalten.<br />
Dabei wird als erstes eine<br />
Sondierbohrung (d = 140<br />
mm), meistens in Pfahlmitte<br />
bis auf die Solltiefe des<br />
Großbohrpfahls erstellt. Mit<br />
den Aufschlüssen aus dieser<br />
Bohrung werden dann,<br />
je nach Art und Anzahl der<br />
aufgespürten Blöcke, weitere<br />
Kleinbohrungen am<br />
Umfang des Großbohrpfahls<br />
angeordnet. Aufgrund<br />
der Bohrprotokolle<br />
werden die Sprengladungen<br />
berechnet, in den mit<br />
PVC-Rohren versehenen<br />
Bohrlöchern entsprechend<br />
angebracht und verzögert<br />
gezündet.<br />
Schalung für Pfeiler und<br />
Pylon<br />
Die Pfeiler, bestehend aus<br />
zwei mit Querholmen verbundenen<br />
Stielen sowie die<br />
über die Brückenplatte ragenden<br />
Pylone weisen einen<br />
äußerst komplizierten<br />
Querschnitt auf. der sich in<br />
Brückenlängsrichtung mit<br />
zunehmender Höhe stetig<br />
verbreitert. Zudem sind die<br />
einzelnen Stiele im obersten<br />
Teil des Pfeilers in<br />
Brückenquerrichtung zunehmend<br />
gegen außen bis<br />
zu einer maximalen Neigung<br />
der Pylone von 8:1<br />
geneigt, wodurch an das<br />
Schalungskonzept von<br />
Pfeiler und Pylon bezüglich<br />
Anpassungsfähigkeit, Bedienungsfreundlichkeit,<br />
Neigungsverstellbarkeit,<br />
Sicherheit, Belastbarkeit<br />
und Wirtschaftlichkeit größte<br />
Anforderungen gestellt<br />
wurden. Technische und<br />
bauterminliche Überlegungen<br />
führten zu einer Auftei-<br />
lung der Pfeiler und Pylone<br />
in drei Bereiche mit voneinander<br />
unabhängigen<br />
Kletterschalungen für jeden<br />
Stiel (d.h. 3x2 Schalungen).<br />
Schalungspaar 1 und 2<br />
deckten die Pfeilerbereiche<br />
„OK Pfahlbankett bis UK<br />
oberer Holm“ bzw. „oberer<br />
Holm bis UK Querträger“<br />
ab. Für den Bereich 3<br />
(Querträger bis OK Pylon)<br />
mussten auf der Außenseite<br />
infolge der großen Vorneigung<br />
spezielle Sperrenkonsolen<br />
angewendet werden.<br />
Die elegante Form der Pfeiler-<br />
und Pylonstiele konnte<br />
verständlicherweise nicht<br />
exakt der vorgegebenen<br />
Kurve nachgebaut werden.<br />
Mit polygonal erstellten<br />
Etappen von rund 4m Höhe<br />
ergab sich dennoch ein geschwungenes,abgerundetes<br />
Gesamtbild.<br />
Besonderen Augenmerks<br />
bedurfte die Konzipierung<br />
der eigentlichen Schalung.<br />
Dabei war unter anderem<br />
auf ein einheitliches Schalungsbild<br />
von unten bis<br />
oben (Schaltafelstöße, Farbe<br />
des Betons), auf eine<br />
saubere Ausbildung der Arbeitsfugen<br />
(Einlage von<br />
Trapezleisten) und auf eine<br />
funktionelle und schalmaterial-schonende<br />
Herstellung<br />
zu achten. Die Schalungen<br />
bestanden aus vier, ein<br />
Rechteck bildenden Grundelementen.<br />
Die eigentliche<br />
Querschnittsform der Pfeiler-<br />
und Pylonstiele wurde<br />
mit Schalungseinlagen<br />
(massiv ausgebildeten Kisten)<br />
erstellt. Für die Anpassung<br />
der Schalung an<br />
die stetig ändernden Abmessungen<br />
der Stiele<br />
konnten die Schalungseinlagen<br />
auf einer Schaltafelgrundbelegung<br />
der seitlichen<br />
Schalungselemente<br />
leicht verschoben und wieder<br />
fixiert werden. Dies<br />
sparte nicht nur Zeit, sondern<br />
vermied ein ständiges<br />
Zuschneiden von neuen<br />
Schaltafelteilen und deren<br />
Einpassen in das Grundelement<br />
mit der damit verbundenen<br />
Gefahr von unterschiedlichenBetonfärbungen.<br />
Die von Schalungstechnikern<br />
erwarteten<br />
Probleme beim Binden dieses<br />
Schalungskonzepts
(ungenügende Vorspannmöglichkeit<br />
der Bindstäbe<br />
zur Aufnahme der Frischbetondrücke)<br />
konnten auf<br />
der Baustelle von Beginn<br />
an einwandfrei gelöst werden.<br />
Freivorbau<br />
Für die Erstellung des<br />
Fahrbahnträgers hatten<br />
Christian Menn und sein<br />
Team infolge verschiedener<br />
Überlegungen zusätzlich<br />
zur ausgeschriebenen<br />
Ausführungsmethode des<br />
Freivorbaus einen Variantenvorschlag<br />
eingereicht,<br />
der dann auch ausgeführt<br />
wurde. Ausgeschrieben<br />
war das Freivorbausystem<br />
in Anlehnung an die Ausführung<br />
der Rheinbrücke in<br />
Diepoldsau. Dabei wurden<br />
nach dem Vorfahren des<br />
Wagens die Schrägseile<br />
der folgenden Etappe an<br />
vorfabrizierten Betonelementen<br />
montiert. Das Betonelement<br />
und die<br />
Wagenkonstruktion wurden<br />
auf Zug und Druck miteinander<br />
verbunden und<br />
vorne an den Schrägseilen<br />
aufgehängt. Um das ganze<br />
System in der Sollage zu<br />
halten, musste es massiv<br />
ballastiert werden. Während<br />
des Betonierens war<br />
der Ballast sukzessive zu<br />
reduzieren, um vertikale<br />
Verschiebungen vorne so<br />
gering wie möglich zu halten.<br />
Das Betonelement<br />
wurde in den definitiven<br />
Fahrbahnträgerquerschnitt<br />
einbetoniert.<br />
Bei der Sunnibergbrücke<br />
wäre die oben beschriebene<br />
Methode durch die sehr<br />
flache Schrägseilanordnung<br />
und durch die Krümmung<br />
im Grundriss relativ<br />
heikel auszuführen gewesen.<br />
Bei Längenänderungen<br />
der<br />
Schrägseile im Bauzustand<br />
infolge Temperatur oder<br />
zunehmender Last beim<br />
Betonieren wären die Bewegungen<br />
vorne am Vorbauwagen<br />
und damit auch<br />
die Winkeländerungen in<br />
der Anschlussfuge größer<br />
ausgefallen. Ebenso sind<br />
die Druckkräfte im Betonelement<br />
größer, und die Ablenkungskräfte<br />
aufgrund<br />
der starken horizontalen<br />
Krümmung des Fahrbahn-<br />
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
trägers mussten ebenfalls<br />
in den Anschlussgelenken<br />
des Betonelementes aufgenommen<br />
werden.<br />
Beim Variantenvorschlag<br />
wird der Fahrbahnträger-<br />
Querschnitt in zwei Teilen<br />
betoniert:<br />
- vorne die beiden seitlichen<br />
Längsträger<br />
- hinten, um eine Etappe<br />
zurückversetzt, die<br />
Fahrbahnplatte<br />
Somit erstreckt sich dieser<br />
Freivorbauwagen über<br />
zwei Betonieretappen hinweg<br />
und ist doppelt so lang<br />
wie der ausgeschriebene<br />
Wagen. Dies ergibt folgende<br />
wesentliche Vorteile:<br />
- Das ganze System des<br />
Freivorbauwagens ist<br />
besser ausbalanciert.<br />
- Der ganze Wagen kann<br />
am bereits betonierten<br />
Fahrbahnträgerteil besser<br />
eingespannt werden,<br />
was geringere Bewegungen<br />
in der Anschlussfuge<br />
bewirkt.<br />
- Auf ein vorfabriziertes<br />
Element kann verzichtet<br />
werden, und somit sind<br />
keine Anschlussgelenke<br />
mehr notwendig, was<br />
eine wesentliche Qualitätsverbesserung<br />
des<br />
Längsträgerquerschnitts<br />
bedeutet.<br />
- Die Schrägkabel müssen<br />
erst nach dem Betonieren<br />
eine Tragfunktion<br />
übernehmen.<br />
- Auf eine ständige, komplizierte<br />
Ballastierung<br />
des Vorbauwagens<br />
kann größtenteils verzichtet<br />
werden.<br />
Selbstverständlich war die<br />
Herstellung des Fahrbahnträgers<br />
im Wochentakt<br />
auch für diesen Variantenvorschlag<br />
eine Voraussetzung.<br />
69
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
70<br />
Beton<br />
Bei vorhergehenden Brükkenbauten<br />
bezog Christian<br />
Menn den Beton immer von<br />
Fertigbetonanlagen. Bestens<br />
eingerichtet für die<br />
Produktion von qualitativ<br />
hochstehendem Beton und<br />
infolge großer Werksdichte<br />
immer in der Nähe der<br />
Objekte war der Entscheid<br />
für den Bezug von Beton ab<br />
Fertigbetonwerk sowohl<br />
bezüglich Qualität wie auch<br />
bezüglich Wirtschaftlichkeit<br />
naheliegend. Entgegen<br />
diesen Gewohnheiten wurde<br />
beim Bau der<br />
Sunnibergbrücke erstmals<br />
für die Herstellung von Beton<br />
auf der Baustelle eine<br />
Ortbetonanlage verwendet.<br />
Die größtmögliche Qualität<br />
des Betons und eine größere<br />
Flexibilität und Effizienz<br />
der Baustelle waren für<br />
diesen Entschluss maßgebend.<br />
Die Transportzeit für Fertigbeton<br />
ab dem nächstgelegenen<br />
Werk hätte eine halbe<br />
bis dreiviertel Stunden<br />
betragen, was für einen<br />
qualitativ hochstehenden<br />
Beton, wie er im Brückenbau<br />
verwendet wird, schon<br />
bei normalen äußeren<br />
Bedingungen zu lange ist.<br />
Selbstverständlich konnte<br />
nicht irgendeine Betonanlage<br />
erstellt werden, sondern<br />
die Anlage musste einige<br />
wesentliche Bedingungen<br />
erfüllen:<br />
Steuerung der Anlage mit<br />
Mikroprozessoren<br />
Ausdruck von Chargenprotokollen<br />
Dosiermöglichkeit von mindestens<br />
drei Zusatzmitteln<br />
Vierkomponenten-Kiessilo<br />
Feuchtemesssonde für die<br />
relevanten Zuschlagstoffkomponenten<br />
Winterbetrieb, d.h. Kiessiloheizung,Warmwasseraufbereitung<br />
Feinwasserdosierung<br />
Für eine qualitativ und terminlich<br />
optimale Ausführung,<br />
insbesondere für den<br />
Freivorbautakt des Fahrbahnträgers,<br />
ergaben sich<br />
weitere Anforderungen an<br />
den Frisch- bzw. an den<br />
Festbeton: gute Verarbeitbarkeit<br />
bei niedrigem w/z-<br />
Wert, lange Offenzeit, hohe<br />
Frühfestigkeiten (Wochentakt<br />
Freivorbau) und genügend<br />
Festigkeitsreserven.<br />
Schlussbemerkung<br />
Bei einem optimalen Konzept<br />
ergibt sich die Form im<br />
wesentlichen fast<br />
zwangsläufig aus Statik<br />
und Konstruktion. Die bewusste<br />
architektonische<br />
Gestaltung reduziert sich<br />
auf sehr wenige Visualisierungs-<br />
und Ornamentikaufgaben.<br />
Hohe ästhetische<br />
Qualität ist nicht gratis. Im<br />
vorliegenden Fall sind die<br />
Mehrkosten von 15% gegenüber<br />
der wirtschaftlichsten<br />
Lösung an der zulässigen<br />
Grenze aber gerechtfertigt.<br />
Die Kosten pro<br />
Laufmeter Brücke liegen<br />
weit unter dem Mittelwert<br />
für die gesamte Umfahrungsstrecke<br />
von Küblis bis<br />
Klosters-Selfranga. Die<br />
neuartige Brücke stellte<br />
sehr hohe Anforderungen<br />
an die Planbearbeitung und<br />
vor allem auch an die Ausführung,<br />
die nur dank motivierter<br />
und sorgfältiger<br />
Qualitätsarbeit aller Beteiligten<br />
erfüllt werden konnte.
Klosters<br />
Sunnibergbrücke<br />
71
Davos<br />
Kirchner Museum<br />
72<br />
Kirchner Museum<br />
Standort: Davos<br />
Baujahr: 1991-92<br />
Bauherr: Kirchner-Stiftung, Davos<br />
Architekt: Annette Gigon und Mike Guyer Zürich<br />
Ingenieure: Davoser Ingenieure AG (DIAG)<br />
Literatur: Architektur & Technik 3/94, db Jg. 128 Nr.8 1994<br />
Werk, Bauen + Wohnen 12/1992<br />
Gigon Guyer Architekten 1989–2000<br />
Neues Bauen in den Alpen 1995<br />
Die Familienstiftung Benevenua<br />
in Vaduz, Roman<br />
Nobert und Rosemarie Ketterer,<br />
langjährige Nachlassverwalter<br />
von Ernst Ludwig<br />
Kirchners Werk, ließen<br />
1990 verlauten, dass sie<br />
dem Ort Davos 400 Originalwerke<br />
des Malers, 160 Skizzenbücher<br />
und eine umfangreicheSachbuchbibliothek<br />
schenken wollten, mit<br />
der Auflage dafür ein adäquates<br />
Museum zu errichten.<br />
Für die Projektierung<br />
wurden vier Architekten eingeladen.<br />
Die Jury sprach<br />
sich einstimmig für den Vorschlag<br />
der jungen Züricher<br />
Architekten Annette Gigon<br />
und Mike Guyer aus.<br />
Da Kirchner selbst diplomierter<br />
Architekt war und<br />
aufgrund seines Hanges zur<br />
angewandten Kunst taucht<br />
zwangsläufig die Frage auf,<br />
wie Kirchner sein Museum<br />
gebaut hätte; Kirchner gehörte<br />
zu den Künstlern, die<br />
„ihr Ambiente als eine Aufgabe<br />
der Kunst ansehen<br />
und sich ihren persönlichen<br />
Lebensraum sozusagen<br />
nach ihrem Ebenbild schaffen“.<br />
Die Suche nach einem<br />
Museum „im Sinne Kirchners“<br />
als Ausgangspunkt für<br />
die Arbeit ist aber untauglich.<br />
Ein derartiges Museum würde<br />
in Konkurrenz treten zu<br />
seinem Werk, weil es vorgäbe,<br />
gleich wie sein Werk seine<br />
Schöpfung zu sein. Die<br />
gegenteilige Haltung - verwirklicht<br />
in den selbstinszenatorischenMuseumsarchitekturen<br />
– erzeugt ebenfalls<br />
keine Museumsräume, die<br />
ihrer primären Aufgabe genügen,<br />
„Orte der Kunst“ zu<br />
sein. Nach mehr als zwanzigjähriger<br />
Sensibilisierung<br />
durch die Concept und Minimal<br />
Art - welche gerade die<br />
Grenze zwischen künstlerischen<br />
und alltäglichen Äußerungen<br />
erkundet haben -<br />
scheint das „Zutun“ der Architektur<br />
in Ausstellungsräumen<br />
problematisch oder<br />
schlicht überflüssig.<br />
Über die vermehrte Kritik<br />
von Künstlern und Museumsleuten<br />
an zeitgenössischen<br />
Museumsbauten hinaus<br />
formulierte der Basler<br />
Künstler Remy Zaugg poetisch<br />
und radikal, wie Ausstellungsräume<br />
beschaffen<br />
sein sollten. Diese Vision<br />
lässt sich im Grunde interpretieren<br />
als Wunsch nach<br />
einem künstlerischen Vakuum<br />
- für die Kunst. Der geforderte<br />
Ausschluss künstlerischer<br />
Intentionen aus der<br />
Architektur von Ausstellungsräumen<br />
ist vergleichbar<br />
mit der Verdunkelung<br />
von Kino- und Theaterräumen,<br />
die so der Wahrnehmung<br />
während der Dauer<br />
der Aufführung entzogen<br />
sind. Ein Ausstellungsraum<br />
eines Kunstmuseums kann<br />
aber nicht verdunkelt werden,<br />
da die Werke nur unter<br />
tageslichtähnlichen Bedingungen<br />
betrachtet werden<br />
können und der Besucher<br />
sich im Raum bewegt<br />
und orientiert. Eine<br />
„Ausblendung“ des Ausstel-
lungsraumes zugunsten<br />
der Kunstwerke könnte<br />
sich einstellen, wenn der<br />
Raum so beschaffen wäre,<br />
dass er gleichsam ins Bekannte,Selbstverständliche,<br />
Fraglose zurückfällt.<br />
Ausstellungsräume<br />
Die vier Ausstellungsräume<br />
im Erdgeschoss, die Kerne<br />
des Gebäudes, bleiben ausschließlich<br />
dem Kunstwerk<br />
und seinem Betrachter vorbehalten.<br />
Es sind einfache,<br />
rechtwinklige Räume - sowohl<br />
im Grundriss, als auch<br />
im Schnitt. Die Wände der<br />
Ausstellungsräume sind<br />
massiv und tragen die Konstruktion<br />
der Oberlichtlaterne<br />
und des Daches. Sie bestehen<br />
aus Beton, sind verschalt<br />
mit Holz-Gips-Paneelen<br />
und weiß gestrichen. So<br />
bilden sie einen ruhigen,<br />
neutralen Hintergrund für die<br />
Bilder. Der Boden, vom Besucher<br />
begangen und strapaziert,<br />
besteht aus großteiligem,<br />
rechtwinklig zur Wand<br />
verlegtem, massivem Holzparkett.<br />
Die Glasdecke, die<br />
den Ausstellungsraum jeweils<br />
nach oben begrenzt, ist<br />
durchlässig für das Tageslicht.<br />
Sie filtert das Licht und<br />
verbirgt daneben die Installationen<br />
für das Kunstlicht.<br />
Die Decke besteht analog zu<br />
den tradierten Glasdecken<br />
der Museen aus der Zeit der<br />
Jahrhundertwende aus feinen<br />
Stahlprofilen und darin<br />
eingelegtem mattiertem (geätztem)<br />
Glas. Diese gläserne<br />
Decke spannt sich von<br />
Wand zu Wand. Das Licht<br />
in den Ausstellungsräumen<br />
Davos<br />
Kirchner Museum<br />
ist gleichmäßig - vergleichbar<br />
dem diffusen Licht im<br />
Freien an einem bedeckten<br />
Tag. Unbeeinträchtigt<br />
durch liegenden Schnee<br />
dringt das Tageslicht seitlich<br />
durch die vertikale,<br />
mattierte Verglasung der<br />
Oberlichtaufbauten und<br />
fällt von dort durch die Mattgläser<br />
der Staubdecke in<br />
die darunter liegenden<br />
Ausstellungsräume.<br />
Lamellenstores im Bereich<br />
der Vertikalverglasung erlauben<br />
eine Regulierung des<br />
Tageslichts entsprechend<br />
den Witterungsverhältnissen<br />
und eine Verdunkelung<br />
für die lichtempfindliche<br />
Graphik. Kunstlicht<br />
oberhalb der Staubdecke<br />
ergänzt abends das Tageslicht.<br />
Ein weiterer kleiner<br />
Ausstellungsraum befindet<br />
sich im Untergeschoss. Er<br />
eignet sich durch seine Lage<br />
für didaktische Nutzungen<br />
wie Video- und Filmvorführungen.<br />
Erschließungshalle<br />
Vergleichbar einer teilweise<br />
auskristallisierten und teilweise<br />
flüssig erstarrten Materie<br />
formen die geometrisch<br />
einfachen Kuben der Ausstellungsräume<br />
mit den entstehendenZwischenräumen<br />
das komplexe Volumen<br />
der Halle, die vorwiegend<br />
dem Museumsbesucher zugedacht<br />
ist. Sie bildet den<br />
Ort der Ankunft, der<br />
Information und der Orientierung<br />
und enthält somit die<br />
verschiedenen Elemente<br />
wie Kasse, Büchertisch, Biographie<br />
des Künstlers und<br />
Stiftertafel. Von der Halle aus<br />
ist jeder Ausstellungsraum<br />
einzeln zugänglich. Auf dem<br />
Rundgang von Saal zu Saal<br />
ist also immer die Halle<br />
zwischengeschaltet, so<br />
dass die Ausstellungsräume<br />
ausschließlich das Ziel<br />
und nicht die Zirkulationszone<br />
für den nächsten<br />
73
Davos<br />
Kirchner Museum<br />
74<br />
Raum bilden. Die Hallenfenster<br />
erlauben den Blick<br />
des Besuchers in den<br />
Park, auf die Landschaft<br />
und auf die städtische Bebauung<br />
der Hauptstraße -<br />
auf die Sujets von Kirchners<br />
Malerei.<br />
Äußere Gestalt des Museums<br />
Die Volumina des Museums<br />
sind mit unterschiedlich<br />
transparenten und<br />
unterschiedlich matten<br />
oder glänzenden Gläsern<br />
verkleidet - in ihrer Erscheinung<br />
vergleichbar den verschiedenenAggregatszuständen<br />
von Wasser:<br />
Durchsichtiges, spiegelglattes<br />
Fensterglas im Bereich<br />
der Erschließungshalle<br />
ermöglicht dem Passanten<br />
auf der Straße, an<br />
einigen Stellen in das Museum<br />
hinein und durch<br />
das Museum hindurch auf<br />
die Landschaft zu blicken.<br />
Mattiertes Isolierglas lässt<br />
das Licht gefiltert seitlich in<br />
die Oberlichter über den<br />
Ausstellungsräumen fallen<br />
und von dort über die<br />
innere Glasdecke den<br />
Bildersaal natürlich erhellen.<br />
Profiliertes und mattiertes<br />
Glas verkleidet die<br />
Betonwände der Kunstsäle<br />
und lässt die durchschimmerndeWärmedämmung<br />
vor den Betonwänden<br />
erahnen. Glasscherben<br />
(Abfallglas), der<br />
quasi unbrauchbare „letzte“<br />
Zustand des Glases,<br />
beschweren als glitzernder<br />
Kies das Dach.<br />
Die gläserne Gebäudehülle<br />
ist inspiriert vom hellen al-<br />
pinen Licht des Davoser<br />
Tals. Das Gebäude spielt<br />
und arbeitet mit diesem<br />
Licht. Die verschiedenen<br />
Erscheinungsformen des<br />
Glases im Licht - spiegelnd,<br />
leuchtend, matt<br />
schimmernd und glitzernd<br />
- sind abhängig von den<br />
unterschiedlichen Funktionen<br />
des Glases: der Lichtführung<br />
ins Innere des<br />
Museums wie auch der Eröffnung<br />
von Ein- und Ausblicken.<br />
Glas ist darüber<br />
hinaus ein tradiertes Material<br />
musealer Praxis,<br />
da es die Eigenschaft hat,<br />
den Blick auf wertvolle Gegenstände<br />
zu gewähren,<br />
diese Objekte aber gleichzeitig<br />
zu schützen. Glas bildet<br />
somit beim Kirchner<br />
Museum die Außenhülle<br />
des Gebäudes zum<br />
Schutz des Werks und seiner<br />
Betrachter.<br />
Situation - Situierung<br />
Volumen und Materialisierung<br />
des Gebäudes nehmen<br />
Bezug auf die prominente<br />
städtische Lage des<br />
Museums in einem kleinen<br />
Park, in direkter Nachbarschaft<br />
zum mächtigen<br />
Grandhotel an der Hauptstraße.<br />
Die Kernstücke<br />
des Museums, die hohen<br />
Kuben der Ausstellungsräume,<br />
sind innerhalb der<br />
kleinen Parkanlage zwischen<br />
die bestehende<br />
Baumbepflanzung gestellt.<br />
Sie widerspiegeln in<br />
ihrer Anlage gleichsam die<br />
Davoser Siedlungsstruktur<br />
mit deren lose nebeneinander<br />
gestellten Flachdachgebäuden.
Grundriss<br />
Schnitt<br />
Lageplan<br />
Fassadenschnitt<br />
Davos<br />
Kirchner Museum<br />
75
Davos<br />
Sportzenrum<br />
76<br />
Sportzentrum Davos<br />
Standort: Davos<br />
Baujahr: 1993-96<br />
Bauherr: Kur- und Verkehrsverein, Davos<br />
Architekt: Annette Gigon, Mike Guyer, Zürich,<br />
Adrian Schiess (Farbgebung),<br />
Trix Wetter (Grafik/Beschriftung), Zürich<br />
Ingenieur: DIAG, Davos (Ausführung),<br />
Branger + Conzett, Chur (Tribüne)<br />
Literatur: Archithese, 2 / 97, Bauwelt, Nr. 14 / 1997,<br />
Domus, Nr. 806 / 1998<br />
Gigon Guyer Architekten 1989-2000, Niggli 2000<br />
Das Sportzentrum ersetzt<br />
das 1991 einer Brandstiftung<br />
zum Opfer gefallene,<br />
hölzerne Eisbahngebäude<br />
des Davoser Architekten<br />
Rudolf Gaberel.<br />
Nach Errichtung eines Provisoriums<br />
zur Unterbringung<br />
der für den Betrieb<br />
der Eisbahnen nötigen Infrastrukturen<br />
lud der Verkehrsverein<br />
Davos neun<br />
Architekturbüros zu einem<br />
Wettbewerb ein, in dem<br />
Gigon + Guyer sich durchsetzen<br />
konnten. Aufgrund<br />
eines auf 19 Millionen SFR<br />
reduzierten Budgets musste<br />
der klare Riegel überarbeitet<br />
werden. Eine Reduzierung<br />
der Geschossanzahl<br />
bedingte den Verzicht<br />
auf eine obere Tribüne.<br />
Das neue Gebäude begrenzt<br />
gleich dem Vorgängerbau<br />
das Feld der Eisschnelllaufbahn<br />
bzw. der<br />
Sportanlagen gegen Norden<br />
und fasst den rückwärtigen<br />
Ankunftsraum. Gegenüber<br />
diesen beiden<br />
Außenräumen reagiert<br />
das Bauvolumen jeweils<br />
anders: mit einer zweigeschossigen,vorgelagerten,<br />
licht-, luft- und sichtdurchlässigen<br />
Tribüne gegen<br />
das Eisfeld und mit<br />
einer eingeschossigen,<br />
kompakten Ausstülpung<br />
gegen die Ankunftsseite.<br />
Bei niedrigerer Bauhöhe<br />
erwies sich die Wärmeabstrahlung<br />
auf die Eisbahn<br />
als geringeres Problem,<br />
zumal das Volumen um<br />
einige Meter nach Osten<br />
verschoben und somit von<br />
der Sportfläche abgerückt<br />
ist.<br />
Im prismatischen Bauvolumen<br />
sind eine Vielzahl<br />
von unterschiedlichen<br />
Nutzungen dicht und effizient<br />
zusammengefasst -<br />
Großgarderobe, Restaurants,<br />
Küche, Büros, Maschineneinstellhalle,<br />
Sportmedizinräume, Clubgarderoben,<br />
eine Wohnung<br />
und Kursgästezimmer.<br />
Die schmale Tribüne<br />
steht in enger räumlicher<br />
und funktionaler Beziehung<br />
zu den angrenzenden<br />
öffentlichen Räumen des<br />
Restaurants und der Großgarderobe.<br />
Sie beschattet<br />
deren großflächige Verglasungen<br />
ähnlich einem Brise-Soleil.<br />
Die Tribüne<br />
selbst wird von den Besuchern<br />
über ihren eigentlichen<br />
Zweck hinaus als<br />
Aussichts-, Freiluft- und<br />
Sonnenbalkon benutzt. Die<br />
Tragpfeiler der Tribüne<br />
bestehen aus Beton. Sie<br />
lassen den konstruktiven<br />
Aufbau des gesamten Gebäudes<br />
erkennen - einen<br />
je nach Nutzung verkleideten<br />
oder roh belassenen<br />
Betonbau.<br />
Außen wird der isolierte<br />
Baukörper von einer zweischichtigen,<br />
hölzernen<br />
Fassadenverkleidung -<br />
ähnlich zweier sich überlagernder<br />
Holzzäune - umhüllt.<br />
Aus diesem Konstruktionsprinzip<br />
der Fassade<br />
entwickeln sich die Geländer,<br />
die Schiebeläden,<br />
aber auch die Fenster. Die<br />
innere Lattung der Fassadenverkleidung<br />
aus gehobeltem<br />
Tannenholz ist farbig<br />
gestrichen, die äußere,<br />
durch horizontale<br />
Eisenprofile gehaltene<br />
und distanzierte Lattung<br />
aus Lärchenholz roh.<br />
Die Verfärbungen des rohen<br />
Holzes durch die Witterung<br />
kontrastieren mit<br />
der Farbigkeit des Anstriches<br />
auf der inneren Fas-
sadenschicht. Im Laufe<br />
der Zeit wird dieser Kontrast<br />
stärker, da die äußere<br />
Lattung jenen braunschwarzen<br />
Farbton annehmen<br />
wird, den Gaberels<br />
lärchenholzverschindeltes<br />
Eisbahnhaus zeigte. Der<br />
Farbanstrich soll einerseits<br />
die innere Lattung<br />
und die Fenster schützen,<br />
aber insbesondere die farbige<br />
Welt des Sports widerspiegeln.<br />
In Zusammenarbeit<br />
mit dem Künstler<br />
Adrian Schiess wurden<br />
für die Fassade drei Farben<br />
gewählt, die sich<br />
großflächig über die Gebäudeseiten<br />
ausbreiten -<br />
ein Farbklang aus einem<br />
hellen Orange, einem<br />
komplementären Blau und<br />
einem leuchtenden<br />
Gelb.Eine um sechs zusätzliche<br />
Farbtöne erweiterte<br />
Farbpalette - Dunkelblau,<br />
Framboise, Weiß,<br />
Apricot, Hellgrün und Türkis<br />
- setzt die Farbigkeit<br />
des Gebäudes in den Innenräumen<br />
fort und steigert<br />
sie noch. Ausschliesslich<br />
hölzerne Elemente -<br />
Fensterrahmen, Türen sowie<br />
Wand- und Deckenpaneele<br />
für die Schallabsorption<br />
und die Verkleidung<br />
der Installationen -<br />
sind Farbträger. Sie stehen<br />
Davos<br />
Sportzentrum<br />
im Gegensatz zu den roh<br />
belassenen oder verputzten<br />
Betonwänden der<br />
Tragkonstruktion. Nur im<br />
zweiten Obergeschoss,<br />
der Hotelebene, weichen<br />
Gigon + Guyer von diesem<br />
Prinizip ab: In Feldern reihen<br />
sich sämtliche Farben<br />
entlang der Nordwand des<br />
langen Erschliessungsgangs.<br />
Das von oben<br />
durch Schächte einfallende<br />
Licht wirft Farbreflexe<br />
auf die gegenüberliegende<br />
Wand. Man bewegt sich<br />
gleichsam durch einen<br />
Farbkorridor.<br />
Ähnlich den aufgedruckten<br />
Signeten und Nummern<br />
der Sportlerbekleidung ist<br />
die Beschriftung des Gebäudes<br />
innen wie außen<br />
großmaßstäblich direkt<br />
auf die Gebäudeteile gemalt.<br />
So auch der Schriftzug<br />
DAVOS auf der Frontfassade,<br />
der auf künftigen<br />
Postkarten und Siegerehrungsfotos<br />
für den Ferien-<br />
Sportort werben soll.<br />
Je nach Lichtverhältnissen<br />
ändert sich der Eindruck<br />
des Sportzentrums.<br />
Abends dringt die Farbigkeit<br />
des Inneren nach außen.<br />
Da sich das Gebäude<br />
von der weißen Bebauung,<br />
welche den Ortskern<br />
von Davos prägt, dezidiert<br />
absetzt, stieß das Projekt<br />
von Gigon + Guyer anfangs<br />
auf Widerstand. Doch inzwischen<br />
spricht auch der<br />
Verkehrsverein von einem<br />
wohlgelungenen Gesamtwerk.<br />
77
Davos<br />
Werkhof<br />
78<br />
Werkhof Davos<br />
Standort: Davos<br />
Baujahr: 1998-99<br />
Bauherr: Davos Tourismus<br />
Architekt: Annette Gigon, Mike Guyer, Zürich,<br />
In AG mit Othmar Brügger, Davos<br />
Ingenieur: Conzett, Bronzini, Gartmann AG, Chur,<br />
Peter Flütsch, Chur<br />
Literatur: Gigon Guyer Architekten 1989-2000, Niggli 2000<br />
Der städtebauliche Ansatz<br />
des Projektes zeigt sich in<br />
der Situierung des Werkhofes<br />
und seiner<br />
Materialisierung. Zum einen<br />
schliesst das neue Gebäude<br />
den Ankunftsraum des<br />
Sportzentrums gegen die<br />
Talstrasse, um die räumliche<br />
Verbindung zum Kurpark<br />
hin zu akzentuieren und zu<br />
präzisieren. Zum anderen<br />
wird - als Referenz zum bestehenden<br />
Bau - das Thema<br />
der Holzfassaden aufgegriffen.<br />
Die Standfläche des<br />
zweigeschossigen Volumens<br />
ist auf jene Räume<br />
reduziert, die notwendigerweise<br />
im Erdgeschoss liegen<br />
müssen - die Garagen<br />
für die Lastwagen und<br />
Schneefahrzeuge, die Autowerkstatt<br />
und -Waschanlage<br />
und die Schreinerei.<br />
Die übrigen Räume, die Lager<br />
und Büros, sind im<br />
Obergeschoss angeordnet.<br />
Diese ungleiche Nutzungsverteilung<br />
erzeugt im ersten<br />
Obergeschoss Auskragungen<br />
an den beiden Längsseiten,<br />
welche dazu dienen,<br />
die darunter gelegenen Ausfahrten<br />
der Einstellhallen<br />
und Werkstätten zu schützen.<br />
Die Tragstruktur ist ein Kombination<br />
aus Skelett und<br />
Schottenbauweise mit vorgespannten<br />
Deckenplatten<br />
auf Betonstützen. Die<br />
grosse Auskragung zur Talstrasse<br />
hin wird durch<br />
Stahlbetonscheiben bewerkstelligt,<br />
welche zwischen<br />
Decken- und Dachplatte<br />
eingespannt als wandartige<br />
Träger (Überzüge)<br />
wirken. Die Aussenwände<br />
und Trennwände bestehen<br />
aus vorfabrizierten,<br />
geschosshohen, isolierten<br />
Holzplatten-Elementen.<br />
Eine hinterlüftete Verkleidung<br />
aus horizontalen Holzbrettern<br />
bildet den äußeren<br />
Wetterschutz. Die verschieden<br />
breiten Bretter der parallel<br />
aufgesägten Baumstämme<br />
sind nach der Reihenfolge<br />
des Schnitts montiert.<br />
Analog zu den Fassaden<br />
besteht das Flachdach<br />
aus einer hinterlüfteten Konstruktion<br />
aus Holz, Wärmedämmung<br />
und Beton - ein<br />
„Davoser Dach“. Die Fenster<br />
sind in der Regel bündig<br />
in die Verkleidung gesetzt.<br />
Bei jenen Fenstern,<br />
die keine Einsicht gewähren<br />
sollen, dienen aufgeklappte<br />
Verkleidungsbretter als fixe<br />
Lamellen. Die sich nach außen<br />
öffnenden, verglasten<br />
Stahlflügeltore der Einstellhallen<br />
werden durch die<br />
Gebäudeauskragungen<br />
überdeckt und somit vor<br />
Schnee geschützt. Feuerverzinkte<br />
Bleche verkleiden<br />
die Untersichten der Auskragungen<br />
und reflektieren diffus<br />
Licht in die zurückversetzten<br />
Arbeitsräume.
Um- und Neubau Restaurant Vinikus<br />
Standort: Promenadenstraße in Davos<br />
Baujahr: 1991-1992<br />
Bauherr: Christoph Künzli für Schiabach AG<br />
Scala Vini, Davos<br />
Architekten: Annette Gigon und Mike Guyer, Zürich<br />
Grafik: Lars Müller, Baden<br />
Ingenieur: DIAG, Davos<br />
Literatur: Gigon Guyer Architekten, Niggli, Archithese Jg. 25 1 / 95<br />
Die eindrückliche und ungewohnte<br />
Gestalt des Grundstückes<br />
am Schiabach und<br />
seiner heutigen Bebauung<br />
sind das Resultat einer mehr<br />
als hundertjährigen Nutzung<br />
und Urbarmachung<br />
durch die ehemalige Besitzerin,<br />
eine Bauunternehmung.<br />
Sukzessive wurde<br />
auf der Bachparzelle Kies<br />
abgebaut und damit einhergehend<br />
entstanden Stützmauern.Wasserauffangbecken<br />
für den Rüfenbach<br />
und eine Bachkanalisierung.<br />
Die gewerbliche Bebauung<br />
wurde Stück für Stück ergänzt<br />
zu einer geschlossenen<br />
zweiseitigen Hofbebauung<br />
– raumhaltigen Stützmauern<br />
gleich.<br />
Mit dem Restaurant Vinikus<br />
galt es einen Anfangspunkt<br />
zu setzen im langfristigen<br />
Bestreben der heutigen<br />
Bauherrschaft, den gewerblichen<br />
Hofraum mitten in<br />
Davos Schritt für Schritt in<br />
einen öffentlichen und kulturellen<br />
Raum zu wandeln.<br />
Die Hälfte der vordersten<br />
Liegenschaft - bereits vorher<br />
als Pizzeria genutzt - sollte<br />
umgewandelt werden, um<br />
entsprechend der Leidenschaft<br />
eines Exponenten<br />
der Bauherrschaft, des<br />
jungen Weinhändlers Christoph<br />
Künzli, als Standort für<br />
ein neues Wein- und Speiserestaurant<br />
zu dienen. Die<br />
Grundfläche des früheren<br />
Restaurants wurde in der<br />
Folge unterkellert, um Räume<br />
für den Wein zu gewinnen,<br />
und das oberirdische<br />
Volumen des ehemaligen<br />
eingeschossigen Restaurants<br />
wurde innerhalb der<br />
gesetzlichen Grenzabstän-<br />
Davos<br />
Restaurant Vinikus<br />
de vergrößert, um im Innern<br />
Platz zu schaffen für einen<br />
neuen Gastraum mit angemessener<br />
Höhe.<br />
Die Unterkellerung besteht<br />
aus Beton, während die aufsteigenden<br />
Wände aus<br />
massivem Mauerwerk gebaut<br />
sind. Im Bereich der<br />
großen Fensteröffnung liegt<br />
das Mauerwerk auf einem<br />
im engen Raster abgestützten<br />
Stahlrahmen auf. Gleich<br />
wie die Oberflächen der<br />
bestehenden Hofbebauung<br />
sind die Außenfassaden verputzt.<br />
Auszeichnend wirkt<br />
lediglich, was dieses Gebäude<br />
bezeichnen muss - die<br />
Beschriftung des Restaurants.<br />
In die gemauerte Architektur<br />
eingebaut - ähnlich wie ein<br />
Kuckucksei eingesetzt - ist<br />
der Gastraum aus Holz.<br />
Großflächige, mehrheitlich<br />
furnierte, durch Fugen<br />
rhythmisierte Holzfaserplatten<br />
bilden die Decken, Wände,<br />
Türen und Schränke -<br />
Parkettriemen den Fußboden.<br />
Das innere Holzgehäuse<br />
lässt sich im Bereich<br />
der Fensterfront mit schmalen,<br />
beweglich befestigten<br />
Holzplatten - inneren Fensterläden<br />
- öffnen und in der<br />
Nacht wieder schließen. Aus<br />
dem Hohlraum zwischen<br />
dem hölzernen Kubus und<br />
der Backsteinarchitektur<br />
79
Davos<br />
Restaurant Vinikus<br />
80<br />
wird der Gastraum durch die<br />
offenen Plattenfugen mit<br />
Luft und Elektrizität versorgt.<br />
Eichenfassholz erzeugt die<br />
farbliche Stimmung im Restaurantinnern:<br />
mit millimeterdünnen<br />
Furnieren und<br />
zentimeterdicken Parkettbrettern.<br />
Das Prinzip des Verkleidens<br />
im Gastraum wird im Kellergeschoss<br />
aufgelöst zugunsten<br />
eines Nebeneinanders<br />
von Raum und Möblierung<br />
und deren Materialität. Die<br />
einzelnen Elemente sind so<br />
roh belassen, wie die noch<br />
nicht zur Speise verarbeiteten<br />
Zutaten eines Rezepts.<br />
Zwei in den Rohbau<br />
eingebaute WC-Häuschen<br />
bestätigen als Ausnahme<br />
die Regel. Die Wände sind<br />
aus Beton, wie auch die<br />
Decke und der Boden. Das<br />
begehbare Weingestell aus<br />
Holzfaserplatten im Degustationsraum<br />
ist unverkleidet,<br />
und die Tische aus Eichenholz<br />
sind massiv.<br />
Kleiner Exkurs zur Schriftgestaltung<br />
an Bauwerken:<br />
Oft verunglimpft die Beschriftung<br />
als nachträglicher<br />
Eingriff das Programm und<br />
die Typologie der Architektur.<br />
In der Grenzlage zwischen<br />
„idealer“ Architektur-<br />
Gestalt und einer vorgegebenen<br />
populistischen Werbeform<br />
prallen unvereinba-<br />
re ästhetische Systeme aufeinander<br />
– oder werden<br />
durch massive Trägerkonstruktionen<br />
auf minimale Distanz<br />
gehalten. Das ist die<br />
Regel. Das Kirchner Museum<br />
und das Restaurant Vinikus<br />
bilden eine Ausnahme.<br />
Die Intention der Architekten<br />
zielt auf eine trägerfreie, sich<br />
gewissermaßen mit der Architektur<br />
verbindende Beschriftung<br />
ab, als Analogie<br />
auch zur Bündner Tradition<br />
der direkt aufgemalten Häusernamen.<br />
Für den neu geschaffenen<br />
Schriftzug „Vinikus“<br />
wurden die Proportionen<br />
des Fassadenfeldes<br />
über dem Fensterband der<br />
Gestaltung zugrundegelegt.<br />
Das auf der Basis von<br />
verschiedenen schmal-fetten<br />
Schrifttypen gezeichnete<br />
Logo musste ästhetisch<br />
ausgewogen und robust<br />
genug sein, um sich neben<br />
der üblichen Verwendung<br />
auf Drucksachen auch für<br />
eine monumentale Fassadenschrift<br />
zu eignen. In der<br />
ersten Ausführung (1992)<br />
wurde der Schriftzug mit<br />
geringem Helligkeitskontrast<br />
Ton-in-Ton mit der Fassadenfarbe<br />
direkt auf den Verputz<br />
aufgebracht. Seit der<br />
1994 erfolgten Konzeptänderung<br />
von einem Restaurant<br />
in ein Laden-Restaurant<br />
erscheint die Schrift in einem<br />
kräftigen Rot.
Schulhaus mit Saal<br />
Davos<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
Standort: Alvaschein<br />
Baujahr: 1988-89<br />
Bauherr: Gemeinde Alvaschein<br />
Architekt: Valentin Bearth, Andrea Deplazes, Chur<br />
Ingenieur:<br />
Literatur: Junge Schweizer Architekten/innen, Artemis, 1995,<br />
Neues Bauen in den Alpen, 1992,<br />
Räumlinge, 1 de aedibus, 1999,<br />
Werk, Bauen + Wohnen 1/2, 1993<br />
Valentin Bearth und Andrea<br />
Deplazes haben für<br />
ein kleines Bergdorf ein<br />
Schulhaus geschaffen,<br />
dessen Lösung von einem<br />
weitreichenden Verständnis<br />
für den Charakter einer<br />
solchen Aufgabe zeugt. Die<br />
Schule in Alvaschein<br />
dokumentiert nicht allein<br />
eine Vorstellung „vom Ort“,<br />
sondern sie belegt darüber<br />
hinaus ein Gespür für<br />
die Spannweite des Eingriffes,<br />
den ein solches<br />
Bauwerk ins Leben einer<br />
kleinen Gemeinde darstellt.<br />
Entstanden ist eine<br />
Architektur, die schlüssiger<br />
Aufgabe und Auftraggeber<br />
reflektiert, als es im ersten<br />
Moment erscheinen mag.<br />
Die knappen Platzverhältnisse<br />
im Dorfkern zwangen<br />
dazu, die neue Schul- und<br />
Mehrzweckanlage am Dorfende<br />
an der ehemaligen<br />
Landstraße zu errichten.<br />
Einerseits sollte die Wichtigkeit<br />
und die öffentliche<br />
Funktion der Anlage als<br />
‘Dorfschule’ ihren klaren architektonischen<br />
Ausdruck<br />
erhalten, anderseits sollte sie<br />
durch die Aufteilung in zwei<br />
Baukörper - Schulhaus und<br />
Mehrzweckhalle - als eine<br />
Art „Gehöft“ - in Erscheinung<br />
treten. Die Lage<br />
am Dorfrand wird dadurch<br />
thematisiert und verständlich<br />
gemacht.<br />
In einer einfachen Geste<br />
schaffen der gedrungene<br />
Klassenkörper und ein Saalanbau<br />
eine Art Platz im steilen<br />
Gelände. Damit entsteht<br />
eine große, geschützte<br />
Terrasse, gegen Süden<br />
und gegen das Tal hin geöffnet.<br />
Eine der wenigen<br />
ebenen Flächen in der bewegten<br />
Topographie wird<br />
gleichzeitig zum Spielfeld<br />
und zum Aussichtspunkt,<br />
welcher aus der in sich<br />
gekehrten Struktur des<br />
Dorfes hinausweist. Dieser<br />
Platz verbindet sich mit<br />
dem flach gewordenen<br />
Hang zu einer Weite, die<br />
dem Dorf bisher nicht eigen<br />
war. Dieser Ort, der<br />
sich mindestens ebenso<br />
stark gegen das Dorf behauptet<br />
wie er darin eingebunden<br />
ist, wurde möglich,<br />
weil sich im Ensemble drei<br />
typische, aber gegensätzliche<br />
topographische Entwurfsbewegungen<br />
auf<br />
überlegte Art begegnen:<br />
die Aufschüttung, der Einschnitt<br />
in das Gelände und<br />
das Haus am Hang, das<br />
sich erst durch den Gewinn<br />
des Sockels turmartig<br />
aufzurichten beginnt,<br />
um das Gelände zu beherrschen.<br />
In diesem Haus, dem Klassentrakt,<br />
wird besonders<br />
deutlich, dass der Entwurf<br />
seine Qualität eher in einer<br />
Abfolge von Überlegungen<br />
zum Gebrauch und zu<br />
dessen kultureller Begründung<br />
sucht, als in riskanten<br />
formalen Spekulationen.<br />
Der Trakt beherbergt<br />
auf zwei Geschossen ein<br />
großes Klassenzimmer<br />
mit zudienendem Raum,<br />
81
Davos<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
82<br />
im Erdgeschoss eine weite<br />
Eingangshalle, die zunächst<br />
zu groß erscheinen<br />
mag. Die Form dieser<br />
Räume macht aber die<br />
Bedeutung einer Schule<br />
an diesem Ort klar. Es treffen<br />
sich darin auch die<br />
Politik des Dorfes oder die<br />
Vereine, und im Winter ist<br />
die Halle der Schulhof und<br />
auch ein wenig der Platz<br />
der Gemeinde. Es macht<br />
dies ja die „Modernität“<br />
auch vieler traditioneller<br />
Bauten in den Bergen aus,<br />
dass sie Hüllen für viele<br />
Zwecke sein müssen. Solche<br />
Transparenz und Klarheit<br />
greift die Schule auf:<br />
der Körper ist fast mit dem<br />
Raum identisch, und was<br />
es darin an räumlicher<br />
Spezifizierung braucht, das<br />
entsteht durch Teilung und<br />
nicht durch Addition.<br />
Gerade die Auslegung dieser<br />
Innenräume wird den<br />
Architekten zum Bekenntnis.<br />
Nicht nur das Betonskelett,<br />
dessen Kassetten an ein<br />
abstraktes Raumgitter anspielen,<br />
erinnert an die moderne<br />
Tradition des Schulhausbaues.<br />
Es findet sich<br />
diese auch in den doppelseitig<br />
belichteten Schulzimmern,<br />
in deren großflächigen<br />
Fenstern sich der Bergund<br />
der Talblick auf eindrückliche<br />
Art wie in Bilderrahmen<br />
gegenüberstehen.<br />
Und selbstverständlich weist<br />
auch die Beweglichkeit der<br />
Bühne im Saal in die gleiche<br />
Richtung: sie kann für Feste<br />
mittels Schiebetor gegen<br />
außen gewendet werden.<br />
Erkennt man schließlich<br />
die aufmerksame Behandlung<br />
der meist glatten<br />
und feinen (Holz-) Teile im<br />
Innern, die fast wie Intarsi-<br />
en zwischen der Struktur<br />
einliegen, so mag einem<br />
sogar wieder die Behauptung<br />
vom erzieherischen<br />
Wert einer richtigen und<br />
sorgfältigen Konstruktion<br />
in den Sinn kommen.<br />
Dass man solche Qualität<br />
in der Tragstruktur des<br />
Saales wiederfindet, in<br />
Form einer bemerkenswertenRahmenkonstruktion,<br />
erstaunt weniger, sind<br />
doch die jüngeren Architekten<br />
und Ingenieure der<br />
Region dabei, eine unsentimentale<br />
Technologie des<br />
Holzbaues mit den breiten<br />
Assoziationen dieses Materiales<br />
zu einem sehr freien<br />
entwerferischen Umgang<br />
zu verbinden.<br />
Insgesamt haben die Architekten<br />
in ihrem Projekt<br />
zwei verschiedene Absichten<br />
zueinandergeführt. Die<br />
Qualität der Lösung liegt<br />
darin, wie sich diese beiden<br />
Gebärden zu einer<br />
zusammenhängenden Interpretation<br />
ergänzen. Zum<br />
einen kommen sie ohne<br />
vordergründige bildliche<br />
und atmosphärische Anbiederung<br />
aus, um trotzdem<br />
eine so klare Vorstellung<br />
von der Spezifität der<br />
Aufgabe in dieser Landschaft<br />
zu vermitteln. Zum<br />
andern gerät ihnen dann<br />
der Gegensatz zwischen<br />
dem Direkten, fast Rohen<br />
der Hülle und dem scharf<br />
erdachten inneren Reichtum<br />
doch noch zu einer<br />
Metapher des Ortes.<br />
Konstruktion<br />
Die Mehrzweckhalle wurde<br />
außchließlich in Holz konstruiert.<br />
Die drei Rahmenbinder,<br />
welche die Halle<br />
überspannen, sind als Hohlkastenträger<br />
ausgeführt. Sie
estehen aus zwei großformatigenFurnierschichtholzplatten,<br />
die durch aufgeleimte<br />
Kanthölzer verstärkt<br />
sind. In den U-förmigen<br />
Rahmenstützen lassen<br />
sich die Turngeräte<br />
bequem unterbringen. Der<br />
Rahmenriegel wirkt statisch<br />
als „versteifter Stabbogen“:<br />
Wände und Gurtungen<br />
bilden einen geschlossenen<br />
Kasten, in<br />
den ein dünner Brettschichtholzbogeneingeleimt<br />
ist. Von außen ist dieser<br />
Bogen durch die kreisförmig<br />
angeordneten<br />
Schrauben erkennbar. Dadurch<br />
wurde es möglich,<br />
die Stärke der Schichtholzplatten<br />
auf 27mm zu beschränken.<br />
Der Kastenträger<br />
ist derart steif, dass<br />
auch die horizontal wirkenden<br />
Kräfte der Sportgeräte<br />
ohne zusätzliche Abspannungen<br />
aufgenommen<br />
werden können.<br />
Für die Dachkonstruktion<br />
Lageplan<br />
Davos<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
wurden vorfabrizierte Tafelelemente<br />
mit Wärmedämmung<br />
und Unterdachschalung<br />
verwendet. Auch<br />
sie bestehen aus Schichtholzplatten<br />
mit aufgeleimten<br />
Verstärkungsrippen.<br />
Die Elemente laufen über<br />
jeweils zwei Binderfelder<br />
durch, die Längsstöße<br />
sind versetzt. Die Tafeln<br />
sind mit den Bindern durch<br />
Nägel und Schrauben verbunden,<br />
so dass das ganze<br />
Dach zu einer einzigen<br />
Scheibe wird. Spezielle<br />
Windverbände sind nicht<br />
mehr nötig. Die Tafelelemente<br />
wurden vom Unternehmer<br />
in der Werkstatt<br />
mit Wärmedämmung und<br />
Unterdachschalung versehen.<br />
Auch die Außenwände<br />
sind aus vorfabrizierten<br />
Kantholzelementen mit<br />
aufgenagelter Blindschalung<br />
zusammengesetzt.<br />
Das Aufrichten der Binder<br />
und Wandelemente dauerte<br />
fünf Tage, das Eindekken<br />
des Daches mit den<br />
Tafelelementen konnte in<br />
einem einzigen Tag ausgeführt<br />
werden.<br />
83
Davos<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
84<br />
Querschnitt
EG<br />
1.OG<br />
2.OG<br />
Längsschnitt<br />
Davos<br />
Schulhaus Alvaschein<br />
85
Sumvitg<br />
Caplutta Sogn Benedetg<br />
86<br />
Caplutta Sogn Benedetg<br />
Standort: Sumvitg<br />
Baujahr: 1987-88<br />
Bauherr: Kirchengemeinde Sumvitg<br />
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein<br />
Ingenieure: Jürg Buchli<br />
Literatur: Architektur und Technik 1 / 1990 – 12 / 1996,<br />
Archithese 6 / 90,<br />
Caplutta Sogn Benedetg, Gedanken und Bilder zur<br />
Architektur und Symbolik, von Daniel Schönbächler,<br />
Kunst und Kirche 1 / 90,<br />
Neues Bauen in den Alpen – Architekturpreis 1992,<br />
Peter Zumthor, Häuser 1979 – 1997,Werk, Bauen<br />
und Wohnen Jg. 76 / 43 Nr. 4 1989<br />
Geschichte<br />
Die alte Kapelle im Weiler<br />
Sogn Benedetg über Sumvitg<br />
hatte einen gotischen<br />
Chor aus dem 16. und eine<br />
barocke Ausstattung aus<br />
dem 17. Jahrhundert. Sie<br />
war im Besitz des Klosters<br />
Disentis und gehörte im späten<br />
Mittelalter zu einem Beginenklösterchen.<br />
Begine<br />
war eine im 12./13. Jahrhundert<br />
aufkommende Laiengemeinschaft.<br />
Eine begüterte<br />
Witwe (Rigenza) verhalf<br />
der Gemeinschaft zum<br />
Klösterchen. Archäologische<br />
Untersuchungen lassen<br />
vermuten, dass schon<br />
im 9. Jahrhundert eine kleine<br />
Saalkirche an diesem Ort<br />
stand.<br />
Zerstörung<br />
Mehrmals wurde die Kapelle<br />
durch Lawinenniedergänge<br />
beschädigt und im Jahre<br />
1984 komplett zerstört. Ein<br />
zivilisatorischer Eingriff<br />
(Parkplätze) führte zum Lawinenunglück.<br />
Das Geld der<br />
Versicherung reichte für einen<br />
Neubau nicht aus.<br />
Dazu brauchte es das Engagement<br />
der Kirchengemeinde<br />
Sumvitg und des<br />
Klosters von Disentis. Die<br />
Denkmalpflege hielt lange<br />
an der Rekonstruktion der<br />
zerstörten Kapelle fest. Die<br />
Entscheidung fiel schliesslich<br />
zugunsten einer neuen<br />
Kapelle an einem sicheren<br />
Ort im Schutze des Bannwaldes,<br />
mit dem Zugeständnis<br />
an die Denkmalpflege,<br />
die verfallenen Mauerreste<br />
liegen zu lassen.<br />
Das Bauwerk und sein Ort<br />
Auf einer Kuppe über den<br />
Häusern von Sogn Benedetg<br />
steht die neue Kapelle,<br />
deren Schutzpatron dem<br />
Weiler den Namen gegeben<br />
hat. Ihr Baukörper ist wie bei<br />
vielen älteren Kapellen von<br />
Wiesen umschlossen.<br />
Ihr Chor zeigt, wie es die<br />
Tradition will, nach Osten,<br />
und ihr Eingang steht am<br />
Ende der Windung einer alten<br />
Wegspur, die von den<br />
Häusern aufsteigt wie ein<br />
alter Kirchweg.<br />
Die maßstabslose Überhöhe,<br />
wie sie von unten wahrgenommen<br />
wird, reduziert<br />
sich entlang dieses Weges<br />
auf das Mass einer Geschoßhöhe<br />
beim Eingang.<br />
In der gleichen Bewegung<br />
vermag man ein Empfinden<br />
für die Himmelsrichtungen<br />
und für die Steilheit und Beschaffenheit<br />
des Bodens zu<br />
entwickeln. Die Farbe der
Schindeln verwandelt sich<br />
vom Schwarzgrau der Wetterseite<br />
entlang der Krümmung<br />
langsam in ein helles<br />
Braun auf der Zugangsseite.<br />
Über dem schräg angezogenen<br />
Streifenfundament<br />
wirft sich die Schindelhaut<br />
leicht auf, wie ein abstehender<br />
Saum, und zeichnet dabei<br />
mit dem Schatten die<br />
Geländelinie nach.<br />
Das Bild der Kirche im<br />
Dorf<br />
Viele Ortsbilder in der Surselva<br />
sind geprägt von der<br />
besonderen Spannung, die<br />
zwischen der entworfenen<br />
Architektur der Kirche und<br />
den herkömmlichen Formen<br />
der profanen Bauten<br />
entsteht: Ein weißes Gotteshaus<br />
aus Stein, in seiner<br />
Gestaltung einem weltläufigen<br />
Baustil - dem Barock -<br />
verpflichtet, überstrahlt die<br />
dunklen Holzbauten der<br />
Bauern, deren Formen in<br />
regionalen Baugewohnheiten<br />
verankert sind.<br />
Wir haben uns daran gewöhnt,<br />
dieses Nebeneinander<br />
im Bild der Siedlungen<br />
als Einheit und Ausdruck einer<br />
historischen Ordnung zu<br />
sehen. Die Kirche als Verkünderin<br />
einer Weltreligion<br />
in den Dörfern. Sie tut dies<br />
mit dem Wort. Und sie stellt<br />
dies dar mit ihrer Architektur.<br />
Die neue Kapelle in Sogn<br />
Benedetg wächst aus dieser<br />
Tradition heraus. Wie die<br />
alten Kirchenbauten verfügt<br />
sie als Heiligtum über eine<br />
besondere architektonische<br />
Form, die sie gegenüber<br />
den profanen Bauten auszeichnet;<br />
und sie steht, wie<br />
dies aus historischen Ortsbildern<br />
bekannt ist, an einer<br />
ausgewählten Stelle der Topographie.<br />
In einem Punkt jedoch wird<br />
die Tradition verlassen: Die<br />
Kapelle ist aus Holz gebaut.<br />
Sie wird im Licht der Sonne<br />
Sumvitg<br />
Caplutta Sogn Benedetg<br />
dunkel werden. Schwarz im<br />
Süden, silbergrau im Norden,<br />
wie die alten Bauernhäuser.<br />
Das traditionelle<br />
Baumaterial der Bevölkerung<br />
ist in Sogn Benedetg<br />
auch das Baumaterial der<br />
Kirche. Die einheimische<br />
Tradition des Bauens mit<br />
Holz und die Fähigkeit der<br />
Leute, mit diesem Werkstoff<br />
umzugehen, sind im neuen<br />
Bauwerk präsent.<br />
Verwandschaften<br />
Zumthor hat in der Klosterkirche<br />
von Disentis auf dem<br />
Deckengemälde eine Himmelsleiter<br />
und einen kleinen<br />
hölzernen Glockenträger<br />
auf einem Bauernhaus entdeckt.<br />
Diese Darstellungen<br />
haben ihn bei der Entwicklung<br />
des Glockenturms inspiriert.<br />
Ein leiternartiges<br />
Stabwerk aus Holz, das sich<br />
beim Näherkommen auf<br />
dem Kirchweg vom Hintergrund<br />
löst und in den Himmel<br />
zu ragen beginnt. Erinnerungen<br />
dieser Art, in denen<br />
Bilder von erlebten und<br />
neu gedachten architektonischen<br />
Formen sich verbinden,<br />
sind für Zumthor<br />
Grundlagen des Entwerfens.<br />
Die Kapelle von Sogn Benedetg<br />
wurde erdacht, um diese<br />
besondere Ausstrahlung<br />
zu haben: Die Präsenz eines<br />
zeitgenössischen architektonischen<br />
Objektes, das<br />
noch nie so gebaut wurde,<br />
dessen Wurzeln aber doch<br />
so tief in die Geschichte der<br />
Bauformen zurückreichen,<br />
dass das neue Objekt in all<br />
seiner Fremdheit Erinnerungen<br />
weckt, die Zumthor<br />
wertvoller erscheinen als jedes<br />
direkte Zitat einer alten<br />
Form.<br />
Form und Bewegung<br />
Die Kapelle ist ein einräumiges<br />
Gebäude. Ihre Außenform<br />
und ihre Innenform<br />
entsprechen sich. Diese<br />
Entsprechung ist zugleich<br />
einfach und komplex. Die<br />
87
Sumvitg<br />
Caplutta Sogn Benedetg<br />
88<br />
schlanke äußere Erscheinung<br />
des Baukörpers, der<br />
sich auf einem blatt- oder<br />
tropfenförmigen Grundriss<br />
erhebt - geometrisch betrachtet<br />
beruht die Grundform<br />
der Kapelle auf einer<br />
Lemniskate, einer algebraischen<br />
Kurve vierter Ordnung<br />
(Hälfte einer liegenden<br />
Acht), die in proportionalen<br />
Verkürzungen auch den<br />
Längsschnitt und den Querschnitt<br />
der Kapelle bestimmt,<br />
birgt überraschenderweise<br />
keinen ebenso<br />
schlanken, sondern einen<br />
ausgerundeten und in sich<br />
konzentrierten Innenraum.<br />
Dieser Innenraum erinnert<br />
an ältere kirchliche Zentralbauten<br />
der Region, wie die<br />
Kapellen von Disla oder Vattiz,<br />
wirkt wegen seiner biomorphen<br />
Blattform jedoch<br />
weicher und fließender.<br />
Wenn es stimmt, dass Räume,<br />
die rechtwinklig mit dominierenden<br />
und sich kreuzenden<br />
Bauachsen geordnet<br />
sind, etwas Beherrschendes,<br />
„Männliches“<br />
ausstrahlen können, dann<br />
ist die Form dieser Kapelle<br />
eine bergende, weibliche -<br />
eine „forma materna», die<br />
das Bild der Mutter Kirche<br />
anklingen lässt und die Stimmung<br />
der klassischen, belehrenden<br />
Kirche vermeidet.<br />
Und diese bergende Raumform<br />
ist in Bewegung. Sie<br />
entsteht durch die Ausrichtung<br />
des blattförmigen<br />
Grundrisses von Westen<br />
nach Osten und wird spürbar<br />
in der nach vorne drängenden<br />
Rundung des Chorbezirks.<br />
Sie erfasst den<br />
Raum jedoch nicht in der Art<br />
eines perspektivischen<br />
Sogs. Der Raum bleibt auf<br />
seine schwerpunktartige<br />
Mitte bezogen.<br />
Einkehr und Sammlung<br />
Der Eingang hat als Vorraum<br />
eine konische Form.<br />
Er gibt den Einblick frei in die<br />
Kapelle, indem er sich in dieser<br />
Richtung trichterförmig<br />
ausweitet. Ein Vordergrund<br />
aus vier Stützen des Tragwerkes,<br />
verwandelt diesen<br />
Einblick in einen Durchblick.<br />
Danach betritt man den Kapellenraum,<br />
gegenüber dem<br />
Vorraum um eine Stufe erhöht,<br />
verlässt den festen<br />
Grund und steigt in den hölzernen<br />
Körper. Man muss<br />
sich allerdings noch nach<br />
der innewohnenden Ordnung<br />
ausrichten, weil der<br />
Eingang asymmetrisch angeordnet<br />
ist und nicht die<br />
Richtung auf den Altar aufnimmt.<br />
Ein kurzer Wegabschnitt<br />
wird zu einem Erlebnis.<br />
Der leicht gewölbte Bretterboden<br />
im Innern, der frei<br />
im Gerippe der Balken liegt,<br />
gibt federnd nach unter der<br />
Last des Trittes. 37 freistehende<br />
Holzstützen umgeben<br />
die Blattform des Bodens<br />
und markieren den<br />
Raum. Sie tragen das Dach,<br />
ein Stabwerk aus Holz, das<br />
geformt ist nach dem Bild<br />
der Adern und Nerven eines<br />
Baumblattes oder der Spanten<br />
im Innern eines Bootskörpers.<br />
Hinter den Stützen<br />
verläuft die Rundung einer<br />
silbernen Wand, die als abstraktes<br />
Panorama aus<br />
Licht und Schatten gebaut<br />
und bemalt ist. Vor dem Hintergrund<br />
dieses Panoramas<br />
erscheint die Einheit von<br />
Dach und Stützen als grosser<br />
Baldachin. Ein Kranz<br />
von feinen Lamellen vor den<br />
Fenstern modelliert das von<br />
oben unter den Baldachin<br />
einfallende Licht. Die Wand<br />
hat eine doppelte Aufgabe<br />
zu erfüllen, die Umgebung<br />
so gut wie möglich auszublenden<br />
und gleichzeitig<br />
doch spürbar zu belassen.<br />
Diesem Widerspruch will die<br />
Lichtführung durch den<br />
Fensterkranz und die Silberschicht<br />
der Wand gerecht<br />
werden.<br />
Die Farbgebung wurde zusammen<br />
mit dem Kunstmaler<br />
Jean Pfaff, Matzendorf/<br />
Ventalló, konzipiert und<br />
durch Gieri Schmed, Trun,<br />
ausgeführt. Auf farbliche<br />
Abtönungen konnte verzichtet<br />
werden, denn auf dem<br />
Lascaux-Silbergrau auf<br />
mehrschichtigem Kreidegrund<br />
spielen die vielfältigsten<br />
Farbreflexe des Rau-
mes. Nur die Rückseiten der<br />
Tragstützen wurden weiß<br />
gestrichen, um den harten<br />
Schattenwurf zu dämpfen.<br />
Man fühlt sich geborgen, in<br />
sich ruhend in dieser Schale.<br />
Die architektonische<br />
Form und die Struktur des<br />
Innenraumes wird zum Träger<br />
symbolischer Botschaften,<br />
geschichtlicher Zitate<br />
oder autobiografischer Be-<br />
Sumvitg<br />
Caplutta Sogn Benedetg<br />
findlichkeiten. Erinnerungen<br />
an die Jugend tauchen auf.<br />
Zumthor versteht Architektur<br />
als eine Beschwörung alter<br />
verlorengegangener Stimmungen<br />
und Gefühle. Architektur<br />
ist dem Leben ausgesetzt.<br />
Für Zumthor hat die<br />
gebaute Architektur ihren<br />
Ort in der konkreten Welt.<br />
Dort spricht sie für sich. Die<br />
Kapelle besitzt die Fähigkeit,<br />
Gefühle und Verstand auf<br />
vielfältige Weise anzusprechen.<br />
Sie wirkt daher in sich<br />
ruhend und scheint im Boden<br />
verankert, verwachsen<br />
zu sein.<br />
Der Leitspruch von Bruno<br />
Taut trifft auf dieses Gebäude<br />
zu:„ Wir müssen ständig<br />
den Weg suchen, bei dem<br />
die Wahrheit nicht leidet und<br />
das Gefühl nicht hungert.“<br />
89
Vella<br />
Schulanlage<br />
90<br />
Schulanlage<br />
Standort: Vella<br />
Baujahr: 1994-97<br />
Bauherr: Politische Gemeinde Vella,<br />
Lugnez/GR, Oberstufen- Schulverband<br />
Architekt: Valentin Bearth, Andrea Deplazes, Chur,<br />
Daniel Ladner, Chur<br />
Ingenieur: Blumenthal & Casanova, Ilanz,<br />
Cavigelli & Partner, Ilanz,<br />
Andrea Gustav Rüedi, Chur, (Energiekonzept)<br />
Literatur: Architektur- Aktuell, Nr. 233/234, 1999,<br />
Baudoc-Bulletin, Jg. 26, Nr. 11, 1997,<br />
Bauwelt, Jg. 89, Nr. 15, 1998,<br />
db-deutsche-bauzeitung, Jg. 133, Nr. 5, 1999,<br />
Haus-Tech, Jg. 11, Nr. 11, 1998,<br />
Hochparterre, Jg. 11, Nr. 9, 1998,<br />
Räumlinge, Luzern: Quart Verlag, 1999,<br />
Werk, Bauen + Wohnen, 85 / 1 / 2 1998<br />
Vella ist eines der baulich<br />
weitgehend intakten Dörfer<br />
im Lugnez. Es liegt auf einem<br />
stark besonnten Plateau,<br />
das steil abfällt hinunter<br />
zum Valserrhein, der<br />
nach Ilanz fließt. Am unteren<br />
Rand der Siedlung mit ihren<br />
massigen Bürger- und Bauernhäusern<br />
stehen in einer<br />
geraden Linie das alte, in<br />
den 50er Jahren errichtete<br />
Schulhaus und eine Turnhalle.<br />
Quer dazu erweitern<br />
nun das neue Oberstufenschulhaus<br />
und die Mehrzweckhalle<br />
die bestehenden<br />
Gebäude. Wo es zuvor ausfranste,<br />
ist eine Gesamtanlage<br />
enstanden, hat das<br />
Dorf einen Rand bekommen.<br />
Der Standort befindet<br />
sich am Rande des heutigen<br />
Dorfes, jedoch in der Umgebung<br />
des historischen<br />
Kerns mit seinen stattlichen<br />
Bürgerhäusern, aus denen<br />
man die damalige Weltoffenheit<br />
der Lugnezer Talschaft<br />
ablesen kann. Die erweiterte<br />
Schulanlage soll<br />
gleichzeitig als neues Ortszentrum<br />
dienen, das dank<br />
seiner Infrastrukturen auch<br />
größere kulturelle Anlässe -<br />
zum Beispiel das traditionelle<br />
Sänger- und Chorfest -<br />
übernehmen kann und damit<br />
regionale Bedeutung für<br />
die Talschaft Lugnez erhält.<br />
Das bestehende Primarschulgebäude<br />
samt Aula<br />
stammt aus den fünfziger<br />
Jahren und war renovie-<br />
rungsbedürftig. Für die<br />
Schulhauserweiterung und<br />
Sanierung der Altbauten<br />
hatte die Gemeinde unter<br />
zwölf Architekten einen<br />
Wettbewerb veranstaltet,<br />
den Bearth/Deplazes/Ladner<br />
1994 gewannen.<br />
Die Erweiterung ergänzt die<br />
fragmentarisch wirkend bestehende<br />
Anlage zu einem<br />
neuen Ganzen, so dass zwischen<br />
Alt- und Neubauten<br />
ein Pausen- und Sportplatz<br />
entsteht. Es handelt sich dabei<br />
weniger um einen „urbanen“<br />
Platz, sondern um eine<br />
zwischen die Gebäude eingespannte,<br />
sehr verschieden<br />
nutzbare große Fläche.<br />
Der Eingangsbereich als<br />
Bindeglied der beiden neuen<br />
Baukörper ist direkt von<br />
dieser Fläche aus zugänglich.<br />
Durch die Verteilung<br />
des Programms auf verschiedene<br />
Bauten konnten<br />
die Volumina im Dorf untergeordnet<br />
werden. Der nach<br />
Süden geneigte Hang wird<br />
zur Ausbildung einer Split-<br />
Level-Lösung genutzt; mit<br />
dreigeschossigem Klassenzimmertrakt<br />
talwärts und<br />
der leicht in den Hang eingesenkten<br />
Mehrzweckhalle<br />
mit darunterliegender Zivilschutzanlage<br />
bergwärts.<br />
Dank günstiger Orientierung<br />
und offener, unverbaubarer<br />
Hanglage kann passive<br />
Sonnenenergie ideal genutzt<br />
werden. Das Konzept
für die Neubauten stützt sich<br />
dementsprechend auf diese<br />
Möglichkeit, jedoch nicht,<br />
indem ein komplizierter<br />
technologischer Apparat mit<br />
aufwendigen Detaillösungen<br />
installiert würde, sondern<br />
gerade im Gegenteil,<br />
indem nämlich verschiedene<br />
Parameter möglichst<br />
weitgehend integriert und<br />
die Lösungen vereinfacht<br />
werden. Das Resultat ist<br />
eine zwar schlicht wirkende,<br />
in sich aber hochkomplexe<br />
Architektur.<br />
Masse und Umhüllung<br />
Ausdrücklicher Wunsch der<br />
Bauherren war, dass die<br />
sonnenverwöhnte Lage zu<br />
nutzen sei. Man dachte an<br />
Sonnenkollektoren. Doch<br />
den Projektierenden schien<br />
das Nächstliegende nicht<br />
unbedingt das Beste zu<br />
sein. So entstand das Konzept,<br />
Sonnenwärme passiv<br />
zu nutzen. Durch ein ausgeklügeltes<br />
System baulicher<br />
und haustechnischer Vorkehrungen<br />
konnte der sonst<br />
übliche Heizenergieverbrauch<br />
auf ein Fünftel gedrosselt<br />
werden.<br />
Für die optimale Nutzung<br />
der Passiv-Solarenergie<br />
sind einerseits eine sehr<br />
gute äußere Wärmedämmung<br />
(12cm Steinwolleplatten<br />
ockerfarbig verputzt),<br />
andererseits möglichst<br />
viel nicht verkleidete<br />
Masse im Innern erforderlich.<br />
Masse und Umhüllung<br />
- Außendämmung auf Beton,<br />
Verputzschicht als<br />
Membran - sind die Themen<br />
des Baus und leiten, neben<br />
den funktionalen Anforderungen,<br />
die Motive der Details.<br />
Der Niedrigenergie-<br />
Spezialist Andrea Rüedi<br />
schrieb den Architekten und<br />
Handwerkern ins Pflichtenheft:<br />
“Zwischen Warm und<br />
Kalt dürfen keine Bauteile<br />
außer Dämmstoffe verbaut<br />
werden.“ Die Tragstruktur<br />
wird als massive Schale mit<br />
versteifendem Gerippe<br />
behandelt, entsprechend<br />
Vella<br />
Schulanlage<br />
sind alle Fenster und Türen<br />
im Innern wie Intarsien flächenbündig<br />
im Beton eingelassen,<br />
um die Wanddicken<br />
möglichst nicht zur Erscheinung<br />
zu bringen. Außen<br />
hingegen entwickelt der<br />
Bau eine verhaltene Plastizität.<br />
Die Putzschicht wird<br />
dank der schräg eingezogenen<br />
Leibungen und Stürze<br />
in die Fensterebene - Fenster<br />
mit außen minimal sichtbaren<br />
Rahmen - überführt.<br />
Putz- und Glasflächen bilden<br />
zusammen eine wellenförmig<br />
bewegte Haut.<br />
Selbstverständlich beeinflussten<br />
regionaltypische<br />
Variationen von verputzten<br />
Strickbauten und die Formen<br />
massiver Bündner<br />
Wohnhäuser die Architektur<br />
der Schulhauserweiterung<br />
in Vella. Gemeint sind dabei<br />
außer „formalen“ vor allem<br />
„praktische“ Aspekte, ist<br />
doch in der traditionellen<br />
Bauweise ein großer Erfahrungsschatz<br />
im Umgang mit<br />
und bezüglich der Anpassung<br />
an die lokalen klimatischen<br />
Gegebenheiten abgelagert.<br />
Tatsächlich entwikkelten<br />
sich bei der Schulhauserweiterung<br />
die Formen<br />
aus den praktischen<br />
Parametern heraus. Käme<br />
es nur auf den Energiegewinn<br />
an, müssten die Südfenster<br />
mit der Fassade<br />
bündig sein. Die Abschrägung<br />
der weißgestrichenen<br />
Brüstungen lässt so weniger<br />
Schatten auf die Scheiben<br />
fallen und deshalb bleiben<br />
die Sonnenenergieverluste<br />
im Winter klein. Beispielhaft<br />
sind auch die Beton-Rippendecken.<br />
Beton-Rippendecken<br />
Alle tektonischen Elemente<br />
des Neubaus sind im Interesse<br />
guter Speicherwirkung<br />
massiv: die Wände aus<br />
Sichtbeton mit Großtafelstruktur,<br />
die Decken als Betonrippen,<br />
die Böden aus<br />
grünen Valser Quarzit-Platten,<br />
auch in den Schulzimmern<br />
(ein günstiger Restposten<br />
aus Zumthors Therme<br />
im Nachbartal). Insbesondere<br />
die Betonrippendecken<br />
sind für die Speicherung der<br />
Passivenergie wichtig; ihr<br />
Querschnitt ergibt sich in<br />
Funktion des optimalen<br />
Speichervermögens, wobei<br />
91
Vella<br />
Schulanlage<br />
92<br />
von einer Eindringtiefe von<br />
10 cm ausgegangen wurde,<br />
sowie der optimalen statischen<br />
Bemessung bei<br />
Spannweiten zwischen sieben<br />
und acht Metern (Klassenzimmerbreite).<br />
Das<br />
Sonnenlicht wird im Winter<br />
über innenliegende, umgedrehte<br />
Rafflamellen-Stores<br />
zur Rippendecke reflektiert,<br />
wobei die trichterförmigen<br />
Einzüge von Sturz und Leibung<br />
der Fenster Einstrahldauer<br />
und -wirkung stark<br />
verbessern. Die Lamellenstores<br />
dienen gleichzeitig als<br />
Blendschutz, und die Raumausleuchtung<br />
profitiert von<br />
der Deckenreflexion. Für die<br />
Beschattung im Sommer<br />
kommen die außenliegenden<br />
Stoffstores zum Einsatz.<br />
Die Lehrer hätten ein anderes<br />
System vorgezogen, das<br />
den Blick nach draußen<br />
nicht verwehrt, weil sogar im<br />
Winter die Sonne oft soviel<br />
„Kraft“ hat, dass die Außenstores<br />
unten bleiben müssen.<br />
Die Rippendecke ist unschwer<br />
als Vergrößerung<br />
der Deckenoberfläche zu<br />
verstehen, was ihr neben<br />
einem Mehrangebot an<br />
Speicherfläche zusätzliche<br />
Qualitäten verleiht. So mussten<br />
keinerlei weitere Massnahmen<br />
zur Verbesserung<br />
der akustischen Verhältnisse<br />
in den Klassenzimmern<br />
vorgesehen werden, die<br />
Rippendecke verhindert<br />
Flatterechos und Nachhall.<br />
Die Rippen bilden einen optimalen<br />
Blendschutz, weshalb<br />
die Beleuchtung mit<br />
einfachsten, zwischen die<br />
Rippen montierten Neon-<br />
Sparleuchten ohne Blendraster,<br />
auskommt. Zudem sind<br />
die Leuchtkörper in der Dekkenstruktur<br />
eingelassen und<br />
hängen nicht im Raum, was<br />
der Decke eine gelassene<br />
Wirkung verleiht, trotz ihres<br />
stark modulierten Querschnitts.<br />
Letzterer wiederum<br />
setzt einen rhythmischen<br />
Kontrast zu den harten, glatten<br />
Flächen von Wänden,<br />
Böden und Einbauten.<br />
Als Konsequenz dieses<br />
Konzeptes von ineinander<br />
greifenden, spezifischen<br />
Ausbildungen von Decken,<br />
Wänden, Böden, Fenstern<br />
usw. konnte auf eine Heizungsinstallation<br />
verzichtet<br />
werden. Zur Nachführung<br />
von Frischluft wird im Winter<br />
eine Quell-Lüftung zugeschaltet;<br />
die Speicherwärme<br />
wird mittels der langsam vorbeiströmenden<br />
Luft im Gebäude<br />
verteilt und mittels eines<br />
Wärmetauschers der<br />
neuen Frischluft (über Düsen<br />
im oberen Teil der Wände)<br />
zugeführt. Im Sommer<br />
kann umgekehrt die Nachtkühle<br />
im Gebäude<br />
eingespeichert werden. Ein<br />
solches Konzept der Speicherung<br />
ohne Heizsystem<br />
wurde in dieser Form für ein<br />
öffentliches Gebäude bisher<br />
noch nicht angewandt.<br />
Die Wände der Turnhalle<br />
sind ganz mit Holz verkleidet<br />
und die Decke besteht aus<br />
einer feingliedrigen Sparrenkonstruktion<br />
mit dazwischen<br />
liegenden durchhängenden<br />
Deckenfeldern. Diese dienen<br />
technisch nur der Akustik.<br />
Das Dach wird hingegen<br />
durch die darüberliegenden<br />
Holzplatten gebildet,<br />
die zusammen mit zwei<br />
Zugstangen einen unterspannten<br />
Träger bilden.<br />
Doch die Decke ist nicht das<br />
Dach. Und die Balkenkonstruktion<br />
vermag die tragenden<br />
und deckenden Funktionen<br />
viel „wirklicher“ zu<br />
vermitteln als das Dach.<br />
Verzicht als Strategie<br />
Dass es aus ökologischen<br />
Gründen heute angezeigt<br />
und möglich ist, wärmetechnisch<br />
und damit energiemässig<br />
optimiert zu bauen,<br />
ist ein Gemeinplatz. Wie<br />
dies umgesetzt wird, ist allerdings<br />
überhaupt nicht<br />
ausgemacht. Das Schulhaus<br />
in Vella beschreitet<br />
diesbezüglich einen besonders<br />
interessanten Weg: Es<br />
geht hier nicht darum, mittels<br />
aufwendiger Technologie<br />
möglichst niedrige Verbrauchswerte<br />
zu erzielen,<br />
sondern gerade darum, alles<br />
nicht unbedingt notwendige<br />
Technische wegzulassen<br />
und das, was an
architektonischem Material<br />
ohnehin vorhanden ist<br />
(eben: Tragstruktur, Wände,<br />
Decken, Böden, Fenster<br />
usw.), optimal zu nutzen. Es<br />
ist dies mit anderen Worten<br />
weder eine Strategie des<br />
Verdeckens und Verstekkens<br />
ungeliebter technischer<br />
Installationen (einzige<br />
Ausnahme sind die<br />
Lüftungsinstallationen) im<br />
Namen einer unverstellten<br />
ästhetischen Wirkung von<br />
Materialien und Oberflächen,<br />
noch eine Strategie,<br />
die die Materialien und<br />
Oberflächen im Namen einer<br />
akkuraten Sinnlichkeitserfahrung<br />
als „isolierte Kostbarkeiten“<br />
behandeln wür-<br />
Vella<br />
Schulanlage<br />
den. Entscheidend ist vielmehr,<br />
dass unverstellte Materialien,<br />
rohe Oberflächen,<br />
speziell plastisch ausgebildete<br />
Elemente - Rippendecke,<br />
Außenhaut - in<br />
ihrem komplexen Zusammenspiel<br />
(und damit der gesamte<br />
Entwurf) einen Sinn<br />
bekommen. Das sollte das<br />
Ziel einer jeden architektonischen<br />
Arbeit sein.<br />
93
Vrin<br />
Strickbauten<br />
94<br />
Strickbauten<br />
Standort: Vrin<br />
Architekt: Gion Caminada, Vrin<br />
Ingenieur: u.a. Jürg Conzett, Chur<br />
Literatur: archithese, Nr. 5, 1995,<br />
db-deutsche Bauzeitung, 7+10, 1998,<br />
DBZ-Deutsche Bauzeitschrift, Jg. 44, Nr. 34, 1996,<br />
Deutsches Architektenblatt, 32, 1, 2000,<br />
Mikado, Nr. 1, 2001<br />
Neues Bauen in den Alpen 1999<br />
Vrin, eine kleine Gemeinde<br />
im Graubündner Val Lumnezia,<br />
wie das Lugnezer Tal auf<br />
rätoromanisch heißt, hat<br />
ihre über Jahrhunderte gewachsene<br />
Dorfstruktur bewahrt.<br />
Holz prägt das Ortsbild<br />
in vielen Variationen und<br />
liebevollen Details, bei den<br />
alten Bauernhäusern ebenso<br />
wie bei den Neubauten.<br />
Mit behutsamer Anpassung<br />
an zeitgemäße Anforderungen<br />
wird die vorhandene<br />
Bausubstanz erhalten und<br />
die zurückhaltend moderne<br />
Architektur führt die traditionellen<br />
Holzbauweisen weiter.<br />
Wettergegerbte Holzhäuser,<br />
deren Dächer sich fast berühren,<br />
schmale Wege, Gemüsegärten,<br />
Misthaufen,<br />
Blumenbeete, Brunnentröge.<br />
Vrin, weltabgeschieden<br />
am Talschluss auf 1400 m<br />
gelegen, wirkt wie ein Dorf<br />
aus einer anderen Zeit.<br />
Doch der Ort mit seinen 280<br />
Einwohnern ist kein<br />
Freilichtmuseum, sondern<br />
vielmehr eine vitale Gemeinschaft,<br />
die mit einer Reihe<br />
von Initiativen an die eigenen<br />
Traditionen anknüpft<br />
und daraus Wege für die<br />
Zukunft entwickelt. Eines<br />
dieser Projekte ist die Erhaltung<br />
der gewachsenen<br />
Dorfstruktur und die Anpassung<br />
an die Bedürfnisse der<br />
heutigen Bergbauern-Land-<br />
wirtschaft. Seit vielen Jahren<br />
engagiert sich der Architekt<br />
Gion A. Caminada, der in<br />
Vrin lebt und arbeitet, dafür,<br />
die Bausubstanz zu bewahren<br />
und die Neubauten in<br />
das Dorfgefüge zu integrieren.<br />
Für die vorbildliche Ortsplanung<br />
wurde die Gemeinde<br />
1998 mit dem renommierten<br />
Wakker-Preis des<br />
Schweizer Heimatschutzes<br />
ausgezeichnet.<br />
Wesentliches Verdienst,<br />
dass dies erreicht wurde,<br />
haben ein Denkmalpfleger<br />
und ein Architekt: Der eine,<br />
von 1968 an zehn Jahre im<br />
Graubündner Denkmalamt<br />
für das Ortsbild mitverantwortlich,<br />
war Peter Zumthor.<br />
Erst danach als Architekt<br />
tätig, entwarf er 1983 ein<br />
multifunktionales Gebäude<br />
für eine moderne Bäckerei<br />
und das einzige Café im Ort.<br />
In der Tradition des steinernen<br />
Sockelgeschosses und<br />
darauf ruhender Holzkonstruktion<br />
steht das breit ausladende<br />
Gebäude giebelständig<br />
zur Straße. Vier Etagen<br />
hoch, beherbergt es im<br />
hofseitig ebenerdigen Souterrain<br />
die Backstube, darüber<br />
Laden und Café, in den<br />
beiden Obergeschossen die<br />
Wohnungen der Geschäftsinhaber.<br />
Damit war ein neuer<br />
Typus ins Dorf gezogen:<br />
das urbane Geschäftshaus.<br />
Zugleich dorffähig machte<br />
Zumthor den Baustoff Beton.<br />
Waren die Sockelgeschosse<br />
einst roh gemauert<br />
und verputzt, lässt das Neue<br />
Bauen in den Bergen den<br />
„gegossenen Stein“ sichtbar.<br />
Sauber verarbeitet<br />
bleibt der vom autochthonen<br />
Gneis lichtgraue Beton
so materialehrlich unverhüllt<br />
wie das seit je hier heimische<br />
Holz. Der Andere für<br />
das Ortsbild mitverantwortliche<br />
ist der Architekt Gion A.<br />
Caminada. Auch er verwendet<br />
beide Baustoffe.<br />
Zu den Wurzeln:<br />
Von Zürich nach Vrin<br />
Der Bauernsohn mit dem<br />
neben Casanova häufigsten<br />
Familiennamen am Ort war<br />
zu dem Zeitpunkt zurückgekehrt<br />
ins heimatliche Dorf,<br />
an dem die Bäckerei eröffnet<br />
wurde. Nach Lehr- und<br />
Wanderjahren, unter anderem<br />
als Möbel- und Bauschreiner<br />
sowie dem Studium<br />
von Architektur und<br />
Holzbau an der eidgenössischen<br />
Technischen Hochschule<br />
(ETH) in Zürich, eröffnet<br />
er ein eigenes Architekturbüro.<br />
Und baute von<br />
Anfang an ausschließlich<br />
mit lokal verfügbaren Materialien<br />
in den tradierten Techniken<br />
wie dem Strickbau: ein<br />
langbewährtes Verfahren,<br />
bis zu hauslange, rechteckig<br />
geschnittene und glatt gehobelte<br />
Stämme hochkant liegend<br />
aufeinander zu schichten<br />
und ineinander verschränkt<br />
über Eck zu verbinden,<br />
dass sie eine horizontal<br />
wie vertikal verwindungssteife<br />
Zelle bilden. Diese<br />
Zimmermannshäuser, materialgerecht,<br />
robust und<br />
bodenständig charmant,<br />
bestimmen das historische<br />
Ortsbild mit ihrem warmen<br />
Holzton, welcher, je länger<br />
vom intensiven ultravioletten<br />
Licht gebeizt, umso dunkler<br />
zwischen hellbraun bis<br />
schwarz changiert.<br />
Umbauten im Dorfkern<br />
Neben den Bauernhäusern<br />
bestimmen zahlreiche Ställe<br />
und Scheunen in traditioneller<br />
Holzbauweise das<br />
Ortsbild. Noch heute lebt die<br />
Hälfte der Einwohner Vrins<br />
von der Landwirtschaft, insbesondere<br />
von der Rinderund<br />
Ziegenhaltung. Da nicht<br />
alle Wirtschaftsgebäude den<br />
heutigen technischen Anfor-<br />
Vrin<br />
Strickbauten<br />
derungen entsprechen oder<br />
zu klein sind, wurden sie<br />
behutsam umgebaut oder<br />
erweitert. So wird versucht,<br />
die Bauern im Dorfkern zu<br />
halten und die Abwanderung<br />
und damit die Zersiedlung<br />
der Landschaft zu verhindern.<br />
Die erforderlichen<br />
größeren Ställe wurden als<br />
Gebäudegruppe unterhalb<br />
der Kirche am Ortsrand errichtet,<br />
gemeinsam mit einem<br />
Neubau für ein<br />
Schlachthaus.<br />
In Form und Konstruktion<br />
sind sie unschwer als moderne<br />
Gebäude zu erkennen.<br />
Sie sind eigenständige,<br />
neue Elemente im Dorfbild,<br />
wirken jedoch in ihren Proportionen<br />
und der Holzbauweise<br />
nicht als Fremdkörper.<br />
Ganz aus Holz gebaut sind<br />
die Ställe und ihre darüber<br />
lagernden Heuschober; die<br />
hölzernen Partien der<br />
Wohngebäude lagern auf<br />
steinernen Sockelgeschossen.<br />
Der dafür erforderliche<br />
Bruchstein ist hier äußerst<br />
selten und war daher kaum<br />
erschwinglich. Die nackten<br />
Balken außen, im Verbund<br />
mit der thermischen Haut<br />
aus Holzfaserplatten im Innern<br />
liefern hervorragende<br />
Dämmwerte. Doch sind damit<br />
die konstruktiven Möglichkeiten<br />
des Baumaterials<br />
Holz und seiner Derivate keineswegs<br />
ausgereizt. Ist<br />
beim Bauen im Bestand des<br />
historischen Ortskerns angezeigt,<br />
die tradierten Techniken,<br />
Dimensionen und<br />
Formen mimetisch aufzunehmen,<br />
bieten neue am<br />
95
Vrin<br />
Strickbauten<br />
96<br />
Ortsrand angesiedelte<br />
Strukturen und Funktionen<br />
größeren Spielraum für Experimente.<br />
Wurde früher<br />
das Heu auf der Wiese gedörrt<br />
und trocken in die<br />
Schober gebracht, die daher<br />
luftdurchlässige Gitterkonstruktionen<br />
waren, kommen<br />
die Futtervorräte heute<br />
bloß angetrocknet in die<br />
Scheuer, wo ihnen per Heizgebläse<br />
die Restfeuchte entzogen<br />
wird. Das erfordert<br />
einen winddichten Wandaufbau.<br />
Für die dazu neu zu<br />
errichtenden größeren Ställe<br />
und Scheunen hat Caminada<br />
den herkömmlichen<br />
Strickbau fortentwickelt und<br />
ein Modulsystem ersonnen.<br />
Der erforderliche Dämmwert<br />
wird dort erreicht durch die<br />
gewählte Dicke des Holzes.<br />
Mehrschichtige Konstruktionen<br />
fallen weg. Die rohe<br />
Konstruktion gibt dem Bau<br />
das Gesicht. Gerade beim<br />
Stallbau kommen die physikalischen<br />
Eigenschaften<br />
des Holzes besonders zum<br />
Tragen.<br />
Doch (nicht nur) für die traditionellen<br />
Weisen der Konservierung<br />
war es sinnvoll,<br />
die Lebensmittel in ganzjährigniedertemperaturkonstanten<br />
Räumen zu lagern.<br />
Also leisteten sich selbst die<br />
armen Bauern wenigstens<br />
steinerne Keller; einzig dem<br />
höchsten Herrn errichteten<br />
sie von 1598-1694 die barocke<br />
Kirche und den nach<br />
italienischer Manier freistehenden<br />
Campanile mit zweistöckigemGlockengeschoss<br />
ganz aus Stein.<br />
Den Bauern im Dorf<br />
lassen<br />
Vor dem Hintergrund des<br />
fragilen Existenzgrundes der<br />
alpinen Landwirtschaft, deren<br />
zeitgenössische Schwächephase<br />
Vrin mindestens<br />
zu entstellen drohte, ist<br />
Caminada einst angetreten<br />
unter dem Motto „Den Bauern<br />
im Dorf lassen“. Darum<br />
herum entwickelte er - nicht<br />
allein als Gemeinderat im-<br />
mer im Gespräch mit der<br />
Dorfgemeinschaft und der<br />
für sie zuständigen Administration<br />
in Kanton und Bund<br />
- eine „vrino-zentrische Architekturtheorie“.<br />
Sie beinhaltet<br />
Leitlinien, von denen<br />
einige, wie der konkurrenzlose<br />
Einsatz von Holz und<br />
Sichtbeton unumstößlich<br />
sind, andere mit fortschreitender<br />
Entwicklung indes<br />
hinterfragt werden und gegebenenfalls<br />
neuen Einsichten<br />
weichen müssen: So<br />
war es mit den Balkonen.<br />
Obwohl gedeckte Laubengänge<br />
und Freisitze seit<br />
Jahrhunderten zu den Requisiten<br />
des regionalen<br />
Wohnhauses gehören, vermittelte<br />
der einheimische<br />
Baumeister, bäuerliche Architektur<br />
bedürfe solch inszenatorischer<br />
Mittel nicht:<br />
Der Landmann ist der Landschaft<br />
bis zum Überdruss<br />
ausgesetzt, und genießt zurückgezogen<br />
in seiner dunklen<br />
Kammer ihre sichtbare<br />
Abwesenheit nachgerade<br />
als Kontrastprogramm. Aus<br />
eben diesem Grunde werde<br />
es in seinen Häusern auch<br />
keine panoramischen Fenster<br />
geben. Wenn auch die<br />
Altvorderen weniger der erdrückenden<br />
Natur wegen,<br />
sondern als Tribut an Heizprobleme<br />
und unerschwinglich<br />
teures Glas, nur<br />
schmale Lichtöffnungen in<br />
ihre schnitzwerkverzierten<br />
Blockhäuser schnitten.<br />
Um Zersiedlung zu verhindern,<br />
wurde die tradierte<br />
Hofeinheit (Haus, Stall, Garten)<br />
im Dorfinnern gefestigt.<br />
Neue Stallungen sollen innerhalb<br />
des Siedlungsgebietes<br />
oder am Dorfrand erstellt<br />
werden, bestehende<br />
Ställe dürfen nach Möglichkeit<br />
erweitert werden. Statt<br />
eine geplante Umfahrungsstraße<br />
im Weiler Cons zu<br />
realisieren, wurde so ein<br />
Stall bis 1,20 Meter an die<br />
Kantonsstraße herangerückt.<br />
Die Strasse soll<br />
nach wie vor die Lebensader<br />
bleiben: Spielplatz der<br />
Kinder, auch Tummelplatz
der Haustiere, und selbst die<br />
wenigen Automobile sind<br />
hier oben Idylle. Architektonisch<br />
betont festigt der Stallneubau<br />
die charakteristische<br />
Staffelung der Strassenstruktur.<br />
Die Analyse ergab,<br />
dass alte und kleine<br />
Ställe sich vorwiegend für<br />
die Kleinviehzucht und -haltung<br />
eignen, wie auch die<br />
topographischen Gegebenheiten<br />
die Förderung der<br />
Ziegenhaltung favorisieren.<br />
Ein entsprechendes Projekt<br />
bedingte für die Arbeit eines<br />
Architekten aber wiederum<br />
mehr als nur die Planung<br />
der neuen Stallungen, der<br />
Sennerei und der Hirtenunterkunft.<br />
Gion A. Caminada<br />
war von Beginn an involviert:<br />
von der eigentlichen Motivation<br />
zur Ziegenhaltung<br />
über die Arbeit an der Sanierung<br />
der CAE-Krankheit bis<br />
hin zum Marketing. Der ganze<br />
Werdegang prägte die<br />
architektonische Umsetzung<br />
nachhaltig, und zwar<br />
im Sinne einer ganzheitlichen<br />
Planung.<br />
Nicht das Bausystem ist<br />
der Stagnation unterworfen<br />
Holz wird in Vrin fast überall<br />
verwendet. Im Vordergrund<br />
steht also nicht eine<br />
grundsätzliche Diskussion<br />
zur Wahl des Materials, es<br />
geht um die Wiederentdekkung<br />
der grundlegenden<br />
Eigenschaften von Holz und<br />
den daraus resultierenden<br />
Einsatz. Holz ist nicht Trend,<br />
sondern banale Tradition,<br />
ein natürlicher Sachzwang.<br />
Bei der Verwendung ist es<br />
aber wichtig, dass man sich<br />
nicht auf ein bestimmtes<br />
Konstruktionssystem fixiert;<br />
die Kunst des Bauens nutzt<br />
gerade diesen Spielraum.<br />
So ist es beim traditionellen<br />
Strickbau von spezifischem<br />
Interesse, was mit dieser<br />
Bauweise noch möglich ist.<br />
Es hat sich gezeigt, dass es<br />
heikel ist, eine bauliche Entwicklung<br />
einfach als tot zu<br />
erklären. Denn nicht das<br />
Bausystem ist der Stagnation<br />
unterworfen, sondern<br />
dessen Verwendung.<br />
Holz für zeitgemäße Architektur<br />
Fichte ist das heimische<br />
Baumaterial, das sich im<br />
Vrin<br />
Strickbauten<br />
trockenen Gebirgsklima<br />
Vrins seit Jahrhunderten bewährt<br />
hat. Alle Gebäude,<br />
außer der Kirche und der<br />
Schule, sind aus Holz. Für<br />
die Bewohner ist Holz auch<br />
heute noch ein selbstverständliches<br />
und vertrautes<br />
Baumaterial, das zudem in<br />
ausreichender Menge vorhanden<br />
und relativ preiswert<br />
ist. Holz ist der dem Ort entsprechende<br />
Baustoff und<br />
Gion A. Caminada setzt die<br />
Holzbautradition in seinen<br />
Projekten für Vrin und die<br />
Nachbargemeinden mit modifizierten<br />
Konstruktionen<br />
fort: bei Ställen und Scheunen<br />
ebenso wie bei neuen<br />
Wohnhäusern und öffentlichen<br />
Bauten.<br />
Für die Wohnhäuser adaptiert<br />
Caminada die traditionelle<br />
Strickbauweise, bei der<br />
Kanthölzer, 12 x 20 cm, horizontal<br />
übereinander gelegt<br />
und an den Ecken überblattet<br />
werden. Wie bei den alten<br />
Häusern bleiben die<br />
massiven Holzwände außen<br />
sichtbar, innen werden jedoch<br />
Wärmedämmung und<br />
Bretterschalung vorgesetzt.<br />
Die Häuser sind in Grundriss<br />
und Raumhöhen modernen<br />
Wohnvorstellungen<br />
angepasst, ohne den Maßstab<br />
der umgebenden Bebauung<br />
zu sprengen. Die<br />
Hausfassaden sind weder<br />
gestrichen noch imprägniert.<br />
Dank der geringen<br />
Luftfeuchte trocknet das<br />
Holz immer wieder von<br />
selbst ab. Es wird über die<br />
Jahre verwittern und unter<br />
der Sonneneinstrahlung<br />
nachdunkeln. Bei den Wirtschaftsgebäuden<br />
hat Caminada<br />
den Strickbau zu einer<br />
rahmenähnlichen Systembauweise<br />
weiterentwickelt.<br />
Hier sind die sichtbaren Eckverbindungen<br />
und die senkrechte<br />
Verschalung der traditionellen<br />
Bauart mit einem<br />
zeitgemäßen, kostengünstigen<br />
Konstruktionssystem<br />
kombiniert. Statt einzelner<br />
Bohlen werden hölzerne<br />
Rahmen zusammengefügt,<br />
1,20 m hoch und bis zu 12<br />
m lang, und innenseitig mit<br />
Spanplatten zur Aussteifung<br />
beplankt. Für Caminada ist<br />
es von Interesse, zu zeigen,<br />
wie der Bau gemacht ist.<br />
Dabei geht es vorab um das<br />
Gleichgewicht zwischen<br />
97
Vrin<br />
Strickbauten<br />
98<br />
Konstruktion und Verkleidung.<br />
Die Konstruktion ist<br />
die eigentliche Realität, und<br />
darum muss der Ausdruck<br />
über das rein Bildnerische<br />
hinausgehen.<br />
Selbst das Telefonhäuschen<br />
kreiert er in Übereinstimmung<br />
mit dem spezifischen<br />
„Vrin-Feeling“, ohne einem<br />
heimattümelnden Baustil zu<br />
verfallen. Unbehandelte<br />
Bretter wurden, wechselseitig<br />
versetzt, Lage um Lage<br />
aufeinander genagelt. Für<br />
die individuelle Kabine anstelle<br />
einer Normzelle aus<br />
Glas wurde lange mit der<br />
Schweizer Telecom verhandelt.<br />
Mehrzweckhalle Vrin<br />
Die im Jahre 1963 erstellte<br />
Schulanlage steht an einer<br />
der empfindlichsten Stellen<br />
des Dorfes. Schule und Kirche<br />
dominieren das Dorfbild.<br />
Die Schulanlage wird<br />
nun durch eine parallel dazugeschobeneMehrzweckhalle,<br />
(Turn-, Versammlungs-<br />
und Festhalle) nach<br />
der Kirche zweitgrößtes<br />
Gebäude im Ort, erweitert.<br />
Diese Methode der baulichen<br />
Ergänzung entspricht<br />
dem tradierten An- und Weiterbauen<br />
innerhalb der bestehenden<br />
Dorfstruktur. Für<br />
diesen Gemeindesaal am<br />
Schulhaus galt es, große<br />
Spannweiten stützenfrei zu<br />
überbrücken. Zusammen<br />
mit dem Ingenieur Jürg<br />
Conzett aus Chur erfand<br />
Caminada eine neue Unterspannkonstruktion<br />
für das<br />
Dachtragwerk. Nicht die be-<br />
kannt schweren, verleimten<br />
Holzbinder sollten über den<br />
Köpfen der Nutzer verlaufen,<br />
sondern leichte, schwebende<br />
Bänder den Kräftefluss<br />
visualisieren.<br />
Gewählt wurde ein unterspanntes<br />
System, bei dem<br />
nur zwei Knotenpunkte - die<br />
Anschlüsse des Zugbandes<br />
- große Zugkräfte übertragen<br />
müssen. Die leicht gebauchte<br />
Anordnung des<br />
Zugbandes mit den dichten<br />
Ständern drückt die Binderstreben<br />
im Randbereich<br />
nach oben und reduziert<br />
dadurch die Biegemomente<br />
beträchtlich. Die Zugbänder<br />
bestehen aus je fünf Brettern<br />
von 24 mm Dicke, die<br />
sich problemlos in die gekrümmte<br />
Form biegen lassen.<br />
Hier wird das Holz als<br />
Bündel zugbeanspruchter<br />
Fasern eingesetzt, was<br />
durch die konstruktionsbedingteAufspaltung<br />
in einzelne Lamellen<br />
bei den Auflagerstellen augenfällig<br />
wird. An den fünf<br />
fächerförmig gespreizten<br />
Bohlenenden, die mittels<br />
Metallbändern und -stiften<br />
Zug und Last zwischen Horizontale<br />
und Vertikale vermitteln<br />
und übertragen, wird<br />
die Kraftübertragung optisch<br />
„einsichtig“. Aufgelagert<br />
auf senkrechten Holzpfeilern<br />
in der Außenflucht,<br />
die die Dachlasten aufnehmen,<br />
kragen die konkav gebogenen<br />
Bänder beidseitig<br />
ihrer zwölf Meter Spannweite<br />
noch um Armeslänge<br />
über den Auflagerpunkt aus.<br />
Um diese Funktionen sichtbar<br />
zu lassen, öffnet sich die<br />
Halle im Deckenbereich in<br />
einem über die äußere Fassade<br />
auskragenden Vitrinenfensterband<br />
auf der gesamten<br />
Gebäudelänge.<br />
Nach Süden gerichtet, wird<br />
von dorther und von einem<br />
Panoramafenster gen Westen<br />
das honigfarbene<br />
Leuchten des Innenraums<br />
inszeniert: Tannenholz an allen<br />
Seiten; allein das Sockelgeschoss<br />
ist in Sichtbeton
ausgeführt. Worin neben<br />
anderer Technik die Holzschnitzel-Feuerungsanlage<br />
für den gesamten Schulbereich<br />
und das benachbarte<br />
Gemeinde-, Rathaus untergebracht<br />
ist. Dieses ist eine<br />
überzeugende Intervention<br />
in bestehende Substanz.<br />
Einst ein Aschenputtel unter<br />
den Bauernhäusern, putzte<br />
es Caminada durch Abriss<br />
maroder Partien und zeitgenössische<br />
Interpretation der<br />
neu aufgeführten Haushälfte<br />
heraus zur Dorfschönheit.<br />
Schulhaus Duvin<br />
Das neue „Schulhaus“ bildet<br />
mit der Kirche, dem Friedhof<br />
und der alten Schule (Post<br />
und Kanzlei) das eigentliche<br />
Zentrum des Dorfes. Bei der<br />
Ausformung dieses Zentrums<br />
beschränkte man sich<br />
einzig auf die Baukörper<br />
und auf das kontroverse<br />
Spiel von engen und weiten<br />
Flächen. Die Bauten scheinen<br />
sich über Eck fast zu<br />
berühren. Fließende Übergänge<br />
verbinden Pausenplatz,<br />
Strasse und den öffentlichen<br />
Raum. Die vorgefundene<br />
Identität zu erhalten,<br />
war beim Entwurf das<br />
höchste Ziel.<br />
Der romanische Turm, das<br />
alte behäbige Schulgebäude<br />
und die Wohnhäuser mit<br />
Vrin<br />
Strickbauten<br />
den Ställen vermitteln Beständigkeit.<br />
Als Konstruktion,<br />
die dieser ruhenden<br />
Kraft standhält, fiel die<br />
Wahl auf die Strickbauweise.<br />
Die Gemeinde Duvin lieferte<br />
dazu das Lärchenholz.<br />
Die Lösung vereint traditionelleKonstruktionsmethoden<br />
und den Einsatz moderner<br />
technischer Mittel.<br />
Der Grundriss besteht auf<br />
allen drei Etagen aus zwei<br />
Räumen (Vorraum und<br />
Hauptraum). Die Geschosse<br />
sind durch einläufige<br />
Treppen verbunden. Das<br />
Gebäude ist auch im Innern<br />
aus Holz. Die Schulzimmer<br />
haben eher den Charakter<br />
großzügiger Stuben. Für<br />
stark beanspruchte Teile<br />
(Konstruktion, Fenster, Böden)<br />
wurde Lärchenholz<br />
verwendet, für Verkleidungen<br />
und Möbel Tannenholz<br />
Für einen Strickbau relativ<br />
ungewöhnlich sind die<br />
Spannweiten von acht bis<br />
neun Metern und die großen,<br />
nicht ausgesteiften<br />
Wandflächen. Deshalb wurde<br />
für die Decken ein Holz-<br />
Beton-Verbundsystem gewählt,<br />
das die Lasten vorwiegend<br />
in der Nähe der<br />
steifen Ecken auf die Wände<br />
abgibt und gleichzeitig<br />
genügend Masse für eine<br />
ausreichende Schalldämmung<br />
besitzt. Die untere,<br />
zugbeanspruchte Partie der<br />
Decke besteht aus einer<br />
„Strickdecke“: 14 cm dicke<br />
und 20 cm breite Kanthölzer,<br />
die mit Nut und Kamm<br />
untereinander verbunden<br />
sind. Darüber wurde eine<br />
ebenfalls 14 cm dicke Betonschicht<br />
gegossen. Für<br />
den Verbund wurden in jeden<br />
Balken vier Löcher gestemmt:<br />
zwei tiefere am<br />
Rand, zwei flachere in der<br />
Mitte. Der einfliessende Beton<br />
bildet an diesen Stellen<br />
Schubnocken, die für eine<br />
direkte Kraftübertragung<br />
zwischen den beiden Materialien<br />
sorgen. Über den großen<br />
Fenstern sind die Dekken<br />
mit Zugstangen an die<br />
darüberliegenden Brüstungen<br />
aufgehängt. Pro Wandfeld<br />
wurde nur eine einzige<br />
große Öffnung angeordnet.<br />
Damit ist jeder Wandteil zumindest<br />
einseitig über eine<br />
Eckverblattung gehalten<br />
99
Vrin<br />
Strickbauten<br />
100<br />
und ausgesteift.<br />
Für den Ingenieur stand hier<br />
die Betrachtung von „Grenzzuständen“<br />
im Vordergrund.<br />
Es ging also nicht darum,<br />
„wirkliche“ Spannungs- und<br />
Kräfteverhältnisse zu untersuchen<br />
- das wäre in jedem<br />
Fall illusorisch gewesen -,<br />
sondern „mögliche“ Wege<br />
der Lastableitung zu finden.<br />
Dies entspricht den Grundgedanken<br />
der Plastizitätstheorie.<br />
Eine vorindustrielle<br />
Technik - der Strickbau -<br />
zeigt unter der Anwendung<br />
moderner Ingenieurmethodik<br />
auf einmal ganz neue<br />
Qualitäten.<br />
Ewigkeitsfragen<br />
So weit man hier zurückdenken<br />
kann, ist es Sitte, die<br />
Toten drei Tage lang in der<br />
Stube aufzubahren, dem<br />
schönsten Raum des eigenen<br />
Hauses. Eine spezielle<br />
Kultur des Abschieds hat<br />
sich darum entwickelt, die<br />
inkompatibel zu den modernen<br />
Zeiten scheint. Neuere<br />
fordern deshalb eine Aussegnungshalle,<br />
da die überkommenenTrennungszeremonien<br />
die Leidensbereitschaft<br />
der Zeitgenossen<br />
übersteigen. Die Fraktion<br />
der Bewahrer, an ihrer Spitze<br />
der Architekt, mahnt, die<br />
herkömmliche Trauerkultur<br />
nicht besinnungslos aufzugeben.<br />
Ohne die innige Referenz,<br />
die ihnen in der täglichen<br />
Begegnung erwiesen<br />
werde, würden die Verstorbenen<br />
eher virtuell denn<br />
wirklich verabschiedet. Der<br />
Tod aber sei Teil des Lebens,<br />
und die Neigung, dies<br />
zu verdrängen, könne nur<br />
beitragen zur fortschreitenden<br />
Banalisierung des Lebens.<br />
Gion A. Caminada ist zuversichtlich,<br />
einen Mittelweg<br />
ebnen zu können. „In der<br />
Tradition ist die architektonische<br />
Lösung immer auch<br />
Ausdruck einer Haltung“,<br />
und er verweist auf die der<br />
Vorfahren: Ohnegleichen im<br />
weiteren Alpenraum, erwartet<br />
das Beinhaus neben<br />
der Kirche die Friedhofsbesucher<br />
mit einem unter dem<br />
Dach umlaufenden Fries.<br />
Dieser ist ein vierreihiges<br />
Memento mori menschlicher<br />
Totenschädel, die zur<br />
Erhöhung der Aura Verbli-<br />
chener blendendweiß gekalkt<br />
sind. Der Aufbahrungsraum<br />
hingegen soll ein Ort<br />
sein, „der Trost und Hoffnung<br />
vermittelt. Wo wir ohne<br />
Angst Abschied nehmen<br />
können von unseren Toten“.<br />
Es soll „ein alltäglicher Raum<br />
für die Lebenden sein. Und<br />
unter alltäglich verstehen die<br />
Vriner die Intimität einer warmen<br />
Stube mit Blick durch<br />
das Fenster auf das Treiben<br />
im Dorf. Das Material für die<br />
Totenstube ist gegeben; als<br />
Bindeglied zur steinernen<br />
Kirche: Holz.“<br />
Handwerkliche Erfahrung<br />
Die meisten Holzbauten<br />
werden vom ortsansässigen<br />
Zimmerei- und Schreinereibetrieb<br />
errichtet, der die angelieferten<br />
Balken abbindet<br />
und hobelt. Noch immer<br />
wird viel mit traditionellen<br />
Holzverbindungen gearbeitet.<br />
Wenn möglich wird das<br />
Holz aus der Umgebung<br />
verwendet. Plant ein Bauherr<br />
einen Neubau schon<br />
zwei bis drei Jahre im Voraus,<br />
wird gemeindeeigenes<br />
Holz geschlagen, das in der<br />
Zwischenzeit trocknen<br />
kann.<br />
Umfassende Konzepte<br />
für die Dorfentwicklung<br />
Doch nicht nur Holz wird vor<br />
Ort verarbeitet. Auch die<br />
landwirtschaftlichen Erzeugnisse<br />
werden selbst vermarktet,<br />
beispielsweise in<br />
der dorfeigenen Metzgerei.<br />
Die gewachsenen Strukturen<br />
als Grundlage für künftige<br />
Dorfentwicklung sind<br />
das Ziel weiterer, ineinander<br />
greifender Strategien. So<br />
sollen die Einwohner im Dorf<br />
arbeiten können, um nicht<br />
bis ins Tal pendeln zu müssen.<br />
Vrin ist mit der Futterproduktion<br />
für seine Viehbestände<br />
an Rindern, Schweinen,<br />
Ziegen und Schafen<br />
sowie mit der Viktualienversorgung<br />
für die eigene Bevölkerung<br />
weitgehend autark;<br />
man strebt danach,<br />
auch die Vermarktung in eigener<br />
Regie zu betreiben.<br />
Nach der Leitidee „ausgewogener<br />
Doppelnutzung“,<br />
die überregionale Arbeitstellung<br />
sowie darauf bezogenen<br />
Güteraustausch im Zeitalter<br />
der Globalisierung<br />
auch für die Alpenwirtschaft
als Überlebensmodell beschreibt,<br />
erschließt sich hiermit<br />
eine ergiebigere<br />
Wertschöpfung als in der<br />
bloßen Nutzung von Naturalien.<br />
Dem „Ausverkauf“ des Ortes<br />
als Wochenend-Domizil<br />
ist ein Riegel vorgeschoben:<br />
Grundstücke werden nur an<br />
diejenigen vergeben, die ih-<br />
Vrin<br />
Strickbauten<br />
ren Wohnsitz langjährig hier<br />
nehmen. Vrin ist keine konservierte,zurechtgezimmerte<br />
Bergbauernidylle für<br />
den Massentourismus. Die<br />
Gemeinde vermittelt das Bild<br />
eines intakten Dorflebens, in<br />
das der Tourismus in einer<br />
sanften Form - gedacht ist<br />
vor allem an Wanderer - integriert<br />
ist.<br />
Schlachthaus: Grundrisse, Schnitt, Ansichten<br />
101
Vals<br />
Felsentherm<br />
102<br />
Therme Vals<br />
Standort: Vals<br />
Baujahr: 1994-96<br />
Bauherr: Gemeinde Vals<br />
Architekt: Peter Zumthor, Haldenstein-Chur<br />
Ingenieur: Blumenthal + Buchli, Illanz/Haldenstein<br />
Literatur: Architektur & Technik, Nr. 4, 1998,<br />
Archithese Jg. 26, Nr. 5, 1996,<br />
Baudoc Bulletin, Nr. 11, 1997,<br />
Bauwelt, Jg. 88, Nr. 14, 1997,<br />
Drei Konzepte,<br />
Edition Architekturgalerie Luzern, 1997,<br />
Peter Zumthor, Häuser 1979 – 1997,<br />
Stein, Jg. 113, Nr. 8, 1997,<br />
Werk, Bauen + Wohnen, Nr. 7/8, 1997<br />
Im graubündnerischen<br />
Sport- und Feriendorf Vals<br />
ist keines dieser landläufig<br />
schrillen und lauten Erlebnisbäder<br />
entstanden, sondern<br />
ein einzigartiger Ort der<br />
Ruhe und Erholung. Der<br />
Schweizer Architekt Peter<br />
Zumthor setzt damit neue<br />
Maßstäbe für mutiges Bauen<br />
in der Alpenlandschaft,<br />
ebenso wie für das Bauen<br />
mit massivem Naturstein.<br />
Vals liegt weit hinten im „wilden“<br />
Valsertal, 20 Kilometer<br />
südlich des Bezirkshauptortes<br />
Illanz. Typisch<br />
für die etwa 1000 Einwohner<br />
zählende Bergsiedlung<br />
sind die mit handgespaltenen,<br />
roh zugerichteten<br />
Platten aus lokalem<br />
Gneis (Valser Quarzit) eingedeckten<br />
einfachen Häuser.<br />
Entscheidend zum hohen<br />
Bekanntheitsgrad des<br />
Dorfes trägt das hier gefasste<br />
und abgefüllte<br />
Mineralwasser bei, das sich<br />
in der Schweiz auf der Getränkekarte<br />
nahezu jeder<br />
Gaststätte aufgelistet findet.<br />
An diesen beiden lokalen<br />
Charakteristika - an Stein<br />
und an Wasser - orientiert<br />
sind auch die im Dezember<br />
1996 eröffnete erste Felsen-<br />
Therme der Schweiz, welche<br />
die Gemeinde Vals als<br />
Bauherrin durch Peter<br />
Zumthor mit Kosten von 26<br />
Millionen Franken hat erbauen<br />
lassen. Zumthor<br />
schuf in einem streng geometrischen,<br />
in mehrere Kuben<br />
gegliederten Bau eine<br />
einzigartige archaische<br />
Bade- und Therapielandschaft<br />
voll stiller Sinnlichkeit.<br />
Wichtigste Elemente bilden<br />
dabei ein durch raffinierte<br />
Deckenöffnungen bestrahltes<br />
Innenbad, eine mystisch<br />
anmutende, über einen<br />
schmalen Eingang erreichbare<br />
Felsengrotte, ein Feuer-<br />
und Eisbad, einen Trinkstein,<br />
einen Duschstein, drei<br />
Ruheräume und ein<br />
Klangstein. Hinzu kommen<br />
als weiteres Raumprogramm<br />
mehrere Seminarund<br />
Sitzungsräume.<br />
Historie<br />
30 Grad warm ist das Wasser<br />
der Quelle, die im gut<br />
1200 Meter über dem Meer<br />
gelegenen Talkessel von<br />
Vals aus der Ostflanke des<br />
Berges heraustritt. Bis in die<br />
sechziger Jahre unseres<br />
Jahrhunderts stand bei der<br />
Quelle vor dem Dorfe, das<br />
mit seinen aus Holzbalken<br />
gebauten und mit rohen<br />
Steinplatten bedeckten Bauernhäusern<br />
den schmalen<br />
Talgrund entlang des<br />
Valserrheines belegt, ein<br />
bescheidenes Kurhaus von<br />
1893. Es enthielt eine Anzahl<br />
schön eingerichteter<br />
Badezellen und Duschzimmer,<br />
berichtet ein Chronist.<br />
Etwa ab 1930 hatten die mit<br />
der Zeit immer seltener gewordenen<br />
Gäste des Kurhauses<br />
auch die Möglichkeit,<br />
im sich an der Luft rot<br />
verfärbenden Thermalwasser<br />
eines kleinen Schwimmbeckens<br />
im Freien zu baden.<br />
Um 1960, also noch vor der<br />
Welle des volkstümlichen<br />
rustikalen Alpenstils, der<br />
seither die meisten Neubauten<br />
für den Tourismus in den
Alpentälern stilistisch prägt,<br />
entstand die heute bestehende<br />
Thermalbadanlage.<br />
Obwohl einfach gebaut und<br />
mit vielen architektonischen<br />
und bautechnischen Mängeln<br />
behaftet, wirkt sie erfreulich<br />
direkt und lässt sogar<br />
einen schwachen Abglanz<br />
der hierzulande lange<br />
schon verlorenen Leichtigkeit<br />
des Bauens der fünfziger<br />
Jahre erkennen.<br />
Das neue Thermalbad, das<br />
die bereits obsolet gewordenen<br />
und zudem zu kleinen<br />
Badeanlagen der sechziger<br />
Jahre seit Ende 1996 ersetzt,<br />
wurde in der Südwestecke<br />
des bestehenden Hotelareals<br />
als eigenständiges<br />
Bauwerk in den Hang gebaut.<br />
Man erreicht den neuen<br />
Solitärbau - einen großen,<br />
grasüberwachsenen,<br />
tief in die Hangkante eingelassenen<br />
und mit der Flanke<br />
des Berges verzahnten<br />
Steinkörper - über einen<br />
unterirdischen Verbindungsgang<br />
vom bestehenden<br />
Hotel her und betritt<br />
eine Architektur, die sich der<br />
formalen Eingliederung in<br />
den heutigen Baubestand<br />
entzieht, um tiefer zu fassen<br />
und um anklingen zu lassen,<br />
was im Zusammenhang mit<br />
der Bauaufgabe wesentlicher<br />
schien: das neue Thermalbad<br />
in ein besonderes<br />
Verhältnis zur ursprünglichen<br />
Kraft und geologischen<br />
Substanz der Berglandschaft<br />
und zum eindrücklichen<br />
Relief der Topographie<br />
zu setzen. Vor dem<br />
Hintergrund dieses Anspruchs<br />
gefällt Zumthor der<br />
Gedanke, das neue Bauwerk<br />
vermittle das Gefühl, es<br />
sei älter als seine bereits<br />
bestehenden Nachbarn, sei<br />
in dieser Landschaft schon<br />
immer dagewesen. Berg,<br />
Stein, Wasser - Bauen im<br />
Stein, Bauen mit Stein, in<br />
den Berg hineinbauen, aus<br />
dem Berg herausbauen, im<br />
Berg drinnen sein - wie lassen<br />
sich die Bedeutungen<br />
und die Sinnlichkeit, die in<br />
der Verbindung dieser Wörter<br />
stecken, architektonisch<br />
interpretieren und in Architektur<br />
umsetzen? Entlang<br />
diesen Fragestellungen<br />
wurde das Bauwerk entworfen,<br />
hat es Schritt für Schritt<br />
Gestalt angenommen.<br />
Vals<br />
Felsentherme<br />
Konzept<br />
Der Entwurfsprozess war<br />
dabei für Peter Zumthor immer<br />
wieder ein Prozess des<br />
spielerischen Entdeckens,<br />
des geduldigen und lustvollen<br />
Herausfindens jenseits<br />
von engen formalen Vorbildern.<br />
Das Gefühl für die<br />
mystischen Eigenschaften<br />
einer Welt aus Stein im Innern<br />
des Berges, für Dunkelheit<br />
und Helle, für Lichtreflexe<br />
auf dem Wasser und<br />
in dampfgesättigter Luft, für<br />
die verschiedenen Geräusche<br />
des Wassers in einer<br />
Umgebung aus Stein, für<br />
warme Steine und nackte<br />
Haut, für das Rituelle des<br />
Badens - die Freude, mit<br />
diesen Dingen zu arbeiten,<br />
sie bewusst einzusetzen,<br />
war von Anfang an da. Erst<br />
viel später, als der Entwurf<br />
schon fast fertig war, hat<br />
Zumthor die alten Bäder in<br />
Budapest, Istanbul und Bursa<br />
besucht und dann besser<br />
verstanden, woher diese<br />
Bilder vermutlich kommen,<br />
die wir offenbar alle irgendwie<br />
kennen, und auch,<br />
wie archaisch sie wohl sind.<br />
So ist das Bad denn auch<br />
kein Jahrmarkt der neuesten<br />
technischen Wasserspiele,<br />
der Düsen, Brausen<br />
und Rutschen geworden,<br />
sondern setzt auf die gleichsam<br />
stille, primäre Erfahrung<br />
des Badens, des Sichreinigens,<br />
des Sichentspannens<br />
im Wasser, auf den Kontakt<br />
des Körpers mit dem Wasser<br />
in verschiedenen Temperaturen<br />
und räumlichen<br />
Situationen, auf die Berührung<br />
von Stein.<br />
In der Art eines geometrischen<br />
Höhlensystems mäandriert<br />
ein kontinuierlicher<br />
Innenraum durch die Steinstruktur<br />
des Bades, die aus<br />
103
Vals<br />
Felsentherm<br />
104<br />
großen Blöcken besteht,<br />
entwickelt sich aus engen<br />
Kavernen auf der Bergseite<br />
in größer werdenden<br />
Dimensionen nach vorne<br />
ans Tageslicht. Hier, am vorderen<br />
Rand des Gebäudes,<br />
verändert sich die Wahrnehmung.<br />
Der Außenraum<br />
dringt in die großen Öffnungen<br />
des Gebäudes ein und<br />
verbindet sich mit dem Hohlsystem<br />
der Kavernen. Das<br />
Gebäude als Ganzes erscheint<br />
wie ein großer, poröser<br />
Stein. Präzise geschnitten<br />
dort, wo der „große<br />
Stein“ aus der Hangkante<br />
herausragt, wird die angeschnitteneKavernenstruktur<br />
zur Fassade.<br />
Eine Idee aus der Natur<br />
Und dieser Stein ist aus<br />
Stein gebaut. Eine durchgehende<br />
Schichtenfolge aus<br />
Natursteinen - Valser Gneisplatten.<br />
Die Therme Vals ist<br />
somit ein Beispiel dafür, wie<br />
auch heute noch - oder wieder<br />
- mit massivem Natursteinmauerwerk<br />
gebaut und<br />
gestaltet werden kann. Auf<br />
die Idee der Schichtung<br />
kam Peter Zumthor im weiter<br />
taleinwärts gelegenen<br />
Steinbruch. Dort liegt der<br />
Fels - ganz natürlich - in<br />
ähnlichem Gefüge offen zutage.<br />
In vielen Lagen aufeinander-geschichtet,abgebaut<br />
und rund 1000 Meter<br />
weiter vorne im selben Hang<br />
wieder eingebaut, bestimmt<br />
der Stein Schnitt und Aufriss<br />
der gesamten Struktur. Konstruktiv<br />
sind die Wände eine<br />
statisch wirksame Verbundkonstruktion<br />
aus geschichteten<br />
Steinplatten (10 und<br />
30 cm dick) und armiertem<br />
Beton, mittlerweilen von den<br />
Bauleuten als „Valser-Verbundmauerwerk“bezeichnet.<br />
Sie wurde in Anlehnung<br />
an ältere Stützmauern von<br />
Bergstraßen speziell für das<br />
Gebäude entwickelt.<br />
Zumthor wählte für seinen<br />
Bau drei verschiedene Plattendicken<br />
(31, 47 und 63<br />
mm), die er Schicht um<br />
Schicht in regelmäßiger Abfolge<br />
übereinanderlegen<br />
ließ.<br />
Valser Quarzit<br />
Der Valser Quarzit ist ein<br />
feinkörniger, geschieferter<br />
Glimmerquarzit mit grober<br />
Bänderung. Er besteht je<br />
nach Varietät aus grauen<br />
oder graugrünlichen, zum<br />
Teil augigen, glimmerreichen<br />
Lagen, abwechselnd<br />
mit hellgrauen bis weißen<br />
Quarzlagen. Hauptbestandteile<br />
sind Quarz (0,03-0,4<br />
mm), Kalifeldspat (0,3-0,6<br />
mm) und Hellglimmer (0,05-<br />
0,3 mm). Die Porenausbildung<br />
beschränkt sich auf<br />
Korngrenzen (keine Luftporenausbildung).<br />
Das Gestein<br />
wird lokal seit Jahrhunderten<br />
als Dachbelag,<br />
Mauerstein und Bodenbelag<br />
verwendet. Heute werden<br />
daraus hauptsächlich Fassadenplatten,<br />
Bodenbeläge<br />
und Treppenbeläge hergestellt.<br />
Der einzige Abbauort<br />
befindet sich am südlichen<br />
Dorfausgang von Vals auf<br />
der westlichen Talseite. Die<br />
Firma Truffer AG gewinnt<br />
dort mittels Sprengungen<br />
jährlich zirka 2000 m³ Valser<br />
Quarzit. Sämtliches Material<br />
wird im gleich nebenan liegenden<br />
modernen Werk<br />
verarbeitet.<br />
Präzision in Stein<br />
Die Behauptung sei gewagt:<br />
Noch nie wurde in der für<br />
Präzision bekannten<br />
Schweiz ein Naturstein-<br />
Mauerwerk mit einer solchen<br />
Genauigkeit errichtet<br />
wie dieses Bad in Vals.<br />
Selbst die engen Toleranzen<br />
der schweizerischen SIA-<br />
Mauerwerksnormen genügten<br />
dem Architekten bei weitem<br />
nicht. Für die gesägten<br />
Platten verlangte er vom Naturstein-Lieferanten<br />
eine<br />
Fertigungstoleranz von 1
mm - und dies bei Plattenlängen<br />
von bis zu 320 cm<br />
und Plattenbreiten zwischen<br />
10 und 30 cm. Ungewöhnliche<br />
Exaktheit, die manchem<br />
der beteiligten Handwerker<br />
wohl als Pingeligkeit erschienen<br />
haben mag, war<br />
auch von dem ausführenden<br />
Baunternehmen gefordert.<br />
Die lediglich 1,5 mm<br />
dicken Klebefugen zwischen<br />
den einzelnen Plattenschichten<br />
treffen in allen<br />
Gebäudeecken, ohne<br />
irgendwelche Versätze, millimetergenau<br />
aufeinander.<br />
60 000 Steinplatten<br />
Für das Mauerwerk benötigte<br />
man 60.000 Platten, insgesamt<br />
etwa 4000 t. Diese<br />
wurden im nur wenige hundert<br />
Meter entfernten Steinverarbeitungswerk<br />
der Firma<br />
Truffer AG auf modernstenMaschinenanlagen<br />
gefertigt. Das Werk war<br />
erst kurz vorher für mehrere<br />
Millionen Franken ausgebaut<br />
und modernisiert<br />
worden, so dass die Abwicklung<br />
des Großauftrages keinerlei<br />
besondere Probleme<br />
darstellte.<br />
Mit Valser Quarzit sind auch<br />
die Innenbeläge im Bad selber<br />
und in allen angegliederten<br />
Räumen ausgeführt. Die<br />
Beläge bestehen aus 2 cm<br />
dicken Platten in Längen bis<br />
320 cm und Breiten von<br />
8,33 und 110 cm, die im Klebeverfahren<br />
verlegt und<br />
ausgefugt wurden. Die<br />
Oberfläche ist je nach Benutzerbereich<br />
poliert, geschliffen<br />
oder geflammt.<br />
Normalerweise lassen sich<br />
Natursteinplatten in den genannten<br />
Längen nicht<br />
ohne sogenannte Schüsselungen<br />
(Aufbiegungen)<br />
verlegen. Vorhergehend<br />
durchgeführte Versuche<br />
haben aber gezeigt, dass<br />
dies mit dem Valser Quarzit<br />
durchaus möglich ist. Neben<br />
geschichtetem Naturstein<br />
finden sich im Innern<br />
auch verschiedene massiv<br />
gearbeitete Elemente in<br />
Form von bis zu einem Kubikmeter<br />
großen, lose<br />
aufeinandergelegten Blökken.<br />
Details<br />
Architektonisch betrachtet,<br />
erzeugt die einheitliche<br />
Vals<br />
Felsentherme<br />
Steinschichtung einen in fast<br />
wörtlichem Sinne monolithischen<br />
Eindruck. Gehflächen,<br />
Beckenböden, Dekken,<br />
Treppen, Steinbänke,<br />
Türöffnungen - alles entwikkelt<br />
sich aus demselben<br />
durchgehenden Schichtungsprinzip.<br />
Steinschicht<br />
lagert über Steinschicht. Die<br />
Übergänge vom Boden zur<br />
Wand und von der Wand<br />
zur Decke sind entsprechend<br />
detailliert. Und auch<br />
die technischen Lösungen<br />
für die Wasserabdichtung<br />
der Becken und Böden, die<br />
Beckenüberläufe, die Reinigungsabläufe,<br />
die Heizung,<br />
die Luftaufbereitung, die<br />
Wärmedämmung und die<br />
Bewegungsfugen des Bauwerkes<br />
wurden dem monolithisch-homogenenEindruck<br />
der Gesamtstruktur<br />
zuliebe so entwickelt, dass<br />
sie entweder aufgehen im<br />
Muster der Schichtung und<br />
Fügung der Steinmasse<br />
(Wasserüberläufe, Putzrinnen,<br />
vertikale Bewegungsfugen<br />
usw.) oder innerhalb<br />
der Verbundkonstruktion<br />
von Stein und Beton<br />
(Abdichtungen, Wärmedämmung,<br />
horizontale Bewegungsfugen<br />
usw.) gelöst<br />
werden konnten.<br />
Deckenschalung<br />
So ist mit Abschluss des<br />
Rohbaus das Gebäude eigentlich<br />
schon fast fertig,<br />
zeigt das fertige Bad nur<br />
wenige primäre Details, die<br />
sich ganz direkt aus ihrem<br />
Gebrauch erklären, wie die<br />
aus der Masse des Steinbodens<br />
herausgearbeiteten<br />
Wasserrinnen, die bewusst<br />
gesetzten Armaturen der<br />
Handläufe und Haltestangen<br />
oder die das Mauerwerk<br />
durchstossenden Messingrohre,<br />
aus denen das natürliche<br />
und das aufbereitete<br />
Thermalwasser in die verschiedenen<br />
Becken und<br />
Rinnen fließt.<br />
Obwohl das Bauwerk als<br />
gebaute architektonischtechnische<br />
Struktur gestaltet<br />
ist und naturähnliche Formen<br />
vermeidet, spürt man in<br />
105
Vals<br />
Felsentherm<br />
106<br />
dem Bemühen um den lapidaren<br />
und homogenen Eindruck<br />
der steinernen Masse<br />
noch deutlich das wohl<br />
stärkste der ersten ursprünglichenEntwurfsbilder,<br />
nämlich das des Aushöhlens.<br />
Der mäandrierende<br />
Innenraum mit seinen<br />
Vertiefungen im Boden in<br />
der Form von Becken und<br />
Rinnen, in denen das Quellwasser<br />
sich sammelt, musste<br />
so aussehen, als wäre er<br />
aus dem kompakten Fels<br />
herausgemeißelt worden.<br />
Die Vorstellung, einen riesigen<br />
Monolithen auszuhöhlen,<br />
diesen mit Kavernen,<br />
Vertiefungen und Kerben zu<br />
versehen, hat geholfen, die<br />
Steinmasse nach oben, zum<br />
Licht hin, sorgfältig aufzuschneiden<br />
und damit ein<br />
Netz von Fugen in der Dekke<br />
einzuführen, das so auf<br />
die großen Blöcke im<br />
Grundriss abgestimmt ist,<br />
dass jeweils eine Seite eines<br />
jeden Blockes Streiflicht erhält.<br />
Entstanden ist dabei<br />
eine neue räumliche Dimension,<br />
die den Bereich der<br />
Badeebene auszeichnet<br />
und die eine zusätzliche<br />
Lesart des Bauwerkes ermöglicht:<br />
Große „Tische“<br />
aus Stein, zu einem geometrischen<br />
Muster gefügt, formulieren<br />
hier den mäandrierenden<br />
Innenraum. So wie<br />
jeder Block homogen mit<br />
einem Steinfeld des Bodens<br />
in der Art einer Fußplatte<br />
verbunden ist, so trägt er<br />
auch eine mächtige Platte<br />
aus Beton. Durch die<br />
schmalen Fugen zwischen<br />
den einzelnen Deckenplatten<br />
sickert Tageslicht ein.<br />
Regie<br />
Die Besucher erleben dies,<br />
wenn sie das künstlich beleuchtete<br />
Kavernensystem<br />
des Zugangs und die dunkel<br />
ausgeschlagene Umkleidekammer<br />
verlassen und -<br />
nun als Badegäste - auf dem<br />
erhöhten Felsband stehend,<br />
zum ersten Mal das Raumkontinuum<br />
der Badeebene<br />
vor sich liegen sehen. Und<br />
wenn man beginnt, in die<br />
Landschaft der Blöcke hinabzusteigen,<br />
und anfängt,<br />
die ineinander übergehenden,<br />
sich öffnenden und<br />
wieder schliessenden<br />
Raumzonen zu durchwandern,<br />
wird man gewahr,<br />
dass Türöffnungen in die<br />
Blöcke hineinführen, dass<br />
jeder Block einen besonderen<br />
Hohlraum in sich birgt.<br />
In diesen Räumen werden<br />
Nutzungen angeboten, die<br />
der Intimität bedürfen oder<br />
die von dieser profitieren.<br />
Die Namen, die sich für die<br />
verschiedenen Blöcke im<br />
Verlauf der Arbeit am Gebäude<br />
eingebürgert haben,<br />
weisen auf diese Funktionen<br />
hin: Schwitzstein,<br />
Duschstein, Massageblock,<br />
Trinkstein, Ruheraum, Feuerbad,<br />
Blütenbad, Kaltbad,<br />
Klangstein. Hinter dem lokker<br />
gesetzten Grundmuster<br />
der Blöcke, das in verschiedene<br />
orthogonale Ordnungslinien<br />
eingebunden ist<br />
und mit sich wiederholenden<br />
figürlichen Konstellationen<br />
arbeitet, steht eine Ablaufregie,<br />
die die Badegäste<br />
einmal auf bestimmte Punkte<br />
hinführt und sie in anderen<br />
Bereichen frei schlendern<br />
und entdecken lässt.<br />
Der zusammenhängende<br />
Großraum zwischen den<br />
Blöcken ist sequentiell aufgebaut.<br />
Die Perspektive ist<br />
immer kontrolliert. Sie gewährt<br />
Ausblicke oder verwehrt<br />
diese in einem Maß,<br />
das der räumlichen Fassung,<br />
dem räumlichen Bild<br />
der einzelnen Raumsequenz<br />
Sorge trägt und auf<br />
dessen Bedeutung im Ganzen<br />
achtet.<br />
Bodenbelag
Vals<br />
Felsentherme<br />
107
Paspels<br />
Oberstufenschulhaus<br />
108<br />
Oberstufenschulhaus<br />
Standort: Paspels<br />
Baujahr: 1997-98<br />
Bauherr: Politische Gemeinde Paspels<br />
Architekt: Valerio Olgiati, Zürich<br />
Ingenieure: Gebhard Decasper, Chur<br />
Literatur: Architektur Aktuell 1999 Mai 228/0,<br />
Baumeister 2000/1 Jg. 97,<br />
Bauwelt 1999 Heft 37,<br />
Detail 2001 Nr. 1,<br />
Hochparterre 1998 11/12, Hochparterre 1998 6/7<br />
Ein fertiger Rohbau<br />
Paspels, ein Dorf im<br />
Domleschg, genauer ein<br />
Vorort von Chur, wächst und<br />
braucht ein neues Schulhaus.<br />
Zudem haben sich<br />
acht weitere Berggemeinden,<br />
was den Schulunterricht<br />
betrifft, angeschlossen<br />
und schicken ihre<br />
Kinder nach Paspels, der<br />
größten der Gemeinden mit<br />
ungefähr 400 Einwohnern.<br />
Es wurde ein regional beschränkter<br />
Wettbewerb<br />
ausgeschrieben, den der<br />
Architekt Valerio Olgiati gewann,<br />
der zwischen Flims<br />
und Zürich pendelt.<br />
Paspels liegt auf einer Hangschulter<br />
über dem Tal (800<br />
ü. NN.). Es gibt schon ein<br />
Schulhaus aus der Gründerzeit,<br />
das zweimal erweitert<br />
wurde. Es steht parallel zu<br />
einer Quartierstraße, die<br />
den Höhenkurven folgt. Sittlich-ländliche<br />
Ruhe herrscht<br />
weit herum. Der Blick<br />
schweift über ein sanft ansteigendes<br />
Feld zum Waldrand<br />
und darüber hinweg zu<br />
den Bergen. Auf der anderen<br />
Seite der Straße steht<br />
ein sonderbares Objekt, der<br />
Neubau der Volksschule.<br />
Ein scharf geschnittener<br />
Betonwürfel, oben der<br />
Hangneigung folgend<br />
schräg abgeschnitten. Mit<br />
der Wucht eines erratischen<br />
Blocks wirkt der Bau wie ein<br />
ausgehöhlter Fels.<br />
Irritierend und fremd, aber<br />
von fern wirkend wie eine<br />
der Burgruinen, die in der<br />
Gegend die Merkpunkte der<br />
Betrachtung bilden. Das<br />
kleine Schulhaus beeindruckt.<br />
Solide verankert, wie<br />
die ehemaligen Burgen,<br />
steht es da, als ob etwas zu<br />
verteidigen wäre. Und tatsächlich:<br />
das Schulhaus<br />
verteidigt die Lust, zur Schule<br />
zu gehen. Der Architekt<br />
Valerio Olgiati schuf hier Innenräume,<br />
die dem Vernehmen<br />
nach Schüler begeistern<br />
und Lehrer stolz machen,<br />
darin zu unterrichten.<br />
Systematik und Irritation<br />
Der Bau schweigt bis man<br />
ihn befragt. In jeder Fassade<br />
sitzen zwei tiefe Fensterbänder,<br />
die in den Hausecken<br />
ansetzen und in der<br />
Gebäudemitte von einem<br />
wandbündigen Einzelfenster<br />
begleitet werden. Die<br />
Wiederholung des Motivs<br />
lässt das Bildungsgesetz<br />
erahnen, aber nicht entschlüsseln.<br />
Kein Dachvorsprung,<br />
keine Gesimse, der<br />
Baukörper bleibt glatt und<br />
geschlossen. Massiv und<br />
schwer will er zäh der Zeit<br />
Widerstand entgegensetzen.<br />
Nur an den Ecken, wo<br />
das Fenster den Block aufschlitzt,<br />
wird die Mauer dünn<br />
und die Irritation findet einen<br />
Durchschlupf.<br />
Entwurfsgrundlagen<br />
Ausgangspunkt des Entwurfs<br />
ist nicht die Suche<br />
nach allgemeingültigen Analogien,<br />
sondern sind die<br />
Konstanten des Orts: die<br />
Berglandschaft mit ihren<br />
Ausblicken, die Neigung des<br />
Hangs, die Streusiedlung.
Der Baukörper greift diese<br />
Merkpunkte auf; das Quadrat<br />
wertet jede Himmelsrichtung<br />
gleich, die Dachschräge<br />
folgt dem Hangverlauf,<br />
das Volumen steht frei<br />
in der Landschaft, ein unterirdischer<br />
Gang verbindet<br />
das neue mit dem alten<br />
Schulhaus. Die eingeschnittenen<br />
Fensterbänder aber<br />
zeigen, dass das Haus trotz<br />
des massiven Auftritts letztlich<br />
kein trutziger Keil in der<br />
Landschaft ist, sondern ein<br />
Hohlkörper, der dem Druck<br />
des Hangs nachgibt. Leicht<br />
verzogen zeigt sich denn<br />
auch der Bau, wobei der<br />
Architekt mit der Ästhetik<br />
des Regelmäßigen bricht.<br />
Die Verzerrung simulierte<br />
Valerio Olgiati erst am Computer<br />
und überprüfte sie anschließend<br />
im Modell. Dabei<br />
spielte er mit der Willkür der<br />
Maschine und entschied<br />
schließlich doch aus dem<br />
Bauch heraus. Beim Hinschauen<br />
vor Ort stellt sich<br />
ein leises Gefühl des Unberechenbaren<br />
ein. Erst beim<br />
Blick auf die Grundrisse sind<br />
die vier Grad Abweichung<br />
vom rechten Winkel ablesbar.<br />
Valerio Olgiati sucht das<br />
Moment der Irritation, sein<br />
Bau widersetzt sich dem<br />
schnellen Verstehen.<br />
Das Besondere des Baus<br />
begründet sich zunächst<br />
aus dem neuartigen Grundriss:<br />
Statt dem üblichen<br />
Zweispänner mit einer<br />
Gang- und einer Zimmerzone,<br />
definiert Olgiati hier ein<br />
Erschließungskreuz in einem<br />
(ungefähren) Quadrat<br />
von 20 Meter Kantenlänge.<br />
Es ist eine Volksschule nach<br />
den Richtlinien des Kantons<br />
Graubünden. Das Verhältnis<br />
von Erschliessungsflächen<br />
zu Unterrichtsräumen<br />
ist sogar besser als in einer<br />
üblichen Korridorschule.<br />
Die einläufigen Treppen sind<br />
übereinander geschichtet<br />
und bilden den Angelpunkt<br />
für das Erschließungskreuz.<br />
Dieses stößt in den Obergeschossen<br />
in allen Himmelsrichtungen<br />
an die Außenwand<br />
und öffnet von Stockwerk<br />
zu Stockwerk<br />
veränderte, eigenwillig verzogene<br />
Raumfiguren. Im Innenraum<br />
ist erlebbar, was<br />
von außen her gesehen<br />
Paspels<br />
Oberstufenschulhaus<br />
vage bleibt - die Räume<br />
sind aus dem rechten Winkel<br />
gerückt und wirken<br />
deshalb dynamisch.<br />
Eine solche Geometrie<br />
schafft die Möglichkeit, die<br />
Erschließungswege mit Tageslicht<br />
zu versorgen. Die<br />
Restfläche in den vier Ecken<br />
des Quadrates definiert die<br />
Fläche der Schulzimmer, in<br />
jeder Ecke befindet sich also<br />
ein Raum. Auf zwei Geschossen<br />
entstehen acht<br />
Räume, die sich in sechs<br />
Schulzimmer und zwei kleinere,<br />
sogenannte Vorbereitungsräume<br />
gliedern. Bei<br />
genauerem Betrachten der<br />
Grundrisspläne, stellt man<br />
fest, dass jedes Schulzimmer<br />
über eine andere Geometrie<br />
verfügt. Jedes Element<br />
ist einmalig: die Position<br />
der Eingangstüre, die<br />
Ausrichtung zwischen Lehrer<br />
und Schüler, das Fenster<br />
jedes Schulzimmers und die<br />
Orientierung des Ausblicks.<br />
Auch die feinen Details<br />
überzeugen. Dies beginnt<br />
mit der Eingangstür aus<br />
Bronze und Glas. Jedes Teil<br />
des Türrahmens wurde im<br />
Bronzewerk von Dornach<br />
einzeln gezogen. Die einzelnen<br />
Teile des Türrahmens<br />
differenzieren auch farblich,<br />
weil schon kleine Unterschiede<br />
in der Mischung das<br />
Metall verändern.<br />
Architecture pure<br />
Man betritt das Schulhaus<br />
durch einen großzügigen<br />
Windfang und kommt in einen<br />
Vorraum, der durch die<br />
ganze Gebäudetiefe geht.<br />
Das Licht sickert von hinten<br />
und von oben in den Raum<br />
und die Treppe saugt die<br />
Bewegung nach oben.<br />
Oben angekommen, betritt<br />
man eine Wiese. So ist jedenfalls<br />
der Eindruck, den<br />
man vor dem breiten Fensterband<br />
hat. Alle Fenster<br />
des Hauses sind Würfe in<br />
die Landschaft. Die Vorzone,<br />
die auch als Pausenhal-<br />
109
Paspels<br />
Oberstufenschulhaus<br />
110<br />
le dient, ist „architecture<br />
pure“, wie sich Olgiati ausdrückt.<br />
Hier sind die elementaren<br />
Mittel der Architektur<br />
direkt eingesetzt: Licht,<br />
Raum und Körper. „Kein<br />
Spiel mit der Materialität, keine<br />
Erzählungen, kein Fries,<br />
kein Rahmen, keine<br />
Fußleiste, kein Materialwechsel.<br />
Nichts als Oberflächen<br />
im Licht. Mit dem<br />
Minimum an Mitteln wird<br />
das Maximum an Wirkung<br />
erzielt. Ein Raumkreuz aus<br />
Beton endet mit Ausblicken<br />
in die Landschaft. Boden,<br />
Wände, Decken sind karg<br />
und glatt und doch: der<br />
Beton leuchtet.<br />
Im Stock darüber wiederholt<br />
sich’s und ist trotzdem ganz<br />
anders. Das liegt nicht nur<br />
an der Pultdecke, sondern<br />
daran, dass die Grundfigur<br />
des Raumkreuzes gespiegelt<br />
wurde. Nirgends sind<br />
die Wände der Kreuzarme<br />
parallel, was überraschende<br />
perspektivische Wirkungen<br />
ergibt. Der Gang, der von<br />
der Mitte her kurz aussieht,<br />
wird plötzlich von der anderen<br />
Seite her lang.<br />
Aufbau<br />
Die Kinder und die Lehrer<br />
werden kaum wissen, wie<br />
das Haus aufgebaut ist. Es<br />
ist ohne Modell schwer zu<br />
erklären, obschon die Organisation<br />
eigentlich einfach<br />
ist. Es gilt das Prinzip der<br />
Schachteln in der Schachtel.<br />
In die große Schachtel<br />
der äußeren Betonmauern<br />
stellt Olgiati die kleineren<br />
Schachteln der Klassenzimmer.<br />
Das Quadrat des<br />
Grundrisses ist, wie bereits<br />
erwähnt, leicht verzogen,<br />
nirgends bleibt ein rechter<br />
Winkel. Die drei Klassenräume<br />
und das halb so große<br />
Sammlungszimmer hingegen<br />
haben je einen rechten<br />
Winkel, der im Hausinnern<br />
liegt. Rechtwinklig ist auch<br />
der Anschluss der kürzeren<br />
Wand, in der auch die Tür<br />
liegt, an die Fassade. Dadurch<br />
entstehen die schräg<br />
zueinander stehenden Korridorwände<br />
des Raumkreuzes.<br />
Eigentlich handelt es<br />
sich um einen Windmühlengrundriss.<br />
Jedes Schulzimmer<br />
blickt in eine andere<br />
Richtung. Das Erd- und das<br />
Obergeschoss sind gegen-<br />
einander versetzt, die Treppe<br />
steht unten links und<br />
oben rechts im Aufenthaltsraum.<br />
Keine innere Wand<br />
steht übereinander. Damit<br />
hat sich auch die Systematik<br />
der Fassaden entschlüsselt.<br />
Die Fenster folgen der<br />
«Drehung der Klassenzimmer<br />
um die Ecke». Die große<br />
Schachtel ist innen mit<br />
der durchgehenden Wärmedämmung<br />
ausgekleidet,<br />
die Wände und die Decken<br />
sind nur mit einem ausgetüftelten<br />
System von Metallankern<br />
mit der Außenschale<br />
verbunden. Auch die Klassenzimmer<br />
sind mit einem<br />
Holzmantel aus Lärchenholz<br />
ausgeschlagen. Sie<br />
funktionieren wie Zigarrenschachteln,<br />
denn sie lassen<br />
sich ganz ausräumen.<br />
Alle Zutaten in den Schulräumen<br />
wie Wandtafel,<br />
Heizkörper, Lampen und<br />
Lavabo sind nachträglich<br />
aufgeschraubt. Die Möbel<br />
stehen lose im Raum, Ablagefläche<br />
bieten Aluminiumgestelle<br />
auf Rädern. Olgiati<br />
will den Innenraum nicht mit<br />
bündigen Einbauten zum<br />
Design zwingen, er bietet<br />
eine präzis gearbeitete Hülle,<br />
nicht mehr, aber auch<br />
nicht weniger. Innenarchitektur<br />
im klassischen Sinn<br />
interessiert ihn nicht. Ob aus<br />
den Räumen Gerümpelkammern<br />
oder ein stimmiges<br />
Ganzes werde, hänge<br />
von den Bewohnern ab, von<br />
Lehrern und Schülern.<br />
Der von Wand zu Wand<br />
durchgehende Fensterschlitz<br />
reißt ein Landschaftsloch<br />
in die Holzschale<br />
und rettet so den Raum<br />
vor der „Alphüttendumpfheit“.<br />
Der Unterschied zwischen<br />
der dämmrigen Intensität<br />
der Vorräume und der<br />
heiteren Wohnlichkeit der<br />
Schulstuben ist frappierend.<br />
Es gibt ein ‚Inneninnen’ und<br />
ein ‚Außeninnen’ im<br />
Schulhaus Paspels.<br />
Die kühle Betonwelt der Erschließung<br />
aber wünscht<br />
sich Valerio Olgiati leer. Es
gibt eine Uhr, einen Papiereimer,<br />
Fenster und schwere<br />
Eichentüren, die rahmenlos<br />
in der Betonwand liegen.<br />
Auf den ersten Blick sieht es<br />
nach Rohbau aus, nach<br />
ungebändigter Architektur.<br />
Hier wirken die Schattenfugen,<br />
die in die Decke eingelassenen<br />
Lampen, die samtene<br />
Oberfläche des Betons<br />
und das Grün der Wiesen,<br />
das durch die Fenster leuchtet.<br />
Die Dramaturgie, die sich in<br />
diesem Schulhaus entfaltet,<br />
prägt sich jedem Besucher<br />
ein. Im Gang ist es kühl,<br />
dunkel, hallig, und es riecht<br />
nach Zement. Im Schulzimmer<br />
ist es warm, hell, schallschluckend,<br />
und es riecht<br />
nach Bündner Stube.<br />
Dem fremdartigen Äußeren<br />
hat Valerio Olgiati die vertraute<br />
Bauernstube eingesetzt,<br />
was bei den Einwohnern<br />
erst nach einiger Zeit<br />
auf Akzeptanz stieß. Diese<br />
Tatsache realisierten auch<br />
die Verantwortlichen: Sie<br />
veranstalteten das Einweihungsfest<br />
nicht zum Zeitpunkt<br />
der Fertigstellung,<br />
sondern erst drei Monate<br />
später. Mit Erfolg, weil die<br />
Jugendlichen ihren positiven<br />
Eindruck in die Dörfer getragen<br />
und damit jede Kritik in<br />
Kürze abgefangen haben.<br />
Konstruktion<br />
Die Konstruktion gehorcht<br />
konsequent dem Prinzip<br />
des Hineinstellens. Nirgends<br />
gibt es einen Widerspruch.<br />
Dennoch musste die BaukommissionÜberzeugungsarbeit<br />
auch während der<br />
Bauzeit unter den Bauschaffenden<br />
leisten. Es wurden<br />
von dem Bauleiter nur<br />
minimalste Abweichungen<br />
vom Planmaß toleriert und<br />
der Sichtbeton in einer hohen<br />
Qualität verlangt. Z.B.:<br />
Auf die Höhe eines Geschosses<br />
weichen die Betonwände<br />
nur 2 bis 3 Millimeter<br />
ab: dies ist ein Zehntel<br />
des üblichen Toleranz-<br />
Paspels<br />
Oberstufenschulhaus<br />
maßes. Um messerscharfe<br />
Betonkanten zu erhalten,<br />
mussten die Bauarbeiter<br />
in die Schalung klettern<br />
und die Stöße mit Kitt<br />
verfugen, damit kein Zementwasser<br />
auslaufe und<br />
sich zu unregelmäßigen<br />
Konturen verhärte. Durch<br />
Motivation und der Begeisterung<br />
für Maßarbeit konnte<br />
solch ein Einsatz erreicht<br />
werden. Dies hat rund drei<br />
Wochen gedauert und war<br />
nicht ohne Konflikte: Die erste<br />
Betonwand wurde wieder<br />
abgebrochen, weil sie<br />
nicht den erwähnten Anforderungen<br />
genügte. Um<br />
Baukommission, Gemeinderat<br />
und die Bauleute zu<br />
überzeugen, dass nichts<br />
Unmenschliches verlangt<br />
werde, unternahm die ganze<br />
Truppe einen Ausflug<br />
nach Bregenz. Am Beispiel<br />
des Kunstmuseums von<br />
Peter Zumthor sollte die gewünschte<br />
Qualität des<br />
Sichtbetons demonstriert<br />
werden. Die Reaktion der<br />
Beteiligten fiel besser als erwartet<br />
aus. Das Motto der<br />
Bauarbeiter „Die schlagen<br />
wir noch lange“ trieb zu<br />
Höchstleistungen an. Die<br />
Baukommission entschied<br />
auf Anraten von Valerio Olgiati,<br />
dass man auf wartungsintensiveDilatationsfugen<br />
verzichtet und mit Rissen<br />
in der Betonschale zu<br />
leben wäre, die es aber<br />
trotzdem zu vermeiden galt.<br />
Architekt und Ingenieure<br />
haben gerechnet und beim<br />
Betonieren darauf geachtet,<br />
dass die Mauern angemessen<br />
schwinden können. Die<br />
sorgfältige Konstruktionsweise<br />
ermöglicht den fugenlosen<br />
Auftritt und unterstützt<br />
die Wirkung eines Baus, der<br />
aus einem Guss gedacht<br />
worden ist und eine entsprechende<br />
Umsetzung findet.<br />
So treffen in Paspels der<br />
Mut einer Gemeinde und die<br />
radikale Haltung des Architekten<br />
zu einem außergewöhnlichen<br />
Betonbau zusammen.<br />
Die mit Konsequenz zu<br />
Ende gedachte Konstruktion,<br />
die das gewählte Material<br />
Beton zwingend erfordert,<br />
führte dazu, dass jede<br />
Mauer nicht nur optisch richtig<br />
erscheint, sondern auch<br />
konstruktiv notwendig ist.<br />
111
Paspels<br />
Oberstufenschulhaus<br />
112<br />
Ein radikaler Betonbau<br />
also, dessen Erschließungskreuz<br />
als eigener<br />
Baukörper in die Hülle gestellt<br />
ist und zusammen<br />
mit den Geschossdecken<br />
einen tragenden, geschlossenen<br />
Kern bildet.<br />
Dieser Kern ist mit der Außenwand,<br />
aufgrund der<br />
thermischen Trennung,<br />
mit sogenannten ‚Schubdornen’<br />
(Metallankern)<br />
kraftschlüssig verbunden<br />
und wirkt erst als Ganzes<br />
stabil.<br />
Das Schulhaus von Paspels<br />
lebt von der Spannung der<br />
Gegensätze, von den<br />
Holzstuben und der kühlen<br />
Betonwelt, vom Schein des<br />
Kubischen und der Abwei-<br />
chung vom rechten Winkel,<br />
vom Archaischen des Betons<br />
und dem mondänen<br />
Auftritt der Baubronzerahmen.<br />
Der Bau besticht<br />
durch die Durchdringung<br />
von Konstruktion und<br />
Materialität. Von Stil hält<br />
Valerio Olgiati nichts, weil er<br />
damit nur eine Fixiertheit auf<br />
die Oberfläche verbindet.<br />
Die alleinige Inszenierung<br />
des Äußerlichen widerspricht<br />
aber seinem Verständnis<br />
von Architektur. Er<br />
vergleicht hingegen die Architektur<br />
mit Mathematik, die<br />
ihren eigenen unumstößlichen<br />
Regeln gehorcht. Dabei<br />
gibt es zwar verschiedene,<br />
aber jeweils folgerichtige<br />
Wege, die zur Lösung einer<br />
Aufgabe führen können.
ef. Evangelische Kirche<br />
Standort: Cazis<br />
Baujahr: 1996 -<br />
Bauherr: ref. Evang. Kirchengemeinde Cazis<br />
Architekt: Werner Schmidt<br />
Ingenieur: Heinz Isler<br />
Literatur: DBZ 47/6.1999, Hochparterre 2001 14, 1/2,<br />
Architektur u. Technik 12/1996<br />
´Ab ovo erzählen´. Es begann<br />
1952, als die rund 100<br />
Mitglieder umfassende reformierte<br />
Gemeinde<br />
Summaprada in Graubünden<br />
eine Wiese erwarb, um<br />
das hier stehende Bauernhaus<br />
in ein Pfarrhaus umzubauen.<br />
1968 wurde die eigenständige<br />
Gemeinde<br />
Cazis gegründet und das<br />
Pfarrhaus verkauft; der Verkaufserlös<br />
sicherte der<br />
Gemeinde ein großes<br />
Grundstück am Dorfrand.<br />
1984 wurde im Grundsatz<br />
beschlossen, eine Kirche zu<br />
bauen, was zunächst 1987<br />
abgelehnt wurde; die Kosten<br />
waren zu hoch. In den<br />
Folgejahren konnte die Gemeinde<br />
die Arrondierung ihres<br />
Geländes in die landwirtschaftliche<br />
Nutzzone verhindern,<br />
1994 bewilligte die<br />
Kirchengemeindeversammlung<br />
einen Kredit<br />
für 7 Projektaufträge an<br />
Architekturbüros aus der<br />
Region und Graubünden.<br />
Im März 1996 wurde der<br />
ungewöhnliche Entwurf von<br />
Werner Schmidt zur Realisierung<br />
angenommen, im<br />
April erfolgte der erste Spatenstich.<br />
Ab ovo ist lateinisch<br />
und bedeutet so viel wie<br />
»vom Anfang her«, wörtlich<br />
übersetzt hieße es »vom<br />
Ei«, also vom Ursprung an.<br />
Die Einführung dieses auch<br />
in der Literaturwissenschaft<br />
gängigen Begriffes (ab ovo<br />
erzählen heißt, eine Geschichte<br />
von ihrem möglichst<br />
frühen Anfang her zu<br />
erzählen) bietet sich in naheliegender<br />
Weise auch<br />
wegen des Gegenstandes<br />
an, von dem erzählt wird:<br />
der Neubau der reformierten<br />
Kirche in Cazis.<br />
Werner Schmidt gebrauchte<br />
in der Beschreibung seines<br />
Entwurfes die Metaphern<br />
Stein, Gebärmutter,<br />
Ei. Angesichts der drei, nahe<br />
der Hauptstraße lagernden,<br />
dem Sonnenverlauf folgend<br />
eingekerbten und sich<br />
verschneidenden eiförmigen<br />
Gebilde, deren<br />
ungeometrische Schalenstruktur<br />
das Abbild eines<br />
idealen, weil natürlich geformten<br />
Volumens darstellt,<br />
drängt sich das Bild vom Ei<br />
deutlich auf. Was sich ändern<br />
wird, sind die drei noch<br />
glatten Außenseiten: erst<br />
bemoost, zeigen sie<br />
Wasserspuren, Rostspuren,<br />
Risse gar. Und: Sie werden<br />
- wenn denn das benötigte<br />
Geld noch aufgetrieben wird<br />
- in den entwurflichen Gesamtzusammenhanggestellt:<br />
mit freistehendem gläsernen<br />
Glockenturm mit einer<br />
hölzernen Tragkonstruktion,glasüberdachtem,langgestreckten<br />
Verbindungstrakt,<br />
Gemeindeterrasse und Nebengebäuden.<br />
Ab ovo heißt<br />
ganz deutlich auch, dass der<br />
Architekt keiner liturgischen<br />
Form Gestalt zu geben hatte,<br />
er also vom weißen Blatt<br />
Papier und dem weiteren<br />
natürlichen wie städtebaulichen<br />
Kontext aus lediglich<br />
dem Raumprogramm folgen<br />
musste. Und das verlangte<br />
einen in seiner Größe<br />
flexibel gestaltbaren Sakralbau,<br />
dessen kleinste<br />
Einheit dem alltäglichen Nutzen<br />
genügen und dessen<br />
Potential dem sonntäglichen<br />
Anspruch leicht Raum<br />
hinzufügen können sollte.<br />
So wurde aus dem maximal<br />
geforderten Kirchenraum<br />
einer mit zwei Ergänzungen,<br />
jede zuschaltbar durch zwei<br />
in den Boden absenkbare<br />
Wände. Bei größeren Hochzeiten<br />
oder Konzerten finden<br />
so mehr als 300 Menschen<br />
Raum, der wöchentliche<br />
Gottesdienst dagegen<br />
Cazis<br />
ev. ref. Kirche<br />
113
Cazis<br />
ev. ref. Kirche<br />
114<br />
findet im intimen Rahmen<br />
einer 50-plätzigen Kapelle<br />
statt.<br />
Über alle Faszination der Erscheinung<br />
des Neubaus<br />
hinaus erregt seine technische<br />
Lösung nicht mindere<br />
Aufmerksamkeit. Ausgehend<br />
von der dreidimensionalen<br />
Darstellung über ein<br />
Modell 1 :100 wurden von<br />
dem wesentlich genaueren<br />
zweiten Modell 1 : 50<br />
Horizontalschnitte (Scheibchen)<br />
genommen, deren<br />
Umrisse über einen Scanner<br />
digital aufbereitet wurden.<br />
In enger Abstimmung<br />
mit dem Schalenbauingenieur<br />
Heinz Isler erfolgten<br />
nun - da die Kugeln<br />
in Spritzbetontechnik ausgeführt<br />
werden sollten - die<br />
Korrekturen. Hieraus ergab<br />
sich wiederum ein Modell (1<br />
:20), an dem die endgültige<br />
Form der drei Steine definiert<br />
wurde. Wieder zerschnitten,<br />
wieder gescannt,<br />
wurden alle weiteren<br />
Planungen ausschließlich<br />
über CAD geleistet und die<br />
folgende praktische Ausführung<br />
kontrolliert; eine<br />
Vorgehensweise, die angesichts<br />
der schwierigen weil<br />
nichtgeometrischen Figuren<br />
wohl die effektivste war.<br />
Für jeden der Steine wurden<br />
32 formgebende Holzbinder<br />
individuell gefertigt und auf<br />
der Baustelle aufgestellt. Auf<br />
diese von einem Stütz- und<br />
Arbeitsgerüst gehaltene<br />
Grobstruktur wurde ein<br />
Bauvlies gespannt, darüber<br />
ein Netz flexibler Armierungseisen,<br />
das als innere<br />
Armierung den ersten<br />
Spritzbeton aufnimmt (jeweils<br />
Schichten von 2 bis 3<br />
cm). Auf diese erste Hülle<br />
wurde eine zweite, äußere<br />
Armierung montiert, die<br />
wiederum mehrere Schichten<br />
Beton aufnimmt. Nach<br />
profil-genauem Abziehen<br />
wurde die nun etwa 15 cm<br />
dicke Schale fein abgerieben<br />
(taloschiert). Die Poren<br />
werden geschlossen und<br />
die Kapillarwirkung des<br />
Wassers von aussen nach<br />
innen ist deshalb gering. Um<br />
eine zu schnelle Trocknung<br />
mit Rissbildung zu ver-meiden,<br />
wurden die betreffenden<br />
Abschnitte unter einem<br />
Arbeitszelt ausreichend<br />
feuchtgehalten.<br />
Bei den Betonschalen der<br />
Kirche in Cazis handelt es<br />
sich um eine Neuheit. „Jede<br />
freie Form ist einmalig“ sagt<br />
der Schalenbaumeister.<br />
„Schalen mit solchen<br />
Fensterschlitzen haben wir<br />
noch nie gemacht.“ Die Fenster,<br />
die wie Schnitze aus<br />
einem Apfel herausgeschnitten<br />
sind waren eine Herausforderung<br />
für den Ingenieur.<br />
„Ein Fußball ist eine dünne,<br />
gespannte Haut, die auch<br />
den Druck eines Achtzig-<br />
Meter-Kicks aushält, solange<br />
man nicht mit dem Messer<br />
hineinschneidet.“ Die<br />
Lösung ist ihm beim Betrachten<br />
seiner Schuhe gekommen:<br />
Wie Schnürsenkel<br />
laufen in Cazis dünne<br />
Zickzack-Eisenstreben über<br />
die Fenster, halten die<br />
Schalenhälften zusammen<br />
und tragen die Kräfte von<br />
einem Ufer zum anderen.<br />
Noch ist der Bau unvollständig<br />
und so beispielsweise<br />
auch das ökologische<br />
Energiekonzept. Die Steinkörper<br />
werden von innen<br />
isoliert, um einen niederen k-<br />
Wert zu erreichen. Aktive<br />
und passive Energie aus der<br />
Sonne soll die Räume erwärmen.<br />
Der Glockenturm<br />
ist zugleich ein Luftkollektor.<br />
Die Luft im Turm zirkuliert<br />
unter den Sakralräumen<br />
hindurch. Sobald die Luft im<br />
Turm wärmer als der Speicher<br />
aus Gesteinsbrocken<br />
ist, beginnt sie zu zirkulieren.<br />
Die Gesteinsbrocken geben<br />
die Wärme an die Räume<br />
ab.<br />
Der zwischenzeitliche finanzielle<br />
Mangel, wegen gestiegener<br />
Baukosten und dem<br />
daraus resultierenden Provisorium,<br />
führte zu einer<br />
speziellen Ästhetik einer Kirche<br />
wie von woanders herkommend.
Spannbandbrücke Pùnt da Suransuns<br />
Viamala<br />
Punt da Suransuns<br />
Standort: Viamala-Schlucht<br />
Baujahr: 1997-1999<br />
Bauherr: Verein KulturRaum Viamala, Chur<br />
Ingenieur: Jürg Conzett, (Conzett, Bronzini, Gartmann AG)<br />
Literatur: 2G, Nr.14, 2000/II - Building in the Mountains,<br />
Schweizer Ingenieur und Architekt<br />
Nr.1 / 2 Jan. 2000<br />
Die Pùnt da Suransuns ist<br />
eine Spannbandbrücke von<br />
40 m Öffnung, die den Fußweg<br />
durch die Viamala über<br />
den Hinterrhein führt. Als Teil<br />
des „steinernen Wegs“ besteht<br />
ihr Gehweg aus Andeerer<br />
Granit-Platten, die<br />
über untenliegende Stahlbänder<br />
vorgespannt sind.<br />
Diese Vorspannung erhöht<br />
die Steifigkeit gegenüber einer<br />
konventionellen Konstruktion<br />
beträchtlich.<br />
Im Jahr 1996 wurde die Veia<br />
Traversina mit dem Traversiner<br />
Steg als erste Etappe<br />
des Wanderwegs durch die<br />
Viamala eröffnet. Für ihre<br />
Fortsetzung durch den südlichen<br />
Teil der Schlucht musste<br />
zwischen der Wildener<br />
Brücke und Rania ein neuer<br />
Weg angelegt werden, der<br />
nördlich der Viamalabrücke<br />
der Nationalstraße A13 den<br />
Hinterrhein überquert. Für<br />
die Projektierung dieses<br />
Flußübergangs veranstaltete<br />
der Verein KulturRaum<br />
Viamala im Herbst 1997 einen<br />
Ideenwettbewerb unter<br />
regionalen Ingenieurbüros.<br />
Situation<br />
Die Wahl des richtigen<br />
Standorts der Brücke erwies<br />
sich schwieriger, als auf den<br />
ersten Blick vermutet. Eine<br />
Brücke an der engsten Stelle<br />
des Flußlaufs erlaubt zwar<br />
eine kurze Konstruktion, der<br />
westliche Zugang müsste<br />
aber durch eine steil abfallende<br />
Felswand und eine<br />
daran anschließende Rüfe<br />
geführt werden. Zudem sollte<br />
die Wegführung von der<br />
darüberliegenden Aussichtskanzel<br />
der alten Viamala-Straße<br />
eingesehen<br />
werden können, um eine<br />
Gefährdung durch<br />
heruntergeworfene Gegenstände<br />
zu vermeiden. Eine<br />
Querung des Flusses im<br />
Norden führt zu ähnlichen<br />
Probleme auf der gegenüberliegenden<br />
rechten<br />
Flussseite; auch hier verhindern<br />
steile Felswände und<br />
rutschige Talflanken eine<br />
dauerhafte Weganlage. Somit<br />
erwies sich die Flussverbreiterung<br />
unterhalb Suransuns<br />
als bester Standort. Mit<br />
40 m Spannweite ist die<br />
Brücke zwar vergleichsweise<br />
lang, die Zugänge<br />
müssen dafür aber<br />
weder von Norden noch von<br />
Süden schwieriges Terrain<br />
durchqueren und der Respektabstand<br />
zu den<br />
obenliegenden Straßenbauten<br />
ist gewährleistet.<br />
Ein Spannband in Stein<br />
Das Tragwerk selbst entstand<br />
aus zwei Grundideen.<br />
Zum einen überzeugte das<br />
Spannbandsystem sowohl<br />
technisch als auch ästhetisch<br />
wegen der<br />
unterschiedlichen Höhen<br />
der beiden Ufer und der Forderung<br />
nach einem genügenden<br />
Durchflussprofil. Die<br />
zweite Idee war, den südlichen<br />
Abschnitt des Viamalawegs<br />
als steinernen Weg<br />
zu bauen. Der Gegensatz<br />
zur Veia Traversina mit ihren<br />
Holzbauten markiert damit<br />
die Kulturscheide zwischen<br />
Nord und Süd auch materiell,<br />
und die Wandernden er-<br />
115
Viamala<br />
Punt da Suransuns<br />
116<br />
halten einen Vorgeschmack<br />
auf die Plattenwege in Avers,<br />
im Bergell und Veltlin. Der<br />
scheinbare Gegensatz zwischen<br />
der Forderung nach<br />
einer leichten Konstruktion<br />
(wegen der Verankerung<br />
des Spannbands) und dem<br />
schweren Steinmaterial<br />
konnte durch die Vorstellung<br />
überwunden werden,<br />
ein dünner vorgespannter<br />
Steinbelag verhalte sich so,<br />
als wäre er eine einzige große<br />
monolithische Felsplatte.<br />
Dieses Prinzip ist eine Hommage<br />
an Heinz Hossdorf,<br />
der in den fünfziger Jahren<br />
für den Neubau der Teufelsbrücke<br />
eine vorgespannte<br />
Granitkonstruktion vorgeschlagen<br />
hatte.<br />
Materialien<br />
Als Stein wurde der in der<br />
Nähe gewonnene Andeerer<br />
Granit (korrekt: Andeerer<br />
Gneis) gewählt, weil er<br />
hervorragende physikalische<br />
Eigenschaften aufweist.<br />
Da die Brückenstelle<br />
von Salzsprühnebeln der<br />
obenliegenden Nationalstraße<br />
erreicht werden<br />
kann, wählte man für sämtliche<br />
Stahlteile V4A-<br />
Chromnickelstahl.<br />
Weil eine Vermörtelung der<br />
S t e i n f u g e n<br />
ausführungstechnisch nicht<br />
möglich war, sind die<br />
Stoßfugen der Steinplatten<br />
mit drei Millimeter dicken<br />
Aluminiumbändern gefüllt.<br />
Das kriechfähige Aluminium<br />
wird seit langem in der Glasbefestigung<br />
verwendet und<br />
dient hier als Mörtelersatz<br />
und Ausgleichsschicht.<br />
Tragwerk<br />
Das Spannband wirkt statisch<br />
ähnlich wie eine Hängebrücke,<br />
wenn man sich<br />
den Gehbelag gleichzeitig<br />
als Tragkabel und als Versteifungsträger<br />
vorstellt. Da<br />
der Versteifungsträger sehr<br />
schlank ist, kann die Berechnung<br />
in zwei Stufen<br />
durchgeführt werden. Zunächst,<br />
die Brücke als Ganzes<br />
betrachtet, wie ein biegeweiches<br />
Seil. Die Kräfte<br />
und Verformungen können<br />
am Seilpolygon bestimmt<br />
werden. Dabei muss der<br />
Horizontalzug (H) jeweils so<br />
angepasst werden, dass<br />
das elastisch verlängerte<br />
Polygon zwischen die festen<br />
Verankerungspunkte passt.<br />
Mit diesem Vorgehen ist der<br />
Einfluss zweiter Ordnung<br />
(unter Verformung) berücksichtigt<br />
und die iterative Bestimmung<br />
(iterativ = schrittweise<br />
in wiederholten Rechengängen<br />
der exakten<br />
Lösung annähernd) von H<br />
kann über ein Tabellenkalkulationsprogrammweitgehend<br />
vereinfacht werden.<br />
Das Verfahren ist im Gegensatz<br />
zur klassischen<br />
Formänderungstheorie der<br />
Hängebrücken anschaulich<br />
und übersichtlich.<br />
Der ‘Versteifungsträger“<br />
wirkt nur lokal, er glättet die<br />
Knicke der Biegelinie. Wenn<br />
diese Knickwinkel - vereinfachend<br />
- als gegebene,<br />
unveränderliche Werte betrachtet<br />
werden, bewirkt das<br />
Biegemoment im Versteifungsträger<br />
die Umwandlung<br />
dieser Knickwinkel in<br />
eine stetige Krümmung von<br />
einer gewissen Länge. Diese<br />
Länge ist von der Biegesteifigkeit<br />
des Trägers abhängig.<br />
Als statisches Modell<br />
dient ein unendlich langer<br />
Stab mit der Zugkraft H,<br />
auf den eine Einzellast wirkt.<br />
Wenn sich die Tangenten an<br />
den Biegelinien unter dem<br />
Knickwinkel des biegeweichen<br />
Seils schneiden, entspricht<br />
das Biegemoment<br />
einem oberen Grenzwert<br />
des wirklichen Trägers. In<br />
gleicher Weise können<br />
auch die Einspannmomente<br />
an den Verankerungsstellen<br />
berechnet werden.<br />
Dank der Vorspannung des<br />
Gehbelags dürfen für die<br />
Dehn- und Biegesteifigkeit<br />
des Spannbands ideelle<br />
Querschnittswerte eingesetzt<br />
werden, bei denen die<br />
Mitwirkung des Steins<br />
berücksichtigt ist. Die effek-
tive Biegesteifigkeit der aneinander<br />
gepressten Steinplatten<br />
wurde in einem Versuch<br />
mit fünf Steinplatten<br />
gemessen. Je nach Genauigkeit<br />
des Fugenschnitts ergaben<br />
sich daraus Abminderungen<br />
der Biegesteifigkeit<br />
auf weniger als die<br />
Hälfte des theoretischen<br />
Werts. Die Vorspannung erhöht<br />
auch die Steifigkeit gegen<br />
seitliche und drehende<br />
Einwirkungen. Die Frequenz<br />
der vertikalen Eigenschwingung<br />
ist deutlich<br />
niedriger als diejenige der<br />
ersten Torsionseigenform,<br />
so dass eine gefährliche<br />
Flatterschwingung ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
Aufgrund der einfachen<br />
Geometrie lässt sich der<br />
Horizontalzug bei 2kN/m<br />
ständiger Last sofort zu 400<br />
kN berechnen. Für die Bestimmung<br />
der Vorspannung<br />
wurde eine Nutzlast von<br />
ebenfalls 2 kN/m als ausreichend<br />
angesehen, so dass<br />
bei mittlerer Temperatur eine<br />
totale Kraft von 800 kN in die<br />
Zugbänder eingeleitet wurde.<br />
Für die Dimensionierung<br />
des Stahlquerschnitts ist die<br />
Ermüdung in den Einspannstellen<br />
bei den Auflagern<br />
maßgebend. Die entsprechenden<br />
Spannungen<br />
konnten durch „Blattfedern“<br />
im Auflagerbereich stark reduziert<br />
werden. Für die<br />
Spannungsberechnung<br />
wurden die Grenzfälle „homogener<br />
Querschnitt“ und<br />
„reibungsloser Querschnitt“<br />
untersucht und verglichen.<br />
Günstig ist dabei, dass der<br />
stählerne Hauptstrang mit<br />
seiner großen Zugkraft zwischen<br />
den obenliegenden<br />
Steinplatten und den zusätzlichen<br />
Stahllamellen gleichsam<br />
eingepackt ist und daher<br />
ziemlich genau in die<br />
neutrale Achse des Gesamtquerschnitts<br />
zu liegen<br />
kommt.<br />
Konstruktion<br />
Die Brücke ist in Trockenbauweise<br />
hergestellt, das<br />
heißt, nach dem Gießen der<br />
Viamala<br />
Punt da Suransuns<br />
Widerlager wird nur noch<br />
gestapelt, gespannt und geschraubt.<br />
Deshalb mussten<br />
die Widerlager mit hoher<br />
Präzision ausgeführt werden.<br />
Ein Geometer kontrollierte<br />
die Schalungen. Die<br />
vertikalen Schwerter, an denen<br />
die Zugbänder befestigt<br />
sind, wurden direkt in den<br />
Konstruktionsbeton eingegossen.<br />
Die Versorgung der<br />
Baustelle erfolgte per Helikopter,<br />
was wegen der kurzen<br />
Transportwege zur nahegelegenenKantonsstraße<br />
finanziell verantwortet<br />
werden konnte. Der Helikopter<br />
transportierte die relativ<br />
leichten Zugbänder als<br />
ganze Stücke in zwei Flügen<br />
an den Einbauort. Die Aufhängung<br />
bestand aus einer<br />
Seilharfe und einer quer liegenden<br />
provisorischen Verspannung.<br />
Nach dem Versetzen<br />
der Stahlbänder wurden<br />
die Granitplatten Stück<br />
für Stück vom unteren Widerlager<br />
her verlegt. Die<br />
Platten sind mit den Geländerpfosten<br />
an den Stahlbändern<br />
befestigt. Die<br />
untenliegenden Muttern zog<br />
man vorerst aber nur soweit<br />
an, dass sich die Steinplatten<br />
auf den Stahlbändern<br />
noch verschieben ließen.<br />
Der fertige Steinbelag wurde<br />
mit Stahlzwischenlagen<br />
gegen die Schwerter geschiftet,<br />
so dass sich die<br />
Platten beim Anspannen der<br />
Stahlbänder untereinander<br />
verkeilten und sich jetzt wie<br />
eine auf den Kopf gestellte<br />
Bogenbrücke verhalten.<br />
Nach dem Verkeilen der<br />
Stahl-Endblöcke wurden<br />
dann die Muttern der Geländerpfosten<br />
endgültig angezogen.<br />
Der Unternehmer<br />
schweißte darauf den Handlauf<br />
an Ort und Stelle auf die<br />
Geländerpfosten.<br />
Während der Projektierung<br />
wurde die Konstruktion an<br />
einem Modell im Maßstab<br />
1:20 überprüft. Drei Millimeter<br />
starke Granitplättchen<br />
bildeten dabei den Gehbelag<br />
nach. Die Ergebnisse<br />
der statischen Berechnungen<br />
ließen sich dabei zumindest<br />
qualitativ überprüfen,<br />
insbesondere fiel auch<br />
im Modell die große Torsionssteifigkeit<br />
auf. Die größte<br />
Unbekannte bildete die<br />
Voraussage des Schwin-<br />
117
Viamala<br />
Punt da Suransuns<br />
118<br />
gungsverhaltens, da für die<br />
Strukturdämpfung keine Erfahrungswerte<br />
vorlagen.<br />
Entsprechend vorsichtig<br />
wurden die maximalen<br />
Schwingungsamplituden für<br />
die Ermüdungsberechnung<br />
eingesetzt. Beim Überqueren<br />
der Brücke ist die vertikale<br />
Schwingung deutlich<br />
zu spüren, sie wird aber von<br />
den Passanten so kommentiert,<br />
dass die Brücke doch<br />
nicht so weich sei, wie sie<br />
aussehe. Damit betrachtete<br />
Jürg Conzett die Anforderung<br />
an die Gebrauchstauglichkeit<br />
als erfüllt.<br />
Ausblick<br />
Kurz vor Baubeginn an der<br />
Pùnt da Suransuns wurde<br />
der Traversiner Steg durch<br />
einen Felssturz zerstört.<br />
Gegenwärtig wird ein Wiederaufbau<br />
an einer etwa 70<br />
m rheinwärts gelegenen<br />
Stelle studiert. Aufgrund der<br />
Topografie ist eine stark geneigte<br />
Treppenbrücke sinnvoll,<br />
die wegen der deutlich<br />
unterschiedlich geneigten<br />
Talflanken eine Spannweite<br />
von etwa 50 m aufweisen<br />
wird.
Val Tschielbach-Brücke<br />
Donath<br />
Val Tschielbach-Brücke<br />
Standort: bei Donath<br />
Baujahr: 1925<br />
Bauherr: Kanton Graubünden<br />
Ingenieur: Robert Maillart<br />
Literatur: Bauwelt, Jg. 89, Nr. 15, 1998,<br />
Robert Maillart – Brückenschläge, Höhere<br />
Schule für Gestaltung Zürich Schriftenreihe, 1990,<br />
Robert Maillart, v. Max Bill<br />
Robert Maillart -<br />
Sein Leben und Wirken<br />
R. Maillart wurde 1872 in<br />
Bern geboren, wo er auch<br />
das Gymnasium besuchte.<br />
Von 1890 bis 1894 studierte<br />
er am Eidgenössischen<br />
Polytechnikum (der heutigen<br />
ETH) in Zürich. Nach<br />
Abschluss des Studiums<br />
kehrte er für drei Jahre nach<br />
Bern zurück und nahm<br />
dann 1897 eine Stelle beim<br />
Städtischen Tiefbauamt Zürich<br />
an. 1899 wechselte er<br />
zur Firma Froté & Westermann,<br />
wo er 1901 Gelegenheit<br />
hatte, beim Bau der Innbrücke<br />
Zuoz das von ihm<br />
entwickelte Brückenbausystem(Dreigelenk-Hohlkastengewölbe)<br />
erstmals auszuführen.<br />
Die Idee des hohlen<br />
Betonträgers wurde zu<br />
einer der Haupterneuerungen<br />
im Baubereich des 20.<br />
Jahrhunderts, und eine große<br />
Anzahl solcher Brücken<br />
wurde erbaut; es handelt<br />
sich dabei auch heute noch<br />
um eine der gebräuchlichsten<br />
Formen für Betonbrükken<br />
einer mittleren Spannweite.<br />
Maillarts erster Entwurf nach<br />
der Gründung seiner Firma<br />
Maillart und Co. am 1. Februar<br />
1902 war für ein Paar<br />
Wassertanks aus Beton, die<br />
als Gasometer für St.Gallen<br />
benützt wurden. Maillart entwickelte<br />
speziell dafür eine<br />
analytische Methode, die als<br />
erste korrekte Annäherung<br />
an die Problematik der<br />
dünnwandigen Schalen aus<br />
Beton gelten muss. Seine<br />
Methode wurde denn auch<br />
von Europas leitendem, frühen<br />
Förderer des Eisenbetons,<br />
Fritz von Emperger,<br />
anerkannt, der Maillarts Entwurf<br />
und Analyse in seinem<br />
Handbuch für Eisenbetonbau<br />
erwähnt. Für diese<br />
Tanks wurde weitaus weniger<br />
Material gebraucht, als<br />
dies in dem von der Stadt<br />
vorgeschlagenen Entwurf<br />
der Fall gewesen wäre. Es<br />
folgte die bedeutende Entwicklung<br />
der unterzugslosen<br />
Pilzdecke mit internationalen<br />
Patenten. Der erste<br />
ausgeführte Bau mit Pilzdecken<br />
war das Zürcher<br />
Lagerhaus Giesshübel, bei<br />
welchem die Stützen nahtlos<br />
in die Platten über den<br />
gebogenen Kapitellen übergehen.<br />
Ein Jahr später erhielt<br />
Robert Maillart einen<br />
Lehrauftrag am Polytechnikum.<br />
Vor allem dank diesem neuartigen<br />
Deckensystem gelang<br />
ihm der internationale<br />
Durchbruch. Sein Unternehmen<br />
erstellte ab 1912<br />
nun Bauwerke in Spanien,<br />
Russland, Frankreich, Italien,<br />
Finnland und Ägypten.<br />
Dazwischen baute Maillart<br />
Brücken in der Schweiz. Der<br />
Ausbruch des Ersten Weltkriegs<br />
überraschte ihn in<br />
Riga, wo er gerade am Bau<br />
einer großen Fabrik arbeitete.<br />
1918, nach der Revolution,<br />
kehrte er verwitwet und<br />
mittellos in die Schweiz zurück.<br />
Robert Maillart begann eine<br />
neue Laufbahn als projektierender<br />
Ingenieur. 1919 eröffnete<br />
er ein Bauingenieur-<br />
Büro in Genf, 1924 ein<br />
Zweigbüro in Bern und<br />
1929 ein weiteres in Zürich.<br />
Hier gelang ihm - neben<br />
Dreigelenk-Hohlkastengewölbe<br />
und Pilzdecke - seine<br />
dritte wichtige Erfindung:<br />
119
Donath<br />
Val Tschielbach-Brücke<br />
120<br />
das Brückenbausystem des<br />
versteiften Stabbogens.<br />
Maillarts Ziel bei dieser Art<br />
von Konstruktion war zunächst<br />
einmal die Herstellung<br />
eines Bogentragwerkes,<br />
das sehr dünn sein sollte,<br />
um dadurch die Baukosten<br />
niedrig zu halten, und<br />
zuletzt, eine Form zu schaffen,<br />
welche die reine strukturelle<br />
Eleganz zum Ausdruck<br />
bringen würde. Im<br />
Jahre 1933 entwickelte er<br />
dann mit der Schwandbach-<br />
Brücke seinen bekanntesten<br />
Entwurf dieses Typs.<br />
Sein eigentlicher Verdienst<br />
im Hochbau liegt in der Entwicklung<br />
der unterzugslosen<br />
Pilzdecke. Maillart gelangen<br />
neuartige und bahnbrechende<br />
Bauten, die ihn<br />
zum bedeutendsten schweizerischen<br />
Bauingenieur des<br />
beginnenden 20. Jahrhunderts<br />
machten. Maillart starb<br />
am 5. April 1940 in Genf.<br />
Gestalt<br />
Die Val Tschielbachbrücke,<br />
welche sich bei Donath in<br />
der südöstlichen Schweiz<br />
befindet, drückt sich beidseitig<br />
gegen den felsigen Untergrund<br />
um die kleine<br />
Schlucht zu überwinden.<br />
Sie wurde wie viele andere<br />
Brücken in den zwanziger<br />
Jahren in dieser Gegend der<br />
Schweiz gebaut, um die Infrastruktur<br />
dieses schlecht<br />
erschlossenen Gebietes zu<br />
verbessern. Viele kleine,<br />
schwierig zu erreichende<br />
Bergdörfer drohten durch<br />
Abwanderung zu veröden<br />
und um diese Kulturlandschaft<br />
zu retten, beschloss<br />
man, durch ein Straßennetz,<br />
welches viele Brücken beinhaltete,<br />
die An- und Abfuhr<br />
von Gütern zu erleichtern.<br />
Da sich das Projekt volkswirtschaftlich<br />
nicht rechnete,<br />
war man auf eine möglichst<br />
wirtschaftliche Ausführung<br />
des Straßen- und Brückenbaus<br />
bedacht.<br />
Die Straßenbrücke über das<br />
Val Tschiel ist der früheste<br />
versteifte Stabbogen Mail-<br />
larts, der in seiner ursprünglichen<br />
Form erhalten ist. Diese<br />
Brücke besteht aus einem<br />
biegungsfesten Versteifungsbalken,<br />
(der Fahrbahnplatte<br />
und den beiden<br />
Brüstungen), mit welchem<br />
der Stabbogen selbst durch<br />
Stützenscheiben, in Abständen<br />
von 3,14 m verbunden<br />
ist, woraus sich ein vollständig<br />
versteiftes Tragwerk ergibt.<br />
Diese Stabbogenbrücke<br />
spannt über 43,2 Meter. Die<br />
gleichmäßigen Lasten wie<br />
die Eigenlast und die<br />
Schneelast werden über<br />
den 20 bis 29 cm dicken<br />
Betonbogen abgetragen.<br />
Die Fahrbahn ist nur 16 cm<br />
dick, wird aber durch die<br />
Brüstungsträger mit einer<br />
Höhe von 1,02 m versteift.<br />
Maillart ging davon aus,<br />
dass die Fahrbahn die gesamten<br />
Biegemomente<br />
durch ungleiche Lasten aufnehmen<br />
werde.<br />
Maillart, der sich bei dieser<br />
Brücke wie auch bei seinen<br />
anderen Bauwerken damit<br />
beschäftigt hatte, eine möglichst<br />
kostengünstige Lösung<br />
zu finden, verwendete<br />
eine eingespannte Stabbogenbrücke<br />
mit versteifter<br />
Fahrbahn. Maillart passte<br />
die Brücke nicht der Kurve<br />
der Wegeführung an, sondern<br />
spannt die Brücke gerade<br />
über die Schlucht.<br />
Auch ist die Brücke waagerecht,<br />
um auf einfachere Annahmen<br />
zurückgreifen zu<br />
können. Die Widerlager,<br />
welche nicht wie der Rest<br />
des Bauwerkes in Eisenbeton,<br />
sondern steinern ausgeführt<br />
sind, nehmen diesen<br />
gekrümmten Straßenverlauf<br />
trichterförmig auf und leiten<br />
ihn dann auf die schmale,<br />
gerade Brücke. Das Wider-
lager hat einen romanisch<br />
anmutenden Ausschnitt,<br />
welcher das Widerlager<br />
leichter macht und zugleich<br />
strukturiert. Außerdem besitzt<br />
es eine massive Brüstung<br />
aus dem gleichen steinernen<br />
Material mit Schneelöchern,<br />
wie sie auch in der<br />
Eisenbetonkonstruktion des<br />
Trägers zu finden sind. Die<br />
Schneelöcher sind im Bereich<br />
des Bogens immer<br />
zwischen den Stützenscheiben<br />
angeordnet, die Fahrbahn<br />
und Bogen verbinden.<br />
Der Brückenträger ist vollständig<br />
aus Eisenbeton und<br />
lehnt sich nicht wie das Widerlager<br />
an traditionelle<br />
Bauweisen an. Auffällig ist<br />
die dicke Fahrbahn im Verhältnis<br />
zum schlanken Bogen.<br />
Die Fahrbahn bildet mit<br />
der massiven Brüstung einen<br />
trogförmigen Träger.<br />
Die Brüstung schließt mit<br />
einen dickeren Betonbalken<br />
ab, der nach außen hin etwa<br />
10 cm übersteht und damit<br />
eine Schattenkante bildet,<br />
welche die Brüstung alleine<br />
schlanker und strukturierter<br />
erscheinen lässt. Zudem<br />
rhythmisieren die Schneelöcher,<br />
in Form eines Halbkreises<br />
den Fahrbahnträger.<br />
Dazu ist in der Brüstung<br />
unter dem überstehenden<br />
Balken ein kleiner horizontaler<br />
Versatz in der Fläche.<br />
Dieser endet mit der letzen<br />
Querwand, die direkt am<br />
Widerlager sitzt. Der Bogen,<br />
der mit diesen dünnen<br />
Querwänden in regelmäßigen<br />
Abständen mit der<br />
Fahrbahn in Verbindung<br />
steht, verschmilzt im mittleren<br />
Bereich mit der Fahrbahn.<br />
In der Mitte geht der<br />
Bogen bis auf wenige Zentimeter<br />
in der Fahrbahn auf<br />
und das verstärkt den<br />
schlanken Eindruck der gesamten<br />
Konstruktion. Die<br />
dünnen Stützenscheiben<br />
sind mit Vouten ausgebildet,<br />
wo sie an die Fahrbahn stoßen,<br />
und treffen unten in ihrem<br />
normalen Querschnitt<br />
auf den Bogen. Der Bogen<br />
selbst ist von der Unterseite<br />
her gerundet und von der<br />
Oberseite polygonal ausgeführt.<br />
Mit der gerundeten<br />
Unterseite konnte Maillart<br />
sich nicht von der traditionellen<br />
Vorstellung der Brücke<br />
lösen und hat damit in die-<br />
Donath<br />
Val Tschielbach-Brücke<br />
sem Punkt nicht konsequent<br />
nach einer preiswerteren<br />
Lösung gesucht. Die<br />
Einspannung des Bogens<br />
wird optisch durch eine<br />
trichterförmige Aufweitung<br />
der Dicke zum Widerlager<br />
hin sichtbar. Letztlich kann<br />
man sagen, dass der Bogen<br />
dank des felsigen Untergrundes<br />
eine geringe Höhe<br />
hat und dadurch das Bauwerk<br />
dynamisch und spannungsvoll<br />
wirkt.<br />
Prof. Dr.-Ing. M. Ros beschreibt<br />
das Bauwerk folgendermaßen:<br />
„Die zwei<br />
Versteifungsträger, gleichzeitig<br />
als massive Brückenbrüstungen<br />
dienend, werden<br />
durch die 16 cm starke<br />
Fahrbahnplatte zu einem<br />
einheitlichen Trog, dem eigentlichenVersteifungsbalken<br />
verbunden, dessen<br />
Quersteifigkeit durch die<br />
vollwandigen Stützen, die<br />
als auf die ganze Brückenbreite<br />
durchgehende Querwände<br />
ausgebildet sind, gewährleistet<br />
wird. Der vollwandige<br />
Stabbogen und die<br />
Fahrbahnplatte bilden die<br />
waagerechten Verspannungen,<br />
die waagerechte Kräfte<br />
aufzunehmen und auf die<br />
Widerlager zu übertragen<br />
vermögen. Das Traggebilde<br />
für lotrechte Kräfte, Stabbogen<br />
und Versteifungsträger<br />
und die beiden waagerechten<br />
Verspannungen, durch<br />
die vorerwähnten Querwände<br />
verbunden, gewährleisten<br />
die räumliche Stabilität.“<br />
Der schlanke Betonbogen<br />
mit einer Dicke, die gerade<br />
genügt, um die Längskräfte<br />
aufzunehmen und den Aufbau<br />
sicherzustellen, wird auf<br />
ein Leergerüst aufgebaut,<br />
das schon an sich wesentlich<br />
günstiger zu errichten<br />
ist, als ein solches, das die<br />
ganze Brückenlast aufnehmen<br />
müsste. Die Biegemomente<br />
werden durch den<br />
aus der Fahrbahnplatte und<br />
den beiden Brüstungen gebildeten<br />
Versteifungsträger<br />
aufgenommen. Konstruktiv<br />
handelt es sich also um einen<br />
mit einem biegefesten<br />
Balken versteiften Stabbogen,<br />
zwischen dem in Abständen<br />
von einigen Metern<br />
Vollwandstützen, also Querwände,<br />
die Verbindung herstellen.<br />
121
Donath<br />
Val Tschielbach-Brücke<br />
122<br />
Die Bezeichnung „Stabbogen“<br />
erscheint bei den ersten<br />
Ausführungen noch<br />
zutreffend. Allerdings ist<br />
schon bei der Val Tschiel-<br />
Brücke die Bogenaufsicht<br />
als Polygon ausgebildet,<br />
währenddessen die Untersicht<br />
noch im Bogen geführt<br />
ist, um einer ästhetischen<br />
Tradition zu genügen. Der<br />
Landquart-Viadukt von Maillart<br />
ist jedoch vollständig<br />
polygonal ausgeführt, desgleichen<br />
die späteren „versteiften<br />
Stabbogen“, zu denen<br />
man richtigerweise eigentlich<br />
„versteifte Stabpolygone“<br />
sagen müsste.<br />
Bogenbrücke mit versteifter<br />
Fahrbahn<br />
Prof. Wilhelm Richter fand<br />
schon um 1890, dass der<br />
Bogen sehr dünn werden<br />
kann, wenn man dafür die<br />
Fahrbahntafel biegesteif<br />
macht, so dass sie die Biegemomente<br />
aus der ungleichen<br />
Verkehrslast aufnimmt.<br />
Als Maillart dies 1924<br />
in konkreten Entwürfen zur<br />
Anwendung brachte, gab es<br />
viele Skeptiker. Das Ingenieurwesen<br />
verstand sich<br />
seit Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
zunehmend als<br />
angewandte Wissenschaft.<br />
Hierzu gehörte die mathematische<br />
Analyse und Berechnung<br />
der Bauwerke.<br />
Versteifte Bogenbrücken<br />
waren damals nicht zu berechnen,<br />
so dass viele Ingenieure<br />
sie ablehnten. Eine<br />
Forschungsarbeit der American<br />
Society of Civil Engineers<br />
von 1935 befand die<br />
technische Analyse einer<br />
solchen Konstruktion als zu<br />
kompliziert und zu langwierig<br />
und betrachtete vielmehr<br />
den gegenteiligen Fall einer<br />
Unterbindung des versteifenden<br />
Effektes der Fahrbahnplatte.<br />
Für Maillart war das Verhalten<br />
einer Konstruktion unter<br />
Last so einfach und sinnfällig,<br />
dass die Probleme einer<br />
mathematisch Analyse da-<br />
bei praktisch verschwanden.<br />
Es war für ihn nicht<br />
notwendig, die Beziehung<br />
zwischen einfachen Formeln<br />
und einer generellen<br />
Theorie darzulegen, da das<br />
gebaute Resultat unmittelbar<br />
im Maßstab 1:1 geprüft<br />
werden konnte. Eine zweite<br />
Arbeit zum Thema Bogenbrücken<br />
wurde kurz nach<br />
Maillarts Tod von einem<br />
Schüler Max Richters, einem<br />
langen Widersacher<br />
Maillarts, publiziert. Diese<br />
Studie deckt auf, was Maillart<br />
fast zwanzig Jahre zuvor<br />
schon erfasst hatte, dass es<br />
in der Tat zwei verschiedene<br />
Theorien zu versteiften<br />
Stabbogenbrücken gibt. Bei<br />
der einen wird die Verbindung<br />
zwischen Bogen und<br />
Fahrbahn als vollständig angenommen,<br />
bei der anderen<br />
liegen die Verbindungspunkte<br />
so weit auseinander,<br />
dass sie als freistehende Unterstützungen<br />
aufzufassen<br />
sind. Die Entscheidung zwischen<br />
den beiden Theorien<br />
hängt von der vorausgegangenen<br />
Wahl der Brückenform<br />
ab und nicht vom Beweis<br />
der Angemessenheit<br />
dieser Wahl im Vergleich zu<br />
einer “richtigeren“ generellen<br />
Theorie für alle Formen.<br />
Eine weitere Bestätigung für<br />
Maillart gibt die Arbeit im<br />
Bezug auf das optimale Verhältnis<br />
von Steifigkeit der<br />
Fahrbahn [IF] zur Steifigkeit<br />
des Bogens [IB]. Die Spannungen<br />
im Bogen bei<br />
gleichmäßiger Belastung einer<br />
Brückenhälfte nehmen<br />
bis zum Verhältnis 2:1 [IF:IB]<br />
zu, um hier wieder abzufallen.<br />
So sollte man also einen<br />
dünnen Bogen mit einer<br />
stark versteiften Fahrbahn<br />
bauen, oder genau umgekehrt.<br />
Selbst wenn Maillart<br />
die mathematisch wissenschaftlichen,<br />
nach einer generellen<br />
Theorie suchenden<br />
Ingenieure immer ablehnte,<br />
wurden viele seiner Annahmen<br />
durch diese später bestätigt.<br />
Martin Söding, Jens Kroell
Traversiner Steg<br />
Viamala<br />
Traversiner Steg<br />
Standort: Viamala Schlucht<br />
Baujahr: 1996<br />
Bauherr: Verein KulturRaum Viamala, Chur<br />
Ingenieur: Jürg Conzett, (Conzett, Bronzini, Gartmann AG)<br />
Literatur: db-deutsche-bauzeitung, Jg. 132, Nr. 5, 1998,<br />
Detail, Jg. 39, Nr. 8, 1999,<br />
Hochparterre, Jg. 10, Nr. 12, 1997,<br />
mikado, Nr. 12, 1996,<br />
Neues Bauen in den Alpen, Architekturpreis 1999,<br />
Schweizer-Ingenieur-und-Architekt, Jg.115, Nr.1/2,<br />
1997,<br />
Topos, Nr. 36, 2001<br />
Obwohl die Brücke 1999<br />
durch einen Steinschlag zerstört<br />
und nicht mehr wiederhergestellt<br />
wurde, soll sie<br />
hier beschrieben werden.<br />
Historisch ist der Traversiner<br />
Steg auf die alten römischen<br />
Wegspuren im Traversina<br />
Tobel zurückzuführen. Idee<br />
war es, im Zuge eines Museumsprojektes<br />
„Kultur-<br />
Raum Viamala“ die alten römischen<br />
Pfade wiederherzustellen.<br />
Eine komplette<br />
Rekonstruktion dieser<br />
Wege wäre allerdings zu kostenintensiv<br />
gewesen. So<br />
entschloss man sich durch<br />
Fußgängerbrücken die<br />
Wegfragmente miteinander<br />
zu verbinden - eine davon<br />
war der Traversiner Steg des<br />
jungen Schweizer Ingenieurs<br />
Jürg Conzett.<br />
An einigen Stellen ist der<br />
Traversina Tobel bis zu<br />
sechshundert Meter tief und<br />
die Stelle, wo die Brücke errichtet<br />
wurde, ist für große<br />
Baumaschinen unzugänglich.<br />
Der Steg musste deshalb<br />
mit einem Hubschrauber<br />
eingeflogen werden,<br />
wodurch das Gewicht des<br />
47 m langen Trägers auf<br />
maximal 4,3 t beschränkt<br />
war; eine strenge Anforderung,<br />
die von Anfang an für<br />
die Projektierung maßgebend<br />
war und zu einem ungewöhnlichen<br />
leichten Drei-<br />
gurt-Fachwerk aus Holz<br />
und Stahl führte.<br />
Aufgrund dieser natürlichen<br />
Gegebenheiten schieden<br />
konventionelle Hängebrükken<br />
mit Rückverankerung<br />
ebenso aus wie Bogenoder<br />
Balkenbrücken.<br />
Situation<br />
Das südliche Widerlager der<br />
Brücke lag auf einem leicht<br />
ins Tobel vorspringenden<br />
Felskopf, unmittelbar neben<br />
den Spuren des historischen<br />
Pfades. Deutlich erkennbar<br />
führt der alte Weg<br />
von diesem Punkt aus etwa<br />
horizontal ins Traversiner<br />
Tobel hinein, die Wegspuren<br />
brechen aber nach wenigen<br />
Metern an einer senkrechten<br />
Felswand ab. Auf<br />
der Nordseite des Tobels<br />
verlaufen die Wegspuren<br />
mehrere Meter höher, hier<br />
war das Widerlager deshalb<br />
etwas niedriger platziert.<br />
Das nördliche Widerlager<br />
lag gut acht Meter über der<br />
Kante des darunterliegenden<br />
Felsabbruchs, womit<br />
trotz der talwärts fallenden<br />
Schieferung dieser Talflanke<br />
eine genügende Sicherheit<br />
gegen Abgleiten gewährleistet<br />
war. Über einige<br />
neu angelegte Trittstufen<br />
und eine Kehre gelangte<br />
man vom nördlichen<br />
Brückenende wieder auf<br />
den alten Weg.<br />
123
Viamala<br />
Traversiner Steg<br />
124<br />
Tragwerk<br />
Hauptmerkmal der Brücke<br />
ist eine hybride Tragwerkskonstruktion<br />
mit hoher Redundanz,<br />
die sich zum einen<br />
durch den „Schnitz“, einen<br />
unterspannten Parabelträger<br />
als Dreigurt-Fachwerkträger<br />
mit hölzernen Druckgurt,<br />
und zum anderen<br />
durch den optisch schweren<br />
Überbau aus Gehweg und<br />
vollwandigen Brüstungen<br />
darstellt. Der „Schnitz“, die<br />
eigentliche tragende Konstruktion,<br />
besteht aus einem<br />
Leimholzbinderdruckgurt<br />
mit Querschnitt 8 x 44,5 cm,<br />
zwei Edelstahlseilen ∅ 24<br />
mm und Pfosten aus 4 sägerauen<br />
Lärchenhölzern 30<br />
x 80 mm und Diagonalverbänden<br />
aus Edelstahlseilen<br />
∅ 8 mm.<br />
Zur Aussteifung gegen seitliche<br />
Windkräfte waren die<br />
Untergurtseile bis zu 4 m<br />
gespreizt worden. Die Spreizung<br />
ist notwendig, damit<br />
eine zunehmende Seitenwindeinwirkung<br />
kein Versagen<br />
des luvseitigen Seiles<br />
bewirkt, bei einem solchem<br />
Fall hebt die Konstruktion ab<br />
und kippt über das leeseitige<br />
Tragseil. Um dieser Situation<br />
entgegenzuwirken,<br />
hilft ausschließlich die Geometrie<br />
und das Verhältnis<br />
von Brückengewicht zu<br />
Windlast.<br />
So ist der Unterbau in sich<br />
steif und kann Biegemomente<br />
ableiten. Der nur auf<br />
zwei Punkten gelagerte<br />
Schnitz kann diese Kräfte<br />
nicht in die Auflager einleiten<br />
und würde schon bei<br />
geringen Windlasten zu<br />
pendeln beginnen. Die<br />
Einleitung der Torsionskräfte<br />
aus horizontalen<br />
Windlasten übernimmt<br />
beim Traversiner Steg die<br />
überlagerte Gehwegs- und<br />
Brüstungskonstruktion.<br />
Deshalb ist die Brüstung<br />
im Auflagerbereich gegen<br />
die Biegebeanspruchung<br />
mit aufgeleimten Gurthölzern<br />
in den äußeren drei<br />
Feldern verstärkt worden.<br />
Der überlagerte schwere<br />
Überbau aus Gehweg und<br />
vollwandigen Brüstungen<br />
mit einer Höhe von 1,2 m<br />
und einer Breite von ebenfalls<br />
1,2 m stützt sich über<br />
verlängerte Geländerpfosten<br />
auf den Diagonalstreben<br />
des Schnitzes ab. Der<br />
Überbau wurde nachträglich<br />
auf dem eingeflogenen<br />
Träger Feld für Feld von den<br />
Seiten nach Innen aufgebaut.<br />
Im Anschluss erfolgte die<br />
Montage der liegenden<br />
Brettschichtholzscheibe.<br />
Sie setzt sich aus insgesamt<br />
vier Teilen zusammen, die<br />
als zusätzliche Windscheibe<br />
zum Schnitz und als Witterungsschutz<br />
des Druckgurtes<br />
dient. Darüber wurde der<br />
Gehbelag aufgebracht, der<br />
sich aus Lagerhölzern und<br />
Nut- und Federbrettern zusammensetzt.<br />
Bei den dünnen Brüstungselementen<br />
wurden die Stöße<br />
jeweils in die Mitte zwischen<br />
zwei Geländerpfosten<br />
gelegt und anschliessend<br />
mit außen angebrachten<br />
Stoßlaschen verschraubt<br />
und verleimt.<br />
Durch die exakte Einpassung<br />
der Stoßlaschen zwischen<br />
die Geländerpfosten,<br />
wird die Brüstung als eine<br />
durchgehende Platte wahrgenommen.<br />
Bauausführung<br />
Im Frühjahr 1994 wurde das<br />
Bauprojekt den Mitgliedern<br />
des Vereins KulturRaum<br />
Viamala und der Öffentlichkeit<br />
vorgestellt. Über Sponsoring<br />
und öffentliche Beiträ-
ge konnte innerhalb von<br />
zwei Jahren die Finanzierung<br />
der Brücke gesichert<br />
werden. Im Februar 1996<br />
erfolgte der definitive Baubeschluss<br />
und im April begannen<br />
die Arbeiten an den Widerlagern.<br />
Gleichzeitig erfolgte<br />
der Zusammenbau<br />
der Unterkonstruktion, etwa<br />
500 m von der Einbaustelle<br />
entfernt. Besonders zu erwähnen<br />
bleibt die millimetergenaue<br />
Abbundarbeit der<br />
ausführenden Holzbaufirmen.<br />
Schon während des<br />
Abbunds wurde das Gewicht<br />
der Konstruktionsteile<br />
stichprobenweise überprüft.<br />
Nach Beendigung des Aufrichtens<br />
wurde der ganze<br />
Unterbau an jedem Auflager<br />
mit einer Federwaage angehoben.<br />
Die daraus resultierenden<br />
Werte stimmten innerhalb<br />
der Messtoleranzen<br />
mit den berechneten überein.<br />
Der Einflug erfolgte am<br />
18.Juni 1996, dabei hing die<br />
Brücke in 60 Meter Anhängedistanz<br />
vom Helikopter,<br />
wodurch die Abtriebskräfte<br />
des Rotors gering blieben.<br />
An der Einbaustelle wurde<br />
die Brücke gefasst und nach<br />
unten in ihre definitive Lage<br />
gezogen. Die weiteren Montagearbeiten<br />
erfolgten speditiv,<br />
so dass der Traversiner<br />
Steg Mitte Juli 1996 für<br />
Wanderer freigegeben<br />
wurde.<br />
System<br />
Dreigurt-Fachwerkträger<br />
in Holz- Stahl- Konstruktion<br />
mit gespreizten Untergurten<br />
und biegesteifen<br />
Brüstungen. Damit wird<br />
der Travesiner Steg zu einem<br />
überlagerten komplexen<br />
System von hoher<br />
Redundanz. Dies wirkt sich<br />
insbesondere auf die Auswechselbarkeit<br />
von Einzelteilen<br />
des Tragwerks aus.<br />
Technische Daten<br />
Spannweite<br />
47,00m<br />
Höhe über Grund<br />
38,00 m<br />
Gehwegbreite<br />
1,20m<br />
Geländerhöhe<br />
1,10 m<br />
Pfeilhöhe<br />
5,00 m<br />
Gewicht Unterbau<br />
4,13 t<br />
Gewicht Überbau 8,13 t<br />
Tragfähigkeit<br />
2,5 kN/m²<br />
Schneelast<br />
3,0kN/m²<br />
Baukosten<br />
390.000,- DM<br />
Viamala<br />
Traversiner Steg<br />
Materialien<br />
Druckriegel in Lärchen-<br />
Brettschichtholz 8 x 44,5<br />
cm, wetterfest verleimt, Festigkeitsklasse<br />
A<br />
Untergurtseile in Edelstahl,<br />
einlagiges Rundlitzenseil, 6<br />
x 36 + 1 SES, Werkstoff<br />
1.4401, Durchmesser<br />
24mm<br />
Pfosten und Querträger in<br />
Lärchen – Schnittholz, Festigkeitsklasse<br />
1, sägerau<br />
Gehweg- Unterkonstruktion<br />
(Windscheibe) in Lärchen-<br />
Brettschichtholz, 80mm,<br />
wetterfest verleimt Festigkeitsklasse<br />
B<br />
Gehbelag als Verschleißschicht<br />
in Lärchenschalung<br />
30 mm, Nut und Feder<br />
Brüstung aus Dreischichtplatten<br />
K1 – Multiplan in<br />
Douglasie 26 mm<br />
Ausfachungen mit<br />
Stahlstangen RODAN, verzinkt,<br />
Durchmesser 8 mm<br />
Holger Meyer, Manuel Kleen<br />
125
Viamala<br />
Traversiner Steg<br />
126<br />
Überlagerung<br />
Schnitz mit Aussteifungen<br />
Querschnitt Auflager
Engadiner Nusskuchen<br />
Für den Teig:<br />
300 g Mehl<br />
150 g Zucker<br />
1 Ei<br />
1 Prise Salz<br />
160g Butter<br />
Mehl zum Ausrollen<br />
Für die Füllung:<br />
20g Butter<br />
300g Zucker<br />
250g grobgeschnittene Walnüsse<br />
1/4 l Sahne<br />
Zum Bestreichen:<br />
1 Eigelb<br />
Zubereitungszeit: 30 Minuten.<br />
Kühlzeit: 30 Minuten.<br />
Backzeit: 30-40 Minuten.<br />
So wird’s gemacht:<br />
Das Mehl in eine Backschüssel<br />
geben. In die Mitte<br />
eine Mulde drücken. Den<br />
Zucker, das Ei und das Salz<br />
hineingeben. Die Butter in<br />
Flöckchen auf dem Mehlrand<br />
verteilen. Die Zutaten in<br />
der Mulde verrühren. Von<br />
außen nach innen einen<br />
Mürbeteig kneten. Den Teig<br />
zugedeckt 30 Minuten in<br />
den Kühlschrank stellen.<br />
Inzwischen für die Füllung<br />
die Butter in einem Topf zerlassen<br />
und nach und nach<br />
den Zucker hineingeben.<br />
Unter ständigem Rühren<br />
hellbraun werden lassen.<br />
Die zerkleinerten Walnüsse<br />
mit der Sahne zugeben und<br />
zweimal aufkochen lassen.<br />
Die Nussmasse fast kalt<br />
werden lassen.<br />
Engadin<br />
Nusskuchen<br />
Den Backofen vorheizen:<br />
Elektroherd auf 200°, Gasherd<br />
Stufe 3.<br />
Zwei Drittel des Teiges auf<br />
einer bemehlten Arbeitsfläche<br />
ausrollen.<br />
Eine ungefettete Springform<br />
damit auskleiden.<br />
Den überstehenden Teig am<br />
Rand abschneiden.<br />
Den restlichen Teig zu einer<br />
runden Platte ausrollen.<br />
Die Nussmasse in die Form<br />
auf den Teig füllen und glattstreichen.<br />
Das Eigelb verquirlen. Den<br />
Teigrand damit bestreichen.<br />
Die Teigplatte auflegen und<br />
am Rand fest andrücken.<br />
Die Platte mit dem restlichen<br />
Eigelb bestreichen.<br />
Mit einer Gabel Löcher hineinstechen.<br />
Die Form in den Ofen auf die<br />
mittlere Leiste stellen. Den<br />
Teig 30-40 Minuten backen.<br />
Die Form aus dem Ofen<br />
nehmen und den Kuchen<br />
auf dem Kuchengitter abkühlen<br />
lassen.<br />
Natürlich schmeckt der Engadiner<br />
Nusskuchen auch<br />
ohne - aber mit einer großen<br />
Portion Schlagsahne ist er<br />
noch besser.<br />
127
Impressum:<br />
Erscheinungsdatum: 17.5.2002<br />
Herausgeber: Institut für Tragwerksentwurf<br />
und Bauweisenforschung<br />
Schloßwender Str.1<br />
D 30159 Hannover<br />
Redaktion:<br />
Text: Thomas Schubert<br />
Layout: Heidi Drossel<br />
Die Beiträge von Studierenden wurden redaktionell<br />
überarbeitet. Die Verfasser sind in diesem Fall am<br />
Textende genannt.<br />
Impressum