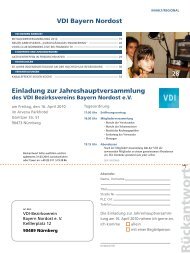Was droht und wenn warum? - Technik in Bayern
Was droht und wenn warum? - Technik in Bayern
Was droht und wenn warum? - Technik in Bayern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dipl.-Phys. Gerhard Grosch<br />
Redaktion TiB<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
<strong>Was</strong> <strong>droht</strong> <strong>und</strong> <strong>wenn</strong> <strong>warum</strong>?<br />
Das fragt sich jeder Schachspieler nach e<strong>in</strong>em<br />
gegnerischen Zug <strong>und</strong> bemüht sich meist vergeblich,<br />
mehr als zwei oder drei Züge richtig vorauszuplanen.<br />
Und Schach ist e<strong>in</strong>fach im Vergleich<br />
zum Leben, wo sich Prognosen regelmäßig als<br />
falsch erweisen.<br />
„Die Notwendigkeit zu entscheiden ist stets<br />
größer als das Maß der Erkenntnis“ philosophierte<br />
Immanuel Kant. Und Benjam<strong>in</strong> Frankl<strong>in</strong><br />
me<strong>in</strong>te salopp: „In dieser Welt ist nichts sicher<br />
außer Tod <strong>und</strong> Steuern“. Diese Aussagen beschreiben<br />
unsere f<strong>und</strong>amentale Unsicherheit:<br />
egal, was wir tun oder lassen, überall spielt der<br />
Zufall mit, alles kann riskant se<strong>in</strong>. Dennoch müssen<br />
wir jeden Tag entscheiden, welche Risiken<br />
wir e<strong>in</strong>gehen. Heutzutage heißt das nonchalant<br />
„no risk, no fun“, aber es geht ja meist nicht um<br />
Spaß. Aber wie entscheiden wir uns? Aus dem<br />
Bauch, mit dem Kopf? Die Evolution hat Optimisten<br />
<strong>und</strong> Pessimisten hervorgebracht <strong>und</strong> dass<br />
ke<strong>in</strong>e der beiden Varianten ausgestorben ist, bedeutet<br />
wohl, dass beide notwendig s<strong>in</strong>d: die Optimisten,<br />
um Neues zu wagen <strong>und</strong> die Pessimisten,<br />
um dabei nicht Kopf <strong>und</strong> Kragen zu riskieren.<br />
Unser Bestreben nach Risikom<strong>in</strong>imierung<br />
(ganz wesentlich auch durch <strong>Technik</strong>) führte zu<br />
dem Paradoxon, dass das <strong>in</strong>dividuelle Leben heute<br />
sicherer ist als je zuvor, andererseits aber neuartige,<br />
oft globale Großrisiken entstanden s<strong>in</strong>d.<br />
Diese s<strong>in</strong>d für uns besonders <strong>in</strong>transparent <strong>und</strong><br />
oft schwer zu begreifen, was möglicherweise zu<br />
wachsender Risikoaversion bei vielen Menschen<br />
geführt hat. Andere Gründe für diese Risikoabneigung<br />
mögen der Machbarkeitsglaube des modernen<br />
Menschen se<strong>in</strong> <strong>und</strong> auch unsere langfristige<br />
Lebensperspektive: wir <strong>in</strong>vestieren sehr viel <strong>in</strong><br />
Ausbildung, Altersvorsorge oder <strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heit<br />
<strong>und</strong> davon wollen wir doch etwas haben. Auch die<br />
<strong>in</strong>tensive Berichterstattung <strong>in</strong> den Medien schärft<br />
unsere Wahrnehmung. Aber <strong>warum</strong> reagieren<br />
andere Nationen ganz anders? Kulturelle <strong>und</strong> historische<br />
Prägungen spielen e<strong>in</strong>e Rolle. Die e<strong>in</strong>en<br />
belächeln unsere „German Angst“, die anderen <strong>in</strong>terpretieren<br />
sie als „German Klugheit“.<br />
editorial<br />
Auf allen Ebenen versucht man, dem Risiko beizukommen.<br />
Ratgeberbücher für den E<strong>in</strong>zelnen,<br />
Universitätslehrstühle, Institute <strong>und</strong> Gremien verschiedener<br />
Art für Forschung <strong>und</strong> Politikberatung,<br />
kommerzielle Beratungsunternehmen <strong>und</strong> firmeneigene<br />
Risikomanagementabteilungen sollen dafür<br />
sorgen, dass wir alles „im Griff“ haben. Nicht nur<br />
die aktuelle F<strong>in</strong>anzkrise oder die Ereignisse um<br />
Fukushima wecken Zweifel am nachhaltigen Erfolg<br />
dieser Bemühungen. Immer wieder schwimmen<br />
„schwarze Schwäne“ (Nassim Taleb) vorbei; sie<br />
symbolisieren Ereignisse, die „eigentlich“ nie hätten<br />
e<strong>in</strong>treten dürfen. Aktuell wird auch kontrovers diskutiert,<br />
wie e<strong>in</strong>e Gesellschaft große Risiken überhaupt<br />
legitimieren kann. Darf „man“ übergroße Rettungsschirme<br />
aufspannen oder Nanoteilchen freisetzen?<br />
Risiken lauern überall. Wir üben uns daher<br />
zwangsläufig ständig <strong>in</strong> Risikobewertung <strong>und</strong> trotzdem<br />
fällt es uns schwer, konsistente <strong>und</strong> zuverlässige<br />
E<strong>in</strong>ordnungen zu treffen. Die <strong>Technik</strong> hat es noch<br />
am leichtesten; sie formuliert Regeln <strong>und</strong> Normen,<br />
die e<strong>in</strong>en weitgehend objektiven Rahmen vorgeben.<br />
Und sie muß nicht über die Realisierung von<br />
Projekten entscheiden. Es obliegt der Gesellschaft,<br />
gewisse Unfall oder Versagenshäufigkeiten zu akzeptieren<br />
oder abzulehnen. Aber wir tun uns viel<br />
schwerer, <strong>wenn</strong> wir <strong>in</strong> der Wissenschaft e<strong>in</strong>e theoretischempirische<br />
oder <strong>in</strong> der Politik e<strong>in</strong>e praktische<br />
Diskussion führen. Risiken können dann ganz<br />
unterschiedlich angegangen werden. Als aktuelles<br />
Beispiel mag die vor kurzem vom B<strong>und</strong>esverkehrsm<strong>in</strong>ister<br />
erhobene Forderung nach e<strong>in</strong>er Helmpflicht<br />
für Fahrradfahrer dienen. Nun kamen aber<br />
im Jahr 2009 <strong>in</strong> Deutschland 7030 Personen im<br />
Haushalt ums Leben, überwiegend durch Stürze,<br />
aber „nur“ 462 Radfahrer. Es hat sich aber noch niemand<br />
getraut, Helm pflicht beim Fensterputzen zu<br />
fordern. Vermissen Sie da die Logik?<br />
Sicherlich, aber es geht nicht nur um Zahlen.<br />
Auch Umsetzbarkeit, effektiver Mittele<strong>in</strong>satz<br />
oder gesellschaftliche Akzeptanz bestimmen den<br />
Umgang mit Risiken. Schach ist doch e<strong>in</strong>facher.<br />
Ihr<br />
Liebe Leser,<br />
e<strong>in</strong> ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu, <strong>und</strong> wir wünschen Ihnen <strong>und</strong> Ihren Angehörigen e<strong>in</strong><br />
ges<strong>und</strong>es <strong>und</strong> glückliches Neues Jahr. Stellvertretend für viele VDI- <strong>und</strong> VDE-Mitglieder, die für ihren<br />
vorbildlichen E<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> 2011 geehrt wurden, möchten wir Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hard Höpfl, dem Vorsitzenden<br />
des VDI Landesverbandes <strong>Bayern</strong>, zur Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande gratulieren.<br />
Die Redaktion „<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“<br />
3
6<br />
8<br />
10<br />
INHALt<br />
4<br />
Foto: brandtronik.de<br />
Foto: US Defense Government<br />
Foto: extremsporttrader.de<br />
Schwerpunkt<br />
Risiko <strong>und</strong> Risikomanagement 6<br />
Das Spannungsverhältnis zwischen Schicksal <strong>und</strong> Eigenverantwortung.<br />
Ortw<strong>in</strong> Renn<br />
Risikowahrnehmung <strong>und</strong> Risikokommunikation – e<strong>in</strong> Überblick 8<br />
„Die Angst des Rauchers vor dem Schlangenbiss“.<br />
Astrid Epp, Stephanie Kurzenhäuser-Carstens, Mark Lohmann <strong>und</strong> Gaby-Fleur Böl<br />
Kann man Risiken bändigen? 10<br />
Der Umgang mit Risiken (<strong>in</strong>) der <strong>Technik</strong>.<br />
Interview mit Hubert Sacher, tüV Service GmbH, München<br />
Maßnahmen <strong>und</strong> Herausforderungen beim Schutz von It-Systemen 12<br />
Wie verw<strong>und</strong>bar ist unsere technische Infrastruktur?<br />
Mario Goll<strong>in</strong>g <strong>und</strong> Gabi Dreo Rodosek<br />
Hilfe, die Produktion steht! 15<br />
Die Absicherung unserer globalen Lieferketten.<br />
Klaus-Jürgen Meier<br />
Die automatische U-Bahn ist sicher unterwegs! 17<br />
Bitte e<strong>in</strong>steigen, es ist alles unter Kontrolle.<br />
Konrad Schmidt <strong>und</strong> Holm Jerosch<br />
Die globale Katastrophe als Merkmal e<strong>in</strong>er Gesellschaft 35<br />
Der historische H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> von Peter Schüßler<br />
Sicherheit am Berg mit Laptop <strong>und</strong> Karab<strong>in</strong>er 38<br />
Florian Hellberg <strong>und</strong> Chris Semmel<br />
Versicherung!!! 40<br />
Oft umstritten, oft unverzichtbar.<br />
Joachim Crönle<strong>in</strong><br />
Die Diskussion über die Kernenergie – wo liegen die Probleme? 41<br />
Überlegungen von Gerhard Grosch<br />
Neue Energien, neue Risiken, neue Chancen 42<br />
thomas Blunck<br />
titelbild<br />
Ist Fallschirmspr<strong>in</strong>gen riskant? Daran scheiden sich die Geister.<br />
Foto: US Defense Government, Staff Sgt. Jason Colbert<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Hochschule <strong>und</strong> Forschung<br />
Hochschule München:<br />
Der Rechner als Rettungshelfer 43<br />
Christiane Pütter<br />
tU München:<br />
Schöne neue technikwelt – Segen oder Fluch? 46<br />
Christ<strong>in</strong>e Schmidt<br />
Neu:<br />
technologie-Campus an der HS Amberg-Weiden 44<br />
„Elektronik im Kraftfahrzeug“ <strong>und</strong> eCartec:<br />
Forschung des technologie-Campus Freyung 47<br />
Rudi Demont<br />
Aktuelles<br />
VDI-Forum: Moderne Sicherheitstechnik 36<br />
Gerhard Grosch<br />
B<strong>und</strong>esverdienstkreuz am Bande für Prof. Höpfl 45<br />
Rubriken<br />
Regional 19<br />
Veranstaltungskalender 23<br />
Buchbesprechungen 48<br />
Leserbriefe 49<br />
Ausstellungstipp 50<br />
Humor 50<br />
Vorschau 50<br />
Impressum 50<br />
VDI Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
VDI Bezirksvere<strong>in</strong> München, Ober- <strong>und</strong> Niederbayern e.V.<br />
Westendstr. 199, D-80686 München<br />
Tel.: (0 89) 57 91 22 00, Fax: (0 89) 57 91 21 61<br />
www.vdi.de, E-Mail: bv-muenchen@vdi.de<br />
VDI Bezirksvere<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> Nordost e.V.<br />
c/o Ohm-Hochschule, Keßlerplatz 12, D-90489 Nürnberg<br />
Tel.: (09 11) 55 40 30, Fax: (09 11) 5 19 39 86,<br />
E-Mail: vdi@ohm-hochschule.de<br />
VDE <strong>Bayern</strong>, Bezirksvere<strong>in</strong> Südbayern e.V.<br />
Landesvertretung <strong>Bayern</strong><br />
Richard-Strauss-Str. 76, D-80286 München<br />
Tel.: (0 89) 91 07 21 10, Fax: (0 89) 91 07 23 09<br />
www.vde-suedbayern.de, E-Mail: vde-sbay@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
INHALt<br />
Gewerbesteuer: München 490 Punkte – Garch<strong>in</strong>g 330 Punkte.<br />
Diesen Kostenvorteil <strong>und</strong> noch viel mehr bietet die Gewerbeimmobilie<br />
mit den Vorzügen von München <strong>und</strong> der Wirtschaftlichkeit<br />
von Garch<strong>in</strong>g.<br />
Provisionsfreie Vermietung direkt vom Eigentümer<br />
Telefon: 089/30 90 99 90, E-Mail: <strong>in</strong>fo@bus<strong>in</strong>esscampus.net<br />
www.bus<strong>in</strong>esscampus.net<br />
5
Schwerpunkt<br />
Risiko <strong>und</strong> Risikomanagement<br />
Risiken beruhen auf dem Spannungsverhältnis zwischen unabwendbarem Schicksal <strong>und</strong><br />
Eigen verantwortung. Erst <strong>wenn</strong> die Zukunft als vom Menschen zum<strong>in</strong>dest teilweise bee<strong>in</strong>flussbar<br />
angesehen wird, ist es möglich, Gefahren zu vermeiden oder deren Konsequenzen<br />
zu mildern. Wie man das machen kann, wird im Folgenden beschrieben.<br />
Mit dem Begriff des Risikos werden solche<br />
potenziellen Nutzenverluste betrachtet, die<br />
nicht zwangsweise e<strong>in</strong>treten müssen, sondern<br />
sich lediglich mit e<strong>in</strong>er mehr oder weniger berechenbaren<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit ereignen können.<br />
Insofern kommt beim Konzept des Risikos<br />
neben dem Problem der Bewertung von künftigen<br />
versus gegenwärtigen Nutzenverlusten<br />
noch die Bewertung der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
bzw. der Unsicherheit h<strong>in</strong>zu. Ab welcher Höhe<br />
der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit ist es politisch klug<br />
<strong>und</strong> sozialpolitisch angemessen, volkswirtschaftliche<br />
Ressourcen zur Risikom<strong>in</strong>derung<br />
oder vermeidung zu verwenden, auch <strong>wenn</strong><br />
das negative Ereignis möglicherweise niemals<br />
e<strong>in</strong>treten wird? Die momentane Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
um die politischen Konsequenzen aus<br />
dem Unfall <strong>in</strong> Fukushima <strong>und</strong> die Debatte um<br />
den Klimaschutz zwischen den USA <strong>und</strong> Europa<br />
verdeutlichen die unterschiedliche politische<br />
Reaktion auf diese zentrale Frage im Umgang<br />
mit Risiken.<br />
Gerade angesichts der mit Risiken verb<strong>und</strong>enen<br />
Unsicherheiten <strong>und</strong> Interpretationsspielräumen<br />
ist es für e<strong>in</strong>e Gesellschaft zentral, sich<br />
auf wichtige Gr<strong>und</strong>züge der Risikoerfassung<br />
<strong>und</strong> des Risikomanagements zu verständigen.<br />
Dazu sollen die folgenden Ausführungen e<strong>in</strong>ige<br />
Gr<strong>und</strong>überlegungen bereitstellen.<br />
Gr<strong>und</strong>lagen von Risikoerfassung<br />
<strong>und</strong> von Risikomanagement<br />
Weil Risiken das Geme<strong>in</strong>wohl ganzer Gesellschaften<br />
bedrohen können, ist es Aufgabe der<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> der politischen Entscheidungsträger,<br />
bestmögliche Risikoabschätzungen<br />
vorzunehmen. Die naturwissenschaftlich<br />
<strong>und</strong> technisch ausgerichteten Risikowissenschaften<br />
haben e<strong>in</strong>e Reihe von wissenschaftlichen<br />
Methoden <strong>und</strong> <strong>Technik</strong>en entwickelt,<br />
um Folgen von Handlungen oder Ereignissen<br />
unter der Bed<strong>in</strong>gung der Unsicherheit vorherbestimmen<br />
zu können. Dazu müssen e<strong>in</strong>erseits<br />
UrsacheWirkungsBeziehungen im Pr<strong>in</strong>zip<br />
bekannt <strong>und</strong> andererseits mögliche Verteilungsmuster<br />
über Zeit oder über Individuen<br />
statistisch abschätzbar se<strong>in</strong>. Risikoabschätzung<br />
6<br />
ist die systematische Komb<strong>in</strong>ation von Wissen<br />
über beobachtete oder experimentell nachgewiesene<br />
Regelmäßigkeiten <strong>und</strong> Zufallsvariationen.<br />
Mit Hilfe der <strong>in</strong>duktiven Statistik können<br />
die relativen Häufigkeiten möglicher Schadensfälle<br />
zuverlässiger als auf der Basis re<strong>in</strong>er<br />
Intuition prognostiziert werden. Bei allem Fortschritt<br />
<strong>in</strong> der Modellierung von Konsequenzen<br />
<strong>und</strong> Wahrsche<strong>in</strong>lichkeiten verbleiben aber viele<br />
Unsicherheiten, die mit mangelndem Wissen,<br />
<strong>und</strong>eutlichen Systembegrenzungen, Extrapolationsfehlern<br />
u.a.m. verb<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d. Zudem<br />
können wissenschaftliche Risikoberechnungen<br />
nur Durchschnittswerte über (theoretisch unendlich)<br />
lange Zeiträume widerspiegeln. Wann<br />
<strong>und</strong> wo sich e<strong>in</strong> Risiko als Schaden manifestieren<br />
wird, bleibt im Nebel der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitsberechnungen<br />
verborgen.<br />
Die zentralen Kriterien der Risikoabschätzung<br />
s<strong>in</strong>d das Schadensausmaß <strong>und</strong> die E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit.<br />
Im Allgeme<strong>in</strong>en wird<br />
Schaden als Summe negativ bewerteter Konsequenzen<br />
von menschlichen Aktivitäten (z.B.<br />
Autounfälle, Krebs durch Rauchen, Skiunfälle)<br />
oder natürlichen Ereignissen (z.B. Erdbeben,<br />
Law<strong>in</strong>enunglücke, Vulkanausbrüche) verstanden.<br />
Schäden können <strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlicher (etwa<br />
Zahl der Verletzten) oder <strong>in</strong> diskreter Form<br />
(Stahlkessel explodiert oder hält) auftreten. Die<br />
Identifikation von möglichen Schadenskategorien<br />
bedeutet immer auch e<strong>in</strong>e soziale, kulturelle<br />
oder politische Prioritätensetzung. Selbst<br />
<strong>wenn</strong> man den Bedeutungs<strong>in</strong>halt von Risiko<br />
lediglich auf potentielle Ges<strong>und</strong>heitsschäden<br />
<strong>und</strong> mögliche ökologische Bee<strong>in</strong>trächtigungen<br />
begrenzt, verbleibt die Notwendigkeit, unter<br />
der Vielzahl von möglichen Schäden diejenigen<br />
auszuwählen, die von der Gesellschaft als<br />
besonders dr<strong>in</strong>glich e<strong>in</strong>gestuft werden. Vorrangiges<br />
Ziel muss es dann se<strong>in</strong>, diese Schäden abzuwehren<br />
oder wenigstens zu m<strong>in</strong>imieren.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus ist für die Abschätzung des<br />
Risikos entscheidend, welches Schutzgut von<br />
den Regulierungsbehörden vorgegeben ist. Geht<br />
es um den Schutz des menschlichen Lebens, um<br />
die Erhaltung bestimmter Ges<strong>und</strong>heitsstandards,<br />
um die Bewahrung von Biotopen, um<br />
die Erhaltung der biologischen Vielfalt, um die<br />
Re<strong>in</strong>heit von <strong>Was</strong>ser <strong>und</strong> Luft oder um den Beitrag<br />
zu e<strong>in</strong>er nachhaltigen Entwicklung? Bei der<br />
Frage nach dem Umgang mit Risiken muss immer<br />
die Frage nach dem Bezugspunkt (etwa Ges<strong>und</strong>heit,<br />
Umwelt, Wohlergehen) <strong>und</strong> nach dem<br />
Schutzgut <strong>und</strong> nach dem Schutzziel (Beispiele:<br />
schadstofffreies <strong>Was</strong>ser, schadstoffarmes <strong>Was</strong>ser,<br />
schadstoffbelastetes <strong>Was</strong>ser unterhalb der<br />
Schwelle akuter Ges<strong>und</strong>heitsgefährdung usw.)<br />
beantwortet werden. Nur unter der Bed<strong>in</strong>gung<br />
e<strong>in</strong>es politisch festgelegten Referenzmaßstabes<br />
macht e<strong>in</strong>e Risikoabschätzung S<strong>in</strong>n.<br />
E<strong>in</strong>e entscheidungsanalytische<br />
Perspektive für das Bewerten von<br />
Risiken<br />
Beim Abwägen der Vor <strong>und</strong> Nachteile von<br />
verschiedenen Handlungsmöglichkeiten unter<br />
Unsicherheit haben sich entscheidungsanalystische<br />
Verfahren bewährt. Durch sie<br />
werden Risiken <strong>und</strong> Nutzen systematisch<br />
<strong>und</strong> explizit bewertet. Sie zeichnen sich durch<br />
e<strong>in</strong>e geregelte Vorgehensweise aus, die für e<strong>in</strong><br />
rationales <strong>und</strong> nachvollziehbares Abwägen<br />
s<strong>in</strong>nvoll <strong>und</strong> notwendig s<strong>in</strong>d. Diese Regeln<br />
e<strong>in</strong>zuhalten bedeutet jedoch nicht, sich auf<br />
e<strong>in</strong>e bestimmte Risikohöhe oder e<strong>in</strong>en bestimmten<br />
Grenzwert festzulegen. Es gibt<br />
ke<strong>in</strong>en „automatischen“ Algorithmus, mit<br />
dessen Hilfe sich Grenzwerte objektiv festlegen<br />
lassen. Risiken werden immer auch nach<br />
subjektiven Gesichtspunkten als akzeptabel<br />
oder unakzeptabel e<strong>in</strong>gestuft.<br />
Der entscheidungsanalytische Ansatz erfolgt<br />
<strong>in</strong> drei Schritten:<br />
Festlegen von Zielen, die dem Schutz von<br />
Leben, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Umwelt dienen <strong>und</strong><br />
es weiterh<strong>in</strong> ermöglichen, gesellschaftliche<br />
Chancen effektiv zu nutzen.<br />
Untersuchen der Folgen, die sich beim Verwirklichen<br />
dieser Ziele ergeben können.<br />
Abwägen zwischen dem zu erwartendem<br />
Nutzen <strong>und</strong> dem gesellschaftlichen Schaden,<br />
der zu befürchten, bzw. dem Aufwand, der zu<br />
erbr<strong>in</strong>gen ist.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Foto: ADAC<br />
Als erster Schritt müssen zunächst e<strong>in</strong>mal<br />
die Ziele <strong>und</strong> Kriterien festgelegt werden, anhand<br />
derer man die Risiken beurteilen <strong>und</strong> vor<br />
allem die Reduktionsmaßnahmen bewerten<br />
kann. Teilweise ist der Entscheidungsträger<br />
durch gesetzliche oder andere Vorgaben bereits<br />
festgelegt. Andernfalls muss die gesamte <strong>in</strong> unserer<br />
Gesellschaft vorherrschende Werte <strong>und</strong><br />
Kriterienvielfalt <strong>in</strong> ihrer legitimen Bandbreite<br />
ausgelotet werden. Der nächste Schritt nach<br />
dem Festlegen der Entscheidungskriterien ist<br />
das Messen der Konsequenzen, die sich durch<br />
die e<strong>in</strong>zelnen Regulationsmöglichkeiten ergeben.<br />
Für jedes Kriterium ist zu bestimmen,<br />
welche Folgen Grenzwerte, Abgaben, freiwillige<br />
Vere<strong>in</strong>barungen aber auch der Verzicht auf politische<br />
Maßnahmen haben. Wird das gesteckte<br />
Ziel gr<strong>und</strong>sätzlich erreicht? Wie effektiv s<strong>in</strong>d<br />
dabei die e<strong>in</strong>gesetzten Mittel? Welche Nebenwirkungen<br />
treten auf? Der dritte Schritt nach<br />
dem Festlegen der Entscheidungskriterien <strong>und</strong><br />
dem Messen der Konsequenzen ist das Abwägen<br />
zwischen Nutzen <strong>und</strong> Schaden, bzw. Risiko.<br />
Dafür müssen die <strong>in</strong> den Profilen vorliegenden<br />
natürlichen E<strong>in</strong>heiten <strong>in</strong> sogenannte Nutzene<strong>in</strong>heiten<br />
umgewandelt werden. Theoretisch<br />
muss der Entscheidungsträger die Messwerte<br />
<strong>in</strong> Nutzenwerte umwandeln. Bei mehreren Entscheidungsträgern<br />
– was meist die Realität ist<br />
– wird dies schwierig, weil jeder die Nutzenwerte<br />
subjektiv anders zuweist <strong>und</strong> auch die Nutzengew<strong>in</strong>ne<br />
bzw. verluste anders <strong>in</strong>terpretiert.<br />
Hier bieten sich diskursive <strong>und</strong> partizipative<br />
Verfahren an, bei denen die notwendigen relativen<br />
Gewichtungen der Nutzen <strong>und</strong> Risikoaspekte<br />
deliberativ, d.h. im Konsens der betroffenen<br />
Gruppen, getroffen werden.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Schlussbemerkung<br />
Risiken erfordern sowohl Strategien der wissenschaftlichen<br />
Erfassung <strong>und</strong> – <strong>wenn</strong> möglich<br />
– Quantifizierung von Risiken wie auch<br />
der Bewusstse<strong>in</strong>s <strong>und</strong> Vertrauensbildung <strong>in</strong><br />
Regulationsbehörden. Das Ziel ist es, relevante<br />
Akteure wissenschaftlich <strong>in</strong> die Lage zu versetzen,<br />
Risiken zu erkennen <strong>und</strong> nach Maßgabe<br />
der gesellschaftlich vere<strong>in</strong>barten Schutzziele zu<br />
reduzieren.<br />
Dabei ist die risikoorientierte Wissensverbesserung<br />
e<strong>in</strong> geeignetes <strong>und</strong> wichtiges Mittel<br />
zur Verr<strong>in</strong>gerung der verbleibenden Ungewissheiten.<br />
Aufklärung über Fakten ist jedoch<br />
nicht genug <strong>und</strong> überzeugt die Menschen oft<br />
nicht, dass diese Risiken <strong>in</strong> den Normalbereich<br />
schwerpunkt<br />
gehören. <strong>Was</strong> notwendig ist, ist e<strong>in</strong>e transparente<br />
entscheidungsanalytische Gegenüberstellung<br />
von Nutzen <strong>und</strong> Risiken. Bei diesem Urteil<br />
müssen auch die Betroffenen e<strong>in</strong>bezogen werden,<br />
so dass die verbleibenden Ungewissheiten<br />
<strong>und</strong> Mehrdeutigkeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em diskursiven<br />
Verfahren <strong>in</strong>terpretiert <strong>und</strong> <strong>in</strong> entsprechende<br />
Handlungsanweisungen überführt werden.<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Ortw<strong>in</strong> Renn<br />
Institut für Sozialwissenschaften<br />
Universität Stuttgart<br />
Autounfälle <strong>und</strong> Vulkanausbrüche –<br />
Risiken werden immer auch nach subjektiven<br />
Gesichtspunkten als akzeptabel oder<br />
unakzeptabel e<strong>in</strong>gestuft.<br />
GR<strong>und</strong>leGende liteRAtuR<br />
Beck, U.: Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e andere Moderne, Frankfurt/Ma<strong>in</strong><br />
(Suhrkamp 1986)<br />
Renn, O.: Risk Governance. Cop<strong>in</strong>g with Uncerta<strong>in</strong>ty<br />
<strong>in</strong> a Complex World. London<br />
(Earthscan 2008)<br />
Renn, O.; Schweizer, P.-J., Dreyer, M. <strong>und</strong><br />
Kl<strong>in</strong>ke, A.: Risiko. Über den gesellschaftlichen<br />
Umgang mit Unsicherheit. München<br />
(ÖKOM Verlag 2007)<br />
WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der B<strong>und</strong>esregierung<br />
Globale Umweltveränderungen<br />
1999: Welt im Wandel: Der Umgang mit<br />
globalen Umweltrisiken. Berl<strong>in</strong>: Spr<strong>in</strong>ger.<br />
7<br />
Bild: Hubert Sattler, Salzburg Museum<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
Foto: EXIT GmbH<br />
Schwerpunkt<br />
Risikowahrnehmung <strong>und</strong> Risikokommunikation –<br />
e<strong>in</strong> Überblick<br />
„Die Angst des Rauchers vor dem Schlangenbiss“ – so war vor e<strong>in</strong>igen Jahren e<strong>in</strong> Artikel <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er großen deutschen Tageszeitung überschrieben, der sich mit der Frage beschäftigte,<br />
<strong>warum</strong> sich die Menschen am meisten vor den D<strong>in</strong>gen fürchten, durch die sie tatsächlich eher<br />
selten zu Tode kommen.<br />
Diese Angst der Verbraucher<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Verbraucher<br />
vor D<strong>in</strong>gen, die aus wissenschaftlicher<br />
Sicht ke<strong>in</strong> Risiko darstellen, ist <strong>in</strong> letzter Zeit<br />
verstärkt zum Thema e<strong>in</strong>er Reihe von Veröffentlichungen<br />
geworden. So wurde erst kürzlich<br />
behauptet, dass Verbraucher zwar relativ<br />
unbekümmert natürliche Gifte aller Art essen,<br />
im H<strong>in</strong>blick auf Pestizide aber <strong>in</strong> Panik geraten<br />
[1]. Auf der anderen Seite wird wiederum e<strong>in</strong>e<br />
gewisse „Risikomüdigkeit“ diagnostiziert, die<br />
dazu führt, dass sich die „überalarmierte Öffentlichkeit<br />
der Gegenwart (…) die Ohren zuhält“,<br />
wodurch der Alarm entwertet würde [2].<br />
Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo <strong>in</strong> der<br />
Mitte. Gleichwohl lässt sich beobachten, dass<br />
„auf der e<strong>in</strong>en Seite relativ unbedeutende Risiken<br />
e<strong>in</strong>en erheblichen Platz <strong>in</strong> der öffentlichen<br />
Wahrnehmung e<strong>in</strong>nehmen, während andererseits<br />
zum Teil schwerwiegende Risiken unterschätzt<br />
oder sogar verdrängt werden“ [3].<br />
Aus der Risikoforschung ist seit langem bekannt,<br />
dass es <strong>in</strong> verschiedenen Bereichen erhebliche<br />
Unterschiede <strong>in</strong> der Wahrnehmung<br />
dessen gibt, was als Risiko bezeichnet wird.<br />
Menschen nutzen neben Schadensausmaß <strong>und</strong><br />
wahrsche<strong>in</strong>lichkeit offenbar noch e<strong>in</strong>e Reihe<br />
8<br />
anderer Informationen, um Risiken zu charakterisieren<br />
<strong>und</strong> zu bewerten. Wurde ursprünglich<br />
von der These ausgegangen, dass sich diese<br />
Unterschiede <strong>in</strong> der Bewertung vorrangig<br />
zwischen Experten <strong>und</strong> Laien f<strong>in</strong>den lassen<br />
würden, so zeigte sich zunehmend, dass es e<strong>in</strong>e<br />
Vielzahl von Faktoren gibt, die die Wahrnehmung<br />
e<strong>in</strong>es Risikos maßgeblich bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Neben Prozessen der <strong>in</strong>dividuellen Verarbeitung<br />
<strong>und</strong> Bewertung von Risiko<strong>in</strong>formationen<br />
spielen demnach auch soziale Prozesse der Risikovermittlung<br />
<strong>und</strong> verstärkung e<strong>in</strong>e wichtige<br />
Rolle (z.B. die Darstellung von Risikothemen <strong>in</strong><br />
den Medien). Insbesondere kann unterschieden<br />
werden zwischen den Eigenschaften des Risikos,<br />
der Situation des Wahrnehmenden <strong>und</strong> der<br />
Darstellung e<strong>in</strong>es Risikos <strong>in</strong> den Medien.<br />
Eigenschaften des Risikos<br />
Möchte man verstehen, <strong>warum</strong> e<strong>in</strong> Thema<br />
<strong>in</strong> der Öffentlichkeit als Risiko wahrgenommen<br />
wird, sollte die Analyse zunächst bei den<br />
Eigenschaften des Risikos selbst ansetzen. Hier<br />
können drei zentrale Faktoren benannt werden,<br />
die e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die Risikowahrnehmung<br />
haben: die Neuheit (bzw. Bekanntheit) e<strong>in</strong>es<br />
Risikos, das zu dem Risiko vorhandene (wissenschaftliche)<br />
Wissen sowie das e<strong>in</strong>er riskanten<br />
Aktivität oder Technologie zugeschriebene<br />
Katastrophenpotential. Neue Risiken, über die<br />
es zudem häufig wenig Wissen gibt – wodurch<br />
auch deren Konsequenzen nicht überschaubar<br />
s<strong>in</strong>d – werden oft risikoreicher beurteilt<br />
als bekannte Risiken. Umgekehrt lässt sich<br />
dagegen beobachten, dass Risiken, bei denen<br />
e<strong>in</strong>e robuste (belastbare) wissenschaftliche<br />
Wissensbasis vorhanden ist, ger<strong>in</strong>ger e<strong>in</strong>geschätzt<br />
werden. So stufen Verbraucher Ges<strong>und</strong>heitsrisiken<br />
im Zusammenhang mit genetisch<br />
modifizierten oder bestrahlten Lebensmitteln<br />
als bedrohlicher e<strong>in</strong> als „altbekannte“ Lebensmittelrisiken<br />
wie Salmonellen, Alkohol oder<br />
fettreiche Ernährung. Schließlich steigt die Risikowahrnehmung,<br />
<strong>wenn</strong> e<strong>in</strong>er riskanten Aktivität<br />
oder Technologie Katastrophenpotential<br />
zugeschrieben wird, <strong>wenn</strong> also im schlimmsten<br />
Falle viele Menschen gleichzeitig mit Leib<br />
<strong>und</strong> Leben be<strong>droht</strong> se<strong>in</strong> könnten (z.B. bei Flugzeugabstürzen).<br />
Die Gleichzeitigkeit ist dabei<br />
wichtig, denn treten Schäden oder Todesfälle<br />
zeitlich <strong>und</strong> räumlich verteilt auf, wirkt das<br />
Gesamtausmaß des Schadens zunächst weniger<br />
furchte<strong>in</strong>flößend oder „katastrophal“ (z.B.<br />
beim Autofahren). Das ger<strong>in</strong>gere Katastrophenpotential<br />
ist also e<strong>in</strong>e Erklärung dafür,<br />
<strong>warum</strong> viele ges<strong>und</strong>heitliche Risikoverhaltensweisen<br />
im Vergleich zu technologischen Risiken<br />
unterschätzt werden.<br />
Situation des Wahrnehmenden<br />
Auf der Ebene des Individuums s<strong>in</strong>d wiederum<br />
die Faktoren Freiwilligkeit / Kontrollierbarkeit,<br />
Betroffenheit <strong>und</strong> Informiertheit von<br />
zentraler Bedeutung. So werden Risiken, die der<br />
eigenen Kontrolle unterliegen <strong>und</strong> die freiwillig<br />
e<strong>in</strong>gegangen werden, als weniger riskant beurteilt<br />
als Risiken, die man nicht kontrollieren<br />
kann <strong>und</strong> denen man unfreiwillig ausgesetzt<br />
ist. Um die Relevanz der Dimension „Freiwilligkeit“<br />
zu verdeutlichen, wird hier auch zwischen<br />
Entscheidern <strong>und</strong> Betroffenen unterschieden.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Während man sich als Entscheider für oder<br />
gegen das E<strong>in</strong>gehen e<strong>in</strong>es Risikos entscheiden<br />
kann (z.B. für das Rauchen), wird man sich als<br />
Betroffener e<strong>in</strong>er Gefahr ausgesetzt sehen (z.B.<br />
Pestizidrückständen <strong>in</strong> Lebensmitteln). Freiwillig<br />
e<strong>in</strong>gegangene Risiken werden demnach<br />
häufig gar nicht als solche empf<strong>und</strong>en, woh<strong>in</strong>gegen<br />
Risiken, denen man sich durch Dritte<br />
ausgesetzt fühlt, eher überschätzt bzw. als (unausweichliche,<br />
h<strong>in</strong>zunehmende) Gefahr wahrgenommen<br />
werden. Neben der Freiwilligkeit ist<br />
für die Wahrnehmung e<strong>in</strong>es Risikos auch von<br />
zentraler Bedeutung, ob man sich von diesem<br />
überhaupt betroffen fühlt. Risiken, die für das<br />
eigene Leben oder das von Familie <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en<br />
relevant sche<strong>in</strong>en, werden als bedrohlicher<br />
wahrgenommen als solche Risiken, die aus<br />
Sicht des Wahrnehmenden mit se<strong>in</strong>em Leben<br />
überhaupt nichts zu tun haben. Und schließlich<br />
wirkt sich auch der Grad der eigenen Informiertheit<br />
<strong>in</strong> dem S<strong>in</strong>ne auf die Risikowahrnehmung<br />
aus, dass e<strong>in</strong> Gefühl der Informiertheit<br />
e<strong>in</strong> Risiko eher als weniger bedrohlich ersche<strong>in</strong>en<br />
lässt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil damit<br />
häufig e<strong>in</strong> Wissen darüber verb<strong>und</strong>en ist, wie<br />
das Risiko zu m<strong>in</strong>imieren <strong>und</strong> damit zu kontrollieren<br />
ist.<br />
Mediale Darstellung von Risiken<br />
Neben diesen Faktoren muss aber auch beachtet<br />
werden, dass die Wahrnehmung von Risiken<br />
häufig nicht auf <strong>in</strong>dividueller Ebene beg<strong>in</strong>nt,<br />
da viele Umwelt <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heits risiken<br />
für den E<strong>in</strong>zelnen nicht s<strong>in</strong>nlich erfahrbar s<strong>in</strong>d.<br />
Der Verbraucher kann <strong>in</strong> der Regel nicht ermitteln,<br />
ob aus Plastikverpackungen abgesonderte<br />
Stoffe e<strong>in</strong> Ges<strong>und</strong>heitsrisiko darstellen. Hier<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
kommt den Medien e<strong>in</strong>e<br />
wichtige Rolle zu. Zum<br />
Beispiel gaben im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er Repräsentativbefragung<br />
knapp 90% der 1024<br />
Befragten an, das erste<br />
Mal aus den Medien von<br />
der Thematik „Pestizide <strong>in</strong><br />
Obst <strong>und</strong> Gemüse“ erfahren<br />
zu haben [4]. Da die<br />
Medien vorrangig Ereignisse<br />
aufgreifen, die e<strong>in</strong>en<br />
Nachrichtenwert besitzen,<br />
<strong>und</strong> daher im medialen<br />
Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit<br />
am ehesten<br />
Erfolg versprechen, handelt<br />
es sich nicht immer um<br />
Themen oder Ereignisse,<br />
denen auch aus wissenschaftlicher Sicht mediale<br />
Aufmerksamkeit gebührt. Die Selektionskriterien<br />
der Medien entsprechen nicht den Kriterien<br />
<strong>und</strong> der Geschw<strong>in</strong>digkeit der Wissenschaft.<br />
Daher werden häufig Themen aufgegriffen, die<br />
zwar medial anschlussfähig s<strong>in</strong>d, deren mediale<br />
Aufbereitung aber <strong>in</strong> der Öffentlichkeit zugleich<br />
den E<strong>in</strong>druck entstehen lässt, man habe es mit<br />
e<strong>in</strong>er tatsächlichen Bedrohung zu tun, obwohl<br />
dies aus wissenschaftlicher Perspektive nicht<br />
gerechtfertigt ist. Und auch dies bee<strong>in</strong>flusst<br />
schließlich das, was <strong>in</strong> der Öffentlichkeit als<br />
Risiko wahrgenommen wird.<br />
Die hier <strong>in</strong> aller Kürze vorgestellte Vielzahl<br />
von E<strong>in</strong>flussfaktoren auf die Risikowahrnehmung<br />
macht e<strong>in</strong>e genaue Vorhersage von Themenkarrieren<br />
zwar im E<strong>in</strong>zelfall oft schwierig,<br />
liefert aber bereits jetzt wertvolle Anhaltspunkte,<br />
<strong>wenn</strong> es um die Gestaltung von Risikokommunikation<br />
geht.<br />
Schlussfolgerungen für die Risikokommunikation<br />
Risikokommunikation zielt darauf ab, die<br />
zwischen Wissenschaft <strong>und</strong> Öffentlichkeit<br />
häufig divergierenden E<strong>in</strong>schätzungen e<strong>in</strong>es<br />
Ereignisses e<strong>in</strong>ander anzunähern. Dazu ist es<br />
aber notwendig, dass entsprechend der drei<br />
oben vorgestellten Kategorien von E<strong>in</strong>flussfaktoren<br />
gefragt wird: Um welche Art von Risiko<br />
geht es, wer nimmt das Risiko wahr, <strong>und</strong> zwar<br />
auf Gr<strong>und</strong>lage welcher Informationsbasis? Erst<br />
dann kann e<strong>in</strong>e auf die E<strong>in</strong>schätzungen <strong>und</strong><br />
Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe abgestimmte<br />
Risikokommunikation Aussicht auf<br />
Erfolg haben. Des Weiteren ist es von zentraler<br />
Bedeutung, dass die Angesprochenen die Infor<br />
liteRAtuR<br />
schwerpunkt<br />
mationen auch auf sich beziehen. Risiken, die<br />
allgeme<strong>in</strong> als bedrohlich bekannt s<strong>in</strong>d, werden<br />
nicht automatisch als Risiko für die eigene Person<br />
angesehen („Mir wird schon nichts passieren“).<br />
So kann e<strong>in</strong>e (zu) allgeme<strong>in</strong> gehaltene<br />
Risikokommunikation, die auf ges<strong>und</strong>heitliche<br />
Risiken für die Bevölkerung h<strong>in</strong>weist, unter<br />
Umständen <strong>in</strong>s Leere laufen. Daneben ist zu<br />
prüfen, ob die Empfänger der Risikokommunikation<br />
auch tatsächlich e<strong>in</strong>e h<strong>in</strong>reichend<br />
verständliche <strong>und</strong> objektive Informations basis<br />
bekommen, die sie benötigen um sich e<strong>in</strong>e<br />
„angemessene“ Risikowahrnehmung zu erarbeiten.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der Relevanz der medialen<br />
Berichterstattung für die Risikowahrnehmung<br />
sollte daher neben den Mechanismen der medialen<br />
Selektion <strong>und</strong> Darstellung auch das<br />
Mediennutzungsverhalten der verschiedenen<br />
Zielgruppen erfasst werden. Vor diesem H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
bleibt abschließend festzuhalten, dass<br />
nicht nur das Verständnis der Öffentlichkeit für<br />
die Wissenschaft <strong>und</strong> wissenschaftliche Prozesse<br />
gefördert werden sollte, sondern umgekehrt<br />
auch e<strong>in</strong> wissenschaftliches Verständnis des<br />
Zusammenspiels von Medien, Öffentlichkeit<br />
<strong>und</strong> Verbraucherschaft gefordert ist.<br />
Dr. Astrid Epp,<br />
Dr. Stephanie Kurzenhäuser-Carstens,<br />
Dr. Mark Lohmann <strong>und</strong><br />
PD Dr. Gaby-Fleur Böl<br />
B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für Risikobewertung,<br />
Fachgruppe Risikoforschung, -wahrnehmung,<br />
-früherkennung <strong>und</strong> -folgenabschätzung,<br />
Abteilung Risikokommunikation, Berl<strong>in</strong><br />
[1] Krämer, Walter: Leckeres Gift, <strong>in</strong>: Der tagespiegel<br />
vom 16. September 2011<br />
[2] Schulze, Gerhard: Krisen. Das Alarmdilemma.<br />
S.Fischer 2011.<br />
[3] Risikokommission (2003) ad hoc-Kommission<br />
„Neuordnung der Verfahren <strong>und</strong><br />
Strukturen zur Risikobewertung <strong>und</strong> Standardsetzung<br />
im ges<strong>und</strong>heitlichen Umweltschutz<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland“,<br />
Abschlussbericht der Risikokommission, S<br />
20 (Onl<strong>in</strong>e: http://www.apug.de/archiv/<br />
pdf/RK_Abschlussbericht.pdf)<br />
[4] B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitut für Risikobewertung (BfR)<br />
(2008) Zweitevaluation der Bekanntheit<br />
des B<strong>und</strong>es<strong>in</strong>stitutes für Risikobewertung,<br />
Abschlussbericht. Berl<strong>in</strong>: BfR (Onl<strong>in</strong>e:<br />
http://www.bfr.b<strong>und</strong>.de/cm/221/zweitevaluation_der_bekanntheit_des_bfr_abschlussbericht_2008.pdf)<br />
9<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
SCHWERPUNKt<br />
Kann man Risiken bändigen?<br />
Oft bergen technische Anlagen e<strong>in</strong> nicht unerhebliches Betriebsrisiko. Um dies zu m<strong>in</strong>imieren<br />
wurden schon im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert technische Überwachungsvere<strong>in</strong>e gegründet. Aber der<br />
Risikobegriff <strong>und</strong> unser Umgang damit haben sich verändert. Wir führten dazu e<strong>in</strong> Interview<br />
mit Dipl.-Ing. Hubert Sacher vom Kompetenzzentrum der TÜV Süd Industrie Service GmbH.<br />
TiB: Der TÜV entstand ja <strong>in</strong> der Zeit der Industrialisierung<br />
zur Vermeidung von Dampfkesselexplosionen.<br />
Inwieweit hat sich der Risikobegriff<br />
seitdem verändert?<br />
Sacher: Früher war Risiko negativ besetzt als<br />
Gefahr für Leib <strong>und</strong> Leben. Heute ist der Begriff<br />
objektiviert <strong>und</strong> mathematisch def<strong>in</strong>iert als<br />
E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit mal Schadenshöhe<br />
e<strong>in</strong>es Ereignisses. Risiken werden dadurch<br />
vergleichbar. Beispielsweise kann damit nachgewiesen<br />
werden, dass e<strong>in</strong> neu entwickeltes<br />
wirtschaftlicheres Prüfkonzept mit dem Betriebsunterbrechungen<br />
weitgehend vermieden<br />
bzw. m<strong>in</strong>imiert werden, m<strong>in</strong>destens ebenso<br />
sicher ist wie das bisher zulässige fristenorientierte<br />
Prüfkonzept. Man betrachtet also beim<br />
Risiko e<strong>in</strong>erseits den Aspekt der Gefahr für den<br />
Menschen, andererseits die Wirtschaftlichkeit<br />
als Komb<strong>in</strong>ation von Sicherheit plus Verfügbarkeit.<br />
Mit anderen Worten: Der Risikobegriff<br />
wird nun zunehmend auch als Möglichkeit zur<br />
wirtschaftlichen Optimierung von Anlagen <strong>und</strong><br />
Systemen verstanden <strong>und</strong> auch genutzt.<br />
TiB: Wie wird Risiko erfasst, analysiert <strong>und</strong><br />
quantifiziert?<br />
Sacher: Die Risikoanalyse ist technisch bestimmt<br />
<strong>und</strong> probabilistisch. Der Mensch wird<br />
über die statistische Zuverlässigkeit menschlicher<br />
Handlungen abhängig von Ausbildung<br />
<strong>und</strong> Erfahrung berücksichtigt. Faktoren wie<br />
Korruption bleiben außen vor. Diese E<strong>in</strong>flüsse<br />
kommen aber über die „Sicherheitskultur“ <strong>in</strong>s<br />
Spiel, die bei Anlagenbetreibern <strong>und</strong> Herstellern<br />
e<strong>in</strong>e große Rolle spielt. Generell gilt <strong>in</strong> unserem<br />
Rechtsraum, dass der Betreiber für den sicheren<br />
Betrieb der Anlagen verantwortlich ist <strong>und</strong><br />
nachweisen muss, dass er alles für die Sicherheit<br />
Nötige (nach Stand der <strong>Technik</strong>) getan hat.<br />
In manchen Staaten gibt es gesetzlich def<strong>in</strong>ierte<br />
Schranken für Risiken von technischen Anlagen,<br />
nicht aber <strong>in</strong> Deutschland. Allerd<strong>in</strong>gs muss<br />
man akzeptieren, dass die Analysen nur so gut<br />
se<strong>in</strong> können wie die Vorgaben <strong>und</strong> Annahmen.<br />
Es gibt immer wieder Szenarien, an die bei der<br />
Auslegung niemand gedacht hat. Außerdem ändert<br />
sich die Welt. Früher konnte man sich z.B.<br />
10<br />
Selbstmordattentate mit Flugzeugen nicht vorstellen,<br />
sie wurden daher <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
beim Entwurf von sensiblen Anlagen nicht explizit<br />
berücksichtigt.<br />
TiB: Wie werden Risiken <strong>in</strong> der Öffentlichkeit<br />
wahrgenommen?<br />
Sacher: Das Publikum übernimmt die abstrakte<br />
Def<strong>in</strong>ition eher nicht. Vor allem bei den<br />
öffentlich diskutierten „Restrisiken“ stößt die<br />
probabilistische Def<strong>in</strong>ition an Grenzen, da sowohl<br />
die Häufigkeit wie auch die Schadenshöhe<br />
statistisch schwer zu fassen s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> die Aussage,<br />
etwas sei mit der Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit von<br />
95% oder auch 99% sicher bei potentiell sehr<br />
großen Schäden nicht mehr wirklich trägt. E<strong>in</strong><br />
typisches Beispiel dafür ist die Diskussion um<br />
die Risiken der Kernkraft. Im privaten Bereich<br />
werden bewusste Risikoabwägungen eher bei<br />
wirtschaftlichen Fragen vorgenommen („lohnt<br />
sich die Installation e<strong>in</strong>er Solaranlage auf dem<br />
Dach?“). In der Freizeit dagegen werden auch<br />
hohe Risiken ohne H<strong>in</strong>terfragen <strong>in</strong> Kauf genommen<br />
(z.B. Drachenfliegen, Bergsteigen).<br />
TiB: Die Gerichte verlangen die E<strong>in</strong>haltung des<br />
Stands der <strong>Technik</strong>, beschrieben durch Normen<br />
<strong>und</strong> Vorschriften. Andererseits werden Normen<br />
zwangsläufig von der Entwicklung überholt. <strong>Was</strong><br />
bedeutet das für die Praxis?<br />
Sacher: Das ist <strong>in</strong> der Tat e<strong>in</strong> schwieriges<br />
Problem. Man berücksichtigt Normen so weit<br />
wie möglich, da sie im Allgeme<strong>in</strong>en den Erfahrungsschatz<br />
der Fachwelt widerspiegeln.<br />
Aber auch die Betriebserfahrung spielt bei der<br />
Ermittlung des Standes der <strong>Technik</strong> e<strong>in</strong>e zentrale<br />
Rolle. Daraus wurden z. B. für Raff<strong>in</strong>erien<br />
äußerst detaillierte <strong>und</strong> rigide Verhaltensvorschriften<br />
abgeleitet. Im Übrigen müssen besonders<br />
kritische Bereiche wie Druckbehälter,<br />
explosionsgefährdete Anlagen, sowie Sicherheitsbauteile<br />
von zugelassenen Organisationen<br />
überprüft werden. In Deutschland beispielsweise<br />
schreibt die Betriebssicherheitsverordnung<br />
Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeitsplätze<br />
vor, die e<strong>in</strong>en angemessenen Schutz der<br />
Beschäftigten (entsprechend dem Risiko des<br />
Arbeitsplatzes) nach Stand der <strong>Technik</strong> sicherstellen<br />
sollen. Die Europäische Gesetzgebung<br />
fordert als Voraussetzung für den freien Warenverkehr<br />
<strong>in</strong> der EU für alle Produkte mit Gefährdungspotential<br />
das CEKennzeichen. Damit<br />
erklärt e<strong>in</strong> Hersteller, dass se<strong>in</strong> Produkt allen<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsvorschriften entspricht <strong>und</strong> alle<br />
vorgeschriebenen Gefährdungsanalysen, Risikobewertungen<br />
etc. durchgeführt wurden.<br />
TiB: Dessen E<strong>in</strong>haltung wird aber nicht<br />
flächen deckend überprüft?<br />
Sacher: Das ist richtig. Zum e<strong>in</strong>en handelt<br />
es sich um e<strong>in</strong>e re<strong>in</strong>e Selbstauskunft der Hersteller<br />
– mit allen E<strong>in</strong>schränkungen, die solche<br />
Selbstauskünfte haben – zum anderen besteht<br />
noch Handlungsbedarf bezüglich der Verantwortung<br />
der Behörden. Es erfolgt zwar e<strong>in</strong>e<br />
Stichprobenprüfung die aber aus me<strong>in</strong>er Sicht<br />
nicht für e<strong>in</strong>e flächendeckende Wirksamkeit<br />
sorgt. Wir stellen immer wieder fest, dass gerade<br />
marktführende Firmen e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensivere<br />
Marküberwachung fordern, um schwarze Schafe<br />
zuverlässig zu erkennen. Zum<strong>in</strong>dest für Verbraucherprodukte<br />
wurde die Marktüberwachung mit<br />
dem neuen Produktsicherheitsgesetz verschärft,<br />
das am 1. Dezember 2011 <strong>in</strong> Kraft getreten ist.<br />
TiB: S<strong>in</strong>d Normen Innovationsbremsen?<br />
Sacher: Def<strong>in</strong>itiv nicht, weil sie für e<strong>in</strong>e Konkretisierung<br />
<strong>und</strong> Weiterentwicklung des Standes<br />
der <strong>Technik</strong> sorgen, sprich: Unscharfe Regelungen<br />
werden konkretisiert, Entwicklungs bedarf<br />
wird erkannt <strong>und</strong> entsprechend artikuliert, wobei<br />
e<strong>in</strong>e Fokussierung auf wesentliche Änderungen<br />
erfolgt. Natürlich gibt es immer wieder Debatten<br />
darüber, was wesentlich heißt, aber auch<br />
hier gibt der Risikobegriff Hilfestellung.<br />
TiB: Der TÜV Süd arbeitet mittlerweile <strong>in</strong> vielen<br />
Ländern. Wird da mit technischen Risiken<br />
anders umgegangen?<br />
Sacher: Generell betrachten wir es als unsere<br />
Aufgabe unsere über 145jährige Erfahrung<br />
<strong>in</strong> der Beherrschung von Risiken technischer<br />
Systeme weiterzugeben. Aber unsere Erfahrung<br />
zeigt auch, dass technische Risiken <strong>in</strong> anderen<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Hubert Sacher (l<strong>in</strong>ks) im Gespräch mit TiB-Redakteur Gerhard Grosch.<br />
Ländern unterschiedlich betrachtet werden.<br />
Es gibt verschiedene Sicherheitskulturen <strong>und</strong><br />
gesellschaftliche Akzeptanzkriterien. Zum Beispiel<br />
wird die Mensch Masch<strong>in</strong>e Schnittstelle<br />
<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>ene notwendige Kompetenz<br />
des Personals h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Auswirkung<br />
auf das Gesamtrisiko unterschiedlich bewertet.<br />
TiB: Nehmen Großrisiken zu?<br />
Sacher: E<strong>in</strong>deutig ja. Immer mehr Strukturen<br />
werden vernetzt; das br<strong>in</strong>gt neue zum Teil schwer<br />
durchschaubare Funktionalitäten, aber auch zunehmende<br />
Intransparenz durch Komplexität<br />
sowohl der Hardware als vor allem der Software<br />
für die Steuerung mit sich. Häufig wird auch versäumt<br />
die Wartung <strong>und</strong> Ertüchtigung bestehender<br />
Netze, z.B. Strom, Kommunikationssysteme,<br />
Straßen oder Bahn, an die geänderten Funktionalitäten<br />
anzupassen. Damit steigt die Gefahr<br />
von flächendeckenden Blackouts mit schwerwiegenden<br />
Folgen für Bevölkerung <strong>und</strong> Wirtschaft.<br />
Die Gefahren von Attacken über Internet werden<br />
zwar medial ausgebreitet, aber zu wenig ernst<br />
genommen. Und manchmal werden bekannte<br />
Risiken im Interesse der Wirtschaftlichkeit nicht<br />
berücksichtigt (Beispiel Fukushima).<br />
TiB: Wie sollen wir damit umgehen?<br />
Sacher: Risiken, deren E<strong>in</strong>tritt existentielle<br />
Folgen haben, kann man nur auf zwei Arten behandeln:<br />
Alles, aber auch wirklich alles, zu ihrer<br />
E<strong>in</strong>dämmung tun oder aber sie ganz vermeiden.<br />
Die Frage ist nur, ob man bereit ist die daraus<br />
resultierenden E<strong>in</strong>schränkungen zu akzeptieren.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
TiB: Wäre e<strong>in</strong> Flugzeug für 1000 Passagiere<br />
vernünftig?<br />
Sacher: Technisch ja, wirtschaftlich ja, psychologisch<br />
ne<strong>in</strong>. Aber das kann sich ändern,<br />
der Mensch kann sich auch an Großrisiken<br />
gewöhnen.<br />
TiB: Gibt es neuartige Risiken <strong>und</strong> wie gehen<br />
wir damit um?<br />
Sacher: Neben den erwähnten wachsenden<br />
Systemrisiken kann man Nanotechnik<br />
<strong>und</strong> Chemie anführen. Die Auswirkungen der<br />
Nanotechnik s<strong>in</strong>d noch weitgehend unklar.<br />
Und die Chemie entwickelt ständig neue Substanzen,<br />
die lediglich auf der Gr<strong>und</strong>lage der<br />
bisher bekannten Risiken evaluiert werden<br />
können.<br />
TiB: Warum wird das <strong>in</strong> der Öffentlichkeit im<br />
Gegensatz etwa zur Kernkraft wenig diskutiert?<br />
Sacher: Dieser E<strong>in</strong>druck täuscht e<strong>in</strong> wenig.<br />
Wir haben beispielsweise im Zusammenhang<br />
mit Spielzeug schon sehr heftige öffentliche<br />
Diskussionen über die chemische Sicherheit<br />
gesehen. E<strong>in</strong> Ergebnis dieser Diskussionen<br />
war die Neufassung der Europäischen<br />
Spielzeugrichtl<strong>in</strong>ie mit e<strong>in</strong>er deutlichen Verschärfung<br />
der Vorgaben für die chemische<br />
Sicherheit. Diese Diskussionen verlaufen<br />
ähnlich emotional wie die Diskussion um<br />
die Kernkraft, wo jeder, auch noch so unbedeutende<br />
Zwischenfall, <strong>in</strong> der Öffentlichkeit<br />
kontrovers, nicht immer objektiv, diskutiert<br />
wird. Auf der anderen Seite bee<strong>in</strong>flussen che<br />
SCHWERPUNKt<br />
mische Produkte (z.B. Arzneien) das tägliche<br />
Leben im positiven S<strong>in</strong>n. Damit rückt das damit<br />
verb<strong>und</strong>ene Risiko <strong>in</strong> den H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>.<br />
TiB: Zum Schluss: Gehen wir (persönlich, Unternehmen,<br />
Gesellschaft, Politik) angemessen mit<br />
Risiko um?<br />
Sacher: Ne<strong>in</strong>! Wie schon erwähnt, werden<br />
verschiedene Risiken nicht sorgfältig genug<br />
berücksichtigt. Wir akzeptieren <strong>in</strong>transparente<br />
Risiken, wir verdrängen mögliche Konsequenzen<br />
aus Bequemlichkeit oder Angst um Wohlstand,<br />
wir scheuen generell oft die konsequente<br />
Ause<strong>in</strong>andersetzung mit Risiken. Die Risikobewertung<br />
quantifiziert zwar die Gefahren, sie<br />
sagt aber nicht Ja oder Ne<strong>in</strong>, die Entscheidung<br />
müssen wir selber treffen.<br />
TiB: Vielen Dank für das Gespräch.<br />
Das Interview mit Hubert Sacher führten<br />
Gerhard Grosch <strong>und</strong> Silvia Stettmayer<br />
WeiteRe <strong>in</strong>FoRmAtionen<br />
Die tÜV SÜD Industrie Service bietet sicherheitstechnische<br />
Dienstleistungen für Betreiber<br />
<strong>und</strong> Hersteller baulicher sowie technischer<br />
Anlagen <strong>und</strong> E<strong>in</strong>richtungen.<br />
R<strong>und</strong> 2.400 Mitarbeiter beraten bei Planung<br />
<strong>und</strong> Bau, unterstützen bei der Durchführung<br />
<strong>und</strong> sichern den störungsfreien Betrieb bis<br />
h<strong>in</strong> zur Entsorgung.<br />
11<br />
Foto: Silvia Stettmayer<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
Quelle: Symantec Corporation<br />
SCHWERPUNKt<br />
maßnahmen <strong>und</strong> Herausforderungen beim Schutz<br />
von it-Systemen<br />
„Die Zahl der veröffentlichten Sicherheitslücken war im Jahr 2010 weiterh<strong>in</strong> hoch“. Dieses Zitat<br />
aus dem Lagebericht 2011 des B<strong>und</strong>esamtes für Sicherheit <strong>in</strong> der Informationstechnik (BSI) sowie<br />
zahlreiche Pressemeldungen führen uns das Thema IT-Sicherheit immer wieder vor Augen.<br />
Die Diskussionen um das Thema Staatstrojaner<br />
<strong>und</strong> die damit verb<strong>und</strong>enen rechtlichen<br />
Aspekte oder das Auftauchen des auf<br />
den Namen Duqu getauften StuxnetSohns<br />
s<strong>in</strong>d nur e<strong>in</strong>ige Beispiele. Anlässlich dieser<br />
anhaltenden Diskussionen wird im Rahmen<br />
Abb. 1: Herausforderungen der IT-Sicherheit<br />
12<br />
zielgerichte Angriffe entwickeln sich weiter<br />
sowohl gegen geistiges Eigentum e<strong>in</strong>es<br />
Unternehmens (Hydraq), als auch gegen<br />
spezielle Ziele (stuxnet)<br />
dieses Beitrags e<strong>in</strong> kurzer Überblick über<br />
gegenwärtige Maßnahmen <strong>und</strong> Herausforderungen<br />
beim Schutz von ITSystemen<br />
gegeben, der selbstverständlich ke<strong>in</strong>esfalls<br />
umfassend se<strong>in</strong> kann, sondern nur schlaglichtartig<br />
die Problematik umreißt.<br />
Angriffe basierend auf der Auswertung sozialer Netzwerke<br />
Cross Correlation (Auswertung <strong>und</strong><br />
Zusammenführung von Daten mehrerer<br />
sozialer Netzwerke) hat zugenommen<br />
Zero-Day-Exploits nehmen zu<br />
Ausnutzung bisher nicht bekannter<br />
Schwachstellen (Zero-Day-Exploits)<br />
OBFUSCATION<br />
EXPLOIT LIBRARY<br />
COMMAND & CONTROL<br />
USER INTERFACE<br />
UPDATABILITY ENGINE<br />
Toolkit-Sammlungen für Angriffswerkzeuge<br />
Baukastensätze für Angriffswerkzeuge<br />
werden immer verbreiteter<br />
Mobile Bedrohungen nehmen zu<br />
<strong>in</strong>sbesondere für Android<br />
Quelle: Symantec Corporation<br />
VULNERABILITIES<br />
115<br />
163<br />
2009 2010<br />
Derzeitige Maßnahmen zum<br />
Schutz von It-Systemen<br />
In aller Regel handelt es sich bei ITSystemen<br />
um sog. soziotechnische Systeme. Menschen <strong>in</strong>teragieren<br />
mit ITSystemen <strong>in</strong>dem sie sie bedienen<br />
<strong>und</strong> nutzen. Schutzmaßnahmen gegen Bedrohungen<br />
setzen daher gewöhnlich sowohl auf der<br />
sozialen, als auch auf der technischen Ebene an.<br />
Nicht-technische Schutzmaßnahmen<br />
Entgegen der häufig verbreiteten Me<strong>in</strong>ung,<br />
dass die Masse der Angriffe auf die technische<br />
Teilkomponente des soziotechnischen Systems<br />
abzielen, werden dem Microsoft Security Intelligence<br />
Report zufolge lediglich etwa 10 %<br />
der Schadsoftware durch Sicherheitslücken<br />
auf Seiten der technischen Teilkomponente<br />
verursacht. Zu fast 50 % erfolgt e<strong>in</strong>e Infektion<br />
e<strong>in</strong>es W<strong>in</strong>dowsRechners durch e<strong>in</strong>e bewusste<br />
Benutzer<strong>in</strong>teraktion (44,8 %). In weiteren<br />
26 % aller Fälle wird der Rechner durch die<br />
USBAutorunFunktion – e<strong>in</strong>e Methode zum<br />
automatischen Starten von Programmen auf<br />
USBDatenträgern (die lediglich bis Vista standardmäßig<br />
aktiviert ist) <strong>in</strong>fiziert.<br />
Aus gutem Gr<strong>und</strong> rückt daher die Sensibilisierung<br />
der ITNutzer („Security Awareness“)<br />
zunehmend <strong>in</strong> den Fokus der ITSicherheit. Darunter<br />
werden alle Maßnahmen verstanden, um<br />
das Wissen, die Haltung <strong>und</strong> den Umgang von<br />
Mitarbeitern bezogen auf den Schutz des physischen<br />
<strong>und</strong> vor allem des <strong>in</strong>formationstechnischen<br />
„Assets“ e<strong>in</strong>er Organisation zu verbessern.<br />
Technische Schutzmaßnahmen<br />
Den Übergang zwischen nichttechnischen<br />
<strong>und</strong> technischen Schutzmaßnahmen bilden alle<br />
vom Adm<strong>in</strong>istrator vorzunehmenden Konfigurationen.<br />
Für praktisch jedes System existieren<br />
spezielle Security Guides oder Best Practices,<br />
um – abhängig von den jeweiligen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
– e<strong>in</strong>en hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.<br />
Dies betrifft z.B. das Deaktivieren<br />
nicht benötigter Dienste oder die Vorgabe von<br />
Komplexitätsrichtl<strong>in</strong>ien für Passwörter.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Neben diesen konfigurationsspezifischen Aufgaben<br />
muss die jeweilige Software auch auf den<br />
aktuellen Stand gehalten werden, <strong>in</strong>dem Updates<br />
der Hersteller zeitnah e<strong>in</strong>gespielt werden. Der<br />
E<strong>in</strong>satz von (aktueller) AntiVirenSchutzsoftware<br />
sowie Firewalls sollte ebenfalls e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit<br />
se<strong>in</strong>. Zur Erkennung von Angriffen<br />
ist darüber h<strong>in</strong>aus der E<strong>in</strong>satz von Intrusion<br />
Detection Systemen (IDS) ratsam. Im Gegensatz<br />
zu Firewalls, die Datenverkehr anhand festgelegter<br />
Regeln filtern (z.B. nur die Nutzung von Web<br />
/EMailDiensten erlauben) können IDS Angriffe<br />
aufspüren. Ähnlich den Virenscannern (die alle<br />
Dateien, Programme sowie den Arbeitsspeicher<br />
analysieren), suchen IDS mittels Sensoren nach<br />
E<strong>in</strong>brüchen (<strong>in</strong>dem z.B. LogDateien, Systemdaten<br />
wie etwa der Registry oder Datenpakete<br />
im Netz untersucht werden). Wird im Falle e<strong>in</strong>es<br />
Angriffs nicht nur e<strong>in</strong> Alarm ausgelöst sondern<br />
auch Gegenmaßnahmen (wie das Verwerfen von<br />
Datenpaketen oder das Trennen von Verb<strong>in</strong>dungen)<br />
getroffen, wird von e<strong>in</strong>em Intrusion Prevention<br />
System (kurz IPS) gesprochen.<br />
LINZ.VERÄNDERT,<br />
INGENIEURE<br />
LINZ, DIE ERFOLGREICHE DONAUSTADT, VERBINDET KULTUR, NATUR<br />
UND INDUSTRIE. 2012 VERFÜHRT SIE ZUM ABENTEUER TECHNIK MIT<br />
INNOVATIONSLABORS UND WERKSTOUREN.<br />
WWW.LINZ.AT/TOURISMUS I WWW.LINZ-TOURISMUS.INFO<br />
• Stahl: multimedial <strong>und</strong> hautnah<br />
Tauchen Sie e<strong>in</strong> <strong>in</strong> die voestalp<strong>in</strong>e Stahlwelt <strong>und</strong> erfahren Sie mehr<br />
über das L<strong>in</strong>z-Donawitz-Verfahren.<br />
www.voestalp<strong>in</strong>e-stahlwelt.at<br />
• 3D Reisen im Museum der Zukunft<br />
Im Ars Electronica Center <strong>in</strong>teraktive Erlebniswelten, Technologie<br />
<strong>und</strong> Medienkunst erleben.<br />
www.aec.at<br />
Lassen Sie sich von L<strong>in</strong>z begeistern <strong>und</strong><br />
fordern Sie jetzt Informationen an!<br />
Tourismusverband L<strong>in</strong>z<br />
Tel. +43 732 7070 2009<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
tourist.<strong>in</strong>fo@l<strong>in</strong>z.at<br />
LINZ<br />
TOURISMUS<br />
Insbesondere <strong>in</strong> sicherheitskritischen Bereichen<br />
(z.B. <strong>in</strong> Krankenhäusern, bei Banken, beim<br />
Militär) kann darüber h<strong>in</strong>aus e<strong>in</strong>e physikalische<br />
Netztrennung des Intranets vom Internet s<strong>in</strong>nvoll<br />
se<strong>in</strong>. Physikalisch bedeutet <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
den Aufbau zweier völlig getrennter Netze<br />
(separate Rechner, Kabel, Router etc.) ohne direkte<br />
Verb<strong>in</strong>dung untere<strong>in</strong>ander, damit z.B. der Schutz<br />
der Patientendaten sichergestellt ist.<br />
Herausforderungen beim Schutz<br />
von It-Systemen<br />
Doch <strong>warum</strong> versagen die Schutzmaßnahmen <strong>in</strong><br />
letzter Zeit <strong>in</strong> zunehmendem Maße? Warum ist es<br />
renommierten Firmen wie etwa der Computerbörse<br />
Nasdaq oder Sony mit se<strong>in</strong>em Playstation Network<br />
nicht möglich, sich gegen Angriffe zu verteidigen?<br />
E<strong>in</strong>en Überblick über aktuelle Themen der ITSicherheit<br />
des vergangenen Jahres zeigt Abbildung 1.<br />
Während <strong>in</strong> der Vergangenheit Massenwürmer<br />
wie Sasser oder Conficker die ITSysteme<br />
be<strong>droht</strong> haben, zeigen die Lehren von Stuxnet,<br />
dass der Trend h<strong>in</strong> zu immer gezielteren<br />
SCHWERPUNKt<br />
Angriffen mit hohem Entwicklungsaufwand<br />
geht, die spezielle Anwendungen angreifen.<br />
So wird im Falle von Stuxnet der Zeitaufwand<br />
für Hard <strong>und</strong> Software auf m<strong>in</strong>destens sechs<br />
Monate <strong>und</strong> der Personalaufwand auf m<strong>in</strong>destens<br />
fünf bis zehn Entwickler geschätzt. Gegen diese<br />
speziellen Angriffsmuster haben gegenwärtige<br />
Schutzmaßnahmen nur wenig entgegenzusetzen.<br />
Nicht-technische Herausforderungen<br />
Auf dem Gebiet der primär nichttechnischen<br />
Schutzmaßnahmen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sbesondere moderne<br />
Varianten des Social Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g an erster Stelle<br />
zu nennen. Durch Social Networks wie Facebook<br />
oder X<strong>in</strong>g ist es relativ e<strong>in</strong>fach möglich, Informationen<br />
zu relevanten Personen zu erhalten.<br />
E<strong>in</strong> Beispiel, wie e<strong>in</strong>fach <strong>und</strong> effizient dies ist,<br />
zeigt z.B. die speziell geschaffene „Figur“ Rob<strong>in</strong><br />
Sage, 25 Jahre alt, Absolvent<strong>in</strong> der Technischen<br />
Hochschule <strong>in</strong> Massachusetts <strong>und</strong> Analyst<strong>in</strong><br />
für Cybersicherheit der USMar<strong>in</strong>e. Knapp 300<br />
Mitarbeiter der NSA, Industrielle <strong>und</strong> Politiker<br />
schickten ihr Fre<strong>und</strong>schaftsanfragen <strong>und</strong> ließen<br />
GRUPPEN-<br />
ANGEBOT<br />
2 Tage ab<br />
€ 75,–<br />
p.P. im DZ<br />
13
SCHWERPUNKt<br />
Ganzheitliche, übergreifende<br />
Betrachtung nötig!<br />
Abb. 2: IT-Sicherheit muss ganzheitlich verstanden werden.<br />
sich freimütig vertrauliche Informationen entlocken.<br />
E<strong>in</strong>e andere Form der Nutzung von Facebook<br />
<strong>und</strong> Co. stellt Social Phish<strong>in</strong>g dar, bei dem<br />
zunächst soziale Netzwerke durchforstet werden<br />
<strong>und</strong> dann, abhängig von den persönlichen Interessen<br />
sowie den vorhandenen Kontakten, e<strong>in</strong>e<br />
spezielle EMail erstellt wird, die vorgibt aus dem<br />
Fre<strong>und</strong>eskreis zu stammen (Absender gefälscht)<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong> Thema behandelt, dass von speziellem<br />
Interesse ist <strong>und</strong> so die Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit des<br />
Öffnens dramatisch erhöht.<br />
Neben allen technischen Schutzmaßnahmen<br />
sollte zudem nicht unterschätzt werden, dass e<strong>in</strong><br />
nicht unerheblicher Teil der „E<strong>in</strong>brecher“ nicht<br />
von außen stammt, sondern ihren Ursprung <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Organisation haben, also klassische<br />
Innentäter s<strong>in</strong>d. Die meisten der Schutzmaßnahmen<br />
berücksichtigen diesen Aspekt leider nur<br />
unzureichend. Hier ist verstärkt der Schutz von<br />
Daten anstelle des Schutzes von Diensten gefragt.<br />
Technische Herausforderungen<br />
E<strong>in</strong> wichtiger Gr<strong>und</strong> für das Versagen von<br />
technischen Schutzmaßnahmen ist die wach<br />
14<br />
PC<br />
Dienste<br />
Media-<br />
Stream<strong>in</strong>g e-Commerce<br />
DatenVoIPbank Telefonie<br />
WLAN-<br />
Router<br />
Core-<br />
Router<br />
VPN-Router<br />
(mit Firewall)<br />
Server<br />
IP-TV<br />
Netzdrucker<br />
WLAN<br />
PC<br />
Smartphone<br />
Autonomes<br />
System<br />
Border-<br />
Router<br />
Funkmast<br />
Router<br />
Cloud<br />
Autonomes<br />
System<br />
Border-<br />
Router<br />
Autonomes<br />
System<br />
Rechenkapazität<br />
Router<br />
Border-<br />
Router<br />
Ressourcen<br />
Super-<br />
Computer<br />
DSL-<br />
Router<br />
Speicher<br />
wechselseitige<br />
Abbildung<br />
Router<br />
Home-<br />
Office<br />
Server<br />
Router<br />
Satellit<br />
sende Komplexität der Systeme. Sicherheit ist<br />
für viele Adm<strong>in</strong>istratoren nur e<strong>in</strong>e unter vielen,<br />
teilweise konkurrierenden Anforderungen<br />
<strong>in</strong> der täglichen Arbeit geworden. Diese beiden<br />
Faktoren führen dazu, dass Adm<strong>in</strong>istratoren de<br />
facto kaum noch <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, falsche (unsichere)<br />
E<strong>in</strong>stellungen vollständig zu vermeiden.<br />
Die heutigen Ansätze zur Erkennung von Angriffen<br />
s<strong>in</strong>d, wie schon erwähnt, unzureichend.<br />
Signaturbasierte Ansätze, bei der die gesammelten<br />
Daten mit bekannten Mustern (Signaturen)<br />
aus der Musterdatenbank verglichen werden,<br />
<strong>und</strong> die sowohl bei Virenscannern als auch bei<br />
IDS/IPSSystemen am weitesten verbreitet s<strong>in</strong>d,<br />
s<strong>in</strong>d leider nahezu nicht <strong>in</strong> der Lage spezialisierte<br />
Angriffe zu erkennen. Verhaltensbasierte Ansätze,<br />
die anstelle der Suche nach Mustern <strong>in</strong> Daten<br />
das Verhalten des Systems („Anomalien“) beobachten,<br />
s<strong>in</strong>d hier wesentlich vielversprechender.<br />
Sicherheit <strong>in</strong> der Softwareentwicklung ist<br />
noch zu häufig e<strong>in</strong> Nischenthema, das vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> von Kosten <strong>und</strong> Zeitdruck allzu<br />
sehr vernachlässigt wird. Es ist daher unabd<strong>in</strong>gbar,<br />
Sicherheit als explizite Anforderung<br />
<strong>in</strong> den Softwareentwicklungsprozess<br />
aufzunehmen<br />
(„Security by Design“), <strong>und</strong><br />
umzusetzen.<br />
virtualisiert Fazit<br />
Die Trend der Vernetzung<br />
verschiedenster Geräte <strong>und</strong><br />
Anwendungen schreitet<br />
kont<strong>in</strong>uierlich voran <strong>und</strong><br />
mit ihr das E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gen des<br />
Internets <strong>in</strong> immer mehr<br />
Bereiche unseres Lebens.<br />
real<br />
Das führt dazu, dass bisher<br />
aus der IT bekannte Angriffe<br />
sich <strong>in</strong> neue Gebiete (Smart<br />
Grids, mobile Geräte) ausweiten.<br />
So nimmt z.B. die<br />
Gesamtanzahl der MobilgeräteMalwareVarianten<br />
konstant zu <strong>und</strong> liegt aktuell<br />
laut McAfee ThreatReport<br />
bei 1200, mit starkem Fokus<br />
auf Android. Speziell<br />
Stuxnet, bei dem vermutet<br />
wird, dass e<strong>in</strong>e Erst<strong>in</strong>fek tion<br />
mittels USBDatenträger<br />
erfolgt ist, zeigt allerd<strong>in</strong>gs<br />
auch, dass selbst bisher als<br />
weitestgehend sicher angenommene<br />
Konzepte, wie<br />
das der physikalischen Netztrennung<br />
im Fokus der Angreifer s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong>en 100%igen Schutz gab es nicht <strong>und</strong> es<br />
wird ihn auch <strong>in</strong> der Zukunft nicht geben. Für<br />
die Zukunft ist anzunehmen, dass neue Themen,<br />
wie etwa das Thema Cloud Comput<strong>in</strong>g –<br />
aufgr<strong>und</strong> des Potenzials zur Kostenreduktion<br />
<strong>und</strong> zur Steigerung der Verfügbarkeit – e<strong>in</strong>e<br />
zunehmende Verbreitung erfahren. Dabei wird<br />
die Gewährleistung der Informationssicherheit<br />
e<strong>in</strong>e neue <strong>in</strong>ternationale Dimension erreichen<br />
(BSILagebericht).<br />
ITSicherheit zu stärken ist e<strong>in</strong> Ziel das nur<br />
durch ganzheitliche Sicherheitsmaßnahmen<br />
erreicht werden kann. Ganzheitlich bedeutet<br />
hierbei sowohl den Schutz von Kommunikations<strong>in</strong>frastrukturen<br />
(Systemen, Diensten,<br />
Daten) bis h<strong>in</strong> zu Cloud Diensten <strong>und</strong> Cloud<br />
Ressourcen.<br />
Dipl.-Wirt.-Inf. (Uni) Mario Goll<strong>in</strong>g <strong>und</strong><br />
Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek<br />
Lehrstuhl für Kommunikationssysteme <strong>und</strong><br />
Internet-Dienste<br />
Universität der B<strong>und</strong>eswehr München<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Adaptive lieferantennetzwerke zur Absicherung der lieferfähigkeit<br />
Hilfe, die Produktion steht!<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
SCHWERPUNKt<br />
Bekannt war es schon vorher. Und doch hat die Katastrophe im weit entfernten Fukushima<br />
nochmals verdeutlicht, wie anfällig die Versorgung des deutschen Marktes auf Störungen<br />
reagiert. Ganze Industriezweige waren davon betroffen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.<br />
Die Wettbewerbsfähigkeit fordert von den<br />
Unternehmen die Konzentration auf Kernkompetenzen<br />
<strong>und</strong> damit die Arbeitsteiligkeit.<br />
Es entsteht e<strong>in</strong>e Abhängigkeit von Lieferantenketten,<br />
die aufgr<strong>und</strong> der Globalisierung längst<br />
den gesamten Globus umspannen.<br />
Adaptive Liefernetzwerke<br />
Bei e<strong>in</strong>em Brutto<strong>in</strong>landsprodukt von ca.<br />
2.500 Mrd. Euro im Jahr 2010 wurden Güter<br />
für fast 800 Mrd. Euro importiert. Japan belegte<br />
dabei aus deutscher Sicht mit 22 Mrd. Euro sogar<br />
nur Platz 14 <strong>in</strong> der weltweiten Rangliste der<br />
Importstaaten. <strong>Was</strong> wäre also die Folge, <strong>wenn</strong><br />
beispielsweise die Versorgung aus Ch<strong>in</strong>a (Platz<br />
1 mit e<strong>in</strong>em Importvolumen von ca. 77 Mrd.<br />
Euro) unterbrochen ist?<br />
E<strong>in</strong>e großflächige Naturkatastrophe mag<br />
die Ausnahme se<strong>in</strong>, für Unternehmen ist aber<br />
häufig der Ausfall e<strong>in</strong>zelner Zulieferer schon<br />
schwierig genug. Die vielfältigen Ursachen<br />
dafür reichen von Schadensereignissen über<br />
Insolvenz oder Streiks bis h<strong>in</strong> zu banalen Planungsfehlern.<br />
Da e<strong>in</strong>e Abkehr von der Konzentration<br />
auf Kernkompetenzen für Unternehmen<br />
derzeit als <strong>und</strong>enkbar ersche<strong>in</strong>t, s<strong>in</strong>d adaptive<br />
Liefernetzwerke zur Sicherung der Versorgung<br />
aufzubauen. Darunter versteht man e<strong>in</strong> Netzwerk<br />
an Lieferanten, welches äußerst kurzfristig<br />
<strong>und</strong> nur mit m<strong>in</strong>imalem Aufwand verändert<br />
werden kann. E<strong>in</strong> adaptives Lieferantennetzwerk<br />
beg<strong>in</strong>nt bei der Rohstoffgew<strong>in</strong>nung <strong>und</strong><br />
endet im eigenen Unternehmen.<br />
Das Netzwerk entscheidet<br />
über das Risiko<br />
Die Gestaltung e<strong>in</strong>es Lieferantennetzwerkes<br />
ist entscheidend für das Ausmaß, <strong>in</strong> dem Lieferausfälle<br />
e<strong>in</strong>es Lieferanten durch andere Lieferanten<br />
kompensiert werden können.<br />
Zwischen dem Ort e<strong>in</strong>es Schadensereignisses<br />
(z.B. Produktionsausfall, Transportschaden)<br />
<strong>und</strong> dem eigenen Unternehmen können mehrere<br />
Instanzen (= Lieferanten <strong>und</strong> deren Unterlieferanten)<br />
liegen. Dabei kann es sogar se<strong>in</strong>, dass<br />
der Schaden gar nicht wahrgenommen wird, da<br />
Abbildung 1<br />
Schadensbewertung:<br />
Sehr hohe Auswirkung<br />
Ke<strong>in</strong>e Auswirkung<br />
5th tier<br />
4th tier<br />
andere (Unter)Lieferanten <strong>in</strong> die entstandene<br />
Bresche spr<strong>in</strong>gen. Absatzseitig kann es nicht nur<br />
zu e<strong>in</strong>em Lieferausfall, sondern auch zu erhöhter<br />
Nachfrage kommen, <strong>wenn</strong> e<strong>in</strong> Konkurrent<br />
se<strong>in</strong>e Lieferverpflichtungen nun nicht erfüllen<br />
kann. Die gezielte Gestaltung des Liefernetzwerkes<br />
kann Unternehmen helfen, die Schadeneffekte<br />
zu kompensieren. Schäden haben e<strong>in</strong>e<br />
Auswirkung sowohl <strong>in</strong> Lieferrichtung als auch<br />
entgegengesetzt. In Zeiten hoher Konjunktur<br />
ist Ersatz für ausgefallene Lieferungen deutlich<br />
schwieriger erhältlich als bei niedriger Auslastung<br />
der Kapazitäten. Die Schadens wirkung ist<br />
also abhängig vom Schadenszeitpunkt.<br />
Frühzeitiges Erkennen <strong>und</strong> Ergreifen von<br />
Vorbeugungsmaßnahmen s<strong>in</strong>d unverzichtbar.<br />
Doch gerade das ist aufgr<strong>und</strong> der sich dynamisch<br />
wandelnden Beschaffungs <strong>und</strong> Absatzmärkte<br />
sehr komplex. Klassische Instrumente<br />
wie die FehlermöglichkeitE<strong>in</strong>flussAnalyse<br />
(FMEA) stoßen an ihre Grenzen. Die Risikoprioritätszahl,<br />
also das Produkt aus Schadense<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
Schadenswirkung<br />
<strong>und</strong> Entdeckungswahrsche<strong>in</strong>lichkeit, täuscht<br />
e<strong>in</strong>e stabile Bewertungslage vor. Beschaffungs<br />
<strong>und</strong> Absatzmärkte s<strong>in</strong>d aber ständig <strong>in</strong> Bewe<br />
Lieferrichtung<br />
3rd tier<br />
2nd tier<br />
1st tier<br />
Schadenereignis Unternehmen<br />
gung. So müsste auch die Risikoprioritätszahl<br />
diesen Veränderungen kont<strong>in</strong>uierlich nachgeführt<br />
werden.<br />
Geschw<strong>in</strong>digkeit <strong>und</strong><br />
Flexibilität s<strong>in</strong>d trumpf<br />
Die Unternehmen s<strong>in</strong>d diesen Marktentwicklungen<br />
jedoch nicht hilflos ausgesetzt, sondern<br />
können immer noch maßgeblich die Risiken <strong>und</strong><br />
potenziellen Schäden durch den Aufbau ihrer Lieferantennetzwerke<br />
selbst bee<strong>in</strong>flussen. Je schneller<br />
auftauchende Gefahren erkannt werden <strong>und</strong> je größer<br />
die geschaffenen Handlungsspielräume <strong>in</strong> dem<br />
Netzwerk s<strong>in</strong>d, desto ger<strong>in</strong>ger wird sich der Ausfall<br />
von Lieferanten auf die eigene Lieferfähigkeit<br />
gegenüber K<strong>und</strong>en auswirken. In Abb. 2 ist e<strong>in</strong>e<br />
Auswahl von Gestaltungsansätzen zum Aufbau<br />
adaptiver Netze aufgeführt. So kann beispielsweise<br />
bereits die Produktentwicklung durch die Auswahl<br />
geeigneter Werkstoffe verh<strong>in</strong>dern, dass das Unternehmen<br />
<strong>in</strong> die Abhängigkeit von Angebotsmonopolen<br />
gerät. Durch die Vertragsgestaltung mit Lieferanten,<br />
die Festlegung des Beschaffungsmodells<br />
oder die konkrete Auswahl von Lieferanten ist der<br />
E<strong>in</strong>kauf beteiligt. E<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeit <strong>in</strong><br />
allen Planungszyklen verstärkt das Wissen über<br />
15
SCHWERPUNKt<br />
Der Aufbau e<strong>in</strong>es adaptiven Lieferantennetzwerks kann nicht alle<strong>in</strong>e durch den E<strong>in</strong>kauf realisiert werden. Nahezu alle Unternehmensfunktionen<br />
müssen e<strong>in</strong>en Beitrag leisten, um Monopolsituation zu vermeiden <strong>und</strong> flexibel auf veränderte Randbed<strong>in</strong>gungen reagieren zu können.<br />
16<br />
Abbildung 2<br />
Controll<strong>in</strong>g<br />
Aktualisierte Zielvere<strong>in</strong>barung<br />
Lieferantencontroll<strong>in</strong>g<br />
Lieferantenauditierung<br />
Kennzahlenmonitor<strong>in</strong>g<br />
Liefer(fe<strong>in</strong>)abrufe<br />
Produktion<br />
Bestandsplanung<br />
Personalflexibilität<br />
Kapazitätsreserven<br />
Technologische Alternativen<br />
die Lieferanten sowie das Verständnis untere<strong>in</strong>ander.<br />
Kapazitive <strong>und</strong> technologische Reserven <strong>in</strong><br />
der Produktion verschaffen ebenso Spielräume wie<br />
e<strong>in</strong> flexibles Distributionsnetz. Kurze Lieferwege<br />
senken das Transportrisiko. Das (Beschaffungs)<br />
Controll<strong>in</strong>g hat kont<strong>in</strong>uierlich alle relevanten unternehmens<strong>in</strong>ternen<br />
Kennzahlen, aber auch logistische<br />
<strong>und</strong> f<strong>in</strong>anzielle Kennzahlen der Lieferanten<br />
zu überwachen. Damit wird ersichtlich, dass der<br />
Aufbau risikom<strong>in</strong>imierter <strong>und</strong> damit adaptiver<br />
Lieferantennetze nicht die alle<strong>in</strong>ige Aufgabe der<br />
E<strong>in</strong>kaufsabteilungen se<strong>in</strong> kann. Nahezu alle Diszipl<strong>in</strong>en<br />
im Unternehmen haben für das Erreichen<br />
der Zielsetzung e<strong>in</strong>en Beitrag zu leisten.<br />
Zur Realisierung e<strong>in</strong>es adaptiven Liefernetzwerkes<br />
ist e<strong>in</strong> strukturierter <strong>und</strong> mehrstufiger<br />
Prozess erforderlich, der <strong>in</strong> def<strong>in</strong>ierten Abständen<br />
wiederholt durchlaufen werden muss. Der<br />
Ausgangspunkt ist die Fragestellung, welche<br />
Konsequenzen sich aus Lieferschäden <strong>in</strong> den<br />
folgenden Abstufungen ergeben. Diese s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
steigender Wirkung sortiert:<br />
die Lieferung kommt teilweise verspätet (z.B.<br />
Teillieferungen durch den Lieferanten)<br />
die Lieferung kommt vollständig verspätet<br />
(z.B. Produktionsprobleme beim Lieferanten)<br />
der Teil e<strong>in</strong>er Lieferung fällt aus (z.B. Spezifikationsprobleme<br />
<strong>in</strong> der Abstimmung zwischen<br />
Lieferant <strong>und</strong> K<strong>und</strong>e)<br />
Produktplanung /<br />
-entwicklung<br />
Materialbedarf (Menge, Ausführung, …)<br />
Produkttechnologie<br />
Transport <strong>und</strong> Distribution<br />
e<strong>in</strong>e Lieferung fällt vollständig aus (z.B. vollständiger<br />
Transportschaden nach Annahme)<br />
der Lieferant fällt mittelfristig aus (z.B. Kündigung<br />
des Vertrages durch Lieferanten)<br />
der Lieferant fällt mit sofortiger Wirkung aus<br />
(z.B. unvorhergesehener Konkurs, Naturkatastrophe)<br />
Da <strong>in</strong> ke<strong>in</strong>em Fall von e<strong>in</strong>er h<strong>und</strong>ertprozentigen<br />
Liefersicherheit ausgegangen werden<br />
kann, ergeben sich aus den Konsequenzen<br />
für jede Frage unterschiedlich starke<br />
Risiken für das Unternehmen. In e<strong>in</strong>er Chancen<br />
<strong>und</strong> Risikoabwägung lassen sich die resultierenden<br />
Vor <strong>und</strong> Nachteile gegenüberstellen.<br />
Es ergibt sich e<strong>in</strong>e transparente Entscheidungsgr<strong>und</strong>lage<br />
für das Management<br />
um Notfallpläne aufzubauen oder präventive<br />
Maßnahmen e<strong>in</strong>zuleiten.<br />
Adaptive Liefernetzwerke –<br />
e<strong>in</strong> Analogon zur Evolution<br />
Will e<strong>in</strong> Unternehmen den globalen Marktentwicklungen<br />
nicht als Spielball ausgesetzt<br />
se<strong>in</strong>, so muß es sich schnell <strong>und</strong> nur mit möglichst<br />
ger<strong>in</strong>gem Aufwand auf neue Situationen<br />
e<strong>in</strong>stellen. Wie kurzfristig <strong>und</strong> unvorhersehbar<br />
Veränderungen auf Unternehmen e<strong>in</strong>wirken,<br />
zeigen e<strong>in</strong>drucksvoll die Konjunkturkrise<br />
aus dem Jahr 2009 sowie die Naturkatastrophe<br />
Planung<br />
Netzwerk-<br />
konzeption<br />
Vertragliche Gestaltung<br />
Lieferantenauswahl (Bonität,<br />
Referenzen, Lieferleistung, …)<br />
Kritischer Pfad<br />
Multi-Sourc<strong>in</strong>g Konzepte<br />
Geographische Distanz<br />
Verfolgung von Markttrends<br />
Umsatz- <strong>und</strong> Absatzplanung<br />
Kapazitätsabgleich<br />
Produktionstechnologie<br />
Produktionsplanung <strong>und</strong> -steuerung<br />
Corporate Plann<strong>in</strong>g Forecast<strong>in</strong>g and Replenishment<br />
von Fukushima. Der Aufbau adaptiver Lieferantennetzwerke<br />
bietet Unternehmen die<br />
Chance, sich auf e<strong>in</strong>e veränderte Unternehmensumgebung<br />
e<strong>in</strong>zustellen <strong>und</strong> auf diese<br />
Weise die Unternehmensexistenz zu sichern.<br />
Damit verfolgen adaptive Lieferantennetzwerke<br />
dieselbe Ausrichtung, welche Tier <strong>und</strong><br />
Pflanzenarten im Laufe der Evolution erfolgreich<br />
vor dem Aussterben bewahrt hat. Zum<br />
Aufbau e<strong>in</strong>er effektiven Anpassungsfähigkeit<br />
s<strong>in</strong>d alle Unternehmens bereiche gefordert.<br />
Zusammenfassung<br />
Adaptive Lieferantennetzwerke s<strong>in</strong>d die<br />
Voraussetzung, um im Fall e<strong>in</strong>es Lieferausfalls<br />
durch Veränderung der Lieferantenstrukturen<br />
reagieren zu können. Dafür werden entsprechende<br />
Produktplanung <strong>und</strong> gestaltung, flexible<br />
<strong>und</strong> standardisierte Geschäftsprozesse<br />
sowie kapazitive <strong>und</strong> technologische Reserven<br />
<strong>in</strong>nerhalb des Unternehmens benötigt. Der<br />
Vorteil adaptiver Lieferantennetzwerke ist also<br />
nicht ohne Kosten zu haben, kann aber die<br />
Unternehmens existenz retten.<br />
Prof. Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Meier<br />
IPL – Institut für Produk tionsmanagement<br />
<strong>und</strong> Logistik,<br />
Hochschule München<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
die automatische u-Bahn ist sicher unterwegs!<br />
Das „offene Schutzsystem“ der Nürnberger U-Bahn.<br />
SCHWERPUNKt<br />
Um das richtige Bremsen bei Gefahr sorgen sich die Fahrgäste, <strong>wenn</strong> sie zum ersten Mal mit<br />
der automatischen U-Bahn fahren. Ganz konträr dazu die Gedanken des Betriebsleiters <strong>und</strong><br />
der verantwortlichen <strong>Technik</strong>er: Hoffentlich haben wir ke<strong>in</strong>e Störung, die uns den Fahrplan<br />
durche<strong>in</strong>ander br<strong>in</strong>gt!<br />
Die Zeit war reif für den vollautomatischen<br />
Betrieb<br />
Die 1972 eröffnete UBahn <strong>in</strong> Nürnberg ist<br />
das Rückgrat für den ÖPNV der Stadt <strong>und</strong> der<br />
Region. 1997 wurde der Bau e<strong>in</strong>er dritten L<strong>in</strong>ie<br />
beschlossen, die e<strong>in</strong>en Teil des vorhandenen Systems<br />
mit benutzen sollte. Neue Fahrzeuge <strong>und</strong><br />
auch die Ersatzbeschaffung für die erste Fahrzeugserie<br />
waren notwendig. Gleichzeitig sollte<br />
die Attraktivität für die Fahrgäste durch kürzere<br />
Takte <strong>und</strong> mehr Flexibilität bei Großereignissen<br />
wie Fußballspielen verbessert werden. Dabei<br />
sollten die Kosten für den Betrieb gesenkt werden.<br />
Dieses zusammen gab den Auslöser, über<br />
e<strong>in</strong>e vollautomatische UBahn nachzudenken,<br />
weltweit gibt es das bereits seit 30 Jahren. In<br />
Nürnberg jedoch wurde Neuland betreten,<br />
musste doch e<strong>in</strong>e konventionelle L<strong>in</strong>ie (vorhandene<br />
Fahrzeugtechnik <strong>und</strong> mit Fahrer) migriert<br />
werden <strong>und</strong> während der Bauphase der Betrieb<br />
weitergeführt werden.<br />
E<strong>in</strong> Team aus verschiedenen Spezialisten der<br />
VAG, der technischen Aufsichtsbehörde <strong>und</strong><br />
des Herstellers wurde gebildet. Als Basis diente<br />
das semiautomatische System der baugleichen<br />
UBahn München. Nach vielen Überlegungen,<br />
Diskussionen <strong>und</strong> zwei Jahre später wurde die<br />
Machbarkeit <strong>und</strong> Wirtschaftlichkeit e<strong>in</strong>es AGT<br />
[automated guided tra<strong>in</strong>] Systems durch e<strong>in</strong>e<br />
Studie bestätigt.<br />
Die weltweit erste UBahnL<strong>in</strong>ie im Mischbetrieb<br />
automatisch / konventionell wurde 2001<br />
<strong>in</strong> Angriff genommen. Unabd<strong>in</strong>gbar für die<br />
Realisierung <strong>und</strong> spätere Zulassung war weiterh<strong>in</strong><br />
die Zusammenarbeit der verschiedenen<br />
Spezialisten von allen Beteiligten. Die Technische<br />
Aufsichtsbehörde war bei Besprechungen<br />
immer mit dabei, die Wünsche des Service, der<br />
Wartung <strong>und</strong> des Betriebs wurden gehört, der<br />
Hersteller koord<strong>in</strong>ierte die sonst unabhängigen<br />
Unternehmensbereiche für Signaltechnik <strong>und</strong><br />
Fahrzeuge. <strong>Was</strong> muss detektiert, zusätzlich be<br />
trachtet werden, <strong>wenn</strong> ke<strong>in</strong> Fahrer im Fahrzeug<br />
h<strong>in</strong>schaut <strong>und</strong> gegebenenfalls reagiert?<br />
Das war viel Arbeit für alle Beteiligten. Technische<br />
Details zur Zulassung f<strong>in</strong>den sich unter<br />
http://rub<strong>in</strong>nuernberg.de.<br />
Das nicht mehr für den Betrieb der Züge benötigte<br />
Personal wird weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> der K<strong>und</strong>enbetreuung<br />
beschäftigt.<br />
Gefühltes Risiko <strong>und</strong> Bremssysteme<br />
Von Gesprächspartnern, die nicht mit der<br />
<strong>Technik</strong> von Schienenfahrzeugen vertraut s<strong>in</strong>d,<br />
kommt häufig die Frage: „Bremsen die automatischen<br />
UBahnen bei Bedarf denn auch rechtzeitig?“<br />
Ne<strong>in</strong>, dass der Zug fährt, unkontrolliert <strong>und</strong><br />
unaufhaltsam bis zum Crash, wie es bei e<strong>in</strong>igen<br />
Actionfilmen spannend <strong>in</strong> Szene gesetzt ist, das<br />
ist bei Beachtung der Sicherheitsvorschriften<br />
nicht möglich. Und zwar auch im konventionellen<br />
Betrieb: Der Fahrer muss e<strong>in</strong> bestimmtes<br />
Pedal, e<strong>in</strong>en Knopf <strong>in</strong> regelmäßigen Abständen<br />
betätigen, die Totmannschaltung leitet sonst unweigerlich<br />
e<strong>in</strong>e Bremsung bis zum Stillstand e<strong>in</strong>.<br />
Video Erkennung<br />
Analyse von Störungen<br />
Erkennen von<br />
Gefahrsituationen<br />
E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>güberwachung<br />
HF-Transpondersystem<br />
für die Detektion von<br />
Gegenständen im<br />
Gleisbereich<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012 17
SCHWERPUNKt<br />
Jedes Fahrzeug hat drei vone<strong>in</strong>ander unabhängige<br />
Bremssysteme. Das wirkungsvollste<br />
ist die elektrodynamische Bremse, die wie e<strong>in</strong><br />
Generator wirkt <strong>und</strong> die Bewegungsenergie <strong>in</strong><br />
elektrische Energie umwandelt. Diese elektrische<br />
Energie wird <strong>in</strong> das Netz e<strong>in</strong>gespeist <strong>und</strong><br />
kann somit von anderen Zügen im Netz zum<br />
Beschleunigen aufgenommen werden.<br />
Der Zug kann auch wie e<strong>in</strong> PKW über Scheibenbremsen<br />
gebremst werden. Diese besitzen<br />
zusätzlich e<strong>in</strong>en Federspeicher <strong>und</strong> erfüllen<br />
failsafe Anforderungen. Beim bislang nur<br />
theoretischen Ausfall jeglicher Energie<br />
werden die Räder so <strong>in</strong> jedem Fall<br />
gebremst. Diese Bremse hält das Fahrzeug<br />
auch im Stillstand (Parkbremse).<br />
Kurz h<strong>in</strong>ter den Signalen bef<strong>in</strong>den<br />
sich sogenannte magnetische Fahrsperren.<br />
Diese s<strong>in</strong>d bei e<strong>in</strong>em „Halt“<br />
zeigenden Signal aktiv <strong>und</strong> lösen über<br />
e<strong>in</strong>e Empfangse<strong>in</strong>richtung auch bei<br />
e<strong>in</strong>em fahrergesteuerten Zug e<strong>in</strong>e sofortige<br />
Zwangsbremsung aus. Im Automatikbetrieb<br />
fährt die sogenannte<br />
ATO (Automatic Tra<strong>in</strong> Operation) den<br />
Zug <strong>und</strong> die ATP (Automatic Tra<strong>in</strong><br />
Protection) überwacht wie e<strong>in</strong>e Art<br />
Fahrlehrer die ATO.<br />
Bahnsteigüberwachung<br />
Viele vollautomatische UBahnen<br />
haben BahnsteigAbschlusstüren,<br />
die – wie bei e<strong>in</strong>em Aufzug – erst dann öffnen,<br />
<strong>wenn</strong> der Zug <strong>in</strong> der richtigen Position dah<strong>in</strong>ter<br />
steht.<br />
In Nürnberg war dieses aufgr<strong>und</strong> des Mischbetriebes<br />
nicht möglich. Auch die besten Fahrer<br />
schaffen es nicht ständig, auf +/ 50 cm genau<br />
anzuhalten. Außerdem hat Nürnberg teilweise<br />
gekrümmte Bahnsteige <strong>und</strong> man müsste den<br />
sich ergebenden Raum zwischen Bahnsteig<br />
<strong>und</strong> Fahrzeugtüren zusätzlich überwachen.<br />
Daher wurde für e<strong>in</strong> „offenes Schutzsystem“<br />
entschieden. Gegenüber liegende HFSender<br />
<strong>und</strong> Empfänger sichern den Gleisbereich am<br />
Bahnsteig auf gesamter Länge bis <strong>in</strong> den Tunnelbereich<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> (siehe Abb. S. 17). Die Hochfrequenzstrahlen<br />
des Systems haben e<strong>in</strong>en Abstand<br />
von 15 cm zue<strong>in</strong>ander <strong>und</strong> ermöglichen,<br />
dass Gegenstände größer als e<strong>in</strong>e Kugel mit<br />
e<strong>in</strong>em Durchmesser von 30 cm sicher erkannt<br />
werden. Von herumfliegenden Zeitungen werden<br />
die Strahlen nicht unterbrochen, dadurch<br />
werden Fehlalarme reduziert.<br />
Wird e<strong>in</strong> E<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>gl<strong>in</strong>g oder größer Gegenstand<br />
entdeckt, gibt das System sofort Alarm:<br />
18<br />
Der ankommende Zug wird gebremst, <strong>in</strong> der<br />
Leitstelle werden die Bilder der jeweiligen Videokameras<br />
voll e<strong>in</strong>geblendet. Die ständig laufende<br />
Aufzeichnung erlaubt dem Mitarbeiter,<br />
die Situation zu beurteilen <strong>und</strong> erforderliche<br />
Maßnahmen zu veranlassen (Personal vor Ort,<br />
Polizei, Krankenwagen etc.).<br />
Die Servicetüren an den Bahnsteig enden<br />
können nur mit Schlüssel geöffnet werden <strong>und</strong><br />
s<strong>in</strong>d mit e<strong>in</strong>em Meldekontakt ausgestattet. D.h.<br />
das Instandhaltungspersonal muss sich bei der<br />
Leitstelle anmelden <strong>und</strong> diese deaktiviert den<br />
E<strong>in</strong>klemmschutz.<br />
Meldekontakt. Erfolgt dies nicht, so werden Züge<br />
<strong>in</strong> diesem Bereich sicherheitshalber automatisch<br />
e<strong>in</strong>gebremst. Damit nicht genug: Bei Langzügen<br />
wird auch der Kupplungsbereich zwischen den<br />
zwei Fahrzeugen durch zusätzliche Hochfrequenzstrahlen<br />
überwacht. Sollte e<strong>in</strong> Fahrgast <strong>in</strong><br />
den Kupplungsbereich stürzen, so wird er zweifelsfrei<br />
erkannt <strong>und</strong> die Zugabfahrt unterb<strong>und</strong>en.<br />
Um den Betrieb seltener durch Fehlalarme<br />
zu stören, wurde auch e<strong>in</strong>e Taubenerkennung<br />
entwickelt. Diese generieren im Flug e<strong>in</strong> bestimmtes<br />
Muster an Strahlunterbrechungen<br />
<strong>und</strong> können so ausmaskiert werden. An e<strong>in</strong>igen<br />
Stationen fliegen diese Tiere auf der Suche nach<br />
Brötchenkrümeln durch das Gleis.<br />
Vollautomatische U-Bahn-Fahrzeuge<br />
Die neuen Fahrzeuge haben zusätzliche<br />
E<strong>in</strong>richtungen <strong>und</strong> Sensoren erhalten. Für die<br />
Fahrgäste sichtbar s<strong>in</strong>d Schieberampen an den<br />
Türen, die den Spalt bis zur Bahnsteigkante sichern.<br />
Rollstuhlfahrer, Rollatorbenutzer oder<br />
Fahrgäste mit K<strong>in</strong>derwagen <strong>und</strong> kle<strong>in</strong>e K<strong>in</strong>der<br />
wissen das zu schätzen.<br />
Die Türen weisen über die Motorstromüberwachung<br />
e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>klemmschutz auf (s.<br />
Abb.). Darüber h<strong>in</strong>aus gibt es e<strong>in</strong>e Sensorik<br />
<strong>in</strong> der Türkante, die auch kle<strong>in</strong>e Gegenstände<br />
erkennt, <strong>wenn</strong> die Tür bereits geschlossen ist.<br />
Zu diesem Zweck schickt e<strong>in</strong> InfrarotSender<br />
gepulstes InfrarotLicht durch den über den<br />
gesamten Türspalt reichenden Hohlraum des<br />
Gummiprofils zu e<strong>in</strong>em Empfänger. Selbst<br />
dünne Gegenstände wie e<strong>in</strong>e H<strong>und</strong>ele<strong>in</strong>e, die<br />
beim Schließen der Türen normalerweise nicht<br />
erkannt werden können, lösen spätestens beim<br />
Losfahren des Zugs Alarm aus <strong>und</strong><br />
stoppen den Zug. Überwacht werden<br />
z.B. aber auch die Innenbeleuchtung<br />
(e<strong>in</strong>e ausgefallene Lampe wird toleriert)<br />
oder die Heizung <strong>und</strong> Lüftung.<br />
Über Notsprechstellen kann der Fahrgast<br />
jederzeit Kontakt zu e<strong>in</strong>em Disponenten<br />
<strong>in</strong> der Leitstelle aufnehmen.<br />
Diese wiederum können über e<strong>in</strong>e<br />
FunkLANVerb<strong>in</strong>dung <strong>und</strong> Videokameras<br />
life <strong>in</strong> das Fahrzeug schauen.<br />
Im Notfall wird das Fahrzeug blokkiert<br />
oder gebremst (im Bahnsteigbereich).<br />
Halten im Tunnelbereich<br />
wird nach Möglichkeit vermieden,<br />
obwohl auch diese Situationen mit<br />
Evakuieren von Fahrgästen regelmäßig<br />
durch das Servicepersonal <strong>und</strong><br />
die Feuerwehr geübt wird.<br />
Fahrbetrieb<br />
Jedes vollautomatische Fahrzeug erhält<br />
vom Zentralrechner e<strong>in</strong>en Fahrbefehl, dieser<br />
gilt bis zum nächsten Bahnhof. Die Sicherheitssysteme<br />
der Station senden die Freigabe,<br />
die Türen werden geschlossen <strong>und</strong> nach e<strong>in</strong>em<br />
kurzen technischen Check der Fahrzeugsysteme<br />
setzt sich das Fahrzeug <strong>in</strong> Bewegung.<br />
Das Bewegungsprofil beschleunigenrollenbremsen<br />
richtet sich energieoptimiert nach<br />
der Strecke. Die aktuelle Position ermittelt<br />
das Fahrzeug über die erfolgten Radumdrehungen<br />
<strong>und</strong> spätestens nach 90 m erfolgt e<strong>in</strong>e<br />
Synchronisierung mit gekreuzten Leiterschleifen<br />
im Gleis. Im nächsten Bahnhof wird dann<br />
zielgenau (+/ 30 cm) gehalten, die Türen<br />
öffnen sich zum Fahrgastwechsel. Der Zentralrechner<br />
erhält die Bestätigung, die Fahrt<br />
geht weiter.<br />
Dipl-Ing. Konrad Schmidt,<br />
Betriebsleiter der VAG Nürnberg<br />
Dipl.-Ing. Holm Jerosch<br />
Betriebsleiterbüro<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
VDI/VDE<br />
VDI/VDE<br />
VDI Mitgliederversammlung 2012 19<br />
Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure 20<br />
VDe-ehrenmedaille für Prof. Dr. Petra Friedrich 21<br />
Besuch der Iaa 22<br />
VDe Youngnet Konvention 27<br />
Aktuelles<br />
VDe awards 2011 28<br />
VDI Preise 2011 30<br />
Der Bergwald geht onl<strong>in</strong>e 33<br />
excellente elektro<strong>in</strong>genieure 34<br />
Inhalt/RegIonal<br />
E<strong>in</strong>ladung zur VDI-Mitgliederversammlung 2012<br />
Alle Mitglieder unseres Bezirksvere<strong>in</strong>s werden hiermit zur ordentlichen Mitgliederversammlung<br />
2012 e<strong>in</strong>geladen. Sie f<strong>in</strong>det am 19. März 2012 um 17.30 Uhr im Chiemseesaal des TÜV<br />
Süd, Westendstr. 199, 80686 München, statt.<br />
Bitte melden Sie sich an: Tel.: (089) 57 91 22 00, Fax: (089) 57 91 21 61, E-Mail bv-muenchen@vdi.de<br />
tagesordnung<br />
genehmigung der niederschrift über die<br />
ordentliche Mitgliederversammlung<br />
am 14.03.2011 <strong>und</strong> der tagesordnung<br />
tätigkeitsbericht für das geschäftsjahr 2011<br />
Bericht des Schatzmeisters zum Jahresabschluss<br />
2011<br />
Bericht des Rechnungsprüfers<br />
genehmigung des Jahresabschlusses 2011<br />
entlastung des Vorstands<br />
ehrungen<br />
Bericht des Schatzmeisters über den haushaltsplan<br />
2012<br />
Wahlen zum Vorstand *<br />
ausblick auf 2012<br />
Verschiedenes<br />
Die Teilnahme an den Abstimmungen ist<br />
an die Vorlage e<strong>in</strong>es gültigen Mitgliederausweises<br />
geb<strong>und</strong>en. Anträge zur Tagesordnung<br />
richten Sie bitte bis zum 14.02.2012<br />
schriftlich an die Geschäftsstelle.<br />
Das Protokoll der Mitgliederversammlung<br />
2011 ist <strong>in</strong> Heft 4/11, S. 30 von „<strong>Technik</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“ oder <strong>in</strong> der Geschäftsstelle nachzulesen.<br />
*Neu zu besetzen ist die Position des Vorsitzenden, da Prof. Dr.-Ing Bernd-Robert Höhn mit Wirkung vom 31.12.2011 aus dem<br />
Amt ausgeschieden ist.<br />
Ferner s<strong>in</strong>d zu besetzen die Positionen des Stellvertretenden Vorsitzenden <strong>und</strong> des Schatzmeisters, deren Amtsperioden im März<br />
2012 enden.<br />
Für die Position des Vorsitzenden kandidiert Dipl.-Ing. Hans-Joachim Lösch,<br />
für den Stellvertretenden Vorsitzenden kandidiert Dr.-Ing. Johannes Fottner.<br />
Für die Position des Schatzmeisters gab es bei Redaktionsschluss noch ke<strong>in</strong>en Kandidaten.<br />
Wahlvorschläge können bis zum 30.01.2012 an die VDI Geschäftsstelle gerichtet werden.<br />
Im Heft 2 der „<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“ werden sich alle Kandidaten ausführlich vorstellen.<br />
33<br />
Herzliche E<strong>in</strong>ladung auch zum Festvortrag<br />
von Prof. Dr.-Ing Markus Lienkamp zum<br />
Thema Elektromobilität<br />
Beim anschließenden Abendimbiss haben<br />
Sie Gelegenheit zu geselligem Beisammense<strong>in</strong><strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>teressanten Gesprächen.<br />
Der Vorstand<br />
19<br />
Grafik: TUM
Foto: Anton Tremmel<br />
StuDenten unD JungIngenIeuRe<br />
SPS-Sem<strong>in</strong>ar bei Siemens<br />
E<strong>in</strong>e SPS, was ist das <strong>und</strong> wie geht das? Das versuchten die 12 Teilnehmer auf der Exkursion<br />
der VDE Hochschulgruppe bei Siemens herauszuf<strong>in</strong>den.<br />
Die Mitglieder der VDE-Hochschulgruppe beim SPS-Sem<strong>in</strong>ar.<br />
An e<strong>in</strong>em nebligen Morgen trafen wir uns<br />
im Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gszentrum <strong>in</strong> der Richard-Strauss-<br />
Straße <strong>in</strong> München. Nach e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>führung<br />
zum Unternehmen Siemens <strong>und</strong> dem Vertrieb,<br />
20<br />
vor allem <strong>in</strong> der Region <strong>Bayern</strong>, g<strong>in</strong>g es auch<br />
schon ans Thema SPS. Die verschiedenen Ausführungen<br />
<strong>und</strong> Zusatzkomponenten e<strong>in</strong>er SPS<br />
wurden vorgestellt <strong>und</strong> die Teilnehmer durf-<br />
ten sich daraufh<strong>in</strong> unter Anleitung an e<strong>in</strong>er<br />
Simatic S7-300 versuchen. Zum E<strong>in</strong>satz kam<br />
dabei die neue Entwicklungsplattform „TIA-<br />
Portal“, <strong>in</strong> der die Projektierung der Steuerung<br />
<strong>und</strong> der Visualisierung zusammen möglich<br />
ist. Bereits nach dem Mittagessen konnte Bewegung<br />
<strong>in</strong> das Modell e<strong>in</strong>es Förderbandes mit<br />
Sensorik gebracht werden, mit dem bis zum<br />
Schluss noch weiter experimentiert wurde.<br />
Auch <strong>wenn</strong> sich der Nebel draußen nicht<br />
bis Ende auflösen wollte, hat sich bei allen<br />
Teilnehmern der Nebel um das Thema SPS gelichtet,<br />
auch <strong>wenn</strong> das Sem<strong>in</strong>ar an nur e<strong>in</strong>em<br />
Tag (e<strong>in</strong>e normales E<strong>in</strong>steigersem<strong>in</strong>ar dauert<br />
bereits e<strong>in</strong>e ganze Woche) nur e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> dieses Gebiet vermitteln konnte.<br />
Markus Breunig, VDE Hochschulgruppe<br />
Exkursion <strong>in</strong>s BMW Museum <strong>und</strong> der Art Car<br />
Sonderausstellung<br />
Die Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure des VDI<br />
München ließen es sich nicht entgehen <strong>und</strong><br />
besuchten am 21. September <strong>in</strong> der letzten Ausstellungswoche<br />
die temporäre Ausstellung des<br />
BMW Museums.<br />
Zur Eröffnung im Oktober 2010 waren dort<br />
alle 17 Art Cars zu bestaunen. Renn- <strong>und</strong><br />
Straßenfahrzeuge wurden <strong>in</strong> den letzten 35<br />
Jahren von renommierten Künstlern wie Roy<br />
Lichtenste<strong>in</strong>, Andy Warhol oder Jeff Koons<br />
äußerlich neu gestaltet. Jedes Fahrzeug erzählt<br />
se<strong>in</strong>e eigene Geschichte <strong>und</strong> manche sogar<br />
mehrere. So wurde beispielsweise das Art Car<br />
Nr. 4 eigenhändig von Andy Warhol bemalt<br />
<strong>und</strong> erreichte auf der Rennstrecke <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Klasse den 2. Platz beim 24-St<strong>und</strong>en-Rennen<br />
von Le Mans.<br />
Die 20 Teilnehmer erhielten vor der eigentlichen<br />
Exkursion e<strong>in</strong>e kurze Unternehmenspräsentation<br />
<strong>und</strong> konnten sich über Praktika<br />
<strong>und</strong> Festanstellungen bei BMW <strong>in</strong>formieren.<br />
Anschließend g<strong>in</strong>g es von der Konferenzzone,<br />
welche sich <strong>in</strong> der Basis des Vierzyl<strong>in</strong>der-<br />
Gebäudes bef<strong>in</strong>det, weiter <strong>in</strong> die temporäre<br />
Die VDI-suj besucht das BMW-Museum <strong>in</strong> München.<br />
BMW Ausstellung <strong>und</strong> natürlich <strong>in</strong> das BMW<br />
Museum selbst. Auf mitreißende Weise wurde<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong>wissen zu den rollenden<br />
Kunstwerken vermittelt <strong>und</strong> für alle, die sich<br />
die e<strong>in</strong>malige Gelegenheit der Art Car Aus-<br />
stellung entgehen ließen, bleibt nun nur noch<br />
e<strong>in</strong> Blick auf die Homepage: www.bmw-artcars.de<br />
Christian Körger, VDI-AK suj München<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Foto: privat
Foto: privat<br />
Ehrung für Frau Prof. Dr.-Ing. Petra Friedrich<br />
Prof. Helmut Klaus<strong>in</strong>g überreicht die VDE-Ehrenmedaille<br />
Am 4.11.2011 fand <strong>in</strong> Nürnberg e<strong>in</strong> Kam<strong>in</strong>abend<br />
mit Vortrag <strong>und</strong> Diskussion zu dem aktuellen<br />
Thema „Die Kunst des Klüngelns – oder:<br />
Network<strong>in</strong>g, der Schlüssel zum Erfolg“ statt, der<br />
vom Team der Elektro<strong>in</strong>genieur<strong>in</strong>nen im VDE <strong>in</strong><br />
Zusammenarbeit mit dem AK Ingenieur<strong>in</strong>nen<br />
im VDE-BVn Nordbayern veranstaltet wurde.<br />
Im Rahmen dieses Kam<strong>in</strong>abends wurde die<br />
frühere langjährige Vorsitzende des Ausschusses<br />
Elektro<strong>in</strong>genieur<strong>in</strong>nen, Frau Prof. Dr.-Ing. Petra<br />
Friedrich, Hochschule für angewandte Wissenschaften,<br />
Kempten, für ihre besonderen Verdienste<br />
um den Ausschuss Elektro<strong>in</strong>genieur<strong>in</strong>nen<br />
mit der VDE-Ehrenmedaille ausgezeichnet.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Prof. Dr.-Ing. Helmut<br />
Klaus<strong>in</strong>g überreichte<br />
die Medaille <strong>und</strong> hob<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Laudatio <strong>in</strong>sbesondere<br />
das langjährige<br />
große Engagement<br />
von Frau Friedrich<br />
hervor, die Attraktivität<br />
des Ingenieurberufs<br />
für Frauen herauszustellen<br />
<strong>und</strong> publik zu<br />
machen.<br />
Wir gratulieren!<br />
So verhandelt man richtig – die VDE-Hochschulgruppe bei Invensity.<br />
Prof. Dr.-Ing Petra Friedrich erhält die VDE-Ehrenmedaille.<br />
Die VDE Hochschulgruppe lernt bei Invensity die<br />
hohe Kunst des Verhandelns<br />
Wir alle haben schon e<strong>in</strong>mal verhandelt, sei es <strong>in</strong> Italien am Strand über den Preis e<strong>in</strong>es Handtuches<br />
oder sei es mit dem Partner darüber, woh<strong>in</strong> man zum Kaffeetr<strong>in</strong>ken geht.<br />
Weil die Verhandlungskunst auch im Beruf<br />
von großer Bedeutung ist, haben wir von der<br />
VDE Hochschulgruppe München Ende Oktober<br />
das Sem<strong>in</strong>ar „Verhandeln <strong>in</strong> herausfordernden<br />
Situationen“ bei der Unternehmens- <strong>und</strong> Strategieberatung<br />
Invensity besucht.<br />
In Teams wurde e<strong>in</strong>e Fallstudie bearbeitet.<br />
Es galt, e<strong>in</strong> fiktives amerikanisches Arzneimit-<br />
telunternehmen dabei zu unterstützen, e<strong>in</strong>en<br />
Blutdrucksenker auf den hart umkämpften deutschen<br />
Markt zu br<strong>in</strong>gen <strong>und</strong> dort zu etablieren.<br />
Hierzu mussten wir die Voraussetzungen <strong>in</strong><br />
Deutschland haargenau analysieren. Das komplizierte<br />
Zulassungsverfahren <strong>und</strong> die starke<br />
heimische Konkurrenz stellten nur zwei Faktoren<br />
dar, die zu berücksichtigen waren.<br />
VDe<br />
Gegen fünf Uhr am Nachmittag war es<br />
jedoch geschafft. Als Consultants hatten wir<br />
das amerikanische Pharmaunternehmen<br />
von unseren Fähigkeiten überzeugt.<br />
Der Workshop wurde immer wieder von<br />
fiktiven Gehaltsverhandlungen aufgelokkert,<br />
bei denen jeder selbst versuchen konnte,<br />
das frisch erworbene Wissen über Verhandlungen<br />
gleich anzuwenden.<br />
Da geschicktes Verhandeln ganz schön<br />
hungrig machen kann, hat uns Invensity zu<br />
e<strong>in</strong>em opulenten Mittagsmahl e<strong>in</strong>geladen.<br />
Die Pizzen waren gigantisch. Auch das abschließende<br />
Com<strong>in</strong>g together, bei dem wir<br />
die Möglichkeit hatten, uns mit erfahrenen<br />
Unternehmensberatern auszutauschen, war<br />
e<strong>in</strong>e sehr wertvolle Erfahrung.<br />
An dieser Stelle e<strong>in</strong> herzliches Danke!<br />
Wir freuen uns auf weitere Sem<strong>in</strong>are der<br />
Invensity Academy.<br />
Philipp Schmidbauer<br />
VDE Hochschulgruppe<br />
21<br />
Foto: privat
Fotos: Messe Frankfurt<br />
RegIonal<br />
Besuch der IAA <strong>in</strong> Frankfurt<br />
Früh morgens am 20. September 2011 versammelten sich 10 neugierige Teilnehmer am<br />
Münchner Hauptbahnhof, um geme<strong>in</strong>sam bei e<strong>in</strong>er sehr <strong>in</strong>teressanten Exkursion der<br />
Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure des VDI BV München dabei zu se<strong>in</strong>. Das Ziel der Exkursion<br />
hieß 64. Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) PKW 2011 <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong>.<br />
Großer Andrang herrschte auch heuer wieder auf der IAA. Gespannt wartet man auf<br />
neue Antriebskonzepte.<br />
Auf der H<strong>in</strong>fahrt lernten sich die Teilnehmer<br />
kennen <strong>und</strong> diskutierten munter neben<br />
aktuellen Themen zur Energieversorgung auch<br />
darüber, was sie auf der Messe <strong>in</strong> puncto Neuerungen<br />
wohl erwarten würde. Durch die gute<br />
Ticketorganisation konnte der Besuch sofort<br />
nach Ankunft auf der Messe beg<strong>in</strong>nen. Da Jeder<br />
andere Interessen hat, haben sich die Teilnehmer<br />
<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>e Gruppen aufgeteilt, somit konnte<br />
jeder besichtigen, was ihn <strong>in</strong>teressierte.<br />
Obwohl die Exkursion auf e<strong>in</strong>en Dienstag<br />
fiel, war die Messe sehr gut besucht. Man<br />
sche<strong>in</strong>t sich nicht mehr nur auf gut gemachte<br />
Werbespots zu verlassen oder auf den E<strong>in</strong>druck<br />
vom Autohaus des Vertrauens. Vielmehr wollen<br />
die zukünftigen Käufer e<strong>in</strong>es neuen PKWs<br />
sich selbst <strong>und</strong> <strong>in</strong> aller Ausführlichkeit e<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>druck von den Vehikeln <strong>und</strong> der jeweiligen<br />
Marke dazu machen. Entsprechend aufwendig<br />
s<strong>in</strong>d die Präsentationen der e<strong>in</strong>zelnen Firmen<br />
dann auch ausgefallen, denn die IAA ist ja nicht<br />
irgende<strong>in</strong>e Automobilmesse, sondern die größte<br />
Automobilausstelllung der Welt.<br />
Doch was gab es nun konkret zu sehen? In<br />
der Mehrzahl bereits e<strong>in</strong>geführte Modelle. Die<br />
<strong>Technik</strong> der heutigen Fahrzeuge war eher an<br />
den Ständen der Zulieferer <strong>und</strong> Komponenten-<br />
22<br />
hersteller zu f<strong>in</strong>den. Durch die Bank haben die<br />
Hersteller ihre Wagen noch effizienter gemacht,<br />
d. h. der Verbrauch <strong>und</strong> der CO 2 -Ausstoß s<strong>in</strong>d<br />
weiter gesunken. Dafür gibt es mehr technische<br />
Assistenzsysteme <strong>in</strong> den PKWs <strong>und</strong> die gesamte<br />
Verarbeitung ist hochwertiger geworden oder<br />
macht zum<strong>in</strong>dest den E<strong>in</strong>druck. Dies lassen<br />
sich die Hersteller dann aber auch gut bezahlen.<br />
Gerade bei Autos „Made <strong>in</strong> Germany“ hat<br />
man wirklich tolle D<strong>in</strong>ge <strong>in</strong>s Auto gebracht.<br />
Automatisches E<strong>in</strong>parken, selbst öffnende<br />
Heckklappe, <strong>wenn</strong> man mit dem Schlüssel <strong>in</strong><br />
der Tasche unter das Heck des Wagens tritt<br />
oder e<strong>in</strong>en Müdigkeitsassistenten. In den Autos<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>zwischen immer mehr Kamerasysteme<br />
verbaut <strong>und</strong> ermöglichen neben e<strong>in</strong>er guten<br />
R<strong>und</strong>umsicht auch Funktionen wie beispielsweise<br />
e<strong>in</strong> Notbremssystem oder automatisches<br />
Ausweichmanöver, <strong>wenn</strong> plötzlich H<strong>in</strong>dernisse<br />
auf der Fahrbahn s<strong>in</strong>d.<br />
In den Punkten Elektromobilität oder anderen<br />
zukünftigen Antriebssystemen halten sich<br />
viele Hersteller mit konkreten Aussagen noch<br />
stark zurück. Lediglich von Opel gibt es das<br />
neue Modell Ampera, welches schon re<strong>in</strong> elektrisch<br />
fahren kann. Alle anderen Produzenten<br />
versprechen für die nahe Zukunft, ihre Modelle<br />
auf den Markt zu br<strong>in</strong>gen, was auch immer das<br />
bedeuten mag.<br />
Für den Besucher heißt es warten <strong>und</strong> <strong>in</strong><br />
zwei Jahren wohl wieder zur IAA kommen,<br />
um sich die neuen Antriebskonzepte anzuschauen.<br />
Bis dah<strong>in</strong> nutzen wir zur Fortbewegung<br />
mit e<strong>in</strong>em Elektromotor eben die Bahn,<br />
welche uns nach e<strong>in</strong>em sehr langen Messetag<br />
wieder nach Hause br<strong>in</strong>gt.<br />
Thomas Baumecker<br />
VDI-AK suj München<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
2. Januar 2012 / Montag<br />
19:00 Treff<br />
YoungProfessionals Stammtisch<br />
Veranstalter: VDE BV Südbayern YoungProf<br />
Ort: München<br />
Adresse: Pauls Wirtshaus, Augustenstr. 53 (E<strong>in</strong>gang<br />
Gabelsberger Straße), 80333 München<br />
Info: + Anmeldung 089/ 12129754,<br />
christoph.wegner@web.de<br />
Anmeldung: Das Treffen f<strong>in</strong>det jeden ersten Montag im<br />
Monat statt<br />
9. Januar 2012 / Montag<br />
16:30 Vortrag<br />
Konsumkultur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Mangelgesellschaft?<br />
Über Bedürfnisse, utopische Träume <strong>und</strong><br />
realexistierende Widersprüche <strong>in</strong> der DDR<br />
Veranstalter: Münchner Zentrum für Wissenschafts- <strong>und</strong><br />
<strong>Technik</strong>geschichte, Deutsches Museum<br />
Ort: München<br />
Adresse: Deutsches Museum, Bibliotheksbau,<br />
Sem<strong>in</strong>arraum der Institute, Museums<strong>in</strong>sel 1,<br />
80538 München<br />
Referent: Prof. Dr. Ina Merkel, Philipps-Universität<br />
Marburg<br />
19:00 Treff<br />
Stammtisch Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure (suj)<br />
München<br />
Veranstalter: VDI-AK suj (Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure)<br />
München<br />
Ort: Ludwigs am Viktualienmarkt<br />
Adresse: Heiliggeiststr. 6, 80331 München<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Anmeldung: nicht erforderlich (offenes Treffen)<br />
10. Januar 2012 / Dienstag<br />
15:00 Exkursion<br />
Kälteversorgung Innenstadt – Besichtigung der<br />
neuen <strong>Technik</strong>zentrale im Stachus<br />
Veranstalter: VDI / IDV TGA Team München<br />
Ort: München<br />
Adresse: Stachus Untergeschoß, genauer Treffpunkt bei<br />
Anmeldung<br />
Referent: Albert Brachner, Gebäudetechnik Stachus<br />
Info: max. 20 TN, Anmeldung erforderlich<br />
Anmeldung: He<strong>in</strong>z Eberhard: eberhard.he<strong>in</strong>z@swm.de;<br />
Fax: 089/2361-3317<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
VeRanStaltungSKalenDeR<br />
Januar/Februar 2012<br />
10. Januar 2012 / Dienstag<br />
16:00 Treff<br />
Die <strong>Technik</strong> h<strong>in</strong>ter der (Opern)-Kunst<br />
Veranstalter: VDI-AK, Aktuelles Forum <strong>Technik</strong><br />
Ort: München<br />
Adresse: Nationaltheater, Maximilianstr.<br />
Info: Lohn.K-H@web.de oder Tel. 08142/ 8665<br />
19:00 Treff<br />
VDI/VDE Treff<br />
Veranstalter: VDI BG Landshut<br />
Ort: Landshut<br />
Adresse: Landshut Gasthaus „Zur Insel“<br />
Info: Dr.-Ing. Helmut Straßer<br />
11. Januar 2012 / Mittwoch<br />
17:00 Vortrag<br />
Objektorientierung <strong>in</strong> der Automatisierungstechnik –<br />
S<strong>in</strong>n <strong>und</strong> Nutzen anhand e<strong>in</strong>es konkreten Beispiels<br />
Veranstalter: VDE Südbayern AKA<br />
Ort: München<br />
Adresse: Hochschule München, Dachauer Str. 98b,<br />
E-Bau, Hörsaal E0103<br />
Referent: Dr.-Ing. Josef Papenfort<br />
Info: Tel. 089/6124575, Wolfgang Bethge<br />
Anmeldung: per mail: vde-sbay@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
12. Januar 2012 / Donnerstag<br />
17:30 Vortrag<br />
Alternative Fuels <strong>in</strong> Aviation<br />
Veranstalter: Technische Universität München<br />
Ort: Garch<strong>in</strong>g<br />
Adresse: Hörsaal MW 1801, Fakultät für<br />
Masch<strong>in</strong>enwesen, 85748 Garch<strong>in</strong>g<br />
Referent: Richard L. Altman<br />
13. Januar 2012 / Freitag<br />
18:00 Exkursion<br />
Erwachen des Drachens – Ch<strong>in</strong>a; aufsteigende<br />
Weltmacht <strong>und</strong> Wirtschaftsgigant<br />
Veranstalter: VDI-AK <strong>Technik</strong>geschichte<br />
Ort: München<br />
Adresse: Tegernseesaal des TÜV, Westendstr. 199, Haus<br />
C, 5. Stock, Zi. 16<br />
Referent: Prof. Peter Becker<br />
Gebühr: 6 Euro, Studenten <strong>und</strong> Schüler gratis<br />
Anmeldung: 089-795182 oder<br />
horst.beutil@physik.uni-muenchen.de<br />
23
VERANSTALTUNGSKALENDER<br />
16. Januar 2012 / Montag<br />
14:00 Exkursion<br />
Besichtigung der Geothermie Unterhach<strong>in</strong>g<br />
Veranstalter: VDI-AK Bio., Mediz<strong>in</strong>- <strong>und</strong> Umwelttechnik<br />
Ort: Unterhach<strong>in</strong>g b. Mü.<br />
Adresse: Geothermie Unterhach<strong>in</strong>g, Grünwalder Weg 8,<br />
82008 Unterhach<strong>in</strong>g<br />
Referent: N.N., Geothermie Unterhach<strong>in</strong>g<br />
Achtung: Veranstaltung wird verschoben!<br />
18:00 Vortrag<br />
Gegenwart <strong>und</strong> Zukunft der Biokraftstoffe<br />
Veranstalter: VDI BG Innviertel<br />
Ort: 84489 Burghausen<br />
Adresse: OMV Deutschland GmbH, Vortragsräume<br />
003/005, Haim<strong>in</strong>ger Str. 1, 84489 Burghausen<br />
Referent: Dr. Hans-Jürgen Wernicke, Vorsitzender der<br />
DECHEMA e.V.<br />
17. Januar 2012 / Dienstag<br />
18:15 Vortrag<br />
E<strong>in</strong>führung – Heilung aus dem Cyberspace<br />
Veranstalter: VDE BV Südbayern, AKML<br />
Ort: München<br />
Adresse: TU München, Theresienstr. 90, Geb. N3,<br />
Hörsaal N 0314<br />
Referent: Prof. Dr. Bernhard Wolf<br />
Info: Tel. 089/289-22967<br />
18:30 Vortrag<br />
R<strong>in</strong>gvorlesung „Gesellschaftliche Innovation“<br />
Veranstalter: Hochschule München / SCE<br />
Ort: Hochschule München<br />
Adresse: Lothstrasse 34, 80335 München / Oskar-von-<br />
Miller-Saal<br />
Referent: Frau Hourvash Pourkian<br />
Info: Titel: „International Women <strong>in</strong> Power“<br />
Gebühr: Kostenfrei<br />
19. Januar 2012 / Donnerstag<br />
16:45 Exkursion<br />
Klärwerk Gut Großlappen<br />
Veranstalter: VDI-AK suj (Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure)<br />
München<br />
Ort: Münchner Stadtentwässerung<br />
Adresse: Großlappen-Freis<strong>in</strong>ger Landstraße 187, 80939<br />
München<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Gebühr: VDI 3,00 Euro / Gast 5,00 Euro<br />
Anmeldung: erforderlich bis 12.01.2012<br />
24<br />
20. Januar 2012 / Freitag<br />
17:00 Treff<br />
VDI Fliegertreff<br />
Veranstalter: VDI Fliegergeme<strong>in</strong>schaft<br />
Ort: München<br />
Adresse: Ratskeller München, Raum Elysium<br />
Info: Dipl.-Ing. H.-G. Stockert, Tel. (0 89) 75 43 19,<br />
Fax (0 90 91) 24 37<br />
24. Januar 2012 / Dienstag<br />
19:30 Vortrag<br />
Smart Grid – Lösungsansatz zur Integration der<br />
erneuerbare Energien<br />
Veranstalter: VDI BG Ingolstadt<br />
Ort: Hochschule Ingolstadt<br />
Adresse: Mensa, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt<br />
Referent: Prof. Dr.-Ing. Wilfried Zörner<br />
Info: Kompetenzfeld erneuerbare Energien<br />
25. Januar 2012 / Mittwoch<br />
14:15 Exkursion<br />
Forschungsreaktor <strong>in</strong> Garch<strong>in</strong>g<br />
Veranstalter: VDI-AK suj München<br />
Ort: Forschungs-Neutronenquelle He<strong>in</strong>z Maier-Leibnitz<br />
Adresse: Lichtenbergstr.1, 85748 Garch<strong>in</strong>g<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Gebühr: VDI 3,00 Euro / Gast 5,00 Euro<br />
Anmeldung: erforderlich bis 18.01.2012<br />
26. Januar 2012 / Donnerstag<br />
17:30 Vortrag<br />
Flights of Discovery<br />
Veranstalter: Technische Universität München<br />
Ort: Garch<strong>in</strong>g<br />
Adresse: Hörsaal MW 1801, Fakultät für<br />
Masch<strong>in</strong>enwesen, 85748 Garch<strong>in</strong>g<br />
Referent: Ken Szalai<br />
18:00 Vortrag<br />
Kosmische Kerzen werfen e<strong>in</strong> Licht auf die dunkle<br />
Seite des Universums<br />
Veranstalter: VDI-AK <strong>Technik</strong>geschichte<br />
Ort: München<br />
Adresse: Max-Planck-Saal des Akad. Gesangvere<strong>in</strong>s<br />
(AGV), Ledererstr. 5<br />
Referent: Dr. Josef Gaßner<br />
Gebühr: 6 Euro, Studenten, Schüler <strong>und</strong> AGVer gratis<br />
Anmeldung: Tel. 089-795182 oder<br />
horst.beutil@physik.uni-muenchen.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
30. – 31. Januar 2012 / Montag + Dienstag<br />
09:00 Sem<strong>in</strong>ar<br />
TIEF.BAU.TEX – Bauen mit Geokunststoffen<br />
Veranstalter: HTW Chur, Institut Bauen im alp<strong>in</strong>en Raum (IBAR)<br />
Ort: Chur, Schweiz<br />
Adresse: HTW Chur, Pulvermühlstrasse 57, 7004 Chur<br />
Info: Weiterbildung am 30.01.2012, Fachtagung am<br />
31.01.2012<br />
Gebühr: Weiterbildung: 340,- CHF, Fachtagung CHF 50,-<br />
Anmeldung + Info: www.htwchur.ch/tiefbautex<br />
30. Januar 2012 / Montag<br />
18:00 Treff<br />
Indoor-Beach-Volleyball <strong>und</strong> gemütliches Treffen<br />
Veranstalter: VDI-AK suj München<br />
Ort: München<br />
Adresse: Friedenstr. 22c, 81671 München<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Anmeldung: unverb<strong>in</strong>dlich unter <strong>in</strong>fo@suj-muenchen.de<br />
1. Februar 2012 / Mittwoch<br />
08:30 Exkursion<br />
Voith Turbo, Heidenheim<br />
Veranstalter: VDI-AK suj München<br />
Ort: Voith Turbo GmbH & Co. KG<br />
Adresse: Alexanderstr. 2, 89522 Heidenheim<br />
Info: www.suj-muenchen.de - Vergünstigung für<br />
Studenten<br />
Gebühr: VDI 9,00 Euro / Gast 14,00 Euro<br />
Anmeldung: erforderlich bis 23.01.2012<br />
6. Februar 2012 / Montag<br />
16:30 Vortrag<br />
E<strong>in</strong>e neue „Landschaft“ des Unsichtbaren – dunkle<br />
L<strong>in</strong>ien im Spektrum der Sterne<br />
Veranstalter: Münchner Zentrum für Wissenschafts- <strong>und</strong><br />
<strong>Technik</strong>geschichte, Deutsches Museum<br />
Ort: München<br />
Adresse: Deutsches Museum, Bibliotheksbau,<br />
Sem<strong>in</strong>arraum der Institute, Museums<strong>in</strong>sel 1,<br />
80538 München<br />
Referent: Prof. Dr. Jürgen Teichmann, Deutsches<br />
Museum<br />
19:00 Treff<br />
Stammtisch Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure München<br />
Veranstalter: VDI-AK suj München<br />
Ort: Ludwigs am Viktualienmarkt<br />
Adresse: Heiliggeiststr. 6, 80331 München<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Anmeldung: nicht erforderlich (offenes Treffen)<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
VERANSTALTUNGSKALENDER<br />
6. Februar 2012 / Montag<br />
19:00 Treff<br />
YoungProfessionals Stammtisch<br />
Veranstalter: VDE BV Südbayern, YoungProf<br />
Ort: München<br />
Adresse: Pauls Wirtshaus, Augustenstr. 53 (E<strong>in</strong>gang<br />
Gabelsberger Straße), 80333 München<br />
Info: + Anmeldung: 089/12129754, christoph.<br />
wegner@web.de<br />
Anmeldung: Das Treffen f<strong>in</strong>det jeden ersten Montag im<br />
Monat statt<br />
7. Februar 2012 / Dienstag<br />
18:15 Vortrag<br />
<strong>Was</strong> ist krank, was ist ges<strong>und</strong> – zur Bedeutung des<br />
Krankheitsbegriffs<br />
Veranstalter: VDE BV Südbayern, AKML<br />
Ort: München<br />
Adresse: TU München, Theresienstr. 90, Geb. N3,<br />
Hörsaal N 0314<br />
Referent: Prof. Dr. Dr. Klaus Bergdolt<br />
Info: Tel: 089/289-22967<br />
19:00 Vortrag<br />
Passivhausschule Ottobeuren: Überzeugende<br />
Ergebnisse durch E<strong>in</strong>klang von Architektur <strong>und</strong><br />
Haustechnik<br />
Veranstalter: VDI-TGA, IDV<br />
Ort: München<br />
Adresse: Hochschule München, Lothstr. 34, Raum Nr.<br />
G-1.27; Parken i.d. Tiefgarage<br />
Referent: Dipl.-Ing. Architekt Ralf Horstkotte, München;<br />
Dipl.-Ing. Stefanie Gütt<strong>in</strong>ger, Kempten<br />
Info: bernhard.fritzsche@he<strong>in</strong>emann-gmbh.de<br />
9. Februar 2012 / Donnerstag<br />
18:00 Vortrag<br />
Von der Weltwirtschaftskrise zur Weltordnungskrise?<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der globalen Architektur des 21. Jh.<br />
Veranstalter: VDI-AK <strong>Technik</strong>gschichte<br />
Ort: München<br />
Adresse: Chiemseesaal im Hauptgebäude des TÜV,<br />
Westendstr. 199<br />
Referent: Prof. Günther Schmid<br />
Gebühr: 6 Euro, aber Studenten <strong>und</strong> Schüler gratis<br />
Anmeldung: Tel. 089-795182 oder<br />
horst.beutil@physik.uni-muenchen.de<br />
25
VeRanStaltungSKalenDeR<br />
14. Februar 2012 / Dienstag<br />
19:00 Vortrag<br />
„Jahreszeitlich orientierter“ Vortrag<br />
Veranstalter: VDI-AK Frauen im Ingenieurberuf<br />
Ort: München<br />
Adresse: TU München, Theresienstr. 90, 80333<br />
München, Gebäude N3, 5. Etage, Bibliothek<br />
Referent: Dipl.-Ing. Angelika Re<strong>in</strong>hard<br />
Info: fib-muenchen@vdi.de, Details zum Vortrag im<br />
Newsletter<br />
19:30 Vortrag<br />
Energieversorgung 2100 – Kernfusion oder doch<br />
W<strong>in</strong>dräder<br />
Veranstalter: VDI BG Ingolstadt<br />
Ort: Hochschule Ingolstadt<br />
Adresse: Mensa, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt<br />
Referent: Dr. Ralph Dux<br />
Info: Max-Plank-Institut für Plasmaphysik<br />
17. Februar 2012 / Freitag<br />
17:00 Treff<br />
VDI Fliegertreff<br />
Veranstalter: VDI Fliegergeme<strong>in</strong>schaft<br />
Ort: München<br />
Adresse: Ratskeller München, Raum Elysium<br />
Info: Dipl.-Ing. H.-G. Stockert, Tel. (0 89) 75 43 19,<br />
Fax (0 90 91) 24 37<br />
18. Februar 2012 / Samstag<br />
09:30 Sem<strong>in</strong>ar<br />
Gedächtnistra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />
Veranstalter: VDI-AK suj (Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure)<br />
München<br />
Ort: Ludwigs am Viktualienmarkt<br />
Adresse: Heiliggeiststr. 6, 80331 München<br />
Referent: Dom<strong>in</strong>ik Moersen<br />
Info: www.suj-muenchen.de - Vergünstigung für<br />
Studenten<br />
Gebühr: VDI 30,00 Euro / Gast 45,00 Euro<br />
Anmeldung: erforderlich bis 13.02.2012<br />
26<br />
20. Februar 2012 / Montag<br />
18:30 Vortrag<br />
“Sehr geehrter Herr Maggi” zum<br />
Veranstalter: VDI-AK: Aktuelles Forum München<br />
Ort: München<br />
Adresse: Rahnstüberl im Hansa-Haus, Briennerstr. 39,<br />
80333 München<br />
Info: begrenzte Teilnehmerzahl<br />
Anmeldung: Lohn.K-H@web.de oder Tel.: 08142 / 8665<br />
27. Februar 2012 / Montag<br />
19:00 Treff<br />
Gemütliches Treffen Studenten <strong>und</strong> Jung<strong>in</strong>genieure<br />
(suj) München<br />
Veranstalter: VDI-AK suj München<br />
Ort: München<br />
Adresse: www.suj-muenchen.de<br />
Info: www.suj-muenchen.de<br />
Anmeldung: nicht erforderlich (offenes Treffen)<br />
28. Februar 2012 / Dienstag<br />
17:00 Exkursion<br />
GVZ Ingolstadt, Zukunft der Energieversorgung <strong>in</strong><br />
Industriegebäuden<br />
Veranstalter: VDI BG Ingolstadt<br />
Ort: Ingolstadt<br />
Adresse: GVZ, Gebäude J „Hotel im GVZ“, 85049<br />
Ingolstadt<br />
Info: GVZ, Güter Verteilungs Zentrum<br />
Anmeldung: unter Tel. 08450/901610<br />
Vorschau<br />
1. März 2012 / Donnerstag<br />
18:00 Vortrag<br />
Kultur- <strong>und</strong> Mediz<strong>in</strong>geschichte des Weihrauchs<br />
– von der Weihrauchstraße bis <strong>in</strong> die heutige<br />
Forschung<br />
Veranstalter: VDI-AK <strong>Technik</strong>geschichte<br />
Ort: München<br />
Adresse: Max-Planck-Saal des Akad. Gesangvere<strong>in</strong>s<br />
(AGV), Ledererstr. 5<br />
Referent: Michaela Mertens<br />
Gebühr: 6 Euro, aber Studenten, Schüler <strong>und</strong> AGVer<br />
gratis<br />
Anmeldung: Tel. 089-795182 oder<br />
horst.beutil@physik.uni-muenchen.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
„<strong>Technik</strong> im Brennpunkt“<br />
Unsere sehr erfolgreiche Vortragsreihe „<strong>Technik</strong> im Brennpunkt“<br />
wird im Jahr 2012 fortgesetzt.<br />
Die erste Veranstaltung f<strong>in</strong>det am 7. Februar 2012 um 19.00 Uhr<br />
im Audimax der Technischen Universität München, Arcisstr. statt.<br />
teRMIne<br />
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM, wird zum Stellenwert der Bildung<br />
für die <strong>in</strong>ternationale Wettbewerbsfähigkeit sprechen.<br />
Bitte kommen Sie zahlreich!<br />
Nähere Informationen unter Tel. (0 89) 57 91 22 00 <strong>in</strong> der VDI Geschäftsstelle.<br />
<strong>Technik</strong> zum Anfassen <strong>und</strong> Mitmachen!<br />
Am Samstag, den 28. Januar 2012 f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> der Agentur für Arbeit München ab 9.00 Uhr die<br />
Berufs<strong>in</strong>formationsmesse „Fasz<strong>in</strong>ation <strong>Technik</strong>“ für Schüler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Schüler statt.<br />
Die Agentur für Arbeit München hat <strong>in</strong> Zusammenarbeit<br />
mit dem Vere<strong>in</strong> Deutscher Ingenieure<br />
(VDI), dem Verband der Elektrotechnik,<br />
Elektronik <strong>und</strong> Informationstechnik (VDE)<br />
<strong>und</strong> der Landeshauptstadt München die Studien-<br />
<strong>und</strong> Berufs<strong>in</strong>formationsmesse „Fasz<strong>in</strong>ation<br />
<strong>Technik</strong>“ <strong>in</strong>s Leben gerufen.<br />
Petra Sprenger, Teamleiter<strong>in</strong> der Berufsberatung<br />
<strong>in</strong> der Agentur, empfiehlt jungen Leuten<br />
sich bei der Wahl des Studienfaches bzw. des<br />
Ausbildungsberufes nicht zu sehr e<strong>in</strong>zuengen,<br />
sondern auch Alternativen zu erwägen. „Wir<br />
Energy-Harvest<strong>in</strong>g im Amateurfunk<br />
möchten bei Jugendlichen frühzeitig Begeisterung<br />
für <strong>Technik</strong> wecken. Es ist wichtig sich<br />
rechtzeitig mit den eigenen Stärken <strong>und</strong> Berufswünschen<br />
ause<strong>in</strong>ander zu setzen <strong>und</strong> sich<br />
umfassend zu <strong>in</strong>formieren. Ingenieur<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Ingenieure berichten vor Ort von ihrem Berufsleben,<br />
führen den Schüler<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Schülern<br />
praktische D<strong>in</strong>ge vor <strong>und</strong> animieren sie zum<br />
Mitmachen <strong>und</strong> Ausprobieren.“<br />
Viele namhafte Firmen <strong>und</strong> Institutionen wie<br />
Siemens, Astrium GmbH, Rohde & Schwarz,<br />
Hochschule Dual, VDMA <strong>und</strong> die Deutsche<br />
Bahn AG stellen <strong>in</strong>teressante Projekte vor <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong>formieren über verschiedene Berufsbilder.<br />
WEITErE InForMATIon<br />
„Fasz<strong>in</strong>ation technik“<br />
Samstag, 28. Januar 2012<br />
von 9.00 bis 15.00 uhr<br />
Berufs<strong>in</strong>formationszentrum (BiZ)<br />
agentur für arbeit München<br />
Kapuz<strong>in</strong>erstr. 30<br />
www.fasz<strong>in</strong>ation-technik-muenchen.de<br />
Aufruf zum Bauwettbewerb „CW-Sender mit Selbstversorger-Taste“<br />
Zur Amateurfunktagung am 10./11. März<br />
2012 <strong>in</strong> der Hochschule München schreibt das<br />
Veranstaltungsteam den folgenden Konstrukteurs-<br />
<strong>und</strong> Funkbetriebswettbewerb aus:<br />
Gesucht wird e<strong>in</strong>e Morsetaste, deren Hubbewegung<br />
e<strong>in</strong>en Telegraphie-Sender mit Strom<br />
versorgt. Um möglichst viele neue Ideen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen<br />
zu können, wird den Konstrukteuren<br />
e<strong>in</strong> hoher Freiheitsgrat gewährt. So ist z.B. auch<br />
e<strong>in</strong>e Fußtastung zugelassen.<br />
Der Energiespeicher darf vor Beg<strong>in</strong>n der eigentlichen<br />
Übertragung durch Geben von bis zu<br />
10 „V“s bei ausgeschaltetem Sender aufgeladen<br />
werden.<br />
Für den Sender s<strong>in</strong>d 2 Klassen – VHF 2 m<br />
<strong>und</strong> Kurzwelle 80 m oder 10 m – vorgesehen.<br />
Zum Funktionsnachweis wird e<strong>in</strong>e Zufallstextnachricht<br />
mit der Länge e<strong>in</strong>er SMS von<br />
160 Zeichen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Nebenraum übertragen.<br />
Gewertet werden (<strong>in</strong> absteigender Reihenfolge)<br />
die gepulste Sendeleistung während der<br />
Übertragung des letzten Zeichens<br />
Konstruktion <strong>und</strong> Handl<strong>in</strong>g<br />
Übertragungsfehler (Maluspunkte)<br />
Telegraphie-Tempo/Übertragungszeit<br />
Tonqualität sowie Frequenzkonstanz.<br />
Den ersten 3 Gew<strong>in</strong>nern w<strong>in</strong>ken wertvolle<br />
Sachpreise.<br />
Zielgruppen: Schüler <strong>und</strong> Studenten sowie<br />
Funkamateure<br />
Veranstalter:<br />
Deutscher Amateur Radio Club<br />
Distrikt Oberbayern<br />
Info: http://www.darc.de/distrikte/c/<br />
27<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
VDe<br />
VDE Südbayern verleiht die VDE-Awards<br />
Der VDE Südbayern zeichnete <strong>in</strong> diesem Jahr mit den VDE Awards 2011 zum dritten Mal<br />
herausragende Leistungen auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet aus.<br />
Frau Götz (li.) <strong>und</strong> Frau Prof. Petra Friedrich.<br />
Die Preise wurden <strong>in</strong> den Kategorien Wirtschaft,<br />
Wissenschaft <strong>und</strong> Schule vergeben, zusätzlich<br />
wurde der Medienpreis <strong>Technik</strong> verliehen.<br />
„Mit den VDE-Awards möchten wir hervorragende<br />
technische Entwicklungen <strong>und</strong> das Engagement<br />
der Preisträger für mehr <strong>Technik</strong>begeisterung<br />
<strong>in</strong> der Bevölkerung honorieren“, so Prof.<br />
Dr.-Ing. Petra Friedrich, Vorsitzende des VDE<br />
Südbayern. Die Preise wurden den Preisträgern <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er feierlichen Veranstaltung mit ca. 100 Gästen<br />
am 24. November 2011 im Königssaal des Bayerischen<br />
Hof <strong>in</strong> München übergeben.<br />
Frau Heike Götz (Bayerisches Fernsehen)<br />
begrüßte die Preisträger <strong>und</strong> die Gäste aus<br />
Wirtschaft, Hochschule, Politik, Verbände <strong>und</strong><br />
Medien des „Münchener VDE-Abends 2011“<br />
im Königssaal des Bayerischen Hofs <strong>und</strong> stellte<br />
die Gastgeber<strong>in</strong> Frau Prof. Dr.-Ing. Petra Friedrich<br />
(Vorsitzende VDE BV Südbayern) vor. In<br />
e<strong>in</strong>em unterhaltsamen Dialog erläuterte Frau<br />
Prof. Friedrich die Zielsetzungen dieses Abends<br />
(„Würdigung hervorragender Leistungen <strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> um die <strong>Technik</strong>, sowie Pflege <strong>und</strong> Aufbau<br />
e<strong>in</strong>es Netzwerkes mit den verschiedenen Gesellschaftsgruppen“),<br />
sowie die Aktivitäten <strong>und</strong><br />
besonderen Ereignisse des VDE Bezirksvere<strong>in</strong>s<br />
Südbayern im vergangenen Jahr. Anschließend<br />
stellte Frau Götz den stv. Vorstandsvorsitzenden<br />
des VDE, Prof. Dr.-Ing. Helmut Klaus<strong>in</strong>g vor.<br />
In se<strong>in</strong>em Grußwort gab Prof. Klaus<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>en<br />
Überblick über die aktuellen Querschnittsthemen<br />
des VDE (Smart Grid, Mediz<strong>in</strong>technik,<br />
Elektromobilität <strong>und</strong> Smart Home), betonte<br />
die Notwendigkeit der Normung <strong>und</strong> Standardisierung<br />
dieser Themen <strong>und</strong> versprach diese<br />
28<br />
Themen „aggressiv“ voranzutreiben. Abschließend<br />
wies er auf den im Jahr 2012 anstehenden<br />
VDE-Kongress zum Thema „Smart Grid“<br />
h<strong>in</strong> <strong>und</strong> betonte das Engagement des VDE an<br />
Ausbildung <strong>und</strong> Forschung, <strong>und</strong> stellte somit<br />
die Verb<strong>in</strong>dung mit der Verleihung des VDE-<br />
Awards 2011 her.<br />
Danach folgte die Keynote des Abends von<br />
Dipl.-Ing. Rudolf Mart<strong>in</strong> Siegers (Leitung Siemens<br />
Deutschland). Herr Siegers stellte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Rede die Herausforderung der Industrie<br />
im aktuellen politischen <strong>und</strong> wirtschaftlichen<br />
Umfeld dar. „Die Zukunft ist grün, dar<strong>in</strong> stekken<br />
die Herausforderungen <strong>und</strong> Chancen der<br />
deutschen Wirtschaft“ war die Botschaft se<strong>in</strong>er<br />
Rede. Letztendlich wies Herr Siegers nochmals<br />
auf das Dauerthema des Ingenieurmangels <strong>in</strong><br />
Deutschland h<strong>in</strong> <strong>und</strong> rief auch den weiblichen<br />
Nachwuchs auf, sich für die moderne <strong>Technik</strong><br />
zu begeistern.<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>es festlichen Abendessens<br />
wurden <strong>in</strong> gewohnt charmanter Weise von Frau<br />
Götz <strong>und</strong> Frau Prof. Friedrich die von e<strong>in</strong>er<br />
hochkarätig besetzten Jury ausgewählten Preisträger<br />
geehrt. Als Preisträger der VDE-Awards<br />
2011 wurden ausgezeichnet:<br />
Kategorie Schule<br />
Simpert – Kraemer – Gymnasium Krumbach<br />
Das Simpert-Kraemer-Gymnasium unter<br />
Leitung des Rektors Norbert Rehfuß, sowie mit<br />
den Lehrerkollegen Gerhard Dempf, Michael<br />
Prautzsch <strong>und</strong> Alexander Schury,<br />
förderten die naturwissenschaftliche <strong>und</strong><br />
technische Kompetenzvermittlung <strong>in</strong> besonderer<br />
Weise. Bee<strong>in</strong>druckend waren die Breite<br />
der Projekte <strong>und</strong> die Kont<strong>in</strong>uität seit vielen<br />
Jahren. Erwähnt seien hier nur stellvertretend<br />
die Betreuung der Wettbewerbe „Jugend<br />
forscht“, „Schüler experimentieren“, das Projekt<br />
„Physics 4u“, die Veranstaltung „<strong>Technik</strong> erleben“<br />
sowie die erfolgreichen Robotik-Kurse.<br />
Kategorie Wissenschaft<br />
Hochschulabschlussarbeiten<br />
Sascha Laumann (Hochschule München)<br />
Herr Laumann hat se<strong>in</strong>e Bachelorarbeit als<br />
Abschluss se<strong>in</strong>es Studiums bei Prof. Gerstner<br />
durchgeführt. Der Titel ist “Emulation of core<br />
components <strong>in</strong> a magma deformation rig”. Die<br />
Arbeit wurde im Rahmen e<strong>in</strong>es Forschungsprojekts<br />
der Ludwig – Maximilian – Universität<br />
München, Fakultät für Geowissenschaften, bearbeitet.<br />
Für die experimentelle Vulkanologie<br />
wird das Verhalten des Magmas unter hohem<br />
Druck <strong>und</strong> Temperatur mit e<strong>in</strong>em Testgerät<br />
untersucht.<br />
Angelika Jann<strong>in</strong>g (TU München)<br />
Frau Jann<strong>in</strong>g erhält für ihre Diplomarbeit mit<br />
dem Titel „Fault Simulation for Cryptographic<br />
Devices on FPGA“ den VDE Award. Sie hat diese<br />
Arbeit nach ihrem Studium am Lehrstuhl von<br />
Prof. Sigl, TU München, angefertigt. Sie wurde<br />
mit der Note 1 bewertet; auch die sonstigen Studienleistungen<br />
s<strong>in</strong>d überragend – wieder e<strong>in</strong>mal<br />
e<strong>in</strong> Beweis dafür, dass e<strong>in</strong> Ingenieursstudium<br />
ke<strong>in</strong>e männliche Domäne ist. Die Arbeit befasst<br />
sich mit Testverfahren, mit denen man die<br />
Sicherheit von Hardwareimplementie rungen<br />
gegenüber Fehlerattacken überprüfen kann.<br />
Stefan Michel (Hochschule Augsburg)<br />
Herr Michel hat Elektrotechnik mit dem<br />
Schwerpunkt Informations- <strong>und</strong> Kommunikationstechnik<br />
studiert <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e Diplomarbeit<br />
mit dem Titel „Konvertierung e<strong>in</strong>es videoformatunabhängigen<br />
E<strong>in</strong>gangssignals auf e<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />
der Auflösung frei def<strong>in</strong>ierbares Ausgangssignals<br />
mit Hilfe e<strong>in</strong>es FPGAs“ <strong>in</strong> der Industrie<br />
bei der Firma Rhode <strong>und</strong> Schwarz durchgeführt.<br />
Betreut wurde er von Frau Professor<br />
Hollmann. Die Arbeit realisiert e<strong>in</strong>e digitale<br />
Video-E<strong>in</strong>gangsschnittstelle für e<strong>in</strong> Analysesystem,<br />
mit dem die Qualität von digitalen Videoquellen<br />
überprüft werden kann <strong>und</strong> Fehler<br />
auch markiert werden können.<br />
Ralf Rüther (Universität der B<strong>und</strong>eswehr,<br />
München)<br />
Herr Rüther hat se<strong>in</strong>e Bachelorarbeit im<br />
Fachhochschulstudiengang „ Technische Informatik<br />
<strong>und</strong> Kommunikationstechnik“ bei Prof.<br />
Englberger durchgeführt. Se<strong>in</strong>e Arbeit ist Teil<br />
e<strong>in</strong>es Projektes zur Entwicklung autonom agierender<br />
Roboterfahrzeugen. Der Titel der Arbeit<br />
„Weiterentwicklung der Roboterplattform<br />
Rumbler (Kettenfahrzeug)“ zeigt, dass es sich<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Fotos: Stefan Schumacher<br />
Die diesjährigen Preisträger der VDE Awards.<br />
nicht um e<strong>in</strong> isoliertes Projekt geht, sondern um<br />
die Fortsetzung e<strong>in</strong>er umfangreichen Entwicklung.<br />
Bee<strong>in</strong>druckend waren das methodische<br />
Vorgehen, der hohe E<strong>in</strong>satz <strong>und</strong> das Ergebnis <strong>in</strong><br />
sehr kurzer Zeit.<br />
Christian Kandler (TU München)<br />
Herr Kandler hat se<strong>in</strong>e Diplomarbeit bei<br />
Professor Hamacher am Lehrstuhl für Energiewirtschaft<br />
<strong>und</strong> Anwendungstechnik der TU<br />
München angefertigt. E<strong>in</strong>e Arbeit, die sich mit<br />
dem aktuellen Thema der Elektromobilität<br />
befasst. Es wurde die „Energiewirtschaftliche<br />
Optimierung der hauseigenen erneuerbaren<br />
Stromerzeugung zur Versorgung e<strong>in</strong>es Elektrofahrzeugs“<br />
– so der Titel – am Beispiel e<strong>in</strong>es<br />
E<strong>in</strong>familienhauses an verschiedenen Standorten<br />
<strong>in</strong> Deutschland untersucht. Es wurden<br />
neben der Photovoltaik als Energiequelle zum<br />
Laden des Elektrofahrzeugs auch Mikro- W<strong>in</strong>dkraftanlagen<br />
<strong>und</strong> Mikro- Blockheizkraftwerke<br />
<strong>in</strong> die Betrachtung e<strong>in</strong>bezogen.<br />
Wissenschaftliche arbeiten<br />
Dr.-Ing. Felix Antreich (TU München)<br />
Dr. Antreich erhielt den VDE Award 2011 für<br />
e<strong>in</strong>e hervorragende Dissertation mit dem Titel<br />
„Array Process<strong>in</strong>g and Signal Design for Tim<strong>in</strong>g<br />
Synchronization”. Dr. Antreich hat diese Arbeit<br />
an dem DLR Institut für Kommunikation <strong>und</strong><br />
Navigation durchgeführt, <strong>in</strong> Zusammenarbeit<br />
mit dem Institut für Netzwerktheorie <strong>und</strong> Signal<br />
verarbeitung der Technischen Universität<br />
München <strong>und</strong> betreut von Professor Nossek.<br />
Für die Satellitennavigation ist die hochgenaue<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Ermittlung der Laufzeit e<strong>in</strong>es Navigationssignals<br />
entscheidend, auch unter Störe<strong>in</strong>flüssen.<br />
In e<strong>in</strong>em ersten Teil der Arbeit hat Dr. Antreich<br />
e<strong>in</strong> Verfahren vorgeschlagen, das diese Aufgabe<br />
genauer <strong>und</strong> mit weniger Rechenaufwand erledigt.<br />
Im zweiten Teil wurde e<strong>in</strong> Optimierungsverfahren<br />
für den Entwurf der Navigationssignale<br />
entwickelt, wodurch die Genauigkeit<br />
ebenfalls deutlich verbessert werden kann.<br />
Dr. Ingo Stork genannt Wersborg (TU München)<br />
Dr. Ingo Stork genannt Wersborg hat e<strong>in</strong>e<br />
Doktorarbeit mit dem Titel „A cognitive architecture<br />
for production systems such as laser<br />
material process<strong>in</strong>g“ am Lehrstuhl für Datenverarbeitung<br />
bei Prof. Diepold im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
wissenschaftlichen Tätigkeit durchgeführt.<br />
Die Arbeit wurde mit summa cum laude beurteilt.<br />
Dr. Stork zeigt <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Arbeit, wie man<br />
durch den E<strong>in</strong>satz moderner Methoden der<br />
Informationstechnik, <strong>in</strong>sbesondere des masch<strong>in</strong>ellen<br />
Lernens, höchst komplexe Prozesse<br />
der Materialbearbeitung durch Laser automatisiert<br />
beherrschen kann. Der Lernprozess des<br />
Systems ist technisch realisiert, <strong>in</strong>tegriert <strong>und</strong><br />
benötigt ke<strong>in</strong>e zusätzliche Programmierarbeit.<br />
Das Ergebnis ist beispielsweise e<strong>in</strong>e höhere<br />
Qualität e<strong>in</strong>er Laser-Schweißnaht <strong>und</strong> e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gerer<br />
Energiebedarf.<br />
Kategorie Wirtschaft<br />
Start up<br />
cellasys GmbH<br />
Die cellasys GmbH wurde im Januar 2007 von<br />
Dr. Joachim Wiest als Ausgründung des He<strong>in</strong>z<br />
VDe<br />
Nixdorf-Lehrstuhls für Mediz<strong>in</strong>ische Elektronik<br />
der TU München zusammen mit Prof. Dr. B. Wolf<br />
gegründet. Die cellasys bietet Systemlösungen<br />
zur kont<strong>in</strong>uierlichen Analyse der Vitalität lebender<br />
Zellen. Diese be<strong>in</strong>halten Forschung <strong>und</strong> Entwicklung,<br />
Fertigung <strong>und</strong> Wartung zellbasierter<br />
Systeme. Darüber h<strong>in</strong>aus bietet die cellasys auch<br />
Beratungsleistungen bei der Entwicklung neuer<br />
Applikationen, Datenmanagement <strong>und</strong> Daten<strong>in</strong>terpretation<br />
an. Die zellbasierten Systeme der<br />
cellasys GmbH messen verschiedene Parameter<br />
im Mikromilieu lebender Zellen. Dies s<strong>in</strong>d die<br />
extrazelluläre Ansäuerung, die zelluläre Atmung<br />
<strong>und</strong> die Morphologie der Zellen.<br />
Kategorie Wirtschaft<br />
Handwerk<br />
Mart<strong>in</strong> Starkloff<br />
Die Meisterprüfung von Herrn Starkloff bestand<br />
<strong>in</strong> der Anforderung aus Planung, Berechnung<br />
<strong>und</strong> Aufbau der Energieverteilung mit<br />
Lastmanagement e<strong>in</strong>er Industrieanlage. Die<br />
Bewertung der Meisterprüfung zeigte e<strong>in</strong> gutes<br />
bis sehr gutes Ergebnis.<br />
Herr Starkloff fand se<strong>in</strong>e Berufung <strong>und</strong> Neigung<br />
letztendlich, nach e<strong>in</strong>igen Umwegen, <strong>in</strong><br />
der Ausrichtung Elektrotechnik, wobei die berufliche<br />
Weiterentwicklung bei Weitem noch<br />
nicht abgeschlossen ist.<br />
Medienpreis technik<br />
Silvia Stettmayer<br />
Frau Stettmayer kümmert sich seit vielen Jahren<br />
äußerst engagiert um die Belange <strong>und</strong> die<br />
kommunikative Verbreitung von technischen<br />
Themen. Sie ist Chef<strong>in</strong> vom Dienst der geme<strong>in</strong>sam<br />
von VDI <strong>und</strong> VDE herausgegebenen Zeitschrift<br />
„<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“. Nicht zuletzt ist es<br />
Frau Stettmayer zu verdanken, dass diese Zeitschrift<br />
<strong>in</strong>zwischen zu den etablierten <strong>und</strong> erfolgreichsten<br />
Veröffentlichungen aus dem Ingenieurumfeld<br />
<strong>in</strong> Deutschland gehört. Sie versteht<br />
es immer wieder aufs Neue, die Kolleg<strong>in</strong>nen <strong>und</strong><br />
Kollegen der Redaktion „auf Spur zu br<strong>in</strong>gen“<br />
<strong>und</strong> auch dort zu halten.<br />
Technischer Journalismus ist die Kunst, Intellekt<br />
<strong>und</strong> Emotionen, Kopf <strong>und</strong> Herz, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Synthese zu e<strong>in</strong>er höheren, gleichwohl gut<br />
verdaulichen Dimension zu verb<strong>in</strong>den. Frau<br />
Stettmayer beherrscht diese Kunst <strong>in</strong> besonders<br />
hohem Maße <strong>und</strong> ermöglicht es damit den Lesern,<br />
<strong>Technik</strong> aus anderen, oft überraschenden<br />
Blickw<strong>in</strong>keln zu sehen.<br />
Lutz Imhof<br />
VDE BV Südbayern<br />
29
VDI<br />
VDI Preis 2011<br />
Am 11.11.2011 war es wieder soweit. Karnevalsbeg<strong>in</strong>n? Ne<strong>in</strong>, viel besser. Der VDI Preis 2011.<br />
Die besten Bewerber mit ihren zukunftsweisenden <strong>und</strong> raff<strong>in</strong>ierten Abschlussarbeiten <strong>und</strong><br />
Projekten wurden ausgezeichnet.<br />
Die Diplomandenehrung, bekannt aus den<br />
vergangenen Jahren, wurde erstmalig durch<br />
den neuen VDI Preis abgelöst. Die Ausrichtung<br />
erfolgte <strong>in</strong> Zusammenarbeit des VDI Bezirksvere<strong>in</strong><br />
München, Ober- <strong>und</strong> Niederbayern <strong>und</strong><br />
der TÜV SÜD AG. E<strong>in</strong> mehrköpfiges Komitee<br />
ermittelte aus den zahlreichen Bewerbungen die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Gew<strong>in</strong>ner. Gr<strong>und</strong>legende Neuerung<br />
beim VDI Preis 2011 ist neben den bestehenden<br />
Kategorien „Bachelorthesis“, „Masterthesis“<br />
<strong>und</strong> „Diplomarbeit“ die Erweiterung um „Dissertation“,<br />
„Jung<strong>in</strong>genieur aus der Industrie“<br />
<strong>und</strong> „Ingenieur Start-Up“.<br />
In se<strong>in</strong>er Begrüßung unterstrich Prof. Dr.-<br />
Ing. Bernd-Robert Höhn, Vorsitzender des BV<br />
München, Ober- <strong>und</strong> Niederbayern, vor allem<br />
die Bedeutung des Ingenieurs <strong>in</strong> der heutigen<br />
Zeit. „Warum geht es uns <strong>in</strong> Deutschland<br />
so gut?“, so Prof. Dr.-Ing. Höhn. Im Kennzahlenvergleich<br />
liegt der prozentuale Anteil<br />
der Bevölkerung, welche im produzierenden<br />
Gewerbe tätig ist, höher als <strong>in</strong> anderen vergleichbaren<br />
Ländern. Dazu tragen vor allem<br />
die Ingenieure e<strong>in</strong>en großen Teil bei, da aus<br />
Ihren Ideen die Produkte entstehen, welche<br />
nachgefragt <strong>und</strong> produziert werden müssen.<br />
Somit schließt sich der Kreis, denn durch junge<br />
<strong>und</strong> gut ausgebildete Ingenieure s<strong>in</strong>d <strong>und</strong><br />
bleiben wir besser als alle anderen. Nachfolgend<br />
gratulierte Dr. Kai Strübbe, Leiter der<br />
Embedded Systems bei der TÜV SÜD AG, den<br />
Gew<strong>in</strong>nern zu Beg<strong>in</strong>n se<strong>in</strong>es Festvortrages.<br />
„Als jungen Ingenieur<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> Ingenieuren<br />
steht Ihnen die Welt offen, Sie s<strong>in</strong>d gefragt“,<br />
so die e<strong>in</strong>leitenden Worte von Dr. Strübbe. Im<br />
Vortrag selbst erfuhren alle Anwesenden mehr<br />
über die Aufgaben des TÜV. Das Unternehmen<br />
bietet viel mehr, als Ihnen alle zwei Jahre mit<br />
e<strong>in</strong>er Plakette, die Funktionstüchtigkeit Ihres<br />
Autos für weitere zwei Jahre zu besche<strong>in</strong>igen.<br />
Zusammen mit se<strong>in</strong>em <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären<br />
Team von Ingenieuren sorgt sich Dr. Strübbe<br />
branchenübergreifend <strong>und</strong> weltweit für Sicherheit,<br />
Standardisierung <strong>und</strong> Datenschutz<br />
von <strong>und</strong> durch Embedded Systems, z. B. im<br />
Bereich Smart Grids. Diese e<strong>in</strong>gebetteten Systeme<br />
s<strong>in</strong>d elektronische Rechner oder Computer,<br />
die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em technischen Kontext e<strong>in</strong>ge-<br />
30<br />
b<strong>und</strong>en s<strong>in</strong>d.<br />
Kategorie „Bachelorarbeit“<br />
B. Eng. Peter Baudy hat den ersten Preis mit<br />
se<strong>in</strong>er Bachelorarbeit „Weiterentwicklung der<br />
Roboterplattform BobbyCar (2WD)“ gewonnen.<br />
Herr Baudy studiert an der Universität<br />
der B<strong>und</strong>eswehr München Elektrotechnik <strong>und</strong><br />
Technische Informatik.<br />
Das Ziel des Projekts „BobbyCar“ ist die Erprobung<br />
von Multi-Prozessor-Systemen mit<br />
H<strong>in</strong>blick auf die autonome Steuerung des Vehikels.<br />
Hierfür wurden im Rahmen der Bachelorarbeit<br />
die notwendigen Nutzungsanforderungen<br />
im Bereich der Sensorik <strong>und</strong> Aktorik konzeptioniert<br />
<strong>und</strong> durch die Realisierung e<strong>in</strong>es<br />
Sensor Subsystem erfüllt. Dabei galt es neben<br />
dem Entwurf <strong>und</strong> der Implementierung der<br />
Hardware zur Ansteuerung der Sensorik auch<br />
die notwendige Software zur Diagnose <strong>und</strong> zur<br />
Aufbereitung bzw. Auswertung der Sensordaten<br />
zu entwickeln.<br />
Kategorie „Masterarbeit“<br />
Der Gew<strong>in</strong>ner <strong>in</strong> der Kategorie „Masterarbeit“<br />
ist Christoph Falter M. Sc., welcher im<br />
Bauhaus Luftfahrt e. V. beschäftigt ist. Se<strong>in</strong>e Arbeit<br />
mit dem dem Titel „A Two-Step Solar Thermochemical<br />
Cycle Based on Ceria Redox-Reactions:<br />
Reactor Design, Fabrication and Test<strong>in</strong>g“<br />
legte er an der Eidgenössischen Technischen<br />
Hochschule (ETH) <strong>in</strong> Zürich im Fachbereich<br />
Masch<strong>in</strong>en<strong>in</strong>genieurwissenschaften ab.<br />
Der solare, thermochemische Prozess wandelt<br />
CO 2 <strong>und</strong> <strong>Was</strong>ser mit Hilfe konzentrierter<br />
Solarenergie <strong>in</strong> Synthesegas (e<strong>in</strong>e Mischung<br />
aus Kohlenmonoxid <strong>und</strong> <strong>Was</strong>serstoff) um,<br />
das mit dem Fischer-Tropsch-Prozess zu<br />
Benz<strong>in</strong>, Diesel, Keros<strong>in</strong> o. ä. umgeformt werden<br />
kann. Die mit Abstand <strong>in</strong> größter Menge<br />
vorkommende erneuerbare Energiequelle der<br />
Solarenergie kann daher dazu genutzt werden,<br />
erneuerbare, umweltfre<strong>und</strong>liche Kraftstoffe<br />
herzustellen, die direkt <strong>in</strong> heutigen Autos<br />
<strong>und</strong> Flugzeugen genutzt werden können. Im<br />
zweiten Schritt der experimentellen Analyse<br />
beschäftigte sich der Absolvent mit Konstruktion,<br />
Bau <strong>und</strong> Erprobung e<strong>in</strong>es Reaktors zur<br />
Demonstration des untersuchten Prozesses.<br />
Kategorie „Diplomarbeit“<br />
Dipl.-Ing. Christian Kandler konnte sich <strong>in</strong><br />
der Kategorie „Diplomarbeit“ durchsetzen. Se<strong>in</strong>e<br />
Arbeit mit dem Thema „Energiewirtschaftliche<br />
Optimierung der hauseigenen erneuerbaren<br />
Stromerzeugung zur Versorgung e<strong>in</strong>es Elektrofahrzeugs“<br />
absolvierte er an der Technischen<br />
Universität München (TUM) im Fachbereich<br />
Elektrotechnik.<br />
Im Rahmen der Diplomarbeit wird e<strong>in</strong>e<br />
ener giewirtschaftliche Analyse der benötigten<br />
hauseigenen Anlagen<strong>in</strong>frastruktur erneuerbarer<br />
Energien durchgeführt, um für e<strong>in</strong>en<br />
E<strong>in</strong>familienhausbesitzer e<strong>in</strong>e kostengünstige<br />
<strong>und</strong> une<strong>in</strong>geschränkte Mobilität durch e<strong>in</strong><br />
Elektrofahrzeug nutzer- <strong>und</strong> standortspezifisch<br />
garantieren zu können. Dabei werden neben<br />
der Erstellung <strong>und</strong> Integration diverser Szenarien<br />
<strong>und</strong> Nutzerprofile für Elektrofahrzeuge<br />
<strong>in</strong>sbesondere die regenerativen Anlagentypen<br />
Photovoltaik <strong>und</strong> Mikrow<strong>in</strong>dkraft h<strong>in</strong>sichtlich<br />
ihrer standortabhängigen Daten basierend auf<br />
h<strong>in</strong>terlegten Wetterdaten näher untersucht <strong>und</strong><br />
zur st<strong>und</strong>engenauen Bereitstellung des benötigten<br />
Ladebedarfs verwendet. Überdies wird<br />
e<strong>in</strong>e optionale Berücksichtigung e<strong>in</strong>er wärmegeführten<br />
Mikro-Blockheizkraftwerk-Anlage<br />
vorgesehen, sofern diese im zugr<strong>und</strong>e gelegten<br />
Haushalt bereits bestand.<br />
Kategorie „Dissertation“<br />
Für die Kategorie „Dissertation“ wurde Herr<br />
Dr.-Ing. Bassil Akra geehrt. Se<strong>in</strong>e Doktorarbeit<br />
legte er an der Technischen Universität München<br />
im Fachbereich der Mediz<strong>in</strong>technik ab. Die Arbeit<br />
trägt den Titel „A non-degradable polyurethane<br />
scaffold for aortic valve tissue eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g”.<br />
Im Rahmen dieser Arbeit sollten künstliche,<br />
strömungsoptimierte Polyurethangerüste für<br />
das Tissue Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g (Gewebezüchtung) von<br />
Aortenherzklappen hergestellt <strong>und</strong> evaluiert<br />
werden, um die begrenzt verfügbaren Homografts<br />
(menschliche Herzklappen) zu ersetzen.<br />
Dies sollte auf der patentierten Methode von<br />
Prof. B. Reichart <strong>und</strong> dem Institut für Textil-<br />
<strong>und</strong> Verfahrenstechnik Denkendorf (Prof. H.<br />
Planck, Dr. M. Dauner) basieren. Hierfür wurden<br />
Aortenklappenprothesen mit ähnlichen<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Die Preisträger mit Prof. Dr.-Ing. Bernd-Robert Höhn: (v.l.n.r.) Dipl.-Ing. Dr. Ronald Naderer, MBA, Christoph Falter M. Sc., Dipl.-Ing. Christian<br />
Kandler, Dipl.-Ing. Silvia Henke, Prof. Dr.-Ing. Bernd-Robert Höhn, Dr.-Ing. Bassil Akra <strong>und</strong> B. Eng. Peter Baudy<br />
Maßen wie die menschliche Aortenklappe<br />
mittels Sprühverfahren hergestellt. Die für die<br />
Beschichtung benötigten vaskulären Zellen<br />
wurden aus Venen gewonnen <strong>und</strong> kultiviert.<br />
Weiterh<strong>in</strong> wurden die Polyurethangerüste mit<br />
gewonnenen Zellen besiedelt <strong>und</strong> biologisch<br />
untersucht. Im Anschluss wurde mittels e<strong>in</strong>es<br />
Endoskops die Funktion der neu entwickelten<br />
Prothese mit e<strong>in</strong>em Homograft verglichen um<br />
die Bewegungsunterschiede der Klappen zu def<strong>in</strong>ieren<br />
<strong>und</strong> das Klappendesign zu verbessern.<br />
Zuletzt wurde e<strong>in</strong>e Strömungsanalyse der optimierten<br />
Klappen mittels „Particle Image Velocimetry“<br />
(PIV) durchgeführt.<br />
Kategorie „Jung<strong>in</strong>genieur aus der<br />
Industrie“<br />
In der Kategorie „Jung<strong>in</strong>genieur aus der Industrie“<br />
liegt Frau Dipl.-Ing. Silvia Henke ganz<br />
vorne. Als Mitarbeiter<strong>in</strong> der L<strong>in</strong>de AG im Bereich<br />
Marktentwicklung Lebensmittel hat sich<br />
Frau Henke mit Ihrer Arbeit mit dem Thema<br />
„Bestimmung der Trennkräfte von Partikeln<br />
mit dem Atomic Force Mikroscope <strong>und</strong> dem<br />
Strömungskanal“ ause<strong>in</strong>ander gesetzt.<br />
Das Resultat dieser Projektarbeit heißt<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
BANARG®, e<strong>in</strong> natürliches Gasgemisch aus<br />
Ethen <strong>und</strong> Stickstoff, welches die Auskeimung<br />
von Kartoffeln im Lager zuverlässig <strong>und</strong> kostengünstig<br />
verh<strong>in</strong>dert. Die Auskeimung von<br />
Kartoffeln führt jährlich zu e<strong>in</strong>er Vernichtung<br />
von ca. 10.000 Tonnen Kartoffeln, welche nicht<br />
mehr über den Handel abgesetzt werden dürfen.<br />
Die Austriebsverzögerung durch BANARG®<br />
ist bed<strong>in</strong>gt durch e<strong>in</strong>e gehemmte Zellstreckung.<br />
BANARG® ist ges<strong>und</strong>heitlich völlig unbedenklich<br />
<strong>und</strong> somit e<strong>in</strong>e echte Alternative zum<br />
herkömmlichen Keimhemmer Chlorpropham<br />
(CIPC), dessen Zulassung zum Jahresende 2014<br />
auslaufen soll. Über e<strong>in</strong>e softwaregestützte<br />
Komplett-Lösung lassen sich die Anforderungen<br />
an e<strong>in</strong>er exakten kont<strong>in</strong>uierlichen Dosierung<br />
der Gase <strong>in</strong> Abhängigkeit von Produkt <strong>und</strong><br />
Raum zuverlässig umsetzten.<br />
Kategorie „Ingenieur Start-up“<br />
In der letzten Kategorie „Ingenieur Start-<br />
Up“ wurde Dipl.-Ing. Dr. Ronald Naderer, MBA<br />
als Sieger geehrt. Als Geschäftsführer der Firma<br />
FerRobotics Compliant Robot Technology<br />
GmbH <strong>und</strong> <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Johannes<br />
Kepler Universität L<strong>in</strong>z trägt se<strong>in</strong>e Bewer-<br />
VDI<br />
bung den Titel „FerRobotics – Flexible Automatisierung<br />
von Handarbeit“.<br />
Ziel war es, e<strong>in</strong> kompaktes Standardequipment<br />
„von der Stange“ zu entwickeln, das<br />
e<strong>in</strong> Werkzeug so gefühlvoll wie die menschliche<br />
Hand führt, jedoch e<strong>in</strong>facher, besser <strong>und</strong><br />
schneller sowie ohne Bee<strong>in</strong>trächtigung von<br />
Umfeldbelastungen. Mit dem aktiven Kontaktflansch<br />
ACF stellt FerRobotics e<strong>in</strong> Produkt zur<br />
Verfügung, das Automatisierung von Handarbeit<br />
technologisch <strong>und</strong> wirtschaftlich s<strong>in</strong>nvoll<br />
ermöglicht. Schlüsselparameter ist die Kontaktkraft.<br />
Bei konstanter Kontaktkraft <strong>in</strong>tegriert das<br />
Gerät gefühlvoll auftretende Widerstände oder<br />
Konturenverläufe. Durch die lückenlose Rückmeldung<br />
der Kontaktsituation wird die Qualitätskontrolle<br />
automatisch mitgeführt. Es muss<br />
nur ger<strong>in</strong>gfügig <strong>in</strong> den bestehenden Prozess<br />
e<strong>in</strong>gegriffen werden, er kann aber auch völlig<br />
neu ausgelegt werden. Die gefühlvolle Charakteristik<br />
der Handarbeit bleibt bei Ausschöpfung<br />
aller Vorteile im automatisierten Ablauf.<br />
Manuel Reichl<br />
VDI-AK suj München, TiB-Redaktion<br />
31<br />
Foto: Stefan Schumacher
RegIonal<br />
Ausflug nach Frankfurt <strong>und</strong> Darmstadt<br />
Fahrt der VDE-Hochschulgruppe zur VDE YoungNet Convention<br />
Nach der Teilnahme am eStudentday <strong>in</strong> Leipzig<br />
letztes Jahr war dieses Jahr die VDE Young-<br />
Net Convention als große Exkursion der VDE<br />
Hochschulgruppe an der Reihe. So brachen<br />
dreizehn aktive <strong>und</strong> e<strong>in</strong>ige Neumitglieder am<br />
Sonntagmorgen von München auf. Nachdem<br />
wir noch vier Erlanger Jungmitglieder aufge-<br />
32<br />
Ehrung auf der Bildungsmesse forscha<br />
Top-25 Ingenieur<strong>in</strong>nen<br />
ausgezeichnet<br />
Foto: dib<br />
Auf der Messe forscha wurden u.a. Prof. Dr.<br />
rer. nat. Doris Schmitt-Landsiedel, Ord<strong>in</strong>aria<br />
des Lehrstuhls für Technische Elektronik der<br />
TU München (3.v.li.) <strong>und</strong> Dr.-Ing. Andrea Bör<br />
(3.v.re.), seit 1. November 2011 Kanzler<strong>in</strong> der<br />
Universität Passau, geehrt.<br />
nommen hatten, erreichten wir schon gegen<br />
14 Uhr unsere Unterkunft <strong>in</strong> der hessischen<br />
Metropole Frankfurt. Aufgr<strong>und</strong> dieser frühen<br />
Ankunft schaffte es der Großteil unserer<br />
Gruppe auch noch, an der Stadtrallye durch<br />
Darmstadt teilzunehmen <strong>und</strong> durch Erspielen<br />
e<strong>in</strong>er großen Menge Lösegeld den Darmstädter<br />
„König Lui“ frei-<br />
zukaufen. Bei dieser<br />
Gelegenheit konnten<br />
wir Darmstadt, e<strong>in</strong>e<br />
<strong>in</strong>teressante Mischung<br />
aus <strong>in</strong>teressanter Alt-<br />
sowie moderner Universitätsstadt<br />
bereits<br />
gut kennenlernen.<br />
Am Abend fand das<br />
traditionelle „Get Together“<br />
statt, e<strong>in</strong>e sehr<br />
gute Möglichkeit, um<br />
nicht nur den Hunger<br />
nach der Stadtrallye zu<br />
stillen, sondern auch<br />
bei guter Live-Musik<br />
Kontakte mit VDE-<br />
Jungmitgliedern aus<br />
ganz Deutschland zu<br />
knüpfen.<br />
Am nächsten Morgen<br />
galt es dann, nach<br />
Darmstadt zurück zu<br />
fahren, um im hochmodernenMessegebäude„Darmstadi-<br />
um“ an der YoungNet-Convention teilzunehmen.<br />
Bei dem vielfältigen Vortragsangebot<br />
<strong>in</strong> sechs Foren mit <strong>in</strong>teressanten <strong>und</strong> brandaktuellen<br />
Themen wie „Cloud Comput<strong>in</strong>g“,<br />
„Energy Harvest<strong>in</strong>g“ <strong>und</strong> „Dunkler Materie“<br />
war mit Sicherheit für jeden Teilnehmer etwas<br />
dabei.<br />
Gegen 17.00 Uhr endete mit den letzten Vorträgen<br />
dann auch die YoungNet-Convention,<br />
aber nur den Besuch e<strong>in</strong>es weiteren Highlights<br />
zu ermöglichen: Um 18.00 konnten wir an der<br />
Eröffnung des „MikroSystem<strong>Technik</strong>“-Kongress<br />
teilnehmen, an der neben Frau Prof. Dr.<br />
Anette Schavan, B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>ister<strong>in</strong> für Bildung<br />
<strong>und</strong> Forschung sowie Herr Wulf, VDE-Präsident<br />
<strong>und</strong> Vorstandsvorsitzender der Alcatel-<br />
Lucent Deutschland AG, noch weitere wichtige<br />
Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft <strong>und</strong><br />
Industrie teilnahmen.<br />
Den langen Tag ließen wir noch auf der „After-<br />
Show-Party“ <strong>in</strong> Darmstadt sowie e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>eren<br />
Lokal <strong>in</strong> Frankfurt mit dem <strong>in</strong>teressanten<br />
Nahmen „Oberbayern“ auskl<strong>in</strong>gen, wobei sich<br />
wieder die Möglichkeit zum Ausbau der Kontakte<br />
zu anderen VDE-Jungmitgliedern bot.<br />
Am Dienstag konnten wir dann noch am MST-<br />
Kongress teilnehmen, bei dem wir uns mit vielen<br />
<strong>in</strong>teressanten Themen der Mikro systemtechnik<br />
vertraut machen sowie Kontakte zu potentiellen<br />
Arbeitgebern knüpfen konnten.<br />
Quir<strong>in</strong> Scheitle<br />
VDE Hochschulgruppe<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Foto: Sebastian Krösche
Wald<strong>in</strong>formationssystem nordalpen<br />
Der Bergwald geht onl<strong>in</strong>e<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
FoRSchung<br />
Im Rahmen des deutsch-österreichischen EU-Forschungsprojektes „Wald<strong>in</strong>formationssystem<br />
Nordalpen“ (WINALP) wurde e<strong>in</strong> praxisorientiertes Flächen<strong>in</strong>formationssystem für die Bergwälder<br />
der Bayerischen <strong>und</strong> Nordtiroler Kalkalpen sowie für e<strong>in</strong> Pilotgebiet im Salzburger<br />
Land entwickelt.<br />
In diesem Informationssystem f<strong>in</strong>den Forstleute<br />
konkrete H<strong>in</strong>weise auf die natürliche Waldzusammensetzung<br />
<strong>und</strong> die vorherrschenden<br />
Standortbed<strong>in</strong>gungen der Bergwälder. Ermöglicht<br />
hat das unter anderem die Förderung aus<br />
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale<br />
Entwicklung (EFRE) im Programm INTERREG<br />
IV A – Europäische Territoriale Zusammenarbeit.<br />
Die Projektkoord<strong>in</strong>ation übernahm Prof.<br />
Dr. Jörg Ewald, Professor für Botanik <strong>und</strong> Vegetationsk<strong>und</strong>e<br />
an der Hochschule Weihenstephan-<br />
Triesdorf. Die Bayerische Forschungsallianz unterstützte<br />
die Projektpartner bei der Antragstellung<br />
<strong>und</strong> übernahm das Projektmanagement.<br />
Wie feucht oder trocken ist dieser Waldstandort?<br />
Wie hoch ist das Nährstoffangebot? Welche<br />
Baumarten s<strong>in</strong>d an diesen Standort angepasst?<br />
Vor diesen <strong>und</strong> weiteren Fragen stehen Forstpraktiker,<br />
Waldbesitzer <strong>und</strong> Forstbetriebe bei der<br />
Bewirtschaftung ihrer Bergwälder. Um die Bergwälder<br />
optimal bewirtschaften zu können, s<strong>in</strong>d<br />
flächendeckende Informationen zum Standort<br />
e<strong>in</strong>e wesentliche Entscheidungshilfe. Solche hoch<br />
auflösenden Informationen zu den Wuchsbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Waldstandorte <strong>in</strong> den Nordalpen<br />
standen bisher jedoch nur für e<strong>in</strong>zelne Gebiete<br />
zur Verfügung. Mit dem Wald<strong>in</strong>formationssystem<br />
Nordalpen wird diese Lücke geschlossen.<br />
Für alle Waldflächen der Bayerischen <strong>und</strong> Nordtiroler<br />
Kalkalpen sowie für e<strong>in</strong> Pilotgebiet im<br />
Salzburger Land liegen ab sofort digitale Waldtypenkarten<br />
im Maßstab 1:25.000 vor, die die <strong>in</strong><br />
den Bergwäldern herrschenden Umweltbed<strong>in</strong>gungen<br />
dokumentieren. Auf dieser Basis können<br />
Forstleute heute schon die Risiken von morgen<br />
e<strong>in</strong>planen <strong>und</strong> den Bergwald für das nächste<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert entsprechend gestalten.<br />
Das Wald<strong>in</strong>formationssystem wurde mit Hilfe<br />
von Geographischen Informationssystemen<br />
(GIS) umgesetzt <strong>und</strong> vere<strong>in</strong>t hochwertige, an<br />
Punkten im Gelände verprobte Vegetations-<br />
<strong>und</strong> Bodenprofildaten mit flächendeckend verfügbaren<br />
Geodaten zu Geste<strong>in</strong>, Böden, Relief<br />
<strong>und</strong> Klima. Die Punkt- <strong>und</strong> Geodaten bilden<br />
Screenshot aus dem Internet-Viewer der Waldtypenkarte.<br />
die Gr<strong>und</strong>lage für die GIS-gestützte Modellierung<br />
von vegetationswirksamen ökologischen<br />
Standortfaktoren. Aus den vielfältigen Komb<strong>in</strong>ationen<br />
der natürlichen Standortfaktoren<br />
werden nach def<strong>in</strong>ierten Modellvorschriften<br />
Waldtypen, die e<strong>in</strong> vergleichbares Angebot an<br />
Wärme, <strong>Was</strong>ser <strong>und</strong> Nährstoffen aufweisen, berechnet.<br />
Die Waldtypen werden <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er digitalen<br />
Karte im Maßstab 1:25.000 dargestellt <strong>und</strong><br />
<strong>in</strong> Form von Steckbriefen erläutert, die Auskunft<br />
darüber geben, wie viel Wärme, Nährstoffe<br />
<strong>und</strong> <strong>Was</strong>ser zur Verfügung stehen <strong>und</strong> welche<br />
Baumarten von Natur aus vorkommen.<br />
Im Wald<strong>in</strong>formationssystem werden die Modellergebnisse<br />
zusammen mit den Datengr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>und</strong> den Rechenmodellen gespeichert. Das<br />
System ist offen für verbesserte Datengr<strong>und</strong>lagen<br />
<strong>und</strong> neue Auswertungsrout<strong>in</strong>en, so dass weitere<br />
Auswertungen <strong>und</strong> Aktualisierungen vorgenommen<br />
werden können. Bei Veränderung der Datengr<strong>und</strong>lagen<br />
oder modifizierten Modellvorschriften<br />
können künftig aktualisierte Neuauflagen<br />
erstellt werden. Somit bietet das Wald<strong>in</strong>formationssystem<br />
auch <strong>in</strong> Zukunft e<strong>in</strong>e langfristig gültige<br />
Informationsquelle für die Waldbewirtschafter.<br />
Das Wald<strong>in</strong>formationssystem für die Bayerischen<br />
Alpen wird an der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Wald <strong>und</strong> Forstwirtschaft (LWF) gehostet<br />
<strong>und</strong> gepflegt. Ausgewählte Inhalte sollen <strong>in</strong> die<br />
Geo<strong>in</strong>formationssysteme der Bayerischen Forstverwaltung<br />
<strong>und</strong> der Bayerischen Staatsforsten<br />
übernommen werden. E<strong>in</strong> webbasiertes Informationssystem<br />
wird <strong>in</strong> Kürze für die Öffentlichkeit bereit<br />
gestellt. Interessierte können sich hier <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Kartenviewer über die natürliche Waldzusammensetzung<br />
<strong>und</strong> die vorherrschenden Standortbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>in</strong>formieren.<br />
Dr. Birgit Reger<br />
<strong>und</strong> Prof. Dr. Jörg Ewald<br />
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Freis<strong>in</strong>g<br />
KonTAKT<br />
Bayerische Forschungsallianz<br />
Dipl.-Ing. silv. tania Walter<br />
Wissenschaftliche Referent<strong>in</strong><br />
telefon: +49 89 9901888-114<br />
e-Mail: walter@bayfor.org<br />
www.w<strong>in</strong>alp.<strong>in</strong>fo<br />
33<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
RegIonal<br />
Exzellente Elektro<strong>in</strong>genieure!<br />
Die TU München hat der Elektro<strong>in</strong>genieur<strong>in</strong> <strong>und</strong> Naturwissenschaftler<strong>in</strong> Prof. Evel<strong>in</strong>e Gottze<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> dem Elektro<strong>in</strong>genieur Prof. Leon O. Chua den Ehrentitel TUM Dist<strong>in</strong>guished Affiliated<br />
Professor verliehen.<br />
Die beiden renommierten Wissenschaftler s<strong>in</strong>d<br />
der Fakultät für Elektrotechnik <strong>und</strong> Informationstechnik<br />
seit vielen Jahren verb<strong>und</strong>en. Als TUM Dist<strong>in</strong>guished<br />
Affiliated Professor zeichnet die TUM<br />
seit 2007 <strong>in</strong>ternational führende Wissenschaftler<br />
aus, die außerhalb der TUM e<strong>in</strong> Wissenschaftsgebiet<br />
maßgeblich entwickelt haben <strong>und</strong> mit ihren<br />
Fachkollegen an der TUM auf e<strong>in</strong>e lange Zusammenarbeit<br />
zurückblicken können.<br />
Bahnbrechende Erkenntnisse hat Prof. Dr.-<br />
Ing. Evel<strong>in</strong>e Gottze<strong>in</strong> auf dem Gebiet der Regelungstechnik<br />
gemacht. Sie gilt als Expert<strong>in</strong> für<br />
die Lage- <strong>und</strong> Bahnregelung von Satelliten <strong>und</strong><br />
der Regelung von Trag- <strong>und</strong> Führungssystemen<br />
bei Hochgeschw<strong>in</strong>digkeits-Magnetbahnen.<br />
1993 bekam sie als erste Frau den Werner-von-<br />
Siemens-R<strong>in</strong>g, 1998 den Bayerischen Maximiliansorden<br />
für Wissenschaft <strong>und</strong> Kunst <strong>und</strong> 2000<br />
das große B<strong>und</strong>esverdienstkreuz.<br />
Dabei war der Weg der heute 80-Jährigen<br />
nicht immer e<strong>in</strong>fach. Geboren <strong>und</strong> aufgewachsen<br />
<strong>in</strong> Leipzig absolvierte sie nach Ende des<br />
Zweiten Weltkriegs zunächst e<strong>in</strong>e Ausbildung<br />
zur Elektrotechniker<strong>in</strong>, da ihr <strong>in</strong> der DDR aufgr<strong>und</strong><br />
ihrer Herkunft der Hochschulzugang zunächst<br />
verwehrt wurde. Als e<strong>in</strong>e von nur sieben<br />
Frauen unter etwa 600 Studierenden studierte<br />
sie <strong>in</strong> Dresden Elektrotechnik, Mathematik <strong>und</strong><br />
Physik. Nach ihrer Flucht <strong>in</strong> die B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Ende der 1950er-Jahre arbeitete sie unter<br />
anderem beim Hubschrauber- <strong>und</strong> Flugzeughersteller<br />
Bölkow <strong>und</strong> wurde 1983 an der TUM<br />
promoviert. Bis 1996 war sie Lehrbeauftragte<br />
für das Fach „Regelungsprobleme <strong>in</strong> der Raum-<br />
34<br />
Prof. Dr.-Ing. Evel<strong>in</strong>e Gottze<strong>in</strong> <strong>und</strong> Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Leon Chua (re.), die Preisträger des<br />
TUM Dist<strong>in</strong>guished Affiliated Professor.<br />
fahrt“ an der Universität Stuttgart <strong>und</strong> ist dort<br />
seit 1996 Honorarprofessor<strong>in</strong>.<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Leon Chua, Berkeley,<br />
Kalifornien, ist e<strong>in</strong> herausragender Wissenschaftler<br />
auf dem Gebiet der Theorie nichtl<strong>in</strong>earer<br />
Schaltungen. Er ist der Erf<strong>in</strong>der des Memristors,<br />
den er als miss<strong>in</strong>g circuit element 1971<br />
veröffentlicht hat. Der Name Memristor ist e<strong>in</strong><br />
Kofferwort aus memory <strong>und</strong> resistor, also e<strong>in</strong><br />
passives elektrisches Bauelement, dessen elektrischer<br />
Widerstand nicht konstant ist, sondern<br />
von se<strong>in</strong>er Vergangenheit abhängt. Heute, etwa<br />
40 Jahre nach se<strong>in</strong>er Konzeption, gew<strong>in</strong>nt Chuas<br />
Erf<strong>in</strong>dung erneut an Aktualität. Möglicherweise<br />
verändert sie die Logik- <strong>und</strong> Speicherschaltungen<br />
nachhaltig. Memristoren könnten die<br />
heute üblichen flüchtigen Speicher ersetzen<br />
<strong>und</strong> Rechner mit weit höherer Energieeffizienz<br />
ermöglichen, die nach dem E<strong>in</strong>schalten sofort<br />
betriebsbereit s<strong>in</strong>d.<br />
Für se<strong>in</strong>e herausragenden Werke hat Chua zahlreiche<br />
<strong>in</strong>ternationale Preise <strong>und</strong> Auszeichnungen<br />
bekommen. Unter anderem trägt der 75-Jährige<br />
neun Ehrendoktortitel. Leon Chua hat als Humboldt-Forschungspreisträger<br />
e<strong>in</strong> Jahr lang am<br />
Lehrstuhl für Netzwerktheorie <strong>und</strong> Signalverarbeitung<br />
der TUM verbracht. Zudem ist er Visit<strong>in</strong>g<br />
Fellow am Institute for Advanced Study der TUM<br />
<strong>und</strong> hat mit se<strong>in</strong>en Vorträgen die Studierenden<br />
der Fakultät für Elektrotechnik <strong>und</strong> Informationstechnik<br />
begeistert. Seit 1971 ist er Professor für<br />
Electical Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g and Computer Sciences an<br />
den University of California <strong>in</strong> Berkeley.<br />
TUM-Vizepräsident Hans Pongratz überreichte<br />
die Ehrung an die beiden Wissenschaftleh anlässlich<br />
der Jahrfeier „Tag der Fakultät Elektrotechnik<br />
<strong>und</strong> Informationstechnik“.<br />
Mart<strong>in</strong>a Spreng<br />
Fakultät für Elektrotechnik <strong>und</strong> Informationstechnik,<br />
Technische Universität München<br />
Eröffnung ‚Haus der Forschung’ <strong>in</strong> München<br />
<strong>Bayern</strong>s Wirtschaftsm<strong>in</strong>ister Mart<strong>in</strong> Zeil <strong>und</strong> <strong>Bayern</strong>s Wissenschaftsm<strong>in</strong>ister Wolfgang<br />
Heubisch eröffnen Haus der Forschung <strong>in</strong> München<br />
Am 7. November 2011 eröffneten <strong>Bayern</strong>s<br />
Wirtschaftsm<strong>in</strong>ister Mart<strong>in</strong> Zeil <strong>und</strong> <strong>Bayern</strong>s<br />
Wissenschaftsm<strong>in</strong>ister Wolfgang Heubisch das<br />
Haus der Forschung <strong>in</strong> München. Damit hat nun<br />
auch die Landeshauptstadt e<strong>in</strong>e zentrale Anlaufstelle<br />
für alle Fragen zur Technologie- <strong>und</strong><br />
EU-Forschungsförderung. Bereits im vergangenen<br />
Jahr war das Hauptquartier des Hauses der<br />
Forschung <strong>in</strong> Nürnberg an den Start gegangen.<br />
Neben der Information <strong>und</strong> Beratung zu Forschungs-<br />
<strong>und</strong> Technologieförderprogrammen<br />
bietet das Haus der Forschung unter anderem<br />
Information <strong>und</strong> Beratung zu F<strong>in</strong>anzierungsprogrammen,<br />
Kooperationsanbahnung <strong>und</strong><br />
Wissens- <strong>und</strong> Technologietransfer.<br />
Informationen unter:<br />
www.hausderforschung.bayern.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Die globale Katastrophe<br />
als Merkmal e<strong>in</strong>er Gesellschaft<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
H<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong><br />
Wenige Wochen vor der Katastrophe <strong>in</strong> Tschernobyl veröffentlichte der Soziologe Ulrich Beck<br />
se<strong>in</strong> Buch Risikogesellschaft. Seither ist die Angst vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft<br />
e<strong>in</strong>er öffentlichen Gelassenheit im Umgang mit den globalen Krisen gewichen. Seien<br />
es Epidemien, F<strong>in</strong>anzkrisen oder gar die Reaktorkatastrophe von Fukushima – ke<strong>in</strong> Ereignis<br />
führte zu panischen Reaktionen <strong>in</strong> der deutschen Bevölkerung.<br />
e<strong>in</strong> Buch trifft den Zeitgeist<br />
Im April 1986 erschien das bekannte Buch<br />
zur Risikogesellschaft des deutschen Soziologen<br />
Ulrich Beck, <strong>in</strong> dem er e<strong>in</strong>e von technologischen<br />
Gefahren geprägte Spätmoderne beschrieb.<br />
Wenige Tage später kam es am 26. April 1986<br />
zur Kernreaktorkatastrophe <strong>in</strong> Tschernobyl.<br />
E<strong>in</strong>er 2. Auflage im Mai 1986 fügte Beck e<strong>in</strong><br />
Vorwort „Aus gegebenem Anlaß“ h<strong>in</strong>zu, <strong>in</strong> dem<br />
er schrieb: „Vieles, das im Schreiben noch argumentativ<br />
erkämpft wurde – die Nichtwahrnehmbarkeit<br />
der Gefahren, ihre Wissensabhängigkeit,<br />
ihre Übernationalität [...] – liest sich nach der<br />
Katastrophe von Tschernobyl wie e<strong>in</strong>e platte<br />
Beschreibung der Gegenwart. Ach, wäre es die<br />
Beschwörung e<strong>in</strong>er Zukunft geblieben, die es zu<br />
verh<strong>in</strong>dern gilt!“ Die direkte zeitliche Folge von<br />
Ersche<strong>in</strong>en <strong>und</strong> Katastrophe bescherte Becks<br />
Buch e<strong>in</strong>e ungeheure <strong>in</strong>ternationale Beachtung,<br />
so dass es bis heute <strong>in</strong> über 30 Sprachen<br />
übersetzt wurde <strong>und</strong> der Begriff der Risikogesellschaft<br />
E<strong>in</strong>zug <strong>in</strong> den allgeme<strong>in</strong>en Sprachgebrauch<br />
gef<strong>und</strong>en hat.<br />
die Moderne als Weltgefahrengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Die Kernthese des Buchs ist, dass die klassischen<br />
Differenzierungen der modernen Gesellschaft<br />
durch technologische Umwälzungen <strong>und</strong><br />
die dadurch verursachten ökologischen Gefahren,<br />
wie Luftverschmutzung, Ozonloch oder<br />
Gentechnik, an Bedeutung verlieren. Demnach<br />
spielen bekannte Ungleichheiten, wie zwischen<br />
Arm <strong>und</strong> Reich, Zentrum <strong>und</strong> Peripherie oder<br />
E<strong>in</strong>heimischen <strong>und</strong> Neuankömml<strong>in</strong>gen, angesichts<br />
globaler Gefährdungen ke<strong>in</strong>e f<strong>und</strong>amentale<br />
Rolle mehr.<br />
Diese Entwicklung befand Beck so neuartig,<br />
dass sie e<strong>in</strong>e neue Gesellschafts bezeichnung<br />
rechtfertigte. Der Unternehmer <strong>und</strong> die<br />
Re<strong>in</strong>igungskraft leben <strong>in</strong> derselben Risikogesellschaft<br />
<strong>und</strong> s<strong>in</strong>d deshalb gleichermaßen<br />
von universalen <strong>und</strong> grenzüberschreitenden<br />
Gefährdungen betroffen. Im Gegensatz dazu<br />
verband man <strong>in</strong> der Industriegesellschaft mit<br />
<strong>Technik</strong>entwicklung die Hoffnung auf kont<strong>in</strong>uierlich<br />
wachsenden Reichtum. Da dieser<br />
<strong>in</strong> der Realität jedoch ungleich verteilt wurde,<br />
bestanden gesellschaftliche Differenzierungen<br />
fort. Laut Beck haben <strong>in</strong> der heraufziehenden<br />
Risikogesellschaft die Folgen technischen Fortschritts<br />
e<strong>in</strong>en gegenteiligen, nämlich nivellierenden<br />
Effekt. Tschernobyl <strong>und</strong> die radioaktive<br />
Wolke betrafen alle Menschen, machten nicht<br />
am Eisernen Vorhang halt <strong>und</strong> unterschieden<br />
auch nicht zwischen Arm <strong>und</strong> Reich.<br />
Die Risikogesellschaft ist somit e<strong>in</strong> neuer Typ<br />
der Industriegesellschaft, <strong>in</strong> der der <strong>in</strong>dustrielle<br />
Reichtum globale Risiken hervorruft. Beck<br />
bezeichnete sie als Zweite Moderne. Die globalisierte<br />
Welt stellt sich nun als Weltgefahrengeme<strong>in</strong>schaft<br />
dar, deren Mitglieder mit über<strong>in</strong>dividuellen<br />
<strong>und</strong> nicht kalkulierbaren Großgefahren<br />
konfrontiert s<strong>in</strong>d.<br />
die Wirkung der<br />
risikogesellschaft<br />
In den 25 Jahren nach Ersche<strong>in</strong>en des Titels,<br />
hat sich die öffentliche Wahrnehmung verfestigt,<br />
tatsächlich <strong>in</strong> der Risikogesellschaft zu<br />
leben. Zahlreiche Katastrophen <strong>und</strong> Krisen<br />
untermauern kont<strong>in</strong>uierlich die Aktualität des<br />
Beckschen Gesellschaftsmodells. Beispiele hierfür<br />
s<strong>in</strong>d der R<strong>in</strong>derwahns<strong>in</strong>n, die SARSEpidemie,<br />
die Tsunami Katastrophe im Indischen<br />
Ozean, die Schwe<strong>in</strong>egrippePandemie aber<br />
auch die F<strong>in</strong>anzkrise des Jahres 2008. Kürzlich<br />
haben sich die Ereignisse des Aprils 1986<br />
<strong>in</strong> Tschernobyl bei der Kernreaktorkatastrophe<br />
von Fukushima wiederholt.<br />
Durch die damit verb<strong>und</strong>ene fortlaufende<br />
Rezeption des Buchs ersche<strong>in</strong>en uns Becks<br />
E<strong>in</strong>sichten heute so selbstverständlich, dass<br />
vergessen wird, um welchen Paukenschlag soziologischer<br />
Theoriebildung es sich vor 25 Jahren<br />
handelte. Mittlerweile haben wir uns an die<br />
Existenz globaler Katastrophen gewöhnt <strong>und</strong><br />
die Angst vor dem Zusammenbruch der Gesellschaft<br />
ist e<strong>in</strong>er Gelassenheit im Umgang mit<br />
derartigen Krisen gewichen.<br />
Erhofften sich die Leser des Buches <strong>in</strong> den<br />
Jahren nach se<strong>in</strong>em Ersche<strong>in</strong>en noch H<strong>in</strong>weise<br />
zur Lösung derartiger globaler Krisen, so<br />
werden Ulrich Beck <strong>und</strong> die Risikogesellschaft<br />
heute immer dann zitiert, <strong>wenn</strong> e<strong>in</strong>e Erklärung<br />
für die Unausweichlichkeit des Geschehenen<br />
verlangt wird.<br />
Literatur<br />
Dipl.-Soz. Peter Schüßler<br />
Deutsches Museum, München<br />
Beck, ulrich: risikogesellschaft. Auf dem Weg<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e andere Moderne, Suhrkamp Verlag<br />
Frankfurt am Ma<strong>in</strong>, 1986, iSBn 9783518<br />
113653, 12,50 euro<br />
35<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
Vdi ForuM<br />
Viele <strong>in</strong>teressierte Zuhörer kamen zum VDI Forum VDI BV-GF R. Schmidt (li.) <strong>und</strong> LV-Geschäftsführer Dr. Th. Bruder<br />
VDi Forum<br />
„Moderne Sicherheitstechnik“<br />
Be<strong>in</strong>ahe täglich erreichen uns Meldungen über kle<strong>in</strong>e <strong>und</strong> große Unfälle, neue Bedrohungen<br />
im Internet, Terrordrohungen oder gar Katastrophen. Und jeder denkt: Sicherheit tut not. Auch<br />
der VDI widmete dem Thema Risiko e<strong>in</strong> Forum: Innovative Sicherheitstechnik. Durch e<strong>in</strong>e glückliche<br />
Hand bei der Auswahl der Vortragenden wurde es e<strong>in</strong>e sehr anregende Veranstaltung.<br />
e<strong>in</strong>führung<br />
Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hard Höpfl, Vorsitzender des<br />
VDI Landesverbands <strong>Bayern</strong> begrüßte die<br />
Funktionsträger aus Behörden, Wissenschaft<br />
<strong>und</strong> Wirtschaft <strong>und</strong> natürlich die anwesenden<br />
VDIMitglieder. Er wies darauf h<strong>in</strong>, dass wir<br />
alle nach Sicherheit suchen, aber zwecks Wahrnehmung<br />
von Chancen trotzdem Wagnisse<br />
e<strong>in</strong>gehen müssten. Sicherheit schaffe Vertrauen<br />
<strong>und</strong> sei für e<strong>in</strong>e Gesellschaft essentiell.<br />
Der gastgebende TÜV wurde durch Walter<br />
Reithmaier von der Geschäftsführung TÜV<br />
SÜD Automotive vertreten. Er zitierte die Satzung<br />
des TÜV, die diesen auf den Schutz von<br />
nicht nur materiellen Werten verpflichte. Mit<br />
mittlerweile 16.000 Mitarbeitern weltweit kümmert<br />
sich der TÜV daher auch zunehmend um<br />
die Sicherheit von Strukturen, Verfahren <strong>und</strong><br />
Prozessen aller Art.<br />
Der Vorsitzende des VDI Bezirksvere<strong>in</strong>s<br />
München, Prof. Dr. BerndRobert Höhn,<br />
übernahm dann die Moderation <strong>und</strong> beschrieb<br />
als Ziel der Veranstaltung e<strong>in</strong>en<br />
Überblick über die gesamte Bandbreite der<br />
Sicherheitstechnik.<br />
36<br />
Bedeutung der Sicherheitsforschung<br />
E<strong>in</strong>en Überblick über das große Feld der Sicherheitsforschung<br />
gab Prof. Dr. Klaus Thoma<br />
vom FraunhoferInstitut für Kurzzeitdynamik,<br />
ErnstMachInstitut, Freiburg.<br />
Das Programm „Forschung für die zivile Sicherheit“<br />
des B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isteriums für Bildung<br />
<strong>und</strong> Forschung (BMBF) untersucht mit verschiedenen<br />
Partnern umfassend die Probleme<br />
der Security für Mensch <strong>und</strong> Infrastruktur, wobei<br />
auch SafetyAspekte nicht ausgeklammert<br />
werden (security = Schutz vor absichtlichen,<br />
von Menschen ausgelösten Angriffen; safety =<br />
Schutz vor zufälligen, unbeabsichtigten Schäden;<br />
d. Red.). Sicherheit ist e<strong>in</strong>es der großen<br />
Themen der Zukunft neben Energie, Mobilität,<br />
Umwelt, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Kommunikation.<br />
Warum ist Sicherheitsforschung so wichtig?<br />
Weil Gefahren immer <strong>und</strong> überall drohen. Zwar<br />
hat die <strong>Technik</strong> e<strong>in</strong>erseits immer mehr Sicherheit<br />
ermöglicht, andererseits aber auch die Voraussetzungen<br />
für e<strong>in</strong>e immer leistungsfähigere<br />
<strong>und</strong> komplexere Infrastruktur zur Versorgung<br />
mit Gütern <strong>und</strong> Information geschaffen, die<br />
e<strong>in</strong>er neuartigen Verletzlichkeit unterliegt. Das<br />
wurde bisher zu wenig erkannt <strong>und</strong> beachtet<br />
(Ausnahme Brandschutz). Wegen zunehmender<br />
Bevölkerungskonzentration <strong>in</strong> Megacities<br />
<strong>und</strong> der Vernetzung <strong>in</strong> globalem Ausmaß können<br />
Terrorangriffe, organisierte Krim<strong>in</strong>alität,<br />
Cyber Crime, Großunfälle, Naturkatastrophen<br />
oder Epidemien verheerende Effekte haben.<br />
Die Forschung soll kritische Strukturen def<strong>in</strong>ieren<br />
(Verkehr, Versorgung, Behörden, Banken,<br />
Information) <strong>und</strong> mit e<strong>in</strong>em holistischen Sicherheitsansatz<br />
e<strong>in</strong>e resiliente (fehlertolerante)<br />
Gesellschaft ermöglichen. Ziel ist Security by<br />
Design, <strong>in</strong>dem möglichst alle für e<strong>in</strong> Projekt<br />
wichtigen Risiken von vornhere<strong>in</strong> berücksichtigt<br />
werden.<br />
Die Forschung wird sowohl auf EU wie auch<br />
auf nationaler Ebene betrieben. Neu ist, dass<br />
nicht nur die klassischen technischen Felder<br />
bearbeitet werden, sondern dass u.a. auch Soziologie,<br />
Recht, Ethik, Medien <strong>und</strong> vor allem<br />
die Endnutzer wie die Feuerwehr e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden.<br />
Als konkrete Anwendungsbeispiele wurden<br />
e<strong>in</strong> Hochhauskonzept mit e<strong>in</strong>sturzgeschütztem<br />
Kern <strong>und</strong> SOGRO, e<strong>in</strong> Projekt zur Sofortrettung<br />
bei Großunfällen vorgestellt.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Vdi ForuM<br />
Das Podium (v.l.n.r.): Prof. K. Thoma, R. von zur Mühlen, Prof. B.-R. Höhn <strong>und</strong> Fr. Prof. C. Eckert Prof. R. Höpfl, Vorsitzender LV mit Gatt<strong>in</strong>.<br />
Sicherheit im <strong>in</strong>ternet<br />
Prof. Dr. Claudia Eckert (TU München, Fakultät<br />
für Informatik <strong>und</strong> FraunhoferInstitut<br />
für Sichere Informationstechnologie) startete<br />
ihren Vortrag mit der provokanten Aussage<br />
„Sicherheit im Internet gibt es nicht“, setzte<br />
aber gleich h<strong>in</strong>zu, man dürfe natürlich nicht<br />
aufgeben. Die Informationsverarbeitung <strong>und</strong><br />
vernetzung schreitet rasend schnell voran<br />
<strong>und</strong> Daten s<strong>in</strong>d sowohl Wirtschaftsgut als auch<br />
Steuerungselemente. Das macht sie <strong>in</strong>teressant<br />
für Ausspähen <strong>und</strong> Manipulation. Cyberangriffe<br />
s<strong>in</strong>d wegen ger<strong>in</strong>gem Risiko, hoher Effektivität<br />
<strong>und</strong> möglichen großen Gew<strong>in</strong>nen sehr<br />
attraktiv. Es besteht dr<strong>in</strong>gender Handlungsbedarf<br />
sowohl bei der Technologie wie beim<br />
Problembewusstse<strong>in</strong>. Ziel muss wiederum<br />
se<strong>in</strong>: Design for Security, was sich sowohl auf<br />
die <strong>Technik</strong> wie auf die Bedienabläufe bezieht.<br />
Die Systeme müssen über ihren gesamten Nutzungszeitraum<br />
immer wieder getestet werden,<br />
da sich die Bedrohungen weiterentwickeln. Die<br />
Anwender müssen es e<strong>in</strong> umfassendes Risikomanagement<br />
betreiben. Vor allem müssen die<br />
Mitarbeiter <strong>in</strong>tensiv geschult werden, da der<br />
Mensch das schwächste Glied der Kette bleibt.<br />
Aktuelle Problemfelder s<strong>in</strong>d u.a. Smart Grids<br />
<strong>und</strong> Cloud Comput<strong>in</strong>g.<br />
Sicherheitstechnik als gesellschaftspolitische<br />
Säule der <strong>in</strong>dustrie<br />
Aus der Praxis berichtete höchst anschaulich<br />
Ra<strong>in</strong>er von zur Mühlen von der VON ZUR<br />
MÜHLEN’SCHE GmbH, e<strong>in</strong>er auf Sicherheitsberatung<br />
<strong>und</strong> RiskManagement spezialisierten<br />
Consult<strong>in</strong>gGesellschaft. Er betonte, dass es<br />
ke<strong>in</strong>e Schadensereignisse gibt, sondern Auslöser<br />
<strong>und</strong> Prozesse, an deren Ende e<strong>in</strong> Schaden<br />
steht. Und für jeden Verantwortlichen gilt die<br />
Beweislastumkehr, er muss gegebenenfalls<br />
nachweisen, dass er alles Nötige zur Unterb<strong>in</strong>dung<br />
von Schadensprozessen getan hat.<br />
Der E<strong>in</strong>tritt von Schäden muss verh<strong>in</strong>dert<br />
(z.B. ke<strong>in</strong> brennbares Material vorhanden),<br />
beh<strong>in</strong>dert (Videoüberwachung), rechtzeitig<br />
entdeckt (Sensorik) <strong>und</strong> geeignet bekämpft<br />
(Spr<strong>in</strong>kleranlage) <strong>und</strong> im schlimmsten Fall<br />
e<strong>in</strong>deutig nachgewiesen werden. Häufig besteht<br />
zu wenig Risikobewusstse<strong>in</strong> <strong>und</strong> die<br />
Berufung auf Bestandsschutz <strong>und</strong> daher unterbliebene<br />
Investitionen z.B. <strong>in</strong> Brandschutz<br />
können gewaltige Kosten nach sich ziehen.<br />
Wenn wegen e<strong>in</strong>er <strong>und</strong>ichten <strong>Was</strong>serleitung<br />
mit nachfolgendem Kurzschluss schließlich<br />
e<strong>in</strong> Hochhaus total abbrennt, Gesamtschaden<br />
30 Mio. Euro, hat das schon e<strong>in</strong>en hohen Anschauungswert.<br />
Laut von zur Mühlen ist das<br />
Risikomanagement oft unsystematisch. Je<br />
nach Gegebenheit müsse man entweder konsequent<br />
die E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit oder<br />
die Schadenshöhe e<strong>in</strong>es möglichen Vorfalles<br />
reduzieren. Und vor allem: Sicherheit muss als<br />
Querschnittsthema angegangen <strong>und</strong> als Unternehmensziel<br />
def<strong>in</strong>iert werden.<br />
Podiumsdiskussion<br />
Die abschließende Podiumsdiskussion mit<br />
den Referenten leitete Prof. Höhn.<br />
Klare Antwort auf die E<strong>in</strong>gangsfrage: S<strong>in</strong>d<br />
Handy <strong>und</strong> Onl<strong>in</strong>ebank<strong>in</strong>g sicher? Ke<strong>in</strong>esfalls.<br />
Gibt es Sicherheitszertifikate für Datengeräte?<br />
Ne<strong>in</strong>, auch ke<strong>in</strong>e transparente Prüfung von<br />
„Apps“. Das ist zu teuer, Zertifizierung ist zu<br />
kompliziert. Kann man Hochhäuser nachträglich<br />
sicherer machen? In gewissem Ausmaß<br />
durch Anwendung spezieller Materialien. Wie<br />
lange s<strong>in</strong>d „sichere“ Systeme sicher? Das Hase<strong>und</strong>IgelSpiel<br />
läuft ewig.<br />
Ziel des Risikomanagements ist vorausschauendes<br />
Handeln, beweisbar ist Sicherheit<br />
aber nicht. Für kritische Anwendungen muss<br />
man segmentierte Inselkonfigurationen vorsehen,<br />
was aber nicht durch die Mitarbeiter<br />
durch löchert werden darf. Auch wird die EU<br />
e<strong>in</strong>e neue Richtl<strong>in</strong>ie erlassen, damit bei Auslieferung<br />
von Kommunikationsgeräten alle<br />
Sicherheitsfunktionen aktiviert s<strong>in</strong>d. Manche<br />
Firmen machen dies aber bei Updates zum Teil<br />
rückgängig. Security by Design gibt es noch zu<br />
selten wegen fehlender Vorschriften, hier ist die<br />
Politik gefordert.<br />
Prof. Höhn beendete die Diskussion mit der<br />
Bemerkung, bei der Ingenieurausbildung sei<br />
die Rechnergläubigkeit zu bekämpfen <strong>und</strong><br />
stattdessen kritisches Mitdenken e<strong>in</strong>zufordern.<br />
gespräche am Buffet<br />
Prof. Höpfl dankte dann allen Referenten <strong>und</strong><br />
Zuhörern <strong>und</strong> leitete zum geselligen Teil über.<br />
Die spannenden Vorträge <strong>und</strong> das attraktive<br />
Buffet animierten noch viele der Besucher zu<br />
langen Diskussionen.<br />
37<br />
Fotos: Silvia Stettmayer<br />
Gerhard Grosch<br />
Redaktion TiB
Alle Abbildungen: DAV<br />
ScHWerPunkt<br />
Sicherheit am Berg mit Laptop <strong>und</strong> Karab<strong>in</strong>er<br />
Die Sicherheitsforschung ist e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>richtung des Deutschen Alpenvere<strong>in</strong>s für bessere<br />
Aus rüstung <strong>und</strong> risikobewusstes Verhalten im Bergsport.<br />
Bergsport ist modern, Bergsport liegt im<br />
Trend. Das bestätigen die Mitgliederzahlen des<br />
Deutschen Alpenvere<strong>in</strong>s als weltgrößter Bergsteigerverband.<br />
In den letzten 10 Jahren stieg sie<br />
um 30 % auf knapp 900.000 Mitglieder. Bergsport<br />
ist aber auch mit Risiken verb<strong>und</strong>en. Aus<br />
Verantwortung für se<strong>in</strong>e Mitglieder <strong>und</strong> den<br />
Bergsport betreibt der Deutsche Alpenvere<strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e eigene Sicherheitsforschung. Gerade Risiken<br />
<strong>in</strong> der Freizeit werden <strong>in</strong> der Gesellschaft oft<br />
kritisch diskutiert <strong>und</strong> positive Aspekte außer<br />
Acht gelassen. Die DAV Sicherheitsforschung ist<br />
e<strong>in</strong>e Initiative für bessere Ausrüstung <strong>und</strong> risikobewusstes<br />
Verhalten im Bergsport.<br />
Lange tradition<br />
Vierzig Jahre ist es her, dass der „DAVSicherheitskreis“<br />
gegründet wurde: E<strong>in</strong> tödlicher<br />
Unfall aufgr<strong>und</strong> e<strong>in</strong>es gebrochenen Pickels war<br />
Anlass für damalige Extrembergsteiger <strong>und</strong><br />
Alp<strong>in</strong>journalisten wie Manfred Sturm, Jürgen<br />
38<br />
W<strong>in</strong>kler, Elmar Landes, Toni Hiebeler <strong>und</strong> Pit<br />
Schubert, mehr Sicherheit zu fordern. Vorschläge<br />
<strong>und</strong> Forderungen an Hersteller sowie die<br />
Gründung e<strong>in</strong>es Normungsgremiums machten<br />
die Ausrüstung kont<strong>in</strong>uierlich verlässlicher. Das<br />
Handlungsfeld wurde beständig erweitert: In<br />
Kletterhallen <strong>und</strong> auf Skitouren wurde nicht<br />
nur das Material, sondern speziell das Verhalten<br />
der Bergsportler untersucht, um gefährliche<br />
Fehler zu entdecken <strong>und</strong> Verhaltenstipps zu<br />
formulieren. Alp<strong>in</strong>e Sicherheit ist immer e<strong>in</strong><br />
Konglomerat: Infrastruktur, Ausrüstung <strong>und</strong><br />
Verhalten spielen zusammen, das schwächste<br />
Element entscheidet. E<strong>in</strong>e Kunst ist, da anzusetzen,<br />
wo man am meisten bewirken kann. So<br />
bilden Forschungsarbeiten <strong>und</strong> Unfall analysen<br />
die Gr<strong>und</strong>lage. Um die Ergebnisse umzusetzen,<br />
arbeiten die DAVSicherheitsforscher beispielsweise<br />
bei den deutschen <strong>und</strong> europäischen<br />
Normungsgremien DIN <strong>und</strong> CEN mit, die Standards<br />
für sichere Ausrüstung def<strong>in</strong>ieren; sie<br />
br<strong>in</strong>gen Forschungsergebnisse e<strong>in</strong> <strong>und</strong> diskutieren<br />
über Anstöße anderer Sicherheitsexperten.<br />
Den Bergsportlern werden die Ergebnisse<br />
<strong>in</strong> Form von Empfehlungen <strong>in</strong> zahlreichen<br />
Veröffentlichungen zugänglich gemacht. Im<br />
Magaz<strong>in</strong> „Panorama“ <strong>und</strong> der Fachzeitung<br />
„Berg<strong>und</strong>steigen“ ersche<strong>in</strong>en regelmäßig diesbezügliche<br />
Artikel. Dabei ist das Ziel der Sicherheitsforschung,<br />
e<strong>in</strong>e praxisnahe Abwägung von<br />
Maßnahmen zur Risikoreduktion zu treffen.<br />
E<strong>in</strong>e 2010 durchgeführte Untersuchung zum<br />
Klettersteiggehen ist e<strong>in</strong> Beispiel dafür.<br />
klettersteigsets<br />
Klettersteiggehen ist e<strong>in</strong>e Diszipl<strong>in</strong> des Bergsports,<br />
bei der man sich im Felsgelände mit fest<br />
<strong>in</strong>stallierten Sicherungshilfen bewegt. Der Klettersteiggeher<br />
hängt sich zur Sicherung mittels<br />
Klettersteigset <strong>in</strong> die Drahtseilsicherung am<br />
Fels e<strong>in</strong>. Das Klettersteigset bildet zum e<strong>in</strong>en<br />
die Verb<strong>in</strong>dung zwischen Fels <strong>und</strong> dem Klettersteiggeher,<br />
zum Zweiten hat es e<strong>in</strong>e fangstoßdämpfende<br />
Funktion. Die Kräfte bei e<strong>in</strong>em<br />
Sturz sollen auf e<strong>in</strong> verträgliches Maß reduziert<br />
werden. Ursprünglich ist das Klettersteigset für<br />
erwachsene 80 kg schwere Personen konstruiert<br />
worden. In den letzten Jahren s<strong>in</strong>d aber auch<br />
immer mehr Familien mit K<strong>in</strong>dern auf Klettersteigen<br />
unterwegs. Funktionieren Kletter<br />
steigsets auch für K<strong>in</strong>der? Mit dieser Kernfrage<br />
startete die DAVSicherheitsforschung im Sommer<br />
2010 e<strong>in</strong>e Untersuchung. Die Frage mag<br />
verblüffen – es gibt doch e<strong>in</strong>e Norm, die Sicherheit<br />
garantieren soll! Leider tut sie das nicht für<br />
K<strong>in</strong>der, denn die Materie ist komplexer, als man<br />
auf den ersten Blick vermutet.<br />
Die gültige Norm EN 958 für Klettersteigsets<br />
schreibt e<strong>in</strong>e dynamische Prüfung mit 80 kg<br />
Eisenmasse vor. Diese aber verformt sich beim<br />
Sturz nicht; während der menschliche Körper<br />
beim Abfangen e<strong>in</strong>es Sturzes Energie aufnimmt:<br />
durch Muskelspannung oder durch Verrenkungen<br />
<strong>und</strong> Knochenbrüche. Deshalb beansprucht<br />
e<strong>in</strong> Mensch e<strong>in</strong> Klettersteigset weniger als e<strong>in</strong>e<br />
Eisenmasse – selbst e<strong>in</strong> 100KiloMensch nutzt<br />
im Gegensatz zur 80kgEisenmasse den möglichen<br />
Bremsweg e<strong>in</strong>es Klettersteigsets nicht aus.<br />
Schlecht: denn nur e<strong>in</strong> langer Bremsweg macht<br />
den Sturz „weich“. Wie sich die Klettersteigsets<br />
bei ger<strong>in</strong>geren Gewichten verhalten <strong>und</strong> welche<br />
Auswirkungen das für leichte Menschen hat,<br />
war bisher nicht geklärt.<br />
dummies im freien Fall<br />
Um dieser Frage nachzugehen, wurde e<strong>in</strong><br />
Klettersteigsturz im Labor mit e<strong>in</strong>em dem<br />
menschlichen Körper entsprechenden Dummy<br />
nachgestellt. Es handelt sich dabei um Dummies<br />
vomTyp Hybrid III aus der Automobil<strong>in</strong>dustrie.<br />
Die Versuche wurden zusammen mit dem Institut<br />
für forensisches Sachverständigenwesen<br />
<strong>in</strong> München (IfoSa) durchgeführt. Analog zum<br />
Normtest stürzten die Dummies aus fünf Metern<br />
Höhe <strong>in</strong> das Klettersteigset. Dabei wurden<br />
die Beschleunigung am Kopf des Dummies, die<br />
Bremskraft am Klettersteigset <strong>und</strong> der Bremsweg<br />
am Falldämpfer gemessen. Der Sturzverlauf<br />
wurde mit e<strong>in</strong>er Hochgeschw<strong>in</strong>digkeitskamera<br />
gefilmt, um die Verletzungsmechanismen<br />
erkennen zu können.<br />
Die Auswirkungen für den menschlichen<br />
Körper können mit zwei unterschiedlichen Methoden<br />
bewertet werden. Zum E<strong>in</strong>en über die<br />
auf den Körper wirkende Kraft <strong>und</strong> damit die<br />
(negative) Beschleunigung am Anseilpunkt; sie<br />
wird über e<strong>in</strong>e Kraftmesszelle am Klettersteigset<br />
gemessen. Welche Beschleunigungen am<br />
Anseilpunkt ges<strong>und</strong>heitsverträglich s<strong>in</strong>d, wurde<br />
schon <strong>in</strong> mehreren mediz<strong>in</strong>ischen Studien<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
untersucht. Die Literatur nennt 6 g als akzeptable<br />
Beschleunigung <strong>und</strong> 12 g als Grenzwert<br />
(zum Vergleich: Im Loop<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>er Achterbahn<br />
wirken maximal 4 g). Dieser Ansatz ist natürlich<br />
eher allgeme<strong>in</strong> gehalten, lässt aber schon<br />
e<strong>in</strong>e grobe E<strong>in</strong>ordnung der Sturzfolgen zu.<br />
Die zweite Methode ist, für den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Sturzfall die Verletzungswahrsche<strong>in</strong>lichkeit zu<br />
bestimmen. Dazu wird der Sturzverlauf sowie<br />
die Dauer <strong>und</strong> Höhe der wirkenden Beschleunigungen<br />
betrachtet. Diese Bewertung führte<br />
der Forensiker Prof. Dr. Jochen Buck durch;<br />
die zu erwartenden Verletzungsfolgen stufte er<br />
nach dem sogenannten AIS Code (Abbreviated<br />
Injury Scale) e<strong>in</strong>).<br />
Brechende Wirbelsäulen<br />
Die Ergebnisse der Versuchsreihe waren alarmierend.<br />
Der Bremsweg beim 34KiloDummy<br />
(entspricht e<strong>in</strong>em 12Jährigen), lag im Mittel bei<br />
19 cm, beim 15KiloDummy waren es nur noch<br />
211 cm (s. Tab.). Die gemessene Beschleunigung<br />
am Kopf des 34KiloDummy betrug durchschnittlich<br />
29 g, beim 15KiloDummy 54 g! Für<br />
K<strong>in</strong>der wären die Stürze mit e<strong>in</strong>er Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
von 2239 Prozent tödlich verlaufen (AIS<br />
45) – alle<strong>in</strong> durch das „harte“ Abbremsen.<br />
Der Bremsweg des 48 kg Dummy lag bei 30<br />
cm <strong>und</strong> die erwartete Verletzungsschwere bei<br />
AIS 34. Dies entspricht e<strong>in</strong>er Überlebenswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
von 8797 %, was für e<strong>in</strong> Notfallsystem<br />
als gerade noch tragbar zu bewerten<br />
ist. Der 77kgErwachsenenDummy überlebt<br />
zwar den Sturz mit 9799 % Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit,<br />
kann aber für sich genommen ernsthafte<br />
oder schwere Verletzungen davontragen. Auch<br />
zeigt sich e<strong>in</strong> deutlicher Unterschied im Bremsweg<br />
zwischen Eisenmasse <strong>und</strong> Dummy. Selbst<br />
der 77KiloDummy schöpft im Mittel nur 65<br />
cm Bremsweg aus; der Bremsweg ist jedoch<br />
der entscheidende Faktor für die Verletzungsschwere.<br />
Ke<strong>in</strong> W<strong>und</strong>er, dass auch der schwerste<br />
Dummy mit „ernsthaften“ bis „schweren“ Verletzungen<br />
rechnen muss.<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Zusammen mit Prof. Dr. Veit Senner von der<br />
TU München wird derzeit an e<strong>in</strong>er Computersimulation<br />
gearbeitet. Das Ziel ist, den Unterschied<br />
MenschEisenmasse herauszuarbeiten<br />
<strong>und</strong> unterschiedliche Sturzverläufe am Computer<br />
durchzuspielen. Die Ergebnisse sollen <strong>in</strong><br />
neue Normanforderungen e<strong>in</strong>fließen, die es ermöglichen,<br />
funktionstüchtige Bremsen auch für<br />
leichtgewichtige Personen zu bauen.<br />
umsetzung der ergebnisse<br />
Die beste Regel für den Bergsportler am Klettersteig<br />
ist natürlich: Nicht stürzen! Denn das<br />
Klettersteigset ist nur e<strong>in</strong> Notfallsystem, das Leben<br />
rettet, aber Verletzungen toleriert. Bei leicht<br />
Masse Eisenmasse Dummy<br />
Bremsweg<br />
[mm]<br />
Bremskraft<br />
[kN]<br />
Bremsweg<br />
[mm]<br />
Bremskraft<br />
[kN]<br />
berechnete<br />
Beschleunigung am<br />
Anseilpunkt [g]<br />
ScHWerPunkt<br />
gewichtigen Personen ist die Problematik noch<br />
verschärft. Die DAVSicherheitsforschung ist<br />
dabei, e<strong>in</strong>e Normänderung zu bewirken, sodass<br />
Klettersteigsets auch für leichtgewichtige Personen<br />
geprüft werden. Die Hersteller arbeiten mit<br />
Hochdruck <strong>und</strong> technologischer Kreativität an<br />
Lösungen. Bis es praxistaugliche Klettersteigsets<br />
auch für leichtgewichtige Personen auf dem<br />
Markt gibt, hilft nur e<strong>in</strong>e zusätzliche Sicherung<br />
mittels Bergseil, um e<strong>in</strong>en Sturz auszuschließen.<br />
Dipl.-Ing. (FH) Florian Hellberg<br />
staatl. geprüfter Bergführer<br />
Dipl.-Sportwiss. Chris Semmel<br />
staatl. geprüfter Bergführer<br />
gemessene<br />
Beschleunigung<br />
am Kopf [g]<br />
77 kg 1064 5,2 653 5,6 7,3 19,3 2-3<br />
48 kg 604 5,1 304 5,0 10,7 30,0 3-4<br />
34 kg 401 4,9 185 5,1 15,3 29,2 4-5<br />
15 kg – – 56 3,9 26,2 54,3 5<br />
Tab.: Ergebnisse im Mittel von acht verschiedenen Klettersteigsets.<br />
AIS<br />
39
ScHWerPunkt<br />
Oft umstritten, oft überlebenswichtig<br />
Versicherung!!!<br />
Nicht gerade selten s<strong>in</strong>d die Fälle, <strong>in</strong> denen<br />
diese Überschrift durchaus berechtigt ist, was<br />
häufig dann der Fall ist, <strong>wenn</strong> sich man sich mit<br />
der <strong>in</strong>dividuellen Risikosituation zu wenig beschäftigt<br />
hat. Passender ist dagegen e<strong>in</strong>e weitaus<br />
weniger emotionsbehaftete Überschrift wie<br />
„Risikomanagement“.<br />
Um die folgenden Informationen von e<strong>in</strong>er<br />
emotionalen auf e<strong>in</strong>e rationale Basis zu stellen,<br />
ist es wohl s<strong>in</strong>nvoll zu erklären, dass es<br />
sich bei e<strong>in</strong>em Versicherungsvertrag um e<strong>in</strong>en<br />
F<strong>in</strong>anzdienstleistungsvertrag handelt, der bei<br />
def<strong>in</strong>ierten Ereignissen f<strong>in</strong>anzielle Mittel zur<br />
Verfügung stellt, <strong>in</strong> der Regel, um e<strong>in</strong> Unternehmen<br />
weiterführen zu können. Damit ist e<strong>in</strong> Versicherungsvertrag<br />
e<strong>in</strong> wesentlicher Faktor des<br />
Risiko managements e<strong>in</strong>es Unternehmens.<br />
risiken <strong>und</strong> mögliche kosten für e<strong>in</strong><br />
unternehmen<br />
Die Kernfrage ist eigentlich, ob e<strong>in</strong> Unternehmen<br />
die f<strong>in</strong>anziellen Folgen von Risiken, also<br />
tatsächlich e<strong>in</strong>getretene Schäden, selbst tragen<br />
möchte oder kann, oder ob diese über e<strong>in</strong>en externen<br />
Risikoträger, <strong>in</strong> der Regel e<strong>in</strong>e Versicherungsgesellschaft,<br />
abgedeckt werden sollen.<br />
E<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für das Risikomanagement<br />
ist dar<strong>in</strong> zu sehen, dass der<br />
Betrieb se<strong>in</strong>e Risiken kennt oder bereit ist, diese<br />
Risiken ermitteln zu lassen.<br />
Das geschieht <strong>in</strong> mehreren Schritten:<br />
Analyse der Risiken – betriebs<strong>in</strong>dividuelles<br />
Vorgehen<br />
Bewertung der Risiken – Ermittlung möglicher<br />
Kosten<br />
Beratung zur Risikom<strong>in</strong>derung – reale Kosten<br />
Maßnahmen zur Risikoabwehr – reale Kosten<br />
Entscheidung über den Risikoselbstbehalt<br />
oder die Risikoabgabe – Optimierung<br />
Klärung der Höhe <strong>und</strong> des Umfangs der Restrisiken<br />
– Ermittlung möglicher Kosten<br />
Schon an dieser Stelle kann man erkennen,<br />
dass der f<strong>in</strong>anzielle Bereich des Risikomanagements<br />
nur e<strong>in</strong>en Teil des GesamtRisikomanagements<br />
darstellt.<br />
E<strong>in</strong> Risiko stellt aber lediglich die Möglichkeit<br />
dar, dass e<strong>in</strong> Schaden e<strong>in</strong>tritt <strong>und</strong> darf<br />
nicht mit dem E<strong>in</strong>tritt e<strong>in</strong>es Schadens selbst<br />
verwechselt werden. Von besonderer Bedeutung<br />
ist aber, dass man eben diese Risiken ermittelt<br />
40<br />
oder von Dritten ermitteln lässt. E<strong>in</strong>e Möglichkeit<br />
hierfür bietet sich durch Versicherungen an,<br />
denn die Versicherungsgesellschaften verfügen<br />
e<strong>in</strong>erseits über e<strong>in</strong>e hohe Zahl an Experten,<br />
die <strong>in</strong> vielen technischen <strong>und</strong> kaufmännischen<br />
Bereichen über entsprechende Erfahrung <strong>und</strong><br />
bezüglich der Risikoanalyse über e<strong>in</strong>e hohe<br />
Kompetenz verfügen. Andererseits besitzen die<br />
Gesellschaften e<strong>in</strong>e enorm große Datenbank<br />
von Statistiken, wodurch sie die E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
von potentiellen Risiken <strong>in</strong> vielen<br />
Fällen sehr genau berechnen können.<br />
Auf dem Gebiet der Risikoabwehr gibt es neben<br />
den Versicherungen noch mehrere öffentlichrechtliche<br />
E<strong>in</strong>richtungen, die Beratungen<br />
vornehmen (Polizei, Feuerwehr, IHK u.v.a).<br />
Nachdem <strong>in</strong> den genannten Bereichen die<br />
Kosten zusammengestellt worden s<strong>in</strong>d, ist<br />
endlich <strong>und</strong> letztlich der Unternehmer die<br />
letzte Entscheidungs<strong>in</strong>stanz bei der Frage, ob<br />
die Risikof<strong>in</strong>anzierung durch Eigenmittel oder<br />
Fremdmittel erfolgen soll. In der Regel wird er<br />
sich es sich für e<strong>in</strong>e Versicherung entscheiden,<br />
<strong>in</strong>sbesondere, <strong>wenn</strong> die Eigenkapitalausstattung<br />
nicht besonders groß ist.<br />
die Scheu vor der f<strong>in</strong>anziellen<br />
risiko bewertung<br />
„… es passiert schon nichts, wir passen schon<br />
auf“, diese E<strong>in</strong>stellung ist <strong>in</strong> zweierlei H<strong>in</strong>sicht<br />
falsch oder deutet auf e<strong>in</strong> ungenügendes Risikomanagement<br />
h<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>erseits wird der schon beschriebene<br />
Fehler gemacht, e<strong>in</strong> Risiko mit e<strong>in</strong>em<br />
Schadenfall zu verwechseln, weil e<strong>in</strong> Risiko nur<br />
den möglichen Schadenfall be<strong>in</strong>haltet. Andererseits<br />
geht man davon aus, dass man auf alle<br />
Markt <strong>und</strong> Umweltereignisse E<strong>in</strong>fluss hat, was<br />
für Naturkatastrophen, Krim<strong>in</strong>alität, Fremdverschulden<br />
<strong>und</strong> auch für die derzeitigen Marktrisiken<br />
sicherlich nicht zutreffen kann<br />
Aber noch häufiger stellen Unternehmer die<br />
Frage: „Wie lässt sich das Risiko e<strong>in</strong>es Schadene<strong>in</strong>tritts<br />
<strong>in</strong> Kosten umrechnen?“ Andererseits<br />
berechnet jeder Unternehmer den erwarteten<br />
Umsatz <strong>und</strong> die erwarteten Kosten se<strong>in</strong>er Produktion,<br />
obwohl diese Daten auch nur Wahrsche<strong>in</strong>lichkeiten<br />
darstellen; man ist es eben gewohnt,<br />
Bus<strong>in</strong>esspläne zu berechnen, nicht aber<br />
Risikoberechnungen vorzunehmen.<br />
Dabei unterschieden sich die Berechnungen<br />
von Bus<strong>in</strong>essplänen <strong>und</strong> Risikoplänen nicht<br />
wesentlich vone<strong>in</strong>ander. Bei den Risikoplänen<br />
wird <strong>in</strong> der Regel mit den Vermögenswerten<br />
begonnen, die zur Produktion notwendig s<strong>in</strong>d.<br />
Danach werden mit statistischen Mitteln die E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeiten<br />
von Risiken bestimmt<br />
<strong>und</strong> so kommt man recht schnell zu konkreten<br />
Werten bzw. Kosten.<br />
Warum also die Scheu vor der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Bewertung der Risiken? Möglicherweise weil<br />
man auch hier nicht berücksichtigt, dass Risiko<br />
nicht gleich Realität ist. Sieht man für die millionen<br />
schwere neue Fabrikationshalle das Risiko,<br />
dass diese durch e<strong>in</strong>en Brand zerstört wird, steht<br />
gleich der Wiederbeschaffungswert dieser Halle<br />
im Vordergr<strong>und</strong>. Werden <strong>in</strong> gleicher Weise alle<br />
potentiellen Risiken des Unternehmens aufsummiert,<br />
kommen Werte zusammen, die alle<br />
Befürchtungen übertreffen <strong>und</strong> jegliche Kostenvorstellungen<br />
sprengen.<br />
Aber es wurde bereits darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
dass bei e<strong>in</strong>em vernünftigen Risikomanagement<br />
auch die E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeiten mit berücksichtigt<br />
werden müssen. So lässt sich an dieser<br />
Stelle bereits festhalten, dass e<strong>in</strong>e Beratung<br />
bei dieser Berechnung sicherlich angebracht ist.<br />
d<strong>in</strong>ge, die das unternehmen selbst<br />
nicht berechnen kann<br />
Vorher wurden bereits e<strong>in</strong>ige Risiken genannt,<br />
auf die das Unternehmen selbst ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss<br />
hat. H<strong>in</strong>zu kommen aber noch die Gefahren, bei<br />
denen das Risiko von der Änderung des allgeme<strong>in</strong>en<br />
Zustands ausgeht. Insbesondere sei hier<br />
auf den Klimawandel h<strong>in</strong>gewiesen.<br />
Dieser ist zwar <strong>in</strong> aller M<strong>und</strong>e <strong>und</strong> jeder kann<br />
bei dem Thema mitreden, aber es ist äußerst<br />
schwer, dieses Risiko zu bewerten, also <strong>in</strong> konkrete<br />
Zahlen zu fassen. Hier muss wieder auf den<br />
großen DatenPool der Versicherer h<strong>in</strong>gewiesen<br />
werden. Und darüber h<strong>in</strong>aus auch darauf, dass<br />
Versicherungsgesellschaften bereits <strong>in</strong> den 70er<br />
Jahren mit <strong>in</strong>tensiven Untersuchungen über Klimaveränderung<br />
begonnen haben <strong>und</strong> somit bereits<br />
e<strong>in</strong>e 40jährige Erfahrung vorweisen können.<br />
Aus der Sicht e<strong>in</strong>es Versicherers ist zu empfehlen,<br />
auf die vorhandene Erfahrung zurückzugreifen.<br />
Vielleicht wird dadurch ja auch der Versicherer<br />
e<strong>in</strong> Partner des Unternehmens im Bereich des<br />
Risikomanagements <strong>und</strong> es gäbe dann z.B. nicht<br />
Sektoren unserer Volkswirtschaft, <strong>in</strong> denen weniger<br />
als 10 % der Unternehmen e<strong>in</strong>e Betriebsunterbrechungsversicherung<br />
haben.<br />
Dr. Joachim Crönle<strong>in</strong><br />
Vorsitzender des Vorstands Münchener <strong>und</strong><br />
Magdeburger Agrarversicherung AG<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Quelle: kernenergie.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
ScHWerPunkt<br />
Die Diskussion über die Kernenergie – wo liegen<br />
die Probleme?<br />
Das Für <strong>und</strong> Wieder <strong>in</strong> der Ause<strong>in</strong>andersetzung um die Kernkraft liefert e<strong>in</strong> irritierendes Beispiel<br />
für e<strong>in</strong>e Risikodiskussion, die auch nach Jahrzehnten nicht zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>haltlichen Konsens<br />
geführt hat.<br />
Das unterfränkische Atomkraftwerk<br />
Grafenrhe<strong>in</strong>feld.<br />
Warum fällt e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>igung so schwer? E<strong>in</strong><br />
Hauptgr<strong>und</strong> ist sicher die oft fehlende Trennung<br />
der zwei Argumentationsebenen Risiko<br />
<strong>und</strong> Interessen. Methodisch gesehen berühren<br />
oder überschreiten wir sogar die Grenze des<br />
Verständnisses komplexer Systeme <strong>und</strong> des<br />
zwischenmenschlichen RisikoDialogs darüber.<br />
Vielleicht nahm die Debatte auch daher oft Züge<br />
e<strong>in</strong>es quasireligiösen Glaubenskriegs an.<br />
„kernkraft ist sauber <strong>und</strong> sicher“<br />
Bei der Nutzung der Kernkraft treten <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Stadien Probleme <strong>und</strong> Risiken auf:<br />
Umweltschäden beim Uranabbau, Betriebsrisiko<br />
der Kraftwerke (möglicher GAU), Bau<br />
von Kernwaffen <strong>und</strong> ihre Weiterverbreitung,<br />
Terrorrisiko (Angriff auf Kernkraftwerke oder<br />
schmutzige Bombe), Zwischen <strong>und</strong> Endlagerung,<br />
Entstehung e<strong>in</strong>es atom<strong>in</strong>dustriellpolitischadm<strong>in</strong>istrativen<br />
Komplexes, der (siehe<br />
z.B. Japan) zu Korruption <strong>und</strong> Manipulation<br />
neigt <strong>und</strong> die Vorspiegelung fast unerschöpflicher<br />
Energie.<br />
Davon s<strong>in</strong>d nur die Umweltschäden e<strong>in</strong>igermaßen<br />
quantifizierbar. Ansonsten s<strong>in</strong>d die<br />
Gefahren entweder unabsehbar (Endlagerung,<br />
Atombombene<strong>in</strong>satz) oder treten kalkulatorisch<br />
nur sehr selten e<strong>in</strong> (GAU), was die Kernkraftanhänger<br />
als Restrisiko abtun; sie stufen<br />
unsere deutschen Kernkraftwerke als sicher<br />
oder sogar als absolut sicher e<strong>in</strong>.<br />
risko <strong>und</strong> Verantwortung<br />
Nun ist Risko aber def<strong>in</strong>iert als Entrittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
x Schadenshöhe, der Begriff<br />
Restrisiko ist <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>n nicht korrekt,<br />
sondern vernebelnd. Absolute Sicherheit gibt<br />
es nicht. Wenn es wegen der ger<strong>in</strong>gen E<strong>in</strong>trittswahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
ke<strong>in</strong>e verlässliche Statistik<br />
gibt <strong>und</strong> die Schadenshöhe nicht mehr bezifferbare<br />
Ausmaße annehmen kann, ist das Risiko<br />
nicht mehr berechenbar (<strong>und</strong> daher auch<br />
nicht versicherbar). Mit Risiken, deren E<strong>in</strong>tritt<br />
existentielle Folgen haben kann, kann man nur<br />
auf zwei Arten verantwortungsvoll umgehen:<br />
entweder alles überhaupt nur Mögliche zu ihrer<br />
E<strong>in</strong>dämmung tun (was dann zu teuer oder zu<br />
kompliziert wird) oder aber sie ganz vermeiden<br />
(s. Interview mit dem TÜV <strong>in</strong> diesem Heft)<br />
Augen zu <strong>und</strong> durch<br />
Verschließt man die Augen vor den Risiken,<br />
kann man offensiv Argumente für<br />
verschieden ste Interessen <strong>in</strong>s Feld führen:<br />
Energie sicherheit, Politische Machtausübung,<br />
Erhalt des Wohlstands, Schonung fossiler Rohstoffe,<br />
Arbeitsplätze, Rendite, Unabhängigkeit<br />
von Öllieferungen durch unsichere Staaten,<br />
CO 2 Reduktion, Partei<strong>in</strong>teressen, Vertrauen <strong>in</strong><br />
<strong>Technik</strong> etc.<br />
Diese Motive s<strong>in</strong>d durchaus wichtig <strong>und</strong> legitim.<br />
Welche jeweils dom<strong>in</strong>ieren, bestimmt <strong>in</strong><br />
üblicher politischer Logik die Verteilung der<br />
Macht zu e<strong>in</strong>em bestimmten Zeitpunkt. Wer<br />
aber se<strong>in</strong>e Entscheidung ausschließlich aus<br />
diesen Interessen heraus begründet, die Argumente<br />
der Risikoebene aber ignoriert, muß sich<br />
sehr kritische Fragen nach se<strong>in</strong>em Rationalitätsbegriff<br />
gefallen lassen. Denn die möglichen<br />
Schäden können um viele Größenordnungen<br />
höher se<strong>in</strong> als der Nutzen aus der Realisierung<br />
von Interessen.<br />
Politik <strong>und</strong> Psychologie<br />
Ortw<strong>in</strong> Renn fordert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Beitrag <strong>in</strong><br />
diesem Heft, die Entscheidung durch Abwägen<br />
zwischen dem zu erwartendem Nutzen <strong>und</strong><br />
dem zu befürchtenden gesellschaftlichem<br />
Schaden zu treffen. Bei Une<strong>in</strong>igkeit böten sich<br />
diskursive <strong>und</strong> partizipative Verfahren an.<br />
Das übliche politische Lagerdenken unterdrückt<br />
aber oft mit Absicht rationale Argumente.<br />
Die Kontrahenten werfen sich wechselseitig<br />
Ideologie oder gar Hysterie vor (wobei nie<br />
geklärt wurde, was das eigentlich me<strong>in</strong>t) oder<br />
wahlweise Lobbyhörigkeit. Letztlich bleiben die<br />
eigentlichen Motive häufig im Dunkeln. Man<br />
weiß nicht recht, woher die „German Angst“<br />
kommt (andere sagen „German Vernunft“).<br />
Und was ist an e<strong>in</strong>er Technologie „l<strong>in</strong>ks“ oder<br />
„rechts“? Der Diskurs führt unter diesen Umständen<br />
nicht zum Ende der Debatte. Wer soll<br />
überdies am Diskurs partizipieren (die „Wutbürger“?)<br />
<strong>und</strong> mit welcher Legitimation?<br />
krise der demokratie als gAu?<br />
Die Demokratie erleidet gerade e<strong>in</strong>e Akzeptanzkrise,<br />
weil viele der repräsentativen Demokratie<br />
nicht mehr zutrauen, Probleme im S<strong>in</strong>ne<br />
der Bürger zu lösen. Das H<strong>in</strong>e<strong>in</strong> / H<strong>in</strong>aus bei der<br />
Atompolitik <strong>in</strong>nerhalb kurzer Zeit hat viele verunsichert,<br />
die den Vorgang nicht als konsistente<br />
Risikoabwägung sondern als Panikreaktion wegen<br />
e<strong>in</strong>er bevorstehenden Wahl <strong>in</strong>terpretierten.<br />
kernenergie nicht verantwortbar<br />
Die Kernenergie ist e<strong>in</strong> besonders prägnantes<br />
Beispiel großer <strong>und</strong> globaler Risiken. Es ist aber<br />
gr<strong>und</strong>sätzlich nicht möglich, völlig rationale<br />
Risikobewertungen zu erstellen, vor allem kennen<br />
wir die Zukunft nicht.<br />
Daher führen Traditionen, politische Interessen,<br />
kulturelle <strong>und</strong> persönliche Prägung<br />
sowie Optimismus oder Pessimismus bei<br />
verschiedenen gesellschaft lichen Gruppen<br />
<strong>und</strong> <strong>in</strong> verschiedenen Ländern oft zu gegensätzlichen<br />
Auffassungen. Die Vielzahl <strong>und</strong> die<br />
Größe der mit der Kernenergie verb<strong>und</strong>enen<br />
Risiken lassen aber ihre Ablehnung als zw<strong>in</strong>gend<br />
ersche<strong>in</strong>en, noch dazu, wo sie ja nicht<br />
alternativlos ist.<br />
Gerhard Grosch<br />
Redaktion TiB<br />
41
ScHWerPunkt<br />
Neue energien, neue risiken, neue Chancen<br />
Deutschland steigt aus der Atomkraft aus <strong>und</strong> kommt so dem Wunsch e<strong>in</strong>er breiten Mehr heit<br />
der Bevölkerung nach. Ganz abgesehen von den offenen Fragen stellt sich damit e<strong>in</strong>e riesige<br />
Herausforderung. Denn mit dem Umbau der Energiewirtschaft darf der Kampf gegen die<br />
Erderwärmung nicht vergessen werden, e<strong>in</strong>em der größten Probleme der Menschheit überhaupt.<br />
E<strong>in</strong> schneller Verzicht auf die Kernkraft darf nicht zu Lasten des Klimaschutzes gehen.<br />
Wir brauchen mehr<br />
erneuerbare energie<br />
Der massive Ausbau der erneuerbaren Energieträger<br />
bleibt die e<strong>in</strong>zige Lösung, doch um<br />
was für e<strong>in</strong>e Herkulesaufgabe es sich handelt,<br />
wird deutlich, <strong>wenn</strong> man sie durchrechnet: Für<br />
den Atomausstieg bis 2022 müssten unter Beibehaltung<br />
der geltenden Klimaziele, <strong>wenn</strong> wir<br />
e<strong>in</strong>e unveränderte Stromnachfrage annehmen,<br />
ab sofort drei W<strong>in</strong>dräder <strong>in</strong> der Nord oder Ostsee<br />
errichtet werden oder 15 Turb<strong>in</strong>en im Inland<br />
– pro Tag, zehn Jahre lang. Oder <strong>in</strong>sgesamt fast<br />
3.000 Quadratkilometer Photovoltaik module.<br />
Das ist teuer – <strong>und</strong> doch auch e<strong>in</strong>e große Chance<br />
für die Marktposition Deutschlands bei diesen<br />
Zukunftstechnologien.<br />
neuartige risiken für <strong>in</strong>vestoren<br />
Es wird aber auch klar, dass wir es mit ganz<br />
neuen Risiken zu tun bekommen, <strong>und</strong> ich spreche<br />
nicht davon, dass vielleicht die e<strong>in</strong>e Stromtrasse<br />
oder das andere Pumpspeicherkraftwerk<br />
am Widerstand der betroffenen Bürger scheitern<br />
könnten. Es geht darum: Wie lange halten<br />
Photovoltaikmodule im Langzeitbetrieb? Wie<br />
lange produzieren sie Strom <strong>in</strong> erwarteter Menge?<br />
Wie oft muss man bei Geothermieprojekten<br />
den Bohrturm ansetzen, um fündig zu werden?<br />
Wie häufig gehen W<strong>in</strong>dkraftanlagen kaputt? Wie<br />
schadensanfällig s<strong>in</strong>d die neuen Anlagen vor den<br />
42<br />
Küsten, ständig dem Salzwasser, den Wellen <strong>und</strong><br />
immer wieder schweren Orkanen ausgesetzt?<br />
Diese Fragen zeigen, dass Investoren <strong>in</strong> die neuen<br />
Technologien – bei attraktiven Chancen natürlich<br />
– e<strong>in</strong> nicht unerhebliches Risiko e<strong>in</strong>gehen, was<br />
Projekte be oder bisweilen gar verh<strong>in</strong>dert. H<strong>in</strong>zu<br />
kommt, dass Hersteller von Solarmodulen oder<br />
W<strong>in</strong>drädern heute üblicherweise Leistungsgarantien<br />
auf ihre Produkte geben. Diese Garantien<br />
belasten ihre Bilanzen <strong>und</strong> b<strong>in</strong>den Kapital, das den<br />
Unternehmen <strong>in</strong> dem boomenden Markt für weitere<br />
Expansion fehlt. All das kann dem Erreichen<br />
der Ziele für den Umbau der Energieerzeugung im<br />
Wege stehen – <strong>und</strong> es vor allem auch verteuern.<br />
Versicherungen können risiken<br />
abfedern<br />
Hier ist die Versicherungswirtschaft <strong>in</strong> der<br />
Lage zu helfen, <strong>in</strong>dem sie den Investoren spezielle<br />
Risiken abnimmt, damit zu e<strong>in</strong>er höheren Investitionssicherheit<br />
beiträgt <strong>und</strong> den neuen Technologien<br />
so den Markte<strong>in</strong>tritt erleichtert. Munich<br />
Re ist hier Vorreiter. Wir haben <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
erheblich Knowhow aufgebaut <strong>und</strong> e<strong>in</strong>e Reihe<br />
<strong>in</strong>novativer Versicherungslösungen entwickelt.<br />
So decken wir bereits die Leistungsgarantien von<br />
e<strong>in</strong>er ganzen Reihe von PhotovoltaikHerstellern<br />
<strong>und</strong> haben im Februar die erste entsprechende<br />
Deckung auch für W<strong>in</strong>dräder auf den Markt gebracht.<br />
Mittelfristig sehen wir im Bereich erneuerbarer<br />
Energien e<strong>in</strong> Geschäfts potenzial <strong>in</strong> Höhe<br />
e<strong>in</strong>es mittleren dreistelligen Millionenbetrags.<br />
Bereits für 2011 planen wir e<strong>in</strong>e Verdopplung des<br />
Prämienvolumens.<br />
Man muss weitere Risiken <strong>in</strong>s Auge fassen: <strong>Was</strong><br />
ist, <strong>wenn</strong> die Sonne nicht so stark sche<strong>in</strong>t oder<br />
der W<strong>in</strong>d nicht so stark weht wie im Geschäftsplan<br />
angenommen? Können sich Fernwärmeversorger<br />
oder Liftanlagenbetreiber gegen aus ihrer<br />
Sicht zu warme W<strong>in</strong>ter absichern? Oder Hoteliers<br />
gegen verregnete Sommer? <strong>Was</strong> bedeutet e<strong>in</strong> heftiger<br />
W<strong>in</strong>tersturm über der Nordsee für die dort<br />
<strong>in</strong>stallierten W<strong>in</strong>dparks? Wie verfügbar s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em solchen Fall die Schiffe <strong>und</strong> Kräne, die die<br />
W<strong>in</strong>dmühlen reparieren?<br />
Im Kern geht es ja bei Versicherern darum,<br />
Schadenwahrsche<strong>in</strong>lichkeiten zu berechnen.<br />
Normalerweise werden Versicherungen auf der<br />
Basis von Schäden <strong>in</strong> der Vergangenheit kalkuliert.<br />
Sofern sich das Risiko nicht ändert, lässt<br />
sich aus der Schadenerfahrung e<strong>in</strong>e Schadenwahrsche<strong>in</strong>lichkeit<br />
für die Zukunft ableiten.<br />
Das ist bei sich ändernden Risiken oder auch<br />
neuen Entwicklungen natürlich schwer möglich.<br />
Hier s<strong>in</strong>d dann beispielsweise Kalkulationen<br />
auf der Gr<strong>und</strong>lage des Wissens über die<br />
Technologie, Schadenerfahrungen bei anderen,<br />
aber vergleichbaren <strong>Technik</strong>en (Beispiel: Korrosion<br />
<strong>und</strong> Sturmexponierung bei Ölbohrplattformen<br />
<strong>und</strong> bei OffshoreW<strong>in</strong>dAnlagen) <strong>und</strong><br />
Materialk<strong>und</strong>e nötig.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der großen Erfahrung mit Naturkata<br />
strophen kann Munich Re solche neuen Risiken<br />
e<strong>in</strong>schätzen, Kumule, also Risikobündelungen,<br />
erkennen <strong>und</strong> neue <strong>in</strong>novative Lösungskonzepte<br />
zum Risikotransfer entwickeln. Gleichzeitig<br />
ist die Kompetenz auf diesem Gebiet Gr<strong>und</strong>lage<br />
dafür, dass wir uns auch auf der Kapitalanlageseite<br />
engagieren <strong>und</strong> <strong>in</strong> den kommenden Jahren<br />
bis zu 2,5 Milliarden Euro direkt <strong>in</strong> erneuerbare<br />
Energien <strong>in</strong>vestieren. So haben wir zum Jahreswechsel<br />
W<strong>in</strong>denergie anlagen mit e<strong>in</strong>er Gesamtleistung<br />
von 73 Megawatt übernommen. Direkte<br />
Investitionen können wir uns auch im Rahmen<br />
des Wüstenstromprojekts Desertec vorstellen,<br />
dessen Realisierung Munich Re vor genau zwei<br />
Jahren mit Partnern angeschoben hat.<br />
die Versicherungswirtschaft als<br />
wichtiger Wegbereiter<br />
In der gegenwärtigen Diskussion um die neue<br />
Energiepolitik wird immer deutlicher: Die gewaltige<br />
Herausforderung, vor der wir stehen, können<br />
wir nur meistern, <strong>wenn</strong> den neuen Technologien<br />
möglichst viele Hürden beiseite geräumt werden.<br />
Der Versicherungswirtschaft kommt hier e<strong>in</strong>e<br />
wichtige Rolle zu: als Risikoträger, als Innovator<br />
<strong>und</strong> als Investor.<br />
Dr. Thomas Blunck<br />
Mitglied des Vorstands von Munich Re<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
Grafiken: Hochschule München<br />
Der rechner als rettungshelfer<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
HocHScHuLe MüncHen<br />
Professor<strong>in</strong> Gerta Köster simuliert <strong>und</strong> modelliert das Verhalten von Menschen <strong>in</strong> der Menge.<br />
Ihre Arbeit im Fachbereich Scientific Comput<strong>in</strong>g ist Teil e<strong>in</strong>es Projektes zur besseren Planung<br />
regionaler Evakuierungs-Maßnahmen.<br />
Ob Fußballspiel, Musikfestival oder auch e<strong>in</strong>fach<br />
nur der Bummel durch die Fußgängerzone<br />
– was den e<strong>in</strong>en Spaß br<strong>in</strong>gt, stellt andere vor<br />
Herausforderungen. Rettungskräfte zum Beispiel<br />
müssen wissen, wie sie öffentliche Räume<br />
bei Gefahr schnell <strong>und</strong> sicher evakuieren können.<br />
An dieser Frage arbeitet Dr. Gerta Köster<br />
mit, Professor<strong>in</strong> an der Fakultät für Informatik<br />
<strong>und</strong> Mathematik. Ihr Untersuchungsobjekt<br />
ist die Region um das FritzWalterStadion <strong>in</strong><br />
Kaiserslautern. Das Fußballstadion auf dem<br />
Betzenberg fasst ca. 50.000 Menschen <strong>und</strong> liegt<br />
mitten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dicht bebauten Wohngebiet.<br />
Abb. oben: Skizzierte Darstellung von Personenbewegungen<br />
im Modell e<strong>in</strong>es Zellulär-<br />
Automaten.<br />
Abb. rechts: Simulation e<strong>in</strong>es Staus im Modell<br />
regionale evakuierung – Planung,<br />
kontrolle <strong>und</strong> Anpassung<br />
Gerta Kösters Arbeit ist e<strong>in</strong> Bauste<strong>in</strong> des<br />
Projektes REPKA, ausgeschrieben „Regionale<br />
Evakuierung – Planung, Kontrolle <strong>und</strong> Anpassung“.<br />
Gefördert wird REPKA vom B<strong>und</strong>esm<strong>in</strong>isterium<br />
für Bildung <strong>und</strong> Forschung (BMBF).<br />
Das Projekt ist e<strong>in</strong>es von <strong>in</strong>sgesamt 17 verschiedenen<br />
Forschungsvorhaben unter dem Motto<br />
„Forschung für die zivile Sicherheit – Schutz<br />
<strong>und</strong> Rettung von Menschen“. REPKA konzentriert<br />
sich auf die Frage was passiert, <strong>wenn</strong> e<strong>in</strong>e<br />
große Menschenmenge e<strong>in</strong> Gebäude verlassen<br />
hat <strong>und</strong> dann weiter <strong>in</strong> Sicherheit gebracht werden<br />
soll.<br />
E<strong>in</strong>e der Gr<strong>und</strong>fragen <strong>in</strong> solchen Szenarien<br />
ist das Verhalten von Menschen <strong>in</strong> Gruppen.<br />
Gerta Köster entwickelt mathematische Modelle<br />
zur Simulation von Gruppenbewegungen.<br />
Basis ihrer Arbeit ist der so genannte zelluläre<br />
Zustandsautomat. Dabei teilt e<strong>in</strong> Gitter den<br />
Raum <strong>in</strong> Zellen e<strong>in</strong>, die entweder leer oder besetzt<br />
s<strong>in</strong>d – besetzt s<strong>in</strong>d sie durch Menschen,<br />
H<strong>in</strong>dernisse oder Ziele. Der Status jeder Zelle<br />
wird durch Regeln ständig <strong>und</strong> automatisch<br />
aktualisiert.<br />
Simulation zwischen Mathematik,<br />
<strong>in</strong>formatik <strong>und</strong> Soziologie<br />
Industriepartner <strong>und</strong> e<strong>in</strong>er der Auftraggeber<br />
des Projektes an der Hochschule München ist<br />
Siemens, wo Gerta Köster vor ihrem Wechsel<br />
an die Hochschule gearbeitet hat. Bei dem<br />
TechnologieKonzern hat sie mit zehn KollegInnen<br />
e<strong>in</strong>en Simulator entwickelt. Dieser<br />
simuliert <strong>und</strong> visualisiert das Gehverhalten<br />
von mehreren zehntausend Personen, die<br />
sich gleichzeitig bewegen.<br />
Damit forscht die Wissenschaftler<strong>in</strong> auf<br />
dem Fachgebiet Scientific Comput<strong>in</strong>g an e<strong>in</strong>er<br />
Schnittstelle zwischen Mathematik <strong>und</strong><br />
Informatik. Ihre <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Arbeit bezieht<br />
aber auch e<strong>in</strong>en ganz anderen Bereich<br />
mit e<strong>in</strong>, die Soziologie nämlich. Von der<br />
Soziolog<strong>in</strong> Annette Spellerberg weiß Gerta<br />
Köster, dass Menschenansammlungen <strong>in</strong><br />
Gruppierungen von Bezugspersonen funktionieren.<br />
Die Professor<strong>in</strong> an der TU Kaiserslautern<br />
– die Universität arbeitet ebenfalls an<br />
dem REPKAProjekt mit – hat sich auf Stadtsoziologie<br />
spezialisiert. Annette Spellerberg sagt<br />
über das Verhalten <strong>in</strong> Notsituationen: „Familien<br />
gehen geme<strong>in</strong>sam unter – oder sie überleben<br />
zusammen.“ Es ergibt also ke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, Massen<br />
nur als Ansammlung von E<strong>in</strong>zelnen zu betrachten.<br />
Betrachtung von Personengruppen<br />
„Dass wir Menschen <strong>in</strong> Gruppen simulieren, ist<br />
das Neue an diesem Projekt“, erklärt Köster. „Nach<br />
dem bisherigen Stand der <strong>Technik</strong> wurden immer<br />
nur E<strong>in</strong>zelpersonen betrachtet.“ Sie setzt ihre<br />
Gruppenmodelle nun auf den SiemensSimulator<br />
auf. Dabei werden Eigenschaften der Personen wie<br />
Alter <strong>und</strong> Geschlecht über die daraus resultierende<br />
Gehgeschw<strong>in</strong>digkeit <strong>in</strong>dividuell simuliert. Das<br />
neue Modell soll darstellen, wie Menschen – weil<br />
sie sich ja mite<strong>in</strong>ander unterhalten – nebene<strong>in</strong>ander<br />
gehen <strong>und</strong> wie die Kle<strong>in</strong>gruppen versuchen,<br />
zusammenzubleiben. Menschenmengen teilen<br />
sich üblicherweise <strong>in</strong> Pärchen <strong>und</strong> Dreier oder<br />
ViererGruppierungen auf, das ist bei Fußballfans<br />
nicht anders als bei Konzertbesuchern oder auch<br />
bei Passanten <strong>in</strong> der Innenstadt.<br />
Gr<strong>und</strong>sätzlich gilt: Je größer e<strong>in</strong>e Menschenansammlung,<br />
desto langsamer wird die Menge<br />
E<strong>in</strong> Effekt, der durch die Gruppen verstärkt<br />
wird. Gefährlich wird es, <strong>wenn</strong> sich die Masse<br />
vor H<strong>in</strong>dernissen oder Engpässen verdichtet.<br />
Im schlimmsten Fall könnten E<strong>in</strong>zelne von der<br />
Menge zu Tode getrampelt oder so gequetscht<br />
werden, dass sie ersticken. Durch Simulationen<br />
am Rechner sollen StauGefahren <strong>und</strong> bedrohliche<br />
Verdichtungen identifiziert werden.<br />
Gerta Kösters Forschungsergebnisse über das<br />
Gruppenverhalten werden <strong>in</strong> die Arbeit von Siemens<br />
e<strong>in</strong>fließen. Der dort entwickelte Simulator<br />
soll dann die konkrete Arbeit von Rettungskräften<br />
bei Entscheidungen unterstützen. Polizisten<br />
<strong>und</strong> Feuerwehrleute der Stadt Kaiserslautern,<br />
die sich ebenfalls an dem REPKAProjekt beteiligen,<br />
unterziehen den Simulator auch e<strong>in</strong>em<br />
Praxistest. Das heißt sie nehmen Bedienerfre<strong>und</strong>lichkeit<br />
<strong>und</strong> Alltagstauglichkeit aus der<br />
Sicht des Anwenders kritisch unter die Lupe.<br />
Zu Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gszwecken be<strong>in</strong>haltet REPKA<br />
Planspiele als virtuelle Evakuierungsübungen.<br />
HelferInnen sollen am Rechner Szenarien<br />
durchspielen <strong>und</strong> sich auf alle Gefahrensituationen<br />
– seien es Anschläge, Unfälle oder Naturkatastrophen<br />
– besser vorbereiten können.<br />
Damit der Spaß für die Menschen sicher bleibt.<br />
Christiane Pütter<br />
Hochschule München<br />
43
Foto: Frank Schubert, München, fschubix@t-onl<strong>in</strong>e.de<br />
AktueLLeS<br />
technologie-Campus an der Hochschule amberg-Weiden e.V. geht an den Start<br />
technologie-transfer: Die Brücke für die<br />
Verzahnung von Wirtschaft <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
Der TechnologieCampus der Hochschule<br />
AmbergWeiden e.V. sieht sich mit Standorten<br />
<strong>in</strong> Amberg <strong>und</strong> Weiden als synergetische Ergänzung<br />
zur Hochschule.<br />
Der Fachkräftemangel, der demografische<br />
Wandel, die Profilierung der Region, die Energiewende,<br />
das s<strong>in</strong>d die Herausforderungen, die<br />
Geschäftsführer<strong>in</strong> Dr. Kar<strong>in</strong> Preißner für den<br />
TechnologieCampus an der Hochschule AmbergWeiden<br />
sieht.<br />
Der Wissens <strong>und</strong> Technologietransfer von<br />
der Hochschule <strong>in</strong> die Praxis wird mit Unterstützung<br />
der Landkreise <strong>und</strong> kreisfreien Städte<br />
der nördlichen <strong>und</strong> mittleren Oberpfalz, Partnern<br />
der Hochschule <strong>und</strong> Förderung durch den<br />
Freistaat <strong>Bayern</strong> den regionalen Innovationsmotor<br />
der Hochschule AmbergWeiden deutlich<br />
stärken.<br />
Gebäude des Technologie-Campus am Standort Amberg.<br />
Der Auftrag des Technologietransfers erwächst<br />
u.a. auch aus den Zielvere<strong>in</strong>barungen<br />
der Hochschule AmbergWeiden mit dem Bayerischen<br />
Staatsm<strong>in</strong>isterium für Wissenschaft,<br />
Forschung <strong>und</strong> Kunst, als Hochschule <strong>in</strong> der Region<br />
den KnowhowTransfer <strong>in</strong> die regionalen<br />
Unternehmen zu gewährleisten.<br />
Für den Technologiecampus Standort Amberg<br />
sanierte die Gewerbebau Amberg GmbH<br />
44<br />
e<strong>in</strong> bestehendes Gebäude mit 13 flexiblen<br />
Büroe<strong>in</strong>heiten. E<strong>in</strong>ige Firmen, darunter auch<br />
Gründer, haben sich mit dem Start im April<br />
2011 bereits e<strong>in</strong>gemietet. Am Standort Weiden<br />
wird noch gebaut. Dort wird der Technologie<br />
Campus Ende 2012 se<strong>in</strong>en Betrieb aufnehmen.<br />
Dr. Kar<strong>in</strong> Preißner, promovierte Chemiker<strong>in</strong><br />
<strong>und</strong> zuletzt Geschäftsführer<strong>in</strong> von Hochschule<br />
<strong>Bayern</strong> e.V. <strong>in</strong> München, übernahm zum 1. Oktober<br />
2011 die Geschäftsleitung des Technologie<br />
Campus AmbergWeiden <strong>und</strong> hat es sich zum<br />
Ziel gesetzt, den TechnologieCampus zu e<strong>in</strong>er<br />
Marke zu etablieren.<br />
Worauf sie besonderen Wert legt? „Mite<strong>in</strong>ander<br />
reden <strong>und</strong> vone<strong>in</strong>ander wissen!“ Preißner<br />
hält die Kommunikation zwischen den Mitgliedern<br />
des Trägervere<strong>in</strong>s, Professoren sowie Vertretern<br />
der Wirtschaft <strong>und</strong> Kommunen für die<br />
wesentliche Gr<strong>und</strong>lage, um den Technologie<br />
Campus AmbergWeiden zu e<strong>in</strong>em vitalen Ort<br />
des Austausches zu entwickeln.<br />
Neben konsequentem, kont<strong>in</strong>uierlichem<br />
Market<strong>in</strong>g <strong>und</strong> nachhaltiger Pflege des Netzwerks<br />
nennt sie folgende weitere Schwerpunkte<br />
ihrer Tätigkeit: Akquise von Fördermitteln auf<br />
Länder, B<strong>und</strong>es <strong>und</strong> EUEbene, Aus <strong>und</strong><br />
Weiterbildung, F<strong>und</strong>rais<strong>in</strong>g, Schaffung e<strong>in</strong>es<br />
gründerfre<strong>und</strong>lichen Klimas, Zusammenbr<strong>in</strong>gen<br />
potentieller Kooperationspartner.<br />
Zunächst aber wird sich Preißner bei den<br />
Landräten <strong>und</strong> Oberbürgermeistern der Region<br />
vorstellen <strong>und</strong> versuchen, e<strong>in</strong>e gegenseitige Vertrauensbasis<br />
aufzubauen. „Ich möchte wissen,<br />
welche Wünsche <strong>und</strong> Forderungen die Gebietskörperschaften<br />
an den TechnologieCampus<br />
stellen“, erläutert sie. Außerdem will sie im<br />
DozentenKollegium der HAW für ihre E<strong>in</strong>richtung<br />
werben. Und noch e<strong>in</strong> großes, langfristiges<br />
Ziel verfolgt die Geschäftsführer<strong>in</strong>: Sie will mit<br />
ihrem Engagement dazu beitragen, dass <strong>in</strong> Zeiten<br />
des demografischen Wandels hoch qualifizierte<br />
Arbeitsplätze angeboten werden, um die Abwanderung<br />
gut ausgebildeter Männer <strong>und</strong><br />
Frauen aus der Nordoberpfalz zu verh<strong>in</strong>dern.<br />
terMiN<br />
der technologiecampus an der Hochschule<br />
AmbergWeiden <strong>und</strong> die Hochschule<br />
AmbergWeiden veranstalten am<br />
14.02.2012 ab 15:15 uhr<br />
e<strong>in</strong>e hochschulöffentliche <strong>in</strong>formationsveranstaltung<br />
zum technologietransfer.<br />
Siemens <strong>in</strong>novatorium<br />
kaiserWilhelmr<strong>in</strong>g 23<br />
92224 Amberg<br />
Weitere iNFOrMatiONeN<br />
dr. kar<strong>in</strong> Preißner<br />
kaiserWilhelmr<strong>in</strong>g 23a<br />
92224 Amberg<br />
Fon +49 9621/4823941<br />
Fax +49 9621/ 4824941<br />
k.preissner@techcamphaw.de<br />
www.techcamphaw.de<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
Foto: Bayerische Staatskanzlei<br />
Prof. Dr. re<strong>in</strong>hard Höpfl mit Verdienstkreuz<br />
am Bande ausgezeichnet<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Vdi LAndeSVerBAnd<br />
Am 17. November wurde Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hard Höpfl, Präsident der Hochschule Deggendorf <strong>und</strong><br />
Vorsitzender des VDI Landesverbandes <strong>Bayern</strong>, von M<strong>in</strong>isterpräsident Horst Seehofer mit dem<br />
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland ausgezeichnet.<br />
Prof. Dr. Re<strong>in</strong>hard Höpfl (l<strong>in</strong>ks) mit M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
Horst Seehofer.<br />
Professor Höpfl leitet seit 1996 die Geschicke<br />
der Deggendorfer Fachhochschule mit Umsicht<br />
<strong>und</strong> immensem persönlichen Engagement, er<br />
hat sich um die E<strong>in</strong>richtung <strong>und</strong> deren hervorragender<br />
Entwicklung verdient gemacht. E<strong>in</strong>en<br />
besonderen Schwerpunkt legt<br />
er auf die Pflege der <strong>in</strong>ternationalen<br />
Kontakte. So wurde<br />
bereits 1997 das Akademische<br />
Auslandsamt der FH Deggendorf<br />
e<strong>in</strong>gerichtet <strong>und</strong> ab dem<br />
W<strong>in</strong>tersemester e<strong>in</strong> so genannter„Auslandsorientierter<br />
Studiengang“ angeboten.<br />
Aufgr<strong>und</strong> se<strong>in</strong>er <strong>in</strong>ternationalen<br />
Erfahrung wurde er <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong> Expertenteam zum Aufbau<br />
e<strong>in</strong>er Fachhochschule <strong>in</strong><br />
Beirut berufen, seit 2001 ist<br />
er als Peer <strong>in</strong> der SwissPeer<br />
Review bei der Evaluierung<br />
von Schweizer Hochschulen tätig. Die FH Deggendorf,<br />
ursprünglich für vier klassische Studiengänge<br />
konzipiert, konnte durch mutige <strong>und</strong><br />
zukunftsorientierte Entscheidungen um die Studiengänge<br />
Wirtschafts<strong>in</strong>formatik, Medientech<br />
e<strong>in</strong> neuer Geschäftsführer für den<br />
VDi Landesverband <strong>Bayern</strong><br />
nik <strong>und</strong> International Management erweitert<br />
werden. H<strong>in</strong>zu kommen noch e<strong>in</strong> <strong>in</strong>novatives<br />
Studienkonzept „ITKompaktkurs“ <strong>und</strong> e<strong>in</strong> berufsbegleitendes<br />
Weiterbildungsstudium, das<br />
zum Abschluss als „Master of Bus<strong>in</strong>ess Adm<strong>in</strong>istration“<br />
führt. Vorbildlich setzte sich Professor<br />
Höpfl jedoch auch für die Bildungsreihe „Hochschulen<br />
für die Wirtschaft“ e<strong>in</strong>. Dank dieses<br />
hohen Engagements trägt die FH Deggendorf<br />
heute erheblich dazu bei, die wissenschaftlich<br />
technische Infrastruktur des Raumes zu verbessern.<br />
Durch se<strong>in</strong>en unermüdlichen E<strong>in</strong>satz<br />
konnte sie sich zu e<strong>in</strong>er der erfolgreichsten<br />
Hochschulen entwickeln.<br />
Neben dieser anspruchsvollen beruflichen<br />
Tätigkeit engagiert sich Professor Höpfl <strong>in</strong><br />
vorbildlicher Art <strong>und</strong> Weise <strong>in</strong> verschiedenen<br />
ehrenamt lichen Funktionen, nicht zuletzt auch<br />
seit 2009 als Vorsitzender des VDI Landesverbandes<br />
<strong>Bayern</strong>, <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Heimatstadt Schorndorf<br />
<strong>und</strong> se<strong>in</strong>em Heimatlandkreis Cham.<br />
Am 01. Januar 2012 übernimmt Dipl-Ing. (FH)/Dipl.-Wirtschafts<strong>in</strong>g. (FH) Michael M<strong>und</strong>enbruch<br />
das Amt des Geschäftsführers von Dr. Thomas Bruder.<br />
Dipl.Ing. (FH), Dipl. Wirtschafts<strong>in</strong>g. (FH)<br />
Michael M<strong>und</strong>enbruch ist seit 1992 VDIMitglied<br />
<strong>und</strong> engagierte sich im Bezirksvere<strong>in</strong><br />
München zuerst im Arbeitskreis Studenten <strong>und</strong><br />
Jung<strong>in</strong>genieure.<br />
Nach se<strong>in</strong>em Studienabschluss war er als<br />
Vorstandsmitglied im BV München zuständig<br />
für das Ressort „Mitgliederbetreuung“, gründete<br />
2007 den Arbeitskreis „Unternehmer <strong>und</strong><br />
Führungskräfte“ <strong>und</strong> übernahm 2010 den Vorstandsposten<br />
„Verb<strong>in</strong>dung zu Industrie <strong>und</strong><br />
Wirtschaft“. In se<strong>in</strong>er neuen Funktion im VDI<br />
Landesverband möchte er die Stellung des VDI<br />
<strong>in</strong> ganz <strong>Bayern</strong> stärken.<br />
Im Hauptberuf ist Michael M<strong>und</strong>enbruch<br />
Projektmanager (zertifiziert nach IPMA / GPM),<br />
Certified Professional für Requirements Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
(iSQI), Lehrbeauftragter für Projektmanagement<br />
an der Hochschule München sowie<br />
Tra<strong>in</strong>er bei der Industrie <strong>und</strong> Handelskammer<br />
(IHK) München. Zu se<strong>in</strong>en Schwerpunkten<br />
zählen Beratung von Unternehmen, Schulungen<br />
sowie Qualifizierungen im Projektmanagement,<br />
Coach<strong>in</strong>g, Projektberatung <strong>und</strong> Projektleitung<br />
auf Zeit.<br />
Seit 2003 bildet er mit se<strong>in</strong>em eigenen Unternehmen<br />
Projektmanager aus <strong>und</strong> führt diese zur<br />
<strong>in</strong>ternational anerkannten IPMAZertifizierung.<br />
45
Fotos: TUM<br />
tu MüncHen<br />
Schöne neue technikwelt – Segen oder Fluch?<br />
Ferienakademie an der Evangelischen Akademie Tutz<strong>in</strong>g beschäftigt sich mit Nutzen <strong>und</strong><br />
Risiken <strong>in</strong>telligenter Masch<strong>in</strong>en<br />
Autonome Roboter oder Sensornetzwerke<br />
zur Messung, Steuerung <strong>und</strong> Überwachung s<strong>in</strong>d<br />
nicht nur vom Menschen gesteuerte Werkzeuge,<br />
sondern stehen bei ihren vielfältigen Aufgaben<br />
im engen Kontakt mit Personen. Dies erfordert<br />
nicht nur e<strong>in</strong>e Beschäftigung mit der technischen<br />
Seite solcher modernen Hilfsmittel, sondern auch<br />
mit ihren gesellschaftlichen Aspekten. Unter dem<br />
Motto „Schöne neue <strong>Technik</strong>welt. Das Zeitalter<br />
der <strong>in</strong>telligenten Masch<strong>in</strong>en“ diskutierten Fachwissenschaftler<strong>in</strong>nen<br />
<strong>und</strong> Student<strong>in</strong>nen vom 14.<br />
bis 16. Oktober an der Evangelischen Akademie<br />
Tutz<strong>in</strong>g über den Umgang mit den modernen<br />
Helfern nicht nur aus elektro <strong>und</strong> <strong>in</strong>formationstechnischer,<br />
sondern auch aus psychologischer,<br />
soziologischer <strong>und</strong> juristischer Perspektive.<br />
die MenschMasch<strong>in</strong>e<strong>in</strong>teraktionsforschung<br />
In ihrem E<strong>in</strong>führungsvortrag stellte Astrid<br />
Weiss, Wissenschaftler<strong>in</strong> am ICT&S Center der<br />
Universität Salzburg, die bisherigen Ergebnisse<br />
der MenschMasch<strong>in</strong>eInteraktionsforschung aus<br />
soziologischer Sicht vor. Sie verwies dabei auf die<br />
Notwendigkeit der <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Zusammenarbeit<br />
aus Elektrotechnik, Informatik, Soziologie<br />
<strong>und</strong> Mediz<strong>in</strong> mit ihren unterschiedlichen Anforderungen<br />
an e<strong>in</strong> <strong>in</strong>telligentes System. In e<strong>in</strong>em<br />
anschließenden Gesprächsforum wurden die<br />
Fragen vertieft, wie <strong>in</strong>tensiv solche <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären<br />
Teams zusammenarbeiten müssen, welche<br />
neuen Möglichkeiten der Interaktion <strong>in</strong>telligente<br />
Roboter (technisch) bieten können <strong>und</strong> (sozial)<br />
wünschenswert s<strong>in</strong>d <strong>und</strong> welche gesellschaftlichen<br />
Auswirkungen die Integration <strong>in</strong>telligenter<br />
Systeme <strong>in</strong> das tägliche Leben haben kann.<br />
46<br />
Forum „generationentechnik“<br />
Wie sich bald herausstellte, gab es <strong>in</strong>haltliche<br />
Überschneidungen mit dem Forum zur<br />
„Generationentechnik“, sodass sich die beiden<br />
Gruppen kurzerhand zusammensetzten <strong>und</strong><br />
den E<strong>in</strong>satz von Robotern beispielsweise <strong>in</strong> der<br />
Pflege geme<strong>in</strong>sam erörterten: Wie kann <strong>Technik</strong><br />
im Alter unterstützen? Stellen Roboter nicht<br />
e<strong>in</strong>e Entmenschlichung der Versorgung <strong>und</strong><br />
Pflege hilfebedürftiger Personen dar? Reicht<br />
es da schon, Roboter mit menschenähnlichem<br />
Antlitz zu versehen?<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Persönlichkeitsschutz<br />
Spätestens bei den Themen Sicherheit<br />
<strong>und</strong> Persönlichkeitsschutz wurde klar, dass<br />
auch juristische Aspekte e<strong>in</strong>e Rolle spielen:<br />
Wer haftet, <strong>wenn</strong> Menschen von „ihrem“ Roboter<br />
verletzt werden? E<strong>in</strong>e GPSunterstützte<br />
Gehhilfe bietet zwar mehr Bewegungsfreiheit<br />
<strong>und</strong> Sicherheit für Demenzkranke, birgt<br />
aber auch das Risiko e<strong>in</strong>er permanenten<br />
Überwachung <strong>und</strong> des Missbrauchs personenbezogener<br />
Daten.<br />
Viola Schmid, Professor<strong>in</strong> für Öffentliches<br />
Recht an der TU Darmstadt <strong>und</strong> Spezialist<strong>in</strong><br />
für CyberLaw, führte aus, dass <strong>in</strong><br />
diesen, wie auch <strong>in</strong> anderen Bereichen der<br />
MenschMasch<strong>in</strong>eKommunikation, noch<br />
Gesetzeslücken <strong>und</strong> rechtliche Grauzonen<br />
bestehen, wie der Datenschutz um Vorratsdatenspeicherung,<br />
Onl<strong>in</strong>eDurchsuchungen,<br />
Cyber mobb<strong>in</strong>g, Gendatenbanken <strong>und</strong> die<br />
abweichende Rechtsprechung <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Ländern beweisen.<br />
Obgleich die weitaus meisten Teilnehmer<strong>in</strong>nen<br />
an der Ferienakademie die moderne<br />
<strong>Technik</strong> als Segen empf<strong>in</strong>den, wurde bei der<br />
abschließenden Podiumsdiskussion die Verantwortung<br />
der Medien angemahnt. Sie habe nicht<br />
nur kritiklos über den neuesten Stand der <strong>Technik</strong><br />
<strong>und</strong> deren Nutzen zu berichten, sondern<br />
auch die Verpflichtung, über Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Risiken technischer Entwicklungen umfassend<br />
zu <strong>in</strong>formieren.<br />
kompetenzWorkshops<br />
Ergänzt wurde das Programm der Ferienakademie<br />
durch KompetenzWorkshops zu<br />
Kommunikation <strong>und</strong> Präsentation, Gehaltsverhandlungen<br />
sowie e<strong>in</strong>em Stimm <strong>und</strong><br />
Mikrofontra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. Abends gab es die Möglichkeit,<br />
auf „Spielplätzen <strong>in</strong> der <strong>Technik</strong>welt“<br />
mittels WiiBoxen die MenschMasch<strong>in</strong>e<br />
Interaktion beim Bowl<strong>in</strong>g, Tennis <strong>und</strong> Boxen<br />
selbst zu testen.<br />
Die Ferienakademie f<strong>in</strong>det traditionell am<br />
Wochenende vor Beg<strong>in</strong>n des W<strong>in</strong>tersemesters<br />
statt. Die Kooperationsveranstaltung des GenderZentrums<br />
der TU München mit der Universität<br />
der B<strong>und</strong>eswehr München richtet sich<br />
<strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie an Student<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> junge Absolvent<strong>in</strong>nen<br />
der Ingenieurwissenschaften; die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Vorträge, Foren <strong>und</strong> Workshops s<strong>in</strong>d<br />
jedoch bewusst <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är gehalten. In jedem<br />
Jahr steht e<strong>in</strong> anderes aktuelles Thema zur<br />
Diskussion.<br />
Christ<strong>in</strong>e Schmidt<br />
Gender-Zentrum, TU München<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
AktueLLeS<br />
VDi-Kongress „elektronik im Kraftfahrzeug“ <strong>und</strong><br />
Messe eCartec<br />
Technologie-Campus Freyung präsentiert Forschungsergebnisse <strong>und</strong> Dienstleistungen<br />
v.l.: Dipl-Ing. (FH) Alexander Fasch<strong>in</strong>gbauer <strong>und</strong> Prof. Dr.-Ing.<br />
Andreas Grzemba vom Technologie Campus vor ihrer Präsentation<br />
am Stand von Inf<strong>in</strong>eon <strong>in</strong> Baden-Baden.<br />
Vdikongress „elektronik im kraftfahrzeug“<br />
Am 12. <strong>und</strong> 13. Oktober fand <strong>in</strong> BadenBaden<br />
der 15. Internationale VDIKongress „Elektronik<br />
im Kraftfahrzeug“ statt. Mit 1.350 Teilnehmer<br />
war der sehr bedeutende Kongreß mehr<br />
als gut besucht. Über 100 Aussteller konnten<br />
dort die neusten Trends <strong>und</strong> Entwicklungen der<br />
Branche aufzeigen.<br />
Bei gut 60 elektrischen Steuergeräten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
großen BMW ist auch im Auto Stromsparen<br />
angesagt. Nicht jedes Steuergerät muss<br />
immer laufen. Für e<strong>in</strong>en solchen sogenannten<br />
„Teilnetzbetrieb“ im Auto hat Inf<strong>in</strong>eon zusammen<br />
mit BMW <strong>und</strong> dem Technologie Campus<br />
Freyung e<strong>in</strong>en neuartigen Chip entwickelt, der<br />
dieses Stromsparen ermöglicht. Die notwendigen<br />
Anpassungen dafür zu entwickeln <strong>und</strong> die<br />
Integration <strong>in</strong> das Testfahrzeug vorzunehmen,<br />
war die Arbeit des Technologie Campus. Die<br />
Vorstellung des Chips <strong>in</strong> BadenBaden stieß<br />
auf großes Interesse aller Autobauer. Diese<br />
Technologie wird sicherlich <strong>in</strong> den nächsten<br />
Jahren von allen Autoherstellern e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden.<br />
Messe ecartec<br />
Mehr wie 500 Unternehmen aus 24 Ländern<br />
präsentierten ihre Produkte dieses Jahr vom 18.<br />
bis 20 Oktober auf der Messe eCarTec <strong>in</strong> München.<br />
Thema dieser Messe ist die EMobilität:<br />
Elektrofahrzeuge, Speicher, Antriebs <strong>und</strong> Motorentechnik<br />
sowie Infrastruktur <strong>und</strong> F<strong>in</strong>anzierungsmöglichkeiten.<br />
Die Firma Technagon GmbH aus Haus im<br />
Wald, die Ladesäulen entwickelt <strong>und</strong> fertigt,<br />
widmet sich dem Thema „Vernetzungskonzepte“<br />
im Bereich EMobilität. Der Technologie<br />
Campus Freyung präsentierte auf dem Stand<br />
von Technagon se<strong>in</strong>e Ergebnisse zum Thema<br />
ECar Simulator, Flottenanalyse sowie Energienutzungspläne.<br />
Gerade beim Thema EMobili<br />
v.l.: Dipl.-Ing. (FH) Sven Plaga vom Technologie Campus mit zwei<br />
Mitarbeitern der Firma Technagon GmbH auf dem geme<strong>in</strong>samen<br />
Stand auf der eCarTec <strong>in</strong> München.<br />
tät ist der Vergleich von Elektrofahrzeugen mit<br />
den heutigen konventionellen Autos notwendig<br />
um feststellen zu können, welche <strong>Technik</strong> wo<br />
rentabel ist. Der ECar Simulator erlaubt es dem<br />
Nutzer Fahrten auf se<strong>in</strong>em Smartphone zu trakken<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>en Kostenvergleich anzustellen. Um<br />
dasselbe Thema geht es bei der Flottenanalyse.<br />
Lohnt es sich für e<strong>in</strong> Unternehmen e<strong>in</strong>en Teil<br />
se<strong>in</strong>er Fahrzeugflotte durch Elektroautos zu<br />
ersetzen? Die Flottenanalyse gibt die Antwort.<br />
Diese für den Anwender <strong>in</strong>teressanten Dienstleistungen<br />
des Technologie Campus wurden bei<br />
dem Fachpublikum der eCarTec sehr positiv<br />
aufgenommen.<br />
Rudi Demont<br />
Technologie Campus Freyung<br />
Weitere iNFOrMatiONeN<br />
Hochschule deggendorf<br />
technologie campus Freyung<br />
grafenauer Str. 22<br />
94078 Freyung<br />
www.technologiecampusfreyung.de/<br />
47<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP
BucHBeSPrecHungen<br />
risiko<strong>in</strong>telligenz<br />
Brigitte Witzer, ECON, Berl<strong>in</strong> 2011,<br />
ISBN 9783430201117, 19,99 Euro<br />
E<strong>in</strong> Buch lesen birgt e<strong>in</strong> Risiko: ist es die<br />
Lebenszeit, die man <strong>in</strong>vestiert, wert? Bei dem<br />
vorliegenden Werk ist die Antwort zwiespältig.<br />
Die Stärke des Buches ist die Betonung<br />
der Erkenntnis, dass wir mit Risiken emotional<br />
umgehen (müssen), da die Realität e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles<br />
Konstrukt <strong>und</strong> der Mensch ke<strong>in</strong> rationales<br />
Wesen ist. Daher fordert die Autor<strong>in</strong> die<br />
Entwicklung von Risiko<strong>in</strong>telligenz. Das me<strong>in</strong>t<br />
die Fähigkeit, das Leben erfolgreich zu meistern<br />
<strong>und</strong> wird sichtbar <strong>in</strong> unterschiedlichen Handlungskompetenzen<br />
<strong>und</strong> e<strong>in</strong>em klaren S<strong>in</strong>n<br />
für die Realität. Um diese wolkige Def<strong>in</strong>ition<br />
etwas zu konkretisieren, führt uns die Autor<strong>in</strong><br />
schnellen Schritts durch weite Gebiete der Persönlichkeits<br />
<strong>und</strong> der Managementpsychologie,<br />
mit Abstechern <strong>in</strong> die Sozialpsychologie. Man<br />
hätte das Buch auch „Persönlichkeitsentwicklung“<br />
betiteln können. Von Bauchgefühl über<br />
Intelligenz <strong>und</strong> Weisheit, von Coolness bis zum<br />
Helfersyndrom kommt alles vor. Auch wichtige<br />
Themen wie Komplexität, Statistik <strong>und</strong> Risikowahrnehmung<br />
werden zwar angesprochen, aber<br />
nie angemessen vertieft. Am Ende geht es e<strong>in</strong>em<br />
wie bei den meisten Lebenshilfebüchern: sie<br />
bieten oft im Wesentlichen nur Zirkelschlüsse<br />
<strong>und</strong> man ist dann so klug wie zuvor: glücklich<br />
wird, wer Glück hat, erfolgreich wird, wer Erfolg<br />
hat, Risiko<strong>in</strong>telligenz besitzt, wer Risiken erfolgreich<br />
meistert. Aber wie geht man mit Risiken<br />
nun wirklich um? Vorsichtig, na klar. Ansonsten<br />
ist man halt Optimist oder Pessimist.<br />
48<br />
Gerhard Grosch<br />
Alles hat se<strong>in</strong>e Zeit, nur ich hab<br />
ke<strong>in</strong>e<br />
Wege <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e neue Zeitkultur<br />
Karlhe<strong>in</strong>z Geißler, Oekom Verlag, München 2011,<br />
ISBN 978-3-527-32651-8, 19,95 Euro<br />
Manchmal komme ich nicht umh<strong>in</strong> <strong>und</strong> lese<br />
e<strong>in</strong> Buch schon deshalb, weil mich der Titel nicht<br />
mehr loslässt. Das neue Werk des renommierten<br />
Zeitforschers <strong>und</strong> emeritierten Professors für<br />
Wirtschaftspädagogik der Universität der B<strong>und</strong>eswehr<br />
<strong>in</strong> München, Karlhe<strong>in</strong>z Geißler, gehört dazu.<br />
Die vier Hauptkapitel Alles hat se<strong>in</strong>e Zeit – Die<br />
Zeit <strong>in</strong> der Vormoderne, Alle Macht der Uhr – Die<br />
Zeit der Moderne, Alles zu jeder Zeit – Die Zeit der<br />
Postmoderne <strong>und</strong> Wege aus der Zeitfalle führen<br />
den Leser von e<strong>in</strong>em naturabhängigen Zeitablauf<br />
über die zeitordnende Macht der Uhr bis h<strong>in</strong> zur<br />
„Vergleichzeitigung“ der Abläufe, die wir heute <strong>in</strong><br />
weiten Bereichen des Lebens f<strong>in</strong>den. Im Kapitel<br />
Alles zu jeder Zeit treffen wir sie alle wieder (<strong>und</strong><br />
auch e<strong>in</strong> wenig uns selbst): die „FetischistInnen<br />
der Gleichzeitigkeit“, die „Simultanten“, die<br />
immer <strong>und</strong> überall erreichbar s<strong>in</strong>d, viele D<strong>in</strong>ge<br />
gleichzeitig machen <strong>und</strong> doch nie Zeit haben.<br />
„Dass die Menschen für die Industriegesellschaft<br />
funktionieren, hat die Uhr besorgt, dass sie für die<br />
Zeitverdichtungsgesellschaft funktionieren, dafür<br />
sorgen Mobiltelefon <strong>und</strong> Internet.“<br />
E<strong>in</strong>gängig, mit milder Ironie geschrieben <strong>und</strong><br />
ohne moralischen Zeigef<strong>in</strong>ger beschreibt Geißler<br />
die Entwicklung des Verständnisses von Zeit,<br />
er<strong>in</strong>nert e<strong>in</strong>drücklich daran, worum es wirklich<br />
gehen sollte <strong>und</strong> zeigt uns Wege aus der Zeitfalle.<br />
Jedem „Simultanten“ wärmstens zu empfehlen<br />
(falls er sich e<strong>in</strong>mal die Zeit dazu nimmt)<br />
<strong>und</strong> jedem anderen natürlich auch, denn: „<strong>Was</strong><br />
nützt uns Geschw<strong>in</strong>digkeit, <strong>wenn</strong> der Verstand unterwegs<br />
ausläuft“? (Karl Kraus)<br />
Silvia Stettmayer<br />
naturgeschichten<br />
über fitte Blesshühner, Biber mit Migrationsh<strong>in</strong>tergr<strong>und</strong> <strong>und</strong><br />
<strong>warum</strong> wir uns die umwelt im gleichgewicht wünschen<br />
Josef H. Reichholf, Albrecht Knaus Verlag München,<br />
ISBN 978-3-8135-0378-4, 19,99 Euro<br />
Wie der Untertitel schon verrät, versteht sich<br />
das Buch nicht als trockene Wissenschaftslektüre.<br />
Vielmehr sollen – für quasi jede Altersgruppe<br />
– die spannenden Geschichten <strong>und</strong> Fragen<br />
unserer Umwelt ergründet werden.<br />
Der prom<strong>in</strong>ente Ökologe Josef Reichholf versucht<br />
mit kurzen <strong>und</strong> orig<strong>in</strong>ellen Geschichten<br />
spannende Fragen r<strong>und</strong> um Umwelt, Ökologie,<br />
Flora <strong>und</strong> Fauna zu erklären. Dabei beschränken<br />
sich die e<strong>in</strong>zelnen Kapitel nicht auf die<br />
re<strong>in</strong> ökologische bzw. biologische Bewertung,<br />
sondern beleuchten auch ethische, moralische<br />
oder gar philosophischreligiöse Fragen. Auch<br />
<strong>wenn</strong> die e<strong>in</strong>zelnen Geschichten sich um Pflanzen<br />
oder Tiere ranken, so ist zentrales Element<br />
meist die Interaktion bzw. die Abhängigkeiten<br />
mit uns – den Menschen.<br />
Die e<strong>in</strong>zelnen Kapitel verstehen sich nicht<br />
als lose Sammlung, sondern greifen gut <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander.<br />
Themen wie der hohe Energieverbrauch<br />
von Vögeln, die spärliche Körperbehaarung des<br />
Menschen im Vergleich zu verwandten Primaten,<br />
die Funktionen <strong>und</strong> mögliche Nebenwirkungen<br />
von Liebe oder die Wanderschaften von<br />
Insektenvölkern werden <strong>in</strong> flüssig geschriebenen<br />
<strong>und</strong> gut nachvollziehbaren Kapiteln erklärt.<br />
Illustrationen r<strong>und</strong>en die e<strong>in</strong>zelnen Kapitel ab.<br />
Wer also e<strong>in</strong>en kurzweiligen Nachmittag<br />
mit der Frage der Geme<strong>in</strong>samkeiten von E<strong>in</strong>flüssen<br />
der Tsetsefliege auf das Fell von Zebras<br />
<strong>und</strong> die Wanderbewegungen von Vormenschen<br />
ergründen möchte, ist bei diesem Buch<br />
gut aufgehoben.<br />
Wolfgang Berger<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012
VDi-<strong>in</strong>genieurhilfe e.V. – Wir helfen gerne<br />
die Vdi<strong>in</strong>genieurhilfe e.V. ist e<strong>in</strong> aus Spenden<br />
f<strong>in</strong>anzierter, geme<strong>in</strong>nütziger Vere<strong>in</strong>, der <strong>in</strong><br />
not geratenen <strong>in</strong>genieur<strong>in</strong>nen <strong>und</strong> <strong>in</strong>genieuren<br />
<strong>und</strong> deren H<strong>in</strong>terbliebenen unterstützung<br />
anbietet, unabhängig von e<strong>in</strong>er Vdi Mitgliedschaft.<br />
trotz allgeme<strong>in</strong>er sozialer M<strong>in</strong>destabsicherung,<br />
beispielsweise durch renten oder andere<br />
Sozialleistungen, geraten immer wieder<br />
auch Menschen mit akademischer Ausbildung <strong>in</strong><br />
not, <strong>wenn</strong> sie durch e<strong>in</strong>e schwere erkrankung,<br />
Arbeitsplatzverlust, e<strong>in</strong>en unfall oder andere ereignisse<br />
aus der Bahn geworfen werden. ganz an die<br />
jeweilige notsituation angepasst, können wir dann<br />
Hilfe anbieten, sei es <strong>in</strong> Form materieller/f<strong>in</strong>anzieller<br />
unterstützung, durch persönliche Beratung,<br />
durch vermittelnde gespräche mit Wohnungs <strong>und</strong><br />
Sozialämtern oder durch kontaktaufnahme zu<br />
anderen <strong>in</strong>stitutionen. Helfen Sie mit! Weisen Sie<br />
Hilfsbedürftige auf die Vdi<strong>in</strong>genieurhilfe h<strong>in</strong>!<br />
Leserbriefe<br />
Zum editorial „Smart grid – revolution oder evolution?“,<br />
tiB 6/2011<br />
„Stromautobahnen“ haben Sie <strong>in</strong> Ihrem Leitartikel geschrieben?<br />
Ok, Sie haben den Begriff <strong>in</strong> Anführungszeichen gesetzt <strong>und</strong> geschrieben,<br />
dass die Netzbetreiber diese durchs Land ziehen wollen. Man versteht<br />
die Welt nicht mehr, auch Datenautobahnen soll es geben. Diese<br />
dummen Begriffe verbreiten sich wie die „Pest“.<br />
Die Begriffe Autobahn, Eisenbahn, Straßenbahn, Untergr<strong>und</strong>bahn<br />
(UBahn), Schnellbahn (SBahn) usw. kenne ich ja, aber Stromautobahn?<br />
Ist das die Straße, auf der nur Elektroautos fahren dürfen? Müßte<br />
dann die „normale“ Autobahn nicht Autoautobahn heißen?<br />
Gerade Ingenieure sollten präzise se<strong>in</strong>, auch im sprachlichen Ausdruck.<br />
Reicht es (Ihnen) nicht, Strombahn zu sagen?<br />
Gerhard Gehr<strong>in</strong>ger<br />
Zu tiB 5/2011 – Abkürzungen<br />
In TiB Heft 05/2011 ist e<strong>in</strong>e w<strong>und</strong>erbare Tabelle von Abkürzungen<br />
e<strong>in</strong>gefügt. Aber <strong>in</strong> gleichen Heft s<strong>in</strong>d noch e<strong>in</strong>e Menge mehr Abkürzungen<br />
zu f<strong>in</strong>den, teils mit Erläuterung, teils ohne. Da ich die Zeitschrift<br />
sehr schätze wegen ihrer verständlichen Darlegungen auch für<br />
e<strong>in</strong>en seit Jahren pensionierten Ingenieur wie ich, wäre ich sehr dankbar,<br />
<strong>wenn</strong> Sie bei allen Artikeln gr<strong>und</strong>sätzlich darauf achten, dass Abkürzungen<br />
auch erläutert s<strong>in</strong>d.<br />
Henrik Müller<br />
Fehlerteufel <strong>in</strong> tiB 5/2011<br />
In Ausgabe 05/2011 hat sich auf Seite 47 der Fehlerteufel verewigt.<br />
Bei der oberen Abbildung kann es sich nicht um e<strong>in</strong>e Kurbelwelle<br />
handeln. Tatsächlich handelt es sich um e<strong>in</strong>e Wagkastenstruktur e<strong>in</strong>es<br />
Schienenfahrzeugs <strong>in</strong> Differentialbauweise.<br />
Marco H<strong>in</strong>terreiter<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012<br />
Ansprechpartner:<br />
dipl.<strong>in</strong>g. roland Meisner, BV München,<br />
ober <strong>und</strong> niederbayern e.V., 80686 München,<br />
(02597) 17 99, <strong>in</strong>genieurbuero@<br />
meisner.de<br />
<strong>in</strong>g.(grad.) He<strong>in</strong>rich Wann<strong>in</strong>ger, über den<br />
BV <strong>Bayern</strong> nordost<br />
e.V. keßlerplatz<br />
12 90489<br />
nürnberg (0911)<br />
55 40 30, <strong>in</strong>genieurhilfe@vdi.de<br />
geschäftsstelle<br />
der Vdi<strong>in</strong>genieurhilfe,<br />
Vdi Platz<br />
1 40468 düsseldorf,<br />
(0211) 62<br />
142 82, <strong>in</strong>genieurhilfe@vdi.de<br />
JEDE SPENDE HILFT!<br />
HELFEN AUCH SIE?<br />
NOT<br />
IST<br />
KEIN<br />
MAKEL.<br />
AktueLLeS<br />
Spendenkonto der Vdi<strong>in</strong>genieurhilfe e.V., deutsche<br />
Bank Ag düsseldorf, BLZ: 300 700 10 , kto: 5 491 790<br />
VDI-Ingenieurhilfe e.V.<br />
Es muss sich ke<strong>in</strong> Ingenieur schämen, <strong>wenn</strong> er <strong>und</strong> se<strong>in</strong>e<br />
Familie e<strong>in</strong>mal <strong>in</strong> Not geraten. Jeden kann es treffen.<br />
Bedürftigkeit macht ke<strong>in</strong>e Unterschiede. Wir spenden Ihnen<br />
Trost. Stärken Ihnen den Rücken. Beraten, begleiten <strong>und</strong> unterstützen<br />
Sie. Scheuen Sie sich nicht, wenden Sie sich bitte<br />
an unsere Vertrauensleute – wir helfen gerne!<br />
Ihre Not ist uns Verpfl ichtung: VDI-Ingenieurhilfe e. V.<br />
Not? Ruf 0211 6214-282!<br />
VDI-Ingenieurhilfe e. V., VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf<br />
www.vdi-<strong>in</strong>genieurhilfe.de
Foto: Deutsches Museum<br />
AuSSteLLungStiPP / HuMor / VorScHAu<br />
Kunst <strong>und</strong> Werbung an<br />
Verkehrsflugzeugen<br />
Sonderausstellung <strong>in</strong> der Flugwerft Schleißheim<br />
Der „Pokemon-Jet“.<br />
Die Sonderausstellung zu Kunst <strong>und</strong> Werbung<br />
an Verkehrsflugzeugen des NARAVerlags<br />
zeigt mit zahlreichen Fotografien <strong>und</strong> Modellen<br />
e<strong>in</strong>en bunten Aspekt der Verkehrsluftfahrt.<br />
Wenn der „PokemonJet“ landet oder<br />
„Wunala Dream<strong>in</strong>g“ zur Startbahn rollt, ist den<br />
Flugzeugen an jedem Flughafen e<strong>in</strong>es gewiss:<br />
Staunen im Term<strong>in</strong>al, auf dem Vorfeld <strong>und</strong> der<br />
Besucherterrasse. Flugzeuge mit kunstvoller<br />
Sonderlackierung sorgen für großes Aufsehen<br />
<strong>und</strong> genau das ist auch so gewollt. Die hohe<br />
Aufmerksamkeit schafft Sympathie <strong>und</strong> e<strong>in</strong><br />
positives Image wird so auf die Airl<strong>in</strong>e <strong>und</strong> auf<br />
den Flughafen übertragen.<br />
Schon <strong>in</strong> den Anfangsjahren der Fliegerei<br />
sah man solche Werbeflugzeuge im E<strong>in</strong>satz<br />
50<br />
HuMOr<br />
Es gibt e<strong>in</strong>en ewigen Wettkampf zwischen der Natur <strong>und</strong> den Ingenieuren:<br />
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,<br />
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen.<br />
Bis jetzt gew<strong>in</strong>nt die Natur.<br />
Vorschau TiB 2/2012<br />
Luft- <strong>und</strong> raumfahrt<br />
2012 feiert die dgLr ihren 100. geburtstag. Aber wie gestaltet<br />
sich der Flugzeugbau von morgen, welche tendenzen zeichnen<br />
sich für die bemannte <strong>und</strong> die unbemannte raumfahrt ab?<br />
Thema Heft 3/2012<br />
Kunststoffe<br />
<strong>und</strong> das Spektrum der Botschaften reichte von<br />
der Zahnpasta bis zu Sportereignissen. Mit der<br />
Zeit wurden verschiedenste Aussagen auf diese<br />
Weise kommuniziert, auch politische Werbung<br />
<strong>und</strong> Selbstdarstellung e<strong>in</strong>er Fluggesellschaft<br />
machten vor den Flugzeugen ke<strong>in</strong>en Halt.<br />
Zur Ausstellung ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong> reich bebilderter<br />
Katalog mit dem Titel „Kunst <strong>und</strong> Werbung<br />
an Verkehrsflugzeugen“.<br />
Weitere iNFOrMatiONeN<br />
bis 29. Januar 2012<br />
deutsches Museum Flugwerft Schleißheim<br />
Ferd<strong>in</strong>andSchulzAllee (für naviSysteme)<br />
85764 oberschleißheim<br />
www.deutschesmuseum.de/flugwerft/<br />
Thema Heft 4/2012<br />
Innovationsmanagement<br />
Foto: H. Goussé, Airbus S.A.S. 2011<br />
Nachrichten aus <strong>Technik</strong>, Naturwissenschaft <strong>und</strong> Wirtschaft<br />
Impressum<br />
Herausgeber:<br />
Vere<strong>in</strong> Deutscher Ingenieure (VDI),<br />
Bezirksvere<strong>in</strong> München, Obb. u. Ndb. e.V.<br />
Anschrift der Redaktion:<br />
„<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong>“, Westendstr. 199 (TÜV)<br />
80686 München<br />
Chefredakteur: Dipl.-Ing. Jochen Lösch (verantw.)<br />
Tel. (0 89) 57 91 22 00, Fax (0 89) 57 91 21 61<br />
Chef<strong>in</strong> vom Dienst: Silvia Stettmayer<br />
Tel. (0 89) 57 91 24 56, Fax (0 89) 57 91 21 61<br />
E-Mail: tib@bv-muenchen.vdi.de<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. Wolfgang Berger; Lale Briese; Dipl.-Ing. Andreas<br />
Demmig; Dr. Frank Dittmann; Dipl.-Phys. Gerhard Grosch;<br />
Christ<strong>in</strong>a Kaufmann M.A.; Dipl.-Ing. Friedrich Münzel;<br />
Dipl.-Ing. MEng. Ra<strong>in</strong>er Rackl; Dipl.-Wirt.-Ing. Manuel<br />
Reichl; Dipl.-Ing. Franz Regler;<br />
Dipl.-Ing. Sebastian Wielgos<br />
Verlag:<br />
atlas Verlag GmbH<br />
Flößergasse 4, 81369 München<br />
Tel.: (0 89) 55 241-0, Fax: (0 89) 55 241-271<br />
Geschäftsführer: Thomas Obermaier<br />
Anzeigenleitung: Stefanie Be<strong>in</strong>l<br />
Tel.: (0 89) 55 241-240, Fax: (0 89) 55 241-271<br />
E-Mail: stefanie.be<strong>in</strong>l@atlas-verlag.de<br />
Anzeigenverkauf: Veronika Stoiber<br />
Tel.: (0 89) 55 241-142, Fax: (0 89) 55241-271<br />
E-Mail: veronika.stoiber@atlas-verlag.de<br />
Anzeigendisposition: Marion Kraus<br />
Tel.: (0 89) 55 241-227, Fax: (0 89) 55 241-271<br />
E-Mail: marion.kraus@atlas-verlag.de<br />
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 16 von 01.01.2012<br />
INFO<br />
INFO<br />
TIPP<br />
Vertriebsleitung <strong>und</strong> Abobetreuung:<br />
Christ<strong>in</strong>e Hartl<br />
Tel.: (0 89) 55 241-273, Fax: (0 89) 55 241-244<br />
E-Mail: christ<strong>in</strong>e.hartl@atlas-verlag.de<br />
Layout <strong>und</strong> Grafik: Roland Maier, rm-kommunikation.de<br />
Internet-Service: Lösch <strong>und</strong> Partner GmbH<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> ersche<strong>in</strong>t zweimonatlich.<br />
Der Bezugspreis ist bei VDI- <strong>und</strong> VDE-Mitgliedern der<br />
Bezirks vere<strong>in</strong>e <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> sowie dem IDV <strong>in</strong> der Mitgliedschaft<br />
enthalten.<br />
Jahresabonnement 36,– Euro / 72,– SFr; E<strong>in</strong>zelheft 8,–<br />
Euro / 16,– SFr. Jahresabonnement für Studenten gegen<br />
E<strong>in</strong>sendung e<strong>in</strong>er entsprechenden Bestätigung 27,– Euro<br />
/ 54,– SFr. Der Euro-Preis be<strong>in</strong>haltet die Versandkosten für<br />
Deutschland <strong>und</strong> Österreich, der SFr-Preis die Versandkosten<br />
für die Schweiz. Bei Versand <strong>in</strong> das übrige Ausland<br />
werden die Porto-Mehrkosten berechnet. Die Abodauer<br />
beträgt e<strong>in</strong> Jahr. Das Abo verlängert sich um e<strong>in</strong> weiteres<br />
Jahr, <strong>wenn</strong> es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich<br />
gekündigt wird.<br />
Urheber-<strong>und</strong> Verlagsrecht<br />
Die Redaktion behält sich vor, Manuskripte <strong>und</strong> Leserbriefe<br />
zu kürzen. Sie übernimmt ke<strong>in</strong>e Haftung für unverlangt<br />
e<strong>in</strong>gesandte Manuskripte, Fotos <strong>und</strong> Illustrationen. Die Zeitschrift<br />
<strong>und</strong> alle <strong>in</strong> ihr enthaltenen e<strong>in</strong>zelnen Beiträge <strong>und</strong><br />
Abbildungen s<strong>in</strong>d urheberrechtlich geschützt.<br />
Druck: Vogel Druck- <strong>und</strong> Medienservice GmbH<br />
Leibnitzstr. 5, 97204 Höchberg<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> Ausg. Süd: ISSN1610-6563<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> Ausg. Nord: ISSN1610-6555<br />
Nächster Redaktionsschluss: 16. 01. 2012<br />
<strong>Technik</strong> <strong>in</strong> <strong>Bayern</strong> 01/2012