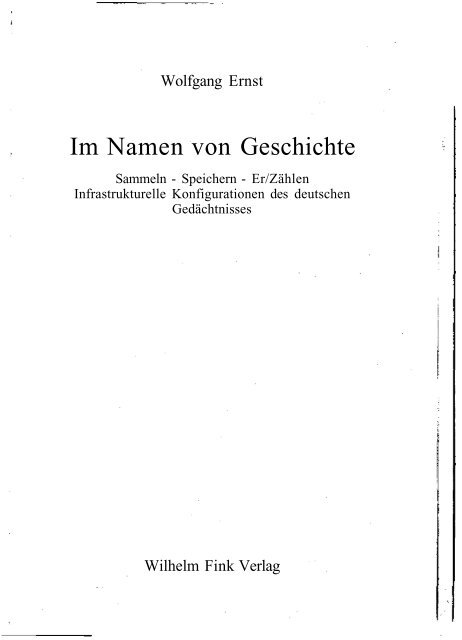Im Namen von Geschichte - Lehrstuhl für Medientheorien ...
Im Namen von Geschichte - Lehrstuhl für Medientheorien ...
Im Namen von Geschichte - Lehrstuhl für Medientheorien ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Wolfgang Ernst<br />
<strong>Im</strong> <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
Sammeln - Speichern - Er/Zählen<br />
Infrastrukturelle Konfigurationen des deutschen<br />
Gedächtnisses<br />
Wilhelm Fink Verlag
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />
Umschlagabbildung:<br />
Das Heeresarchiv Potsdam im Bau, aus:<br />
Archivalische Zeitschrift 45 (1939)<br />
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen<br />
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über<br />
http://dnb.ddb.de ab ruf bar.<br />
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.<br />
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe<br />
und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und<br />
Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren<br />
wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und<br />
andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten.<br />
ISBN 3-7705-3832-3<br />
© 2003 Wilhelm Fink Verlag, München<br />
Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH, Paderborn
BIO-IMPLIKATIONEN<br />
Die vorliegende Arbeit stellt die hinsichtlich des Forschungsstands leicht aktualisierte<br />
Version der gleichnamigen Habilitationsschrift dar, die im Oktober 1998<br />
an der Philosophischen Fakultät III der Humboldt-Universität zu Berlin eingereicht<br />
wurde. Die darin aufscheinenden Fragestellungen reflektieren gleichzeitig<br />
Forschungsstationen des Autors in den 90er Jahren: am Essener<br />
Kulturwissenschaftlichen Institut (Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen)<br />
Mitarbeit im deutsch-israelischen Forschungsprojekt Nationalism and the<br />
molding of sacred Space and time (vergleichende Denkmalforschung); Lehrtätigkeit<br />
als Dozent <strong>für</strong> Theorie und <strong>Geschichte</strong> der Historiographie am Fachbereich<br />
<strong>Geschichte</strong> der Universität Leipzig (Leipziger Fallstudien) und am<br />
Leipziger Institut <strong>für</strong> Museologie (Ästhetik des historischen Museums zwischen<br />
Monument und Dokument); ein Forschungsjahr am Deutschen Historischen<br />
Institut in Rom (Archäologie als Provokation der Historie); Mitarbeit in<br />
der kultursemiotischen Projektgruppe am Forschungsschwerpunkt Literaturwissenschaft<br />
in Berlin (Arbeiten über das Verhältnis <strong>von</strong> historischem Roman<br />
und archivischer Evidenz im 18. bis 20. Jh.); Begleitung des Projekts Kulturgeschichte<br />
der Infrastruktur (Gedächtnisagenturen) am Historischen Seminar der<br />
Universität Jena; Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet<br />
Theorie und Archäologie der Medien an der Kölner Kunsthochschule <strong>für</strong><br />
Medien; Gastprofessur (<strong>Lehrstuhl</strong> Theorie und <strong>Geschichte</strong> künstlicher Welten)<br />
an der Fakultät Medien der Bauhaus-Universität Weimar (Versuch einer<br />
Medienarchäologie des Wissens im kritischen Anschluß an Foucault). Die Perspektive<br />
der Medienwissenschaften zeichnet verantwortlich <strong>für</strong> die im vorliegenden<br />
Text mehrfach skandierte Behauptung, daß Gedächtnispolitik als<br />
Funktion <strong>von</strong> Speichertechniken zu lesen ist; der zunächst vorgesehene Akzent<br />
auf der Untersuchung des symbolischen Netzes nationaler Denkmalorte hat<br />
sich somit auf die realen Agenturen ihres Gedächtnisraums verschoben. Der<br />
Vektor dieser Arbeit hat sich damit um 180 Grad verkehrt, hin zur Analyse<br />
non-diskursiver Techniken der memoria. Die Signifikanten dieses Gedächtnisses<br />
sind parallel dazu ihrerseits im Fluß gewesen. Nicht nur, daß eine Reihe <strong>von</strong><br />
Typoskripten inzwischen das Licht der Publikation erblickt haben, sondern<br />
auch ganze Archivkörper, Gedächtnisinstitutionen und Sammlungen sind zwischenzeitlich<br />
als Funktion der deutsch-deutschen Wiedervereinigung nach Berlin<br />
verschoben worden (etwa Teile des Bundesarchivs und des ehemaligen<br />
Zentralen Staatsarchivs der DDR). Ein auf dezentrale Studien angelegtes Pro-
6 BIO-IMPLIKATIONEN<br />
jekt, das unter dem Alibi der Reisen zu deutschen Gedächtnisorten ein Bild der<br />
Gegenwarten Deutschlands zeitigte, verschrieb sich unter der Hand der Rezentrahsierung<br />
seiner Datenbanken.<br />
Kernthese dieser Arbeit ist eine Kehrseite der Historie: der Nachweis, daß<br />
gerade im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als in Deutschland <strong>für</strong> öffentliche<br />
Lesung Vergangenheit im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong> historistisch angeschrieben<br />
wurde, an jenen Orten, welche im Verborgenen die Datenbanken <strong>für</strong> diesen<br />
Diskurs überhaupt erst zur Verfügung stellten, eine sehr unmittelbare, aber hermeneutisch<br />
dissimulierte Einsicht in die pragmatische Organisation des Gedächtnisses<br />
als Speichermedien herrschte. Diese mithin kulturtechnischen<br />
Bedingungen jenseits des Interface Historie, die diskursiv im Modus der Narration<br />
idealistisch zum Verschwinden gebracht wurden, medienarchäologisch<br />
und archivnah wieder zur Ausstellung zu bringen ist zugleich der aktuelle Vektor<br />
des vorliegenden Projekts: Beihilfe zur Erinnerung daran, daß mehr denn je<br />
alternativ zum Programm <strong>Geschichte</strong> andere, nicht-historische Formen <strong>von</strong><br />
Schnittstellen zu den Relikten verflossener Zeit denkbar sind. Zuallererst will<br />
diese Arbeit jedoch, ihrer These entsprechend, auch die namhaften <strong>Im</strong>pulse ihrer<br />
eigenen Arbeitsbedingungen nicht verbergen. Dank <strong>für</strong> Anregungen, Kritik und<br />
die Ermöglichung <strong>von</strong> Forschungen gilt folgenden Gedächtnisagenturen:<br />
Berlin: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz; Staatsbibliothek<br />
Preußischer Kulturbesitz; Bundesarchiv; Archiv der Berlin-Brandenburgischen<br />
Akademie der Wissenschaften; Brandenburgisches Denkmalamt / Meßbildarchiv<br />
(Reiner Koppe); Archiv der Humboldt-Universität zu Berlin (Winfried<br />
Schultze); Archiv zur <strong>Geschichte</strong> der Max-Planck-Gesellschaft (Eckart Henning);<br />
Essen: Kulturwissenschaftliches Institut des Wissenschaftszentrums<br />
Nordrhein-Westfalen; Leipzig: Landratsamt Leipzig, Referat Denkmalpflege<br />
(Herr Schwerdtfeger); Rat der Stadt Leipzig, Stadtarchiv; Stadtgeschichtliches<br />
Museum Leipzig; Pavillon und Verwaltung des Völkerschlachtdenkmals (Herr<br />
Poser); Universität Leipzig, Archiv; Archiv der Deutschen Bücherei (Johannes<br />
Jacobi); Marburg: Archivschule Marburg (Angelika Menne-Haritz und Nils<br />
Brübach); Institut <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität<br />
(Peter Rück und Johannes Burkardt); München: Monumenta Germaniae Historica<br />
(Herr Seitz); Prag: Archiv des Jüdischen Museums in Prag (Frau<br />
Hamäckovä); Nürnberg: Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums<br />
(Eberhard Slenczka); Staatsarchiv Nürnberg (Herr Friedrich)<br />
<strong>Namen</strong>tlich geht mein Dank <strong>für</strong> Anregungen, Unterstützung und Kritik an<br />
die Hauptgutachter meiner Habilitationsschrift Friedrich Kittler (Humboldt-<br />
Universität zu Berlin), Otto Dann (Albertus-Magnus-Universität Köln), Engelbert<br />
Plaßmann (Humboldt-Universität zu Berlin); ferner an: Susan Crane, Dan
BIO-IMPLIKATIONEN 7<br />
Diner, Horst Fuhrmann, Uwe Jochum, Sebastian Klotz, Reinhart Koselleck,<br />
Olaf Rader, Hans-Ulrich Reck, Wolfgang Schaffner, Cornelia Vismann, Bernhard<br />
Siegert, Siegfried Zielinski.<br />
Präzise <strong>Im</strong>pulse verdanke ich den im Umkreis des <strong>Lehrstuhl</strong>s Ästhetik und<br />
Theorie der Medien an der Fakultät Kulturwissenschaften der Humboldt-Universität<br />
entstandenen oder entstehenden wissenschaftlichen Arbeiten und Diskussionen<br />
(Peter Berz, Stefan Heidenreich, Philipp <strong>von</strong> Hilgers, Markus<br />
Krajewski, Gloria Meynen, u. v. a.).<br />
Dank auch an die Leiter des <strong>von</strong> der German-Israeli Foundation for Seientific<br />
Research 1990-1992 geförderten Forschungsprojekts Nationalism and the<br />
molding of sacred Space and time Lutz Niethammer (Historisches Seminar<br />
der Friedrich-Schiller-Universität Jena) und Saul Friedländer (University of<br />
California, Los Angeles / Universität Tel Aviv) sowie an meine damaligen Forschungskollegen<br />
Maoz Azaryahu (Tel Aviv) und Avner Ben-Arnos (Omer).<br />
Das Deutsche Historischen Instituts in Rom unter der Direktion <strong>von</strong> Arnold<br />
Esch gewährte ein großzügiges Forschungsstipendium und die Möglichkeit zur<br />
institutsinternen Archivbenutzung 1992/93; Dank dort auch an Jens Petersen<br />
(Abteilung Zeitgeschichte); Hermann Goldbrunner (Bibliothek); ferner an die<br />
Mediävisten Wilhelm Kurze und Martin Bertram <strong>für</strong> geduldige Hinterfragungen<br />
(meinerseits) ihres Fachs.<br />
Mein Dank gilt auch denjenigen Institutionen und Personen, deren Unterstützung<br />
so selbstverständlich erschien, daß sie der hlinde Fleck einer ausdrücklichen<br />
Erwähnung an dieser Stelle geblieben sind. Gewidmet sei diese<br />
Arbeit den ICE-Zügen der Deutschen Bahn AG, worin sich Teile der Endfassung<br />
im Pendeln zwischen Berlin und meinen wechselnden Arbeitsorten enpassant<br />
schrieben. Wenn Reisezeit lückenlos in Schreibzeit verwandelt und die<br />
Eisenbahn zum Büro wird, bedarf es keiner Geschichtsgläubigkeit mehr, um an<br />
den Effekt <strong>von</strong> Bewegung zu glauben. Bleibt nur ein Risiko, das in Tolstois<br />
Kreutzersonate literarisch verewigt steht: daß jemand einem während der Fahrt<br />
seine Lebensgeschichte erzählt, so daß man zum Schreiben über non-narratives<br />
Gedächtnis gar nicht kommt. 1<br />
Epochenschwelle, Glosse unter der Sigle »<strong>Im</strong>«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.<br />
22. August 1997,29
INHALTSVERZEICHNIS<br />
- Bio-<strong>Im</strong>plikationen 5<br />
- Inhaltsverzeichnis 9<br />
- Logistisch kommentiertes Inhaltsverzeichnis 13<br />
- Leseanweisung 25<br />
EINFÜHRUNG 47<br />
- Deutsche Gedächtnisagenturen zwischen Monument und<br />
Dokumentation: Das infrastrukturelle Dispositiv 47<br />
BUCH I: ZWISCHEN AUFZEICHNUNG UND<br />
ALLEGORISIERUNG DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES .. 89<br />
MONUMENTA GERMANIAE 91<br />
- Vorgeschichten der Monumenta Germaniae Historica 91<br />
- Kristallisation der MGH 119<br />
- Verlaufsformen der MGH 160<br />
- Annalistik als Provokation der Historiographie 190<br />
- Ur/kunde: Diplomatik und Archäologie 218<br />
- Einbruch der Bilder in den Text der Historie 241<br />
ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES • 271<br />
- Archivwesen in Italien 271<br />
- Reich(s)weiten: Das Deutsche Historische Institut Rom 286<br />
- Editionsunternehmen des DHI 323<br />
- Archäologen und Historiker im Widerstreit 342<br />
- Archäologie und Historie im Widerstreit 359
10 iNHAl.TSVKRZKICHNIS<br />
BUCH II: DIE KLASSISCHEN GEDÄCHTNISORTE<br />
(UND IHRE MEDIALEN GRENZEN) 381<br />
MUSEUM 383<br />
- Allegorien der Historie: Das Germanische Nationalmuseum<br />
in Nürnberg 383<br />
- Kontraststudie: Museum oder Grab? Das Zentralmuseum<br />
jüdischer Altertümer in Prag 421<br />
- Semiophoren zwischen historischem Dokument und nationalem<br />
Monument: Die Reichskleinodien 444<br />
- Exkurs über das Autoritätsverhältnis <strong>von</strong> Knochen, Denkmälern<br />
und Buchstaben 455<br />
- Vorgeschichte am GNM 472<br />
- Das deutsche Gedächtnis als Generalrepertonum:<br />
Archiv, Bibliothek und Museum im Medienverbund 495<br />
- Organisation der deutschen Kulturgeschichte 516<br />
- Intermedialität des Gedächtnisses? Auf dem Weg zur<br />
Dokumentationswissenschaft 538<br />
ARCHIV 553<br />
- Vorspiel: Literatur und Archiv 553<br />
- Kein Gedächtnis ohne Adresse: Deutsche Archive zwischen<br />
Pertinenz und Provenienz 564<br />
- Staat machen: Preußen in den Archiven 583<br />
- Archive im politischen Einsatz 614<br />
- Archivlagen: Das Staatsarchiv Düsseldorf 636<br />
- Das Reichsarchiv: Optionen und Realität 650<br />
- Die Geburt des Reichsarchivs aus dem Generalstab 672<br />
- Archivtransfer unter Kriegsbedingungen 703<br />
- Kehrseite: Jüdische Archivlektüren und Gedächtnislöschung 728<br />
BIBLIOTHEK 757<br />
- Bibliotheksräume 757<br />
- Mechanisierung der Bibliothek 772<br />
- Archäologie einer Nationalbibliothek: Die Deutsche Bücherei 791<br />
- Verlaufsformen der Deutschen Bücherei 825<br />
- Die Paulskirchenbibliothek 842<br />
- Preußen in den Bibliotheken: Staatsbibliothek Berlin 865
INHALTSVKRZKICHNIS 11<br />
- Lettern, buchstäblich: Literatur 1813, die Leipziger Bugra 1914<br />
und das Deutsche Kulturmuseum 890<br />
BUCH III: SRZAHLEN 919<br />
INVENTAR UND STATISTIK 921<br />
- Nation und Inventar 921<br />
- Zwischen Meßbildanstalt und imaginärem Museum:<br />
Meydenbauers photogrammetrisches Denkmäler-Archiv 950<br />
- Der wissensarchäologische Blick: Statistik 995<br />
- Neue Gedächtnismaschinen: Statistik im Dienst des<br />
Dritten Reiches (Hollerith, Mikrofilm) 1034<br />
- Resümee 1059<br />
DEUTSCHE SPEICHER: DATENRÄUME DER BIBLIOTHEK<br />
UND DES (BILD)ARCHIVS 1065<br />
- Datenräume: Literatur- und Quellenverzeichnis 1067<br />
- Deutsche Speicher: Ein Bilderatlas 1107<br />
- Analytischer Index 1137
LOGISTISCH KOMMENTIERTES<br />
INHALTSVERZEICHNIS<br />
Die Konfiguration der Kapitel dieser Arbeit bildet ein kartesisches Gitter <strong>von</strong> thematischen<br />
Längs- und Querschnitten. Die Themen, hier in Blöcken gruppiert und in Kolonnen<br />
hintereinandergeschaltet, kommen in Form entsprechender Module innerhalb der<br />
einzelnen Kapitel jeweils rekursiv zur Sprache. Je nach Gesichtspunkt sind sie dementsprechend<br />
umgruppierbar. Allein das Gesetz des linearen Ausdrucks in Buchform setzt<br />
die vorliegende Reihenfolge fest; dies impliziert keine kausale oder zeitliche Sequentialität.<br />
2 Bewußt durchbrechen methodische Reflexionen und Kontraststudien die<br />
Einheitlichkeit thematischer Blöcke, denn Infrastruktur meint nicht nur Gedächtnisagenturen,<br />
sondern auch Epistemologien. Was gelegentlich sprunghaft aussieht, spiegelt<br />
die Kontingenz einer Forschung, die mit den Unwahrscheinlichkeiten <strong>von</strong> kulturhistorischer<br />
Überlieferung selbst rechnet. Eine methodische und kompositorische Engführung<br />
vorweg:<br />
LESEANWEISUNG<br />
Lektüre dieser Arbeit und <strong>von</strong> Archiven<br />
Archivographie als Verknappung der Historie<br />
Historiographische <strong>Im</strong>plikationen<br />
Thematische Einführung:<br />
DEUTSCHE GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT<br />
UND DOKUMENTATION: DAS INFRASTRUKTURELLE DISPOSITIV<br />
Infrastrukturelle Bahnungen des deutschen Gedächtnisses, Logistik des Realen<br />
Archäologie der Archive und Archiv-Wissen: Einschnitte 1806 bis 1945<br />
Nationalgedächtnis als Medienwissen: Retroperspektiven<br />
Kulturwissenschaften als Funktion ihrer Speicher<br />
Widerlager: Geschichtsspeicher, museale Konfigurationen<br />
B U C H I thematisiert die Sammlung, kritisch-historische Verarbeitung und Edition<br />
deutscher Gedächtnisdaten. Das Editionsprojekt deutscher Geschichtsquellen des Mittelalters,<br />
die Monumenta Germaniae Historica, legt die Grundlagen zum Gebrauch <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong>, operiert selbst aber radikal wissensarchäologisch. Zunächst Abrisse des<br />
Geschicks der MGH zwischen 1806 und 1945:<br />
2 Vgl. Kay Kirchmann, Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer<br />
Theorie der Interdependenzen <strong>von</strong> Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen<br />
Zivilisationsprozeß, Opladen (Leske & Budrich) 1998, 233
14 LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS<br />
VORGESCHICHTEN DER MGH<br />
Der <strong>Im</strong>puls der Freiheitskriege<br />
<strong>Geschichte</strong> bauen. Vom Steins ästhetischer Historismus<br />
Diskrete Antiquarik: Die Taufschale Kaiser Friedrichs I.<br />
Barbarossa, Goethe und die MGH<br />
Diskursive Dispositive: Grimms Zirkular<br />
Administration. Großunternehmen der Geschichtswissenschaft als Aufschreibesysteme<br />
Der Berliner Plan<br />
Wessenbergs Plan<br />
Die Vergangenheit kartographieren, Archive schürfen<br />
KRISTALLISATION DER MGH<br />
Archiv, monumenta, documenta<br />
Die Ordnung der MGH<br />
Ein Publikationsmedium, das zu Buche schlägt: Zweckbestimmung der MGH<br />
Datenträger, Gedächtnis des Abfalls und Aufzeichnung<br />
Politik und Gegengedächtnis<br />
(Politik der) Formatierungen<br />
Antiquitates<br />
Zeit/Räume der MGH<br />
Böhmer<br />
Schnittstellen zum Germanischen Nationalmuseum Nürnberg<br />
VERLAUFSFORMEN DER MGH<br />
<strong>Im</strong> Neuen Reich: Staat machen mit den MGH<br />
Editionskrisen der MGH<br />
Die MGH im Speichermedienverbund<br />
Ernst H. Kantorowicz, Albert Brackmann, die MGH und die Integrität archivgestützter<br />
Historiographie nach 1933<br />
<strong>Im</strong> ///. Reich. Ostforschung, Europa-Buch und jenseits<br />
Zwei strukturanalytische Exkurse über den Gegenstandsbereich der MGH als Provokationen<br />
<strong>von</strong> Historiographie:<br />
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE<br />
Die Folgen <strong>von</strong> 1806 (Ranke)<br />
Droysen und die Differenz <strong>von</strong> Datenaskese und Darstellungsästhetik<br />
Koordinaten <strong>von</strong> Raum und Zeit<br />
Archäologie der Annahstik
Annahstik und Archiv<br />
Die Insistenz der Annalistik<br />
LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS 15<br />
UR/KUNDE: DIPLOMATIK UND ARCHÄOLOGIE<br />
Urkundensemiotik und Historische Hilfswissenschaften<br />
Editionskriterien der MGH<br />
Krisen der Diplomatik<br />
Diplomatik als Archäologie<br />
Paläographie<br />
Die Medientechniken deutscher Speicheragenturen sind zunächst an Textarbeit orientiert.<br />
Neue Möglichkeiten der Bildverarbeitung (Aufnahme wie Reproduktion) generieren<br />
ein differentes Gedächtnis:<br />
EINBRUCH DER BILDER IN DEN TEXT DER HISTORIE<br />
Monumenta Germaniae Graphica<br />
Das Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden, Marburg<br />
Zwischen Hand-Schrift und Automation: Medienkontroversen<br />
Schrift zwischen Ornament und Information, Monument und Dokumentation<br />
Mikroverfilmung 1940<br />
Das deutsche Gedächtnis liegt auch in italienischen Archiven und Monumenten aufgespeichert.<br />
Die Arbeit des Deutschen Historischen Instituts in Rom eröffnet die Möglichkeit<br />
zur Parallellesung der Monumenta Germaniae Historica an der Schnittstelle zum<br />
Diskurs des national Anderen:<br />
ARCHIVWESEN IN ITALIEN<br />
Archivwesen in Italien <strong>von</strong> Napoleon bis zum Staatsarchiv in Rom<br />
Die Öffnung der Vatikanischen Archive<br />
REICH(S)WEITEN: DAS DEUTSCHE HISTORISCHE INSTITUT<br />
Rom als Gedächtnisspeicher der deutschen Nation und deutsch-römische<br />
Archivbezüge<br />
Vorgeschichten des DHI und die Schnittstellen zum Vatikanischen Archiv<br />
Frontstellungen: Kulturkampf und preußisch-römische Archivästhetik<br />
Paul Fridolin Kehr: Diplomatik als Politik und als Archäologie<br />
Zwischen Archiv und Historie: Die Krise <strong>von</strong> 1901<br />
Modularität der Historie als Archiv: Die Denkschrift Kehrs <strong>von</strong> 1913
16 LOGISTISCH KOMMI:NTIJ:RTI;S INHALTSVERZEICHNIS<br />
EDITIONSUNTERNEHMEN DES DHI<br />
Nuntiaturberichte<br />
Repertorium Germanicum (und EDV)<br />
Stauferforschung<br />
Archäologie eines Archivs und Archivbrand (Nachlaß Sthamer, Staatsarchiv<br />
Neapel)<br />
Das Gedächtnis der Steine: Kastell Bari<br />
In Rom prallen Historie und Archäologie als differente Modi der Wahrnehmung und<br />
Verarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit aufeinander. Am Beispiel des Deutschen Historischen<br />
und des Deutschen Archäologischen Instituts wird diese Differenz institutionell wie<br />
methodisch (Wissensarchäologie versus Historiographie) expliziert:<br />
ARCHÄOLOGEN UND HISTORIKER IM WIDERSTREIT<br />
Plädoyer <strong>für</strong> ein Historisch-Archäologisches Institut: Die Platnersche Bibliothek<br />
als Scharnier<br />
Close re-reading: Die Eingabe Schottmüllers<br />
Relationen zwischen DHI und DAI<br />
Korrespondenz, Information und die doppelte Nationalisierung Roms<br />
(1870/71)<br />
Gedächtnistechnik: Archäologische Datenbanken (1889)<br />
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT<br />
Der wissensarchäologische Blick (die Kopplung <strong>von</strong> Monument, Archiv und<br />
Archäologie)<br />
Daten, Information, Erzählung und Kritik an der monumentalen Philologie<br />
BUCH II thematisiert die klassischen Gedächtnisorte Museum, Archiv und Bibliothek<br />
und ihre medialen Grenzen. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg figuriert<br />
als Fokus der Versuche, das deutsche Kulturgedächtnis in Objekten zu versammeln.<br />
Was hier im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> Nationalhistorie geschieht, ist in der Praxis Administration<br />
diverser Gedächtnisse.<br />
ALLEGORIEN DER HISTORIE: DAS GERMANISCHE NATIONAL-<br />
MUSEUM IN NÜRNBERG<br />
Antizipationen des GNM: Minutoli und der Berliner Plan<br />
Ästhetische Dispositive des GNM<br />
1852: Distanz zu Rom und Schnittstellen zwischen GNM und RGM<br />
Museum und Germanistik als Medien der Kulturgeschichte<br />
Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß: Die historische Sammlung als Dissimulation <strong>von</strong><br />
Genealogie<br />
Vom Gutachten Rankes bis zur Verreichlichung 1871
LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS 17<br />
Allegoresen des Nationalen: Zwischen Archäologie (Monument) und Dokument<br />
(Historie)<br />
Nach den Enden des Reiches: Deutschland als Sammlungsobjekt, ungeteilt<br />
Judaica im GNM: Die Initiative <strong>von</strong> 1912<br />
Museumsdidaktik im Dritten Reich, Weltkrieg und Archivlöcher<br />
Kulturgeschichtliche Inventarisierung als non-diskursive Operation schreckt am Ende<br />
nicht vor der Musealisierung einer noch gegenwärtigen Kultur zurück:<br />
KONTRASTSTUDIE: MUSEUM ODER GRAB?<br />
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG<br />
Jüdische Museen in Böhmen und Mähren<br />
Museumstechniken<br />
Filmische Realität<br />
Museum einer untergegangenen Rasse}<br />
Epilog: Das Memorial der Pinkas-Synagoge und andere Konsequenzen<br />
Gegenüber dem Text(t)raum der Nationalhistorie folgen Artefakte einer ideosynkratischen<br />
Logik:<br />
SEMIOPHOREN ZWISCHEN HISTORISCHEM DOKUMENT UND<br />
NATIONALEM MONUMENT: DIE REICHSKLEINODIEN<br />
Die Reichskleinodien 1866 und 1870<br />
Insignien<br />
Reichskleinodien (zum Dritten)<br />
EXKURS ÜBER DAS AUTORITÄTSVERHÄLTNIS VON KNOCHEN,<br />
DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN<br />
Kaulbachs Allegorie<br />
Knochen als Generatoren historischer <strong>Im</strong>agination<br />
Signifikantenketten: Knochen und Buchstaben<br />
Die Neue Wache Berlin<br />
Politische Archäologie in Kathedralen und Ruinen: Quedlinburg, Braunschweig,<br />
andere Orte<br />
VORGESCHICHTE AM GNM<br />
Ordnung und Klassifikation der Prähistorie: Das Auftauchen eines<br />
(Vor)Geschichtskontinents<br />
Gustav Kossinna<br />
Lokalstudie zur Überlieferungswahrscheinlichkeit<br />
Die Emergenz der Vorgeschichte am Landesmuseum in Brunn
18 LOGISTISCH KOMMKNTIKRTHS INIIAI.TSVKRZKICHNIS<br />
An den Grenzen der Möglichkeit materieller Versammlung <strong>von</strong> Artefakten schaltet die<br />
Gedächtnisagentur Museum um auf die Sammlung <strong>von</strong> Information und stellt somit den<br />
(gescheiterten) Anschluß an die Ästhetik <strong>von</strong> Datenverarbeitung dar:<br />
DEUTSCHES GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM<br />
Schnittstellen zu den MGH, Blättersammlung und Katalog<br />
Schrift und Information: Deutschland als Datenstruktur, General-Repertorium,<br />
Organismus und Bibliotheksphantom<br />
Gutachten Haupt, Archiv und Verwandtschaften<br />
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE<br />
Kulturarchäologie als Verwissenschaftlichung des Museums<br />
Musik: Instrumente, Notationen und Frequenzen archivieren<br />
Bücher und Einbände als Semiophoren<br />
Alltagsgeschichte und Serienbildung: Grabdenkmäler und die Ordnung der<br />
Dinge als imaginäres Museum<br />
Monumenta iconographica und Reliquiae Medii Aevi<br />
INTERMEDIALITÄT DES GEDÄCHTNISSES? AUF DEM WEG ZUR<br />
DOKUMENTATIONSWISSENSCHAFT<br />
Archiv, Repertorium und Dokumentation<br />
Inventarisation und wissenschaftliche Dokumentation als Informatik (Otlet)<br />
Memory extender GNM? Mikrofilm, Schallkonserven und Information unter<br />
Weltkriegsbedingungen<br />
Archive sind nicht nur das gedächtnisarchäologische Leitmedium dieser Arbeit, sondern<br />
auch ihr konkretes Objekt. Zunächst Ausführungen zum hybridgen Genre Literaturarchiv<br />
und zur Genealogie archivischer Methodik:<br />
VORSPIEL: LITERATUR UND ARCHIV<br />
Patriarch(iv) Goethe<br />
Das Goethe- und Schiller-Archiv Weimar<br />
KEIN GEDÄCHTNIS OHNE ADRESSE: DEUTSCHE ARCHIVE ZWI-<br />
SCHEN PERTINENZ UND PROVENIENZ<br />
Zwischen Registratur und Archiv: Archi(v)textur, Begründung und Bodenlosigkeit<br />
des Archivs (Erhard)<br />
Suprematie der Provenienz<br />
Archivwissenschaft und Historiographie
LOGISTISCH KOMMKNTIKRTHS INHALTSVERZEICHNIS 19<br />
Es folgen Studien konkreter Archivsysteme und ihrer Exzesse. Es zeichnet den preußischen<br />
und deutsch-preußischen Staat aus, daß er weniger in narrativen <strong>Geschichte</strong>n denn<br />
in der Struktur seiner Archive selbst gespiegelt wird:<br />
STAAT MACHEN: PREUSSEN IN DEN ARCHIVEN<br />
Staatsgeheimnisse: Archiv und Historie, Verwaltung, Bürokratie<br />
Hardenberg als Archont des Archivs (Berliner Zentralplan)<br />
Hardenberg archiviert<br />
Historisierung und Verreichhchung des Archivs<br />
ARCHIVE IM POLITISCHEN EINSATZ<br />
1933 (folgende)<br />
Archive an der Schnittstelle zum Diskurs: Kriegsausstellungen<br />
Deutsch-polnische Frontstellung: Das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft und<br />
geschichtswissenschaftliche Fortbildung<br />
Die Enden <strong>von</strong> 1945<br />
DAS REICHSARCHIV: OPTIONEN UND REALITÄT<br />
Nachlaß eines <strong>Im</strong>periums: Das Reichskammergericht Wetzlar<br />
DestiNation 1848/49 folgende: Paulskirchen-, Bundes- und Reichsarchiv,<br />
Abteilung Frankfurt/M.<br />
Die Verfassungsurkunde <strong>von</strong> 1849<br />
Archivdiskussionen 1867/68 und Verreichhchung 1870/71<br />
Weltkrieg / Archiv<br />
DIE GEBURT DES REICHSARCHIVS AUS DEM GENERALSTAB<br />
Kriegsgeschichtsschreibung<br />
Zugangsbedingungen, Gedächtnissperren und Effekte der Büroreform<br />
Die Umgestaltung des Reichsarchivs (1932/33)<br />
Reorganisation 1937 und die politische Askese des Archivs<br />
Das Bild- und Filmarchiv<br />
Organisiertes Gedächtnis 1934: Datensynchronisation<br />
Archivschutz unter Weltkriegsbedingungen und Verluste 1945<br />
ARCHIVTRANSFER UNTER KRIEGSBEDINGUNGEN<br />
1815 und 1870/71 aus der Sicht <strong>von</strong> 1915<br />
Das Pariser Inventar (Weltkrieg II)<br />
Dienstbesprechungen (archiviert), Grenzlinien, Un/Ordnung<br />
Archivtransfer im Protektorat Böhmen und Mähren<br />
Aktenverschub und -nichtung 1945, und am Ende: das Telos deutschen Archiv-
20 LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS<br />
KEHRSEITE: DEUTSCH-JÜDISCHE ARCHIVLEKTÜREN UND<br />
3EDÄCHTNISLÖSCHUNG<br />
^olgen des Novemberpogroms<br />
\rchiv und Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt/M.<br />
\ktenausgabe als Mikrophysik <strong>von</strong> Gedächtnismachgt (Freund und Feind)<br />
Ceine Mythenschau: Germania Judaica (die jüdische Perspektive) und Rasseniunde<br />
aus Akten (die NS-Perspektive)<br />
Vn der Schnittstelle zur Öffentlichkeit bildet die Bibliothek eine (gegenüber Archiven)<br />
lifferente Speicherästhetik aus. Zuächst zwei wissensarchäologisch-systematische Zugriffe<br />
auf Methoden und Mechanik der Bibliothek:<br />
ilBLIOTHEKSRÄUME<br />
)as Wissenschaftliche System<br />
vlosterästhetik (Schrettinger, Ostwald)<br />
Vufstellung und Katalog<br />
4ECHANISIERUNG DER BIBLIOTHEK<br />
•tandorte und Bibliotheksmaschinen: Gedächtnis versus Erinnerung (Hegel)<br />
Zu-)Ordnung, Formatierung und Weltformat (Wilhelm Ostwald)<br />
•tandardisierung des Alphabets und Mechanisierung des Karteikastens<br />
)ann konkrete Fallstudien:<br />
.KCHÄOLOGJJ-; EINER NATJONAUiJßUOTHEK: DIE DEUTSCHE<br />
ÜCHEKEl<br />
ur Genealogie der Deutschen Bücherei aus dem Pflichtexemplar<br />
inale einer Nationalbibliothek: Arche 1913<br />
rchitekturen der Deutschen Bücherei<br />
itzung, Pragmatik und Katalogisierung der Deutschen Bücherei<br />
ine Ortsbegehung des deutschen Gedächtnisses<br />
;hillers Motto<br />
ERLAUFSFORMEN DER DEUTSCHEN BÜCHEREI<br />
uch(t)raum Deutschland: Nationalbibliothek und -graphie<br />
'ifferenzen 1933 und Kriegsbedingungen der Deutschen Bücherei<br />
>IE PAULSKIRCHENBIBLIOTHEK<br />
>ie Initiative Hahns 1848<br />
or- und Nachspiele der Parlamentsbibliothek<br />
n <strong>Namen</strong> der Nation
LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS 21<br />
Station Nürnberg<br />
Bibliothekstransfer 1938: Mythos und archivische Evidenz im Widerstreit<br />
PREUSSEN IN DEN BIBLIOTHEKEN: STAATSBIBLIOTHEK BERLIN<br />
Preußische Instruktionen und Gesamtkatalog<br />
Realkatalogisierung<br />
Kriege sammeln: 1870/71, 1914 und 1939 (Berlin, Leipzig)<br />
Logistik 1945ff<br />
Schriftmuseale Objekte und Buchstaben zirkulieren nach 1806 als (wissens-)archäologische<br />
Signifikanten des deutschen Gedächtnisses. Ihr Spiel oszilliert zwischen monumentaler<br />
Autorisierung des Diskurses im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong> und der Einsicht in ihre<br />
dokumentarisch nüchterne Medialität:<br />
LETTERN, BUCHSTÄBLICH: LITERATUR 1813, DIE LEIPZIGER<br />
BUGRA 1914 UND DAS DEUTSCHE KULTURMUSEUM<br />
Lettern 1813 (Fichte, Müffling)<br />
Deutscher Buchhandel als Dispositiv <strong>von</strong> Literatur DestiNationen der Palatino.<br />
Heidelberg<br />
Leipzig 1914: Die Internationale Ausstellung <strong>für</strong> Buchgewerbe und Graphik<br />
und deutsch-französische Frontstellungen<br />
Die Halle der Kultur bis an ein Deutsches Kulturmuseum<br />
Deutschland, buchstäblich: Der typographische Raum der Nation<br />
BUCH III handelt vom Kalkül, das in der behandelten Epoche jenseits des Historismus<br />
operiert. Die Kartographierung der deutschen Gedächtnislandschaft wird<br />
konkret im Medium des Denkmalinventars. Der Einbruch einer nicht mehr interpretierenden,<br />
sondern photogrammetrisch messenden Inventansierungstechnik generiert ihr<br />
anders gelagertes Archiv:<br />
NATION UND INVENTAR<br />
Metamorphosen des Denkmalbegriffs<br />
Inventarisation als Aufschreibesystem<br />
Jüdische Denkmalinventarisation (Bayern 1935)<br />
Denkmalverwaltung und -schütz nach 1870/71<br />
Ausfuhr <strong>von</strong> Kulturgut (1939) und Kunstschutz in Weltkriegen<br />
ZWISCHEN MESSBILD ANSTALT UND IMAGINÄREM MUSEUM:<br />
MEYDENBAUERS PHOTOGRAMMETRISCHES DENKMÄLER-<br />
ARCHIV<br />
Maß und Figur<br />
Karrieren der Photogrammetne<br />
Ein mcdicnarchäologisches datum: Unfall ... und Archiv
22 LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS<br />
Photographie und Gedächtnis<br />
Photogrammetrie im Militäreinsatz und in der Archäologie<br />
Denkmalinventarisation<br />
Photographische Reich(s)weiten: Monumenta Germaniae<br />
Photogrammetrie und Archiv<br />
Zwischen Meßbildanstalt und Denkmälerarchiv: Die Adressierung der<br />
Gedächtnisagentur als Schnittstelle <strong>von</strong> Realem und Symbolischen<br />
Der Zerstörung vorbeugen: Die vergangene Zukunft <strong>von</strong> Meydenbauers Prognosen<br />
Die Thematisierung des Inventars als Gedächtnismedium wird hier gekoppelt an ein<br />
ästhetisches Dispositiv, das seine Kehrseite darstellt: die Entwicklung statistischer Operationen.<br />
Archivisches und statistisches Denken stehen im wissensarchäologischen Verbund<br />
- eine Provokation der Erzählbarkeit <strong>von</strong> Historie. Gekoppelt an Staatsmacht<br />
bringt sie Subjekte zum Verschwinden:<br />
DER WISSENSARCHÄOLOGISCHE BLICK: STATISTIK<br />
Statistik zwischen Staats-, National- und Hilfswissenschaft<br />
Statistik und Historie: Beloch, Quetelet, Buckle, Droysen, Hegel<br />
Das Gesetz der Statistik: Zustände und Transformationen<br />
Visualisierung der Statistik: Otto Neurath und das Deutsche Kriegswirtschaftsmuseum<br />
Leipzig<br />
NEUE GEDÄCHTNISMASCHINEN IM DIENST DES DRITTEN<br />
REICHS (HOLLERITH, MIKROFILM)<br />
Statistische Nachweisbarkeit und ihre Automation als Medium des Antisemitismus<br />
Ein Mikrofilmprojekt des Reichssippenamts<br />
Verfilmung als Gedächtnisutopie: Genealogical Society und die Mikrophysik<br />
deutscher Speicher<br />
RESÜMEE<br />
<strong>Im</strong> bibliographischen Anhang stellt die Arbeit wenn nicht (wie in der Leseanweisung)<br />
ihr Betriebsgeheimnis, so doch die Datenbank aus, auf der sie beruht. Der abschießende<br />
Bilderatlas deutscher Gedächtnisagenturen sucht nicht nach Abbildern oder Allegorien,<br />
sondern ihren Schaltplänen:
LOGISTISCH KOMMENTIERTES INHALTSVERZEICHNIS 23<br />
DATENRÄUME: LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS<br />
DEUTSCHE SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
ABBILDUNGSLEGENDEN<br />
ANALYTISCHER NDEX
LESEANWEISUNG 1<br />
Eine erzählende oder aufzählende <strong>Geschichte</strong> gibt immer nur katalogartiges Tatsachenwissen.<br />
Sie läßt den Stoff in seiner zufälligen Gestalt bestehen. Geschichtliche<br />
Betrachtung aber hat ihn aufzuschließen und zu durchdringen. Sie hat<br />
analytische Methoden auszubilden, das heißt solche, die den Stoff »auflösen« (wie<br />
die Chemie mit ihren Reagentien) und seine Strukturen sichtbar machen. Die<br />
Gesichtspunkte da<strong>für</strong> können nur aus vergleichender Durchmusterung der Literaturen<br />
gewonnen, das heißt empirisch gefunden werden. 2<br />
Ist es möglich, sich in der Beschreibung einer Vergangenheit <strong>von</strong> der unreflektierten<br />
Nähe zum Archiv zu lösen und dennoch das Archiv durchscheinen zu<br />
lassen? Die vorliegende Arbeit versucht sich in diesem Sinne an einer Betrachtungsweise,<br />
die - nahe an der Wissensarchäologie Michel Foucaults - Strukturen<br />
sichtbar machen will; dementsprechend verweigert sie sich dezidiert dem<br />
historischen Diskurs, indem sie das klassische Medium der Historiographie, die<br />
Narration, ausdrücklich zu meiden sucht. Sie sucht damit letztlich auch das<br />
methodische Oxymoron einer historischen Archäologie zu vermeiden, wie sie<br />
der Historiker Wolfgang Schmale auf höchstem Niveau historischer Grundrechteforschung<br />
(Archäologie hier also als Subjekt und Objekt der Begründung<br />
/ arche) geschrieben hat. Ausdrücklich näher an Foucault »erster Archäologie«<br />
(Les Mots et les choses) denn am erst in der Archeologie du Savoir entwickelten<br />
Begriff des archive rückt Schmale <strong>von</strong> einer »allzu linear-kausalen Sicht« ab, um<br />
im Dienste einer künftig <strong>für</strong> Europa notwendigen »multi-hnearen <strong>Geschichte</strong>«<br />
rückwirkend neben »kausalen Kontinuitäten auch Diskontinuitäten und nicht<br />
kausal miteinander verbundene Erscheinungen« zu beschreiben. 3 Dennoch<br />
setzt auch Schmales Rekonstruktion <strong>von</strong> Rechtskulturtechniken, die sich mit<br />
der vorliegenden Untersuchung in der Zentralität der Analyse <strong>von</strong> Wissensspeichern<br />
und -Vermittlern einig ist, noch ein phatisches Modell <strong>von</strong> Historie<br />
voraus, eine Referenz außerhalb des archivischen Apparats, der die Untersu-<br />
1 Diese Leseanweisung, vorweg formuliert, bildet eine das Alpha und Omega aus Einleitung<br />
und Schlußfolgerung noch umklammernde Texteinfassung zweiter Ordnung.<br />
2 Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter [ :; 'Bern 1948],<br />
8. Aufl. Bern / München (Francke) 1973, 25<br />
3 Wolfgang Schmale, Archäologie der Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit:<br />
ein deutsch-französisches Paradigma, München (Oldenbourg) 1997, 116 u. 441;<br />
siehe speziell sein Kapitel »Archäologie des Rechts als Methode«, 108-117
26 LHSHANWKISUNG<br />
chung erst ermöglicht. Von daher bildet er seine diskursanalytisch avanciert<br />
erarbeiteten Befunde bei aller Nähe zu statistischen Diagrammen, zur formalen<br />
Relationierung und zur histoire serielle nach wie vor im Darstellungsmodus<br />
einer totalisierenden Historie ab. Demgegenüber strebt die vorliegende Arbeit<br />
nach einer medienarchäologischen Analyse, welche den Akzent einer<br />
<strong>Geschichte</strong> der Medien kultureller Überlieferung hin zu einer Untersuchung<br />
der Medien der <strong>Geschichte</strong> selbst verschiebt - was nicht ohne Konsequenzen<br />
<strong>für</strong> die Form der Darstellung bleibt. Sie findet da<strong>für</strong> Bundesgenossen etwa in<br />
Hans Ulrich Gumbrechts Versuch, das Jahr 1926 als Querschnitt zu schreiben.<br />
Auch Gumbrecht weiß um den Zusammenhang zwischen der inzwischen nicht<br />
mehr plausiblen didaktischen Funktion <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> und der Neigung,<br />
<strong>Geschichte</strong> narrativ zu begreifen und darzustellen; folglich »muß eine postdidaktische<br />
Einstellung zu unserem Wissen <strong>von</strong> der Vergangenheit das Streben<br />
nach nichtnarrativen Formen der historiographischen Darstellung beinhalten.« 4<br />
Der Verzicht auf den roten Faden der historiographischen Linearität zugunsten<br />
einer expliziten Synchronie <strong>von</strong> thematischen Modulen und nicht-diskursiven<br />
Realitäten, die »nicht zu einem kohärenten und homogenen Bild zusammenschießen«<br />
, aber führt zu Formen der Darstellung, die eigens eine<br />
vorweggestellte »Gebrauchsanweisung« verlangen. Ist ein Geschichtsdenken<br />
möglich, das auf das Nacheinander ihres Zeitrahmens, damit also auch auf subjektbestimmte<br />
Handlungskompetenz verzichtet? Auch der vorliegende Text<br />
besteht vielmehr aus einer Serie <strong>von</strong> thematisch verknüpften, methodisch aufeinander<br />
bezogenen, in Unterabschnitten ausformulierten und durch ein Netz<br />
indexialischer Querbezüge konfigurierten Datensätzen, deren Ordnung [patterns,<br />
oder im Sinne Curtius': »Durchmusterung«) <strong>von</strong> der Spezifik jeweilig nur<br />
bedingt ineinander übersetzbarer Gedächtnismedien, nicht der Historie vorgegeben<br />
ist: Editionen (Monumenta Germaniae Historica), Institute (Deutsches<br />
Historisches Institut Rom), Bildunternehmen (Urkunden- und Denkmalphotographie<br />
sowie -inventarisation), Speicher (Germanisches Nationalmuseum,<br />
Preußisches Archivwesen und Reichsarchiv, Deutsche Bücherei Leipzig und das<br />
Nationalbibliotheksphantom). Quer dazu objektorientierte Suchschnitte - eine<br />
in der tatsächlichen Grabungsarchäologie bereits veraltete Methode, ersetzt<br />
durch Stratifikation als »combination of strata and Interfaces« - die Schnittstelle<br />
zwischen Archiv und historischem Diskurs, im übertragenen Sinne dieser<br />
Arbeit. 5 Dazwischen Blitz(ein)schläge deutscher <strong>Geschichte</strong>: Speicherdatenverwaltung<br />
als Gewalt am deutsch-jüdischen Gedächtnis. In Form des gefrore-<br />
Hans Ulrich Gumbrecht, 1926. Ein Jahr am Rand der Zeit [ :: 1997], a. d. Amerikan.<br />
übers, v. Joachim Schulte, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 2001, 9<br />
Edward C. Harris, Principlcs of archaeological stratigraphy, London (Academic Press)<br />
2. Aufl. 1997,54
LKSHANWKISUNG 27<br />
nen Blitzes hat der Architekt Daniel Libeskinds die paradoxe Bauaufgabe der<br />
1988 ausgelobten Expansion der berlingeschichtlichen Sammlung gelöst: die<br />
Verklammerung mit einem gleichzeitig eigenständig und als Abteilung des Berlin<br />
Museums fungierenden Jüdischen Museum. Die widersprüchliche Autonomie<br />
beider Gebäude wird - als scheinbar gegenstrebige Fügung - an der<br />
Oberfläche bewahrt, »während die beiden in der Tiefe verbunden werden«. 6<br />
Die wissensarchäologische Krypta dieser unterirdischen Verbindung ist das<br />
Gedächtnis des Archivs, das divergierende Vergangenheiten verklammert.<br />
»Fragmentierung und Zersplitterung kennzeichnen den Zusammenhalt des<br />
Ensembles« . Auch die das deutsch-jüdische Gedächtnis betreffenden<br />
Abschnitte dieser Arbeit bleiben in den Kontext ihrer respektiven<br />
Speichermedien eingebettet, wenngleich sie (wie schießlich auch das Libeskind-<br />
Projekt) zur historisch-thematischen Verselbständigung tendieren.<br />
Die Arbeit präpariert technische Aspekte, wissensarchäologisch faßbare<br />
Konfigurationen, diskontinuierliche Momente und diskursive Schnittstellen<br />
deutscher Gedächtnisagenturen <strong>von</strong> 1806 bis 1945 nicht als Behauptung <strong>von</strong><br />
Generalthesen im Modus einer Wissenschafts- oder Institutionsgeschichte heraus,<br />
sondern als deren beharrliche Kleinarbeitung, als beschreibende Dekomposition<br />
ihres Anspruchs, Daten im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> zu verwalten. Was<br />
zwischen 1806 und 1945 diskursiv im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> verhandelt wird,<br />
ist als Gedächtnispraxis ihr non-diskursives Dementi. 7 Prägnante Kristallisationen<br />
<strong>von</strong> Gedächtisfiguren sind in dieser Arbeit daher nur bedingt chronologisch,<br />
sondern vielmehr in parallelgeschalteten, im Wissen um die Notwendigkeit<br />
<strong>von</strong> Redundanz in Informationsübertragungsprozessen vor gelegentlichen<br />
Wiederaufnahmen des schon Befundenen nicht zurückschreckenden Sondierungen<br />
angeordnet und als archäologische Suchschnitte sowohl durchgeführt<br />
wie lesbar. Es gibt daher kein zentrales Kapitel, wie es sich am Thema Reichsarchiv<br />
etwa angeboten hätte. Die großen <strong>Geschichte</strong>n der Monumenta Germaniae<br />
Historica in Berlin, des Deutschen Historischen Instituts in Rom, des Germanischen<br />
Nationalmuseums in Nürnberg, des Geheimen Staatsarchivs in<br />
Berlin und der Deutschen Bücherei in Leipzig sind längst geschrieben; der vorliegenden<br />
Arbeit geht es im dose reading, im Umlesen weitläufiger Passagen <strong>von</strong><br />
Primär- und Sekundärtexten dieser <strong>Geschichte</strong>n und in Kopplung mit der Evidenz<br />
ihrer archivischen Grundlagen (Doubles) vielmehr um den detaillierten<br />
6 Begründung der Jury zum 1. Preis, in: Realisierungswettbewerb Erweiterung Berlin<br />
Museum mit Abteilung Jüdisches Museum. Voraussetzungen, Verfahren, Ergebnisse,<br />
hg. v. d. Senatsverwaltung <strong>für</strong> Bau- und Wohnungswesen, Berlin (Januar 1990), 73<br />
7 Zum Widerstreit zwischen Historie als statistischer Datenverwaltung und als narrative<br />
Sprache siehe Jacques Ranciere, Die <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong>. Versuch einer Poetik<br />
des Wissens [»Paris 1992], Frankfurt/M. (S. Fischer) 1994, bes. 14,128f, 147 u. 150
28 LHSKANWEISUNG<br />
Nachweis, daß <strong>für</strong> die deutschen Gedächtnisagenturen 1806-1945 im Schatten<br />
des Totalitätshorizont <strong>Geschichte</strong> die Praxis im Umgang mit und in der Herstellung<br />
<strong>von</strong> Vergangenheit Speicherverwaltung heißt. Diese Praxis bedarf in<br />
der bezeichneten Epoche des Begriffs der <strong>Geschichte</strong> gar nicht, solange nicht<br />
diskursive Schnittstellen jenseits <strong>von</strong> Memorialtechniken es fordern; die Notwendigkeit,<br />
einer diskursiven Öffentlichkeit gegenüber Daten als <strong>Geschichte</strong><br />
erzählen zu sollen, führt zu einer unauflösbaren Spannung zwischen diskretmonumentaler<br />
und narrativ-dokumentanscher Aufarbeitung des deutschen<br />
Gedächtnisses. Die thematischen Module der vorliegenden Arbeit oszillieren<br />
ihrerseits zwischen diesen zwei Formen der Verarbeitung <strong>von</strong> Daten, die im<br />
Text anhand <strong>von</strong> Agenturen der Gedächtnisproduktion (Archiv, Museum,<br />
Bibliothek, Quelleneditionen und Denkmalinventare) unter Betonung der dem<br />
jeweiligen Medium eigenen Speicher- und Übertragungsform diskutiert werden.<br />
Zwischen den Zeilen einer durch Gedächtnismedien informierten Wissensarchäologie<br />
und ihrer historiographischen Darstellung ist die angesprochene<br />
Vergangenheit als Datenlage radikal präsent; <strong>von</strong> daher die Privilegierung<br />
des historischen Präsenz in der Darstellung und die Partikularität der einzelnen<br />
Befunde, die sich an die Aggregationen des Vorgefundenen, nämlich Akteneinheiten<br />
und Momentaufnahmen halten und den Raum dazwischen nicht mit narrativen<br />
Kunstgriffen überbrücken, sondern in seiner Leere, in seinen Diskontinuitäten<br />
ausstellen. Die dargebotenen Datensätze können wahlweise oder in<br />
Folge gelesen werden; wenn sie dabei fragmentiert erscheinen wie die Streuung<br />
gespeicherter Texteinheiten auf der Festplatte eines Computers, die erst im<br />
Moment der Adressierung wieder zu kohärenten Dateien zusammengelesen<br />
werden, erinnern sie gerade in der Zurückweisung literarischer Verknüpfungsmacht<br />
an die gedächtnistechnische Alternative zu historiographisch etablierten<br />
Kontextualitäts-Effekten. Die knappen, diskursiv vereinzelten und bisweilen<br />
aphoristisch isolierten Argumente im Verbund mit impliziten Verweisketten<br />
strukturieren die verstreute, durch Brüche und Interpunktionen gekennzeichnete<br />
Menge dokumentarischer Zitate. Was dabei bisweilen aussieht wie die<br />
Unfähigkeit, komplexe oder disparate Materie durch Darstellung in den Griff<br />
zu bekommen, da ebenso historische Dokumente wie einfache Beschreibungen<br />
<strong>von</strong> Sachverhalten zitiert werden, ist zumindest ebenso Ausdruck einer Weigerung,<br />
diskrete, aus Bibliothek und Archiv destillierte Datensätze im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> zusammenzuzwingen. Gibt es einen allzu großem Respekt vor<br />
einem Forschungsgegenstand »oder, besser gesagt, vor seinem eigenen Zettelkasten«?<br />
fragt Stefan Breuers Rezension <strong>von</strong> Michael Sukales Weber-Biographie.<br />
Sukale selbst meint, »in der Auswahl der Bruchstücke sein Stück Arbeit<br />
hinlänglich getan« zu haben, und begründet seinen Verzicht auf eine Auseinandersetzung<br />
mit der Forschung damit, daß, wer über Sekundärliteratur
LESEANWEISUNG 29<br />
schreibe, nur Tertiärliteratur hervorbringe . Kommentiert Breuer:<br />
»Vielleicht ist das so.« 8 Die Stärke der vorliegenden Arbeit liegt weniger in der<br />
Erschließung neuer Quellenbestände denn in ihrer andersartigen Verknüpfung.<br />
Die dabei zu Paraphrasen gerinnenden archivischen Befunde werden als Grabungsbericht<br />
einer medien- und wissensarchäologisch vermessenen Landschaft<br />
präsentiert 9 - eine Darstellung, die nicht behauptet, die Mengen ihres Gegenstandes<br />
jederzeit im (hermeneutischen) Griff zu haben und als Geschichtserzählung<br />
zu kontrollieren. <strong>Im</strong> gelegentlichen Scheitern einer argumentativ linearen<br />
Interpretation der Befunde, im fortwährenden Zusammenbruch narrativer<br />
Kohärenz und in die Unaufgelöstheit widersprüchlicher Aussagen kommt die<br />
agonale Verfaßtheit <strong>von</strong> speicherbasiertem Wissen um Vergangenheit und<br />
medienarchäologisch diskretes Wissen um Speichertechniken selbst zur Ausstellung<br />
- die Trümmerlandschaft <strong>von</strong> Gedächtnis abzüglich einer es zusammenzwingenden<br />
<strong>Geschichte</strong>. Ziel ist nicht ein weiterer historiographischer, also<br />
vom Begriff der <strong>Geschichte</strong> zusammengehaltener Beitrag zu Gedächtnisaggregaten,<br />
sondern der Versuch, dieselben abzüglich des historischen Diskurses diskret<br />
auszuhalten und zu (be-)schreiben. Archivische oder bibliothekarische<br />
Fundstücke sind, Karteikarten gleich, im Text gesondert ausgestellt; zu Begriffen<br />
verknappte Zitate zeigen sich im Fließtext kursiviert. Die Bruchstellen <strong>von</strong><br />
Diskurs und Archiv bleiben sichtbar.<br />
Lektüre dieser Arbeit und <strong>von</strong> Archiven<br />
»Die positivistische Geschichtsforschung macht sich eines Übergriffs in das<br />
Gebiet der Kunst schuldig, wenn sie versucht, die Geschichtsschreibung unter<br />
ihre Arbeitsregeln zu zwingen« 10 , wie umgekehrt »jede künstliche Klassifizierung<br />
der Dinge oder der Kenntnisse <strong>von</strong> den Dingen vor allem durch das Fehlen<br />
des Historismus gekennzeichnet« ist. 11 Daher verzichtet die vorliegende<br />
Studie auch weitgehend auf historiographische, also: literarisch gefilterte<br />
8 Über Michael Sukale, Max Weber. Leidenschaft und Disziplin. Leben, Werk, Zeigenossen,<br />
Tübingen (Mohr Siebeck) 2002, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 165<br />
v. 19. Juli 2002, 43<br />
9 Hier methodisch formuliert in Anlehnung an Christian Höller, Umbrüche. Zur Problematik<br />
diskursiver Verschiebungen, in: Texte zur Kunst, 7. Jg. Nr. 27, September<br />
1997<br />
10 Ernst H. Kantorowicz, Über Grenzen, Möglichkeiten und Aufgaben der Darstellung<br />
mittelalterlicher <strong>Geschichte</strong>. Historiker-Tagung, Halle, am 24. April 1930, in: Tumult.<br />
Schriften zur Verkehrswissenschaft 16 (1995), 5<br />
11 B. M. Kedrow, Klassifizierung der Wissenschaften, Bd. 1., Köln (Pahl-Rugenstein)<br />
1975,4
30 LKSEANWKISUNG<br />
Ansprüche in der Darstellung. Rudolf Focke definiert auf der 6. Versammlung<br />
Deutscher Bibliothekare in Posen 1905 die Form des Aggregats als kognitiv<br />
fragmentarische Anhäufung ohne inneren Zusammenhang im Unterschied zum<br />
System als Form der logischen Einheit} 2 Der historische, also erzählende und<br />
erzählte Diskurs, der - <strong>von</strong> Vorworten abgesehen - auf der Darstellungsebene<br />
indifferent gegenüber den Aggregatzuständen der Adressierungssysteme der<br />
<strong>von</strong> ihm verarbeiteten Gedächtnisse bleibt, soll hier also durch die Orientierung<br />
im archivischen Raum ersetzt sein: Daten-Rückpeilung}^ Eine Serie konkreter,<br />
mithin auch diskontinuierlicher Extrakte, samples und Tiefenbohrungen (jenseits<br />
wissensarchäologischer Metaphorik: data mining in Texträumen) spürt diskreten<br />
gedächtniskybernetischen Konfigurationen des Archivs im Archiv nach<br />
— eine Kasuistik <strong>von</strong> Handlungsregulativen anstelle <strong>von</strong> im <strong>Namen</strong> der Historie<br />
verallgemeinerten Aussagen. 14 An die Stelle <strong>von</strong> Generalisierungen treten<br />
objektorientierte Thesen mittlerer Reichweite. Archivische Datenmengen werden<br />
dabei nicht neu erzählt, sondern neu konfiguriert - und das nicht im Sinne<br />
rhetorischer Figuren, sondern <strong>von</strong> Modellen, die modular auf ein Textgitter eingetragen<br />
werden, das um die Lücken, Fragmentaritäten und Anschließbarkeiten<br />
nicht nur weiß, sondern sie auch ausstellt. Wenn sich Historiker heute<br />
weniger an Theorien denn an Modellen ausrichten, ist auch die Rede vom<br />
Muster zunächst im statistischen Sinne zu verstehen 15 , wie sie in dieser Arbeit<br />
einerseits Gegenstand der kritischen Rekonstruktion, zugleich aber die implizite<br />
Provokation narrativer Historiographie darstellt. Als Voraussetzung der<br />
Aussage ist das Archiv mit im Spiel, das, als Archiv geschrieben, nicht länger<br />
den blinden Fleck der Selbstbeobachtung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> bilden soll. Dennoch<br />
kann es nicht in seiner Totalität be- und geschrieben werden, solange nicht die<br />
Kategorie <strong>Geschichte</strong> eine künstliche Beobachterdifferenz einzieht. Foucault<br />
ist dieser Aporie nicht entkommen, indem er seine Archäologie des Wissens erst<br />
als nachträgliche Methodisierung <strong>von</strong> Die Ordnung der Dinge abzufassen vermag,<br />
ihrerseits aber nicht objektorientiert zur Durchführung bringt. Sind<br />
Schreiben aufgrund des Archivs und Nachdenken über das Archiv nur als<br />
getrennte Operationen realisierbar, oder konvergieren sie im gedächtnisme-<br />
12 Rudolf Focke, Allgemeine Theorie der Klassifikation und kurzer Entwurf einer<br />
Instruktion <strong>für</strong> den Realtkatalog, Posen (Jolowicz) 1905<br />
13 Thomas Pynchon, Die Enden der Parabel, Reinbek (Rowohlt) 1981, 909<br />
14 Zur Differenz <strong>von</strong> Narrativität und Kasuistik siehe Mohammed Rassem /Justin Stagl,<br />
Expose, in: dies. (Hg.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit, Paderborn u.<br />
a. (Schöningh) 1980, 11-16 (14)<br />
15 Patrick Bahners, Die Vernünftigkeit des Fehlerhaften. Musterbuchprüfung: Eine<br />
Inventur der Frühncuzcitforschung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 18. Oktober<br />
1995, unter Bezug auf den Historiker Winfried Schulze (München)
LliSEANWEISUNG 31<br />
dienarchäologischen Zugriff? Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die Formationen,<br />
das Skelett und die archivischen Anordnungen <strong>von</strong> Gedächtnis wissensvektoriell<br />
anzuschreiben; in diesem Sinne schreibt Richard Pfennig<br />
wissenschaftshistorisch (besser: wissensarchäologisch) <strong>von</strong> der »Gruppierung<br />
der Tatsachen«. 16 Hinter dem Isomorphismus <strong>von</strong> Gedächtnis, Kapital, Speichern<br />
und Institutionen sucht diese radikale Archäologie also nicht länger eine<br />
generierende epistemologische Kraft als geheimen Drahtzieher diskursiver<br />
Marionetten auszumachen, sondern deren Koexistenz diskret, ohne nostalgische<br />
Fragen nach ihrer Verursachung, zu registrieren. Die Begriffe der archivischen<br />
Registratur, des museologischen Inventars und des bibliothekarischen<br />
Repertoriums figurieren somit nicht schlicht als Objekt, sondern ebenso als<br />
Agenten der Darstellung. Arche wird hier jeweils als Anweisung zur Modellbildung,<br />
nicht als Ursprung (und wenn, dann als Verweis auf eine sprunghafte<br />
wissensarchäologische Diskontinuität) verstanden.<br />
Wunschbild dieser Arbeit ist die Darstellung eines Systems, das Gedächtnis<br />
und der Adressat seines Gedächtnisses zugleich ist. 17 Für einmal fallen in dieser<br />
Arbeit Gegenstand und Methode, Repräsentanz und Repräsentiertes in eins:<br />
Das Thema, die deutschen Gedächtnisspeicher (Archiv, Bibliothek, Museum)<br />
und ihre Agenturen (Monumenta Germaniae Historica, Denkmälerstatistiken,<br />
Gedächtnismaschinen) ist zugleich der Nachweis der Orte, an denen ihre Erforschung<br />
sich schrieb; im Prozeß der Transformation ihrer Fundstücke in den<br />
argumentativen (wenn nicht erzählenden) Zusammenhang einer wissensarchäologisch<br />
orientierten Darstellung erhoben sich die Erfahrungen der konkreten<br />
Ab-Schreibszenen wie Phantome aus dem Schacht der Erinnerung. Diese<br />
Nähe zu den in sich höchst verschieden konfigurierten Gedächtnismedien gibt<br />
entsprechend variierende Schreib- und Darstellungsstile vor. In jedem Fall sollten<br />
Zitate (ob Primär- oder Sekundärquellen im Sinne der Beobachterdifferenz)<br />
als Elemente einer semiotischen Einbettung in konkrete Institutionen unangetastet<br />
bleiben wie ein wissensarchäologisches Artefakt, das entdeckt, geborgen,<br />
registriert, kommentiert und ausgestellt, nicht aber schadlos als Teilmenge einer<br />
16 Richard Pfennig, Wer hat zuerst die Analysis <strong>von</strong> der Metaphysik emancipiert?, in:<br />
Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. August Wilmanns zum 25. März 1903<br />
gewidmet, Leipzig (Harrassowitz) 1903, 499-514 (500)<br />
17 Siehe Ranulph Glanville, What Is Memory, That It Can Remember What It Is?, in: R.<br />
Trappl / G. Pask (Hg.). Progress in Cybernetics and Systems Research, Bd. IV, Washington,<br />
D.C. / London 1978, 27-37; dt. in ders., Objekte, Berlin (Merve) 1988. Siehe<br />
Dirk Baecker, Überlegungen zur Form des Gedächtnisses, in: Siegfried J. Schmidt<br />
(Hg.), Gedächtnis: Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung,<br />
Frankfurt/M. (Suhkarhp) 1991, 337-359 (344), sowie der., Anfang und Ende<br />
in der Geschichtsschreibung, in: Bernhard Dotzler (Hg.), Technopathologien, München<br />
(Fink) 1992,59-85
32 LKSEANWKISUNG<br />
unterstellten <strong>Geschichte</strong> in Erzählung transformiert werden kann. Von daher<br />
operiert die Arbeit nicht flächendeckend, sondern <strong>von</strong> ihren Ausgangspunkten<br />
her, d. h. konkreten Archivlagen, die nicht diskursiv umgeschichtet, zerstückelt<br />
und narrativ rekonfiguriert werden, anderenfalls sie ihre Gestalt verlören.<br />
Gleichzeitig werden die Zitate nicht durch elegante metonymische, also rhetorische<br />
Operationen zur evidentiellen Illustration in den diskursiven Fluß der<br />
Narration integriert, sondern stehen dazu in einem eigen-, wider- oder auch<br />
dysfunktionalen Verhältnis. Denn zwei Paradigmen strukturieren die vorliegende<br />
Arbeit: eine histonographsche und eine medienwissensarchäologische<br />
Achse. »Da es keine Selbstorganisation eines kulturellen Gedächtnisses gibt, ist<br />
es auf Medien und Politik angewiesen« 18 ; so werden Museum, Bibliothek und<br />
Archiv als Gedächtnisagenturen, deren exemplarische Untersuchung das Kernstück<br />
der Texte ausmacht, sowohl als Behauptung wie als konkret gewordene<br />
Institutionen analysiert. Auf dem Spiel steht dabei nicht die Integration, sondern<br />
das Nebeneinander <strong>von</strong> Theorie und Positivitäten der Historie. <strong>Geschichte</strong><br />
(Narration) übt als Medium der Reduktion <strong>von</strong> Komplexität archivischer<br />
Primär- und Transformation bibliothekarischer Sekundär- zu historiographischen<br />
Tertiärdaten Gewalt aus. Angesichts der radikalen Gegenwärtigkeit des<br />
Dispositivs solcher Informationsträger (mit dem Bezugspunkt und als Bestandteil<br />
deutscher Vergangenheit) bietet sich alternativ zum Anspruch geschlossener,<br />
umfassender Darstellungen und Thesen, die Einzelfälle zum illustrierenden<br />
Beleg degradiert, der modulare, mikroanalytische Zugriff auf diskrete<br />
Datenmengen an. Fokussiert werden Dokumente, Intrigen, Situationen und<br />
Konstellationen <strong>von</strong> Gedächtnistechniken an der Schnittstelle zum historischen<br />
Diskurs 19 , dabei die sich auftuende Kluft dazwischen nicht nur in Kauf genommen,<br />
sondern geschrieben wird, diskontinuierlich und brüchig, ständig<br />
anschlußfähig <strong>für</strong> Kopplungen weiterer Module 20 - in der Absicht, die Autonomie<br />
<strong>von</strong> Speichern, ihre logistische Selbstreferenz gegenüber jenem <strong>Namen</strong><br />
der <strong>Geschichte</strong> nachzuweisen, dessen Behauptung <strong>für</strong> den betreffenden Zeitraum<br />
<strong>von</strong> 1806 bis 1945 (<strong>von</strong> Napoleon bis Alan Turing, <strong>von</strong> Hegel bis Frie-<br />
18 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen<br />
Gedächtnisses, München (Beck) 1999, 15. Diese Monographie erschien erst nach<br />
Abschluß der vorliegenden Arbeit; eine Reihe thematischer Korrespondenzen ist<br />
implizit.<br />
19 <strong>Im</strong> Sinne <strong>von</strong>: H. La Fontaine / Paul Otlet, Die Schaffung einer Universalbibliographie<br />
[1895], in: Peter R. Frank (Hg.), Von der systematischen Bibliographie zur Dokumenation,<br />
Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 1978, 143-169 (144, Punkt 4)<br />
20 Es geht bei einer nur scheinbar arbiträren Kopplung heterogener Aussagen um den<br />
Nachweis <strong>von</strong> Strukturhomologien diverser Speicher-, Gedächtnis- und Kulturtechniken;<br />
vgl. Stefan Rieger, Speichern, Merken: die künstlichen Intelligenzen des Barock,<br />
München (Fink) 1997, Einleitung (8)
LliSUANWIüSUNG 33<br />
drich Meinecke) ebenso gilt wie <strong>für</strong> jene historiographischen Werke, denen<br />
ablesbar ist, ob sie vornehmlich in Räumen der Bibliothek oder in Archiven verfaßt<br />
wurde (autopoetische Schwellenwerte). Es geht also um Hervorhebungen<br />
<strong>von</strong> Archiveinheiten im Sinne einer Exposition, die aus dem Depot Ausschnitte<br />
ausstellt, die gegebenenfalls zurückzusinken in die Latenz des Magazins. Auch<br />
die Ästhetik der Philologie, lange Garant hermeneutischer Ganzheitsansprüche,<br />
ist eine Funktion dieser Transformation, denn an die Stelle der klassischen Ausgabe<br />
mit dem autoritativen Text rückt die historisch-kritische Ausgabe, »die ihn<br />
in seine Stufen zerlegt und die Pluralität <strong>von</strong> Lesarten aufdeckt, zuweilen einen<br />
Kult des Bruchstücks betreibt.« 21 Für eine selbstbewußte Philologie, die weiß,<br />
daß die Schönheit im Detail liegt, gilt in Abwandlung eines Spruches <strong>von</strong> Karl<br />
Kraus: »Je näher man eine Handschrift ansieht, desto ferner sieht sie zurück«<br />
. Die Logik des zuweilen sprunghaft erscheinenden Verknüpfungsmodus'<br />
dieser Arbeit hat diese Form, da sie nicht mehr dem Phantom einer<br />
historischen Kohärenz nachjagt, sondern der die Logistik, den Zeigern der<br />
Gedächtnisverknüpfung in ihrer radikal räumlichen Verfaßtheit folgt. Ausgangspunkt<br />
ist die Kontingenz archivischer Befunde. Verschwindet, wenn die<br />
Bruchstücke des Archivs als solche zur Ausstellung, also als Aussagen des Dispositivs<br />
Archiv zur Geltung kommen, die originäre Eigenleistung des Autors?<br />
In Nietzsches philologischen Aufzeichnungen findet sich eine Bemerkung als<br />
Keimzelle seiner literarischen Technik: ein »fortwährendes Umkleiden des<br />
Gedankens mit anderen Formen, um den Wert der gewählten zu schätzen«. Es<br />
geht also um kritische Reformulierung. Nietzsches Basler Vorlesung <strong>von</strong><br />
1872/73 zur antiken Rhetorik ist, wissensarchäologisch gelesen, eine lückenlose<br />
Montage <strong>von</strong> Zitaten. Und in seinen Democritea zitiert Nietzsche das Verdikt<br />
eines Anhängers <strong>von</strong> Epikur (der in allem Original sei) über Chrysipp:<br />
»Man möchte nur aus seinen Schriften die Zitate wegnehmen und man würde<br />
sehen, daß das leere Papier zurückbliebe«. 22 Nachdem die Chimäre der historischen<br />
Narration zerlegt ist, wird freilich die Frage drängend, worauf eine<br />
Wissensarchivologie denn hinauswill. Archive erfassen und dokumentieren<br />
lediglich »diskontinuierliche Stationen einer Historie« , da<br />
ein Echtzeit-Verhältnis zwischen Proliferation und Speichern die Kapazität des<br />
Archivs sprengen würde. Damit ist dem Begriff der Diskontinuität in Foucaults<br />
Archäologie eine konkrete Manifestation im Sinne des Archivs abge-<br />
21 Sigle »L.J.«, Der Zauber der Handschrift, über den Serienbeginn »Wir vom Archiv«<br />
mit Fundstücken aus dem Quelleninstitut des Deutschen Literaturarchivs Marbach,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 12. August 1997<br />
22 Henning Ritter, Nietzsche <strong>für</strong> Philosophen? Zu einer Tagung über<br />
seine philosophischen Anfänge, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 25. März<br />
1992, N5
34 Ll-SKANWKISUNG<br />
wonnen, und zugleich die Grenze der histonographischen Narration markiert.<br />
Wenn in dieser Arbeit die Schilderung der Leitmedien Archiv, Bibliothek und<br />
Museum entlang führender deutscher Gedächtnisagenturen verläuft, geschieht<br />
dies nicht in einer umfassenden, in sich geschlossenen Weise (was in entsprechenden,<br />
narrativ schlüssigen Monographien hinreichend geleistet ist), sondern<br />
vielmehr pointiert in Hinblick auf Konfigurationen der Gedächtnisverwaltung.<br />
An die Stelle einer historischen Darstellung (gleichwohl chronologischen Seriationen<br />
folgend) tritt hier also ein (gedächtnis-)medienarchäologischer Zugriff,<br />
eine Funktion der Archiv-Sondierungen, die damit eine andere, radikal ahistoriographische<br />
Ordnung der Textmodule eröffnen und transparent werden lassen.<br />
Die einzelnen Abschnitte schreiben sich objektorientiert, d. h. ihrem<br />
jeweiligen Gegenstand entsprechend mehr oder minder diskursiv - bis hin zu<br />
Ausführungen, die nicht nur um den Inhalt einziger Akte(n) kreisen, sondern<br />
ihre Sequenz als Ablage beschreiben. Die Kontingenzen der Forschungszusammenhänge,<br />
Bibliotheks- und Archivzugänge und die Suchkriterien des<br />
Autors sind gekoppelt an die Kontingenzen ihres archivischen Dispositivs im<br />
Konkreten. Das Ergebnis sind Modelle <strong>von</strong> Konfigurationen der Vergangenheit,<br />
nicht <strong>Geschichte</strong>(n). Die Textmodule verstehen sich als Symptome eines nicht<br />
organischen, sondern Text-Körpers, als Markierungen einer Karte, die ihrerseits<br />
kein reales Land meint, sondern sein Modell ist. Für diese Arbeit gilt mithin auch<br />
eine Erfahrung Johann Wolfgang <strong>von</strong> Goethes in der Arbeit an der Ipbigenie:<br />
»So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie <strong>für</strong> fertig erklären, wenn<br />
man nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat.« 23 Die ausgestellten<br />
Archiv-samples bilden einen Flickenteppich in Hinblick auf ihre Lücken, die hier<br />
ausgestellt werden sollen, im Unterschied zum Vorschein einer Fülle <strong>von</strong> Historie;<br />
ihre Auswahl ist dennoch nicht primär im historischen Kontext exemplarisch,<br />
sondern gedächtnisarchäologisch signifikant. 24 Die Konfrontation mit<br />
historischer Evidenz im Archiv ist derart, daß, je diskreter man die Dokumente<br />
anschaut, ihr scheinbar historischer Zusammenhang desto ferner rückt. Vielmehr<br />
entrückt, lösen sich die Bestandteile der Historie in diskrete Monumente auf. Ihr<br />
lokales Wissen heißt jeweils Dossier (respektive Akte). Aus diesen Aggregaten<br />
schreibt sich die vorliegende Arbeit in rhythmischen Abständen, d. h. sie wurden<br />
behutsam in kohärente Textzusammenhänge transformiert, ohne den diskreten<br />
Charakter einer begrenzten Reichweite der Aussage zu überschreiten.<br />
23 Zitiert nach: Lexikon der Goethe-Zitate, Zürich / Stuttgart (Artemis) 1968, Vorwort<br />
des Herausgebers (Richard Dobel)<br />
24 Vgl. David Marc Hoffmann, Zur <strong>Geschichte</strong> des Nietzsche-Archivs: Elisabeth Förster-Nietzsche,<br />
Fritz Koegel, Rudolf Steiner, Gustav Naumann, Josef Hofmiller;<br />
Chronik, Studien und Dokumente, Berlin / New York (de Gruyter) 1991, Vorwort,
LKSEANWKISUNG 35<br />
Die Behauptung einer Asymmetrie <strong>von</strong> monumentaler Denkmal- als Symbolpolitik<br />
gegenüber einem geschichtswissenschaftlich erfaßten, d. h. dokumentfixierten<br />
Realen der Historie 25 würde bereits das <strong>Im</strong>aginäre der <strong>Geschichte</strong><br />
(und der Nation) verfehlen, in deren <strong>Namen</strong> sie sich schreibt. Das Reale interveniert<br />
überhaupt erst mit den messenden und rechnenden Medien, als Positivierung<br />
jenes Reellen gemäß Jacques Lacan, das sich - selbst(-)redend - der<br />
historischen Beschreibbarkeit apriori entzieht, da alle Schrift (und damit die<br />
archivische Ordnung) schon wieder auf der Ebene des Symbolischen operiert. 26<br />
Der Dreischritt <strong>von</strong> Sammeln-Speichern-(Er-)Zählen im Titel dieser Arbeit<br />
bezeichnet diese real-symbolisch-imaginäre Differenz sowohl als historischepochale<br />
Folge wie als medienarchäologische Zustandsmodi. In Maurice Halbwachs'<br />
Ausführungen »erscheint das Archiv nicht. Wollte man es dennoch<br />
einführen, so wäre es nicht die <strong>Geschichte</strong> schlechthin und auch nicht das<br />
kollektive Gedächtnis.« 27 Halbwachs' quasi-metaphysische Instanz eines kollektiven<br />
Gedächtnisses täuscht über das real existierende Archiv hinweg, lenkt<br />
ab <strong>von</strong> der präzisen Analyse jener Gedächtnisagenturen, welche speichermächtig<br />
Erinnerung verschalten - jene installierten lieux de memoire als Institution,<br />
wie sie Foucault als geschichtskulturelle Monumentalisierungsformen definiert.<br />
Demnach ist es ein präzises System der Abarbeitung an aus Vergangenheit<br />
überkommenen Materialitäten (Bücher, Texte, Register, Akten, Gebäude, Institutionen,<br />
Regelungen, Techniken, Realien), welches in jeder Gesellschaft organisierte<br />
Formen bildet und dazu dient, dieser wissensarchäologischen<br />
Datenmenge, <strong>von</strong> der sie sich strategisch nicht trennt, Gesetz und Ausarbeitung<br />
zu geben. 28 Der Blick auf Vergangenheit ist eine Disposition des Archivs; unter<br />
dem Begriff der Wissensarchäologie hat Foucault daran erinnert; <strong>von</strong> dieser und<br />
seinerseits - wieder - kategonal zwischen Monument und Dokument in der<br />
Forschungs- und Darstellungspraxis differenziert. Die vorliegende Arbeit über<br />
die Relation <strong>von</strong> diskursorientierten Denkmälern der Geschichtskultur und<br />
non-diskursiven Gedächtnisagenturen in Deutschland nimmt diese Spur<br />
25 Dazu Aleida Assmann, Arbeit am national Gedächtnis. Eine kurze <strong>Geschichte</strong> der<br />
deutschen Bildungsidee, Frankfurt/M. u. a. (Campus) 1993, 52<br />
26 Siehe Hermann Lang, Die Sprache und das Unbewußte: Jacques Lacans Grundlegung<br />
der Psychoanalyse, Frankfurt/M. (Suhrkamp), 2. Aufl. 1993, bes. 146. Zur im-mediaten<br />
Vorstellung der Materie als »das unmittelbar und zweifellos gegebene Reale« siehe<br />
Ernst Mach, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum<br />
Psychischen, 9. Aufl. Jena 1922, 198<br />
27 Axel Jürgen Behne, <strong>Geschichte</strong> aufbewahren. Zur Theorie der Archivgeschichte und<br />
zur mittelalterlichen Archivpraxis in Deutschland und Italien, in: Peter Rück (Hg.),<br />
Mabillons Spur, 1990, 277-297 (283)<br />
28 Michel Foucault, Archäologie des Wissen ( !: 'Paris 1969), Frankfurt/M. (Suhrkamp) 6.<br />
Aufl. 1994, 15
36 LKSHANWKISUNG<br />
anhand der Ergebnisse eines komparativen Forschungsprojekts zu Monumentalisierungsformen<br />
des Nationalen und zur (quasi-)sakralen Verfaßtheit nationaler<br />
Zeiträume auf 29 , nicht ohne auf der eigenen Darstellungsebene den<br />
diskursiven Widerstreit <strong>von</strong> Monument und Dokument in der Repräsentation<br />
<strong>von</strong> Vergangenheit widerzuspiegeln: als doppeltes Register <strong>von</strong> diskreten,<br />
modularen (und mithin anschlußfähigen, offenendigen, textil ausfransenden)<br />
Schriftstücken auf Seiten <strong>von</strong> Gedächtnis, Monument und Archiv einerseits,<br />
und <strong>von</strong> (geschlossenen) Narrativen auf Seiten <strong>von</strong> Erinnerung, Dokument und<br />
<strong>Geschichte</strong> andererseits. So ist der Text auf zwei Ebenen lesbar: Als lose verkoppelte<br />
Ordnung und Ausstellung textueller (Be-)Funde stellt sie dem Leser<br />
die Option ihrer Rekombination zur Verfügung; gleichzeitig erhält diese Serie<br />
<strong>von</strong> Zitaten und Exzerpten Form durch das Angebot begleitender Argumente,<br />
die geschichtskritischen Grundthesen dieser wissensarchäologisch angelegten<br />
Arbeit. Sie sucht also nicht so sehr nach den Intentionen und Motiven handelnder<br />
Subjekte, nicht nach den primordialen Stimuli des historischen<br />
Diskurses, sondern versteht sich als dessen Umschrift, »a rule-governed transformation<br />
of something which has already been written.« 30 Genau so arbeitet<br />
auch das Archiv als Institution, schon formierte Akten der Administration weiterverarbeitend,<br />
speichernd, übertragend. Die historische Rekonstruktion<br />
medialer Infrastrukturen einer Nation und ihrer topologischen Gedächtnisorte<br />
im 19. und frühen 20. Jh. teilt also ihren Darstellungsmodus mit dem Medium,<br />
durch welches Deutschland als Nation diskursiv erst herstellbar war und das<br />
somit auch ein inneres Objekt der Studie bildet: die Erzählung. 31 Wahrscheinlich<br />
ist einer der Wege, der figurativen, qua Sprache notwendig rhetorisch prästrukturierten<br />
historischen Analyse dieses diskursiven Gitters zu entrinnen, sich<br />
buchstäblich einzuschreiben in seine sukzessiven Transformationen, in Angleichung<br />
an genau jene faktographischen, nüchternen Präsentationsformen, welche<br />
den Klartext der Nation als administrativen Akt (archivbezogen: Akten)<br />
formierten - wenngleich diese unter einer Decke »Großer Erzählungen« (Jean-<br />
Francois Lyotard) wie <strong>Geschichte</strong>, Nation, kaschiert waren und verborgen<br />
29 Nationalism and the molding of sacred space and time, Forschungsprojekt der<br />
Deutsch-Israelischen Stiftung <strong>für</strong> Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung<br />
(Jerusalem/München); Projektdauer Januar 1990 bis September 1994.<br />
30 Athar Hussain, A brief resume of the Archaeology of Knowledge, in: Theoretical<br />
Practice, Doppelheft 3/4 (Marxism & the Sciences), Herbst 1971, London, 104-107<br />
(105), unter Bezug auf Michel Foucault<br />
31 Auf diese Grenzwerte narrativer Sequenzen im Rahmen <strong>von</strong> Diskursanalysen kommt<br />
Friedrich Kittler zu sprechen, interviewt <strong>von</strong> Alessandro Barberi: Weil das Sein eine<br />
<strong>Geschichte</strong> hat, in: Osterreichische Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaften, 11. Jg.,<br />
Heft 4 (2000), 109-123
LESEANWEISUNG 37<br />
daher umso effektiver am Werk waren, in jenen Hohlräumen des Schweigens,<br />
den die Erzählung ausspart. Alternativ zur historischen Apperzeption der Vergangenheit<br />
fordert Berel Lang: »Only a chronide of the facts is warranted,<br />
because otherwise one opens up oneself to the dangers of narrativization and<br />
the relativization of emplotment.« 32 Dem setzt Saul Friedländer ein quasianthropologisches<br />
Bedürfnis nach Erzählung entgegen, »the need of some stable<br />
narration«; »a mere enumeration of events leaves us at best with annnals or a<br />
chronicle« 33 . Genau dieser Faktizität aber gilt es standzuhalten, und das heißt:<br />
keine Metahistorie, jetzt nicht mehr; angesichts archivischer Datenfriedhöfe gilt<br />
vielmehr die archäologische Analyse <strong>von</strong> skelettierter Historie. 34 Mit einer<br />
gewissen Inhumanität der Wissensarchäologie (also der Ausgeschlossenheit des<br />
Subjektfaktors) korrespondieren Konstruktionstechnik und Stil dieser Arbeit:<br />
modulare Bausteine aus Archiv, Museum und Bibliothek fügen sich zu einer<br />
un(ab)geschlossenen Aufzählung (eher denn Erzählung) des Themas im<br />
Modus der Anschließbarkeit; Daten, Archivbefunde und Thesen werden<br />
innerhalb einzelner Kapitel im wiederholten Aufgriff eher sequentiell unter<br />
dem Aspekt verschiedener Kopplungen verarbeitet und folgen damit keiner<br />
geschlossenen historischen Reihe, die Anschlüsse eher ausschließt. Vergleichbar<br />
objektorientierten Programmiersprachen bietet der Text dem Leser den<br />
modularen Zugriff auf Archiv- oder Bibliotheks-Bausteine an, die jeweils<br />
aktuell benötigt, also aktiviert werden und mithin <strong>von</strong> der Notwendigkeit, im<br />
eigenen Text das umfangreiche Komplettprogramm Historie zu speichern,<br />
entlasten. Der Text dieser Arbeit übernimmt vorläufig historiographische<br />
Bausteine vorliegender Erzählungen, um sie an akuten Stellen durch jene<br />
O-Töne aus dem Archiv zu ersetzen, auf die sie - in Form <strong>von</strong> Fußnoten -<br />
selbst immer schon verweisen.<br />
Archivographie als Verknappung der Historie<br />
Archive, Bibliotheken und Museen speichern und verzeichnen nach analogen<br />
Kriterien <strong>Geschichte</strong>. <strong>Geschichte</strong> als Medium der Reduktion <strong>von</strong> Komplexität<br />
versagt aber ihrererseits in der Darstellung <strong>von</strong> Archiven und weiterer Forma-<br />
32 Berel Lang, paraphrasiert <strong>von</strong> Hayden White, Historical Emplotment and the<br />
Problem of Truth, in: Saul Friedländer (Hg.), Probing the Limits of Representation:<br />
The Holocaust and the »Final Solution«, Cambridge, Mass. / London 1992, 37-53 (44)<br />
33 Introduction, in: Friedländer 1992: 5<br />
34 Vgl. Heinrich Harke, The Anglo-Saxon Weapon Burial Rite, in: Past and Present No.<br />
126 (February 1990), 22-43 (24)
38 LKSKANWKISUNG<br />
tionen der Datenspeicherung, weil sie als historiographische Narration gerade<br />
deren Gedächtnistektonik verfehlt. Angesichts der radikalen Gegenwärtigkeit des<br />
archivischen Dispositivs der Informationsträger zum Bezugspunkt deutsche Vergangenheit<br />
bietet sich der modulare Zugriff auf Informationsfragmente an, und<br />
das heißt: Lücken in Kauf zu nehmen, ständig anschlußfähig zu bleiben <strong>für</strong> Kopplungen<br />
weiterer Module. <strong>Im</strong> Unterschied zur Geschlossenheit <strong>von</strong> Erzählstrukturen<br />
gilt <strong>für</strong> modulare Darstellung die prinzipielle Reversibilität der Befunde;<br />
insofern changiert die Schreibweise zwischen Ausstellung des Archivs und Argument.<br />
Das Archiv (d. h. die Struktur der Gedächtnisagenturen Archiv, Bibliothek/Magazin,<br />
Museum/ Depot) transitiv zu schreiben heißt (s)einer prinzipiell<br />
offenen, supplementierbaren Katalogstruktur zu folgen - einer Karteiform, die in<br />
der Informatik längst als bypercard wiederentdeckt worden ist. So interpretiert<br />
auch Friedrich Kittler Michel Foucaults methodische Grundentscheidung, »keinerlei<br />
Reflexivität zuzulassen, sondern nur Beziehungen, die man transitiv nennen<br />
könnte im Sinne der mathematischen Transitivität, daß sich a zu b verhält und<br />
nie a zu
Ll-SEANWEISUNG 39<br />
arbiträre Verweisungen aussprechen - analog zu jenem Verweissystem, das in<br />
Form <strong>von</strong> Referenzen und Fußnoten <strong>von</strong> Texten aus der entsprechenden Epoche<br />
(Epoche hier als Archiv-Abschnitt, als Fonds) angelegt ist, also positiv vorliegt.<br />
Die Hervorhebung <strong>von</strong> Archiveinheiten hat den Sinn einer (T)Ex(t)position, einer<br />
Positionierung, die aus dem Depot Abschnitte ausstellt, um sie gegebenenfalls<br />
wieder in dessen Latenz zurückzuversenken. Inwieweit lassen sich Diskurse verknappen,<br />
d. h. in eine nur spärlich mit argumentativen, weisenden Narrationsscharmeren<br />
ausgestattete Serie <strong>von</strong> Archivzitationen verwandeln? Oder wird der<br />
Autor damit im ursprünglichsten Sinne des Wortes selbst zum Vermehrer der<br />
copia der Exzerpte? Die Archivmodule würden dadurch nicht schlicht in Argumente<br />
verwandelt und zugleich abgekürzt, sondern zwischen ihnen werden<br />
Kurzschlüsse hergestellt, Textmengen also geschaltet. Die Metapher spricht Klartext:<br />
Nicht um das Wesen der Dinge geht es (Schrift), sondern um ihre Relationen,<br />
Schaltungen also, um Modularität, um Diskursanalyse als Mikrophysik der<br />
Macht (Deleuze / Foucault). Das heißt Arbeit am Ort der Brüche; nur Bruchstellen<br />
sind Fundorte (Benjamin) zur Analytik der Macht. Technische Formen<br />
der Rationalität (Klassifizierungstechniken etwa) sind anderen Formen der Macht<br />
wie Erkenntnis oder Technik nicht fremd; »wir treffen denselben Typen verlagert<br />
wieder, dichte und vielfältige Schaltungen, doch keinen Isomorphismus« - mithin<br />
Verschichte. Es gibt keine allgemeine Regel, die den Beziehungstypus zwischen<br />
Gedächtnisrationalität und Geschichtsprozeß festlegt. »Wenn ich die<br />
Rationalität <strong>von</strong> Herrschaft untersuche, versuche ich Schaltungen darzustellen.« 38<br />
Speicheranalyse, medienarchäologisch, ist also eine ebenso »fröhliche Wissenschaft<br />
der Schaltpläne« (Friedrich Kittler) wie die Diskursanalyse selbst. Solche<br />
Schaltungen bilden kein virtuelles Archiv; es gilt vielmehr, sie in ihrer Tatsächlichkeit<br />
zu benennen, als mediale Zwischenschicht, die sich zwischen Archiv und<br />
historische Interpretation schieben (und die Foucault sich - sobald sie jenseits des<br />
Raums der Bibliothek liegen - weitgehend weigerte zu analysieren). Die linguistische<br />
Operation, die eine diskursiv sich gebende, narrativ strukturierte Argumention<br />
<strong>von</strong> einer Auflistung und plausiblen Konfiguration <strong>von</strong> Archivmodulen<br />
scheidet, ist eine minimale, ein Effekt <strong>von</strong> wenigen Adverbien. 39 So legt diese<br />
Operation Hand an die Integrität jener archäologischen Fragmente namens Quellenzitate<br />
und verstümmelt sie, um sie sprachlich in den narrativen Fluß der Argumentation<br />
einfügen und anschließen zu können. Doch es geht bei dieser Kritik<br />
weder um eine Fetischisierung <strong>von</strong> Primärquelle und Archiv, als Sehnsucht nach<br />
38 Michel Foucault / Gerard Raulet, Um welchen Preis sagt die Vernunft die Wahrheit?<br />
Ein Gespräch (Zweiter Teil), in: Spuren. Zeitschrift <strong>für</strong> Kunst und Gesellschaft,<br />
2/1983,38-40<br />
39 Vgl. Roland Barthes, Le discours de l'histoire, dt.: Historie und ihr Diskurs, in: Alternative.<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Literatur und Diskussion 11 (1968), 171-180
40 LhSKANWl-ISUNG<br />
einer Autorität der Referenz, die mit Ursprung und Wahrheit verwechselt wird,<br />
noch um eine Reduzierung der Operationen des Historikers auf Archivarbeit; sie<br />
umfaßt anerkanntermaßen gleichrangig Analyse (Dokumentation), Durcharbeiten<br />
(Konzeptualisierung) und literarische Darstellung (Historiographie) des<br />
Stoffs 40 - medientechnisch formuliert die Transformation <strong>von</strong> Archiven in Literatur,<br />
also ihre Überführung in Bibliotheken. Vielmehr geht es - hier in Anlehnung<br />
an F. de Saussures Strukturale Linguistik - um den Nachweis, daß in<br />
syntagmatischen Reihen sogenannter Sekundärliteratur ein deriviertes, mithin<br />
durchgearbeitetes (also in der Datensprache: processed) paradigmatisches Archiv<br />
aufgespeichert ist, dessen Tugend günstigenfalls Transparenz heißt, also nicht die<br />
Paraphrasierung der Archivfundstücke, sondern deren diskrete Ausstellung und<br />
Nachweis, so daß sich anhand der Spur, die der Fußnotennachweis legt, die<br />
Archivinformation wiederherstellen läßt (Feedback). Wissenschaftlichkeit heißt<br />
dabei das Vertrauen darauf, daß solche Nachweise und Zitationen auf einem<br />
Sockel verabredeter Kontrollmechanismen der Nachprüfbarkeit ruhen. In solchen<br />
Publikationen ist das Archiv transportierbar gemacht, und als Druck diskursfähig.<br />
Auch das meint der Begriff Übertragung im Kontext einer Studie zur<br />
Infrastruktur des deutschen Gedächtnisses.<br />
Historiographische <strong>Im</strong>plikationen<br />
Der Diskurs des Nationalen neigt zu Monumentalisierungsformen - nicht nur<br />
am Objekt der Denkmäler, sondern auch als Form <strong>von</strong> Textverhandlung, als<br />
monumentale Diskursformation. Zu unterscheiden bleibt am Ende zwischen<br />
einem emphatischen, materialen Monument-Begriff und Formen diskursiver<br />
Monumentalisierung. Der new historicism sucht die im Prozeß der Überlieferung<br />
(Übertragung, Tradition) allmählich isolierten Texte und monumentalen Textblöcke<br />
(klassifiziert, kanonisiert) wieder in die Geschwätzigkeit dialogischer<br />
Intertextualität, die Bachtinsche Polyphonie zurückzuübersetzen. In jüngster Zeit<br />
ist eine Reihe <strong>von</strong> Studien erschienen, die sich einzelner Aspekte des Zusammenhangs<br />
<strong>von</strong> Nation und Historie annehmen - zu Denkmälern, Museen,<br />
Geschichtsschreibung und -bildern in Deutschland. Von dieser Seite scheint also<br />
die nationale Denkmallandschaft hinreichend erforscht. Das Fundament <strong>für</strong><br />
vergleichende Untersuchungen ist damit gelegt; bleibt die Untersuchung ihrer diskursiven<br />
versus infrastrukturellen Vernetzung. Das Text-Depot des Nationalbegriffs<br />
ist aufgehoben in den Gedächtnisinstitutionen Geschichtswissenschaft,<br />
40 Dazu Paul Ricoeur, Das Rätsel der Vergangenheit. Erinnern - Vergessen - Verzeihen,<br />
Göttingen (Wallstein) 2000 (in Anlehnung an Michel de Certeau)
Ll'SKANWKISUNG 41<br />
Archiv und Museum (jede Bibliographie zur nationalen Gedächtniskultur ist<br />
selbst bereits Agent dessen, was sie registriert). Archive sind das Gedächtnis der<br />
Nation (Novalis) als technisches Gestell. Die Basis einer Studie über nationale<br />
Allegoresen ist Teil der Beschreibung und gerade als historiographische Arbeit<br />
immer schon verstrickt in ihr Thema. Die vorliegenden Fallstudien geraten unter<br />
der (schreibenden) Hand zu Allegoresen einer Abwesenheit <strong>von</strong> Vergangenheit<br />
- allerdings handelt es sich nicht um arbiträre, sondern um präzise (vor)strukturierte<br />
Allegorien, figuriert durch die Vorgaben des Vorgefundenen (Evidenz aus<br />
Archiven, Museen, Forschungsliteratur). Das Gesetz dessen, was an Vergangenheit<br />
gesagt werden kann, ist ganz konkret präfiguriert als Netz <strong>von</strong> Archiven, die<br />
wirklich existieren. Damit ist diese Studie, die über archivalische Speicher des<br />
deutschen Gedächtnisses handelt, zugleich objektonentiert und ein Paradigma<br />
ihres Gegenstandes, die (archivalische) Grundlegung aller Archäologien des Wissens<br />
betreffend. Bei dieser Methode steht zwar <strong>für</strong> den Autor zu be<strong>für</strong>chten, »sich<br />
als externer Beobachter der Geschichtsschreibung mitten in deren blinden Fleck<br />
zu plazieren und dort nicht wieder herauszukommen« 41 , weshalb der Großteil<br />
<strong>von</strong> Geschichtsforschern daher lieber einen anderen Weg wählt und auf die Narration<br />
zurückkommt; zudem fördert das archivnahe Schreiben nicht die Lesbarkeit<br />
dieser Schrift. Doch in dem insistenten Versuch, das Archiv zu schreiben 42 ,<br />
formuliert sich - zwischen Monument und Dokument - das Thema dieser Arbeit<br />
transitiv. Christian Jouhaud beschreibt am Beispiel <strong>von</strong> Kardinal Richelieu in<br />
Paris, was der Versuch heißt, ein Archiv so umzuschreiben, daß seine Komponenten<br />
in <strong>Geschichte</strong>(n) eingefügt werden können: »In the transformative work<br />
that the archives undergo, we can discern an enterprise of reinvestment, a recycling<br />
of energy as well as of the persuasive strength and performativity of documents<br />
into the dynamics of political action.« 43 Dies steht im performativen<br />
Bunde mit einem Versuch aus der Literaturgeschichtsschreibung, Roberto Gonzalez<br />
Echevarrias Myth and Archive: »My text is part of the economy of texts that<br />
it attempts to describe and classify an archival fiction.« 44 Nur daß die Fiktion<br />
in der vorliegenden Arbeit nicht den Roman im Allgemeinen, sondern die<br />
41 Dirk Baecker, Anfang und Ende in der Geschichtsschreibung , in: Bernhard Dotzler<br />
(Hg.), Techno-Pathologien, München (Fink) 1992, 59-85 (68)<br />
42 Analog zu Roland Barthes, Ecnre, verbe intransitif? (1970), in: ders., Iuvres completes,<br />
Bd. II (1966-1973), hg. v. Eric Marty, Paris (Seuil) 1994, 273-280 (278f: »La diathese«);<br />
s. a. Hayden White, Schreiben im Medium, in: Hans Ulrich Gumbrecht / K.<br />
Ludwig Pfeiffer (Hg.), Schrift, München (Fink) 1993, 311-318<br />
43 Christian Jouhaud, Richelieu's Workshop: From Archive to Manuscript, from the Production<br />
of Writings to the Writing of History, in: The South Atlantic Quartely 91,<br />
Heft 4 (Fall 1992), 993-1010 (1003)<br />
44 Roberto Gonzalez Echevarria, Myth and Archive. A Theory of Latin American Narrative,<br />
Durham / London (Duke Univcrsity Press) 1998, 9
42 LESEANWEISUNG<br />
Form der <strong>Geschichte</strong> speziell meint. Ihr <strong>Im</strong>puls ist die Rückverwandlung <strong>von</strong><br />
Historie (mit Kollektivbegriffen wie »19. Jahrhundert«) in die Diskretheit ihrer<br />
Archiv- und Bibliot(h)exturen; <strong>von</strong> daher die operative Entscheidung, den Text<br />
in die diversen Ordnungsebenen der Herkunft seiner Wissensmodule auszudifferenzieren<br />
(»Diskurs«, »Bibliothek«, »Archiv«). Die dem entsprechende<br />
hypertextuelle Schreibweise präsentiert dem Leser das Material »in verknüpfter<br />
beziehungsweise verknüpfbarer Form«, setzt also einen Leser voraus, der das<br />
Interesse hat, »die Forschung selbst nachzuvollziehen oder gar noch einmal<br />
durchzuführen« 45 - auf Kosten der stnngenten Analyse, weil sich die non-lineare<br />
Darstellung dem entzieht? Die implizite Netz-Ästhetik der vorliegenden Arbeit<br />
ist damit <strong>von</strong> deren Kritik betroffen, denn während in einem traditionellen akademischen<br />
Aufsatz die Materialien den Argumenten untergeordnet sind, die<br />
ihrerseits einer übergreifenden These unterliegen, wird in hypertextuell erstellten<br />
Arbeiten genau diese Hierarchie in Frage gestellt: »Die Relation zwischen Dokument<br />
und Argument hat sich durch die Masse des Materials und die Art der Einbindung<br />
in die Präsentation verkehrt« - zugunsten des Materials als<br />
wissensarchäologischer Formation <strong>von</strong> Monumenten, nicht Dokumenten.<br />
Tatsächlich geht es der Archäologie um die Reifizierung <strong>von</strong> Relationen; »die Präsentation<br />
wird dann eher zum >Ausdruck< der Auffassung des Autors <strong>von</strong> einem<br />
Sachverhalt als dessen Analyse« . Das Archiv zum Zuge kommen zu lassen<br />
erfordert eine archäologische Wahrnehmung, d. h. die Erfassung <strong>von</strong> Textmengen<br />
und ihren Steuerzeichen als Bild. Die archäologische Verkettung <strong>von</strong><br />
Information darf - im Sinne eines Grundsatzes <strong>für</strong> Bibliothekare - sich auf Hermeneutik,<br />
also verstehende Lektüre nicht einlassen (Präsentistik im Sinne Walter<br />
Seitters 46 ). An die Stelle <strong>von</strong> historischer <strong>Im</strong>agination tritt die rhetorische Technik<br />
der inventio, gekoppelt hier sehr konkret an die archivische Ordnung des<br />
Inventars. Aus der synekdochischen Präsentation, welche den Befund immer<br />
schon als Teilmenge eines Ganzen namens Historie unterstellt, wird damit eine<br />
parataktische Schreibweise, deren argumentativer Duktus Pfade innerhalb eines<br />
Systems <strong>von</strong> bibliographischen und archivahschen Verweisen aufweist - fragile,<br />
quasi molekulare Verbindungen, ein Dementi narrativer Syntax und historischer<br />
Semantik. Gerard Genette verweigert sich gerade in seinem theoretischen Werk<br />
über We(i)sen und Techniken der Narration am Beispiel <strong>von</strong> Marcel Prousts<br />
45 Martin Klaus, Bücher im elektronischen Nirwana. Verknüpfen statt Argumentieren:<br />
Die Entwicklung des Hypertext <strong>von</strong> der Wissenschaft zur Ideologie, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung Nr. 195 v. 23. August 2000, N6, unter Bezug auf entsprechende<br />
Analysen in: American Quarterly Bd. 51 Heft 2 (1999), 237-282<br />
46 Walter Seiner, Kristall, Labyrinth: Die zwei Seiten des Schlosses. Ein Beitrag zur Physik<br />
des Kaisers, in: W. E. / Cornelia Vismann (Hg.), Geschichtskörper. Zur Aktualität<br />
<strong>von</strong> Kantorowicz, München (Fink) 1998, 47-58
LESEANWEISUNG 43<br />
Gedächtnisroman A la Recherche du Temps Perdu der Versuchung, seinerseits<br />
den Effekten narratologischer Kohärenzstiftung zu verfallen, um nicht dem Werk<br />
<strong>von</strong> Proust »eine künstliche Einheit zu geben«. 47 Der Zugriff und die Verknüpfung<br />
sind nicht arbiträr, sondern gesteuert durch die <strong>von</strong> den jeweiligen Speichermedien<br />
selbst vorgegebenen Vektoren, bilden mithin also die Realität <strong>von</strong><br />
Gedächtnisverfügungsmacht ab. Belegstellen sind damit Anschreibepunkte in<br />
einem Datenraum, der wissenskybernetisch als Speicher adressiert wird; nicht<br />
anders hat Walter Benjamin in seinen Thesen zur <strong>Geschichte</strong> die Aktualität der<br />
Vergangenheit als Funktion ihrer Zugriffsbedingungen beschrieben. Innerhalb<br />
dieser Wissenskybernetik wird die Raumdifferenz <strong>von</strong> Bibliothek, Museum und<br />
Archiv als Diversifikation des Zugriffs und der Adressierung transparent. Nicht<br />
aus Archiven soll dann <strong>Geschichte</strong> geschrieben werden, sondern neue Archive<br />
sind so herstellbar. Das erfordert ein Schreiben im Medium nicht im grammatischen<br />
Sinne (Hayden White), sondern im archivischen Inbegriff solcher Texte, die<br />
im Unterschied zu anderen Schriften der <strong>Geschichte</strong> das, was sie schreiben, auch<br />
in Gang gesetzt haben. 48 Für Staatsarchive gilt in der Tat, daß das <strong>von</strong> ihnen vernetzte<br />
Textwerk auch mit den Tools generiert wurde, mit denen sie es als Speicher<br />
festschreiben. Für alle anderen, rhizomatischen Diskursformen ist »die am wenigsten<br />
verdächtige, d. h. absolut bedeutungslose Ordnung die alphabetische«. 49<br />
Die Separierung <strong>von</strong> Diskurs, Bibliothek und Archiv muß in dieser Arbeit<br />
nicht künstlich hergestellt werden, sondern liegt in ihrem Gegenstand bereits vor.<br />
Sollen sie, um nicht im wissenschaftlichen Fließtext ineins verschmolzen zu werden,<br />
dreispaltig zur Darstellung kommen, analog zu Jacques Derridas' Text-Layout<br />
in Glas, oder Peter <strong>von</strong> Moos' diskreter Entfaltung des mittelalterlichen<br />
Aussagentyps Consolatio} In Form seines Nachlasses liegt ein Protagonist dieser<br />
Untersuchung, Albrecht Meydenbauer, als und in einem Archiv vor. Doch wie<br />
das Archiv schreiben, wenn hier etwas Interdependentes immer schon in den<br />
linear-sukzessiven Code der Schrift überführt werden muß? 50 Wer die Kartondeckel<br />
des Archivs in Wetzlar öffnet, trifft wieder auf narrative Module. Das<br />
47 Gerard Genettc, Die Erzählung, München (Fink) 1994, Nachwort (297)<br />
48 Friedrich Kittler schließt daran seine Definition <strong>von</strong> Software an: Der Kopf schrumpft.<br />
Herren und Knechte im Cyberspace, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 9. September<br />
1995<br />
49 Heiko Idensen / Matthias Krohn, Bild-Schirm-Denken, manual <strong>für</strong> hypermediale Diskurstechniken,<br />
in: Norbert Bolz, Friedrich Kittler u. Christoph Tholen (Hg.), Computer<br />
als Medium, München (Fink) 1993, 245-266 (246)<br />
50 Siehe den Paragraphen 2.1.3 »Interdependenz versus Linearität - Darstellungsprobleme<br />
einer paradigmatischen Mediengeschichte«, in: Kay Kirchmann, Verdichtung,<br />
Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer Theorie der Interdependenzen <strong>von</strong><br />
Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen Zivilisationsprozeß, Opladen<br />
(Leske & Budrich) 1998, 231-234
44 LKSKANWKISUNG<br />
Archiv schreiben kann also nicht heißen, es abzubilden; dies würde die Narration<br />
als kleinste Einheit der Historie nur wieder verdoppeln. Das Wesen des Archivs<br />
liegt vielmehr in seinem Weisen, seinen paratextuellen Markierungen: Ordnungszeichen<br />
/ Operatoren des Mechanismus' seiner Dokumentenverarbeitung.<br />
Das Archiv läßt sich also nicht diskursiv schreiben, ohne es bereits zu transformieren;<br />
sein Aggregatzustand läßt sich vielmehr nur anschreiben, als Nachvollzug<br />
des Gesetzes / der Setzung, der Vorgefaßtheit seiner Adressierung. Die<br />
einzelnen Module lassen sich mit Vektoren versehen, indexikalischen Stichworten,<br />
die eine An(ders)ordnung ermöglichen, ohne die Struktur des Archivs dabei<br />
zu zerstören. Das prekäre double-bind <strong>von</strong> diskursiver und archivischer Darlegung<br />
gilt es zu bewahren; ferner soll die Differenz zwischen der Vernetzungsstruktur<br />
eines wissenschaftlichen Textes in seinem rekursiven Spiel <strong>von</strong> narrativer<br />
Argumentation und Anmerkungsapparat im Unterschied zur Vernetzung und<br />
Kontingenz des archivischen Raums deutlich werden. Diese Archivtextur - die<br />
ganz eigene Anschlußmöglichkeiten eröffnet - kann nur vor Ort nachvollzogen<br />
werden, da sie im Akt diskursiver Textverarbeitung gelöscht wird. Es macht einen<br />
Unterschied, ob eine Druckschrift Teil eines Archiv-Moleküls ist, also eines Faszikels<br />
oder eines Kartons, im Unterschied zur Einreihung in die Ordnung der<br />
Bibliothek. Die parergonalen Verweissysteme - Signaturen, Standortnummern -<br />
wollen also mitausgestellt werden. Der Raum der Bibliothek ist ein virtueller,<br />
insofern er die Information nicht mehr an den Ort ihrer Lektüre bindet, sondern<br />
prinzipiell jederzeit verfügbar ist. Das Archiv ist dagegen durch die Exklusivität<br />
der Raumgebundenheit seiner Daten charakterisiert. Das historische Apriori aller<br />
Geschichtsschreibung heißt Archiv; eine Historie des Archivs als der zentralen<br />
Speichereinheit im 19. und frühen 20. Jahrhundert oszilliert daher immer im<br />
double-bind zwischen genitivus subiectivus und genitivus obiectivus, zwischen<br />
<strong>Geschichte</strong> und Schickung. Wenn das Verhältnis der beiden grundlegenden Funktionen,<br />
die Medien erfüllen - nämlich Speichern und Übertragen - thematisch<br />
wird (»Denn was ist das Ansichhalten anderes als Speichern im Verhältnis zur<br />
Übertragung?«), werden die Epochen der <strong>Geschichte</strong> als Speichertechnologien<br />
entzifferbar; »aber diese Speichertechniken, diese materialen Bedingungen der<br />
<strong>Geschichte</strong>, sind auch wiederum ebensoviele Orte des Entzugs, postalische Halte,<br />
das heißt Orte, an denen das Schicken anhält«: katechontische Relaisstationen.<br />
Die Spur, welche die Epoche der Schrift hinterläßt, ist das Archiv. Doch dessen<br />
Dokumente »bezeugen an sich selbst nur historische Weisen der Speicherung;<br />
bestenfalls sind sie« - wie Urkunden und Akten - »Gegenstand einer Schickung<br />
gewesen, <strong>von</strong> der ihre Ränder« - Adressen, Siegel, Marken und Aktenvermerke<br />
- »noch zeugen.« 51 Was aber bezeugt den Zeugen, das historische Dokument?<br />
Bernhard Siegert, Relais: Geschicke der Literatur als Epoche der Post 1751-1913, Berlin<br />
(Brinkmann & Böse) 1993, 16f
Ll-SKANWI-ISUNG 45<br />
Die Aktenspur, und diese ist außerhalb der Archive nicht zu finden, allenfalls als<br />
medienarchäologischer Irrläufer. Das Archiv kann also historiographisch nicht<br />
beschrieben werden, insofern es selbst das Prinzip vorgibt, das <strong>Geschichte</strong> erst<br />
schreibbar macht (Niklas Luhmanns »Beobachterparadox«). Gedächtnismedienarchäologie<br />
bedeutet gerade nicht, jenem Provenienzprinzip zu folgen, durch<br />
das sich die deutsche Archivlehre (Brenneke) lange als geschichtsbewußt (d. h. als<br />
Rücksicht nehmend auf historisch gewachsene Bestände) gegenüber dem<br />
in Frankreich vorherrschenden Pertinenzprinzip definierte? Hier geht es um<br />
alternative Schreibweisen dieser Arbeit. Doch das archivwissenschaftlich als »geschichtlich«<br />
stilisierte Provenzienzprinzip ist schlicht der Verweis auf administrativ<br />
geschlossene Bestände, d. h. ein Verweis auf den autopoietischen Zug jeder<br />
Administration. Macht- wird hier zur Gedächtniskybernetik; emphatisch historisch<br />
(narrativ) ist daran nichts. Das Objekt des Verweises auf <strong>Geschichte</strong> ist also<br />
deren Dementi. Gleichrangig zur Vergangenheit als Erzählung sind ihre parerga<br />
(Gerard Genette: Paratexte) in Form <strong>von</strong> alphanumerischen Chiffren, Signaturen,<br />
Indices. Historiographie allgemein, und das Genre der Denkmalgeschichtsschreibung<br />
insbesondere, kann nicht schlicht »über« jenes nationale Gedächtnis<br />
schreiben, ohne nicht selbst schon in Monumentalisierungsformen <strong>von</strong> Schrift<br />
sich zu verfangen; das Thema ist also immer auch historiographische Selbstaffektion.<br />
Die Unmöglichkeit, das Archiv gleichzeitig zu denken und zu schreiben,<br />
dokumentiert Foucault, der in seiner Archäologie des Wissens das Archiv theoretisch<br />
behauptet, es in seiner Histoire de lafolie aber nicht expliziert. Das Archiv<br />
ist gerade im Verborgenen (gleichsam positiviert in der gleichnamigen Formatierungsoption<br />
der laufenden Textverarbeitungsprogramme) am Werk, analog zu<br />
Foucaults paranoider Machttheorie, der er hier selbst unterliegt. Der kritische<br />
Einwand gegenüber jeder archivographischen Schreibweise lautet: »Versuchen Sie<br />
nicht, unlesbar zu werden. Alle großen Archivare waren sehr einfache Erzähler.<br />
Auch aus Respekt vor ihren Gegenständen.« 52 Doch erst die Trennung, die Beobachterdifferenz<br />
<strong>von</strong> Archiv und Narrativität macht die grands recits (<strong>Geschichte</strong>,<br />
Nation, Fortschritt) möglich. Die Schreibweisen <strong>von</strong> Vergangenheit sind ein<br />
Effekt ihrer Gedächtnis-Dispositive. Historiographie beruht auf dem Raum der<br />
Bibliothek, also den bereits diskursiv übersetzten Quellen; unmittelbar zum<br />
Archiv aber ist die Registrierung <strong>von</strong> Vergangenheit ein non-diskursives Geschäft.<br />
52 Eine mahnende Notiz <strong>von</strong> Siegfried Zielinski, Gründungsrektor der Kunsthochschule<br />
<strong>für</strong> Medien Köln
EINFÜHRUNG<br />
Deutsche Gedächtnisagenturen zwischen Monument und<br />
Dokumentation: Das infrastrukturelle Dispositiv<br />
Dove sta memoria}<br />
(Gerhard Merz)<br />
Die Medien des Archivs halten Antworten bereit. <strong>Im</strong> Anschluß an die Mechanisierung<br />
<strong>von</strong> Bürotechniken nach 1900 und die Technifizierung <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
im Zweiten Weltkrieg - im Sinne der <strong>von</strong> Siegfried Giedion Ende 1948<br />
diagnostizierten anonymen <strong>Geschichte</strong>^ — zieht die Dokumentationswissenschaft,<br />
das zivile Erbe der Kriegsjahre 1945 antretend, unter Rekurs auf den<br />
(beide Entwicklungen verklammernden) Apparat des mikrofilmbasierten Rapid<br />
Selector Bilanz: »Das Memoria-Medium ist diejenige technische Einheit, in die<br />
unmittelbar die Koden eingezeichnet werden.« 2 Der das schreibt, greift in seiner<br />
Literaturliste 1950 auf keine Vorkriegshteratur mehr zurück; gerade in den<br />
Raum dieser Vergessenheit schreibt sich die Zeitspanne der vorliegenden Untersuchung<br />
ein. Die klassische Geisteswissenschaft hält an ihrem unverdrossenen<br />
Kredo fest: »<strong>Geschichte</strong> kann man kontrollieren, die Erinnerung aber läßt sich<br />
nicht lenken.« 3 Doch es gibt tatsächlich eine medienarchäolgisch faßbare memoriale<br />
Kybernetik: reale Archive, Bibliotheken, Museen, Quelleneditionen,<br />
Denkmälerinventare - allen Formen ihrer diskursanalytischen oder dekonstruktiven<br />
Visualisierung zum Trotz, wie sie Foucault und Derrida als Bibliothekspantasmen<br />
und Archiv-Gesetz jenseits der Analyse ihrer institutionell und<br />
1 Siegfried Giedion, Mechanization Takes Command, Oxford University Press 1948;<br />
dt. Die Herrschaft der Mechanisierung: ein Beitrag zur anonymen <strong>Geschichte</strong>, Frankfurt/M.<br />
(Athenäum) 1987<br />
2 Gabor Orosz, Übersicht über die Problematik der Dokumentationsselektoren, in;<br />
Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische Dokumentationsarbeit 1, Heft 9 (November<br />
1954), 173-178 (173); der Autor verweist u. a. auf J. C. Green, The Rapid Selector<br />
- An Automatic Library, Rev. Doc. 17, Heft 3 (1950), 66-69<br />
3 Ulrich Raulff, Marktwert der Erinnerung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. Mai<br />
1998, über: Henri Rousso, La hantise du passe, Paris 1998
48 EINFÜHRUNG<br />
medial verdinglichten Korrelate denken. Solche Gedanken beruhen zwar ihrerseits<br />
auf Lektüren tatsächlicher Nationalbibliotheken und -archive, doch weist<br />
die Wiedereinführung des Singulars archive durch Foucault und Derrida ins<br />
Französische gerade auf beider Ausblendung des archivwissenschaftlich realen<br />
Begriffs dieser Gedächtnisagentur hin (die Institution Archiv ist archives in<br />
Frankreich). 4 Formen der historischen Repräsentation werden mehr denn je<br />
ernstgenommen <strong>von</strong> der Geschichtswissenschaft; Forschungen und Publikationen<br />
über Denkmäler, Inszenierungen und Orte als Medien der Geschichtskultur<br />
haben Hochkonjunktur. 5 Ein bis an den Rand der Inflation gehender<br />
(weil - so Ulrich Raulff - die überkommene Ordnung des historischen Wissens<br />
selbst auflösende) Boom an kulturwissenschaftlicher Gedächtnisforschung<br />
bezeugt es im Schatten des französischen Flaggschiffs, der <strong>von</strong> Pierre Nora konzipierten<br />
und edierten monumentalen, siebenbändigen Bestandsaufnahme der<br />
Topographie nationaler Erinnerung namens Les lieux de memoire (Paris 1984-<br />
1992). Demgegenüber scheint es nun wieder angebracht, die materiale Vertäuung<br />
nationaler Gedächtnisräume zu fokussieren, die Art und Weisen, wie (sich)<br />
unter der Bezeichnung Gedächtnis begrenzte Sparten einer institutionellen Wissenskultur<br />
buchstäblich einen Speicherplatz in der <strong>Geschichte</strong> sichern. 6 Ein solcher<br />
Forschungsgang verläuft - entfernt angelehnt an Francis Bacons<br />
Differenzierung <strong>von</strong> Phantasia, Memoria und Ratio und deren gedächtnispoetischer<br />
Weiterentwicklung durch Giambattista Vico 7 - entlang der Schnittstelle<br />
Michel Foucault, Archeologie du Savoir, Paris 1969, und Jacques Derrida, Mal d'Archive,<br />
Paris 1995, dt.: Dem Archiv verschrieben, Berlin (Brinkmann & Böse) 1997, 7f<br />
(einleitende Notiz der deutschen Übersetzer H.-D. Gondek / H. Naumann)<br />
Etwa Wolfgang Hardtwig, Erinnerung, Wissenschaft, Mythos. Nationale Geschichtsbilder<br />
und politische Symbole in der Reichsgründungsära und im Kaiserreich, in: ders.,<br />
Geschichtskultur und Wissenschaft, München (dtv) 1990; Klaus Fröhlich / Heinrich<br />
Th. Grüttcr /Jörn Rüscn (Hg-), Geschichtskultur (Jahrbuch <strong>für</strong> Geschichtsdidaktik<br />
1991/92), Pfaffenweiler (Centaurus) 1992, 224-263; Thomas Nipperdey, Nationalidee<br />
und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert, in: ders., Gesellschaft, Kultur,<br />
Theorie. Gesammelte Aufsätze zur neueren <strong>Geschichte</strong>, Göttingen (Vandenhoeck<br />
& Ruprecht) 1976, 133-173. Über das Kyffhäuser-Denkmal (erbaut 1891-1896 nach<br />
Plänen <strong>von</strong> Bruno Schmitz) und das Bauernkriegs-Panorama Nordhausen (1974-1989,<br />
ausgemalt <strong>von</strong> Werner Tübke) als protomediale, nämlich quasi-kinematographische<br />
Wahrnehmungskonstruktion des Nationalgedankens siehe exemplarisch Lorenz<br />
Engell, Kino ohne Kino. Zur Medienanalyse zweier Nationaldenkmäler, in: ders., Ausfahrt<br />
nach Babylon. Essays und Vorträge zur Kritik der Medienkultur, Weimar (Verlag<br />
u. Datenbank f. Geisteswissenschaften) 2000, 245-262<br />
Analog zu einer Formulierung <strong>von</strong> Stefan Heidenreich, Was verspricht die Kunst?,<br />
Berlin (Berlin Verlag) 1998, 215<br />
Siehe Patrick H. Hutton, Giambattista Vico and the Poetics of Memory, in: ders.,<br />
History as an Art of Memory, Hanover / London (New England UP) 1993, 32ff
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 49<br />
vom bildhaft gespeicherten <strong>Im</strong>aginären der Großen Erzählungen (<strong>Geschichte</strong>,<br />
Nation) zum Symbolischem ihrer schriftlichen Registrierung, <strong>von</strong> (Text-)Denkmallandschaften<br />
in ihrer Kopplung <strong>von</strong> Kognition, Ästhetik und Kommunikation<br />
zur Infrastrukturierung des deutschen Gedächtnisses durch non-diskursiv<br />
operierende Agenturen und ihrer Logistik im Realen einer programmatisch als<br />
Archiv, Bibliothek oder Museum ausdifferenzierten, geschalteten und institutionalisierten<br />
Hardware. 8 »Diskursive Regeln legen fest, was aufzeichnungswürdiges<br />
und aufbewahrungswürdiges Wissens ist« 9 ; non-diskursive<br />
Apparaturen aber sind das mediale Gesetz, die Ermöglichung dieser Regeln.<br />
Pierre Nora zufolge ist »selbst ein Ort, der so rein aus Erinnerungsmaterial<br />
besteht wie ein Archivdepot«, nur dann lieux de memoire, wenn die Vorstellung<br />
ihn mit einer symbolischen Aura versehen hat. 10 Diese Arbeit zielt gerade nicht<br />
auf die Identifizierung eines politisch-sozialen Subjekts der nationalen Gedächtnisagenturen,<br />
sondern auf deren mediales Dispositiv. »Wir überblicken, rückwärts<br />
sehend, eine gewisse Masse <strong>von</strong> Begebenheiten« (eine mithin archivische<br />
Datenmenge), »die wir mit dem <strong>Namen</strong> ><strong>Geschichte</strong>< zu umfassen suchen.<br />
Gehört alles überhaupt Geschehene der <strong>Geschichte</strong> an?« 11 Gehört das Geschehene<br />
überhaupt der <strong>Geschichte</strong> an? Die vermeintlichen Gegenstände der<br />
<strong>Geschichte</strong> sind nicht gleich identisch mit deren Beschreibungsmethode: der<br />
Erzählung. Institutionelle, wissenschaftliche und mechanische Techniken der<br />
Speicherung, Verarbeitung und Übertragung <strong>von</strong> deutscher Gedächtnisinformation<br />
im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> lassen sich vielmehr als non-diskursives,<br />
objektives Korrelat zu jenen Literaturen lesen, die vorgeben, <strong>Geschichte</strong> zu<br />
(be-)schreiben. Auf eine solche Infrastruktur der deutschen Gedächtnisoperatoren<br />
trifft Kittlers Definition der Aufschreibesysteme (engl.: Discursive Networks)<br />
zu und ist als medienbewußter Akzent mit Jurij Lotmans Begriff <strong>von</strong> Kultursemiotik<br />
koppelbar: »das Netzwerk <strong>von</strong> Techniken und Institutionen , die<br />
einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter<br />
Daten erlaubt« . Lotman modifiziert am Beispiel des<br />
Wechsels literarischer Schulen in Rußland vom 18. zum 19. Jahrhundert, daß<br />
8 Zu einer medienarchäologischen <strong>Im</strong>plementierung der Differenz real / symbolisch /<br />
imaginär bei Jacques Lacan siehe Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900,<br />
München (Fink) 1985; 3. Überarb. Aufl. 1995<br />
9 Günther Stocker, Schrift, Wissen und Gedächtnis: das Motiv der Bibliothek als Spiegel<br />
des Medienwandels im 20. Jahrhundert, Würzburg (Königshausen & Neumann)<br />
1997, 77<br />
10 Werner Paravicini, Rettung aus dem Archiv? Eine Betrachtung aus Anlaß der 700-<br />
Jahrfeier der Lübecker Trese, in: Zeitschrift des Vereins <strong>für</strong> Lübeckische <strong>Geschichte</strong><br />
und Altertumskunde Bd. 78 (1998), 11-46 (29)<br />
11 Herman Grimm, Das Universitätsstudium der Neueren Kunstgeschichte, in: Deutsche<br />
Rundschau Bd. LXVI (Jan. - März 1891), 390-413 (394)
50 EINFÜHRUNG<br />
die kulturelle Diskursstrategie »<strong>Geschichte</strong> überhaupt erst mit dem Zeitpunkt<br />
beginnt, wo die Selbstbeschreibung einsetzt« - eine Se/^beschreibung, die<br />
solange nur Möglichkeit, nur Virtualität bleibt, wie sie nicht im »vereinfachenden<br />
Mechanismus der Typographie« medial zum Einsatz kommt. 12<br />
Infrastrukturelle Bahnungen des deutschen Gedächtnisses, Logistik des Realen<br />
Gegenüber Einzelstudien zu expliziten Nationaldenkmälern heißt die Forderung<br />
an eine Geschichts- als Medicnwissenschaft vielmehr, Gedächtniskultur<br />
infrastrukturell zu denken. Gedächtniskulturtechniken und folglich Informationsspeicherung<br />
kann systemintern »nur in enger und wechselseitiger<br />
Verbindung mit den Problemen der Übertragung und Verarbeitung <strong>von</strong> Informationen<br />
gesehen werden« 13 - in markanter Differenz zur Analyse individualpsychischer<br />
Prozesse des Erinnerns, Wiederholens und Durcharbeitens derselben.<br />
Theodor W. Adorno und Max Horkheimer verkennen in ihrer Dialektik<br />
der Aufklärung diese mediale Einsicht, indem sie dem »bloßen Wahrnehmen,<br />
Klassifizieren und Berechnen« den Anspruch auf Erkenntnis absprechen. 14<br />
Schnittstellen zum Diskurs, also zur Kommunikation im hermeneutischen<br />
Sinne sind dann gegeben, wenn Daten nicht rein übertragen, sondern auch zu<br />
Informationswerten verarbeitet werden. Dazu bedarf es einer formalen Netzbildung,<br />
die erlaubt, »eine große Zahl <strong>von</strong> Stellen <strong>für</strong> spezielle Aufgaben mit<br />
entsprechendem Informationsbesitz (Gedächtnis) einzurichten.« 15 Goethe,<br />
selbst einmal Bibliothekschef der heutigen Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar,<br />
deren Bücherausleihlisten dokumentieren, »aus welchen Quellen sich die deutsche<br />
Klassik täglich nährte« 16 , ahnte die Spannung zwischen den Pardigmen<br />
12 Juri M. Lotman, Das dynamische Modell eines semiotischen Sytems, in: ders., Kunst<br />
als Sprache. Untersuchungen zum Zcichcncharakter <strong>von</strong> Literatur und Kunst, Leipzig<br />
(Reclam jun.) 1981, 89-110 (99f)<br />
13 Norbert Fichtner, Informationsspeicherung. Technik-, Theorie, Weltanschauung, Berlin<br />
(Akademie) 1977, 87. Zum kommunikationstheoretisch gefaßten Informationskreislauf:<br />
Peter Badura, Die Verwaltung als soziales System. Bemerkungen zu einer<br />
Theorie der Verwaltungswissenschaft <strong>von</strong> Niklas Luhmann, in: Die Öffentliche Verwaltung<br />
23, Heft 1/2 (Januar 1970), 18-22 (19)<br />
14 Friedrich Kittler, Copyright 1944 by Social Studies Association, Inc., in: Sigrid Weigel<br />
(Hg.), Flaschenpost und Postkarte. Korrespondenzen zwischen Kritischer Theorie<br />
und Poststrukturalismus, Köln / Weimar / Wien (Böhlau) 1995, 185-193 (190, unter<br />
Bezug auf die Ausgabe 1955)<br />
15 Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, 3. Aufl. Berlin<br />
(Duncker & Humblot) 1976, 193<br />
16 Thomas Steinfeld, Extreme Hanglage. In Weimar verkommt die Anna-Amalia-Bibliothek,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 8. August 1998
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 51<br />
Speichern (die Technik der Weimarer Klassik) und Übertragung, als er nicht nur<br />
die Garantie <strong>für</strong> die politisch mißlungene Einigung Deutschlands in der Anlage<br />
seiner Chausseen sieht, sondern 1825 »Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe<br />
und alle möglichen Facilitäten der Communication« auch als neuen Faszinationstyp<br />
der gebildeten Welt ausmacht, Carl Friedrich Zelter gegenüber <strong>von</strong><br />
einer damit korrespondierenden Überbildung spricht und in aller Vieldeutigkeit<br />
damit das rechte Wort findet. 17 Der Tübinger Professor der Nationalökonomie<br />
Friedrich List, 1832 zurückgekehrt aus den USA, sieht als Zentrum <strong>für</strong><br />
ein deutsches Eisenbahn-System Leipzig vor und erwägt das manifeste Dispositiv<br />
solcher Planungen »in militärischer Beziehung«. Durch die Eisenbahn, so<br />
List, wird die militärische Verteidigung gegenüber der Offensive an Bedeutung<br />
gewinnen und die Bahnkapitalisten gar dazu motivieren, »den Krieg selbst tot<br />
zu machen« - Katechontik als Strategie korrespondiert fortan mit der Institutionalisierung<br />
<strong>von</strong> Speichern und Depots. 18 1948/49 rücken preußische und<br />
badische mobile Einsatzreserven der Armee mit der Eisenbahn zu ihren infrastrukturell<br />
vorgegebenen Einsatzorten, und im Preußisch-Österreichischen<br />
Krieg 1866 sowie 1970/71 wurde die Mehrzahl aller Truppenbewegungen mit<br />
der Eisenbahn vollzogen. Der Begriff Infrastruktur selbst entstammt dem (französischen)<br />
Eisenbahnbau <strong>von</strong> 1875. 19 In der internationalen Technikersprache<br />
sind damit sämtliche ortsfesten Anlagen als Voraussetzung und im Dienst der<br />
Mobilität gemeint; daraus erklärt sich die Übertragung des Begriffs in den Thesaurus<br />
dieser Arbeit (sind doch Archive als Gedächtnisinstitution die <strong>Im</strong>mobilien,<br />
die Bedingung <strong>für</strong> das Fluidum <strong>von</strong> Historie als Diskurs). Die Bezeichnung<br />
wurde dann im Dezember 1951 im Nato-Infrastruktur-Programm<br />
logistisch und medial auf Standardisierungsmaßnahmen hin ausgeweitet, an<br />
deren Ende digitale Informationsverarbeitung und das Internet selbst stehen.<br />
Auch kultureller Diskurs heißt Verkehr; kein Culturstaat ist möglich ohne<br />
Eisenbahn, Telegraph und Telephon 20 , und das Postwesen ist »die staatliche<br />
17 Goethe an J. P. Eckermann am 23. Oktober 1828 und an Zelter; siehe den Eintrag<br />
»Eisenbahn« in: Goethe-Wörterbuch, hg. v. d. (vormal.) Akademie der Wissenschaften<br />
der DDR, d. Akademie der Wissenschaften in Göttingen u. d. Heidelberger<br />
Akademie der Wissenschaften, 3. Bd., 1. Lieferung, Stuttgart / Berlin / Köln (Kohlhammer)<br />
1991<br />
18 Zitiert nach: Alf Lüdtke, Eisenbahnfahren und Eisenbahnbau, in: Lutz Niethammer<br />
u. a., Bürgerliche Gesellschaft in Deutschland. Historische Einblicke, Fragen, Perspektiven,<br />
Frankfurt/Main 1990, 101-119<br />
19 Dirk van Laak, Der Begriff »Infrastruktur« und was er vor seiner Erfindung besagte,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte, 41. Jg., Bonn (Bouvier) 1999<br />
20 T. Beer, Carl Ludwig, in: Wiener klinische Wochenschrift 8 (1895), 354-357 (357),<br />
zitiert nach: Soraya de Chadarevian, Die »Methode der Kurven« in der Physiologie<br />
zwischen 1850 und 1900, in: Hans-Jörg Rheinberger / Michael Hagner (Hg.), Die
52 EINFÜHRUNG<br />
Form der Communication« 21 . Solche Kommunikation aber ist nicht mehr in<br />
organizistischen Metaphern zu greifen, an die auch der Diskurs der Historie<br />
gekoppelt ist (Tradition), sondern in Begriffen der Infrastruktur und als technisches<br />
Übertragungs- und Kontrollsystem. Das vom Germanischen Nationalmuseum<br />
in Nürnberg weitgehend vergessene Gedächtnis der Kopplung <strong>von</strong><br />
Technik und Kultur ist auch der <strong>Im</strong>puls <strong>für</strong> Oskar <strong>von</strong> Miller zur Gründung<br />
des Deutschen Museums in München: »Der Fachmann der verschiedensten<br />
Gebiete der Wissenschaft und Technik steht hier ehrfurchtsvoll vor den Originalapparaten<br />
großer Erfinder und Entdecker, <strong>von</strong> denen die meisten längst<br />
verlorengegangen sein würden, wenn sie das Deutsche Museum nicht der Nachwelt<br />
erhalten hätte.« 22 Insofern Technik <strong>von</strong> einem diskreten Fortschrittsmodell<br />
ausgeht, vergißt sie - analog zu Michel Foucaults Design <strong>von</strong> Historie als<br />
Folge sich ersetzender cpistemischcr Epochen (in Les Mots et les Choses) - ihre<br />
vorherigen Zustände geradezu systematisch. »<strong>Geschichte</strong> insgesamt wäre also<br />
die Wissenschaft <strong>von</strong> allem, was in der Zeit abläuft, <strong>von</strong> den wechselnden<br />
Zuständen.« 23 Damit tritt der Hardware <strong>von</strong> Kommunikation die Einsicht in<br />
ihre mediale Verschaltung beiseite; ist das We(i)sen der Post das Andere des<br />
Archivs im 19. Jahrhundert? Der Direktor des Preußischen Provinzial-Archivs<br />
in Düsseldorf lamentiert über den »in weiteren Kreisen auch der sogenannten<br />
Gebildeten herrschenden Materialismus, dem eine Meile Eisenbahn oder dergl.<br />
mehr gilt als alle Archive der Welt.« 24 Post ist als kybernetisches Prinzip »weniger<br />
das äussere technische Material der Fortbewegung, als vielmehr deren<br />
Zwecke, innere Richtung und Verzweigung« , mithin: Vektoren.<br />
Die vorliegende Arbeit sucht die Vektoren des deutschen Gedächtnisses<br />
in diesem Sinne aufzuweisen. 1810 hat Friedrich Ludwig Jahn die Einsicht, daß<br />
sich erst im Reisen das Bild eines nationalen Zusammenhangs herstellt und entsprechender<br />
Übertragungsmedien bedarf, gekoppelt an »gute Straßenaufsicht«.<br />
25 Jahn erinnert ausdrücklich an Fichtes Entwurf des geschlossenen Han-<br />
Experimentalisierung des Lebens. Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften<br />
1850/1950, Berlin (Akademie) 1993, 28-49 (31)<br />
21 Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte<br />
der Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig (Westermann) 1877, 332f.<br />
22 J. Zenneck, Oskar <strong>von</strong> Müller, Berlin (VDI) 1934 (= Deutsches Museum. Abhand-<br />
lungen und Berichte, 6. Jg., Heft 2), 36f<br />
23 Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Nachlaß / Archiv Wilhelm<br />
Ostwald, Signatur 4964: »Bücherkataloge und die Pyramide der Wissenschaften«,<br />
BI. 109<br />
24 Carl Wilhelm v. Lancizolle, Denkschrift über die Preußischen Staats-Archive nebst<br />
vergleichenden Notizen über das Archivwesen einiger fremder Staaten, Berlin 1855, 1<br />
25 Friedrich Ludwig Jahn, Deutsches Volkstum [ ;; 1810], hg. v. Franz Brummer, Leipzig<br />
(Reclam) o. J. [ca. 1890], Absatz »Beförderungsmittel«, 252f
GEDÄCHTNISAGKNTURKN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 53<br />
delsstaats und leitet daraus eine Einschränkung <strong>von</strong> Reisen ins Ausland ab: Die<br />
Definition des Nationalen bedarf der Differenzsetzung, die seinerseits in Staatsgrenzen<br />
Ausdruck findet, wie sie die frühe Neuzeit noch nicht kannte. Da<br />
gerade Preußen Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst darauf angewiesen ist,<br />
entsprechend avancierte Verkehrstechniken aus Frankreich und England zu<br />
kopieren, gründet Christian Peter Wilhelm Beuth in Berlin 1821, fast zeitgleich<br />
zum deutschen Gedächtnisunternehmen Monumenta Germania Historica, die<br />
Technische Gewerbeschule; tatsächlich entwickelt Beuth seine Initiativen in<br />
praktischer Partizipation an den Verwaltungsreformen des Freiherrn vom Stein,<br />
Spiritus rector der MGH. Die vorliegende Studie sucht dementsprechend die<br />
Neuformation des deutschen Gedächtnisses im Zuge der Befreiungskriege,<br />
unter denen die Sammlung und Edition mittelalterlichen Quellen durch die<br />
MGH prominent firmiert, weniger unter dem Aspekt ihrer Kopplung an den<br />
Diskurs der <strong>Geschichte</strong> denn im Kontext der technischen Infrastrukturierung<br />
der emergenten Nation zu untersuchen. Als Beuth mit Kabinettsordre vom 21.<br />
Juli 1819 Direktor der umgebildeten Technischen Deputation <strong>für</strong> Gewerbe<br />
wird, sind ihr Sammlungen <strong>von</strong> Kupferstichen und Zeichnungen, Modellsammlungen,<br />
Maschinensammlungen, Produkten- und Fabrikatensammlungen<br />
zugewiesen; Sammlungen sind eben nicht nur Gedächtnis <strong>für</strong> künftige Historie,<br />
sondern auch Datenbanken zur Rückkopplung <strong>von</strong> Gegenwart. In einem<br />
Bericht vom 17. Juli 1822 plädiert Beuth <strong>für</strong> die Einführung eines technischen<br />
Schulwesens in Preußen unter Hinweis auf die analoge Berechtigung des philologischen<br />
Unterrichts ; in Anlehnung an den <strong>von</strong> Eduard<br />
Gerhard geprägten Begriff der monumentalen Philologie <strong>für</strong> das Studium<br />
archäologischer Artefakte ließe sich vom Bewußtsein einer technischen Philologie<br />
sprechen. <strong>Im</strong> Vorgriff des späteren Deutschen Instituts <strong>für</strong> Normung erinnert<br />
Beuths Insistenz auf Standardisierung daran, daß die Einheit Deutschlands<br />
infrastrukturell nicht schon in der Anlage <strong>von</strong> Verkehrswegen und Eisenbahnstrecken<br />
lag (wie Goethe glaubte), sondern erst in der länderübergreifenden<br />
Festlegung <strong>von</strong> Spurenweiten und genormten Einzelteilen, wie es dem engineering<br />
des Verwaltungswesens, jener Vorbedingung aller Archive, der »Verkettung«<br />
diskreter Papierformate, Aktenfächer und Karteikästen entsprach. 26<br />
26 Waldemar Hellmich, Zehn Jahre deutscher Normung, in: Deutscher Normenausschuß<br />
(Hg.), DIN 1917-1929, Berlin 1927; auch in: Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure<br />
71 (1927), Nr. 44, 1525-1531, hier zitiert nach: Peter Berz, Der deutsche Normenausschuß.<br />
Zur Theorie und <strong>Geschichte</strong> einer technischen Institution in: Armin<br />
Adam / Martin Stingelin (Hg.), Übertragung und Gesetz. Gründungsmythen, Kriegstheater<br />
und Unterwerfungsstrategien <strong>von</strong> Institutionen, Berlin (Akademie) 1995, 221-<br />
236 (225). Zu Beuth siehe: H. J. Sträube, Chr. P. Wilhelm Beuth, Berlin (VDI) 1930 (=<br />
Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte, 2. Jg. Heft 5)
54 EINFÜHRUNG<br />
Anfang Januar 1813, kurz vor dem alliierten Befreiungskrieg gegen Napoleon,<br />
weist der preußische Offizier Blücher darauf hin, daß die Nation »hergestellt«<br />
werden muß 27 - und das im strategisch-technischen Sinne, bevor sie auf der<br />
symbolischen Ebene <strong>von</strong> Geschichtsbewußtsein wiederherzustellen ist. Gibt es<br />
nationale Gedächtnisstile im Sinne ihrer Spe'ichertechniken, die analog zum<br />
buchstäblich engineering <strong>von</strong> Nationen in Begriffen der Infrastruktur<br />
beschreibbar sind? »Some will not hesitate to explain the genesis<br />
of modern states through the history of their techniques. Others will track<br />
historical determinism burried under much technician evidence« 28 - Norm und<br />
Archiv im Verbund. In einer Denkschrift <strong>von</strong> 1883 unterstreicht Siemens, daß<br />
erst die Anwendung der Elektrizität im großen Maßstab »die Notwendigkeit<br />
der Feststellung bestimmter elektrischer Maße <strong>für</strong> den Verkehr und ständiger<br />
Einrichtungen <strong>für</strong> die Kontrolle der zur Verwendung kommenden Masse schon<br />
unabweislich herausgestellt« hat . »Die Einheit<br />
der Republik erfordert Einheit im Maß- und Gewichtssystem«, war eine<br />
Einsicht der Französischen Revolution nach 1789 in die Medien der Nationbildung.<br />
29 Zu diesen gehört bekanntlich auch Claude Chappes Durchsetzung des<br />
optischen Telegraphensystems; Nachrichtentechnik ist die Avantgarde der Standardisierung.<br />
Was nach 1791 noch im Dienste der Nation steht (»Mit dem Telegraphen<br />
schrumpfen die Entfernungen, und riesige Bevölkerungsmassen werden<br />
gewissermaßen an einem einzigen Punkt versammelt« 30 ), sprengt wenige<br />
Generationen später schon den nationalen Rahmen (wie die internationale<br />
Meterkonvention <strong>von</strong> 1875). »Die Normensysteme sind die Fundamente aller<br />
Kultur« 31 ; solche Vereinheitlichungen können aber zunächst nur in Momenten<br />
<strong>von</strong> Systembrüchen installiert werden. In Frankreich bot die Revolution <strong>von</strong><br />
27<br />
Zitiert nach: Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770 - 1990,<br />
München (Beck) 1993,62<br />
28<br />
Jean-Francois Picard, Techniquc universelle ou filiercs nationales? Lcs cas de l'clectrification<br />
des chemins de fern en Europe, in: Revue Internationale d'Histoire et de<br />
Philosophie des Sciences et des Techniques, 2.Serie, Bd. 1, Heft 1 (1997), 125-158 (hier<br />
engl. Abstract, 216f)<br />
29<br />
Eingabe des Prieur de la cote d'or an den Pariser Nationalkonvent, zitiert nach: Kay<br />
Kirchmann, Verdichtung, Weltverlust und Zeitdruck. Grundzüge einer Theorie der<br />
Interdependenzen <strong>von</strong> Medien, Zeit und Geschwindigkeit im neuzeitlichen Zivilisationsprozeß,<br />
Opladen (Leske & Budrich) 1998, 252<br />
30<br />
Chappe an den vom Nationalkonvent bestellten Gutachter Lakanal 1793, zitiert ebd.,<br />
253; dazu Patrice Fliehy, Uno histoirc de la communication moderne, Paris (Dicouverte)<br />
1991; dt. Tele. Die <strong>Geschichte</strong> der modernen Kommunikation, Frankfurt/M. 1994<br />
31<br />
W. Porstmann, Normenlehre. Grundlagen, Reform und Organisation der Maß- und<br />
Normensysteme. Dargestellt <strong>für</strong> Wissenschaft, Unterricht und Wirtschaft, Leipzig<br />
(Haase)1917,vi
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 55<br />
1789ff »die günstigste Gelegenheit zur Ausmerzung unrationeller Methoden<br />
und Systeme«; in Deutschland wurde der »Augenblick« der Reichsbildung<br />
1870/71 nur teilweise genutzt , als man die vielen verschiedenen<br />
in Gebrauch befindlichen Maße nicht etwa durch eine deutsche Einheit<br />
ersetzte, sondern das metrische System, das seit dem Revolutionsjahr 1795<br />
in Frankreich gültig war, übernahm. »Man kann ganz allgemein sagen, daß die<br />
Einheiten und das Deutsche, wie auch immer man letzteres begreifen will, nicht<br />
wirklich zusammenpassen« 32 ; erst der Ausnahmezustand <strong>von</strong> Weltkrieg I<br />
zwingt die deutsche Industrie zur Konstitutierung des Normenausschusses.<br />
Walter Porstmann spricht folgerichtig <strong>von</strong> der »Norm als Waffe«, die mit dem<br />
22. Dezember des Jahres 1917 in die Gründung des deutschen Instituts <strong>für</strong> Normung<br />
(DIN) mündet. Doch nicht auf die schlichte Übersetzung historiographisch<br />
etablierter Begriffe in die <strong>von</strong> Kybernetik, Signaltheorie und Informatik<br />
zielt die vorliegende Studie, sondern auf den gleichzeitige Nachweis ihrer Differenz.<br />
Zeichentheoretisch formuliert wäre das der Schritt <strong>von</strong> der Mimesis an<br />
den Gegenstand zu dessen Indizierung. Mit der Zeichenlogik auf der Ebene <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> korrespondiert eine Logistik auf der Ebene ihrer Verzeichnung als<br />
Gedächtnis, und in der Vermessung der Literalität eines Zeitalters tritt die Vermessung<br />
seines archivischen Raumes, des Raums der Signaturen und Magazinadressen,<br />
als selbstbezügliches Kriterium (nämlich Index) hinzu. Es handelt<br />
sich also um diverse Modi der Er/zählung <strong>von</strong> Literalität. Und so sind die Verwalter<br />
des deutschen Gedächtnisses zwischen 1806 und 1945 Moderatoren des<br />
Archivs, das nicht nach Sinn oder Unsinn der aus seinen Buchstabenmengen<br />
umzuschreibenden <strong>Geschichte</strong> fragt. »II ne s'agira pas de declamer contre la<br />
betise, mais de se soumettre ä eile pour l'inventorier et la cataloguer.« 33 Horst<br />
Völz unterteilt Speichertechmken nach Kategorien, die hier epochal verstanden<br />
werden: mechanisch ( Buchdruck, Schallplatte, Lochband) - mithin der Zeitraum<br />
dieser Arbeit -, magnetisch (Magnetband, Ferritkerne, Bubble Domänen),<br />
elektrisch (Kondensatoren der dynamischen Halbleiterspeicher), chemisch<br />
(Fotografie). 34 Die Grenzen zur mechanischen Datenverarbeitung, <strong>von</strong> welcher<br />
32 Stefan Heidenreich, Die deutsche Einheit [Beitrag aus Anlaß des 10. Jahrestages der<br />
deutschen Wiedervereinigung], in: Frankfurter Allgemeine Zeitung <br />
v. 2. Oktober 2000<br />
33 Albert Thibaudet, Gustave Flaubert 1821-1880. Sa Vie - Ses Romans - Son Style, Paris<br />
1922, 226 (Einfügung W. E. in Anlehnung an ein Sprachspiel <strong>von</strong> Jacques Lacan). Dazu<br />
Bernhard Sicgcrt, Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pecuchet,<br />
in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft.<br />
5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-40 (27)<br />
34 Horst Völz, Allgemeine Systematik und Grenzen der Speicherung, in: die Technik, 34.<br />
Jg., Heft 12, Dezember 1979, 658-665 (660)
56 EINFÜHRUNG<br />
der Untertitel der vorliegenden Arbeit über deutsche Gedächtnisinfrastrukturierung<br />
spricht, meint Maschinen nicht nur im technischen, sondern auch logischen<br />
Sinn; so spricht der Bibliothekswissenschaftler Paul Ladewig 1912 hinsichtlich<br />
Bücherverzeichnungs- und Magazinierungstechniken <strong>von</strong> absoluter<br />
Mechanisierung? 5 Gerade weil die maschinale Kinematik als emergentes Dispositiv<br />
des 19. Jahrhunderts dessen organizistische Metaphorik dementiert<br />
(etwa die Rede vom »Archivkörper«), sucht der Diskurs sie zusammenzuzwingen;<br />
wenn Maschinen als Organprojection (also im Sinne Marshall McLuhans<br />
als Prothesen) des Menschen definiert werden, erscheinen auch Speichermaschinen<br />
als ein Auesseres des Menschen, das vorher sein Inneres war 36 - die<br />
Verwechslung <strong>von</strong> Gedächtnis und Erinnerung. Wo Archiv und Bibliothek<br />
nicht nur die Speichermedien, sondern auch das Objekt <strong>von</strong> Forschung sind,<br />
braucht diese - <strong>für</strong> einmal - keinen Gegenstand außerhalb ihrer selbst zu<br />
behaupten, etwa das Modell Historie. Medienarchäologie plädiert da<strong>für</strong>, die<br />
Aufgaben des Historikers <strong>von</strong> der literarisch verarbeiteten Darstellung der Vergangenheit<br />
in eine Informationswissenschaft umzuakzentuieren. Information<br />
existiert erst, wenn sie abrufbar ist, und das <strong>von</strong> uns mit der Konjunktur <strong>von</strong><br />
Geschichtsphilosophien und beredten Historismen assoziierte 19. Jahrhundert<br />
hat eine verschwiegene Kehrseite: die Arbeit der Datenbanken, auf die der<br />
historische Diskurs hier herunterformuliert wird (Daten meinen hier die Organisation<br />
<strong>von</strong> Information zu ihrer Analysierbarkeit).<br />
Nationale Gedächtnisbildung meint in Deutschland um 1800 eine pragmatische,<br />
weniger symbolische Kulturtechnik. Als Friedrich Schiller 1805 verstirbt,<br />
wirbt Rudolf Zacharias Becker <strong>für</strong> ein (Schiller-)»Denkmal der Nazionaldankbarkeit«;<br />
die daraufhin gesammelten Spenden aber werden nicht in ein<br />
ursprünglich gedachtes Denkmal, sondern <strong>für</strong> die Ausbildung <strong>von</strong> Schillers vier<br />
Kindern investiert. 37 Selbst Ende der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts resultiert<br />
die sowjetische Bewegung zur Aufarbeitung und zum Gedenken der Opfer stalinistischer<br />
Konzentrationslager Memorial nicht im ursprünglich konzipierten<br />
Denkmal, sondern in flächendeckender archivischer Dokumentation. Bereits<br />
am 18. Oktober 1814 schlägt ein anonym bleibender Autor vor, den Jahrestag<br />
der Leipziger Völkerschlacht zwischen den alliierten Truppen und denen Napo-<br />
35 Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig (Wiegandt) 1912, 199<br />
36 Kapp 1877: Kapitel XI (Die Maschinentechnik) 165, 167, 169, unter Bezug auf: Franz<br />
Reuleaux, Theoretische Kinematik. Grundzüge einer Theorie des Maschinenwesens,<br />
Braunschweig 1875. Reuleaux seinerseits trug 1884 das Thema »Kultur und Technik«<br />
vor, Abdruck in: Zeitschrift des V.D.I. 1885, 24ff, und in: Carl Weihe, Franz Reuleaux<br />
und seine Kinematik, Berlin (Springer) 1925, 65-95<br />
37 Otto Dann, Schiller, in: fitiennc Francois / Hagen Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte,<br />
Bd. II, München (Beck) 2001, 171-188 (176)
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 57<br />
leons nicht in Form eines symbolischen Nationaldenkmals zu memorieren, sondern<br />
(nachrichtentheoretisch avant la lettre und damit <strong>von</strong> Napoleon als Organisator<br />
lernend) durch die Anlage nationaler Verkehrssysteme, »als große<br />
Land- und Wasserkommunikation« - etwa einen Donau-Elbe-Rhein-Kanal. 38<br />
Den Gedanken hat Goethe vorformuliert, der das Kanalsystem, also die Infrastruktur<br />
Venedigs als »ein großes, respecktables Werk versammelter Menschenkraft,<br />
ein herrliches Monument, nicht eines Befehlenden, sondern eines<br />
Volcks« in einer Tagebucheintragung vom September 1786 würdigt. 39 Hier<br />
wird der (terminologisch lediglich bis auf die Reichsgründung 1870/71 zurückgehende)<br />
Begriff <strong>von</strong> Infrastruktur selbst zum Monument, wenn auch in organizistischen<br />
Metaphern des Körpers der Nation verfangen (»Diese Kanäle<br />
werden das Herz <strong>von</strong> Deutschland durchströmen«). Karl Friedrich Schinkel<br />
richtet im November 1812, also im unmittelbaren Vorfeld der Befreiungskriege<br />
gegen die napoleonische Besatzung, anläßlich notwendiger Instandsetzungsund<br />
Neubauarbeiten an den Schleusen des Friedrich-Wilhelm-Kanals einen<br />
Vorschlag an das preußische Innenministerium, Funktion und Ästhetik zu verbinden.<br />
Indem bei »an sich so bedeutenden Bauwerken auch das Ästhetische<br />
berücksichtigt werden mÖgte«, kann ein Verkehrsbau »zugleich auch den Charakter<br />
eines öffentlichen Monuments erhalten«. 40 Doch bleibt hier als Projektion<br />
künstlerischer Ausschmückung letztlich Beiwerk (parergon), was im<br />
Vorschlag <strong>von</strong> 1814 Ornament und Logistik selbst verschränkt: In der Moderne<br />
schiebt sich das Denkmal, das »nutzbare Monument« ins Funktionale.<br />
<strong>Im</strong> Unterschied zum <strong>Im</strong>aginären der Nation denkt der infrastrukturelle Ansatz<br />
auch die Anschlüsse (»Diese Kanäle würden wichtig <strong>für</strong> alle dessen Nachbarländer<br />
seyn«). Schaltstellen im Verkehrsfluß - die konkreteste Form aller<br />
Diskurse -, also die kommunikativen Relais selbst werden so national signifi-<br />
38 In der Ausgabe Nr. 292 der Allgemeinen Zeitung v. 19. Oktober 1814; nachgedruckt<br />
in: Preußischer Correspondent Nr. 175 v. 4. November d. J. Dazu Hermann Dreyhaus,<br />
Die ersten Vorschläge zur Errichtung eines Völkerschlachtdenkmals bei Leipzig,<br />
in: Zeitschrift <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> der Architektur VI (1913), 225-232<br />
39 Siehe die Einleitung <strong>von</strong> Horst Bredekamp zu: Ferdinand Piper, Einleitung in die<br />
Monumentale Theologie, Gotha 1867, Nachdruck Mittenwald (Mäander) 1978, El-E<br />
47 (Eil)<br />
40 Bericht der Technischen Oberbaudeputation an das Departement <strong>für</strong> Handel und<br />
Gewerbe im Ministerium des Innern, 25. November 1812, eigenhändiges Konzept<br />
K. F. Schinkels, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitzt (II. HA Gen.Dir.,<br />
Oberbaudepartement, Nr. 387, Bl. 93f). Abdruck und Reproduktion in: Stephan<br />
Waldhoff, »...wodurch diese Bauwerke den Character der öffentlichen Denkmähler<br />
erhalten«. Die ästhetische Aufwertung des Ökonomiebaues in Schinkels Projekt<br />
einer Ausschmückung des Friedrich-Wilhelm-Kanals, 49-67 (Anhang 63-67)
58 EINFÜHRUNG<br />
kant 41 : »Ein großer Kanal bietet eine Reihe auf einander folgender Monumente<br />
in den Schleusen, Brücken, und andern Werken dar, bei welchen die Kunst über<br />
die <strong>von</strong> der Natur dem Menschen entgegengesetzten Schwierigkeiten siegte.«<br />
Demgegenüber dienen die Adressen des historischen Gedächtnisses nur noch<br />
als Etiketten: »Man gebe daher diesen Kanälen, ihren Schleusen und schwierigen<br />
Bautheilen, die <strong>Namen</strong> der erhabenen Monarchen, Heerführer und Offiziere,<br />
welche den großen Kampf entschieden, so wie derjenigen Regenten die<br />
dem europäischen Bunde vor der Leipziger Schlacht beitraten.« Das also heißt<br />
nationale Gedächtnispolitik als re-engineering; mit der Schlußforderung, daß<br />
eine darstellende Politik der Bücherei notwendig <strong>von</strong> einer Technik der Bücherei<br />
supplementiert werden muß, endet auch Ladewigs Abhandlung <strong>von</strong> 1912<br />
. Die symbolische Verschaltung <strong>von</strong> denkwürdigen <strong>Namen</strong> der Strategen<br />
und realen Schleusen (Schaltstellen der Infrastruktur der Nation) korrespondiert<br />
mit jenem taktischen Kriegsspielapparat, den der Kriegsrat George Leopold<br />
Baron <strong>von</strong> Reiswitz in ein und demselben Kontext der Befreiungskriege<br />
<strong>für</strong> König Friedrich Wilhelm III. baute - ein Spiel, das im Unterschied zu<br />
barocken Denkspielen an die Stelle <strong>von</strong> Ornamenten die mathematisch-strategische<br />
Berechnung <strong>von</strong> Wahrscheinlichkeiten stellte und folglich »mit dem<br />
Reellen operieren« will. Die Kommunikation der Mit- und Gegenspieler lief<br />
hier nicht mehr face to face respektive mündlich, sondern in definitiv getakteten<br />
Zeiträumen auf Schiefertafeln; die Abläufe werden so in diskrete Schritte<br />
zerlegt, d. h. algorithmisierbar. Seitdem brauchen <strong>von</strong> geografischen Räumen<br />
lediglich die zeitlichen Daten gewußt zu werden, welche die medialen Systeme<br />
ihrer Überwindung oder optischen Erfassung liefern. »So wie sich geschichtliche<br />
Daten und solche zukünftiger Szenarien dem Echzeitsystem, das der taktische<br />
Kriegsspielapparat abgibt, zuführen ließen, transformierte sich auch der<br />
klassische Feldherrnhügel in eine Schreibstube. 42<br />
Die Kontingenz des Mediums will es, daß analog zum Vorschlag eines infrastrukturellen<br />
Völkerschlachtdenkmals in derselben Allgemeine Zeitung die<br />
41 Anstatt der Denkmalpflege buchstäblich im Wege zu stehen (»der Riese Verkehr«):<br />
Hans Karlinger, Denkmalpflege und Großstadtentwicklung, in: Nachrichten-Blatt <strong>für</strong><br />
rheinische Heimatpflege, Organ <strong>für</strong> Heimatmuseen, Denkmalpflege, Archivberatung,<br />
Natur- Landschaftsschutz, hg. v. Landeshauptmann der Rheinprovinz, 2. Jg. 1930/31,<br />
Heft 7/8, 109-115(113)<br />
42 Philipp <strong>von</strong> Hilgers, Spiele am Rande der Unberechenbarkeit, in: Bodo-Michael Baumunk<br />
/ Margret Kampmeyer-Käding (Hg.), Katalog VII zur Ausstellung 7 Hügel -<br />
Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts: Träumen. Sinne, Spiele, Leidenschaften: Über<br />
die subjektive Seite der Vernunft, Berlin (Henschel) 2000, 109-111 (110). Siehe George<br />
Leopold Baron <strong>von</strong> Reiswitz, Taktisches Kriegs-Spiel oder Anleitung zu einer mechanischen<br />
Vorrichtung um taktische Manocuvres sinnlich darzustellen, Berlin (Gädicke)<br />
1812
GEDÄCHTNISAGI-NTURF.N ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 59<br />
Schnittstelle zu Kulturwissen definiert ist: als Funktion des »Verkehrs durch<br />
verbindende Kanäle, und humanere Posteinrichtungen, so wie allgemeine<br />
Gleichheit in Münze, Maaß und Gewicht«. 43 Unter dem Titel Vorläufige Nachrichten<br />
über die Leipziger Herbstmesse findet der Buchhandel als Opfer der<br />
Knegsverblutung <strong>von</strong> 1806-1815 Erwähnung - wenig Chancen <strong>für</strong> Autoren,<br />
»die nun wieder das Schwerdt mit der Feder vertauschen müssen«. Kurz darauf<br />
erinnert der Verleger Friedrich Christoph Perthes an den deutschen Buchhandel<br />
als Bedingung, also arche und Dispositiv »des Daseyns einer deutschen<br />
Literatur«. 44 Eine dieser Bedingungen heißt Regelung des Copyright und der<br />
Entgelte <strong>für</strong> Autoren. <strong>Im</strong> Schriftwechsel, den der Bibliothekar des Frankfurter<br />
Paulskirchenparlaments <strong>von</strong> 1848/49 mit Verlagen führt, die sich zur Stiftung<br />
ihrer Veröffentlichungen <strong>für</strong> die <strong>von</strong> ihm zu konzipierte Reichsbibliothek bereit<br />
erklärt hatten, ist an die Verlagsbuchhandlung Breitkopf & Härtel in Leipzig<br />
am 4. April 1849 vom Aufbau eines »Abdruck der teutschen Literatur« und<br />
einem »Denkmal der Thätigkeit unserer unternehmenden Verlagsbuchhandlungen«<br />
die Rede; die Funktionalität des deutschen Buchhandels kippt, an der<br />
diskursiven Schnittstelle zum Begriff der Nation, immer wieder ins Symbolische.<br />
45 Die Buchhändlerinitiative <strong>von</strong> 1848/49 bereitet ihrerseits in der Semantik<br />
<strong>von</strong> Denkmal und Stiftung schlicht das Terrain <strong>für</strong> eine strategische<br />
Territorialisierung des literarischen Raums Deutschland (mapping) im Medium<br />
katalogischer Inskription; so wird die Aufzeichnungsmaschine im Raum des<br />
Aufgezeichneten selbst aufgestellt. 46 Paulskirchenbibhothekar Plath resümiert<br />
den Wunsch der beteiligten Buchhändler, »wenn der Eintragung in den Reichscatalog<br />
später gesetzlich eine juridische Bedeutung beigelegt würde, könnten<br />
bei Fragen über Autorenrechte, Nachdruck usw. dem deutschen Buchhandel<br />
leicht Vortheile daraus entsprießen«. 47 Tatsächlich wird im Anschluß an die Einweihung<br />
des Leipziger Völkerschlachtdenkmals ein Jahrhundert später, im<br />
Oktober 1913, der Grundstein zur benachbarten Deutschen Bücherei gelegt.<br />
1814 aber zahlt in Leipzig nur die Frage, ob zur Wiederaufnahme des Messe-<br />
43<br />
Siehe Bernhard Siegert, Relais: Geschicke der Literatur als Epoche der Post 1751-1913,<br />
Berlin (Brinkmann & Böse) 1993<br />
44<br />
Friedrich Christoph Perthes, Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseyns<br />
einer deutschen Literatur, Hamburg 1816. Wiederabdruck als Anhang in: Helmut Hiller<br />
/ Wolfgang Strauß (Hg.), Der deutsche Buchhandel. Wesen, Gestalt, Aufgabe,<br />
Hamburg (Verlag <strong>für</strong> Buchmarkt-Forschung) 1975<br />
45<br />
Albert Paust, Dokumente zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsbibliothek <strong>von</strong> 1848 (Typoskript),<br />
Blatt 6, in: Nachlaß Paust, Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig<br />
46<br />
Vgl. Wolfgang Schaffner, Operationale Topographie, in: Hans-Jörg Rheinberger (Hg.),<br />
Räume des Wissens: Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin (Akademie) 1997, 63-<br />
90 (65)<br />
47<br />
In: Börsenblatt <strong>für</strong> den deutschen Buchhandel Jg. 16 (1848) Nr. 103
60 EINFÜHRUNG<br />
betriebs hinreichend Waarenlager vorhanden sind: Gegenüber allen Gedächtniskapitalfragen<br />
hat die pure Speicherung Vorrang. 48 Etwa gleichzeitig, zum<br />
Jahr 1819, organisiert der Freiherr vom Stein die Datenbank des deutschen<br />
Gedächtnisses als Monumenta Germaniae Historica. Verborgenheit als Garant<br />
machtvollster Wirkung ist die Signatur der Gedächtnismacht in der Moderne.<br />
Die progressive Unsichtbarwerdung ihrer Infrastruktur entzieht sich der historischen<br />
Beschreibung (woraus Theodor Mommsens Verweigerung einer Römischen<br />
Kaisergeschichte einst die Konsequenz zog); das Funktionieren <strong>von</strong><br />
<strong>Im</strong>perien ist narrativ nicht anschreibbar. 49 Gedächtnismacht (archivisch strukturierte<br />
Informationskontrolle) geht somit auf Mechanismen über. Damit ist die<br />
medienarchäologische Schwellenzeit dieser Studie definiert. Die Grenzen der<br />
Darstellbarkeit <strong>von</strong> Infrastruktur betreffen auch ihre (kultur)geschichtliche<br />
Untersuchung. Wer über die Autobahnen <strong>von</strong> einem Ort zum anderen gelangt,<br />
gibt dort nicht ständig Rechenschaft über die Konstruktion des Motors, der<br />
diese Übertragung er ermöglicht, und über die Brücken, die dabei überquert<br />
werden; so bleibt auch an den Produkten der historischen Forschung etwas<br />
weitgehend unsichtbar: die Infrastruktur ihrer Registraturen, die Ordnung des<br />
Archivs. In dem Moment aber, wo Infrastrukturelemente bildhaft werden, also<br />
in die Ordnung des Symbolischen eintreten, sind sie schon nicht mehr Infrastruktur.<br />
Gerade die funktional bedingte Schmucklosigkeit technischer Baudenkmale<br />
im Unterschied zur bürgerlichen Baukunst erhebt sie ihrerseits zum<br />
kulturgeschichtlichen Monument. 50 Der infrastrukturelle Normalzustand, das<br />
Schweigen, der Operationsmodus <strong>von</strong> Technik, Institution und Administration,<br />
aber redet eben nicht. Die vorliegende Arbeit kreist daher um die Schnittstellen<br />
zwischen der symbolischen, d. h. alphanumerisch strukturierten Gedächtnisinfrastruktur<br />
und dem imaginären Diskurs des Nationalen, und um die Momente,<br />
in denen das <strong>Im</strong>aginäre <strong>von</strong> Denkmälern auf das Symbolische des Archivs als<br />
Begründung ihrer Referenz verweist. Thematisiert werden shifter (im Sinne<br />
Roman Jakobsons als Kurzschlüsse <strong>von</strong> Code und Botschaft) zwischen Aufschreibesystemen<br />
(Inventaren etwa) und Semantik (die Behauptung der Historie);<br />
schließlich Einbrüche des Realen einerseits in den Diskurs der Historie und<br />
andererseits in das Regime der Gedächtnisadministration, welches als Paratext<br />
non-diskursiv in Erinnerungsakten am Werk ist. Dieser Raum des Nicht-Dis-<br />
48 So der Artikel vom Vortag: Allgemeine Zeitung Nr. 291 v. 18. Oktober 1814<br />
49 Siehe W. E. (Hg.), Die Unschreibbarkeit <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien. Theodor Mommsens Römische<br />
Kaisergeschichtc und Heiner Müllers Echo, Weimar (Verlag & Datenbank <strong>für</strong><br />
Geisteswissenschaften) 1995<br />
50 So Werner Lindner, Das technische Kulturdenkmal im Bild der Heimat, in: Conrad<br />
Matschoß / ders. (Hg.), Technische Kulturdenkmale, i. A. der Agricola-Gesellschaft<br />
beim Deutschen Museum, München (Bruckmann) 1932, 5-8 (8)
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 61<br />
kursiven soll dabei nicht als letztendlich diskursiv verfaßt betrachtet werden,<br />
sondern radikal wissensarchäologisch, also: dissoziiert vom Diskurs. Zwar<br />
gesteht Michel Foucault zu, daß auch Nicht-Diskursives beim Wissen am Werk<br />
ist, doch sieht er allein im Diskurs jene synthetische Energie, die in der Lage<br />
ist, Institutionen, Techniken, gesellschaftliche Gruppen und andere Organisationsformen<br />
zu einer kohärenten Formation zusammenzubinden. Von daher<br />
schwächt er die non-diskursiven Operatoren durch den Begriff des Prädiskursiven<br />
und holt sie damit wieder in die Hermeneutik des Diskurses ein. 51 Philippe<br />
Lejeune spricht (bezogen auf gedruckte literarische Texte) <strong>von</strong> Beiwerk,<br />
das in Wirklichkeit jede Lektüre steuert. Es geht also um kybernetische Operatoren<br />
52 , die Wissen über Vergangenheit - archivwissenschaftlich formuliert - als<br />
Raum zwischen Provenienz (Rücksicht auf Herkunft) und Pertinenz (Betreff)<br />
organisieren: die Ordnung der Vergangenheit als Historie und ihre Alternativen<br />
in der Epoche <strong>von</strong> 1806-1945, zwischen zwei Kriegen also. Die antinapoleonische<br />
Mobilisierung <strong>von</strong> Energien verhalf in Deutschland der Literatur als<br />
Medium und Kommando zum Durchbruch, während Weltkrieg II nicht nur<br />
andere Kommando-, sondern gerade auch andere Gedächtnistechniken einführte,<br />
die Erzählung des ersten damit vergessen machend. 53 Das Verhältnis <strong>von</strong><br />
arbiträren zu non-arbiträren Agenturen der Archivierung entspricht der Achse<br />
ornamental versus infrastrukturell. Zudem stellt sich in der Fragestellung<br />
Monument versus Dokument, Denkmal versus infrastruktureller Agentur <strong>von</strong><br />
Gedächtnispohtik ein analoges Problem: das der Relation und (Un)Verbundenheit<br />
zwischen Realem und Symbolischen, Klartext und Metapher, Redundanz<br />
und Information. Der 1915 inaugurierte Bismarck-Turm beim Leipziger<br />
Vorort Lützschena etwa ist erbaut mit Geldern der dankbaren Ubersee-Kaufleute<br />
Leipzigs und bildet insofern architektonisch eine kommunizierende Röhre<br />
mit dem 1920 geplanten, 90 Meter hohen Leipziger Internationalen Zentral-<br />
Welthandels-Palast mit U-Bahnanschluß (der Utopie blieb wie der pantheonartige<br />
Messepalast aus Eisenbeton und der kreisrunde Messeturm <strong>von</strong> Richard<br />
Tschammer und Emanuel Haimovici). Der Leipzier Bismarckturm ist ein Bau-<br />
51 Barry Allan (Rezensent), über: Ian Hacking, Rewriting the Soul: Multiple Personality<br />
and the Sciences of Memory, Princeton (UP) 1995, unter Bezug auf: Michel Foucault,<br />
The Archaeology of Knowledge, transl. A. Sheridan Smith, New York 1972, 72 u. 76,<br />
in: History and Theory 36, Heft 1 (February 1997), 63ff (80f)<br />
52 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris 1975, 4, zitiert nach: Gerard<br />
Genette, Paratexte: das Buch vom Beiwerk des Buches, Frankfurt/M. u. New York<br />
(Campus) 1989 ( :: -Paris 1987), 10<br />
53 Siehe Friedrich Kittler, Medien und Drogen in Pynchons Zweitem Weltkrieg, in: Die<br />
unvollendete Vernunft. Moderne versus Postmoderne, hg. v. Diemtar Kamper / Willem<br />
van Reijen, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1987, 240-259 (242f)
62 EINFÜHRUNG<br />
stein der symbolischen Infrastruktur <strong>von</strong> rund 350 über das Deutsche Reich<br />
verteilten Exemplaren dieser Gattung: »Ein schlichter Wachturm, der als mahnender<br />
Finger gen Himmel zeigt, und dessen Flamme als Mahnzeichen weithin<br />
leuchten soll«. 54 Mit dem Datum vom 30. September 1943 bricht das militärische<br />
Reale im Medium des administrativ Symbolischen in das <strong>Im</strong>aginäre dieses<br />
Baus ein, mit der Erlaubnis des Amts <strong>für</strong> Wehrmachts-, Wehrwirtschafts- und<br />
Luftschutzangelegenheiten der Reichsmessestadt Leipzig »zur Errichtung einer<br />
Beobachtungsstelle auf der 1. Plattform des Bismarckturmes und zur Benutzung<br />
des Turmes zu Beobachtungszwecken«. 55 An dieser Stelle im Leipziger<br />
Stadtarchiv setzt die aktenkundliche Überlieferungslage des Bismarck-Turms<br />
<strong>von</strong> Lützschena zunächst aus, um wieder einzusetzen mit einem Vorschlag vom<br />
März 1947, den verlassenen Turm als Gaststätte umzunutzen. 56 Das Jahr 1945<br />
hat der Turm überlebt, da er auch der nachrückenden Sowjetarmee als Peilpunkt<br />
auf dem künstlich angelegten Hügel diente.<br />
Die Schnittstelle zum Realen heißt Verkehrsanbindung, transportlogistisch<br />
oder in der Inszenierung <strong>von</strong> Sichtachsen. Das galt schon <strong>für</strong> die Anlage der<br />
deutschen Ruhmeshalle Walhalla bei Regensburg 57 ; <strong>für</strong> das ostpreußische Tannenberg-Denkmal<br />
zumal, wo »der Gedächtniswille alle bloße Historizität<br />
abwerfend, an Stelle des individuellen Figurendenkmals den Gedenkraum<br />
zu schaffen sucht« 58 - mnemische Energie verlagert sich vom figürativrhetorischen<br />
auf den museal-archivischen Gedächtnisraum, der Lettern oder<br />
Knochen, jedenfalls Signifikanten birgt. Als die Vorbereitungen seit Beginn des<br />
Jahres 1924 feste Form annahmen, war die Wahl des Ortes zunächst offen, an<br />
dem das Denkmal errichtet werden sollte. Die Stätte mußte einerseits an (willkürlich)<br />
einem Brennpunkt der mehrtägigen Weltkriegsschlacht gefunden werden<br />
und einen panoramischen Blick auf das Schlachtfeld eröffnen, »und mußte<br />
doch nahe genug zu Straßen, Bahnen und Ortschaften gelegen sein, um die Tausende<br />
heranzuführen, die vor dem Denkmal den Geist der Schlacht und das<br />
Wesen Ostpreußens verspüren sollten.« 59 Infrastruktur diktierte auch die Orts-<br />
54<br />
Zitiert in: Heinz-Jürgen Böhme / Stefan Riedel, »Wer den Turm hat, hat die Burg«, in:<br />
Leipziger Blätter 22/1993, 38-43, hier: 39<br />
55<br />
Stadtarchiv Leipzig, Kap. 26 A Nr. 100, Bd. 2, Blatt 67<br />
56<br />
Ebd., Akte Stadtverordnetenversammlung/Rat der Stadt (StVuR) Nr. 8605, den Bismarck-Turm<br />
Lützschena betreffend (Nachkriegszeit), Blatt 2<br />
57<br />
Siehe Jörg Träger, Der Weg nach Walhalla. Denkmallandschaft und Bildungsreise im<br />
19. Jahrhundert, Regensburg (Bosse) 2 1991<br />
58<br />
Hubert Schrade, Das deutsche Nationaldenkmal, München (Langen & Müller)<br />
1934, 105<br />
59<br />
Erich Maschke, »Die <strong>Geschichte</strong> des Reichsehrcnmals Tannenberg«, Tannenberg.<br />
Deutsches Schicksal - Deutsche Aufgabe, hg. v. Kuratorium <strong>für</strong> das Reichsehrenmal<br />
Tannenberg, Oldenburg i. O. / Berlin (Stalling) 1939, 197ff, hier: 202
GhDÄCHTNISAGI'NTURüN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 63<br />
wähl <strong>von</strong> Auschwitz als deutschem Konzentratioslager. <strong>Im</strong> Sommer 1941 wird<br />
Rudolf Höß zu Himmler beordert, der ihm mitteilt, er habe nach Erteilung des<br />
Führerbefehls zur so benannten Endlösung der Judenfrage »Auschwitz wegen<br />
seiner günstigen Anbindung an das oberschlesische Schienennetz im Raum Kattowitz<br />
ausgewählt, doch auch deshalb, weil die große Fläche unter anderem<br />
Raum <strong>für</strong> Absperrungsmaßnahmen biete.« 60 Wo Genozid als Verwaltungsakt<br />
stattfindet, entscheidet Infrastruktur an den Schaltstellen, buchstäblich. Die<br />
Einfahrt zum Lager Auschwitz II (Birkenau) macht noch heute augenfällig, wie<br />
durch das Schienennetz das System der Konzentrationslager prinzipiell in das<br />
Reich, d. h. hier: die Reichweite seiner Infrastruktur eingebunden war, während<br />
gleichzeitig <strong>für</strong> die geheime Raketenversuchsanstalt in Peenemünde die Produktion<br />
der rund 20.000 Einzelteile des Aggregat 4 (Propagandaname V2)<br />
dezentral und modular geschah, korrespondierend mit der mechanischen Verlochkartung<br />
in der deutschen Kriegswirtschafts- und Gedächtnisadministration.<br />
61 Es gilt, über jenes Reale <strong>von</strong> Gedächtnispolitik aufzuklären anstatt<br />
geschichtsmetaphonsch da<strong>von</strong> abzulenken. Dabei ist die Frage nach nationalen<br />
Gedächtnisstilen nie unsymbolisch: »Allerdings gelten die Informationstechnologien<br />
als ein Bestandteil der jeweiligen nationalen Kultur eines Landes.« 62<br />
Hinsichtlich der Verflechtung <strong>von</strong> Rüstungsindustrie, Konzentrationslagern<br />
und alliierten Bombardements wird die Erinnerung an Infrastruktur im Zweiten<br />
Weltkrieg selbst monumental, solange noch Sichtbarkeit vorliegt. Aktuelle<br />
Formen des Gedenkens haben sich demgegenüber einer Infrastruktur zu stellen,<br />
die effektiver im Unsichtbaren wirkt. Sich dem Realen zu stellen heißt nicht<br />
nur, Phänomenologisches, Strukturelles und Axiomatisches gleichermaßen als<br />
unterschiedliche Formen <strong>von</strong> Realität anzuerkennen, sondern auch, sich dem<br />
nicht Abbildbaren zu stellen. »Was ist realer als die abstrakte Formel E = m c 2<br />
<strong>für</strong> die Atombombe? Eine ästhetische Sprache, ihre Mittel wären<br />
gegenüber den technischen und logistischen Mitteln der Gewaltanwender banal<br />
und anachronistisch.« Das Reale kann auch die Abstraktion eines Bits besit-<br />
60 Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt/M. (Fischer) 1994,<br />
3 Bde., hier: Bd. 2, 944, unter Bezug auf die Zeugenaussage <strong>von</strong> Höß im Trial of the<br />
Major War Criminals<br />
61 Siehe W. E., Archäologie Peenemünde Bausteine V2, gemeinsam mit Axel Doßmann,<br />
in: Ulrike Greiner-Kemptner / Robert F. Riesinger (Hg.), Neue Mythographien.<br />
Gegenwartsmythen in der interdisziplinären Debatte, Köln / Wien (Böhlau) 1995,<br />
46-71<br />
62 Michael V. Larin, Rußland - der Westen: Einige Integrationsprobleme neuer Informationstechnologien<br />
im Bereich es Dokumentationsmanagement, in: Deutscher<br />
Dokumentartag 1995 (Proceedings), Fachhochschule Potsdam, September 1995<br />
(Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation), 345-351 (345)
64 EINFÜHRUNG<br />
zen. 63 « Einsatz dieser Studie ist die Untersuchung, inwieweit auch die Administration<br />
des deutschen Gedächtnisses analog dazu eine Bewegung fort <strong>von</strong><br />
manifesten Denkmälern hin zu nur noch kybernetisch faßbaren Agenturen<br />
beschreibt. Die Notation der Präsenz und Absenz Qacques Lacan) kommt in<br />
den Repertorien des Archivs zum Vollzug. Der realen Struktur eines solchen<br />
Netzes eignet keine Anschaulichkeit; diese ergibt sich »nur über einen Plan, eine<br />
Karte« 64 , und das verlangt nach kartographischer Inventarisierung der Daten,<br />
nicht nach Historiographie: An der Schwelle zu einer Epoche, die den Begriff<br />
des Netzes nicht mehr in Begriffen der Textwissenschaft, sondern der integrierten<br />
Schaltkreise faßt. Explizit wird auch die deutsche Gedächtniskultur<br />
nach 1989/90 nicht mehr in sinnstiftenden Begriffen der <strong>Geschichte</strong> erzählt,<br />
sondern als lexikographisches »Inventars« registriert. 65<br />
Archäologie der Archive und Archiv-Wissen: Einschnitte 1806 bis 1945<br />
»Regardees avec l'oeil de Parcheologue les archives en general et plus particuherement<br />
les Archives nationales se presentend comme une succession d'alluvions<br />
laisses par les epoques differentes et qui, superposees les unes aux autres,<br />
forment ensemble une architecture stratifiee.« 66 Der archäologische Blick soll<br />
dabei der Versuchung widerstehen, in »flüchtig hingeworfenen Daten und leise<br />
skizzierten Umrissen« sogleich <strong>Geschichte</strong> wiederzuerkennen; er will jenem rhetorischen<br />
Hang zur Denkfigur der Prosopopöie 67 entsagen, die ein Denker der<br />
Archivkunde 1830 in Analogie zu historiographischen Aporien der seinerzeit<br />
noch jungen Disziplin Prähistorie benennt und in eine archäologische Metapher<br />
kleidet: »Wie der geistreiche Cuvier aus einem Fossil die dazu gehörige Gattung<br />
63 Gabriele Werner, Welche Realität meint das Reale? Zu Alfred Hrdlickas Gegendenkmal<br />
in Hamburg, in: kritische berichte, Heft 3 (1988), 57-65, Schlußpassage. Lacans<br />
Definition des Realen kommt in dieser Behauptung nicht vor.<br />
64 Georg Schmid, Die Sache und die Sprache. Semio-Logisches zur Stadtbezeichnungsgeschichte,<br />
in: ders. (Hg.), Die Zeichen der Historie. Beiträge zu einer semiologischen<br />
Geschichtswissenschaft, Wien / Köln / Graz (Böhlau) 1986, 347-372 (361)<br />
65 In diesem Sinne das Programm der Herausgeber <strong>von</strong>: fitienne Francois / Hagen<br />
Schulze (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. 1, München (Beck) 2001; dazu die<br />
Rezension <strong>von</strong> Hans-Ulrich Wehler, Was uns zusammenhält, in: Die Zeit Nr. 13 v. 22.<br />
März 2001, 28<br />
66 Krzystof Pomian, Les Archives. Du Tresor des chartes au Caran, in: Pierre Nora<br />
(Hg.), Lieux de memoire, Bd. III (Les France), Paris (Gallimard) 1992, 163-233 (202)<br />
67 Zu dieser geschichtshalluzinogenen Figur siehe W. E., Texten ein Gesicht geben: Die<br />
Prosopopöie des Archivs im <strong>Namen</strong> Ernst Kantorowicz
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 65<br />
erkennt; so muß der Historiker aus der isolirten Lebensäußerung irgend eines<br />
gesellschaftlichen Zustandes den ganzen verwandten Kreis derselben darstellen<br />
können.« 68 Am Beispiel konkreter Gedächtnisagenturen soll eine demgegenüber<br />
wissensarchäologische Antwort auf die Frage nach den Entstehungsbedingungen<br />
der genealogisch an den Nationbegriff gekoppelten Historie selbst gegeben werden,<br />
die erst in den Medien ihrer Datenserienbildung, buchstäblich und visuell,<br />
synoptisch überhaupt sichtbar und in anschauliche Formen gebracht werden<br />
konnte - reproduzierbar, klassifizierbar und hierarchisierbar. 69 »Gedächtnisse<br />
werden gemacht, und zwar jeweils als vorhistorische Arbeit< in einer >Vorzeitübrigens zu allen Zeiten da ist oder wieder möglich ist
66 EINFÜHRUNG<br />
schreibt, als er (nach dem Ruin des deutschen 19. Jahrhunderts) die neue Intellektualisierung<br />
als Entzauberung der Welt mit der Formel »durch Berechnen<br />
beherrschen« bzw. »technische Mittel und Berechnung« angibt - ein ebenso<br />
historisch datierbarer wie medienarchäologisch (also strukturell) adressierbarer<br />
Moment. 73 Thematisch wird das Verhältnis <strong>von</strong> emphatischen Gedächtnisorten<br />
(Nationaldenkmäler etwa) 74 zu den infra- und infostrukturellen Agenturen der<br />
Verschaltung <strong>von</strong> Gedächtnismacht in Deutschland - auch das Verhältnis <strong>von</strong><br />
Historikerkörpern zum Korpus diskreter Akten. Derrida spricht vom patriarchive<br />
75 ; damit ein Staat als Organisation zum <strong>Im</strong>aginären einer Nation werden<br />
kann, zu einem Vaterland, bedarf es der Umkodierung seiner Archivbasis. Wenn<br />
Staaten nicht mehr auf Gesellschaft, sondern Technologien basieren, gilt dies<br />
unter verkehrten Vorzeichen: »After World War II the power of Information<br />
control formerly attributcd to the State in the archivc would begin to bc<br />
attributed to technology (as in the media epistemology of Marshall McLuhan),<br />
to institutional infrastructures (as in the archaeology of Michel Foucault), to language<br />
(as in structuralist poetics), to corporations (as in the novel of Thomas<br />
Pynchon).« 76 Der kühle wissensarchäologische Blick ist in der Lage, diesen konstitutiven<br />
Zug moderner Nationen (unter anderen) zu analysieren. Gemäß Levi-<br />
Strauss streben kalte Gesellschaften danach, kraft der Institionen, die sie sich<br />
geben, »auf quasi automatische Weise« (zumindest non-diskursiv) die Auswirkungen<br />
zum Verschwinden zu bringen, welche geschichtliche Faktoren auf ihr<br />
Gleichgewicht und ihre Kontinuität haben könnten. 77 Denn der Anspruch <strong>von</strong><br />
Staat (wie <strong>von</strong> Wissenschaft) heißt nicht kollektives, sondern funktionales<br />
Gedächtnis; damit aber steht der Gedächtnisbegriff selbst auf dem Spiel: in seiner<br />
Eigenschaft als Speicher externer Materialien, in seiner diskontinuierliche<br />
Aufnahmebereitschaft und seiner vollständige Intcrpretationsbedürftigkeit als<br />
Medium (nicht Form) ist das Archiv nur bedingt ein Ort, an dem Gesellschaf-<br />
;en ihr Gedächtnis bewahren. 78 Das Archiv zögert den Zerfall der Artefakte auf<br />
3<br />
Max Weber, Wissenschaft als Beruf, in: Geistige Arbeit als Beruf. Vorträge vor dem<br />
Freistudentischen Bund, München / Leipzig (Duncker & Humblot) 1919, 1-37 (16)<br />
4<br />
Zu diesem Begriff demnächst W. E., Gedächtnisorte: Orte der Abwsenheit, in: Lexikon<br />
der Orte und der Örter, hg. v. Barbara Bongartz / Miriam Jakobs<br />
5<br />
Derrida 1995, 16 (Anm.)<br />
6<br />
Thomas Richards, Archive and Utopia, in: Rcpresentations 37 (Winter 1992), 104-135<br />
(130)<br />
7<br />
Claude Levi-Strauss, Das wilde Denken, Frankfurt/M. 1973, 270; dazu Jan Assmann,<br />
Das kulturelle Gedächtnis: Schrill, lirinnerung und politische Identität in Irühen<br />
Hochkulturen, München (Beck) 1992, 68<br />
8<br />
Siehe Andreas Schelske, Zeichen einer Bildkultur als Gedächtnis, in: Klaus Rehkämper<br />
/ Klaus Sachs-Hombach (Hg.), Bild, Bildwahrnehmung, Bildverarbeitung, Wiesbaden<br />
(Deutscher Universitäts-Verlag) 1998, 59-67
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 67<br />
der materiellen Ebene hinaus (katechontisch), nicht auf der hermeneutischen;<br />
ungenutzt, nicht reaktiviert, verfallen sie dem Vergessen. 79 Archive sind das<br />
Gedächtnis der Nation (Hardenberg) 80 , aber nicht primär deren Erinnerung und<br />
zweitens vielmehr das des Staates. Auch auf der Klimax des Historismus ist das<br />
Archiv nicht schlicht »ein Arsenal <strong>für</strong> die Vertheidigung überlebter Vorrechte«,<br />
ein »Geschichtssaal in seiner idealen Gestaltung« (<strong>von</strong> Löher) 81 oder dessen<br />
Kehrseite, die pragmatische Registratur der Administration, ein Arbeitsspeicher<br />
jenseits aller Gedächtnisemphase, sondern eine »energetische<br />
Sammlung in steter Bewegung«. Indem sein Erfassungsbereich auf »die Spuren<br />
menschlichen Wirkens« überhaupt ausgedehnt wird, tritt ein kulturwissenschaftliches<br />
anstelle des juridischen Paradigmas. Solche Spuren werden nicht<br />
schlicht gespeichert, sondern mit Blick auf die Gegenwart geklärt und producirt,<br />
mithin also - im Sinne eines Mediums - prozessiert 82 ; gegenüber dem<br />
Schriftarchiv ist das Gedächtnis nicht auf den Datenspeicher reduzierbar. 83 Wo<br />
nicht länger ein rechtsantiquanscb.es, sondern das öffentliche Interesse die Orientierung<br />
des Archivs bildet, wird ihm ein diskursiver Anschluß imperativ eingeschrieben.<br />
Der archivische Raum als Medium des Historismus ist ein<br />
vektorbestimmtes Koordinatennetz aus Raum- und Zeitdaten (wenn Vektor hier<br />
die Übersetzung <strong>von</strong> Sinn ist); auf die konkrete Frage »Was ist historischer<br />
Sinn?« lautet eine Antwort 1938: »Die wißbegierige Anteilnahme an der Vergangenheit<br />
und das Bewußtsein, daß man selbst nicht ein zusammenhanglos<br />
im leeren Raum schwebender Punkt, sondern das Glied einer schier endlosen<br />
Kette ist, die die blasse und wirre Vergangenheit mit der in undurchdringlichen<br />
79 Siehe Heinz <strong>von</strong> Focrster, Was ist Gedächtnis, daß es Rückschau und Vorschau ermöglicht?,<br />
in: Siegfried J. Schmidt (Hg.), Gedächtnis: Probleme und Perspektiven der<br />
interdisziplinären Gedächtnisforschung, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1991, 56-95<br />
80 Novalis, Fragmente, hg. v. E. Kamnitzer, Dresden 1929, 487, hier zitiert nach: Mattias<br />
Hermann, Das Reichsarchiv (1919-1945). Eine archivische Untersuchung im Spannungsfeld<br />
der deutschen Politik, Dissertation Humboldt-Universität Berlin, FB<br />
Geschichtswissenschaft, 1994, Bd. I, 29<br />
81 Dazu Volker Wagner, Archive als Häuser der <strong>Geschichte</strong>, in: Klaus Bergmann / Klaus<br />
Fröhlich / Annette Kuhn / Jörn Rüsen / Gerhard Schneider (Hg.), Handbuch der<br />
Geschichtsdidaktik, 5. überarbeitete Auflage, Seelze-Velber (Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung)<br />
1997<br />
82 Konstantin Höhlbaum, Über Archive. Zur Orientirung , in: ders. (Hg.), Mittheilungen<br />
aus dem Stadtarchiv <strong>von</strong> Köln, 1. Heft, Köln (DuMont) 1882, 1-15 (3f; dort<br />
auch Zitat <strong>von</strong> Löher)<br />
83 Dazu Peter Krapp, »Screen Memory«: 1 Iypcrtcxt und Deckerinnerung, m: Deutsche<br />
Vierteljahrsschrift <strong>für</strong> Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Jg. 72 (1998), Sonderheft:<br />
Medien des Gedächtnisses, 279-296 (283), unter Bezug auf: Aleida Assmann /<br />
Jan Assmann / Christoph Hardmeier (Hg.), Schrift und Gedächtnis, München 1983,<br />
277 u. 281
68 EINFÜHRUNG<br />
Nebel gehüllten fernen Zukunft verbindet.« 84 Dem folgt zugleich die Antinomie<br />
des Historismus, seine Provokation: »In einer Zeit wie der unseren, in der<br />
die Technik und die Naturwissenschaften die Geisteswissenschaften so sehr in<br />
den Hintergrund schieben, schwindet auch der historische Sinn« . Die Physik eines Hermann <strong>von</strong> Helmholtz und die neuen Technologien<br />
seiner Zeit eröffnen Datenräume, wie sie die Historie noch nicht kennt. »L'application<br />
du calcul ä la transmission des temoignages de generations en generations<br />
ne repose que sur de tres-faux raisonnements.« 85 Wir befinden uns<br />
heute im Übergang vom Zeitalter der (Text-)Archivierung und Speicherung zu<br />
dem der (Signal-)Übertragung. Insofern ist der Titel Sammeln - Speichern -<br />
Er/zählen nicht allein die Definition der in dieser Arbeit behandelten Gedächtnisagenturen<br />
als Medien, sondern handelt auch <strong>von</strong> der epochalen Abfolge ihrer<br />
Tradition: Kulturtechniken der Berechnung einer Gegenwart als Speicher und<br />
ihre Erzählung als <strong>Geschichte</strong>. 86 Wilhelm Dilthey konzedierte eine unerzählbare,<br />
allein durch technische (messende, experimentelle) Medien zu registrierende<br />
Arbeit des Realen, die den narrativen Aufschreibemöglichkeiten der<br />
Historie (und damit der <strong>Geschichte</strong>) entgeht: Schlachtlärm zum Beispiel, nondiskursiver<br />
Tumult also. 87 Wenn Gregor <strong>von</strong> Tours seit der Erschaffung des<br />
Menschen eunetam annorum congeriem connotare zu schreiben sich anschickt,<br />
meint er damit nicht »errechnen«, sondern »erzählen« - der sprunghafte<br />
Er/zählmodus der frühmittelalterlichen Annalistik. »Die heutige Geschichtswissenschaft<br />
trennt rigoros zwischen erzählter und gezählter Zeit . Für das<br />
Frühmittelalter gilt das nicht« 88 ; ein Regensburger Fortsetzer der Annales Fuldenses<br />
schreibt zum Jahr 884: instand anno, quo ista conputamusP Mehr als ein<br />
Wortspiel ist die Verklammerung des Erzählens <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>n und der Zäh-<br />
84<br />
Arpad Weixlgärtncr, <strong>Geschichte</strong> im Widerschein der Reichskleinodien, Baden b. Wien /<br />
Leipzig (Rohrer) 1938, 12<br />
85<br />
Pierre Claude Francois Daunou, Cours d'Etudes historiques, hg. v. Alphonse Honore<br />
Taillandier, Deheque u. a., Paris (20 Bde) 1842-49, Bd. 1, 35<br />
86<br />
Siehe Bernhard Siegert, Das Leben zählt nicht. Natur- und Geisteswissenschaften bei<br />
Dilthey aus mediengeschichtlicher Sicht, in: Claus Pias (Hg.), Dreizehn Vorträge zur<br />
Medienkultur, Weimar (VDG) 1999, 161-182<br />
87<br />
Wilhelm Dilthey, Die Abgrenzung der Geisteswissenschaften. Zweite Fassung, in:<br />
Gesammelte Schriften VII, Stuttgart / Göttingen 8. Aufl. 1992, 311. Siehe auch W. E.,<br />
Bausteine zu einer Ästhetik der Absenz, in: Bernhard J. Dotzler / Ernst Müller (Hg.),<br />
Wahrnehmung und <strong>Geschichte</strong>. Markierungen zur aisthesis materialis, Berlin (Akademie-Verlag)<br />
1995,211-236<br />
88<br />
Arno Borst, Computus. Zeit und Zahl in der <strong>Geschichte</strong> Europas, Berlin (Wagenbach)<br />
1990, 29 u. 116, Anm. 77, unter Bezug auf Harald Weinrich u. Reinhart Koselleck<br />
89<br />
»<strong>Im</strong> augenblicklichen Jahr, in dem wir dies erzählen«: Borst 1990: 41, unter Bezug auf:<br />
Annales Fuldenses a. 884, MGH Scriptores rerum Germanicarum 7 (1891), 112
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 69<br />
lung <strong>von</strong> Zeit; die volkssprachlichen Vokabeln conter, contar, raccontare, erzählen,<br />
to teil bezeugen das Oszillieren zwischen einer narrativen und einer statistischen<br />
Wirklichkeitswahrnehmung. An die Stelle der katechontischen<br />
(Speicher-)Techniken der Beharrung treten, mobilisiert durch die Kriege <strong>von</strong><br />
1806/15 bis 1945, auch am Ende der Neuzeit die Kräfte der Beschleunigung;<br />
beschleunigte Körper und Nachrichten aber lassen sich nur noch durch nichtsymbolische<br />
Apparate rezipieren, speichern und verarbeiten 90 - nach der Epoche<br />
der Kopplung <strong>von</strong> (gespeicherter) Energie und Materie also die posthistoire<br />
der Information. In der Gedächtniskultur ist die Vitalität politischer Symbolik<br />
gekoppelt an die Transparenz bürokratischer Systeme. 91 Michel Foucault hat das<br />
Kräfteverhältnis <strong>von</strong> symbolischer Repräsentation der Macht und ihrer infrastrukturellen<br />
Schaltungen mit einem zeitlichen Vektor versehen, der <strong>von</strong> der<br />
klassisch-theatralischen Gesellschaft zum Disziplinarregime weist, wo Macht<br />
eher durch Überwachung als durch Zeremonien ausgeübt wird, durch Observation<br />
eher als durch kommemorative Erzählungen. 92 Das Archiv synchronisiert<br />
alle diese Epochen gleich unmittelbar zur Präsenz ihrer Aktivierung durch<br />
die (Aus-)Lesung. Die vorliegende Untersuchung fokussiert die Momente, in<br />
denen Infrastruktur und Symbolisierung des deutschen Gedächtnisses im 19.<br />
Jahrhundert ineinander umschlagen, als szenische Schnittstellen <strong>von</strong> denotativen<br />
Gebrauchs- und konnotativen Kommunikationsfunktionen der deutschen<br />
Gedächtnisarchitektur, als Bedeutungsverschiebungen im pragmatischen Zeichenregime.<br />
Umberto Eco erklärt die Grenzen, ja die Blindheit des infrastrukturellen<br />
Blicks buchstäblich am Beispiel der Speicher. 93 Die liaison zwischen<br />
Speicher und Diskurs ist nicht ihrerseits nicht schlicht diskursiv, sondern auch<br />
medial definiert; das historische Beispiel französischer Staatsbegräbnisse macht<br />
transparent, daß der Staat nicht mehr durch schlichte Anweisungen Gedächtnisakte<br />
in nationale Ereignisse transformieren kann. Vielmehr bedarf er zwischen<br />
reiner Sichtbarkeit und arcanum einer dritten Form <strong>von</strong> Macht, einer repräsentativen,<br />
szenischen, signifikanten, öffentlichen und kollektiven Zwischenschicht<br />
der Ereignisse: »For that to happen, they had to become media events, that is,<br />
events that were created at least partially by the mass media.« 94<br />
90<br />
Siehe Stefan Kaufmann, Kommunikationstechnik und Kriegsführung 1815-1945: Stufen<br />
medialer Rüstung, München (Fink) 1996, Einleitung (12ff)<br />
91<br />
Avner Ben-Amos und Eyal Ben-Ari, Resonance and reverberations: ntual and<br />
bureaucracy in the State funerals of the French Third Republic, in: Thcory and Society<br />
24(1995), 163-191 (163)<br />
92<br />
Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York (Vintage)<br />
1979,193<br />
93<br />
Umberto Eco, Einführung in die Semiotik, München 1972, 295<br />
94<br />
Ben-Amos / Ben-Ari 1995: 175 (unter Bezug auf Foucault) u. 181
70 EINFÜHRUNG<br />
In den Jahren nach 1800 führt der deutsche Krieg gegen Napoleons <strong>Im</strong>perium<br />
zu einer Mobilisierung sowohl materialer als auch imaginärer Ressourcen,<br />
indem <strong>Geschichte</strong> als nationaler Diskurs regelrecht, d. h. als kulturelle Regularität<br />
95 implementiert wird. Akten, die Spurung des Archivs, sind hier noch<br />
Akte: Mit der Unterzeichnung der Rheinbundakte durch 16 deutsche Staaten<br />
am 12. Juli 1806 in Paris ist das Ende eines Reiches besiegelt, das die Abdankung<br />
Kaiser Franz II. im August besiegelt. Die Emergenz <strong>von</strong> romantischem<br />
Geschichtsbewußtsein vollzieht sich auf dem Abgrund der Erfahrung einer<br />
Diskontinuität, der Verabschiedung eines <strong>Im</strong>periums, das sich aus der Antike<br />
ableitet: Rom/antik. l)b Ergänzend (und das Wort ebenso sehend wie lesend)<br />
weist Seitter darauf hin, daß Diskontinuität zu 80 % aus Kontinuität besteht.<br />
Nach dem Doppelsieg über die preußischen Heere bei Jena und Auerstedt zieht<br />
Napoleon am 27. Oktober in Berlin ein, um die deutschen Territorien endgültig<br />
neuzuordnen. »Die Landkarte des Reiches verliert einen guten Teil ihrer<br />
Buntscheckigkeit«; Bistümer und Abteien, kleine Fürstentümer und Reichsstädte<br />
werden mediatisiert, also größeren Territorien zugeschlagen. 97 Mit dieser<br />
politischen Demodularisierung erlischt auch die Epoche der regionalen,<br />
pluralen, multidiskursiven <strong>Geschichte</strong>n. »An die Stelle der vielen <strong>Geschichte</strong>n<br />
ist Die <strong>Geschichte</strong> in der Einzahl getreten, jener >Kollektivsingulardie Bedingung der Möglichkeit aller Einzelgeschichten in sich enthält^« 98 An<br />
die Stelle autonomer Genealogien wird Die Geschiebte als nationale Behauptung<br />
geschrieben. In Deutschland insistierte dementsprechend nicht das<br />
Gedächtnis, sondern die Drohung seines Verlusts. Die geplante Enteignung<br />
deutscher Archive zugunsten eines Zentralarchivs unter Napoleon in Paris hob<br />
diese Institution als Medium nationaldiskursiver Einheitsstiftung überhaupt erst<br />
ins Bewußtsein; bereits mit der <strong>von</strong> Napoleon erzwungenen Auflösung geistlicher<br />
Fürstentümer durch den Reichsdeputationshautschluß <strong>von</strong> 1803 strömen<br />
endlose Mengen <strong>von</strong> Archivalien, Büchern und Musealien, also Quellen der<br />
Historie wie der Kunst wie der Technik, in einen unbestimmten Raum, den erst<br />
Archive, Bibliotheken und Museen wieder eindämmen und damit eine Beob-<br />
95 Siehe Friedrich A. Kittler / Manfred Schneider / Samuel Weber (Hg.), Diskursanalysen<br />
1: Medien, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1987, Editorial<br />
96 Eine graphische Anschreibung <strong>von</strong> Walter Seitter (Wien) in der Diskussion zu seinem<br />
Vortrag »Archäologie des Wissens. Die Rhetorisierung der Bibliothek«, Fakultät<br />
Medien, Bauhaus-Universität Weimar, 2. Februar 1998<br />
97 Fragen an die deutsche <strong>Geschichte</strong>: Wege zur parlamentarischen Demokratie; Katalog<br />
der gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Dom in Berlin, Bonn (Deutscher Bundestag,<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit) 1996, 37<br />
98 Friedrich A. Kittler (Hg.), Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften.<br />
Programme des Poststrukturalismus, Paderborn / München / Wien / Zürich (Schöningh)<br />
1989, 8 (»Einleitung«), unter Bezug auf Reinhart Koselleck
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 71<br />
achterdifferenz zum Alten Reich setzen, das erst fortan als <strong>Geschichte</strong> denkbar<br />
ist. Gleichzeitig ist diese Datenflutung eine translatio studii, die mediale Operation<br />
einer Datenübertragung als »monumentale Wissensweitergabe«, die erst<br />
nachträglich unter dem Begriff Tradition diskursiviert wird und zugleich das<br />
Dispositiv <strong>für</strong> die Kulturwissenschaften und die kulturhistorischen Romane des<br />
19. Jahrhunderts bildet . In diesem präzisen Sinne markieren<br />
die Daten 1806 und 1813 Einsätze der vorliegenden Arbeit; die Leipziger<br />
Völkerschlacht »machte dieser größten Gefahr, welcher die moderne Bildung<br />
vielleicht je ausgesetzt gewesen ist, ein Ende, ohne daß die Sieger <strong>von</strong> ferne<br />
Gleiches mit Gleichem vergalten« Exegi monumentum
72 EINFÜHRUNG<br />
Deutsche Bund als Kollektivsingular der Nation hinzutrat. Hinter dem romantischen<br />
Diskurs der deutsch-mittelalterlichen Historie also zieht noch immer<br />
der Zwerg der Genealogie seine Fäden. Es sind die monumentalen Quelleneditionen<br />
des 19. Jahrhunderts, die aus der Gedächtnisforschung überdauert haben<br />
(tatsächlich also zu Monumenten wurden), während die historischen Befunde<br />
dieser Zeit, ihre jeweilige Interpretation, wissenschaftlich meist kritisch überholt<br />
sind. Anders als die mittelalterlichen Quellen, die sich der flüchtigen Lektüre<br />
monumental sperren, heißt Beschleunigung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> in der<br />
Moderne auch die Beschleunigung ihrer Dokumente, die in der literarischen<br />
Zirkulation entziffer- und zitierbar sind.<br />
Nur bedingt folgt die Logistik <strong>von</strong> Gedächtnisagenturen den Einschnitten <strong>von</strong><br />
Regimen (etwa die deutsche Reichseinigung <strong>von</strong> 1870/71). Vom Ende her gibt die<br />
Epoche des Zweiten Weltkriegs einen Haltepunkt vor - mit der Fortentwicklung<br />
und vor allem der kriegsbedingten, technische Kräfte konzentrierenden Durchsetzung<br />
<strong>von</strong> nicht-schriftlichen Gedächtnismedien wie Mikrofilm und der Entwicklung<br />
<strong>von</strong> neuartigen Speichern. Die aber folgen überhaupt nicht mehr der<br />
Mechanik (Montage, Gestänge, Geschiebe, Gerippe), sondern der Elektronik,<br />
verflüssigen mithin also das Gestell des Gedächtnisses in einer Weise, die Martin<br />
Heideggers ungewollte Antizipation der universalen Maschine, die auf geschlossenen<br />
Schaltkreisen basiert, wohl als das Wesen der Technik geahnt hat:<br />
»Das Wort nennt jetzt nicht mehr einen vereinzelten Gegenstand<br />
<strong>von</strong> der Art eines Büchergestells oder eines Ziehbrunnens. Ge-Stell nennt jetzt<br />
auch nicht irgendein Beständiges des bestellten Bestandes. Ge-Stell nennt das aus<br />
sich gesammelte universale Bestellen der vollständigen Bestellbarkcit des Anwesenden<br />
im Ganzen. Der Kreisgang des Bestellens ereignet sich im Ge-Stell und als<br />
das Ge-Stell.« 102<br />
Solche Speicher sind keine Abbildung <strong>von</strong> Gedächtnis, sondern bilden (setzen)<br />
es: »Das Ge-Stell bestellt durch seine Maschinerie zum voraus eine andere Art<br />
und Ordnung <strong>von</strong> Stellen« . Das 19. Jahrhundert ist eben<br />
nicht allein das Zeitalter des emphatischen Gedächtnisses im Historismus, des<br />
Individualismus und Subjektivismus, sondern auch das »des beginnenden Kollektivismus<br />
und der heraufziehenden Technifizierung« als dessen infrastrukturelle<br />
Bedingung. 103 Damit ist eine Medienarchäologie auf den Plan gerufen,<br />
welche »nicht den metaphorisch-bildlichen Assoziationen <strong>von</strong> Vermittlung, Ausdruck<br />
und Botschaft leichtfüßig folgt, sondern die Funktionsweise, die Spezifität<br />
102 Martin Heidegger, Das Ge-Stell, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 79: Bremer und Freiburger<br />
Vorträge, hier: Einblick in das was ist (Bremer Vorträge 1949), Frankfurt/M.<br />
(Vittorio Klostermann) 1994, 24-45 (32 u. 33)<br />
103 Wolfgang Kohre, Gegenwartsgeschichtliche Quellen und moderne Überlieferungsformen<br />
in öffentlichen Archiven, in: Der Archivar 8 (1955), Sp. 197-210 (Sp. 199)
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 73<br />
und die Konstitutionsleistung technischer Apparaturen der Speicherung, Übertragung<br />
und Berechnung <strong>von</strong> Daten beschreiben will.« 104 Spezifisch wird diese<br />
Methode mit jener Epoche um 1800, die durch die Erosion der bis dahin monopolisierenden<br />
abendländischen Wissenstechnik, der Bibliothek, markiert ist. An<br />
deren Stelle treten die Archive als buchstäblicher Ursprung des Realen. Napoleon<br />
als Organisator hat höchstselbst <strong>für</strong> die Priorität <strong>von</strong> Echtzeit gegenüber memory<br />
die Vorbilder geliefert; die optische Telegraphie Claude Chappes (Einsatz 1794)<br />
und das Gegenmodell des kaiserlichen Archivars Daunou positionieren die akzeleratorische<br />
<strong>Im</strong>plikation <strong>von</strong> Nachrichtenübertragungstechniken gegenüber der<br />
speichertechnischen Latenz <strong>von</strong> Gedächtnis als Nachrichtensenke. 105<br />
Nationalgedächtnis als Medienwissen: Retroperspektiven<br />
Die Bruchstelle <strong>von</strong> symbolischer und imaginärer Gedächtnisarbeit ist eine<br />
Funktion des Verhältnisses <strong>von</strong> Hard- und Software und geht weit über die<br />
Praktiken und die Organisation des »Hochladens« gesammelter Erinnerung<br />
(Hans Moravec) hinaus. Media Memory, also Kulturwissenschaft als Medienarchäologie,<br />
fragt nach der Rolle <strong>von</strong> Maschinen im vorgeblich sozialen Prozeß<br />
des Erinnerns »und nach dem Beitrag der Techno-logie zum alltäglichen Dialog<br />
mit der Vergangenheit, wie passive >Speicher< mit den aktiven Formen des >Erinnerns<<br />
kombiniert werden können.« 106 1910 beschreibt Werner Sombart in kritischer<br />
Distanz zu monokausalen Modellen die Bedeutung <strong>von</strong> Technik<br />
(darunter ausdrücklich auch »Redetechnik«) <strong>für</strong> Kultur, definiert als materieller<br />
Kulturbesitz, als Speicher also und als »institutionelle Kultur«, »Menschenanordnungen,<br />
Anordnungen im Staat« [meine Kursivierung, W. E.]. Die Fokussierung<br />
<strong>von</strong> Technik habe »in bestimmten Köpfen zu der Annahme geführt <br />
die Kultur sei gleichsam eine Funktion der Technik.« 107 Sie könne gerade auch<br />
dann wirken, »weil sie nicht da ist.« Die antike Tragödie der Orestie beispiels-<br />
104 Michael Wetzel, Von der Einbildungskraft zur Nachrichtentechnik, in: Peter Klier /<br />
Jean-Luc Evard (Hg.), Mediendämmerung. Zur Archäologie der Medien, Berlin (Bittermann)<br />
1989, 11-39 (16f)<br />
105 Friedrich Kittler, Alphabetische Öffentlichkeit und telegraphisches Geheimnis. Telegraphie<br />
<strong>von</strong> Lakanal bis Soemmering, in: Etienne Francois u. a. (Hg.), Marianne-Germania.<br />
Deutsch-französischer Kulturtransfer im europäischen Kontext, Leipzig<br />
(Leipziger Universitätsverlag) 1998, Bd. 2, 491-506 (493f)<br />
106 Qeert Lovink, Media Memory, in: Gerfried Stocker / Christine Schöpf (Hg.), Memesis.<br />
The Future of Evolution, Wien / New York (Springer) 1996 : 230-233 (232f)<br />
107 Werner Sombart, Technik und Kultur, in: Verhandlungen des Ersten Deutschen<br />
Soziologentages [Oktober 1910 in Frankfurt/M.]. Reden und Vorträge, Tübingen<br />
(Mohr) 1911 [Nachdruck Frankfurt/M. (Sauer & Auvermann) 1969], 63-83 (76)
74 ' EINFÜHRUNG<br />
weise ist »nur möglich, weil Iphigenie keine Nachrichten nach Hause senden<br />
konnte« , womit Übertragungstechnik den Rand <strong>von</strong> Diskursanalyse<br />
einem Schweigen gegenüber definiert, deren Analysierbarkeit Michel<br />
Foucault exklusiv der Wissensarchäologie zuschreibt. In Sombarts Frage: »Was<br />
hat es <strong>für</strong> eine Bedeutung, wenn wir zwischen die Worte >Technik< und >Kultur<<br />
ein >und< setzen« kommt die Boolesche Logik medienkulturell zu<br />
sich, indem diskrete Quantifizierung Kultur im Akt der Messung überhaupt<br />
generiert und damit ein Archiv im Sinne <strong>von</strong> Repertorien (Germanisches Nationalmuseum)<br />
und Quelleneditionen (Monumenta Germaniae Historica) bildet:<br />
»Die geistige Kultur ist im gleichen Umfang abhängig <strong>von</strong> der Gestaltung der<br />
Technik. Ich denke z. B. an die Methoden der Reproduktion zur Herstellung<br />
<strong>von</strong> Sammlungen archäologischer Art, oder ich denke an die Möglichkeit, Quellen<br />
in Druckwerken niederzulegen. Die moderne Experimental-Psychologie<br />
ist im wesentlichen in ihrer Entwicklung gebunden durch die Möglichkeit<br />
der Herstellung feiner Meßinstrumente, Zählinstrumente, Zählapparate und dergl.<br />
Die moderne Philologie baut sich heutzutage mehr und mehr auf phonetischen<br />
Apparaten auf, auf der Möglichkeit, die Schwingungen festzustellen, die bei der<br />
Stimmausgabe entstehen.« 108<br />
Die medienarchäologische Zäsur, die <strong>für</strong> die vorliegende Fragestellung nach<br />
non-diskursiven Dispositiven des deutschen Nationalgedächtnisses sensibilisiert,<br />
setzt als Anfang, als arche der Frage das Ende des Untersuchungszeitraums:<br />
den Zweiten Weltkrieg als Katalysator eines neuen, technisch induzierten<br />
Paradigmas der Informationsverarbeitung. Es geht dabei nicht um die<br />
historiographische Beschreibung einer Entwicklung, sondern um die Darlegung<br />
einer wechselnden Abfolge <strong>von</strong> Aggregatzuständen des Gedächtnisses. Der<br />
Jetzt-Zustand (die universale diskrete automatisierte Rechenmaschine) ist<br />
Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Kriegs, und diese arche der<br />
Gegenwart setzt die zeitliche Begrenzung der vorliegenden Arbeit. Die militärische<br />
Vorgeschichte aktueller Apparate ist (wenngleich dissimuliert) noch spürbar;<br />
»in diesem Kontext sind Speichern und Abfragen bloße Befehle, keine<br />
sozialen Prozesse mit möglichen historischen <strong>Im</strong>plikationen. Die Hardware-<br />
Architektur bestimmt die Software« . Die Turing-Maschine<br />
trennt nicht mehr Daten und Instruktion, sondern bewahrt sie gleichzeitig als<br />
und im Gedächtnis. Damit ist das Archiv als Dispositiv auf sich selbst bezogen:<br />
das Ende eines semantischen Gedächtnisbegriffs. 109 Gleichzeitig wird diese<br />
108 Sombart 1911: 70f; siehe auch Hermann Helmholtz, Die Lehre <strong>von</strong> den Tonempfindungen<br />
als physiologische Grundlage <strong>für</strong> die Theorie der Musik, Braunschweig<br />
(Vieweg) 1863, unveränd. Nachdr. Frankfurt/M. (Minerva) 1981<br />
109 Siehe Daniel C. Dennctt, Philosophie des menschlichen Bewußtseins, Hamburg<br />
(Hoffmann undCampc) 1994, 276ff
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 75<br />
mathematische Gedächtnisästhetik an non-diskursive (Hilfs-)Wissenschaften<br />
wie die im 19. Jahrhundert endgültig aufkeimende Statistik als Aufzeichungssysteme<br />
nationaler Zeit/räume rückgekoppelt.<br />
Der Zweite Weltkrieg markiert nicht nur den Anfang vom fortgesetzten<br />
Ende analoger Gedächtnistechniken. Die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse<br />
<strong>von</strong> 1945/46 erinnern auch daran, daß das Privileg der Schrift als Medium<br />
des Archivs seine Grenzen in einem Jahrhundert erreicht hat, welches Entscheidungen<br />
zunehmend nicht mehr dem Schriftverkehr, sondern dem Telefon<br />
anvertraut. Auf seine Weise hat ein Archivar des Bundesarchivs genau registriert,<br />
daß unter diesen Umständen die projektierte Edition <strong>von</strong> Akten zur<br />
deutschen auswärtigen Politik 1918-1945 <strong>für</strong> den Historiker nicht dasselbe<br />
bedeuten kann wie die älteren Publikationen; insbesondere die Veröffentlichungen<br />
aus den Akten der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse spielen dabei<br />
eine Rolle, die »als Ergänzung zu den Dokumenten die mündliche Aussage<br />
bringen.« Führende Persönlichkeiten autoritärer Staaten »<strong>von</strong> der Natur<br />
des Nationalsozialismus und des Bolschewismus können aus gegebenen Gründen<br />
nicht aktenfreudig sein.« 110 Eine Medienarchäologie des Wissens muß dort<br />
ansetzen, wo Michel Foucaults Diskursanalysen seinerseits enden. 111 Sie<br />
schreibt <strong>von</strong> der Erfahrung eines Bruchs aus; nicht länger geben Archive (im<br />
bibliothekarischen Sinn Foucaults) unsere historischen Aprioris ab und erzeugen<br />
einen Schein nichtdiskursiver Wirklichkeiten; die Differenz <strong>von</strong> Bibliothek<br />
und Archiv selbst wird <strong>von</strong> ihren Medien (Buch / Akte) diktiert. 112 Heute »ist<br />
das Reale (und nicht erst seit Watergate) sehr anders registriert«. 113 Die amerikanische<br />
Commission on Preservation and Access and the Research Libraries<br />
Group legte den Abschlußbericht der »Task Force on Archiving of Digital<br />
Information« ins Netz und »envisions the development of a national system of<br />
digital archives«; 114 das Digitale und das Nationale aber kommen nicht mehr<br />
110 Wolfgang Mommsen, Deutsche Archivalien im Ausland: I. Auswärtiges Amt, in: Der<br />
Archivar. Mitteilungsblatt <strong>für</strong> deutsches Archivwesen, 4. Jg Nr. 1 (Februar 1951),<br />
Sp. 1. Zu solchen »ephemären« Quellen siehe Johann Gustav Droysen, Zur Quellenkritik<br />
und deutschen <strong>Geschichte</strong> des 17. Jahrhunderts, in: Forschungen zur deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> 4 (1864), 15-20 (20)<br />
111 Dazu W. E., M.edium F.oucault. Weimarer Vorlesungen über Archive, Archäologie,<br />
Monumente und Medien, Weimar (Verlag & Datenbank <strong>für</strong> Geisteswissenschaften,<br />
Reihe Medien, hg. v. Claus Pias, Joseph Vogl u. Lorenz Engell, Bd. 4) 2000<br />
112 Siehe Heinrich Otto Meisner, Archive, Bibliotheken, Literaturarchive, in: Archivalische<br />
Zeitschrift 50/51 (1955), 167-183 (174)<br />
113 Kittler / Schneider / Weber (Hg.) 1987: Editorial; s. a. Friedrich Kittler, Ein Verwaiser,<br />
in: Gesa Dane u. a. (Hg.), Anschlüsse. Versuche nach Michel Foucault, Tübingen<br />
(diskord)1985,141-146<br />
' l4 ftp://ftp.rlg.org/pub/archtf/final-report.doc
76 EINFÜHRUNG<br />
zusammen. Es kann nicht darum gehen, unter dem Eindruck Neuer Medien<br />
retrospektiv deren lineare Vorgeschichten zu entziffern und den zur Verhandlung<br />
stehenden Alten Medien Begnfflichkeiten zu implementieren, die den<br />
Neuen Medien gegenüber den Effekt eines »immer schon« erzielen wollen.<br />
Vielmehr gilt es, die Infrastruktur der Lage des deutschen Gedächtnisses 1800-<br />
1945 auf Differenzen, Resistenzen und Inkompatibilitäten hin zu untersuchen,<br />
die eine Umschreibung des Gedächtnisses unter elektronischen Bedingungen<br />
<strong>von</strong> ihren Vorgängern unterscheidet. Nicht die <strong>Geschichte</strong> ist different, sondern<br />
ihre Lage: Was vorliegt, sind Archive, Bibliotheken, Museen, die nach analogen<br />
Kriterien <strong>Geschichte</strong> gespeichert und verzeichnet haben. Diese Struktur ist<br />
nicht-arbiträr, aber auch nicht programmierbar und macht als Befund eine<br />
Arbeit darüber zur objektorientierten Medienwissenschaft.<br />
Kulturwissenschaften als Funktion ihrer Speicher<br />
1910 definiert Heinrich Rickert die Differenz <strong>von</strong> Kultur- und Naturwissenschaften<br />
ausdrücklich nicht <strong>von</strong> ihren Gegenständen, vom Material her, sondern<br />
als Unterschied in »Einordnung und Verarbeitung des Materials«, also auf<br />
der ebenso methodischen wie medialen Ebene ihrer Datenverarbeitung; erst der<br />
Begriff der <strong>Geschichte</strong> als der des »einmaligen Geschehens in seiner Besonderheit«<br />
setzt die historischen Kultur- <strong>von</strong> den Naturwissenschaften ab. 115 Dementsprechend<br />
weist etwa auch die Begriffsbildung <strong>für</strong> den hypothetischen,<br />
zunächst nur aus einer Feder bekannten »Urvogel« Archäoptenx logisch bereits<br />
auf die Annahme seiner Allgemeinheit als Species, nicht als Einzelfund . Die historischen Kulturwissenschaften praktizieren eine Datenästhetik, die<br />
eine explizit medienarchäologische Relektüre anschließbar macht, lehren sie<br />
doch »politische, künstlerische, literarische und soziale Kulturerscheinungen in<br />
den Bedingungen ihres Entstehens zu verstehen«, gerade ohne sie zu interpretieren<br />
- Arbeit am Archiv, an der arche, am Apriori des Diskurses im Sinne<br />
Foucaults . Die Aufspeicherung technischer Apparate leistet<br />
allerdings gerade das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg nicht, sondern<br />
das Münchner Deutsche Museum, das in der Satzung als »Museum <strong>von</strong><br />
Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik« definiert ist; das Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Technik und Kultur bleibt gespannt.<br />
Diese Studie will die Theorie, Durchsetzung und Praxis der Kulturgeschichte<br />
im 19. Jahrhundert als Dispositiv analysieren, <strong>von</strong> dessen Datenbanken die<br />
115 Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen (Mohr), 2.<br />
Aufl. 1910, 2 u. 16
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 77<br />
Medienwissenschaften heute zehren. 116 Die Trennung <strong>von</strong> Schreiben und Speichern<br />
schickt sich an, aufgehoben zu werden in jenem Medium, welches Bücherwissen<br />
und Versuchsanleitungen, Texte und Formeln, Vergangenheiten und<br />
Zukunftsprojekte in einheitlichem Format an einheitlichen Adressen ablegt.<br />
Damit wird auch Kultur berechenbar, am Ende jener Epoche, die mit Kulturwissenschaften<br />
als Funktion idealistischer Philosophie begann, sich positivistisch<br />
da<strong>von</strong> löst, durch Friedrich Nietzsches Denken pragmatisiert, d. h. politisiert<br />
wird, bis zu zwei Weltkriegen, denengegenüber jeder human-emphatische Kulturbegnff<br />
in die Knie geht, um fortan in kybernetischen Termini begriffen zu werden.<br />
Wenn Kultur eine Funktion <strong>von</strong> Gedächtnistechniken ist 117 , wird über die<br />
Erbschaft unserer Zeit buchstäblich der Aufbau und der Verfügung <strong>von</strong> Hardware<br />
entscheiden. 118 Zwar warnt Renate Lachmann vor medienarchäologischer<br />
Absolutierung: »Das Gedächtnis ist mithin kein passiver Speicher, sondern ein<br />
komplexer Textproduktionsmechanismus« 119 , doch schließt die These <strong>von</strong> Kultur<br />
als Textmenge den Begriff des Werkzeugs nicht aus. 120 Selbst Jürgen Habermas<br />
definiert Kultur als Funktion eines Reservoirs: »Kultur nenne ich den<br />
Wissensvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer, indem sie sich über<br />
etwas in der Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen.« 121 Nicht zufällig<br />
erfolgt fast jeder Zerstörungsakt <strong>von</strong> Kultur als Vernichtung <strong>von</strong> Gedächtnis,<br />
als Tilgung <strong>von</strong> Texten, als Vergessen <strong>von</strong> Zusammenhängen. 122 Dementspre-<br />
116<br />
Darüber allgemein, und über Victor Hehns Kulturgeschichte der Pflanze zwischen<br />
Archäologie und Historie speziell, siehe W. E., Radikale Wissensarchäologie oder:<br />
Kultur als Funktion ihrer Speicher, in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell<br />
(Hg.), Orte der Kulturwissenschaft. 5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag)<br />
1998,55-80.<br />
117<br />
Jurij M. Lotman / B. A. Uspenskij, Zum semiotischen Mechanismus der Kultur, in:<br />
Semiotica sovietica, hg. v. K. Eimermacher, Aachen 1986, Bd. 2, 853-880<br />
iis Friedrich Kittlcr, Vortrag im Rahmen der Vcranstaltungsreihe: Erbschaft unserer Zeit,<br />
veranstaltet vom Einstein-Forum Potsdam / Berliner Festspiel GmbH, Staatsbibliothek<br />
Preußischer Kulturbesitz Berlin, Haus 2 (Potsdamer Platz) 1996; siehe Thomas<br />
de Padovas Bericht in: Der Tagesspiegel, 19. November 1996<br />
119<br />
Renate Lachmann, Kultursemiotischer Prospekt, in: Anselm Haverkamp / dies.,<br />
Memoria. Vergessen und Erinnerung (= Poetik und Hermeneutik Bd. 15), München<br />
(Fink) 1993, xvn-xxvu (xvn)<br />
120<br />
Roland Poser, Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation kulturwissenschaftlicher<br />
Grundbegriffe, in: Aleida Assmann / Jürgen Harth (Hg.), Kultur als<br />
Lebenswelt und Monument, Frankfurt/M. (Fischer) 1991, 34-77 (49), unter ausdrücklichem<br />
Verweis auf Locher, Radierer und Schreibmaschinen.<br />
121<br />
Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 5. Aufl. 1988, 209<br />
122<br />
Jurij Lotman, Über das typologische Studium der Kultur, in: ders., Kunst als Spra-<br />
che, Leipzig (Reclam) 1981, 52
78 EINFÜHRUNG<br />
chend agonal definiert Michel de Certeau seinen kulturwissenschaftlichen Zugriff:<br />
»Das Verhältnis der Produzenten zu dem Kräftefeld, in das sie eingreifen, muß<br />
also zu einer kriegswissenschaftlichen Analyse der Kultur führen.« 123 Die gedächtnismedien-<br />
und wissensarchäologischen Suchschnitte der vorliegenden Arbeit<br />
sind strategisch, nicht mit flächendeckendem Anspruch angelegt. Jurij M. Lotman<br />
und Boris A. Uspenskij definieren im Kontext einer sowjetischen Semiotik,<br />
die inzwischen selbst Teilmenge des kulturellen Gedächtnisses wurde, daß Kultur<br />
»ihrem eigentlichen Wesen nach gegen das Vergessen gerichtet« ist; sie überwindet<br />
das Vergessen, indem sie es in einen Mechanismus des Gedächtnisses<br />
verwandelt. 124 Doch widersprechen beide einer reinen Speicheranalogie, der<br />
zufolge kulturelles Gedächtnis mit archivarischen Einlagerungen zusammenfällt<br />
; erst die konstruktive, generative Leistung der Aktivierung <strong>von</strong><br />
gespeicherten Daten im Medium der Erzählung (und anderen Medien der Kodierung,<br />
Speicherung und Zirkulation <strong>von</strong> kulturellem Sinn, also: Vektoren), welche<br />
die Zeithorizonte einer gegebenen Gesellschaft synchronisiert, macht aus ihnen<br />
das kulturelle Gedächtnis. »Kultur wird in diesem Sinne verstanden als der historisch<br />
veränderliche Zusammenhang <strong>von</strong> Kommunikation, Gedächtnis und<br />
Medien.« 125 Medienarchäologie sensibilisiert demgegenüber <strong>für</strong> das Problem<br />
der Adressierung <strong>von</strong> Texten. Gedächtnis ist eine grundlegende, aber nicht<br />
hinreichende Bedingung <strong>für</strong> Kultur; alles, was nicht adressierbar ist, kann eine<br />
Kultur nicht erinnern und das Geschriebene oder Gedruckte ist, obgleich gespeichert,<br />
vergessen. 126 Solange das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als<br />
Rechts-, nicht Volksfiktion existiert, »ward auch die teutsche <strong>Geschichte</strong> fast nur<br />
<strong>von</strong> dem juristischen Standpunkte aus gefaßt, so daß die Entwicklung der Verfassung,<br />
in ihren gesetzlichen Formen, der Leitfaden war, an welchen sich das<br />
Uebrige reihen mußte.« Demgegenüber plädiert die Epoche nationaler Mobili-<br />
123 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin (Merve) 1988, 20<br />
124 Lotman / Uspenskij 1986: 859. Vgl. die Gleichsetzung <strong>von</strong> Kultur und »Informationssammeln«:<br />
Marshall McLuhan, Die magischen Kanäle (*Understanding Media, 1964),<br />
Düsseldorf / Wien (Econ) 1968, 151. Zur Historisierung der Moskau-Tartu-Schule:<br />
Klaus Städtke, Kultur als semiotische Tätigkeit, in: Weimarer Beiträge 41, Heft 4<br />
(1995), 507-527<br />
125 Aleida Assmann u. Jan Assmann, Das Gestern im Heute. Medien und soziales<br />
Gedächtnis, in: Klaus Merten / Siegfried J. Schmidt / Siegfried Weischenberg (Hg.),<br />
Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft,<br />
Opladen (Westdeutscher Verlag) 1994, 114. Dazu auch Siegfried J. Schmidt,<br />
<strong>Geschichte</strong> beobachten. <strong>Geschichte</strong> und Geschichtswissenschaft aus konstruktivistischer<br />
Sicht, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaften 8, Heft 1<br />
(1997), 19-44 (34ff)<br />
126 Siehe Axel Roch, Adressierung <strong>von</strong> Texten als Signale über Bilder, in: Verstärker. Von<br />
Strömungen, Spannungen und überschreibenden Bewegungen, Jg. 2, Nr. 2, Mai 1997,<br />
hg. v. Markus Krajewski u. Harun Maye
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 79<br />
sierung mnemischer Energien 1815 da<strong>für</strong>, den todten Besitz deutscher Geschichtsquellen<br />
in einen lebendigen zu verwandeln; Medium einer Volksgeschichte ist die<br />
Erzählung, ohne welche »die teutsche <strong>Geschichte</strong> noch so verworren vor den<br />
Augen desjenigen da, der nicht eigentliches Studium aus ihr machen<br />
kann.« Konkret heißt dies die Administration eines kulturpädagogischen Programms;<br />
Lehrer sollen künftig »das Herz des Knaben mit großartigen Darstellungen<br />
aus der <strong>Geschichte</strong> unseres Volkes erwärmen« - Narration als Medium<br />
der historischen <strong>Im</strong>agination 127 , bisweilen kriegsentscheidend. »Das historische<br />
Selbstbewußtsein unserer Heere lieferte 1870 die ausharrende Kraft« . Was aber im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> praktiziert wird, ist derzeit noch<br />
nicht selbstverständlich, sondern muß als Diskurs erst durchgesetzt werden. Zu<br />
den »Hauptquellen, aus welchen nicht nur Kräfte des Widerstandes gegen die<br />
immer noch mächtigen bösen Geister der Zeit, sondern auch Belebungen acht<br />
vaterländischer Gesinnung geschöpft werden müssen, gehört die<br />
gründliche Erforschung und die mehr und mehr sich verbreitende Kunde der<br />
<strong>Geschichte</strong>« . Ist Kultur gegenüber der Trägheit biologischgenetischer<br />
Evolution ein extrasomatisches, »nicht-erblich vermitteltes Gedächtnis<br />
eines menschlichen Kollektivs, das in einem bestimmten System <strong>von</strong> Verboten<br />
und Vorschriften zum Ausdruck kommt« 128 - wobei die Vorschriften außerhalb<br />
des Organismus in Form <strong>von</strong> Aufzeichnungen gespeichert sind - 129 , liegt sie als<br />
Funktion <strong>von</strong> synchronen Vektoren, <strong>von</strong> kybernetischen Operationen vor, demgegenüber<br />
der Begriff <strong>von</strong> memory zur Metapher wird. Vilem Flusser bezweifelt<br />
die - <strong>von</strong> Lotman nahegelegte - »Unterscheidung zwischen Heredität und Paideia,<br />
zwischen der Übertragung ererbter und erworbener Informationen«; vielmehr<br />
geht er <strong>von</strong> deren Verknüpfung aus, »da die genetische Information das<br />
Gedächtnis nicht nur vorprogrammiert, bevor es <strong>von</strong> der kulturellen weiterprogrammiert<br />
wird, sondern überhaupt erst die Struktur des Gedächtnisses aufbaut<br />
- ganz im Sinne des Konstruktivismus in der Neurologie. »Die genetische<br />
Information verhält sich zur kulturellen nicht nur, wie sich zwei übereinandergelagerte<br />
Programme in einem Computer zueinander verhalten, sondern auch,<br />
127<br />
Chiffre »H«, Ein Wort über die teutsche <strong>Geschichte</strong>, in: Rheinischer Merkur, 2. Jg.<br />
1815/16, Nr. 264 v. 7. Juli 1815<br />
128<br />
Lotman/Uspenskij 1986: 856; s. a. dies., Die Rolle dualistischer Modelle in der Dynamik<br />
der russischen Kultur, in: Poetica (1977) Heft 1, lff<br />
129<br />
Siehe F. Klix, Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen<br />
Informationsverarbeitung, Wien (3. Aufl.) 1976; ferner W. E., <strong>Im</strong> <strong>Namen</strong> des Speichers:<br />
Eine Kritik der Begriffe »Erinnerung« und »Kollektives Gedächtnis«, in: Moritz<br />
Csäky / Peter Stachel (Hg.), Speicher des Gedächtnisses. Bibliotheken, Museen,<br />
Archive, Teil 1: Absage an und Wiederherstellung <strong>von</strong> Vergangenheit - Kompensation<br />
<strong>von</strong> Geschichtsverlust, Wien (Passagen: Orte des Gedächtnisses) 2000, 99-127
80 EINFÜHRUNG<br />
wie sich die Hardware des Computers zu der Methode verhält, nach der er programmiert<br />
wird.« 130 Marshall McLuhan definiert in Die magischen Kanäle<br />
(UnderStanding Media, :: '1964) unter Bezug auf Julian Huxley den Menschen im<br />
Unterschied zu »rein biologischen Geschöpfen« als dasjenige, das über einen<br />
»Übertragungs- und Umformungsapparat« verfügt, der seinerseits »auf seiner<br />
Fähigkeit, Erfahrung zu speichern«, basiert. Die Toronto-Schule (Harold Innis,<br />
Eric Havelock, Marshall McLuhan) präzisiert, daß Kulturen durch die Kapazität<br />
ihrer Medien der organisierten Weitergabe, d. h. ihrer Aufzeichnungs-, Speicherungs-<br />
und Übertragungstechnologien definiert sind - und nicht etwa durch<br />
Kommunikation im anthropologisch emphatischen Sinne. 131 »Die Pointe und<br />
Provokation dieser Richtung besteht darin, daß sie aus der Literaturwissenschaft<br />
eine Ingenieurwissenschaft macht« 132 , was nicht ohne Folgen <strong>für</strong> die Schreibbarkeit<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> bleibt. Weshalb der Anfang und die Emergenz der Computertechnologie<br />
als »der wahrhaft erste Fall einer Evolution, die genau diesen<br />
vordem uneinholbaren Vorsprung der Kultur noch einmal überbietet« 133 , auch<br />
den Endpunkt dieser Studie darstellen. In ihrer Kopplung an Medien betrachtet,<br />
ist Kultur nicht mehr primär durch ihre Speicherfunktionen, sondern zunehmend<br />
durch die Weitergabe <strong>von</strong> Information definiert - vom Archiv (Speichern) zum<br />
Signal (Übertragen). »So einschneidend haben die Techniken der Informationsübertragung<br />
die Techniken der Speicherung verändert« . Die<br />
nachrichtentechnisch induzierte Zeichenästhetik kodiert auch die Semiotik und<br />
Philologie des 19. Jahrhunderts neu, die in Versuchen zur Mechanisierung und<br />
Standardisierung linguistischer Analysen und Statistiken resultiert.<br />
Der deutschen Geschichtskultur fehlt es weitgehend an einem politisch definierten<br />
Kulturbegriff 134 ; allerdings wurde der Kulturbegriff in Deutschland als<br />
strategisch-semantische Opposition zum Begriff der Zivilisation gegen die Ideale<br />
der Französischen Revolution national positioniert. 135 Die vorliegende Arbeit<br />
versteht sich partiell als Kritik <strong>von</strong> Kulturwissenschaften als hermeneutischer,<br />
sinnfixierter Ablenkung <strong>von</strong> der Wahrnehmung des infrastrukturellen Symboli-<br />
130 ilem Flusser, Kommunikologie, Frankfurt/M. (Fischer) 1998, 309<br />
131 Siehe auch Stocker 1997: 60f (»Medien und Gedächtnis«)<br />
132 Aleida Assmann (unter Bezug auf Friedrich Kittler), Exkurs: Archäologie der literarischen<br />
Kommunikation, in: Miltos Pechlivanos / Stefan Rieger / Wolfgang Struck /<br />
Michael Weitz (Hg.), Einführung in die Literaturwissenschaft, Stuttgart / Weimar<br />
(Metzler) 1995, 200-206 (201)<br />
133 Friedrich Kittler, Wenn das Bit Fleisch wird, in: Martin Klepper u. a. (Hg.), Hyperkultur.<br />
Zur Fiktion des Computerzeitalters, Berlin / New York 1996, 150f<br />
134 Siehe etwa Raymond Williams, Gesellschaftstheorie als Begriffsgeschichte. Sudicn<br />
zur historischen Semantik <strong>von</strong> Kultur, München 1972<br />
135 Siehe H. Bausinger, Zur Problematik des Kulturbegriffs, in: A. Wierlacher (Hg.),<br />
Fremdsprache Deutsch, Bd. I, München 1980, 58-69
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 81<br />
sehen und seiner Realitäten. Nicht-diskursive Praktiken bilden die Grenzen dessen,<br />
wo<strong>von</strong> gesprochen werden kann, mithin einen Aussagesockel: den definitiven<br />
Horizont, ohne den weder die Ausagegegenstände erscheinen könnten noch<br />
ein solcher Platz im Inneren der Ausage selbst bezeichnet werden könnte. 136 Alle<br />
Kulturgeschichtsschreibung <strong>von</strong> Infrastruktur ist ihrerseits Teil einer solchen;<br />
Infrastruktur betrifft eben nicht nur das Objekt des Historikers, sondern auch die<br />
Bedingungen seiner eigenen Arbeit, das Verhältnis <strong>von</strong> historischer <strong>Im</strong>agination<br />
zum Realen seiner Forschung: die Formation der Archive, ihre Streuung, ihre<br />
Registratursysteme, ihren Zugang - alle Geschichtsschreibung vorweg strukturierend.<br />
Denn die Information, das Gedächtnis der betreffenden Institution bleibt<br />
bei derselben (das Archiv des Unternehmens Monumenta Germaniae Historica;<br />
das Archiv der Verwaltung des preußischen Geheimen Staatsarchivs als Bestandteil<br />
seiner selbst; das Archiv des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg).<br />
Subjekt und Objekt dieser Schrift (das Dispositiv des Archivs) fallen an dieser<br />
Stelle ineins; die binäre Struktur der Untersuchung ist <strong>von</strong> einem medienarchäologischen<br />
Historismus geprägt, d. h. der Analyse der fortwährenden Beziehungen<br />
zwischen archivischen Gedächtnisagenturen, den die <strong>Geschichte</strong> erzählt, und<br />
einer Erzählung, die <strong>von</strong> den Archiven, die sie erzählt, selbst strukturiert wird. 137<br />
Was bleibt, ist die Beobachterdifferenz. Der monumentalistische Diskurs der<br />
Historie entstand »als das Medium, in dem der Staat zugleich sich selbst und eine<br />
ewige Ordnung sichtbar macht« . Leopold <strong>von</strong> Rankes<br />
Darstellung Fürsten und Völker ist - objektorientiert - vor allem durch die<br />
Anschauungsweise seines jeweils vorwaltenden Quellenmaterials bestimmt;<br />
»nicht das dynamische, sondern das statische Moment der Berichterstattung überwiegt.«<br />
138 Hier liegt also die infrastrukturelle, indexikalische Präfiguration der<br />
Historie auf der Ebene des Archivs (als non-diskursives Korrelat zu jener rhetorischen<br />
Präfiguration historischer Sinn- und Erzählbildungsmuster, die Hayden<br />
Whites Metahistory nahelegt).Nicht jeder kulturelle Speicher ist Archiv, und der<br />
Unterschied <strong>von</strong> Brief und Archivalle ist der zwischen Diskurs und Gesetz: Staatliche<br />
Institutionen und juristische Akten sind eben nicht wie sprachliche Akte<br />
Funktionen einer »rhetorischen Verfaßtheit«. Ihre De- und Rekompomerbarkeit<br />
folgt Kalkülen jenseits semantischer Figuren 139 , wie denn auch das <strong>für</strong> Preußens<br />
136 Gilles Deleuze, Foucault, Frankfurt/M. 1987, 20f<br />
137 Formuliert hier analog zu Michel Foucault, »II faut defendre la societe«. Cours au<br />
College de France [1976], Paris (Gallimard u. Seuil) 1989; dazu Ulrich Raulff, Die<br />
geheime <strong>Geschichte</strong>. Michel Foucault entwirft eine agonale Historik, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung v. 22. April 1998<br />
138 Hermann Oncken, Aus Rankes Frühzeit, Gotha (Perthes) 1922, 40f<br />
139 Vgl. das Forschungsprogramm des kultur- und literaturwissenschaftlichen Graduiertenkollegs<br />
Repräsentation, Rhetorik, Wissen der Europa-Universität (Viadrina)<br />
Frankfurt/Oder
82 EINFÜHRUNG<br />
König Wilhelm III. geschaffene taktische Kriegsspiel des Baron <strong>von</strong> Reisnitz<br />
1812 die Befreiungskriege auf eine Grundlage stellte, die Computerspielen und<br />
kombinatorischen Gedächtnisapparaten näher steht als Erzählungen <strong>von</strong> Feldherrnkunst<br />
zum Ruhm der Historie. <strong>Im</strong> Falle der Archive Preußens und des<br />
Preußischen Historischen Instituts in Rom wird die Verschränkung <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
und Politik transparent. Nicht allein das Archiv als Institution und Agent der<br />
Geschichtswissenschaft, sondern seine Schnittstellen, d. h. vornehmlich: Asymmetrien<br />
gegenüber differenten Formen <strong>von</strong> Gedächtnis, Erinnerung und deren<br />
Aktivierung sollen im Vordergrund der Betrachtung stehen.<br />
Rom ist seit dem Mittelalter ein Satellit des deutschen Nationalgedächtnisses;<br />
daraus folgt die Integration, der Binnenexkurs römischer Kapitel in diese(r)<br />
Arbeit, auch unter dem methodischem Aspekt der Differenzierung <strong>von</strong> Monument<br />
und Dokument, Archäologie und Historie in der Datenverarbeitung <strong>von</strong><br />
Vergangenheit. Es gilt nämlich, zwischen Gedächtnis und Speicher zu unterscheiden.<br />
Vielleicht gibt es das <strong>von</strong> Maurice Halbwachs nur nebulös definierte<br />
kollektive Gedächtnis überhaupt nicht, insofern technische und administrative<br />
Speicher Daten transferieren, nicht erinnern; fraglich ist, ob eine solche Kategorie<br />
»nicht bloß als Metapher anzusehen« ist, da das soziales Gedächtnis die Organe<br />
nicht angibt, über die es verfügt - seine technischen Übertragungsmedien Schmidt<br />
1997: 36>. Die romantische Vorstellung vom Archiv als Gedächtnis der Gesellschaft<br />
wird immer noch vorwiegend inhaltlich verstanden, »doch sind Archive<br />
tatsächlich Gedächtnisse oder sind sie eher wie Andenken, an denen sich das<br />
Gedächtnis verankern kann? Bewahren Archive Informationen zur weiteren<br />
Verwendung auf, oder sind sie vielmehr unverzichtbar als Instrumente der<br />
Amnesie-Prävention?« 140 Archive sind das Register, welches gegenüber der<br />
mündlichen Überlieferung die Möglichkeit zur Modifikation und Korrektur<br />
aktueller Gedächtnisleistungen bereithält, mithin also die <strong>Im</strong>plementierung einer<br />
Feedback-Option, ein Speicher zweiter Ordnung. Kultur wird in ihren Gedächtnisinstitutionen<br />
nicht dokumentiert, sondern im Akt der Dokumentation<br />
geschaffen; um eine Beobachtungdifferenz einziehen zu können, muß sie<br />
sich selbst dabei <strong>von</strong> den konkreten Medien der Kultur unabhängig machen, d. h.<br />
Metadaten jenseits der physischen Informationsträger bereitstellen. 141 Keine<br />
140 Angelika Menne-Haritz, Das Provenienzprinzip - ein Bewertungssurrogat? Neue<br />
Fragen zu einer alten Diskussion, in: Der Archivar 47, Heft 2 / 1994, 230-252 (237)<br />
141 In diesem Sinne C. Carlson, Dokumentär am Institut <strong>für</strong> den Wissenschaftlichen<br />
Film, Göttingen, interviewt 1998 vom Medienkünstler Christoph Keller; siehe ders.,<br />
Lost / Unfound: Archives As Objects As Monuments, im Katalog ars viva 00/01 -<br />
Kunst und Wissenschaft, Ausstellung der Preisträger des Kulturkreises der deutschen<br />
Wirtschaft im Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., Berlin (Staatliche Galerie<br />
Moritzburg / Halle, Januar bis März 2000)
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 83<br />
Kultur ohne entsprechende Speichereinrichtungen, tatsächliche oder logische Orte<br />
und Institutionen, kybernetische Organisationsprinzipien des Aus- und Einzuschließenden.<br />
Kultur- als Medienwissenschaft fragt nach der Funktion jener Filter,<br />
»die zwischen offiziellen Speicherwelten und dem Bereich des Inoffiziellen,<br />
zwischen Manifestation und Latenz stehen«, nach den Mechanismen, welche <strong>für</strong><br />
die Zirkulation <strong>von</strong> Information zuständig sind. »Nach welchen Kriterien wird<br />
Wissen mit dem Index des Aufschubs versehen und damit zeitlich gesperrt?« 142<br />
Anhand <strong>von</strong> Institutionen des deutschen Gedächtnisses wie den MGH, dem<br />
GNM und dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin soll diese katechontische Fragestellung<br />
konkretisiert werden (nicht vergessend, daß die Aufzeichnung der<br />
<strong>Geschichte</strong> parallel zu der des Menschen in Psychiatrie und Kriminalwissenschaften<br />
sich entwickelte).<br />
Widerlager: Geschichtsspeicber, museale Konfigurationen<br />
Zur Verhandlung steht kein virtuelles musee imaginaire, sondern eine Serie<br />
institutioneller Gegebenheiten, denn es gibt jene wirksamen Orte, eingeschrieben<br />
in die Einrichtung der Gesellschaft, »sozusagen als Gegenplazierungen oder<br />
Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb<br />
der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen<br />
Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden<br />
können.« 143 Das Projekt, alles zu akkumulieren, die Idee, eine Art Generalarchiv<br />
zusammenzutragen, gehören einer Modernität an, die sich mit Museum,<br />
Bibliothek und monumentaler Edition entsprechende Heterotopien institutionalisiert<br />
hat . Die thematischen Blöcke dieser Arbeit haben nicht den<br />
Anspruch, Vergangenheit abzubilden, sondern weisen ihre Ausbildung als<br />
Latenz <strong>von</strong> Gedächtnis durch Agenturen nach; thematische Kolonnen nehmen<br />
in parallehsierten Anläufen Momente auf, in denen jene Institutionen sich ihres<br />
eigenen Gedächtnismechanismus' erinnern, ihren Aggregatzustand wechseln<br />
und bewußte oder implizite Alternativen zum historischen Diskurs formulieren.<br />
Der Verknüpfungsmodus dazwischen bemüht dementsprechend auch nicht<br />
mehr das Modell <strong>Geschichte</strong>, sondern läßt Verweise auf die zu ermittelnde<br />
Infrastrukturierung <strong>von</strong> Gedächtnisarbeit 1806-1945 sich selbst herstellen.<br />
Obgleich die Epoche des national fermentierten Entwicklungsbegriffs - <strong>für</strong><br />
142<br />
Stefan Rieger, Memona und Oblivio. Die Aufzeichnung des Menschen, in: Pechhvanosu.<br />
a. 1995:378-392(378)<br />
143<br />
Michel Foucault, Andere Räume, in: Karlheinz Barck / Peter Gente / Heidi Paris /<br />
Stefan Richter (Hg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen<br />
Ästhetik, Leipzig (Reclam), 3. Aufl. 1993, 34-46 (34)
84 EINFÜHRUNG "<br />
Deutschland die Zeit seit den Befreiungskriegen bis zum Zusammenbruch der<br />
Großen Erzählungen 1945 - alles daran setzt, der Logistik <strong>von</strong> in Daten- und<br />
Objektbanken gespeichertem Wissen <strong>von</strong> Vergangenheit einen Vektor namens<br />
<strong>Geschichte</strong> als Sinn zu unterstellen, bricht immer wieder die Reflexion über<br />
Gedächtnis als Selbstreferenz der Speichermedien durch; genau diese mnemotechnischen<br />
Konstellationen sucht diese Arbeit quer durch die behandelten<br />
Medien und Institutionen zu isolieren. Einen Längschnitt durch die wissensarchäologischen<br />
Lagen stellt auch die Fokussierung der jeweiligen Reaktionsformation<br />
auf das deutsch-jüdische Gedächtnis dar: Die beschriebenen<br />
Gedächtnisagenturen operieren immer schon mit Selektion und Ausschluß <strong>von</strong><br />
Daten (archivische Kassation etwa), also am Rande einer Löschung. Ein und<br />
derselbe Apparat ist auf Erinnern und Vergessen durch die Zustände Speichern<br />
und Löschen programmierbar, indifferent gegenüber kulturhistorischen<br />
Emphasen. Vergangenheit als großen Speicher, als Reservoir des Wissens aufzufassen,<br />
ermöglicht überhaupt erst den Zugriff darauf. Die eher im Verborgenen<br />
arbeitende Kehrseite der hermeneutischen Großen Erzählungen sind die<br />
Großunternehmen der deutschen Wissenschaftsakademien, flankiert <strong>von</strong> der<br />
Erstellung monumentaler Realenzyklopädien (Brockhaus, Meyer 1911 u. a.). <strong>Im</strong><br />
Auftrag eines Gesamtspeichers namens Kultur arbeiten hier die General- und<br />
Schreibsekretäre und verrichten ihre positivistische Schattenarbeit. 144 Der<br />
Unterschied zu den enzyklopädischen Wissensprojekten der Aufklärung liegt<br />
darin, daß das 19. Jahrhundert mit dem Begriff Kultur die non-diskursiv vorliegenden<br />
und administrierten Datenbanken diskursiv anschließen konnte. Es<br />
gilt demnach, die Praxis der Kulturwissenschaften im 19. Jh. zu entfesseln, d. h.<br />
nachträglich <strong>von</strong> ihrem geistes- und idecngeschichtlichen, mithin anthropozentrischen<br />
Kulturbegriff zu befreien, den ein Zeitgenosse als kognitive<br />
Rückkopplung beschrieb: »Hiernach wäre der Inhalt der Wissenschaft ihrem<br />
forschenden Verlaufe nach überhaupt nichts Anderes als der zu sich selbst<br />
zurückkehrende Mensch« . Das erfordert die Bestandaufnahme<br />
der non-diskursiven Präsenz der Vergangenheit als Archiv und in Archiven. Es<br />
sollen also ausdrücklich nicht kulturwissenschaftliche Diskursstifter wie Jakob<br />
Burckhardt fokussiert werden, sondern Gelehrte vom Schlage Theodor<br />
Mommsens, die Wissen gleichzeitig als Ästhetik (Kultur) und als Datenbanken<br />
organisieren und Gedächtniskapital damit zur Verfügung stellen. Dieses Kapital<br />
ist (unter Bedingungen elektronischer Datenverarbeitung mehr denn je) auch<br />
non-narrativ konfigurierbar; bereits die Bewältigung der Datenmengen, die in<br />
den kulturwissenschaftlichen Großprojekten des 19. Jahrhunderts entstehen,<br />
144 Formuliert in Anlehnung an Arbeiten der Rechtshistonkenn Cornelia Vismann und<br />
des Historikers, Literatur- und Medienwissenschaftlers Bernhard Siegert
GHOÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 85<br />
erforderte neue Techniken der Archivierung. Diese fördern ihrerseits eine<br />
mediale Sensibilität <strong>für</strong> vergangene Speicherpraktiken sowie <strong>für</strong> Übertragungsprozesse.<br />
Ein epistemologischer Effekt dieser Datenbewältigung war die Ausdifferenzierung<br />
<strong>von</strong> sogenannten Hilfswissenschaften wie Paläographie -<br />
Medienwissenschaften in nuce.<br />
Ernst Cassirer hat das Auseinanderklaffen <strong>von</strong> wissenschaftlicher, verzeitlichter<br />
Historie und Gedächtnisräumen mit Blick auf den Diskurs des Mythos<br />
bestimmt, der den Vorrang des räumlichen Anschauens vor dem zeitlichen selbst<br />
dort bewahrt, wo er die Form der Erzählung (»<strong>Geschichte</strong>«) annimmt. Ihm bleibt<br />
die geschichtsphilosophisch wesentliche Dimension des Werdens und der Stetigkeit<br />
des Werdens fremd. Auch das heißt Gedächtnistfrc/wologie: »Nicht mit der<br />
zeitlichen Kontinuität, sondern mit der räumlichen Kontiguität ist der mythische<br />
Begriff der Ursächlichkeit innerlich verwandt und verwachsen«; das Prinzip des<br />
pars pro toto, der Synekdoche, wurzelt in dieser Grundauffassung. 145 Die mtegrative<br />
Operation des historischen Diskurses ist an ursprünglich nicht zeitliche,<br />
sondern räumliche Gestaltungen, »gewisse Konfigurationen und >Konstallationen<<br />
angeknüpft« . Gegenstand dieser Arbeit sind folglich nicht historische,<br />
sondern wissensarchäologisch intrigante Lagen und Situationen. Pierre<br />
Noras monumentale Edition Les lieux de memoire faßt es (<strong>für</strong> Frankreich) objektonentiert:<br />
Das Gedächtnis »haftet am Konkreten, im Raum, an der Geste, am<br />
Bild und Gegenstand«; die <strong>Geschichte</strong> hingegen ist auf »zeitliche Kontinuitäten«<br />
fixiert. 146 Konkret meint Nora Museen, Archive, Friedhöfe und Sammlungen,<br />
Feste, Jahrestage, Verträge, Protokolle, Denkmäler, Wallfahrtsstätten, Vereine -<br />
andere Räume im Sinne Michel Foucaults. Beiden Modellen aber gerät<br />
das Betriebssystem solcher Orte, die Materialität ihrer Gedächtnistechniken aus<br />
dem Blick. In ihrer Verwaltung und Exposition monumentaler, symbolischer Zeichen<br />
der <strong>Geschichte</strong> fungieren historische Museen als Allegorien des Nationalen<br />
- »media to shape the national memory and to create and maintam a desired<br />
political consciousness« 147 . Ein Schwerpunkt der Untersuchung über Monumentahsierungsformen<br />
des Nationalen gilt demnach Allegoresen in historischen<br />
Museen und Sammlungen, jenen Stätten, in denen die Modellierung quasisakraler<br />
Zeiträume buchstäblich stattfand und noch stattfindet. Für Deutschland<br />
schlägt sich der Bogen vom Nürnberger Germanischen Nationalmuseum bis<br />
hin zu typographischen Monumenten, Wilhelminischen Prachteditionen wie<br />
145 Ernst Cassirer, Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, Darmstadt 1977, 48<br />
146 Siehe Pierre Nora, Zwischen <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis, Berlin (Wagenbach) 1990,<br />
bes. 11-33 »Die Gedächtnisorte« (13 u. 17)<br />
147 Aus der Projektskizze: Nationalism and the Molding of Sacred Space and Time, Forschungsprojekt<br />
der Deutsch-Israelischen Stiftung <strong>für</strong> Wissenschaftliche Forschung<br />
und Entwicklung (1990 bis 1993, Leitung Lutz Niethammer / Saul Friedländer)
86 EINFÜHRUNG<br />
Deutschlands Ruhmeshalle als typographischen Denkmalsformen, die in der Geistes-Walhalla<br />
der Deutschen Bücherei Leipzig zum inneren Objekt wird - nationale<br />
Markierungen einer hieroglyphischen Geschichtsschrift. Die <strong>Geschichte</strong> der<br />
Institutionalisierung <strong>von</strong> Geschichtswissenschaft und ihrer Methoden seit dem<br />
19. Jahrhundert ist unmittelbar dem aufkeimenden Nationaldiskurs verhaftet. Die<br />
Institutionalisierung der Geschichtswissenschaft stand (und fiel nicht) mit dem<br />
Bedürfnis, den Begriff der Nation qua historischer Identität zu gewinnen.<br />
Geschichtsschreibung selbst stellt immer schon eine Monumentalisierungsform<br />
des Nationalen dar; die Untersuchung zum Satelliten des deutschen Gedächtnisses,<br />
dem Deutschen Historischen Institut in Rom seit 1888, soll diese Funktion<br />
präzisieren. Entsprechende Studien diskutieren in großer Zahl und Reich(s)weite<br />
Fragen der adäquaten Aus-, Dar- und Nachstellbarkeit <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> in Gedächtnismedien<br />
wie Archiv, Bibliothek, Museum und Inventar. 148 Die vorliegende<br />
Fragestellung ist da<strong>von</strong> insofern unterschieden, als daß sie Konfigurationen (realer<br />
und eingebildeter Art) herauspräpariert, in denen Kopplungen zwischen historiographischen<br />
Allegoresen und Gedächtnisschaltungen (auf infrastruktureller<br />
Ebene) stattfinden. Historische Hermeneutik hegt in mit imaginären Werten operierenden<br />
Gedächtnisagenturen nicht allein in der bloßen Aneinanderreihung <strong>von</strong><br />
Objekten der Vergangenheit, sondern darin, sie anders darzustellen, als sie aus<br />
dem Archiv oder Magazin überkommen sind. In einigen Fällen bedeutet diese<br />
Alterität, daß Datenbanken nicht als Dokumente der Historie, sondern als<br />
Monumente, als Allegorien der ansonsten undarstellbaren Abstraktion Nation<br />
gelesen werden. Der moderne Nationalismus brach das religiöse Monopol auf<br />
die metaphysische Dimension <strong>von</strong> Erinnerung und bediente sich seinerseits quasisakraler<br />
Elemente, um Identität in institutionalisierten Kulten und Riten zu manifestieren.<br />
Die Genealogie des historischen Museums in der Romantik verweist<br />
tatsächlich auf die Profanisierung der Kirche; als ästhetische Kirche übernahm<br />
es analoge Funktionen der Symbolisation <strong>von</strong> Raum und Zeit (Rahmen<br />
und Inhalt der ehemaligen Kartäuserkirche <strong>für</strong> das Nürnberger Museum machen<br />
dies sinnfällig). Der Gedanke der Ehrenhalle in Archiven und Bibliotheken zieht<br />
daraus bis ins selbsternannte Dritte Reich hinein die Konsequenz. Bleibt zu untersuchen,<br />
inwieweit nicht gerade dort, wo Vergangenheit nicht vermittels<br />
Zeremonien, symbolischer Erinnerung und Emanationen des kollektiven<br />
Gedächtnisses ritualisiert und vergegenwärtigt, sondern ausdrücklich schlicht<br />
gespeichert wird, die nationale Gedächtnismacht liegt: inwieweit also der historische<br />
Diskurs eines Gitters aus technischen Prothesen und stabilen Referenzen<br />
bedarf, eines institutionellen Korrelats. Die historistische Idee der Nation kann<br />
148 Etwa Hartmut Bookmann, <strong>Geschichte</strong> im Museum? Zu den Problemen und Aufgaben<br />
eines deutschen historischen Museums, München 1987
GEDÄCHTNISAGENTUREN ZWISCHEN MONUMENT UND DOKUMENTATION 87<br />
sich nur in einem geschichtlichen Rahmen halten; der Rahmen selbst aber heißt<br />
radikal unhistonsch die Präsenz(haltung) <strong>von</strong> Speichern. Die Weltknegssammlungen<br />
in der Königlichen Bibliothek Berlin sowie in der Deutschen Bücherei<br />
Leipzig operieren als non-diskursive, funktionale Agenturen des nationalen<br />
Gedächtnisses im Unterschied zu symbolisierenden Kriegsdenkmälern. 1917<br />
gründete König Wilhelm II. <strong>von</strong> Württhemberg das Deutsche Auslands-Museum<br />
in Stuttgart. Seine Mitbegründer aus Industrie und Wissenschaft dachten dabei<br />
schon an die »wertvollen Dienste (des Instituts) im kommenden Wirtschaftskrieg.«<br />
149 Museale Missionen verdanken sich realen Interessen, die sich gerne als<br />
Kulturträger tarnen; unter dieser Perspektive gerät auch das Projekt eines Deutschen<br />
(Kriegs-)Wirtschaftsmuseums ins Leipzig zum Untersuchungsgegenstand.<br />
Gedächtnis-Infrastrukturforschung verlangt nach flächendeckenden Studien; als<br />
präzise Ortung aber muß sie auf local knowledge beruhen. Konkrete Speicheranalysen<br />
präzisieren die vorgelegten Studien fallweise - Suchschnitte, diskursarchäologisch<br />
gesprochen, und archivische Tiefenbohrung, mitten ins Herz des<br />
deutschen Gedächtnisses.<br />
149 Elisabeth Wehrmann zitiert die Württemberger Zeitung, in: Die Zeit Nr. 41,2. Okto-<br />
ber 1992, 60
BUCH I:<br />
ZWISCHEN AUFZEICHNUNG UND<br />
ALLEGORISIERUNG DES DEUTSCHEN<br />
GEDÄCHTNISSES
MONUMENTA GERMANIAE<br />
Vorgeschichten der MGH<br />
Die Edition deutscher Geschichtsquellen des Mittelalters Monumenta Germaniae<br />
bistorica (MGH) steht <strong>für</strong> das Auseinanderfallen <strong>von</strong> nationalhistorischem<br />
<strong>Im</strong>puls auf der Ebene des Diskurses und einer Forschungspraxis der Datenverarbeitung<br />
und -edition, welche in ihrer Diskretheit ideologische Indienstnahmen<br />
konterkariert (auch wenn es die nationalkonservativen Historiker an der<br />
<strong>für</strong> archiv- und hilfswissenschafthche Ausbildung zuständigen Pariser Ecole des<br />
Chartes waren, die im besetzten Frankreich des Zweiten Weltkrieg die größten<br />
Zugeständnisse an das Regime <strong>von</strong> Vichy und Berlin machten 1 ). Die MGH<br />
organisieren das deutsche Gedächtnis, ohne selbst <strong>Geschichte</strong> zu schreiben. Das<br />
Wissen um die deutsche Vergangenheit im Mittelalter erhält so eine neue Infrastruktur<br />
<strong>für</strong> die Rekonstruktion jenes Reiches, auf das sie sich bezieht: das<br />
Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Dessen Niederlage und die Reorganisation<br />
der deutschen Territorien nach 1806 gehen einher mit der Mobilisierung<br />
<strong>von</strong> Geschichtsenergien als Reserve der Nation. Das Gedächtnis an<br />
reales, auf Schlachtfeldern vergossenes Blut setzte ein Unternehmen in Gang,<br />
dessen Vorversuche daran gescheitert waren, daß es solcher Infusion zur Belebung<br />
der Archive als zusätzlichem Energiequantum ermangelt hatte. Das<br />
Vorwort zur Edition des ersten Bandes (Scriptores) der MGH nennt die Befreiungskriege<br />
gegen Napoleon als den <strong>Im</strong>puls des Unternehmens, und das Blut der<br />
Gefallenen als Kraftstoff eines symbolischen Aufschreibesystems, das auf allegorische<br />
Supplemente verzichtet. 2 Das im Vertragsentwurf mit dem Verlag<br />
Hahn <strong>für</strong> die Luxusausgabe zunächst vorgesehene Frontispiz (das »zu stechende<br />
Bild eines Karolingischen Fürsten im Kloster Sta. Maria in Trastevere<br />
zu Rom«) kam nicht zur Ausführung; die MGH blieben eine originäre Textbank,<br />
deren Datenverarbeitung eher am Beispiel der Dokument-Bearbeitungsbögen<br />
und der Grundkarteien (mit Eingaben zur archivahschen Überlieferung,<br />
der Drucke und Regesten, sowie der Spezialliteratur) denn in Allegorien zum<br />
1 Dazu Lutz Raphacl, Die Pariser Universität unter deutscher Besatzung 1940-1944, in:<br />
<strong>Geschichte</strong> und Gesellschaft, Jg. 23, Heft 4 (1997)<br />
2 Georgius Heinricus Pertz (Hg.), Monumenta Germaniae Historica, Bd. 1 (Scriptores),<br />
Praefatio (Hannoverae a. a. 8. Idus Maias a. 1826), Hannover 1826, xiv
92 MüNUMENTA GHRMANIAE<br />
Ausdruck kommt und die elektronische Erfassung heute anschließbar macht. 3<br />
Zunächst aber schreibt sich das Gedächtnis der Nation als Geschichtsbuch. Der<br />
Verleger Friedrich Perthes hatte in der napoleonischen Zeit den Gedanken einer<br />
vaterländischen Zeitschrift, des Deutschen Museums, verwirklicht; in der Epoche<br />
der Restauration entwirft er den Plan einer großangelegten Europäischen<br />
Staatengeschichte aus nationaler Sicht, wie sie das deutsche Publikum im vergangenen<br />
Jahrhundert nur in Übersetzungen kennengelernt hatte. Sie soll »dem<br />
praktischen Bedürfnis einer Zeit dienen, die alle historischen Zusammenhänge<br />
frisch zu beleben unternahm« 4 , und damit keinen Gesetzen der Historie darstellungsmimetisch<br />
nachspüren, sondern sie überhaupt erst setzen. Die Leitung<br />
des Unternehmen durch den Göttinger Historiker Arnold Heeren und den<br />
Gothaer Bibliothekar Ukert gibt das Medium dieser Operation präzise an: den<br />
durch das Programm Erzählung aktivierten Speicher.<br />
Der <strong>Im</strong>puls der Freiheitskriege<br />
Präzise als der Freiherr vom Stein »mit dem Actenleben abgeschlossen hat«<br />
, wird er zum Initiator der MGH im Zustand der politischen<br />
Geschäftslosigkeit; die Leere sucht er auszufüllen durch Wissenschaft: »Ich<br />
wählte deutsche <strong>Geschichte</strong>, zum Theil veranlaßt durch den Unterricht, den ich<br />
darin meiner jüngsten Tochter gab, und durch das wieder erweckte Nationalinteresse.«<br />
5 Stein formuliert bereits in seinem sogenannten politischen Testament<br />
vom 14. November 1808, einem Rundschreiben an die Mitglieder des<br />
General-Departements, die Einsicht in die mobilisierende Kraft einer neuen<br />
Volkserziehung als Funktion militärisch-administrativer Staatsreform. 6 Die<br />
Supplementierung <strong>von</strong> Leerstellen (durch Schrift) ist die Bedingung historischer<br />
<strong>Im</strong>agination, und Nationalpädagogik ist ihre Adresse. »Denckmahl ist ein Ding,<br />
welches die Kinder veranlasset, ihre Eltern nach der Ursach und Bedeutung zu<br />
3 Vertragsentwurf vom März 1825 im MGH-Archiv 338 Nr. 71 (Abschrift), hier zitiert<br />
nach: Zur <strong>Geschichte</strong> und Arbeit der Monumenta Germaniae Historica. Ausstellung<br />
anläßlich des 41. Deutschen Historikertages München, 17.-20. September 1996. Katalog,<br />
München (MGH) 1996, 20 (Markus Wesche); s. a. Kap. IX »Die Zukunft hat<br />
schon begonnen: DTP, www und CD-Rom« (Wolfram Setz), 86f<br />
4 Hermann Oncken, Aus Rankes Frühzeit, Gotha (Perthes) 1922, 26<br />
5 Steins Selbstbiographic, zitiert nach: Georg Heinrich Pcrtz, Das Leben des Ministers<br />
Freiherrn vom Stein, 6 Bde. (-1823-1831), Ausgabe Berlin (Reimer) 1849ff, Bd. 6.1<br />
(1855), 196<br />
6 Siehe Peter Marx / Eckart Pankoke, Publizität und Enthusiasmus. Staatsrepräsentation<br />
und romantische <strong>Im</strong>aginatuion in der »deutschen Bewegung« 1789-1815, in: Jörg-Dieter<br />
Gauger/Justin Stagl (Hg.), Staatsrepräsentation, Berlin (Reimer) 1992, 89-104 (99)
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 93<br />
fragen« - etwa ein Cörper, der wegen seiner besonderen Beschaffenheit Aufmerksamkeit<br />
auf sich zieht. Vor allem aber »Schrifften sind die wichtigste<br />
Art der Denckmahle.« 7 So zwangsläufig erwachsen Korpora <strong>von</strong> Quelleneditionen<br />
aus der Notwendigkeit, die Körper <strong>von</strong> Töchtern mit Geschichtsbewußtsein<br />
zu programmieren.<br />
Als Spiritus rector des Unternehmens organisiert vom Stein die Textmengen<br />
deutscher Vergangenheit nicht parataktisch, sondern syntaktisch, was nur durch<br />
die Unterstellung eines transzendenten Signifikats, der <strong>Geschichte</strong>, möglich ist.<br />
Zur Reduktion der Komplexität <strong>von</strong> Datenmengen wird im heuristischen Vorgriff<br />
eine <strong>Geschichte</strong> vorausgesetzt, die durch diese Operation erst entsteht:<br />
»Deutsche <strong>Geschichte</strong> wird gegenwärtig nach einem größeren und vielseitigeren<br />
Gesichtspunkte behandelt werden müssen; Es ist daher notwendig sich zu<br />
bemühen, den Schatz <strong>von</strong> Geschichtsquellen jeder Art, der sich in denen Staatsarchiven<br />
finden, die durch Verbindung mit den saekularisierten Archiven vergrößert<br />
wurden, kennen zu lernen, bekannt zu machen, das abhanden Gekommene wieder<br />
auszuforschen und zu sammeln.« 8<br />
Die Epochen der Historiographie sind demnach gemäß den Zäsuren spektakulärer<br />
Archivöffnungen zu schreiben. Die ersten Worte der monumentalen<br />
Edition verweisen auf das latente Archiv deutscher Geschichtsquellen, weder<br />
absent noch präsent. Sie markieren den wissensarchäologischen Punkt, an dem<br />
die Initiative der MGH einsetzten: »labentibus <strong>Im</strong>perii rebus«. Ein vorliegendes<br />
Gedächtnis gilt es zu mobilisieren: »latentes historiae fontes aperire et<br />
tenues eius atque turbidos plerumque rivulos in unius velut alvei copiam colligere«<br />
. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher<br />
Nation 1806 bedeutete auch das Ende seiner Reich(s)weite als Kanzleiregime;<br />
seine Transformation in ein historisches Archiv (aktuell fortlebend nur partiell<br />
etwa in Wien und im allgemeinen Reichsarchiv in München) ist vergleichbar mit<br />
dem Schicksal des Berliner Geheimen Staatsarchivs 1947, als per Alliiertenbeschluß<br />
die endgültige Auflösung des Landes Preußen erfolgt und aus einem<br />
administrativen Arbeitsspeicher historisches Gedächtnis wird. 9 In seiner Denkschrift<br />
<strong>für</strong> ein russisches Nationalmuseum beschreibt B. <strong>von</strong> Wichmann die<br />
Korrelation <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perium und der Gedächtnistopographie <strong>von</strong> »Handschriften,<br />
Chroniken, Urkunden und Documenten«; sind diese nun (wie vornehm-<br />
Johann Martin Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, Leipzig 1752, 194f,<br />
hier zitiert nach: Norbert Wibiral, Ausgewählte Beispiele des Wortgebrauchs <strong>von</strong><br />
»Monumentum« und »Denkmal« bis Winckclmann, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Kunst und Denkmalpflege, Wien 1952, 93-98 (97)<br />
Harry Bresslau, <strong>Geschichte</strong> der Monumenta Germaniae historica, Hannover 1921, 18<br />
Gerhard Zimmermann, in: Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem (Hg.), Geheimes<br />
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Westkreuz) 1974, 5
94 MüNUMKNTA GliRMANIAE<br />
lieh die älteren) »in und außerhalb den Grenzen des Reichs zerstreut, so<br />
hat das National-Museum dahin zu sorgen, daß des Kaisers Befehl oder Unterstützung<br />
ihre Herbeischaffung erleichtere.« 10 Und das war Zar Alexander, der<br />
sich 1819 spontan zu einer finanziellen Unterstützung der angehenden MGH<br />
bereitfand (die vom Stein ablehnte). Wichmanns Erkenntnis bezeichnet zugleich<br />
den blinden Fleck der Sammlungsmacht des Germanischen Nationalmuseums<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts, die <strong>von</strong> keinem imperialen Interpretanten autorisiert<br />
war. Die MGH als symbolisches Gedächtnis Deutschlands entziffern sich<br />
als Postskriptum einer administrativer Infrastruktur, indem der Freiherr vom<br />
Stein erst die Preußischen Reformen organisiert, dann das Quelleneditionsprojekt<br />
11 - in einer Zeit, als der real existierende Militär- und Verwaltungsapparat<br />
Preußens die Spuren der romantischen Bewegung, dessen »acherontische Dynamik«<br />
(Carl Schmitt) ein <strong>Im</strong>puls der Freiheitskriege war, zugunsten der »Ordnungslogik<br />
staatlichen Sicherheitsdenkens« verdrängt . Alternativ zum Medium romantischen Geschichtsbewußtseins, der Narration,<br />
formuliert 1823 der preußische Statistiker J. G. Hoffmann den Diskurs<br />
des Staates und seine jüngstvergangene Transformation buchstäblich infrastrukturell,<br />
als Verkehr: »Gänzliche Umwandlung altgewohnter Handelswege,<br />
entstehend aus den Ansichten der Gewerbepolizei und des Steuerwesens.« 12<br />
Das Findbuch zum Nachlaß des Reichsfreiherrn Heinrich Friedrich Karl vom<br />
Stein im Geheimen Staatsarchiv (PK) Berlin weist u. a. seine Geschichtswerke<br />
aus, darunter eine <strong>Geschichte</strong> der Deutschen. Von den ältesten Zeiten bis 911,<br />
erschienen nach 1815 u-nd eine Französische <strong>Geschichte</strong>, geschrieben zwischen<br />
1809 und 1812. Seinem Briefwechsel mit Gneisenau 1811 folgen Briefe betreffend<br />
den Französischen Krieg 1812/13, wie der später sogenannte Befreiungskrieg<br />
zunächst noch objektonentiert heißt; darunter explizit auch seine Memoire<br />
sur l'etat de l'Allemagne et sur les moyens d'yformer une insurrection nationale.<br />
»Aus der frisch erwachten und tiefer gegründeten Liebe <strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong>,<br />
worin sich wiedergewonnenes National-Gefühl einen edlen Ausdruck gab, wird<br />
die Fülle neuentdeckter, dem Staub und der Verwesung entrissener, historischer<br />
Denkmale begreiflich, welche seit zweien Decennien beharrlicher Eifer gesammelt<br />
und zu einem National-Gut geschaffen hat.« 13<br />
10 B. <strong>von</strong> Wichmann, Rußland's National-Museum, Riga (Hacker) 1820, 8<br />
11 Dazu E. Müller-Mertens, Die Begründung der Monumenta Germaniae Historica<br />
durch den Freiherrn <strong>von</strong> Stein, in: Preußische Reformen - Wirkungen und Grenzen,<br />
1982 (SB Akad. Wiss. DDR. - Gesell. Wiss. 1), 138ff<br />
12 Zitiert bei A. Lüdtke, »Gemeinwohl«, Polizei und »Festsetzungspraxis«: Staatliche<br />
Gewaltsamkeit und innere Verwaltung in Preußen (1815-1850), Göttingen (Vandenhoeck<br />
& Ruprecht) 1982, 51<br />
13 Vorrede der Herausgeber L. F. Plöfer, H. A. Erhard u. L. B. v. Medem, in: Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Archivkunde 1 (1833/34). Hamburg (Perthes) 1834, ii
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 95<br />
Damit ist der symbolische Mehrwert des Archivs benannt, seine Überkodierung<br />
durch den Diskurs des Nationalen; Geschichtsbewußtsein ist dessen Funktion.<br />
Zunächst schreibt es sich als Effekt der militärischen Niederlage <strong>von</strong> 1806, wo<br />
»unter dem Drucke der Fremdherrschaft der Sinn <strong>für</strong> alles Volksthümliche und<br />
<strong>für</strong> die vaterländische <strong>Geschichte</strong> mit ungeahnter Kraft erwacht war«; Ferment<br />
dieser mnemischen Energie ist ein ästhetischer Diskurs im strategischen Einsatz:<br />
»getragen <strong>von</strong> dem durch Litteratur- und Kunststudien erschlossenen Verständniss<br />
des Mittelalters.« 14 Zäsur und arche - der moderne Begriff der (National-)<br />
<strong>Geschichte</strong> beginnt, wo militärische Terminologie und Umschichtung <strong>von</strong> Akten-Lagen<br />
buchstäblich zusammenschießen. Die Umgestaltung der politischen<br />
Verhältnisse in Deutschland durch die französische Revolution und die Napoleonische<br />
Zeit schuf »<strong>für</strong> die Quellen eine völlig neue Lage« 15 . Die meisten Urkunden hatten ihren praktisch-juristischen Wert verloren,<br />
der Hang zur Geheimhaltung war damit gewichen, die früheren geistlichen und<br />
viele weltliche Staaten und Institutionen waren untergegangen und ganze Stände<br />
verloren ihre bisherigen Privilegien. In den staatlichen Archiven war das Material<br />
nunmehr nicht nur konzentriert, sondern auch leichter zugänglich. Ausgangspunkt<br />
<strong>für</strong> Quelleneditionen war die Fülle des Überlieferten, nicht die Abwesenheit<br />
des Nicht-Dokumentierten (eine Differenz <strong>von</strong> Historie und politischer<br />
Archäologie, wie sie die deutsche Geschichtsforschung nach dem Untergang der<br />
DDR in den Archiven der einstigen Staatssicherheit erneut erfuhr 16 ).<br />
<strong>Geschichte</strong> bauen. Vom Steins ästhetischer Historismus<br />
'Z.wi Zeit der Befreiungskriege waren zwei Reaktionsformationen auf die Ruptur<br />
mit dem Alten Reich denkbar: eine Ästhetik des Verlusts genealogischer Bindungen,<br />
aus deren Quelle sich die musealen und literarischen Projekte der Romantik<br />
speisten 17 ; <strong>für</strong> vom Stein aber, den Wiener Kongreß vorahnend und damit die<br />
Kopplung <strong>von</strong> politischer und ästhetischer Restauration <strong>für</strong>chtend, konnte eine<br />
Annäherung an die Gotik »vom rein Antiqarisch-Restaurativen nicht erfolgen,<br />
14 Vorrede zum Meklenburgischen Urkundenbuch, 1, Schwerin 1863, v, zitiert nach:<br />
Behne 1990: 281, Anm. 7<br />
15 Die Anfänge der Historischen Hilfswissenschaften in Bayern. Begleitheft einer Ausstellung<br />
der Universitätsbibliothek (Maximilian-Univ.) München zum 41. Deutschen<br />
Historikertag, 1996, 49 (»Ausblick«)<br />
16 Stefan Wolle, Die Akten der DDR-Archive - Giftmülldeponie oder Fundgrube <strong>für</strong><br />
den Historiker?, in: Gewerkschaftliche Monatshefte, 42. Jg., 7/1991, 438-435<br />
17 Dazu, am Beispiel Englands (hier besonders Sir Walter Scott): Stephen Bann, The<br />
Inventions of History. Essays on the Reprcsentation of the Past, Manchester / New<br />
York 1990
96 MONUMKNTA GKRMANIAK<br />
sondern nur aus einem neu schöpferischen Geist, wie er sich in Steins organischer<br />
Schau <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> als fortwirkender Vergangenheit ausspricht.« 18 Diese<br />
»organische Schau« war allein vor dem Hintergrund eines organisatorischen Dispositivs<br />
implementiertbar; daß aber Vergangenheit nicht als diskrete Datenmenge,<br />
sondern als Zusammenhang wahrnehmbar war, ist eine Funktion des genealogischen,<br />
kontinuitätsstiftenden und -verlangenden <strong>Im</strong>perativs. Gleich dem Freiherrn<br />
<strong>von</strong> Aufseß bei seiner Initiierung des Germanischen Nationalmuseums in<br />
Nürnberg war Steins Bezug zu den <strong>von</strong> ihm gesammelten Objekten familiengeschichtlich<br />
imprägniert. Die Ansicht, daß Stein bereits 1805 den Entschluß faßte,<br />
<strong>für</strong> das Grab seiner Eltern in Frucht bei Ems eine gotische Kapelle umzugestalten,<br />
läßt sich zwar nicht belegen, doch schreibt er am 9. Mai 1816 an seine Schwester<br />
Marianne <strong>von</strong> einer Objektverlegung: »Ich bin im Handel wegen der kleinen<br />
Deutschordens Capelle in Coblenz - ich will sie nach Frucht transportieren und<br />
sie zur Grabstätte <strong>für</strong> meine Eltern und mich einrichten.« 19 In seinem wiederhergestellten<br />
Familiensitz Nassau errichtet vom Stein einen gotischen Erinnerungsturm<br />
als Arbeitszimmer <strong>für</strong> die geplanten Reformarbeiten und als Ort<br />
patriotischer Jahresfeiern. Autorisiert wird diese Inszenierung durch die Leiche:<br />
Noch vor dem Begräbnis ist der tote Stein nach der Überführung aus seinem<br />
Alterssitz Cappenberg in diesem Turm aufgebahrt »und somit der Kreis symbolhaften<br />
Handelns geschlossen.« Die Gliederung dieses Turms manifestiert, daß das<br />
Symbolische des Memorials immer an das Pragmatische der Daten gekoppelt ist.<br />
Der Vorraum wird als Archiv genutzt; das Arbeitszimmer ȟberrascht durch<br />
seinen geschlossenen Zentralismus« (Eimer). In Goethes Wilhelm Meister figuriert<br />
eine »Turmgesellschaft«, in der individuelle Texte als Bedingung <strong>für</strong> an<br />
Speicherwissen rückkoppelbare »Weltkenntnis«, diskurspraktisch aber als Bedingung<br />
<strong>von</strong> Autorschaft und des buchstäblichen Bildungsgesetzes »in chronologischer<br />
Reihe« archiviert werden. So wird das autobiographische Subjekt nicht<br />
anders gebildet als die <strong>Geschichte</strong> <strong>für</strong> die deutsche Nation nach 1806 / 1813.<br />
Goethe steht auch hier mit dem Freiherrn vom Stein im Bund: »Der Turm hat<br />
nicht umsonst im Einweihungsraum, anstelle eines Altars und der Heiligenbilder,<br />
ein Schriftenarchiv. Er ist eine literarische Bürokratie und damit die Agentur selber<br />
des Bildungsromans. Techniken der Macht und des Schreibens müssen zusammenkommen,<br />
um eine neue narrative Gattung zu erzeugen.« 20 Zwischen den<br />
18<br />
Gerhard Eimer, Caspar David Friedrich und die Gotik, Hamburg 1963, Nachtrag:<br />
Zum patriotischen Kunstprogramm des Freiherrn vom Stein, 39-49 (40)<br />
19<br />
Zitiert nach: Eimer 1963: 43, unter Bezug auf: Adolf Bach, Das Elternhaus des Freiherrn<br />
vom Stein, Bonn 1957, 81<br />
20<br />
Friedrich A. Kittler, Über die Sozialisation Wilhelm Meisters, Kapitel VI (Aufschreibesysteme),<br />
in: Gerhard Kaiser / ders., Dichtung als Sozialisationsspiel, Göttingen<br />
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1978, 99-114 (107)
VORGESCHICHTEN DER MüNUMENTA 97<br />
Außenmauern und den gotisch eingewölbten Innenwänden nimmt in vom Steins<br />
Domizil eine schmale, <strong>von</strong> Türen verschlossene Zone einen Teil der Bibliothek<br />
auf. In das Maßwerk der Lünettenfelder sind Porträts der geschichtlichen Leitbilder<br />
aus dem Reformationszeitalter, dem Dreißigjährigen Krieg und den Befreiungskriegen<br />
eingefügt. »Alles schließt sich konzentrisch um den in der Mitte<br />
stehenden Schreibtisch« - Oberfläche und Unterlage <strong>für</strong> Feldherrn,<br />
Sekretäre und Historiker gleichfalls. 21 Dem oberen Turmraum ist in der<br />
Parkettmitte das Eiserne Kreuz mit dem Wahlspruch der preußischen Landwehr<br />
eingelassen. Seine figurative Ausstattung ist - gleich der Befreiungshalle in Kelheim<br />
- an Zahlen gekoppelt; neben der Büstengruppe der verbündeten Monarchen<br />
hingen ursprünglich zwei allegorische Gemälde vom Sieg des Guten über<br />
das Böse, an die sich vier (heute sechs) Tafeln mit den historischen Daten der<br />
Befreiungskriege reihen. Stein diskutiert 1820 mit Ludwig <strong>von</strong> Bayern die Pläne<br />
zur Regensburger Walhalla; neben der pragmatischen hat er die ästhetische Mobilisierung<br />
deutschen Erbes im Blick. In Bezug auf die Bemühungen der Brüder<br />
Boisseree um die Wiederanerkennung mittelalterlicher Kunst schreibt er am 8.<br />
Juli 1821, daß über der kunsthistorischen Quellenforschung die praktische Sorge<br />
um das Kunstwerk steht, seine museale und diskursive Her-Stellung. 22 Dementsprechend<br />
engagiert sich Stein gemeinsam mit Gneisenau in den Verhandlungen<br />
um die Rückführung verschleppter Kunstschätze aus Paris 1815. <strong>Im</strong> Juli 1820<br />
bricht Stein nach Rom auf, wo er versucht, die deutschrömischen Künstler<br />
auf deutschhistorische Stoffe hinzulenken. Das objektive Korrelat aller Historienmalerei<br />
ist das Skelett der Historie: Annalistik und Chronologie; daher<br />
schenkt er der römischen Künstlerbibliothek Chronikwerke. Der Freiherr Bunsen<br />
bemerkte dazu aus Rom im Mai 1821 kurz nach der Abreise Steins, daß es den<br />
Malern an einer solchen Bekanntschaft mit der <strong>Geschichte</strong> ihrer Nation noch<br />
ganz fehlt; in einem solchen Moment wirkt ein zu stiftender Diskurs »entscheidend<br />
auf die Künstler«. Historische <strong>Im</strong>agination nämlich supplementiert Orte<br />
und Stellen erst dann, wenn sie als Mangel definiert sind. 23 Die verborgene Kehrseite<br />
pragmatischer MGH-Logistik liegt also im <strong>Im</strong>aginären; Stein ließ sich <strong>für</strong><br />
das Obergeschoß <strong>von</strong> Schloß Cappenberg Ölbilder mit Thematiken deutscher<br />
Kaisergeschichte konzipieren. <strong>Im</strong>mer aber bedarf es dabei der Rückkopplung an<br />
das Archiv deutscher Vergangenheit. Stein rät den beauftragten Maler Kolbe zum<br />
erneuten Nachlesen der Chroniken, denn Kaiser Otto sei ihm mißlungen, und<br />
21 Zugleich eine Allegorie auf den Arbeitsplatz, an dem sich die vorliegende Studie<br />
schrieb.<br />
22 Eimer 1963: 45, unter Bezug auf: Freiherr vom Stein, Briefwechsel, Denkwechsel und<br />
Aufzeichnungen, bearbeitet <strong>von</strong> Erich Botzenhart, Bd. I-VII, Berlin 1931-1937, VI<br />
18,22<br />
23 Zitiert nach: Eimer 1963: 47, unter Bezug auf Steins Briefwechsel, VI 15
98 MoNUMENTA GKRMANIAE<br />
wünscht in einem Brief an die Gräfin Voß in Berlin 1818 vom Künstler, die<br />
Gesichter gemalter Kämpfer »aus der Natur und nicht aus der Einbildungskraft«<br />
zu wählen. 24 Natur ist dabei, was die Gegenwart vorgibt: »Will er idealisieren, so<br />
wähle er die Züge des Feldmarschalls Blücher und seinen Körperbau«; dem Herzog<br />
Konrad könne Gneisenau seine Züge leihen .<br />
Schnorr <strong>von</strong> Carolsfeld hat es seinerseits unternommen, auf seiner Darstellung<br />
<strong>von</strong> Barbarossas Tod im kleinasiatischen Fluß Saleph unter dem Gefolge des Kaisers<br />
ein Porträt des Feldherrn vom Stein als Reichskanzler einzumalen, was wegen<br />
der engen Beziehungen Friedrich Barbarossas zum genius loci <strong>von</strong> Schloß Cappenberg<br />
»besonders persönlich wirkt« (Eimer). Hier heißt Historie noch genealogische<br />
Behauptung, nicht Historismus. So nahe liegen um 1815 Archiv und<br />
Aktualität - ein Verhältnis, zwischen das sich noch nicht das Symbolische des<br />
geschichtsphilosophisch emphatischen Diskurses geschoben hat. 1966 dagegen<br />
liest sich im Kontext der Ausstellung mittelalterlicher Glasmalerei aus der Sammlung<br />
des Reichsfreiherrn der <strong>Im</strong>puls <strong>von</strong> 1806 gebrochen durch das Jahr 1945: »In<br />
einer Zeit, da das deutsche Selbstgefühl krank ist und jede Regung, in unserer<br />
Vergangenheit Größe zu sehen als >nationalistisch< verschrieen wird, nehmen wir<br />
dankbar die Möglichkeit wahr, eine Sammlung zu zeigen, die zu unseren bedeutenden<br />
nationalen Besitztümern gehört.« 25 Museale Räume wirken (geschichts-)<br />
halluzinogen. In der gotisierend getäfelten, mit Bildern großer Deutschen<br />
geschmückten Bibliothek im neugotischen Turm seines Wohnsitzes in Nassau<br />
arbeitet vom Stein in den Sommermonaten »an dem <strong>von</strong> ihm ins Leben gerufenen<br />
Corpus« der Monumenta Germaniae Historica, dessen erster Band 1826<br />
erscheint. 26 Auch der Historienromancier Sir Walter Scott ließ sich in seinem<br />
Arbeitszimmer <strong>von</strong> antiquarischen Objekten umgeben porträtieren, als schaue<br />
ihm beim Schreiben das Mittelalter selbst in Gestalt einer Ritterrüstung über die<br />
Schulter. Diese Versammlung aber existierte nur als Bild, in der Sprache seiner<br />
eigenen historischen <strong>Im</strong>agination. Tatsächlich stand sein Schreibtisch - wo<strong>von</strong><br />
sich der heutige Besucher <strong>von</strong> Abbotsford noch überzeugen mag - inmitten eines<br />
puren Gedächtnisses, dem Gestell der Historie: Regale voll <strong>von</strong> Referenzbüchern.<br />
Die vorgebliche Einsicht in <strong>Geschichte</strong> ist <strong>von</strong> der Historie durch das Absehen<br />
<strong>von</strong> ihrer eigenen Arbeitsgrundlage, den Datenbanken (Archiven), erkauft. Deren<br />
Mitthematisierung nicht nur als Referenz, sondern auch als Aussageform nämlich<br />
würde die Erzählung der Vergangenheit als deren Betrug erweisen. Für vom<br />
24 Eimer 1963: 48, unter Bezug auf Steins Briefwechsel, VI 594 (4. Juni 1828)<br />
25 Lise Lotte Möller, Vorwort zu: Meisterwerke mittelalterlicher Glasmalerei aus der<br />
Sammlung des Reichsfreiherrn vom Stein (Ausstellungskatalog), Museum <strong>für</strong> Kunst<br />
und Gewerbe Hamburg, 1966, 5<br />
26 Peter Bloch, Über die Kunstbestrebungen und die Sammeltätigkeit des Reichsfreiherrn<br />
vom Stein, in: Meisterwerke 1966, 9-13 (12)
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 99<br />
Stein ist der Begriff der Monumenta Germaniae doppelt kodiert, im Materiellen<br />
wie als (Text-)Information - das Gedächtnis der Dinge als Effekt ihrer Zuschreibung.<br />
Der museale Blick liest die Objekte nicht mehr in ihrer liturgischen, sondern<br />
kunsthistorischen Dimension. 27 Das ihm Wesentliche begleitet Stein im<br />
letzten Lebensjahrzehnt auf Schloß Cappenberg »als >Monumenta Germaniae<br />
historica< im tiefsten Sinne des Wortes. Die Glasgemälde waren wahrhaft leuchtende<br />
Zeugnisse der Vergangenheit«; losgelöst aus ihren alten sakralen Funktionen<br />
»sprechen diese Glasgemälde unmittelbar zu uns« (Eimer) und werden so im<br />
technischen Sinne Medien der historischen Einbildung. Alternativ zum virtuellen<br />
Raum des historischen Diskurses im <strong>Im</strong>aginären (aber analog dazu als »Sprache«<br />
wahrgenommen 28 ) gilt hier die symbolische Präsenz des realen Artefakts im<br />
archivischen Raum: buchstäblich re-collcction als Denkmalstiftung.<br />
Diskrete Antiquarik:<br />
Die Taufschale Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, Goethe und die MGH<br />
Über Streifzüge vom Steins bei Antiquaren berichtet Ernst Moritz Arndt.<br />
Metonymien bilden dort den Bezug einer individuellen Gegenwart zur und als<br />
<strong>Geschichte</strong>. <strong>Im</strong> Sommer 1817 kommt Stein <strong>für</strong> vier Tage mit Goethes Herrn,<br />
dem Herzog <strong>von</strong> Weimar, nach Köln, um »in der alten heiligen Stadt allerlei<br />
Raritäten« zu beschauen. Der Herzog erwirbt eine Reihe gemalter Glasfenster<br />
des Mittelalters und eine silberne Schüssel, welche Friedrich Barbarossa seinem<br />
Paten, dem Sohn des Grafen <strong>von</strong> Kappenberg (wo Stein jetzt wohnt) als Taufgeschenk<br />
vermacht hatte. 29 Goethe setzt sich ausführlich mit diesem Objekt<br />
auseinander, bis ihm angesichts widersprechender Expertengutachten später<br />
über dem antiquarisch kritischen Dissensus Lust und Mut zu weiterem Studium<br />
ausgehen. Antiquarik arbeitet als diskrete Datenverarbeitung und ist insofern<br />
strukturell unwillig zur kohärenten Geschichtsschreibung. Die historische<br />
Überdeterminierung archäologischer Signifikanten ist nicht nur auf eine »klare<br />
27 Siehe Hana Volavkovä, Schicksal des Jüdischen Museums in Prag, Prag 1965, 94<br />
28 Zur Metapher: »die Quellen sprechen« siehe Michael Zimmermann, Quelle als Metapher.<br />
Überlegungen zur Historisierung einer historiographischen Selbstverständlichkeit,<br />
in: Historische Anthropologie, 5. Jg. Heft 2 (1997), 268-287<br />
29 Siehe E. M. Arndt, Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn<br />
Heinrich Karl Friedrich <strong>von</strong> Stein, Berlin 1858, zitiert nach: Bloch 1966: 12. Ebd. die<br />
Angabe: Taufschale mit ihrer Gravierung vom Meister des Aachener Barbarossaleuchters,<br />
eine Gabe des Kaisers an seinen Paten Otto <strong>von</strong> Cappenberg (nicht an dessen<br />
Sohn), heute: Kunstgewerbemuseum Berlin (die dortige Inv. Nr. des 1933 aus dem<br />
Weimarer Großherzoglichen Hause erworbenen Stücks lautet: 1933,25)
100 MONUMHNTA GHRMANIAH<br />
Lage« bedacht (damit noch einig mit dem Willen der Archäologen), sondern<br />
auch gewillt, »diese notfalls herzustellen.« 30<br />
Am 1. April 1820 jedenfalls sendet Goethe aus Weimar der Direktion der<br />
neugegründeten Societas Apencndis Fontibus der MGH, deren Ehrenmitglied<br />
er seit 28. August 1819 auf Steins Initiative ist, eine Beschreibung der durch<br />
seine Vermittlung durch die Erbgroßherzogin <strong>von</strong> Sachsen-Weimar, Maria Paulowna<br />
erworbenen angeblichen Taufschale Friedrichs I. Barbarossa 31 mit der<br />
Bitte um sachkundige Erläuterung; Goethe selbst war im Zweifel, ob diese Taufschüssel<br />
»nicht vielleicht eher Friedrich II. zugeschrieben werden könne, welches<br />
nur <strong>von</strong> Kennern der deutschen <strong>Geschichte</strong> gründlich zu beantworten seyn<br />
möchte.« 32 Goethe ließ 1820 eine lithographische Abbildung der Schale anfertigen.<br />
Einer der Gutachter, der Sekretär der MGH Dümge, deklariert im Gang<br />
seiner Argumentation »in völliger Verkennung der hohen methodischen Bedeutung<br />
des Provenienz-Prinzips« (Goetz) die Frage, wie die Schaale nach Köln<br />
gelangt sein mochte, <strong>für</strong> »an und <strong>für</strong> sich unerheblich, da wir so viele Beispiele<br />
der seltsamsten Zerstreuung alter Denkmale vor uns haben.« 33 Bevor<br />
historisch-genetisches Bewußtsein, objektiviert in der Herkunftsgeschichte<br />
musealer Objekte, greifen konnte, mußte zunächst aufgeräumt werden, Freiraum<br />
geschaffen werden durch Ordnung der Dinge, um sie dann diskursiv qua<br />
Historie neu zu organisieren. Demgegenüber installierte ein weiterer Gutachter,<br />
der Landeshistoriker Karl Ludwig Troß, eben jedes Provenienzprinzip <strong>für</strong><br />
Musealien (das in den Preußischen Staatsarchiven später verbindlich werden<br />
sollte 34 ): Unter Hinzuziehung einer Urkunde konnte er <strong>für</strong> die Datierung der<br />
Schale erläuertern, »wie wichtig es bei jedem Denkmale der Vorzeit sey, auf<br />
Oertlichkeiten eine besondere Rücksicht zu nehmen, und wie wenig Urkunden,<br />
wenn sie sonst auch noch so gleichgültig scheinen, zu vernachlässigen<br />
30<br />
Klaus Voigtländer, Die Stiftskirche St. Servatii zu Quedlinburg, Berlin (Akademie)<br />
1989, Kapitel »Confessio«, 101-119 (114)<br />
31<br />
Aus dem Nachlaß des Kanonikus und Kunstsammlers Franz Pick in Bonn, welcher<br />
sie nach der Säkularisation <strong>von</strong> 1803 aus dem Prämonstratenser-Stift Cappenberg in<br />
Westfalen erworben hatte. Siehe Informationsblatt 1410 des Kunstgewerbemuseums<br />
am Tiergarten (Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz), Text: Lothar<br />
Lambacher, Berlin 1997<br />
32<br />
Zitiert nach: Carl Schüddekopf, Goethe und die Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche<br />
Geschichtskunde, in: Goethe-Jahrbuch 21 (1900), 66<br />
33<br />
Zitiert nach: Werner Gocz, »Barbarossas Taufschale« - Goethes Beziehung zu den<br />
Monumenta Germaniae historica und seine Erfahrung mit der Geschichtswissenschaft, •<br />
in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters, 50. Jg. Heft 1 (1994), 73-88 (81)<br />
34<br />
Siehe Cornelia Vismann / W. E., Die Streusandbüchse des Reiches: Preußen in den<br />
Archiven, in: Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft 21 (Thcmcnhcft »preußisch«),<br />
Frankfurt/M. (Syndikat) 1995, 87-107
VORGESCHICHTEN DER MÜNUMENTA 101<br />
sind.« 35 Goethe aber verzweifelte am antiquarischen Widerstreit des Gegenstandes;<br />
nachdem seine Anfrage in sechs verschiedenen, differerierenden Historikergutachten<br />
auslief, ohne eine verbindliche Antwort zu erhalten,<br />
»zeigte sich, wie unmöglich es sei, antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein<br />
deshalb geführtes Aktenheft ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch-kritischen<br />
Dissensus, und ich leugne nicht, daß mir nach solcher Erfahrung<br />
weitere Lust und Mut zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigsten Fürstin<br />
hatte ich eine Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Widerspruch<br />
dem andern folgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum<br />
noch die silberne Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweifelte, ob<br />
man Bild und Inschrift noch vor Augen habe.« 36<br />
Das Wesen der Historie als Archiv und das Weisen der Dinge als Archäologie<br />
diffundieren. Darin liegt die Verweigerung diskreter Datenverarbeitung gegenüber<br />
narrativer Kohärenz, die Anschlußmöglichkeiten an ideologische Diskurse<br />
(die Erzählung deutscher Kaisergeschichte) ermöglicht. Die <strong>von</strong> Goethe als<br />
arbiträr beargwöhnte »Unverbindlichkeit histonsch-antiquarisch-archivalischer<br />
Forschung« (Goez), an der Goethe <strong>für</strong> die MGH etwa mit seiner Beschreibung<br />
einer Chronik des Otto <strong>von</strong> Freysingen selbst beteiligt gewesen war 37 , ist keine<br />
Willkür, sondern archäologisch-philologischer Positivismus in ideologiekritischer<br />
Resistenz. Goethe schreibt am 9. Dezember 1822 über das »Taufbecken<br />
mit eingegrabener alter Vorstellung und Inschrift«: Jedermann sei überzeugt, daß<br />
Kaiser Friedrich I. »mit im Spiele« sei, nun aber koexistierten so viele Auslegungen<br />
»über wer sonst, wie, wann und wo, daß die Sinne sich verwirren und<br />
man lieber das Becken wieder einschmelzen, damit nur niemand weiter darüber<br />
meinen könnte« . Es geht bei Goethes Mißtrauen<br />
gegenüber der antiquarischen Tätigkeit der MGH auch um die Abgrenzung seiner<br />
Schriftgattung Literatur, die anderen Kriterien denn denen der Diplomatik<br />
und Antiquarik folgt und nicht auf die unlösliche Bindung <strong>von</strong> Worten und Dingen<br />
angewiesen ist. Am 29. Juni 1820 schreibt Goethe an Lambert Büchler, den<br />
Sekretär der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, <strong>von</strong> seiner Überzeugung,<br />
»daß alle Ueberlieferung nur durch innern Assens und Zustimmung erst<br />
gewiß« werde . Das aber darf man einem Sekretär<br />
nicht schreiben, dessen Funktion es gerade ist, jenseits <strong>von</strong> hermeneutischer<br />
Metaphysik <strong>für</strong> die buchstäbliche Überlieferung Sorge zu tragen; seine Arbeit ist<br />
35<br />
In: Archiv <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde 4 (1822-1823), 507f, zitiert nach: Goez<br />
1994:84<br />
36<br />
Tag- und Jahreshefte, Sophienausgabe 1/36 (Weimar 1893), 164 (zu 1820), zitiert nach:<br />
Goez 1994: 86<br />
37<br />
In: Archiv <strong>für</strong> deutsche Geschichtskundc 2 (1820-1821), 301-305; Manuskript datiert:<br />
Jena, 1. Juli 1820
102 MONUMHNTA GHRMANIAH<br />
- im Unterschied zur Arbeit <strong>von</strong> Dichtern oder Historikern - durch eine »Verarbeitung<br />
<strong>von</strong> Wissen auf dem Niveau seiner buchstäblichen Materialität« buchstäblich<br />
charakterisiert. »Nicht Erzählung, sondern Aufzählung, nicht Verstehen,<br />
sondern Registrieren ist ihre Signatur.« 38 Historische Zusammenhänge müssen<br />
materialiter hergestellt werden, oder sie sind nicht. Ironie dieser <strong>Geschichte</strong>: Die<br />
zugehörige Büste Kaiser Barbarossas im Zinnenkranz der Roma war seit je in<br />
Cappenberg verblieben, doch bis 1882 in einem Reliquienschrein verborgen. »So<br />
wußte Stein nichts <strong>von</strong> dem bedeutendsten Unterpfand der alten Kaiserzeit in<br />
seiner unmittelbaren Nähe.« Die richtige Identifizierung des<br />
genannten Taufpaten mit dem Grafen Otto <strong>von</strong> Cappenberg gelang bereits 1820<br />
Georg Friedrich Grotefend, »doch fand dessen auf provenienzgeschichtliche<br />
Überlegungen gestütztes Urteil nicht den Beifall Goethes« .<br />
Erst die korrekte Interpretation des sogenannten Testaments des Grafen Otto<br />
<strong>von</strong> Cappenberg erbrachte den endgültigen Beweis: danach schenkte Otto dem<br />
Stift das CAPUD ARGENTEUM AD IMPERATORIS FORMATUM EFFI-<br />
GIEM CUM SUA PELVINICHILOMINUS ARGENTEA.<br />
Die Datenlagen des. deutschen Gedächtnisses nach den Wirren der Befreiungskriege<br />
sind konfus. In einem auf den 14. Juni 1820 datierten Brief an<br />
Büchler sagt Goethe weitere Unterstützung in der Mobilisierung <strong>von</strong> Jenaer<br />
Handschriften mit Hilfe des Bibliotheksschreibers Johann David Gottlob<br />
Compter zu; an Voigt schreibt Goethe am 1. Mai 1807: »Wir brauchen mechanisch<br />
tätige Subalterne.« 39 Diese Findung aber wird durch den laufenden<br />
Prozeß erschwert, »die akademische Bibliothek völlig umzubilden«. Die Unordnung<br />
der Nachweisführung des 1801 verstorbenen Vorgängers <strong>von</strong> Goethe<br />
als Bibliotheksleiter in Jena, Büttner, faßt Goethe in seinen Annalen <strong>für</strong> das<br />
Jahr 1802 in ein buchstäblich wissensarchäologisches Bild: »Das Neue schob<br />
sich flözweise über das Alte hin« - eine Lage, die<br />
<strong>von</strong> späteren Bibliothekarsgenerationen positiv definiert wird: »Besinnen wir<br />
uns einmal, was der Ausdruck geologische Schichten besagen will! Sobald wir<br />
historisch denken, wird uns auch die Ordnung einer Bibliothek, in der die alten<br />
Bestände liegen, wie sie die Zeit gelagert hat, nicht nur erträglich vorkommen,<br />
sondern auch natürlich.« 40 Als der Dichter Karl <strong>Im</strong>mermann 1832 in die publi-<br />
38 Bernhard Siegert, Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pecuchet,<br />
in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft.<br />
5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-40 (26)<br />
39 Zur Korrektur dieser in der Bibliothekswissenschaft gängig zitierten Aussage durch<br />
den Kontext siehe: Rainer-Maria Kiel, Goethe und das Bibliothekswesen in Jena und<br />
Weimar, in: Bibliothek und Wissenschaft 15 (1981), 1-82 (76f)<br />
40 Georg Leyh, Systematische oder mechanische Aufstellung, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Biblio-<br />
thekswesen, 31. Jg. (1914), 407
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 103<br />
zistisch-juristischen Katakomben des verwaisten Reichskammergerichts in<br />
Wetzlar hinabsteigt, erscheinen ihm dort »wahrhaft schauerlich zwei ungeheure<br />
Aktenhaufen, die wie Flözgebirge durcheinandergeschoben in einem<br />
Winkel des Gebäudes lagen.« 41 Das Gewachsene - zunächst nicht Historie,<br />
sondern schlicht Lagerung - wird, an den historischen Diskurs der Wissensgenese<br />
gekoppelt, selbst zum Signifikat, zur Aussage, zum Wert. Demgegenüber<br />
insistiert die Klassik auf Klassifikation. Die Revolution <strong>von</strong> Ordnungssystemen<br />
suspendiert nicht nur die Adressierbarkeit <strong>von</strong> Gedächtnis, sondern<br />
schreibt ihnen auch eine präsentistische Wahrnehmung des Gegebenen vor:<br />
Kaum ein Experte <strong>für</strong> Manuskripte zur älteren deutschen <strong>Geschichte</strong> seinen<br />
zu finden, denn: »Das augenblicklich Gegenwärtige zieht soviel Aufmerksamkeit<br />
an sich, daß das längst Vergangene völlig in die blaue Ferne verschwindet.«<br />
42 Während seiner Arbeiten am Jenaer Codex des Otto <strong>von</strong> Freising<br />
entwirft Goethe im Juni 1820 ein Schema als Muster zur Handschriftenbeschreibung<br />
und schickt es an die Gesellschaft nach Frankfurt: »Es würde sogar<br />
zuletzt durch eine tabellarische Übersicht möglich, daß man die Beschaffenheit<br />
mehrerer Manuscripte neben einander mit einem Blick übersehen könnte«<br />
. Goethe operiert hier als genau derjenige<br />
»Augenmensch«, als den er sich selbst bezeichnet, indem seine archäologische<br />
Wahrnehmung vor allem die äußerlichen Merkmale der Urkunde festhalten<br />
will: »Besitzer«, »Bekannt und citiert«, »Format«, »Größe«, »Blätterzahl«,<br />
»Initiale«, Zahl der Hände bis hin zu Angaben über »Druckausgaben« - nicht<br />
also philologische Angaben über die Texte, »zu denen die Beschreibung erst<br />
hinführen soll« . Goethe wendet zeitgleich ähnliche<br />
Prinzipien in einem Schema zur Recension des Triumphzugs <strong>von</strong> Mantegna (ein<br />
Kupferstich) an; gleichrangig werden Handschriften und Bildquellen nicht nur<br />
semiotisch, sondern auch unter dem Aspekt der Standardisierung ihrer Datenverarbeitung<br />
betrachtet. Der Frankfurter Geschäftsführer der Zentraldirektion<br />
der Gesellschaft seit März 1823, Johann Friedrich Böhmer, nimmt dagegen<br />
Goethes Beitrag zu den MGH nicht mit Blick auf die Infrastruktur der<br />
Gedächtnisarbeit, sondern im Rahmen des romantischen Diskurses der <strong>Im</strong>agination<br />
wahr: Den Deutschen nütze nur das »vom nationalen Geist Beseelte«,<br />
denn »national, nicht universal ist jetzt unser aller Losung« .<br />
Goethe betont demgegenüber in einer Nachschrift <strong>für</strong> Büchler (Jena, den 14.<br />
Juni 1820) »die Bestimmung des Deutschen, sich zum Repräsentanten der<br />
sämtlichen Weltbürger zu erheben« .<br />
41<br />
Zitiert nach: Hans Kaiser, Die Archive des alten Reichs bis 1806, in: Archivalische<br />
Zeitschrift 35 (1925), 205-220 (218)<br />
42<br />
MGH-Archiv 113/17 fol. llf, zitiert hier nach: Katalog MGH 1996: 12f (13)
104 MONUMKNTA Gl'RMANlAK<br />
Diskursive Dispositive: Grimms Zirkular<br />
Das virtuelle Archiv, auf dem die Archive der MGH weniger beruhen, sondern<br />
in dem sie sich verorten, verrät sich in einer auf Sammlung, Speicherung und<br />
Verarbeitung <strong>von</strong> Geschichtsdaten angelegten diskursiven Disposition und institutionellen<br />
Konditionierung dieser Diskurse in Deutschlands frühem 19. Jahrhundert.<br />
Neben den MGH formierten sich (nach den Aufrufen Ernst Moritz<br />
Arndts im Zuge der Befreiungskriege und Johannes <strong>von</strong> Müllers Schriften) Marksteine<br />
(Rothe) wie das Etymologische Wörterbuch der romanischen Sprachen <strong>von</strong><br />
Diez oder der erste Band des Deutschen Wörterbuchs <strong>von</strong> Jacob und Wilhelm<br />
Grimm, beide 1854 erschienen. 43 »Deutsch« meint hier - wie auch noch in den<br />
später <strong>von</strong> Wilhelm Braune und Hermann Paul begründeten Beiträgen zur<br />
<strong>Geschichte</strong> der deutschen Sprache und Literatur (1873ff) - einen lexikographischen<br />
Sprachraum auf Signifikantenebene, nicht das emphatische nationale Signifikat.<br />
44 Jacob Grimm »sieht anfangs sich unvermerkt zu allen denkmälern der<br />
vorzeit hingezogen und <strong>von</strong> denen der gegenwart abgewandt« 45 . Das impliziert<br />
auf der Darstellungsebene auch die Absehung <strong>von</strong> der auktorialen Gegenwart<br />
(der Gervinus zeitgleich eine dezidiert politische Literaturgeschichtsschreibung<br />
entgegensetzte); Historie wird erst möglich, wo das Archiv nicht mehr Objekt<br />
der Beschreibung ist. Derselbe Jacob Grimm verschickt 1815 in Wien als Sekretär<br />
der hessischen Legation ein Circular wegen Aufsammlung der Volkspoesie;<br />
zugleich mit der politischen Restauration der post-napoleonischen Staatenwelt<br />
Europas stellte sich die Mobilisierung eines symbolischen Gedächtniskapitals ein,<br />
das im Zeichen <strong>von</strong> Unterbrechung und Verlust steht. Die ausdrückliche Stiftung<br />
einer phonozentnsch orientierten Gesellschaft per Schrift-Zirkular (mit einem<br />
dem Text nachfolgenden leeren Blatt zur spezifischen Anrede individueller Adressaten<br />
46 ) entspricht als Kommunikationsmedium der <strong>Im</strong>plementierung der deutschen<br />
Nation im <strong>Im</strong>aginären. Flächendeckende Erfassung soll »alles, was unter<br />
dem gemeinen deutschen Landvolke <strong>von</strong> Lied und Sage vorhanden ist«, retten<br />
und sammeln. 47 Bedingung da<strong>für</strong> war eine antike Kulturtechnik: die bewußte<br />
43 Arnold Rothe, Kulturwissenschaften und kulturelles Gedächtnis, in: Jan Assmann /<br />
Tonio Hölscher (Hg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 265-<br />
290 (266)<br />
44 Herbert Blume, PBB - Das Organ <strong>für</strong> Sprachgeschichte, in: Armin Burkhardt / Helmut<br />
Henne (Hg.), Germanistik als Kulturwissenschaft. Hermann Paul: 150. Geburtstag und<br />
100 Jahre Deutsches Wörterbuch, Braunschweig (Arts et Scicntia) 1997, 13-18 (15)<br />
45 Deutsches Wörterbuch Bd. 1, Leipzig 1854, lxiii, fotomech. Nachdruck München 1984<br />
46 » daß jedesmal den besonderen näheren Umständen angemessen dazu noch<br />
geschrieben werde« (Jacob Grimm and Wilhelm, 10. Februar 1815).<br />
47 Facsimile, mit einem Nachwort <strong>von</strong> Kurt Ranke, hg. Ludwig Deneke, Kassel (Brüder<br />
Grimm-Museum) 1968
VoRGKSCHICHTKN DKR MONUMHNTA 105<br />
Modifikation des phönizischen Konsonantenalphabets hin zu einem Vokalalphabet<br />
<strong>von</strong> Seiten eines unbekannten Griechen, der ganz offensichtlich die<br />
Gesänge Homers zu speichern trachtete. 48 »Ihre Gesänge«, so Johann Gottfried<br />
Herder, »sind das Archiv des Volkes«, und mit dem Grammophon erben die<br />
Rundfunkanstalten diese archivische Sendung. 49 Der <strong>von</strong> Grimm initiierte Verein<br />
sollte so namenlos sein wie sein literarischer Gegenstand: deutsch; Anonymität<br />
gilt als »das Signum des Volkstümlichen« <strong>für</strong> diese erste volkskundliche<br />
Sozietät . Die Konsequenz aus Anonymität aber heißt Statistik.<br />
Was Grimm noch als Gruppenunternehmen plant (und damit scheitert), leistet<br />
sein Schüler Wilhelm Mannhardt mit der Aussendung <strong>von</strong> 150000 Fragebogen im<br />
Jahr 1868, kulminierend im Befragungswerk des Deutschen Volkskundeatlanten<br />
in den zwanziger und dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts. In diesem Moment<br />
schreibt sich Archäologik logozentristisch; noch sei »unser Vaterland aller Enden<br />
ausgestattet mit diesem Gut, das im Verborgenen, seiner eigenen Schöne<br />
unbewußt, fortlebt, und seinen unverwüstlichen Grund allein in sich selber trägt«<br />
(Grimm). Solche Latenzen harren der Ausgrabung, und das heißt Gedächtnisarchäologie,<br />
nicht historische Interpretation:<br />
»Es ist vor allem daran gelegen, daß diese Gegenstände getreu und wahr, ohne<br />
Schminke und Zuthat, aus dem Munde der Erzählenden, und thunlich in und mit<br />
deren selbsteigenen Worten, auf das genaueste und umständlichste aufgefaßt werden,<br />
und was in der lebendigen örtlichen Mundart zu erlangen wäre, würde darum<br />
<strong>von</strong> doppeltem Werthe seyn, wiewohl auf der andern Seite selbst lückenhafte<br />
Bruchstücke nicht zu verschmähen sind.« <br />
Gleichzeitig ortet Hegel »die erfüllte Äußerung der sich kundgebenden Innerlichkeit«<br />
im physischen Ton (Enz. § 459); demgegenüber ist (im nächsten Paragraphen)<br />
die Erinnerung der Äußerlichkeit des phonetischen Ereignisses »das<br />
Gedächtnis«. 50 Der Ursprungseffekt oraler Traditionen in der Ethnographie aber<br />
ist ein Mythos: »Orale Traditionen müssen als aktuelle Texte älterer, inzwischen<br />
verlorengegangener Versionen eingeschätzt werden.« 51 In Grimms Circular<br />
scheint sie auf, die noch heute gelegentlich formulierte funktionale Verschränkung<br />
<strong>von</strong> Archäologie und Archiv (dessen Schweigen zum Trotz): »der Archi-<br />
48<br />
Barry B. Powell, Homer and Writing, in: Ian Morris / ders. (Hg.), A new Companion<br />
to Homer, Leiden / N. Y. (Brill) 1996, 3-32<br />
49<br />
Dazu Bert Lemmich, Das Prinzip Archiv, in: Info 7. Information und Dokumentation<br />
in Archiven, Mediotheken, Datenbanken, Heft 1 (Juli) 2000, 15. Jg., 4-16 (13)<br />
50<br />
Dazu Jürgen Trabant, Vom Ohr zur Stimme. Bemerkungen zum Phonozentrismus<br />
zwischen 1770 und 1830, in: Hans Ulrich Gumbrecht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.),<br />
Materialität der Kommunikation, Frankfurt/M. 1988, 63-79 (64f)<br />
51<br />
Dag Henrichsen, »Ehi rOvaherero«. Mündliche Überlieferungen <strong>von</strong> Herero zu ihrer<br />
<strong>Geschichte</strong> im vorkolonialen Namibia, in: Werkstatt<strong>Geschichte</strong> 9 (1994), 15-24 (15)
106 MüNUMKNTA GhRMANIAE<br />
var als Vermittler zwischen der toten Vergangenheit und dem lebenden Volk« 52 .<br />
Historisches Bewußtsein entsteht in der Verwechslung <strong>von</strong> Evidenz und Halluzination;<br />
Historiker - analog zu Musikerpraxis - lassen das Archiv (die Partitur)<br />
durch ihren (Klang-)Körper laufen. Das also heißt Aktivierung des Archivs, seine<br />
energetische Aufladung durch re-enactment (Collingwood). Der französische<br />
Historiker Jules Michelet vernahm im Archiv halluzonatorisch das Murmeln der<br />
Toten; der historische Diskurs fungierte unter der Droge der Einbildungskraft<br />
(vergleiche die <strong>von</strong> William Blake illustrierten Night Thougkts Edward Youngs<br />
1797): »Dans les galeries solitaires des Archives oü j'errai vingt annees, dans ce<br />
profond silence, des murmures cependant venaient ä mon oreille.« 53 In einem<br />
Post-Scriptum Grimms zeichnet sich am Rande ein Korrelat zum Unternehmen<br />
der MGH ab (auch vom Stein in Frankfurt wurde durch das Circular adressiert):<br />
Grimm lädt ausdrücklich dazu ein, »in Archiven und Klöstern Ihrer Gegend<br />
nach altdeutschen Büchern und Handschriften zu spüren nicht zu versäumen«;<br />
der logozentnsche <strong>Im</strong>puls wird durch seine Speichermedien unterlaufen. Es ist<br />
ein Zirkular, das überhaupt erst die Bedingung zur Versammlung eines Textgedächtnisses<br />
setzt. Unter verkehrten Vorzeichen werden es die deutschen<br />
Bibliotheken sein, welche durch die - europaweit einzigartige - Institution der<br />
Fernleihe (»das Ausleihen der Bücher zur Benützung nicht nur an dem Ort der<br />
Bibliothek, sondern in fernen Gegenden« 54 ) logistisch kompensieren, was auf<br />
staatlicher Ebene defizitär blieb: die zentrale Monopolisierung des Wissens.<br />
Administration. Großunternehmen der Geschichtswissenschaft als<br />
Aufschreibesysteme<br />
In der zwischen Pragmatik und Literatur oszillierenden Rubrik »Briefe, Denkschriften<br />
und sonstige Arten« findet sich der Briefwechsel vom Steins mit dem<br />
Geheimen Legationsrat Karl Friedrich Eichhorn 1816-17 betreffs einer historischen<br />
Gesellschaft in Berlin, deren Aufgabe einer Sammlung deutscher Altertümer<br />
jenseits der Urkunden ausdrücklich auch Realien umfassen soll; Staatskanzler<br />
Hardenberg läßt das entsprechende Promemona zu den Akten schreiben - ein<br />
52 Aufsatztitel Eric Ketelaars, in: Der Archivar, 48. Jg., Heft 4 (Nov. 1995), 589-597<br />
53 Jules Michelet, Histoire de France, Preface de 1869, 24 (= Oeuvres Completes IV, hg.<br />
v. Paul Viallaneix, Paris / Flammarion 1974). Siehe auch W. E., Hornbostels Klangarchiv:<br />
Gedächtnis als Funktion <strong>von</strong> Dokumentationstechnik, in: Sebastian Klotz (Hg.),<br />
»Vom tönenden Wirbel menschlichen Tuns«: Erich M. <strong>von</strong> Hornbostel als Gestaltpsychologe,<br />
Archivar und Musikwissenschaftler, Berlin / Milow (Schibri) 1998, 116-131<br />
54 H. Baumgarten, Archive und Bibliotheken in Frankreich und Deutschland, in: Preußische<br />
Jahrbücher Bd. 36 Heft 6 (1875), 626-654 (650)
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 107<br />
Akt der Visualisierung. 55 Konsequent erwachsen die Wurzeln der MGH einer<br />
diskursiven Mobilmachung. Erwin Töllner weist zum Jubiläumsjahr des 175jährigen<br />
Bestehens der MGH 56 nach, daß die Initiative zur Gründung der MGH im<br />
Frühjahr 1816 nicht - wie bei Bresslau zu lesen - vom Reichsfreiherrn<br />
ausging, sondern <strong>von</strong> einem Plan Berliner Staatsmänner und Gelehrter (Signatoren:<br />
Altenstein, Ancillon, Eichhorn, Niebuhr, Rühs, Savigny, Staegemann<br />
und Süvern) zur Gründung einer Gesellschaft <strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong> vom 31.<br />
Mai 1816. 57 Es war dann eine administrative Strategie, die zur konkreten Geburt<br />
der MGH aus den Befreiungskriegen führte. Vom Stein selbst benannte die Transition<br />
<strong>von</strong> der militärischen und politischen zur Gedächtnis-Topographie (loci):<br />
»Kenntnis des Ortes ist die Seele des Dienstes.« Oskar Negt und Alexander Kluge<br />
beschreiben den Eigensinn aller Bürokratien als die Vektoren <strong>von</strong> Historie, haben<br />
sie doch zunächst die Absicht, Erfahrungen aufzugreifen und das, was sie verwalten,<br />
auch zu verstehen (im Sinne <strong>von</strong>: Berührung aufzunehmen). Das ist der<br />
Brückenschlag zur historischen Hermeneutik als Funktion einer administrativen<br />
Logik jenseits <strong>von</strong> Historie. Bürokratien aber inkorporieren nur das, was ihre<br />
Programme zu verarbeiten in der Lage sind: »Das Leitungsnetz einer Bürokratie<br />
ist eine Art Automat. Dieser Automat wird die Erfahrungsbereiche, mit denen er<br />
umgeht, nach seinem Bilde modeln, aber nicht zulassen, daß wirkliche Verhältnisse<br />
den Apparat modeln.« 58 Vielleicht liegt die Definitionsmächtigkeit <strong>von</strong> Wirklichkeit<br />
dann doch eher auf Seiten des Apparats. Auch der Historiker Barthold<br />
Georg Niebuhr (1776-1831), mit seinem vehementen Interesse am Urtext des<br />
Nibelungenliedes und an isländischen Sprachdenkmälern ein Mitbegründer der<br />
Disziplin Deutsche Philologie, war vom Freiherrn vom Stein zunächst aus dänischen<br />
Diensten als Finanzfachman nach'Preußen geholt worden und 1809 zum<br />
Geheimen Staatsrat ernannt. Nachdem er aufgrund <strong>von</strong> finanzpolitischen Streitigkeiten<br />
mit dem neuen Staatskanzler Graf Hardenberg dort wieder ausschied,<br />
wurde er im gleichen Jahr zum Historiographen des königlichen Hofes sowie auf<br />
Vorschlag Wilhelm <strong>von</strong> Humboldts in die philologische Klasse der Akademie der<br />
Wissenschaften berufen, wo er in seiner Antrittsrede verkündete: »Nachdem<br />
55<br />
Dokument D 3, gedruckt in Pertz 1854 (Bd. 5): 58, und Theodor Volbehr, Die Zukunft<br />
der deutschen Museen, Stuttgart (Schrecker & Schröder) 1909, 22ff (25)<br />
56<br />
Siehe Erwin Töllner, Carl Friedrich Eichhorns Anteil an der Gründung der Monumenta<br />
Germaniae Historica, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters,<br />
namens der Monumenta Germaniae Historica hg. v. Johannes Fried, Hans Martin<br />
Schaller, Horst Fuhrmannn und Rudolf Schiefer, 50. Jg. Heft 1, Köln / Weimar / Wien<br />
(Böhlau) 1994, 33-72, bes. 44ff<br />
57<br />
Diesen Plan beschreibt G. Winter, Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae<br />
Historica, in: Neues Archiv 47 (1928), 1-30<br />
5S<br />
Oskar Negt / Alexander Kluge, <strong>Geschichte</strong> und Eigensinn, Frankfurt/M. (2001)<br />
1981,304
108 MüNUMKNTA GKRMANIAK<br />
Deutschland jede andere Art des Ruhmes verloren hat, oder absterben sieht ,<br />
bleibt ihm nur noch der Ruhm höherer Gelehrsamkeit.« 59 Geschichtszeichen: Die<br />
Quellensammlung sollte, wie Stein formulierte, den Zweck haben, »zur Erhaltung<br />
der Liebe zum gemeinsamen Vaterland und Gedächtnis unserer großen Vorfahren<br />
beizutragen.« 60 Gerade diese diskursstiftende Operation verfährt radikal<br />
unhistorisch, genau so, wie es im Nachlaß des Herrn <strong>von</strong> Friedersdorf, dem Fontane<br />
in seinem Roman Stechlin in idealer Gestalt ein Denkmal setzt, rückschauend<br />
über Preußens Reformzeit heißt: »Stein die Revolutionierung des<br />
Vaterlandes an, den Krieg der Bureaus gegen die aus der <strong>Geschichte</strong> des Landes<br />
hervorgegangenen Verhältnisse, des Wissens und eingebildeten Talents gegen<br />
Tugend und ehrenwerte Charaktere.« 61 So wird der operative Bruch mit tradierter<br />
Historie zur Bedingung ihrer Reemergenz als Nationalgeschichte.<br />
Der Diplomatiker Karl Brandi erweitert den Horizont seiner objektorientierten<br />
Disziplin um 1900 dadurch, daß er auf der Einbeziehung <strong>von</strong> Kanzleien und<br />
Schreibstuben in die Urkundenforschung insistiert - mithin also einen Rekurs<br />
auf jene Infrastruktur, die beim Zustandekommen einer Urkunde parergonal mit<br />
am Werk ist. Der Blick ist mit anderen Worten auf das Aufschreibesystem gerichtet:<br />
jenes »Netzwerk <strong>von</strong> Techniken und Institutionen, die einer gegebenen<br />
Kultur die Entnahme, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben.«<br />
62 Erst zögernd nimmt Urkundenarchäologie dabei die Gegenwart <strong>von</strong><br />
Datenverarbeitung in technischen Medien zur Kenntnis. Die epistemologische<br />
Diskontinuität, welche die Infrastruktur der MGH <strong>von</strong> der Gegenwärtigkeit<br />
elektronischer Datenverarbeitung trennt, liegt in der Differenz <strong>von</strong> Datenverarbeitung<br />
und Berechnung (Computing). Die Objekte der MGH - zu einem guten<br />
Teil Schriftprodukte mittelalterlicher Kanzleien - wurden mit dem Subjekt der<br />
Edition gleichrangig, und das Verhältnis zu den Daten nicht synekdochisch im<br />
Sinne der Hermeneutik des historischen Diskurses, sondern seriell (also äußerlich<br />
<strong>von</strong> Extriontäten) bestimmt. Diese Medienarchäologie der Historie sucht<br />
jene Dokumentenmaterie, auf deren Lagerung die Gesellschaft insistiert, als<br />
Monumente zu bearbeiten und zu beschreiben: »Der neue Archivar refingiert das<br />
59 Barthold C. Witte, Der preußische Tacitus. Aufstieg, Ruhm und Ende des Historikers<br />
Barthold Georg Niebuhr 1776-1831, Düsseldorf 1979, 78, hier zitiert nach: Meves<br />
1985: 323f<br />
60 Zitiert nach: Horst Fuhrmann, Goethe, Frankfurt und die Anfänge der Monumenta<br />
Germaniae Historica, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1995, Tübingen<br />
(Niemeyer) 1995,2-22(4)<br />
61 Marwitz 1852, zitiert in: Martin Fontius, Begriffsgeschichte und Literaturgeschichte.<br />
Einige methodische Bemerkungen, in: Karlheinz Barck / Martin Fontius / Wolfgang<br />
Thierse (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe. Studien zu einem historischen Wörterbuch,<br />
Berlin (Akademie) 1990,49-64(57)<br />
62 Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München (Fink) 1987, 429
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 109<br />
Kanzlei-Archiv der Monumente und operiert darin wie ein Kanzler oder General-Sekretär:<br />
monumentarisch.« 63 Demgegenüber löst sich der Begriff des Dokuments<br />
im Zuge der Datenverarbeitung <strong>von</strong> seiner diplomatischen Definition:<br />
Zunächst (im Diskurs der Historiographie) eine Urkunde, ein Beweis durch ein<br />
Schriftstück oder irgendein Beweisobjekt, hat sich dieser Ausdruck allmählich<br />
besonders auf das Gebiet der Verwaltung übertragen, »bis zu dem Tag, an dem<br />
Lafontaine und Otlet und ihr Bibliographisches Institut sich des noch ungenügend<br />
definierten Begriffs bemächtigten.« 64 Die Textartefakte der MGH dienen<br />
zunächst zu nichts als Beweis, weshalb sie auch Monumenta heißen.<br />
Die Bundesversammlung zu Frankfurt am Main beschließt in den Jahren<br />
1819, 1820 und 1821, dieses - wie es heißt - »wichtige National-Unternehmen«<br />
den Regierungen wiederholt aufs dringendste zu empfehlen, wodurch sich auch<br />
fast alle nicht nur zu Geldbeiträgen, sondern auch zur »Eröffnung ihrer Bibliotheken<br />
und Archive« bewogen fanden. 65 Gleich dem späteren Unternehmen<br />
eines General-Repertoriums deutscher Kulturdenkmäler durch den Freiherrn<br />
<strong>von</strong> Aufseß in Nürnberg ist der Anspruch der MGH flächendeckend (und<br />
somit als symbolischer Raum identisch mit dem der Nation, die damit durchmessen<br />
wird): »So ergab sich daraus die Nothwendigkeit, jede Bibliothek<br />
und jedes Archiv in Deutschland, und die wichtigsten des Auslandes eigends<br />
untersuchen zu lassen« .<br />
Der Berliner Plan<br />
Johannes Müller erwähnt in einem Brief an den schwäbischen Historiographen<br />
Johann Christian Pfister vom 14. März 1805 (also noch vor der preußischen<br />
Niederlage gegen Napoleon) Berliner Pläne zur Errichtung einer Gesellschaft,<br />
»welche eine vollständige Ausgabe der >Scriptor. rer. Germamcar.< auf muratorische<br />
Art unternehmen möchte«. Die Initiative zu diesem Unternehmen war<br />
<strong>von</strong> dem Historiker und Diplomaten Karl Ludwig <strong>von</strong> Woltmann ausgegangen,<br />
der bereits als Jenenser Professor <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> in der Allgemeinen Litteratur-<br />
Zeitung vom 22. April 1797 einen Plan der Quellensammlung zur deutschen<br />
63 Walter Seitter, Zur Gegenwart anderer Wissen, in: Michel Foucault / Walter Seitter,<br />
Das Spektrum der Genealogie, Bodenheim (Philo) 1996, 94-112 (102), unter Verweis<br />
auf Foucault 1973: 14, 182<br />
64 Marcel Godet, Dokumentation, Bibliotheken und Bibliographie. Versuch einer Definition<br />
ihres Charakters und ihrer Beziehungen, in: Peter R. Frank (Hg.), Von der<br />
systematischen Bibliographie zur Dokumentation, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1978,<br />
405-4515, hier: 405
110 MüNUMIiNTA GKRMANIAH<br />
<strong>Geschichte</strong> veröffentlicht und Johannes <strong>von</strong> Müller zugeschickt hatte. Inspiriert<br />
da<strong>von</strong> oder analog dazu verfaßt im Berliner Personenkreis der Major am Kadettencorps<br />
Heinrich <strong>von</strong> Menü (Minutoli) im Frühjahr 1810 einen Unmaßgeblichen<br />
Vorschlag zur Stiftung einer altertumsforschenden Gesellschaft in Berlin,<br />
deren Zweck es sein soll, die vaterländischen Denkmäler zu sammeln und zu<br />
beschreiben (nicht aber als <strong>Geschichte</strong> zu erzählen). Während Minutoli dabei<br />
»nur archäologische Gegenstände im Auge« hat, bezieht ein anonymer Gutachter<br />
in seiner Stellungsnahme vom 17. April 1810 auch »seltene Handschriften,<br />
ungedruckte Chroniken, alte <strong>Geschichte</strong>, Lieder« ein . Minutolis Sohn Alexander wird später als preußischer Beamter in<br />
Liegnitz 1845 nicht nur eine Vorbilder-Sammlung <strong>von</strong> Erzeugnissen der Industrie<br />
der Vorzeit eröffnen, sondern sie (nach dem Vorbild der gewerbeästhetischen<br />
Kupferstich-Vorlegeblätter Peter C. W. Beuths) im Medium Photographie<br />
publizieren, wobei »erst die Photographie den Sammlungsgegenstand zum<br />
Kunstwerk macht«. 66 Am 20. November 1814 jedenfalls legt der <strong>von</strong> Minutoli<br />
informierte Konrad Levezow in Berlin seinen Entwurf zur Konstitution einer<br />
deutschen altertumsforschenden Gesellschaft vor, deren Zweck »Sammlung und<br />
Aufklärung der frühesten und mittelalterlichen Altertümer des deutschen Vaterlandes<br />
im allgemeinen und des Preußischen Staates insbesondere« sein soll, auch<br />
hier noch mit archäologischem Akzent auf matenaler Kultur . Minutolis und Levezows Entwürfe werden <strong>von</strong> Alois Hirt<br />
an den Historiker Christian Friedrich Rühs, die Rechtshistoriker Eichhorn und<br />
Friedrich Karl <strong>von</strong> Savigny sowie an Niebuhr weitergeleitet; Forum dieser<br />
Gesprächsrunden ist die Berliner Universität, die diskursstiftend agiert. Rühs<br />
verfaßt daraufhin mit Datum vom 14. Dezember 1814 die Stellungnahme<br />
Unvorgreiflicbe Gedanken über eine Gesellschaft <strong>für</strong> das deutsche Altertum,<br />
worin er einerseits das deutsche Altertum <strong>von</strong> der klassischen Antike absondert,<br />
die im Unterschied zur deutsche Altertumskunde »etwas Abgeschlossenes und<br />
Vollendetes« sei - Klassik versus <strong>Geschichte</strong>. Der Quellenrekrutierungsbereich<br />
war auf ganz Deutschlandbezogen, eine »Volks-« und »Nationalangelegenheit«.<br />
Zweck der Gesellschaft sei »Sammlung, Herstellung, Prüfung und Erläuterung<br />
aller Quellen, woraus sich das Sein und Leben des deutschen Volkes nach allen<br />
Richtungen als ein organisches Ganzes <strong>von</strong> seinem frühesten, der Forschung<br />
zugänglichen Zustande durch alle Übergänge bis in die bestehenden Verhältnisse<br />
begreifen und verfolgen läßt«. Hier wird den diskreten Quellen über den me-<br />
66 Bernd Vogelsang, Das Museum im Kästchen oder: Die Erfindung des Kunstgewerbemuseums<br />
als Photosammlung durch den Freiherrn <strong>von</strong> Minutoli (1806-1887), in: Silber<br />
und Salz. Zur Frühzeit der Photographie im deutschen Sprachraum (1839-1860).<br />
Kataloghandbuch zur Jubiläumsausstellung 150 Jahre Photographie, hg. v. Bodo v.<br />
Dewitz / Reinhard Matz, Köln / Heidelberg (Braus) 1989, 522-547 (544 u. 540)
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 111<br />
tonymischen Begriff Deutschland ein integrierender Diskurs implementiert; die<br />
methodische Konsequenz daraus heißt Abwendung <strong>von</strong> der Antiquarik, hin »zu<br />
einer allgemeinhistorischen Erfassung der Aufgaben«. Niebuhrs Gutachten vom<br />
26. Februar 1815 setzte gegen die Konzentration auf Archivalien auf didaktische<br />
Philologie: Speziahsteneditionen blieben »tot in den Bibliotheken«; vielmehr<br />
sollen die Ergebnisse allgemein zugänglich gemacht werden. Nation kann nur<br />
im Massenmedium Buch gestiftet werden; vom Stein wußte in seinem Brief an<br />
Pertz vom 11. August 1824, daß die Gesellschaft nicht verlangen konnte, daß<br />
die Hahnsche Buchhandlung »ihr Capital in eine todte Masse bedrucktem<br />
absatzlosen Papier verwandle. Unterdessen glaube ich daß sich hinreichend<br />
Abnehmer finden werden, da der Geschmack an <strong>Geschichte</strong> wieder zu erwachen<br />
scheint« - im Unterschied zu der in seinem Brief an Pertz<br />
vom 17. Oktober 1826 beklagten Kälte gegenüber diesem Gegenstand. Totes<br />
Gedächtniskapital gilt es durch aktive Erinnerungspolitik (als <strong>Im</strong>perativ) zu<br />
mobilisieren. Die Differenz zwischen einem »litterärischen Depot« und seiner<br />
narrativen Mobilisierung beschreibt <strong>für</strong> seinen Vorschlag eines Nationalmuseums<br />
B. vom Wichmann: Die eine Hauptabteilung des Museums diene der<br />
Sammlung (»vorbereitend«), während die zweite Hauptabteilung die »selbstthätig<br />
wirkende« zu nennen sei; ihr Zweck formuliert sich in Begriffen der<br />
Gedächtnisökonomie: »Das todte Kapital der Vorgängerin in Circulation bringen,<br />
und das geistige, durch schriftstellerisches Wort zusammen gehaltene Band<br />
bilden, welches die Vaterlandskunde mit der Nation, und umgekehrt diese mit<br />
jener, in eine fortlaufende und ersprießlich Berührung bringt« . Demnach war auch <strong>für</strong> Niebuhr der Volksgeist keine »quasimetaphysische<br />
Entität«, sondern eine kulturelle Notwendigkeit und damit organisierbar.<br />
In einem Brief an Eichhorn vom 26. März 1816 definiert vom Steins<br />
Skizze zu Aufgaben und Organisation einer Gesellschaft <strong>für</strong> die Sammlung<br />
deutscher Geschichtsquellen des Mittelalters das »Aufsuchen und Bekanntmachen<br />
der in Bibliotheken, Archiven usw. noch vergrabenen Manuskripte,<br />
Urkunden« - Wissensarchäologie, buchstäblich, die unmittelbar nach Verschüttung<br />
der Präsenz <strong>von</strong> Institutionen des Alten Reiches einsetzt (Diskontinuität<br />
ist die Bedingung <strong>von</strong> Historiographie als Beobachterdifferenz). <strong>Im</strong><br />
Sinne des Archivs als Saum der Gegenwart (Foucault) deklariert <strong>von</strong> Savigny<br />
(Vom Beruf unserer Zeit <strong>für</strong> Gesetzgebung und Rechtswissenschaft) die Zirkularität<br />
<strong>von</strong> Speichergedächtnis und Aktualisierung. So sei nicht vorab zu<br />
bestimmen, welche Anteile <strong>von</strong> altgermanischen Einrichtungen in der Verfassung<br />
und im bürgerlichen Recht wieder erweckt werden könne: »Freilich nicht<br />
dem Buchstaben, sondern dem Geiste nach, aber den ursprünglichen Geist<br />
lernt man nur kennen aus dem alten Buchstaben« . Der Berliner Plan <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong> sieht schließlich eine
112 MüNUMHNTA GKRMAN1AK<br />
historische Geographie Deutschlands mit den dazu gehörigen Charten vor; noch<br />
ist das Unternehmen <strong>von</strong> Gedächtnisarbeit als topographischer Synchronisation<br />
nicht geschichtlich-philosophisch verzeitlicht (und entzieht sich somit in gewisser<br />
Weise auch der daran geschulten Geschichtsästhetik unserer Rekonstruktion).<br />
<strong>Im</strong> Geheimen Staatsarchiv Berlin, Rep. 92 (Nachlaß Meinecke Nr. 112),<br />
befindet sich eine Kladde, das Kollegheft des Studenten Friedrich Meinecke zur<br />
Vorlesung des Diplomatikers und Historiographen der MGH Harry Bresslau:<br />
»Historische Geographie <strong>von</strong> Deutschland. Berlin S.S. 1884«; so setzte sich fort,<br />
was in den Befreiungskriegen als militärische Aufklärung begonnen hatte, als<br />
tableau. 67<br />
<strong>Im</strong> Frühjahr 1816 wendet sich der Klosteramtsmann zu St. Michaelis in Lüneburg,<br />
Anton Christian Wedekind, an den Direktor der historisch-philologischen<br />
Klasse der Göttinger Akademie der Wissenschaften, Johann Gottfried Eichhorn,<br />
mit dem Plan zur Stiftung eines Geschichtspreises. Das Archiv der Göttinger<br />
Sozietät birgt Eichhorns ausführliche Antwort, eine Punctation vom 25. August<br />
1816 an den »Fundator« Wedekind; <strong>für</strong> die Preisaufgaben schlägt er neben der<br />
zehnjährlichen Herausgabe eines deutschen Geschichtsschreibers des Mittelalters<br />
und der kritischen Bearbeitung einzelner »Zeiträume oder Gegenstände der mittleren<br />
und neuen deutschen <strong>Geschichte</strong> (in lateinischer Sprache) im Geschmack<br />
der Antiquitatum medn aevi <strong>von</strong> Muratonus« als drittes Genre vor:<br />
»Ein deutsch geschriebenes Geschichtsbuch, <strong>für</strong> das Kunst der Darstellung zur 2ten<br />
Hauptbedingung gemacht wird, damit endlich auch der deutsche Styl gewinne. Die<br />
erste müßte immer seyn: sorgfältige und kritische Zusammenstellung <strong>von</strong> Thatsachen,<br />
nie aber (nach dem Vorgang der Prcisscliriftcn, welche das französische<br />
Nationalinstitut zu krönen pflegt) bloße Entwicklung sogenannter Ansichten.«<br />
<br />
Hier formuliert sich die <strong>für</strong> die spätere Edition der MGH charakteristische<br />
Ästhetik diskreter Dokumentenverarbeitung gegenüber narrativer Einbettung.<br />
Als der 20. Januar 1819 in Frankfurt/M., dem Ort des Deutschen Bundestags, die<br />
Gründung der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde notiert, definiert<br />
der lateinische Name Societas aperiendis fontibus präziser den Zugang zu den<br />
Datenbanken (klassisch: Archiven) als Schlüssel zur Verfügungmacht über nationales<br />
Geschichtswissen und dessen Mobilisierung - fünf Jahre, nachdem 1813<br />
reale Völker- als Kriegsmannschaften mobilisiert worden waren gegen Napoleon.<br />
Das kollektive Gedächtnis, ein letztlich diffuser Begriff, ist hier präzise als Effekt<br />
einer Kollektion, Sammlung faßbar. Die <strong>von</strong> den MGH herzustellende nationale<br />
Vergangenheit als Bewußtsein ist eine Funktion <strong>von</strong> Gedächtniskybernetik, Len-<br />
67 Vgl. das Tableau general e la Populaton des territoires conquis dans la demiere guerre<br />
sur Napoleon et sur ses Allies in: Pertz 1854 (Bd. 4): 605
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 113<br />
kung, administrativer Verfügung, doch dabei in hohem Maße diskursanfällig.<br />
Rekonstruktionen der Vergangenheit sind zumeist »aus den Verfügbarkeiten des<br />
Präteritums gezimmert«, ohne letztendliche Verifizierung <strong>von</strong> außen: »Noch das<br />
neutralste archäologische oder archivarische Zeugnis wird erst zu einem solchen<br />
durch das Wagnis der Interpretation, der selektiven Rekonstruktion im Vorstellungsvermögen,<br />
die es hervorbringt.« 68 Archive waren zugleich diskursiv und<br />
non-diskursiv zu mobilisieren: als Rede vom Ursprung oder Beginn (historisch,<br />
ontologisch) und als nomologisches Prinzip (Gesetz, Kommando, Autorität,<br />
Ordnung). 69 Der erstrebte Effekt eines Nationalgeschichtsbewußtseins war zunächst<br />
einmal eine Funktion kollektiver Finanzierung, die <strong>von</strong> einer anfänglich<br />
privaten Initiative aus Kreisen des Bürgertums und Adels (die Freunde des Freiherrn<br />
vom Stein) und vor dem Hintergrund der Reserven vom Steins gegenüber<br />
jedweder direkten Abhängigkeit der Gesellschaft <strong>von</strong> preußischen Autoritäten -<br />
notwendig auf Staat umschalten mußte. Gerade lokale und regionale Altertumsvereine<br />
geraten in Abhängigkeit <strong>von</strong> staatlichen Dotationen, wogegen sich vom<br />
Stein wehrt: Sie hatten sich politischer Interessen zu enthalten und zu rein wissenschaftlichen<br />
Zwecken organisiert zu sein. Metternichs Mißtrauen gegenüber<br />
den MGH beruht auf der Furcht der restaurativen Ordnung. Aus österreichischer<br />
Sicht fragte sich in der Tat, zu welchem Zweck denn die Erweckung des<br />
historischen Geistes diente: zur Begründung oder zur Dekonstruktion der bestehenden<br />
politischen Ordnung? »History could be dangerous, if lt could be shown<br />
through the source material that modern claims and medieval law were<br />
at odds.« 70 Wien verweigert den MGH zeitweise die Unterstützung aus Angst,<br />
darin Stoff <strong>für</strong> politische Agitation geliefert zu bekommen: »Wer konnte es sich<br />
nur träumen lassen, daß ein Unternehmen, welches einen so ausgemachten literarischen<br />
Wert hat, als ein gefahrdrohendes, Staatsmänner beunruhigendes<br />
Unternehmen angesehen werden könne« . Die Frankfurter<br />
Bundesversammlung gibt das Ersuchen um Finanzierung an die einzelnen<br />
-Regierungen weiter, die sich nur zögernd bereiterklärten (Baden durch Überlassung<br />
der Dienste des Archivrats Dümge, Preußen durch sporadische Geldüberweisungen).<br />
Die Infrastruktur des deutschen Gedächtnisses ist in diesem<br />
Moment eine Funktion fiskalischer Praxis, was auch die Wahrnehmung der Infrastruktur<br />
<strong>von</strong> Historie auf Objektebene schärft. Vom Stein kommentiert dementsprechend<br />
die Fragen, die Band 4 seines Publikationsorgans Archiv dem<br />
68 George Steiner, Von realer Gegenwart. Hat unser Sprechen Inhalt? Mit einem Nachwort<br />
<strong>von</strong> Botho Strauß, München (Hanser) 1990, 219<br />
69 Jacques Derrida, Archive Fear, in: Diacritics 25 (1995), 9-64 (9); orig. Mal d'Archive.<br />
Une <strong>Im</strong>pression Freudienne, Paris (Galilee) 1995; dt. jetzt unter dem Titel: Dem<br />
Archiv verschrieben, Berlin (Brinkmann & Böse) 1997<br />
70 Crane 2000: 91, unter Bezug auf Bresslau 1921: 100
114 MüNUMHNTA GKRMANIAK<br />
Publikum mit Blick auf das Editionsdesign der künftigen MGH zur Diskussion<br />
stellt: »Ohne Benutzung der Formeln, Gesetze, Urkunden, Briefe bleiben die<br />
Chroniken selbst unverständlich und trocken, aus jenen Hülfsmitteln lernt man<br />
das Innere der Staatsverfassung, Verwaltung, das häusliche und ländliche Leben<br />
kennen« .<br />
Wessenbergs Plan<br />
Susan Crane weist im Kontext der MGH-Vorgeschichten auf einen weiteren<br />
Plan, entworfen <strong>von</strong> J. H. <strong>von</strong> Wessenberg, Generalvikar <strong>von</strong> Konstanz: eine<br />
Volltextsammlung schriftlicher Quellen <strong>von</strong> Gesetzen und volkskundlichem<br />
Material (wie Legenden und Gesänge) aus Archiven in allen Teilen Deutschlands,<br />
supplementiert <strong>von</strong> Information auf der Medienebene des diskursiv zirkulierenden<br />
Wissens. Jede Bibliothek <strong>von</strong> Rang soll eine Bibliographie ihrer Quellen zur<br />
Verfügung stellen, und ein Inventar <strong>von</strong> historisch-patriotischen Gegenständen<br />
und Kunstwerken aller herrschaftlichen Residenzen, Städte und ihrer Umgebung.<br />
71 Wessenberg plädiert <strong>für</strong> eine Aufgabenteilung dieses Projekts durch<br />
Gesellschaftliche Vereine in jedem deutschen Einzelstaat; diese Gruppierung soll<br />
eine zentrale Leitung in Köln unter vom Steins Führung bilden. Demgegenüber<br />
scheitert vom Steins Frankfurter Gesellschaft <strong>von</strong> 1819 bei dem Versuch, lokale<br />
Außenstellen einzurichten, denn die lokale Aufarbeitung lokalen Gedächtnisses<br />
in ihrer Nähe zum Objekt entzieht sich ihrer zentralen Koordination, die zur<br />
Transformation dieser Datenmengen in Information tendiert. »The essentially<br />
local nature of historical collecting continued to argue that collecting was best<br />
done locally, best undertaken by those with an organic connection to the native<br />
soil in which lay buned the trasures of their past« . In Begriffen<br />
der Ethnologie gemäß Clifford Geertz und des new historicism heißt das: local<br />
knowledge, versehen mit diskursiven Vektoren respektive Operatoren - die Ausrichtung<br />
auf Nation. Derartige Zeiger, »die nichts tun als verweisen« (Gloria<br />
Meynen), machen die organisatorische Differenz an den Dingen: »Ein Zeiger ist<br />
eine Variable, die die Adresse einer Variablen enthält.« 72<br />
Ein Brief Böhmers an Pertz vom 23. April 1826 73 benennt das diskursive Dispositiv<br />
der MGH mit dem quasi-sakralen Begriff der unsichtbaren Kirche, den<br />
das spätere Germanische Nationalmuseum als realer Bau sowohl vom konkre-<br />
71 Robert Hering, Freiherr <strong>von</strong> Stein, Goethe und die Anfänge der MGH, in: Jahrbuch<br />
des freien deutschen Hochstifts (1907), 303<br />
72 Kernighan / Richie, Programmieren in C, München / London 1990: 91, zitiert nach:<br />
Meynen 1997: 1<br />
73 MGH Rep. 338, Tit. 9, Nr. 215, Blatt 81
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 115<br />
ten Standort als auch <strong>von</strong> seinen <strong>Im</strong>plikationen her als »ästhetische Kirche« (um<br />
hier Hubert Schrades Terminus zu verwenden) realisieren sollte. Hier zeigen<br />
sich die zwei Körper der MGH, ihr sowohl physischer (Träger und Repräsentanten)<br />
als auch (analog zum body politic in der spätmittelalterlichen politischen<br />
Theologie) historischer Körper (das EdkionskorpHS, seinerseits gekoppelt an<br />
das Textkorpus der Archive). »The MGH remained a profoundly personal<br />
collective collection, a dispersed set of collectors contributing to the whole«<br />
- womit auf personaler und Korporationsebene das vollzogen<br />
wird, was Hayden White <strong>für</strong> die Rhetorik des histonographischen Diskurses<br />
im 19. Jahrhundert analysiert hat: metonymische (Monumenta) und synekdochische<br />
(»contributing to the whole«) Operationen. Dabei bilden die disiecta<br />
membra der MGH, konkret: die disseminierten Mitglieder und Korrespondenten,<br />
ein symbolisches Netz, das im Raum des <strong>Im</strong>aginären (»the whole«)<br />
arbeitet, wo (real) ein Loch, reine Abwesenheit <strong>von</strong> Vergangenheit ist (a hole).<br />
Die Vergangenheit kartographieren, Archive schürfen<br />
Eine nationale Gemeinschaft im kanonischen Text zu konstituieren, heißt im<br />
Fall der MGH konkret die Edition eines Kanons der deutschen Geschichtsquellen<br />
des Mittelalters - eine endliche Menge an Daten, die es zu erfassen,<br />
berechnen und zu erzählen gilt. <strong>Geschichte</strong> ist, vor allen <strong>Geschichte</strong>n, vermessene<br />
Vergangenheit; ihre Datenverarbeitung vollzieht dies unpassioniert. Der<br />
Berliner Plan <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> 1816 sagt ausdrücklich, daß durch<br />
die lückenlose Erforschung der Landesgeschichte »gerade wie bey der Vermessung<br />
eines Landes, ein Netz gezogen werden« muß, eine nicht mehr semantische,<br />
sondern geometrische Textur, »wo jedem Einzelnen, der Mitarbeiter wird,<br />
ein bestimmter Kreis seiner Thätigkeit angewiesen wird.« 74 Eine quasi-militärische<br />
Logistik ist aller Geschichts-Logik (als deren Effekt) vorgeschaltet.<br />
In seinem Kommentar vom 26. März 1818 zu einem Entwurf Dümges bemerkte<br />
vom Stein, daß man bei der Ausgabe der Quellen Deutscher <strong>Geschichte</strong><br />
des Mittelalters »soviel als möglich nach Zeitfolge ordne, z. B. nach Regenten-<br />
Stämmen, sie aber nicht zerstückele und zerreiße. Als Zugabe würde auch noch<br />
eine Geographie des Mittelalters bearbeitet werden müssen« .<br />
Aus den Bemerkungen Arndts über die Sammlung der Geschichtsquellen geht<br />
hervor, wie unentschieden die räumliche noch neben der zeitlichen Ordnung<br />
der Vergangenheit oszilliert. Die Ordnung nach der Zeit scheint ihm zuallererst<br />
wichtig, dann auch die nach Orten und Landen. »Doch möchte ich selbst dies<br />
als eine untergeordnete Rücksicht ansehen, wenn es den geschwinderen Fort-<br />
Abgedruckt in Pertz 1855 (Bd. 6:2): lOlff (107), zitiert nach: Töllner 1994: 59
S MÜNUMILNTA GKRMANIAK<br />
lg des Werks, die Förderung des Drucks und der Ausgabe, nur im geringsten<br />
nmen könnte« . Vielmehr bedeutet die temralisierende<br />
Option ein Kunstmittel, durch das diachron eine deutsche Konuität<br />
als Effekt zu erzielen war, wohingegen die topographische Ordnung<br />
mer das widerspiegelt, was der <strong>Im</strong>puls der MGH zu transzendierten trach-<br />
: die landesgeschichtliche Partikularisierung, die sich institutionell in regioen<br />
Quellensammlungsunternehmen niederschlägt. Arndt plädiert im Sinne<br />
• geschichtsdidaktischen Machbarkeit und des nationalpatriotischen <strong>Im</strong>peras<br />
der Stiftung <strong>von</strong> Gedächtnis <strong>für</strong> den Vorrang des Diskurses über die Histoauch<br />
auf der Publikationsebene:<br />
»Wenn die gehörige Zahl Arbeiter beisammen sind und sich jeder sein Theil genommen<br />
hat <strong>von</strong> dem, was <strong>für</strong> die große Sammlung bestimmt ist, so könnte man allenfalls<br />
auch zuerst drucken, was zuerst fertig wäre; denn in unserer unruhigen Zeit,<br />
die eben ihrer Eile wegen so weniges zu Stande kommen läßt, heißt es wohl mehr<br />
als je: was du thun willst, thue geschwind. Der Unbequemlichkeit, die dadurch entstände,<br />
würde das Register abhelfen können; wer hier suchte, würde leicht finden<br />
und bald Bescheid lernen; anderen, als die einigermaaßen schon Finder sind,<br />
würde die Sammlung überhaupt wenig helfen.« <br />
r philologische Zirkelschluß einer an Historie (also Texten) orientierten Herneutik<br />
hegt darin, immer nur das Finden können, wonach schon gesucht<br />
rd; demgegenüber formuliert Theodor Mommsen später das Wort <strong>von</strong> der<br />
Draussetzungslosen Forschung«, die gerade »nicht das findet, was sie nach<br />
/eckerwägungen und Rücksichtsnahmen finden soll und finden möchte, was<br />
leren, außerhalb der Wissenschaft liegenden praktischen Zielen dient« (also<br />
vektoriell-illustrative Dokumente eingelesen wird), sondern »was logisch<br />
d historisch dem gewissenhaften Forscher als das Richtige erscheint, in einem<br />
>rt zusammengefaßt: die Wahrhaftigkeit.« 75 So wird eine Wissenschaftsme-<br />
>de selbst zum ethischen Monument. Die Transparenz des historiographilen<br />
Diskurses wird dabei auf die Objektebene verlegt, die Edition <strong>von</strong><br />
Schichtsschreibern des Mittelalters zwischen Subjekt und Objekt der Histo-<br />
: »Denn eben so sehr als um die Nachrichten ist es uns um den Geist und<br />
in des Zeitalters und Schriftstellers zu thun, welches und in welchem dargellt<br />
ist: wir wollen, indem wir uns unterrichten, auch ein ganzes und volles<br />
d des Darstellers und Erzählers haben« .<br />
Michel Foucault hat seine Methode, der Vergangenheit Aussagen abzurin-<br />
I, wissensarchäologisch beschrieben: »Man muß bis auf den Grund der Mine<br />
mrfen; das braucht Zeit, und es kostet Mühe.« 76 In seiner <strong>Geschichte</strong> des Kan-<br />
'itiert nach: Horst Fuhrmann, Einladung ins Mittelalter, München (Beck) 1987, 233<br />
nterview mit Didier Enbon in: Liberation v. 21. Januar 1983, zitiert <strong>von</strong> Eribon in<br />
einer Biographie: Michel Foucault, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1993, 393
VORGESCHICHTEN DER MONUMENTA 117<br />
tons St. Gallen hat der Archivar des gleichnamigen Stifts - Nachfolger also jenes<br />
Hepidanus, mit dessen Sangallenser Annalen die Scriptores der MGH 1826 einsetzen<br />
- um 1830 seine Forschungstätigkeit in eine analoge geo-archäologische<br />
Metapher gekleidet:<br />
»Jedermann kennt die Verrichtungen, durch die man aus den Eingeweiden der<br />
Erde die Metalle erhält. Die Bergmänner steigen in die unterirdischen Klüften<br />
hinab, hauen dort <strong>von</strong> den Felsen die Stuffen los, zermalmen sie in Pochwerken<br />
zu Staube, sondern mit Schwemmen die Metallkörner <strong>von</strong> dem Sande ab, schmelzen<br />
dieselben in Oefen zusammen, und übergeben die gewonnen Massen<br />
<strong>von</strong> Gold, Silber, Kupfer &c. den Künstlern, den Handwerkern zu vielfachem<br />
Gebrauche.« 77<br />
Und das heißt Datenverarbeitung digital: das Einlesen <strong>von</strong> Daten in bits, die dann<br />
diskret weiterverarbeitet werden können. Auf ähnliche Weise kam auch <strong>von</strong> Arx'<br />
<strong>Geschichte</strong> zustande: er »nahm in dunkeln Archiv-Gewölbern seinen Aufenthalt,<br />
zog dort aus langen Reihen geschriebener alter Bücher, und aus vielen Kisten<br />
pergamentener Urkunden das, was ihm zur <strong>Geschichte</strong> dienen konnte, heraus,<br />
reinigte es <strong>von</strong> den diplomatischen Formeln« - also <strong>von</strong> genau jenen<br />
parerga, welche die Infrastruktur der Wissensadministration markieren -, »ordnete<br />
die vielen kleinen auf solche Weise gewonnenen historischen Notizen« -<br />
Module - »in ein Ganzes zusammen, so wie die Alten ihre Mosaik-Bilder verfertigten<br />
und übergiebt es da dem Publicum als eine <strong>Geschichte</strong>.« Wissensarchäologische<br />
Metaphern <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> 78 brauchen also nicht nachträglich<br />
gefunden zu werden: in ihren Quellentexten selbst sind sie schon konkret<br />
benannt. Von Arx' <strong>Geschichte</strong> ist demzufolge »nichts andres als die Erzählung,<br />
welche ein Archivar seinen Mitbürgern <strong>von</strong> dem macht, was er in alten Handschriften,<br />
und Archiven Merkwürdiges gefunden hat«. Dabei geht er vom Stift<br />
St. Gallen »als dem Mittelpunkt der Geschäfte« (Grundlage <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> - ihr<br />
vorgeschaltet - ist die Kanzlei), »dem beständigen Sitze der Regierung, und der<br />
reichhaltigen Quelle der vaterländischen <strong>Geschichte</strong>« aus; diese Erzählung ist<br />
gleichzeitig eine Metonymie Deutschlands: »Auf seinem Wandeln durch die Vorwelt<br />
hat er wahrgenommen, daß die St. Gallische <strong>Geschichte</strong><br />
viele Jahrhunderte hindurch im Kleinen die <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> Deutschland, ja oft<br />
die <strong>von</strong> ganz Europa darstelle« . Seine Darstellung »knüpft an den<br />
Faden seiner Begebenheiten, der durch zwölfhundert Jahre ununterbrochen fortläuft,<br />
die Kunden an«; die Kontinuität <strong>von</strong> Historie ist ein Effekt des Fortdauerns<br />
<strong>von</strong> Archiven als Überlieferung. »Auch webt er fast die ganze <strong>Geschichte</strong><br />
77 Ildefons <strong>von</strong> Arx, <strong>Geschichte</strong> des Kantons St. Gallen, Bd. 1, Vorrede, vii-x (Nachdruck<br />
der Ausgabe <strong>von</strong> 1810-13 / 1830), hg. Stiftsarchiv St. Gallen, St. Gallen 1987<br />
78 Siehe Alexander Demandt, Metaphern <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong>. Sprachbilder und Gleichnisse<br />
im historisch-politischen Denken, München (Beck) 1978
118 MoNUMKNTA GKRMANIAE<br />
des Kantons Appenzell in seine Erzählung ein« -Accounts to reconcile; Anecdotes<br />
topick up, Inscriptions to make out; Stories to weave in; Traditions to sift; Personages<br />
to call upon; Panegyricks topaste up at this door (Laurence Sterne) 79 : eine<br />
textile Metapher also, die nicht erst in poststrukturaler Intertextualitätstheorie,<br />
d. h. nachträglich gefunden werden muß. Von Arx will ausdrücklich »als ein<br />
Archivar, das ist diplomatisch-richtig schreiben«; darum nimmt er nichts in diese<br />
<strong>Geschichte</strong> auf, was er nicht entweder in gleichzeitigen, oder wenigstens in alten<br />
Handschriften, oder Urkunden gelesen hatte« . Hier schreibt sich ein<br />
medizinisch-archäologisches Autopsie-Paradigma, das seit J. J. Winckelmanns<br />
Antikenbeschreibungen die historische Ästhetik flankiert.<br />
»Er trieb in diesem seine Gewissenhaftigkeit so weit, daß er, Urkunden-Sammlungen<br />
ausgenommen, nie einem gedruckten Buche etwas nachschrieb, und immer<br />
zum Beweise dessen, was er erzählt, seinen Gewährsmann nennt. Um diesem Vorsatze,<br />
so viel möglich, getreu zu bleiben, entsagte er dem Vergnügen, seine Erzählung<br />
mit Betrachtungen, Rückblicken, Vergleichungen, Anspielungen &c. zu<br />
würzen, und ist zufrieden, die Aufmerksamkeit des Lesers durch das bloße<br />
Zusammenstellen der Thatsachen in Anspruch zu nehmen.« <br />
Ein archivalisch-räumliches Gedächtnisparadigma (als Gestell) entsagt hier, forschungs-<br />
und datenorientiert, der literarischen Darstellungsästhetik. Der das hier<br />
unterstreicht weiß, wo<strong>von</strong> die Rede ist: Als Korrespondent der MGH edierte er<br />
in Band 1 der Reihe Scriptores die Annales Sangallenses, in Band 2 die Scriptores<br />
rerum Sangallensium. 80 Eine solche Datenverarbeitung ist unmittelbar an<br />
Gedächtnisprothesen gekoppelt; ein Gemälde <strong>von</strong> 1820 im Gemeinderatssaal<br />
Ölten zeigt Ildefons <strong>von</strong> Arx, 71jährig, flankiert <strong>von</strong> den Schubregistern eines<br />
Katalogs. Hirn und Augen sind fixiert auf die Apparatur des Gedächtnisses.<br />
Zitiert in: Robert K. Merton, On the Shoulders of Giants - A Shandean PostScript<br />
(1965), dt. Frankfurt/M. 1980. Siehe, demgegenüber, die Leerstellen-Interpretation<br />
<strong>von</strong> Henry James' Novelle: The Figure in the Carpet (1896), in: Wolfgang Iser, Der<br />
Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München (Fink) 1976, 12; Iser betont<br />
die Differenz <strong>von</strong> Bild und Diskursivität (21)<br />
Hannover 1826, 63-85 u. Hannover 1829, 1-183
Kristallisation der MGH<br />
Archiv, monumenta, documenta<br />
KRISTALLISATION DER MHG 119<br />
Der badische Legationsrat J. Lambert Büchler als Sekretär und der Archivrat<br />
Carl Georg Dümge als Redakteur beginnen die Herausgabe des Publikationsorgans<br />
der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche <strong>Geschichte</strong> als Archiv; es »führt mit<br />
Recht diesen <strong>Namen</strong>, weil darin alle Vorarbeiten <strong>für</strong> das große Unternehmen,<br />
Nachrichten über Handschriften, Untersuchungen über die einzelnen Quellenschriften,<br />
niedergelegt wurden« 1 , ist damit also nicht gedächtnisemphatisch,<br />
sondern als Arbeitsspeicher definiert. Anfragen <strong>für</strong> »eine gründliche <strong>Geschichte</strong><br />
des deutschen Vaterlandes« weist die Redaktion 1820 zurück: Nicht die Narration<br />
Deutschlands, sondern die Sammlung <strong>von</strong> entsprechenden Quellenschriften<br />
ist Ziel der MGH 2 , deren Planung mühsam ihre Struktur findet. Inventio<br />
und Inventar der deutschen Historie: Das Archiv wird zunächst ein Medium<br />
der Findung dessen, was überhaupt gesucht werden soll. »Während man sich<br />
zu orientieren suchte, fing man erst an, den Umfang der Arbeit zu übersehen,<br />
die Masse des Stoffes, die Schwierigkeit ihn zu bearbeiten, namentlich wegen<br />
der in so vielen Bibliotheken und Archiven zerstreuten Handschriften und<br />
Urkunden, welche sich viel zahlreicher erwiesen, als man anfänglich geglaubt<br />
hatte« . Nach dem ursprünglichen Plan verteilt man die<br />
einzelnen Quellenschriftsteller auf verschiedene Gelehrte zur Bearbeitung, aber<br />
es zeigt sich bald, daß auf diese Weise »weder Einheit noch Plan und Methode«<br />
zu erreichen ist . Erst mit dem Eintritt <strong>von</strong> G. H. Pertz in das Unternehmen<br />
kommt die Edition zu ihrer Form, indem sie fortan <strong>von</strong> Autoren auf<br />
Sachen, <strong>von</strong> Menschen auf Register umschaltet 3 ; abgesetzt <strong>von</strong>einander »tam<br />
Annalium quam Monumentorum Germaniae edendorum munus mihi<br />
1 Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des<br />
dreizehnten Jahrhunderts, 2 Bde, 3. umgearbeitete Auflage, Berlin (Wilhelm Hertz)<br />
1873, Bd. 1:15. Diese Textgrundlage manifestiert zugleich den Abgrund, die Verlorenheit<br />
<strong>von</strong> Geschichtsforschung. Die Story führt zurück in das Jahr 1995, als der<br />
Autor nachts im kafkaesken Gebäude der Geisteswissenschaften der ehemaligen Akademie<br />
der Wissenschaften der DDR, Prenzlauer Promenade 149-152, Berlin, eingeschlossen<br />
wurde. Allein die Suche nach einem Fluchtfenster führte in die subterranen<br />
Stauräume der dort noch verbliebenen Bibliotheken. Was ins Auge fällt, sind Buchrücken,<br />
die antiquarische Atmosphäre ausatmen: der Wattenbach etwa.<br />
2 Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, hg. v. J. Lambert Büchler /<br />
Carl Georg Dümge, 1. Bd., Frankfurt/M. 1820, »Vorerinnerung« der Redaktion, iv<br />
3 C. Grau, G. H. Pertz (1795-1876) als Wissenschaftsorganisator, in: Fortschritt und<br />
Reaktion im Geschichtsdenken der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hg. v. H.<br />
Schleier, 1988
120 MoNUMHNTA GhRMANIAK •<br />
impositum est« . Die dritte Meldung der Miszellen im Archiv<br />
<strong>von</strong> 1820 etwa bringt »Nachrichten über die Erhaltung der vorzüglichen Denkmale«<br />
des Doms zu Goßlar; noch betreffen die MGH also auch Monumente im<br />
Sinne des archäologischen Gegenstands. Die Nachricht »zeigt den Ungrund<br />
eines Gerüchtes, welches den nahen Untergang der uralten Domkirche zu<br />
Goßlar und der dann befindlichen Monumente« be<strong>für</strong>chten läßt . L. F. Höfer scheidet 1833/34 mittelalterliche Quellen in die Gruppe der<br />
(relativ klar definierten) Urkunden und in die Menge »heterogener Quellen, <strong>für</strong><br />
welche hier die sehr allgemeine Benennung >I lustonsche Denkmäler< gewählt<br />
ist.« 4 Eine Anzeige des Schlestscben Vereins zur Unterstützung der Herausgabe<br />
einer Sammlung altdeutscher Denkmale der <strong>Geschichte</strong> und Kunst weist auf den<br />
Reichtum des Landes an »Gcschichts- und Kunst-Denkmalen der Vorzeit,<br />
namentlich des Mittel-Alters« hin, sodann auf die Urkundensammlung im Landesarchiv<br />
Breslau, den Reichtum der Kunstvorzeit sowie die »Denkmale des<br />
höchsten Alterthums vor der christlichen Zeit«. Auch wird auf gleichzeitige<br />
Inventarisierungs- und Editionsbestrebungen der Nachbarländer hingewiesen,<br />
»<strong>von</strong> gleichem durch die Zeit herbeigeführtem Geiste angeregt« - Zeitgeist, an anderes Wort <strong>für</strong> episteme.<br />
In seinem Traktat Von nützlicher Einrichtung eines Archivi (1680) lokalisiert<br />
Gottfried Wilhlem Leibniz ebendort monumental Die Monumenta der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche <strong>Geschichte</strong> verkünden die Metonymie des Eigennamens<br />
ihres Initiators, der in Berlin tatsächlich Denkmal geworden ist und dort<br />
exemplarisch die Monumenta als Buchobjekt zur Schau trägt. Bis 1870 auf dem<br />
ehamligen Dönhoffplatz stehend, bleibt die <strong>von</strong> Hermann Schievelbein geschaffene<br />
Bronzefigur dann gegenüber dem damaligen Zeughaus aufgestellt. Topo-<br />
Korrespondenzen: »Es hat damit einen Standort erhalten, der der Person des<br />
Freiherrn entspricht« (Wolfgang Fritz). Vier Eckfiguren meinen Steins Charaktereigenschaften<br />
zu symbolisieren: Vaterlandsliebe, unbeugsame Willenskraft,<br />
Frömmigkeit und Wahrheitsliebe. Die mit dem Rcichskleinod der deutschen<br />
Kaiserkrone gekrönte Figur (Vaterlandsliebe) hält im Arm ein großes Buch mit<br />
der Aufschrift Monumenta Germaniae und allegorisiert damit nicht allein den<br />
L. F. Höfer, Historische Denkmäler. Vorermneruni;, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkundc,<br />
Diploimtik und Geschiclne, hg. dems., I I. A. Krliard u. 1.. 15. v. Medcin, Bei. I (1833/<br />
34), Hamburg (Perthes) 1834, 338-351 (338f)<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz, Von nützlicher Einrichtung eines Archivi [Mai bis Juni<br />
1680], in: ders., Politische Schriften, hg. v. Zentralmstitut f. Philosophie an der Akademie<br />
d. Wissenschaften der DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie-Verlag)<br />
1986, 332-340 (337). Zur Begriffsgeschichte des Monuments s. a. die Einleitung <strong>von</strong><br />
Horst Bredekamp zu: Ferdinand Piper, Einleitung in die Monumentale Theologie,<br />
Gotha 1867, Nachdruck Mittcnwald (Mäander) 1978
KRISTALLISATION I>LR MHG 121<br />
Sinnspruch der MGH (sanctus amor patnae), sondern setzt diese Edition deutscher<br />
Geschichtsqucllen des Mittelalters so in Relation zu musealen Monumenten<br />
- die implizite Korrespondenz, das Andere der Druckbuchstaben; vier<br />
große Reliefplatten weisen in allegorischen Darstellungen auf die Befreiungskriege<br />
gegen Napoleon, während der umlaufende Fries »in mehr realistischer<br />
Weise« und ausdrücklich betitelt die spezifischen Verdienste und Aktivitäten des<br />
Freiherrn aufzeigt: Preussens Verwaltung 1807 und 1809 etwa (in Leserichtung<br />
des MGH-Bandes), ein Bild, das seiner Natur nach in der Tat der buchstäblichen<br />
Legende bedarf, da sich die Reform <strong>von</strong> Administration nur unsinnlich<br />
veranschaulichen läßt, sich dem Regime der Allegorien gerade entzieht. 6 Die realistischere<br />
Darstellungsform <strong>für</strong> die Infrastrukturierung Preußens durch den<br />
Minister Freiherrn vom Stein ist in der Tat der angemessenere Verweis.<br />
Die Kopplung <strong>von</strong> Monument und Historie im Begriff der MGH stellt ein<br />
Oxymoron dar. Sie erfolgt in einer Zeit, als das Schriftstück sich die Objektwelt<br />
unterwirft; <strong>für</strong> die Epoche des Positivismus gilt die Gleichung Dokument = Text.<br />
»A questa stona fondata su documenti ehe s'impongono da se, Fustel de Coulanges<br />
contrappone lo spinto e la reahzzazione della stona erudita tedesca; spirito<br />
e reahzzazione ehe sono espresse ad esempio nei >Monumenta Germaniae<br />
histonca< . Si puö allora parlare del tnonfo del documento sul monumento.« 7<br />
Als 1759 in Frankreich der oberste Kontrolleur der Finanzen Silhouette ein<br />
Generaldepot des öffentlichen Rechts und der Historie einzurichten beschließt,<br />
aus dem später das Cabinet des Charles erwächst, ernennt er den Rechtsanwalt<br />
und Publizisten Jacob-Nicholas Moreau zum Direktor, der <strong>von</strong> Rechtsmonumenten<br />
spricht; Silhouettes Nachfolger Bertin schreibt an Ludwig XVI., daß die<br />
<strong>Geschichte</strong> und das öffentliche Recht einer Nation auf ihren Monumenten beruht<br />
. Semantische Inferenzen <strong>von</strong> Dokument und Monument<br />
verschränken deren Definition: »II termine >monumenti< verrä ancora usato<br />
correntemente nel secolo XIX per le grandi collezioni di documenti« .<br />
Diese (Rück-)Ubertragungen dekonstruieren jede stabile Unterscheidung beider<br />
Datenaggregatzustände <strong>von</strong> Zeitspuren. Für die Monumenta Germaniae Historien<br />
unterscheidet Jens Kuhlenkampff zwischen dem Sammeln und Edieren als<br />
Akt des Andenkens und Bewahrens und dem Charakter des Gespeicherten: »So<br />
handelt es sich bei den gesammelten Stücken eben gerade nicht um gestiftete<br />
Erinnerungszeichen, sondern um Dokumente und Zeugnisse, die aufgrund ihrer<br />
Wolfgang D. Fritz, Die Errichtung des Berliner Stein-DunkmaU. in: S<br />
der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1 G/1982, 151<br />
Jacques Le Goff, Stona c memoria, Turin (Einaudi) 1982, Kapitel III »Documento /<br />
monumento«, 443-455 (444), unter Bezug auf das 1. Kapitel in: Fustel de Coulanges,<br />
La monarchie franque (1888). Die deutsche Übersetzung <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis<br />
(Frankfurt/M. u. a.: Campus 1992) sieht dieses Kapitel nicht vor.
122 MoNUMKNTA GhRMANIAK<br />
Herkunft und aufgrund der Eigenschaften, die sie infolgedessen besitzen, Hypothesen<br />
darüber, >wie es gewesen istMonumenta Germaniae medii aevi', sodann<br />
taucht die Variation auf >Monumenta Germaniae medii aevi Historica'. Dies<br />
erschien zu lang, und so einigte man sich auf die resolute Form >Monumenta Ger-<br />
8 Jens Kuhlenkampff, Notiz über die Begriffe »Monument« und »Lebenswelt«, in: Aleida<br />
Assmann / Dietrich Harth (Hg.), Kultur als Lebenswelt und Monument, Frankfurt/M.<br />
(Fischer) 1991, 26-33 (27)<br />
9 Siehe Norbert Wibiral, Ausgewählte Beispiele des Wortgebrauchs <strong>von</strong> »Monumentum«<br />
und »Denkmal« bis Winckelmann, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong> Kunst und<br />
Denkmalpflege, Wien 1952, 93-98 (93)<br />
10 Hans-Jürgen Pandel, Die Daten und die Fakten. Zur Quellenkritik in der Aufklärung,<br />
in: Horst Walter Blanke /Jörn Rüscn (Hg.), Von der Aufklärung zum Historismus.<br />
Zum Strukturwandel des historischen Denkens, Paderborn/ München/Wien/<br />
Zürich (Schöningh) 1984, 187, unter Bezug auf Karl Ludwig Woltmann, Von der<br />
historischen Arbeit und vom Urteil über dieselbe, in: <strong>Geschichte</strong> und Politik 5 (1804),<br />
Bd. 2, 225-76<br />
" Pierre Claude Francois Daunou, Cours d'Etudes histonques, hg. v. Alphonsc Honorc<br />
Taillandier, Deheque u. a., Paris (20 Bde) 1842-49, Bd. 1, 60; Daunou subsumiert die<br />
Diplomatik unter die Disziplin der Archäologie selbst (62).
KRISTALLISATION DLR MHG ' 123<br />
mamae Historica'. Mit diesem Titel ist der erste Band der Scnptores mit den Chroniken<br />
und Annalen der Merowingerzeit 1826 erschienen.«'-<br />
<strong>Im</strong> Juli 1824 heißt es in einem Vertragsentwurf der Institutsdirektion der Gesellschaft<br />
mit dem Hofbuchhändler Hahn in Hannover noch Monumenta Germaniae<br />
historica medü aevi; in einer Verlagsanzeige heißt es dann Mon. historica<br />
Germaniae . u Dümge schrieb am 31. Mai 1819 in einer Marginalie <strong>von</strong> einer<br />
Collectio monumentor« . Schließlich wird der Freiherr vom<br />
Stein am 4. März 1825 <strong>von</strong> Pertz als typographische Aussage zitiert: »Ich würde<br />
den Titel >Monumenta Germaniae historica / inde a. a. Chr. 500-1500< wählen«<br />
.<br />
Die Fragmentank des Archivs und das Fraktale der Archäologie wehren des<br />
Unwahren, welches im <strong>Namen</strong> des Ganzen auftritt. Band 1 der MGH (Scnptores)<br />
erzählt - abgesehen vom patriotischen Vorwort, das als Editorial <strong>von</strong> der<br />
Textdatenbank getrennt gehalten ist - keine <strong>Geschichte</strong>(n), sondern listet Annalen<br />
auf, eine Serie <strong>von</strong> Information statt Historie: ein knapper, auf die Deutung<br />
geographischer <strong>Namen</strong> ausgerichteter Sachkommentar und ein kritischer Apparat,<br />
ein <strong>Namen</strong>sregister und ein Glossar beschließen diesen Band, der selbst ein<br />
Folio-Monument des Buchdrucks darstellt. Solch eine kontextuelle Aggregation<br />
<strong>von</strong> Dokumenten und ihres kritisch-philologischen Beiwerks »contains a<br />
set of (computer readable and therefore retnevable) >descnptors< and of (nonmachine-readable<br />
and therefore non-retnevable) commentaries.« 14 <strong>Im</strong> Falle der<br />
Monumenta Germaniae Historica verstellt die Frage der <strong>Namen</strong>sbenennung<br />
und der Objekte (Quellentexte) den eigentlichen Akt der diskursiven Monumentahsierung,<br />
die im Projekt der Semiose <strong>von</strong> Daten im Archiv zur MGH-<br />
Edition geschieht - Geschichtskontrolle durch Zugriff und Standardisierung.<br />
Bereits die Loslösung der (handschriftlich noch buchstäblich diskursiven)<br />
Manuskripte <strong>von</strong> ihrer archivalischen Signatur, d. h. ihre universale Zitierbarkeit<br />
als Bestandteil der Edition der MGH übersetzt das Reich der Gedächtnisverwaltung<br />
in die typographische Voraussetzung <strong>von</strong> Historie als Universalgeschichte<br />
(in die Galaxis Gutenbergs oder <strong>von</strong> Microsoft). Das Archiv als<br />
Gedächtnisprothese ist nicht schlicht eine Technik, um den archivierbaren Gehalt<br />
einer Vergangenheit passiv zu speichern, welcher ohnedies besteht; »the<br />
12<br />
Freundlicher Hinweis <strong>von</strong> Horst Fuhrmann, ehem. Präsident der MGH, Brief v. 20.<br />
Dezember 1993<br />
13<br />
Archiv der MGH München, Nr. 72 (Abschrift <strong>von</strong>: Archiv der Akademie der Wissenschaften<br />
Berlin, Rep. 338, Tit. 4)<br />
14<br />
Michael Eisner, ARBOR. Eine Sprache zur Beschreibung und ein Programmpaket zur<br />
Verarbeitung hierarchischer Datenobjekte der klassischen Archäologie und Kunstgeschichte,<br />
Sankt Augustm (Gesellschaft <strong>für</strong> Mathematik und Datenverarbeitung)<br />
1989, 9 u. 1
124 MONUMI-NTA GHRMANIAK<br />
technical structure of the >archiving< archivc also detennines the structure ol the<br />
>archivable< content in lts very emergence and in lts relation to the future. Archivation<br />
produces as much as it records the event.« 15 Die karolingischen Annalen<br />
etwa sind - falls nicht exemplarisch im Faksimile wiedergegeben - so publiziert,<br />
daß die Marginalien zu Osterterminen isoliert zum alleinigen Gegenstand der<br />
Darstellung werden. Diese editorische Isolierung (Historie als Extrakt <strong>von</strong><br />
Tabellen) koinzidiert mit der genealogischen Tendenz ihres Gegenstands, dem<br />
Vektor des Übertragungsprozesses in der monastischen Tradition der Annalen:<br />
»Mit den Ostcrtafcln selbst wurden nun auch die Randbemerkungen abgeschrieben,<br />
und gingen so <strong>von</strong> einem Kloster ins andere über; bald fing man an darauf<br />
Werth zu legen, schrieb die noch ganz kurzen und mageren, völlig formlosen Annalen<br />
auch abgesondert ab, setzte sie fort, verband sie mit anderen, und machte<br />
sich endlich auch an die Arbeit, die dürftige Kunde über die frühere Vorzeit durch<br />
Benutzung anderer Quellen, aus Schriftstellern aller Art, aus der Sage und gelehrter<br />
Berechnung zu ergänzen.« <br />
Erst dann ist Zeitverlauf als Erzählung schrcibbar. Parerga falten sich so zu<br />
Historie, umgekehrt proportional zum Editionsprinzip des Apparats: »Von gelehrtem<br />
Beiwerk sollte nur gegeben werden, was diesem Charakter entsprach,<br />
die notwendigsten Anmerkungen und Einleitung«; dabei »ward bewußt auf<br />
jeden gelehrten Prunk <strong>von</strong> Anfang an verzichtet« .<br />
Der Titel der Monumenta bedeutet eine metonymische Verschiebung ihrer<br />
<strong>Im</strong>plikation. Johann Friedrich Böhmer unterstreicht in der Vorrede zu Bd. 1 der<br />
<strong>von</strong> ihm herausgegebenen Regesta <strong>Im</strong>perü 1833, daß »das aus den Urquellen<br />
hervortretende Bild dessen, was unser Vaterland gewesen ist, nun zur Belehrung<br />
oder - zum Andenken« diene - munumenia in ihrer gedächtnisstiftenden Funktion.<br />
16 Nicht die Objekte, sondern die methodischen Editionsprinzipien sind<br />
also das deutsche Gedächtnismonument; diese »die Beherrschung des ausgebreitetesten<br />
handschriftlichen Stoffes fordernde Verfahren« (Hermeneutik, so<br />
Nietzsche, ist der Wille zur Macht über Text 17 ), unterscheidet sich <strong>von</strong> allem,<br />
13<br />
Jacques Derrida, Archive Fcver. Freudian <strong>Im</strong>pression, in: Diacntics 25, Heft 2 (1995),<br />
9-63 (17)<br />
16<br />
Johann Friedrich Böhmer, Regesta <strong>Im</strong>pern, Bd. 1: Die Regesten des Kaiserreichs unter<br />
den Karolingern 751-918, hg. <strong>von</strong> der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,<br />
neubearbeitet v. Engelbert Mühlbacher u. vollendet v. Johann Fechner, Hildesheim<br />
(Olms) 1966, xix. Nicht zu verwechseln mit dem »in dem deutschen Rcichsarchiv dereinst<br />
vorhanden gewesenen Registrum <strong>Im</strong>perü, d. h. derjenigen Bücher, welche sämmtliche<br />
Urkunden und Ausschreiben der Regenten nach der Zeitfolge der Ausfertigung<br />
enthielten«: ders., Die Urkunden der Römischen Könige und Kaiser <strong>von</strong> Conrad I. bis<br />
Heinrich VII. 911-1313, Frankfurt/M. (Varrcntrapp) 1831, viii<br />
17<br />
Siehe auch Hugo Andres Krüss, Die Beherrschung des Wissens, in: Nachrichten <strong>für</strong><br />
Dokumentation Jg. 18 / 1967, Heft 5, 153-155
KRISTALLISATION OHR MHG 125<br />
was hei früheren Werken solcher An und <strong>von</strong> Philologen hervorgebracht<br />
worden ist und »ertheilte der Deutschen Arbeit« (mit kapitaler Letter) »ihren<br />
bestimmten Charakter und sicherte ihr einen Werth <strong>für</strong> alle Zeiten« - monumentum exegi aere perennius (Horaz). Demgegenüber ist an die<br />
Stelle der quellenkn tischen Emphase des 19. Jh. nach dem zweiten Weltkrieg<br />
die mentalitätsgschichthche Betrachtung frühmittelalterlicher Historiographie<br />
zu einem eigenständigen Gegenstand wissenschaftlichen Interesses aufgerückt. 18<br />
Der radikale Positivismus des 19. Jh. aber steht auch ästhetisch auf Seiten der<br />
Annalistik, ist ihr affin; er schaut und ediert - so das Beispiel der MGH SS Bd. 1<br />
- auf die frühesten Quellen nationaldeutscher Geschichtsschreibung als diskrete<br />
Monumente im Sinne der Pariser Historikergruppe Annales (und Foucaults),<br />
nicht - wie die Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert - als Dokumente<br />
eines jenseitigeren Sinns: des Geschichtsdenkens im Mittelalter. »Man hat in vielen<br />
Anläufen und unter immer neuen Aspekten Chroniken, Annalen, Viten usw.<br />
als Erscheinungen mittelalterlichen Geschichtsdenkens betrachtet und sie damit<br />
einem ihrem Wesen entsprechenden Licht ausgesetzt« - oder<br />
gerade versetzt, da dies etwa das Handwerklich-Technische, also das spezifisch<br />
Unhistoriographische der Annalistik vernachlässigt, womit also über ihren Wert<br />
nicht alles gesagt ist. »Eine solche Vernachlässigung konnte zu der Kluft führen,<br />
die zwischen der großen quellenkritischen Arbeit der Ära Pertz und Holder-<br />
Egger und ihrer Nachfahren auf der einen und der Erforschung mittelalterlichen<br />
Geschichtsdenkens aus der anderen Seite heute hegt« . Nicht <strong>von</strong><br />
ungefähr geschah die Wiederaufnahme des Genres der Jahrbücher im 19. Jh.,<br />
wie es im Vorwort der Jahrbücher der deutschen <strong>Geschichte</strong> als Einleitung zur<br />
<strong>Geschichte</strong> des fränkischen Reichs unter den Karolingern manifest wird. Die<br />
»Anwendung der strengen Form, welche Jahrbücher sonst fordern«, traf hier<br />
auf Schwierigkeiten:<br />
»Denn es war hier ein äußerst dürftiges, lückenhaftes Material zu verarbeiten, welches<br />
durchaus kein stetiges Fortschreiten <strong>von</strong> Jahr zu Jahr, sondern unter mehr<br />
sprungweisem Vorgehen höchstens ein jeweiliges Innehalten bei einem hervorragenden<br />
Ereignis oder einer namhaften Persönlichkeit gestattete, an welche sich<br />
dann eine oder die andere Jahreszahl hin und wieder anheften ließ. Je weniger<br />
indes die strenge Form der Jahrbücher gewahrt werden konnte, um so mehr bot<br />
sich Gelegenheit, der hauptsächlichsten Aufgabe derselben gerecht zu werden, und<br />
eine unnachsichtige Kritik sowohl der Quellen als auch der Bearbeitungen dieses<br />
Theils der <strong>Geschichte</strong> zu üben.« 19<br />
ls Helmut Beumann, Vorwort, in: Hans Patze (Hg.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein<br />
im späten Mittelalter, Sigmaringen (Thorbecke) 1987, 7; s. a. Hans-<br />
Werner Goetz, Geschichtsschreibung und Gcschichtsbewußtsein im hohen Mittelalter,<br />
Berlin (Akademie) 1999<br />
19 Jahrbücher der Deutschen <strong>Geschichte</strong>, Bd. 1: Die Anfänge des karohngischen Hau-
126 MONUMHNTA GhRMANIAU<br />
Der wissensarchäologische Wille zur diskreten Quellenkritik also (etwa der<br />
Annalen <strong>von</strong> Metz) dominiert über den Hang zur Narration (an der diskursiven<br />
Oberfläche des Historismus). Für den Fortsetzungsband gilt dann jedoch<br />
schon ansatzweise die annalistischc Askese der diskreten Datendifferenz:<br />
»Es war möglich, der Aufgabe, welche <strong>für</strong> die Jahrbücher des deutschen Reiches<br />
gestellt ist, die Thatsachen den Jahren nach genau zu trennen, mehr als bei der<br />
<strong>Geschichte</strong> der ersten Pippmiden zu genügen. Nur widerstrebend zwar fügt sich<br />
die gewaltige Gestalt Karl Manells in diese Zerlegung ihrer Thätigkeit; doch es<br />
entspricht die annalistische Darstellung der ursprünglichen Aufzeichnungsweise<br />
der Ereignisse in jener Zeit und unterstützt die kritische Untersuchung des dürftigen<br />
Materials.« 20<br />
Die Jahrbücher stehen hier also ihrem historischen als histonographischem<br />
Gegenstand nahe, schreiben <strong>Geschichte</strong> also archivnah, transitiv als Form<br />
gegenüber ihrer medialen Vorlage - im Kampf gegen die Fiktionen des Faktischen,<br />
gegenüber den poetischen VeHührungen der historischen <strong>Im</strong>agination<br />
(im Sinne Whites): »Je dürftiger das geschichtliche Material ist, desto mehr ladet<br />
es zu künstlicher Combination ein, um den Personen und Thatsachen eine<br />
kunstvolle Gestaltung zu geben; doch dieser verführerische Weg liegt / der Aufgabe<br />
der Jahrbücher fern, und der Verfasser des vorliegenden Bandes zieht es<br />
vor, die <strong>Geschichte</strong> der Jahre 714-741 nach möglichst gesicherten Grundlagen<br />
einfach zu erzählen« .<br />
Vor dem Hintergrund dieser wissensarchäologischen Ästhetik des Positivismus<br />
im 19. Jh. liest sich die Praxis frühmittelalterlicher Annalistik und ihrer<br />
modernen Edition in Form <strong>von</strong> Regesten gleichsam als Schreibmaschine, als ecriture<br />
automaüque. Wenn Böhmer - so Droysen - die Regesten als »das Höchste<br />
der Geschichtsschreibung« bezeichnet und Ranke sein »Selbst auslöschen können<br />
möchte«, müsse ein »nicht ganz Bornierter« merken,<br />
...«daß er auf diesem Wege dazu kommt, allerdings ein Vakuum, eine Rechenmaschine<br />
zu werden, geschickt genug, mit Addieren und Subtrahieren <strong>von</strong> Zitaten ein<br />
objektives Resultat herauszubringen, das <strong>von</strong> dem ernst Geschehenen, <strong>von</strong> dem,<br />
was die Menschen getan, gewollt und gelitten haben, ungefähr so eine Vorstellung<br />
oder Anschauung gibt, wie der am andern Morgen nach der fröhlichen Hochzeit<br />
aus dem Speise- und Tanzzimmer ausgekehrte Schmutz und Müll <strong>von</strong> dem Fröhlichen<br />
und Bunten, was da tags zuvor die Menschen erfüllt und erfreut hat« 21<br />
ses, <strong>von</strong> Heinrich Eduard Bonneil, Berlin (l)uncker & Humblot) 1975 (Neudruck der<br />
Auflage 1866), vn<br />
20 Theodor Breysig, Jahrbücher des frankischen Reiches 714-741, Leipzig (Duncker &<br />
I lumbloi) 1 869 - Jahrbücher der 1 )euischen (ieschichte Bd. 1 a, vn<br />
21 Johann Gustav Droysen, paraphrasiert nach: Fritz Ernst, Zeitgeschehen und<br />
Geschichtsschreibung, in: ders., Gesammelte Schriften, Heidelberg (Hermes) 1985,<br />
289-341 (318)
KRISTALLISATION DIR MHG 127<br />
- tatsächlich eine archäologische Lage. Vor dem Hintergrund der an der MGH-<br />
Arbeit geschulten Praxis <strong>von</strong> Geschichtsforschung übertrug sich diese Datenverarbeitungsästhetik<br />
auf Generationen deutscher Historiker, etwa Friedrich<br />
Meinecke. 22 In einer Denkschrift an den Reichsminister des Innern vom 30.<br />
November 1922 unterstreicht Paul Kehr, daß die Monumenta nicht nur eine Editionsstelle,<br />
sondern »die hohe Schule unseres verbesserten gelehrten Nachwuchses«<br />
ist. 23 Das Resultat sind Quelldatenbänke <strong>für</strong> Lehre und Forschung, doch soll<br />
niemals vergessen werden, daß hier eine dritte Seite am Werk war, die das Material<br />
selektiert, transkribiert, übersetzt und ediert hat: »So often have we all used<br />
such publications that we can easily forget that they are not the real thing. Even<br />
with a scrupulously aecurate editor, therc are features of the original which are<br />
not reproducible: most obviously we loose the docuinent as an archaeological<br />
artifact.« 24 Vergangenheitsdarlegung in ihren zwei Aggregatzuständen als Anmerkungsteil<br />
und als Archiv »berichtet, wie es gewesen. Erzählung spielt eine Möglichkeit<br />
durch.« 25 Die Alternative heißt also Informatik statt <strong>Geschichte</strong>. So<br />
spricht auch Theodor Mommsen in seiner Denkschrift über den Plan des Corpus<br />
Inscriptionum Latinarum, verfaßt 1847 in Italien <strong>für</strong> die Preußische Akademie<br />
der Wissenschaften in Berlin, Klartext:<br />
»Zweck des C.I.L. ist, die sämmtlichen Inschriften in eine Sammlung zu vereinigen,<br />
sie in bequemer Ordnung zusammenzustellen, dieselben nach Ausscheiden<br />
der falschen Steine in einem möglichst aus den letzten zugänglichen Quellen genommenen<br />
Text mit Angabe erheblicher varietas lectionis kritisch genau wiederzugeben<br />
und durch genaue Indices den Gebrauch derselben zu erleichtern. Ein<br />
Kommentar ist wünschenswerth, nicht aber nothwendig.« 2 ''<br />
Tatsächlich ist die Epigraphie das, was zwischen <strong>Geschichte</strong> und Archäologie<br />
steht, vermittelnd und sich dazwischen schiebend, ganz nahe an der historischen<br />
Hilfswissenschaft der Diplomatik und der Paläographie. Mommsen fordert vom<br />
Bearbeiter nach Möglichkeit die kritische Autopsie des Befunds, »weil er sonst<br />
einen der Hauptvorzüge, den die Epigraphik vor der andern Literatur voraus<br />
hat, die unzweifelhafte, unanfechtbare Sicherheit des Textes, muthwilhg auf-<br />
22 Siehe Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 92, NL Meinecke Nr. 112, Kollegheft über<br />
die Vorlesung »Prof. Bresslau. Diplomatik. Berlin 5.5.1884«; Beilage am Ende: Heft<br />
»Prof. Menzel. Lateinische Paläographie des Mittelalters. Bonn W.S. 1883/84«<br />
23 Archiv MGH München, Findbuch »Akten Berlin: Centraldircktion der MGH«, Titel<br />
6 Nr. 189<br />
24 D. P. Dymond, Archaeology and History. A plea for reconciliation, London 1974, 55<br />
23 Alfred Andersch, Wintcrspelt. Roman (1974), Zürich (Diogenes) 1977, 22<br />
lu Abdruck in G. u. B. Walser (1 Ig.), Theodor Mommsen. Tagebuch der französisch-italienischen<br />
Reise 1844/1845 (Bern u. Frankfurt/M., 1976), 223-252 (225); dazu W. E.,<br />
White Mythologics? Informatik statt <strong>Geschichte</strong>(n) - die Grenzen der Metahistory,<br />
in: Storia della Storiografia 25 (1994), Mailand (Jaca Book), 23-50
128 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
opfern würde« . Zudem fordert Mommsen die »gleichmäßige<br />
Behandlung« der ganzen Sammlung: eine Grundbedingung aller Informatik (das<br />
Standardisierungsprogramm der Vergangenheit heißt <strong>Geschichte</strong>). Und auch das<br />
Reale aller Informatik wird deutlich, jenes Interesse, aus der sie ihre Autorität<br />
zieht: »Sammeln, sichten, kontroliren« . So ist der wissenschaftliche<br />
Wille zur Wahrheit identisch mit dem Willen zur Kontrolle des Wissens - nicht<br />
nur gegenüber nicht-institutionalisierten Agenten der Wissenschaft, den Amateuren<br />
und dilettanti, sondern auch als Teil einer epistemologischen Disposition,<br />
die Begriffe wie Repertorium auch in zeitgenössischen Handbüchern des Criminalrechts<br />
auftauchen läßt. 27<br />
Die Frankfurter Zentraldirektion der MGH jedenfalls votiert am 5. März<br />
1825 per Zirkularbeschluß <strong>für</strong> Steins Präferenz, die Quellenedition Monumenta<br />
Germaniae historica zu nennen. 28 Mehr verrät das Archiv nicht über die Wahl<br />
des Begriffs, der avant la lettre auf Michael Foucaults methodische Einleitung<br />
zur Archeologie du savoir verweist. Am Ende des 1. Weltkriegs durchdenken die<br />
MGH nach einer Epoche pragmatischer Datenverwaltung und -edition ihren<br />
Stellenwert im Koordinatennetz der Nation neu und im Plural; aus Monumenten<br />
werden flüchtige Momente:<br />
»Auch die Wissenschaften können sich den Schicksalen der Nation nicht entziehen,<br />
und nicht unberührt <strong>von</strong> dem Gange der vaterländischen Dinge ist ihr Gedeihen.<br />
Gilt das um wie viel mehr <strong>von</strong> einem Unternehmen, das wie kein anderes<br />
mit dem Aufstieg des deutschen Volkes seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts<br />
verbunden ist, ja das selbst ein Moment in der Entwicklung des nationalen<br />
Bewußtseins war. Der Leitspruch der Monumenta >Sanctus amor patriae dat animum
KRISTALLISATION DER MHG 129<br />
wieder behauptet, sondern im ersten Denkmalschutzgesetz, dem hessischen <strong>von</strong><br />
1902, ausdrücklich erwähnt, bezogen auf historische Schriftüberreste (namentlich<br />
Urkunden). Da sich <strong>für</strong> diese im Archivwesen eine eigene Fachwissenschaft<br />
zuständig erklärt, fallen sie »zunächst faktisch, dann auch rechtlich und administrativ<br />
aus Denkmalbegriff und Denkmalpflege heraus« .<br />
Höfer sucht der »so heterogenen« Quellengattung der historischen Denkmäler<br />
- eben im Medium Archiv - eine »möglichst streng chronologische Folge« zu<br />
geben . Die Faktizität der MGH-Editionspraxis bestimmt das terminologische<br />
Verhältnis <strong>von</strong> Urkunden und Akten,<br />
»nachdem die Historiker <strong>für</strong> den weiteren Quellenbereich durch die >Monumenta<br />
Germaniae historica< (im Russischen nennt man sie pamjatniki = Denkmäler) die<br />
Möglichkeit der Zusammenfassung <strong>von</strong> Scriptores, Leges, Diplomata, Epistulae,<br />
Antiquitates bewiesen haben. Nichts scheint näher zu liegen, als daß wir den<br />
geschichtlich engeren Archivalienbereich unter dem Oberbegriff >Archivdokumente<<br />
vereinigen. Als allgemeiner übergeordneter Begriff bliebe der des >Dokuments<<br />
schlechthin, dessen sich auch die Bibliotheken bedienen könnten . Für<br />
Museen als Institutionen, die gleichfalls historische Zeugnisse sammeln, wäre freilich<br />
der Begriff >Dokument< zu eng, da ihr Sammelgegenstand überwiegend aus<br />
nicht schriftlichen >Monumenten< besteht.« 30<br />
Zwischen Dokument und Monument schreibt sich in der lapidarischen<br />
<strong>Namen</strong>sgebung der MGH auch die Differenz <strong>von</strong> Symbol und (nationaler)<br />
Allegorie: »Lateinisch der Name - der Inhalt eine großartige vaterländische Tat.<br />
Stolz klingt es wie mächtige Fanfarenstöße, dieses Monumenta Germaniae:<br />
Deutschlands Denkmale. 31 Manuskripte figurieren im Editionswerk der<br />
MGH nicht denotativ als notwendige Illustration einer historischen Bedeutung<br />
jenseits des Texts, sondern fungieren vielmehr konnotativ, indem sie ein network<br />
<strong>von</strong> Zeichen in ihrem eigensinnigen Zusammenhang zur Anschauung<br />
bringen, in ihrer Eigenlogik als selbstreferentielles Universum, das <strong>für</strong> nichts<br />
außer <strong>für</strong> sich selbst spricht. Das Unternehmen der MGH befreit damit das<br />
Schriftartefakt wissensarchäologisch, d. h. es transformiert sogenannte Dokumente<br />
zurück in schweigende Monumente, gelagert in ihrem strikt archi(v)<br />
philologischen Kontext. Die <strong>Geschichte</strong> in ihrer traditionellen Form unternahm<br />
es, »die Monumente der Vergangenheit zu >memorisieren
130 MüNUMENTA GKRMANIAE<br />
gesprochen, dem »broken talk« der Fragmente und gibt ihnen »a tongue« 32 -<br />
Exorzismus des archäologischen Schweigens. Demgegenüber sucht eine an der<br />
Pariser Ecole des Annales orientierte Historiographie die Dokumente in Monumente<br />
zu transformieren, indem man »dort, wo man <strong>von</strong> den Menschen hinterlassene<br />
Spuren entzifferte, dort, wo man in Aushöhlungen das wieder zu<br />
erkennen versuchte, was sie gewesen waren, eine Masse <strong>von</strong> Elementen entfaltet,<br />
die es zu isolieren, zu gruppieren, passend werden zu lassen, in Beziehung<br />
zu setzen und als Gesamtheiten zu konstituieren gilt.« 33 Nichts anderes vollzieht<br />
eine (eher im gedächtnis-katechontischen Sinn des Archivs denn im Sinne<br />
<strong>von</strong> Derridas Begriff der differance) dekonstruktive Lektüre geschichtswissenschaftlicher<br />
Texte, die auf ihre Zeugnisse hin überprüfbar ist (Fußnoten) und<br />
damit aus der plausiblen Geschlossenheit (ein Effekt der Narration) in die<br />
Modularität <strong>von</strong> Informationseinheiten des Archivs (respektive der Bibliothek<br />
oder des Museums im Medienverbund) rücküberführt werden kann, die ihrerseits<br />
anders, neu konfiguriert oder supplementiert werden können: Rearchivierung<br />
heißt diese Methode. Die MGH stellen tatsächlich Aufzeichnungen der<br />
deutschen Vergangenheit struktural aus, um sie höchst diversen Formen der<br />
Beschreibung zugänglich zu machen, unter denen der Modus der Historiographie<br />
nur eine ist. Begegnen wir dieser Datenausstellungsästhetik mit einer wissensarchäologischen<br />
Analyse, die ihrerseits ihren Gegenstand, die Institution<br />
der MGH, nicht primär als wissenschahsgescbicbtlicbes Dokument entziffert,<br />
sondern vielmehr als isolierbare, monumentale Verkettung <strong>von</strong> Evidenzen und<br />
Diskursinseln, deren Interrelation nicht notwendig auf einen linearen temporalen<br />
Kontext namens Historie hinführt. Kein Denkmal im historischem Sinn,<br />
kein totalisierendes Gedächtnistheater: die MGH distanzieren sich vom historistischen<br />
Panoptizismus und <strong>von</strong> der Vereinheitlichungstendenz des historischen<br />
Blicks an allen Fronten. 34<br />
Zwischen Monument und Dokument ist der (öffentliche) Leseraum historiographisch<br />
internalisierter kultureller Er-Innerung (englisch bezeichnend recollection)<br />
epistemologisch separiert <strong>von</strong> seinen verborgenen Datenverarbeitungs<br />
und -speicherräumen. An dieser Stelle interessiert die Resonanz der Differenz<br />
<strong>von</strong> Gedächtnis und Erinnerung in der deutschen Semantik; während das Innerliche<br />
mit der organizistischen, personalen, internalisierten Erinnerung korrespondiert,<br />
setzt es sich ab vom mechanischen, extern bewahrten, archivischen<br />
32 W. T. Mac Cullagh, W.T., On the uses and study of history, Dublin 1842, 29<br />
33 Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 1973, 14f<br />
34 Vgl. Donald Preziosi über Sir John Soanes Londoner Monumentenmuseum um 1830:<br />
Modernity again: The Museum as trompe l'oeil, in: Peter Brünette / David Wills (Hg.),<br />
Deconstruction and the Visual Arts. Art, Media, Architecture, Cambridge / New<br />
York / Oakleigh (CUP), 141-150 (150)
KRISTALLISATION DER MHG 131<br />
Gedächtnis (angelehnt an G. W. F. Hegels Begrifflichkeit). 35 »Möge Niemanden<br />
das scheinbar mechanische meiner Arbeit misfallen «, schreibt Böhmer in<br />
seiner auflistenden Edition deutsch-mittelalterlicher Urkunden, die er dann -<br />
wissensarchäologisch präzise - als »grundlegende Arbeit« und non-diskursive<br />
»Untermauerung« eines Gebäude bezeichnet, auf dem dann Historie als Geschichtsschreibung<br />
gebaut werden kann; erst der <strong>von</strong> ihm rettend zitierte Wahlspruch<br />
der MGH (Sanctus amor patriae dat animum) macht aus dem quasi<br />
konsonantischen Alphabet der Urkunden die vokalisierte Sprache der Historie<br />
. Die <strong>Namen</strong>sgebung der Monumenta Germaniae Historica<br />
verliert ihre monumentale Singularität als Bestandteil einer Serie verwandter<br />
(wenngleich abgeleiteter) Diktionen. Philipp Jaffe, lange Zeit Mitarbeiter der<br />
MGH, publiziert (<strong>von</strong> diesen zurücktretend) selbständig in fünf Bänden 1864-<br />
1869 die Bibliotheca Rerum Germanicorum:<br />
»Hinweisend auf die langsamen Fortgang der Monumenta Germaniae, auf die<br />
nach 40 Jahren noch gänzlich fehlenden drei Abtheilungen der Urkunden, Briefe<br />
und Alterthümer, gab der Herausgeber als seinen Zweck an, Quellen verschiedener<br />
Art, vorzüglich solche, welche in den Monumenten fehlen, zu einzelnen auch<br />
in sich abgerundeten Gruppen zu vereinigen, so daß ein Ort, eine bedeutende Persönlichkeit<br />
oder ein wichtiger Zeitraum den Mittelpunkt bilde. So sind zuerst 1864<br />
Monumenta Corbeiensia erschienen , und schon 1865 folgen Monumenta<br />
Gregoriana.« <br />
Am 14. April 1820 verfaßt Karl Benedikt Hase, Kustos der Königlichen Bibliothek<br />
und Professor an der Ecole Royale et speciale des langues orientales Vivantes<br />
in Paris, ein Antwortschreiben auf die Bitte der Zentraldirektion der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, die Bearbeitung der Byzantiner <strong>für</strong> die<br />
Sammlung der deutschen Quellenschriftsteller zu übernehmen. Seinem detaillierten<br />
Konzept folgt ein summarischer Titel: Monumenta historiae Germanicae,<br />
ex auctoribus Byzantinis eruta et digesta? k Eine Auflistung Pertz' <strong>von</strong> Handschriften<br />
der Königlichen Bibliothek in Hannover zur <strong>Geschichte</strong> des deutschen<br />
Mittelalters erwähnt unter anderem »ein Convolut in Folio, enthält 1) gedruckt:<br />
Monumenta historica adhuc inedita Fascicul. I« . Eine Beiläufige<br />
Übersicht der Hauptquellenschriften deutscher <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters<br />
35<br />
Siehe etwa Ernst <strong>von</strong> Wildenbruch, Deutschland, sei wach!, Berlin 1915, 115 (Hinweis<br />
Karen Lang, Santa Monica)<br />
36<br />
Abgedruckt in: Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde zur<br />
Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher <strong>Geschichte</strong>n des<br />
Mittelalters, hg. J. Lambert Büchler u. Carl Georg Dümge, Bd. 1 (1819-20), Frankfurt/M.<br />
(Andrea) 1820, 536-542 (541). Handschriftliche Entwürfe zu diesem Schreiben<br />
finden sich im Archiv der MGH München, Akten der Zentraldirektion (Hase),<br />
Akademie-Akten, lfd. Nr. 113/20, Bl. 10 u. Bl. 11-13
132 MONUMHNTA GliRMANIAE<br />
nennt u. a. das Monumentum Benedictino-Buranum . Der Begriff der<br />
Dokumente ist demgegenüber immer schon an historische Semantik gekoppelt,<br />
nicht Monument im Sinne der diskreten Textkritik. Für einen Moment ist das<br />
Monument also Name und Adresse einer geschichtswissenschaftlichen Praxis<br />
geworden, als ein Text-Körper der deutschen <strong>Geschichte</strong>, ein corpus seiner<br />
Urkunden und damit unterschieden <strong>von</strong> allegorisierenden Denkmalen. Der<br />
Staatskörper des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation war derzeit eine<br />
Leiche (corpse); als Textkorpus steht er im Rahmen der MGH wieder auf. Das<br />
Wort <strong>von</strong> der jähre-, ja jahrhundertelang dauernden Mumie eines Staates in Schillers<br />
Spaziergang erinnert an Herders Satz über Einrichtungen, Verfassungen usw.:<br />
»Oft steht Jahrhunderte lang ihr Körper zur Schau dar, wenn die Seele des Körpers<br />
lang entflohen ist.« 37 Zwischen dem monumentalen <strong>Im</strong>aginarium der deutschen<br />
Nation und dem dokumentarischen Symbol deutscher Quellentexte<br />
sammeln die MGH das, was geblieben ist - die Basis <strong>für</strong> den historischen Umgang<br />
mit der deutschen Vergangenheit in einem Zeitalter der Zerstreuung 38 , eine<br />
Sammlung, deren Agentur nicht auf der Ebene der Schriftstücke, sondern ihrer<br />
Register steht. In diesem Sinne erinnert Wichmann an die Notwendigkeit <strong>von</strong><br />
Haupt-Registern unter Verwendung jenes Begriffs <strong>für</strong> schriftliche Artefakte, der<br />
den MGH ihren <strong>Namen</strong> verleihen wird - die »erste Grundlage« (also Archäologie)<br />
zu einem vollständigen Codex diplomaticus »aller dieser im Reiche sich befindenden<br />
handschriftlichen Monumente, mit genauer Angabe des Orts, wo sie sich<br />
befinden, und ihres Inhalts«
KRISTALLISATION DER MHG 133<br />
die kohärente, doch nicht zusammenhängende Darstellung des archäologisch<br />
Gegebenen auf dem Weg zur digitalen Erzählung? Die mimetische Form der<br />
Erzählung verhält sich analog zur Welt, während das digitale Narrativ ein nonlineares<br />
Mosaik <strong>von</strong> Fragmenten präsentiert; Information wird hier in diskreten<br />
Schritten prozessiert, ohne Anspruch auf Repräsentativität gegenüber dem, was<br />
sie kommuniziert. Der einzelne Moment (die Information als Ereignis) wird hier<br />
in der Tat zum digitalen Monument »whose subject matter is the representation<br />
of our increasingly digital culture . The sense of digital most important to me<br />
is that with digitalization, information becomes easily edited into different<br />
forms.« 40 Dagegen schreibt sich der Begriff des documentum nicht nur <strong>von</strong> der<br />
schulischen Unterrichtsdidaktik her, <strong>von</strong> den pädagogischen Nationalisierungsprogrammen<br />
um 1800, sondern auch <strong>von</strong> einem höchst exakten Dispositiv, dem<br />
des Rechts: »si e evoluto verso il significato di >prova< ed e ampiamente usato nel<br />
vocabolario legislativo« . Die institutionalisierte Historiographie<br />
aller europäischen Länder im 19. Jahrhundert eröffnet zwei parallele<br />
Publikationsserien: die Monumente (absteigend) und die Dokumente (in Expansion);<br />
in Anlehnung an den Schriftbegriff der Monumenta Germaniae Historica<br />
faßt der österreichische Musikwissenschaftler Guido Adlers eine Editionsreihe ins<br />
Auge, in der »erstens eigentliche Denkmäler (Kunstwerke) und zweitens Dokumente<br />
ferner Quellenschriften theoretisch-historischen Inhaltes« herausgegeben<br />
werden sollen , an den Grenzen zum <strong>Im</strong>memorial:<br />
dem Klang, der erst unter technischen Bedingungen archivierbar, mithin zum<br />
Monument werden kann. Demgegenüber gilt <strong>für</strong> das 20. Jahrhundert ein dritter<br />
Modus, die Information: »dal trionfo del documento alla rivoluzione documentaria.<br />
Con la scuola positivista il documento trionfa« .<br />
Die Ordnung der MGH<br />
Die Infrastruktur der MGH-Editionen basiert auf einer topographischen eher<br />
denn chronologischen Ordnung (dem chronologischen Arrangement in den finalen<br />
Publikationen zum Trotz, die das Betriebsgeheimnis ihrer Genese dissimu-<br />
Denkmal der Tonkunst) in: Elisabeth Th. Hilscher, Denkmalpflege und Musikwissenschaft.<br />
Einhundert Jahre Gesellschaft zur Herausgabe der Tonkunst in Österreich<br />
(1893-1993), Tutzing (Schneider) 1995,15-20. Adam Friedrich Kirsch faßt 1746 in seinem<br />
lateinisch-deutschen Wörterbuch unter monumentum sowohl das »Gedenkzeichen,<br />
Denkmal«, als auch die »Chronik, alte Historien«.<br />
40 Brooks Lundon, Not what it used to be: The overloading of memory in digital narrative,<br />
in: George Slusser / Tom Shippey (Hg.), Fiction 2000: Cyberpunk and the future of<br />
narrative, Athens, Georgia (Univ. of Georgia Press) 1992,153-167, Anm. 2, unter Bezug<br />
auf Steve Jones
134 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
Heren): Das mapping, die Chartographie der Archive, in denen die authentischen<br />
Dokumente lagern, ist ihre essentielle operative Basis. Auf diese Weise siegt Synchronisation<br />
über historisches Bewußtsein (das erst ihr Effekt ist). So stellt sich<br />
in der Tat die Frage, »wie man über Zeit noch denken kann, wenn die Sachdimension<br />
durch die Vorstellung geformter Materie besetzt ist.« 41 Das 19. Jahrhundert<br />
transformiert archivalische Räume in die Halluzination temporaler<br />
Epochen im Medium Historie (d. h. narrativ). Reinhart Koselleck hat den Widerstreit<br />
<strong>von</strong> Zeit- und Raumordnung im Vorgriff auf das (tatsächlich alphabetisch<br />
geordnete) Lexikon Geschichtliche Grundbegriffe so definiert. Der Vorrang des<br />
chronologischen Prinzips innerhalb der Artikel betrifft Methode wie Darstellung,<br />
»denn die <strong>Geschichte</strong> eines Begriffs läßt sich nur behandeln, wenn <strong>von</strong><br />
Situation zu Situation die Sinnfälligkeit eines Begriffs registriert wird: Dauer,<br />
Wandel und Neuheit lassen sich nur chronologisch erfassen und somit historisch<br />
interpretieren. Kein Zitat daher ohne Angabe der Jahreszahl!« 42 Ein temporaler<br />
Index (als semiotisches Geschichtszeichen) tritt hier an die Stelle der archivalischen<br />
Signatur. Dennoch sind data generell in Dateien gespeichert, die nicht zeitlich<br />
definiert sind, sondern als organisierte Datensammlungen. Dementsprechend<br />
ist die Herausgabe diplomatischer Quellen des deutschen Mittelalters als<br />
gedächtnisproduzierende Maschinerie eine permanente Provokation jeder emphatischen<br />
Geschichtserzählung, indem sie historische Semantik und Semiotik durch<br />
gedächtniskybernetische Operationen ersetzt. So gibt es gar keine Erinnerung<br />
sui generis, nicht einmal Gedächtnis, lediglich Adressen, welche Datenbanken<br />
aktivieren, worin nur taxonomische Klassifikation Speicherplätze deklariert.<br />
Temporale Lokalisation ist eine spatiale Metapher, »the configuration of a spaceas-information-model<br />
within a historical context« 43 . Sie ist nicht <strong>von</strong> ontologischer,<br />
sondern strategischer Bedeutung, um einen Kontext assoziieren zu können,<br />
der durch Exklusionsmechanismen Gedächtnis spezifizieren kann. Fehlgeleitet<br />
wäre die Verwechslung <strong>von</strong> Gedächtnis, das immer präsentistisch operiert, mit<br />
dem retrieval vergangener (aber gespeicherter) Daten. Gedächtnis ist nichts als<br />
ein je aktuelles cross-checking des Zustands einer gegebenen Systems (Archiv,<br />
Bibliothek, Museum). Zeit ist in Bezug auf Gedächtnis nichts als ein Konstrukt,<br />
Redundanzen aufzuspüren , ganz wie die<br />
Adaptation der alphabetischen Katalogisierung <strong>von</strong> Büchern die klassische topo-<br />
41 Niklas Luhmann, Gleichzeitigkeit und Synchronisation, in: ders., Soziologische Aufklärung<br />
5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990, 95-130 (Vortrag, gehalten<br />
am Institut <strong>für</strong> Soziologie der Universität Wien am 9. November 1989), 95<br />
42 Reinhart Koselleck, Richtlinien <strong>für</strong> das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte 11 (1967), 81-99 (95)<br />
43 Lily Diaz, A Simultaneous View of History: The Creation of a Hypermedia Database,<br />
in: Leonardo 28, Heft 4 (1995), 257-264 (257)
KRISTALLISATION DER MHG 135<br />
graphische, auf den artes memoriae basierende Klassifikation in Büchereien (korrespondierend<br />
mit den Fakultäten der Rhetorik) nach 1800 ersetzte.<br />
Die imaginäre Zeit der <strong>Geschichte</strong>, Objekt der MGH als histoire (im Sinne<br />
<strong>von</strong> Benveniste und Barthes), ist mit der Realzeit der Quellenforschung als<br />
(buchstäblich im Sinne des Datenverkehrs) discours zu synchronisieren. Eigentlich<br />
haben die ältesten Annalen des Mittelalters und die Geschichtsschreiber der<br />
Goten, Merovinger und Langobarden das Werk eröffnen sollen; die Vorarbeiten<br />
dazu aber sind schwierig »und die Benutzung so unentbehrlicher Handschriften<br />
noch nachzuholen, daß diese ganze Abtheilung einstweilen übergangen<br />
wurde, um nicht zu lange mit dem wirklichen Beginn der Publicationen zögern<br />
zu müssen« - ein aus der Dramatik vertrauter eclat<br />
<strong>von</strong> erzählter und Erzähl-Zeit. Die MGH-Entscheidung <strong>für</strong> eine vorrangig<br />
chronologische Edition der Quellen impliziert bereits zu Beginn ein Problem<br />
der Synchronisation, d. h. das des Einschubs nachträglich entdeckter Schriften<br />
in bereits feststehende Editionen. Um die chronologische Folge dennoch möglich<br />
zu erhalten, sollen die einzelnen Bände mit Interimstiteln (chartons) erscheinen<br />
und die Haupttitel jedes Bandes »erst nach Vollendung des Ganzen, so dann<br />
die Bände chronologisch geordnet werden könnten«, nachgeliefert werden. 44<br />
Historische Zeit steht immer schon in einem nachträglichen Verhältnis zur<br />
Datenprozessierung.<br />
Ein Publikationsmedium, das zu Buche schlägt: Zweckbestimmung der MGH<br />
Innerhalb der Quellen-Kategorien ist die Edition der MGH wiederum nach<br />
dem Endjahr geordnet, doch nicht pedantisch: »Nicht nur wird nachträglich<br />
mitgetheilt, was während der Arbeit neu entdeckt wird, sondern es bleibt auch<br />
oft das Gleichartige zusammen. <strong>Namen</strong>tlich wird die Fortsetzung nicht vom<br />
Hauptwerk getrennt, wenn sie nicht ganz selbständiger Art ist« . Die Rede ist hier <strong>von</strong> deutscher <strong>Geschichte</strong> als Funktion ihrer Edition.<br />
Das Korpus der MGH wird gleichursprünglich zum nationalen <strong>Im</strong>perativ,<br />
den kollektiven Gedächtniskörper der Nation aus seinen disiecta membra<br />
zu versammeln, zusammenzulesen. Nationale Identität konstituiert sich im hermeneutischen<br />
Zirkel zwischen Lesbarkeit und Dasein. Schon während des 18.<br />
Jahrhunderts empfand man in Deutschland »das Bedürfniß einer planmäßig<br />
geordneten, kritischen Sammlung der echten und ursprünglichen Geschichtsquellen;<br />
aber alle Wünsche scheiterten an der Zerstückelung Deutschlands,<br />
an der Unmöglichkeit, ein Zusammenwirken Vieler herbeizuführen, an<br />
dem Mangel ausreichender Geldmittel« . Die Alterna-<br />
Vortrag der Central-Direction, in: Archiv IV (1822), 31
136 MONUMENTA GERMANIAE<br />
tive zum Ordnungsprinzip der MGH vollzogen die Historiker der französischen<br />
Kongregation der Mauriner, trainiert an der Herstellung einer <strong>Geschichte</strong><br />
ihres Ordens und der Kirche. Seit 1738 erscheint der Recueil des Historiens des<br />
Gaules et de la France; Dom Bouquet und seine Fortsetzer haben dabei ein synoptisches,<br />
den MGH entgegengesetztes Prinzip verfolgt:<br />
»Sie gaben zu jeder Periode alles darauf bezügliche aus allen Schriftstellern,<br />
wodurch scheinbar ein großer Vortheil <strong>für</strong> den Geschichtsschreiber erreicht wird,<br />
da er seinen ganzen Stoff übersichtlich vor Augen hat. Dagegen aber wird es ihm<br />
außerordentlich schwer ein kritisches Unheil über die Quellen zu gewinnen, weil<br />
er sie nirgends vollständig beisammen hat; und doch kommt bei der geschichtlichen<br />
Forschung gerade darauf so viel an: es ist wenig damit gewonnen, die Worte<br />
einer historischen Nachricht zu haben, wenn man nicht weiß, wie viel Glauben der<br />
Schriftsteller verdient.« <br />
Demgegenüber edieren die MGH jeden Schriftsteller möglichst in seiner Integrität,<br />
und das typographisch diskret. So wird nicht etwa dasjenige weggelassen,<br />
was ein Verfasser aus anderen bekannten Quellen lediglich entlehnt<br />
hat; vielmehr werden diese Teile durch kleineren Druck kenntlich gemacht,<br />
»weil es <strong>für</strong> uns auch <strong>von</strong> Wichtigkeit ist zu wissen, aus welchen abgeleiteten<br />
Quellen die Folgezeit ihre Kenntniß schöpfte, und wie auf diese<br />
Weise die Kunde der <strong>Geschichte</strong> allmählich verengt und entstellt wurde«<br />
. Histoire und discours im Widerstreit: Nicht der Effekt einer geschlossenen<br />
<strong>Geschichte</strong> ist Zweck der MGH als Edition, sondern die Bereitstellung<br />
eines modularen Apparats zur Ver-Fügung <strong>von</strong> Historie - eine Schriftmacht,<br />
die buchstäblich Textmonumente <strong>für</strong> ein künftiges Gedächtnis bereitstellt.<br />
Nicht historischer Sinn (etwa der transzendente Referent »Nation«), sondern<br />
die Morphologie <strong>von</strong> Historiographie wird transparent. Die mnemische Energie<br />
(Aby Warburg) der MGH verrät sich nicht in ihren (Buch-)Objekten, sondern<br />
im Dazwischen ihrer Einbettung. Bei der Initiierung des Editionsprojekt<br />
hatte der Freiherr vom Stein sein Volk im Auge, um »den Geschmack an deutscher<br />
<strong>Geschichte</strong> zu beleben, ihr gründliches Studium zu erleichtern, und hierdurch<br />
zur Erhaltung der Liebe zum gemeinsamen Vaterland und dem<br />
Gedächtniß unserer großen Vorfahren« beizutragen. 45 Dieser Vektor ist den<br />
MGH nicht ausdrücklich eingeschrieben (vom Vorwort zu Bd. I der Scriptores<br />
abgesehen); es in der Form ihrer (Editions-)Organisation abzulesen bedarf<br />
einer non-diskursiven, archäologischen Hermeneutik, welche die Metaphern<br />
des Geistes technisch liest. Infrastruktur macht die historische <strong>Im</strong>agination<br />
einer Nation erst operabel; in der Mitte des 19. Jahrhunderts bezeichnet der<br />
französische Verleger Migne sein editorisches Großunternehmen einer Patro-<br />
45 Zitiert nach: Wattenbach 1873: 15, unter Bezug auf MG. SS. I., »Praefatio«
KRISTALLISATION DER MHG 137<br />
logie lateinischer Texte des Mittelalters »besser als die Eisenbahn, besser als der<br />
Luftballon; sie ist die Elektrizität.« 46<br />
Ersetzen wir die Paraphrasen Wattenbachs durch den narrativ weniger eleganten,<br />
da non-diskursiven Klartext der Statuten der MGH (als Monument im Sinne<br />
des Archivs), den »Plan der Ausgabe der Monumenta Germanica medii<br />
aevi«. § 1 (»Zweck der Sammlung«) benennt die »Herausgabe einer vollständigen<br />
und berichtigten Sammlung geschriebener Quellen der deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong>«; § 2 (»Umfang«) rechnet dazu »sowohl was als <strong>Geschichte</strong> geschrieben<br />
ward, als die uns erhaltenen Denkmähler, und nimmt jenes vollständig , <strong>von</strong><br />
diesen aber nur diejenigen auf, welche entweder <strong>von</strong> unmittelbarer Beziehung auf<br />
die <strong>Geschichte</strong> sind, oder bei dem jetzigen Zustande der Litteratur eine vorzügliche<br />
Aufmerksamkeit und Sorge ansprechen.« Die Quelle fungiert hier also nicht<br />
als diskretes Monument i. S. Foucaults, sondern jedes der monumenta ist so<br />
immer schon eine Metonymie des <strong>Im</strong>periums, partiales Substitut des <strong>Namen</strong>s der<br />
Historie als Be/Reich.<br />
§ 3 (»Eintheilung«) unterscheidet erstens »Was als <strong>Geschichte</strong> geschrieben<br />
ward: <strong>Geschichte</strong>n, Chronike, Annalen, Lebensbeschreibungen. (Scriptores)«;<br />
zweitens »Die weltlichen und geistlichen Gesetze. (Leges)«; drittens<br />
»Die Urkunden. (Diplomata)«; viertens »Die Briefe. (Epistolae)« und fünftens<br />
»Gemischte Beiträge: , einzelne Sprachdenkmäler. (Antiquitates).« Die<br />
Statuen widersprechen »geistlose Abschriften, Auszüge oder Ausführungen<br />
- es sei denn, diese Monumente sind selbst ein Zeitdokument:<br />
»Von den Schriftstellern, welche <strong>von</strong> der Schöpfung, Troja's Zerstörung, Christi<br />
Geburt an, manches Jahrhundert hindurch nur ältere Werke abschreiben oder ausziehen,<br />
wären die meisten erst <strong>von</strong> dem Puncte a aufzunehmen, wo sie eigenthümlich<br />
werden; wogegen diejenigen Werke, welche (gleich Ottos <strong>von</strong> Freisings<br />
Chronik) zwar größtentheils auf andern uns erhaltnen Quellen beruhen, aber als<br />
in sich abgeschloßne Arbeiten besonders ausgezeichneter Geister zugleich Denkmähler<br />
der ganzen Bildung ihrer Zeit sind, Abkürzungen keiner Art unterworfen<br />
würden.« <br />
Ermessensfragen. Hundert Jahre später ist es notwendig, eine Grenzregulierung<br />
und Kompetenzabgrenzung der Arbeitsprogramme der MGH und verwandter<br />
wissenschaftlicher Großunternehmen vorzunehmen, etwa gegenüber der Historischen<br />
Reichskommission und zur Historischen Kommission <strong>für</strong> das Reichsarchiv.<br />
47 Gedächtnisarbeit, im Unterschied zur narrativen Herstellung historischer<br />
Zusammenhänge, ist Partition.<br />
46 Zitiert nach: Kurt Flasch, Napoleon der Prospekte. Migne - ein spirituell-industrieller<br />
Komplex, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 7. Juni 1995<br />
47 Archiv MGH München, Verzeichnis Akten Berlin, Titel 2 Nr. 57 (1911-1922) u. 61<br />
(1928)
138 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Datenträger, Gedächtnis des Abfalls und Aufzeichnung<br />
Die Epochen der kulturellen Überlieferung sind durch Medienrevolutionen<br />
zäsuriert. Erst die eherne Letter, <strong>für</strong> dauerhafte identische Reproduktion gegossen,<br />
machte in einer medial höchst materiellen metonymischen Verschiebung <strong>von</strong><br />
der Schrift zum Druck den Spruch des Horaz buchstäblich wahr: Monumentum<br />
aere perennius. Tatsächlich aber führt der Buchdruck durch die selektive oder<br />
kontingente Überführung <strong>von</strong> Handschriften in Buchdruck (und die damit einhergehende<br />
sukzessive Zerstörung handschriftlicher Druckvorlagen) zu einem<br />
Traditionsverlust. 48 Ein Teil der mittelalterlichen Urkunden und Dokumente<br />
wandert nach ihrer typographischen Übersetzung in die MGH zum Recycling<br />
in Werkstätten: »Mit der Konzentration auf den Sinn des Überlieferten und der<br />
Medialisierung der Schrift zum Kanal wird deren Materialität irrelevant« 49 -<br />
gleich der insistenten Ästhetik des »reinen« Druckbilds in der kritischen Edition<br />
<strong>von</strong> Handschriften durch Carl Lachmann. 50 Eliminierung <strong>von</strong> noise: hier wird<br />
der nachrichtentechnische Begriff des Kanals konkret. Die MGH in ihrem<br />
douhle-bind zwischen geschichtsromantischer Gründung und philologisch-positivistischer<br />
Fabrik sammeln die Schriftdenkmäler zur deutschen <strong>Geschichte</strong> des<br />
Mittelalters und monumentalisieren sie zugleich, denn Zweck des Unternehmens<br />
ist die Wiederherstellung des Wortlauts der Urkunde im Moment der Niederschrift.<br />
Ausgeschieden wird damit weitgehend, »was aus Gesprächen der<br />
Abschreiber in den Text eingeflossen sein könnte. Die <strong>Geschichte</strong>, der der Monumentist<br />
doch zuarbeitet, muß ihm als Verschmutzung der Reinheit der Quelle<br />
erscheinen. 51 Parallel zur historischen Umschaltung <strong>von</strong> Macht als Effekt ihrer<br />
symbolischen Repräsentation auf Staat als Bürokratie und Verwaltung nach 1806<br />
findet also eine Fixierung auf Schriftquellen statt, <strong>für</strong> die das Materialerschließungsunternehmen<br />
der MGH charakteristisch ist. Hier wird bereits vor<br />
48 Siehe Jan-Dirk Müller, Der Körper des Buches. Zum Medienwechsel zwischen Handschrift<br />
und Druck, in: Hans Ulrich Gumbrecht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.), Materialität<br />
der Kommunikation, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 203-217 (bes. 206 u. 214)<br />
49 Wolfgang Struck, <strong>Geschichte</strong> als Bild und als Text. Historiographische Spurensicherung<br />
und Sinnerfahrung im 19. Jahrhundert, in: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske,<br />
hg. v. Susi Kotzinger / Gabriele Rippl, Amsterdam / Atlanta, GA (Rodopi)<br />
1994, 349-361 (353)<br />
50 Dazu Harald Weigcl, »Nur was du nie gesehn wird ewig dauern«. Carl Lachmann und<br />
die Entstehung der wissenschaftlichen Edition, Freiburg (Rombach) 1989, 219ff<br />
(bes. 228)<br />
51 Patrick Bahners (Rez.), Ein Kapitel <strong>für</strong> sich, über: Horst Fuhrmann, Menschen und<br />
Meriten. Eine persönliche Portraitgalerie. Zusammengestellt und eingerichtet unter<br />
Mithilfe <strong>von</strong> Markus Wesche, München (Beck) 2001, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung<br />
Nr. 124 v. 1. Juni 2002, 58
KRISTALLISATION DER MHG 139<br />
jeder hermeneutischen Interpretationsarbeit der zu generierende Text der<br />
<strong>Geschichte</strong> massiv eingegrenzt; »zusätzlich findet jedoch eine weitere, folgenschwere<br />
Konzentration statt: nämlich die auf den Inhalt, den Informationsgehalt<br />
der Quellen« . Struck verfolgt diese These anhand der Quellentypologie<br />
in der Allgemeine <strong>Geschichte</strong> Karl <strong>von</strong> Rottecks 52 , wo nicht nur die Schrift,<br />
sondern auch die Realien, die dinghaften Zeugnisse der Vergangenheit in ihrer<br />
Semiotisierung aufgehen. Alte Gebäude werden akribisch vermessen und in<br />
Zeichnungen übersetzt, um dann abgerissen werden zu können. »Dies liegt in<br />
der Konsequenz der Fixierung auf die Zeichenheftigkeit <strong>von</strong> Monumenten; sind<br />
solche Zeichen erst einmal erkannt und entziffert, dann werden ihre Träger überflüssig.<br />
Informations- wie Materialwert werden frei flottierbar« .<br />
So wird aus wissensarchäologisch faßbaren Daten in einem Akt hermeneutischer<br />
Anverwandlung, d. h. im Medium der Semiose qua Aufzeichnung, historische<br />
Information - die Unterwerfung der diskreten monumenta unter einen alphanumerischen<br />
Kode, der in technische Standards der Vermessung überführbar ist,<br />
sobald das Aufzeichnungsmedium nicht mehr Schrift, sondern Vermessung<br />
heißt. »Wenn man den Abfall nicht mehr als Ganzes sieht, einfach als eine Menge<br />
Müll, sondern in seiner höchst komplizierten Zusammensetzung <strong>von</strong> unwahrscheinlichsten<br />
Kombinationen verschiedenster kleiner Dinge , entdeckt man<br />
eine sehr informative Zustandsbeschreibung.« 53 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts,<br />
nach durch politische und industrielle Revolutionen vollzogenen Traditionsbrüchen,<br />
führt ein Verlustbewußtsein zum diskursiven Bedürfnis einer kompensatorischen<br />
<strong>Geschichte</strong> im emphatisch-philosophischen Sinn. Sanctus amor<br />
patriae} »Break a vase, and the love that reassembles the fragments is stronger<br />
than the love that took its symmetry for granted when it was whole.« 54 Als<br />
Resultat <strong>von</strong> Napoleons Säkularisation des Kircheneigentums öffneten sich<br />
immense Archive der europäischen Lesung, was - ähnlich wie die zeitverzögerte<br />
Öffnung des Geheimarchivs im Vatikan um 1880 - zu einem plötzlichen Output<br />
<strong>von</strong> Massendaten der Vergangenheit führt. Eine Menge dieser Daten, dekontextualisiert<br />
aus ihrer gedächtnisspezifisch funktional orientierten Umgebung, wird<br />
unverzüglich zur Makulatur. Über alte Handschriften zum Maculaturwerth in<br />
52 Karl <strong>von</strong> Rotteck, Allgemeine <strong>Geschichte</strong> vom Anfang der historischen Kenntnis bis auf<br />
unsere Zeiten. Für denkende Geschichtsfreunde, 15. Aufl. Braunschweig 1841, Bd. 1<br />
53 Friedrich Kittler (im Gespräch mit Wolfgang Ernst u. Anita Kontrec), Atlantis no<br />
more, in: Fritz 2, Berlin (Frühjahr) 1986, 14-23 (22f), unter Bezug auf den Entropiebegriff<br />
im Romanwerk Thomas Pynchons.<br />
54 Der Karibische Poet Derek Welkott, zitiert <strong>von</strong> Karlheinz Barck, Memory of<br />
Waste/Waste Memory chez Heiner Müller, Vortrag auf der Konferenz Memory of<br />
Waste, Montreal 1996, Typoskript, 10. Vgl. E. H. Kantorowicz, The Problem of<br />
Medieval World Unity, in: The Annual Report of the American Historical Association<br />
1942, Bd. III, Washington 1944, 33
140 MüNUMKNTA Gl'RMANIAE<br />
Fürth berichtet Wichmann 1820 ; die Vossische Zeitung druckt 1855 adäquat<br />
unter der Rubrik Vermischtes die Meldung über einen Archivar, der <strong>für</strong> ihn<br />
offensichtlich nicht als historisch bewertete Dokumente in die Makulatur gibt.<br />
In Nürnberg steht am 25. Mai vor dem Kreis- und Stadtgericht der Fall des<br />
Beamten Roth zur Verhandlung:<br />
»Wenn man sehen will mit welcher Vorliebe Archivbeamte an dem ihnen anvertrauten<br />
Geschichtsmaterial hängen, muß man den Wechsel in den Physiognomien<br />
der fünf <strong>für</strong> diesen Prozeß einberufenen Archivare betrachten, so oft ihnen eine<br />
zerschnittene Urkunde, ein verdorbenes Buch, dem K. Archiv angehörig, zur<br />
Cognition <strong>von</strong> dem Richter vorgelegt wird. Welcher Grad <strong>von</strong> Leichtsinn muß<br />
einen Archivbeamten beherrschen, der werthvolle Dokumente als Pergament zu<br />
technischen Zwecken, alte Druckschriften als Maculatur hingiebt! Der Mann fing<br />
wahrscheinlich damit an, daß er aus alten Pergamentmanuscripten die leeren<br />
Bögen ausschnitt, diesen folgten bald ganze Bände, werthvolle Aktenstücke, die<br />
ihrer legalen Auszeichnung, der Schnüre und Siegel beraubt wurden. Um die<br />
Abgänge und Spoliationen zu verdecken, fälscht der K. Archivar Roth, der den<br />
Titel Regierungsrath führt, die Repertorien und Geschäftsbücher, reißt ganze Blätter<br />
aus denselben heraus, streicht nach Belieben aus und setzt willkürlich Defekte<br />
an wo keine waren. Bloß der materielle Werth an Gold, Kupfer, Wachs,<br />
Maculatur (den antiquarischen und Kunstwerth kann ich hier nicht anschlagen),<br />
bei den Archivalien kann auf 650 Fl. berechnet werden.« 55<br />
Hier ist das Grenzgebiet zwischen Archiv und Museum berührt: Wappenabbildungen<br />
und Siegelabdrücke sammeln Archive nur in dem Maße, wie sie zur besseren<br />
Erschließung ihrer Bestände notwendig sind. »Stoffliche Gegenstände, die<br />
an und <strong>für</strong> sich keine Archivalien darstellen (auch nicht als Bestandteil archivischer<br />
Sammlungen), finden sich häufiger als Beilagen zu den Akten«, doch<br />
»darüber hinausgehende Materialien dieser Art gehören in Museen bzw. in Bibliotheken«<br />
56 : Das Gutenberg-Zeitalter trennt das multimediale Ensemble einer<br />
Urkunde als semiotisches Gesamtkunstwerk, und bedurfte zu diesem Zweck des<br />
medienarchäologischen Blicks der materialphilology (»the direct study of literary<br />
works or texts as medieval artifacts unmediated by modern editions« 57<br />
- also gerade unter Umgehung ihrer Drucklegung in der kritischen Edition wie<br />
etwa der Monumenta Germaniae historica), um sie als Monumente eher denn als<br />
historische Dokumente und als originären Informationsverbund wiederzuentdecken.<br />
Der <strong>Im</strong>materialität philologisch entzifferter Information haftet eine<br />
55 Vossische Zeitung Nr. 124 (1855), 7i (Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 178, Abt.<br />
VII, Nr. 1: »Nachrichten über fremde Archive (auch historische Museen) 1844-1869«,<br />
Bl. 60r/v, 61v)<br />
56 Otto Meisner, »Archive und Museen«, in: Archivmitteilungen 2/1957, 38-41 (40)<br />
57 Stephen G. Nichols, Why Material Philology?, in: Zeitschrift <strong>für</strong> deutsche Philologie<br />
116 (1997), Sonderheft Philologie als Textwissenschaft. Alte und neue Horizonte, hg.<br />
v. Helmut Tervooren u. Horst Wenzel, 10-30 (12)
KRISTALLISATION DER MHG 141<br />
materiale Spur an (parerga), die - monumentalistisch statt dokumentarisch<br />
betrachtet - in ihrem Materialwert aufgeht.<br />
Das philosophische Konstrukt einer emphatischen Idee <strong>von</strong> Historie, pragmatische,<br />
gedächtnisinstituierende Agenturen wie die Monumenta Germaniae<br />
Historica in Berlin, Orte der materiellen Artefaktenaufspeicherung wie das Germanische<br />
Nationalmuseum in Nürnberg und Magazine <strong>für</strong> alle Arten <strong>von</strong> Drucksachen<br />
wie letztendlich die Leipziger Deutsche Bücherei seit 1916 sind notwendig,<br />
um nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation den Verlust,<br />
die Dekontextualisierung <strong>von</strong> Bedeutungsträgern zu kompensieren. Solche<br />
Institutionen vollziehen an solchen Artefakten einen Prozeß der Resemiotisierung<br />
58 , indem sie den archäologischen Status sowohl <strong>von</strong> Texten als auch <strong>von</strong><br />
Objekten (Monumenten) in Dokumente einer Historie transformierten, die<br />
hauptsächlich vom Modell einer Erzählung namens Nation präfguriert wird.<br />
Diese symbolische Registrierung und Transformation macht die Originale im<br />
Kontext des Diskurses in hohem Maße überflüssig; es reicht aus, ihre Materialität<br />
schlicht zu speichern, also zu sichern, als Autorisierung der zirkulierenden immateriellen<br />
Information. Erst hermeneutische Anverwandlung macht aus äußerlichem<br />
Gedächtnis bedeutungsvolle Erinnerung 59 ; diese Operation aber ist nur als<br />
dissimulatio artis möglich, unter diskursiver Ausblendung genau jener non-narrativen,<br />
non-diskursiven Zeichenoperationen wie Signaturen, Inventare und Kataloge,<br />
die sie bedingen. Auch als Leopold <strong>von</strong> Ranke Ordnung in die konfuse<br />
Masse Venetianischer Gesandtenberichte bringt (die relazioni, das einstige feedback-M.ed\um<br />
der Politik der Republik), ist dies allein als synekdochische Erzählung<br />
möglich {<strong>Geschichte</strong>n der romanischen und germanischen Völker im<br />
Mittelalter). Temporalisierende Narrative aber beruhen auf nackter Synchronisation,<br />
einer recyclage culturel (Walter Moser). Die archivischen Strukturen <strong>von</strong> Informationen<br />
aus der (datierten) Vergangenheit fließen in der radikalen Gegenwart<br />
<strong>von</strong> Daten zusammen; aus der archivalischen Perspektive betrachtet ist diese<br />
Form <strong>von</strong> Gedächtnis überhaupt nicht mehr assoziiert mit einer tiefenzeitlichen<br />
Dimension, sondern Bestandteil einer gedächtniskybernetischen Kopplung <strong>von</strong><br />
Vergangenheit und Gegenwart. Demzufolge gibt es Gedächtnis allein im metaphorischen<br />
Sinn <strong>von</strong> Gedächtnisräumen. 60<br />
58<br />
Siehe Uwe Jochum, Das tote Gedächtnis der Bibliothek, in: Verband der Bibliotheken<br />
des Landes Nordrhein-Westfalen: Mitteilungsblatt [MB NRW] 45 Heft 4 (1995), Anm.<br />
64 u. 66, unter Bezug auf: Renate Lachmann, Kultursemiotischer Prospekt, in: Memoria.<br />
Vergessen und Erinnern, hg. v. Anselm Haverkamp u. dies., München (Fink) 1993,<br />
xvii-xxvii (xviii)<br />
59<br />
Siehe Hermann Schmitz, Hegels Begriff der Erinnerung, in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte<br />
9, Bonn (Bouvier) 1964, 37-44<br />
60<br />
Siehe Leopold <strong>von</strong> Ranke, Studien und Portraits zur italienischen <strong>Geschichte</strong>, hg. v.
142 MONUMENTA GHRMAN1AE<br />
Gegengedächtnis und Politik der Formatierungen<br />
In der modularen, auf offene historiographische Anschlüsse angelegten Struktur<br />
der MGH ist ein alle ideologisierende Hermeneutik umgehendes Gedächtnis<br />
angelegt. Über das »litterarische Unternehmen« gibt es zunächst (laut einem Brief<br />
vom Steins an Spiegel vom 8. Februar 1824) die »widersinnigsten Ansichten« auf<br />
Seiten des Publikums: »Die Einen glauben die Gesellschaft habe revolutionäre<br />
Absichten, Andere besorgten sie bezwecke die Wiederherstellung der weltlichen<br />
und geistlichen Aristocratie, und beyderley verrückte Ansichten haben gelähmt«<br />
. Vor dem Hintergrund der Karlsbader Beschlüsse liest sich das<br />
Gespenst der staatlichen Zensur der MGH konkret. In einem Schreiben an Büchler<br />
erklärt Dahlmann unter Protest seinen Rückzug <strong>von</strong> der Mitarbeit an den<br />
MGH; mit dem Bundestagsbeschluß vom 20. September 1819 sieht er den Sinn<br />
der Herausgabe der Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters aufgegeben:<br />
»Denn ich hielt es <strong>für</strong> unglaublich, daß dieselben Hände, welche das Todesurteil<br />
unsrer Preßfreiheit unterzeichnet haben, ein Werk zur Ehre der Literatur versuchen<br />
möchten.« 61 Noch deutlicher Falck in Kiel an Büchler:<br />
»Aber auch <strong>für</strong> die Sache selbst kann die Einführung der Censur, das sogenannte<br />
Preßgesetz nicht anders als störend seyn. Auf uns Holsteiner, <strong>für</strong> welche das Preßgesetz<br />
das erste Geschenk des deutschen Bundes geworden, macht die Einführung<br />
der Censur einen um so unangenehmeren Eindruck, da dieses Product des Mittelalters<br />
zu unserer Väter Zeit schon bei uns verschwand, und dem lebenden<br />
Geschlechte nur historisch bekannt gewesen ist. Was Napoleon uns unangefochten<br />
ließ, hat der Bundestag uns genommen. Wer mag überall seine Arbeiten<br />
einer andern Censur als einer wissenschaftlichen unterwerfen?« <br />
Eine diskursive Substitution: Der <strong>Im</strong>perativ der Wahrheit als Wille zum Wissen<br />
sublimiert den klassischen Anspruch autoritärer Macht. Mit Mühe sucht vom<br />
Stein den Schaden zu begrenzen. Gegenüber Dahlmann läßt er die politische<br />
Beurteilung der Karlsbader Beschlüsse unerörtert; »so kann unser litterarisches<br />
Unternehmen, ohne <strong>von</strong> ihnen gestört und gehindert zu werden, seinen Fortgang<br />
haben, da es mit der Gegenwart in keiner unmittelbaren Berührung steht, da<br />
die Theilnahme einzelner Bundesgesandten an der Direction theils etwas Zufälliges<br />
theils die Sache fördernd ist« . Was als<br />
nationalpatriotisches Projekt durch den <strong>Im</strong>puls einer unmittelbar präsenten Befreiungskriegs-Geschichtsästhetik<br />
begann, wird unter veränderten politischen Be-<br />
Willy Andreas, Wiesbaden / Berlin (Vollmer) 1957, Kapitel II »Die Verschwörung gegen<br />
Venedig im Jahre 1618«, bes. 86-90 »Neue Quellen - Das Venezianische Archiv« (86)<br />
61 Zitiert nach: Georg Heinrich Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein,<br />
6 Bde, 1823ff, hier: Bd. 5, Ausgabe Berlin (Reimer) 1854, 466
KRISTALLISATION DER MHG 143<br />
dingungen zum Beginn des Historismus. Der <strong>für</strong> die Herausgabe <strong>von</strong> deutschen<br />
Geschichtsquellen in Paris ausgeschaute Mitarbeiter, ein an der Berliner Universität<br />
lehrender Privatdozent namens Stenzel, hat als Freiwilliger die Feldzüge <strong>von</strong><br />
1813 und 1814 bis Paris mitvollzogen; nach Übernahme einer Professur an der<br />
Universität Breslau schreibt er im Anschluß an die Karlsbader Beschlüsse: »Das<br />
Unerfreuliche der politischen Angelegenheiten lenkt die Aufmerksamkeit auf wissenschaftliche<br />
Beschäftigung« . Steins Unternehmen<br />
zwischen Restauration und Liberalität ist sowohl gegen »die demokratischen<br />
Phantasten als die gemieteten Verteidiger der Fürstelwillkür« gerichtet, die »sich<br />
vereinigen, rücksichtslos auf das Hergebrachte, Geschriebene, Urkundliche, ein<br />
neues Verfassungsgebäude zu errichten«; dem setzt Stein »die Wiederherstellung<br />
des Alten mit zeitgemäßen Abänderungen«, eine aktualisierte Ständeverfassung<br />
also, entgegen. 62 Inwieweit bildet die Form der MGH eine politische Aussage? Es<br />
gab ein Vorbild <strong>für</strong> die Furcht vor (Geschichts-)Wissen als Hypertext; das Pariser<br />
Parlament bezog sich in seinem Verbot der Encyclopedie 1759 explizit auf die<br />
potentiell subversive Funktion <strong>von</strong> Querverweisen. »Das ganze in diesem Wörterbuch<br />
verstreute Gift« finde sich darin angelegt 63 - der wissensarchäologische<br />
Nullpunkt der Moderne als »Moment, wo sich die Welt weniger als ein großes<br />
sich durch die Zeit entwickelndes Leben erfährt, sondern eher als ein Netz, das<br />
seine Punkte verknüpft und sein Gewirr durchkreuzt.« 64 Martin Heidegger thematisiert<br />
in seinen Schriften Zeit des Weltbilds und Grundfragen der Metaphysik,<br />
daß in der mathematischen Welt der modernen Naturwissenschaften der unverwechselbare<br />
Ort durch die prinzipiell gleichwertige Position ersetzt wird:<br />
»Nowhere is there a >whereplace
144 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Geschichtsdiskursanalysen in Speicherästhetik. »Heutzutage setzt sich die Lagerung<br />
an die Stelle der Ausdehnung«, und man kennt die Bedeutsamkeit der Probleme<br />
der Lagerung in der zeitgenössischen Technik: Speicherung der Information<br />
oder der Rechnungsteilresultate im Gedächtnis einer Maschine, Zirkulation diskreter<br />
Elemente mit zufälligem Ausgang« . Herbert G. Wells<br />
formulierte es 1938: »This Encyclopaedic organization need not be concentrated<br />
now in one place; it might have the form of a network.« 66 Kohärenz wird in informationsorientierten<br />
Datenbanken lokal und momentan vom Benutzer gestiftet,<br />
nicht mehr durch eine auktorial vorgegebene, <strong>von</strong> Semantiken vordefinierte<br />
lineare Organisation des Materials. Montierte Wissensfragmente 67 bestimmen die<br />
Informationssituation; schon sehr früh, spätestens aber mit dem Buchdruck hat<br />
sich der <strong>von</strong> Formaten wie Papyrusrolle oder Kodex konventionalisierte Text <strong>von</strong><br />
einer reinen Linearität verabschiedet und in Inhaltsverzeichnissen, Registern, Fußnoten<br />
und Randbemerkungen Techniken des Anschlusses an andere Texte gefunden.<br />
»Diese Entlinearisierung wurde dann in den Bibliotheken noch potenziert,<br />
indem dort die Texte in Katalogen und Bibliographien nach verschiedenen Kriterien<br />
sortiert und damit einer weiteren Vernetzung unterzogen wurden« - einhergehend<br />
mit der Kulturtechnik einer Lektüre, die sich frei im Text zu bewegen<br />
vermag . Rezeptionsästhetisch ist es eine nach Kohärenz strebende<br />
Lesepraxis (vor dem Hintergrund einer virtuellen Realität namens Deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong>), eher als die Bestandsaufnahme des disseminativen Charakters<br />
der MGH als Medium, das den ganzen Unterschied zwischen <strong>Geschichte</strong> und<br />
Gedächtnis derselben ausmacht. Es ist die Lesbarkeit, welche Forschung <strong>von</strong><br />
Öffentlichkeit und Archäologie (die Arbeit im Archiv) <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> (als Effekt<br />
narrativer Historiographie) trennt:<br />
»Von manchen der bedeutenderen Quellen sind nun neben der großen Sammlung<br />
auch Octavausgaben veranstaltet, weniger <strong>für</strong> die gelehrte Forschung, weil<br />
ihnen der kritische Apparat fehlt, als zum Lesen bestimmt; und dazu kann man<br />
nicht genug rathen, weil das blosse Nachschlagen und Benutzen einzelner Stellen<br />
zu so vielen Irrthümern und Mißverständnissen Anlaß giebt, und nur das Lesen<br />
im Zusammenhang die richtige Anschauung gewährt; nur dadurch gewinnt man<br />
ein lebendiges Bild <strong>von</strong> den einzelnen Schriftstellern, wie <strong>von</strong> der ganzen Zeit.«<br />
<br />
66 World Brain, London (Methuen) 1938, 49, zitiert nach: Uwe Jochum, Bibliotheksutopien,<br />
in: Mitteilungsblatt des Verbands der Bibliotheken des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen (MB NRW) 44 (1994) 3, 279-292 (282)<br />
67 Rainer Kuhlen, Wie real sind virtuelle Bibliotheken und virtuelle Bücher?, in: Neue<br />
Dimensionen in der Informationsverarbeitung. Proceedings des 1. Konstanzer Informationswissenschaftlichen<br />
Kolloquiums (KIK '93), hrsg. Josef Herget, Konstanz<br />
(Universitätsverlag) 1993, 41-57 (52)
KRISTALLISATION DER MHG 145<br />
<strong>Geschichte</strong> ist als narratives Genre eine diskursive Formatierung <strong>von</strong> Gedächtnisdatenmaterial;<br />
auf der non-disursiven Ebene regiert das Format ihrer Übertragungshardware.<br />
Da nämlich die Edition der Quellenschriftsteller insbesondere<br />
<strong>für</strong> das Studium des Geschichtsforschers bestimmt ist, spielt die Bequemlichkeit<br />
der Benutzung <strong>für</strong> den nachschlagenden Gelehrten eine Hauptrolle, und das meint<br />
konkret: »Jetzt wo meistens horizontale Schreibtische gewöhnlich sind, ist diesen<br />
das Quartformat angemessener« . Für den Zusammenhang <strong>von</strong><br />
Speicher und Raum (Normierung <strong>von</strong> Regalen und Gebäuden) und standardisiertem<br />
Format als Bedingung der Aufspeicherung <strong>von</strong> Drucksachen steht die spätere<br />
Vision einer Organisierung der Organisation: »<strong>Im</strong> Monismus wird die<br />
zur Zeit höchste Stufe der Entwicklung, die der Organisation, erreicht.« 68 Auch<br />
nach der Reform der MGH im April 1875 mit einer neuen Zentraldirektion<br />
erscheinen die Rechtsquellen (Leges) weiterhin im Folioformat; ein Kritiker interveniert:<br />
Der Jurist liest seine Texte »anders wie der Historiker« und will vor allem<br />
eine handhabbare Edition. Aus diesem Grund erscheit das Reichsgesetzblatt nicht<br />
in Folioformat; aus diesem Grunde zirkulieren Taschenausgaben <strong>von</strong> Gesetzbüchern,<br />
und aus diesem Grunde hat auch Mommsen seine Pandekten nicht in<br />
Folioformat ausgegeben. 69 Holder-Egger verteidigt das Folio-Format:<br />
»Es wird z. B. in der Scriptores-Abtheilung oft nothwendig, vier und mehr<br />
Columnen auf der Seite einzurichten, was in Folio sich leichter machen läßt, bei<br />
Quartformat Unzuträglichkeiten hat. Ferner, je größer das Format ist, desto weniger<br />
Bände sind <strong>für</strong> jede Epoche nothwendig, um das ganze Material aufzunehmen.<br />
Wenn er z. B, mit Hülfe der Indices etwas zu suchen<br />
unternimmt, so ist es ein Vortheil, weniger Indices aufschlagen zu müssen, um sich<br />
über das Vorkommen einer Sache zu unterrichten.« <br />
Eine Funktion des Formats ist die Distribution. Johann Friedrich Böhmer vertritt<br />
in einem Brief an Georg Heinrich Pertz aus Frankfurt, den 27. Januar 1852,<br />
den Standpunkt, der dem Liebhaber genügt und dem Bedürfnis eines Gymnasiallehrers<br />
<strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> entspricht: »Ich meine denjenigen (auch <strong>von</strong> Guerard <strong>für</strong><br />
Frankreich bezeichneten), dessen Monumenta nicht in 20 Folianten, sondern in<br />
12 Octavbänden aufzubewahren sind, die petite prioriete historischer Gelehrsamkeit.«<br />
70 Derweil sind die Monumenta, obgleich textfixiert, selbst zu einem<br />
Denkmal des Buchgewerbes geworden; »wie vor einem barocken Monumental-<br />
68 Wilhelm Ostwald, Gegen den Monismus, Leipzig (Unesma) 1913, 54<br />
69 Heinrich Brunner, Die Umgestaltung der Monumenta Germaniae, in: Preußische Jahrbücher,<br />
35. Bd., Berlin 1875, 535-541 (540)<br />
70 Archiv der MGH, Rept. 338 Nr. 217, fol. 102-105, zitiert nach: Horst Fuhrmann<br />
(unter Mitarbeit <strong>von</strong> Markus Wesche), »Sind eben alles Menschen gewesen«: Gelehrtenleben<br />
im 19. und 20. Jahrhundert, dargestellt am Beispiel der Monumenta Germaniae<br />
Historica und ihrer Mitarbeiter, München (Beck) 1996, 144
146 MüNUMKNTA Gl-RMANIAE<br />
bau stehen wir in den Bibliotheken vor den 68 starken Foliobänden«. 71 Diese<br />
Architextur, im Unterschied zu kompakten Erzählpaketen, stellt Information<br />
gebündelt zur Verfügung, anstatt sie vorzuformulieren. <strong>Im</strong> Zusammenhang mit<br />
elektronischer Datenverarbeitung meint die Bezeichnung Information retrieval<br />
das Suchen und Auffinden <strong>von</strong> Information aus einem Speicher anhand einer<br />
Spezifizierung nach Sachverhalten; Norbert Wiener spricht in diesem Zusammenhang<br />
ausdrücklich <strong>von</strong> der in Büchern und Bibliotheken gespeicherten Information.<br />
72 Die Aggregate der MGH leisten genau dies, bilden aber auch eine<br />
Schnittstelle zum Diskurs; diesem Primat entspricht, daß seit 1849 zudem eine<br />
Sammlung <strong>von</strong> Quellentexten in Übersetzungen erscheint. Die hermeneutische<br />
Anschließbarkeit <strong>von</strong> Quelltextblöcken an den historischen Diskurs bedarf der<br />
» U eher Setzungen, aus denen uns der Inhalt der Schriften weit reiner entgegentritt,<br />
indem der Leser hier nicht durch die einzelnen Schwierigkeiten beschäftigt<br />
wird, die sonst leicht seine Aufmerksamkeit zerstreuen«; Wattenbach erwartet<br />
»schöne Bruchstücke zu einer Literaturgeschichte der mittelalterlichen<br />
Geschichtsquellen« - Erzählvorlagen, modular.<br />
Antiquitates<br />
Die Sammlung der MGH wird in fünf Abteilungen geplant: Schriftsteller,<br />
Gesetze, Kaiserurkunden, Briefe und Antiquitäten. Letztere gliederten sich wie<br />
folgt: »V. Alterthümer. A. Urkundliche Denkmähler. 1. Todtenbücher u.s.w. 2.<br />
Inschriften« 73 , darunter Objekte wie die bereits <strong>von</strong> Mabillon registrierte Prachtbibel<br />
des Archivs <strong>von</strong> San Callisto mit einer Inschrift auf der Weltkugel in der<br />
Hand des Königs. Ferner listet das Inhaltsverzeichnis des Archiv <strong>von</strong> 1824 <br />
Dichterisches auf, etwa Verse aus Friedrichs II. Zeit, sowie Verschiedenes: Runen-<br />
Alphabete bis hin zu Formeln J* Dichtung als Gattung der MGH oszilliert hier<br />
71 G. A. Zischka, Index Lexicorum, Wien 1959, xl, über Johann Heinrich Zedlers Grosses<br />
vollständiges Universal-Lexikon (1732ff)<br />
72 Rafael Capurro, Information. Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen<br />
Begründung des Informationsbegriffs, München / New York / London / Paris (K<br />
G Säur) 1978, 232f, unter Bezug auf K. Laisiepcn, E. Lutterbeck, K. H. Meyer-Uhlenried,<br />
Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation, o. c, 353. Der englische<br />
Text lautet: »searching and retrieval of Information from storage aecording to<br />
speeification by subjeet.«<br />
73 Archiv der Gesellschaft, 5. Bd, hg. G. H. Pertz, Hannover (Hahn) 1824, 451f<br />
74 Zur Edition <strong>von</strong> Dichtung der Ottonenzeit siehe Gabriel Silagi, in: Mittelalterliche Textüberlieferung<br />
und ihre kritische Aufarbeitung, Beiträge der Monumenta Germaniae<br />
Historica zum 31. Deutschen Historikertag Mannheim 1976, unveränd. Nachdruck<br />
1993, Monumenta Germaniae Historica München, 71-75
KRISTALLISATION DER MHG 147<br />
zwischen literarischem Monument und historischem Dokument; ein analoges<br />
Beispiel macht das methodische Problem der Aufarbeitung des Realbereichs in<br />
der Dichtung transparent: »Wie jedes andere Gedicht kann man die Ilias entweder<br />
als Poesie, d. h. um ihrer selbst willen lesen«, oder als altphilologisches<br />
Dokument. »Ein Kommentar müßte versuchen, beiden Ansprüchen Genüge<br />
zu tun.« 75 Dem emanzipatorischen Bürgertum aber ist das deutsche Gegenstück,<br />
das Nibelungenlied, zunächst fremd. Hegel spricht diese Diskontinuität<br />
aus: »Die Burgunder, Kriemhilds Rache, Siegfrieds Taten, der ganze Lebenszustand,<br />
das Schicksal des gesamten untergehenden Geschlechts das alles hat<br />
mit unserem häuslichen, bürgerlichen, rechtlichen Leben, unseren Institutionen<br />
und Verfassungen in nichts mehr irgendeinen lebendigen Zusammenhang.« 76<br />
<strong>Im</strong>mer wieder oszilliert die diskrete Datendarbietung der MGH zwischen dem<br />
Charakter als Datenbank und dem diskursiven Anspruch ihrer historiographischen<br />
Aufbereitung. Auf der kontinuitätsstiftenden Funktion <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
insistiert Engel im Jahre 1937 im Kontrast zur politisch abstinenten Wissensarchäologie<br />
(das Rechtsdenkmal als Ruine):<br />
»Als politische Erscheinung ist das deutsche Mittelalter tot, und man sollte es auch<br />
in seinen letzten Resten, die noch hereinragen in unsere Gegenwart, politisch sterben<br />
lassen. Als geschichtliche Erscheinung aber ist das deutsche Mittelalter die tragende<br />
Brücke zwischen Vorzeit und Neuzeit, ist das Mittelalter die unmittelbare<br />
völkische Vorstufe unserer Gegenwart.« 77<br />
Wissenschaftspolitisch geht das mit der Umschaltung des pluralistischen Titels<br />
des MHG-Publikationsorgans Neues Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> Ältere Deutsche<br />
Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften<br />
deutscher <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des<br />
Mittelalters einher.<br />
Eine der gelehrten Bemerkungen in Band 5 des Archivs (1824) aus der Feder<br />
des Bibliothekars Ildefons <strong>von</strong> Arx im Kloster St. Gallen fragt grundsätzlich<br />
nach dem Betreff der Rubrik Alterthümer: »Denn da steigt die Frage auf: welche?<br />
Ob auch solche, <strong>von</strong> denen schon Zeichnungen irgendwo anzutreffen sind,<br />
z. B. der im J. 830 verfertigte Bauriß der Kirche und ganzem Kloster <strong>von</strong> St.<br />
75 Wolf-Hartmut Friedrich, Verwundung und Tod in der Ilias, Göttingen 1956, 9f, zitiert<br />
nach: Bernhard D. Haage, Urjans Heilung (Pz. 506, 5-19) nach der »Chirurgia« des<br />
Abu L-Qasim Halaf Ibn Al-'Abbas As-Zahrawi, in: Zeitschrift <strong>für</strong> deutsche Philologie<br />
104, Heft 3 (1985), 357<br />
76 Ulrich Schulte-Wülwer, Die bildenden Künste im Dienste der nationalen Einigung,<br />
in: Jörg Jochen Müller (Hg.), Germanistik und deutsche Nation 1806-1848, Stuttgart<br />
(Metzler) 1974, 273-294 (290)<br />
77 Wilhelm Engel, Deutsches Mittelalter. Aufgabe und Weg seiner Erforschung, in: Deutsches<br />
Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters 1 (1937) Heft 1, 3-10 (5)
148 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Gallen«, oder gar Musiknoten? 78 Die eigenständige Abteilung Antiquitates<br />
innerhalb der Edition der MGH speist sich aus allem, was der geschichtsemphatisch<br />
orientierte Editionsbegriff nicht erfaßt (und was <strong>von</strong> daher nicht hilfswissenschaftlich,<br />
sondern wissensarchäologisch eine Provokation der Historie<br />
darstellt). Die Abteilung Antiquitates speichert Textartefakte auf- ein Museum<br />
des Unklassifizierten, nämlich Denkmäler, die in den anderen Abteilungen<br />
(ScriptoreSy Leges, Diplomata, Epistolae) keinen Ort finden: Inschriften, Totenbücher,<br />
Bemerkungen in Kaiendarien oder Martyrologien, Verzeichnisse <strong>von</strong><br />
Gütereinkünften, Codices traditionum und dergleichen, »endlich auch einzelne<br />
Sprachdenkmäler« . Tatsächlich ist ursprünglich vorgesehen,<br />
nur die Schriftsteller aufzunehmen, »welche ordentliche Geschichtserzählungen<br />
enthielten mit Ausschluß der trockenen kleinen Chroniken und<br />
Annalen«, die füglich in gesonderten Bänden vereinigt und nachgeliefert werden<br />
könnten, »und mit Ausschluß aller Bruchstücke« . Der<br />
historische Blick will nur wahrnehmen, was sich ihm schon als <strong>Geschichte</strong> präfiguriert<br />
darbietet.<br />
Zeit/Räume der MGH<br />
Theodor Mommsen, Direktor der Abteilung Auetores antiquissimi der MGH,<br />
übernimmt die Herausgeberschaft solcher Schriftsteller, die <strong>für</strong> die älteste deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> in Betracht kommen und <strong>für</strong> die »der kritische Apparat<br />
beschafft« werden soll; prekär aber bleibt seine Position in der nationalspezifischen<br />
Fixierung <strong>von</strong> Quelltexten zwischen Spätantike und Frühmittelalter. 79 Die<br />
<strong>für</strong> die MGH definierten »Gränzen der Zeit nach« nennt eine medienarchäologische wie administrativ-kybernetische<br />
Ruptur des deutschen Gedächtnisses, den »breiten Grenzsaum etwa des 15. Jhs.«,<br />
an dem die Begriffe Urkunden und Akten (<strong>für</strong> beweiskräftige und nicht-beweiskräftige<br />
Schriftstücke) sich sachlich ausdifferenzieren. 80 »Die Zeitgränzen der<br />
78 Archiv 1824: 799f. Ein zeitverschobenes Echo auf diese Frage spiegelt das Internet, die<br />
elektronische Nachfolge gelehrter Korrespondenzsysteme, in Form einer Diskussionsabfolge<br />
zum Plan <strong>von</strong> St. Gallen (in einer Historiker-mtfz/^ox des World Wide<br />
Web). Siehe die Nachricht <strong>von</strong> Marian Bleeke: »The plan of St. Gall, if I remember<br />
correctly, is an ideal plan, not a plan of an actual monastery as built.« mbleeke@MID-<br />
WAY.UCHICAGO.EDU, 1, Februar 1995<br />
79 Siehe dazu die Mommsen-Exzerpte im Nachlaß Wickert, Handschriftenabteilung der<br />
Staatsbibliothek (PK) Unter den Linden, Karton 39, fasc. 744 (betitelt »MGH«), Blatt<br />
l,5u. 7<br />
80 Heinrich Otto Meisner, Das Begriffspaar Urkunden und Akten, in: Forschungen aus<br />
mitteldeutschen Archiven. Zum 60. Geburtstag <strong>von</strong> Hellmut Kretzschmar, hg. Staatl.
KRISTALLISATION DER MHG 149<br />
Sammlung sind das Aufhören der classischen Litteratur und der allgemeine<br />
Gebrauch der Buchdruckerkunst« mit der Begründung, daß die nicht gedruckten<br />
Quellen des Mittelalters »dem allgemeinen Gebrauch entzogen«, also in einem<br />
non-diskursiven Raum gespeichert sind . Die »geographische Gränzen«<br />
sind durch den »Umfang der deutschen Sprache« definiert, »also der deutschen<br />
Völker, und der des deutschen Reichs sollten auch die des Unternehmens<br />
seyn, da aber beide nicht immer zusammenfallen, so treten dabei mehrere Beschränkungen<br />
ein« . § 10 in Statuten und Plan ergänzt: »Es wird dabei die<br />
zeitige Ausdehnung des deutschen Reiches über die Nachbarländer, wie z. B. Italien,<br />
beachtet« . Für Epochen, in denen der moderne<br />
Grenzbegriff noch nicht existierte 81 , ist damit das Nomadische die Unmöglichkeit<br />
<strong>von</strong> Ordnung und Archiv, ist doch die <strong>Geschichte</strong> der ausgewanderten<br />
Stämme bis zu ihrer Vernichtung oder ihrem Untergang großenteils »<strong>von</strong> unserer<br />
<strong>Geschichte</strong> nicht zu trennen« . »Dem Inhalte nach« liegen die Grenzwerte<br />
des Sammlungswerks MGH in dem Zweck, »die Erscheinungen deutschen<br />
Lebens in jeder Gestalt bis in seine einzelnsten Entwicklungen (also auch Stadtund<br />
Klosterchroniken) zu beachten«, demgegenüber »allgemeine Weltbegebenheiten<br />
und Einrichtungen nur, soweit die Theilnahme der Deutschen daran ausdrücklich<br />
erhellt« . Das Kriterium ist metonymisch: der Begriff deutsch. Eine<br />
Diskussion der Begrenzung des Zeitraums <strong>für</strong> die Ausgabe der Geschichtsschreiber<br />
des Mittelalters (Scriptores) findet sich in einem 1822 veröffentlichten Vortrag<br />
der Central-Direction (J. G. v. Fichard) zur Beantwortung <strong>von</strong> Anfragen eines<br />
Jenaischen Rezensenten. Nach Hintenanstellung der Geburt Christi als Zeitpunkt<br />
der »Berührung <strong>von</strong> Rom und Germanien«, d. h. als »Wendepunkt der europäischen<br />
<strong>Geschichte</strong>«, ist als »die eigentliche Gränze das Mittelalter bezeichnet«,<br />
das »in Beziehung auf Deutschland« (also relational) mit Chlodwig I. und der<br />
Herrschaft der Franken über Gallien beginnt. Der Zeitraum endet mit der Regierung<br />
Kaiser Maximilians I. »als dem Beginnen der neueren <strong>Geschichte</strong><br />
Deutschlands«; sie »erschöpft den Raum des Mittelalters«., indem sie die Epoche<br />
neuzeitlicher Staatsverwaltung inauguiert. 82 Das Datum der finalen Zäsur des Projekts<br />
MGH setzt also nicht Geschichtsphilosophie, sondern der Beginn des Buchdrucks,<br />
die technische Reproduzierbarkeit administrativer Akten. Das deutsche<br />
Gedächtnis, inkorporiert im Quellenwerk der MGH, skandiert den Rhythmus<br />
administrativer Aggregatzustände und nicht die Melodie historischer Ereignisse.<br />
Archivverwaltung im Staatssekretariat <strong>für</strong> innere Angelegenheiten , Berlin<br />
(Rütten & Loening) 1953, 34-47 (46)<br />
81 Dazu Lucien Febvre, »Frontiere« - Wort und Bedeutung, in: ders., Das Gewissen des<br />
Historikers, Berlin (Wagenbach) 1988, 27-37<br />
82 Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, Bd. 4, Frankfurt/M.<br />
1822, 3-32 (6ff)
150 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Die Findung eines wissensarchäologischen Nullpunkts ist das Dilemma aller<br />
historischen Dokumentation. Zweifelhaft ist das Anfangsdatum der Quellenedition<br />
MGH; das Archiv überkommener Texte ist nicht die Grundlage, sondern<br />
der Abgrund aller Nationalhistorie. Die Germania des Tacitus ist im<br />
Gespräch, also der Blick des Anderen. Vom Stein hat die Sammlung <strong>für</strong> die Zeit<br />
<strong>von</strong> Chlodwig bis zum Untergange der Staufischen Kaiser, »also auf die Dauer<br />
eines großen und mächtigen Deutschen Reiches«, begrenzen wollen; Dümge<br />
erlangt eine Ausdehnung bis zum Schluß des 15. Jahrhunderts . Zur Funktion der Schriftstücke im Diskurs des Rechts und der Verwaltung<br />
gehören auch die Formulare, die mit Leerstellen und Variablen arbeiten,<br />
seitdem Kaiser Maximilian I. die Einladungen zum Reichstag mit solchen<br />
Druckerzeugnissen standardisiert. Damit endet die Kunst der Diplomatik; die<br />
Rechtspraxis der Neuzeit hinterläßt schon <strong>für</strong> die sogenannte prästatistische<br />
Zeit ein Schriftgut, dem nur noch mit der quantifizierenden histoire serielle<br />
(Francois Füret, Pierre Chaunu) beizukommen ist, deren Leser nicht mehr<br />
der Urkundenforscher, sondern Computer sind. 83 Als zeitliche Grenzen der<br />
Quellensammlung waren damit ein philologisches und ein medienarchäologisches<br />
Kriterium, nämlich »das Aufhören der klassischen Literatur und der allgemeine<br />
Gebrauch der Buchdruckerkunst« bestimmt; schon beim ersten Band<br />
der Monumenta kam man »auf die bestimmten Jahresgrenzen 500 und 1500<br />
zurück«. 84 Allerdings ist der Versuch, Hardware-orientiert ein Pergament- und<br />
Papierzeitalter oder typologisch ein Urkunden- und ein Aktenzeitalter zu<br />
unterscheiden und dem Mittelalter bzw. der Neuzeit zuzuordnen, genau <strong>für</strong><br />
diejenige historische Phase unscharf, in der diese vermeintliche Grenze verlaufen<br />
müßte: die Jahrhunderte vor und nach 1500. Aufgrund <strong>von</strong> statistisch<br />
erhobenen Analysen bleiben Form und Charakter des erhaltenenen Quellenmaterials<br />
trotz der Veränderungen, die der Buchdruck bedingte, in der Zeit vom<br />
14. bis zur Mitte des 17. Jahrhundert relativ einheitlich. 85 Setzen die MGH mit<br />
dem Aufhören des Weströmischen Reiches ein, plädiert der als Vertreter der<br />
83 F. Ranieri, Versuch einer quantitativen Strukturanalyse des deutschen Rechtslebens im<br />
16.-18. Jahrhundert anhand einer statistischen Untersuchung der Judikatur des Reichskammergerichts,<br />
in: ders. (Hg.). Rechtsgeschichte und quantitative <strong>Geschichte</strong>,<br />
Frankfurt/M. (Klostermann) 1977, 1-22 (2 u. 9)<br />
84 Bresslau 1921: 138. Zur Setzung <strong>von</strong> Anfang und Ende in der Geschichtsschreibung<br />
siehe Dirk Baecker, in: Bernhard Dotzler (Hg,), Technopathologien, München (Fink)<br />
1992,337-359<br />
85 Uwe Neddermeyer, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und<br />
Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative<br />
Aspekte, Wiesbaden (Harrassowitz) 1996,29 (unter Bezug auf die Studien <strong>von</strong> Hagen<br />
Keller)
KRISTALLISATION DER MHG 151<br />
Berliner Akademie der Wissenschaften bei der Reorganisation des Instituts<br />
maßgeblich beteiligte Theodor Mommsen aufgrund seiner Vertrautheit mit dem<br />
römischen Staatskalender <strong>von</strong> 354 (Chrono-, nicht Historiographie), mit der<br />
Ravennater Kosmographie des 5. und 6. Jahrhunderts sowie mit der Chronik<br />
des Cassiodor aus der Zeit des Gotenkönigs Theoderich <strong>für</strong> eine inverse Perspektive:<br />
nicht des Bruchs, sondern des Übergangs zwischen spätrömischem<br />
und germanischen Reichen, der Insistenz der römischen Ordnung in Institutionen.<br />
86 »Man sollte diese Epoche nicht als die Bildung römisch-germanischer<br />
Königreiche bezeichnen, sondern als die Zersplitterung des römischen<br />
Reiches in Theilstaaten.« 87 Die juridische Ordnung generiert ein <strong>von</strong> den<br />
Textarchäologien der Mediävisten differentes Gedächtnis - im Widerstreit, der<br />
Diskontinuitäten akzentuiert. Mommsen spricht <strong>von</strong> gegenseitiger Ergänzung<br />
zwischen Philologie, Rechtswissenschaft und Historie ; <strong>von</strong> einer Suprematie<br />
des historischen Diskurses ist nicht die Rede. Mommsen vergleicht die Lage des<br />
Forschers dieser Übergangszeit nicht mit der Lage des Archäologen (so heißt<br />
die <strong>von</strong> Mommsen dirigierte, 1875 gegründete neue Abteilung Auetores<br />
antiquissimi vom Standpunkt der MGH aus 88 ), sondern des Botanikers, »dem<br />
nur die Knospe vorliegt und nicht die voll entwickelte Blüte und die gereifte<br />
Frucht.« 89 <strong>Geschichte</strong> ist die Theorie virtueller Räume.<br />
Nationalbewußtsein bedarf der Historie als spezifischer Abgrenzung gegenüber<br />
dem humanistisch-metahistorischen Anspruch auf antike Texte - eine<br />
operative Differenz, die in der »litterarischen Einleitung« Wattenbachs über die<br />
Quellenausgaben des 16. Jahrhunderts thematisch wird. Anfang und Ende seiner<br />
Deutsche Geschichtsquellen im Mittelalter fallen hierin zusammen: Fast<br />
gänzlich schien der Sinn <strong>für</strong> Kritik verloren, »bis wir im fünfzehnten Jahrhunderten<br />
wieder einzelne Spuren da<strong>von</strong> wahrnehmen, worauf dann bald die<br />
Bestrebungen der Humanisten <strong>für</strong> die Wiederbelebung der classischen Studien<br />
86 Die Insistenz institutioneller Kontinuität bestätigt jetzt auch Stefan Esders, Römische<br />
Rechtstraditionen und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer<br />
Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht)<br />
1997<br />
87 Theodor Mommsen, Ostgotische Studien, in: Neues Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere<br />
deutsche Geschichtskunde 14 (1889), 542; s. a. Oswald Redlich, Theodor Mommsen<br />
und die Monumenta GcrmanUe, in: dem., Ausgewählte Schriften, Zürltli / Leipzig /<br />
Wien (Amalthea) 1928. 141-155 (146f)<br />
88 Zum Brand der <strong>von</strong> ihm bearbeiteten Jordanes-Handschriften siehe W. E. (Hg.), Die<br />
Unschreibbarkeit <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien. Theodor Mommsens Römische Kaisergeschichte und<br />
Heiner Müllers Echo, Weimar (Verlag & Datenbank <strong>für</strong> Geisteswissenschaften) 1995<br />
89 In: Neues Archiv 16, 51, zitiert nach: Redlich 1928: 147
152 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
auch der Kunde des frühen Mittelalters zugute kommen« . Und am Ende <strong>von</strong> Band II heißt es über die Schriften der Mönche im 13.<br />
Jahrhundert:<br />
»Wir können hiermit die Entwickelung der Historiographie Deutschlands<br />
im früheren Mittelalter als abgeschlossen betrachten; mit Rudolf <strong>von</strong> Habsburg<br />
kommt ein neuer Aufschwung und es entstehen wieder achtungwerthe Werke über<br />
die <strong>Geschichte</strong> der Gegenwart; mit dem Reiche selbst nimt auch die<br />
Geschichtschreibung eine andere Gestalt an und verlangt eine abgesonderte<br />
Behandlung.« <br />
In dieser Wahrnehmung sind die Morphologie des Deutschen Reiches (als historisches<br />
Objekt) und die seiner historiographischen Beschreibung koexistent. Das<br />
Ende der Epoche des Mittelalters aus der Perspektive der MGH ist der Beginn<br />
seiner Erforschung: Überall läßt Kaiser Maximilian nach alten Urkunden und<br />
Chroniken suchen; sein Historiograph Stabius soll »daraus ein großes Geschichtswerk<br />
zusammensetzen« . Dieses Zur-Verfügung-<br />
Stellen vollziehen die MGH selbst nach. Mit der Renaissance divergiert die<br />
Historie: In Italien interessiert das römische Altertum fast ausschließlich, während<br />
sich in Deutschland die Kritik sogleich auf die Urkunden der christlichen<br />
Religion richtet. Eine religionspolitische Diskontinuität triggert Gedächtnisarbeit;<br />
die als drückend empfundene päpstliche Herrschaft veranlaßte zur Prüfung<br />
der Überlieferung. »Da werden die alten lauteren Quellen der <strong>Geschichte</strong> wieder<br />
ans Licht gezogen, und gefeierte Humanisten wenden auch diesem Felde<br />
ihre Thätigkeit zu« . Demgegenüber bedarf das Medium<br />
der Übermittlung noch keiner Übersetzung:<br />
»Mehrere unserer besten Geschichtsquellen sind nur in Abschriften des fünfzehnten<br />
Jahrhunderts erhalten. Denn nicht als Quellen <strong>für</strong> gelehrte Forschung<br />
betrachtete man damals diese Schriften; noch waren sie unmittelbar als<br />
darstellende Geschichtswerke willkommen, da man in der Sprache sowohl wie in<br />
der ganzen Denkweise jenen Zeiten noch nicht so fern stand, daß es eines eigenen<br />
Studiums bedurft hätte, um sich an den Schriften des Mittelalters zu erfreuen, sie<br />
auch nur zu verstehen.« <br />
Innerhalb dieses Fensters hat der Monitor der MGH ein weiteres Fenster<br />
geschachtelt; die Hauptedition konzentriert sich auf die Zeit <strong>von</strong> 700 bis 1250.<br />
Symbolischer Einschnitt ist der Tod Kaiser Friedrichs des Zweiten (respektive<br />
der Beginn des Interregnums).<br />
Der säkulare Hang zur Zahlensymbolik, jenem stränge attractor, verunschärft<br />
die mediengeschichtliche Präzision des Realen. Der ursprüngliche Plan<br />
der MGH sah als Zeitgrenze <strong>für</strong> die Quellensammlungen die Reformation vor,<br />
»weil bis dahin kein Gegensatz katholischer und protestantischer Ansichten die<br />
Einheit der Unternehmung stören könne« . Erst die Luther-
KRISTALLISATION DER MHG 153<br />
sehe Bekehrung vollzog, gekoppelt an das neue Medium Druckschrift, eine Aufheizung<br />
des Bibeltextes gegenüber der kühlen, die Partizipation des Betrachters<br />
absorbierenden katholischen Liturgie." <strong>Im</strong> übrigen sollte die einstige Ausdehnung<br />
des deutschen Reiches <strong>für</strong> die Entscheidung, ob eine Quelle aufzunehmen<br />
sei, maßgeblich sein. Deutschland in der kartographische Definition der MGH<br />
ist <strong>Im</strong>perium als präzise arche, Reich(s)weiten <strong>von</strong> Befehl und Archiv. »Eine<br />
historische Geographie mit den dazugehörigen Karten« war im Plan der MGH<br />
vorgesehen ; Einzugsbereich der Handschriften und Urkunden sollten<br />
die Bibliotheken und Archive des westlichen und mittleren Europa sein, und<br />
zwar nicht nur <strong>für</strong> die deutsche <strong>Geschichte</strong> . Arndt erklärt sich<br />
am 16. Juni 1818 <strong>für</strong> die Aufnahme der »Geschichtsschreiber der Deutschen<br />
Stämme«, selbst die der Angelsachsen und Spanier vom 5. bis 9. Jahrhundert, »da<br />
die Stämme bis dahin wo sie sich als besondere Glieder ausgebildet«, nach wie<br />
vor zusammenhängen . Das <strong>Im</strong>perium, <strong>von</strong> dessen Vorgeschichte<br />
hier die Rede ist, heißt Archiv erst in dem Moment, wo es 1806 selbst<br />
zum Monument geworden ist. Seine Urkunden sind seitdem nicht mehr an<br />
Macht gebunden: ineipit Historia als Reichs-Simulakrum 91 . Geschichtsquellenforschung<br />
und -edition ist immer erst in dem Moment möglich, wo die Öffnung<br />
des Archivs die Machtlosigkeit der Dokumente, ihre Verwandlung <strong>von</strong> Instrumenten<br />
der Macht in bloß historische Objekte indiziert. Pertz blieb es in Rom<br />
1823 versagt, die inneren Räume des Vatikanischen Archivs zu betreten. 92 Genau<br />
hier manifestiert sich eine Spur des Realen <strong>von</strong> Gedächtnismacht: Vielleicht sind<br />
ja <strong>Im</strong>perien überhaupt nicht als Literatur (be)schreib- und edierbar, sondern vielmehr<br />
in bester antiquarischer, also non-narrativer Tradition als Statistik; Mommsen<br />
schrieb es als Römisches Staatsrecht. "Das Wesen des <strong>Im</strong>perium ist so sehr das<br />
correlate Eingreifen in verschiedene Kreise«, daß eine narrative Synthese dem<br />
nicht gerecht wird. 93<br />
Böhmer<br />
Johann Friedrich Böhmer, seit 1824 Sekretär und Kassenführer der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, sammelt und ediert die deutschen Kaiser-<br />
90 Manfred Schneider, Luther mit McLuhan. Zur Medientheorie und Semiotik heiliger<br />
Zeichen, in: Friedrich A. Kittler / Manfred Schneider / Samuel Weber (Hg.), Diskursanalysen<br />
1: Medien, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1987,13-25 (22)<br />
91 Auch nach 1871 blieb Österreich an den MGH beteiligt; so lebte das Heilige römische<br />
Reich deutscher Nation mithin als Reichweite des Archivs bis 1918 fort (Bresslau<br />
1921:751).<br />
92 Bresslau 1921: 109<br />
93 Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht, 1. Bd., Leipzig 3 1887, xi
154 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Urkunden als Regestenwerk. Böhmer sieht die Urkunden als die »sicherste<br />
Grundlage aller Geschichtskunde« (archäo-logisch also) und stellt sie noch über<br />
die Chroniken: »Stets gleichzeitige Nachrichten, zeigen sie die Sachen, wie man<br />
sie damals sah und kannte, nicht wie man sie später sich dachte«; kommentiert<br />
Schulin : So dringt selbst der romantische Geist »bis zur exaktesten,<br />
nüchternsten Quellenforschung vor« - <strong>Geschichte</strong> als Disziplin<br />
der Nachrichten. Die metaphysische Deutschvolktheorie eines Fichte findet ihr<br />
philologisches Korrelat in der Diplomatik. Die Monumenta werden, ihrem <strong>von</strong><br />
Büchler 1819 mitgegebenen Motto Sanctus Amor Patriae gemäß, ein quasisakrales<br />
Medium der Vaterlandsliebe:<br />
»Wenn es wahr ist, dass das Selbsbewußtseyn der Nationen in ihrer <strong>Geschichte</strong><br />
ruht, und wenn Niemand seiner selbst vergessen, sondern vielmehr sich kennen<br />
soll, so werden Zeit und Kraft hier nicht vergeudet seyn, diene das aus den Urquellen<br />
hervortretende treue Bild dessen, was unser Vaterland gewesen ist, nun zur<br />
Belehrung oder - nur zum Andenken.« 94<br />
Die deutsche Nation steht nach 1806 unter einem psychosozialen Trauma; die<br />
Niederlage des preußischen Staates korrespondiert mit der Abwesenheit einer<br />
nationalen Autorität, deren Spiegelbild Napoleon heißt. Sanctus amor patriae,<br />
buchstäblich: »Die Leerstelle >Vater< wird dort, wo keine Trauerarbeit geleistet<br />
worden ist, durch jenen weißen Fleck im <strong>Namen</strong> der Liebe gefüllt.« 95 Das<br />
Unternehmen der MGH konvertiert Schrift-Artefakte der Vergangenheit in<br />
Fragmente einer deutschen Totalität, ohne den fragmentarischen Charakter (die<br />
irreversiblen Bruchstellen) zu verwischen. Diese Rupturen insistieren im<br />
Geschichts-Unterbewußten; das Fragment fungiert dabei als die zeitliche<br />
Schaltstelle: »Der Stempel des >nicht mehr< bezeichnet nicht allein Verlust ,<br />
sondern läßt etwas Künftiges auf etwas Vergangenes wirken«, so daß das, was<br />
war, das ist, was gewesen sein wird«- .<br />
In seinem Schreiben an Pertz vom 6. September 1846 nennt Böhmer die Monumenta<br />
»das große National-Conservatorium der vaterländischen Geschichtsquellen«,<br />
neben welchem kleinere Sammlungen <strong>für</strong> den Privatbesitz und <strong>für</strong><br />
einzelne Landschaften notwendig sind, »wenn die Quellen wirklich Gemeingut<br />
werden sollen« 96 . So dient die Gründung der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche<br />
94 Johann Friedrich Böhmer, Regesta chronologico-diplomatica Karolorum. Die Urkunden<br />
sämmtlicher Karolinger in kurzen Auszügen mit Nachweisung der Bücher, in welchen<br />
solche abgedruckt sind, Frankfurt/M. 1833, x<br />
95 Pierre Fedida, Ich liebhasse dich. Fragment, Zeit, Sprache, in: Lucien Dällenbach /<br />
Christiaan L. Hart Nibbrig (Hg.), Fragment und Totalität, Frankfurt/M. 1984, 104<br />
96 Archiv BB-AdW, Berlin, Findbuch (Bestand München) »Monumenta Germaniae<br />
Historica. Ausführliches Inhaltsverzeichnis zu: Repositur 338«, 136ff »IX. Korrespo-
KRISTALLISATION DER MHG 155<br />
Geschichtskunde im Jahre 1819 mit dem Auftrag einer Sammlung bzw. Edition<br />
aller historiographischer Quellen zur <strong>Geschichte</strong> der Deutschen und Deutschlands<br />
<strong>von</strong> ca. 500 bis 1500 »vorrangig dem Ziel, einen <strong>Im</strong>puls zur Realisierung<br />
der Nationalstaatsidee im Deutschen Bund zu geben.« 97 Der Autor transformiert<br />
hier die Monumenta selbst zum Dokument einer nationalstaatlichen Entwicklung,<br />
die er ex eventu unterstellt - ein historiographischer Kunstgriff,<br />
dessen Vektor die politische Energie einer gegebenen Gegenwart, nicht Historie<br />
ist. In Verfassung und Kunst, in Gotik, Minnesang und Urkunden sucht Böhmer<br />
das Innenleben seines Volkes. Wo romantischer Geist gerade in der exaktesten<br />
Quellenforschung west, gibt es keinen archäologischen Nullpunkt<br />
historischer Hermeneutik. 98 In einem Buch <strong>von</strong> 1832 stellt Böhmer seinen<br />
Begriff vom altgermanischen Recht, das er eigentlich bis 1804 erhalten sieht, in<br />
den Mittelpunkt:<br />
»Kein fremder Staat hat dieses deutsche Reich überwunden . Diese germanische<br />
Freiheit ist im römischen Reich nie untergegangen, sie war bis vor 28 Jahren<br />
noch erhalten, sie bestand in dem vom Kaiser und Reich ausgesprochenen Schütze<br />
jedes wohlerworbenen Rechtes . In den zahllosen <strong>von</strong> den Kaisern an die einzelnen<br />
Reichsstände erteilten Bestätigungsbriefen waren diese Ausdrücke jederzeit<br />
miteinander verbunden. Ihr Inbegriff, also mit einem Worte das urkundliche<br />
Recht, ist die germanische Freiheit.« <br />
Von daher das Interesse Böhmers an vom Steins Gesellschaft, als deren Sekretär<br />
er in Frankfurt seit 1824 fungiert. Nicht antiquarische Romantik, sondern eine<br />
politische Insistenz auf juristischer Kontinuität ist hier maßgebend, wogegen<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke (Böhmer gegenüber) die Verschiedenheit der Jahrhunderte<br />
akzentuiert: »Die Historie trachtet sie vielmehr alle in ihrer Verschiedenheit und<br />
also jedes in seinem besonderen Wesen zu erkennen und zu würdigen« . Böhmer sieht Mabillon und die französischen<br />
Benediktiner des 17. Jahrhunderts als seine Vorbilder, gerade weil sie nicht<br />
prunkende Geschichtsbücher, wohl aber Quellensammlungen, Lexika und dergleichen<br />
hinterließen, denen wir Kenntnisse des Mittelalters verdanken. Die<br />
Einsicht in Kulturtechnik aber wird <strong>von</strong> Böhmer gleich wieder ins Geschichts-<br />
denzen« (Regesten!) 143. Tit. 9, Nr. 217, 1845-1863, Bd. 3: Böhmers Briefe an Pertz.<br />
»Die Aufgaben der MGH. Schrb. v. 6.9.1846 und Böhmer's «<br />
97 Dieter Berg, Mediävistik - eine »politische Wissenschaft«. Grundprobleme und Entwicklungstendenzen<br />
der deutschen mediävistischen Wissenschaftsgeschichte im 19.<br />
und 20. Jahrhundert, in: Wolfgang Küttler / Jörn Rüsen / Ernst Schulin (Hg.),<br />
Geschichtsdiskurs Bd. 1, Frankfurt/M. (Fischer) 1993, 317-330 (318)<br />
98 Ernst Schulin, Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch: Studien zur Entwicklung<br />
<strong>von</strong> Geschichtwissenschaft und historischem Denken, Göttingen (Vandenhoeck<br />
& Ruprecht) 1979, 35
156 MONUMENTA GERMANIAE<br />
metaphysische gewendet: Diese Gelehrten seien »keine bloßen Mechaniker«<br />
gewesen; »sie erkannten den Geist Gottes, der durch die <strong>Geschichte</strong> weht, selbst<br />
wenn sie Wörterbücher schrieben« .<br />
Die Abstinenz <strong>von</strong> Narration ist also kein Hinweis auf eine nicht-ideologische<br />
Form der Verzeichnung <strong>von</strong> Vergangenheit, sondern schlicht ihre wissensstrategisch<br />
effektivere Alternative zu diesem Zweck. Die Zusammenhangleistung<br />
gegebener Daten wurde lange jenseits des Textes, in der angenommenen Perspektive<br />
Gottes geleistet (das scholastische Verständnis <strong>von</strong> Kontingenz); dem<br />
entspricht auch die scheinbare Un-Ordnung barocker Kunst- und Wunderkammern.<br />
Seit der <strong>von</strong> Koselleck definierten europäischen Sattelzeit aber (circa<br />
1770 bis 1830), in der Historie zeitlich dynamisiert, verstanden und getrieben<br />
wird, wird auch ihre Kunde metanarrativer.<br />
Schnittstellen zum Germanischen Nationalmuseum Nürnberg<br />
Was die schriftfixierten MGH metonymisch im Titel führen, stellt später das<br />
Nürnberger Nationalmuseum aus; weil in den Monumenta nur schriftliche<br />
Quellen gesammelt werden, komponiert im Jahre 1833 dessen Initiator, der Freiherr<br />
<strong>von</strong> Aufseß, eine erste kulturhistorische Sammlung aus seinem Familienarchiv<br />
99 - ein Ursprung der Kulturhistorie aus der Genealogie. Wie den MGH geht<br />
es Aufseß zunächst um eine Rettungsanstalt, welche zerstreute Quellen und<br />
Gegenstände deutscher Kulturgeschichte aufbewahren und den historischen<br />
Wissenschaften zugänglich machen soll. Gleichfalls analog zu den MGH entsteht<br />
das GNM aus der organisatorischen Notwendigkeit, dem freien Flottieren<br />
literarischer und materieller Artefakte Einhalt zu gebieten, um sie innerhalb des<br />
geschlossenen Diskurses einer Nationalhistorie präsentieren zu können. Erst im<br />
Monumentenbegriff definiert sich die Differenz <strong>von</strong> MGH und GNM:<br />
»Es war gewiss Zeit, diesem Treiben durch eine ausgedehnte Organisation nach<br />
Möglichkeit Einhalt zu thun, durch einen grossen Verein <strong>von</strong> Altertumsfreunden,<br />
der seine Fühlfäden über ganz Deutschland erstrecken und weniger die Erforschung<br />
und sachgemässe Veröffentlichung der Quellen, als die Erhaltung, Sammlung<br />
und Bergung der Denkmäler deutscher Vorzeit - das Wort Denkmäler in<br />
seiner weitesten Bedeutung genommen - zum Zweck haben musste.« <br />
Die Differenz der Medien Edition und Museum ist erst wieder aufgehoben auf<br />
der semiotischen Ebene des Medienverbunds der Dokumentationswissenschaft.<br />
99 So argumentieren Heinrich Dilly /James Ryding, Kulturgeschichtsschreibung vor und<br />
nach der bürgerlichen Revolution <strong>von</strong> 1848, in: Ästhetik und Kommunikation 21<br />
(1975), 15-32
KRISTALLISATION DER MHG 157<br />
Vorrang hat in der (Selbst-)Beschreibung des GNM immer wieder die Begrifflichkeit<br />
der Inventarisation; lange Zeit flössen dem Haus nicht so sehr Artefakte,<br />
sondern Informationen im Sinne eines Generalrepertoriums deutscher Kulturgeschichte<br />
zu. Aus Anlaß der Erhöhung des bayerischen Staatsbeitrags an das<br />
Museum am 30. April 1856 kommentierte der Fürst <strong>von</strong> Öttingen-Wallerstein:<br />
»So ist dasselbe eine Anstalt <strong>von</strong> ungeheurer Tragweite, nicht sowohl wegen der<br />
Kunstwerke und historischen Monumente, welche es besitzt (diese sind <strong>von</strong> keiner<br />
ausserordentlichen Bedeutung ), aber wegen seiner Leistungen auf dem<br />
Boden der deutschen <strong>Geschichte</strong> und Altertumskunde. Dieses Museum hat den<br />
grossen Zweck, ein Repertorium, einen lebendigen Index alles dessen zu liefern,<br />
was <strong>für</strong> deutsche Vergangenheit irgend <strong>von</strong> Bedeutung ist. Ich habe die Bibliothek<br />
und die Repartition dieses Instituts eingesehen . <strong>für</strong>wahr kein Land<br />
braucht einen solchen Quellenschatz mehr als Deutschland, vermöge seiner politischen<br />
Gestaltung und seiner Trennung in zahlreiche Einzelstaaten.« <br />
<strong>Im</strong> Widerstreit liegen während der formativen Phase des GNM immer wieder<br />
Objekt und Information; das Museum ist in seinen formativen Jahren weniger<br />
eine Sammlung <strong>von</strong> Preziosen denn eine Summe <strong>von</strong> Repertorien. An die Stelle<br />
des Fetischs tritt die Information, ohne daß darin der semiotisch unbeschreibliche<br />
Rest des Materialen aufgeht:<br />
»Denn was ist im Grunde und insbesondere heutzutage das Museum anderes, als<br />
die Summe seiner mehr oder weniger sorgfältig katalogisierten, repertorisierten<br />
oder sonst der leichten und bequemen Benutzung nach Möglichkeit zugänglich<br />
gemachten kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen! - Anfangs freilich, in<br />
den Zeiten der Vorstandschaft des Freiherrn <strong>von</strong> Aufsess, hätte die Antwort auf<br />
diese Frage wohl keineswegs so selbstverständlich, vielmehr wesentlich abweichend<br />
gelautet. kamen nach den Absichten des Barons die Sammlungen,<br />
einschliesslich der Bibliothek und des Archives, erst in zweiter Linie; im Vordergrund<br />
seines Interesses aber stand das Generalrepertorium, durch das er im<br />
Laufe der Jahre der Zersplitterung Deutschlands in Rücksicht seiner zahlreichen<br />
Staatssammlungen, Landes- und <strong>für</strong>stlichen Archive, öffentlichen und privaten<br />
Bibliotheken u.s.f. wirksam begegnen zu können und so der auf die Erkenntnis<br />
deutschen Wesens im weitesten Sinne gerichteten historischen Forschung einen<br />
ausserordentlichen Dienst zu leisten hoffte. Überall wird in seinen Artikeln und<br />
Aufrufen dieses Generalrepertorium, das ja unter anderm auch mit einem Bilderrepertoium<br />
über alle vorhandenen Gegenstände deutscher Kunst (bis zum >Normaljahr<<br />
1650) verbunden sein sollte, als die >wichtigsteHautpaufgabe< des<br />
Museums bezeichnet, und auch in dem den dreifachen Zweck der Anstalt darlegenden<br />
§ 1 der Satzungen steht es an erster Stelle.« <br />
Auch <strong>für</strong> <strong>von</strong> Aufseß' Schüler Harless und <strong>von</strong> Eye bilden die Repertorien noch<br />
den eigentlichen Kern, den Brennpunkt des Museums . Nicht das archäologische<br />
Monument, sondern die Dokumentation hat damit Priorität; der Begriff<br />
Museum als objektorientierte Institution der Wissenssammlung stellt (heute)
158 MONUMENTA GERMANIAE<br />
demgegenüber eine Verengung dar, die aus der disziplinären und institutionellen<br />
Ausdifferenzierung diverser Gedächtnismedien zu erklären ist, wenngleich<br />
integral gedacht. Ende März 1853 wird Johann Caspar Beeg, Aufseß' Schwiegersohn<br />
und <strong>von</strong> 1853-1859 Zweiter Vorstand des Museums, zu Verhandlungen<br />
mit den Bundestagsgesandten nach Frankfurt/M. gesandt; in Gesprächen mit<br />
einzelnen Abgeordneten spricht er »eine analoge Unterstützung wie <strong>für</strong> die<br />
Frankfurter Gesellschaft d. d. 1819« an. 100<br />
Eine Teilmenge der Datensätze des deutschen Mittelalters, die schriftlichen<br />
Geschichtsquellen, wird vom Unternehmen MGH in einer Weise organisiert,<br />
welche - analog zum anfänglichen Plan des Germanischen Museums - nicht<br />
Historie, sondern Gedächtnis zur Verfügung stellt. Die Logistik der Datenverarbeitung<br />
führt darauf hin, d. h. fort <strong>von</strong> der Erzählung; Johann Friedrich Böhmer<br />
skizziert es in einem Brief an Georg Heinrich Pertz aus Frankfurt, den 27.<br />
Januar 1852:<br />
»Frhr vom Stein dachte Anfangs wohl nur an eine bessere Sammlung der zerstreut<br />
vorhandenen Scriptoren. Dann wollte man einem größeren Johann <strong>von</strong> Müller den<br />
Weg bereiten, und darum auch Classiker und Byzantiner extrahieren. Endlich fand<br />
man, daß die <strong>Geschichte</strong> schon fertig in den Scriptoren enthalten sei. Du brachtest<br />
dann Ordnung in die Ideen, erweitertest das Feld der Aufgabe, z. B. auch über die<br />
Urkk., gabst Grundsätze und Muster der gelehrten Behandlung. Wenn der deutsche<br />
Bund ein großes Generalconservatorium der deutschen Geschichtsquellen<br />
wollte anlegen lassen, so konnte die Aufgabe nicht würdiger gelöst werden.« 101<br />
Die so in Angriff genommene Datenverarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit ist an Apparate,<br />
an formalisierte Bearbeitungsbögen und Grundkarteien (mit den Rubriken<br />
Archivalische Überlieferung, Drucke u. Regesten, Spezialliteratur usf.) gebunden.<br />
102 Als Aggregat entspricht dies der Bauform <strong>von</strong> Maschinen eher als literarischen<br />
Bauformen des Erzählens (Eberhard Lämmert), also der historischen<br />
Matrix lOi . Man versucht, die endliche Menge <strong>von</strong> Informationen der Vergangenheit<br />
(eine computerable number) in Elemente zu zerlegen, und zwar nicht im Zeichen<br />
der Historie als Ordnung des Wissens, sondern als Montage, als Assemblage,<br />
100 Beeg an Aufseß, Frankfurt, 29. 3. 1853, Ausfertigung; Altregistratur GNM, Kapsel<br />
21, zitiert nach: Peter Burian, Das Germanische Nationalmuseum und die deutsche<br />
Nation, in: Deneke / Kahsnitz 1978: 127-262 (155; s. a. 159)<br />
101 Archiv der MGH, Rep. 338 Nr. 217, Bl. 102-105, zitiert nach: Fuhrmann 1996: 144<br />
102 Siehe das Beispiel <strong>für</strong> die Erfassung und Bearbeitung des Editionsmaterials anhand<br />
der Urkunde Kaiser Friedrich II. <strong>für</strong> den Deutschen Orden <strong>von</strong> 1221 Dezember,<br />
Catania, in: Zur <strong>Geschichte</strong> und Arbeit der Monumenta Germaniae Historica, Katalog<br />
der Ausstellung anläßlich des 41. Deutschen Historikertages München, 17.-20.<br />
September 1996, München (MGH) 1996, 59-63<br />
103 Dazu Jörn Rüsen, Historische Vernunft. Grundzüge einer Historik, 3 Bde, Göttingen<br />
(Vandenhoek & Ruprecht) 1983-1989
KRISTALLISATION DER MHG 159<br />
als Sammlung aus einzelnen Bestandteilen - eine Datenästhetik, die parallel sich<br />
im Maschinenbau tatsächlich realisiert. Bernhard Joseph Docen sieht in der Sammeltätigkeit<br />
eine Grundlagenwissenschaft; er verurteilt theoretische Konstruktionen<br />
und mikrologische Datenverschiebung gleichermaßen und vesucht, den<br />
Mittelweg einer Mosaiktheorie zu gehen, d. h. »aus den vollständigen Daten der<br />
fragmentarischen und korrrupten Überlieferung ein großes Puzzle des Mittelalters«<br />
zu formen (Ulrich Hunger):<br />
»Um beyde Abwege zu vermeiden, giebt es kein sicheres Mittel, als sich <strong>von</strong> den<br />
übergebliebenen Werken der früheren Zeiten, die wie die Ruinen eines grossen<br />
Tempels ohne Ordnung und oft versteckt genug noch da liegen, eine so viel möglich<br />
vollständige Kenntnis zu erwerben, um die zerstreuten Bruchstücke in den<br />
ununterbrochenen Umkreis des Ganges der deutschen Bildung, jedes an den ihm<br />
zukommenden Ort, zurückzuführen« 104<br />
- Datenrückpeilung (Thomas Pynchon). Bedingung der Datensammlung ist die<br />
Urkundenzerstreuung, wie sie 1803 infolge der Säkularisierung kirchlicher<br />
Archive geschieht; das Resultat aber heißt nicht notwendig Geschichts-, sondern<br />
schlicht Editionsbegehren - Monumenta, nicht Documenta Germaniae.<br />
104 Bernhard Joseph Docen, Miscellaneen zur <strong>Geschichte</strong> der teutschen Literatur, 2.<br />
Aufl., München 1809, Bd. 1, zitiert nach: Ulrich Hunger, Altdeutsche Studien als<br />
Sammeltätigkeit, in: Jürgen Fohrmann / Wihelm Vosskamp (Hg.), Wissenschaft und<br />
Nation: Studien zur Entstehungsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft,<br />
München (Fink) 1991, 96f
160 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Verlaufsformen der Monumenta Germaniae Historica<br />
Symbolisches Gedächtnis und administrative Infrastruktur gehen Hand in<br />
Hand. Nach der Organisation der Preußischen Reformen zielt die Gründung<br />
der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde 1819 auf die Sammlung,<br />
Bearbeitung, Speicherung und Edition aller mittelalterlichen Quellen zur<br />
<strong>Geschichte</strong> des Deutschen Reiches mit dem Ziel, »einen <strong>Im</strong>puls zur Realisierung<br />
der Nationalstaatsidee im Deutschen Bund zu geben.« 1 Zunächst unter<br />
dessen Kuratel, übernimmt dann Preußen die MGH, institutionsgeschichtlich<br />
den politischen Anspruch Preußens als Synekdoche Deutschlands manifestierend.<br />
<strong>Im</strong> Bewußtsein dessen rät J. A. F. Eichhorn dem Freiherrn vom Stein<br />
schon in der Formulierung der Berliner Pläne einer Historischen Gesellschaft,<br />
alles zu vermeiden, »was eine Eifersucht der übrigen deutschen Staaten<br />
erwecken konnte.« 2 Der Zweck der regionalen MGH-Zuliefergesellschaften<br />
soll demnach durch »Männer <strong>von</strong> bekannten und geliebten <strong>Namen</strong>« an ihrer<br />
Spitze gefördert werden. 3 So verschiebt sich metonymisch auf die Ebene der<br />
Handelnden, was als semiotische Zuschreibung der Autorität des <strong>Namen</strong>s<br />
Deutschland Fiktion bleibt.<br />
<strong>Im</strong> Neuen Reich: Staat machen mit den MGH<br />
Erst das Kaiserreich vollzieht die Umwandlung der Privatgesellschaft MGH in<br />
eine halbstaatliche Körperschaft. Die Monumenta gewinnen eine auch äußerlich<br />
andere Gestalt: an die Stelle des unhandlichen Folioformats tritt das Großoktav,<br />
das sich leichter benutzen ließ »und doch eine gewisse repräsentative Feierlichkeit<br />
nicht verleugnete« - so beschreibt Karl Preisendanz das Nationalwerk. Als<br />
Datenbank aber gerät es aus den Fugen: »Wer heute vor der Bibliothek der<br />
Monumenta steht, findet sich nur schwer auf den ersten Blick zurecht. Fast verwirrend<br />
wirken die zahlreichen Abstufungen und Abteilungen.« 4 Die Administration<br />
des deutschen Gedächtnisses bedarf ihrerseits einer institutionellen<br />
Infrastruktur. Heinrich <strong>von</strong> Treitschke setzt nach der Neugründung des deutschen<br />
Reiches »der festen Ordnung der deutschen Monarchie« warnend die<br />
1 Dieter Berg, Mediävistik - eine »politische Wissenschaft«. Grundprobleme und Entwicklungstendenzen<br />
der deutschen mediävistischen Wissenschaftsgeschichte im 19.<br />
und 20. Jahrhundert, in: Wolfgang Küttler / Jörn Rüsen / Ernst Schulin (Hg.),<br />
Geschichtsdiskurs Bd. 1, Frankfurt/M. 1993, 317-330 (318)<br />
1 Stein, Briefe und Schriften Bd. 5, 494f, Nr. 416, zitiert nach: Töllner 1994: 53, Anm. 66<br />
3 Harry Bresslau, <strong>Geschichte</strong> der Monumenta Germaniae historica, Hannover 1921,12<br />
4 Karl Preisendanz, Monumenta Germaniae, in: Die Pyramide Nr. 6, Wochenschrift des<br />
Karlsruher Tagblatts vom 9. Februar 1919
VERLAUFSFORMEN DER MGH 161<br />
»Mächte der Zerstörung« gegenüber 5 ; Deutschland bedarf entsprechender<br />
Gedächtnisbunker (bis hin zum Leipziger Völkerschlachtdenkmal <strong>von</strong> 1913).<br />
Autoritätsbezogen schreibt sich auch die deutsche Historiographie: »Dieses<br />
Zeitgeschehen prägte und formte auch die deutsche Geschichtsschreibung, die<br />
sich nach dem Staate ausrichtete« 6 , jenem Vektor also, der - Hegel sagte es ausdrücklich<br />
- erst die raison d'etre der Organisation <strong>von</strong> Vergangenheit als<br />
<strong>Geschichte</strong> ist. 7 Die Opposition Ordnung versus Dekomposition als Frage der<br />
Archive begriffen zu haben, ist eine Leistung der MGH. Denn nicht nur die<br />
<strong>Geschichte</strong>, vor allem ihre Wissenschaft bedarf des Staates vice versa; »Der<br />
Staatsbegriff gilt der festen äußeren Fassung volkischen Lebens in den<br />
wechselnden Formen seiner geschichtlichen Bedingtheiten« .<br />
Die Verbindung <strong>von</strong> Staat und Schrift aber heißt zunächst nicht Historiographie<br />
oder Literatur, sondern Heraldik und Gesetz. 8 Die Aufnahme altgermanischer<br />
Gesetze und Formeln in die MGH hat 1820 Priorität <strong>für</strong> vom Stein 9 ; umgekehrt<br />
bedarf eine solche Edition der staatlichen Autorisierung: Keiner Gesellschaft in<br />
einem Lande werde es gelingen, eine hinreichende Kenntnis »des vorhandenen<br />
Quellenvorraths sich zu verschaffen, wenn sie nicht durch die Regierung autorisiert<br />
wird«. 10 Ein Jahrhundert später ist aus einem patriotisch-funktionalen<br />
Projekt seine positivistische Monumentalisierung geworden, und das heißt<br />
Autonomie; im Juli 1924 schreibt MGH-Präsident Paul Kehr in einer Eingabe<br />
an den Reichsminister des Innern: »Die Aufgaben der Monumenta Germaniae<br />
sind wissenschaftlicher Natur und hätten an sich mit der Staatsverwaltung nichts<br />
zu tun.« 11 Die positivistische Historie sieht ab <strong>von</strong> Geschichtsphilosophie als<br />
Totalitätshorizont der Forschung, ohne die sich die Signifikanten der Vergangenheit<br />
in der Tat nicht endgültig als historische Faktizität sichern lassen.<br />
»Nenne man das nun >histoire totales oder >Gesamtgeschichte
162 MüNUMENTA GHRMANIAE<br />
nicht einfach ><strong>Geschichte</strong>
VERLAUFSFORMEN DER MGH 163<br />
Medien auszutreiben, die bis dato walteten. 18 Kehr klagt in diesem Sinn die Ausrichtung<br />
heterogener Befunde, die Vektorisierung <strong>von</strong> Historiographie zur Allegorie<br />
des Nationalen ein. Der Bewegung der Freiheitskriege entsprangen einst<br />
die MGH, aus den Kämpfen um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Historische<br />
Kommission in München, »aber das Zeitalter der Reichsgründung und des Ausbaues<br />
des Reiches ist <strong>für</strong> die Historische Forschung fast unfruchtbar geblieben.«<br />
Es schreibt dies derselbe Kehr, der zu Beginn seiner Amtszeit als Direktor des<br />
Preußischen Historischen Instituts in Rom in diskreter Opposition ideologischer<br />
Vereinheitlichung komplexen Datenmaterials formuliert, man könne aus<br />
der geschichtlichen Überlieferung »nicht das herausschälen, was jeweils als<br />
national angesprochen wird, sondern man kann sie wissenschaftlich nur in ihrem<br />
ganzen Komplex erfassen«. 19 Was in der Gegenüberstellung der Zitate hier wie<br />
Dekonstruktion im Vollzug aussieht, verdankt sich vornehmlich den verschiedenen<br />
Adressen. Diese gegenstrebige Fügung charakterisiert auch die <strong>von</strong> der<br />
nationalsozialistischen Ideologie determinierten Ausführungen Engels, der seinerzeit<br />
neben einer deutsch-völkischen Mediävistik dennoch einfordert, »auch<br />
<strong>für</strong> das Mittelalter die deutsche <strong>Geschichte</strong> im europäisch-abendländischen Rahmen<br />
zu sehen«, und Quellenkritik anstelle <strong>von</strong> Deutung, nachdem er Seiten<br />
zuvor der »gänzlich wertfreien und voraussetzungslosen«, als liberal bezeichneten<br />
Geschichtsforschung und -Schreibung eine Absage erteilt hat . Die w'issensarchäologiscbe Praxis der Mediävistik ist nur mit Gewalt<br />
auf den Nenner einer ideologisierten <strong>Geschichte</strong> zu bringen.<br />
Der antiphilosophische, am Ende auch gegen Karl Lamprechts Kulturgeschichte<br />
gekehrte Affekt einer positivistischen Geschichtswissenschaft resultiert<br />
aus dem Rückzug diskreter Forschung gegenüber der Politik und<br />
korreliert so mit einer Bewegung, die nach dem Ende heilsgeschichtlicher Bindungen<br />
zur Archäologisierung im Umgang mit den Speichern der Vergangenheit<br />
führt. Wenn keine transzendenten, idealen Referenten - seien sie das<br />
Christentum oder die Nation - mehr Geschichtswissenschaft binden, zieht sie<br />
sich auf ihre Institutionen zurück: Akademien, Universitäten, Datenspeicher.<br />
Die historische <strong>Im</strong>agination des 19. Jahrhunderts leistet die nationale Totalisierung<br />
fragmentarischer Quellen erzähltechnisch durch die Rhetorik synekdochischer<br />
Integration des Einzelnen als Teil eines angenommenen Ganzen, als<br />
Textmaschine zur Integration und Einverleibung (Textcorpus) diverser Daten-<br />
18 Friedrich A. Kittler (Hg.), Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften.<br />
Programme des Poststrukturalismus, Paderborn / München / Wien / Zürich 1989, 8<br />
(»Einleitung«)<br />
19 Paul Kehr, Denkschrift über die Zukunft des Historischen Instituts in Rom (April<br />
1907), zitiert nach Elze/Esch (Hg.) 1990: 29ff
164 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
lagen. Deutschlands Geschichtsbewußtsein ist keine metaphysische Gabe, sondern<br />
ein Produkt diskursiver Strategien <strong>von</strong> Staat(en) im Singular und im<br />
Plural, die sich in Initiativen vom Schlag der MGH und ergänzender Institute<br />
bündeln:<br />
»Ausgehend <strong>von</strong> der Überzeugung, daß den Deutschen eine deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> fehle, daß die Vorbereitung und Herstellung einer solchen zur Annäherung<br />
und Verbindung zwischen den verschiedenen Staaten und Ländern Deutschlands<br />
höchstersprießlich, vor allem <strong>für</strong> den Staat, <strong>von</strong> dem das Werk ausgehend<br />
wirken möchte, daß jedoch durch die schon bestehenden Akademien der Zweck<br />
nicht erreicht werden könne, schlagen die Antragsteller die Bildung einer großen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong> vor, die sich indessen aus einer Anzahl <strong>von</strong><br />
Landesgesellschaften zusammensetzen soll. Keine <strong>von</strong> diesen Gesellschaften<br />
soll aber partikulare Landesgeschichte, sondern alle sollen allgemeine deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> betreiben.« <br />
Eine Anmerkung Bresslaus verrät an dieser Stelle, daß ein solch offenes Bekenntnis<br />
zum Geschichts- als Staatsinteresse im arcanum desselben, mithin also<br />
sein historiographisch blinder Fleck bleibt: Diese einleitenden Gedanken nämlich<br />
stehen nicht in dem eigentlichen Plan, wie er vom Stein mitgeteilt und <strong>von</strong><br />
ihm öffentlich verbreitet worden ist, sondern in dem Begleitschreiben, mit welchem<br />
der Plan dem Staatskanzler Hardenberg übersandt wird. 20<br />
Editionskrisen der MGH<br />
1873 publiziert die <strong>von</strong> Sybel herausgegebene Historische Zeitschrift eine vernichtende<br />
Kritik der neuesten MGH-Edition. 21 1887, lange nach der infolge<br />
dieser Krise erfolgten Reorganisation der MGH, schreibt sich eine völlig anders<br />
geartete Kritik durch Ottokar Lorenz, der nach sieben Jahren Mitarbeit <strong>von</strong><br />
Dümmler aus dem Stab der MGH entlassen worden ist, im Vorwort zum 2. Bd.<br />
der 3. Auflage seines Werks Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit<br />
der Mitte des 13. Jahrhunderts (Berlin 1887). Lorenz kritisiert darin die Darbietung<br />
einer nicht homogenisierten, sondern kritisch edierten »Fülle <strong>von</strong><br />
Redactionen, Emendationen und Ableitungen«; so bleibt dem Benutzer nichts<br />
übrig, »als selbst wieder eine Art <strong>von</strong> Vergleichung der >Texte< und >Recensionen<<br />
zu veranstalten« - modulare Lektüren also, die Vergangenheit<br />
als strukturierte Datenbank, nicht als kohärente Erzählung aus dem<br />
Speicher zur Verfügung stellt. »A short string of bare documents replaces all the<br />
20 Z. T. wörtlich abgedruckt in: Adolf Harnack, <strong>Geschichte</strong> der kgl. preußischen Akademie<br />
der Wissenschaften zu Berlin, Bd 1, Berlin (Reimer) 1900, 678f<br />
21 Karl Friedrich Stumpf, Über die Merovinger-Diplome, in: Historische Zeitschrift 29<br />
(1873), 343-407
VERLAUFSFORMEN DER MGH 165<br />
legend, nearly all the narrative« 22 ; (Gedächtnis-)Medieneffekte, konkret: der<br />
Rhythmus <strong>von</strong> Archivöffnungen (sowie Ausgrabungen) und die damit verbundenen<br />
Datenschwemmen triggern wissensarchäologische Verwerfungen.<br />
Als Niebuhr die zweite Ausgabe seiner Römischen <strong>Geschichte</strong> unternimmt,<br />
»hardly a stone of the first edition was left Standing. the whole work of<br />
Niebuhr went out of date with unprecedented speed« ; out ofdate meint<br />
hier Zeitpunkte wie Daten selbst. Kritische Edition als non-diskursiver Widerstand<br />
gegenüber narrativer closure aber ist genau, was Lorenz verstört; er sehnt<br />
sich nach jenen alten Quellenpublikationen <strong>für</strong> den Hausgebrauch, welche »ein<br />
<strong>für</strong> allemal mittheilen, woran sich ein geschichtsbeflissener Mensch recht und<br />
schlecht zu halten vermag«. Er nimmt daher lieber gewisse Überlieferungs-<br />
Unsicherheiten in Kauf nehmen, »wenn er auf dem Wege der kritischen Ausgaben<br />
schließlich ja überhaupt zu keinem Ende mehr kommen kann« . Verarbeitet ein Herausgeber die Abweichungen aller Rezensionen<br />
einer Quelle in eine Darstellung, ergibt das in der Tat zwar einen Standardtext<br />
ein <strong>für</strong> allemal, kontert Ludwig Weiland, doch »nur keinen authentischen«. 23<br />
Lorenz polemisiert gegen eine hyperkritische Philologie, welche »nach einem<br />
großen Papierkorb <strong>für</strong> das viele unnütze Zeug, was sich in Tausenden <strong>von</strong><br />
Handschriften findet«, verlangt; auch die historische Editionskunst fordere »die<br />
sorgfältigste Herbeischaffung und Drucklegung alles und jedes, was im Papierkorb<br />
der Vergangenheit steckt« . Die Rede ist also vom Archiv<br />
ebenso wie vom kulturellen Abfall. Die MGH geben Einblick in die Werkstatt<br />
der Historie als Forschung; ihre Pragmatik <strong>von</strong> Gedächtnisadministration ist<br />
immer schon ein Dementi jener Kohärenz, die der historische Diskurs als <strong>Im</strong>aginäres<br />
der Nation auf der literarischen Darstellungsebene zu stiften hatte.<br />
Lorenz aber kann »bei dem großen Nationalwerke der Monumenta Germaniae«<br />
gerade die deutsche Geschichtsordnung nicht länger erkennen:<br />
»Von Band zu Band ist weniger die Rede geworden <strong>von</strong> einer eigentlichen Ordnung<br />
des zusammengehörigen Materials. Es ist ja geradezu unglaublich, in welcher<br />
ganz zufälligen Aufeinanderfolge die Quellen aneinander gereiht sind. Weder ein<br />
geographischer, noch ein chronologischer Faden führt uns durch das Labyrinth die-<br />
22 Lord Acton, zitiert aus seinem Nachlaß (Add. 5011, 339) durch: Herbert Butterfield,<br />
Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship, Cambridge<br />
(University Press) 1955, 76. Butterfield zementiert seinen Fließtext durch die begleitenden<br />
Notizen Actons im Anmerkungsapparat, die in ihrem non-diskursiven<br />
Staccato Historiogramme darstellen. Heute ist eine direkte Lesung dieser Notizen<br />
möglich, unter weitgehendem Verzicht auf ihre narrative Paraphrase in der Beobachtung<br />
zweiter Ordnung durch Butterfield.<br />
23 Ludwig Weiland, Quellenedition und Schriftstellerkritik, in: Historische Zeitschrift<br />
58, München / Leipzig 1887, 310-335 (328)
166 MONUMENTA GERMANIAE<br />
ser aus den Mappen der Mitarbeiter haufenweise zusammengelegten Materialien.<br />
Nord und Süd, italienische und slavische, geistliche und weltliche Teritorien wechseln<br />
kaleidoskopisch in diesen großen ungelenken Folianten.« <br />
Weiland nennt demgegenüber den Gesichtspunkt, der <strong>von</strong> Anfang an bei der<br />
Auswahl der Quellen maßgebend war: alles, »was an geschichtlichen Aufzeichnungen<br />
auf dem Boden des alten <strong>Im</strong>perium entstanden ist« . Die Reihenfolge der Quellen ist in der Edition chronologisch nach dynastischen<br />
Perioden geordnet (karolingisch, sächsisch, salisch, staufisch) und setzen<br />
mit den Annalen ein; es folgen die »Chroniken und <strong>Geschichte</strong>, welche zum<br />
Theil noch die annalistische Form beibehalten.« 24 Diese Seriation impliziert also<br />
ihrerseits eine historiographische Genealogie, die alternativ als Ruptur zwischen<br />
den Aufschreibeordnungen Annalistik und Historie beschreibbar ist. Lorenz<br />
vermißt gerade ob der in der Gedächtnisdatenverwaltung der MGH praktizierten<br />
Diskretion einen »durchgreifenden Gesichtspunkt«, denn genau dies<br />
heißt Aktualisierung der Vergangenheit abzüglich der historischen Erzählung.<br />
Das Echo Weilands nennt jene Ordnung, die alle Historien dementiert:<br />
»Überhaupt, welches Princip der Ordnung könnte ein durchschlagendes genannt<br />
werden, außer etwa das alphabetische? Und welchen Vortheil verspricht man sich<br />
etwa <strong>von</strong> der Anwendung eines formalen Ordnungsprincips? Behält man dadurch<br />
etwas besser im Gedächtnis, in welchem <strong>von</strong> zwanzig Bänden eine Quelle steht?«<br />
<br />
Neben der zeitlichen gelten auch räumliche Grenzüberschreitungen. Was definiert<br />
die deutsche Nation als Gedächtnisraum? Die MGH-Reihe der Scriptores<br />
inkorporiert zahl- und umfangreiche Exzerpte aus französischen, englischen<br />
und nordischen Geschichtsquellen, »wodurch die Monumenta Germaniae das<br />
in ihrem <strong>Namen</strong> liegende Arbeitsfeld überschritten, ja geradezu verlassen hätten«<br />
25 . Damit gilt der Name der MGH als Sortierung <strong>für</strong> deutsches Gedächtnis.<br />
Michael Tangl entgegnet später, daß lediglich im 29. Bd. der Scriptores<br />
Auszüge nordischer, polnischer und ungarischer Quellen abgedruckt sind; gelegentlich<br />
hat sich Mommsen abschätzig über den wissenschaftlichen Vollwert<br />
solcher Auszüge geäußert. Um dem Anspruch einer Handreichung der <strong>für</strong> die<br />
deutsche <strong>Geschichte</strong> wichtigen italienischen Quellen sicherzustellen, wäre<br />
tatsächlich die gesamte Edition Murartoris im Maßstab 1:1 in den MGH mit-<br />
24 w_ Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 5. Aufl. I, 25, hier<br />
zitiert nach: O. Holder-Egger, Die Monumenta Germaniae und ihr neuester Kritiker.<br />
Eine Entgegnung, Hannover (Hahn) 1887, 5<br />
25 Michael Tangl, Wilhelm Gundlach und sein Angriff auf die Monumenta Germaniae<br />
historica, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung (Ausgabe München), 4. April 1903,<br />
26-28 (26)
VERLAUFSFORMEN DER MGH 167<br />
abzudrucken. Archivische Datenbanken verfügen über kein systeminternes<br />
Kriterium der Selektion; erst die nationalhistoriographische Perspektive ermöglicht<br />
Abkürzung <strong>von</strong> Gedächtnislandschaften in Zeichen, ist damit aber dem<br />
Flottieren politischer Gebilde ausgeliefert: Nie habe jemand daran gedacht, daß<br />
man sich auf Deutschland in den Grenzen <strong>von</strong> 1820 oder 1864 oder 1866 oder<br />
1870 beschränken müsse, »was die lächerliche Folge gehabt hatte, daß man jetzt<br />
keine österreichischen Quellen mehr publicieren dürfe, da<strong>für</strong> aber die <strong>von</strong><br />
Preußen und Posen, Schleswig und Elsaß-Lothringen nachtragen müßte«<br />
. Lorenz verblüfft seine Fachkollegen durch die<br />
Aussage, daß die Abfassungszeit einer Geschichtsquelle <strong>für</strong> ihre Wertschätzung<br />
so gut wie gleichgültig sei, »die Zeitentfernung eines Schriftstellers <strong>von</strong> den <strong>von</strong><br />
ihm beschriebenen Ereignissen«. Gleichzeitigkeit (die Gedächtniszeit des<br />
Archivs) »gibt an sich gar keine Bürgschaft <strong>für</strong> die Glaubwürdigkeit einer<br />
Nachricht« . Kennt Ranke damit potentiell die <strong>Geschichte</strong><br />
des 16. Jahrhunderts besser als Guicciardini, Mommsen die Römische besser<br />
als Livius? Für Lorenz ist »das Gesetz des gescheidteren Mannes« die Provokation<br />
der historiographischen Ordnung 26 , ein Effekt der philologisch-kritischen<br />
Synchronisation:<br />
»Die heutige Quellenkritik lenkt alle ihre Aufmerksamkeit auf die Feststellung der<br />
Herkunft, beziehungsweise auf die Priorität der Ueberlieferung. In die<br />
geschichtlichen Arbeiten ist eine ganz mechanische Anwendung der Gleichzeitigkeitsfrage<br />
eingedrungen . <strong>Im</strong> ganzen und großen betrachtet, muß man als feststehend<br />
ansehen, daß der spätere Berichterstatter eine Sache besser weiß oder<br />
wenigstens wissen kann, als der frühere.« <br />
Unter dieser polemischen Perspektive löst sich Geschichtsschreibung in der Tat<br />
zugunsten einer modularen Konfiguration <strong>von</strong> Archiveinheiten auf; so habe es<br />
»nur einen sehr untergeordneten Werth festzustellen, ob ein Schriftsteller eine<br />
Nachricht aus gleichzeitiger oder abgeleiteter Quelle genommen hat«. Denn die<br />
Gegenwart ist selbst schon wie ein Archiv strukturiert:<br />
»Was man gewöhnlich unter den Gesichtspunkten der Entlehnung bei einem<br />
Historiker lobt und tadelt, beruht meist auf gänzlicher Verkennung der Ueberlieferung.<br />
Entlehnen, abschreiben, ausziehen, compiliren? - ja was thut denn überhaupt<br />
ein Geschichtsschreiber anderes als abschreiben? Erfindet er etwa die<br />
Nachrichten? ist er ein Dichter oder Seher?« <br />
Albert Brackmann spricht später, in seiner Rezension <strong>von</strong> Ernst Kantorowicz<<br />
Monographie Kaiser Friedrieb der Zweite (1927), <strong>von</strong> mythischer<br />
26 »Wir waren bisher anderer Meinung«: W. Wattenbach, über O. Lorenz* Vorrede des<br />
zweiten Teils <strong>von</strong> Deutschlands Geschichtsquellen in der zweiten Hälfte des Mittelalters,<br />
in: Neues Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> Ältere Deutche Geschichtskunde 13, Heft<br />
2 (1888), 251-258 (256)
168 MüNUMENTA Gl-RMANIAE<br />
Schau. 27 Das Archiv schreiben aber heißt, seine Elemente diskret zu rekonfigurieren.<br />
Nach den Grundsätzen dieser Quellenkritik würde man zu dem<br />
Absurdum gelangen, daß selbst Historiker wie Ranke und Sybel zum Teil keine<br />
eigenen Nachrichten lieferten; »vieles haben sie sogar aus den Dokumenten der<br />
Archive abgeschrieben, folglich braucht man diese Schriftsteller nicht, man<br />
gehe und suche nur die Dokumente und alten Zeitungsblätter auf; da fließen<br />
ja die gleichzeitigen Quellen!« . Damit korrespondiert<br />
Lorenz' Zustandsbeschreibung der Lage deutscher Geschichtsschreibung am<br />
Ausgang des Mittelalters, Mitte des 13. Jahrhunderts, wo der Verfall der kaiserlichen<br />
Zentralmacht und die Reichsauflösung mit einer Regionalisierung<br />
der Geschichtsschreibung, einer »territorialen Auffassung der <strong>Geschichte</strong>«<br />
nicht nur geographisch, sondern auch hinsichtlich der Diskursmodi<br />
korrespondiert:<br />
»Wer damals ein Buch copirte, um ein Exemplar da<strong>von</strong> zu besitzen, der glaubte<br />
auf den Inhalt desselben ein größeren Anrecht zu haben, als wir auf den Inhalt<br />
eines gedruckten Buches . Daraus ergibt sich das interessante Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Schreiben und Abschreiben, <strong>von</strong> Schriftsteller und Schreiber . Ein starkes<br />
Beispiel da<strong>für</strong> ist der Chronist Witte in Liesborn, der die Reisen, welche er in<br />
seiner Quelle fand, <strong>von</strong> sich selbst erzählt. Berechnete man die Kosten des<br />
Materials und den Zeitaufwand der mechanischen Arbeit, so trat der Begriff des<br />
litterarischen Eigenthums völlig in den Hintergrund.« 28<br />
Zunächst gilt dieser Kopier- als Übertragungsmodus implizit auch <strong>für</strong> den Forscher<br />
im Archiv. Schrift wird hier als Medium begriffen, das nicht hinter <strong>Geschichte</strong><br />
verschwindet, sondern sie hervorbringt:<br />
»Instructiv ist das Explicit der Dresdner Martinushandschrift im NA. V, 151, wo<br />
>scripta< nur Von der mechanischen Thätigkeit Jacobs <strong>von</strong> Mainz verstanden werden<br />
kann; zweideutig ist auch der Ausdruck im Französischen . Scribere heißt<br />
zunächst nicht Schriftstellern, sondern mit der Feder manipuliren. Erst in übertragener<br />
Bedeutung bezieht es sich auf den Autor.« <br />
Auch unter den gelehrten Arbeiten der Minoriten findet sich unter dem Einfluß<br />
der Scholastik kaum eine solche, »die <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> im engern Sinne<br />
berechnet wäre« - das Kalkül prähistoriographischer Zeitverarbeitung.<br />
Stilistische Diskursivität macht die Differenz zwischen der Kompilierung<br />
(sampling) <strong>von</strong> Quellenzitaten und Historiographie (Erzählung).<br />
27 Siehe dazu Heinz-Dieter Kittsteiner, Von der Macht der Bilder. Überlegungen zu<br />
Ernst H. Kantorowicz' Werk »Kaiser Friedrich der Zweite« in: Cornelia Vismann /<br />
W. E. (Hg.), Geschichtskörper. Zur Aktualität <strong>von</strong> Ernst H. Kantorowicz, München<br />
(Fink) 1998<br />
28 Ottokar Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 1. Bd., 3. Aufl. Ber-<br />
lin (Hertz) 1886, Einleitung, 4 f
VERLAUFSFORMEN DER MGH 169<br />
Lorenz beschreibt die Kybernetik <strong>von</strong> Geschichtsschreibung als Feedback-<br />
Schleife zwischen Darstellung und Datenbank:<br />
»Wenn jene Documente dazu dienen können, den Schriftsteller,<br />
der sie benutzt oder nicht benutzt hat, zu berurtheilen und zu controliren, so<br />
wird doch in erster Linie bei diesen Betrachtungen nicht die Gleichzeitigkeit, sondern<br />
die Natur und der Charakter der benutzten Quellen das Entscheidende sein.<br />
Die Abstammung einer Nachricht kann in der <strong>Geschichte</strong> nur in Rücksicht<br />
auf den Zeugen, aber nicht auf die Zeit <strong>von</strong> Interesse sein. Die gesammte Geschichtsschreibung<br />
beruht daher nicht auf dem Prinzip der Gleichzeitigkeit der<br />
Quellen und Nachrichten, sondern darauf, dass die Ueberlieferungen <strong>von</strong> gewissen<br />
Thatsachen <strong>von</strong> einem in der Sache überlegenen Verstand geprüft worden sind.<br />
Diese Eigenschaften sind nun bei mittelalterlichen Schriftstellern zwar nicht<br />
häufig, aber sie fehlen keineswegs, und sie bilden auch hier die einzigen Leitsterne<br />
in dem Labyrinth <strong>von</strong> Nachrichten und Quellen.« <br />
Zur Verhandlung steht der unauflösbare Widerstreit <strong>von</strong> diskreter Gedächtnisarchäologie<br />
versus synthetisierender Historie.<br />
<strong>Im</strong> Februar 1903 folgen weitere diesbezügliche Angriffe auf die Editionspraxis<br />
der MGH <strong>von</strong> Seiten Gundlachs im Grenzboten, auf die Michael Tangl unter<br />
Rückverweis auf die 1887er Krise antwortet. Tangl ist in seinen Wiener Jahren<br />
seit 1891 Mitarbeiter der MGH-Edition <strong>von</strong> Karolingerdiplomen, wo er in seinen<br />
Untersuchungen die kritischen Probleme, <strong>von</strong> denen er handelte, mit Fragen<br />
der politischen und kirchlichen <strong>Geschichte</strong> in Beziehung setzt. »Dadurch wird<br />
das antiquarische Moment, das in quellenkundlicher Arbeit naturgemäß nicht<br />
fehlt, in den seinigen doch immer wieder zurückgedrängt.« 29 Denn Historiographie<br />
heißt die diskursiv aufgeladene Verflüssigung eines diskreten Datensatzes<br />
vom Schlage der MGH. Die Differenz der Gedächtnisästhetik liegt in ihrer<br />
Adressierung, zwischen den Vektoren Forschung (diskrete Daten-Monumente<br />
verlangend) versus öffentliche Darstellung (Interpretation, also Dokumente<br />
lesend). 1893 macht Tangl auf einer Tagung der Philologen- und Schulmännerversammlung<br />
in Wien den Vorschlag, ein Gymnasial-Lesebuch <strong>von</strong> Quellen<br />
altdeutscher <strong>Geschichte</strong> mit Auszügen der MGH einzuführen. 1813 publizierte<br />
in diesem Sinne Fr. <strong>von</strong> Raumer ein Handbuch merkwürdiger Stellen aus den<br />
lateinischen Geschichtsschreibern des Mittelalters, und die <strong>Geschichte</strong> der<br />
Hohenstaufen (1824) »gab das Beispiel einer lebendigen Benutzung der Quellen,<br />
einer auf Leben, Verfassung, Sitte eingehenden Darstellung, welche nicht <strong>für</strong> den<br />
Gelehrten allein geschrieben ist« 30 .<br />
29 E. E. Stengel, Nachruf auf Michael Tangl, in: Historische Zeitschrift 125, München /<br />
Berlin 1922, 372-375 (374f)<br />
Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten<br />
Jahrhunderts, 2 Bde, hier Bd. I, 3. umgearbeitete Auflage, Berlin (Wilhelm<br />
Hertz) 1873, 25
170 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Das Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom birgt den Nachlaß<br />
seines ehemaligen Mitarbeiters Philipp Hiltebrandt. Dessen Lebenserinnerungen<br />
nennen Gründe <strong>für</strong> die Erschöpfung der Geisteswissenschaften an deutschen<br />
Universitäten (und <strong>für</strong> seine eigene Abwendung <strong>von</strong> der Geschichtsforschung<br />
zugunsten des Journalismus) - die Konzentration auf die gedächtnistechnische<br />
Verarbeitung <strong>von</strong> Datensätzen der Vergangenheit zuungunsten hermeneutischinterpretierender<br />
Operationen. Die Datenästhetik der Experimental- und Laborwissenschaften<br />
schließt sich kurz mit der diskreten Gedächtnisadministration<br />
der MGH:<br />
»Es war nicht nur eine gewisse Erschöpfung in der Behandlung der nun so unzählige<br />
Male behandelten Fragen eingetreten und es hatten sich nicht nur viele begabte<br />
junge Leute, die früher den Geisteswissenschaften zugetan gewesen wären, den<br />
grössere Aussichten bietenden Natur-Wissenschaften, der Medizin und der Technik,<br />
zugewandt; das Schlimmste war, dass die Naturwissenschaften selber in die<br />
Geschichts-Wissenschaft eindrangen und hier vielfach massgebend wurden, was<br />
einen mehr oder weniger starren Determinismus ergab. In der >geopolitischen<<br />
Auffassung gewann ein physikalisches, in der rassentheoretischen ein biologischzoologisches<br />
Princip Raum. Aber nicht weniger verhängnisvoll war das Eindringen<br />
des technischen Geistes, der die <strong>Geschichte</strong> als Wissenschaft allein auf die<br />
Editions-Technik mit Hilfe der Paläographie und Diplomatik oder mit anderen<br />
Worten auf das Handerksmässige beschränken wollte und da aufhörte, wo<br />
die <strong>Geschichte</strong> erst recht eigentlich anfängt. In die Editions-Institute, wie die<br />
Monumenta Germaniae, die die geschichtliche Ueberlieferung über das Deutsche<br />
Volk bis zum Ende der ersten Hälfte des Mittelalters enthalten, war vollends der<br />
Geist Wagners im goetheschen Faust eingezogen; um geistige Oede und Dürre in<br />
Hochkultur kennen zu lernen, brauchte man nur einmal einen Bier-Abend der<br />
>Monumentalisten< zu besuchen, wo <strong>von</strong> kaum etwas anderem als <strong>von</strong> >Varianten<<br />
und >Konjekturen< gesprochen wurde.« 31<br />
Der Berliner Historiker Hans Delbrück, bei dem Hiltebrandt studierte, berief<br />
sich demgegenüber auf Ranke: »Ohne Zusammenfassung bleibt die Historie<br />
Stückwerk«. Seine Kriegsgeschichte war entsprechend als Universalgeschichte<br />
konzipiert, im Gespür <strong>für</strong> das, was universale Kriterien <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> bereitstellen.<br />
Hiltebrandt übernimmt <strong>von</strong> Delbrück die »Neigung <strong>für</strong> die historische<br />
Synthese«; weitere Inspiration erhält er <strong>von</strong> Max Lenz (der <strong>Lehrstuhl</strong>nachfolger<br />
Heinrich <strong>von</strong> Treitschkes), <strong>von</strong> dem er hört, zum darstellenden Historiker gehöre<br />
in allererster Linie »die historische Phantasie; um aber auf dem Boden der Tatsachen<br />
zu bleiben, muss sie durch das Sieb der historischen Kritik gegossen<br />
werden«. 32 Eine weitere Fassung <strong>von</strong> Hiltebrands Lebenserinnerung faßt es in<br />
31 Archiv des Deutschen Historischen Instituts Rom, Nachlaß Ph. Hiltebrandt, Nr. 1:<br />
»Hiltebrandt, Philipp: Lebenserinnerungen, 1. Fassung (Tintennumerierung), Maschinenskripte«,<br />
Bl. 66f<br />
32 Ebd., Nachlaß Hiltebrandt, Nr. 4: Lebenserinnerungen, 2. Fassung, Bl. 81 u. 84
VERLAUFSFORMEN DER MGH 171<br />
anderen Worten: Die Geschichtsschreibung habe eine Richtung eingeschlagen,<br />
»die man als die des >Technizismus< bezeichnen« könne. Universal-<strong>Geschichte</strong>n,<br />
»die nicht nur Kompilationen waren«, traut er nur noch Ranke, Delbrück und<br />
Lamprecht zu; kompilierten Weltgeschichten fehlt »das geistige Band«:<br />
»Schliesslich verbreitete sich eine Richtung, die in Urkunden-Lehre, Diplomatik<br />
Paläographie und in der Editions-Technik das eigentliche Wesen der Geschichtswissenschaft<br />
erblickte: der Hilfs-Wissenschaftler suchte sich an die Stelle des wirklichen<br />
Historikers, der Handwerker an die Stelle des Architekten zu setzen. Die<br />
Folge dieser Entwicklung war, dass die zusammenfassenden Werke <strong>von</strong> Nicht-<br />
Historikern, wie Steward Houston Chamberlain (>Grundlagen des XX. Jahrhunderts^<br />
und Oswald Spengler geschrieben wurden, und dass Emil Ludwig mit<br />
seinen Biographien, die eine Zwitter-Bildung zwischen <strong>Geschichte</strong> und Roman<br />
darstellten, den Markt beherrschte.« 33<br />
Die Konjunktur des historischen Romans ist also ein Retro-Effekt, die diskursive<br />
Kompensation diskreter, non-diskursiver Gedächtnisarchäologie und des<br />
<strong>von</strong> ihr eröffneten, aber nicht besetzten Raums der <strong>Im</strong>agination.<br />
Die MGH im Speichermedienverbund<br />
Die MGH sind weniger das Produkt eines historischen Sinns, sondern einer<br />
Organisation. Ein Jahrhundert nach vom Stein denkt der Historiker und Wissenschaftspolitiker<br />
Paul Kehr diese Funktionalität <strong>von</strong> Diskursstiftung als institutionellen<br />
Verbund weiter. Ein mitten im Ersten Weltkrieg (April 1917)<br />
gefaßter Beschluß, die zum 20. Januar 1919 anstehende Jahrhundertfeier in einer<br />
<strong>Geschichte</strong> der MGH zu manifestieren, führt zu Kriegsende unter verkehrten<br />
historischen Vorzeichen (Geburt der MGH aus den deutschen Befreiungskriegen<br />
1806-1815) dazu, daß ihr Autor Harry Bresslau im Sommer 1919 dieses<br />
Werk »in aller Muße« fertigstellen kann; jede Feier war vor dem Hintergrund<br />
der Lage im Januar 1919 unversehens ausgeschlossen. Bresslau hat seine <strong>Geschichte</strong><br />
der MGH also in den Raum einer diskursiven Leere geschrieben. 34 Wissenschaftspolitiker<br />
aber bürgen <strong>für</strong> Kontinuität über solche Rupturen hinweg.<br />
Kehrs Nachlaß in jenem Archiv, das er selbst einmal dirigierte (das Geheime<br />
Staatsarchiv in Berlin), sagt es in einem Schreiben vom 25. April 1922, adressiert<br />
an einen Berliner Staatssekretär. Nach und nach, »offenbar einer natürlichen<br />
Sendung folgend«, habe sich in seiner Hand eine Reihe historischer Forschungs-<br />
33 Ebd. Nr. 5, Lebenserinnerungen, 2. Fassung, Bl. 4<br />
34 Harry Bresslau, autobiographischer Aufsatz, in: Sigfrid Steinberg (Hg.), Die Geschichtswissenschaft<br />
der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 2, Leipzig 1926, 1-55<br />
(47)
172 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
institute vereinigt: zum Preußischen Historischen Institut in Rom zunächst das<br />
Kaiser-Wilhelm-Institut <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong>, dem sich später die Monumenta<br />
Germaniae anschlössen, und das »nicht zufällig. Denn diese Institute<br />
gehören ihren Aufgaben nach durchaus zusammen. Wenn es mir gelänge,<br />
diese Verbindung aus einer persönlichen zu einer organischen u. dauernden zu<br />
machen«, würden aus non-diskursiven Verschaltungen Körper, Korporationen<br />
im Sinne geschichtsdiskursiver Kopplung. 35 Erst wenn die institutionelle Physik<br />
<strong>von</strong> Gedächtnisagenturen in metaphysischer Verkennung (oder im Anschluß<br />
an juristische Fiktionen 36 ) als Organismen metaphorisiert wird, ist ihren Datenbanken<br />
<strong>Geschichte</strong> statt reinem Gedächtnis abzuringen, die durch einheitliche<br />
Kanäle zusammengehalten wird; Kehr fordert <strong>für</strong> den Verbund deutscher<br />
Geschichtsinstitute ein »gemeinsames Lokal, eine gemeinsame Bibliothek u.<br />
gemeinsame Hilfsmittel« . Das Kultusministerium wünschte die Unterbringung<br />
des geplanten Superinstituts in der Berliner Staatsbibliothek; »das Berliner<br />
Depot des römischen Instituts steht noch auf dem Papier« . Eine<br />
Unterbringung im Neubau des Geheimen Staatsarchivs Berlin-Dahlem dagegen<br />
würde sie isolieren, fern <strong>von</strong> allen gelehrten Verbindungen ähnlicher Art »Vox<br />
clamantis in deserto« . So sehr beruht gelehrter Diskurs noch auf dem<br />
Medium der persönlichen Konversation entgegen der Möglichkeit technischen<br />
Informationsaustauschs und Datentransfers. Kehr muß zugestehen, daß die Personalunion<br />
des Generaldirektoriums der Staatsaarchive mit der Leitung jener<br />
Institute noch »keine organische Verbindung« darstellt, beharrt aber auf der<br />
Archivanbindung, um dort junge Leute <strong>für</strong> seine Institute ausbilden zu können:<br />
hinsichtlich des Nachwuchses ist das Gebiet der mittelalterliche Geschichtsforschung<br />
»völlig bankrott«. Kehrs Diktion legt es nahe, daß im Archiv nicht<br />
Historiker, sondern Gedächtnistechniker ausgebildet werden: Er kann »mit dem<br />
jetzt noch vorhandenen Material nicht eine einzige Archivarstelle und auch<br />
keine Assistentenstelle, sei es am römischen Institut, sei es bei den Monumenten,<br />
besetzen« . Objektorientiert formatieren die MGH deutsche <strong>Geschichte</strong><br />
tatsächlich als Feldforschung im Archiv; der logistische Kopf der<br />
Edition bildet die Schnittstelle zum Medium Bibliothek. Die 48. ordentliche<br />
Hauptversammlung der Zentraldirektion der MGH findet am 9. März 1925<br />
im neuen Sitz der MGH Berlin, Charlottenstraße 41, statt; sie ist so »in ihre alte<br />
und natürliche Residenz zurückgekehrt«, die sie einst unter G. H. Pertz inngegehabt<br />
hat, zu dessen Zeiten ihnen ein eigenes Zimmer in der damaligen<br />
Königlichen Bibliothek eingeräumt worden war. 37 Bei der Reoganisation der<br />
35 NL Kehr C 8 = Bl. 131 (handschriftlich)<br />
36 Siehe Ernst H. Kantorowicz,.The King's Two Bodies, Princeton 1957<br />
37 Paul Kehr, Bericht über die Herausgabe der Monumenta Germaniae historica 1924,<br />
Sitzungsberich. phil.-hist. Kl. 1925 (Akademie der Wissenschaften Berlin), 118
VERLAUFSFORMEN DER MGH 173<br />
Zentraldirektion 1875 hatte sich diese Anbindung nicht aufrechterhalten lassen;<br />
seit 1894 erhalten die MGH im Reichsversicherungsamt Lokal, allerdings <strong>von</strong><br />
dem Zentrum ihrer Arbeiten, der großen Bibliothek, weit entfernt. Nach der<br />
Zuweisung <strong>von</strong> Räumen in der Staatsbibliothek (mit eigenem Zugang) stehen<br />
die MGH in einem supplementären Verhältnis zum buchbasierten Gedächtnis<br />
- als habe der Architekt sie <strong>von</strong> Anfang an <strong>für</strong> die Monumenta bestimmt. Darunter<br />
vor allem »einen großen Bibliotheksaal, der in unmittelbarer Verbindung<br />
mit den Katalogsälen der Staatsbibliothek steht« , als direktes<br />
Interface zum Gedächtnis der Bibliothek. Der Nachkriegssitz der MGH in der<br />
Münchener Staatsbibliothek setzt diese logistische Situation fort.<br />
Ernst H. Kantorowicz, Albert Brackmann, die MGH und die Integrität<br />
archivgestützter Historiographie nach 1933<br />
Fungierte das institutionelle Monument MGH im spezifisch politischen Kontext<br />
der Herrschaft des Nationalsozialismus als Bunker passiven Widerstands, als eine<br />
Art katechon gegenüber der Vereinnahmung durch totalitäre Ideologien? 38<br />
Einem im Februar 1939 abgeschlossenen geheimen Dossier der SS-Wissenschaftsorganisation<br />
Ahnenerbe entnimmt Fuhrmann, daß gerade die Monumenta<br />
Germaniae Anstoß erregten: Hier vornehmlich seien jüdische Gelehrte tätig,<br />
»trotz einer neuen Zeit«. Kontinuitäten der MGH über 1945 hinweg: Nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg konnte die Arbeit »ohne die in anderen Fächern häufig tiefgreifende<br />
Unterbrechung fortgesetzt werden«, auch an Büchern, »die während<br />
der Zeit des Nationalsozialismus entstanden, aber <strong>von</strong> seinem Geist unbeeinflußt<br />
geblieben waren«. 39 Die Praxis im Verhältnis <strong>von</strong> Kantorowicz zu den MGH<br />
heißt zunächst Quellenedition, eine Kopplung seines historischen Feldes, die Zeit<br />
der Staufer. Der Jahresbericht 1932 verkündet es: »Eine längst notwendige neue<br />
Ausgabe der Annales Piacentini Gibellini nach der Londoner Handschrift will<br />
38 Am Beispiel des aufgrund seiner Kritik am Nationalsozialismus 1935 vom Lehrbetrieb<br />
an der Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität ausgeschlossenen, seit 1934 im<br />
Verborgenen der MGH arbeitenden Mediävisten Carl Erdmann: Kaspar Elm, Mittelalterforschung<br />
in Berlin, in: Reimer Hansen / Wolfgang Ribbe (Hg.), Geschichtswissenschaft<br />
in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert. Persönlichkeiten und Institutionen,<br />
Berlin / New York (de Gruyter) 1992, 211ff (233)<br />
39 Fuhrmann 1987: 268. So konserviert die Arbeit der MGH »in der Stellung eines<br />
modernen Vivarium« das »geistige Erbe des Abendlandes über die Kriege der Gegenwart«<br />
hinweg - Tradition als »ununterbrochener« Datentransfer: Monumenta Germaniae<br />
Historica. Dienststelle Pommersfelden 1945-48, Höchstadt (Mens) [= Otto<br />
Meyer, Berichte an die Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica <strong>für</strong> die<br />
Zeit vom Kriegsende bis zum 31. März 1948], Vorbemerkung u. 15
174 • MONUMENTA GERMANIAE<br />
Herr Dr. Ernst Kantorowicz übernehmen und damit seiner >stillen Liebe< zu den<br />
Monumenta Germaniae offnen Ausdruck verleihen« 40 - Sanctus amor patriae,<br />
eine Paraphrase <strong>von</strong> Kantorowicz< eigenen Worten. 41 Das aber heißt zunächst<br />
Leihverkehr <strong>von</strong> Urkunden. Als Anlage zu einem Brief der Öffentlichen Studienbibliothek<br />
in Salzburg vom 26. Februar 1931 an die Zentraldirektion der<br />
MGH etwa trifft die Handschrift V.3.B.19 »auf Veranlassung« <strong>von</strong> Ernst Kantorowicz<br />
ein. Durch die Übernahme einer ordentlichen Professur in Frankfurt/M.<br />
geriet dieses Editionsprojekt ins Stocken. 42 Diskurs und Daten der<br />
Historie (<strong>Geschichte</strong> als Text und als Anmerkungsapparat) im Widerstreit: Nur<br />
da könne die George-Schule die Ziele der Wissenschaft den eigenen gleichsetzen,<br />
»wo diese gewillt ist, die Kluft zwischen Wahrheit und Nation zu schließen, und<br />
eindeutig, mit vollem Bewußtsein und innerster Berechtigung als Losung den<br />
Wahlspruch der Monumenta auf ihre Fahnen setzen darf: Sanctus amor patriae<br />
dat animum.« 43 Ernst H. Kantorowicz hinterfragt das Infragestellen des nationalen<br />
Momentes als <strong>Im</strong>puls <strong>von</strong> Geschichtsschreibung, worunter weder nationalistisches<br />
Gepolter noch vaterländische Schönfärberei zu verstehen sei. Was er<br />
meint, ist das bruchartige Auseinanderfallen <strong>von</strong> Nationalitäts- und Wahrheitsgefühl:<br />
»Ich wies bereits darauf hin, daß die positivistische Stellungnahme es<br />
eigentlich auch ausschlösse, daß man als Deutscher - sofern damit ein wirklicher<br />
Glaube an etwas wie eine deutsche Sendung, an Deutschland überhaupt verknüpft<br />
ist - <strong>Geschichte</strong> schreiben könne« .<br />
Deutsche Kaiserreichsgeschichte ist ohne italienische Quellen zu Friedrich II.<br />
unschreibbar . Dem hat Wattenbach entgegengesetzt, daß zwar<br />
viele der z. T. in den MGH edierten italienische Quellen die Zeit Friedrichs II.<br />
berühren; die meiste Literatur aber stehe »völlig außerhalb jeder Beziehung zu<br />
den deutschen Geschichtsquellen, und wir wenden uns nun nach dieser Abschweifung<br />
wieder nach Deutschland zurück« . Die Kaisergeschichte<br />
<strong>von</strong> Friedrich II. wird metonymisch auf Deutschland hin registriert.<br />
Ein Halbsatz im Vorwort zum Ergänzungsband (1931) <strong>von</strong> Ernst H. Kantorowicz<<br />
Monographie Kaiser Friederich der Zweite (1927) insistierte gegenüber dem<br />
40<br />
Paul Kehr, Bericht über die Herausgabe der Monumenta Germaniae Historica 1929,<br />
in: Neues Archiv, 49. Bd., Berlin 1932, iv<br />
41<br />
Ernst Kantorowicz, Berlin, 15. März 1930, an Paul Kehr. Geheimes Staatsarchiv Preußischer<br />
Kulturbesitz Berlin, Rep. 92 (HA I), Nachlaß Paul F. Kehr, AI 6 Lit., ka-ke, fasc.<br />
»Prof. Dr. Ernst Kantorowicz«, Blatt 112<br />
42<br />
Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Rep. 338, MGH<br />
Titel 2 Nr. 52<br />
43<br />
Ernst H. Kantorowicz, Über Grenzen, Möglichkeiten und Aufgaben der Darstellung<br />
mittelalterlicher <strong>Geschichte</strong> (Rede auf dem deutschen Historiker-Tag in Halle, 24.<br />
April 1930), abgedruckt in: Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft 16: Kantorowicz,<br />
Wien 1992,. 5-10, hier: 10
VERLAUFSFORMEN DER MGH 175<br />
folgenden gelehrten Anmerkungsapparat noch auf der Suprematie des historischen<br />
Bildes; in der Nachkriegsauflage läßt Kantorowicz genau diesen Begriff<br />
(und sonst nichts) streichen. 44 Günther Wolf spricht - den Riß zwischen dem<br />
Buch <strong>von</strong> 1927 und dem Ergänzungsband skizzierend - <strong>von</strong> einer im ganzen<br />
nicht überholten Biographie, »die auch in Details noch heute eine wahre Fundgrube<br />
- besonders im Ergänzungsband - darstellt«. 45 Was bleibt und als wissensarchäologisches<br />
Monument überdauert, sind Datenlagen; zur Verhandlung steht<br />
ihre Interpretation.<br />
»Wenn wir dennoch ein paar Worte noch anfügen so geschieht dies, weil wir glauben,<br />
nicht ohne ein bekennendes Wort lediglich in der Editionstätigkeit verharren<br />
zu sollen, weil wir, wie oben gesagt, durch die faszinierende Gestalt des Staufers<br />
uns ebenfalls zur Aussage insbesondere in den <strong>von</strong> uns als grundlegend angesehenen<br />
Dingen geradezu genötigt fühlen.« <br />
Zwischen Monument und Denkmal: »Zunächst wird eine historische Betrachtungsweise<br />
wie sie hier geübt wird, immer geneigt sein, die Personen des Helden<br />
sozusagen zu isolieren und aus ihrem natürlichen Zusammenhang herauszulösen.«<br />
46 Panegyrische Historiographie neigt zu diskursiven Monumentalisierungsformen;<br />
Kantorowicz< Biograph Alain Boureau unternimmt seinerseits<br />
einen »Besuch am Denkmal Kantorowicz«. 47 Der Bestseller Kaiser Friedrich der<br />
Zweite führt zu einem regelrechten Historikerstreit in der Weimarer Republik,<br />
kulminierend auf dem deutschen Historikertag in Halle 1930. Dort verteidigt<br />
Kantorowicz seine Schreibweise gegen Attacken <strong>von</strong> Seiten der historischen<br />
Zunft in einer programmatischen Rede, einer Invektive gegen den Suprematie-<br />
Anspruch der »positivistischen Geschichtsforschung« in Darstellungsfragen:<br />
»Denn hier macht sich der Positivismus nicht mehr anheischig, nur die Methode<br />
der Geschichtsschreibung zu bestimmen, sondern dehnt seinen Übergriff aus<br />
auch auf die Menschlichkeit des Geschichtsschreibers, deren Artung er gemäß<br />
44 Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin 1927. Ergänzungsband, Berlin<br />
1931. Rezension Albert Brackmann, Kaiser Friedrich II. in »mythischer Schau«,<br />
in: Historische Zeitschrift 140 (1929), 534-549. Kantorowicz< Entgegnung erschien<br />
unter dem Titel: Mythenschau, in: Historische Zeitschrift 141 (1930), 457-471. Brackmann<br />
antwortete daraufhin mit einem Nachwort, ebd., 472-478<br />
45 Günther Wolf, Einleitung zur ersten Auflage 1966, 4, in: ders. (Hg.), Stupor mundi:<br />
zur <strong>Geschichte</strong> Friedrichs II. <strong>von</strong> Hohenstaufen, 2., völlig neubearb. Auflage Darmstadt<br />
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1982<br />
46 Friedrich Baethgen, Besprechung <strong>von</strong> Ernst Kantorowicz' »Kaiser Friedrich der<br />
Zweite«, in: Günther Wolf (Hg.): Stupor Mundi. Zur <strong>Geschichte</strong> Friedrichs II. <strong>von</strong><br />
Hohenstaufen, Darmstadt 1966, Wege der Forschung Bd. 101, 49-61 (53)<br />
47 Alain Boureau, Kantorowicz. <strong>Geschichte</strong>n eines Historikers, a. d. Franz. übers, v.<br />
Annette Holoch, Nachwort Roberto delle Donne, Stuttgart (Klett-Cotta) 1990 (Kapitelüberschrift)
176 . MüNUMENTA GKRMANIAE<br />
den <strong>für</strong> die Forschung als nützlich und brauchbar befundenen Regeln festsetzen<br />
zu dürfen glaubt« . Ist ein solches Werk mit wissenschaftlichem<br />
Anspruch ohne Fußnoten statthaft? 48 Kantorowicz jedenfalls<br />
legt als Reaktion auf diese Debatte 1931 seinen ErgänzungsbandVor, ein Fußnotenwunder,<br />
eben nur aus Fußnoten und Exkursen bestehend (worauf er 1927<br />
nicht in Form einer Fußnote, sondern eines Nebensatzes verwiesen hatte).<br />
Womit die Zunft pazifiziert war; gleichzeitig aber konvertierte Kantorowicz mit<br />
der Arbeit daran vom Erzähler zum archivgestützten Forscher.<br />
Die Verschaltung des deutschen Gedächtnisses an Kaiser Friedrich II. folgt<br />
nach 1933 einer anderen Ordnung:<br />
»Nach deutscher Auffassung gehört in eine Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage<br />
sämtliches Schrifttum <strong>von</strong> jüdischen Autoren, gleich welchen Gegenstand sie<br />
behandeln. Also nicht nur die Arbeit eines jüdischen Autors über die <strong>Geschichte</strong><br />
der Juden im Königreich Sizilien zur Zeit Friedrichs II., sondern desgleichen die<br />
Biographie eines Judenhistorikers über Friedrich II., auch wenn sie thematisch wie<br />
inhaltlich mit dem Judentum sich expressis verbis nicht beschäftigt.« 49<br />
Gemeint ist Ernst H. Kantorowicz. Damit wird der Verfasser eines deutschen<br />
Nationalgeschichtsbuchs aus der deutschen Geschichtsschreibung ausgegrenzt,<br />
bis hin zum entsprechende Publikationsverbot deutschhistorischer Schriften<br />
durch deutsch-jüdische Historiker - dies der Grund, auf anderen Themen anderer<br />
Länder (erst Burgund, dann England) auszuweichen, wie Kantorowicz<<br />
Publikationsliste nach 1933 ausweist. K. A. <strong>von</strong> Müller, Herausgeber des einst<br />
<strong>von</strong> Leopold v. Ranke mitgegründeten Fachorgans Historische Zeitschrift, wendet<br />
sich <strong>von</strong> München aus am 2. Dezember 1935 an Albert Brackmann: »Die<br />
Ausschaltung aller - nicht wenigen - nichtarischen Mitarbeiter an der H.Z. reißt<br />
erhebliche Lücken in den regelmäßigen Stab der Referenten und der sonstigen<br />
Mitarbeiter.« 50 Innere Emigration gegenüber dem NS-Staat heißt <strong>für</strong> Kantorowicz<br />
nach seiner vorzeitigen Emeritierung 1934 zunächst einmal Resistenz gegen<br />
Ideologie, konkret: der Rückzug in die Binnenräume des deutschen Gedächtnisses,<br />
etwa die Foschungsräume der Monumenta Germaniae Historica in Berlin.<br />
Das »Geheime Deutschland«, <strong>von</strong> dem im George-Kreis die Rede war, ist<br />
hier als arcanum faßbar, als das gelehrte Deutschland, der Raum der diskreten<br />
48 Dazu Anthony Grafton, Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote, Berlin<br />
(Berlin Verlag) 1995, Kapitel 3: Wie der Historiker zu seiner Muse fand: Rankes Weg<br />
zur Fußnote, 85f<br />
49 Wilhelm Grau (Frankfurt/M.), Der Aufbau der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage<br />
in Frankfurt a. Main, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 59 (1942), 489-494<br />
(493)<br />
50 Geheimes Staatsarchiv PK Berlin, HA I, Rep. 92, Nachlaß Albert Brackmann, Nr. 51,<br />
fasc. »Historische Zeitschrift u. Dazugehöriges, 1919-1939«, Bl. 59
VKRLAUI-SFORMEN DER MGH 177<br />
Dokumente und urkundlichen Monumente, die sich politischer Vereinnahmung,<br />
jeder Ideologisierung entziehen. Kantorowicz< studiolo ist in den Tagen des<br />
Rückzugs aus einer nationalsozialistisch dominierten Wissenschaftslandschaft<br />
also die Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica im direkten Anschluß<br />
an die Berliner Staatsbibliothek. Aus dem amerikanischen Exil schreibt E. K. an<br />
den deutschen Verlag seines Vorkriegserfolgs Kaiser Friedrich der Zweite am 31.<br />
Oktober 1949 in Berkeley über die Verfügung seiner zwischengelagerten Vorkriegsibliothek.<br />
»Was ich ganz gern hätte, wären meine Arbeitssachen<br />
(Monumenta und alles was s. Z. in dem kleinen Arbeitszimmer war: Lexika, Mediaevalia,<br />
Fridericiana ec.« - also sein Apparat; »entbehrlich wäre gewiss vieles<br />
der Historica und der Classica.« 51 Was Kantorowicz nach 1933 zunächst das<br />
Bleiben in Berlin subjektiv ermöglicht, ist »eine Art institutioneller Inbegriff <strong>von</strong><br />
Deutschland - aber ein lateinisch gefaßter: die Monumenta Germaniae Historica«.<br />
52 Die Monumenta als Bunker gegenüber nationalsozialistischer Ideologie?<br />
Schon einmal hat sich Kantorowicz auf dieses Gehäuse berufen, bei den Arbeiten<br />
zum Ergänzungsband <strong>von</strong> Kaiser Friedrich der Zweite.^ Nach seiner frühzeitigen<br />
Emeritierung geht er dort in Opposition zu Hitler. Denn gelehrte<br />
Bibliotheken, das immer wieder jede Festschreibung in Frage stellende Reich der<br />
Fußnoten, sind ein Ort der Emigration, des Widerstands gegen totalisierende<br />
narrative Ideologien. Kantorowicz beschreibt in einem Brief vom 14. Oktober<br />
1934 an Paul Kehr seine Emotionen im Reich der MGH, »als ich vor kurzem<br />
zum erstenmal wieder die Treppen zu den Monumenta hinaufstieg.« 54 Und kurz<br />
darauf freut er sich »schon jetzt, im neuen Jahr die früheren Monumenta-Abendgespräche<br />
wieder aufzunehmen« . Sein Kontrahent<br />
Albert Brackmann hatte es geahnt: In Kantorowicz stecke doch zugleich<br />
»ein >Positivist
178 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
1914 kritisierte Dietrich Schäfer Paul Kehr <strong>für</strong> dessen aus Anlaß des 25jährigen<br />
Bestehens seines Preußischen Historischen Instituts in Rom niedergeschriebenes<br />
Diktum, den Spezialisten <strong>für</strong> Neueste <strong>Geschichte</strong> ermangele es - auf<br />
dem Niveau der Ausbildung <strong>für</strong> Mädchenlyzeen - an handwerklich-hilfsdiziplinären<br />
Kenntnissen: »Historische Hilfswissenschaften und neuzeitliche Geschichtsschreibung<br />
stehen nicht zu einander in dem Verhältnis <strong>von</strong> Handwerk<br />
und Kunstübung.« 55 Auf dem deutschen Historikertag in Halle am 24. April<br />
1930 thematisiert Kantorowicz in seiner Rede Über Grenzen, Möglichkeiten und<br />
Aufgaben der Darstellung mittelalterlicher <strong>Geschichte</strong>^ genau diese Inkommensurabilität<br />
<strong>von</strong> Forschung und Narration in der Historie als keine absolute;<br />
es gebe weder einen Nullpunkt an Positivismus noch völlige Interpretationsfreiheit.<br />
Kehr bemerkte zu der sich daran anschließenden Kontroverse, wie<br />
lächerlich es sei, daß gewisse Kollegen Kantorowicz kritisierten, »obwohl sie ja<br />
selbst gar nicht <strong>Geschichte</strong> schreiben konnten.« Er könne das auch nicht und<br />
wolle es auch nicht. »Historische Forschung sei eben ein Ding und historische<br />
Darstellung ein anderes« . In einem Brief vom 20. Februar<br />
1931 an Kehr aus dem Grand Hotel in Hof gastein räumt Kantorowicz ganz in<br />
dessen Sinne ein, »dass der Diplomatiker nicht auch Historiker sei, was <br />
offenbar wirklich nur selten zusammenfällt.« 57 Kehr bleibt dem Positivismus des<br />
19. Jahrhunderts verhaftet; erst spät hat es ihn dazu getrieben, wenigstens <strong>für</strong><br />
Teilgebiete die Ergebnisse seiner kritischen Arbeit »auch darstellerisch zu formen«<br />
. Kehr (noch in Göttingen) hat es in einem Artikel<br />
über das Archivwesen Italiens deutlich geschrieben: »Geschichtsforscher brauchen<br />
keine Geschichsschreiber zu sein. Geschichtschreibung ist reine Kunst.« 58<br />
1937 ist dieser Widerstreit scheinbar in Ideologie aufgehoben: »Wir kennen heute<br />
solche Gegensätze nicht mehr«; beide Modi seien »gleich notwendige Formen<br />
deutscher Geschichtswissenschaft« .<br />
In welchem Maße können Geschichtskörper aus einem archivischen Korpus<br />
rekonstruiert werden? In einem Brief an Paul Kehr (Berlin, 14. Okt. 1934) fragt<br />
Kantorowicz an, im Neuen Archiv, dem Publikationsorgan der Monumenta<br />
Germaniae Historica, und in den Quellen und Forschungen des Deutschen<br />
55<br />
Dietrich Schäfer, Das Preußische Historische Institut in Rom und die deutsche<br />
Geschichtswissenschaft, in: Internationale Monatsschrift <strong>für</strong> Wissenschaft Kunst und<br />
Technik, 8. Jg., Nr. 4 (Januar 1914), Sp. 394-420 (Sp. 412); daran anschließend Kehrs<br />
Erwiderung: Geschichtsstudium und Historisches Institut, Sp. 421-428<br />
56<br />
Kritisch ediert <strong>von</strong> Eckhart Grünewald, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des<br />
Mittelalters, 50. Jg., Heft 1 (1994), 104-125<br />
57<br />
Geh. Staatsarchiv (PK) Berlin, HA I, Rep. 92 Nachlaß Kehr, A I 6 Lit. Ka-Ke, fasc.<br />
»Prof. Dr. Ernst Kantorowicz«, Bl. 103r.<br />
58<br />
In: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, Jg. 1901, München 30. Juli, Nr. 172, 1-4 (4)
VERLAUFSFORMEN DER MGH 179<br />
Historischen Instituts Rom zwei seiner neuen Aufsätze über normannische laudes<br />
(die Christus z>ma£-Liturgie) und über den Kanzler Friedrichs II., Petrus <strong>von</strong><br />
Vinea, abdrucken zu können: »Für mich persönlich wäre es rebus sie stantibus<br />
ja nicht ganz unwichtig, wenn endlich wieder einmal eine gedruckte Lebensäusserung<br />
<strong>von</strong> mir vorläge.« 59 Heute liegt das Wissen um Kantorowicz, <strong>von</strong> Schriftspuren<br />
in seinem Nachlaß abgesehen, in nichts als gedruckten Lebensäußerungen<br />
vor. »Seine Konzeption des symbolischen Körpers, der den biologischen Körper<br />
besetzt, ist sehr interessant. wie ein Körper einen anderen, einen rechtlich<br />
bestimmten, besetzen kann.« 60 Sein am Princetoner Center for Advanced<br />
Study (New Jersey) entstandenes Hauptwerk Die zwei Körper des Königs (1957),<br />
ein Beitrag zur Genese der politischen Theologie des modernen Staatsgedankens,<br />
ist keine romanhafte Geschichtsschreibung mehr, sondern gelehrte Wissenschaft<br />
aus Einsicht in die politische Verführbarkeit erzählender Darstellungen.<br />
Denkmäler sind nicht Denkmale. Das Wort Denkmale begreift der Mediävist<br />
und Symbolforscher Percy Ernst Schramm im altertümelnden Sinn des 18. Jahrhunderts<br />
als ein Ding, das »wir mit unseren Sinnen erfassen« und das uns »an den<br />
einstigen Besitzer und die Welt, in der er lebte, so denken läßt, daß er und mit ihm<br />
auch sie deutlich vor unserem geistigen Auge stehen«. Denn »um <strong>Geschichte</strong> zu<br />
begreifen, bedarf es nicht nur des Wissens, sondern auch der Phantasie, jedoch<br />
einer an dem noch Erkennbaren gezügelten Phantasie. Ihr möchten wir Anhalte<br />
verschaffen«, mithin also: Monumente. 61 Das ist die Begründung der <strong>Im</strong>agination<br />
im Archiv, non-arbiträr, im Unterschied zur historiographischen Fiktion. 1964<br />
rezensiert Heinz Friedrich zwei Neuerscheinungen (Schramm / Mütherich,<br />
Denkmale der deutschen Könige und Kaiser) bzw. Wiederauflagen (Kantorowicz,<br />
Kaiser Friedrich der Zweite). Das letztere Monumentenbuch ist historiographisch,<br />
das erstere katalogisch angelegt. <strong>Im</strong> Unterschied zu Kantorowicz' »porträtierenden<br />
Geschichtsschreibung« haben Schramm / Mütherich diese Denkmale nicht<br />
narrativ errichtet (also in Anklang an Nietzsches Begriff der »monumentalen<br />
Historie«), sondern materialiter »zusammengetragen, inventarisiert und erläutert«<br />
(Friedrich). Dagegen läßt Kantorowicz< Porträtierung Friedrichs II. den<br />
Leser »geschichtliche Größe über die Zeiten hinweg begreifen wie etwas<br />
Heutiges.« In einem kleinen Satz aus der Unterrichtsanweisung <strong>für</strong> Manfred,<br />
Friedrichs II. Sohn, werde »der Geist des Staufers faszinierender offenbar<br />
59<br />
Geh. Staatsarchiv PK Berlin, HA I, Rep. 92 Nachlaß Kehr, A I 6 Lit. Ka-Ke, fasc.<br />
»Prof. Dr. Ernst Kantorowicz«, Bl. 106<br />
60<br />
Eric Laurent (Diskussionsbeitrag), in: Tumult 1992, 105<br />
61<br />
Percy Ernst Schramm / Florentine Mütherich (Hg.), Denkmale der deutschen Könige<br />
und Kaiser, München (Prestel) 1964, zitiert nach: Heinz Friedrich (Rez.), Denkmal <strong>für</strong><br />
einen Kaiser. Ernst Kantorowicz' »Friedrich II.« und die »Denkmale der deutschen<br />
Könige und Kaiser«, in: Deutsche Zeitung v. 15./16. Februar 1964, 18
180 MONUMENTA GERMANIAE<br />
als in den Überresten seiner Schatzkammer.« Kantorowicz< historiographisches<br />
Monument, »sein >Denkmal< der Hohenstaufen beweist, was Geschichtswissenschaft,<br />
wenn sie sich souverän über ihre Materialien erhebt, zu leisten vermag.« 62<br />
Die Denkmale seines Freundes und Kollegen Schramm<br />
»sind wirklich nur >Anhalte' <strong>für</strong> die vergegenwärtigende historische Phantasie, die<br />
der Herausgeber liefert - >AnhalteHort< der<br />
Könige und Kaiser, zusammengefügt aus Reliquien und Herrschaftszeichen, aus<br />
Gewändern und Schmuck, aus Büchern, Kuriositäten und Musikinstrumenten,<br />
ergibt auf 264 Bildcrtafeln ein imposantes Dokumentarium mittelalterlicher Adelskultur<br />
. Aber trotz gegenteiliger Versicherung des Herausgebers treten diese<br />
>Denkmalc< aus dem musealen Bereich kaum heraus. Das Buch kann seinen Charakter<br />
als gründliches und wissenschaftliches Inventarium nicht verleugnen: die<br />
Anhäufung <strong>von</strong> Materialien wird kaum durch den visionär erneuernden Blick des<br />
großen Geschichtsschreibers belebt und aus der katalogisierenden Deskription<br />
befreit.« <br />
Was bleibt, ist eine wissenschaftliche Leistung mit musealer Nüchternheit<br />
(Friedrich), eine Ästhetik, die dem Speicher des Germanischen Nationalmuseums<br />
in Nürnberg näher steht denn den Halluzinationen der Historie.<br />
<strong>Im</strong> III. Reich. Ostforschung, Europa-Buch und jenseits<br />
Auch nach der Inkorporation der MGH in das unter dem nationalsozialistischen<br />
Regime neugeschaffenen Reichsinstitut <strong>für</strong> Ältere Deutsche <strong>Geschichte</strong><br />
steht das Unternehmen eher auf Seiten des Archivs denn auf der <strong>von</strong> ideologisierender<br />
Geschichtsschreibung. Der Direktor der MGH, Stengel, gibt in<br />
einem Brief an den kommissarischen Generaldirektor der Staatsarchive Zipfel<br />
(zugleich Direktor des Reichsarchivs) in Berlin am 4. Dezember 1937 der Hoffnung<br />
Ausdruck, »daß die alte Tradition des Zusammenhangs, die Archivverwaltung<br />
und Monumenta Germaniae verbindet, zu weiterer fruchtbarer<br />
Ausgestaltung gelangen möge.« 63 Diente philologischer Positivismus (als Editionspraxis)<br />
den MGH zu ideologiekritischer Resistenz? Der Diplomatiker Karl<br />
Brandi dementiert diese These, indem er sich als Mitherausgeber der Zeitschrift<br />
62 Heinz Friedrichs Rezension <strong>von</strong> Ernst Kantorowicz, Kaiser Friedrich II. (Berlin 1927,<br />
Quellenband 1931), stellt »den Biograph und sein Modell« fotografisch nebeneinander;<br />
E. K. im Alter <strong>von</strong> 30 Jahren, Bronzebüste, und Friedrich II. als Marmorbüste<br />
<strong>von</strong> einem süditalienischen Künstler<br />
63 Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, Akten betreffend: Das Reichsinstitut <strong>für</strong> ältere<br />
deutsche Geschichtskunde. (Mon. German. hist.) Band 1 v. 4. Dezember 1937. Archivabteilung.<br />
Titel »Fremde Archive« Nr. 201a
VERLAUFSFORMEN DER MGH 181<br />
<strong>für</strong> Urkundenforschung nichtsdestotrotz im Dritten Reich auf Seiten der<br />
Ostraumideologie der Nationalsozialisten schlägt; seine Vorlesung Unser Recht<br />
auf den Osten und seine Mitarbeit am sogenannten Ostbuch, läßt durchscheinen,<br />
daß Geschichtswissenschaft hier als Tarnung <strong>für</strong> politische Zwecke dient.<br />
Einerseits weiß er, daß die Aufgabe gerade des Urkundenforschers sich darauf<br />
beschränkt »sich gar nichts entgehen zu lassen« 64 , gegebene Daten also zu konfigurieren,<br />
nicht aber ihre Zwischenräume durch historische Erzählungen aufzufüllen.<br />
Als Spezialist <strong>für</strong> mittelalterliche Dokumentenfälschung und Evaluator<br />
ihres Aussagewerts (seine Dissertation handelte über Urkundenfälschung im<br />
Kloster Reichenau) weiß er um den Zusammenhang <strong>von</strong> Gesagtem und Nicht-<br />
Gesagtem. Brandi spricht <strong>für</strong> mittelalterliche Fälschungen zwar <strong>von</strong> »Urkunden<br />
mehr oder minder bedenklicher Art«:<br />
»Und doch würden wir uns selbst eines überaus schätzenswerten Materials entäußern,<br />
wollten wir grundsätzlich alle Fälschungen beiseite legen. Einerseits sind<br />
nämlich die meisten Fälschungen aus allerlei echten und erfundenen Elementen<br />
künstlich zusammengesetzt; und andererseits, selbst wenn in einer ganzen Urkunde<br />
kein echtes Wörtlein ist, darf diese noch unsere ganze Aufmerksamkeit in<br />
Anspruch nehmen, wenn sie tatsächliche Verhältnisse berührt, die uns anderweit<br />
nur unvollkommen bekannt sind.«<br />
Entkoppelt vom Diskurs historischer Wahrheit wird auch eine Fälschung zur<br />
wissensarchäologischen Grabungsstätte.<br />
Theodor Mayer wendet sich als neuer Präsident der MGH in einem handschriftlichen<br />
Brief aus Marburg, den 8. Mai 1942, an Kehr, »der ich ja nicht in<br />
der Monumenta-Traditon aufgewachsen bin. » 65 In seiner Antwort (maschinenschriftlich,<br />
11. Mai 1942) stellt dieser sich weiterhin als Ratgeber zur Verfügung<br />
trotz der Differenzen, die er mit Stengel hatte »und seiner Egeria, denen<br />
ich nicht wieder zu begegnen wünsche.« Stengel hatte ihm die Hefte des Neuen<br />
Archivs (wie er das Organ der MGH hier demonstrativ noch nach seinem alten<br />
<strong>Namen</strong> nennt) und seit Sommer 1940 überhaupt nicht mehr Produkte der<br />
Monumenta zugehen lassen; nichtsdestotrotz ist daraus kein Hinweis auf den<br />
Rückzug der alten Monumenta-Schule gegenüber einer im Dritten Reich ideologisierten<br />
MGH ablesbar. Der Brief ist gezeichnet mit dem Hitlergruß 66 , und<br />
noch kurz vor dem Ende des Polenfeldzugs begrüßt Kehr in einem Brief an seinen<br />
Kollegen Walther Holtzmann am 17. September 1939 Hitlers Ostraumpolitik,<br />
hier ganz im Bunde mit einer ganzen Phalanx deutscher Mediävisten und<br />
64<br />
Zitiert nach der Sendereihe Zeitzeichen im Westdeutschen Rundfunk Köln, 9. März<br />
1996 (WDR 5)<br />
65<br />
Geheimes Staasarchiv (Preußischer Kulturbesitz) Berlin-Dahlem, Rep. 92, Nachlaß<br />
Kehr, A V la-b »Mon. Germ. Hist.«, Bl. llr<br />
66<br />
Ebd., Bl. 12; Bl. llv. trägt den handschriftlichen Antwortentwurf Kehrs.
182 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Archivare: »Der Instinkt des Historikers sagt mir, daß der große europäische<br />
Knoten seiner Lösung entgegengeht«, und Kehr erwartet, daß »die polnische<br />
Sache liquidiert ist.« 67 Der Nationalsozialismus betreibt mit Archivalien aus<br />
dem deutschen Mittelalter Politik. Der Kampf um das Reich in 12 Jahrhunderten<br />
deutscher <strong>Geschichte</strong> heißt eine Urkunden-Ausstellung des Bayerischen<br />
Hauptstaatsarchivs München zur Reichstagung der NS-Kulturgemeinde 1936.<br />
Dem vorausgegangen war die Buchausstellung Das wehrhafte Deutschland,<br />
veranstaltet <strong>von</strong> der NS-Kulturgemeinde und der Reichsstelle zur Förderung<br />
des deutschen Schrifttums (zunächst auf dessen Reichstagung 1936 in München,<br />
dann in Berlin). Angereichert wandert diese Ausstellung durch deutsche Städte,<br />
als »eine Schau der geistigen Kräfte, die an der inneren Wehrhaftmachung des<br />
deutschen Volkes arbeiten«. 68 Nun steht wieder eine Ausstellung an, zur 4.<br />
Reichstagung der NS-Kulturgemeinde in München, ergänzt durch Bestände der<br />
bayerische Staatsbibliothek, des Hauptstaatsarchivs, des Armeemuseums, des<br />
Stadtarchivs, des Kriegsarchivs, der Armeebibliothek und des Hauptarchivs der<br />
NSDAP. Daraus werden zwei eigene Abteilungen historischer Dokumente<br />
zusammengestellt, »die den Wehrgedanken und den Kampf um das Reich in 12<br />
Jahrhunderten deutscher <strong>Geschichte</strong> unmittelbar veranschaulichen. Die eigentliche<br />
Buchausstellung spricht <strong>für</strong> sich selbst.« Die geschichtsvektorielle Ausrichtung<br />
der Archivalien soll es sein, »den mehr als tausendjährige Kampf<br />
zwischen den Zieh- und Fliehkräften des Reiches an einmaligen Urkunden des<br />
Hauptstaatsarchivs München darzustellen« , und diskrete,<br />
gedächtnisverwaltende Diplomatik vermag es hier nicht, sich dieser ideologisierenden<br />
Inanspruchnahme durch historische Erzählung zu entziehen. Alles<br />
beginnt mit Karl dem Großen: »Das Stammesherzogtum wird beseitigt. Absetzbare<br />
Grafen schalten als königliche Beamte, obendrein <strong>von</strong> den Königsboten,<br />
missi dominici, in ihrer Tätigkeit überwacht.« Die Beschreibung macht dabei die<br />
Urkunde selbst zum Subjekt der Darstellung; nicht nur als historisches Dokument,<br />
auch als diplomatisches Monument wird sie gelesen:<br />
»777, Januar 7. König Karl schenkt dem Kloster Fulda den Gau Hammelburg. -<br />
Man beachte den Einfluß der Antike im Hinblick auf den Beschreibstoff (Pergament),<br />
auf die Schrift (aus der spätrömischen Kursive entwickelt), auf die Sprache<br />
67 Zitiert nach einem Beitrag <strong>von</strong> Reinhard Elze, in: Paul F. Kehr. Zugänge und Beiträge<br />
zu seinem Wirken und seiner Biographie. Veranstaltung zum 60. Geburtstag <strong>von</strong><br />
Arnold Esch am 20. Mai 1996, hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen<br />
(Niemeyer) 1997, 30<br />
68 Walter Stang, in: Der Kampf um das Reich in 12 Jahrhunderten deutscher <strong>Geschichte</strong>.<br />
Urkunden-Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs München zur Reichstagung<br />
der NS.-Kulturgemeinde, bearbeitet v. Staatsarchivrat Dr. L. F. Barthel, 1936,<br />
NS-Kulturgemeinde - Amtsleitung Berlin (Sonderdruck), 2
VERLAUFSFORMEN DER MGH 183<br />
(Latein), auf das Siegel (antike Gemme) und auf die Tironischen Noten (Kurzschrift<br />
zwischen den Schnörkeln des Beglaubigungszeichens). Von König Karl ist<br />
das Y in der Raute des Monogrammes eigenhändig gezeichnet.« <br />
Konkrete Urkundenkommentare wechseln in dieser Ausstellung mit narrativen<br />
Synthesen, d. h. Historien, ab, bleiben aber dem Gedächtnis der Dinge verhaftet:<br />
»Daß die Revolution <strong>von</strong> 1918 nichts Bleibendes bewirken konnte, fast möchte<br />
man es aus dem äußeren Zustand der bayerischen Verfassung <strong>von</strong> 1919 entnehmen,<br />
die gerade durch den Vergleich mit der <strong>von</strong> 1818 in ihrer Formlosigkeit entlarvt<br />
wird. Die >Kleinigkeiten' einer Urkunde verraten oft viel. Der neue Staat wird<br />
sich eine neue, dem Willen zur dauernden Geltung entsprechende Form der Beurkundung<br />
schaffen.« <br />
So wird Typographie im Anschluß an paläographisches Wissen zum Agenten<br />
der Geschichtsdarstellung; die Differenz <strong>von</strong> Dokument und Monument ist<br />
eben nicht allein auf die <strong>von</strong> semantischem Inhalt und formaler Aussage reduzierbar.<br />
Der Bund <strong>für</strong> Deutsche Schrift e.V. im Verbund mit dem Schriftenbund<br />
Deutscher Hochschullehrer macht 1935 einen an den Reichs- und Preußischen<br />
Minister <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin gerichteten,<br />
die Typographie der MGH betreffenden Vorschlag:<br />
»Wie wir der Presse entnehmen, ist anstelle der Zentraldirektion der >Monumenta<br />
Germaniae< das Reichsinstitut <strong>für</strong> ältere <strong>Geschichte</strong> getreten . Dieser Wechsel<br />
veranlaßt uns zu der Anregung, es möge auch die Druckgestalt der Mon.<br />
einem Wechsel unterzogen werden dergestalt, daß der bisherige durch gängige<br />
Lateindruck - auch des deutschen Textes - durch den Deutschdruck der deutschen<br />
Texte ersetzt wird. Bismarck, der bekanntlich aus Gründen der Zweckmäßigkeit<br />
ein eifriger Verfechter des Deutschdrucks war, setzte es s. Zt. durch und zwar<br />
gegen v. Sybel, daß die Veröffentlichungen aus den kgl. Preuß. Staatsarchiven^<br />
deren erste Bände in Antiqua gesetzt waren, in der Fortsetzung in Deutschdruck<br />
herauskamen.« 69<br />
<strong>Im</strong> <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> wird hier vereindeutigt, was die gedächtnistechnischen<br />
Hilfsdisziplinen der MGH demgegenüber in ihrer Kompliziertheit<br />
vieldeutig, da nur diskret verhandelbar, lassen. 70 Die Verengung des Dateneinzugsbereichs<br />
auf ein geschichtspolitisch definiertes Deutschland, das die MGH<br />
stets transzendiert hatten, konterkariert ein Brief Pery Ernst Schramms an Paul<br />
Kehr (Göttingen, 7. September 1933) betreffs seiner genealogischen Studien der<br />
mittelalterlichen ordines: Sowohl in Bezug auf das Reichsgebiet als auch bezüg-<br />
69 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Berlin, Rep. 338<br />
»MGH« Titel 1 Nr. 29, Abschrift im Archiv der MGH München zu WII b 1287/35<br />
70 Siehe Peter Rück, Paläographie und Ideologie: die deutsche Schriftwissenschaft im<br />
Faktur-Antiqua-Streit <strong>von</strong> 1871-1945, in: Signo. Revista de Historia de la Cultura<br />
Escrital (1994), 15-33
184 MONUMENTA GERMANIAE<br />
lieh der Anliegerstaaten seien sie »in demselben Zusammenhang« zu edieren,<br />
»denn kaum auf einem anderen Gebiet lasst sich vergleichende Verfassungs- und<br />
Liturgiegeschichte so treiben wie gerade bei dem Problem der Krönung«, nationalistischer<br />
Singularisierung zum Trotz. 71 Komparatistik ist zu dieser Zeit längst<br />
auch ein Effekt ihrer technischen Bedingung, geradezu Vorschrift: der Vergleichbarkeit<br />
<strong>von</strong> Urkundentexten im Medium der Buchedition und der Urkundenphotographie.<br />
Der Anschluß Österreichs ans Deutsche Reich bedeutet <strong>für</strong> das<br />
Reichsinstitut »im Grunde die Fortführung und Vollendung einer alten Tradition«,<br />
da Österreich seit den Gründungstagen der Monumenta »amtlich und wissenschaftlich<br />
jederzeit deren lebendiges Glied war.« Damit aber ist zugleich die<br />
Differenz zwischen gedächtnisadministrativen Kopplungen und politisch-diskursiver<br />
Vereinheitlichung genannt. In einem Schreiben vom 13. März 1935 an<br />
das Reichs- und Preußische Ministerium <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung<br />
erkennt die Akademie der Wissenschaften in Wien den ihr vorgelegten<br />
Entwurf der Satzung des Reichsinstitus <strong>für</strong> Ältere Deutsche Geschichtskunde als<br />
Organisation an, »die das Gesamtgebiet der auf Erforschung und Darstellung der<br />
deutsch-mittelalterlichen <strong>Geschichte</strong> gerichteten Bestrebungen im ganzen Deutschen<br />
Reich erfasst und auf die Einfluss zu nehmen der Wiener Akademie daher<br />
nicht zusteht.« Die Wiener Akademie versichert ihre weitere Mitarbeit; was sich<br />
hier dokumentiert, ist - wie im Falle des Germanischen Nationalmuseum in<br />
Nürnberg - das unbestimmbare, zwischen Eigen und Fremd oszillierende Verhältnis<br />
des im Netzwerk der MGH kristallisierten Gedächtnisses <strong>von</strong> Österreichs<br />
zum Deutschen Reich: »Dies alles entspricht einer Uebung, die gerade in diesen<br />
Tagen das 100. Jahr ihres Bestandes erreicht hat.« 72<br />
Nachfolger Paul Kehrs als Generaldirektor der preußischen Archive und<br />
Direktor des Geheimen Staatsarchiv wird am 1. Oktober 1929 Brackmann.<br />
Brackmann bittet den Reichs- u. Preußischen Minister <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung<br />
und Volksbildung um Befreiung vom Vorlesungsbetrieb, da er nun auch<br />
ehrenamtlicher Leiter des Reichsarchivs ist (11. November 1935). 73 Dem war<br />
dieselbe Bitte um Befreiung <strong>von</strong> den Vorlesungen <strong>für</strong> das Sommersemester 1935<br />
vorausgegangen, da »die Leitung der preussischen Staatsarchive zur Zeit infolge<br />
der Umstellung ihrer Tätigkeit auf die Aufgaben des neuen Deutschland eine<br />
erhöhte Arbeitslast mit sich bringt« . Und zuvor<br />
die Bitte um Vorlesungsbefreiung <strong>für</strong> das Sommersemester 1934, da »ich durch<br />
die nationale Revolution vor sehr viele neue und schwierige Aufgaben gestellt<br />
71 BBAdW Berlin, Rep. 338, Tit. 9 Nr. 244, Bl. 453<br />
72 MGH-Akten (ehemals im Archiv der AdW Berlin): »Beziehungsakte MGH« der<br />
preußischen Akademie, Bl. 141, Abschrift<br />
73 Geheimes Staatsarchiv (PK), Rep. 92 NL Albert Brackmann, Nr. 56, Bl. 18
VERLAUFSFORMEN DER MGH 185<br />
bin«. Außerdem hat er seitens des Stellvertreters Hitlers, des Reichsministers<br />
Hess, die Aufgabe bekommen, die am 20. Dezember 1933 begründete Nordostdeutsche<br />
Forschungsgemeinschaft zu leiten. Zudem sind durch das neue Erbhofgesetz<br />
und die Rasseforschung neue wichtige »staatspolitische Aufgaben« auf<br />
die Archive zugekommen . Brackmann fungiert als Mitherausgeber<br />
des Organs Deutsches Archiv <strong>für</strong> Landes- und Volksforschung seit<br />
1937. 74 <strong>Im</strong> Gegensatz zu Ernst Kantorowicz treibt Brackmann nicht der darstellerische,<br />
sondern der archivalische <strong>Im</strong>puls in der Beschäftigung mit Vergangenheit:<br />
Seitdem er über geschichtliche Dinge nachdenken lernte, »haben mich<br />
weniger die großen geschichtlichen Darstellungen gefesselt als die neuen Wahrheiten,<br />
die der vordrängenden Geschichtsforschung zu verdanken waren.« 75<br />
Brackmann richtet das <strong>von</strong> ihm neu gegründete Berlin-Dahlemer archivwissenschaftliche<br />
Ausbildungsinstitut auf Ostforschung aus und prognostiziert, daß<br />
die Zeiten vorbei seien, »in denen der Archivar sich beschränken konnte, sein<br />
Archiv in Ordnung zu halten, und daß die weitere Entwicklung ihn voraussichtlich<br />
in steigendem Maße in die Welt hineinziehen« werde 76 - was im Nationalsozialismus<br />
als Herrschaftspraxis auch über das Gedächtnis Tatsache wird<br />
und nicht allein archivisch, sondern auch archäologisch zum Zuge kommt. 77<br />
1935 tritt Brackmann - Freund des Systems, doch nicht bedingungslos - <strong>von</strong> der<br />
Leitung der Historischen Zeitschrift zurück, die er seit 1928 gemeinsam mit Friedrich<br />
Meinecke leitet; er wird »zu Fall gebracht, weil er sich dem neuen totalitären<br />
Kurs als Mensch und Gelehrter nicht verschreiben konnte«, heißt das in<br />
der Nachkriegsperspektive. <strong>Geschichte</strong> als ideologisches Narrativ und als Datenbank<br />
stehen auch bei ihm im Konflikt: 1935 nimmt er im Sammelwerk Karl der<br />
Große oder Charlemage »offen und mutig gegen die Verunglimpfung und Entstellung<br />
des großen abendländischen Kaisers als >Karl der Sachsenschlächter<<br />
Stellung« und gab »der historischen Wahrheit die Ehre« .<br />
74 Dazu und zur Rolle der Historischen Zeitschrift 1936-44 siehe Willi Oberkrome,<br />
Volksgeschichte: methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen<br />
Geschichtswissenschaft 1918-1945, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1993,<br />
172ffu. 180ff<br />
75 Albert Brackmann, Gesammelte Aufsätze, Weimar 1941, 518ff: Antrittsrede in der<br />
Preußischen Akademie der Wissenschaften <strong>von</strong> 1926, zitiert nach: Hermann Meinen,<br />
Albert Brackmann und das deutsche Archivwesen, in: Archivalische Zeitschrift, 49.<br />
Bd., München (Zink) 1954, 127ff (127)<br />
76 Archivalische Zeitschrift 40, 1931, 1, zitiert nach: Meinert 1954: 136<br />
77 Über die Suche nach den Gebeinen Heinrichs des Löwen im Braunschweiger Dom im<br />
Zuge des nationalsozialistischen Versuchs, ihn zum Vorläufer einer »Ostraumpolitik«<br />
zu erklären, siehe Karl Arndt, Mißbtrauchte <strong>Geschichte</strong>. Der Braunschweiger Dom<br />
als politisches Denkmal (1934/45), in: Niederdt. Beitr. z. Kunstgesch. 20, München /<br />
Berlin 1981, 213-244 (214)
186 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
Für Europa als historische Identität sind Mediävisten zuständig, denn sie haben<br />
es im Blick. 1928 dankt ein Historiker Brackmann <strong>für</strong> die Übersendung seiner<br />
Untersuchung über Heinrich IV. als Politiker, neue Stücke zur <strong>Geschichte</strong> Barbarossas<br />
und eine Abhandlung über die Ostpolitik Ottos des Großen:<br />
»Mit großem Anteil habe ich auch die Erweiterung der Hist. 2s. begrüßt. Es ist ja<br />
dringend notwendig daß bei uns ganz großzügig etwas <strong>für</strong> die mittelalterlichen<br />
Studien geschieht, nicht nur <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> im engeren Sinne. In der Tat sind<br />
doch immer noch wir Historiker bei diesen Studien an der Spitze, da wir ja einst<br />
einen umfassenderen Blick uns bewahrt haben. Allerdings scheint mir<br />
doch schließlich um ein eigenes Organ nicht herumzukommen.« 78<br />
Anders als Kantorowicz läßt sich Brackmann <strong>von</strong> einem ideologischen <strong>Im</strong>puls<br />
zum holistischen Zugriff auf diskrete Quellen verführen. Sein Schriftverkehr in<br />
Sachen Europa-Bibliothek sagt es, eine Schriftenreihe zum Zweck der geistigen<br />
Mobilisierung des Kontinents in dem ihm eigenen Medium Buch. Brackmann<br />
antwortet auf die den Beiträgern gestellte Frage, seit wann und in welchem Sinne<br />
man <strong>von</strong> einer Einheit Europas in allen angegebenen Beziehungen sprechen<br />
könne. 79 Ilse Tönnies, die federführende Herausgeberin, wendet sich in einem<br />
Brief vom 13. Mai 1938 an Brackmann mit der Bitte, nicht das Schlußkapitel des<br />
Buches Die europäische Gesamtverantwortung, sondern das Kapitel Das Reich<br />
(Deutschland und Oesterreich) zu übernehmen . Ein weiterer Brief<br />
<strong>von</strong> Tönnies an Brackmann (Berlin, 24. Oktober 1938) betrifft dessen Bitte um<br />
Aufschub des Abgabetermins:<br />
»Gerade dieses Buch ist ja so ausserordentlich diffizil, und es ist die Frage, ob es<br />
überhaupt noch Sinn hätte, es zu veröffentlichen, wenn wir den Erscheinungstermin<br />
auf den Oktober 1939 legen müssen . Ausserdem, wer weiss, was bis zum<br />
Oktober des kommenden Jahres aus Europa geworden ist! Gerade in der nächsten<br />
Zeit hat das Buch seinen Wert und seine Sendung . in dem Fall des<br />
EUROPA-BUCHES sind besondere Terminverschiebungen wirlich einen Katastrophe<br />
<strong>für</strong> dieses Werk und <strong>für</strong> den Verlag.« <br />
Doch unter Weltkriegsbedingungen gibt es nur noch Gegenwart. Die nahe<br />
Zukunft ist unkalkulierbar, und <strong>von</strong> daher auch die Variable Gedächtnis; das ist<br />
der agonale Einbruch der Gegenwart als Unmöglichkeit <strong>von</strong> Historioraphie.<br />
Ein weiterer Brief Tönnies' an Brackmann (Berlin, 3. November 1939) betrifft<br />
78 Geheimes Staatsarchiv PK, Berlin, HA I, Rep. 92, Nachlaß Brackmann, Nr. 51, fasc.<br />
»Hansischer Geschichtsverein Bremen / Lübeck, 1928-1938; Bl. 22v, Brief aus Greifswald,<br />
15. Juni 1928<br />
79 Europäische Bibliothek. Eine Schriftenreihe <strong>für</strong> das Gebiet der Geisteswissenschaften,<br />
hg. Erich Brandenburg, Erich Rothacker, Friedrich Stieve u. I. Tönnies. Akte<br />
Nachlaß Brackmann, Nr. 51, fasc. »Hoffmann & Campe Verlag, Hamburg, 1937-1939,<br />
Bl. 118/119u. 133
VERLAUFSFORMEN DER MGH 187<br />
genau dies, nämlich Brackmanns Anregungen einer schon vorläufigen Ausgabe<br />
des Europa-Buchs:<br />
»Jedoch könnten diese Bücher erst zu Ostern erscheinen, da ein so grosser<br />
Papiermangel besteht, dass wir es nicht wagen, unsere bisherige Disposition zu<br />
überschreiten. Das Wesentlichste aber ist das Bedenken: Was ist bis Ostern? Es ist<br />
sehr riskant, sich bei der wechselnden aussenpolitischen Lage sich jetzt auf eine<br />
solche Veröffentlichung festzulegen.« <br />
Am 9. November 1939 (an Brackmann) antizipiert Tönnies das Kriegsende:<br />
»Wir beabsichtigen eigentlich, nach Beendigung des Krieges das EUROPA-<br />
BUCH in noch grösserem Umfang herauszugeben als ursprünglich geplant,<br />
denn die Bedeutung des Buches kann ja nur wachsen« . Diese in Briefform<br />
gespeicherte Sendung bleibt liegen im Geheimen Staatsarchiv, als deutscheuropäisches<br />
Gedächtnis en souffrance. 80<br />
Wenn Zentralen zerfallen, entscheiden »die politische Lage« diskursiv und<br />
»die Gestaltung der Verkehrsverhältnisse« infrastrukturell über den Fortgang<br />
einer Institution. Am Ende des Zweiten Weltkrieg unterstehen die MGH »dem<br />
Gesetz des deutschen Schicksals«, dessen Gedächtnis sie selbst setzen: <strong>Im</strong><br />
Bewußtsein, »daß die deutsche Wissenschaft unter den Aktivposten, über welche<br />
Deutschland heute noch verfügt, in allererster Reihe steht, werden alle<br />
Beteiligten freudig ihre ganze Kraft daran setzen, den ehemals so stolzen Bau<br />
des ehrwürdigen Instituts aus seinen Trümmern neu wieder aufzurichten.« 81<br />
In einem Schreiben vom 23. September 1946 aus Berlin an den Chef der Militärregierung<br />
<strong>für</strong> Deutschland, General Lucius Clay, bittet Walther Meißner<br />
<strong>von</strong> der Bayerischen Akademie der Wissenschaften um dessen Patronage der<br />
ausgelagerten Bibliothek des (den MGH vorher unterstellten) Deutschen<br />
Historischen Instituts in Rom unter Berufung auf ihr wissenschaft(sgeschicht)<br />
liches Gewicht: Mehr als 50.000 Bände zur <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters, »zur<br />
Fortsetzung der Arbeiten der Monumenta Germaniae Historia unentbehrlich«.<br />
Nach einer im Bayerischen Ministerium <strong>für</strong> Unterricht und Kultus aufgenommenen<br />
telefonischen Meldung aus Pommersfelden bei Erlangen, wo die Bibliothek<br />
zwischenlagert, ist <strong>von</strong> der amerikanischen Kontrollregierung in Berlin ihr<br />
Abstransport nach Offenbach am Main verfügt worden, wo sie »überprüft und<br />
evtl. Teile derselben nach den Vereinigten Staaten überführt werden« soll.<br />
»Damit wäre die Tätigkeit der Monumenta aufs äußerste geschädigt« 82 ; so<br />
80 Zu diesem Begriff siehe: Jacques Lacan, Das Seminar über E. A. Poes »Der entwendete<br />
Brief«, in: ders., Schriften I, hg. v. Norbert Haas, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1975<br />
(-••ficrits, Paris 1966), 7-41 (28f)<br />
81 Friedrich Baethgen, Monumenta Germaniae Historica. Bericht <strong>für</strong> die Jahre 1943-<br />
1948, in: Deutsches Archiv VIII 1951, 1-21 (8 u. 21)<br />
82 MGH-Akten (ehemals Archiv AdW Berlin): »Beziehungsakte«, Bl. 176
188 MONUMENTA GERMANIAE<br />
datenorientiert sind die Operationen des deutschen Gedächtnisses und am<br />
nationalen Nullpunkt nicht vom Begriff der <strong>Geschichte</strong>, sondern <strong>von</strong> ihren<br />
Arbeitsspeichern abhängig. Gleichzeitig bilden die edierten MGH, »die langen<br />
Reihen der Bände in Folio, Quart und Oktav, mehr als zweihundert an der<br />
Zahl«, selbst eine Bibliothek, ein wissensarchäologisches Monument. Nach<br />
1945 scheint dieses Monument zunächst kontextlos in der Landschaft »unserer<br />
aus allen Fugen geratenen Gegenwart« zu stehen; fraglich ist deshalb, ob sich<br />
die Institution der MGH »nicht ur noch kraft eines allgemeinen Beharrungsvermögens<br />
fortschleppe«. 83 Unter verkehrten Vorzeichen schien mit Beginn des<br />
Zweiten Deutschen Reiches 1870/71 bereits das aus romantischer Nostalgie<br />
gespeiste Gedächtnis der deutschen Kaiserzeit überschrieben und damit das<br />
Unternehmen MGH posthistorisch zu werden; Baethgen zitiert dazu aus der<br />
Vorrede zur 4. Auflage <strong>von</strong> Wilhelm <strong>von</strong> Giesebrechts <strong>Geschichte</strong> der deutschen<br />
Kaiserzeit (1873): »Wer versteht noch die heiße Sehnsucht nach einem einigen,<br />
großen, mächtigen Deutschland in einer Zeit, wo ein neues Reich und ein neues<br />
Kaisertum begonnen hat?« Heute jedoch - also 1950 - ist »die historische Epoche,<br />
die durch das Mit- und Gegeneinander dieser autonomen Machtstaaten ihr<br />
entscheidendes Gepräge empfing, mit dem zweiten Weltkrieg unwiderruflich<br />
zu Ende gegangen«, zumal <strong>für</strong> Deutschland, das aufgehört hat, ein autonomer<br />
Machtstaat zu sein . Das Feedback <strong>von</strong> Gegenwart und<br />
Gedächtnis (mit Reiz als elektrophysiologischem <strong>Im</strong>puls mnemischer Energie<br />
- Baethgen spricht <strong>von</strong> deutschen Energien — charakterisiert) wird<br />
neu konfiguriert:<br />
»Von allen Zeitabschnitten der mittelalterlichen Periode ist heute wohl der früheste<br />
derjenige, der unser Interesse am stärksten wachzurufen vermag. Die Zeit des<br />
Übergangs <strong>von</strong> der Antike zum Mittelalter bietet mit ihren inneren und äußeren<br />
Krisen, ihren Massenbewegungen, ihren weltanschaulichen Wandlungen so mannigfache,<br />
oft überraschende Parallelen dieser Epoche dadurch einen eigenen, oft<br />
geradezu erregenden Reiz empfängt«,<br />
ebenso - unter verkehrten Vorzeichen - die spätmittelalterliche Epoche der Staatenauflösung<br />
. »Da Deutschland heute nicht mehr das Subjekt,<br />
sondern lediglich das Objekt derartier
VERLAUFSFORMEN DER MGH 189<br />
Ausweichen auf Geistesgeschichte sollen nicht nur außerdeutsche Quellen<br />
berücksichtigt werden, sondern auch die Konfiguration <strong>von</strong> deutsch und Mittelalter<br />
im Titel der MGH umakzentuiert werden: Baethgen schlägt die neue<br />
Unterbezeichnung Deutsches Institut <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters vor . Das deutsche Gedächtnis verlagert sich vom Signfikat auf die Ebene seiner<br />
Signifikantenströme, der Geschichts/orec/mng.
190 MüNUMKNTA Gl'RMANIAE<br />
Annalistik als Provokation der Historiographie<br />
Die Folgen <strong>von</strong> 1806 (Ranke)<br />
Zwischen Quellenkunde und literarischer Eleganz als Demodularisierung wissensarchäologisch<br />
diskreter Befunde: So in etwa läßt sich das Verhältnis zwischen<br />
der Arbeit der Monumenta Germaniae Historica und den jeweils zeitgenössischen<br />
Historikern bezeichnen. Eine Schnittstelle bildet Leopold <strong>von</strong> Ranke, dessen<br />
historiographische Ästhetik am 23. Januar 1936 Friedrich Meinecke in einem Festvortrag<br />
an der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin als Effekt der<br />
Befreiungskriege (gleichursprünglich also zur Genese der MGH) beschreibt: »Ins<br />
Reale hinein, sei es um es zu gestalten, sei es um es zu erkennen, ging fortan der<br />
Weg des deutschen Geistes.« Ranke habe die Befreiungskriege »zwar nicht elementar<br />
miterlebt, aber mit sinnendem Gemüte gleichsam nacherlebt, als Bedürfnis<br />
nach strenger Empirie und nach »Vermählung des Empirischen mit der Idee«. 1<br />
Goethes und Herders Jugend fehlte demgegenüber noch jene Kriegserfahrung als<br />
der »mächtige <strong>Im</strong>puls, der hinzukommen mußte, um am geschichtlichen Leben<br />
die Vermählung <strong>von</strong> Idee und Realität überall und voran im Staate und den ihn<br />
tragenden Kräften der Nation wahrzunehmen.« Gedächtnis als Archiv ist Mechanik;<br />
historische Erinnerung wird nur, was ein <strong>Im</strong>perativ mobilisiert. <strong>Im</strong> Falle Rankes<br />
sind das die aus der Zeit <strong>von</strong> 1806 bis 1815 sich entwickelnden nationalen und<br />
politischen Bewegungen . Rankes Historiographie schreibt also ins Reale<br />
hinein, doch im Zeichen eines <strong>Im</strong>aginären, denn die meta-physische Kehrseite seines<br />
Insistierens auf Empirie ist die Geschichtsreligion Rankes. Ranke beschritt<br />
methodisch den Weg <strong>von</strong> der Sekundär- zur Primärquelle, bis zur Auflösung des<br />
narrativen Zusammenhangs aller Historie im Archiv. Daß sich das Subjekt des<br />
Historikers nicht selbst dabei auflöst, verhindert sein Glaube an einen transzendenten<br />
Sinn jenseits der Zerstreutheit der kontingenten Daten. Scheinbar steckt<br />
Gott im Detail (Aby Warburg), doch gleichzeitig flüstert Klio den Historikern<br />
ständig zu, daß die Details, so entscheidend sie auch sein mögen, noch nicht Gott<br />
sind: »Nach der Mühsal in Archiven und Bibliotheken, nach dem Aufspüren <strong>von</strong><br />
Urkunden und verschollenen Manuskripten, selbst nach der Anordnung der<br />
Bruchstücke zu einem sinnvollen Mosaik hat wohl so mancher unter uns das<br />
Gefühl, daß die Aufgabe doch noch nicht erfüllt ist.« 2 An der variablen Stelle der<br />
Leopold v. Ranke. Gedächtnisrede, in: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie<br />
der Wissenschaften, Öffentliche Sitzung zur Feier des Jahrestages König Friedrichs II.<br />
am 23. Januar 1936, Berlin (Verlag der AdW) 1936, xxxiii-xlv (xliv)<br />
Yosef Hayim Yerushalmi, Ein Feld in Anatot. Versuche über jüdische <strong>Geschichte</strong>, Berlin<br />
(Wagenbach) 1993, Vorwort, unter Bezug auf ein Diktum Aby Warburgs
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 191<br />
Verkopplung <strong>von</strong> Ordnung und Sinn setzt Ranke, der in seiner Jugend 1817 das<br />
prägnante Luthergedächtnisjahr durchlebt hatte, Gott ein: »Die Wurzeln des universalen<br />
Erkenntnisdranges, aus dem Rankes Werk aufgestiegen ist, ruhen in der<br />
religiösen Sphäre.« 3 Selbst ohne geschichtsphilosophische Emphase, bedürfen die<br />
Daten der Vergangenheit einer synekdochischen Aufladung im <strong>Im</strong>aginären; Ende<br />
März 1820 wird es zum O-Ton Ranke:<br />
»In aller <strong>Geschichte</strong> wohnt, lebet, ist Gott zu erkennen. Jede Tat zeuget <strong>von</strong> ihm,<br />
jeder Augenblick prediget seinen <strong>Namen</strong>, am meisten aber der Zusammenhang<br />
der <strong>Geschichte</strong>. Er steht da, wie eine heilige Hieroglyphe, an seinem Äußersten<br />
aufgefaßt und bewahrt, vielleicht, damit er nicht verloren geht künftigen<br />
sehenderen Jahrhunderten.« <br />
Historische Darstellung als primäre Aufgabe der Geschichtswissenschaft bedarf<br />
der erzählenden Veranschaulichung als adäquate Form <strong>für</strong> die zeitlich ablaufende<br />
Ereignisfolge, »allerdings kann sie nicht als absolute Form gelten«; 4 mag <strong>Geschichte</strong><br />
nach wie vor die effektivste Form der Mobilisierung, Verarbeitung und<br />
Weitergabe (sowie Speicherung) <strong>von</strong> Daten der Vergangenheit sein - die einzige<br />
ist sie nicht. Ihr Begriff ist an Funktionalität mehr denn an Sinn gekoppelt - nicht<br />
nur in Hinblick auf die Vermittlung, sondern auch hinsichtlich der Quellenlage.<br />
Archivische Formationen verlangen nach einem methodisch flexiblen Darstellungsmodus<br />
als ihr strategisches Äquivalent. Alexander <strong>von</strong> Humboldts Worte<br />
formulieren in einem Brief an Ranke vom Februar 1833 dessen »Talent, gleich<br />
mächtig in dem Drange nach Combination (Verknüpfung des Geschehenen<br />
durch Intelligenz) als in der glücklichsten Belebung der Sprache« . Doch die kognitive Dissonanz zwischen diskreter<br />
Datenästhetik der Archivforschung und synthetisierender Darstellung als Historie<br />
bleibt bis ins Alterswerk Rankes unaufgelöst, mithin ein Widerstreit: »Der<br />
Drang nach dem Universalen, der Zwang, sich in das Einzelne zu vertiefen, die<br />
Sorge, Fragment zu bleiben, ringen miteinander« . Materialsammlungen,<br />
Parerga stehen am Ende eines Historikerlebens: Rankes<br />
Weltgeschichte. Nur wer <strong>für</strong> das Archiv als non-narrativem Gedächtnis nicht<br />
blind ist, hat Einsicht in seine verborgenen Verknüpfungen; wer die Entwürfe<br />
zu Rankes Weltgeschichte aufschlägt, die der erblindete Achtzig- und Neunzigjährige<br />
diktiert, da er »die Anschauung aus den Quellen nur noch mit Hilfe<br />
fremder Augen zu gewinnen vermochte« , ahnt es.<br />
Die ideologisierte Geschichtswissenschaft der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts<br />
deklarierte eine Dreieinigkeit zwischen Forschung, Darstellung und Auffassung<br />
3 Hermann Oncken, Aus Rankes Frühzeit, Gotha (Perthes) 1922, 2<br />
4 Carl August Lückerath, Prolegomena zur elektronischen Datenverarbeitung im<br />
Bereich der Geschichtswissenschaft, Historische Zeitschrift 207. Bd. (1968), 265-296<br />
(272)
192 MONUMENTA GHRMANIAE<br />
der Vergangenheit; »jedenfalls lehne ich es ab, zuzugeben, daß zwischen diesen<br />
drei Gebieten geschichtlichen Wissens ein Gegensatz besteht« - eine Ablehnung<br />
also wieder besseres Wissen. 5 Vergangenheit in ihrer modularen Konfiguration<br />
als Gedächtnis zu lesen heißt auf der Darstellungsebene, das Archiv zu schreiben.<br />
In einer Aufzeichnung der dreißiger Jahre bemerkt Ranke einmal, daß die<br />
Historie immer wieder umgeschrieben wird, unter der Einwirkung der jeweiligen<br />
Tendenzen der Zeit, und daß man daher immer wieder durch diesen<br />
Schleier »zu der ursprünglichen Mitteilung zurückkehren« müsse. Diese Tendenzen<br />
sind in konkreten Speicherrekursen faßbar. Doch würde man diese ohne<br />
den <strong>Im</strong>puls der Gegenwart überhaupt aktivieren? Solche <strong>Im</strong>pulse stiften auf der<br />
Darstellungsebene Einheit, wo Fragmente im Speicher vorliegen. In einem Brief<br />
an seinen Verleger Friedrich Perthes am 15. März 1932 aus Berlin kündigt Ranke<br />
<strong>für</strong> das nächste Heft seiner Historisch-politischen Zeitschrift einen Aufsatz »Fragment<br />
deutscher <strong>Geschichte</strong>« zum 16. Jahrhundert an: »über die Möglichkeit, die<br />
Einheit <strong>von</strong> Deutschland zu behaupten, nach der Reformation; wie man sich<br />
aber in die Parteyung religiöser Theorien warf und Deutschland zu gründe richtete«<br />
. Oncken beschreibt das Zustandekommen<br />
<strong>von</strong> Rankes Deutsche <strong>Geschichte</strong> im Zeitalter der Reformation zwischen<br />
1825 und 1835 als Kampf mit der Diskretheit des Materials: »Indem diesmal die<br />
Aktenbestände der wichtigsten deutschen Archive unmittelbar zugrunde gelegt<br />
werden konnten, wurde die quellenmäßige Fundamentierung der Reformationsgeschichte<br />
aus den echtesten Quadern gefügt: stufenweise war er zu diesem<br />
ursprünglichsten Material vorgeschritten« . Bei der Darlegung<br />
einer Datenbank aber bleibt es nicht. Was Archäologie in Historie transformiert,<br />
ist nicht nur die Insistenz der Hermeneutik, sondern auch die<br />
apotropäische Verwechslung <strong>von</strong> Daten und Leben: »Vor allem aber rauschte in<br />
seinem Erkenntnisdrange, indem er hier in die tiefsten Lebensschächte seiner<br />
eigenen Individualität hinabstieg, auch der Quell des Lebens selber und verlieh<br />
diesem Werke, wie ein Blutstrom vom Herzen kommt, eine tiefere menschliche<br />
Wärme« . Von Schächten spricht Oncken an anderer Stelle, im Kontext<br />
<strong>von</strong> Rankes Archiv-Recherche in Venedig; Reisen ins Innere des Archivs sind<br />
auch Erkundungen der Psyche. 6 Der Zugang zur Erinnerung über Inventare<br />
heißt Gedächtnis, logistisch präzise; Erinnerung ist <strong>für</strong> Hegel keine hervorbrin-<br />
Hans Hirsch, Das Österreichische Institut <strong>für</strong> Geschichtsforschung 1854-1934, in: Mitteilungen<br />
des Österreichischen Instituts <strong>für</strong> Geschichtsforschung 49 (1935), 1-14 (13)<br />
Siehe W. E., Reisen ins Innere des Archivs, in: Ulrich Johannes Schneider /Jochen<br />
Kornelius Schütze (Hg.), Philosophie und Reisen, Leipzig (Leipziger Universitätsverlag)<br />
1996, 160-177; ferner W. E., Rhetorik des Ornaments, in: Ursula Franke /<br />
Heinz Paetzold (Hg.), Rhetorik des Ornaments und <strong>Geschichte</strong>. Studien zum Strukturwandel<br />
des Ornaments in der Moderne, Bonn (Bouvier) 1996, 283-301
ANNAUSTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 193<br />
gende Funktion des Geistes, sondern im Gegenteil eine versenkende, indem sie<br />
räumlich und zeitlich gesonderte Eindrucksinhalte in den nächtlichen Schacht,<br />
die Tiefe unanschaulicher geistiger Aufbewahrung zusammenzieht. Die Erweckung<br />
dieser Tiefe, um ihren Gehalt wieder zutage zu fördern, überläßt Hegel<br />
vielmehr dem Gedächtnis - scharf unterschieden <strong>von</strong> der Erinnerung. 7<br />
Zur Differenz <strong>von</strong> Datenaskese und Darstellungsästhetik<br />
Wer nichts über die Sache versteht, schreibt über die Methode«, meint Gottfried<br />
Hermann, einer der Väter der kritischen Philologie zu Beginn des 19. Jahrhunderts;<br />
<strong>von</strong> solchem Vorwurf habe sich die Monumenta freigehalten, »indem sie<br />
in den Editionen selbst ihre Prinzipien zur Geltung brachten, in ständiger Korrespondenz<br />
mit der fortschreitende Erkenntnis, den gewandelten Bedürfnissen<br />
und den technischen Verbesserungen.« 8 Ist die Beschränkung auf kritische<br />
Datenverarbeitung eine Verständnisverkürzung oder eine Entschlackung der<br />
Historie? 1857 klagt Johann Gustav Droysen:<br />
»Wir sind in Deutschland durch die Rankesche Schule und die Pertzischen Arbeiten<br />
auf unleidliche Weise in die sogenannte Kritik versunken, deren ganzes<br />
Kunststück darin besteht, ob ein armer Teufel <strong>von</strong> Chronisten aus dem anderen<br />
abgeschrieben hat Es hat schon einiges Kopfschütteln veranlaßt, daß ich <br />
behauptet habe, die Aufgabe des Historikers sei Verstehen.« <br />
<strong>Im</strong> gleichen Brief reagiert Droysen auf diesen Defekt durch Verkündigung seines<br />
Entschlusses, im nächsten Semester an der Berliner Universität »Enzyklopädie<br />
und Methodologie der historischen Wissenschaft« zu lesen - die Anfänge <strong>von</strong><br />
Droysens Historik. Den Anschluß der MGH zur Geschichtswissenschaft bildet<br />
in der Tat das Seminar Leopold <strong>von</strong> Rankes, nicht Droysens Historik; deutsches<br />
Gedächtnis entsteht in Kopplung an Datenbanken, nicht an literarische Darstellungsfragen.<br />
Ranke stellt in seiner Schrift Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber<br />
(1824) ein Muster <strong>von</strong> Quellenkritik auf, während seine praktischen Übungen die<br />
Mehrzahl künftiger MGH-Mitarbeiter »an den Monumenten« ausbildeten . Der Nachweis <strong>von</strong> intertextuellen Verweisen im Medium des<br />
Archivs organisiert Daten der Vergangenheit nach einem funktional anderen<br />
Modell als Historiographie es leistet. Rankes Kommentar zur Annalistik ist sich<br />
dieser Differenz bewußt und formuliert sie ausdrücklich:<br />
7 Hermann Schmitz, Hegels Begriff der Erinnerung, in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte<br />
Bd. 9, Bonn (Bouvier) 1964, 37-44 (40)<br />
8 H. Fuhrmann, Die Sorge um den rechten Text, in: ders., Einladung ins Mittelalter,<br />
München 1987, 234f
194 MoNUMKNTA GliRMANIAK<br />
»Die Aufzählung äußerer Bestimmung, Mann, Zahl, Thatsache, hat etwas Gleichartiges<br />
mit einer <strong>von</strong> außen eingedrungenen Schematisirung. Sie dringen beide<br />
nicht in das Innere des großartigen Stoffes vor. aus den Hieroglyphen erhebt<br />
sich uns eine Überlieferung in Bildern; ist dies schon <strong>Geschichte</strong>? Es sind nur<br />
Denkmale, lautlos und einsilbig; die <strong>Geschichte</strong> kann nicht anders überliefert werden<br />
als durch Gedächtnis und Erzählung. Man hat in neuer Zeit den größten<br />
Werth auf den Zusammenhang der Poesie mit der Historie gelegt, was auch daher<br />
rührt, daß die Poesie unendliche viel aufgenommen hat, was in die Historie gehört,<br />
allein der Charakter der Wissenschaft beginnt erst, wo es sich ausscheidet.« 9<br />
Dagegen setzte Droysen als die Aufgabe des Historikers Hermeneutik das Verstehen,<br />
eine subjektzentrierte Perspektive, die (auch) um die Autorität des Autors<br />
kreist. Die aber wird <strong>von</strong> der diskreten Praxis der MGH ausgeschaltet; Fuhrmann<br />
spricht <strong>von</strong> dem »anonym machende Gesamtwerk« der Monumenta. Das<br />
Schicksal der Editoren: »Wo die Ausgabe eines Textes zitiert wird, pflegt nicht<br />
selten allein der Ort innerhalb des Gesamtwerks der Monumenta angegeben zu<br />
werden, der Name des Bearbeiters fehlt«. Das korrespondiert mit der Anonymität<br />
eines Teils der dargelegten Texte selbst, etwa in der Notation: Die Chronik<br />
<strong>von</strong> Montecassino, MGH Scriptoren 34. 10 Droysen liest sein Berliner Semester<br />
Enzyklopädie und Methodologie der historischen Wissenschaften als Reaktionsformation<br />
gegenüber der MGH-Praxis des Umgangs mit Vergangenheit als Datenbank.<br />
So hat er schließlich die Aufgabe der Geschichtswissenschaft definiert:<br />
das Schweigen <strong>von</strong> Daten in die Rede <strong>von</strong> Historie zu verwandeln, sie also hermeneutisch<br />
derart aufzubereiten, daß sie der geschichtlichen Interpretation<br />
zugänglich wird. Auch Fuhrmann plädiert gegen die dekontextualisierende, nur<br />
kritisch-editorisch gerahmte Präsentation eines Dokuments als quasi-archäologisches<br />
Monument, da Quellen über die Edition ihres Wortlauts hinaus zur Aussage<br />
drängen und <strong>für</strong> ihr rechtes Begreifen die Einbeziehung außerhalb des Textes<br />
liegender Gesichtspunkte und Verständnisfelder fordern, ob nun gesellschaftlicher,<br />
soziologischer, theologischer oder anderer (etwa medienarchäologischer)<br />
Art. »Die entscheidenden Entdeckungen sind nicht im kritischen Apparat, sondern<br />
über die Individualität früherer Menschen und Zeiten gemacht worden«<br />
. Der gute Wille der Hermeneutik als Verstehenwollen<br />
aber ist untrennbar verstrickt in den Willen zum Wissen als Textmacht. Fuhrmann<br />
formuliert, was im <strong>Im</strong>puls der MGH einmal auf den Vektor Deutschland ausgerichteter<br />
Text hieß: »Bei aller Sorge um den rechten Text sollte der Historiker<br />
nicht minder die Sorge um die Voraussetzung mitbedenken, sich um den rechten<br />
9 Zitiert nach: Eberhard Kessler, Rankes Idee der Universalhistorie, in: Historische Zeitschrift<br />
178, Heft 2 (1954), Anhang (Typoskript Ranke), 307 f<br />
10 Horst Fuhrmann, Gelehrtenleben. Über die Monumenta Germaniae Historica und ihre<br />
Mitarbeiter, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters 50 (1995), 1-31 (18f)
ANNAI.ISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 195<br />
Text sorgen zu dürfen« . Derselbe Droysen, der in seiner Historik <strong>für</strong> die<br />
Kategorie der Verstehens plädierte, hat ein wissensarchäologisches Verfahren vorgeschlagen,<br />
Befunde aus ihrer narrativen, historiographischen Umklammerung<br />
wieder zu befreien und Kritik als veritable Dekonstruktion zu nobilitieren: »daß<br />
sie die neu kombinierten alten Nachrichten aus ihrer neuen Umgebung und<br />
Kombination herauslöse und soweit möglich in ihre alte Atmosphäre zurückbringe«;<br />
etwa die Darstellung der Reformationszeit aus der Feder Rankes:<br />
»So würde man doch sich sehr bedenken, Rankes Benutzung des Materials ohne<br />
weiteres als feste Grundlage zu verwerten. Wie vortrefflich Rankes Auffassung<br />
und Darstellung ist,- man würde über ihn hinaus zu den Archiven selbst<br />
gehen, die er benutzt hat; wenn man das nicht kann, seine Darstellung sich so zerlegen,<br />
daß man seine einzelnen archivalischen Angaben ablöst <strong>von</strong> der Form und<br />
dem Zusammenhang, in den er sie gestellt hat; man würde das Mosaikbild, das er<br />
komponiert hat, zerlegen, um sich die einzelnen Stiftchen zu einer neuen Komposition<br />
reinlich und handlich zurechtzulegen.« 11<br />
Diese Wahrnehmung der radikalen Gegenwart <strong>von</strong> Gewordenem, »das räumliche<br />
Beieinander aus unzähligen Zeitfolgen«, beschreibt den reinen Raum des<br />
Archivs. 12 Auf dem Mißtrauen gegenüber historiographisch bereits aufbereiteten<br />
Daten beruht auch die Arbeitspraxis <strong>von</strong> Michel Foucault, sich nicht damit begnügen,<br />
bereits publizierte Bücher zu dieser oder jener Epoche zu lesen, »sondern<br />
sich selbst ein Bild machen.« 13 <strong>Im</strong> Falle Foucaults ist dies die Folge seiner Einsicht<br />
in den Zusammenbruch der Großen Erzählungen (vor allem des Marxismus): Es<br />
scheint ihm nicht mehr »ausreichend, den Wissenden Vertrauen zu schenken und<br />
<strong>von</strong> oben herab zu bedenken, was andere tief unten gesucht hatten.« Foucault mag<br />
daher nicht mehr die Materie, über die er zu reflektieren sich anschickt, fertig aus<br />
den Händen der Historiker in Empfang nehmen, sondern lieber »sich selber auf<br />
die Suche machen, um es zu definieren und als historischen Gegenstand in Angriff<br />
zu nehmen.« Anstelle <strong>von</strong> Reflexion über <strong>Geschichte</strong> also Reflexion in der <strong>Geschichte</strong><br />
- »eine Arbeit, die man selbst machen muß. Man muß bis auf den Grund<br />
der Mine schürfen«. 14 Damit ist nicht nur Foucaults Begriff der Wissensarchäo-<br />
11 Johann Gustav Droysen, Historik. Historisch-kritische Ausgabe <strong>von</strong> Peter Leyh 1:<br />
Die Vorlesungen <strong>von</strong> 1857, Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung aus den<br />
Handschriften (Stuttgart-Bad Cannstatt, 1977), 155<br />
12 Gustav Droysen, Zur Quellenkritik und deutschen <strong>Geschichte</strong> des 17. Jahrhunderts,<br />
in: Forschungen zur deutschen <strong>Geschichte</strong> 4 (1864), 15-20 (20) Wiederabdruck in:<br />
ders., Texte zur Geschichtstheorie. Mit ungedruckten Materialien zur »Historik«, hg.<br />
Günter Birtsch /Jörn Rüsen, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1972, 60-65 (63)<br />
13 Didier Eribon, Michel Foucault. Eine Biographie, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1993<br />
("•Paris: Flammarion 1989), 392<br />
14 Michel Foucault in der Zeitung Liberation, 21. Januar 1983, zitiert nach: Eribon 1993:<br />
392f, der ihn ebd. interviewte.
196 MONUMENTA GßRMANlAE<br />
logie ein metaphorischer Effekt <strong>von</strong> Archivarbeit, sondern auch definiert, was das<br />
heißt: das Archiv (transitiv) schreiben. Deutlich ist damit ebenfalls, wie sich (bei<br />
Foucault) das Bild der Tiefe in etwas einschreibt, das doch Parataxe meint - die<br />
Tiefenmetapher <strong>für</strong> den Umgang mit Texten und ihrer Bedeutung ist eine hermeneutische<br />
Verführung, die historische Syntax erst möglich macht und der auch der<br />
Wissensarchäologe schwerlich entkommt. Die semantische Begriffsverschiebung<br />
macht es manifest: Nicht Reflexion über <strong>Geschichte</strong> ist der Gegenstand solcher<br />
Arbeiten, sondern <strong>Geschichte</strong> als eine Form des Nachdenkens und Darstellens<br />
archivischer Gegebenheiten; Reflexion in der <strong>Geschichte</strong> meint so das Navigieren<br />
im Raum (und nicht jenseits) des Textarchivs.<br />
Auf dem Feld der Mediävistik ist es Wolfram <strong>von</strong> den Steinen, der mit Das<br />
Kaisertum Friedrichs des Zweiten nach den Anschauungen seiner Staatsbriefe<br />
(Berlin / Leipzig 1922) buchstäblich die Bausteine zur Verfügung stellte, welche<br />
der deutsch-jüdischen Historikers und George-Schüler Ernst H. Kantorowicz<br />
dann 1927 zu einem literarisch-biographischen Meisterwerk zusammenfügen<br />
kann. Springender Punkt ist auch hier die Differenz zwischen modularem und<br />
narrativem Gedächtnis, wie B. Schmeidler, Rezensent <strong>von</strong> Steinens Publikation,<br />
diskutiert. Längst vor dem deutschen Historikerstreit <strong>von</strong> 1930 zwischen dem<br />
Berliner Ordinarius <strong>für</strong> mittelalterliche <strong>Geschichte</strong>, Albert Brackmann, und<br />
Kantorowicz um Formen der Geschichtsschreibung, und geradezu als dessen<br />
Präfiguration, war die Zunft <strong>für</strong> diesen (irreduziblen) Widerstreit sensibilisiert:<br />
»Der Verfasser dieser Einzelstudie zu den Staatsanschauungen des Mittelalters<br />
sucht die Einheit und den inneren Zusammenhang in den Aeußerungen und<br />
Erlassen des letzten großen staufischen Kaisers herauszuarbeiten.« 15 Hegel hatte<br />
es verkündet: »Der große Mann ist der Geschäftsführer des Weltgeistes«, ist<br />
damit also aktenkundig zu fassen. Ist die (administrative) Wirklichkeit wie ihr<br />
historiographischer Reflex strukturiert?<br />
»Die ältere Generation der eigentlich klassischen mittelalterlichen Historiker<br />
würde an eine solche Frage mit einer vorläufigen kritischen Stiluntersuchung der<br />
Briefe usw., Klärung des Anteils des Petrus de Vineis <strong>von</strong> dem anderer, herangetreten<br />
sein und der mehr ästhetisch-künstlerisch gestaltenden Arbeitsweise des<br />
Verfassers und mancher anderer jüngerer mittelalterlicher Historiker ziemlich verständnislos<br />
und wohl geradezu ablehnend gegenüber gestanden haben. Sie klärten<br />
das Einzelne vielfach endgültig bis in kleinste und kamen meist nicht zur Gestaltung<br />
eines größeren Ganzen aus den bereitgestellten Bausteinen. Man mag sich die<br />
umgekehrte Methode einer neuen Zeit wohl gefallen lassen, wenn nicht vergessen<br />
wird, daß die schöpferisch-geistige Gestaltung und Durchdringung niemals<br />
<strong>von</strong> der exakten Einzeluntersuchung ganz gelöst werden kann . Mehr Geist<br />
und etwas weniger Methode ist sicherlich mit Recht das Programm einer jüngeren<br />
Richtung der mittelalterlichen Geschichtsforschung.« <br />
15 In: Preußische Jahrbücher Bd. 191 (Jan. bis März 1923), 371f (371)
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 197<br />
Herder erklärte in einer rhetorischen Trope der Umkehr die Nacktheit einer<br />
griechischen Statue zum eigentlichen Schmuck der Kunst. 16 Historiographie hat<br />
den Versuch einer schmucklosen Literatur unternommen. Grillparzer hat, spottend,<br />
Rankes historiographisches Kredo der Stilaskese zu jener Konsequenz<br />
getrieben, vor der ihr Autor zurückschreckte: »Eure Geschichtsschreibung im<br />
letzten Ausdruck ist die Urkunde im Naturselbstdruck.« 17 Auch das heißt Wissensarchäologie,<br />
buchstäblich. Der Direktor des Preußischen Historischen<br />
Instituts in Rom, Paul Kehr, plant 1904 mit dem Istituto Storico Italiano eine<br />
gemeinsame Edition der Regesta Cbartarum Italiae. Kehr und Monaci entwerfen<br />
die Maxime »arrivare al piü possibile al testo originale e riprodurre il centenuto<br />
con le parole stesse del documento.« 18 Doch archivische Monumente<br />
selbst sprechen nicht; ihre historiographische Verwandlung in Dokumente des<br />
Lebendigen ist ein rhetorischer Akt.<br />
»Die >Quellen< springen immer tiefer unter den immer höher werdenden Bergen<br />
der >Literatur
198 MONUMUNTA GERMANIAE<br />
zung und das unentbehrlichste Hilfsmittel <strong>für</strong> die gelehrte Forschung der Zukunft.<br />
Daß Deutschland-Preußen schon jetzt in Rom die relativ beste und vollständigste<br />
historische Bibliothek besitzt, gibt der deutschen Wissenschaft <strong>von</strong> vornherein ein<br />
Übergewicht über die andern Institute. Auch das Kaiserliche archäologische Institut<br />
beweist die Notwendigkeit seiner Existenz vornehmlich durch die starke<br />
Benutzung seiner ausgezeichneten Bibliothek.« 21<br />
Koordinaten <strong>von</strong> Raum und Zeit<br />
Louis Althussers Kritik an Hegels totalisierendem Geschichtsbegriff bezweckt<br />
- im Sinne der Pariser Historikerschule um die Zeitschrift Annales - den Hinvveis<br />
auf unterschiedliche Periodisierungen und Zeitebenen als Pluralisierung<br />
>iner scheinbar einzigen und allgemeinen <strong>Geschichte</strong>. Sie führt den Nachweis,<br />
laß verschiedene Modi derselben existieren, verschiedene Geschichtsformen, die<br />
e nach ihrem Typus ausdifferenziert sind: »Man muß diese Unterschiede in den<br />
Rhythmen und Skandierungen auch denken in bezug auf ihre Fundierung, ihren<br />
Typus der Verknüpfung, der Verschiebung und Verdrehung, wodurch diese ver-<br />
;chiedenen Zeiten untereinander verbunden sind.« 22 Auch Reinhart Koselleck<br />
;pricht in Bezug auf Preußen zwischen Reform und Revolution archäo-chrolologisch<br />
<strong>von</strong> »verschiedene Schichten geschichtlicher Zeit, deren differieende<br />
Dauer, Geschwindigkeit oder Beschleunigung die Differenzen der<br />
lamaligen Epoche auslösten.« 23 Diese multiple Wahrnehmung einer hier noch<br />
ls Signifikat formulierten Historie, der nach Anpassung auch in der Darstellung<br />
leischt, gilt es auf der Ebene ihrer Signifikation, also medialen Verzeichnung,<br />
ipeicherung (die Umschichtungen des Archivs) und Übertragung weiterzuden-<br />
.en, der Art ihrer Einschreibung: Denn was Althusser hier formuliert, benennt<br />
atsächlich die Techniken und die Kybernetik <strong>von</strong> Aufschreibesystemen und<br />
bren Speichern. Die Konstruktion <strong>Geschichte</strong> beruht auf räumlich angeordneen<br />
Daten und der Annahme, daß zwischen ihnen eine zeitliche Beziehung<br />
>esteht. Es gibt sehr konkrete Geschichtszeichen, und die heißen Signale, logitische<br />
Markierung, die gleich unmittelbar Archive und Archäologien steuern:<br />
Denkschrift Kehrs an den preußischen Minister der geistlichen und Unterrrichts-<br />
Angelegenheiten, 6. Oktober 1911 (Archiv DHI-Rcg. 10, Bl. 87r-97r (Bl.95v-96r) =<br />
Goldbrunner a. a. O., 61 (Anhang V)<br />
: Louis Althusser, L'objet du Capital, in: ders. / E. Balibar / R. Establet, Lire le Capital,<br />
Bd. II, Paris 1965, 48; hier in der deutschen Übersetzung durch Peter Schöttler,<br />
Althusser und die Geschichtsschreibung der »Annales« - Ein unmöglicher Dialog, in:<br />
kultuRRevolution 20 (Dezember 1988), 26-31 (30)<br />
Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht,<br />
Verwaltung und soziale Bewegung <strong>von</strong> 1791 bis 18148 ( :: '1966), 2. berichtigte<br />
Auflage Stuttgart (Klett) 1975,14
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 199<br />
»Wie die bürgerliche <strong>Geschichte</strong> Wappen zu Rathe ziehet, Münzen untersucht,<br />
und alte Inschriften entziffert, um Epochen in den Revolutionen des Menschengeschlechts<br />
festzusehen : so muß die Naturgeschichte in den Archiven der<br />
Welt nachsuchen, alte Denkmäler aus den Eingeweiden der Erde hervorziehen,<br />
diese zerstreuten Trümmer sammeln, und alle Spuren natürlicher Veränderungen<br />
vereinigt als Beweise gebrauchen, die den Forscher zur Bestimmung der verschiedenen<br />
Alter der Natur leiten können. Dies ist das einzige Mittel, um Ruhepuncte<br />
in der Unendlichkeit des Raumes zu finden, und einige Zahlsteine auf dem ewigen<br />
Weg der Zeit zu legen. Die Vergangenheit ist wie die Entfernung; unser Gesicht ist<br />
zu kurz, und würde sich ganz ihr verlieren, hätte nicht <strong>Geschichte</strong> und Zeitrechnung<br />
an den dunkelsten Stellen Signale und Fackeln aufgestellt, die uns auf unserem<br />
Weg leuchten. « 24<br />
Von der Chronologie schreibt Paul Valery, sie sei im Verhältnis zu den übrigen<br />
(impliziten) Bedingungen jedes beliebigen historischen Werkes »ebenso konventionell<br />
wie die alphabetische Reihenfolge.« 25 Chronologie bindet <strong>Geschichte</strong><br />
zurück an jene Daten, mit der ihre Autorität steht und fällt:<br />
»Wer über die Glaubwürdigkeit der <strong>Geschichte</strong> nachgedacht hat, wird die<br />
Ueberzeugung gewonnen haben, daß eine eigentlich beglaubigte <strong>Geschichte</strong> nur<br />
durch als historisch richtig erwiesene Ueberlieferungen, namentlich aber durch<br />
Urkunden erreicht werden kann . Ein Verstoß <strong>von</strong> wenigen Tagen schon kann<br />
manchmal den ganzen Hergang einer der wichtigsten Handlungen in Verwirrung<br />
bringen und die ganze Verkettung der Thatsache auseinanderreißen.« <br />
Datierung dient der Ortung <strong>von</strong> Autorität, in <strong>Geschichte</strong> wie in Dichtung.<br />
Anfang 1960 haben haklose Plagiatsvorwürfe Paul Celan so aufgestört, »daß er<br />
fortan jede Notiz markierte wie ein Buchhalter seiner selbst« . Tatsächlich geht Datierung in Verortung über, ablesbar im Rückgang<br />
der systematischen Beschäftigung mit Datierungspraxis in historiographischen<br />
Quellen nach dem Ersten Weltkrieg: »Die Zeitkategorie war hinter die<br />
Raumkategorie zurückgetreten, der >Historismus ins Landschaftliche übertragen^«<br />
26 Eine Schreibweise der Chronologie heißt Annalistik. Annalen sind<br />
Eintragungen auf ein chronologisches Endlosband serieller Natur in diskreten<br />
24<br />
Georges-Louis Leclerc Buffon, Epochen der Natur (1778), dtsch. in 2 Bdn, St. Petersburg<br />
1781, 3f<br />
25<br />
Paul Valery, Cahiers / Hefte 1-6, Frankfurt/M. 1987-1993, hier: Heft 5, 538. Dazu Jacques<br />
Ranciere, Sprache der Tatsachen, Poetik des Wissens, in: Neue Rundschau, 105.<br />
Jg. 1994, Heft 1<br />
26<br />
Peter Rück, Konjunkturen der Chronologie und der Zeitmaße. Zur urkundlichen<br />
Festdatierung im 13. Jahrhundert, in: ders. (Hg.), Mabillons Spur, Marburg (Institut<br />
<strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften) 1992, 301-318 (305), unter Bezug auf: Karl Pivec,<br />
Die Stellung der Hilfswissenschaften in der Geschichtswissenschaft, in: Mitteilungen<br />
des Instituts <strong>für</strong> Österreichische <strong>Geschichte</strong> (MIÖG) 54 (1942), 3-16 (10)
200 MüNUMENTA GERMANIAE<br />
Zuständen zwischen Präsenz (Eintrag) und Speicher - »kürzlich und ohne<br />
besondere Zierlichkeit«; »in annalibus alles distincte muß ausgezeichnet seyn.« 27<br />
Nach den Erfindungen der Schrift (zu Zwecken, die zunächst vielmehr Kalkulation<br />
denn Literatur hießen) sind Jahrhunderte vergangen, bevor die Schreiber<br />
lernten, daß Schreiben auch Erzählen bedeuten kann, wenn seine Linearität an<br />
den Diskurs der Historie gekoppelt ist; »zuerst haben sie wohl nur aufgezählt<br />
und Szenen beschrieben.« 28 Indem die fränkischen Annalen in den MGH nicht<br />
als historische Dokumente, sondern als temporis monumenta, als hoc genus<br />
monumentorum benannt werden 29 , repräsentieren sie nicht eine Vorstufe der<br />
Historiographie, sondern eine alternative Schreibweise <strong>von</strong> Vergangenheit und<br />
Gegenwart als Datenmenge. Disziplinär aber gehört die Analyse der Annalistik<br />
- als Diplomatik - ins Ressort der Historischen Hilfswissenschaften, wird also<br />
unter die Arbeitsinstrumente des Historikers subsumiert. Geographie und<br />
Chronologie seinen <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> »dasselbe, was die Kenntniß der geographischen<br />
Länge und Breite <strong>für</strong> die Schifffahrt bedeutet, - eine genaue Ermittelung<br />
der Zeit, Localität und Verhältnisse derjenigen Umstände, auf welche sie<br />
sich beziehen.« 30 Navigation heißt Orientierung im Datenraum des Archivs; die<br />
Infrastruktur der Historie bildet ein zeit-räumliches Koordinatennetz wie die<br />
Orts- und Zeitangaben mittelalterlicher Königsurkunden ein positives Skelett,<br />
das Dispositiv <strong>für</strong> die Rekonstruktion eines Itinerars bieten, wie fiktiv der<br />
Rechtsinhalt der Urkunde auch sein mag. 31 Laut Aussage Hugos <strong>von</strong> St.-Viktor<br />
machen persone, a quibus res geste sunt (handelnde Personen), loca, in quibus<br />
geste sunt (Schauplätze), und tempora, quando geste sunt (Zeitpunkte) die Daten<br />
der Geschichtsschreibung aus; in dem Sinn ist die mittelalterliche Karte »gewissermaßen<br />
die graphische Darstellung des Menschen im Raum, das Annalenschema<br />
die in der Zeit.« 32 1849 - lange vor Fernand Braudel - publizierte J. S.<br />
17 Eintrag »Annales« in: Johann Heinrich Zedler, Großes Vollständiges Universal-Lexikon,<br />
Bd. 2, Halle / Leipzig 1732 (Reprint Graz 1961), Spalte 381; dort auch Angaben<br />
zur Differenz <strong>von</strong> Annalen und »Historien-Büchern«. S. a. Bd. 5 (1733), Eintrag<br />
»Chroniken und Historien«, Sp. 2270<br />
!8 Vilem Flusser, Die Revolution der Bilder. Der Flusser-Reader zu Kommunikation,<br />
Medien und Design, Mannheim (Bollmann) 2. Aufl. 1996, 36<br />
29 Ildefons <strong>von</strong> Arx, De annalibus Germanorum antiquissimus monitum, in: MGH Bd.<br />
1 (Scriptores), hg. v. G. H. Pertz, Hannover 1826, 1<br />
50 Eduard Brinckmeier, Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten<br />
und Völker, besonders des Mittelalters, 2. Auflage Berlin (Hempel) 1882, Vorrede<br />
zur ersten Auflage, v<br />
51 Beispielhaft da<strong>für</strong> die Studie <strong>von</strong> Dirk Alvermann, Königsherrschaft und Reichsintegration:<br />
eine Untersuchung zur politischen Struktur <strong>von</strong> regna und <strong>Im</strong>perium zur Zeit<br />
Kaiser Ottos II.; (967) 973-983, Berlin (Duncker & Humblot) 1998, Teil B<br />
52 Anna-Dorothee v. den Brincken, Europa in der Kartographie des Mittelalters, in:<br />
Archiv <strong>für</strong> Kulturgeschichte 55, Heft 2 (1973), 289-304 (294)
ANNALISTIK. ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 201<br />
Howson sein Traktat The History oftbe Mediterrane an: »We look on the Mediterranean<br />
as on a picture within a frame«; Geohistorie wird hier als Historiengemälde<br />
allegorisiert. Dagegen wird das neuzeitliche Europa <strong>von</strong> einer<br />
chronologischen Grenze bestimmt: »the time when the curtains of the Ocean<br />
were suddenly uplifted«. Howson ruft in der Tat Assoziationen an Braudels<br />
historiographische Skala der Zeiten am Rande des Mittelmeer wach, wenn er das<br />
Meer als Schauplatz und Zeugen <strong>von</strong> Kulturgeschichte beschreibt: Bevor er zu<br />
dem eigentlich Historischen kommt (properly historical), werden »physical features«<br />
und »physical configurations« besprochen - eine veritable historische<br />
Morphologie, historiographisches mapping?^ Der Kulturhistoriker Klemm setzt<br />
der chrono- und kartographischen Datenorganisation die Mündlichkeit des<br />
historischen Epos entgegen, »und wenn die Geschlechtstafeln gewissermaßen<br />
das Knochengerüst darstellen, die schlichte Erzählung Fleisch und Haut bildet<br />
- so versucht das Epos den lebendigen Hauch darüber auszugießen, die Wärme<br />
des Blutes, die Seele zu erwecken - es verhält sich zur Erzählung wie die Landschaft<br />
zur Landcharte , wie die Büste zur Todtenmaske.« 34 Agens der<br />
<strong>Geschichte</strong> bei Howson aber ist das Meer selbst; die Marginalität seiner Küsten<br />
wird zum Zentrum des Geschehens. Dann spricht Howson <strong>von</strong> den Phöniziern<br />
als »establishing new lines of communication« - eine den Diskursbegriff im<br />
Sinne aller Verkehrstechniken beim Wort nehmende Vernetzung des Raums.<br />
»They first communicated to the Greeks the use of alphabetic writing«, ohne<br />
dies »History had been impossible«. <strong>Geschichte</strong> (hier mit kapitaler Letter<br />
geschrieben) wird so in ihrer Historiographizität ernstgenommen. Seit der<br />
Erfindung des Buchdrucks »we contrast the age of manuscripts and the age<br />
of printed books«; die historische Koinzidenz der geohistorischen Entäußerung<br />
Europas 1495 und des Paradigmenwechsels der Aufschreibesysteme (auch der<br />
Historie selbst) schließt sich kurz zu einer epochalen Zäsur. Das Mittelmeer gibt<br />
Howson den musealen Rahmen <strong>für</strong> ein geographisches Koordinatennetz zur<br />
Erfassung sukzessiver Historie: Phönizier, Griechen, Römer und Sarazenen liefern<br />
ihm »the parallels of our latitude«; Ägypter, Etrusker, die Karthager, Vandalen<br />
und Venedig sind ihm »the meridians of our longitude«: »Within the<br />
Spaces formed by the intersection of these historic lines we may make<br />
some voyages together« - buchstäblich Kybernetik .<br />
Die figurative, literarisch-rhetorische Darstellung der Vergangenheit zielt an<br />
den non-diskursiven Agenturen ihrer Gedächtnisdatenverarbeitung vorbei;<br />
33 J. S. Howson sein Traktat The History of the Mediterranean , London 1849, 5-9. Vgl.<br />
Svetlana Alpers, Kunst als Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jh., Köln<br />
(Dumont) 1985<br />
34 Gustav Klemm, Allgemeine Cultur-<strong>Geschichte</strong> der Menschheit, 1. Bd.: Die Einleitung<br />
und die Urzustände der Menschheit, Leipzig (Teubner) 1843, Einleitung, 6
202 MONUMENTA GERMANIAE<br />
»only a chronicle of the facts is warranted, because otherwise one opens up oneself<br />
to the dangers of narrativization and the relativization of emplotment.« 35<br />
Der Unterschied <strong>von</strong> kontingent strukturierter Annalistik und kausal-kontextorientierter<br />
Historiographie entspricht dabei einem mathematischen Kalkül 36<br />
(das zugleich die archivischen Optionen <strong>von</strong> Pertinenz- oder Provenienzprinzip<br />
der Aktenordnung markiert): »A System which produces a sequence of<br />
Symbols according to certain probabilities is called a stocbasticprocess, and<br />
the Special case of a stochastic process in which the probabilities depend on the<br />
previous events, is called a Markoff process or a Markoff chain.« Damit kommt<br />
der Einfluß <strong>von</strong> Kontext (gemeinhin das Historische) ins Spiel . Vergangenheit als Archiv kann plausibler als Datenfriedhof beschrieben<br />
werden denn durch historische <strong>Im</strong>agination 37 ; Annalistik und Chronologie<br />
stehen auf Seiten der Datenketten. Ernst wird die wissensarchäologische<br />
Alternative zur Historie, wo sie nicht mehr Metapher bleibt, sondern serielles<br />
Aufschreibesystem wird. Analog zu Marginalien an frühmittelalterlichen Ostertafeln,<br />
dem Ursprung der Annalistik, setzt Narration, also die Erzählbarkeit der<br />
Vergangenheit (im Unterschied zu numerischer Aufzählung) am Rande <strong>von</strong><br />
gedächtnis-infrastrukturierenden Listen an. Das gilt <strong>für</strong> die Ordnung der Zeit<br />
wie <strong>für</strong> die Ordnung <strong>von</strong> Wissensräumen. Daß die Bibliothek des Klosters St.<br />
Gallen auch ein Wissensspeicher des kaiserlichen Hofes Karls des Dicken war,<br />
daraus derselbe sich seine Lesbücher holen ließ, deduziert Ildefons <strong>von</strong> Arx<br />
(ehedem Archivar des gleichnamigen Stifts und Herausgeber des 1. Bandes der<br />
MGH) aus einer entsprechend wissensarchäologischen, nicht historiographischen<br />
Marginalie, selbst als Fußnote formuliert: »Bemerkungen am Rande des<br />
Katalogs der Bibliothek«. 38 Die Administration<br />
der Vergangenheit als Gedächtnis folgt Zahlen, nicht Erzählung:<br />
»Die Chronisten des Mittelalters schreiben fast durchweg nicht <strong>Geschichte</strong> in unserem<br />
Sinne oder in der Weise des Thukydides, sondern sie berichten nach einander<br />
zusammenhanglose Facta, <strong>von</strong> denen sie Kunde erhalten. Matheus Paris z. B., der<br />
<strong>für</strong> uns wichtigste englische Autor der Stauferzeit, bringt wie seine Vorgänger und<br />
35 Hayden White, Historical Emplotment and the Problem of Truth, unter Bezug auf die<br />
Schriften <strong>von</strong> Berel Lang, in: Saul Friedländer (Hg.), Probing the Limits of Representation.<br />
Nazism and the »Final Solution«, Cambridge, Mass. / London 1992, 37-53 (44)<br />
36 Wolf Kittler, Digitale und analoge Speicher. Zum Begriff der Memoria in der Literatur<br />
des 20. Jahrhunderts, in: Anselm Haverkamp / Renate Lachmann (Hg.), Gedächtniskunst;<br />
Raum - Bild - Schrift, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1991, 387-408, bes. 389<br />
37 Siehe W. E., White Mythologies? Informatik statt <strong>Geschichte</strong>(n) - die Grenzen der<br />
Metahistory, in: Storia della Storiografia 25 (1994), Themenheft »Hayden White's<br />
Metahistory twenty years after«, Mailand (Jaca Book), 23-50<br />
38 <strong>Geschichte</strong> des Kantons St. Gallen, Bd. 1, 75. Nachdruck der Ausgabe <strong>von</strong> 1810-13 /<br />
1830, hg. Stiftsarchiv St. Gallen, St. Gallen 1987
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 203<br />
Nachfolger kapitelweise unter eigenen Rubriken nacheinander Berichte über die<br />
verschiedensten Dinge, über welche ihm mündliche oder schriftliche Mittheilungen<br />
zukommen. Hat er soeben erzählt, daß Kaiser Friedrich vor Parma liegt und<br />
die Stadt zur Übergabe zu zwingen sucht, so setzt er dahinter vielleicht die Nachricht,<br />
daß eine Scheune auf einem Gute seiner Abteil abgebrannt ist.« 39<br />
Diese Gegenwart ist als Nachrichtenraum strukturiert, und alle Signale darin<br />
gleich unmittelbar zur Dekodierung.<br />
Archäologie der Annalistik<br />
Annalen sind ist nicht die Vorstufe, sondern eine Alternative zur historischen<br />
Sinnbildung. 40 Sie sind eine Funktion <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien, nicht ihrer Deutung, und<br />
erweisen sich als ein Quietiv, nicht als ein Inzentiv der Geschichtsschreibung -<br />
Stillstellung und Entsemiotisierung der <strong>Geschichte</strong>, so Jan Assmann (der hier <strong>von</strong><br />
einem kalten Gedächtnis schreibt). Königslisten erschließen die Vergangenheit,<br />
dokumentieren sie, entziehen sie jedoch gerade der historischen <strong>Im</strong>agination. »Sie<br />
zeigen, daß sich nichts Erzählbares ereignet hat«, und sind »ein Instrument der<br />
Orientierung und Kontrolle, nicht der Sinnstiftung.« 41 Annalistik nämlich ist -<br />
im Unterschied zur Historiographie - an die Administration <strong>von</strong> Reichen selbst<br />
gekoppelt, und sie endet nicht mit dem Frühmittelalter, sondern kehrt im 19. Jahrhundert<br />
wissensökonomisch unter dem <strong>Namen</strong> Statistik wieder: das, was erzählt.<br />
Die Alternative zur narrativen Historiographie drückt sich hier nicht nur im Textmodus,<br />
sondern auch in der Schreibweise, im Notationssystem selbst aus:<br />
»Rien de plus instructif en general que les tableaux chronologiques des statisticiens,<br />
oü, annee par annee, ils nous revelent la hausse ou la baisse croissante d'une<br />
consommation ou d'une production seciale, d'une opinion politique particuliere<br />
traduite en bulletins de vote . Chacun de ces tableaux, ou mieux chacune des<br />
courbes graphiques qui les represente, est une monographie historique en quelque<br />
sorte. Et leur ensemble est la meilleure histoire qu'on puisse narrer.« 42<br />
Theodor Mommsen weist die originäre Staatsnähe der Annalen anhand der Annales<br />
des Tacitus nach. So ist die römische Geschichtsschreibung aus den Senats-<br />
39 O. Holder-Egger, Die Monumenta Germaniae und ihr neuester Kritiker. Eine Entgegnung,<br />
Hannover (Hahn) 1887, 20f<br />
40 Siehe Carlo Ginzburg, Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der <strong>Geschichte</strong>, in:<br />
Fernand Braudel et al., Der Historiker als Menschenfresser. Über den Beruf des<br />
Geschichtsschreibers, Berlin (Wagenbach) 1990, 85-102 (bes. 94f)<br />
41 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität<br />
in frühen Hochkulturen, München (Beck) 1992, 73ff<br />
42 Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation, Paris 1890, Kapitel IV (Qu'est-ce que l'histoire?),<br />
Absatz »L'Archeologie et la Statistique«, 116f
204 MONUMKNTA GERMANIAE<br />
Protokollen erwachsen: »Die Fixierung der Thatsachen, welche das einzelne<br />
Gemeinwesen betreffen und bewegen, das heisst die Geschichtsschreibung<br />
knüpft da, wo das Gemeinwesen durch eine ständige Körperschaft repräsentiert<br />
wird, mit einer gewissen Nothwendigkeit an die Aufzeichnungen der Beschlüsse<br />
und Verhandlungen derselben an.« 43 Damit ist ein Verhältnis <strong>von</strong> Schrift und<br />
Geschehen angesprochen, das einen prä-historistischen Zustand der Datenverarbeitung<br />
nicht als einen Abschnitt in der <strong>Geschichte</strong> der Historiographie, sondern<br />
eine fortwährende Option bezeichnet. Es gilt also auch eher systematisch<br />
denn zeitlich <strong>für</strong> Leibniz< Fragment Apokatastasis panton: »Entsprechend dem<br />
prähistoristischen Zeitalter, sind <strong>für</strong> Leibniz Erlebbares und Protokollierbares,<br />
also >wirkliche< und >geschriebene< <strong>Geschichte</strong> - noch kongruent.« Es bedeutet<br />
einen nicht mehr historisch, sondern nur noch wissensarchäologisch faßbarer<br />
Kurzschluß, wenn Steierwald fortsetzt, »daß das Denken in repräsentativen Zeichensystemen<br />
dem späten 20. Jahrhundert mit seinen elektronischen Simulationen<br />
näher steht, als das epische 19. Jahrhundert.« 44 Daten und Tabellen,<br />
nicht <strong>Geschichte</strong>n; ebenso bezieht sich der Begriff Naturgeschichte aus prähistoristischer<br />
Perspektive »nicht wie im heutigen Verständnis auf die Entwicklung<br />
der Objekte und Arten der Natur, sondern auf die Beschreibung ihres<br />
gegebenen Zustandes. Die Naturgeschichtsschreibung vollzieht daher eine<br />
flächige Beschreibung des Bestehenden und nicht die historische Evolution des<br />
Gewordenen.« 45 Die auch als acta senatus oder commentarii senatus bezeichneten<br />
Aufzeichnungen im republikanisch-antiken Rom werden im Allgemeinen<br />
nicht veröffentlicht, es sei denn vereinzelt im Reichsblatt (Mommsen), den acta<br />
urbis. Narration ist hier eine Funktion der Aufschreibesysteme: Sowohl die Reihenfolge<br />
der erzählten Ereignisse wie deren Auswahl wird durch die Beschaffenheit<br />
dieser Hauptquelle bedingt, »beides sehr zum Schaden der historische<br />
Oekonomie und der innerlichen Vollständigkeit der Erzählung«:<br />
»In wie weit die Reihenfolge der Erzählung der Chronologie nicht der Vorgänge<br />
selbst, sondern der durch sie veranlassten Senatsverhandlungen sich anschliesst,<br />
wird durch die am Schluss aufgestellten Tabellen besser als durch weitläufige Darlegung<br />
vor Augen geführt, während andrerseits die nothwendige Beschränkung<br />
dieses Satzes durch Zusammenfassung des Gleichartigen sich daraus ebenfalls<br />
ergiebt.« <br />
43 Theodor Mommsen, Das Verhältnis des Tacitus zu den Acten des Senats, in: Sitzungsberichte<br />
der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, Jg. 1904, 2.<br />
Halbband, Berlin 1904, 1146-1155 (1146 u. 1148)<br />
44 Ulrike Steierwald, Wissen und System: zu Gottfried Wilhelm Leibniz< Theorie einer<br />
Universalbibliothek, Köln (Greven) 1995, 56 u. 65<br />
45 Ebd., 57, unter Bezug auf: Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben.<br />
Die <strong>Geschichte</strong> der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte, Berlin<br />
(Wagenbach) 1993,16
ANNAI.ISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 205<br />
Dementsprechend sende(r)orientiert wird in der römischen Dokumentenspeicherung<br />
auch »die Kriegserzählung nicht nach der Zeit der Action, sondern<br />
nach der des Rapports eingestellt« .<br />
<strong>Im</strong>mer schon unter dem Begriff <strong>Geschichte</strong> wahrgenommen, also als Gegenstand,<br />
nicht als Subjekt <strong>von</strong> Geschichtaufzeichnung, wird Annalistik in den MGH<br />
zu einer Allegorie des Nationalen. In einer »Nachricht über die beiden ersten<br />
Bände der Monumenta« disktuiert der Herausgeber (G. H. Pertz) den Ursprung<br />
der Annales Germanorum antiqissimi). Er hatte im 5. Band des Archiv die sogenannten<br />
kleinen Annalen nachgewiesen, »mit denen die Geschichtsschreibung in<br />
Deutschland anfängt«, indem hie und da ein Geistlicher an den Rand der den<br />
größeren Kirchen unentbehrlichen Zeittafeln christlicher Feste kurze Bemerkungen<br />
»über die ihm denkwürdigen Vorfälle seiner Zeit« - monumenta also - neben<br />
das Jahr, in welchem sie sich zugetragen hatten, aufzeichnete - Notizen, welche<br />
»ihrer Entstehung nach eine fast urkundliche«, also: archäo-logische Glaubwürdigkeit<br />
besitzen. Pertz datiert den Anfang dieser Art Geschichtsschreibung auf<br />
das Endes des siebten Jahrhunderts in die Niederlande, welche damals der Sitz des<br />
Hausmeiers Pippin und damit der Mittelpunkt des fränkischen Reichs waren:<br />
»Dabei ist es merkwürdig, daß <strong>von</strong> solcher wissenschaftlichen Thätigkeit im achten<br />
und neunten Jahrhundert nur sehr schwache Spuren in Frankreich und Italien<br />
vorkommen, wodurch es vollends außer Zweifel tritt, daß unser Vaterland zwar<br />
seine Schrift aus benachbarten Ländern erhalten, aber die Geschichtschreibung bei<br />
sich selbständig und ohne lebendiges Vorbild, aus den ersten Bedürfnissen frei entwickelt,<br />
und im Laufe eines Jahrhunderts mit überraschender Schnelligkeit bis zu<br />
Einhards lange unübertroffenen Werken fortgebildet hat.« 46<br />
<strong>Im</strong> Unterschied zur Historiographie sind Annalen <strong>von</strong> einem namenlosen, linguistisch<br />
nicht repräsentierten Subjekt verfaßt. 47 Die Annales Sangallenses, wie<br />
sie im ersten Band der MGH (Scriptores) auch im Faksimile reproduziert sind,<br />
geben eine Auflistung <strong>von</strong> Ereignissen, aber auch Nicht-Eintragungen in (ihrerseits<br />
gedächtnislosen) Speicherplätzen (Variablen) zu lesen, Lücken also, Schweigen<br />
als Aussage. Chronometrie reebnet mit dem seriellen Charakter der humanen<br />
Existenz selbst 48 , wie es in Sankt Gallen, »ubi historiam nunquam neglectam<br />
fuisse, multis indieiis constat.« 49 Solche Texturen sind <strong>für</strong> Historiker Information,<br />
46<br />
In: Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, hg. G. H. Pertz, 6.<br />
Bd., Hannover (Hahn) 1838, 258f<br />
47<br />
Siehe Klaus Weimar, Der Text, den (Literar-)Historiker schreiben, in: Hartmut Eggert<br />
/ Klaus R. Scherpe / Ulrich Profitlich (Hg.), <strong>Geschichte</strong> als Literatur: Formen und<br />
Grenzen der Repräsentation <strong>von</strong> Vergangenheit, Stuttgart (Metzler) 1990, 29-39 (34)<br />
48<br />
Hayden White, Tropics of Discourse. Essays in cultural criticism, Baltimore/London<br />
Qohn Hopkins UP) 1978, 234<br />
49<br />
Ildefons <strong>von</strong> Arx, XVI. Annales Sangallenses Maiores, dicti Hepidanni, in: MGH<br />
1826,72
206 MüNUMKNTA GuRMANIAE<br />
Nachrichten . Information aber darf nicht mit Bedeutung verwechselt<br />
werden: »Two messages, one of which is heavily loaded with meaning<br />
and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, as regards<br />
information«; die Herausforderung der Analyse <strong>von</strong> Texttradition (und der sie<br />
flankierenden Quellenkritik) ist vielmehr: »How does noise affect the accuracy<br />
of the message finally received at the destination? How can one minimize the<br />
undesirable effects of noise, and to what extent can they be eliminated?« 50 Natur<br />
und Tradition der Historie koinzidieren, wenn radikale Philologie der Versuchung<br />
widersteht, Lücken in Aufschreibesystemen durch narrative Konjekturen<br />
zu füllen. Das Kredo der streng philologischen Methode hat Theodor Mommsen<br />
beschrieben: die »einfach rücksichtslos ehrliche , keine Lücken der Überlieferung<br />
oder des eigenen Wissens übertünchende, immer sich selbst und anderen<br />
Rechenschaft legende Wahrheitsforschung.« 51 Mit Fragen nach dem Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Traditions-, also Übertragungsverlust und Bedeutung setzt die mathematische<br />
Kommunikationstheorie an. Die historische Erzählung (tautologisch<br />
gesprochen) ist demgegenüber immer schon eine Modellierung serieller Datenassemblagen,<br />
das Design eines Rahmens, in den Ereignisse versetzt werden, um<br />
sie als Elemente verschiedener Handlungstypen kodieren zu können. »But this<br />
fashioning is a distortion of the whole factual field of which the discourse purports<br />
to be a representation consisting in the arrangement of events in an<br />
order different from their chronological order« . Narrativisierung<br />
produziert - im Unterschied zur Chronik - Bedeutungen »by imposing a<br />
discursive form on the events by means that are poetic in nature.« 52 Doch<br />
sind auch Annalen nicht ganz und gar non-diskursiv verfaßt, sondern eingebettet<br />
in ein holistisches Dispositiv. Es geht der Geschichtsschreibung - mit Burckhardt<br />
und Droysen gesprochen - darum, Objekte oder Phänomene in historischem<br />
Zusammenhang begreiflich zu machen. Ist die annalistische Organisation der<br />
Ereignisdaten selbst immer schon Erzählung in nuce? Es bedarf spezifischer<br />
Schreibweisen des factual field, der Datenverarbeitung als »the manipulation of<br />
data to produce a more useful form, which we shall call information. The<br />
sequence of operations required to perform a specific task is known as an algorithm.«<br />
5i Auch Hayden Whites annalistische Emphase spiegelt die Suche nach<br />
50 Warren Weaver, Introductory Note on the General Setting of the Analytical Communication<br />
Studies, in: C. E. Shannon / W. Weaver, The mathematical theory of communication,<br />
Urbana, 111., 1963, 3-28 (8)<br />
51 Zitiert nach: Horst Fuhrmann, Einladung ins Mittelaler, München (Beck) 1987, 233<br />
52 Hayden White, The Content of the form. Narrative discourse and historical representation,<br />
Baltimore / London (Johns Hopkins UP) 1987, 42<br />
53 J. D. Richards / N. S. Ryan (Hg.), Data Processing in Archaeology, Cambridge U. P.<br />
1985,lf
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 207<br />
einer Schreibästhetik <strong>von</strong> »a mere sequence of events« in serieller, sequentieller<br />
Ordnung . Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts reflektiert<br />
Barthold Niebuhr über die Differenz zwischen Annalen und Historiographie 54 ;<br />
die Definition »dieser beyden Titel <strong>von</strong> Geschichtsbüchern« ist bekanntlich eine<br />
<strong>von</strong> den lexicalischen Aufgaben, welche Gellius mehr mit Belesenheit als mit<br />
Nachsinnen zu lösen versucht habe. Niebuhr definiert Annalistik als semiotische<br />
Indizierung <strong>von</strong> Zeitverläufen:<br />
»Einerseits fortschreitend; durch Anzeichnung des Geschehenden, unter den<br />
Jahren wo es sich ereignete; vereinzelt, ohne Verbindung mit dem Vergangenen,<br />
ohne Vorbereitung des Künftigen; was irgend in der Gegenwart beschäftigt, ohne<br />
einige Rücksicht darauf <strong>von</strong> welcher Art es ist, und wie bald es völlig gleichgültig<br />
wird. Andrerseits durch umfassende Erzählungen, deren Gegenstand vollständig<br />
und vollendet ist Erzählungen aber schildern und erklären.« <br />
Die Grundlage <strong>von</strong> Tradition ist nicht <strong>Geschichte</strong>, sondern die Struktur unanfechtbarer<br />
Institutionen und unansehnlicher Schriftregime (Kalender, Listen); erst<br />
die Kombination <strong>von</strong> Medium (Schrift) und Autorität (die amtliche Funktion <strong>von</strong><br />
Staatsregistratur) setzt Überlieferung fest. »Die Institutionen können wir einigermaßen<br />
begreifen; den Werdeprozeß hat schon das Altertum nicht gekannt und<br />
wir werden ihn nie erraten.« 55 There is no memory im geschichtsphilosophisch<br />
emphatischen Sinn; »Spuren der Vergangenheit sind sind noch lange kein<br />
Gedächtnis.« 56 Statt die <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> Gedächtnisinstitutionen zu erinnern, gilt<br />
es Erinnerung selbst schon deren Effekt zu denken, als Aktivierung <strong>von</strong> Gestellen<br />
im philosophischen Sinn Martin Heideggers und der technischen Medien.<br />
Beide Genres, Annalistik wie Chronik, sind nicht auf dergleichen Ebene des historischen<br />
Diskurses angesiedelt, sondern dies- und jenseits desselben. Annalen als<br />
Teilmenge einer evolutionären <strong>Geschichte</strong> der Historiographie anzusiedeln würde<br />
den historischen Diskurs bereits ihnen gegenüber privilegieren 57 ; die Aufschrei-<br />
54<br />
Barthold G. Niebuhr, Ueber den Unterschied zwischen Annalen und Historie (1827),<br />
in: ders., Kleine historische und philologische Schriften. Zweite Sammlung, Ausgabe<br />
1928-1843 (Nachdruck Osnabrück 1969), 229-241 (229).<br />
55<br />
Theodor Mommsen an Wilamowitz, 4. Februar 1884, zitiert nach: Karl Christ, Theodor<br />
Mommsen und die »Römische <strong>Geschichte</strong>«, in: Theodor Mommsen, Römische<br />
<strong>Geschichte</strong>, München (dtv) 1976, Bd. 8, 48. Zu Mommsens Revision <strong>von</strong> Niebuhrs<br />
Thesen zur antiken Annalistik siehe: Dieter Timpe, Mündlichkeit und Schriftlichkeit<br />
als Basis der frührömischen Überlieferung, in: Jürgen v. Ungern-Sternberg (Hg.), Vergangenheit<br />
in mündlicher Überlieferung, Stuttgart 1988, 266-287 (269). Siehe auch<br />
Alfred Heuss, Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert, Kiel (Hirt) 1956.<br />
56<br />
Ernst Mach, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum<br />
Psychischen, 9. Aufl. Jena 1922, 194<br />
57<br />
Niebuhr ebd.; siehe auch 241: Livius' Werk Ab urbe condita könne weder annales<br />
noch historiae genannt werden.
208 MONUMENTA GERMANIAE<br />
bepraxis griechischer Logographen im kleinasiatischen Ionien des 6. Jahrhunderts<br />
v. Chr. differiert vom Modus der Historien Herodots nicht im Sinne eines Fortschrittsmodells,<br />
sondern als kognitive Alternative. Annalen zeichnen sich durch<br />
ihre Nähe zu Daten aus. Während ein Blatt wie die Neueste Weltkunde schlicht<br />
»vereinzelte Facta« liefert, da geben die Europäischen Annalen »eine ganze Masse<br />
<strong>von</strong> Factis, die unter eine Rubrik gehören, oft <strong>von</strong> einem ganzen Jahre, systematisch<br />
geordnet.« In den Annalen »erhalten wir die wirkliche Zeitgeschichte schon<br />
zusammengestellt, geprüft, berichtigt«, in der Weltkunde »die Data dazu, so wie<br />
sie TagesNachricht liefert«. 58 Leibniz< Versuch, ein virtuelles Gesamtprotokoll<br />
der Welt zu kalkulieren, d. h. aus einer auf-, nicht erzählenden Kombinatorik aller<br />
verfügbaren Buchstaben hochzurechnen, läßt sich als imaginärer Handschriftenfund<br />
aus Annalen und Chroniken ableiten; »ich habe dadurch alles was erzehlet<br />
werden soll, gefunden.« 59 Denn erst als (Symbol-)Folge aufschreibbarer Ereignisse,<br />
also Schrift-Ereignisse,sind Prozesse als <strong>Geschichte</strong> faßbar, speicherbar,<br />
berechenbar, übertragbar; »die Form der Chronik ist ihrem Gegenstand gewachsen«<br />
. Die narrative Konstruktion <strong>von</strong> Realität als kulturelles<br />
Sinnverarbeitungsmuster ist verantwortlich <strong>für</strong> die Differenz zwischen<br />
der Praxis der Annalen und der Versuchung ihrer semantischen Filterung durch<br />
das Gitter Historie. Der Verfasser einer Autobiographie macht die Entdeckung,<br />
daß »once I had discovered in the New York Times Index what eise had been<br />
happening at the time of some personal event, I could scarcely resist connecting<br />
the lot into one coherent whole - connecting, not subsuming, not creating historical-causal<br />
entailments, but winding it into the story.« 60<br />
Jacob Burckhardt verhehlte nicht seine Abneigung gegen die viri eruditi der<br />
MGH, deren »Zusammenstellung lauter wahrer, gut erforschter Thatsachen«<br />
noch keine Wahrheit ausmache, »keinen wirklichen geschichtlichen Eindruck«. 61<br />
58<br />
Zitiert nach Gerhart <strong>von</strong> Graevenitz, Mythos: Zur <strong>Geschichte</strong> einer Denkgewohnheit,<br />
Stuttgart 1987,187, unter Bezug auf Eduard Heyck (1898). Zu den Erzeugnissen der<br />
Tagespresse und der »flüchtigen Literatur«, die in einem »täglich wiederholenden<br />
atmosphärischen Prozeß« aus »Wasserniederschlägen« zu »Quellen« <strong>für</strong> Historiker<br />
siehe Johann Gustav Droysen, Zur Quellenkritik und deutschen <strong>Geschichte</strong> des 17.<br />
Jahrhunderts, in: Forschungen zur deutschen <strong>Geschichte</strong> 4 (1864), 15-20<br />
59<br />
Leibniz an den Herzog Johann Friedrich <strong>von</strong> Braunschweig-Lüneburg, ca. 1671. Siehe<br />
Hans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt ["1983], 3. Aufl. Frankfurt/M. 1993,121-<br />
149 (128ff), über Leibniz< Bibliotheks- (vielmehr denn Archiv-)Phantasie Apokatastatis<br />
(Fragment <strong>von</strong> 1715)<br />
60<br />
Jerome Bruner, The narrative construction of Reality, Cricital Inquiry (Autumn) 1991,<br />
hier: 19<br />
61<br />
Zitiert nach: Horst Fuhrmann, Gelehrtenleben. Über die Monumenta Germaniae<br />
Historica und ihre Mitarbeiter, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters<br />
50, 1/1994, 1-31 (6)
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 209<br />
Diese logozentristische Verkettung <strong>von</strong> Wahrheit, Na(rra)tion und Historie tritt<br />
hier in Differenz zur positivistischen Ästhetik einer informationsorientierten<br />
Diplomatik. Ähnlich äußert sich Gustav Droysen, der <strong>von</strong> Fabrikarbeit spricht<br />
und bei den Monumentisten unter Pertz Kopfschütteln mit der Behauptung veranlaßt,<br />
»die Aufgabe des Historikers sei Verstehen« . Es ist das<br />
leere Grab der Absenz <strong>von</strong> Vergangenheit, das der okzidentale Logozentrismus<br />
wahrzunehmen sich scheut, ausgrenzt und im Medium der Historie kompensiert<br />
- »certain pasts may be dismissed at once as alien to history.« 62 Zu der Differenz<br />
<strong>von</strong> Monument und Dokument gesellt sich die <strong>von</strong> Historie und Erinnerung:<br />
»In memory the past is a spectacle; here alone is >the past recaptured
210 MüNUMENTA GHRMAN1AE<br />
genheit überhaupt nicht als Historie statt. Sagen und Lieder »reichen zwar in<br />
eine höhere Zeit hinauf, als die Urkunden, und auch später noch, in urkundlicher<br />
Zeit, umhüllt ihr heiterer Schimmer die nackte historische Kunst; sie haben<br />
jedoch <strong>für</strong> solche Perioden, wo sie nicht ausschließliche Quelle sind, einen<br />
beschränkten, meist Ungewissen Werth« . Es ist der Speicher,<br />
der das Gedächtnis entlastet und seine Organisation als <strong>Geschichte</strong> möglich<br />
macht:<br />
»In späterer Zeit, bei verändertem, künstlicher gewordenem Zustande der Gesellschaft,<br />
wurde in Annalen und Urkunden verzeichnet, was sonst dem<br />
Gedächtnis war anvertraut und <strong>von</strong> diesem treu bewahrt und fortgepflanzt worden.<br />
Und wie äußere Notwendigkeit diese ersten Aufzeichnungen veranlaßte, so<br />
machte sie sich auch nicht minder bei ihrer Sammlung geltend, ohne daß hierbei<br />
Sinn <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> vorgewaltet hätte. In Aufzeichnungen über rechtliche Verhandlungen<br />
konnten die Zeitgenossen unmöglich eine Quelle <strong>für</strong> die<br />
<strong>Geschichte</strong> erblicken bis endlich in neuerer Zeit ein practisch-tüchtiger Sinn<br />
die geretteten zahlreichen Trümmer, die nun eine geänderte Bedeutung erhalten<br />
hatten, in neue Sammlungen vereinte.« 66<br />
Mit der Differenzierung <strong>von</strong> Annalistik und Historiographie als alternativer<br />
Modi <strong>von</strong> Zeitverarbeitung 67 korrespondieren die Medien ihrer Speicherung.<br />
In Zedles Universallexikon <strong>von</strong> 1732 fallen die »Jahr-<strong>Geschichte</strong>«<br />
noch in den Bereich des archivium regni (Reichsarchiv); anders sieht das die<br />
Archivkunde Brennekes. Er weist Annalen und Chroniken ausdrücklich den<br />
Bibliotheken zu, obwohl sie sich auf Geschichtliches beziehen. »Dagegen<br />
gehören geschichtliche Stoffe enthaltende Staatsschriften oder historische Darstellungen<br />
zu prozessualen Zwecken in die Archive; denn hier ist der Zweck der<br />
Mitteilung und Belehrung nicht überwiegend.« So bilden etwa die Relationen<br />
(Abschlußberichte) der venezianischen Gesandten, »obwohl sie sich in ihrer<br />
geschliffenen Form wie literarische Produkte lesen«, Archivgut. 68<br />
Wattenbach analysiert die Annalen <strong>von</strong> S. Amand (= MG. I, 6-11) wissensarchäologisch,<br />
d. h. den Rhythmus ihrer Anfänge, Einsätze und Rekurse:<br />
»Die am Eingang stehende Nachricht <strong>von</strong> der Schlacht bei Tertri 687 ist nachträglich<br />
zugesetzt; die regelmäßig fortgesetzten Aufzeichnungen beginnen erst 708,<br />
und auch <strong>von</strong> da an möchte ich noch nicht behaupten, daß gleich <strong>von</strong> Anfang an<br />
alles gleichzeitig eingetragen wäre; die Form der kurzen und noch sehr dürftigen<br />
66 L. B. v. Medem, Zur Archivwissenschaft, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde, hg. v. L. F.<br />
Höfer, H. A.Erhard u. L. B. v. Medem, Bd. 1 (1833/34), 1-51 (6f)<br />
67 Dazu Lucian Hölschcr, The new annalistic: A sketch of a theory of history, in: History<br />
and Theory 36, Heft 3 (Oktober 1997), 317-335<br />
68 Adolf Brenneke, Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und <strong>Geschichte</strong> des europäischen<br />
Archivwesens, bearbeitet <strong>von</strong> Wolfgang Leesch, Leipzig (Koehler & Amelang)<br />
1953,34
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 211<br />
Bemerkungen, wenn man z.B. zu dem Jahr 708, wo Ostern auf den 15. April fiel,<br />
an den Rand schrieb: (Das war damals) als Drogo im Frühjahr starb - das deutet<br />
eher auf ein späteres Besinnen und Ueberdenken der Vergangenheit. Auch ist das<br />
ganz natürlich; so lange der Eindruck noch frisch ist, fühlte man kein Bedürfnis<br />
ihn künstlich festzuhalten, und erst später machte sich das Verlangen geltend, die<br />
verschiedenen Erinnerungen aus einander zu halten und zu ordnen. Wenn aber<br />
nun eine Reihe solcher Aufzeichnungen beisammen ist, dann ändert sich der Gesichtspunkt,<br />
man legt Werth auf diese Zusammenstellung und setzt sie um ihrer<br />
selbst willen fort, trägt Jahr <strong>für</strong> Jahr die wichtigsten Begebenheiten ein, um <strong>für</strong> spätere<br />
Zeiten ein Denkmal zu hinterlassen.« 69<br />
Tatsächlich steht eine annalistische Zeitregistratur nicht nur <strong>für</strong> Zeiten der<br />
Unordnung, sondern auch <strong>für</strong> jene Erinnerung, die ganz im Gegenteil Rom<br />
heißt, also imperium. Die entstehungsgeschichtliche Parallele zu den mittelalterlichen<br />
Annales liegt in den antiken Konsullisten und den Annalen der römischen<br />
pontifices maximi, die Tacitus zur historiographischen Literaturgattung<br />
entwickelt. Die Fränkischen Reichs-Annalen haben diese Herrschaftsbindung<br />
nicht vergessen; ihr leises Echo transportieren die Klosterbibliotheken als Buch-<br />
Gedächtnis. <strong>Im</strong> 8. und 9. Jahrhundert finden sie sich kombiniert mit der Überlieferung<br />
<strong>von</strong> Gesetzes- und Kapitularientexten; »durch all dies wird die<br />
vielseitige Verwendbarkeit dieser Gattung ebenso unterstrichen wie ihre (ztw.)<br />
polit. Bedeutung 70 .« Es ist diese nicht-kontingente Seite am komputistischen<br />
Gerüst der Annalen, die an den Zusammenhang <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perium und Informatik<br />
erinnert. Wattenbach weist in seiner Kommentierung der Annalen des ersten<br />
Sciptores-Bandes der MGH explizit darauf hin:<br />
»Findet sich dagegen eine Reichsgeschichte, welche, wenn auch noch so dürftig,<br />
doch das Bestreben nach vollständiger Mittheilung dessen zeigt, was vom Mittelpunkt<br />
aus gesehen das ganze Reich betrifft, so wird man den Ursprung schwerlich<br />
in einem Kloster zu suchen haben . Den Klöstern lag ein solcher Gesichtspunkt<br />
ursprünglich ganz fern, während der Hof damals noch wirklich den lebendigen<br />
Mittelpunkt des Reiches bildete, an dessen Bewegungen und Heerfahrten auch die<br />
Bischöfe fortwärend sich beteiligen mußten.« <br />
Auf der Ebene <strong>von</strong> Gedächtnisaufbereitung im Rahmen der MGH vollzieht<br />
sich die Spannung zwischen Datum und Information als Spiegelung und Verdopplung<br />
des Weges <strong>von</strong> Annalen zu Chronik (und Historie), ganz analog zum<br />
historiographischen Auswuchern der Ostertafeln in ihren marginalen Eintragungen.<br />
J. F. Böhmer, Bibliothekar in Frankfurt/M. und mit Pertz Direktor der<br />
69 W. Wattenbach, Deutschlands Gcschichtsqucllcn im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten<br />
Jahrhunderts, 2 Bde, hier Bd. I, 3. umgearbeitete Auflage, Berlin (Wilhelm<br />
Hertz) 1873, 110<br />
70 Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München / Zürich (Artemis) 1980, Eintrag »Annalen«<br />
(K.-U. Jaeschke), Sp. 657-661 (658f)
212 MONUMENTA GERMANIAE<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, hat anfangs die Redaktion der<br />
MGH-Abteilung der Kaiserurkunden übernommen, diese aber später wieder<br />
aufgegeben und sich auf die ursprünglich als Vorarbeit da<strong>für</strong> gedachten Regesten<br />
beschränkt. Doch auch<br />
»Diese haben in den neueren Bearbeitungen immer weitere Ausdehnung erhalten;<br />
die kurzen Urkundenauszüge sind vollständiger geworden und durch Auszüge aus<br />
den Geschichtssschreibern und Annalen in Verbindung gebracht; das ganze historische<br />
Material einer Periode wird dem Geschichtsforscher geordnet vor Augen<br />
gelegt und in den Einleitungen die Quellen besprochen und gewürdigt.« <br />
Enargeia als rhetorische Darstellungstechnik der Veranschaulichung ist an<br />
kybernetische Operationen der Ordnung gebunden. Die Editionspraxis der<br />
MGH macht die prekäre Grenze zwischen narrativer Ordnung und modularem<br />
Informationsdesign transparent. Die Reihenfolge der Quellenpräsentation<br />
ist chronologisch in zweifacher Weise: nach den angegebenen größeren Perioden<br />
und auch innerhalb der kleinen Abteilungen. In einer solchen Periode<br />
werden zuerst die Annalen wiedergegeben, »streng nach Jahren geordnet, oft<br />
gleichzeitige, in der Regel kurze Aufzeichnungen« < Wattenbach 1873: 22>. An<br />
dieser Stelle bricht bei Wattenbach eine historiographische Unscharfe des Annalenbegriffs<br />
ein, die er seinerseits als Anmerkung aus dem Fließtext seiner <strong>für</strong><br />
historische Narration plädierenden Argumentation auszugliedern sich genötigt<br />
sieht: »In den letzten Bänden ist der Begriff der Annalen immer weiter und wie<br />
mir scheint, übermäßig ausgedehnt«. Und sein Fließtext fährt fort mit Chroniken<br />
und <strong>Geschichte</strong>n, »welche zum Theil noch die annalistische Form beibehalten,<br />
doch nur als äußere Gestalt, denn sie sind meistens nicht gleichzeitig und<br />
unterbrochen, sondern zusammenhängend, im Rückblick auf einen größeren<br />
Zeitraum aufgezeichnet, und versuchen, über die bloße Aufzeichnung der Thatsachen<br />
hinausgehend, deren pragmatische Verbindung und innere Entwickelung<br />
nachzuweisen« .<br />
1824 plädieren die Richtlinien der MGH da<strong>für</strong>, in die Edition keine »Ritter-<br />
Romane« einzubeziehen. 71 Schwieriger ist die Abgrenzung <strong>von</strong> Chroniken und<br />
Annalen: Wie sollen beide klar unterschieden werden? »Etwa Chronik, chronologische<br />
<strong>Geschichte</strong> einer Stadt, Klosters, Familie; - Annalen eines größern Landes,<br />
Reichs &. oder - Annalen, eine chronologische <strong>Geschichte</strong> als historisches<br />
Kunstwerk; - Chronik ein bloß nach einzelnen Jahren aufgenommenes Verzeichniß<br />
der localen Tags-Begebenheiten?« . Hier kommt es zur strukturellen<br />
Korrespondenz zwischen dem <strong>Namen</strong> Monumenta und der Gattung der<br />
Annalen. Eine Anmerkung der Herausgeber präzisiert, daß eine scharfe Unter-<br />
71 Archiv Bd. 5 (1824): 801
ANNALISTIK ALS PROVOKATION DER HISTORIOGRAPHIE 213<br />
Scheidung <strong>von</strong> Annalen und Chronisten ohne Nutzen <strong>für</strong> die Zwecke der MGH<br />
sei - »Annalen sind Werke, die aus Jahresabschnitten bestehen; Chroniken,<br />
worin eine andere Form vorherrscht« . Darin genau<br />
aber liegt - der Indifferenz der MGH zum Trotz - der qualitative Sprung <strong>von</strong><br />
diskretem Aufschreibesystem zu narrativer Historie, der in narratologischen<br />
Debatten zur Historiographie neuerdings wieder eine Rolle spielt: Annalen versus<br />
Historiographie. Historiographische Indeterminiertheit kommt in dem<br />
Moment zutage, wo die Abgrenzung ihrer Genres selbst betroffen sind: Es verstehe<br />
sich »<strong>von</strong> selbst, daß diese Gattungen durch keine scharfe Grenzen gesondert<br />
sind, und manches Stück so sehr in der Mitte steht, daß es nur nach<br />
zufälligen Umständen hier oder dort seine Stelle findet« .<br />
Zur Verhandlung stehen die (Schrift-)Ränder eines Hohlraums namens Vergangenheit;<br />
<strong>Geschichte</strong> ist die literarische Form, in der sich eine Kultur über ihre<br />
Vergangenheit Rechenschaft gibt Qohan Huizinga). Historische <strong>Im</strong>agination<br />
bedarf der Figuration, um rhetorisch zu greifen. Demgegenüber bietet die Ästhetik<br />
des Archivs als Kriterium <strong>von</strong> Form-Gebung die Klassifikation. Solche Formen<br />
»sind Antworten auf die fundamentale, durch die Formen verdeckte<br />
Sachlage, daß lose und feste Kopplungen zugleich reproduziert werden - als<br />
Medium in invarianter und unsichtbarer, als Form in variabler und sichtbarer<br />
Weise.« 72 Die Formen Archiv, Bibliothek und Museum, doch ebenso die Listenförmigkeit<br />
<strong>von</strong> Annalen und Chroniken sowie deren akademische Edition beziehen<br />
ihre kulturtechnische Funktion daraus, daß sie dem temporalen Wandel<br />
negentropisch standhalten. Die (An-)Ordnung der Annalen in der Edition der<br />
MGH beginnt wissensarchäologisch (im strengen Sinne als Listen) und endet im<br />
Lokalkolorit, jenen Farben, die Datencluster in den Effekt eines (historisch) Realen<br />
73 verwandeln. Den Schluß bilden Biographien und kleinere Erzählungen verschiedener<br />
Art, »welche nebst den Localchroniken in das lebendige Treiben der<br />
Zeit einführen, und denen wir größtentheils das Fleisch und Blut zu dem chronologischen<br />
Gerüste der Annalen verdanken« . Mit der<br />
Liebe zum Detail, zum Marginalen, zum sonst Übersehenen wird qua Rhetorik<br />
der Synekdoche die Kontrollgewalt der Historie bis in die letzten Winkel des<br />
Daseins ausgeweitet. Diese Ratio der historiographischen Ökonomie aber tarnt<br />
sich metaphorisch als der Funke sozialer respektive mnemischer Energie, die aus<br />
dem datum geschlagen wird:<br />
»There is a curious thing about historical >detailsGod dwells in the detail< (Der liebe Gott wohnt im<br />
Detail). This does not refer to the painting of unrelated details but to the pan which<br />
72 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1995, 213<br />
73 Roland Barthes, L'Effet du reel, in: Communications 11 (1968), 84-90
214 MONUMKNTA Gl-KMANIAT.<br />
is contained in cvery en. evcn a histoncal >atom
ANNAI.ISTIK ALS PROVOKATION DI-R HISTORIOGRAPI ML 215<br />
verständl. ebenso wie heilsgeschichtl. überzeugende Zeitrechnung« . Diese (zu aller Narration) alternative Ästhetik der Registrierung<br />
<strong>von</strong> Weltgeschehen erinnert - unter umgekehrten Vorzeichen - erneut an Leibniz'<br />
Phantasie einer Weltbibhothek, aus deren endlichen Buchstabenkombinationen<br />
sich alle mögliche und tatsächliche Historie hochrechnen läßt. Für jede<br />
private Lebensstunde eines Individuums kalkuliert er 10000 Lettern und hat<br />
damit Subjektivität finit berechenbar gemacht. Bei einer Seite <strong>von</strong> 100 Zeilen,<br />
jede zu 100 Buchstaben berechnet, würde »<strong>für</strong> ein Werk, welches die annalistische<br />
<strong>Geschichte</strong> des ganzen Menschengeschlechts bis in alle Einzelheiten enthält,<br />
eine Anzahl <strong>von</strong> Buchstaben nicht überschritten zu werden brauchen,<br />
welche sich auf hunderttausend Millionen behefen.« 75 Aus annalistischer<br />
Perspektive ist die Welt kalkulierbar.<br />
Die Insistenz der Annalistik<br />
Die Annales Mosellam (= MG. SS. XVI, 491-499) verzeichnen in ihrem früheren<br />
Teil bis 771 nur die großen Reichsbegebenheiten, die Feldzüge des Jahres,<br />
zuweilen einen Todesfall oder einen anderen merkwürdigen Vorfall: »so kurz,<br />
daß die eigentliche Kenntnis <strong>von</strong> den Dingen vorausgesetzt wird; an Erzählung<br />
ist kein Gedanke, nur an chronologische Ordnung der Erinnerungen« -cinc Allegorie auf die Ästhetik der MGH selbst. Die Diskretheit<br />
solcher Annalen ist vielleicht ebensosehr in Hinblick auf eine nicht<br />
narrativ sich selbstverständigende Gesellschaft hin zu lesen; das radikal <strong>Im</strong>aginäre<br />
dieser Gesellschaft - frei nach Castoriadis - ist eben nicht das Modell der<br />
<strong>Geschichte</strong>. Vielmehr ist die Aufzeichnung hier vom Verlangen nach narrativen<br />
Leistungen entlastet, die ihren Ort nicht in und als Historiographie finden, sondern<br />
in liturgischen Kontexten, in oralen Gesängen etwa 7 ' 1 oder im Epos, das<br />
erst im Medium Schrift zu einem Effekt der Gedächtnisordnung des Archivs<br />
75 Gottfried Wilhelm Leibniz, Apokatastatis panton, zitiert nach: Max Ettlinger, Leibniz<br />
als Geschichtsphilosoph, München 1921, 29; dazu Bernhard Siegert, Frivoles Wissen.<br />
Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pecuchet, in: Hans-Christian v. Herrmann /<br />
Matthias Middcll (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft. 5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag)<br />
1998, 15-40 (bes. 28-33)<br />
76 Zu den Grundbedingungen oraler Traditionsbildung im Zeitalter der frühmittelalterlichen<br />
Annalisten siehe Johannes Fried, Die Königserhebung Heinrichs I. Erinnerung,<br />
Mündlichkeit und Traditionsbildung im 10. Jahrhundert, in: Michael Bogolte (Hg.),<br />
Mittelalterforschung nach der Wende, München (Oldenbourg) 1995, 267-318, bes.<br />
273ff. Über das Genre der Annalen als »un effet de Pecnture«: Krzysztof Pomian, De<br />
Phistoire, partie de la memoire, ä la memoire, objet d'histoirc, in: Revue de Metaphysique<br />
et de Morale 1/1998, 63-110 (76ff)
216 • MONUMKNTA GKRMANIAI;<br />
wird: »Das geschriebene Epos gleicht einer Pflanze, die ihrem heimathlichen<br />
Boden enthoben, und ins Herbarium gelegt wird« . Der<br />
Übergang zu narrativen Formen der Registrierung <strong>von</strong> Gegenwart als künftiger<br />
Vergangenheit ist in der Annalistik zunächst kein qualitativer Akt, sondern eine<br />
modulare Aggregation: »Man copierte sie und bereicherte sie zugleich durch<br />
Verbindung der verschiedenen Exemplare, ohne sich jedoch noch eine redigierende<br />
Thätigkeit zu erlauben, welche das nothdürftigste Maß überschritt« . So etwa die Met/er Annalen, »ebenfalls schon <strong>von</strong> dem<br />
ersten Hauch der karohngischen Zeit berührt und <strong>von</strong> räthselhaften Notizen<br />
zur Erzählung übergehend« . Wo kein staatlicher Interpretant die arbiträr<br />
scheinenden Signifikantenketten zusammenliest, sind wir mit Randbemerkungen<br />
zu Ostertafeln konfrontiert, die in der Tat nicht den Anspruch erheben, als<br />
literarische Erzeugnisse zu gelten. »Erst der lichteren Zeit des großen Karl<br />
gehört der Gedanke an, diese Notizen mit anderen Nachrichten zu einem<br />
Ganzen zu verbinden, und sie dann mit Absicht und Bewußtsein als gleichzeitige<br />
Aufzeichnung der <strong>Geschichte</strong> weiter zu führen« .<br />
Annalen wollen mit wissensarchäologischem Blick, als monumentale (im Sinne<br />
<strong>von</strong> diskreten) Datenreihe gelesen werden, im Unterschied zur historisch-ästhetischen<br />
Schau. Annalistische Informationsästhetik ist Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
nicht schlicht ein antiquarisches Genre, sondern vielmehr ein neben aller<br />
Erzählung operierendes Aufschreibesystem und verweist als Objekt des ersten<br />
Bands der MGH zugleich auf eine noch praktizierte Form <strong>von</strong> Gedächtnissynchronisation;<br />
daran erinnert auch B. <strong>von</strong> Wichmann in seinem 1820er Plädoyer<br />
<strong>für</strong> ein russisches National-Museum. Eine der Aufgaben sei<br />
»die Führung eines genauen historischen Jahrcs-Protokolls, einfach verzeichnend:<br />
>das ist Denkwürdiges im Vaterlande geschehen, und so ist es geschehen*; also<br />
Reichs-Annalen im weiteren Sinne des Wortes. Samelt ja eine jede Behörde<br />
die ihre Localität betreffenden Notizen Jahr aus Jahr ein, und werden diese oft<br />
ungelesen in den Archiven aufgethürmt, wie, wen eine summarische Anzeige<br />
dessen, was sich zugetragen, jährlich dem National-Museum eingesandt würde,<br />
damit es auswählen und die Goldkörner auf die späteren Zeiten bringen könne?« 77<br />
Bedingung der Transformation solcher Statistiken in Historie ist ihre Organisation:<br />
»Nur wer die Verwirrung, den verwahrlosten Zustand kennt, in welchem sich<br />
früher diese Annalen befanden, an verschiedenen Orten und meist in sehr fehlerhafter<br />
Gestalt gedruckt, ohne Unterscheidung ihres echten, gleichzeitig niedergeschriebenen<br />
Gehalts und der späteren Zusätze, kann sich eine richtige Vorstellung<br />
machen <strong>von</strong> dem außerordentlichen Gewinn, welcher der Geschichtsforschung<br />
daraus erwuchs, daß nun alle jene Annalen in einem Bande vereinigt, kritisch<br />
77 B. <strong>von</strong> Wichmann, Rußlands National-Museum, Riga (I läcker) 1820, 22f
ANNALISTIK. ALS PROVOKATION DKR HISTORIOGRAIMIIK 217<br />
gesichtet und durch neue Entdeckung bereichert zur ungehinderten Benutzung<br />
bereitet vorlagen.« <br />
Doch jenseits <strong>von</strong> Annalistik als Objekt einer gepflegten Geschichtswissenschaft<br />
wird sie zuweilen unversehens wieder zu ihrem Subjekt. Wo soziale Ordnung<br />
zusammenbricht, bricht auch Historie als Erzählung ab. In den letzten<br />
Tagen des Zweiten Weltkriegs retransformiert die geordnete Narration zur<br />
annahstischen Kargheit mitsamt ihren Lücken und Iterationen:<br />
»21.2.45 Starke Sowjet. Angriffe abgewehrt.<br />
23.2.45 desgl.<br />
23.3.45 desgl.« 78<br />
Alexander Kluge hat mit seiner Schlachtbescbreibung in drei Variationen darauf<br />
reagiert. Wo auf eine narrative Ordnung der Begebenheiten im Stile Droysens<br />
oder auch Niebuhrs verzichtet wird 79 , eröffnet sich ihre Koppelbarkeit an<br />
eine Ästhetik der Information <strong>von</strong> Vergangenheit, die nicht mehr Historiographie<br />
heißen muß. 80<br />
7X Kalenderaufzeichnungen <strong>von</strong> Martin Klcint (zu den Kämpfen an der Oderfront), in:<br />
Erinnerungen an das Kriegsende in Halbe. Zusammengestellt <strong>von</strong> Meinhard Stark, in:<br />
Herbert Pietsch / Rainer Potratz / ders. (Hg.), Nun hängen die Schreie mir an :<br />
HALBE. Ein Friedhof und seine Toten, Berlin (Edition Hentrich) 1995, 32-57 (35)<br />
79 Klaus Oettinger, Vergegenwärtigung und Konstruktion. Bemerkungen über Möglichkeiten<br />
historischer Darstellung, in: Archiv <strong>für</strong> Kulturgeschichte 54, Heft 1 (1972),<br />
153-167 (166), unter Bezug auf: Golo Mann, Geschichtsschreibung als Literatur, Bremen<br />
1964, 17f; Alexander Kluge, Schiachtbcschreibung, Ölten / Freiburg 1964<br />
80 Siehe auch W. E., Die Insistenz der Annalistik. Momente der Monumenta Germamae<br />
Historica, in: Olaf B. Rader (Hg.), Turbata per aequora mundi. Dankesgabe an Eckhard<br />
Müllers-Mertens, Hannover (Hahn) 2001 (Studien und Texte / Monumenta Germaniac<br />
Historica; Bd. 29), 223-231
218 MONUMKNTA Gl-RMANIAK<br />
Ur/kunde: Diplomatik und Archäologie<br />
Urkundensemiotik und Historische Hilfswissenschaften<br />
Die Basiseinheit der Datenbank Monumenta Germaniae Historica, die Urkunde<br />
im semiotisch-juridischen Verbund, oszilliert zunächst zwischen (Rechts-)Monument<br />
und Dokument.<br />
»Auch das Siegel war ein Symbol, nur nicht wie die festuea das Symbol der<br />
vollzogenen Rechtshandlung, sondern das Symbol der Urkundenden Person. Der<br />
siegreiche Durchbruch des Urkundenbeweises war hier doch erkauft durch einen<br />
Kompromiß, die nunmehr dauernde Verbindung <strong>von</strong> Urkunde und Symbol, und<br />
die verschiedenartigen Versuche, Urkunde und Symbol auf irgendeine Weise<br />
in Verbindung miteinander zu bringen, bezeichnen uns einen Weg, den das<br />
Aufkommen des Siegels zum Zwecke der Beglaubigung der Urkunde genommen<br />
hat.« 1<br />
Der Diplomatik ist dementsprechend auch die äußere Kritik der parerga semantisch<br />
wesentlich; das Medium autorisiert die Botschaft. Solange Presse und Rundfunk<br />
zur Verkündung dessen, was gelten soll, noch nicht zur Verfügung standen,<br />
war es wichtig, »ein Diplom vorweisen zu können, das >pnma facie< durch seine<br />
beweiskräftige (urkundliche) Form der Echtheitsvermutung Nachdruck verlieh.« 2<br />
Für die öffentliche Urkunde (eine amtliche Anordnung, Verfügung oder Entscheidung)<br />
gilt bei Erfüllung der <strong>für</strong> sie vorgesehenen Formerfordernisse noch<br />
heute der volle Beweis ihres Inhalts als erbracht (§ 417 ZPO). Die Formalien sind<br />
damit gesetzlicher Bestandteil und im Beweisverfahren Echtheitskriterium jeder<br />
Urkunde geblieben; sie transportieren das Gedächtniswissen um den Ursprung<br />
aller Diplomatik am Rand einer Negation: »dass, wie die urkundliche Forschung<br />
selbst, so auch die Urkundentheorie im Kampf mit den Fälschungen sich entwickelt<br />
hat.« 3 Der Historiker Gatterer scheidet 1765 in seinen Elementa artis<br />
diplomaticae universalis (dann 1798 im Abnss der Diplomatik, 1799 als Praktische<br />
Diplomatik) die den Originalen eigentümlichen graphischen und semiotischen<br />
sowie die Originalen und Kopien gemeinsamen Merkmale (Formular). »Aber<br />
dann kommt die Sucht des Klassifizierens der Urkunden, Schriftarten, Formeln<br />
in ungezählte Abteilungen und Unterabteilungen - der berüchtigte >Linneismus<br />
M. Tangl, Urkunde und Symbol, in: Festschrift Heinrich Brunner zum siebzigsten<br />
Geburtstag, Weimar (Böhlau) 1910, 761-773 (773)<br />
Ingo Röslcr, Über die Terminologie russischer Archivdokumente, in: Archiv und<br />
Historiker (Festschrift H. O. Meisner), Berlin 1956, 471-495 (477)<br />
Hermann U. Kantorowicz, Schriftvergleichung und Urkundenfälschung. Beitrag zur<br />
<strong>Geschichte</strong> der Diplomatik im Mittelalter, in: Quellen und Forschungen aus Italienischen<br />
Archiven und Bibliotheken 9(1906), 38-56 (51)
UR/KUNDU: DIPLOMATIE UND ARCHÄOI.OGIK 219<br />
graphicuspraktischen<<br />
Diplomatik bezeichnete, die Urkunden juristisch anwenden zu lehren, wankten<br />
schon allenthalben die alten Voraussetzungen da<strong>für</strong>. Sie wurden rein historische<br />
Quellen. Doch war dies kein Schaden <strong>für</strong> die Wissenschaft. Sie lernte jetzt<br />
absehen <strong>von</strong> allen Nebenzwecken, welche der Diplomatik seit ihrer Entstehung<br />
angehaftet hatten. Die Schätzung der Urkunden als wertvoller, unbefangener<br />
Quellen stieg, aber sie richtete eben deshalb ihr Augenmerk vor allem auf den<br />
Inhalt.« 5<br />
Mit dieser Historisierung des diplomatischen Gedächtnisses endet, was Mabillons<br />
Einsicht in die Wandlungen der Merkmale einer Urkunde pro ratione temporum<br />
in Gang gesetzt hat . Daß Urkunden funktional<br />
unerschließbar sind ohne jenen Apparat, der sie als Gedächtnis zu adressieren<br />
erlaubt, weiß auch der vormalige Hauptmann in preußischen Diensten J. W. v.<br />
Archenholtz, der auf seiner englischen Reise mit dem 1086 angelegten altenghsch-normanmschen,<br />
metaphorisch Domesday Book betitelten Lehnregisters<br />
Wilhelms des Eroberers konfrontiert wird. Dieses ist <strong>von</strong> Altertumsforschern<br />
längst als »das einzige Document seiner Art, und als ein schätzbares Denkmal«<br />
<strong>für</strong> historische und juridische Zwecke erkannt; alle handschriftlichen Kopien<br />
desselben aber sind entweder unvollständig oder fehlerhaft, und der Zugang<br />
zum Original, das im königlichen Exchequer (nicht im Archiv) aufbewahrt<br />
hegt, ist mit Kosten und Schwierigkeiten verknüpft. »Der Nutzen desselben ist<br />
so einleuchtend, daß die Regierung schon lange eine Ausgabe dieses Buchs<br />
beschlossen hatte« - wortgetreu gedruckt, aber kommentarlos:<br />
»Die Herausgeber haben <strong>von</strong> alle dem nichts hinzugefügt, wodurch der Nutzen<br />
und Gebrauch desselben hätte anschauend erläutert werden können; keine Nachricht<br />
<strong>von</strong> der Authenticität dieser Urkunde, gleichzeitigem Altcrthum mit Wilhelm<br />
dem Eroberer, ursprünglichem Zweck, und möglichem Gebrauch <strong>für</strong> den philosophischen<br />
Geschichtsschreiber, Alterthums- und Sprachforscher, Staatsmann und<br />
Rechtsgelchrten dieser und anderer Länder; am wenigsten aber zweckmäßige histo-<br />
Oswald Redlich, Allgemeine Einleitung zur Urkundenlehre, in: W. Erben / L.<br />
Schmitz-Kallenberg u. ders., Urkundenlehre, 1. Teil, München / Berlin 1907), 1-36 (8)<br />
Redlich 1907: 9. Die Kategorisierung der Dokumente nach ihrer Funktion als legale und<br />
nicht-legale Dokumente als Aufgabe der Diplomatik definiert <strong>für</strong> den nordamerikanischen<br />
Archivraum Luciana Duranti in einer Artikelserie der kanadischen Zeitschrift<br />
Arcbivana 1989-1992; kritisch dazu: Angelika Menne-Haritz, Die Archivwissenschaft,<br />
die Diplomatik und die elektronischen Verwaltungsaufzeichnungen (Johannes Papritz<br />
zum 100. Geburtstag), demnächst in: Archiv <strong>für</strong> Diplomatik (1998)
220 MONUMKNTA GKRM ANIAU<br />
rischc, geographische und antiquarische Register und tabellarische Vorstellungen<br />
<strong>von</strong> der Cultur, Besitzungsart, Bevölkerung, Einkünften, Auflagen, Werth und<br />
Ertrag jeder einzelne Grafschaft, wie es ums Jahr 1085 beschaffen war.« 6<br />
Rudolf. Erich Raspes Bearbeitung bleibt unvollendet; ein Finanzierungsmißverständnis<br />
macht dem geplanten Kommentar unversehens ein Ende, »ohne<br />
welchem das Domesday Book nicht viel besser wie eine Hieroglyphe ist« . Aus dem Dokument wird ein Monument, das tief ins 20. Jahrhundert hineinragt<br />
und zwar kaum noch wirkliche Rechtsrelevanz hat, dennoch aber <strong>von</strong><br />
Juristen in Streitfällen gelegentlich noch nach Anhaltspunkten durchforstet<br />
wird. »The more purely historical meaning of the Domesday Book emerged<br />
gradually, and in that it achievecl an unnvaled symbohe value.« 7 Wo sich ein<br />
Textartefakt nicht selbst als historisches Dokument zu lesen gibt, bedarf es der<br />
wissensarchäologischen Erschließung. Textentzifferung jenseits der Suche nach<br />
dem Autor gilt <strong>für</strong> alle archäologisch distanten Räume:<br />
»A mesure qu'il s'enforce dans un passe plus profond, Parcheologue perd davantagc<br />
de vue les individualites; au delä du XII siecle, les manusents deja commencent<br />
ä lui faire defaut, et eux-memes d'ailleurs, actes officiels le plus souvent,<br />
Pinteressent surtout par leur caracterc impersonnel.« 8<br />
Genau diese Eigenschaft macht solche Texte formalisierbar, d. h. automatisierund<br />
berechenbar.<br />
Noch als Mitte des 19. Jh. E. Littfaß die Stadt Berlin mit einem neuen Nachrichtenmedium<br />
durchsetzte, bedarf die Nachricht der ornamentalen Flankierung,<br />
um ästhetisch transportiert werden zu können. Die Zeit schreibt am 15. April<br />
1855 über diese Säulen: »Die äußere Form derselben ist durchaus geschmackvoll<br />
und gefällig und sind dieselben an den oberen Theilen mit besonderen Ornamenten<br />
verziert.« 9 Auch das <strong>für</strong> Urkunden prekäre Verhältnis <strong>von</strong> Information<br />
und Ornament läßt sich signaltheoretisch fassen, als Spiel zwischen der Reduktion<br />
<strong>von</strong> Komplexität und Redundanz. Zwar hat Friedrich Nietzsche Historie als<br />
den »Versuch, das Heraklitische Werden in Zeichen abzukürzen« gefaßt 10 ;<br />
h J. W. v. Archenholtz, England und Italien, Erster Teil, Karlsruhe (Schmieder), 2. Aufl.<br />
1791, 123ff (125), unter Bezug auf: Domesday Book seu Liber Censualis Wilhelrm<br />
Primi Regis Angliae , 2 Bde., hg. A. Farlcy, London 1783<br />
7 James M. O'Toole, The Symbolic Significance of Archives, in: The American Archivist<br />
56, no. 2 (1993), 234-255 (249f); siehe auch Elizabeth M. Hallam, Domes Book<br />
Through Nine Ccntuncs, London (Thamcs & Hudson) 1986<br />
s Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation, Paris 1890, Kapitel IV (Qu'cst-ce que Phistoire?),<br />
Absatz »L'Archeologic et la Statistique«, 99ff (100)<br />
v Zitiert in: Ernst Litfaß (1816-1874). Bestandskatalog des Nachlasses, Katalog einer<br />
Sonderausstellung anläßlich des 150. Geschäfts- und Bürgerjubiläums <strong>von</strong> Ernst Litfaß<br />
im Märkischen Museum, Stadtmuseum Berlin 1996, 38<br />
10 Siehe Martin Stingelin, Historie als »Versuch, das Flerakhtischc Werden [...] in Zci-
: DllM.OMATlk UNI) ARCIIÄOLOGIK 221<br />
dem läuft der Satz des Aufklärungshistorikers Johann Martin Chladenius voraus,<br />
daß »sinnreiche <strong>Geschichte</strong>« nur in »verjüngen Bildern« berichtet werden kann 11 .<br />
Doch Redundanz ist überlieferungstechnisch immer am Werk:<br />
»Nun braucht der Sender seine Zeichen niemals mit größtmöglicher Sparsamkeit.<br />
Er verwendet immer weit mehr Zeichen, als streng genommen notwendig wären<br />
. Das relative Übermaß an Zeichen wird Redundanz genannt. Es verschafft<br />
dem Empfänger die Möglichkeit einer gewissen statistischen Vorhcrsagbarkeit der<br />
Zeichenfolge. Diese Vorhersagbarkeit bringt die Verständlichkeit . Redundanz<br />
ist eine statistische Konsequenz der Speicherorganisation im Gedächtnis des Empfängers,<br />
sie ist der Code, der das Zusammensetzen der Elemente regelt.« 12<br />
Auf paläographischem Weg Buchstaben, Wörter, Proportionen und Seiten statistisch<br />
eindeutig zu erfassen ist die Tugend der Historischen /-/zZ/swissenschaften<br />
- eine angemessene Bezeichnung, wenn die Supplementierung der Historie<br />
zugleich als deren Bedingung, deren arche begriffen wird. 13 Die bibliothekarische<br />
Ordnung des Wissens organisiert kein Ensemble <strong>von</strong> Hilfswissenschaften<br />
als Elemente einer historischen Syntax (also im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>), sondern<br />
eine parataktische Reihe gleichrangiger Disziplinen: »Daher huldigen wir lieber<br />
dem Grundsatze: die verschiedenen Wissenschaftszweige nach ihren Grundoder<br />
Hauptbegnffen zu ordnen und sie alle als selbständige Theile gelten zu lassen.«<br />
14 In dieser polymathischen Ordnung bilden dann Realenzyklopädien, Literaturgeschichte,<br />
Bibliotheks- und Archivwissenschaft (als inneres, grammatisches<br />
Objekt der Ordnung selbst), Diplomatik, Paläographie, Epigraphik, Kryptographik,<br />
Dechiffrierkunst, Heraldik, Chronologie, Genealogie und Archäologie<br />
schlicht eine Serie, kein <strong>von</strong> gcschichtsphilosophischer Kohärenz zusammengehaltenes<br />
System. Johann Gustav Droysens Schlagwort der »Fabrikarbeit <strong>für</strong> die<br />
chen abzukürzen«. Zeichen und <strong>Geschichte</strong> in Nietzsches Spätwerk, in: Nietzsche-<br />
Studien 22,28-41<br />
11 Chladenius, Allgemeine Geschichtswissenschaft, Leipzig 1742, Kapitel 6 u. 7<br />
12 Abraham M. Moles, Information und Redundanz, in: Hans Ronge (Hg.), Kunst und<br />
Kybernetik, Köln (DuMont) 1968, 14-27 (21 u. 23)<br />
13 Peter Rück, Historische Hilfswissenschaften nach 1945, in: ders. (Hg.), Mabillons Spur:<br />
zweiundzwanzig Miszellen aus dem Fachgebiet Historische Hilfswisscnschafcn der<br />
Philipps-Universität Marburg, Marburg/Lahn (Institut <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften)<br />
1992, 1-20 (15). Eine medienwissenschaftlich und kulturtechnisch orientierte<br />
Historik verlangt nach einer Rcetablicrung der Historischen Hilfswissenschaften; siehe<br />
Eckart Henning, Bcgriffsplädoycr <strong>für</strong> die Historischen »Hilfs«wisscnschaften, in:<br />
Herold-Jahrbuch N.K 1 (1996), 13-23; ferner ders., Auxilia histonca: Beitrage zu den<br />
historischen I Iiltswisscnschaftun und ihren Wechselbeziehungen, Köln / Weimar / Wien<br />
(Böhlau) 2000<br />
14 Johann Georg Seizinger, Bibliotheks-Technik. Mit einem Beitrag zum Archivwesen<br />
[1855], 2. Ausgabe Leipzig (Costenoble) 1860, 12
222 MONUMHNTA Gl-KMANIAK<br />
Monumenta« aber wechselt im Informationszeitalter<br />
seine Vorzeichen vom Negativen ins Positive. Die Lettern MGH stehen<br />
nicht <strong>für</strong> glänzende Geschichtserzählungcn, sondern krönen die Disziplin<br />
ihrer Hilfswissenschaften. Nach anfänglichem Schwanken zwischen verschiedenen<br />
Varianten (Nebenwissenscbaften, Hüfsdoktrinen) hat sich der Begriff Hilfswissenschaften<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts in der Literatur wie in der Lehre<br />
durchgesetzt; »erst in der Gegenwart beobachten wir wieder einen neuen Trend:<br />
zum Ausdruck >Historische Grundwissenschaften^« 15 Hilfswissenschaften stellen<br />
den wissensarchäologischen Anteil der Historie dar. In der Phase ihrer tastenden<br />
diskursiven Formierung als Disziplinen stehen sie noch nicht in einem<br />
Subordinationsverhältnis gegenüber dem historischen Diskurs, der sich seinerseits<br />
erst nach 1800 noch mstititionell und methodisch zur Meisterwissenschaft<br />
des 19. Jahrhunderts aufschwingt. Seine konkurrierenden Varianten aber werden<br />
nicht vergessen; folglich enthierarchisiert der Freiherr <strong>von</strong> Aufseß, Begründer des<br />
Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg, die Suprematie des historischen<br />
Diskurses gegenüber alternativen Formen in der (Daten-)Verarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit:<br />
Der Darstellung <strong>von</strong> kulturarchäologischen Zuständen als Forschungsobjekt<br />
»gebührt mit Recht der Platz neben der <strong>Geschichte</strong>, nicht,<br />
wie bisher, unter ihr als blosse Gehülfen und Diener der <strong>Geschichte</strong>, als Hülfswissenschaften.«<br />
16 Institutionell ist der <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften<br />
an der Berliner Universität an die MGH gekoppelt, wo im Winter<br />
1856/57 der Monumentist und Ranke-Schüler Rudolf Koepke, außerordentlicher<br />
Professor <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und deutsche Literaturgeschichte, erstmals wieder<br />
nach dem Tod <strong>von</strong> Rühs eine Encyclopädie der <strong>Geschichte</strong> und ihrer Hilfswissenschaften<br />
liest. 1860/61 spart Gustav Droysen in seiner Vorlesung zur Historik<br />
die historischen Hilfswissenschaften aus; 1862 kommt es zur Errichtung eines<br />
außerordentlichen <strong>Lehrstuhl</strong>s <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften, besetzt <strong>von</strong><br />
Philipp Jaffe, MGH-Mitarbeiter in der Reihe Scnptores. 1873 wird dieser <strong>Lehrstuhl</strong><br />
in ein Ordinariat umgewandelt und der Diplomatiker Wilhelm Wattenbach<br />
darauf berufen. Wattenbach ist zuvor noch Provinzialarchivar in Breslau; die<br />
Ästhetik des Archivs ergreift den Raum der Historie. Dessen Nachfolger Michael<br />
Tangl aus Marburg setzt in Berlin die Ausbildung <strong>von</strong> Archivaspiranten fort. 17<br />
1:1 »Auxilia I listorica« oder Bchülfl zu den I listorischen und dazu erforderlichen Wissenschaften.<br />
Die Anfänge der Historischen Hilfswissenschaftenin Bayern, Katalog einer<br />
Ausstellung zum 41. Deutschen Historikertag, Universitätsbibliothek München 1996, 8<br />
16 Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß, System der deutschen Geschichts- und Alterthumskunde entworten<br />
zum Zwecke der Anordnungen der Sammlungen des germanischen Museums,<br />
1853 (der deutschen Bundesversammlung in Frankfurt als Denkschrift vorgelegt), 4.<br />
17 Dazu Eckart Henning, Die Historischen Hilfswissenschaften in Berlin, in: Reimer<br />
Hansen / Wolfgang Ribbe (Flg.), Geschichswisenschaft in Berlin im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
Persönlichkeiten und Institutionen, Berlin / New York (de Gruyier) 1992,
Editionskriterien der MGH<br />
UK/KUNDI-.: Dii'i.oMA'riK UND ARCIIÄOIOGII- 223<br />
Johann Friedrich Böhmer, seit 1824 Sekretär und Kassenführer der 1819 vom Freiherrn<br />
vom Stein in Frankfurt gegründeten Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche<br />
Geschichtskunde als Trägerin des MGH-Projekts, betrieb die Sammlung und Edition<br />
deutscher Kaiserurkunden und sieht dann »die sicherste Grundlage aller<br />
Geschichtskunde«. Was sonst meint Archäologie denn buchstäblich Ur-Kunde<br />
(und Ausgrabung derselben im Archiv 18 ); das althochdeutsche unchundi ist das<br />
mündliche Zeugnis, wie es in der ästhetischen Urkundenbetrachtung phonozentristisch<br />
anklingt, die, eine mittelalterliche Urkunde in den Händen halten, tatsächlich<br />
den Hauch der <strong>Geschichte</strong> zu spüren glaubt, »schön und fremd zugleich <strong>für</strong><br />
das ungeübte Auge.« 1
224 • MONUMI:NTA GF.KMANIAH<br />
»welcher den vorhandenen Vorrath möglichst gesichtet und zur weiteren Bearbeitung<br />
vorbereitet, zu bequemem Gebrauch vorzulegen hat«. 22 Bedingt ist also<br />
auch dieser Sinn - zumal, wenn es um paläographische Materie, um Buchstabenformen<br />
geht - plausibel in Begriffe der digitalen Vektorrechnung überführbar. Was<br />
aber nach der Reorganisation der MGH, als in Verbidung mit der Wiener Akademie<br />
der Wissenschaften Sickel mit der Ausgabe der Kaiserurkunden beauftragt<br />
wird, den hermeneutischen <strong>Im</strong>puls ausmacht, ist Wille zur Macht über Texte; just<br />
in jener Zeit, als ein neues deutsches Kaiserreich kraftvoll sich erhob, haben die<br />
österreichischen Historiker »die Res gestae des alten Reiches in entsagungsvoller<br />
Arbeit zum größten Teil <strong>für</strong> das Mittelalter wieder hergestellt und damit das<br />
Andenken an dieses heilige Reich treu bewahrt« . Tut dies zu<br />
meinem Gedächtnis: Der Diplomatik, so gedächtnisasketisch sie auf den ersten<br />
Blick als Hilfswissenschaft erscheint, ist dennoch ein memorialer <strong>Im</strong>perativ zur<br />
Erinnerung, ein imperiales Gedächtnis als aktiver Vektor eingeschrieben, das (wie<br />
der historische Diskurs überhaupt) Kontinuitäten privilegiert. Das Medium dieser<br />
Forschung, die Urkunde, bietet selbst ein »Beispiel <strong>für</strong> Kontinuität einerseits -<br />
Pseudokontinuität andererseits: die Urkunde des frühen Mittelalters, welche die<br />
Fortdauer des germanischen Rechtsempfindens trotz der Rezeption einer römischen<br />
Rechtseinrichtung beweist«. 23 So zeigt sich »das Zurückfinden der Hilfswissenschaften<br />
zur <strong>Geschichte</strong> am sinnfälligsten vor allem in dem Rückschreiten<br />
in die Rechtsgeschichte« .<br />
C. F. Eichhorn erinnert 1815 in der <strong>von</strong> ihm gemeinsam mit F. C. <strong>von</strong> Savigny<br />
und J. F. L. Göschen herausgegebenen Zeitschrift <strong>für</strong> geschichtliche Rechtswissenschaft<br />
an die Spannung zwischen modularcr, diskreter Urkundenforschung und<br />
narrativer Geschichtsdarstellung; in den diplomatischen Disziplinen »nehmen die<br />
erzählenden Quellen eine Sonderstellung ein« . Die Urkunde ist<br />
hier die buchstäblich wissensarchäologische Grundlage der Historie; »besonders<br />
22 W. Wattenbach, über O. Lorenz» Vorrede des zweiten Teils <strong>von</strong> Deutschlands Geschichtsquellen<br />
m der zweiten Hälfte des Mittelalters, in: Neues Archiv der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Ältere Deutchc Geschichtskunde 13, Heft 2 (1888), 251-258 (257)<br />
23 Karl Pivec, Die Stellung der Hilfswissenschaften in der Geschichtswissenschaft, in:<br />
Mitteilungen des Österreichischen Instituts <strong>für</strong> Geschichtsforschung 54 (1941), 3-15<br />
(9). Dieser historiographischen Konservativität setzt Lord Acton die Diskontinuitätserfahrung<br />
der politischen Revolution <strong>von</strong> 1848 und ihre Effekte auf die deutsche<br />
Geschichtswissenschaft entgegen: »1848 changed German history. It became charged<br />
with pohtical meaning. Gicsebrccht, 1 Iäusscr, Sybel, Droyscn, Mommscn, all culminating<br />
in Treischke«: Nachlaß Add. 4929, 155, zitiert in: Herbert Butterfield, Man on<br />
His Past: The Study of the History of Historical Scholarship, Cambridge (University<br />
Press) 1955 (78). Zu den politischen Rupturen treten die
UR/KUNUI:: DIPLOMATIK UND ARCHÄOIOGII- 225<br />
wünschenswerth wäre <strong>für</strong> die Bearbeitung der deutschen Specialgeschichte die<br />
Vereinigung mehrerer <strong>für</strong> denselben Zweck, zumal da bei einer auf Urkunden<br />
gegründeten <strong>Geschichte</strong>, welcher die Darstellung eigentlich nur untergeordneter<br />
Zweck ist, Theilung der Arbeit zulässig ist.« 24 1882 konstatiert der Autor eines<br />
Handbuchs über die historische Hilfswissenschaft der Chronologie<br />
»gerade in unserer Zeit das Bemühen, alte Urkunden hervorzuholen und zu studiren,<br />
überhaupt die Neigung zur Durchforschung der historischen Quellen, auf<br />
denen alle Geschichtsschreibung beruht , wie schon die zahlreichen bestehenden<br />
und noch immer neu sich bildenden historischen Vereine darthun, deren<br />
Bemühungen im Wesentlichen nicht auf Geschichts Schreibung, sondern auf<br />
Geschichts forschung gerichtet sind.« 23<br />
Nicht die Narration, sondern die Edition der Vergangenheit als Gedächtnis hat<br />
Vorrang im wissenschaftshistorischen Kontext des Positivismus. <strong>Im</strong> Spannungsfeld<br />
<strong>von</strong> diskreter Diplomatik (Edition der MGH) und narrativer Nationalgeschichtsschreibung<br />
stand der Freiherr vom Stein selbst: Verfaßte er doch<br />
eine <strong>Geschichte</strong> der Deutschen, beginnend mit den germanischen Verfassungszuständen,<br />
eine Französische <strong>Geschichte</strong>, einsetzend mit dem 5. Jahrhundert,<br />
und eine <strong>Geschichte</strong> des Zeitraums 1789-1799. Die <strong>Geschichte</strong> der Deutschen<br />
entstand »in engster sachlicher und zeitlicher Verbindung mit den Plänen <strong>für</strong><br />
die Monumenta Germaniae Historica. 26 Nicht aber zur Illustration vorformulierter<br />
<strong>Geschichte</strong>(n) dient Diplomatik, sondern sie emanzipiert das schrift-bildliche<br />
Artefakt zum eigenständigen Monument - wie es Karl Brandi, Harry<br />
Bresslau und Justin Stangel 1908 im Vorwort zu Heft 1 ihrer Zeitschrift Archiv<br />
<strong>für</strong> Urkundenforschung formulieren. Gleich Eichhorn plädiert Böhmer zuvor<br />
<strong>für</strong> eine kulturwissenschaftlich orientierte Rechtshistorie:<br />
»Die Chronisten beschäftigen sich am Ende doch mehr mit dem äußeren Leben<br />
der Völker. Das innere erkennt sich besser in Verfassung und Kunst. Insbesondere<br />
aber sind alle Beziehungen auf öffentliches und Privatrecht bei uns <strong>von</strong> höchster<br />
Wichtigkeit, weil das Kleinod des germanischen Volkes, die Freiheit, wie sie Tacitus<br />
geschildert, später in den Rechtszustand sich umbildete.« <br />
Nicht aus methodisch abstrakter Präferenz, sondern aus dem konkreten Gespür,<br />
daß im urkundlichen Recht die germanische Freiheit sich aufspüren ließ, deren<br />
Ausdruck und Garant sie bis 1806 waren, speist sich also die ausdrücklich nonnarrative,<br />
dokumentarische Archiv-Archäologie (»sicherste Grundlage«). Ge-<br />
24 Bd. 1 (1815), 139, zitiert nach: Töllner 1994: 57f<br />
25 Eduard Brinckmeier, Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten<br />
und Völker, besonders des Mittelalters, 2. Auflage Berlin (Hempel) 1882, »Vorrede<br />
zur zweiten Auflage«, xv<br />
2U So ihr I Icrausgeber W. Hubatsch, XII, zitiert nach: Müller-Mertcns 1982: 138
226 MONUMHNTA GhRMANIAl-<br />
schichte ist hier Rechtsgeschichte und nicht interessenloses Geschäft: nicht Geschichtsdokumente,<br />
sondern Rechtsmonumente stehen zur Verhandlung. 27<br />
Die MGH setzen vorgängige Quellcneditionen nicht schlicht fort, sondern<br />
begründen sie neu. Ausdrücklich legt die Direktion fest, daß bei neuen Ausgaben<br />
der Geschichtsschreiber in der Regel nicht <strong>von</strong> einer früheren Bearbeitung,<br />
sondern <strong>von</strong> der oder den besten Handschriften auszugehen sei und auch die<br />
Gesetze und Urkunden einer neuen Sammlung bedurften - Gedächtnis als<br />
Infrastruktur der Historie. Der geeigete Ort, »diese Erfahrungen anzusprechen<br />
und geltend zu machen«, also diskursiv zu mobilisieren, war die 1819 unter dem<br />
Titel Archiv <strong>für</strong> die Zwecke der Gesellschaft gegründete Zeitschrift . Ursprung (arche) und Wahrheit werden in dieser Editionspraxis<br />
ineins gelesen (Nietzsches wissensgenealogischen Einsichten zum Trotz);<br />
mythischer Fluchtpunkt sind »die wahren und letzten Quellen«, die doch<br />
editionstechnische Produkte, keine ontologischen Letzbegründungen sind.<br />
Hauptzweck jeder Bearbeitung ist »die genaueste Herstellung des ursprünglichen Textes der Quellen«, sie nach ihrer »Verwandtschaft<br />
und Abhängigkeit vom Original zu ordnen« und dem Werke einen »strenghistorischen<br />
Charakter zu geben«, um damit »den Weg zu einem bestimmten<br />
Urtheil über seine Glaubwürdigkeit zu bahnen.« Das soll mikrohistorisch zu<br />
wichtigen Resultaten ȟber den Zusammenhang der schriftlichen Ueberliefcrungen<br />
und über die Wahrheit vieler einzelnen Thatsachen« führen, makrohistorisch<br />
aber zugleich »über die Bildungsgeschichte des Mittelalters im Großen«<br />
- die Doppelte Bindung der MGH . Solange<br />
<strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> den Effekten einer reinen Textwissenschaft lebt, bildet sie keine<br />
eigene Methode der Edition aus: Die Bearbeitung der Quellen ist »<strong>von</strong> den<br />
gewöhnlichen philologischen nicht unterschieden«, da die »diplomatisch-treue<br />
Herstellung des Werks« Hauptzweck ist . Diese<br />
äußerste Datenaskese kommt ohne den Begriff <strong>Geschichte</strong> selbst aus: Erklärende<br />
Anmerkungen sollen »das Gegentheil eines fortlaufenden (Kommentars,<br />
nur einzelne weder aus dem Zusammenhang noch aus allgemein bekannten<br />
Umständen deutliche Stellen auf die kürzeste Art entwickeln, und werden, <strong>von</strong><br />
den critischen Anmerkungen getrennt, unter diese zu stehn kommen«<br />
. Die Ordnung der Daten löst sich nicht nur vom narrativen,<br />
sondern auch vom chronologischen, d. h. Lineantät implizierenden<br />
Dispositiv; »die bei den äußern Verhältnissen des Unternehmens unausführbare<br />
chronologische Ordnung der Schriften in jeder Abtheilung wird durch ein<br />
27 Zitiert nach Ernst Schulin, Traditionskntik und.Rekonstruktionsversuch: Studien<br />
zur Entwicklung <strong>von</strong> Geschichtswissenschaft und historischem Denken, Göttingen<br />
197V, 341'
UR/KUNDK: DIPLOMATIK UND ARCHÄOLOGIE 227<br />
Inhaltsverzeichnis vor, ein kurzes Sach- und ein Wortregister am Ende jedes<br />
Bandes und durch ähnliche Verzeichnisse über jede ganz erschienene Abtheilung<br />
ersetzt«. 28 Die Unausführbarkeit der chronologischen Ordnung verweist<br />
darauf, daß ihr Medium nicht die Zeit, sondern die Alphanumerik <strong>von</strong> Textgedächtnissen<br />
ist: »Die meisten dieser Rätseldaten sind Lesefehler.« 29<br />
Bei der Edition <strong>von</strong> Texten mittelalterlicher Plagiatoren werden zwar jene<br />
Stellen ausgelassen, die aus in den MGH bereits veröffentlichten Schriften lediglich<br />
kopiert sind; »keineswegs aber dürfen jemals solche größeren Stellen ausgelassen<br />
werden, wo der Inhalt der Erzählung zwar <strong>von</strong> früheren Chronisten<br />
entnommen, aber abweichend oder anders vorgetragen, erzählt wird, weil eben<br />
in diesen Abweichungen und Verschiedenheiten oft der größte historische Werth<br />
liegt« . Historie ist eine Differenz, die hier nicht in einem wie<br />
auch immer gearteten Wesen derselben, sondern in den Effekten ihrer traces, den<br />
(typo-)graphischen Operatoren, also editorischen (Schrift-)Setzungen liegt und<br />
nicht nach narrativer Interpretation, sondern Spurensicherung heischt: »Auch<br />
die kleinste Abweichung müsse angezeigt, die eignen Bemerkungen des Vergleichenden<br />
aber mit einem Zeichen versehen sein, um diese sogleich zu erkennen«<br />
. <strong>Geschichte</strong> als Gegenstand solcher Editionen verzeichnet<br />
dementsprechend nicht die Regel, sondern die Abweichung, nachrichtentechnisch<br />
gesprochen den random noisc im Lauf, also in der Übertragung der Dinge:<br />
»Denn der Gegenstand der <strong>Geschichte</strong> ist nicht das stille, ruhige Leben des Landmannes,<br />
oder Bürgers, noch edle, schöne Handlungen, die gewöhnlich im Verborgenen<br />
geschehehen, selten zur Kenntniß der Zeitgenossen, und noch seltener<br />
zur Kunde der Geschichtsschreiber gelangen, sondern es sind Zwiste, Unruhen,<br />
Kriege, und überhaupt jede Störung, oder Abweichung im gewohnten Gange der<br />
Dinge.« <br />
Die Jenaische allgemeine Litteraturzeitung kritisiert den Grundsatz der MGH,<br />
jeweils nur einen Codex als Text zugrundezulegen und alle anderen Lescarten<br />
nur unterhalb des Textdrucks als Anmerkungen vorzubringen? 0 Diese Ansicht<br />
läßt einen räumlichen Begriff des Text-Archivs mitschwingen, der dann Historiographen<br />
zur temporalisierenden Verfügung steht. Die klassische Ordnung<br />
der Rhetorik (Klassifikation und Disposition) wird damit nicht schon vorweg<br />
in die einer (narrativen) Historie überführt, die ihre Operationen sublim und<br />
im Sinne des Realitätseffekts tarnt, doch die Konzentration auf eine Textvorlage<br />
schafft da<strong>für</strong> die Bedingung:<br />
28 Archiv Bd. 5, 1824: 797, § 9 »Ordnung«<br />
29 Hermann Grotefend, Chronologisches. Lesefehler und Verwandtes, in: Korrespondenzblatt<br />
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine Nr. 4-<br />
6, 74. Jg. 1926, Sp. 114<br />
}0 »Vortrag«, in: Archiv 4 (1S22), 32, unter Verweis auf »Archiv 11. 59. 234.«
228 ' MONUMKNTA GKRMANIAK<br />
»Wenn das Ganze nicht zu grammatikalischen, sondern zum historischen<br />
Gebrauch dienen soll, so dürfte wohl die getadelte Weise manche Vertheidiger finden,<br />
welche die Grundlage der vorzüglichsten Handschrift zum Text,<br />
unter diesen die Varianten in Noten beigefügt, die Anmerkungen aber in Beilagen<br />
an den Schluß verwiesen, als die zweckmäßigste ansehen dürften.« <br />
Anmerkungen als Verweis auf urkundliche Quellen im narrativ nicht Gesagten<br />
der Historie sind mehr als eine rhetorische Figur; sie bilden zugleich die Grundlage<br />
und den Entzug, die wissensarebäologische Unterminierung der narrativen<br />
Historie, sind doch archivahsche Q.uellenvananten in der Lage, alle anderen<br />
Quellen, insbesondere »die farbigen und unentbehrlichen aber stets absichtsvollen<br />
und literarisch gebundenen Erzählungen der Geschichtsschreiber wirksam<br />
zu kontrollieren« 31 - mithin gilt <strong>für</strong> das Archivdatum ein »Vetorecht«<br />
(Reinhart Koselleck).<br />
In einem Brief an Pertz vom 18. September 1826 anläßlich des Erscheinens <strong>von</strong><br />
Band 1 der MGH (Scriptores) preist vom Stein die typographische Schönheit des<br />
Werks. 32 Das Phänomen des historischen Bewußtseins ist (auch) ein Effekt <strong>von</strong><br />
Buchdruck; das zeitliche Limit der MGH-Edition (um 1500) ist genau der<br />
medienarchäologische Punkt, an dem die Bedingung ihrer eigenen Praxis (die<br />
typographische Transformation <strong>von</strong> Manuskripten in Buchdruck) einsetzt. Dieser<br />
medienarchäologische Moment ist gekoppelt an einen ereignisgeschichtlichen,<br />
die Reformation <strong>von</strong> 1517, wie es der Berliner Plan vom 31. Mai 1816 in einer<br />
Denkschrift an den Staatskanzler Hardenberg zur Gründung der Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Deutschlands ältere Geschichtskunde noch als Zeitlimit vorsieht 33 . Ein <strong>von</strong> einem<br />
Übertragungsmedium gesetzter Einschnitt gewinnt am Ende Priorität über eine<br />
geistesgeschichthche Datierung (die ihrerseits - so Luthers Medium der Flugschrift<br />
- eng mit dem neuen Pnntmedium verbunden ist): »The past could not be<br />
set at a fixed distance until a uniform spatial and temporal framework had been<br />
construeted.« 34 Paragraph 8 der Statuten und Plan der Gesellschaft jür ältere<br />
31<br />
Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung, hg. v. Karl Brandi, Harry Bresslau u. Michael Tangl,<br />
Bd. I, Leipzig 1908, Einleitung, 2<br />
32<br />
Georg Heinrich Pertz, Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, 6 Bde, Berlin<br />
1849-1855, hier Bd. 6.1, Berlin (Reimer) 1855, 273. Aus wissenschaftlicher Sicht gilt<br />
der Band inzwischen allerdings als weitgehend veraltet: Hartmut Hoffmann, Die Edition<br />
in den Anfängen der Monumcnta Germaniae Historica, in: Rudolf Schicffer<br />
(Hg.), Mittelalterliche Texte. Überlieferung, Befunde, Deutungen (MGH Schriften 42),<br />
Hannover 1996, 189-232 (200)<br />
33<br />
Siehe Adolf Harnack, <strong>Geschichte</strong> der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften,<br />
Berlin 1900, 678 (»Die MGH«)<br />
34<br />
Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Comunications and<br />
Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge (CUP) 1979, Bd. I, 301
UR/KUNDK: DIIM.OMATIK UND ARCHÄOI.OC;II-: 229<br />
deutsche Geschichtskunde, wie sie in der Anfangszeit der MGH den Mitghedsurkunden<br />
beigegeben war, definiert »Die Zeitgränzen der Sammlung : Das<br />
Aufhören der classischen Literatur und der allgemeine Gebrauch der Buchdruckerkunst,<br />
also 500 bis 1500.« Das hat Konsequenzen <strong>für</strong> den Begriff historischer<br />
Epochen selbst. Das Schriftmaterial des Mittelalters, medial als endliche<br />
Manuskriptmenge definierbar, unterscheidet sich dadurch <strong>von</strong> der Neuzeit als<br />
Datenexplosion:<br />
»Wenn man den Stand der Dinge näher betrachet, .so wird man sich der Wahrnehmnung<br />
nicht verschliefen können, daß unsere historische Thätigkeit, so weit<br />
sie der vaterländischen <strong>Geschichte</strong> zugekehrt ist, sich auffallend ungleich vcrthcilt.<br />
Um das große Werk der Monumenta Germamac, diese herrliche Schöpfung Stem's,<br />
hat sich eine dichte Reihe <strong>von</strong> Forschern geschaart, welche die Geschiche des<br />
früheren deutschen Mittelalters nach allen Richtungen bearbeiten. <strong>Im</strong> vierzehnten<br />
Jahrhundert lichtet sich diese Reihe aber schon merklich und je näher wir<br />
der Gegenwart kommen, desto spärlicher wird die Zahl der Pubhcationen,<br />
Forschungen und Darstellungen.«'"'<br />
Was die Publikation <strong>von</strong> Quellen angeht, so verschwinden im 19. Jahrhundert<br />
die auf die letzten Jahrhunderte deutscher <strong>Geschichte</strong> bezüglichen fast vollständig<br />
neben den mittelalterlichen; den Monumenta war <strong>für</strong> die neuere Zeit<br />
zunächst kein auch nur annähernd gleichrangiges Editionsunternehmen an die<br />
Seite gestellt. Alle <strong>von</strong> einzelnen Staaten, Landschaften, Städten und Gelehrten<br />
herausgegebene Chroniken, Urkunden- und Regestenwerke beschränken sich<br />
fast ohne Ausnahme auf das Mittelalter oder regionale Absichten. Quellenstatistische<br />
Quantsprünge prästrukturicren damit den Rhythmus der Historiographie,<br />
denn »es hegt in der Natur der Dinge, daß die Massenhaftigkeit des<br />
archivahschen Materials mit der Nähe der Zeiten, man möchte fast sagen in geometrischer<br />
Progression wächst, daß unsere Archive schon über irgend ein Jahr<br />
der Reformationszeit das unendlichfache enthalten wie über ein Jahr der Staufenzeit«<br />
.<br />
Das Editionsmedium der MGH dementiert das überkommene Format seiner<br />
Inhalte. Indem die Texte sequentiell, nämlich seitenweise organisiert sind und<br />
durch die selbstbezügliche Einheit Buch zusammengehalten werden, erhalten sie<br />
eine festgesetzte Geschlossenheit, die der Form ihrer Lagerung als Urkundenarchiv<br />
widerspricht. Erst im elektronischen Jenseits dieses Mediums, das die Aufzeichnung<br />
wieder <strong>von</strong> seinem Trägermedium separiert, knüpft die Edition wieder<br />
an diese handschriftliche Vorgeschichte an: »Often desenbed as >nonsequential<br />
writings hypertext allows the reader to dynamically alter the manner in which<br />
35 H. Baumgarten, Archive und Bibliotheken in Frankreich und Deutschland, in: Preußische<br />
Jahrhbücher, 36. Bd., Berlin (Reimer) 1875, 626-654 (641)
230 MoNUMKNTA GKKMANIAK<br />
Information IS presented.« 36 In der prinzipiellen Unabschheßbarkeit <strong>von</strong> kritischen<br />
Editionen, die mit der Zeit immer wieder nach Neuedition verlangen, ist die<br />
ständige Modifizierung der Daten und die Datenpflege angelegt; den Einschnitt<br />
setzt allem das Faktum der jeweiligen (Buch-)Pubhkation, die cm abschließendes<br />
Manuskript verlangt. Die Konfrontation der ersten MGH-Editoren mit der vielseits<br />
beklagten Unordnung der Urkunden in den vorliegenden deutschen Archiven<br />
bedeutet zunächst eine Situation, die der des Archäologen im Feld nicht<br />
unähnlich ist und eine analoge Stratigraphie ihrer (Ge-)Schichten erfordert: »The<br />
excavation recording of single >contexts
UR/KUNDI-;: DIPI.OMATIK. UND ARCHÄOI.OGU-: 231<br />
sehen Entwürfe des 19. Jahrhunderts darauf zielen, sie durch Erzählung zu vereinheitlichen,<br />
erinnert zeitgenössisches Design <strong>von</strong> Benutzeroberflächen digitaler<br />
Maschinen inzwischen wieder daran, daß solche großen Erzählungen<br />
einmal im Gegensatz zur rhetorischen Mnemotechnik standen, worin Wissen<br />
in visuellen Bildern organisiert wurde. 39 Um Nation als notwendig geschlossenes<br />
Bewußtsein zu stiften, bedurfte es einer anderen Technik als die allen<br />
Verknüpfungen gegenüber offene Struktur der Datenlandschaften. Die Navigierbarkeit<br />
der deutschen Archivräume ist eine virtuelle, <strong>von</strong> den MGH im<br />
Medium Typographie nur bedingt durchgeführte Option, denn das 19. Jahrhundert<br />
verfährt gedächtnismedial arbeisteilig - mit dem Museum (etwa dem<br />
Germanischen Nationahnuseum) als dem Reich der begehbaren Bilder, die vom<br />
Bereich der Erzählung (Geschichtsbücher) ebenso getrennt existiert wie <strong>von</strong><br />
dem der Speicherregister (Archiv). Dessen archivahschen Artefakte werden erst<br />
als Funktion einer Scmiosc zu historischen Dokumenten, zu einer Datenbank.<br />
Der Preis da<strong>für</strong>: »From in situ and unknown, to removed and researched, before<br />
it has any impact on knowledgc, the evidence has largely lost its original intcgnty«;<br />
kulturelle Semantik »rests only in the Information attached to it in the<br />
form of associated records.« 40 Der Akt der Registrierung, der Verzeichnung und<br />
Kontextualisierung steht einerseits in einem parergonalen Verhältnis zum<br />
Objekt, dem Semiophor der Historie. 41 David Crowther unterscheidet zwei<br />
Gruppen <strong>von</strong> artifacts attnbutes: intrinsische (Material, Dekoration) und relative<br />
(Kontext, <strong>Geschichte</strong>, Funktion). Darüber hinaus kommt das matenale<br />
Defizit der Semiotik ins Spiel, die <strong>von</strong> ihr nur bedingt faßbare Materialität des<br />
Zeichenträgers: keine Frage des Konzepts, sondern der Physik. »It is a measure<br />
of the direct social relevance of archacology that the repositones for its raw<br />
material, semi-digested or otherwise, should be public institutions whose principle<br />
functions are the provision of a cultural Service« .<br />
Gedächtnisdatenbanken sollen damit nicht schlicht Historikern zur Anfertigung<br />
eines diskursiven Geschichtsbilds, sondern der Öffentlichkeit selbst zur<br />
unmittelbaren Lesung zur Verfügung stehen.<br />
39<br />
Siehe etwa Klaus Bartels, Die Welt als Erinnerung. Mnemotechnik und virtuelle<br />
Räume, in: Spuren Nr. 41 (April 1993), 31-39<br />
40<br />
David Cnuvther, Archaeoloi;y, Material Culture and Museums, in: Susan M. Pearce<br />
(I li;.), Museum Studies in Material Culutre, London I9SS, 35-46 (42)<br />
41<br />
Diesen Begriff prä;^l Krzys/.tot Pomian <strong>für</strong> »tels objets bitaees qui unissent Line<br />
dimension semiotique et une dimension materielle«: De rhistoire, parue de la racmoire,<br />
a la memoire, objet d'histoire, in: Revue de Metaphysique et de Moralc 1/1998,<br />
63-110(67)
232 MoNUMKNTA CJI-.KMANIAI'.<br />
Krisen der Diplomatik<br />
1873 publiziert die <strong>von</strong> Sybel herausgegebene Historische Zeitschrift eine vernichtende<br />
Kritik der neuesten MGH-Publikation. 42 Zunächst wird das Archiv als<br />
das Gesetz dessen definiert, was über Vergangenheit überhaupt gesagt werden<br />
kann:<br />
»Die-allwärts geöffneten Archive lassen uns über Schätze gebieten, dieselben zur<br />
Vcrglcichung heranziehen , wie dies in früherer Zeit kaum geahnt werden<br />
konnte. Deshalb sind wir jetzt in der glücklichen Lage, an Stelle unsicherer und<br />
zweifelhaft gelassener Bestimmungen klare und festwaltende Gesetze zu erkennen,<br />
eine Menge <strong>von</strong> Merkmalen zu entdecken, die ehedem völlig übersehen worden<br />
waren.« <br />
Stumpf, der Rezensent der die neue Serie Diplomatum imperii der MGH (Bd.<br />
XXIV) eröffnenden Edition der merovingischen Königsurkunden durch A. F.<br />
Pertz (der Sohn <strong>von</strong> Georg Heinrich Pertz), erklärt die Publikation selbst zur<br />
Teilmenge des so verstandenen Archivs und berichtet zunächst über eine prägnante<br />
Erfahrung auf seinen »archivarischen Kreuz- und Querfahrten«:<br />
»Ich vermißte meistens jedwede Ordnung und Übersicht und mußte sie mir selber<br />
mit großer Mühe und vielem Zcitaufwande herstellen. Sollte uns nicht vielleicht<br />
Gleiches auch hier bei Benutzung des geöffneten Merovinger-Archivs<br />
begegnen? So glaube ich hinreichend die Behauptung gerechtfertigt zu haben,<br />
daß wir hier einem nichts weniger als geordneten Merovinger-Archiv gegenüberstehen,<br />
wo gleichsam die verschiedensten Hände nach Beheben schalteten und<br />
walteten: so wenig läßt sich eine einheitliche Rcdaction oder eine planmäßige Sichtung<br />
und Bearbeitung des Stoffes entdecken.« <br />
Die Edition der Merovingerurkunden, also der pubhkationszeithch verschobene<br />
chronologische Einsatzpunkt der MGH, manifestiert das Dilemma, die<br />
Definition dieses Archivs mit unstetigen Zeit-Räumen auf Seiten der historischen<br />
Referenz zur Deckung zu bringen. Jede Edition bedeutet buchstäblich<br />
Definition als relationale Begrenzung »der Sammlung nach Zeit- und Raumbeziehungen«,<br />
wobei<br />
»ohnedies die Frage aufgeworfen werden durfte, ob überhaupt Documente der<br />
Merovinger-Epochc, deren überwiegende Anzahl mit deutschem Grund und<br />
Boden nichts zu schaffen hat, in die Monumente Germamae historica aufgenommen<br />
werden sollten oder nicht? - Spricht schon die Continuität und Ähnlichkeit<br />
unserer Zustände mit jenen urfränkischen entschieden <strong>für</strong> eine Berücksichtigung<br />
auch ihrer ältesten Documente, so doch gewiß nur in wohlbedachter Auswahl.«<br />
<br />
42 Karl Friedrich Stumpf, Über die Merovinger-Diplome, in: Historische Zeitschrift 29<br />
(1873), 343-407
U K / M INI )l : D l l ' l l > M A I IK U N I ) A l < ( I lAl >l l H ,11 2 3 3<br />
Monument ist demnach das, was als Institution oder ihr Effekt (über)dauert.<br />
Urkundeneditionen stehen dabei buchstäblich auf Seiten der Archäologie. Auch<br />
hier scheint die zur Zeit dieser Rezension in Preußen sich formulierende Ästhetik<br />
der Provenienz als archivarisches Ordnungsprinzip auf; weit unentbehrlicher<br />
als ein Verzeichnis über die gedruckte Literatur sei eine Übersicht über die<br />
benutzten handschriftlichen Quellen nach dem Muster des Franzosen Delisle<br />
im Catal. des actes de Philippe-Auguste, »wo im Anhange dieselben, nach ihrer<br />
Provenienz alphabetisch geordnet, verzeichnet stehen« . <strong>Im</strong><br />
Bunde mit der Urkundenarchäologie stehen die neuen Medien der Reproduktion;<br />
sie erlauben eine Rückkopplung <strong>von</strong> Lektüre der Edition und originärer<br />
Diplomatik nicht mehr allein auf Seiten der Editoren, sondern auch der Leser:<br />
»Wir besitzen fast <strong>von</strong> allen noch erhaltenen Originalen ausgezeichnete Facsimilc<br />
, die uns in den Stand setzen, jede Edition derselben bestens controlliren zu<br />
können. Aber noch wichtiger <strong>für</strong> uns ist die dadurch gewonnene Möglichkeit,<br />
betreffs der Gesetze des Urkundenwesens der Merovinger aus der ungetrübtesten<br />
und lautersten Quelle zu schöpfen.« <br />
Die Kopplung <strong>von</strong> arche und logos auf Seiten der Diplomatik betrifft auch die<br />
Editionsethik; Stumpf stört sich an der wiederholten Bemerkung Autographum<br />
deperditum. In seinem Verständnis gilt, »daß wo kein Original benutzt ist, dasselbe<br />
<strong>für</strong> verloren gilt. Varianten nach verloren gegangenen Originalen zu citiren<br />
ist jedenfalls unerlaubt, weil man keineswegs da<strong>für</strong> einstehen kann, daß der<br />
betreffende Abdruck dasselbe diplomatisch genau wiedergegeben habe« . Unmittelbarkeit <strong>von</strong> Gedächtnisdaten bedeutet in der Edition die<br />
typographisch (scheinbare) Auslöschung der Übertragungsspuren, buchstäblich:<br />
»Es ist heutigen Tags Axiom, daß die Eigenthümhchkeit der Originale in jeder Hinsicht<br />
unangetastet gelassen und Alles, was mit unsern Lettern nur irgendwie wiederzugeben<br />
ist, beibehalten werden solle. Sogar entschiedene Fehler in Originalen<br />
waren zu belassen; deren Verbesserung gehörte in die Anmerkungen. Nur<br />
was in Folge entstandener Lücken zu ergänzen ist, darf innerhalb Klammern in den<br />
Text aufgenommen werden, aber auch nur, wenn uns <strong>für</strong> diese Ergänzung Belege aus<br />
gleichartigen Urkunden zu Gebote stehen.« <br />
Tatsächlich bedeuten Archäologie und radikale Philologie als Methode Widerstand<br />
gegenüber der Versuchung, Lücken des Archivs mit historischer <strong>Im</strong>agination<br />
(im Medium der Narration) zu füllen; Konjekturen sind unbedingt als solche<br />
kenntlich. Der wissensarchäologische Blick der Diplomatik unterscheidet sich<br />
dennoch signifikant <strong>von</strong> dem des photographischen Apparats; diese Differenz<br />
heißt Hermeneutik (im Sinne der Definition Friedrich Nietzsches) als Verfahren,<br />
sich im <strong>Namen</strong> des Verstehens eines Textes autoritativ zu bemächtigen 4 - 1 :<br />
43 Friedrich Nietzsche, in: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, hg. v. G. Colli /<br />
M. Montinari, Bd. 12, München / Berlin / New York 1980, 140, Fragmentengruppe 2
234 MONUMKNTA GKKMANIAK<br />
»Gerade in diesem Theile der Edition zeigt es sich am Besten, ob ein Herausgeber<br />
Herr seines Stoffes im echten Sinn des Wortes sei oder nicht. Denn Urkunden richtig<br />
zu ediren ist nicht so leicht, wie leider noch heutigen Tages <strong>von</strong> Vielen geglaubt<br />
wird, die Alles gethan, ja ein gelehrt sein sollendes Werk zu Stande gebracht zu<br />
haben wähnen, wenn sie die Documente gerade so, wie sie dieselben zufällig vorgefunden,<br />
gleichsam mechanisch abschreiben und abdrucken lassen.« <br />
Hermeneutik als Verstehenwollen verführt dazu, selbst Signalarmes Rauschen<br />
buchstäblich zu lesen; <strong>für</strong> verfehlt hält Stumpf es, »das Gekritzel im leer gebliebenen<br />
Raum der Schlußzeilc des Urkundentextes«, das offenbar nur eingeschrieben<br />
wurde, um Interpolationen vorzubeugen, z. B. als Amen zu entziffern<br />
. Ganz im Sinne <strong>von</strong> Carlo Ginzburgs Erinnerung an die<br />
Nähe <strong>von</strong> philologischer Kritik und Kriminalistik 44 ist »bei dem Inquisitionsverfahren,<br />
welches eröffnet werden muß, um die Handschriften, diese scheinbar<br />
stummen Zeugen zum Sprechen zu bringen«, <strong>von</strong> der ganzen Handschrift<br />
auszugehen, »nicht nur <strong>von</strong> der an sich ja bestimmbaren, doch aber seelenlosen<br />
Schrift.« 43 Kritische Parcrga der Edition wuchern in den Text hinein; wiederholt<br />
macht Stumpf darauf aufmerksam, »was Alles in die Anmerkungen hätte<br />
gewiesen werden sollen«, um die hermcneutische Fiktion der Trennbarkeit <strong>von</strong><br />
gesicherten und variierenden Textdaten aufrechterhalten zu können:<br />
»Doch will ich gleich hier bemerken, dals es durchaus nicht meinem Geschmacke<br />
entspricht, wenn eine Urkundenausgabe gleichsam <strong>von</strong> der Glosse trieft. Vielmehr<br />
wünschte ich hier nur das unumgänglich Nothwendige, was zur Erklärung und<br />
Richtigstellung des Textes nach den Gesetzen der Diplomatik dient, aufgenommen<br />
zu sehen.« <br />
Philologische Richtigstellung ist nicht ein Selbstzweck der Diplomatik, sondern<br />
die fortgeschriebene Spur ihrer Ursprünge in einer wissensstrategischen Stellung;<br />
das grundlegende und seinerzeit noch unentbehrliche Editionswerk Mabillons<br />
ist »mit directem Bezug auf die angefeindeten ältesten (Merovinger-) Urkunden<br />
der Benedictinerklöster Frankreichs abgefaßt worden« , also<br />
im Kampf um Besitzansprüche (tatsächliches und symbolisches Gedächtniskapital).<br />
Der nationalsymbolische Mehrwert treibt dementsprechend auch den<br />
Rezensenten »in Hinblick auf die Wichtigkeit und Bedeutung der vorliegenden<br />
(148). Dazu Martin Stingelin, Nietzsche, die Rhetorik, die decadence, in: Sprache und<br />
Literatur in Wissenschaft und Unterricht 7S/76 (1 WS), 27-44 (28)<br />
Garlo Ginzburg, Spurensicherung. Der Jäger entzilleri die Führte, Shcrlock 1 lolmes<br />
nimmt die Lupe, Freud liest Morelli - die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst,<br />
in: ders., Spurensicherungen. Über verborgene <strong>Geschichte</strong>, Kunst und soziales Gedächtnis,<br />
Berlin 1983<br />
Ludwig Traube, Vorlesungen und Allhandlungen, hg. v. Franz. Boll, München 1909, 7
UR/KUNDI.: DII'I.OMATIK UND ARCIIÄOI.OCI!- 235<br />
Publication als integrierenden Theils unseres Nationalwerk.es, der Monumenta<br />
Germaniae bistonca« .<br />
Diplomatik als Archäologie<br />
Bedeutet die Rearchäologisierung <strong>von</strong> Gedächtniswissenschaft ihre Enthistorisierung<br />
und Überführung in einen mechanischen Apparat? Skrupulöse Editionstechnik<br />
birgt die Gefahr in sich, »zu einer handwerklichen Mache zu<br />
erstarren und das Bereitstellen des Textes bereits <strong>für</strong> die historische Aussage<br />
selbst zu nehmen.« 46 Philipp Jaffe, Mitarbeiter der MGH und seit 1862 außerordentlicher<br />
Professor der Historischen Hilfswissenschaften an der Universität<br />
Berlin, wird psychisch im Widerstreit <strong>von</strong> narrativem Willen und diskreter<br />
Datenverarbeitung zerrieben und begeht am Ende diverser Editionsunternehmen<br />
1870 Selbstmord - ein tödliches Opfer der asketischen MGH-Ästhetik <strong>von</strong><br />
Wisscn.sverarbcitung?<br />
»Der Selbstmord J äff es, der sich in Wittenberge erschoß, hat mich tief erschüttert.<br />
Die Ursache ist mir noch dunkel. Vielleicht genügte seinem Geiste die bloß kritische<br />
Forschung und das Sammeln <strong>von</strong> Material nicht, während ihm die Natur versagt<br />
hatte, was den Geschichtsforscher macht, die Phantasie, welche Kunstwerke erzeugt.<br />
Seine Leistungen als Forscher sichern Jaffe die Fortdauer in den Bibliotheken.« 47<br />
Eine medienwissenschaftlich radikale Perspektive ist die Sammlung, Verarbeitung,<br />
Speicherung und Darbietung einer Quelle als wissensarchäologisches Monument.<br />
»The bases for histoncal knowledge are not empincal facts but wntten texts, even<br />
lt ihese tcxt.s masquerade in the guisc ot wars or revolutions« 4S ; demgegenüber<br />
klagt die Histonkerzunh das »eigentlich Historische« cm (Arnold Esch), das<br />
doch allein in einer narrativen Mobilisierung solcher Befunde liegt, also in der rhetorisch-dramatischen<br />
Literarisierung (Hayden Whitc). Von hier rührt auch die<br />
durchaus methodische Distanz des Diplomatikers Paul Kehr zum Histonographen<br />
Gregorovius, <strong>von</strong> dessen Lektüre er als Student nichtsdestoweniger den<br />
4(S H. Fuhrmann, Die Sorge um den rechten Text, in: ders., Einladung ms Mittelalter,<br />
München 1987, 235; siehe auch Arnold Esch, Deutsche Geschichtswissenschaft und<br />
das mittelalterliche Rom. Von Ferdinand Gregorovius zu Paul Kehr, in: Hartmut<br />
Bookmann / Kurt Jürgcnsen (Hg.), Nachdenken über <strong>Geschichte</strong>. Beiträge aus der<br />
Ökumene der Historiker, In memoriam Karl Dietrich Erdmann, Neumünster (Wachholtz)<br />
1991, 55-76 (72)<br />
47 Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher, über Jatfe /um 14. April 1S70, /inert<br />
nach: Theodor <strong>von</strong> Sickel, Römische Erinnerungen 1. Nebst ergänzenden Brieten und<br />
Aktenstücken hg. v. Leo Santifaller, Wien (Universum) 1947, 23, Anm. 3<br />
48 Paul de Man, Literary History and Literary Modernity, in: Morton W. Bloomfield<br />
(Hg.), In Search of Literary Theory, Ithaca 1972, 267
236 MONUMKNTA GKRMANIAE<br />
<strong>Im</strong>puls zu einer Romreise erhalten hatte, so wie Rankes Archivästhetik letztendlich<br />
auf einen romantischen <strong>Im</strong>pulsgeber, die Historienromane Walter Scotts,<br />
zurückgeht. Ihm sei <strong>Geschichte</strong> »als ein großartiges Drama« erschienen 49 , wobei<br />
»man seiner Darstellungskunst mit ihrem hohen Verarbeitungsgrad die Benutzung<br />
<strong>von</strong> Archivalien wenig ansieht, sondern seine <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom<br />
ganz aus erzählenden Quellen gearbeitet glaubt.« 50 Hier fassen wir die zwei Körper<br />
des Historismus im 19. Jahrhundert: Derselbe Gregorovius regt die Gründung<br />
einer wissenschaftlichen Zeitschrift Archivio Stonco Romano und die<br />
Erarbeitung eines Codex diplornaücus urbis Romae an und legt dem italienischen<br />
Minister einen Plan <strong>für</strong> die Ordnung und Inventarisierung der Archive in und<br />
außerhalb Roms vor . Zwar hatte Gregorivius höchstselbst<br />
gesagt, der Blick über Rom mache einen mehr zum Philosophen als hundert Winterabende<br />
hinter dem Aristoteles, doch dessen ungeachtet: »Man las Gregorovius<br />
- und verfertigte Regesten.« 3i So wird das Bildbegehren der <strong>Im</strong>agination durch<br />
Sortierung bewältigt. Viele positivistischen Historiker, so Esch , betrieben<br />
eine »<strong>von</strong> keinem Ganzen ausgehende, auf kein Ganzes zuführende, in sich<br />
kreisende Forschung«. Transzendente Referenten aber organisieren nur bedingt<br />
die Signifikanten der Vergangenheit endgültig; das Scheitern geschichtsphilosophischer<br />
Konstrukte motiviert die Reduktion <strong>von</strong> Gedächtnis auf ihre Gegebenheiten<br />
(also Daten) in Speichern (weil man »an keinen philosophisch gesicherten<br />
Weg der <strong>Geschichte</strong> mehr glaubte«)' 1 -, ein »positivistisches Verlangen nach unbezweifelbarer<br />
Sicherung historischer Faktizität, wie es, auf der Ebene des Dilettantismus,<br />
Flauberts Romanfiguren Bouvard und Pecuchet« umtreibt - und<br />
ebenso scheitern läßt . Zugunsten des einen historischen Sinns<br />
war »das Sinnenhalte abhanden gekommen, die Intuition geächtet und durch<br />
Systematik ersetzt« 53 ; die Zuversicht in einen gesicherten Urkunden- und Quellenbestand<br />
als Repräsentation der Vergangenheit in ihrer Totalität bedenkt selten<br />
die wissensarchäologische Frage, »welch zulällige Uberliclcrungslragmente cm-<br />
4 ' ; Paul Kehr, Ferdinand Gregorovius und seine <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom im Mittelalter,<br />
in: Deutsche Revue 46, 1 (1921), 266, zitiert hier nach Esch 1991: 67<br />
50 Esch 1991: 59f, unter Bezug auf Urteile über Gregorovius' Hauptwerk, zusammengestellt<br />
in Bd. III, 764 ff <strong>von</strong>: Ferdinand Gregorovius, <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom im<br />
Mittelalter, neu hg. W. Kampf, Darmstadt 1952-57<br />
M Esch 1991: 76, unter Bezug auf ein Gregorivius-Zitat bei J. Honig, Ferdinand Gregorovius,<br />
Stuttgart (2. Aufl.) 1943, 288 u. 432<br />
y ~ Ernst Schulin, Vom Beruf des Jahrhunderts türdie <strong>Geschichte</strong>: das 19. Jh. als Epoche<br />
des Historismus, in: Arnold Esch / Jens Petersen (Hg.), <strong>Geschichte</strong> und Geschichtswissenschaft<br />
in der Kultur Italiens und Deutschlands, Tübingen 1989, 33f<br />
" Esch 1991: 72, unter Bezug auf: ders., Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-<br />
Zufall als methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985),<br />
529 ff
UR/KUNDI:: DIPLOMATIK UND ARCHÄOI.OGII-: 237<br />
stiger Wirklichkeit man denn damit überhaupt in Händen, welch verzerrte Proportion<br />
einstiger Wirklichkeit man denn damit überhaupt vor Augen« hat .<br />
An dieser Stelle ist nicht Geschichts-, sondern Medienbewußtsein angebracht, das<br />
Wissen um die Regeln und Zufälle <strong>von</strong> Übertragungstechniken. <strong>Im</strong> Falle Roms<br />
fallen Übertragung und <strong>Im</strong>perium (als geschichtliche Bestimmung oder Schicksal<br />
diskursiv getarnt) incins; gerade Theodor Mommsen hat, auf Metaphysik nichts<br />
gebend, ȟber positivistische Faktenrekonstruktion hinaus auch eine Vorstellung<br />
vom Zusammenhang des Ganzen, <strong>von</strong> der Idee Roms« (schon <strong>für</strong> Edward Gibbon<br />
ist der Zusammenhang der Historie eine Funktion der Autorität <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien);<br />
auch das ihm gegenwärtige, national geeinte Italien könne Rom nicht ohne<br />
eine universale Sendung übernehmen. 54 Die Wahrnehmung einer je gegebenen<br />
Wirklichkeit setzt sich aus ähnlich kontingenten, als verläßlich angenommenen<br />
Daten und Nachrichten zusammen wie die Analogiebildung Vergangenheit. In<br />
Datenbanken deliriert eben auch die Autorität, welche die Zuordnung <strong>von</strong><br />
Bildern/Daten zu einem angenommenen Referenten garantiert. Indem eine solche<br />
Autorität <strong>für</strong> die Vergangenheit nicht mehr existent ist, wird sie, analog zu<br />
staatlicher Macht, durch die institutionalisierte Geschichtswissenschaft substituiert.<br />
Deren Archiv aber differiert alle Autorität und ist ihr Aufschub: Erst dann,<br />
wenn keine Bindung der Dokumente an Macht mehr vorliegt, wird die Archivsperre<br />
aufgehoben, und die Arbeit des Historikers beginnt nach-träglich. Die<br />
Einrichtung einer preußischen Historischen Station im Zuge der Öffnung der<br />
Vatikanischen Archive in Rom nach 1880 steht <strong>für</strong> die Operation, archivische dokumentierte<br />
Geschäfte (Droysen), Gedächtnismonumente einer Macht, in deren<br />
Dokumentation, in Historie zu transformieren. Diskurs verhandelt dabei das Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Institution (Archive) und Interpretation (Historie).<br />
Paul Kehr, der langjährige Direktor dieses Preußischen Historischen Instituts,<br />
nennt die diskrete Arbeit der mediävistischen Hilfswissenschaften reelle Historie;<br />
die Gedächtnistcchmkcn des I Iistonkers sind hier das funktionale Spiegelbild<br />
des <strong>von</strong> Kehr anhand mittelalterlicher Kanzleiuntcrsuchungen identifizierten<br />
Realen der <strong>Geschichte</strong> als Administration.^ Den damit implizierten Verbund<br />
<strong>von</strong> Philologie und Archäologie hat H. Beumann am Beispiel der Diplomatik<br />
ausdrücklich benannt:<br />
54 Esch 1991: 72, unter Bezug auf den Satz <strong>von</strong> 1871 zu Quintino Sella »A Roma non si<br />
sta senza avere dei proposti cosmopoliti« (was nicht »universale Sendung« meint),<br />
zitiert in: 1 ; . Cliabod, Storiit dclla pnliticit cstui'n iulUmt sirti \#~ia A\ i «Uf*. ßj. [, Hm-i<br />
1951, 189<br />
53 Zitiert <strong>von</strong> Horst Fuhrmann in: Paul F. Kehr. Zugänge und Beiträge zu seinem Wirken<br />
und seiner Biographie. Veranstaltung zum 60. Geburtstag <strong>von</strong> Arnold Esch am<br />
20. Mai 1996, hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen (Niemeyer)<br />
1997,27
238 MoNUMKNTA Gl'iRMANIAK<br />
»Genau so wie der Diplomatiker bei der Urkundenkritik zuerst die äußeren und<br />
inneren formalen Merkmale untersucht, ehe er die inhaltlichen Bestandteile bewertet,<br />
sollte auch der Archäologe zuerst seine Ergebnisse erarbeiten. In der Tat könnte<br />
man Datierung und Typologie mit der Arbeit des Diplomatikers vergleichen. Aber<br />
mit diesem Arbeitsgang hat sich nur der Archäologe zufriedengegeben, dem die<br />
historische Fragestellung aus dem Blick gekommen war.« 56<br />
Die wissensarchäologische Provokation der Historie aber wird ihrerseits in den<br />
historischen Diskurs eingeholt und verharmlost, wenn Archäologie dem Mediävisten<br />
schlicht als Hilfswissemchetft gilt- s7<br />
Paläograpbie<br />
Urkundenlese(n) heißt weniger Hermeneutik denn pattern recognition - eine<br />
Lektüre, die nicht auf Identität, sondern Differenzmarkierung aufbaut: einer<br />
zumeist schwer entzifferbare Schrift mit vielen Abkürzungszeichen, »die stets<br />
wiederkehrende Anfangs-, Mittel- und Schlußsilben ersetzen, untereinander oft<br />
nur ganz winzige Unterscheidungsmerkmale tragen und zu sinnentstellenden Irrtümern<br />
führen können«; gelegentlich »bleibt dann noch immer ein unerklärbarer<br />
Rest <strong>von</strong> Buchstaben, die aller durchschauenden Erkenntnis trotzen, vor<br />
allem dann, wenn äußere Schäden hinzukommen wie Brüche und Knicke an den<br />
Faltslcllcn und Zerstörungen an dcw Rändern schließlich der Mäusefraß.« 5S<br />
Lettern an den Grenzen zum Realen. An die Stelle des ästhetischen Monuments<br />
tritt aus dieser Perspektive als kleinste Archiveinheit die nicht im idealistischhistorischen,<br />
sondern maschinell-diskreten Sinne dynamisierte Information 59 ;<br />
Datenverarbeitung, jenseits der historischen <strong>Im</strong>agination, hält sich mit macbine<br />
•' )f> In: Protokoll Nr. 191 des Konstanzer Arbeitskreises lür mittelalterliche <strong>Geschichte</strong>, 95<br />
37 Reinhard Wenskus, Randbemerkungen zum Verhältnis <strong>von</strong> Historie und Archäologie,<br />
insbesondere mittelalterlicher <strong>Geschichte</strong> und Mittelalterarchäologie, in: Herbert<br />
Jankuhn / ders. (Hg.), Geschichtswissenschaft und Archäologie: Untersuchungen zur<br />
Siedlungs-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte (Vorträge und Forschungen / Konstanzer<br />
Arbeitskreis <strong>für</strong> mittelalterliche <strong>Geschichte</strong>; Bd. 22), Siginanngen (Thorbecke)<br />
1979,637-657(656)<br />
58 pjerbert Flender, Das Historische Archiv der Stadt Wetzlar, in: Heimatkalender des<br />
Kreises Wetzlar, 1952, 101-108, zitiert hier nach: Irene Jung, Archiv-Info. Das Historische<br />
Archiv Wetzlar- Aufgaben, <strong>Geschichte</strong> und Bestände, Wetzlar (Stadt Wetzlar /<br />
Eigendruck)1992, 24f<br />
s9 Dazu Menne-Haritz 1998 (mit Blick auf elektronische Nachrichtenwege), Typoskript,<br />
26: »Die gängige Unterscheidung, nach der die Diplomatik <strong>für</strong> das Einzelstück und<br />
die Archivwissenschaft <strong>für</strong> die Komplexe zuständig seien, ist nicht mehr haltbar. Das<br />
kleinste archivische Elemente ist eben nicht das einzelne Dokument, ebenso wie die<br />
Produktion einer Aufzeichnung nicht die kleinste Einheit der Verwaltungsarbelt ist.«
UR/KUNIM-:: DIPLOMATIE UND ARCHÄOLOGII- 239<br />
reasoning an das Vorgefundene 60 , wie auch die Diplomatik Sickels sich in dem<br />
Maße <strong>von</strong> der Geschichtswissenschaft entfernte, wie sie sich einer »fast naturwissenschafthche<br />
Schärfe der Analyse« zuwandte. 61 Diese Wissensarchäologie<br />
ist weder Philologie noch Historie, sondern science, eine exakte Wissenschaft,<br />
mathesis: »Archaeology, reheved of the passion for objects (from antiquities<br />
and works of art to museum pieces) needs to seek, record, consult, process,<br />
reconstruct the truncated and distorted Information.« 62 Damit korrespondiert<br />
die Differenz zwischen Dokument und Monument - ein mithin archivalischsymbohsches<br />
doublc-bind, wenn es nicht allein die Information, sondern auch<br />
die matenalen Informationsumstände, also die Träger der Information zu konservieren<br />
gilt . In der Informationstheorie ist Redundanz - ein<br />
Begriff, der hier an die Semantik des Ornaments gekoppelt werden soll - derjenige<br />
Teil einer Botschaft, der in einem technischen System nicht übertragen werden<br />
muß, ohne daß der Informationsgehalt der Nachricht verringert wird. 6j> Gilt<br />
dieses Verhältnis auch <strong>für</strong> die Relation <strong>von</strong> Signatur und Dokument in Archiv,<br />
Bibliothek und Museum? Betrachten wir Information als Wissenspartikel, das<br />
aus dem Gedächtnis eines Systems in die aktuelle Informationsbearbeitung transportiert<br />
werden kann, ohne seine Identität zu ändern - ganz wie es der klassische<br />
Programmbefehl einer Textverbeitungssoftware als Operation <strong>von</strong> Übertragen<br />
und Laden vorschreibt. Information wird durch den Akt der Mitteilung (falls<br />
dies schon Kommunikation ist) in einen Wissensbestand transformiert, oder vielmehr<br />
einverleibt; erst externe Wahrnehmung macht Daten zu Zeichen. Das<br />
Archiv nun ist jener systematische Ort in der Kartographie <strong>von</strong> Gedächtnistopographie,<br />
an dem Daten in Information verwandelt werden, denn systemloses,<br />
also unorganisiertes Material kann nicht zur Speicherung und Übermittlung <strong>von</strong><br />
Information gereichen. Deshalb die Kodierung eines Systems: »Dort wo die Elemente<br />
in ihrem Zueinander nicht geordnet sind und das Auftreten eines jeden<br />
gleich wahrscheinlich ist, d. h. dort, wo keine Struktur, sondern nur eine amorphe<br />
Entrophiemasse vorhanden ist, ist Information unmöglich.« 64 Schreibt die<br />
Metaebene der Datenorganisation am Datenkorpus mit, oder steht sie zu solchen<br />
Banken in einem parergonalen Verhältnis? Einmal mehr taucht die Frage auf, in<br />
60 M. J. Doran, Archaeological reasoning and machine reasoning, in: J.-C. Gardin (Hg.),<br />
Archeologie et Calculateurs, Paris (Editions du CNRS) 1970, 57-69<br />
61 Menne-Haritz 1998, Typoskript, 25, unter Bezug auf: Pivec 1941: 7<br />
62 F. Djindjian, Introduction, in: ders. / H. Ducasse (Hg.), Data Processing and Mathematics<br />
Applied to Archaeology ( = Pact 16/1987, Council of Europc), 11<br />
63 Axel Roch, Mendels Message. Genetik und Informationstheorie, TS 1996<br />
64 Jurij M. Lotman, Die Struktur literarischer Texte, München 1972, 421, zitiert nach:<br />
Ingrid Hantsch, Scmiotik des Erzählens. Studien zum satirischen Roman des 20. Jahrhunderts,<br />
München (Fink) 1975, 4
240 MoNUMhNTA Gl-KMANIAh<br />
welchem Verhältnis bei Gedächtnismedien Programm und Narrativität stehen. 65<br />
Von der Erzählung zurück zur Datenbank: Die aktuelle Herausforderung durch<br />
die Informatik gilt auch <strong>von</strong> Seiten eines Publikums, das - zunehmend computerästhetisch<br />
geschult - mit Information als solcher, also nicht mehr notwendig<br />
auf narrative Verpackung und Transport derselben angewiesen, umzugehen versteht.<br />
Von den Datenlagen des Archivs her die Befunde der Vergangenheit unmittelbar,<br />
d. h. ohne historiographische Filter darzustellen hat zur Folge, nicht länger<br />
dokumentarisch-illustrativ das Vorgefundene zur Autonsierung, zum Schmuck,<br />
oder zum Ornament argumentativer Strategien zu degradieren, die Datenmaterial<br />
am Rande der Narration nur als Indiz <strong>für</strong> eine angenommene <strong>Geschichte</strong> ins<br />
Spiel bringen, sondern im Sinne einer konsequent fortgeschnebenen dichten<br />
Beschreibung die Struktur des Speichers selbst zu (be-)schreiben. »Es ist dies<br />
auch der Augenblick, da infolge der Abwesenheit eines Zentrums oder eines Ursprungs<br />
alles zum Diskurs wird« Wl . Die Logik historiographischer Texte verlangt<br />
die Unterwerfung diskreter Befunde unter einen narrativen Zusammenhang;<br />
Detailuntersuchungen sollen dann nur exemplarischen Charakter haben. Die<br />
Diskretion der Historischen Hilfswissenschaften aber lehrt, die scheinbaren<br />
Exempel als die Bausteine des Gedächtnisses selbst zu lesen.<br />
65 Vgl. Friedrich Kittlcr, Medien und Drogen in Pynchons Zweitem Weltkrieg, in: Die<br />
unvollendete Vernunft. Moderne versus Postmoderne, hg. Dietmar Kamper / Wilhelm<br />
van Reijen, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1987, 240-259 (249)<br />
6(1 Siehe Jacques Derrida, Die Struktur, das Zeichen und das Spiel, in: Peter Engelmann<br />
(Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion, Stuttgart (Rcelam) 1990, 114-139 (117)
EINBRUCH DI-:R BILDHR IN OI;N TI-:XT DKR HISTORIE 241<br />
Einbruch der Bilder in den Text der Historie<br />
Wenn Epochen ihr Ende nahen sehen, wird die Wahrnehmung sensibel <strong>für</strong> ihre<br />
Ursprünge. Diskontinuitäten in der Administration <strong>von</strong> visuellem Gedächtnistransfer<br />
fallen in den Zuständigkeitsbereich <strong>von</strong> Medienarchäologie; ein<br />
Jahrhundert, nachdem sich die photographische Reproduktion in den paläographisch-diplomatischen<br />
Disziplinen durchgesetzt hat, ist sie im Begriff, <strong>von</strong><br />
elektronischen Verfahren verdrängt zu werden. »Gerade dieser Umstand sichert<br />
ihr in der Retrospektive hohe Aufmerksamkeit.« 1 Das Zeitalter der Pbotograpbie<br />
nennt der Paläograph Ludwig Traube 1909 den ihm gegenwärtigen gedächtnistechnologischen<br />
Index seiner Wissenschaft. Speicherbare Lichtschnft als Schrift<br />
des Realen hat zu diesem Zeitpunkt die Nachfolge der handschriftlichen Faksimilierung<br />
symbolischer Schriften angetreten; schon 1843 konstruiert Bain den<br />
ersten Teleautograpben zur elektrischen Übertragung <strong>von</strong> Handschriften und<br />
Zeichnungen. Ein Beispiel da<strong>für</strong>: »das handschriftlich wiedergegebene Wort<br />
>Deutschland
242 MONUMKNTA Gl-RMANIAM<br />
acquainted with the an of drawing«, und medicnarchäolgisch radikalisiert definiert<br />
sich der Bruch mit Mimesis, Semantik und Hermeneutik der Bilder in seiner<br />
Definition: »The picture, divested of the ideas which accompany it, and considered<br />
only in its ultimate naturc is but a succcssion, or variety of stronger lights<br />
thrown upon one part of the paper, and of dccper shadows on another.« Die Betonung<br />
hegt hier auf kontinuierlichen Übergängen - heute die Bildauflösungsgrenze<br />
des digitalen scanmng. Je bizarrer die Urkunde oder das archäologische Objekt,<br />
desto näher steht sie den Möglichkeiten des Mediums Photographie; »the<br />
instrument chroniclcs vvhatcver it secs, and certainly would delineate a chimneypot<br />
or a chimney-sweepcr with the same lmpartiality as it would the Apollo of<br />
Belvedere«. 5 Die archäologische Ästhetik verlagert sich vom Objekt auf den Blick<br />
selbst. Talbot weist in The Pencü of Nature anhand <strong>von</strong> Tafel III (»Articles of<br />
China«) darauf hm, daß es nur wenig länger dauere, die ganze Vitrine eines Porzellansammlers<br />
optisch auf Photopapier zu bannen, als sie in der üblichen Weise<br />
schriftlich zu inventarisieren; »the more stränge and fantastic the forms of his old<br />
teapots, the more advantage m liaving their pictures given instead ol tlieir descnptions.«<br />
6 Damit kürzt das neue Medium nicht nur die Aufzeichnungssysteme der<br />
Speicherung selbst ab, sondern generiert erstmals ein nicht mehr schnft-, sondern<br />
bildbasiertes Bildgedächtnis (auch wenn das Vokabular - Chronik und Inventar<br />
- noch dem Schriftregime verhaftet bleibt). In The Pencü of Nature kommen,<br />
strukturell analog, auch das Faksimile eines historischen Buchdrucks (Tafel IX,<br />
»containing the Statutes of Richard the Second«), sowie »A Scene in a Library«<br />
(Tafel VIII) zur Abbildung. Das Faksimile eines kunsthistorischen Stiches schließlich<br />
(Tafel XXIII, »Hagar in the desert«) soll die unlimitierte Reproduzierbarkeit,<br />
damit auch neuen Sicherungs- und Speieheroptionen photographischer Objekte<br />
nachweisen (»thus they may be preserved from loss, and multipled to any<br />
extent«). Technische Bedingung da<strong>für</strong> war, daß die Photographien sich ihrerseits<br />
nicht mehr in chemischen Prozessen verflüchtigtigen; »how charming it would<br />
be lf it were possible to cause these natural images to impnnt themselves durably,<br />
and remain fixed upon the paper!«. 7 Die Aufzeichnungsästhetik bleibt - Talbots<br />
Schriftmetaphonk der Photographie verrät es - fixiert auf das Trägermedium<br />
Papier. Die photographische Inventarisierung einer Sammlung steht im Bund mit<br />
den Versuchen einer Selbstauf/.eichnung physikalischer Bewegungen (Talbot<br />
spricht <strong>von</strong> self-representation) im Medium des Graphen oder der Photographie<br />
(Marey, Muybndge). Der neue, nicht mehr <strong>von</strong> forensischer Rhetorik, sondern<br />
Ebd., Text zu Tafel II »View of the Boulevards at Paris«<br />
Für eine Übersetzung .siehe Woligan«; Kemp (I lg.), Theorie der Fotografie: eine Anthologie,<br />
Bd. 1, München (Schirmer / Mosel) 1980, 60-63 (61)<br />
Talbot 1844 (»Brief Historical Sketch of the Invcntion of the Art«)
EINBRUCH DKR BILDER IN DKN TEXT DER HISTORIE 243<br />
<strong>von</strong> Chemie und Technik induzierte Begriff <strong>von</strong> Evidenz wirkt seinerseits zurück<br />
in den Raum des Gerichts:<br />
»And should a thief afterwards purloin the treasures - if the mute testimony of the<br />
picturc wcre to bc produccd against him in court - it would ccrtainly bc evidence<br />
of a ncw kind; . Howcvcr numcrous the objeets - however complicaced the<br />
arrangement - the Camera depicts them all at once.« <br />
Die sogenannte Rechtsarchäologie als juristische Hilfswissenschaft hat das Bild<br />
als induktives Erkcnntnismittel sowie als im Sinne aller Archäologien und Diplomatik<br />
urkundliche Quelle im 17. und 18. Jahrhundert unter den Bezeichnungen<br />
iunsprudentia symbolica und lunsprudentia picturata erkannt 8 ; zeitgleich zur<br />
Publikation des ersten Bands Sciptores der Monumenta Germaniae Historica<br />
veröffentlicht Ernst P. Spangenberg in demselben Verlag Hahn (Hannover) seine<br />
Beiträge zur Kunde der teutschen Rcchtsalterth•ümer und Rechtsquellen unter<br />
Rückgriff auf Johann Carl Heinrich Dreyers Manuskript Iunsprodentia Gcrmanorum<br />
picturata (Universitätsbibliothek Göttingen), das 19. Jahrhundert baut<br />
nicht nur mediävistische Textdatenbanken <strong>von</strong> Schlage der MGH, sondern registriert<br />
auch den Einbruch <strong>von</strong> bildreproduzierenden Medien in das Reich des<br />
Textdrucks, angeführt vom medialen Flaggschiff der Photographie. Mit der fortwährenden<br />
Verschlagwortung der Bilder unterwarf sich das logozentristische<br />
Denken noch einmal das Gedächtnis der Bilder, doch unter der Hand verwandelt<br />
die Photographie, <strong>für</strong> die ihr Gegenstand neben den Bildern auch Text sein<br />
darf, die hermeneutische Wahrnehmung der Buchstaben (Lesen) selbst in ein<br />
Bild: in Lettern, die als Figuren gesehen - und nicht mehr nur entziffert - werden.<br />
Die Differenz zwischen einer philologischen Hermeneutik und einem<br />
archäologischen Blick auf antike Buchstaben hat der Paläograph Ulrich Friedrich<br />
Kopp in einer Abhandlung über Phömzische Inschriften 1819 pointiert, wo er<br />
eine lectio difficilior nicht nur nach Buchstabenformen, sondern nach Semantik<br />
vorschlägt: »So mußte eine bessere Les-Art auch dem Inhalte nach gerechtfertiget<br />
werden«; Lektüre bleibt an Sprache und nicht unvoreingenommen am<br />
Schriftbild orientiert (und damit <strong>von</strong> medialer Wahrnehmung getrennt). Kopp<br />
grenzt sich <strong>von</strong> der Bemerkung eines Zeitgenossen ab, »nur das Lesen sey des<br />
Paläographen Sache, das Verstehen müsse man dem Philologen überlassen.« 9 Die<br />
Kupferstichreproduktion hat es erstmals ermöglicht, »lebendige Handschrift c\cs<br />
s Erna Patzclt, Das Bild als urkundliche Quelle <strong>für</strong> Wirtschaftsgeschichte, in: Archivalische<br />
Zeitschrift 50/51 (1955), 740-753 (742). Siehe Karl <strong>von</strong> Amira / Claudius <strong>von</strong><br />
Schwerin, Rechtsarchäologic. Gegenstände, Formen und Symbole Germanischen<br />
Rechts, Teil I: Einführung in die Rechtsarchäologie, Berlin (Ahncnerbe-Stikung) 1943,<br />
bes. 7-10 (»Vorläufer«)<br />
9 Ulrich Friedrich Kopp, Bilder und Schriften der Vorzeit, 2 Bde, Mannheim (Selbstverlag)<br />
1819-1821, hier Bd. 1, Abhandlung IV »Phönicische Inschriften«, 195-272 (195)
244 MONUMI-NTA GKKMANIAH<br />
duktalen in einen skulptalen Modus zu übertragen« 10 , und die vervielfältigenden,<br />
mechanischen Künste leisten Dienste genau dort, »wo es sich um getreue,<br />
nicht manirierte Wiedergabe <strong>von</strong> Handschriften, Drucken, Kupferstichen, Holzschnitten,<br />
Gemälden« und Photographien selbst handelt, Schrift wie Bild also<br />
gleichrangig (und indifferent) als reproduzierfähiges Signal gespeichert werden<br />
- eine <strong>von</strong> ihr selbst nicht zu leistende Ergänzung, tatsächlicher aber die Provokation<br />
jeder Literaturgeschichte." Technische Reproduktion macht historische<br />
Typographien nicht nur medienarchäologisch zugänglich, sondern generiert<br />
überhaupt ein Bewußtsein <strong>für</strong> das Medium Druck. 12 Die Verbildlichung <strong>von</strong><br />
Schrift war längst imperiale Praxis in Byzanz, wo im 11. Jahrhundert kaum ein<br />
Steuerbeamter in oströmischen Provinzen mehr lateinisch verstand; das alte lateinische<br />
Rekognitionswort Legimus hinter dem Urkundentext wird dort selbst<br />
zum Zeichen, dem man ansieht, daß der rekognoszierende Beamte seine Wortbedeutung<br />
nicht mehr kannte, »sondern es mehr malte als schrieb«, als ein Symbol<br />
der Römertradition, aus der das byzantinische Kaisertum seine Ansprüche<br />
ableitete.« 13 Walter Benjamin hat die Bilderlese als Alternative zur buchstäblichen<br />
Lesung in seinem Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen<br />
Reproduzierbarkeit 1935/36 formuliert: Da das Auge schneller erfaßt, als die<br />
Hand zeichnet, wird der Prozeß bildlicher Reproduktion »so ungeheuer beschleunigt,<br />
daß er mit dem Sprechen Schritt halten konnte«. 14 Als Bildsortieroption<br />
und Gedächtnismediendifferenz läßt sich diese Aussage auf die<br />
Verwaltung des Bildgedächtnisses übertragen; während es die Arbeit klassischer<br />
Vergangenheitsforschung ist, <strong>von</strong> Ort zu Ort zu reisen, um in Bibhotheken und<br />
Archiven ihr Material zu sammeln, ist »kein Fassungsvermögen, keines Menschen<br />
Gedächtnis so groß, daß es eine Zeichnung, die an einer Stelle gesehen,<br />
an einem anderen Orte m all ihren kleinsten Ausführungen gegenwärtig<br />
haben kann« . Graphische Urkunden sind »das Sorgenkind aller<br />
Sekretäre«, denn organisiertes Gedächtnis - die Architextur des Memorialen -<br />
ist eine Funktion <strong>von</strong> Formaten und nur insofern gezielt adressierbar. Gedächt-<br />
10 Rück 1992: 42, unter Bezug auf: Charles Bigclow, Principles of Type Design for the<br />
Personal Workstation, in: Gutenberg-Jahrbuch 61 (1986), 253-270, bes. 258f<br />
" Gustav Könnecke, Bildcratlas zur <strong>Geschichte</strong> der deutschen Nationallitcratur. Eine<br />
Ergänzung zu jeder deutschen Literaturgeschichte. Nach den Quellen bearbeitet, 2.<br />
Auflage Marburg (Elwcrt) 1912, Prolog [1894]<br />
'- »Die modernen Mittel der photographischen Technik ermöglichen es.« Druckschriften<br />
des fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhunderts in getreuen Nachbildungen, hg. v.<br />
de. Direktion der Reichsdruckerei, Berlin (Reichsdruckerei) 1884-87, 1. Heft, Vorwort<br />
13 Franz Dölger, Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Ausdruck ihrer politischen<br />
Anschauungen, in: Historische Zeitschrift 159 (1939), 229-250 (239)<br />
14 In: Gesammelte Schriften Bd. 1/2, Frankfurt 1980, 2. Fassung 474 f, zitiert nach Rück<br />
1992:41
EINBRUCH DKR BIEHIR IN DI:N TKXT DKR HISTORIK 245<br />
nisverwaltende Archivare haben jedoch nur <strong>für</strong> Schriftstücke das Einheitsmaß<br />
(Archivmaß) entwickelt: »Während sie jedes Aktenstück seines Formates wegen<br />
gleich in das richtige Fach unterbringen können, wissen sie nicht, was sie mit<br />
einer Zeichnung ihres Formates wegen anfangen sollen, schließlich werden sie<br />
gerollt und oben auf den Schrank gelegt. da liegen sie, zerrissen und verstaubt,<br />
unerkannt und ungeordnet« .<br />
Und so sind selbst die Zeichnungen der Architekten <strong>von</strong> Staatsarchivgebäuden,<br />
Nationalbibhotheken und Kulturmuseen ihrerseits »vernachlässigt und<br />
vergessen«, der blinde Fleck in der Gedächtnisarchitektur.<br />
Monumenta Germamae Graphica<br />
In der Datenverarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit zu Beginn des 19. Jahrhunderts<br />
herrscht zunächst kein Medienverbund: Die Publikationsinstrumente trennen die<br />
Urkunde als Text <strong>von</strong> der Urkunde als Bild; <strong>für</strong> die Aufbewahrung gezeichneter<br />
Urkunden aber »fehlte der Sinn« vollends. 1 " 1 Dementsprechend verzichten auch<br />
die MGH weitgehend auf Beilagen in Form <strong>von</strong> Zeichnungen (außer Münzen,<br />
Siegel, Wappen, In- und Grabschriften): Abbildungen aller andern Art bleiben<br />
einem künftigen deutschen Montjaucon überlassen; ansonsten müssen »alle pecuniaire<br />
Kräfte des Unternehmens, auf schöne Lettern, gutes Papier und den correktesten<br />
Druck verwendet werden« . Allein die Scriptores in<br />
folio der MGH (1829) 16 leisten sich Schriftwiedergabe in Lithographie; um die<br />
<strong>von</strong> Bearbeitern der Monumenta durch ständiges Lesen, Abschreiben und Nachzeichnen<br />
gewonnenen Erkenntnisse im Verlauf praktischer Archivarbeiten weitergeben<br />
zu können, muß <strong>für</strong> in beliebiger Anzahl reproduzierbare Schrifttafeln<br />
gesorgt werden. Das erste Werk dieser Art in Deutschland sind die <strong>von</strong> G. H.<br />
Pertz edierten Schnfttafeln zum Gebrauch bei diplomatischen Vorlesungen, eine<br />
gesonderte Sammlung der den ersten Monumentabänden zur Illustration beigegebenen<br />
Beispiele <strong>von</strong> Schriften und Miniaturen: Nachzeichnungen, die <strong>von</strong><br />
Pertz, Wattenbach, Böhmer oder Bethmann angefertigt waren (11 Hefte 1844-<br />
1872 und ein Register <strong>für</strong> die Bände 1 bis 10). Das späte 19. Jahrhundert bricht<br />
das Monopol der Typographie in der Edition vergangener Texte durch die photographische<br />
Reproduktion, die Texte in Bilder verwandelt; damit einher geht<br />
auch eine allmähliche Loslösung <strong>von</strong> Karl Lachmanns Leitprinzip der emenda-<br />
13 F. Wolff, Denkmalarchive. Broschüre des gleichnamigen Vortrags, gehalten auf dem 1.<br />
Denkmalarchivtag in Dresden am 24. September 1913, Berlin (Wilhelm Ernst & Sohn)<br />
1913, 5, unter Bezug auf historische Bauzeichnungen im Kontrast zur Schriftstückfixierung<br />
der MGH<br />
u> Bd. 2, hg. v. Pertz
246 MONUMKNTA Gl-KMANIAM<br />
tio in der Edition mittelalterlicher Texte, also deren kritischen Korrektur (und<br />
damit Virtuahsierung). Demgegenüber steht die Anerkennung der Materialität<br />
des Überlieferungsträgers; »dann ist - polemisch zugespitzt - die fotomechanische<br />
Wiedergabe der Handschrift auch die textkritisch beste aller möglichen Editionen.«<br />
17 Hier wird Medienarchäologie im aktiven Sinne (die Photographie als<br />
Archäologin) zum Agenten einer radikalen Philologie, und die Urkunde zum<br />
»Naturselbstdruck« (Grillparzer in ironischer Anspielung auf Rankes historiographisches<br />
Ideal 18 ). Paul Kehr empfiehlt 1893 in seinem Entwurf <strong>für</strong> das Seminar<br />
<strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften (<strong>für</strong> Marburg) die Anschaffung eines<br />
photographischen Apparats. »Aus diesen, zunächst zu Lehrzwecken bestimmten<br />
Aufnahmen werden mit der Zeit ganz <strong>von</strong> selbst die ersehnten Monumenta Germaniae<br />
graphica hervorgehen.« 19 Die technische Semiose <strong>von</strong> Objekt zu Aufzeichnung<br />
generiert ein unvordenkliches Archiv neuer Monumente.<br />
Das Projekt Kaiserurkunden in Abbildungen 20 ist tatsächlich eine Analogie<br />
zur Funktion des <strong>von</strong> Andre Malraux definierten imaginären Museums photographischer<br />
Reproduktion <strong>von</strong> Kunstwerken zum Zweck der Vergleichung jenseits<br />
umständlicher Reisen; wer seine Haupthandschriften in vollständiger<br />
Photographie sich verschafft, »hat die Handschriften nebeneinander auf dem<br />
Schreibtisch liegen und kann die Stunden der Ruhe und Sammlung zu peinlicher<br />
Vergleichung ausnützen« . An die Stelle des Gedankens der Rettung<br />
schriftlicher Geschichtsdokumcnte nach 1806 durch editon.sche Reproduktion<br />
(das Unternehmen der MGH) tritt im Zeitalter der Photographie das<br />
Bildarchiv; das imaginäre Museum hat sein infrastrukturelles Korrelat in der<br />
Zirkulation des Archivs. »Wo je die Vereinigung der Originale an einem Orte<br />
unmöglich oder untunlich ist, da gestattet das hochentwickelte photographische<br />
Reproduktionsverfahren eine Erweiterung und Sicherheit des Vergleiches, an die<br />
17 Hans-Joachim Behr, Der Editor mittelhochdeutscher Texte, in: Armin Burkhardt /<br />
Helmut Henne (Hg.), Germanistik als Kulturwissenschaft. Hermann Paul: 150.<br />
Geburtstag und 100 Jahre Deutsches Wörterbuch, Braunschweig (Ans et Scicntia)<br />
1997,28-34(33)<br />
18 Siehe Gerhard Schilfert, Leopold <strong>von</strong> Ranke, in: Die deutsche Geschichtsschreibung<br />
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Reichsemigun^ <strong>von</strong> oben, hg. v. Joachim<br />
Streisand, Berlin 1963, 241-270<br />
19 Paul Kehr, Entwurf <strong>für</strong> das Seminar <strong>für</strong> historische Hilfswissenschaften, vorgelegt in<br />
Berlin am 29. Oktober 1893 (GStA Dahlem I. HA Rcp. 178 II Gen. Nr. 27, Bl. 2r-3r),<br />
zitiert nach: Johannes Burkardt, Die Historischen Hilfswissenschaften in Marburg<br />
(17.-19. Jahrhundert), Marburg/Lahn (Institut <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften)<br />
1997 (= elemcnta diplomatica; 7), 132f. Dort auch eine detaillierte Übersicht zu paläographischen<br />
Tafelwerken in Kapitel 5.2, 96-109<br />
20 Hg. v. Heinrich <strong>von</strong> Sybel u. Theodor v. Sickel (Textband), Berlin (Weidmann) 1881-<br />
1891 (Textband)
EINBRUCH DI-R BII.DI-.R IN DI-:N TI;XT DKR HISTORIE . 247<br />
noch vor kurzem kaum zu denken war.« 21 Hier setzt ein Medium methodische<br />
Standards. Heinrich <strong>von</strong> Sybel und Theodor Sickel benennen das Ensemble ihrer<br />
Kaiserurkunden in Abbildungen in der Vorrede als Kopplung <strong>von</strong> Gedächtnisarbeit<br />
und Infrastruktur. Von jeher war das eingehende Studium der Kaiserurkunden<br />
dadurch erschwert worden, daß Originale eben Unica sind und sich über<br />
das weite Gebiet des einstigen deutschen Reichs zerstreut finden - <strong>Geschichte</strong><br />
als Gedächtnis disseminiert. Auch in der Gegenwart der Herausgeber - das heißt<br />
an dieser Stelle im relativen wissensarchäologischen Raum der Publikation ca.<br />
1880 - hat sich die Sachlage (konkrete Lager, buchstäblich Archive) »trotz vielfacher<br />
Erleichterungen des Verkehrs und trotz größerer Zugänglichkeit der<br />
Archive nur um weniges günstiger gestaltet.« Um eine (in wissensarchäologischcr<br />
Terminologie) namhafte Anzahl »ursprünglicher Ausfertigungen in den<br />
verschiedenen Fundstätten« einsehen und untereinander vergleichen zu können,<br />
bedarf es nach wie vor eines beträchtlichen Aufwandes <strong>von</strong> Zeit und Mitteln.<br />
»Ohne Benutzung des Materials in semer Urform« läßt sich durch den Einsatz<br />
<strong>von</strong> Faksimiles im Lichtdruck ein großer, »wenn auch nicht der letzte und abschließende<br />
Theil der wissenschaftlichen Arbeit« verrichten 21 - es bleibt eine hermeneutische<br />
Reserve gegenüber der neuen Gedächtnistechnologie.<br />
Was die MGH <strong>für</strong> die Versammlung <strong>von</strong> Schriftdenkmälern als Edition geleistet<br />
haben, holt die Photographic als Bildcrgedächtnis ein. Medienarchäologischcs<br />
Faktum in beiden Fällen ist die Notwendigkeit, daß ein technisches Dispositiv<br />
<strong>von</strong> Vergleichbarkeit Standardisierung erfordert. Der Lichtdruck im Faksimile-<br />
Werk <strong>von</strong> Sybel und Sickel weist keine Rasterung auf; allerdings sind die Vorlagen<br />
hier und da durch Retuschen geschönt worden . Das<br />
1879 vom französischen Innenministerium in Paris herausgebrachte Recueü de<br />
Fac-simüe aus den Archives Departementales (basierend auf Heliographie) sagt<br />
es: »Les täches ont ete attenuces. On a pensee que la reproduction, tout en etant<br />
rigoureusement exaete, devait demeurer intelligente« . Damit digitalen Bikiverarbeitungstechnikcn ist auch diese Intelligenz programmierbar<br />
geworden. Die erste Lieferung des Urkundenbildwerks geschieht<br />
auf Veranlassung der Kgl. Preußischen Archivverwaltung; Ziel ist eine Sammlung<br />
getreuer Abbilder <strong>von</strong> ungefähr 300 Urkunden und Briefen deutscher Könige<br />
und Kaiser <strong>von</strong> Pippin bis Maximilian I., also wieder bis zu einer medienarchäo-<br />
21 Aus der Einleitung zu: Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung I (Leipzig 1908), 3<br />
22 Hier zitiert nach: Heinrich Meyer zu Ermgasscn, Das »Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden«<br />
in Marburg. Aufgaben, Arbeitsweisen und Stellung in der <strong>Geschichte</strong><br />
des Urkundenfaksimile, in: Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in<br />
Europa: <strong>Geschichte</strong>, Umfang, Aufbau und Verzeichnungsmethoden der wichtigsten<br />
Urkundenfotosammlungen; mit Beiträgen zur EDV-Erfassung <strong>von</strong> Urkunden und<br />
Fotodokumenten, hg. v. Peter Rück, Sigmaringen (Thorbecke) 1989, 17-24 (17f)
248 MoNUMKNTA ( JKKM ANI AK<br />
logischen Zäsur, dem Druck <strong>von</strong> Massenakten, mit erläuternden Texten . Die so definierte Zeitgrenze deckt sich mit der<br />
Editionsepoche der MGH; diese Kopplung ist explizit: Daß in die ersten Lieferungen<br />
vorzüglich Urkunden des 10. Jahrhunderts eingereiht wurden, »geschah<br />
im Hinblick auf die schon begonnene Ausgabe dieser Diplome in den Monumenta<br />
Germaniae«, also im gedächtniskybernetischen Verbund . Die Edition <strong>von</strong> Monumenten der Vergangenheit in Parallelverarbeitung (Text<br />
und Bild) folgt einer anderen Logistik als die narrative Ordnung der Historie. Um<br />
die Veröffentlichung zu beschleunigen, werden die durch verschiedene Mitarbeiter<br />
ausgwählten und erläuterten Abbildungen der Kaiserurkunden zunächst ohne<br />
Rücksicht auf die chronologische Reihenfolge in geblockten Lieferungen den<br />
Abnehmern zugestellt; erst in dem der letzten Lieferung vorbehaltenen Inhaltsverzeichnis<br />
soll die zeitliche Aufeinanderfolge berücksichtigt und damit den<br />
Besitzern Gelegenheit geboten werden, die Tafeln chronologisch zu ordnen - als<br />
array. Dieser Index bildet die Schnittstellen zur Kompatibihsierung diverser Ordnungs-<br />
und Speichersysteme; ein chronologisches und ein systematisches Verzeichnis<br />
der publizierten Urkunden mit den erforderlichen Konkordanztafeln<br />
bleiben der Schlußlieferung vorhalten, »so daß die Abnehmer sich die Tafeln dann<br />
nach ihrem Belieben ordnen mögen« . Nichts anderes heißt<br />
Bildersortierung, solange ihr Gedächtnis nicht Bildern, sondern alphanumerischer<br />
Adressierung folgen muß. Ähnlichkeit ist erst das Kriterium einer digital automatisierten,<br />
also nicht mehr zwischen Bild und Text trennenden Sortierung kompilierter<br />
Quellentexte, etwa mittelalterlicher Stundenbücher und Litaneien. Hier<br />
ist nicht mehr traditionelles Verstehen gefragt - eine ideale Applikation <strong>für</strong> den<br />
Computer gerade in seiner Dummheit bei der Auscmandcrsorticrung ähnlicher<br />
und einzigartiger Elemente. »To the Computer the mysteries of the meaning of<br />
the text are not relevant. The words migh as well be figures.« 23 Zum Zug<br />
kommt diese digitale Datenprozessierung vor allem dann, wenn die Menge an<br />
Information <strong>für</strong> menschliches Gedächtnis unverwaltbar wird. Vor allem können<br />
in dieser Form <strong>von</strong> Faksimilierung auch die äußeren Merkmale der Urkunde<br />
mehr oder minder wiedergeben werden; »so wird vollends heutzutage, wo die<br />
Reproductionen <strong>von</strong> Schriftdenkmälern so wesentliche Fortschritte gemacht hat,<br />
daß die Beschaffung eines durch Treue und Billigkeit ausgezeichneten Apparats<br />
<strong>von</strong> Abbildungen immer leichter wird, auch größeren Kreisen die Betheiligung<br />
an dem Studium der Urkunden ermöglicht« .<br />
Dieses Archiv sortiert nach Formaten, nicht nach Inhalten; in erster Linie soll <strong>für</strong><br />
23 Michael Michael, Computers and Manuscript Illumination, in: Computers and the<br />
history of art, hg. Anthony Hamber, Jean Miles u. Vaughan Williams, London / New<br />
York (Mansell) 1989, 200-206 (203f)
K l N I U U K : i I I H K B l I . D I - . K I N D l - N ' I Y . X T I H K H l S T l >KII 2 4 9<br />
die Auswahl die Form der Denkmäler, »möge sie nur in den äußeren Merkmalen<br />
oder zugleich in diesen und in den inneren zum Ausdruck kommen, und erst in<br />
zweiter Linie soll auch der Inhalt« berücksichtigt werden . Technisch<br />
detailliert werden Verfahren und Operationen des Lichtdrucks beschrieben; »es<br />
entsteht mithin eine Druckfläche, welche, eingewalzt etwa wie ein lithographischer<br />
Stein und durch die lithographische Presse gezogen, den inalterablen Lichtdruck<br />
liefert« . Das Reale der Materie sträubt sich dabei in der Praxis<br />
gegen das mimetische Ideal der getreuen Abbildung und wird im physikalischchemisch<br />
blöden (im Sinne Lacans also reine Signifikantenströme lesenden),<br />
unhermeneutischen Blick der Photographie als Lichtdruck verstärkt, da dieser<br />
medienarchäologisch asketische Blick nicht zwischen Sinn (Buchstaben) und<br />
Unsinn (Fleck) unterscheidet:<br />
»<strong>Im</strong>mer aber bleiben auf den alten Documenten einzelne Unebenheiten, Risse,<br />
Brüche, kleine Falten zurück; Flecke und Löcher befinden sich zwischen den<br />
Buchstaben. Das Alles kommt im photographischen Abbilde zur Geltung, oft verstärkt<br />
durch die verschiedenartige Wiedergabe verschiedener Farbennüancen in<br />
der Photographie. So sind, um eine tadellose Wiederholung des Originals herzustellen,<br />
zahlreiche Correcturen unter beinahe mikroskopischer Collation der<br />
Urschrift unerläßlich gewesen.« <br />
In einer anderen Publikation ist der beigegebene Lichtdruck ohne vorgängige<br />
Glättung des Pergaments hergestellt worden; die mit dem Textfragment gemachte<br />
Erfahrung hatte gelehrt, daß infolge der Glättungsoperation leicht die Buchstaben<br />
der Rückseite durchscheinen und so die Lesbarkeit beeinträchtigt wird. Em<br />
nachträglich an einzelnen Stellen unternommener Glättungsversuch ergibt,<br />
daß der verwitterte Rand des Pergaments trotz äußerster Vorsicht zerbröckelt.<br />
Doppelte Ränder der Lesbarkeit: da es nicht möglich ist, bei der Aufnahme der<br />
Photographie die Ränder des Pergaments überall glatt aufzulegen, sind einige<br />
Buchstaben und Buchstabenspuren im Lichtdruck nicht ersichtlich, »worauf ich<br />
in der Adnotation aufmerksam mache.« 24 <strong>Im</strong> Schema der Tafeltexte, <strong>von</strong> Sybel/<br />
Sickel bildet eine knappe Inhaltsangabe mit entsprechender Zeitbestimmung den<br />
Kopf, vergleichbar dem Adreßkopf jedes Speichers; den Abschluß bildet der diplomatische<br />
Kommentar »oder der Hinweis auf einen solchen« - eine hypertextuelle Verweisstruktur anstelle homogenisierender<br />
Narration. Archivologie statt Historie gilt, wo das deutsche Gedächtnis nicht<br />
namentlich adressierbar ist; <strong>für</strong> die Sachlage der ältesten Urkunden korrespondiert<br />
die Formatierung und Formahsierung mit der Form ihrer Edition. Am Beispiel<br />
des Dokuments einer Schenkung Pippins an das Kloster Fulda (die Villa Deinin-<br />
24 O. Lenel, Neue Ulpianfragmente, in: Sitzungberichte der Kgl. Preuß. Akademie der<br />
Wissenschaften, Jg. 1904, Berlin 1904,2. Halbband Juli-Dezember, 1156ff (1158)
250 MoNUMKNTA GKRMANIAH<br />
gen, Attigny 760, Juni) erläutern die Herausgeber, wie bis weit in das 9. Jahrhundert<br />
hinein die Mehrzahl der Königsurkunden nach Formeln stilisirt worden sind,<br />
so daß »bei engem Anschluß an Formeln die Individualität des Dictators<br />
nicht zum Ausdruck« kommt. Darum verzichten die Herausgeber auch in analogen<br />
Fällen darauf, »den Dictator namhaft machen zu wollen« 25 ; jenseits <strong>von</strong><br />
<strong>Namen</strong> aber ist ein solcher Befund auch als <strong>Geschichte</strong> nicht schrcibbar. Ecrkure<br />
automatique herrscht auf der Ebene anonymer Aufschreibesysteme, die sich entsprechenden<br />
Gedächtnistechniken zur Verfügung stellen.<br />
Das Lichtbüdarchiv älterer Originalurkunden Marburg<br />
Edmund Ernst Stengel ist der Gründer des Lichtbildarchivs am Seminar <strong>für</strong><br />
Historische Hilfswissenschaften der Universität Marburg. »Ausgaben <strong>für</strong><br />
Fotomateriahen weist erstmals ein eigenhändiger Eintrag <strong>von</strong> Karl Brandi im<br />
Rechnungsbuch des Seminars <strong>für</strong> 1898 nach« ; auch die<br />
Rekonstruierbarkeit der Historie einer Bildgedächtnisagentur unterliegt mithin<br />
dem Schriftregime und nicht dem <strong>von</strong> Bildern. Stengel definiert das Lichtbildarchiv<br />
als dokumentarisch-monumentahsche Doublette; die Aufnahmen dürfen<br />
»nichts unterdrücken und müssen soviel wie möglich <strong>von</strong> den äußeren<br />
Merkmalen der Originale herausholen.« Ein technisches Medium fungiert<br />
hier selbst als Analytiker und Wissensarchäologe. <strong>Im</strong> Unterschied zum subjektiven<br />
Blick bedarf es dazu der strengen Standardisierung im Spiel mit Formatierungen,<br />
denn wo die Aufnahmen die Urkunden nicht nur zu behelfsmäßigen<br />
Sonderzwecken der wissenschaftlichen Forschung, »sondern in ihrer einheitlichen<br />
Erscheinung als Denkmäler wiedergeben sollen, müssen sie möglichst<br />
die natürliche Größe ihrer Vorlagen erreichen wobei natürlich das Verhältnis<br />
zum Original durch einen jeweils mit aufzunehmenden Maßstab nachzuweisen<br />
ist.«-''' Das Mals wird damit dem Objekt im Akt der Reproduktion<br />
selbst eingeschrieben; als technische Darstellung erhebt die Reproduktion damit<br />
einen intersubjektiv gültigen Anspruch: »Jedem Photogramm wohnt als einer<br />
rein deskriptiven und objektiven Darstellung der Charakter des Wissenschaftlichen<br />
inne.« 27 Inwieweit ordnet ein äußerlicher, archäologischer Blick Urkunden<br />
anders zueinander, als es die historische Hermeneutik vollzieht? Der<br />
britische Urkundenforscher J. O. Westwood (1805-1893) ist kein Paläograph<br />
vom Fach, sondern Botaniker, und bezeichnenderweise interessierten ihn, »dem<br />
25 Sybel / Sickel 1891: »Lieferung I. Tafel 1., 1<br />
26 In: Minerva-Zeitschrift 6 (1930), zitiert nach: Ermgassen 1989: 19f<br />
27 Paul Marc, Bibliothekswesen, in: Angewandte Photographie in Wissenschaft und<br />
Technik, hg. v. Karl-Wilhelm Wolf-Cz-ipck, Berlin (Union) 191 I, IV, 57-76 (57)
EINBRUCH DI-:R BII.DHR IN DI:N THXT DI:R HISTORU-: 251<br />
deskriptiven Charakter der damaligen Botanik entsprechend, die Formen der<br />
Buchstaben und Ornamente« - wie auch der Kulturhistoriker Karl Lamprecht<br />
die buchstäbliche Ornamentik mittelalterlicher Handschriften als »Nebenfrucht<br />
anderer Studien, welche mich seit dem Jahre 1SSO in die Archive und Bibliotheken<br />
der Rheinlande führen«, entdeckt, graphisch sortiert und damit zunächst<br />
<strong>von</strong> der hermeneutischen Lesung befreit. 28 Westwood publiziert m seiner illustrierten<br />
Palaeographia sacra pictoria (London 1843-1845) das erste Beispiel<br />
einer paläographischen Textgeschichte. 29<br />
Technisch wird das Verhältnis <strong>von</strong> Archiv (Latenz) und Historie (Entwicklung<br />
der Daten) im Medium Photographie als Option negativ/positiv definiert. Aufgabe<br />
der Marburger Zentralstelle <strong>für</strong> Urkundenphotographie ist es, »die Negative<br />
aufzubewahren, sowie auf Anfordern <strong>von</strong> auswärts nach ihnen Positive <br />
herzustellen.« 30 Alle Negative werden in Formatserien nach numerus currens, also<br />
gemäß der nackten wissensmechanischen Ordnung <strong>von</strong> Gedächtnis in dem feuersicheren<br />
Tresorraum des Lichtbildarchivs abgelegt. Urkundenphotographie<br />
dient - jenseits des hermeneutischen Wunsches, unlesbar gewordene Schriften<br />
wieder entzifferbar zu machen - der Sicherung getrennt aufbewahrter Originale<br />
in der Reproduktion. 31 Zu jeder Serie werden Formatbücher geführt, in denen die<br />
Negative unter Angabe des Gegenstands der Aufnahme, der zugehörigen Zugangsnummer,<br />
des Lagerorts, <strong>von</strong> Signatur und Datum der betreffenden Urkunde<br />
verzeichnet sind. Damit ist das Datum Subjekt und Objekt der Archivierung, im<br />
double-bind <strong>von</strong> aktueller Archiv-Signatur und historischem Datum. Das Archiv<br />
hat eine Adresse transitiv und intransitiv, ist also anschreibbar und schreibt selbst<br />
an. Was <strong>für</strong> ein solches Archiv-Gedächtnis gleichrangig Daten sind, trennt erst<br />
28 Karl Lamprecht, Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrhunderts, Leipzig (Dürr)<br />
1882, Vorwort. Seine Einleitung treibt die orgamzistische Metapher weiter: »Sobald<br />
der Deutsche den Schreibgrillcl vom römischen IVovm/i.ilen oder vom Iren m die<br />
Hand gedrückt erhielt, begann er dem ersten Buchstaben sein ornamentales Empfinden<br />
einzuverleiben. erst mit der Mitte des 13. Jahrhunderts verließ die Ornamentik<br />
den Körper der Initialen.« Einleitung, 1. Siehe auch Peter Rück, Paläographie<br />
und Ideologie: die deutsche Schriftwissenschaft im Faktur-Antiqua-Streit <strong>von</strong> 1871-<br />
1945, in: Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita 1 (1994), 15-33, unter Hinweis<br />
auf Wilhelm Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter (1871) und Hermann<br />
Degering, Atlas der Schriftformen des Abendlandes (1929)<br />
- v Traube 1909: 68f; Anm. d. Hg. unter Verweis auf den Dictionary of National Biography<br />
LX <strong>von</strong> 1899: »Allerdings ist Westwood Naturforscher und allerdings besteht<br />
zwischen seiner paläographischen und seiner naturwissenschathchen Methode große<br />
Ähnlichkeit.«<br />
30 E. E. Stengel 1930, zitiert nach Ermgassen 1989: 20<br />
31 Siehe Helmut Koch, Original und Kopie, in: Archivarbeit und Geschichtsforschung,<br />
hg. v. d. Hauptabteilung Archivwesen im Ministerium des Innern der Regierung der<br />
Deutschen demokratischen Republik, Berlin (Rütten & Loening) 1952, 120-132 (127)
252 MoNUMKNTA Gl'.RMANI AK<br />
die historische Hermeneutik in Daten <strong>von</strong> Vergangenheit und Gegenwart. Wenn<br />
dabei die Signatur dem Bild des Objekts eingeschrieben wird, steht Gedächtnisadressierung<br />
nicht mehr in einem parergonalen Verhältnis zum Gegenstand; als<br />
unüherschreithares Gesetz gilt, »daß bei jeder einzelnen Aufnahme die Signatur<br />
der Handschrift und die Blattziffer auf einem aufgesteckten Zettel angegeben<br />
wird , so daß bei der späteren Ordnung und Benützung des Materials, geschehe<br />
sie durch wen immer, jeder Zweifel und Irrtum ausgeschlossen bleibt.« Von<br />
daher soll jedesmal einen Maßstab mitaufgenommen werden . Jenseits der Verschlagwortung gilt die geometrische Vermessung als Gedächtnisraum,<br />
der Bilder und ihre Adressen in ein und demselben Medium erfaßt.<br />
Dieser archivische Raum ist durch präzise Koordinaten anschreibbar (sonst delirieren<br />
die Signifikantenmengen). Das Modell entstammt dem Schriftarchiv; daß<br />
bei jeder Abschrift oder Kollation die Bibhothekssignatur des Schriftdenkmals<br />
sowie die Blattziffer genau notiert und »wie bei einem juridischen Aktenstücke«<br />
Ort, Datum und Unterschrift beigefügt werden muß, »ist eine Regel <strong>von</strong> fast<br />
beschämender Selbstverständlichkeit« .<br />
Produkt dieses Aufzeichnungssystems ist Vergangenheit nicht als Erzählung<br />
(<strong>Geschichte</strong>), sondern als Datenbank; als wissenschaftliches Endergebnis der zu<br />
leistenden photographischen Inventansationsarbeit schwebt Stengel schließlich<br />
»ein nach Urkundenarchiven geordneter Katalog sämtlicher älterer Urkunden auf<br />
deutschem Boden« vor. Die heuristische Leitidee ist dabei das Gedächtnis als<br />
archivischer Ort, ein non-diskursiver heu de memoire, nicht die synekdochische<br />
Emlesung und Relektüre <strong>von</strong> Gedächtnisobjekten als Partikeln einer unterstellten<br />
Historie. Ein solcher Archivkatalog bildet die wissensarchäologische Grundlage(rung)<br />
des Urkundengedächtnisses: »Er wird aus der die Lichtbildarbeit<br />
begleitenden Kartothek ganz <strong>von</strong> selbst herauswachsen und am besten heftweise<br />
ausgegeben werden können« . Ermgassen beschreibt die Gedächtnismaschine<br />
l.ichtbildarchiv als Zuschreibungstechnik; Medium der Befehle<br />
und Übertragung ist die Alphanumerik, logozentristisch also im buchstäblich<br />
kybernetischen, nicht dekonstruktiven Sinn. Eine zu jeder Aufnahme erstellte<br />
Karteikarte im Format DIN A 5 verzeichnet nach einem bestimmten Schema <strong>für</strong><br />
jede Urkunde eine Reihe <strong>von</strong> technischen und wissenschaftlichen Daten. Zeichen<br />
haften an Materialitäten (Zcichenkörper und -träger), Daten nicht; die Informationstheorie<br />
hat durch ihr Paradigma der Meßbarkeit <strong>von</strong> Information Zeichen<br />
zu Daten ohne Perjormanz werden lassen. 3 - Durch die Aufzeichnung als Aufspeicherung<br />
wird urkundliche Reproduktion selbst zum Monument. So<br />
32 Sybille Krämer auf der Konferenz Medien und Gesellschaft an der Jahrhundertwende,<br />
Humboldt-Univerität zu Berlin, Institut <strong>für</strong> Ästhetik, 2. November 1996, in Anlehnung<br />
an einen Betriff <strong>von</strong> Paul Zumthor
EINBRUCH DI-:K BII.DKR IN DI:N THNT DI-:R HISTOKII 253<br />
»bietet die Faksimileausgabe wenigstens <strong>für</strong> Schriftwerke und Miniaturen einen<br />
Ersatz <strong>für</strong> den Fall, daß das Original durch elementare Mächte, durch rohe Menschenhand<br />
oder durch den Zahn der Zeit zerstört wird. Die Reproduktionstechnik<br />
vollbringt das Wunder, aus den ältesten und widerstandslosesten Denkmälern,<br />
die uns der Vorfahren Wissensdrang und Kunstsinn hinterlassen hat, ein Erbe dauerhafter<br />
als Erz zu machen.« <br />
Umgekehrt macht diese Logik das Original selbst redundant. Oliver Wendell<br />
Holmes konstatiert in seiner Schrift Das Stereoskop und der Stereograph (1 859)<br />
an abgelichteten Objekten die Trennung <strong>von</strong> Information und Hardware ganz<br />
so, wie der Prozeß der Drucklegung, also Mediatisierung mittelalterlicher Urkunden<br />
<strong>von</strong> Seiten der MGH zuweilen die Originale verzichtbar machte:<br />
»Materie in großen Mengen ist immer immobil und kostspielig; Form ist billig und<br />
transportabel. Jeder denkbare natürliche und künstliche Gegenstand wird in<br />
Bälde seine Oberfläche <strong>für</strong> uns abschälen. Die Menschen werden auf alle merkwürdigen,<br />
schönen und großartigen Gegenstände Jagd machen, so wie man in<br />
Südamerika die Rinder jagt, um ihre Haut zu gewinnen und den Kadaver als wertlosen<br />
Rest liegen läßt.«' J<br />
Genau das aber ist Pergament als Grund <strong>von</strong> Urkunden, deren Schrift sich in<br />
der photographischen Reproduktion abschält <strong>von</strong> der Trägersubstanz - eine<br />
technische Praxis, die materiell längst eingeübt war:<br />
»Und so sind auch wohlgehütete Reliquien, ihres religiösen Sinns entkleidet, vor<br />
der Ökonomie des Gütertausches nicht sicher: Voller Schaudern berichtet ein<br />
Augenzeuge des Wütens der Säkularisation im Dom zu Bamberg, >wie man das<br />
Brautkleid der hl. Kunigunde auf ein Brett nagelte und mit einem Gerbermesser<br />
die Perlen, Edelsteine und Kameen herabgerbte, um sie an die Händler zu verkaufen,<br />
wie man die Schädel <strong>von</strong> Heinrich und Kumgundc aus ihren Fassungen<br />
<strong>von</strong> Gold und Edelsteinen riss und sie in die Ecke warf; wie man die wundervollen<br />
Reliquienbehälter <strong>von</strong> Elfenbein mit dem Hammer einschlug, um die Goldbeschläge<br />
zu gewinnen.««' 4<br />
Die Folge der <strong>von</strong> Holmes <strong>für</strong> das Zeitalter der Photographie diagostizierten<br />
Ablösung der Information <strong>von</strong> ihren Trägern werde »eine so gewaltige<br />
Sammlung <strong>von</strong> Formen sein, daß sie nach Rubriken geordnet und in großen<br />
Bibliotheken aufgestellt werden wird, wie es heute mit Büchern geschieht«<br />
; hier insistiert die Bibliothek als mediale Leitmetapher der<br />
Wissensspeicherung.<br />
33 Deutsch in: Kemp (Hg.) 1980: 114-121 (119f)<br />
34 Wolfgang Struck, <strong>Geschichte</strong> als Bild und als Text. Historiographische Spurensicherung<br />
und Sinnerfahrung im 19. Jahrhundert, in: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske,<br />
hg. v. Susi Kotzinger / Gabriele Rippl, Amsterdam / Atlanta, GA (Rodopi)<br />
1994, 349-361 (352f), unter Bezug auf: Jakob H. <strong>von</strong> Hefner-Alteneck, Entstehung<br />
und Einrichtung des bayerischen Nationalmuseums in München, Bamberg 1890, 10
254 MONUMHNTA Gl-KMANIAK<br />
Das Zeitalter der Urkundenphotographie verflüssigt den Begriff des Monuments<br />
selbst, indem es ein neues Parameter <strong>für</strong> das, was als Gedächtnis auf<br />
Dauer gestellt wird (Währung), definiert. Die Zahl der auf deutschem Boden<br />
vorhandenen Urkunden <strong>für</strong> die Zeit bis 1200 lautet 8000; <strong>für</strong> die Zeit <strong>von</strong> 1250-<br />
1250: 20000; <strong>für</strong> 1250-1275: 25000 - computable numbers. So erschien es möglich,<br />
bei regelmäßig fortschreitender Arbeit in absehbarer Zeit zum Planziel<br />
einer Gesamtreproduktion zu kommen, bei Verzicht auf »die seit dem letzten<br />
Viertel des 13. Jahrhunderts uferlos anschwellende Masse der spätmittelalterlichen<br />
Urkunden« . Bei den Aufnahmen soll es sich nicht nur<br />
um ein wissenschaftliches Hilfsmittel zum Schriftvergleich handeln, sondern<br />
um ein Denkmälerarchiv, »das die reproduzierten Dokumente auch in ihrem<br />
äußeren Eindruck getreue wiedergibt und sie <strong>für</strong> den jederzeit drohenden Fall<br />
ihres Verlustes möglichst zu ersetzen imstande ist.« Die Photographien dürfen<br />
keine optische Information unterdrücken und müssen »sowiel wie möglich <strong>von</strong><br />
den äußeren Merkmalen der Originale, auch Tintenunterschiede und Rasuren,<br />
herausholen« . Da die Aufnahmen die Urkunden nicht zu<br />
behelfsmäßigen Forschungszwecken, sondern »in ihrer einheitlichen Erscheinung<br />
als Denkmäler« wiedergeben sollen, müssen sie möglichst die natürliche<br />
Größe ihrer Vorlagen erreichen. Indem das Verhältnis zum Original durch einen<br />
jeweils mit aufzunehmenden Maßstab nachzuweisen ist .<br />
Die Senenbildung <strong>von</strong> Gedächtnis ist an die Standardisierbarkeit seiner Messdaten<br />
gebunden; Anomalien unterlaufen die Wahrnehmungsschwellen einer<br />
solchen Datenbank <strong>für</strong> histoirc serielle.-^<br />
Die Zentralstelle Marburg dient zur Aufbewahrung der (leserichtigen) Negative.<br />
Dispositiv <strong>von</strong> Gedächtnisdiskursen wird hier zur Instanz. Ihre Anglicderung<br />
an das 1891 in Verbindung mit der preußischen Archivschule gegründete<br />
Seminar <strong>für</strong> mittelalterliche <strong>Geschichte</strong> und geschichtliche Hilfswissenschaften<br />
(zunächst unter Paul Kehr, dann Michael Tangl) geschieht »wegen seiner archivwissenschafthehen<br />
Tradition«; das impliziert die Unterwerfung der (Ab-)Bilder<br />
unter das Paradigma einer Textverwaltungswissenschaft in naher Beziehungen<br />
zum dortigen Staatsarchiv . Ein symbolischer Tausch: Archive<br />
stellen der Marburger Zentralstelle ihre Urkunden, »um sie <strong>für</strong> die Zukunft um<br />
so mehr schonen zu können« , <strong>für</strong> die photographischc Aufnahme zur Verfügung<br />
. Vergleichbar mit Aufseß' Projekt eines Generalrepertoriums<br />
deutscher Kulturgeschichtsquellen des Mittelalters im Germanischen Nationalmuseum<br />
Nürnberg schwebt Stengel als abschließendes Ziel und zugleich als wissenschaftliches<br />
Endergebnis der zu leistenden photographischen Inventansati-<br />
Da/.u (kritisch) Carlo Gin/.bun;, Microliisiory: Two or Three Things That 1 Know<br />
about lt, in: Critical lnquiry 20 (Autumn 1993), 10-35 (21)
EINBRUCH OI;R BII.DI-R IN DHN TI;XT DLR HISTORIH 255<br />
onsarbeit ein nach Urkundenarchiven geordneter Katalog sämtlicher älterer<br />
Urkunden auf deutschem Boden vor: womit der Akt der Messung, Registrierung<br />
und der symbolischen Umarbeitung zur Ordnung eines historischen Quellenkorpus'<br />
in ein und demselben Prozcss(or) ablaufen. Eine Entschließung des<br />
damals aktuellen deutschen Archivtags lautete dementsprechend, eine Zentralstelle<br />
<strong>für</strong> die Lichtbildaufnahme der älteren Urkunden auf deutschem Boden (bis<br />
1275) zu schaffen, um auf diesem Weg »<strong>von</strong> einer der großartigsten bildhaften<br />
Erscheinungsformen unserer älteren Vergangenheit« - die also semiotisch wahrgenommen<br />
wird, nicht schlicht als Schriftspeichcr - »ein einheitlich geschlossenes<br />
Denkmal-Archiv zu schaffen« (denn Standardisierung ist die Bedingung massenhafter<br />
Archive). Stengel nutzt hier einen Begriff, den Albrecht Meydenbauer<br />
<strong>für</strong> die photogrammetnsch vermessenen Bestände historischer Architekturdokumentation<br />
in Form der Preußischen Mcßbildanstalt geschaffen hat; auch die<br />
diskursive Begründung eines solchen Unternehmens ist analog: die Anlage eines<br />
Gedächtnis-Zweitkörpers <strong>für</strong> den Fall des Verlusts der Originale und deren<br />
Schonung durch Gebrauch <strong>von</strong> Abbildern, leicht zugänglich und erhältlich. 1989<br />
heißt der auf zehntausend Urkunden angewachsene Marburger Bestand schlicht<br />
Datenbank des Lichtbildarchivs - eine computergestützte Dokumentation auf<br />
dem Gebiet der Diplomatik. Die <strong>von</strong> der Hardware der Reproduktionstechnik<br />
(erst Photographie, dann digitale Bildspeicherung) erzwungene Standardisierung<br />
führt zu dementsprechenden Konsequenzen, die Anschheßbarkeit serieller Geschichtsforschung:<br />
quantitative Methoden lassen den Bestand als repräsentativ<br />
<strong>für</strong> die Summe der überlieferten deutschen Originalurkunden bis 1250 erscheinen.<br />
36 »Ob aber die Onginalübcrlieferung selbst in statistischem Sinne zufallsvcrtcilt<br />
und damit repräsentativ <strong>für</strong> die gesamte Urkundenproduktion des<br />
Mittelalters ist, muß bezweifelt werden.« Prägende Bedingungen der Zusammensetzung<br />
<strong>von</strong> Quellenüberlieferung sind, unter anderem, die Abhängigkeit der<br />
Überheferungschance vom behandelten Rechtsgegenstand, die Verwaltungsorganisation<br />
des Urkundenempfängers und der soziale Status der Betroffenen. »Die<br />
Tradierung des Urkundenmaterials ist also nicht allein <strong>von</strong> den Zufällen der<br />
<strong>Geschichte</strong> abhängig, sondern durchaus auch <strong>von</strong> strukturellen Faktoren.«' 7 Es<br />
gilt dabei neben den Diskursen auch die Techniken der Speicher-, vor allem aber<br />
36 Dazu Emmanuel Lc Roy Ladune, L'histonen et l'ordmateur, in: ders., Lc terntoirc de<br />
l'historien, Paris (Gallimard) 1973<br />
' 7 Frank Michael Bischoff. Die Datenhank des Marburger »l.ichtbildarchivs älterer Originalurkunden<br />
bis 1250«. Systembeschreibung und Versuch einer vorläufigen statistische<br />
Auswertung, in: Rück 1989: 25ff (33), unter Bezug auf Arnold Eschs Beobachtungen zu<br />
den Urkundenübcrlieferungsverhältnissen der Stadt Lucca: Überheferungs-Chance und<br />
Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift<br />
240 (1985), 529-570
256 MoNUMKNTA Gl-KMANIAli<br />
der Übertragungsmedien zu thematisieren; aus der Perspektive der Archive kommen<br />
letztere schwerlich in den Blick: Ȇbertragungsmedien hinterlassen kaum<br />
Spuren. Weil es <strong>von</strong> ihnen kein Archiv gibt, darum haben sie keine Historiographie.«<br />
38 Die Logik der Schrift gibt es vor: Quellenüberlieferung, ein klassisches<br />
Analyseobjekt der Geschichtsforschung, läßt sich mit Jack Goody als delayed<br />
transfer definieren - ein Begriff, der Archiv- und Übertragungsprozcsse ineins<br />
setzt, im katechontischen Datenauf- und -verschub; Gedächtnis wird so nicht<br />
mehr als Aufbewahrung, sondern als Verzögerung denkbar. Für einen der ersten<br />
elektronischen Großrechner der Nachknegswelt, den amerikanischen ENIAC,<br />
ist dieser Begriff Hardware geworden: als Idee, materielle Verzögerungselemente<br />
in der Datenübertragung als (Zwischen-)Speicheremheiten zu verwenden. Eine<br />
Kette <strong>von</strong> <strong>Im</strong>pulsen oder die Information, die sie darstellen, kann als gespeichert<br />
betrachtet werden, solange sie Kanäle durchlaufen. 39 Der Speicher verlangsamt<br />
die Übertragung, ohne ihre Option zu dementieren. Die daran angeschlossene<br />
Zirkulation <strong>von</strong> Archiv und Historiographie praktiziert dabei Schleifen <strong>von</strong><br />
Befehlen, Adressierungen, Datierungen, Speichcrungen und Rückkopplungen. 40<br />
Erst wenn Gedächtnis zum Gegenstand <strong>von</strong> Übertragung statt Archivierung<br />
geworden ist, verschwindet es in reiner Signalverarbeitung.<br />
Zwischen Hand-Schrift und Automation: Medienkontroversen<br />
1858 stellt Theodor Sickel den ersten Teil der <strong>für</strong> den Unterricht am Institut <strong>für</strong><br />
Österreichische Geschichtsforschung bestimmten Monumenta graphica medii<br />
aevi fertig 41 ; 1870 veröffentlicht er zehn zunächst handgepauste, dann in Kupfer<br />
gestochene Tafeln <strong>von</strong> Karolingerurkunden aus dem nach Wien gelangten<br />
Nachlaßteil des 1834 in Marburg verstorbenen Paläographen Kopp mit Siegelabdrücken.<br />
»Kopp sammelte Einzelbuchstaben« 42 ; aus der Vervielfältigung<br />
3s pctcr Bcrz, Protokoll des Berliner Treffens vom 1. Februar 1997 des DFG-Projekts:<br />
Theorie und <strong>Geschichte</strong> der Medien<br />
39 Vgl. Alan Turing, The State of the Art. Leeture to the London Mathematical Society<br />
on 20th February 1947, dt. in: ders., Intelligencc Service: Schriften, hg. Bernhard Dotzler<br />
/ Friedrich Kittler, Berlin (Brinkmann & Böse) 1987, 183-207 (188)<br />
40 Jack Goody, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge (UP)<br />
1986, 104 (dt.: Frankfurt/M. 1990). Siehe auch ders. (Hg.), Literarcy in traditional<br />
societies, Cambridge (UP) 1968, 14 (über »preserved commonunication«); Bernhard<br />
Siegcrt, Relais: Geschicke der Literatur als Lpoche der Post 1 751 -191 3, Berlin (Brinkmann<br />
& Böse) 1993,25<br />
41 Th. Sickel, Monumenta Graphica medn aevi ex ar'chivis et bibliotheteis imperii Austriaci<br />
collecta edita jussu atque auspicns ministem eultus et publicae mstructioms caes.<br />
reg. Vindobonae, neun Lieferungen 1859-1869, Schlußlieferung (10) 1882<br />
•'•' |ohanna Aberle / ln;i Preschet; 1 >ic Urkunilens.immking des I listorischcn Seminars
EINBRUCH DI-.R BILDI.R IN DI;N THXT DKR HISTORIE 257<br />
diskreter paläographischer Schnftquellen (Textstücke, Urkundensiegel und<br />
Münzen) erwächst 1817ff in vier Bänden Kopps Palaeograpbia cntica zur ausdrücklichen<br />
Überwindung des schnftkundhchen Analphabetismus' in der Altphilologie.<br />
43 Seine Schenkung Kopps an die junge Berliner Universität König<br />
Friedrich Wilhelms III. im Juni 1820 führt nicht nur zu einem Apparat <strong>für</strong><br />
Lehre und Forschung, sondern das mediale Surrogat triggert eine ganze Disziplin.<br />
Kopp definiert in seiner Schenkung nämlich den »zur Begründung eines<br />
<strong>Lehrstuhl</strong>s <strong>für</strong> Diplomatik zweckmäßig angelegten Apparat«; die Medien der<br />
Reproduktion sind hier die arche jener Historischen Hilfswissenschaften, die<br />
in Berlin zunächst in Form einer außerordentlichen (1862, Philipp Jaffe) und<br />
1873 mit einem Ordinariat (Wilhelm Wattenbach, assistiert ab 1877 vom Extraordinarius<br />
Harry Bresslau) institutionalisiert wird. Anderenorts vollzieht sich<br />
ein analoger Sprung <strong>von</strong> typo- zu photographischen Gedächtnismedien. In<br />
einem Gespräch mit Joseph Feil, dem Albert Jäger seine »Noth an Material <strong>für</strong><br />
paläographische Übungen und Studien« klagt, fällt dieser auf den Gedanken,<br />
»ob sich nicht auf photographischem Wege Abdrücke <strong>von</strong> Urkunden erzeugen<br />
ließen? Mir fuhr der Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf«, dem angesprochenen<br />
Medium entsprechend. Jäger wendet sich an den Chemieprofessor<br />
Redthenbacher und gibt ihm einige Pergamenturkunden des 15. Jahrhunderts<br />
zu jedem beliebigen Experimente; Redtenbacher überrascht ihn mit dem Gutachten,<br />
daß das Pergament, wenn es durch den Dunst destillierten Wassers<br />
weich gemacht wird, ebensowenig wie die Schrift Schaden leide. »So kam auf<br />
diesem Wege das Institut zu einem Schatze photographierter Urkunden, die an<br />
Treue der Wiedergabe durch keine Feder und Menschenhand übertroffen werden<br />
können.« 44 Die reproduktionstechnische Debatte, wie denn <strong>Geschichte</strong> als<br />
Dokument zu kopieren ist, verläuft zunächst zwischen Handpause versus photographischem<br />
Faksimile, analog zu der um Kupferstich versus Photographie.<br />
Henri Delaborde verteidigt in seiner Schrift Die Fotografie und der Kupferstich<br />
(1856) das alte Medium gerade ob seines subjektiven Zugs und rückt die Kupferstichreproduktion<br />
<strong>von</strong> Gemälden im Begriff der Buchstäblichkeit der paläographischen<br />
Reproduktionsdiskussion nahe:<br />
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Rückblick und Bestandsaufnahme, in:<br />
Friedrich Beck / Botho Brachmann / Wolfgang Hempel (Hg.), Archivistica docet.<br />
Beiträge zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären Umfelds, Potsdam (Verl.<br />
f. Berlin-Brandenburg) 1999, 524-557 (525), unter Bezug auf den Bestand Kgl. Universitätsbibliothek<br />
Berlin im Universitatsaichiv der Humboldt-Universität, Act.i:<br />
Apparatus Diplomaticus 1820-1875, Sign. 609<br />
43 Ulrich Friedrich Kopp, Palaeographia cntica, Bd. 1 »Praefatio«, 1<br />
44 Albert Jäger, Graf Leo Thun und das Institut <strong>für</strong> österreichische Geschichtsforschung,<br />
in: Österreichisch-ungarische Revue, Neue Folge, 8, 1890, 17 f.
258 MONUMI-.NTA GKRMANIAK<br />
»Aufrichtige Unterwerfung unter die Autorität des Werkes - das ist ohne Zweifel<br />
das erste Gebot dieser Arbeiten. Aber die Nachahmung wäre unbefriedigend,<br />
wenn sie nur den Charakter einer buchstabengetreuen Kopie hätte. Damit ein Stich<br />
nach Wunsch seine Vorlage reproduziert, muß der Kupferstecher die Intentionen<br />
des Malers analysiert, sie den Mitteln, über die er verfügt, angeglichen und die<br />
Sprache des Bildes in die Sprache seines Mediums übersetzt haben. Mit einem<br />
Wort, er muß sich den Geist des Bildes anverwandelt haben, aber dabei hat er bis<br />
zu einem bestimmten Punkt den Buchstaben verändert. Der Kupferstich muß<br />
also die Malerei zugleich kopieren und kommentieren . Die Fotografie<br />
dagegen hält sich an das Faktische, beginnt und endet bei ihm.« <br />
Delaborde zufolge soll der Kupferstich Ȋ la fois copier et commenter la peinture,<br />
sous peine d'abdiquer ses privileges et de se derober aux conditions de Part. La<br />
photographie , ne procedant que du fait, commence et finit avec lui.« 45 Ein<br />
generativer Begriff <strong>von</strong> Originalität konkurriert mit der augenscheinlichen Mimesis:<br />
Realismus »Thus realism besteht »not only in copying the real, but in copymg<br />
a (painted) copy of the real: that famous real is set further back, or<br />
delerred, or at least grasped through the pictural dross with which lt has becn daubed<br />
before being subjeeted to the word: code upon code, says realism.« 46 Die Versachlichung<br />
des Verhältnisses zu Daten der Vergangenheit war, wenn schon nicht<br />
Effekt, so zumindest doch eine Begleiterscheinung der fortschreitenden Mechanisierung<br />
ihrer Vermittlung. <strong>Im</strong> Notebook (selbst ein Aulschreibesystem) des britischen<br />
Kunsthistorikers Bernard Berenson findet sich unter dem Datum 14.<br />
Oktober 1893 eine Betrachtung zur kunstkntischen <strong>Im</strong>plikation der neuen Technologie<br />
Photographie: »Printing itself scarcely could have had a greater effect on<br />
the study of the classics than photography is beginning to have on the study of<br />
the Old Masters.« 47 Der technische Innovationsschub in Sachen Reproduktion<br />
wird <strong>von</strong> Berenson also mit einem qualitativen Paradigmenwechsel im Diskurs<br />
gleichgesetzt. »Engraving, which is the medium for pnntmg Visual arts, was discovered<br />
at the same moment as printing, which is the medium of engraving the<br />
hterarv arts.«" 18 Die Erfindung des Buchdrucks nutzte dennoch vornehmlich den<br />
41<br />
I lenri Delaborde (I 8 1 1-1899), La Photographie et la gravure, in: Revue des Deux-Mondes<br />
(1. April 1856), 617-38, zitiert nach: Segolcne Le Men, Pnntmaking as metaphor for<br />
translation: Philippe Burty and the Gazette des Beaux-Arts in the Second Empire, 88-<br />
108, in: Michael Orwicz (Flg.), Art Criticism and its Institutions, Manchester (UP)<br />
1994, 105, Anm. 32<br />
46<br />
Roland Barthes, in: James Sturrock (I Ig.), Structuralism and since. From Lcvi-Strauss<br />
to Dernda, Oxford 1979, 75<br />
47<br />
Zitiert in Frank Flerrmann (I Ig.), The English as Collcctors. A Documentary Chrestomathy,<br />
London 1972, 353<br />
4S<br />
Charles Blanc, Grammairc des arts du dessin, Rcnouard, 1883 (1880), 617, zitiert u.<br />
übersetzt nach: l .c Men 1994:97
EINBRUCH DI-R BII.DKR IN IM-:N TI-.XT DI-R HISTORIK 259<br />
Textwissenschaften, was die Suprematie der Historiographie beförderte; Artefakte<br />
waren nur einem umgrenzten Publikum autoptisch zugänglich. Dagegen kommt<br />
die Reproduktionstechnik Photographie vorrangig den Bilddokumenten zugute.<br />
Dieser Akzentwechsel als reproduktionstechnischer Effekt des musee imaginaire<br />
49 geht Hand in Hand mit einer Verwissenschaftlichung der Methode, da sich<br />
ganz neue Vergleichsmöghchkeiten eröffneten. Berenson kritisiert die Rezeptionsverzerrungen<br />
im herkömmliche Medium des Kupferstichs:<br />
»The hitch in connoisscurship has always been in companson <br />
depends largely upon pnnts. But the companson of a pnnt with lts original<br />
will show how misleading such an aid to memory must be. No engraver<br />
can hclp putting a great dcal of himself into his reproduetion. His pnnt<br />
has no other valuc than that of a copy really aecurate connoisseurship is so<br />
new a science changed since the days before railway and<br />
photographs.« 30<br />
Die Infrastruktur <strong>von</strong> materiellem Transport und <strong>von</strong> Datenübertragung war<br />
damit revolutioniert. In der Tat waren an Kupferstichen immer wieder der subjektive<br />
Einschlag des Kupferstechers und die Rezeptionsästhetik seiner Zeit in<br />
Form <strong>von</strong> Abweichungen in der Linienführung ablesbar. Der Weg führt nun<br />
<strong>von</strong> der individuellen Differenz in der Reproduktion zur technisch disziplinierten<br />
Wiedergabe. Clarke publiziert die in der Bibliothek der Universität <strong>von</strong><br />
Cambridge aufgestellten antiken Inschriften in typographisch analoger Drucktechnik:<br />
»The endeavour which has been made to introduce a species of type<br />
suited to the hthography of the Antients, will afford a more aecurate representation<br />
of the appearance of Inscriptions on Grecian Marbles than anything<br />
that has hitherto issued from the press« )
260 • MONUMI-NTA GKRMANIAI-:<br />
Wird Geschichtswissen im 19. Jahrhunderts auf der einen Seite kritisch-methodisch<br />
philologisiert, also ganz und gar vertextet, koppelt sich im Zuge verbesserter<br />
technischer Möglichkeiten zur Reproduktion <strong>von</strong> Bildern die historische<br />
<strong>Im</strong>agination vom Text und der geschriebenen Überlieferung ab; »Visual devices<br />
expand other consciousncss of the past« - Bildbände, museale Ausstellung und<br />
historische Stätten »promote visual rather than verbal <strong>Im</strong>ages.« 51 Der Sekretär<br />
der französischen Academie des Sciences (selbst Physiker und Astronom) benennt<br />
in seinem Plädoyer <strong>für</strong> den Ankauf des Daguerre-Patents durch den französischen<br />
Staat die Bundesgenossenschaft <strong>von</strong> Archäologie und Photographie,<br />
den buchstäblich medienarchäologischen Blick: Bei der Ansicht der ersten <strong>von</strong><br />
Daguerre ausgestellten Bilder drängt sich ihm der Gedanke auf, welchen Vorteil<br />
während Napoleons ägyptischer Expedition 1798 »ein so genaues und schnelles<br />
Mittel der Wiedergabe gewährt haben würde«, sowohl zur Massenregistrierung<br />
als auch Wahrung hieroglyphischer Darstellungen, die der gelehrten Welt »durch<br />
die Habgier der Araber und den Vandahsmus gewisser Reisenden« verloren<br />
gegangen sind: Um Millionen <strong>von</strong> Hieroglyphen zu kopiren, welche die Monumente<br />
<strong>von</strong> Theben, Memphis, Karnak u.s.w. bedecken, würden jahrelange Reisen<br />
und Legionen <strong>von</strong> Zeichnern erforderlich sein; »mittels des Daguerrotyps<br />
vermöchte ein einziger Mensch diese unendliche Arbeit zu gutem Ende<br />
führen.« 52 In die photographische Praxis aber schreibt sich die Chemie der Substanz<br />
als Verrauschung gegenüber der Metaphysik des perfekten Abbilds ein. Als<br />
1849 der Schriftsteller Maxime du Camp (begleitet <strong>von</strong> Gustave Flaubert) im<br />
Auftrag der Pariser Academie des Inscnptions et des Beiles Lettres die Monumente<br />
und Dokumente Ägyptens im neuen Bildmedium aufzeichnet, versagt es<br />
zwar nicht angesichts der Denkmäler, doch bei der Dokumentation eben jener<br />
Hieroglyphen; gegenüber ihrer photographischen Unscharfe insistiert auch weiterhin<br />
die handzeichnerische Technik, deren präziser Vollzug an kognitive<br />
Lesung, an Hermeneutik gekoppelt ist. Demgegenüber sieht der photographische<br />
Apparat nichts als Bilder und trennt nicht Aufschrift und Stein. 53 Auch das<br />
mediale Gesetz <strong>für</strong> ein photogrammetnsches Denkmälerarchiv heißt Kopplung<br />
<strong>von</strong> (Bau-)Zeichnung und Photographie:<br />
»Das Material muß aber in Zeichnung und Bild bestehen, während die einseitige<br />
Bevorzugung des Bildes in Photogra'phien zu einer Verflachung der Kunstwissenschaft<br />
führt, der darum nur das mit Hilfe der Meßbildkunst errichtete Archiv der<br />
51 David Lowenthal, The Past is a Foreign Coumry, Cambridge (UP) 1985, 258<br />
32 Francois J. D. Aragon, Das Daguerreotyp (1839), zitiert nach: Hubertus <strong>von</strong> Amelunxen,<br />
Die aufgehobene Zeit. Die. Erfindung der Photographie durch William Hcnr<br />
Fox Talbot, Berlin (Nishcn) 1988, 58<br />
33 Burkhard Müller, Auf Reisen mit Flaubert. Du Camps Orient-Fotografien, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung v. 23. Mai 1998, Beilage, VI
ElNBKUCI I DI-.R BlI.ni.K IN DHN Tl-.XT OHR HlSTORII- 261<br />
Baudenkmäler vorbeugt. da die Bilder nur eine Übertragung des freien Ausblicks<br />
am Orte in das Arbeitszimmer vorstellen. Was man nicht sehen kann,<br />
kann man nicht messen; da<strong>für</strong> sieht das Bild alles auf einem Standpunkte Sichtbare<br />
auf einmal, erspart darum das Einzelsehen an Ort und Stelle . Soll dieses Bild<br />
zur Messung benutzt werden; so muß die Herleitung in die Papierfläche<br />
übertragen werden.«' 14<br />
Drawing thvngs together (Bruno Latour). Berenson sieht den photographisch supplementierten<br />
Blick auf Seiten der Naturwissenschaften: Vergleichende Betrachtung<br />
ist jetzt objektiv möglich; »such a comparison attains almost the aecuraey of<br />
the physical science« . Demgegenüber heißt Kupferstich, nach<br />
Charles Blanc: »Wc agree with Diderot that engraving IS less a copy than lt IS a<br />
translation. » 55 <strong>Im</strong> Fall paläographischer Kopien heißt Pausen Abschreiben und<br />
ist eine mithin performative Kritik der Schriftzüge des Urkundenonginais. Photographische<br />
Abbildungen sind da<strong>von</strong> in einer anderen Form, als. nachträgliche<br />
Manipulation, betroffen: Zwar kann die Hand des Retoucheurs nachhelfen, »doch<br />
sobald diese thätig wird, tritt eben ein, was man vermeiden will: das Verfahren<br />
steht dann nicht mehr als ein rein mechanisches da und büßt an technischer Sicherheit<br />
ein.« So pflegen die Korrekturen bei der Photogravüre zahlreich zu sein. 56<br />
Urkundenphotographie liest ihr Objekt als Bild; während sich die Pause auf die<br />
Wiedergabe <strong>von</strong> Kontur und Form der Buchstaben beschränkt, präsentiert der<br />
Lichtdruck »ein Gesammtbild des jetzigen Zustandes der Urkunde«: etwa Farbe<br />
und Beschaffenheit des Pergaments, und Erhaltung des Schreibstoffs. Die autographische<br />
Nachbildung läßt sich praktisch nur durchführen, wenn - wie Plarttung<br />
bei den meisten seiner Spccimina - die Wiedergabe sich auf diplomatisch<br />
charakteristische Stücke beschränkt, »und den sonstigen Text, also den eigentlichen<br />
Körper der Urkunde, wegläßt.« 37 Bei dieser paläographischen Abschrift<br />
werden die Kürzel, Schleifen und sonstigen Merkmale festgehalten 58 , also die Differenzkntenen<br />
des Schriftsatzes. Ohne Textkörper (bei Rück heißt er »Kontextteil«)<br />
wird die Urkunde hier in eine optische Adresse überführt; diese (<strong>von</strong><br />
Mabillon vertraute) »gestauchte, auf die graphischen Charaktenstika verkürzte<br />
Wiedergabetechnik« ist gleichsam, ein graphischer Regest .<br />
54 Albrecht Mcydcnbauer, Handbuch der Messbildkunst. In Anwendung auf Baudenkmäler-<br />
und Reise-Aufnahmen, Halle/Saale 1912, iii, 30 u. 37f<br />
^ Blanc, Grammairc, 658, zitiert u. übersetzt nach Le Mcn 1994<br />
"•' J. v. Pflugk-Harttung, Über die Herstellung der neuesten Abbildungen <strong>von</strong> Urkunden,<br />
in: Historische Zeitschrift 53 (1885), 95-99 (96)<br />
37 Heinrich v. Sybel, Urkundenbilder in Lichtdruck oder Durchpausung, in: Historische<br />
Zeitschrift 53 (N. F. 17), München / Leipzig 1885, 470-476 (474)<br />
58 Theodor Schieffer, Die Göttinger Papsturkunden-Sammlung in Bonn, in: Rück (Hg.)<br />
1989
262 MONUMKNTA GkRMANIAF.<br />
Nie Gesehenes lesen: Urkundenphotographie, dem menschlichen Augen<br />
überlegen, entzaubert Pahmpsestc. <strong>Im</strong> Unterschied zu chemischen Verfahren<br />
der Lesbarmachung wird durch photographische Verfahren »das Objekt in keiner<br />
Weise verändert oder beschädigt« 59 ; der me^/zenarchäologischc Blick gräbt<br />
Daten aus, ohne sie zu zerstören. 60 »In jedes Schriftwerk haben die Schreiber<br />
und Leser so viel Lebendiges hineingelegt , das der Auferweckung harrt«<br />
. Eine technisch zu sich gekommene, zunächst idealistisch konzipierte<br />
Entwicklung latenter Bilder sind das Thema einer Medienarchäologie,<br />
die Medien nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt <strong>von</strong> Gedächtnisanalysen<br />
meint. So kann die Photographic »oft mehr aus dem Original herausholen<br />
, als mit dem bloßen Auge zu erkennen ist«. 61 Jenseits der klösterlichen<br />
Hermeneutik alter Codices (und in ihrer konsequenten säkularen Nachfolge)<br />
interessieren sich dann Archäologen, Altphilologen (wie Ulrich <strong>von</strong> Wilamowitz-Moellendorf),<br />
Astrologen und Kriminologen <strong>für</strong> den neuen technischen<br />
Blick - hier nicht durch die Universität, sondern das Medium miteinander verbunden.<br />
Denn photographische Verfahren bilden Daten nicht schlicht ab, sondern<br />
generieren sie; sie ist m der Lage, »Bilder herzustellen , bei denen die Contraste in der Lichtwirkung stärker sind als auf dem Original,<br />
und welche daher dem Auge mehr Details sichtbar machen, als das Original<br />
es vermag.« 6 Darüber hinaus vermag Photographie im Unterschied zu<br />
invasiven Lektüren das, was sie zur Sichtbarkeit bringt, auch zur »dauernden<br />
Festhaltung« zu bringen, also Archive zu bilden .<br />
Palimpsestphotographie war ein Argument zur Durchsetzung dieses Reproduktionsmediums<br />
auf dem Gebiet der Diplomatik, womit es in seinen Mampulalionsmöghclikcitcn<br />
erkannt wird, andererseits aber — jenseits der editonsch<br />
stabilisierten drucktechnischen Edition - die Definition der Reproduktion<br />
yi Georg Baumert / Max Dennstedl / Felix Voigtländcr, Lehrbuch der Gerichtlichen<br />
Chemie, Bd. 2: Der Nachweis <strong>von</strong> Schnftfälschungcn, Blut, Sperma usw. unter besonderer<br />
Berücksichtigung der Photographie, 2. Aufl. Braunschweig (Vieweg) 1906, Einleitung,<br />
5<br />
60 Einen solchen buchstäblich medienarchäologischen Akt beschreibt der Direktor des<br />
Staatsarchivs Düsseldorf <strong>für</strong> die Wiedcrlesbarmachung zusammenklebender Altarchivalien<br />
eines Ende des Zweiten Weltkriegs zur Bergung bestimmten, dann versenkten<br />
Lastkahns: Bernhard Vollmer, Die Photographie und die Mikrophotographie als<br />
1 lilfsmittel der Archive, in: Archivalische Zeitschrift 47 (1951), 211-215 (213f)<br />
61 Helmut Koch, Original und Kopie, in: Archivarbeit und Gcschichtssforschung, hg. v.<br />
d. Hauptabt. Archivwesen im Ministerium des Innern der Regierung der Deutschen<br />
Demokratischen Republik, Berlin (Rütten & Loening) 1952, 120-132 (132)<br />
62 E. Pringsheim, Photographische Rcconstruction <strong>von</strong> Palimpsesten, in: Verhandlungen<br />
der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin im Jahre 1893, 12. Jg., Leipzig (Barth) 1894,<br />
58f. (Hinweis Peter Gcimer, Berlin)
EINBRUCH DHR BII.DKR IN DI.N TI;XT DHR HISTORIE 263<br />
selbst verunsichert. In der Lesbarmachung abradierter Pergamenttexte fungiert<br />
der vom Ordensbruder Raphael Kögel am 1912 eigens eingerichteten Pahmpsestphotographie-Institut<br />
der benediktinischen Erzabtei Beuron entwickelte<br />
Röntgenblick der Bestrahlung mit UV-Licht als Medicnarchäologie diskursiven<br />
Abfalls, buchstäblich; über einen Mittelsmann in London steht Kögel in<br />
Verhandlungen mit der Firma Kodak zur Gründung einer ßenedictine Reflexo-<br />
Copy Limited, und zur Untermauerung heißt das Argument: »The Benedictme<br />
process needs no dark room.« 63 Der Angehörige desjenigen Ordens, dem schon<br />
durch Papst Gregor den Großen die Pflege handschriftlicher Überlieferung<br />
anbefohlen war, wechselt später mit einer gewissen medien(archäo)logischen<br />
Konsequenz (und unter Rückwechsel zu seinem alten Vornamen Gustav nach<br />
seinem Ordens- und Kirchenaustntt 1924) unter Vortäuschung eines fingierten<br />
Studienwegs auf eine Professur <strong>für</strong> Photochemie in Karlsruhe und zur Kriminalistik.<br />
Seine eigene Biographie wurde somit Pahmpsest: »Zugleich betrieb er<br />
systematisch die Entsorgung seiner eigenen Vergangenheit.« 64 Halbreligiöse<br />
Metaphern über Figuren wie Kögel, »der als eine Leuchte seines Ordens galt<br />
und dann in einem Dunkel erlosch« , werden in einer Epoche unter<br />
hochtechnischen Bedingungen jedoch längst <strong>von</strong> der Wirklichkeit selbst unterlaufen;<br />
noch m seiner Zeit als Ordensbruder läßt sich Kögel beim kaiserlichen<br />
Patentamt in Berlin am 23. September 1912 seine »Vorrichtung zum Aufzeichnen<br />
elektrischer Wellen mit Morseapparat« patentieren. Drahtlose Bildübertragung<br />
schickt sich im 20. Jahrhundert an, die bislang historisch-philologische<br />
Tradition aller schriftbasierten Vergangenheit in Televisionen abzukürzen.<br />
Der Anstoß zur Pahmpsestphotographie soll allerdings nicht <strong>von</strong> ungefähr<br />
<strong>von</strong> einem Juristen gekommen sein/ 0 Für Jnridica im Speziellen nämlich galt,<br />
daß der Text entfernt wurde, wenn der Inhalt der Schrift auf wertvollen Pergamenten<br />
bereits anderswo verarbeitet war oder <strong>für</strong> die damaligen Zeiten als veraltet<br />
galt/ 16 James Marchand <strong>von</strong> der Universität Illinois entdeckte bei seinen<br />
63 Die amerikanische Institution des Benediktinerordcns als buchstäblich Incorporated<br />
regt den Mediävisten Ernst H. Kantorowicz nach eigenem Bekunden später zur<br />
Monographie The King's tzi'o Bodies (Princeton 1957, Vorwort) an; dem Zweitkörper<br />
der Historie wäre demnach ein medialer Drittkörper beiseite zu stellen.<br />
64 Johannes Werner, Über P. Raphael Kögel und die Anfänge der Palimpsestforschung<br />
in Beuron, in: Erbe und Auftrag. Benediktinische Monatsschrift, Bd. 73, Heft 2 (1997),<br />
Beuron (Beuroncr Kunstverlag), 138-145 (143f). Siehe auch Wolf Kittler, Literatur,<br />
Edition und Reprographie, in: DVjS 65, Heft 2 (Juni 1991), 205-235 (225f)<br />
6:1 Johannes Herrmann, Otto Gradewitz 1860-1936, in: Wilhelm Doerr (Hg.), Sempter<br />
Apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1368-1968, Bd.<br />
3, Berlin / Heidelberg / New York Toronto 1985, 136-147 (139)<br />
66 Auch dazu R. Kögel, Die neue Pahmpsestphotographie, in: Photographische Korre-<br />
spondenz, Juli 1915, Nr. 658, 1
264 MoNUMKNTA Gl'KMAN!AI-<br />
Forschungen, daß hinter den lateinischen Schriften in italienischen Klöstern<br />
gotische Aufzeichnungen aus der Zeit um das 5. Jahrhundert versteckt sind.<br />
Durch Bestreichen mit einer säurehaltigen Lösung, durch Ultraviolettphotographie<br />
und Entwicklungsbehandlung, durch Einscannen mit 256 Graustufen<br />
und Graustufenseparation sowie durch pixelweise Entfernung <strong>von</strong> störenden<br />
Flecken mit einem Mal- bzw. Graphikprogramm gelingt es ihm, viele dieser<br />
»hinter dem Latein unsichtbaren Texte« wieder lesbar zu machen. 67 Paläographische<br />
Spurensicherung durch das Medium Photographie steht im Bunde mit<br />
Kriminalistik und Medizin^ — eine Riickcrinnerung an die medizinischen<br />
Ursprünge der Semiotik. »Autopsia and histona were two key-words doctors<br />
and historians had in common.«' 1 ' H. A. Erhard moniert in der diplomatischen<br />
Zeicbenkunde <strong>von</strong> 1837 70 , daß der Begriff der Semiotik <strong>von</strong> einer »ganz anderen<br />
Wissenschaft« besetzt sei - der medizinischen Semiotik als Symptomatologie.<br />
Der Ausdruck soll in der Diplomatik daher durch Sematologia ersetzt<br />
werden - ein Begriff, der nicht Inhalte, sondern Formen,<br />
nicht Erzählungen, sondern die Äußerlichkeiten ihres Transportmediums<br />
Schrift meint. Das Gedächtnis daran bedarf keiner Historie.<br />
Schrift zwischen Ornament und Information, Monument und Dokumentation<br />
Auf der Konferenz der landesgeschichtlichen Publikationsinstitute auf dem 9.<br />
Deutschen Historikertag in Stuttgart 1906 schlägt der Kulturhistoriker Karl<br />
Lamprecht in der Debatte über die Form <strong>von</strong> Editionen mittelalterlicher Urkunden<br />
in deutschen Archiven vor, alle älteren deutschen Urkunden bis 1250<br />
oder 1270 zu photographieren, um ihre wissenschaftliche Benutzung zu erleichtern.<br />
71 Harold Steinackcr greift diesen Vorschlag auf und modifiziert ihn <strong>für</strong> die<br />
Region, als Plädoyer <strong>für</strong> die Schaffung landschaftlicher Plattenarchive:<br />
67<br />
Wolfgang Limpcr, OCR und Archivierung: Texterkennung, Dokumentation, Textrecherche,<br />
München (tc-wi) 1993, 13<br />
6S<br />
Otto Mente / Adolf Warschauer, Die Anwendung der Photographie <strong>für</strong> die Archivalische<br />
Praxis, Leipzig 1909, 24, unter Hinweis auf: M. Dennstadt und F. Voigtlaender,<br />
Der Nachweis <strong>von</strong> Schnftfälschungen, Blut, Sperma usw. unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Photographie, Braunschweig 1906<br />
69<br />
Arnaldo Momighano, History between Medicine and Rhetonc, in: ders., Ottavo Contributo<br />
alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Anüco, Rom (Storia e Letteratura)<br />
1987, 13-25(13)<br />
70<br />
In: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und der Künste, hg. v. J. S. Esch / J.<br />
G. Gruber, 29. Teil. Leipzig 1837, 303-309<br />
71<br />
Edmund E. Stengel (Marburg), Über den Plan einer Zentralstelle <strong>für</strong> die Lichtbildaufnahme<br />
der älteren Urkunden auf deutschem Boden. Nach einem Vortrag auf dem Deutschen<br />
Archivtage, in: Minerva-Zeitschrift, 6. Jg., März/April 1930, Heft 3/4, 33-36 (33)
EINBRUCH DI-.R BII.DKR IN DKN TI-.XT DKR HISTORII: 265<br />
»Man stelle die landschaftlichen Urkundenbücher gleichsam >in effigie« her, indem<br />
man alle Originale, die in das Werk hineingehören, aber auch alle <strong>für</strong> die diplomatische<br />
Beurteilung nötigen fremden Originale, m Lichtbildern an einer Stelle vereinigt,<br />
ebenso die Abbildungen oder noch besser die Abgüsse der dazugehörigen<br />
Siegel. Diese Sammlungen <strong>von</strong> Photographien (bezw. Platten) und Abgüssen<br />
könnten <strong>von</strong> den Landesarchiven oder, wenn die Raumverhältnisse das empfehlen,<br />
in den Landesmuseen verwahrt und verwaltet werden. Das Urkundenbuch<br />
in effigie ersetzt natürlich nicht alle Arbeit in den Archiven selbst.« / -<br />
Fortan existieren zwei Textkörper, die Originale im Archiv und ihre photographische<br />
Reproduktion, im Unterschied zur typographischen Standardisierung<br />
der Urkundenedition Monumenta Germaniae Historica. Lamprecht konzipiert<br />
seinen Plan als Reichsunternehmen: ein Jahrhundert, nachdem der preußische<br />
Staatskanzler Hardenberg den Plan einer Zentralisierung realer deutscher<br />
Urkunden aus Archiven in Berlin verfolgt hatte, denn »auch bei wissenschaftlichen<br />
Unternehmungen ist immer der Grossbetrieb am wirtschaftlichsten«<br />
. Da die altösterreichischen Lande nicht m eine »straffe<br />
staatliche Einheit aufgegangen« sind, denkt auch niemand an Monumenta Austriae<br />
.<br />
Die seit 1880 sukzessive vorgelegten Kaiserurkunden in Abbildungen Sickels<br />
und Sybels sind »nicht nur als diplomatische, sondern auch als nationale Unternehmung<br />
gedacht« . Paläographische Schriften werden im späten<br />
19. Jahrhundert zunehmend monumental-dokumentarisch doppelt kodiert:<br />
Träger historischer Information einerseits, als Schriftdenkmäler aber gleichzeitig<br />
auch vom Interpretanten der Nation überdeterminiert. Urkunden sind »trotz der<br />
Besonderheiten der diplomatischen Schrift als Denkmäler, die genau datiert sind,<br />
viel mehr als bis jetzt <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> der Schriftentwicklung« heranzuziehen<br />
, also als Signifikanten, nicht als Transport eines Signifikats<br />
namens Ereignishistonc. Die erste große französische Faksimile-Sammlung,<br />
das Musee des archives departementales. Recueil de fac-simile heliographiques de<br />
documents tires des archves des prefectures, maines et hospices, zusammengestellt<br />
anläßlich der Pariser Weltausstellung <strong>von</strong> 1878 <strong>von</strong> Natahs de Wailly, Leopold<br />
Delisle und Jacques Quicherat, hat genau diese gcdächtnissemiotische Funktion.<br />
An der Ästhetik des einzelnen Schriftdenkmals entzündet sich jene organizistische<br />
Metaphonk, die <strong>von</strong> der Archivwissenschaft auf den Gesamt/?ör/>t > r<br />
des Schnftgedächtnisses übertragen wird; »sobald der Deutsche den Schreibgriffel<br />
vom römischen Provinzialen oder vom Iren in die Hand gedrückt erhielt,<br />
begann er dem ersten Buchstaben sein ornamentales Empfinden einzuver-<br />
72 Harold Steinacker, Diplomatik und Landeskunde. Erläutert am Stand der Forschung<br />
<strong>für</strong> die östereichischen Alpenländer, in: Mitteilungen des Instituts <strong>für</strong> Österreichische<br />
Geschichtsforschung, XXXII. Bd., Innsbruck 1911, 385-434 (405t)
266 MONUMKNTA Gl-IRMANIAK<br />
leiben« 73 . Mabillon hat noch die Lehre <strong>von</strong> Nationalschriften vertreten. Demgegenüber<br />
unterstreicht Ludwig Traube in seiner Genealogie der Paläographie die<br />
Verdienste Scipione Maffeis, der den Zusammenhang der verschiedenen lateinischen<br />
Schriftarten durchschaute oder, »wie ich es mit darwinistischer Nomenklatur<br />
ausdrücke«, er erkannte, daß die sogenannten Nationalschriften nicht<br />
verschiedene Arten, sondern Spielarten, »Varietäten derselben Art« (nämlich der<br />
römischen Schrift) sind . In populären Editionen wie der des<br />
Marburger Archivars Gustav Könnecke, Bilderatlas zur <strong>Geschichte</strong> der deutschen<br />
Nationallilcralur (Marburg 1886), die unter dem Titel Deutscher Literaturadas<br />
(Marburg 1909) auch als Volksausgabe erscheint, dient die Photographie zur Faksimiherung<br />
solcher national überdeterminicrter Schriftdenkmäler im Medium<br />
reichsweiter Distribution. Dieser Gedächtnispolitik im Raum des <strong>Im</strong>aginären<br />
der Nation steht ein lnirastrukturellcs Korrelat zur Seite, die Forderung nach<br />
Abgabe <strong>von</strong> Pflichtexemplaren entsprechender Lichtbildaufnahmen an Bibliotheken<br />
und Archive, wie sie das französische Unterrichtsministerium in einer<br />
Verlügung vom I. )um I Y>77 zwar vorgeschrieben, aber in der Praxis nicht durchgesetzt<br />
hat .<br />
Das Germanische Nationalmuseum gibt 1982 ein Faksimile der mit Miniaturen<br />
ausgestatteten Evangehenhandschnft heraus, die um das Jahr 1030 in der<br />
Benediktiner-Abtei Echtcrnach entstanden ist; der damalige Stand des Offsetdrucks<br />
ermöglichte bereits einen Grad der Angleichung <strong>von</strong> Original und<br />
Reproduktion, der iür die Wahrnehmungsmöghchkcit des menschlichen Auges<br />
ununterscheidbar war. Eine subtile Differenz hegt vielmehr auf der Hardware-<br />
Ebene des medialen Speichers, im Stofflichen, da die Struktur der organischen<br />
Materie Pergament eine andere ist als die des modernen Industrieproduktes<br />
Papier. Andererseits ist es die industrielle Herstcllungsweise <strong>von</strong> Papier als Bildund<br />
Schriftträger, der die standardisierte Multiplizicrung absolut gleicher Exemplare<br />
der Wiedergabe des Originals ermöglicht - Kriterium des technischen Medienbegriffs.<br />
»Damit wird eine Verbreitung der vorzüglichsten Quellenschätze<br />
unserer Vorzeit< erreicht, wie sie die Satzungen des Germanischen Nationalmuseums<br />
schon 1852 forderten.« 74 Die Teleologie des GNM, seine Verpflichtung<br />
als Gedächtnis, läuft auf das Medium Photographie hinaus. In seinem<br />
Verlangen nach weiterer Informatisation, mit dem Verschwinden des real existierenden<br />
Monuments im Schrift- oder Bildakt seiner medialen Aufzeichnung,<br />
1<br />
K.ul 1 ..imprechl, Initial -Orn.imeiHik in I l.uulsi In ilien des S. bis 13. |li., I .eip/.ii; 1 8S2,<br />
zitiert nach: Rück 1992:47<br />
74<br />
Elisabeth Rücker, Die Erwerbung des Goldenen Evangehenbuchcs <strong>von</strong> Echtcrnach <strong>für</strong><br />
das Germanische Nationalmuseum Nürnberg, in: Rainer Kahnsitz / Ursula Mende /<br />
dies. (Hg.), Das Goldene Evangehcnbuch <strong>von</strong> Echtcrnach. Eine Prunkhandschrift des<br />
11. Jahrhunderts, Frankfurt/M. (S. Fischer) 1982, 12
EINBRUCH DI-:R BIUM-.R IN DI:N TKXT DI:R HISTORIH 267<br />
vergißt der Historiker leicht die Materialität der Textträger. 7:> Mit der medialen<br />
Unterscheidung <strong>von</strong> Monument und Dokument korrespondiert die Unterscheidung<br />
<strong>von</strong> innerer und äußerer Urkundenkritik in der Diplomatik; angesichts<br />
hochtechnischer Medien überführen Historiker ihre Quellen im Prozeß<br />
der Historisierung (etwa als Edition mittelalterlicher Handschriften) nicht länger<br />
lediglich ins homogene Medium Gutenbergs. Denn solche Handschriften<br />
sind nicht nur historiographische Quellen, sondern auch Aussagen im Sinne der<br />
Diskursanalyse; mit ihren Schriftzügen und Miniaturen sind sie Materialitäten<br />
im Sinn der Mediengeschichte. Als derart konstitutive Einheiten sind sie keine<br />
Dokumente, sondern multimediale Monumente, wie sie allerdings erst die Digitaltechnik<br />
auch archivierbar gemacht hat. »Anstelle eines chronologischen<br />
Handschriftenstammbaums, um den es Historikern und Editoren des 19. Jahrhunderts<br />
ging, tritt die Kopräscnz aller Handschriften in einem digitalen<br />
Museum.« 76 Dieses Museum findet inzwischen als Bildschirmdisplay statt:<br />
»Hypertextes restruetunng of Information Signals the collapse of the page as<br />
a pliysical delimiiing agent .uul the ciul ol lhe book as a unit ol physical endosure«.<br />
77 Die Befreiung der Archiv-Module aus ihrer geschichtsnarrativen Einbindung<br />
und ihre Überführung in die monumentale Kontextlosigkeit <strong>von</strong><br />
Datenbanken ist nicht der End-, sondern ein Zwischenschritt <strong>für</strong> Diskursanalyse<br />
im Sinne Foucaults; <strong>für</strong> die Diplomatik heißt das, Urkunden als Artefakte<br />
einer anderen, non-diskursiven An/Ordnung zuführen zu können. Bereits die<br />
Diplomatik des 19. Jahrhunderts denkt an Urkunden die Infrastruktur des<br />
Archivs mit - womit es unerläßlich war, nicht nur die einzelnen Kanzleien und<br />
Schreibstuben zu erforschen, »sondern vorzüglich auch ihre Zusammenhänge<br />
und Wechselwirkungen«. 78<br />
<strong>Im</strong> Zentralarchiv <strong>für</strong> Historische Sozialforschung (Köln) hat sich aus dem<br />
zunächst quantifizierenden Verfahren eine quellenonentierte Datenverarbeitung<br />
herausgebildet, die inzwischen auch qualitative formale Methoden einsetzt; ihr<br />
Ziel ist die möglichst exakte Abbildung historischer Quellen auf dem Rechner.<br />
75<br />
Siehe dazu, am Beispiel einer epigraphische Inkunabel der römischen Frühgeschichte<br />
aus dem latinischen Satricum, W. E., White Mythologies? Informatik statt <strong>Geschichte</strong>(n)<br />
- die Grenzen der Metahistory, in: Themenheft »Hayden White's Metahistory twenty<br />
ycars aftcr«, in: Storia dclla Storiografia 25 (1994), Mailand (Jaca Book), 23-50<br />
76<br />
Friedrich Kittler, Museen an der digitalen Grenze, Typosknpt, 6; publiziert unter dem<br />
Titel: Museums on the 1 hgital Fronlier, m: Thomas keenan (1 Ig.), The l'iuls ol the<br />
Museum, Barcelona (Fondacion Tapies) 1996, 67-80<br />
77<br />
Lily Di'az, A Simultancous View of History: The Crcation of a Hypermedia Databasc,<br />
in: Leonardo 28, Heft 4 (1995), 257-264 (259)<br />
7X<br />
Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung, hg. v. Karl Brandi, Flarry Bresslau u. Michael Tangl,<br />
Bd. 1, Leipzig 1908, Einleitung, 2
268 MONUMI-INTA Gl-RMANIAK<br />
»Dabei sollen die genuinen Eigenschaften und Wesensmerkmale historischer<br />
Quellen - insbesondere deren Vieldeutigkeit und Kontextbezogenheit - nicht<br />
durch Standardisierung oder Kodierungen unterdrückt, sondern bewußt beibehalten<br />
werden.« 79 Diplomatik handelt immer schon, unter Berücksichtigung <strong>von</strong><br />
Materialitäten der Kommunikation und Schrift als Information, zunächst <strong>von</strong><br />
den standardisierbaren äußeren Kennzeichen des archivischen Stoffs:<br />
»Höchst mannigfaltig wie die einzelnen Thcile sind, aus denen er sich zusammensetzt,<br />
ist nicht wenig damit gewonnen, denselben vorläufig, nach seinen äußern<br />
Unterscheidungszeichen, in einzelne Klassen zu sondern, indem hierdurch, da die<br />
Form einer Sache nothwendig eine Beziehung zu ihrem Inhalt hat, dieser in<br />
einer gewissen Gliederung erscheint und seine Ordnung im Voraus angedeutet ist.<br />
Mit der Form, im ausgedehnten Sinn des Worts, beschäftigen wir uns also<br />
hier; und zwar soll alles Aeußerliche des Stoffs unter diesem <strong>Namen</strong> verstanden<br />
werden: das Material worauf geschrieben ist, die Schriftzüge und Schreibweise;<br />
und die ganze übrige Ausstattung der Urkunden.« xo<br />
Darin liegt tbc contcnl of ibe form (I Iaydcn White): Diplomatik handelt vom<br />
inedienarchäologrschen Blick au! Ur-Ktinde(n). Dieser Blick ist nicht hermeneutisch,<br />
sondern technisch ausgerichtet. Als der Archivar <strong>von</strong> Medem als<br />
Rezensent <strong>von</strong> Eberts Publikation Zur Handscbnfienkunde Epigraphik <strong>von</strong><br />
Diplomatik und Bücherhandschnftenkunde scheidet, wirft ihm Blume in der<br />
Halleschen allgemeinen Literatur Leitung vom Mai 1826 vor, daß »dieser<br />
Gegensatz bei einer rein wissenschaftlichen Behandlung der ganzen Lehre wohl<br />
nicht zu Grunde gelegt« werden dürfe. Kommentiert <strong>von</strong> Medcm: »Allein >wissenschaftlich<<br />
kann doch hier füglich nichts anderes heißen als technisch« . Genau so operiert Gedächtniswissenschaft.<br />
Mikroverfilmung 1940<br />
Mit den Grenzen des Reiches expandiert auch die symbolische Reichweite der<br />
Monumcnta Germaniac Historica. Der Jahresbericht des Reichsinstituts <strong>für</strong><br />
ältere deutsche Geschichtskunde (MGH) vermeldet 1940, daß der Sieg der deutschen<br />
Wehrmacht im Westen den Weg in die Urkunden- und Handschriftenschätze<br />
der besetzten Gebiete geöffnet hat; an die Stelle <strong>von</strong> Urkundenraub (wie<br />
zur Zeit des Ursprungs der MGH unter Napoleon) tritt nun, gedächtnistechnologisch<br />
induziert, die Option der Photokopierung <strong>von</strong> Urkundenbeständen,<br />
79 AHF Informationen (Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen<br />
in der Bundesrepublik Deutschland e.V.) Nr. 68 v. 14. Dezember 1993<br />
so L. B. v. Medem, Zur Archivwissenschaft, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde, hg. L. F. Flöfer,<br />
II. A.Erhard u. ders., Bd. i (IS33/34), 1-51 (I Of)
EINBRUCH DI:R BII.DI.R IN DI:N THXTDKR HISTORII-: 269<br />
namentlich aus dem Nationalarchiv und der -bibliothek in Paris. Archivassessor<br />
Theodor Schieffer tut sich dabei besonders hervor.<br />
Der Präsident des Reichsinstituts wendet sich am 2. August 1940 an das<br />
Staatsarchiv Breslau mit der Bitte, ihm unter Bezug auf eine Entschließung des<br />
Deutschen Archivtags <strong>von</strong> 1929 Urkunden aus der Zeit bis 1200 an die Adresse<br />
des Lichtbildarchivs älterer deutschen Urkunden in Berlin zuzusenden - eine<br />
Konzentration <strong>von</strong> Gedächtniskapital auf der Basis neuer Reproduktionsmedien.<br />
Aber gerade diese technischen Möglichkeiten sind an der Schwachstelle<br />
ihrer Übertragung verwundbar. Das Staatsarchiv Breslau schreibt am 16. August<br />
1940 dem Generaldirektor der Staatsarchive nach Berlin, daß mit Rücksicht auf<br />
die durch die Kriegsverhältnisse eingeschränke Geschäftslage des Staatsarchivs<br />
und die aus dergleichen Ursache »z. Zt. mit dem Postversandt verbundenen<br />
Gefahren« der <strong>für</strong> den Arbeitsbeginn gewählte Zeitpunkt denkbar ungünstig<br />
ist. Bezug ist dabei eine Verfügung des Generaldirektors vom 23. Juli 1940 (A.V.<br />
4831) über die »NichtVersendung <strong>von</strong> Originalen«.<br />
Es verblassen nicht nur Schriften, auch Photographien. Die neapolitanische<br />
Handschrift des Verwaltungsregisters des Stauferkaisers Friedrich II. <strong>für</strong> die Zeit<br />
vom 6. September 1239 bis zum 13. Juni 1240 wird zusammen mit den älteren<br />
Beständen des Staatsarchivs Neapel Ende des Zweiten Weltkrieges in die Villa<br />
Montesano unweit Nola ausgelagert und dort bei einer Vergeltungsaktion der<br />
Deutschen Wehrmacht 1943 vernichtet; der in den dreißiger Jahren <strong>für</strong> das Reichsinstitut<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde angefertigte Film tritt darum an die<br />
Stelle der verlorenen Handschrift. Dessen Negativrolle ist erhalten, allerdings völlig<br />
verblaßt; kaum lesbar ist selbst der älteste Abzug. Daher kommt den Kollationen,<br />
die Eduard Sthamer im Druck des Registers vermerkte, ein umso höherer<br />
Quellenwert zu. 81 Phototechnik im Archiv macht einen wesentlichen Unterschied<br />
zwischen der Photographie, die sich auf das Einzelstück oder die Zusammenstellung<br />
<strong>von</strong> Einzelstücken erstreckt, und der Verfilmung ganzer Bestände. <strong>Im</strong> ersten<br />
Fall dient die Photographie als zeitweiliger, <strong>für</strong> einen bestimmten Fall gebrauchter<br />
Ersatz des Archivdokuments; im zweiten Fall ist beabsichtigt, einen dauernden<br />
Ersatz, »ein ständiges Zweitstück der Archivbestände zu schaffen.« 82 Aus<br />
solchen Sätzen spricht die Erfahrung <strong>von</strong> Weltkrieg II als Durchsetzung des Mediums<br />
Mikroverfilmung; die Verfilmung großer Archivbestände stellt zwar noch<br />
Neuland dar, doch haben »während dieses Krieges größere Aktionen in dieser<br />
Zur <strong>Geschichte</strong> und Arbeit der Monumenta Germaniae Histonca, Katalog der Ausstellung<br />
anläßlich des 41. Deutschen Historikertages München, 17.-20. September<br />
1996, München (MGI I) 1996, 83 u. 85<br />
Horst Rypalla, Technische Fortschritte in Restaurierung und Vervielfältigung, in:<br />
Archivarbcit und Gcschichtssforschung: 1952, 176-184(182)
270 MONUMI-.NTA GKKMANIAI-:<br />
Hinsicht stattgefunden« . Das <strong>von</strong> Zeiss <strong>für</strong> solche Zwecke<br />
entwickelte Mikroverfilmungsgerät Dokumator entspricht in seiner Linearität<br />
(Filmspulen) jedoch nicht der assoziativen Konzeption <strong>von</strong> Vannevar Bushs<br />
Memory Extender A1> :<br />
»Das Durchblättern einzelner Stücke, das nun einmal integrierender Bestandteil<br />
der Forschungsarbeiten in Archiven ist, aber auch schon ein rascheres Überlesen,<br />
das Nebeneinanderstellen verschiedener Archivahen zum Vergleich und zur<br />
Zusammcnarbeiumg sind im Dokumator-/.esegeräz entweder überhaupt<br />
unmöglich oder gestalten sich so umständlich, daß <strong>von</strong> der Anwendung des Lesegerätes<br />
keinerlei Vorteil zu erwarten ist.« <br />
Medienarchive sind eine Funktion der materiellen Haltbarkeit ihrer Träger;<br />
auch nach einer Beobachtungszeit <strong>von</strong> fünfzig Jahren spricht Rypalla noch <strong>von</strong><br />
einem zu geringen Zeitraum, um Endgültiges über die Ersetzbarkeit <strong>von</strong> Archiven<br />
durch Mikrofilmarchive aussagen zu können . Seitdem<br />
wird die Zeit des Gedächtnisses <strong>von</strong> Medien mitbestimmt, die nicht mehr in<br />
Menschenhand beschrieben sind.<br />
S1 Vannevar Bush, As wo may think, in: Atlantic Monthly, Juli 1945, 101-108
ROM ALS SATELLIT<br />
DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
Archivwesen in Italien<br />
Gedächtnismorphologie wird geprägt <strong>von</strong> Archivologie, Genealogie und Taktik.<br />
Paul Kehr wendet sich 1896 mit dem Vorschlag an die Göttinger Akademie<br />
der Wissenschaften, sämtliche Papsturkunden bis 1198 zu sammeln, nach dem<br />
Vorbild der Diplomata-Ausgaben der Monumenta Germamae im Volltext zu<br />
edieren und dabei die Briefmasse nach Empfängern zu ordnen. Diese Entscheidung<br />
führte ihn (da er sich grundsätzlich nicht mit gedrucken Quellenvorlagen<br />
begnügte) <strong>von</strong> Anfang an auf die Archive als Überlieferungskörper, »auf das Verfolgen<br />
und Wiederzusammenfügen <strong>von</strong> Archivfonds, deren <strong>Geschichte</strong> und<br />
Zusammenhang man bis dahin oft nicht gekannt hatte.« 1 Disicctn membra nicht<br />
der Vergangenheit, sondern ihres Gedächtnisses werden so zu einem Korpus im<br />
Medium des Drucks modular wiederzusammengefügt. Michel Foucault hat in<br />
Überwachen und Strafen argumentiert, daß der menschliche Körper in eine<br />
Machtmaschinerie eingeht, »die ihn durchwühlt, zergliedert und wieder zusammensetzt«<br />
2 ; diese Aussage gilt auch <strong>für</strong> seine (Zweit-)Verkörperungsformen als<br />
archivisches Gedächtnis. Urkunden und Akten in Archiven schreiben keine<br />
historische Identität fest. In der Arbeit mit Archiven kommt die Einsicht, hier<br />
mit etwas zu Gedächtnis Gewordenem konfrontiert zu sein, das es am Anfang,<br />
nicht war. An der Historie gilt es ihre archivische Bedmgheit mitzuerforschen,<br />
denn im Unterschied zur menschlichen Neurophysiologie <strong>von</strong> Erinnerung gilt<br />
<strong>für</strong> historisches Gedächtnis die Trennung <strong>von</strong> Adresse und Ort des Gespeicherten.<br />
Kehr Forderung nach einer <strong>Geschichte</strong> des Überlieferungskörpers erfüllt die<br />
Kriterien Gustav Droysens <strong>für</strong> die »eigentliche Quellenkritik, der sozusagen<br />
genealogischen Darlegung der Überlieferung« 3 - ein Begriff, den Friedrich<br />
Arnold Esch, Deutsche Geschichtswissenschaft und das mittelalterliche Rom. Von<br />
Ferdinand Grcgonvius zu Paul Kehr, in: Hartmut Bookmann / Kurt Jürgensen (Hg.),<br />
Nachdenken über <strong>Geschichte</strong>. Beiträge aus der Ökumene der Historiker, Ncumünstcr<br />
(Wachholtz) 1991, 55-76 (68f)<br />
Zitiert nach: James Miller, Die Leidenschaften des Michel Foucault, Köln (Kiepenheuer<br />
& Witsch) 1995, 352<br />
Johann Gustav Droysen, Zur Quellenkritik und deutschen <strong>Geschichte</strong> des 17. Jahrhunderts,<br />
in: Forschungen zur deutschen <strong>Geschichte</strong> 4 (1864), 15-20 (20). Wiederabdruck in:<br />
ders., Texte zur Geschichtstheorie. Mit ungedruckten Materialien zur »Histonk«, hg.<br />
Günter Birtsch / Jörn Rüscn, Göttingen (Vandcnhocck & Ruprecht) 1972, 60-65 (65)
272 ROM ALS SATKU.IT DKS DKUTSCIIKN GKDÄCIITNISSKS<br />
Nietzsche auf seinen Umgang mit Historie überträgt und den Michel Foucault<br />
im Anschluß an seine wissensarchäologischc Methode rezirkuliert, um jede sich<br />
in der <strong>Geschichte</strong> vermeintlich abzeichnende Teleologie zu zerstreuen. 4 Nur daß<br />
es bei Gedächtnisfragen nicht um Geschichtszeichen geht, sondern um Archivund<br />
Bibhothekssignaturen, um Adressen als Abkürzung <strong>von</strong> Speicherdatenmengen.<br />
Dementsprechend ist nicht so sehr die <strong>Geschichte</strong> im Allgemeinen, sondern<br />
das Archiv »der Schauplatz, auf dem verschiedene Interpretationen <strong>von</strong><br />
>Dingen
AIU:IIIV\VI-:SI-:N IN ITALIHN 273<br />
aus, ihren Vorteil >im Fluge zu erfassen^ Was sie gewinnt, bewahrt sie nicht.« 7<br />
Die Differenz <strong>von</strong> Strategie und Taktik definiert damit den Unterschied <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
als Archiv und Aktualität.<br />
Archivwesen in Italien <strong>von</strong> Napoleon bis zum Staatsarchiv in Rom<br />
»Kein Land der Welt ist in Bezug auf Archive trotz aller bureaukratischen Zentralisation<br />
so wenig eine Einheit wie Italien.« 8 In seinem Lagebericht zum<br />
Archivwesen Italiens benennt Kehr, damals als Professor in Göttingen, die italienische<br />
Nationbildung (ihr engineenng) als Standardisierung (auch) seiner<br />
Archive, denn der junge Einheitsstaat fand zunächst eine Zahl <strong>von</strong> Staatsarchiven<br />
<strong>von</strong> »ganz verschiedenem Charakter und durchaus abweichenden Systemen«<br />
vor- divergente Graphismen der Gedächtnisordnung in ihren Signaturen.<br />
»Die große innere Verschiedenheit auszugleichen vermochte er freilich nicht, umso<br />
mehr drang er auf eine äußere Gleichmäßigkeit. nach welchen Prinzipien sind<br />
sie zu organisiren ? Nach dem französischen System der Materien oder nach<br />
dem historischen System der Provenienzen? Endlich: wie ist das Bedürfnis des Einheitsstaates<br />
mit dem partikularen Recht der einzelnen Territorien auszusöhnen?« 9<br />
Anders als in Deutschland wird die Erörterung und Entscheidung dieser Dinge<br />
in Italien »nicht der bureaukratischen Weisheit allein überlassen«, sondern diskursiv<br />
verhandelt. Wer irgend sachverständig zu sein glaubt, vertritt öffentlich<br />
in Wort und Schrift sein Votum; die Reform des italienischen Archivwesens gilt<br />
als eine Frage nationaler Wichtigkeit - im Unterschied zu dem, was die Spezifikation<br />
geheim <strong>für</strong> das preußische Staatsarchiv in Berlin nahelegt - <strong>für</strong> Preußen,<br />
»die wir besser als die Italiener gelernt haben, regiert zu werden«. Hier grenzt<br />
die Gedächtniskybernetik des Archivstaats hart an die <strong>von</strong> Foucault analysierte<br />
Kunst der gouvernementahte. 10 1870 berufen die Minister des Innern und des<br />
Unterrichts in Rom eine Kommission <strong>von</strong> Sachverständigen; bis zum Jahr 1875,<br />
7<br />
Michel de Certcau, Kunst cies Handelns, Berlin (Merve) 1988; dazu: Stefan Germer,<br />
in: Texte zur Kunst, 1. Jg., Nr. 3 (Sommer 1991), 185f<br />
8<br />
Paul Kehr, Das Archivwesen Italiens, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München),<br />
Jg. 1901, Nr. 172, 30. Juli, 1<br />
9<br />
Paul Kehr, Das Archivwesen Italiens II. Die Staatsarchive, in: Beilage zur Allgemeinen<br />
Zeitung [München] Nr. 181, Jg. 1901,3-7(3)<br />
10<br />
Zum Archivstaat Preußen siehe: Cornelia Vismann / W. E., Die Streusandbüchse des<br />
Reiches: Preußen in den Archiven, in: Tumult. Schritten zur Verkehrswissenschaft 21<br />
(Themenheft »preußisch«), Frankfurt/M. (Syndikat) 1995, 87-107; zu Michel I ; oucaults<br />
Analyse der »Steuerkünste« (in Medizin, Navigation und Politik): ders., Sexualität<br />
und Wahrheit, Bd. 2: Der Gebrauch der Lüste, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 3. Aufl.<br />
1993, 178 (unter Betonung der unabdingbar damit verbundenen »Befehlskompetenz«)
274 ROM ALS SAJ I.I.IJ i' DKS DHUTSCHHN GI-DÄCHTNISSHS<br />
dem Erlaß ds neuen Archivgesetzes, schreibt sich zahlreiche Literatur über das<br />
italienische Archivwesen. Archive aber stehen auf der Seite des Staates als Apparat<br />
(seine Prothese und Fortsetzung als Gedächtnis), nicht auf Seiten der Nation<br />
als Diskurs. Von daher trägt schließlich »das bureaukratische Element doch den<br />
Sieg da<strong>von</strong>«; die Staatsarchive werden gegen das Votum der Sachverständigen<br />
dem Ministerium des Innern unterstellt. »Seitdem ist unverkennbar die wissenschaftliche<br />
Auffassung vor der administrativen zurückgetreten; der Beamte im<br />
Archivar überwiegt den Gelehrten« . Explizit analogisiert Kehr diesen<br />
Prozeß mit der Neuorganisation des deutschen Gedächtnisses, das durch die<br />
Zentralisation des Archivwesens geneigt ist, eine gleiche Ordnung des Archivwesens<br />
auch im Ausland vorauszusetzen. Aber der Forscher muß anderenorts<br />
»nicht nur das historische Wissen besitzen, dessen er überall bedarf; er muß<br />
zugleich eine archivahsche Kcnntniß haben, wie er sie sonst nirgends nöthig<br />
hat«. Das heißt speziell <strong>für</strong> Italien: Kenntnis der Morphologie und Genealogie<br />
der Archive.<br />
»Wer auf gründliche und erschöpfende Arbeit über irgend ein Problem der älteren<br />
italienischen oder deutsch-italienischen <strong>Geschichte</strong> ausgeht, muß sich zuvor<br />
in den Besitz der <strong>Geschichte</strong> jedes einzelnen archivahschen Fonds setzen. Es<br />
gibt in Italien keinen anderen Weg, zum Ziele zu gelangen, als die gründlichste<br />
Aufräumen der archivalischen Ueberlielerung, fortschreitend <strong>von</strong> Ort z.u Ort, <strong>von</strong><br />
Archiv zu Archiv, <strong>von</strong> Bibliothek zu Bibliothek, <strong>von</strong> Sammlung zu Sammlung.<br />
Das aber kann nur eine glehrte Körperschaft, ein organisirtes wissenschaftliches<br />
Arbeiterkorps.« <br />
Denn die Gegenwart der Vergangenheit hegt in der Logistik ihrer Speicher. Ausdrücklich<br />
verweist Kehr an dieser Stelle auf das <strong>für</strong> seine Konzentration auf<br />
Akten aus dem Vatikanischen Archiv in die Kritik geratene deutsche historische<br />
Institut in Rom: »Wir würden es <strong>für</strong> keinen Gewinn halten, wenn das Institut<br />
den Schwerpunkt seiner Arbeiten in entfernte Jahrhunderte verlegte, sich mit tausendjährigen<br />
Urkunden beschäftigte, aus denen gewiß <strong>für</strong> die Ghronologie, die<br />
Paläographie, die Diplomatik, die historische Geographie allerlei zu lernen ist,<br />
die aber zum Verständnis der Gegenwart schlechterdings nichts austragen.« 1 ' Die<br />
Ergebnisse geschichtlicher Studien, so dort weiter, erweckten »ein um so größeres<br />
Interesse, je mehr sie sich der Gegenwart nähern.« Kehrs hält das fü richtig<br />
nur in Bezug auf die Leser des Berliner Tageblattes: »Von solcher Anschauung<br />
ist denn freilich nur noch ein kleiner Schritt zu der modernsten Historiographie<br />
in der >Woche* und im >Tag
ARCHIVWHSI-N IN ITALIKN 275<br />
mationen und Diskontinuitäten im Verhältnis <strong>von</strong> Vergangenheit (als Gedächtnis)<br />
und Gegenwart; damit ist der Eigensinn der Archive, der Diplomatik und<br />
der Archäologie eine Blockade gegenüber immediater Rückkopplung <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
an Gegenwart.<br />
»Man wende nicht ein, daß das eine interne Angelegenheit der italienischen<br />
Geschichtswissenschaft sei. Da könnten wir lange auf die Erfüllung unserer Wünsche<br />
warten. Und gegen die nationalistische Geschichtsforschung ließe sich überhaupt<br />
manches sagen. In Italien zumal hat sie, <strong>für</strong> das Mittelalter wenigstens, gar<br />
keine Berechtigung. Will man Rom und Florenz zu Objekten der Lokalforschung<br />
machen? Die Ueberliefcrungen gehören vor allem der allgemeinen Kultur, gehören<br />
der Kirche, gehören dann auch der italienischen Nation, aber zu einem guten Theil<br />
auch dem deutschen Volk. Denn die Zahl der Dokumente unsrer alten Kaiser und<br />
unsrer Vorfahren in diesen italienischen Beständen ist unübersehbar. Es ist also<br />
nicht nur unser gelehrtes Interesse allein, es ist zugleich ein Stück nationaler<br />
Pflicht, sie wieder aufzusuchen, systematischer und umfassender als das bisher hat<br />
geschehen können.« <br />
Monumentale Dokumentcnspeicher werden so selbst zum Nationaldenkmal.<br />
Dabei setzt die mediale Form der Gedächtnisaggregation die Differenz <strong>von</strong> Speicher<br />
und Diskurs; hybride Apparate bedürfen der analytischen Sezierung dessen,<br />
was <strong>für</strong> öffentliche Leser und das, was <strong>für</strong> administrationsinterne Lesung<br />
gespeichert ist:<br />
»Archivalische Fonds befinden sich in mehr oder minderer Zahl auch in den <br />
Bibliotheken. Die Scheidung <strong>von</strong> Archiv und Bibliothek ist in Italien<br />
bei aller bureaukratischen Distinktion (die Bibliotheken unterstehen wie bei<br />
uns der Unternchtsverwaltung, die Staatsarchive, wie wir sahen, dem Ministerium<br />
des Innern) doch nicht so vollständig, wie wir das vorauszusetzen <strong>von</strong> vornherein<br />
geneigt sind. Die Nationalbibhothek, die kgl. Bibliothek und die Bibliothek der<br />
R. Dcputazionc di stona patna in Turin, ciie Ambrosiana in Mailand besitzen<br />
Urkundenbestände und andere Materialien, die nach der strengen Theorie in ein<br />
Archiv gehören würden.«
276 ROM ALS SATKU.IT DI-;S DKUTSUIKN GKIMCHTNISSHS<br />
Mittelalters »zerrissen und zertrümmert« in die Neuzeit gelangt; nur einige<br />
da<strong>von</strong> haben sich den Klöstern selbst als Monumenti nazionali, »gleichsam als<br />
Zeugen da<strong>von</strong>, wie es einst allerorten war«, erhalten . Die Idee<br />
Napoleons, ein allgemeines Zentralarchiv des Regno d'Italia in Mailand zu<br />
begründen, hat in den Augen Kehrs zwar etwas Großartiges, doch der Schaden<br />
ist größer gewesen als der Nutzen. Mit der Aufhebung der Klöster und Kongregationen<br />
sind ihre Archive zwar nicht herrenlos, aber einen Augenblick lang<br />
der Gefahr völliger Vernichtung ausgesetzt; eine große Masse alter Urkunden,<br />
ja ganze Archive gerieten in Privatbesitz oder in die Hände <strong>von</strong> Händlern und<br />
Goldschlägern. »Was nicht zugrunde gerichtet wurde, ging wohl wunderliche<br />
Wege«: Das Archiv <strong>von</strong> Brondolo, südlich <strong>von</strong> Venedig, wird <strong>von</strong> einem deutschen<br />
Antiquar erstanden und verhandelt, um zum Teil im Germanischen<br />
Nationalmuseum in Nürnberg, zum Teil in den Sammlungen der Universität<br />
Heidelberg, zum Teil im Staatsarchiv in Rom zu enden. Aus dem Archiv <strong>von</strong> S.<br />
Salvatore di Lecceto bei Siena haben sich über 200 Urkunden in die köngliche<br />
Bibliothek nach Berlin verirrt ; Archive sind nicht die Bestimmung,<br />
sondern die Segmentierung <strong>von</strong> Gedächtnis. Der antiquarische Historiker - wie<br />
sich der Wissensarchivar Kehr hier selbst bezeichnet - »wird vielleicht zweifeln,<br />
ober sich eines Fortschritts des Menschengeschlechts freuen darf, der mit solcher<br />
barbarischen Verwüstung der alten Ueberlieferung und des Besitzes unsrer Vorfahren<br />
verbunden gewesen ist« . Um etwa den Rücktransport<br />
der Vatikanischen Akten aus Paris nach 1815 zu finanzieren, mußt ein Teil derselben<br />
verkauft werden: archivisches Gedächtniskapital, das sich selbst verzehrt.<br />
<strong>Im</strong> Geheimen Staatsarchiv Berlin, Rep. 178, Alu. VII, Nr. 1, findet sich unter<br />
den Nachrichten über fremde Archive <strong>für</strong> den Zeitraum 1844-1869 als Beilage zu<br />
Nr. 15 der Allgemeinen Zeitung vom 15. Januar 1855 auch ein Kommentar über<br />
die Archive der ehemaligen Republiken Genua und Venedig und die darin aufgespeicherten<br />
Schätze. 12 Aufspeicherung ist genau jener prädiskursive Zustand,<br />
der Archiv <strong>von</strong> Historie trennt. Unter der Sigle »Th. S.« heißt es über das Mailänder<br />
Staatsarchiv und die Spuren seiner Benutzung durch Historiker:<br />
»Nach 1500 finde ich bei keinem Historiker eine Spur <strong>von</strong> eigentlicher Benützung<br />
des Mailänder Staatsarehives, und selbst die später entstehenden Urkunden-Sammlungen<br />
<strong>von</strong> Du Mont u. A., haben verhältnissmassig nur wenige aus diesem Archive<br />
entnommene Documente aufzuweisen. Dass namentlich am Schlüsse des letzten<br />
Jahrhunderts die noch erhaltenen Schätze in Vergessenheit gerathen oder wenigstens<br />
unzugänglich waren, da<strong>für</strong> spricht wohl am deutlichsten die Arbeit Verri's<br />
. Dass nach allem dem, die in Mailand aufbewahrten Schätze bis auf jüngste Zeit<br />
kaum gekannt und kaum benützt waren, erklärt sich aus dem Zustande, in<br />
12 GehStaAr Berlin, Rep. 178, Abt. VII, Nr. 1: Nachrichten über fremde Archive (auch<br />
historische Museen) 1844-1869, Bl. 65r/v
ARCIIIV\VI;SI:N IN ITAI.IKN 277<br />
dem sich nach Jahrtehunderte langer Vernachlässigung der diplomatische Theil dieses<br />
Archives befand . Was früher in Mailand als diplomatisches Archiv bezeichnet<br />
wurde, enthielt nämlich nur die Pergament-Urkunden, und erst 1852 unter der<br />
jetzigen Direction wurde eine Sezione storica dadurch gebildet, dass in dem Locale<br />
der General-Direction alle anderen dahin einschlagenden Sammlungen vereinigt<br />
wurden.« <br />
Die Konstitution einer historischen Sektion benennt den Akt, der Historie als Diskurs<br />
bedingt: nämlich ihre Differenzierung <strong>von</strong> anderen Beobachtungsformen<br />
<strong>von</strong> Zeit-Zuständcn. Demgegenüber kennt der Autor die »im Ursprünge meist<br />
fehlerhafte Anlage« der meisten Archive gut genug um zu wissen, daß sie in<br />
früheren Zeiten »mehr nach durch augenblickliche Umstände gebotene Normen,<br />
als nach dem Bedürfnisse (namentlich der Geschichtsforschung!) entsprechenden<br />
Plänen entstanden sind« . Denn der Vektor <strong>für</strong> Gedächtnis hieß<br />
die längste Zeit Rechtsdokumentation, nicht Historie. 13 Die Verlusterfahrungen<br />
des napoloenischen Zentralarchivs macht sich der italienische Staat bei seiner<br />
Säkularisation geistlicher Archive nicht zunutze; besonders in Rom werden bei<br />
der Aufhebung der Klöster im Jahre 1871 Massen <strong>von</strong> Materialien fortgekommen<br />
, andererseits seit Ende 1874 das aufgehobene Nonnenkloster<br />
<strong>von</strong> S. Maria in Campomarzo selbst zum Sitz des neuen Staatsarchivs bestimmt,<br />
mit einer »großen Menge an Kammern, welche trotz des Umbaus nur zu sehr den<br />
zellenartigen Charaker ihres Ursprunges an sich tragen« - Speicherarchitektur in<br />
arrays als Dispositiv <strong>für</strong> die neue Geclächtnisdisziphn .<br />
Harry Bresslau berichtet in einem im Aktenkonvolut Nachrichten über fremde<br />
Archive gespeicherten Text über seine Reise nach Italien im Herbst 1876. u Nicht<br />
über die Freundlichkeit der Archivare, sondern den sachlichen Zustand besonders<br />
der geistlichen Archive klagt er: »Meist unter der Leitung der bischöflichen<br />
Kanzler, geistlicher oder weltlicher Bureaubeamten, die mit laufenden Geschäften<br />
überhäuft, sich um die ihrer Obhut unterstellten älteren Documente weder<br />
kümmern können noch wollen, gehen diese Archive einem sicheren Verderben<br />
entgegen« . Ist ein archivisches Gedächtnis an den Schaltkreis noch<br />
agierenden Macht angeschlossen, fungiert es als Zwischenspeicher, nicht als<br />
emphatisches Depot <strong>für</strong> Historiographie. Die ursprüngliche Stellung der Archive<br />
|J Dazu Walter Seiner, Zur Gegenwart anderer Wissen, in: Michel Foucault / ders.,<br />
Das Spektrum der Genealogie, Bodenheim (Philo) 1996, 94-113<br />
14 Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin-Dahlem. Hier mit dem Stempel »Kon. Preuss.<br />
historisches Institut Rom« versehen. Umfassend dazu: Arnold Esch, Auf Archivreise.<br />
Die deutschen Mediävisten und Italien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aus<br />
Italien-Briefen <strong>von</strong> Mitarbeitern der Monumenta Germaniae Historica vor der Gründung<br />
des Historischen Instituts in Rom, in: ders. /Jens Petersen (Hg.), Deutsches Ottocento.<br />
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento, Tübingen (Niemeyer)<br />
1998,187-234
278 ROM ALS SATKU.IT DKS DKUTSCHI-N GHDÄCHTNISSI-:S<br />
als Altregistratur einer Kanzlei ist die machtarchäologisch authentische, indem sie<br />
offenbart, daß aus der Perspektive <strong>von</strong> vollziehender Macht ein Dokument erst<br />
dann zur Archivalie wird, wenn es seine Machtbindung verloren hat und damit<br />
administrativ wertlos wird. Dann erst eröffnet sich die Zuganghchkeit <strong>für</strong> den<br />
Historiker, der damit Macht gegenüber in einem per defimtionem nach-träglichen<br />
Verhältnis bleibt, ganz im Sinne der <strong>von</strong> Freud definierten Latenzzeit der traumatischen<br />
Neurose^). »La repesentation du reel est donc generalement tardive.« 16<br />
»Helfen kann da nur eins: schleunige Säcularisation der geistlichen Archive, Einziehung<br />
wenigstens ihres älteren Bestandes (etwa bis zum 15. Jahrhundert) und<br />
Ueberweisung desselben an die Staatsarchive . Für Italien ist es eine Ehrenpflicht,<br />
da<strong>für</strong> zu sorgen, dass die ehrwürdigen Denkmale seiner <strong>Geschichte</strong> (die ja<br />
<strong>für</strong> so lange Zeit auch die unsrige ist) nicht durch die Unwissenheit und Gleichgültigkeit<br />
derer, die sie verwalten, zu Grunde gehen oder in die Hände der Goldschläger<br />
fallen.« <br />
Mit der Nationalisierung Italiens nach 1870 verengt sich dort auch ein<br />
Ges(ch)ichtskreis, der nun nicht mehr den deutsch-italienischen Horizont des<br />
ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation umfaßt, jenes römische<br />
Deutschland, auf dem die Historiographie im Umkreis Stefan Georges<br />
beharrt. 17 Wie im Falle der Einbeziehung Österreichs in das zu administrierende<br />
Territorium der MGH und des GNM gilt auch <strong>für</strong> Italien als Historie die Zwitterstellung<br />
zwischen Eigen- und Fremd(Archiv)körper des deutschen Gedächtnisses.<br />
Vor der italienischen Einigung ist nicht nur die politische Lage, sondern<br />
auch die Wahrnehmung <strong>von</strong> Gedächtnislagen anders. Am 6. November 1829<br />
(be)schreibt Ranke <strong>von</strong> Rom aus die archivische Situation: Zur historiographisehen<br />
»Hervorbringung gehört auch ein gewissermaßen schon eingewohnter<br />
Zustand, wo nichts Neues uns stört, sondern nur das Alte in hergebrachter Weise<br />
auf uns wirkt« 18 - kein random access, sondern Rechnen mit den Beständen. Ita-<br />
13 Sigmund Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion III, Abschnitt<br />
»Latenz und Tradition«, in: ders., Studienausgabe, Bd. IX, Frankfurt/M. (S. Fischer)<br />
1989, 455-584 (516); einen daran anschließenden Kurzschluß <strong>von</strong> Prosopopöie und<br />
Technik beschreibt Freud ebd., 571, in seinem Vergleich der Latenz »mit einer photographischen<br />
Aufnahme , die nach einem beliebigen Aufschub entwickelt und in<br />
ein Bild verwandelt werden mag.«<br />
16 Clement Rosset, Le reel. Traite de l'Idiotic, Paris (Minuit) 1986, 130<br />
17 Siehe W. E., Das »Geheime Deutschland« als Dementi des »Dritten Reichs«: Ernst<br />
Kantorowicz 1933, in:Jerzy Strzelczyk (Hg.), Ernst H. Kantorowicz (1895-1963).<br />
Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz. Vorträge des Symposiums am Institut<br />
<strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan, 23.-24. November<br />
1995, Poznan (Instytut Historii UAM) 1996, 155-164<br />
ls Siehe Martin Ostcrkamp, in: Conrad Wicdemann (Hg.), Rom - Paris - London.<br />
Erfahrung und Selbsterfahrung deutscher Schriftsteller und Künstler in den fremden<br />
Metropolen. Ein Symposion, Stuttgart 1988, 341
ARCHIV\VI-SI-:N IN ITALIEN 279<br />
lien aber hat sich gegenüber dem Geschichtsballast Roms 1870 durchgesetzt. Die<br />
<strong>von</strong> den italienischen Truppen an der Porta Pia des päpstlichen Rom geschlagene<br />
Mauerbresche manifestiert den Einbruch der (National-) <strong>Geschichte</strong> in die<br />
<strong>Im</strong>mobilität der Ewigen Stadt. 19 An die Stelle <strong>von</strong> Befestigungsmauern, die katechontisch<br />
mit Gedächtnis, Depot und Speicher korrespondieren, treten Verflüssigung<br />
und Transgression der Stadtgrenzen durch Kommunikationslinien. Diese<br />
Umwandelung der heiligen Stadt in eine weltliche ist <strong>für</strong> Gregorovius die Kehrseite<br />
jener Zeit, als das heidnische Rom mit gleicher Intensität in das geistliche<br />
verwandelt wurde: »Die Klöster werden zu Bureaus umgeschaffen; man öffnet<br />
die versperrten Klosterfenster oder bricht neue in die Wände, oder macht neue<br />
Portale.« 20 Neue Schaltpläne: Auf der Ebene der Gedächtnisadministration wird<br />
der Befund, daß aller Umbruch der <strong>von</strong> Infrastrukturen ist, manifest. Das Archiv<br />
des italienischen Nationalstaates, der 1870 in Rom die Kirchenstaatsverwaltung<br />
ablöst, besteht zunächst vorrangig aus dem Erbe der päpstlichen Ministerien,<br />
und das heißt: Aktenberge, die teilweise kassiert werden. Gedächtnis als materielles<br />
Dispositiv oszilliert so sehr konkret zwischen Erinnern und Vergessen. Mit<br />
der Eroberung Roms werden dort die Archivalien der aufgehobenen Klöster<br />
zugänglich; aus diesem Grund verfaßt Ferdinand Gregonvius <strong>für</strong> die Historische<br />
Zeitschrift <strong>von</strong> 1876 einen ersten Überblick über die Bestände, unter denen<br />
Historie erstmals selbst eine beobachtungsdifferenzierte Untermenge (Klasse IV<br />
als Archww stonco diplomatico) bildet. Denn in Rom, »wo Stadtgeschichte<br />
immer auch in Weltgeschichte hinüberspielt, stellte sich gerade <strong>für</strong> die nichtitalienischen<br />
Forscher sogleich die Frage, ob sich dieser eigentümliche Charakter<br />
Roms auch in den neue gewonnene Archivahen widerspiegele (insofern speatlum<br />
mundi) oder ob in diesen Beständen nur das lokale, im Vatikanischen Archiv<br />
hingegen das universale Element zu finden sei.« 21 Der heutige Sitz des Staatsarchivs<br />
Rom ist ein vormaliges Gebäude der römischen Universität La Sapienza -<br />
ein monumentaler Bau als Speicher des dokumentarischen Gedächtnisses. So<br />
unterscheidet sich die Tradition der Kirche <strong>von</strong> der des Staates; an die Stelle <strong>von</strong><br />
19 Siehe W. E., Einbruch des Realen in die Visionen Roms: Das Jahr 1870, in: Stefan Germer<br />
/ Michael F. Zimmermann (Hg.), Bilder der Macht - Macht der Bilder: Zeitgeschichte<br />
in Darstellungen des 19. Jahrhunderts, München / Berlin (klmkhardt und<br />
Biermann) 1997,461-469<br />
20 18. Juni 1871. Siehe Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher, hg. u. kommentiert<br />
v. 11. -W. Kraft u. Markus Völkel, München 1991<br />
21 Arnold Esch (Rcz.), über: Lucio Lumc (Flg.), L'Archivio di Stato di Roma, Florenz<br />
(Nardini) 1992, in: Quellen und Forschunge aus italienischen Archiven und Bibliotheken,<br />
hg. v. Deutsches Historisches Institut Rom, Tübingen (Niemeyer) 1993, 73if,<br />
unter Bezug auf: F. Gregorovius, Das Römische Staatsarchiv, in: Historische Zeitschrift,<br />
hg. v. Heinrich <strong>von</strong> Sybel, 36. Bd. (München 1876), 141-165
280 ROM ALS SATI-XI.IT DI-:S UKUTSCHKN GHDÄCHTNISSK.S<br />
Dogmen, welche Archive verschlüsseln, tritt das Ideal der Transparenz der<br />
Datenbanken; damit tritt auch Historie als wissenschaftliches Gedächtnis an die<br />
Stelle <strong>von</strong> Liturgie als religiöser Erinnerung. 22<br />
Die Öffnung der Vatikanische Archive<br />
Die Kopplung <strong>von</strong> Kirchenmacht und Archiv liegt im Registerwesen. »Zahlreich<br />
sind die Nachrichten, die da<strong>von</strong> erzählen , daß die<br />
Päpste selbst die Register benutzten und damit zugleich deren Autorität dartun«<br />
23 - womit das Wissen um Archivpraxis selbst im narrativen Rahmen übermittelt<br />
ist. Schon vor dem Jahr 1859, als das Ende des päpstlichen Staats sich<br />
ankündigt, ließ Papst Pius IX. durch den Archivar Thciner die historischen<br />
Rechte des Papstes auf den Besitz des Kirchenstaats in einem Urkundenbuch<br />
vor aller Welt darstellen« . Der Vektor heißt hier vergangene<br />
Zukunft im juridischen Sinne, nicht Geschichtskultur; unter der Hand<br />
aber reformuliert sich der Diskurs. So entsteht mit dem Codex diplomaticus Dominu<br />
Temporaiis Santae Sedis, »was keineswegs die ursprüngliche Absicht im<br />
Vatican gewesen ist, ein literarisch-wissenschaftliches Monument der <strong>Geschichte</strong><br />
des Kirchenstaats , während dieser selbst unterging« . Die<br />
Archive des Vatikan waren unter der Herrschaft Napoleons »zwar nicht unbeachtet,<br />
aber im Ganzen wissenschaftlich unbeachtet« geblieben, schreibt Gregorovius<br />
< 1876: 145>; tatsächlich aber gibt der oberste Archivar des Kaisers,<br />
Daunou, während der kurzen Zeit der Dislokation päpstlicher Archive nach<br />
Paris (inklusive der Inquisitionsakten) am 1. Oktober 1810 die Anweisung, die<br />
Aufmerksamkeit auf alles zu richten, was die Politik der Kurie aufdecken<br />
kann. 24 Die französischen Archivare können die Masse der Schriftstücke nicht<br />
mehr dokumentarisch klassifizieren, sondern nur noch monumentahsch messen:<br />
durch Zählung der Register, Bände, Konvolutc. »<strong>Im</strong> Allgemeinen scheinen<br />
nicht die Urkunden selbst benutzt worden zu sein, sondern nur die bereits vorhandenen<br />
und damals mit nach Paris gekommenen Repertonen und Indices« -<br />
Archivlektüren zweiter Ordnung; »daneben aber stiess man in Paris auch auf<br />
Stücke, welche bisher noch nicht cingetheilt und noch nicht repertorisiert waren:<br />
' diese sind erst in Paris mit Signaturen versehen worden« und damit als Gedächt-<br />
— Dazu (<strong>für</strong> die Antike) Hubert Cancik, Rome as a sacred landscape. Varro and the End<br />
of Republican Religion in Rome, in: Vi.sihle Religion IV/V (1985/86), 250-265<br />
J! Rudolf <strong>von</strong> 1 leckel, Das päpstliche und sicilisclie Re^i.sterwesen, in vergleichender<br />
Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der Ursprünge, in: Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung,<br />
hg. v. Karl Brandi / Harry Brcsslau / Michael Tangl, 1. Bd., Leipzig<br />
(Veit) 1908,371-511 (443)<br />
24 Siehe Archivalisehe Zeitschrift 5 (ISSO), X2
AKCHIVWKSKN IN ITALIEN 281<br />
ms adressierbar, buchstäblich zuschreibbar. 25 Der Vorschlag, die Physik der<br />
Papiere durch Kassation um ein Drittel zu vermindern, gibt den anwesenden<br />
päpstlichen Archivaren unter Marino Marim Gelegenheit, unliebsame Inquisitionsakten<br />
zum Verschwinden zu bringen. So verknüpft ist Absenz mit Absentierung,<br />
die sich, jenseits physischer Vernichtung, bereits in der bewußten<br />
Fehlsignatur <strong>von</strong> Aktenbündeln manifestiert; Sabotage im Archiv ist ein Spiel<br />
<strong>von</strong> Alphanumerik und Kryptographie. Blinder Fleck des gedächtnis-registrierenden<br />
Blicks der Historie ist die Gegenwart selbst, dergegenüber Wissensarchäologie<br />
buchstäblich auf den Plan gerufen ist; die Pariser Inspektoren<br />
»omitted to ask for the records of the reigmng Pope, which were buried in the<br />
gardens of the Vatican and not recovered for nearly fifty years.« 26 In dem <strong>für</strong><br />
Napoleons geplantes zentrales Europaarchiv provisorisch bereitgestellten Pariser<br />
Palais Soubise manifestiert Daunou die nein order durch Rearrangement vor<br />
allem der Kataloge; »as Daunou lost control of the archive before he finished,<br />
rearrangement was synonym for introducing confusion« - radikaler<br />
Übertragungs- und Rückübertragungsverlust. 27 Die kurze Zeit vor der Rückführung<br />
der römischen Papiere nutzen die französischen Kuratoren nicht <strong>für</strong><br />
Extrakte vermeindlich wichtiger Dokumente, sondern <strong>für</strong> die symbolische<br />
Durchmessung der archivischen Gebirge: Die Akten werden indiziert, und<br />
Daunou versammelte diese Listen als strategische Munition <strong>für</strong> den erwarteten<br />
antiklerikalen Kampf der Zukunft. »Certain key-words made fanatics more<br />
fanatical like Pope, Jesuit, Index, Inquisition«. Als Subjekt und Objekt der<br />
Gedächtmsfindung bleiben die Indices gegenüber dem, was bis nach 1815 an<br />
realen Archiven nach Rom zurückgeht, in Paris, so daß die päpstliche Geheimhaltung<br />
im Medium der Symbolischen, der Adressierbarkeit <strong>von</strong> Speichern,<br />
unterlaufen ist: »The scholars who saw what Daunou could find published their<br />
little harvest, bit by bk , to the world« . Darunter befindet sich auch einer der Herausgeber der Monumenta<br />
Germamae Histonca, G. H. Pertz, der Weihnachten 1821 zum Zweck der Edi-<br />
23 Paul Kehr, Die Kaiscrurkundcn des Vatikanischen Archivs, in: Neues Archiv der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe<br />
der Quellenschriften deutschen <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters, 14. Bd., Hannover<br />
(Hahn) 1889, 345-352 (347). Die Einsicht in die Serie der Registerbände des<br />
Archivio Segreto Pontificio bietet »das Material nur in abgeleiteter Form dar« (346).<br />
2(S Owen Chadwick, Catholicism and History: The Opening of the Vatican Sccret Archives,<br />
Cambridge I97S, 15, unter Bezug auf: J. Schmidlin, Papstgcschichtc der neuesten<br />
Zeit, Bd. 1, München 1933, xi<br />
17 Zu diesem Fall auch Arnold Esch, Überlieferungs-Chance und Uberheferungs-Zufall<br />
als methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985), 529-<br />
570 (549)
282 ROM ALS SATHU.IT DHS DHUTSCI IHN GI-.IMC<br />
tion der Leges-Binde in Kenntnis der in Paris indizierten Bestände römischen<br />
Boden betritt und dort tatsächlich Zugang zu Teilen des Vatikanischen Archivs<br />
gewinnt. Geschichtspolitikkritisch bemerkt Pertz dazu, Petn Schlüssel seien die<br />
Schlüssel des Mittelalters, also dessen Dekodierungsregel, doch »unsere Gelehrten<br />
haben die unwiederbringlichen Jahre der Anwesenheit jener Schätze in Paris<br />
verloren, die diplomatischen Verhandlungen bei ihrer Rückkehr nach Rom auf<br />
Sicherung eines gemeinsamen Eigenthums der gebildeten Mit- und Nachwelt<br />
<strong>für</strong> die bescheidene Forschung nicht Bedacht genommen.« 28 Pertz ist es, der das<br />
Diktum prägt, die beste Verteidigung der Päpste sei die archivische Entheimlichung<br />
ihres Wesens - ein Sein, das damit im Medium des Speichers angesiedelt<br />
und in seiner Zugänghchkeit definiert ist . Buttcrficld zitiert<br />
analog aus dem Nachlaß Lord Actons ein preußisches Gegenstück: »The Keeper<br />
of the Berlin archives said that Prussia had nothing fo fear from publicity<br />
because the worst was already kown.« 29 <strong>Im</strong> Zuge der Arbeiten Theodor <strong>von</strong><br />
Sickels erhält Paul Kehr später Zugang in das päpstliche Geheimarchiv; dort<br />
kann er nicht deduktiv <strong>von</strong> den logistischen Findmitteln ausgehen, sondern<br />
erhält erst in der Arbeit am konkreten Urkundenmaterial nach und nach »einen<br />
annähernden Ueberblick über den gesammten Urkundenvorrath des Vaticanischen<br />
Archivs, dessen Organisation und Anlage« - ein<br />
Wechsel <strong>von</strong> der historisch-dokumentarischen zur wissensarchäologisch-datenverarbeitenden<br />
Ebene. Der Bestand Archiv der Engelsburg ist in seiner ursprünglichen<br />
Einteilung nicht mehr rekonstruierbar, »wenngleich die noch<br />
sichtbaren Signaturen auf den Rücken der Urkunden und eine umfassende Vergleichung<br />
mit den Angaben in den Indices vielleicht eine Zusammenstellungnach<br />
den älteren Eintheilungspnncipien noch ermöglichen« . So<br />
tragen die Artefakte das Gedächtnis ihrer Übertragung als parergonale Spur<br />
nicht nur an, sondern auch in sich; Signaturen werden <strong>für</strong> den Diplomatiker<br />
zum Teil des Textes (als Informationsmenge) selbst. 30 Kehr wird zum Wissengenealogen<br />
und Morphologen des Archivs, indem er die verschiedenen Lagen<br />
der Ordnung anatomisch herauspräpariert:<br />
»Die ganze Anordnung trägt den Stempel der allmählichen Entstehung an sich, so<br />
dass m.ui im Hmzelnen die ursprüngliche Gliederung und die in der Folge zu ver-<br />
- lS G. H. Pertz, Italienische Reise vom November 1821 bis August 1823, in: Archiv der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung eines Gesammtausg.ibe<br />
der Quellenschriften deutscher <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters, 5. Bd. 1824/25,<br />
hg. v. dems., 1 lannover (1 lalm) 1824, Abscliniu Rom: Vatikanisches Archiv, 24-33 (24f)<br />
2y In: Herbert Buttcrficld, Man on Ilis Fast: The Study of the History of Historical<br />
Scholarship, Cambridge (University Press) 1955, 84 (Anm. 2)<br />
30 Siehe W. E., LITTERA.TXT. Distante Blicke auf Buchstaben, in: Eckart Goebcl /<br />
Wollgang Klein (1 lg.), I .iieraun lorselumg heule, Berlin (Akademie) I'W, Hh-')7
AlU'.MIVWT.SHN IN lTAl.lKN 283<br />
schiedenen Malen versuchte Anordnung auseinanderzuhalten hat. Denn die ursprüngliche<br />
Eintheilung musste fortwährend durch die neuen Erwerbungen<br />
durchbrochen werden.« <br />
Mit dem Dazwischentreten eines erwachten historistischen Bewußtseins ändert<br />
sich die Archivästhetik (Wahrnehmung und Selbstorgamsation) erneut hin zur<br />
Präsentistik, als sie an eine neue, nationalpohtische Revolution gekoppelt wird.<br />
<strong>Im</strong> September 1870 weilte Lord Acton in Wien, wo <strong>für</strong> ihn ein Abendessen mit<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke arrangiert worden ist. Unvermittelt wird der Raum des<br />
Archivs zum Ereignis, als die Nachricht eintrifft, daß die italienischen Truppen<br />
im Begriff sthen, Rom <strong>für</strong> König Viktor Emmanuel einzunehmen. In Momenten<br />
politischer Unordnung ist auch die symbolische Ordnung (und damit<br />
Sperre) des Archivs suspendiert; Acton reist also Hals über Kopf nach Rom mit<br />
dem verwegenen Plan, inmitten des Aufruhrs Gelegenheit zum Eintritt ins Vatikanische<br />
Geheimarchiv zu finden. Von wohlmeinenden Freunden aber wird<br />
seine Kutsche schon vor den Toren Roms gestoppt; »the door to the Vatican<br />
archive itself bore a carved inscription, threatening excommunication to any<br />
unauthonzcd person who passed through it.« 31 Minghetti, der italienische Botschafter<br />
in Wien, hatte Rom per Telegraphie <strong>von</strong> Actons Überfall unterrichtet<br />
und damit die Geschwindigkeit des Historikers durch die Gegenwärtigkeit reiner<br />
Singalübertragun« lnterzipicrt. »The Italien troops held him in honourable<br />
custody until order had been restored.«'- Der Zusammenbruch einer<br />
öffentlichen Ordnung zieht nicht zwangsläufig den der Gedächtnisorte nach<br />
sich; mit dem Mauerdurchbruch an der Porta Pia Roms droht auch der Unfall<br />
des Vatikanischen Archivs, aus dem unerwartete Lesarten der Daten, nämlich<br />
Information, sich hätten speisen können. Als 1870 piemontesische Truppen den<br />
Vatikanbezirk besetzen, suchen sie - ebenso wie Acton - nach der römischen<br />
Handschrift des Liber Diurnus, einem zentralen Dokument im Disput wider<br />
die päpstliche Unfehlbarkeit. Die italienische Regierung aber ist vor dem verschlossenen<br />
Archww Segreto des Vatikan stehengeblieben, das zunächst - weil<br />
in Opposition zum neuen Säkularregime - der Forschung noch unzugänglicher<br />
als vor den Ereignissen <strong>von</strong> 1870 bleibt. Ein Jahrzehnt später sitzt der Urkundenforscher<br />
Theodor <strong>von</strong> Sickel tatsächlich im Vatikanischen Archiv und<br />
erfragt eher zufällig ein Beispiel älterer Handschrift, um sie mit vorliegenden<br />
Dokumenten zu vergleichen. »The official told him that they had a document<br />
31 Geoffrcy J. dies, Archivcs and Histonans: An Introduction, in: ders. (Hg.), Archivists<br />
and Histonans, Gcrman I listorical Institute, Washington 1996 (Oceasional Papers No.<br />
17), 5-14(6)<br />
32 Herbert Butterfield, Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship,<br />
Cambridge (University Press) 1955, 82, unter Bezug auf: Theodor <strong>von</strong> Sickel,<br />
Römische Kriniierungen, Wien I 947, />
184 ROM ALS SATKU.IT DI-.S DI.UTSCIIKN GI.DÄCJ U'NLSSI-.S<br />
»vhich would meet the case; and when this was put into his hands lt was the<br />
nstonan who quickly reahsed that herc was the Liber Diurnus himself«, wel-<br />
;hes solange <strong>von</strong> den Archivpräfekten negiert worden war .<br />
>o wird ein paläographisches Monument zum historisch-politischen Dokument<br />
luf Wegen, die nicht archivsystematisch, sondern informationstheoretisch, als<br />
£ffekt stochastischer (Wahrscheinhchkeits-)Prozesse erklärt werden können,<br />
lankes Schüler <strong>von</strong> Sybel hat 1851 die Gelegenheit, in Paris Akten des Wohlahrtsausschusses<br />
der Französischen Revolution einzusehen. <strong>Im</strong> Archiv komnentiert<br />
ein Beamter den darauf liegenden Staub: »1 can assure you with<br />
ibsolute certainty that since that time no hand has disturbed these papers or this<br />
•ase« 33 ; so wird randorn noisc selbst zum Protokoll der Übertragungsverläßlichteit<br />
(signal-to-noise-ratio) <strong>von</strong> Daten der Vergangenheit.<br />
Für die hernach installierten deutschen und anderen Forschungsinstitute in<br />
lom bekommen die päpstlichen Archive eine universale Bedeutung; aufgrund<br />
ier spezifischen Lage der Zentralgewalten im Mittelalter machen etwa die <strong>für</strong><br />
len deutschen Raum in Betracht kommenden Bestände oft die Hälfte des gesamen<br />
Materials aus. 34 Entsprechend erfaßt das vom Preußischen Historischen<br />
Institut in Rom unternommene Editionsprojekt Repertonum Germanicum<br />
:inen geohistorischen Raum als Koordinatennetz, als »Verzeichnis der in den<br />
päpstlichen Reistcrn und Kammeralakten vorkommenden Personen, Kirnen<br />
und Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom<br />
Beginn des Schismas bis zur Reformation.« Das Medium dieses Repertoriums,<br />
ias die Technik des Archivs zum Titel hat, besteht aus einem Textband, der die<br />
Personennamen nennt und auf die Dokumente verweist, und einem Indexband<br />
;twa <strong>für</strong> Wörter und Sachen, sowie die Daten der Regesteneinträge und Fundstellen.<br />
Ein entsprechend strukturiertes Repcrtorium zieht als deutsches Geiächtnismedium<br />
die Kopplung an EDV zwangsläufig nach sich. Bis zu seiner<br />
Öffnung war das Vatikanische Archiv ein Stück unvergangener Vergangenheit,<br />
loch <strong>von</strong> Historie ist erst die Rede, wenn die Geschichtswissenschaft darauf<br />
/.ugntf hat. <strong>Im</strong> präzisen Sinne <strong>von</strong> Droysens 1 lislonk implementiert Preußen<br />
iurz nach Öffnung des Archivs in Rom eine Historische Station: »Das einzige<br />
Mittel, diese Dinge als historisches Material verwendbar zu machen, ist, es zu<br />
>ammeln und zu katalogisieren«. 35 Dieser <strong>Im</strong>puls speist auch die archäologischen<br />
11 I 1. v. SVIH'1, Pariser SIIKIKMI, in: deis.. Von rage und Abhandlungen, München / Leipzig<br />
1897, 365, hier zitiert in der Übersetzung <strong>von</strong> ßutterlield 1955: 83<br />
' 4 Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre<br />
Erforschung, 2. Aufl. Rom (Regenberg) 1951, J57<br />
1:1 Johann Gustav Droysen, Mistorik. I Iistorisch-kritische Ausgabe v. Peter I.eyh, Bd. 1.,<br />
Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann-1 lol/boog) 1977, 74
AKCI IIVWI-.SI N IN ITAI.II-N 285<br />
Rom-Topographien dieser Zeit (etwa <strong>von</strong> Rodolfo Lanciani), das mapping der<br />
Vergangenheit: eine Mobilisierungsmaschine, die sich <strong>von</strong> militärischer Rekognition<br />
nur durch die Wahl seiner Instrumente unterscheidet. Die Öffnung uralter<br />
Archive zieht den buchstäblich wissensarchäologischen Blick auf sich; durch<br />
einen Motu propno vom 1. Mai 1884 richtet Papst Leo XIII. eine Schule <strong>für</strong><br />
Paläographie beim Vatikanischen Archiv selbst ein.
286 ROM ALS SATELLIT ni-.s DI'.UTSCIIKN GI.UÄC:IIINISSI-.S<br />
Reich(s)weiten: Das deutsche historische Institut ROM<br />
Weder im Inneren noch außerhalb des Bewußtseins Deutschlands, dient Rom<br />
lange als paradeutscher Gedächtnisort, als Supplement der nationalen Struktur,<br />
als Archiv der deutschen Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert, die hier<br />
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation zumal nach dessen Ende erinnerte<br />
- ein Echo, das bis zur Idee des römischen Deutschland des Kreises um<br />
Stefan George mitschwingt. Diese enge deutsch-römische Relation ist heute <strong>von</strong><br />
der Distanz der Diskontinuität geprägt, die das historische Verhältnis durch ein<br />
wissensarchäologisches ersetzt: »Nach dem Kriege war das römische Deutschtum<br />
wie vom Winde verweht.« 1 Die Hundertjahrfeier des Deutschen Historischen<br />
Instituts in Rom ist, aller diplomatischen Rhetorik zum Trotz, <strong>von</strong> der<br />
Tatsache einer Diskontinuität geprägt. »Aus diesem Grund machte das Institut<br />
sich selbst zum Gegenstand historischer Forschung.« 2 Diese Ruptur ist ein<br />
Effekt <strong>von</strong> Kommunikationstechniken geworden.Seit 1972 untersteht das DHI<br />
dem Ministerium lür f-orschung und Technologie. Ab 1967 erhält es einen eigenen<br />
Verwaltungsleiter mit der Begründung, »die immer schlechter werdende<br />
Postverbindung zwischen Italien und Deutschland hätte eine wirksame Verwaltung<br />
<strong>von</strong> Bonn aus ungeheuer erschwert.«' Der damalige Direktor erinnert<br />
sich: »Erst in allerletzter Zeit ist es gelungen, die notwendige Kommunikation<br />
mit Deutschland per >Tclefax< wieder zu beschleunigen.« <br />
Rom als Gedächtnisspcichcr der<br />
deutschen Nation und deutsch-römische Archrobc/.i-ige<br />
1818 reist Johann Friedrich Böhmer, später Sekretär und Kassenführer der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> Altere Deutsche Geschichtskunde in Frankfurt (MGIT), nach Rom.<br />
1 her kommt er in Kontakt nicht mit der Antike, sondern mit der mittelalterlichen<br />
deutschen Kunst, vermittels der Maler Cornelius, Schnorr <strong>von</strong> Carolsfeld, Passavant.<br />
1 Ein nur scheinbares Paradox: die Bildung deutschen Nationalbewußtseins<br />
erfolgt hier über den Umweg Rom. Bartholdy, Repräsentant Preußens in Rom,<br />
verstand die Malerei in seiner Wohnung durchaus als nationale Angelegenheit; sie<br />
war erstellt durch preußische Künstler. Hier liefen die Bemühungen Peter Cor-<br />
1 Archiv Dill Rom, Nachlaß 1 liltcbrandt, Nr. 7: Lebenserinnerungen, 2. Fassung<br />
(Mascliinen.skripi), 24<br />
1 Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. Reinhard Elze / Arnold<br />
Esch, Tübingen (Niemeyer) 1990, Vorwort<br />
3 Reinhard Elze, Das DHI in Rom 1888-1988, in: Elze / Esch 1990, 24<br />
4 Siehe Ernst Schulin, Traditionskntik und Rekonstruktionsversuch: Studien zur Entwicklung<br />
<strong>von</strong> Geschichtswissenschaft und historischem Denken, Göttingen 1979, 29
RI-:K:II(S)WI-:ITHN: DAS DKUTSCHK HISTORISCH IK INSTITUT ROM 287<br />
nelius' und Friedrich Overbecks um die monumentalbildnerische Erneuerung<br />
deutscher vaterländischer Kunst im 2. Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zusammen.<br />
In Rom prallen Antike und Christentum nicht nur historisch, auch ästhetisch aufeinander.<br />
1814 senden Cornelius und andere <strong>von</strong> Rom aus eine Denkschrift<br />
an Mettermch in Wien, an den bayerischen Kronprinzen Ludwig in München und<br />
an den preußischen Staatskanzler Hardenberg in Berlin, um die Förderung<br />
nationaler Monumentalprojekte anzuregen. 5 Später verfolgt das Preußische Historische<br />
Institut in Rom den Plan, die Räume der Villa Massimo mit Freskodarstellungen<br />
deutscher Maler (Schnorr, Veit, Koch, Overbeck) gewissermaßen als<br />
ein nationales Monument zu besetzen, das mit der Übernahme durch das Preußische<br />
Historische Institut der Nachwelt erhalten werden soll. »Das gentile und aus<br />
dem Mittelalter kommende Bewußtsein eines Reichszusammenhangs ist den<br />
Deutschen durch die Katastrophe <strong>von</strong> 1945 weitgehend genommen« . Der Bezug der deutschen Reiche zu Rom ist bis zu dieser Diskontinuierung<br />
ein metonymischer; Kehr verteidigt 1926 mit diesem Argument die Notwendigkeit,<br />
daß (junge) Historikern mit dem italienischen Ausland in Kontakt<br />
kommen und dessen kulturelle Besonderheiten kennenlernen: Roms und Italiens<br />
historische Überlieferungen, »welche auf Jahrhunderte hinaus zugleich Überlieferungen<br />
der deutschen <strong>Geschichte</strong> sind«, bilden ein Lehr- und Lernmaterial des<br />
deutschen Gedächtnisses. 6 Der deutsch-römische Bezug, nachdem er <strong>von</strong> der<br />
Historie zur Wissensarchäologie diskontinuiert worden ist, bleibt in den Speichern<br />
aufgehoben. Für den Kenner der italienischen Archive bestand kein Zweifel<br />
darüber, daß noch viele unbekannte Dokumente <strong>von</strong> Wichtigkeit <strong>für</strong> die<br />
deutsche <strong>Geschichte</strong> dort verborgen lagen: »Wie hätte das auch anders sein können<br />
bei der engen Verbindung des deutschen Königtums mit Rom und Italien im<br />
Mittelalter«; schließhchhatte jeder der kaiserlichen Romzüge in den italienischen<br />
Archiven seine Spuren hinterlassen . Historiographisches mapping<br />
heißt hier Nachzeichnung <strong>von</strong> Herrscherrcisewegen; auf der Sicherung solcher<br />
Trassen (trace/Spuv) beruht das Indizienparadigma einer Historie, die <strong>von</strong><br />
daher auf Ereignisse schließt. Archiv-Spuren sind solche, die sich der historische<br />
Diskurs durch Aneignung unterwirft - »Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten.«<br />
7 Und das heißt <strong>für</strong> das deutsch-historische Institut in Rom Strategie statt<br />
bloßer Taktik in der Gedächtnispolitik:<br />
Monika Wagner, Allegorie und <strong>Geschichte</strong>, Tübingen 1989, Kapitel II, 41 ff<br />
Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin-Dahlem, I Iauptabt. (HA) I, Reposirur 178, Abt.<br />
XXXV, Nr. 8, Vol. I: »Preußisches Staatsministerium. Akten betreffend: Das preußische<br />
historische Institut in Rom. Band vom 4. Dezember 1929 Titel Rom. Preuß. Min.<br />
Präs. an Finanzmin; Ref.: Dr. Kehr. Berlin, 7. Juli 1926<br />
So der notorische Titel eines Aufsatzes <strong>von</strong> Sigmund Freud, in: Internationale Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> ärztliche Psychoanalyse Bd. 2 (1914), 485-491
288 ROM ALS SATI-.I.UT DI-:S ni-.uTsr.iii-.N GI-DÄCIITNISSHS<br />
»Der Leitung des Instituts stand aber <strong>von</strong> vornherein fest, daß nur eine systematische<br />
Durcharbeitung der Archive und ihrer Fonds anstatt der stoßweisen und<br />
oberflächlichen Gelegenhcitsforschungen der früheren Zeit zum erwünschten<br />
Ziele führen könne. Und welche Aussicht eröffnete sich hier unsern jüngeren Mitgliedern:<br />
durch Forschungsreisen über das ganze schöne Land hin bis in die entlegensten<br />
Orte den Gesichtskreis zu erweitern, Land und Leute kennen zu lernen,<br />
sich des unerschöpflichen Reichtums dieser Überlieferung zu bemächtigen.«<br />
<br />
Kehr als Geschichtsdatcnsammler formuliert hier seine Archivsystematik. Es<br />
geht um historische Hermeneutik als Beherrschung einer Textlandschaft, das<br />
mapping <strong>von</strong> Archiven als deren Durchquerung. So entsteht eine archivologische<br />
Achse Berlin/Rom: das Abkommen Kehrs mit dem römischen Istituto Storico<br />
Italiano und der Plan einer gemeinsamen Publikation Regesta chartarum Italiaex<br />
die mit dem Endpunkt 1378 der deutschen Quellenedition MGH italienischen<br />
Urkundenstoff(Stengel 1938) bereitstellen soll. Die deutsche Seite wählt zur<br />
Bearbeitung die alten Ghibellinenstädte Pisa, Siena, Volterra, die Italiener Florenz,<br />
später Rom und Neapel. Die <strong>von</strong> beiden Instituten herausgegebenen Regestenbände<br />
tragen auf ihrem Titelblatt »als erinnerungsvolles Sinnbild dieses<br />
wissenschaftlichen Bündnisses ein Medaillon mit den Büsten <strong>von</strong> L. A. Muratori<br />
und G. W. Leibniz, deren Andenken sie gewidmet sind, und an deren Traditionen<br />
sie anknüpfen« ; das heißt Aufbereitung diplomatischer<br />
Daten zu Information, die dann als <strong>Geschichte</strong> geschrieben werden kann. Andere<br />
Aufgaben des Instituts liegen »auf geistesgeschichtlichem Gebiet« (Stengel 1938),<br />
doch die Primäraufgabe heißt Mobilisierung archivischer Speicher. Ein deutsches<br />
Geschichtsinstitut gerinnt zur Monumentahsicrung des Nationalen, wenn es<br />
unter Reichsforschung in Italien subsumiert wird. Der deutsche Historiker Schlözer<br />
berichtet im Herbst 1888 über gefährliche Rivalen der Preußischen Historischen<br />
Station, etwa die österreichische Schule unter dem Diplomatiker <strong>von</strong><br />
Sickcl, »der aus literarisch genügsam bekannter Eitelkeit uns zu schaden sucht,<br />
während die französische Schule aus nationaler Eil ersucht uns in der I lerausgabe<br />
<strong>von</strong> Dokumenten den Rang ablaufen mochte. 8 Die Edition <strong>von</strong> Archivalien gilt<br />
somit selbst als monumentale Allegorie des Nationalen. Der Speicher Rom 9<br />
oszilliert zwischen nationalem Gedächtnisort (als Satellit) und Kosmopohtik; ein<br />
Zeitungsartikel Maximilian Ciaars unter dem Titel Römischer Brief (Rom, März<br />
1901) nennt <strong>für</strong> das vergangene Vicrteljahrhundert die Wissenschaft und ihre Ver-<br />
Schlözer an Außenministerium, 24. August 1888 = Nr. 3 I, Bl. 232 f., zitiert nach:<br />
Lothar Burchardt, Gründung und Aufbau des preußischen Historischen Instituts in<br />
Rom, in: QFIAB 59/1979, 334-391 (347f)<br />
Siehe W. E., Ist die Stadt ein Museum? Rom zum Beispiel, in: Dirk Roller (Mg.), Stadt<br />
und Mensch. Zwischen Chaos und Ordnung, Frankfurt/M. u. a. (Peter Lang) 1996,<br />
263-286
RI:K;H(S)\VKITI':N: DAS DI-.UTSCIII-: HISTORISCHE INSTITUT ROM 289<br />
tretung in den verschiedenen Nationen, »die sich an dem unerschöpflichen Wissensquell<br />
niederließ, den <strong>für</strong> alle Teile und Zweige der Weitvergangenheit die<br />
ewige Roma mit ihren lebendigen und gedruckten Erinnerungen, mit Archiven<br />
und Bibliotheken, Handschriften und Büchern, Bildern, Statuen, Steinen und<br />
Monumenten darbot.« 10 Rom repräsentiert alle Formen der Gedächtnisaggregation<br />
im double-bind <strong>von</strong> kosmopolitischer und nationaler Ästhetik. Kehr sieht<br />
1926 das Preußische Historische Institut nicht allein als Außenposten des deutschen<br />
Gedächtnisses, sondern ebenso relational im Kontext der Kolonie ausländischer<br />
Institute in Rom; »alle anderen Nationen sind sich dieser Notwendigkeit<br />
einer innigeren Berührung mit den auswärtigen Kulturzentren bewußt«. Preußen<br />
darf dabei nicht hinter dem Reich (welches das Archäologische Institut betreibt)<br />
zurückstehen. 11 Das Gedächtnis des deutschen Reichs ist <strong>von</strong> den Dokumenten<br />
im Vatikanischen Archiv zunächst nicht unmittelbar berührt. Das Statut <strong>für</strong> die<br />
Preußische Historische Station in Rom vom 8. April 1888 definiert jedoch als<br />
Institutsaufgaben neben der Erstellung des Repertonum Germanicum und der<br />
Erfassung der entsprechenden päpstlichen Nuntiaturberichte aus Deutschland<br />
»die wissenschaftliche Erforschung der deutschen <strong>Geschichte</strong> zunächst im Vatikanischen<br />
Archiv; sodann in den übrigen römischen und italienischen Archiven<br />
und Bibliotheken.« 12 <strong>Im</strong>jahresbencht des Instituts <strong>von</strong> 1905 läßt Kehr den Passus<br />
gesperrt drucken: »die röm. u. ital. Archive u. Bibliotheken systemat. zu durchforschen«,<br />
mit dem nicht mehr gesperrt gedruckten Nachsatz »und alle <strong>für</strong> die<br />
deutsche <strong>Geschichte</strong> irgend wichtigen Materialien zu verzeichnen«. Die folgenden<br />
Jahresberichte bis zum Weltkrieg enthalten nur noch den gesperrten Teil. <strong>Im</strong><br />
Unterschied zum italienischen Schwesterinstitut Istituto itahano per ü mediocvo<br />
wird auf nur lokal relevante Materialien bei dieser Erfassung verzichetet; <strong>für</strong> die<br />
<strong>von</strong> Fedor Schneider verzeichneten Regesten der Stadt Volterra (1907) heißt es<br />
im Vorwort zur Begründung des Zeithmits der Urkundenaufnahme <strong>von</strong> den ältesten<br />
erhaltenen bis zum Jahre 1300,<br />
»Dieses Jahr hat sich das königl. preußische historische Insulin zur Grenze der<br />
<strong>von</strong> ihm herausgegebenen Regesten gesetzt, weil die große Zeit der Staufer auch<br />
in ihren letzten Ausläufern berücksichtigt werden sollte und mit der Wende des<br />
10<br />
Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, Rep. 92, NL Kehr, A V 5: »Deutsches histor. Inst,<br />
in Rom«, Bl. 179<br />
11<br />
Kehr ebd., Hauptabt.(HA) 1, Repositur 178, Abt. XXXV, Nr. 8, Vol. I (fasc. cit.)<br />
12<br />
Archive und Bibliotheken sind hier Subjekt und Objekt der Forschung; nach 1900 werden<br />
die bibliotheks- und archivgestützten Forschungsergebnisse, ergänzend zur Zeitschrift<br />
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken in der<br />
besonderen Schriftenreihe Bibliothek des Königlich Preußischen Instituts veröffentlicht.<br />
Die Bibliothek wird somit zur (publizistischen) Performance, also transitiv verstanden,<br />
ein Medium der Transformation <strong>von</strong> Archivdaten in diskursiv zirkuherbares Wissen.
290 ROM ALS SATI-.I.I.IT m-.s DKUTSCIIKN GKI>ÄCI-ITNISSI-:S<br />
XIII, Jahrhunderts das rein lokale Material zu überwiegen beginnt; Dokumente<br />
allgemeiner Bedeutung werden seither recht selten. Wir aber, die wir im Speziellen<br />
Allgemeines, im Zufälligen Gemeingültiges suchen und suchen müssen, wir<br />
mußten auch unser Ziel innerhalb des Notwendigen zu stecken wissen.« 13<br />
Das Deutsche Reich fungiert also als Hohlform des Gedächtnisdiskurses, einer<br />
national bestimmten Vorstellung vom historischem Zusammenhang Deutschlands<br />
mit Italiens. Bis zum Jahr 1300 registriert Schneider in Volterra 1000<br />
Urkunden; wieviele er wegläßt, wird aus seinem Vorwort zahlenmäßig nirgends<br />
klar (kommentiert Wilhelm Kurze) - I Iistonc neigt zur Registrierung <strong>von</strong> Positivitäten,<br />
nicht Absenzen. Schneiders Fragestellungen korrespondieren mit<br />
seiner Studie über die Reichsverzüdltung in der Toscana <strong>von</strong> der Gründung des<br />
Latigubardcnrcichcs (56S) bis zum Ausgang der Slaujer (1268); in diesem Kontext<br />
ist Lokalgeschichte unverzichtbar; <strong>von</strong> den im Rahmen <strong>von</strong> Herrschaftsgeschichtsschreibung<br />
gesammelten lokalen Daten profitiert dann eine spätere<br />
Sozialgeschichte. Herrschaftsforschung ist nicht länger möglich ohne Erforschung<br />
ihrer lokalen Bedingtheiten. Dem entspricht die Geschichtsfigur des<br />
parspro toto in der Toskana-Forschung noch heute - »eine überwältigende Fülle<br />
<strong>von</strong> Fragen nach dem Ganzen« -, aber auf einer Ebene, die nicht mehr <strong>Im</strong>perium<br />
meint. Die Frage nach der Reichsverwaltung ist »kein besonderer Schlüssel<br />
zur Toscanaforschung« mehr; vielmehr macht sie heute »den Historiker zum<br />
Gesprächspartner des Kunsthistorikers«. 14<br />
Paul Kehr definiert zum 25. Institutsjubiläum 1913 |D die Institutsaufgaben:<br />
die »mechanische Arbeit in den Archiven, welche die Mitarbeiter <strong>für</strong> die Publikationen<br />
des Instituts zu machen <strong>von</strong> Amtswegen gehalten sind, sowie Datenzulieferung<br />
an die MGH und an das Editionsprojekt Regesta <strong>Im</strong>pem. Kehr<br />
versteht es dabei zunächst, die Institutsaufgaben mit seinem (auftraggeberfernen)<br />
Editionsprojekt Italia Pontificia zu koppeln, was zwar vor dem Weltkrieg nicht<br />
offiziell in den Berichten des Instituts anführbar ist, praktisch aber zur Verhinderung<br />
profunderer Reichsgescbichtsiorschung am Institut führt. Erst am Ende<br />
<strong>von</strong> Kehrs Projekt kommt es um 1930 zu einer entsprechenden Ncuformulierung,<br />
zur Erweiterung des Instuutsauhrags auf Mittelalterforschung überhaupt.<br />
Theodor Mayer, damaliger Präsident der Monumenla Gerniamae I Iistonca und<br />
damit auch Direktor des Deutschen I listonschen Instituts in Rom im Zweiten<br />
''Zitiert nach einem unveröffentlichten Typosknpt des Mediävisten Wilhelm Kurze<br />
(Deutsches Historisches Institut Rom), Die sogenannten »Forschungen zur Reichsi;e.scliii'lne<br />
in Italien« .im Preußischen, dann Deutschen I listonschen Institut m Rom,<br />
mit Dank an den Autor<br />
14 Arnold lisch, Forschungen in Toscana, in: Klze / lisch 1990: 209<br />
1:1 Paul Kehr, Das Preußische Historische Institut in Rom, in: Internationale Monatszeitschrift<br />
<strong>für</strong> Wissenschaft, Kunst und Technik, November 1913, Sp. 1 -36
RKICII(S)W!-:ITI-:N: DAS DKUTSCIII-. HISTORISCHH INSTITUT ROM 291<br />
Weltkrieg, leitet im Jahresbericht 1942 die »Erforschung der Reichsherrschaft in<br />
Italien, besonders des Reichsgutes« ein. Die Hinweise Kehrs auf die symbolische<br />
Archiv-Verknüpfung <strong>von</strong> Deutschland und Italien werden unter Weltkriegsbedingungen<br />
zu einer realen Option. Nach der deutschen Besetzung Italiens gibt<br />
es bei Dienststellen des Ahnenerbes der SS sowie bei Generaldirektion der<br />
Preußischen Staatsarchive Bestrebungen, italienische Archive in deutsche Verfügungsgewalt<br />
zu bringen. Mayer reist zur Prüfung solcher Pläne im März 1944<br />
nach Italien, lenkt den Plan aber »in eine völlig andere Richtung« und gibt ihm<br />
damit einen neuen Sinn, indem er anstelle der Idee, wichtige Kinzeldokumente<br />
zur deutschen <strong>Geschichte</strong> aus den Archiven herauszuziehen, vorschlägt, diese<br />
Stücke photographisch aufzunehmen. Dieses Projekt soll <strong>von</strong> den Mitgliedern<br />
des Deutschen Historischen Instituts in Rom durchgeführt werden, »wobei mit<br />
der Aufnahme in den frontnahen Regionen Mittelitaliens begonnen werden<br />
sollte« 16 - der Krieg selbst schreibt die Schnittstellen <strong>von</strong> Gegenwart und Archiv<br />
als Dringlichkeit vor. Nach zehnjähriger Pause tritt 1953 Walter Holtzmann als<br />
neuer Direktor in die Fußstapfen Paul Kehrs. 17 Der aus der Vorkriegs- und<br />
Knegszeit des DHI am Institut verbliebene Hagemann durchsucht weiterhin italienische<br />
Archive in den Marken nach Reichsgeschichte der staufischen Periode;<br />
seine Arbeit wird unter der alten Aufgabe aufgeführt, »welche die deutsche Verwaltung<br />
in Italien betrifft.« Holtzmann schreibt nun <strong>von</strong> sogenannten Reichssachen.<br />
Seit 1962 ist Gerd Tellenbach Direktor am DHI; in den entsprechenden<br />
Jahresberichten ist nun wieder <strong>von</strong> Reichsgeschichte die Rede. Aktuell firmiert<br />
die ehemalige Reichsgeschichte unter Toscanaforschungen. Die Kopplung des<br />
deutschen Gedächtnisses an die Praxis italienischer Archivforschung bleibt lose.<br />
Vorgeschichten des DHI und die Schnittstellen zum Vatikanische Archiv<br />
Zeitgleich mit dem deutschen Gedächtnis organisiert der Initiator der MGH,<br />
der Freiherr vom Stein, auch dessen Satelliten. Am 21. Juli 1817 bittet er in<br />
einem Schreiben an seinen Freund Barthold Niebuhr, preußischer Gesandter in<br />
"' Lutz. Klinkhammer, Die Abteilung »Kunstschutz« der deutschen Militärverwaltung in<br />
Italien 1943-1945, in: QFIAB 72/1992, 483-549 (522), unter Bezug auf Mayers Mcmorandum<br />
(datiert Verona, 1. April 1944), abgedruckt in: Commissionc Alleata (APO 394),<br />
Sottocommissione per i monumenti, belle arti e archivi (Hg.), Rapporte» finale sugh<br />
archivi, Roma (Istituto poligrafico dello Stato) 1946, 43-46; dazu auch Karen Schönwälder,<br />
1 listoriker und Politik. Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus, Frankfurt/M.<br />
/ New York (Campus) 1992, 207 i<br />
17 Siehe W. Holtzmann, Vortrag vor der Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Forschung des Landes<br />
Nordrhein-Westfalen 1955, zur Krise des Preußischen Historischen Instituts in Rom<br />
1901
292 ROM ALS SATHLI.IT DI-;S DHUTSCHLN GKIMCHTNISSF.S<br />
Rom, dort nach bisher unbekannten Quellen <strong>für</strong> die deutsche <strong>Geschichte</strong> zu<br />
suchen . So verstricken sich die Anfänge der MGH mit den<br />
Geschicken Roms. Das Gedächtnis Preußens liegt nicht notwendig und ausschließlich<br />
auf preußischem Territorium; Gedächtniskartographie und Reicheweiten<br />
stehen in Dissonanz. Der Provinzialoberpräsident <strong>von</strong> Schön schreibt<br />
in seinem Brief an Staatskanzler Hardenberg aus Danzig, den 4. Juli 1822, in<br />
Ergänzung seiner Ausführungen über das in Venedig vermutete Ordensarchiv,<br />
daß in den päpstlichen Archiven in Rom, »der allerhöchsten Wahrscheinlichkeit<br />
nach, sehr ausführliche Nachrichten über den Zustand <strong>von</strong> Preussen, vor<br />
der Eroberung, über die Eroberung und über die Gründung <strong>von</strong> Marienburg<br />
seyn müssen«, denn der Hochmeister hatte dem Papst darüber Meldung zu<br />
machen. Von Schön bittet Niebuhr, »wegen der Benutzung dieses Römisch-<br />
Preussischen Archivs Schritte zu thun, das in Rom vorhandene ansehen zu lassen,<br />
und darüber zu schreiben. aber wer im Griechen- und Römerthum<br />
versunken ist, der versagt selbst seinem deutschen Herzen die Stimme, und ich<br />
habe keine Antwort erhalten.« 18 Das DHI Rom (Archiv) speichert den Antrag<br />
preußischer Historiker auf Errichtung eines Historischen Reichsinstituts in<br />
Rom. 19 Verschiedene Editionsunternehmen aus dem Vatikanischen Archiv seien<br />
bereits an Nachbarinstitutc abgetreten, etwa das seit 1881 praktizierende Österreichische<br />
Historische Institut und die Görres-Gesellschaft; <strong>von</strong> daher plädiert<br />
die Schrift, neben den Vatikanischen Archiven »die möglichst umfassende<br />
Erschliessung aller italienischen Archive und Bibliotheken <strong>für</strong> unsere <strong>Geschichte</strong>«<br />
ins Auge zu fassen . Da es sich bei den Arbeiten in Rom und in Italien<br />
»durchaus um gesamtdeutsche Interessen« handele, strebt die Petition ein<br />
Reichsinstitut an, um dem bislang unverbundenen Nebeneinander <strong>von</strong> Historikern<br />
und Archivaren deutscher Einzelländer in den Archiven Roms eine Bündelung<br />
zu verleihen; Reichseinigung soll auch auf der Ebene des historischen<br />
Diskurses stattfinden und ausdrücklich nach dem Vorbild des deutschen<br />
archäologischen Instituts und der Monumenta Germamac der Reichsregierung<br />
unterstellt und mit Reichsstipcndicn ausgestaltet werden. Dieses historische<br />
Institut ist an den Organismus des Reichs angeschlossen: »ein lebensfähiges und<br />
lebensspendendes Organ der grossen deutschen Wissenschalt wie unserer internationalen<br />
Beziehungen« .<br />
Aktenfaszikel bilden die Mikrophysik <strong>von</strong> Historie. Vielleicht lassen sich Gedächtnis-Konfiguationen<br />
am ehesten auf der Ebene ihrer kleinsten molekularen<br />
ls Publiziert in: Kemhold koser, Die Neuordnung des preussischen Aichivwesens durch<br />
den Staatskanzler Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg, Leipzig (Hirzel) 1904, 7li<br />
'*' Unter den Akten »Akadem. Kommission/Kuratorium« im GehStAr Berlin (Nr. 11, Bl.<br />
105ff), gedruckt und mit den Unterschriften diverser deutscher Historiker versehen, o.<br />
Datum
RKK:H(S)\V!-.I'IT:N: DAS DI-:UTSCHI-. HISTORISCH I-: INSTITUT ROM 293<br />
Einheiten fassen. Dasselbe heutige Archiv des damaligen Königlich Preußischen<br />
Historisches Instituts speichert Akten unter dem Titel Organisation d. Instituts.<br />
Angefangen: 24.2.1900; nachträglich ist dem Begriff »Organisation« dann »u. <strong>Geschichte</strong>«<br />
angefügt und eingeschrieben 20 . Um die Jahrhundertwende beginnt sich<br />
ein Institut selbst zu historisieren, das zu Beginn eine reine Funktion der Erforschung<br />
des Vatikanischen Archivs war. Teil I der Akte (Bl. 1) spricht <strong>von</strong> der<br />
Vorgeschichte der Station, den Gründungsimpuls damit zum Gegenstand wissensarchäologischer<br />
Analyse machend. Den Auftakt der Akte bildet ein Bericht<br />
aus der Allgemeine Zeitung vom 17. Mai 1880, das Vatikanische Archiv betreffend.<br />
Wieder greift eine unsichtbare Hand ein und vermerkt handschriftlich:<br />
»geschrieben ohne Kenntnis der Öffnung des Archivs. Verf. soll v. Pflug-Harttung<br />
sein« . Die Allgemeine Zeitung jedenfalls berichtet (auf Seite 2010)<br />
vom Gespräch eines deutschen Gelehrten mit dem liberalem Cardinal Antonelli<br />
im Vatikanischen Archiv und dem Wunsch nach Einsicht in die päpstliche Bann-<br />
Bulle <strong>von</strong> 1520 gegen Luther, in beiderseitigem Interesse der Aufklärung; die Antwort<br />
heißt Verweigerung. Um 1880 erscheint mit der Publikation <strong>von</strong> Gachard,<br />
Les Archives du Vatican, nicht nur eine Serie <strong>von</strong> Abschriften relevanter Dokumente,<br />
sondern vor allem ein Rubriken-Verzeichnis des Archivs. Ermöglicht hat<br />
er damit dessen Adressierung, eine Option, die zuvor nur Napoleon I. <strong>für</strong> einen<br />
Moment eröffnet hatte, als er das vatikanische Archiv 1810/11 nach Paris transportieren<br />
ließ, um es dort neben den französischen Sammlungen und denen <strong>von</strong><br />
Salzburg, Wien, Salamanca, Venedig, Florenz u. a. zu einem Zentral- und Weltarchiv<br />
zu vereinigen; die Reichweite des <strong>Im</strong>periums (als Signal- und Kommandoübertragung)<br />
sollte so mit der Bereichsweite seiner Archive (als Signal- und<br />
Kommandospeicher) korrespondieren. Der designierte Generaldirektor Pierre-<br />
Claude-Francois Daunou ordnete bereits das Material und legte eine <strong>für</strong> die<br />
interne Archivverwaltung verfaßte Systematische Übersicht über das Vatikanische<br />
Archiv im Druck vor. Mit dieser Veröffentlichung ist das römische Archivwissen<br />
nicht mehr geheim; Inhalte und eine vorläufige Klassifikation werden so diskursiv<br />
anschließbar. 1810 gibt Daunou prompt anonym einen Essai histonque surla<br />
puissance temporelle des Papes heraus, welches nach dem Sturz des Kaisertums<br />
<strong>von</strong> der französischen Regierung vernichtet wird,. Wissensarchäologisch heißt die<br />
Grundlage historischer Kenntnis hier intelligence service. 2]<br />
Die <strong>von</strong> Napoleon konfiszierten Akten kehren mit dem alliierten Befehl vom<br />
19. April 1814 nach Rom zurück - ein Transfer, der erst 1817 abgeschlossen ist.<br />
20 DHI Rom / Archiv, Registratur, Älterer Teil, Faszikel Nr. 12<br />
21 Dazu W. E., Reisen ins Innere des Archivs, in: Ulrich Johannes Schneider /Jochen<br />
Kornelius Schütze (Hg.), Philosophie und Reisen, Leipzig (Leipziger Universitätsverlag)<br />
1996,160-177
294 ROM AI.^ SATKI.UT ni:s OKUTSCIIHN GKDÄCIITNISSKS<br />
Datenübertragung im analogen Zeitalter heißt immer auch Datenverlust: Einzelne<br />
Akten blieben in französischer Hand; der Band mit brisanten Dokumenten<br />
zum Prozeß des Sant' Uffizio gegen Galilei kehrt erst 1846 zurück. Andere<br />
Konvolute werden teilweise verkauft; Tcilabdrucke da<strong>von</strong> finden sich in Sybels<br />
Historische Zeitschrift <strong>von</strong> 1879 wieder. Doch Datenverluste waren im 16.<br />
bis 18. Jh. gravierender, solange die Familien der jeweiligen Papstverwaltung<br />
brisante Stücke der jeweils eigenen Bibliothek einverleiben ließen. Der norwegische<br />
Historiker Peter Andreas Munch jedenfalls darf als einer <strong>von</strong> wenigen<br />
das Innere des Vatikanischen Archivs betreten, muß seine Denkschrift darüber<br />
aber im norwegischen Staatsarchiv <strong>für</strong> die Lebenszeit des damaligen päpstlichen<br />
Arehivpräfekten Theincr mit einem Publikationsvcrbot hinterlegen . Die deutsche Übersetzung unter dem Titel Aufschlüsse über<br />
das päpstliche Archiv fällt 1880 buchstäblich mit dem Aufschluß der Archivtüren<br />
unter Papst Leo XIII. zusammen, bleibt nach Selbstaussage des Autors<br />
jedoch diesseits der Schwelle zur Transparenz, die erst in der Mikrophysik des<br />
Archivs ablesbar ist:<br />
»Erst wenn man die päpstlichen Register Band <strong>für</strong> Band durchgeht sieht man<br />
wie sie die genaueste Controle über die kleinsten und<br />
geringfügigsten Einzelheiten gewann, wie sie durch die unerschütterliche Zähigkeit<br />
und Conscquenz, welche den Grundzug ihres Wesens ausmachen, ein heilsames<br />
Gegengewicht gegen die Schrankenlosigkeit bildete welche sonst - ein<br />
Merkmal des Mittelalters - die Völker in die wildeste Barbarei geworfen haben<br />
würde.« <br />
Der Quellenbefund sagt es: Geschichtsübenragung und -gesetz werden im Aufschreibesystem<br />
der Urkunde identisch. Die römische Kurie steht im Bund mit<br />
dem Katechontischen des Archivs selbst:<br />
»An den Mauern des Vatikans hört das Getriebe und die unruhige Hast des demokratisch<br />
und mechanisch gewordenen Zeitalters auf . Die römische Kurie hat<br />
etwas Zeitloses, sie blickt auf Jahrtausende zurück und sich rechnet mit weiteren<br />
)ahrtauscndcn. l'ür sie gibt es deshalb keine Ungeduld, sie kann immer warten und<br />
braucht nichts zu überstürzen, und da sie weiss, dass die Zeit eine ihrer Stärken ist,<br />
so bildet das -tcmpoicggiare«, (.las Zeitgcwmnncn, einen der hauptsächlichen Grundsätze<br />
ihrer Politik.«"'"'<br />
Diese geradezu posthistorische Knstalhation endet mit der Öffnung der vatikanischen<br />
Archive im Jahre 1881, die in der <strong>Geschichte</strong> der historischen Wissenschaft<br />
buchstäblich Epoche gc»mcht hat; die Epochen der Historiographie sind<br />
weniger l'.l lekl Ac\ ( iivschichte denn \ on A rcliivziit;äm;cn. Bis in die jungsl ver-<br />
11 DH1 Rom, Archiv, Nachlaß 1 liltcbrandt, Nr. 7: I.cbonserinnerungen,<br />
(Mnschinenskript), Hl. VS
Ri:K:ii(s)\\T.iTkN: DAS DI-.UTSCIU-. HISTORISCHH INSTITUT ROM 295<br />
gangene Wissenschaftshistorie gilt, daß die Ambiguität der Beziehungen zum<br />
Archiv, abhängig <strong>von</strong> den jeweiligen ideologischen Strömungen, den Rhythmus<br />
prägt, in dem sich die historische Forschung entwickelt hat. »Deutlicher gesagt:<br />
wenn man will, läßt sich die Historiographie der letzten Jahre anhand einer<br />
Analyse des Spannungsverhältnisses nachzeichnen, das die Geschichtswissenschaft<br />
zum Archiv aufgebaut hat.« 23 Wo ein Archiv zur »unvergleichhche<br />
Fundgrube geschichtlicher Überlieferung« wird 24 , hat es seine Funktion als<br />
justiziables Gedächtnis (besser: Arbeitsspeicher) der Macht aber schon verloren,<br />
und der Historiker als Analytiker <strong>von</strong> Macht kommt immer schon zu spät.<br />
Historische Forschung wird also entscheidend <strong>von</strong> den Zugangsdaten des<br />
Archivs getaktet; Archivsperren aber bilden ein katcchon.Dle Wahrnehmung<br />
gegenwärtiger Wirklichkeit setzt sich aus ähnlich Kontingenten Zugangskanälen<br />
zu Datenbanken zusammen wie die Analogiebildung Vergangenheit. Francois<br />
Füret verweist im Hinblick aut die quantitative Geschichtschreibung 1971 ausdrücklich<br />
auf den Computer; »man könnte also die Frage, wie die Geschichtsschreibung<br />
ihren Gegenstand konstituiert, auf dem Umweg über die Frage<br />
behandeln, wie sie ihre Archive und Computer organisiert, denn auch hier<br />
werden Unterscheidungen kenntlich.« 2 '' Die Differenz liegt in der Autorität,<br />
welche die Zuordnung <strong>von</strong> Bildern und Daten zu einem angenommenen Referenten<br />
garantiert. Diese Autorität fehlt <strong>für</strong> die retrospektive Vergangenheit bzw.<br />
sie wird, analog zu staatlicher Macht, durch die institutionalisierte Geschichtswissenschaft<br />
substituiert. Das Geheimes Staatsarchiv in Berlin-Dahlem etwa<br />
wurde erst durch die Autlösung eies Landes Preußen durch die Alliierten 1947<br />
zum historischen Archiv umkodiert. 26 Das Archiv ist die Differenz der Autorität,<br />
ihr Aufschub. Genau dann, wenn keine Bindung der Dokumente an Macht<br />
mehr vorhegt, wird die Archivsperre aufgehoben, und die Arbeit des Historikers<br />
setzt ein, nach-trägheh. Die Einrichtung der preußischen Historischen Station<br />
in Rom im Zuge der Öffnung der Vatikanischen Archive steht <strong>für</strong> diese<br />
Sichtbarmachung latenter Datenbanken: Die in einem wissensarchäologisch<br />
faßbaren Aggregatzustand archivisch vorliegenden Geschäfte (Droysen), den<br />
zu Schrift geronnenen Monumenten einer Macht, werden im Akt ihrer Doku-<br />
23 Arlettc Farge, Das brüchige Leben. Verführung und Aufruhr im Paris des 18. Jahrhunderts,<br />
aus d. Frz. [-'Paris 1986] v. Wolfgang Kaiser, Berlin (Wagenbach) 1989, 7<br />
24 Edmund E. Stengel, Präsident des Reichsinstituts <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde,<br />
Berlin: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1938, in: Forschungen u. Fortsehr.<br />
14 Nr. 34 v. 1. De/. 1938, 401 f<br />
-'' Dirk Baecker, Anhing und Ende in der Geschichtsschreibung , m: Bernhard Hot/ler<br />
(Hg.), Techno-Pathologien, München (Fink) 1992, 59-85 (671')<br />
Jr ' Siehe W. E. / Cornelia Vismann, Die Streusandbüchse des Reiches: Preußen in den Archiven,<br />
in: Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft 21 (Themenheft »preußisch«),<br />
Frankfurt/M. (Syndikat) 1995, 87-107
296 ROM ALS SATHLUT DHS DKUTSCIIKN GI;I>ÄCHTNISSI-;S<br />
mentation in Historie transformiert. So formiert sich das Verhältnis <strong>von</strong> Institution<br />
(Vatikan, Preußen, Historisches Institut) und Interpretation (Historie).<br />
Es gilt also, archivische Daten zu prozessieren, d. h. zu standardisieren, um sie<br />
einer Beschreibung im Rahmen des historischen (vielmehr denn des administrativen)<br />
Diskurses zugänglich zu machen. So hat die Einrichtung der Preußischen<br />
Historischen Station in Rom 1888 den dortigen deutschen Archivstudien<br />
»das Ziel der Vereinheitlichung gesetzt« .<br />
Bereits 1823 unternimmt und verfaßt Georg Heinrich Pertz im Rahmen der<br />
Monumenta Germaniac Histonca eine Italienische Reise und äußerte sich mit<br />
Blick auf die gedruckt vorliegenden Register Gregors VII. und Johannes VIII<br />
über die Arkanpraxis der Gedächtnisvcrwaltung des Vatikan:<br />
»An ihnen erkennt jeder den hohen Werth einer vollen Übersieht des inneren, bei<br />
den erschütterndsten äußeren Stürmen klaren und sicheren Geschäftslebcns .<br />
Das Bild dieser Größe wiederholt sich in den Briefen nicht nur eines Papstes; ihre<br />
Vertheidiger haben nicht weise gehandelt, sie bisher der Verborgenheit zu überlassen;<br />
denn hier kann kein Geschichtsschreiber durch die Größe seines Blickes<br />
das Fehlende ersetzen. Die beste Verteidigung der Päpste ist die Enthüllung ihres<br />
Systems.« <br />
Unverborgenheit. Auf dem fünften deutschen Historikertag in Nürnberg 1898<br />
gipfelt das Referat des Kölner Stadtarchivars Hansen, der zeitweise dem Historischen<br />
Institut als Assistent angehört hat, in der als Resolution verabschiedeten<br />
Anregung an die deutschen Institute in Rom, durch eine gemeinsame, zusammenfassende<br />
und systematische Veröffentlichung dessen, was sie seither über den<br />
Inhalt der römischen und italienischen Archive und Bibliotheken ermittelt haben,<br />
der Forschung zugänglich zu machen, insbesondere die ihr bisher noch immer<br />
unmögliche Übersicht über den Umfang und Inhalt dessen, was <strong>von</strong> den Archivalien<br />
der päpstlichen Regierung erhalten und zugänglich war. 27 Auch Kehr weiß,<br />
daß der wichtigste zusammenhängende Quellcnstoff des Vatikanischen Archivs<br />
die Register selbst sind, jene Bände also, m welche die Beamten der päpstlichen<br />
Kanzlei die ausgehenden Bullen und Brcvcn eintrugen . Denn<br />
die Macht über Archive ist die über seine Adreßköpfe. Da in den vatikanischen<br />
Archiven ein Publikationsverbot <strong>für</strong> Inventarc besteht, fühlt sich der Vatikan<br />
durch diesen Vorgang m seiner Arcluvhoheit bedroht —<br />
nicht anders als die Staatsarchive der Sowjetunion nach ihrem Ende 28 - und<br />
erwirkt eine Distanzierung der römischen Institute <strong>von</strong> diesem Beschluß. Paranoia<br />
ist eine der möglichen Energien <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und ihre Erforschung. <strong>Im</strong><br />
Vatikanischen Archiv vermutete die deutsche Historie die Quellen sowohl der<br />
27 In: Archiv DHl, Altregistratur Nr. 3 V, Bl. 70-75, zitiert nach Burchardt 1979: 354<br />
- s Patricia Kennedy Grimsted, Russian Archives in Transition: Caught Bctwecn Pohtical<br />
Crossfirc and Ecommic Gnsis, m: American Archivist Bd. 56 (Fall 1993), 614-662
Rhicii(s)\viTTi;N: DAS DKUTSCIU-. FIISTORISCIII-: INSTITUT ROM 297<br />
<strong>Geschichte</strong> des Papsttums wie der <strong>Geschichte</strong> seiner Beziehungen zu den europäischen<br />
Nationen; »allem thatsächhch enthält es nur Fragmente da<strong>von</strong>«. Nach den<br />
Erfahrungen fast zweier Jahrzehnte seit Öffnung der Archive unter Papst Leo<br />
XIII gesteht Kehr zu, daß man <strong>von</strong> Anfang an hinter den jahrhundertelang verschlossenen<br />
Toren des Vatikanischen Archivs viel mehr vermutet hatte als wirklich<br />
vorhanden war. »Die lange Spannung hatte die stärksten Hoffnungen erregt,<br />
das ängstlich behütete Geheimnis hatte immer wieder die weitgehendsten Erwartungen<br />
erweckt.« 29 Dialektik <strong>von</strong> Blindheit und Einsicht: Der Datenentzug schafft<br />
ein Gedächtnisbegehren, welches die Sache nie füllt. Schon das antike Archiv der<br />
Päpste teilte alle Katastrophen des Papsttums: den normannischen Brand, die Bürgerkriege<br />
der römischen Faktionen, die Flucht der Päpste; »so ist es bis auf dürftige<br />
Reste zugrunde gegangen« . Die Zusammenführung diverser<br />
päpstlicher Archive war em Effekt erst ihrer Zerstückelung, der Rückführung aus<br />
ihrer- so Kehr - »babylonischen Gefangenschaft« in Paris 1815:<br />
»Für die Forschung wäre vielleicht die gesonderte Erhaltung der einzelnen so vereinigten<br />
Archive am bequemsten gewesen. Aber die Archive sind nun einmal nicht<br />
<strong>für</strong> den Gelehrten allein da. Die Verwaltung hatte andere Bedürfnisse und strebte<br />
aus diesem archivalischen Chaos zu einer sachlichen Ordnung. Sind doch auch die<br />
alten Komplexe des Engelsburg-Archivs und des Geheimarchivs selbst nichts<br />
anderes als zusammengesetzte Archivahen aus verschiedenen Provenienzen. Von<br />
Anfang an sind so die archivalischen Bestände der römischen Kirche in fortwährender<br />
Bewegung gewesen und auch heute noch ist diese Bewegung nicht zum<br />
Stillstand gekommen. Der Forscher hat hier die schwere, aber auch reizvolle<br />
Arbeit zu leisten, durch die verschiedenen archivalischen Systeme zu dem<br />
ursprünglichsten vorzudringen.« <br />
Archive tradieren eben nicht schlicht Daten als Gedächtnis, sondern werden<br />
ihrerseits übertragen. Die hermeneutische Archäologie-Metapher kommt am<br />
Objekt Archiv zu sich, vergleichbar der Textarbeit <strong>von</strong> Philologen, verräumlicht<br />
als Architektur des Archiv-Raums. Kehr fordert damit das, was Michel Foucault<br />
in Anlehnung an Nietzsche definiert hat, die genealogische Analyse der gegebenen<br />
Daten. In seinen archivalischen Erinnerungen zieht er <strong>für</strong> das Preußische<br />
Historische Institut in Rom daraus die Konsequenz; ist es bislang wesentlich eine<br />
Publikationsstelle <strong>von</strong> Materialien aus dem Vatikanischen Archiv gewesen und<br />
sein Charakter vor allem haushaltstechnisch <strong>von</strong> der Funktion einer römischen<br />
Station der Berliner Akademie, bzw. der preußischen Archivverwaltung <strong>für</strong><br />
bestimmte und eng begrenzte Forschungsaufgaben bestimmt, »aber nicht der<br />
eines historischen Instituts«, vertritt er demgegenüber die Forderung einer systematischen<br />
Forschung über ganz Italien hin. »Ich denke mir das Institut als<br />
29 Paul Kehr, Das Archivwesen Italiens IV: Die Vatikanischen Sammlungen, in: Beilage<br />
zur Allgemeine Zeitung (München) Nr. 194 v. 2b. August 1901, 4-7 (4
298 ROM ALS SATU.UT nr.s OI-UTSCIUN GHIMCHTNISSHS<br />
eine die deutschen Materialien der italienischen Archive und Bibliotheken repertorisirenden<br />
Zentralstelle« . Es geht also um nichts weniger<br />
als die Organisation des in Italien residenten deutschen Gedächtnisanteils.<br />
Vor allem auf die Initiative Heinrich <strong>von</strong> Sybels, den Spiritus rector der römischen<br />
Stationsgründung, geht die auffällige Bindung des Institus an die preußische<br />
Archivverwaltung zurück, deren Generaldirektor Sybel <strong>von</strong> 1875 bis 1895<br />
war. 30 In einem anonym veröffentlichten Artikel benennt Paul Kehr, seinerzeit<br />
noch Geschichsprofessor in Göttingen, aus der Perspektive seines Itahenaufenthalts<br />
zu Archivrccherchen und angesichts der anstehenden Ersetzung W. Friedensburgs<br />
als erstem Sekretär des Preußischen Historischen Instuts durch einen<br />
preußischen Provinzialarchivar, Archivrat Joachim in Königsberg, zwei Kardinaljchlcr<br />
der Arbeit des Preußischen I hstonschen Instituts in Rom. Zunächst<br />
verlangt er eine umfassendere Forschung im vatikanischen Archiv selbst, da in<br />
diesem »ungeheure Magazin der verschiedensten archivahschen Provenienzen«<br />
die vorhandenen Inventare meist »nur onentirende Summarien« seien, die<br />
er durch eine systematische Durchforschung aller Bestände des Archivs als Aufgabe<br />
des Instituts ersetzt sehen möchte, anstelle der Beschränkung auf deutsche<br />
Nuntiaturen des 16. Jahrhunderts. Und anstatt der Fixierung auf das vatikanische<br />
Archiv soll der Forschungsbereich ganz Italien umspannen, denn Italien habe <strong>für</strong><br />
die deutsche <strong>Geschichte</strong> eine ähnliche Bedeutung wie <strong>für</strong> die Kunstgeschichte.<br />
Doch ist die preußische Perspektive wirklich die Metonymie des Reiches?<br />
»Wir sind aber noch radikaler. Wir stielten nicht nur der Preußischen Archivvcrwaltung<br />
das Vermögen ab, ein wirkliches historisches Institut in Rom zu unterhalten,<br />
wir sind sogar so kühn, dem Staate Preußen selbst natürlich nicht die<br />
Kompetenz, wohl aber den inneren Beruf dazu zu bestreiten. Das Königreich<br />
Preußen feiert gerade jetzt seinen 200. Geburstag. Für die Erforschung seiner<br />
Beziehungen zu Rom und Italien bedarf es gewiß keines besonderen Instituts; <strong>für</strong><br />
die rein preußischen Interssen wäre ein solches in St. Petersburg oder in Paris viel<br />
mehr am Platz. Es ist doch vor allem die <strong>Geschichte</strong> Deutschlands, vorzüglich des<br />
alten Reichs, dann die <strong>Geschichte</strong> der alten Kirche, der ein römisches Institut dienen<br />
soll . Hier handelt es sich wirklich einmal um ein gesammtdeutsches <br />
v...>, nicht um ein preußisches Sondermteresse.«''<br />
Der Münchener I lisionker K. 'l'h. <strong>von</strong> I Ieigel hat bereits verlangt, dieses preußische<br />
Institut in ein Reichsinstitut zu verwandeln:<br />
»Aber ist es nicht wunderlich, daß in der historischen Wissenschaft die partikularistischen<br />
Momente noch stärker sind als selbst in der Politik? Wir sind nun glück-<br />
30 Stengel 1938:401t<br />
•'' Gezeichnet gnech. »pi« , Das Preußische Historische Institut in Rom,<br />
datiert Rom 1. Januar 1901, in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, München 11. Januar<br />
1901 Nr. 9, 1-4 (4)
Ri icii(N)\vrnT\: DAS DI rrsciu HISTOKISCI II [\STITIT ROM 299<br />
lieh cm geeinigtes Volk, aber als ob wir dem Ausland unsern inneren Dissenz möglichst<br />
deutlich zeigen wollten, unterhalten wir statt eines deutschen historischen<br />
Instituts deren zwei, das preußische und das der Görres-Gesellschatt. Die<br />
Publikationen beider Institute aber sind streng wissenschaftlich, weder spezitisch<br />
protestantisch, noch spezifisch katholisch.« <br />
Ist Archivforschung als Infrastruktur <strong>von</strong> Gedächtnisarbeit also unberührt <strong>von</strong><br />
diskursiven Symbohsierungsfunktionen? Es ist die Präsenz dieses vatikanischen<br />
Universalspeichers zu Betreffen des europäischen Mittelalters und der frühen<br />
Neuzeit, welche Rom gegenüber anderen Gedächtnisorten auszeichnet. Als im<br />
preußischen Kultusministerium einmal der Plan auftaucht, das historische Institut<br />
nach Paris zu verlegen, schreibt Kehr, in Paris fehlte der »heroische Hintergrund«,<br />
den der Historiker braucht; nur in Rom könnten die jungen Gelehrten<br />
zu »Virtuosen der archivahschen Forschung« ausgebildet werden. 32 Das Vatikanische<br />
Archiv bildet einen anderen Zeit/Raum, eine Heterotopie'' gegenüber<br />
nationaler Historiographie, da der Forscher dort »sich nicht durch moderne<br />
politische Grenzen bestimmen lassen kann. <strong>Im</strong> Vatikanischen Archiv kann<br />
man nur nach Diöcescn arbeiten.« ' 4 Archive, die generativen Zellen <strong>von</strong> ITistone,<br />
können ihrerseits nicht auf einem historischen Tableau vereinheitlicht werden:<br />
»Wenn der Grundsatz Gemeingut der Archivare geworden ist, dass >jedes<br />
Archiv auf seine eigene Weise behandelt werden muss
300 ROM ALS SATI-I.UT DKS nr.uTsciir.N GI-DÄCIITNISSKS<br />
die Konsultationsbibliothek, welche Archiv und Bibliothek verbindet« . So konkret sind gedächtniskybernetische Schaltungen und Türen.<br />
Die Transformation vom Verwaltungsarchiv zur internationalen Forschungsstätte<br />
ist dabei keine lineare; Fink macht darauf aufmerksam, daß es sich »nicht<br />
um ein öffentliches Archiv im gewöhnlichen Sinne, sondern um das Archiv eines<br />
Souverains handelt, der das volle Verfügungsrecht über das Archiv hat« - weshalb<br />
ihm der offizielle Name auch nach der Öffnung (Fink spricht <strong>von</strong> »Eröffnung«)<br />
noch eignet: Archivio Segreto Vaticano« .<br />
Frontstellungen: Kulturkampf und preußisch-römische Archivästhetik<br />
Der Beirat des Deutschen Historischen Instituts faßt in seiner konstituierenden<br />
Sitzung am 1. Oktober 1961 den Beschluß, einen Vertreter der neueren <strong>Geschichte</strong><br />
in Gestalt Theodor Schieders aufzunehmen. Dieser vermittelte R. Lill<br />
nach Rom, u. a. zu Kulturkampfstudien, die einen den <strong>Im</strong>petus zur Gründung<br />
der Preußischen historischen Station selbst gebildet hatten. Denn hundert Jahre<br />
zuvor hatte der innere Präventivkrieg des deutschen Staates mit dem. Konflikt<br />
mit der katholischen Kirche und der katholischen Bewegung über die Schulaufsicht<br />
und die Zivilehe begonnen. Der Kanzelparagraph, der den Geistlichen die<br />
Behandlung staatlicher Angelegenheiten »in einer den öffentlichen Frieden<br />
gefährdenden Weise« verbietet, die Mai-Gesetze <strong>von</strong> 1873 und das Verbot des<br />
Jesuitenordens unterstellen Kirche und Klerus staatlicher Aufsicht. »Auch nach<br />
dem Abbau der Ausnahmegesetze bleibt der politische Katholizismus gegenüber<br />
dem Reich mißtrauisch.« 36 Dem Ursprung des historischen Instituts in Rom ist<br />
dieser mnemisch-energetische Vektor eingeschrieben, als der Kulturkampf der<br />
1870er Jahre noch vibriert und der Durchforschung der vatikanischen Archive<br />
einen potentiell politischen Charakter verleiht. Überließ man sie österreichischkatholischen<br />
Kreisen, so bestand nach preußischer Aulfassung die Gefahr, daß<br />
diese die vatikanischen Archivalien »<strong>für</strong> ihre einseitigen Parteizwecke in tendenziöser<br />
Weise zurechtlegen und ausbeuten« würden; cm preußisches Institut<br />
hingegen konnte dagegen als »Anstalt zur Wahrung wissenschaftlicher Objektivität<br />
und historischer Treue« fungieren. Diese diskursiv korrigierende Funktion<br />
setzte allerdings voraus, daß das Institut nicht allzu deutlich als Sprachrohr des<br />
Staates in Erscheinung treten durfte. 37 Von daher die nicht direkte Anbindung<br />
•"' ITagen an die deutsche <strong>Geschichte</strong>. Wege zur parlamentarische Demokratie, Katalog der<br />
gleichnamigen HistonschenAusstellung im Deutschen Dom in Berlin, o. J. (1996), 180f<br />
17 Burchardt 1979: 338, unter Bezug auf cm Schreiben des Kultusministeriums an das<br />
Finanzministerium, 31. Oktober 1884 (GehStaAr Rep 7h V c Sekt. 1 Tit. XI Teil II<br />
Nr. 3, Bei. 1, Bl. 401.)
Rr.ici i(s)\vi';rn-N: DAS DI-UTSC :I II. HISTORISCI II-. INSTITUT ROM 301<br />
des Instituts an ein Ministerum, sondern an die Berliner Akademie der Wissenschaften.<br />
Preußen forscht im <strong>Namen</strong> der Wahrheit; diese Objektivität aber ist<br />
durch ihre diskursive Positionierung selbst schon eine Parteinahme. Wenige<br />
Wochen nach Eintreffen der Sybelschen Petition beantragte das Kulturministerium<br />
erstmals (aber zunächst erfolglos) Haushaltsmittel <strong>für</strong> das projektierte<br />
Institut, da »Preußen, an der Spitze des neuen Deutschen Reiches stehend, sich<br />
dem Berufe nicht entziehen kann, die <strong>Geschichte</strong> des alten Reiches deutscher<br />
Nation aufzuhellen.« 38 Auch das heißt Reich(sweite) als mapping: die neue<br />
impenale Ausdehnung mit der gedächtnissymbolischen Zeit zur Deckung zu<br />
bringen. Preußen ist in dieser Selbstwahrnehmung eine Metonymie des deutschen<br />
Reichs. Die Eingabe der vier Historiker wird vom Unterrichtsministerium<br />
weitergeleitet an die Königliche Akademie der Wissenschaften; deren Gutachten,<br />
verfaßt durch Max Duncker (7. Juni 1883) korreliert den kosmopolitischarchäologischen<br />
und den (national-)mediävistischen <strong>Im</strong>puls:<br />
»Angesichts der günstigen Erfolge, welche die auf römischem und attischem Boden<br />
gegründeten archäologischen Institute den classischcn Studien eingetragen haben,<br />
kann die Akademie die Absicht, der Erforschung des Mittelalters, insbesondere des<br />
deutschen Mittelalters, und der nächstfolgenden Zeiten ein ähnliches Förderungsmittel<br />
zuzuführen, nur <strong>für</strong> berechtigt halten. Mag es dem ersten Blick erscheinen,<br />
als ob dem breit ausgedehnten Leben der germanischen und romanischen Völker<br />
der einheitliche Boden, der Punkt fehlte, an dem ihre Geschicke sich vollzogen und<br />
abgelagert, <strong>von</strong> dem aus ihre Vergangenheit erschlossen und zurückgewonnen werden<br />
könnte: jede nähere Betrachtung erkennt, daß auch diese Völker und Zeiten in<br />
der universellen Stellung des päpstlichen Stuhls eine Zusammenfassung ihrer Tendenzen,<br />
ein Centrum gefunden und besessen haben. Gilt dies <strong>für</strong> das<br />
gesammte Westeuropa, so auch im besonderen Sinn <strong>für</strong> Deutschland seit Wiedcraufnehtung<br />
des Kaiserthums durch Karl den Großen, seit der Verbindung des<br />
deutschen Kömgthums mit der Kaiserkrone durch Otto 1. Enger als die eines der<br />
anderen germanisch-romanischen Völker ist dadurch die <strong>Geschichte</strong> der deutschen<br />
I Icrrscher, des deutschen Volkes mit dem Papstthum, mit den kirchlichen Dingen,<br />
mit Italien verbunden worden. I liernach ist Rom unstreitig als der Punkt gegeben,<br />
<strong>von</strong> dem aus erforschende Arbeit an der <strong>Geschichte</strong>, insbesondere des Mittelalters,<br />
nachhaltige Förderung erfahren hat.« <br />
Die Koordinaten der Historie kommen mit denen ihrer Speicher zur Deckung.<br />
Erst die kritische Edition <strong>von</strong> Akten macht diese Evidenz verfügbar und eröff-<br />
is Schreiben des Kultusministeriums an das Finanzministerium, 23. 6. 1882 (Nr. 3 I, Bl.<br />
9ff), zitiert nach: Burchardt 1979: 339; die zitierte Passage deckt sich mit dem Wortlaut<br />
der Eingabe 1 Ieinnch <strong>von</strong> Sybel / Georg Waitz / Wilhelm Wattenbach /Julius Weizsäcker<br />
v. 23. April 1883 an das preußische Unterrichtsministerium, zitiert in: W. Friedensburg,<br />
Das Königlich Preußische Historische Institut in Rom in den dreizehn ersten<br />
Jahren seines Bestehens 1888-1901, Anhang zu den Abhandlungen der Kgl. Preuß.<br />
Akad. d. Wiss. 1903, Berlin 1903, 19
302 ROM ALS SATKU.IT HHS DKUTSCMHN GHDACHTNISSKS<br />
net einen Raum der Historie. Schottmüller konzipierte die römische Station<br />
zugleich als Ausbildungsstätte <strong>für</strong> Historiker:<br />
»Den Secretär leiteten bei diesen Vorschlägen Erwägungen wie die, welche einige<br />
Jahre später zur Gründung der Archivschule in Marburg i. H. geführt haben. Ob<br />
freilich eine derartige Hinrichtung in Rom zweckmäßig und lebensfähig gewesen<br />
wäre, steht wohl dahin. Eine Notwendigkeit zu erartigen Experimenten lag<br />
jedenfalls nicht vor. Kann der Archäologe die <strong>für</strong> sein Studium erforderliche<br />
Anschauung natürlich nur auf dassischcm Boden gewinnen, so hat der Historiker<br />
daheim in den historischen Semmanen volle Gelegenheit, sich die Methode<br />
seiner Wissenschaft anzueignen.« <br />
Der Station stand die Bibliothek des deutschen archäologischen Instituts zur<br />
Verfügung; »aber die Bedürfnisse waren hier und dort so verschieden, daß sie sich<br />
nur in ganz vereinzelten Werken berühren mochten« . Burchardt konstatiert<br />
auch anhand des Preußischen Historischen Instituts Symptome der in der<br />
Wissenschaftspolitik des Wilhelminischen Deutschland gelegentlich erkennbaren<br />
Tendenz zur Verreicblichung, die über die dem Reich durch die Verfassung<br />
gebotene wissenschaftspolitische Abstinenz hinausging .<br />
So entsteht das deutsch-römische Historikermstitut als preußische Gründung,<br />
doch wird wie etwa bei der gleichzeitig errichteten Physikalisch-Technischen<br />
Reichsanstalt bereits die Tendenz erkennbar, daß das Reich zunehmend auch<br />
auf wissenschaftspohtische Kompetenzcrweitcrung drängt. Beide Institute verkörpern<br />
die neue modulare Ästhetik im Umgang mit Daten: Das römische<br />
Unternehmen soll die vatikanischen Archive in seine Bausteine segmentieren<br />
und ebenso edieren; die physikalisch-technische Messung als Quantifizierung<br />
<strong>von</strong> Wahrnehmung prägt die naturwissenschaftlich korrelatc Umgangsweise<br />
mit Daten. Während Theodor Mommsen in Berlin die Vorlesungen zur Römischen<br />
Kaiscrgeschichtc hält, emergiert buchstäblich ein Reich der Präzisionsmessungen<br />
und der Normal-Kichungs-Kommissioncn. »Diese Institutionen<br />
verstehen wir nicht mehr. Die Autorität der Geschichtshermcneutik, Dilthcy,<br />
versucht noch zwischen Mommsen und Helmholtz, Geisteswissenschaft<br />
und Ingenieurswissenschatt, Grenzkriege zu führen, um das barbarische <strong>Im</strong>perium<br />
der reellen Zahlen und seine Träger außen vor zu halten« -vergebens. 39<br />
Arnold Esch beschreibt die geschichtswissenschaftlichen Großunternehmungen<br />
des 19. Jahrhunderts in Begriffen der Massendatenverarbeitung; auf Historiker<br />
in Italien mußten diese neuen umfassenden Unternehmungen {Corpus Inscriptionum<br />
latinarum, Monumenta Germamae Historie, Italid Pontifkü) wie Mi\\~<br />
dreschet' wirken, »die ganze Übcrlieferungslandschaften flächig abfraßen und<br />
•''' Bernhard Siegert, Sandhaufen und Sumpt. Rom als »caput mortuum der Kaiserzeit«,<br />
in: W. E. (Hg.), Die (Un-)Schreibbarkeit <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien als Literatur, Weimar (Verlag<br />
und Datenbank <strong>für</strong> Gcisteswisscnscluhen) 1996, 99-1 13 (1 10)
Rkicn(s)whiTi.N: DAS DI-.UTSC:IIK HISTOKLSCIII-. INSTITUT ROM 303<br />
gleich anschließend wohlrotierte, dichtgepreßte Bündel erfaßter Überlieferung<br />
ausstießen: C1L Band VI 1, 2, 3« . Das heißt data processing und<br />
korrespondiert weniger mit der geschichtsphilosophischen Logik eines Geistes<br />
denn mit medialer Gedächtnislogistik; bei Kehr hat das Wort Forschungsstrategie<br />
»einen guten Sinn« .<br />
Nach Jahren erster Durchsicht liefert das Vatikanische Archiv keine Munition<br />
mehr <strong>für</strong> den staatlich-kirchlichen Kulturkampf in Preußen. Das PHI wird 1898<br />
auf Drängen Sybels aus seinem bisherigen Unterstellungsverhältnis (Kultusministerium)<br />
gelöst und statt dessen der <strong>von</strong> Sybel geleiteten und dem Staatsministerium<br />
direkt unterstellten preußischen Archivverwaltung zugeordnet, was zu<br />
Be<strong>für</strong>chtungen Anlaß gibt, daß es die »ohnehin hypertrophen archivahschen<br />
Tendenzen in der Institutsarbeit« weiter verstärken werde . Es geht jetzt nicht mehr darum, aus der Historie im Rahmen des Kulturkampfes<br />
ein Gegen-Gedächtnis zu machen 40 , sondern um Datensammlung, die<br />
eine ganz andere Form der Zeit speichert. Mit der preußischen Archivanbindung<br />
korrespondiert eine spezifische Ästhetik seiner Außenstellen. Ein ehemaliger<br />
Mitarbeiter des römischen Instituts, Philipp Hiltebrandt, berichtet über die dortigen<br />
Zustände unter der Direktion <strong>von</strong> Paul Kehr, der die Verspätung <strong>von</strong> Mitarbeitern<br />
seines Instituts bei den täglichen Arbeiten im vatikanischen Archiv<br />
regelmäßig mit der Begründung notierte, »es gebe drei Systeme, das preussische<br />
des pünktlichen Antretens, das französische der völligen Ungebundenheit und<br />
das östereichische, das beide Systeme vermische und deshalb >Schlamperei< sei.« 41<br />
Der preußische Diskurs der Mmuziösität schaltet Arbeitstechniken und Gedächtnisorganisation<br />
zusammen: »Dieselbe Kleinlichkeit bewies er bei den<br />
paläographischen Uebungen, die er eingerichtet hatte« . Hiltebrandt selbst kehrt später nicht als Historiker, sondern als journalistischer<br />
Korrespondent nach Rom zurück. Dies ist nicht die Antinomie, sondern<br />
die Konsequenz, seiner Arcliivarbeii, denn die Nachnchtenlagc der (legenwart,<br />
ihr Fchtzcit-Gedächlms also, ist .selbst wie cm Archiv strukturiert:<br />
»Hinzu kam dann, dass ich über eine lange Uebung im >Telegraphieren' verfügte,<br />
die ich mir, so paradox das zunächst klingt, durch meine Tätigkeit in den Archiven<br />
erworben hatte. Denn die unzähligen >Excerptc% die ich aus Archivahen angefertigt<br />
hatte, trugen den Charakter <strong>von</strong> Telegrammen, da sie in kürzester Form das<br />
Wesentliche des Dokuments enthalten mussten. Jetzt traten die Zeitungen an Stelle<br />
der >Dokumentc
304 ROM ALS SATI-I.I.IT DI ; .S DHUTSCIIKN GHDÄCIITNISSKS<br />
Hiltebrandt findet am Ende dieser Erfahrung zurück zu einer journalistisch<br />
dynamisierten Historie:<br />
Die Muse Kleio hat eine zweifache Seele. Die eine ist auf die Forschung, die andere<br />
auf die Darstellung gerichtet; die eine erfordert Speciahsten Handwerker, die das<br />
Material herbeischaffen und bearbeiten, die andere >Architekten', die den Bau entwerfen<br />
und ausführen. <strong>Im</strong> Staube der Archive hatte ich zur Genüge geweilt<br />
. Mit dieser Kenntnis ausgerüstet, glaubte ich zur darstellenden Geschieht-<br />
Schreibung übergehen zu können. Sie erfuhr durch die Journalistik' eine erhebliche<br />
Verstärkung; denn diese bringt mit dem politisch-sozialen Leben und mit den<br />
handelnden Persönlichkeiten in Berührung, und dies ergibt die historische Lebenserfahrung<br />
. Diese war in gelehrten Sakristeien schwerlich zu erzielen.«<br />
<br />
Als Hiltebrandt wieder seine alte römische Arbeitsstätte besucht, geschieht dies<br />
nicht mehr zu Forschungszwecken, sondern um dort transarchivisch zur zusammenfassenden<br />
Schnft überzugehen. Der Ort wird nun perspektivisch-panoptisch<br />
zum Ausgangspunkt einer Darstellung, die als <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom<br />
»ins Auge fasst« 1940 erscheint.<br />
Paul Fndolin Kehr: Diplomatik als Politik und als Archäologie<br />
Die im DHI verwahrten^ ungedruckten Erinnerungen <strong>von</strong> Philipp Hiltebrandt<br />
beschreiben in einem Kapitel das Preußische Historische Institut und seinen<br />
Direktor. Hiltebrand zufolge war Kehr<br />
»kein 1 listoriker im wirklichen Sinne, er hörte eigentlich mit der <strong>Geschichte</strong> da<br />
auf, wo sie erste eigentlich anfängt. Lr konnte <strong>für</strong> den Bau nur Steine, d. h. Urkunden<br />
suchen und sie behauen, aber niemals eine darstellende Architektur aufführen.<br />
Er suchte dieses Manko durch eine geistreichelndc Skepsis der Geschichtsschreibung<br />
gegenüber zu verbergen. Nur gelegentlich trat dieser Mindcrwcrtigkcits-<br />
Komplex bei ihm zutage. So äusserte er mir gegenüber einmal: >In mir hat der<br />
gelehrte Stumpfsinn doch geradezu phänomenale Höhen erklommen.« Wie sein<br />
Bruder, der Halbcrstädter Arzt, auf Nierensteine, so hatte er sich auf Papstregesten,<br />
d.h. auf die kritische Bearbeitung <strong>von</strong> Auszügen aus Papst-Urkunden spezialisiert;<br />
wie sein Bruder, so machte er beinahe 60 Jahre lang tagtäglich immer<br />
wieder dieselbe Operation. >Andere spielen Skat, wieder andere sammeln<br />
Käfer oder Pflanzen, ich sammle Papst-Urkunden' pflegte er zu sagen. Freilich hat<br />
er es verstanden, sein Unternehmen bestens zu 'organisieren'. das ganze<br />
Unternehmen diente praktisch gesehen in erster Linie in majorem Papae glonam.<br />
43 Josef Heckenstein, Paul Kehr. Lehrer, Forscher und Wissenschaftsorganisator in Göttingen,<br />
Rom und Berlin, in: 1 lartnuu Bookmann / 1 lermann Wellenreuther (1 Ig.),<br />
Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe, Götingen (Vandcnhoeck<br />
& Ruprecht) 1987, 239-260 (247), Amn. 12
Ri'.ici I(S)WHITI-:N: DAS DI:UTSC;I 11: HISTORISCH 11; INSTITUT ROM 305<br />
Man hat deshalb Kehr mit Mommsen, dem Begründer des Corpus Inscnptionum<br />
Latinarum in eine Reihe gestellt. Der Vergleich ist völlig unzulänglich, denn die<br />
eigentlich Grosse Mommsens beruht auf seinen grossen darstellenden Werken,<br />
die bei Kehr gänzlich fehlen. Er hat mir später einmal gesagt, er habe den<br />
Grund zu einer neuen Auffassung der <strong>Geschichte</strong> des Papsttums bis 1198 gelegt<br />
. Ich forderte ihn auf, die betreffenden Abschnitte über das Papsttum in meinen<br />
Ideen und Mächten zu lesen. Er kam dann erstaunt wieder zu mir und sagte:<br />
>Wo haben Sie das her, es ist ja dasselbe, was ich gebracht habe.< Ich antwortete<br />
ihm, dass ich das ja schon auf der Universität gelernt habe, worauf er nichts weiter<br />
tu erwiedern wusstc als: >Ja um <strong>Geschichte</strong> schreiben zu können, muss man<br />
Journalist sein.' Darauf erklärte ich meinerseits: >Nicht Journalist sondern Historiker.'<br />
Mit Recht hat Johannes Haller, der Verfasser der bekannten Papstgeschichte<br />
deshalb einmal gesagt: >da.il Kehr sich wie ein Blinder am Staketen-Zaun seiner<br />
Papst-Rcgesten die Papstgeschichte entlang getastet habe.' In der Tat war es geradezu<br />
erstaunlich, wie wenig er, der sich sein ganzes Leben lang mit der Papstgeschichte<br />
beschäftigt hatte, <strong>von</strong> dieser tatsächlich wusste. Er hatte sich eben immer<br />
nur mit dem Behauen <strong>von</strong> Bausteinen aber niemals mit der Architektur beschäftigt,<br />
die nicht nur Handwerk sondern Geist erfordert.«<br />
Archi(v)texturen. Inwieweit ließen sich unbeantwortete Fragen der <strong>Geschichte</strong><br />
aus den römischen Archiven beantworten? Die Organisation des Wissens ist<br />
weniger eine Funktion seiner Inhalte denn semer institutionellen Dispositive.<br />
Das System Kehr, so Hiltebrandt, beruhte auf alles anderem denn auf seinen<br />
Leistungen als Historiker. Da eine histonographische Tätigkeit ihn nicht in<br />
Anspruch nahm, war Kehr »frei <strong>für</strong> die Begründung einer Machtstellung, die in<br />
erster Linie auf der richtigen psychologischen Behandlung des Kulturmimsteriums<br />
beruhte.« 44 Der Diplomatiker Kehr steht auf Seiten der Bürokratie und<br />
weiß: gerade Gedächtnis wird administriert. Die Habilitationsschrift Kehrs <strong>für</strong><br />
die Zulassung als Privatdozent in Marburg unter dem Titel Die Urkunden Otto<br />
III. (1890) ist ein Meisterwerk der Spezialdiplomatik (der Schule Sickels),<br />
und nur ausnahmsweise treibt ihn der Instinkt des Historikers dazu, das Material<br />
nicht allein archivkritich, sondern auch historisch auszuwerten - in einem<br />
gesonderten, das Material diskursivierenden Aufsatz, »der den Historikern<br />
zeigte, wie die mühsame Arbeit des Diplomatikers auch <strong>für</strong> die politische <strong>Geschichte</strong><br />
nutzbar zu machen ist.« 4 " 1 Als Kritiker der Zustände am Preußischen<br />
Historischen Institut Rom vom 1 1. Januar 1909 in der Beilage zur München-<br />
44 Archiv DHI/R, Nachlaß Hiltebrandt, Nr. 2, »Zustände am Historischen Institut«,<br />
36ff. Vgl. Bernhard vom Brocke (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik<br />
im Industriezcitalter: Das »System Althoff« in historischer Perspektive, Hildesheim<br />
(Lax) 1991<br />
4:1 Walther Holtzmann, Paul Fridolin Kehr, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> Erforschung des<br />
Mittelalters 1950, Marburg (Simons), 26-58 (30), unter Bezug auf: Paul Kehr, Zur<br />
<strong>Geschichte</strong> Ottos III., in: Historische Zeitschrift 66 (1891), 385-443
306 ROM ALS SATKI.UT DKS DI-.UTSCIII-N GKIMCMTNISSKS<br />
Augsburger Allgmeinen Zeitung (unter der griechisch gedruckten Sigle »pi«)<br />
beklagt Kehr die »gleichgültige mechanische Arbeit« der dortigen Nachwuchshistoriker.<br />
Kehr plädiert <strong>für</strong> die historische Auswertung <strong>von</strong> Kanzleiurkunden<br />
im Unterschied zur »mechanischc Verwerthung der Urkunden z. B.<br />
in einigen Abtheilungen der Jahrbücher der deutschen <strong>Geschichte</strong>« . Ganz im Sinne <strong>von</strong> Michel Foucaults Differenzierung zwischen aufgespeicherten<br />
Aussagen als Dokument und als Monument kritisiert er die<br />
Attitüde <strong>von</strong> Historikern gegenüber Urkunden, »das historische Material <br />
herauszuschälen und zur Ergänzung und Kontrolle der anderwärts überlieferten<br />
geschichtlichen Nachrichten zu verwerthen« . Gedächtnisdaten verlangen<br />
nach diskreter, zunächst einmal nicht an den Kontext <strong>von</strong> Historien<br />
gebundener Lektüre.<br />
Der Diskurs des Preußischen Historischen Instituts in Rom ist aus der Perspektive<br />
Kehrs nicht auf den Begriff preußisch zu reduzieren: Vor allem der<br />
<strong>Geschichte</strong> Deutschlands, des alten Reiches, dann die <strong>Geschichte</strong> der alten Kirche<br />
soll ein römisches Institut dienen . Als Gegenstück<br />
plant Kehr - nach dem Vorbild Sickels in Wien - ein historisches Institut<br />
in Deutschland einzurichten; daß die Monumenta Germaniae Historica der gegebene<br />
Mittelpunkt <strong>für</strong> ein solches Institut seien, das zugleich der Ausbildung jüngerer<br />
Historiker und der wissenschaftlichen Forschung selbst dienen soll, »stand<br />
mir <strong>von</strong> Anfang an fest« . Seit Mai 1915 ist<br />
Kehr auch Generaldirektor der preußischen Archive in Berlin. Die Archive sind<br />
»eine »wahre Heimat; als Verwaltungsobjckte interessierten sie mich weniger«<br />
. Und doch hat Kehr genau das praktiziert: die Arbeit an <strong>Geschichte</strong><br />
ils Verwaltung ihrer Archive. Kehrs deutsch-historischer Institutsplan in Verbindung<br />
mit dem Geheimen Staatsarchiv wird in Richtung eines Instituts<br />
ür Archivwissenschaft abgebogen, wo eben nicht nach Wiener Vorbild die<br />
löherc Ausbildung der Archivare, Bibliothekare, Musealbeamten und des aka-<br />
Jemischen Nachwuchses gemeinsam stattfindet. Kehrs Initiative hat vielmehr<br />
Einfluß auf die Einrichtung eines historischen Instituts bei der Kaiser-Wilhelm-<br />
Gesellschaft, dessen Leitung er übernimmt. Unter der Signatur C. verzeichnet<br />
ler Berliner Nachlaß Kehrs Denkschnlten; Nr. S. betrillt den Plan einer »orgaiische<br />
Verbindung« <strong>von</strong> Monumenta Germaniae Historica, Preußischem<br />
historischem Institut und Deutschem Archäologischen Institut in den Räumen<br />
ler Berliner Staatsbibliothek. Ein wissensorganologisches Weltbild wird hier<br />
ils Medienverbund konzipiert. Nach dem Ersten Weltkrieg leitet Kehr in Italien<br />
>is 1936 da.s römische Institut. Die Umbildung i\ct Monumenta Gcrmainac<br />
iistonca zum Reichsinstitut <strong>für</strong> ältere deutsche <strong>Geschichte</strong> im Statut <strong>von</strong><br />
935 geht auf Kehr zurück, der gegen die kollegiale Verfassung der bisherigen<br />
vlGH nun das autoritäre Führungsprinzip durchsetzt .
RKICI I(S)WHITKN: DAS DI-U'I'SCHH HISTORISCHI-: INSTITUT ROM 307<br />
Der historische Teil der deutschen <strong>Geschichte</strong> reicht darin bis 1900; mit diesem<br />
Datum setzt der Forschungsbereich der Zwillingsanstalt Reicbsmstitut <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
des neuen Deutschland ein.<br />
Paul Kehr ist Archäologe nicht im Sinne der gleichnamigen Disziplin, sondern<br />
in einer ihm eigenen Akzentuierung, Antiquarianismus und Archivwissen<br />
verschränkend. Seme Sammlung antiker klemformatiker Kunstgegenstände hat<br />
er auf Archivreisen erworben, als Dokument persönlicher Erinnerungen,<br />
»wobei das eigenwertige Zeugnis der Denkmäler nicht im Vordergrund stand.<br />
Sie ermöglichten ihm einen sehr persönlichen Zugang zur Frühgeschichte des<br />
Landes und der Stadt.« 46 Er blickt auf solche Artefakte mit den Augen des<br />
Diplomatikcrs: »Dem Erforscher schriftlicher Dokumente waren die Werke der<br />
Kleinkunst eine Quelle anderer Art, die <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> eines Volkes<br />
wichtig erschien« - auch wenn dies in den Würdigungen seines Lebenswerkes<br />
und <strong>von</strong> ihm selbst unerwähnt blieb . Dieser Negativbefund<br />
liest sich als die diskursive Tabuisierung eines subjektiven Blicks, wie er dem<br />
Sammler eignet und den der positivistische Wissenschaftler sich versagt. Hier<br />
gilt kein Fetisch. Unterdessen ist Kehr, der Wissensarchäologe italienischer<br />
Archive, selbst Archiv geworden. Als corpse wie als Text-Korpus ist er zerfallen.<br />
Das Findbuch, angefertigt <strong>von</strong> Ernst Schubert 1952 (Merseburg), bemerkt<br />
zur Revision 1992/93: »urspr. Ordnung durch häufige Benutzung weitestgehend<br />
zerstört. Der Bearbeiter hatte die Briefe zunächst kaufmännisch abgelegt.<br />
Eine Foliierung war unterblieben.« 47 In Vorbereitung ist eine Biographie Paul<br />
Kehrs <strong>von</strong> Michele Schubert, welche die symbolische Ordnung der Historie<br />
gegenüber der realen Fragmentank des Archivs narrativ wiederherstellt.<br />
Kehr ist inspiriert <strong>von</strong> der Organisation <strong>von</strong> Speicherwissen zur deutschen<br />
Vergangenheit, wie es die Edition der Monumenta Germaniae Histonca modellierte.<br />
Zunächst aber, bei Studienbeginn, (ver)führt ihn ein Werk historischer Bellektristik,<br />
Ferdinand Gregorivius' <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom im Mittelalter^ in<br />
Richtung der italienischen Metropole. Nicht anders war Leopold <strong>von</strong> Ranke<br />
zunächst inspiriert <strong>von</strong> den Historienromanen Sir Walter Scotts (dessen poe-<br />
4fl Wolfgang Pülhorn, Antke Kleinkunst der Sammlung P. I\ Kehr, lieft 4 der Reihe des<br />
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (Mg. Gerhard Bott), Die vor- und trühge-'<br />
schichtlichen Altertümer im Germanischen Nationalmuseum, GNM Nürnberg 1987, 7f<br />
47 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Repositur 92, Nachlaß<br />
Kehr. Die Korrespondenzen im Nachlaß Kehr (Geheimes Staatsarchiv, I. IIA Rep.<br />
92 NL Kehr A I Nr. 1 ff.) wurden inzwischen »unter diesem Gesichtspunkt erstmalig gründlich gesichtet«:<br />
Michele Schubert, Auseinandersetzungen über Aufgaben und Gestalt des Preußischen<br />
Historischen Instituts in den Jahren 1900 bis 1903, in: Quellen und Forschungen aus<br />
italienischen Archiven und Bibliotheken 76 (1996) 383-454 (385) - eine Durchsicht,<br />
die der Autor zcitglcich <strong>für</strong> sich beansprucht.
308 ROM ALS SATEU.IT DES PKUTSCHKN GKIMCIITNISSKS<br />
tischen <strong>Im</strong>agination der Historie er alsdann differenzkonstitutiv <strong>für</strong> seine asketische<br />
Geschichtsschreibung abweist, als ihn das Archivbegehren bis nach Venedig<br />
führt 48 ). Kehr erlebt den deutsch-französischen Krieg <strong>von</strong> 1870/71 mit vollem<br />
Bewußtsein:<br />
»Ich sehe und höre noch unseren Direktor am Morgen des 3. September 1870 den<br />
Sieg <strong>von</strong> Sedan und die Gefangennahme Napoleons mit dem Zaubertwort >Schulfrei<<br />
verkünden . In dem nahen Erfurt betraehteten wir neugierig die Tausende<br />
gefangener Turkos in ihren malerisehen Kostümen und in ihrer martialischen Haltung,<br />
und ebenso ergriffen folgten wir in Gotha den fast täglichen militärischen<br />
Begräbnissen und lauschten dem dumpfen Trommelwirbel und den Salven über das<br />
Grab. Dieses waren meine stärksten Jugendennnerungen, die mich wohl zur<br />
Historie hätten führten können und noch lieber zum Kriegsmann. Aber wie immer<br />
ich mich umschaue, ich sehe keinen Weg, der mich nach Rom und nach Italien hätte<br />
führen können. Dazu bin ich erst durch eine literarische Anregung gekommen« 49 ,<br />
nicht etwa durch das Archiv. Kehr war Student der <strong>Geschichte</strong> im ersten Semester<br />
in Göttingen »und gelangweilt durch die nüchternen Vorlesungen«, als ihm<br />
die <strong>Geschichte</strong> der Stadt Rom im Mittelalter <strong>von</strong> Ferdinand Gregorovius in die<br />
Hände fällt. Er liest sie »zuerst mit Begeisterung, später mit größerer Kritik,<br />
und ich fühlte beinahe instinktiv, daß dieses Rom einmal der Gegenstand meiner<br />
Arbeiten sein würde«; so beschließt der achtzehnjährige Student seine erste<br />
Romfahrt . Seine Itahenfahrt im September 1879 führt ihn jedoch nicht<br />
über Verona und Venedig hinaus; hier aber filtert sein Textgedächtnis - der<br />
deutsche Geschichtsdiskurs - den Wahrnehmungsrahmen seines Itahencrlebnisses<br />
und präfigunert die Konstruktion seiner späteren Arbeit am deutschen<br />
historischen Institut m Rom:<br />
»Ich wußte bereits so viel <strong>von</strong> der <strong>Geschichte</strong> dieser Städte, daß mir doch ein guter<br />
Teil der <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters lebendig wurde und besonders der Zusammenhang<br />
mit der deutschen <strong>Geschichte</strong>. Auf der Arx <strong>von</strong> Verona hatte einst<br />
Theoderich der Große residiert und als Dietrich <strong>von</strong> Bern lebt er noch heute in<br />
<strong>Geschichte</strong> und Sage, und was diese Stadt auch später <strong>für</strong> die ältere deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> bedeutet hat, haben mich hernach meine archivalischen Forschungen in<br />
Verona gelehrt.« <br />
Diese deutsch-italienische, mithin relativische Geschichtsverschränkung holt<br />
ihn auch bei der Kehre zur archivischen Ästhetik ein. Als ihn das preußische<br />
4S Dazu W. E., Rhetorik des Ornaments, in: Ursula Franke / Heinz Paetzold (Hg.), Rhetorik<br />
des Ornaments und <strong>Geschichte</strong>. Studien zum Strukturwandel des Ornaments in<br />
der Moderne, Bonn (Bouvier) 1996, 283-301; leiner W. E., Reisen ins Innere des Archivs,<br />
in: Ulrich Johannes Schneider /Jochen Kornclius Schütze (Hg-), Philosophie und Reisen,<br />
Leipzig (Leipziger Univcrsitätsvcrlag) 1996,160-177<br />
49 Paul Fridolin Kehr, Italienische Erinnerungen (Vorträge der Abt. f. Kulturwiss. d. Kaiser-Wilhelm-!<br />
minus im Palazzo Zuccan, 1. Reihe, I lel'i 21), Wien (Scliroll) 1940, 6
Ri-.ic:ii(s)\vi-;n'i-N: DAS DUUTSCHT; HISTORISCH!-: INSTITUT ROM 309<br />
Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in<br />
einem Schreiben vom 2. November 1907 vertraulich um Stellungnahme betreffs<br />
einer Eingabe des Archäologen Konrad Platz zur Erforschung <strong>von</strong> in Ravenna<br />
gefundenen Resten des Theoderich-Palastes und entsprechender Mosaiken bittet,<br />
unterstreicht ein beigefügtes Schreiben Plaths an den Minister (Wiesbaden,<br />
12. September 1907) die »ganz unschätzbare Bedeutung« dieser Entdeckung<br />
»<strong>für</strong> die deutsche Kulturgeschichte, insbesondere <strong>für</strong> die Erforschung der deutschen<br />
Königspaläste«. 50<br />
<strong>Im</strong> Oktober 1886 endlich weilt Kehr in Rom, ausgestattet mit wissenschaftlichen<br />
Aufträgen seitens der Zentraldirektion der MGH und der Historischen<br />
Kommission der Provinz Sachsen. Ein Brief <strong>von</strong> Paul Kehr an Theodor Mommsen<br />
(Florenz, 28. März 1898) betrifft die Liberpontificalis-Ausga.be <strong>für</strong> die MGH<br />
und macht einen Erweiterungsvorschlag. Projektiert ist die <strong>Geschichte</strong> des Papsttums<br />
<strong>von</strong> 600-1200 und damit »eine in Allem u. Jedem bis auf den Grund<br />
zurückgehende Bearbeitung des Quellenmaterials«. Die <strong>von</strong> der Zentraldirektion<br />
geplante Abteilung Gesta pontijicum Romanorum sollte die histonographische<br />
Überlieferung der <strong>Geschichte</strong> der Päpste umfassen; Kehr will diese<br />
Arbeit erweitern und hat hierbei hauptsächlich die päpstlichen Register im Sinn:<br />
»Nun ist allerdings das Gregors I. bei den Epistolae untergebracht, aber am Ende<br />
ist das doch nur eine Frage der Bibliothekshülfswissenschaften «, und die<br />
Organisation <strong>von</strong> Gedächtnis <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> also eine Funktion der Sortierung:<br />
»So ordnet sich alles natürlich.« In der Papsturkundenausgabe sollen die einzelnen<br />
Privilegien und Briefe ediert werden, in den Monumenta die Biographien,<br />
Register »u. was sonst sich dazu fügt.« 11 ' Zu den älteren Papsturkunden führte<br />
ihn der dann abgebrochene Plan einer Monographie über die Entstehung des<br />
Kirchenstaates, eines seinerzeit infolge des Kulturkampfes aktuellen Themas; da<br />
es weder eine Diplomatik der Papsturkunden gibt, die eine sichere Entscheidung<br />
über echt oder unecht erlaubt, um »über die traditionelle apologetische oder<br />
polemische Auffassung der <strong>Geschichte</strong> des Papsttums hinauszukommen« 32 ,<br />
konzipiert Kehr eine kritische Edition der Papsturkunden bis Innozenz III. Solcher<br />
archivgestützter Editionsarbeit gegenüber meint Kehrs Seitenhieb gegen die<br />
»falschen Propheten <strong>von</strong> heute« am 7. November 1896 den Leipziger Fachkollegen<br />
Karl Lamprecht. Pflicht des Historikers sei es, »die Überlieferung zu sam-<br />
50<br />
Archiv DHI Rom, Registratur, Älterer Teil, fasc. Nr. 7, Bl. 14 ff.<br />
11<br />
Staatsbibliothek Berlin (PK) Haus 1, Unter den Linden, Nachlaß Theodor Mommsen,<br />
Faszikel MGH, Bl. lf<br />
32<br />
Kehr, zitiert nach: Rudolf Hiestand, Die ltalia Pontifica, in: Das Deutsche Historische<br />
Institut in Rom 1888-1988, hg. <strong>von</strong> Reinhard Elze / Arnold Esch, Tübingen (Nicmeyc-r)<br />
1990, I68f (169)
310 ROM ALS SATKI.I.IT bi-s DKUTSCHKN GI-DÄCI ITIMISSICS<br />
mein und in Sicherheit zu bringen«, wie es in Form der MGH geschehe. 53 Zur<br />
Verhandlung steht hier also das wissensarchäologische Moment in Kehrs Geschichtsverständnis.<br />
Der Historiker Ernst H. Kantorowicz beklagte auf seiner<br />
Historikertagrede in Halle 1930, daß gerade die mittelalterliche <strong>Geschichte</strong> -<br />
vom outsider Gregorovius abgesehen - völlig versagt und sich seit Giesebrechts<br />
Tagen (dessen <strong>Geschichte</strong> der Kaiserzeit im Jahre 1855 zu erscheinen<br />
begann) »den nationalen Aufgaben und Pflichten völlig entzogen« habe. 54 Ideologischen<br />
Veremnahmungsversuchen der Historie zum Trotz fordert Kehr dagegen<br />
ausdrücklich keine nationalstaatliche Verengung der deutschhistorischen<br />
Forschung, keine »Beschränkung auf die Denkmäler der eignen Nation«,<br />
denn: »Alle Nationen des Abendlandes haben Teil an der gemeinsamen Überlieferung<br />
des Mittelalters« . Der Akzent<br />
liegt hier auf Kulturgeschichte als (Wissens-)Transfer, ist also vom Übertragungsmedium<br />
her gedacht. Kehrs Edition des Regestenwerks Italiapontifica ist<br />
dementsprechend nicht chronologisch, sondern nach den jeweiligen Empfängern<br />
angelegt; Historie wird in Post aufgelöst. Damit ist die Aussage des Regestenwerks<br />
<strong>von</strong> Papst auf die Empfängennstitutionen verschoben, auf die Korrelation<br />
<strong>von</strong> Übertragung und Gesetz; dies bedeutet »nicht das einzelne Stück, etwa nur<br />
das Original aufzustöbern«, sondern das ganze Archiv eines bestimmten Empfängers<br />
aufzufinden und zu rekonstruieren . Nicht die<br />
kirchliche Institution (Kirchenpolitik, Rechtsgeschichte) steht dabei im Mittelpunkt,<br />
sondern die Frage, was aus ihren Archivalien geworden ist. Da sich die<br />
Vergangenheit <strong>von</strong> Institutionen durch ihre Speicher definiert, folgt am Ende der<br />
Einleitung zu jedem Institut stets ein besonderer Abschnitt De archivis, »selbst<br />
wenn ihm nicht selten nur das eine Wort >nihil< folgte. Hatte 1896 das einzelne<br />
>Monument< im Vordergrund gestanden, so war es nun die <strong>Geschichte</strong> des Überlieferungskörpers«<br />
. Auseinandergerissene Fonds soll die<br />
Edition ideell wieder zusammenfügen; damit wird auch kopiale Überlieferung<br />
bis zu späteren Abschriften des 18. Jahrhunderts als historisches Zeugnis anerkannt.<br />
Die Italid Pontijica zielt auf eine Archivgeschichte aller kirchlichen<br />
Institutionen bis 1198, soweit sie in Beziehung zu Rom gestanden haben; Fluchtpunkt<br />
ist also der imperialc Bezug des Archivs, oder in Kehrs Worten: eine<br />
urkundlichen Quellenkunde . Sein Vorbild<br />
ist dabei das ebenfalls regional aufgebaute Corpus Inscriptionum Latinarum<br />
"' 3 Göttinger Nachrichten, Geschäftl. Mitteilungen aus dem Jahre 1896, 72-86 (73), zitiert<br />
nach: 1 liestand 1990: 171<br />
54 Ernst H. Kantorowicz, Über Grenzen, Möglichkeiten und Aufgaben der Darstellung<br />
mittelalterlicher <strong>Geschichte</strong> (Rede auf dem deutschen Historiker-Tag in Halle, 24.<br />
April 1930), abgedruckt in: Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft 16: Kantorowkv.,<br />
Wien IW2, S--I0, liier: 7\
RIUCI i(s)\vi-.ri'KN: DAS DHUTSCHI-: HISTORISCHH INSTITUT ROM 311<br />
und dessen Qualitäten »Ordnung, Präzision, Sauberkeit«, wogegen »wir Historiker<br />
diesen Philologen gegenüber Pfuscher und Stümper sind« . Der wissensarchäologische Anteil des Historikers vom Typus Kehr<br />
ist in der Praxis der Diplomatik angelegt. Kann man jedoch über das Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Wissensarchäologie und Historie in einer Sprache sprechen, die (als wissenschzhsgeschichtliche<br />
Rekonstruktion) selbst schon am historischen Diskurs und<br />
damit an der Veräußerhchung der archäologischen <strong>Im</strong>plikation der Gedächtnisarbeit<br />
zur historischen Hilfswissenschaft teilhat? Wie sähe der archimedische<br />
Punkt aus, <strong>von</strong> dem aus eine Wissensarchäologie auch auf den Akt ihrer Beschreibung<br />
übergriffe?"<br />
Zwischen Archiv und Historie: Die Krise <strong>von</strong> 1901<br />
Die Repositur 92 des Geheimen Staatsarchivs (PK) Berlin birgt im Nachlaß Paul<br />
Kehr unter der Sigle A V 5 (»Deutsches histor. Inst, in Rom«) Fragmente der<br />
Diskussion aus dem Krisenjahr 1901. Die Ablagerung der Daten folgt dem reinen<br />
Algorithmus der Datierung. Eine gedruckte Eingabe an den Reichskanzler<br />
(Marburg, 20. März 1901, unter der Federführung <strong>von</strong> G. v. Below, K. Brandi und<br />
G. Frhr. v. d. Ropp) enthält die Bitte um Errichtung eines Historischen Reichs\nstituts<br />
in Rom; der Anlaß sind die vorläufige Einstellung der Edition Rcpertonum<br />
Germanamcum und der Lcitungsswechsel. 36 <strong>Im</strong> Unterschied zum dortigen<br />
deutsch-archäologischen Institut und anderen historischen Auslandsinstituten in<br />
Rom leiste das römische Histonkerhaus keine Nachwuchsausbildung:<br />
»Kann man auch das Studium des Historikers mit demjenigen der Archäologen<br />
nicht avif der ganzen Linie vergleichen, so wird man doch darauf hinweisen dürfen,<br />
dass die Mitglieder jener Institute seit Jahren den unvergleichlich bildenden<br />
" Vgl. dazu die prägnante Paraphrase der Kritik Jacques Derndas an Michel Foucaults<br />
Untersuchungen zum Verhältnis <strong>von</strong> Wahnsinn und Gesellschaft in der »Prcfazionc«<br />
<strong>von</strong> Carlo Ginzburg, II fonnaggio e i vermi. II cosmo di un mugnaio del >500, Turin<br />
(Einaudi) 1976, xvi<br />
36 Alois Schulte, Leiter des römischen Instituts <strong>von</strong> 1901-1903, spricht sich in einer<br />
Denkschrift <strong>für</strong> die Fortsetzung des Unternehmens in anderer Form der Datenverarbeitung<br />
aus. Referiert in: Max Braubach, Aloys Schulte in Rom (1901-1903). Ein Beitrag<br />
zur deutschen Wissenschaftsgeschichte, in: Reformata Reformanda. Festgabe <strong>für</strong><br />
Hubert Jedin, 2. Teil, Münster (Aschendorff) 1965, 509-557 (524): »Entweder konnte<br />
man die bei der Masse der Nachrichten allzu aufwendige chronologische Anordnung<br />
durch das geographische Prinzip ersetzen oder - radikaler - sich mit einem großen<br />
Index begnügen«, d. h. die Uinschaltung <strong>von</strong> Textversammlung auf die Verwaltung<br />
ihrer Information, ganz in der Tradition des vorn Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß <strong>für</strong> das Germanische<br />
Nationalmuseum in Nürnberg angedachte Gcncral-Repcrtorium deutscher<br />
KulturmoiHinicntc.
312 ROM ALS SATKU.IT DKS DKUTSCMKN GKDÄC<br />
Einfluss eines Aufenthalts in der ewigen Stadt und des Gedankenaustausches über<br />
die verschiedensten individuellen Arbeiten mit Nutzen und Freude an sich erfahren<br />
haben.« <br />
Die Eingabe plädiert da<strong>für</strong>, das römische Institut nicht länger an die preußische<br />
Archiverwaltung anzukoppeln, sondern es nach dem Vorbild der MGH und des<br />
DAI als Reichsinstitut anzulegen. Das Preußische Historische Institut ist seit<br />
1897 etatisiert, indem es der preußischen Archivverwaltung unterstellt, damit<br />
aber zunehmend auf Archivzwecke, speziell die Erforschung der Vatikanischen<br />
Archive, zugeschnitten ist, in Differenz zur in seinen Statuten allgemeiner definierten<br />
Zielsetzung deutsch-italienischer Geschichtsforschung. 1902 erfolgt<br />
dann eine Reorganisation durch die Bildung eines Kuratoriums und wissenschaftlichen<br />
Beirats. Ein Artikel in der Zeitung Germania. Zeitung <strong>für</strong> das deutsche<br />
Volk und Handelsblatt vom 1. Mai 1902 spricht sich gegen eine weitere<br />
Bindung an die Archivverwaltung aus:<br />
»Die Archivverwaltung ist ein kleines, streng bureaukratisches Ressort . Die<br />
Geschäftsordnung <strong>für</strong> die Archive auf ein historisches Institut in der URBS<br />
AETERNA anzuwenden, ist ein Unding, weil bureaukratische Schablone<br />
stets der Tod aller Wissenschaft gewesen ist. Das römische Institut nimmt sich<br />
mit seinem merkwürdigen Titel als »exponiertes Archiv' immer wie ein Fremdkörper<br />
in diesem Organismus aus und stört die harmonische Monotonie der kleinen<br />
Verwaltung.« <br />
Soweit zur Struktur, zur institutionelle Lage; Zeltungsmeldungen präzisieren den<br />
Konflikt auf personaler Ebene. Dem Leiter des preußischen historischen Instituts<br />
in Rom, Alois Schulte, war durch den päpstlichen Archivbeamten, den Jesuitenpater<br />
Ehrle, ein Bündel Akten zum Ablaßstreit vom Jahre 1517 zur Veröffentlichung<br />
vorgelegt worden. Erinnern wir an dieser Stelle noch einmal an die Welle<br />
der Euphorie, die nach der Öffnung der Vatikanischen Archive unter Papst Leo<br />
XIII die europäische Geschichtsforschung durchlief: Datenhaldcn auch <strong>für</strong> deutsche<br />
Gelehrte wurden dort latent zum Abbau und zur Aktualisierung vermutet,<br />
Enthüllungen zu einer Reihe offener Fragen. Zum einen betrügt dieses römische<br />
Archiv seit mehr als hundert Jahren die Schlüssclattitüdc der Hermeneutik: Es gibt<br />
Daten zu sortieren, nicht aber Wahrheiten preis, weshalb die wissensarchäologische<br />
Methode einem solchen Speicher angemessener ist als die historiographische.<br />
Die Tiefenmetapher der archivischen Schürfung ist ein Effekt der Tatsache, daß<br />
die westliche Kultur seit der Renaissance durch Umgang mit perspektivisch<br />
konstruierten Bildern daraufhin konditionicrt ist, Flächen als Illusion einer Erstreckung<br />
in der Ticlc wahrzunehmen; solche ms Unbewußte abgesunkenen Konditionicrungen<br />
gilt es wieder ans Licht des Bewußtseins zurückzuzerren.<br />
Andererseits aber treten Forscher dort tatsächlich gelegentlich auf Minen.<br />
Schulte, der als Katholik Bedenken trug, die Vcröllcnilicluing zu bewirken, habe
Ri-:ici-i(s)\vi-;rn-.N: DAS DI-.UTSCIII-: HISTORISCHII-: INSTITUT ROM 313<br />
in dieser Sache beim Reichskanzler angefragt und darauf den Bescheid erhalten:<br />
»Ignorieren!« . Ein Artikel in der Deutsch-evangelischen Korresponenz<br />
berichtet da<strong>von</strong> unter dem Titel »Freiheit der Wissenschaft«, den Schulte <strong>von</strong><br />
einem befreundeten Journalisten mit der Bitte zugesandt erhält, sofort nur das<br />
Wort Erfunden zu telegraphieren. So verhandeln Signale das deutsche Gedächtnis<br />
fast in Echtzeit; Schulte geht gleichzeitig eine Depesche des Preußischen<br />
Archivdirektors Koser mit der Bitte zu, einstweilen nichts ohne ministerielle Zustimmung<br />
zu unternehmen - ein Übertragungsmedienkneg um Weisungen, die<br />
Vektoren aller memoria . Ein Artikel in der Magdeburgische<br />
Zeitungvom 15. September 1903 nimmt dazu unter dem Titel Ein beachtenswerter<br />
Fall Stellung. Schulte habe die Direktion am römischen PHI<br />
niedergelegt, »weil es ihn mit seiner Qualifikation als korrekt katholischer Historiker<br />
in Konflikt gebracht« habe. Dadurch sei »unerwartet schnell nach der langausgedehnten<br />
Diskussion über die Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft, die<br />
konfessionell katholische Wissenschaft ad absurdum geführt worden« . Tatsächlich war der Elan Schuhes bereits 1902 durch den überhandnehmenden<br />
Bürokratismus in der Finanzverwaltung seines römischen Instituts gebrochen<br />
worden; in der Zeitung Germania erscheint dazu am 21. Mai ein Artikel mit<br />
der Überschrift »Vom Preußischen Institut in Rom oder Bureaukratie und Wissenschaft«.<br />
Schulte war <strong>von</strong> Berlin wegen der unterlassenen Inventarisierung eines<br />
Lineals gerügt worden; der Artikel fragt: »Daß man dem berühmten Historiker<br />
trotz aller wiederholter Vorstellungen zumutet, die Dienste eines Kanzhsten, eines<br />
Copisten und eines Calculators zu verrichten?« .<br />
Kopisten und Kalkulatoren (also Computer) sind die römischen Historiker also<br />
nicht allein aul Objektebene (in der Datenverarbeitung der vatikanischen<br />
Archive), sondern auch in der Gedächtnisverwaltung auf technischer Ebene. Insofern<br />
hat Paul Kehr nicht Unrecht, wenn er am 9. August 1903 an Schulte schreibt:<br />
»Sie haben den Mut gehabt, das Institut zu übernehmen . Und das Ergebnis?<br />
+/- Null. Die Nuntiaturen gehen nicht, das Repertorium geht nicht<br />
. Woran hegt das? Doch offenbar nur an der Organisation. Die Hemmnisse<br />
sind zu groß.« 57 Vielleicht hegt die Wahrheit dieser Historie ja nicht in ihren<br />
Erzählungen, sondern in Ablaßzahlen, Berechnungen und Rechnungen in Geld,<br />
»wie man es zählte und was es erzählt«. 58 Die im vatikanischen Archiv entdeck-<br />
Aus dem Nachlaß Schulte zitiert durch Braubach ebd., 543. Dort auch, en detail, der<br />
Konflikt um die Ablaßaktenveröffentlichung (»Was war in Wirklichkeit geschehen?«),<br />
545ff.<br />
Lea Ritter-Santim und Giovanni Chianni, in: Lea Ritter Santini (Hg.), Eine Reise der<br />
Aufklärung. Lessing in Italien 1775 (Ausstellungskataloge Herzog August Bibliothek<br />
Wolfenbüttel / Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), I, Berlin, 1993, Kapitelüberschrift<br />
zu ilcn Seiten 201-206
314 ROM ALS SATKI.UT DI-;S DKUTSCIII-N GI-.DÄCHTNISSKS<br />
ten Akten-Konvolute mit Ablaßrechnungen des Reformationsjahres 1517 - vermutlich<br />
die Abrechnung der päpstlichen Ablaßkommission mit dem Bankhaus<br />
Fugger in Augsburg - drohten im Falle ihrer Veröffentlichung einerseits die Beziehung<br />
der preußischen Regierung zum Vatikan zu verdunkeln, andererseits<br />
der Zentrumspartei und der ultramontanen Geschichtswissenschaft mit ihrer<br />
Behauptung unangenehm zu werden, zur Zeit der Reformation sei schon nicht<br />
mehr mit Ablässen gehandelt worden. Nach des Reichskanzlers Weisung »Ignorieren!«<br />
legt Schulte die Direktion nieder. Jedenfalls scheint nicht so sehr der<br />
Skandal um die Publikation der Ablaßfundc, sondern die Personalpolitik des<br />
ambitionierten Paul Kehr der römischen Zeit Schuhes ein Ende gesetzt zu haben.<br />
Keine <strong>Geschichte</strong> erzählt da<strong>von</strong>, sondern ein Unfall des Archivs (auf gleicher<br />
Ebene wie die am Rande <strong>von</strong> Schuhes wirtschaftshistorischen Forschungen aufgetauchten<br />
Ablaßfunde selbst) zeigt es; nicht ein urkundliches Dokument, sondern<br />
der Umschlag, also das Übertragungsmedium, im Nachlaß Kehr, in dem sich<br />
ein Brief Schuhes an ihn findet, trägt die Bemerkung <strong>von</strong> seiner Hand: »Jedenfalls<br />
ein ganz guter Geschichts- und Archivforscher. Ich habe ihn auf sehr elegante<br />
Weise abgehängt.« 59<br />
<strong>Im</strong> seinem zehnten Jahrgang 1957 veröffentlichte das Mitteilungsblatt <strong>für</strong><br />
deutsches Archivwesen einen bis dahin unpublizierten Text Friedrich Meineckes<br />
vom April 1901 über »Archivberuf und historische Forschung«. Hierin nimmt<br />
Meinecke Stellung zur genannten Marburger Petition vom 1. April 1901, welche<br />
die Umwandlung des Preußischen historisches Instituts in Rom in ein Reichsinstitut<br />
forderte, nachdem Paul F. Kehr im Januar d. J. in der Augsburger Allgemeinen<br />
Zeitung dahingehend plädiert hattc/'°Aus Anlaß dieser Krise des PHI<br />
äußert sich Meinecke zum Verhältnis <strong>von</strong> Archivar und Historiker:<br />
»Es hat sich allerdings in den letzten Jahrzehnten auf einigen Gebieten mittelalterlicher<br />
Forschung ein Wandel vollzogen, der den Archivar etwas ins Hintertreffen<br />
geschoben li.it. IM ist nicht mehr wie liuhei der eigentliche Iraker systematischer<br />
Urkundenforschung und hilfswissenschaf liehet' Studien überhaupt: der Diplomatiker<br />
<strong>von</strong> Fach, der durch vielfache Archivreisen versiert ist, der über ein viel rei-<br />
59 Selbst eine Nachricht des Archivs: »Freundliche. Mitteilung <strong>von</strong> Dr. Rudolf Morsey«<br />
bemerkt Braubach 1965: 555 in einer Anmerkung; seinerzeit lagerte der Nachlaß Paul<br />
Kehr (Rep 92) noch im Deutschen Zentralarchiv Merseburg (DDR), jetzt Geheimes<br />
Staatsarchiv (PK) Berlin-Dahlem. Der Aufsatz <strong>von</strong> Schubert 1996 fügt den Recherchen<br />
Braubachs keine wesentlichen Thesen oder Archivbefunde hinzu, sondern wiederholt<br />
vielmehr seine Argumentation aus leicht verschobener Perspektive (Kehr statt<br />
Schulte); die in der vorliegenden Studie erhobene Forderung, das Archiv y.u schreiben<br />
(transitiv und modular also), soll nicht heißen, es schlicht zu paraphrasieren, sondern<br />
die Ausstellung der diskreten Archivbelundc mit Vektoren zu versehen.<br />
(l ° Anm. d. Schriftlciumi; <strong>von</strong> Der Archivar: »Der Aufsatz war offenbar<br />
iür die Beilage der Augslnirger Allgemeinen Zeitung bestimmt«.
RI-:ICII(S)\VI-.ITI-;N: DAS DHUTSCIÜ-: HISTORISCH!-. INSTITUT ROM 315<br />
cheres Vergleichsmatenal verfügt, hat den an sein Archiv gebundenen Archivar<br />
überholt. Dieser Verlust ist aber reichlich wettgemacht durch die Aufgaben der<br />
Aktenforschung . Wir erinnern an die großen, grundlegenden Publikationen<br />
zur polnischen <strong>Geschichte</strong>, ferner daran, daß sich ihm neuerdings, durch die<br />
Wendung des geschichtlichen Interesses zur inneren <strong>Geschichte</strong>, ein neues Arbeitsfeld<br />
eröffnet . Dies neue Forschungsgebiet ist die innere <strong>Geschichte</strong> der<br />
deutschen Territorien, keine antiquarische am Einzelnen klebende, sondern eine<br />
<strong>von</strong> großen Gesichtspunkten ausgehende Erforschung auch des scheinbar Kiemen,<br />
die vergleichende Verfassungs-, Vcrwaltungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte<br />
des deutschen Volkes, erfaßt an ihren historischen Trägern, den Territorien.« M<br />
Die Metonymie des Reiches greift - synekdochisch - über auf die Methode.<br />
Gedächtniskybernetik tritt an die Stelle des emphatischen, philosophisch fermentierten<br />
Geschichtsgedächtnisses, denn <strong>für</strong> die großen historischen Publikationen<br />
ist der ständige Archivbenutzer »zugleich ein Stück Archivbeamter, d. h.<br />
ein Mann, der sich in die organische Struktur des <strong>von</strong> ihm benutzten Archivs hineinlebt,<br />
sein muß, und umgekehrt der Archivbeamte sich in die wissenschaftliche<br />
Ziele seines Benutzers hineinarbeiten und mit ihm mitforschen muß« .<br />
Durch gesperrten Druck steht hervorgehoben: »Lebendige Wechselwirkung zwischen<br />
Archivberuf und historischer Forschung ist ein unumgängliches Postulat<br />
der modernen Geschichtswissenschaften« . Zwei gleichrangige Modi der<br />
Datenverarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit, zwei diverse Formen der Konfrontation<br />
<strong>von</strong> Gedächtnis liegen hier also im (vom Meinecke mit der rhetorischen Figur<br />
der Komplementarität aufgehobenen) Widerstreit. Foucaults wissensarchäologisch-monumentahsche<br />
Methode, die Datenserien bildet, statt <strong>Geschichte</strong>n zu<br />
erzählen, kontrastiert hier zu Meineckes historisch-dokumentarischer Methode.<br />
Gewinnen Information aus Archiven nicht schon mit Urkundenkritik, sondern<br />
erst im Rahmen einer Geschichtstheorie Bedeutung? »Ohne Theorie stünde die<br />
Schrift des sächsischen Bischofs gleichwertig neben Henry Bcnraths Brief-<br />
Roman >Die Kaiserin Thoophano« oder >l btlers Tagcbüchcr< neben den echten<br />
Diplomen Ottos des Großen und böten Sätze wie >Der Hund frißt Fleisch< und<br />
>Die Normannen plündern Tours< Wahrnehmungen gleicher Qualität.« 62 Bedarf<br />
es eines hermeneutischen Horizonts, um Daten <strong>von</strong> Information zu trennen?<br />
Bestimmte Publikationen seien »bei der Eigenart des Materials« überhaupt nur<br />
<strong>von</strong> einem erfahrenen und findigen Archivbeamten durchzuführen; genügt<br />
umgekehrt diese Beteiligung an den Editionsarbeiten auf die Dauer <strong>für</strong> die wisenschafthehe<br />
Entwicklung des Archivbeamten?<br />
'•' Der Archivar, Januar 1957, Sp. 1-6 (Sp. 3)<br />
hl Johannes Fried, Gens und regnum. Wahrnehmungs- und Deutungskategorien politischen<br />
Wandels im früheren Mittelalter. Bemerkungen zur doppelten Theoriebildung<br />
des Historikers, in: Klaus Schreiner / lüren Miethke (Hg.), Sozialer Wandel, Sigmaringen<br />
(Thorbccke) 1994, 73-104 (741)
316 ROM ALS SATHU.IT ni-.s DHUTSCIIHN GHDÄCIITNISSKS<br />
»Ohne die selbständige geistige Verarbeitung des Gesammelten und ohne lebendigen<br />
Konnex mit den allgemeinen, die Forschung leitenden Fragen und Interessen<br />
entartet die Publikationstätigkeit entweder zur Handwerksroutine oder zum<br />
antiquarischen Sammeleifer. Gothein hat zuerst <strong>von</strong> dem Fehler gesprochen, >in<br />
den publizierende Archivare so leicht verfallen, das Bedettende und Bedeutungslose,<br />
das nirgends ununterschiedcner als in Verwaltungsaktcn zusammenliegt, mit<br />
gleicher Liebe zu behandeln".« <br />
Genau diese transhermeneutische Datenästhetik aber scheidet die Programmierung<br />
der Gedächtnisdatenbanken <strong>von</strong> narrativer Historiographie.<br />
Modularität <strong>von</strong> Historie als Archiv: Die Denkschrift Kehrs <strong>von</strong> 1913 h}<br />
In seiner Denkschrift über die Begründung eines Instituts <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong><br />
<strong>von</strong> 1913 konstatiert Kehr ein neues Paradigma der Geschichtsforschung als<br />
Effekt der Öffnung der Archive. Archivahsche Datenmassen bedeuten einen<br />
Quantsprung <strong>für</strong> die Wissenschaft. Es geht im Zeitalter der Informatik nicht länger<br />
um die Frage, welche rhetorischen Formationen aus Daten <strong>Geschichte</strong><br />
machen, sondern um die Anverwandlung <strong>von</strong> Daten in Information; dabei ist es<br />
ist das Archiv, welches das Gedächtnis der Vergangenheit erst adressierbar macht.<br />
Den res gestae liegen Register vor, doch was sich im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> als<br />
lebendige Erinnerung gibt, täuscht über dieses mechanische Dispositiv hinweg.<br />
In Form der Geschichtswissenschaft hat sich die Moderne eine Maschine erfunden,<br />
die endlose Datenströme oder -sätze in endliche Information transformiert.<br />
Das Repertorium Germanicum und die Publikation der auf Deutschland bezogenen<br />
päpstlichen Nuntiaturbenchte im Archivo Segreto des Vatikan <strong>von</strong> Seiten<br />
des Deutschen Historischen Instituts in Rom geben seit rund hundert Jahren ein<br />
Beispiel da<strong>für</strong>, was Rom (auch) heißt: die Ausbeute eines Read only memory, zu<br />
dem sich alle Historiographie wie ein random access memory verhält (kaiserliche<br />
Juristen und katholische Dogmatiker wußten es längst 64 ). Das Repertorium Germanicum,<br />
das vom DHI Rom herausgegebene Verzeichnis der in den päpstlichen<br />
Registern und Kammeralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des<br />
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas<br />
bis zur Relormation, kommt durch seine aul eine Aneinanderreihung <strong>von</strong><br />
Kürzeln verknappten, non-narrativen und parataktisch formulierten Petenten-<br />
63 DHI Rom, Archiv, Beilage (Typoskript, Abschrift <strong>von</strong> Abschrift) zu Alt. Reg. Nr. 5)<br />
Paul Kehr, Denkschrift über die Begründung eines Instituts <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong>,<br />
datiert 9. September 1913<br />
M Dazu Bernhard Siegert, Der Untergang des römischen Reiches, in: FL U. Gumbrecht /<br />
K. L. Pfeiffer (Hg.), Paradoxicn, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener<br />
Kpistemologie, Frankfurt/M. 1991,497
RI-IC> I(S)\VT.ITI:N: DAS DI-.UTSCHI: HISTORISCHI-: INSTITUT ROM 317<br />
Regesten im Kampf gegen den Zahlenfriedhof nicht nur den Redundanzverknappungs-Programmen<br />
der Informatik nahe, sondern als Editionspraxis der<br />
hochformalisierten Diktion der päpstlichen Kanzlei selbst nahe, wo etwa ein<br />
Datar die magna data verzeichnete. Kehr stellt den Gewinn <strong>für</strong> die historische<br />
Wissenschaft durch die ersten Aktenpublikationen der Nuntiaturberichte nicht<br />
in Abrede, steht aber vor dem Problem des'dataprocessing:<br />
»Aber die Berichte der Nuntien waren an historischem Wert doch sehr ungleich<br />
und verschieden, zu abhängig <strong>von</strong> der Bedeutung des Nuntius und der Wichtigkeit<br />
der berichteten Ereignisse. Das Institut hat deshalb eine andere <br />
Publikationsmethode geplant, indem statt der ganzen Texte, wo es angeht, nur<br />
Regesten, <strong>von</strong> allen Texten nur die historisch wichtigen Aktenstücke geboten werden<br />
den gewaltigen Quellcnstoff durch mehr monographische Darstellungen<br />
mit Urkunden- und Regestenanhängen zu bewältigen.« 65<br />
Die Regestenedition reduzierte die Berichte allerdings auf einen so schmalen<br />
Aussagewert, daß das Institut inzwischen wieder zur Volledition der Texte<br />
übergegangen ist. Jede Selektion <strong>von</strong> Seiten des Bearbeiters bedeutet Manipulation<br />
der Information; unterschiedlichen historischen Fragestellungen wird die<br />
Wespentaille <strong>von</strong> Regesten nicht gerecht und nötigt am Ende wieder zum Rückgriff<br />
auf das Original. Der historische Diskurs bedarf der Redundanz, denn sie<br />
macht die Differenz aus zu Informationspaketen, deren Preis Unscharfe qua<br />
Uniformierung der Materie ist - zumal wenn es sich, wie im Fall <strong>von</strong> Nuntiatur-Depeschcn,<br />
bereits um Zeitgeschichtspost im Telegrammstil handelt. 66<br />
Die Öffnung diverser Archive seit den Napoleonischen Kriegen im 19. Jahrhundert<br />
bedeutet die Proliferation einer Datenmenge <strong>für</strong> die Geschichtswissenschaft,<br />
deren paradigmatische Konsequenz metahistorische Rhetorikanalysen<br />
nicht zu verarbeiten wissen. Der Siegeszug einer metonymischen, also alle diversen<br />
Details der Vergangenheit zu einem historischen Ganzen integrierenden<br />
Darstellung läßt sich als Strategie zur Bewältigung neuer Datenmassen lesen; zwischen<br />
Historiker und <strong>Geschichte</strong> aber schiebt sich die Archivologie. Neuordnung:<br />
Heute ist es (auch in den Publikationsreihen des DHI) die EDV, die Monumente<br />
des Archivs, als Daten neutralisiert, in ein uniformes Verarbeitungssystem überträgt,<br />
also dem vorliegenden Kontext der Vatikanischen Archive entreißt, um sie<br />
einer dillerenten Beschreibung namens I Iistorie zugänglich zu machen - eines<br />
Referenten, der - im Gegensatz zur Materialität des Archivs als realem Agenten<br />
des Kirchenstaats - im <strong>Im</strong>aginären lieet. Die Worte Kehrs über Archrvarbeit sind<br />
6:1 Paul Kehr, Das Preußische Historische Institut in Rom, in: Internationale Monatsschrift<br />
<strong>für</strong> Wissenschaft Kunst und Technik, 8 (1913), 2, 2-42 (15f)<br />
66 Siehe: Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, Dritte<br />
Abteilung 1572-1585, 7, im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearbeitet<br />
<strong>von</strong> Almut Bues, Tübingen 1990, Einleitung, bes. Kapitel 5 »Editionspnnzipicn«
318 ' ROM ALS SATI-.U.IT DI;S IM-UTSCIII-.N GF.DÄCIITNISSHS<br />
nun selbst archivisches Gedächtnis geworden; so gelesen, kommentiert das Archiv<br />
sich selbst. Denn solange die auf Archive gegründete Rede der Historie ihre<br />
Bedingtheit nicht sieht und die »Archive ihrer eigenen Vergangenheit« nicht<br />
durchforstet, blendet sie die Selbstvcrstrickung in ihr Thema aus. 67 Es läßt sich<br />
historisch nicht über das Archiv sprechen, ohne nicht schon transitiv das Archiv<br />
zu sprechen. Hier hegt die Nahtstelle zur Archäologie: »Now archaeologists are<br />
having to make judgments on the work of their predecessors as they are excavating<br />
in the field and in archives.« 68 Kehr sagt es unter Verweis auf die neuen Reproduktionstechniken<br />
<strong>von</strong> Quellenmaterial, etwa Sickels und Sybcls Edition<br />
Deutsche Urkunden in Lichtbildern. »Die großen politischen Ereignisse des 19.<br />
Jahrhunderts wirkten tiel und anregend aul den historischen Sinn der Gebildeten.<br />
In diese Zeit fiel auch die allgemeine Öffnung der Archive«; was Kehr hier<br />
nebeneinander nennt, markiert tatsächlich eine Bedingung <strong>von</strong> Urkundenforschung<br />
jenseits ihrer Machtgebundenheit:<br />
»Mit einem Male wurde eine ungeheure, fast unübersehbare Masse historischen<br />
Quellenmateriales, vor allem die Urkunden, der Forschung zur freien Verfügung<br />
gestellt. Freier wurde der arehivalische Verkehr zwischen den verschiedenen Kulturländern;<br />
die Fortschritte der Technik, besonders die Photographie, kamen<br />
hinzu: so strömte und strömt die Fülle des historischen Febens in neuen Materialien,<br />
die der Bearbeitung, in alten Matenahen, die der Neuordnung harren,<br />
zugleich mit ihnen neue Aufgaben und Erneuerung der alten, befruchtet durch die<br />
Fortschritte der benachbarten Wissenschaften, der Philologie, der Rechts- und<br />
Staatswissenschaft, der Theologie.« 69<br />
Es ist eine rhetorische Technik (Figuren der Prosopopöie und des Euphemismus)<br />
als Bedingung der historischen <strong>Im</strong>agination gegenüber der Lage des Archivs,<br />
schweigende Daten und ihre Träger mit der Fülle des historischen Lebens zu verwechseln.<br />
Zwischen Historie und Archäologie, <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis<br />
schiebt sich das Archiv. Historiker denken dabei - und darin scheidet sich das<br />
Zeitalter des Positivismus vom fröhlichen Positivismus Michel Foucaults - Vergangenheit<br />
als vergangenes Leben, während Archäologie in der Lage ist, Vabsent<br />
de rhistoirc (Michel Certeau) zu konfrontieren. Materialien, die der Neuordnung<br />
harren: Kehr verlangt »eine mühsame, den Älteren unbekannte Ordnung und<br />
67<br />
Peter Rück (Hg.), Mabillons Spur: zweiundzwanzig Miszellen aus dem Fachgebiet<br />
Historische Hilfswissenschaften der Philipps-Universität Marburg; zum 80. Geburtstag<br />
<strong>von</strong> Walter Hcinemeyer, Marburg/Lahn 1992, 11, unter Bezug auf Karl Christ,<br />
<strong>Geschichte</strong> und Fxistcnz, Berlin 1991, 26<br />
s<br />
Farissa Boniante, Introduction, in: dies., Firuscan File and Akerlile: a handbook ol<br />
Etruscan studies, Warminster 1986, 4<br />
(
RHK:II(S)\\T.ITI-:N: DAS DI-.U TSCI n; HISTORISCH]- INS'ITI'UT ROM 319<br />
Prüfung der Bausteine«, also ein buchstäblich modulares Paradigma. EDV überträgt<br />
heute tatsächlich Monumente des Archivs als Daten neutralisiert in ein uniformes<br />
Verarbeitungssystem und enthistorisiert sie damit, entkleidet sie ihres<br />
historisch gegebenen Kontexts. 7 ^ Kehr kritisiert die Entwicklung der modernen<br />
Geschichtswissenschaft, die schließlich mit Lamprecht, Breysig und Anderen in<br />
vagen Philosophemen« ende 71 ; vielmehr möchte er die Forschung selbst in den<br />
Vordergrund treten sehen . Das aber heißt Ausstellung <strong>von</strong> Datenbanken<br />
statt Geschichtserzählung, und Speicheranalyse als Kulturwissenschaft.<br />
Mit dem modernen Nationalstaat gebiert sich auch das historische Bedürfnis<br />
nach dem Archiv. Die Säkulansierungwellen seit der Französischen Revolution<br />
und Napoleon verlegte gedächtnishturgischen Energien auf die Historie<br />
selbst; die Begründung der französischen Diplimatikerschule Ecolc des Charles<br />
aber war keine gcschichtsphilosophisch emphatische, sondern eine funktionale:<br />
»Das neue zentralisierte Frankreich brauchte Archivare«. Derartige Institute<br />
»wollen und können nicht Historiker erzeugen«, sind aber als Durchgangsstationen<br />
Diener der Ausbildung <strong>von</strong> »Archivaren, Bibliothekaren, Museumsbeamten«<br />
. Archiv(ver)schübe sind die diffe'rance <strong>von</strong><br />
Historiographie; »durch die Öffnung der Archive haben sich die Aufgaben der<br />
historischen Forschung der früheren Zeit gegenüber vollständig verschoben;<br />
der Historiker sieht sich einem gewaltigen Komplex <strong>von</strong> Überlieferungen<br />
gegenübergestellt, den er zu beherrschen, zu durchdringen, zu ordnen und kritisch<br />
zu verwerten lernen muß.« 72 Hermeneutik als Textverstehen ist zunächst<br />
der Wille zur Beherrschung <strong>von</strong> Datenmengen. Ein Nachfolger Kehrs auf dem<br />
römischen Direktionsposten kommentiert dies als »sehr persönliche Gedankenführung,<br />
die das Geschäft des Historikers ganz <strong>von</strong> der Geschichtsschreibung<br />
auf die Quellenkritik, <strong>von</strong> der Synthese auf die Analyse, <strong>von</strong> der<br />
Darstellung auf die SpezialUntersuchung verlegt, so als schließe das eine das<br />
andere aus und als dispensierten die neuen Errungenschaften der Urkundenlehre<br />
da<strong>von</strong>, <strong>Geschichte</strong> auch zu schreiben« . Die Alternative<br />
heißt wissensarchäologischen Ästhetik, die Archivlagen selbst (be)schreibend.<br />
Historiographische, d. h. literarisch ausformulierte Darstellungen hielt Kehr in<br />
70 Siehe W. E., White Mythologics? Informatik statt <strong>Geschichte</strong>(n) - die Grenzen der<br />
Metahistory, in: Storia della Storiografia 25 (1994), Mailand (Jaca Book), Themenheft<br />
»Hayden White's Metahistory twenty years aftcr«, 23-50<br />
71 Kehr 1913: Denkschrift über die Gründung eines Instituts <strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong> im<br />
Rahmen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschalt, Abschrift im Archiv des 1)1 11, Tvposknpt, 3<br />
71 Ebd., zitiert <strong>von</strong> Arnold Esch, Deutsche Geschichtswissenschaft und das mittelalterliche<br />
Rom. Von Ferdinand Gregonvius zu Paul Kehr, in: Hartmut Bookmann / Kurt<br />
Jürgensen (Hg.), Nachdenken über <strong>Geschichte</strong>. Beiträge aus der Ökumene der Historiker.<br />
In memoriam Karl Dietrich Erdmann, Neumünster 1991, 55-76 (73)
320 ROM ALS SATKLUT DI-:S DI-UTSCHKN GKDÄCIITNISSKS<br />
der Tat »schlicht <strong>für</strong> überflüssig , die Werke Rankes eingeschlossen«<br />
. Kehrs Mißtrauen gegenüber narrativer Geschichtsdarstellung<br />
bezieht sich konsequent auch auf die Grundlage erzählender Quellen,<br />
auch wenn sie <strong>für</strong> ihn eher ornamentalen, supplementären Wert haben. Sein<br />
Plädoyer <strong>für</strong> eine eher kombinatorische denn narrative Datenverarbeitung korrespondiert<br />
mit der naturwissenschaftlichen Ästhetik seiner Zeit in einer Weise,<br />
die ihrerseits kaum auf einen historisch kohärenten Nenner gebracht werden<br />
kann, sondern vielmehr in eine parallele epistemologische Serie setzbar ist: »Die<br />
Kombinatorik ersetzt nicht nur die schaffende Phantasie, sondern ist ihr überlegen.«<br />
73 Kehr ahnt das Ende des Autors aus der Perspektive des Archivars:<br />
»Jedermann erkannte, daß diese Aufgabe nur <strong>von</strong> einer Organisation zu bewältigen<br />
sei« ; hier ist er sich einig mit einem zeitgleichen<br />
Schlagwort des Versuchs, Wissenstransfer zu standardisieren: »vom Individualismus<br />
zur Organisation.« 74 Als Adolf Harnack seine <strong>Geschichte</strong> der kgl. preussischen<br />
Akademie der Wissenschaften zu Berlin um 1900 ediert, stehen auch bei<br />
ihm die Seele des Historikers nach Synthese und seine praktischen Einsichten<br />
als Wissenschaftsorganisator im Konflikt; <strong>für</strong> die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
registriert er die Notwendigkeit wissenschaftlicher Großunternehmen.<br />
Organisation <strong>von</strong> Vergangenheit als Datenbank ist die Voraussetzung <strong>für</strong><br />
den Zugriff auf ein unterstelltes historisches Ganzes:<br />
»Unter Organisation verstehen wir also, ganz unabhängig da<strong>von</strong>, ob es sich um ein<br />
Lebewesen oder ein soziales Gebilde, um ein Verfahren oder eine Maschine handelt,<br />
erstens die Aufteilung der Funktionen, indem man diese in ihre Elemente zerlegt<br />
und jedes Element unter solchen Umständen sich bestätigen läßt, daß das beste<br />
Güteverhältnis entsteht, und zweitens die Verbindung dieser getrennt mit maximalem<br />
Güteverhältnis arbeitenden Funktionen zu einheitlicher Wirkung, derart,<br />
daß auch <strong>für</strong> das Gesamtgebilde das maximale Güteverhältnis herauskommt.« 73<br />
Das gilt nun auch <strong>für</strong> die Akten aus dem Archiv der römischen Inquisition Sanctitm<br />
Ofjicium, die bislang vor allem hinsichtlich individueller Prozesse gegen<br />
Galileo Galilei oder zu Giordano Bruno <strong>von</strong> paranoidem Interesse gewesen<br />
sind, der 1600 auf Geheiß der Inquisiation in Rom verbrannt wurde. Ist ein<br />
73 Wilhelm Ostwald, Kombinatorik und schaffende Phantasie, in: Günther Lotz / Lothar<br />
Dunsch / Uta Kring (I Ig.), Forschen und Nutzen. Wilhelm Ostwald zur wissenschaftlichen<br />
Arbeit, Berlin (Akademie) 1982, 28<br />
74 Ders., Normen, in: Werkbund-Jahrbuch 1914; hier zitiert nach: Rolf Sachsse, Das<br />
Gehirn der Weh: 1912. I)ie Organisation der Organisatoren durch die Brücke. I'.m<br />
vergessenes Kapitel Mediengeschichte, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft<br />
zu Großbothen e.V., 5. Jg., Heft 1/2000, 38-57 (50)<br />
7:> Ders., Über Organisation und Organisatoren, I. Teil: Allgemeine Theorie, in: Lotz u.a.<br />
1982: 103ff (103)
RKICII(S)\VI:I'II;N: DAS DHUTSCHH HISTORISCHI-: INSTITUT ROM 321<br />
Archiv einmal nicht mehr nur als schmales Quellen-Rinnsal <strong>für</strong> spektakuläre<br />
Einzelfälle, sondern in seiner Masse zugänglich, »muß ein neuer Forschungsstil<br />
gewählt werden« (Herman Schwedt); Statistik tritt an die Stelle der narrativen<br />
Filter des Archivs - und damit eine wissensarchäologische Nähe des Archivs<br />
zum Staat als Stand der Dinge. Auf einem Fachkongreß, den der Vatikan zu dieser<br />
Archivöffnung Anfang 1998 ausrichtet, fordert der kanadische Forscher J.<br />
De Bujanda daher auch eine neue Methode: Während man früher nach Einzelfällen<br />
und -quellen forschte, müsse man jetzt Datenbanken erstellen, um die<br />
übergroße Fülle neuen Materials zu sichten. Wie konnte man überhaupt über<br />
die <strong>Geschichte</strong> der Inquisition schreiben, ohne das Archiv zu kennen, so fragt<br />
Arnold Esch als Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom. 76 Zugespitzt<br />
läßt sich die Behauptung riskieren, daß Einsicht ins Archiv und Historie<br />
sich lange Zeit ausschließen. In die Tür zum Vatikanischen Archiv war<br />
einmal eine Inschrift geschnitzt, die - selbst Kardinalen 77 - mit Exkommunikation<br />
im Falle des unautorisierten Zutritts drohte, also mit dem Ausschluß aus<br />
der katholischen Gcdächtnisgcmeinschaft. 78 Nun stehen die vatikanischen<br />
Inquisitionsakten also der Forschung offen, und gleichzeitig fassen wir damit<br />
den verborgenen Gegensinn des Zusammenhangs <strong>von</strong> Archiv und (kultureller)<br />
Kommunikation: Ex-Kommunikation im ausschließenden wie zeitlichen Sinne.Mit<br />
der modularen, nicht synthetisierenden, wissensarchäologischen Ästhetik<br />
korrespondiert die Selbstcharakterisierung Kehrs als ein innerlich kalter<br />
Mensch 79 und extern <strong>von</strong> Kehr als einem »Mann der Unterscheidung und der<br />
Unterschiede, das heißt: der Über- und Unterordnung, und zwar im fachlichen<br />
wie im persönlichen Bereich« - wobei Differenzbildung<br />
nichts anderes als Datenkritik darstellt. In diesem Sinne liest sich Kehrs<br />
Methodik: »Es gibt bei Kehr nur die Untersuchungsrichtung <strong>von</strong> der urkundlichen<br />
Aussage zum historischen Sachverhalt« , so daß<br />
er zuweilen <strong>von</strong> punktuellen Ansätzen aus zu wesentlichen historischen Einsichten<br />
vorgestoßen ist 80 , nicht aber umgekehrt, d. h. deduktiv. Einer dieser raren<br />
76 Herman H. Schwedt, Die inoffiziellen Mitarbeiter des Vatikans, in: Berliner Zeitung<br />
Nr. 32 v. 7./8. Februar 1998, 9<br />
77 Theodor <strong>von</strong> Sickel, Römische Erinnerungen nebst ergänzenden Briefen und Aktenstücken,<br />
hg. v. Leo Santifaller, Wien (Universum) 1947, 35<br />
78 Geoffrey J. Gilcs, Archivcs and Historians: An Introduction, in: ders. (Hg.), Archivists<br />
and Historians, German Historical Institute, Washington 1996 (Occasional<br />
Papers No. 17), 5-14 (6), unter Bezug auf: Herbert Butterfield, Man on His Past: The<br />
Study ol the I li.siory ol I Iistorical Scliolarship, Cambridge 1969, 82<br />
7>> Bnei an Joh. 1 laller v. 2. September 1903; liegt abschriftlich in der <strong>für</strong> eine geplante,<br />
aber nie erschienenen Biographic Kehrs angelegte Matenalsammlung <strong>von</strong> Friedrich<br />
Bock bei den MGH (Fleckcnstein 1987: 240, Anm. 4)<br />
80 Theodor Schieffer, Neue deutsche Biographic 11, 396
322 ROM ALS SATKLLIT DHS DKUTSCIII-N GF.DÄCHTNISSKS<br />
historiographischen Vorstöße Kehrs sind die Vier Kapitel aus der <strong>Geschichte</strong><br />
Kaiser Heinrichs III. S] , wobei schon der Titel kennzeichnend <strong>für</strong> die »schmucklose<br />
Ehrlichkeit Kehrs« (Fleckenstein) ist. Diese <strong>Geschichte</strong> geht selbstverständlich<br />
(ders.) <strong>von</strong> den Urkunden aus - buchstäblich <strong>von</strong> der arche also -,<br />
behandelt anschließend die Notare, dann in sich erweiternden Kreisen die<br />
Akteure, dann die Schwerpunkte der Herrschaft des Kaisers in Deutschland, Italien,<br />
Burgund und im Verhältnis <strong>von</strong> Kaisertum und Papsttum, »tastet darauf<br />
ihre Reichweite ab und sucht vor allem den Verbindungen zwischen ihnen, den<br />
Zusammenhängen, in die sie eingebunden sind, nachzugehen. Genau das aber<br />
ist die entscheidende Gabe, die den Historikern auszeichnet« . Kehrs kühler wissensarchäologischer Blick, asketisch distanziert<br />
<strong>von</strong> historischer <strong>Im</strong>agination, macht ihn aufmerksam <strong>für</strong> die Struktur <strong>von</strong><br />
Institutionen jenseits <strong>von</strong> diskursiv definierten Kulturgeschichten, so daß ihn,<br />
der bis 1914 acht Bände der Italia pontifica vorlegt, das Papsttum nicht eigentlich<br />
als geistliche, sondern nur als juridische, politische und kulturelle Institution<br />
interessierte - »obwohl alle diese Erscheinungsformen ohne den geistlichen<br />
Kern nicht recht verständlich waren« . Vielleicht aber<br />
ist das, was hier geistlicher Kern heißt, selbst eine Funktion non-diskursiver,<br />
institutionaler Techniken. Kehr ahnt es; die fünf Bände der Germania sacra, die<br />
das Kaiser-Wilhelm-Institut <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong> unter seiner Leitung bis<br />
1944 herausbringt, äußern im Untertitel ihren non-narrativen Charakter: Historisch-statistische<br />
Darstellung der deutschen Bistümer, Domkapitel, Kollegiatund<br />
Pfarrkirchen, Klöster und sonstigen kirchlichen Institute.<br />
81 In: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1930, Nr. 3 (Neudruck<br />
1963 im Angang zu F.. Sicindorll, Jahrbücher der deutschen <strong>Geschichte</strong>, Bd. 2)
Editionsunternehmen des DHI<br />
Nuntiaturbenchte<br />
Enn IONSUNTI;RNI:HMEN DES DHI 323<br />
Das Editionsprojekt Nuntiaturbenchte aus Deutschland (<strong>für</strong> das 16. Jahrhundert),<br />
erster Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit der Preußischen Historischen<br />
Station, bleibt zunächst getarnt, um nicht kurialen Argwohn zu wecken. 1<br />
Als das Arbeitsgebiet indiskreter Weise im Sommer 1888 dorthin verraten wird,<br />
stößt Konrad Schottmüller im Vatikan auf Mißtrauen 2 ; angesichts der innerdeutschen<br />
kirchenpolitischen Lage vermutete man dort, daß das Institut seine<br />
Hauptaufgabe »gleichsam im Sammeln historischer Munition <strong>für</strong> die Weiterführung<br />
des Kulturkampfes« sah . Die Ergänzung des<br />
Reihentitels Nuntiaturbenchte mit aus Deutschland ist eine gedächtnispolitische<br />
Aussage. An der <strong>Namen</strong>sgebung haben österreichische Historiker maßgebend<br />
mitgewirkt, doch die Frage, welches Deutschland hier eigentlich gemeint ist, hat<br />
sich damals anscheinend niemand gestellt: der Sprachraum der Nation oder die<br />
Territorien, die das Heilige römische Reich deutscher Nation umschlossen hatte?<br />
»Das zu Ende des 19. Jahrhunderts so genannte Alte Reich oder gar jenes großdeutsche<br />
Idealgebilde, das Preußen mit seiner siegreichen Reichsgründung <strong>von</strong><br />
1871 endgültig zunichte gemacht hatte?« . Das Signifikat im<br />
<strong>Im</strong>aginären (»Deutschland«) verunsichert die symbolische Ordnung der Historie.<br />
Kehr stellt den Gewinn <strong>für</strong> die historische Wissenschaft durch die ersten<br />
Aktenpubhkationen der Nuntiaturbenchte nicht m Abrede, weiß aber um das<br />
prekäre Verhältnis <strong>von</strong> diplomatischem Medium und historischer Botschaft, analog<br />
der Dillerenz <strong>von</strong> ras geslac und hisLona rerurn gcsLarum. Die Berichte der<br />
Nuntien sind »an historischem Wert sehr ungleich und verschieden«, abhängig<br />
<strong>von</strong> der Bedeutung des Nuntius und der Wichtigkeit der berichteten Ereignisse.<br />
»Das einmal angenommene Editionsschema aber läßt sich dieser Tatsache nicht<br />
leicht anpassen; es beruht auf einem rein formalen Prinzip« .<br />
Historische Informatik, im Unterschied zu Historiographie, läuft auf serielle<br />
Datenpräsentationsverfahren hinaus; daher fordern andere Gelehrte eine andere<br />
Form dieser Publikation, eine Auswahl der wichtigsten Aktenstücke. Die Nuntiaturbenchte<br />
aus Deutschland sind selbst immer nur ein Ausschnitt aus der<br />
1 Siehe Georg Lutz, Die Nuntiaturbenchte und ihre Edition, in: Reinhard Elze / Arnold<br />
Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen (Niemeyer)<br />
1990, 87-122 (871)<br />
2 Schreiben Schottmüllcrs an Althoff v. 3. Oktober 1888 = Nr. 3 I, Bl. 192, zitiert nach:<br />
Lothar Burchardt, Gründung und Aufbau des preußischen Historischen Instituts in<br />
Rom, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken<br />
59/1979, 334-391 (350)
320 ROM ALS SATKLI.IT DKS DKUTSCHKN GKOÄCIITNISSKS<br />
der Tat »schlicht <strong>für</strong> überflüssig , die Werke Rankes eingeschlossen«<br />
. Kehrs Mißtrauen gegenüber narrativer Geschichtsdarstellung<br />
bezieht sich konsequent auch auf die Grundlage erzählender Quellen,<br />
auch wenn sie <strong>für</strong> ihn eher ornamentalen, supplementären Wert haben. Sein<br />
Plädoyer <strong>für</strong> eine eher kombinatorische denn narrative Datenverarbeitung korrespondiert<br />
mit der naturwissenschaftlichen Ästhetik seiner Zeit in einer Weise,<br />
die ihrerseits kaum auf einen historisch kohärenten Nenner gebracht werden<br />
kann, sondern vielmehr in eine parallele epistemologische Serie setzbar ist: »Die<br />
Kombinatorik ersetzt nicht nur die schaffende Phantasie, sondern ist ihr überlegen.«<br />
73 Kehr ahnt das Ende des Autors aus der Perspektive des Archivars:<br />
»Jedermann erkannte, daß diese Aufgabe nur <strong>von</strong> einer Organisation zu bewältigen<br />
sei« ; hier ist er sich einig mit einem zeitgleichen<br />
Schlagwort des Versuchs, Wissenstransfer zu standardisieren: »vom Individualismus<br />
zur Organisation.« 74 Als Adolf Harnack seine <strong>Geschichte</strong> der kgl. preussischen<br />
Akademie der Wissenschaften zu Berlin um 1900 ediert, stehen auch bei<br />
ihm die Seele des Historikers nach Synthese und seine praktischen Einsichten<br />
als Wissenschaftsorganisator im Konflikt; <strong>für</strong> die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
registriert er die Notwendigkeit wissenschaftlicher Großunternehmen.<br />
Organisation <strong>von</strong> Vergangenheit als Datenbank ist die Voraussetzung <strong>für</strong><br />
den Zugriff auf ein unterstelltes historisches Ganzes:<br />
»Unter Organisation verstehen wir also, ganz unabhängig da<strong>von</strong>, ob es sich um ein<br />
Lebewesen oder ein soziales Gebilde, um ein Verfahren oder eine Maschine handelt,<br />
erstens die Aufteilung der Funktionen, indem man diese in ihre Elemente zerlegt<br />
und jedes Element unter solchen Umständen sich bestätigen läßt, daß das beste<br />
Güteverhältnis entsteht, und zweitens die Verbindung dieser getrennt mit maximalem<br />
Güteverhältnis arbeitenden Funktionen zu einheitlicher Wirkung, derart,<br />
daß auch <strong>für</strong> das Gesamtgebildc das maximale Güteverhältnis herauskommt.« 73<br />
Das gilt nun auch <strong>für</strong> die Akten aus dem Archiv der römischen Inquisition Sanc-<br />
tum Officium, die bislang vor allem hinsichtlich individueller Prozesse gegen<br />
Galileo Galilei oder zu Giordano Bruno <strong>von</strong> paranoidem Interesse gewesen<br />
sind, der 1600 auf Geheiß der Inquisiation in Rom verbrannt wurde. Ist ein<br />
73 Wilhelm Ostwald, Kombinatorik und schaffende Phantasie, in: Günther Lotz / Lothar<br />
Dunsch / Uta Kring (Hg.), Forschen und Nutzen. Wilhelm Ostwald zur wissenschaftlichen<br />
Arbeit, Berlin (Akademie) 1982, 28<br />
74 Ders., Normen, in: Werkbund-Jahrbuch 1914; hier zitiert nach: Rolf Sachsse, Das<br />
Gehirn der Welt: 1912. Die Organisation der Organisatoren durch die Brücke. Ein<br />
vergessenes Kapitel Mediengeschichte, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gcsellschaft<br />
zu Großbothen e.V., 5. Jg., Heft 1/2000, 38-57 (50)<br />
75 Ders., Über Organisation und Organisatoren, I. Teil: Allgemeine Theorie, in: Lotz u.a.<br />
1982: 103ff (103)
RI-:K:H(S)WKITI-N: DAS DHUTSCHH HISTORISCITK INSTITUT ROM 321<br />
Archiv einmal nicht mehr nur als schmales Quellen-Rinnsal <strong>für</strong> spektakuläre<br />
Einzelfälle, sondern in seiner Masse zugänglich, »muß ein neuer Forschungsstil<br />
gewählt werden« (Herman Schwedt); Statistik tritt an die Stelle der narrativen<br />
Filter des Archivs - und damit eine wissensarchäologische Nähe des Archivs<br />
zum Staat als Stand der Dinge. Auf einem Fachkongreß, den der Vatikan zu dieser<br />
Archivöffnung Anfang 1998 ausrichtet, fordert der kanadische Forscher J.<br />
De Bujanda daher auch eine neue Methode: Während man früher nach Einzelfällen<br />
und -quellen forschte, müsse man jetzt Datenbanken erstellen, um die<br />
übergroße Fülle neuen Materials zu sichten. Wie konnte man überhaupt über<br />
die <strong>Geschichte</strong> der Inquisition schreiben, ohne das Archiv zu kennen, so fragt<br />
Arnold Esch als Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom. 76 Zugespitzt<br />
läßt sich die Behauptung riskieren, daß Einsicht ins Archiv und Historie<br />
sich lange Zeit ausschließen. In die Tür zum Vatikanischen Archiv war<br />
einmal eine Inschrift geschnitzt, die - selbst Kardinalen 77 - mit Exkommunikation<br />
im Falle des unautorisierten Zutritts drohte, also mit dem Ausschluß aus<br />
der katholischen Gcdächtnisgemeinschaft. 78 Nun stehen die vatikanischen<br />
Inquisitionsakten also der Forschung offen, und gleichzeitig fassen wir damit<br />
den verborgenen Gegensinn des Zusammenhangs <strong>von</strong> Archiv und (kultureller)<br />
Kommunikation: Ex-Kommunikation im ausschließenden wie zeitlichen Sinne.Mit<br />
der modularen, nicht synthetisierenden, wissensarchäologischen Ästhetik<br />
korrespondiert die Selbstcharakterisierung Kehrs als ein innerlich kalter<br />
Mensch 7 ^ und extern <strong>von</strong> Kehr als einem »Mann der Unterscheidung und der<br />
Unterschiede, das heißt: der Über- und Unterordnung, und zwar im fachlichen<br />
wie im persönlichen Bereich« - wobei Differenzbildung<br />
nichts anderes als Datenkntik darstellt. In diesem Sinne liest sich Kehrs<br />
Methodik: »Es gibt bei Kehr nur die Untersuchungsrichtung <strong>von</strong> der urkundlichen<br />
Aussage zum historischen Sachverhalt« , so daß<br />
er zuweilen <strong>von</strong> punktuellen Ansätzen aus zu wesentlichen historischen Einsichten<br />
vorgestoßen ist 80 , nicht aber umgekehrt, d. h. deduktiv. Einer dieser raren<br />
76<br />
Herman H. Schwedt, Die inoffiziellen Mitarbeiter des Vatikans, in: Berliner Zeitung<br />
Nr. 32 v. 1.1%. Februar 1998, 9<br />
77<br />
Theodor <strong>von</strong> Sickel, Römische Erinnerungen nebst ergänzenden Briefen und Aktenstücken,<br />
hg. v. Leo Santifaller, Wien (Universum) 1947, 35<br />
78<br />
Geoffrey J. Giles, Archives and Historians: An Introduction, in: ders. (Hg.), Archivists<br />
and Historians, German Historical Institute, Washington 1996 (Occasional<br />
Papers No. 17), 5-14 (6), unter Bezug auf: Herbert Butterfield, Man on His Fast: The<br />
Study of the History of Historical Scholarship, Cambridge 1969, 82<br />
79<br />
Brief an Joh. Haller v. 2. September 1903; liegt abschriftlich in der <strong>für</strong> eine geplante,<br />
aber nie erschienenen Biographie Kehrs angelegte Materialsammlung <strong>von</strong> Friedrich<br />
Bock bei den MGH (Fleckenstein 1987: 240, Anm. 4)<br />
80<br />
Theodor Schieffer, Neue deutsche Biographie 11, 396
322 ' ROM ALS SATKI.UT DI-;S I)KUTSCUI;N GIUMCI ITNISSKS<br />
historiographischen Vorstöße Kehrs sind die Vier Kapitel aus der <strong>Geschichte</strong><br />
Kaiser Heinrichs ///. S1 , wobei schon der Titel kennzeichnend <strong>für</strong> die »schmucklose<br />
Ehrlichkeit Kehrs« (Fleckenstein) ist. Diese <strong>Geschichte</strong> geht selbstverständlich<br />
(ders.) <strong>von</strong> den Urkunden aus - buchstäblich <strong>von</strong> der arche also -,<br />
behandelt anschließend die Notare, dann in sich erweiternden Kreisen die<br />
Akteure, dann die Schwerpunkte der Herrschaft des Kaisers in Deutschland, Italien,<br />
Burgund und im Verhältnis <strong>von</strong> Kaisertum und Papsttum, »tastet darauf<br />
ihre Reichweite ab und sucht vor allem den Verbindungen zwischen ihnen, den<br />
Zusammenhängen, in die sie eingebunden sind, nachzugehen. Genau das aber<br />
ist die entscheidende Gabe, die den Historikern auszeichnet« . Kehrs kühler wissensarchäologischer Blick, asketisch distanziert<br />
<strong>von</strong> historischer <strong>Im</strong>agination, macht ihn aufmerksam <strong>für</strong> die Struktur <strong>von</strong><br />
Institutionen jenseits <strong>von</strong> diskursiv delmierten Kulturgeschichten, so daß ihn,<br />
der bis 1914 acht Bände der Itaha pontifica vorlegt, das Papsttum nicht eigentlich<br />
als geistliche, sondern nur als juridische, politische und kulturelle Institution<br />
interessierte - »obwohl alle diese Erscheinungsformen ohne den geistlichen<br />
Kern nicht recht verständlich waren« . Vielleicht aber<br />
ist das, was hier geistlicher Kern heißt, selbst eine Funktion non-diskursiver,<br />
institutionaler Techniken. Kehr ahnt es; die fünf Bände der Germania sacra, die<br />
das Kaiser-Wilhelm-Institut <strong>für</strong> Deutsche <strong>Geschichte</strong> unter seiner Leitung bis<br />
1944 herausbringt, äußern im Untertitel ihren non-narrativen Charakter: Historisch-statistische<br />
Darstellung der deutschen Bistümer, Domkapitel, Kollegiatund<br />
Pfarrkirchen, Klöster und sonstigen kirchlichen Institute.<br />
81 In: Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1930, Nr. 3 (Neudruck<br />
1963 im Angang zu E. Steindorff, Jahrbücher der deutschen <strong>Geschichte</strong>, Bd. 2)
Editionsunternchmcn des DHI<br />
Nuntiaturbenchte<br />
EI)[TIONSUNTI-:RNI-;IIML-:N DKS DHI 323<br />
Das Editionsprojekt N'untiaturb•enchte aus Deutschland (<strong>für</strong> das 16. Jahrhundert),<br />
erster Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit der Preußischen Historischen<br />
Station, bleibt zunächst getarnt, um nicht kurialen Argwohn zu wecken. 1<br />
Als das Arbeitsgebiet indiskreter Weise im Sommer 1888 dorthin verraten wird,<br />
stößt Konrad Schottmüllcr im Vatikan auf Mißtrauen 2 ; angesichts der innerdeutschen<br />
kirchenpohtischen Lage vermutete man dort, daß das Institut seine<br />
Hauptaufgabe »gleichsam im Sammeln historischer Munition <strong>für</strong> die Weiterführung<br />
des Kulturkampfes« sah . Die Ergänzung des<br />
Reihentitels Nuntiaturbcnchle mit aus Deutschland ist eine gedächtnispolitische<br />
Aussage. An der <strong>Namen</strong>sgebung haben österreichische Historiker maßgebend<br />
mitgewirkt, doch die Frage, welches Deutschland hier eigentlich gemeint ist, hat<br />
sich damals anscheinend niemand gestellt: der Sprachraum der Nation oder die<br />
Territorien, die das Heilige römische Reich deutscher Nation umschlossen hatte?<br />
»Das zu Ende des 19. Jahrhunderts so genannte Alte Reich oder gar jenes großdeutsche<br />
Idealgebilde, das Preußen mit seiner siegreichen Reichsgründung <strong>von</strong><br />
1871 endgültig zunichte gemacht hatte?« . Das Signifikat im<br />
<strong>Im</strong>aginären (»Deutschland«) verunsichert die symbolische Ordnung der Historie.<br />
Kehr stellt den Gewinn <strong>für</strong> die historische Wissenschaft durch die ersten<br />
Aktenpublikationen der Nuntiaturberichte nicht in Abrede, weiß aber um das<br />
prekäre Verhältnis <strong>von</strong> diplomatischem Medium und historischer Botschaft, analog<br />
der Differenz <strong>von</strong> res gestae und bisloria rerum gestarum. Die Berichte der<br />
Nuntien sind »an historischem Wert sehr ungleich und verschieden«, abhängig<br />
<strong>von</strong> der Bedeutung des Nuntius und der Wichtigkeit der berichteten Ereignisse.<br />
»Das einmal angenommene Editionsschema aber läßt sich dieser Tatsache nicht<br />
leicht anpassen; es beruht auf einem rein formalen Prinzip« .<br />
Historische Informatik, im Unterschied zu Historiographie, läuft auf serielle<br />
Datenpräsentationsverfahren hinaus; daher fordern andere Gelehrte eine andere<br />
Form dieser Publikation, eine Auswahl der wichtigsten Aktenstücke. Die Nuntiaturberichte<br />
aus Deutschland sind selbst immer nur ein Ausschnitt aus der<br />
1 Siehe Georg Lutz, Die Nuntiaturbenchte und ihre Edition, in: Reinhard Elze / Arnold<br />
Esch (Hg.), Das Deutsehe Historische Institut in Rom 1888-1988, Tübingen (Niemeyer)<br />
1990,87-122 (87f)<br />
2 Schreiben Schottmüllers an Althoff v. 3. Oktober 1888 = Nr. 3 I, Bl. 192, zitiert nach:<br />
Lothar Burchardt, Gründung und Aufbau des preußischen Historischen Instituts in<br />
Rom, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken<br />
59/1979,334-391(350)
324 ROM ALS SATKLI.IT OKS DLUTSCHLN GLDÄCHTNISSKS<br />
päpstlichen Politik und stellen nicht deren Universalität dar, »sie bieten nur die<br />
<strong>Geschichte</strong> der Beziehungen der Kurie zu Deutschland und auch so weder vollständig<br />
noch auch vielleicht immer zutreffend« . Kehr denkt das Mittelalter<br />
nicht national, sondern universalistisch.<br />
Ist Geschichtsforschung einmal an einen archivischen Speicher gekoppelt,<br />
wie es das Vatikanische Archiv darstellt, wird sie auf dessen gedächtnistechnisches<br />
System ausgerichtet und ähnelt in ihrer weiteren Entwicklung der Flugbahn<br />
<strong>von</strong> Geschossen. »Ist eine Richtung einmal eingeschlagen, gibt es nur<br />
relativ geringe Abweichungen.« 3 Gegenüber dem wissensarchäologisch-archivischen<br />
data processing stellt das Wahrnehmungsmuster Historie bereits eine<br />
Selektion dar; angesichts der Datenflut solcher päpstlicher Relationen schaltet<br />
das preußisch-römische Institut daher um auf Datenverknappung, eine andere<br />
Pubhkationsmethode, in der lediglich exemplarische Aktenstücke dargeboten<br />
werden, um so synekdochisch »ein vollständiges Bild der päpstlichen Politik zu<br />
gewinnen« -Reduktionsstrategien <strong>von</strong> Komplexität, die-<strong>von</strong><br />
der Verzeichnungsstruktur des Archivs selbst geprägt - ein mapping der Vergangenheit<br />
ermöglichen. Zumal, wenn die vatikanischen Archive Grundlage der<br />
Forschung sind, läßt sich »aus der geschichtlichen Überlieferung nicht das herausschälen,<br />
was jeweils als national angesprochen«, d. h. adressiert wird, »sondern<br />
man kann sie wissenschaftlich nur in ihrem ganzen Komplex erfassen.« 4<br />
Der Arbeitsplan des Historischen Instituts sieht <strong>für</strong> das Mittelalter ein Repertonum<br />
Germanicum, <strong>für</strong> die frühe Neuzeit die Edition der Nuntiatur-Benchte<br />
vor. In dem ersten sollen aus dem Vatikanischen Archiv alle Dokumente im<br />
Auszug zusammengestellt werden, die das Deutsche Reich im 15. Jahrhundert<br />
betreffen - »eine Arbeit <strong>für</strong> paläographisch geschulte Kopisten, denn die Masse<br />
des Stoffes war so gross«, daß nach Publikation des ersten Bandes durch Arnold<br />
Oscar Meyer auf den weiteren Druck verzichtet wird und sich die Arbeit auf<br />
die Zusammenstellung auf Zetteln reduziert. Gustave Flaubert hat solche Kopistenaporien<br />
in seiner Novelle Bouvard et Pecuchet nicht nur be-, sondern auch<br />
geschrieben - die endlose Stoffsammlung und -Ordnung als Ironisierung des<br />
bibliotheksphantasmatischen Anspruchs <strong>von</strong> Kulturwissenschaften im 19. Jahr-<br />
So beschreibt Ulrich Marsch den Aspekt einer Institutionengeschichte technisch ausgerichteter<br />
Wissenschaften: Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der Weimarer Republik<br />
und im Dritten Reich, in: Wisscnschaftsfördcrndc Institutionen im Deutschland<br />
des 20. Jahrhunderts, hg. v. Rüdiger vom Bruch / Eckart Henning [Dahlemer Archivgespräche<br />
5/1999, hg. v. Archiv zur <strong>Geschichte</strong> der Max-Planck-Gesellschaft], 57- 69<br />
(59), unter Bezug auf Nathan Rosenberg, Exploring the Black Box. Technology, Economics,<br />
and History, Cambridge 1994<br />
Kehr in den Anfängen seiner Amtszeit als Direktor des Preußischen Historischen<br />
Instituts (»Denkschrift über die Zukunft des Historischen Instituts in Rom«, April<br />
1907), zitiert in: Esch 1991: 59
EDITIÜNSUNTKRNKHMKN DES DHI 325<br />
hundert. Der Mitarbeiter Hiltebrandt nennt diese Arbeit deshalb »so stumpfsinnig,<br />
weil ihr jedes geistige Band fehlte. Da man rein chronologisch vorging,<br />
so kam es vor, dass der Bearbeiter nach einer Urkunde über Oldenburg eine solche<br />
über Kärnten zu behandeln hatte.« 5<br />
Die Nuntiatur-Berichte sind <strong>für</strong> Zeit der Gegenreformation so umfangreich,<br />
daß Hiltebrandt die Gefahr sieht, begabte Leute an ihrer Massenverarbeitung wissenschaftlich<br />
abstumpfen zu lassen. Er will lieber zur Bearbeitung <strong>von</strong> Problemen<br />
der europäischen <strong>Geschichte</strong> übergehen, doch Direktor Kehr, »kein Historiker<br />
im wirklichen Sinne«, will sich nicht auf dieses Gebiet begeben. Stattdessen läßt<br />
er italienische Stadt-Regesten bearbeiten, was in Deutschland niemand interessierte<br />
und Italiener verstimmte, »denn was hätte man in Deutschland gesagt, wenn<br />
junge italienische Gelehrte die Urkunden der Stadt Bielefeld oder Greifswald herausgegeben<br />
hätten?« Die nunmehr hundertjährige <strong>Geschichte</strong> der<br />
Edition <strong>von</strong> Nuntiaturberichten durch das DHI in Rom ist vom Dauerstreit um<br />
die Textwiedergabe als Volledition oder Regest gekennzeichnet: »Auch erfolgt die<br />
Mittheilung durchweg im vollen Wortlaut, selbst da wo anscheinend Unwichtiges<br />
berichet wird.« 6 Von einer Volledition geht auch der 7. Band der Dritten Abteilung<br />
aus, alle Berichte und Weisungen vom 25. April 1573 bis zum Jahresende<br />
1574 in chronologischer Folge umfassend. Das erste Schreiben ist dabei durch den<br />
Schlußpunkt des Vorgängerbandes vorgegeben, obwohl so die unglückliche Situation<br />
entstand, daß ein Aktenkonvolut, das sich aus mehreren Schriftstücken zusammensetzt,<br />
»zerrissen wurde«. 7 So formal sind die Schnitte, durch welche die<br />
Reproduktionslogik des Mediums Buch die Historie als Erzählung unterbricht.<br />
Repertonum Germamcidm (und EDV)<br />
In Ludwig Quiddcs kurzer Amtszeit als Nachfolger Schottmüllcrs in der Leitung<br />
des römischen Instituts fiel die Diskussion um die Erstellung eines Repertonum<br />
Germamcum als Speziahnventar aller die deutsche <strong>Geschichte</strong> betreffenden vaktikanischen<br />
Archivallen. Kultusministerium und Reichskanzlei in Berlin erklärten<br />
sich <strong>von</strong> dem Projekt ebenso angetan wie die Akademie der Wissenschaften<br />
und eine Historikerkommission; es stößt aber auf den Widerstand des preußischen<br />
5<br />
Archiv DHI Rom, Nachlaß Hiltebrandt, Nr. 2, Bl. 35ff »Zustände am Historischen<br />
Institut« (44f)<br />
6<br />
Walter Friedensburg, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstücken,<br />
I. Abtheilung 1533-1559, Bd. 1: Nuntiaturen des Vergerio 1533-1536, Gotha<br />
1892, xi<br />
7<br />
<strong>Im</strong> Auftrage des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb: v: Almut Bues,<br />
Tübingen (Nicmeyer) 1990, Einleitung (Editionsprinzipien), L, Anm. 233
326 ROM ALS SATKI.I.IT DI-:S M-UTSCIIKN CJi.nAc:i 11 NLSSI-S<br />
Finanzministeriums: »Da das Repertonum nicht der preußischen, sondern<br />
der deutschen <strong>Geschichte</strong> gewidmet sei, komme eine Finanzierung aus preußischen<br />
Geldern nicht in Frage« . Diverse<br />
Diskurse kommen hier nicht im <strong>Namen</strong> eines virtuellen Referenten namens<br />
Historie nicht zur Deckung. Die Lösung liegt schließlich in einem anderen gemeinsamen<br />
Nenner: der Übernahme der Kosten durch den kaiserlichen Dispositionsfonds<br />
bei der Reichshauptkasse; ein erster Probeband ist dann 1897<br />
erschienen. Projektepoche sind die Jahre 1378 bis zur Reformation; die Reicheweite<br />
der Erfassung heißt Deutsches Reich, geographisch gefaßt nach seinen 60<br />
Diözesen und nach deutsch klingenden <strong>Namen</strong>. Die Aktenbände in den vatikanischen<br />
Archiven mit Material aus 800 europäischen Diözesen sind nicht national<br />
untergliedert; Kriterium des Repertonum Germanicum sind daher nicht archivische<br />
Provenienz, sondern die deutschen Betreffe, die mit Hilfe der Kanzleiregister<br />
(Indici) gefiltert werden. Quellenforschung zum Mittelalter aber trifft immer<br />
schon auf ein transnationales Dispositiv. Eine Beschränkung auf Quellen der deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> ist wissenschaftlich nicht zu halten, da die <strong>Geschichte</strong> anderer<br />
Länder im Kontext der katholischen Kirche nicht <strong>von</strong> der deutschen zu trennen<br />
ist. 8 Die Umstellung der Edition <strong>von</strong> Chronologie auf Petenten läßt ein Netz <strong>von</strong><br />
Querverbindungen und Verweis barkeiten entstehen; nicht als <strong>Geschichte</strong>, sondern<br />
als Hypertext ist diese Lage wissensstratigraphisch faßbar. Operationahsierung<br />
<strong>von</strong> Komplexität heißt die weniger historische denn informatische Herausforderung<br />
an die <strong>von</strong> Quidde initiierte Edition <strong>von</strong> Korrespondenzregistern der römischen<br />
Kurie in einer Zeit, in der sie in der Tat das Zentralorgan der universalen<br />
Kirchenverwaltung darstellte. 9 Aponen des data processing:<br />
»Aber wiederum zeigte es sich, daß man es mit einem <strong>für</strong> unsere hergebrachte Editions-<br />
und Regestentechnik gänzlich neuen und ungewohnten Faktor zu tun hatte,<br />
nämlich mit der erdrückenden Masse des Materials. Tausende und aber Tausende<br />
<strong>von</strong> Regesten häuften sich zu wahren Bergen, die zugänglich zu machen wieder besondere<br />
Indizes erfordert hätte. Darauf mußte man notgedrungen verzichten,<br />
entschloß sich aber doch zum Druck eines Bandes, gleichsam eines Spczimen. Dieser<br />
1897 erschienene Band umfaßt aber nur das erste Pontifikatsjahr Eugens IV.<br />
vom 11. März 1431 bis 10. März 1432 und enthält 2828 Regesten. Natürlich ist mit<br />
einem solchen Fragment nichts anzufangen.« <br />
1933 bringt Gerd Tellenbach das Repertonum Germanicum in eine vorläufig<br />
verbindliche Form. Es gibt eine produktionsästhetische Affinität <strong>von</strong> Rom und<br />
Kehr 1907, zitiert nach: Reinhard Elze, Das DHI in Rom 1888-1988, in: Elzc / Esch<br />
1990:29<br />
Siehe auch Armin Adam, Institution, Kommunikation, Autorität. Die Legaten der<br />
römisch-katholischen Kirche, in: ders. / Martin Stingelin (Hg.), Übertragung und<br />
Gesetz, Berlin (Akademie) 1995, 93-111
EniTIONSUNTKRNKHMKN I)KS DHI . 327<br />
ROM i0 ; der Rhythmus <strong>von</strong> Memorialtechniken verläuft in nicht-kontinuierlichen<br />
Sprüngen, als Funktion ihrer Hardware: »Einen weiteren Entwicklungsschub<br />
brachte die Elektronische Datenverarbeitung mit ihren Möglichkeiten der<br />
mechanischen Indizierung - mit Rückwirkungen auf die Textgestaltung« (Brigide<br />
Schwarz). Die spezifische Technik des Repertorium Germanicum besteht<br />
darin, daß auf dieselben Personen und Orte bezügliche Einträge aus verschiedenen<br />
Registerserien in sehr verkürzten lateinischen Regesten zusammengeführt<br />
werden - und dies ist möglich, weil bereits die Vorlagen hochgradig standardisiert<br />
sind und eine exakte Begrifflichkeit (die des kanonischen Rechts) voraussetzen.<br />
Diese werden unter den <strong>Namen</strong> der Bittsteller alphabetisch und in sich<br />
chronologisch geordnet. Diese vor allem <strong>von</strong> Gerd Tellenbach gefundene Form<br />
hat medienarchäologisch avant la lettre einen damals noch nicht absehbaren Vorteil:<br />
»die Standardisierung und die Kürzungen erleichtern die Verwertung durch<br />
die Elektronische Datenverarbeitung ganz entscheidend. Die Gleichartigkeit<br />
des Materials wird auch Längsschnittuntersuchungen zulassen, die ähnlich<br />
umfassend andernorts - über 100 Jahre! - kaum möglich sein dürften.« 11 Nachrichtentheorie<br />
rechnet damit als Verhältnis <strong>von</strong> Information und Rauschen;<br />
Hauptproblem solcher Editionen bleiben die Möglichkeiten und Grenzen <strong>von</strong><br />
Vereinheitlichung und Formahsierung insbesonders bei den ausführlichen<br />
Falldarstellungcn unter den Rubriken de dedaratonis und de diversis jorrms. Die<br />
Glättung der Formularvarianten würde das Material rechtsgeschichtlich deformieren;<br />
jede Verkürzung der Falldarstellungen heißt Verlust an historischer<br />
Information. 12 Data retrieval im Vatikan stößt auf semantische Binnengrenzen:<br />
die Tausende <strong>von</strong> Registerbände des Vatikanischen Archivs sind gerade in ihrem<br />
Inhaltsreichtum zunächst jeder systematischen Forschung verschlossen; »hier<br />
kann man wohl finden, aber nicht suchen« - eine wissensarchäologische Lage<br />
also beschreibt Johannes Haller 1903 in seiner Forderung einer Zugangserschließung.<br />
Wegen des schieren Umfangs müsse man auf ein Regestenwerk<br />
verzichten und sich statt dessen auf ein Repertorium im eigentlichen Sinne be-<br />
10 Dazu W. E., Ist die Stadt ein Museum? Rom zum Beispiel, in: Dirk Roller (1 Ig.), Stach<br />
und Mensch. Zwischen Chaos und Ordnung, Frankfurt/M. u. a. (Peter Lang) 1996,<br />
263-286<br />
11 Brigide Schwarz, Klerikerkarrieren und Pfründenmarkt, in: Das Repertorium Germanicum.<br />
EDV-gestützte Auswertung vatikanischer Quellen: neue Forschungsperspektiven,<br />
hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom 1992, 246f<br />
12 Aus dem Protokoll (Verfasser: Bertram) einer Besprechung zum Projekt Repertorium<br />
Penitentiarie Germanicum am 10. März 1993 am Deutschen Historischen Institut in<br />
Rom, Typoskript (Einwand Schmugge). Zur EDV analoger rechtshistorischer Datensätze<br />
(am Beispiel der Akten des ehemaligen Reichskammergerichts in Wetzlar) F.<br />
Ranieri (Hg.), Rechtsgcschichte und quantitative <strong>Geschichte</strong>. Arbeitsberichte, Frankfurt/M.<br />
(Klostermann) 1977
328 ROM ALS SATKLLIT DI:S DHUTSCHKN GKUÄCHTNISSKS<br />
schränken, vor allem aber einen alphabetischen Index der Personen und Orte<br />
erstellen, als »das eigentliche Repertorium Germanicum <strong>für</strong> das Vatikanische<br />
Archiv« . Jeder historiographische Zugang beruht<br />
demnach auf der mechanichsten aller Sortierungen jenseits <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>.<br />
Haller schlägt ergänzend vor, dabei aus Machbarkeitsgründen den geographischen<br />
Umfang des Repertorium Germanicum auf das polithistorisch definierte<br />
Deutschland zu begrenzen. In der Frage Regesten versus Indices kommt es unter<br />
Gerd Tellenbach zu einem Kompromiß, einer Kreuzung und Verschränkung; die<br />
einzelnen Bände bestehen seitdem aus einem einheitlichen Textteil, der Regesten<br />
enthält, »die jedoch so viele <strong>Namen</strong> und sonstige Angaben enthalten, daß sie<br />
ihrerseits wiederum durch Indices erschlossen werden müssen«, ein Personenund<br />
Ortsregister. 13 Die vergangene Zukunft der Adressierbarkeit als und im<br />
Archiv schreibt sich rezeptionsästhetisch vorweg ein: Wenn der Editor ein Regest<br />
verfaßt, denkt er schon an den künftigen Index. Seit Beginn der 1980er Jahre<br />
geschieht unter Verwendung des TUSTEP (Tübinger System <strong>von</strong> Textverarbeitungsprogrammen)<br />
eine elektronische, d. h. programmgesteuerte automatische<br />
Indizierung durch textimmanente Steuerzeichen: Operatoren, »die im Text sonst<br />
nicht vorkommen und bei der Herstellung der Indices als Erkennungs- und<br />
Befehlszeichen fungieren« . Die neue (Text-)Semiotik arbeitet<br />
im Verborgenen der Verweise. Dazu treten Hilfshsten, etwa keyword-in-context-\nd\CQS.<br />
Einem unhermeneutischen System wie der EDV gilt jeder Name<br />
potentiell auch als Adresse; inhaltlich sind dabei der Index der Vornamen und<br />
der Index der Zunamen identisch. Umdentifiziert stehen die <strong>Namen</strong> »ungeprüft<br />
und unverbunden nebeneinander« , wie auch die Orte (grob<br />
lokalisiert durch die Angabe der zugehöjigen Diözese, soweit sie im Text vorhanden<br />
ist).« Die Signifikantenketten des Alphabets sortieren <strong>Namen</strong> auch als<br />
Unsinn (Jacques Lacans Begriff der alphabetise). Hier gelten die Probleme des<br />
similarity based retneval, insofern Lettern <strong>für</strong> den Computer indifferent Bitmengen<br />
darstellen. Die Uneindeutigkeit mittelalterlicher Eigennamen wird <strong>von</strong><br />
der Maschine kaum begriffen. Je weiter vorn im <strong>Namen</strong> die Schreibvariante<br />
steht, desto weiter <strong>von</strong>einander entfernt erscheinen die <strong>Namen</strong> im Index; »die<br />
Identifizierung ist vom Benutzer der Indices vorzunehmen«. Schreibvarianten<br />
versetzen hier Historie, und »wer den Index gewinnbringend nutzen will,<br />
hat ferner zu berücksichtigen, daß der Sprachgebrauch weder der Quellen noch<br />
der Bearbeiter normiert ist« . <strong>Im</strong> Unterschied zu kalkulierenden<br />
Programmen sind die Indices nach alphabetisch-mechanischen und nicht<br />
13 Hubert Höing, Die Erschließung des Repertorium Germanicum durch EDV-gestützte<br />
Indices, in: Repertorium Germanicum 1992, 310-323 (312), unter Bezug auf die Haller-Zitate<br />
in: D. Brosius, Das Repertorium Germanicum, in: Elzc / Esch (Hg.) 1990,<br />
123-165 (145f)
EDITIONSUNTF.RNF.I IMLN oi.s DHI 329<br />
nach logisch-systematischen Kriterien aufgebaut; Verweise fehlen in der Regel.<br />
»Der Erfolg beim Auffinden des Gesuchten hängt ganz wesentlich <strong>von</strong> der Findigkeit<br />
des Suchenden ab« . Was unsortiert bleibt, findet seine<br />
Adresse im Rest-Allwort-Index - eine Liste, in der alle kleingeschnebenen Wörter<br />
erfaßt sind, die nicht in einem der anderen Indices erscheinen« . Das Speichermedium findet zurück zum ursprünglichen Aggregatzustand<br />
seines Objekts, die elektronisch gespeicherte Form des Repertonums reaktiviert<br />
unter Vermeidung der Nachteile des gebundenen Buches die Vorteile des Zettelkastens,<br />
nämlich »Flexibilität, Sortierbarkeit, weitere Auswertbarkeit und - über<br />
den Zettelkasten hinaus - die Vcrknüpfbarkcit <strong>von</strong> Suchkriterien« . Das elektronische Korpus transzendiert den historischen Diskurs, wo er<br />
Vergangenheit nicht mehr erzählt, sondern berechnet; das Speichersystem generiert<br />
den Zusammenhang. Als Prosopographie erfaßt das Repertonum Germanicum<br />
die in ihm zusammengestellten Personen in einem sie vergleichbar<br />
machenden Gruppenzusammenhang und endet damit dort, wo das individuelle<br />
biographische Interesse den Gruppenaspekt überlagert. Diese Auswertung geht<br />
»tendenziell, zwar nicht notwendigerweise, in letzter Konsequenz aber doch in<br />
historische Statistik über, wenn sie die individuellen Sachverhalte entpersönlicht,<br />
anonymisiert; denn es erhebt sich in der Regel die Frage nach dem Umfang und<br />
Gewicht, das ein jeweiliges prosopographisch bestimmendes Phänomen besessen<br />
hat.« 14 Der Mediävist Meuthen präzisiert in einer Anmerkung diesen Begriff<br />
<strong>von</strong> Geschichtskörpern, die es - nicht anders als den Begriff <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
selbst - in ihre Vielzahl aufzulösen gilt, um sie neuen Gruppierbarkcitcn zugänglich<br />
zu machen. Jeder Kollektivsingular - auch der Begriff <strong>Geschichte</strong> - trägt<br />
Reinhart Koselleck zufolge die Bedingung der Möglichkeit aller Einzelgeschichten<br />
in sich 15 , doch Meuthen hält den <strong>für</strong> das Unternehmen vorgeschlagenen<br />
Begriff Kollektivbiographie nicht <strong>für</strong> glücklic, denn Biographie geht <strong>von</strong><br />
einer gelebten Einheit aus - eine Individualität, die im Begriff des Kollektivs<br />
gerade verschwindet oder zum Verschwinden gebracht wird. Die Gesetze der<br />
Historie schreiben ihre Darstellung buchstäblich vor; die Übereinstimmung der<br />
Rechtsmatenen findet ihren schriftlichen Niederschlag in einer konsequenten<br />
Formahsierung, welche die einschlägigen individuellen Gegebenheiten in einer<br />
relativ kleinen Zahl <strong>von</strong> massenhaft anwendbaren Texiformeln einfängt - »ein<br />
Umstand, der <strong>für</strong> die Homogenisierung <strong>von</strong> Daten als Grundlage historischer<br />
Prosopographie überaus günstig ist« , also auch <strong>für</strong> ihre<br />
14 Erich Meuthen, Auskünfte des Repertonum Germanicum zur Struktur des deutschen<br />
Klerus im 15. Jahrhundert, in: Das Repertorium Germanicum 1992: 280-305 (280)<br />
15 Siehe Friedrich A. Kittler (Hg.), Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften.<br />
Programme des Poststrukturalismus, Paderborn / München / Wien / Zürich<br />
1989, 8 (»Einleitung«)
330 ROM ALS SATKU.IT DI-S DKUTSCI IHN GI.DÄCHTNISSKS<br />
elektronische Verarbeitung. <strong>Namen</strong> als Daten oszillieren zwischen Anschließbar -<br />
keit an den historisch-biographischen und den antiquarisch-statistischen Diskurs.<br />
Meuthen verteidigt anhand anhand der Lemmata des RG (und des Problemes der<br />
Mehrfachnennungen) die Notwendigkeit historischer Daten- als Personenkonfiguration,<br />
denn hier schließt sich Statistik unversehens mit individueller Personengeschichte<br />
kurz. Hängt Historie an namentlicher Adressierbarkeit? »Gerade<br />
bei den Landes<strong>für</strong>sten fragt man natürlich, wer das denn sei, der hier aufgeführt<br />
werde, wer etwa nicht bzw. wer mehr, wer weniger. <strong>Geschichte</strong> geht nie und nimmer<br />
in Statistik auf« . Die Anschließbarkeit an Historie als<br />
den solche Arbeiten legitimisierenden Diskurs muß gesichert bleiben, »nicht<br />
zuletzt <strong>für</strong> die Sinnerschließung einer zunächst so entmutigend scheinenden<br />
Sache, wie sie das RG auf den ersten Blick ist« . Der wissensarchäologische<br />
Blick dagegen bekennt sich zur Widcrständigkeit der Urkunden gegenüber ihrer<br />
Verwertbarkeit im historischen, also erzählenden Diskurs:<br />
»Die inhaltlichen Bestimmungen der Urkunden sind, wie es Rechtszeugnisscri<br />
eigcnthümhch zu sein pflegt, in starre Formeln eingezwängt, welche das Hervortreten<br />
individueller Momente erschweren. Die geschichtlichen Materialien sind<br />
gleichsam in winzigen Stückchen in's Gestein der Formel eingesprengt, und nicht<br />
ohne Mühe aus ihm herauszulösen und zu verwerthen.«"'<br />
Das Verfahren, Information aus solchem Gestein zu gewinnen, heißt in der Tat<br />
Statistik; schon deren primitivste Form, eine zahlenmäßige Zusammenstellung<br />
der <strong>von</strong> den verschiedenen Herrschern ausgestellten Diplome, ist überaus lehrreich:<br />
»Auch wenn man hiebei den Zufälligkeiten, denen die Dokumente aus der<br />
Vorzeit Jahrhundert hindurch ausgesetzt waren, Rechnung trägt , so bleiben<br />
doch Unterschiede, deren Bedeutung eine tiefere ist« . Kriterium<br />
<strong>für</strong> die Identifizierung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> ist also die DiHcrcnz. Line Menge gegebener<br />
Urkunden konstituiert eine Aussage nicht in Hinsicht auf Narration, also<br />
Historie, sondern deren Infrastruktur: »die <strong>Geschichte</strong> der Institutionen und ihrer<br />
allmählichen Entwicklung« . Kehr zeichnet anhand diplomatischer<br />
Kriterien die Romanisierung der Kanzlei Ottos III. nach und liest diesen<br />
wissensarchäologisch gewonnenen Befund seinerseits als ein geschichtsdokumentarisches<br />
Indiz einer intendierten Zusammenführung <strong>von</strong> Deutschland und<br />
Italien zu einheitlichen Reichsteilen, zu ihrer Union als politischem Ziel . Kehr mobilisiert dabei auch die Ausagen äußerlicher Kennzeichen, urkundensemiotisch<br />
17 ; auf den Wachssiegeln Kaiser Ottos III. findet sich erstmals die<br />
16 Paul Kehr, Zur <strong>Geschichte</strong> Otto's 111., in: Historische Zeitschrift, hg. v. Heinrich<br />
<strong>von</strong> Sybel / Max Lehmann, Bd. 66, München / Leipzig 1891, 385-443 (388)<br />
17 Siehe Peter Rück (Hg.), Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden: Beiträge<br />
zur diplomatischen Semiotik, Sigmannngen (Thorbecke) 1996
EniTIONSUNTHRNHHMI-N DKS DHI 331<br />
Legende Ronovatw impern Romanorum und das Bild der kriegerischen Roma,<br />
auf dem letzten Stempel auch die Legende Aurea Roma. Die Anonymität <strong>von</strong><br />
Historie aber liegt in den <strong>Namen</strong> ihrer Sekretäre, der Kanzleivorsteher Ottos III.:<br />
»Merkwürdig ist doch, wie gerade diese beiden Männer in unsrer histonographischen<br />
Überlieferung zurücktreten. Weder Willigis noch Hildbald haben einen Biographen<br />
gefunden, ja <strong>von</strong> dem letzeren wissen wir so gut wie nichts; ohne die<br />
Urkunden wüßten wir nicht einmal, daß er Kanzler gewesen . Lediglich die<br />
Interventionen sind es, welche uns inmitten einer trümmerhaften oder unsicheren<br />
Überlieferung allein einen zuverlässigen Maßstab <strong>für</strong> die Größe und <strong>für</strong> die Bedeutung<br />
der politischen Wirksamkeit dieser Männer gewähren.« <br />
In den Unterbrechungen der Narration scheint das Reale der Vergangenheit als<br />
Aufzeichnung erst auf. Kritik der historischen Narration ist die Einsicht in ihre<br />
Infrastruktur: »Klarer und schärfer als in den erzählenden Quellen, denen zumeist<br />
nur die äußeren Wandlungen, wie die neue Hofordnung, in die Augen fielen, tritt<br />
uns in den Urkunden der Charakter des Regiments« entgegen; buchstäblich<br />
reflektieren Urkunden<br />
»politische und staatsrechtliche Momente <strong>von</strong> der größten Bedeutung . Wohl<br />
vermögen uns auch die Urkunden im Einzelnen kein ganz getreues Bild zu geben,<br />
aber im ganzen bewähren sie doch ein zuverlässiges Totalbild vom Wesen und<br />
Wirken einer Regierung, und der Historiker wird, wenn er die historischen Matenahen,<br />
welche sie bergen, sammelt, mindestens eine wesentliche Ergänzung zu<br />
dem gewinnen, was ihm die anderen Formen der Überlieferung bieten.« <br />
Dieses Wissen steht in keinem hilfswissenschaftlichen, sondern alternativen<br />
Wissensverhältnis zur Historie.<br />
Stauferforschung<br />
In den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts wehren die deutschen Archäologen<br />
in Rom sich gegen Pläne Bethmann-Hollwegs in Berlin, das römische Institut<br />
mit einer geplanten preußischen Kunstakademie in Rom zu fusionieren, wie<br />
es A. Kampf, Präsident der Königlich preußischen Akademie der Künste, dem<br />
Fürsten <strong>von</strong> Bülow als Kanzler des Deutschen Reichs vorschlägt. 18 Für Archäologen<br />
und Historiker war in Rom gesorgt, doch die Kunsthistoriker? »Während<br />
Deutsches 1 listorisches Institut Rom, Archiv, Registratur, Älterer Teil, Nr. 7 (altes<br />
Rubrum: »Akten betr. Verkehr in. d. Kultusministerium. Gutachtliche Äußerungen<br />
über sonstige Gegenstände«), »Abschrift <strong>von</strong> Abschrift zu U I. 31003«: Berlin, den 6.<br />
November 1907; betrifft: Errichtung eines kunsthistorischen Instituts in Rom sowie<br />
die Gestaltung des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts in Rom
332 ROM ALS SATI-XUT DI-:S DKUTSUIKN GKIMCMTNISSKS<br />
in Deutschland neuerdings an fast allen Universitäten kunstgeschichtliche Professuren<br />
errichtet werden, deren >Apparate< mit Photographien und Büchern<br />
zur Verfügung stehen so findet man in Rom, der Hauptstätte <strong>für</strong> das Studium<br />
der Weltgeschichte der Kunst nichts entsprechendes« . Für jüngere<br />
Kunsthistoriker können Führungen <strong>von</strong> großem Wert sein, »da sie jetzt<br />
viele Monate brauchen, um sich nur einigermaßen in der Fülle der Epochen<br />
zurechtzufinden, die in Rom aufeinandergeschichtct sind« - die<br />
Zurechtfindung in solchen strata heißt Wisscnsarchäologie. Kampf plädiert <strong>für</strong><br />
den Anschluß eines kunsthistorischen Instituts in Rom an das deutsche archäologische<br />
Institut, wo die kunstgeschichtliche Orientierung der Klassischen<br />
Archäologie seinem Anliegen der Blickschärfung entgegenkommt .<br />
Realität aber wird dieser <strong>Im</strong>puls in Kopplung an Historie. Um 1912 stockt die<br />
Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom ihren Etat durch<br />
Verkauf <strong>von</strong> Büchern der mittleren und neueren Kunstgeschichte an das Preußische<br />
Historische Institut auf; die Klassische Archäologie definiert sich - in den<br />
Spuren Winckelmanns - weiter als antike Kunstgeschichte. Paul Kehr wiederum<br />
sucht die Gründung eines eigenständigen kunsthistorischen Instituts in<br />
Rom durch die Gründung einer entsprechenden Abteilung an seinem Institut<br />
1907 zu verhindern; mit dem Erwerb des Materials vom Archäologischen Institut<br />
aus Mitteln des Ministeriums plant er zugleich ein römisches Wissenschaftszentrum<br />
<strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong>, Kunstgeschichte und Archäologie. 1913 eröffnet<br />
fast zeitgleich die Bibliotheca Hertziana in Rom; Kehr seinerseits baut die Photothek<br />
seines Instituts aus, ein Wettlauf um das Speicherprivileg in Rom. 19<br />
Kehrs vornehmlich auf die Erforschung der süditalienischen Stauferkastelle ausgerichtete<br />
kunsthistorische Abteilung am PHI verfolgt eine dichte Kopplung<br />
dieser Monumente mit archivischen Dokumenten; er, der Kunstgeschichte im<br />
Grunde genommen als Phantasie-Wissenschaft ansieht, baut weniger auf Sehen<br />
denn auf Lesen der Vergangenheit und beorderte Eduard Sthamcr zur Erforschung<br />
der Kastellbauakten an das Staatsarchiv <strong>von</strong> Neapel. 20 Eine Emphase der<br />
Italien-Forschungen des PHI hegt seinerzeit auf dem Zeitalter der Staufer, »die<br />
mehr als irgend ein anderes deutsches Haus mit der <strong>Geschichte</strong> Italiens verwachsen<br />
sind, vorzüglich die Epoche Kaiser Friedrichs II. und seiner Epigonen«<br />
. Kehr publiziert diese Aussage kurz vor Ausbruch des<br />
Ersten Weltkriegs. Zu diesem Zeitpunkt existiert bereits die Reihe Kunstgeschichtlichc<br />
Forschungen, herausgegeben <strong>von</strong> seinem Institut in Rom (darunter<br />
etwa das Falkenbuch Friedrichs II.). Eine Annonce seines Verlags Karl W. Hier-<br />
19 Goldbrunner 1990: 49, unter Bezug auf: Quellen und Forschungen aus Italicnischen<br />
Archiven und Bibliotheken 17, 1 (1914-1924), vif.<br />
20 Zitiert nach: UH1 Rom, Archiv, Nachlaß 1 likebrandt, Nr. 5, Lebenserinnerungen. 2.<br />
Fassung, Bl. 48
EDITIONSUNTKRNI-HMKN DHS DHI 333<br />
semann (Leipzig) nimmt diesen Faden im Juli 1920 auf und verkündet Band 1<br />
<strong>von</strong> Arthur Haseloff, Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, mit »Aufmessungen<br />
und Zeichnungen« <strong>von</strong> Erich Schulz und Philipp Langewand:<br />
»Noch heute, nach 700 Jahren reden die erhaltenen Reste jener Monumente eine<br />
eindringliche Sprache, die uns den Glanz und die Macht jener Zeit wie den<br />
hohen künstlerischen Sinn des kaiserlichen Bauherrn vor Augen führt« .<br />
Getriggert wird die Vermarktung historischer Forschung hier nicht durch das<br />
Archiv, sondern durch historische <strong>Im</strong>agination:<br />
»Seit eine romantische Anschauungsweise diesen lange Zeit mißachteten Werken<br />
den Zauber ihrer glänzenden Vergangenheit wieder verlieh, hat auch die wissenschaftliche<br />
Forschung ihnen ihr Augenmerk zugewandt. Jeder Versuch aber, in die<br />
Geheimnisse ihrer Entstehung einzudringen, sie nach ursprünglicher Gestalt, Stil<br />
und Zweck zu erklären, mußte scheitern, solange nicht die geschichtliche und die<br />
kunstgeschichtliche Forschung zur gemeinsamen Ergründung der einschlägigen<br />
Probleme aufgerufen wurden.« <br />
Das Preußische Historische Institut in Rom, zu dessen Forschungaufgaben satzungsgemäßg<br />
alle Formen deutsch-italienischer Beziehungen gehören, bleibt also<br />
nicht bei der Urkundenforschung stehen, sondern faßt »auch die monumentalen<br />
Zeugen der Vergangenheit ins Auge« . An den Grenzen der Bilder eröffnet<br />
sich das Archiv. Als Arthur Haseloff den Auftrag erhält, die hohenstaufischen<br />
Bauten Unteritaliens zu bearbeiten, erkennt er bald, daß ohne eine erschöpfende<br />
Bearbeitung der geschichtlichen Quellen, vor allem des Urkundenmaterials aus<br />
der Zeit Karls I. <strong>von</strong> Anjou, keine abschließenden Ergebnisse zu gewinnen sind.<br />
Eduard Sthamer wird daraufhin zur Mitarbeit herangezogen, und es entstehen die<br />
Ergänzungsbände, <strong>von</strong> denen der erste die Vewaltung der Kastelle unter Kaiser<br />
Friedrich II. und Karl I. <strong>von</strong> Anjou behandelt, der andere die Dokumente zur<br />
<strong>Geschichte</strong> der Kastellbauten publiziert. Die süditahenischen Monumente aus<br />
staufischer Zeit werden <strong>von</strong> Haseloff in situ erforscht und vermessen; Steine aber<br />
tragen <strong>von</strong> sich aus keinen differenzierten zeitlichen Index an sich, geben sich mithin<br />
also in archäologischer Synchronie, nicht in historischer Folge zu lesen und<br />
bedürfen des textuellen Supplements <strong>für</strong> eine kunsthistorische Einordnung. Kehr<br />
vermag einem Zirkelschluß in seiner Argumentation nicht zu entgehen, wenn<br />
Text und Objekt sich dann gegenseitig bedingen:<br />
»Aber es sind, <strong>von</strong> Castel del Monte und Lago Pesole abgesehen, Ruinen, oft nur<br />
kümmerliche Trümmer. Wie nun verteilt sich an diesen Monumenten der Anteil<br />
der Staufer und der ihrer Nachfolge im Königreiche, der Anjous? Die Baudenkmäler<br />
selbst schweigen darüber, nicht aber die Dokumente, die wenigstens aus der<br />
anjovinischen Zeit sich in großer Zahl im Staatsarchiv <strong>von</strong> Neapel und vorzüglich<br />
in den anjovinischen Registern befinden. So stellte sich die Notwendigkeit heraus,<br />
mit der technischen und kunsthistonschcn Untersuchung der Monumente selbst die<br />
gründlichste archivahsche Forschung zu verbinden.«
334 ROM ALS SATHLUT PKS DKUTSCI IHN GLDÄCI ITNISSUS<br />
Kehr legte die Emphase der Itahenforschungen des Preußischen Historischen<br />
Instituts diskurstaktisch (und mit Blick auf die Italienreise seines Kaisers) auf das<br />
Zeitalter der Staufer, »die mehr als irgend ein anderes deutsches Haus mit der<br />
<strong>Geschichte</strong> Italiens verwachsen sind, vorzüglich die Epoche Kaiser Friedrichs II.<br />
und seiner Epigonen.« Hier wird neues Quellenmatenal an den Tag kommen,<br />
eine wissensarchäologische Metapher: ein und derselbe Diskurs verhandelt beide<br />
Disziplinen, (Bau-)Archäologie und Historie. »Denn aus jener Zeit sind nicht nur<br />
Tausende <strong>von</strong> Urkunden erhalten, auch die Monumente reden zu uns, die Kastellbauten<br />
Kaiser Friedrichs II.« . Saxa loquntur? Es ist ein veritables<br />
Historiker-Phantasma, monumentales Schweigen in historische Rede (also Diskurs)<br />
verwandeln zu wollen.Seit 1908 arbeitet Sthamer in den Archiven <strong>von</strong> Neapel.<br />
Die dortigen Dokumente zu besagten Bauten - schreibt Kehr, der Kontrahent<br />
der Lamprechtschen Kulturgeschichte - »bieten aber zugleich ein so reiches<br />
Material <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> der Architektur und des Handwerks in jener Zeit und<br />
<strong>für</strong> unsere Kenntnis der Verwaltung, kurzum eine solche Fülle <strong>von</strong> Details der<br />
Kunst- und Kulturgeschichte«, so daß das Institut beschließt, sie zu veröffentlichen.<br />
In systematischer Bestandsaufnahme des Archivs publiziert das PHI diese<br />
Regesten und Auszüge: Dokumente zur <strong>Geschichte</strong> der Kastellhauten in Unteritalien<br />
unter Friedrich II. und Karl I. (1239-1285) als Vorläufer der monumentalen<br />
Publikation Haseloffs. Niemand denkt damals an die Errichtung einer<br />
besonderen Abteilung <strong>für</strong> Kunstgeschichte am Institut; der Selbstläufer aber entwickelt<br />
sich genau dazu. »Geht das Institut hier nicht bereits über seine natürlichen<br />
Grenzen hinaus? Wäre nicht ein selbständiges kunsthistorisches Institut in<br />
Rom besser am Platze?« Nein. Kehr bedient sich einer Argumentation, die<br />
allerdings auch <strong>für</strong> das Archäologische Institut in Rom gegolten hätte:<br />
»Je mehr Spezialinstitutc wir im Auslandc unterhalten, um so größer wird die Kollisionsgefahr.<br />
In der Art, wie wir Deutschen nun einmal heute unsere Wissenschaft<br />
betreiben, steckt eine leider uns angeborene oder anerzogene Ressortenge, eine<br />
Leidenschaft des Spezialistentums, ein Fanatismus des Sichabschließens, die gewiß<br />
vortreffliche und technisch vollkommene Leistungen hervorbringen, aber zugleich<br />
eine wissenschaftliche und auch menschliche Beschränktheit zur Folge haben .<br />
Wie viel gegenseitige Anregung, Ergänzung, Weiterbildung erwächst doch aus diesem<br />
engen Zusammensein <strong>von</strong> Historikern und Kunsthistorikern am Institut. <br />
Kann doch die eine Disziplin so wenig wie die andere der strengen archivalischen<br />
Forschung entbehren. Sind am Ende ihre Methoden nicht dieselben, sind es nicht<br />
auch zum großen Teil ihre Objekte?« <br />
Das double-hind zwischen diskret-archivarischer und kunstästhetischer Darstellung<br />
schreibt sich hier analog zum epistcmischen Widerstreit zwischen Forschung<br />
und Historiographie in der Stauferforschung, wie er im Historikerstreit<br />
um Ernst H. Kantorowicz< Monographie Kaiser Friedrich der Zweite (Berlin<br />
1927) offen zum Ausbruch kommen wird.
Archäologie eines Archivs und Archivbrand<br />
(Nachlaß Sthamer, Staatsarchiv Neapel)<br />
EDITIONSUNTF.RNI;HMI;N DI-:S DHI 335<br />
Information über Vergangenheit ist eine Funktion ihrer Adressierbarkeit als<br />
Gedächtnis. Der Nachlaß Sthamer im Archiv des Deutschen Historischen<br />
Instituts Rom birgt den Entwurf eines Planes <strong>für</strong> die Fortsetzung der Bearbeitung<br />
der Angiovinischen Register in Neapel, eine Vorlage <strong>für</strong> Kehr, datiert<br />
Hamburg, den 3. September 1908 . Unter Punkt »A. Methode<br />
der Durchforschung und Publikation« heißt es dort, das Archiv der Anjou in<br />
Neapel habe wie kein anderes Archiv jener Jahrhunderte einen modernen Charakter<br />
getragen:<br />
»Die Akten waren nach der Provenienz, den Adressaten und dem Betreff bis ms<br />
Einzelne streng gegliedert. Allein diese ursprünglich vorhandene Ordnung ist im<br />
Laufe der Jahrhunderte verwischt und fast unkenntlich gemacht worden. Nicht<br />
nur ist Vieles überhaupt gänzlich verloren gegangen, sondern auch das Erhaltene<br />
ist durch elementare Einflüsse (Wasser, Eeuer etc.) und durch Menschenhand<br />
(>Neuordnungen
336 ROM ALS SATKI.I.IT DKS DI-:UTSCI IKN GKIMCHTNISSI-S<br />
säten zuzuweisen, oder auch die Akten, die vom König selbst ausgingen, <strong>von</strong><br />
denen seiner Vikare streng zu scheiden.« <br />
Denn der symbolischen Ordnung der Historie vorgängig ist die <strong>von</strong> Archivschaltungen,<br />
analog zur Verwaltungsmacht der Gegenwart, deren Derivat sie<br />
sind. So daß mit der rekonstruierenden Synthese keine historische Erzählung, sondern<br />
die Beschreibung eines Aggregatzustands <strong>von</strong> archivischem Gedächtnis<br />
gemeint ist: Dieser rekonstruierenden Synthese eine sichere methodische Handhabe<br />
zu geben, will Sthamer sodann notwendig ein genaues Itinerar der Könige<br />
aufstellen, um es dadurch zu ermöglichen, undatiert im Gedächtnisraum flottierende<br />
Akten einem bestimmten Jahr zuzuweisen. <strong>Im</strong> Umkehrschluß läßt sich<br />
dabei auch »ein tiefgreifender Einfluss des Itincrars auf die Kanzlei und die Gestaltung<br />
des Archivs beobachten« . Unter dem Absatz »Editionsprinzipien«<br />
beschreibt Sthamer dann den notwendigen Kritischen Apparat, der auf ein<br />
Minimum beschränkt werden soll: »Es werden nur wesentliche Abweichungen<br />
<strong>von</strong> der archivalischen Vorlagen (z. B. Konjekturen) verzeichnet«, offenbare<br />
Schreibfehler verbessert er »stillschweigend« . Die »Systematische<br />
Ausbeute« betrifft zum einen die Akten zur Baugeschichte der hohenstaufischen<br />
Schlösser im Königreich Sizilien in Absprache mit Haseloff, bereits separat publiziert.<br />
»Diese Art der Publikation bedingt die Anordnung der Akten: Sie hat im<br />
Wesentlichen der Anlage des Haseloff'sehen Werkes zu entsprechen« ;<br />
<strong>von</strong> daher das topographische Prinzip. Dann die Akten zur <strong>Geschichte</strong> des früheren<br />
Mittelalters: Die bisherige Durchsicht der Register ergibt überraschend, daß<br />
sich entsprechende Dokumente in extenso dort gar nicht fanden; andererseits aber<br />
solche, in denen sich Personen respektive Korporationen auf Privilegien aus der<br />
Zeit Friedrichs II. berufen. Bleibt zu untersuchen, inwieweit diese Berufungen<br />
auf alte Privilegien sich durch erhaltenen Dokumente als richtig erweisen lassen,<br />
»und was etwa als blos formelhafte Wendung auszuscheiden ist« . In<br />
einem Text aus dem römischen Nachlaß Sthamer Nr. 3, Bl. lff (Archiv DHI) heißt<br />
es dazu unter dem Titel Aufruhr gegen Karlv. Anjou, der König oder seine Beamten<br />
hätten sich keineswegs »mechanisch an das gehalten«, was ihnen durch das<br />
Studium der alten Akten bekannt ist; »vielmehr scheint es, als ob sie dadurch<br />
lediglich Anregungen empfangen haben« . Denn das Archiv hat nicht<br />
immer als das Depot <strong>von</strong> Wissensmacht fungiert, als das es sich der Moderne zu<br />
lesen gibt; vielmehr bildet es deren Virtualität ab. Drittens nennt Sthamers Plan<br />
Akten zur <strong>Geschichte</strong> der Mittelmeermächte im Ausgange des 13. Jahrhunderts,<br />
auf deren Basis er bei der Einseitigkeit des Materials (päpstliche und Angiovinische<br />
Akten) nicht an eine erschöpfende Darstellung der gesamten politischen<br />
Beziehungen der Mittelmeermächte in jener Epochen denken kann; vielmehr muß<br />
er sich auf die Behandlung einzelner Verhältnisse beschränken, »<strong>für</strong> die die vorliegenden<br />
Akten gerade Stoff bieten.« Hieraus ergibt sich, daß er <strong>für</strong> die Anord-
EDITIONSUNTKRNHHMKN DHS DHI 337<br />
nung der Dokumente nicht ein chronologisches, sondern ein sachliches Ordnungsprinzip<br />
zur Anwendung zu bringen plant . Die Aktenlagen geben<br />
das Gesetz der Historiographie vor. Sthamer schlägt vor, Akten photographieren<br />
zu lassen, wie schon im Vatikanischen Archiv . Längst schreibt sich die<br />
Datenerfassung der Historie nicht mehr ausschließlich durch die Hand des Historikers<br />
ab; seine eigenen Arbeitsberichte (Unter Nr. 2 im römischen Nachlaß Sthamer)<br />
an das Historische Institut in Rom aus Neapel sind ab den Blättern 125-129<br />
(5. Juli 1919) maschinenschriftlich verfaßt. Die Schreib- und Lesemaschinen des<br />
20. Jahrhundert schicken sich an, das Dispositiv automatisierbarer Datenprozessierung<br />
zu bereiten. Ein späterer Bericht Sthamers, datiert Berlin, den 26. Mai<br />
1932 (Typoskript), behandelt seine 1931/32er Reise nach Unteritalien und Sizilien,<br />
wo er die Studien <strong>von</strong> 1908 im Staatsarchiv Neapel durch Forschungen in<br />
geistlichen Archiven ergänzt . Ein deutscher Pioniertrupp<br />
verbrennt ein Dezennium später, am 30. September 1943, in der Nähe<br />
<strong>von</strong> Nola bei Neapel die Villa Montesana, die dem Staatsarchiv Neapel derzeit als<br />
Auslagerungsdepot dient, und verursacht damit auch den Verlust der angiovimschen<br />
Register. Doch »lost archives are not necessanly and irretnevably lost«<br />
angesichts moderner Reproduktionstechniken, die jedem Archiv einen Zweitkörper<br />
verleihen: »The registers were set together piece by piece<br />
with the hclp of finding aids, handwritten copies or microfilms Coming from all<br />
over the world« 21 ; das Registerwesen aber ist selbst schon ein Ersatz des Archivs,<br />
die Reaktion auf dessen Verlust gewesen, wie es die diplomatische Gründungslegende<br />
vom Verlust der Urkunden (der cariae) des französischen Königs Philipp<br />
II. August in der Schlacht bei Freteval gegen Richard Löwenherz <strong>von</strong> England<br />
berichtet. 22 Es gibt, medienarchäologisch wahrgenommen, keinen ersten Akt,<br />
keine erste Akte des Archivs. Die Abschriften Sthamers im zweiten Teil seines<br />
Nachlasses, über Umwege 1964 aus einem Keller der Deutschen Staatsbibliothek<br />
Unter den Linden, wo es im Kriege aufbewahrt worden war, als Bestand <strong>von</strong><br />
Monumenta-Material (damals sehr summarisch verzeichnet) zu den MGH<br />
gelangt, sind dadurch im Wert potenziert. Zunächst tragen die Kästen »N« (<strong>für</strong><br />
»Nachtrag«) bei der Übernahme außen keinen Hinweis auf Sthamer, und das<br />
Findbuch gibt den Inhalt dieser erst 1964 hinzugekommenen Kästen nicht an.<br />
Gedächtnis ohne buchstäbliche Adressierung bleibt taub: »Obwohl das Archiv<br />
21 Leopold Auer, Archival losses and their impact on the work of archivists and histonans,<br />
in: Memory of the world at risk: archives destroyed, archives recontrueted, München<br />
u. a. (Säur) 1996 (= Archivum, Bd. 42), 1-9 (5); zu Zerstörung und Rekonstruktion<br />
der Anjou-Register im Staatsarchiv Neapel auch der Beitrag <strong>von</strong> Stefano Palmieri in<br />
diesem Band.<br />
22 Auch dazu Cornelia Vismann, Akten: Ihre Ordnungen als <strong>Geschichte</strong> des Rechts,<br />
Diss. Goethe-Universität Frankfurt/M. 1998, Abschnitt »Register und Thesaurus«
338 ROM ALS SATLLLIT DLS DHUTSCHI-N GLDÄCIITNISSKS<br />
zugänglich war und eine Kopie des Findbuchs schon seit langem bei den Monumenta<br />
in München vorlag, blieb der Nachlaß Sthamer unerkannt, und offensichtlich<br />
unbenutzt, weil nicht wirklich inventarisiert; auch im Personenregister<br />
des Findbuchs erscheint Sthamers Name darum nicht.« 23 <strong>Namen</strong> verbürgen nach<br />
wie vor privilegiert die Adressierbarkeit <strong>von</strong> Gedächtnis; die Verfügungsgewalt<br />
über die Einspeisung <strong>von</strong> Daten der Vergangenheit in den historischen Diskurs<br />
hat der, der die Adreßköpfe (jenes caput mortuum) schreibt. Identifiziert wird<br />
dieser Bestand Sthamer <strong>von</strong> Reinhard Elze als Teil der Materialien, welche die<br />
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften im Herbst 1992 an<br />
die MGH in München zurückgibt. Elze wiederum ist der Aufsatz <strong>von</strong> Lutz<br />
Khnkhammer über die Abteilung Kunstschutz der deutschen Militärverwaltung<br />
in Italien 1943-1945 gewidmet, der die näheren Umstände des Archivbrands diskutiert.<br />
24 Die Verbrennung der Villa Montesano geschah aufgrund des deutschen<br />
Befehls, aufzugebendes Gelände nach dem Aufstand der Neapolitaner Bevölkerung<br />
gegen die Besatzungsmacht den Allierten nur als Wüste zu überlassen. 25<br />
Deutscherseits scheint man nichts <strong>von</strong> der monumentarischen Existenz oder<br />
dokumentarischen Bedeutung des Archivdepots gewußt zu haben; eine <strong>von</strong><br />
höherer Stelle angeordnete, bewußte Zerstörung des Archivs hätte »höchstwahrscheinlich<br />
in den militärischen Akten einen Niederschlag gefunden« - Aktenarchäologie<br />
schreibt sich hier im eigenen Medium. <strong>Im</strong> Bundesarchiv-Militärarchiv<br />
Freiburg/Br. hat Klinkhammer jedoch keinen Reflex eines solchen Befehls feststellen<br />
können. 26<br />
Das Gedächtnis der Steine: Kastell Bari<br />
Die bau- und kunsthistonsche Forschungen an süditalienischen Stauferkastellen<br />
entstehen <strong>von</strong> Seiten des Historischen Instituts in Rom im Anschluß an eine<br />
gemeinsame Süditalienreise des Direktors Kehr mit Kaiser Wilhelm II. im Frühjahr<br />
1905 (Bari, Castel Del Monte, Tram, Ruvo, Bitono und Altamura). Zwischen<br />
Monument und Dokument spalten sich der archäologische und der<br />
archivarische Blick 27 : »Wohl kannte ich bereits Land und Leute und leidlich vor<br />
- J Arnold Esch / Andreas Kiesewettcr, Süditalien unter den ersten Angiovinen: Abschriften<br />
aus den verlorenen Anjou-Registern im Nachlaß Eduard Sthamer, in: Quellen und<br />
Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 74 (1994), 646-663 (652f)<br />
14 In: QFIAB 72 (1992), 483-549<br />
- 5 Unter Verweis auf: Bundesarchiv / Militärarchiv Freiburg, RII 24-14, Bd. 81: XIV.<br />
Pz.Korps, 29.9.1943<br />
- 6 Klinkhammer 1992: 501, Anm. 45<br />
17 Als Realisierung einer ausdrücklich präsentistischcn I.cs- respektive Sehart <strong>von</strong> Castel<br />
del Monte zwischen Monument und Dokument (im Sinne der Archäologie des Wissens
EniTlONSUNTKKNKHMKN IJKS DHI 339<br />
allem die Archive, aber erst jetzt lernte ich die großen Reste der Staufenzeit mit<br />
anderen Augen anschauen.« 28 <strong>Im</strong> Nachhall des Kaiserbesuchs öffnen sich deutschen<br />
Forschern die Tore und Türen <strong>von</strong> Monumenten und Bibliotheken; der<br />
Direktor der Bibhtheca Consorziale in Bari etwa steuert Nachrichten aus seiner<br />
historischen Notizensammlung über das Kastell bei. So unterstützt, gelingt es<br />
dem beauftragten Fachwissenschaftler Haseloff, »in die Struktur des Bareser<br />
Kastells tiefer einzudringen und durch glückliche Funde unsere Kenntnis dieses<br />
Bauwerkes zu erweitern.« Zwischen Monument und Dokument seien weitere<br />
Forschungen nötig, »endlich eine umfassende Forschung im großen Staatsarchiv<br />
in Neapel, bis es möglich sein wird, aus der Summe <strong>von</strong> Beobachtungen, Aufnahmen<br />
und Forschungen heraus die <strong>Geschichte</strong> der Friderizianischen Schloßbauten<br />
in Apuhen zu schreiben« . An diesem Punkt müssen Daten nicht<br />
notwendig in Kunstgeschichte transformiert werden; alternativ dazu formuliert<br />
sich ein wissensarchäologisches data processing. Die <strong>Geschichte</strong> des Kastells in<br />
Bari ist »die typische <strong>Geschichte</strong> eines apuhschen Kastells« - zu Beginn der Bau<br />
der Normannenzeit, dann ein Neubau unter Friedrich II, ein Umbau unter Karl<br />
<strong>von</strong> Anjou, eine Neubefestigung zur Zeit Karls V. »und endlich eine letzte zerstörende<br />
Umwandlung im 19. Jahrhundert: das sind die fünf Perioden, die <strong>für</strong><br />
die Gestaltung eines apulischen Kastells die Wendepunkte zu bedeuten pflegen.«<br />
Wendepunkte, Tropen - hat auch Baugeschichte ihre Rhetorik? Das Kastell,<br />
1832 unter Ferdinand II der Stadt übergeben, wurde zum Gefängnis, zur Carabinieri-Kaserne<br />
und zur Marinesignalstation umgestaltet und so ein Zustand<br />
geschaffen, »der in vielen <strong>für</strong> die Kunstdenkmäler Apulicns begeisterten Herzen<br />
den Wunsch einer Herrichtung <strong>für</strong> Museums- und Bibhothekszweckc<br />
wachgerufen hat« . Dieselbe Wissenschaft, die das Territorium<br />
geo-historiographisch besetzt, reklamiert <strong>für</strong> diese einst realen Machtorte<br />
die Markierung gedächtnissymbolischer Präsenz. Nicht gekoppelt an historische<br />
Diskurse, sind solche Orte nichts als radikale Präsenz des Vorliegenden:<br />
»Die Küstenkastelle, die vor aller Augen liegen, sind fast gar nicht beachtet worden«;<br />
an eine Durchforschung »der dem Untergang geweihten Ruinen im<br />
Innern Apuhens, eine Feststellung des Gewesenen durch Nachgrabungen hat<br />
bisher niemand gedacht« . Einen bleibenden Eindruck <strong>von</strong><br />
Kastellarchitektur erhielt Kaisers Friedrich II. im Heiligen Land; <strong>für</strong> das Kastell<br />
Bari sind als Vorbild Festungsbauten in Palästina auszumachen, womöglich<br />
unter Einstellung syrischer und byzantinischer Architekten der Kreuzfahrerzeit.<br />
»Aus diesen weltgeschichtlichen Zusammenhängen erklärt sich, daß die<br />
Michel Foucaults) siehe: Walter Seitter, Kristall, Labyrinth. Die zwei Seiten des Schlosses.<br />
Ein Beitrag zur Physik des Kaisers, in: Ernst / Vismann 1998, 47-58<br />
- s Königlich Prcussischcs I listonsches Institut m Rom (Hg.), Das Kastell in Bari, bcarb.<br />
v. Arthur Haseloff, Berlin 1906, »Vorrede« Kehr (Rom, 15. Februar 1906), 5
340 ROM ALS SATKI.I.IT OHS DKUTSCHI-N GKDÄCHTNISSKS<br />
einzige Burgengruppe gleicher Anlage in Europa die des Deutschritterordens in<br />
Preußen ist.« Bauarchäologie bringt entlegene Typen in Serien zusammen; der<br />
Bezug auf die Marienburg in Ostpreußen erlaubt es dann, <strong>für</strong> die Finanzierung<br />
des Forschungsprojekts nationalhistorisch zu argumentieren.<br />
Kastell Bari liest sich als verwundeter Baukörper:<br />
»Vom Gefängnissaal führte eine jetzt verschüttete Wendeltreppe zum Obergeschoß.<br />
Dieser obere Teil des Turms ist durch die Explosion <strong>von</strong> 1696 zerstört, aber<br />
in seinem zerstörten Zustande bietet er ein besseres Bild des Gewesenen als der<br />
andere besser erhaltene Turm mit seinen modernen Verunstaltungen. Hier, wo kein<br />
Putz sie verdeckt, tritt die ganze Schönheit und Sorgfalt des Quadermauerwerks<br />
und des Steinschnitts zutage.« <br />
Ruinierung als historische Analyse - ein archäologischer Akt, um den schon die<br />
gemalten oder gebauten Ruinenphantasien um 1800, zwischen Strukturanalyse<br />
und Allegorie der Vergänglichkeit oszillierend, wissen. 29 Ein gotisches Kapitell<br />
im Turm des Kastells <strong>von</strong> Bari erweist sich als stilistischer Fremdkörper:Nach<br />
allem, was bekannt war, nimmt Friedrich II erst kurz vor 1240 die gotischen<br />
Formen auf. »Die Daten passen vorzüglich zur Ableitung des Stils aus Deutschland,<br />
aber bisher sind hier keine Vorbilder nachgewiesen worden, welche die<br />
unteritalischen Nachahmungen erklären könnten« ; historische<br />
Ungleichzeitigkeit und archäologische Kopräsenz <strong>von</strong> Archivalien und /<br />
oder Monumenten bilden irreduzible Dissonanzen. Ausführliche Vorarbeiten<br />
und ein Weltkrieg verzögerten die Publikationen des Bandes Die Bauten der<br />
Hohenstaufen in Untentalien? 0 Der Diskurs wird mit romantischem Geschichtsbegehren<br />
(als Funktion eines Mangels) aufgeladen; die wissenschaftliche<br />
Begründung aber gelingt erst in der Mobilisierung und Verschränkung zweier<br />
Disziplinen, der geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Forschung »zur<br />
gemeinsamen Ergründung der einschlägigen Probleme« 31 : monumentale Philologie.<br />
Selbst die geringfügigen Reste, die <strong>von</strong> den Residenzschlössern erhalten<br />
blieben, »vermögen <strong>von</strong> ihrer künstlerischen Bedeutung eine Vorstellung zu<br />
gegeben« : Die (kunst-)histonsche <strong>Im</strong>agination operiert mit der visuellen<br />
Rhetorik des pars pro toto - solange nicht auch noch die Ruinen zu entropischen<br />
Steinmassen verfallen. Ohne mediale Supplementierung aber operiert auch<br />
diese <strong>Im</strong>agination nicht; der Akzent hegt dabei auf Photomaterial, Plänen, Auf-<br />
29<br />
Siehe W. E., Historismus im Verzug. Museale Annke(n)rezeption im britischen Neoklassizismus<br />
(und jenseits), Hagen (Rottmann) 1990, Kapitel »Kontrastanalyse«, zu<br />
den Ruinenphantasien des britischen Architekten Sir John Soane in seinen Crude<br />
Hints towards a History ofmy House (1813)<br />
30<br />
Die Bauten der Hohenstaufen m Unteritalicn, hg. Preußisches Historisches Institut in<br />
Rom, Bd. I (Arthur Haseloff), Leipzig 1920<br />
31<br />
Verlagsanzeige Karl W. Hiersemann, Leipzig, Juli 1920
EDITIONSUNT[-;RNI;HMEN DES DHI 341<br />
rissen und Schnitten: »Sie geben <strong>von</strong> dem erhaltenen Bestand, soweit er ohne<br />
Ausgrabungen zu erkennen war, ein erschöpfendes Bild« . Dem entspricht<br />
auch die wissensarchäologische Darbietung <strong>von</strong> Urkunden im Ergänzungsband<br />
II 32 , denn ihre Bedeutung weist »weit über die Grenzen der<br />
Kunstgeschichte in das Gebiet der Kulturgeschichte hinein«. Um dieser erweiterten<br />
Anforderung gerecht zu werden, bringt die Ausgabe den nahezu vollständigen<br />
Text der Dokumente; »der wortgetreue Abdruck war um so mehr ein<br />
Erfordernis, als es ganz unmöglich wäre, den reichen Inhalt der Dokumente auszugsweise<br />
in eindeutiger, jeden Irrtum ausschließender Form wiederzugeben«<br />
. Das ist wissensarchäologische Diskretion.<br />
Die Finanzkrisen der Nachkriegszeit zwingen das Historische Institut in Rom<br />
zur »Ablösung alles nicht unbedingt notwendigen Beiwerks« 33 - womit die kulturästhetische<br />
Dimension gegenüber den archivischen Daten der Historie als<br />
parergonal diskontinuiert wird. Kehr, der Initiator der historisch-kunsthistorischen<br />
Fusion, muß es im Jahresbericht 1922/23 schreiben: »Unsere kunsthistorischen<br />
Forschungen müssen abgebrochen werden« . Als aber im Mai 1924<br />
das Königreich Italien die Siebenhundertjahrfeier der Universität Neapel begeht,<br />
einer Stiftung des Hohenstaufenkaisers Friedrich II., liegt an seinem Sarkophag<br />
im Dom zu Palermo ein Kranz mit der Inschrift:<br />
SEINEN KAISERN UND HELDEN<br />
DAS GEHEIME DEUTSCHLAND 34<br />
Stefan George hat durch sein Gedicht Die Gräber in Speier einen ersten Anstoß<br />
zur Friedrich-Biographie seines Jüngers Ernst H. Kantorowicz gegeben; der<br />
Anlaß <strong>für</strong> dieses George-Gedicht war seinerseits ein archäologischer Moment, die<br />
Öffnung der Kaiser-Gräber um 1900. 35 Ein Horizont <strong>von</strong> Geistern umschwärmt<br />
die nüchternen Analysen <strong>von</strong> Archiv und Monumenten; der Widerstreit beider<br />
Modi <strong>von</strong> Umgang mit dem Gedächtnis der Vergangenheit bleibt unaufgclöst.<br />
32 Dokumente zur <strong>Geschichte</strong> der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. <strong>von</strong><br />
Anjou. Teil I: Capitanata, bearbeitet <strong>von</strong> Eduard Sthamer, Leipzig 1912<br />
33 QFIAB 17, 2(1914-1924), xv<br />
34 Ernst H. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Berlin (Bondi) 1927, Vorbemerkung<br />
33 Siehe Hartmut Bookmann, »Uns stockt der blick im aufgeschlagnen buche«. Über »Die<br />
graeber in Speier« <strong>von</strong> Stefan George, in: Der Aquädukt 1763-1988. Ein Almanach aus<br />
dem Verlag C. H. Beck, 1988, 356-364
342 ROM ALS SATKI.IJT nr.s DKUTSCI M:N GI DACIITNISSKS<br />
Archäologen und Historiker im Widerstreit<br />
Das Verhältnis <strong>von</strong> Dokument und Monument in der Wahrnehmung <strong>von</strong> Vergangenheit,<br />
ihre alternative Verarbeitung als Historie oder als Wissensarchäologie,<br />
wird aus deutscher Perspektive in Rom institutionell faßbar: in der Stellung<br />
des historischen zum archäologischen Institut. Burchardt entziffert die Gründungsphase<br />
des (zunächst) Preußischen Historischen Instituts Rom in umfassenden<br />
finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen; deshalb<br />
soll sie nicht »isoliert« (monumcntalisch) als Institutions- oder Wissenschaftsgeschichte,<br />
sondern »gleichsam als ein Stück Sozialgcschichtc im weiteren Sinne aufgefaßt<br />
werden« . Womit die narrativ-kontextualisierende<br />
Beschreibung aus diskret-monumentalen Modulen (Archivalien zur Institution)<br />
wieder ein Dokument zur Illustration einer dahinterstehenden (Gesellschafts-)<br />
Historie macht - eine synekdochische Präfiguration im Sinne <strong>von</strong> Hayden Whites<br />
Metahistory. Dementsprechend formuliert sich bei Burchardt (»so exemplifiziert<br />
die <strong>Geschichte</strong> des preußischen historischen Instituts ...«) als Beleg, was alternativ<br />
geschichtsvektoriell wahrnehmbar ist. <strong>Im</strong> Januar 1886 jedenfalls regt Preußens<br />
Gesandter am Vatikan <strong>von</strong> Schlözer die Gründung einer historischen Abteilung<br />
beim deutschen Archäologischen Institut in Rom an; der ihm nahestehende<br />
Konrad Schottmüller, Professor beim Königlich Preußischen Kadettencorps in<br />
Berlin, sucht den Kronprinzen und den Reichskanzler da<strong>für</strong> zu gewinnen<br />
. Schottmüller, später tatsächlich Erster Sekretär der historischen<br />
Station, formuliert in einem Brief aus Rom an Heinrich <strong>von</strong> Sybel und an<br />
den Reichskanzler Otto <strong>von</strong> Bismarck, datiert 26. Februar 1886, in Orientierung<br />
am Modell der französischen Ecole de Rome das Ziel, durch eine solche Fusion<br />
mit italienisch-historischen Forschungen über die reine Erschließung der Vatikanischen<br />
Archive hinausgehen zu können. 1 Sybel in Berlin aber will <strong>von</strong> einem<br />
Reichsinstitut nichts wissen. Da der Versuch, Bismarck da<strong>für</strong> zu gewinnen, scheitert<br />
und auch die Leiter des Archäologischen Instituts aus ihrer grundsätzlichen<br />
Abneigung gegen eine solche Verbindung keinen Hehl machen, »fielen die<br />
Pläne Schottmüllers im Entstehen.« 2 Die Angst vor einer möglichen baldigen<br />
Schließung der gerade erst der Forschung geöffneten Vatikanischen Archive im<br />
Pontifikat des Nachfolgers <strong>von</strong> Leo XIII. drängt Sybel vielmehr zur Konzentration<br />
aller Kräfte auf diesen Fundus. Der Historiker und spätere Leiter des Preußischen<br />
Historischen Instituts in Rom, Alois Schulte, notiert auf sein Exemplar der<br />
<strong>von</strong> ihm mit unterschriebenen Eingabe der Marburger Historiker Georg <strong>von</strong><br />
Deutsches Historisches Institut, Archiv, Alt. Reg. 11, Bl. 20<br />
Paul Kehr, Das Preußische Historische Institut in Rom, in: Internationale Monatsschrift<br />
<strong>für</strong> Wissenschaft Kunst und Technik, November 1913, Sp. 1-42 (4f)
AKCIIÄOI.OCHN UND HISTORIKF.K IM WIDKRSTKKIT 343<br />
Below, Karl Brandi und Goswin <strong>von</strong> der Roppe an den Reichskanzler Graf<br />
Bülow, worin die Umwandlung des an die preußische Archivverwaltung angeschlossenen<br />
römischen Instituts in ein Reichsinstitut verlangt wird: »Die Ausnutzung<br />
des vatikanischen Archivs äußerst dringlich. Verschlußgefahr. Die<br />
Sammlung muß im Vordergrund bleiben.« 3 Noch tobte in Deutschland der »Kulturkampf«;<br />
die Mobilisierung der römischen Archivdaten verfolgte einen strategischen<br />
Zweck.<br />
»Die Verbindung des neuen Historischen Instituts mit dem älteren Archäologischen<br />
hätte damals in der Tat sehr vieles <strong>für</strong> sich gehabt. Die junge Gründung<br />
hatte so <strong>von</strong> Anfang an einen festen I lalt gefunden und <strong>von</strong> der Tradition und der<br />
damals noch großen Autorität des Archäologischen Instituts Nutzen gezogen.<br />
Und dieses wiederum hätte manche ihm vielleicht nützliche Anregung <strong>von</strong> jenem<br />
empfangen. Dennoch können wir Historiker uns nur beglückwünschen, daß<br />
es anders gekommen, und daß dem Historischen Institut die Möglichkeit einer<br />
freien, selbständigen, unabhängigen Entwicklung nach seinen eigenen Bedürfnissen<br />
ermöglicht worden ist.« <br />
Kehrs Begründung ist eher unsubstantiell, deutet aber eine diskursive Selbstreferenz<br />
des historischen gegenüber dem archäologischen Diskurs an (wenngleich<br />
eher disziphnorganisatorisch denn epistemologisch begründet). Keine gegenseitige<br />
Supplementarität, sondern Koexistenz.<br />
Plädoyer <strong>für</strong> ein Historisch-Archäologisches Institut:<br />
Die Platnersche Bibliothek als Scharnier<br />
Noch 1902 verfügt die Bibliothek des PHI in Rom nicht über einen Bestand der<br />
Monumenta Germaniae Historica, wie der damalige Direktor Aloys Schulte in<br />
seinem Schreiben an den preußischen Ministerialdirektor Althoff am 11. April<br />
1902 beklagt. 4 Dies ist nicht die einzige historische Literatur, welche das römische<br />
Archäologen-Institut der historischen Station voraus hat: »Sehr bedauerlich ist<br />
es, daß die Platneriana dem archäologischen Institut angegliedert ist, nicht<br />
unserm, mit dem sie aus sachlichen Gründen verbunden sein müßte« . Bei der Bibhotheca Platneriana handelt es sich um eine Spezialsammlung italienischer<br />
Stadt- und Lokalgeschichten, die der Freiherr Ferdinand <strong>von</strong> Platner<br />
Zitiert aus dem Bonner Nachlaß Schuhes durch: Max Braubach, Aloys Schulte in Rom<br />
(1901-1903). Ein Beitrag zur deutschen Wissenschaftsgeschichte, in: Reformata Reformanda.<br />
Festgabe <strong>für</strong> Hubert Jedin, 2. Teil, Münster (Aschendorff) 1965, 509-557 (517)<br />
Zitiert nach: Hermann Goldbrunner, Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica: Zur<br />
<strong>Geschichte</strong> der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in: Das Deutsche<br />
Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. <strong>von</strong> Reinhard Elze / Arnold Esch,<br />
Tübingen (Niemeyer) 1990, 33-86 (43)
344 ROM ALS SATIÜ.UT UI;S DEUTSCHHN GHDÄCHTNISSKS<br />
1879 dem Archäologischen Institut in Rom anläßlich seines fünfzigjährigen Bestehens<br />
vermacht, wo sie als eigene Bibliothek (bis heute separat) aufgestellt ist. In<br />
der Platneriana war eine ideale Keimzelle <strong>für</strong> eine historische Bibliothek angelegt;<br />
indem sie im Archäologischen Institut jedoch nicht ergänzt wird, verliert sie<br />
an Wert und wird vom wissenschaftlichen Instrument historischer Forschung zu<br />
einem bibliotheksgeschichtlichen, mithin wissensarchäologischen Monument,<br />
dessen Signifikat nicht Historie, sondern ihr Stifter heißt. 5 Die Einlagerung der<br />
Bibliotheca Platneriana bei den Archäologen gibt vielmehr Spekulationen einer<br />
institutionellen Kopplung Raum. <strong>Im</strong> April 1879 war aus Anlaß der Fünfzigjahrfeier<br />
des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts in Rom demselben<br />
durch Baron Ferdinand <strong>von</strong> Platner, Sohn des frühern, durch seine Mitarbeit an<br />
Bunsens Werk über Rom auch wissenschaftlich bekannten sächsischen Geschäftsträgers,<br />
dessen Sammlung <strong>von</strong> Chroniken italienischer Städte übereignet worden,<br />
»nun bestimmt, das Andenken an den <strong>Namen</strong> Platner auch in den Räumen<br />
des Instituts lebendig zu erhalten.« 6 Platner d. J. ergänzt die Bestände danach<br />
noch fortwährend. Der gedruckte Katalog ist zunächst nur alphabetisch geordnet,<br />
dann auch sachlich. Ferdinand Gregorivius als Autor einer <strong>Geschichte</strong> der<br />
Stadt Rom im Mittelalter bemerkt nachträglich, wie sehr dieses Hilfsmittel <strong>für</strong><br />
jeden Historiker aktiviert werden kann; »enthält sie doch eine Menge <strong>von</strong> Specialgeschichten,<br />
die oft nur mit der größten Mühe und an entlegenen Stellen zu<br />
beschaffen oder einzusehen sind, bequem nebeneinander dem Studirenden <br />
zur Hand« . Hier formuliert sich <strong>für</strong> das Medium Bibliothek, was<br />
als musee imaginaire <strong>von</strong> Andre Malraux im Medium Photographie Wissenschaft<br />
regruppieren wird. Unter Verweis auf die Wirksamkeit der römisch-archäologischen<br />
Ecole de France auch <strong>für</strong> junge Historiker fährt der Artikel fort:<br />
»Bei der Uebernahmc der Platncrschen Bibliothek haben sich Stimmen geregt,<br />
welche darauf hinwiesen, daß die Sammlung den Zielen und dem Charakter des<br />
Instituts als eines archäologischen fremd sei . Freilich, <strong>von</strong> specieller Archäologie<br />
ist nicht viel darin zu finden, obwohl auch der Archäolog nicht ganz ohne<br />
Ausbeute bleiben wird. Aber grade die Uebenveisung dieser Sammlung hat andererseits<br />
auch wieder Anlaß gegeben, dem Gedanken nahe zu treten, ob denn das<br />
Institut selber nicht etwa seinen Grundplan soweit ändern bezw. insofern erweitern<br />
sollte, daß eine derartige, den allgemeinen geschichtlichen Studieen auch<br />
des Mittelalters und der Neuzeit dienende Sammlung in ihm eben nicht mehr<br />
Siehe Horst Blanck, Die Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom,<br />
in: Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (Geisteswiss.)<br />
46, Köln/Opladen 1955,20<br />
Carl Benrath (Bonn), Artikel in der Kölmsche Zeitung vom 15. März 1886. Hier<br />
zitiert aus dem Exemplar des Artikels im DHI Rom, Archiv, Registratur, Älterer Teil,<br />
Fasz. Nr. 12, Bl. 7. Zugefügt ist eine handschriftliche Notiz: »Vorschlag zur Erweiterung<br />
des archäologischen Instituts zu Rom in ein historisch-archäologisches«.
ARCHÄOLOGEN UND HISTORIKER IM WIDERSTREIT 345<br />
etwas Fremdes, sondern ein organischer Bestandteil werde. Als das Institut in dem<br />
sehr bescheidenen Umfang eines privaten Unternehmens durch die bekannten<br />
Altertumsfreunde hier gegründet wurde, war es durchaus angezeigt, seine Zwecke<br />
so scharf und wenn man will einseitig zu umgrenzen, wie dies geschehen ist. Grade<br />
infolge dieser Centrahsirung hat das Institut auch späterhin, als ihm ein öffentlicher<br />
Charakter zuerkannt wurde, Hervorragendes geleistet und zur Entwicklung<br />
wissenschaftlichen Studiums des classischen Altertums nicht nur unter Deutschen<br />
beigetragen. Aber schon mehrfach ist <strong>von</strong> Freunden des Instituts die Frage<br />
erörtert worden, ob denn auch heutzutage noch, wo die Verhältnisse ganz anders<br />
stehen, wo <strong>von</strong> der italienischen Regierung überall das Nötige geschieht oder erbeten<br />
werden kann, um Reste des Altertums, sei es aufzudecken, sei es zu schützen,<br />
und wo hinreichende Kräfte im Lande selber vorhanden sind, um das, was zutage<br />
gefördert wird, zu untersuchen und zu verwerten - ob unter diesen ganz anders<br />
gewordenen Verhältnissen das Institut nicht, mit Einem Worte, aus einem<br />
specifisch archäologischen zu einem allgemein historischen Institut gemacht werden<br />
solle. diese Frage nahezulegen, dazu bot gerade die Ueberführung<br />
der Platnerschcn Bibliothek oder vielmehr der hochwichtigen Ergänzungen zu<br />
derselben willkommenen Anlaß.« <br />
Und die Ordnung des Archivs gruppiert diesem Vorschlag einen vorgängigen<br />
Artikel zu. Die Kölnische Volkszekung vom 21. August 1884 berichtet <strong>von</strong> der<br />
neunten Generalversammlung der Görres-Gesellschaft in Freiburg i. Br., wo im<br />
Rahmen der »historischen Section« ein Dr. Gottlob die Gründung einer Handbibliothek<br />
<strong>für</strong> deutsche Historiker am Campo Santo im römischen Vatikan be<strong>für</strong>wortet,<br />
nachdem dort bereits Ansätze dazu (etwa 800 Werke) vorhanden waren.<br />
»Weiterhin be<strong>für</strong>wortete Hr. Dr. Gottlob die Gründung eines >Römischen Archivs<br />
<strong>für</strong> neuere Kirchengcschichte' zur Veröffentlichung <strong>von</strong> Actenstückcn aus römischen<br />
Archiven . <strong>Im</strong> Laufe der sehr lebhaften und interessanten Discussion<br />
entwickelte Professor v. Hertling den Plan der Gründung eines Instituts <strong>für</strong><br />
Geschichtswissenschaft in Rom etwa nach Analogie des römischen archäologischen<br />
Instituts. Besonders nutzbar würde ein solches Institut werden <strong>für</strong> Kirchengeschichte,<br />
also <strong>für</strong> ein Gebiet, auf welchem gegenwärtig ein gewisser Mangel<br />
an geschulten Arbeitern besteht.« <br />
Die Resolution wird angenommen. In diesem Sinne weist auch eine Zeitungsnotiz<br />
im Populo Romano vom 10. Mai 1888 auf die damals denkbare institutionelle<br />
Konjunktion <strong>von</strong> Archäologie und Historie hin, indem der Titel »La stazione storica<br />
di Roma« in der Rubrik Scienze et Lettere unter dem Stichwort Archeologia<br />
storica erscheint. 7 Ein Zeitungsauschnitt vom 11. Mai in der Vossischen Zeitung<br />
schließlich meldet ein Bedürfnis an, Gedächtnis <strong>für</strong> Historie aufzubereiten: »Bei<br />
der großen Fülle des in Rom aufgespeicherten historischen Materials war es<br />
seit vielen Jahren Wunsch der Historiker, dort cm ähnliches Institut <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
errichtet zu sehen, wie es seit längerer Zeit <strong>für</strong> die Archäologie besteht.« Als durch<br />
Archiv DHI Rom, Alt. Registratur, Nr. 11, Bl. 28
346 ROM ALS SATIU.UT DI-;S DI-UTSCHKN GI-DÄCHTNISSKS<br />
Papst Leo XIII die Öffnung des vatikanischen Geheimarchivs erfolgt, beantragt<br />
die Akademie der Wissenschaften beim Kultusministerium folgerichtig zunächst<br />
eine »historische Station in Rom« zu gründen. <strong>Im</strong> Archiv des DHI Rom lagern<br />
heute Kopien der einschlägigen preußischen Kultusministenalakten aus dem ehemaligen<br />
Zentralen Staatsarchiv Merseburg (nach dem Ende der DDR jetzt im<br />
Geheimen Staatsarchiv, Berlin-Dahlem). 8 Demnach riet Schlözer in Rom, Juni<br />
1888, dem dortigen Leiter der Preußische Historischen Station Schottmüller,<br />
sofort die Eifersucht der deutschen, in Rom etablierten Archäologen gegen die<br />
neuen Eindringlinge möglichst zu beseitigen, »damit die Römer nicht etwa die<br />
Genugtuung hätten, deutsche Geschichtsforscher und deutsche Archäologen hier<br />
feindlich gegenüberstehen zu sehen«. 9 Schottmüller verständigt sich daraufhin<br />
mit dem Sekretär des Archäologischen Instituts Petersen. Schlözer hält Berliner<br />
Gerüchte um »Zwistigkeiten« zwischen Schottmüller und den Archäologen<br />
<strong>für</strong> unerklärlich ; diese Zwistigkeit aber sind der institutionelle Effekt<br />
eines epistemischen Widerstreits zwischen Historie und Archäologie als differenten<br />
Methoden der Datenverarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit. Schottmüller schließlich<br />
berichtet nach Berlin, die deutsch-römischen Archäologen begegneten den<br />
Historikern mit Mißtrauen, »als ob es auf eine wenigstens teilweise Depossedierung<br />
des Archäologischen Instituts abgesehen sei« . Tatsächlich geht es um das »Eindringen« des Historischen in die Suprematie<br />
des archäologischen Zugriffs auf Rom; eine Differenz, die nicht auf reine<br />
Raum- und Institutionsfragen reduzierbar, sondern auch als Effekt eines diskursiven<br />
Widerstreit <strong>von</strong> Archäologie und Historie zu lesen ist. Dabei teilen Archäologie<br />
und Historie ein wissensarchäologisches Vorgehen, ob als Ausgrabung im<br />
Gedächtnis des italienischen Bodens oder im Archiv. Schottmüller wird im Vatikanischen<br />
Archiv, obgleich Protestant, freundlich behandelt. In den Worten<br />
Schlözers gilt es <strong>für</strong> den Leiter der historischen Station zunächst nicht primär,<br />
»Dokumente aufzufinden und ans Tageslicht zu schaffen, als vielmehr das Terrain<br />
zu sondieren, Einblick in das jetzige (römische und sonstige italienische) archivalische<br />
Gebiet zu gewinnen und auszukundschaften«, um mit dieser Spurung<br />
<strong>von</strong> Wissen jüngere Historiker m Rom unterweisen zu können .<br />
Close re-reading: Die Eingabe Schottmüllers<br />
Diese Zeilen schrieben sich vom Archiv des DHI Rom aus; sein Sehepunkt<br />
(Chladenius) ist der Bearbeitung inskribiert. Ein Ort, an dem die Registratur<br />
herrscht und wo, ihrer Logistik gemäß, die Kontingenz <strong>von</strong> Historie als Lose-<br />
Rep. 76 V c Sekt. I Tit. XI Teil II Nr. 3, Bd. Iff<br />
Ebd. Nr. 3, I, Bl. 155-159(158)-
ARCHÄOLOGEN UND HISTORIKER IM WIDERSTREIT 347<br />
blattsammlung oder als Aktenbündel evident ist. Kompaktus-Anlage, gleichförmige<br />
Kartons, Nachlässe gleich Urnen in einem Kolumbarium, zwischen<br />
Asche und Druck. Lesen, Forschen und Schreiben im Archiv, in seiner Verlassenheit,<br />
Trockenheit, klinischen Abstinenz, das sind Übungen in Sachen Abgewöhnung<br />
der Historikerhalluzination, ständig Leben hinter den bereits narrativ<br />
aufbereiteten Texten zur Vergangenheit zu imaginieren. Nähern wir uns diesem<br />
Archiv mit archäologischem Blick; was sagt es uns? Archive schweigen. Kontingenzen<br />
im archivischen Raum: Wir treffen auf ein institutionshistorisches<br />
Dokument und lesen es als diskretes, wissensarchäologisches Monument: die<br />
bereits erwähnte Eingabe <strong>von</strong> Konrad Schottmüller betreffs der Erweiterung<br />
des Archäologischen Instituts in Rom in ein historisch-archäologisches vom 26.<br />
Februar 1886. 10 Nähern wir uns dem Objekt in Form eines dose reading, das<br />
diskursive Module und <strong>Namen</strong> als Gedächtnisadressen, nicht Personen liest:<br />
»Das preußische, später vom deutschen Reich übernommene Institut in Rom<br />
wurde seiner Zeit nur <strong>für</strong> Archäologie gegründet<br />
1. weil die Ausbeute <strong>für</strong> diese Wissenschaft in dem damals noch nicht abgesuchten<br />
Terrain eine außerordentlich reiche war und die bis dahin unvollständig<br />
erforschten Alterthümer allgemein zugänglich waren,<br />
2. weil andere hier zu pflegende Wissenschaften, wie speziell die Philologen sich<br />
in ihrem eigenen Interesse unter die Ägide der Archäologie stellen konnten, und<br />
3. weil die Forscher auf anderem, namentlich historischem Gebiet bei der früher<br />
hier üblich gewesenen, hermetischen Abschließung der Archive nicht genügend<br />
geistige Nahrung fanden.« <br />
Es gilt also die Äquivalenz zwischen historischem Diskurs und der Autorität der<br />
Archive. Alles ändert sich mit deren Öffnung - Einbruch der Historie in eine<br />
archäologische Landschaft:<br />
»War dennoch seiner Zeit die ausschließliche Begünstigung der Archäologie eine<br />
naturgemäße, also vollberechtigte gewesen, so hört diese /l//
348 ROM ALS SATKI.I.IT DHS i>i-:uTsair.N GKDACIITNISSKS<br />
Schottmüller den geeigneten Moment, »auch das deutsche Institut zu allgmeinenen<br />
wissenschaftlichen Zwecken zu erweitern«. In erster Linie könne hierbei nach<br />
der Beschaffenheit des Quellenmaterials nur die <strong>Geschichte</strong> in Frage kommen:<br />
Für diese weht hier seit einiger Zeit eine starke tramontana, ein frischer geistiger<br />
Zugwind, der die Benützung der zahlreichen hiesigen Archive, so auch namentlich<br />
des vatikanische Geheimarchivs in liberaler Weise gestattet. Die jungen Historiker,<br />
die nur in der Heimat sich ausbilden, lernen großenteils nur aus den<br />
Collegien ihrer Lehrer, aus gedruckten Büchern und aus den den verhältnißmäßig<br />
spärlichen Originalquellen, welche das Inland ihnen zu bieten vermag. Selbst<br />
Oesterreich, welches als ein auf altem Culturboden errichteter Staat viel reicher an<br />
Urkunden u. Originalquellen ist, hat angesichts der Verhältnisse es <strong>für</strong> nöthig<br />
erachtet, ein eigenes Institut <strong>für</strong> österreichische Geschichtskunde hier zu errichten<br />
und zu dessen Förderung selbst dem bedeutendsten Diplomatiker, Sickhel, <strong>für</strong><br />
längere Zeit hierher kommandiert. Frankreich hat, wie schon erwähnt, drei Historiker<br />
zur Anlernung der jüngeren Kräfte hier angestellt, und nur wie Deutsche stehen<br />
bisher beschämt zurück. Der wohl schon früher unternommenen Versuch,<br />
Euer Durchlaucht auch hierführ zu interessieren, ist, soweit ich es zu beurteilen<br />
vermag, hauptsächlich gescheitert<br />
1. weil die Sache falsch angefaßt war,<br />
2. weil Euer Durchlaucht mit der allzu langsamen Fertigstellung der Monumcnta<br />
Germaniae historica unzufrieden sind, und<br />
3. weil im Allgemeinen Euer Durchlaucht mit den spärlichen, praktisch verwendbaren<br />
Resultaten der heutigen Geschichtsforschung unzufrieden sind, d. h. mit<br />
anderen Worten<br />
Es war<br />
1. die Nothwendigkeit Euer Durchlaucht nicht überzeugend dargethan,<br />
2. Es wurden zu große Geldmittel verlangt und<br />
3. ward die Organisation nicht so klar vorgezeichnet, daß Euer Durchlaucht das<br />
Gewinnen greifbarer Resultate mit Sicherheit voraussetzen konnten.<br />
Alle drei Schwierigkeiten lassen sich mit Leichtigkeit heben. Wie in der diplomatischen<br />
Welt gewisse Kriterien zur Prüfung <strong>von</strong> Aechtheit u. Zuverlässigkeit <strong>von</strong><br />
Aktenstücken verwendet werden, so müssen <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> uns ähnliche<br />
Hilfsmittel zur Hand sein, wie die Diplomatik, Paläographie, Chronologie u.a.m.<br />
Bei dem Mangel an hinreichenden Originalen müssen bei uns gedruckte Hilfsmittel,<br />
(wie die <strong>von</strong> Jaffe, Wattenbach, Ahrcndts u. A. herausgegebene Tafeln) Ersatz<br />
bieten. Wie wenig aber derartige Hilfsmittel imstande sind, die Wirkung <strong>von</strong> Origm
AlU:i lÄOl.OCHN UND H ISTOKI KI-.R IM Wl I )l KSIKI-IT 3 4 9<br />
Denn <strong>Geschichte</strong> ist, wie ihre Erforschung, eine Funktion <strong>von</strong> Strategien. Nicht<br />
anders als jenes Sandkastenspiel stellt sich der Tisch dar, auf dem der Historiker<br />
seine Materialien verschiebt: mapping}^ Mobilisiert werden eben nicht allein<br />
Heere, sondern auch Archiv(text)e, und jene »metrische Stellenordnung und<br />
Lagebestimmung«, mit der Martin Heidegger einmal den »Raum« definierte 12 ,<br />
koppelt den Generalstabstisch an das Atelier des Historikers, der diese Disposition<br />
dann vermittels Narration verzeitlicht - jene Erzählmaschme, die <strong>Geschichte</strong><br />
erst generiert. Der Ersatz da<strong>für</strong>, daß ihm die Autorität fehlt, Befehle ins Reale zu<br />
entlassen, wo Befehl (arche) also nicht mehr anders als in Form des Archivs<br />
adressierbar ist. Was die Hermeneutik einmal Kompilation nannte, ist nach Verlust<br />
der verbindlichen Referenztexte (Bibel, Antike) zur Rekonstruktion der Vergangenheit<br />
als taktisches Planspiel geworden. So disqualifiziert der Feldherr<br />
Erich Ludendorff im Kapitel »Pflicht zum Schreiben« seines Buches Tannenberg.<br />
Geschichtliche Wahrheit über die Schlacht einmal jene militärgeschichtlichen Forschungen,<br />
die aus Texten nichts als ein »totes Mosaik« versammeln, das der Realität<br />
des Feldherrentums nicht nahekomme. Auch Strategie werde als - oft<br />
nachträgliches - »Mit-der-Hand-über-die-Karte-fahren« betrieben (historiographische<br />
Urschrift also), was ebensowenig Feldherrentum sei. 13 Und in noch<br />
einem Punkte kommen sich Kriegs- und Geschichtswissenschaft nahe. Dem<br />
Historiker als Spurensicherer (Carlo Ginzburg) entspricht viel präziser das Spiel<br />
der Kryptographie: <strong>Im</strong> Laufe des Ersten Weltkriegs bildete sich das Entziffern<br />
chiffrierter Funksprüche und Telegramme (Ludendorff meint die russischen) »zu<br />
einer völligen Wissenschaft« aus . So also entsteht Wissen als Technik.<br />
Bleibt die notwendige Differenzierung <strong>von</strong> Strategie und Taktik: Der Petit<br />
Robert zitiert eine Definition <strong>von</strong> 1867: Strategie als die »Art de faire evaluer une<br />
armee sur un theätre d'operations jusqu'au moment oü eile entre en contact avec<br />
l'ennemi«, und Paul Valery: »La tactique ruine la Strategie. La bataille d'ensemble<br />
gagnee sur la carte est perdue en detail sur les coteaux.« 14 Dies ist keine Allegorie,<br />
sondern die Klartextbeschreibung der Praxis historischer Forschung.<br />
Schottmüller schließlich bringt seine Forderung in Position:<br />
»Der 2. u. 3. oben hervorgehobene Uebelstand, die Inanspruchnahme zu großer<br />
Geldmittel und das Fehlen sicheren Erfolges, läßt sich gemeinsam heben, indem,<br />
wenn sich die Bewilligung der Mittel <strong>für</strong> eine Neugründung nicht erreichen Hißt,<br />
zuvörderst die Umwandlung des bestehenden archäologischen Instituts< in eines<br />
<strong>für</strong> >Archäologie u. <strong>Geschichte</strong>« erbeten wird. Würden nun an Stelle des aus-<br />
" Zur Verstrickung <strong>von</strong> Kartographie und Klio siehe Svetlana Alpcrs, Die Kunst als<br />
Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, Köln (Dumont) 1985<br />
12 Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen (15. Aufl.) 1979, 110<br />
13 Nachdruck Deutscher Militär Verlag, Remschcid 1988, 88<br />
14 Petit Robert. Dictionnaire de la languc francaise (Ausgabe Paris 1989)
350 ROM ALS SATHI.UT ni-s DKUTSCMHN GI-'.DÄCHTNISSKS<br />
scheidenden archäologischen Secretairs ein Historiker ernannt, und würden<br />
zunächst nur Stipdendien an Historiker verliehen, so wäre damit zunächst die<br />
finanzielle Seite erledigt. Die Organisation dieser historischen Abthcilung muß<br />
aber, theils um die zu geringe Ausbeute zu vermeiden, welche jetzt die Archäologie<br />
zeitigt, theils auch, um den, bei den correspondircnden Instituten der anderen<br />
Staaten auftretenden Mängeln zu begegnen, ein genau bestimmte sein. Das Arbeitsgebiet<br />
wird auf den Vorschlag des hiesigen Leiters bzw. Secretaires der historischen<br />
Abtheilung <strong>von</strong> einer Commission in Berlin geprüft, genehmigt oder abgeändert,<br />
dem Reichskanzler zur Bestätigung vorgelegt. Die Candidaten, die um ein römisches<br />
Stipendium sich bewerben, haben vor eben dieser Commission ein Examen<br />
abzulegen, das ihre Befähigung, namentlich in Diplomatik, Paläographie u. Chronologie<br />
bekundet, da ohne die nöthige Kenntniß auf diesen Gebieten fruchtbringende<br />
Thätigkeit selbst unmöglich ist. Der Leiter der historischen Abtheilung ist<br />
eines Theils verpflichtet, je nach der Aendcrung der Verhältnisse die größere oder<br />
geringere Zugänglichkeit der einzelnen Archive zu überwachen, u. an die Commission<br />
in Berlin zu melden, um so derselben die Kontrolle der Arbeitsvertbeilung<br />
zu ermöglichen. Sodann aber ist derselbe auch verpflichtet, da bei dem Fehlen<br />
hinreichender Kataloge die Mehrzahl der zum Studium Herkommenden ohne<br />
präzise Anleitung einen Theil der Zeit nutzlos verliert, regelmäßig eine Anleitung<br />
zu geben, und zu dem Zweck in den fünf Wintermonaten wöchentlich zwei Collegien<br />
ä 4 Stunden zu lesen u. zwar<br />
a gewissermaßen eine auf die römische Verhältnisse zugespitze historische Propädeutik<br />
zu geben<br />
b über ein dem Specialstudium entnommenes Thema vorzutragen.« <br />
Wöchentliche gemeinsame Konferenzen und öffentliche Sitzungen »in deutscher<br />
Sprache« (Schottmüllcr) und entsprechende Berichte sollen »der Außenwelt<br />
gegenüber« die Tätigkeit der historischen Abteilung vermitteln . Wenn<br />
es gelänge, die Bewilligung <strong>von</strong> weiteren Stipendien zu erwirken, sei es »im<br />
Interesse der Geschichtsforschung <strong>von</strong> hohem Werth, nicht nur philologischhistorisch<br />
Vorgebildete herzusenden, sondern auch Juristen, resp. solche jungen<br />
Leute, welche sich der diplomatischen Carnere widmen wollen« . Denn<br />
Archivgedächtnis ist an andere Funktionalitäten gebunden denn die Suprematie<br />
des historischen Diskurses.<br />
Das Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom speichert diesem<br />
Dokument gegenüber unter dem Titel »Korrespondenz mit Zentraldirektion<br />
Berlin/Allgemeine Korrespondenz« seine Sicht dieser Dinge. Vom 11. Juni<br />
1888 datiert der Erlaß des Reichskanzlers über die Gründung einer Preußischen<br />
Historischen Station in Rom; am 22. Juni 1888 meldet der Archäologe Conze aus<br />
Rom an das Sekretariat der Zentrale in Berlin, die Nachricht über diese Gründung<br />
sei bisher nur auf nicht-amtlichem Weg zu ihm durchgedrungen. Schottmüller<br />
war im Frühjahr 1888 nach Rom gekommen, um die Station einzurichten;<br />
»ganz im Geiste des Status, in dem ausdrücklich <strong>von</strong> einem guten Einvernehmen<br />
mit den Archäologen, mamentlich in Bezug auf Bibliotheks-Angelegenheiten
ARC1 1ÄOI.OGKN UNI) HlSTOKIKHR IM Wl I) I. KS'l'f< IJT 351<br />
die Rede war« (§ 8 des Statuts <strong>für</strong> die Historische Station in Rom vom 9. April<br />
1888 15 ), dachte er zunächst an eine Vereinigung der Historischen Station mit dem<br />
Archäologischen Institut ; die Station wird also vom<br />
Bibliotheksparadigma her gedacht; Wünsche, die über die übliche Grenze hinausgehen,<br />
sollen an die Zentraldirektion in Berlin weitergeleitet werden. Am 5.<br />
Juli 1888 bittet Conze in seinem Schreiben an das Sekretariat der Berliner Zentraldirektion<br />
respektive der Unterbringung der Bibliothek des Historischen Station<br />
jedoch um Zurückhaltung. Auf den Antrag des Königlichen Preußischen<br />
Historischen Instituts, seine Dienstwohnung im Archäologischen Institut Rom<br />
zu nehmen, antwortet Petersen in seinem Schreiben an die Berliner Zentrale<br />
{brutto copia) am 14. Juli 1890 unter Betonung der Tatsache, daß dieser Zustand<br />
nur ein vorübergehender sein könne. Petersen spricht <strong>von</strong> einer seinem Institut<br />
entstehenden »Belastung mit Dingen, die nicht im Geringsten mit Archäologie<br />
zu tun haben«, und <strong>von</strong> einer »indirekte Schädigung der Institutsinteressen«.<br />
Relationen zwischen DHI und DAI<br />
<strong>Im</strong> Italienbeobachter <strong>von</strong> 1938 beschreibt Armin <strong>von</strong> Gerkan in der Serie »Stätten<br />
Deutscher Kultur-Arbeit in Italien« das Deutsche Archäologische Institut in<br />
Rom als ein immer schon geschichtspolitisiertes; eine solche Aufgabe, die Erforschung<br />
der frühen Langobardenzeit, sei wieder <strong>für</strong> die nächste Zukunft geplant<br />
und genehmigt, teilweise sogar schon in Angriff genommen worden; so zeige sich,<br />
»dass das Deutsche Archäologische Institut in Rom nicht einer >überlebten< Wissenschaft<br />
dient, sondern durch Mitarbeit an der Erforschung der mittelbaren und<br />
unmittelbaren Vorgeschichte unseres Volkes seinen Teil gegenwartsnaher Aufgaben<br />
<strong>für</strong> Volk und Reich erfüllt.« 16 Friedrich Bock, langjähriger Zweiter Sekretär<br />
des DHI Rom, beschreibt dann in derselben Serie das Deutsche Historische Institut<br />
in Erinnerung an jene Komplementantät <strong>von</strong> Archäologie und Historie, die<br />
in der Gründungsphase seines Instituts einmal (erfolglos) angedacht worden war;<br />
»was eine weitere Zusammenarbeit mit der Frühgeschichte, die das Archäologische<br />
Institut jetzt aufgenommen hat , an Erkenntnis über unser Volk bringen<br />
kann, lässt eine solche Zusammenarbeit auf holländischem Boden über die<br />
Franken ahnen.« 17 Sind also die als methodisch vermuteten Differenzen der Disziplinen<br />
Historie und Archäologie nichts als die Masken blanker instituts- und<br />
wissenschaftspolitischcr Strategien? Daß die disziplinäre Abgrenzung <strong>von</strong> Histo-<br />
15 Abdruck im Deutschen Reichsanzeiger vom Mai 1888<br />
16 Jg. II, Nr. 1, 1. Januar 1938, 18ff (20)'<br />
17 Italienbeobachter, Jg. II, Nr. 3, 1. März 1938, 12f (13), unter Verweis auf das Januarheft<br />
derselben Zeitschrift.
352 ROM ALS SATIJ.LIT DI:S IM-UTSCI II;N GKDÄCI ITNISSKS<br />
rie und Archäologie Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht so selbstverständlich<br />
war, wie sie aus der institutionell verhärteten Perspektive heute erscheint, unterstreicht<br />
Walter Friedensburg, um die Jahrhundertwende Leiter der Anstalt, in seiner<br />
Abhandlung Das Königlich Preussiscbe Historische Institut in Rom in den<br />
dreizehn ersten Jahren seines Bestehens 1888-1901. Darin bildet die Diskussion<br />
um eine originäre Fusion <strong>von</strong> DAI und PHI ein Leitmotiv: Noch 1890, aus Anlaß<br />
der Umbenennung der Station in ein Institut - also im Moment eines institutionsgeschichtlichen<br />
Flimmerns - »war nämlich der Gedanke einer Verschmelzung<br />
mit dem archäologischen Institut nicht gänzlich aufgegeben«. 18 Als die Station<br />
1888 gegründet ist, erklärt Bismarck sich zur Stärkung und Sicherung des Instituts<br />
»vielleicht auf dem Wege der Fusion des Flistonschen und Archäologischen<br />
Instituts im Reichsbudget« bereit, weil der römische Gesandte <strong>von</strong> Schlözer auf<br />
die mit reichen Mitteln ausgestatteten römischen Unternehmungen Frankreichs<br />
und Österreichs hingewiesen hat. 19 Angenommen, die Spannungen zwischen dem<br />
DAI und dem jungen DHI in Rom Ende des 19. Jh. und jenseits ließen sich auf<br />
haushaltstechnische Engen reduzieren (und Kchrs Dircktionspohtik spricht<br />
da<strong>für</strong>): dann bleibt immer noch ein damalig offenkundiger Bedarf, diese Machtstrategien<br />
hinter wissenschaftlichen Argumenten maskieren zu müssen. Was die<br />
Auswahl dieser Argumente steuert, erinnert an die noch jungen Abgrenzungsprobleme<br />
zwischen Archäologie und (Kunst-)Histone - eine Trennung, die noch<br />
nicht so selbstverständlich war, daß ihre Genese vergessen ist.<br />
In Diskursen sprechen sich Institutionen. Ihre Interessen geben die Ränder<br />
der Sprachen an, die aufeinandertreffen, wenn Historie und Archäologie sich<br />
begegnen. Prominent figuriert hier das Verhältnis <strong>von</strong> DHI und DAI. Es soll<br />
nicht nur nachgefragt werden, ob es sich denn im Verhältnis <strong>von</strong> Archäologen<br />
und Historikern im 19. Jahrhundert nicht vielmehr um einen Widerstreit handelt.<br />
Vielmehr soll das Studium auch dann bestehen, der Versuchung zu widerstehen,<br />
die Frage ihrerseits historisch anzugehen und damit vorweg schon den<br />
einen wider den anderen Diskurs zu pnvilcgicren. Den Befund, jenes düster,<br />
<strong>von</strong> der Umklammerung des historischen Diskurses versuchsweise zu befreien<br />
und einer archäologischen Beschreibung zugänglich zu machen, muß die narrative<br />
Organisation der vorliegenden Publikationen (Gelehrtenbiographien u.a.)<br />
aufgelöst und in den Zustand unbearbeiteter Urkunden zurückgruppiert<br />
werden. Ferdinand Gregorovius etwa transformiert sein Quellen-, also sein<br />
archäologisches Material in eine Erzählung, übersetzt damit den Befund in den<br />
ls Aus dem Anhang zu den Abhandlungen der König). Preuss. Akademie der Wissenschaften<br />
vom Jahre 1903, Berlin (Verlag der Königl. AdW in Commission bei Georg<br />
Reimer) 1903 (Abh. d. Prcuß. Akad. d. W. Berlin, Philos.-Hist. Klasse 1903), 45<br />
19 Vermerke Bismarcks zu einem Schreiben des preuß. Kult. Min. v. 30. Sept. 1884 u. c.<br />
Bericht Schlözers v. 24. Aug. 1888, Pol. Arch. d. Aus. A. Abt. lüb Nr. 500
ARCHÄOLOGEN UNI) HISTORIKER IM WIDERSTREIT 353<br />
historischen Diskurs; innerhalb dessen bewegt sich der heute Gregonvius-Interpret<br />
ebenfalls. Doch der Rand dieses Diskurses ist (wieder) erreicht. Es geht<br />
nämlich auch darum, anhand <strong>von</strong> Historiker-Äußerungen über Archäologen<br />
(in und anhand <strong>von</strong> Rom: in jedem Sinne »topisch«) die Struktur einer Abwehrbewegung<br />
herauszuarbeiten, welche die methodische Infragestellung <strong>von</strong><br />
Historie durch Archäologie berührt. Dies zunächst dennoch selbst als historische<br />
Rekonstruktion zu betreiben, ist kein performativer Widerspruch. Denn<br />
nicht vom disziplinären Außen der Geschichtstheorie ist der historische Diskurs<br />
zu erschüttern; nur mitten im Zentrum seines Selbstverständnisses, am Ort<br />
seiner Praxis und seines klassischen Gegenstandsbereichs ist er zu fassen. Ulrich<br />
<strong>von</strong> Wilamowitz-Moellendorff, Mitglied der Zentraldirektion des Deutschen<br />
Archäologischen Instituts Berlin, schreibt in seinen Erinnerungen 1848-1914<br />
(Leipzig 1928) unter Anspielung auf die Platneriana des römischen DAI <strong>von</strong><br />
der Einsicht in Geistes- als diskursstrategischer Institutionsgeschichte:<br />
»<strong>Im</strong>mer mehr ist mir klar geworden, daß das Heil der Altertumsstudien daran<br />
hangt, wie das Institut geführt und ausgebaut wird. Da es ein Jahrzehnt preußisch<br />
gewesen, dann bald, 1871, in der ersten Freude auf das Reich übergegangen war,<br />
während sonst die Kulturaufgaben den Einzelstaaten überlassen blieben, ergab sich<br />
ein gewisser Streit der Ressorts. Das preußische Kultusministerium sah scheel auf<br />
die Reichsanstalt, Althoff zumal, der mit Michaelis <strong>von</strong> Straßburg her in Feindschaft<br />
lebte und daher auch die Archäologie an den Universitäten unbillig zurücksetzte.<br />
Die Gründung eines preußischen historischen Institutes war ein wenig<br />
freundlicher Akt, und es regte sich Begehrlichkeit nach unserer Bibliothek, deren<br />
Reichtum an italienischer Lokalhteratur die Historiker reizen konnte. Das Reich<br />
zeigte wenig Interesse.« <br />
Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Auslandsinstitute nach Ende des<br />
Ersten Weltkriegs war prekär. 20 Theodor Wiegand vom DAI weilte 1921 zu<br />
Gesprächen in Rom. 21 Nach dem Ersten Weltkrieg bestand sehr real die Gefahr<br />
einer Konfiskation der deutschen Institute <strong>von</strong> Seiten des italienischen Staaten.<br />
Die daraus resultierende ollenc Systemlage ermöglichte Gedanken neuer Institutsmischungen.<br />
Kehr pointierte in seinen Memoranden das römische DAI,<br />
nachdem er in der Vorkriegszeit selbst das kunsthistonsche Institut ans DHI zu<br />
ziehen und die kunsthistorischen Bestände des DAI zu erwerben getrachtet<br />
hatte. Nach dem Krieg sieht <strong>für</strong> Kehr, der in Rom als Gutachter in Sachen DAI<br />
<strong>für</strong> das Kultusministerium in Berlin weilte, die Vision so aus:<br />
20 Arnold Esch, Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien nach dem<br />
Ersten Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation. Paul Kehrs »Römische<br />
Mission« 1919/1920, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und<br />
Bibliotheken 72 (1992), 314-373. Siehe die entsprechenden Memoranden Kehrs im<br />
Archiv des DHI Rom, Registratur, Älterer Teil, bes. Fase. 91<br />
21 Esch 1992: 323; siehe C. Watzinger, Theodor Wiegand, München 1944, 358f
354 ROM ALS SATKI.UT DI:S DKUTSCIIKN GI;DÄCHTNISSKS<br />
»Wären endlich die Archäologen zu bewegen, <strong>von</strong> der einsamen Höhe des Tarpeischen<br />
Felsens herabzusteigen und mit den andern gewöhnlichen Menschen<br />
gemeinsam zu arbeiten, so ließe sich in Rom in der Verbindung <strong>von</strong> Archäologie,<br />
<strong>Geschichte</strong> und Kunstgeschichte ein Zentrum schaffen, das der großen Vergangenheit<br />
der ewigen Stadt und unserer eigenen Wissenschaft würdiger wäre als die<br />
wissenschaftliche Kleinstaaterei, die sich in der Schaffung <strong>von</strong>einander unabhängiger<br />
, isolierter, und darum auf die Dauer impotenter Institute erschöpft.« 22<br />
Kehr beklagt (als Differenz zu Gesamtinstituten anderer Nationen) die deutschwissenschaftliche<br />
»Zersplitterung in eine Mehrheit <strong>von</strong> Instituten«. 23 Statt »das<br />
sinkende Archäologische Institut« nach dem Muster des französischen durch die<br />
Angliederung des neuen historischen Instituts zu stärken, sei das Gewicht der<br />
deutschen Wissenschaft in Rom durch die Gründung eines neuen Instituts, eben<br />
des Historischen, »weiter zersplittert und geschwächt« worden, und »daran ist<br />
der enge Ressortstandpunkt schuld, an dem die deutsche Wissenschaft krankt,<br />
die in strenger Trennung der Disziplinen und in Spezialistentum sich bestätigt.«<br />
In Deutschland gelte zwar das umschlingende Band universitärer Fakultäten,<br />
doch in Rom blieben »unsere Institute ohne jeder Verbindung miteinander,<br />
durchaus isoliert und auf sich selbst angewiesen«, die ein vollständiges<br />
»Sonderleben« führten. 24 Von Christian Hülsen, dem langjährigen 2. Sekretär des<br />
DAI, werden die Nachkriegspläne Kehrs, in Rom die deutsche Archäologie und<br />
(Kunst-)Historie institutionell zusammenzulegen (also der alte Plan des preußischen<br />
Kultusministeriums unter der Federführung Althoffs), zurückgewiesen.<br />
Kehr persönlich arbeitet unterdessen - über disziplinäre Grenzen hinweg - erfolgreich<br />
mit einem italienischen Archäologen zusammen, Rudolfo Lanciani, dem<br />
Topographen des antiken Rom. Vielleicht wird Wissenschafts diskursiv getrieben;<br />
faßbar aber ist sie, als Gedächtnis, nur noch instititionsarchäologisch, in<br />
einer Logik, die Differenzen setzt.<br />
22 Kehr, zitiert in: Esch 1992, 325f. Stellungnahme Kehrs zur Organisation des Archäologischen<br />
Instituts v. 11. Januar 1908 (Archiv DHI Rom, Reg. 7, f.35r.); dazu auch<br />
Goldbrunncr 1990: 55. Vgl. Archiv DHI Rom, Registratur, Älterer Teil, fasc. Nr. 7,<br />
Bl. 31 ff: In der Stellungnahme Kehrs betr. des Antrags der Berliner Akademie der<br />
Künste auf Errichtung eines kunsthistorischen Instituts in Rom (mit u. a. archäologischer<br />
Begründung) an den Reichskanzler Fürst Bernhard <strong>von</strong> Bülow v. 6. November<br />
1907 spricht Kehr nicht nur <strong>von</strong> einem »Super-Institut«, sondern bedient sich dergleichen<br />
Wendung eins Herabsteigens der deutschen Archäologen vom Tarpejischen<br />
Felsen (dem Sitz des DAI).<br />
23 Esch 1992: 326, Anm. 35 (undatierter Entwurf Kehr)<br />
24 Ebd.; Anm. 36. Esch 1992: 327: »Bis hierher gestrichen«
ARCHÄOLOGEN UND HISTORIKER IM WIDERSTREIT 355<br />
Korrespondenz, Information und die doppelte Nationalisierung Roms (1870/71)<br />
Ein Brief aus Rom zur Diskussion der Neubaukosten des Deutschen Archäologischen<br />
Instituts in Rom weist darauf hin, daß das Haus nach dem Ersten<br />
Weltkrieg auf seinen Bibhothekswert reduziert wurde; Italien hatte fortan Ausgrabungen<br />
durch Fremdnationen untersagt. 23 Aus Archäologie als internationalem<br />
Diskurs in Rom (zu Anfang des 19. Jahrhunderts, als die päpstliche<br />
Regierung dieser jungen, scheinbar unpolitischen Disziplin ohne jeden Nationalismus<br />
gegenüberstand und nicht die geringsten Bedenken hatte, Ausländern<br />
Ausgrabungen zu gestatten) wird ihre partikuläre ideologische Aufladung<br />
durch den (national-)histonschen Diskurs:<br />
»Die italienische Archäologie hat unterdessen eine Anzahl Gelehrter herangebildet,<br />
die <strong>von</strong> der nationalen Begeisterung <strong>für</strong> die glorreiche Vergangenheit getrieben,<br />
wissenschaftlich den ausländischen durch die genannten staatlichen<br />
Bestimmungen sogar überlegen sind. Zudem hat der Fascismus , der ja<br />
neurömischer Romantizismus ist und ganz in altrömischen Ueberlieferungen lebt,<br />
die Gründung eines grossen italienischen archäologischen Instituts geplant.«<br />
<br />
Am 12. Januar 1929 berichtet derselbe Autor, ehemals Historiker am deutschen<br />
historischen Institut in Rom, <strong>von</strong> einem Vortrag des römischen DAI-Direktors<br />
Curtius vor Journalisten über die internationale Bedeutung der Archäologie,<br />
die »auf dem Boden der Menschlichkeit und Wissenschaft die durch den Krieg<br />
zenssenen Verbindungen zwischen den einzelnen Völkern« wiederherstelle.<br />
Doch anstelle solch humanistischer Begründungen stand beim Gründungsakt<br />
des Instituts die Pragmatik der Übertragungsmedien im Vordergrund; Curtius<br />
übersieht absichtlich oder unabsichtlich, daß die Verhältnisse einhundert Jahre<br />
zuvor gänzlich anders lagen: »Damals fehlten die Eisenbahnen . Ein Korrespondenz-Institut,<br />
das Anfragen beantwortete, war damals tatsächlich am<br />
Platze« . Moderne Medien des archäologischen Nachrichtenverkehrs<br />
aber überholen die stationäre Funktion dieser Korrespondenzinstitution; der<br />
Akzent auf Datenübertragung, einst ihre arche, verlagert sich zugunsten der<br />
archäologischen Datenspeicherung. In Form einer archäo-bibhographischen<br />
CD-ROM im Programm Diabola stellt das Institut heute seinen Bibliotheksspeicher<br />
aus.<br />
Das später rein deutsche archäologische Institut in Rom ist zwar auch als<br />
historische Entwicklung, präziser aber als Serie administrativer Transformationen,<br />
genealogisch also, zu beschreiben. Gegründet 1829 <strong>von</strong> Deutschen, Fran-<br />
Nachlaß Philip Hiltcbrandt im Deutschen Historischen Institut Rom, Archiv, Nr. 105,<br />
Bl. 5 (Brief v. 22. Dezember 1928)
356 ROM ALS SATHIJ.IT ni-:s DHUTSCHF.N GKDÄCHTNISSI-S<br />
zosen, Italienern u. a. als Knotenpunkt eines internationalen Nachnchtennetzes<br />
über Altertümer in der Tradition humanistisch-antiquarischer, europaweiter<br />
Korrespondenzsysteme, als Istituto di corrispondenza archeologica, wird es<br />
seit 1858 vom preußischen Staat allein finanziert und 1874 als Kaiserlich Deutsches<br />
Archäologisches Institut dem Deutschen Reich unterstellt. Ein Bericht<br />
Henzens an die Zentraldirektion vom 1. Oktober 1856 benennt die Situation<br />
nach dem Tod des ersten Sekretärs, Braun:<br />
»Der Hauptzweck des Instituts, nach welchem es sich benennt, ist die archäologische<br />
Korrespondenz, und in Bezug auf diese muß leider zugegeben werden, daß sie<br />
seit den letzten acht Jahren an Ausdehnung sehr abgenommen hat. Die Ursache<br />
da<strong>von</strong> ist in Italien größtenteils in den Verhältnissen zu suchen. dazu kommt<br />
ferner die seit 1848 eingetretene politische Zerrüttung, in der mehr und mehr das<br />
Interesse sich <strong>von</strong> den Studien ab- und der Politik zugewendet hat . Ferner ist<br />
die Konkurrenz der in Neapel und anderswo erscheinenden archäologischen Zeitschriften<br />
in Anschlag zu bringen . Endlich darf nicht verschwiegen werden,<br />
daß auch die Umwandlung des Formats unsrer Publikationen in dieser Flinsicht<br />
einen nachteiligen Einfluß geübt hat.« 26<br />
In einer Institution, die sich als Knotenpunkt <strong>von</strong> archäologischer Nachrichtenkorrespondenz<br />
begründet, bestimmen die Formate der Informationsübertragung<br />
deren Stellenwert mit. Das Archäologische Institut leistet in einer Zeit,<br />
als Reisen kostspielig war, Auskunftsdienste; der Zusammenhang <strong>von</strong> Verkehr<br />
und Korrespondenzsystemem - also Diskurs im medialen Sinn - ist offenbar.<br />
Für Rom-Reisende bietet die Bibliothek des DAI einen Stützpunkt. In der Lage<br />
des Instituts tritt eine Wandlung ein, als die Italiener des Risorgimento 1870/71<br />
ins päpstliche Rom einziehen und der römische Mythos, die romanita ideologisch<br />
eine Triebfeder wird. Sehen wir <strong>für</strong> einen Moment ab <strong>von</strong> den umfassenden<br />
Veröffentlichungen zur <strong>Geschichte</strong> des DAI aus Anlaß seines 150)ähngen<br />
Bestehens und wählen vielmehr die Perspektive eines ehemaligen Mitarbeiters<br />
des Preußischen Historischen Instituts, dessen Nachlaß das Archiv des römischen<br />
Instituts und darunter in Akte Nr. 3 ein Kapitel über Die wissenschaftlichen<br />
Institute birgt; demnach konnten die Archäologen der neugeborenen<br />
italienischen Nation <strong>von</strong> Anfang an »nicht recht verwinden, dass die teutonische'<br />
Archäologie in der Erforschung der römischen Vergangenheit, die erste<br />
Stelle einnahm und - <strong>von</strong> Niebuhr an - manche Legende zerstörte, und dass das<br />
Germanentum ausgerechnet aul dem >1 leiligen 1 lügel< des Kapitols sein Instituts-Gebäude<br />
errichtete«. So habe das archäologische Institut in politischer<br />
Hinsicht eher schädlich als nützlich gewirkt . Die Segmentierung der<br />
Vergangenheit ist eine Funktion der Mobilisierung ihrer Archive als Historie.<br />
Die Energie dazu speist sich aus einer radikalen Gegenwart, der Geburt der<br />
26 Aus dem Entwurf im römischen Archiv zitiert <strong>von</strong> Kolbe 1984: 382
ARCHÄOLOGEN UND HISTORIKER IM WIDERSTREIT 357<br />
modernen italienischen Nation. Hatte die Archäologie Italiens lange im Schatten<br />
der Entdeckungen Griechenlands und des Orients gestanden, trat sie »dank<br />
den aufrüttelnden Kräften des gegenwärtigen Italiens in eine neue glänzende<br />
Epoche«. 27 Prähistorie, Etruskische Forschung, Römische Kunst und Spätantike<br />
bezeichnen seitdem die großen Felder archäologischer Erinnerung im<br />
nationalen Rahmen Italiens. Rom aber transformiert auch aus deutsch-archäologischer<br />
Sicht zu einem Satelliten des Reiches; Theodor Mommsen schreibt aus<br />
Berlin am 13. Oktober 1871 an Henzen betreffs des deutschen archäologischen<br />
Instituts in Rom, keine preußische Anstalt werde sich auf die Länge den Beziehungen<br />
zum Reich entziehen können, und »es wäre reiner Formalismus, wenn<br />
wir uns weigern wollten, die Berichte über das Institut in Zukunft dem Reichskanzler<br />
zu erstatten und so weiter. Mehr hängt ja nicht daran«. 28 Die französische<br />
Perspektive der <strong>Geschichte</strong> des ÜAI in Rom nimmt die reichsorticntierte<br />
Neuprogrammierung des Instituts aufmerksam wahr:<br />
»L'annee 1870 modifiait la facc de l'Europc et ccllc de la Villc Eterncllc; et aussi<br />
pour les archeologues, les conditions du travail. une ordonnance impenale<br />
datee de Versailles , transformait l'Institut de Correspondance<br />
Archeologique de Prusse en un etablissement national . Theoretiquement, et<br />
bien que l'usage de la langue allemande demeurät encore exclus des sciences publiques,<br />
le caractere international de cet Institute etait desormais efface.« 29<br />
Am 1. Januar 1885 erscheint in der Kölnischen Zeitung ein vom Althistoriker<br />
Wilhelm Ihne verfaßter Artikel über das archäologische Institut. Ihne hatte bei<br />
seinem Besuch in Rom festgestellt, daß dort die italienische, französische und<br />
lateinische Sprache, nicht aber Deutsch zugelassen war; ihm scheint die Zeit<br />
gekommen, diesen Brauch zu ändern. Nachdem Fürst Bismarck die deutsche<br />
Sprache in den diplomatischen Verkehr eingeführt hat, »dürfte doch auch wohl<br />
die deutsche Wissenschaft sich nicht scheuen, dem Auslande gegenüber ihre<br />
eigne Sprache zu reden.« 30 Um 1900 beweist der Konflikt zwischen deutschen<br />
und italienischen Archäologen um die Ausgrabung und Zusammensetzung der<br />
17<br />
Gerhard Rodenwaldt, Archäologisches Institut des Deutschen Reiches 1829-1929,<br />
Berlin (de Gruyter) 1929, 49<br />
2X<br />
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Haus 1 (Unter den Linden), Handschriftenabteilung,<br />
Nachlaß Lothar Wickert, Karton 39, fasc. 742 »DAL, Bl. 12.<br />
Wickerts Exzerpt stammt - wie sein Verweis »(St. B. Bin)« es indiziert - aus demselben<br />
Speicher, der nun seinen eigenen Nachlaß lagert: Autoreferenz der Vergangenheit<br />
als Archiv.<br />
" y Emile Male, L'histoirc de Poeuvre de l'Ecole Francaise de Rome, Paris (Boccard) 1931,<br />
11, hier zitiert nach: Deutsches Archäologisches Institut Rom, Archiv, Karton I<br />
»<strong>Geschichte</strong> des Instituts«, Bl. 84<br />
30<br />
Zitiert nach: Lothar Wickert, Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Archäologischen<br />
Instituts 1879 bis 1929, Mainz (Zabern) 1979, 27
358 ROM ALS SATKI.I.IT DI:S DKUTSCI II:N GLDÄCI ITNISSLS<br />
Ära Pacis, des Augustus-Altars in Rom, daß es einen archäologischen Nullpunkt<br />
<strong>von</strong> Hermeneutik nicht gibt. Archäologische Datenverarbeitung steht<br />
immer schon an der Schnittstelle zum Symbolischen des nationalen Diskurses;<br />
die Heftigkeit der Reaktion auf die Germanisierung des römischen Instituts ist<br />
unter diesem Blickwinkel zu verstehen. »Offene Feindschaft aber war die Folge,<br />
wenn deutsche Gelehrsamkeit die Deutung <strong>von</strong> Funden, welche <strong>von</strong> den Italienern<br />
in den Rang <strong>von</strong> Nationalhcihgtümern erhoben wurden, anzuzweifeln<br />
wagte« . Als gegen Ende des Jahrhunderts (1898/99) auf<br />
dem römischen Forum Monumente wie der lapis niger, das Romulusgrab und<br />
die älteste lateinische Steininschnft freigelegt werden, auf welche sich Mitteilungen<br />
antiker Antiquare und Historiker beziehen ließen, glaubten gelehrte<br />
italienische Patrioten, daß damit die Ergebnisse der modernen kritischen Geschichtsforschung,<br />
besonders der deutschen, ganz oder teilweise widerlegt seien<br />
- eine Debatte, die sich strukturell in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts mit<br />
dem Fund des Lapis Satricanus wiederholte, der den <strong>von</strong> der philologischen<br />
Hyperkritik <strong>für</strong> fiktiv gehaltenen ersten (Mit-)Konsuln des republikanischen<br />
Rom, Publius Valerius Poblicola, namentlich zu dokumentieren scheint. 31<br />
31 Siehe W. E., Archaeology as a provocation to history, in: Catherine M. Gilliver / ders.<br />
/ Fncdcmann Scriba (Flg.), Archaeology - kleology - Mcthod. Inter-Academy Seminar<br />
on Current Archaeological Research 1993, Rom (Canadian Academic Centre in<br />
Italy) 1996, 19-39
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT '• 359<br />
Archäologie und Historie im Widerstreit<br />
Was uns heute in Rom vor Augen liegt, hat kaum mehr mit dem zu tun, was die<br />
Archäologie dort bis circa 1870 beschrieb und betrieb. Nicht allein die realen<br />
Ruinen Roms aber bestimmen dessen Diskurs, sondern der Blick auf sie, und<br />
das, waran sie in den Augen der Betrachter erinnern - im Kontext einer historischen<br />
Lektüre also, die damit zur Allegorie ihrer Unlesbarkeit wird. Sind Ruinen<br />
das, was sich der Erzählbarkeit entzieht? Gibt es einen ruinösen Schreibstil,<br />
ihnen angemessen zu begegnen, einen broken talk} x Ist Roms imperiales Gedächtnis<br />
ein »museum of ruined intentions«? An welche andere Erzählung erinnern<br />
Piranesis traumarchäologische Räume Roms?<br />
Der wissensarchäologische Blick<br />
(die Kopplung <strong>von</strong> Monument, Archiv und Archäologie)<br />
Erst als diskursive Verhandlung, als histonographische Aktivierung eines<br />
Gedächtnisses findet <strong>Geschichte</strong> statt. Der Rest (Bibliotheken, Archive, Depots,<br />
Inventare) sind Speicher und die Agenturen ihrer wissensarchäologischen Verarbeitung:<br />
Büchermagazine wie das des Deutschen Historischen Instituts und des<br />
Deutschen Archäologischen Instituts in Rom sowie die Festplatten angeschlossener<br />
Computer. Der Brite D. P. Dymond (Universität Cambridge) war Historiker,<br />
bevor er (aus Zufall, wie er schreibt) Archäologe wurde. Dymond hat sein<br />
Buch Archaeology & History mit einem beschwörenden Untertitel versehen: A<br />
plea for reconciliation. Die Graphik des Titels sucht es plastisch zu machen:<br />
Schnittpunkt beider Diskurse ist ein Knoten (»&«). Ein solches Plädoyer <strong>für</strong> die<br />
Versöhnung beider Disziplinen sagt nichts anderes, als daß da etwas im Streit<br />
liegt. Die Verführung läge nun dann, in die Falle der Dichotomie zu tappen, die<br />
als rhetorische Inszenierung in der Fragestellung angelegt ist. Die Differenz <strong>von</strong><br />
Historie und Archäologie ist nicht nur disziphn- und mstitutionengeschichthch<br />
unter diesen <strong>Namen</strong> benennbar; vielmehr läuft der damit angedeutete Widerstreit<br />
quer durch Archäologie und Historie selbst und ist <strong>von</strong> der Art, wie ihn Jean-<br />
Fran^ois Lyotard beschreibt: <strong>Im</strong> Unterschied zum gerichtlichen Prozeß ist ein<br />
Widerstreit ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der mangels<br />
einer auf die Argumentationen der beiden anwendbaren Urteilsregel nicht angemessen<br />
geschlichtet werden kann. 2 Vormals war Archäologie (wie die Numismatik)<br />
schlicht eine Zulieferung der Historiographie gewesen; »mais, ä present,<br />
1 Siehe Norbert W. Bolz / Willem van Rcjcn (H».), Ruinen des Denkens / Denken in<br />
Ruinen, I'Yankfurt/M. (Suhrkamp) 1996<br />
2 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, München (I-'ink) 1987
358 • ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
Ära Pacis, des Augustus-Altars in Rom, daß es einen archäologischen Nullpunkt<br />
<strong>von</strong> Hermeneutik nicht gibt. Archäologische Datenverarbeitung steht<br />
immer schon an der Schnittstelle zum Symbolischen des nationalen Diskurses;<br />
die Heftigkeit der Reaktion auf die Germanisierung des römischen Instituts ist<br />
unter diesem Blickwinkel zu verstehen. »Offene Feindschaft aber war die Folge,<br />
wenn deutsche Gelehrsamkeit die Deutung <strong>von</strong> Funden, welche <strong>von</strong> den Italienern<br />
in den Rang <strong>von</strong> Nationalheiligtümern erhoben wurden, anzuzweifeln<br />
wagte« . Als gegen Ende des Jahrhunderts (1898/99) auf<br />
dem römischen Forum Monumente wie der lapis niger, das Romulusgrab und<br />
die älteste lateinische Steininschrift freigelegt werden, auf welche sich Mitteilungen<br />
antiker Antiquare und Historiker beziehen ließen, glaubten gelehrte<br />
italienische Patrioten, daß damit die Ergebnisse der modernen kritischen Geschichtsforschung,<br />
besonders der deutschen, ganz oder teilweise widerlegt seien<br />
- eine Debatte, die sich strukturell in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts mit<br />
dem Fund des Lapis Satricanus wiederholte, der den <strong>von</strong> der philologischen<br />
Hyperkritik <strong>für</strong> fiktiv gehaltenen ersten (Mit-)Konsuln des republikanischen<br />
Rom, Publius Valerius Poblicola, namentlich zu dokumentieren scheint. 31<br />
31 Siehe W. E., Archaeology as a provocation to history, in: Catherine M. Gilliver / ders.<br />
/ Friedemann Scriba (Hg.), Archaeology - Ideology - Method. Inter-Academy Seminar<br />
on Current Archaeological Research 1993, Rom (Canadian Academic Centre in<br />
Italy) 1996, 19-39
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 359<br />
Archäologie und Historie im Widerstreit<br />
Was uns heute in Rom vor Augen liegt, hat kaum mehr mit dem zu tun, was die<br />
Archäologie dort bis circa 1870 beschrieb und betrieb. Nicht allein die realen<br />
Ruinen Roms aber bestimmen dessen Diskurs, sondern der Blick auf sie, und<br />
das, waran sie in den Augen der Betrachter erinnern - im Kontext einer historischen<br />
Lektüre also, die damit zur Allegorie ihrer Unlesbarkeit wird. Sind Ruinen<br />
das, was sich der Erzählbarkeit entzieht? Gibt es einen ruinösen Schreibstil,<br />
ihnen angemessen zu begegnen, einen broken talk} 1 Ist Roms imperiales Gedächtnis<br />
ein »museum of ruined intentions«? An welche andere Erzählung erinnern<br />
Piranesis traumarchäologische Räume Roms?<br />
Der wissensarchäologische Blick<br />
(die Kopplung <strong>von</strong> Monument, Archiv und Archäologie)<br />
Erst als diskursive Verhandlung, als historiographische Aktivierung eines<br />
Gedächtnisses findet <strong>Geschichte</strong> statt. Der Rest (Bibliotheken, Archive, Depots,<br />
Inventare) sind Speicher und die Agenturen ihrer wissensarchäologischen Verarbeitung:<br />
Büchermagazine wie das des Deutschen Historischen Instituts und des<br />
Deutschen Archäologischen Instituts in Rom sowie die Festplatten angeschlossener<br />
Computer. Der Brite D. P. Dymond (Universität Cambridge) war Historiker,<br />
bevor er (aus Zufall, wie er schreibt) Archäologe wurde. Dymond hat sein<br />
Buch Archaeology & History mit einem beschwörenden Untertitel versehen: A<br />
plea for reconciliation. Die Graphik des Titels sucht es plastisch zu machen:<br />
Schnittpunkt beider Diskurse ist ein Knoten (»&«). Ein solches Plädoyer <strong>für</strong> die<br />
Versöhnung beider Disziplinen sagt nichts anderes, als daß da etwas im Streit<br />
liegt. Die Verführung läge nun darin, in die Falle der Dichotomie zu tappen, die<br />
als rhetorische Inszenierung in der Fragestellung angelegt ist. Die Differenz <strong>von</strong><br />
Historie und Archäologie ist nicht nur disziplin- und institutionengeschichtlich<br />
unter diesen <strong>Namen</strong> benennbar; vielmehr läuft der damit angedeutete Widerstreit<br />
quer durch Archäologie und Historie selbst und ist <strong>von</strong> der Art, wie ihn Jean-<br />
Francois Lyotard beschreibt: <strong>Im</strong> Unterschied zum gerichtlichen Prozeß ist ein<br />
Widerstreit ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der mangels<br />
einer auf die Argumentationen der beiden anwendbaren Urteilsregel nicht angemessen<br />
geschlichtet werden kann. 2 Vormals war Archäologie (wie die Numismatik)<br />
schlicht eine Zulieferung der Historiographie gewesen; »mais, ä present,<br />
1 Siehe Norbert W. Bolz / Willem van Rejen (Hg.), Ruinen des Denkens / Denken in<br />
Ruinen, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1996<br />
2 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit, München (Fink) 1987
360 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
les roles sont intervertis; les historiens ne sont plus que les guides secondaires et<br />
les auxiliaires des piocheurs.« 3 Es gibt einen archäologischen Anteil in der Historie<br />
selbst, und die <strong>Namen</strong> da<strong>für</strong>, nämlich Quellen und Archive als Fundamente<br />
der <strong>Geschichte</strong>, deuten semantisch nicht nur ihr archäologisches Element an, sondern<br />
implizieren (wie alle Oppositionsbildungen) auch gleich eine Hierarchisierung.<br />
»La science appelee l'archeologie et ses differentes branches peuvent<br />
sembler des Supplements ou des appendices de l'histoire; mais ils n'ent sont pas<br />
les preliminaires.« 4 Für eine Historiographie, die auf diesen Fundamenten baut,<br />
werden sie nicht selten zu einer Chimäre; das Archiv ist nicht der Grund, sondern<br />
der Abgrund der Historie. Die Quellenmetaphorik verdeckt naturalistisch<br />
die Apparatur dieser Datenlage; in einer Rede des damaligen Direktors des Kölner<br />
Stadtarchivs heißt es: »Wir erschließen dem Rheinland die lauteren Quellen<br />
seines geschichtlichen Lebens, wir decken die Spuren auf, die der Wandel der<br />
Geschlechter auf diesem alten Kulturboden hinterlassen hat.« 5 Die unprocessed<br />
data (Hayden White), nicht Informationen stellen das archäologische<br />
Material der Historie dar. Dymond faßt sie unter dem Begriff records zusammen;<br />
»as historical evidence, records are largely unconscious, and not slanted for the<br />
consumption of posterity. In this they are therefore akin to the vast majority of<br />
archaeological artifacts«. 6 Ein Effekt der non-narrativen Verfaßtheit und Logistik<br />
des Archivs ist es, daß erzählende Quellen recht eigentlich nicht dorthin<br />
gehören - vielmehr Verwaltungsakten, die ohne Überlieferungsabsicht generiert<br />
wurden. Es ist dies das archäologische Moment der Historie selbst, wie es in einer<br />
frühen, vor 1828 zu datierenden Denkschrift über Notwendigkeit und Zweck der<br />
Hyperboreisch-Römischen Gesellschaft (<strong>von</strong> Eduard Gerhards Hand, im Archiv<br />
des DAI Rom) heißt: »Der nächste und wichtigste Zweck unsrer Gesellschaft<br />
die Sammlung und Feststellung archäologischer Thatsachen« , was<br />
zwar den »archäologischen Verkehr« (sprich: Diskurs) nicht ausschließe, doch<br />
jenseits unklarer Hermeneutiken »muß eine neue Bestrebung im Gebiete der<br />
Archäologie versucht werden; sie muß auf dem Weg des Faktischen fortschrei-<br />
3 Der Soziologe Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation, Paris 1890, Kapitel IV (Qu'estce<br />
que l'histoire?), Absatz »L'Archeologie et la Statistique«, 99ff (101)<br />
4 Pierre Claude Francois Daunou, Cours d'fitudes historiques, hg. v. Alphonse Honore<br />
Taillandier, Deheque u. a., Paris (20 Bde) 1842-49, Bd. 1, 162<br />
5 Joseph Hansen, Die Gesellschaft <strong>für</strong> Rheinische Geschichtskunde in den Jahren 1881-<br />
1906, in: Die Gesellschaft <strong>für</strong> Rheinische Geschichtskunde. Ziele und Aufgaben 1881-<br />
1906, Köln 1907, 86. Dazu Rudolf Schieffer, »Die lauteren Quellen des geschichtlichen<br />
Lebens« in Vergangenheit und Zukunft, in: Michael Borgolte (Hg.), Mittelalterforschung<br />
nach der Wende, München (Oldenbourg) 1995 [Historische Zeitschrift, Beiheft<br />
Nr. 20], 239-254 (244)<br />
6 D. P. Dymond, Archaeology and History. A plea for reconciliation, London (Thames<br />
& Hudson) 1974,67
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 361<br />
ten . Ihr Mittelpunkt kann nur Rom seyn« , ganz wie <strong>für</strong> die Mittelalterforschung<br />
aufgrund der Öffnung des Vatikanischen Archivs 1881. 7 Das hat<br />
Archäologie mit Archivologie gemeinsam: Beide organisieren sich im Moment<br />
ihrer Gründung. Bleibt Archäologie dabei non-narrativ orientiert, weil sie ihre<br />
Funde schlicht ausstellt, im Unterschied zu <strong>Geschichte</strong>n, die auf Textarchiven<br />
bauen? »Hard for me to think that exhibition isn't a narrative form of organization.«<br />
8 Archäologie, Archivologistik, Historie: Rom verschränkt die Ästhetik der<br />
Disziplinen relativisch. Rom sei ein unvergleichlich günstiger Ort <strong>für</strong> das Studium<br />
der <strong>Geschichte</strong> »nicht nur, weil der Historiker hier auf Schritt und Tritt der<br />
<strong>Geschichte</strong> begegnet« (ist dies schon »<strong>Geschichte</strong>«? Rom konfrontiert den<br />
Betrachter vielmehr mit der Gegenwart disparater Überreste), »sondern auch<br />
weil er im Vatikanischen Archiv so viele Quellen zur <strong>Geschichte</strong> der letzten tausend<br />
Jahre findet wie in keinem anderen Archiv der Welt.« 9 Es gilt also die Analogisierung<br />
<strong>von</strong> Archäologie und Archiv. Die Edition <strong>von</strong> Urkunden des Archivs<br />
(was sonst heißt Wissensarchäologie buchstäblich 10 ) erinnert an den archäologischen<br />
Anteil der Historie: Theodor Mommsen nennt die kritisch-philologische<br />
Methode die »keinem Zweifel ausbiegende, keine Lücke der Überlieferung oder<br />
des eigenen Wissens übertünchende, immer sich selbst und anderen Rechenschaft<br />
legende Wahrheitsforschung.« 11 Mithin weiß die wissensarchäologische Beschreibung<br />
mit Fragmenten und Lücken, Diskontintäten und Leerstellen, kurz:<br />
Schweigen zu rechnen, statt sie zugunsten einer kontinuitätsverbürgenden Historie<br />
narrativ zu überbrücken. Die Rede <strong>von</strong> Rom (als Diskurs) beruht auf einem<br />
Fundament, das materialiter Archäologie und textualiter Archivologistik ist.<br />
Gregorovius war »zufrieden, ein geistiges Totalbild Roms verfaßt zu haben welches<br />
doch auf dem festen Grunde der umfassendsten und gediegensten Studien<br />
in den Archiven ruht« 12 - eine wissensarchäologische Metapher. Das Fundament<br />
des Archivs aber, aus dem die Geschichtswissenschaft ihre Autorität zieht, ist ein<br />
Abgrund: ein fonds, das zwischen fondement (metaphysischer Begriff vom<br />
7 A. Rieche, Die Satzungen des Deutschen Archäologischen Instituts 1828 bis 1972, Mainz<br />
(<strong>von</strong> Zabern) 1979; Seitenangaben in Klammern beziehen sich auf dieser Ausgabe.<br />
8 E-mail der Historikerin Susan Crane vom 22. Oktober 1995<br />
9 Begrüßung durch den scheidenden Institutsdirektor Prof. Dr. Reinhard Elze, in der<br />
Broschüre: Hundert Jahre Deutsches Historisches Institut in Rom 1888-1988 (Reden<br />
zum Festakt), 14<br />
10 Zum semantischen düster <strong>von</strong> Urkunde, Archäologie, origines und antiquitates, unter<br />
Bezug auf Buchstäblichkeit und Archiv, siehe Herders Fragmente: Archäologie des<br />
Morgenlandes, u.: Älteste Urkunde des Menschengeschlechts, in: Herders Sämmtliche<br />
Werke, hg. v. Bernhard Suphan, 6. Bd., Berlin 1883<br />
11 Zitiert nach: Horst Fuhrmann, Einladung ins Mittelalter, München (Beck) 1987, 233<br />
12 Römische Tagebücher, hg. v. H.-W. Kruft / M. Völkel, München 1991, 356, Eintr. v. 9.<br />
Juni 1875
362 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
»Grund«) und fondation (präziser Akt der Macht) oszilliert: »L'origine de l'autorite,<br />
la fondation ou le fondement, la position de la lois ne peuvant par definition<br />
s'appuyer finalement que sur elle-memes, elles sont elles meines une violence<br />
sans fondement.« 13 Kehr definiert 1913 Archivologistik in Italien:<br />
»Nicht so leicht wie die Herren hinter ihren Büchern und am komfortablen Schreibtisch<br />
vielleicht denken, sind diese archivalischen Forschungen in ungeordneten oder<br />
ganz anders wir wir es gewohnt sind eingerichteten und oft schwer zugänglichen<br />
Archiven; nicht nur Sicherheit in der Technik der Forschung erfordern sie. Sind<br />
nun die uns interessierenden Dokumente in den allerverschiedensten Fonds verstreut,<br />
so bleibt, um zu ihnen zu gelangen, eben kein anderer Weg als die genaueste<br />
Durchsicht dieser Fonds, eine Arbeit also, die genau dieselbe ist, die den italienischen<br />
Gelehrten <strong>für</strong> ihre eigene <strong>Geschichte</strong> obliegt.« <br />
Der in Rom um die Jahrhundertwende tätige Archäologe Ludwig Pollak hat seine<br />
berufsweisende Urszene, die Inspiration zur Archäologie als Kind in dem<br />
Moment, wo er auf dem jüdischen Friedhof bei der Altneusynagoge in Prag<br />
beobachtet, »wie man dort alte unbrauchbar gewordene Torah-Pergamentrollen<br />
und Fragmente derselben feierlich begrub.« 14 Der Archivkundler Heinrich Otto<br />
Meisner erklärt wenig später die Motivation <strong>für</strong> die notorischen, als sexualpathologische<br />
Neigung zum Fetischismus gedeuteten Autographendiebstähle des<br />
Privatgelehrten Karl Hauck im Preußischen Hausarchiv zu Charlottenburg mit<br />
der <strong>von</strong> Hauck selbst angegebenen Veranlagung, schon als Knabe am liebsten auf<br />
Kirchhöfen, bei Begräbnissen und beim Ausschachten alter Gräber anwesend sein<br />
zu wollen. »Von dieser Vorliebe <strong>für</strong> Moder wollte Hauck eine Brücke zu seinen<br />
Handschriftendiebstählen schlagen«; das Reale des Archivs bleibt bei den Leichen.<br />
15 Die gemeinsame Erfahrung des Archivs (Ranke: Venedig) und der Relikte<br />
(Rom) ist jedenfalls die <strong>von</strong> disiecta membra. Werden Historiker je in der Lage<br />
sein, Archivmaterial nicht unverzüglich als Dokumente einer vergangenen Zeit,<br />
13 Jacques Derrida, Force de loi: le »fondement mystique de Pautorite«, in: Cardozo Law<br />
Review 11 (1990), 919; 942; dt.: Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität«,<br />
Frankfurt/M. 1991<br />
14 Ludwig Pollak, Meine Erinnerungen. Manuskript, datiert 9. November 1933; aufbewahrt<br />
im Nachlaß Pollak, »Ricordi autobiografici«, Museo Barracco Rom, Sigle<br />
MBF/5; zitiert auch in: Margarete Merkel-Guldan, Die Tagebücher <strong>von</strong> Ludwig<br />
Pollak. Kennerschaft und Kunsthandel in Rom 1893-1934, Wien (Verlag der österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften) 1988, 31ff. Zur rituellen Bedeutung der<br />
Torabegräbnisse siehe Falk Wiesemann, Judaica aus süddeutschen Synagogen. Zur kulturgeschichtlichen<br />
Bedeutung neuer Gcnisa-Fundc, in: Anzeiger des Germanischen<br />
Nationalmuseums und Berichte aus dem Forschungsinstitut <strong>für</strong> Realienkunde 1989<br />
(Verlag des GNM), 103-114<br />
15 Heinrich Otto Meisner, Die Archivdiebstähle Haucks. Tatsachen und Folgerungen,<br />
in: Archivalische Zeitschrift 36 (1926), 178-187 (185)
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 363<br />
sondern als Bestandteil eines diskursiven Netzes, das zum Archiv führt und dessen<br />
Evidenz das Schriftstück im Archiv als Beleg dokumentiert, zu lesen? Kehr<br />
sah allein in der genealogischen Rekonstruktion des jeweiligen Archivs den<br />
Schlüssel zum Verständnis seiner individuellen Logistik - Wissensarchäologie als<br />
Archivologie. »Genügt etwa, daß irgendetwas irgendwo noch jetzt vergraben liegt<br />
und niemand weiß da<strong>von</strong>? Ist das gegenwärtig? Es ist vielmehr, als wäre es<br />
nicht.« 16 Nicht erst seine Öffnung macht das Vatikanische Archiv zu einem Stück<br />
»unvergangene Vergangenheit« (Droysen), doch <strong>von</strong> Historie ist erst die Rede,<br />
wenn die Geschichtswissenschaft darauf Zugriff hat. Preußen implementiert kurz<br />
darauf in Rom seine Historische Station im präzisen Sinne <strong>von</strong> Droysens Historik,<br />
die eine mediale Bedingung <strong>von</strong> Historie buchstäblich definiert: »Das einzige<br />
Mittel, diese Dinge als historisches Material verwendbar zu machen, ist, es zu<br />
sammeln und zu katalogisieren« . <strong>Geschichte</strong> ist {cot)lectio:<br />
»Wer die <strong>Geschichte</strong> der Päpste im Mittelalter studieren will, muß ihre über das<br />
ganze Abendland bis in die kleinsten Archive zerstreuten Akten und Urkunden<br />
zusammensuchen.« 17 Die Öffnung des Archivio Segreto des Vatikan 1880/81 markiert<br />
einen wissensarchäologischen Wendepunkt, der seinerseits institutionelle<br />
Effekte zeitigt. 1884 etwas schlägt der Präsident der Görres-Gesellschaft, Georg<br />
Freiherr <strong>von</strong> Hertling, der Historischen Sektion der Gesellschaft auf der Generalversammlung<br />
in Freiburg die Gründung eines Instituts vor, das in Rom nach<br />
dem ausdrücklichen Vorbild des Deutschen Archäologischen Instituts auf dem<br />
Kapitol archivische Geschichtsforschung und Christliche Archäologie zusammenführen<br />
soll; das Römische Institut wird 1888 tatsächlich in den Räumen des<br />
deutschen Priesterkollegs auf dem Campo Santo gegründet. Für einmal kommt<br />
es also zu jener Allianz, welche die preußischen Institute in Rom verfehlten. 18<br />
Ist Historie das, was den archäologischen Blick auf die Dinge versperrt? Als<br />
sich Gregorovius im August des Jahres 1863 der Stadt Ravenna nähert, wird<br />
seine historische <strong>Im</strong>agination bereits <strong>von</strong> »Erinnerungen« an Goten und<br />
Byzanz aufgeladen, und er fragt sich, wie eine Stadt aussieht, welche das Denkmal<br />
solcher Zeiten und Taten ist: »Aber auch hier erfahren wir, daß die Wirklichkeit<br />
sich zur eingebildeten Vorstellung immer ironisch verhält, und daß diese<br />
eine gewisse Zeit braucht, um sich zu reinigen und der reellen Gestalt der Dinge<br />
ganz mächtig zu werden.« 19 Auch Theodor Mommsen erfährt analog die Dif-<br />
16 Johann Gustav Droysen, Histonk. Historisch-kritische Ausgabe, hg. v. Peter Leyh,<br />
Stuttgart-Bad Cannstatt 1977, hier: »Histonk. Die Vorlesungen <strong>von</strong> 1857«, 67<br />
17 Kehr, zitiert in: DHI 1988, a.a.O.<br />
18 Erwin Gatz, Zur <strong>Geschichte</strong> des »Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft«, in:<br />
Paolo Vian (Hg.), L'Archivio Segreto Vaticano e le ricerche storiche, Rom 1983, 23-26<br />
(25f)<br />
19 Ferdinand Gregorovius, Wanderjahre in Italien, München (Beck) 1968, 2
364 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
ferenz zwischen Vergangenheit als <strong>Im</strong>aginärem (historische <strong>Im</strong>agination) und<br />
der Gegenwart <strong>von</strong> Infrastruktur, als er am 24. November 1844 Italien erreicht:<br />
»Welche Kluft mich auch da<strong>von</strong> trennte, und ewig das heissersehnte Ziel zu entfernen<br />
schien - da bin ich, auf dem heiligen Boden der Natur, der Kunst, der<br />
<strong>Geschichte</strong>! Aber der Augenblick fordert sein Recht, nirgends gebietender<br />
und löstiger, als <strong>für</strong> den ankommenden Reisenden. Der Bootsmann, der Facchino,<br />
der Douanier, die Polizei - so viele erbitterte Feinde abzuhalten ist die erste<br />
Aufgabe.« 20<br />
Der Einbruch des Realen in die historischen Halluzinationen Roms heißt Enttäuschung:<br />
»Erst wenn man dessen Denkmäler aufsucht und darin umherwandert,<br />
fühlt man das Wehen des Hauchs alter Vergangenheit in solcher Macht,<br />
wie etwa nur in Rom allein, wo der geschichtliche Geist freilich ein universaler<br />
ist, während er in Ravenna nur einer Periode angehört« .<br />
Die Funktion der Historie ist die, solcher kognitiven Dissonanzen zwischen<br />
<strong>Im</strong>agination und Realem Herr zu werden. Gregorovius gibt das Stichwort Rom<br />
vor: Lassen wir uns auf die metonymische Verkettung ein. Am 30. Dezember<br />
1844 lautet die Eintragung »Rom« in Mommsens italienischem Tagebuch: »Da<br />
bin ich auf dem Capitol und höre den Wind um meinen Hügel pfeifen, wie er<br />
wohl um Romulus gepfiffen hat. Doch via! an den glauben wir ja nicht mehr«<br />
. Die kognitive Dissonanz der Diskurse ist hier ablesbar;<br />
Wissenschaft (als Hermeneutik) sucht Herr zu werden über die historische<br />
<strong>Im</strong>agination (Zensur). Das Echo lautet GOETHE, dessen italienisches Tagebuch<br />
<strong>für</strong> den 22. Januar 1787 vermerkt, daß auch in Rom ist »zu wenig <strong>für</strong> den<br />
gesorgt« sei, »dem es Ernst ist, ins Ganze zu studieren. Er muß alles aus unendlichen,<br />
obgleich überreichen Trümmern zusammenstoppeln«. Goethe hat<br />
Schwierigkeiten, den archäologischen Eindruck mit der Historie aus der Asche<br />
der Druckbuchstaben zu verknüpfen. Er liest Vitruv, »daß der Geist der Zeit<br />
mich anwehe wo das alles erst aus der Erde stieg«; ferner Palladio, »der zu seiner<br />
Zeit noch vieles ganzer sah, maß und mit seinem großen Verstand in Zeichnungen<br />
herstellte«. Und so steigt ihm »der alte Phönix Rom wie ein Geist aus<br />
seinem Grab, doch ists Anstrengung statt Genusses und Trauer statt Freude.<br />
Gewiß man muß sich einen eignen Sinn machen Rom zu sehn, alles ist nur<br />
Trümmer« . Goethe verarbeitet in Rom<br />
die Erfahrung der Heterogenität durch die Einführung eines Raum-Zeit-<br />
Systems, also die räumliche Veranschaulichung <strong>von</strong> Zeit jenseits der Bibliothek:<br />
ein Chronotopos (Michail Bachtin). 21<br />
20 Theodor Mommsen. Tagebuch der französisch-italienischen Reise 1844/1845, hg. v.<br />
G. u. B. Walser, Bern u. Frankfurt/M. 1976, 86<br />
21 Dazu Klaus Städtke, Realistische Literatur - Literarisches Abbild der Wirklichkeit.<br />
Abbild als Konstruktion: Figuren in Raum und Zeit bei Puschkin, Gogol und Tolstoi,
I ARCHÄOLOGIE<br />
UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 365<br />
Daten, Information, Erzählung und Kritik an der monumentalen Philologie<br />
Die Differenz <strong>von</strong> Erzählung und Daten klafft auf, wo Hermeneutik Sinn und<br />
Bedeutung gegenüber puren Positivitäten behaupten will. Zerfällt historische<br />
und/oder archäologische Rekonstruktion in zwei distinkte Schritte, die Sammlung<br />
<strong>von</strong> Daten einerseits und ihre Interpretation andererseits? Tatsächlich ist<br />
die Unterstellung einer solchen Dichotomie in der Praxis unrealistisch. Schon<br />
»when we distinguish layers in an excavation, and record the character and contents<br />
of each, we are mentally processing observed data«, und die Definition<br />
einer Kultur oder die Einbettung <strong>von</strong> Funden in Gesellschaften und Ökonomien<br />
sind schon reine Interpetation und Generalisierung auf nächst höherem<br />
Niveau . Es gibt keinen Nullpunkt der Archäologie, jenes<br />
Reich reiner Tatsachen, das tatsächlich nichts anderes wäre als das Gegenstück<br />
zu Leopold <strong>von</strong> Rankes historiographischer Asymptote: »bloß« zu »zeigen, wie<br />
es eigentlich gewesen.« Tatsächlich aber verlangt die Rechtsarchäologie nach<br />
hermeneutischer Askese:<br />
»Eine Verarbeitung der Quellen hat allein zu dem Zwecke zu erfolgen, die aus<br />
ihnen zu erkennenden sichtbaren Erscheinungen des Rechtslebens darzustellen.<br />
Nicht aber ist es Aufgabe der Rechtsarchäologie, die Schlüsse auf die Entwicklung<br />
des Rechts und der Rechtseinrichtungen zu ziehen, die dieses Material allenfalls<br />
ermöglicht.« 22<br />
Auf den differierenden Feldern <strong>von</strong> Monument und Philologie wird »nur eine<br />
mit Kunst der Kritik und historischem Takt verbundene Intuition den Weg<br />
finden zwischen phantasierender Schau und seelenloser Realistik« .<br />
Der archäologische und der historische Blick kreuzen sich, ohne je zu konvergieren.<br />
Unter wissenschaftsgeschichtlichem Bezug auf Amira / Schwerin,<br />
tatsächlich aber im Sinne Foucaults über deren Fixierung auf sichtbare Dinge<br />
(also Realien im altertumskundlichen Sinne) hinausgehend, hat Wolfgang<br />
Schmale eine Archäologie des Rechts verfaßt, die das archivische Textmaterial<br />
privilegiert 23 - womit erneut ein medialer Speicher die Grenzen des Sagbaren<br />
definiert.<br />
in: Literarische Widerspiegelung. Geschichtliche und theoretische Dimensionen eines<br />
Problems, Berlin / Weimar (Aufbau) 1981, 239-290 (259f)<br />
22 Karl <strong>von</strong> Amira / Claudius <strong>von</strong> Schwerin, Rechtsarchäologie. Gegenstände, Formen<br />
und Symbole Germanischen Rechts, feil 1; Einführung in die ft.eehtmj'ehäalögie, Berlin<br />
(Ahnenerbe-Stiftung) 1943, 129; Strukturell analog argumentierend: Ernst H.<br />
Kantorowicz, Über Grenzen, Möglichkeiten und Aufgaben der Darstellung mittelalterlicher<br />
<strong>Geschichte</strong> (Rede auf dem deutschen Historiker-Tag in Halle, 24. April 1930)<br />
23 Wolfgang Schmale, Archäologie der Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit:<br />
ein deutsch-französisches Paradigma, München (Oldenbourg) 1997, 108ff
366 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
Historiker mobilisieren Monumente der Vergangenheit als Dokumente in<br />
Form umfangreicher Publikationen. Historie als Geschichtswissenschaft ist ein<br />
Medium, und immer ist bei der Sammlung, Sichtung und Edition des Materials<br />
diese dritte Hand im Spiel. »Even with a scrupulously accurate editor, there are<br />
features of the original which are not reproducible: most obviously we lose the<br />
document as an archaeological artifact« . Es gilt, gerade die<br />
Befunde der <strong>Geschichte</strong>, auch der Neuzeit und Zeitgeschichte, archäologisch zu<br />
lesen. Archäologische Monumente können auf zwei Weisen konfrontiert werden:<br />
zum Zweck historischer Studien, die sie unversehens zu dokumentarischen<br />
Beweisen unterstellter Ereignisse transformieren, oder aber genuin archäologisch:<br />
»de les decrire et de les expliquer en eux-memes, ce qui a donne lieu ä >la<br />
science appelee archeologie'. L'archeologie apparait donc dejä ici comme une discipline<br />
autonome, distincte de Phistoire.« 24 Die datensammelnde Ästhetik der<br />
Archäologie verwandelt »historische« Evidenz in calcul (Zahlen statt Erzählung)<br />
und strebt nach »details positifs, des dates precises«. 25 Zwischen das transzendente<br />
Signifikat »<strong>Geschichte</strong>« und die Zuhandenheit des Archivs schiebt sich<br />
eine abgrundtiefe Differenz, vollzieht sich eine mise-en-ahime, die Winckelmanns<br />
Nostalgie über die Verlorenheit der Antike im Moment ihrer Konfrontation<br />
als Ruine in nichts nachsteht. Erst die metonymische Adressierung der<br />
Vergangenheit ermöglicht den historischen Diskurs; Name ist gleich Adresse<br />
(des Gedächtnisses). Demgegenüber hat es die Archäologie (des Wissens) mit<br />
Daten als Materialitäten zu tun: »Nur Topfscherben, Geräte und Waffen, keine<br />
Einzelnamen und Einzeltaten; aber alles das ist keine <strong>Geschichte</strong>, oder<br />
beweist nur, daß es hier einmal <strong>Geschichte</strong> gegeben hat.« 26 Laut Ernst Jünger<br />
spürt Archäologie in den Schichten der Erde Reiche auf, <strong>von</strong> denen selbst die<br />
<strong>Namen</strong> verloren gegangen sind (Über den Schmerz, 1934). Der archäologische<br />
Blick kommt dem Ingenieurwesen nahe; Theodor Mommsen hat einmal beklagt,<br />
daß Spezialisten nur zu leicht <strong>für</strong> einen Kreis halten, was nur ein Kreissegment<br />
ist . Archäologie dagegen transformiert nicht diskrete<br />
Segmente und Module in synekdochische Kreise <strong>von</strong> Historie. Der italienische<br />
Meisterarchäologe aus der Zeit des Risorgimento, Rudolfo Lanciani, war, seiner<br />
eigenen Bekundung zufolge, als Sohn eines Ingenieurs (des päpstlichen idraulico)<br />
<strong>für</strong> das archäologische Fach sensibilisiert. Archäologie erträgt es, den Lücken<br />
24 Mouza Raskolnikoff, Histoire romaine et critique historique dans PEurope des lumieres:<br />
la naissance de l'hypercritique dans l'historiographie de la Rome antique, Rome<br />
(Ecole Francaise de Rome) / Strasbourg (AECR) 1992, 689, unter Bezug auf: Pierre<br />
Claude Francois Daunou, Cours d'Etudes historiques, hg. v. Taillandier, Deheque u.<br />
a., Paris 1842ff<br />
25 Daunou 1842, zitiert nach: Raskolnikoff 1992: 690<br />
26 Oswald Spengler, Frühzeit der Weltgeschichte, München (Beck) 1966, Einleitung, xv
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 367<br />
als solche ins Auge zu schauen, ohne sie gleich mit dem inneren Auge der historischen<br />
<strong>Im</strong>agination mit Bildern der <strong>Geschichte</strong> zu füllen. Die archäologische<br />
Tugend heißt Diskretion: jauger (= eichen, ausmesse«, abschätzen) und frier (=<br />
aussuchen, -lesen, sortieren); die triage, in Frankreich, ist ein archivkundlicher<br />
Begriff): »L'archeologue se jauge non ä l'ampleur de l'edifice mais ä la solidite<br />
des pierres qu'il emploie. Ayant ä bätir dans l'inconnu, in ne saurait trop trier ses<br />
materiaux. II admet le vide et laissera disjoint le puzzle«; damit wird seine Wissenschaft<br />
zu einer science stricte. 27 Michel Foucault hat Wissenschaftsgeschichte<br />
durch eine Archäologie des Wissens ersetzt, wobei er als Akzentverschiebung <strong>von</strong><br />
der Historie zur Archäologie beschreibt, was doch gleichzeitig ein irreduzibler<br />
Widerstreit zwischen Augenzeugenschaft und Spur ist, und die historische Ordnung<br />
ein Organisationsversuch zu seiner Beherrschung. Die <strong>Geschichte</strong> in ihrer<br />
traditionellen Form unternahm es, »die Monumente der Vergangenheit zu<br />
>memorisieren
368 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
<strong>Geschichte</strong>, die mit ihrer hardware, also ihren eigenen Übermittlungsinstanzen<br />
identisch wird. Denn die Agentur der Überlieferung hat originär Anteil an dem<br />
Geschehen selbst, der Botschaft des Mediums. Schreibwerkzeuge schreiben an<br />
den Gedanken mit (Friedrich Nietzsche), Aufschreibesysteme mit an der Historie.<br />
Archäologie als Disziplin der stummen und kontextlosen Gegenstände sucht<br />
nicht länger ihre Legitimation allein durch Anschluß an den historischen<br />
Diskurses; man könnte vielmehr »sagen, daß die <strong>Geschichte</strong> heutzutage zur<br />
Archäologie tendiert- zur immanenten Beschreibung des Monuments« .<br />
Monumentale Philologie im Sinne Foucaults heißt: Serien bilden, und die Monumente<br />
nicht in Dokumente transformieren, sie also a priori einem geschichtlichen<br />
Zusammenhang unterstellen. Die Wissenschaft der Buchstaben weiß darum: »Si<br />
l'on envisage, theoretiquement, la totalite des actes linguistiques possibles, is rest<br />
que l'ecrit, le texte, est plus souvent monument que document.« 19 Was den Monumenta<br />
Germaniae Historica den <strong>Namen</strong> gab, korrespondiert mit einer Archäologisierung<br />
der Altphilologie. Aus der Sicht der christlichen Archäologie kritisiert<br />
Piper die MGH da<strong>für</strong>, das sie »bis jetzt allein Geschichtsschreiber und Gesetze«<br />
umfaßt, »obwohl unter demselben Titel auch die Alterthümer ihre Stelle finden<br />
sollen, namentlich die Inschriften.« 30 In seinem Grundriss der Denkmälerkunde 31<br />
charakterisiert Emil Braun die Bedingungen, unter denen ein Text als Monument<br />
gelesen wird. Auch schriftliche Denkmäler gehören »wenigstens einem Theil<br />
ihres Daseins nach zu dem Bereich der Denkmälerkunde, mögen sie immerhin<br />
dazu bestimmt sein nachmals den Auslegern der Sprachdenkmäler und den<br />
Geschichtsforschern in Beziehung auf ihren Inhalt übergeben zu werden«<br />
. Der archäologische Blick auf Denkmäler seinerseits sieht sie<br />
zunächst als Monumente, nicht als kunstbistorische Dokumente:<br />
»Ebenso muß die Denkmälerkunde mit jener systematischen Uebung des Blicks<br />
beginnen, welche dazu führen soll Eindrücke, die auf die Anregung gemeiner Sinneslust<br />
berechnet sind, rasch zu vernichten und die Wunder des Tiefsinns und die<br />
höchsten Aeusserungen der Sittlichkeit auch unter befremdlicher Hülle und unter<br />
Formen, die <strong>für</strong> das moderne Gefühl verletzend erscheinen, mit Sicherheit zu entdecken.«<br />
<br />
29 Paul Zumthor, Document et Monument. A propos des plus anciens textes de langue<br />
francaise, in: Revue des Sciences Humaines fasc. 97, Jan.-März 1960, 5-20 (6). Siehe<br />
auch Stephen G. Nichols, Why Material Philology?, in: Zeitschrift <strong>für</strong> deutsche Philologie<br />
116 (1997), Sonderheft Philologie als Textwissenscbaft. Alte und neue Hori-"<br />
zonte, hg. v. Helmut Tervöoren u. Horst Wenzel, 10-30<br />
30 Ferdinand Piper, Einleitung in die Monumentale Theologie, Gotha 1867, 7f (Anm. 6)<br />
31 Hyperboreisch-Römische Studien <strong>für</strong> Archäologie. Mit Beiträgen <strong>von</strong> K. O. Müller,<br />
Th. Panofka, Otto M. B. Stackeiberg, F. G. Welcker u. Emil Braun, hg. v. Eduard Gerhard,<br />
zweiter Theil, Berlin (Georg Reimer) 1852: Archäologischer Nachlass aus Rom<br />
<strong>von</strong> Eduard Gerhard und dessen Freunden, Berlin 1852, 1-76
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 369<br />
Erst die Absicht vom Kunstwerk gibt Einsicht in dessen kulturelle Information.<br />
An die Stelle ästhetischer Wahrnehmung tritt dabei das Messen als dose reading<br />
des archäologisch Diskreten:<br />
»Hier müssen wir nahe herantreten an das Einzelne, müssen mit Maass und<br />
Gewicht den spezifischen Gehalt jeder Erscheinung zu ermitteln suchen und die<br />
Differenzpunkte an der Stelle aufzufinden wisen, an welcher sie ihren Sitz haben.<br />
Nur dadurch ist eine Aussöhnung bleibender Art möglich und mit ihr ist zugleich<br />
das Resultat einer gründlichen Vermessung der Gränzgebiete der Wissenschaft<br />
übergeben.« <br />
In seiner Übersicht der Kunstgattungen benennt Braun die radikal unhermeneutische<br />
Option eines Stylgesetz: »In dieser Sphäre hat dasselbe vorerst nur<br />
rein formelle Geltung« - ein Bildsortiergedanke im Primat des<br />
Äußerlichen, den Heinrich Wölfflin <strong>für</strong> die Kunstgeschichte auf die Spitze<br />
getrieben hat. 32 Braun empfiehlt, »die Denkmäler nach Gattungen und Arten<br />
zusammenzuordnen« und nimmt es dabei in Kauf, daß die archäologische Ordnung<br />
der Dinge (parataktisch) den historischen Sinn (Syntax und Semantik) zu<br />
unterlaufen droht. So wird Archäologie zur Provokation der Historie; obwohl<br />
bei einer solchen Zusammenstellung die Artefakte ferner Jahrhunderte und der<br />
Jetztvergangenheit »verhältnismässig nahe an einander herantreten«, werde<br />
durch eine solche Anordnung, wie sie etwa Zoega aufgestellt und Gerhard fortgeführt<br />
hat, »<strong>für</strong> feine und richtige Unterscheidung doch mehr gewonnen, als<br />
durch die substilsten kunsthistorischen Bestimmungen« . Das<br />
verlangt ganz im Sinne <strong>von</strong> Foucaults Archäologie des Wissens, Serien zu bilden;<br />
die »grossen Massen, welche die Kunstgattungen bilden, stehen unter einander<br />
selbst wieder in einer gewissen, nicht blos zufälligen Verbindung.«<br />
»Ursprünglich« sieht Braun ihren gemeinsamen Mittelpunkt, ihre arche, in der<br />
Architektur . Der Berliner Archäologe Eduard Gerhard, auf den<br />
Braun hier rekurriert, optiert ebenso <strong>für</strong> die Serienbildung; sein methodisches<br />
Paradoxon, etruskische Monumente betreffend, lautet: Artis monumentum qui<br />
unum vidit, nullum vidit, qui mille vidit, unum vidit«. . Gerhard<br />
hatte die archäologische Alternative zum kunsthistorischen Blick auf Antiken<br />
(anders als seinerzeit G. E. Lessing am Ort des Laokoon) in Rom erlebt 33 ;<br />
»ursprünglich eine philologische Natur« und »nicht durch eine aus besonderer<br />
Begabung hervorgehende Neigung <strong>für</strong> die bildende Kunst zur Beschäftigung<br />
M Dazu W. £., Digitale Bildarchivierung: der Wöltiiin-Raiküi (gemeinsam mit Stefan<br />
Heidenreich), in: Sigrid Schade / Christoph Tholen (Hg.), Konfigurationen. Zwischen<br />
Kunst und Medien, München (Fink) 1999, 306-320<br />
33 Dazu W. E., Not seeing Laocoon: Description on the Stage of Reason, demnächst in:<br />
John Bender / Michael Merinman (Hg.), Regimes of Description: In the Archive of<br />
the Eighteenth Century, Stanford UP
370 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
mit derselben getrieben«, hat ihn der Aufenthalte in Rom buchstäblich diskursiv<br />
dazu gebracht; »durch den unausgesetzten Verkehr mit den Kunstwerken<br />
selbst, die ihm durch Betrachten, Vergleichen und Beschreiben genau bekannt<br />
und vertraut wurden, erwuchs ihm mit den einzelnen Aufgaben der Forschung<br />
die Auffassung der gesammten Disciplin« . Umfassende, auf Autopsie<br />
beruhende Monumentenkenntnis blieben ihm Alpha und Omega der Archäologie,<br />
ihre Einsicht bis an die Grenzen der Blindheit. »So lange er es seinen<br />
Augen noch etwas zumuten durfte, suchte er die Antikensammlungen auf, um<br />
sie womöglich zu katalogisieren. »Sein Gedächtnis das Gesehene fest zu halten<br />
war erstaunlich, in übersichtlicher Beherrschung des ganzen Denkmälerstoffs<br />
ist ihm Niemand gleich gekommen« . Denn Wissensaufklärung<br />
arbeitet im Jahrhundert enzyklopädischen Kultur- als Summe <strong>von</strong> Hilfswissenschaften<br />
panoptisch, als Kontrolle durch Blicke(n). Gerhard erhält den Eindruck,<br />
»dass alle bisherigen Forscher einem durch die Natur der Sache<br />
nicht gerechtfertigten Eklecticismus folgten« und fordert folglich,<br />
»dass, wie die Philologie alles was an Erzeugnissen der Litteratur erhalten ist als<br />
Gegenstand und Quelle ihrer Forschung ansieht, so die Archäologie den gesammten<br />
Vorrath <strong>von</strong> Denkmälern, alles was an Erzeugnissen der Kunst und des Kunsthandwerks<br />
auf uns gekommen ist, zur Grundlage habe. Als eine der Philologie<br />
verwandte und ebenbürtige Disciplin sollte sie, die er später als monumentale<br />
Philologie bezeichnete, in gleichem Sinn, mit gleicher Methode durch wissenschaftliche<br />
Erforschung der Monumente ihrerseits das Gebäude der Alterthumswissenschaft<br />
errichten helfen und daher stets mit der Philologie gemeinsam<br />
arbeiten. Die ungeheure Masse der Monumente musste aber durch Kritik geprüft<br />
und gesichtet werden. Galt es dabei zunächst die Tradition in allen ihren Momemten<br />
äusserlich festzustellen, so konnte die innere, auf das Wesen eingehende Kritik<br />
nur vermittelst eines sicheren Takts geübt werden, der auch hier, wie in der<br />
Philologie durch Lecture, nur durch lebendigen Verkehr mit den Kunstwerken<br />
erworben und gebildet werden kann. Uebersehbar und <strong>für</strong> die wissenschaftliche<br />
Benutzung brauchbar wird diese Welt <strong>von</strong> Monumenten erst durch Ordnung und<br />
Classificirung. Die Technik nach ihren verschiedenen Richtungen, der Fundort,<br />
Stil und Darstellung nach ihrer geschichtlichen Entwickelung, die Gegenstände<br />
endlich der Darstellung, geben eine Reihe <strong>von</strong> Gesichtspunkten ab, nach welchen<br />
die Kunstwerke zu betrachten und streng zu sondern sind, wenn eine wirklich<br />
methodische Erforschung derselben möglich werden soll.« 34<br />
Beschreibung - im Unterschied zum Verstehensbegriff Diltheyscher Hermeneutik<br />
- bleibt hier bewußt dem Objekt gegenüber äußerlich. Unter dem Titel<br />
Zur monumentalen Philologie definierte Gerhard in einen Vortrag vor der Phi-<br />
34 Otto Jahn, Eduard Gerhard. Ein Lebensabriss, in: Gesammelte Akademische Abhandlungen<br />
und Kleine Schriften <strong>von</strong> Eduard Gerhard, 2. Band, Berlin (Georg Reimer)<br />
1868, i-cxvii (lxix f.), unter Bezug auf: E. Gerhard, Prodromus Mythologischer Kunsterklärung,<br />
München-Stuttgart-Tübingen 1828
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 371<br />
lologenversammlung in Berlin 1850 seinen Begriff der Archäologie als Disziplin,<br />
»aus dem gegebenen Stoff« - Daten also - methodisch Resultate <strong>für</strong> die<br />
Altertumskunde zu gewinnen und ein Bild des Alterthums herzustellen, wie es<br />
gerade nicht aus den Schriften, sondern aus den Kunstwerken entgegentritt:<br />
»Seiner Anlage nach und mehr noch wegen des physischen Hemmnisses seiner<br />
Augen war das spezifisch Künstlerische, die formale Darstellung und Durchbildung<br />
<strong>für</strong> Gerhard nicht das unmittelbar und vorzugsweise in den Kunstwerken<br />
ihn interessirende. Er fasste sie wesentlich als Monumente auf, als einen Theil des<br />
wissenschaftlichen Apparats <strong>für</strong> die antike Culturgeschichte, denen man abfragen<br />
müsse, was sie über Anschauungen und Denkweise des Alterthums uns verkünden.<br />
So war auch der eigentlich historische Sinn, der die allmähliche Entwickelung<br />
in ihren einzelnen Momenten zu verfolgen bestrebt ist, bei ihm nicht vorherrschend,<br />
er war eine entschieden systematisirende Natur, welche den Zusammenhang<br />
des Einzelnen aus der Einheit des Gedankens zu gewinnen suchte.« 35<br />
Damit ist implizit die Alternative zu Winckelmanns kunstgeschichtlich orientierter<br />
Archäologie, <strong>für</strong> die das Fach dann doch in seiner Mehrheit optierte, formuliert,<br />
auch wenn Gerhards Modell auf gegenseitige Komplementarität der<br />
altertumswissenschaftlichen Teildisziplinen zielt. Gerhards Schlagwort einer<br />
Archäologie als monumentale Philologie zielt nicht auf Methodik, sondern ausschließlich<br />
auf die Materialität ihrer Untersuchungsobjekte im Gegensatz zu<br />
Schriftdokumenten (Rößler). Piper beschreibt im Kontext der Christlichen<br />
Archäologie, daß das lateinische monumentum einmal weniger die Materie<br />
(»Stoff und dessen Gestaltung«) denn auf den energetischen <strong>Im</strong>perativ des<br />
Gedächtnisses als Erinnerungs-, Denkzeichen meinte - einen Vektor, keinen Speicher<br />
. Gerhard empfiehlt seinen Lesern ausdrücklich, bei der<br />
Betrachtung antiker Werke Winckelmanns Weg einzuschlagen, die ästhetische<br />
Auffassung antiker Kunstwerke »dem umfassenden Standpunkt« einer monumentalen<br />
Philologie unterzuordnen und damit an den historischen Diskurs (»wie<br />
jede andre auf einer geschichtlichen Basis ruhende Forschung«) zu koppeln. 36<br />
35 Jahn 1868: lxxi, Anm. 1, unter Verweis auf die Verhandlungen der Philologenversammlung<br />
40ff., sowie: Archäologischer Anzeiger zur Archäologischen Zeitung Jg. 8,<br />
Nr. 21/22 (1850), Sp. 203ff (»Archäologische Thesen«). Siehe auch Detlef Rößler,<br />
Eduard Gerhards »Monumentale Philologie«, in: Dem Archäologen Eduard Gerhard<br />
(1795-1867) zu seinem 200. Geburtstag, hg. v. Henning Wrede, Berlin 1997 (Winckelmann-Institut<br />
der Humboldt-Universität 2), 55-61; Rößler verweist auf die Nachklänge<br />
des Begriffs bei Philologen (Ulrich <strong>von</strong> Wilamowitz-Moellendorff) und Kunstarchäologen<br />
(Piper 1867, § 16, 45-49, mit explizitem Bezug auf Gerhard), vor allem aber auf<br />
die Differenz zu Michel Foucaults diskursanalytische Verwendung des Begriffs »Monument«<br />
(dort das Antonym zum »Dokument«) in der Archeologie du Savoir (1969)<br />
36 Eduard Gerhard, Über archäologische Sammlungen und Studien. Zur Jubelfeier der<br />
Universität Berlin, Berlin (Reimer) 1860, 21 u. 23
372 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
Damit ist Archäologie dem hermeneutischen Zirkel verfallen; August Boeckh<br />
definiert - in einer unbewußten Medientheorie der Gutenberg-Ära - Philologie<br />
als »Reproduktion des Produzierten« 37 , und der Altphilologe Hermann Usener<br />
definiert in einer Berliner Rektoratsrede: »Das [Alpha] und [Omega] aller<br />
geschichtlichen Forschung ist das geschriebene Wort« . Zu<br />
<strong>Geschichte</strong> aber wird ein Buchstabenspeicher erst in seiner energetischen Aufladung<br />
durch den historischen Diskurs; Medium dieser Verlebendigung <strong>von</strong><br />
Lettern ist die Literatur. An dieser Stelle wird die (die vorliegende Arbeit strukturierende)<br />
Parallelisierung <strong>von</strong> Archäologie und Archiv buchstäblich und zeichnet<br />
den Riß, der die deutsche Geschichtsforschungslandschaft zwischen<br />
technischer Administration <strong>von</strong> Gedächtnisdatenbanken (das Unternehmen<br />
MGH, GNM, Archive) und narrativen Operationen des <strong>Im</strong>aginären (Historismus)<br />
spaltet. Usener erwähnt ausdrücklich die konsequente Philologisierung der<br />
Bearbeitung der Geschichtsquellen Deutschlands (MGH) in ihrer neuen Phase<br />
(besonders durch Jaffe) unter Kuratel der Berliner Akademie der Wissenschaften<br />
; so werden auch die Monumenta vom Zug zur monumentalen<br />
Philologie vereinnahmt, d. h. entarchäologisiert, nachdem ihre Anregung die<br />
historischen Vereine in Deutschland in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts<br />
zunächst dazu angeleitet hat, »neben den geschriebenen und gedruckten,<br />
auch den aus der Erde gehobenen Urkunden grössere Aufmerksamkeit zu schenken«<br />
- zerstreutes Fundmaterial, dem diskursiv im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>,<br />
gedächtnispraktisch aber im Medium des Inventars ein grössere Gesichtspunkt<br />
abgerungen wird. 38<br />
Usener definiert unter Anspielung auf Leopold <strong>von</strong> Ranke das double-bind<br />
zwischen Forschung und Darstellung, archäologischem Datum und historischer<br />
Information:<br />
»Die Inschriften des Altertums und die Archivalien neuerer Zeiten liefern freilich<br />
dem Historiker ein durch seine Unmittelbarkeit und Urkundlichkeit unschätzbares<br />
Material. Aber inschriftliche Tatsachen bleiben vielfach toter Buchstabe,<br />
solange nicht die literarische Überlieferung sie an ihre Stelle zu rücken verstattet,<br />
den Zusammenhang vermittelt, den nackten <strong>Namen</strong> mit Fleisch und Blut ausstattet.<br />
Aus Archivalien allein, und wären es venezianische Gesandtschaftsberichte,<br />
läßt sich nicht <strong>Geschichte</strong> schreiben; die Literatur ist es, welche die treibenden<br />
Kräfte der Zeit kündet.« <br />
37 Zitiert nach: Hermann Usener, Philologie und Geisteswissenschaft [1882], in: ders.,<br />
Vorträge und Aufsätze, Leipzig / Berlin (Teubner) 1907, 1-34 (9)<br />
38 Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuseums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des<br />
Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabern) 1902,1-72 (1).<br />
Durch den labyrinthischen Palast der heimischen Vorgeschichte führt erst ein Ariadnefaden<br />
namens Entwick(e)lung, das narrative Modell kulturhistorischer Sinnbildung.
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 373<br />
Tatsächlich aber gilt es, wissensarchäologisch an alternative Programme zur Ordnung<br />
der Signifikanten zu erinnern. Edmund E. Stengel, seit Oktober 1937 Leiter<br />
des Reichsinstituts <strong>für</strong> ältere deutsche <strong>Geschichte</strong> (MGH) und Direktor des<br />
Deutschen Historischen Instituts in Rom, adressiert die primären mittelalterlichen<br />
Quellen, die Urkunden, als »unmittelbare Denkmäler der <strong>Geschichte</strong>«. 39<br />
Analog zu Useners Begriff der Unmittelbarkeit der Inschriften des Altertums ist<br />
auch in der aktuellen Altertumskunde <strong>von</strong> ihnen die Rede als zeitunmittelbarem<br />
Material — Material, das sich dem archäologischen, nicht primär hermeneutischen<br />
Blick zu lesen (oder besser: zu sehen) gibt. Monumentale Philologie heißt in der<br />
epigraphischen Schule Stephen V. Tracys die »Herausfilterung individueller Steinschreiber«;<br />
was Buchstaben hier - im Sinne Useners - an ihre Stelle zu rücken<br />
verstattet, ist nicht die Kopplung an antike Literatur, sondern die »Beschränkung<br />
des Erkenntnisprozesses auf Buchstaben«, auf Lettern, buchstäblich, medienarchäologisch<br />
der digitalen Ästhetik <strong>von</strong> optical character recognition als Erfassung<br />
des Standardbuchstabens strukturell verwandt (Lettem-tracing). Die Begriffskopplung<br />
<strong>von</strong> archäologischer Epigraphik und digitalen Medien wird buchstäblich<br />
in der Elektronenlithographie, den Inschriften der Gegenwart in Silizium. 40<br />
Optisch ist diese Lesart insofern, daß auch die diplomatische Beschreibung <strong>von</strong><br />
Urkunden stellenweise zur archäologischen Ekphrasis wird, d. h. der sprachlichen<br />
Beschreibung eines (Erscheinungs-)5z7ds des Schriftartefakts:<br />
»Unter der Corroborationsformel Rota (Durchmesser 12,5 cm) in rother Farbe.<br />
<strong>Im</strong> äusseren Kreis: Dextera domini fecit virtutem, dextera domini exaltavit; im<br />
inneren Kreis: W. divina favente clementia rex Sicilio, ducatus Apulie et principatus<br />
Capue. Goldene Bulle verloren, an der Plica Reste der braunrothen Seidenfäden<br />
durch vier Löcher (in Kreuzform)« 41<br />
- Texte als Bilder sehend. Vom archäologisch präsenten Buchstaben zum historischen<br />
Datum weist kein nahtloser Weg, sondern eine Kluft, die ganze Differenz<br />
<strong>von</strong> Syntax und Semantik; Datierungen können zwar mit Kriterien wie Inhalt<br />
und Prosopographie im Register des historischen Diskurses, aber »nur sekundär<br />
mit den >externen< Kriterien, wie Stein und Buchstabenmaße« vorgenommen<br />
werden - mit erhöhter Vorsicht.« 42 Während in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-<br />
39<br />
Zitiert nach: Walter Heinemeyer, Edmund E. Stengel (1879-1966). Professor der mittleren<br />
und neueren <strong>Geschichte</strong>, in: Ingeborg Schnack (Hg.), Marburger Gelehrte in der<br />
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Marburg 1977, 536-543 (541)<br />
40<br />
Friedrich Kittler insistiert darauf in: ders., Draculas Vermächtnis. Technische Schriften,<br />
Leipzig (Reclam) 1991 (Rückumschlag)<br />
41<br />
Paul Kehr, Die Kaiserurkunden des Vatikanischen Archivs, in: Neues Archiv der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe<br />
der Quellenschriften deutschen <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters, 14. Bd., Hannover<br />
(Hahn) 1889, 345ff (353)<br />
42<br />
Boris Dreyer, Vom Buchstaben zum Datum? Einige Bemerkungen zur aktuellen
374 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
hunderts die nichtliterarischen, sprich epigraphischen Quellen der Antike abschließend<br />
bearbeitet werden, wird den Überresten des Mittelalters, den Urkunden,<br />
das gleiche Interesse zugewandt - monumentale Philologie im Bund mit<br />
philologischen Monumenten; <strong>für</strong> die Mediävistik seiner Zeit spricht Karl Pivec<br />
<strong>von</strong> einer philologischen Neuorientierung. »Heute ist es <strong>für</strong> den Paläographen<br />
eine Selbstverständlichkeit, bei Datierungsfragen der Philologie einen breiten<br />
Raum zu geben« 43 ; erst so gelingt es, wissensarchäologische Monumente in historische<br />
Dokumente zu transformieren. Die diplomatische Diktatanalyse etwa<br />
treibt (rhetorische) Prosopopöie, gelingt es doch damit, »manche Gestalten<br />
des 11. und 12. Jahrhunderts aus der monumentalen Erstarrung eines bloß aus<br />
Deutung der Handlungsweise gewonnenen Bildes zu einem Charakter mit<br />
persönlich-individuellen Zügen umzuwandeln« . In Österreich setzt<br />
Theodor Sickel am Institut <strong>für</strong> Geschichtsforschung unter dem Begriff Historische<br />
Hilfswissenschaften eine Urkundenwissenschaft (also Diplomatik als<br />
Archäologie) durch, der sie nicht nur ebenbürtig, ja alternativ dem narrativ-literarischen<br />
Diskurs der Historie beiseite stellt, sondern den Blick auf Spuren der Vergangenheit<br />
mit der mikroskopischen Betrachtung der Naturwissenschaften<br />
koppelt; als 1874 dem Wiener Institut Kunstgeschichte in Person <strong>von</strong> Franz<br />
Wickhoff angekoppelt wird, schließt sie an die positivistische Richtung, die Giovanni<br />
Morelli zur Bestimmung der Authentizität <strong>von</strong> Kunstwerken entwickelt<br />
hat: Diplomatik und Kunsthistorie im Spurensicherungsverbund. 44<br />
Mit Sickels naturwissenschaftlich-deskriptiver Ästhetik im Umgang mit<br />
Urkunden des Mittelalters wird der Historismus an seine eigene Antinomie<br />
erinnert, insofern hier »Methoden einer in ihrer inneren Struktur entgegengesetzten<br />
Wissenschaft auf eine andere übertragen« werden .<br />
Sickels Antipode Julius <strong>von</strong> Ficker, der eine individualisierende und rechtshistorische<br />
Urkundenwissenschaft betreibt, »leitet so über zu der Geisteshaltung<br />
des Historismus und entfernt sich <strong>von</strong> dem naturwissenschaftlichen Positivismus<br />
Sickels« . Dazwischen steht Archäologie im double-bind <strong>von</strong><br />
Natur- und Geisteswissenschaft.<br />
»Steinschreiberforschung«, in: Hermes. Zeitschrift <strong>für</strong> Klassische Philologie Bd. 126,<br />
Heft 3 (1998), 276-296 (276, 283, 290 u. 296)<br />
43 Karl Pivec, Die Stellung der Hilfswissenschaften in der Geschichtswissenschaft, in: Mitteilungen<br />
des Österreichischen Instituts <strong>für</strong> Geschichtsforschung 54 (1941), 3-15 (12)<br />
44 Hans Hirsch, Das Österreichische Institut <strong>für</strong> Geschichtsforschung 1854-1934, in:<br />
Mitteilungen des Österreichischen Instituts <strong>für</strong> Geschichtsforschung 49 (1935), 1-14<br />
(5 u. 7). Siehe Carlo Ginzburg, Spurensicherung. Über verborgene <strong>Geschichte</strong>, Kunst<br />
und soziales Gedächtnis, Berlin (Wagenbach) 1983; Ginzburg bezieht allerdings die<br />
diplomatische Disziplin, die <strong>von</strong> Mabillon entwickelte Methode des discrimen veri et<br />
falsi, nicht ein.
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 375<br />
»Die methodische Errungenschaft Sickels, der Diktat- und Schriftvergleich zur<br />
Beurteilung <strong>von</strong> Echt oder Falsch, läßt sich ohne Zwang in Parallele stellen zu der<br />
mikroskopischen Bobachtung und zur Exaktheit der Naturwissenschaften. Auch<br />
der Begriff der SickePschen Kanzleimäßigkeit läßt sich als Begriff der Gesetzmäßigkeit<br />
methodisch aus den Naturwissenschaften ableiten. Wie bei einem Experiment<br />
ist die Erkenntnis der Kanzleimäßigkeit einer Urkunde das Ergebnis der<br />
Feststellung einer Reihe <strong>von</strong> Tatsachen, aus der kein Glied ausfallen darf, soll das<br />
Ergebnis stimmen - beim Experiment würde man sagen eintreten. Es mag als<br />
symbolisch erscheinen, daß das Lieblingskolleg Sickels die Chronologie gewesen<br />
ist, die sich in einen physikalisch-naturwissenschaftlichen und einen historischen<br />
Teil gliedert.« <br />
Der Urkunde als Artefakt der Historie wird damit ein radikal non-narrativer<br />
Umgang zugeleitet; als Teil einer Experimentalanordnung wird sie, jenseits aller<br />
Semantik <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>, zum epistemischen Ding in reiner Gegenwärtigkeit<br />
und Ästhetik. 45 Der Hilfswissenschaftler Hans Hirsch spricht vom blitzblanken<br />
Werkzeug der Urkundenwissenscbaft und <strong>von</strong> der Verwendung <strong>von</strong> haarscharfen<br />
Instrumenten ; die Grabungswerkzeuge des (Wissens-)Archäologen<br />
entstammen dem generalisierten Labor (ob Archiv- oder<br />
Experimentalanordnung). Am Ende dieser naturwissenschaftlich diskreten Operationen<br />
stehen nicht <strong>Geschichte</strong>n, sondern Datenverarbeitung, »in mancher<br />
Hinsicht primitiv und mechanisch«, also mechanisierbar: »etwa wenn alle >et< in<br />
einer Diktatgruppe verzettelt wurden« .<br />
Gerhard seinerseits verschweigt in seiner Begründung <strong>von</strong> Archäologie als<br />
monumentaler Philologie allerdings die alternative -wissensarcbäologiscbe Variante<br />
innerhalb der Philologie seiner Zeit, die <strong>von</strong> der Schule Gottfried Hermanns vertretene<br />
datenasketische Beschränkung <strong>von</strong> Philologie ausschließlich auf Exegese<br />
und Kritik der Klassiker . Der Widerstreit <strong>von</strong> Monument und<br />
Dokument schreibt sich in Gerhards Texten unter der Hand ein. Rößler zitiert<br />
Gerhards Formulierung vom ergänzenden Gegensatz und deutet sie - eher wissenschahsgeschicbtlicb<br />
denn wissensarchäologisch - als Symptom <strong>für</strong> »das komplizierte<br />
Verhältnis einer sich allmählich zur Selbständigkeit entwickelnden<br />
Wissenschaft zu ihrer Mutterdisziplin hier in eine Form gefaßt, die man -<br />
ob nun vom Autor so beabsichtigt oder nicht - als Paradoxon bezeichnen<br />
könnte« (58). Aktuelle Wissenschaft nennt diese widerstrebige Fügung Dekonstruktion;<br />
das aus der Philologie abgeleitete Modell <strong>Geschichte</strong> scheitert am<br />
archäologischen Befund, der immer nur eine Leere, eine Abwesenheit anstelle <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> aufweist; »die Lücken der Überlieferung«, jene Effekte <strong>von</strong> random<br />
noise (tatsächlich silence) im medialen Übertragungskanal namens Tradition, »ver-<br />
45 Vgl. Hans-Jörg Rheinberger / Michael Hagner (Hg.), Die Experimentalisierung des<br />
Lebens. Experimentalsysteme in den biologischen Wissenschaften 1850/1950, Berlin<br />
(Akademie) 1993
376 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
mag nur eine intuitive Kombination z überbrücken, welche aus denselben Quellen<br />
gespeist wird« . Das Verhältnis <strong>von</strong> Archäologie und Philologie<br />
bleibt nicht nur methodisch, sondern auch institutional ein gespanntes.<br />
Nicht zufrieden damit, durch wissenschaftliche Forschung seinerseits die Archäologie<br />
zu fördern, hält Gerhard sich verpflichtet, »der Disciplin Selbständigkeit<br />
und Ebenbürtigkeit, namentlich der Philologie gegenüber zu erkämpfen und zu<br />
behaupten, ihr auf Universitäten und Schulen den Platz und die Wirksamkeit zu<br />
sichern, die ihr zukamen« . Ganz diskurspraktisch also institutionalisiert<br />
Gerhard eine auf technischen Reproduktionmedien basierende Gedächtnismaschine<br />
an Museen und Universitäten, den archäologischen Apparat, ein<br />
musee imaginaire nicht ästhetischer, sondern funktionaler Form: erst durch die<br />
allein auf der Reproduktions-, also Informationsebene systematisch vollziehbare<br />
Vergleichung gleichartiger Kunstdenkmäler (als Serienbildung) läßt sich Stil<br />
statistisch bestimmen. 46 Anstelle ästhetischer Illustration bringt der archäologische<br />
Lehrapparat eine repräsentative Auswahl antiker Werke zur Anschauung;<br />
photographische Abbildungen laufen dabei »als die lebendigten und treuesten<br />
Copien« antiker Kunst wie Inschriften anderen technischen Reproductionen den<br />
Rang ab. 47 Neben das abgußplastische (mechanische) tritt das photographische<br />
(chemische) Negativ; damit ist die Bresche geschlagen, Signale als Information<br />
anstelle <strong>von</strong> Materialitäten der Nachbildung treten zu lassen. Technik und Ästhetik<br />
des Gipsabgusses bereiten die photographische Ästhetik der Authentizität des<br />
Abgebildeten vor, wie es die Begründung des Römisch-Germanischen Centralmuseums<br />
<strong>für</strong> die Versammlung plastischer Nachbildungen nicht zu erreichender<br />
Originale definiert: »weil in ihnen der objektivste Ausdruck, unverfälscht durch<br />
etwa mangelhafte Auffassung oder vorgefasste Idee des Darstellers gegeben wird«<br />
- datum, buchstäblich . Wenn im Sinne <strong>von</strong> Gerhards<br />
archäologischem Lehrapparat (und damit maschinisch) nicht der Informations-,<br />
nicht der ästhetische Wert zählt, wenn also »nicht der Stoff, sondern die Form<br />
46 Zur analogen, erneut die Homologie <strong>von</strong> Archäologie und Diplomatik unterstreichende<br />
Einrichtung eines paläographischen Lehrapparats an der Berliner Universität<br />
aufgrund einer Schenkung entsprechender Kupferstiche Ulrich Friedrich Kopps 1820<br />
siehe Johanna Aberle / Ina Prescher, Die Urkundensammlung des Historischen Seminars<br />
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Rückblick und Bestandsaufnahme,<br />
in: Friedrich Beck / Botho Brachmann / Wolfgang Hempel (Hg.), Archivistica docet.<br />
Beiträge zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären Umfelds, Potsdam (Verl.<br />
f. Berlin-Brandenburg) 1999, 524-557<br />
47 Eduard Gerhard, Über archäologische Apparate und Museen, in: Denkmäler und Forschungen<br />
(= Archäologische Zeitung Jg. 16, Nr. 116/117/ 1858), Sp. 205-212 (Sp. 205,<br />
208 u. 210). Dazu Veit Stürmer, Eduard Gerhards »Archäologischer Lehrapparat«, in:<br />
Wrede 1997: 43-46; Stürmer nennt die Gerhardschen Tafelwerke und Vorlegemappen<br />
eine »Photothek« avant la lettre (45).
ARCHÄOLOGIE UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 377<br />
und Bedeutung der Fundstücke« maßgeblich ist, ist eine Serie <strong>von</strong> Nachbildungen<br />
»in ihrer Zusammenstellung <strong>von</strong> weit höherem Werthe , da es nicht<br />
möglich ist, die Originale gleich den Abgüssen zu vergleichender Uebersicht an<br />
einem Orte zu vereinigen« . Indem dabei »auch <strong>für</strong> den schriftlichen<br />
Theil unsers Denkmälervorraths« photographische Reproduktionen zum Einsatz<br />
kommen (wie <strong>für</strong> die Vertreitung der ältesten Inschriften Roms durch Rietschl's<br />
epigraphische Faksimiles) , wird monumentale Philologie<br />
eine Funktion <strong>von</strong> Lichtschrift, mit medienphilologischen und wissensarchäologischen<br />
Konsequenzen jenseits der humanistischen Klassischen<br />
Archäologie. Gerhards Plädoyer, antike Kunstwerke nicht mehr schlicht ästhetisch,<br />
sondern philologisch zu lesen - eine Opposition,<br />
die <strong>von</strong> an Menschenhand gekoppelten, also interpretativen Darstellungsmedien<br />
in Text und Bild ausgeht, wird vom neuen Reproduktionsmedium Photographie<br />
unterlaufen, das an die Stelle jeder Lesung physische Informationen setzt.<br />
In seinem 1853 publizierten Grundriss der Archäologie nimmt Gerhard<br />
erneut Stellung »Ueber das Verhältnis der Archäologie zur Philologie und zur<br />
Kunst«, indem er das Studium der materiellen Kultur als Funktion ihres Textgedächtnisses<br />
propagiert; die Denkmälerforschung des klassischen Altertums<br />
müsse »<strong>von</strong> dessen litterarischer Kenntniss ausgehn, auf welcher die im engeren<br />
Sinn so genannte Philologie beruht; ihren monumentalen Theil bearbeitet<br />
auf philologischer Grundlage der Archäolog« 48 . Dem hermeneutischen Zirkelschluß<br />
entkommt er so ebensowenig wie jene methodisch avancierte Mediävistik,<br />
die aktuell unter dem Schlagwort materiell philology Artefakte wie etwa<br />
eine mittelalterliche Pergamenturkunde zum Schauplatz genuinen Wissenspro-<br />
, nicht -reproduktion erklärt und damit Gerhards monumentale Philologie wissenschaftsgeschichtsvergessen<br />
schlicht neu erfindet. 49 Auch Jahre später ist die<br />
prekäre Relation nicht aufgehoben. »Haben Sie <strong>von</strong> dem Aufsatz <strong>von</strong> Bruns,<br />
dem einzigen, der das Gebiet berührt, über das Verhältnis <strong>von</strong> Archäologie und<br />
Philologie Notiz genommen? (Februar 1886)«, fragt der Historiker Hans Delbrück<br />
in einem Brief aus Berlin vom 19. Januar 1889 den Archäologen Adolf<br />
Michaelis. 50 Der italienische Altphilologe Gaetano de Santis plädierte unter<br />
48 Eduard Gerhard, Grundriss der Archäologie. Für Vorlesungen nach Müllers Handbuch,<br />
Berlin (Reimer) 1853, »Beilagen« 39. L, 4<br />
49 Siehe Stephen G. Nichols, Why Material Philology. Some Thoughts, in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
deutsche Philologig M-. 116 {\W), Heft 4 ^ Sonderheft ?wr New Phihhsy\ originell<br />
nähert sich Nikolaus Wegmann der <strong>Geschichte</strong> und den Relikten der Berliner Mauer<br />
1961-1989 unter diesem Gesichtspunkt als »deutschem Altertum«, in: Weimarer<br />
Beiträge Bd. 47 (2001) Heft 1, 104-123 (118)<br />
50 Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Haus 1 (Unter den Linden) Berlin, Nachlaß<br />
Lothar Wickert, Kasten 16, III. Material zu Mommsen, fasc. 805 »Briefe an Adolf<br />
Michaelis, 1889 (Auszüge)«, Typoskript, Bl. 2
378 ROM ALS SATELLIT DES DEUTSCHEN GEDÄCHTNISSES<br />
Berufung auf Wilamowitz-Moellendorff vehement <strong>für</strong> die »monumentale Philologie«.<br />
Sein Disput mit Patroni über den Charakter der Archäologie oszilliert<br />
zwischen Natur- und Kunstwissenschaft im Versuch, die Disziplin einerseits<br />
<strong>von</strong> der deutschen Kunstarchäologie, andererseits <strong>von</strong> der positivistischen<br />
Naturwissenschaft abzugrenzen (ganz auf der Linie Benedetto Croces). Curtius<br />
versucht die Religation an den historischen Diskurs:<br />
»Deshalb kann man sich auch nicht bei der Methode beruhigen, welche mit umfassender<br />
Gelehrsamkeit <strong>von</strong> Ed. Gerhard durchgeführt worden ist, der vorwiegend<br />
statistischen Methode, der Nachweisung aller in Cultus und Bild ausgeprägten<br />
Formen des griechischen Götterglaubens. Denn auch er stellt sich <strong>von</strong> vorn herein<br />
auf den >festen Boden der griechischen Mythologie', und knüpft erst an den<br />
Schluß seiner Göttersysteme eine Reihe >mythologischer Parallelen', einen inhaltreichen<br />
Ausblick in die Methologien der nichtgriechischen Nachbarvölker, indem<br />
er die verwandten Vorstellungen zusammenstellt. Wie aber Eins mit dem Anderen<br />
zusammenhängt, wie sich die Analogien gebildet haben und wie sie geschichtlich<br />
zu begreifen sind, das bleibt im Dunkeln.« 51<br />
Als Experten monumentaler Philologie sind Archäologen eher dem Museum<br />
denn dem Reich narrativer Texte (<strong>Geschichte</strong>) zugeordnet, folgen also einer<br />
anderen Medienlogi(sti)k. Althistoriker beanspruchen die Antike literarisch;<br />
Archäologie flüchtet sich in die Kunst. Christian Hülsen präzisiert es in einem<br />
Brief vom 15. Mai 1911: »Die Gebiete welche beim römischen Institut vertreten<br />
sein sollten mag man bezeichnen als: Archaeologia figurata, mit spezieller<br />
Berücksichtigung <strong>von</strong> Skulptur und Vasenkunde; Architektur; christliche<br />
Archäologie mindestens bis zum 7./8. Jhdt ; Epigraphik, namentlich lateinische;<br />
Praehistorie oder wenn Sie lieber wollen Palaethnologie; Topographie<br />
<strong>von</strong> Rom und <strong>von</strong> Italien im allgemeinen.« 52 Otto Jahn führte es nach<br />
archäologischer Anleitung durch Braun in Rom nach Berlin an die Universität.<br />
Dort wird er der Arbitrarität archäologischer Signifikanten Herr durch Verfahren<br />
der Hermeneutik (die Nietzsche als Wille zur Textbemächtigung definierte),<br />
indem er philologische und archäologische Studien »in engste Verbindung mit<br />
einander« setzte, um die »bereits erstarkte Methode der Philologie auf die dem<br />
Spiel der Willkür noch allzu sehr preisgegebene Archäologie zu übertragen« 53 .<br />
Ludwig Curtius wiederum setzt den Akzent auf den Widerstreit und konstatiert,<br />
daß Philologie und Archäologie sich zwar in unzähligen Punkten berühren und<br />
51 Ernst Curtius, Die griechische Götterlehre vom geschichtlichen Standpunkt, in:<br />
Preußische Jahrbücher 36. Bd., Berlin 1875, 1-17 (2f)<br />
52 Zitiert nach: Lothar Wickert, Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Archäologischen<br />
Instituts 1879 bis 1929, Mainz (Zabern) 1979, 123<br />
53 Adolf Michaelis, <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Archäologischen Instituts 1829-1879, hg.<br />
v. d. Ccntraldircction des Archäologischen Instituts, Berlin (Ashcr) 1879, 133
I ARCHÄOLOGIE<br />
UND HISTORIE IM WIDERSTREIT 379<br />
schneiden, »daß aber >Wort< und >Form< jedes seinen gesonderten Bereich einnimmt<br />
und daß die Wissenschaft <strong>von</strong> der antiken >Form< längst aufgehört hat,<br />
die demütige Tochter der Wissenschaft vom antiken >Wort< zu sein.« 54 Mit der<br />
Photographie aber löst sich die Materie <strong>von</strong> der Form (Oliver Wendeil Holmes).<br />
Zwischen Monument und Philologie steht die Epigraphik als Disziplin, die das<br />
Textarchiv der Vergangenheit nicht als Bild zu lesen, sondern als Graphenmenge<br />
zu sortieren lehrt. Zunächst aber geht es um Lesarten, buchstäblich; die<br />
Beschlüsse der philologisch-historischen Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften<br />
vom 26. Mai 1846 sind dem Jahn-Mommsenschen Plan, das Corpus<br />
Inscriptionum Latinarum vor allem auf Autopsie der Originale zu gründen,<br />
wenig förderlich. 55 Henzen schreibt am 13. Juni 1846 aus Rom an Gerhard unter<br />
kritischem Rekurs auf Muratoris epigraphische Publikationen: »Die Herren der<br />
Akademie würden ja doch bei philologischen Arbeiten die besten Codices aufsuchen;<br />
wie kommt es denn nun, daß es in der Epigraphik unnütz sein soll, auf<br />
die Originale selbst zurückzugehen, während es notorisch ist, daß dieselben bis<br />
jetzt fast immer schlecht kopiert sind?« 56 Die Präzision der Monumentalen Philologie<br />
ist gekoppelt an den medienarchäologischen Blick. 57<br />
54<br />
Robert Curtius, Deutsche und antike Welt. Lebenserinnerungen, Stuttgart 1950, zitiert<br />
nach: Wickert 1979: 122<br />
55<br />
Kolbe 1984: 13, Anm. 41, unter Bezug auf Adolf Harnack, <strong>Geschichte</strong> der kgl. preussischen<br />
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin (Reimer) 1900, und Lothar<br />
Wickert, Theodor Mommsen. Eine Biographie, 4 Bde., Frankfurt/M. (Klostermann)<br />
1959-1980 (II 166 ff.)<br />
56<br />
Brief v. Wilhelm Henzen an Eduard Gerhard, in: Wilhelm Henzen und das Institut auf<br />
dem Kapitol, ausgewählt u. hg. v. Hans-Georg Kolbe, Mainz (Philipp <strong>von</strong> Zabern)<br />
1984,13<br />
57<br />
Siehe W. E., Texte lesen sehen. Palimpsestuöser Rückblick auf die Epoche der Urkundenfotografie,<br />
in: Eikon 21/22 (1997), Wien (Triton), 128-130; ferner W. E., White<br />
Mythologies? Informatik statt <strong>Geschichte</strong>(n) - die Grenzen der Metahistory, in: Storia<br />
della Storiografia 25 (1994), Mailand (Jaca Book), Themenheft »Hayden White's<br />
Metahistory twenty ycars aftcr«, 23-50
BUCH II:<br />
DIE KLASSISCHEN GEDÄCHTNISORTE<br />
(UND IHRE MEDIALEN GRENZEN)
MUSEUM<br />
Allegorien der Historie:<br />
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg<br />
Zwischen Gedächtnis-Infrastruktur als Praxis musealer Inventarisierung und<br />
den darauf aufsetzenden ideologischen Nationalgeschichtsallegorien zieht sich<br />
eine Kluft, die am GNM in Nürnberg einsehbar wird. In seiner ersten Epoche<br />
als kulturelles Generalrepertorium ist es ein Exponent jener Gedächtnistechniken,<br />
auf denen prinzipiell auch jede Rede über das GNM basiert. Mithin ist also<br />
jedes Wort über die Vergangenheit des GNM eine Vergegenwärtigung der Tatsache,<br />
daß Archive, Depots und Büchermagazine - obgleich im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> - stets radikal präsent vorliegen, und daß es plausibel ist, nicht über<br />
Gedächtnisapparate zu sprechen, sondern ihr Werk transitiv auszusprechen.<br />
Was stattfindet, ist Datenverarbeitung als Subjekt wie als Objekt jeder Rede<br />
über das GNM. 1<br />
So zielte das GNM nicht nur auf die Anlage eines Archivs der deutschen Kulturgeschichte,<br />
sondern bildet auf der Ebene seines Betriebssystems einen internen Speicher,<br />
das Verwaltungsarchiv. Fehlt es, muß Wissensarchäologie anstelle archivischer Forschung<br />
treten. Gerade weil »in den ersten Anfängen eines Unternehmens sich die treibenden<br />
Kräfte und ihr Charakter am besten und klarsten zu offenbaren pflegen«,<br />
bedauert der Historiograph einer zeitgleich zum GNM 1852 beschlossenen deutschen<br />
Gedächtnisagentur, »dass sichere Nachrichten aus der ersten Zeit des Museums doch<br />
nur in verhältnissmässig spärlicher Zahl mitgetheilt werden konnten; das römisch-germanische<br />
Centralmuseum besass eben keine wohlbestallten Sekretäre, Archivbeamte<br />
und Assistenten, die jeden Vorgang und alle Korrespondenzen genau registrirten und<br />
aufbewahrten.« Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-<br />
Germanischen Centralmuseums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen<br />
Bestehens des Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v.<br />
Zabern) 1902, 1-72 (71). Das technische Gedächtnis ist der blinde Fleck der Gedächtnisorte.<br />
Ersatzweise greift Ludwig Lindenschmit (Sohn) auf oral history zurück, auf<br />
parerga der Speicher: ders., Erinnerungen als Randverzierungen zum Charakterbild<br />
Ludwig Lindenschmits und zur <strong>Geschichte</strong> seines Lebenswerkes, in: Festschrift zur<br />
Feier des fünfundsiebzigjährigen Bestehens des Römisch-Germanischen Central-<br />
Museums zu Mainz 1927, Mainz (v. Zabern) 1927, 1-51
384 MUSEUM<br />
Antizipationen des GNM: Minutoli und der Berliner Plan<br />
Johann Heinrich Freiherrr <strong>von</strong> Minutoli, preußischer Generallieutnant, stammt<br />
aus einer italienischen, zur Zeit der Kämpfe zwischen den Hohenstaufen und dem<br />
Hause Anjou nach der Schweiz geflücheten Familie. Einundzwanzigjährig wird<br />
Johann Heinrich als Stabskapitän <strong>für</strong> sechzehn Jahre ans Berliner Kadettencorps<br />
versetzt und nimmt an der Berliner Militärischen Gesellschaft ebenso Anteil wie<br />
an historischen und archäologischen Studien. Eine Expedition nach Ägypten 1820<br />
führt zum Erwerb <strong>von</strong> Altertümern, deren Großteil <strong>für</strong> 22000 Taler König Friedrich<br />
Wilhelm III. erwirbt; dieser wird im Berliner Museum unter den ägyptischen<br />
Altertümern aufbewahrt. Minutoli veröffentlicht über seine Erlebnisse seine Reise<br />
zum Tempel des Jupiter Ammon und nach Oberägypten (Berlin 1824, deutsch Leipzig<br />
1829); vor seinem Tod in Berlin am 16. September 1846 erscheinen auch die<br />
Militärisch>e Erinnerungen (Berlin 1845). Seine Sammlung <strong>von</strong> Miniaturen,<br />
Gemälden, historischen Gläsern u. a. wird nach seinem Tode zerstreut? Am 1.<br />
April 1810 bringt Minutoli einen »unmaßgeblichen Vorschlag zur Stiftung einer<br />
altertumsforschenden Gesellschaft« zu Papier 3 und hat dabei zunächst offenbar<br />
nur archäologische Gegenstände im Auge; auch Savigny, in der Nachschrift zum<br />
Berliner Plan, erhebt die Forderung, daß alle Eigentümer <strong>von</strong> Archiven und<br />
Urkunden, Korporationen und Individuen, gesetzlich <strong>für</strong> die Erhaltung derselben<br />
verantworlich gemacht werden sollen . Erinnerung ist die<br />
Funktion <strong>von</strong> Gedächtnis als Infrastruktur <strong>von</strong> Gesetzen, Institutionen, Speichern.<br />
Am 17. April 1810 wird Minutolis Entwurf anonym begutachtet, unter<br />
Vorschlag <strong>von</strong> fünf Rubriken: prähistorische Überreste, Statuen, Reliefs, Münzen,<br />
Malereien, Glasfenster, Inschriften, Schnitzereien, Glocken, Diplome, Siegel, seltene<br />
Handschriften, ungedruckte Chroniken, alte Gedichte, Lieder, Verträge,<br />
Adelsdiplome, Familien- und Städteurkunden und die Denkmäler aler Baukunst.<br />
Und dies nicht aus einem allgemeinen kulturhistorischen <strong>Im</strong>puls, sondern<br />
aufgrund der Erfahrung einer epistemologischen Ruptur, der Dislokation der<br />
Kulturgüter nach 1803, als alte Archive, Bibliotheken, Klöster aufgelöst oder<br />
umformatiert wurden . Diese zunächst also Texte wie Objekte<br />
Allgemeine Deutsche Bibliographie, 21. Bd., Neudruck der 1. Auflage <strong>von</strong> 1885, Berlin<br />
(Duncker & Humblot) 1970, 771 f. Julius, der Sohn Heinrichs v. Minutoli und Polizeipräsident<br />
Berlin während der März-Revolution, ist später an Ordnungsdispositiven<br />
der Gegenwart interessiert, wie sein Vater an denen der deutschen Vergangenheit:<br />
Julius schrieb Lieber das römische Recht auf dem linken Rheinufer (Berlin 1831), und<br />
Ueher das Straf- und Besserungssystem Europa's (Berlin 1843). ADB 21, 772-776<br />
Dazu Georg Winter, Zur Vorgeschichte der Monumenta Germaniae Historica, in:<br />
Neues Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, 47. Bd., unveränderte<br />
Neuausgabc Berlin (Weidmannsche Verlagsbuchhandlung) 1957, 1-30 (5ff)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 385<br />
umfassende Initiative setzt die Agenda <strong>für</strong> den späteren Berliner Plan, die Vorgeschichte<br />
des Editionsunternehmens der Monumenta Germaniae Historica als text<br />
on/^-Sammlung. <strong>Im</strong> Sommer 1814 - nach der Völkerschlacht <strong>von</strong> Leipzig - nimmt<br />
Minutoli seinen Plan wieder auf und legt ihn dem Archäologen und Professor der<br />
Altertümer an der Akademie der bildenden Künste Konrad Levezow vor, der daraufhin<br />
am 20. November einen Entwurf zur Konstitution einer deutschen altertumsforschenden<br />
Gesellschaft in Berlin ausarbeitet. Deren Zweck ist zuvorderst<br />
die Schaffung eines allgemeinen Nationalmuseums, »welches alle bildlichen Altertümer<br />
der Deutschen im Original oder in Zeichnungen und Abgüssen sowie die<br />
Beschreibungen und Nachrichten verlorener Monumente aufnähme«. Liegt der<br />
Akzent auf kulturgeschichtlicher Dokumentation statt auf kunsthistorischer<br />
Ästhetik, kann an die Stelle des Originals als Monument das Surrogat als Dokument<br />
treten. Der Dresdner Bibliothekar Gustav Klemm (1802-67) plädiert in einer<br />
verwandten Fantasie über ein Museum <strong>für</strong> die Culturgeschichte <strong>für</strong> einen entsprechend<br />
wissensarchäologischen Blick auf Kultur:<br />
»Dieß ist die wahre Unparteilichkeit und Gerechtigkeit des Historikers, dem die<br />
wegwerfende und bedauerliche Vornehmheit ganz fremd ist, mit welcher der<br />
Kunstdilettant auf die anspruchslosen Schnitzwerke der Eskimos oder die seltsamen<br />
Gruppen und krausen Gebilde der Chinesen, Mexicaner und Ägypter blickt<br />
und einem Rafael oder einen mediceischen Venus zueilt, um hier seine Kenntniß<br />
der Kunstsprache zu entfalten. Wie der Naturforscher die Bandwürmer, Scolopendern,<br />
Kröten und deren Genossen mit derselben Theilnahme betrachtet, <br />
so bieten dem Historiker die schmierigen Pelze und Geräthe der Bosjesman und<br />
Eskimo nicht minder Stoff zum Denken dar, als die Federkleider der Mexicaner<br />
oder die Marmorstatuen der Hellenen.« 4<br />
Klemms imaginäres Museum übersetzt die zehn Bände seiner Allgemeinen Cultur-<strong>Geschichte</strong>,<br />
deren Systematik und Inhaltsverzeichnis in mnemotechnische<br />
Räume - im Sinne der Hauptthese der vorliegenden Arbeit »eine speichertechnische<br />
Alternative zur narrativen Geschichtsschreibung«. 5 Das Manko solcher<br />
kulturgeschichtlichen Versuche liegt im Scheitern, im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong><br />
die archäologischen Sammlungen zu organisieren; als empirische Unternehmen<br />
bleiben sie Kompendien. Zu den deutschen Monumenten sollen <strong>für</strong> Levezov<br />
wichtige deutsche Sprach- und Literaturdenkmäler vor der Erfindung der<br />
Buchdruckerkunst zählen; eine vollständige Bibliothek gedruckter Werke über<br />
4 Vgl. Gustav Klemm, Allgemeine Cultur-<strong>Geschichte</strong> der Menschheit, 1. Bd.: Die Einleitung<br />
und die Urzustände der Menschheit, Leipzig (Teubner) 1843, Beilage: Fantasie<br />
über ein Museum <strong>für</strong> die Culturgeschichte der Menschheit, 352-362 (360f)<br />
5 Bernhard Siegert, Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pecuchet,<br />
in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft.<br />
5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-40 (35f)
386 MUSEUM<br />
die <strong>Geschichte</strong> und Altertümer der Deutschen soll angegliedert werden . Buchdruck ist hier jene Epochenschwelle, die deutsche Historie<br />
als Objekt <strong>von</strong> der Neuzeit, der Welt des Beobachters also trennt. Die Daten<br />
der Administration des Projekts aber sind durch die Schnittstelle zum Symbolischen<br />
markiert und verraten den <strong>Im</strong>puls der Freiheitskriege. Schon die Nachschrift<br />
zum Berliner Plan sucht die Konstitution der drei Landesgesellschaften<br />
in Preußen, Österreich und Bayern auf das symbolische Datum des 18. Oktober<br />
(1816) zu terminieren, und Lcvczow schlägt vor, am 15. Oktober jedes Jahres,<br />
also am Vortag der Schlacht bei Leipzig, zur Feier der »Wiedergeburt Deutschlands«<br />
eine allgemeine öffentliche Sitzung anzuberaumen .<br />
Dieser Gründungsmoment (arebe) ist nicht <strong>von</strong> Sachzwängen vorgegeben<br />
(datum), sondern folgt der Logik gedächtnisliturgischer Zeitrhythmik: Skandierung<br />
einer regelmäßigen Wiederkehr, die Verneinung <strong>von</strong> Vergangenheit. Ein<br />
Akt kurzfristiger Speichernutzung: »Dem Zwang des Kalenders folgend, hebt<br />
Erinnerung das Gedächtnis ins Leben. Der nächste Tag verdrängt es wieder. Die<br />
Vergangenheit bleibt, was sie ist: vergangen.« 6<br />
Der Mitgutachter und Historiker Christian Friedrich Rühs vollzieht dann<br />
die Abwendung <strong>von</strong> der anfänglich unter kulturarchäologischem Vorzeichen<br />
stehenden Tendenz zu einer allgemeinhistorischen Fassung des Plans, indem er<br />
den Unterschied zwischen der klassischen Archäologie und der allein auf historischer<br />
Forschung zu begründenden deutschen Altertumskunde definiert<br />
. Hat Levezows Entwurf noch »subsidiarische Untersuchungen<br />
über die Altertümer der Griechen und Römer« vorgesehen, deren Ziel<br />
die Edition eines »Preußischen Museums der alten klassichen Denkmäler sein<br />
würde« , löst sich Rühs <strong>von</strong> der humanistischen Metahistorie.<br />
Der Einzug des Diskurses der Historie geht mit einer Renaissance des nationalen<br />
Mittelalters im Gegensatz zum kosmopolitischen Neoklassizismus einher.<br />
Rühs' Unvorgreißiche Gedanken über eine Gesellschaft <strong>für</strong> das deutsche Altertum<br />
(Berlin, 14. Dezember 1814) stellen fest, daß offenbar Begriffe, die mit dem<br />
Studium der griechischen und römischen Archäologie und Antiquitäten verbunden<br />
sind, auf deutsche Altertumskunde nicht anwendbar sind:<br />
»In jenen ist der Stoff etwas Abgeschlossenes und Vollendetes; sie sind nicht bloß<br />
um ihrer selbst willen, sondern auch in lierarischer und ästhetischer Hinsicht<br />
wichtig und unentbehrlich; in der deutsche Altertumskunde können wir aber nur<br />
die Keime und den Anfang eines noch fortdauernden Zustandes erkennen und die<br />
Zwischenglieder und Metamorphosen aufsuchen, durch welche noch Vorhandenes<br />
sich in seine bestehende Form hinübergebildet hat: ihr eigentliches Interesse<br />
ist also, außer dem vaterländischen, nur ein historisches.« <br />
Harry Pross, Magie der runden Zahlen, in: Die Zeit Nr. 13 v. 24. März 1989
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 387<br />
Monumentale, diskrete Archäologie tritt hier in Widerstreit zur dokumentarischen,<br />
integrativen Historie; die rhetorischen Tropen Metapher und Metonymie<br />
sind am Werk. Das Ziel der zu gründenden Gesellschaft ist denn auch <strong>von</strong> Herders<br />
Geschichtsbegriff imprägniert: Sammlung, Herstellung, Prüfung und Erläuterung<br />
aller Quellen, woraus sich »das Sein und Leben des deutschen Volks nach<br />
allen Richtungen als ein organisches Ganzes <strong>von</strong> seinen frühesten, der Forschung<br />
zugänglichen Zustande durch alle Übergänge bis in die bestehenden Verhältnisse<br />
begreifen und verfolgen läßt« . Vaterland, Volk und Publikum<br />
treten als Kollektivsingulare an die Stelle des klassischen Referenten der<br />
Historie - »in dem Licht einer großen Volksangelegenheit , worin jedes<br />
Besondre verschwindet« . Diese Semantik liest sich ein Jahr nach<br />
der Leipziger Völkerschlacht konkret, die den Volksbegriff militärisch fundiert<br />
und einhundert Jahre später als anonymer Denkmaltypus symbolisch zur Verwirklichung<br />
kommt. 7<br />
»Es muß daher selbst der Zusatz des preußischen Staates wohl wegfallen, der als<br />
solcher kein Altertum hat; diese Unterordnung des Individuellen muß aber<br />
dem preußischen Staat, <strong>von</strong> dem der Gedanken ausgeht und angeregt wird, einen<br />
neuen Glanz und ein erhöhtes Anrecht auf das allgemeine Vertrauen der Deutschen<br />
erteilen. Daher sind auch die Altertümer aller andern nicht germanischen<br />
Völker <strong>von</strong> der Beschäftigung dieses Vereins <strong>von</strong> selbst ausgeschlossen« ,<br />
im Unterschied etwa zum Universalismus des British Museum im Seereich England:<br />
ein <strong>Im</strong>perium bedarf keines emphatischen Geschichtsbegriffs. Und<br />
»Großbritannien besitzt in der Westminster Abbey den wohl eindrucksvollsten<br />
Ort geschichtlicher Erinnerung: sie macht ein Geschichts-Museum überflüssig.«<br />
8 Rühs kontrastiert den deutschen Befund, die deutsche Fundlage mit<br />
der englischen Society of Antiquaries: »Einzelnes Schönes und Gründliches<br />
schwimmt allerdings in dem Ozean der Archaeologia britannica, aber es fehlt<br />
alle Beziehung auf einen Zusammenhang und vieles ist deswegen völlig bedeutungslos<br />
und nichtig« . Preußen als Metonymie<br />
Deutschlands ist ein <strong>Im</strong>puls, der institutionell die Projekte der historischen Mo-<br />
7 Dazu W. E., Präsenz der Toten und symbolisches Gedenken: Das Völkerschlachtdenkmal<br />
zwischen Monument und Epitaph, in: Katrin Keller / Hans-Dieter Schmid<br />
(Hg.), Vom Kult zur Kulisse. Das Völkerschlachtdenkmal als Gegenstand der Geschichtskultur,<br />
Leipzig (Universitätsverlag) 1995, 62-77<br />
% Stellungnahme des Vorsitzenden des Gesamtvereins der deutschen Gesehiehts- und<br />
Altertumsvereine: Zur Konzeption <strong>für</strong> ein »Deutsches Historisches Museum«, in: Der<br />
Archivar Jg. 40, H. 2 (1987), Sp. 196-199 (Sp. 196). Der Gesamtverein, vormals bereits<br />
Träger des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg auf Sammlungsinitiative des<br />
Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß, plädiert vielmehr <strong>für</strong> eine Supplementierung des GNM durch<br />
eine Abteilung »Deutsches Historisches Museum« (Sp. 198).
388 MUSEUM<br />
bilisierung des deutschen Gedächtnisses bis hin zur Preußischen Historischen<br />
Station in Rom (seit 1888) charakterisiert, gleichzeitig aber problematisch wird<br />
in Spannung mit dem 1871er Reich. »Mit vaterländischem Sinn betrachtet«<br />
könne auch der kleinste Rest aus dem Altertum, eine zerbrochene Scherbe etwa,<br />
»teuer werden und die Betrachtung an sich ziehn; aber in wissenschaftlicher<br />
Hinsicht wird das Einzelne nur dann bedeutend, wenn es in ein Ganzes eingefügt<br />
zur Erläuterung und zum Verständnis desselben beiträgt« . Es spricht sich die Trope der Synekdoche, also des narrativen<br />
Dokuments parspro toto im Unterschied zur Archäologie des diskreten Monuments,<br />
wenn im Speziellen Allgemeines, im Zufälligen Gemeingültiges gesucht<br />
wird, ganz im Sinne der reziproken Macht- und Kulturpoetik des new historicism:<br />
»das Allgemeine und Gemeingültige auch im Kleinen, im Alltäglichen, im<br />
Lokalgeschichtlichen«. 9 Rühs definiert zunächst »die antiquarische Richtung«,<br />
also die geschichtsvektor-orientierte Sammlung aller Denkmäler, »der uneigentlichen<br />
sowohl als eigentlichen, die aus der frühsten Vorzeit übrig sind«.<br />
Auch Ruinen und Gemälde sind »nicht bloß um des ästhetischen Zwecks willen<br />
sondern auch um <strong>von</strong> denselben die Vorstellungen über Trachten, Gebräuche<br />
und Lebensart abzuziehn und zu berichtigen« . Eine dokumentationswissenschaftliche Semiotik der Information tritt an<br />
die Stelle der Schatzsuche. 10 <strong>Im</strong> Vorwort zur englischen Ausgabe <strong>von</strong> A Century<br />
of Arcbaeological Discoveries des Straßburger Archäologen Adolf Michaelis<br />
erinnert sein britischer Kollege P. Gardner daran, daß seit dem Beginn der<br />
deutschen Grabungen im antiken Olympia archäologische Funde nicht mehr in<br />
die Nationalmuseen der ausgrabenden Länder gelangten, sondern im Gastland<br />
verblieben. Seitdem verläßt kein Objekt mehr Griechenland:<br />
»All that the western nations are now allowed to gain by work in the East is knowledge.<br />
We have reached the scientific stage of discovery. And since knowledge<br />
has thus been put in the place of actual spoil, it is natural that excavation has been<br />
conducted in a more orderly and scientific way, find spots and circumstances of<br />
finding being recorded with great exactness.« 11<br />
Wenn - wie 1875 - Information und Aufzeichnung an die Stelle der ästhetischen<br />
Versammlung materieller Objekte treten, ist der Schritt zur Archäologie als<br />
9 Arnold Esch, Forschungen in Toscana, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom<br />
1888-1988, hg. v. Reinhard Elze / Arnold Esch, Tübingen (Niemeyer) 1990, 209<br />
10 Siehe Wolfgang Struck, <strong>Geschichte</strong> als Bild und als Text. Historiographische Spurensicherung<br />
und Sinnerfahrung im 19. Jahrhundert, in: Zeichen zwischen Klartext und<br />
Arabeske, hg. v. Susi Kotzinger u. Gabriele Rippl, Amsterdam / Atlanta, GA (Rodopi)<br />
1994,349-361<br />
11 Adolf Michaelis, A Century of Archaeological Discoveries, London (John Murray) 1908,<br />
x (dtsch.: Ein Jahrhundert Kunstarchäologischer Entdeckungen, 2. Aufl. Leipzig 1908)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 389<br />
Datenverarbeitung vollzogen. Damit korrespondiert ein asketischer Begriff <strong>von</strong><br />
Historie, der Daten, nicht <strong>Geschichte</strong>n publiziert. Auch wenn Eichhorn und<br />
Andere im Umkreis des Berliner Plans den Mangel einer geschriebenen gesamtdeutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> bedauerten, ging ihr Vorschlag schlicht in Richtung einer<br />
Sammlung historischer und urkundlicher Quellen - kein historiographischer<br />
Auftrag. 12<br />
Sammlung, nicht Geschichtsschreibung: Hierin liegt die strukturale Analogie<br />
des Plans der ausdrücklichen »Anlegung eines großen deutschen Nationalmuseums«<br />
(Gutachten Karl Friedrich Eichhorn, 16. Dezember 1814) zur Konzeption<br />
der MGH. Das Stakkato Töllners faßt dieses Gutachten unter Stichworten<br />
zusammen, die kybernetische Begriffe der Medienkommunikation meinen:<br />
»Stiftung eines deutschen Nationalmuseums. Sammeln - Mitteilen - Darstellen.<br />
Errichtung eines Kunst- und Denkmalinventariums mit sachkundigen Erläuterungen.<br />
Forderung nach einem weitgesteckten Rahmen. Warnung vor Zersplitterung,<br />
Wahrung des Zusammenhangs. Öffentlichkeitsarbeit« . Die Emphase auf Sammlung erklärt sich aus dem Kontext eines konkreten<br />
Syntheseverlusts, den der Kollektivsingular <strong>Geschichte</strong> (hier konkret versammelnd)<br />
erst allmählich zu supplementieren versteht. Die Ortsangabe dieser<br />
Situation heißt Jena, wo mit der Niederlage gegen Napoleon 1806 Preußen<br />
zugrunde gegangen war. Nicht <strong>von</strong> ungefähr liest hier Hegel, der später <strong>Geschichte</strong><br />
als Philosophie ausformuliert; konkret hält 1808 auch der Historiker<br />
Heinrich Luden eine Reihe öffentlicher Vorlesungen, die wenig später unter<br />
dem Titel Einige Worte über das Studium der vaterländischen <strong>Geschichte</strong> (Jena<br />
1810) veröffentlicht werden. Demzufolge stand Deutschland auf dem Grab des<br />
Heiligen Römischen Reiches; die Verfassung, <strong>für</strong> welche die Generation der<br />
Vorfahren gelebt hatte, liege teils selbstverschuldet, teils <strong>von</strong> Feinden zertrümmert<br />
am Boden. Seine Generation hat sie zusammenbrechen sehen; historisch<br />
ist sie Vergangenheit, doch als politarchäologische Ruine steht sie vor aller<br />
Augen . Ludens Publikation ist an einen Adressaten errichtet,<br />
der als Interpretant selbst Zeichen und überhaupt erst konstituiert werden<br />
mußte - das deutsche Volk, und so besteht sein sein Denkmal zunächst aus reinen<br />
Vorlesungen, die Monumentalität erst in Buchform gewannen. <strong>Im</strong>merhin<br />
hat dieses Denkmal ein Fundament - diskursiv, in der Jenenser Hörerschaft <strong>von</strong><br />
1810 und im pupular memory (Crane). Während in Berlin also Pläne zu einer<br />
12 Susan Crane, Collecting and Historical Consciousness in Early Nineteenth-Century<br />
Germany, Ithaca / London (Cornell University Press) 2000, 132, unter Bezug auf<br />
einen Brief v. 31. Mai 1816 an das Ministerium des Innern zur Begründung einer<br />
Historischen Gesellschaft, unterzeichnet <strong>von</strong> Altenstein, Ancillon und Staegemann<br />
sowie <strong>von</strong> Rühs, Eichhorn, v. Savigny und Niebuhr, Geh StaAr PK Berlin, Rep. 76 Vc<br />
Sekt. 1, Tit. 11, Teil 1, Bl. 1 (siehe Winter 1957: 3)
390 MUSEUM<br />
Sammlung deutscher Altertümer geschmiedet werden, versucht ein Philosoph,<br />
diese Formen der Aneignung <strong>von</strong> Vergangenheit (als Gedächtnis) auf den<br />
Begriff der <strong>Geschichte</strong> (als Erinnerung) zu bringen. Crane definiert den Überrest<br />
in Anlehnung an Hegels Begriff des Gefühls als leere Form, die der Füllung<br />
mit historischem Sinn, also der Aufwertung zum Denkmal harrt, denn die Vergangenheit<br />
ist nicht das, was überlebt, sondern die Spur dessen, was einmal<br />
gelebt hat. »Erinnerung (remembrance or memory) is literally an internalization,<br />
a >bringing in< or filling up (er-innern) with meaning« .<br />
Das Gedächtnis ist ein technisches Gestell, Erinnerung eine Information, die<br />
sich erst in diesem Kontext erkennt. Der historische Diskurs wird implementierbar<br />
erst, wenn dieses Dispositiv bereitgestellt ist.<br />
Ästhetische Dispositive des GNM<br />
Romantische <strong>Im</strong>agination vermag Vergangenheit halluzinativ zu vergegenwärtigen;<br />
ein mit dem literarischen Genre des Romans geladener Diskurs wird der<br />
archäologischen Konfrontation mit den überkommenen Trümmern der Tradition<br />
implementiert - als fiktionales Movens, das die realen Module in Bewegung<br />
setzt und rekonfiguriert. Am 24. Juni 1829 betritt der junge Ritter Freiherr<br />
Joseph <strong>von</strong> Laßberg die Ruine Burg zu Trifels bei Anweiler, der alte Sitz Kaiser<br />
Friedrichs I. (und Reichsschatzkammer): »rechts gieng eine türe in die kapelle<br />
und ich trat mit einer solchen rürung hinein, dass mir schon da die hellen tränen<br />
aus den äugen fielen; den ich dachte an alle die männer, die vor mir darin gestanden<br />
hatte.« Dieses Erlebnis (der dortige Ritterschlag durch seinen Oheim) ist<br />
ihm auch 1839 noch gegenwärtig; historische <strong>Im</strong>agination fungiert als mnemische<br />
Energie: »zum 53. male vergegenwärtige ich mir ort und zeit, gesichter und<br />
auch die kleinsten handlungen und umstände, die bei dieser heiligen handlung<br />
mir vorkamen, und gottlob! auch heute noch mit derselben lebendigkeit des<br />
fülens als damals.« 13 Gedächtnisarbeit heißt: Daten aus dem Speicher zu laden;<br />
ihr diskursives Aktivierungsprogramm heißt Historie als Erzählung. Mit dem<br />
Reichsdeputationshauptschluß <strong>von</strong> 1803, der Aufhebung des Johanniterordens,<br />
der Mediatisierung der meisten deutschen Fürsten und auch der Reichsritterschaft<br />
1806, kurz: mit dem Ende des alten Deutschen Reiches, schienen diese in<br />
der Tiefe der Tradition wurzelnden Institute vernichtet. Der Wiener Kongreß<br />
bot noch einmal die Gelegenheit zu ihrer Wiederbelebung. Fast parallel, gera-<br />
13 Zitiert nach: Volker Schupp, Joseph <strong>von</strong> Laßberg als Handschriftensammler, in:<br />
»Unberechenbare Zinsen«. Katalog zur Ausstellung der vom Land Baden-Württemberg<br />
erworbene Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek, hg. v.<br />
Felix Heinzer, Stuttgart (Württembergische Landesbibliothek) 1993, 14-33 (16f)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 391<br />
dezu kompensatorisch konstituierte sich in Wien ein bürgerliches Pendant, das<br />
die wissenschaftlichen Bestrebungen des als hessischer Legationssektretär beim<br />
Kongreß tätigen Jacob Grimm unterstützen soll: jene Gesellschaft, die hinter der<br />
Absendung seines berühmten Zirkulars wegen Aufsammlung der Volkspoesie<br />
steht. »Freilich, auch Jacob Grimm war bei der Volksepik auf die schriftliche<br />
Fixierung angewiesen« . Logos heißt Lese/n als Sammlung.<br />
In diesem Moment taucht in Wien die Nibelungenhandschrift auf. 14 Schupp registriert<br />
eine semiotische Verschiebung in der Motivation Laßbergs: Von der Wiener<br />
Zeit an geht es ihm um die Rettung der mittelalterlichen Hinterlassenschaften<br />
des deutschen Adels. Die Bewahrung des Nibelungenliedes <strong>für</strong> die Donaueschinger<br />
Bibliothek der Fürsten zu Fürstenberg war in diesem Kontext eine<br />
patriotische Tat (Schupp), um den Kauf durch den englischen Lord Spencer<br />
Marlborough (einen bekannten Bibliomanen) zu verhindern: »Einem britischen<br />
Knochenvergraber sollte er zu Theil werden, und <strong>für</strong> Deutschland, <strong>für</strong> unser<br />
Schwabenland auf ewig verloren sein!« .<br />
Nachspiel: 1982 werden drei Stücke aus der Handschriften-Sammlung Laßbergs<br />
in das Gesamtverzeichnis national wertvollen Kulturgutes und national wertvoller<br />
Archive eingetragen (Erbe = Inventar); zehn Jahre später trägt sich das<br />
Haus Fürstenberg mit dem Gedanken an den Verkauf der Handschriften-Sammlung,<br />
die bereits in einem Züricher Freihafen lagerte, um dort der deutschen<br />
Gesetzgebung (Kulturgüterliste) entzogen zu sein. Schließlich kauft das Land<br />
Baden-Württemberg 1993 die Handschriften an. 15 Das Gesetz zum Schutz deutschen<br />
Kulturgutes gegen Abwanderung vom 6. August 1955 16 hat ein solches<br />
Verzeichnis initiiert; der Schrift-Akt der Eintragung <strong>von</strong> Artefakten und Archivalien<br />
macht sie zum Bestandteil nationalen Kulturguts. 17 Parallel dazu ist auch<br />
das kulturgeschichtliche Museum das Register der Objekte; 1922 wird die Tätigkeit<br />
des Germanischen Nationalmuseums mit nur als »Rettungsanstalt <strong>für</strong> das<br />
Kulturgut vergangener Jahrhunderte« definiert, sondern mit dem Hinweis<br />
14 Dazu Uwe Meves, Barthold Georg Niebuhrs Vorschläge zur Begründung einer wissenschaftlichen<br />
Disziplin »Deutsche Philologie« (1812-1816), in: Zs. f. Deutsche Philologie<br />
104 (1985), 321-356<br />
15 Hans-Peter Geh, Die Erwerbung der Handschriften-Sammlung der F.F. Hofbibliothek<br />
Donaueschingen durch das Land Baden-Württemberg, in: Katalog »Unberechenbare<br />
Zinsen«, op. cit., 1-4 (2f)<br />
16 Bundesgesetzblatt Teil I, 1955, 501 ff; wiedergegeben in: Der Archivar. Mitteilungsblatt<br />
<strong>für</strong> deutsches Archivswesen, Dezember 1955, 7. Jahrgang Heft 4, 381-384<br />
17 Registriert (schriftlich wie mikro-photographisch) wird im Moment des Vcrlusts: Eine<br />
Verzeichnung der Donaueschingcr Bibliothek steht erst angesichts ihrer drohenden<br />
Dissemination in die Auktionshandel an. Aktuell dazu Christof Siemes, Der Nibelungen<br />
Not. Warum die Hofbibliothek <strong>von</strong> Donaueschingen nun endgültig in alle Winde<br />
zerstreut wird, in: Die Zeit v. 2. September 1999, 40f
392 MUSEUM<br />
begründet, es gelte »wertvolle deutsche Kunstwerke vor der Gefahr der Abwanderung<br />
ins Ausland zu retten«, und an diese Vorstellung vom Museums als der<br />
wird seitdem immer wieder erinnert. 18<br />
Nach der Leipziger Völkerschlacht <strong>von</strong> 1813 leitet sich Geschichtsbewußtsein<br />
nicht mehr <strong>von</strong> transzendenten Mächten, sondern vom <strong>Namen</strong> des Volkes ab.<br />
Kurze Zeit nach der Diskussion des Steinschen Planes zur Edition der Monumenta<br />
Germaniae historica verfaßt der hessische Landschaftsmaler Georg Wilhelm<br />
Issel 1817 eine Denkschrift Über deutsche Volksmuseen. Einige fromme<br />
Worte über Museen deutscher Alterthümer und Kunst. Er forderte darin »die<br />
anschauliche Zusammenstellung alles desjenigen, was die Sitten und<br />
Gebräuche des Vaterlandes <strong>von</strong> der ältesten bis zu den neuern Zeiten zu bezeichnen<br />
und zu versinnlichen vermag« 19 , rekurriert also auf den symbolischen Mehrwert<br />
der musealen Ausstellung gegenüber reiner Objektmagazinierung. Noch<br />
hat das Nationalmuseum keine genuin historische Ausformulierung gefunden;<br />
zur Aufnahme der Sammlungen denkt er sich eine ästhetische Kirche, »ein würdiges<br />
in deutschem Stil aufgeführtes Gebäude«, das eine Scheinkapelle, eine Kirchenschatzkammer,<br />
ein Grabgewölbe, eine Waffenkammer, einen Rittersaal,<br />
einen Fürstensaal, Räume mit Vasen und Geräten, Architektur, Skulptur, Malerei,<br />
altdeutsche Literatur und einen der Reformation geweihten Raum enthält.<br />
Die vergangene Epoche ist hier noch nicht genuin historisch begriffen, sondern<br />
liegt als Hohlform vor, die nun aber mit historischer <strong>Im</strong>agination auratisch aufgeladen<br />
wird. Der Berliner Kunsthistoriker Herman Grimm fordert in seinem<br />
idealen Entwurf eines Museum <strong>für</strong> vaterländische Kunstgeschichte 1891, die<br />
Materialität der Kultur gegenüber ihrer Unterwerfung durch die Schrift der<br />
<strong>Geschichte</strong> zu emanzipieren, also »nicht bloß die geschriebenen Monumenta<br />
historica Germaniae dem Volke nahe zu bringen«; ein Museum ist »eine <strong>von</strong> den<br />
Stätten, wo zu denen, die in Worte kein Vertrauen mehr setzen wollen, die Steine<br />
redeten. Die Steine, und neben ihnen die leichten Pinsel- und Federzüge, die die<br />
Hand unserer großen Maler zog.« 20 Die neuen Kunstsammlungen werden mit<br />
Vorliebe in mittelalterlichen, seit der Säkularisation ungenützten Bauten eingerichtet;<br />
zum inneren Objekt dieses architektonischen Verhältnisses wird in<br />
Nürnberg der leere Schrein der abwesenden Reichskleinodien in Wien. 1806 soll<br />
das Augsburger ehemalige Ursulinenkloster (dem Modell des Pariser Musee des<br />
18<br />
Burian 1978:224, zitiert hier den Jahresbericht des GNM 69 (<strong>für</strong> 1922), 1922,1, u. Jahresbericht<br />
GNM 77 (<strong>für</strong> 1930), 1930, 2<br />
19<br />
Zitiert nach: Karl Lohmcycr, Aus dem Leben und den Briefen des Landschaftsmalers<br />
und Hofrats Georg Wilhelm Issel, in: Neues Archiv <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> der Stadt Heidelberg<br />
XIV, Heft 3 u. 4, Heidelberg 1929, 189 u. 314f<br />
20<br />
Herman Grimm, Das Universitätsstudium der Neueren Kunstgeschichte, in: Deutsche<br />
Rundschau Bd. LXVI Qan. - März 1891), 390-413 (413)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 393<br />
monuments frangais Alexander Lenoirs entsprechend 21 ) als Depot <strong>für</strong> einen Teil<br />
der Münchener Altertümersammlungen dienen 22 ; das neue Gedächtnis besetzt<br />
die Ruinen liturgischer Autorität. 23 Doch muß der spätere Gothische Raum des<br />
Bayerischen Museums in München durch Gabriel <strong>von</strong> Seidl im Zuge der<br />
Umbauten zwischen 1894 und 1900 historistisch imitiert werden; historische<br />
Atmosphäre liegt nicht mehr im Raum, sondern wird ihm aufgetragen und eingeschrieben.<br />
Der architektonische Schrein des Germanischen Nationalmuseums,<br />
die Katharinenkirche, dient 1938 seinerseits der Aufstellung der zurückgekehrten<br />
Reichskleinodien - Rückkopplung <strong>von</strong> Aura und Objekt. 24<br />
1852: Distanz zu Rom und Schnittstellen zwischen GNM und RGM<br />
Das Germanische Nationalmuseum kommt 1852 bei der Gründung des Gesamtvereins<br />
Deutscher Geschichts- und Altertumsvereine unter der Schirmherrschaft<br />
des Kronprinzen Johann <strong>von</strong> Sachsen zustande; analoge Initiativen haben die<br />
Grammatik da<strong>für</strong> vorformuliert. Die Statuten des Vereins <strong>von</strong> Alterthumsfreunden<br />
im Rheinlande (Fassung vom 1. Oktober 1841) definieren im Ersten Abschnitt,<br />
§ 1, das Programm solcher Unternehmen, die Datensammlungen als<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> überhaupt erst lokal wieder generierten:<br />
»Unter dem <strong>Namen</strong> >Verein <strong>von</strong> Alterthumsfreunden im Rheinlande< bildet sich<br />
eine Gesellschaft, bestimmt <strong>für</strong> die Erhaltung, Bekanntmachung und Erklärung<br />
antiker Monumente aller Art in dem Stromgebiete des Rheins und seiner Nebenflüsse<br />
<strong>von</strong> den Alpen bis an das Meer Sorge zu tragen, ein lebhafteres Interesse<br />
da<strong>für</strong> zu verbreiten und, soviel möglich, die Monumente aus ihrer Vereinzelung in<br />
öffentliche Sammlungen zu versetzen.« 25<br />
Diese Satzung schreibt sich in enger Anlehnung an das 1828/29 in Rom gegründete<br />
Istituto di correspondenza archeologica, dessen regolamento bestimmt, »alle<br />
21<br />
Stephen Bann, Poetik des Museums. Lenoir und Du Sommerard, in: Jörn Rüsen / W.<br />
E. / Heinrich Th. Grütter (Hg.), <strong>Geschichte</strong> sehen. Beiträge zur Ästhetik historischer<br />
Museen, Pfaffenweiler 1986, 35-49<br />
22<br />
Volker Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790-1870, München 1967, 28f, unter<br />
Bezug auf: Gudrun Calov, Die Museumskirche, in: Festschrift Eduard Trautscholdt,<br />
Hamburg 1965, 20-38<br />
23<br />
Zur »Kunst als säkularisierte Kirche« siehe Bazon Brock, Ästhetik gegen erzwungene<br />
Unmittelbarkeit. Die Gottsucherbande. Schriften 1978-1986, hg. v. Nicola <strong>von</strong> Velsen,<br />
Köln (DuMont) 1986, 53-57<br />
24<br />
Abb. 81 in: Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg 1852-1977. Beiträge zu seiner<br />
<strong>Geschichte</strong>, im Auftrag des Museums hg. v. Bernward Deneke u. Rainer Kahsnitz,<br />
München (Deutscher Kunstverlag) 1978, 84<br />
25<br />
Zitiert nach Abb. 6a in: Gabriele John, 150 Jahre Verein der Altertumsfreunde im<br />
Rheinlande, Köln (Rheinland-Verlag) 1991
394 • MUSI-UM<br />
archäologischen, d. h. auf Architektur, Skulptur und Malerei, Topographie und<br />
Epigraphik bezügliche Tatsachen und Entdeckungen« zu sammeln und bekanntzumachen,<br />
»damit sie auf diese Weise vor dem Verlorengehen befreit und<br />
durch Konzentration an einem Punkte wissenschaftlich nutzbar gemacht würden«<br />
- ein Akt der Inventarisierung mehr denn<br />
eine Funktion <strong>von</strong> Geschichtsbewußtsein. Welcker warnt die Philologenversammlung<br />
vor einer Historisierung der Altertumswissenschaften; insofern<br />
transformierte der Bonner Verein janusköpfig als Beispiel <strong>für</strong> »den neuen Typ<br />
historischer Wissenschaft, als dessen Inbegriff der [frühe] Historismus gelten<br />
soll, ohne vorerst die humanistische Tradition aufzugeben.« 26 <strong>Im</strong> Verlauf<br />
des Jahrhundert vollzieht sich der Ersatz der Antike durch das Mittelalter als<br />
Vereinsfokus. Die Archiv genannte Artefaktensammlung des Vereins verrät die<br />
Nähe <strong>von</strong> Archäologie und Archiv; das Bücherregal heißt Repositum. Seit den<br />
Napoleonischen Kriegen ist das archäologische Bewußtsein im deutschsprachigen<br />
Raum mehr denn je nicht humanistisch, kosmopolitisch und neoklassizistisch,<br />
sondern auch national akzentuiert; Klassische und Provinzialrömische<br />
Archäologie differenzieren sich aus und <strong>von</strong>einander ab. Ludwig Urlicht aber,<br />
vormals Hauslehrer beim preußischen Gesandten Bunsen in Rom, 1840 zurückgekehrt<br />
und in Bonn im Fach Klassische Philologie habilitiert, fordert, auch im<br />
Rheinland die antike Kunst »nicht <strong>von</strong> einer Ecke, sondern vom Mittelpunkt<br />
des Gebäudes her zu betrachten«, und das heißt Rom. Keine antiquarische<br />
Tätigkeit mit Anspruch auf Wissenschaftlichkeit könne sich »ungestraft dem<br />
Einfluß des Instituts <strong>für</strong> Archäologische Korrespondenz« entziehen. 27 Diese<br />
Geschichtsperspektive ist noch nicht national kartographiert. Unter Hinweis<br />
auf die archäologischen Grundlagen modernen Staatsrechts vermerkt später<br />
Theodor Mommsen: »Keine politische und keine historische Forschung im<br />
grossen Stil kann absehen <strong>von</strong> Rom.« Franz Kugler dagegen will anläßlich <strong>von</strong><br />
Fund und Sicherstellung eines Knüpfteppichs in der Quedlinburger Stiftskirche<br />
»endlich anfangen, statt über jeden antiken Scherben Dissertationen zu<br />
schreiben, die Gegenstände, an welche die Culturgeschichte unseres Vaterlandes<br />
sich knüpft, ihrem Untergange zu entreißen!« 28 Die textile Knüpftechnik<br />
fungiert hier als Metonymie des Textes der deutschen Historie, nicht mehr in<br />
<strong>Geschichte</strong>n Roms verstrickt.<br />
Nachdem die im August 1852 in Dresden tagende Versammlung deutscher<br />
Geschichts- und Althertumsforscher die Gründung eines germanischen Natio-<br />
26 Ebd., 13, unter Bezug auf U. Muhlack<br />
27 BonnerJahrbücher4(1844), 197, zitiert nach: John 1991: 12<br />
28 Franz Kugler, Kunstbemerkungen auf einer Reise in Deutschland im Sommer 1832.<br />
Quedlinburg, in: Museum 1 (1833), 165f, zitiert nach: Klaus Voigtländer, Die Stiftskirche<br />
St. Servatii zu Quedlinburg, Berlin (Akademie) 1989, 31
DAS GKRMANISCHF. NATIONAI.MUSEUM IN NÜRNBERG 395<br />
nalmuseums beschlossen hat, erfolgt auf der Versammlung in Mainz, September<br />
1852, sodann die Gründung eines dortigen Museums <strong>für</strong> römisch-germanische<br />
Altertümer in Deutschland. Aufseß unterstützt diese Initiative und<br />
bedingt sich <strong>für</strong> das in Nürnberg geplante Museum »nur die Repertorien über<br />
die römischen Alterthümer nebst Zeichnungen und Gypsabgüssen <strong>von</strong> denselben«<br />
aus, »soweit sie mit dem germ. M. in Verbindung stehen«. 29 Nicht auf<br />
der Ebene der Objekte, sondern der Repertorien ist das GNM der Zentralspeicher<br />
der Nation. In der Folgezeit stellte sich die Frage nach dem Verhältnis<br />
beider Institutionen, die im Begriff der germanischen Kultur eine gemeinsame<br />
Schnittmenge bilden. In einem Antwortschreiben des GNM-Vorstands vom<br />
26. Mai 1853 an den Vertreter des römisch-germanischen Museums in Mainz<br />
erklärt <strong>von</strong> Aufseß seinen Wunsch, daß die beiden Museen »ein Körper seien<br />
und eine Verfassung hätten« . Die institutionelle Anbindung aber differiert:<br />
»Ihr habt euch, anstatt dem germ. M., dem Centralvereine angeschlossen<br />
und euere Sammlung ist Eigenthum des Vereines, während unser Museum<br />
Eigenthum der deutschen Nation, d., h. Stiftungsgut <strong>für</strong> deise ist, ewig, unantastbar<br />
und untheilbar.« Vielmehr plädierte Aufseß <strong>für</strong> den Anschluß des<br />
Mainzer Museums an sein Haus, »als die Abtheilung desselben, welche gerade<br />
am Rheine den klassichen Boden hat, als die röm.-germ. des Heidenthums«<br />
. Der Sammlungsgegenstand<br />
des GNM ist schließlich der Raum, das imperium des Heiligen<br />
römischen Reiches deutscher Nation. Dann und in der territorialen Präsenz<br />
Roms auf deutschem Boden liegt eine doppelte Bindung, die Wiederanbindung<br />
der durch die archäologische Kluft <strong>von</strong> der deutschen <strong>Geschichte</strong> getrennten<br />
Epochen:<br />
»Unser Museum soll nicht blos ein kulturhistorisches sein, es soll auch ein historisches<br />
werden. so muß sich unwillkürlich der Wunsch aufdrängen, auch die<br />
Denkmäler jener deutschen Männer zu sehen, welche gelebt haben, ehe die deutsche<br />
Kunst selbständige größere Denkmäler zu errichten vermochte; es wird<br />
erwünscht sein, die Darstellung der urgermanischen Völkerschaften aus den Denkmälern<br />
der Römer kennen zu lernen, und so dürfte wol den jetzt bereits bestehende<br />
Einzelsammlungen des Museums einstens eine weitere anzufügen sein, die<br />
den Beginn der Betrachtung dann machen wird, indem sie <strong>von</strong> klassisch-römischen<br />
Denkmälern alle diejenigen umfaßt, die zur deutschen <strong>Geschichte</strong> in irgend welcher<br />
Beziehung stehen, so alle Darstellungen <strong>von</strong> Germanen auf römischen Monumenten,<br />
so alle die Statuten und Porträtbüsten derjenigen Römer, welche mit den<br />
Germanen gekämpft oder in sonstiger weise Einfluß auf Deutschlands Geschicke<br />
hatten.« <br />
29 Drucksache: Bericht über das Verhältnis des germanischen Museums zu dem römischgermanischen<br />
Museum in Mainz (1856), zitiert aus dem Exemplar im Archiv des<br />
GNM, Akten zur Vorgeschichte des GNM, Karton la, 2
396 MUSEUM<br />
Das Mainzer Haus jedenfalls widersetzt sich den wiederholten Vereinnahmungsbegehren<br />
<strong>von</strong> Seiten des GNM Nürnberg aus Gründen, die mit dem<br />
Beharrungsvermögen einmal instutuierter Speicher eher institutions- denn methodengeschichtlich<br />
plausibel sind. 30<br />
Museum und Germanistik als Medien der Kulturgeschichte<br />
Nach 1806 regeneriert Geschichtsbewußtsein als deutsches sich in den Regionen;<br />
das bedeutet Wissensarchäologie in situ. Obgleich sich der königlich-sächsische<br />
Altertumsverein in den ersten Jahren zunächst vorzugsweise die Aufgabe gestellt<br />
hat, überall <strong>für</strong> die Erhaltung der in den verschiedenen Teilen des Königreichs<br />
zerstreuten Denkmäler früherer Jahrhunderte »an dem Orte ihrer ursprünglichen<br />
Bestimmung Sorge zu tragen«, ergibt sich die folgerichtige Notwendigkeit,<br />
»bereits zurückgestellte und in Vorrathsräumen einem sichern Untergange<br />
entgegen gehende Kunstwerke durch die Aufnahme in ein Vereinsmuseum zu retten«<br />
und Gegenständen, »die einzeln unwichtig erscheinen, durch deren Vereinigung<br />
zu größern Reihenfolgen eine Bedeutung <strong>für</strong> historische Uebersichten<br />
zu verleihen«. 31 Die Aufladung der Objekte mit historischer Semantik vollzieht<br />
sich durch die museale Her-Stellung eines im historischen Aussagemodus (also<br />
narrativ) behaupteten Zusammenhangs. <strong>Im</strong> Medium Museum wird symbolisch<br />
als Feld der deutschen Historie hergestellt - durch rhetorische Umwertung des<br />
archäologisch Partikularen der Artefakte inpartespro toto. Infolge des Einschnitts<br />
der napoleonischen Kriege und ihrer Folgen <strong>für</strong> Deutschland sieht Klemm eine<br />
Abkehr <strong>von</strong> den Konglomeraten der barocken Kunst- und Naturalienkammern<br />
und die Museen vielmehr danach streben, mit visueller Rhetorik synekdochisch<br />
ein organisches Ganzes zu formen, auf das die einzelnen Dokumente in ihrem<br />
Quellenwert zu beziehen waren. So gibt es plötzlich kein unnützes Bruchstück<br />
mehr, wenn »die einzelnen Fäden, die das Altertum verloren hat zu dem<br />
großen Gewebe desselben gehören« und das fragmentarisch Erhaltene zur<br />
»Grundlage oder Ausfüllung eines anziehenden Ganzen« dienen kann. 32<br />
30 Dazu Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuseums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens<br />
des Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabern) 1902,<br />
1-72 (34ff über die Fusionsangebote <strong>von</strong> Aufseß
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 397<br />
Zu diesem Behuf bedarf es des Ersatzes der mit diskreten Datensätzen operierenden<br />
Antiquarik durch den heuristischen Vorgriff der Historie. Diese Operation<br />
aber folgt einem algorithmischen Kalkül, wie er der Dichter und Historiker<br />
Peter Friedrich Kanngießer (1774-1833) entwirft: das Quellenmaterial nach logischen<br />
Regeln in die einzelnen Teile zu zerlegen, es nach dem Gesetz der Gleichartigkeit<br />
künstlich zu ordnen und durch kombinierende Beurteilung zu einem<br />
Ganzen zu verbinden. »Aus diesen Elementen entsteht ein System des Wissens,<br />
dem die Attribute des Organischen, des Bündigen, der Überschaubarkeit der<br />
Zusammenhänge aller Teile zukommen« . Damit Serien<br />
<strong>von</strong> Daten den historistischen Effekt des Organischen zeitigen, bedarf es einer<br />
Wahrnehmung, die Zusammenhänge sehen will, wo diskrete Sprünge voriegen.<br />
Narrativ kohärente Darstellung ist die Bedingung da<strong>für</strong>. Indem »durch die wissenschaftliche<br />
Darstellung die organischen Zuammenhänge in einer Ganzheit<br />
sichtbar wurden, spiegelten sie die Wirklichkeit adäquat, weil die Elemente des<br />
Kulturlebens selbst als auf einen Organismus bezogen galten« .<br />
Der Freiherr <strong>von</strong> Aufseß höchst legt dar, daß der Effekt des Ganzen auf der<br />
Mechanik eines Systems beruht, um das schiere Material als Quellen <strong>für</strong> Kulturwissenschaft<br />
verfügbar machen zu können. »So boten ihm die Mineralien- und<br />
Münzsammlungen ein Beispiel, um daran zu erinnern, daß das einzelne, an und<br />
<strong>für</strong> sich bedeutungslose Objekt erst durch die Plazierung in einem angemessenen<br />
Bezugsfeld seinem Charakter als Dokument entsprechend erkannt werden<br />
könnte« - oder vielmehr als Monument, das nicht unverzüglich<br />
als Illustration einer Historie, sondern schlicht in seiner diskreten Präsenz<br />
dasteht. Aufseß stützt sich, Deneke zufolge, auf einen apokryphen Goethetext:<br />
»Als Masse jedoch, in einer Sammlung und Folge, erhalten sie theils mehr Werth, theils werden diese unterrichtend, indem sie<br />
dem aufmerksam betrachtenden die alte Zeit und die Zustände unserer Nation vor<br />
Augen stellen, nachrichten besthätigen, über Culturzustand, Sitten und Gebräuche<br />
usw. neues Licht ertheilen.« <br />
Name ist gleich Adresse^; <strong>Namen</strong>sgebung macht Gedächtnis nicht nur anschreibbar,<br />
sondern konfiguriert sein We(i)sen mit. <strong>Im</strong> Falle des GNM hat es sich<br />
um eine ganz persönliche Entscheidung <strong>von</strong> Aufseß< gehandelt; die zu Dresden<br />
abgehaltene Versammlung deutscher Geschichts- und Alterthumsforscher gab<br />
ihm Gelegenheit, »dem dort repräsentierten deutschen gelehrten Publikum<br />
meine Vorschläge zur Errichtung eines deutschen Nationalmuseums, <strong>von</strong> mir<br />
absichtlich germanisches Museum genannt, zu machen.« 34 Damit ist ein Diffe-<br />
33<br />
Text einer Originalgraphik <strong>von</strong> Joseph Beuys (1974), vertrieben als Postkarte in der<br />
Edition Staeck, Nr. 15016<br />
34<br />
Aufseß an Maximilian II., München, 4. Oktober 1852, Ausfertigung; Archiv M, MK<br />
14187; siehe Burian 1978: 132
398 MUSKUM<br />
renz-, nicht Identitätskriterium gemeint; die germanische Altertumskunde wird<br />
so genannt, um das Zeitalter anzudeuten, das sie umfaßt, im Unterschied zur<br />
deutschen Epoche, als deren <strong>Geschichte</strong> das Mittelalter oder die christliche<br />
Zeit der deutschen Nation gedeutet wird. 35 Es gab einmal eine Zeit, in der unter<br />
der Bezeichnung Germanisten Wissensarchäologen gemeint waren, seit seinem<br />
Erstauftreten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Germanist war ursprünglich<br />
eine Analogiebildung zum <strong>Namen</strong> Romanist <strong>für</strong> den Historiker des<br />
Römischen Rechts. 36 Auf dem ersten deutschen Germanistentag in Frankfurt/M.<br />
1846 beansprucht der Vorsitzende Jacob Grimm den <strong>Namen</strong> Germanist <strong>für</strong> alle<br />
Teilnehmenden; neben den dort versammelten eigentlichen Germanisten als den<br />
an der germanischen Rechtstradition geschulten Juristen zählen also die Sprachund<br />
Literaturwissenschaftler dazu, und - darunter Ranke mit seinem erfolgreichen<br />
Aufruf zur Bildung eines allgemeinen deutschen Geschichtsvereins - die<br />
Historiker. Germanistik im archäo-logischen Wortsinn heißt dementsprechend<br />
auch die Suche nach nationalen Ursprüngen und der Versuch, Germanen (im<br />
Gegensatz zu den Kelten) als Ureinwohner Europas wissenschaftlich zu begründen.<br />
37 Jenseits philologischer Hermeneutik heißt dieses Auf-den-Grund-Gehen<br />
buchstäblich Ausgrabung; Archäologie emanzipiert sich vom Schriftsinn: »Man<br />
hat die Schriften, die Münzen, die Sprachlaute durchforscht; nun lasst uns in die<br />
Gräber steigen und die Ueberreste der Menschen selbst betrachten.« 38 Auf dem<br />
Titelblatt der daraus resultierenden und dies sagenden Schrift formieren sich die<br />
an einer Eiche lehnenden Ausgrabungsinstrumente und die Unordnung eines<br />
Grabfunds (Schädel, Urnen, Waffen, Schmuck) <strong>von</strong> der Signifikantenmenge zur<br />
geordneten Aussage im Druck in harter Prosa: »Die Gräber mit Eisenwaffen<br />
stammen aus der Zeit der Völkerwanderung.« 39 Rückt ein Satz auf das Titelblatt,<br />
wird die Adressierung des Werks selbst zur wissensarchäologischen Aussage. Ein<br />
35 Gustav Klemm, Handbuch der germanischen Altertumskunde, Dresden 1836, xi<br />
36 Jörg Jochen Müller, Zur Bedeutungsgeschichte des <strong>Namen</strong>s »Germanist«, in: ders.<br />
(Hg.), Germanistik und deutsche Nation 1806-1848. Zur Konstitution bürgerlichen<br />
Bewußtseins, Stuttgart (Metzler) 1974, 5ff (6)<br />
37 In diesem Sinne bereits die Schrift, die Wilhelm Lindenschmit 1846 Jacob Grimm zum<br />
Frankfurter Germanistentag überreicht: Der Vorweh Räthsel oder: Sind die Deutschen<br />
eingewandert? Dazu das Vorwort v. Kurt Böhner, in: Wilhelm und Ludwig Lindenschmit,<br />
Das Germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Rheinhessen [""1848]<br />
, Reprint Mainz (v. Zabern) 1969, vii-xix<br />
38 Ludwig Lindenschmit, Koservator des Vereins zur Erforschung des rheinischen<br />
<strong>Geschichte</strong> und Alterthümer zu Mainz, Vorrede [1847], zu: Wilhelm u. Ludwig Lindenschmit,<br />
Das Germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Rheinhessen,<br />
Mainz (v. Zabern) 1848<br />
39 Siehe das Vorwort Kurt Böhners zum Nachdruck der Schrift <strong>von</strong> W. u. L. Lindenschmit<br />
1848, Mainz (v. Zabern) 1969, vii-xix (vii)
DAS GKRMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 399<br />
Antrag Michelsens 40 zur Gründung eines Central-Antiquarium respektive<br />
einer allgemeinen deutschen Alterthümer-Sammlung (eben nicht der Begriff des<br />
Museums) <strong>für</strong> Kunstaltertümer, kunstgewerbliche Gegenstände, alte Geräte und<br />
dergleichen <strong>für</strong> Deutschland wird auf dem Frankfurter Germanistentag nicht<br />
angenommen 41 ; die Institutionalisierung des nationalen Gedächtnisses verläuft<br />
zunächst prozessual. Michelsens Vorschlag gilt als unrealistisch, weil die Lokalvereine<br />
ein Zentralmuseum nicht durch Auslieferung ihrer Altertümer (Unica<br />
und Originale) unterstützen konnten; es gebe also keine Doubletten <strong>für</strong> ein solches<br />
Zentralmuseum. Ein Redner allerdings, Hans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufseß,<br />
schlägt »mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, Originale zu erhalten, vor, ein<br />
Museum <strong>von</strong> Nachbildungen zu gründen«. 42 Vom Objekt zur Information heißt<br />
die Strategie, auf der die Organisation des deutschen Kulturwissens möglich ist.<br />
Vom passiven Aufbewahrungsort materieller Reste der Vergangenheit transformiert<br />
das dann tatsächlich realisierte Museum zum Produzent <strong>von</strong> Geschichtsbildern,<br />
indem es die nationalgeschichtlich gestellte Sinnforderung durch<br />
Präsentation historischer Bildsemantik einzulösen trachtet: die Funktion einer<br />
Reduktion <strong>von</strong> Komplexität zugunsten eines optischen Gesamteindrucks der<br />
deutschen Kulturhistorie, die simultane Repräsentation ihrer Totalität im Unmittelbarkeitsanspruch<br />
sinnlicher Gegenwärtigkeit. Die musealen Zusammenstellungen<br />
betreiben eine genuin mediale poiesis <strong>von</strong> Historie in Dokumenten, im<br />
Gegensatz zum impliziten kulturtechnischen Wissen der einzelnen authentischen<br />
Zeugnisse (Monumente). »Der bildliche Semantisierungsprozeß <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> verwandelt Monumente in Arrangements, um so die Forderung nach<br />
Kontextualisierung der >kalten Tatsachen< zu erfüllen« - um<br />
den Preis der wissensarchäologischen Einsicht in die materiale Qualität der Rea-<br />
40 Andreas Ludwig Jacob Michelsen (1801-1881), Prof. f. <strong>Geschichte</strong> in Kiel als Nachfolger<br />
Dahlmanns, Prof. f. Staats- und Völkerrecht in Jena, 1848-1849 im Paulskirchenparlament,<br />
wird 1862 Vorstandsnachfolger <strong>von</strong> Aufseß< im GNM und verwirft<br />
dessen Generalrepertoriengedanken: Hochreiter 1994: 78; das <strong>für</strong> die Repertorisierung<br />
verwendete Geld soll vielmehr dazu verwendet werden, »das zu erwerben, was eben<br />
damals noch billig zu haben war«: Franz Friedrich Leitschuh, Das Germanische<br />
Nationalmuseum in Nürnberg, Bamberg 1890, 26. Wo die Suprematie der Inforamtion<br />
gegenüber dem Warenwert nicht mehr überwiegt, siegt das museologischen über<br />
das dokumentationswissenschaftliche Paradigma.<br />
41 Verhandlungen der Germanisten zu Frankfurt am Main am 24., 25. und 26. September<br />
1846, Frankfurt a. M. 1847 (Über das Central-Antiquarium: 203f). Zitiert nach<br />
Ernst Schulin, Vom Beruf des Jahrhunderts <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong>: das 19. Jh. als Epoche<br />
des Historismus, in: Arnold Esch /Jens Petersen (Hg.), <strong>Geschichte</strong> und Geschichtswissenschaft<br />
in der Kultur Italiens und Deutschlands (Bibliothek des Deutschen<br />
Historischen Instituts in Rom 71), Tübingen 1989, 29<br />
42 Zitiert nach: Jörg Jochen Müller, Die ersten Germanistentage, in: ders. (Hg.) 1974: 297-<br />
318 (311 f)
400 MUSEUM<br />
lien; dem historischen Diskurs (und damit dem Schauplatz der Schrift) einmal<br />
unterworfen, können - wie im GNM tatsächlich - problemlos Kopien oder<br />
Abbildungen an die Stelle <strong>von</strong> Originalen treten. Denn was zählt, sind Information<br />
und allegorischer Mehrwert, gegenüber dem Primat der Authentizität. Doch<br />
zugleich entwickeln die musealen Institutionen Strategien, den Arrangements<br />
wieder Monument-Charakter zu verleihen, durch Integration affektiv besetzter<br />
Gegenstände wie reale Gräber und Grabdenkmäler in den Ausstellungskontext<br />
oder die Ansiedlung in Gebäuden, die selbst Monumentcharakter besitzen. 43<br />
Denn »am echtesten wirken solche Museen, wo sie in den Räumen untergebracht<br />
werden konnten, die noch der Lebende einst in Kraft und Fülle des Geistes<br />
geweiht; wo noch ein Zimmer im Geschmack seines einstigen Besitzers<br />
möbliert <strong>von</strong> seinen Lebensgewohnheiten erzählt.« Demgegenüber erzählt<br />
»das Gehäufte, Gestapelte all dieser ausgelegten Gegenstände und Schriften, die<br />
des Kommentars bedürfen«, nämlich der Historie, gar nicht, sondern zählt als<br />
Inventar: »Katalognummer, Anmerkung, Philologie.« 44 So fallen die diskursivöffentliche<br />
Schauseite (das terminal) und der datenverarbeitende Teil des musealen<br />
Gedächtnisses auseinander. Für das Germanische Nationalmuseum sind<br />
tatsächlich zunächst die Veste Coburg oder die Wartburg im Gespräch, allerdings<br />
aus institutionspragmatischen, nicht architekturemphatischen Gründen.<br />
Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß;<br />
Die historische Sammlung als Dissimulation <strong>von</strong> Genealogie<br />
Der junge fränkische Freiherr Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß - nicht anders als wenig<br />
später der junge Heinrich Schliemann und zuvor Sir Walter Scott 45 - unternahm<br />
Ausgrabungen in den Hügeln seiner Heimatstadt Aufseß auf der Suche nach<br />
lokalen Alterthümern <strong>für</strong> seinen persönlichen Besitz und nach einem materielles<br />
Substrat der Nation als be/greifbarer <strong>Geschichte</strong>. <strong>Geschichte</strong> bedurfte der<br />
Einverleibung, um als Er-Innerung operieren zu können; »his interest in medieval<br />
art and antiquities likewise stemmed from the certainty that he was connected<br />
to this period through his own family, whose nobility dated back to the<br />
fourteenth Century.« 46 Die Insistenz des historischen Diskurses auf Kontinuität<br />
43<br />
Struck 1993: 358, Anm. 22, unter Verweis auf die Dokumente in: Theodor Hampe,<br />
Das Germanische Nationalmuseum <strong>von</strong> 1852 is 1902, Leipzig 1902, 140ff<br />
44<br />
Rudolf Presber, Geweihte Stätten, Berlin (Vita) 1914, 50<br />
45<br />
Stephen Bann, The Inventions of History. Essays on the Rcprescntation of the Past,<br />
Manchester u. a. (Manchester UP) 1990<br />
46<br />
Susan A. Crane, (Not) Writing History: Rethinking the Intersections of Personal<br />
History and Collective Memory with Hans <strong>von</strong> Aufsess, in: History & Memory 8:1<br />
(Spring / Summer 1996), 5-29 (16)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 401<br />
sitzt auf dem Genealogie-Paradigma des Adels auf. Dieser Anspruch ist der<br />
Interpretant der Historie - unsichtbare (Geschichts-)Energie hinter dem Projekt<br />
des durch <strong>von</strong> Aufseß konzipierten Generalrepertoriums deutscher Kulturgeschichtsgüter<br />
als Katalog, der den Bestand sämtlicher deutscher Archive<br />
inventarisieren soll. Der Münchner Kulturgeschichts- und Statistikprofessor<br />
Riehl bezeichnet den durch Figuren wie <strong>von</strong> Aufseß verkörperten politischsozialen<br />
Stand des grundbesitzenden Geschlechtsadels dieser Zeit als »rückwärts<br />
schauendes Uebergangsgebilde«, das »den Zusammenhang mit der<br />
Vergangenheit« festhält - ein in der neuen Landschaft kontextloses Monument,<br />
»ein Stück Mittelalter in der Gegenwart und doch auch längst schon kein ganz<br />
achtes Stück Mittelalter mehr. Er gibt uns Urkunde« in einer Form der<br />
Aufspeicherung <strong>von</strong> Tradition, zu denen die Editionen der Monumenta<br />
Germaniae Historica das mediale Korrelat bilden. 47 Zwar kommt der <strong>Im</strong>puls<br />
zu <strong>von</strong> Aufseß< Geschichtsenergie aus der Verteidigung seiner genealogischen<br />
Rechte, doch sublimiert und überführt er diese in einen allgemeinverbindlichen<br />
Diskurs:<br />
»Wer das Vaterland liebt, sey er Fürst oder Unterthan , der muß auch eine<br />
Liebe zur <strong>Geschichte</strong> des Vaterlandes hegen . Dies ist mein historisches Glaubensbekenntnis<br />
. Die Geschichts- und Kunstkenntnis sollte nicht Eigenthum<br />
einer Klasse seyn, sondern, wie in alter Zeit, sich unter alle Klassen der Menschen<br />
verbreiten. So war es in frühester Zeit, als noch die Thaten der Väter bloß<br />
im Munde des Volkes fortlebten, dann später, als jeder nur irgend bedeutende Ort<br />
seine eigene Chronik, fast jede Familie eine kleine Hauschronik führte.« 48<br />
Es geht um den Anschluß des historischen Diskurses an die Familienc^rom&<br />
der <strong>von</strong> Aufseß. In seinem Aufruf An meine lieben und verehrten Standesgenossen<br />
in allen deutschen Ländern dagegen ist die Klassenlosigkeit aufgehoben;<br />
der <strong>Im</strong>puls zum Nationalprojekt GNM ist ein sublimiert aristokratischer, die<br />
genealogische Kompensation des Schnitts <strong>von</strong> 1806. Von Aufseß schreibt »nicht<br />
nur als I. Vorstand des germanischen National-Museums, sondern noch vielmehr<br />
als Glied einer Familie, welche, bis zur Auflösung des deutschen Reiches<br />
ihre uralt-angestammte Reichsfreiheit bewahrend, stets <strong>für</strong> das deutsche Vaterland<br />
zu dienen bereit war«:<br />
»Wo es sich, wie hier, um Erhaltung, um Kenntnis und um eine Zusammenstellung<br />
aller, auch der speziellsten Quellen der <strong>Geschichte</strong> der deutschen Vorzeit handelt,<br />
kann wohl kein Stand mehr betheiligt erscheinen, als derjenigen, dessen ganze<br />
47 Wilhelm Heinrich Riehl, Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Vortrag in<br />
der öffentlichen Sitzung der kgl. Akademie der Wissenschaften, München 1864, 14f<br />
48 Vorwort (Januar 1832) des Herausgebers H. Frh. v. Aufsess zur ersten Ausgabe<br />
(1. Jg.) der Monatsschrift Anzeiger <strong>für</strong> Kunde des deutschen Mittelalters (München<br />
1832), Sp. 3
402 MUSEUM<br />
Existenz, dessen politische und Familien-Grundlage in der Vorzeit wurzelt und<br />
dessen Würdigung in der bürgerlichen Gesellschaft vorzugsweise auf seiner<br />
<strong>Geschichte</strong> und deren Erkenntnis beruht.« 49<br />
Als Maßeinheit gilt die genealogische Generation:<br />
»Und sollte es darum, wo ein ehernes Gesetz der Natur und der Weltgeschichte<br />
dieses geheimnisvolle Maß, diese Schranken vorgezeichnet hat, so ganz kindisch<br />
sein, das historische Bewußtsein der Geschlechter in einem besonders berufenen<br />
Stande wach zu erhalten und in Familienüberlieferungen und Stammbäumen <strong>von</strong><br />
dem geschichtlichen Berufe und dem Lebensalter der Geschlechter sich selber und<br />
Andern Kunde zu bewahren?« 50<br />
Ein Zweck des GNM ist damit neben der historischen die adelsgenealogische<br />
Auskunft; indexikalisches Medium dieses Gedächtnisses ist das Archiv:<br />
»Indem es sämmtliche Urkunden- und Aktenschätze aller Archive in ein<br />
großes Repertorium, mit <strong>Namen</strong>s- und Ortsverzeichnis versehen, aufnimmt,<br />
indem es a 1 1 e historischen und genealogischen Werke sammelt und die handschriftlichen<br />
ebenso wie die Urkunden wenigstens verzeichnet und repertorisirt,<br />
indem es alle Monumente, Grabsteine, Siegel und Wappen, wo sie sich auch befinden<br />
mögen, in gleicher Weise zusammenträgt, ist es allein möglich, die <strong>Geschichte</strong><br />
des Adels, so wie jedes einzelnen Geschlechtes, sogar jedes bedeutenden Mannes,<br />
jeder Burg so vollständig, als eben die Quellen überhaupt es irgend zulassen, kennen<br />
zu lernen. so daß mit der Zeit jede Familie die sie betreffenden historischen<br />
und antiquarischen Nachrichten und Abbildungen schön geordnet in einem<br />
oder mehreren Bänden als Familienalbum und Urkundenbuch zusammen erhalten<br />
kann.« <br />
Diese schöne Ordnung der Vergangenheit zum kosmos heißt nicht notwendig<br />
schon Historie. <strong>Im</strong> Tausch gegen Information sollen private adelige Reliquien,<br />
Geschichtsquellen u. a. am GNM deponiert werden; <strong>von</strong> Aufseß< erhabenes<br />
Vorbild ist eine Gründung des Erzherzogs Ferdinand in Österreich vor fast dreihundert<br />
Jahren, »der bei seinen <strong>für</strong>stlichen Genossen zur Errichtung einer historischen,<br />
jetzt noch berühmten Sammlung auf seinem Schlosse Ambras sich eine<br />
gute Beisteuer <strong>von</strong> Bildern und Rüstungen erbat« - die Ambraser Sammlung als<br />
»Zierde der Kaiserstadt Wien«. Am 28. Juni 1831 bittet Aufseß den Freiherrn<br />
Joseph <strong>von</strong> Lassberg, ihn seinem »Freunde und Gevatter« Jacob Grimm bekanntzumachen,<br />
ihm bislang lediglich aus seinen Werken vertraut: »Da seine<br />
Rechtsalterthümer kein Inhaltsregister haben und dies zum Aufsuchen einzelner<br />
Materien erleichternd ist, so habe ich hierzu ein genaues Register gemacht<br />
49 Exemplar (Druckschrift Nürnberg, im März 1855) im GNM, Archiv, Akten zur Vorgeschichte<br />
des GNM, Karton la, fasc. »Repertorium«<br />
50 Wilhelm Heinrich Riehl, Über den Bebgriff der bürgerlichen Gesellschaft, Stuttgart<br />
1851, 165, zitiert nach: <strong>von</strong> Aufseß, ebd.
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 403<br />
und will es dem Verleger zusenden.« 51 Damit definiert Aufseß seine Funktion<br />
deutlich: die Administration des deutschen Gedächtnisses, nicht seine Schreibung<br />
als Historie. Dementsprechend (und hier verwandt mit seinem Kritiker<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke) wünscht <strong>von</strong> Aufseß, daß sein Unternehmen als »ein deutsches<br />
Gemeingut angesehen würde, daß meine Person ganz dabei verschwände,<br />
und jeder der etwas wüßte oder hätte, sich berufen fühlte, es hier anzuzeigen u.<br />
es in das große Volksbuch eintragen zu lassen zum ewigen Gedächtnis und zur<br />
gemeinsamen Benützung« . Medium der Kulturnation ist ihr Register; der<br />
<strong>von</strong> ihm seit 1832 redigierte Anzeiger <strong>für</strong> Kunde des deutschen Mittelalters ist<br />
daher - »im Anschluß« an das Publikationsorgan Archiv der Frankfurter Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde / MGH nicht<br />
allein ein Korrespondenz- und Kommunikationsmedium zur Datenzirkulation<br />
über deutsche Vorgeschichte und Mittelalter, sondern eine Einschreibefläche des<br />
<strong>Im</strong>aginären der Nation. Zwischen Deutschland und Bayern: Als Nationalanstalt<br />
wird das GNM vom deutschen Bundestag anerkannt, dann auch <strong>von</strong> Bayern als<br />
Stiftung mit allen Rechten einer juridischen Person; es ist somit »der nationale<br />
Charakter der Stiftung durch die bayer. Staatsverfasssung garantiert«. 52 Das<br />
deutsche Reich liegt längst (nach 1806) im <strong>Im</strong>aginären; als Staatsform ist<br />
Deutschland durch seine aktuellen (verkehrsApolitischen Strukturen jeweils neu<br />
definiert. 53 Nie hat sich Aufseß mit der Bitte um finanzielle Unterstützung an<br />
Regierungen eines Landes gewandt, in dem zwar Deutsche leben, die aber nicht<br />
zum Deutschen Bund gehörten: »Sobald es sich um die Förderung des Museums<br />
<strong>von</strong> Staats wegen handelte, hatte auch der Begriff >deutsch< <strong>für</strong> Aufseß eine ausschließlich<br />
staatliche Bedeutung«; erst 1949 wird Deutschland erstmalig Staatsname<br />
. Demgegegenüber betont Museumsdirektor<br />
Essenwein in einem Schreiben vom 16. Oktober 1866 an die Bundesliquidationskommission<br />
unter Bezug auf die Satzungen das Museums als »gemeinsames<br />
untheilbares und unveräußerliches Eigenthum aller Deutschen, sowohl derjenigen<br />
die jetzt noch politisch zu Deutschland gehören als derjenigen, die da<strong>von</strong><br />
getrent sind, wie die Schweiz, Elsaß, die russischen Ostseeprovinzen«. 54<br />
51<br />
Typographische Umschrift des Briefes im Archiv des GNM, Akten zur Vorgeschichte<br />
des GNM, Karton la<br />
52<br />
Gez. Nürnberg, im April 1872: Das Direktorium des germanischen Nationalmuseums.<br />
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Akten des Direktoriums<br />
der Staatsarchive betreffet das Germanische Museum irt Nürnberg, ßti. 1 v. 1894<br />
bis 1904,1. Rep 178 Abt. VII. Eingefügt sind Drucksachen, paginiert Bl. 46, Titel: Germanisches<br />
Nationalmuseum. Einladung zu Jahresbeiträgen.<br />
53<br />
Dieser Infrastruktur trägt die Einrichtung des Deutschen Handelsmuseum als selbständigem<br />
Aninstitut des GNM Rechnung: Leitschuh 1890: 95f<br />
54<br />
Reinkonzept; Altregistratur GNM, Kapsel 25, zitiert nach Burian 1978: 168
404 MUSEUM<br />
Vom Gutachten Rankes bis zur Verreichlichung 1871<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke äußert sich als Gutachter in einem Brief an den preußischen<br />
Kabinettsrat Illaire v. 24. August 1853 ȟber das germanische Museum des Freiherrn<br />
<strong>von</strong> Aufseß«. Ranke rühmt die bestehende Privatsammlung, rügt aber den<br />
damit verbundenen, darüber hinausgehenden Anspruch eines Gesamtrepertoriums<br />
deutscher Altertümer als Standardisierung der kulturgeschichtlichen<br />
Information:<br />
»Er meint, Alles, was sich auf deutsche <strong>Geschichte</strong> bezieht, und zwar bis zu einer<br />
Epoche, wo sich die ganze Schreibseligkeit deutscher Beamten und Gelehrten<br />
bereits entwickelt hatte, bis zum Jahr 1648 zusammenbringen und ordnen zu können,<br />
so daß bei ihm auf jede historische Anfrage eine zuverläßige Antwort zu finden<br />
wäre. Herr <strong>von</strong> Aufseß hat wohl nie in einem großen deutschen Archiv<br />
ernstlich gearbeitet; sonst würde er wissen, daß zuweilen die Reliquien einzelner<br />
Jahre ganze Zimmer erfüllen. Wie kann man sich einbilden, die Fragen, die<br />
im Laufe der Zeit entstehen, im voraus zu wissen und Antworten darauf fertig<br />
zu halten? Die Schematisierung des Stoffes, wie sie Herr <strong>von</strong> Aufseß aufstellt,<br />
mag ihren Werth haben <strong>für</strong> allerhand Merkwürdigkeiten und Curiosa: <strong>für</strong><br />
lebendiges Wissen ist sie tödtlich. Herr <strong>von</strong> Aufseß hat seine Sammlungen auf zehn<br />
Jahre zur Grundlage eines Nationalmuseums dem öffentlichen Gebrauch überlassen<br />
. Welch ein Fundament <strong>von</strong> Sand! Aber darauf denkt Herr <strong>von</strong> Aufseß ein<br />
Monument aufzurichten, das, wie er in seinem Anschreiben sagt, den Cölner Dom<br />
überragen soll!« 55<br />
Die Monumente der Moderne sind Institutionen (Ranke spricht <strong>von</strong> einem<br />
»großen nationalen Institut«), nicht mehr symbolische Denkmäler. Der Treibsand<br />
der Dinge (Signifikanten, die erst durch die Kopplung an das Signifikat<br />
deutscher Historie einen festen Stellenwert erhalten) aber ist gekoppelt an Kapitalflüsse.<br />
Kapital und Gedächtnis stellen verwandte Aggregatzustände dar; Aufseß<br />
rechnet Kultur(geschichte) als Effekt <strong>von</strong> surplus:<br />
»Wie will er das nöthige Geld zusammenbringen? Er denkt, es werden sich<br />
Leute finden, die ihre zinstragenden Papiere bei der bairischen Bank niederlegen,<br />
welche die Zinsen zu Gunsten des Museums einziehen und nach zehn Jahren die<br />
Papiere zurückgeben soll, wenn man nicht vorzieht, dann auch auf das Capital<br />
Verzicht zu leiten. Mir erscheint dies Projekt chimärisch.« <br />
Politische und militärische Zäsuren zeitigen reale Effekte auch <strong>für</strong> Chimären.<br />
1942 läßt sich <strong>für</strong> den Ersten Direktor des GNM »deutlich an der Gründungskurve<br />
ablesen, daß jede Welle unserer jüngsten <strong>Geschichte</strong>, 1871,1918, 1933, als<br />
Ausdruck des Selbstgefühls, der nationalen und völkischen Besinnung die Grün-<br />
55 In: Günter Jon. Henz, Zu Leopold <strong>von</strong> Rankes Briewechsel, in: Archiv <strong>für</strong> Kulturgeschichte<br />
54, 2 (1972), 285-324 (308f)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 405<br />
düng weiterer Museen mit sich brachte«. 56 1902 ist das fünfzigjährige Museumsjubiläum<br />
unter Teilnahme des Kaiserpaares ein patriotisches Fest. Kalendarik triggert<br />
memoria; die Spekulationen mit der Zahlenmystik des kalendarischen Rituals<br />
kann das Gedächtnis in die Irre führen. »It was the admitted hope that the nation<br />
would view the museum >as a national monument of victory< (Siegesdenkmal), as<br />
a monument of the same spirit that had so unanimously united Germany.« 57 Jenseits<br />
der historischen Erzählung machen Zahlen eine andere Aussage. Das Direktorium<br />
hat im Januar 1871 erfolglos dem Bundesrat eine Denkschrift mit der Bitte<br />
übergeben, ihm aus den Kriegentschädigungsgeldern eine Kapitalsumme zu überweisen,<br />
die es gestatte, die vorhandenen Schulden zu tilgen. Die Konservierungsmaßnahmen<br />
<strong>für</strong> die Gipsabgußsammlung sind aufschiebbar, doch Originale<br />
bedurften sofortiger Restauration . Der zwanzigster Jahresbericht<br />
des germanischen Nationalmuseums (datiert 1. Januar 1874) registriert<br />
hohe Ausgaben, »um jene Schätze <strong>für</strong> die älteste <strong>Geschichte</strong> der Druckkunst, der<br />
größten deutschen Erfindung, zu erhalten, zu deren Erwerbung uns die Verhandlungen<br />
des deutschen Reichstages veranlassten.« Für das Archiv gilt es, durch<br />
Ankauf eine größere Zahl Pergamenturkunden zu retten, die bereits den Händen<br />
des Goldschlägers verfallen waren« Jahresbericht 1874>; Gedächtniskapitalströme<br />
sind nur bedingt durch die Institutionen der <strong>Geschichte</strong> zu steuern. Was<br />
an Archivalien derart dem GNM zufällt, ist in der Tat bei aller Zufälligkeit eine<br />
stochastisch zu definierende Menge, ein sample des deutschen Gedächtnisses.<br />
Nachdem das Land Baden-Württemberg 1972 vom Germanischen Nationalmuseum<br />
die seine Lande betreffenden Urkunden, Akten und Bände (zurück-)<br />
erwirbt, um sie als Bestand H 52a dem Stuttgarter Hauptstaatsarchiv einzuverleiben,<br />
ist diese Datenmenge nicht einmal ein Torso, sondern ein fragmentarischer<br />
Bestand, dessen Provenienzgruppen nicht mehr wiederzuerkennen sind, ein zerstückelter<br />
Archivkörper, allen Versuchen ihrer Restitution (ihnen also ein historisches<br />
Gesicht wiederzugeben) zum Trotz. Statt historischer Dokumente sind sie<br />
hier zunächst reine Signifikanten <strong>von</strong> Gedächtnismediation, d. h. Strömungen <strong>von</strong><br />
56 Heinrich Kohlhaußen, Die Bedeutung der Museen <strong>für</strong> die Wissenschaft und ihre<br />
Erschließung, in: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation (Hg.), Die Dokumentation<br />
und ihre Probleme. Vorträge, gehalten auf der ersten Tagung der Deutschen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation vom 21. bis 24. September 1942 in Salzburg, Leipzig<br />
(Harrassowitz) 1943, 32-39 (36)<br />
57 Karen Lang, Monumental Unease: Monuments and the Making of National Identity<br />
in Germany, in: Francoise Forster-Hahn (Hg.), <strong>Im</strong>agining Modern German Culture:<br />
1889-1910, National Gallery of Art (Washington), Hanover / London (University<br />
Press of New England) = Studies in the History of Art 53 [1996], 275-299, Anm. 28,<br />
unter Bezug auf: Jahresbericht des Germanischen Nationalmuseums 17 (<strong>für</strong> 1870),<br />
Nürnberg 1871, 1, in: Deneke / Kashnitz (Hg.), Das Germanische Nationalmuseum<br />
Nürnberg 1825-1977, München / Berlin 1978, 195
406 MUSEUM<br />
Geschichtsbegebren - eine Provokation der Ästhetik <strong>von</strong> Staatsarchiven. Aus<br />
archivarischer Sicht entsteht so der Eindruck antiquarisch isolierter Einzelstücke,<br />
das Produkt eines Irrwegs des Handelns mit und Sammeins <strong>von</strong> mehr oder weniger<br />
wertvollen Schriftstücken, an dessen Anfang immer die Zerstörung eines<br />
Archivs oder eines Überlieferungszusammenhangs steht. »In der Isolierung geht<br />
nicht nur dieser alte Kontext verloren, sondern wird umgekehrt auch der Zugang<br />
<strong>für</strong> die Forschung unendlich erschwert. Anders als bei Provenienzbeständen ist<br />
bei Sammlungsgut keine Suche im logischen Überlieferungszusammenhang möglich.«<br />
58 Wo das Provenienzprinzip versagt, die archivische Bedingung des historischen<br />
Diskurses, fällt Gedächtnis in die reine Chronologie zurück: »Angesichts<br />
der zahlreichen Unsicherheiten ist die chronologische Reihung der einzige objektive<br />
Anordnung« . Konfrontiert mit dieser buchstäblich wissensarchäologischen<br />
Fundlage ist Ordnung nur unter Verzicht auf Kohärenz und<br />
Restitution ursprünglicher Ordnung möglich - als reines Inventar, das die<br />
Bestände alphanumerisch vermißt. Das Objekt ist auf seine reine Materialität<br />
zurückgeworfen, Gedächtnis damit syntaktisch, nicht semantisch faßbar, d. h.<br />
meßbar: »Der Umfang beträgt 3 Regalmeter« .<br />
Aufseß erwirbt die Nürnberger Karthäuserkiche <strong>für</strong> das Museum aufgrund<br />
des pragmatischen <strong>Im</strong>perativs, nicht durch <strong>Im</strong>mobilien im Staatsbesitz zu demselben<br />
in Abhängigkeit zu geraten. Die metonymische Aufladung der Lokalität<br />
mit musealer Semantik ist eine nachträgliche; Architektur und Apparat liegen<br />
bezüglich der Aufstellung der Sammlungen im Widerstreit: die da<strong>für</strong> bestimmten<br />
Räumlichkeiten erheben als architektonische Denkmäler »auf Beachtung<br />
ihrer selbst zu sehr Anspruch , als daß sie den Forderungen rein wissenschaftlicher<br />
Systematik gänzlich hätten untergeordnet werden dürfen«. 59 Eine in<br />
Nürnberg im Juni 1872 <strong>von</strong> den Direktoren A. Essenwein und Frommann<br />
unterzeichnete Denkschrift argumentiert <strong>für</strong> einen Neubau als Annex zur Karthause:<br />
»So interessant die ehrwürdigen alten Räume erscheinen, so sind sie halb<br />
in Ruinen«, feucht und gänzlich unbeheizbar, so daß die Gegenstände faktisch<br />
Schaden litten und fast halbjährig unbenutzbar waren .<br />
Der Jahresbericht 1874 berichtet <strong>von</strong> der Übertragung des Augustinerkloster an<br />
das Museum und der Restauration der Karthause, deren Wiederaufbau und<br />
künstlerische Ausstattung; Andenken an die Stifter des Restaurationswerk werden<br />
supplementär angebracht. Von Anbeginn an steht die abstrakte, gedächtnis-<br />
58 Archivalien aus dem Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Inventar des<br />
Bestands H 52a im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, bearb. v. Christine Bührlen-Grabinger<br />
u. a., Stuttgart (Kohlhammer) 1995, Einleitung (11)<br />
59 Broschüre: Die Kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen des germanischen<br />
Museums. Wegweiser <strong>für</strong> die Besuchenden, Nürnberg 1872, 5
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 407<br />
logistische Systematik des Sammlungsauftrags des GNM in einem Spannungsverhältnis<br />
zu einer Gegebenheit, die schon Historie ist: die Architektur der realen<br />
Räume, in welche die Architextur der Programmräume einzurichten war.<br />
Daran erinnert auch die Ausschreibung im Wettbewerb <strong>für</strong> den jüngsten Erweiterungsbau.<br />
Die I. Preisgruppe (Nr. 1077: Bruno Lambert, Ratingen) nennt den<br />
derzeit aktuellen Zustand ein Konglomerat aus zufälligen Anbauten, das entflechtet<br />
werden müsse. Die historische Baustubstanz solle erkennbar gemacht,<br />
<strong>von</strong> »unerwünschten Zutaten« befreit und ins Museumserlebnis einbezogen<br />
werden 60 ; dabei sind gerade die unerwünschten Bauteile Zeichen des Dazwischentretens<br />
<strong>von</strong> Historie. 61 Dem trägt die zweite Preisgruppe Rechnung (Nr.<br />
1002: <strong>von</strong> Gerkan, Mark + Partner, Hamburg), welche die gegenwärtige Baustruktur<br />
des Museums als Ergebnis eines langjährigen Wachsttums- und Veränderungsprozesses,<br />
respektiert und keine gravierenden Eingriffe vornehmen will.<br />
Und Jürgen Joedicke (Nr. 1021 im Ankauf) definiert in seinen Erläuterungen das<br />
Germanische Nationalmuseum als Subjekt und Objekt eines Überblicks der<br />
deutschen Kulturgeschichte; neben seinen Ausstellungen und Sammlungen ist es<br />
»in seinem baulichen Bestand selbst ein Teil dieser <strong>Geschichte</strong>.« An einem solchen<br />
Ort zu entwerfen erfordere, »das Vorhandene als geschichtliches Kontinuum<br />
zu respekieren«, nicht als Unterordung oder Anpassung, als »Versuch, in<br />
einen Dialog mit dem Vorhandenen einzutreten.« Der neue Eingang als Nahtstelle<br />
zwischen vorhandenem Bestand und den Erweiterungsbauten soll in Form,<br />
Raum, und Gestalt das Museums nicht nur in seiner Funktion gerecht werden,<br />
sondern muß »ein unverwechselbarer Ort in einer <strong>von</strong> historischer Kontinuität<br />
geprägten Stadt sein« . Eben dieser Stadt aber wurde die<br />
Diskontinuität deutscher Reiche 1945 eingeprägt.<br />
Allegoresen des Nationalen:<br />
Zwischen Archäologie (Monument) und Dokument (Historie)<br />
Museale Zustände der Nation (ein Begriff aus <strong>von</strong> Aufseß< System): Auch nationales<br />
Gedächtnis schweigt, wenn es nicht diskursiv mobilisiert wird. Nichts als<br />
stumme Monumente liegen vor, falls nicht diese eine <strong>Geschichte</strong> sie zum Reden<br />
bringt, sie in Dokumente einer zum Schweigen gebrachten Stimme transformiert.<br />
62 1870, als ein neuer Begriff <strong>von</strong> Nation in Deutschland sich abzeichnet,<br />
60<br />
Wettbewerb Erweiterungsbau, Protokoll der Jury, Germanisches Nationalmuseum<br />
1984,24<br />
61<br />
Siehe W. E., Die Akropolis <strong>von</strong> Athen: Verwandlungen eines klassischen Monuments,<br />
in: Geschichtsdidaktik Heft 1/1984, 93f<br />
62<br />
Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1974, Einleitung
408 MUSEUM<br />
konzipiert der Erste Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg,<br />
August Essenwein, asymmetrisch zur politideologischen Aufladung <strong>von</strong><br />
Artefakten aus Deutschland sein Museum als auf ästhetisch autonomen<br />
Monumenten, nicht allein auf Dokumentation <strong>für</strong> Historie basierendes Haus,<br />
»vorzugsweise kulturgeschichtlich«; <strong>von</strong> daher der Akzent auf den verschiedenen<br />
Künsten »als die Blüthen der Kultur«, da auf diesen Gebieten »gerade die<br />
Monumente die wichtigste Rolle spielen« und in ihnen »diejenigen Theile der<br />
Kultur repräsentiert sind, welche nicht nur historisches Interesse haben, welche<br />
nicht nur der Wissenschaft angehören, sondern durch die Schönheit der Formen<br />
zum Gefühle und zu den Herzen Aller am lautesten sprechen.« 63 Dies gilt<br />
<strong>für</strong> das Dokument Essenwein 1870 selbst, das in einem asymmetrischen Verhältnis<br />
zu jener Positivität steht, die heute das GNM als Gebäude, Sammlung<br />
und (autorisierte) Institution tatsächlich darstellt. Der lesende Historiker navigiert<br />
also durch einen virtuellen Raum, dessen Elemente verschoben werden wie<br />
Module in einem Datenprogramm. Und ständig erinnert das Dokument in der<br />
Diskussion über die historischen Bestände des GNM thematisch daran, was <strong>für</strong><br />
jede Verhandlung der Historie des GNM gilt: daß Vergangenheit eine Funktion<br />
ihrer Administration und diese zugleich Subjekt und Objekt der Rede ist. Zwischen<br />
Historie und Archäologie sucht die Verfaßtheit des GNM auf der Ebene<br />
des nationalpädagogischen Diskurses nach einer Verbindung beider modi <strong>von</strong><br />
Vergangenheitsbearbeitung, zementiert aber auf der Ebene seiner musealen<br />
Dokumentationspraxis ihr Auseinanderbrechen. So unterstreicht Essenwein in<br />
seiner Darlegung der neuen Statuten seines Hauses, daß nach wie vor »alle Einzelzweige<br />
der archäologischen Wissenschaften gleichmäßig gepflegt, daß die<br />
eigentlich historischen Studien mit den kulturgeschichtlichen in Verbindung<br />
gebracht und so die <strong>Geschichte</strong> und die Zustände des Volkes in allen seinen<br />
innern und äußern Beziehungen« erforscht und dargestellt werden sollen<br />
. Das kulturgeschichtliche Museum ist didaktisch geschichtsorientiert,<br />
in der Praxis aber der Archäologie näher und definiert sich<br />
dementsprechend als diskretes Medium.<br />
Unter den Bedingungen <strong>von</strong> national engineering werden nicht nur symbolische<br />
Artefakte, sondern auch infrastrukturell im Diskurs agierende Gedächtnisagenturen<br />
zu lieux de memoire:<br />
»Die nationale Größe und die Thaten, durch die sie hergestellt worden ist, sind in<br />
Nationaldenkmälern verewigt worden. Ein Nationaldenkmal aber, einen mächti-<br />
63 August Essenwein, Das germanische Nationalmuseum zu Nürnberg. Bericht über den<br />
gegenwärtigen Stand der Sammlungen und Arbeiten, sowie die nächsten daraus<br />
erwachsenden Aufgaben, an den Verwaltungsausschuß erstattet (1870), mit Anmerkungen<br />
<strong>von</strong> Rainer Kahsnitz versehen in: B. Danecke / ders. 1978: 993-1026 (998f)
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 409<br />
gen Hebel <strong>für</strong> die Entzündung patriotischer Begeisterung und Tatkraft, besitzt<br />
Deutschland auch in seinem germanischen Museum. Ist es tatsächlich doch aus<br />
dem Boden der nationalen Bewußtseins hervorgewachsen.« 64<br />
Eine Denkschrift <strong>für</strong> ein russisches Nationalmuseum wünscht, »daß der Eingang<br />
zum National-Museum durch Aufstellung vaterländischer Denkmähler bezeichnet<br />
werde, wie dies in Grätz und Pest geschehen ist« - der<br />
Historie vorgeschaltet ist die Allegorie. Deutsche Historie als Allegorie der<br />
Nation kommt auch im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ins Blickfeld<br />
und an die Grenzen der Darstellbarkeit. Die Text- und Kulturwissenschaften<br />
(Literaturwissenschaft, Komparatistik, Geschichtswissenschaft, Anthropologie,<br />
Ethnologie) haben zur Analyse solcher Allegoresen ein anspruchsvolles methodisches<br />
Instrumentarium entwickelt; dieses Instrumentarium gilt es auf die<br />
Textur des Musealen anzuwenden. Bei der Zusammenstellung disparater und<br />
fragmentarischer historischer Objekte in Geschichtsmuseen einer Nation schreibt<br />
sich immer schon eine allegorische Differenz ein, die jede nationalpädagogische<br />
und geschichtswissenschaftliche Absicht verschiebt. Die vom Germanischen<br />
Nationalmuseum in Nürnberg erworbene, <strong>von</strong> Philipp Veit gemalte Germania<br />
aus dem Frankfurter Paulskirchenparlament <strong>von</strong> 1848/49 wird bald wieder eingerollt:<br />
Dies hat, wie Bookmann unterstreicht, nicht allein politische, sondern<br />
museumsgeschichtliche Gründe. Die Funktion der Allegorisierung der deutschen<br />
Nation übernahm nämlich nicht so sehr jenes Objekt, sondern das Museum<br />
selbst. Es liefert damit nicht allein das antiquarische Ausgangsmaterial <strong>für</strong> Historienmaler<br />
und Bühnenbildner, sondern ihm selbst ist diese Rolle bereits eingeschrieben.<br />
Wenn der Gründer des Museums, der Freiherr <strong>von</strong> Aufseß, sich gerne<br />
in einer mittelalterlichen Rüstung porträtieren ließ, so ging es dabei also um mehr,<br />
als die Vergangenheit möglichst wirklichkeitsnah und lebendig nachzustellen.<br />
Allegorischen Charakter zeitigt nicht so sehr die Semantik, sondern die Ordnung<br />
der Sammlung in ihrer Anfangsphase. Ein methodisches und pragmatisches Problem<br />
wird politisch, insofern das Museum »in seiner anfänglichen räumlichen<br />
Zerrissenheit und in seinen inneren Kämpfen ein getreues Bild der damaligen<br />
politischen Lage Deutschlands darstellte«. Ebenso gilt es später als Träger der<br />
nationalen Bewegung, »als Verkörperung des nationalen Gedankens - wie es<br />
mehr als einen vergeblichen Anlauf machte - ganz wie das Bewußtsein der<br />
Zusammengehörigkeit des deutschen Volkes.« Einen nachträglichen Sinn, eine<br />
teleologische Lektüre erhält diese Unordnung erst, als »im goldenen Glänze <br />
die deutsche Einheit aufging!« .<br />
64 Franz Friedrich Leitschuh, Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, Bamberg<br />
1890, 92. Siehe auch Rainer Kahsnitz, Museum und Denkmal, in: Das kunst- und<br />
kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert, hg. v. Bernward Deneke u. ders.,<br />
München 1977, 152-175
410 MUSHUM<br />
Nach den Enden des Reiches: Deutschland als Sammlungsobjekt, ungeteilt<br />
Das GNM hat auch Zugriff auf das Depot eines anderen nationalen Symbols, das<br />
Inventar des Deutschen Bundes - »dasjenige unter dem Eigenthum des Bundes,<br />
das historischen Werth hat« 65 . Konkret handelte es sich dann um Gegenstände<br />
aus der Paulskirche, dem Sitzungsort der ersten deutschen Nationalversammlung.<br />
Essenwein nennt sie historische Reliquien; der Aufbewahrungsort, die zur<br />
Museum säkularisierte ehemalige Nürnberger Kartäuserkirche, wird resakralisiert<br />
in einer Semiotik zweiter, nämlich historischer Ordnung, die mit dem quasi-<br />
Sakralen des nationalen Diskurses wiederaufgeladen wird. Reichensperger nennt<br />
die museale Wiederherstellung dieser Ruine eine archäologische That; aus der<br />
Binnenperspektive des GNM aber wird korrigiert: »Nicht blos eine archäologische,<br />
sondern eine kühne und gewagte That war es, inmitten der Kriegsrüstungen<br />
und Gefahren«. 66 Es ist also ein Gedächtnisimperativ, der historisches<br />
Bewußtsein zwischen Monument und Dokument unterscheiden läßt. Nicht der<br />
materielle, sondern der semiotische Wert als Geschichtszeichen zählt, denn<br />
obgleich manche der Gegenstände »keinen großen materiellen Werth haben, so<br />
sind sie so interessante Erinnerungen an eine wichtige Zeit, daß sich Jedermannn<br />
der Sinn <strong>für</strong> historische Erinnerungen hat, dem Beschlüsse der Commission<br />
Dank wissen wird, diese Erinnerungszeichen auf historischem Boden aufzubewahren«<br />
. Hier gerät die nationalgeschichtliche<br />
<strong>Im</strong>plikation des GNM in Konflikt mit seiner Pragmatik als Kulturgedächtnisspeicher.<br />
<strong>Im</strong> Realen der Klassifikation, in »die der Vorzeit gewidmeten nach wissenschaftlichem<br />
System geordneten Sammlungen« nämlichen können diese »uns<br />
angebotenen historischen Reliquien nicht eingereiht werden.« 67<br />
In einer Druckschrift des germanischen Nationalmuseums Nürnberg vom<br />
22. Juli 1854 (gezeichnet Aufseß/Beeg/Frommann/Harleß) an die deutschen<br />
Buchhändler mit der Bitte um die Überlassung <strong>von</strong> Gratisexemplaren (»Verlagswerke,<br />
welche auf deutsch-historische Zustände Bezug haben«) deklariert<br />
sich die GNM-Bibliothek »zugleich eine deutsche Nationalbibliothek«.<br />
Die Museumsleitung sah sich nicht nur durch das Symbolische der Schillerfeiern<br />
<strong>von</strong> 1859, sondern vielleicht mehr noch durch die Eröffnung der durchge-<br />
65 Essenwein an Bundesliquidationskommission, Nürnberg, 16. Oktober 1866, zitiert<br />
nach: Peter Burian, Das Germanische Nationalmuseum und die deutsche Nation, in:<br />
Deneke / Kahsnitz 1978: 127-262 (171)<br />
66 Sechster Jahresbericht des Germanischen Nationalmuseums zu Nürnberg vom 1.<br />
Januar bis 31. Dezember 1859, Nürnberg (german. Mus.) 1860, Einleitung, unter<br />
Bezug auf Reichensperger, Christlich-germanische Baukunst, 3. Ausg. Trier 1860, 82<br />
67 Essenwein an Bundesliquidationskommision, Nürnberg, 2. März 1867, Reinkonzept;<br />
Altregistratur GNM, Kapsel 25
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSKUM IN NÜRNBERG 411<br />
henden Eisenbahnverbindung zwischen Wien und München zu der Erwartung<br />
berechtigt, »daß die deutsche Einheit doch mehr sei als ein bloßes Phantasiebild«.<br />
68 Wie die Infrastruktur des Staates aber bedurfte auch die des Museums<br />
eines imaginären Surplus, um zu einer nationalen Angelegenheit zu werden;<br />
1864 konstatiert die Museumsleitung ihre Vorstellung, daß das Haus »in den<br />
Augen des deutschen Volkes etwas Anderes als eine Sammlung <strong>von</strong> Dokumenten,<br />
Büchern und Alterthümern, vielmehr in Wahrheit eine Nationalsache ist.« 69<br />
Konkret heißt das die nationale Ausrichtung des Museums unter Verzicht auf<br />
jede staatliche Bindung des Instituts oder seines Programms ; Staat als Administration und <strong>Geschichte</strong> als das <strong>Im</strong>aginäre der Nation<br />
operieren auf verschiedenen Ebenen. Museumsdirektor Essenwein schreibt<br />
1872 70 über den Einbezug überregionaler und transnationaler Gewerbezeugnisse<br />
in die Ausstellung des GNM. Zum Verständnis <strong>von</strong> »Geist und Form<br />
deutschen Lebens« ist es unumgänglich, auch solche Gegenstände zur Darstellung<br />
zu bringen, die national nicht gefertigt wurden. Korrespondierend damit<br />
akzentuiert er die politische Grenzen übergreifenden Kulturverflechtungen:<br />
»Wer sollte sich einbilden, z. B. die deutsche Poesie des Mittelalters, zu kennen,<br />
wenn er nicht die verwandte französische kennt? Wer sollte den Cölner Dom<br />
verstehen, wenn er nicht die französischen Cathedralen studiert hat, die seine<br />
Vorgänger sind, und an denen der Meister des Cölner Domes selbst studiert<br />
hat?« So sei es auf so vielen Gebieten . Denn die Begriffe <strong>von</strong> Gedächtnis als Funktion <strong>von</strong> Sammeln,<br />
Speichern und Übertragen einerseits und Tradition als Transfer andererseits sind<br />
untrennbar, Definitionen des Nationalen sprengend.<br />
Kulturtransfer spielt sich mit der Teilung Deutschlands auch intra-national<br />
ab. 1949 scheitert der Beitrag der Stadt Leipzig <strong>für</strong> das Germanische Nationalmuseum<br />
in Nürnberg an der deutsch-deutschen Teilung; Bürgermeister Austel<br />
ordnet an, daß die Zahlung des Beitrags an das Germanische Natinalmuseum<br />
Nürnberg aus dem Dispositionsfonds des Oberbürgermeisters einzustellen sei,<br />
»solange die Beibehaltung der Zonengrenzen eine unmittelbar Überweisung des<br />
Beitrags an das Museum nicht zuläßt«. 71 Folgt die Bitte <strong>von</strong> Seiten des Nürnberger<br />
Hauses um Erneuerung der Beitragszahlungen trotz währungstechni-<br />
68<br />
Chronik des germanischen Museums, in: Anzeiger GNM 1860, Sp. 289-298 (289),<br />
zitiert nach: Burian 1978: 150<br />
69<br />
Chronik des GNM 1864, Sp. 17-28 (17), zitiert ebd.<br />
70<br />
August Essenwein, Einige Worte zur Frage über die Aufgaben des germ. Museums,<br />
in: Kunst und Gewerbe Jg. 6 (1872), 321-323<br />
71<br />
Stadtarchiv Leipzig, Stadtverordnetenversammlung: Rat der Stadt Nr. 8671, Stadtdirektor,<br />
Hauptverwaltungsamt, 13. April 1949, an Dr. Bethe - Kunstgewerbemuseum -<br />
über Amt <strong>für</strong> Kunst und Kunstpflege
412 MUSEUM<br />
scher Schwierigkeiten, da die Stadt Leipzig zu den ältesten Förderern und Mitgliedern<br />
des GNM gehörte. Eine Notiz der Stadtverwaltung vom 24. März<br />
vermerkt auf dem entsprechenden Dokument, das Stadtfinanzamt habe laut<br />
telefonischer Auskunft »bis zum Umbruch« Zahlungen <strong>für</strong> das Germanische<br />
Nationalmuseum geleistet. 72 Was mit der Beschränkung auf den kleindeutschen<br />
Nationalstaat nach der Reichsgründungung begonnen hatte, setzte sich nach<br />
dessen Ende fort, bis schließlich nach 1949 nur noch die westliche Hälfte der<br />
politischen Nation in Gestalt der Bundesrepublik Deutschland dem Museum<br />
gegenüber den deutschen Gesamtstaat darstellte - ohne Vertreter der Deutschen<br />
Demokratischen Republik. »Der Verzicht auf jede programmatische oder institutionelle<br />
Berücksichtigung der nationalen Spaltung - etwa durch das Freihalten<br />
eines der früheren Reichssitze im Verwaltungsrat -, scheint ein<br />
neues Anzeichen <strong>für</strong> die seit den Anfängen immer wieder zutage getretene<br />
Absicht der Museumsleitung zu sein, die politische Wirklichkeit in dem<br />
Gemeinwesen, in dem das Museum seinen Sitz hat, nicht in Frage zu stellen«,<br />
konstatiert Burian 1978 . Die zu Beginn der fünfziger Jahre beschlossene<br />
Einrichtung <strong>von</strong> Heimatgedenkstätten <strong>für</strong> die »Sammlung der Kulturdokumente<br />
jener deutschen Landsmannschaften und Stämme, die heute ihre Heimat<br />
in der Gewalt fremder Beherrschung wissen« 73 , ist andererseits eine museale<br />
Neuschöpfung 74 . Sie bedeutet, ähnlich wie früher die Annahme der Bibliothek<br />
der Frankfurter Nationalversammlung oder, nach der Reichsgründung, der<br />
Erwerb <strong>von</strong> zeithistorischen Dokumenten, eine nationalpolitische Aktualisierung<br />
der Sammlungstätigkeit. Diese Charakterisierung rechtfertigt Burian<br />
durch die Feststellung des Verwaltungsrats vom Oktober 1952, daß das<br />
Museum bei der Übernahme <strong>von</strong> Kunstgegenständen <strong>für</strong> solche Gedenkstätten,<br />
soweit es sich nicht um ausdrückliche Ankäufe oder Schenkungen handele,<br />
»nicht Eigentümer, sondern nur treuhänderischer Besitzer sein soll, und dass<br />
die erworbenen Gegenstände <strong>für</strong> eine möglich Restituierung anlässlich der<br />
Rückkehr der Deutschen in ihre Heimatgebiete zur Verfügung stünden«. 75 Das<br />
GNM wird so zu einem Ort <strong>von</strong> derelictio. Während das GNM in anderen<br />
Kontexten gerade nicht als nationales Depot, sondern als Aktivposten des deut-<br />
72 Bethe an OB Dr. Zeigner, 23. März 1948<br />
73 Theodor Heuss, Das Germanische National-Museum, in: Noris. Zwei Reden, Nürnberg<br />
1953, 22f (als Verwaltungsratsvositzender beim Festakt zur Hundertjahrfeier im<br />
August 1952 gehalten)<br />
74 Verwaltungsbericht Grotes <strong>für</strong> 1952/53 (Protokolle des Verwaltungsrats, 24. Oktober<br />
1953, Anlage; Direktionsakten GNM). Vgl. die nach 1945 angebrachten Erztafeln zur<br />
Erinnerung an verlorene Ostprovinzen als Supplement des Denkmals <strong>von</strong> Kaiser Wilhelms<br />
I. in Koblenz (Deutsches Eck)<br />
75 Protokolle des Verwaltungsrats, 4. Oktober 1952 (Direktionsakten GNM), zitiert<br />
nach: Burian 1978: 239f
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 413<br />
sehen Gedächtnisses definiert wird, soll es <strong>für</strong> die Dokumente deutscher Kunst<br />
aus den 1945 verlorenen Ostgebieten zunächst schlicht Zwischenlager sein,<br />
doch spätere Definitionen dieser neuen Museumsaufgabe gingen dann doch <strong>von</strong><br />
der Engdültigkeit dieser politischen Lage aus »und ersetzten politische Absichten<br />
durch den Hinweis auf den Charakter der neuen Museumsabteilung als<br />
einer Stätte der nationalen Erinnerung« - vom Zwischenzum<br />
Endlager also.<br />
Judaica im GNM: Die Initiative <strong>von</strong> 1912<br />
Jüdische Bürger Nürnbergs lancieren im Dezember 1912 gemeinsam mit der<br />
Museumsleitung des GNM den Aufruf zur Einrichtung eines Deutsch-jüdischen<br />
Museums im Zusammenhang mit der Nationalanstalt des GNM. Der<br />
Deutschland-Test: »Das Archiv des Museums bewahrt einige bezeichnende<br />
Zeugnisse <strong>für</strong> nationalistische und rassistische Mentalität, zum Beispiel einen<br />
Zeitungsartikel unter der Überschrift >Jüdisch-germanische Museumskultur
414 MUSEUM<br />
- eine synekdochische Strategie der musealen Einverleibung. Zwischen Abteilung<br />
(so genannt im Rubrum des entsprechenden Archivordners des GNM)<br />
und (eigenständigem) Museum deutet sich im Akt der institutionellen Benennung<br />
die Gratwanderung an, die das deutsch-jüdische Verhältnis charakterisiert.<br />
Der Aufruf! balanciert dementsprechend, dieses »eindringlich zum Beschauer<br />
sprechende >Deutsch-jüdische MuseumGermanisches Museum< Anspruch macht. Dem Germanischen<br />
Museum habe ich z.B. die Absicht gehabt, das Archiv und die Akten<br />
über den pfälzischen Aufstand im Jahre 1848 zu schenken, da ich das Germanische<br />
Museum <strong>für</strong> den besten Aufbewahrungsort dieser interessanten Sammlung erachte.<br />
Einem germanisch-jüdischen Museum möchte ich aber diese Schenkung nicht überlassen.<br />
Ich hoffe, es werden sich aber Mittel und Wege finden lassen, dass das<br />
deutsch-jüdische Museum <strong>für</strong> sich gesondert zur Aufstellung kommt und dass es<br />
mit dem Germanischen Museum weiter keinen Zusammenhang hat, ausser dass es<br />
in Nürnberg zur Aufstellung kommt. Ich hoffe zuversichtlich, dass das<br />
Museum das bleibt, als was es gegründet worden ist, als eine Sammelstätte germanischer<br />
Altertümer. Es hätten ja dann auch Museen über lettische, serbische,<br />
jüdiüchc etc. Altertümer angegliedert werden können. Dies hätte insofern noch eine<br />
Berechtigung, als die fraglichen Stämme früher grosse Teile unseres Vaterlandes<br />
bewohnten und zum Teil heute noch bewohnen. Was das Volk Israel betrifft, das<br />
im deutschen Volk nur Gastrecht geniesst, so liegt meines Erachtens nicht der mindeste<br />
Grund vor, das Programm des Stifters in dieser Richtung zu erweitern.«<br />
Darauf antwortet Direktor <strong>von</strong> Bezold am 6. Februar 1913, die satzungsmäßige<br />
Aufgabe, Denkmale der deutschen Kulturgeschichte zu bewahren, könne<br />
»nicht nach Sympathien und Antipathien, sondern nur nach bestimmten wissenschaftlichen<br />
Grundsätzen gelöst werden und ist <strong>von</strong> Anfang an so aufgefasst worden,<br />
dass alle Erscheinungen, welche die deutsche <strong>Geschichte</strong> beeinflusst haben, in<br />
den Sammlungbereich des Museums gezogen wurden. So sind denn auch <strong>von</strong><br />
allem Anfang an jüdische Altertümer gesammelt worden. Schon Essenwein trug sich<br />
mit dem Gedanken, die Juden selbst zur Erwerbung <strong>von</strong> jüdischen Altertümern<br />
heranzuziehen . Es handelt sich dabei nicht um ein Verherrlichen des Juden-
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 415<br />
tums, sondern einfach um die Sammlung wissenschaftlichen Materials und darum,<br />
dass Dinge, welche bisher auf den allgemeinen Museumsfond verrechnet wurden,<br />
nunmehr aus einem besonderen Fond bezahlt werden sollen.« <br />
Die Vektoren administrativer Museumspraxis also, nicht ideologische Emphasen<br />
definieren hier Gedächtnispolitik. Dieser Pragmatik setzt sich ein Zeitungsausschnitt<br />
in demselben Archivfaszikel, ein Leserbeitrag <strong>von</strong> Heinrich Pudor unter<br />
dem Titel Jüdisch-germanische Museumskultur (divinatorisch wider Willen) entgegen,<br />
der gegen »diesen beabsichtigten Einbruch des Judentums in deutsches<br />
Stammland« Protest erhebt: Das Germanische Museum in Nürnberg »soll germanisch<br />
sein oder es soll nicht sein. Die deutsch-jüdischen Altertümer, soweit<br />
solche schon drin sind, sollen in ein <strong>von</strong> den Juden zu gründendes Museum in<br />
Palästina gebracht werden.« Der Artikel kulminiert in einem Seufzer: »Was uns<br />
nicht dieses Jahr 1913 noch alles bringen wird« - es bringt die Einweihung des<br />
Leipziger Völkerschlachtdenkmals. Symbolisch aber wird <strong>von</strong> Pudor der spätere<br />
nationalsozialistische Umsiedlungsplan europäischer Juden nach Palästina oder<br />
Madagaskar vorweggenommen. 78 Pudor referiert am Ende einen Protest, den<br />
eine Gruppe Gleichgesinnter an das bayerische Ministerium »gegen diese beabsichtige<br />
Verjudung unseres Germanischen Nationalmuseums« gerichtet hat und<br />
gestattet sich den Vorschlag zu machen, den bisherigen Titel eines Germanischen<br />
Nationalmuseums umzuändern in »Modernes germanisch-deutsch-jüdisches<br />
internationales Nationalmuseum« . Am 10. März 1929 wird auf einer<br />
Zusammenkunft der Leiter jüdischen Museen die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>für</strong> Sammlungen jüdischer Kunst- und Altertümer beschlossen mit<br />
dem Ziel einer Gesamtveröffentlichung mit dem ungefährem Titel Die jüdischen<br />
Geschichts- und Kulturdenkmäler in Deutschland, als »Ersatz <strong>für</strong> ein jüdisches<br />
Zentralmuseum« 79 . Nicht anders hat in der Genealogie des GNM das Aufseß'sche<br />
Generalrepertorium als Ersatz <strong>für</strong> die unmögliche Zusammenfügung der<br />
Materie deutscher Kulturgeschichte gedient. Erneut wird diskutiert, ob weiterhin<br />
selbständige jüdische Museen errichtet oder an existierenden deutschen<br />
Museen jüdische Abteilungen eingerichtet werden sollen. Jacob Seifensieder wiederholt<br />
seinen Vorschlag <strong>von</strong> 1912, dem Germanischen Nationalmuseum in<br />
Nürnberg eine Auswahl solcher Altertümer geschenk- oder leihweise zur Verfügung<br />
gestellt werden, <strong>für</strong> die Angliederung einer derartigen Sammlung; diese<br />
78 Zum »Madagaskar-Plan« siehe etwa Ulrieh Herbert, Die deutsche Militärverwaltung<br />
und die Deportation der französischen Juden, in: Christian Jansen u. a. (Hg.), Von der<br />
Aufgabe der Freiheit: politische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19.<br />
und 20. Jahrhundert (Festschrift <strong>für</strong> Hanns Mommsen zum 5. November 1995) Berlin<br />
(Akademie) 1995, 427-450 (432)<br />
79 Karl Ladenburg, in: Central-Verein-Zeitung, 8. Jg., Nr. 24 (14. Juni 1929), 319
416 MUSEUM<br />
war im Sinne des damaligen Direktoriums »nicht Eigentum einer einzelnen<br />
Gemeinde oder Landschaft, sondern Ehre und Stolz aller deutschen Juden, ähnlich<br />
wie das Germanische Nationalmuseum Eigentum aller Deutschen ist.« 80<br />
Alfred Grotte, Mitgründer des Jüdischen Museums in Breslau, <strong>für</strong>chtet demgegenüber<br />
um die jüdische Differenz: daß nach einer solchen Übereignung des<br />
Materials an das GNM »es in der überwältigenden Fülle der dort aufgespeicherten<br />
Kunstschätze verschwinden dürfte« . Was bleibt<br />
(nach 1945)? Die Problematik der deutsch-jüdischen Beziehungen nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg, etwa bei den Beratungen über den dann nicht verwirklichten<br />
Vorschlag, eine im Besitz des Museums befindliche Haggadah-Handschrift des<br />
15. Jahrhunderts (aus einer jüdischen Gemeinde stammend) zum Zwecke des<br />
Erwerbs des deutschen Gedächtnismonuments Echternachter Codex zu verkaufen.<br />
Theodor Heuss bat, das Abgeben dieser Handschrift »politisch und taktisch«<br />
daraufhin zu prüfen, ob damit durch den Verzicht des deutschen Nationalmuseums<br />
auf ein kulturgeschichtliches Dokument des Judentums »nicht Schaden<br />
angerichtet würde«. 81 Später werden tatsächlich zwei in der Bibliothek verwahrten<br />
Haggadah-Handschriften auf Betreiben des Verwaltungsratsmitglieds Ernst<br />
Beutler (vom Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt/M.) an die Schocken<br />
Library in Jerusalem abgegeben.<br />
Museumsdidaktik im Dritten Reich, Weltkrieg und Archivlöcher<br />
Nach der Novemberrevolution <strong>von</strong> 1919 plädiert Direktor Bezold da<strong>für</strong>, das<br />
Museum aus seinem Zustand als »anachronistisches Altertum«, selbst zum<br />
Monument kristallisiert also, herauszuführen »in den Dienst der Volksbildung«. 82<br />
Die Einrichtung einer entsprechenden Schausammlung wird erst nach 1933 realisiert,<br />
nachdem die Scheidung zwischen Schau- und Studienräumen bereits gängige<br />
Münze in der deutschen Museologie geworden war. In der ersteren werden,<br />
um das Beispiel der Neuordnung des Römisch-Germanischen Centralmuseums<br />
in Mainz um 1900 zu nennen, »nur geschlossene Gruppen und wohlerhaltene<br />
Einzelgegenstände zur Anschauung gebracht, während die fragmentierten<br />
Sachen, Scherbenmaterial usw. mehr den Depots zugewiesen sind, die nur auf<br />
80<br />
Jacob Seifensieder, Wohin mit den deutsch-jüdischen Altertümern? in: Central-Verein-Zeitung,<br />
6. Jg., Nr. 25 (24. Juni 1927), 359, zitiert im Beitrag »Jüdische Museologie«,<br />
in: Wiener Jahrbuch <strong>für</strong> jüdische <strong>Geschichte</strong>, Kultur und Museumswesen 1<br />
(1994), 55-70 (66f)<br />
81<br />
Protokolle des Verwaltungsrats, 2. Juli 1954; Direktionsakten GNM, zitiert nach:<br />
Burian 1978: 241<br />
82<br />
Verwaltungsbericht Bezolds <strong>für</strong> 1918/19 (Protokolle des Verwaltungsausschusses, 31.<br />
Juli 1919, Anlage; Altregistratur GNM, Kapsel 758, zitiert nach Burian 1978: 227
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 417<br />
besonderen Wunsch zugänglich gemacht werden.« 83 Erst der Besuch durch<br />
Frontsoldaten auf Heimaturlaub im Ersten Weltkrieg läßt dann anhand der<br />
Objekte, die der Ausstellung zunehmend selbst als Frontfunde zufallen, Parallelen<br />
zwischen dem Leben der Steinzeit und dem Schützengrabenleben als Schnittstelle<br />
zwischen Depot und Schausammlung plausibel erscheinen .<br />
Damit ist einerseits der archivische Verschlußmechanismus der Gedächtnisinstitution<br />
Museum angesprochen, der gerade als Kehrseite zum Diskurs (also zur<br />
Öffentlichkeit) hin sich formiert; zum anderen aber auch - um hier eine Maßeinheit<br />
aus der Nachrichtentheorie zu borgen - die signal-to-noise-ratio innerhalb<br />
dieser Agentur, wo ästhetische Ordnung und entropische Unordnung, ein kulturhistorischer<br />
und ein chirurgisch malinvasiver, mithin wissensarchäologischer<br />
Zustand aufeinanderprallen und nur bedingt die zur Disposition stehenden<br />
Daten diffundieren lassen. Für den am 1. Januar 1937 vom Bayerischen Staatsministerium<br />
<strong>für</strong> Unterricht und Kultus im Einvernehmen mit dem Reichs- und<br />
Preußischen Ministerium <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung auf einstimmigen<br />
Vorschlag des Verwaltungsrates zum Ersten Direktor ernannten Heinrich<br />
Kohlhaußen heißt das Programm zunächst Dislokation im Pragmatischen,<br />
nicht im Ideologischen:<br />
» bei dem unübersichtlichen Grundriß des Museums die Sammlungen so lange<br />
in den vorhandenen Baulichkeiten zu verschieben, bis ein Höchstmaß an Ordnung<br />
und Klarheit erreicht wird. Das bedeutet, das zusammenhanglose Nebeneinander<br />
verschiedener Fachsammlungen in ein sinnvolles Nacheinander und Zueinander<br />
zu bringen, einen Entwicklungsablauf zu bieten, zeitlich und sachlich zusammenhängende<br />
Raumfolgen zu schaffen.« <br />
Die Unterlegung des Modells <strong>Geschichte</strong> dient hier zur Reduktion <strong>von</strong> Komplexität,<br />
als Ordnungsfaktor angesichts kontingenter, erst auf der Ebene<br />
des Katalogs zusammenfindender musealer Parataxe. Direktor Kohlhaußen<br />
bezeichnet es im ersten <strong>von</strong> ihm herausgegebenen Jahresbericht als »die Aufgabe<br />
unserer Gegenwart die rechte Form zu finden, um eine unendliche<br />
Gestaltungsfülle aus Jahrtausenden in die leitenden Linien der Entwicklung<br />
einzuordnen.« Klarheit des Aufbaus dient demnach nicht als Asymptote<br />
<strong>von</strong> Objektivität, sondern »als Wertung, so daß auch der Außenstehende, der<br />
einfachste Volksgenosse, ja gerade er zwangslos zum Wesentlichen geführt<br />
wird«.<br />
83 Karl Schumacher, Das Römisch-Germanische Central-Museum <strong>von</strong> 1901-1926, in:<br />
Festschrift zur Feier des fünfundsiebzigjährigen Bestehens des Römisch-Germanischen<br />
Central-Museums, Mainz (Wilckens) 1927, 57-97 (57). Die Scheidung zwischen<br />
der Auflistung <strong>von</strong> Originalen und Kopien, die mit dem Jahresbericht des RGM seit<br />
1902/03 einsetzt, ist an diese Differenz gekoppelt.<br />
84 Jahresbericht des GNM 84 (<strong>für</strong> 1937), 1938, 2, zitiert nach Burian 1978: 227
418 MUSEUM<br />
Zu Beginn des Parteitages der NSDAP findet 1936 in der Kartäuserkirche die<br />
feierliche Eröffnung der <strong>von</strong> der Dienststelle des Reichsleiters Alfred Rosenberg<br />
in Zusammenarbeit mit dem Museum, der Preußisches und der Bayerischen<br />
Staatsbibliothek besorgten Ausstellung Das politische Deutschland statt.<br />
»Der Schicksalsweg des deutschen Volkes« wird an Urkunden, Handschriften,<br />
Bildern, Büchern und Karten veranschaulicht; ein Weiheraum Ewiges Deutschland<br />
beschließt die in historischer Abfolge aufgebaute Ausstellung, unterstützt<br />
<strong>von</strong> der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums durch einen<br />
Katalog . Erst an die Distributionsmedien<br />
der Bibliothek (Schrift und Buch) gekoppelt, läßt sich das diskrete<br />
Material der GNM im Sinne der Ideologie mobilisieren. Die Funktion des nicht<br />
inventarisierenden, sondern beschreibenden Katalogs definiert der Kunsthistoriker<br />
Herman Grimm 1891 in seinem idealen Entwurf eines Museum <strong>für</strong><br />
vaterländische Kunstgeschichte: »Die Kataloge haben die Werke ausreichend zu<br />
erklären. Sie müssen gut verfaßte Beschreibungen jedes Stückes enthalten und<br />
ihm den welthistorischen Platz anweisen.« 85 <strong>Im</strong> Unterschied zur nationalsozialistischen<br />
Propaganda nicht wesentlich: »Unsere Zeit verlangt die Möglichkeit,<br />
auch ohne persönliche Unterweisung Anderer das zu Wissende erlangen<br />
zu dürfen. Die heutige Aufgabe ist, das Volk im höchsten Sinne dem Staate<br />
nutzbar zu machen« . Der Zweite Weltkrieg aber zwingt zu ganz anderen<br />
Dislokationen. Mediale Stellvertretungen beschwören die Geister eines desintegrierenden<br />
Reiches. Eine Photographie aus dem Archiv des Museums<br />
(Nachlaß Kohlhaußen) zeigt die Attrappe des Neptunbrunnens des Georg<br />
Schweigger (1613-90) aus Schloß Peterhof bei Leningrad im Hof des Germanischen<br />
Nationalmuseums; der 1652-60 in Nürnberg gegossene Brunnen war<br />
1797 nach Rußland verkauft worden. Das Foto (eine Aufnahme nach 1941)<br />
dokumentiert offensichtlich Überlegungen, Kunstwerke deutscher Herkunft<br />
aus den <strong>von</strong> der Wehrmacht eroberten fremden Gebieten nach Deutschland zu<br />
überführen. 86 Wenig später lagern spätmittelalterliche Skulpturen des Museums<br />
im Bergungsbunker unter der Nürnberger Burg. Melancholisch blickende<br />
Madonnen wissen um das Katechon des Museums als Lager, ganz wie das British<br />
Museum seine Objekte zeitgleich in Londons Underground-Tunneln<br />
birgt. 87 Am 25. Oktober 1945 erfolgt im wiedereröffneten Vortragssaal ein vom<br />
Museum veranstalteter Konzertzyklus. Für die allegorischen Grundlagen, wel-<br />
85 Herman Grimm, Das Universitätsstudium der Neueren Kunstgeschichte, in: Deutsche<br />
Rundschau Bd. LXVI (Jan. - März 1891), 390-413 (413)<br />
86 Abb. 84 und Legende in Deneke / Kahsnitz 1978: 86<br />
87 Siehe W. E., Unges(ch)ehene Museen: Bomben, Verschwinden, in: Martin Stingelin /<br />
Wolfgang Scherer (Hg.), HardWar / SoftWar. Krieg und Medien 1914 bis 1945, München<br />
(Fink) 1991,197-218
DAS GERMANISCHE NATIONALMUSEUM IN NÜRNBERG 419<br />
ehe diskursiv das GNM als Nationalunternehmen einst mit Geschichtsenergie<br />
speisten, ist das Gedächtnis jenseits des deutschen Reiches dabei blind; das an<br />
der Stirnseite des Vortragssaals befindliche, <strong>für</strong> die Museumsarbeit einst programmatische<br />
Fresko Wilhelm <strong>von</strong> Kaulbachs (die Graböffnung Karls des<br />
Großen durch Kaiser Otto III.) wurde durch einen Vorhang verdeckt. 88<br />
Seite 1 im Findbuch zu Teil I der Altregistratur im Archiv des GNM informiert<br />
unter der Überschrift Akten zur <strong>Geschichte</strong> des Germanischen Museums,<br />
daß es sich hierbei um Akten und einzelne Produkte handelt, »die bei einer<br />
offensichtlich vor dem 1. Weltkrieg vorgenommenen Aktenausscheidung wegen<br />
ihrer >Historischen Bedeutung< archiviert wurden. Ein Teil der Registratur<br />
scheint damals eingestampft worden zu sein.« Als non-diskursives Gedächtnis<br />
einer Institution regelt sich die Aktenlagerung und -klassifizierung des Archivs<br />
unter dem Gesichtspunkt des administrativen Betreffs; zu dieser Funktion steht<br />
die Ordnung des historischen Diskurses in einem dysfunktionalen Verhältnisses.<br />
Heinrich Kohlhaußen baut seit 1937 die Jahresberichte des GNM wieder zu<br />
umfassenden, oft mit programmatischen Überlegungen durchsetzten Rechenschaftsberichten<br />
aus. Grundlage da<strong>für</strong> sind die Akten, mit denen er sich umgibt.<br />
An ihnen hängt die Sagbarkeit der Historie; die Quellenlage zur <strong>Geschichte</strong> des<br />
GNM ist daher umso ungünstiger, als mit der Zerstörung des Dienstzimmers des<br />
Ersten Direktors bei einem Bombenangriff am 16. März 1945 die dort liegenden<br />
naturgemäß in erster Linie in Betracht kommenden Akten vernichtet werden -<br />
eine Lücke, die auch nicht wieder durch den inzwischen ins Archiv des Museums<br />
übergegangenen persönlichen Schriftnachlaß Kohlhaußens geschlossen werden<br />
konnte, ebensowenig wie durch das im Bundesarchiv unter den Aktenresten der<br />
Reichskanzlei vorhandene Material. »Daß aus diesen und anderen Gründen ein<br />
ursprünglich geplanter Aufsatz über >Das Museum im Dritten Reich< <strong>von</strong> dem<br />
vorgesehenene Autor zu einem Zeitpunkt als unausführbar abgebrochen wurde,<br />
als eine Ersatzlösung nicht mehr möglich war, betrachten die Herausgeber als<br />
schwerwiegenden Mangel des Bandes« 89 , so daß unklar bleibt, ob das GNM<br />
tatsächlich weitgehend unberührt <strong>von</strong> Verstrickungen in die nationalsozialistische<br />
Zeit, blieb, »wie die wenigen bisher bekannt gewordenen Quellen suggerieren«<br />
. Lücken skandieren unser Wissen <strong>von</strong> Vergangenheit ex negativo.<br />
Historische <strong>Im</strong>agination setzt am Nichtvorhandenen ein, also zwischen den Zei-<br />
88 Deneke / Kahsnitz 1978, Chronik: 91. Aufseß hatte in diesem Gemälde ein Sinnbild<br />
<strong>für</strong> die Arbeit im Museum gesehen, »hinabzusteigen in die lang verborgenen Tiefen<br />
der Vorzeit, um aufzusuchen des alten Reiches Herrlichkeit«, zitiert nach: Andrian-<br />
Werburg, Irmtraud Frfr. <strong>von</strong>, Das Germansiche Nationalmuseum. Gründung und<br />
Frühzeit, Nürnberg (Germanisches Nationalmuseum) 2002, 19<br />
89 Nachwort der Herausgeber, in: Deneke / Kahsnitz 1978: 1183-1195 (1184)
420 MUSEUM<br />
len des Quellentextes oder im Umkreis des Fragments. <strong>Geschichte</strong> ist so »im allgemeinsten<br />
Sinn der Ort der (scheinbaren) Leere - oder der (verlogenen) Fülle<br />
-, es sind die Bereiche der Lücken und blinden Flecken, sie ist die antizipierte<br />
Nachträglichkeit der Schrift.« 90 Schreiben wir die <strong>Geschichte</strong> also aus der Erfahrung<br />
ihrer Abwesenheit vielmehr wissensarchäologisch.<br />
90 Georg Schmid, Die Figuren des Kaleidoskops. Über <strong>Geschichte</strong>(n) im Film, Salzburg<br />
1983, 107
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 421<br />
Kontraststudie: Museum oder Grab?<br />
Das Zentralmuseum jüdischer Altertümer in Prag 1<br />
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg steht <strong>für</strong> den Versuch, deutsche<br />
Kulturgeschichte zentral zu inventarisieren; das kurze Zwischenspiel des<br />
Versuchs, dort eine deutsch-jüdische Sammlung zu inkludieren, hat die Aporie<br />
des Germanischen im Museumsnamen offengelegt. Mit dem Jüdischen Zentralmuseum<br />
in Prag treffen wir auf das Paradox einer ausschließlich unter jüdischer<br />
Mitarbeit betriebenen, gleichzeitig aber antisemitisch funktionalisierten<br />
Einrichtung als Medium der <strong>von</strong> Nationalsozialisten konzipierten und so genannten<br />
Endlösung der Judenfrage. Beginnen wir mit der Vorgeschichte dieses<br />
Endes, ohne zu vergessen, daß sich dazwischen nicht Linearität, sondern Brüche<br />
vollziehen.<br />
Jüdische Museen in Böhmen und Mähren<br />
Jüdische Studien umfaßten seit jeher Naturwissenschaften und Mathematik, Philosophie<br />
und Sprachwissenschaft, doch Kunstgeschichte fand lange keinen Platz<br />
»largely due to sensitivities raised by the second commandment of the Decalogue,<br />
which prohibits making images for idolatrous purposes [Ex. 20:4-5].« 2 Erst<br />
mit der Liberalisierung der jüdischen Studien, verbunden mit deren Akademisierung,<br />
kommen auch historische Untersuchungen zum Zuge, und zeitgleich<br />
mit dieser Verwissenschaftlichung kommt es zu entsprechenden<br />
Museumsgründungen in ganz Europa. In Prag heißt der Initiator Salomon Hugo<br />
Lieben (1881-1942), der zunächst die Kultusgegenstände verlassener Synagogen<br />
inventarisieren will und 1906 einen Verein zur Gründung des Jüdischen<br />
Museums ins Leben ruft. Dem Jüdischen Zentralmuseum in Prag unter NS-<br />
Direktive geht die Selbstmusealisierung des Judentums in Böhmen und Mähren<br />
voraus. Vor allem das Sammlungsprogramm des Jüdischen Zentralmuseums <strong>für</strong><br />
Mähren-Schlesien in Nikolsburg/ Mikulov (seit 1936) deckt sich museologisch<br />
formal mit dem späteren Projekt in Prag: als planmäßige (photographische)<br />
Inventarisierung jüdischer Friedhöfe und Architektur, Archivalien und Ritualgegenstände;<br />
diskursiv aber markiert angesichts fortschreitender Säkularisierung<br />
die Verwandlung <strong>von</strong> Religiosität in historisches Bewußtsein etwas anderes als<br />
1 Mit Dank <strong>für</strong> sachdienliche Hinweise <strong>von</strong> Seiten Hanno Loewys und seiner Mitarbeiter<br />
vom Fritz Bauer Instituts zur <strong>Geschichte</strong> und Wirkung des Holocaust, Frankfurt/M.<br />
2 Linda A. Altshuler / Anna R. Cohn, The Precious Legacy, in: David Altshuler (Hg.),<br />
The Precious Legacy. Judaic Treasures from the Czechoslovak State Collections, New<br />
York (Summit Books), 1983, 16-45 (19 u. 23)
422 MUSEUM<br />
die spätere Inventarisierung des Jüdischen durch diejenigen, die es auslöschen<br />
wollen. 3 Was sich in Prag unter NS-Verdikt vollzog, erinnert nur scheinbar<br />
(nämlich unter den verkehrten Vorzeichen einer freien Entscheidung) an eine<br />
vorangegangene Praxis: Die Akzession <strong>von</strong> Artefakten in Nikolsburg/Mikulov<br />
machte im September 1937 notwendig, eine unmittelbar benachbarte, nicht mehr<br />
benutzte Privatsynagoge dem Museum <strong>für</strong> weitere Ausstellungszwecke zu überlassen.<br />
Die Entwicklung geht vom Museum als antiquarischer Kammer hin zur<br />
Dokumentation; mit der Sammlung <strong>von</strong> Ausstellungsobjekten sollte auch der<br />
Aufbau einer Bibliothek und (unter Leitung <strong>von</strong> Alfred Engel) eines Archivs zur<br />
<strong>Geschichte</strong> und Kultur der Juden in Mähren-Schlesien in Angriff genommen<br />
werden. Informationsgewinn (Inventarisation) hat hier den Vorrang gegenüber<br />
der Ästhetik <strong>von</strong> Musealien, denn <strong>für</strong> das Zentralmuseum übernahm der Verein<br />
nach dem Vorbild des Landesverbands der Israelitischen Kultusgemeinde in Bayern<br />
auch die Dokumentation kulturgeschichtlich wertvoller jüdischer Denkmäler:<br />
Ritualgegenstände und Kultusstätten aufgelöster oder in Auflösung<br />
befindlicher Landgemeinden. Von den bedeutendsten Grabsteinen in ganz<br />
Mähren-Schlesien wurden Photographien angefertigt und dem Museum als Zentralstelle<br />
<strong>für</strong> derartige Abbildungen* zugewiesen. Die Logistik des Depots ist<br />
(gegenüber der öffentlichen Ausstellung) verborgen am Werk; Ästhetik und<br />
Gedächtnis fallen auseinander: »Die Ausstellung des Museums läßt sich nur<br />
höchst bruchstückhaft rekonstruieren, da sich dazu in den Akten kaum Unterlagen<br />
befinden.« 5 Der Ort der Akten aber, das Archiv, ist nicht allein Bedingung<br />
einer auf das Ereignis zurückschauenden Historiographie, sondern schon dessen<br />
Protagonist. Solche spezifisch deutsch-jüdischen Gedächtnisorteteilen das<br />
Schicksal der Verschickung erst <strong>von</strong> Artefakten (Musealien, Archivalien), dann<br />
der Menschen (ihre Besitzer) und schließlich der Gedächtnishüter (Museumsund<br />
Archivmitarbeiter).<br />
3 Ein Bericht des Mitarbeiters Engel erwähnt das Mezewebuch eines Rabbiners: »Es<br />
enthält nur <strong>Namen</strong> und Daten und wäre einer Abschrift in Kartothekform würdig.«<br />
Zitiert in: Falk Wiesemann, Das Jüdische Zentralmuseum <strong>für</strong> Mähren-Schlesien in<br />
Nikolsburg, in: Wiener Jahrhbuch <strong>für</strong> jüdische <strong>Geschichte</strong>, Kultur und Museumswesen<br />
Jg. 1 (1994), 107-131 (123). Über »jüdische Museologie« im deutsch-jüdischen<br />
Kulturraum auch der Aufsatz <strong>von</strong> Margrethe Brock-Nannestad im gleichen Wiener<br />
Jahrbuch <strong>für</strong> jüdische <strong>Geschichte</strong> (55-71); über frühe Pläne eines »jüdischen Zentralmuseums«<br />
bes. 63ff.<br />
4 Verein an Hugo Glattaucr, Wien, 9. Dezember 1935, Jüdisches Zentralmuseum Nikolsburg/Mikulov<br />
41589, zitiert nach: Wiesemann 1994: 126<br />
5 Wiesemann 1994: 129, Anm. 14. Wiesemann verweist auf E. Dostal, Das jüdische Zentralmuseum<br />
in Nikolsburg, Typoskript mit Korrekturen <strong>von</strong> Engel (1936), Jüdisches<br />
Zentralmuseum Nikolsburg 43 837 (im Staatlichen Jüdischen Museum Prag im<br />
Bestand Archivalien der Kultusgemeinden, Mikulov Nr. 615-649)
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 423<br />
Gegenüber dem Betrachter kann ein Gegenstand im Verhältnis <strong>von</strong> Gegenwart<br />
oder Vergangenheit stehen. Es gibt Formen des Sammeins, die Kontinuität verbürgen<br />
sollen und andere, die Dinge aus dem Lebenszusammenhang in eine Ordnung<br />
versetzen, die Gewalt ausübt. Ein museales Inventarisierungsprogramm 6 in<br />
Frankfurt am Main bildet die Vorwegnahme des Prager Mechanismus <strong>von</strong> 1942/<br />
Am 28. Januar 1940 verfügt Adolf Hitler die Gründung der Hoben Schule, einer<br />
Parteiakademie <strong>für</strong> nationalsozialistische Doktrin und Erziehung, geplant am<br />
Chiemsee. Tatsächlich errichtet wurde im März 1941 <strong>von</strong> Reichsleiter Alfred<br />
Rosenberg als deren Frankfurter Zweigstelle das Institut zur Erforschung der<br />
Judenfrage, eine Sammelstelle vor allem <strong>für</strong> jüdisches Bibliotheksgut aus den<br />
besetzten Territorien 8 ; im März 1942 wird etwa in Paris die Dienststelle Westen<br />
des Einsatzstabs Rosenberg eingerichtet und konfisziertes jüdisches Bibliotheksgut<br />
und Mobiliar an dem Ort gesammelt, inventarisiert und verteilt, wo nun die<br />
neue Nationalbibliothek das Wissen darum mit einem Wissensmonument überschreibt.<br />
9 In Prag (wohin 1944 Teile des Frankfurter Bücherbestands gelangen)<br />
6 Bernhard Purin führte als Kurator am Jüdischen Museum Wien eine Ausstellung zur<br />
Beschlagnahme und Verteilung <strong>von</strong> Sammlungen jüdischer <strong>Geschichte</strong> und Kultur in<br />
Österreich unter dem Titel INVENT-ARISIERT durch.<br />
7 Zur Überführung jüdischer Ritualgegenstände, Musealien und Urkunden in das<br />
Frankfurter Historische Museum und Stadtarchiv siehe die Akte Sign. 6302, Bd. 1 und<br />
Sign. 166 im Stadtarchiv Frankfurt/M.; auszugsweise photographisch reproduziert in:<br />
Felicitas Heimann-Jelinek, »Was übrig blieb«. Das Museum Jüdischer Altertümer in<br />
Frankfurt 1922-1938, Frankfurt/M. 1988; zu Kompetenz- und Klassifikationsschwierigkeiten<br />
zwischen Archiven, Museen und dem Frankfurter Institut zur Erforschung<br />
der Judenfrage: H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der<br />
Juden aus Deutschland, Tübingen 1974 616ff<br />
8 Klärung in die verworrene Genealogie dieses Instituts bringt Dieter Schiefelbein, Das<br />
»Institut zur Erforschung der Judenfrage Frankfurt am Main«. Vorgeschichte und<br />
Gründung 1935-1939, Frankfurt/M. 1994 (= Materialien Nr. 9 des Frankfurter Studien-<br />
und Dokumentationszentrums zur <strong>Geschichte</strong> und Wirkung des Holocaust /<br />
Fritz Bauer Institut, hg. in Zusammenarbeit mit dem Institut <strong>für</strong> Stadtgeschichte,<br />
Frankfurt/M. ), bes. 25ff. S. a. Altshuler / Cohn, Anm. 2 zu Kap. I, Seite 276, unter<br />
Bezug auf: Documents 171-PS abd 286-PS, Office of U.S. Chief of Counsel, International<br />
Military Tribunal, Nuremberg, National Archive Record Group 238. Bl. 763-<br />
767 enthält den Bericht J. Pohls v. 29. April 1943 über den Stand der Katalogisierung<br />
der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage und betont ihre im europäischen Rahmen<br />
einzigartige Vollständigkeit (Kopie im Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 502-1; s. a.<br />
Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Gerichtshof,<br />
Nürnberg 1947, Bd. 25, 242-246). Siehe auch Wilhelm Grau, Der Aufbau der Bibliothek<br />
zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt a. Main, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Bibliothekswesen<br />
59 (1942), 489-494<br />
9 Alexander Smoltzczyk, Die Türme des Schweigens, in: Zeit-Magazin Nr. 5, 24. Januar<br />
1997,10-17
424 MUSEUM<br />
erhielt unterdessen im Rahmen des Zentralamts zur Regelung der Judenfrage in<br />
Böhmen und Mähren (unter Reinhard Heydrich) SS-Untersturmführer Karl<br />
Rahm die Verfügungsgewalt über das neu betitelte Jüdische Zentralmuseum. Die<br />
jeweiligen Aggregatzustände des Museums jüdischer Altertümer in Prag lassen<br />
sich gegenüber solchen Kontexten nur bedingt als <strong>Geschichte</strong> erzählen. Dem<br />
Depot - und das war es vorrangig - gilt es vielmehr im Darstellungsmodus der<br />
Medienarchäologie zu begegnen. Die Daten aus dem Textarchiv aber erlauben es<br />
nur unzureichend, das Thema im historischen Raum zu lokalisieren; die Problematik<br />
des Belegs ist <strong>für</strong> dieses Mal ausdrücklich Teil des Themas selbst. Verlassen<br />
wir uns auf die Aussagen der überlebenden Museumsmitarbeiterin Hana Volavkovä,<br />
bedeutet dies, sich gleichzeitig auf all jene differerierenden Bewegungen der<br />
moralischen <strong>Im</strong>munisierung, der nachträglichen Rechtfertigung einzulassen, die<br />
an jener Monographie mitschreiben, um den toten Museumskollegen in einer doppelten<br />
Frontstellung zum Zionismus einerseits und zum tschechischen Nachkriegsantisemitismus<br />
andererseits ein Gedächtnis zu errichten. Ihre Variante der<br />
jüdischen Museumsinitiative ist kaum belegbar; alle Verweise hierauf sind sozusagen<br />
im Konjunktiv zu lesen. Demgegenüber müssen die nachweislichen Informationen<br />
herauspräpariert und neuen Konfigurationen zugänglich gemacht<br />
werden. Die Fakten, die Volavkovä präsentiert, stehen - <strong>für</strong> die Autorin anders als<br />
<strong>für</strong> die nachgeborenen, speziell die deutschen Leser - unter dem Vorbehalt eines<br />
Traumas, das eine ganz andere Faktizität eröffnet. 10 Ihre Schrift ist gleichzeitig ein<br />
historisches Dokument und ein Gedächtnismonument dieser Vorgänge, geradezu<br />
die Autorität des Realen in der buchstäblichen Ordnung der Museumshistorie:<br />
1950 zur ersten Leiterin des Prager Staatlichen Jüdischen Museums ernannt (wie<br />
es sich bis vor kurzem darstellte), ist sie die einzige überlebende Zeugin seiner Vorgeschichte:<br />
»Die Sache begann ganz einfach und <strong>für</strong> die damalige Zeit völlig normal.«<br />
11 Kann man es zulassen, daß sich, wie auch immer ein Text im Einzelnen<br />
strukturiert sei, eine historische Erzählung abrollen wird, wo doch die Ordnung<br />
der narrativen Rekonstruktion <strong>von</strong> Vergangenheit in Form <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>/n<br />
selbst immer schon jenen Diskurs affirmiert, welcher dem Nationalsozialismus<br />
Begriffe wie Endlösung und Endsieg semantisch überhaupt erst ermöglichte?<br />
»Beginn« (arche) bedeutete in der altgriechischen Polis auch Befehl; Gedächtnis<br />
bedarf des <strong>Im</strong>perativs zur Erinnerung, um überhaupt in Bewegung gesetzt zu werden.<br />
12 Die Neukonfiguration des Jüdischen Museums in Prag ist tatsächlich Effekt<br />
10<br />
Siehe Reinhard Koselleck, »Terror und Traum«, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur<br />
Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. 1979<br />
11<br />
Hana Volavkovä, Schicksal des Jüdischen Museums in Prag, übers. Erich Bertleff, Prag<br />
1965,29<br />
12<br />
Siehe Jacques Derrida, Mal d'Archive. Une <strong>Im</strong>pression Freudienne, Paris (Galilee)<br />
1995, Einleitung
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 425<br />
einer administrativen Order. Am 28. Mai 1942 verschickt das Prager jüdische Rathaus<br />
(<strong>von</strong> den Besatzern zu einem Organ erhoben, das jüdische Selbstverwaltung<br />
vortäuschen sollte) eines seiner Rundschreiben aus mit der Aufforderung, daß alle<br />
ehemaligen jüdischen Kultusgemeinden in Böhmen und Mähren ihr gesamtes<br />
bewegliches Eigentum zu verpacken und an die Adresse Jüdisches Zentralmuseum<br />
in Prag zu senden haben. Bei dieser Sendung <strong>von</strong> Objekten aus geschlossenen<br />
Synagogen ist das postalische Medium in der Tat schon eine Botschaft, die bei<br />
Volavkovä mit Schicksal übersetzt ist; in Prag formierte sich weniger ein jüdisches<br />
Museum denn eine Paketstelle, ein Depot: »Doch verpackt wurden Kultgegenstände,<br />
ausgepackt und katalogisiert hingegen Objekte . Schon unterwegs<br />
hatte sich mit ihnen eine Wandlung vollzogen: aus Gegenständen des Gottesdienstes<br />
wurden Gegenstände aus einem bestimmten Material« . Volavkoväs Akzentuierung dieser gewaltsamen, abrupten, keinem<br />
langsamen kulturgeschichtlichen Transformationsprozeß unterliegenden Differenz<br />
wird auch historiographisch zum Akt des Widerstands, des Überlebenswillens<br />
gegen die Sachsprache der NS-Administration; seinerzeit aber zwingt der<br />
Zeitdruck die Beteiligten <strong>von</strong> Seiten des jüdischen Museums, sich ebenso sachlich<br />
auf die notwendigste Dokumentation und wissenschaftliche Datenerfassung zu<br />
beschränken. 13 So werden soziale Kontexte zu Schrift, und diese Aufzeichnung<br />
war nicht diskursiv (Historiographie, Literatur, Prosa), sondern Gedächtnisverwaltung.<br />
Am 3. August 1942 sendet der Prager jüdische Ältestenrat ein weiteres<br />
Schreiben an die Außengemeinden, das präzise Instruktionen zur dokumentarischen<br />
Verzeichnung der Transfer-Objekte enthält. Die Sanktionierung <strong>für</strong> deren<br />
Inspektion und mögliche Einverleibung in das zentrale jüdische Museum beruht<br />
in fataler Weise auf der Autorität der Besatzer 14 und hat gemäß einer Anordnung<br />
des SS-Untersturmführers Karl Rahm zu erfolgen . In<br />
diesem Punkt koinzidieren die Interessen der Prager jüdischen (Rest-)Gemeinde<br />
- bei aller Vorsicht, was die Repräsentativität des Ältestenrats betrifft - und der<br />
NS-Zentralstelle. Als Datenbanken sind museale Depots indifferente Objekte <strong>von</strong><br />
Registratur; den Unterschied macht allein die Absicht, die diskursive Ausrichtung<br />
(der Sinn) ihres Gebrauchs. Damit ist eine klassische Bedingung des Mediums<br />
Museum angesprochen, die es <strong>von</strong> rein non-diskursiven Speichern unterscheidet:<br />
die Ausstellung und das Zeigen als diskursive Schnittstelle zum Besucher, dem<br />
Adressaten. Nach den Plänen der deutschen Zentralstelle soll das Museums seit<br />
seiner Gründung im August 1942 nicht schlicht Depot, die Sammelstelle <strong>für</strong> syna-<br />
13<br />
Marketa Peträsovä, Collections of the Central Jewish Museum (1942-1945), in: Judaica<br />
Bohemiae Jg. 24/1 (Prag 1988), 23-59 (27)<br />
14<br />
»With the consent of the superior authority«. Übersetzung aus dem Tschechischen:<br />
Peträsovä
426 MUSEUM<br />
gogale Gegenstände, Bücher und Archivalien aus dem Besitz der ehemaligen jüdischen<br />
Kultusgemeinden Böhmens und Mährens sein und die fachmännische Sichtung<br />
und Ordnung des Materials durchführen, sondern es im Rahmen <strong>von</strong><br />
Spezialausstellungen auch »sinnvoll exponieren. Die Ausstellungen sollten<br />
in den <strong>für</strong> diese Zwecke besonders adaptierten Synagogen zusammengefaßt werden.«<br />
15 Die Trennung <strong>von</strong> Depot und Museum manifestiert eine Aktennotiz vom<br />
16. April 1943, die Ausfolgung <strong>von</strong> Gegenständen aus den Lagern der Treuhandstelle<br />
<strong>für</strong> das jüdische Zentralmuseum betreffend.<br />
Der Wortlaut des Rundschreibens der Jüdischen Kultusgemeinde in Prag<br />
vom 28. Mai 1942 betont implizit die deutsche Aufsicht: »Die zu überführenden<br />
Gegenstände sind sorgfältig verpackt an die JKG Prag abzusenden.<br />
Zugleich ist ein Verzeichnis der abgesandten Gegenstände in vierfacher Ausfertigung<br />
in deutscher Sprache zu verfassen.« 16 So ist das Idiom dieser Logistik<br />
<strong>von</strong> Sammlung und Gedächtnis die zu dieser Zeit aktuelle Sprache der Macht.<br />
Dieser Fall verweist auf eine umfassendere Praxis. Am 4. Juni 1942 etwa wird<br />
dem Finanzamt in Kitzingen auf dessen Anfrage, ob es eine Anzahl jüdischer<br />
Gebetbücher der Gestapo miteinsenden solle, die Auskunft erteilt: »Jüdische<br />
Gebetsbücher, die keinen künstlerischen oder archivalen Wert besitzen <br />
können eingestampft werden«, denn Ritualien solcher Art repräsentierten<br />
keinen spezifischen Geldwert, »geschweige denn schienen sie <strong>von</strong> musealem<br />
Interesse« . Anders verhält es sich, wenn eine Sammlung kultischen<br />
Silbergeräts zu pseudowissenschaftlichen Zwecken diente, wie seit<br />
August 1942 in Berlin beim RSHA in Kooperation mit einer Anweisung der<br />
Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Hier manifestiert sich, noch<br />
einmal, die erzwungene Aporie jüdischer Kooperation mit den Tätern; die<br />
Zentrale der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ist ein Organ des<br />
Reichssicherheitshauptamts, und ihr kommt allein »in dieser ermächtigen<br />
Eigenschaft (freilich nur instrumental und nicht initiativ) unbestrittenen Anordnungsgewalt«<br />
zu . Lager sind erst dann als Gedächtnis zu nutzen, wenn<br />
ihre Inhalte adressierbar, also greifbar sind. Ein Brief der Jüdischen Kultusgemeinde<br />
in Prag an die Zentralstelle <strong>für</strong> jüdische Auswanderung vom 26. Mai<br />
1942 sagt es bezüglich der Stadt Brno/Brünn, wo die Bücherei der jüdischen<br />
Gemeinde <strong>von</strong> der Gestapo im März 1939 beschlagnahmt worden war: »Die<br />
genaue Anzahl der Bände kann nicht angegeben werden, da auch die Kataloge<br />
weggeführt wurden« . Was zählt, ist der Zugang zum Wissen: Register,<br />
Kataloge, die Macht ihrer Verfügbarkeit. Der Mitarbeiterstab des Zentralmu-<br />
15 Jahresbericht <strong>für</strong> das Jahr 1943, 30. November 1943: Archiv des Jüdischen Museums<br />
Prag, Bestand War Museum Fund, Inv. Nr. 18, zitiert nach Petrasovä 1988: 26<br />
16 War Museum Fund, Inv. Nr. 20 (1942-44)
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 427<br />
seums in Prag versah die eingegangenen Gegenständen mit Übernahmeprotokollen<br />
und mit laufenden Inventarnummern, um sie dann - jenseits aller kulturhistorischen<br />
Hermeneutik - bestimmten Materialgruppen zuzuordnen. Die<br />
Verzeichnungsarbeiten in der Prager Pinkas-Synagoge standen dabei unter der<br />
wissenschaftlichen Aufsicht des seiner Stelle am Brünner Gymnasium beraubten<br />
Alfred Engel, hauptverantwortlich <strong>für</strong> die »Kommission D«, die sich überwiegend<br />
mit Archivalien beschäftigte . »To process<br />
only what had been delivered« (Peträsovä) heißt Datenverarbeitung. Demgegenüber<br />
strebten die jüdischen Museumsmitarbeiter mit demselben Material<br />
kein museales Monument, das stumme Zeugnis einer untergehenden Kultur an,<br />
sondern die Angst um die Fortexistenz der Juden überhaupt trieb sie zu dem<br />
Versuch einer umfassenden Dokumentation des jüdischen Lebens in Böhmen<br />
und Mähren . Die Inventarisierungsmaschine Museum<br />
ermöglichte dabei die Aufzeichnung eines kulturellen Erbes, nachdem den<br />
Juden im Protektorat verboten war, andere Medien wie Schreibmaschinen und<br />
Kameras zu besitzen. <strong>Im</strong> Unterschied zur archäologisch-ethnologischen NS-<br />
Perspektive akzentuiert der jüdische Mitarbeiterstab ein sozialgeschichtliches<br />
Programm musealer Datenverarbeitung und Darstellung; nicht Kuriositäten<br />
und Raritäten, sondern Dokumente des Wirtschafts- und Kulturentwicklung<br />
sind das Ziel. Dies bedeutet die Erfassung <strong>von</strong> Dokumentation auch jener<br />
Objekte, die nicht direkt vom Museum erworben werden, resultierend in einer<br />
Kartei als »index of all traces of the Jews in the Protectorate of Bohemia and<br />
Moravia«. 17 Gegen die NS-Ästhetik der Prager Synagogensammlungen als<br />
Kunst- und Wunderkammer einer als fremd gedachten Kultur, gegen das Lager,<br />
setzt der jüdische Mitarbeiterstab systematische Museologie. Bereits die Hausordnung<br />
<strong>für</strong> die Arbeitsstätten zur Errichtung des Jüdischen Zentralmuseums<br />
in Prag vom 1. August 1942 rubriziert die eintreffenden Objekte nach den Chiffren<br />
»M« <strong>für</strong> Museum, »L« <strong>für</strong> Lager und »N« <strong>für</strong> nicht klassifizierbar.<br />
Museumstechniken<br />
Der Prager museumsinterne Wochenbericht vom 14.-20. Dezember 1944 vermeldet,<br />
daß neben der »normalen Verarbeitung <strong>von</strong> Gegenständen aus eingetroffenen<br />
Sendungen« eine Fachkommission mit der wissenschaftlichen Verarbeitung<br />
des musealen Materials nach kunsthistorischen Gesichtspunkten befaßt ist 18 - eine<br />
fatale Verkehrung der musealen Transsubstantation der Objekte, eine Rücküber-<br />
17 Poläk, Programm der Museumstätigkeit, 12. November 1942, War Museum Fund, Inv.<br />
Nr. 17; Übersetzung: Peträsovä 1988: 26f<br />
18 War Museum Fund, Akten »1943-45«, Inv. Nr. 18
428 MUSEUM<br />
setzung kultischer »Semiophoren« in Materialitäten der <strong>Geschichte</strong>. 19 Denn historisch<br />
werden Objekte normalerweise erst, nachdem sie eine Zeit als Abfall hinter<br />
sich gebracht haben; in den Depots des Prager Museums jedoch, in Kontakt der<br />
jüdischen Mitarbeiter mit der Materie der Erinnerungsstücke, implodierte diese<br />
supplementäre kulturelle Logik historischer, also distanzierter und konstruierter<br />
Zeit. »Hier konnte man fast mit eigenen Augen sehen, welche Zusammenhänge<br />
zwischen diesen verschiedenen Zahlenkolonnen, nämlich dem Abgang der lebendigen<br />
Menschen und dem Zugang der toten Objekte, bestanden«; zur Gewißheit<br />
wurde dieser Kurzschluß, als im Jahr 1944 der Posteingang aus Auschwitz allmählich<br />
versiegte . Wieder ist der postalische Diskurs der<br />
präzise Indikator <strong>für</strong> Historie und gleichzeitig <strong>von</strong>posthistoire. Denn hier stehen<br />
die mediale Operation des Museums als symbolische Überlebensgeste und der<br />
reale Tod der Operanden in einem Echtzeit-Tauschverhältnis. Synagogenschätze<br />
werden hier auf direktem Wege zu Museumsobjekten, ohne Vermittlung, ohne<br />
die Tätigkeit <strong>von</strong> Sammlern. Keine Mediation mehr, kein Museum als Medium;<br />
Volavkovä vergleicht diesen Zustand mit dem antiken Gebilde des Tempelmuseums,<br />
nur daß hier das Sammeln der Menschen, die diese Gegenstände bis dahin<br />
verwendet hatten, vorausgegangen war. Der Dokumentarfilm Todesmühlen wird<br />
es später anhand der Konzentrationslager <strong>von</strong> Auschwitz und Majdanek zeigen:<br />
Berge <strong>von</strong> Brillen, Uhren, Goldzähnen. Inventarisierung und Depot, das klassische<br />
proprium des Museums, sind in Prag bereits ein Abbild des Genozids,<br />
während jene, die in diesen Depots arbeiteten, diese <strong>für</strong> ein halbwegs sicheres Versteck<br />
vor den Transporten halten; »die kafkische Erinnerung ging ihnen<br />
noch ab« . Keine Paranoia also im Museumslager, denn<br />
scheinbar steht die museale, symbolische Erfassung der jüdischen Kultur in Einklang<br />
mit der realen nationalsozialistischen Politik - eine taktische Unternehmung,<br />
unter deren »Firmennamen« (Volavkovä) das besagte jüdische Kulturgut<br />
konzentriert, verarbeitet und bis zu jenem Zeitpunkt aufbewahrt werden soll, da<br />
es seinen rechtmäßigen Eigentümern zurückerstattet werden kann. Eine nur<br />
scheinbar ähnliche Strategie verfolgen in einem anderen Medium, dem Film über<br />
das Leben im Ghetto Theresienstadt, die jüdischen Beteiligten; die Initiative zu<br />
diesem Propagandafilm ist nicht, wie der Historiker Lutz Niethammer vermutet,<br />
eine getarnte Botschaft der Juden in Theresienstadt an die Mit- und Nachwelt,<br />
sondern ein ganz und gar <strong>von</strong> den SS-Behörden in Prag gesteuertes Projekt. 20 In<br />
19 Zum Begriff der »Semiophoren« (Trägersubstanzen, die Zeichen transportieren) siehe<br />
Krzystof Pomian, Der Ursprung des Museums: Vom Sammeln, Berlin (Wagenbach) 1988<br />
20 Lutz Niethammer, Widerstand des Gesichts? Beobachtungen an dem Filmfragment<br />
»Der Führer schenkt den Juden eine Stadt«, in: Journal <strong>Geschichte</strong> 2/1989, 34ff; den<br />
Titel des Films und das Wissen um die Umstände seiner Entstehung und Aufführung<br />
korrigiert Karel Margry, Das Konzentrationslager als Idylle: »THERESIENSTADT«
DAS ZENTRALMUSEUM JODISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 429<br />
der jüdischen Arbeit am Prager Museum hingegen birgt sich tatsächlich die Hoffnung,<br />
»daß wenigstens das Resultat dieser Arbeit alles überdauern und auch <strong>für</strong><br />
die Zukunft erhalten bleiben werde« . Mit dem zeitlichen<br />
Aufschub aber hebt sich die subversive Sinngebung des Museums auf, denn den<br />
Hintergrund des Museums bildet der Massenmord, »und die Sammlungen sind<br />
nicht etwa ein Symbol, sondern ein sehr reales Dokument der dahingemordeten<br />
Gesamtheit« .<br />
Was als Depot gemeint ist - ein als »Museum« getarntes Postpaket, um die<br />
jüdischen Kulturgüter <strong>für</strong> die Zeit nach dem »tausendjährigen Reich« zu suspendieren<br />
und aufzubewahren, entpuppt sich als ein Schaufeln am eigenen<br />
Grab. Die Mitarbeiter des Museums organisieren in Raten ihren eigenen Tod;<br />
jene, die seit 1942 an der Schaffung des Zentralen Jüdischen Museums in Prag<br />
mitarbeiten, werden am Ende selbst sukzessive in die Vernichtungslager abtransportiert.<br />
Dazwischen herrscht eine direkte Relation. In einem internen<br />
»Bericht über die am 20. bis 25. September 1944 im Zentralmuseum vorgenommene<br />
Revision« heißt es, daß ein Teil der bislang aus jüdischen Gemeinden<br />
an Poläk übergebenen Gegenstände »nach seinem Abtransport unverarbeitet<br />
geblieben sind und wir empfehlen, diese Pendenz ordnungshalber ehestens zu<br />
erledigen«; nach wie vor seien alle Gegenstände »in den Regalen ordentlich<br />
untergebracht.« 21 Datenverarbeitung durch die Opfer verdoppelt invers die<br />
Logistik und die administrative Ordnung, mit der die Täter ihr Genozidprogramm<br />
durchführen. Heinrich Baab, ehemaliger Leiter des Judenreferats der<br />
Gestapo, hat 1966 einen Ablaufplan <strong>für</strong> die Durchführung der Judendeportationen<br />
aus Frankfurt gezeichnet. Am Ende dieser schematischen Darstellung<br />
ist ganz konkret ein Zug gezeichnet, vor dem als Vektor »Osten« steht. Auf der<br />
Lokomotive ist ein Begriff eingetragen: »ENDE«. Etre en train - der Nationalsozialismus<br />
läßt uns keine Metaphern mehr, das Verbrechen hilflos zu beschreiben:<br />
Hat er doch alle solche Metaphern als Klartext entziffert, wie ja auch<br />
zahlreiche Hörer Hitlers und die Leser <strong>von</strong> Mein Kampf hermeneu tisch kaum<br />
begriffen, daß er es nicht als Metaphern meint, wenn Schicksal als Destination<br />
in Deportation und harte Transportsysteme umgesetzt wird. Diskursanalysen<br />
solcher Texte erfordern den Blick auf reale Infrastrukturen. Volavkovä beschreibt<br />
den Zustand des Prager Museums im Moment der Ankunft aller<br />
möglichen Objekte aus Böhmen und Mähren, vor der Orientierung durch administrative<br />
Arbeiten: »Bis jetzt war es eigentlich ein Bahnhof , wo sich die<br />
Kisten mit den Kunstgegenständen wie in einem Magazin ansammelten, um<br />
- Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, in: Fritz Bauer Institut (Hg.),<br />
Auschwitz. <strong>Geschichte</strong>, Rezeption und Wirkung, Frankfurt a. M. / New York (Campus)<br />
1996 (= Jahrbuch 1996 zur <strong>Geschichte</strong> und Wirkung des Holocaust), 319-351<br />
21 War Museum Fund, Inv. Nr. 22, Blatt 2 u. 3
430 MUSEUM<br />
scheinbar <strong>für</strong> ewige Zeit hier liegenzubleiben« . Das<br />
Museum ist als Medium immer Endstation <strong>für</strong> Objekte; <strong>für</strong> ihre Besitzer und<br />
dann auch die Museumsmitarbeiter selbst war diese Endstation die Rampe <strong>von</strong><br />
Auschwitz. Das Museum - ein Bahnhof <strong>von</strong> Gegenständen, die ihren ehemaligen<br />
Kontexten entrissen sind. Erst der Überbau einer Ausstellung, also ihre<br />
Zusammenstellung in neuen Bedeutungen, vermag diesem Archiv in Prag unter<br />
den Augen der SS gleichsam als hermeneutische Simulation noch einen Sinn zu<br />
geben. In der Tat ist das, was wir »Museum« nennen, ja nichts als ein Oberflächeneffekt<br />
des Depots, und ebenso, wie der Prager Fall die Ekstase und Perversion<br />
des Museums darstellt, manifestiert er auch die des Depots; Hunderte<br />
Pergamentrollen, »mochten sie auch noch so gut verpackt und geordnet sein,<br />
konnten nie zu einem normalen Museumsdepot werden. Sie blieben das Beinhaus<br />
der einzelnen jüdischen Kultusgemeinden und verlangten nach ihrem<br />
Grab« . Jüdische Kultusgegenstände wie die Thora verlangen nach<br />
einem Begräbnis, wie es das Museum nicht leisten kann. Dem Leiter des jüdischen<br />
Zentralmuseums Prag, Josef Poläk, kommen Zweifel an den Möglichkeiten<br />
des Mediums in diesem Falle, seinen Methoden der Katalogisierung. »Wie<br />
sollte man mit diesen Methoden den Thorarollen gerecht werden, deren Alter<br />
weder auf Grund einer Inschrift, noch einer Widmung, noch einer Signatur,<br />
noch einer Stilanalyse bestimmt werden konnte«, da er alle Merkmale der Zeit<br />
negiert, seine antike Buchform bewahrt hat und stets auf gleiche Art und Weise<br />
abgeschrieben wurde ? Traditionsbewahrung unterläuft hier Historie;<br />
diese kulturgeschichtliche Differenz des traditionellen Judentums zum<br />
modernen abendländischen Bewußtsein macht seine historische Darstellung im<br />
Museum diffizil. Das zugleich simulierte und reale Museum enthüllt am Ende<br />
die nicht allein anagrammatische Verbindung <strong>von</strong> Museum und Mausoleum 22 :<br />
»Und als es nach dem Krieg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde,<br />
stand es nur noch als Mausoleum da, als warnendes Mahnmal« . Das Museum wird selbst zum Ausstellungsgegenstand, zurückverwandelt<br />
vom Dokument zum Momument. Historiker sind es gewohnt,<br />
menschliche Spuren in Dokumente einer <strong>Geschichte</strong> zu verwandeln, <strong>für</strong> die<br />
sie scheinbar sprechen - obgleich sie meist nichtsprachlicher Natur sind oder<br />
insgeheim etwas anderes sagen. In diesem Fall ist das Verstummen selbst thematisch.<br />
Michel Foucault schlägt vor, historische Dokumente in wissensarchäologische<br />
Momumente zurückverwandeln und sie mit kühlem Blick zu<br />
isolieren, zu gruppieren und in Beziehungen zu setzen 23 ; im Prager Museum<br />
22 Dazu Theodor W. Adorno, Das Valery Proust Museum, in: ders., Prismen. Kulturkritik<br />
und Gesellschaft, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1969<br />
23 Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1973, 15
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 431<br />
scheint Foucaults Plädoyer in unerhörter Weise zur Kenntnis genommen worden<br />
zu sein.<br />
<strong>Im</strong> nationalsozialistisch besetzten Prag hat das jüdische Zentralmuseum<br />
keine Öffentlichkeit, ist geheim und arrangiert seine Ausstellung »Jüdisches<br />
Leben <strong>von</strong> der Wiege bis zum Grab« auf strengen Befehl des Sturmbannführers<br />
Günther vom März 1943 nur <strong>für</strong> wenige Parteifunktionäre, welche die Ausstellung<br />
am 6. April 1943 abnehmen - das simulierte Museum als veritable<br />
Grabkammer. Ausstellungen, die <strong>für</strong> niemanden bestimmt sind - ein unges(ch)ehenes<br />
Museum, das Dementi der Exposition wie der Destination in unheimlicher<br />
Nähe zum musealen Sublimen, zur Erkenntnis der Undarstellbarkeit. So<br />
spiegelt das Museum als Simulakrum schweigend die Praxis eines realen Bezugs<br />
wieder - vergleichbar mit der <strong>von</strong> der SS in Theresienstadt aus Anlaß einer anstehenden<br />
Inspektion durch das Rote Kreuz initiierten Stadtverschönerungsaktion<br />
? Dieses argumentum ex silentio erfordert eine<br />
medienarchäologisch geschulte Wahrnehmung, die nicht auf <strong>Geschichte</strong>n fixiert<br />
ist, sondern mit Absenzen zu rechnen vermag; in Prag diente das Museum seinen<br />
Mitarbeitern als Aufschub des eigenen Todes. Museen und Gedächtnisstätten<br />
in ehemaligen Konzentrationslagern werden zumeist post festum <strong>von</strong><br />
Überlebenden geschaffen; das Prager Museum hingegen wird »auf dem Marsch<br />
in die Gaskammern geschaffen und installiert«, <strong>von</strong> Toten ohne Begräbnis, »die<br />
fast das gesamte Material durchgearbeitet hatten, ein Material, das bis Kriegsende<br />
auf hunderttausend Katalognummern angewachsen war« . An dieser Stelle ist eine Erzählung dieses Museums unmöglich. Zeitgleich<br />
mit den Objekten werden ihre Verzeichner numeriert, verzählt. So vollzieht<br />
sich am historischen Museum als Verbrechen, was sonst sein essentieller<br />
Mangel ist: Die Abwesenheit <strong>von</strong> Menschen zwischen den Objekten war hier<br />
durch ihre Abweisung geschaffen; diese Erinnerung aber blendet die wissenschaftliche<br />
Registrierung des Materials aus. Während eines Arbeitstreffens der<br />
Museumsmitarbeiter am 6. Oktober 1942 gibt Poläk eine Anweisung zur Katalogisierung;<br />
die einzelne Karte soll ein knappes Bild des Gegenstandes übermitteln,<br />
der unter der betreffenden Nummer in das Inventar angenommen wird:<br />
»Er ist also rein objektiv zu beschreiben und jede subjektive Meinung, ob nun<br />
in gutem oder schlechtem Sinne, ist wegzulassen.« 24 Die archäologische Beschreibung<br />
in ihrem Positivismus wird damit zur Resistenz wider Ideologie,<br />
eine Ideologie, welche jüdische Objekte immer schon kommentierte, taxierte,<br />
(ab)qualifizierte. Das Verschwinden der subjektiven Stimme aber ist auch NS-<br />
24 »Minutes of the working meetings of the planning commission« (War Museum Fund),<br />
zitiert nach Peträsovä 1988: 38 = Protokoll (Aw 2) über die Arbeitssitzung an 5. Oktober<br />
1942, Blatt 4
432 MUSEUM<br />
Programm, indem es gerade Personen sind - Subjekte in jeder Hinsicht -, die<br />
sukzessive in die Vernichtungslager deportiert werden. Ein solches Gedenken<br />
läßt sich wissenschaftlich-museal, mithin museologisch, post festum nicht mehr<br />
nachstellen; Ideologien gegenüber ist diese Logistik indifferent. So kann nach<br />
Kriegsende unter erneut veränderten Bedingungen dann auch über das aus der<br />
Not geborene System der uniform registration geschrieben werden: »It is with<br />
these very progressive concepts that the present workers of the State Jewish<br />
Museum can link up and continue their work in this spirit« ; Informatik überdauert hier die Zäsuren der Historie. Die Praxis musealer<br />
Logistik bis hin zum Mankoprotokoll - die Differenz zwischen den Objektlieferungen<br />
und ihren beigelegten Listen - gleicht die subversive<br />
Intention der Mitarbeiter am Ende der formahsierten Sprache des<br />
Nationalsozialismus an. Die interne Arbeitsanweisung <strong>für</strong> die Karteien des Jüdischen<br />
Zentralmuseums vom 3. Mai 1943 formuliert zur Unterscheidung der<br />
Objekte numerische Kodes, basierend auf dem Dezimalsystem. Alphanumerik<br />
überwindet das Übersetzungsproblem menschlicher Sprachen: »This System<br />
was probably intended for the prevention of difficulties which could arise as a<br />
result of different knowledge of Czech and German terms and languages in<br />
general in such a bilingual group as the Czech Jews« . Die<br />
Umstellung <strong>von</strong> individueller Beschreibung auf uniforme Registrierung der<br />
Museumsobjekte geschieht unter den Augen der Nationalsozialisten, die auch<br />
dann, wenn verschiedene Gruppen simultan am Werk sind, jederzeit einen<br />
Überblick über das versammelte Vermögen sicherstellen wollen - eine fatale<br />
Situation, in der Macht produktiv wird, weil sie gerade im Akt der Unterdrückung<br />
einer neuen Ordnung <strong>von</strong> Standards zum Durchbruch verhilft, die<br />
heute eine Grundlage unserer Wissens- als Datenverarbeitung darstellt.<br />
Filmische Realität<br />
Nachdem die Nationalsozialisten keine jüdischen Synagogen mehr in Brand<br />
stecken, da das Programm des Genozids an den Juden längst angelaufen ist,<br />
erklären sie unter den Augen der noch lebenden jüdischen Kultusgemeinde das<br />
sakrale Inventar und die Bestimmung der Gotteshäuser zu historischen Ausstellungsstücken.<br />
<strong>Im</strong> längst schon musealen Raum der Prager Altneu-Synagoge<br />
wird noch Leben simuliert, als dort ein Propagandafilm über das scheinbar<br />
friedliche und ungestörte Leben der Juden im Prag der Kriegsjahre gedreht<br />
wird, als Antwort auf Anfragen internationaler Institutionen gedacht. Juden<br />
werden in Gebetsmäntel gehüllt, um einen fingierten Gottesdienst darzustellen.<br />
»Allen Mitwirkenden bebten jedoch die Hände, die die Gebetsbücher hielten,<br />
und beim Gesang zitterten ihre Stimmen, denn im Hintergrund assisiterte ein
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 433<br />
Mann im Ledermantel bei der Kamera« - der Prager Gestapochef persönlich<br />
. <strong>Im</strong> Entwurf <strong>für</strong> den Bericht des Museums über das I.<br />
Quartal 1944 heißt es dazu: »Die erforderlichen Ritualgegenstände werden dem<br />
Museum entnommen, das auch den größten Teil der Funktionäre und Sänger<br />
bereitstellt.« 25 Das eigentliche Museum ist längst eine Funktion filmdramaturgischer<br />
Absichten, Subjekt einer rassistischen Erzählung:<br />
»3./ Um den Eindruck zu erwecken, daß der Film vor 40 bis 100 Jahren spielt,<br />
genügt es nicht, den Mitwirkenden unmoderne Hüte aufzusetzen. Man müsste<br />
denn auch Kragen, Krawatten, Gehröcke und Hosen - also komplette Kostüme<br />
aus der Zeit haben, und dies nicht nur <strong>für</strong> die Männer, sondern ebenso <strong>für</strong> die<br />
Frauen und Kinder. Abgesehen <strong>von</strong> der Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit<br />
der Beschaffung, sind unsere Mitwirkenden ausschliesslich Dilettanten, die sich in<br />
Maske und Kostüm nicht bewegen können, sodass ihre Darstellung wahrscheinlich<br />
wie Provinzschmierentheater wirken würde. Für Beschaffung <strong>von</strong><br />
Kostümen und Mitwirkung eines Theaterfriseurs / der über die notwendige Auswahl<br />
an Barten verfügt / müssten wir zudem wohl eine besondere Bewilligung<br />
haben.<br />
4./ In das vorgelegte Drehbuch können die <strong>von</strong> Herrn SS Sturmbannführer<br />
Günther gewünschten zusätzlichen Szenen ohne Störung des Aufbaus bis auf zwei<br />
eingereiht werden, sodass ein zweiter Teil überflüssig wäre. Die beiden Szenen,<br />
welche den Aufbau und Handlungsablauf stören würden, sind Auslösung der<br />
Erstgeburt und Kapores-Schlagen. Diese beiden Szenen sind filmisch vor allem<br />
deshalb schlecht auszuwerten, weil sie eine ausserordentlich lange Erklärung erfordern.<br />
Es wäre im Interesse des Gesamtfilms daher sehr zu empfehlen, wenn<br />
Auslösung und Kapores fortbleiben könnte. <br />
6./ Es dürfte kaum möglich sein, die Szene Beschneidung sozusagen als ganzes mit<br />
allen Details zu filmen. Man kann wohl äusserstenfalls während der gesprochenen<br />
Erklärung eine halbnah-Aufnahme bringen, bei der zu sehen ist, dass sich der Rabbiner<br />
mit dem Kind befasst, dann aber aus der Nähe wohl erst den Augenblick,<br />
wo er das Kind hochhebt und ihm den <strong>Namen</strong> gibt.« 26<br />
Ein unheimliches Vivarium: Es ist jene Tarnung einer real vollzogenen Absentierung<br />
im Nationalsozialismus, die jede museologische Inszenierung jüdischen<br />
Lebens heute didaktisch fragwürdig macht. Tatsächlich sind die Prager<br />
Filmszenarien ein Echo auf Bilder in Fritz Hipplers nationalsozialistischen Propagandafilm<br />
Der ewige Jude <strong>von</strong> 1940, der mit Juden aus polnischen Ghettos<br />
scheinbar alltägliche Sequenzen auch in einer Synagogenkulisse inszeniert.<br />
Ekstase der Simulation: Auch die Mitwirkenden an diesem Film werden im<br />
Herbst 1944 nach Auschwitz deportiert, gleich Mitarbeitern des Zentralmuseums<br />
wie Alfred Engel, der ein System mit aufbaut, das dann seinen eigenen Tod<br />
25 War Museum Fund, Akten »1943-45«, Inv. Nr. 18<br />
26 Jüdisches Museum Prag, Archiv, War Museum Fund, Inv. Nr. 20 (Akten 1942-44),<br />
Dokument »Film Altneu-Synagoge. Bemerkungen zur Aktennotiz vom 18.3.1944«
434 MUSEUM<br />
archiviert. 27 Hat das jüdische Team im musealen Gehäuse ein Denkmal des<br />
deutsch-tschechischen Judentums inmitten seiner Vernichtung schaffen wollen?<br />
»Historische Bildzeugnisse fügen sich ja nicht immer den Intentionen ihrer Auftraggeber«;<br />
ihre ästhetische Wahrnehmung mag ihre eigenen Bezüge haben<br />
. Scheinbar verfolgt der Stab des jüdischen Zentralmuseums<br />
eine ähnliche Taktik, doch in diesem Falle scheitert die Vorstellung der<br />
ästhetischen Subversion: Durch den Tod nicht nur ihrer Besitzer, sondern auch<br />
ihrer Verwalter 28 werden die Objekte im Prager Jüdischen Museum historisch<br />
schon in der Gegenwart des Nationalsozialismus. Dem künftigen Judentum soll<br />
unter dem Tarnnamen »Museum« sein Kulturgut bewahrt werden - die Nationalsozialisten<br />
aber nehmen diese Simulation wörtlich, und was <strong>von</strong> jüdischer<br />
Seite dekonstruktiv gedacht ost, fällt hier der musealen Kontrolle <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
und physischen Überresten einer Kultur anheim. Durch Entzug des realen<br />
Referenten wird das Museum am Ende tatsächlich zum historischen Dokument.<br />
Was in der Lesart Volavkoväs <strong>von</strong> jüdischer Seite unter dem Ausstellungstitel<br />
Jüdisches Leben <strong>von</strong> der Wiege bis zum Grab als Museum des Protests gemeint<br />
ist, als die subtile Subversion der Bilder und Objekte unter den Augen der nationalsozialistischen<br />
Aufsicht, wird selbst unter der Hand zur musealen Allegorie<br />
einer bitteren Realität. Das phantasmagorische Vorhaben rettet die Autoren nicht:<br />
»Das >simulierte< Museum nahm immer mehr und mehr nichtsimulierte Aspekte<br />
an« . Erst der museale Blick bringt die jüdischen Mitarbeiter<br />
des Prager Zentralmuseums dazu, die Objekte nicht mehr in ihrer sakralen,<br />
sondern kunsthistorischen Dimension zu lesen - in Anbetracht des Genozids<br />
akzeptieren die noch Lebenden bereits den posthistorischen Blick auf ihre eigene<br />
Kultur. Ludmila Kybalovä als Leiterin des Prager Jüdischen Museums spricht mit<br />
Blick auf den Gebäudeteil Meisel-Synagoge <strong>von</strong> einer ethnographischen Ausstellung<br />
2 ^', der aktuell akademisch kultivierte fremde Blick auf die eigene Kultur 30<br />
erinnert damit fatal an die Prager Variante der musealen Abspaltung vorgeblich<br />
fremder Bestandteile aus dem Deutschlandbild des Nationalsozialismus. Am 6.<br />
April 1943 nimmt SS-Obersturmbannführer Günther im jüdischen Zentralmuseum<br />
Prag die Axxssx.cMvLng Jüdisches Leben <strong>von</strong> der Wiege bis zum Grab ab. Die<br />
jüdischen Museumsleute riskieren hier, in Form einer kulturgeschichtlichen Aus-<br />
27 Am 6. Juli 1943 noch hatte er die seinerzeit <strong>von</strong> ihm selbst angelegten Korrespondenzakten<br />
des Jüdischen Museums Nikolsburg verzeichnet: Wiesemann 1994: 129<br />
28 <strong>Im</strong> August 1944 wurde der jüdische Leiter des Museums, Josef Polak, wegen seiner<br />
Tätigkeit in der Widerstandsbewegung verhaftet und kam während eines Todesmarsches<br />
ums Leben.<br />
29 Gespräch mit dem Autor in Prag, 9. Juni 1992<br />
30 Etwa Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1994
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 435<br />
Stellung rassistische Vorurteile der Nationalsozialisten zu unterlaufen; fast alle<br />
Szenarien sind (nach Auskunft <strong>von</strong> Volavkovä, die <strong>von</strong> unausgesprochenen Dialogen<br />
spricht) semiotisch verschlüsselt, um eine allegorische Lektüre unter den<br />
Augen der Gegner zu ermöglichen. »Mit dem >Opferaltar< im Hintergrund, an<br />
dem die Deutschen eine eifrige Tätigkeit entfalteten, glückte hier ein wirkungsvolles<br />
museologisches Werk«; allerdings kam dann doch andererseits der Verdacht<br />
auf, daß es hier um mehr ginge, als bewilligt worden war, und so ergeht der<br />
Befehl, augenblicklich Übersetzungen aller hebräischen Texte anzufertigen<br />
. Die nationalsozialistischen Aufseher suchen also die<br />
Museumsmitarbeiter <strong>für</strong> Objekte, Bilder und Lettern, die sie nicht verstanden,<br />
zur Rede zu stellen - die letzten Vertreter und Träger eines Wissens, auf das auch<br />
die Vertreter der sogenannten Endlösung der Judenfrage nicht verzichten möchten.<br />
Eine museumsinterne Aktennotiz vermerkt, daß SS-Sturmbannführer<br />
Günther anordnete, kurzfristig Bilder und Skizzen mit Beschreibungen vorzulegen,<br />
die sich auf die Entwicklung des jüdischen Lebens im böhmisch-mährischen<br />
Raum seit Beginn der jüdischen Siedlung beziehen sollen und nicht<br />
allgemein bekannt sind. Sämtliche Angaben müssen historisch belegt sein; »man<br />
kann sich auch der Bücher bezw. Urkunden bedienen, die in der SS-Standort-<br />
Kommandantur liegen.« 31 Am Ende erweist sich das scheinbare Paradox, daß die<br />
nationalsozialistische Idee des Prager Museums einer »untergegangenen« jüdischen<br />
Kultur selbst im Widerspruch zum geplanten Genozid als totaler Auslöschung<br />
stand, vielmehr als Konsequenz, wenn mit Vernichtung vielleicht nicht<br />
einmal in erster (oder letzter) Instanz die Menschen, sondern das Jüdische als das<br />
Gewesene gemeint ist. Der Vernichtung können sich die Täter nur durch die<br />
Macht über das Gedächtnis der Dinge sicher sein; so hinterläßt die Bewegung der<br />
Auslöschung selbst eine Spur. Es liegt selbst in der musealen »Einverleibung« des<br />
Geopferten noch einmal eine Affirmation des Gelöschten, eine noch perfidere<br />
Form der damnatio memoriae. Das Projekt des Genozids bedarf geradezu konstitutiv<br />
des musealen Supplements; so sind in Prag unter ein und demselben<br />
<strong>Namen</strong>, dem des Museums, Bewahrung und Rettung einerseits, Vernichtung und<br />
Auslöschung andererseits denkbar (<strong>von</strong> dieser Ambivalenz ist das Medium<br />
Museum im Kontext völkerkundlicher Ausstellungen seitdem stigmatisiert).<br />
Nicht um die Löschung der Zeugnisse, sondern um den Ersatz <strong>von</strong> Opfererinnerung<br />
durch das Gedächtnis der Täter geht es dem NS. Dazu sind ihm alle<br />
Medien recht (Museum, Photographie): »Wieder diese Bilder, die die SS gemacht<br />
hat, um der Welt eines Tages zu zeigen, wie sie die Juden vernichtete.« 32<br />
31 War Museum Fund, Inv. Nr. 20 (Akten 1942-44)<br />
32 Harun Farocki, Kommentartext zu seinem Film Bilder der Welt und Inschrift des<br />
Krieges (1988), Typoskript, 14
436 MUSEUM<br />
Museum einer untergegangenen Rasse?<br />
»Die Nazis haben über ihre Absichten nicht mehr hinterlassen als die Bezeichnung<br />
>Museum einer untergegangenen Rasse
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 437<br />
blind spot der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik? Tatsächlich ist das<br />
Museum die komplementäre Kehrseite der Deportationen. Relevant ist die Differenz<br />
in der Lesart <strong>für</strong> den aktuellen Rechtsanspruch auf die Objekte, die als<br />
NS-Beutegut dem Staat Israel als Rechtsnachfolger der ausgelöschten jüdischen<br />
Gemeinden <strong>von</strong> Böhmen und Mähren zufallen würden, nicht also dem Jüdischen<br />
Museum in Prag - so daß das Diaspora-Museum <strong>von</strong> Tel Aviv mit seinen Repliken<br />
einen Fonds an Originalen erhielte. Ist dies ein Grund <strong>für</strong> die lange Zurückhaltung<br />
des Prager Museums bis in die letzten Jahre, über die Ursprünge seiner<br />
heutigen Beständen in der NS-Vergangenheit zu informieren? 37 Am 15. Oktober<br />
1994 wird gemeldet, daß das Jüdische Museum in Prag wieder den jüdischen<br />
Gemeinden der Tschechischen Republik restituiert ist.<br />
Nicht die musealen Objekte, sondern der Akzent ihrer Inszenierung macht<br />
die Differenz. Aktuelle Ausstellungen wiederholen das Dilemma der vierziger<br />
Jahre, etwa die 1990er Ausstellung Where Cultures Meet. The Story ofthejews<br />
in Czechoslovakia im Diaspora-Museum, Tel Aviv, die Ausstellung Jüdische<br />
Schätze aus Prag. Aus den Sammlungen des Staatlichen Tschechischen Museums<br />
<strong>für</strong> jüdische Kunst im Israel-Museum, Jerusalem (1990), sowie zuvor schon die<br />
Ausstellung The Precious Legacy. Judaic Treasures from the Czechoslovak State<br />
Collections (USA 1983). Der Akzent liegt jeweils auf Kunstwerken, nicht Kulturhistorie<br />
- Monumentalisierung statt Dokumentation. Die konzeptionellen<br />
Unterschiede der beiden Ausstellungen in Jerusalem und den USA sind signifikant;<br />
das Israel-Museum setzt den Tod in Theresienstadt ans Ende, während<br />
die amerikanische Konzeption mit einem Verweis auf die Dauerhaftigkeit jüdischen<br />
Lebens schloß. In Israel aber wird die Shoah nicht mit einem Ende des<br />
jüdischen Lebens insgesamt gleichgesetzt; »auch der amerikanische Ausstellungstitel<br />
>Precious Legacy< enthält den Verweis auf jene, die sich dieses >Vermächtnisses<<br />
heute annehmen« . Indem sich Israel zum Erbe der<br />
jüdische Diaspora erklärt, verbindet es Holocaust und Staatsgründung ideologisch<br />
miteinander als dunkle und Lichtseite derselben historischen Zäsur. Damit<br />
wird - nachträglich - auch dem Depot des Prager Zentralmuseums in seiner<br />
(<strong>von</strong> den jüdischen Mitarbeitern) als Gepäckaufgabe gedachten Form ein anderer<br />
Zeitvektor eingeschrieben: Das Museumsprojekt dient in diesem zionistischen<br />
Deutungsrahmen nicht als Rettung jüdischer Kontinuität vor Ort,<br />
sondern als Rettung einer diskontinuierten, quasi chirurgisch präparierten<br />
Substanz im Prozeß einer Neugründung auf nationaler Grundlage, also der<br />
Transformation <strong>von</strong> Juden in ein Staatsvolk. Nicht nur <strong>für</strong> das Museum als<br />
Agentur einer Sammlung (unter dem Nationalsozialismus), sondern auch <strong>für</strong><br />
37 Zur Nachkriegsgeschichte siehe Arno Parik, Das Jüdische Museum in Prag. Seine Entwicklung<br />
und <strong>Geschichte</strong> seit 1945, in: Wiener Jahrbuch <strong>für</strong> jüdische <strong>Geschichte</strong>, Kultur<br />
und Museumswesen 2 (1996), 9-42
438 MUSEUM<br />
das Museum als Ausstellungsobjekt der Nachkriegszeit gilt, daß die respektiven<br />
Strategien der Erinnerung grundverschieden bleiben. Jeder Versuch, in<br />
Form eines lokalen Museums das Schicksal (oder die <strong>Geschichte</strong>?) der Juden in<br />
Böhmen und Mähren festzuhalten, steht immer schon in der obszönen Spur des<br />
nationalsozialistischen Projekts des Prager Museums. An diesem Punkt kommt<br />
es zur Krise der Museumsidee überhaupt, denn die Ausstellung blendet notwendig<br />
das Fundament aus, auf dem sie entstand: »Dieses Museum der Kriegszeit<br />
war ganz eng mit dem Leben und vor allem mit dem Tod verbunden,<br />
obwohl die schriftlichen Dokumente darüber nichts verraten« . Ein Schweigen, aus dem der Historiker schwerlich ein Argument<br />
macht 38 : Klassische Museographie würde hier der Bodenlosigkeit verfallen. Das<br />
hat Konsequenzen <strong>für</strong> die Idee des historischen Museums, jener Transformationsmaschine<br />
<strong>von</strong> Gedächtnis in <strong>Geschichte</strong>. Das jüdische Schicksal in der Zeit<br />
des Nationalsozialismus »has become, in a way, secularized, even if this carries<br />
with it for us the loss of a certain privilege of speech that has largely been<br />
ours since Europe discovered the great massacre«, schreibt der französisch-jüdische<br />
Historiker Vidal-Naquet. 39 Und das Medium Museum hat unzweifelhaft<br />
Teil daran; wie Georg Heuberger vom Jüdischen Museum Frankfurt anmerkt,<br />
ist die museale Aufarbeitung jüdischer <strong>Geschichte</strong> in Deutschland problematischer<br />
als generell die komplizierte Umsetzung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> in Museen; die<br />
museale Aufarbeitung birgt in sich »die Tendenz einer antiquarischen Ablösung<br />
vom gesellschaftlichen Kontext - eine Tendenz, die gerade angesichts des noch<br />
lebendigen Judentums und des auch in Deutschland <strong>von</strong> Juden in Angriff<br />
genommenen Neubeginns zu Mißverständnissen führen könnte.« 40 Mißverständnisse?<br />
Nach dem Krieg findet die kleine nach Prag zurückgekehrte<br />
jüdische Gemeinde zwar das fast vollständige Depot ihrer einstigen Kultusgemeinde<br />
vor, doch ist sie selbst (trotz zügiger Wiederbelebung durch Zuwanderung<br />
jüdischer »Optanten« aus östlichen Landesteilen) entweder zu<br />
schwach, dieses Erbe in Anspruch nehmen zu können, oder die kommunistische<br />
Machtübernahme beendet diese religiösen und kulturellen Ansätze. Die<br />
sakralen Orte sind jedenfalls vom Museum besetzt. 1950 »schenkt« das jüdische<br />
Zentralmuseum sie dem Staat, der durch massiven Druck Kontrolle darüber zu<br />
gewinnen trachtete. »Schlimm ist, daß das Museum alles in sich aufgesogen hat,<br />
auch die Alt-Neu-Synagoge, in der am Sabbat Gottesdienst stattfindet. Man hat<br />
38<br />
Vgl. Arnold Esch, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches<br />
Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift Bd. 240 (1985), 529-570 (559)<br />
39<br />
Hier zitiert nach: Hayden White, The Politics of Historical Interpretation, in: Critical<br />
Inquiry, September 1982, 134f<br />
40<br />
Georg Heuberger, in: Hinaus aus dem Ghetto ... Juden in Frankfurt am Main 1800-<br />
1950, Frankfurt/M. 1988, Vorwort
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 439<br />
das schlimme Gefühl, daß man in einem Museum betet und daß die Touristen<br />
kommen, um genau das zu sehen: uns als die letzten Mohikaner« 41 - letztendlich<br />
so, wie die deutschen Besatzer es einst sehen lassen wollten?<br />
Die kulturwissenschaftliche Methode des new historicism versucht, sich dem<br />
Jüdischen Museums in Prag angemessen zu nähern, indem sie auf solche Sammlungen<br />
als »a ritual process, a rehearsal of cultures« schaut. 42 Fatal ist die museale<br />
Erprobung <strong>von</strong> Kulturen im Kontext der Genozid-Politik der nationalsozialistischen<br />
Ära. Ein prominenter new historicist, der amerikanische Literaturwissenschaftler<br />
Stephen Greenblatt, äußert sich in seinem Beitrag »Resonance and<br />
Wonder« auch zum Jüdischen Museum in Prag. Er weiß, das museale Objekt<br />
bedarf darin der Text-Information im harten Sinne des Archivs, um nicht fehlgelesen<br />
zu werden: »This museum is not so much about artifacts as about<br />
memory, and the form the memory takes is a secularized kaddish, a commemorative<br />
prayer for the dead.« 43 Archäologisches Schweigen, die Präsenz einer<br />
Abwesenheit prallt hier auf die Sehnsucht der historischen <strong>Im</strong>agination, die dort<br />
Stimmen halluziniert - ein geisterhaftes Zwischenreich des Untoten. Diese resonance<br />
hat historische Vorbilder. Unter dem Titel »Eine Gemeinde erlischt«<br />
berichtet S. Brückheimer in Marktbreit vom Sterben einer jüdischen Gemeinde<br />
und präfiguriert eine geradezu wissensarchäologische Wahrnehmung, die <strong>von</strong> der<br />
Nachkriegsgeneration mit dem nationalsozialistischen Genozid an Deutschen<br />
jüdischer Abstammung assoziiert wird. Abwesenheit - jene Leere, die nicht<br />
Nichts, sondern ein Fehlen ist -, generiert Halluzinationen abgezogenen Lebens:<br />
»Die Synagoge war ausgeleert. Nur die Strahlen der untergehenden Sonne füllten<br />
sie und der aufgewirbelte, auf- und abwogende Staub. Ich stand versonnen, an die<br />
Wand gelehnt. Da - da ballte sich der Staub. Nebelhaftes Dehnen und Gleiten.<br />
Bänke zogen sich wieder durch den Raum. Vor dem Pulte aber mit der Samtdecke,<br />
deren Goldbuchstaben Reflexe schössen, die mich ins Herz trafen vor<br />
dem Pulte stand tallisumhüllt der Vorbeter. Und durch die Synagoge klang seine<br />
schwache Stimme: >Lecho dodi likras kalloh
440 MUSEUM<br />
liehen Museen . Zwei Wahrnehmungsmodi - Betrachten<br />
und Erinnern - liegen hier im (diskursiven) Widerstreit: die Anschauungsqualität<br />
des Objekts und die kognitive Information, supplementiert vom jüdischen religiösen<br />
Darstellungsverbot auf der (historischen) Ebene der rituellen Objekte: »the<br />
products of a people with a resistance to joining figural representation to religious<br />
observance, a strong anti-iconic bias : not vision but reading«; doch anstelle<br />
der Bilder glaubt Greenblatt hinter den <strong>Namen</strong>, die er liest, ein anderes Medium<br />
zu vernehmen, »the voiees of those who chanted, studied, muttered their prayers,<br />
wept, and then were forever silenced« . Damit ist Greenblatt einer hermeneutischen<br />
Grundoperation verfallen, der rhetorischen Technik der scheinbaren<br />
Verlebendigung einer Vergangenheit. 45 Demgegenüber gilt es, Schweigen und<br />
Leere selbst auszuhalten. Die Prager Museums-Synagogen nennt Greenblatt eine<br />
Kulturmaschine, die ein unkontrollierbares Oszillieren zwischen Erwartung und<br />
Hoffnungslosigkeit, den Stimmen der Toten und Schweigen generiert - »for resonance,<br />
like nostalgia, is impure, a hybrid forged in the barely acknowledged gaps,<br />
the cesurae, between word like State, Jewish and Museum« . Doch resonance, so Greenblatt weiter, ist nicht notwendig auf Zerstörung<br />
und Absenz gebaut; it can be found as well in unexpected survival. The key is the<br />
intimation of a larger Community of voiees and skills, an imagined ethnographic<br />
thickness«
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 441<br />
losen Denkmälern, sondern nur seinerseits numerisch gedacht werden, wie es<br />
das <strong>von</strong> der Stiftung Initiative Theresienstadt herausgegebene Gedenkbuch<br />
Theresienstadt in zwei Bänden mit den 81396 <strong>Namen</strong> der aus dem Protektorat<br />
dorthin deportierten jüdischen Bevölkerung vollzieht. Wo sich Information auf<br />
Statistik beschränkt, wird individuelles Wissen ausgeblendet. Läßt sich dem<br />
nachträglich im Modus der Biographien entgegenarbeiten - als Restitution<br />
menschlicher Würde durch Erzählung im Widerstand gegen die reine Zählung?<br />
Erst das <strong>Namen</strong>smemorial setzt in Prag die Differenz zur reinen Statistik, wie sie<br />
sich etwa im Bericht über das Jahr 1943 des (so umbenannten) Ältestenrats der<br />
Juden in Prag spiegelt. 47 Die Shoah bedarf keiner ästhetischen Metaphern; aisthesis<br />
als präzise Wahrnehmung der Inskription des Geschehens im Archiv läuft<br />
buchstäblich auf reine Serie jenseits der historischen Erzählbarkeit hinaus. Prags<br />
Jüdisches Museum schreibt es heute (vor), wo die Inventarisierung der Musealien<br />
mit der <strong>von</strong> Deportierten korreliert. <strong>Im</strong> Herbst 1993 kann man die Prager<br />
Holocaust-Gedenkstätte in ihrer INSKRIPTION beobachten, als in der Pinkas-<br />
Synagoge durch Schriftmaler alle <strong>Namen</strong>, Geburts- und Tötungsdaten an die<br />
Wände geschrieben wurden, wobei die Hilfslinien, die noch frei bleiben, Leerstellen<br />
dieses Archivs auf Zeit bilden. »Visitors are asked for silence because it is<br />
very difficult to write the names and dates', sagte ein Hinweisschild. 48 Diese Alphanumerik<br />
stand schon einmal an den Innenwänden des Hauses geschrieben, fiel<br />
aber als Verputz der dauernden Feuchtigkeit zum Opfer - ein nur scheinbar<br />
natürlicher Prozeß: Die erste Beschriftung der Wände in den fünfziger Jahren<br />
wurde <strong>von</strong> der kommunistischen Regierung nach der sowjetischen Okkupation<br />
1968 durch gezielte Vernachlässigung ruiniert. Was (ausstellbar) bleibt, sind Fragmente<br />
dieses seriellen Epitaphs, jetzt integriert in die neue Inskription (gleich den<br />
monumentalen Lettern MEMENTO in einem vergessenen Winkel der Gedenkstätte<br />
Buchenwald). In welchem Verhältnis steht das <strong>Namen</strong>smemorial der Prager<br />
Pinkas-Synagoge zur Architektur des Baus? »The names were not intrinsic<br />
to the walls; they had to be superimposed.« 49 Buchstabenruinen sind das inferno<br />
der <strong>Geschichte</strong>, zwischen corpus und corpse; den Vergessenen werden nicht nur<br />
die Körper, auch die Werke vernichtet (so Bertolt Brecht, »Besuch bei den verbannten<br />
Dichtern«). Der Unterschied zwischen Signifikanten(ver)fall und dem,<br />
was sie aufrecht erhält, heißt Gedenken. Erinnerung des Autors aus Prag, Wohnung<br />
Krasneho Nummer 1: <strong>Im</strong> Juni 1992 zeigt Frau Hyndrakovä eine Schachtel<br />
mit denjenigen Fragmenten der Pinkas-Inschrift, die den <strong>Namen</strong> ihrer deportierten<br />
Eltern und Schwester nennt - Einbruch eines biographischen Blitzes in<br />
47 Archiv der Gedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem), Bestand FA-156<br />
48 Eine Beobachtung des Historikers Axel Doßmann (Berlin / Leipzig) vor Ort.<br />
49 Hillel J. Kieval, Autonomy and Independence: The Historical Legacy of Czech Jewry,<br />
in: Altshuler 1983:48
442 MUSEUM<br />
museologischen Recherchen, die unvermittelt <strong>von</strong> archäologischen Fragmenten<br />
auf die Ebene der Menschen schalten. An der Arbeitszimmerwand hängt ein<br />
Photo, auf dem sie selbst als Kind mit ihrer Schwester in einer Turnhalle figuriert;<br />
die Vergrößerung bildete zur selben Zeit Teil der Ausstellung »Precious Legacy«.<br />
77927 <strong>Namen</strong> harren im Memorial der Pinkas-Synagoge ihrer Re-Inskription.<br />
Dieser Akt des Gedenkens heißt auch konkrete Identifizierung - die Sprache der<br />
Administration, unsymbolisch, und doch durch kein anderes Denkmal überbietbar.<br />
<strong>Namen</strong>sreihen sind damit Protagonisten des Gedenkens. 50 Jüngste<br />
Aktenfunde aus dem Sonderarchiv des KGB in Moskau ließen auch die Bücher<br />
der (provisorischen) Standesämter in den Konzentrationslagern <strong>von</strong> Auschwitz<br />
u. a. auftauchen, also »Sterbelisten«, welche den Toten wieder <strong>Namen</strong> zuschreibbar<br />
machen, massenhaft. Mit den herkömmlichen Aufschreibesystemen der<br />
Historiographie war diese Datenmenge nicht mehr zu bewältigen, es sei denn mit<br />
Hilfe der EDV. 51 Eine Informationstafel zur Pinkas-Synagoge (November 1994)<br />
weist darauf hin, daß dieser Ort bis 1941 dem religiösen Ritus diente; dann zerstörten<br />
die Nationalsozialisten die Innenausstattung. Kein Wort aber über die<br />
Verwendung als Museumsdepot in nuce während der Besatzung, dem blind spot<br />
der musealen Erinnerung. Das Prager Museumsarchiv sagt es differenzierter.<br />
In einem Brief vom 5. März 1943 berichtete der Ältestenrat der Juden in Prag an<br />
das Zentralamt <strong>für</strong> die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren (Vorgang:<br />
Auftrag SS-Obersturmführer Rahm) über den baulichen und kulturhistorischen<br />
Wert der Pinkas-Synagoge; sollte infolge der kriegsbedingten Verhältnisse<br />
die bauliche Adaptierung nicht möglich sein, »würden wir vorschlagen, die<br />
Pinkassynagoge ähnlich der Hochsynagoge und der Klaussynagoge als Museum<br />
einzurichten.« 52 Nach der Assanierung des jüdische Ghettos insolfge <strong>von</strong> Überschwemmungen<br />
Ende des 19. Jahrhunderts waren allein die Synagogen auf dem<br />
ursprünglichen Straßenniveau verblieben - mit dem Resultat, daß infolge der<br />
Überschwemmungen im Sommer 2002 ganze <strong>Namen</strong>sreihe im Pinkas-Memorial<br />
ausgewischt werden. Christian Boltanski hat die Nähe <strong>von</strong> Museum und Lager<br />
einmal unter dem Titel »Reserves« installiert, denn Speicher sind auch der Auf-<br />
50 Zur analog gestalteten »Halle der <strong>Namen</strong>« in der Gedenkstätte Yad Vashem bei Jerusalem<br />
siehe W. E., Arsenale der Erinnerung, Katalogbeitrag zur Ausstellung: Speicher.<br />
Ein Versuch über die Darstellbarkeit <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>/n, Offenes Kulturhaus Linz<br />
(Hg.), Linz 1993, 63-72 (70)<br />
51 Siehe Jan Parcer, Wolfgang Levermann, Thomas Grotum, Remembering the Holocaust:<br />
preservation and improved Accessibility of the Archives in the Memorial<br />
Oswiecim/Brzezinka (Auschwitz/Birkenau), in: Historical Informatics: an Essential<br />
Tool for Historians? A Panel Convened by the Association for History and Computing<br />
at the nineteenth Annual Meeting of the Social Science History Association,<br />
Atlanta, Georgia, October 14th, 1994, 44-51<br />
52 War Museum Fund, Inv. Nr. 20 (Akten 1942-44)
DAS ZENTRALMUSEUM JÜDISCHER ALTERTÜMER IN PRAG 443<br />
schub des Todes. Wenn Boltanski blecherne Schachteln mit Photos Verstorbener<br />
stapelt, zu denen Lautsprecher die <strong>Namen</strong> der Toten murmeln, sind wir aus dem<br />
Raum der Erzählung unvermittelt in den der Zählung, der Komputation<br />
gelangt. 53 Das sich derzeit erneut generierende <strong>Namen</strong>s-Memorial in der Pinkas-<br />
Synagoge korrespondiert mit dem Signifikantentaumel der Grabsteine des Alten<br />
Jüdischen Friedhofs an der Klaus-Synagoge. Eine Notiz des Referenten in der<br />
Kultur- und Schulabteilung des Zentralsekretariats, Josef Poläk, betraf die Aufsicht<br />
alter jüdischer Friedhöfe durch das Museum: »Es ist nötig, daß der Friedhof<br />
einmal richtig in Ordnung gesetzt wird«, um einen »unesthätischen <br />
Eindruck« zu vermeiden. 54 Wäre es eine ob des Geschehens ästhetisch angemessenere<br />
Lösung, die <strong>von</strong> Nationalsozialisten zu musealen Zwecken mißbrauchten<br />
Synagogen heute leer auszustellen? Der 1946 in Lodz geborene Architekt Daniel<br />
Libeskind hat die Konsequenz aus der Prager Erfahrung tatäsächlich gezogen;<br />
die gleichzeitig unterbrechenden und verbindenden vertikalen Türme des <strong>von</strong><br />
ihm entworfenen Berliner Jüdischen Museums (zunächst ein Annex zum Berlin<br />
Museum) bestehen aus Leerräumen (voids). Die museologische Kunst wird daraus<br />
bestehen, der Verführung zu wiederstehen, sie wieder zu füllen.<br />
53<br />
Siehe die Ausstellungskritik »Gestapelter Tod« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung<br />
vom 29. März 1993, 33, Sigle »E. N.«<br />
54<br />
War Museum Fund, Inv. Nr. 20, Korrespondenz 1941/42
444 MUSEUM<br />
Semiophoren zwischen historischem Dokument und<br />
nationalem Monument: Die Reichskleinodien<br />
Das Sachgut der Reichskleinodien fungiert als materiale Metonymie des Reichs<br />
und seines Zeitraums, empfunden als Versinnbildlichung eines politischen Geschicks:<br />
Das riebe heißen sie im 13. Jahrhundert und stehen »<strong>für</strong> das Reich selbst,<br />
sein Schicksal war auch das des Reiches, auf und ab: hin und her warf es den<br />
Schatz; auf und ab, hin und her warf es das Reich.« 1 Von jährlichen Schaustellungen<br />
in Prag abgesehen, ruhten die Reichskleinodien in der Burg Karlstein bei<br />
Prag, bis 1421 die Hussitenunruhen Kaiser Sigismund sie zur Flüchtung der nach<br />
Ungarn zwingen; »so irrte das >reich< fern vom Reiche umher« . Von diesem Moment in der Serie ihrer diversen Einlagerungen an ist<br />
der Bezug des Freiherrn <strong>von</strong> und zu Aufseß zu den Reichskleinodien ein<br />
metoriymischer, denn als die Reichskleinodien über Ungarn in die derzeit mächtigste<br />
Stadt des Reiches nach Nürnberg verbracht worden waren, nahm der Bamberger<br />
Fürstbischof Friedrich <strong>von</strong> Aufseß als zuständiger Diözesanbischof »die<br />
Vorweisung der Heiltümer auf dem Hauptmarkt in Nürnberg vor den versammelten<br />
Großen des Reiches vor«. 2 Zum Schutz vor französischen Truppen an<br />
den Toren Nürnbergs gelangen die Reichskleinodien während der Revolutionskriege<br />
nach Wien, wie die Empfangsquittung des kaiserlichen Schatzmeisters<br />
vom 29. Oktober 1800 bezeugt. War das Nürnberger Verwahrungsprivileg mit<br />
der Reichsverfassung zugleich erloschen? Weder der Deutsche Bund noch seine<br />
Mitgliedsstaaten sehen sich in der Kontinuität des Reiches. 3 Lord Castlereagh<br />
implementiert in einer Note vom 11. September 1815 das Völkerrechtsprinzip,<br />
geraubte Kunstwerke sollten den Staaten zurückerstattet werden, »denen sie<br />
gehörten«. Vergleichbar der Rückführung der Bronzequadriga vom Brandenburger<br />
Tor und weiterer Antiken aus Paris nach Berlin 1815 (ein <strong>Im</strong>puls zur<br />
Gründung des Alten Museums) bewirkt die Struktur <strong>von</strong> Umweg, Verlust und<br />
Begehren die semiotische Aufladung der Objekte zu nationalen Symbolen; verwaiste<br />
Objekte verweisen auf den verlorenen Kontext. »Was ist ein Ding?<br />
Zuweilen auch: was gilt's?« (Hebbel). 4 Kehren die Kleinodien je an ihren Platz<br />
zurück, gibt es diesen, kommen sie an ihrem Bestimmungsort an oder sind beide<br />
archäologisch identisch? Ist das, was einmal Insignien waren (wie es Percy Ernst<br />
Heinrich Kohlhaußen, Die Reichskleinodien, Berlin 1938, 3<br />
Hans Max <strong>von</strong> Aufsess, Des Reiches erster Konservator. Hans <strong>von</strong> Aufsess, der Gründer<br />
des Germanischen Nationalmuseums 7. 9. 1801 - 6. 5. 1872, o. J., o. O. (Druck nach<br />
der Jahresgabe 1971 <strong>für</strong> die Mitglieder der Fränkischen Bibliophilen Gesellschaft), 9<br />
Patrick Bahners, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17. Mai 1995<br />
Motto der Einleitung <strong>von</strong> Arpad Weixlgärtner, <strong>Geschichte</strong> im Widerschein der Reichskleinodien,<br />
Baden b. Wien / Leipzig (Rohrer) 1938, 11
DIE RHICHSKLEINODIEN 445<br />
Schramm in Herrschaftszeichen und Staatssymbolik ausführlich darlegt), nicht<br />
mehr an den Körper des Souveräns, sondern an dessen Nachfolge, die Nation als<br />
politischer Körperschaft gebunden? Inwieweit tritt heute der Begriff <strong>von</strong> Kulturgut<br />
das symbolische Erbe dessen an, was einmal Insignien waren? Arcana<br />
imperii: Sicherheit als Sichtbarkeitsentzug und (Re)Präsentationsbedürfnis liegen<br />
im Konflikt. Bereits 1784 ist angesichts der vielen Wünsche, das Heiltum zu<br />
besehen, eine Verlegung in eine Art museal gestalteten Gewölbe auf der Burg ins<br />
Auge gefaßt worden. Heute jedenfalls birgt das GNM nichts als den leeren<br />
Schrein jener Insignien, lieu-tenant. Leer, platzhaltend, stellvertretend ist auch<br />
der Kaiserstuhl Karls des Großen im Aachener Dom. Diese Absenz macht<br />
Inhaltsfülle halluzinieren; historische <strong>Im</strong>agination ist der Effekt eines Mangels,<br />
der Lücken im Archiv. Ist das Reale hier an seinem Ort, weil etwas schmerzt?<br />
»Aus dem <strong>Im</strong>perium Romanum ward das Sacrum <strong>Im</strong>perium des christlichen<br />
Abendlandes. Und der Stuhl Karls des Großen steht auf deutschem Boden. Dieser<br />
Stuhl ist das schauererregendste, inhaltsvollste Nationalheiligtum der Deutschen.<br />
Aachen ist das Fatum der Deutschen mehr als Weimar. Hier senken<br />
sich die Wurzeln in realen, nicht erdichteten Boden.« 5<br />
Die Reichskleinodien 1866 und 1870<br />
Das asymmetrische Verhältnis <strong>von</strong> Staat und Nation (d. h. deren Bedarf nach<br />
Mehrwerten im <strong>Im</strong>aginären) kristallisiert sich im Vorschlag des Direktors des Germanischen<br />
Nationalmuseums zu Nürnberg, Essenwein, an Reichskanzler Bismarck,<br />
die Reichskleinodien aus Wien in den Prager Friedensverhandlungen nach<br />
dem Preußischen Krieg mit Österreich 1866 zurückzufordern: In Nürnberg sei<br />
jetzt das GNM »der richtigste Ort <strong>für</strong> die Aufbewahrung der jedem Deutschen<br />
hochwichtigen historischen Erinnerungszeichen«. Solche Semiophoren 6 sind Vermittler<br />
zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, als »Monumente des<br />
Regimentes« und Insignien der Herrschaft sind sie »greifbare Monumente <br />
wenn auch die Mehrzahl der Originalquellen in der Sammlung kulturhistorischer<br />
Blätter enthalten ist, wenn auch die Sammlung der Abbildungen Vieles ergänzen<br />
muß.« 7 Die Kupferstichsammlung des GNM dient seinerzeit »vorzugsweise dem<br />
Ordnen der historischen und kulturgeschichtlichen Blätter«. Diese Ordnung ist<br />
5<br />
Theodor Haecker, Vergil. Vater des Abendlands, Leipzig (Hegner) 3. Aufl. 1935<br />
("•1931), 134<br />
6<br />
Diesen Begriff definiert im museologischen Zusammenhang Krzysztof Pomian,<br />
Collectionneurs, Amateurs et Curieux. Paris, Venise: XVIe - XVIIIe siecle, Paris 1987<br />
7<br />
Zitiert nach: Peter Burian, Das Germanische Nationalmuseum und die deutsche<br />
Nation, in: Das Germanische Nationalmuseum Nürnberg 1852-1977, hg. v. Bernward<br />
Deneke u. Rainer Kahsnitz, München 1978, 127-262 (170ff)
446 MUSEUM<br />
als visuelle Evidenz <strong>von</strong> Historie wichtig, »wenn der ganze Entwicklungsgang der<br />
Kultur des deutschen Volkes vom Beginne des 16. Jahrhunderts bis auf unsere<br />
Tage an den Augen vorüberzieht« 8 , wie er sich im Medium diskreter archäologischer<br />
Monumente nicht als lineare Seriation plausibel veranschaulichen läßt;<br />
Historie als Signifikat der narrativen Form »kann sich nur indirekt, das heißt<br />
durch Allegorese zeigen.« 9 Original sind im Nürnberger Fall nicht die Objekte,<br />
sondern ihre auf Füllung harrende Fassungen - Gedächtnis im Verzug:<br />
»Vom silbernen Reliquienschrein, der einst die zu den Kleinoden des heiligen römischen<br />
Reiches gehörigen Reliquien barg, <strong>von</strong> den Lederkapseln, die einzelne Theile<br />
der Krönungsinsignien enthielten, bis zu den Glasschränken, in denen dieselben<br />
zuletzt ausgestellt waren, ehe sie auf Nichtwiederkommen aus der Stadt Nürnberg,<br />
welcher Kaiser Sigismund <strong>für</strong> ewige Zeiten das Recht der Aufbewahrung verliehen<br />
hatte, geflüchtet wurden. Ein schöner Festzug <strong>für</strong> die allen Deutschen gemeinsame<br />
Anstalt müßte es sein, wenn einst diese Kleinoden in das nationale germanische<br />
Museum gelangen würden. Den Schluß der Reihe der Denkmäler aus dem<br />
öffentlichen Leben bildet bis jetzt die uns übergebene Einrichtung des ehemaligen<br />
Sitzungssaales des Bundestages des deutschen Bundes zu Frankfurt a. M., ferner<br />
die auf das 48er deutsche Parlament bezüglichen Gegenstände.« 10<br />
In einem Moment, als die nationaldiskursive Progammierung des GNM objektorientiert<br />
wird, stützt Essenwein seinen (unbeantworteten) Antrag an Bismarck<br />
ausdrücklich auf die damals vollzogene staatsrechtliche Umgestaltung Deutschlands;<br />
ist sonst die Gedächtnispolitik des Museums <strong>von</strong> kulturwissenschaftlicher<br />
Depotbildung markiert, argumentiert sie hier im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong>:<br />
»Das deutsche Volk kann jetzt nachdem Österreich aus Deutschland ausgeschieden<br />
ist, nachdem es die Verbindung mit den anderen Stämmen gelöst hat, diese<br />
Reliquien nicht mehr außerhalb Deutschlands in Österreich lassen; es muß sie in<br />
seiner Mitte haben. so kommt endlich noch dazu, daß Nürnberg die Stadt ist,<br />
der das Recht der Aufbewahrung bis zum Untergange des Reiches zustand, daß<br />
im germanischen Museum selbst sich noch der kostbare Schrein befindet in dem<br />
ehemals die Insignien und Reliquien aufbewahrt wurden. Auch sollten die Insignien<br />
so lange das Reich dauerte an geweihter Stelle aufbewahrt werden. Das germanische<br />
Museum ist in der Lage (in) einer über der Sakristei seiner jetzt als<br />
Kunsthalle dienenden Kirche befindlichen Kapelle, die in gothischem Stil erbaut,<br />
ganz gewölbt ist, noch den alten Altar hat eine Stätte bieten zu können, die auch<br />
• 8 Zwanzigster Jahres-Bericht des germanischen Nationalmuseums, 1. Januar 1874<br />
9 Hayden White, Das Problem der Erzählung in der modernen Geschichtstheorie, in:<br />
Pietro Rossi (Hg.), Theorie der modernen Geschichtssschreibung, Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1987, 57-106(82)<br />
10 August Essenwein, Das germanische Nationalmuseum. Bericht über den gegenwärtigen<br />
Stand der Sammlungen und Arbeiten, sowie die nächsten daraus erwachsenden<br />
Aufgaben, an den Verwaltungsausschuß erstattet, Nürnberg 1870 = Deneke / Kashnitz<br />
1978:993-1026(1017)
DIE REICHSKLEINODIEN 447<br />
in dieser Rücksicht der Würde der Gegenstände volkommen entspräche.« <br />
Der museale Raum als sacred Space: Nachdem einst die Kirche die Semiotik<br />
spätantiker Herrschaftsinisgnien adaptiert hatte, kommt es umgekehrt zu einer<br />
imitatio sakraler Symbole durch die Myterien des Staates. 11 Es handelt sich bei<br />
den Reichskleinodien um Objekte, die mit mnmemischer Energie je nach Kontext<br />
aufladbar sind; das GNM behauptet, sie quasi heraldisch fassen zu können,<br />
gerade in seiner institutionalisierten Verfaßtheit. Nicht in, sondern parergonal an<br />
den Objekten, in ihrer gedächtnisstrategischen Positionierung liegt ihre<br />
Geschichtswirksamkeit, denn auch wenn sie aktuelle keine politische Bedeutung<br />
hatten, »so könnte in Zukunft auf irgend einer Seite der Wunsch sich regen, ihnen<br />
eine solche zu geben«; der Kaiser <strong>von</strong> Österreich etwa »dürfte schwerlich geneigt<br />
sein, sie wieder nach Nürnberg zu geben, wenn nicht durch Neutralität der<br />
Anstalt die Gewähr geleistet ist, daß keine Macht sie derselben entziehen kann«<br />
. Signifikanten erscheinen<br />
hier en souffrance, die <strong>Geschichte</strong> als Geschick, als postalische Sendung<br />
strukturieren - »unzustellbar«. 12 Denken wir die Artefakte analog dazu als archivbestimmt<br />
(»Archiv heißt ein Behältnis <strong>von</strong> Sachen und Briefschaften« 13 ), deren<br />
Latenzzeit auf Adressierung wartet, ist deutlich, daß zwischen dem Essenwein<br />
beschriebenen Delirium der Reichskleinodien und ihrer musealen Einlagerung<br />
die Differenz, der Einschnitt der Institution liegt, welcher aller Arbitrarität der<br />
Zeichen Schranken setzt und der Logistik <strong>von</strong> Gedächtnismacht selbst entspricht.<br />
14 <strong>Im</strong> November 1870 erscheint ein Zeitungsartikel in Nürnberg mit dem<br />
Vorschlag, die deutschen Reichskleinodien dem Germanischen Museum einzuverleiben.<br />
»Hier steht der große silberne Schrein, der einst die Reliquien in sich<br />
schloß« - konkret der Rchquienschrein, als Speicher das Museum überhaupt.<br />
Denn dem 19. Jahrhundert gilt das Museum selbst als Heiligtum, als ästhetische<br />
Kirche. 15 Ist damit nicht der Schrein der Kleinodien, sondern das Museum selbst<br />
ihre eigentliche Fassung? Volker Plagemann sucht diese Vorstellung zu korrigie-<br />
11 In diesem Sinne Ernst Kantorowicz, Mysteries of State. An Absolutist Concept and<br />
its Late Mediaeval Origins, in: Harvard Theological Review Bd. 47 (1955), 65-91, u. a.<br />
unter Bezug auf Percy Ernst Schramm, Sacerdotium und Regnum im Austausch ihrer<br />
Vorrechte, in: Studi Gregoriani II (1947), 403-457<br />
12 Siehe Jacques Lacan, Das Seminar über E. A. Poes »Der entwendete Brief«, in: ders.,<br />
Schriften I, hg. Norbert Haas, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1975, 7-41 (28t)<br />
13 Johann Heinrich Zedler, Großes Vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 2, Halle / Leipzig<br />
1732 (Reprint Graz 1961), Spalte 1244<br />
14 Stefan Brotbeck spricht - unter Bezug auf Lacan 1975 - <strong>von</strong> der »verschütteten arcbe<br />
des Briefes«: »Sujet en souffrance«, in: Riss. Zeitschrift <strong>für</strong> Psychoanalyse 7 (Februar<br />
1988), 57-82 (58)<br />
15 Siehe Hubert Schrade, Schicksal und Notwendigkeit der Kunst, Leipzig 1936
448 MUSEUM<br />
ren, den Romantikern sei daran gelegen gewesen, die christlichen Sakralbauten<br />
durch Museen ersetzen zu wollen. 16 In der nationalliberalen Aachener Zeitung<br />
vom 7. Dezember 1870 dagegen wird ein analoger Anspruch unter Berufung auf<br />
das alten Krönungsrecht Aachens erhoben. In der Aachener Stadtverordnetensitzung<br />
vom 24. Januar 1871 wird einstimmig beschlossen, den (damals noch)<br />
König Wilhelm in einer Adresse zu bitten, <strong>für</strong> seine Kaiserkrönung Aachen auszuersehen.<br />
Wilhelm aber vermeidet (im Unterschied zur Rolle der Reichskleinodien<br />
im Nationalsozialismus), in der Staatssymbolik eine unmittelbare<br />
Anknüpfung an das alte Reich zum Ausdruck zu bringen; in einem 1872 erschienen<br />
Buch des Oberzeremonienmeisters Graf Stillfried über Die Attribute des<br />
Neuen Deutseben Reiches, das wohl offiziösen Charakter besitzt, werden da<strong>für</strong><br />
Insignien und heraldische Zeichen neu entworfen. Ein post scriptum zum gängigen<br />
Bild Wilhelms I., er habe seiner Krönung zum deutschen Kaiser im Ritual<br />
des Spiegelsaals <strong>von</strong> Versailles nur widerwillig zugestimmt, liefert Karl Hampe<br />
1934. »Ein Brüsseler Archivfund« 17 , quellenkritisch angereichert mit anderen<br />
Belegen (etwa den Aktenpublikationen zur Auswärtigen Politik Preußens<br />
in jenen Jahren), triggert das deutsche Gedächtnis als unerwarteter Einbruch<br />
archivischer Information (d. h. des Unerwarteten im Kommunikationssinn der<br />
Systemtheorie) in den Diskurs der Nationalgeschichte, die sie deformiert. 18<br />
Einem eigenhändigen Bericht des belgischen Gesandten Baron Beaulieu an König<br />
Leopold II. zufolge, den Hampe im Archiv des Brüsseler Außenministerium<br />
unter dem Titel Correspondance politique. Legations, Pays-Bas Bd. 15 (1866-<br />
1868) entdeckt, memoriert der italienische Kronprinz Humbert in einem vertraulichen<br />
Gespräch, König Wilhelm I. habe ihm in bei seinem Besuch in<br />
Potsdam (Juli 1867) tatsächlich mitgeteilt, »daß er die Vollendung des Kölner<br />
Domes beschleunige, um sich dort zum Kaiser <strong>von</strong> Deutschland krönen zu lassen«<br />
19 . An dieser Bruchstelle des Archivs, dem Scharnier <strong>von</strong> Gedächtnis und<br />
Diskurs, enthüllt die Historie ihre fragile Begründung im Datenspeicher; »entweder<br />
ergibt genauere Prüfung des mitgeteilten Schriftstückes die Unglaubwürdigkeit<br />
der Nachricht oder aber die bisherige Auffassung der Haltung Wilhelms<br />
I. in der Kaiserfrage bedarf erheblicher Abwandlungen und Berichtigungen«. 20<br />
16 Volker Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790-1870, München 1967<br />
17 Karl Hampe, Wilhelm I. Kaiserfrage und Kölner Dom. Ein biographischer Beitrag zur<br />
<strong>Geschichte</strong> der deutschen Reichsgründung, Kohlhammer (Stuttgart) 1936, Vorwort<br />
(1935)<br />
18 Archivkundlich gilt bereits <strong>für</strong> die Anlage <strong>von</strong> Regesten, daß Intus- oder Darinvermerke<br />
auf Akten »weniger das Wichtige als das Unerwartete herausheben« sollen: Heinrich<br />
Otto Meisner, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, 2. Aufl. Leipzig 1952,95<br />
19 Zitiert nach Hampes Abschrift in Hampe 1936: 9<br />
20 Hampe 1936: 2; vgl. seine Option <strong>für</strong> die Authentizität der Nachricht ebd., 13
Insignien<br />
DIE REICHSKLEINODIEN 449<br />
Objekt und Diskurs der Reichskleinodien konvergieren im Medium Druckkunst,<br />
in der Prachtausgabe <strong>von</strong> Franz Bock, Die Kleinodien des Heiligen Römischen<br />
Reiches Deutscher Nation nebst den Kroninsignien Böhmens, Ungarns<br />
und der Lombardei und ihren formverwandten Parallelen (Wien, k. k. Hofund<br />
Staatsdruckerei 1864) als musealem, enargetischer Raum 21 : »Wie es die<br />
Kleinodien des deutschen Reiches zum Inhalt hat, soll es selber ein Kleinod<br />
sein, ein Kleinod der graphischen Künste und der archäologischen Wissenschaft,<br />
auf dass es eine Ehre der Nation sei, deren alterthümliche Ehrendenkmale<br />
es vor Augen stellt.« 22 Metonymische Operationen (ein erweiterter Begriff<br />
der Reichskleinodien) lassen selbst die Kästen und Aufbewahrungsorte der<br />
Kleinodien, also alles, »was nur mit dem Hauptgegenstand in Beziehung zu setzen<br />
war«, seine Darstellung finden . Ein Anhang verweist zunächst<br />
auf die in Verlust geratenen deutschen Reichskleinodien, <strong>von</strong> welchen sich<br />
Abbildungen bei Delsenbach (einer älteren Publikation der Nürnberger Reichskleinodien)<br />
erhalten haben - Gegenstände, die bei der Flucht nach Wien nach<br />
1800 abhanden kamen, oder aus Notgrabungen wieder zutage traten (etwa der<br />
ungarische Krönungsschatz <strong>von</strong> Orsova). Monument aber ist das Selbstredende;<br />
niemand könne in Abrede stellen, daß »alle diese Gegenstände um ihrer selbst<br />
willen, rein als historische Denkmäler einer grossen Vergangenheit betrachtet,<br />
eine Herausgabe verdienen«. Neben dieses »rein historische und nationale<br />
Interesse« tritt das der Wissenschaft: »die Archäologie der Kunst wie auch die<br />
Culturgeschichte« sowie »die moderne Kunstindustrie, welche bei gegenwärtiger<br />
Richtung zu einem strengeren Styl darin reiche Fundgrube <strong>von</strong> Vorbildern<br />
besitzt«. Auf Objekte bezogen ist die Rede <strong>von</strong> der »Archäologie des Mittelalters,<br />
wenn wir die monumentale Kunst ausschliessen, hat es vorzugsweise mit<br />
der Kunst der Verarbeitung edler Metalle und der Bronze zu thun« .<br />
Das gilt selbst <strong>für</strong> die Buchbinderei, die also (darauf weist die Bucheinbandseparation<br />
im GNM hin) - nicht gelesen, sondern beschaut wird, als Scharnier<br />
<strong>von</strong> Text und Objekt. Die Publikation zielt auf eine vergleichende Formentwicklung,<br />
d. h. »den eigentlichen Kern der Archäologie«; hinzu kommt das<br />
»culturgeschichtliche Wissen« und das »bessere Verständnis <strong>von</strong> mancherlei<br />
Zuständen« . Ein deutsches Gedächtnisobjekt oszilliert hier zwischen<br />
21 Zur rhetorischen Trope der Veranschaulichung (enargeia) siehe Stephen Greenblatt,<br />
Verhandlungen mit Shakespeare, Berlin (Wagenbach) 1990, Einleitung<br />
22 Jacob Falke, Prospectus / Broschüre zu Bock 1964. Die Druckerei merkt an, daß es<br />
»wegen der Grosse und Kostbarkeit des hier angezeigten Werkes nicht möglich ist,<br />
dasselbe den Kunstfreunden und Bibliotheken zur Ansicht zuzusenden«.
450 MUSEUM<br />
Diskurs und Zustand, Dokument und Monument, <strong>Geschichte</strong> und Archäologie.<br />
Es ist diese Differenz, die der ästhetische Historismus nur scheinbar auflöst;<br />
als Unterschied zwischen konkreten Speicher- und Übertragungstechniken und<br />
ihrer diskursiven Weiterverarbeitung schreibt sie sich fortwährend weiter.<br />
»Staat, Verwaltung und Rechtspflege sind idealer Natur und nicht in Denkmälern<br />
verkörpert; doch sind die Insignien Denkmäler, die uns jene Gebiete vor<br />
Augen führen« . Damit stehen Staatssymbole in der<br />
Tradition <strong>von</strong> Heraldik; uniformierende Kennzeichen verschiedenster Art,<br />
besonders im militärischen Bereich Flaggenembleme wie auch im wirtschaftlichen<br />
Bereich Waren- bzw. Markenzeichen, sind Ausdrucksformen einer demokratisierten<br />
modernen Heraldik . Es geht bei Heraldik<br />
zunächst um Techniken der Subjektproduktion, deren Funktion, einen Zweitkörper<br />
zu erschaffen, auf den Staat selbst übertragen werden; »die Heraldik<br />
produziert also juristische Personen dadurch, daß sie jede <strong>von</strong> ihr ergriffene<br />
Person mit Zweitkörpern umstellt, die diese auf andere physische Personen<br />
beziehen.« 23 Lückerath diskutiert die Überführbarkeit dieser Informationen in<br />
EDV und denkt an die »formale Erfassung wappenmäßiger Formen mittels<br />
Beschreibung« (z. B. Schildform und Registrierung des Schildinhaltes: Wappenbilder<br />
geometrischer oder figürlicher Art); »ferner wären auch Speicherungen<br />
unter motivischen oder gestalterischen Aspekten möglich« . Auf<br />
einem verwandten Sektor, der ähnlichkeitsbasierten vergleichenden Erkennung<br />
digitalisierter historischer Wasserzeichen, wird dieses Ziel durch einen similarity<br />
task processing algorithm inzwischen als Datenbank im Internet realisiert. 24<br />
Historische Darstellung als Maßgabe der Geschichtswissenschaft »braucht<br />
die erzählende Veranschaulichung in hohem Maße als adäquate Form <strong>für</strong> die<br />
zeitlich ablaufende Ereignisfolge, allerdings kann sie nicht als absolute Form<br />
gelten« 25 ; an der digitalen Grenze zur automatisierten, zählenden (d. h. kalkulierenden)<br />
Veranschaulichung wird <strong>Geschichte</strong> redundant. Zwischen diskretem<br />
Monument und narrativem Dokument siedelt sich ein mediävistischer<br />
Bestand im GNM konkret an: »Als Denkmäler des Staats- und Rechtslebens<br />
23 Walter Seitter, Menschenfassungen. Studien zur Erkenntnispolitikwissenschaft, München<br />
(Boer) 1985, 10, unter Bezug auf Ernst Kantorowicz, The Ring's Two Bodies. A<br />
Study in Mediaeval Political Theology, Princeton 1957<br />
24 Christian Rauber / Peter Tschudin / Thierry Pun, Retrieval of <strong>Im</strong>ages from a Library<br />
of Watermarks for Ancient Paper Identification, Textvorlage zu Vortrag 14, Konferenzband<br />
EVA >97 Berlin: Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie,<br />
12.-14. November 1997, veranstaltet <strong>von</strong> Vasari Enterprises (Aldershot) u. Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> angewandte Informatik (Berlin)<br />
25 Carl August Lückerath, Prolegomena zur elektronischen Datenverarbeitung im<br />
Bereich der Geschichtswissenschaft, in: Historische Zeitschrift 207. Bd. (1968), 265-<br />
296 (272)
DIE REICHSKLEINODIEN 451<br />
müssen wir auch die Urkunden betrachten; sie bilden nach den Satzungen der<br />
Anstalt als >Archiv< eine besondere Hauptabtheilung« .<br />
Reichskleinodien (zum Dritten)<br />
Das Bundesarchiv Berlin birgt eine Denkschrift über die deutschen Reichskleinodien<br />
in der Wiener Hofburg und den Nürnberger Anspruch 2 * 1 ; ein Absatz<br />
schreibt eine Kurzgeschichte der Reichskleinodien:<br />
»Ueber die Augenweide kostbarer Gestaltung edelsten Materials hinaus ergreift den<br />
Betrachter der Reichskleinodien wieder und wieder die ungeheurere Ballung<br />
geschichtlicher Tatsachen, die sich mit diesen wenigen Gegenständen verbindet. Da<br />
ist die Hl. Lanze aus Siegener Stahl und der Zeit des grossen Kaiser Karl entstammend,<br />
ursprünglich burgundische Königslanze, wird sie seit Heinrich I. rechtswirksames<br />
Reichssymbol, mit ihr siegt Otto der Grosse 955 in der bedeutungsvollen<br />
Schlacht auf dem Lechfelde.« <br />
Der Reichsminister und Chef der Berliner Reichskanzlei Lammers schreibt am<br />
18. Juni 1938 aufgrund einer entsprechenden Führer-Anweisung an den Oberbürgermeister<br />
der Stadt Nürnberg, Liebel, betreffs der Zurückführung der<br />
Reichsinsignien und Reichskleinodien nach Nürberg - gekoppelt an die Überweisung<br />
der Reichsbibliothek aus GNM in Deutsche Bücherei Leipzig, zur<br />
Kompensation? Als der italienische Konsul in Wien Anspruch auf den Krönungsmantel<br />
und die Augustus-Gemme erhebt, entscheidet Hitler dagegen<br />
(August 1938). Die Reichskleinodien fungieren als Semiophoren, im Nationalsozialismus<br />
und durch Hitler, der das tausendjähige Reich an die Symbole des<br />
Alten Reiches in mythischer Geschichtszirkularität rückkoppelbar macht, überdeterminiert.<br />
Ȇber Alter und Herkunft aber der Reichskleinodien steht ihr<br />
gemeinsames Schicksal, das Schicksal der Nation, das sie zu einer unlösbaren<br />
Einheit zusammenschweißte. In ihm haben sie mehrfach Wesen und Bedeutung<br />
gewandelt« . Da sind zunächst die drei Aachener Kleinodien,<br />
u. a. das Evangliar Karls des Großen. Auf dem (in Heinrich Kohlhaußens<br />
Buch abgebildeten) Beginn des Johannesevangeliums machen die beiden<br />
Anfangsbuchstaben in ihrer tierartigen Bildung den Eindruck <strong>von</strong> Fabelwesen.<br />
»Nicht ohne Grund ist diese Seite schlecht erhalten, ruhten doch auf ihr die<br />
Schwurhände vieler deutscher Kaiser und Könige.« Und in Anspielung auf<br />
Kaulbachs Historiengemälde im GNM: »Wir brauchen die Überlieferung <strong>von</strong><br />
der Findung dieses Buches im Jahre 1000 auf den Knien des toten Kaisers beim<br />
Gruftbesuch Ottos III. nicht zu glauben«; eventuell wurden Faksimiles <strong>von</strong><br />
Kaiser Karl in Auftrag gegeben. Der Speicherzustand des Evangeliars wird zur<br />
26 Bestand R 43 II / 1236, Bl. 44 ff, Typoskript
452 MUSEUM<br />
nationalen Allegorie: »Ist doch der Zwiespalt dieses Buches der Zwiespalt seines<br />
Reiches« . Die 1938 auf Anordnung Adolf Hitlers<br />
nach Nürnerg überführten Reichskleinodien werden entgegen der ursprünglichen<br />
Planung nicht im Museum, sondern als eigenständige Aufstellung in der<br />
Katharinenkirche gezeigt, zentral vor dem Kaisermantel. Die altarähnliche,<br />
quasi-sakrale Inszenierung des Heiltumsschreins entzieht die Objekte damit<br />
ausdrücklich ihrer Lesbarkeit als Dokumente im musealen Rahmen zugunsten<br />
eines metahistorischen Anspruchs als Monumente. Das Germanische Nationalmuseum<br />
macht im 19. Jahrhundert selbst immer wieder darauf aufmerksam,<br />
daß die Verbindung eines sakralen Dispositivs und der Nation in der mittelalterlich-christlichen<br />
Idee eines heiligen römischen Reiches deutscher Nation<br />
selbst schon angelegt ist. Indem sich das Museum - im Gegensatz zum historiographischen<br />
Text - vor allem der gegenständlichen Vergangenheit annimmt,<br />
ist es <strong>von</strong> der Ambivalenz mittelalterlicher Herrschaftszeichen unmittelbar<br />
betroffen: Sie symbolisierten nicht einfach das Königtum, sondern sie sind es<br />
auch. Kohlhaußen nennt die deutschen Reichskleinodien auf der ersten Tagung<br />
der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation 1942 »Form gewordener<br />
Schicksalsträger des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« - eine auf<br />
ihre Signifikanten verwiesene, ihrem Geschick ausgelieferte Entität. Ist diese<br />
abgespaltene Aura später auf Gedächtnisräume übertragbar? Antiquarische<br />
Objekte stehen <strong>für</strong> nationale <strong>Geschichte</strong> erst in der vom Medium Museum<br />
arrangierten allegorischen Konfiguration.<br />
Das Privileg Kaiser Sigismunds <strong>von</strong> 1424 verweist den Krönungsschatz (Insignien)<br />
unveräußerlich nach Nürnberg und die Aachener Kleinodien in den<br />
Domstift. Ihr Eigentum verbleibt beim Reich; der Text der Verleihungsurkunde<br />
spricht <strong>von</strong> »unser und des heiligen reichs heiligtum«. Essenwein schreibt hinsichtlich<br />
der Rückführung der Reichskleinodien nach Nürnberg im Modus der<br />
<strong>Geschichte</strong> als Destination (vergangene Zukunft); den Anspruch auf Rückführung<br />
der Reichskleinodien setzt erst das Dritte Reich durch. Auch das heißt<br />
data. processing: Politisch differente Kontexte vermögen das Archiv (respektive<br />
das Depot) zu aktivieren, Dokumente und Objekte mit einer Energie zu laden,<br />
die ihnen nicht eigen, sondern kontextuelll angelegt ist und sie aus dem Raum<br />
des Museums in einen Raum radikaler Präsenz, realer Gegenwart hochlädt. Am<br />
26. Juli 1938 hält der Nürnberger Oberbürgermeister Willy Liebel im Haus<br />
Wahnfried in Bayreuth vor Hitler persönlich einen Vortrag über die Rückführungsforderung<br />
der Reichskleinodien nach dem deutschen Einmarsch in<br />
Österreich und macht deutlich, daß er in ihnen keineswegs bloße Musealien sah,<br />
sondern reale Symbole <strong>für</strong> den Anspruch des Dritten Reiches, legitimer Nachfolger<br />
des ersten großdeutschen Reiches zu sein. Die <strong>von</strong> Kohlhaußen erhoffte<br />
Aufstellung im Germanischen Nationalmuseum unterblieb damit zugunsten
DIE REICHSKLEINODIEN 453<br />
der <strong>von</strong> Liebel beförderten und tatsächlich durchgeführten Präsentation in der<br />
städtischen Katharienenkirche - doch auch dieser Zustand blieb provisorisch. 27<br />
Geplant war eine künftige Unterbringung in einer der Vortragssäle der bereits<br />
im Bau befindlichen Kongreßhalle - die Insignien des Reiches in der Obhut der<br />
NSDAP; deren reichsweiter Anspruch bedarf der Autorisierung durch Reliqien.<br />
Anfang Februar 1939 liegt das <strong>von</strong> dem rechtskundigen Stadtrat Karl<br />
Fischer im Auftrag des Nürnberger OB erstellte Gutachten vor, demzufolge das<br />
Eigentum der Reichskleinodien nicht zu den Hoheitsrechten des Alten Reichs<br />
gehört, sondern den Privatrechten des Kaisers. Dieses Eigentum war damit aber<br />
weder auf den Kaiser als Privatmann übergegangen - im Sinne der zwei Körper<br />
des Souveräns -, noch (mit dem 6. August) 1806 auf das Kaiserreich Österreich.<br />
Der 1815 gegründete Deutsche Bund ist demgegenüber ein neues, selbständiges<br />
Gebilde, wie auch das zweite deutsche Kaiserreich <strong>von</strong> 1871. So manifestieren<br />
die Kleinodien als archäologische Objekte die Diskontinuitäten der<br />
deutschen Vergangenheit, die kein Geschichtsbegriff überspielt; Gedächtnispolitik<br />
kann nicht abgeleitet, sondern nur gesetzt werden. Liebel drängt auf den<br />
Erlaß eines eigenen Reichsgesetzes und die kontextualisierende Mitversammlung<br />
aller auf die Kleinodien bezüglichen Archivalien ebenfalls in Nürnberg,<br />
doch ein Gutachten des damaligen Nürnberger Stadtarchivdirektors Gerhard<br />
Pfeiffer erinnert mit archivwissenschaftlicher Unerbittlichkeit daran, daß dies<br />
an »den Grundfesten des deutschen Archivwesens - das auf die Erhaltung<br />
geschlossener Archivkörper baute - rüttelte« . Auf der archivischen<br />
Einsicht in die Diskretheit <strong>von</strong> Datenbeständen beruht auch die Resistenz<br />
der preußischen Staatsarchive gegen totalisierende Erzählungen und Zentralisierungsversuche,<br />
also die Gedächtnismonopolisierungsbestrebungen des NS-<br />
Staats. Die diskursiv verordnete Versammlung <strong>von</strong> Objekten unterscheidet sich<br />
<strong>von</strong> der Dezentriertheit ihrer Begründung im Realen des Archivs, ihrer Verankerung<br />
im Urkunden- als Rechtswesen. Liebeis Reichsgesetzentwurf scheitert<br />
kurz vor seiner Verabschiedung durch die Reichsregierung am Ausbruch des<br />
Zweiten Weltkriegs, der dann aus Schutzgründen zur Verkapselung der Artefakte<br />
führte. Als Täuschungsmanöver läßt Liebel am 5. April durch einen SS-<br />
Offizier noch zwei große - allerdings leere - Kisten wegfahren, um so einen<br />
Abtransport der Kleinodien zu fingieren, während sie real in einem Behälter<br />
einer eigens da<strong>für</strong> vorgesehenen Nische einer Bunkeranlage eingemauert werden<br />
- eine Farce auf den leeren Schrein, der nun im GNM seiner Kleinodien<br />
entblößt harrt. Materiale Modi der Speicherung sind radikal non-diskursiv, jenseits<br />
aller historischen Begründung verfaßt; der Zeitzeuge Wilhelm Schwemmer<br />
27 Gerhard Rechter, in: Nürnberg - Kaiser und Reich. Ausstellungskatalog des Staatsar-<br />
chivs Nürnberg, 1986
454 MUSEUM<br />
nimmt an, daß mit dieser Kombination aus fingiertem Speicher und realer<br />
Flüchtung eine Vernichtung der Reichskleinodien aufgrund einer Weisung aus<br />
Berlin (Hitlers JVero-Befehl) entgegengewirkt werden sollte. Um nach Kriegsende<br />
die Ablieferung der Kleinodien zurück nach Wien durch den <strong>für</strong> Denkmäler,<br />
Kunst und Archive zuständigen US-Offizier Captain J. C. Thompson zu<br />
verhindern, läßt Ernst Troche, Nachfolger Kohlhaußens als Direktor der GNM,<br />
durch den Ordinarius <strong>für</strong> Kirchenrecht und deutsche Rechtsgeschichte der Universität<br />
Erlangen, Hans Liermann, ein weiteres Rechtsgutachten erstellen, das<br />
zu dem Ergebnis kommt, daß niemand Eigentumsrechte an den Reichskleinodien<br />
gelten machen kann. Die als Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit<br />
anzusehenden Kleinodien kann jedoch die dazu berufene Staatsgewalt neu organisieren.<br />
<strong>Im</strong> Dezember 1945 beschließt der Alliierte Kontrollrat in Berlin auf<br />
Antrag der österreichischen Bundesregierung die Rückführung der Reichskleinodien<br />
nach Wien, wo sie in der Hofburg seitdem wieder exponiert sind.<br />
Der Nürnberger Speicherplatz und sein Inhalt bleiben getrennt.
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 455<br />
Exkurs über das Autoritätsverhältnis <strong>von</strong> Knochen,<br />
Denkmälern und Buchstaben<br />
Aktualisierung gibt das Stichwort <strong>von</strong> Gedächtniskybernetik vor, wie sie auch<br />
<strong>für</strong> das Archiv gilt: Latent lagernde Information wird durch Transfer in den<br />
aktuellen Arbeitsspeicher der Datenverarbeitung zugänglich gemacht. Theodor<br />
Heuss sieht im August 1952 im Sinn des Nürnberger Museums »nie bloße Konservierung<br />
eines Gewesenen«, sondern »dessen Vergegenwärtigung als geistigpolitische^)<br />
Auftrag. Und solcher Auftrag steht unter dem wechselnden Gesetz<br />
der Stunde.« 1 Die Kopplung <strong>von</strong> Speicher und Energie setzt Gedächtnis als<br />
Erinnerung (imperativisch) in Gang, und zwar radikal jetztzeitig. Die Museumsstiftung<br />
<strong>von</strong> 1852 bestimmt, »aus den vielfältigen Zeugnissen deutscher<br />
Kunst- und Kulturgeschichtliche Maßstäbe <strong>für</strong> eine Zielsetzung der eigenen<br />
Gegenwart gewinnen zu können.« Zeitgenössische Kunst wird nicht in die<br />
Sammlungstätigkeit, doch ihre museale Fassung einbezogen; Aufseß läßt 1859<br />
die Südwand der Kartäuserkirche <strong>von</strong> Wilhelm <strong>von</strong> Kaulbach mit dem Historienfresko<br />
Kaiser Otto I. öffnet die Gruft Karls des Großen ausstatten. 2<br />
Kaulbachs Allegorie<br />
Museale Halluzinationen der Vergangenheit bilden die Inversion des archäologischen<br />
Schweigens ihrer Relikte, denn statt verstaubter Knochen sieht Otto<br />
hier Gruft Karl den Großen majestätisch thronend und die gesuchte Größe der<br />
Vergangenheit als lebendige Gegenwart - »eine sprechende Allegorie <strong>für</strong> den<br />
mit dem Museums verknüpften Wunsch nach Erneuerung des alten Reichsgedankens.«<br />
3 Aufseß äußert aus Anlaß der Enthüllung des Kartäuserkirchen-<br />
Freskos 1859, daß dem Germanischen Museum kein treffenderes und schöneres<br />
Sinnbild der geschichtsarchäologischen Aufklärung gegeben werden konnte:<br />
»Denn auch wir sind berufen, hinabzusteigen in die lang verborgenen Tiefen der<br />
Vorzeit, um aufzusuchen des alten Reiches Herrlichkeit, sie, die längst abgestorbene,<br />
wieder hell zu beleuchten mit dem Fackelschein der Wissenschaft der Wissenschaft,<br />
auf daß sich jedermann daran erfreue und stärke, ja, wie Kaiser Otto<br />
wollte, zu neuen Taten der Ehre und des Ruhmes der deutschen Nation sich<br />
ermanne.« <br />
1 Theodor Heuss, Sichtbare <strong>Geschichte</strong>. Gedenkrede zur Hundertjahrfeier des Germanischen<br />
National-Museums, Nürnberg 1952, 22<br />
2 Zur Öffnung der Gruft Karls des Großen durch Kaiser Otto III., der ihm ein Halskreuz<br />
entnahm: Olaf B. Rader, Wettlauf um die Toten. Warum Grabbesuche den<br />
Mächtigen so wichtig sind, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 7. März 1998, vi<br />
3 Faltblatt zur Ausstellung Facetten bürgerlicher Kunst und Kultur im GNM 1995/96
456 MUSEUM<br />
Kaiser Otto hat tatsächlich die Gebeine Karls in seine Obhut genommen;<br />
»dennoch wiedersprach Kaulbachs Fresko in seinem artifizellen Charakter gerade<br />
jenem Authentizitätsprinzip, dem das Museum sich verpflichtet fühlte und dem<br />
alle übrigen Ausstellungssstücke entsprachen, die Originale ebenso wie die Nachbildungen«.<br />
4 Die zeitgleiche Historiographie <strong>von</strong> Augustin Thierry, Prosper de<br />
Barante, Sir Walter Scott und Leopold <strong>von</strong> Ranke setzt auf den dokumentarischen,<br />
nicht länger allegorischen Effekt des Realen in der Prozessualisierung <strong>von</strong> Gedächtnis.<br />
5 Auf diskursiver Ebene ist das GNM also nicht schlicht jenes Depot und<br />
Archiv, das es auf infrastruktureller Gedächtnisebene funktional darstellt, sondern<br />
ein Agent, ein Aktivposten des nationalen Erinnerungsimperativs. Vergangenheit<br />
im GNM ist der Anspruch auf deutsche Zukunft in diesem Sinne. Auf<br />
nicht-diskursiver Ebene aber setzt sich die Speicherfunktion durch; bleibt das<br />
Spannungsverhältnis zwischen der Funktion als historisches Museum im strengen<br />
Sinne, das Denkmäler und Urkunden der deutschen Nation zu sammeln hat,<br />
und seinem ursprünglich kulturhistorischen Auftrag als Versammlung bürgerlicher<br />
Altertümer der Vergangenheit. »Wohl deshalb war es<strong>für</strong> die Idee des Pantheons,<br />
das die Größe des deutschen Geistes hätte sichtbar machen können, oder<br />
als Ruhmeshalle der deutschen <strong>Geschichte</strong> wenig geeignet und blieb trotz aller<br />
Ehrenhallen in stärkerem Maße bloße Sammlung« -<br />
und ließ damit eine Lücke <strong>für</strong> das spätere Deutsche Historische Museum in Berlin.<br />
Wappenreihen demonstrieren in Nürnberg, daß - so August Essenwein im Führer<br />
<strong>von</strong> 1887 - »unsere Kartause ein großes monumentales Stammbuch« geworden<br />
ist - Genealogie im Bund mit Historie. Bildserien großer Denker, Künstler,<br />
Erfinder und Wissenschaftler beherrschen die Tradition <strong>von</strong> bis auf die Antike<br />
zurückreichenden Gedächtnisspeichern, vor allem Bibliotheksausstattungen. 6<br />
Auch die Oberlausitzer Gedenkhalle mit implementiertem Kaiser-Friedrich-<br />
Museum in Görlitz (eingeweiht 1902) manifestiert, daß Gedächtnisinstitutionen<br />
nun selbst denkmalfähig wurden. Auch wenn die Absicht der Ehrung, die Errichtung<br />
eines Denkmals <strong>für</strong> Kaiser Wilhelm I. und Kaiser Friedrich III im Vordergrund<br />
des Interesses stand, geschah dies nicht in Form eines Reiterstandbildes; es<br />
erfolgte ebenfalls nicht die Form der Errichtung einer Gedächtniskirche, sondern<br />
im Medium Museum. »In der Görlitzer Ruhmeshalle ein Denkmal zu sehen, dem<br />
kurioserweise ein Museum angehängt worden sei, würde dem zeitgenössischen<br />
Museumsverständnis nicht gerecht« . Als es darum geht, »im<br />
4 Francis Haskell, Die <strong>Geschichte</strong> und ihre Bilder: die Kunst und die Deutung der Vergangenheit,<br />
München (Beck) 1995, 308<br />
5 Dazu (unter Hinweis auf Roland Barthes' Aufsatz »L'fiffet du reel«) Stephen Bann,<br />
The Clothing of Clio, Cambridge 1985<br />
6 Kahsnitz 1977: 171, unter Bezug auf Ernst Robert Curtius, Eurpäische Literatur und<br />
lateinisches Mittelalter, 4. Aufl. Bern 1963, 69
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 457<br />
Volk historischen Sinn begründende« Monumente zu schaffen (wie etwa Schinkels<br />
Entwurf eines Doms als Denkmal <strong>für</strong> die Freiheitskriege im Auftrag Friedrich<br />
Wilhelms III. 1824/25), übernehmen die historischen Museen eine analoge<br />
Funktion .<br />
Die Substitution <strong>von</strong> Tod durch Erweckbarkeit heischenden SchlaP, wie es<br />
Kaulbach in seinem Gemälde <strong>für</strong> das GNM vollzogen hat, ist konstititiv <strong>für</strong> den<br />
historischen Diskurs. 8 Als Jacob Grimm am 20. September 1863 stirbt, wird das<br />
Erlebnis durch den Augenzeugen, seinen germanistischen Kollegen Wilhelm<br />
Scherer, sogleich literarisch in emblematischen Bildern monumentalisiert: Seine<br />
Leiche liegt auf seinem Bett, zu Häupten die Büste seines bereits verstorbenen<br />
Bruders Wilhelm, »neben ihm ein Buch, das ihm gewidmet und das er nicht<br />
mehr gesehen . Sein Gesicht wenig verändert. Es war als ob er schliefe.«<br />
9 Leiche icorpse) und Lese-Korpus schließen sich aus. Auch das Warten auf<br />
Barbarossa heißt Subsitution <strong>von</strong> Tod (Knochen) durch Schlaf (Mythos); im<br />
Untergeschoß der Architektur des Kyffhäuser-Denkmals Wilhelms II. bei<br />
Nordhausen, aus Mitteln deutscher Kriegervereine 1892-97 erbaut, sitzt im<br />
Berg und in ihn eingebunden Barbarossa im Augenblick des Erwachens. Darüber<br />
reitet Wilhelm, die Destination dieses katechontischen Wartens, aus dem<br />
Berg ins Licht. Liegt das Motiv des Einschlafens und Erwachens der Funktionsweise<br />
des Gedächtnisses näher als die lineare Chronologie, weil darin beliebig<br />
große Zeiträume transzendiert werden können? »Der Sinn solcher<br />
Koppelungen läßt sich mit einer glücklichen Formel <strong>von</strong> Arno Borst als Identifikation<br />
des Futurs mit dem Perfekt< bezeichnen.« 10 In Begriffen der Kybernetik<br />
formuliert, geht es hier um die Übertragung <strong>von</strong> Daten aus dem Fest- in<br />
den Arbeitsspeicher; im Fall des Museums also aus Depot, Magazin und Speicher<br />
in den Raum der Exposition, die terminale Schnittstelle zum Diskurs.<br />
Gedächtnisstiftende Autorität aber gewinnen monumentale Kompositionen<br />
erst durch materiale Signifikanten (Knochen etwa), ein den Museologen wohlvertrauter<br />
Kunstgriff- die Integration affektiv besetzter Gegenstände. 11 Die<br />
7<br />
Siehe G. E. Lessings Traktat: Wie die Alten den Tod gebildet. Eine Untersuchung<br />
(1769)<br />
8<br />
Zu Carl Blechern 1826er Gemälde Gotische Kirche in Ruinen, worin ein schlafender<br />
Mann an einer Säule ruht, siehe Crane 1992: 3f<br />
9<br />
Zitiert nach: Der Tod eines Vaters (Statt eines Titelkupfers), in: Germanistik und deutsche<br />
Nation 1806-1848. Zur Konstitution bürgerlichen Bewußtseins, hg. v. Jörg Jochen<br />
Müller, Stuttgart (Metzler) 1974, ix<br />
10<br />
Assmann 1993: 54, unter Bezug auf: Arno Borst, Bararossas Erwachen, in: Odo Marquard<br />
/ Karlheinz Stierle (Hg.), Identität (Poetik und Hermeneutik VIII), München<br />
1979, 57<br />
11<br />
Dazu Wolfgang Struck, <strong>Geschichte</strong> als Bild und als Text. Historiographische Spurensicherung<br />
und Sinnerfahrung im 19. Jahrhundert, in: Zeichen zwischen Klartext und
458 MUSEUM<br />
leere Menge der Gebeine ist in der antiken Grabstätte »das irreduzible Element,<br />
nach dem sich, andere Elemente, die Werkzeuge des Genusses ordnen, Ketten,<br />
Becher, Waffen«. 12 Es ist immer jenes kleine Stück des Realen nötig, damit sich<br />
Menschen vergewissern können, in einem realen Wahrnehmungsraum zu sein;<br />
daher die Nähe <strong>von</strong> Museum und Opferstätte seit der Französischen Revolution<br />
(etwa der Museumsentwuf Etienne-Louis Boullees <strong>von</strong> 1793) 13 - »wodurch<br />
sich bewahrheitet, daß es beim Körper zweitrangig ist, ob er tot oder lebendig<br />
sei« .<br />
Knochen als Generatoren historischer <strong>Im</strong>agination<br />
Das <strong>Im</strong>aginäre symbolischer Denkmäler bedarf der Autorisierung durch das<br />
Reale der darin geborgenen Knochen. Und umgekehrt? <strong>Namen</strong> fungieren als die<br />
Metonymien der Historie. Ein entsprechendes Epitaph Miltons, buchstäblich<br />
On Shakespeare (in Analogisierung <strong>von</strong> Knochen und Buchstaben), beschreibt<br />
1632 das Anti-Denkmal, das <strong>Im</strong>memorial (Jean-Francois Lyotard):<br />
»What needs my Shakespeare for his honoured bones,<br />
The labour of an age in piled stones,<br />
Or that his hallowed relics should be hid<br />
Under a star-ypointing pyramid?<br />
Dear son of memory, great heir of fame,<br />
What need'st thou such weak witness of thy name?« 14<br />
Demnach bedürfen Knochen nicht der Denkmäler; dies aber gilt nur, solange<br />
der stattdessen angesprochene literarische Ruhm über ein Dispositiv kultureller<br />
Remanenz, die Bibliothek nämlich, verfügt. Die Nähe <strong>von</strong> Völkerschlachtdenkmal<br />
und Deutsche Bücherei in Leipzig manifestiert dieses Verhältnis<br />
instutionell. 15 In seinen drei Essays On Epitaphs warnt der romantische briti-<br />
Arabeske, hg. v. Susi Kotzinger u. Gabriele Rippl, Amsterdam / Atlanta, GA (Rodopi)<br />
1994,349-361<br />
12 Jacques Lacan, Radiophonie (* Paris 1970), übers, v. Hans-Joachim Metzger, Weinheim<br />
/ Berlin (Quadriga) 1988,13<br />
13 So der Lüneburger Psychoanalytiker Klaus-Josef Pazzini auf der Tagung Understanding<br />
Museums in Iserlohn (Februar 1996), zitiert nach: Axel Dossmann, Besucher im<br />
Internet zählen nicht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 27. Februar 1996<br />
14 Zitiert nach: Jonathan Goldberg, Voice Terminal Echo. Postmodernism and English<br />
Renaissance texts, New York / London (Methuen) 1985,127. Zu Wordsworths Reprise<br />
dieser Passage in Wordsworths Essays upon Epitaphs siehe Paul de Man, Ideologie des<br />
Ästhetischen, hg. v. Chr. Menke, Frankfurt/M. 1993, 131-145 (139f)<br />
15 Siehe W. E., Memory and (Dissemi)Nation: Völkerschlachtdenkmal und Deutsche<br />
Bücherei at Leipzig 1813/1913. Between Real Bones and Symbolic Letters, in: Journal<br />
of Historical Sociology 8, Heft 4 (1995), 329-351; ferner ders., Monument und
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 459<br />
sehe Dichter Wordsworth nachhaltig vor dem Gebrauch der rhetorischen Figur<br />
der Verlebendigung eines toten Objekts (Prosopopöie), vor der Konvention,<br />
dem auf der Straße des Lebens Reisenden <strong>von</strong> der Stimme des Verstorbenen ein<br />
sta viator zurufen zu lassen, davor, daß Epitaphe so tun, als ob der Verstorbene<br />
<strong>von</strong> seinem eigenen Grabstein aus spricht. Zunächst aber ist die Situation der<br />
Konfrontation mit Knochen eine archäologische. Womit der Prahistoriker<br />
tatsächlich konfrontiert ist, sind »skeleton data of inhumations«. 16 Die Vision<br />
des Propheten Ezechiel <strong>von</strong> Israels Heimholung ist ein Medium, solche Signifikantengräber<br />
zu reanimieren:<br />
»Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren plötzlich<br />
Sehnen auf ihnen, und Fleisch umgab sie, und Haut überzog sie . Jetzt<br />
sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen,<br />
wir sind verloren. So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber.« 17<br />
Eine materielle Variante, die <strong>von</strong> den Vergangenheit hinterlassenen Hohlräumen,<br />
ihrer Abwesenheit und Leere am Rand der Negation in die Fülle der Fiktion vergangenen<br />
Lebens zu verwandeln, ist die archäologische Technik der Ausgräber<br />
<strong>von</strong> Pompeji, die in der Lavaschicht ausgesparten und damit aufbewahrten Leichenräume<br />
durch Gipsausguß in Figuren zu verwandeln. 18 Der israelische Ex-<br />
General im Befreiungskrieg und dann Archäologe Yigael Yadin hat 1963 bis 1965<br />
in den Ruinen der antiken Festung Massada am Toten Meer nach den Skeletten<br />
der zelotischen Widerstandskämpfer der Jahre 72/73 gegen die römischen Belagerer<br />
gegraben und ist - unter Ausblendung des diese Aussage veruneindeutigenden<br />
Grabungsberichts - im Sinne der staatshistorisch erwünschten Aussage<br />
fündig geworden. So wird Archäologie zum politischen <strong>Im</strong>perativ, <strong>für</strong> den Religion<br />
das Dispositiv gesetzt hat. Was unter dem Boden der antiken Synagoge<br />
zutage trat, waren Fragmente einer Schriftrolle, die ihren Text (in der ungebrochenen<br />
Kontinuität des Hebräischen) sofort zu lesen gab: Kapitel 37,10 des<br />
Buches Ezechiel, erneut. Die Textur der Erinnerung (seien es Knochen, seien es<br />
Transfer: Das deutsch-französische Gedächtnis der Leipziger Völkerschlacht, in:<br />
Etienne Francois / Reinhart Meyer-Kalkus (Hg.), Deutsch-französischer Kulturtransfer<br />
1790-1890<br />
16 Heinrich Harke, The Anglo-Saxon Weapon Burial Rite, in: Past and Present 126<br />
(Februar 1990), 22-43 (24)<br />
17 Ez. 37,7f. u. llf. Siehe auch Arnold Angenendt, Corpus incorruptum. Eine Leitidee<br />
der mittelalterlichen Reliquienverehrung, in: Saeculum Bd 42, Jg. 1991, 320-348 (348,<br />
hier unter Bezug auf: Hans Belting, Bild und Kult. Eine <strong>Geschichte</strong> des Bildes vor dem<br />
Zeitalter der Kunst, München 1990). Angenendt (339) nimmt Bezug auf die Ezechiel-<br />
Vision und das Biblische Buch Hiob (in der Vulgata-Version) 19,26<br />
18 Dazu der Katalog der Ausstellung (New York, Juli-September 1990): Rediscovering<br />
Pompeji (Ministero per i beni culturali e ambientali, Italy, und IBM Italy), Rom<br />
(L'Herma) 1990, 133
460 MUSEUM<br />
Buchstaben) wird dort, wo Archäologie und Archiv zusammenfallen, zur Allegorie<br />
der Lesbarkeit <strong>von</strong> Ruinen. Der archäologische Nullpunkt ist <strong>für</strong> die<br />
Große Erzählung Nation ideologisch wertlos; nur unter Bereitstellung einer<br />
Schnittstelle zum Diskurs nationaler Mythen macht Archäologie SinnP Um auf<br />
archäologischen Fragmenten monumentale Bedeutung zu behaupten, bedarf es<br />
mehr als der materiellen Evidenz; Archäologie »cannot take the place of the<br />
living tradition of a nation as transmitted by its literary texts.« 20 Die Medienästhetik<br />
<strong>von</strong> Schrift als Übertragungsmedium jüdischer Tardition ist an den<br />
kommemorativen <strong>Im</strong>perativ zachor gekoppelt: ein auch aus anderen Erinnerungskulturen<br />
vertrauter Befehl. Die Politik der arche, im Griechischen, meint<br />
nicht nur Anfang, sondern auch Ordnung. Würde der Petersdom in Rom einstürzen,<br />
sobald seine Strukturen nicht mehr durch die Gegenwart der Knochen<br />
<strong>von</strong> Petrus in seiner Krypta autorisiert sind? Die antike memoria beruhte darauf,<br />
war ihre architektonische Fassung (memoria als Bezeichnung einer gebauten<br />
Rahmung des Grabs); die confessio in der Vatikanischen Basilika ist darüber<br />
errichtet. 21 Die Archäologie sagt Ja nur zum Grab des Apostels, nicht zur Authentizität<br />
der aufgefundenen Knochen. Papst Pius XII gesteht das ein und ersetzt<br />
das Archiv des Realen durch die Geltung der Tradition, mithin also die archäologische<br />
Lage durch die Autorität und Geltung <strong>von</strong> Historie:<br />
»Am Rande des Grabes fand man Reste menschlicher Gebeine, <strong>von</strong> denen man<br />
jedoch nicht mit Sicherheit nachweisen kann, daß sie zu den sterblichen Überresten<br />
des Apostels gehören. Dies hat indes mit der geschichtlichen Wirklichkeit des<br />
Grabes nichts zu tun. Die Riesenkuppel wölbt sich genau über dem Grab des<br />
ersten Bischofs <strong>von</strong> Rom, des ersten Papstes.« 22<br />
So trennt die Macht der Tradition zwischen <strong>Geschichte</strong> und einer Materialität<br />
<strong>von</strong> Gedächtnis, die vielleicht gar nicht die ihre ist.<br />
Signifikantenketten: Knochen und Buchstaben<br />
Der Status <strong>von</strong> Archivalien oszilliert zwischen Monument und Dokument; die<br />
Buchstaben klösterlicher Chroniken haben einen den Knochen-Reliquien adä-<br />
19<br />
Siehe Yigael Yadin, Masada. Herod's Fortress and the Zealots' Last Stand, London 1971,<br />
188. Zu jüngsten Zweifeln an der historischen Evidenz dieser Archäologie <strong>von</strong> Masada<br />
siehe Gisela Dachs, Ein Mythos wird überflüssig, in: Die Zeit v. 7 Oktober 1994<br />
20<br />
Arnaldo Momigliano, Biblical Studies and Classical Studies. Simple Reflections upon<br />
Historical Method, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere<br />
e Filosofia Serie III, 9, 1, Pisa (1981), 25-32 (26)<br />
21<br />
Dazu Carlo Pietrangeli, Vorwort zu: Michele Basso, Führer durch die Vatikanische<br />
Nekropole, Rom (S. Pietro in Vaticano) 1986<br />
22<br />
Weihnachtsbotschaft des Papstes v. 23. Dezember 1950, zitiert nach: Basso 1986: 85
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 461<br />
quaten Status und werden im Mittelalter als Manifestation göttlicher Vorsehung<br />
oft in Schreinen, Kapellen oder Reliquaren aufbewahrt - in physischer Nachbarschaft<br />
zu den Reliquien <strong>von</strong> Heiligen, unter deren symbolischer Patronage<br />
sie versammelt sind und die sie - rückgekoppelt - dokumentieren. Das englischnormannische<br />
Domesday Book ist einerseits Auflistung, andererseits aber<br />
Semiophor mit einer Bedeutung weit jenseits eines Inventars <strong>von</strong> Grundbesitz<br />
und feudalen Rechten; in den ersten Jahrhunderten seiner Existenz wird es nur<br />
marginal <strong>für</strong> administrative Zwecke eingesetzt und ist wichtig vielmehr als ein<br />
majestic and unchangeable memorial6.es normannischen Triumphes.« 23 Damit<br />
ist der reziproke Mechanismus der gegenseitigen Autorisierung <strong>von</strong> Dokumenten<br />
und Monumenten beschrieben, wie ihn die topographische Konjunktion<br />
<strong>von</strong> Nationaldenkmal und -bücherei in Leipzig als Aussage setzt.<br />
Was dem Erinnerungsort seine Autorität gibt, das sind die dort begrabenen<br />
Knochen. Diese Autorität aber ist hinfällig wie ihre physische Materialität;<br />
damit ganz wesentlich der (IN)Schrift verwandt. 24 Die Exhumierung der Knochen<br />
des ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten <strong>Im</strong>re Nagy, Protagonist<br />
des Aufstandes <strong>von</strong> 1956 in Budapest, wurde vom Rattern der protokollierenden<br />
Schreibmaschine begleitet; nationale Aufschreibesysteme korrespondieren<br />
mit der (Wiederan-)Ordnung der Knochen. <strong>Im</strong> Leipziger Alten Rathaus ist eine<br />
Inschrift eingelassen, die <strong>von</strong> der dahinter eingemauerten Urne des Paulskirchenabgeordneten<br />
Leon Blum mit Erde aus seinem Grab in Frankfurt/M. kündet;<br />
Jacques Derrida beschreibt den Charakter aller Schrift zu Beginn seiner<br />
Grammatologie als durchweg testamentarisch. Als Ludwig I. 1814 die Walhalla<br />
bei Regensburg als Ehrentempel der Heiligen Allianz und als Denkmal des<br />
Sieges über Napoleon plant, will er unter dem vornehmlich literarischen Protagonisten<br />
gewidmeten Bau eine Gruft der Helden der Befreiungskriege anlegen<br />
- eine archäologische Grundlage aus realen Knochen. Damit bringen die<br />
Sieger der Kriege gegen Napoleon in eine symbolische Ordnung zurück, was<br />
die Wirren der Französischen Revolution durcheinandergeworfen haben. Schon<br />
1765 erscheint ein anonymer Artikel im Mercure de France mit dem Vorschlag,<br />
23 James M. O'Toole, The Symbolic Significance of Archives, in: The American Archivist<br />
56, Heft 2 (Frühjahr 1993), 234-255, unter Bezug auf M. T. Clanchy, From Memory to<br />
written Reford: England, 1066-1307, Cambridge, Mass. (Harvard UP) 1979,125ff, und<br />
Brian Stock, The <strong>Im</strong>plications of Literarcy: Written Language and modeis of Interpretation<br />
in the Eleventh and Welfth Centuries, Princeton (UP) 1983, 244ff<br />
24 Andräs B. Hegedüs, Frühlingsmorgen auf Parzelle 301, in: Österreichische Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Geschichtswissenschaften, Heft 1/1990, 117-121; ferner Susan Greenberg, Les<br />
funerailles nationales d'<strong>Im</strong>re Nagy, in: Alain Brossat / Sonia Combe / Jean-Yves<br />
Potel /Jean-Charles Szurek (Hg.), A l'Est, la memoire retrouve, Paris (La Dicouverte)<br />
1990,124-149
462 MUSEUM<br />
die Kirche der Hlg. Genevieve, Schutzpatronin <strong>von</strong> Paris und des Königreichs,<br />
als nationale Begräbnisstätte großer Denker, Literaten und Künstler zu benutzen<br />
(ein Elisee chretien); in der Französischen Revolution löst die profane Sinngebung<br />
die christliche ab, im Umbau zum Pantheon durch Quatremere de<br />
Quincys klassizistische Bereinigung. 25 Alexandre Lenoir, seit 1791 Leiter des<br />
Depots der durch die französischen Revolutionäre beschlagnahmten Kunstwerke,<br />
präsentiert sie im aufgehobenen Konvent der Petits Augustins 1795 bis<br />
1816 unter dem <strong>Namen</strong> Musee des Monuments francais als chronologisch geordnete<br />
Sammlung. Lenoir kreiert in einem Park hinter dem Kloster ein tatsächliches<br />
Elysee mit Grabstätten französischer Geistesheroen und ruht nicht, ihre<br />
sterblichen Überreste <strong>von</strong> den ursprünglichen Bestattungsorten nach Paris zu<br />
überführen. Die zentrale gotische Kapelle mit Sarkophag und Gebeinen <strong>von</strong><br />
Abelard und Heloise sind errichtet aus Trümmern einer Kapelle <strong>von</strong> Saint-<br />
Denis, dem Ort der dort vandalisierten französischen Königsgräber. Lenoir<br />
berichtet ausführlich über seine Bemühungen um die Identifizierung der verschiedenen<br />
angeblichen Gräber 26 ; auf der Ebene des Katalogs finden symbolische<br />
Lettern und reale Knochen, signifikant verkettet, zusammen - eine museale<br />
Zusammenlese im Sinne Martin Heideggers. 27 Ein Gönner des Germanischen<br />
Nationalmuseums in Nürnberg, Freiherr Leopold <strong>von</strong> der Borch aus Frankfurt/M.,<br />
läßt sich 1896 in einer gemauerten Gruft im Viktoriabau des Museums<br />
selbst bestatten. Der Entwurf Friedrich Gillys <strong>für</strong> ein Denkmal Friedrichs des<br />
Großen auf dem Leipziger Platz in Berlin <strong>von</strong> 1797 in Form eines Tempels über<br />
einem rechteckigen Sockelbau sieht im Sockelgeschoß die Gruft <strong>für</strong> den Sarkophag<br />
des Königs, dazu die Bibliothek und ein Museum Fridericianum vor.<br />
Gillys Beschreibung, erhalten im Geheimen Staatsarchiv Berlin, erwähnt ein<br />
Museum Fridericianum allerdings nicht 28 ; das Schweigen der Vergangenheit, das<br />
sich in den Lücken des Archi(v)textes auftut, kann hier nur in Fußnoten supplementiert,<br />
nicht aber in der argumentativen Narration verarbeitet werden. Die<br />
25 Martin Papenheim, Erinnerung und Unsterblichkeit. Semantische Studien zum Totenkult<br />
in Frankreich, Stuttgart (Klett-Cotta) 1992, 287ff<br />
26 Rainer Kahsnitz, Museum und Denkmal. Überlegungen zu Gräbern, historischen<br />
Freskenzyklen und Ehrenhallen in Museen, in: Bernward Deneke / ders. (Hg.), Das<br />
kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert. Vorträge des Symposions<br />
im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, München (Prestel) 1977,152-175<br />
(154f)<br />
27 Alexandre Lenoir, Musee des monumens fran?ais ou description historique et chronologique<br />
des Statues en marbre et en bronze, Basreliefs et Tombeaux des Hommes et<br />
des Femmes celebres, pour servir ä l'Histoire de France et ä celle de l'Art ornee de gravures,<br />
8 Bde, Paris 1800-1821<br />
28 Franz Rudolf Zankl, Das Pergamonmuseum. Untersuchung zu einem Museumstypus,<br />
in: Museumskunde Bd. 41 (1972), 1-132 (33)
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 463<br />
Signifikantenverkettung im Medienverbund Museum und Bibliothek beruht<br />
hier nicht auf der Autorisierung durch das Archiv, sondern durch die Archäologie<br />
der Gruft: Gebeine. 29 Die Kirche des Wiener Arsenals birgt in dessen Zentrum<br />
tatsächlich ein Heeresgeschichtliches Museum. <strong>Im</strong> Untergeschoß ist<br />
ursprünglich ein Raum <strong>für</strong> die Bestattung berühmer Soldaten vorgesehenen;<br />
tatsächlich finden keine wirkliche Bestattung statt. <strong>Im</strong> Gedächtnisdiskurs zählt<br />
die Behauptung.<br />
Das nach der deutschen Reichseinigung errichtete Kyffhäuser-Monument bei<br />
Nordhausen ist auf der Absenz des Leichnams <strong>von</strong> Kaiser Friedrich I. Barbarossa<br />
errichtet - ein Pendant zur Leere seines mutmaßlichen Grabs im libanesischen<br />
Tyros. Reichskanzler Bismarck begreift, daß die Kontrolle des kollektiven<br />
<strong>Im</strong>aginären überhaupt erst Nation bildet und unterstützt die Suche des deutschen<br />
Professors Johannes Nepumuk Sepp nach den Gebeinen des Kaisers kurz<br />
nach dem deutsch-französischen Krieg <strong>von</strong> 1870/71 - ein veritables archäologisches<br />
Unternehmen Barbarossa, ebenso erfolglos. Sepps nationaler Gedächtnisimperativ<br />
erinnert an antike Praxis; der athenische Stratege Kimon überführte<br />
die Gebeine des attischen Heros Theseus - zumindest »a suitable impressive skeleton«<br />
(P. J. Rhodes) - <strong>von</strong> Skyros nach Athen; junge Mächte bedürfen einer<br />
Gründungsmythologie bzw. »Archäologie« im allerersten Wortsinn. 30 Thukydides<br />
nennt das archaiologia; zur Archivologie wird eine solche Translation in<br />
dem Moment, wo deren literarische Dokumentation in das Gedächtnis der<br />
Deutschen Bücherei selbst eingeht. 31 Die translatio imperii wird hier buchstäblich<br />
im Wissenstransfer - erst <strong>von</strong> Knochen, dann <strong>von</strong> Lettern. 32 Die Präsenz<br />
realer Knochen steht in einem reziproken Verhältnis zu Auferstehungsmythen,<br />
die gerade im Raum einer Absenz stattfinden. Der Dom in Speyer behauptet<br />
zunächst, Barbarossas Reste zu bergen; gleichzeitig verweigert Bischof Weis, die<br />
Kaisergrüfte zu öffnen:<br />
»Durch den Besitz der Reliquien des grossen Hohenstaufen wäre die Ehre des<br />
Domes namhaft erhöht, und wir greifen nicht zur Ausflucht, um die Volkssage <strong>von</strong><br />
der Wiederkehr des Rothbartes aus dem Morgenlande zur Erneuerung des Rei-<br />
29 Siehe Kurt Merckle, Das Denkmal König Friedrichs des Großen in Berlin. Aktenmäßige<br />
<strong>Geschichte</strong> und Beschreibung des Monuments, Berlin 1894, bes. 65ff<br />
30 Dazu Jürgen <strong>von</strong> Ungern-Sternberg, Das Grab des Theseus und andere Gräber, in:<br />
Wolfgang Schuller (Hg.), Antike in der Moderne (= Xenia. Konstanzer althistorische<br />
Vorträge und Forschungen 15), Konstanz 1985, 321-329. Mit Dank an den Autor, im<br />
Gedächtnis an ein brainstorming beim Kaffee am Rande des Deutschen Historischen<br />
Instituts in Rom 1992.<br />
31 Johannes Nepumuk Sepp, Meerfahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale mit<br />
Barbarossa's Grab, Leipzig (Seemann) 1879, vii<br />
32 Siehe W. Goetz, Translatio <strong>Im</strong>perii. Ein Beitrag zur <strong>Geschichte</strong> des Geschichtsdenkens<br />
und der politischen Theorien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tübingen 1958
464 MUSEUM<br />
ches nicht zu stören, habe man den in prosaischer Stille erfolgten Rücktransport<br />
verschwiegen. Die Gebeine sind in Tyrus verschwunden, und die dortige Kathedrale<br />
geht darum uns um so näher an und sollte Nationaleigenthum werden.«<br />
<br />
Die Neue Wache Berlin<br />
Die Befreiungskriege setzen sich ihr Gedenken in Gestalt der Berliner Neuen<br />
Wache, längst bevor ein Leipziger Völkerschlachtdenkmal am Ort des Geschehens<br />
sich 1913 endlich realisiert. Zwischen 1816 und 1818 <strong>von</strong> Karl Friedrich<br />
Schinkel als neue Königswache <strong>für</strong> Friedrich Wilhelm III. erbaut, ersetzt die<br />
Neue Wache ein älteres Wachgebäude am Kronprinzenpalais, jetzt aber als<br />
repräsentativer Bau im Sinne eines Monuments der Befreiungskriege. Der funktionale<br />
Bezug liegt im Militärischen, wie auch der symbolische Mehrwert an das<br />
Reale der Befreiungskriege erinnert: die Armee. Die <strong>von</strong> Schinkel erwogene<br />
Bekrönung des Gebäudes mit einem Zinnenkranz in Erinnerung an mittelalterliche<br />
Wehrarchitektur wird verworfen, ebenso wie die Aufstellung <strong>von</strong> Trophäen<br />
auf den vorderen Ecktürmen der Wache in Form <strong>von</strong> antikisierenden<br />
Rüstungen. 33 Nicht die Schauseite, sondern die Struktur des Baus macht seinen<br />
militärisch-memorativen Doppelbezug manifest. Schinkel beschreibt die dissimulatio<br />
artis, die konsumtiv <strong>für</strong> mediale Techniken ist: Der Plan dieses ringsum<br />
freiliegenden Gebäudes ist einem römischen Castrum nachgeformt. Von daher<br />
die vier Ecktürme und der innere Hof: »Letzterer ist nützlich, um die Oekonomie<br />
gegen den ringsum laufenden Platz zu verbergen.« 34 Das ursprüngliche<br />
Skulpturenprogramm spricht den Bezug zu den Befreiungskriegen (vorweg die<br />
1822 aufgestellten Denkmäler der Generäle Scharnhorst und Bülow) ebenso<br />
deutlich aus wie die Aufstellung mehrerer großer Haubitzen im benachbarten<br />
Kastanienwäldchen, erbeutet <strong>von</strong> der preußischen Armee <strong>von</strong> den Truppen<br />
Napoleons I. und ergänzt nach 1870/71 durch eine weitere französische Kanone<br />
als Kriegstrophäe des deutsch-französischen Krieges. Mit dem Ende der deutschen<br />
Monarchie 1918 verliert die Neue Wache ihre militärische Funktion; was<br />
bleibt, ist das Angebot der Neuen Wache als Medium symbolischer Mobilisierung<br />
schlafender, in Monumenten gebundener nationaler Gedächtnisenergien.<br />
Frida Schottmüller, Mitarbeiterin an den Berliner Museen, schlägt 1924 die Entkernung<br />
des Gebäudes und seine Transformation in ein Kriegerdenkmal vor; in<br />
33 Jürgen Tietz, Schinkels Neue Wache Unter den Linden. Baugeschichte 1816-1993, in:<br />
Christoph Stölzl (Hg.), Die Neue Wache Unter den Linden. Ein deutsches Denkmal<br />
im Wandel der <strong>Geschichte</strong>, Berlin (Oehler & Amelang) 1993, 9-93 (13)<br />
34 Karl Friedrich Schinkel, Sammlung architektonischer Entwürfe, Berlin 1856, lff,<br />
zitiert nach: Tietz 1993: 13f
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 465<br />
der Raummitte soll ein Sarkophag aufgestellt werden, allen Deutschen gewidmet,<br />
»die uns der Krieg nahm«. 35 Der Sarkophag: leer? Etienne Boulles Entwurf<br />
eines Kenotaphs <strong>für</strong> Newton zeigt ein leeres Grab; Thema ist hier das Reale der<br />
Physik selbst. Der markanteste Eingriff in die Ausstattung der Wache besteht<br />
nach dem Zweiten Weltkrieg in der Entfernung des durch den Krieg beschädigten<br />
schwarzen Granitmonolithen, der bei seiner Demontage in mehrere Teile<br />
zerbricht; so fragil ist Gedächtnis als Monument. 36 Splitternachlaß eines deutschen<br />
Gedächtnisorts: Ohne verbindlichen Interpretanten ist er seines Zeichencharakters<br />
beraubt und auf seine pure Materialität zurückverwiesen, jenen<br />
Punkt Null an Bedeutung, auf den der Vektor des abstrakten Versuchs, das<br />
Undarstellbare <strong>von</strong> Massenvernichtung darzustellen, hinausläuft. Die Materialität<br />
des Blocks war einmal durch ein Attribut, ein parergon an Figurativität<br />
supplementiert: den <strong>von</strong> Ludwig Gies geschaffenen Eichenkranz. 1945 aus der<br />
Wache entfernt, um ihn vor Plünderungen zu schützen, kehrt der Kranz 1946<br />
an seinen alten Platz zurück. Die 1948 entwendeten vergoldeten Blätter des<br />
Kranzes tauchen 1960 in einem Schließfach des West-Berliner Bahnhofs Zoo<br />
wieder auf. Da die DDR an einer Übergabe der Eichenblätter nicht interessiert<br />
ist, wird Ludwig Gies <strong>von</strong> westlicher Seite beauftragt, den Kranz zu rekonstruieren.<br />
In einem das originale Gegenstück andeutenden, einfachen kubischen<br />
Raum aus Werkstein auf dem ehemaligen Garnisonsfriedhof Lilienthalstraße in<br />
Berlin-Neukölln findet der Kranz im Rahmen eines Ehrenmals am Volkstrauertag<br />
1966 seine neue Aufstellung - Bewegungen, wie sie mit archäologischer<br />
Sensibilität <strong>für</strong> diskursive Umschichtungen <strong>von</strong> Gedächtnis eher denn im Versuch<br />
der Unterstellung historischer Linearität zu fassen sind. 37<br />
35<br />
Frida Schottmüller, Ein Denkmal <strong>für</strong> die gefallenen, in: Der Kunstwanderer 1924, 80,<br />
zitiert nach: Tietz 1993: 22<br />
36<br />
Tietz 1993: 87. Und 242, Anm. 206: »Dokumentationsstelle Denkmalpflege: Brief des<br />
stellvertretenden Stadtgartendirektors Jaenisch vom 8.9.1972. Der Brief gibt Auskunft<br />
über den Verbleib des schwarzen Granitsteins. Die einzelnen Teile des Steins wurden<br />
auf einem Lagerplaz der VEB Stuck und Naturstein eingelagert.«<br />
37<br />
Referat der Vorgänge hier nach Tietz 1993: 86; ferner 241, Anm. 199: »Der Osten holt<br />
das Eichenlaub nicht ab. Der Morgen 12.3.1960.« Und Anm. 200: »Die Blätter des<br />
Eichenkranzes lagen in der Gepäckaufbewahrung. Die Welt 1.3.1960.« Der Anmerkungsapparat<br />
refragmentiert die Erzählung: Bausteine machen auch das Geschick der<br />
Neuen Wache aus. Das Plädoyer <strong>für</strong> die Rearchäologisierung ihrer Denkmalhistoriographie<br />
heißt nichts anderes als weitgehendste Ausstellung des Archivs. Wo Quellen<br />
ausstellbar sind, bedarf sie keiner narrativen Einkleidung in indirekter Rede, keiner<br />
Einverleibung in einen Erzählfluß, der alle Befunde auf dem unterstellten Schauplatz<br />
der einer deutschen <strong>Geschichte</strong> nivelliert.
466 MUSEUM<br />
Politische Archäologie in Kathedralen und Ruinen:<br />
Quedlinburg, Braunschweig, andere Orte<br />
Ideologisch aufgeladen war die deutsche Archäologie seit der Zeit der Befreiungskriege;<br />
die deutsch-französische Frontstellung verläuft auch an dieser symbolischen<br />
Grenze. Der französische Adel identifizierte sich immer schon mit<br />
den Franken als Befreiern <strong>von</strong> Rom; die französische Revolution spielt demgegenüber<br />
die Kelten im Aufstand gegen die fränkische Oberschicht aus. Auf<br />
deutscher Seite hält, diesseits der <strong>von</strong> Foucault in der Archäologie des Wissens<br />
explizierten Konjunktion <strong>von</strong> Geschichts- und Subjektbegriff, der Prähistoriker<br />
Gustav Kossinna am 9. August 1885 einen Vortrag über Die vorgeschichtliche<br />
Ausbreitung der Germanen:<br />
»Wenn ich den Versuch wage, die vaterländische Archäologie mit der <strong>Geschichte</strong><br />
in Verbindung zu bringen und den durch die Arbeit unseres Jahrhunderts aufgesammelten<br />
reichen Funden aus heimischem Boden gleichsam ihre Subjektlosigkeit<br />
zu nehmen, so hat mich dazu nicht zum mindesten der Umstand veranlasst, dass<br />
die Achäologen der Keltenfrage sich neuerdings wieder energischer zuwenden.<br />
Die Rückseite der Keltenfrage ist <strong>für</strong> Deutschland die Germanenfrage. <br />
Wo haben wir es im heutigen Deutschland in vorgeschichtlicher Zeit mit Germanen,<br />
wo mit Nichtgermanen zu thun?« 38<br />
Konkret wird diese archäologische Konstellation im Spiel <strong>von</strong> historischem<br />
Textdokument und archäologischem Monument, in der Spannung <strong>von</strong> (wissens-)archäologischer<br />
Subjektlosigkeit und historischer Identitätsstiftung, die<br />
der <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> Subjekten als Adressen bedarf. »Das große Geheimnis des<br />
Todes schafft am leichtesten die Weihe der Statte.« 39 Knochen autorisieren das<br />
Denkmal; doch Denkmäler sind Zeichen, deutungslos und verloren in der<br />
Ferne, insofern sie nicht <strong>von</strong> einer realen Autorität auf eine Signifikanz verpflichtet<br />
werden. Dieser Boden, dieser Krieg, diese Toten: Denkmäler, die buchstäblich<br />
(wie die zu ihnen gehörigen Texte) auf Knochen errichtet sind, ziehen<br />
ihre Autorität aus der sublimen Präsenz des Erinnerten. Heinrich Himmler gibt<br />
also im Zuge der Umgestaltung des Quedlinburger Doms zu einer NS-Weihestätte<br />
den (vergeblichen) Auftrag, die sterblichen Überreste König Heinrich I.<br />
zu finden. Auf der ersten <strong>von</strong> den Nationalsozialisten inszenierten Feier im<br />
Gedenken an Heinrich am 2. Juli 1936 (sein Millenium) aber kann trotz eines<br />
ausdrücklichen Grabungsversuchs keine Knochenspur nachgewiesen werden:<br />
38 Zitiert nach: Günter Smolla, Archäologie und Nationalbewußtsein, in: Ausstellungskatalog:<br />
»Zwischen Walhall und Paradies«. EineAusstellung des Deutschen Historischen<br />
Museums in Zusammenarbeit mit dem Museum <strong>für</strong> Vor- und Frühgeschichte SMPK,<br />
Sept.-Nov. 1991 Zeughaus Berlin (Unter den Linden), DHM GmbH 1991, 11-15 (13)<br />
39 Rudolf Presber, Geweihte Stätten, Berlin (Vita) 1914, 69
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 467<br />
»Herrn Heinrichs Gebeine fanden wir nicht mehr, aber sein Geist und sein<br />
Leben sind bei uns.« 40 Ideologische <strong>Im</strong>agination hat ein Loch des Realen zu füllen:<br />
»Wir stehen heute vor der leeren Grabstätte« (Himmlers Rede 1936). Das<br />
Reale ist, was an seinem Platz bleibt. Als <strong>von</strong> Seiten des SS-Arbeitsstabs zur<br />
Umgestaltung des Quedlinburger Doms im Mai 1938 der Vorschlag kommt,<br />
den Stiftsschatz zu verlegen, interveniert der Denkmalschutz (Giesau), den der<br />
Gedanke allein schon tief erschüttert, »diese Dinge könnten jemals ihren Platz<br />
wechseln. Das können sie eben nicht, sondern sie gehören nur an diese einzige<br />
Stelle.« 41 <strong>Im</strong> Großen und Ganzen kommt es nicht dazu, »der überkommenen<br />
Form Gewalt anzuthun« .<br />
Gegen die archäologischen Interessen des Denkmalschutzes steht der ideologische<br />
<strong>Im</strong>perativ des Nationalsozialismus: »Die Wirklichkeit ruft gebieterisch«<br />
(Giesau) 42 ; die Macht über Gedächtnis ist sein Interpretant. Auf die Umpolung<br />
vom historischen Dokument zum metahistorisch gültigen, kontextlosen Monument<br />
zielt die Rekonfiguration des Innenraums, um die bisherige Gemeindekirche<br />
»zum nationalen Feierraum und Gedenkhalle an den König Heinrich I.<br />
umzugestalten, dabei <strong>von</strong> manchen, dem heutigen Kunstempfinden nicht<br />
mehr entsprechenden unhistorischen und verfehlten Zutaten früherer Instandsetzungen<br />
zu säubern.« 43 In ihrer posthistoire liest sich eine solche geschichtsspurlöschende<br />
Denkmalästhetik selbst als historisches Monument, und so wäre<br />
es unangebracht, seinerseits <strong>für</strong> die Epoche des Nationalsozialismus Spurenverwischung<br />
zu betreiben: »Was in Braunschweig als Zeugnis des Mißbrauchs<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> übrigblieb, gilt es als Last der Erinnerung weiter zu tragen.« 44<br />
1940 publiziert Carl Erdmann (auf Bitten des Grabungsleiters R. Höhne, der<br />
die Veröffentlichung der Grabung <strong>von</strong> 1936 vorbereitet) seinen Aufsatz Das Grab<br />
Heinrichs I. als archäologisch-philologische, damit gegenüber der Geschichtsideologie<br />
implizite Kritik der politischen Archäologie Heinrich Himmlers. Fußnote<br />
1 betont, daß die Ergebnisse seiner Arbeit unabhängig <strong>von</strong> der Ausgrabung<br />
40<br />
Vorwort zur Himmler-Rede 1936. Berlin 1936. Verfaßt <strong>von</strong> SS-Obersturmführer Gunter<br />
d'Alquen, Chefredakteur des Schwarzen Korps, zitiert nach: Klaus Voigtländer, Die<br />
Stiftskirche St. Servatii zu Quedlinburg, Berlin (Akademie) 1989, 42<br />
41<br />
Akten IfD 1935/38, Bl. 132, zitiert nach:<br />
Voigtländer 1989: 47<br />
42<br />
Akten IfD 1935/38, Bl. 165<br />
43<br />
Akten C 28 II, Nr. 8813, Bl. 34. Vgl. die Säuberung der klassischen Akropolis vom<br />
intrahistorischen (d. h. byzantinisch-osmanischen) Schutt im 19. Jahrhundert; dazu<br />
W. E., Die Akropolis <strong>von</strong> Athen: Verwandlungen eines klassischen Monuments«, in:<br />
Geschichtsdidaktik Heft 1/1984, 93f<br />
44<br />
Karl Arndt, Mißbrauchte <strong>Geschichte</strong>. Der Braunschweiger Dom als politisches Denkmal<br />
(1934/45), in: Niederdt. Beitr. z. Kunstgesch. 20, München / Berlin 1981,213-244,<br />
hier: 231
468 MUSEUM<br />
seien, die im Jahre 1936 im Auftrage des Reichsführers Himmler durchgeführt<br />
wurden und, wie damals mitgeteilt, angeblich zur Auffindung der Gebeine Heinrichs<br />
I. führten. »Ich habe aber nicht erfahren, wo die Gebeine Heinrichs I.<br />
gefunden worden sind.« 45 Erdmann hält sich an die philologische Evidenz, quel-<br />
/enkritisch: »Wir versuchen deshalb, uns <strong>von</strong> der ursprünglichen Anlage nicht<br />
nach den aufgedeckten Grabstellen, sondern nur nach den sicher zeitgenössischen<br />
Zeugnissen ein Bild zu machen, also nach den alten Schriftstellern und den erhaltenen<br />
Särgen« . Damit ist das Verhältnis <strong>von</strong> Philologie und Archäologie,<br />
<strong>von</strong> buchstäblichem Text und signifikanter Fundanordnung angesprochen.<br />
Historiker lesen nicht nur primär Texte, sondern schreiben auch (über)<br />
<strong>Geschichte</strong> in diesem Medium; Historiographie ist damit wesentlich Neuvertextung.<br />
»Skelette, historische Gebrauchsgegenstände, prähistorische Siedlungsreste<br />
und dergleichen sollen natürlich nicht umstandlos unter >Text< subsumiert sein;<br />
sie ausdrücklich einzubeziehen, würde sehr umständlich werden, ohne doch<br />
an den Grundzügen etwas zu ändern.« 46 Denn wenn überhaupt, dann vollzieht<br />
sich <strong>Geschichte</strong> in Materialitäten - auch wenn diese in der Maske <strong>von</strong> Texten auftreten.<br />
Die Physik der Dinge (nennen wir sie Hardware) ist die Unruhe der<br />
Historie; ihr Substrat wird in den mündlichen oder schriftlichen Medien des kollektiven<br />
Gedächtnisses zwar diskursiv verhandelt (das wäre die je daraufhin zu<br />
schreibende Software), geht aber nicht in der historischen oder gar historiographischen<br />
Semiose auf. Mit genau dieser Spaltung liegt Erdmann im Kampf.<br />
Zunächst schließt er durch den Nachweis eines Heiligengrabs (mit zugehöriger<br />
Confessio) diese Stätte als Grab Heinrichs I., der eben nicht heiliggesprochen war,<br />
aus. Die Spur legen ihm Bildquellen, etwa ein Kupferstich <strong>von</strong> 1710. Erdmann<br />
vermutet die Gebeine des Königs in der Umgebung eines identifizierten Bleisarges<br />
(der Äbtissin Mathilde) oder - infolge früherer Zusammenlegung - in diesem<br />
selbst. Noch aber ist der Arbeitsspeicher der Archäologie nicht zugänglich: »Was<br />
hier tatsächlich gefunden wurde wird uns hoffentlich die Veröffentlichung über<br />
die Grabung <strong>von</strong> 1936 lehren« . Die Suche nach dem Grab Heinrichs<br />
I. im Quedlinburger Dom verrät den Versuch des Dritten Reichs, die Behauptung<br />
einer tausendjährigen Kontinuität auf Signifikanten zu gründen - eine arcbaiologia<br />
im Sinne der Definition Thukydides' mit dem Ziel, politische Kultstätten zu<br />
45 Carl Erdmann, Das Grab Heinrichs I., in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters<br />
(namens des Reichsinsitutes <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde [Monumenta<br />
Germaniae historica]), hg. v. Edmund E. Stengel, 4. Jg., M. i, Weimar (ßöhlau)<br />
1940, 76-97<br />
46 Klaus Weimar, Der Text, den (Literar-)Historiker schreiben, in: Hartmut Eggert /<br />
Klaus R. Scherpe / Ulrich Profitlich (Hg.), <strong>Geschichte</strong> als Literatur: Formen und<br />
Grenzen der Repräsentation <strong>von</strong> Vergangenheit, Stuttgart (Metzler) 1990, 29-39 (29<br />
u.37, Anm. 1)
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 469<br />
setzen.* 7 Hegel definiert Erinnerung in Abgrenzung zum Beinhaus des Gedächtnisses<br />
48 : Erst mobilisiert durch diskursiv induzierte mnemische Energien sind<br />
gespeicherte Lettern zum Zweck semantischer Effekte konfigurierbar. In Braunschweig<br />
veranlaßt Ministerpräsident Klagges im Juni 1935 die Grabung nach den<br />
Gebeinen Heinrichs des Löwen und seiner Gemahlin Mathilde. Unter der notorischen<br />
Doppelgrabplatte finden sich ein Steinsarkophag und Reste eines<br />
Holzsarges jeweils mit Skeletten, die dem Paar zugewiesen werden. Die Öffentlichkeit<br />
ist <strong>von</strong> der Grabung ausgeschlossen; ein Grabungsbericht erscheint auch<br />
hier nicht. Aufklärung darüber versprechen Ausgrabungen im Archiv: Das Bundesarchiv<br />
Berlin-Lichterfelde, Bestand Reichskanzlei, birgt eine Akte mit dem Typoskript Hauptkostenvoranschlag <strong>für</strong> die Errichtung der Gruft<br />
Heinrich d. Löwen im Dom zu Braunschweig der Architekten Walter und Johannes<br />
Krüger, Regierungsbaumeister a. D. - die Architekten des Tannenberg-Denkmals<br />
zum Gedenken an Hindenburgs Ostpreußenkämpfe im Ersten Weltkrieg. 49<br />
Blatt 6 listet das archäologische Relikt stückmäßig auf; Gedächtnis ist als modulare<br />
Lagerung berechenbar. Unter der laufenden Nr. 9 heißt es zum Eintrag 1:<br />
»Stck. Sarkophagplatte mit den Bildern Heinrichs des Löwen und seiner Gattin<br />
ihrer augenblicklich die Bauarbeit hindernder Lagerung wegen weiterzuschaffen<br />
und im Dom neu zu lagern«; <strong>für</strong> diese Gedächtniskapitalverschiebung werden im<br />
Ganzen 50 Reichsmark veranschlagt.<br />
Vom Subjekt einer politischen Archäologie, die zwanghaft Gebeinen deutscher<br />
Herrscher zu (er-)finden hat, wird Adolf Hitler 1945 selbst zum Gegenstand<br />
einer solchen. An die Stelle geschichtsmächtiger Subjekte tritt nach dem<br />
Ableben der Augenzeugen der Agent Archiv und verwandelt jede Erinnerung<br />
in die Effekte eines Gedächtnismediums; kürzlich deklassifizierte Dokumente<br />
aus dem Moskauer KGB-Archiv entfachen die Kontroverse um Hitlers Leiche<br />
erneut. Das russische Fernsehen strahlt vorgeblich authentisches Filmmaterial<br />
über Hitlers toten Körper aus, aufgenommen vom sowjetischen Geheimdienst<br />
fünf Tage nach dessen Selbstmord im Bunker der Berliner Reichskanzlei; zweifelhaft<br />
bleibt der Übertragungsweg des Filmmaterials. Wahrscheinlich bergen<br />
die KGB-Archve ein präziseres Gedächtnis an diese Vorgänge; der Historiker<br />
Lev Bezymensky spricht <strong>von</strong> sechsmaligen Umbettungen der Leiche Hitlers.<br />
1946 läßt Stalin die vorgebliche Leiche und die seiner Geliebten Eva Braun<br />
exhumieren und einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterziehen; 1970<br />
4? Dazu Ungern-Sternberg 1985: 324; zur Öffnung der Königs- und Kaisergräber (Friedrichs<br />
II.) im Dom <strong>von</strong> Palermo siehe Ferdinand Gregorivius, Wanderjahre in Italien,<br />
München (Beck) 1986, 786f<br />
48 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bdn., Frankfurt/M. 1979: Bd. 1., 346<br />
49 Reale Schlachtfelder sind der Boden <strong>für</strong> Kriegsgedächtnis, doch Reichsehrenmal<br />
wurde auch dieses Denkmal erst per NS-Dekret 1935.
470 MUSEUM<br />
werden die letzten Rest vom KGB vernichtet, um es Neo-Nazis unmöglich zu<br />
machen, damit einen sakralen Wallfahrtsort zu begründen. 50 Gedächtnis bedarf<br />
der Verortung, Lokalisierbarkeit. Bei Entzug solcher Relikte heißt der wahre<br />
Ort gedächtnismächtiger und -politischer Verhandlung <strong>von</strong> Vergangenheit das<br />
Archiv. 51 Solchen ideologisch aufgeladenen Ausgrabungen steht die nüchterne<br />
Chronik eines Schiffsuntergangs entgegen. Am 30. Januar 1945 wird das ehemalige<br />
KdF-Passagierschiff Wilhelm Gustloff, das nun ostpreußische Flüchtlinge<br />
rückzuführen suchte, <strong>von</strong> einem sowjetischen U-Boot in der Ostsee<br />
versenkt; 5300 Tote. In der aktuellen Form des dokumentarfilmischen Gedenkens<br />
daran erweist sich, daß gerade die medienarchäologische Kargheit des<br />
Materials und der Verzicht auf jede audiovisuelle Orchestrierung nach Jahrzehnten<br />
noch zu erschüttern vermag - in Kombination mit den Erzählungen<br />
der Überlebenden, durch die eine vielmehr bildhafte Insistenz der Erinnerung<br />
an das Entsetzen durchscheint. Die Psyche agiert also monumentalistisch eher<br />
denn dokumentarisch; nur daß der Kommentator aus den Untergang des Schiffs<br />
eher symbolisch-historisch denn allegorisch-archäologisch darstellt und der<br />
logistischen Koinzidenz des Kalendariums eine metaphysische, geschichtsphilosophische<br />
Logik abgewinnt: der Schiffsuntergang fiel auf einen Jahrestag der<br />
NS-Machtergreifung. Die Katastrophe der Wilhelm Gustloff hat die NS-<br />
Führung zu bagatellisieren versucht, »aber er wurde zu einem makabren Symbol<br />
ihres eigenen Untergangs.« 52 Die Ablenkung vom Realen der Leichen<br />
erzwingt ihre Rückkehr als Geister-, sprich Medienarchäologie. Aktuelle Hightech-Aufnahmen<br />
vom Meeresgrund, <strong>von</strong> Wrackteilen, geborstenen Maschinen<br />
und zertrümmerten Schiffsaufbauten sind weit da<strong>von</strong> entfernt, in einem oberflächlichen<br />
Sinne informativ zu sein: »Die Roboteraugen - optische Prothesen<br />
einer neugierigen, auf Daten vergessenen Nachwelt - sind blind. Den Spezialkameras<br />
der Bundesmarine gibt dieser schauerliche Friedhof kein Geheimnis<br />
mehr preis« . Dem emphatischen Begriff des Monuments steht der des<br />
Datums entgegen, der Information, die Positivität des Befunds. Gedächtniswissenschaft<br />
entziffert Monumente als Informationsspeicher. 53 An den Orten<br />
50<br />
David Hearst, Russian television shows film of »Adolf Hitler's corpse«, in: The Guardian<br />
v. 17. September 1992<br />
51<br />
In diesem Sinne der Vortrag <strong>von</strong> Wladimir Kozlov, stellv. Direktor des Staatlichen<br />
Archivs der Russischen Föderation (Moskau): Hitlers Leiche und die sowjetische Politik,<br />
am Institut <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und Biographie,Lüdenscheid 13. September 1998<br />
52<br />
Klaus Kreimeier, Chronik eines Untergangs, Kommentar zu Maurice Philipe Remys<br />
Fernsehdokumentation (NDR) über den Untergang des am 30. Januar 1945 torpedierten<br />
Passagierschiffs Wilhelm Gttstloff, in: Freitag (Berlin), Ausgabe v. 4. Februar 1994<br />
53<br />
Roland Poser, Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen Explikation kulturwissenschaftlicher<br />
Grundbegriffe, in: Aleida Assmann / Jürgen Harth (Hg.), Kultur als<br />
Lebenswelt und Monument, Franfurt/M. (Fischer) 1991, 34-77 (66)
KNOCHEN, DENKMÄLERN UND BUCHSTABEN 471<br />
der meisten deutschen Konzentrationslager ist der Bau <strong>von</strong> Erinnerungsstätten<br />
»durch eine verhängnivolle Dialektik gekennzeichnet: die Errichtung <strong>von</strong> Symbolen<br />
zur Erinnerung bedeutete gleichzeitig die Zerstörung der letzten Spuren«<br />
54 ; im Fall <strong>von</strong> Buchenwald muß sogar die Asche der Opfer entfernt<br />
werden, um die gewünschte Gedenkstätte errichten zu können. Monumente des<br />
Realen sind dort vielmehr die Leichenberge im April 1945. Anders Auschwitz;<br />
dort »können die Reste selbst viel besser als unmittelbar Zeichen der Erinnerung,<br />
als Zeugen der Vergangenheit wirken, als es indirekte künstliche Symbole<br />
je könnten« . Mit diesem Akzent auf dem Realen der Signifikanten korrespondiert<br />
die Emphase der buchstäblichen Daten: Die vornehmlichste Funktion<br />
der Erhaltung <strong>von</strong> Resten im Rahmen einer Gedenkstätte ist die<br />
Dokumentation, »klare und zuverlässige Informationen über das vermitteln,<br />
was in der Vergangenheit geschehen ist.« Auf der Ebene der visuellen Kommunikation,<br />
zwischen (Buchstaben-)Lesen und (Knochen respektive Trümmer-)<br />
Sehen operiert die Authentizität der Wahrnehmung als Interpretant, das an die<br />
Institution der Gedenkstätte gekoppelte Versprechen einer Vergangenheit, die<br />
sich seihst durch ihre Spuren darstellt . Hinter dieser Maske<br />
aber lacht die symbolische Ordnung des Archivs, unerbittlich.<br />
54 Jörn Rüsen, Auschwitz: Den Sinn des Sinnlosen begreifen, in: Gewerkschaftliche<br />
Monatshefte 11/1995, 657-663 (658)
472 MUSEUM<br />
Vorgeschichte am GNM<br />
Wissen prähistorische Artefakte um ihre vergangene Zukunft in der Zuschreibung<br />
durch nationaler Gedächtnisse?<br />
»Accidents of geography set the location of Upper Paleolithic art in Gallic rather<br />
than German territory! As a consequence the French, with their flair for the<br />
appreciation of >Art< and their sturdy individualism, have been forced to the gruppy<br />
and impersonal observation and description, and the ethnographic explanation, of<br />
those monuments in the possession of which, for all their age, their national pride<br />
rejoices . German scholarship, on the contrary, lacking the impetus furnished<br />
by possession, has seldom feit inclined to apply to this material the great resources<br />
of its literal and methodical painstakingness; instead that opposite propensity of the<br />
Teutonic mind, toward unrestraincd theoretical speculation, has run riot over the<br />
field and in such dicta as that of the >purity< of Paleolithic art, to which >any secret<br />
mystical influence is entirely foreign< (Kühn), has given peremptory Statement to<br />
what is without doubt the most egregious example in art-historical research of<br />
anachronistic interpretation, the >art for art's sake< explanation of Franco-Cantabrian<br />
art.« 1<br />
Daten sind zunächst in einem buchstäblich vor-geschichtlichen Zustand, bevor<br />
sie (gekoppelt an Erzählungen) in historische Information verwandelt werden.<br />
»Selbst der Prähistoriker spricht <strong>von</strong> seiner >Dokumentation
VORGESCHICHTE AM GNM 473<br />
hen können. Chronologisches Wissen bedeutet mehr als ein Schema. Jahreszahlen<br />
reden <strong>von</strong> einem Leben, das einmal wirklich war. Erst in dieser Ordnung<br />
der Funde erwacht ihr tieferer Sinn.« 3<br />
Vorgeschichte ist so nur noch in Formen faßbar; verschwunden sind Syntax und<br />
Semantik des vorgefundenen Vokabulars.<br />
Prähistorie: Das Auftauchen eines (Vor)Geschichtskontinents<br />
»Was man unter Prähistorie versteht, braucht man heute nicht mehr zu erklären.<br />
Der Begriff steht fest. Aber auch hier wäre es gut, wenn man sich nach einem anderen<br />
<strong>Namen</strong> da<strong>für</strong> umsehen wollte, denn die Bezeichnung Prähistorie ist aus einer<br />
Anschauungsweise erwachsen, <strong>für</strong> die nur das geschriebene Wort als eigentliche<br />
Geschichtsquelle galt. Wir aber erkennen den Realien den gleichen dokumentarischen<br />
Wert zu wie den Schriftquellen, und wir können es nicht anerkennen, daß<br />
eine Zeit >vorgeschichtlich< sein soll, <strong>für</strong> die uns durch die Ausgrabungen jahraus,<br />
jahrein neue vollwertige Geschichtsquellen dargeboten werden.« 4<br />
Aktuell rückt die gemeinte Disziplin vom Begriff der »Vorgeschichte« oder<br />
»Prähistorie« eher ab und versteht sich als auf frühe, zum größtem Teil schriftlose<br />
Zeiträume spezialisierte Historie. »Die Beschränkung des Begriffs ><strong>Geschichte</strong><<br />
auf Zeiträume schriftlicher Überlieferung wird in dieser Diskussion als<br />
überholt und willkürlich empfunden.« 5 Und dann ergänzt der Autor, daß dabei<br />
zumehmend der Begriff der Archäologie methodisch eine »erhebliche Faszination«<br />
ausübt - also doch alternativ zur historischen Methode? Der<br />
archäologische Befund der Prähistorie wird metonymisch, durch semantische<br />
Anbindung in den historischen Diskurs eingeholt; die Bezeichnungen Vorgeschichte<br />
und Vorzeit »widersprechen der sprachlichen Logik. Es gibt<br />
schließlich doch nur eine <strong>Geschichte</strong>, die sich zwanglos in Urgeschichte, Alte<br />
<strong>Geschichte</strong>, Mittlere <strong>Geschichte</strong> und Neuere und Neueste <strong>Geschichte</strong> gliedert«. 6<br />
3 Oswald Spengler, Das Alter der amerikanischen Kulturen (1933), in: ders., Reden und<br />
Aufsätze, München (Beck) 1937, 138-147 (138f). Dazu auch W. E., Radikale Wissensarchäologie<br />
oder: Kultur als Funktion ihrer Speicher, in: Hans-Christian v. Herrmann<br />
/ Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft. 5 Vorträge, Leipzig<br />
(Universitätsverlag) 1998, 55-80<br />
4 Otto Lauffer, Das Historische Museum. Sein Wesen und Wirken und sein Unterschied<br />
<strong>von</strong> den Kunst- und Kunstgewerbe-Museen, in: Museumskunde III Heft 1, Berlin<br />
1907, Kap, II: »Die Realien als ajehäplogische Quellen«, 8ff (|2f)<br />
' Dirk Raetzel-Pablan, Ur- und frühgeschichtliche Archäologie, in; <strong>Geschichte</strong> In Wls»<br />
senschaft und Unterricht 53 (2002), 375ff (375)<br />
6 Georg Klose-Freystadt, Vorgeschichte oder Urgeschichte?, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong><br />
deutsche Vorzeit, 3. Jg., Heft 8 (1927), 113-115 (113f). Anm. 2: »Die Bezeichnungen<br />
>Prähistorie< und >prähistorisch< scheinen in demselben Maße zu schwinden, wie die<br />
>Historie< und das >historisch< der ><strong>Geschichte</strong>< und dem >geschichtlich< gewichen sind.«
474 MUSEUM<br />
Die museale Ordnung der Prähistorie folgt dabei einer eigenen Log(ist)ik; in der<br />
Studiensammlung des GNM werden Mitte 1920 alle entsprechend in den Abteilungskatalog<br />
aufgenommenen, in der Schausammlung nicht ausgestellten Funde<br />
vereinigt. Sie dienen in erster Linie wissenschaftlichen Zwecken. Die Aufstellung<br />
prähistorischer Artefakte erfolgt »gemäß den an sie gestellten Anforderungen«<br />
nicht in chronologischer, sondern in topographischer Anordnung. Auf Depotebene<br />
spielt sich die Differenz <strong>von</strong> Lager-, Bearbeitungs- und Geschichtszeit ab,<br />
denn im Magazin harren alle Funde, die noch nicht aufgestellt und katalogisiert<br />
sind; sie sind lediglich als Gesamteingang in das Museumsinventar eingetragen.<br />
In diesem Zustand bleiben Realien archäologisch integer, denn sie sind noch nicht<br />
dem historischen Diskurs unterworfen: »Dieses gesamte Material ist nicht konserviert<br />
und meist noch in dem Zustand, in dem es dem Boden entnommen<br />
wurde«, solange Raummangel eine Arbeit im Magazin unmöglich macht. 7<br />
1926 definiert Leonhard Franz das Wesen einer historischen Wissenschaft<br />
durch ihren Gegenstand: Mensch, »der Mensch nicht als Naturgebilde, sondern<br />
als Geistträger«. Franz scheidet die historische Disziplin <strong>von</strong> einer naturwissenschaftlichen,<br />
etwa der Chemie, wo man aufgrund <strong>von</strong> Beobachtungsreihen<br />
Gesetze zu finden sucht, nach denen sich die Vorgänge vollziehen; der Geist<br />
aber sei nur bedingt <strong>von</strong> der Materie bestimmt. »Neben seinem naturgebundenen<br />
Funktionieren steht als gewichtiger Faktor der menschliche Wille.« Daher<br />
darf das Emporschießen der Naturwissenschaften nicht dazu führen, <strong>Geschichte</strong><br />
als Entwicklungsgeschichte zu betrachten, »in dem Sinne, daß wir über<br />
das Ordnen der Erscheinungen hinaus zu Gesetzen der <strong>Geschichte</strong> gelangen<br />
wollten. Der Historiker hat zweierlei zu tun: zu beschreiben, was war; das ist<br />
eine Art statistischer Tätigkeit. Dann aber hat er Kräfte und Werte im Geschehen<br />
bloßzulegen.« 8 Unter verkehrten Vorzeichen oszilliert die epistomologische<br />
Alternative zur Historie, die Archäologie, als Querschnittsdisziplin<br />
zwischen Geistes- und Naturwissenschaft genau in diesem Sinn. Prähistorie als<br />
eigenständiger Sammlungsbereich schält sich erst im Verlauf des späten 19. Jahrhunderts<br />
heraus. Die Ordnung der Artefakte geschieht zunächst nur nach topographischen<br />
Kriterien; eine zeitlich-historische Klassifizierung ist noch nicht<br />
etabliert. Hier läßt sich die Fabrikation <strong>von</strong> Historie als diskursiver Verstehenshorizont<br />
nachzeichnen; sie ist funktional im Sinne der Reduktion <strong>von</strong><br />
Datenkomplexität, deren Quantum die Umschaltung auf eine qualitativ-methodische<br />
Form der Datenprozessierung zu ihrer hermeneutischen Bewältigung<br />
Direktor W. Unverzagt, Die Prähistorische Abteilung des Museums <strong>für</strong> Völkerkunde<br />
in Berlin, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> deutsche Vorzeit, 3. Jg., Heft 4 (1927), 49-51 (49f)<br />
Leonhard Franz, Ist die Urgeschichte eine historische oder eine naturwissenschaftliche<br />
Disziplin?, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> deutsche Vorzeit, 2. Jg. Heft 4 (1926), 57-59 (57f)
VORGESCHICHTE AM GNM 475<br />
verlangt. Das Anwachsen des vorgeschichtlichen Denkmälerstoffs führt in der<br />
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts »zur Sonderung der wirren Masse<br />
<strong>von</strong> Bodenfunden« (solche der Stein-, der Bronze- und der Eisenzeit), also zu<br />
der <strong>von</strong> Christian Jürgensen Thomsen in Dänemark entwickelten Auf- und<br />
Kopenhagener Ausstellung des Dreiperiodensystems, dessen stratigraphische<br />
Bestätigung als wissensarchäologisches System erst nachträglich erfolgte. 9 In<br />
einem Brief an Lindenschmit vom 17. Mai 1854 klagt Thomsen über ur- und<br />
frühgeschichtliche Museen, die ihre Artefakte nach wie vor »nur nach Materien<br />
wo<strong>von</strong> sie verfertigt sind zu ordnen«; diese radikale Suprematie der Signifikanten<br />
»giebt eine anscheinende aber falsche Harmonie«. Demgegenüber soll die<br />
periodenweise Zusammenstellung - auch um den Preis offensichtlicher Lacunen<br />
(die Differenz <strong>von</strong> Archäologie und den narrativen Konjekturen der Historie)<br />
- »eine andere Uebersicht , u andere Resultate, als wenn man<br />
alle Augenblicke wieder <strong>von</strong> vorn anfangen mus oder gar keine Zeit Ordnung<br />
hat« . Die Ordnung des Symbolischen verheißt wissenspolitische<br />
Ästhetik gegenüber dem Rauschen des Realen.<br />
»Aber zu noch weit feinerer Gliederung des Denkmälerbestandes als durch solche<br />
>stratigraphischen< (= schichtenbeschreibenden) Feststellungen gelangte man in der<br />
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts durch den Gedanken, die verschiedenen<br />
Erscheinungsformen etwas des Beiles, des Schwertes, der Gewandnadel und<br />
gewisser Schmucksachen entwicklungeschichtlich zu ordnen, <strong>von</strong> den primitivsten<br />
Anfängen bis zur vollkommensten Gestalt zu verfolgen. Grabbeigaben,<br />
Schatzfunde usw. stellen die Beziehungen zwischen den >Typenreihen< der verschiedenen<br />
Gerate her, zeigen, welche Schmucksachen, Schwert-, Beil- und Gefäßformen<br />
gleichzeitig im Gebrauche waren. Tausende <strong>von</strong> Beispielen bestätigten<br />
bisher die Richtigkeit dieses Vorgehens, das uns mit ziemlicher Sicherheit das<br />
Altersverhältnis, die >relative Chronologie
476 MUSEUM<br />
nungssysteme. Möglichkeitsbedingung einer Chronologie ist die gedächtniskybernetische<br />
Kopplung:<br />
»Da aber in den Mittelmeerländern die schriftliche Überlieferung, somit ><strong>Geschichte</strong><<br />
und Zeitrechnung, schon Jahrtausende früher einsetzte als in den nördlicheren<br />
Gegenden, da ferner zwischen beiden Gebieten reger Handel blühte, so<br />
ist es klar, daß in der Ausbeute <strong>von</strong> Gräbern und Siedlungen neben vorgeschichtlichem<br />
Gegenständen des Nordens mitunter genau datierbare des Südens<br />
begegnen, die uns dann über das wirkliche Alter der heimischen Denkmäler willkommene<br />
Winke zu geben vermögen.« <br />
In dem <strong>von</strong> Christian Ludwig Scheidius aus den hinterlassenen Manuskription<br />
Leibniz< und Johann Georg Eccard zusammengestellten Buch De origine Germanorum<br />
wird die Sonderung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> und Prähistorie sinnfällig durch<br />
Absenz: Eisenzeitliche Gegenstände sind nirgends abgebildet, denn sie fallen in<br />
eine Periode, in der bereits schriftliche (»literarische«) Überlieferung einsetzt:<br />
»Diese Auffassung <strong>von</strong> den Altertümern ist das Erbe der Humanistenzeit. Die Einstellung<br />
zu den archäologischen Quellen scheint auf den ersten Blick hin grundverschieden<br />
zu der Wertung des nordischen Materials, dem selbständige Bedeutung<br />
zugemessen wurde, während sie hier nur Quelle zweiter Ordnung sind. Aber<br />
besteht wirklich ein solcher Unterschied? Sind nicht die archäologischen Monumente<br />
des Nordens im Grunde nur Lückenbüßer <strong>für</strong> die fehlende schriftliche<br />
Ueberlieferung? Werden sie nicht, sobald es beim Eintritt in die Eisenzeit die<br />
schriftliche Ueberlieferung gestattet, ausgeschaltet und durch literarische Zeugnisse<br />
ersetzt? <strong>Im</strong>mer noch besteht der Grundatz: Archäologia ancialla philologiae.« 11<br />
Dennoch ringt sich die Forschung zur Erkenntnis, hier: Anerkennung einer differenzierbaren<br />
Periode durch, »in welcher in unserer Heimat Menschen lebten<br />
und <strong>Geschichte</strong> geschah, eine Penode, über die es keine schriftliche Ueberlieferung<br />
gibt, und in welcher allein die Hinterlassenschaften der damals lebenden<br />
Menschen eine Einblick gestatten.« Prähistorie ist die Geburt einer Wissenschaft<br />
aus der Neukonfiguration bestehender Lagerungsdaten: »Kurz man ist sich jetzt<br />
erst dessen bewußt, daß es überhaupt eine vorgeschichtliche Zeit< gibt. Die<br />
prähistorische Wissenschaft beginnt eigentlich jetzt erst« . Am konkreten<br />
Fall, der <strong>Geschichte</strong> des ältesten römischen Köln, liest sich das so:<br />
»Da uns christliche Ueberlieferung aus dieser Zeit nicht erhalten geblieben ist, sind<br />
wir darauf angewiesen, unsere Kenntnisse auf anderem Wege zu ergänzen. Hier<strong>für</strong><br />
kommen in erster Linie die Dinge in Frage, die uns der Boden durch die Jahrtausende<br />
hindurch, wie in einem Archive , treu bewahrt hat.<br />
Eines ist allerdings dabei Bedingung und Voraussetzung: daß diese Sachen <strong>von</strong><br />
11 P. Stemmermann, Die Anfänge der deutschen Vorgeschichtsforschung. Deutschlands<br />
Bodenaltertümer in der Anschauung des 16. und 17. Jahrhunderts, Leipzig (Kabitzsch)<br />
1934,121f
VORGESCHICHTE AM GNM 477<br />
fachkundiger Hand und mit aller Sorgfalt dem Boden entnommen werden - so wie<br />
man eine alten Handschrift sorgfältig in die Hand nimmt -, um ihnen alles das abzugewinnen,<br />
was sie uns über diese längst vergangen Zeit zu berichten vermögen.« 12<br />
Zur Zeit der Gründung des Germanischen Nationalmuseums befindet sich die<br />
Vorgeschichte als Disziplin ihrerseits in einem vorwissenschaftlichen Stadium<br />
und ist eine Funktion wissensgeographischer Koordinaten. In West- und Süddeutschland<br />
dominieren zunächst aufgrund der ethnisch (scheinbar) deutbaren<br />
römischen und frühmittelalterlichen Altertümer historische Fragestellungen,<br />
was einer systematischen Erfassung des eigentlich vorgeschichtlichen Materials<br />
eher entgegenwirkt; demgegenüber ist »in Nord- und Ostdeutschland aufgrund<br />
fehlender geschichtlicher Bezüge allein der Fundstoff Grundlage archäologischer<br />
Bewertungskriterien.« 13 Das Schweigen der (prähistorischen) Archäologie<br />
und die textgestützte Beredtheit der klassischen, hier: provinzialrömischen<br />
Archäologie generieren zwei verschiedene Formen <strong>von</strong> Gedächtnis.<br />
Die vor- und frühgeschichtlichen Funde, die vor 1885 vom GNM erworben<br />
werden, spiegeln in ihrer Provenienz (bei stochastisch gleichmäßiger Streuung<br />
der Fund- und Herkunftsorte) - nicht die Prähistorie, sondern die Erwerbsumstände;<br />
»Fundkonzentrationen gehen auf die Schenkung ortsgebundener Sammlungen<br />
zurück« . Aus archäologischen Signifikanten<br />
gebildete Signifikanten zweiten Grades (Sammlungen) definieren wissensarchäologisch<br />
die Kartographie der Historie. Der Eigenname hatte anscheinend<br />
zur Folge, daß das Germanische Nationalmuseum in der breiten Öffentlichkeit<br />
auch als Zentralstelle <strong>für</strong> vorgeschichtliche, nach damaliger allgemeiner Auffassung<br />
germanische Altertümer angesehen wurde. Deutsch war damit gleichbedeutend<br />
mit den Germanen des Tacitus. »Die >deutsche Vorzeit< umfaßte das<br />
deutsche Mittelalter und die Vorgeschichte, dies umso mehr, als die vorgeschichtlichen<br />
Funde sich der Datierung und ethnischen Zuweisung noch größtenteils<br />
entzogen und gemeinhin als >alt-deutsch< gelten mußten, wenn sie auf<br />
deutschem Boden gefunden wurden« . Bei Nicht-Datierbarkeit<br />
<strong>von</strong> Daten (Artefakte) ruft keine Historie zur Ordnung; so fallen prähistorische<br />
und frühmittelalterliche Objekte zusammen. Zunächst wird das<br />
vorgeschichtliche Material als Teil des Ganzen einer Objektdatenbank und nicht<br />
als gesonderte Quellengattung betrachtet; die einzelnen Funde und Fundkomplexe<br />
sind in den Kunst- und Altertumssammlungen nach Funktionen getrennt<br />
(Hausgerät, Schmuck oder Religion). In dieser Anordnung greift kein Diskurs<br />
12 Fritz Fremersdorf, Ein wichtiger Fund aus der Römerzeit, in: Nachrichtenblatt der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> deutsche Vorgeschichte, Jg. 1, Heft 4/5 (1925), 26-28 (26)<br />
13 Wilfried Menghin, Die vor- und frühgeschichtliche Sammlung, in: Deneke / Kashnitz<br />
1978: 666-671 (665), unter Bezug auf Ernst Wähle, Einheit und Selbständigkeit der<br />
prähistorischen Forschung, Mannheim 1974, 16-21
478 MUSEUM<br />
der Historie. Nach 1866, unter der Direktion Essenweins, werden die vor- und<br />
frühgeschichtlichen Fundobjekte erstmals geschlossen ausgestellt; doch ist dieser<br />
Vorgang ausschließlich im Zusammenhang mit der Umorganisation der<br />
Sammlungen, nicht als Effekt einer neuen Epistemologie anzusehen. Der preußische<br />
Landgerichtsrat Alexander Julius Robert Rosenberg setzt dort seine Forderung,<br />
Vergleichsobjekte aus allen Gegenden Deutschlands zusammenzustellen,<br />
durch, indem er testamentarisch seine Sammlung <strong>von</strong> steinzeitlichen Funden und<br />
Nordostdeutschland 1881 dem GNM vermacht. Rosenbergs Motivation - die<br />
Suprematie der Typologie über eine nationaltopographische Ordnung prähistorischer<br />
Artefakte - wird in einem <strong>von</strong> Essenwein zitierten Schreiben deutlich:<br />
»Nach § 1 der Satzung <strong>für</strong> das germanische Museum ist es zwar nur Zweck, die<br />
Kenntnisse der deutschen Vorzeit zu fördern und die Denkmale <strong>für</strong> deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> zu sammeln. Obwohl nun wenigstens die Steinaltertümer einer vorgeschichtlichen<br />
Zeit angehören und ebenso zweifellos nicht dem deutschen Volke<br />
zugehörig waren, so halte ich die Aufstellung derselben in einem germanischen<br />
Museum dennoch <strong>für</strong> geboten. Schon deshalb, weil sie auf deutschem Boden zweifellos<br />
erwachsen sind und jedenfalls den Urbewohnern deutschen Bodens angehörig<br />
waren.« 14<br />
Rosenberg argumentiert gegen das System lokaler Einteilung vorgeschichtlicher<br />
Altertümer. Das parataktische Nebeneinanderstellen einer möglichst großen<br />
Anzahl jeweils gleichartiger Stücke aus den verschiedenen Fundprovinzen soll<br />
zeigen, »was an gemeinsamen Motiven durch alle Zeiten und Gegenden der<br />
großen Kulturperioden vorhanden ist, und wieweit das Gemeinsame nach<br />
Gegenden durch lokale Einflüsse modifiziert wird« . In einer solchen Nebeneinanderstellung bildet der Raum des Archivs<br />
das Dementi historischer, nämlich syntaktischer Zeit.<br />
Eine Rekonstruktion des Ausstellungsprinzips <strong>von</strong> 1885 ist aufgrund des<br />
gedruckten Katalogs möglich; gegliedert ist sie nach vier Kategorien. Einleitend<br />
sollten Ensembles <strong>von</strong> Höhlenplätzen und Pfahlbausiedlungen neben den Serien<br />
Rosenbergs verdeutlichen, »wie die Epoche im Ganzen sich präsentiert, wenn auf<br />
den Stellen untergegangenen Lebens geforscht und gesucht wird«. 15 Das übrige<br />
Material war nach den Materialitäten der Hardware selbst geordnet und in Serien<br />
zusammengefaßt, welche durch die vermeintliche Funktion der Funde bestimmt<br />
waren. Serien meint hier ausdrücklich nicht die Zusammenfassung einzelner<br />
Geräteformen zu entwicklungsgeschichtlichen Reihen, sondern den archäologischen<br />
Blick: das gruppenweise getrennte Nebeneinander gleichartiger Geräteformen,<br />
ohne daß die verschiedenen Typen miteinander in eine historisch unterstellte<br />
14 August Essenwein / Johanna Mestorf, Katalog der im germanischen Museum befindlichen<br />
vorgeschichtlichen Denkmäler, Nürnberg 1886,3f, zitiert nach: Menghin 1978: 672<br />
15 Essenwein a.a.O., 8, zitiert nach Menghin 1978: 674
VORGESCHICHTE AM GNM 479<br />
Beziehung gebracht wurden. »Herkunft, Zeitstellung und Fundzusammenhänge<br />
blieben unberücksichtigt« (Menthin), und auch bei den Tongefäßen erfolgte keine<br />
chronologische oder typologische Ordnung; gliedernder Faktor war vielmehr die<br />
Herkunftsregionen: »Gefäße unterschiedlichster Form, Funktion und Zeitstellung,<br />
z. B. aus Schlesien, standen als geschlossenes Ensemble neben ebenso inhomogenen<br />
Komplexen aus der Provinz Posen, dem Rheinland, Süddeutschland<br />
oder aus Holstein usw.« . Das heißt Ordnung nach Exterioritäten<br />
- und ihre Beschreibung in Begriffen, wie sie Michel Foucault analog und<br />
mit Blick auf eine andere archäologische Stätte (das antike Karthago) in Sidi Bou<br />
Said - 1966-68 bei Tunis verfaßt. 16 Wo kein historischer Diskurs die Objekte auf<br />
einer jenseitigen Ebene bindet, spannt sich zwischen ihnen kaum eine Relation,<br />
sondern ein Schweigen. »Diese Sammlung qualifiziert sich in der Tat nur zur Aufstellung<br />
nach Formen« 17 ; hier resoniert eine Taxonomie, die Gustav Friedrich<br />
Klemm 1836 in seinem Handbuch der Germanischen Altertumskunde (Dresden)<br />
einer non-diskursiven Alternative gegenübergestellt hat:<br />
»Wenn es eine Classification <strong>von</strong> Gefässen gilt, kann dies wohl kaum durch etwas<br />
anderes als die Form derselben geschehen. Man könnte vielleicht mathematische<br />
Figuren oder Berechnung gegenseitiger Verhältnisse, etwa der Höhe zur<br />
Breite, des waagerechten zum lothrechten Durchmesser als Massgabe nehmen,<br />
allein <strong>für</strong> das Praktische würde eine solche Eintheilung zu schwierig, zu verwickelt<br />
seyn und die altüblichen, einem jeden verständlichen <strong>Namen</strong> würden mit minder<br />
bekannten vertauscht werden müssen.« <br />
Das parataktische Nebeneinander <strong>von</strong> nord- und süd-, ost- und westdeutschen<br />
Funden war methodisch nicht zu bewältigen, d. h. in eine historische Syntax zu<br />
integrieren. Zwar hat das (im Museum Kopenhagen seit 1830 durchgesetzte)<br />
Dreiperiodensystem als Ordungskriterium in Deutschland inzwischen allgemeine<br />
Anerkennung gefunden, doch ist die chronologisch-antiquarische Differenzierung<br />
innerhalb der einzelnen Perioden regional unterschiedlich weit<br />
fortgeschritten - Zeitpuffer nicht auf der Ebene der <strong>Geschichte</strong>, sondern ihrer<br />
Datenverarbeitung. Eine synchronisierte Darstellung der sich in der Fundabfolge<br />
spiegelnden kulturgeschichtlichen Entwicklung ist daher nicht möglich.<br />
Wo aber Synchronisation versagt, greift kein historisches Paradigma. Grundsätzliche<br />
Gesichtspunkte der Ausstellungskonzeption <strong>von</strong> 1885 formuliert Leopold<br />
<strong>von</strong> Ledebur (dessen ideellen Einfluß auf Rosenberg Menghin vermutet),<br />
1838 <strong>für</strong> die Ausstellung des Königlichen Museums vaterländischer Alterthümer<br />
im Schloß Monbijou in Berlin:<br />
16<br />
Dazu Didier Eribon, Michel Foucault. Eine Biographie, Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1993, 266f<br />
17<br />
Johanna Mestorf, a.a.O., 14, zitiert nach Menghin 1978: 676
480 • MUSEUM<br />
»Das ähnliche und verwandte in Form und Stoff, ohne Rücksicht auf Lokalität der<br />
Findung, ward nebeneinandergestellt; die so zur Anschauung gebrachten allmählichen<br />
Übergänge werden nicht wenig dazu beitragen, den oft sehr problematischen<br />
Zweck und die schwankende Terminologie dieser Gegenstände der Feststellung<br />
näher zu bringen. Die <strong>für</strong> die verschiedenen Richtungen religiöser, häuslicher, kriegerischer<br />
und commerzieller Tätigkeit der Völker so wichtigen Fragen: ob die Übereinstimmung<br />
der Gegenstände geographisch bedingt wird; ob die eine oder andere<br />
Form <strong>von</strong> Alterthümern ausschließlich oder überwiegend der einen oder anderen<br />
Gegend anhcim falle; werden durch eine solche Zusammenstellung am schnellsten<br />
ihre Beantwortung finden.« 18<br />
Die Beschreibung der Übergänge ist nur aufgrund der Einschreibung des Vektors<br />
Historie als Entwicklung möglich; der Fundstoff im Germanischen Nationalmuseum<br />
bietet jedoch kaum Ansätze zur systematischen Ordnung, »da die Funde<br />
nur als Schauobjekte zur Dokumentation <strong>von</strong> Kulturzuständen gesammelt wurden«<br />
. Es sind die Forschungen des Schweden Oskar Montelius<br />
und Paul Reineckes, deren chronologische Ordnung des vorgeschichtlichen<br />
Materials überhaupt erst die Parallelisierung der nord- und süddeutschen Funde<br />
ermöglichen. Nach Weltkrieg II erhält die prähistorische Sammlung des GNM<br />
erstmals einen fachwissenschaftlichen Abteilungsleiter; »die Verselbständigung<br />
der Vor- und Frühgeschichte als wissenschaftliche Disziplin stand ihrer Integration<br />
in die <strong>von</strong> Kunsthistorikern dominierten kulturgeschichtlichen Museen entgegen«<br />
. Der Speicher GNM hat unterdessen seine eigene<br />
Vorgeschichte, prähistorisch konfiguriert: »Unter negativen Aspekten ist die<br />
Sammlung, in deren Bestand und Struktur längst überholte Ideen des 19. Jahrhunderts<br />
nahezu unverfälscht aufscheinen, museales Fossil«, kommentiert Menghin;<br />
der Schwerpunkt müsse im GNM daher auf Erforschung und Darstellung<br />
der archäologischen Perioden des germanischen und deutschen Frühmittelalters<br />
liegen, »während die eigentliche vorgeschichtliche Sammlung als Illustrationsmittel<br />
sowie als historisches Denkmal aus der Gründungszeit des Germanischen<br />
Nationalmuseums mit ihrer Auffassung <strong>von</strong> der in die graue Vorzeit erweiterten<br />
>deutschen Vorzeit< bewahrt werden sollte« . Die Selbsthistorisierung der<br />
Sammlung macht die Datenbank zum Denkmal der Wissensarchäologie.<br />
Gustav Kossinna<br />
In Anlehnung an die wissenschaftstheoretische Theorie <strong>von</strong> Thomas Kuhn stellt<br />
Günter Smolla die These auf, erst Gustav Kossinna habe die prähistorische<br />
Archäologie zum Fach, zur Spezialdisziplin gemacht, indem er ihr ein Paradigma<br />
18 Das Königliche Museum vaterländischer Alterthümer im Schlosse Monbjou zu Berlin,<br />
Berlin 1838, ix, zitiert nach: Menghin 1978: 676
VORGESCHICHTE AM GNM 481<br />
gab 19 ; das heißt: »er begründete und formte eine wissenschaftliche Gemeinschaft<br />
die das gleiche Ziel: <strong>Geschichte</strong> mit archäologischen Quellen zu erschließen,<br />
mit gemeinsamen Methoden bearbeitete.« 20 Smolla verweist an dieser Stelle auf<br />
Analogien zur Kulturgeschichtsmethodik Karl Lamprechts; die Kopplung <strong>von</strong><br />
Archäologie und Historie aber ist vor allem der Versuch, »die vaterländische<br />
Archäologie mit der <strong>Geschichte</strong> in Verbindung zu bringen und den durch die<br />
Arbeit unseres Jahrhunderts ausgesammelten reichen Funden aus heimischem<br />
Boden gleichsam ihre Subjektlosigkeit zu nehmen.« 21 Genau so hat Michel Foucault<br />
die Funktion <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> in der Einleitung seiner Archäologie des Wissens<br />
definiert: als Bedingung <strong>für</strong> die Selbstvergewisserung des Subjekts in der<br />
Zeit. Klassische Archäologie (in Winckelmanns Erbe noch monumentale Philologie,<br />
wie sie Eduard Gerhard nennt) und Vorgeschichtsarchäologie (radikal<br />
monumenten-, nicht textgebunden) liegen hier im Widerstreit:<br />
»Nicht nur der Stoff ist bei den Wissenschaften ein ganz verschiedener: die klassische<br />
Archäologie will einen Teil der Kunstgeschichte sein; die Vorgeschichtsforschung<br />
aber ist eine allumfassende Wissenschaft, die eine ganze Welt wieder<br />
aufzubauen hat, aus einer Epoche, in der es keinen geschriebenen Buchstaben gibt,<br />
außerordentlich wenig oder gar keine große Kunst, aber recht viel Kleinkunst.« 22<br />
Zwischen Geistes- und Naturwissenschaften oszillieren Varianten der Archäologie<br />
und -graphie. Aus dem Aufsatz »Zum heutigen Stand der Vorgeschichtsforschung«<br />
des Leipziger Privatdozenten und späteren Professors der Philosophie,<br />
Hermann Schneider, den Kossinna in Mannus 3 (1911) abdruckt und mit einem<br />
eigenen Aufsatz »Anmerkungen zum heutigen Stand der Vorgeschichtsforschung«<br />
(127-130) ergänzt, geht hervor, daß Vorgeschichte sowohl als <strong>Geschichte</strong><br />
(also Geisteswissenschaft) wie als Naturwissenschaft wahrgenommen wird,<br />
während die neukantianische Schule um Wilhelm Windelband und Heinrich<br />
Rickert grundsätzlich Geistes- und Naturwissenschaften, Interpretation und<br />
Objektivitätsideal trennen. Kossinna denkt die Subjektlosigkeit der prähistorischen<br />
Archäologie in einer regelrechten Kombination <strong>von</strong> natur- und geisteswissenschaftlicher<br />
Methode:<br />
19 Das Kossinna-Syndrom, in: Fundberichte aus Hessen 19/29, 1979/80, Festschrift U.<br />
Firscher (1980), 1-9. Siehe auch Heinrich Harke, Die deutsche Tradition der Vor- und<br />
Frühgeschichte: Gedanken zu intellektuellen, strukturellen und historischen Bedingungen,<br />
in: Arheo 16 (1994), 3-9<br />
20 Günter Smolla, Gustav Kossinna nach 50 Jahren. Kein Nachruf, in: Acta PraehistoricaetArchaeologicaJg.<br />
16/17, Berlin 1984/85, 9-14 (11)<br />
21 Vortrag Kossinna auf der Versammlung der deutschen Anthropologischen Gesellschaft<br />
in Kassel am 9. August 1895, in: Zeitschrift des Vereins <strong>für</strong> Volkskunde 6 (1896), 1<br />
22 Gustav Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte: eine hervorragend nationale Wissenschaft,<br />
7. Auflage, durch Anmerkungen ergänzt v. Werner Hülle, Leipzig (Kabitsch)<br />
1936,260
482 MUSEUM<br />
»Allerdings darf man das so fruchtbare Prinzip der Statistik nicht in der banausischen<br />
Weise mißbrauchen, daß man ganz mechanisch alles nach rein äußerlichen<br />
Gesichtspunkten in arithmetische Reihen bringt, wie dies jetzt auf anderen Gebieten<br />
der Forschung wohl geschehen ist, sondern muß immer <strong>für</strong> die inneren mehr<br />
verdeckten Unterschiede und besonders <strong>für</strong> die äußeren Beeinflussungen, die<br />
zuweilen scheinbare Störungen der Entwicklung veranlassen, ein offenes Auge<br />
behalten« 23<br />
Scharf umgrenzte archäologische Kulturprovinzen decken sich <strong>für</strong> Kossinna zu<br />
allen Zeiten mit ganz bestimmten Völkern oder Völkerstämmen, sind also an<br />
Nationalgeschichten rückgekoppelt. Auch auf Grundlage zufälliger und durch<br />
die Art der Überlieferung stark lückenhafter Grab-, Siedlungs-, Verwahr- oder<br />
Einzelfunde aus vorgeschichtlicher Zeit kann damit etwas über ihre Zugehörigkeit<br />
zu einem ganz bestimmten Volk oder Volksstamm ausgesagt werden, so<br />
»daß wir diese Bodenaltertümer als ebenso wichtige Urkunden <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong><br />
der Völker anerkennen müssen, wie die geschriebenen Urkunden der<br />
geschichtlichen Zeit im engeren Sinne« .<br />
Kossinna weiß um die ideologischen <strong>Im</strong>plikationen seiner siedlungsarchäologischen<br />
Methode: »<strong>Im</strong>merhin gehört zur Verbindung <strong>von</strong> Archäologie und<br />
<strong>Geschichte</strong> das höchste Maß kritischer Vorsicht.« Hülle stellt fest, daß besonders<br />
bei den eigentlichen Historikern das richtige Verständnis <strong>für</strong> die Fragilität<br />
dieser Bindung selten zu finden war . In seinem Vortrag »Ausbreitung der<br />
Germanen« geht Kossinna nicht <strong>von</strong> einer weitgehend hypothetischen »Urzeit<br />
aus vorwärts, sondern als richtige Seiler lieber rückwärts, ir lern wir den<br />
Faden möglichst an die Enden der <strong>Geschichte</strong> und Sprachforschung anknüpfen«<br />
- eine genealogische Verknüpfung <strong>von</strong> Archäologie<br />
und Historie auf Kosten der wissensarchäologischen Diskretion. 24 Ulrich<br />
Kahrstedt warnt später, nach dem Zusammenbruch der politisch instrumentalisierten<br />
deutschen Vorgeschichtsfoschung: »Die Funde, die den Bodenforscher<br />
ermuntigen werden, eine Grenze zu ziehen, verraten weder die Sprachnoch<br />
die politische Grenze, sie sind etwas Drittes.« 25 Zunächst aber sieht die<br />
Vorgeschichtsforschung nach 1933 »die Machtmittel des Staates zugunsten der<br />
23 Aus der Straßburger Dissertation Gustav Kossinna, Über die ältesten hochfränkischen<br />
Sprachdenkmäler (1881), in: Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte<br />
der Germanischen Völker, hg. v. Bernhard ten Brink, Ernst Martin u. Wilhelm<br />
Scherer, Straßburg / London, Bd. 46 (1881), zitiert nach: Smolla 1984/85: 14<br />
24 Kommentiert Smolla ebd.: »eine Methode, die in den USA als »direct hiutoi'ieai<br />
approach< bezeichnet wird und schon in Friedrich Schillers Jenaer Antrittsvorlesung<br />
<strong>von</strong> 1789 beschrieben wurde.«<br />
25 Ulrich Kahrstedt, Grundsätzliches zu historischen und archäologischen Grenzen, in:<br />
Horst Kirchner (Hg.), Ur- und Frühgeschichte als Historische Wissenschaft. Festschrift<br />
zum 60. Geburtstag <strong>von</strong> Ernst Wähle, Heidelberg (Winter) 1950, 60-63 (62)
VORGESCHICHTE AM GNM 483<br />
antiken Komponente unserer <strong>Geschichte</strong> eingesetzt«; die diskursive Begründung<br />
26 da<strong>für</strong> hat deutsche Vorgeschichtsforschung geliefert:<br />
»Persönlicher Tatkraft bleibt es vorbehalten, das germanische Altertum dem deutschen<br />
Volke wieder näher zu bringen, und zwar geschieht dies in innerem Zusammenhang<br />
mit den Anfängen der völkischen Bewegung schon in der Vorkriegszeit<br />
durch Gustav Kossinna. Diejenige Kraft, die allen Schwierigkeiten zum Trotz 1852<br />
das Germanische Nationalmuseum gegründet und den Gedanken der Geschichtsvereine<br />
aufrecht erhalten hat, ringt sich in bezug auf die vorgeschichtlichen Altertümer<br />
wieder durch. Sie wird durch das naturwissenschaftliche Zeitalter insofern<br />
gefördert, als man jetzt ganz allgemeine dazu übergeht, auch die weniger >schönen<<br />
Denkmäler als geschichtlich wertvoll anzusprechen.« 27<br />
Kossinna spielt prähistorische Artefakte als Dokumente gegen ihr Schweigen<br />
als Monument aus; Großes künde die vorgeschichtliche Archäologie, »freilich<br />
nicht in Museen und Sammlungen, wo die Denkmäler der Vorgeschichte -<br />
trümmerhaft, wie sie die Erde wieder herausgibt - das Auge des Laien nur zu<br />
oft enttäuschen.« Kossinna plädiert <strong>für</strong> die mediale Supplementierung dieses<br />
ästhetischen Mangels vorgeschichtlicher Daten, <strong>für</strong> den Versuch, »durch<br />
anschauliche Wiederherstellungen, Ergänzungen, Nachbildungen im kleinen,<br />
wie im großen das alte Kulturleben dem Auge und der Phantasie der Beschauer<br />
wenigstens etwas näherzubringen« . Realisiert sieht er<br />
diese Didaktik im Römisch-Germanische Zentralmuseum zu Mainz und im<br />
Halleschen Museum <strong>für</strong> Vorgeschichte, nicht aber am GNM; dort fällt prähistorische<br />
Archäologie lange nicht in den Bereich der Kulturhistorie. Nach 1933<br />
vollzieht das GNM eine Durcharbeitung und Neuaufstellung der vorgeschichtlichen<br />
Sammlungen, wobei der Begriff der Prähistorie zum Anspruch<br />
der Darstellung deutscher Nationalgeschichte selbst in Widerspruch gerät.<br />
»Hier muß daran erinnert werden, daß in der Gründungsphase nichts über den<br />
Anfang der deutschen <strong>Geschichte</strong> als Grenze <strong>für</strong> die Sammlungstätigkeit des<br />
Museums vereinbart worden war.« 28 Eine wissenschaftliche Durcharbeitung<br />
nicht im Sinne einer Anamnese des geschichtskulturellen Unbewußten, sondern<br />
im Sinne einer ideologiegesättigten Neuaufstellung wird der vorgeschichtlichen<br />
Sammlung in Nürnberg 1935 anläßlich des Reichsparteitages der NSDAP mit<br />
26 Über Diskursbegründer im Unterschied zur Begründung einer Wissenschaft siehe<br />
Michel Foucault, Was ist ein Autor, in: ders., Schriften zur Literatur, übers. Karin<br />
vpn Hpfer, Münzen (Nympfoenburger VerlagsbuclihandJungJ J974, 7-3J, bes.<br />
26: »prähistorisch« meint hier (ausdrücklich) die Zugehörigkeit ssu einem andere«<br />
Diskursivitätstyp.<br />
27 Ernst Wähle, Deutsche Vorgeschichtsforschung und klassische Altertumswissenschaft,<br />
Sonderdruck aus: Deutsches Bildungswesen Heft 10, Oktober 1934, als Einlage in:<br />
Nachrichtenblatt <strong>für</strong> Deutsche Vorzeit, 11. Jg. 1935, 1-12 (6)<br />
28 Burian 1978: 22 lf, unter Bezug auf Jahresbericht GNM 82 (<strong>für</strong> 1935), 1935, 2
484 MUSEUM<br />
rassen- und kulturgeschichtlichem Akzent auf den deutschsprachigen Raum<br />
zuteil. Die Aufstellung des Grundstocks der vorgeschichtlichen Sammlung, die<br />
Sammlung und Systematik Alexander Rosenbergs, hat bislang weder auf eine<br />
rassengeschichtliche Auswertung noch kulturgeschichtliche Zusammenstellung<br />
der Funde Wert gelegt; die Neuaufstellung durch Direktor Zimmermann hingegen<br />
folgt dem Grundsatz »der Darbietung und Deutung der Funde im nationalen<br />
Sinn« einerseits, »andererseits durch die Materialerstreckung.« 29 Das<br />
bedeutet ein Abrücken <strong>von</strong> wissensarchäologischer Dokumentation (Repertorium)<br />
hin zum Effekt des auratischen Originals: »Es soll ferner versucht werden,<br />
noch fehlende Einzelstufen oder fehlendes Material nach Möglichkeit mit<br />
Originalen zu ergänzen. Erst in zweiter Linie soll an die Heranziehung <strong>von</strong><br />
Abgüssen und Nachbildungen gedacht werden« .<br />
Ein epistemischer, nicht allein zeitlicher Abgrund trennt <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong><br />
Prähistorie. Die Zusammenordnung <strong>von</strong> prähistorischer und frühmittelalterlicher<br />
Archäologie als Disziplin spiegelt sich in der Kompartmentalisierung des<br />
GNM; durch Analogiebildung und Supplementierung der Objektserien in<br />
Original oder Nachbildung läßt sich eine Kluft nur prothetisch überbrücken,<br />
»welche diese Abtheilung <strong>von</strong> den entsprechenden späteren Abtheilungen des<br />
Museum scheidet«. Deren innigere Verbindung soll in Form <strong>von</strong> Reproduktionsmedien,<br />
»durch Nachbildungen vorzugsweise <strong>für</strong> die Gebiete angestrebt werden,<br />
auf denen sich der Anschluß an das Mittelalter und durch diese an die neuere Zeit<br />
finden lassen wird« . Der historische Diskurs verlangt<br />
nach Kontinuität und Zusammenhang im Medium integrativer Textoperationen.<br />
Wenn aber die Texte zwischen den Dingen fehlen, findet Vergangenheit als<br />
Erzählung nicht statt. Das auszuhalten ist die Qualität der Prähistorie. Ersatzweise<br />
werden die Dinge selbst zur (Er)Zählung arrangiert, als Monumente also<br />
anderen Konfigurationen zugänglich gemacht. Nicht an den Dingen, sondern<br />
den Relationen dazwischen machen sich historische Diskurse fest:<br />
»Wenn jede Zeit allen ihren Erzeugnissen einen gleichmäßigen Stempel aufdrückt,<br />
so finden natürlich auch innere Beziehungen zwischen allen Erzeugnissen einer solchen<br />
Zeit statt, und sie stehen sich untereinander näher als selbst den verwandten<br />
einer anderen Zeitperiode. Nun ist es aber auch eigenthümlich, daß die Erhaltung<br />
der Denkmäler gewissen strengen, aber nicht ganz einfachen Gesetzen folgt; daß<br />
aus jeder Zeit vorzugsweise bestimmte Denkmäler erhalten sind, deren vielleicht<br />
sämmtliche oder wenigstens die Mehrzahl der verwandten Denkmäler in der nächsten<br />
Epoche nicht mehr vorhanden sind, so daß sich nicht alle Reihen ohne Unterbrechung<br />
<strong>von</strong> der ältesten Zeit durch alle späteren Zeiten verfolgen lassen.« <br />
' Louis Adalbert Springer, Die Neuaufstellung der vorgeschichtlichen Sammlungen des<br />
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> Deutsche Vorzeit,<br />
11. Jg. 1935, 199-204 (199f)
VORGESCHICHTE AM GNM 485<br />
Die Provokation <strong>von</strong> Historie liegt in der Einsicht archäologischer Diskontinuität,<br />
besonders in Bezug auf jene Anzahl <strong>von</strong> Denkmälern, <strong>von</strong> denen aus der<br />
ältesten Periode der deutschen Kultur »so manche erhalten sind, deren Reihe sich<br />
bis in die frühchristlichen Zeiten Deutschlands verfolgen läßt, ohne jedoch in eine<br />
Reihe <strong>von</strong> mittelalterlichen Werken sich fortzusetzen«. <strong>Im</strong> Modus des historischen<br />
Diskurses lassen sich die Monumente des GNM nicht zusammenschließen:<br />
»Dies gab Veranlassung, im wesentlichen alle Denkmäler der vor- und frühchristlichen<br />
Periode Deutschlands, die sich in Originalen oder Abgüssen in unseren Sammlungen<br />
befinden, zu einer selbständigen Abtheilung zu vereinigen und nur einzelne<br />
Repräsentanten in die Serien einzureihen, welche sich, wie z. B. Schwerter, in ununterbrochener<br />
Reihenfolge <strong>von</strong> dieser Zeit bis auf die unsrige verfolgen lassen. <br />
Ihr Inhalt ist so verschiedener und mannigfaltiger Art und doch wieder nach allen<br />
Seiten so lückenhaft, daß es schwer hält, ein praktisches System zu finden, nach welchem<br />
die Sammlung zu ordnen wäre. Das Direktorium des Museums hat daher vorläufig<br />
geglaubt, daß unter dieser Umständen eine rein geographische Ordnung nach<br />
Fundorten am zweckmäßigsten sein dürfte.« <br />
Wo Historie als Organisationsprinzip zur Reduktion <strong>von</strong> Artefakten-Komplexität<br />
versagt, tritt Geographie an ihre Stelle. Hier heißt die Abwesenheit <strong>von</strong><br />
Historie dann folgerichtig Raumordnung. Reizvoll an diesem Kapitel GNM ist<br />
es, die Genese, Etablierung und Stabilisierung einer Wissenschaft abzulesen, die<br />
am Ende Prähistorie heißen wird: Vergangenheit in statu nascendi, die Emergenz<br />
einer Sichtweise auf Vergangenheit, die als Aussage noch nicht formuliert<br />
ist. Diese Genese oszilliert zwischen wissensarchäologischer Form und historischer<br />
Semantik des Gedächtnisses:<br />
»Wenn auch wahrscheinlich die Originale noch längere Zeit nach unserem<br />
geographischen System geordnet bleiben können, so wird es doch nothwendig<br />
werden, die Reihe der Abgüsse systematisch so zu ergänzen, daß sich ganze Serien<br />
daraus bilden und, wenn auch nicht der zeitliche Entwicklungsgang, doch wenigstens<br />
der gesammte Formenkreis einer jeden solchen Serie sich überblicken läßt;<br />
daß z. B. sämmtliche Formen und Verzierungsweisen der Fibeln, Schnallen,<br />
Urnen, Schwerter, Speere u. s. w. sich zeigen.« <br />
Lokalstudie zur Überlieferungswahrscheinlichkeit<br />
Das Germanische Nationalmuseum, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts<br />
»ideelles Zentrum deutscher Kultur- und Kunstbewahrung« 30 , erhält vor 1860<br />
30 Wilfried Menghin, Oberflacht: Zwischen Walhall und Paradies, im Ausstellungskatalog:<br />
Zwischen Walhall und Paradies. Eine Ausstellung des Deutschen Historischen<br />
Museums in Zusammenarbeit mit dem Museum <strong>für</strong> Vor- und Frühgeschichte SMPK,<br />
Sept.-Nov. 1991 Zeughaus Berlin Under den Linden, DHM GmbH 1991, 81-84 (82)
486 MUSEUM<br />
zwei Baumsärge aus dem alemannischen Friedhof in Oberflacht (Baden-Württemberg)<br />
aus unbekannten Grabungszusammenhängen als Geschenk; sie bleiben<br />
circa einhundert Jahre im Nürnberger Museum frei aufgestellt. Das Raummedium<br />
Museum privilegiert das diskrete, isolierte Monument (im Unterschied<br />
zum kontextorientierten Medium Geschichtsschreibung). Als Scharniere, Übersetzer<br />
und Schnittstellen beider Aus- und Darstellungsmodi fungieren Münzen,<br />
Leitfossilien zwischen Text und Objekt, Datum und Bild - Semiophoren im<br />
Sinne der Signalübertragung 3 '. »Die Münzen sind eine unwiderlegbare Zeitbestimmung,<br />
in der Art, dass die Vergrabung eines Fundes nie älter als die beigegebenen<br />
Münzen sein kann. Hier ist ein Irrthum nicht denkbar«; Sicherheit<br />
gewinnen Erkenntnisse zur Archäologen der Merowingerzeit erst durch münzdatierte<br />
Gräber in Selzen in Rheinhessen, wo die beigegebenen Silbermünzen<br />
des römischen Kaisers Justinian I. (526-565) die Datierung der Grablege frühestens<br />
in das 6. Jahrhundert bestätigen . Die Gedächtnisinstitution<br />
Germanisches Nationalmuseum, weit entfernt, nur passiver Speicher<br />
<strong>für</strong> archäologische Daten zu sein, führt gleichzeitig Ausgrabungen durch,<br />
etwa 1891 im altfränkischen Gräberfeld bei Pfahlheim (Schwäbische Alb), allerdings<br />
nur unvollständig den Grabungskontext dokumentierend. <strong>Im</strong> folgenden<br />
Jahr gräbt das Berliner Museum <strong>für</strong> Völkerkunde auf dem Mühlberg bei Pfahlheim<br />
und hebt die Inventare <strong>von</strong> mindestens sechs Bestattungen? 1 <strong>Im</strong> Begriff<br />
des Inventars als Grabausstattung konvergieren Text und Objekt der Archäologie;<br />
die Überführung <strong>von</strong> Realien (Artefakte) und Realem (Schädel, »bei einigen<br />
Körpern sogar nur eine formlose Masse <strong>von</strong> Moder« 33 ) aus Grabinventaren<br />
in das symbolische Schriftregime <strong>von</strong> Museumsinventaren ist ein Akt der memorialen<br />
Semiose, die den vormodernen Zusammenhang <strong>von</strong> Gedächtniskunst<br />
und Totengedächtnis (Simonides-Legende) methodisiert. Indem auf Inventarseiten<br />
die Zeichnung <strong>von</strong> Fundstücken ihren Ordnungsnummern im Speicher<br />
zugeordnet werden, wird ihre Bildgegenwart als Gedächtnis numerisch adressierbar.<br />
34 So werden nicht nur Gräber zu Zahlenreihen, sondern auch ihre skiz-<br />
31<br />
Über den Zusammenhang <strong>von</strong> Geld und Information: Bernhard Vief, Digitales Geld,<br />
in: Florian Rotzer (Hg.), Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen Medien, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1991, 117-146<br />
32<br />
Winfried Menghin, Pfahlheim: Eine Ausgrabungsruine des 19. Jahrhunderts, in: Katalog<br />
DHM 1991, 85-115 (88)<br />
33<br />
Wilhelm und Ludwig Lindenschmit, Das Germanische Todtenlager bei Selzen in der<br />
Provinz Rheinhessen [*1848] , Reprint mit einem Vorwort v. Kurt Böhner, Mainz (v.<br />
Zabern)1969, 11<br />
34<br />
Siehe die Abbildung <strong>von</strong> zwei gegenüberliegenden Inventarseiten aus dem Handkatalog<br />
<strong>von</strong> L. Lindenschmit mit Fundstücken aus den Gräbern <strong>von</strong> Hallstatt, in: Jensen<br />
1985: 140
VORGESCHICHTE AM GNM 487<br />
zierten Inhalte tabellarisch zuordenbar, analog zur Praxis der Kopplung <strong>von</strong><br />
technischen Zeichnungen an den erklärenden Text durch alphanumerische Zeiger;<br />
archäologische Befunde sind damit als Aggregate beschreibbar wie ein<br />
elektrodynamischer Apparat. 35 Animiert wird das Skelett durch physiognomische<br />
Analogie zu lebenden Einwohnern; Anthropometrie und Kranologie<br />
bilden ein Archiv jenseits der Schrift. Die Grenze <strong>von</strong> Vor- und Frühgeschichte,<br />
zwischen Christenthum und Heidenthum aber wird gezogen, sobald<br />
ein Fundvergleich eine Bestimmung des Zeitalters erlaubt; die Lösung der Frage<br />
über Nationalität wird verzeitlicht . Durch münzfundgestützte<br />
Datierung (das Scharnier <strong>von</strong> Artefakt und Schrift) gelingt es<br />
den Lindenschmits, »in den Gräbern <strong>von</strong> Selzen einen festen Punkt <strong>für</strong> die<br />
Archäologie errungen zu haben« , jene archimedische Koordinate,<br />
<strong>von</strong> der aus Signifikanten im zeiträumlichen Koordinatennetz der Historie verortbar<br />
sind. Emergenz einer Disziplin, die mit Materialitäten, nicht Symbolen<br />
rechnet:<br />
»Für die grosse Frage der neueren Wissenschaft über die alten Völker Europa's<br />
mag im Historischen das Material beisammen und der Aktenbündel geschlossen<br />
sein, auch im Linguistischen dürfte die Spruchreife nicht mehr allzulange auf<br />
sich warten lassen; allein es kann ein Verdikt erst dann gefällt werden, wenn auch<br />
die Archäologie mit festem Systeme sich ihre Beweismittel gebildet hat.« <br />
Beweismittel werden, jenseits aller monumentalen Philologie, nun nicht mehr<br />
durch Emendation <strong>von</strong> Texten, sondern in transhistorischen Indizien des Realen,<br />
der Knochenbildung, gesucht. Spurensicherung 36 :<br />
»Die deutsche Hüften-, Knöchel- und Schädelbildung blieb sich gleich, was bei<br />
der Sprache weniger der Fall war. Hier ist ein Punkt, den die Phantasie nicht verwischen<br />
kann, denn wir haben die Vergleichung alle Tage zur Hand. Schärft euer<br />
Auge da<strong>für</strong> nur mit halb soviel Übung, als womit der Künstler den Feder- und<br />
Pinselstrich an Schriften und Gemälden zu unterscheiden vermag, und ihr werdet<br />
finden, dass dieses Kennzeichen nur dann zu verachten ist, wenn es materiell verstümmelt<br />
vorliegt. Es ist hiermit, um bei dem Gleichniss des Schreibens zu bleiben,<br />
wie mit dem nationalen Kennzeichen der Schriftzüge. Wenn wir deutsche<br />
Handschriften vergleichen, so finden wir so viele Abweichungen als es Individuen<br />
gibt, was mit der naturhistorischen Entdeckung parallel bleibt, dass es nicht zwei<br />
Thiere gibt, bei welchen die eine Hälfte eines Thieres zu einem andern passt.«<br />
<br />
35<br />
Etwa Andre Marie Ampere, Description d'un appareil electro-dynamique, 2. Aufl.<br />
Paris 1826<br />
36<br />
Zum Verbund <strong>von</strong> Philologie, Kriminologie und Psychoanalyse in der besprochenen<br />
Epoche: Carlo Ginzburg, Spurensicherung. Über verborgene <strong>Geschichte</strong>, Kunst und<br />
soziales Gedächtnis, Berlin (Wagenbach) 1983
488 MUSEUM<br />
Der archäologische Blick steht nicht länger auf Seiten der Philologie, sondern<br />
der Naturwissenschaften - nicht hermeneutisch, sondern beschreibend. So wird<br />
auch Schrift als Signifikantenbild, nicht semantisch gelesen. Kaum aber ist<br />
die Archäologie als Provokation der historischen <strong>Im</strong>agination etabliert, indem<br />
sie der Versuchung Widerstand leistet, »eine fragmentarische Existenz in eine<br />
erfüllte umzudeuten« 37 , wird sie dem historischen Diskurs unterworfen - das<br />
double-bind des 19. Jahrhunderts, wie sie in Eduard Gerhards Begriff der<br />
Archäologie als monumentale Philologie zum Ausdruck kommt:<br />
»Die <strong>Geschichte</strong>, d. h. die geschriebene, übereinstimmende und unparteiische<br />
Ueberlieferung der Vorzeit, ist ein unentbehrlicher Leitfaden, den die Archäologie<br />
nie verlassen darf, um auf eigene Faust Entdeckungen zu suchen, gleich dem<br />
abenteuerlichen Schatzgräber, der, statt nach den Regeln der Geologie mit Schacht<br />
und Stollen den Erzadern zu folgen, viel mehr auf die schnellbereichernde Wünschelruthe<br />
vertraut.« <br />
Denn ohne Kopplung an Erzählung ist eine archäologische Datenlage Unordnung,<br />
und ein Widerstreit auf der Ebene <strong>von</strong> Artefakten kann nur unter Zuhilfenahme<br />
<strong>von</strong> historischen Urkunden entschieden werden, also in Unterwerfung<br />
der Materialitäten an den historischen Diskurs . Information aber<br />
entsteht erst im Treffen auf das Unerwartete; »eben das Fatale hat die größte<br />
Überlieferungs-Chance« (die Chance der Archäologie und der Archivare), und<br />
gegen zufällige Auslese schützt gerade die wenig systematische Ordnung. Dabei<br />
treten »gewissermaßen historische und antiquarische Überlieferung auseinander«. 38<br />
Die Arbeit der Wissensarchäologen verlegt sich zunehmend auf Ausgrabungen<br />
in musealen Archiven - und hier trifft sie bei dem Versuch, die Gesamtzahl<br />
der in Pfahlheim zwischen 1883 und 1905 geborgenen Gräber zu ermitteln, auf<br />
ähnliche Lücken wie die Ausgräber materialer Artefakte. Angaben über die Lage<br />
der Gräber zueinander und zur Lage der Funde in den Gräbern finden sich zwar<br />
in den Bereichen, die sich auf die Ausgrabungen des Germanischen Nationalmuseums<br />
beziehen, Aber auch hier muß da<strong>von</strong> ausgegangen werden, doch »ein<br />
Gräberfeldplan ist aus den überlieferten Unterlagen nicht zu rekonstruieren und<br />
selbst die Lokalisierung des Friedhofes im Gelände hat eine scharfsinnige Analyse<br />
der spärlichen Literaturangaben zur Voraussetzung« .<br />
Historische Dokumentation (kontextorientiert) und archäologisches Monument<br />
(diskontinuiert) bilden eine Dichotomie nicht nur auf Objektebene, sondern<br />
37 Wolf-Hartmut Friedrich, Philologen als Teleologen, in: ders., Dauer im Wechsel, Göttingen<br />
1977, 22-35; hier zitiert nach Esch 1985: 557<br />
38 Arnold Esch, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem<br />
des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985), 529-570 (541, 549 u. 551)
VORGESCHICHTE AM GNM 489<br />
auch auf der ihrer Darstellung. Bei unzulänglicher Fundbergung, mangelnder<br />
Dokumentation, unvollständiger Ausgrabungen und unglücklichem Fundverbleib<br />
ist der Friedhof vom Mühlberg in Pfahlheim »isoliert betrachtet als archäologische<br />
Ruine zu sehen« - als Beobachtung zweiter Ordnung eine<br />
wissensarchäologische Ruine allemal. Fundzusammenhänge lassen sich, als stochastische<br />
Streuung betrachtet, als Graphen anschreiben und damit - jenseits der<br />
Grenzen linguistischer Deskription - rechnen. 39 Das Studium <strong>von</strong> Relationen<br />
und ihre Kartographierung (v)ersetzt den monumentalen Blick auf das einzelne<br />
Objekt - eine Dissonanz <strong>von</strong> diskretem Datum und Kontext in der Korrelation<br />
<strong>von</strong> Kenntnis über die genaue Lage und Bewertung <strong>von</strong> Grabfunden<br />
»in Zusammenhang mit der historisch-archäologischen Situation« <strong>von</strong> Pfahlheim<br />
im 7. Jahrhundert . Strategie und Begriff der Lage verschränken<br />
die archäologische, archivische und militärischen Wahrnehmung<br />
gegebener Daten 40 . Einschlägige Akten lagern in Archiven, so wie archäologische<br />
Objekte im Boden, die alle <strong>für</strong> viele Jahre geheim bleiben werden; in dieser<br />
Lage bleiben nur Hypothesen und das heißt Erzählungen. 41 Aber machbar<br />
scheint es, an den Blaupausen archäologischer Fundlagen selber Figuren des<br />
Unbekannten namens Historie abzulesen. Von deren Körpern »gibt es immer<br />
nur das, was Medien speichern und weitergeben können« (ob nun Erdreich oder<br />
museale Speicher). »Mithin zählen nicht die Botschaften oder Inhalte«, sondern<br />
einzig die Konstellationen der Artefakte, das Schema ihrer Wahrnehmbarkeit<br />
überhaupt . Archäologische Artefakte werden zur historischen<br />
Dokumentation als Funktion einer Datenbank; die Eintragung darin geht<br />
mit einem Statuswechsel als epistemisches Ding (Jörg Rheinberger) einher:<br />
»From in situ and unknown, to removed and researched, before it has any<br />
impact on knowledge, the evidence has largely lost its original integrity«; die<br />
Bedeutung des Objekts wird auf die Ebene der Aufzeichnungen verschoben, die<br />
ihm Information zuschreiben. 42 Der Akt der Registrierung, der Verzeichnung<br />
und Kontextualisierung steht in einem parergonalen Verhältnis zum Objekt,<br />
dem Semiophor (Krzsysztof Pomian). David Crowther unterscheidet zwei<br />
39<br />
Siehe etwa Abb 1. (Fundfrequenzkurve) zu: Albrecht Dauber, Der Forschungsstand<br />
als innere Gültigkeitsgrenze der Fundkarte, dargestellt am Beispiel Nordbadens, in:<br />
Kirchner (Hg.) 1950,99-111<br />
40<br />
Siehe W. E., Unges(ch)ehene Museen: Bomben, Verschwinden, in: Martin Stingelin /<br />
Wolfgang Scherer (Hg.), HardWar / Soft War. Krieg und Medien 1914 bis 1945, München<br />
(Fink) 1991, 197-218<br />
41<br />
Vgl. Friedrich Kittler, Grammophon - Film - Typewriter, Berlin (Brinkmann & Böse)<br />
1987, 3f<br />
42<br />
David Crowther, Archaeology, Material Culture and Museums, in: Susan M. Pearce<br />
(Hg.), Museum Studies in Material Culture, London 1988, 35-46 (42)
490 MUSEUM<br />
Gruppen <strong>von</strong> artifacts attributes: intrinsische (Material, Dekoration) und relative<br />
(Kontext, <strong>Geschichte</strong>, Funktion). <strong>Im</strong> Moment der archäologischen Entdeckung<br />
kommt ein Prozeß ins Spiel, der das Objekt mit der Registrierbarkeit<br />
bereits transformiert - konzeptuell wie physikalisch. Das Objekt wird seiner<br />
homöostatischen Lage entrissen und ist damit auf künstliche Erhaltung seines<br />
Zustands angewiesen, was seinerseits einer institutionellen Infrastruktur bedarf.<br />
Damit begründet sich Kultur als gesellschaftliches Projekt.<br />
Die Fallstudien der vorliegenden Arbeit erheben nicht den flächendeckenden<br />
Anspruch auf wissensarchäologische Repräsentativität. Zu ihrer systematischen<br />
Auswahl gesellt sich vielmehr eine Serie stochastisch gestreuter Archivund<br />
Bibliothekbefunde, und deren Einspielung geschieht im Vertrauen darauf,<br />
daß auch partikulares Wissen in seiner Zufälligkeit, daß also auch das Kontingente<br />
ein Wissen um epistemologische Verhältnisse hat und verrät. Prähistorie<br />
muß in diesem Sinne medienarchäologisch, nämlich <strong>von</strong> den Übertragungsmedien<br />
ihrer Signifikanten her begriffen werden, die jedes Signifikat erst konstituieren<br />
und dabei immer schon verschieben. Die kartographische Feststellung<br />
der Verteilung <strong>von</strong> Funden auf verschiedene Nationen sagt nichts vorweg über<br />
deren Nationalität; Überlieferung <strong>von</strong> Daten ist eine Funktion <strong>von</strong> Kommunikation,<br />
Transport und Verkehr:<br />
»Gemeinsame Alterthümer müssen in bewegliche und unbewegliche getheilt<br />
werden. Die transportablen Alterthümer unterliegen immerhin ohne Weiteres der<br />
Möglichkeit, als Handelsartikel, Tauschmittel oder Kriegsbeute in die Hände wilder<br />
Völker gerathen zu sein, wie denn die ganze Indianerwelt heutzutage mit englischen<br />
und französischen Stahl- und Feuergewehren versehen ist. Was aber die<br />
unbeweglichen Monumente anbelangt, so glauben wir, diese Alterthümer<br />
könnten dem ursprünglichen, noch reinerhaltencn Geschlechte angehören.« <br />
Überlieferungschance und -zufall eines Datums unterliegen Wahrscheinlichkeiten,<br />
die <strong>von</strong> der Nachrichtentheorie auf berechenbare Maße gestellt wird.<br />
Arnold Esch untersucht die Überlieferungs-Massen (Notariats-Urkunden) im<br />
Archiv <strong>von</strong> Lucca unter dem Gesichtspunkt der Maßstäbe unserer historischen<br />
Erkenntnis - »seltsame Umverteilung der Wirklichkeit durch die Überlieferung!«;<br />
demgegenüber hat das ägyptische Wüstenklima die antiken Papyri <strong>von</strong><br />
Fayum {Überreste im Sinne Droysens, ohne Überlieferungsabsicht) Schriftliches<br />
ohne Ansehen der Bedeutung überdauern lassen .<br />
Das gilt <strong>für</strong> die Archive der Historie ebenso wie <strong>für</strong> die der prähistorischen<br />
Archäologie, die sich fragen muß, »ob ein weittragender Streifen <strong>von</strong> Gräbern<br />
gleichen Typs nun wirklich einen (sagen wir:) alemannischen Siedlungskorridor<br />
abbilde, oder ob er nicht einzig der Tatsache verdankt wird, daß der Bau einer<br />
Autobahnlinie hier, und vorerst nur hier, Gräber zutage förderte - ob der kartierte<br />
Streifen also Völkerwanderung abbilde oder nur den massierten Zufall
VORGESCHICHTE AM GNM 491<br />
<strong>von</strong> Fundumständen.« Zudem sind beigabenlose Gräber (oder Gräber aus beigabenloser<br />
Zeit) prinzipiell unterdokumentiert, »weil sie bei Aufdeckung die<br />
geringere Chance haben, erkannt, gemeldet und damit <strong>von</strong> der Wissenschaft<br />
registriert zu werden« - wie im Falle der Furchungen <strong>von</strong><br />
Ackerbauern, die das oben genannte Gräberfeld <strong>von</strong> Selzen zutagebringen. Das<br />
Gedächtnis des Realen differiert eklatant <strong>von</strong> dem des Symbolischen (also des<br />
Aufgezeichneten). Die Maßstäblichkeit dessen zu erkennen, was die Kanäle der<br />
Überlieferung sortieren, »und das heißt: die auslesende Überlieferung zu entzerren«,<br />
ist nicht nur eine Frage <strong>von</strong> Vergangenheit, sondern der Nachrichtenlagen<br />
schon jeder Gegenwart (Zeitungen etwa: »Was aber mag dann das Maß<br />
dieser Wahrheit sein?«); es gilt also, das (aus der Geographie vertraute) Verzerrungsgitter<br />
zu zeichen . Genau an dieser Stelle, an der Eschs Fragestellung<br />
mit dem Schlußsatz aussetzt (»Lassen wir uns nicht entmutigen, in<br />
das Dunkel hineinzufragen«), setzt die mathematische Informationstheorie<br />
(und der Historiker als semantic receiver) ein und fragt: »How does noise affect<br />
information? after the signal is received there remains some undesirable<br />
(noise) uncertainty about what the message was«? 43 Historische Forschung<br />
gleicht sich der Nachrichtentheorie an, indem sie gegebenen Daten die Botschaft<br />
einer Vor- an die Nachwelt im Modell der Historie (also als Kode) unterstellt.<br />
Das »empfangene« Signal ist damit eine Funktion des überlieferten Signals<br />
und einer zweiten Variable, der Störung. »Noise is considered to be a chance<br />
variable just as the message . In general it may be represented by a suitable<br />
stochastic process.« 44 Mithin läßt sich das, was Esch hermeneutisch als Überlieferungs-Chance<br />
zu fassen sucht, mathematisch so formulieren: E =f(S, N).<br />
Von daher lassen sich Verzerrungen in der Überlieferung an den Stellen ihrer<br />
medialen Kanäle, mithin den stochastischen Streuungen des Marktes und den<br />
Zwischenspeichern Museen ausmachen; nicht die Normalserie, sondern das<br />
Abweichende wird registriert:<br />
»Die irrtümliche Ansicht nordischer Alterthumsforscher, als seien die Geräthe und<br />
Waffen <strong>von</strong> Stein in Süddeutschland, namentlich den Rheingegenden seltener,<br />
beruht wahrscheinlich auf dem Umstände, dass in den Museen zum Theil nur die<br />
ungewöhnlichen Formen oder nur ausgezeichnete Exemplare aufbewahrt<br />
werden. Die Steinwaffen hiesiger Gegend, obgleich durch den Antiquitätenhandel<br />
massenweise ins Ausland verkauft, finden sich doch noch zu Dutzenden in<br />
jeder selbst kleineren Privatsammlung.« «cLindenschmit 1848: 49, Anm. 2><br />
43 Warren Weaver, Recent Contributions to the Mathematical Theory of Communication<br />
[1949], in: Claude E. Shannon / ders., The mathematical theory of communication,<br />
Urbana, 111. (University of Illinois Press), 1963, 1-28 (18, 21)<br />
44 Claude E. Shannon, The Mathematical Theory of Communication [1948], in: ders. /<br />
Warren Weaver 1963: 29-125 (65)
492 MUSEUM<br />
Die Emergenz der Vorgeschichte am Landesmuseum in Brunn<br />
Historie ist an starre Designatoren, mithin <strong>Namen</strong> und Begriffe (als Ereignisse)<br />
gebunden; Vorgeschichte ist anonym, also nur in anderen Formen adressierbar.<br />
Als Ende des 19. Jahrhunderts die erste Beschreibung der Konfiguration des landesgeschichtlichen<br />
Franzens-Museums in Brunn (Brno) erscheint, kann ihr Verfasser,<br />
der seit dem 7. März 1836 als Kustos amtierende Albin Heinrich, lediglich<br />
einige wenige Altertümer der vorgeschichtlichen Zeit seines Landes namhaft<br />
machen:<br />
»Die Bronzegegenstände wurden damals consequent als >römischeheidnische< Alterthümer bezeichnet. Der Gegenstand an sich<br />
erschien als das Wertvollste, während die Fundverhältnisse, auf welche die<br />
moderne Forschung mit Recht ein großes Gewicht legt, gar nicht berücksichtigt<br />
wurden; ja in der Mehrzahl der Fälle erschien sogar der Fundort nebensächlich.« 45<br />
Chaotische Lagerhaltung: Den Beginn der Tätigkeit Heinrichs bildete die Katalogisierung<br />
der Sammlungen, »eine Sisyphusarbiet angesichts des chaotischen<br />
Zustandes, in dem sich der größte Teil der Bestände befand« . Heinrich<br />
selbst schreibt, daß bei der Übergabe und Übernahme der Museumsinventarien<br />
und der dazu gehörigen Sammlungen »die verschiedenen Gegenstände alle<br />
chaotisch durch-, über- und untereinander als rudis indigestaque moles in mehreren<br />
Gemächern aufgeschichtet lagen«
VORGESCHICHTE AM GNM 493<br />
herausgegebene, vom damaligen Kustos M. Trapp verfaßte Führer durch das<br />
Franzens-Museum in Brunn kann bereits auf eine eigene (auch so genannte)<br />
vorgeschichtliche Abtheilung und die Bedeutung derselben »<strong>für</strong> die urälteste<br />
<strong>Geschichte</strong>« seines Landes aufmerksam machen - womit auch die arche in den<br />
Diskurs der Historie eingeholt ist, nicht ihr blinder Fleck bleibt. Doch Trapp<br />
hat Probleme mit der Synchronisation der Befunde:<br />
»Auch dieser >Führer< enthält jedoch nur eine Aufzählung jener Ortschaften<br />
Mährens, <strong>von</strong> welchen prähistorische Funde in der Sammlung sind, ohne Berücksichtigung<br />
des archäologischen Charakters der einzelnen Funde; der letztere kam<br />
auch in der Aufstellung der Objecte in keiner Weise zum Ausdruck, indem neu hinzugekommene<br />
Stücke einfach dorthin gelegt wurden, wo eben Raum war. Überdies<br />
wurde der Sammlung eine ziemlich beträchtliche Anzahl <strong>von</strong> solchen Objecten<br />
einverleibt, die sich bei näherer Untersuchung als durchaus nicht hinein gehörig<br />
erwiesen die systemlose Aufstellung machte eine Übersicht dessen, was wirklich<br />
beachtenswert ist, nahezu unmöglich; da jedoch fachmännisch verfasste Inventarien<br />
derartiger Sammlungen <strong>für</strong> die Forschung außerordentlich wertvoll sind, so<br />
habe ich der Mühe unterzogen, jedes einzelne Stück unserer prähistorischen Sammlung<br />
nach seiner Provenienz und Zeitstellung zu untersuchen, das Zusammengehörige<br />
auch zusammen zu legen und eine ganze Sammlung in übersichtlicher<br />
Weise neu zu ordnen. 47<br />
Bei den Gegenständen fand sich zwar oft ein Zettel vor, dieser enthält aber meist<br />
nur den <strong>Namen</strong> des Spenders. Hier äußert sich die Suprematie des Diskurses,<br />
der Verhandlung der Objekte, über ihre Historie als Referenz im <strong>Im</strong>aginären.<br />
Die Grenze zwischen Vorgeschichte und Historie ist auch in Brunn keine ontologische;<br />
die Culturepoche der slavischen Zeit gehört größtenteils schon der<br />
<strong>Geschichte</strong> an; »immerhin sind aber die ersten Jahrhunderte dieser Zeit durch<br />
historische Zeugnisse nur so spärlich erhellt, dass wir sie noch zur >Vorgeschichte<<br />
rechnen und die eigentliche historische Zeit< <strong>für</strong> unsere engere Heimat<br />
erst beiläufig mit dem 11. Jahrhundert beginnen lassen dürfen .<br />
Der mit nationaler respektive regionaler mnemischer Energie geladene Diskurs<br />
liegt im Widerstreit mit den wissenschaftlichen Interessen an einer Vorgeschichte<br />
als Wissenschaft, die solche Eingrenzungen nicht kennt. Die Ursache<br />
da<strong>für</strong>, daß <strong>von</strong> aktuellen Neufunden nur ein Bruchteil nach Brunn gelangt, liegt<br />
in einer »sehr bornierten Auffassung des Zweckes eines Landesmuseums, einer<br />
Auffassung, die die Landeshauptstadt und mit ihr auch das Landemuseum aus<br />
rein nationalen Gründen in einen Gegensatz zu dem übrigen Mähren zu bringen<br />
sucht« , §Q bildet sich das prähistorische Gedächtnis als Funk.-<br />
und Frühgeschichte, Volkskunde, Musikarchiv, Landesgalerie und Landesforschungsinstitut<br />
Anthropos.<br />
47 A. Rzehak, Die prähistorische Sammlung des Franzens-Museums, in: Museum Francisceum,<br />
Annales 1898, Brunae 1899, 53f
494 MUSEUM<br />
tion nationalideologischer Strategien, nicht als Produkt objektiv vorliegender<br />
Fundlagen. Unter deutscher Besatzung wird nicht allein seit dem 15. November<br />
1941 in der Museumsverwaltung rein deutscher Schriftverkehrt eingeführt;<br />
dem Museum als Landesforschungsinstitut ist auch ein Anthropos-Institut <strong>für</strong><br />
»rassenarchäologische Forschung« angegliedert. 48 Ein Schreiben vom 31. März<br />
1942 äußert die Bitte um eine vorsichtigere Bearbeitung <strong>von</strong> altsteinzeitlichen<br />
Schädelfunden als rassenkundlicher Dokumente : Werden archäologisch<br />
diskrete Monumente als ideologische Dokumente verhandelt, als Teil einer<br />
Erzählung, werden sie geschichtsmächtig. 49 Wissensarchäologische Diskretion<br />
wäre hier politischer Widerstand.<br />
48 Siehe etwa den Brief des Abteilungsleiters v. 23. Mai 1942 an Dr. häbil. Alfred Rust in<br />
Ahrensburg, Neandertaler-Theorien betreffend: Moravske Muzeum v Brne, Archiv<br />
MM, A 1, Akten »Landesmuseum in Brunn« (1942)<br />
49 Vgl. Otto Reche, Stärke und Herkunft des Anteiles Nordischer Rasse bei den West-<br />
Slawen, in: H. Aubin / W. Kohte / J. Papritz (Hg.), Deutsche Ostforschung: Ergebnisse<br />
und Aufgaben seit dem Ersten Weltkrieg,Bd. 1, Leipzig 1942, 58ff
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 495<br />
Das deutsche Gedächtnis als Generalrepertorium:<br />
Archiv, Bibliothek und Museum im Medienverbund<br />
1853 publiziert Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß sein im Jahr zuvor in Dresden der Versammlung<br />
deutscher Geschichts- und Altertumsforscher, dann der deutschen<br />
Bundesversammlung in Frankfurt als Denkschrift vorgelegtes System der deutschen<br />
Geschichts- und Alterthumskunde entworfen zum Zwecke der Anordnungen<br />
der Sammlungen des germanischen Museums, das wissenstopisch und<br />
räumlich zum logistischen Zentrum der Gedächtnisinstitution wird. Aufseß'<br />
System reiht die Dinge nicht chronologisch, sondern systematisch. Der weitgehende<br />
Verzicht auf Geistesgeschichte begünstigt »Aussagen über Strukturen,<br />
über >Zustände
496 MUSEUM<br />
tistik »als der dem Zuständlichen zugewandten Disziplin«. 4 Friedrich August<br />
Wolf bringt 1807 in seinem Überblick sämmtlicher Theile der Alterthums-Wissenschaft<br />
Archäologie und Statistik in Verbindung, parallel zu Systembildungen<br />
im Sinne <strong>von</strong> Aufseß
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 497<br />
Seitdem sind nicht mehr die pohtologischen Theorien der Kameralwissenschaften,<br />
sondern deren Hilfswissenschaften Grundlage <strong>für</strong> Ausbildung in<br />
Staatswissen - Datenquellen, aus denen sich die Kulturwissenschaft des 19.<br />
Jahrhunderts speist. In diesem Archiv fallen Staat und <strong>Geschichte</strong> ineins: »Die<br />
Statistik ist ebenso eine allgemeine Hilfsdisziplin aller Geschichtswissenschaften<br />
wie die wissenschaftliche Buchhaltung jedes geordneten Staates« , und Alexander <strong>von</strong> Humboldt definiert das epistemologische Dispositiv<br />
der neuen Zeit als Antinomie der Erzählung: »<strong>Im</strong> politischen Haushalte<br />
wie bei der Erforschung <strong>von</strong> Naturerscheinungen sind die Zahlen immer das<br />
Entscheidende« . Diese Erfahrung ist <strong>von</strong> Diskontinuität gezeichnet;<br />
Statistik liefert nicht allein aktuell Auskunft über den Staat, sondern ist im<br />
Moment der Registrierung bereits vergangene Zukunft: »Die Statistik sammelt<br />
die Materialien <strong>für</strong> die künftige <strong>Geschichte</strong>, und die jetzige Generation ist um<br />
so mehr verpflichtet, der folgenden bessere Materialien zu hinterlassen, als sie<br />
zu Erkenntnis gelangt ist, wie nachteilig ihr selbst die Unsorgsamkeit der Vorwelt<br />
in dieser Beziehung wird« - demnach ist der preußische Staat 1806 an seiner<br />
eigenen Opazität zusammengebrochen. Der Geschichtsschreiber muß<br />
Staatsmerkwürdigkeiten »kraft seines Amtes registrieren« und nicht erzählen;<br />
»er muß also Statistiker sein« . In<br />
statistischen Tabellen ist fortan nicht allein Staat, sondern auch der Stand der<br />
Kultur kalkulier-, also meßbar; damit verbunden ist die Entheimung, der freie<br />
Zugang der Daten zugunsten einer »Öffentlichkeit der Nachrichten« .<br />
Quelldatenbanken wie die MGH und die Acta Borussica werden - asymmetrisch<br />
zur Inanspruchnahme <strong>für</strong> diskursive Historiographie - ihrerseits auch <strong>für</strong><br />
statistische Angaben gelesen. Carl Gustav Adolph Knies bezeichnet 1850 auf<br />
etymologischer Grundlage die Statistik wie selbstverständlich als Kunde des<br />
Staates oder des Zustandes und des Zuständlichen »und schließlich, beide Ausagen<br />
kombinierend, als Wissenschaft vom (gegenwärtigen) Zustand des Staates«,<br />
womit zugleich jenes Verhältnis zur Historie an Aktualität gewinnt, <strong>für</strong><br />
das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besonders die Äußerungen Schlözers<br />
über <strong>Geschichte</strong> als Ganzes und Statistik als Teil derselben »fast kanonischen<br />
Charakter« (Deneke) besitzen. Zerschnitte man buchstäblich eine »durch<br />
mere Jar-Hunderte fortlaufende <strong>Geschichte</strong> in schickliche Perioden, und höbe<br />
dann aus jeder blos die StatsMerkwürdigkeiten in engerer statistischer Bedeutung<br />
heraus, so würde dies so viel einzelne (alte) Statistiken geben, als Perioden<br />
angenommen sind« . Schlözer wird seitdem<br />
<strong>für</strong> seinen Leitsatz <strong>von</strong> der <strong>Geschichte</strong> als einer fortlaufenden Statistik und der<br />
Statistik als einer stillstehenden <strong>Geschichte</strong> zitiert. Auch dieses Modell einer<br />
Archäologie des Wissens aber scheitert an der Unfähigkeit, damit Transforma-
498 MUSEUM<br />
tionsprozesse der <strong>Geschichte</strong> zu erklären; <strong>für</strong> Historiker ist es gerade wesentlich,<br />
symbolische und materielle Daten der Kultur nicht schlicht aus der Perspektive<br />
ihrer im Speicherzustand vermeintlichen Statik zu betrachten, sondern<br />
ihnen eine immanente Dynamik zu unterstellen. »Auch Knies sieht eine Problematik<br />
darin, daß mit dem Begriff des Zustandes als dem Kennwort der Statistik<br />
eine Dauer postuliert wird, über deren Erstreckung keine Klarheit zu<br />
erlangen sei.« 8 Disziplinen wie die Statistik sind im Nürnberg Leitwissenschaften.<br />
In einem Appell <strong>von</strong> 1846 spricht <strong>von</strong> Aufseß die Forderung aus, daß es<br />
»keine sogenannte Neben- oder Hilfswissenschaft der <strong>Geschichte</strong>« mehr gebe,<br />
vielmehr eine jede »mit Recht ihre selbständige Stellung und Ebenbürtigkeit mit<br />
der <strong>Geschichte</strong> selbst« behauptet. An die Stelle der Suprematie der historischen<br />
Narration tritt die parataktische Beiordnung alternativen Formen der Datenverarbeitung<br />
der Vergangenheit. 9<br />
Das Dispositiv der Statistik steht im Bund mit einer wissensarchäologischen<br />
Wahrnehmung der Dinge. Musealien sind <strong>für</strong> <strong>von</strong> Aufseß vorrangig Träger <strong>von</strong><br />
Information (Monument und Datum) 10 ; schon vor der Gründung des Germanischen<br />
Nationalmuseums hat er den wissenschaftlich produktiven, mithin diskurssetzenden<br />
Charakter der <strong>von</strong> ihm beabsichtigten Anstalt betont. Ihmzufolge<br />
sollen die Sammlungen »dem Institute mehr als Hilfsmittel denn als Selbstzweck<br />
beigegeben sein« 11 ; Lauffer benennt das double-bind dieser Wissensproduktion<br />
als historisch-archäologische Arbeit} 2 In seinem Sendschreiben an den Frankfurter<br />
Germanistentag vom Jahre 1846 definiert <strong>von</strong> Aufseß, das Museum solle<br />
»in innigster Beziehung zu den historischen Vereinen« wirken; »sie sollten die<br />
Träger desselben sein, das Museum das Herz derselben, in welches das heiße Blut<br />
einströmen sollte, um geläutert wieder in die Adern zurückzukehren«
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 499<br />
1902:20> - Dztendearing. Was derzeit die diskursstrategische Verwechslung <strong>von</strong><br />
Organismus und Apparat meint, ist demnach ein Medium im Sinne seiner informationskybernetischen<br />
Definition. Aufseß< System entkoppelt die Sammlung<br />
<strong>von</strong> der Subjektivität des Sammlers, die immer auf dessen Einzelpersönlichkeit<br />
zugeschnitten ist; »ein Museum dagegen ist auf die Allgemeinheit zugeschnitten,<br />
und seine Sammlungen müssen immer nach einem systematischen Programm<br />
ausgebaut werden.« 13 Auch Lauffer sieht <strong>für</strong> die Gattung Historisches Museum,<br />
im Unterschied zum Kunstgewerbemuseum, den persönlichen Geschmack des<br />
Sammlungsleiters unmaßgeblich:<br />
»Bei dieser Art <strong>von</strong> Sammlungen hat der Direktor eine viel mehr gebundene Marschroute.<br />
Die Vermehrung ist hier vor allem abhängig <strong>von</strong> dem jeweiligen<br />
Stande der Wissenschaft, sie ist abhängig <strong>von</strong> dem System der Altertumskunde,<br />
deren Fortschritte sie begleitet und deren Erkenntnisse durch die Sammlungsgegenstände<br />
möglichst lückenlos belegt und veranschaulicht werden.« 14<br />
Ist das Dispositiv der Sammlung ein System, keine Erzählung, gibt sich das<br />
Gedächtnis als Maschine, die ihren Objekten den Speicherplatz zuschreibt.<br />
Schnittstellen zu den MGH, Blättersammlung und Katalog<br />
Wie im Fall des Projekts <strong>von</strong> Aufseß' (und unter ausdrücklichem, arbeitsteiligem<br />
Verweis auf dieses Modell) beginnt auch das in der Versammlung der deutschen<br />
Alterthumsforscher und historischen Vereine am 18. September 1852<br />
beschlossene Römisch-Germanische Centralmuseum zunächst nicht primär als<br />
Sammlung <strong>von</strong> Objekten und Originalen, sondern <strong>von</strong> Information und Kopien;<br />
keine staatliche Agentur hat die Macht, eine zentralmuseale Versammlung <strong>von</strong><br />
Originalalterthümern selbst aus den Vereins- und Staats-Sammlungen zu verfügen,<br />
so daß man in Mainz »lediglich vollkommen getreue Nachbildungen derselben<br />
zu vereinigen streben wird«. 15 Gedächtnis läßt sich als deutsches, d. h.<br />
zusammenhängend, nur in der Zusammenführung <strong>von</strong> Daten behaupten, als<br />
Gesammtübersieht der deutschen Altherthümer . Dazu<br />
bedarf es des Speichermedienverbunds <strong>von</strong> Museum, Bibliothek und Archiv, als<br />
dessen Bedingung die Standardisierung <strong>von</strong> Datenformaten in der Reproduktion<br />
und der Stellenwertlogik systematischen Gedächtnisses als Spiel <strong>von</strong> arrays<br />
13 Lauffer 1907, Heft 2, Kapitel III: Die Sammlungen <strong>von</strong> Altertümern und die lokale<br />
Begrenzung ihres Arbeitsgebietes, 78-89 (80)<br />
14 Lauffer ebd., Kapitel VI: Historische Museen und Kunstsammlungen, 89-99 (93)<br />
15 Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuseums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des<br />
Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabern) 1902, 1-72 (16)
500 MUSEUM<br />
und Variablen. Einmal gedächtniskybernetisch durchgespielt, läßt sich die Institution<br />
nicht mehr abschaffen, sondern nur noch ersetzen oder verschieben:<br />
»So wenig wie eine gute Universitätsbibliothek, falls sie einigermaßen auf der Höhe<br />
bleiben will, in der Not den Ankauf <strong>von</strong> neuen Büchern einstellen kann, so wenig<br />
darf das Römisch-Germanische Central-Museum als Centralarciv der deutschen<br />
Bodenurkunden darin erlahmen, wenigstens die wichtigsten neuen Typen, die alljährlich<br />
der Boden spendet, in getreuen Nachbildungen, Photographien oder Zeichnungen<br />
im Museum zu vereinigen, an der richtigen Stelle einzuordnen und durch<br />
entsprechende Veröffentlichungen in ihrer Gesamtbedeutung zur allgemeinen<br />
Kenntnis zu bringen. Bei einem etwaigen Zerfall des Central-Museums,<br />
das einzig in seiner Art in Deutschland die Aufgaben eines frühgeschichtlichen<br />
Nationalmuseums übernommen hat, bliebe dem Deutschen Reich wohl nichts<br />
anderes übrig, als irgendwo ein neues derartiges Nationalmuseum zu schaffen.« 16<br />
Das Vorwort des Herausgebers Hans Freiherr <strong>von</strong> Aufseß zur ersten Ausgabe<br />
der Monatsschrift Anzeiger <strong>für</strong> Kunde des deutschen Mittelalters (München 1832)<br />
benennt ausdrücklich die Orientierung seines Museumsprojekts und Systems am<br />
Modell der Monumenta Germaniae Historica; die Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche<br />
Geschichtskunde zu Frankfurt habe in den sechs Bänden ihres Mitteilungsorgans<br />
Archiv den Beweis geliefert, wie man zur Kenntnis der handschriftlichen<br />
Quellen der deutschen Mittelaltergeschichte gelangen könne. Der Schnitt liegt<br />
mit 1806 im Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation: »Die<br />
Rechtsalterthümer, wenn gleich anscheinend nicht mehr im praktischen Werthe<br />
, finden geistvolle und treue Bearbeiter und Sammler« .<br />
Der Begriff der Rechtsaltertümer, oszillierend zwischen Monument und Dokument,<br />
verlangt nach einer Disziplin, der Rechtsarchäologie: »Monumentale, bildliche,<br />
sachliche und nicht eigentlich urkundliche schriftliche Zeugnisse bilden den<br />
Stoff dieser Wissenschaft« 17 ; zu ihren Objekten gehören auch die immateriellen<br />
Denkmäler als Formen des Rechtsbrauches: Handlungen, Gesten, Körperhaltung,<br />
die in Rechtsbestimmungen, in Beschreibungen und bildlichen Darstellungen<br />
überliefert wurden. 18 Dieser Monumentalästhetik entspricht die Wende zur<br />
16 Karl Schumacher, Das Römisch-Germanische Central-Museum <strong>von</strong> 1901-1926, in:<br />
Festschrift zur Feier des fünfundsiebzigjährigen Bestehens des Römisch-Germanischen<br />
Central-Museums, Mainz (Wilckens) 1927, 57-97 (83f). Die Sammlung des Zerstreuten<br />
(ebd.) soll mithin nicht selbst der Dekonstruktion anheimfallen können; damit steht<br />
und fällt die Behauptung, der Name einer gedächtnisemphatischen <strong>Geschichte</strong>.<br />
17 Adolf Laufs, Die Fehrsche rechtsarchäologische Bildersammlung, in: Aus der Arbeit<br />
des Archivars. Festschrift <strong>für</strong> Eberhard Gönner, hg. v. Gregor Richter, Stuttgart (Kohlhammer)<br />
1986, 361-374 (362 u. 368, Anm. 45<br />
18 Witold Maisei, Gegenstand und Systematik der Rechtsarchäologie, in: Louis Carlen<br />
(Hg.), Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde, Bd. 1 / 1978,<br />
4-24 (4), zitiert nach: Laufs, a.a.O.
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 501<br />
material culture im GNM: »Am meisten vernachläßigt wurde bisher wohl die<br />
bildende Kunst mit ihren Denkmälern deutscher Vorzeit« .<br />
Es gab einmal eine Zeit, in der Historie nach ihren Materialitäten meßbar war,<br />
mit einem archäologischen Blick auf Archiv-Artefakte:<br />
»So lange man noch mitten unter uns fortfährt, durch öffentliche Aufstriche alte<br />
Registraturen, ohne vorherige genaue Durchsicht und Auswahl, zum Einstampfen<br />
in Papiermühlen zu verkaufen, (kürzlich habe ich selbst mit Mühe aus Juden-Händen<br />
einige Zentner alter Rechnungen und Akten aus dem 15tcn bis 17ten Jahrhundert<br />
vom gewissen Untergange errettet); so lange noch Pergamenthändler auf<br />
die kläglichste Weise alte Manuscripte und Urkunden vernichten, (unlängst habe<br />
ich einen Codex mit Mahlereien aus dem 15. Jahrhundert, und ein Urkundenbuch<br />
aus dem 14. Jahrhundert dem Gewichte nach erkauft); so lange noch in den allermeisten<br />
Privatarchiven und Registraturen der Städte, Stiftungen und adelichen<br />
Geschlechter Würmer und Moder ihre Verheerungen fortsetzen dürfen, und<br />
eine unglaubliche Unordnung kaum an eine Benüthzung denken läßt , so lange<br />
noch durch die Zerstörung der Witterung, weit mehr aber durch den Vandalismus<br />
der Alterthumsfeinde und Ignoranten die herrlichsten Denkmäler alter Bildnerei<br />
und Baukunst zu Grunde gerichtet werden, ohne daß eine schützende Hand zu<br />
finden wäre, - so lange werde ich meine Klage fortsetzen.« <br />
Denn Datenspeicher tendieren zur Entropie. Dieser Verlust ist als solcher ablesbar<br />
erst »in einer Zeit, wo man aufgeklärt und wissenschaftlich gebildet seyn<br />
will« . Ein Medium setzt ein Diskussionsforum durch synchronisierende<br />
Schaltung:<br />
»Indem ich die Herausgabe dieses Anzeigers auf mich nahm, ging ich <strong>von</strong> der Ansicht<br />
aus, daß es vor Allem nothwendig sey, erst eine genaue Kenntnis vom Daseyn<br />
aller Quellen zu erhalten, bevor man die Auswahl derselben zur eigentlichen Benützung<br />
selbst vornehmen könne . Daher lag es zugleich mit in meiner Absicht,<br />
durch diese Anzeiger eine beständige Wechselwirkung, eine offene Correspondenz<br />
zwischen allen Denjenigen, welche thätig im Fache der deutschen <strong>Geschichte</strong>,<br />
Alterthumsforschung oder Kunst sich bezeigen, herzustellen.« <br />
<strong>Geschichte</strong> als Diskurs beruht auf Rückkopplungen im Medium Schrift; Informationsübertragung<br />
heißt hier sehr konkret Post, als Gabe: Selbst die kleinsten<br />
Notizen, »die mir unfrankiert Jeder durch die Post oder auf Buchändlerwegen<br />
nach Nürnberg, unter der Aufschrift >Redaction des deutschen Anzeigen<br />
zusenden möge, sind nun die erste Erwartung, welche ich <strong>von</strong> dem<br />
Publikum zu hegen mich berechtigt fühle« . Das Archiv schreiben heißt<br />
hier zunächst: Abschreiben + Kommentieren. Bevor Nachrichten zu <strong>Geschichte</strong><br />
verarbeitet werden können, müssen sie als Gedächtnis adressierbar sein - die<br />
Herstellung diskursiven Geschichtsbewußtseins ist eine Funktion <strong>von</strong> Speicherkybernetik.<br />
<strong>Im</strong> Vorwort zum 2. Jg. seines Anzeigers (Nürnberg 1833) korreliert<br />
<strong>von</strong> Aufseß das Quantum der Nachrichtensendungen mit der Schwelle,<br />
ab der Information strukturiert werden kann:
502 MUSEUM<br />
»Wer sich überzeugt, wie viel Materialien zur Füllung nur Eines so großen Bogens<br />
gehören , wird nicht mißkennen, wie es zu wünschen wäre, wenn nicht sehr<br />
große Vorräthe immerwährend eingesendet werden. Gerne wollte ich z. B. passendere<br />
Zusammenstellungen bei der Rubrik >Denkmäler der Vorzeit< einführen,<br />
wenn durch reiche Auswahl dies möglich wäre. So muß ich freilich immer noch<br />
auf eine andere Ordnung verzichten, als die eingeführte, wobei jedoch das Aufsuchen<br />
durch das genaue Register erleichtert ist.« <br />
So stellt sich der Herausgeber seinen Anzeiger »als ausgebildetes Institut im<br />
Geiste« vor, welches Historie instituiert, und hofft, das Organ werde zu dem,<br />
was er sein soll, nämlich »ein allgemeines Correspondenzblatt und ein Repertorium<br />
der Geschichtsquellen und aller Denkmäler unseres Mittelalters« . Seine Entdeckung einer deutschen Kultur- und Mentalitätsgeschichte<br />
ist eine implizite Kritik an der medial einkanaligen Quellenselektion der MGH:<br />
»Soll aber eine gründliche Umgestaltung der Geschichtsschreibung erfolgen,<br />
so müssen sich freilich große Talente und gründliche Forscher dazu beilassen, aus<br />
Quellen Historie zu schreiben, die dem Volke lieb wird . Ueber die Gründlichkeit,<br />
mit der man die Buchstaben der Chroniken und Urkunden studiert, darf<br />
die Erforschung des Geistes, der über und in denselben waltet, nicht vergessen<br />
werden. Doch zu solcher Forschung gehören, außer den alten Chronisten, Urkunden<br />
und Akten, auch noch ganz andere Quellen, gehört gleichsam eine Zeichenund<br />
Bildersprache der Vorzeit, welche über Dinge, die in den schriftlichen Quellen<br />
nimmermehr zu finden sind, die nöthigen Aufschlüsse und zu jenen Pergamenten<br />
erst das richtige Verständnis gibt.« 19<br />
§ 6(b) der Satzungen des GNM definiert die Schnittstelle zu den MGH präzise,<br />
denn nach Herstellung dieser Repertorien soll aus der Gesamtquellenmenge das<br />
Vorzüglichste und Wesentlichste durch Veröffentlichung dem gelehrten Publikums,<br />
vor allem aber an den Monumenta der Frankfurter Gesellschaft <strong>für</strong> älter<br />
deutsche Geschichtskunde vorgelegt werden: »vorzugsweise die <strong>von</strong> derselben<br />
nicht bearbeiteten Zweige deutscher Geschichtswissenschaft, Literatur, Kunst<br />
und Archäologie berücksichtigend« 20 - Arbeitsteilung in der Speicherverwaltung<br />
des deutschen Gedächtnisses.<br />
Das GNM als Institution ist eine Stiftung; seinerseits stiftet es deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> als Zusammenhang dort, wo sie bislang vielmehr disparat wahrgenommen<br />
wurde. Tradition bedarf der Institution, um den Zeichentransfer zu sta-<br />
19 Hans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufseß, Zweite Denkschrift <strong>für</strong> die höchsten und hohen<br />
deutschen Regierungen, das germanische Nationalmuseum in Nürnberg betreffend,<br />
Nürnberg 1861, 10<br />
20 Hier zitiert aus dem Anhang zu: Hans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufseß, Das germanische<br />
Museum und seine nationalen Ziele. Denkschrift zur Erläuterung des dem norddeutschen<br />
Bundesrath vorliegenden Haupt'schen Gutachtens über dieses Museum, Lindau<br />
(Stettner) 1869, 18
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 503<br />
bilisieren, eines greifbaren Bandes. Ein solches Gesammtorgan zu schaffen,<br />
»vermöge dessen das örtlich Getrennte und Zerstreute, aber innerlich Zusammengehörige<br />
einen geistigen Einigungspunkt erhält, ohne selbst körperlich<br />
centralisiert und seinem bisherigen Bestimmungsort entrückt werden zu müssen«,<br />
sei die Grundidee des germanischen Museums , also ein<br />
semiotechnischer Kunstgriff, der nur im Medium Repertorium, also als Datenbank<br />
zu leisten ist. Ein 1860er Druck 21 des Grundrisses der Karthause zu Nürnberg,<br />
Sitz des germanischen Museums, zeigt neben den Ausstellungsräumen die<br />
jeweils betreffenden Büros <strong>für</strong> die Repertorien; ein Raum ist darin ausdrücklich<br />
designiert <strong>für</strong> das Generalrepertorium. Die Institution eines Nationalmuseums<br />
inmitten eines partikularisierten Staatenverbund ist zunächst die Funktion eines<br />
Mangels. Diese Idee entspricht den besonderen Verhältnissen eines Landes, das<br />
die Zentralisation der Originalschätze nicht zuläßt. Das Nürnberger Haus speichert<br />
zwar auch Originalschätze, fungiert aber vorrangig als Generalrepertorium:<br />
»Mit Freuden können wir Deutschen darauf verzichten in Originalen alle diese<br />
Schätze in Einem Lokale zu vereinigen , wenn wir so weit sind, zu wissen, wo<br />
etwas zu finden ist und vorläufig alles Dieß in organisch-wissenschaftlicher Ordnung<br />
zu Papier gebracht haben. Es wird dann durch reichliche Unterstützung auch<br />
möglich werden, neben diesen bloß beschreibenden Verzeichnissen <strong>von</strong> den<br />
wesentlichen und besten Gegenständen Abgüsse, Zeichnungen, wie schriftliche<br />
Kopien zu erlangen und im Nationalmuseum wohlgeordnet zusammen zu stellen,<br />
um so dem Forscher in den meisten Fällen die Originalien selbst bei seinen Arbeiten<br />
entbehrlich zu machen.« 22<br />
Das Projekt GNM muß also - analog zum Projekt der MGH auf der Dokumentenebene<br />
- Zusammenhang stiften, wo (noch) keiner vorliegt. Die Hermeneutik<br />
des 19. Jahrhunderts emendiert nicht nur mittelalterliche Handschriften,<br />
sondern auch die Gedächtnisordnung der Dinge. Nichts macht die Differenz<br />
zur überlebten Ästhetik der Kunst- und Wunderkammer deutlicher als der Versuch<br />
des GNM Nürnberg, seine Gruppen naturgemäß zu ordnen, also durch<br />
Unterstellung eines organizistischen, transzendenten Signifikats namens (Kultur-)<br />
<strong>Geschichte</strong>. Essenwein sieht sich damit beschäftigt, in einer Totalrevision<br />
der Sammlungen und Kataloge »die letzten Inkonsequenzen zu beseitigen und<br />
die zusammengehörigen Gruppen müssen auch wohl <strong>für</strong> die nächste Zeit festgehalten<br />
werden, wenn nicht auf's Neue das ganze Museum in ein Chaos zerlegt<br />
und daraus wieder neu geschaffen werden soll.« <br />
Dieser Effekt ist eine Funktion <strong>von</strong> Gedächtniskybernetik - Praxis der Admi-<br />
21 In: GNM, Archiv, Registratur, Kapsel la, »Druckschriften 1830 ff«<br />
22 Bekanntmachung und Aufruf, das germanische Nationalmuseum betreffend, Artikel<br />
in: Korrespondent <strong>von</strong> und <strong>für</strong> Deutschland, 19. Juni 1853, 1309 f (Archiv GNM,<br />
Registratur, Kapsel la, fasc. »1852-54 Gründung«
504 MUSEUM<br />
nistration, jener non-diskursiven Exteriorität (Archiv im Sinne Foucaults als<br />
Gesetz), die in der diskursiven Präsentation zugunsten der unterstellten inneren<br />
Zusammenhänglichkeit der Objekte dissimuliert wird:<br />
»So müssen naturgemäß der Aufbewahrung und Verwaltung wegen alle Blättersammlungen<br />
in äußeren Zusammenhang gebracht werden; das System legt die<br />
Städteansichten, die Landkarten, die Porträte, die kulturgeschichtlichen Darstellungen,<br />
die Blätter, welche die <strong>Geschichte</strong> des Holzschnitts und der Kupferstechkunst<br />
repräsentieren, weit auseinander; in der Praxis ist eine Verwaltung nicht<br />
denkbar, wenn diese nicht in äußerem Zusammenhange stehen. Zuweilen sind es<br />
auch unsere Lokalitäten, welche den verschiedenen Gruppen einen andern Zusammenhang<br />
anweisen.« <br />
Räumliche, inventarische und semantische Ordnung differieren. »The collection<br />
is not constructed by its Clements; rather, it comes to exist by means of its<br />
principle of organization.« 23 Nicht nur werden zu allen Abteilungen entsprechende<br />
Kataloge geführt, sondern schließlich in doppelter Buchführung ein<br />
numerischer (oder Inventar-)Katalog und ein systematischer:<br />
»Jeder Gegenstand erhält, sobald er in die Abtheilung eingereiht wird, eine Nummer,<br />
welcher außerdem der Buchstabe der Abtheilung beigefügt ist, und wird in<br />
den numerischen oder Inventarkatalog ganz kurz eingetragen. Dieser Inventarkatalog<br />
ist gebunden; der systematische Katalog dagegen besteht aus losen Blättern,<br />
deren jedes eine ausführliche Beschreibung des betreffenden Gegenstandes, sowie<br />
die Nr. desselben enthält. Die systematische Ordnung ist darin strenge festgehalten,<br />
und jeder Zugang wird sofort an die betreffende Stelle zwischen die andern<br />
Zettel eingeschoben. Da wir nicht unbedingt vor Irrthum geschützt sind, so ist es,<br />
wenn sich bei der Bestimmung und Beschreibung eines Gegenstandes ein Fehler<br />
eingeschlichen hat, sehr leicht möglich, jeden Augenblick an Stelle des falschen<br />
Zettels einen richtigen einzuschalten oder, wenn in der Reihenfolge der Zettel ein<br />
Mißgriff gemacht wurde, denselben zu beseitigen. Die Sammlung selbst ist<br />
ohnehin, wo nicht die Oertlichkeiten zu einer Abweichungen zwingen, in derselben<br />
Folge geordnet wie der systematische Katalog.« <br />
Hier schreibt sich der Prolog zur modularen Ästhetik der Programmierung <strong>von</strong><br />
Gedächtnis. In dieser Ordnung zählt Zeit nicht,- Materie fügt sich einer räumlichen,<br />
indexikalischen, verweisenden, mithin also: semiotischen Ordnung. Essenweins<br />
Bericht ist eine Schalttafel des Museums, dessen Logistik er als Hypertext<br />
(avant la lettre) definiert:<br />
»Wir haben bei einzelnen Abtheilungen erwähnt, daß neben den betreffenden<br />
Katalogen eine Reihe <strong>von</strong> Aufzeichnungen hergehen. Wo es sich nur um wenige<br />
kurze Verweisungen handelt, da kann leicht an jeder Stelle des systematischen<br />
Katalogs ein besonderer Zettel eingeschaltet werden, der diese Verweisungen<br />
23 Susan Steward, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir,<br />
the Collection, Baltimore (Johns Hopkins UP) 1984,155, zitiert nach: Crane 1992: 158
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 505<br />
enthält; wo jedoch die Zahl derselben eine sehr große wurde, da ist es zweckmäßiger,<br />
diese Verweisungen zu einem besonderen Repertorium zu vereinigen.<br />
Dies ist z. B. der Fall bei der Sammlung der Holzschnitte und Kupferstiche, wo<br />
die in der Bibliothek eingereihten Werke viele Illustrationen enthalten, welche <strong>für</strong><br />
die <strong>Geschichte</strong> dieser Künste <strong>von</strong> Wichtigkeit sind. Hier ist ein besonders Verzeichnis<br />
der in der Bibliothek vorhandenen Kupferstiche und Holzschnitte aufgestellt.«<br />
<br />
Hinzu kommen alphabetische Personen- und Ortsregister. Auf der Ebene der<br />
Dokumentation im Medienverbund ist die Differenz <strong>von</strong> Original und Abbildung<br />
(semiotisch) nicht mehr entscheidend, ganz wie in der Überführung <strong>von</strong><br />
Objekten und Texten, Räumen und Stellen in das Reich uniformer Lettern der<br />
Historiographie. Standardisierung macht überhaupt erst heterogene Teilmengen<br />
(aus Archiv, Bibliothek, Museum) im <strong>Namen</strong> einer als homogen unterstellten<br />
Historie prozessierbar; bereits Aufseß< System <strong>von</strong> 1853 deklariert die<br />
Kombination <strong>von</strong> Museum, Bibliothek und Archiv als Begründung einer neuen<br />
Ordnungswissenschaft, »<strong>für</strong> welche ihm sozusagen nur noch der Begriff der<br />
Dokumentation fehlte.« 24 Auch die Differenz zwischen Primär- und Sekundärzitat<br />
ist im Reich Gutenbergs nur noch eine der Kennzeichnung durch graphische<br />
Operatoren, nicht aber aus der Materialität der Dinge ableitbar (etwa<br />
Manuskript oder Urkunde versus Buchdruck). Ist sie damit zum Verschwinden<br />
gebracht worden, oder vielmehr auf die Spur einer Spur reduziert, irreduzibel?<br />
Graphisch entgeht dieser Aporie erst das Verfahren optischer Einlesung und<br />
Wiedergabe der heterogenen Quellen, die damit die Ansicht ihrer Eigenart diskret<br />
bewahren Für die Wappen als Objekt wissensarchäologischer Studien wird<br />
im GNM ein Speziallexikon aus Verweisen auf Figuren, Familien u. a. zusammengestellt.<br />
Massendaten und die daraus resultierende Notwendigkeit der<br />
Reduktion ihrer Komplexität zwingen die Speicher- und Klassifikationslogistik<br />
der Gedächtnismaschine Museum zu neuen Verfahren:<br />
»Früher wurden alle neue Zeichnungen, Abbildungen u. s. w. gleichfalls mit Nummern<br />
und Katalogzetteln versehen und als Theile der Hauptsammlung betrachtet,<br />
überhaupt im Kataloge ebenso wie Originalgegenstände behandelt. Als<br />
jedoch das Direktorium die Nothwendigkeit empfand, die Sammlung dieser<br />
Abbildungen entschieden zu fördern, und als in den jüngsten Jahren die Zugänge<br />
in Folge dessen tausendweise geschahen, war es nicht mehr möglich, dieses System<br />
aufrecht zu erhalten. Die Einrichtung mußte daher so getroffen werden, daß die<br />
Blätter durch ihre systematische Ordnung einen Katalog vollständig überflüssig<br />
24 Johannes Rogalla <strong>von</strong> Bieberstein, Archiv, Bibliothek und Musem als Dokumentationsbereiche.<br />
Einheit und gegenseitige Abgrenzung, Pullach b. München (Verlag<br />
Dokumentation) 1975, 47; v. Bieberstein weist ebd. (46f.) auf das Vorbild <strong>von</strong> Jerzy<br />
Mniszechs Gedanken über die Gründung eines Museum Polonicum (1775) und das<br />
Böhmische Museum <strong>von</strong> 1818 als Medienverbund hin.
506 MUSEUM<br />
machten, und daß daraus nach und nach das jetzt fast alle Abtheilungen der Sammlungen<br />
begleitende Bilderrepertorium entstand, welches einen sehr zweckmäßigen<br />
Cursus der gesammten Alterthumswissenschaft, soweit sie sich durch<br />
darstellbare Monumente verfolgen läßt, repräsentiert.« <br />
Damit ist der Katalog auf die Dinge gefaltet, die scheinbar selbst dessen Ordnung<br />
vorzugeben scheinen - eine Verkehrung <strong>von</strong> Gedächtnisordnung und <strong>Geschichte</strong>,<br />
der <strong>von</strong> Roland Barthes als rhetorische Operation beschriebene Effekt des<br />
Realen. 2 ^ Erst die Kopplung <strong>von</strong> Katalog und Diskurs generiert Historie. Unter<br />
ausdrücklichem Bezug auf den Versuch des GNM, »die gesamte germanische Vergangenheit<br />
nach allen Kategorien in historischer Sammlung herzustellen und in Repertorien nachzuweisen«, begründet Droysen das<br />
endliche »Prinzip <strong>für</strong> alle Sammlungen <strong>von</strong> Dingen, die den Menschen angehen«:<br />
das historische. Diese Kopplung aber ist gegenseitig bedingt, denn »andererseits,<br />
das einzige Mittel, diese Dinge als historisches Material verwendbar zu machen,<br />
ist, es zu sammeln und zu katalogisieren« 2 ^ - Mechanismen zur Mobilisierung des<br />
Gedächtnisses.<br />
Schrift und Information: Deutschland als Datenstruktur,<br />
General-Repertorium, Organismus und Bibliotheksphantom<br />
Die kulturtechnische Funktion <strong>von</strong> Schriftzeichen war es immer schon, Abwesendes<br />
zu repräsentieren; am Ende steht eine Zeichenwelt, die frei <strong>von</strong> empirischem<br />
Analogiezwang, aber doch strukturanalog zur Welt des Bezeichneten ist.<br />
Einbildungskraft - und insbesondere die historische - ist »das der Schrift zuarbeitende<br />
subjektive Vermögen, die alphabetisch verzeichneten Analogien in<br />
Anschauung zurückzuverwandeln.« 27 Dem steht die aktuelle wissensarchäologische<br />
Abkehr vom Begriff der Information als etwas Abbildendem entgegen;<br />
Informationstechnologie funktioniert nach dem Prinzip <strong>von</strong> Informationsteuerung,<br />
und nur an bestimmten Schnittstellen (Benutzeroberflächen) sind diese<br />
Steuerungen in die vertraute Sprache abbildender Sachinformation zurückübersetzbar.<br />
»Information nicht mehr als Information ><strong>von</strong> etwas
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 507<br />
Gegenüber dem auf Vollständigkeit in der Zusammenstellung alles vorhandenen<br />
Quellenmaterials zielenden Generalrepertorium kann die tatsächlich in<br />
Nürnberg vorhandene Sammlung nur eine metonymische Funktion erfüllen und<br />
»durch die systematische Anordnung des Aufgestellten und die auf Mannichfaltigkeit,<br />
so daß wo möglich jedes Fach vertreten wird, abzielende Auswahl des<br />
Dargebotenen gleichsam ein Muster derartiger Sammlungen bilden«. 28 Demnach<br />
soll das GNM »nicht sowohl eine Schau- oder Ausstellung <strong>von</strong> Originalprachtwerken<br />
als vielmehr ein Centralpunkt zur Belehrung und Uebersicht über<br />
die gesammte nationale Literatur, Kunst, <strong>Geschichte</strong> und Kultur sein« . Was bleibt, ist der Akzent auf der Dokumentation, als Mikrochip des<br />
Gedächtnisses. Kultur ist das aufgezeichnete Gedächtnis gegenüber der Vergänglichkeit<br />
der Artefakte. Registrierte Wissensräume aber leiden darunter, daß<br />
ihnen die Möglichkeit der Orientierung realer Körper in realen, mithin musealen<br />
Räumen fehlt. Die Ordnung des Repertoriums ist eine wissensarchäologische,<br />
äußerliche, insofern sie Vergangenheit nicht gemäß einer historischen<br />
Semantik klassifiziert; <strong>von</strong> Aufseß< Sendschreiben an die Versammlung der deutschen<br />
Rechtsgelehrten, Geschichts- und Sprachforscher in Frankfurt/M. 1846<br />
betont »die Zusammenstellung <strong>von</strong> gleichartigen Stoffen zu einem systematisch<br />
geordneten Ganzen, bei dem zunächst die Gewichtigkeit der einzelnen Materialien<br />
<strong>für</strong> Aussagen zu den Sachbereichen ausgeklammert blieb«. 29 Ein Echo<br />
des <strong>von</strong> Aufseß'schen Systems schreibt sich im kulturgeschichtlichen Konzept<br />
Karl Lamprechts weiter; die Disposition seiner Bonner Vorlesung Deutsche<br />
Altertümer hat ein studentisches Kollegheft festgehalten:<br />
»I. Politische <strong>Geschichte</strong>. 1. bis zur Augustinischen Zeit<br />
2. Rom u. die Deutschen bis zur Enstehung der Stammeseinheit.<br />
II. Reale und ideale Cultur<br />
III. Land und Volk.<br />
IV. der Staat.<br />
V. Das Kriegswesen<br />
VI. Die Wirtschaft<br />
VII. Haus und Familie.<br />
VIII. Geistesleben.« 30<br />
28<br />
Alexander Ziegler, <strong>Geschichte</strong> Deutscher National-Unternehmungen, Dresden<br />
(Höckner)1863,44<br />
29<br />
Bernward Deneke, Das System der deutschen Geschichts- und Altertumskunde des<br />
Hans <strong>von</strong> und zu Aufsess und die Historiographie im 19. Jahrhundert, in: Anzeiger<br />
des GNM 1974, Nürnberg 1974, 144-158 (145f)<br />
30<br />
Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, Rep. 92, Nachlaß Meinecke, Nr. 116, Kollegheft<br />
»Dr. C. Lamprecht. Deutsche Altertümer. Bonn, S.S.8. (Heft <strong>von</strong> M. Thischke)«, 6<br />
(»Disposition«)
508 MUSEUM<br />
<strong>Im</strong> Sinne solcher Abteilungen ist auch das GNM ist ein System; sein Repertorium<br />
aber wird nicht als Medium, sondern als Organismus 31 verhandelt: »Das<br />
germanische Museum ist wesentlich und vor Allem ein vermittelndes Organ,<br />
kein producierendes, und wenn zwar die Production nicht völlig ausgeschlosen<br />
ist, so darf doch diese statutengemäß erst in zweiter Linie in Betracht kommen«<br />
. Information wird im System des GNM nicht nur gesammelt<br />
und gespeichert, sondern auch unmittelbar übertragen. Die Einrichtung<br />
eines Anfragenbureaus gibt zunächst zu Mißverständnissen Anlaß; während das<br />
Museum Anfragen <strong>von</strong> historischem Belang erwartet, »liefen eine Masse Fragen<br />
ein über Abstammung, <strong>Namen</strong> und Wappen <strong>von</strong> Familien, deren Einfluß<br />
auf die Gestaltung der deutschen <strong>Geschichte</strong> selbst dem schärfsten Auge des<br />
Forschers ewig verhüllt bleiben wird« . Das transzendente<br />
Signifikat <strong>Geschichte</strong> findet zunächst - und zumal vor der Reichsgründung <strong>von</strong><br />
1871 - nicht emphatisch statt, sondern als Kollektivsingular individueller<br />
<strong>Geschichte</strong>n. Auch Aufseß< eigener Widerstand gegen eine auf pure Verzeichnung<br />
des historischen Werts reduzierte Erfassung <strong>von</strong> Urkunden (ihre Semiotisierung<br />
als Historie) liest sich vor dem Hintergrund so genealogisch konkreter,<br />
als es die national-systematische Argumentation als diskursive Strategie transparent<br />
werden läßt. Seine Familie, zum fränkischen Uradel zählend, verlor mit<br />
dem Ende des Alten Reiches 1806 den Großteil seiner Privilegien und bis 1850<br />
auch die letzten Sonderrechte; an diese Leerstelle tritt das kulturwissenschaftlich<br />
definierte Gedächtnis des GNM, das mit Diskontinuitäten rechnet.<br />
Läßt sich das durch <strong>von</strong> Aufseß konzipierte Generalrepertorium plausibel in<br />
Begriffen der Informatik, d. h. durch Algorithmen und Datenstrukturen<br />
beschreiben, oder vielmehr in Differenz dazu ? Handelt es sich hier doch um ein<br />
»nach seiner Beschaffenheit diffuses, vielfältig beziehbares Material«, also diffizil<br />
adressierbar. 32 Auch Speicherprogramme sind letztlich konkrete Formulierungen<br />
abstrakter Klassifikationen, die sich auf bestimmte Darstellungen und<br />
Datenstrukturen stützten. 33 Gilt dies auch <strong>für</strong> archivisch-museale Datenklassifikation?<br />
»Erstens hat man das intuitive Gefühl, daß Daten den Algorithmen<br />
vorangehen: man muß Objekte haben, bevor man Operationen auf sie anwenden<br />
kann« . Das Prinzip Realkatalog bildet die Ordnung des<br />
Wissens im Speicher buchstäblich noch ab; insofern gilt, daß seine Daten<br />
zunächst Abstraktionen realer Phänomene darstellen und vorzugsweise als<br />
31 Zur Spannung <strong>von</strong> Mechanik und Bildung in der deutschen Romantik siehe David F.<br />
Lindenfeld, The practical imagination: the German science of State in the nineteenth<br />
Century, Chicago / London (University of Chicago Press) 1997<br />
32 Hans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufsess und die Anfänge des Germanischen Nationalmuseums.<br />
Ausstellungskatalog Nürnberg 1972, Vorwort<br />
33 Vgl. Nikiaus Wirth, Algorithmen und Datenstrukturen, Stuttgart (Teubner) 1975, 7
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 509<br />
abstrakte Strukturen formulierbar sind. Datenbanken vom Typus General-<br />
Repertorium sind eine Abstraktion der Wirklichkeit des deutschen Kulturgedächtnisses,<br />
weil die im Rahmen des Ordnungssystems nebensächlichen und<br />
belanglosen Eigenschaften und Besonderheiten der realen Objekte unberücksichtigt<br />
bleiben - der <strong>für</strong> Historiker entscheidende Kontext.<br />
Papritz zufolge soll das General-Repertorium »den alten Traum der Archivare<br />
verwirklichen und den Gesamtinhalt eines mehrzelligen Archivs nach<br />
einem Gesamtplan ohne Rücksicht auf die Provenienz, d. h. nach dem Pertinenz-Prinzip<br />
nachweisen. Zugleich soll es den Mangel der alphabetischen<br />
Sachindices vermeiden.« 34 Die Herstellung eines General-Repertoriums erinnert<br />
an die Praxis des Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß, <strong>für</strong> den archivischen Teil des General-Repertoriums<br />
deutscher Kulturmonumente am Nürnberger Germanischen<br />
Nationalmuseum Abschriften <strong>von</strong> Regesten deutscher Archive zu organisieren:<br />
»Das General-Repertorium wird aus den Abfall-Produkten der Fondsrepertorien<br />
genährt; es werden dazu die entsprechend genormten Karteikarten<br />
benutzt« . Außer der Verwertung der Abfall-Produkte, die bei der archivischen<br />
Verzeichnungsarbeit <strong>von</strong> Fonds-Repertorien entstehen, hat das General-Repertorium<br />
noch die Funktionen der Daten-Rückkopplung im Auskunftsund<br />
Benutzerdienst: »Die Sacharbeiter müssen zu diesem Zweck über jede<br />
vom Archiv erteilte Auskunft und über jedes Benutzungsgesuch eine (rote)<br />
Karteikarte ausfüllen, die das Thema in Form eines Aktentitels nennt«, um<br />
etwa wissenschaftliche Arbeiten diverser Benutzer zu koordinieren .<br />
Dabei vermag das General-Repertorium die auf der Grundlage des Provenienzprinzips,<br />
also im Wissen um die administrative Genese der Schriftstücke<br />
geführte »wissenschaftliche Recherche nicht zu ersetzen . Es arbeitet im<br />
Gegensatz dazu mehr oder weniger mechanisch« . Gedächtnismaschinen<br />
bleiben diskret. Variablen eines fundamentalen Systems ändern nur<br />
ihren Wert, aber niemals ihre Struktur und nie die Wertemenge, die sie annehmen<br />
können. Folglich bleibt die Größe des musealen Speichers, den sie im<br />
GNM belegen, konstant. Die Hardware des musealen Speicherraums schreibt<br />
an der symbolischen Verzeichnung seiner Objekte mit; die Festlegung des<br />
Systems korrespondiert mit den Formaten des Magazins.<br />
Aus Anlaß des 100. Todestags <strong>von</strong> Aufseß' weist ein GNM-Ausstellungskatalog<br />
darauf hin, daß der in Nürnberg ausgebildete Altertumswissenschaftler<br />
Otto Lauffer das Prinzip <strong>von</strong> dessen Systematik ins 20. Jahrhundert übersetzt<br />
hat 35 ; am Ursprungsort aber ist es gescheitert. Ein Konflikt des Museumsgrün-<br />
34 Johannes Papritz, Archivwissenschaft, 2. durchges. Ausgabe Marburg (Archivschule)<br />
1983, Bd. 4, Teil 111,2: Archivische Ordnungslehre, zweiter Teil, 282<br />
35 Katalog GNM 1972, unter Verweis auf: Lauffer 1907
510 MUSEUM<br />
ders mit A. v. Essenwein, dem Ersten Direktor des Museums seit 1866, um die<br />
Fortsetzung des Generalrepertoriums (besonders des Archivs) manifestiert es,<br />
nachdem dessen Abbruch in einem Gutachten M. Haupts vom 19. August 1868<br />
zugunsten einer Konzentration auf die realen kulturgeschichtlichen Sammlungen<br />
<strong>von</strong> Musealien gefordert wurde. Aufseß beharrt auf dem Informationsverbund:<br />
»So kann nimmermehr ein germanisches Nationalmuseum in Wahrheit<br />
und mit Ehren bestehen, wenn es sein Archiv aufgibt und die Urkunden als<br />
bloße Schreibmuster in die Antiquitätensammlung verweist.« 36 Diese Verschränkung<br />
<strong>von</strong> Museum und Archiv ist im Falle eines Schwesterinstituts, des<br />
Frankfurter Historischen Museums, evident. <strong>Im</strong> Verein mit der im gleichen<br />
Gebäude untergebrachten historischen Abteilung des Stadtarchivs (also ohne<br />
die kurrenten-Akten, in Trennung <strong>von</strong> Macht und Kanzlei) ist es berufen, »die<br />
Erinnerung an Frankfurts reiche Vergangenheit allezeit lebendig zu erhalten« -<br />
eine Sicht der Dinge, »die mit der Definition des Musems als besonderem wissenschaftlichem<br />
Archiv Bezüge sucht, <strong>von</strong> denen zuvor nie die Rede war.« 37<br />
Diese Übertragung der Archivästhetik auf den Raum des Museums bedeutet<br />
dessen Wissensarchäologisierung. Der Tübinger Stiftsbibliothekar Hans Reichardt<br />
weiß 1846, daß in der Altertums- als Denkmälerkunde die pure Erfassung<br />
und Zusammenstellung, also Sammlung und Speicherung der Quellen noch<br />
keine Wissenschaft des damit intendierten Gegenstandes ausmachen; erst in der<br />
diskursiven Verarbeitung transformiert sie zum (mutilierten) Geschichtskörper:<br />
»Insofern erscheint Altertumswissenschaft als das Resultat der Durchdringungen<br />
zweier Faktoren, des gegebenen Objekts und des begreifenden Subjekts, und enthält<br />
daher das reale Leben des Alterthums, das als solches untergegangen ist, in geistiger<br />
Form wiederhergestellt. Oder : isolierten und toten Denkmälern, denen<br />
die innere Totalität, welche die einzelnen Organe zu einem Organismus verbindet,<br />
verloren gegangen ist, wird durch die Wissenschaft der Zusammenhang, welcher<br />
in der antiken Welt auf reale Weise, in der Form der äußeren sinnlichen<br />
Erscheinung vorhanden war, in geistiger Form mitgeteilt.«^<br />
Das Nürnberger Generalrepertorium aber zeichnet schlicht auf. Deutschlandweite<br />
Portofreiheit gilt dabei <strong>für</strong> die Übermittlung entsprechender lokaler<br />
Information an das GNM nur bedingt - ein Defekt des auf local knowledge aus<br />
36 Hans v. Aufseß an die Mitglieder des Verwaltungsausschusses, Kreßbronn, 1. Mai<br />
1869, zitiert im Katalog GNM 1972, Dokument H 14<br />
37 Das Historische Museum Frankfurt am Main - Plan, Gründung und die ersten fünfundzwanzig<br />
Jahre, in: Trophäe oder Leichenstein? Kulturgeschichtliche Aspekte des<br />
Geschichtsbewußtseins in Frankfurt im 19. Jahrhundert. Eine Ausstellung des Historischen<br />
Museums Frankfurt, Frankfurt 1978, 23-48 (40)<br />
38 Hans Reichardt, Die Gliederung der Philologie, Tübingen 1846, bes. 11, 32ff, zitiert<br />
nach: Deneke 1974: 153
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 511<br />
den diversen Geschichts- und Altertumsvereinen angewiesenen Unternehmens.<br />
Mit <strong>von</strong> Aufseß' Idee eines Repertoriums vornehmlich <strong>für</strong> Urkunden korrespondiert<br />
später die eines Zentralkataloges deutscher Bücher; erst Ende des 19.<br />
Jahrhunderts werden die Bestände der Königlichen Bibliothek Berlin und weiterer<br />
zehn preußischer Universitätsbibliotheken als Gesamtkatalog verzeichnet;<br />
vom Buchstaben »B« an wird das Unternehmen im Jahre 1935 zum Deutschen<br />
Gesamtkatalog <strong>von</strong> einhundertzwei deutschen und österreichischen Bibliotheken<br />
ausgeweitet. Doch deutsche <strong>Geschichte</strong> als Ereignis unterbricht die<br />
Bedingungen ihrer eigenen Gedächtnis-Infrastruktur; das der Erstellung des<br />
Deutschen Gesamtkatalogs zugrundeliegende Manuskript ist während des<br />
Zweiten Krieges verlorengegangen. 39 Wie auch das Generalrepertorium soll der<br />
bibliothekarische Gesamtkatalog des GNM die mangelnde Zentralspeicherung<br />
des deutschen Gedächtnisses kompensieren; nach dem Scheitern der Frankfurter<br />
Paulskirchen- als Nationalbibliothek 1848/49 bleibt die Idee, die verstreuten<br />
Bestände wenn schon nicht physisch zusammenzubringen, so doch in einem<br />
Katalog zentral nachzuweisen. Karl-Eduard Förstemann schlägt vor, qua Befehl<br />
Duplikate der lokalen Bibliothekskataloge einzutreiben; diese würden dann<br />
»einer aus sachverständigen Männern zu bildenden Commission zu übergeben<br />
sein, welcher es obläge, daraus einen alphabetischen General-Nominal-Katalog<br />
aller öffentlichen Bibliotheken des Staats zu schaffen« . Damit tritt die Ordnung des Alphabets an die Stelle des geopolitisch<br />
definierten Territoriums Deutschland, eine wissensarchäologische Revolution,<br />
die auch das Unternehmen <strong>von</strong> Aufseß' konfrontiert.<br />
Das Gutachten Haupt<br />
Der Berliner Professor Moritz Haupt wirft durch die Veröffentlichung seines<br />
amtlichen Berichts über das Germanische Museum zu Nürnberg vom 19.<br />
August 1868 an das königlich preußische Kultusministerium »eine Brandfackel<br />
in diese sich seither ruhig entwickelnde deutsche Nationalanstalt«. 40 Haupt<br />
stellt darin das Projekt des Generalrepertoriums infrage und sucht das GNM<br />
auf seine kulturgeschichtliche Sammlung zu konzentrieren; Aufseß stellt dem<br />
punktweise die Mechanik seines Generalrepertoriums entgegen, etwa die<br />
Option der Bildersortierung (Punkt 9). Es sei eben keine Torheit, »ein syste-<br />
39<br />
Bernd Hagenau, Der deutsche Gesamtkatalog: Vergangenheit und Zukunft einer Idee,<br />
Wiesbaden (Harrassowitz) 1988, 1<br />
40<br />
Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufseß, Das germanische Museum und seine nationalen Ziele.<br />
Denkschrift zur Erläuterung des dem norddeutschen Bundesrath vorliegenden<br />
Haupt'schen Gutachtens über dieses Museum, Lindau (Stettner) 1869,1
512 MUSEUM<br />
matisch und chronologisch geordnetes Bilderrepertorium, zum schnellern Aufsuchen<br />
der einzelnen Alterthumsgegenstände in den Sammlungen und Abbildungen<br />
des Museums anzulegen und zwar nur in leichten Umrissen auf kleinen<br />
Blättchen« . Gegenüber Haupts Kritik am Projekt eines<br />
Urkundenrepertoriums hält Aufseß daran fest, daß dessen wissenschaftlicher<br />
Wert <strong>für</strong> schnelle Orientierung im deutschen Urkundenschatz über allem Zweifel<br />
erhaben sei, da es gleichsam ein deutsches Reichsarchiv repräsentiere, »welches<br />
das zufällig zerstreute Urkunden-Material zur gegenseitigen Ergänzung in<br />
sich vereinigt. Die Auswahl der Urkunden, sowie die Anordnung und Repertorisierung<br />
derselben, bleibt natürlich immer Sache der historischen Kritik und<br />
der praktischen Organisation« . Das meint Urkunden-Kybernetik.<br />
Die Bibliothek des GNM wiederum strebt Vollständigkeit auf dem<br />
Gebiet deutscher <strong>Geschichte</strong> bis zum Jahr 1650 an; real ist dieses Ziel in absehbarer<br />
Zeit unerreichbar. Dennoch werde »ein vollständiges Verzeichnis derjenigen<br />
Schriften die noch fehlen, <strong>von</strong> keiner Seite zu beanstanden sein, schon<br />
deshalb nicht, weil man doch zuerst wissen muss, was fehlt, um es zu suchen<br />
und zu finden« - eine gedächtnissemiotische, weil in Dyaden<br />
<strong>von</strong> Absenz und Präsenz der Information kalkulierende Verzeichnungslogik.<br />
Die epistemologische Figur der Repertorisierung der Kunst- und<br />
Altertumssammlungen korrespondiert mit den Inventarien <strong>von</strong> Denkmälern<br />
verschiedener deutscher Länder, wie es namentlich in Preußen mit dem Denkmalkonservator<br />
<strong>von</strong> Quast verbunden ist:<br />
»Ist es nicht ein unendlicher Vortheil <strong>für</strong>'s Ganze, wenn die verschiedenen Repertorien<br />
der General-Conservatorien einen Einigungspunkt finden und es die<br />
verwandten Gegenstände geordnet neben einander erscheinen und zwar zur<br />
öffentlichen gemeinsamen Benutzung? Sind die Grenzen Württemberg's und Bayern's<br />
denn zugleich Grenzen der Kunst und ist es nicht gut die schwäbischen und<br />
fränkischen Denkmäler, abgesehen <strong>von</strong> zufälligen politischen Grenzen, wenigstens<br />
auf dem Papier zusammen zu stellen? Soll Deutschland denn nicht einmal darin<br />
einig sein, die Zeugnisse der Cultur und Bildung in einer Uebersicht zu veranschaulichen<br />
un diese zur Benützung darzubieten?« <br />
So ist das Kulturgedächtnis der deutschen Nation als symbolische (Papier-)<br />
Maschine definiert. Solange Deutschland politisch keinen Einheitsstaat bildete,<br />
ist ein Zentralmuseum nicht denkbar; <strong>von</strong> daher die alternative Konstruktion des<br />
GNM, worin die Sammlungen nicht als einziger oder Hauptzweck, sondern »als<br />
Attribut und dem Hauptzwecke dienstbar, als Beispiel und Illustration der ideal<br />
centralisirten Einzelmuseen und sonstiger Kunst- und Alterthumsschätze<br />
Deutschlands angesehen und benützt werden« . Hauptzweck<br />
des GNM sind demnach »nicht die Sammlungen, sondern die dem deutschen<br />
Volke versprochenen und ihm schuldig gewordenen belehrenden Repertorienarbeiten«<br />
intra muros des Instituts . Da das GNM eine selbständige
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 513<br />
Stiftung ist, keine Staatsanstalt, bleibt das in der Satzung vorgeschriebene Generalrepertorium<br />
als Primärfunktion des Museums bindend; auch das <strong>von</strong> Haupt<br />
bestimmte Urteil der Berliner Akademie der Wissenschaften, »die gleichsam den<br />
grossen Generalstab im Heere der Gebildeten bildet«, sei nicht maßgebend, da<br />
sie kein amtliches Organ darstellt . Bleibt das Dilemma des GNM,<br />
das asymmetrische Verhältnis <strong>von</strong> Gesamtrepertorium im Symbolischen und<br />
Sammlung im Realen nicht restlos koordinieren zu können. Von Vollständigkeit<br />
konnte am allerwenigsten beim Archiv die Rede sein, »welches deshalb auch nur<br />
Rettungsanstalt <strong>für</strong> Aktenstücke, Urkunden und Briefe <strong>von</strong> geschichtlicher<br />
Bedeutung sein und zur sichern Verwahrung kleiner Stadt- und Familienarchive<br />
Gelegenheit bieten will« . <strong>Im</strong>mer wieder ist das Museum in<br />
der Defensive, wenn es sich, obgleich nicht an staatliche Behörden gekoppelt,<br />
um nationweite Informationssammlung bemüht. Ein Rundschreiben, die Druckschrift<br />
Bitte des germanischen Museums an die verehrlichen Archiv-Vorstände,<br />
Mitteilung <strong>von</strong> Urkunden-Regesten und Acten-Verzeichnissen betreffend<br />
(Nürnberg, im September 1854), appelliert an das postalische System der Nation:<br />
»Rücksichtlich der durch den Druck veröffentlichten, genügt es uns, nähere Verweisungen<br />
auf die treffenden Urkunden- oder Regesten-Werke zu erhalten. Da<br />
wir nun sämtliche Urkunden in Regestenform zu bearbeiten gedenken (abgesehen<br />
<strong>von</strong> etwa später noch zu nehmenden Abschriften der allerwichtigsten Urkunden),<br />
so erlauben wir uns, zugleich auf die <strong>von</strong> uns dazu gewählten Formulare ergebenst<br />
aufmerksam zu machen, indem wir solche in je einem lithographierten ausgefüllten,<br />
und einem noch unausgefüllten Blatte vorzulegen uns die Ehre geben. da<br />
uns daran liegt, gleiches Format zu haben.«<br />
Denn deutschlandweite Datenspeicherung bedarf der Speicherinfrastrukturellen<br />
Standardisierung. Nur durch kontinuierliche Mitteilungen können etwa vorhandene<br />
Lücken archivalischer Quellen ausgefüllt werden, »indem man Kenntnis<br />
erlangt, wo sich die fehlenden Stücke befinden, so daß <strong>für</strong> die Geschichtsquellen<br />
jedes Landes eine bisher noch nicht erreichte Vollständigkeit erzielt wird«. 41<br />
Modell dieser Datenerfassung im Dienste deutscher Kulturhistorie sind dabei<br />
Medien, die im Dienste der Machttechnik und Regierungskunst entwickelt wurden:<br />
Tabelle und Staatstafel. Gottfried Wilhelm Leibniz hat dieses Vorbild <strong>von</strong><br />
Aufseß< Generalrepertorium als schlüßel aller Archiven und Registraturen<br />
des ganzen landes definiert, deren Rubriken und Register also einzurichten seien,<br />
»daß sie endtlich in diese Staatstafel als in ein centrum zusammen lauffen« 42 - und<br />
41<br />
Zitiert nach dem Exemplar im GNM, Archiv, Akten zur Vorgeschichte des GNM,<br />
Karton la, fasc. »Repertorium«<br />
42<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz, Entwurff gewisser Staats-Tafeln [Frühjahr 1680], in: ders.,<br />
Politische Schriften, hg. v. Zentralinstitut f. Philosophie an der Akademie d. Wissenschaften<br />
der DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie) 1986, 340-349 (341)
514 MUSEUM<br />
dies weniger panoptisch denn - diesseits aller Geschichtsbilder und historischen<br />
<strong>Im</strong>agination - logistisch im seinerzeit aktuellen Medium der Datenübertragung:<br />
»schrifftlich, dieweil man nicht allezeit die dinge in Nature vor äugen haben und<br />
besichtigen, auch nicht alles in Modelle bringen, oder abmahlen und vorbilden<br />
kan« . Am 15. Februar 1869 erläßt der 1. Vorstand des GNM, Essenwein,<br />
unter dem Eindruck des Haupt-Gutachtens einen Fragenkatalog an Wissenschaftler<br />
und Archivare, das Archiv des GNM und die Grenzen der Repertorisierung.<br />
Darauf entgegnet <strong>von</strong> Aufseß 1869 in der Drucksache Eine Beantwortung der<br />
Fragen über das Archiv des germanischen Museums. Essenwein bezweifelt, ob die<br />
Urkundensammlung des GNM so weit geführt werden kann, »daß sie sich endlich<br />
zu einem Archiv <strong>für</strong> ganz Deutschland gestalten; »Gehen so viele Urkunden<br />
aus öffentlichen und Privatarchiven noch verloren, dass wir sie gesammelt zu<br />
einem wirklichen deutschen Nationalarchive vereinigen können?« .<br />
Aufseß antwortet:<br />
»Daß noch Tausende <strong>von</strong> Urkunden und Akten zu erwerben, da<strong>von</strong> zeugt die tägliche<br />
Erfahrung. Da der nächste Zweck des Museums-Archivs die Rettung derselben<br />
ist, so kann die Frage eines >wirklichen deutschen NationalarchivesArchiv< entsteht?« Denn das Archiv ist als hoheitsstaatliche Institution<br />
eine Funktion seiner Verwaltung, und insofern in seiner Genese nicht<br />
kontingent. Aufseß stellt die Gegenfrage: »Beruhen etwa die Vermehrungen der<br />
Alterthumssammlungen weniger auf >ZufallArchiv< zu nennen? Besteht nicht der Begriff eines Archives gerade darin, daß es<br />
das urkundliche Material zusammenhält, welches in Bezug auf ein Land, eine<br />
Stadt, eine Familie nach und nach im Fortgang der <strong>Geschichte</strong> dieses Landes, oder
DAS DEUTSCHE GEDÄCHTNIS ALS GENERALREPERTORIUM 515<br />
der Stadt, der Familie sich gebildet hat? Wird nicht eher das als Archiv des germanischen<br />
Museums zu bezeichnen sein, was sich nach und nach mit der Fortbildung<br />
der Anstalt an Akten in dessen Registratur sammelt, und aus dem man eben gerade<br />
die <strong>Geschichte</strong> der Entwicklung des germanischen Museums verfolgen kann?«<br />
Damit wird das GNM vom Subjekt zum Objekt des Archivs. Frage 26 suggeriert,<br />
daß das Haus eine deutschlandweite Urkundensammlung nicht hinreichend<br />
als ein Archiv organisieren kann. Damit steht der Begriff des Archivs<br />
selbst zur Disposition; Aufseß' Entgegnung definiert den Archivgedanken als<br />
buchstäbliche Grundlage des Museums, in der das Medium aufgeht:<br />
»Eben so originell als neu ist hier der Begriff eines >ArchivsUrkunden- und Aktensammlung<<br />
zu übersetzen. Die Sache bleibt sich doch gleich. Es läßt sich einmal nicht<br />
bestreiten, daß im german. Museum ein Archiv vorhanden ist, man mag es übersetzen<br />
in's Deutsche oder nicht und daß es förmlich organisiert ist, laut §. 1 und 6<br />
der Satzungen und § 132 bis 136 des Organismus . Das Archiv steht unter den<br />
Sammlungen des germ. Museums in e r s t e r Linie und der vorige I. Vorstand ging<br />
sogar so weit, es als den Hauptzweck des Museums aufzustellen, daraus eine<br />
Pflanzschule <strong>für</strong> junge Archivare zu bilden.« <br />
Damit ist die Ordnung des Archivs - im Unterschied zu Bibliothek und Kunstsammlung<br />
- als Dispositiv deutscher Kulturgeschichte, als Projekt des GNM<br />
definiert.
516 MUSEUM<br />
Organisation der deutschen Kulturgeschichte<br />
»Was könnte auch das Volk mehr stählen, als der Hinblick auf eine große Vergangenheit,<br />
wie ihn eine Anstalt bietet, welche ihm eine <strong>Geschichte</strong> und die<br />
Entwicklung seiner Kultur lebendigvor Augen führt« 1 - eine visuelle Positivierung<br />
der rhetorischen enargeia. Zunächst aber verfügt Deutschland auch nach<br />
1815 nicht über zentrale Institutionen der Gedächtnispolitik. Als anderen<br />
Nationen seit Ende des 18. Jahrhunderts »aus Curiositätensammlungen wissenschaftliche<br />
Bildungsanstalten machten da fehlten in Deutschland thatsächlich<br />
die Mittel, das Gleiche zu thun« . Die sehr reale Folge dieses<br />
Mangels heißt Verlust deutscher Kulturgüter an ausländische Museen. Das<br />
GNM definiert sich demgegenüber als eine kunst- und kulturgeschichtliche<br />
Sammlung, dessen zentraler Anspruch einer Bindung des materiellen Gedächtnisses<br />
nicht auf institutioneller, staatlicher Ebene liegt, sondern in der Monopolisierung<br />
der Informationspolitik: »eine damit verbundene historische und<br />
archäologische Bibliothek, sowie ein Archiv; durch trefflichste Katalogisierung<br />
und Nutzbarmachung der vorhandenen Schätze, sowie durch Repertorien in<br />
Schrift und Bild« . Alle diese Gruppen vereinigt ergeben »das Bild des<br />
Entwickelungsganges unserer Kultur, so weit es sich in Monumenten darstellen<br />
läßt. Für das Undarstellbare dienen die Schriften in der Bibliothek und die<br />
Aufzeichnungen der Repertorien« . Denn der Anspruch eines historischen<br />
Sinns ist an Objekten nicht ablesbar; seine Unterstellung bedarf des textuellen<br />
Supplements. Kultur läßt sich erst auf der Ebene <strong>von</strong> Listen und<br />
Katalogen nachweisen, und ihre Einheitlichkeit ist nur <strong>für</strong> das Mittelalter gegeben;<br />
andere Zeiten stehen dementsprechend in einer gesonderten Abteilung.<br />
Das GNM versteht sich - korrespondierend mit seinem ursprünglichen<br />
<strong>Im</strong>puls als kulturgeschichtliches Repertorium - vor allem als Lehranstalt: »Nicht<br />
bloss Kostbarkeiten sollen gesammelt werden, sondern das Material, welches<br />
zum Studium der <strong>Geschichte</strong> unserer Kultur erforderlich ist.« Der aktuelle<br />
Theoriebegriff des cultural exchange findet sich hier mit einem deutlich nationalen<br />
Vektor akzentuiert: »Die auswärtigen Beziehungen werden nur betont, wo<br />
sie zur Erklärung der deutschen Verhältnisse nöthig sind« . Die Sammlung<br />
und Präsentation der Objekte dienen keinem rein pädagogisch Schönen und<br />
Guten nationalen Kulturwissens; im merkantilen Interesse sind sie Vorbild <strong>für</strong><br />
gewerbliche Zwecke, also das, was unter dem Begriff ästhetischer Historismus<br />
(Hannelore Schlaffer) Konsequenzen im Design zeitigt. Doch »Anlage und Ten-<br />
1 August Essenwein / Georg Karl Frommann, Die Aufgaben und die Mittel des germanischen<br />
Museums. Eine Denkschrift, Nürnberg 1872. Verlag der literarisch-artistischen<br />
Anstalt des germanischen Museums, 7
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 517<br />
denz der Sammlungen sind in erster Linie auf die Wissenschaft gerichtet«, und<br />
das heißt im System Essenwein(s) um 1872 Geschicbts- als Leitwissen: »Wer vermöchte<br />
auf irgend einem Gebiete des Lebens mit segensreichem Erfolge eigene<br />
Bahnen einzuschlagen, der nicht an der Hand der <strong>Geschichte</strong> gesehen, wie sich<br />
die Verhältnisse bisher entwickelt haben« . Der Historismus<br />
schreibt den Gang des Museums vor. Kulturgeschichte wird in den Abteilungen<br />
des GNM als Baumstruktur verstanden, enzyklopädisch verzweigt in<br />
Pfade, systematisch, nicht hypertextuell oder hypertemporal vernetzt. Das durch<br />
<strong>von</strong> Aufseß zur Klassifizierung des Repertoriums entworfene Flußdiagramm<br />
Schema der deutschen Geschichts- und Alterthumskunde, nach welchem die<br />
Sammlungen des germanischen Museums geordnet sind zeigt es; hier sind Historische<br />
Ereignisse (mit den subdirectories »Oertlichkeiten«, »Persönlichkeiten«<br />
und »Begebenheiten«) als Baum <strong>von</strong> den Historische Zustände (mit den<br />
subdirectories »allgemeine Cultur- und sociale Zustände« sowie »besondere<br />
Anstalten <strong>für</strong> allgemeines Wohl«) abgesetzt, also nicht durch einen übergreifenden<br />
Geschichtsbegriff integriert. Von den historischen Zuständen hebt sich Ereignisgeschichte<br />
als distinkte Datenmenge ab; sie sind es, die durch narrative<br />
Historiographie nicht erfaßt werden, vielmehr durch einen wissensarchäologischen<br />
Blick, der auch die Produkte einer ereignislosen Zeit als Nachricht liest:<br />
»Und doch sind <strong>von</strong> kulturhistorischem Standpunkte die Erzeugnisse des gewöhnlichen<br />
Treibens und Schaffens einer Zeit wichtiger, als die Werke der hervorragenden<br />
Meister . Zu dem Kenner aber, der die geheimnisvolle, doch niemals lügende<br />
Sprache der Vergangenheit versteht und aus den eigenthümlichen Formen irgend<br />
welches Denkmales, aus dem besonderen Zuge und Schwünge der Linien jeder<br />
Schrift oder Zeichnung den Charakter des Verfertigers und seiner Zeit zu erkennen<br />
weiß, sprechen die >alten Pfannen und Töpfe< so vornehmlich, wie die bewunderten<br />
Meisterwerke der Kunst.« 2<br />
Kulturarchäologie als Verwissenschaftlichung des Museums<br />
Auf der Mitgliederversammlung des Historischen Museums in Frankfurt am<br />
Main vom 9. März 1904 trägt Otto Lauffer, wissenschaftlicher Direktorialassistent,<br />
den Erwerbsbericht vor. Nach mehrjähriger Tätigkeit am GNM übernahm<br />
er mit der kunstgewerblichen Abteilung auch die Verwaltungsgeschäfte und<br />
transformierte die Ästhetik des Museums in einen Gedächtniswissenschaftsbetrieb.<br />
Lauffer verwendet eine altertumskundliche Systematik, bezeichnet sie als<br />
August <strong>von</strong> Eye, Die Sammlung <strong>von</strong> Küchengeräthen im germanischen Museum, in:<br />
Anzeiger <strong>für</strong> Kunde der deutschen Vorzeit, Neue Folge, Bd. 2, 1855, 229, hier zitiert<br />
nach: Walter Hochreiter, Vom Musentempel zum Lernort: zur Sozialgeschichte deutscher<br />
Museen 1800-1914, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1994, 76
518 MUSEUM<br />
kulturgeschichtlich-archäologische Anschauungsweise 3 und charakterisiert sie als<br />
Methode, unter der die »Dinge selbst beurteilt sein wollen« - keine Denkmäler<br />
(im Sinne Droysens). Für den Trägerverein des Museums war das wesentliche<br />
Merkmal der Artefakte, daß sie zur Überlieferung der <strong>Geschichte</strong> Frankfurts<br />
gehörten; in diesem Sinne bezeichnet Duard Fay sie 1869 als Reliquien. Lauffers<br />
Methode unterstellt den Dingen dagegen keine historische Überlieferungsabsicht,<br />
sondern zielt auf die empirische, archäologische Untersuchung der Dinge<br />
- kritische Beschreibung eher denn Erzählung. 4 Die archäologische Beschreibung<br />
wird hier zur Provokation der Historie. 1904 begründete Lauffer den<br />
Erwerb des Gipsabgusses einer Ofenkachel damit, daß so die Entwicklungsreihe<br />
der im Museum schon vorhandenen spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Ofenkacheln<br />
komplettiert werden; Artefakte erhalten ihren musealen Wert durch die<br />
funktionale Stellenzuweisung im Speicher, die Relation innerhalb einer archäologischen<br />
Serie, und nicht durch Lokalgeschichte als Selektionskriterium. Ausstellungsästhetik<br />
wird zu einer Funktion der verwissenschaftlichten Ordnung<br />
der Dinge: keine pittoreske Anordnung, keine ästhetischen Aufwertung der Vergangenheit,<br />
sondern eine altertumskundlich systematische Klassifizierung, »die<br />
das Studium der Entwicklung der Ofenkachel, der Kriegsaltertümer oder der<br />
Leuchtkörper zuließ, aber kaum mehr ein Denkmal der <strong>Geschichte</strong> der Stadt<br />
war. Ein primär wissenschaftliches Archiv stand in Aussicht , an dem<br />
in spezifischer Weise Beschäftigten wissenschaftliche Information abrufbar<br />
waren« . Analog bezweckte Lauffer damit auch die Erschließung und<br />
Neuordnung des Stadtarchivs nach wissenschaftlichen Grundsätzen, der kulturgeschichtlich-archäologischen<br />
Anschauungsweise verwandt. Vergleichbar<br />
damit ist die Ordnung des Repertoriums am GNM Nürnberg als technische,<br />
insofern sie Vergangenheit nicht nach einer historischen Semantik klassifiziert.<br />
Lauffers Postulat der Wissenschaftlichkeit bedeutet die Subsumierung der Darstellungs-<br />
unter die Forschungweise, der zufolge nur Vergleichbares vergleichbar<br />
ist - in kulturgeschichtlicher Diskretion. »So ist eine zweite Sache, ob die<br />
darauf beruhende >Rechtsgeschichte des späten Mittelalter tatsächlich eine legitime<br />
Darstellung der Entwicklung ist, tatsächlich etwas mit <strong>Geschichte</strong> zu tun<br />
bekommt oder eben nur eine Darstellung der Entwicklung des Rechts ist« . Diese archäologische Distanz meint Unaufgeregtheit. 1907 publiziert Otto<br />
3 Zu Lauffers Definitionen der Archäologie siehe auch W. E., Kultur als Funktion ihrer<br />
Speicher, demnächst in: Matthias Middell / Hans-Christian <strong>von</strong> Herrman (Hg.), Standortbestimmungen<br />
der Kulturwissenschaften, Leipzig (Universitätsverlag)<br />
4 Jürgen Steen, Das Historische Museum Frankfurt am Main - Plan, Gründung und die<br />
ersten fünfundzwanzig Jahre, in: Almut Junker (Red.), Trophäe oder Leichenstein?<br />
Kulturgeschichtliche Aspekte des Geschichtsbewußtseins in Frankfurt im 19. Jahrhundert,<br />
Frankfurt/M. 1978, 23-48 (41)
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 519<br />
Lauffer einen Aufsatz unter dem Titel Das Historische Museum. Sein Wesen und<br />
Wirken und sein Unterschied <strong>von</strong> den Kunst- und Gewerbemuseen und expliziert<br />
darin erneut seine ausdrücklich kulturgeschichtlich-archäologische Methode<br />
als nicht mehr auf eine ästhetische Anschauung der Dinge gerichtet; sie regelt<br />
(kybernetisch also) vielmehr die Prozedur, wie die Dinge unter einem bestimmten<br />
Aspekt (neben anderen möglichen) konfigurierbar sind. Das technische Artefakt<br />
tritt im kühlen archäologischen Blick gleichrangig neben das Kunstwerk.<br />
»Die Archäologie des Zwecks führte im Gerüst der Systematik der Überlieferung<br />
nach Klassen <strong>von</strong> Altertümern Entwicklungsreihen menschlich-praktischer<br />
Tätigkeit vor« ; diese (Auseinander-)Setzung der Objekte<br />
dekonstruiert das historische Museum. Verwissenschaftlichung die Institution<br />
hier dem, worauf sie dem <strong>Namen</strong> nach verpflichtet ist: <strong>Geschichte</strong>. Vielmehr<br />
manifestiert sich hier ein epistemischer Zug zur wissensarchäologischer Serienbildung,<br />
die verwandte Phänomene in der Ausstellungspraxis anthropologischer<br />
und anderer Museen seiner Zeit zeitigt. Dieser Umgang mit Speichern heißt Austreibung<br />
der historischen <strong>Im</strong>agination: »Das Ausstellen der >Realienlebendig< machen, so ist es zugleich ausgeschlossen, die reale <strong>Geschichte</strong> authentisch<br />
zu rekonstruieren« . Der Diskurs der Kulturwissenschaften<br />
setzt die hermeneutische Differenz zwischen wissensarchäologischer Inventarisierung<br />
und historischer Interpretation:<br />
»Wer nicht einen wissenschaftlich fundierten sicheren Überblick über den<br />
Gesamtbereich der national Kulturgeschichte in dem weitesten Sinne des<br />
Wortes sich angeeignet hat, der kann über die einfache Katalogisierungsarbeit nicht<br />
weit hinauskommen. Er bleibt in der roheren und fast möchte man sagen geistlosen<br />
Hälfte literarischer Museumsarbeit stecken, die nur das Äußere der Realien<br />
berücksichtigt und lediglich beschreibender Natur ist. Der viel schwierigeren,<br />
wichtigeren und feineren Hälfte der Arbeit, der wissenschaftlichen Behandlung<br />
der Altertümer, die die entwicklungs- und sittengeschichtliche Betrachtungweise<br />
in den Vordergrund stellt, kann er nie gewachsen sein.« 5<br />
Neben die sachgemäße Katalogisierung der Sammlungsgegenstände tritt als wissenschaftliche<br />
Aufgabe der Lokalmuseen die Inventarisierung der <strong>für</strong> die lokale<br />
5 Otto Lauffer, Das Historische Museum. Sein Wesen und Wirken und sein Unterschied<br />
<strong>von</strong> den Kunst- und Kunstgewerbe-Museen, in: Museumskunde. Zeitschrift <strong>für</strong> Verwaltung<br />
und Technik öffentlicher und privater Sammlungen, Bd. III, Heft 4 (Berlin<br />
1907), Kapitel VII: Die wissenschaftlichen Aufgaben der historischen Museen, 237ff<br />
(239)
520 MUSEUM<br />
<strong>Geschichte</strong>, Kunst und Archäologie »irgendwie <strong>von</strong> Bedeutung« seienden Gegenstände,<br />
ganz unabhängig da<strong>von</strong>, ob diese sich in der eigenen Sammlung, in Öffentlichem<br />
oder privatem Besitz befinden. Vom Symbolischen der Registrierung als<br />
Information entlastet, kann das Reale - statt musealer Dislokation - an seinem<br />
Ort verbleiben:<br />
»Es ist ja bekannt, wie infolge der stetigen Regsamkeit des Kunstmarktes die Realien,<br />
die bis auf die neueste Zeit noch an ihrer alten Stelle, womöglich im alten<br />
Gebrauch geblieben sind, mit fast unaufhaltsamer Schnelligkeit aus ihrem Zusammenhange<br />
herausgerissen werden . Eben aus diesem Grunde ist es notwendig,<br />
über den Bestand der lokalen Denkmäler noch genaue Inventare anzulegen.<br />
Dabei muß die schriftliche Beschreibung der Stücke so viel als möglich durch<br />
pohotographische und zeichnerische Aufnahmen in hinlänglicher Größe unterstützt<br />
werden, und so kommt zu der Inventarisation als untrenntlich mit ihr verbundene<br />
weitere Aufgabe die Anlegung und sorgfältige Ausgestaltung eines<br />
lokalen Denkmälerarchivs.« <br />
Sobald das Museum primär nicht mehr Objekte, sondern Information sammelt,<br />
wandelt es sich gedächtnismedial zum Archiv. Dazu rechnet Lauffer auch die<br />
»planmäßige Aufnahme aller noch auf dem Erdboden sichtbaren Überreste aus<br />
vorgeschichtlicher Zeit« 6 - das archäologische Paradigma diesseits und jenseits<br />
<strong>von</strong> Historie korrespondiert mit kartographischen, transsubjektiven Aufzeichnungsapparaten,<br />
wie sie Albrecht Meydenbauer als photogrammetrisches Verfahren<br />
entwickelt hat. Auch <strong>für</strong> den Museologen Lauffer stellt ein Bewußtsein<br />
<strong>von</strong> Verlust, die Antizipation vergangener Zukunft, die (negative) Geschichtsenergie<br />
solcher Projekte bereit. Er verwünscht das Schicksal <strong>von</strong> Hamburg, das<br />
eine seiner schönsten und reichsten Kirchen hatte in Trümmer und Asche sinken<br />
sehen. »Und wenn es geschehen sollte, wird man den Wert eines sorgfältige<br />
ausgebauten Denkmälerarchivs immer besonders lebhaft empfinden«; dieser<br />
dokumentarische Anteil soll daher neben den monumentalen Realien einen Teil<br />
der Sammlung historischer Museen bilden .<br />
Musik: Instrumente, Notationen und Frequenzen archivieren<br />
Nicht alle Künste sind im GNM repräsentiert, ihrer Differenzierung nach Speichermedien<br />
entsprechend:<br />
»Die Poesie, der geistige Inbegriff aller Kunst, ist nicht körperlich genug, um Denkmale<br />
zu schaffen, die an und <strong>für</strong> sich Sammlungs- und Ausstellungsgegenstände<br />
6 Lauffer 1907: 240, unter Bezug auf sammlungs- und literaturbasierte Inventarisierung<br />
in Oberbayern 1903-1908; siehe Franz Weber, Die vorgeschichtlichen Denkmale des<br />
Königreiches Bayern, Bd. I, München (Kgl. Generalkonservatorium der Kunstdenkmale<br />
und Altertümer Bayerns) 1909, Einleitung
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 521<br />
wären; die Bücher, in denen ihre Denkmale niedergeschrieben und aufbewahrt sind,<br />
gehören der Bibliothek an. Ähnlich verhält es sich mit ihrer Schwester, der Musik.<br />
Diese hat indessen in den Instrumenten, auf denen sie vorgetragen wurde, Denkmäler<br />
hinterlassen, die eine eigene Sammlung bei uns bilden.« <br />
Anstelle <strong>von</strong> Musik lassen sich nur die Materialitäten und Medien ihrer Diskurse<br />
museal lesen, supplementär und parergonal:<br />
»Werke, welche sowohl Musikalien und damit den Entwicklungsagng der Musik,<br />
als auch die Theorien enthalten, bilden einen Theil der Bibliothek; eine kleine Auswahl<br />
ist, anschließend an die Instrumente, ausgelegt und dabei auch wesentlich auf<br />
das Formelle Rücksicht genommen, so daß das Publikum die Neumen, die Entwicklung<br />
der Notenschrift und Verwandtes, was sich eben mit den Augen und<br />
nicht mit dem Ohre erfassen läßt, selbst die verschiedene Gestalt der Noten- und<br />
Chorbücher überblicken kann.« <br />
Essenwein gibt die logozentristische Flüchtigkeit musikalischer Aussagen zu<br />
bedenken, wobei die seinerzeit noch fehlenden Aufzeichnungsmedien des akustisch<br />
Realen (Edisons Phonograph) den blinden Fleck seines Arguments bilden:<br />
»Musik hat mit Sprache, Theater und Ballett gemeinsam, daß sie nicht mehr existiert,<br />
sobald sie verklungen, bzw. zu Ende gespielt wird. Die Einzelheiten der<br />
Tonkunst werden dokumentiert durch graphische Symbole, Tonwerkzeuge und<br />
musikikonographische Belege. Diese drei Kategorien >gefrorener Musik< erscheinen<br />
in Aufseß< System: Instrumente, Instrumentenikonographie (unter<br />
>Instrumentalmusikalien'; geschriebene und gedruckte Noten <strong>für</strong> Instrumente<br />
werden als >Instrumentalmusikalien< aufgeführt; es fehlt somit die <strong>für</strong> die Aufführungspraxis<br />
so wichtige Ikonographie der Vokalmusik).« <br />
Welchen Unterschied die Option der Schallwellenaufzeichnung <strong>für</strong> die Musikinstrumentenausstellung<br />
macht, schreibt 1908 Carl Stumpf, Direktor des Psychologischen<br />
Instituts der Berliner Universität und Gründer des dortigen<br />
Phonogramm-Archivs, das seit 1900 das im Unterschied zu früheren Epochen<br />
vom audiovisuellen Gedächtnis mitgeprägte Jahrhundert einläutet:<br />
Erst wenn wir durch den Phonographen über die lebendige Musik unterrichtet<br />
sind, und wenn wir durch genaue Analyse die darin vorkommenden Intervalle<br />
festgestellt haben, erst dann können wir mit Nutzen auch die Instrumente zum<br />
Vergleich heranziehen, und die im jeweiligen Musiksystem liegenden Gründe aufdecken<br />
, warum man sie so und nicht anders gebaut hat 7<br />
- eine Medienarchäologie des Tons, buchstäblich. Und Stumpf ergänzt: »Ohne<br />
Hilfe des Phonographen stehen wir vor den Schaukästen der Museen, in denen<br />
7 Carl Stumpf, Das Berliner Phonogrammarchiv, in: Internationale Wochenschrift <strong>für</strong><br />
Wissenschaft, Kunst und Technik, 22. Februar 1908, 225-246; Wiederabdruck in: Artur<br />
Simon (Hg.), Das Berliner Phonogramm-Archiv 1900-2000. Sammlungen der traditionellen<br />
Musik der Welt, Berlin (VWB) 2000, 65-84 (67)
522 MUSEUM<br />
die Instrumente in stummer Grabesruhe aufbewahrt werden, verwundert, aber<br />
verständnislos« <br />
In einem undatierten Faltblatt aus der Frühzeit des Museums über Die<br />
musikalischen Sammlungen des germanischen Museums zu Nürnberg werden<br />
darunter nur geschriebene oder gedruckte Kompositionen und theoretische<br />
Werke verstanden; Musikinstrumente und Musikikonographie werden nicht<br />
einmal am Rande erwähnt. 8 In der Aufstellung der Musikinstrumente unter<br />
Heinrich Kohlhaußen im 1. Obergeschoß des Augustinerbaus 1938 kommen<br />
dann kulturhistorische wie auch speziell musikgeschichtliche Zusammenhänge<br />
kaum zur Geltung: Die Instrumente werden nach Typen gruppiert dargeboten.<br />
1872 ist zwar <strong>von</strong> den vorhandenen Musikinstrumenten »ein relativ systematisch<br />
geordnetes Inventar« vorhanden, in dem die Einzelstücke mit der<br />
Sigle MI und einer laufenden Nummer versehen wurden, doch im Anzeiger<br />
des GNM <strong>für</strong> 1884-86 heißt es über die entsprechende Abteilung, »zu einer<br />
Übersicht der <strong>Geschichte</strong> der musikalischen Instrumente hat sie sich trotzdem<br />
bis jetzt nicht erheben können«. 9 Die Zeichenregime des Inventars, worin<br />
buchstäblich Signaturen als Verweise des materiell Realen fungieren, stehen<br />
hier im Widerstreit zur Ordnung der Historie; es findet eine Verschiebung<br />
zwischen der externen Abbildung der Sammlung im musealen Raum (Katalog,<br />
Führer) und der internen Gedächtnisordnung des Depots (Inventar) statt.<br />
Der erste Band des Kataloges der Musikinstrumente des Conservatoire in<br />
Brüssel, verfaßt <strong>von</strong> Victor-Charles Mahillon 1880, gab mit seiner Einleitung<br />
eine bis in die Gegenwart gültige Klassifikation der Musikinstrumente vor;<br />
longue duree als Maßstab historischer Wahrnehmung gilt also nicht nur auf<br />
der Ebene der Ereignisse (Fernand Braudel), sondern auch auf der Ebene der<br />
Speicher. Katalog und Systematik werden hier selbst zum Ereignis, zur Aussage<br />
im Sinne Foucaults, als wissensarchäologische Setzung, Wandlungen<br />
überdauernd.<br />
Mit der Klassifikation der Musikinstrumente korrespondiert die der Musik.<br />
Mahillons Katalog wird um 1914 in Berlin <strong>von</strong> Erich Moritz <strong>von</strong> Hornbostel<br />
und Curt Sachs verfeinert, unter Rückgriff auf die Bibliotheksklassifikation <strong>von</strong><br />
Melvil Dewey. Von der musikhistorischen Erzählung zur Zählung ihrer Materialitäten:<br />
»Die Ordnung ist hier nicht mehr narrativ, sondern folgt der gänzlich<br />
sprachunabhängigen Ordnung <strong>von</strong> Dezimalbrüchen.« 10 Von Hornbostel<br />
8<br />
John Henry van der Meer, Historische Musikinstrumente, in: Daneke / Kahsnitz 1978,<br />
814-832(815)<br />
9 79f = Wortlaut Bericht Essenwein 1870 in Daneke / Kahsnitz: 1008<br />
10<br />
Sebastian Klotz, Von der Musica Mundana zum Phonogrammarchiv. Das Archivieren<br />
<strong>von</strong> Klängen in seinen allegorischen und realen Dimensionen, in: Lab. Jahrbuch 1996/<br />
97 <strong>für</strong> Künste und Apparate, hg. v. d. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien mit dem Verein
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 523<br />
ist es auch, der in einem technischen Medium, der grammophonischen Wachswalze,<br />
die Möglichkeit zur Archivierung <strong>von</strong> Stimme und Musik selbst, also<br />
ihre <strong>Im</strong>plementierung im Realen als Gedächtnis, erkennt. Hornbostels Überlegungen<br />
zur Anordnung der übertragenen Melodien betreffen die Taxinomie.<br />
Zur lexikalischen Klassifizierung, die den gleichsam anonymen Schallaufzeichnungen<br />
(Klotz) zunächst einen <strong>Namen</strong> und einen Ort im Archiv zuweist, gesellt<br />
sich neben der Ordnung nach Region, Zweck oder Anlaß der aufgezeichneten<br />
Komposition und der Tonquelle ein Kriterium, das innermusikalisch gewonnen<br />
wird: Hornbostel führt das Tonmaterial selbst ein, also eine Dimensionen, dessen<br />
systematische Untersuchung der Phonograph erst hervorgebracht hat. So<br />
daß dieses Gedächtnismedium ein vollkommen neuartiges Dispositiv des<br />
Archivs ermöglicht, das nicht mehr lexikalisch, sondern nach eigenem akustischen<br />
Recht immediat geordnet wäre, nach musikinhärenten Kriterien, so daß<br />
»Schallzeugnisse mit vergleichbaren rhythmischen Mustern, einem identischen<br />
Tonmaterial, melodisch ähnlichen Verlaufsformen und verwandten Fakturen<br />
oder Schwierigkeitsgraden in einer Signaturgruppe stehen. Die Signaturen<br />
wären aber keine herkömmlichen aus Buchstaben und Ziffern bestehenden<br />
Kürzel, sondern die musikalischen Bestandteile selbst« n - analog zu Hornbostels<br />
Versuchen, den Ursprung des Alphabets in Universalien der Lautmaterie<br />
zu finden. In der Sprache der Archive heißt dies, die Speicheradressierung ist<br />
der gespeicherten Aussage gegenüber nicht mehr äußerlich, sondern operativ<br />
mit ihr gekoppelt - Übertragung und Speicherung, Inhalt und Form des Gedächtnisses<br />
zugleich. Sobald Melodiefloskeln und damit Verlaufsgestalten sowie<br />
Tonklassen selbst als Suchkriterien gelten, die nicht ihrerseits verbalisiert werden,<br />
wäre ein Archiv <strong>von</strong> Klängen erreicht, »das sich selbst in seinem eigenen<br />
Medium erkennt, ordnet und regeneriert«; tatsächlich weisen einige der Wachszylindercontainer<br />
neben der obligatorischen lexikalischen Information auf dem<br />
Deckel (Sammler, Inventarnummer, Inhalt der Aufnahme, Aufnahmejahr) auf<br />
den Pappzylinder des Containers geklebte Notenbeispiele auf, »die wohl als<br />
Incipits den Inhalt der Container musikalisch-visuell veranschaulichen« . Erst mit der neuen Praxis technischer Medien entstehen solche<br />
Arbeits- und Archivierungsformen <strong>von</strong> Musik jenseits Schrift- und notentextfixierter<br />
Philologie tatsächlich. Zwischen den Materialitäten der musikalischen<br />
Gedächtniskommunikation differenziert auch das GNM, wo aus konservato-<br />
der Freunde der KHM, Köln (Walther König) 1997, 33-48 (43f), unter Bezug auf:<br />
Ernich M. <strong>von</strong> Hornbostel / Curt Sachs, Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch,<br />
in: Zeitschrift <strong>für</strong> Ethnologie 46 (1914), 553-590<br />
11 Klotz 1997: 44, unter Bezug auf: Erich M. <strong>von</strong> Hornbostel, Vorschläge <strong>für</strong> die Transkription<br />
exotischer Melodien, in: Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft<br />
XI (1909/10), 1-25 (15)
524 MUSEUM<br />
rischen, medienmateriellen Gründen das kulturhistorische Konzept der Darbietung<br />
<strong>von</strong> Papier (Noten, Musikalien, Graphik) aufgegeben wurde und seitdem<br />
weniger nach kunst- oder literaturgeschichtlich als nach musikhistorisch<br />
begründeten Perioden präsentiert wird. »Parallelismus der Künste, der nicht im<br />
Material begründet liegt, zu fordern, schien immer bedenklich« , heißt es wie ein Echo <strong>von</strong> G. E. Lessings 1766er Traktat Laokoon:<br />
oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Bei der Aufstellung in Vitrinen<br />
wird gelegentlich die Spielhaltung des einzelnen Instrumentes berücksichtigt;<br />
die Gestaltung des Saales, in dem die Musikinstrumente tatäschlich erklingen<br />
sollen, wird durch akustische Rücksichten mit geprägt. Akustische Frequenzen<br />
bilden hier einen anderen Archivraum als das sichtbasierte Museum, denn<br />
Musikinstrumente können zwar »visuelle Schönheit besitzen, in erster Linien<br />
sind sie aber zur Erzeugung <strong>von</strong> Klängen bestimmt. Soweit es ohne Eingriffe in<br />
den dokumentarischen Wert eines Instrumentes möglich ist, wird versucht, es<br />
spielbar zu machen« . Die Suprematie über Phonozentrismus liegt im<br />
Konflikt mit der klassischen Funktion des Speichers. Als 1962 unter der Direktion<br />
Ludwig Grotes <strong>für</strong> das GNM die Musikinstrumentensammlung der Lauten-<br />
und Geigenmacherfamilie Rück erworben wird, ist es deren besonderes<br />
Anliegen, »zumindest einen Teil der Instrumente in spielbaren Zustand zu versetzen.<br />
Damit wurde auch in Nürnberg ein wichtiger Schritt zur Neubelebung<br />
des Klangbildes historischer Musik getan« .<br />
Anima I machina: »In Fachkreisen beginnt man einzusehen, daß historische<br />
Musik am besten auf zeitgenössischen Instrumenten klingt« - ein<br />
diskursiver Kurzschluß <strong>von</strong> Aufschreibesystemen (graphische Fixierung <strong>von</strong><br />
Klang) und Reaktivierung durch radikal präsente Körper (Klangkörper, Musiker,<br />
Stimmen). So wird die Zeit des Archivs, sobald es nicht Texte, sondern<br />
Maschinen speichert, reversibel.<br />
Bücher und Einbände als Semiophoren<br />
»Auch die Wissenschaft hat ihre Denkmäler vor Allem in Büchern niedergelegt;<br />
die Bücher bilden somit die hauptsächlichen Monumente« . Die Autoren denken vor allem an kulturgeschichtliche Blätter,<br />
die sich auf die <strong>Geschichte</strong> der Wissenschaften beziehen; »zur Ausübung bedarf<br />
manche Wissenschaft aber auch der Instrumente Meßapparate und dgl.«,<br />
damit Daten überhaupt erst zu Information werden. Ausstellen lassen sich nicht<br />
nur die Produkte, sondern auch die Medien, die materialen »Quellen jeder Wissenschaft<br />
- die Tintenfässer, Federn, Lineale und Griffel«. Sind solche Objekte<br />
unter der Rubrik Kunst oder Wissenschaft zu ordnen? Der medienarchäologische<br />
Blick auf Wissenschaft ist ein radikal externer, der nicht auf Inhalte, son-
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 525<br />
dem Formen schaut: »Wir haben als die hautpsächlichsten Monumente der Wissenschaft<br />
die Bücher bezeichnet; ihr äußeres Gewand - der Büchereinband - soll<br />
Gegenstand der ersten Betrachtung der eigentlichen handwerklichen Thätigkeit<br />
sein« . Die Werke der Wissenschaft sind gehüllt in<br />
Stoffe, die nicht buchstäblich Text und daher gegenständlich ausstellbar sind -<br />
Klio medialer Leib. Essenwein begreift die Verwaltung des Wissens nicht <strong>von</strong><br />
seiner Semantik(dem vom Symbolischen der Buchstaben implizierten <strong>Im</strong>aginären),<br />
sondern <strong>von</strong> seiner gedächtnisapparativen Verfaßtheit her: in Realien<br />
(so der museologische Terminus <strong>für</strong> die Objektwelten). Der kulturwissenschaftliche<br />
Zugriff sensibilisiert also <strong>für</strong> die Medien der Übertragung:<br />
»Einen entsprechenden Übergang dazu <strong>von</strong> der Wissenschaft selbst finden wir in<br />
einer alten Originalbibliothek, die wir den Besuchern unserer Sammlungen vor<br />
Augen führen können, der Bibliothek des gelehrten Staatsmannes und zugleich Professors<br />
der Jurisprudenz an der Wittenberger Universität aus dem Zeitalter der<br />
Reformation, des Nürnberger Patriziers Christoph Scheurl. Die äußere Form der<br />
Bibliotheken im ganzen Mittelalter war eine sehr einfache.« <br />
Mit Erfindung des Buchdrucks - das heißt massenhafter Distribution und Standardisierung<br />
im Wissenstransfer - »mußte sich naturgemäß ein einfacher, handwerksmäßiger<br />
Bibliothekseinband ausbilden. Die älteren Einbände dagegen<br />
waren jeder als einzelnes Kunstwerk betrachtet.« Die Rede ist speziell <strong>von</strong><br />
Büchern im liturgischen Kontext; da die Bücher dem Dienst des Altars<br />
bestimmt waren, wurden sie auch ähnlich wie die übrigen Altargeräte ausgestattet.<br />
Nicht ihre religiöse Aura, sondern ihr kulturarchäologischer Informationswert<br />
ist ersetzbar: »<strong>Im</strong> Original haben wir freilich <strong>von</strong> diesen älteren,<br />
kostbaren Werken keine in unseren Sammlungen, wohl aber eine Reihe <strong>von</strong><br />
Abgüssen, die durch Bemalung, die hier unumgänglich nöthig ist, uns die Originale,<br />
so weit als möglich, vor Augen führen und ersetzen müssen« . Auch <strong>für</strong> die Ledereinbände des 14. und 15. Jahrhundert gilt,<br />
daß die Fläche des Deckels der Ort ist, wo der Schmuck angebracht wurde;<br />
»auch sie sind also nicht auf eine Massenaufstellung berechnet« . Die Bücher bilden mit ihren Inhalten historische Dokumente, mit<br />
ihren Einbänden jedoch kulturgeschichtliche Monumente:<br />
»Es werden also in die kulturgeschichtlichen Sammlungen nur die <strong>von</strong> den<br />
Büchern getrennten Einbände aufzunehmen, die andern aber in die Bibliothek einzureihen<br />
sein, die freilich dadurch manches Buch erhält, das mehr des Einbandes<br />
wegen <strong>für</strong> uns wichtig ist, seinem Inhalte nach aber keinen oder nur untergeordneten<br />
Werth hat. Manche Bücher der Bibliothek sind deshalb hier, in der dem<br />
Publikum vorgeführten Reihe der Büchereinbände aufgelegt, und es dürfte selbst<br />
der Fall vorkommen, daß wir einzelne Werke, um deren kulturgeschichtlich wichtige<br />
Einbände zu schützen, dem liberalen allgemeinen Gebrauche vorenthalten<br />
müssen.«
526 MUSEUM<br />
<strong>Im</strong> Vordergrund der kulturgeschichtlichen Präsentation steht im heutigen Germanischen<br />
Nationalmuseum das Objekt als ästhetische Größe; die Beschreibung<br />
rückt in den Nebengrund. Schneider demonstriert anhand des Einbands<br />
des Ecbternachter Evangeliars, daß die vielen diskursiven und (hilfs-)wissenschaftlichen<br />
Anschlüsse als Einstiegspunkte, als in schriftliche Form gebrachte<br />
Erklärungen »das kostbare Objekte verdecken würden - Beschreibung, historischer<br />
Wert, kunsthistorischer Wert, <strong>Geschichte</strong> des Objekts. 12 <strong>Im</strong> museologischen<br />
Kunstgriff der Überlagerung des Artefakts durch eine transparente<br />
Schrifttafel, der Transparenz jener Barriere, die sich zwischen Auge und Objekt<br />
schiebt - der (historische) Text - kommt das Wesen der Hermeneutik als Lesen<br />
zu sich. An den Bildgrenzen der Schrift gilt es, Bildsortierung zur Aussage werden<br />
zu lassen, denn in schriftfixierter Pädagogik kann die Erklärung kulturarchäologischer<br />
Medienvielfalt nur schwer erfolgen. »Die Zusammengruppierung<br />
<strong>von</strong> Objekten spricht darüber <strong>für</strong> sich selbst, wenn, wie im Germanischen<br />
Nationalmuseum möglich, aus der Fülle der Objekte geschöpft werden kann«<br />
. Die Plurivalenz der Objekte »entzieht sich eben einseitig<br />
historischer Bestimmung«; Artefakte sind gleichzeitig kunsthistorisch, technik-<br />
oder wirtschaftsgeschichtlich dekodier- und lokalisierbar. »Wollte man<br />
diese kulturhistorischen Komponenten schriftlich vermitteln, ein Schilderwald<br />
würde entstehen« . Verzeichnung (Semiose) und Realie,<br />
Infrastruktur und narrative Historie liegen hier irreduzibel im Widerstreit. Die<br />
Planung <strong>für</strong> den inzwischen realisierten Erweiterungsbau des GNM akzentuierte<br />
die Infrastrukturierung des Wissens der Objektwelt, als Oszillieren zwischen<br />
der <strong>Im</strong>materialität elektronischer Information und der Evidenz der<br />
Materie; »die Vermittlungstechnologien des 21. Jahrhunderts - die Inventarbanken<br />
und die Führungsphones mit Induktionsschleifen und Festplatte« Einzug<br />
halten, daneben aber »der Ästhetik der Objekte eine Chance lassen«<br />
. Medienarchäologisch kehrt das GNM damit zu der Konzeption<br />
durch <strong>von</strong> Aufseß als Kombination <strong>von</strong> Sammlung (Monument) und<br />
Repertorium (Information) zurück.<br />
Musealien als kulturelle Semiophoren sind unter bestimmten Umständen diskursiver<br />
Aufladung in der Lage, kognitive Dissonanzen im Diskurs der Kulturhistorie<br />
zu fokussieren und zu verdinglichen. Die Schwierigkeiten in den<br />
Bemühungen Grotes, den Ecbternachter Kodex <strong>für</strong> das Museum zu erwerben,<br />
sind eine Funktion der Morphogenese der deutschen Nation, »die als Folge der<br />
politischen Entwicklung im Laufe der <strong>Geschichte</strong> ihre Gestalt entscheidend<br />
12 Ulrich Schneider, Die Sammlungen des Germanischen Nationalmuseums und seine<br />
Darstellungskonzeption, in: Michael Fehr / Stefan Grohe (Hg.), <strong>Geschichte</strong> - Bild -<br />
Museum, Köln 1989, 32-37 (33f)
ORGANISATION DER DEUTSCHEN KULTURGESCHICHTE 527<br />
verändert hat«; dementsprechend diffizil ist es, den nationalen Charakter eines<br />
Sammlungsgegenstands als diskursives Kriterium da<strong>für</strong> zu nehmen, »ob er in<br />
der Nürnberger Nationalanstalt zurecht einen Platz« findet. Um die geforderte<br />
Summe zahlen zu können, verkauft das Museum ein Bild des niederländischen<br />
Meisters Lucas van Leyden (Moses schlägt Wasser aus dem Felsen), weil es - so<br />
die damalige Begründung - wegen seiner niederländischen Herkunft nicht zum<br />
eigentlichen Sammlungsgebiet des GNM gehört. Der Widerspruch <strong>von</strong> Seiten<br />
des Freiburger Kunsthistorikers Kurt Bauch ist ebenfalls national begründet:<br />
»Denn dieses Bild ist, wenn man es nicht politisch, sondern historisch ansieht,<br />
ein Werk der deutschen Kunst ihrem damaligen Bereiche nach.« 13 Am 29.<br />
Januar 1954 reicht Grote, Direktor des GNM, im Einvernehmen mit dem Verwaltungsratvorsitzenden,<br />
Bundespräsident Theodor Heuss, den Antrag <strong>für</strong> die<br />
Erwerbung der Handschrift beim Bundesinninministerium ein. Es soll nun seinen<br />
Platz in dem Speicher finden, den ihm das Dispositiv des GNM zugewiesen<br />
hat, fest in ein rein symbolisches Wertsystem eingelagert:<br />
»Die Handschrift stellt ein Gesamtkunstwerk <strong>von</strong> höchstem Range dar, gleich<br />
bedeutungsvoll <strong>für</strong> die deutsche <strong>Geschichte</strong>, <strong>für</strong> unseres Geistes- und Kunstgeschichte,<br />
so daß sie ohne zu übertreiben mit einem der romanischen Dome verglichen<br />
werden kann. Wenn ein Kunstwerk überhaupt als nationales Kunstwerk<br />
angesprochen werden kann, ist es dieses Buch. Es darf <strong>für</strong> Deutschland auf keinen<br />
Fall verlorengehen. Er würde hier als Symbol der Majestät des<br />
Hl. Römischen Reiches Deutscher Nation betrachtet werden.« 14<br />
Daß es um Gedächtnisverwaltung, nicht um kulturgeschichtliche Metaphysik<br />
geht, manifestiert die aktuelle Ausstellungspraxis. Der Einband des Kodex dient<br />
heute als Ausstellungsstück, während der Textteil in der Bibliothek lagert, ein<br />
Spiegel der Mediendifferenz des Gedächtnisses <strong>von</strong> Bibliothek und/oder Museum,<br />
<strong>von</strong> ästhetischer und wissensarchäologischer Information. Dieser Widerstreit<br />
ist als solcher registriert, eine Funktion der Aufschreibesysteme des<br />
Speichers: Als Buch erhält der Kodex eine Signatur (<strong>für</strong> den Standort) und,<br />
getrennt in der Einbandsammlung, eine Inventarnummer.<br />
13 Zitiert nach: Burian 1978: 239f, unter Bezug auf a) Verwaltungsbericht Grotes <strong>für</strong><br />
1954/55 (Protokolle des Verwaltungsrats, 4. Juni 1955, Anlage; Direktionsakten<br />
GNM) und b) Bauch an Grote, Freiburg im Breisgau, 28. Dezember 1954, Ausfertigung;<br />
Sonderakten »Echternachter Kodex, (Bd. 2) Schreiben der Professoren«, Altregistratur<br />
GNM, Abt. III, ohne Nr.<br />
14 Zitiert nach: Elisabeth Rücker, Die Erwerbung des Goldenen Evangelienbuches <strong>von</strong><br />
Echternach <strong>für</strong> das Germanische Nationalmuseum Nürnberg, in: Rainer Kahnsitz /<br />
Ursula Mende / dies. (Hg.), Das Goldene Evangelienbuch <strong>von</strong> Echternach. Eine<br />
Prunkhandschrift des 11. Jahrhunderts, Frankfurt / M. (S. Fischer) 1982, 13
528 MUSKUM<br />
Alitagsgeschichte und Senenbildung: Grabdenkmäler und die Ordnung der<br />
Dinge als imaginäres Museum<br />
Die Abteilung Alltagsgeschichte gereicht dem GNM zur Verobjektivierung des<br />
deutschen Wesens und bildet einen seiner populärsten Teile: »Wenn die deutsche<br />
Nation vorzugsweise eine häusliche, wenn das Familienleben vor Allem bei uns<br />
in seiner reinsten Entwicklung wahrzunehmen ist, so wird die Vorführung dessen,<br />
was das Haus in seinem Innern birgt, gewiß das Interesse Aller in hohem<br />
Grade beanspruchen« . Dem Besucher dieser Abteilung<br />
tritt »eine Fülle kulturgeschichtlicher Monumente« entgegen, die wiederum<br />
durch Abgüsse und Abbildungen supplementiert werden . Gegenüber<br />
der Inklination der museal-archäologischen Medienästhetik, den Blicks »blos<br />
auf die Einzelheiten« zu 'werfen, will das historisch vektonsierte Haus »auch das<br />
Bild des Ganzen in seinem Entwicklungsgange verfolgen«:<br />
»Es ist eine Reihe m's Auge zu fassen, die uns das häusliche Leben im Ganzen, zu<br />
Bildern abgerundet, vorführt. Es ist jedoch außer dieser Serie <strong>von</strong> Bildern,<br />
soweit als möglich, auch eine Reihe <strong>von</strong> Lokalitäten einzurichten, deren jede ein<br />
vollkommenes Bild einer bestimmten Zeit, Gegend und Gesellschaftsklasse gibt,<br />
so daß das Publikum, welches sie durchschreitet in einer solche Reihe gewissermaßen<br />
den Entwicklungsgang des häuslichen Lebens auf's Neue durchlebt«<br />
<br />
- eine geschichtshalluzinogene Technik des Mediums Museum, indem der<br />
buchstäbliche Gang, der discours des Betrachters mit dem intendierten Effekt<br />
einer <strong>Geschichte</strong> (histoire) zusammenfallen. Essenwein legt indes Wert auf die<br />
wissenschaftliche Differenz zu dem synkretistischen Effekt eines Geschichtsbildes,<br />
zusammengesetzt aus einzelnen Versatzstücken. Das Museum als<br />
archäologisch diskrete Korrektur <strong>von</strong> Historienbildern, in Abkehr vom ästhetischen<br />
<strong>Im</strong>puls des GNM selbst, wie es das Gemälde <strong>von</strong> August <strong>von</strong> Kreling,<br />
Hans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aujscß in seiner Studienstube, als Erinnerung manifestiert:<br />
»Ein Alterthumshebhaber mag so seine Wohnung ansprechend <strong>für</strong> sich und als<br />
Gegenstand des Neides <strong>für</strong> seine Freunde einrichten; Aufgabe einer wissenschaftlichen<br />
Anstalt ist das nicht. Wenn eine wissenschaftliche Anstalt dergleichen<br />
Gesammtbilder darstellen will, muß sie solche geben genau so, wie sie wirklich<br />
waren, und nicht so, wie sie der allermodernste sentimentale Weltschmerzler, welcher<br />
mit der Gegenwart zerfallen ist und sich ein romantisches Bild der alten Zeit<br />
ausmalt, sich vorstellt. Außer im 19. Jahrhundert wollte man nie romantisch<br />
sein, man war einfach, wahr und darum charakteristisch; die Kammer der Armen<br />
bot kein malerisches Elend, sondern eben Elend dar . Für eine wissenschaftliche<br />
Anstalt, die gar keinen andern Zweck hat, als zu zeigen, wie Alles wirklich<br />
war, ist es Schwindel, wenn man einen Schrank aus Tirol, einen Tisch aus Danzig,<br />
einen Stuhl aus Köln in ein Zimmer stellt, das ein nürnbergisches Getäfel hat, weil
ORGANISATION DI;K DKUTSUM-.N KuiTuiuir.scmanT: 529<br />
in jeder Stadt und in jeder Provinz die Gegenstände, auch in derselben Zeit, etwas<br />
verschieden gebildet wurden und daher nie in dieser Weise beisammen waren.«<br />
Keine Präsentierung einer Vergangenheit also, die so nie Gegenwart war. Essenweins<br />
Darstellung spielt sich vor dem Hintergrund einer Kritik an der Entscheidung<br />
des Direktoriums ab,<br />
»das malerische Ensemble des ehemaligen Refektoriums zu zerstören, bei dessen<br />
Herstellung seiner Zeit gewiß nicht die Absicht vorgelegen hatte, ein wirkliches<br />
Bild zu geben, sondern aus Noth zu einer etwas malerischen Aufstellung<br />
gegriffen hat. Diese malerische Aufstellung hatte bei einem früheren Besuche<br />
einige schwärmerische Künstler in eine nie dagewesene romantische alte Zeit versetzt,<br />
so daß sie eigens wiederkamen um dieselbe als Folie <strong>für</strong> historische oder<br />
Genrebilder zu malen.« <br />
Die Halluzination <strong>von</strong> Geistern ist ein Medieneffekt. Leopold <strong>von</strong> Rankes historiographische<br />
Ethik gegenüber Walter Scotts geschichtsromanesker Ästhetik hat<br />
sich längst in den Raum der visuellen <strong>Geschichte</strong> eingeschrieben. 15 Fragmenten<br />
einen Rahmen geben 16 : Durch die Trennung <strong>von</strong> Schau- und Studiensammlung<br />
macht das moderne Museum den öffentlichen zum ornamentalen (Bildungs-)<br />
Raum jenseits <strong>von</strong> Verfügungsmacht über Gedächtnis. Die Disjunktion <strong>von</strong><br />
Ornament und Information gilt auch in der Museologie:<br />
»Wir haben also zu unterscheiden zwischen sachlicher Gruppierung und dekorativer<br />
Aufmachung der Museumsstücke. Die Gruppierung kann immer nur erfolgen<br />
aus einer wissenschaftlichen Durchdringung des inneren Wertes der<br />
Einzelstücke, sie kann daher in befriedigender Weise <strong>von</strong> niemandem anders als<br />
<strong>von</strong> einem Fachmanne vorgenommen werden. Die dekorative Aufmachung dagegen<br />
ist nur eine äußere Zutat, die wir hinzubringen, um das Interesse des Publikums<br />
an den Ausstellungsgegenständen zu vermehren. Der Fachmann kann<br />
sie ganz entbehren.« 17<br />
Schausammlungen dienen der geordneten Instruktion des Publikums, das nach<br />
Bildung sucht (bzw. das nationalpädagogisch gebildet, d. h. formiert werden<br />
soll), während das wissenschaftliche Studium auf Information zielt. »Das Magazin<br />
soll demgegenüber aber nun nicht etwa nur ein wüstes Durcheinander beiseite<br />
gestellter Gegenstände sein«, wie es heute etwa die defragmentierbare<br />
Datentopographie <strong>von</strong> PC-Festplatten es suggeriert:<br />
Dazu Stephen Bann, Poetics of the Museum, in: Lotus International 35, Heft 2/1982,<br />
37-43<br />
Ausführlich dazu W. E., Framing the Fragment: Archacology, Art, Museum, in: Paul<br />
Duro (Hg.), The Rhetoric of the Frame. Essays on the Boundancs of the Artwork,<br />
Cambridge/New York (Cambridge UP) 19%, 111-135<br />
Lauf f er 1907 (Heft 3), Kapitel VI: Die Anordnung historisch archäologischer Sa mm<br />
lungen, 2221
530 MUSEUM<br />
»Es hat vielmehr die Aufgabe, die nicht ausgestellten Stücke konserviert in einer<br />
solchen Verfassung aufzubewahren, daß dem Spezialforscher ihr rasches Auffinden<br />
und ihr Studium jederzeit möglich ist. Die Gruppierung der Emzelstücke muß<br />
also in dem Magazin genau nach demselben System und in derselben Sorgfalt<br />
erfolgen wie in der Schausammlung, nur können sie wesentlich enger und ohne<br />
jede dekorative Ausstattung aufgestellt werden, das ist der einzige Unterschied.«<br />
<br />
Die Unordnung der Vergangenheit wird <strong>von</strong> den Ordnungsmedien der Historie<br />
kompensiert. In De oratore erläutert Cicero die ars memoriae anhand des<br />
(Un)Falls <strong>von</strong> Simonides, der die verschütteten Opfer eines Gastmahls anhand<br />
ihrer Anordnung wieder zu identifizieren vermochte (ordo). Der anschauliche<br />
Zusammenhang der Dinge (enargeia) in der Rhetorik heißt bei Cicero bildhafte<br />
Darstellung (informatio) eines Sinnzusammenhangs. Daten der Vergangenheit<br />
werden in den Gedächtnismedien Museum, Archiv und Bibliothek nicht als<br />
narrativer Diskurs organisiert (also »historisch«), sondern in einer informationsonentierten<br />
Weise als Magazin und Depot. Die Ordnung der Dinge im<br />
Museum korrespondiert mit einem musealen Blick auf deutsche Geschichtslandschaften.<br />
Der erste preußische Denkmalpfleger Quast sieht in der Kunstlandschaft<br />
des Vorharzes »doch den Vorzug, innerhalb seiner Grenzen <strong>von</strong> den<br />
Zeiten des ersten Aufblühens unter den Ottonen an eine fest geschlossene<br />
Reihenfolge <strong>von</strong> Monumenten bis zum Untergang der Kunst des Mittelalters<br />
aufzuweisen, in einer Vollständigkeit, daß in Deutschland nur Cöln hiemit wetteifern<br />
könnte.« 18 Quast nimmt damit die Landschaft als geschichtstopographische<br />
Serie wahr und (um)sieht sie dahingehend als musealen, chronologisch<br />
geordneten Raum.<br />
Wenn die Ästhetik sich auf der Diskursebene der Historie bewegt, zählt nicht<br />
so sehr der Kunstwert des Emzelstücks, sondern sein Dokumentationscharakter,<br />
so daß eine Mischung aus Original und Kopie keine Dissonanz hervorruft. In der<br />
Sammlung der Grabdenkmale (seinerzeit 6 Originale und 64 Abgüsse) »zeigt sich<br />
neben dem künstlerischen auch das historische Moment in voller Bedeutung; dieselbe<br />
wird in ihrer chonologischen Ordnung auch den Entwicklungsgang zeigen,<br />
den die Grabsteine im Laufe der Zeiten genommen.« <strong>Im</strong> Grabdenkmal erinnert<br />
sich die antike Bedeutung <strong>von</strong> monumental neben der kulturgeschichtlichen Seite<br />
sind die Grabdenkmäler »zugleich Geschichtsdenkmäler; sie führen uns das<br />
Gedächtniß der großen Männer, zum Theil ihre Gestalt, vor«:<br />
Ferdinand <strong>von</strong> Quasi, Wie läßt sich der historische Gang der Ausbreitung des romanischen<br />
und gothischen Styls in der Gegend <strong>von</strong> Halberstadt an dennoch vorhandenen<br />
monumentalen Bauwerken des ehemaligen Bisthums nachweisen? In: Korrespondenzbl.<br />
d. Gesamtver. d. dt. Gesch.- u. Alterthumsver. 14 (1866), 1, zitiert nach: Voigtländer<br />
1989: 31, Anm. 69
ORGANISATION DI:R DEUTSCHEN KULTURGF.SCHICHTH 531<br />
»Auf diesem Gebiete können wir uns also nicht begnügen, den kulturgeschichtlichen<br />
Entwicklungsgang zu verfolgen; hier müssen wir weiter gehen. Diese Sammlung<br />
muß eine Walhalla werden, in der sich die <strong>Geschichte</strong> Deutschlands und<br />
seiner großen Männer spiegelt, und mit Rücksicht auf die nationale, patriotische<br />
Seite unserer Aufgabe, wie mit Rücksicht auf den praktischen Umstand, daß<br />
unsere fertigen Kreuzgänge nur durch diese Grabdenkmale entsprechende Ausfüllung<br />
finden, müssen wir die Beschaffung derselben als die erste Hauptaufgabe<br />
betrachten.« 19<br />
Auch die Sammlung <strong>von</strong> Grabdenkmälern wird <strong>von</strong> Medien der Dokumentation<br />
supplementiert, einer Sammlung ihrer Abbildungen. Zwei Gedächtnisalgorithmen<br />
im Widerstreit:<br />
»Sie ist, wie alle unsere Sammlungen, bei denen es der Natur der Sache nach thunhch<br />
ist, chronologisch geordnet; früher war sie es, wie alle Sammlungen, bei denen<br />
dies überhaupt möglich, nach dem Alphabet, und wir werden wol auch,<br />
wenn sie etwa den dreifachen Umfang der jetzigen erreicht haben und wenn die<br />
Reihe der Abgüsse eine Uebersicht über den Entwicklungsgange aller der kunstund<br />
kulturgeschichtlichen Momente bieten wird, diese Blätter wieder alphabetisch<br />
ordnen, um in einem gegebenen Falle das Gesuchte möglichst rasch zu finden.«<br />
<br />
Die alphabetische ist die flexibelste Ordnung zur Bewältigung inventarischer<br />
Komplexität. Für diesen Entzug <strong>von</strong> historischem Sinn steht die Technik der<br />
alphabetischen Begriffsreihung in Enzyklopädien und Lexika, die (so auch Foucault)<br />
alle Möglichkeiten der ästhetischen Erkenntnis überschreitet; auch der<br />
Entwurf <strong>für</strong> das Publikationsprojekt Geschichtliche Grundbegriffe beruhte gerade<br />
nicht auf einer historischen Ordnung, sondern sah die alphabetische Gliederung<br />
vor. Denn jede systematische Einteilung nach Sachbereichen bedeute<br />
einen interpretatorischen Vorgriff: Begriffe, die heute getrennt gedacht werden,<br />
konnten früher gerade dasselbe meinen. »Jede solche Einteilung vergewaltigt<br />
die <strong>Geschichte</strong> zumindest einiger Begriffe«; das neutrale Alphabet biete hier<br />
allein die Chance, »so elastisch und der geschichtlichen Bewegung so angemessen<br />
wie möglich zu verfahren.« 20<br />
In der Gemäldeabteilung muß das GNM naturgemäß auf Supplementierung<br />
der spärlichen Originale durch Medien der Reproduktion zurückgreifen; so wie<br />
es die Gipsabgüsse <strong>für</strong> plastische Werke in der Abteilung der Monumente ist,<br />
sind es hier die kolorierten Kopien <strong>von</strong> Werken der Meister in den zerstreuten<br />
19 Essenwein 1870: 1000; dazu auch Kahsmtz 1977: 163<br />
20 Reinhart Koselleck, Richtlinien <strong>für</strong> das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte 11 (1967), 81-99 (94). Leicht modifiziert in der<br />
Einleitung zu: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen<br />
Sprache in Deutschland, hg. v. Otto Brunner, Werner Conze u. dems., Bd. 1,<br />
Stuttgart (Klett Cotta) 1972, xxv
530 MUSEUM<br />
»Es hat vielmehr die Aufgabe, die nicht ausgestellten Stücke konserviert in einer<br />
solchen Verfassung aufzubewahren, daß dem Spezialforscher ihr rasches Auffinden<br />
und ihr Studium jederzeit möglich ist. Die Gruppierung der Einzclstückc muß<br />
also in dem Magazin genau nach demselben System und in derselben Sorgfalt<br />
erfolgen wie in der Schausammlung, nur können sie wesentlich enger und ohne<br />
jede dekorative Ausstattung aufgestellt werden, das ist der einzige Unterschied.«<br />
<br />
Die Unordnung der Vergangenheit wird <strong>von</strong> den Ordnungsmedien der Historie<br />
kompensiert. In De oratore erläutert Cicero die ars memoriae anhand des<br />
(Un)Falls <strong>von</strong> Simonides, der die verschütteten Opfer eines Gastmahls anhand<br />
ihrer Anordnung wieder zu identifizieren vermochte (ordo). Der anschauliche<br />
Zusammenhang der Dinge (enargeia) in der Rhetorik heißt bei Cicero bildhafte<br />
Darstellung (informatw) eines Sinnzusammenhangs. Daten der Vergangenheit<br />
werden in den Gedächtnismedien Museum, Archiv und Bibliothek nicht als<br />
narrativer Diskurs organisiert (also »historisch«), sondern in einer informationsorientierten<br />
Weise als Magazin und Depot. Die Ordnung der Dinge im<br />
Museum korrespondiert mit einem musealen Blick auf deutsche Geschichtslandschaften.<br />
Der erste preußische Denkmalpfleger Quast sieht in der Kunstlandschaft<br />
des Vorharzes »doch den Vorzug, innerhalb seiner Grenzen <strong>von</strong> den<br />
Zeiten des ersten Aufblühens unter den Ottonen an eine fest geschlossene<br />
Reihenfolge <strong>von</strong> Monumenten bis zum Untergang der Kunst des Mittelalters<br />
aufzuweisen, in einer Vollständigkeit, daß in Deutschland nur Cöln hiemit wetteifern<br />
könnte.« 18 Quast nimmt damit die Landschaft als geschichtstopographische<br />
Serie wahr und (um)sieht sie dahingehend als musealen, chronologisch<br />
geordneten Raum.<br />
Wenn die Ästhetik sich auf der Diskursebene der Historie bewegt, zählt nicht<br />
so sehr der Kunstwert des Einzelstücks, sondern sein Dokumentationscharakter,<br />
so daß eine Mischung aus Original und Kopie keine Dissonanz hervorruft. In der<br />
Sammlung der Grabdenkmale (seinerzeit 6 Originale und 64 Abgüsse) »zeigt sich<br />
neben dem künstlerischen auch das historische Moment in voller Bedeutung; dieselbe<br />
wird in ihrer chonologischen Ordnung auch den Entwicklungsgang zeigen,<br />
den die Grabsteine im Laufe der Zeiten genommen.« <strong>Im</strong> Grabdenkmal erinnert<br />
sich die antike Bedeutung <strong>von</strong> monumenta; neben der kulturgeschichtlichen Seite<br />
sind die Grabdenkmäler »zugleich Geschichtsdenkmäler; sie führen uns das<br />
Gedächtniß der großen Männer, zum Theil ihre Gestalt, vor«:<br />
18 Ferdinand <strong>von</strong> Quast, Wie läßt sich der historische Gang der Ausbreitung des romanischen<br />
und gothischen Styls in der Gegend <strong>von</strong> Halberstadt an dennoch vorhandenen<br />
monumentalen Bauwerken des ehemaligen Bisthums nachweisen? In: Korrespondenzbl.<br />
d. Gesamtver. d. dt. Gesch.- u. Alterthumsver. 14 (1866), 1, zitiert nach: Voigtländer<br />
1989: 31, Anm. 69
ORGANISATION DI:R DKUTSCHI-N KUI.TURGI-.SCHICITIT. 531<br />
»Auf diesem Gebiete können wir uns also nicht begnügen, den kulturgeschichtlichen<br />
Entwicklungsgang zu verfolgen; hier müssen wir weiter gehen. Diese Sammlung<br />
muß eine Walhalla werden, in der sich die <strong>Geschichte</strong> Deutschlands und<br />
seiner großen Männer spiegelt, und mit Rücksicht auf die nationale, patriotische<br />
Seite unserer Aufgabe, wie mit Rücksicht auf den praktischen Umstand, daß<br />
unsere fertigen Kreuzgänge nur durch diese Grabdenkmale entsprechende Ausfüllung<br />
finden, müssen wir die Beschaffung derselben als die erste Hauptaufgabe<br />
betrachten.« 19<br />
Auch die Sammlung <strong>von</strong> Grabdenkmälern wird <strong>von</strong> Medien der Dokumentation<br />
supplementiert, einer Sammlung ihrer Abbildungen. Zwei Gedächtnisalgonthmen<br />
im Widerstreit:<br />
»Sie ist, wie alle unsere Sammlungen, bei denen es der Natur der Sache nach thunhch<br />
ist, chronologisch geordnet; früher war sie es, wie alle Sammlungen, bei denen<br />
dies überhaupt möglich, nach dem Alphabet, und wir werden wol auch,<br />
wenn sie etwa den dreifachen Umfang der jetzigen erreicht haben und wenn die<br />
Reihe der Abgüsse eine Uebersicht über den Entwicklungsgange aller der kunstund<br />
kulturgeschichtlichen Momente bieten wird, diese Blätter wieder alphabetisch<br />
ordnen, um in einem gegebenen Falle das Gesuchte möglichst rasch zu finden.«<br />
<br />
Die alphabetische ist die flexibelste Ordnung zur Bewältigung mventanscher<br />
Komplexität. Für diesen Entzug <strong>von</strong> historischem Sinn steht die Technik der<br />
alphabetischen Begnffsreihung in Enzyklopädien und Lexika, die (so auch Foucault)<br />
alle Möglichkeiten der ästhetischen Erkenntnis überschreitet; auch der<br />
Entwurf <strong>für</strong> das Publikationsprojekt Geschichtliche Grundbegriffe beruhte gerade<br />
nicht auf einer historischen Ordnung, sondern sah die alphabetische Gliederung<br />
vor. Denn jede systematische Einteilung nach Sachbereichen bedeute<br />
einen interpretatonschen Vorgriff: Begriffe, die heute getrennt gedacht werden,<br />
konnten früher gerade dasselbe meinen. »Jede solche Einteilung vergewaltigt<br />
die <strong>Geschichte</strong> zumindest einiger Begriffe«; das neutrale Alphabet biete hier<br />
allein die Chance, »so elastisch und der geschichtlichen Bewegung so angemessen<br />
wie möglich zu verfahren.« 20<br />
In der Gemäldeabteilung muß das GNM naturgemäß auf Supplementierung<br />
der spärlichen Originale durch Medien der Reproduktion zurückgreifen; so wie<br />
es die Gipsabgüsse <strong>für</strong> plastische Werke in der Abteilung der Monumente ist,<br />
sind es hier die kolorierten Kopien <strong>von</strong> Werken der Meister in den zerstreuten<br />
19 Essenwein 1870: 1000; dazu auch Kahsnitz 1977: 163<br />
20 Reinhart Koselleck, Richtlinien <strong>für</strong> das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte 11 (1967), 81-99 (94). Leicht modifiziert in der<br />
Einleitung zu: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politischsozialen<br />
Sprache in Deutschland, hg. v. Otto Brunner, Werner Conze u. dems., Bd. 1,<br />
Stuttgart (Klett Cotta) 1972, xxv
532 MUSKUM<br />
Gallerien Europas. Information steht hier als Effekt eines materialen Mangels<br />
auf dergleichen Werteskala wie der ästhetische Wert: »So haben wir natürlich<br />
um so größeres Gewicht wieder auf die Mappen zu legen. Wenn auch auf diesem<br />
Gebiete Photographien ungenügend, Lithographien und Kupferstiche nur<br />
mit Vorsicht zu benützen sind, so bietet doch unsere Sammlung <strong>von</strong> Nachbildungen<br />
eine schöne Uebersicht« . An die Miniaturen<br />
schließt sich die Abteilung Handzeichnungen:<br />
»Wenn bis in die neueste Zeit authentische Nachbildungen <strong>von</strong> Handzeichnungen<br />
noch schwieriger zu beschaffen waren, als Nachbildungen <strong>von</strong> Gemälden, und<br />
wenn Alles, was an Vervielfältigungen bis vor wenigen Jahren erschienen, <strong>von</strong><br />
weniger als zweifelhaftem Werthe war, so ist es erfreulich, daß unsere Mappen<br />
noch nicht viele solche Nachbildungen enthalten; jetzt aber, wo die Photographie<br />
in ein Stadium übergegangen , daß durch ihre Hülfe tadellose Nachbildungen<br />
erscheinen können, jetzt ist es jedenfalls eine der nächsten Aufgaben der<br />
Anstalt, hier <strong>für</strong> Sammlung alles Wichtigen zu sorgen und die Meister möglichst<br />
vollständig zu vertreten.« <br />
<strong>Im</strong> nächsten Schritt werden die Reproduktionsmcdicn selbst vom Subjekt zum<br />
(inneren) Objekt der Ausstellung: »Gehen wir <strong>von</strong> den zeichnenden Künsten<br />
auf die vervielfältigenden über, so ist die zunächst uns begegnende Abtheilung<br />
die der Holzschnitte« .<br />
Monumenta Iconographica und Reliquiae Medii Aevi lx<br />
Analog zum Editionsprojekt deutscher Geschichtsquellen des Mittelalters, den<br />
Monumenta Gcrmaniac Historica, ist die diskursive Einbindung der Institution<br />
Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg zwar ein patriotischer <strong>Im</strong>puls (der<br />
Freiherr Hans <strong>von</strong> Aufseß spricht <strong>von</strong> einer Nationalanstalt, doch vollzieht sich<br />
die Praxis eher als »eine nach trocken staubiger Gelehrsamkeit und nicht nach<br />
nationaler Begeisterung strebende, durch Karteikarten und Gipsabgüsse gekennzeichnete<br />
Anstalt« 22 . Der in der Nürnberger Museumspraxis tolerierte<br />
Abguß als Surrogat des Originals bedeutet Simulation als Information - Dokumentationswissenschaft<br />
ist das Paradigma des GNM als Bedingung nationaler<br />
Gedächtnisarbeit.<br />
21 Unter dem Titel Reliquiae medü aevi publizierte A. Kssenwein, Direktor des GNM,<br />
eine Denkschrift (Nürnberg 1884)<br />
21 Rainer Kahsnitz, Museum und Denkmal. Überlegungen zu Gräbern, historischen<br />
Freskenzyklen und Ehrenhallen in Museen, in: Bernward Deneke / ders. (Hg.), Das<br />
kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert. Vorträge des Symposions<br />
im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, München (Prestel) 1977, 152-175<br />
(152)
ORGANISATION DI-;K DKUTSCHKN KUI.TURGI-SCHICHTI-. 533<br />
Alois Riegl unterscheidet im Erinnerungswert <strong>von</strong> Artefakten gewollte und<br />
ungewollte Denkmale, je nach Überlieferungsabsicht des Urhebers; das Museum,<br />
das solche ungewollten Denkmäler sammelt, ist als Ganzes im Riegischen<br />
Sinne selbst ein gewolltes Denkmal, »weil es institutionell bestimmt ist, Vergangenheit<br />
zu vermitteln« . Der historische Wert ist<br />
primär ein (vom Datenträger loslösbarer) Informationswert:<br />
»Endlich muß festgestellt werden, daß der Kultus des historischen Wertes, wenngleich<br />
er bloß dem Originalzustande eines Denkmals vollen urkundlichen Wert<br />
einräumt, doch auch der Kopie einen beschränkten Wert zugesteht, falls das Original<br />
(die >Urkunde
534 MUSKUM<br />
Historiographie. Auf alle drei Gruppen <strong>von</strong> Geschichtsquellen (schriftliche, bildliche,<br />
und die in Original erhaltenen Denkmäler) greift der Historiker zurück,<br />
und da nicht jeder Geschichtsschreiber sämtliche Onginalquellen selbst durchforschen<br />
und selbst benützen kann, muß eine Grundlage durch entsprechende<br />
Publikationen geschaffen werden, »<strong>für</strong> deren Treue und Zuverlässigkeit aber auch<br />
eine offizielle Garantie geboten sein muß« . Für Schnftquellen aus dem<br />
Mittelalter firmiert das Unternehmen der Monumenta Germaniae Historica als<br />
national konzipierte Edition unter der Leitung einer vom deutschen Reiche eingesetzten<br />
Zentralkommission. Eine solche Verwaltung, die notwendige Standardisierung<br />
in der Datenverarbeitung erst ermöglicht und durchsetzt, fehlt lür<br />
andere Quellengattungen; kulturarchäologisches Bildmaterial liegt zerstreut und<br />
unpubhziert vor und wird nicht vollständig, sondern nach je subjektiven Kriterien<br />
zur Darstellung gebracht:<br />
»Einer giebt flott malerische Bilder, cm anderer zwar sorgfältige, aber ganz<br />
trockene; einer giebt die Erscheinung im ganzen, der andere legt auf sorgfältigste<br />
Detailbehandlung Wert, ein anderer Nicht. Einer zeichnet geometrisch in Grundund<br />
Aufriß, ein anderer perspektivisch; einer giebt Maße an, ein anderer nicht;<br />
einer zeichnet in Originalgröße, ein anderer giebt die Sache vergrößert.«<br />
<br />
Daraus resultiert die Notwendigkeit einer Standardisierung <strong>von</strong> Bildwiedcrgabe,<br />
ein reproduktionstechnisches Korrelat zur Methodisierung der Kulturwissenschaften.<br />
Essenwein fordert da<strong>für</strong> eine Kommission aus Historikern, Kunsthistorikern<br />
und Künstlern zum Ziel einer Edition der Monumenta iconographica<br />
medü aevi. Die lateinische Bezeichnung war absichtlich gewählt, um nicht allein<br />
die Parallele mit den MGH auszudrücken, sondern um vor allem zu unterstreichen,<br />
daß es sich dambei um eine Veröffentlichung handelte, welche »den höchsten<br />
Ansprüchen der Wissenschaft gerecht, wie die Monumenta Germaniae, ein<br />
Denkmal deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit werden will« . Analog zu methodischen Aporien in der Editionspolitik des<br />
Unternehmens MGH kommt es auch in der nationalen Definition <strong>von</strong> Bilddenkmälern<br />
(am Beispiel <strong>von</strong> Mosaiken und Wandgemälden) zu Unscharfen:<br />
»Gleich diese erste Abteilung führt uns zur Frage, wie weit wir geographisch ausgreifen<br />
sollen; wie bei den Monumenta Germaniae historica soll es sich auch hier<br />
um deutsche <strong>Geschichte</strong> handeln, wie dort aber nicht im kleinlichsten und<br />
engsten Sinne. Wir müssen alle, die auf deutsche <strong>Geschichte</strong> sich beziehen,<br />
berücksichtigen. Wir dürfen nicht vergessen, daß die deutsche Kultur sich<br />
nicht vereinzelt entwickelt hat, sondern als Teil jener der christlich abendländischen<br />
Völkerfamilie. So werden auch in der Publikation mancherlei fremde<br />
Elemente unbedingt berücksichtigt werden müssen. <br />
Ab dem 15. Jahrhundert kommt es sprunghaft zu massenhaften Bildquellen -<br />
eine mediale Zäsur, die Durchsetzung des typographischen Drucks, gibt (wie
ORGANISATION DHR DHUTSCHKN KuiTURGKsciua ITH 535<br />
auch den Monumenta und den deutschen Archiven) die Epochen der Historie<br />
als Sammlungsgegenstand vor. Die Bedingung kulturwissenschaftlicher Gedächtnisorganisation<br />
heißt dabei weniger Erzählung denn Berechnung, die Metonymie<br />
<strong>von</strong> Format und Übertragung, orientiert an den Formaten der MGH;<br />
dieses Editionsunternehmen setzt längst die Standards <strong>für</strong> die Administration<br />
des deutschen Speichers:<br />
»Wenn wir etwa 60 Tafeln im vierfachen Formate der Folioausgabe der Monumenta<br />
histonca in Aussicht nehmen, so dürfte es möglich sein, in 1/5 der Originalgröße<br />
alles Wichtige wiederzugeben, wobei natürlich nichts anderes die Grundlage bilden<br />
kann als Pausen der Originale, die sodann photographisch verkleinert werden, um<br />
die entsprechende Zeichnung zu erhalten. Was sich diesem Vorgange entzieht, ist<br />
aus freier Hand <strong>von</strong> dem Originale selbst und mit Benützung <strong>von</strong> Photographicn,<br />
die nach dem Originale aufgenommen sind, nachzuholen, während als Publikationsmittel<br />
lithographischer Farbendruck benützt werden kann. Einzelne kleine Teile<br />
können in Originalgröße wiedergegeben werden.« <br />
Besonders Tafelbilder und gemalte Tücher bedürfen eines dem Gegenstand<br />
angepaßten, also objektorientierter Reproduktionsmediums. Essenwein optiert<br />
<strong>für</strong> den Kupferstich; noch hat sich die Gleichsetzung <strong>von</strong> Photographie und<br />
Abbildungstreue medienästhetisch nicht durchgesetzt:<br />
»Dagegen müßten wir eine Reproduktion durch die Photographie oder Lichtdruck<br />
nach den Originalen als absolut unannehmbar bezeichnen. Wer, ohne <strong>von</strong> der Photographie<br />
zu leben, deren neuere glänzende Resultate genauer untersucht hat, weiß<br />
vollständig, daß die vorzügliche Wiedergabe auf Kosten der dokumentarischen<br />
Treue erreicht ist, daß die Vorzüglichkeit nur durch Handretouchen des Negativs<br />
oder dadurch erreicht wird, daß man einen Abdruck vollständig grau in Grau übermalt<br />
und danach ein neues Negativ herstellt, welches abermals retouchirt <br />
wird, bevor man Abdrücke da<strong>von</strong> macht. Es ist also die photographische Aufnahme<br />
nach dem Originale nur als Hilfmittel benützt, obwohl die Wiedergabe mit<br />
der Prätention auftritt, ein wirkliches Spiegelbild zu sein. Aber die Treue des<br />
Arbeiters, welcher sie benützt, soll genauer Kontrolle unterworfen werden und<br />
letztere soll nicht überflüssig erscheinen, weil man glaubt, die Natur, die ja nicht<br />
lügen kann, habe das Bild selbst wiedergegeben.« <br />
Der Ordnung der Bilder ist nicht selbstverständlich die Ordnung der Kulturhistorie<br />
ablesbar. Siegel - weil an philologisch identifizierbare Textmengen gebunden<br />
- fungieren als chronologische Leitfossihen der deutschen <strong>Geschichte</strong>, nicht<br />
etwa Grabsteine, die <strong>für</strong> die Zeit des Bestatteten vollkommen bedeutungslos sein<br />
können, weil sie häufig erst Jahrzehnte nach dem Tode des Bestatteten gefertigt<br />
sind. »Ein Siegel kann nur aus der Zeit des Sieglers selbst und der Urkundenausstellung<br />
herrühren« ; Fundament und Garant der Historie<br />
als Ordnung <strong>von</strong> Vergangenheit sind Recht und Gesetz. Das Reich der Bilder<br />
aber ist auf den Diskurs der Historie nicht reduzierbar und diese ist nur bedingt<br />
abbildbar. Essenwein fragt, ob es gerechtfertigt sei, sich ausschließlich auf die
536 MUSKUM<br />
Bedeutung zu beschränken, »welche die Bilder als Geschichtsquellen haben«,<br />
und »ob nicht auch diejenigen bildlichen Darstellungen aufzunehmen wären, in<br />
welchen so manches Verwandtes« zur Evidenz kommt . Nur bedingt vermag das Modell der Historie die Medienvielfalt ihrer Quellen<br />
zu disziplinieren. Neben den Monumenta iconographica konzipiert Essenwein<br />
die Bildedition <strong>von</strong> Rehquiae - »alles, was uns das Mittelalter körperlich<br />
Greifbares hinterlassen hat; es sind also auch die Quellen, aus denen die Monumenta<br />
iconographica zu schöpfen haben, rehquiae« . Rcliquiac<br />
legen eine rein äußerliche, archäologische Gruppierung nahe, doch will<br />
Essenwein nicht die Überreste der Vorzeit als Geschichtsquellen betrachten,<br />
wenn deren »technische Herstellung ausschließlich als Grundlage <strong>für</strong> die Einteilung<br />
zu nehmen« ist . Was dem historischen Diskurs hier<br />
entgeht, ist also nur medienarchäologisch faßbar. Zweck der Publikation ist weniger<br />
das einzelne Monument, sondern dessen Vergleichbarkeit:<br />
»Die Hauptsache wird sein, daß je nach der Größe einer einzelnen Objektgruppe<br />
ein gleicher Maßstab in gleichem Verhältnisse zur Originalgröße durch alle Objekte<br />
einer Gruppe geht, z. B. die Hälfte der Originalgröße, wo letztere so groß ist,<br />
daß sie nicht selbst bei der Wiedergabe festgehalten werden kann, so daß, trotz der<br />
Verschiedenheit des Maßstabes, Vergleiche <strong>von</strong> Objekt zu Objekt leicht möglich<br />
sind.« <br />
Schwarzer und farbiger Holzschnitt, teilweise auch »die denselben verdrängenden<br />
modernen Reproduktionsweisen« wie Zinkotypie sind <strong>für</strong> dieses Editionsprojekt<br />
geeignet, weil »gerade durch sie die monumentale Erscheinung des<br />
ganzen Werkes« herausgestellt wird - das Monumentale als Effekt medialer<br />
Hardware. Das Unternehmen hat nicht allein einen technischen, auch<br />
einen imaginären Mehrwert als nationale Allegorie. Zum Nationaldenkmal aber<br />
kann es nur werden, »wenn es aufhört, individuell zu sein« - eine Frage der Subvention. Vorgeschlagener Sitz des Unternehmens ist das<br />
GNM, denn es verfügt über das Dispositiv einer geeigneten Infrastruktur <strong>für</strong> die<br />
mediale Verarbeitung <strong>von</strong> Gedächtnisdaten: ein eigenes Publikationsorgan sowie<br />
Lokalitäten <strong>für</strong> die Aufbewahrung der entstehenden Originalzeichnungen,<br />
»etwaiger Lagervorräthe, sogar <strong>für</strong> den Vertrieb eine eigene Buchhandlung« -<br />
die Litterarisch-artistische Anstalt des germanischen Museums . Der Standortvorteil des GNM hegt im Zeugniswert, nämlich der Kopräsenz<br />
<strong>von</strong> Gcschichtsquellcn, »die wir in den erhaltenen Ongmaldenkmalen<br />
selbst vor Augen haben« ; die (<strong>für</strong> die okzidentale Wissenskultur<br />
charakteristische) Rückkopplung <strong>von</strong> Wahrheitsanspruch und Evidenz<br />
gilt besonders <strong>für</strong> die Reliquien.<br />
Die medienarchäologischen Grenzen der projektierten Monumenta Germaniae<br />
iconographica liegen im Modus ihrer Bildsortierung angelegt, denn die logo-
ORGANISATION DI:R DI UTSCHHN KUI.TURC;I;S(:IIIC:HTI-. 537<br />
zentnstischc Vcrschlagwortung der Bestände des Germanischen Nationalmuseums<br />
und seines General-Repertonums bleibt bislang diesseits der Schwelle<br />
einer bildbasierten Ortung der Bilder (ein bis an die Schwelle des Digitalen<br />
ungelöstes Problem der Bildarchivierung). Wer etwa nach Teppichornamenten<br />
sucht, nach Gewandgebung oder Fragen des Kolorits, würde keinen Erfolg<br />
haben: »Der Benutzer einer Datenbank kann nur dasjenige finden, was die Ka-:<br />
talogisierer zu indizieren bereit waren.« 24 Der reale museale Raum des GNM leistet<br />
keine bildbasierte Bildsortierung im Sinne der ars memoriae. <strong>Im</strong> frühen 16.<br />
Jahrhundert realisierte Gmlio Gamillo ein hölzernes Gedäehtnistheatcr, welches<br />
den die Position der Bühne einnehmenden Betrachter im Innenraum mit in<br />
Ränge und Segmente gegliederten Bildsenen konfrontierte; auch hinter dieser<br />
scheinbar bildbasicrtcn Bild-sortierung aber lauert das humanistische Gespenst<br />
der Textwissenschaft - standen diese Symbole doch nicht tür sich selbst als Aussagen,<br />
sondern fungierten als orientierende icons <strong>für</strong> darunter liegende Fächer<br />
mit Texten <strong>von</strong> Schriftstellern und Philosophen: »Stellt man sich alle Kisten und<br />
Fächer in diesem Theater vor, dann sieht es allmählich doch eher wie eine sehr<br />
ornamentale Aktenablage aus«, die ideell auf das Gedächtnis des Makrokosmos<br />
abgestimmt ist, in ihrer Technik aber eine archivische Repositur bildet. 23<br />
24 Horst Scholz, Das Bildarchiv Foto Marburg und die Erschließung seiner Bestände mittels<br />
EDV, in: Peter Rück (Hg.), Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden<br />
in Europa: <strong>Geschichte</strong>, Umfang, Aufbau und Vcrzcichnungsmcthoden der wichtigsten<br />
Urkundenfotosammlungen, Sigmaringen (Thorbecke) 1989, 141-153 (146). Siehe auch<br />
W. E. / Stefan Heidenreich, Bilder archivieren: Der Wölfflin-Kalkül, demnächst in:<br />
Christoph Tholen / Sigrid Schade (Hg.), Konfigurationen zwischen Künsten und<br />
Medien, München (Fink) 1998<br />
25 Franccs A. Yates, Gedächtnis und Erinnern: Mnemonik <strong>von</strong> Aristoteles bis Shakespeare,<br />
Weinheim (VCH / Acta Humaniora) 1990, 6. Kapitel »Gedächtnis in der Renaissance:<br />
das Gedächtnistheater des Giulio Camillo«, 134. Vgl. Harmut Winkler, Medien -<br />
Speicher - Gedächtnis, Vortrag an der Hochschule <strong>für</strong> angewandte Kunst, Synema,<br />
Wien (15. März 1994), im Internet unter der Adresse: www.rz.uni-paderborn.de /<br />
-Winkler/gedacht.html, § 2
538 MUSEUM<br />
Intermedialität des Gedächtnisses?<br />
Auf dem Weg zur Dokumentationswissenschaft<br />
Zwischen Gedächtnis und Dokumentation wird die Meta-Physik der Erinnerung<br />
gebildet aus der Konjunktion <strong>von</strong> Lexikon, Bibliothek, Archiv, Museum:<br />
Zentren der Erinnerung auch als Orte pragmatischen Handelns. Die Infrastruktur<br />
des Gedächtnisses bildet das institutionelle double dieser Erinnerung.<br />
Die Schnittstelle <strong>von</strong> Museum, Bibliothek und Archiv hegt in ihrem Charakter<br />
als begehbaren Datenräumen; Dokumentationswissenschaften suchen jene<br />
Bereiche zusammenzuschalten, indem sie aus der Physik <strong>von</strong> Gedächtnisagenturen<br />
ihren Informationswert destillieren. Dokumentation ist keine Institution,<br />
»sondern eine Tätigkeit und ihr Ergebnis, nämlich die Zusammenstellung <strong>von</strong><br />
Informationen unabhängig vom Träger und der Quelle zur Beantwortung <strong>von</strong><br />
im voraus gestellten Fragen« und mithin beliebig teilbar^ - eine Datenästhetik,<br />
die <strong>von</strong> bibliotheksbasierten Wissenswissenchaften in Gang gesetzt, aber erst<br />
<strong>von</strong> den Mihtärbürokratien des Zweiten Weltkriegs zum maschinellen Durchbruch<br />
und zur Verschiebung der (Wissens-)Machtproblematik <strong>von</strong> der Übertragung<br />
auf die der Verarbeitung <strong>von</strong> Information gebracht wurde. 2<br />
Archiv, Repertonum und Dokumentation<br />
Jeder systematische Versuch einer Kartographie der Infrastruktur <strong>von</strong> Gedächtnisinstitutionen<br />
stöfk auf Abgrenzungsprobleme zwischen Archiv und Dokumentation,<br />
auf den Unterschied zwischen Bibliotheken, Museumssammlungen,<br />
Archiven, Aufzeichnungsstellen <strong>für</strong> Meßdaten oder anderen sammelnden, ordnenden<br />
und informierenden Einrichtungen. In allen Fällen geht es um die<br />
betriebswirtschaftlich vertraute Frage nach flexiblen, wenig Speicherenergie bindenden<br />
Lagerformen (Kapital und Gedächtnis). Liegt das, was dreidimensional<br />
ist, im musealen Magazin, und das Zweidimensionale im Archiv? Oder ist das<br />
Kriterium der Ausdifferenzierung <strong>von</strong> Gedächtnis die Erschließung des Materials}<br />
Um als Archiv oder Dokumentation zu gelten, müssen gesammelte Mate-<br />
Angelika Mcnne-Haritz, Schlüsselbegriffe der Archivterminologie: Lehrmaterial <strong>für</strong><br />
das Fach Archivwissenschaft, Marburg (Archivschule) 1992, 78<br />
»Documcntation was no longer for scicntific crcativity in the library but for military-scientific<br />
burcaucracics«: Colin Burkc, Information and Sccrecy. Vannevar Bush,<br />
Ultra, and thc Othcr Memcx, London 1994, 13. Dazu Gloria Mcyncn, Bürokratien<br />
<strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien, Bibliothek und Maschinen, Magisterarbeit Humboldt-Universität Berlin,<br />
Fakultät Kulturwissenschaften, <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>Geschichte</strong> und Ästhetik der Medien<br />
(Friedrich A. Kittler), 1997
Aul' DKM WliC; ZUR DoKUMr.NTAnONSWISSHNSaiAIT 539<br />
rialien erschlossen sein. »Ob es sich dabei nun um eine grobe Ordnung und<br />
Ablage nach Sachgebieten oder um einen Thesaurus mit Feldern, Deskriptoren<br />
und Facetten handelte, was dann <strong>für</strong> die grundsätzliche Berücksichtigung als<br />
Archiv oder Dokumentation nicht mehr entscheidend.« 3 Die Brüsseler Definition<br />
<strong>von</strong> 1931 definiert Dokumentieren als mediale Operation: »Reumr, classer<br />
et distribuer des documents de tout genre dans touts les domaines de l'activite<br />
humaine.« 4 Archive und Museen teilen mit Bibliographien die Eigenschaft<br />
<strong>von</strong> Dokumentationsstellen als Kulturaufgabe, also die Sorge der Speicherung<br />
und Übertragung gedächtnisreifer Daten. Damit ist die Definition <strong>von</strong> Kultur<br />
als Funktion ihres Gedächtnisses in kybernetische Echtzeit überführt und der<br />
Begriff der Dokumentation die Transzendierung ausdifferenzierter Gedächtnisagenturen<br />
zum Mcdicnvcrbund. Die erste Denkschrift des Germanischen<br />
Nationalmuseums (die Gründungssatzung <strong>von</strong> 1852) deklariert - abseits vom<br />
patriotischen Sinneffekt - den Zweck des Unternehmens speicherpragmatisch:<br />
»a) ein wohlgeordnetes Generalrepertorium über das ganze Quellenmaterial <strong>für</strong><br />
die deutsche <strong>Geschichte</strong>, Literatur und Kunst, vorläufig bis zum Jahre 1650, herzustellen;<br />
b) ein diesem Umfang entsprechendes allgemeines Museum, bestehend<br />
in Archiv, Bibliothek, Kunst- und Alterthums-Sammlung, hauptsächlich durch<br />
Copien aus anderen Museen zu errichten, c) beides durch zweckmäßige Anordnung<br />
und Bearbeitung allgemein zugänglich und nutzbar zu machen, und endlich<br />
d) durch Veröffentlichung der bedeutendsten Quellenschätze und Herausgabe<br />
belehrender Handbücher gründliche Kenntnis der historischen, literarischen und<br />
artistischen Zustände der deutschen Vorzeit zu verbreiten.« 3<br />
Das Nürnberger Museum versteht sich also originär als Medienverbund. Die<br />
jüngste Satzung <strong>von</strong> 1986 will im deutschen Sprachraum Zeugnisse der <strong>Geschichte</strong><br />
und Kultur, Kunst und Literatur wissenschaftlich erforschen, sammeln,<br />
bewahren und der Öffentlichkeit erschließen. Damit ist das GNM als Medium<br />
im Sinne der Informationstheorie definiert; das Programm des GNM erfüllt<br />
Martha Meyder-Althoff, Markus Holmer, Sabine Kaak u. a., Archiv- und Dokumentationsführer<br />
Hamburg, Hamburg (Universität) 1990, Vorwort, 7<br />
Zitiert nach: Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918,<br />
Leipzig (Keohler & Amelang) 1969, 94f. Dieselbe Stelle zitiert Meisner in seinem Aufsatz:<br />
Archive und Museen, in: Archivmitteilungen 2/1957, 38-41 (38), kommentiert als<br />
»ursprüngliche, nicht mehr unbestrittene Definition des Internationalen Instituts <strong>für</strong><br />
Dokumentation in Brüssel (1911)«. Zur Vorgeschichte des Begriffs: F. Donker Duyvis,<br />
Die Entstehung des Wortes »Dokumentation« im <strong>Namen</strong> der FID [1959], in: Peter R.<br />
Frank, Einleitung, in: ders. (Hg.), Von der systematischen Bibliographie zur Dokumentation,<br />
Darmstadt (Wiss. Buchgesellschaft) 1978, 99-102<br />
Das Germanische National-Museum. Organismus und Sammlungen (Denkschriften<br />
des Germanischen National-Museums, Bd. 1), Abt. 1, Nürnberg 1856, 9, hier zitiert<br />
nach: Kahnsnitz 1977: 152
540 Musr.uM<br />
seine Funktion als Gedächtnisagentur. Sammeln, Speichern, Weitergeben - allein<br />
der Begriff der Berechnung oszilliert hier noch zwischen wissensarchäologischer<br />
Zählung diskreter Daten und (kultur-)historischer .Erzählung. Was zählt, ist die<br />
Dokumentation: »Somit sieht sich unsere Anstalt nicht als Historisches Museum,<br />
sondern als institutionalisiertes Nachschlagewerk deutscher Kunst und<br />
Kultur« ; mithin also der begehbare enzyklopädische<br />
Raum, »vereint und chronologisch vom Mittelalter bis ins späte 18. Jahrhundert<br />
abschreitbar sind Gemälde und Skulpturen, kirchliches und profanes Kunsthandwerk«<br />
. Der Aggregatzustand, in dem dieser Medienverbund <strong>von</strong><br />
Museum, Archiv und Bibliothek sich heute präsentiert, heißt selbst Inventar. Er<br />
knüpft an den Sprachgebrauch der Humanisten im 16. Jahrhundert hinsichtlich<br />
der Konnotationen <strong>von</strong> musacum als Stätte des Studiums <strong>von</strong> Zeugnissen der<br />
Vergangenheit an, »der geistigen Beschäftigung mit antiken Bronzen, Skulpturen,<br />
Schriften, Münzen, Bildern, mit Sammlungen verschiedenster Dinge, oft<br />
auch nur <strong>von</strong> Büchern« unter Aussparung des emphatischen Geschichtsbegnffs,<br />
den zu implementieren erst Johann Joachim Wmckclmanns Kunstgeschichte und<br />
G. W. F. Hegels Geschichtsphilosophie sich anschicken. Kontemplation war einmal<br />
der konkreten Sammlung vorgeschaltet; »der Charakter als Stätte des Denkens<br />
an Vergangenes in einer Atmosphäre einsamer Versenkung« scheint<br />
den Äußerungen der Humanisten <strong>für</strong> den Begriff musaeurn oft wichtiger als der<br />
Inhalt der Sammlung 6 - mithin also ein virtueller Speicherbegriff.<br />
Inventarisation und wissenschaftliche Dokumentation als Informatik (Otlct)<br />
Die systematische Aufspeicherung <strong>von</strong> Artefakten korrespondiert mit ihrer<br />
Standardisierung im Medium des Symbolischen (Schrift). Was mit <strong>von</strong> Aufseß<br />
als Plan eines General-Repertoriums deutscher Kulturdenkmäler begonnen hat<br />
und scheitert, insistiert doch als dokumentationswissenschaftliche Notwendigkeit.<br />
Ein anonymer Berichterstatter jedoch vergleicht 1895 das vom Brüsseler<br />
Institut <strong>für</strong> Bibliographie angestrebte Universalvcrzeichnis mit dem »babylonischen<br />
Turmbau«, präjudiziert also den Zusammenbruch dieses Unternehmens<br />
analog zu <strong>von</strong> Aufseß< Generalrepertorium. 7 Der deutsche Museums^oom nach<br />
der Reichsgründung resultierte in einer inkompatiblen Pluralität wissensorganisatorischer<br />
und verwaltungsmäßiger Art; Kohlhaußen als Direktor des GNM<br />
Kahsnitz 1977: 159, unter Verweis auf: Liliane Chätelet-Lange: Le »Museo di Vanves«,<br />
in: Zeitschrift <strong>für</strong> Kunstgeschichte, Bd. 38 (1975), 266-285, bes. 279-283<br />
Johannes Rogalla <strong>von</strong> Bieberstein, Archiv, Bibliothek und Musein als Dokumentationsbe'reiche.<br />
Einheit und gegenseitige Abgrenzung, Pullach b. München (Verlag Dokumentation)<br />
1975, 80, unter Bezug auf: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen Bd. 12, 525
Aui ; DI-:M WKC; ZUR DOKUMKNTATIONS\VISSHNSC:HAI-T 541<br />
spricht <strong>von</strong> in staatliche, städtische, Provmzialsammlungen und Stiftungen auseinander<br />
fallenden Museen mit divergierenden Bezugsrahmen:<br />
»So wird z. B. die Inventarisation der Neuzugänge, gewissermaßen das Gerüst aller<br />
wissenschaftlichen Forschung, nach den verschiedensten Methoden durchgeführt.<br />
Größe des Invcntarzettels, Inhalt und Umfang der wissenschaftlichen Beschreibung,<br />
Literaturangaben und Fotobeilagcn, das alles obliegt keineswegs einer einheitlichen<br />
Regelung. Verschiedentlich hat sich aber auch hier schon zur Erleichterung der schematischen<br />
Arbeit ein Inventar/cttcl in DIN-Format mit Vordrucken sowie Raum<br />
<strong>für</strong> Kleinfotos eingeführt, der eine gar zu individuelle Behandlung ausschließt« 8<br />
- ein Auftritt der bildbasierten Archivierung durch Sortierung. Die Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> eine Reichsplanung der Inventarisation, der Drucke und der Erschließung<br />
im weiteren Sinne (als Organisation der Auskunftei 9 ) bedeute eine<br />
gewisse finanzielle Gleichschaltung« . Diesem Plädoyer <strong>für</strong> musealökonomische<br />
Gleichschaltung folgt jedoch ihre histonstische Antinomie in Methodenfragen.<br />
Die Inventarbände der Bau- und Kunstdenkmäler seien zwar trotz<br />
der Verschiedenheit einzelner I.ändcrprogramme allmählich zu einem »bestimmten<br />
Typ zusammengewachsen«, also standardisiert; eine solch »im einzelnen<br />
elastische Rahmenform« möchte Kohlhaußen auch <strong>für</strong> die Katalogisierung der<br />
musealen Denkmäler realisiert sehen. Doch habe »eine schematische Erschließung<br />
nur da Sinn« - also einen gemeinsamen Vektor -, wo es sich um ausschließlich<br />
typische Denkmäler handelt. »Schon bei guten wenn auch schlichten<br />
handwerklichen Arbeiten widersetzt sich das persönlich geartete Material einer<br />
Klassifizierung«. Standardisierung und Widerstand: Kohlhaußen erwähnt den<br />
ganz mißglückten Versuch einer Einführung der Deweyschen Klassifikation im<br />
Katalog der Waffensammlung Dreger vom Jahre 1926. 10 Jedes echte Kunstwerk,<br />
jedes handwerklich gute Gerät entziehe sich kraft seiner individuellen Gestaltung<br />
einer schematischen Erfassung. Mit dieser Individualität <strong>von</strong> Werkzeugen<br />
korrespondiert die Unmöglichkeit ihrer automatisierten Speicherung; medien-<br />
s Heinrich Kohlhaußen, Die Bedeutung der Museen <strong>für</strong> die Wissenschaft und ihre<br />
Erschließung, in: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation (Hg.), Die Dokumentation<br />
und ihre Probleme. Vorträge, gehalten auf der ersten Tagung der Deutschen<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation vom 21. bis 24. September 1942 in Salzburg, Leipzig<br />
(Harrassowitz) 1943, 32-39 (37)<br />
9 Das bibliothekarische Pendant zur <strong>von</strong> Kohlhaußen angesprochenen »Auskunftei«<br />
bildete das Auskunftsbüro der deutschen Bibliotheken bei der Königlichen Bibliothek<br />
in Berlin, vom damaligen Bibliotheksdirektor Adoll Llarnack als »nationales Bureau«<br />
tituliert: Dazu Ernst Mohrmann, in: Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deutschen<br />
Buchhändler zu Leipzig: Urkunden und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung,<br />
Leipzig (Börsenverein der deutschen Buchhändler) 10. Ausgabe 1915), 22<br />
10 Unter Bezug auf: M. Dreger, Waffcnsamlung Dreger. Einführung in die Systematik<br />
der Waffen. Berlin und Leipzig 1926
542 MUSI-UM<br />
archäologisch »begann Programmierbarkeit, so sie denn <strong>von</strong> Kalkühsierung<br />
unterschieden werden darf, wohl erst zu jener Zeit, als die Technologie <strong>von</strong><br />
Werkzeugen zu Maschinen überging«, anstelle der Einzelstückherstellung also<br />
die standardisierte Massenproduktion tritt. 11<br />
»Aber auch das einzelne Museum mit anspruchsvollen Werken der Kunst oder<br />
Kultur widersetzt sich der mittelbaren Erschließung. Es unterliegt schon als<br />
Gesamtform im Wandel der Zeiten einer Veränderung ; denn in der Art der<br />
Aufstellung und Wirkungskraft der in ihm versammelten Werke offenbart sich<br />
sowohl ein gut Stück wissenschaftlicher Leistung wie der ästhetische Sinn. Es sind<br />
nicht mehr die Reste eines längst zerstörten Ganzen, die ihrem Ursprungsort und<br />
-plan entfremdeten Elemente, die da planlos und traurig verkümmern, sondern<br />
sie sind, soweit vorhanden, mit anderen verwandten Werken zu einer neuen Ordnung<br />
verbinden, die den Beschauer belehrt und entzückt. An solche Wirkung<br />
dachte schon Goethe, als er 1816 in >Kunst und Altcrtum< schrieb: >Jede methodische<br />
Zusammenstellung zerstreuter Elemente bewirkt eine Art <strong>von</strong> geistiger<br />
Geselligkeit, welche denn doch das Höchste ist, wonach wir streben«.« <br />
Keine Mimesis also an vergangene respektive ferne, also: absente Wirklichkeiten,<br />
sondern originäre Präsentation im Prozeß der Semiose. Der Geist methodischer<br />
Zusammenstellung aber weht nur bedingt in kunst- und kulturgeschichtlichen<br />
Sammlungen. »Die Gegenstände aus dem Reiche der Natur lassen sich leichter<br />
klassifizieren und damit wesentlicher erfassen als die individuellen Schöpfungen<br />
des Menschen« ; Wissensarchäologic steht jenseits <strong>von</strong> Hermeneutik. Die<br />
Klassifikationssysteme des GNM sind Teil eines umfassenden Dispositivs, das<br />
Wissen durch systematische Speicherung kalkulierbar macht. 1910 erklärt Paul<br />
Otlet Dokumentation zur neuen Form <strong>von</strong> Wissenschaft und »das Buch im heutigen<br />
Sinne« zur »überlebte Einrichtung«; Otlet und sucht vielmehr vor allem<br />
auch die neuen Informationsmedien Schallplatte, Photographie und Film »gebündelt<br />
und thematisch gezielt« einzusetzen - eine programmatische Antwort auf die<br />
heraufdrängenden Erfordernisse der Naturwissenschaften, Technik und Medizin<br />
. Der Begriff des documentum selbst ist schon zum Effekt seines<br />
Mediums, der Schrift, geworden; bei Cicero und Caesar meint er zunächst<br />
eher pädagogisch (doceo) »Beweis, Beispiel, Warnung«. Die Entwicklung zur<br />
Bedeutungen <strong>von</strong> Schriftstück respektive Urkunde findet später im juridischen<br />
Diskurs statt und ist eine mediale Funktion der Ausbreitung <strong>von</strong> Schnftlichkeit<br />
selbst. »Aus der Bedeutungsverwandtschaft zwischen Dokumentation und Information<br />
ist erklärbar, daß 1905 P. Otlet sie in Beziehung mit seinen bibliogra-<br />
Friedrich Kittler, Hardware, das unbekannte Wesen, in: Lab. Jahrbuch <strong>für</strong> Künste und<br />
Apparate 1996/97, hg. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien, Köln (Verlag Walther König)<br />
1997,348-363 (350)
Aui ; DKM WKC; ZUR DOKUMKNTATIONSWISSHNSCHAIT 543<br />
phischen Aktivitäten brachte.« 12 Die aus dem seit 1895 existierenden Institut<br />
International de Bibliographie in Brüssel 1937 transformierte Föderation Internationale<br />
de Documentation definiert mit ihrem ersten Betriebsorganisationsberater<br />
Ernst Hymans den alten (Rechts-)Begnff Dokumentation neu als »das<br />
Sammeln, Ordnen und Verteilen <strong>von</strong> Dokumenten jeder Art« 13 und macht ihn<br />
damit informationstheoretisch anschließbar. Für Otlet umfaßt die Dokumentation<br />
Bereiche, die sich sowohl kombinieren als auch vermischen:<br />
»A. Les Documcnts particuliers .<br />
B. La Bibliotheque .<br />
C. La Bibliographie <br />
D. Archives documentaires (Dossiers, materiaux de la documentation): Les Archivcs<br />
ou dossiers comprennent les pieces originales et les petits documents dans leur<br />
integrite ou par fragments. <br />
E. Les Archives administratives <br />
F. Les Archives anciennes <br />
G. Les documents autrcs que bibliographiques et graphiques: c'est la musique, ce<br />
sont les incnptions lapidaires, ce sont les procedes relativcment recents par lesquels<br />
s'enregistre et se transmet Pimage de la realite en mouvemcnt et la pensee parlee<br />
(phonographc, disquc, discothequc).<br />
H. Les Collcctions Muscographiqucs qui se presente comme objets ä<br />
trois dimensions. <br />
I. L'Encyclopcdie .« u<br />
Am Mundaneum in Brüssel wird die Deweysche Dezimalklassifikation adaptiert<br />
- ein letztlich bis auf Descartes zurückgehender numerischer Versuch, das<br />
Universum zu kalkulieren, der dennoch so willkürlich bleibt wie die <strong>von</strong> Michel<br />
Foucault einleitend in Die Ordnung der Dinge zitierte chinesische Enzyklopädie,<br />
und ebenso chaotisch^. Maßgeblich aber ist - gegenläufig zu Hegels<br />
Phänomenologie des Geistes - der Versuch, in Form eines bibliographischen<br />
Repertonums den Geist meßbar, d. h. kalkulierbar zu machen, konkret: »einer<br />
intellektuellen Statistik als Basis dienen«, und das in einer »Nomenklatur<br />
12 Rafael Capurro, Information. Ein Beitrag zur etymologischen Begründung des Informationsbegriffs,<br />
München u. a. (K. G. Säur) 1978, 231<br />
13 F. Donker Duyus, Die Entstehung des Wortes »Dokumentation« im <strong>Namen</strong> der FID<br />
(-•'1959), in: Frank 1978, 99-102 (99); früher datiert Carl Björkbom die neue Begriffsmünze<br />
ebd., 103ff<br />
14 Otlet 1934: 6f »Fundamenta«; zur Position der Archive siehe Fritz Zimmermann, Die<br />
Stellung der Archive innerhalb eines Systems der Dokumentation, in: Archivahsche<br />
Zeitschrift 62 (1966), 87-125 (88)<br />
15 So unter ausdrücklichem Bezug auf das Bibliographische Institut in Brüssel (<strong>von</strong> dem<br />
Foucault markant absieht): Jorge Luis Borges, Die analytische Sprache John Wilkins',<br />
in: ders., Das Eine und die Vielen. Essays zur Literatur, München (Flanscr) 1966, 209-<br />
214(212)
544 MUSHUM<br />
der menschlichen Kenntnisse, die fest und universal ist und sich in einer internationalen<br />
Sprache ausdrücken läßt, der der Ziffern«. 16 Von der Anwendung der<br />
statistischen Methode auf den Bestand der Bibliotheken hat schon Dilthey<br />
geträumt 17 ; einen bibhotheksstatistischen Versuch, »das wissenschaftliche<br />
Gewicht der Bücher graphisch versinnbildlichen« - eine wissensarchäologische<br />
Visualisierung mithin - machen Diagramme in der bibliothekstechnischen<br />
Abteilungen der Internationalen Ausstellung <strong>für</strong> Buchgewerbe<br />
und Graphik in Leipzig 1914. 18 Die 1934er Publikation <strong>von</strong> Otlets Traite de<br />
Documentation als Le Livre sur le Livre liest sich retrospektiv im Kontext der<br />
Schriften <strong>von</strong> de Saussure, Jakobson, Shannon, Meyer-Epler und anderer Kommunikationstheoretiker<br />
19 . Parallel zum Brüsseler Institut denkt die Münchner<br />
Organisation Die Brücke an eine Zentralauskunftstelle der Adressen <strong>von</strong> Aulbewahrungsorten<br />
wissenswerter Sammlungen (Dinge, Schriftstücke, Bücher,<br />
Drucksachen, Bilder); das Archiv dieser Stelle soll »eine Art Inhaltsverzeichnis<br />
aller erdenklichen Begriffe und Gegenstände vorstellen, dessen einzelne Stichwörter<br />
Hinweise auf alle möglichen bestehenden Sammlungen des Gegenstandes<br />
enthielten.« 20 Der Archivbegriff verlagert sich somit zum Ort des<br />
Verweises auf Daten, nicht deren Speicher; gerade die Existenz einer Zentral-<br />
1(1 H. La Fontaine / Paul Otlet, Die Schaffung einer Universalbibliographie [1895], in:<br />
Peter R. Frank (LIg.), Von der systematischen Bibliographie zur Dokumenation, Darmstadt<br />
(Wiss. Buchgesellschaft) 1978, 143-169 (145)<br />
17 Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Bd. 1, 3. Aufl. Leipzig /<br />
Berlin (Teubner) 1933 (unveränd. Neudruck der Ausgabe 1883), 1 15; s. a. Georg Leyh,<br />
Statistik, in: Handbuch der Bibliothekswissenschaft, begründet v. Fritz Mielkau. 2.<br />
vermehrte u. verbesserte Auflage hg. v. Georg Leyh, Bd. 2: Bibhotheksvcrwaltung,<br />
Wiesbaden (Harrassowitz) 1961, 735-761<br />
18 C. Nörrenberg, Die Bibliotheken auf der BUGRA, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen,<br />
29. Jg., 12. Heft (1912), 533-535 (535). Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig<br />
(Wiegandt) 1912, widmet der »Statistik der Bücherei« ein ganzes Kapitel (XX)<br />
und verweist ebenso auf die graphische Darstellung als Mittel, die Statistik augenfällig<br />
zu machen (380). S. a. Otto Neurath, Bildstatistik nach Wiener Methode in der<br />
Schule, Wien / Leipzig 1933<br />
19 Robert Estivals, Vorwort zur Wiederauflage <strong>von</strong>: Paul Otlet, Traite de Documentation.<br />
Le Livre sur le Livre. Theorie et Pratique, Brüssel (Mundancum) 1934, iv. Siehe auch<br />
Claude Shannon / Warren Weaver, Mathematical Theory of Communication, Indiana,<br />
111. 1963; über die Berechcnbarkeit <strong>von</strong> Sprache als Phantasiespekulation einer Universalbibliothek:<br />
Bemerkungen über (in ehe Richtung <strong>von</strong>) Bernard Shaw, in: Borges 1966:<br />
246f. Über Wörter selbst als Informationsspeicher (wie sie John Wilkins' analytische<br />
Universalsprachc in An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language<br />
1668 konzipierte): Marshall McLuhan, Die magischen Kanäle ( ;; 'Understandmg Media,<br />
1964), Düsseldorf /Wien (Econ) 1968, 68<br />
20 K. W Bührer / Adolf Saager, Das Brückenarchiv I. Allgemeine Gesichtspunkte, Ans-<br />
bach (Seybold) 1911,4
AUI ; DKM Wl-X; ZUR DoKUMKNTATlONSWISSKNSClIAlT 545<br />
auskunftssteile ermöglicht dadurch die Dezentralisierung der Datenbanken.<br />
Tatsächlich bauen sich an öffentlichen und privaten Orten permanent Archive<br />
selbst auf (gelehrte Schriftnotizen, Photographien aller Art), so daß »das Material<br />
<strong>für</strong> die Zentralauskunftsstelle gar nicht erst zu schaffen werden braucht,<br />
sondern in Wirklichkeit bereits fast vollständig vorhanden ist«; es kommt<br />
also darauf an, die Adressen und den zerstreuten Inhalt zu katalogisieren . Geht die Tendenz der Dokumentation <strong>von</strong> der Speicherung in Richtung<br />
Übertragung? In einer generalisierten Bedeutung aber holt der Archivbegriff<br />
den der Dokumentation wieder em. Zimmermann registriert, »daß der<br />
Begriff des >Archivs< insgeheim durch das Gebäude der Dokumentation geistert<br />
und gute Lust verspürt, sich mit ihm zu identifizieren«, doch Archive<br />
und Registraturen »stellen eine Dokumentation eigener Art dar. Sie beruhen<br />
<strong>von</strong> Haus aus nicht auf einem freiwilligen Gründungsvorgang« ; die arche, das aussagensetzende Kommando der Herrschaft als<br />
Beginn der Institution, setzt überhaupt erst die Differenz <strong>von</strong> Macht- und<br />
Kulturgedächtnis. 21<br />
Steht das Archiv tendentiell auf Seiten der Geistes-, Dokumentation auf Seiten<br />
der Naturwissenschaften? Hanns W. Eppelsheimer definiert neben der naturwissenschaftlichen<br />
und technischen Dokumentation auch das Riesenreich - die<br />
Gedächtnisreichweite - der Geisteswissenschaft »mit der Unzahl <strong>von</strong> Völkerschicksalen<br />
und Kulturen und ihrer Reste in Bibliotheken, Archiven und Museen«,<br />
jenes »kaum zu übersehende Erbe« als ein Arbeitsfeld der Dokumentation<br />
(denn Kultur ist eine Funktion ihrer Speicher). <strong>Im</strong> Sinne der Methoden naturwissenschaftlicher<br />
Belegbereitschaft sind bereits die deutschen Gedächtnisdatenbanken<br />
des 19. Jahrhunderts, die Quellensammlungen etwa der griechischen und<br />
lateinischen Inschriften, der Monumenta Germamae histonca, der Chroniken<br />
deutscher Städte »zum Druck gebrachte Dokumentensammlungen«. 22 Die Herausforderung<br />
an das Germanische Nationalmuseum als Datenverarbeitungsmedium<br />
lautet im Systementwurf des Gründers <strong>von</strong> Aufseß 1853 »Schriftliches und<br />
Bildliches so zu verschmelzen, dass beides vereinigt in em und dasselbe System<br />
und Fachwerk emgepasst werden konnte« 23 - Bildgrenzen der Schrift und der<br />
<strong>Geschichte</strong> als ArchiTextur. Der <strong>Im</strong>perativ, nationale Identität durch Geschichtsbewußtsein<br />
museal zu stiften, steht in einem Interessenskonfhkt zu <strong>von</strong> Aufseß'<br />
System: denn die Welt, schrieb Friedrich Schlegel, ist kein System, sondern eine<br />
21 Siehe Armin Adam / Martin Stingelin (Hg.), Übertragung und Gesetz. Gründungsmythen,<br />
Kncgstheater und Unterwerfungsstrategien <strong>von</strong> Institutionen, Berlin (Akademie)<br />
1995<br />
22 Hans Wilhelm Eppelsheimer, Die Dokumentation in den Geisteswissenschaften, in:<br />
Nachrichten <strong>für</strong> Dokumentation 2 (1951), 87f<br />
23 Abgedruckt in Deneke / Kahsnitz 1978: 975-992 (977)
546 MUSKUM<br />
<strong>Geschichte</strong>. 24 Was mechanistisch aussieht (Aufseß< Ordnungsapparatur), sieht<br />
der Verfasser im Sinne der integrativcn Figur der Metonymie, der master trope<br />
<strong>von</strong> Historiographie im 19. Jahrhundert 25 , als ein vollendetes Ganzes im Zusammenhange<br />
der einzelnen Fachsysteme: »Eine bestimmt formulirte Tdcc eines<br />
Gesammtsystems aller einzelnen Fächer, in dem diese sich sämmtheh als organische<br />
Theile zusammenfinden und gegenseitig ergänzen, wie auch aneinander<br />
abgeben, was dem andern mit stärkerem Zuge sich hingiebt, war als Anknüpfungs-<br />
und Verständigungsmittel hiezu nothwendig aufzustellen« . <strong>Geschichte</strong> als Ereignis und als Zustand sind <strong>für</strong> Aufseß nicht - wie sein<br />
System in der graphischen Darstellung suggeriert - gleichrangig; die Zustände sind<br />
vielmehr »gleichsam die Grundlage und Staffage der historischen Begebenheiten<br />
und Personen« . Der Unterschied und die Affinität zum Verknüpfungsmedium<br />
Hypertext ist das Verhältnis <strong>von</strong> Einzelinformation und<br />
(unterstelltem respektive abwesendem) Ganzem: »Das Einzelne musste dem<br />
Ganzen sich unterordnen und aecomodiren . Denn in ihrer Zusammenstellung<br />
durchdringen und kreuzen sich Kirche und Staat, Kirche und Schule, Wissenschaft<br />
und Schule, Kunst und Gewerbe, Handel und Gewerbe« . Aufseß< System verfügt selbst noch einmal über Fußnoten, jenem minimalsten<br />
Ansatz <strong>von</strong> hypertextueller Textwissensverknüpfung. Abteilung B<br />
(Zustände) teilt die Untergruppe Schrift und Schriftproduct u. a. in die Schriftprodukte<br />
Inschriften und Archivahen, deren letztere wiederum in »Urkunden<br />
und Grundbücher«, »Akten und Rechnungen«, »Briefe, Stammbücher, Notizenbücher«.<br />
Dann die Anmerkung »Wo es sich ausscheiden liess, sind Briefe, Urkunden<br />
und Akten da eingereiht, wo sie als Quelle hingehören« - Gedächtnisdaten<br />
oszillieren zwischen Betreff und Provenienz, zwischen Monument und Dokument,<br />
zwischen System und <strong>Geschichte</strong> . Kulturgedächtnis<br />
und totale Erfassung des Menschen gehen zusammen, denn es sind Korpora und<br />
Körper, in die sich die Gcdächtnistcchniken in ihrer Exteriorität, ihrer Äußerlichkeit,<br />
einschreiben, als Zähmung und Steuerung dieser Körper in ihrer unvordenklichen<br />
Komplexität und Vergeßlichkeit. 26 Gegen diese Vergeßlichkeit setzt<br />
Zitiert nach: Ernst Schulin, Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch: Studien zur<br />
Entwicklung <strong>von</strong> Geschichtwisenschaft und historischem Denken, Göttingen (Vandenhoek<br />
& Ruprecht) 1979, 40, unter Bezug auf Anm. 64<br />
1 Zur rhetorischen Trope der Metonymie siehe I Iayden White, Metahistory. The historical<br />
imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore, Mar. / London 1973, 31 ff<br />
' David Wellbery, Diskussionsbeitrag, in: Hartmut Eggert, Ulrich Profitlich, Klaus R.<br />
Schcrpc (Hg.), <strong>Geschichte</strong> als Literatur. Formen und Grenzen der Repräsentation <strong>von</strong><br />
Vergangenheit, Stuttgart 1990, 381-384, hier: 382f, unter Bezug auf: Michel Foucault,<br />
Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, übers. Walter Seitter, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1977
Aur ni-M WKG ZUR DOKUMKNTATIONSWISSI-NSCHAIT 547<br />
der Mensch die Apparate des Archivs als Statistik und Gedächtnis: »Niemand<br />
wird leugnen können, dass vorstehendes System so ziemlich alles Lebensverhältnisse<br />
des Menschen berührt, wenigstens dass solche irgend einer Rubrik subsumirt<br />
werden können« . Erst in der Kopplung mit<br />
Bibliothek und Archiv als diskursivem Dispositiv aber wird das System zu dem,<br />
was <strong>von</strong> Aufseß virtuell vorschwebt:<br />
»Ein ungleich reicheres Detail wird sich aber erschlossen, wenn die grosse Zahl<br />
<strong>von</strong> Sammelwerken, <strong>von</strong> denen wir blos die Scriptores, die historischen Zeitschriften<br />
und Taschenbücher mit ihren mannigfaltigen Aufsätzen anzudeuten<br />
brauchen, mit beigezogen werden und aus ihnen jede Einzelheit dem Systeme eingereiht<br />
werden wird. Bis jetzt sind blos alphabetische Register darüber angefertigt,<br />
sowie über die in Druckwerken und Handschriften vorkommenden Abbildungen<br />
merkwürdiger Gegenstände. Es ist jedoch die nächste Aufgabe des Museums dieses<br />
Alles dem Systeme einzufügen und dadurch dem Suchenden zu bieten was<br />
vorläufig möglich erscheint.« <br />
Diese rctrieval-Tcchmkcn des Arbeitsspeichers sind in § 6 der Satzungen des<br />
Germanischen Museums vorgeschrieben: Die Verzeichnisse und Beschreibungen<br />
»in ein streng wissenschaftliches System zu bringen und mit alphabetischen<br />
<strong>Namen</strong>s-, Orts- und Sachregistern zu versehen, so, dass augenblicklich jede<br />
Anfrage auch über den speziellsten Gegenstand beartwortet werden kann.« Erst<br />
die Adressierung macht ein System operabel (und deutsche Kulturgeschichte<br />
kalkulierbar), wenn diese Statistik bis auf die kleinsten Einheiten selbst, also die<br />
Texte, Bilder und Objekte durchschlägt. Die (museale) Ordnung der Kultur um<br />
1850 ist nicht die des Archivs, sondern der Bibliothek. In seiner zweibändigen<br />
Allgemeinen Culturwissenscbaft. Die materiellen Grundlagen menschlicher Cultur<br />
(Leipzig 1854/55) betont der sächsische Bibliothekar Gustav Friedrich<br />
Klemm die Bindung der Überlieferung <strong>von</strong> Erfahrung an Sprache und »gedächtnisstüztendc<br />
Hilfsmittel« schriftlicher respektiver hicroglyphischer Natur (Mnemotechnik<br />
des Museums), eine Funktion seiner eigenen Arbeitsweise. Klemm<br />
verweist auf die 1820 erschienene zweite Ausgabe <strong>von</strong> F. A. Eberts Schrift Die<br />
Bildung des Bibliothekars, »die fortan immer auf meinem Schreibtisch zu finden<br />
war und Ordnung in meine Studien brachte« .<br />
Memory Extender GNM?<br />
Mikrofilm, Schallkonserven und Information unter Weltkriegsbedingungen<br />
Läßt sich das System <strong>von</strong> Aufseß' als digitales Speicher- und Sortierprogramm<br />
schreiben? Die <strong>von</strong> Vannevar Bush schon vor Weltkrieg II konzipierte, dann<br />
1945 <strong>für</strong> zivile Nutzung publizierte Konzeption einer auf assoziativer Datenverknüpfung<br />
aufgebauten Gedächtnismaschine {Memory Extender), real gebaut,
548 MUSKUM<br />
wäre die Verwirklichung der Virtualität <strong>von</strong> Projekten im Sinne der MGH und<br />
des GNM gewesen: ein Schreibtisch mit analogen Archivierungsgeräten. Die<br />
Relektüre der Genealogie des GNM in Begriffen der Informationsverarbeitung<br />
ist kein anachronistisches Misverständnis oder ein medienarchäologischer<br />
Mißgriff, sondern dann zwingend angelegt. Elisabeth Rücker sagt es <strong>für</strong> die<br />
Bibliothek des GNM, deren Gründung in der Satzung vom 1. August 1852 festgeschrieben<br />
ist, noch bevor die eigentliche Museumsgründung am 17. August d.<br />
J. in Dresden auf der Versammlung deutscher Geschichts- und Altertumsforscher<br />
beschlossen wird. Dann ist in § 1 definiert, cm »wohlgeordnetes Generalrepertorium<br />
über das ganze Quellenmatcrial <strong>für</strong> die deutsche <strong>Geschichte</strong>,<br />
Literatur und Kunst« bis zum Jahre 1650 herzustellen, und das heißt konkret<br />
einen Gedächtmsapparat zu bauen: »ein diesem Umfang entsprechendes allgemeines<br />
Museum zu errichten, bestehend aus Archiv, Bibliothek, Kunst- und<br />
Altertumssammlung«. Ein Unterpunkt ergänzt den öffentlichen Auftrag: »beides<br />
nicht nur allgemein nutzbar und zugänglich zu machen, sondern auch mit<br />
der Zeit durch Herausgabe der vorzüglichsten Quellenschätze und belehrender<br />
Handbücher gründliche Kenntnis der vaterländischen Vorzeit zu verbreiten«<br />
(ein Part, der weitgehend <strong>von</strong> den MGH geleistet wird). Die Funktion der<br />
Bibliothek, wissenschaftliche Fachliteratur <strong>für</strong> die Forschung bereitzustellen, die<br />
sich nach der Gründung des GNM auf das Rcpertorium konzentrierte, war »eine<br />
verfrühte Aufgabe, die erst jetzt im Zeitalter der Computer mit der Aussicht auf<br />
damals bereits angestrebte Vollständigkeit angegangen werden könnte.« 27 <strong>Im</strong><br />
Computer kommt die Virtualität <strong>von</strong> Aufseß' Plan zu sich. Das Repertonum<br />
zieht <strong>von</strong> den Objekten (geformte Materie) und Textkorpora die Daten ab und<br />
macht sie als diskrete Information berechenbar. Morse geht etwa zur gleichen<br />
Zeit einen Schritt weiter und schlägt <strong>für</strong> die Übertragung (und nicht mehr allein<br />
Speicherung) <strong>von</strong> Texten 1840 vor, das Alphabet (das ja im <strong>Namen</strong> schon auf<br />
digitale Binarität reduziert ist) in eine Reihe <strong>von</strong> Punkten und Strichen zu übertragen;<br />
derart chiffrierte Texte können dann als Reihe <strong>von</strong> langen und kurzen<br />
Stromimpulsen über Telegrafenkabel geschickt werden 28 ; jede auf dem Computer<br />
erstellte Darstellung schreibt diese Signalisierung <strong>von</strong> Information fort. Mit<br />
Vannevar Bushs Publikation einer ungebauten Gedächtnismaschine, deren Baupläne<br />
nichtsdestotrotz existieren 29 , endet die thematisierte Epoche dieser Arbeit<br />
über Speichertechniken jenseits <strong>von</strong> Historie. Die Mechanik der Memex beruht<br />
27 Elisabeth Rücker, Die Bibliotek des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, in:<br />
Bibliotheksforum Bayern (BFB) 12 (1984) 2, 143-152 (143)<br />
2S Peter Gendolla, Zeit: zur <strong>Geschichte</strong> der Zeiterfahrung; vom Mythos zur »Punktzeit«,<br />
Köln (DuMont) 1992, 92<br />
29 Siehe Lab. Jahrbuch 1997 <strong>für</strong> Künste und Apparate, hg. v. der Kunsthochschule <strong>für</strong><br />
Medien Köln, Köln (König) 1997, Bildsene <strong>Im</strong>aginierte Maschinen, 140
AU1 : DKM WKG ZUR DoKUMKNTATIONSWISSl.NSCHAIT 549<br />
ihrerseits auf dem Medium Mikrofilm, wie es bereits 1926 Watson Davis und<br />
Edwin Slosson zur Reproduktion wissenschaftlicher Literatur vorgeschlagen<br />
hatten. Davis, der später das American Documentation Institute (einen Vorläufer<br />
der American Society of Information Science) mitbegründete, war ein Prophet<br />
der weltweiten Dokumentenorganization und unter den Pionieren der<br />
sachthematischen Indizicrung als Grundlage <strong>von</strong> Information retneval. Von<br />
Davis sind Notizen eines Treffens mit Bush am 15. November 1932 erhalten, wo<br />
sie eine solche mikrofilmgestützte Indizierung diskutierten: eine Technologie zur<br />
Miniatunsicrung, Verteilung und Selektion wissenschaftlich-technischer Information.<br />
30 Davis inspiriert damit auch H. G. Wells, der in seiner Vortragsserie<br />
1936-38 World Brain (publiziert 1938) <strong>für</strong> eine »permanent World Encyclopedia«<br />
plädiert, zur Vereinheitlichung und Verkörperung des gesamten Welt- und<br />
Kulturwissens, wie es die Organisation Die Brücke im Begriff der Weltenzyklopädie<br />
und speziell Wilhelm Ostwald unter dem Titel Das Gehirn der Welt 1912<br />
angedacht hat. Wo Zusammenhang »nicht mechanisch, sondern funktionell gegeben<br />
ist«, bedarf es eines logistischen Zentralorgans 31 ; der Begriff der Zentralauskunft<br />
wird nicht mehr mechanisch, sondern kybernetisch gedacht. Genau<br />
hier liegt auch die Differenz zu vorschnellen Analogien zwischen dieser Auskunftsorganisation<br />
und dem logistisch (bis hinunter zum packet switching der<br />
Information) radikal dezentralen Internet - Differenzen, auf denen eine Medienarchäologie<br />
insistiert, die mit Diskontinuitäten rechnet.' 2 Medium der Gedächtnissynchronisation<br />
ist bei Wells nicht mehr das Buch:<br />
»By means of microfilm thc rarcst and most intncate dquments and articlcs can be<br />
studies now at first hand, simultaneously in a score of projection rooms. Ther IS no<br />
practical obstaclc whatever now to the creation of an efficient index to all human<br />
knowledge, ideas and archievements, to the creation, that is, of a complete planetary<br />
memory for all makind. And not simply an index; the direct reproduction of the<br />
thing itsclf can be summoned to any propcrly prcparcd spot.« <br />
Die da<strong>für</strong> notwendige Infrastruktur bedarf allerdings einer »centrahzed and<br />
uniform organization«, doch dies nicht mehr im geo-, sondern wisscnstopographischen<br />
Sinne: »1t necd not have any Single local habitation becausc thc<br />
30<br />
James M. Nyce / Paul Kahn, A Machine for the Mind: Vannevar Bush's Memex, in:<br />
dies. (Hg.), From Memex to Hypertext: Vannevar Bush and the Mind's Machine, San<br />
Diego / London (Academic Press) 1991, 39-66 (49f)<br />
31<br />
Als Sonderdruck aus: Nord & Süd (Jg. 1912, Heft 1) separat erschienen München<br />
(Selbstverlag Die Brücke) 1912<br />
32<br />
Eine solche Analogie zieht - aus mediengeschichtlicher Perspektive - beharrlich Rolf<br />
Sachsse, Das Gehirn der Welt: 1912. Die Organisation der Organisatoren durch die<br />
Brücke. Ein vergessenes Kapitel Mediengeschichte, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft<br />
zu Großbothen e.V., 5. Jg., Heft 1/2000, 38-57
550 MUSUUM<br />
continually inceasing facilities of photography render reduplication of our indices<br />
and records continually easier« < Wells 1938: 63>. Unter dem Titel Memory<br />
of the World treibt die UNESCO das Phantasma eines Weltregisters <strong>von</strong> kulturgedächtmswürdigen<br />
Dokumenten durch die konsequenteste aller Standardisierungen<br />
auf die Spitze: im Medium des Digitalen, das gleichrangig Schriften,<br />
Töne und Bilder registriert erstmals dies zu realisieren vermag, weil hier<br />
Programm als Vision und als algonthmische <strong>Im</strong>plementierung erstmals zusammenfallen.<br />
33 Nicht minder planetansch angelegt ist ein zeitgenössisches Archivierungsprojekt<br />
auf Bildbasis: Der Pariser Bankier Albert Kahn (gest. 1940)<br />
verknüpft Datenbank- und Gedächtniskapital-Asthetik; er schickt seit 1910<br />
Kameramänner in alle Welt, »um mit der Kamera festzuhalten, was ein oder<br />
mehrere Jahrzehnte danach nicht mehr oder nicht mehr in seiner ursprünglichen<br />
Form existieren würde.« 34 Analog zur Begründung des deutschen Denkmäler-Archivs<br />
durch Albrecht Mcydenbauer auf Basis photogrammetrischer<br />
Platten ist auch <strong>für</strong> Kahn das Auswahlkriterium die Drohung künftiger Ruination.<br />
So koppelt sich das kurz vor Weltkrieg I begonnene Projekt eines Weltbildarchivs<br />
mit dem heraufziehenden Weltkrieg II, der diese Vision mit einer<br />
realen Signatur versieht. Die Sammlung firmiert heute in Boulogne-Billancourt<br />
unter dem <strong>Namen</strong> Archive de laplanete. Die Nachrichten <strong>für</strong> Dokumentation<br />
fassen dementsprechend den Begriff des Dokuments im Medienverbund;<br />
die Herstellungsart der Information ist dabei unwesentlich: »Kleinschriften-Aufzeichnungen<br />
und Hieroglyphen, Handschriften und Schriftstücke,<br />
heute im Mittelpunkt alle Erzeugnisse der Druck- und Reproduktionstechnik<br />
, die Aufnahme <strong>von</strong> Wort und Ton und die fertigen Lochkarten«<br />
Aur DKM Wi:c; ZUR DOKUMUNTATIONSWISSINSCIIAI T 551<br />
Vorstellung , als sei Dokumentation mit Mikrofotografie schlechthin<br />
gleichzusetzen«; Dokumentation im Bereich des Archivwesens ist jedoch nicht<br />
auf das Problem der technischen Reproduktion <strong>von</strong> Archivalien reduzibel. j:)<br />
Technische Dokumentation denkt Optik und Akustik, Seh-, Les- und Hörbarkeit<br />
zusammen. Das Tempo des Rundfunks überführt das Klangarchiv in die<br />
quasi-Echtzeit <strong>von</strong> Synchronisation. Unter den technischen Adressierungsbedingungen<br />
der Schallkonserve ist das Klangarchiv als Arbeitspeicher der Gegenwart<br />
denkbar:<br />
»Alle diese Schallkonserven müssen innerhalb weniger Minuten greifbar und sendebereit<br />
sein. Die Katalogisierung und Dokumentation muß daher so weit ausgebildet<br />
sein, daß alle Bedarfsträger und Sachbearbeiter daraus alle wesentlichen<br />
Angaben über Titel und Datum, Inhalt und l.aufdauer, genaue Beurteilung (politische,<br />
künstlerisch und technisch) sowie sonstige Merkmale entnehmen können.«'"<br />
Die Archive des 20. Jahrhunderts liegen, medieninduziert, schon weithin jenseits<br />
der Schrift, indem »eine Reihe großer politischer Dokumente und<br />
geschichtlicher Ereignisse in ihrer Urfassung nur als Schallaufnahme vorliegen.«<br />
Dominik erinnert hier »an die Proklamation des Führers, Kriegserklärung an<br />
Polen, an die Notenwechsel mit der englischen Regierung (beim beabsichtigten<br />
Austausch Verwundeter)« ; hinzu fügt sich die Bildaufzeichnung. Eine<br />
Definition Norbert Wieners besagt, daß das Opfer auf dem Altar der Dokumentationswissenschaft<br />
die Materialität der Objekte ist: »Information ist Information,<br />
nicht Materie und Energie« ; Buch und Wissen<br />
werden wieder sepanerbar. A book's a Book although there's nothing m't«, ironisiert<br />
L. Stanley Jast die bibliographische Manie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.<br />
Auch wenn das Lexikon keine etymologische Verwandtschaft <strong>von</strong><br />
tome (Band) und tomb (Grab) aufweist, gräbt (digs up) Bibliographie vergessene<br />
Information wissensarchäologisch wieder aus. 37 »Zwischen Paul Otlet und<br />
Assurbampal liegen gute 2500 Jahre!« 38 Bücher sind Speicherformate. Je geringer<br />
der energetische Aufwand im Übertragungsprozeß, desto höher der Informationsgrad<br />
des Signals. Die erste Tagung der Deutschen Gesellschaft <strong>für</strong><br />
3:1<br />
Zimmermann 1966: 94, unter Bezug auf Hans W. Eppelsheimer, in: Der Archivar 4<br />
(1951), Sp. 27f<br />
Vl<br />
Herbert Dominik, Chefingenieur im Reichsmimstcnum <strong>für</strong> Volksaufklärung und Propaganda,<br />
Direktor der Reichsrundfunk-Gesellschaft, Hochwenige Schallaufzeichnung<br />
und Dokumentation, in: Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation (Hg.), Die Dokumentation<br />
und ihre Probleme, Leipzig (Harrassowitz) 1943, 46-50 (48)<br />
37<br />
. Stanley Jast, Bibhography and the Deluge: I Accuse, in: The Library Association<br />
Record 38 (1936), 353-360<br />
3S<br />
Heinrich Roloff, Dokumentär oder Dokumentalist? Kritische Betrachtungen zu<br />
einem neuen Sprachgebrauch, in: Dokumentation 1, Heft 9 (1954), 180-182 (181)
552 MUSKUM<br />
Dokumentation <strong>von</strong> 1942 findet bereits unter Weltkriegsbedingungen statt, als<br />
in der Tat Technologien der Bewegung <strong>von</strong> Materie über immaterielle Information<br />
sich durchsetzt (Raketenleitstrahlen der V2, Radar, Computer). Der<br />
dann implizite Trend zu Normung und Vereinheitlichung macht die klassischen,<br />
seit 1800 autarken Dokumentationsbereiche Archiv, Bibliothek und<br />
Museum wieder gegenseitig transparent, so daß der Einsatz der elektronischen<br />
Datenverarbeitung nicht nur die 1937 <strong>von</strong> Hugo Krüss als Ziel jeglicher Dokumentationstätigkeit<br />
definierte Beherrschung des Wissens verbessert, sondern<br />
zugleich »das vielfach in Vergessenheit geratene Bewußtsein der Zusammengehörigkeit<br />
der klassischen Dokumentationsbereich Archiv, Bibliothek und<br />
Museum wiederherstellt« .
ARCHIV<br />
Vorspiel: Literatur und Archiv<br />
Aleph und arche - Wilhelm Dilthcys Plädoyer, so bald als möglich an einer<br />
Stelle mit dem Zusammenlegen <strong>von</strong> Handschriften in einem »Staatsarchiv der<br />
Literatur« anzufangen, entspringt einer Metonymisierung <strong>von</strong> Leben und Staat:<br />
»Die politischen Archive entstanden ans den Bedürfnissen des Lebens selber.<br />
Urkundenarchive Aktenarchive wurden dann in den modernen Staatsarchiven<br />
gesammelt, und nun konnten die Materialien der <strong>Geschichte</strong> geordnet<br />
und aufgeschlossen werden. Was hier die Bedürfnisse des Lebens selber herbeigeführt<br />
haben, das soll nun <strong>für</strong> die Litteratur <strong>von</strong> den Anforderungen der Wissenschaft<br />
aus erwirkt werden. Früher oder später wird das nationale Gefühl diese<br />
Forderung durchsetzen.«'<br />
Längst bevor der Kollektivkörper der Nation als Interpretant die disiecta membra<br />
seines Gedächtnisses institutionell zu versammeln sich anschickt, vollzieht<br />
sich die Selbstarchivierung auf individueller Ebene wie selbstverständlich, in Reziprozität<br />
<strong>von</strong> (Wissens-)Archäologie und Archiv als Subjekt und Objekt, archivischem<br />
Fakt und (auto)biographischer Fiktion. Weil der Kaufmann Heinrich<br />
Schliemann, manischer (Er-)Finder und Ausgräber Trojas, fast all sein Geschriebenes<br />
archiviert, kann sein Leben »wie ein großer Text interpretiert werden. <br />
Die Quellenkritik fördert auch die Archäologie im engsten Sinne.« 2<br />
Patnarch(ivarf Goethe<br />
Zwei Generationen zuvor ist Literaturarchivierung als nationales Geschäft noch<br />
virtuelle Option. Zur gleichen Zeit, als Preußen sein Archivwesen neu organisiert,<br />
um das <strong>Im</strong>aginäre der <strong>Geschichte</strong> im Sinne des nation building nicht minder<br />
zu mobilisieren als kurz zuvor die Truppen im Kampf gegen Napoleon, faßt<br />
1 Wilhelm Dilthey, Archive der Literatur in ihrer Bedeutung <strong>für</strong> das Studium der<br />
<strong>Geschichte</strong> der Philosophie, in: Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> der Philosophie, II. Band 3.<br />
Heft, Berlin (Reimer) 1889, 343-367 (366f)<br />
- Justus Gobet, Heinrich Schliemann. Archäologe und Abenteurer, München (Beck)<br />
1997, lOf<br />
3 Zum Historiker als archonte de l'archive: Jacques Dernda, Mal d'archive, Paris (Gal-<br />
limard) 1995,89
554 ARCHIV<br />
Goethe im Mai 1822 eine neue Gesamtausgabe seiner Werke ins Auge und weiß<br />
um die Notwendigkeit eines archivischen Dispositivs als vorgängige Bedingung<br />
aller auktorialer posthistoire, die Erfassung und Ordnung des vorhandenen<br />
Materials durch »eine reinlich ordnungsgemäße Zusammenstellung aller<br />
Papiere, besonders solcher, die sich auf mein schnftstellenches Leben beziehen,<br />
wobei nichts vernachlässigt noch unwürdig geachet werden sollte.« 4 Dem technischen<br />
Speicher sind - im Unterschied zu Hegels Begriff der Erinnerung - alle<br />
Daten gleich bedeutend. Goethe verwendet auf diesen Speicher den Begriff<br />
Archiv nicht metaphorisch, sondern mit Fachtermini wie Rcpertorium und<br />
Repositur im Sinne der zeitgleich ausformulierten staatlichen Institution Archiv<br />
<strong>für</strong> eine Gesamtheit <strong>von</strong> Papieren: auf daß »nicht allein Gedrucktes und Ungedrucktes,<br />
Gesammeltes und Zerstreutes vollkommen geordnet beisammen<br />
steht, sondern auch die Tagebücher, cingangene und abgesendete Briefe in einem<br />
Archiv beschlossen sind«; darüber lag ihm »ein Verzeichnis nach allgemeinen<br />
und besonderen Rubriken, Buchstaben und Nummern aller Art gefertigt« vor<br />
. <strong>Im</strong> Unterschied zur Epoche des Alten Reiches<br />
berücksichtigt das Archiv nun nicht mehr allem die Rechtsverhältnisse des Staates,<br />
sondern auch das Historische als Eigenwert - wobei diese <strong>Geschichte</strong> nicht<br />
vorliegt, sondern im Medium des Archivs erst hergestellt wird. 5 Dementsprechend<br />
verwendet Goethe die Begriffe Archiv und Historie geradezu synonym,<br />
»im Zusammenhang mit historischen Forschungen gern die Worte archivansch<br />
und archivalisch, beide gleichbedeutend« . So organisiert er<br />
auch mit seinem Nachlaß die vergangene Zukunft seiner Gegenwart, so wie zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts eine Reihe <strong>von</strong> Zeitschriften den Titel Archiv führt.<br />
Über einen Aufsatz im Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Geschmacks<br />
bemerkt er 1795: »Wenn ein Archiv Zeugnisse <strong>von</strong> der Art eines Zeitalters aufbehalten<br />
soll, so ist es zugleich seine Pflicht, auch dessen Unarten zu verewigen«.<br />
6 Damit ist die Nachricht <strong>von</strong> der Gegenwart bereits archivisch<br />
Goethes Werke, hg. l. A. d. Großherzogin Sophie v. Sachsen in 4 Abteilungen, Weimar<br />
1887-1918, Abt. 1: Werke, Bd. 41 II, 25ff, zitiert nach: Willy Flach, Goethes literarisches<br />
Archiv, in: Staatliche Archivverwaltung im Staatssekretariat f. Innere Angelegenheiten<br />
(Hg.), Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft, zum<br />
65. Geburtstag <strong>von</strong> Heinrich Otto Meisner, Berlin (Rütten & Loening) 1956, 45-71.<br />
Über die an den Archivgedanken gekoppelte Herausbildung des Urheberrechts »in<br />
jenen zweimal 30 Jahren vor und nach 1800 , die nach Goethes literarischer Wirksamkeit<br />
benannt werden«, siehe Heinrich Bosse, Autorschaft ist Werkherrschaft, Paderborn<br />
/ München / Wien (Schöningh) 1981 (8)<br />
Flach 1956: 47, unter Bezug auf den Hintrag »Archiv« in: Allgemeine Kncyclopadic<br />
der Wissenschaften und Künste <strong>von</strong> Johann Samuel lisch u. Johann Gottfried Gruber<br />
(5. Teil 1820)<br />
Weimarer Gesamtausgabe 1/40, 196, zitiert nach: Flach 1956: 54f
VORSI'IKI.: Ll'l'l-KATUR UNI) ARCHIV 555<br />
strukturiert, und der Speicher nicht im emphatischen Sinn der <strong>Geschichte</strong>, sondern<br />
systemtheoretisch als geschlossenes Universum definiert - ein Ort der<br />
Sicherheitsverwahrung (Arbeitsspeicher und Datenbank der Gegenwart), so<br />
etwa <strong>für</strong> Depositionen <strong>von</strong> Privatbriefen im Weimarer Archiv bei seiner Rom-<br />
Reise 1786. Wenn Wissenschaft in erster Linie eine Operation des »Trennen und<br />
Absonderns« ist, sei es ratsam, »das einmal Abgetrennte und Gesonderte in<br />
Lehrbüchern gleichsam wie in Archiven stehen zu lassen«. 7 Was Titel <strong>für</strong> Werke<br />
sind, ist <strong>für</strong> deren Gedächtnis die Signatur. Zunächst findet diese Adressierung<br />
im selben Medium wie das Adressierte statt: in Form <strong>von</strong> Buchstaben, die sich<br />
gegenseitig ausblenden. Die Übermittlung dieses Befunds sagt es selbst: »Einzelne<br />
Blätter finden Sie bei ihm nie herumliegen, wenn sie nirgends hinpassen,<br />
so klebt er <strong>von</strong> einem Bogen Papier eine Kapsel zusammen und macht eine Aufschrift<br />
darauf und nun erst werden sie [unleserlich]«; Goethe seinerseits schreibt<br />
an Kanzler v. Müller am 24. April 1830, daß er gelegentlich »Bücher versiegelt,<br />
um nicht wieder zum Lesen verführt zu werden«. 8 Und Goethes Faust, der in<br />
Frankfurt 1775 noch aus in einem Sack geborgenen »Papierschmtzeln«, als »das<br />
alte noch vorrätige höchst confuse Manuscnpt« besteht, wird 1798 »abgeschrieben<br />
und die Teile sind in abgesonderten Lagen nach den Nummern eines<br />
aus<strong>für</strong>hehen Schemas hintereindergelegt« . So wird aus Lettern der Literatur Alphanumerik, eine Zeichenmenge<br />
des Speichers. Mit der Einsiegelung des Manuskripts im August<br />
1831 ist der Kreis durchlaufen und hat sich geschlossen ; archivische<br />
Räume bilden so ein autopoetisches, als geschlossener Schaltkreis<br />
anschreibbares System. <strong>Im</strong> seinerseits als Archiv gesteuerten Nachlaß Goethes<br />
findet die Transition <strong>von</strong> Körper und Korpus als Autoreferenz statt, analog<br />
zum <strong>von</strong> der deutschen Archivkunde entwickelten Begriff des Archivkörpers:<br />
»Dieses ganze bei ihm liegende, aufsein Leben, besonders sein schriftstellerisches<br />
Leben, bezogene Schriftgut war <strong>von</strong> ihm aus- und bei ihm eingegangenes, also<br />
organisch gewachsenes Schriftgut. Es besteht kein Zweifel, daß Goethe damit<br />
folgerichtig den Begriff des Archivs auch auf literarisches Schriftgut übertragen<br />
hat. In der Verbindung dieser beiden Ausdrücke und Vorstellungen hat<br />
Goethe - wenn es erlaubt ist, moderne Archivtheorie auf seine Maßnahmen rückwärtig<br />
zu übertragen - den Grundsatz der Herkunft, das Prinzip der Provenienz,<br />
also den entscheidenden Gesichtspunkt aller Archivgestaltung, auf sein Schriftgut<br />
und sein Archiv und damit auf das literarische Archiv schlechthin angewendet.«<br />
<br />
1789: W 11/13, 431, zitiert nach: Flach 1956: 58<br />
Goethes Sekretär Kräuter brieflich (26. Januar 1 821) an die Gräfin <strong>von</strong> Hopfgarten,<br />
zitiert nach: Frnst Robert Gurtius, Goethes Aktenführung, in: Die Neue Rundschau<br />
62 (1951), 110-121 (111); der Brief an Müller zitiert ebd., 120
556 ARCHIV<br />
<strong>Im</strong> Medium Archiv ist Zeit reversibel. Zwischen Goethe und dem Archiv aber<br />
steht ein Aufschreibesystem namens Sekretär: Friedrich Theodor Kräuter, der ein<br />
(<strong>von</strong> ihm so genanntes) Repertonum über die Goethesche Repositur geschaffen<br />
hat. Goethe selbst nennt es ein »bibliothekarisch-archivarisches Verzeichnis« (W<br />
1/41 II S. 28); noch ist der Medienverbund nicht im Sinne der spezifischen Speichermedien<br />
ausdifferenziert. Kriterium der Signaturen ist kein abstraktes, sondern<br />
ein an die reale Ordnung des Speichers gebundenes System; im Verzeichnis<br />
bedeuten die in der ersten Spalte eingefügten Buchstaben und römischen Zahlen,<br />
die einzelnen gelegentlichen Bemerkungen des Kräuterschen Repertoriums entnommen<br />
sind, »offenbar die Einteilung des Archivschrankes nach Abteilungen<br />
und Fächern« . Das Gedächtnis ist ein Apparat und<br />
Bedingung auch dieser Sätze, die als Referenz auf das Archiv, nicht auf <strong>Geschichte</strong><br />
gemeint sind; es gerinnt somit zur Allegone dieses Diskurses, der<br />
beharrlich fragt, ob die Logik angemessen ist, das Wesentliche seines Gegenstandes<br />
zu erfassen. Von daher tendiert der archivologische Diskurs zu metadiskursiver<br />
Retlexivilät; überhaupt handelt jede Rede, jede Schritt im <strong>Namen</strong> der<br />
<strong>Geschichte</strong> immer ebensosehr über den Diskurs selbst wie über die Gegenstände,<br />
die sein Thema bilden. 9<br />
Der Paroxysmus des literarischen Archivs ist es, im Unterschied zur Literatur<br />
selbst ohne den Autor operabel zu sein (was Goethe auch dadurch sichert,<br />
daß er dem Kanzler <strong>von</strong> Müller als Testamentvollstrecker die Oberaufsicht jenseits<br />
der Familie überträgt). Am 4. April 1825 schreibt Goethe an Sulpiz Boisseree,<br />
daß das Archiv, worauf »jetzt und künftig« die Ausgabe letzter Hand zu<br />
gründen sei (Archiv und arche), geordnet dastehe - ein wissensarchäologisches<br />
Monument, aufragend und »jungen Männern, die es catalogirt haben,<br />
bekannt und so möchte der Klarheit und Sicherheit wohl nichts im Wege<br />
stehn.« Das Werkvermächtnis gründet also in den Lagen des Archivs. Der<br />
Kommentar Flachs attestiert, daß ein Gedächtnis dann Archiv ist, wenn es als<br />
verdichtete Maschine unabhängig vom Subjekt des Dichter-Stifters operiert:<br />
»Die Sicherung <strong>von</strong> Goethes literarischem Nachlaß ist also gelungen, seine<br />
Werke können später auch ohne seine eigene Mitwirkung bestehen und veröffentlicht<br />
werden.« 10 Goethe selbst koppelt sein Archiv an ein Betriebsprogramm,<br />
seine Tag- und Jahreshefte:<br />
»In dem nächstfolgenden Hefte wird Erwähnung einer Chronik geschehen, welche<br />
die Lücken der früheren umständlichen Bekenntmsse,wie ich sie wohl nenne<br />
kann, einigermaßen ausfüllet, <strong>von</strong> Anno 1792 aber an, bis auf den heutigen Tag,<br />
9 Vgl. Hayden White, Auch Klio dichtet oder Die Fiktion des Faktischen. Studien zur<br />
Tropologie des historischen Diskurses, Stuttgart (Klett-Cotta) 1986, llf<br />
10 Flach 1956: 69, unter Bezug auf Goethes Brief an Boisserce: W IV/39, 171
VORSI'H-I.: LHT.RATUR UND ARCHIV 557<br />
mehr oder weniger ausführlich die durchlebten Jahre behandelt; sie dient schon in<br />
ihrer jetzigen Gestalt zur Norm, wie meine sämmtlichen Papiere, besonders der<br />
Briefwechsel, der einst verständig benutzt und in das Gewebe <strong>von</strong> Lebensereignissen<br />
mit verschlungen werden könnte.« 1 '<br />
Archi(v)textur der Historie. Der historische Diskurs transformiert die alltägliche<br />
Datenentropie in Ordnung; so läßt sich »dasjenige, was im Vaterlande<br />
und auswärts <strong>für</strong> und wider mich geschehen, besser beurtheilen, indem eins<br />
wie das andere, aus der Staubwolke einer leidenschaftlichen Empirie, in den<br />
reineren Kreis historischen Lichtes tritt« . Das Archiv ist Subjekt<br />
und Objekt cies Goethe Wörterbuchs, in dem seine Bedeutungen zwischen<br />
der Materialität des Speichers und der anarchistischen Antinomie desselben<br />
oszillieren, als Sammlung <strong>von</strong> Dokumenten und Zeugnissen, als Aufbewahrungsort<br />
und Institution im staatlichen, landesherrlichen, aber auch im privaten<br />
Bereich:<br />
Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur <strong>für</strong> das Gegenwärtige,<br />
ein A. <strong>für</strong> das Vergangenene ... auf das geschwindeste war der Wust in eine<br />
erfreuliche Ordnung gebracht 20,42,15 V/v 1 4 als ich den Notcnschrank<br />
eröffnete und ihn fand wie ein altes A.: unbenutzt, aber unberührt B41,l 17,4 Zelter<br />
8.8.26 uö metaphor [Olcan] So sind die Schöffen [in Frankf] lebendige Ae,<br />
Chronicken, Gesetzbücher, alles in einem 39,36,7 Götz 1 im Bild u im<br />
Vergleich [üb das literar Lebenin der 2. Hälfte des 18. Jh] <strong>Im</strong> Ganzen war ...<br />
jener Zustand eine aristokratische Anarchie ... Hamanns Briefe sind hiezu ein<br />
unschätzbares A., zu welchem der Schlüssel im Ganzen wohl möchte gefunden<br />
werden, <strong>für</strong> die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie 35,40,24 TuJ<br />
In der wissenschaftlichen Analyse meint es, »das einmal Abgetrennte und Gesonderte<br />
in Lehrbüchern gleichsam wie in A-en stehen zu lassen« ,<br />
und schließlich eine Sammlung <strong>von</strong> Notizen, Aphorismen und<br />
literarischen Fragmenten: so mehrfach in Wilhelm Meister, etwa als Phihne »dem<br />
geheimen A. ihrer Erfahrungen einige besondere Liebeserklärungen vorbrachte«<br />
. Ferner figuriert im Goethe<br />
Wörterbuch der Fachbegriff archivalisch, der sich gleichursprünghch zu allen<br />
Modi der Bearbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit verhält:<br />
»1 ein Archiv betr, aus einem Archiv stammend 2 >antiquarisch', historischgelehrt<br />
Des Sturm <strong>von</strong> Bocksberg [Ritterschauspiel <strong>von</strong> Jakob Maier] erinnere ich<br />
mich kaum, ich weiß nur daß mir der a-e Aufwand drinne lästig war B 13,92,26<br />
Schiller 14.3.98 vgl zu 1 archivarisch zu 2 altertümlich antiquarisch archäologisch<br />
historisch<br />
Archivarius wie Archivar daß .. am persischen Hofe sich noch immer Dichter<br />
befinden, welche die Chronik es Tages .. in Reime verfaßt ... einem hiezu besonders<br />
bestellten A. überliefern 7,81,27 DivNot NcucrcNcucstc<br />
An Johann Friedrich <strong>von</strong> Cotta, 14. Januar 1824, zitiert nach: Flach 1956, 70
558 ARCHIV<br />
archivansch a ein Archiv bar nun liegen nicht allein diesc[die Tgb], sondern so viel<br />
andere Documente nach vollbrachter a-er Ordnung auf's klarste vor Augen<br />
41,30,15 Lebensbekenntnis«' 2<br />
„m Wörterbuch steht das Archiv pars pro toto <strong>für</strong> das Organisationsprinzips<br />
,'ben jener Publikationsform, die seine Zitate versammelt. Diese Goethe-Ma-<br />
;chine buchstabiert ihre Blaupausen in Wolfgang Schadewaldts Einführung zur<br />
ersten Lieferung des Goethe Wörterbuch unter dem Stichwort »Exzerption«. 13<br />
\llen Texten vorgeschaltet ist ihre archi(v)texturale Vorstrukturierung, denn die<br />
\rbeit galt zunächst der Verzettelung des gesamten <strong>von</strong> Goethe hinterlassend!<br />
Schriftwerks und »der Errichtung eines alphabetisch geordneten Kartenarchivs,<br />
n dem jede Karte unter einem herausgehobenen Stichwort (Lemma) die Stelenangabe<br />
und den ausgeschriebenen originalen Goetheschen Beleg enthält«<br />
;Sp. 3 ;: ">. Grundlage ist der zum Text-Korpus gewordene Zweitkörper des<br />
Vutors: die Weimarer Sophienausgabe (143 Bände, 1887-1919). Archive speisen<br />
ich aus dem Begehren nach einer (virtuellen, nur asymptotisch erreichbaren)<br />
/ollständigkeit; »kein Zeugnis des <strong>für</strong> Goethes Art, sein Fühlen, Denken und<br />
Jrteilen Charakteristischen durfte unterdrückt werden« . Der Ein-<br />
>ruch der EDV in die Goethe-Maschine, die sich einer schlicht automatisierten<br />
Thesaurierung entzieht, ist inzwischen selbst schon Objekt eines medienarhaologischen<br />
Museums; die elektronischen Datenverarbeitungsanlagen sind in<br />
ler Zeit, als der Hauptteil der Exzerption durchgeführt wird, nicht weit genug<br />
•ntwickelt, um produktive Hilfe leisten zu können, zumal es beim Goethe-<br />
X/örterbuch nicht um die Herstellung eines reinen Wort-Index, sondern um<br />
•lgenthch lexikographische Arbeit geht, etwa das Erkennen <strong>von</strong> heute nicht<br />
nehr geläufigen Wortbedeutungen. Als Modellfall <strong>für</strong> die Internationale<br />
r agung <strong>für</strong> lexikographische Automation im November 1960 in Tübingen wurle<br />
der erste Band <strong>von</strong> Goethes <strong>Geschichte</strong> der Farbenlehre Wieland Schmidt<br />
»rogrammiert und durch eine <strong>von</strong> der IBM Sindelfingen zur Verfügung geteilten<br />
Maschine »elektromechanisch aufgeschlüsselt«; der so entstandene<br />
.weibändige Index verhorum (noch einmal die Nähe <strong>von</strong> Latein und Datenerarbeitung)<br />
nebst den dazu gehörigen Lochkarten wird im Archiv des<br />
joethe-Wörterbuchs in Tübingen aufbewahrt. Dann seit 1963 die Verbindung<br />
[er Hamburger Arbeitsstelle mit dem Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt;<br />
Ergebnis der Verzettelung des Goetheschen Schrifttums ist seit 1962/62 ein Karenarchiv,<br />
das <strong>von</strong> drei Millionen Karten (d. h. Goethe-Belege) umfaßt <br />
: Goethe Wörterbuch, hg. v. d. Deutsehe Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der<br />
AdW zu Göttingen u. d. Heidelberger AdW, Erster Band, 1. Lieferung (A - abrufen),<br />
Stuttgart / Berlin / Köln Mainz (Kohlhammer) 1966, Sp. 803ff<br />
; Goethe Wörterbuch, 1. Lieferung (A - azurn), Edition 1978, Sp. 1*-14 :: ", bes. 3 ;: 'ff
VORSIMKL: LITHKATUR UND ARCHIV 559<br />
- bis daß die nächste Generation auch dieses mechanische Speichermcdium virtualisiert.<br />
Mit dem Stichwort Lochkarten schliest Gedächtnistechnik an die<br />
andere, nicht als Schnittstelle zum literarischen Diskurs gemeinte Seite der<br />
Schriften Goethes an, sein Schreibwerk als Beamter. Dies aber wird »niemals<br />
<strong>von</strong> einer Goethebiographie« (auch nicht <strong>von</strong> einer Autobiographie 14 ), sondern<br />
»nur <strong>von</strong> der weimarischen Verwaltungsgeschichte her dargestellt« werden können.<br />
15 Die österreichische Verwaltungslehre kennt noch heute den Begriff,<br />
Akten in Evidenz zu halten - archivisches Gedächtnis als Latenzzustand der<br />
Gegenwart. Folglich ist es das Staats-, nicht das Goethe- und Schillerarchiv Weimar,<br />
das Goethes amtliche Schriften ediert, zu denen, als Pnvataktenstücke, auch<br />
die den Einsatzpunkt dieser Arbeit, die Acta, die traurigen Folgen des 14. Octobers<br />
1806 betreffend gehören. 16 Die Akten des Geheimen Conseils <strong>von</strong> 1776 bis<br />
1786 sind »eine kulturgeschichtliche Quelle <strong>von</strong> hohem Reiz« ; als Archiv der Alltagsgeschichte <strong>von</strong> Volk und Verwaltung speichert es<br />
Daten, die Literaturwissenschaftler in ihrer Fixierung auf Weimarer Klassik<br />
übersehen. <strong>Im</strong>merhin beobachten sie nach der Editon <strong>von</strong> Goethes Akten durch<br />
Willy Flach nun ihrerseits »ihn beim Anlegen und Führen vielfältigster Akten«<br />
- Beobachtung zweiter Ordnung, aber im Medium der ersten. So wird das Dispositiv<br />
des Archivs und das Archiv als Dispositiv wahrgenommen; Goethe<br />
nimmt schließlich seine eigene Existenz ad acta. Es ist Eines, den literarischen<br />
Nachlaß archivisch zu organisieren; etwas Anderes aber, im System des Archivs<br />
selbst zu schreiben. Diese Ästhetik ist die Vorschrift <strong>von</strong> Wilhelm Meisters<br />
Wanderjahren, ein Buch, das durch die Fiktion des Abdrucks gleichberechtigter<br />
Archivblätter in seine Elemente zerlegbar und neu konfigunerbar ist - eine<br />
Option, welche Ihslortk Johann Gustav Droysens auch der Geschichtsschreibung<br />
Rankes gegenüber formuliert. 17 Literaturgeschichten, im Gegensatz zu<br />
1 Siehe Goethes Werke, Bd. X, kommentiert <strong>von</strong> Waltraud Loos u. Erich Trunz, München<br />
(Beck), 6. Aufl. 1976, »Über Autobiographie«, 536f; ferner ebd., »Archiv des<br />
Dichters und Schriftstellers«, 532ff (über die Alphanumerik seiner Verzeichnisse), und<br />
»Lebensbekenntnisse im Auszug«, 534f, über die rhetorische Anschaulichkeit (enargeia)<br />
seiner archivischen Ordnung (»aufs klarste vor Augen«),<br />
1 Hans Haussherr (Rez.), über: Willy Flach (Hg.), Goethes Amtliche Schriften. Veröffentlichung<br />
des Staatsarchivs Weimar, Bd. 1: Goethes Tätigkeit im Geheimen Consilmm,<br />
Teil I: Die Schriften der Jahre 1776-1786, bearb. v. Willy Flach, Weimar (Böhlau)<br />
1950, in: Goethe. Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft, NF 13 (1952), 105-125 (108)<br />
' Dazu Willy Flach, Betrachtungen Goethes über Wissenschaften und Künste in den<br />
weimarischen Landen. Archivalisches Material aus Goethes amtlicher Tätigkeit, in:<br />
Archivalische Zeitschrift 50/51 (1955), 463-467 (466)<br />
'Johann Gustav Droysen, Historik. Flistonsch-kritische Ausgabe v. Peter Leyh 1: Die<br />
Vorlesungen <strong>von</strong> 1857, Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung aus den<br />
Handschriften, Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann / Holboog) 1977, 155
560 ARCHIV<br />
Gedächtnisarchäologien, scheitern daran. 18 Und schließlich verbindet die<br />
Archivare mit Goethe unmittelbar dessen amtliche Tätigkeit, »die ihren schriftlichen<br />
Niederschlag in den staatlichen Archiven gefunden hat, die daher nur aus<br />
deren Material voll erforscht werden kann« . Subjekt und<br />
Objekt des Archivs fallen hier ineins; Gedächtnis schließt sich als Schaltkreis,<br />
<strong>Geschichte</strong> ist darin aufgehoben.<br />
Das Goethe- und Schiller-Archiv Weimar<br />
Verstehen wir unter Literatur auch die konkrete Folge <strong>von</strong> Lettern, dann heißt<br />
vergleichende Literaturwissenschaft vor allem das Wissen um die Sortierung,<br />
Speicherung und Übertragung derselben und durch dieselben (als Archiv- und<br />
Bibliothekssignaturen). Kultur informationstechnologisch zu betrachten heißt,<br />
nicht <strong>von</strong> Kommunikation, sondern Übertragung zu reden und nicht den Sinn<br />
kultureller Texte, sondern die Form ihrer Gegebenheiten zu untersuchen, also<br />
ihre Formatierung, Indizierung und Adressierung (medienarchäologisch). Die<br />
Speicheragenturen einer Kultur (Nationalmuseen, historische Urkundensammlunge<br />
vom Typ der Monumenta Germaniae Historica, die mühsamen Anläufe<br />
zur Deutschen Bücherei) gilt es als (Be-)Gründungsakte zu begreifen, als arche,<br />
die nicht einfach der narrativen Geschichtsschreibung Quellen zugestellt haben,<br />
sondern umgekehrt die wissensarchäologisch faßbare, darum aber gerade nichtnarrative<br />
Hardware nationalstaatlichen Gedächtnisses darstellen. Erst durch die<br />
gesetzliche Pflichtexemplarregclung wird der Nexus zwischen Nationalstaatlichkeit<br />
und Speichermedium etabliert. Umgekehrt bedürfen Magazine, Regale<br />
und Speicher ganz offenbar des Begriffs der Kultur als Ausrichtung (Vektor,<br />
Sinn), um diskursiv mobilisiert - oder überhaupt erst mobilgemacht - werden<br />
zu können. Als der letzte direkte Nachkomme Goethes stirbt, sucht er nach<br />
einer Adresse <strong>für</strong> die Papiere seines Großvaters. Er vermacht sie der Großherzogin<br />
Sophie, und die speichert sie nicht schlicht ab oder lagert sie um, sondern<br />
sucht sie in die kulturhewahrende Tradition des Goethe-Herzogs Carl August<br />
und seiner Nachfolger einzuordnen (Kultur als Kombination <strong>von</strong> Speicherung,<br />
Genealogie und Transfer). Vom Archivar Gustav v. Loeper läßt sie sich zur<br />
Begründung des Goethe- und Schiller-Archivs in Weimar bewegen 19 ; die Stif-<br />
lx Siehe Volker Neuhaus, Die Archivfiktion in Wilhelm Meisters Wanderjabren, in:<br />
Euphorion 62 (1968), 13-27 (26), unter Bezug auf: Erich Trunz, Anmerkungen zu Bd.<br />
VIII der Hamburger Ausgabe, 3. Auflage Hamburg 1957, 630<br />
19 Jochen Golz, Das Goethe- und Schiller-Archiv in <strong>Geschichte</strong> und Gegenwart, in: ders.<br />
(Hg.), Das Goethe-Schiller-Archiv: 1896-1996. Beiträge aus dem ältesten deutschen<br />
Literaturarchiv, Weimar / Köln / Wien (Böhlau) 1996, 13-70 (15)
VORSPIIÜ.: LITERATUR UND ARCHIV 561<br />
tung desselben als Kultursetzung liegt im Bindestrich, der Kopplung <strong>von</strong> <strong>Namen</strong><br />
(Goethe, Schiller) und Adresse (Archiv). Wie aber sieht es aus, mitten im Zentrum<br />
des deutschen Kulturpantheons? Grumach beschreibt 1949 den Zustand<br />
des Goethe-Archivs nach dem Ableben <strong>von</strong> Hans Wahl:<br />
»Das Goethe-Archiv verdient den <strong>Namen</strong> eines Archivs nur in dem Sinne, daß<br />
sich in ihm eine Sammlung handschriftlicher Bestände befindet. Von einer systematischen<br />
Ordnung dieser Bestände oder gar einer fachgerechten archivarischen<br />
Bearbeitung kann nirgends die Rede sein. Die Goethe-Handschriften liegen auch<br />
heute noch in einfachen Holzschränken, die mit einem gewöhnlichen Schlüssel<br />
geöffnet werden können, in der Ordnung, in die sie <strong>für</strong> die Herstellung der<br />
Sophien-Ausgabe gebracht worden sind. Diese Ordnung versagt aber bei den<br />
<strong>von</strong> der Sophien-Ausgabe übergangenen oder vernachlässigten Handschriften<br />
. Ein gedruckter Katalog oder eine ausreichende Handschriftenkartei ist nicht<br />
vorhanden.« 20<br />
Dieses Lager ist also vektoriell auf Übertragung (Sophien-Ausgabe), nicht auf<br />
Gedächtnis buchstäblich ausgerichtet. Goethe selbst als Subjekt, nicht Objekt<br />
<strong>von</strong> Wissensspejcherung, nämlich als Aufseher der heutigen Anna-Amahen-<br />
Bibhothek zu Weimar, versuchte seinerzeit, seinen Bildungsbegnff der Administration<br />
der Bücher selbst einzuschreiben. Verwaltung aber ist resistent<br />
gegenüber kulturemphatischer Deutung und vielmehr pragmatisch. Goethe fordert<br />
seine Bibliothekare auf, in Dianen jeden Tag schriftlich sich und ihm<br />
Rechenschaft über ihr Werk abzulegen. Was da<strong>von</strong> erhalten ist, läuft häufig auf<br />
ein schlicht tabellarisches »desgl. / desgl. / desgl.« der jeweiligen Daten hinaus. 21<br />
Goethes data-processing, durch und durch? Jedenfalls stellt der Buchstabenkomplex<br />
Goethe die vielleicht am erschöpfendsten durchgearbeitete Datenbank<br />
zu Deutschland um 1800 dar.<br />
Das 1896 eingeweihte Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar wird <strong>von</strong><br />
einem seiner Initiatoren, dem Philologen Bernhard Suphan, zum «literarischen<br />
Mausoleum <strong>für</strong> die Fürsten und Ritter deutschen Geistes allzumal« erklärt 22 .<br />
Der Literaturspeicher, der seine eigenen Verarbeitungstechniken (die der Ger-<br />
20 Zitiert nach: Volker Wahl, Die Überwindung des Labyrinths. Der Beginn der Reorganisation<br />
des Goethe- und Schiller-Archivs unter Willy Flach und die Vorgeschichte<br />
seines Direktorats (1954-1958), in: Golz (Hg.) 1996: 70-104 (75)<br />
21 Hinweis Katrin Lehmann, Herzogin-Anna-Amalicn-Bibliothek Weimar. Siehe auch<br />
Rainer-Maria Kiel, Goethe und das Bibliothekswesen in Jena und Weimar, in: Bibliothek<br />
und Wissenschaft Bd. 15 / 1981, 11-82 Detaillierter dazu W. E., Kultur als Funktion<br />
ihrer Speicher, demnächst in: Matthias Middell / Hans-Christian <strong>von</strong> FJerrmann<br />
(Hg.), Ortsbestimmungen der Kulturwissenschaften, Leipzig (Leipziger Universitätsverlag)<br />
1998<br />
22 Zitiert nach: Thomas Steinfeld, Bücherkirche, Geistesburg: Weimar und seine zwei<br />
Bibliotheken, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 1. Februar 1997
562 - ARCHIV<br />
manistik) gleich mitspeichert, wird so auch äußerhch zum Symbol: kein Archiv,<br />
sondern ein Museum, und in den Ausstellungsräumen ist die Bibliothek<br />
des Germanisten Julius Petersen eingeschlossen. »Ursprünglich wurden die<br />
wertvollsten Handschriften auch in den weißen Vitrinen aufgebahrt, die wie<br />
Katafalke aussehen. Heute liegen Faksimiles an ihrer Stelle« .<br />
Öffentliche Bauten, einmal errichtet, setzen beim Betrachter Phantasmagonen<br />
frei 23 , Bibliotheksphantasmen im Sinne Flauberts (und im Sinne der Interpretation<br />
Foucaults). 24 Demgegenüber bedarf es einer asketischen Haltung, völliger<br />
Zurücknahme der Kreativität, damit der Geist kreativ werden kann - ein<br />
Ethos, das den Archivar dieser Institution deutscher Klassik »in seiner strikten<br />
Pflichterfüllung, seinem >wehabgewandten< Dienst im >Heiligtum< bestärken<br />
wollte« . Erst die Arbeit im gcschichlsfernen Ort schafft die<br />
Voraussetzung <strong>für</strong> Literaturgeschichtsschreibung; wo literarische Leichen lagern<br />
(ders.), kommt das Textkorpus zu sich. Institute wie das Goethe- und Schiller-<br />
Archiv sind also nicht die Grund-, sondern die Widerlage(r) der Geistesgeschichte,<br />
die als Wissensrchäologie des Geistes umzuschreiben ist, wenn es um<br />
ihre matenalen Voraussetzungen, ihre Speicher geht. 25 Michel Foucauk hat solche<br />
anderen Räume als Heterotopien benannt. 26 Gerade in seiner Geschichtswidrigkeit<br />
aber ist ein solches Institut der kulturellen Remanenz in Zeiten<br />
versuchter ideologischer Inanspruchnahme potentiell das, was Hermann<br />
Grimm einmal mit Blick auf das Weimarer Gedächtnis eine Zitadelle nennt.<br />
Steht <strong>für</strong> Grimm noch vorrangig die »archivinterne Tätigkeit des Ordnens, Verzeichnens<br />
und Forschens im Mittelpunkt«, tritt später neben der Arbeit an der<br />
Weimarer Goethe-Ausgabe auch die Ausstellungstätigkcit hinzu: »Die Spannung<br />
zwischen wissenschaftlicher Tätigkeit im Innern und Präsentation nach<br />
außen gilt es heute mehr denn je produktiv zu machen« .<br />
Damit ist eine Akzentverschiebung des Archivs <strong>von</strong> der non-diskursiven<br />
Primärfunktion des Speicherns hin zu dem der Übertragung (an der Schnittstelle<br />
zur Öffentlichkeit, also zum Diskurs) benannt, ganz analog zum Trend<br />
aktueller Museumsdidaktik, die Depots selbst <strong>für</strong> das Publikum zu erschließen.<br />
Daneben hat der Geist der deutschen Literatur noch einen Zweitwohnsitz, in<br />
Marbach am Neckar. Kein Elektronenhirn, sondern ein quasi-neurologisches<br />
23 Bernd Kauffmann, Vorwort, in: Jochen Golz (Hg.), Das Goethe- und Schiller-Archiv,<br />
Weimar- Köln - Wien (Böhlauj 1996, 9-1 1 (9)<br />
24 Dazu Michel Foucault, Un »Fantastique« de la bibliotheque, übers, v. Anneliese<br />
Botond, in: ders., Schriften zur Literatur, München (Nymphenburger Verlagsbuchhdl.)<br />
1974, 157-177<br />
25 Siehe Ulrich Johannes Schneider, Die Vergangenheit des Geistes. Eine Archäologie der<br />
Philosophiegeschichte, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1990<br />
6 Michel Foucault, Andere Räume, in: zeitmitschrift. ästhetik & politik Nr. 1 (1990), 4-15<br />
2 t
VoRSPIKL: LlTI-KATUR UND ARCHIV 563<br />
Netz aus reiner Gedächtnismechanik mit Synapsen, die rechteckig und exakt<br />
vermessen sind: Archivkästen <strong>von</strong> 400 x 285 x 170 Millimetern. »15000 Kastenzellen<br />
bilden das Stammhirn, macht 4600 laufende Regalmeter. Unterirdische<br />
Nervenbahnen der Literatur, atombombensicher verwahrt bei 18 Grad und 55<br />
Prozent Luftfeuchtigkeit. Die Zellen vermehren sich unaufhörlich.« 27 Dort also<br />
ist ein Schriftkorpus der Nation konsequent als Speicher, nämlich modular konfiguriert<br />
und damit nicht nur quantifizierbar, sondern als Gedächtnismaschine<br />
programmiert.<br />
27 Christof Siemes, <strong>Im</strong> Schatzhaus der Poeten (über das Deutsche Literaturarchiv Marbach<br />
am Neckar), in: Zeitmagazin Nr. 46, 10. November 1995, 26-34 (30)
564 ARCHIV<br />
Kein Gedächtnis ohne Adresse:<br />
Deutsche Archive zwischen Pertinenz und Provenienz<br />
Das zeitliche Limit der Edition deutscher Urkunden <strong>von</strong> Seiten der MGH ist<br />
der Anfang der Archivhistorie: Archivahsche Ordnungssyteme entstehen in<br />
Deutschland allgemein erst seit dem 15. Jahrhundert. Zunehmende Schriftlichkeit,<br />
gekoppelt an die Umstellung auf geldwirtschaftliche Verhältnisse (Rentenkäufe)<br />
seit dem 14. Jahrhundert, vermehrt die Urkundenbestände auf Seiten<br />
des Reiches, der Stifte und der Klöster 1 und erfordert neue Speichertechniken<br />
zur Reduktion ihrer Komplexität als Gedächtnis, das damals noch Rechtsanspruch<br />
heißt. Die aus der Säkulansationswelle in Deutschland unter Napoleon<br />
resultierende Dokumentenschwemme hat einen Vorläufer in der Ruptur der<br />
Reformation. Die in ihrem Zuge durchgeführte Aufhebung der Stifte und Klöster<br />
»unterbrach eine Entwicklung, die wahrscheinlich auch die größeren<br />
Archive ohne Ordnungssysteme vor die Notwendigkeit der Einführung eines<br />
solchen geführt hätte«; so wird Historie neu konfiguriert. Die Urkunden werden<br />
zumeist in landesherrliche Archive übertragen, »wo sie eine Zeitlang noch<br />
in ihrem alten Verbände lagen, bis die Ordnung aller Urkunden nach Sachbetreffen<br />
oder der zeitlichen Reihenfolge die alten Zusammenhänge vollends zerriß«<br />
; kurz vor Ende des Alten Reiches empfiehlt Joseph<br />
Anton Oegg in seinen Ideen einer Theorie der Archivwissenschaft (Gotha 1804)<br />
eine mechanische Ordnung der Urkunden (chronologisches, Personal-, Realund<br />
Lokalsystem). 2 Archiv- bleibt Arkanpraxis; erst die neue Ordnung der<br />
Akten nach 1806 ist eine öffentliche: »Es ist wissenschaftlich ein höchst bedeutendes<br />
Moment, daß eben der Staat, welcher ursprünglich nicht gewillt war, die<br />
sogenannten >geheimen Archive< als Werkstätten der Wissenschaft behandeln<br />
zu lassen, heute zu den liberalsten gerechnet werden darf.« 3<br />
1<br />
Harald Schieckel, Pertinenz und Provenienz in den alten Ordnungssystemen miteldeutscher<br />
Stifts- und Klosterarchive, in: Archivar und Historiker. Studien zur Archivund<br />
Geschichtswissenschaft. Zum 65. Geburtstag <strong>von</strong> Heirnich Otto Meisner, hg. v.<br />
d. Staatlichen Archivverwaltung im Staatssekretaritat <strong>für</strong> Innere Angelegenheiten<br />
(DDR), Berlin (Rüttcn & Locning) 1956, 89-103 (100)<br />
2<br />
Hans Kaiser, Aus der Entwicklung der Archivkunde, in: Archivahsche Zeitschrift 37<br />
(1928), 98-109(104)<br />
3<br />
C. A. H. Burckhardt (Großherzoglich und Sächsischer Archivar), Die Archivfrage vor<br />
dem Reichstage. Zugleich eine Entgegnung auf die v. Hagke'schc Broschüre: Ucbcr<br />
die Wiederherstellung eines deutschen Reichsarchivs und die Reformen im Archivwesen,<br />
Weimar (Voigt) 1868, 4
DKUTSCHK ARCHIVI-: ZWISCHEN PI-;RTINKNZ UND PROVKNIKNZ 565<br />
Zwischen Registratur und Archiv:<br />
Archi(v)texturen, Begründung und Bodenlosigkeit des Archivs (Erhard)<br />
Die Differenz zwischen Mittelalter und Neuzeit ist mit dem Unterschied <strong>von</strong><br />
Urkunde und Akte (archivalisch) adressierbar. Beide Archivgruppen erläutern<br />
sich gegenseitig; in Form und Abfassung schließen sie sich zugleich gegen die<br />
übrigen Geschichts-Quellen, etwa Chroniken und Annalen, in bestimmter<br />
Weise ab »und bilden ein streng zusammengehöriges Ganze, was nicht bloß der<br />
Historiker anerkennt, sondern auch die, <strong>von</strong> Seiten des Staats, mit ausdrücklicher<br />
Absicht verfügte Sammlung und ungetrennte Verwaltung beider unverkennbar<br />
ausspricht.« 4 Das Archiv steht gleichrangig in einem funktionalem<br />
Verhältnis zum Staat und <strong>für</strong> symbolische Operationen der Geschichtswissenschaft<br />
zur Verfügung. Archivkunde selbst gilt als deren Hilfswissenschaft, seitdem<br />
sie sich zu den »Disciphnen des sogenannten endlichen Wissens« zahlt: computerable numhers bilden ihr logistisches Dispositiv.<br />
Diplomatik und Archivkundc beschäftigen sich vorzugsweise mit Urkunden;<br />
erstere »jedoch diese nur <strong>für</strong> sich, gleichsam in abstracter Weise betrachtet,<br />
in der Archivkunde aber die Urkunden zugleich als Bestandtheile der<br />
Archive auftreten« . F/Akten sind demgegenüber Übertragungskanal<br />
und Code (Gesetz, Steuerungsinstrumente) der Historie. 5 Droysens Begriff<br />
der »Geschäfte« in seiner Histonk rekurriert darauf, doch längst bilden neue<br />
Aufzeichnungstechniken das Leitmedium der historischen <strong>Im</strong>agination:<br />
»Wenn man alle denkbaren Memoires, Verhandlungen und Korrespondenzen der<br />
Napoleonischen Zeit zusammenstellte, so würde man noch nicht einmal ein photographisch<br />
richtiges Bild der Zeiten haben, in den Archiven liegt nicht etwa die<br />
<strong>Geschichte</strong>, sondern es liegen da die laufende Staats- und Verwaltungsgeschäfte in<br />
ihrer ganzen unerquicklichen Breite, die sowenig <strong>Geschichte</strong> sind, wie die vielen<br />
Farbenkleckse auf einer Palette ein Gemälde.« 6<br />
Ist ein Geschichts-Graph mehr als die Verknüpfung einer auf der x- und y-<br />
Achse adressiertbaren archivisch-statistischen Punktmenge? »Aus Geschäften<br />
wird <strong>Geschichte</strong>, aber sie sind nicht <strong>Geschichte</strong>« ; der<br />
L. B. v. Medem, Zur Archivwissenschaft, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde, hg. v. L. F.<br />
Höfer, H. A.Erhard u. ders., Bd. 1 (1833/34), Hamburg (Pcrthes) 1934, 1 -51 (5)<br />
Über den pcrformativen Schrcib(f)akt (und das Signum »f« als Zeichen der Ausführung<br />
einer Ordre in preußischen Kanzleien des 18. Jahrhunderts siehe demnächst:<br />
Cornelia Vismann, Dissertation Goethe-Universität Frankfurt/M.: Akten: Ihre Ordnungen<br />
als <strong>Geschichte</strong> des Rechts, Kapitel IV. 1. a. (Typosknpt), 1 1<br />
Johann Gustav Droysen, Plistonk: historisch-kritische Ausgabe, hg. v. Peter Leyh,<br />
Stuttgart / Bad-Cannstadt (frommann-holzboog) 1977, 11 (= Histonk. Die Vorlesungen<br />
<strong>von</strong> 1857, Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung aus den Handschriften)
566 ARCHIV<br />
Entwicklungsbegnff ist, je akten- und damit prozeßnäher, desto weniger schon<br />
historisch. Unter Akten - ihrerseits schon eine Funktion des Kanzlei-Archivs<br />
- versteht Erhard all diejenigen schriftlichen Geschäftsverhandlungen, die nicht<br />
wie Urkunden »einen bereits in die Wirklichkeit eingeführten Beschluß oder<br />
Vorgang förmlich beglaubigen«, sonder »in einer fortlaufenden Reihe schriftlicher<br />
Aeußerungen, den allmahgen Entwickelungsgang einer Begebenheit oder<br />
eines Verhältnisses darstellen« . Von wissensarchäologischen<br />
Verhältnissen im Unterschied zur narrativen Historie geht auch das System der<br />
deutschen Altertumskunde des Begründers des Germanischen Nationalmuseums<br />
<strong>von</strong> Aufseß unter dem <strong>Namen</strong> Zustände aus. Vor Ranke ist die Archivästhetik<br />
noch nicht nahtlos in die Ästhetik der Historie integriert; »wie groß<br />
auch die Abneigung der gelehrten Historiker <strong>von</strong> Profession, gegen alles, was<br />
Akten heißt, immer sein mag, so gewähren sie doch eine höchst wichtige und<br />
unentbehrliche Quelle <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong>, die man nie ohne wahren und merklichen<br />
Schaden vernachlässigt« .<br />
Das Wahrheitspostulat des okzidentalen Logozentrismus ist an die Augenzeugenschaft<br />
gekoppelt. Abgeleitete Augenzeugenschaft aber, also gespeicherte<br />
und übertragene Evidenz, bedarf der Autonsierung; die Autorität des Archivs<br />
verdankt sich seinen Interpetanten:<br />
»Wenn nun andre etwas zeugen, oder wenn wir selber etwas aufzeichnen, das in<br />
der That geschehen ist, so wird solches die Historie genennet. Die Historie ist also<br />
nichts anders als Erfahrungen, welche wir <strong>von</strong> andern bekommen, und wegen ihres<br />
Zeugnisses davor halten, daß sie wirklich geschehen sind. Es muß also ein<br />
geschickter Historien-Schreiber die Archive zur Hand haben, wenn er etwas wichtiges<br />
zu liefern im Stande seyn will.« 7<br />
Da jedoch Akten sehr verschiedener Art sind »und nicht, wie die Urkunden,<br />
bloß Resultate, sondern ausführliche Verhandlungen enthalten« - prozessuale<br />
Vektoren der Übertragung sind ihr eingeschrieben, im Unterschied zur<br />
residenten, monadischen Monumentalität diskreter Rechtsurkunden -, »so folgt<br />
hieraus <strong>von</strong> selbst, daß eine Auswahl derselben <strong>für</strong> das Archiv getroffen werden<br />
muß« . »Jede Urkunde bildet <strong>für</strong> sich ein Ganzes, das<br />
also, bei der Vernichtung derselben, auch ganz verloren geht; Akten bestehen<br />
hingegen aus vielen einzelnen Theilen, die <strong>für</strong> das Ganze bei weitem nicht alle<br />
<strong>von</strong> gleicher Wichtigkeit sind« - eine Herausforderung an<br />
die standardisierte Organisation des Archivwesens, »wenn man folgerichtig verfahren,<br />
und kein Stückwerk, sondern wirklich ein wohlgeordnetes, gleichför-<br />
Artikel »Historie«, in: Johann Heinrieh Zedler, Großes Vollständiges Univcrsal-Lexikon,<br />
Halle/ Leipzig 1732ff (Reprint Graz 1961), Bd. 13, Spalte 282 u. 284; Artikel<br />
»Archiv« (und die Differenz zur Registratur): Bd. 2, Sp. 1241 ff
DEUTSCHE ARCHIVE ZWISCHEN PERTINENZ UND PROVENIENZ 567<br />
miges Ganzes herstellen will« . Folgerichtigkeit in der Datenabarbeitung<br />
heißt, dem Archiv eine algonthmische Ästhetik einzuschreiben,<br />
welche die Irreversibilität <strong>von</strong> Zeitabläufen in Entscheidungsvorgängen in ihren<br />
schriftlichen Spuren reflektiert. Heinz <strong>von</strong> Foerster hat dies im Modell der<br />
nicht-trivialen Maschine gefaßt, deren in der Vergangenheit durchlaufene<br />
Schritte (und nicht äußere Eingriffe) das aktuelle Verhalten steuern. 8 Das System<br />
bedarf der (Beobachter-)Differenz <strong>von</strong> Verwaltung und Archiv:<br />
»Verhandlungen, die noch nicht abgeschlossen sind, d. h. in denen noch wesentlich<br />
fortgearbeitet wird, gehören nicht m's Archiv, sondern in die Registratur .<br />
Hier muß ich erinnern, daß ich absichtlich nur <strong>von</strong> geschichtlicher Wichtigkeit<br />
der Akten, und nicht <strong>von</strong> einer Wichtigkeit <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> oder <strong>für</strong><br />
die Verwaltung gesprochen habe; denn diese Distinction ist einmal unnütz, da<br />
abgeschlossene Verhandlungen auch <strong>für</strong> die Staatsverwaltung nur ein geschichtliches<br />
Interesse haben können.« <br />
Diese Beobachterdifferenz ermöglicht erst die Wahrnehmung <strong>von</strong> Akten als<br />
<strong>Geschichte</strong>. Leitdifferenz ist die zwischen Verwaltungs- und Wissenschaftsfunktion:<br />
»Sowie es zugleich unwidersprechhch wahr bleibt, daß sobald man das Archiv als<br />
völliges Annexum einer Verwaltungsbehörde, als solcher, betrachtet, der wissenschaftliche<br />
Charakter desselben als etwas tief untergeordnetes erscheint, und in der<br />
Anwendung ganz verschwindet. Denn wenn auch die Verwaltungsbehörde bei<br />
ihren Geschäften wissenschaftlicher Grundsätze und Hülfsinittel bedarf, so<br />
machen diese doch nicht das Wesen derselben aus, sondern dieses wird durch ein<br />
rein praktisches Interesse bestimmt.« <br />
Vorgängig zu aller Archivsemantik ist es »zunächst die äußere Stellung, <strong>von</strong> deren<br />
Sicherheit und Bestimmtheit das glückliche Bestehen und Gedeihen eines jeden<br />
Institutes wesentlich abhängt« . In einem präinformatischen<br />
Zeitalter ist diese Gedächtnissicherung, ganz im Sinne der ars memonae, räumlich<br />
beschreibbar; konkret soll das Arbeitszimmer des Archivars einerseits <strong>von</strong><br />
den Archiven selbst abgesondert sein, andererseits jedoch mit diesem unmittelbar<br />
zusammenhängen, so daß man ungehindert und ohne Umwege aus dem einen<br />
in das andere gelangt. »Das Arbeitszimmer darf nicht gleichzeitig zur Aufbewahrung<br />
<strong>von</strong> Archivalien dienen, sondern nur diejenigen Gegenstände enthalten,<br />
welche zur Arbeit nöthig sind; jedoch kann, wenn es der Raum zuläßt, die Bibliothek<br />
des Archivs in demselben aufgestellt sein« . Das<br />
meint die Trennung <strong>von</strong> Betriebssystem und Datenbanken. Erhard spricht sich<br />
Angelika Mcnnc-Hantz, Die Archivwissenschaft, die Diplomatik und die elektronischen<br />
Verwaltungsaufzeichnungen (Johannes Papntz zum 100. Geburtstag), in: Archiv<br />
<strong>für</strong> Diplomatik (1998), unter Verweis auf: Heinz <strong>von</strong> Focster, Wissen und Gewissen,<br />
Frankfurt/M. (3. Aufl.) 1996, 358
568 ARCHIV<br />
gegen die Ansicdlung <strong>von</strong> Archiven in Universitäten zum Zweck historischer<br />
Studien aus: »Man würde das Archiv zu sehr als einen Gegenstand bloß gelehrter<br />
Forschung betrachten, und seine Wichtigkeit <strong>für</strong> die Administration, sowohl<br />
im allgemeinen, als in einzelnen Fällen, darüber vergessen« .<br />
Der Vorschlag, wissenschaftliche Bestandteile der Archive zu zentralisieren, jeder<br />
Verwaltungsbehörde aber ein Archiv-Depot mit Akten und Urkunden der neueren<br />
Zeit (gemeint ist die Zeit seit dem 16. Jahrhundert) zu belassen, ist Erhard<br />
nicht plausibel, da eine solche Trennung immer arbiträr, ein willkürlicher Akt<br />
bleibt: »Es entscheidet hier also am Ende die Willkür; Jedes Archiv bilde ein<br />
Ganzes!« . Seine Archivästhetik ist - im Sinne einer etatistischen Rhetorik<br />
- der Figur des pars pro toto verschrieben: Archive als Anstalten sind immer<br />
»Theile eines großen Ganzen« namens Staat .<br />
Was heute mathematische Kodierung als Datenversiegelung ist, war einmal als<br />
materielles katechon, als Aufschub gedacht. Alte Archivlokale berücksichtigen fast<br />
ohne Ausnahme lediglich die Sicherung <strong>von</strong> Archivalien gegen Feuergefahr, sind<br />
also meistens Türme oder sonstige Gewölbe mit massiven Mauern, eisernen Türen<br />
und möglichst wenigen, dabei dicht verschlossenen Fensteröffnungen »oder<br />
ähnlichen Vorkehrungen, die sie einem Gefängnisse ähnlicher machen, als einem<br />
Aufbewahrungsorte wissenschaftlicher Schätze« . Denn die<br />
Disziplinierung des Gedächtnisses folgt dem Disziphnarregimc ihrer Gegenwart.<br />
Noch die Empfehlung der Konferenz über die archivische Zusammenarbeit in<br />
Europa (Archivprogramm des Europarats) vom 21./22. November 1994 in Straßburg<br />
fordert die »Entwicklung angemessener Standards <strong>für</strong> die Bestandserhaltung,<br />
einschließlich der Archivbauten.« 9 Gedächtnis ist hier keine bloße Frage <strong>von</strong> Software}<br />
0 Ab/Gründe: Das Archiv ist das Gesetz dessen, was überhaupt ausgesagt<br />
werden kann. Was aber instituiert dieses Gesetz? Wer setzt das Archiv als Gestell?<br />
Die Institution bedarf einer Begründung im Diskurs, einer arcke-au-logw.<br />
»Es dürfte zwar auffallend erscheinen, daß hier <strong>von</strong> einer Begründung des Archivwesens<br />
die Rede sein soll, da doch schon viele Archive thatsächlich begründet<br />
vorhanden sind; allein glaube ich versichern zu dürfen, daß es an einer<br />
wissenschaftlichen Begründung noch viel zu sehr fehlt, und daß man an vielen<br />
Orten kaum in der Annäherung zu einer solchen begriffen ist. Ohne mich nun in<br />
diesem Fach zum Gesetzgeber aufwerfen zu wollen, scheint es mir am<br />
rathsamsten, die Resultate meines Nachdenkens und meiner Erfahrung in apodiktischer<br />
Form zusammenzustellen.«''<br />
9<br />
Konferenzbericht Reimer Witt, in: Der Archivar, Jg. 49, J996, H. 2, Sp. 247-252<br />
(Sp.248)<br />
10<br />
Vgl. Friedrich A. Kittlcr, Thcrc is no Software, in: Stanford Litcrary Review 9, Heft 1<br />
(Spring 1992), 81-90<br />
11<br />
Heinrich August Erhard, Ideen zur wissenschaftlichen Begründung und Gestaltung<br />
des Archivwesens, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde 1834: 183-247 (184)
Dl-UTSCIll- ARCHIVT. ZWISCHEN PKRTINKNZ UND PROVHN IINZ 569<br />
Etymologisch läßt sich die arebe des Archivs nicht eindeutig ergründen; auch<br />
»historisch läßt sich der Begriff eines Archivs nicht ganz entwickeln« - womit<br />
sich das Archiv als Bedingung historischer Forschung auch immer schon ihrem<br />
Diskurs entzieht. »Denn die Alten pflegten eigentlich keinen bestimmten<br />
Begriff mit diesem Worte zu verbinden, und wir finden in dem, was sie Archiv<br />
nannten, nicht selten Gegenstände der verschiedensten Art vereinigt« . Ergründen läßt sich das Archiv vielmehr wissensgenealogisch oder<br />
wissensarchäologisch im Sinne Nietzsches und Foucaults.<br />
Gegenstände, die in cm Archiv aufzunehmen sind, müssen «der Bestimmung<br />
desselben entsprechen«. Der Archivbegriff ist damit vektonell vom Gedanken<br />
der Übertragung ebenso wie der des Speichers geprägt: Sie müssen auf<br />
dem Wege der Geschäftsführung entstanden, völlig abgeschlossen und »als<br />
Belege <strong>für</strong> geschichtliche Verhältnisse quahficirt sein« ; im<br />
Sinne Niklas Luhmanns sind Archive also nur bedingt operativ geschlossen.<br />
Hinsichtlich seiner wissenschaftlichen, d. h. nicht schlicht etatistisch-statistischen<br />
Nutzung versteht sich das Archiv bibliotheksnah, denn es ist »auch in<br />
einem ähnlichen Geiste, nicht wie eine Registratur, sondern vielmehr wie eine<br />
Bibliothek, zu behandeln und zu verwalten« . Demnach ist<br />
die Umpolung <strong>von</strong> Macht auf (ein Dispositiv <strong>für</strong>) Historie nicht erst der Akt<br />
der narrativen Übersetzung diskreter Archivalicn durch die Historiker, sondern<br />
schon die Vorstruktunerung des Materials in der archivahschen Inventarisation<br />
als Um-Ordnung der staatsnahen Registratur selbst. Erhards Versuch, die<br />
Archive aus der Verwaltung herauszulösen und sie zu historischen Instituten<br />
zu machen, ist gescheitert. Als Gcd :
570 ARCHIV<br />
rität« 13 , den Diskurs der <strong>Geschichte</strong>, der als Organismus verbrämt, was System<br />
ist - korrespondierend mit der Definition der Archivalie durch »das organische<br />
Prinzip der Besonderheit« (Meisner), das in dem Moment aufgehoben ist, wo<br />
sie das Trägermedium wechselt. In einer Fußnote ergänzt Meisner: »Von den<br />
Perspektiven des Mikrofilm sehe ich dabei ab«; Mikrofilm macht archivische<br />
Unikate nicht nur reproduzierbar, sondern auch in einer bibliotheksvertrauten<br />
Weise vernetzbar, wie es Vannevar Bush 1945 in Form eines maschinellen<br />
Memory extender angedacht hat. Das »Ziel, Wissen zu vermitteln«, ist ein der<br />
Bibliothek eingeschriebener diskursiver Vektor. Für G. A. Knjazevs Theorie<br />
und Technik des Archivierens ist daher »eine Originalarbeit Archivmaterial,<br />
ihre photographische Wiedergabe aber Bibhotheksmaterial« . Gesellschaftlichen Systeme breiten ihre Gedächtnishilfsmittel<br />
gerade nicht im idealen, sondern konkret medialen Raum aus; mit<br />
dessen Äußerlichkeit korrespondiert in den Institutionen die Äußerlichkeit des<br />
Verwaltens. 14 Michel Foucaults Archäologie des Wissens hat daraus die methodische,<br />
nicht aber die medienbewußte Konsequenz gezogen, die ihm <strong>von</strong> seinem<br />
Lehrer vorgegeben war, denn das administrative Gedächtnis bildet nur<br />
diskursiv eine Schnittstelle zur Geschichtsphilosophie; non-diskursiv aber gilt:<br />
»Die Äußerlichkeit der gesellschaftlichen Maschinen in der Organisation ist an<br />
sich nicht verschieden <strong>von</strong> der Äußerlichkeit der Teile in einer Maschine.« 15<br />
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert beginnt die endgültige Trennung<br />
<strong>von</strong> Archiv- und Registraturplänen; in Baden etwa wurden bis in die Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts in den Registraturen die Archivordnungcn <strong>von</strong> 1801 benützt.<br />
Spät erst vollzieht sich eine sichtbare Trennung (»um nicht Entfremdung<br />
zu sagen!« 16 ) zwischen Archiv und Registratur; die Archivare beschäftigten sich<br />
nur noch mit der Verwaltung des ausgeschiedenen, abgelieferten Schriftguts der<br />
13 Carl Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, München 1925, 24; dazu<br />
Peter Berz, Der deutsche Normenausschuß. Zur Theorie und <strong>Geschichte</strong> einer technischen<br />
Institution in: Armin Adam / Martin Stingelin (Hg.), Übertragung und<br />
Gesetz. Gründungsmythen, Kriegstheater und Unterwerfungsstrategien <strong>von</strong> Institutionen,<br />
Berlin (Akademie) 1995, 221-236 (228)<br />
14 Georges Canguilhem, Das Normale und das Pathologische [1966], aus dem. Franz.<br />
übers, v. Monika Noll u. Rolf Schubert, München 1974, 176. Auch dazu Berz 1995: 234<br />
13 Canguilhem 1974: 177. Zur Opposition »Organismus versus Mechanismus« in<br />
Deutschland um 1800 siehe Barbara Stollberg-Rihngcr, Der Staat als Maschine: zur<br />
politischen Metaphorik des absoluten Fürstenstaats, Berlin (Duncker & Humblot)<br />
1986, Kapitel 7<br />
"' Herbert Berner, Probleme moderner Aktenpläne, in: Der Archivar, 8. Jg., Heft 2 (April<br />
1955), Sp. 89-99 (89f). In der Schrift Jakobs <strong>von</strong> Rammingen, Von der Registratur ,<br />
Heidelberg 1571, ist der Begriff Registratur noch gleichbedeutend mit Archiv: Siehe<br />
Kaiser 1928: 98f
DKUTSCHK ARCIIIVK ZWISCHEN PKRTINI.NZ UNI) PROVKNIKNZ 571<br />
Verwaltungen, deren Registraturen sie fortan unbekümmert läßt. Nicht vollständig<br />
abgeschlossene Verwaltungsvorgänge werden bei der Trennung noch<br />
nicht entbehrlicher älterer Verhandlungen <strong>von</strong> den neueren gesondert repomert;<br />
diese Altregistratur bildet jedoch nicht ein Mittelglied zwischen der Registratur<br />
und dem Archive, sondern sie ist »ein integrirender Theil der Registratur<br />
selbst, und eine, neben dem Archive ganz unabhängig <strong>von</strong> diesem, und zu einem<br />
ganz verschiedenen Zwecke, bestehende Anstalt« . Bis zum<br />
19. Jahrhundert gilt das Archiv als Bestandteil <strong>von</strong> Kanzlei oder Registratur. 17<br />
1806 bindet eine Zeitschrift <strong>für</strong> Archivs- und Registraturwissenschaft beide<br />
Aktenaggregationen durch Titel und Herausgeberschaft: der Archivar Paul<br />
Oesterreicher und der Oberregistrator F. Döllinger in Bamberg . Diverse Gedächtnisagenturen unterscheiden sich durch die ihnen jeweils<br />
eingeschriebenen diskursiven und non-diskursiven Vektoren; alternativ zu<br />
Erhard formuliert Hoefer:<br />
»Registratur - das Stammwort regerere in seiner materiellen und bildlichen Bedeutung<br />
genommen - weist auf die Behandlung und das Ordnen jenes Materials<br />
hin, woraus eine solche Sammlung erwächst sobald eine Verhandlung als<br />
abgeschlossen angesehen, und <strong>für</strong> die Dauer <strong>von</strong> Werth, und Nutzen erachtet werden<br />
kann . Da folglich ein Archiv ohne Registratur eine Masse todten<br />
Stoffes enthalten würde, so müßte eins <strong>von</strong> dem andern getrennt, gar nicht bestehen<br />
können.« lx<br />
Der Rom-nahe Kanzlist Johannes Lydus leitete dagegen die Regesten aus den<br />
res gestae als Staatsakt(ion)en ab 19 ; gibt es eine Wahrheit der Etymologie, auf<br />
die Wissensarchäologen sich jenseits des Archivs berufen können? In Zedlers<br />
Universallexikon aus dem frühen 18. Jahrhundert firmiert unter Register »jedwedes<br />
Buch, in welchem gewisse Briefschaften, Handlungen, geschehene Dinge<br />
u.d.g. in einer solchen Ordnung verzeichnet werden, daß, wenn da<strong>von</strong> Nachricht<br />
zu haben nötig ist, dieselbe alsofort gefunden werden könne« 20 ; elektro-<br />
17 Victor Loewe, Das Deutsche Archivwesen. Seine <strong>Geschichte</strong> und Organisation, Breslau<br />
(Priebatsch) 1921, 1<br />
18 Hoefer, Über Archive und Registraturen, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde 1<br />
(1833/34), Hamburg (Perthes) 1834, 248-258 (248)<br />
19 Siehe Ioannes Lydus, On powers or the magistracies of the Roman State [Pen Archon<br />
tes Romaion politeias], introduetion, critical text, translation, commentary and indices<br />
by Anastasius C. Bandy, Philadelphia (The American Philosophical Society) 1983, 165;<br />
Hinweis Bernhard Siegert (Berlin)<br />
20 Johann Heinrich Zedlcr, Großes Vollständiges Univcrsal-Lcxikon, Halle / Leipzig<br />
1732ff (Reprint Graz 1961), Bd. 30, Sp. 1866. Dazu: Mohammed Rassem, Stichproben<br />
aus dem Wortfeld der alten Statistik, in: Mohammed Rassein / ders. (Hg.), Statistik<br />
und Staatsbeschreibung in der Neuzeit, vornehmlich im 16.-1 8. Jahrhundert, Paderborn<br />
u. a. (Schöningh) 1980, 17-36 (22)
572 • _ ARCHIV<br />
nische Rechner verstehen unter Register den Zwischen- im Unterschied zum<br />
Arbeitsspeicher. 21 Dieses Aufschreibesystem stellt also einen zur narratio rerum<br />
gestarum alternativen Modus der Informationsverarbeitung dar 22 - womit<br />
die indexikalische retneval-Yunkiion des Registers sowohl an die antike und<br />
frühmittelalterliche Annahstik wie die Statistik des 18. und 19. Jahrhunderts gekoppelt<br />
ist. Der Unterschied <strong>von</strong> Inventarisierung und Regest liegt auf der<br />
Archivebene selbst und muß aus der Beschreibung der Stücke sichtbar sein: »In<br />
einer Regestenliste soll die Beschreibung die Handlung vermelden, die in dem<br />
beschriebene Stück verzeichnet ist, im Inventar muss die Art des Stücks in den<br />
Vordergrund treten« . Gedächtnistaktische Praxis führte zur<br />
Dissoziation <strong>von</strong> Registratur und Archiv; Hoefer will deshalb auch »den<br />
gewöhnlichen Sprach-Gebrauch, daß das Archiv der Vergangenheit, die Registratur<br />
aber der Gegenwart angehöre, hier als bezeichnend gelten zu lassen, um<br />
hiernach <strong>für</strong> Letztere die Grenzen aufzufinden« . Gibt es<br />
eine Substanz der Vergangenheit? Hoefer denkt die Registratur als temporären<br />
Bestand <strong>für</strong> künftige Archivalien, das Archiv aber als einen zweckmäßig eingerichteten<br />
und geordneten, bleibenden integnrenden Bestand, eine »würdige, alle<br />
Zeiten nöthige oder nützliche Substanz«. Da die Registratur dem Archiv in die<br />
Hände arbeiten müsse,vektoriell also darauf ausgerichet ist, bedarf es einer beiden<br />
Instituten übergeordneten, gemeinsamen Taxonomie ihrer Elemente - einer<br />
Instruction <strong>für</strong> Registraturen im Format des Archivs . Doch welche<br />
<strong>Geschichte</strong> inkorporiert das Archiv?<br />
»Es würde mehr als gewagt erscheinen, eine <strong>für</strong> alle Archive passende Norm und<br />
Bestimmung zu entwerfen und als ausreichend hier vorschlagen zu wollen. Die<br />
gleiche Bewandnis hat es mit den zu führenden Repertorien, Archiv-Büchern &.,<br />
deren Anlage, mehr oder minder complicirte Einrichtung, systematische oder<br />
andere Anordnung sich eben so verschieden und ungleich eignen müssen, als die<br />
der Archive selbst, in Bezug auf Vorrath, Bedürfnis, Zeit, Raum und Mittel.<br />
Angesehen ihre Stellung und Bedeutung, so erscheinen einige Archive als abgeschlossene,<br />
todte Körper, die nur aus der Vergangenheit ihre Vorräthe geschöpft<br />
haben; andere zeigen sich wieder als lebende, und durch die stets fortzeugende<br />
Registratur bestimmt und sicher wachsende und sich eben so verjüngende<br />
Körper . Noch in anderen sucht man wieder vergebens die Vergangenheit<br />
; sie erscheinen über kurz oder lang als Zeugnisse einer ephemeren verschwundenen<br />
Instiution, und gewinnen durch dieses Verlöschen nur eine histo-<br />
21 Dazu Edgar Mühlhausen, Am Anfang war OPREMA. Die Entwicklungsgeschichte<br />
der ersten funktionsfähigen Rechenanlage in der DDR, in: rechentechnik/datenverarbeitung<br />
24, Heft 7 (1987), 34f (35)<br />
22 Zum Verhältnis <strong>von</strong> bistona und notitia in der frühen (Natur-)Gcschichtsschreibung<br />
und historischen Statistik siehe Arno Seifert, Staatenkunde. Eine neue Disziplin und<br />
ihr wissenschaftstheoretischer Ort, in: Rassem / Stagl (Hg.) 1980: 217-244 (224)
DI-UTSCHK Aiicuivi-; ZWISCHEN PHRTINI-:NZ UND PROVHNIHNZ 573<br />
rische Bedeutung <strong>für</strong> die Zukunft und als Unterabtheilung einen Platz in<br />
größeren Archiven.« 23<br />
Unter EDV-Bedingungen kommt der administrative Speicher auf die (wissensarchäologischc)<br />
In-Differenz <strong>von</strong> Registratur und Archiv zurück; bei steigendem<br />
Einsatz in Behörden sind »aufgrund der größeren Kompatibilität der<br />
Hypertexte und der Möglichkeiten der Volltextrechcrche fließende Übergänge<br />
<strong>von</strong> Findmitteln der Behördenregistratur zu archivischen Findmitteln denkbar«,<br />
die vor allem in Hinblick auf die Festlegung <strong>von</strong> Sperrfristen, jener<br />
Schnittstelle zur historischen Forschung, entscheidend sind. 24<br />
Suprematie der Provenienz<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz weiß um das juristisch-historische double-bind der<br />
Institution Archiv: »Was die Schafften und Briefschafften eines Archivi selbst<br />
betrifft so ist sowohl deren Maten und Sorten, als form und Ordnung zu betrachten.<br />
Die Sorten und Species der Briefschafften sind mancherley, als scripta sunst<br />
vel dispositiva effectum juns habentia, vel narrativa tantum et lnformatoria.« 2 " 1<br />
Ein daran anschließender, schließlich gestrichener Absatz birgt den Gedanken<br />
der Ordnung nach Provenienz: »Die Ordnung mus Hauptsächlich nicht <strong>von</strong><br />
dem Alphabet, als welches zusammengehörige Dinge <strong>von</strong> einander zerstreuet,<br />
noch <strong>von</strong> den Zeiten, als welche nicht allezeit bewust, sondern <strong>von</strong> den Materien<br />
genommen werden« . Wo aber alte Archivordnungen zerstört oder<br />
undurchsichtig vorliegen, bleibt nur, eine neue Ordnung nach Sachbetreffen zu<br />
schaffen 26 ; in der Epoche der Französischen Revolution wird sie zum retneval-<br />
Modus der archivischen Verpflichtung zur öffentlichen Information. 27 Ist der<br />
23 Hoefer 1834: 257. Vom Archiv als »lebender Organismus« - weil an den »staatlichen<br />
Verwaltungskörpcr« angeschlossen - spricht, im ausdrücklichen Gegensatz zu<br />
Museum und Bibliothek, Vcrnhard Vollmer, Archiv und Heimatmuseum, in: Nachrichten-Blatt<br />
<strong>für</strong> rheinische Heimatpflege, 1. Jg., Heft 7/8 (1929), 17-20 (17)<br />
24 Karsten Uhde, Archive und Internet, in: Der Archivar Jg. 49, 1996, H. 2, Sp. 205-216<br />
(213). Ferner Angelika Menne-Hantz, Online-fähige Repcrtonen? Einige Überlegungen<br />
zur Interaktivität <strong>von</strong> Archivfindmitteln, in: Der Archivar 49 (1996), Sp. 603-610<br />
2:> Gottfried Wilhelm Leibniz, Von nützlicher Einrichtung eines Archivi [Mai bis Juni<br />
1680], in: ders., Politische Schriften, hg. v. Zentralinstitut f. Philosophie an der Akademie<br />
d. Wisenschaften der DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie-Verlag) 1986,<br />
332-340(339)<br />
2b Gerhard Schmidt, Die Ordnungsmethoden innerhalb der Archivorganisationstypen,<br />
in: Archivmitteilungen 3/1958, 81-84 (82)<br />
27 Hellmut Kretzschmar, Gedanken über Archivinventare, in: Archivalische Zeitschrift<br />
50/51 (1955), 185-191 (187), unter Bezug auf Wilhelm Wiegands Begriff der »Erklärung<br />
der archivalischen Menschenrechte« (in: Korrespondenzblatt 55/1907, 425).
574 ARCHIV<br />
Überlieferungskörper zerstückelt, kommt der mit dem Provenienzprinzip<br />
gekoppelte orgamzistische Geschichtsbegnff nicht zum Zug. Angesichts der Verluste<br />
an Nachrichten aus der Vorzeit bleibt »oft nichts weiter übrig, als aus vielen<br />
Bruchstücken, so gut als möglich, ein Ganzes zusammenzusetzen, und da<br />
haben wir denn weniger die Herkunft, als die innere Gültigkeit und Brauchbarkeit<br />
der einzelnen Stücke zu beachten« . Gerhard Schmidt<br />
zieht daraus eine archivkundliche Konsequenz, die wissensarchäologisch zur<br />
Provokation der Historie selbst wird, indem sie die dokumentarische und die<br />
monumentalisclic Lesart der Textailclaklc, die historisch-syntaktische und die<br />
diskret-parataktische Ordnung als epistemische, nicht geschichtlich geprägte<br />
Alternativen beschreibt: Provenienz und Pertinenz als »organisch gewachsene«<br />
versus »künstlich geformte« Formen des Archivs folgen nicht zeitlich konsequent<br />
aufeinander oder wechseln zeitlich einander ab »wie zwei Stilformen in<br />
der Baukunst oder in der Malerei«; sie sind also nicht in einer historischen Ordnung<br />
auflösbar. Provenienz und Pertinenz »sind vielmehr zwei Möglichkeiten<br />
der Archivordnung, die dem Archivar zu allen Zeiten offenstanden«, so daß man<br />
in Deutschland <strong>für</strong> die zeit vor 1881 nur <strong>von</strong> Ordnungsmethoden, -verfahren<br />
oder -Systemen sprechen sollte . Geologisch-stratigraphische<br />
Begriffe der Schichtung geben die Terminologie <strong>für</strong> Michel Foucaults<br />
Archäologie des Wissens vor; der Archivar aber hat diese Metaphern immer schon<br />
wörtlich genommen. Er sieht im Provenicnzpnnzip »gern eine Art Leitfossil, das<br />
uns ermöglicht, archivische Formationen zu unterscheiden«; doch daneben tritt<br />
ein anderer archivologischer Grundsatz: »Anstelle der Erhaltung der alten Ordnung,<br />
wie das Provenienzprinzip besagt, tritt der Wunsch, eine neue, bessere<br />
Ordnung zu finden und da<strong>für</strong> ein allseits gültiges System aufzustellen« . Mit der amtlichen Durchsetzung des Provenienzprinzips in<br />
Preußen am 1. Juli 1881 gegenüber dem ancien regime der archivischen Aktenordnung<br />
wird das Betriebssystem Staat/Verwaltung, welches die Akten in Gang<br />
setzt (prozessualisiert), identisch mit dem Programm seines Gedächtnisses als<br />
Archiv. Die Gedächtnisadressierung und der Formfmdungsprozeß genetisch<br />
gewachsener Archive aber läuft nicht wie eine programmierte Maschine ab,<br />
»sondern eher wie eine historische Maschine, also wie eine Maschine, die sich<br />
durch den gerade erreichten eigenen Zustand determinieren läßt gerade weil<br />
der Code kein Programm ist und keine Instruktion gibt.« 28 Bleibt nach der<br />
Aktenübernahme in das Archiv der ursprüngliche Registraturaufbau im wesentlichen<br />
erhalten, spricht die Archivkunde <strong>von</strong> Archivkörpern (ausdrücklich identifiziert<br />
mit dem preußischen System); tatsächlich besteht aber ist dieser Körper<br />
28 Niklas Luhmann, Weltkunst, in: ders., Frederick D. Bunsen u. Dirk Baecker, Unbeobachtbare<br />
Welt: über Kunst und Architektur, Bielefeld (Haux) 1990, 7-45 (29)
DEUTSCHT. ARCHIVE ZWISCHEN PERTINENZ UND PROVENIENZ 575<br />
in den seltensten Fällen ein organisch gewachsener, sondern eine anorganisch<br />
verworfene Masse:<br />
»Die älteren Registraturbestände der verschiedenen städtischen Registraturen sind<br />
in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts vielfach in eine sogenannte >Repomerte<br />
Registratur zusammengeworfen und fort nach einem alphabetischen Schlagwortsystem<br />
neu >geordnet< worden. Eines Tages blieb diese Arbeit allenthalben stecken.<br />
Die nicht mehr laufend gebrauchten Akten wurden nun mit den Signaturen, die sie<br />
gerade trugen, >reponiert
576 ARCHIV<br />
Das Archiv empfängt sein Schriftgut <strong>von</strong> Behörden und ist damit an die zwei<br />
Körper des Staates gekoppelt. »Ein Archiv ist ein organisches Ganzes« 32 , und:<br />
»Jedes Archiv hat sozusagen seine eigene Persönlichkeit, Eigenart, die der Archivar<br />
kennen lernen muss, bevor er an die Ordnung desselben gehen kann« ; <strong>von</strong> daher der seit dem 19. Jahrhundert florierende Begriff Archivkörper? 3<br />
Präziser als Maurice Halbwachs' Begriff vom kollektiven Gedächtnis fassen es<br />
die Archivtheoretiker:<br />
»Wenn wir <strong>von</strong> dem Archiv einer Gemeinschaft sprechen, so müssen wir wir also<br />
das Wort Archiv m einer uncigentlichen Bedeutung gebrauchen: ein derartiges<br />
sogenanntes >Archiv< besteht ja gewöhnlich aus verschiedenen Archiven. Auch der<br />
Staat selbst hat ja kein Archiv, und die Benennung Reichsarchiv ist eigentlich<br />
unrichtig: es gibt nur Archive der vcschiedencn Ministerien, der beiden Kammern<br />
der Generalstaaten etc.« <br />
Der archiv-archäologische Einschnitt heißt Napoleon. Die Entstehung des Historismus<br />
liest sich infolgedessen als Relation zum Archiv:<br />
»Seit 1811 oder 1813 ist fast ein Jahrhundert verflossen, und die Dokumente der<br />
Verwaltung haben sich nach und nach in beunruhigender Weise angehäuft. Es<br />
droht die Gefahr, dass bei der immer wachsenden Sorge <strong>für</strong> die aus den früheren<br />
Jahrhunderten stammenden Stücke die Archive des 19. Jahrhunderts vernachlässigt<br />
werden. Will man der Gefahr entgehen, dass hiervor ein Teil aus Raumrücksichten<br />
ohne Sortierung und Unterscheidung vernichtet wird, so muss das<br />
Abschlussjahr <strong>für</strong> das alte Archiv verlegt und zugleich auch <strong>für</strong> die Folge der<br />
Grundsatz festgestellt werden, der die Grenze zwischen altem und neuem Archiv<br />
bestimmen soll.« <br />
Sortierung und Unterscheidung: Die <strong>von</strong> der Systemtheorie als <strong>für</strong> die Differenzierung<br />
<strong>von</strong> Vergangenheit und Gegenwart definierte Beobachtung zweiter<br />
Ordnung ist hier Institution, eine Funktion des Archivs. »<strong>Im</strong> allgemeinen gibt<br />
das Ende des Mittelalters eine gute Grenze an; aber das Mittelalter endigt nicht<br />
<strong>für</strong> alle Behörden zur gleichen Zeit« ; auf der Speicherebene<br />
<strong>von</strong> Vergangenheit herrscht eine Asynchronie zwischen historischem Ereignis<br />
und Verwaltungsgrenzen (Behörden), nicht minder auch eine Differenz zwischen<br />
Erzählung und Institution: In eine Regestenliste seien nur Urkunden und<br />
ihnen gleichgestellte Stücke aufzunehmen; Urkundenbücher ziehen die Grenze<br />
weiter und nehmen alle geschichtlichen Quellen auf, die nicht erzählender Art<br />
sind (Chroniken) . Die Asymmetrie <strong>von</strong> archivischen und<br />
32 S. Muller / J. A. Feith / R. Fruin, Anleitung zum Ordnen und Beschreiben <strong>von</strong> Archiven,<br />
<strong>für</strong> deutsche Archivare bearbeitet v. Hans Kaiser, mit c. Vorwort v. Wilh. Wiegand,<br />
Leipzig (Harrassowitz) / Groningen (van der Kamp) 1905, 4, Kapitelüberschrift<br />
§2<br />
33 Vgl. Ernst H. Kantorowicz, The King's Two Bodies, Princeton 1957
DKUTSCIII- ARCHIVT; ZWISCHEN PI-.RTINHNZ UND PROVKNII-NZ 577<br />
historischen Interessen formuliert sich als Suprematie der Provenienz vor dem<br />
Betreff als Objektonentierung der Datenbank Archiv. Da jede Ordnung des<br />
Materials nach Inhalten Gefahr läuft, daß »die Auswahl der Stichwörter etwas<br />
Künstliches und Subjektives an sich hat«, kann nur die Ordnung nach Provenienz<br />
die völlig erschöpfende Auskunft über ein Forschungsthema sichern, »weil<br />
sie das feine Gewebe der Akten in Kette und Einschlag nicht zerreißt.« 34<br />
Daran anschließend ist Information (als das unerwartete daturn) möglich: Die<br />
entsprechenden Findbücher dokumentieren »aus der anonym bleibenden Fülle<br />
<strong>von</strong> Schriftstücken nur noch unerwartete Erscheinungen durch sog. >lntus-< oder<br />
>Dann-Vermerke
578 ARCHIV<br />
paramilitärischen Logistik entsprecht erfordert auch die Planung der Papiermaschine<br />
Archiv eine regelrechte Strategie.:<br />
»Die Inventarisierung vollziehe sich durch Bewegungen auf dem Papiers wie<br />
man in der Knegswisscnschaft sagt: man beschreibe alle Serien, Bündel, Bücher,<br />
Originalurkunden etc. auf losen Regestenzctteln und nehme die Neuordnung mit<br />
diesen Zetteln vor, bis das neue Inventar erstgestellt und gedruckt ist. Erst dann<br />
reihe man die Stücke selbst in Ueberemstimmung mit dem neu aufgestellten Inventar<br />
ein.« <br />
Die Inschrift des Archivs liegt in seinen Verweisungen. Bei der Beschreibung eines<br />
Archivs ist vor allem zu beachten, daß das Inventar »nur als Wegweiser dienen<br />
soll; es hat also nur eine Uebersicht über den Inhalt des Archvis zu geben, nicht<br />
über den Inhalt der Stücke«. Dieser Wegweiser »darf die Archivbenutzung selbst<br />
nicht überflüssig machen wollen« . So gesehen gibt es<br />
überhaupt keinen Inhalt des Archivs, »genauso wenig wie es den Inhalt des Überschreitens<br />
einer Straße gibt« - Archi(v)trassen. »Dabei ist diese Handlung doch<br />
<strong>für</strong> den ankommenden Autofahrer <strong>von</strong> höchster Brisanz«; erst aus Kontmgenz<br />
und Unfall ergibt sich Information. Der Aktenauswerter findet dort seinen eigenen<br />
Inhalt: »Man darf sich nicht dadurch verwirren lassen, daß Akten auch aus<br />
Buchstaben und Texten bestehen. Sie sind eher zufällig konservierte Handlungen<br />
und haben daher ihren <strong>Namen</strong>« (früher Händel)?^ Nicht die Vergangenheit selbst<br />
ist also Gegenstand der Archivkunde, sondern die Verfügbarkeit über Vergangenheit<br />
als Gedächtnismedienwissenschaft. »Nicht nur in Kellern oder auf Dachspeichern,<br />
sondern auch in aufgeräumten Sammlungen«, also in Museen, Archiven<br />
und Bibliotheken liegt latent, was anderenorts als verschollen gilt. 36 Wissensarchäologische<br />
Grabungen haben es nicht mit Trümmerstätten, sondern mit<br />
Ordnungssystemen zu tun; finden heißt hier ent-decken, das Entriegeln gedächtniskybernetischer<br />
Türen. Nur Bruchstellen sind Fundstellen (Walter Benjamin);<br />
erst das Unerwartete ist Information. Analog zu dieser systemthcoretisch<br />
informierten archivkundlichen These sucht eine juristische Dissertation über<br />
Denkmalschutz <strong>von</strong> 1930 die archäologische Situation zu fassen und fragt, was ein<br />
Fund ist: »Fund ist das unvermutete Stoßen auf eine<br />
Sache. Damit haben wir den Gegensatz zur Ausgrabung gefunden. Ausgraben ist<br />
das Suchen nach einer Sache.« 37 Wissensarchäologische Sondierungen verhalten<br />
Vi Ein Hinweis <strong>von</strong> Angelika Mennc-I Iantz (Bundesarchiv, Berlin)<br />
36 Richard Armbruster, zur Entdeckung eines bislang unbekannten Opernwerks <strong>von</strong><br />
Mozart (1790) in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg durch den amerikanischen<br />
Musikologcn David Buch, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 13. Juni 1997<br />
37 Joseph Krayer, Denkmalschutz. Inaugural-Dissertation, Rechts- und Staatswissenschaftliche<br />
Fakultät der Bayer. Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg<br />
1930,64
DEUTSCHI-: ARCHIVE /WISCHEN PI-.RTINENZ UND PROVENIENZ 579<br />
sich entsprechend; als der junge Friedrich Meinecke seine Dienst im Geheimen<br />
Staatsarchiv Berlin versieht, sind angesichts der Aktenmassen »auch Entdeckungen<br />
in dieser oder jener vernachlässigten Gruppe möglich«:<br />
»So stieg ich , als ich nach Material <strong>für</strong> den Regensburger Reichstag <strong>von</strong> 1667<br />
suchte, noch über die ordnungsgemäß lagernden brandenburgischen Reichstagsakten<br />
auf die Höhe des Repositonums, wo ganz oben unter der Decke noch eine<br />
Reihe schweinsledern gebundener Folianten ohne Signatur stand. Es waren die hier<br />
gar nicht zu vermutenden Reichstagsakten des Administrators <strong>von</strong> Magdeburg.<br />
Keiner der Archivbeamten wußte <strong>von</strong> ihrer Existenz. Friedrich Wilhelm I.<br />
hatte sie einst nach Berlin schaffen lassen, und da waren sie dann eingeschlagen und<br />
vergessen worden.« 38<br />
Archivwissenschaft und Historiographie<br />
Es gibt ein medienspezifisch differenziertes archiv- oder bibhotheksbasiertes<br />
Schreiben. Um 1822 ist die Mediendifferenz noch durchlässig, als Goethe das <strong>von</strong><br />
Friedrich Theodor Kräuter erstellte Rcpertonum über die Goethesche Repositur<br />
ein »bibliothekarisch-archivarisches Verzeichnis« nennt. 39 England weiß um die<br />
funktionale Differenz der Speichermedien; dort »ist es streng verboten, Stücke,<br />
die einmal in Privatbesitz gewesen sind, wieder im Archiv unterzubringen: sie<br />
werden in eine Bibliothek verbannt« . Denn die Authentizität<br />
der staatsunmittelbaren Urkunde ist dann nicht mehr gesichert, sondern diskursiv<br />
(an Öffentlichkeit, daher an Bibliothek) gekoppelt. Die Differenz zum deutschen<br />
Gedächtnis heißt in der Tat England, wo Tradition nicht zu <strong>Geschichte</strong><br />
gebrochen ist, »wo die alten Archive nicht durch eine Revolution <strong>von</strong> der Gegenwart<br />
geschieden und also viel lebendiger gebheben sind als bei uns , wo<br />
wenigstens die den Archivaren anvertrauten Archive tatsächlich tot sind« . Die Entstehung einer regelgeleiteten Archivwissenschaft im 19.<br />
Jahrhundert korrespondiert mit Optionen der Lösung der Archive <strong>von</strong> ihrer Verbindung<br />
zur Verwaltung zugunsten der Geschichtswissenschaft, die ihrerseits<br />
wieder im Entwicklungsgedanken verwurzelt ist, im Individuahtätspnnzip und<br />
in der organischen Staatsidee (Hegel) der Romantik. Der Wechsel ist nicht so der<br />
»<strong>von</strong> der Ordnung zur <strong>Geschichte</strong>«, sondern der <strong>von</strong> einem statuarischen zu<br />
einem organologischen Ordnungsdispositiv, das die Archive ebenso mitteilen wie<br />
38 Friedrich Meinecke, Erlebtes 1862-1901, Leipzig (Koehler & Amelang) 1941, 140<br />
39 Goethes Werke, Weimarer Ausgabe, I (Werke) Bd. 41 II, 28, zitiert nach: Willy Flach,<br />
Goethes literarisches Archiv, in: Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und<br />
Geschichtswissenschaft (zum 65. Geburtstag <strong>von</strong> Heinrich Otto Meisner), hg. Staatliche<br />
Archivverwaltung im Staatssekretariat <strong>für</strong> Innere Angelegenheiten der DDR,<br />
Berlin (Rütten & Loening) 1956, 45-71 (67)
580 ARCHIV<br />
mit generieren. 40 Was Sickel auf die Urkundenlehre angewandt hatte, verband sich<br />
bei den niederländischen Archivaren zum Begriff des Organismus:<br />
»Aber indem sie diese beiden Begriffe, den des Organismus und den der Entwicklung,<br />
nicht im philosophischen Sinne als Analogie, sondern im rein biologischen<br />
Sinne auffaßten und jedes gewachsene Archiv daher als eine unabänderliche<br />
Gegebenheit ansahen, ließen den Archivar nur als einen verlängerten<br />
Registrator gelten, der das Archiv so, wie es ihm <strong>von</strong> der Verwaltung übergeben<br />
war, zu erhalten hatte. Als Verdienst der Niederländer aber bleibt bestehen,<br />
daß sie mit ihrer ausgeprägten Vorstellung vom Archiv als einem Organismus,<br />
endgültig alle bibliothekarischen und musealen Vorstellungen, die in früheren Zeiten<br />
immer wieder in das Archivwesen hineingewirkt hatten, auszuschalten vermochten.«<br />
<br />
Sammlungen bilden Metastasen des Sammlerkörpers, (s)einen Zweitkörper,<br />
doch »Bibliotheken wie Museen, mögen sie auch zuweilen vom Willen des Stifters<br />
oder Sammlers bestimmte, ausgeprägt individuelle Züge aufweisen, können<br />
niemals als Organismen aufgefaßt werden« ; in einem Zug spricht<br />
Leesch dann Bibhothekslchre und Museumskunde den Anspruch ab, Wissenschaften<br />
stnctu sensu zu sein. Der ordnende Archivar orientiert sich nicht am<br />
Diskurs, sondern hinsichtlich einer internen Logistik und<br />
»darf sich nicht zum Ziel setzen, die Bestände in irgendeiner beliebigen, <strong>für</strong> zweckmäßig<br />
erachteten Weise zu verzeichnen und zu lagern, wie es der ordnende Bibliothekar<br />
kann, dessen Zweckmäßigkeitserwägungen es überlassen bleibt, ob er seine<br />
Bestände alphabetisch, systematisch oder zugangsmäßig aufstellt und nach welchem<br />
System.er sie verzeichnet. Ordnung und Kassation müssen vielmehr in stetem Blick<br />
auf das Ganze, auf die Struktur des Archivs, durchgeführt werden, niemals darf das<br />
einzelne Schriftstück, wie wenn es sich um eine bloße Schriftgutsammlung handele,<br />
in seiner Bedeutung isoliert betrachtet werden.« <br />
Dabei dient die Ordnung des Inventars nicht notwendig als Spiegel oder Zeiger,<br />
als Wegweiser durch die Aktenmagazme; die vom Provenienzprinzip<br />
gesteuerte Architektur der Gedächtnisadressierung divergiert vom gebauten<br />
Speicher: »Auch bei weiträumigen Magazinen ist die geordnete Lagerung der<br />
Bestände kaum je vom behördlichen Organismus her, sondern meist durch die<br />
äußere Raumbedingtheit bestimmt« .<br />
Die Kopplung <strong>von</strong> Archiv und Historie ist ihrerseits eine Funktion wissensarchäologischer<br />
Rupturen. War seit Ahasver Fritschs Tractatus de jure archivi<br />
et cancellanae (Jena 1664) eine »nicht geschichtlich, sondern juristisch ausge-<br />
1 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften,<br />
9. Aufl. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1990, 272 ( :: Les mots et les choses, Paris 1966).<br />
Siehe Cornelia Vismann, Diss. Akten, IV. 2. b: Aktenführung und Subjcktwcrdung,<br />
Typosknpt, 37
DKUTSCHK ARC.I IIVI: ZWISCHEN PKRTINKNZ UND PROVKNU-.NZ 581<br />
richtete« (mithin also diskursiv vektorisierte) Achivwissenschaft erkennbar,<br />
haben auf dem Festland »die Umwälzungen im Gefolge der Französischen<br />
Revolution das Band zwischen Archiv und Verwaltung« zerrissen. Aus dem<br />
juristischen wird der historische Prozeßbegriff; in jedem Fall tragen die Dokumente<br />
ihre Aussage nicht in sich (sonst wären sie Monumente), sondern sie sind<br />
ihnen durch den Speicher zugeschrieben. Der Theorie des passiven Archivrechts<br />
zufolge »beruht die prozessuale Beweiskraft der Dokumente (die ja damals dieselbe<br />
Bedeutung hatte wie heute der historische Aussagewert der Archivalien)<br />
nicht auf dem Eigenwert des einzelnen Dokuments an sich« - also monumentahstisch,<br />
dem Grundsatz der freien Beweisführung entsprechend -, »sondern<br />
auf der Zugehörigkeit zu einem Archiv« . <strong>Im</strong>perium bedeutet<br />
Reich(s)weitc <strong>von</strong> Befehlsgewalt. 41 Und so müssen Archivalien in mtaken<br />
Reichen nicht so sehr Anfang und Ende haben, also Teil einer <strong>Geschichte</strong> sein<br />
können, sondern sich auf Territorium beziehen. Zedler fragt, »ob dergleichen<br />
aus denen Archiven genommene Documenta auch ausser dem Territorio probircn?<br />
Es probiren ja Zeugen extra Territorium, warum nicht auch die<br />
Documenta, da doch beyclc sonst aequipanrct werden?« 1 - Erst mit Hilte des<br />
prozessualen Gegenbeweises, daß es sich bei einem infragestehenden Dokument<br />
nicht um ein <strong>von</strong> Rechts wegen dem betreffeden Archiv zugehöriges, sondern<br />
nur durch Zufall dorthin gelangtes, also »nicht um ein Glied des betreffenden<br />
Archivorganismus, sondern um einen Irrläufer« {membra disiecta des Archivkörpers)<br />
handelt, ist es fortan möglich, dem Dokument die Eigenschaften des<br />
passiven Archivrechts streitig zu machen. In England gehört »zum Wesensmerkmal<br />
eines vollgültigen Archivales der lückenlose Nachweis seiner<br />
Aufbewahrung unter verantwortlicher amtlicher Aufsicht« .<br />
Archiv- und Geschichtswissenschaft konvergieren »durch die gleichartige<br />
Anwendung der formgebenen Kategorien auf den vorliegenden Stoff«, wenn<br />
das gemeinsame Dispositiv Staat heißt:<br />
»Der Historiker ordnet die chaotische Masse der Tatsachen, die er aus dem vorliegenden<br />
Quellenstoff erschlossen hat, in ein System <strong>von</strong> Wertbeziehungen, wobei<br />
er den historischen Wert <strong>von</strong> dem System als Ganzem her gewinnt, oder, schlichter<br />
gesprochen, er formt das Geschehen zur <strong>Geschichte</strong>, indem er aus der Fülle der<br />
Tatachen die historisch bedeutsamen, weil weiterwirkenden Tatsachen auswählt<br />
und in Beziehung zueinander und zu einem umfassenderen Kultursystem setzt;<br />
der Archivar formt die chaotische Masse <strong>von</strong> Schriftstücken unter Anwendung<br />
des Wertgesichtspunktes (Kassation) zum Archiv, indem er sie in Beziehung<br />
zueinander und zu der <strong>von</strong> ihm ermittelten Struktur des Archivs als Ganzem<br />
setzt.« <br />
41 Dazu Purccll, in: Journal of Roman Studics Jg. 80 (1990), 178-82<br />
42 Zcdlcr 1732: Spalte 1243
582 ARCHIV<br />
Wenn Archiv und Historie homologe Leistungen sind 43 , ist das Archiv nicht<br />
länger die Grundlage der Historie, sondern ihre Parataxe. Anfang des 19. Jahrhunderts<br />
ist die Segregation der Archive die Voraussetzung <strong>für</strong> die <strong>Im</strong>plementierbarkeit<br />
des historischen Diskurses, ein Abspaltungsprozeß, indem sie sich<br />
ihres Charakters als behördeneigener Einrichtung entäußern, sich <strong>von</strong> der Verwaltung<br />
loslösen und zu einer separaten Archivverwaltung als einem neuen<br />
staatlichen Verwaltungszweig zusammenwachsen. Hundertfünfzig Jahre später<br />
verlagert sich diese Autopoiesis zurück auf die Verwaltung selbst, indem sich<br />
»auch die Aktenschicht der Altablagen« buchstäblich wissensarchäologisch <strong>von</strong><br />
den Behörden trennt; »neben den Archivar der herkömmlichen Art tritt der<br />
>records managen als ein Archivar neuen Typus« 44 , und aus Verwaltung wird<br />
Workflow managemcnt, das die archivischen Funktionen in den Akt der Signalzwischenspeicherung<br />
überführt. Dieses Archiv zweiten Grades steht nicht<br />
mehr in einem nachträglichen, sondern nahezu echtzeitlichen Verhältnis zur<br />
laufenden Administration <strong>von</strong> Gegenwart. Ein Schaltkreis aber, der nicht mehr<br />
über Fremdreferenz verfügt (das archivischc Gedächtnis als Horizont der<br />
Nichtbeliebigkeit, als externe Restriktivität, »damit aus unendlichen Informationslasten<br />
endliche Lasten werden«), verfällt der Rekursion des Selbstbezugs. 45<br />
43 Zum Übergang vom juridischen zum historischen Dispositiv des Archivs, manifestiert<br />
in der epistemologischen Umordnung vom »Materien-Register« hin zur »chronologischen,<br />
d. i. historischen Ordnung« (eine Verwechslung <strong>von</strong> Bedingung und Effekt)<br />
durch den Hofrath Abbe Schmid 1780 am Beispiel des k. k. geh. Haus-, Hof- und<br />
Staats-Archivs (gegr. 1749 unter Kaiserin M. Theresia, aber letztlich auf Kaiser Maximilian<br />
I. zurückgehend - editorischer Endpunkt der MGH und Anfang des Archivs)<br />
siehe den Artikel »Archiv« in: Österreichisches Volksbuch. National-Encyclopädie, 2.<br />
Aufl., Heft 1, Wien 1850, 154-160 (154 u. 158)<br />
44 Rudolf Schatz, in: Archivalische Zeitschrift 62 (1966), 86<br />
45 Peter Fuchs, Moderne Kommunikation: zur Theorie des operativen Displacements,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1993, 215f., unter Bezug auf: Niklas Luhmann, Ökologische<br />
Kommunikation, Opladen 1986, 269, und K. Knppendorff, Paradox and Information,<br />
in: B. Dervin / M. Voigt (Hg.), Progress in Communication Sciences, Bd. 5,<br />
Norwood, N. J. 1984, 45-71
STAAT MACHHN: PRI-.UIJKN IN UI-N ARCHIVEN 583<br />
Staat machen: Preußen in den Archiven<br />
»Die Behördeneinheit, die wir >Regierung< nennen, ist nur der Rahmen <strong>für</strong><br />
einen unaufhörlich sich umgestaltenden Inhalt« 1 - mithin ein medialer Kanal<br />
des Staates. Die moderne Vergötzung staatlicher Mechanismen 2 und die <strong>von</strong><br />
Max Weber konstatierte Maschinenartigkeit einer effizienten Bürokratie' ist die<br />
machtkybernetische Transformation dessen, was als spätmittelalterhche politische<br />
Theologie der zwei Körper des Königs begann, derzufolge das Amt des<br />
Herrschers (im Unterschied zur Physik seiner Person) unsterblich ist. An diesen<br />
Mechanismus des Staatsapparats sind reale Maschinen anschließbar; »das<br />
Schreiben mit der Maschine verdrängt in den Behördenkanzleien das Schreiben<br />
mit der Hand ; damit dringt m das Aktenwesen an einer entscheidenden<br />
Stelle das mechanische Prinzip cm«, das Standardisierung (Formularwesen) und<br />
den Verlust urkundlicher Einmaligkeit (Vervielfältigung <strong>von</strong> Schriftstücken)<br />
erzwingt . Die Mechanisierung dringt bis auf die Ebene der<br />
Buchstaben durch, wie die Verteidiger der typographischen »deutschen«<br />
Antiqua gegenüber der Schreibmaschine reklamieren. 4 Das Maschmale schreibt<br />
sich auch im Verständnis vom Staatsgedächtnis weiter: »Die Rechtsansprüche,<br />
die ein Staat vertreten, die Machtfrage, die ihn berührt, die kulturelle Sendung,<br />
die er erfüllt hat, treten uns bei der Durchforschung seiner Archive wieder entgegen,<br />
sie sind den Archiven gewissermaßen immanent. Der Staat selbst, darf<br />
man sagen, lebt in ihnen fort.« 3 So sucht sich der Staat »nicht allein durch physische<br />
Macht, sondern auch durch die Darlegung seiner Rcchtstitel zu<br />
beschützen«, ein »Arsenal, das alle Hilfsmittel zum historischen Kriege schnell<br />
und vollständig liefern könne« (»die Kronrecht in Evidenz zu halten« - enargeia<br />
des Archivs), womit die Funktion <strong>von</strong> Archiven zunächst nicht das histo-<br />
' Wilhelm Rohr, Das Aktenwesen der Preußischen Regierungen, in: Archivalische Zeitschrift<br />
Jg. 1939,52-63 (52)<br />
2<br />
Ernst FI. Kantorowicz, Christus-Fiscus, in: Synopsis Festgabe <strong>für</strong> Alfred Weber, Heidelber<br />
1948, 223-235; Wiederabdruck in: ders., Götter in Uniform. Studien zur Entwicklung<br />
des abendländischen Königtums, hg. v. Eckhart Grünewald / Ulrich Raulff,<br />
Stuttgart (Klett-Cotta) 1998, 297-305 (302)<br />
3<br />
Dazu Alfred Kieser (Hg.), Organisationstheorien, Stuttgart / Berlin / Köln (Kohlhammer)<br />
1993,48<br />
4<br />
Peter Rück erinnert an Carl Ernst Poeschels Aufruf vom April 1933 »Gegen Mechanisierung<br />
- <strong>für</strong> Persönlichkeit«, in: ders., Die Sprache der Schrift. Zur <strong>Geschichte</strong> des<br />
Frakturverbots <strong>von</strong> 1941, in: Homo scribens, Tübingen 1993, 231-272 (250; s. a. 252,<br />
zur Entwicklung einer klecksfreien Frakturtype <strong>für</strong> die Schreibmaschine)<br />
5<br />
L. Bittner, Die zwischenstaatlichen Verhandlungen über das Schicksal der österreichischen<br />
Archive nach dem Zusammenbruch Österreichs-Ungarns, in: Archiv <strong>für</strong><br />
Politik und <strong>Geschichte</strong> 3 (1925) 4, Teil 1, 58-96
584 ARCHIV<br />
rische, sondern das juridische Gedächtnis ist/' Das gilt zumal <strong>für</strong> die Archive<br />
Preußens, worin die Vorgänge des Staates mit ihrem Aufzeichnungssystem<br />
aktenkybcrnetisch zusammenfallen; hier gibt es kein Nacheinander <strong>von</strong> System<br />
und Gedächtnis, sondern deren unmittelbaren Anschluß (eine Herausforderung<br />
an die historiographische Beobachterdifferenz). 7 Waren auch die kollegialen<br />
Verfahren der Entscheidungsfindung mündlich, lag die infrastrukturelle<br />
Anschlußfähigkeit solcher Aussagen in ihrer finalen schriftlichen Fixierung;<br />
allem Logozentrismus gegenüber ist das Archiv vorgängig. 8 Der Stil der Aktenführung<br />
ändert sich mit Einbruch der neuen Medien der Datenverzeichnung<br />
im 20. Jahrhundert: »Die Notizen über geführte Gespräche werden nur ausnahmsweise<br />
gemacht und schon gar nicht mehr, seitdem das Telefon viele<br />
Schreiben zur Mitteilung unnötig macht. Auch die Sorgfalt der Verweise hat<br />
nachgelassen.« 9 Auch das Reichsarchiv in Potsdam kann seine Aufgabe, die<br />
<strong>Geschichte</strong> des Weltkriegs zu schreiben, nicht auf Aktenstudium beschränken;<br />
»es bedarf ihrer Ergänzung durch private Quellen aus allen Kreisen der Kriegsteilnehmer«,<br />
mithin oral bistory. 10 Nachdem zur Jahreswende 1919/20 <strong>von</strong><br />
Seiten der Reichsregierung beschlossen wird, der Sammlung der Deutschen<br />
Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 (sog. Kautsky-Akten) eine Sammlung<br />
<strong>von</strong> Akten zur entfernten Vorgeschichte des Weltkriegs seit 1870 folgen zu lassen,<br />
äußert sich ein Diplomat im Herbst 1921: »Wie vieles steht nicht in den<br />
Akten! Wie vieles ist nur mündlich verhandelt! Ohne begleitende Memoiren,<br />
Briefwechsel, persönliche Zeugnisse Mithandelnder und Mitlebender bleiben<br />
sie auch <strong>für</strong> den Historiker nur ein Material ohne wahres Leben«, mithin<br />
kein Archivkörper, sondern »ein Skelett, an dem man vielleicht die Körperlänge<br />
'' Siehe auch Michel Foucault, Vom Licht des Krieges zur Geburt der <strong>Geschichte</strong>, hg. v.<br />
Walter Seitter, Berlin (Merve) 1986. Zur rhetorischen Figur der enargeia siehe Carlo<br />
Ginzburg, Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der <strong>Geschichte</strong>, in: Fernand<br />
Braudel u. a., Der Historiker als Menschenfresser. Über den Beruf des Geschichtsschreibers,<br />
Berlin (Wagenbach) 1990, 85-102<br />
7 In diesem Sinne paraphrasiert Hans-Joachim Neubauer den Beitrag der Flistorikerin<br />
Irina Scherbakowa (Moskau) über den archivischen Zugang zur Stalin-Epoche (Tagung<br />
Die Enden <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>n und die <strong>Geschichte</strong> des Endens, Society for Intellectual<br />
History, Berlin Juni 1998), in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 24. Juni 1998, N5<br />
8 Dazu, unter nachnchtentheoretischer Betonung der Differenz zwischen mündlicher<br />
Entscheidung und schriftlicher Mitteilung: Angelika Menne-Haritz, Die Archivwissenschaft,<br />
die Diplomatik und die elektronischen Verwaltungsaufzcichnungcn (Johannes<br />
Papritz zum 100. Geburtstag), demnächst in: Archiv <strong>für</strong> Diplomatik (1998)<br />
9 Johannes Papritz, Archivwissenschaft, 2. durchges. Ausgabe Marburg (Archivschule)<br />
1983, Bd. 2, Teil 11,2: Organisationsformen des Schriftgutes in Kanzlei und Registratur,<br />
zweiter Teil, 336 (»d. Innere Entartung des Sachakten-Stils«)<br />
10 Ernst Müsebeck, Die nationalen Kulturaufgaben des Reichsarchivs, in: Archiv <strong>für</strong><br />
Politik und <strong>Geschichte</strong> 2, Heft 10 (1924), 393-408 (399)
STAAT MACIIKN: PRKUINKN IN DI:N ARCHIVEN 585<br />
des Toten messen kann, nicht sein Denken und Fühlen«; archivisches Gedächtnis<br />
ist (auf)zähl-, nicht erzählbar. 11 Thimme weiß um die Unzuverlässgkeit,<br />
Arbitrantät und Isoliertheit <strong>von</strong> Dokumenten; im Sinne der signal-to-tioiseratio<br />
der Nachrichten(übertragungs)theone ahnte auch der britische Historiker<br />
Lord Acton das Prinzip der Stillen Post(bistoire) in einer Äußerung des Begründers<br />
der stochastischen Wahrscheinlichkeitsrechnung Laplace: »When a report<br />
passes from one person to another the probability of error increases every time,<br />
until finally one reaches the stage at which it is greater than the probability of<br />
truth«. 12 Dem Torso respektive Fragment der Einzelakte(n) hält Thimme jedoch<br />
das Gegengewicht der dem gleichen Gegenstand gewidmeten Schriftstücke entgegen.<br />
Eben darum hat er sich bei der entsprechenden Aktenpubhkation des<br />
Auswärtigen Amts da<strong>für</strong> eingesetzt, »daß wir nicht etwa die Illustrationsmethode<br />
wählen dürfen, die nur die allerwichtigsten und interessantesten Stücke<br />
herausgreift, sondern möglichst vollständige und geschlossene Aktengruppen<br />
zusammenzustellen« - vom historischen Dokument<br />
also zur modularen Aktengruppierung als Aussagensockel (Monument).<br />
Archive ermöglichen der Staatsverwaltung (und Historie) - systemtheoretisch<br />
formuliert - Selbstbeobachtung 13 ; es läßt »die politischen, gesellschaftlichen<br />
und sittliche Elemente der Vergangenheit in dem treuesten Spiegel uns<br />
schauen« - ein diskursiver Anschluß an die philosophische<br />
Metapher des Bewußtseins. 14 »Die Archive das Gedächtnis des<br />
Staates« (Novalis) 15 ; Spiegel der <strong>Geschichte</strong> ist archivische Information genau<br />
dann, wenn Staatsverwaltung sich mit der Dvnamrs <strong>von</strong> Historie selbst identifiziert.<br />
»Die Eigentümlichkeit des preußischen Erbes, zerstört Lind aufgesplittert<br />
zu sein, aber noch tief in unsere Gegenwart hineinzureichen, kennzeichnet<br />
11<br />
Hier anonym zitiert nach: Friedrich Thimme, Die Aktenpubhkationen des Auswärtigen<br />
Amtes und ihre Gegner, in: Archiv <strong>für</strong> Politik und <strong>Geschichte</strong>, 2. fg. Heft 4/5<br />
(1924), 467-478 (475)<br />
12<br />
Herbert Butterfield, Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship,<br />
Cambridge (University Press) 1955, 75, unter Bezug auf Notizen im Acton-<br />
Nachlaß (Add. 4929,52)<br />
13<br />
Dazu Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1995,<br />
Kapitel 2 »Die Beobachtung erster und die Beobachtung zweiter Ordnung«, 92-164.<br />
Hier liegt die Differenz des Archivs zu Museen und Bibliotheken, deren Funktion als<br />
systeminterner Kontext es ist, das Neue als Neues sich profilieren lassen zu können<br />
(ebd., 490).<br />
14<br />
Siehe Richard Rorty, ist der Begriff der Repräsentation obsolet?, in: Zeitschrift <strong>für</strong> philosophische<br />
Forschung 51, Fleh 3 (1997)<br />
13<br />
Aus seiner Idecnsammlung Blütbenstaub zitiert <strong>von</strong> Bert Lemmich, Das Prinzip<br />
Archiv, in: Info 7. Information und Dokumentation in Archiven, Mcdiotheken, Datenbanken,<br />
Heft 1 (Juli) 2000, 15. Jg., 4-16 (12)
586 ARCHIV<br />
auch den Gang durch die verbliebenen Archive.« 16 Dies liegt im Wesen des<br />
Staates im Unterschied zur Nation. Staatliche Archive »stellen eine der Verköperungsformen<br />
der Staatsidee« dar, »vielleicht das vollständigste und geschlossenste<br />
Abbild des staatlichen Lebens«. 17 Keine Informationstechnik aber<br />
bildet Realität ab, auch die archivischc nicht: »Die aus ihren Speichern ableitbare<br />
>Realität< ist immer nur die Realität desjenigen, der die Abbildung durchgeführt<br />
hat, eine Wirklichkeit, die lediglich seinem internen Umweltmodell<br />
entspricht.« 18 1830 aber insistiert der archivkundige Baron <strong>von</strong> Medcm auf der<br />
durch Archive gesetzten Möglichkeit der Beobachterdifferenz: Gegen die<br />
Behauptung, daß Archive schlicht die unmittelbare Fortsetzung der Registraturen<br />
(als Realität in actu) sind, setzt er die Einsicht, »daß, sobald in einer Registratur<br />
etwas antiquiert ist, dies hierdurch nicht mehr der Gegenwart angehört,<br />
und folglich als den Archiven heimgefallen betrachtet werden muß«. 19<br />
Staatsgeheimnisse: Archiv und Historie, Verwaltung, Bürokratie<br />
»Wer sich mit der Administration befaßt, ohne regierender Herr zu sein, der<br />
muß entweder ein Philister oder ein Schelm oder ein Narr sein«, schreibt<br />
Goethe an Frau Charlotte <strong>von</strong> Stein am 9./10. Juli 1776. 20 Wer Archive <strong>für</strong><br />
historische Zwecke ausbeutet, verkennt ihr Wesen; wenige Archivbeamte des<br />
Geheimen Staatsarchivs haben vor Cosmar die <strong>von</strong> ihnen verwahrten Urkunden<br />
und Akten <strong>für</strong> eigene Forschungen benutzen wollen oder können, da ihre<br />
Auswertungstätigkeit sich auf die Abfassung <strong>von</strong> Rechtsgutachten zur Sicherung<br />
dynastischer Interessen oder auf Arbeiten »<strong>für</strong> die laufende Verwaltungstätigkeit«<br />
beschränkte - nicht historisches Gedächtnis, sondern Arbeitsspeicher.<br />
Zwar hatte die Französische Revolution <strong>von</strong> 1789 der Öffnung der Archive <strong>für</strong><br />
die Geschichtswissenschaft den Weg bereitet, »doch währte es in anderen<br />
europäischen Staaten noch drei Jahrzehnte, ehe diese >arcana impenorums oder,<br />
16 Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht,<br />
Verwaltung und soziale Bewegung <strong>von</strong> 1791 bis 1848, 2. berichtigte Auflage<br />
Stuttgart (Klctt) 1975, Vorwort zur ersten Auflage (1966)<br />
17 Ludwig Bittner, Das Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit, in:<br />
Archivalische Zeitschrift 35 (1925), 154-200, Einleitungssatz<br />
18 Jürgen Ostermann, Datenschutz, in: Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph<br />
<strong>von</strong> Unruh (Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 5, Stuttgart (Deutsche<br />
Verlags-Anstalt) 1987, Kapitel XXI »Datenschutz«, 1115<br />
|y Friedrich Ludwig Baron <strong>von</strong> Medem, Über die Stellung und Bedeutung der Archive<br />
im Staate, in: Jahrbücher der <strong>Geschichte</strong> und Staatskunst, hg. v. Karl LIcinnch Ludiwg<br />
Pölitz, Bd. II, Leipzig 1830, 28-49 (30)<br />
20 Schlußzitat der Einleitung <strong>von</strong> Koselleck 1975: 19
STAAT MACIIKN: PRI-UI>I-:N IN DI:N ARCHIVEN 587<br />
um mit Raumer zu sprechen, >Schutzwehren< und >Heihgtümer< der Forschung<br />
zugänglich machten« 21 - sacred Space & Urne. Was Preußen angeht, so hat Hardenberg<br />
durch eine Zirkularverfügung <strong>für</strong> die Benutzung <strong>von</strong> Provmzialarchiven<br />
das »Grenzjahr« 1500 festgelegt - exakt die obere Bemessungsgrenze <strong>für</strong><br />
Quellenpublikationen der Monumcnta Germaniae Historica. So klar trennt<br />
Macht zwischen Aktualität und Historie: »Das danach entstandene Archivgut<br />
wurde immer noch juristisch interpretiert und als >currentes'/ semicurrentes<<br />
Registraturgut betrachtet« - mithin als Extension und Arbeitsspeicher der<br />
administrativen Gegenwart, nicht als historisches Gedächtnis. 22 <strong>Im</strong> Zeitalter<br />
<strong>von</strong> Historismus und Nationalstaat wird das Archiv zur Bastion des Staatsgedächtnisses;<br />
allmählich tritt seine kameralistische Tätigkeit zurück und ist am<br />
Ende, wie im Fall des Geheimen Staatsarchivs (Preußischer Kulturbesitz) in<br />
Berlin, ein Forschungsinstitut <strong>für</strong> preußische <strong>Geschichte</strong>, die dort nicht als<br />
Abbild, sondern als Struktur, also wissensarchäologisch vorliegt. Denn zunächst<br />
sind die preußischen Staatsarchive Agenturen der preußischen Verwaltung als<br />
eigenständigem, <strong>von</strong> einer Umwelt abgegrenztes System faktischen Handelns,<br />
das im Wege der Verarbeitung <strong>von</strong> Informationen bindende Entscheidungen<br />
herauszustellen und auf diese Weise die in der Umwelt anzutreffende Komplexität<br />
zu verringern hat. 23 Der Direktor der preußischen Staatsarchive Reinhold<br />
Koser sieht konsequent die wichtigste Voraussetzung, also arebe <strong>für</strong> Archivarbeiter<br />
(hier Archivare und Historiker) in der Kenntmß der <strong>Geschichte</strong> der<br />
preußischen Behördenorganisation, die ihrerseits funktional ahistorisch operiert.<br />
24 »Die Verwaltung ist nicht als <strong>Geschichte</strong> angelegt; sie hat es auch<br />
auf keine <strong>Geschichte</strong> angelegt. Auch was auf die Zukunft hm gezielt ist, ist<br />
aus dem Augenblick geschaffen.« 25 Der Referent <strong>Geschichte</strong> ist eine Ablenkung<br />
der Aufmerksamkeit <strong>von</strong> der strukturellen Analogie zwischen Gedächtms-<br />
21 Meta Kuhnkc, Biographie Carl Wilhelm Cosmars, in: Carl Wilhelm Cosmar,<br />
<strong>Geschichte</strong> des Königlich-Preußischen Geheimen Staats- und kabmeuarchivs, hg. v.<br />
Meta Kuhnke, Köln / Weimar / Wien (Böhlau) 1993, 13<br />
22 Botho Brachmann, Archivwissenschaft. Theoneangebote und Möglichkeiten, in:<br />
Archivistica docet: Beiträge zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären<br />
Umfelds, hg. v. Friedrich Beck, Potsdam (Verl. f. Berlin-Brandenburg) 1999, 21-76 (55)<br />
23 Peter Badura, Die Verwaltung als soziales System. Bemerkungen zu einer Theorie der<br />
Verwaltungswisscnschaft <strong>von</strong> Niklas Luhmann, in: Die Öffentliche Verwaltung 23,<br />
Heft 1/2 (Januar 1970), 18-22<br />
24 Denkschrift R. Koser an den Kultusminister vom 31. Januar 1902, GStA Dahlem I.<br />
HARep. 76 Va Sekt. 12 Tit. 10 Nr. 45, Bl. 103r-l 11 r, hier zitiert nach: Johannes Burkardt,<br />
Die Historischen Hilfswissenschaften in Marburg (17.-19. Jahrhundert), Marburg/Lahn<br />
(Institut <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften) 1997, 147<br />
2:1 H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutsch-<br />
land, Tübingen 1974,968
588 ARCHIV<br />
Infrastruktur und aktueller Administration. Max Weber zufolge ist Rationalisierung<br />
ein Effekt der Kombination aus römischem Recht, dem Typus der Stadt,<br />
der neuzeitlichen Form <strong>von</strong> Wissenschaft und der spezifischen Akkumulationsprozesse<br />
des Kapitals mit dem Protestantismus als Ethik der Arbeit. »Aus<br />
dem puritanischen Arbeitsethos >ließ das Verhängnis ein stahlhartes Gehäuse<br />
werden.
STAAT MACIU-.N: Pi
590 ARCHIV<br />
neu erworbenen Territorien Massen <strong>von</strong> Dokumenten aus den säkularisierten<br />
und verfallenen kirchlichen Stiftungen und aus den Registraturen der untergegangenen<br />
Landesherrschaften hinterläßt - Papiere, die darum entweder gar<br />
keine oder nur eine entfernte Beziehung zu den praktischen Aufgaben der<br />
Gegenwart haben. »Gleichwohl waren dieselben großentheils wichtige Denkmäler<br />
der <strong>Geschichte</strong>, die einer angemessenen Aufbewahrung und Pflege wohl<br />
würdig erscheinen mochten.« 34 Kriege verhalten sich katechontisch gegenüber<br />
dem Gedächtnis; in Preußen ist durch die napoleonischen Kämpfe mit der Verwaltungsreform<br />
auch die Neuordnung des Archivwesens zunächst zurückgedrängt<br />
worden. Nach Wiederherstellung des Friedens wird sie »um so<br />
dringender, als der Staat durch die Verträge <strong>von</strong> 1815 mit seine neuen Gebietsteilen<br />
einen sehr reichen Schatz an einzelnen Archiven, der aber zugleich als eine<br />
rudis indigestaque moles sich auftürmte, erworben hatte« -<br />
ganz wie die Leichenberge der Leipziger Oktoberschlacht 1813. 35 Damit korrespondiert,<br />
kompensierend, der Anschluß der Archivare an den historischen<br />
Diskurs; Gollmert wünscht sich, daß bei den Archivaren, auch über den sich<br />
erweiternden Kreis ihrer Amtspflichten hinaus, »mehr und mehr die Begabung<br />
und die Neigung sich entwickele, sich gewissermaßen als Historiographen ihrer<br />
Provinz zu betrachten« . Friedrich der Große äußert demgegenüber<br />
mit Blick auf die historisch-diplomatischen Arbeiten Jean Mabillons<br />
in der ersten Fassung (1742) seiner Vorrede zur <strong>Geschichte</strong> meiner Zeit, »daß es<br />
nicht irgendeinem Pedanten, der im Jahre 1840 zur Welt kommen wird, noch<br />
einem Benediktiner aus der Kongregatio <strong>von</strong> St. Maur zusteht, über Verhandlungen<br />
zu reden, die in den Kabinetten der Fürsten stattgefunden, noch die<br />
gewaltigen Szenen darzustellen, die sich auf dem europäischen Theater abgespielt<br />
haben.« 36 In Preußen dominiert seinerzeit die Auffassung <strong>von</strong> den Archiven<br />
als den arcana imperii; nach der Auflösung der Geheimen Kanzlei ist das<br />
(im Moment seiner derartigen Bezeichnung durch Haugwitz am 27. April 1803<br />
gerade nicht mehr) Geheime Staatsarchiv <strong>von</strong> der unmittelbaren Verknüpfung<br />
mit einer Zentralbehörde befreit - eine Veschiebungen in der Staatskybernetik<br />
<strong>von</strong> Datenproduktion, -Übertragung und -speicherung. <strong>Im</strong> April 1803 wird das<br />
34 Geh. Archiv-Sccrctär am Königl. Geh. Staats-Archiv Dr. L. Gollmert, Die Preußischen<br />
Staats-Archive, in: Archiv <strong>für</strong> Landeskunde der Preußischen Monarchie, 4. Bd.,<br />
4. Quartal 1857, Berlin (Verlag der Expedition), I 13-163 (128)<br />
3D Siehe W. E., Präsenz der Toten und symbolisches Gedenken: Das Völkerschlachtdenkmal<br />
zwischen Monument und Epitaph, in: Katrin Keller / Hans-Dieter Schinid<br />
(Hg.), Vom Kult zur Kulisse. Das Völkcrschlachtdenkmal als Gegenstand der<br />
Geschichtskultur, Leipzig (Universitätsverlag) 1995, 62-77<br />
36 Zitiert nach: Frank M. Bischoff / Axel Koppetsch, Die archivischen Menschenrechte,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 7. Juli 1994
STAAT MACI-IKN: PRHUISKN IN DI.N ARCHIYT.N 591<br />
Archiv zur unmittelbaren Registratur des Ministeriums der auswärtige Angelegenheiten<br />
erhoben, bildet also dessen Gedächtnis in Echtzeit mit aus. 1809<br />
dann wird diesem Amt eine eigene Registratur geschaffen, womit das Geheime<br />
Staatsarchiv endgültig seinen Charakter als Registratur <strong>von</strong> Staatsbehörden verliert<br />
und sich der Akzent im epistemischen Widerstreit verschiebt, den der britische<br />
Historiker Lord Acton als »the enemimty between the truth of history<br />
and the reason of State, between sincere quest and official secrecy« beschreibt 37 .<br />
Entheimlichung <strong>von</strong> Akten heißt Übergabe <strong>von</strong> Geheimnis an Sekretäre. Nach<br />
den Stem-Hardenbergschen Verwaltungsreformen wird das Geheime Staatsarchiv<br />
zum Gesamtarchiv <strong>für</strong> die Zentralbehörden des Staats und der Staatsbehörden<br />
der Provinz Brandenburg. Für die Einordnung oder Angliederung<br />
der massenhaft zuströmenden Akten der verschiedenen Behörden wird eine<br />
Lösung im Provenienzpnnzip gefunden, demzufolge die Gliederung der<br />
Bestände sich daraus ergibt, wie die einzelne Stücke im Geschäftsgang der Verwaltung<br />
zu den Akten gekommen sind. 38 Das ist die wissensarchäologische<br />
Bedingung, die archivische Begründung der Denkbarkeit solcher Daten als<br />
historischer Dokumente. Ist diese Ordnung, diese Datenklassifikation als Algorithmus<br />
zu schreiben? Ist der Computer in der Lage, auf der Grundlage gegebener<br />
Signaturreihen eines Archivs das entsprechende Ordnungssystem zu<br />
rechnen, d. h. als Wissensarchäologe tätig zu werden, jenseits der Datenmerkkapazität<br />
des Historikers?<br />
Archivgenealogien entstehen nicht als Bedürfnis nach Historie, sondern als<br />
Funktion der Notwendigkeit, Umschichtungen der Archivordnung (Repositonen,<br />
Signaturen) nachvollziehbar, also noch verfügbar zu machen. Nicht als<br />
Kontinuität ist das Archiv begreifbar, sondern als Archiv des Archivs, als<br />
Subjekt und Objekt einer wissensarchäologischen Studie: Die im Geheimen<br />
Staatsarchiv, Rep. 74. II. 17, Nr. 10. Vol. 1, aufgespeicherten Aktenstücke »unterrichten<br />
uns über die Anfänge der Gesamtverwaltung der preussischen Staatsarchive.«<br />
39 Die Ursprünge des modernen preußischen Archivwesens deuten auf<br />
die Nähe <strong>von</strong> Verwaltungsakt und Archivordnung als beiderseitige Synchronisation,<br />
Feedback, recychng of memory, so daß der Staatskanzler an Fragen des<br />
Archivwesens »nicht bloss bestimmenden, sondern einen bis in die kleinen Einzelheiten<br />
gehenden persönlichen Anteil genommen hat« .<br />
17<br />
Zitiert in: D. McHlrath (Hg.), Lord Acton: the Dccisive Dccadc. 1864-74, Louvain<br />
1970,131<br />
38<br />
Meile Klinkenborg, <strong>Geschichte</strong> des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin (Typosknpt<br />
1934), Abt. I: Die Begründung des Markgräflich Brandenburgischen Archivs im fünfzehnen<br />
Jahrhundert, Vorwort, vi<br />
j9<br />
Reinhold Koser, Die Neuordnung des preussischen Archivwesens durch den Staatskanzler<br />
Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg, Leipzig (Hirzel) 1904, Einleitung, v
592 ARCHIV<br />
Tatsächlich hat Hardenberg bei Einleitung der Verwaltungsreform 1810 die Aufsicht<br />
über die Archive sich selbst vorbehalten, d. h. dem Geschäftsbereich des<br />
Staatskanzlers zugeordnet. Administration <strong>von</strong> Staat und Dokumenten sind,<br />
<strong>von</strong> keiner historischen <strong>Im</strong>agination geblendet, gleichursprünglich. In diesem<br />
Kontext ist das Archiv eine Agentur der Verwaltung und nicht die auratisch mit<br />
historischer Energie aufgeladene Fundamcntierung <strong>von</strong> Historie. Das gilt zumal<br />
seit der leichteren Verwendbarkeit <strong>von</strong> Verwaltungsdokumenten mit der Erfindung<br />
des Buchdrucks und dem damit einhergehenden Formularwesen als<br />
Bedingung der Standardisierung des Staates: Massenhaftigkeit und leichte Verwendbarkeit<br />
machten das Formular <strong>für</strong> den erstarkenden Terntonalstaat attraktiv.<br />
Doch es veränderte auch den Binnenbereich der Verwaltung selbst, denn jede<br />
geregelte Verwaltung bedurfte eines Dienstplans, einer Hierarchie der Kompetenzen.<br />
In diesem Zusammenhang dienen Formulare als mediale Formatierung:<br />
«In ihnen wurde die gleichmäßige, akkurate Handhabung <strong>von</strong> Akten, die Dokumentation<br />
und Archivierung <strong>von</strong> Briefwechseln, die Erteilung <strong>von</strong> Bescheiden<br />
erst einmal eingeübt.«' 0<br />
§ 3 der Dienstinstruktion Hardenbergs vom 2. Juni 1812 bestimmt, daß nicht<br />
nur die Ministerien, sondern auch andere Staatsbehörden die Archive aus ihren<br />
Registraturen speisen sollen - der Gedanke des modernen Zentralarchivs. In der<br />
Praxis aber versiegen die Ablieferungen; die preußischen Provinzen sind autonom<br />
genug, um sich eine eigene Organisation der Archive vorzubehalten. Das<br />
geplante Zentralarchiv »nahm den Charakter eines historischen Archivs und<br />
Behördenarchivs des Ministeriums des Auswärtigen« an .<br />
Zunächst aber macht ein Schreiben <strong>von</strong> Kultusminister Freiherr <strong>von</strong> Altenstein<br />
an Hardenberg, datiert 19. August 1819, den Vorschlag »den Teil, welcher <strong>für</strong><br />
das eigentliche Staatsrechtliche noch dauernden Wert hat, <strong>von</strong> dem zu trennen,<br />
welchem bloss ein geschichtlicher Wert beigelegt werden kann« . Monument ist im Unterschied zum historischen Dokument das, was<br />
in purer Gegenwart ragt; noch steht die emphatische Geschichtskonstruktion<br />
in einem parergonalen, suplementären Verhältnis zum archivalischen Monument<br />
(Beilegung einer Bedeutung). Ferner schlägt Altenstein vor, aus den<br />
preußischen Provinzen alles, »was <strong>von</strong> allgemeinem wissenschaftlichen Interesse<br />
wäre«, an ein »Centralarchiv« nach Berlin abzuführen (neben dem noch ein<br />
staatsrechtliches Zentralarchiv bestehen sollte), in den Provinzen aber nur das<br />
zu belassen, »was mehr provinzielle Beziehungen hat.« 41 Der geheime Legati-<br />
40 Michael Stollei's, <strong>Geschichte</strong> des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 1: Reichs-<br />
Publizistik und Policey wissenschall, München (Heck) 1988, 337<br />
41 Reinhold Koser, Die Neuordnung des Preussischen Archivwesens durch den Staatskanzlcr<br />
<strong>von</strong> Hardenberg, in: Mitteilungen der K. preussischen Archivverwaltung I Ielt<br />
7, Leipzig 1904, 6
STAAT MACHKN: PRKUÜKN IN DKN ARCHIVEN 593<br />
onsrat Karl Georg v. Raumer in seinem Schreiben an Hardenberg vom Sept.<br />
1819 hält diese Scheidung praktisch <strong>für</strong> rein unmöglich:<br />
»Uebcrall greift geschichtliches, Staats- und völkerrechtliches so durch und in einander,<br />
dass <strong>von</strong> vielen Tausenden <strong>von</strong> Aktenstücken und Urkunden nichts<br />
zusammenbleiben könnte. Alles würde zerstückelt werden. Es wäre die Anatomie<br />
des lebendigen organischen Körpers. Man hätte nun allerdings das Nervensystem<br />
besonders, das Adernsystem und lymphatische System auch besonders, aber der<br />
organische Körper wäre getödtet.« <br />
Archivordnung korreliert mit Heeresdisziplin in ihrem Charakter als Programmierung,<br />
Befehl, Algorithmus. Auch hier ist die Wahrheit (frei nach Friedrich<br />
Nietzsche) ein Heer beweglicher Metaphern. 42 Koser vergleicht den täglichen<br />
Gebrauch des Archivs mit dem Gebrauch eines Heeres, das immer schlagfertig<br />
vor dem Feind steht. »Nun denke man sich, dass ein solches Heer in seinen<br />
Grundabteilungen und bis ins kleinste Detail hinein, eine Umformung seines<br />
Personals erführe, ein Flügel zum andern, eine Waffengattung zur andern. Es<br />
wäre augenblicklich gelähmt« . Das Berliner Geheimen Staatsarchiv »stehet<br />
da seit der glücklichen neulich erfolgten Translocation, in einer Ordnung,<br />
die es, wie ein schlagfertiges Heer, in jedem Augenblick brauchbar macht«<br />
. Doch nur <strong>für</strong> die Archive aufgelöster Staaten<br />
am Rhein, in Westphalen und der aufgelösten Klöster ist eine zentrale Bündelung<br />
denkbar: »Gerade jene Auflösung macht die Anatomie möglich, nützlich,<br />
wünschenswert!"!«, aber erst nach entsprechender Bestandsaufnahme, d. h.<br />
Inventarisierung. Diskontinuitäten ermöglichen Historie; Archivkorpora bilden<br />
Leichen. Hardenberg lehnt eine Zweiteilung des Archivwesens ab, begrüßt aber<br />
die Bildung eines Zentralarchivs, um alle in den Provinzen zerstreuten, zur Dispostion<br />
des Staats stehende Bestände »zu einem Ganzen zu vereinigen« , d. h. an die Hauptrubriken des Staatsarchivs die zerstreuten<br />
Urkunden anzureihen. Was Altenstein und Hardenberg <strong>für</strong> Preussen<br />
beabsichtigten, hat Napoleon <strong>für</strong> Europa durchführen wollen, als er mit dem<br />
Bau eines feuerfesten Archivspeichers aus Stein und Eisen auf dem Platz zwischen<br />
der Militärschule und Invalidendom in Paris begann. Diese Ortung weist<br />
den Akten ihren Platz in der symbolischen Ordnung des <strong>Im</strong>periums zu. Koser<br />
kommentiert den Zentralplan Hardenberg skeptisch als Verwirrung, in der »alle<br />
Spuren der Herkunft der Urkunden, ihrer Entstehung und ihrer ursprünglichen<br />
Aufbewahrungsstätte, sich völlig verwischt haben würden« .<br />
Allein die notwendige Inventarisierung der Akten vor Ort, also in den Provinzen,<br />
schiebt ihre Überführung nach Berlin bis zur Undurchführung auf. Wei-<br />
42 Friedrich Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge im aussermorahschen Sinne 1, in: Sämtliche<br />
Werke. Kritische Studienausgabe, hg. G. Colli / M. Montinan, Bd. 1, München /<br />
Berlin / New York 1980, 880f
594 ARCHIV<br />
terhin steht die Anordnung Hardenbergs im Raum, die zu sekretierenden<br />
Urkunden nach Berlin zu senden. »Unter den übrigen wird ein Unterschied<br />
gemacht werden zwischen denen, welche in fortwährendes Interesse haben, und<br />
denen , wo dies nicht der Fall ist« . Es gilt als<br />
Gedächtnis also das, was fortwährt; die Währung des Gedächtnisses ist seine diskursive<br />
Aufladung. 1821 sind sich Hardenberg und Altenstein darin einig, daß<br />
die Archive »mit Rücksicht auf die Beförderung der Wissenschaften« einzurichten<br />
und zu verwalten seien - ein nach den Arkan- und Kameralfunktionen<br />
der Archive im Absolutismus neuer Gesichtspunkt, der mit dem Projekt der<br />
Monumenta Germamae Histonca des Freiherrn vom Stein, also der wissenschaftlichen<br />
Erschließung deutscher Quellen des Mittelalters zur Grundlegung<br />
einer Nationalgeschichte parallel verläuft. Daß damit die Kameralpolitik der<br />
Archive nicht aufgehoben, sondern vielmehr noch unsichtbarer wurde, beweist<br />
nicht nur jene Modifikation, die bestimmte, daß überhaupt nur solches Schriftgut<br />
an die Archive abgegeben werden sollte, das in der laufenden Verwaltung<br />
nicht mehr benötigt wurde. In der Aufstellung der Materialien, die an das in Berlin<br />
geplante Zentralarchiv abzugeben waren, wird sichtbar, wie wach der<br />
Gedanke an die Sicherheit des Staates auch hinter diesen Reformideen bleibt:<br />
Alle aus politischen Gründen zu sekretierenden Stücke sowie alle Sachen ohne<br />
aktuellen Wert <strong>für</strong> die Feststellung <strong>von</strong> Rechtsfragen sollen aus den Provinzen<br />
an das Zentralarchiv abgeführt werden. Maßgeblich ist nicht nur der Wunsch,<br />
sie in Berlin an wichtigster Stelle <strong>für</strong> die wissenschaftliche Forschung bereitzuhalten,<br />
»sondern auch, sie hier - im Zentrum der Macht - unter den besonderen<br />
Schutz der Staatsmacht zu stellen . Dem sacred Space nationaler, emphatischer, im <strong>Im</strong>aginären operierenden<br />
lieux de memoire der Denkmäler (Text, Objekt, Monument) steht also der<br />
secret Space der Agentur des Archivs, einer Infrastruktur beiseite, die im Verborgenen<br />
des Staates Gedächtnis administriert. Das Maß der Begrenzung wissenschaftlicher<br />
Adressierbarkeit <strong>von</strong> Staatsarchiven ist im <strong>Namen</strong> der Institution<br />
ausgesprochen. Hardenbergs Erlaß vom 22. Juni 1820 beabsichtigt, sämtlichen<br />
Archiven im ganzen Umfang des Staates einen »mit den Staatsrücksichten nur<br />
irgend verträglichen Grad <strong>von</strong> Publizität zu geben und die verborgenen Schätze<br />
im Allgemeinen sowie insbesondere <strong>für</strong> Sprachkunde und <strong>Geschichte</strong> dem Dunkel<br />
zu entziehen.« 43 Die Kybernetik <strong>von</strong> Macht setzt die Beobachtungsdifferenz<br />
<strong>von</strong> Staat(srecht) und Forschung, »um das Interesse des Staates an der Geheimhaltung<br />
der Archive zu wahren« - Verwaltungsarchive <strong>für</strong> den Gebrauch der<br />
Behörden, wissenschaftliche Archive <strong>für</strong> die literarische Benutzung . Entsprechende Entscheidungen fallen dann zwischen 1819 und 1821,<br />
besonders das Plädoyer <strong>für</strong> ein Zentralarchiv. Remhold Koser, selbst später<br />
StA Münster, OP, Nr. 35a, Bd. 1, Bl. 51, zitiert nach: Wolf 1994: 468
STAAT MACHEN: PREUÜEN IN DI-;N ARCHIVEN 595<br />
preußischer Staatsarchivdirektor, hat diese Vorgänge in semer Publikation <strong>von</strong><br />
1904 beschrieben, doch »die entscheidende und <strong>von</strong> Koser ausgewertete Akte<br />
(GStaA, I. HA Rep. 74 Abt. H XVII Nr. 10 Bd. 1) ist lt. Revisionsvermerk im<br />
entsprechenden Repertorium seit 1962 nicht mehr auffindbar.« 44 Der blinde<br />
Fleck des Archivs ist das Archiv seiner eigenen Begründung.<br />
Ein zweites, vom Kultusministerium ersuchtes Gutachten der Berliner Akademie<br />
der Wissenschaften, abgedruckt im Kunst- und Wissenschaftsblatt vom<br />
13. September 1822, hält es <strong>für</strong> unzweckmässig, »die Vorräthe zu sehr zu<br />
konzentrieren, oder wohl gar in einem Reichsarchive der Hauptstadt zu<br />
vereinigen«, denn in einer gebildeten und nach Bildung strebenden Zeit ist es<br />
nicht ratsam, die Provinzen »<strong>von</strong> solchen ererbten Denkmälern und wissenschaftlichen<br />
Schätzen zu entblösscn« und ihres<br />
wesentlichen Inhaltes zu entledigen, ohne zugleich den Sinn <strong>für</strong> die Erforschung<br />
der Vergangenheit in ihr zu schwächen - Batterien der Geschichtsforschung.<br />
Denn die Regeneration <strong>von</strong> Geschichtsbewußtsein aus der Region erfordert<br />
Aktennähe. Am Ende gelangen nur einige, zumeist mittlalterliche Kaiserurkunden,<br />
nach Berlin (die später als Kaiserurkunden in Abbildungen zur<br />
Publikation finden und nach der photographischen Aufzeichnung z. T. zurückgesandt<br />
werden). Die neuen technischen Möglichkeiten <strong>von</strong> archives imaginaires<br />
machen den Archivzentralplan redundant. Hardenberg jedenfalls trägt den<br />
Überlegungen der Berliner Akademiegutachten Rechnung, und beschließt, so<br />
viel als möglich »den einzelnen Provinzen und ihren Bestandteilen dasjenige<br />
als öffentliches Denkmal zu belassen, was das heimathhch erwachsen und bis<br />
hierhin bewahrt worden ist« . Gerinnt die Archivalie zum<br />
öffentliches Denkmal, dient <strong>Geschichte</strong> als Diskurs der Monumentalisierung<br />
administrativer Akte(n) und lädt damit imaginär auf, was dem rein Symbolischen<br />
der Schrift der Administration entstammt - womit ein Monument des<br />
Staates (als datum) zum Dokument einer im <strong>Im</strong>aginären zu konstruierenden<br />
Nationalvergangenheit wird. So ist Historie als Diskurs etabliert, welcher der<br />
reinen Funktionalität des Staates gegenüber Differenz einzuschreiben vermag.<br />
Diese Differenz ist die <strong>von</strong> Archiv und <strong>Geschichte</strong> selbst. Auf einem Tisch des<br />
Lesesaals eines Staatsarchivs nebeneinandergelegt, hegt der Unterschied einer<br />
mittelalterlichen Kaiserurkunde und eines Dokuments zur <strong>Geschichte</strong> ihrer<br />
archivahschen Administration um 1815 im Realen <strong>von</strong> Schreibstoff und Raum,<br />
nicht aber als historische Zeit vor Augen. Erst die Unterstellung einer kogniti-<br />
44 Reinhart Strecke, Die westfälische Denkmälerinventansation <strong>von</strong> 1822 und die Anfänge<br />
der Denkmalpflege in Preusscn, in: Hans-Joachim Bchr / Jürgen Kloostcrhuis<br />
(Hg.), Ludwig Freiherr Vincke: ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restuaration<br />
in Preußen, Münster (Sclbstvcrl. des Vereins <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und Altertumskunde<br />
Westfalens: Abt. Münster) 1994, 483-494 (488)
596 ARCHIV<br />
ven Dimension namens <strong>Geschichte</strong> liest eine Differenz hinein, die tatsächlich<br />
nichts anderes ist als die Funktion einer Gedächtnisordnung, <strong>von</strong> rein symbolischen<br />
Ordnungsinstrumenten wie Inventar, alphabetisches Register oder reine<br />
Chronologie. Archiv im Sinne der Institution und im Sinne Michel Foucaults<br />
heißt in Preußen die Bedingung einer Kultur, die <strong>für</strong> die Ordnung serieller<br />
Datenflüsse ausschließlich das Alphabet hat, so daß das Speichermonopol <strong>von</strong><br />
Diskursen mit ihrem Machtmonopol zusammenfiel; parallel zur Mobilisierung<br />
der Subjekte als Soldaten der Landwehr seit den Napoleonischen Kriegen 45<br />
mobilisiert Preußen auch die Buchstaben, indem das Allgemeine Landrecht festlegt,<br />
daß Schulen und Universitäten Veranstaltungen des Staates sind - eine<br />
(rhetoriktheoretisch gesprochen) dissimulatio artis <strong>von</strong> Macht selbst, denn ohne<br />
akademischen Lehrkörper wäre der Staat auf reine Polizcigewalt reduziert. 46<br />
Wo die Hermeneutik der Lesung unmittelbar an die Genenerung eines Archivs<br />
gekoppelt ist, sind Staatsarchive schon angelegt: »Die Feder muß uns bei dieser<br />
Lektüre stets zur Hand seyn; Hauptsätze und wichtige und neue Gedanken<br />
müssen wir entweder wörtlich oder nach unsrer eigenen Vorstellung niederschreiben.«<br />
47 Niklas Luhmann vollzieht dies als Kopplung an das sowohl Inhalte<br />
wie Adressen speichernde Medium Zettelkasten; wenn er ein Buch las,<br />
hatte er immer Zettel zu Hand, auf denen er die Ideen bestimmter Seiten notierte<br />
- samt bibliographischen Angaben auf der Rückseite. »Ich lese also immer<br />
mit einem Blick auf die Verzettelungsfähigkeit <strong>von</strong> Büchern.« 48 Manifestiert in<br />
der Gründung der Berliner Physikalisch-Technischen Reichsanstalt unter Hermann<br />
<strong>von</strong> Helmholtz (1874) beginnt sich schließlich ein andersartiges, naturwissenschaftlich-mathematisches<br />
Schriftregime abzuzeichnen und mit dem<br />
»Zerbrechen des Schnftmonopols an technischen Medien« ein Archiv ganz<br />
anderer Ordnung zu bilden - dem Friedrich Meinecke mit seinem Vergleich <strong>von</strong><br />
aktenmäßiger und mathematischer Sicherheit immerhin schon nahekam. 49<br />
43<br />
Aus der Institution des mües perpetnus leitete Hardenberg die Achse der Staatsreform<br />
ein: Eugen Moritz Friedrich Rosenstock-Huessy, Kriegsheer und Rechtsgemeinschaft,<br />
Rede zur Verfassungsfeier der Friedrichs-Wilhelm-Universität u. Technischen Hochschule<br />
Breslau, 23. Juli 1932, Breslau (Trewendt & Granier) 1932; Wiederabdruck in:<br />
Tumult. Schriften zur Verkehrswissenschaft, Heft 20, hg. v. Frank Böckelmann, Wien<br />
(Turia & Kant) 1995, 55-57 (56f), unter Bezug auf: Benzenberg, Die Verwaltung des<br />
Staatskanzlcrs Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg, Leipzig (Brockhaus) 1821, 135<br />
"' Friedrich Kittlcr, Das Subjekt als Beamter, in: Manfred Frank / Gcrard Raulet / Willem<br />
v. Reijen (Hg.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 401-420<br />
47<br />
J. A. Bergk, Die Kunst, Bücher zu lesen, nebst Bemerkungen über Schriften und<br />
Schriftsteller, Jena 1797,351<br />
48<br />
Niklas Luhmann, Archimedes und wir. Interviews, hg. v. Dirk Baecker / Georg Stanitzek,<br />
Berlin (Merve) 1987, 125-155 (149f)<br />
49 :;<br />
Theodor Lessing, <strong>Geschichte</strong> als Sinngebung des Sinnlosen [ '1919], München 1983, 37
STAAT MACI IHN: PIU-:UIÜI-:N IN DKN ARCHIVEN 597<br />
Zur Frage der Benutzung <strong>von</strong> Archiven <strong>für</strong> historische Forschung differenziert<br />
das Akademie-Gutachten diskursive Vektoren:<br />
»Die verschiedenartigen Denkmäler, welche gewöhnlich in Archiven aufbewahrt<br />
werden, erfordern in dieser Hinsicht verschiedenartige Bestimmungen. Ganz<br />
andere Grundsätze müssen nach unserm Da<strong>für</strong>halten angewandt werden auf den<br />
Gebrauch <strong>von</strong> Urkunden und Documenten, welche auf noch fortdauernde oder<br />
neure Verhältnisse sich beziehen, als bei solchen welche gänzlich untergegangen<br />
und in keiner Beziehung zur gegenwärtigen Zeit stehende Verhältnisse betreffen,<br />
und also <strong>von</strong> rein antiquarischer oder historischer Natur sind.«" 10<br />
Das Gutachten empfiehlt die Publikation der mittelalterlichen Urkunden, als<br />
deren chronologische Grenze etwa die Mitte des 16. Jahrhunderts angenommen<br />
wird, also die editonsche Zeitgrenze der MGFI als Richtwert. Vorbild ist die britische,<br />
diskursorientierte Gedächtnispolitik, wo 1800 eine parlamentarische<br />
Kommission zur Untersuchung des Zustandes der Archive in ihrem Berichte<br />
»die Bekanntmachung der ältesten und wichtigsen Urkunden durch den Druck<br />
<strong>für</strong> das beste Mittel ihrer Erhaltung« erklärte - Datenmigration (Übertragung)<br />
als Speichern. Hinsichtlich der Urkunden und Akten, »welche mit noch fortdauernden<br />
Verhältnissen in Beziehung stehen, und wozu sich also alles rechnen<br />
lässt, was etwa seit der Mitte des 16ten Jahrhunderts die Archive <strong>von</strong> <strong>für</strong> die<br />
<strong>Geschichte</strong> wichtigen oder brauchbaren Materialien enthalten«, soll wissenschaftliche<br />
Benutzung ebenfalls unmittelbar »und nicht bloss durch Mittheilung<br />
der Archivare auf Anfragen über einzelne unerörterte Thatsachen vergönnt«<br />
werden . Das heißt, das Archiv (transitiv) schreibbar<br />
werden zu lassen, immediat, ohne Zwischenschaltung einer staatsautoritären<br />
Selektion, zur histonographischen Lektüre. Für die Benutzung der Urkunden<br />
und Dokumente, deren Bekanntmachung Bedenkhchkeiten unterliegen könnte,<br />
empfielt das Gutachten die Benutzung unter der Bedingung, daß die Resultate<br />
der darin angestellten Forschungen nicht eher durch den Druck bekannt machen<br />
dürfen als nach Vorlage gegenüber einer höheren, dem Archive vorgesetzten<br />
Behörde. Damit ist der systemischen Gedächtniskybernetik eine Schleife <strong>von</strong><br />
feedback & control, ein Algorithmus in seiner Datenprozessierung, vorgeschrieben,<br />
d. h. einprogrammiert. Repertorien sorgen <strong>für</strong> eine zeiträumliche Ordnung.<br />
Dementsprechend ist das Ordnungsprinzip Nationalgeschichte als Grenz-Defimtion<br />
territorial, nicht geschichtszeithch gefaßt:<br />
»1. Die zweckmäßigste Anordnung der Repertorien scheint uns im Allgemeinen<br />
die geographischc-chronologische zu seyn, so dass die Urkunden zuvörderst nach<br />
den Ländern, Provinzen, Städten, Klöstern, Gemeinden u.s.w. , worauf sie sich<br />
50 Die historisch-philologische Classe der Akademie der Wissenschaften an den<br />
Staatskanzler, Berlin, 30. October 1821, zitiert nach: Koser 1904: 64ff (65)
598 ARCHIV<br />
beziehen, gesondert, und dann in jeder dieser Abtheilungen nach der Folge der Zeit<br />
geordnet würden. Diese Anordnung würde auch in der Aufbewahrung der Urkunden<br />
selbst sehr zweckmässig beibehalten werden können . Sehr nützlich würde<br />
zugleich eine allgemeine rein chronologische Uebersicht des ganzen Urkundenvorraths<br />
eines Archivs seyn, welche dem Repertorium als Recapitulation angehängt<br />
würde, und entweder nur ganz kurze Andeutungen des Inhalts, oder auch nur die<br />
<strong>Namen</strong> der Aussteller und die Nummern, womit die Urkunden in dem Repertorium<br />
bezeichnet sind, enthielte.« <br />
Die Adressierung, also Ordnung des Wissens ist die der Speicher. Deren Alphanumerik<br />
verwandelt die verwalteten Datenbestände in eine diskrete Maschine,<br />
denn die Numerierung der Urkunden soll am zweckmäßigsten nach den einzelnen<br />
geographischen Abteilungen geschehen. »Zur leichtern Auffindung der<br />
Urkunde würde es sehr dienlich seyn, jede Urkunde mit der Zahl, welche die<br />
Abtheilung, zu welcher sie gehört, im Repertorium führt, und der Zahl, welche<br />
ihr in der chronologischen Reihe dieser Abtheilung zugefallen ist, zu bezeichnen«<br />
. Dem angefügt findet sich der Entwurf, konkret: das Formular<br />
einer Urkunden- und Archivalienverzeichnung zu Format(ierung) und Standardisierung).<br />
Das tableau ist das Paradigma einer non-diskursiven Lektüre<br />
<strong>von</strong> Daten der Vergangenheit, und <strong>für</strong> den Fall einer tabellarischen Einrichtung<br />
der Repertonen sind folgende Rubriken vorgesehen:<br />
1. Material, ob Pergament, Acgyptischer Papyrus oder Lumpenpapier.<br />
2. Name des Ausstellers.<br />
3. Wesentlicher Inhalt.<br />
4. Datum der Urkunde.<br />
5. Zahl der Siegel und deren Beschaffenheit .<br />
Für Angaben zu Nr. 1-3 sollen die Worte der Urkunde, »so viel als es die <strong>für</strong> diese<br />
Angaben zweckmässige Kürze erlaubt, in der Sprache der Urkunden selbst«<br />
angegeben werden; m Nr. 4 würde »bei ungewöhnlichen Aeren, die Reduction<br />
auf die gewöhnliche Zeitrechnung in Klammern hinzuzufügen seyn« . Die Signatur steht also in einem intrmsischen, nicht<br />
parergonalen Verhältnis zu ihrem Signifikat. Anstelle der rein mechanischen Verarbeitung<br />
der Daten als Gedächtnis jenseits <strong>von</strong> historischer Smnbildung 51 vollzieht<br />
sich die archivische Gedächtnisbildung vielmehr <strong>von</strong> geschichtsmächtigen<br />
Vektoren in hypertextuellen Begriffs-Netzen her. Johannes Papritz plädiert in<br />
seiner Archiv Wissenschaft <strong>für</strong> die Zusammenlegung <strong>von</strong> Ordnung und Verzeichnung<br />
in einen Arbeitsgang und ist darin geprägt <strong>von</strong> seiner Tätigkeit am Preußi-<br />
Der Historiker Dietrich Schäfer spricht <strong>von</strong> den »mehr mechanischen Arbeiten in den<br />
Archiven«, in: ders., Das Preußische Historische Institut in Rom und die deutsche<br />
Geschichtswissenschaft, in: Internationale Monatsschrift <strong>für</strong> Wissenschaft Kunst und<br />
Technik, 8. Jg., Nr. 4 (Januar 1914), Sp. 394-420 (Sp. 401)
STAAT MACHEN: PREUßEN IN DEN ARCHIVEN 599<br />
sehen Staatsarchiv Danzig Ende der 20er Jahre unter Max Bär, der dort um 1900<br />
mit dem nummerus-currens ein rationelles, systematisches Verfahren zur Erschließung<br />
großer Aktenbestände ohne jegliche Vorordnung entwickelt hat.<br />
Papntz lehnt den ursprünglichen Ansatz Bars zwar als zu mechanisch ab, will<br />
aber auf die Effektivität dieser Erschließungsmethode nicht verzichten. Vielmehr<br />
soll bei der Gliederung des Bestandes »der vorarchivische Organismus respektiert<br />
und alte Ordnung genutzt werden«; alte Ordnung als Aggregatzustand<br />
gefrorener Prozesse stellt gespeicherte, reaktivierbare mnemische Energie dar. 52<br />
Ist ein modulares Repertonum einmal erstellt, läßt es sich rekonfigurieren: »Es<br />
lässt sich übrigens aus dem geographisch-chronologischen Repertonum ein Realrepertonum<br />
zusammen setzen«. Adressierbarkkeit <strong>von</strong> heux de memoire<br />
heißt deren buchstäbliche Standardisierung als Bedingung der Auffindbarkeit,<br />
also Inventio(n): Ȇberall, wo die <strong>Namen</strong> der in den Urkunden vorkommenden<br />
Oerter verschieden sind <strong>von</strong> ihren gegenwärtigen Benennungen, müßten diese<br />
letztern hinzugefügt werden« .<br />
Skeptisch verhält sich das Gutachten gegenüber der geplanten Zentralisierung<br />
der Provinzialarchive in Berlin. Kann ein solcher Archivkörper den Kollektivsingular<br />
des staatlichen Gedächtnisses bilden, »besonders <strong>für</strong> einen aus so<br />
verschiedenen Theilen zusammengesetzten Staat, wie der Preussische Staat«<br />
? Historischer Sinn meint Spürsinn; ein Argument gegen die Zentralisierung<br />
der Archive formuliert, daß »dadurch die Gelegenheit und Aufmunterung<br />
zu Forschungen über die Landesgeschichte den Bewohnern der Provinzen<br />
grossen Theils genommen, und der historische Sinn unterdrückt wird«. Die<br />
Erfahrung des Befreiungskriege, die Gedächtnis strategisch zugleich dislozierten<br />
und mobilisierten, ist noch aktuell in der Warnung: »Selbst die Gefahr einer<br />
gänzlichen Zerstörung aller wichtigen Urkunden eines grossen Reiches mit<br />
Einem Male durch einen unglücklichen Zufall, dürfte gegen die allgemeine Centralisierung<br />
der Urkunden eine nicht geringe Bedcnkhchkeit begründen«<br />
. Be/Lagerung: Die Ortswahl <strong>für</strong> geplante Zentralarchive<br />
ist, unter dem Eindruck der jüngstvergangenen Befreiungskriege,<br />
noch sehr real <strong>von</strong> der Erinnerung an militärische Lagen bestimmt; 1826 kommt<br />
die Preußische Archivverwaltung auf den alten Zentralisierungsplan zurück.<br />
Der Archivrat Hoefer wirde beauftraft, die in Westfalen in Betracht kommenden<br />
Archivalien herauszusuchen, nach Berlin zu überführen und in einem Zug<br />
auch die Auflösung des Archivdepots in Arnsberg und Höxter durchführen.<br />
52 Johannes Papntz, Archivwissenschaft, 2. durchges. Ausgabe Marburg (Archivschule)<br />
1983, Bd. 3, 256; dazu Nils Brübach, Johannes Papritz (1898-1992) und die Entwicklung<br />
der Archivwissenschaft nach 1945, in: Der Archivar, Jg. 51, Heft 4 (1998),<br />
Sp. 573-588(5811)
600 , ARCHIV<br />
Damit ist Westfalen konzeptionell auf zwei Archive reduziert; <strong>für</strong> Minden<br />
(neben Münster) schien in der Standortfrage alles zu sprechen. Provinzdirektor<br />
Vincke aber sieht darin die Festung (Belagerungen waren daher nicht ausgeschlossen)<br />
und plädiert daher <strong>für</strong> ein einziges Archiv in der Provinz Westfalen,<br />
in Münster . 53 Ein militärstrategisches Plädoyer spricht <strong>für</strong><br />
eine Streuung der Archive: Aus Sicherheitsgründen ist es ratsamer, die wichtigsten<br />
Dokumente des Staates an verschiedenen Orten aufzubewahren, »statt sie<br />
der Gefahr eines einzigen Unglücksfalles auszusetzen, der sie allesamt mit<br />
einem mal auslöschen könne« . Eine analoge Argumentation<br />
führt in Amerika zur Zeit des Kalten Krieges zur Geburt des dezentralen Internets<br />
aus der Angst vor einem feindlichen Interkontinentalraketenschlag.<br />
Hardenbergs zentralarchivische Weisung, obgleich letztendlich gescheitert,<br />
bewirkt tatsächlich einen Zwischenschritt: die Vereinigung der Archivalien in den<br />
preußischen Provinzialhauptstädten. Archiv ist dabei ungleich Registratur (als<br />
Arbeitsspeicher), wie es ein Bericht des westfälischen Oberpräsidenten v. Vincke<br />
am 26. April 1822 klarstellt: »Die Registratur hat einen bloss tcmporellen, das<br />
Archiv einen bleibenden Zweck« . Aufbewahrenswert<br />
sind demnach alle Originalurkunden, Verträge »und Urteilssprüche, welche<br />
Rechte und Verbindlichkeiten begründen, der Statistik und <strong>Geschichte</strong> bleibend<br />
nutzbare Nachrichten, die wichtigen Verhandlungen <strong>für</strong> Verfassung, Verwaltung<br />
und Gesetzgebung« . Hardenberg beabsichtigte ferner, alle »auf den<br />
Bibliotheken befindlichen« - somit also in ihrer räumlichen Lagerung wahrgenommenen<br />
- »Originalurkunden <strong>von</strong> der Unterrichtsverwaltung <strong>für</strong> die Archive<br />
einzufordern.« Zweifel entstanden, ob Urkundenabschriften, Privatsammlungen<br />
<strong>von</strong> Urkunden und handschriftliche Chroniken »den Archiven einzuverleiben<br />
seien oder nicht« ; Archivkörper sind gefräßig. Ein Plan, <strong>für</strong><br />
Deutschland relevante Urkunden in ausländischen Archiven kopieren zu lassen,<br />
stellt sich als unbezahlbar heraus; anders dagegen die Bestimmung, aus Kommunalarchiven<br />
Verzeichnisse bzw. Nachrichten zu erhalten. Genau das hat in<br />
Nürnberg der Freiherr <strong>von</strong> Aufseß vermittels seines Generalrepertonums als<br />
Verzeichnung, Transformation <strong>von</strong> Urkunden in Information vorgesehen. Die<br />
Instruktion <strong>für</strong> die Beamten der Staatsarchive in den Provinzen vom 31. August<br />
1867 machte es den Archivaren zur Pflicht, »wenn irgend möglich Abschriften<br />
der innerhalb der Provinz in fremdem Besitz befindlichen Archivalien zu nehmen<br />
und den Archiven einzuverleiben« .<br />
• i3 Wolf 1994: 473. Die strukturelle Kopplung <strong>von</strong> militärischer Festung und der gedächtniskatcchontischen<br />
Funktion der Staatsarchive in Preußen ist eine eigene Untersuchung<br />
wert; siehe als Datengrundlage da<strong>für</strong> Alf Lüdtke, »Gemeinwohl«, Polizei und<br />
»Festungspraxis«. Staatliche Gewaltsamkeit und innere Verwaltung in Preußen 1815-<br />
1850, Göttingen (Vandenhocck & Ruprecht) 1982
STAAT MACHI.N: PIU;UISI:N IN DI-:N ARCHIVEN 601<br />
<strong>Im</strong> anbrechenden Zeitalter historistischen Geschichtsbewußtseins wird jede Form<br />
der archivischen Kassation problematisch. Das Gutachten der Berliner Akademie<br />
der Wissenschaften <strong>von</strong> 1819 spricht sich gegen die Deklanerung einer Urkunde<br />
als wertlos aus; daher sei es besser, »mit Ausnahme neuerer Skripturen lieber gar<br />
keine Urkunde auszuschhessen, als sich der Gefahr preiszugeben, ein Denkmal<br />
zu zerstören, das einem künftigen Geschichtsschreiber irgend einen jetzt nicht<br />
gefühlten Nutzen gewähren könnte.« 54 Diese Geschichtsschreiber aber dürfen<br />
alle, nur nicht Archivare sein. Raumer zählte die »Abneigung <strong>von</strong> wissenschaftlichem<br />
Treiben« zu den Eigenschaften des Archivars ; modulare Urkundenkenntnis insistiert hier als Provokation der narrativen<br />
Fassung <strong>von</strong> Daten als Historie. »Ich verweile lange bei Fragen, die die Rechenmeister<br />
nie zu behandeln gedachten, weil diese Fragen Metaphysik und die<br />
Rechenmeister keine Metaphysiker sind.« 55 So schwankt der Archivar, sobald<br />
nicht mehr der staatsjuristische, sondern der historische Betreff das We(i)sen seiner<br />
Bestände bestimmt, zwischen den Operationslogiken Genese und Kalkül. 56<br />
Hardenberg (archiviert)<br />
Mit Hardenberg stirbt am 26. November 1822 auch der Plan eines Berliner Zentralarchivs.<br />
Nicht die Archive, sondern die Verwaltung der Staatsarchive wurden<br />
vereinheitlicht; nicht das Gedächtnis, sondern seine Infrastruktunerung sind<br />
Staatssache. Seit Ende des 17. Jahrhunderts fordert der brandenburg-preußische<br />
Staat dienstliche Papiere und Korrespondenzen der höchsten Beamten und Offiziere<br />
nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Eintritt des Todes <strong>für</strong> das<br />
Archiv ein; fast regelmäßig besonders bei Ministern und Gesandten im 18. Jahrhundert.<br />
Späterer findet die Beschlagnahme dienstlicher Nachlässe nur noch<br />
ausnahmsweise statt: darunter der Nachlaß des Staatskanzlers Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg.<br />
Ende des 19. Jahrhunderts legt man auf dem Gebiet der freiwilligen<br />
Gerichtsbarkeit fest, daß nach dem Tode eines Beamten die zuständige (Aufsichts-)Behörde<br />
<strong>für</strong> die Sicherung der amtlichen Akten zu sorgen hat, teilweise<br />
durch Kauf <strong>von</strong> verbliebenem Material. Nach dem Ersten Weltkrieg geht das<br />
Preußische Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem zu einer systematischn Sammeltätigkeit<br />
über,, um das mitunter außerordentlich wichtige Material nachträg-<br />
34 Die historisch-philologische Klasse der Akademie der Wissenschaften an den Minister<br />
der geistlichen u.s.w. Angelegenheiten, Berlin, 6. April 1819<br />
x ' ) Condillac, Die Logik oder die Anfänge der Kunst des Denkens. Die Sprache des Denkens<br />
( :: 'La langue des calculs), Berlin 1959, 145. Siehe Jacques Dernda, Die Archäologie<br />
des Frivolen, übers. Joachim Wilke, Berlin (Akademie) 1993<br />
56 Vgl. Michel Foucault, Die Geburt der Klinik, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 13Off
602 ARCHIV<br />
lieh <strong>für</strong> die Geschichtsschreibung sicherzustellen - Archivierung heißt Arretierung<br />
des Signifikantenflusses. Der historische Diskurs (ein Diskurs der Nachträglichkeit<br />
jfer definitionem setzt also einen differenten Akzent des Archivs: <strong>von</strong><br />
Justiziabilität zum historischen Diskurs der Aktenforschung. »Mit der Durchführung<br />
des Provenienzprinzips setzte sich der Grundsatz der Unteilbarkeit der<br />
Nachlässe durch. Sie wurden unter der Repositurbezeichnung Rep. 92 als Archivabteilung<br />
aufgestellt.« 57 Hardenberg, der das preußische Gedächtnis organisierte,<br />
ist selbst ein blinder Fleck des Gedächtnisses. Aus dem Kreis der Koalition<br />
gegen Napoleon wird Metternich durch Heinrich <strong>von</strong> Srbik biographisch erfaßt;<br />
sowohl mit Castlereagh und Talleyrand hat sich eine umfangreiche Historiographie<br />
beschäftigt. »Der Preuße Hardenberg ist dagegen im Schatten geblieben.« 58<br />
Grund da<strong>für</strong> ist die buchstäblich archivalische »Lage des Materials, durch das sich<br />
der Historiker hindurchfmden muß, der auf eine Gesamtdarstellung Hardenbergs<br />
zusteuert.« 59 Das Licht der <strong>Geschichte</strong> blendet die Dunkelheit des Archivs<br />
aus: Metternich »lebte fast <strong>von</strong> Anfang an im vollen Licht der <strong>Geschichte</strong>, beobachtet<br />
<strong>von</strong> den meisten Zeitgenossen«; der Historiker braucht »nur weniges<br />
durch Archivstudien zu ergänzen.« Eine Biographie <strong>von</strong> Hardenberg dagegen ist<br />
»beinahe <strong>von</strong> Anfang bis zum Ende Archivarbeit, also ungewöhnlich zeitraubend<br />
und weitschichtig« . Das Archiv ist Vergangenheit als<br />
Resistenz gegenüber der narrativen Historie. Nicht die Fülle der Dokumente,<br />
sondern Lücken sind konsumtiv <strong>für</strong> den Archiv-Speicher, das Gedächtnis Hardenbergs.<br />
Hausherr greift den Abschnitt heraus, der dadurch gegeben ist, daß die<br />
<strong>von</strong> Ranke herausgegebenen eigenhändigen Memoiren, in die viele Aktenstücke<br />
eingesetzt sind (die Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg,<br />
Leipzig 1877), erst mit dem Jahr 1803 beginnen, als Hardenberg das<br />
Departement des Auswärtigen übernahm. Die Edition Rankes folgt keinem<br />
historiographisch präfigurierten emplotment, sondern der Struktur des (die Verwaltung<br />
abbildenden) Archivs: »Denn nicht nach Jahr und Tag bestimmen sich<br />
die Epochen <strong>für</strong> die historische Auffassung, sondern nach den in den Begebenheiten<br />
vorwaltenden Direktionen« . Doch setzten diese<br />
eigenhändigen Memoiren mit einem kurzen Abschnitt ein, in dem der gestürzte<br />
Staatsmann in den Jahren 1807/08 seine eigene Familiengeschichte zu schreiben<br />
57 Heinrich Waldmann, Der Nachlaß Friedrich Althoffs in Merseburg, in: Bernhard vom<br />
Brocke (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezcitalter.<br />
Das »System Althoff« in historischer Perspektive, Hildesheim (Lax) 1991, 53-58 (53)<br />
•' 1 ' s Hans Hausherr, Die Lücke in den Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten <strong>von</strong><br />
Hardenberg, in: Archivar und Historiker (Festschrift H. O. Mcisncr), Berlin 1956,<br />
457-510(457)<br />
59 Hausherr 1956: 457, unter Bezug auf Karl Gnewanks Besprechung seines Buches: Die<br />
Stunde Hardenbergs, Hamburg 1943, in: Historische Zeitschrift 169 (1949), 390
STAAT MACHI-N: Piu-;ußr.N IN DKN ARCHIVKN 603<br />
beginnt; hinter der durch Staatslogik vorgegebenen Skandierung <strong>von</strong> Aufzeichnung<br />
zieht der autobiographische <strong>Im</strong>puls die Fäden. So »klafft zwischen diesem<br />
ersten Ansatz zu einer Selbstbiographie und dem ausgeführten Teil eine Lücke,<br />
die wir hier auszufüllen suchen, allerdings nicht durch eine biographische Darstellung<br />
des staatsmännischen Werdens, sondern durch die Würdigung derjenigen<br />
Archivahen, die die Lücke zu schließen vermögen« . Bedingung einer Autobiographie ist die Ordnung des Archivs; <strong>für</strong> die<br />
<strong>Im</strong>plementierung einer Nationalgeschichte gilt diegleiche archivische Strukturierung<br />
als Vorbedingung <strong>für</strong> Historie. Für die Einleitung hat sich der spätere<br />
Staatskanzler bereits als Dirigierender Minister in Franken darum bemüht, das<br />
Familienarchiv zu Nörten-Hardenberg ordnen und eine Familiengeschichte<br />
schreiben zu lassen. Ortswechsel des Famihcnsit/.es bedeuten dementsprechend<br />
Übertragungsverluste. Die Archivalien, die Hardenberg mitnahm, sind wahrscheinlich<br />
durch wiederholten Dislokationen weiter geschädigt worden. Auf<br />
einem Repertonum meiner sämtlichen Papiere, verfertiget den 1. Juli 1804 hat<br />
Hardenberg eigenhändig vermerkt: »Die mehrsten dieser Papiere sind in Tempelberg<br />
zurückgeblieben.« 60 Buchstäbhch(e) Archiv-Lagen bestimmen die Lage<br />
der Historiographie. Sie holen Hausherrs Aufsatz ein, denn auch seine Memoirenkritik<br />
will nach Parallelberichten sowie Parallelakten fragen. Die Benutzung<br />
<strong>von</strong> Hardenbergs eigenhändiger <strong>Geschichte</strong> in der Zeit seines Wirkens als Leiter<br />
des auswärtigen Departements sucht parallel nach den Akten des Kabinettsministeriums.<br />
»Aber diese sind leider zu weitaus größten Teil nicht nach Merseburg<br />
gekommen , so daß Arbeiten zur <strong>Geschichte</strong> der preußischen Außenpolitik<br />
auf archivahscher Grundlage vorerst unmöglich scheinen« 61 - der historische<br />
Index zweiter Ordnung (die Gegenwart der Archive).<br />
Mit Ende des Jahres 1793 endet die Niederschrift, durch welche Hardenberg<br />
die Lücke in seinen Denkwürdigkeiten auszufüllen sich anschickt. Wo diskursive<br />
Erzählung ver-sagt, also schweigend aussagt, kommt das archivische<br />
Schweigen mcht-diskursiver Fragmente, der membra disiecta eines vergangenen<br />
Körpers 62 zum Zug. Der Hardenberg-Nachlaß birgt unter der Ziffer L 16 teils<br />
60<br />
Zitiert nach: Hausherr 1956: 499, unter Bezug auf: Gutsarchiv Neuhardenberg, jetzt<br />
Brandenburgisches LHA Potsdam, Rep. 37<br />
61<br />
Hausherr 1956: 500. Anmerkung 17 modifiziert, unter Bezug auf das ehemalige Zentralarchiv<br />
der DDR (jetzt Berlin, Geheimes Staatsarchiv), die Aussagen des Gedächtnisses<br />
als Geschicke des Archivs: »F.br.pr.G. 47 (1935), S. 227 ff. Der obige Abschnitt<br />
dürfte durch die Übergabe <strong>von</strong> Akten aus der Sowjetunion überholt sein. sie werden<br />
jetzt in Merseburg wieder eingeordnet.«<br />
62<br />
Zum Gedächtnisaggregat des Nachlasses siehe W. E., Eduard Fuchs. Sammlung und<br />
Historie, in: Bernhard J. Dotzler / Helmar Schramm (Hg.), Cachaca. Fragmente zur<br />
<strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> Poesie und <strong>Im</strong>agination (Festschrift Karlheinz Barck), Berlin 1996,<br />
30-39, sowie ders., Texten ein Gesicht geben: Die Prosopopöic des Archivs im <strong>Namen</strong>
604 ARCHIV<br />
ausgeführte Entwürfe <strong>für</strong> den fehlenden Teil, die sämtlich in den Monaten entstanden,<br />
in denen die veröffentlichten Denkwürdigkeiten niedergeschrieben wurden<br />
und dem Biographen damit erlauben, in Hardenbergs Schreibwerkstatt zu<br />
blicken. So sieht er ihn sich die Pflicht auferlegen, »täglich einen Notaten Bogen«<br />
vollzuschreiben und eine Disposition machen: »Vie privee, ancetres, education-<br />
Bildung-Umgebungen, femmes, enfants, amis-entours-connaissances, caractereveritas-quahtes-defauts,<br />
occupation-opes-Reisen« . Aus diversen Stichwörtern und Andeutungungen <strong>von</strong> Sätzen, <strong>Namen</strong> und<br />
Daten lassen sich die ersten Schritte der Karriere Hardenbergs ableiten, doch<br />
schwierig wird dies <strong>für</strong> seine Zeit als junger Beamter im hannoverschen Staatsdienst.<br />
»Die Tätigkeit eines Beamten, der nicht gerade an erster Stelle steht, ist<br />
gewöhnlich in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Denn wer wäre imstande,<br />
die Akten der inneren Verwaltung zu durchforschen, um dem Wirken eines einzelnen<br />
nachzuspüren« (Leopold <strong>von</strong> Ranke) - es sei denn eine ganze Arbeitsgemeinschaft<br />
<strong>von</strong> Archivaren. 63 Die <strong>von</strong> Ranke edierten Memoiren Hardenbergs<br />
<strong>von</strong> 1803 bis 1807 füllen zwei stolze Bände, da der Herausgeber die Inscrenda<br />
mitabgedruckt hat, eine Sammlung <strong>von</strong> Schriftstücken, die Hardenberg seinem<br />
Text in zehn Faszikeln beigegeben hatte. Der Text allein wäre sonst nicht verständlich;<br />
historische Diskurse sind nichts ohne Autorisierung im Dispositiv der<br />
Akten. Damit korrespondiert das Werk der Sekretäre: Eine Selbstbiographie, die<br />
Hardenbergs Wirken in der Außenpolitik darstellte, konnte nur als Niederschrift<br />
und Redaktion unter Mitarbeit des Schriftstellers Maximilian Samson Friedrich<br />
Scholl, seines Geheimen Oberregierungsrats im Büro des Staatskanzlers, abgefaßt<br />
werden. Woebi ihm Hardenberg vorschrieb, genauso zu arbeiten wie er<br />
selbst in seinen Memoiren 1807/08: »nämliche eine Geschichtserzählung zu liefern,<br />
eine Reihe <strong>von</strong> Schriftstücken als Inserenda zur Einfügung in die Erzählung<br />
zusammenzustellen und weitere Schriftstücke nur als Beleg <strong>für</strong> die Erzählung<br />
unter der Bezeichnung Pieces justificatives abschreiben zu lassen.« 64 Hausherr<br />
zitiert einen Zwischenbericht Schölls an Hardenberg vom 8. Juni 1822, der dann<br />
seinen Auftrag einer <strong>Geschichte</strong> der Diplomatie Preußens seit 1794 definiert, wie<br />
sie sur la seule inspection des actes geschrieben werden kann:<br />
»S'il a un defaut, c'est celui d'avoir ete redige dans le moment meme oü les evenements<br />
se sont passes, et oü par consequent tout est egalement important aux yeux<br />
Ernst Kantorowicz«, in: Ästhetik und Kommunikation, I Icft.94/95, Jg. 25, Dezember<br />
1996 (Themenheft Medium Gesicht. Die faciale Gesellschaft), 175-182<br />
bi Hausherr 1956: 503, unter Bezug auf: Ranke, Denkwürdigkeiten, Bd. 1,41, und die<br />
<strong>von</strong> Willy Flach geleitete Ausgabe <strong>von</strong> Goethes amtlichen Schriften<br />
M Hausherr 1956: 505, unter Bezug auf die Arbeitsanweisung, Deutsches Zentralarchiv<br />
Abt. Merseburg (jetzt Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem) Rep. 92 Scholl Nr. 1 <strong>von</strong><br />
unbekannter Hand
STAAT MACHI.N: PRI;UIÜ:N IN OKN ARCHIVEN 605<br />
de l'ecnvain qui n'apprend ä tner les faits que lorsqu'il connait les suites qu'ils ont<br />
produites. En travaillant je me suis efforce de raconter les evenements avec<br />
chaleur et intcret, mais je ne me suis pas arretc ä polir mon Stile: c'est une täche que<br />
je ine suis rcscrvcc pour la fin.« <br />
Das Inserieren <strong>von</strong> Archivdokumenten heißt, das Archiv transitiv zu schreiben.<br />
Gezielte Einarbeitung <strong>von</strong> Verträgen, Konkordaten, päpstlichen Bullen, Briefen<br />
und ähnlichen Dokumenten in Chroniken, Viten und in andere Geschichtswerke<br />
war im vorhistoristischen Zeitalter gebräuchlich, was der Forschung die Erhaltung<br />
solcher Zeugnisse mitspeichert. »Nicht selten wurden Urkunden durch kürzere<br />
oder längere erzählende Partien miteinander verbunden als als selbständige<br />
Annalen ediert, was besonders auf die relativ früh einsetzende Klostergeschichtschreibung<br />
zutrifft« 65 - unproecssed data (Hayden White). Der humanistische<br />
Gelehrte benutzte »auch unverarbeitete Zeugnisse der Vergangenheit« wie<br />
Inschriften, Münzen und vor allem Urkunden und Rechtsbücher . Archivsperrzeiten und -Öffnungen skandieren den Rhythmus der<br />
Historiographie. 1828 kommen die Ausarbeitung Schölls und die eigenhändigen<br />
Memoiren Hardenbergs versiegelt ms Archiv; Scholl hatte Ende 1823 verlangt, die<br />
<strong>von</strong> ihm zurückgegebenen Memoiren bis zum Jahre 1850 versiegelt im Archiv<br />
auf-, d. h. der historischen Forschung zu entheben. Latenzzeit <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
ist kalkulierbar: »Zweifellos war die ganze Beschlagnahmeaktion darauf berechnet,<br />
<strong>von</strong> den Papieren Hardenbergs auf lange Sicht nichts an die Öffentlichkeit<br />
gelangen zu lassen.« Ranke erzählt, daß erst Bismarck eigenhändig den Zeitknoten,<br />
d. h. die Siegel löste, um ihm die Veröffentlichung zu ermöglichen -<br />
denn mit dem Beginn eines neuen Reiches sind solche Vorgänge(r) Vorgeschichten<br />
und mithin <strong>für</strong> das unmittelbare Staatsgedächms (das Verwaltungs-,<br />
also Schriftregime des Symbolischen) redundant. So wird Nationalgeschichtsschreibung<br />
im <strong>Im</strong>aginären möglich. »Wir sind an unseren Ausgangspunkt<br />
zurückgelangt, an die Ausgabe Rankes und die Lücke, die Hardenberg selbst<br />
gelassen hat« .<br />
Historisierung und Verreichlichung des Archivs<br />
Infolge der Revolution <strong>von</strong> 1848/49 und der damit verbundenen Umwandlung<br />
Preußens in eine konstitutionelle Monarchie werden die preußischen Staatsarchive<br />
der Aufsicht des Ministerpräsidenten unterstellt. 66 Seit 1852 amtiert der Ber-<br />
b:) Brachmann 1984: 364, unter Bezug auf: F. J. Schmale, Mentalität und Berichtshonzont.<br />
Absicht und Situation hochmittelalterlichcr Geschichtsschreiber. In: Historische Zeitschrift<br />
226 (1978) I i. 1, 12<br />
w> Geheimes Staatsarchiv Berlin, I-'indbuch Rep. 178, 2.3.31. Generaldirektorium der<br />
Staatsarchive 1823-1945,<br />
»Vorbemerkung« Dr. Kohnke, Dipl.-Archivar, Merseburg, 27. April 1977
606 ARCHIV<br />
liner Universitätsprofessor Karl Wilhelm <strong>von</strong> Lancizolle hauptamtlich als Direktor<br />
der preußischen Archive; 1855 erklärt er, die Provmzialarchive sollen <strong>von</strong> der<br />
Sammlung neu entstehender Schriftstücke aus der Administration absehen, da sie<br />
wesentlich <strong>für</strong> die Speicherung <strong>von</strong> Schriftdenkmälern der älteren Zeit bestimmt<br />
seien 67 ; ein Jahr zuvor spricht sich derselbe <strong>für</strong> die Erschließung nichtstaatlicher<br />
Archive aus: Der Staat operiert, wo er nicht selbst über die Gedächtnisträger verfügt,<br />
im Medium des Inventars, der »Verzeichnisse und - <strong>für</strong> wichtigere Documente<br />
- auch Abzüge und Abschriften solcher den Archivbezirk betreffender,<br />
historisch bedeutender Archivahcn«. 68 Die historische<br />
Destination als Trennung <strong>von</strong> residentem Gedächtnis und Arbeitsspeicher<br />
koppelt das Archiv <strong>von</strong> der Kybernetik der Gegenwart ab, deren Medium Registratur<br />
heißt; <strong>für</strong> die Herausbildung des preußischen Archivsystems nach 1815<br />
resümiert Paul Kehr die Koexistenz historischer, z. T. bis in die Zeit der Karolinger<br />
zurückreichende Archive, »auf die die Geschichtsforschung längst Ansprüche<br />
erhob«, gegenüber den Registraturen und Archiven der noch laufenden Verwaltung<br />
im alten Preußen, die bislang als arcana imperu diskursiven Bedürfnissen<br />
gegenüber verschlossen waren . Archivrat Bailleu erklärt es<br />
retrospektiv - aus der Perspektive des happy ends der finalen Durchsetzung des<br />
Provenienzprinzips in der Aktenordnung gegenüber dem »unhistonsch-bibliothekarischen«,<br />
also archivmedienfremden Prinzip der Ordnung nach dem Inhalt<br />
(Pertinenz) - zu einem Hauptfehler der preußischen Archivleitung nach 1815,<br />
»daß man nicht im Archiv einen Strich unter die alten Registraturen machte und<br />
die Aktengruppen der alten Behörden <strong>für</strong> geschlossen erklärte, wie ja auch die<br />
<strong>Geschichte</strong> unter das alte Preußen einen großen Strich gemacht hatte« 69 ; wo ein<br />
Staat derart eng mit seinem Archivwesen korreliert, wird ein Akten-Zeichen (der<br />
Strich) zum Historiogramm seiner <strong>Geschichte</strong>. Das Amt des obersten Direktors<br />
der Archive in Preußen, im Zuge der Archivreform 1832 geschaffen, ist zunächst<br />
mit juristisch vorgebildeten Verwaltungsbeamten besetzt; zwei seiner Träger,<br />
Tschoppe und Lancizolle, sind Mitglieder des bis 1843 bestehenden Ober-Censur-Collegiums.<br />
So direkt ist das Verhältnis <strong>von</strong> Speichern und Kontrolle im Staat.<br />
Das neue histori(sti)sche Bewußtsein des Archivs ist kein Effekt <strong>von</strong> Geschichts-<br />
67 Victor Loewe, Das Deutsche Archivwesen. Seine <strong>Geschichte</strong> und Organisation, Breslau<br />
(Pncbatsch) 1921, 4, unter Bezug auf v. Lancizollc, Denkschrift über die Preußischen<br />
Staatsarchive, als Manuskript gedr. Berlin 1855, (•><br />
(>s K. W. v. Lancizolle, Die Preußischen Provinzial-Archive und ihre Zukunft, Berlin<br />
1854, 3f; dazu Reinhold Koser, Über den gegenwärtigen Stand der Archivalischcn Forschung<br />
in Preußen, Leipzig (Hirzcl) 1900, 21<br />
M Paul Bailleu, Das Provenien/.pnnzip und dessen Anwendung im Berliner Geheimen<br />
Staatsarchive, in: Korrcspondenzblatt des Gcsammtvercins der deutschen Geschicks-<br />
und Alterthumsvereine 50 (Oktober / November 1902), 193-195 (193)
STAAT MACIU-N: PKI-.UISIN IN DHN AKCIIIVI-.N 607<br />
philosophie, sondern institutioneller Setzungen. Erst als Bismarck 1867 das Amt<br />
des Generaldirektors der Staatsarchive dem Geschichtsprofessor und Kronprinzen-Berater<br />
Max Duncker überträgt, tritt das Archivwesen in Preußen »aus seiner<br />
bisherigen Verborgenheit heraus und wurde, als mit der Reichsgründung das<br />
Geschichtsbewußtsein in Deutschland erwachte, bald Gegenstand allgemeiner<br />
Förderung«, verstärkt unter seinem Nachfolger Heinrich <strong>von</strong> Sybel seit 1875<br />
(dem Initiator der Preußischen Historischen Station in Rom nach Öffnung der<br />
Vatikanischen Archive). »Die Archive sollten zu Mittelpunkten der Besinnung<br />
auf die nationale Vergangenheit werden« . An dieser<br />
Stelle ist die histonographische Organisationsform <strong>von</strong> Archivdaten kaum in der<br />
Lage, die gegenseitige Bedingtheit <strong>von</strong> Geschichtsbewußtsein und Archiv- als<br />
Staatsgedächtnispolitik im Sinne einer Priorität (oder eines a priori) zu entscheiden.<br />
Ideologische Aufladung mit politischer Energie ist dann der Moment, wo<br />
administrative Gedächtnisinfrastruktur umschlägt in symbolisch-imaginäre<br />
Mehrwertigkeit. Lancizolles Nachfolger wird Max Duncker (1867-75), Kandidat<br />
Bismarcks, der sich (im Umgang mit Depeschen erfahren) <strong>für</strong> das Archivwesen<br />
immer interessiert. Duncker steht »als Historiker den technischen und den<br />
Fragen der inneren Organisation fern« - gerade die Ausschließhchkeit<br />
<strong>von</strong> Historie und Gedächtnisadministration wird dann thematisch.<br />
Duncker soll die Verbindung des Archivwesens mit dem wissenschaftlichen und<br />
geistigen Leben der Nation herstellen, also Schnittstellen des non-diskursiven<br />
Speichers zum Diskurs bilden; dem entspricht Bismarcks Wunsch, daß auch die<br />
preußischen Archive eine amtliche Pubhkationsstelle werden. Nicht auf den Staat,<br />
sondern die Nation zielt diese Kopplung an Öffentlichkeit, auf ihr Geschichtsgefühl<br />
und Geschichtsbewußtsein. Den amtlichen Charakter der Denkwürdigkeiten<br />
Hardenbergs hat der Bearbeiter Leopold <strong>von</strong> Ranke »fast ganz zu verwischen<br />
verstanden, weil er glaubte, daß dieser seinem Rufe schaden könne«; die <strong>von</strong><br />
Duncker angeregte Herausgabe der Politischen Korrespondenz Friedrichs des<br />
Großen geriet schließlich in die Hände der Berliner Akademie der Wissenschaften<br />
.<br />
Die Architektur des Archivs macht keinen Unterschied zwischen Befehl und<br />
Daten, sobald etwa das Geheime Staatsarchiv in Berlin nicht nur das Gedächtnis<br />
Preußens, sondern mit den Akten der Preußischen Archnvverwaltung auch sein<br />
eigenes Betriebssystem archiviert. Methodisch führt die Erforschung des protected<br />
mode der <strong>Geschichte</strong> als Archiv (d. h. ihrer Gedächtnis- und Übermittlungstechnikcn)<br />
zur Nichtunterscheidung <strong>von</strong> read only memory und randorn access<br />
memory. 70 Gedächtnismedienwissenschaft befaßt sich mit den Krypten, den<br />
70 Siehe I ; riedrich Kittler, Protcctcd Mode, in: Manfred I-'aßlcr / Wulf 1 hlbaeh (I li;.), Inszenierung<br />
<strong>von</strong> Information. Motive elektronischer Ordnung, Gießen (l'ocus) 1992,<br />
82-92 (82)
608 ARCHIV<br />
Betriebsgeheimnissen des Archivs, jenen dem Diskurs verschlossenen und trotzdem<br />
wirksamen Praktiken, welche Gedächtnishandlungen auf kalkulierte Weise<br />
steuern; der Wissensarchäologe steigt in jene kaltglühenden Schächte hinab. 71<br />
1882 wird die Forderung nach Veröffentlichung der Findbücher deutschlandweit:<br />
»Binnen kurzem muss man sich dazu verstehen alle Rcpcrtonen und Register der<br />
staatlichen Archive <strong>für</strong> die Benutzung frei zu geben ; denn ihr Verschluss ist<br />
so unhaltbar wie die fast allgemein üblichen Vorschriften der Administration über<br />
das Recht zur Benutzung eines Archivs. häufiger läßt man die schriftlichen<br />
Spuren vergangenen Lebens sich verwischen: wo man sie nicht muthwilhg austilgt,<br />
entzieht man sie wenigstens der Benutzung und gibt sie gleichgültig dem Verfall<br />
preis. Es wird in den meisten Städten des Vaterlandes hierdurch ein öffentliches<br />
Interesse verletzt zum Schaden <strong>für</strong> Gegenwart und Zukunft.« 72 ,<br />
Diese buchstäblich gedächtnismedicnarchäologische Situation stellt die Frage des<br />
Zugangs zur Information/ 3 Friedrich Meinecke beschreibt die Atmosphäre<br />
während seiner Arbeitsjahre seit 1887 als angehender Archivar im alten Gebäude<br />
des Geheimen Staatsarchivs (Berlin, zwischen Neuer Friedrich- und Klosterstraße,<br />
ehemaliger Platz der brandenburgischen Markgrafen). Nicht Vergangenheit,<br />
sondern Gegenwart ist die tägliche Erfahrung im Umgang mit Benutzern<br />
wie dem Historiker Treitschke, der die ihm vorgelegten Akten mit Emotion las;<br />
«dumpfe Laute des Staunens oder der Entrüstung kamen dabei zuweil aus seinem<br />
Munde«'' 1 , der random noisc historischer Information. Nicht aber das Interlace<br />
zum wissenschaftlichen Gast, sondern der Raum des Magazins, das archivische<br />
Gestell des Gedächtnisses kann sich Meinecke dessen Wesen diskursiv, d. h.<br />
ambulant aneignen: »Gehen Sie nur recht viel herum, sagte man mir in den ersten<br />
Monaten, und sehen Sie sich an, was Sie interessiert. Denn der Archivar muß ein<br />
Liebesverhältnis zu seinem Archiv bekommen wie der Sammler zu seinen Schätzen«<br />
- Buchstaben-Lese .<br />
»In diesen gewaltigen Aktenmassen, die man, wenn man ins Magazin ging, durchwanderte<br />
und oft mit Leitern zu erklettern hatte, steckte ja ein ungeheures, aber<br />
schweigendes Leben - wie man einer Flasche mit starker Flüssigkeit die Kraft nicht<br />
ansieht, die in ihr steckt. man brauchte nur eines der Aktenbündel aufzu-<br />
71 In Anlehnung Laurence Bataillcs Definition der wirksamen Archive, zitiert als Motto<br />
im Vorwort (Elisabeth Leypold) zu dies., Der Nabel des Traums. Von einer Praxis der<br />
Psychoanalyse, Berlin (Quadriga) 1988 (Hinweis Mai Wegener, Berlin)<br />
72 Konstantin 1 lühlbaum, Über Archive. Zur Orientirung , in: ders. (I Ig.), Mittheilungen<br />
aus dem Stadtarchiv <strong>von</strong> Köln, 1. lieft, Köln (DuMont) 1882, 1-15 (8 u. 9)<br />
73 »Die Öffentlichkeit müßte freien Zugang zu den Speichern und Datenbanken erhalten«:<br />
Jean-Francois Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien (in: Theatrum<br />
machinarum 3/4) 1982; 2. Neuauflage Wien (Passagen) 1993, 192 (frz. La condition postmoderne,<br />
Paris 1993)<br />
74 Friedrich Meinecke, Erlebtes 1862-1901, Leipzig (Koehler & Amelang) 1941, 138
STAAT MACIH-N: PRI:UUI-:N IN DKN ARCHIVEN 609<br />
schnüren und zu lesen anzulangen, um solort einen unmittelbaren Kontakt mit<br />
vergangenem Leben zu gewinnen.« 7 ''<br />
- eine taktile Variante <strong>von</strong> Fiktion im Archiv. Die sensuelle Ästhetik der Antiquare,<br />
a taste oftbepast, das quasi »eßbare Fragment« 76 liefert die Kalorien <strong>für</strong><br />
die historische Forschung. War es doch schon Jules Michelets Resurrektionsphantasma,<br />
Leben dort zu halluzinieren, wo tatsächlich nichts als Knochen, Buchstaben,<br />
Signifikanten verwe(i)sen. Dieser materialen Lesart <strong>von</strong> Monumenten der<br />
Vergangenheit steht, unter verkehrten Vorzeichen, eine Meldung unter Vermischtes<br />
aus Nürnberg vom 25. Mai in der Vossische Zeitung Nr. 124 (1855)<br />
über einen Archivar zur Seite, der Dokumente in die Makulatur gibt 77 - die materialistische<br />
Lesart des Archivs. <strong>Im</strong> Epizentrum des preußischen Staatsgedächtnisses<br />
»lagen die Papiere Friedrichs des Großen«, in augenfälliger Rückkopplung<br />
zum Erdgeschoß des Archivgebäudes, wo inmitten der Aktenreposituren das<br />
Gipsmodell der Reiterstatue des Rauchschen Friedrichsdenkmals stand, also<br />
wolle sich die historische <strong>Im</strong>agination, die immer der Figuration bedarf, um aus<br />
Buchstabenketten Leben zu halluzinieren, ihre konkretes Korrelat im Realen des<br />
Objekts erzwingt . Meinecke schreibt vom unmittelbaren Kontakt<br />
mit vergangenem Leben: Was sich hier literarisch elegant schreibt, ist nicht<br />
schlicht die Rhetorik der Prosopopöie, welche aus toter Materie Lebewesen halluziniert<br />
Lind wi.s.scnsarehaologisches Schweigen mit logozcntnstischer Stimme,<br />
dem Medien narrativer Historie, versieht; Meinecke beschreibt den energetischen<br />
Effekt, mit dem stumme Daten erst in historische <strong>Im</strong>agination verwandelt werden<br />
können, in Begriffen, die an in Leydener Flaschen gespeicherte Elektrizität<br />
erinnert; der unmittelbare Kontakt mit vergangenem Leben anhand ihrer Aktenreste<br />
liest sich analog zu den Expenmentalanordnungen seiner Zeit, in denen etwa<br />
ein Emil Du Bois-Raymond frische Froschschenkel forschend an elektrische<br />
Schaltkreise schließt und Duchcnne de Boulogne menschliche Organismen {etnatome<br />
animata) ebenso schaltbar macht (die positive Elektrode an einen Gesichtsmuskel,<br />
die negative zur Ableitung); die Energie menschlicher Schmerzausdrücke<br />
(etwa die Pathosformel des antiken Laocoon) wird damit in Quanten faßbar. 78<br />
Prompt steht auch Meinecke sinnend vor der Repositur 49 des Geheimen Staats-<br />
1 Ebd., 138f. Siehe auch Isehn Gundermann, Das Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem,<br />
in: Museumsjournal 1/1991, 24t<br />
' Siehe Stephen Bann, Clio in Part: On Antiquananism and the 1 listorieal I'iagmcnt, in:<br />
Pcrspecta. The Yale Architectural Journal 23 (1987), 24-37 (bes. 35)<br />
' GehStaAr Berlin, Rep. 178, Abt. VII, Nr. 1, Nachrichten über fremde Archive (auch<br />
historische Museen) 1844-1869, Bl. 60r/v, 61 v<br />
: Duchcnne de Boulogne, Lc Mechanismc de la Physiognomie humaine, Paris 1862.<br />
Siehe Simon Richter, Laocoon's Body and the Aesthetics of Pain, Detroit, Mich.<br />
(WayncUP) 1992, 193-198
610 • ARCHIV<br />
archivs, in welcher die Akten über Schwerverbrecher, homicidia, stupra usw. aus<br />
Jahrhunderten enthält: »Welche schauerlichen Abgründe <strong>von</strong> Verworfenheit,<br />
Unglück, Elend längst vergessener Menschen, welche Einblicke in die dumpfe<br />
Psyche der kleinen Leute <strong>von</strong> ehemals, wen man nur irgendein Paket vornahm<br />
und blätterte« . <strong>Im</strong> Sinne dieser Fluidik im Zwischenraum<br />
archivischer Ordnungsnummern sprechen Deleuze / Guattan <strong>von</strong> »Zeichen<br />
ohne Signifikanten, die der Ordnung des Wunsches Folge leisten: Atemzüge und<br />
Schreie.« 79<br />
Lange, bevor der Geheime Staatsarchiv nach dem Zusammenbruch Preußens<br />
zum historischen Archiv (auch in der Archivterminologie) wird, liegt seine Funktion<br />
zunächst weniger im Service <strong>für</strong> Benutzer, sondern primär in amtlichen<br />
Recherchen <strong>für</strong> Behörden, »in Nachwirkung der alten Rechtsauffassung, daß das<br />
Archiv nur staatlichen Zwecken zu dienen habe« . Hier<br />
geht es also um administrative Betreffe; erst zögernd {seit etwa 1866 unter Max<br />
Dunckcr, dann unter Sybel als Archivdirektor) setzt sich eine wissenschaftliche,<br />
und das heißt zu diesem Zeitpunkt: histonstische Auflassung der Archivzwecke<br />
durch; Funktion dieser diskursiven Umkodierung (oder umgekehrt ihre Bedingung?)<br />
ist die Emergenz jener Revolution im Archiv, die Meinecke als Einführung<br />
des Provenienz- als Ordnungsprinzip erlebt - eine wissensarchäologische<br />
Umschichtung, die auch ein Kampf <strong>von</strong> Personen um die Macht war .<br />
Hatte der Archivar und Günstling Dunckers Paul Hassel die Akten noch nach<br />
ihrem Inhalt ordnen lassen, fordern Max Lehmann und Bailleu demgegenüber die<br />
Ordnung nach ihrer geschichtlichen Herkunft, »d. h. eigentlich in ihrer natürlichen<br />
Ordnung, wie sie als Registraturen bestimmter einzelner Behörden entstanden<br />
sind« . Die Ordnung der Historie wird damit mit der Ordnung<br />
ihres Gedächtnisses gleichgesetzt und die archivische Verzeichnung ein Effekt des<br />
Realen. Gerade die Umschaltung <strong>von</strong> Akteninhalt auf ihren verwaltungskybernetischen<br />
Stellenwert als radikale Entsemantisierung (der systematischen Betreffe)<br />
macht sie mit historischer Semantik aufladbar. Mit dem vom Archivar Lehmann<br />
konzipierten Regulativ <strong>für</strong> die Ordnungsarbeiten im Geheimen Staatsarchiv am<br />
1. Juli 1881 80 kommt das Provenienzpnnzip auch retrospektiv zur Durchführung;<br />
»der Gedanke , die Akten nach ihrer Provenienz zu ordnen, brachte mit<br />
einem Male unglaublich viel Lebendiges und Individualität in das Ganze des<br />
Archivs« - Einbruch histonstischer Ästhetik (Meinecke spricht <strong>von</strong> ästhetischer<br />
79 Gilles Deleuze / Felix Guattan, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 6. Aufl. 1992, 313<br />
so Dazu Ernst Posner, Max Lehmann and the Genesis oi the Prmciple o\ Provenance<br />
[in: Indian Archives, Jan- Juni 1950], in: [Ernst Posner], Archives & the Public Interest.<br />
Selected Essays by Ernst Posner, hg. v. Ken Munden, Wahsington (Public Affair)<br />
1967, 36ff
STAAT MACIIKN: PKT.UÜKN IN DI-;N ARCHIVEN 611<br />
Freude) in den non-diskursiven Raum des Gedächtnisses. »Denn jede einzelne<br />
Behördensignatur war jetzt ein Lebewesen <strong>für</strong> sich mit eigenem Lebenspnnzip,<br />
und die bestimmten Menschen mit besonderen Traditionen und <strong>Im</strong>pulsen,<br />
die einst diese Behörden geleitet hatten, traten nun in das Licht« - als organlose Körper, Effekte der Archiv-Maschine. Die alten<br />
Reposituren werden wieder als Einheit aufgestellt und erhalten eigene Nummern,<br />
versehen mit Indices. Daß die Steuerung dieser Umordnung in absehbarer Zeit<br />
überhaupt möglich war, verdankt sich einem medialen Effekt der Gedächtnisformatierung:<br />
Seit dem 18. Jahrhundert waren preußische Behörden verpflichtet, ihre<br />
Akten zu heften, »weshalb im Archiv die Verschmelzung der Akten verschiedenen<br />
Ursprungs doch meist nur äußerlich geblieben ist und die Sonderung<br />
unschwer erfolgen konnte« . Modular gebündelte Datensätze<br />
sind, objektorientiert, umprogrammierbar. Das Regulativ <strong>von</strong> 1881 geht da<strong>von</strong><br />
aus, daß die Registraturgliederung in jedem Fall auch wirkliche Ordnung sei:<br />
»Dies war im Berliner Geheimen Staatsarchiv bei dem vortrefflichen Zustand der<br />
preußischen Ministenalregistraturen durchaus begründet.« 81 Damit bildet, in<br />
Preußen spezifisch, das Staatsarchiv den Staat zunächst selbst mit, dann ab. Die<br />
Rede ist, durch die rhetorische Figur der Mimesis präfiguriert, <strong>von</strong> einer Gliederung<br />
der Archivbestände nach den Behörden, »worin die Entwicklungsgeschichte<br />
des preußischen Staates sich wiederspiegelt, wie die Schichten der Erdrinde den<br />
Entwicklungsprozeß unseres Weltkörpers wiederspiegeln« .<br />
Das geologische Bild meint, aufgeladen und deflektiert durch den allegorischen<br />
Willen des Diskurses zur <strong>Geschichte</strong>, Evolution, beschreibt aber implizit (d. h.<br />
tatsächlich) einen wissensarchäologischen Befund, nämlich die nicht historische,<br />
sondern kybernetische Kopplung der Akten. Es ist Effekt einer Prolepse, wenn<br />
ganz im Sinne Hegels »der historische Process und die Entwickclung des Staatsorganismus<br />
identisch« behauptet wird ; indem das Provenienzprmzip<br />
die historische Vergegenwärtigung <strong>von</strong> Akten erst möglich macht, bildet<br />
das Archiv die <strong>Geschichte</strong> des Staates nicht ab, sondern ein. »The archive, the<br />
sum total of what can or cannot be said or done, has become the very form of the<br />
modern State.« 82 Bailleus Metapher der Aktenspeicherung ist wörtlich, als technische<br />
Übertragung zu lesen, insofern<br />
»jedes Stück so zu sagen einen schon reservierten Platz, d. h. im Archiv denselben<br />
Platz wiedererhält, den es schon im Ministerium inne gehabt hat. Die Registraturen<br />
des Auswärtigen Amtes im Ministerium und im Archiv sind zwei Hälften eines<br />
Sl Gerhart Enders, Probleme des Provemcnzpnnzips, in: Archivar und Historiker (Festschrift<br />
H. O. Meisner), Berlin 1956, 27-44 (29)<br />
82 Thomas Richards, The <strong>Im</strong>perial Archive. Knowledge and the Fantasy of Empire, London<br />
/ New York (Verso) 1993, 152, unter Bezug auf Thomas Pynchons Roman Gravity's<br />
Rainbow und Michel Foucaults Archäologie des Wissens
612 ARCHIV<br />
organischen Ganzen; denkt man sich diese beiden ungeheuren Aktenmassen, deren<br />
einzelne Glieder wie zwei Räder einer Maschine haarscharf ineinanderpassen,<br />
zusammengeschoben, so würde die Aktenmasse des Archivs die Lücken in den<br />
Ministerialrcgistraturen ausfüllen und umgekehrt.« <br />
Auch dieses Bild schwankt unentschieden zwischen Maschinen- und Organismusmetapher,<br />
deren analytische und synthetische Auflösungsversuche (Staat -<br />
Maschine - Organismus) auch im Gedächtnisbereich (Erinnerung versus<br />
Speicher) das double-bind zwischen kybernetischer Einsicht in das Maschinale<br />
der Archive und den idealistischen Willen zur Begründung der Historie nur<br />
aufschieben, nicht aufheben kann. 83 Wo Entwicklungsgeschichten die Funktion<br />
eines archivischen Algorithmus sind, greift auch der Kulturphilosoph auf Begriffe<br />
der Theoretischen Kinematik zurück. 84 Da nun Akten nach dem Provenienzprinzip<br />
nicht mehr gegenstandsbezogen bequem zusammenliegen, ist<br />
damit allerdings die Anlage »übersichtlicher Verzeichnisse und guter Register«<br />
notwendig : eine Akzentverschiebung <strong>von</strong> der Adressierung des Speichers<br />
als Hardware, als Gedächtnisphysik, zu seiner Informatisation. Diese<br />
Durchsetzung ist, kaschiert unter dem Tarnnamen <strong>Geschichte</strong>, in Deutschland<br />
eine gedächtnisprogrammatische Leistung des nur vordergründig historistischen<br />
Jahrhunderts zwischen Befreiungskriegen und Weltkrieg I.<br />
Das Repertorium der preußischen Staatsarchive und das Generalrepertonum<br />
des Nürnberger GNM bilden notwendig Schnittstellen, wie es am 8. April 1904<br />
der Antrag des Archivdirektors des Kgl. Staatsarchivs Düsseldorf Ilgen auf eine<br />
Dienstreise nach Oberzenn und Nürnberg an den damaligen Generaldirektor<br />
der Staatsarchive, Koser, begründet. Er beabsichtigt im Archiv des Germanischen<br />
Museums dasjenige archivahschc Material nach dem Repertorium zu<br />
verzeichnen, welches den Niederrhein betrifft, zumal sich unter den Akten des<br />
Staatsarchivs aus dem Jahr 1874 bereits Notizen über die den betreffenden<br />
Sprengel angehenden Archivalien des fraglichen Instituts gefunden hatten. S:)<br />
Analog gilt es <strong>für</strong> nicht-staatliche, besonders kirchliche Archive auf die Erhal-<br />
83 Siehe Barbara Stollberg-Rilinger, Der Staat als Maschine: zur politischen Mctaphorik<br />
des absoluten Fürstenstaats, Berlin (Duncker & Humblot) 1986, die schon in der<br />
Einleitung darauf hinweist, daß <strong>Im</strong>manuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft, § 59<br />
(Werkausgabe, hg. v. W. Wcischedel, Bd. X, Frankfurt/M. 1974, 296) sowohl die organizistischc<br />
als auch die maschinale Staatsvorstellung als »nur symbolisch vorgestellt«<br />
entlarvt.<br />
X4 So ausdrücklich Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte<br />
der Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig (Wesermann)<br />
1877,342<br />
83 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Akten des Direktoriums<br />
der Staatsarchive, betreffend das Germanische Museum in Nürnberg, Bd. 1 v.<br />
1854 bis 1904,1. Rep 178 Abt. VII, s. p. (Auszug)
STAAT MACMI-N: PKI-;UI.U-:N IN DI-.N ARC 613<br />
tung solcher Archivalien hinzuwirken und auf die Bereitwilligkeit der Königlichen<br />
Archivverwaltung zu dessen Aufbewahrung hinzuweisen. Aufbewahrung<br />
heißt im Falle der Tätigkeit des Archivrats Wolff in der Provinz Brandenburg<br />
zunächst lediglich symbolisch die Herstellung eines Verzeichnisses der in kirchlichem,<br />
gemeindlichem und privatem Besitz befindlichen Archivalien (erst nach<br />
der Trennung <strong>von</strong> Kirche und Staat 1919 bildet die evangelische Kirche ein<br />
selbständiges Archiv), »dann aber auch um deren Sammlung.« 86 Während sich<br />
das GNM aus der Notwendigkeit, keine staatliche Aquisitionsgewak über deutsche<br />
Archivallen zu besitzen, sogleich auf die symbolische Aufzeichnung des<br />
archivischen Gedächtnisses verlegt, verbleibt die Archivierungspraxis der preußischen<br />
Staatsarchive im double-bind zwischen juristischem Artefakt (Monument)<br />
und historischer Information (Dokument). Das Recht des Staates auf Archivalien,<br />
die »dem Verkehr entzogen, also nicht ersitzungsfähig« sind, definiert einen<br />
non-diskursiven Aggregatzustand <strong>von</strong> Gedächtnis, dem »die landläufige Wertung<br />
der Archive vorwiegend als Insitute zur Forderung historischer Studien«<br />
(Ilgen am 13. Oktober 1911) entgegensteht. 87<br />
Geheimes Staatsarchiv Berlin, Akten des Direktoriums der Staatsarchive, betreffend<br />
Dcnkmalarchive, Bd. 1 v. 20. Juni 1912 bis 1939, Rep. 178 Abt. VII. Schriftverkehr<br />
Koser- Kirchenkonsistorium Brandenburg betr. evtl. Niederlegung Kirchcnarchivalien<br />
im Geheimen-Staatsarchiv, Bl. 7. Schreiben des Königlichen Konsistoriums der<br />
Provinz Brandenburg v. 10. Januar 1913, an den Generaldirektor der Staatsarchive.<br />
Ernst Müller, Das Recht des Staates an seinen Archivallen, erläutert an zwei Prozessen<br />
des preußischen Staates, in: Archivalische Zeitschrift 36 (München 1926, Reprint<br />
Nendeln 1975), 164-177 (172)
614 . ARCHIV<br />
Archive im politischen Einsatz<br />
Wilhelm Rohr notiert <strong>für</strong> das Ende des 19. Jahrhunderts den Niedergang im<br />
preußischen Registraturwesen, wo »Referentensignaturen, unverzeichnet, mangelhaft<br />
signiert, auf Ablageböden« durchcinanderliegen. 1 Demgegenüber wird in<br />
der Weimarer Republik die Nachvollziehbarkcit der Behördentätigkeit als neues<br />
Ziel der Aktenbewertung angegeben, bezogen auf Akten der Militärverwaltung<br />
und der Kriegswirtschaftsbehörden. 2 Mit dieser Dynamisierung und Kybcrnctisierung<br />
des inlormationsreZnc"zW korrespondiert die neue 1 lerausgeberpohuk<br />
der Archivahschen Zeitschrift; »<strong>für</strong> die Aufnahme in unsere archivalische Fachzeitschrift<br />
genügt es fortan nicht mehr, daß ein Beitrag auf Archivalien beruhe, er<br />
muß sich vielmehr m erster Linie auf Archive, Archivalien und deren<br />
Nutzbarmachung beziehen.« 3 Karl Otto Müller<br />
definiert in seinem Beitrag Fragen der Aktenausscheidung deren erweitertes,<br />
kulturwissenschaftliches Kriterium 4 ; bereits die Generalklausel im württembergischen<br />
Kassationsplan <strong>von</strong> 1922 bestimmt, daß <strong>von</strong> den zu vernichtenden Akten<br />
alle, die einen geschichtlichen oder Altertumswert haben »oder sonstwie <strong>von</strong> allgemeiner<br />
Bedeutung sind«, dem Archiv anzubieten seien . Es ist Aufgabe des Archivs, auf eine Vervollständigung seiner Bestände<br />
in der Richtung hinzuarbeiten, »daß sie ein möglichst abgerundetes Bild aller politischen,<br />
rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebensverhältnisse seines<br />
Landes innerhalb der einzelnen Zeiträume bieten« . Das Ideal<br />
einer histoire totale bedeutet die Mimesis des Archivs (als Datenempfänger) an<br />
das Bild der Historie (als vergangener Gegenwart); »the reeeiver is a sort of<br />
inverse transmitter, changing the transmitted signal back into a message, and<br />
handling this message on to the destination« 5 - Transformation <strong>von</strong> behördlich<br />
gewonnen Datenmengen in Information <strong>für</strong> Historiographie. Ernst Zipfel publiziert<br />
1926 Richtlinien über das Aktenbewertungsverfahren; ein bewertender<br />
Archivar soll mit dem Bearbeiter der eingehenden Unterlagen Kontakt aufnehmen.<br />
»Gegenüberlieferung im staatlichen Schriftgut war schon im Reichsarchiv<br />
vorhanden, und sogar die Arbeitsstätten, die »industriellen Werkes konnten<br />
besichtigt werden« . Damit korrespondiert ein offen-<br />
1<br />
Wilhelm Rohr, Das Aktenwesen der preußischen Regierungen, in: Archivalische Zeitschrift<br />
45 (1939), 52ff<br />
2<br />
Angelika Menne-Haritz, Das Provenienzprinzip - ein Bewertungssurrogat? Neue<br />
Fragen zu einer alten Diskussion, in: Der Archivar 47, Heft 2 / 1994, 230-252 (231)<br />
3<br />
Otto Riedner / Ivo Stnedinger, Zur Einführung, in: Archivalische Zeitschrift 35<br />
(1925), 1<br />
4<br />
In: Archivalische Zeitschrift 36 (1926), 188-215<br />
3 ::<br />
Claude Shannon / Warren Weaver, Mathematical Theory of Cominunication ( '1949),<br />
Urbana (University of Illinois Press) 1963, 7
ARCI IIVH IM POLITISCHEN EINSATZ . 615<br />
sives, iniormationsgebendes Selbstverständnis des Archivs, das sich etwa durch<br />
Beteiligung an technischen, beruflichen und wirtschaftlichen Ausstellungen ausweist<br />
um nachzuweisen, »daß auch die Technik der Neuzeit in der Vergangenheit<br />
wurzelt und daß die Wissenschaft aus den Archiven die Quellen entnimmt,<br />
die diese wichtigen Zusammenhänge klarstellen.« In Ermangelung spezifischer<br />
Wirtschaftsarchive wächst den Staats- und Stadtarchiven die Aufgabe zu, »die<br />
Geschäftswelt überhaupt mit aufmerksam zu machen, daß .die Archive nicht allein<br />
<strong>von</strong> Staatsaktionen, Kriegen, höfische Dingen u. dgl. handeln.« Insofern steht das<br />
Speichermedium Archiv im Bund mit dem neuen Reportagemedium Fernsehen:<br />
»Zunächst wird vermutlich die >Reportage< sich des Fernsehens im weitesten<br />
Umfange bedienen können. Ein Gang durch Fabriken, Hafenanlagen, fesselnde<br />
Betnebe wird uns in seinen Bann ziehen.« 6 Die beschleunigte Zeiterfahrung<br />
der Weimarer Republik bedarf der Archive als Feedback-Agenturen der sozialen<br />
Autopoiesis - ein politisch erzieherisches Moment, denn »unsere Zeit braucht dingend<br />
Hinweise auf die Vergangenheit. Keine Zeit war so geneigt, besonders<br />
auf technischem Gebiete, zu vergessen, daß keine Zeitperiode, kein Volk denkbar<br />
ist als reines selbstschöpfensches Eigenerzeugnis, daß vielmehr alles die<br />
Folge und Auswirkung der Zustände und Ereignisse der Vergangenheit bildet.« 7<br />
Damit wird das Archiv zur Agentur aktiver Rehgation <strong>von</strong> Gegenwart an Speicher.<br />
Das Ende des staatsautoritären Gedächtnisses ist der Beginn des Forums,<br />
wenn der Souverän das Volk selbst heißt. Von memory schreitet das Archiv zur<br />
Verarbeitung des Geschehens in realtime (Zeitgeschehen), vom Ort der Remanenz<br />
zum feedback. Diese neue Gedächtnisästhetik ist eine Funktion der politischen<br />
Kultur der Weimarer Republik. Der Staat soll »Sorge da<strong>für</strong> tragen, daß er<br />
um seiner gegenwärtigen Reputation willen seinen Geschäftsverkehr, d. h. seine<br />
politischen Lebensäußerungen so belegt, daß er sie zu jeder Zeit zu vertreten und<br />
zu rechtfertigen vermag.« Nicht mehr Mittelalterspezialisten, sondern archivarische<br />
Generalisten mit neuen fachlichen Quahfikationsschwcrpunkten werden<br />
deshalb in den Archiven gebraucht. 8 Das non-diskursive Gedächtnisaggregat<br />
Archiv bildet eine bislang unerprobte Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Die Schulung<br />
der Archivare in den historischen Hilfswissenschaften war die längste Zeit<br />
das wissenschaftliche und methodische Band, das die Archive zusammenhält:<br />
h Seboldt, Die Weltzeituhr, in: Fernsehen. Zeitschrift <strong>für</strong> Technik und Kultur des gesamten<br />
elektrischen Fernsehwesens, 1. Jg. Nr. 8/1930, 373f, zitiert nach: Heide Riedel,<br />
Fernsehen - Von der Vision zum Programm. 50 Jahre Programmdienst in Deutschland,<br />
hg. v. Deutsches Rundfunk-Museum e. V. Berlin 1985, 54<br />
7 Woldemar Lippert, Archivausstellungen. Erfahrungen und Gedanken, m: Archivalische<br />
Zeitschrift, 37. Bd., München 1928 (Reprint Ncndeln 1975), 110-124 (122, 124)<br />
8 Mcnne-Haritz 1994: 232f, unter Zitation <strong>von</strong>: Ernst Müsebeck, Der Einfluß des Weltkrieges<br />
auf die archivalische Methode, Vortrag auf dem 20. Deutschen Archivtag in<br />
Danzig 1928, in: Archivalische Zeitschrift 38, 1929, 135-150 (144)
616 ARCHIV<br />
»Aber ist es heute noch so? Hat sich nicht der Begriff der historischen Hilfswissenschaften<br />
<strong>für</strong> das 18.-20. Jahrhundert erweitert; gehören jetzt nicht Wissenschaften<br />
zu ihrem Bereich, die vorher ganz abseits des Weges lagen? - Das weite<br />
Gebiet der Nationalökonomie und der Wirtschaftsgeschichte, dem Bank- und<br />
Börsenwesen, der Soziologie, der <strong>Geschichte</strong> der Technik und des Verkehrs gehören<br />
zu den Gebieten, die der wissenschaftliche Beamte eines modernen Aktenarchivs<br />
unter allen Umständen beherrschen muß. Sie sind vielschichtiger <strong>für</strong> ihn<br />
als etwa die genaue Kenntnis und Durchbildung in der Paläographie und Diplomatik<br />
der ersten I Iälfte des Mittelalters. Je langer, je mehr werden aber alle unsere<br />
großen Staats- und Stadtarchive zu Archiven des 19./20. Jahrhunderts. Der Ausgang<br />
des Weltkrieges, die Umbildung unseres politischen Lebens beschleunigen<br />
diesen Prozeß.« <br />
Die theoretischen Artikel in den archivischen Fachzeitschriften aus der Zeit der<br />
Weimarer Republik (meist Archivtagsvorträge) lassen ahnen, daß die Archive<br />
sich durch Massen <strong>von</strong> Papier überschwemmt fühlen. Antwort darauf sind erste<br />
Bausteine zu einer Bewertungstheone - ein Prozeß<br />
analog zu dem, der im 18. Jahrhundert unter dem Druck sich wandelnder Pluralitäten<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>n zur Konzeption des übergreifenden Kollektivsingulars<br />
<strong>Geschichte</strong> führt. Reduktion <strong>von</strong> Komplexität ist die Strategie hinter<br />
historischen Diskursen; Verwaltungswissenschaften ist dies zunächst vertraut. 9<br />
Schließlich speichert das Archiv nicht nur Daten, sondern auch seine eigenen<br />
Programme; nach Übernahme der Akten des Direktoriums der Staatsarchive<br />
durch das Geheime Staatsarchiv im Jahre 1930 erfährt der Bestand eine Bearbeitung,<br />
bei der das alte Registraturschema zugrundegelegt wird. 10 Paul Fridolin<br />
Kehr, zur Zeit der Weimarer Republik Generaldirektor der preußischen Archive,<br />
wird als dort gespeicherter Nachlaß selbst zum Objekt seines Mediums:<br />
»Bei der Revision der wenig intensiv verzeichneten Korrespondenz im Sommer 1992<br />
und Juni/Juli 1993 wurde festgestellt, daß die ursprüngliche Ordnung durch häufige<br />
Benutzung wcitestgehend zerstört worden ist. Der Bearbeiter hatte die Briefe<br />
zunächst kaufmännisch abgelegt. Eine Folncrung war unterblieben. Sie wurde erst<br />
im Laufe der Benutzung vorgenommen und fixiert nun den durcheinander geratenen<br />
Zustand. Da keine Zeit <strong>für</strong> eine Neubearbeitung zur Verfügung stand, wurde nur<br />
die alphabetische Reihung der Briefe - allerdings buchmäßig - wiederhergestellt,«''<br />
- reines Verfahren als archivtechnische, nicht länger hermeneutische Reduktion<br />
historischer Komplexität.<br />
9<br />
Siehe Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation (1964), 3. Aufl.<br />
Berlin (Duncker & Humblot) 1976<br />
10<br />
Geheimes Staatsarchiv Berlin, Findbuch Rcp. 178, 2.3.31. Gencraldircktonum der<br />
Staatsarchive 1823-1945<br />
»Vorbemerkung« Dr. Kohnke, 27. April 1977<br />
" Geheimes Staatsarchiv, Repositur 92, Nachlaß Kehr, »Vorbemerkungen« Archivrat<br />
Endlerjuli 1993
1933 (folgende)<br />
ARCHIVK IM POLITISCHEN EINSATZ 617<br />
Die prominente Rolle <strong>von</strong> Archiven im Dritten Reich ist kein Effekt <strong>von</strong><br />
Geschichtsbewußtsein, sondern einer statistischen Notwendigkeit: »Insbesondere<br />
war es der <strong>von</strong> allen Staatsbürgern verlangte Nachweis der >anschen Abstammungs<br />
der eine ungeahnte Flut <strong>von</strong> Arbeit über die allzukleine Schar der<br />
Archivare hereinbrechen ließ« , eine »Sintflut <strong>von</strong> genealogischen<br />
Anfragen« . Vor allem aber geraten die Archive der NSDAP<br />
und die Staatsarchive in Konflikt. Ein Auszug aus dem Ministerialblatt <strong>für</strong> das<br />
Reichs- und Preußische Ministerium des Innern vom 16. September 1936<br />
betrifft die Sicherung geschichtlicher Unterlagen aus der Kampfzeit der nationalsozialistischen<br />
Bewegung, unter Bezug auf einen Runderlais des Reichs- und<br />
Preußischen Ministers des Innern vom 4. September 1936 12 , worin die staatlichen<br />
Archive ersucht werden, bei den regelmäßigen Aktenaussonderungen ein<br />
besonderes Augenmerk darauf zu richten, entsprechendes Schriftgut nicht zu<br />
vernichten, sondern archivarisch zu sichern. 13 In einem Schriftstück 14 heißt<br />
schon in einer antizipierenden, vergangene Zukunft heischenden Transformation<br />
<strong>von</strong> administrativem Monument zum gedeutetem Dokument geschichtlich,<br />
was zunächst erst archivarisch zu definieren ist . Himmlers Runderlaß<br />
als Reichsführcr SS und Chef der Deutschen Polizei vom Dezember<br />
1936 15 präzisiert die Aufspeicherung <strong>von</strong> bei den Dienststellen der Polizei<br />
befindlichem Material aus der Frühzeit der nationalsozialistischen Bewegung,<br />
das <strong>für</strong> eine kommende Geschichtsschreibung <strong>von</strong> großer Bedeutung sei; besonders<br />
polizeiliche Untersuchungsakten, in denen führende Persönlichkeiten der<br />
Bewegung genannt sind, polizeiliche Berichte <strong>von</strong> Zusammenstößen politischer<br />
Art u. ä. . Jeder Aktenmonopolisierung als Aussage vorgeschaltet<br />
ist ihre inventarische Erfassung als Nachricht an das Hauptarchiv der NSDAP<br />
in München. Um sicherzustellen, daß alle <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> der Partei wichtigen<br />
Akten an einer zentralen Stelle ausgewertet werden, ersucht Himmler,<br />
das Material zu sichten und dem Hauptarchiv über das Geheime Staatspolizeiamt<br />
in Berlin eine Aufstellung mit kurzer Inhaltsangabe der in Frage kommenden<br />
Akten zu übersenden, welches dann mit ihm wegen der Herausgabe<br />
der Akten in Vcrbidung tritt. In diesem Moment aber definieren die Staatsarchive<br />
Gedächtnis, das des Staates ist, als Widerstand. Unter dem Aktenzei-<br />
12 IB 25487/11890<br />
13 Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 178 VII, Nr. 2, E 19, Akten betreffend: Archive<br />
der NSDAP, Bd. 1 v. 16. September 1936 (-1944), Archiv-Abteilung, Bl. 4; die folgenden<br />
Blattnummern in den Zitatangaben beziehen sich auf dieses Konvolut.<br />
14 Aus dem RMBliV.1936 Nr. 52 S. 1609<br />
13 RdErl.d.RFSSuChdDtPol.im RMDJ.v.2.12.1936 -O-Kdo O (8) 3 Nr. 1/36«
618 ARCHIV<br />
chen A.V.5074/36., datiert Berlin, den 21. Dezember 1936, wenden sie sich an<br />
den Preußischen Ministerpräsidenten betreffs der Archivallen aus der formativen<br />
Zeit der nationalsozialistischen Bewegung bei der Pohzeiverwaltung und<br />
erklären ihr Mißtrauen gegenüber dem Plan einer Herausgabe:, die Ablieferung<br />
einzelner Akten und Aktengruppen aus den Registraturen der Dienststellen<br />
des Reiches und der Länder an das Hauptarchiv der Partei in München zum<br />
Zwecke ihres ständigen Verbleibs würde zu einer unorganischen Zerreißung<br />
und Zerstörung <strong>von</strong> Archivkörpern - dem Zweitkörper des Staates - führen.<br />
»Sie würde allen Grundsätzen des staatlichen Archivwesens ins Gesicht schlagen,<br />
seine Desorganisation herbeiführen und in ihren Auswirkungen auf weitere Ressorts<br />
die staatliche Archivverwaltung derart aushöhlen, daß sich eines Tages<br />
geradezu das Problem ihrer Daseinsberechtigung erheben müßte. Und dies zu<br />
einem Zeitpunkt, wo der Staat sich das Recht zu einschneidenden Ordnungsmaßnahmen<br />
auf dem Gebiete des nichtstaatlichen Archivwesens zuspricht. Die<br />
Erfassung <strong>von</strong> behördlichen Archivalien, die sich auf die nationalsozialistische<br />
Bewegung und deren Angehörige beziehen, durch das I lauptarchiv in München<br />
kann und darf also nur auf eine lnventarisation des bei Behörden und Staatsarchiven<br />
Vorhandenen ausgehen.« <br />
Die preußische Archivverwaltung plädiert <strong>für</strong> das, was als Information transportierbar<br />
ist und das Archiv dennoch intakt hält: lnventarisation und Abschriften,<br />
sodann die rasche Rücksendung der Akten. Der Direktor des Reichsarchivs<br />
wendet sich unter dem Aktenzeichen V 19 am 6. Januar 1937 erneut an den<br />
Reichs- und Preußischen Minister des Innern. Berichterstatter ist Staatsarchivrat<br />
Meisner, der das ausnahmslose Provenienzprinzip, mithin geschichtliche<br />
Konkretion in Opposition zu archivischen Rekonfigurationen im Sinne nationalsozialistischer<br />
Ideologeme behauptet, denn international anerkannter Grundsatz<br />
jeder Aktenverwaltung und Archivtechnik war und ist es, die an einer Stelle<br />
erwachsenen Akten auch in ihrem späteren archivischen Leben(so Meisner ausdrücklich)<br />
ungetrennt und unvermischt beisammen zu halten:<br />
Von ihm darf zugunsten der Pohzeiakten betr. geschichtlicher Unterlagen aus der<br />
Kampfzeit der nationalsozialistischen Bewegung keine Ausnahme gemacht werden.<br />
Ich fühle mich verpflichtet, beizeiten vor einer Entwicklung zu warnen,<br />
die in ihre Folgerungen (was der einen Dienststelle recht ist, ist der anderen billig)<br />
zu einer Aufteilung und Zersplitterung der Archivalic nach dem Gegenstande des<br />
jeweiligen Interesses führen muß. Dieses Sachpnnzip ist schon in früheren Zeiten<br />
der Verderber jeder archivalischen Ordnung und damit jeder exakten Kenntnis der<br />
geschichtlichen Vergangenheit gewesen.« <br />
Der Durchschlag eines innerdienstlich gekennzeichneten Schreibens des Generaldirektors<br />
der staatlichen Archive Bayerns vom 22. Dezember 1936 an das<br />
Bayerische Staatsministerium <strong>für</strong> Unterricht und Kultus gelangt an den Generaldirektor<br />
der preußischen staatlichen Archive in Berlin (nunmehr Zipfel); der
ARCHIV!-' IM POLITISCHEN EINSATZ 619<br />
Text betont, »daß die deutschen Archivverwaltungen schon immer mit allem<br />
Nachdrucke, die Akten erfaßten welche <strong>für</strong> das politische Geschehen <strong>von</strong> Bedeutung<br />
sind« . Die Staatsarchive halten an der Trennung des Gedächtnisses<br />
<strong>von</strong> Staat und Partei, dem totahsierenden Regimanspruch zum Trotz, fest.<br />
»Das Hauptarchiv der Partei ist die Übernahmebchörde <strong>für</strong> das archivreife Aktengut<br />
der Partei und ihrer Gliederungen vielleicht auch vorläufig bis zur Schaffung<br />
besonderer Gauarchive . Ein gewaltiges und <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong><br />
Deutschlands wichtiges, überaus aufschlußreiches Aktengut wird im Laufe der<br />
Zeit im Hauptarchiv der Partei zusammenströmen und wird das Archiv zu einem<br />
Brcnnpnkte der Geschichtsforschung machen. Dem gegenüber bleiben die staatlichen<br />
Archive nach wie vor die Übcrnahmestcllcn des Aktengutes der staatlichen<br />
Behörden.« <br />
Dann kommt es zu einem Einbruch der Nummern m die sprachliche Argumentation;<br />
der Unterzeichner Riedner bemerkt, »daß der RuPrMdl. in seinem Erlasse<br />
vom 4. August 1936 - I B 3 25220/11890 (RMBIiV.S.1087; Beilage 5) es vom<br />
Standpunkte des in der modernen Archivtechnik geltenden sog. Provenienzsystems<br />
oder der Registraturzugehörigkeit« selbst als untragbar erklärt hat, daß<br />
»organisch gewachsene Registraturbestände durch eine nach ihrem Inhalte erfolgenden<br />
Verteilung auf verschiedene Archive zerrissen würden« . So<br />
wehrt sich ein Gedächtnis als Speichergestell gegen seine ideologische Hermeneutisierung.<br />
Die diesen Akten selbst beiliegende Abschrift aus einem Sonderdruck<br />
der Archivalische Zeitschrift <strong>von</strong> 1934 16 konkretisiert das Prozedere<br />
<strong>von</strong> behördlicher Aktenabheferung an Staatsarchive und spricht <strong>von</strong> allen möglichen<br />
Bedürfnisse, nicht aber ausdrücklich (oder nur nachgeordnet in § 12) <strong>von</strong><br />
historischem Gedächtnis: Aktengut, das als entbehrlich ausgesondert wird, aber<br />
wegen semer Bedeutung <strong>für</strong> staatliche Belange (Rechtspflege, Verwaltung, Statistik)<br />
oder <strong>für</strong> die wissenschaftliche Forschung und ähnliche Zwecke nicht vernichtet<br />
werden darf (Archivgut), ist ausschließlich an die staatlichen Archive<br />
abzugeben« . Zur Erleichterung künftiger Aktenaussonderungen<br />
soll, sobald sich im Laufe der Bearbeitung die Bedeutung einer Sache in rechtlicher,<br />
politischer, geschichtlicher, volkskundlicher oder ähnlicher Hinsicht ergibt,<br />
der zugehörige Aktenumschlag »in auffallender Weise mit dem Vermerk >Staatsarchiv<<br />
verschen werden« . Denn Gedächtnisgeschick ist eine Frage der<br />
Adressierung. <strong>Im</strong> Zusammenhang mit dem Inventar des im Geheimen Staatsarchiv<br />
beruhenden
620 ARCHIV<br />
Material seien seitdem nicht mehr eingetroffen . Der Krieg setzt der<br />
Selbsthistonsierung der NSDAP ein Ende unter verkehrten Vorzeichen. Das<br />
Staatsarchiv Hannover meldet am 15. Dezember 1943 an den Generaldirektor der<br />
Staatsarchive: »Die Verfg. vom 26.8.40 -A.V. 4855 - betr. Material zur <strong>Geschichte</strong><br />
der nationalsozialistischen Bewegung - ist beim Bombenangriff am 8/9.10. ds. Js.<br />
verbrannt, ebenso auch der Terminkalender.« Gedächtnis ohne Anweisung findet<br />
nicht statt; das Hannoveraner Archiv »kann aus diesem Grunde zur Verfügung<br />
nicht berichten« . Die Abschrift eines Textes aus der Zeitschrift<br />
Deutsche Justiz vom 17. Mai 1935 thematisiert die grundsätzlichere Herausforderung<br />
des staatlichen Archivwesens durch den Zugriff einer Partei, die sich mit<br />
der Staatsgewalt identisch wähnt. In den Akten der Justizbehörden nämlich befinden<br />
sich zahlreiche Schriftstücke, die »<strong>für</strong> die Sippenkunde, die Rasseforschung<br />
und die Feststellung der Abstammung oder der Erbanlage eines Menschen <strong>von</strong><br />
Bedeutung sein können und die deshalb erhalten bleiben müssen«. 17 Vor allem<br />
kriminalbiologische Zivilprozcßakten und Strafprozeßakten, Gesundheitsfragen<br />
betreffend, seien abzuliefern, sobald die Aufbewahrungsfrist abgelaufen sei,<br />
wobei der Vermerk abzuliefernde Forschungssache auf die Akten zu setzen ist.<br />
Das Reichsarchiv antwortet unter der Nr. V 19/1.10.1936 (Potsdam) betreffs der<br />
Verwertung <strong>von</strong> Akten und ihre Ablieferung an die Staatsarchive (Erl.v.7.Sept.36<br />
- I BZ 25458/11890) unter Verweis auf die vom Archiv gesetzte Differenz <strong>von</strong><br />
Arbeitsspeicher und Langzeitgedächtnis.<br />
»Die A.V. vom 10.5.1935 hat zwar die Befriedigung der Interessen der Rassenforschung<br />
und Volkseugenik im Auge, vergißt darüber aber die Beteiligung der<br />
Archive, die unumgänglich ist, um das Material rechtzeitig zu erfassen und zu<br />
sichern, das - wie etwa die Akten über Änderung <strong>von</strong> Familiennamen - nicht bloß<br />
zur sippenamtlichen Auswertung, sondern nach heutiger Auffassung zur dauernden<br />
archivahschen Aufbewahrung geeignet ist.« <br />
Das Staatsarchiv Hannover wendet sich am 16. Dezember 1936 unter dem Zeichen<br />
St.-A. 5542 O.V. besorgt an den Generaldirektor der Staatsarchive Berlin.<br />
Berichterstatter ist Staatsarchivrat Schnath (später Leiter der deutschen Archivkommission<br />
im besetzten Frankreich) betreffs der Erlasse des Reichsjustizministers<br />
<strong>von</strong> 1935 über Arten <strong>von</strong> vernichtungs- und abgabereifen Akten der<br />
Justizbehörden, welche an die zuständigen Gesundheitsämter abgeliefert werden<br />
sollten, und zwar nicht allein solche Akten, die »ihrer Natur nach erbbiologische<br />
bzw. sippenkundhehe Tatbestände erhalten«, sondern auch alle Akten<br />
über Strafverfahren, bei denen auf eine Freiheitsstrafe <strong>von</strong> mehr als einem Jahr<br />
erkannt worden ist. Das wäre die Entmachtung des archivischcn Gedächtms-<br />
' Nr. 147 Aussetzung der Vernichtung <strong>von</strong> Akten AV des RJM. vom 10.5.35 (Via 12687)<br />
Deutsche Justiz S 730 = B1. 15
ARCIIIVI-. IM POLITISCHEN EINSATZ 621<br />
Privilegs an die pohtadministrative Gegenwart selbst - Effekte einer Mimesis<br />
der Parteiorganisation an den Staat. Praktisch führt dies Anordnung dazu, daß<br />
Kriminalakten, die zur Ablieferung an die Staatsarchive und zur dauernden<br />
Aufbewahrung in Betracht kommen, der Archivverwaltung vorenthalten werden<br />
und in den Aufgabenkreis einer archivfremden Behörden übergehen, »die<br />
allerdings bei der weiteren Durchführung dieser Bestimmungen sehr bald selbst<br />
einen archivartigen Charakter annehmen wird« . Der Direktor des<br />
Rcichsarchivs berichtet unter Aktenzeichen V 11 Potsdam, März 1937 über<br />
einen anliegenden, vom Medium Archiv unmediatisierten Gedächtnisrückstau;<br />
erst die archivische Ordnung macht aus Aktenlägern Gedächtnis, d. h. die<br />
Adressierbarkeit <strong>von</strong> Daten <strong>für</strong> Administration und Forschung:<br />
»Wünschen geschichtswissenschaftliche Institute und ähnliche Stellen Akten <strong>von</strong><br />
Reichs- oder Länderbehörden einzusehen, so werden sie in der Mehrzahl der Fälle<br />
sich an die zuständigen Staatsarchive zu wenden haben, da das betreffende Material<br />
in diesen verwahrt und verwaltet wird. Es gilt nun aber leider noch umfangreiches<br />
Aktenmatcnal, das die Forschung interessiert, das aber - obwohl überwiegend<br />
archivreif - noch nicht an die Archive abgegeben worden ist, sondern bei den<br />
Behörden in Boden- und Kellcrregistraturen gestapelt hegt. Solange Aktcnmatenal<br />
dieser Art sich noch bei den Behörden befindet, wird seine unmittelbare<br />
Benutzung durch die wissenschaftliche Forschung nicht zu vermeiden sein. <br />
Die staatliche Archivverwaltung bedauert die Existenz sogenannter >BehördenarchivcSammlung< kommt. Leider huldigt man in wissenschaftlichen Kreisen seit<br />
mehr als einem Jahrhundert dem >Sammlungs
Ein Extrakt aus dem archivischen Mitteilungsblatt Nr 7/37, Ziffer 6 v. 4.6.37,<br />
A.V.3031/37, betont ebenso die Unterstützung des Strebens der staatlichen<br />
Archivverwaltung »nach Unversehrheit der staatlichen und gemeindlichen<br />
Registraturen (Archivkörper)« . Rücksicht auf Körper aber hat das NS-<br />
Regime nie genommen, heißen sie nun Akten oder Menschen.<br />
Archive an der Schnittstelle zum Diskurs: Kriegsausstellungen<br />
Vor dem Vergessen steht die Unlesbarkeit. Der Preußische Finanzminister in Berlin<br />
schreibt am 31. Juli 1939 an den Generaldirektor der Staatsarchive in Berlin<br />
(Staatsministerium) über einen Fall <strong>von</strong> Dislokation und (Kriegs-) Archäologie,<br />
als in den Grundsteinkassetten der alten Siegessäule auf dem Königsplatz u.a. die<br />
Urkunden über die Kriege 1866 und 1870/71 in gutem Zustand gefunden wurden.<br />
Dahingegen war die Urkunde des Krieges <strong>von</strong> 1864 völlig unleserlich; nirgendwo<br />
sonst bilden Archäologie und'Archiv, Geschichtskörper und Aktenkorpus eine<br />
solch intime Schnittstelle. Doppelte Buchführung der Historie:<br />
»Ich beabsichtige, die vorgefundenen Urkunden nebst Beigaben dem Unterhau<br />
der neuen Siegessäule auf dem Großen Stein wieder einzuverleiben und der unleserlichen<br />
Urkunde des Dänischen Krieges eine auf Pergament gedruckte Abschrift<br />
des ursprünglichen, hier nicht bekannten Wortlauts beizufügen. In den beiden<br />
erhaltenen Dokumenten wird die ältere Urkunde als vom 18. April 1865 datiert<br />
erwähnt, und am Schlüsse wird angeordnet, daß eine zweite Ausfertigung >in unserem<br />
Staatsarchiv< aufzubewahren sei. Versuche, diese Urkunde im Preußischen<br />
Geheimen Staatsarchiv in Dahlem zu finden, sind fehlgeschlagen. Ich darf<br />
daher vermuten, daß sämtliche 3 Grundsteinurkunden sich in den Akten des<br />
Staatsministenums befinden.« IS<br />
Das Echo aus dem Archiv schlägt sich nieder im handschriftlichen Entwurf des<br />
entsprechenden Antwortschreibens Berlin, 21. August 1939; in den Akten des<br />
Preußischen Finanzministeriums betreffs des Nationaldenkmals zur Erinnerung<br />
an die Kriege 1864, 1866 und 1870/71 findet sich kein Original der Urkunde vom<br />
18. April 1865, sondern nur ein Exemplar des Kömgl. preuß. Staatsanzeigers vom<br />
19. April 1865 mit einem Abdruck derselben . Die auf Pergament<br />
gedrucken Originale der Urkunden vom 18. April 1865 ließen sich durch die in<br />
den ihnen geltenden Akten enthaltenen Notizen im Staatsarchiv dennoch ermitteln.<br />
Denn Wissensarchäologie im Archiv folgt Aktenzeichen, der arche als Weisung<br />
des Schnftgedächtnisses.<br />
Zur Vorbereitung der (am 8. November 1940 in München eröffneten) Ausstellung<br />
Deutsche Größe l
Beauftragte des Führers <strong>für</strong> die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen<br />
Schulung Alfred Rosenberg ein. Das Protokoll setzt den Akzent<br />
auf ein angeblich bereits früher führerzentriertes Geschichtsbewußtsein: »Bei<br />
den bisherigen Vorschlägen fehlt noch z.T. die klare Herausstellung der entscheidenden<br />
geschichtlichen Persönlichkeiten, wie etwa Friedrich der II. im<br />
Kampf mit Innocenz III.« 20 Diese Worte sind auf dem Dokument nicht nur<br />
unterstrichen, sondern auch mit Bleistiftfragezeichen versehen. Ein Rundschreiben<br />
vom 7. Mai 1940 an die Staatsarchive bittet um versandtfähige Stücke<br />
<strong>für</strong> die Ausstellung und legt Wert auf die »klare Herausstellung der entscheidenden<br />
geschichtlichen Persönlichkeiten«, mithin die Monumentalisierung der<br />
Dokumentation . Die Serie <strong>von</strong> Antwortschreiben ist ein Desaster:<br />
Das Staatsarchiv Hannover (10. Mai 1940) kann keine »Stücke <strong>von</strong> epochemachender<br />
Bedeutung in der deutsche <strong>Geschichte</strong>« bereitstellen ; ebensowenig<br />
Koblenz . Osnabrück meldet »Fehlanzeige«; erst<br />
Düsseldorf wird konstruktiv . Auch Magdeburg meldet potentielle<br />
Archivalien ; das Preußische Geheime Staatsarchiv schließlich (hier<br />
Subjekt und Objekt einer archivischen Information) kann Dokumente nicht<br />
zum deutschen Mittelalter, aber <strong>für</strong> die Zeit <strong>von</strong> Friedrich d. Gr. und Maria<br />
Theresia beisteuern . Zu einer archivologische Selbstreferenz der<br />
Geschichtsausstellung kommt es in jenem Meldebogen, der Wilhelm Putsch,<br />
einen der »Begründer des deutschen Archivwesens« um 1548 (»Archivkanzlei«)<br />
selbst zum Inhalt hat. Das Staatsarchiv Königsberg verfügt über die Goldene<br />
Bulle <strong>von</strong> Rimini Kaiser Friedrichs II. <strong>von</strong> 1226, die dem Deutschritterorden<br />
Preußen zuweist . Später zieht sich das Staatsarchiv Königsberg<br />
mit dem Hinweis aus der Affäre, daß der Deutschordensmeister Hermann <strong>von</strong><br />
Salza nie in Pressen weilte , und in der Tat sieht allein eine nationale<br />
Geschichtsteleologie in diesem <strong>für</strong> Kaiser Friedrichs II. ganz beüäufige Akt<br />
einen »Anteil an der Gründung des preußischen Staates«. 21 Dem wäre eine wissensarchäologische<br />
Lektüre gegenüberzustellen, die an Archivalien nicht die<br />
historischen Folgen, sondern ihre diskreten Aussagen liest.<br />
Größe«. Siehe Hans Ulrich Thamer, <strong>Geschichte</strong> und Propaganda. Kulturhistorische<br />
Ausstellungen in der NS-Zeit, in: <strong>Geschichte</strong> und Gesellschaft 24 (1998), 349-381 (353-<br />
356); ferner Karen Schönwälder, Historiker und Politik. Geschichtswissenschaft im<br />
Nationalsozialismus, Frankfurt/M. / New York (Campus) 1992, 234-237, und W. E.,<br />
»Archival action: The politicisation of German archives from Read Only Memory into<br />
agencies of politics in the Weimar Republic and under the National Sociahst regime«,<br />
demnächst in: History of the Human Sciences (1999)<br />
20 Geheimes Staatsarchiv, Rep. 178 V, Akten betr.: Die Ausstellung »Deutsche Größe«,<br />
Bd. vom 25. April 1940-1941, Bl. 2, Programm (Typoskript) »Arbeitsbesprechung«<br />
-' Ernst H. Kantorowicz, .Kaiser Friedrich der Zweite, Hauptband, Berlin 1927, Neuausgabe<br />
Stuttgart (Klctt-Cotta) 7. Aufl. 1994, 77
624 ARCHIV<br />
Archivisches Gedächtnis zu mobilisieren heißt, diplomatische Monumente des<br />
Speichers und ihre diskursive Ausstellung zu sortieren und zu synchronisieren.<br />
Die Liste mit der Übersicht über die Anmeldungen der einzelen Archive in fortlaufender<br />
Nummer, je nach Archiv, korrespondiert mit einer weiteren Liste der<br />
Verteilung der angemeldeten Stücke auf die Abteilungen der Ausstellung; die<br />
chronologischer Ordnung der Stücke ist durch Zuordnung der laufenden<br />
Nummern erst möglich, der Effekt der deutschhistorischen Erzählung als eine<br />
Zahlenoperation. Das Ausstellungskonzept verspricht eine Ȇberschau des politischen,<br />
geistesgeschichtlichen, künstlerischen, literarischen Werdeganges des<br />
deutschen Volkes« ; der äußere Rahmen ist durch die germanischen Reiche<br />
der Völkerwanderungszeit »und die damit begonnene Volkswerdung und durch<br />
die Erfüllung im Großdeutschen Reich« gegeben . WcsensbesLimmcnd sind<br />
»wie im geschichtlichen Ablauf so auch <strong>für</strong> die Ausstellung die großen führenden<br />
Persönlichkeiten«; es ist ausdrücklich nicht beabsichtigt, »eine zusammenhängende<br />
Geschichtsschreibung zu bringen.« Dort, wo keine großen führenden<br />
Persönlichkeiten des Reiches und Staates oder des Volkes auszumachen sind,<br />
»sind große Rebellen, Außenseiter, getragen <strong>von</strong> einer Reichseinheit und Reichsidee,<br />
herauszustellen« . In der Ausstellung läuft die deutsche <strong>Geschichte</strong><br />
zwangsläufig auf das Großdeutscke Reich <strong>von</strong> 1933-1940 und in Abteilung 14 auf<br />
Rückblick und Vorschau hinaus. Das Protokoll der Arbeitssitzung vom 17. Mai<br />
1940 bestimmt, darüber hinübergreifende Gesichtspunkte zu finden, ein Bild, das<br />
die bislang vorliegenden Archivahen nicht vermitteln . Denn Archivallen<br />
sind diskret, also widerständig gegenüber ldeologisierendcn Figurationen und<br />
Geschichtswillen. Die <strong>für</strong> den neuen Bibliotheksaal des Deutschen Museums in<br />
München geplante Ausstellung soll auf umfangreiche Beschriftungen der ausgestellten<br />
Stücke möglichst verzichten und setzt auf den vorgebliche Klartext <strong>von</strong><br />
Historie selbst; erwünscht sind vielmehr charakteristische, knappe Zitate .Der Leiter des Amtes Schrifttumspflege, Reichsamtsleiter Hagemeyer, bittet<br />
den Generaldirektor der Staatsarchive, auch nicht-preußische Archive in die<br />
Aquirierung entsprechender Dokumente einzubinden. Eines dieser anderen<br />
Archive, vertreten durch den Direktor des Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden,<br />
Kretzschmar, will am 21. Mai 1940 angesichts der Gefahr <strong>von</strong> alliierten Luftangriffen<br />
nicht Archivalien nach München entleihen sehen; er schlägt daher<br />
(unter Verweis auf das Staatsarchiv Marburg) die ersatzweise Entsendung <strong>von</strong><br />
Photokopien vor. Eine entsprechende Reich.saichiv-Order bestimmt, überhaupt<br />
nur Photokopien <strong>von</strong> Archivahen zu Ausstellungszwecken auszuleihen. Der<br />
Krieg zwingt das archivische Gedächtnis zur technischen Ausbildung eines<br />
Zweitkörpers, eines Simulakrums im Medium der Reproduktion. Diese Zeichen<br />
lassen sich abkürzen; »wenn nicht anders gewünscht, werden <strong>von</strong> den Dokumenten<br />
jeweils nur die erste und letzte Seite photokopiert« . Die Ver-
ARCHIVK IM POLITISCHEN EINSATZ 625<br />
Wendung <strong>von</strong> Surrogaten aber ist nicht schlicht eine schutztechnische Notwendigkeit,<br />
sondern ermöglicht überhaupt erst die museumsdidaktische Akzentverschiebung<br />
<strong>von</strong> der wissensarchäologischen zur historisch-politischen<br />
Ausstellung, denn erst die Form und das Format der Nachbildung ermöglicht<br />
das Gestell eines »organischen und architektonisch einheitlichen Zusammenhangs.«<br />
Es geht nicht um die Integrität diskreter Daten, sondern die Wirkung;<br />
ideologische Vektorisierung läßt sich allein durch Vereinheitlichung, also Standardisierung<br />
der Formate, also allein qua Nachbildung der Exponate ermöglichen.<br />
So fand deren politisch manipulatorischer Charakter seinen Niederschlag<br />
in der Ausstellungspräsentation (Thamer). 22<br />
Ein Jahr später, zum Zeitpunkt ihrer territorial größten kriegsmäßigen Ausdehnung,<br />
denkt deutsche Ideologie europaweit. In einem Brief der NSDAP-<br />
Reichsleitung wendet sich das Amt <strong>für</strong> Schrifttumspflege (Alfred Rosenberg)<br />
am 11. Juni 1941 an Staatsarchivrat Fredenchs zum Zwecke einer Ausstellung<br />
mit dem vorläufigen Arbeitstitel Die Souveränität Europas: »Wollen wir die gegenwärtige<br />
Phase des historischen Geschehehens, in welcher wir stehen, begreifen<br />
und die verhaltene Dynamik erkennen, die das Ringen der Völker Europas<br />
bestimmt, so müssen die gegenwärtigen Auseinandersetzung aus einer geschichtlichen<br />
Sicht begriffen werden.« 23 Raum 8 der Ausstellung thematisiert unter<br />
dem Obertitel Einbeitsäußerungen Europas u. a. die geistige Einheit Kontinentaleuropas<br />
und argumentiert ausdrücklich nicht historisch, sondern kulturwissenschaftlich:<br />
»Während bei der politischen Darstellung das chronologische<br />
Element im Vordergrund stehen muß, kommt es bei den Einheitsäußerungen darauf<br />
an, unabhängig <strong>von</strong> der Zeit, Wesensverwandtschaften der kontintentaleuropäischen<br />
Völker darzustellen.« Erst dadurch werde das eigentliche Wesen<br />
Kontinentaleuropas sichtbar . In einer handschriftlichen Aktennotiz<br />
(Berlin, 19. November 1941, A.V.6241 1 ) heißt die Ausstellung dann bereits Die<br />
Anordnung Europas. 24 Die Liste der zu beschaffenden Urkunden nennt u. a.<br />
eine Nachbildung der Nibelungenhandschrift, eine Nachbildung des ältesten Originalprotokolls<br />
des Deutschen Reichstages (Synode zu Frankfurt am 1. Nov.<br />
1007), die Annales Einhardi <strong>von</strong> 741, und unter Nr. 13 die Nachbildung des Privilegs<br />
Kaiser Friedrichs II. 1226, der das Land der Pruzzen als Mandat an den<br />
22 K. Rüdiger, Deutsche Größe. Ein Beispiel künstlerischer Ausstellungsgestaltung, in: Die<br />
Kunst im Deutschen Reich 5, Heft 1 (1941), 36ff, zitiert hier nach: Thamer 1998: 378<br />
- M Geheimes Staatsarchiv (PK), Rp. 178 V, Nr. 14 B, Akten betr: Ausstellung: Die Neuordung<br />
Europas, Bl. 20<br />
24 Über gedächtnisstrategische, reichsorientierte Neuordnungsphantasien unter dem<br />
Tagungs- und Publikationstitel Das Reich und Europa im Zweiten Weltkrieg <strong>von</strong> Seiten<br />
der Historiker unter dem MGH-Präsidenten Theodor Mayer und Walter Platzhoff<br />
(im Rahmen des 1940 begründeten Kriegseinsatzes der Geisteswissenschaften)<br />
siehe Schönwälder 1992: 212ff
626 ARCHIV<br />
Deutschen Orden zuweist. Nr. 38 schließlich die Nachbildung <strong>von</strong> Napeolons<br />
Dekret zur Verhängung der Kontinentalsperre. Reproduktion mobilisieren archivisches<br />
Gedächtnis hier zu Kriegszwecken; der Konflikt zwischen Informationsübertragung<br />
und Aura des Originals aber schreibt sich fort. In einem Brief der<br />
Preußischen Staatsbibliothek (Handschriften-Abteilung) vom 20. Oktober 1941<br />
an den Generaldirektor der Staatsarchive wird die illustrierte Handschrift der<br />
sächsischen Weltchronik <strong>für</strong> die Dauer des Krieges als nicht zugänglich deklariert;<br />
ersatzweise fungieren auch hier Photographien. Daraufhin bittet Der Beauftragte<br />
des Führers <strong>für</strong> die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen<br />
Schulung und Erziehung der NSDAP in Berlin am 28. Oktober 1941 den<br />
Generaldirektor der Staatsarchive noch einmal nachdrücklich, »die Zugänglichmachung<br />
bezw. die Onginalnachbildung unter allen Umständen möglich zu<br />
machen.« Die Begründung des Originals in der neuen Ausstellung ist tautologisch;<br />
sie werde »unter anderem auf Befehl des Führers durchgeführt und ihrer<br />
Bedeutung so bedeutend werden , daß wir uns nicht mit Fotos abgeben können.«<br />
So soll die Möglichkeit der Onginalnachbildung geprüft werden .<br />
Eine Rechnung der Photoabteilung des kunstgeschichtlichen Seminars in Marburg<br />
a. d. Lahn gibt nicht nur die Antwort, welcher Weg eingeschlagen wurde,<br />
sondern reiht das Projekt in die Tradition deutscher Urkundenreproduktion ein.<br />
Gedächtnismedien überdauern Regime, geduldig.<br />
Deutsch-polnische Frontstellung: Das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft<br />
und geschiehtswisscnschafthchc Fortbildung<br />
Das 1930 gegründete Preußische Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche<br />
Fortbildung beim Preußischen Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem<br />
fungiert als Ausbildungsstätte <strong>für</strong> die Archivare des höheren und -<br />
seit 1938 - des gehobenen Archivdienstes in Preußen. 25 Der Bericht über die wiss,<br />
Tätigkeit des Instituts <strong>für</strong> Archivwissenschaft und geschichtswissenschafthche<br />
Fortbildung während des Studienjahres 1930/31 betont zunächst die etatistische<br />
Reaktivierung der Archivfunktionen gegenüber ihrer aus dem 19. Jahrhundert<br />
ererbten historischen Akzentuierung:<br />
»Die Ausbildung der Archivare steht in dem Zeichen einer deutlich erkennbaren<br />
Umgestaltung der Aufgaben der Archivverwaltung. Waren die Staatsarchive<br />
2:> Über die Vorläuferinstitution siehe Hans-Enno Korn, Archivschule Marburg. Institut<br />
<strong>für</strong> Archivwissenschaft - Fachschule <strong>für</strong> Archivwesen, in: Der Archivar Jg. 37<br />
(1984), H. 3, 379-383, und in aller Gründlichkeit Johannes Burkardt, Die Historischen<br />
Hilfswissenschaften in Marburg (17.-19. Jahrhundert), Marburg/Lahn (Institut <strong>für</strong><br />
Historische Hilfswissenschaften) 1997, 138f undpassim
ARCMIVH IM POLITISCHEN EINSATZ 627<br />
bisher wie aile nichtstaathchen Archive in erster Linie historische Archive, so werden<br />
sie in Preußen im Zusammenhang mit der jüngst verfügten im regelmäßigen<br />
Turnus erfolgenden Aktcnablicfcrung der staatlichen Behörden in steigendem<br />
Maße daneben zu Vcrwaltungsarchivcn.« 26<br />
Die Akten werden also unmittelbar an die Verwaltung rückgekoppelt. Wo das<br />
Verhältnis <strong>von</strong> Aufzeichnung und Speicher auf Feedbackschleifen beruht, herrscht<br />
Echtzeit, kein Gedächtnis - eine Rückkehr zum Zustand <strong>von</strong> 1803. Dies<br />
äußert sich in Archivaufsuchungen <strong>von</strong> Seiten der staatlichen Verwaltungsbehörden<br />
und amtlicher Pressestellen; auch Industrie- u. Handelskammern<br />
zeigen Interesse an Archivaren, ebenso Großbanken, die eine Affinität <strong>von</strong> Gedächtnis<br />
und Kapital wittern. Der Berichterstatter fordert einen »Ausgleich<br />
zwischen den rein wissenschaftlichen und diesen praktische Aufgaben«. Die<br />
Ausbildung im Institut erfolgt anhand <strong>von</strong> Material des Geheimen Staatsarchivs<br />
selbst; zum lOOjähngen Todestag des Freiherrn vom Stein am 29. Juni 1931<br />
erscheint ein erster Quellenband. Der Preußische Ministerpräsident in Berlin<br />
antwortet als oberste Behörde des Archivinstituts am 31. Oktober 1932 auf den<br />
Wunsch des Finanzministeriums, das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft aufzuheben<br />
und argumentiert dagegen »aus wissenschaftlichen und politischen<br />
Gründen«, ausdrücklich unter Hinweis auf die dort erfolgende Ausbildung auch<br />
in polnischer Sprache und <strong>Geschichte</strong>. Frontstellung des Archivs: <strong>Im</strong> Falle einer<br />
Auflösung des Instituts würden Preußen und das Deutsche Reich,<br />
»die keine andere wissenschaftliche Einrichtung zur Abwehr der gefährlichen geistigen<br />
Offensive Polens aufzuweisen haben, diesem Lande gegenüber, das schon<br />
12 Jahre hindurch aul dem Gebiet geistiger Propaganda einen mchi wicdcrcin/.uholcnden<br />
Vorsprung hat, unwiderruflich ins 1 Iintertreffen geraten. Das Institut ist<br />
organisch mit allen Unternehmungen zur Abwehr gegen die polnischen Bemühungen<br />
so eng verbunden, daß seine Aufhebung auch die wissenschaftliche Arbeit zur<br />
<strong>Geschichte</strong> unserer Ostmark in entscheidender Weise beeinträchtigen würde.«- 7<br />
In diesem Sinne schreibt kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs ein Staatsarchivar<br />
in Breslau, daß die durch den Frieden <strong>von</strong> Versailles veränderte staatliche<br />
Zugehörigkeit einzelner ehemals deutscher Archive keinen Anlaß gebe, sie aus<br />
dem Rahmen seiner Darstellung zu <strong>Geschichte</strong> und System des deutschen Archivwesens<br />
auszuscheiden, »da sie nach Inhalt und <strong>Geschichte</strong> auch weiterhin deutsche<br />
Archive bleiben«
628 ARCHIV<br />
Zeit als die der Ereignishistorie, und skandieren ein differentes Gedächtnis der<br />
Nachhaltigkeit. »Das historisch so bedeutsame Jahr<br />
1525«, das dem Ordensstaat Preußen die Säkularisation, also Umwandlung in ein<br />
weltliches Herzogtum brachte, »bedeutete, vom Standpunkt des Archivs aus<br />
gesehen, keinen so markanten Einschnitt«; das Königsberger Briefarchiv des<br />
Deutschen Ordens, heute im nachstaatlichen Gedächtniskapkai namens Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz aufgehoben, wurde in der bisherigen Form weitergeführt<br />
und die Folianten weisen »in Einband, Formund Anordnung überhaupt<br />
keinen Unterschied zu der bis dahin üblichen Art auf«. 28 Auch die Reichseinigung<br />
<strong>von</strong> 1871 hat die einzelstaatliche Grundlage des deutschen Archivwesens<br />
nicht geändert ; Gedächtnisadministration und Archivästhetik<br />
setzen auf Kontinuität über Systemgrenzen hinweg. Am Ende der Weimarer<br />
Republik sollen preußische Einsparungen weniger das Dahlemer Archivinstitut<br />
denn das Historische Institut in Rom betreffen, den Satelliten der Staatsarchive<br />
Preußens; da es in den letzten Jahren an Bedeutung verloren habe, soll es nach<br />
Berlin verlegt werden und mit dem Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftliche<br />
Fortbildung fusionieren, das die vom römischen Institut<br />
im Obergeschoß des Dahlemer Instituts bisher <strong>von</strong> Kehr reservierten Zimmer<br />
bezog. 29 In diesem Sinne betont der Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive<br />
Brackmann in Berlin am 27. Juli 1933 auf ein Schreiben des Ministers <strong>für</strong><br />
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 13. Juli 1933 hin die besondere<br />
Bedeutung des Instituts durch die Ausbildung in polnischer Sprache, »durch die<br />
1931 übernommene Aufgabe der Archivverwaltung bedingt, die Abwehr gegen<br />
die Ergebnisse der wissenschaftlichen polnischen Forschung zur <strong>Geschichte</strong> der<br />
deutschen Ostmark in die Wege zu leiten« - eine ideologisierende Frontstellung,<br />
hinter der sich die diskursive Strategie zur Rettung seiner Konzeption des Archivfortbildungsinstituts<br />
tarnt . Der Göttinger Historiker Karl<br />
Brandi erklärt 1934 öffentlich, daß durch das im Januar 1934 zwischen Polen und<br />
Deutschland abgeschlossene Nichtangriffsabkommen im Sinne des »Sammeins<br />
und Ordnens zum geistigen Kampfe« - genuin archivische Arbeiten der Präfiguration<br />
<strong>von</strong> Geschichtspolitik also - genutzt werden muß 30 ; Brackmann ver-<br />
28 Hans Koeppen, Das Archiv des Deutschen Ordens in Preußen, seine Bestände und<br />
seine wissenschaftliche Bedeutung, in: Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz<br />
Berlin 1966, 172-185(174)<br />
2y Für den Ministerpräsidenten gezeichnet: Bracht. Zur Raumvcrschränkung des römischen<br />
und Berliner Instituts: Wolf gang Leesch, Das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft<br />
und geschichtswissenschaftliche Fortbildung (IfA) in Berlin-Dahlem (1930-1945), in:<br />
Gerd Heinrich / Werner Vogel (Hg.), Brandenburgische Jahrhundertc. Festgabe <strong>für</strong><br />
Johannes Schultze zum 90. Geburtstag, Berlin 1971, 219-254 (220)<br />
30 Karl Brandi, Das Abkommen mit Polen - gegen den Geist <strong>von</strong> Versailles (1934), zitiert<br />
in: Schönwälder 1992: 142
ARCHIVH IM pourrscuKN EINSATZ 629<br />
kündet dementsprechend in seiner Eröffnungsansprache zum 25. Deutschen<br />
Archivtag in Wiesbaden am 3. September 1934 auch <strong>für</strong> die Archivverwaltungen<br />
eine neue Zeit- mithin eine ideologische Aktualisierung residenter Akten. Diese<br />
Politisierung des Archivs bahnt sich vor dem 31. Januar 1933 lange an; bereits in<br />
seinem Beitrag zum 22. Archivtag in Linz a. D. am 15. September 1930 spricht er<br />
da<strong>von</strong>, daß der Archivar anders als früher »stärker in das praktische Leben<br />
hineingezogen ist«. 31 Das preußische Archivsystem bleibt also <strong>von</strong> seinen Rah-<br />
menbedingungen - dem parlamentarischen System der Republik und ihrer ge-<br />
sellschaftlichen Dynamisierung - nicht länger unberührt. 32 Brackmann leitet<br />
daraus ein Primat der Politik in der Gedächtnisadministration ab:<br />
»Die wiss. Arbeiten , die <strong>von</strong> ihnen und den Staatsarchivräten geleistet werden,<br />
sind in ihrer Zielsetzung sämtlich durch die politischen Bedürfnisse der<br />
Gegenwart bestimmt, wie es ja überhaupt die Aufgabe der Archivverwaltung seit<br />
Bismarcks Zeiten gewesen ist, ihre wissenschafhche Arbeit auf die politischen<br />
Bedürfnisse Preußens einzustellen. Die publizistische Auswertung hat sie allerdings<br />
stets anderen Instanzen überlassen. Sie würden heutzutage hinsichtlich der<br />
wiss. Ostforschung die Aufgabe des >Bundes deutscher Osten< sein. Der<br />
Preuß. Ministerpräsident muß als Chef der Preußischen Archivverwaltung auch<br />
die Kontrolle über ihre solchen politischen Zwecken dienenden Arbeiten und über<br />
das mit diesen Arbeiten aufs Engste verknüpfte Institut behalten.« 33<br />
Bereits seit dem 1. Januar 1932 dient eine Pubhkations- und Forschungsstelle beim<br />
Geheimen Staatsarchiv unter der Leitung <strong>von</strong> Johannes Papritz der Quellenedi-<br />
tion zur Verwaltungsgeschichte <strong>von</strong> seit dem Ende des 1. Weltkriegs an Polen<br />
gefallenen preußischen Territorien, gekoppelt an die Arbeiten der Nord- und<br />
Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft im irreduziblen »Widerspruch zwischen<br />
wissenschaftlicher Erkenntnis und imperialistischer Zielsetzung« - fatal aber in<br />
dem Moment, wo Antisemitismus in der Ostforschung als Text unmittelbar an<br />
physische Exekutive, Programm also an Befehl gekoppelt war und eine <strong>von</strong> der<br />
Publikationsstelle geführte Kartei auf der Grundlage der Volkszählung vom 17'.<br />
Mai 1939 polnische Minderheiten im Reichsgebiet selektiert. 34 Ein Diskussions-<br />
31 Albert Brackmann, Das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft und geschichtswissenschafthche<br />
Fortbildung am Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, in: Archivahsche Zeitschrift<br />
40 (1941), 1-16(1)<br />
3 - Albert Brackmann, Eröffnungsansprache zum 25. Deutschen Archivtag in Wiesbaden,<br />
Abdruck in: Archivalische Zeitschrift 44 (1936), 1-5(1)<br />
33 Brackmann 27. Juli 1933, GStA Rcp. 178 II Nr. 42, Bl. 50, Abschrift<br />
34 Rudi Goguel, Über die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler am Okkupationsregime<br />
in Polen im zweiten Weltkrieg, untersucht an drei Institutionen der deutschen Ostforschung,<br />
Berlin, Phil. Diss. Humboldt-Universität 1964, 40, 44, 63ff u. 71. Goguel<br />
mobilisiert Quellenbeständc der und zur Berliner Publikationsstelle in (ost-)dcutschen<br />
und polnischen Archiven und gibt sie in drei Kolonnen zur Lesung: als narrativer Text,<br />
als umfangreicher Dokumentenanhang und als Nachweis <strong>von</strong> Primär- und Sekundär-
630 ARCHIV<br />
beitrag des Historikers Reinhard Wittram (Herder-Institut Riga) formuliert auf<br />
einer Tagung der Nordostdeutschen Forschungsgemeinschaft in Posen am 25.-<br />
27. Februar 1943 das Ziel solcher Geschichtsforschung im baltischen Raum, nicht<br />
Gedächtnis (Archive) zu verwalten, sondern sie umzuschreiben: »Der <strong>Geschichte</strong><br />
dieser Länder ihr deutsches Gesicht zu erhalten und es durch eigene Produktion<br />
zu gestalten.« Wenn das Reich eine neue Ordnung setzen will, genüge es nicht,<br />
schlicht »zuverlässiges Informationsmaterial zu schaffen«; um die Einordnung<br />
der Letten zu vollziehen, bedarf es des Mediums der Ideologie: der Narration<br />
»ohne Rücksicht auf die taktischen Bedürfnisse des Tages«, nicht also die rein<br />
archivische Organisation der Erinnerung. <strong>Im</strong>merhin muß so »der volksgeschichtliche<br />
Gesichtspunkt durch den landesgeschichtlichen ersetzt werden«,<br />
eine »objektive Geschichtsschreibung« als implizite Dekonstruktion der<br />
(NS-)Parteilichkeit. 35 Dabei wird die Editionspraxis der Publikationsstelle zum<br />
kateebon des Gedächtnisses selbst, weil damit die entsprechenden Bestände <strong>für</strong><br />
polnische Benutzer gesperrt werden konnten. 36 Über die Arbeit der (zeitweilig<br />
auch den Historiker Werner Conze mitzählenden) Publikationsstelle seit 1936<br />
berichtet der ehemalige Mitarbeiter Oskar Kossmann, der dort aus dem Fundus<br />
seiner in Koffern aus Forschertätigkeit in Polen mitgebrachten Notizen und Karteien<br />
das Wissen über den eiszeitlichen Aufbau und die Bodengüten des Lodzer<br />
Raums korngiert, »deren bisherige Darstellung reine Phantasie war.« Kossmann<br />
entwirft Karten und Tabellen und entwickelt damit ein Navigieren im archivischen<br />
Raum, das alternativ zum narrativen Medium die Historie selbst in Bildzeichen<br />
abkürzt: »Bereits im geschichtlichen Fahrwasser schwimmend, habe ich<br />
dennoch alle kulturgeschichtlichen Erkenntnisse auch optisch, d. i. kartographisch<br />
sichtbar gemacht.« 37 In Grenzziehungsfragen wird solche Arbeit seit 1939<br />
literatur. Die Arbeit hat damit über seine Interpretation hin Bestand, weil die Option<br />
einer modularen Rekonfigunerbarkeit der Dokumente transparent bleibt.<br />
1 Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 178 Nr. VII 3A4 Bd. 2, Bl. 132 r/v: Notizen Zipfels<br />
»Die Kriegswichtigkeit der Arbeit der NOFG« zur Posener Tagung, zitiert im<br />
Dokumentenanhang <strong>von</strong> Goguel 1964: 27f<br />
' Dazu Karl Heinz Roth, Eine höhere Form des Plünderns. Der Abschlußbericht der<br />
»Gruppe Archivwesen« der deutschen Militärverwaltung in Frankreich 1940-1944, in:<br />
1999. Zeitschrift <strong>für</strong> Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, Heft 2/1989, Einleitung<br />
79-91 (88ff), und Brübach 1997: 31<br />
Oskar Kossmann, Es begann in Polen: Erinnerungen eines Diplomaten und Ostforschers,<br />
Marburg (Koch) 2. Aufl. 1995, 171. Vgl. Otto Neurath, Bildstatistik nach Wiener<br />
Methode in der Schule, Wien / Leipzig 1933; zur originären Äquivalenz <strong>von</strong><br />
Kartographie, desenptio und Geographie als Auge der Historie (Beschreibung eher<br />
denn Erzählung): Svetlana Alpers, Kunst als Beschreibung [The art of describingj.<br />
Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, Köln (duMont) 1985, Kap. 4 (213-286).<br />
Ferner Klaus R. Scherpe, Beschreiben, nicht Erzählen! Beispiele zu einer ästhetischen<br />
Opposition: <strong>von</strong> Döblin und Musil bis zu Darstellungen des Holocaust. Antnttsvor-
AKCI-IIVI-: IM poi.rn.sci IHN EINSATZ 631<br />
als kriegswichtig eingestuft, wie auch zum Zweck der Eindeutschung polnischer<br />
Orts- und Eigennamen. Ein pro memoria betreffs der Erweiterung des Aufgabenkreises<br />
des Instituts <strong>für</strong> Archivwissenschaft nennt, <strong>von</strong> Winter signiert, die so<br />
verstandene Tätigkeit »eine nationalpolitische Aufgabe erster Größe« <br />
Das Schreiben des Instituts (datiert Berlin, 19. Dezember 1940) an den Reichsprotektor<br />
in Böhmen und Mähren in Prag betreffs der Archivausbildung in Prag<br />
enthält die Auflistung des Lehrplans des Instituts <strong>für</strong> Archivwissenschaft Berlin<br />
<strong>von</strong> Winter 1937/38 bis Winter 1938/39. An erster Stelle stehen, vorgeschaltet, 15<br />
Stunden <strong>Geschichte</strong> der nationalsozialistischen Bewegung und nationalsozialistischen<br />
Weltanschauung; dann u. a. 10 Stunden politisch-wissenschaftliche Arbeiten<br />
Polens und der Nachfolgestaaten sowie <strong>Geschichte</strong> und Aufbau der deutschen<br />
Ostinstitute . Das Reichsarchiv Troppau schließlich nimmt<br />
am 13. November 1940 Stellung betreffs der geplanten Umstrukturierung der<br />
Wiener Archivschule nach dem Vorbild <strong>von</strong> Berlin-Dahlem: Nicht hauptsächlich<br />
Archivare gelte es auszubilden, sondern Geschichtswissenschaftler <strong>für</strong> die<br />
Mitarbeit an den MGH und Anwärter des Bibliotheks- und Museumsdienstes.<br />
Das Archiv steht und fällt so mit seiner Kopplung an den historischen (nicht<br />
mehr vorrangig staatswissenschaftlichen) Diskurs, wobei gelegentlich noch die<br />
Anschauung <strong>von</strong> Seiten der Leiter des Instituts vertreten worden sei, »daß der<br />
Archivar keineswegs das Höchste sei, was das Institut hervorbringe, ja daß er auf<br />
jeden Fall hinter dem reinen Geschichtswissenschaftler erst in zweiter Linie zu<br />
nennen sei - die Konsequenz aus preußischer Archivgeschichte<br />
nach 1806.<br />
<strong>Im</strong> September 1939 zählt der zwar 1936 wegen angeblicher Protektion jüdischer<br />
Forscher vorzeitig in den Ruhestand versetzte, dort aber noch ganz im Sinne<br />
<strong>von</strong> NS-Ideologie weiteragierende Brackmann das Geheime Staatsarchiv zu den<br />
zentralen Agenturen wissenschaftlicher Beratung <strong>für</strong> Außen- und Innenministerium,<br />
Heereskommanda, Propagandaministerium und SS-Abteilungen; »his<br />
advice concerning futurc frontier adjustments would be heard with respect.« '' s<br />
Neben die Rückkopplung <strong>von</strong> Archiv und Grenzplanung zeitigt auch die <strong>von</strong><br />
Archiv und Archäologie im November 1938 ideologische Effekte, als Brackmann<br />
direkt im Kontakt mit Heinrich Himmler steht, denn wie der selbsternannte<br />
SS-Archäologe war auch er interessiert an den Herrschergräbern in Quedlinburg.<br />
»An inscription the SS had discovered concerning Otto III's appointment of his<br />
lesung Humboldt-Universität Berlin v. 20. Juli 1994, publiziert <strong>von</strong> der Forschungsabteilung<br />
der Humboldt-Universität (Heft 44)<br />
1 Michael Burleigh, Albert Brackmann (1871-1952) Ostforscher: The Years of Retirement,<br />
in: Journal of Contemporary History 23 (1988), 573-588 (578f), unter Bezug auf: GSA<br />
Rep. 92 / Nr. 83 (Brackmann an F. Metz, 23. September 1939). Siehe auch ders., Germany<br />
turns eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich, Cambridge u. a. 1989
632 ARCHIV<br />
aunt to a deputyship while he was in Italy led Brackmann to the conclusion that<br />
use of a similar word to descnbe Boleslaw of Poland in 1000 had important >implications<<br />
for the early history of the Polish State.« 39 Kossmann schreibt über<br />
archivische, wissensarchäologische Praxis im Nationalsozialismus: »Daß daraus<br />
hier und da propagandistisches Schrifttum <strong>für</strong> eine politische Kampagne gedrechselt<br />
wurde, ist eine andere Seite der Medaille, die jedoch den Wissenschaftler<br />
bei seiner Grundlagenforschung nicht beirren darf.« . Nach 1945<br />
wird das kulturwisscnschafthche Potential der Ost(volks)forschung in Historische<br />
Sozialwissenschaften überführt; »einen unmittelbaren, genetisch-kausalen<br />
Nexus zwischen der >Volksgeschichte< und der >moderncn Sozialgcschichtc
ARCI IIVI; IM i'tM.rnscm-N EINSATZ 633<br />
Gestaltung dieser Tiefe, die ihren Gehalt wieder zu Tage fördert, überläßt Hegel<br />
dem Gedächtnis 41 - womit Gedächtnisapparate keine Prothesen, sondern die<br />
Agenten der Erinnerung sind. Medienarchäologie grabt sich dorthin.<br />
Der Zusammenbruch <strong>von</strong> 1945 beendet die Versuche des nationalsozialistischen<br />
Staats zur gewaltsamen Zentralisierung der Archiv- als Reichsgewalt unter<br />
Ausschaltung der Länder, so wie sie <strong>für</strong> den Bereich der militärischen Archive<br />
damals bereits bestand: Kriegsorganisation gibt es vor. Der Wiederaufbau im<br />
Archivwesens beginnt in den neuen Ländern, wo Bestände des Geheimen Staatsarchivs,<br />
etwa in Halle, noch bis 1948 völlig durcheinander gespeichert sind und<br />
damit einer Neu Konfiguration archivischer Metadaten offenstehen 4 -, während<br />
sich als Beweismatenal <strong>für</strong> die Nürnberger Kriegsprozesse parallel dazu ein archivisches<br />
Kurzzeitgedächtnis aus der Quintessenz zentraler Akten des Nationalsozialismus<br />
bildet, dem es »an jeglicher systematischer Ordnung innerhalb der<br />
einzelnen Reihen fehlt, die meistens mehrere tausend Nummern umfassen.« 43 Es<br />
gibt also Nullpunkte archivischer Ordnung; was insistiert, ist die archivische Präfiguration.<br />
Zum Teil werden einstige preußische Provinzial- oder Bezirksarchive<br />
zu Hauptarchiven der neuen Landesregierungen 44 ; Preußen überlebt als Archi(v)<br />
Struktur. Die preußische Archiwerwaltung gehört der <strong>Geschichte</strong> an, doch »noch<br />
über ihre Auflösung hinaus erwiesen sich die Fundamente als brauchbar«, da die<br />
preußischen Provinzialarchive in ihren Beständen so funktional aufgebaut und<br />
innerhalb ihrer historischen, archivischen Räume an selbständige Arbeit gewöhnt<br />
waren, daß sie die Träger eigener Länderarchivverwaltungen werden konnten<br />
. 1945 definieren militärische Demarkationslinien der Alliierten<br />
über das archivische Gedächtnis. Das Geheime Staatsarchiv in Berlin versieht<br />
zunächst auch die Aufgaben des früheren Reichsarchivs mit (das Reich lebt<br />
als Archiv fort) und fühlt sich treuhänderisch verantwortlich <strong>für</strong> alle in den deutsche<br />
Ostgebieten aktionsunfähigen preußischen Staatsarchive 43 ; die historischen,<br />
zu Ende des Zweiten Weltkriegs geflüchteten Bestände des Königsberger Archivs<br />
gelangen zuerst in das Gottinger Archivlager, dann 1976 ans Geheime Staatsar-<br />
41<br />
Hermann Schmitz, Hegels Begriff der Erinnerung, in: Archiv <strong>für</strong> Bcgnffsgeschichte<br />
Bd. 9, Bonn (Bouvier) 1964, 37-44 (40)<br />
42<br />
Walter Nissen, Das Schicksal der ausgelagerten Bestände des Preußischen Geheimen<br />
Staats-ARchivs und des Brandenburg-Preußischen Haus-Archivs und ihr heutiger<br />
Zustand, in: Archivalischc Zeitschrift 49 (1954), 139-148 (145)<br />
43<br />
Staatsarchivrat Wolfgang Mommscn (Nürnberg), Die Akten der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse<br />
und die Möglichkeit ihrer historischen Auswertungin in: Der<br />
Archivar, 3. Jg. (1950), Sp. 14-25 (Sp, 15)<br />
44<br />
Eckhart G. Franz, Föderalismus und Pluralität. Die »Archivlandschaft« der Bundesrepublik<br />
Deutschland, in: Der Archivar Jg. 37 (1984), H. 3, 321-324 (321)<br />
45<br />
Gerhard Zimmermann, in: Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem (Hg.), Geheimes<br />
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Westkreuz) 1974, 15f
634 ARCHIV<br />
chiv Berlin. Hier prallt aktuell der mit dem territorialen Pertinenzprinzip argumentierende<br />
polnische Rückführungsanspruch auf den Standpunkt der Berliner<br />
Archivare, die sich auf die Sprach- und Bevölkerungsbindung eines archivischen<br />
Gedächtnisses berufen. Da sowohl das Geheime Staatsarchiv als auch die Berliner<br />
Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz angehören, deutet sich<br />
ein Tausch der in Krakau lagernden Bestände der Staatsbibliothek gegen die<br />
Königsberger Archivahen an - ein Tausch zweier Währungen, ist doch eine<br />
bibliothekarische Sammlung essentiell unterschieden vom Charakter eines<br />
aus Administration erwachsenen Archivs, dessen Gedächtnis logi(sti)sch nachvollzogen<br />
werden kann. 46 Dove sta memoria (Gerhard Merz)? Aufgrund <strong>von</strong><br />
Sicherheitspolitik und dem prekären Status Berlins verfällt das Archiv noch einmal<br />
in Arkanpolitik:<br />
»Die besondere politische Lage Berlins nach dem letzten Kriege ließ es geboten<br />
erscheinen, über die Tätigkeit des Hauptarchivs (ehem. Preuß. Geh. Staatsarchiv)<br />
möglichst wenig Nachrichten in die Öffentlichkeit dringen zu lassen; bewußt<br />
wurde gegenüber Presse und Punk Z.urückhaltung geübt. Die Sicherheit der nach<br />
der Reaktivierung des Archivs im Mai 1945 aus dem Chaos geretteten Aktenbestände<br />
war den Berliner Archiven oberstes Gebot . Diese Taktik des bewußten<br />
Schweigens hat sich zehn Jahre lang durchaus bewährt.« 47<br />
Erst mit dem 8. Mai 1955 ist nicht nur die Bundesrepublik wieder staatsrechtlich<br />
souverän, sondern auch ihr archivisches Gedächtnis. »Es steht darum, auch wenn<br />
das Land Berlin de jure noch nicht erfaßt ist, nichts mehr im Wege, den Schleier<br />
nun ein wenig zu lüften« . Macht der Aggregatzustand des Archivs einen<br />
Unterschied zwischen Historie und Macht in actul Die Synchromzität der Zeit<br />
des Aixhivs verfäumiieht das, was einmal preußische <strong>Geschichte</strong> hieß, nach 1945<br />
gedächtniskybernetisch in metonymischen Operationen. Durch die gemäß dem<br />
Kontrollratsgesetz Nr. 46 der Alliierten verfügte Auflösung des Landes Preußen<br />
und seiner nachgeordneten Behörden am 25. Februar 1947 ist dem wichtigsten<br />
deutschen Archiv »der Staat, dessen Archivgut er ein halbes Jahrtausend verwahrt<br />
hatte, buchstäblich über Nacht weg«: ein in der deutschen Archivgeschichte singulärer<br />
Vorgang; die Staatenelimmierungen der napoleonischen Zeit waren anders<br />
gelagert** So schließt sich <strong>für</strong> den Zeitraum dieser Arbeit kern Kreis, sondern die<br />
4 k In diesem Sinne Iselin Gundermann, Die Bestände des Histrorischenen Staatsarchivs<br />
Königsberg im Geheimen Staatsarchiv Berlin, Vortrag im Rahmen der Interessengemeinschaft<br />
Genealogie, Stadtbibliothek Berlin, 3. März 1999<br />
47 Gerhard Zimmermann (Archivrat Berlin-Dahlem), Das Hauptarchiv (ehemal. Preuß.<br />
Geh. Statarchiv) in den ersten Nachricgsjahren, in: Der Archivar, 7. Jg. (Juli 1955), H.<br />
3, Sp. 173-180 (173f)<br />
ls Joachim Lehmann, Von Staßfurt und Schönebeck nach Merseburg. Nachknegs-<br />
Schicksale eines deutschen Archivs, in: Jürgen Kloostcrhuis (Hg.), Aus der Arbeit des<br />
Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Selbstverl. des Geh. Staats-
ÄRCHIVH IM I'OI.ITISCHHN EINSATZ 635<br />
Epoche <strong>von</strong> 1806 bis 1945 verschiebt und verlagert Speichermassen. In seiner<br />
neuen Lage 1947 wird das Geheime Staatsarchiv de facto ein Archiv in Latenz.<br />
Wo Dokumente ihren machtvollen Interpretanten verloren haben, werden sie<br />
historisch - die Peripetie eines Dramas, das 1919 mit der Entmachtung des Geheimen<br />
Staatsarchivs durch die politisch dezidierte Einrichtung des in Potsdam<br />
benachbarten Reichsarchivs einsetzt. Die endgültige Begründung des Reichsarchivs<br />
in Potsdam 1919 erfolgte gerade infolge »des deutschen Zusammenbruchs,<br />
sie steht mit ihm in ursächlichem Zusammenhang«. 49 Diskontinuitäten setzen<br />
Archive gerade dadurch, daß sie laufende Akten <strong>von</strong> ihrem staatlichen Interpretanten<br />
trennen, auch wenn Ernst Müsebeck, Leiter der Archivabteilung des<br />
Reichsarchivs, bei der Eröffnung der dortigen Ausstellung Ausstellung des Reichsarchivs<br />
zur Deutschen <strong>Geschichte</strong> seit 1848 im Oktober 1924 den Charakter seiner<br />
Agentur als eine lebende Reichsbehörde betont, welche die innere geschichtliche<br />
Verbindung zwischen den einzelnen Reichsressorts herstellt - das Archiv als Dispositiv,<br />
als verwaltungskybernetisch aktiver Arbeitsspeicher einer Gegenwart, 30<br />
Ein Archivar glaubt »die mahnenden Stimmen der <strong>Geschichte</strong> aus den<br />
Papierbergen der Akten lebendig sprechen« zu vernehmen und möchte sie »auch<br />
in der Zukunft immer verstanden« wissen . Diese Zukunft ist<br />
eine vergangene; vom Subjekt der Aktenlagerung ist das Potsdamer Reichsarchiv<br />
selbst zum Objekt <strong>von</strong> Akten (eines Trümmernachlasses) geworden, diskontinulert<br />
in der Nachfolgeagentur Bundesarchiv (Berhn-Lichterfelde). Seit 1963 gehört<br />
das Geheime Staatsarchiv zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz; indem es dessen<br />
laufende Stiftungsakten aufnimmt, trifft die Bezeichnung historisches Archiv nicht<br />
uneingeschränkt zu. Da aber fast keine staatsrechtliche Kontinuität mehr Preußen<br />
an die Machtnachfolger seiner Territorien bindet, ist sein Untergang die Ermöglichung<br />
seiner archivgestützten histonographischen Beschreibbarkeit. Das Archiv<br />
Preußens ist selbst der Ort eines wissensarchäologischen Bruchs als Aggregatzustand,<br />
in dem Preußens Gedächtnis aufgehoben ist.<br />
archivs PK) 19%, 131-154 (140 u. Anm. 18). Vgl. zur Situation des Reichsarchivs (oder<br />
vielmehr: der Reichsarchive im Plural), das (die) am Ende des Alten Reichs 1806 tot<br />
(Kaiser) waren: Hans Kaiser, Die Archive des alten Reichs bis 1806, in: Archivalische<br />
Zeitschrift 35 (1925), 205-220 (21 Of). Für die Situation des »ersten Archivs des Reiches«<br />
in Wien (E. v. Ottcnthal, Das Institut <strong>für</strong> Österreichische Geschichtsforschung,<br />
Wien 1904, 40) nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie<br />
1918/19 siehe: Bittner 1925<br />
4y Ernst Müsebeck, Der systematische Aufbau des Rcichsarchivs, in: Preußische Jahrbücher<br />
191 (Jan.-März 1923), 294-318 (298)<br />
50 Dazu Helmuth Roggc, Das Rcichsarchiv, in: Archivalische Zeitschritt 35 (1925), 119-<br />
133 (120)
636 ARCHIV<br />
Archivlagen: Das Staatsarchiv Düsseldorf<br />
Räume des Archivs <strong>von</strong> 1806 bis an die wissensarchäologische Ruptur der EDV:<br />
Als ein Historiograph des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf den Gedächtnisort<br />
1968 zum ersten Mal sah, war sein Eindruck des Gebäudes »eher einem verwunschenen<br />
Schlosse gleich als einem modernen Verwaltungsgebäude« 1 . Heute<br />
liest sich dieser Satz unter verkehrten Vorzeichen. Die korrodierende Metallarchitektur<br />
des Hauptstaatsarchivs Düsseldorf läßt kaum vermuten, daß sich darin<br />
ein Schatz uralter Erinnerungsstücke befindet. Vergangenheit, in diesem<br />
modernistischen Kontext, wird zu einer Unterfunktion ihrer non-ornamentalen<br />
Administration; in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptstaatsarchiv und mit<br />
ihm Verbunden steht der Sohtär des Statistischen Landesamts. Archivologische<br />
Hermeneutik heißt Eintauchen in die virtuelle Realität einer Datenwolke,<br />
»inside the box closed to the outside.« 2 Das gilt zumal <strong>für</strong> die Architek(s)tur<br />
des modernen, funktionalen Archivs. Der Archivar angesichts der Aktenbestände<br />
seines Arbeitsplatzes ist Sachwalter einer Latcnz: »Wohlgeordnet in Kästchen<br />
oder Kartons verpackt, harrten sie dem Augenblick, da ein Neugieriger<br />
nach ihnen verlangte« , ein Moment, der im Befehl Datei<br />
laden in der elektronischen Textverarbeitung Programm geworden ist. Das<br />
Archiv verführt zu Halluzination des Katechontischen des Gedächtnisses, denn<br />
die Menge der Archivalien im Magazingebäude scheint zunächst unübersehbar.<br />
»Wieviel Generationen mochten daran gearbeitet haben, daß es möglich war, aus<br />
dieser ungeheuren Zahl an beschriebenen Blättern innerhalb <strong>von</strong> wenigen Minuten<br />
das gesuchte Schriftstück herauszufinden?« . Der latente<br />
Datenraum des Archivs ist strukturell verwandt mit elektronisch vermessenen<br />
Landschaften, die mehr als Funktion einer Datentopologie bestehen denn als real<br />
begehbarer Raum. Hier zählt nicht die Behauptung, sondern die Visualisierung<br />
und Handhabbarkeit der Information. »There are so many data: how can we<br />
turn it into Information and knowledge, how can we handle this with the knowledge<br />
we have?« 3 Zu Beginn des 19. Jahrhunderts definiert der Leiter des Preußi-<br />
Prolog, in: Dieter Seriverius, <strong>Geschichte</strong> des Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchivs,<br />
Düsseldorf (Selbstverlag des Nordrhein-Westfähsches Hauptstaatsarchivs)<br />
1983,6<br />
Christian Hüblcr, in: Discovering CybcrAntarctic. A Convcrsation with Knowbotic<br />
Research (Paolo Atzori), in: Cthcory. Theory, Technology and Culture 19, Heft 1-2,<br />
Artikel 38 (96/03/13), im World Wide Web unter der Adresse http://www.ctheory.com/<br />
Y<strong>von</strong>ne Wilhelm, ebd. Über die differente digitale Architektur des satellitengestützten<br />
Global Positiomng System, das den Raumbegriff selbst »mikrophysisch« auflöst<br />
(Paul Virilio), siehe Laura Kurgan, You are here: Information Drift, in: Assemblagc 25<br />
(Massachusetts Institute of Technology 1995), 15-43
ARCIIIVI.AGKN: DAS STAATSARCHIV DÜSSI;I.DOR[ ; 637<br />
sehen Geheimen Staatsarchivs Raumer - am historischen Diskurs orientiert - die<br />
Archivbestände als analoge Landschaften, zu denen die Repertorien die Landkarten<br />
sind 4 ; am Ende des 20. Jahrhunderts ist diese Landschaft zu einem nondiskursiven<br />
Leerraum geworden, der mit diskreten, modularen Monumenten<br />
aufgeladen ist. Jede elektronische Nachricht steht hier zunächst <strong>für</strong> sich allein.<br />
Indem Digitahsierung Aufzeichnungen aus ihren Kontexten löst, sind sie »neu<br />
kombmierbar, umsortierbar und in neue Zusammenhänge integrierbar. Damit<br />
geht allerdings der Begründungshintergrund verloren« 3 - die arche des Archivs,<br />
an deren Stelle (eine medial induzierte wissensarchäologische Ruptur) kalkulierbare<br />
Vektoren treten. Der Begründungshintergrund »ist nur bei Wahrung der<br />
ursprünglichen Kontexte erhaltbar, also in analoger Darstellung. Analoge und<br />
digitale Darstellung haben unterschiedliche Wirkung auf die Aussage« .<br />
Erkenntnis sieht Friedrich Nietzsche als die rhetorisch ms Werk gesetzte<br />
»Abkürzung eines geistigen Vorgangs zum Zeichen«. 6 Rhetorik soll dabei nicht<br />
auf sprachliche Operationen reduziert verstanden werden, sondern ebenso als<br />
Technik der Wisscnsverwaltung. Die klassische Lösung zur Reduktion <strong>von</strong><br />
Datenkomplexität (über den kognitiven Referenten »Vergangenheit« als ein<br />
Effekt der Synchronisationsleistung radikal gegenwärtig vorliegender Daten)<br />
heißt <strong>Geschichte</strong> als (geschlossene) Erzählung. Diese Semiotik transformiert das<br />
Aufzeichnungssystem des Archivs in Geschichtszeichen; zwischen Monument<br />
und Dokument werden so Archivkorpora zu narrativen Geschichtskörpern,<br />
denn Datenmengen müssen modelliert werden, um <strong>von</strong> Menschen analysierbar<br />
zu sein: Datenkörper. »Our coneept of bodies comes from these kinds of entities<br />
which generate the different layers of our reality and we look for these generators<br />
mostly in data Spaces« .<br />
Die maßgebliche <strong>Geschichte</strong> des Düsseldorfer Hauptstaatsarchiv schreibt<br />
sich an dem Ort und in dem Medium, das auch sein Gegenstand ist: »die<br />
<strong>Geschichte</strong> des Archivs aus den Akten nachzuzeichnen«; autoptisch miterlebt<br />
hat der Autor nur ihre jüngste Zeit, womit - im Sinne der gleitenden Sperrfrist<br />
<strong>von</strong> Dokumenten <strong>für</strong> jeweils dreißig Jahre - die Erzähl- und die erzählte Zeit<br />
auseinanderfallen. »Damit aber unterscheidet sie sich nicht <strong>von</strong> anderen Be-<br />
Reinhold Koser, Die Neuordnung des Preußischen Archivwesens durch den Staatskanzler<br />
Fürsten <strong>von</strong> Hardenberg, Leipzig 1904 (Mitteilungen der K. Preußischen<br />
Archivverwaltung 7), 4<br />
Angelika Menne-I Iaritz, Die Archivwissenschaft, die Diplomatik und die elektronischen<br />
Verwaltungsaufzeichnungen (Johannes Papritz zum 100. Geburtstag), demnächst<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Diplomatik (1998), Typoskript, 23<br />
Siehe Martin Stingclin, Historie als »Versuch, das Hcraklitischc Werden [...] in Zeichen<br />
abzukürzen«. Zeichen und <strong>Geschichte</strong> in Nietzsches Spätwerk, in: Nietzsche-<br />
Studien 22 (1993), 28-41
638 ARCHIV<br />
mühungen, Vergangenheit wiederum zu vergegenwärtigen.« 7 Diese Bemühung<br />
aber heißen nicht notwendig schon <strong>Geschichte</strong>. Vielmehr fällt hier der Akt der<br />
Archiverinnerung zusammen mit der Form, in der das Archiv sich selbst als<br />
Gedächtnis formiert hat. Das Fundament der archivahschen Fonds ist der<br />
blinde Fleck der Archäologie des Archivs als Gedächtnisagentur. Scnverius<br />
wird seines ersten Amtsvorgängers anamnetisch: Keiner habe ihn mehr.gekannt,<br />
der diesem Archiv als erster vorgestanden hatte und sich »an die Aufgabe<br />
gewagt, Übersicht und Ordnung in die ihm anvertrauten alten Aktenbestände<br />
und Urkundenfonds zu bringen« . Die Ästhetik des preußischen<br />
Archivregimes war ein Element des panoptischen Diskurses seiner Zeit.<br />
Archivordnung ist Subjekt und Objekt <strong>von</strong> Gedächtnis, wenn Scriverius über<br />
die Arbeitsweise Theodor Joseph Lacomblets berichtet. Dieser sortiert zunächst<br />
die Datenmassen in kleinere Einheiten und bezeichnet sie, beginnend mit Klosterbänden,<br />
deren Urkunden er auf Tischen und dem Fußboden ausbreitet, um<br />
sie in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, ehe er sie systematisch aufnimmt.<br />
»Seine juristische Bildung wird ihm hierbei zustattengekommen sein«<br />
. Das Dispositiv der Historie (als Effekt) ist lange Zeit<br />
ein radikal unhistonscher Diskurs: Jurisprudenz und Rhetorik. Hierhin liegt<br />
die radikale Präsentistik der Gedächtnispraxis als Archivtechnik, deren historischer<br />
Mehrwert allein im <strong>Im</strong>aginären hegt. 8 Real ist der entropische Zustand<br />
der Akten, den Lacomblet als Archivassistent in Düsseldorf 1819 vorfindet.<br />
Denn der Entzug regional-staatlicher Machtbindung <strong>von</strong> Akten im Archiv<br />
unter dem Suspens der französischen Besetzung hatte aus Korpora mit einem<br />
Schlag Papierleichen(tücher) gemacht. Einmal auf ihre pure Materialität<br />
verknappt, haben Akten als Lager ein ganz anderes Gewicht. Ein Zusammenbruch<br />
in der Architektur des Lagers wird damit zur Ruptur des Archivs selbst,<br />
das durch keine andere symbolische Ordnung aufgefangen ist: »Auch im Archiv<br />
türmten sich ja die Haufen ungeordneter Papiermassen.« Als das Großherzugtum<br />
Berg 1809 direkt unter französische Verwaltung kam, gab man einen<br />
Großteil der Archivahen der Vernichtung preis und erklärte den Rest <strong>für</strong><br />
wertlos. Die restlichen Urkunden und Akten bleiben vergessen im Düsseldorfer<br />
Schloßturm liegen; »verstaubt und in heilloser Verwirrung wurden auch<br />
Wilhelm Jansen, Vorwort, in: Scnverius 1983<br />
Allerdings sprach Theodor Lacomblot I 824 m seiner Instruktion <strong>für</strong> das Düsseldorfer<br />
Regierungsarchiv Gedanken aus, die dem Provicnicnzsystem entsprechen: Berent<br />
Schwinekörper, Zur <strong>Geschichte</strong> des Provenienzprinzips, in: Staatliche Archivvcrwaltung<br />
[DDR] (Hg.), Forschungen aus mitteldeutschen Archiven [Festschrift Hcllmut<br />
Kretzschmar], Berlin (Rütten & Loening) 1956, 48-65 (62), unter Verweis auf: B. Vollmer,<br />
Die Neugründung des Staatsarchivs Düsseldorf, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> rheinische<br />
Heimatpflege, 3. Jg, Heft 11/12 (1931/3), 369
ARCHIVLAGHN: DAS STAATSARCHIV DÜSSELDORF 639<br />
die letzten Zusammenhänge noch zerrissen, als man das Archiv, nach Einsturz<br />
der Turmtreppe 1817, in aller Eile ins nahegelegene Karmeliterinnenkloster<br />
hinüberschaffen mußte.« 9<br />
Preußische Archive, de/zentral: 1806 und die Folgen (Vincke, Lacomblet)<br />
Die Neuordnung <strong>von</strong> Staaten reflektiert sich in ihrem Archivwesen. Der<br />
»Marschtritt französischer Revolutionstruppen« (Scrivenus) läßt 1794 und 1806<br />
die rheinländische Kleinstaatenwelt und mit ihr die Archive und Registraturen<br />
der bisherigen Landesverwaltungen zusammenbrechen. 1815 installiert die<br />
preußische Verwaltung in der neugeschaffenen Rheinprovinz am Sitz jeder regionalen<br />
Regierung nach französischem Vorbild Archivdepots, in denen man das<br />
herrenlos gewordene Archivgut erst einmal einlagerte .<br />
Noch organisiert kein Diskurs namens <strong>Geschichte</strong> die radikal gegenwärtigen<br />
Daten der Vergangenheit, die als Effekt einer (Beobachter-)Differcnz erst <strong>von</strong><br />
dieser Gegenwart abzusetzen war. 10 Der historische Diskurs ist nur einer <strong>von</strong><br />
vielen in der Epistemologie um 1800. Vincke (in einer Tagebucheintragung vom<br />
7. Februar 1794) beabsichtigt, sich parataktisch »mit <strong>Geschichte</strong>, Geographie,<br />
Statistik, Diplomatik, Staats- und Privatrecht und Naturgeschichte meines<br />
Vaterlandes eifrig zu beschäftigen; zu meinem eignen Vergnügen auch Chemie,<br />
Botanik, Mathematik, Physik, Meteorologie.« 11 Derselbe Vincke, nunmehr<br />
preußischer Oberpräsident in Westfalen, verkündet der Regierung Arnsberg im<br />
September 1817, es sei »höheren Orts beabsichtigt, die ehrwürdigen Denkmale<br />
in den Kloster- und Stiftsarchiven, die verwahrlost würden, durch Vereinigung<br />
zu einem allgemeinen Landesarchiv unter sachkundiger Aufsicht zu sichern«<br />
. Womit - im Sinne der späteren Monumenta (Germaruae<br />
Historica) - das Dokument als Denkmal adressiert ist; Archive und Geschichtsvereine<br />
fungieren als komplementäre Agenturen des deutschen Gedächtnisses.<br />
Am 28. Juli 1818 legt der preußische Kultusminister Altenstein dem Oberpräsidenten<br />
<strong>von</strong> Vincke (auf dessen Initiative 12 ) in Westfalen als Erlaß dar, »daß die<br />
y Scrivcrius 1983: 24f, rcsp. Alte Dienstregistratur, zu Genralia 3, Bd. II<br />
10 Siehe Dirk Baecker, Anfang und Ende in der Geschichtsschreibung , in: Bernhard<br />
Dotzlcr (Hg.), Techno-Pathologien, München (Fink) 1992, 59-85<br />
" Staatsarchiv Münster, Nachlaß Vincke, A I, Bd. 4, zitiert nach: Manfred Wolf, Geschichtspflegc<br />
und Identitätsstiftung. Provinzialarchiv und Altertumsverem als kulturpolitische<br />
Mittel zur Integration der Provinz Westfalen, in: Behr / Klostcrhuis 1994,<br />
461-482(482)<br />
12 Gerhard Zimmermann, Hardenbergs Versuch einer Reform der preußischen Archivverwaltung<br />
und deren weitere Entwicklung bis 1933, in: Jahrbuch der Stiftung<br />
Preußischer Kulturbesitz 1966, 69-87 (76)
640 ARCHIV<br />
historischen und antiquarischen Denkmäler und die Kunstmerkwürdigkeiten in<br />
Westfalen und in der Rheinprovinz aufgesucht, gesammelt und an schicklichem<br />
Ort zur Benutzung <strong>für</strong> Kunstbeflissene, Geschichts- und Altertumsfreunde wie<br />
<strong>für</strong> Liebhaber aufgestellt, geordnet und erhalten werden sollen.« 13 Die geplante<br />
Trennung <strong>von</strong> Archiv als Basis <strong>für</strong> (Geschichts-)Wissenschaft und als Extension<br />
einer Staatsverwaltung wird in einer Weisung Vinckes an den nebenamtlichen<br />
Leiter des Archivdepots in Höxter, Paul Wigand, deutlich. Sich ganz und gar der<br />
Archivarbeit zu verschreiben schließt die Möglichkeit, aufgrund des Archivs<br />
Monumenta Germaniae zu edieren, in einer institutionellen Logik <strong>von</strong> Einsicht<br />
und Blindheit aus. 1823 erreicht Vincke <strong>für</strong> Wigand einen einjährigen Berufsurlaub,<br />
um sich ganz den Archivarbcitcn widmen zu können. Als Wigand ihm <strong>von</strong><br />
der Einladung zur Mitarbeit an den Monumenta berichtete, erhält er zur Antwort,<br />
»er müsse sich ausbedingen, daß in diesem Jahr seine ganze Tätigkeit allein<br />
den Archiven gehöre«; Vincke untersagt ihm schlichtweg jede wissenschaftliche<br />
Arbeit in dieser Zeit, »insbesondere die <strong>für</strong> die Monunienta« .<br />
Stein macht Wigand, dem Autor einer <strong>Geschichte</strong> der gejürsteten Rcichsahtei<br />
Corvey und der Städte Corvey und Höxter, das Angebot, die Quellen der sächsischen<br />
Periode (Widukind <strong>von</strong> Corvey) zu earbeiten. Daraufhin legt er der<br />
Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde (seit 1819 in Frankfurt) am 20.<br />
Januar 1820 den Plan einer als Filialverein gedachten Gesellschaft <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
und Altertumskunde Westphalens vor. Historie und Archiv aber bleiben im<br />
Widerstreit, ausschließlich. Wigands Kollege, der Historiker Liborius Meyer, der<br />
(nebenamtlich arbeitende) Betreuer des Archivdepots in Paderborn, sieht in der<br />
Sichtung und Ordnung der verstreuten Archive seine primäre Aufgabe. Für ihn<br />
hat die wissensarchäologische, diskrete, non-narrative Arbeit der Diplomatik am<br />
archivischem Monument Priorität gegenüber seiner (historisch-)hermeneutischen<br />
Auswertung; ihm ist die genaue Untersuchung der einzelnen Urkunde<br />
wichtiger als ihre Eigenverwertung <strong>für</strong> ein landesgeschichtliches Thema. Wigand<br />
dagegen betrachtet die Verzeichnung und Erschließung <strong>von</strong> Archivahen wie die<br />
Erstellung <strong>von</strong> Archivverzeichnissen »zwar als eine unerläßiche, aber doch nur<br />
als eine Pflichtaufgabe« vor dem Hintergrund seines eigentlichen Interssensgebiets,<br />
der landesgeschichtlichen Forschung .<br />
Das Archiv ist nicht nur die Grundlage der historischen Forschung und das<br />
non-narrative Dispositiv aller Geschichtserzählung (jener Tautologie), sondern<br />
seinerseits mit im Spiel derselben: »Traditionally, the disciphne of history was<br />
the foundation on which archival training was based.« 14 Dies gilt schon <strong>für</strong> den<br />
13 Staatsarchiv Münster, OP, Nr. 35a, Bd. 1, Bl. 11, zitiert nach: Wolf 1994: 475<br />
14 F. Gerald Ham u. a., Is the Past Still Prologue? History and Archival Education, in:<br />
American Archivist 56 (Fall 1993), 718ff (718)
ARCHIVI.AGHN: DAS STAATSARCHIV DÜSSELDORF 641<br />
Protagonisten der Frühgeschichte des Düsseldorfer Staatsarchivs Lacomblet,<br />
der uns erstmals in einer Akte am 4. Juni 1816 entgegentritt . Das Archiv verwechselt nicht Akten mit Leben (was Geschichtsschreibung<br />
halluzinatorisch wieder revidiert). Wird das Archiv selbst zum inneren Objekt<br />
einer Historie, läßt es sich als Reflex jener Ereignisse lesen, deren Daten es zur<br />
Verfügung stellt; politische Restauration bedeutete auch im Düsseldorfer Fall<br />
Restriktion im Zugang zur Datenbank der Gedächtnisagentur - die »scharfe<br />
Weisungen zur Geheimhaltung in den Archiven selbst« .<br />
Die <strong>von</strong> Preußen administrativ festgelegten Verwaltungsgrenzen zwischen Köln<br />
und Düsseldorf (als Regierungsbezirken) führen zu einer Asymmetrie der <strong>von</strong><br />
den jeweiligen Archiven abgedeckten Geschichtslandschaften mit den neuen<br />
Gebietseinheiten; alle herrschaftlichen Archive werden daraufhin in Düsseldorf<br />
vereint. Am 6. Oktober 1831 einigen sich beide Archive dahingehend, daß die<br />
Archive eines Landes, Stifts oder Klosters jeweils an einem Ort ungeteilt aufbewahrt<br />
werden sollten. Nur eine Nebenklausel schreibt die getrennte Wahrnehmung<br />
<strong>von</strong> Arbeits- und Gcdächtmsspcicher fort: Lediglich Aktenarchive<br />
(»Registraturen«) könnten, soweit »kein Archiv-, d. h. kein wissenschaftliches,<br />
historisches oder höheres Staats-Interesse hierdurch verletzt wird«, abgetrennt<br />
und bestehenden Behörden überlassen werden . Die zunehmend jenseits des <strong>Im</strong>aginären und Repräsentativen, sondern im<br />
Verborgenen umso effektiver arbeitende (Staats-)Macht entzieht also die Archivalien<br />
jener Neuordnung gemäß dem Paradigma <strong>Geschichte</strong>, solange sie an die<br />
Machtkybernetik noch gebunden sind. Zugrundegelegt wird der vor 1794<br />
bestehende Zustand, mit der Einschränkung, daß einer künftigen Regelungen<br />
<strong>für</strong> die Zeit nach der Auflösung der früheren Verhältnisse unter der französischen<br />
und preußische Herrschaft nicht vorgegriffen werden soll. 15 Eine Berliner<br />
Geschäftsanweisung an Lacomblet als Leiter des preußischen Staatsarchivs<br />
in Düsseldorf gibt am 20. November 1821 eine Verfahrcnsanleitung zur Kybernetik<br />
der Archivalien: Zunächst sollten sie unterteilt werden in solche, die ein<br />
»historisches, antiquarisches, diplomatisches und sonst wissenschaftliches Interesse<br />
haben«, und solche, »welche entweder <strong>von</strong> keinem Belange oder <strong>für</strong> die<br />
laufende Verwaltung <strong>von</strong> Wichtigkeit sind« - womit die Anbindung an laufende<br />
Macht in actu als Ebene der Non-Diskursivität definiert ist, wo keine historische<br />
Bedeutung, kein semantischer Mehrwert im Sinn einer emphatischen<br />
Historie gilt. Die »zur Asservierung geeignet befundene(n) Archivallen« sollten<br />
»zuvörderst nach dem Objecte, demnächst aber die Ein Object betreffenden,<br />
nach der Zeitfolge geordnet« werden. So geordnet werden die Objekte in<br />
summarische Repertonen aufgenommen, welche bei kurzer, regestenhafter<br />
15 AD, Gen. 3, Bd. III, Bl. 5ff
642 ARCHIV<br />
Angabc des Inhalts nur das Jahr, das datum der Archivallen zu enthalten brauchen.<br />
16 Die archäologische Logistik der Chronologie ist aller philosophisch<br />
emphatischen Logik der <strong>Geschichte</strong> vorgeschaltet als Informationsverarbeitung.<br />
Das Archiv behandelt seine Objekte (Textartefakte) zuvorderst als diskretes<br />
Monument zur Aufzeichnung und nicht bereits als Dokument einer zu schreibenden<br />
Historie. Zweck der Operation ist es, die in Unordnung zerstreuten<br />
Unterlagen »in den Griff zu bekommen« : Nicht historisches<br />
Verstehen, sondern Sortierung heißt Gedächtnismacht. Lacomblet läßt die<br />
Urkunden <strong>von</strong> Akten getrennt lagern. Die Verzeichnung, also Semiotisierung<br />
der einzelnen Urkunde im Aufschreibesystem Archiv wird mit Präzision geregelt:<br />
chronologische Lagerung, kurze Angabe des Inhalts, <strong>Namen</strong> der Zeugen,<br />
Ort und Tag der Ausfertigung, kurze Beschreibung der äußeren Beschaffenheit,<br />
Auflösung der älteren Orts- und Personennamen durch Gegenüberstellung der<br />
alten mit der neuen Fassung. Das Provcmenzprinzip »steht noch, obwohl es<br />
sich in den praktischen Arbeiten bereits durchgesetzt hat und anerkant worden<br />
war, verborgen hinter den Dingen«. 17 Gedächtnistechnisch heißt das die Aulbewahrung<br />
der Urkunden in speziellen Urkundenschränken, die aus dem<br />
Verkaufserlös <strong>von</strong> Aktenmakulatur finanziert werden - das Archiv als autophagisches<br />
System, ein Gedächtnis, <strong>für</strong> das die Trennung <strong>von</strong> Hard- und Software<br />
nicht im Realen, sondern allein im Symbolischen des historischen Diskurses<br />
gilt. 1837 ist der Schritt aus dem Internen des Archivs (Manuskriptverwaltung)<br />
an die Öffentlichkeit im Medium des Drucks eine Funktion sowohl diskursiver<br />
<strong>Im</strong>perative (Geschichtswissenschaft) als auch Effekt einer Notwendigkeit<br />
zur Sicherung der Daten. Ein strukturiertes Verzeichnis ist bereits der Schritt<br />
<strong>von</strong> der reinen Datenbank zu ihrer Anschließbarkeit an den historischen Deutungsdiskurs,<br />
zumal<br />
»eine mit diplomatischer Genauigkeit bewirkte Abschriftnahmc und der demnächst<br />
erfolgende Abdruck der Urkunden nicht nur die in der Archiv Instruction<br />
vorgesehene Bildung <strong>von</strong> Copiebüchern großen Theils ersetzt und daher eine<br />
Archiv-Arbeit selbst darstellt, sondern auch durch möglichst richtige und vollständige<br />
Ueberschriften, Berurcheilungen Lind F.rläutcrungen der Urkunden als<br />
eine wissenschaftliche Bearbeitung derselben betrachtet werden darf.« <br />
Das Urkundenbuch <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> des Niederrheins ist Lacomblets »Schritt<br />
vom praktischen Archivar zum wissenschaftlichen Historiker«
Aktenordnungen<br />
ARCHIVLAGEN: DAS STAATSARCHIV DÜSSELDORF 643<br />
Der Philologe und Historiker Woldemar Harleß folgt im Frühjahr 1854 dem<br />
Ruf des gerade sich formierenden Germanischen Museums in Nürnberg als<br />
erster Sekretär dieser Anstalt, kehrt aber schon nach einem halben Jahr nach<br />
Bonn zurück, um hier zunächst eine Bibliotheksanstellung zu suchen, dann das<br />
Archiv der Rheinischen Provinzialvcrwaltung zu ordnen und 1866 Lacomblets<br />
Nachfolger im Düsseldorfer Staatsarchiv zu werden. So durchlässig sind derzeit<br />
noch die Grenzen zwischen Museum, Bibliothek und Archiv <strong>für</strong> Fachleute,<br />
die das Wissen im Umgang mit dem diese Medien gleich umfassenden Textspeicher<br />
beherrschen. Der Untertitel einer Zeitschrift, die darüber berichtet, nennt<br />
die Bandbreite dieses Speicherdispositivs. 18 Was diesen Gedächtnismedienverbund<br />
bindet, ist die Verzeichnungspraxis. Die Aktenbände des Archivs der<br />
Rheinischen Provinzialverwaltung sind seinerzeit »sehr unpraktisch und<br />
undeutlich signiert, ein Umstand, der mit daran schuld ist, daß die Ordnung<br />
schenll wieder zerstört war, zumal das Archiv sich wiederholt Umlegungen und<br />
Umzüge gefallen lassen mußte« . So oszilliert Gedächtnisarchäologie<br />
zwischen symbolischer Adressierung und (Akten-)Lagen ihrer Hardware.<br />
In dem <strong>von</strong> Harleß 1856 da<strong>für</strong> fertiggestellten Findbuch sind die Akten<br />
ohne Rücksicht auf die sachlichen Abteilungen fortlaufend numeriert, »was die<br />
Einschiebung <strong>von</strong> Nachträgen, die Harleß selbst schon in großer Zahl vornehmen<br />
mußte, sehr erschwerte« - ein vom späteren Projekt des Gesamtkatalogs<br />
der Preußischen Bibliotheken vertrautes Dilemma, das double-bind<br />
(buchstäblich) zwischen Bandausgabe im Druck und alternativer Edition in<br />
Zettelform. Gedächtnisadministration als Funktion <strong>von</strong> Spcicherökonomie.<br />
Erforderlich ist auch in diesem Fall, daß der Gesamtkatalog genügend Raum <strong>für</strong><br />
Nachträge bietet, was auf die Gefahr hinausläuft, daß beim Preußischen Gesamtkatalog<br />
»die Fülle des auf der einzelnen Bibliothek Nicht-Vorhandenen<br />
den Besitz der Bibliothek selbst überwuchere und unauffindbar mache.« 19 Die<br />
archivreif gewordenen Akten der Rheinischen Provinzialverwaltung jedenfalls<br />
werden ohne Ordnung und ohne Findbuch zusammengelegt »und bildeten bald<br />
ein unübersehbares Durcheinander« ; aus dem Versuch einer<br />
Ordnung wird so »die Anhäufung solcher Papiermassen unter dem Dach«<br />
. Nachdem die Luftschutzverordnung eines antizipierten Kriegs die Ak-<br />
18 Wilhelm Kisky, Das Archiv der Rheinischen Provinzialverwaltung im Landeshaus in<br />
Düsseldorf, in: Rheinische Heimatpflege. Zeitschrift <strong>für</strong> Museumswesen, Denkmalpflege,<br />
Archivberatung, Volkstum, Natur- und Landschaftsschutz, 10. Jg. 1938, Heft<br />
3,342-345<br />
19 Hermann Fuchs, Der deutsche Gesamtkatalog, Leipzig (Harrassowitz) 1936, 4
644 ARCHIV<br />
ten in Keller zwingt, wo sie, auf dem Boden angehäuft, weder in Ordnung noch<br />
zugänglich sind, wird schließlich »der lange schmale offene Flur durch<br />
Abschlußtüren in einen geschlossenen Raum verwandelt« - vom<br />
Durchgang (Zwischenspeicher) zum selbstreferentiellen Raum, eine Frage der<br />
Differenz <strong>von</strong> Öffnung und Abschluß. Die wissensarchäologische Schwelle<br />
zwischen Gedächtnisapparaten und -rechnern hat Jacques Lacan anhand dieser<br />
Schnittstelle als die Frage der kybernetischen Tür beschrieben, jenem Symbol,<br />
das seit jeher Öffnung und Schließung verkreuzt. »Seit dem Augenblick nun,<br />
da man die Möglichkeit gemerkt hat, beide Züge der Tür aufeinanderzulegen<br />
und das heißt Schaltkreise als solche zu realisieren, bei denen etwas gerade dann<br />
durchgeht, wenn sie geschlossen sind, und etwas gerade nicht durchgeht, wenn<br />
sie offen sind, seit diesem Augenblick ist die Wissenschaft vom Kalkül in die<br />
<strong>Im</strong>plementierungen der Computertechnik übergegangen« - als Funktion des<br />
Gcgcbcnscms miormathscher Türen. 20<br />
Unter Heinrich Theodor Jlgen bezieht das Düsseldorfer Archiv nach 1900<br />
ein Gebäude in der Prinz-Georg-Straße, dessen Magazin intern nicht mehr<br />
durch Mauerwerk gefächert ist; bis in die Regalsysteme setzte sich die neue<br />
Modulantät fort, <strong>für</strong> die gebaute Architektur nur noch Hülle, Fassade ist. Das<br />
Archivlager entspricht der aristotelischen hyle, die in der ersten Substanz<br />
»nichts als reine, völlig bestimmungslose Offenheit oder Bestimmbarkeit<br />
gegenüber dem das wesentliche Sein bestimmenden Aktprinzip (Entelechie)«<br />
ist. 21 Der Raum des Archivs wird funktional adäquat: »Durch diese neue Form<br />
der Lagerung war man nun horizontal wie vertikal beweglich geworden« ; das Archiv wird zu einem kartesischen Koordinatennetz und<br />
ebenso adressierbar. Serielle Ordnungen jenseits aller Diskursivität löschen<br />
Historie als Erinnerung eines ursprünglichen Kontextes. Unter Ilgens Leitung<br />
werden die Urkunden umgelegt und in eine durchgehend chronologische Ordnung<br />
gebracht. Oedinger hat zweckmäßiger die alten Signaturen belassen wollen,<br />
denn Umschichtungen in Archivformationen zerstören das Gedächtnis<br />
ihrer Vorgänge(r); im Fall der Stiftsarchive <strong>von</strong> Essen und Werden hat die schematisch<br />
durchgeführte chronologische Ordnung die Möglichkeit, die alten<br />
Hobs- und Lehnsarchive wiederherzustellen, verbaut. Historisches Gedächtnis<br />
beruht auf funktionalen Strategien der Ordnung. Das in Preußens Gedächtnis<br />
letztendlich durchgesetzte Provenienzprinzip erfüllt die Funktion einer solchen<br />
20 Jacques Lacan, Le seminaire, Bd. II: Le moi dans la theorie de Freud et dans la technique<br />
de la psychanalyse, Paris 1978, 347; freie Übersetzung durch Friedrich Kittler,<br />
Hardware, das unbekannte Wesen, in: Lab. Jahrbuch 1996/97 <strong>für</strong> Künste und Apparate,<br />
hg. v. d. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien Köln, Köln 1997 (Walther König), 348-363 (351)<br />
21 D. Schlüter, Artikel »Akt/Potenz«, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 1, Sp.<br />
134-142 (Sp.137)
ARCI IIVI.AC;HN: DAS STAATSARCHIV DÜSSF.I.OORF 645<br />
Ortung auch jenseits <strong>von</strong> historischem Sinn; unter Ilgen beginnt dieser Prozeß<br />
der Fusion <strong>von</strong> aufgespeicherten Einzelakten in Bestände als deren Wiederherstellung<br />
nach ihrer alten Registraturordnung. Nur so läßt sich ihre Ordnung<br />
durchsichtig machen .<br />
Weimarer Republik, 1933 und die Folgen<br />
Nach dem Ersten Weltkrieg strukturiert sich mit der Gesellschaft auch ihr Archivwesen<br />
neu, das sich <strong>von</strong> der Fixierung auf die reine Staatsbindung als Objektorientierung<br />
ihres Gedächtnisses löst; die Initiative zur Übernahme nichtstaatlichen<br />
Archivguts durch den Provinzialverband kommt <strong>von</strong> der Gründung eines Verbandes<br />
Rheinischer Heimatmuseen: »Das weitere Streben des Verbandes gilt einer<br />
engen Fühlungnahme mit den - entsprechenden Zielen dienenden - Archiven«. 22<br />
Unter Bernhard Vollmer steigen die Aktenneuzugänge in Düsseldorf sprunghaft<br />
an; kein historisches oder administratives Sortierparadigma kann noch Reduktion<br />
<strong>von</strong> Komplexität leisten, so daß das Aufstellungsprinzip nach numerus currens<br />
die reine Folge, also die Vorschrift des Realen zum Medium des Gedächtnisses<br />
macht - und das bei einem Mininum an personeller und materieller Ausstattung<br />
des Archivs. 1929 meldete der Jahresbericht eine Abgabe <strong>von</strong> 1232 Aktenstücken,<br />
1930 338, 1931 2083, 1932 25 471, 1933 3078, 1934 16310, 1935 ca. 6000. Die<br />
Reduktion dieser quantitativen Komplexität ist allein durch eine qualitative<br />
Neuschaltung zu bewältigen, das Akzessions- als Aufstellungsprinzip: Neuzugehende<br />
Akten werden in direktem Anschluß an das jeweils Vorhergehende aufgestellt,<br />
eine geschlossene Nummernfolge bildend. Eine Konkordanz überbrückt<br />
die Kluft zwischen Lagerung und Verzeichnung, die Auffindung einer Lagernummer<br />
in einem Findbuch durch eine supplementierte Liste, die neben der<br />
Lagernummer die Seite, auf der sie steht, enthält . Mit der<br />
Regierungsübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 änderte<br />
sich die Lage, denn das neue Regime begünstigte aus ideologischen Gründen<br />
die Ahnenforschung und ist damit dem Archiv verschrieben. 2 -' Die vom Archiv<br />
prokunerten Gedächtnisdaten aber tangieren nicht notwendig dessen Betriebssystem;<br />
blieb die Archivpraxis unberührt, wertfrei <strong>von</strong> ideologischer Deflexion<br />
im Dritten Reich} Es gab (im Unterschied zum Museumswesen) keinen<br />
Versuch einer völkischen Archivwissenschaft. Der Diskurs des organologischen<br />
Weltbildes (mit Begriffen wie »Blutströme« <strong>für</strong> Datenlagen) spricht sich -<br />
22 Bernhard Vollmer in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichtsund<br />
Altertumsvereine, 76. Jg. 1928, Sp. 198 f., zitiert nach: Scriverius 1983: 53f<br />
23 Dazu Vollmer im Jahresbericht <strong>für</strong> 1933; siehe Scriverius 1984: 111, Anm. 14, resp.<br />
AD, Jl, Bd.. XIV
646 ARCHIV<br />
etwa in den archivwissenschaftlichen Schriften <strong>von</strong> Papntz - zwar noch bis in die<br />
50er Jahre fort, bleibt jedoch abgekoppelt <strong>von</strong> der archivarischen Praxis. Die<br />
Staatsarchive berurteilen (auch retrospektiv) das NS-Regime weniger unter politischen<br />
denn funktionalen Kriterien, wie es Scnvenus ausdrücklich <strong>für</strong> die Schaltstelle<br />
Berlin beschreibt. Über Einstellung des Nachwuchses entscheidet bis 1945<br />
der Preußische Ministerpräsident auf Vorschlag des Generaldirektors der Archive;<br />
Archivpraxis und Archivare bleiben damit unter sich.<br />
Gemäß dem Zweitem Thessalomcherbrief im Neuen Testament ist das katechon<br />
die Instanz, die das Weltende hinausschiebt 24 ; das Katechontische des archivischen<br />
Gedächtnisses ist ein Indikator <strong>für</strong> Krisen im Vertrauen auf die Zukunft.<br />
Das Archiv leistet dem Kriegsfall Vor- durch Verschub; ab 1938/38 ist die Auslagerung<br />
<strong>von</strong> Archivalicn bereits gedachte Realität. Nach der außenpolitischen<br />
Krise im Hochsommer 1938 einigen sich die Archivdirektorenkonferenzen in<br />
Marburg (21. Oktober 1938) und Berlin (13. März 1939) auf eine Auslagerung<br />
auserlesener Archivalicn an besonders geschützte Stellen. Auf die mit dem Luftangriff<br />
auf die Hansestadt Lübeck am 29. März 1942 manifest gewordene neue<br />
Form der Bedrohung reagiert die deutsche Archivdirektion unter Zipfel (am 22.<br />
Mai 1940 zum Kommissar <strong>für</strong> den Archivschutz im gesamten westlichen Operationsgebiet<br />
ernannt) mit der logistischen Segmentierung des deutschen Gedächtnisses.<br />
Mit der vereits existenten Dezentralisierung der Leitungszentren im<br />
System preußischer Staatsarchive korrespondiert nun auch die Lagerung ihrer<br />
Bestände. Zipfel verfügt es am 1. Mai 1942: Die Wendung, welche der Luftkrieg<br />
nahm, zwinge die Archive nunmehr, »ihre wertvollen Bestände in stärkerem<br />
Maße als bisher auseinanderzuziehen und durch Verbringen an eine oder mehrere<br />
Ausweichstellen vor dem Gesamtverlust zu schützen.« 25<br />
Von der wissensarchivologischen Ruptur 1945 bis an die Grenzen zur<br />
Elektronischen Geschichtsdatenverarbeitung<br />
Am 17. April 1945 rücken amerikanische Truppen in Düsseldorf ein. Das erste<br />
Interesse am Archiv bezieht sich in Form <strong>von</strong> Nachforschungen des amerikanischen<br />
Sicherheitsdienstes auf das Gauarchiv und auf wirtschaftsgeschichtliche<br />
Quellen; Historie rangiert demgegenüber nachträglich. Nach der Kapitulation<br />
der Wehrmacht am 8. Mai folgt auch <strong>für</strong> das Düsseldorfer Archiv eine Zeit des<br />
Interregnums, in der es völlig auf sich selbst gestellt ist. Die Kommunikationslimen<br />
mit Berlin sind nicht mehr autorisiert und nicht mehr im Sinne eines impe-<br />
24 Hinweis Walter Seitter (Wien)<br />
25 Wilhelm Rohr, die zentrale Lenkung deutscher Archivgut-Schutzmaßnahmen im<br />
Zweiten Weltkrieg, in: Der Archivar 3. Jg., 1950, Sp. 109
ARCHIVLAGI-N: DAS STAATSARCI nv DÜSSKI.DORF 647<br />
num anschreibbar; die Bindung an die dort vorgesetzten Behörden waren zerrissen.<br />
Die Archivspitze des Reiches wähnt sich auch nach dessen Untergang<br />
weiter existent, aufgehoben <strong>von</strong> (historischer) Zeit: »Es war cm Anachronismus<br />
und wurde <strong>von</strong> Vollmer auch als solcher erkannt, als am 9. Juli und 16. August<br />
sich Zipfel - zuerst dienstlich knapp, dann in pnvathöflichem Ton - an Vollmer<br />
wandte und auf normalen Postkarten um dienstliche Berichterstattung bat.« 26<br />
Und die Rückführung ausgelagerten Archivguts macht den Übertragungsverlust<br />
logistischer Daten manifest; nachdem im Monatsbericht <strong>für</strong> September 1946 der<br />
Abschluß der Rückleitung ausgelagerter Archivgutmassen gemeldet wird,<br />
beginnt die Überprüfung der durch die Transporte erheblich in Mitleidenschaft<br />
gezogenen Archivalien - keine Datensicherung ohne Übertragungsverluste. Teilweise<br />
ist an Akten die alte Beschriftung verlorengegangen, oder Faszikel haben<br />
sich durch Zerreißen morscher Kordeln aufgelöst; teilweise haben sich Schmutz<br />
und Salzverkrustungen auf ihnen abgesetzt. Hier reagiert das chemisch Reale mit<br />
dem Symbolischen des Archivgedächtnisses. Die wissensarchäologische Chance<br />
der Stunde Null ist auch eine <strong>von</strong> Inventaren, denn die Wiederaufstellung der<br />
Bestände soll zu einem Neuaufbau unter Berücksichtigung der bislang gemachten<br />
Erfahrungen genutzt werden; anstelle der bislang schwer überschaubaren territorialen<br />
Gliederung, welche die Archive der kleineren Herrschaften, Stifter und<br />
Klöster sowie der neueren Behördenregistraturen jeweils den alten Landesarchiven<br />
anschloß, werden neue zeitliche und sachliche Gruppen gebildet. 27 Herrschaftsgeschichten<br />
schreiben sich nahe der Ordnung des Archivs selbst, welche<br />
der Logistik der Herrschaft als Administration entspricht. Geschichtsschreibung,<br />
die dem auf die Spur zu kommen sucht, was <strong>von</strong> Akten nicht erfaßt wird,<br />
blendet ihre eigene Formatierung durch solche Archi(v)logistik (ex negativo,<br />
als Ausschlußverfahren) gerne aus. Gelegentlich aber kommt es zu Kurzschlüssen<br />
nationaler Gcdächtnissymbohk mit dem non-diskursiven Realen<br />
des Archivs, oder der immer wieder symbolische Ordnung produzierenden<br />
Logik des Kalenders mit dem Aufschreibesystem archivischer Registratur. Am<br />
14. August 1948 entspricht (aus Anlaß des 700jährigen Domjubiläums) Ministerpräsident<br />
Arnold der Bitte <strong>von</strong> Kölns Oberbürgermeister Pünder, entgegen<br />
gedächtmsverwaltungslogistischen Interessen Archivalien der Kölner<br />
Stifter und Klöster, die bisher in Düsseldorf lagerten, als Dauerleihgabe<br />
dem Stadtarchiv in Köln zur Verfügung zu stellen. Der Chef der Düsseldorfer<br />
Staatskanzlei spricht <strong>von</strong> einer Erinnerungsgabe; aus der Perspektive <strong>von</strong> Archiven<br />
ist Erinnerung keine transzendent gegebene Größe, sondern eine zu stii-<br />
26 Scriverius 1983: 68, resp. Mittlere Dienstregistratur (1940-1966),] 1, Bd. 11, Bl. 9 u. 13<br />
27 Vollmer am 11. Januar 1946 in seinem Bericht über die seit Kriegsende durchgeführ-<br />
ten Arbeiten = MD, J 1, Bd. II, Bl. 22
648 ARCHIV<br />
tende. 28 Das bedeutet einen Verlust des Düsseldorfer Archivgesamtbestands um<br />
ein Fünftel, eine Wunde, die auch nicht durch Archivgeschichtsschreibung<br />
schließbar ist: Für Oediger ist dieser Archivtransfer »noch zu schmerzlich, um<br />
die im Band 1 der Düsseldorfer Bestandsübersichten dargestellte <strong>Geschichte</strong><br />
des Archivs über das Jahr 1949, mit dem sie abbricht, weiter fortsetzen zu können.<br />
29 Wissensarchäologie, das Reich der Archive, rechnet mit Diskontinuitäten,<br />
dergegenüber <strong>Geschichte</strong>(n) das Unwahre ist. Staatsbewußtsein ist gekoppelt an<br />
das Archiv. Daß Gedächtnispolitik Archivkybernetik heißt, weiß das Bundesland<br />
Nordrhein-Westfalen, das nach Kriegsende überhaupt erst entsteht, aufgrund<br />
seiner eigenen Vorgeschichtslosigkeit genau. Dort rückt das archivische<br />
(Retro-)Gedächtnis anstelle kameralistischer Verborgenheit (als arcanum) in den<br />
Mittelpunkt staatlichen Wirkens. Am 26. September 1963 verkündet es der SPD-<br />
Abgeordnete Fritz Schäperkötter:<br />
»Wenn man die Bemühungen des Herrn Ministerpräsidenten anerkennt, einem<br />
neuen Landesbewußtsein durch Schaffung kultureller Einrichtungen usw. mit<br />
einer das ganze Land umfassenden Aufgabenstellung Ausdruck zu geben, so ist im<br />
Hauptstaatsarchiv ein solches Institut bereits vorhanden und bedarf nur der entsprechenden<br />
Herausstellung durch einen repräsentativen Neubau an einprägsamer<br />
Stelle unserer Landeshauptstadt.« 30<br />
Der Archivneubau wird so auch symbolisch zum lieu de memoire. Die Gedächtnislogistik,<br />
also Architextur des Archivs ist gekoppelt an die Architektur des<br />
Symbolischen, die dem Depot einen repräsentativen Mehrwert an Geschichtskultur<br />
abgewinnt - eine ornamentale Redundanz gegenüber der Nichtdiskursivität<br />
der Inventare. Auf der Ebene der Inventare aber wird längst nicht mehr<br />
nach Symbolen, sondern nach Verknüpfung gesucht. Dem Archivar ist der<br />
Computer zunächst schlicht eine lineare Erweiterung des Inventars (und nicht<br />
die Wahrnehmung der damit möglichen Umrechnung, also Transformierbarkeit<br />
der Daten in andere Aggregatzustände), ein adäquates Mittel zur schnellen Fortführung<br />
vorhandener Findhilfsmittel (Indizes, Repertonen). Der Neubau des<br />
Düsseldorfer Archivs (ein siebenstöckiger Magazinbau aus Beton, vom dem sich<br />
zwei Untergeschosse unter der Erde befinden) hat durch seinen Anschluß an die<br />
EDV-Anlage des nunmehr benachbaren Landesamtes <strong>für</strong> Datenverarbeitung<br />
und Statistik »die Nutzbarmachung dieser Technik im Archiv erleichtert« , womit der Schaltkreis wieder geschlossen ist: Die preußische<br />
2S Scriverius 1983: 78, resp. NW 179 Nr. 857 Bl. 28<br />
29 Scriverius 1983: 80, resp. Friedrich Wilhelm Oediger, Landes- und Gerichtsarchive<br />
<strong>von</strong> Jühch-Berg, Kleve-mark, Moers und Geldern. Bestandsübersichten, Siegburg<br />
1957,44<br />
30 Zitiert nach Scriverius 1983: 88f, resp. Neue Dienstregistratur (kurrent), 0.-2.2, Kulturausschuß<br />
NW: Archivuntcrausschuß. Bl. 5f
ARCI IIVI.ACKN: DAS STAATSARCHIV DÜSSKI.DORT 649<br />
Kopplung <strong>von</strong> Staatsverwaltung und Statistik-' 1 ist im Medium Computer als<br />
buchstäbliches Gedächtnis/ee
650 ARCHIV<br />
Das Reichsarchiv: Optionen und Realität<br />
Historiogramm eines Speichers: Karl Demeter zeichnet in seinen Erinnerungen<br />
das Reichsarchiv als Geschichtskörper, als Kollektiv <strong>von</strong> Personen (quer zum<br />
Kollektivsingular des Archivs). Der blinde Fleck der Archivierung des Archivs<br />
ist sein Beamtenkörper, dessen Eigensinn seinerseits nur bedingt in Akten gespeichert<br />
ist. Gerade dessen allzu menschlichen Züge, der Vollzug der Archivpraxis,<br />
kommen »in den rein aktenmäßigen Quellen kaum je zum Vorschein«, obgleich<br />
sie das Betriebsklima kennzeichnen und motivieren. 1 Medienarchäologisch relevant<br />
ist nun der Rapport, die Kopplung zwischen Gedächtnistechniken und<br />
ihrem Vollzug durch Subjekte. Zum historischen Forschungsgegenstand Reichsarchiv<br />
liegen umfangreiche, nahezu alle zur Verfügung stehenden Quellen<br />
erschöpfende, archivische Untersuchungen vor. 2 Demgegenüber stellt der Teppich,<br />
die Verknüpfung der im Folgenden dargelegten Befunde keinen Anspruch<br />
auf repräsentative, das Ganze des Thema pars pro toto abdeckende Flächenhaftigkeit,<br />
sondern die Darstellung inventarisiert und figuriert, den Kontingenzen<br />
archivischer Lagen und ihrer Lesung folgend, also sich auf das Spiel <strong>von</strong> archivischen<br />
Signifikanten einlassend, Konstellationen des archivischen Gedächtnisses<br />
(stränge attractors) als Subjekt wie Objekt der Untersuchung - Korrespondenzen<br />
eines Zettelkastens mit dessen institutionalisiertem Korrelat. »Die Gesamtheit<br />
der Notizen läßt sich nur als Unordnung beschreiben, immerhin aber als<br />
Unordnung mit nichtbeliebiger Struktur.« 3 Die folgenden Behauptungen wollen<br />
nicht vor der Fülle eines nicht Gesagten, aber Gewußten verstanden werden, sondern<br />
als Monumente, die Aussagen autorisierende Stichproben inmitten einer<br />
Leere, die an anderen Stellen, <strong>von</strong> anderen Autoren, mit unendlicher Geduld<br />
längst durch Materialfülle supplementiert worden ist:<br />
»Each states the law and fact and face of< the thing<br />
Just as he'd have them, finds what the thinks fit,<br />
Is blind to what missuits him, just records<br />
What makes his casc out, quitc ignores the rast.« 4<br />
1 Karl Demeter, Das Reichsarchiv. Tatsachen und Personen, Frankfurt/M. (Bernhard &<br />
Graefe) 1969, 5. Dieser Verlag <strong>für</strong> Wehrwesen, gegründet 1918 in Königsberg, ist<br />
koexistent mit der Archäologie des Reichsarchivs selbst.<br />
2 Vorrangig Matthias Herrmann, Das Reichsarchiv (1919-1945). Eine archivischc Institution<br />
im Spannungsfeld der deutschen Politik, 2. (inhaltlich unveränderte) Ausgabe<br />
1993, Diss. phil. Berlin: Humboldt-Universität, 2 Bde.<br />
-' Niklas Luhmann, Kommunikation mit Zettelkästen: Ein Erfahrungsbericht, in: ders.,<br />
Universität als Milieu, Bielefeld (Haux) 1992, 53-61 (57)<br />
4 Robert Browning, Mr Sludgc, »the Medium«, hier zitiert nach: Antonia S. Byatt, Possession:<br />
a romance, London (Vinta^c) 1991, Motto
DAS Rr.ici ISAKCI HY: OPTIONI-N UND RKAUTÄT 651<br />
Gedächtnismedienarchäologie, im Unterschied zur Historie, thematisiert neben<br />
den linear, zeitlich irreversiblen Realisierungen <strong>von</strong> Institutionen, Maschinen<br />
und Programmen auch die im Archiv der Vergangenheit immer schon angelegte<br />
Virtualität ihrer Alternativen. Der Gedanke, ein deutsches Reichsarchiv zu<br />
errichten, eröffnet sich so in seinen unentwegten Neuanläufen nicht als als eine<br />
Kette <strong>von</strong> Scheitern, sondern erinnert an die Pluralität <strong>von</strong> Gedächtnisaggregationen,<br />
unter denen die letztendhch verwirklichte nur eine Untermenge bildet.<br />
Der Reichsarchivgedankc korrespondiert zunächst mit dem politischen Willen<br />
des 19. Jahrhunderts, »die Einheit der deutsche Nation in einem Staate und<br />
durch ihn zu begründen« 5 ; im Akt der arche fallen Gründung und Archiv<br />
zusammen. Wissensarchäologisch liegen <strong>für</strong> die Zeit der Merovmger und Karolinger<br />
wenn schon nicht historisch mtegnerbare Indizien (Dokumente), so doch<br />
Anhaltspunkte vor, daß vornehme Abteien »das fehlende Reichsarchiv ersetzten«.<br />
6 Noch zur Zeit der Währung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher<br />
Nation nennen sich 24 Foliobände des Leipziger Stadtschreibers J. C. Lünig<br />
Teutscbes Reichsarchiv; ferner liegen Michael Heinecke Scriptores rerum Germanicum<br />
vor. Der präzise Grund, warum der Zeitraum dieser Arbeit über die<br />
Infrastruktur des deutschen Gedächtnisses mit dem Jahre 1806 einsetzt, liegt in<br />
seiner datierbaren Ruptur: die preußische Niederlage gegenüber Napoleon und<br />
das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Der materielle<br />
Entzug urkundlicher Gedächtnisträger nämlich, die Erfahrung des Verlust, setzt<br />
das deutsche Archivbegehren erst in Gang; Samet entwirft 1806 den Plan <strong>für</strong> ein<br />
General-Reichs-Archiv, das alle im Königreich Bayern bestehenden Archive<br />
(besonders aus der säkularisierten Klöster) aufnehmen soll.' Der Geburt <strong>von</strong><br />
Nationalarchiven zwischengeschaltet ist der Versuch eines Universalarchivs in<br />
Paris; am Pont d'Iena läßt Napoleon den Bau eines entsprechenden Palastes<br />
beginnen - eine wissensarchäologisch epochale Markierung, welche die Ruine<br />
eines Fundaments hinterläßt. Das Begehren, an einem Ort alle Zeiten, alle Epochen<br />
einzuschließen, der selber außerhalb der Zeit stehen soll, »das Projekt, solchermaßen<br />
eine fortwährende und unbegrenzte Anhäufung der Zeit an einem<br />
unerschütterlichen Ort zu organisieren - all das gehört unserer Modernität an.« 8<br />
Bundesarchiv / militärisches Zwischenarchiv Potsdam, Denkschriften Ernst Müsebeck<br />
1932/33, 90 Mü 6/3, Bl. 30<br />
Karl Brandi, Der byzantinische Kaiserbnef aus St. Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen<br />
Kanzleien, in: Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung 1 (1908), 5ff (9)<br />
Walter Jaroschka, Die Klostersäkularisation und das Bayerische Hauptstaatsarchiv, in:<br />
Josef Kinneier / Manfred Treml (Hg.), Glanz und Elend der alten Klöster: Säkularisation<br />
im bayerischen Oberland 1803, München (Süddeutscher Verlag) 1991, 98-107<br />
(102)<br />
Michel Foucault, Andere Räume, in: zeitmitschrift. ästhetik & politik 1/1990, 4-15<br />
(13). Benjamin Zix hat das Phantasma der universalen Wissensakkumulation als alle-
652 ARCHIV ••<br />
Die Leipziger Völkerschlacht und ihre machtpohtischcn Folgen machten 1813<br />
zwar »dieser größten Gefahr, welcher die moderne Bildung vielleicht je ausgesetzt<br />
gewesen ist, ein Ende, ohne daß die Sieger <strong>von</strong> ferne Gleiches mit<br />
Gleichem vergalten« ; Frankreich aber hält Teile des<br />
Beuteguts auf Dauer zurück - eine immanente Grenze der Reversibilität <strong>von</strong><br />
Gedächtnistransfer. Das gleiche Jahr machte die 1808 in Preußen verkündete<br />
öffentliche Konskription, die Allgemeine Wehrpflicht, zur Wirklichkeit. Die<br />
durch <strong>von</strong> Raumer 1811 verkündete Symbiose <strong>von</strong> Militärstand und Nation<br />
und daraus resultierende »Verbreitung des militärischen Geistes« resultiert in<br />
einem »heilsamen Sinn <strong>für</strong> Ordnung, Subordination und Ehre«. 9 Ein Jahrhundert<br />
später ist es der Erste Weltkrieg, der aus militärischen Massenakten das<br />
national fortwährend aufgeschobene Reichsarchiv generiert.<br />
Nachlaß eines <strong>Im</strong>periums: Das Reichskammergericht Wetzlar<br />
Kaiser Maximilian I. weist mit Innsbruck seiner Hofbuchhaltung 1506 einen<br />
festen Platz zu und setzt damit das Dispositiv <strong>für</strong> ein ständiges Reichsarchiv;<br />
1495 instituiert er das seit 1498 in Frankfurt am Main wirkende, 1527 nach<br />
Speyer verlegte Reichskammergericht samt Archiv. Später siedelt der Bestand<br />
nach Wetzlar über. 10 »Wie kaum ein anderes Archiv dieser Zeit wurde seine<br />
Quantität und Qualität <strong>von</strong> der <strong>Geschichte</strong> gezeichnet«" - wobei es sich hier<br />
jedoch nicht um historische, narrative Zeichen, sondern Einschnitte, graphische<br />
Markierungen handelt. Unsystematische Kassationen sowie Verluste durch<br />
Feuchtigkeit und Fäulnis dezimierten hier kontinuierlich den historischen<br />
Quellenbestand, und deren effektive Bearbeitung konnte nicht mehr erreicht<br />
werden, da die nur wenige Jahre später erfolgte Auflösung des Heiligen Römischen<br />
Reiches Deutscher Nation der Tätigkeit des Reichskammergerichts ein<br />
gorisches Porträt seines Freundes Denon, Direktor des Musee Napoleon in Paris,<br />
gemalt (Musee Nationaux, Palais du Louvrc)<br />
4 Ute Frevert-, Das jakobinische Modell. Allgemeine Wehrpflicht und Nationsbildung<br />
im Preußen-Deutschland, in: Militär und Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert,<br />
Stuttgart (Klett-Cotta) 1997, referiert <strong>von</strong> Ulrich Speck, in: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung v. 22. Oktober 1997<br />
10 Hans Kaiser, Die Archive des alten Reichs bis 1806, in: Archivalische Zeitschrift 35<br />
(1925), 205-220 (208). Siehe auch Michael Stolleis, Das Reich kam nur bis Wetzlar.<br />
Eine Ausstellung über Kaiser Maximilian 1, den Gründer des Rcichskammcrgenchts,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 199 v. 28. August 2002, 33<br />
11 Matthias Herrmann, Das Rcichsarchiv (1919-1945). Eine archivische Institution im<br />
Spannungsfeld der deutschen Politik, Diss. phil. Berlin: Humboldt-Universität 1993,<br />
2 Bde., Bd. 1,34
DAS Rr.ic.i ISAKCIIIV: OHIONHN UND RI AI.ITÄI 653<br />
Ende setzte . Abriß statt Ende: Als mit dem Ende des deutschen Reiches<br />
im Jahre 1806 auch das kaiserliche Reichskammergencht aulgelöst wird, verbleibt<br />
das Archiv dieses obersten Gerichtshofes des alten deutschen Reiches »als<br />
ein im wesentlichen geschlossener und einheitlicher Archivkörper« (Nissen) in<br />
dem ehemaligen Kameralgebäude in Wetzlar 12 - Gedächtnis der Rechtsgestalt<br />
eines aufgelösten Volkes, »die längst als eine erstorbene Hülle abgestreift ist.« 1 -'<br />
Dieses Gedächtnisgebäude, sowohl auf der Ebene der archivischen Signifikanten<br />
wie ihres Speichers und ihrer Interpretanten, verlangt nach wissensarchäologischer<br />
Betrachtung. Als katechontisches Vermächtnis des erloschenen<br />
Reiches insistieren die Lettern dieses Archivs, als die Anregungen zur Errichtung<br />
eines deutschen Reichsarchivs weit vor dem Jahre 1848 <strong>von</strong> seiner Seite<br />
kommen. Die Frage, was aus dem »nunmehr herrenlos gewordenen Archiv«<br />
mit seinen mehr als 80000 Prozeßakten, die in der Masse ungeordnet und mangelhaft<br />
verzeichnet waren, werden soll, kommt bald nach dem Wiener Kongreß<br />
in der deutschen Bundesversammlung in Frankfurt zur Sprache. Energisch<br />
wendet sich Hardenberg 1820 gegen den vorübergehend aufgetauchten Plan,<br />
das Reichskammergerichtsarchiv m seiner Masse zu vernichten. 14 In einer am<br />
30. Januar 1835 dem preußischen Justizminister eingereichten Denkschrift setzt<br />
sich der Wetzlarer Stadtgerichtsdirektor Paul Wigand da<strong>für</strong> ein, daß die preußische<br />
Regierung dieses Archiv »ohne weiteres übernehmen und <strong>von</strong> Hoher<br />
Deutscher Bundesversammlung abgetreten erhalten möge« <br />
- folgenlos. Aus ehemals rechtsverbindlichen Dokumenten wird ein historisches<br />
Monument: Am 1. August 1837 reicht Wigand dem preußischen Gesandten<br />
am Bundestag, <strong>von</strong> Schölcr, seine Druckschriften ein, worin er<br />
»hinreichend angedeutet habe, daß die gefährdeten Schriftvorräte dieses Denkmals<br />
des ehemaligen deutschen Reiches einer Beachtung<br />
wert seien«. 1843 wird der bisherige Stettiner Provinzialarchivar <strong>von</strong> Medem<br />
ans Reichskammergerichtsarchiv nach Wetzlar berufen und wendet sich am 12.<br />
12 Nach der Abdikation des Kaisers Franz <strong>von</strong> der römisch-deutschen Kaiserwürde<br />
gelangt an Teil der ehemaligen Reichsakten an das Wiener k. k. geh. Haus-, Hof- und<br />
Staats-Archiv. Dazu der Artikel »Archiv« in: Österreichisches Volksbuch. National-<br />
Encyclopädie, 2. Aufl., Heft 1, Wien 1850, 154-160 (159)<br />
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ueber die wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts,<br />
seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältnis zu den positiven<br />
Rechtswissenschaften [ r "1802), in: ders., Gesammelte Werke, hg. im Auftrag der<br />
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bd. 4: Jenaer Kritische Schriften, hg. v. Hartmut<br />
Buchner / Otto Pöggeler, Hamburg (Meiner) 1968, 483<br />
14 Walter Nissen, Zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsarchividee im 19. Jahrhundert, in: Archivar<br />
und Historiker. Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft (Festschrift Heinrich<br />
Otto Meisner), hg. v. d. Staatl. Archivverwaltung im Staatssekretariat <strong>für</strong> Innere<br />
Angelegenheiten [DDR], Berlin (Rütten & Loening) 1956, 162-175 (163)
654 ARCHIV<br />
Dezember 1845 in einer <strong>Im</strong>mediateingabe an den preußischen König Friedrich<br />
Wilhelm IV. mit der Bitte, das Archiv vor der Auflösung zu retten und in seinem<br />
Bestand »als ein bleibendes Gesamtarchiv aller deutschen Bundesstaaten<br />
in Wetzlar« fortbestehen zu lassen. Auch 1849 verfolgt der in der Zwischenzeit<br />
in den Ruhestand versetzte Archivrat <strong>von</strong> Mcdem seine Gedanken zur Zcntralisation<br />
der Archive des alten Reiches mit Hartnäckigkeit weiter; seine auf den<br />
7. März d. J. datierte <strong>Im</strong>mediateingabe an Friedrich Wilhelm IV. macht insbesondere<br />
auf den im Deutschen Hause bei Frankfurt »als toten Schatz eingesargten«<br />
Bestand des erzkanzlerischen Archivs aufmerksam und appellierte,<br />
dieses Archiv mit dem noch in Wetzlar verbliebenen Rest des Reichskammergerichtarchivs<br />
zu einem Reichsarchiv zu vereinigen. 15 Das andere Schreiben,<br />
einen Tag früher aus Wetzlar abgesandt, ist an den Rcichsjustizministcr Robert<br />
<strong>von</strong> Mohl gerichtet. Die Historie des Alten Reiches - als Funktion eines<br />
Archiv-Gedächtnisses - fügt sich modular:<br />
»Möchte es Ihnen gelingen, die gewaltigen Trümmer des berühmten Archivs zu retten.<br />
Als Baustücke eines Rcichs-Archivs verwendet, würden diese der <strong>Geschichte</strong><br />
angehörenden Denkmäler, vor ihrer gänzlichen Zerstörung, die bessere Bestimmung<br />
erhalten, ein Institut zu begründen, woran die Wissenschaft sich freuen und<br />
nähren könnte. Ein so völlig zweckloses Vernichtungswerk, wie die <strong>von</strong> der aufgelösten<br />
Bundesversammlung verfügte Auseinandersetzung und Verteilung des<br />
zugleich teilbar und unteilbar erklärten Archivs ist, noch gegenwärtig fortzusetzen<br />
, heißt den unaufhörlich verkündeten Grundsatz deutscher Gemeinschaft und<br />
Einheit wahrlich nichts weniger als heilig halten.« <br />
Eine solche Auseinandersetzung <strong>von</strong> Gedächtnis heißt Dckonstruktion,<br />
buchstäblich. Ein Jahr vor Gründung des Germanischen Nationalmuseums vollzieht<br />
sich das Wetzlarer Teilungsgeschäft im Jahre 1852; allein der preußische und<br />
der untrennbare Bestand vom Reichskammergcncht bleiben in Wetzlar als Torso<br />
zurück - »ein abgeschlossenes Archiv ohne Zugänge, ein<br />
historischer Körper ohne organisches Leben. Es war im letzten Jahrzehnt seines<br />
Bestehens so gut wie ganz geordnet.« 16 Das Archiv bildet keine Schnittstelle zwischen<br />
Magazin und Benutzer (Leseraum); der archivfremde Leser steht in dieser<br />
Zeit, sobald er die Eingangstür passiert hat, »mitten in dem Aktenmagazin, das<br />
er auch sonst gelegentlich durchschreiten mußte. Das Benutzerzimmer war<br />
zugleich Bibliotheksraum« . In dieser sich selbst<br />
löschenden Unmittelbarkeit bildet das Archiv seine Herkunft eindeutig ab, war<br />
Ehem. Deutsches Zentralarchiv [DDR] Abt. Merseburg, jetzt wieder: Geheimes<br />
Staatsarchiv PK Berlin, Rcp. 90, Staatsministerium, Tit. IV, Allgemeine gemeinnützliche<br />
Vorchläge und Pläne, Nr. 1, Bd. 1 Bl. 186 a und b, zitiert nach: Nissen 1956: 172<br />
1 Ernst Müller, Die Auflösung des Preußischen Staatsarchivs zu Wetzlar, in: Archivali-<br />
sche Zeitschrift 37 (1928), 132-141 (132)
DAS RHICHSARCI IIV: OPTIONHN UND RKAI.ITÄT 655<br />
doch das Prozeßmaterial »ehedem in der Registratur (der sog. Leserei) des<br />
Reichskammergenchts zusammen verwahrt«. 17 Die Archivahe ist in ihrer spezifischen<br />
Qualität als Dokument eine Funktion <strong>von</strong> Rechtsansprüchen. Auf dieser<br />
Ebene hörte das Reich nicht auf, sich fortzuschreiben, auch als das Reichskammergencht<br />
1806 in die I Iistone einging:<br />
»Dieses Archiv stand <strong>von</strong> Anfang an unter dem Zeichen der Auflösung. Da die unbeendet<br />
gebliebenen Prozesse in ihren Ursprungsländern wieder aufgenommen werden<br />
sollten, mußten <strong>von</strong> Anfang an zahlreiche Akten an deutsche und ehemals zum<br />
Deutschen Reich gehörige Staaten ausgeliefert werden. Für eine planmäßige Aufteilung<br />
des ganzen Bestandes war eine neue Gesamtverzeichnung Voraussetzung«<br />
,<br />
d. h. die Kartographierung des Ex-Reiches als Generalrepertonum. Zu diesem<br />
Zwecke werden zunächst im Sommer 1808 die noch in Aschaffenburgt befindlichen<br />
Akten nach Wetzlar überführt. <strong>Im</strong> Jahre 1821 setzte die deutsche Bundesversammlung<br />
<strong>für</strong> die Neuverzeichnung und Verteilung der Akten eine<br />
Archivkommission ein. In den Jahren 1847-1852 erfolgt dann die Aufteilung<br />
unter die deutschen Bundesstaaten; allein ein unteilbarer Bestand bleibt übrig<br />
- das Restreich als Individuum. Das <strong>von</strong> der Wetzlarer Archvikommission<br />
erstellte Generalrepertonum der Bestände umfaßt 41 Foliobände; die<br />
alphabetische Reihenfolge dann richtet sich nach dem <strong>Namen</strong> des Klägers,<br />
ergänzt durch eine vierbändige Beklagtenkonkordanz, so daß jeder Prozeß<br />
auffindbar ist. Zusammenhänge werden hier nicht mehr im Medium der Historie<br />
transparent, sondern non-narrativ kombiniert; ein entscheidender Vorteil<br />
ihrer elektronischen Datenverarbeitung ist folgerichtig, daß der Anfraget' »sämtliche<br />
Faktoren in allen Kombinationen miteinander durchrechnen kann«, um<br />
nach Zusammenhängen zu fahnden und per Computer festzustellen, ob eine<br />
Interdependenz oder sonstige Gesetzmäßigkeiten zwischen ihnen bestehen.<br />
»Selbstverständlich kann die Maschine immer nur Rechenergebnisse liefern,<br />
Folgerungen aus ihnen muß der Forscher selbst ziehen.« 18<br />
Durch die Erstellung eines Generalrepertonums wird zunächst die alte, zerrissene<br />
Einheit des Archivkörpers zumindest buchmäßig aufrecht erhalten und<br />
der Nachwelt überliefert; das nach jener Teilung in Wetzlar belassene Archivgut<br />
in seiner Materialität, also der preußische und der untrennbare Bestand,<br />
bleiben dort unverändert bis 1882 zur Verfügung des preußischen Justizmini-<br />
Karl Demeter, Die Abteilung Frankfurt a. Main des Reichsarchivs als Fundstätte <strong>für</strong><br />
die rheinische Orts- und Sippenforschung, in: Rheinische Hcimatpflege, Heft 3/1938,<br />
361-368(362)<br />
: G. Dolezalek, Computer und Rechtsgeschichte. Einführung und Literaturüberblick,<br />
in: Filippo Ranieri (Hg.), Rechtsgeschichte und quantitative <strong>Geschichte</strong>, Frankfurt/M.<br />
(Klostermann) 1977, 36-116 (73)
656 ARCHIV<br />
stenums. Erst dann wird es <strong>von</strong> der preußischen Archivverwaltung übernommen<br />
als Staatsarchiv Wetzlar. 19 In dieser Archivepoche wird eine wenn auch<br />
nicht vollständige, so doch umfängliche Verzettelung der Prozesse »nach kulturgeschichtlichen<br />
Materien« vorgenommen - eine<br />
Umkodierung des archivischen Reichsgedächtnisses <strong>von</strong> der justiziablen Funktionale<br />
ins Kulturwissenschaftliche. So schreibt die Epoche des Historismus<br />
sich ein. Nach dem Ausscheiden des Archivvorstandes Vcltmann vertrat seit<br />
1912 sein Nachfolger Hoogeweg den Gedanken, »diesen Torso - denn das war<br />
es ja nach der Zerreißung durch den Deutschen Bund - noch weiter zu torquieren,<br />
nämlich den preußischen Bestandteil nun auf die Sprengelarchive der<br />
einzelnen preußischen Provinzen vollends aufzuteilen« .<br />
Nach der Gründung des Reichsarchivs in Potsdam wird auch <strong>von</strong> der Reichsarchivverwaltung<br />
zunächst beabsichtigt, die dem Reiche gehörenden Akten<br />
des Reichskammergerichts nach Potsdam zu überführen, wo<strong>von</strong> der preußische<br />
Ministerpräsident am 2. August 1924 dem Reichsminister des Innern abrät:<br />
Jene symbolische, hegemomale translatw imperii würde kritische Stimmen in<br />
Deutschland gegenüber Preußen wachrufen. Er empfiehlt daher <strong>für</strong> die verschiedenen<br />
Archivbestände des alten Reiches und des ehemaligen Deutschen<br />
Bundes »ein mehr im alten Deutschland hegendes Zentrum«, etwa Frankfurt a.<br />
Main, ins Auge zu fassen. Da dort noch die Akten des Bundestages und der<br />
Deutschen Nationalversammlung lagern, können die Akten des Reichskammergerichts<br />
dort tatsächlich zu einem historischen Reichsarchiv vereinigt werden<br />
. 1925 wird das Staatsarchiv Wetzlar aufgelöst und der<br />
Bestand endgültig nach regionalen Betreffen der Prozcßbcklagtcn aufgeteilt; die<br />
Kartographie des deutschen Gedächtnisses wird hier nicht <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>, sondern<br />
vom Diskurs des Rechts ausgerichtet. Nach Frankfurt gelangt allein der<br />
Bestand <strong>von</strong> Prozessen zwischen Souveränen und aus inzwischen nicht mehr<br />
zum Reich gehörigen Gebieten - die Reich(s)weiten einer Gedächtnisaussage<br />
werden vom Rand der Absenz her definiert.<br />
DestiNation 1848/49 folgende: Bundes- und Reichsarchiv<br />
(Abteilung Frankfurt/M.)<br />
Die vom ersten demokratischen deutschen Parlament in der Frankfurter Paulskirche<br />
vor(her)gesehenen Archive werden so nie geschaffen; an ihrer Stelle<br />
entsteht mit dem Reichsarchiv nach dem Ersten Weltkrieg ein historisches For-<br />
19 Karl Demeter, Das Bundesarchiv Abteilung Frankfurt a. M. Entstehung, Aufgabe,<br />
Tätigkeit, in: Archivalische Zeitschrift 49 (1954), 111-125 (113)
DAS RKICI ISARCI IIV: OPTIONEN UND RI-:AI.ITÄT 657<br />
schungsinstitut mit einem Archiv als einer Abteilung. 20 1848 aber setzt das<br />
Frankfurter Parlament den Gedanken eines Reichsarchivs: Archive sind zunächst<br />
keine Funktion <strong>von</strong> Gedächtnis, sondern einer Institution. Der Abgeordnete<br />
Leu-Köln stellt am 19. Mai den Antrag auf Errichtung eines solchen<br />
Archivs; es soll Eigentum des deutschen Volkes werden und dementsprechend<br />
auch <strong>für</strong> jeden Deutschen offenstehen. Er sieht hier einen Zusammenhang mit<br />
den Ideen <strong>von</strong> 1848/49: »Das Volk, nicht der Staat, steht im Vordergründe ;<br />
nicht die organische Schöpfung eines Gemeinschaftswillens beherrscht die<br />
Köpfe.« 21 Die endgültige Aufbewahrung der aus der 1848er Bewegung entstandenen<br />
Akten sowie des alten deutschen Bundestages aber wartete weiterhin<br />
auf ihre Regelung. Die Frankfurter Parlamentsakten, speziell die Petitionen<br />
aus dem Archiv der Nationalversammlung, die Protokolle der Ausschüsse,<br />
deren Akten und die aus der Arbeit der Ministerien enthaltenen Korrespondenzen<br />
bieten »vielerlei Ausbeute zur inneren <strong>Geschichte</strong> der Versammlung,<br />
erklären manchmal erst die plötzlichen Umschwünge der Stimmung, die <strong>für</strong><br />
jedes Parlament so bezeichnend und deren genaue spätere Erfassung, wie die<br />
Praxis lehrt, so schwierig ist«. 22 Denn die Minuten der Historie spiegeln sich in<br />
Akten, nicht Erzählungen; Narration zerbricht daran diskret in modulare Zeiteinheiten.<br />
Demeters Kritik an einer musealen statt geschäftsmäßigen Verortung<br />
als Geschick solcher Minuten des deutsch-parlamentarischen Gedächtnisses<br />
macht es manifest. Die geschlossene Sammlung der an die Paulskirchenversammlung<br />
gerichteten Petitionen, die in den gedruckten stenographischen<br />
Berichten meist kurz erwähnt oder listenmäßig verzeichnet sind, wird zum Teil<br />
(Bestand November 1848 und Schlußphase des Frankfurter Parlaments) in den<br />
1880er Jahren <strong>von</strong> der Witwe eines württembergischen Abgeordneten dem Germanischen<br />
Nationalmuseum in Nürnberg vermacht »und befindet sich noch<br />
dort, wo ihn kaum jemand suchen wird« . Nach dem<br />
Scheitern des Paulskirchenparlamcnts und dem Ende der provisorischen Zentralgewalt<br />
am 20. Dezember 1849 fällt der Aktennachlaß aller Reichsministerien<br />
an die Registratur der Bundeszentralkommission, ist dort unter der Leitung<br />
Johann Daniel Leutheußers aber einer »fortschreitende Zerstörung dieser<br />
20 Angelika Menne-Hantz, Das Provenienzpnnzip - ein Bewertungssurrogat? Neue<br />
Fragen zu einer alten Diskussion, in Der Archivar 47, Heft 2 / 1994, 230-252 (244)<br />
21 Bundesarchiv Koblenz, BA R 43 (Reichskanzlei / Reichsarchiv) I / 887, Bl. 30ff,<br />
Druckschrift Müsebeck 1923, Bl. 30 ss ders., Der systematische Aufbau des Reiel-isitrchivs,<br />
in: Preußische Jahrbücher 191 (Jan.-März 1923), 294-318 (294)<br />
22 In: Nachlaß Delbrück, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Kasten 43,<br />
Faszikel 119 Nr. 2, »Reichsarchiv«, Bl. 2. Siehe Deutsche Staatsbibliothek. Handschrifteninventare,<br />
hg. v. Hans-Erich Teitge, Der Nachlaß Hans Delbrück, bearb. v.<br />
Horst Wolf, Vorwort Hans Schleier, Berlin 1980
658 ARCHIV<br />
Ordnung« ausgesetzt, da dieser die Akten unter dem aktuahstischen Aspekt der<br />
Registratur nach dem »nackten Betreffstandpunkt« und nicht archivisch mit<br />
Blick auf Historiographie (Provenienzprinzip) in ihren Herkunftsaggregationen<br />
beläßt. 23 Als auch der Deutsche Bund infolge der Ereignisse <strong>von</strong> 1866 »ins<br />
Nichts zerronnen« ist und keinen Rechtsnachfolger erhält, verhandelt die zur<br />
Liquidation seines Eigentums eingesetzte Kommission unter Vorsitz Preußens<br />
unter Teilnahme Österreichs und der anderen ehemaligen Bundesmitglieder<br />
auch über einen geeigneten Aufbewahrungsort <strong>für</strong> das überkommene Bundesarchiv;<br />
ins Auge gefaßt wird auch Germanische Nationalmuseum in Nürnberg,<br />
wo es Teil eines kulturgeschichtlichen Gedächtnisses geworden wäre. Die Einigung<br />
lautet schließlich auf die Frankfurter Stadtbibliothek »als einer politisch<br />
besonders neutralen, auch Österreich als vormaliger Präsidialmacht genehmen<br />
Institution«. Ihr wird 1867 das Bundesarchiv samt dem Archiv der Frankfurter<br />
Nationalversammlung und der damaligen Reichsministerien übergeben unter<br />
der Bedingung, daß es ungetrennt und abgesondert aufzustellen, und daß seine<br />
Benutzung jeder der früheren Bundesregierungen und jeder Privatperson zu<br />
gestatten sei . Dem entspricht, analog, die Aufstellungsklausel<br />
<strong>für</strong> die sogenannte Reichsbibliothek, die aus der Paulskirchenversammlung<br />
nach 1849 tatsächlich ans Germanische Nationalmuseum nach Nürnberg<br />
gelangt.<br />
Die provisorische Unterbringung des Reichsarchivs, Abteilung Frankfurt/<br />
Main, im dortigen Rathaus findet am 1. Dezember 1937 ihr Ende, als die Stadt das<br />
ihr gehörige Holzhausenschlößchen ganz <strong>für</strong> diese Zwecke einrichten läßt.<br />
»Räumlich reichte es bei rationellster Ausnützung gerade aus«; Gedächtnis als<br />
Archiv ist kalkulierbar. Die im Weltkrieg zunächst geflüchteten Bestände werden<br />
nach 1945 unversehrt nach Frankfurt zurückgeholt; versehrt aber ist ihr Interpretant<br />
wie ihr Speicherdispositiv: »Freilich waren sie nun behördenmäßig verwaist.<br />
Das Reich gab es faktisch nicht mehr, infolgedessen auch kein Reichsarchiv<br />
mehr«, und das Holzhausenschlößchen befindet sich nun hinter dem Sperrzaun<br />
der amerikanischen Besatzungsmacht . Wer Gedächtnis<br />
nicht mehr administriert, schreibt es fortan als <strong>Geschichte</strong>. Demeter dankt der<br />
Archiv alischen Zeitschrift <strong>für</strong> diese Publikationsmöglichkeit, nachdem er 1954aus<br />
seinem Amt und Wirkungskreis am nunmehrigen Bundesarchiv (Abteilung<br />
Frankfurt) ausgeschieden war. So sucht er »die Entstehung und Entwicklung <br />
des >historischen< Reichs- und jetzigen Bundesarchivs in Frankfurt der Fachwelt<br />
nahezubringen« ; zwischen Kontinuität und Bruch, Akt(en)<br />
und Archiv schreibt sich deutsche Historie in Anführungszeichen.<br />
- 3 Walther Latzke, Die Registraturen der Reichsministerien der Provisorischen Zentralgewalt<br />
1848/48, in: Der Archivar 8 (1955), Sp. 187-198 (Sp. 197f)
Die Verfassungsurkunde <strong>von</strong> 1849<br />
DAS RI:ICH.SARCHIV: OPTIONEN UND REALITÄT 659<br />
Die Massachusetts Constitutwn <strong>von</strong> 1780 als älteste heute noch gültige, schriftlich<br />
fixierte Verfassung war 1893 teilweise bis zur Unlesbarkeit verblaßt; die US-<br />
Legislative autorisierte daher die Anfertigung eines Faksimile mit »the same<br />
force and effect as the original«. Eine schlichte Transkription oder gar gedruckte<br />
Version des Text zu juristischen oder Informationszwecken galt also nicht als<br />
hinreichend; das kopierte Dokument hatte seiner Bedeutung entsprechend vielmehr<br />
auch als Hardware visuell und physikalisch so perfect wie möglich zu<br />
erscheinen. 24 Urkundenscmiotik ist also eher analytisch denn ornamental am<br />
Werk der Verfassung. Wie im Fall der Ornamentik der Pariser Menschenrechtserklärung<br />
<strong>von</strong> 1789 und folgender Grundrechtsdarstcllungen, wo der biblische<br />
Dekalog zum ikonographischen Motiv als monumentale Fundierung des konstitutionellen<br />
Dokuments wird, operiert auch die Urkunde der Grundrechte des<br />
deutschen Volkes im Verlauf der Revolution <strong>von</strong> 1848/49 mit alttestamenthcher<br />
Bildrhetonk, um der neuen Ordnung Würde zu verleihen. »Allerdings muß der<br />
Lithograph insgesamt neun Artikel mit fünfzig Unterparagraphen auf den beiden<br />
Tafeln unterbringen, was dazu führte, daß man die Schrift kaum noch entziffern<br />
kann. Platz gab es immerhin noch <strong>für</strong> eine Germania.« 25 Bizarre Wege<br />
nimmt dieser nationaldemokratisch determinierte Träger eines deutschen<br />
Geschichtszeichens. Als Archivahe an der Schnittstelle zwischen dem Symbolischen<br />
<strong>von</strong> Schrift (als Gesetz) und imaginärem Mehrwert wird diese Urkunde<br />
einer nie ausgeführten Deutschen Reichsverfassung vom 28. März 1849 (in<br />
roten Samt gebunden, auf Pergament gedruckt, und <strong>von</strong> den anwesenden Abgeordneten<br />
eigenhändig unterzeichnet) zunächst eine Zeitlang aus Angst vor<br />
dem Zugriff der politischen Reaktion außer Landes verbracht. Der ehemalige<br />
Paulskirchenabgeordnete Jucho vertraut sie Freunden in Manchester an, läßt sie<br />
aber 1866 zurückholen und schickt sie im März 1870 dem Präsidenten des<br />
Norddeutschen (und später Deutschen) Reichstags, Eduard Simson. »Dessen<br />
Name stand ja selbst als erster unter jenem Verfassungsdokument und bildet<br />
gewissermaßen eine lebendige Brücke zwischen der Paulskirche und dem neuen<br />
Berliner Reichsparlament« . So wird die Urkunde fortan<br />
im Reichstag verwahrt, bis sie im Reichsarchiv in Potsdam Aufnahme findet.<br />
Solche geschichts-, also kontinuitätsverbürgenden lebendigen Brücken aber sind<br />
24 Zitiert nach: James M. O'Toole, The Symbolic Significance of Archives, in: The American<br />
Archivist 56, Heft 2 (Frühjahr 1993), 234-255 (252f)<br />
25 Sigle »flo«, unter Bezug auf: Gunter Kaufmann, Gesetzestafeln als Bildschmuck neuer<br />
Ordnungen. Die Säkularisierung und Profanisierung eines historische Bildmotivs, in:<br />
<strong>Geschichte</strong> in Wissenschaft und Unterricht 1996, Frankfurter Allgemeine Zeitung v.<br />
18. September 1996
660 ARCHIV<br />
selbst zu <strong>Namen</strong> in Findbüchern geworden; Metonymien steuern nicht historiographische<br />
Zusammenhänge, sondern Gedächtnis. Welche Gedächtnisagentur<br />
ist der Heu de memoire <strong>für</strong> eine Verfassungsurkunde? Nach dem<br />
Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 empfiehlt auch dessen Bibliothekdirektor<br />
Eugen Fischer dem Reichstagspräsidenten Göring die Abgabe ans Reichsarchiv,<br />
zumal die Urkunde, rein formal gesehen, doch einen Fremdkörper in der<br />
Reichstagsbibhothek darstellt. Der Wunsch des Reichsarchivs, sie in die Reihe<br />
der anderen Urkunden deutscher Reichsgründungen einzureihen und mit dem<br />
übrigen Urkundenmaterial der Jahre 1848/49 zusammenzustellen, erscheint<br />
begründet angesichts der Senalität deutscher Reiche selbst. <strong>Im</strong> Januar 1944<br />
gelangt die Urkunde gemeinsam mit der Gesetzessammlung des Reichsarchivs<br />
in dessen Bergungslager, die Kahschächte <strong>von</strong> Staßfurt. Unter ungeklärten<br />
Umständen <strong>von</strong> dort in den Neuen Garten <strong>von</strong> Potsdam gelangt, wird sie 1951<br />
durch Zufall wiederentdeckt, um im Berliner Museum <strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong><br />
im Zeughaus Unter den Linden Verwahrung zu finden. So verkörpert diese<br />
Archivalie die deutsche DestiNation besonders in der ungeklärten Diskontinuität<br />
<strong>von</strong> 1945. In den unmittelbaren Nachkriegswirren waren viele Ausweichstellen<br />
des Reichsarchivs ohne Beaufsichtigung blieben; die Auslagerungsplätze<br />
(Bergwerke und Schächte) wurden häufig auf der Suche nach Verwendbarem<br />
geplündert oder zum Objekt gezielter Diebstähle ausgewählter Stücke. In politisch<br />
uneindeutigen Lagen, also keiner machtvollen Zuschreibung, oszillieren<br />
Urkunden zwischen archäologischem Artefakt und historischem Dokument, je<br />
nachdem, ob sie nur erblickt, oder auch gesehen (also historisch gelesen) werden.<br />
Archivische Signifikanten verschwinden, solange sie nicht an Institutionen<br />
und Diskurse gekoppelt sind, hinter der Materialität ihrer Träger; erst der<br />
geschichtshermeneutische Blick sieht ihnen ein Signifikat an, das sie mit einem<br />
Schutzmantel umgibt. Diese Differenz bestimmt ihr Schicksal, d. h. ihre Übertragung<br />
in Gedächtnisorte.<br />
Archivdiskussionen 1867/68 und Verreichlichung 1870/71<br />
Für eine Anzahl deutscher Staatsarchive gilt Mitte des 19. Jahrhunderts, daß sie<br />
sich in einer solchen Unordnung befinden, »daß ihr reicher Inhalt <strong>für</strong> die deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> so gut wie nicht existiert.« 26 Was als Gedächtnis nicht adressierbar<br />
ist, lagert latent, also abgekoppelt vom historische Diskurs. Dem setzt<br />
eine politische Initiative entgegen, was der Freiherr <strong>von</strong> Aufseß im Nürnberger<br />
Nationalmuseum bereits als Generalrepertonum deutscher Quellen des Mit-<br />
26 H. Baumgarten, Archive und Bibliotheken in Frankreich und Deutschland, in: Preußische<br />
Jahrhbüchcr, 36. Bd., Berlin (Reimer) 1875, 626-654 (640)
DAS Ri-iaiSAKCiiiv: OPTIONF.N UNI) RI-AUTÄT 661<br />
telalters plante: Die Zusammenführung des deutschen Archivkapitals im<br />
Medium der Information, als Verzeichnis. Nachdem lediglich entsprechende<br />
Erörterungen im Reichstag des Norddeutschen Bundes 1867/68 ernstere Formen<br />
annehmen, scheitern zunächst alle Bemühungen, den 1848er Reichsarchivgedanken<br />
auf der Grundlage einer Wiedervereinigung der Archivalien des<br />
alten Reiches in den fünfziger und sechziger Jahren zu beleben. Der Plan war<br />
wieder aufgetaucht, als 1867 mit der (Be-)Gründung des Norddeutschen Bundes<br />
»die Form eines einheitlichen Deutschland zuerst fest Gestalt gewonnen<br />
hatte.« Dem Reichstag des Bundes schlägt am 28. September 1867 Landrat Freiherr<br />
v. Hagke als Abgeordneter vor, den Bundeskanzler zu ersuchen, daß das<br />
archivansche Kapital der Norddeutschen Staaten, »dieses wissenschaftliche<br />
Gemeingut der deutschen Nation«, derselben durch die Erstellung vollständiger<br />
Urkunden- und Aktenverzeichnisse der öffentlichen Archive und Veröffentlichung<br />
dieser Verzeichnisse im Druck zugänglich gemacht werden soll. 27<br />
Die Schritte, »die zerstreuten Trümmer der alten deutschen Reichsarchive zu<br />
sammeln und zu einem der ganzen deutschen Nation gemeinsamen Nationalarchiv<br />
zusammenzufassen«, finden also nicht als Zusammenlegung eines<br />
Reichsarchivs, sondern seines Surrogats auf Informationsebene statt . Die Initiative geht also <strong>von</strong> der Notwendigkeit<br />
aus, Nationalbewußtsein »fest in der Vergangenheit zu verankern«; hier<br />
verwirklicht sich keine historische Notwendigkeit, sondern wird im archivischen<br />
Medium der Gedächtnispohtik gesetz(t) und vorgeschrieben. V. Hagke<br />
spricht also <strong>von</strong> der technischen Herstellung eines (als diskursiver Effekt) lebendigen<br />
»Zusammenhanges zwischen der alten Reichsgeschichte und dem neuen<br />
einheitlichen Werden der Nation« . Nach der parlamentarischen<br />
Zustimmung wird sein Antrag <strong>für</strong> den Raum der preußischen Archive<br />
schriftlich modifiziert; Burkhardt aber hält den Druck solcher Urkunden- und<br />
Aktenverzeichnisse (Repertorien also) <strong>für</strong> unmöglich und <strong>für</strong> die historische<br />
Wissenschaft nutzlos. 28 In einer Druckschrift verlangt v. Hagke - einschränkend<br />
- ein Urkundenbuch aller Dokumente bis 1300 in extenso, später in Regestenform,<br />
als »großartiges Nationalwerk«. Aus finanziellen Gründen der Realisierbarkeit<br />
der Repertorisierung der Archivinhalte schlägt v. Hagke zunächst die<br />
Erfassung der norddeutschen Bundesarchive vor. Dieses nicht-diskursiv<br />
begründete Argument aber gerät in seiner Ausschließung des deutschen Südens<br />
in Konflikt mit dem Diskurs des Nationalen:<br />
27 Zitiert nach: Baumgarten 1875: 645<br />
2S C. A. H. Burckhardt (Großherzoglich und Sächsischer Archivar), Die Archivfrage vor<br />
dem Reichstage. Zugleich eine Entgegnung auf die v. Hagke'sche Broschüre: Ueber<br />
die Wiederherstellung eines deutschen Reichsarchivs und die Reformen im Archivwesen,<br />
Weimar (Voigt) 1868, 5
662 ARCHIV<br />
»Wenn aber der norddeutsche Bund ein >großes nationales Wcrk< unternehmen<br />
will, so darf man nicht wohl bei der Benutzung der norddeutschen Archive<br />
stehen bleiben. In historischer Beziehung kann man nicht so schnell mit dem<br />
Süden unseres Vaterlandes abrechnen, wie in politischer, denn jedermann weiß,<br />
daß ein guter Theil unserer deutschen <strong>Geschichte</strong> dem Süden zu verdanken ist.«<br />
<br />
Von Hagke zielt auf die (Wieder-)Herstellung eines deutschen Reichsarchivs, die<br />
Unterstellung sämtlicher norddeutschen Archive unter die Oberaufsicht des<br />
Bundes und die Schöpfung eines nationalen Urkundenbuchs; dabei schränkt er<br />
ein, daß es sich nach Lage der Dinge vorläufig nur darum handeln kann, das<br />
vormalige Reichserzkanzlerarchiv und das des Reichskammergerichts zu<br />
berücksichtigen, »und am Ende reducirt sich der ganz kolossale Plan so weit«<br />
. Doch das Reichskammergericht in Wetzlar ist selbst nichts<br />
als das prähistorische Fossil eines vergangenen Reiches; das Zeitverhältnis des<br />
neuen Staatenbundes zu seinen Vorläufern ist - auf dem Höhepunkt des Epoche<br />
des Historismus - <strong>von</strong> Diskontinuität gezeichnet. »Uns scheint es in der That<br />
vom praktische Standpunkte aus ein völlig nutzloses Unternehmen, dies längst<br />
vergessene, nur historisch bedeutsame Kammergerichtsarchiv in das frische<br />
Leben des norddeutschen Bundes herein zu ziehen« . Die andere Ebene<br />
der Kritik Burkhardts betrifft den Vektor des archivischen Gedächtnisses. Gegenüber<br />
einer allgemeinen Archivreform zugunsten der historischen Wissenschaft<br />
insistiert Staatsarchivar Burkhardt, daß Archivbeamte »nicht blos dazu<br />
da sind, das historische Interesse zu vertreten, sondern daß sie zunächst als Vertreter<br />
praktischer Staatsinteressen in erster Linie fungieren müssen, und keine<br />
Regierung gewillt sein kann, sich dieses Rechtes auf ihre Beamten gänzlich<br />
zu begeben«. Gegen die durch v. Hagke geforderte Zentrahsation der Archiverfassung<br />
plädiert Burkhardt im Wissen, daß sich Geschichtsbewußtsein eher<br />
auf regionalen denn nationalen Ebenen (archivisch re-)genenert, darauf, den<br />
Dingen in den einzelnen Staaten ihren Lauf zu lassen, »denn wir leben in der<br />
Ueberzeugung, daß wie sie bisher ein hervorragendes Verdienst um das Durchgeistigen<br />
unserer Nation gehabt, sie nicht mit einem male in das Schlepptau<br />
genommen werden müssen« . Das Depot als repos? Burk-.<br />
hardt verwendet sich dagegen, die Leitung der Staatsarchive »als Ruheposten<br />
<strong>für</strong> die der Pensionierung nahe Stehenden zu betrachten.« Mehr als eine Frage<br />
<strong>von</strong> archivarischen Standesinteressen ist dieses Argument ein Spiegel der Funktionsverschiebungen<br />
des Archivs; die neuere Zeit sei <strong>von</strong> den alten Ansicht<br />
abgerückt, »daß nur der rein juristisch Gebildete <strong>für</strong> den Archivdienst verwendet<br />
werden könne, und man mit besserm Griff die historisch gebildete jüngere<br />
Generation heranzieht« .<br />
Die Reichsgründung <strong>von</strong> 1870/71 ruft die Frage der Wiederherstellung eines<br />
deutschen Reichsarchivs (angesichts des auch durch <strong>von</strong> Bismarck lamentierten
DAS RHICHSARCHIV: OITIONHN UND RF.AI.ITAT . 663<br />
Zustands preußischer Staatsarchive) erneut in Erinnerung. Die parlamentarische<br />
Debatte reflektiert die neue Identitätsfindung der Nation: »So gewahren<br />
wir auch hier auf unserem Spezialgebiet eine enge Berührung mit den großen<br />
politischen Problemen des zentrahstischen Einheitsstaates und der föderativ<br />
gerichteten Staatsform« . Dennoch ist auch nach<br />
1871 ein positives Ergebnis der Reichsarchivbestrebungen zunächst nicht abzusehen.<br />
Die Logik der Speicherung selbst erzwingt das Nachdenken über das<br />
Staatsgedächtnis: »Es mußte erst dahin kommen, daß die Aktenbestände der<br />
Reichsverwaltung so stark anwuchsen, daß sie auf die Dauern nicht mehr bei<br />
den Behörden selbst aufbewahrt werden konnten« . 1905 macht der<br />
Staatssekretär des Innern, Graf Posadowski, dem Generaldirektor der preußischen<br />
Staatsarchive, Koser, die mündliche Mitteilung, daß seitens der Reichsbehörden<br />
die Errichtung eines Reichsarchivs ins Auge gefaßt werde und das<br />
preußische Geheime Staatsarchiv mit diesem künftigen Reichsarchiv »wo nicht<br />
unter demselben Dache, so doch in unmittelbarer Nachbarschaft miteinander«<br />
unterzubringen. Koscr fordert daraufhin einen Neubau <strong>für</strong> das Staatsarchiv, um<br />
darin gleichzeitig Räume <strong>für</strong> das Reichsarchiv unterzubringen. Posadowski tritt<br />
ebenfalls <strong>für</strong> einen gemeinsamen Bau ein, doch sollen beide Archive räumlich<br />
getrennt und auch beide selbständig erweiterungsfähig bleiben. Die Initiative<br />
kam jedoch in dieser Form zum Stillstand; folgt 1912 die Bewilligung zu einem<br />
Neubau <strong>für</strong> das Staatsarchiv. Die Beteiligung des Reichs daran scheint erneut<br />
die Integration eines Reichsarchivs möglich zu machen; diese Option wird<br />
jedoch vom Reichstag verworfen, da die Länder eine zu enge Bindung ihres<br />
Gedächtnisses an das Preußen <strong>für</strong>chten. Das Reich speichert folglich sein<br />
Gedächtnis der Gegenwart weiterhin in den eigenen, laufenden Behörden auf<br />
und gerät in Konflikt mit der Hardware eines tatsächlich vorgesehenen Archivbaus.<br />
Als 1914 die in mehr als vierzigjähriger Dauer in den Zentralbehörden des<br />
Reiches entstandenen Akten zur Abgabe drängten, stand die Gründung eines<br />
Reichsarchivs wieder zur Debatte, wurde aber vom Reichstag abgelehnt, da dieser<br />
den Bau eines Reichsarchivs nicht mit dem damals in Dahlem neuernchteten<br />
Gebäude des preußischen Geheimen Staatsarchivs verbunden wissen wollte.<br />
Die Budgetkommission war mehrheitlich der Ansicht, daß es der Stellung des<br />
Reiches nicht entsprechen würde, wenn es bei der überwiegenden finanziellen<br />
Beteiligung Preußens an dem Unternehmen in Gefahr geraten könnte, mit seinem<br />
Archiv unselbständig zu werden und in Abhängigkeit <strong>von</strong> Preußen zu<br />
gelangen. 29<br />
2 ' ; Bernhard Poll, Vom Schicksal der deutschen Heercsaktcn und der amtlichen Kriegsgeschichtsschreibung,<br />
in: Der Archivar, 6. Jg., No. 2 / April 1953, Sp. 65-76 (65)
664 ARCHIV<br />
Weltk rieg / A rch iv<br />
Kriege triggern Archive; Weltkrieg I führt spätestens 1917 in Deutschland zu<br />
einer kriegswirtschaftlich bedingten Papierdissemination, an der nicht nur die<br />
Zentralregistraturen in den Ministerien scheitern. »Auch in den Büros trat oft<br />
völlig Auflösung ein«, geradezu »Anarchie«; »mehr wie bisher fehlte die ordnende<br />
Besinnlichkeit«, da die Notwendigkeit <strong>von</strong> Echtzeitentscheidungen keine<br />
Nachträglichkeit erlaubt. Kaiser Wilhelm II. veranlaßt per Kabinettsorder vom<br />
19. Januar 1917 den Staatsminister Drcws zur Grundlegung einer Verwaltungsreform,<br />
deren Ansatz mit dem Systemzusammenbruch 1918/19 unterbrochen<br />
wird. 30 »In kürzester Frist mußten die durch die Demobilmachung plötzlich<br />
freiwerdenden, in fast unvorstellbarer Menge anfallenden militärischen und<br />
kriegswirtschaftlichen Akten aufgenommen werden« 31 - oder skartiert. 32 Aus<br />
einer Auskunftsstelle des Roten Kreuzes <strong>für</strong> Reichsangehörige wird (<strong>für</strong> den<br />
westlichen Kriegsschauplatz, komplementär zu Hamburg <strong>für</strong> den Osten) das<br />
Archiv <strong>für</strong> Kriegsgefangenenforschung in der Reichsarchiv-Abteilung Frankfurt.<br />
Ohne jenen Verzug, der ja erst Historiographie als Differenz zur Gegenwart<br />
ermöglicht, geht Zeitgeschehen in ihrer Registratur auf, als das Archiv neben der<br />
Bearbeitung dieses Materials und der Auskunftstätigkeit eine in der Archivgcschichte<br />
bis dahin ungewöhnliche Aufgabe erhält: die sofortige Auswertung der<br />
Akten zu Zwecken der Geschichtsschreibung über den ersten Weltkrieg. »Es<br />
geriet als Archiv durch diese Zielsetzung in eine nicht unbedenkliche Doppelstellung«<br />
. Ein Kritiker aus Diplomatenkreisen bezweifelt<br />
im Herbst 1921 den Sinn der analogen Publikation <strong>von</strong> Akten zur Vorgeschichte<br />
des Krieges <strong>von</strong> Seiten des Auswärtigen Amts: »Die Zeit ist noch nicht reif, weil<br />
selbst dem objektivsten Historiker - ich sehe ganz ab <strong>von</strong> Journalisten usw. - der<br />
nötige Fernstandpunkt noch fehlt und fehlen muß.« 33 Damit ist Historie als<br />
Beobachterdifferenz zur Gegenwart systematisch und radikal konstruktivistisch,<br />
nicht ontologisch definiert - eine Wahrheit, die schon <strong>für</strong> den Moment der<br />
Aktengenese gilt: »Wer <strong>für</strong> die Akten schrieb, schrieb nicht <strong>für</strong> die zeitgenössische<br />
Öffentlichkeit« . Aktenpublikation in historiographischer<br />
(Fast-)Echtzeit ist demnach Mißbrauch des Archivs. Die Ordnungsarbeiten<br />
30<br />
Hermann Haußmann, Die Büroreform als Teil der Verwaltungsreform, Berlin (Hehmanns)<br />
1925, 4f u. 9<br />
31<br />
Gerhard Schmid, Die Verluste in den Beständen des ehemaligen Reichsarchivs im<br />
zweiten Weltkrieg, in: Festschrift Meisner 1956: 176-207 (176)<br />
3<br />
~ Vgl. Oskar Regele, Die Aktcnsk.irticrung im Wiener Kncgsarchiv in alter und neuer<br />
Zeit, in: Archivalische Zeitschrift Bd. 50/51 (1955), 21 7-22 1 (219)<br />
33<br />
Zitiert in: Friedrich Thimme, Die Aktcnpubhkationen des Auswärtigen Amtes und<br />
ihre Gegner, in: Archiv <strong>für</strong> Politik und <strong>Geschichte</strong>, 2. Jg. Heft 4/5 (1924), 467-478 (473)
DAS RKICHSAKCHIV: OPTIONEN UND RI ; AI HAT 665<br />
(Akzessionen) können diesem so plötzlich entstandenen, mit umfangreichen<br />
Beständen überfluteten und anwachsenden Archiv nicht Schritt halten, zumal<br />
es darauf ankommt, die Akten <strong>für</strong> die Bedürfnisse der abgebenden Behörden<br />
schnell benutzbar zu halten. Vielfach werden daher Akzessionsprovemenzen<br />
gebildet, ein Hybrid aus Gedächtnis und aktueller Verwaltung: Die <strong>von</strong> einer<br />
Behörde übernommenen Registraturteile bleiben geschlossen als Bestand zusammen,<br />
obwohl sie überwiegend Vorakten anderer Stellen enthalten. »Inmitten<br />
der sich auftürmenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Nöte der<br />
Nachknegsjahre gerät das Aktenwesen vollends ms Hintertreffen, die Zusammenhänge<br />
mit der Vergangenheit zerreißen.« 34 Zwischen <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis<br />
(Gedächtnis als Bedarf der Behörden, <strong>Geschichte</strong> als Bedarf des<br />
Diskurses) sichert sich - durch sein weitangelegtes, aktives Akzessionsverfahren<br />
- das neugegründete Potsdamer Reichsarchiv Quellenmaterial auf breiter Basis.<br />
»Es war nicht nur ein wirkliches >Gedächtms< der Verwaltung geworden, sondern<br />
fand auch in starkem und nehmendem Maße die Aufmerksamkeit der historischen<br />
Forschung« . Der Krieg <strong>von</strong> 1914/18 rekonfiguriert<br />
und dynamisiert den Begriff des Archivs, indem er es in Echtzeit an die Aktualität<br />
rückkoppelt.<br />
»So entstand eine neue Form <strong>von</strong> archivalischen Ausstellungen, es entstanden neue<br />
Beziehungen der Archive zur Presse. Hatten vor dein Weltkrieg <strong>für</strong> unsere archivahsche<br />
Arbeit in erster Linie der Staat, die irgendwie organisierte Gesellschaft als<br />
die bestimmenden Mächte unserer nationalen Entwicklung die Richtlinien hergegeben,<br />
so tritt nunmehr ihnen mindestens gleichberechtigt das Volk als der Träger<br />
des nationalen Staates, als der Träger auch der organisierten Gesellschaft zur<br />
Seite.« 35<br />
Das Reichsarchiv oszilliert tatsächlich zwischen Staat und Nation. Daß die<br />
andere, nämlich vielmehr (non-diskursiv) Staats- denn (diskursiv) nationgebundenc<br />
Seite der archivalischen Tätigkeit damit nicht zum Verschwinden<br />
gekommen ist, beschreibt Müsebeck in der Rückkopplung des archivischen gedächtnisses<br />
an die Präsentistik administrativer Logik: »Ohne Mühe sind die <strong>von</strong><br />
den einzelnen Behörden abgelieferten archivreifen, d. h. in der laufenden Verwaltung<br />
nicht mehr ständig gebrauchten Akten im Reichsarchiv greifbar, da sie<br />
ja genau nach der gleichen Ordnung, wie sie bei der Registratur gebräuchlich<br />
war, wieder aufgebaut und repertorisiert werden« - womit die Differenz <strong>von</strong><br />
Vergangenheit und Gegenwart keine ontologische, sondern eme funktionale ist;<br />
mithin ist das archivische Gedächtnis hier ein Latenzzustand des Arbeitsspei-<br />
34<br />
Wilhelm Rohr, Das Aktenwesen der Preußischen Regierungen, in: Archivahsche Zeitschrift^<br />
(1939), 52-63 (54)<br />
35<br />
Ernst Müsebeck, Der Einfluß des Weltkrieges auf die archivahsche Methode, in:<br />
Archivalische Zeitschrift (1929), 135-150 (136)
666 ARCHIV<br />
chers einer gegebenen Verwaltungsepoche. 36 »So angesehen ist das Reichsarchiv<br />
nicht eine tote Behörde im Organismus der gesamten Reichsverwaltung, die<br />
ebensogut wegfallen könnte, sondern eine ganz lebendige Behörde mit eigenem<br />
Daseinscharakter eine organische Institution <strong>für</strong> die Konzentration des<br />
Staatsgedankens« , und die aus dem Widerstreit <strong>von</strong> Geschichts- und<br />
Verwaltungsgedächtnis resultierende Option, »ein zweites, sogenanntes >histonsches<<br />
Reichsarchiv« zu separieren, lehnt Müsebeck als einen inneren Widerspruch<br />
im Aufhau unserer Verwaltung ab. Tatsächlich ist dieser Widerspruch<br />
damit präzise formuliert. Müsebeck nennt selbst das Datum, das die vergangene<br />
Gegenwart der Behördentätigkeit <strong>von</strong> ihrer Jetzzeit trennt und fordert, »daß<br />
jetzt alle Bestände aus allen Registraturen vor 1914 als archivreif, d. h. als nicht<br />
mehr dauernd <strong>für</strong> die laufende Verwaltung gebraucht zu bezeichnen und daher<br />
an das Archiv abzugeben sind« - Beginn der Datendiskretisierung. »Hinreichend<br />
Raum ist <strong>für</strong> diese Bestände freigehalten, um sie aufzunehmen«, und das Archiv<br />
in Potsdam mithin immer auch schon virtuelles Archiv einer vergangenen<br />
Zukunft. »Der Archivar muß mit dem Auge des innerlich Schauenden das ihm<br />
anvertraute Material zu erfassen suchen« ; so generiert der zeitperspektivische<br />
Blick den Diskurs der Historie einbildend, als <strong>Im</strong>agination im Sinne der<br />
<strong>von</strong> Johann Joachim Wmckelmann <strong>für</strong> die antike Kunst entwickelten Ästhetik.<br />
Konkret wird diese vektoriellc Ausrichtung in der Bearbeitung und Herausgabe<br />
des amtlichen Weltkriegswerks durch die Historische Abteilung des Reichsarchivs;<br />
das Schwergewicht seiner Aufgabe »lag weniger in seiner archivischen als<br />
in seiner historischen Forschungstätigkeit.« 37<br />
Schließlich erhält das Archiv einen kulturgeschichtlichen Akzent. Aus Anlaß<br />
der Eröffnung der ersten Ausstellung des Reichsarchivs zur deutschen <strong>Geschichte</strong><br />
<strong>von</strong> 1848-1920 (mit der die Vor/<strong>Geschichte</strong> des Reichsarchivs als virtuelle Option<br />
selbst zusammenfällt) definiert Müsebeck die nationalen Kultur'aufgaben des<br />
Reichsarchivs; im diskursiven Kontext des <strong>Im</strong>aginären namens Nation und Kultur<br />
erhält auch das Archiv eine historische Lesart, im Unterschied zu seiner funktionalen<br />
Bestimmung im Raum des Symbolischen, also als Staatsorgan. So wie<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke als Altmeister der deutschen Geschichtsforschung einmal die<br />
Aufgabe der Historie so definiert habe »zu zeigen, wie es eigentlich geworden<br />
sei«, und wie Schieiermacher den historischen Unterricht als Wissenschaft da<strong>von</strong><br />
definiert, »wie der jetzige Zutand der Menschen nach und nach entstanden ist«,<br />
>6 Ernst Müsebeck, Die nationalen Kulturaufgaben des Reichsarchivs, in: Archiv <strong>für</strong><br />
Politik und <strong>Geschichte</strong> 2, Heft 10 (1924), 393-408 (395)<br />
' 7 Friedrich-Christian Stahl, Die Organisation des Hccresarchivwcscns in Deutschland<br />
1936-1945, in: Heinz Boberach / Hans Booms (Hg.), Aus der Arbeit des Bundesarchivs.<br />
Beiträge zum Archivwesen, zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, Boppard<br />
(Boldt) 1978,69-101 (70)
DAS RI-.ICI ISAKCI IIV: OPTIONEN UND RI-.AI.ITÄT 667<br />
hat auch die deutsche Archivkunde und Archivtechnik (mit erheblichem Zeitverzug,<br />
mithin: Historismus im Verzug) auf diesen historisch-philosophischen Paradigmenwechsel<br />
reagiert, und zwar in Form des Provenienzprinzips in der<br />
Aktenordnung - ein Grundsatz, der im Gegensatz zum pragmatischen Schema<br />
der Sachordnung »der genetisch-kritischen Geschichtsmethode entspricht«<br />
. These der vorliegenden Studie ist demgegenüber vielmehr,<br />
daß umgekehrt die Einführung des Registratursystems in den preußischen<br />
Staatsarchiven die Bedingung ihrer historischen Lesart darstellt, um den vom Diskurs<br />
der Historie privilegierten Begriff politischer Kontinuität (Müsebeck spricht<br />
<strong>von</strong> Gewordensein) sicherstellen zu können. Symptomatisch <strong>für</strong> die rhetorische<br />
Verkehrung dieses Verhältnisses bei Müsebeck ist dessen Fehllesung des notorischen<br />
Ranke-Diktums, wo vielmehr die Rede da<strong>von</strong> ist, Geschichtsschreibung<br />
habe darzulegen, wie es eigentlich gewesen (statt: geworden). 3S<br />
Für das Geheime Staatsarchiv in Berlin haben die Ranke-Schüler Max Lehmann<br />
und Paul Bailleu das Provenienzprinzip durchgesetzt; »auch das Reichsarchiv<br />
hat ganz selbstverständlich <strong>von</strong> seiner Begründung an dieses System<br />
durchgeführt.« Zwischen Truppen- und Aktenformationen: »Bei der Massenhaftigkeit<br />
des ihm zuströmenden Aktenmatenals - man denke nur an die Bestände<br />
der aufgelösten Formationen des alten Heeres - hätte ein sachliches System<br />
zum völligen Durcheinander geführt«; allerdings haben die Protagonisten der<br />
Französischen Revolution auf die Auflösung eines ancien regime mit der Anlage<br />
<strong>von</strong> Pertinenz-Archiven reagiert. In der kulturwissenschaftlichen Fassung werden<br />
auch die bislang so genannten »fremden Bestandteile« des Archivs, d. h. die<br />
Nachlaß- und Bnefsammlungen, integrierbar. Das induziert einen Wandel im<br />
Berufsbild der Archivare; nicht länger ist die Archivwissenschaft eine reine Funktion<br />
der Mediävistik und hilfswissenschaftlichen Diplomatik und pures Sekretariat<br />
des Staatsgedächtnisses. Müsebeck führt ergänzend ein ausdrücklich<br />
soziologisches Argument <strong>für</strong> archivische Gedächtnisfundamentierung an: »Etwa<br />
seit den 70er Jahren, ist das deutsche Volk zum guten Teil entwurzelt, d. h. der<br />
engen Verbindung mit dem Heimatboden beraubt; eine Entwicklung, die <strong>für</strong> die<br />
Festigkeit unseres Nationalbewußtseins <strong>von</strong> der größten Bedeutung ist« . Die Archivierung des Kriegs erfordert eine neue Heuristik 39 :<br />
38 rj)er Historiker »will bloss zeigen, wie es eigentlich gewesen«: Leopold <strong>von</strong> Ranke,<br />
<strong>Geschichte</strong>n der romanischen und germanischen Völker <strong>von</strong> 1494 bis 1514 (= Sämtliche<br />
Werke, Bd. 33/34), Leipzig 1874, VII (Einleitung zur 1. Ausgabe 1824). Dazu<br />
Rudolf Vierhaus, Rankes Begriff der historischen Objektivität, in: Objektivität und<br />
Parteilichkeit, hg. v. Reinhart Koscllcck u.a., München 1977<br />
39 Siehe auch: Marc Bloch, Reflexions d'un histoncn sur les fausses nouvelles de la guerre<br />
(zunächst in: Revue de Synthese histonque, 1921), in: ders., Melanges Historiques,<br />
Tome I, Paris (SEVPEN) 1963, 41-57
668 . ARCHIV<br />
»Viele im Feld gefaßte Befehle und Entschlüsse beruhen auf persönlichen Besprechungen,<br />
über die keine Protokolle oder Aufzeichnungen erhalten sind. Andere<br />
wurden nur telephonisch erteilt oder gefaßt. Notizen zu den Akten unterblieben.<br />
Bei allen Registraturen der bedeutenden militärischen Formationen im Felde bestehen<br />
Lücken, die nachträglich ergänzt werden müssen, wenn die Nachwelt ein<br />
objektives Bild nicht nur <strong>von</strong> den militärischen Vorgängen im Weltkriege, sondern<br />
auch <strong>von</strong> den inneren Beweggründen der Heerführer erhalten soll. Eine <strong>Geschichte</strong><br />
der Marneschlacht zu schreiben wäre auf Grund der amtlichen Akten allein unmöglich<br />
gewesen; ja die Befragung hat hier vielleicht schon zu spät eingesetzt, weil verantwortliche<br />
Teilnehmer nicht mehr am Leben waren.« <br />
Denn der Weltkrieg hat Geschehen und Historiographie in ein neues Medienverhältnis<br />
zueinander gesetzt; »Lücken in den amtlichen Akten die kein<br />
Nachlaß zu beseitigen vermag« können nur durch persönliche Auskünfte<br />
geschlossen werden . Eine gedächtmsmedienarchäologische Schwelle: »If<br />
the signal being transmitted is continuous (as in oral speech) rather than being<br />
formed of discrete symbols (as in wntten speech), how does this fact affect the<br />
problcm?« . Technologien des Aufzeichnung bilden Wirklichkeiten<br />
nicht schlicht ab, sondern bilden selbst ein andersartiges Archiv: »The<br />
technical strueture of the archiving archive also determines the strueture of the<br />
archivable content even in lts very coming into existence and in lts relationship<br />
to the future«; jede Form <strong>von</strong> Aufzeichnung eines Ereignisses generiert es zugleich<br />
mit. 40 Schwierig ist die Lage der Dinge bei denjenigen Behörden, in denen<br />
der Begriff der Abwicklung hinzutritt - mit dem Ende des Weltkriegs in dieser<br />
Form ein Novum, das eine Erschütterung des prinzipiell auf Ewigkeit angelegten<br />
Selbstverständnisses <strong>von</strong> Institutionen darstellt, seinem Wesen nach aber<br />
schon bei der Neubegründung des bayerischen Staates durch Montgelas um die<br />
Wende des 18. zum 19. Jahrhundert und bei der Begründung des Deutschen<br />
Bundes 1815 angewandt worden ist. Einfacher lagen die Verhältnisse archivalisch<br />
bei der Reorganisation Preußens, wo 1807 nach dem Zusammenbruch Zwischenbehörden<br />
geschaffen wurden, die eine trennscharfe Scheidung zwischen<br />
den Registraturen des frideriziamschen Preußens und der Behörden des 19. Jahrhunderts<br />
ermöglichten. Archivzäsuren: Diskontinuitäten der <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong><br />
Staaten sind eine Relation ihrer Speicher. Der Erste Weltkrieg zwingt auch zum<br />
Überdenken der Theorie der Aktenausscheidung; die Dekonstruktion (der ausdrückliche<br />
Abbau) des Staates ruft das Trauma der deutschen Nation <strong>von</strong> 1806<br />
wach, das derzeit zu einer strategischen Neuformierung der Gedächtnisagenturen<br />
(in Form <strong>von</strong> Staatsarchiven und Qucllencditioncn wie den MGH) führte.<br />
Die politischen, sozialen und finanziellen Krisen <strong>von</strong> Weltkrieg I und Weimarer<br />
40 Jacques Dernda, Archive Fever. Frcudian <strong>Im</strong>pressions, in: Diacntics 25:2 (summer<br />
1995), 9-63(17)
DAS Ri.iciisARCiiiv: OPTIONEN UND RKAI.IIAr 669<br />
Republik und die dadurch verursachte Notwendigkeit des Um- und Abbaus <strong>von</strong><br />
Behörden und Ämtern »haben in das vorher so friedliche deutsche Archivwesen<br />
eine Unruhe gebracht, wie sie nur in der Zeit der Neuordnung der politischen<br />
Verhältnisse nach dem Ende des alten deutschen Reiches in ähnlichem Maße zu<br />
verzeichnen war.« 41 Anamnese einer Archivepoche: Müller vertritt den Standpunkt,<br />
daß ein Archiv über jeden Zuwachs <strong>von</strong> Akten aus der Zeit vor 1806 -<br />
»dem >Hauptnormaljahr< <strong>für</strong> die süddeutschen Archivalien 42 « - dankbar sein<br />
dürfe »und mit allen Mitteln suchen muß, solche ältere noch außerhalb der<br />
Archive befindlichen Akten hereinzubekommen« . Nicht die <strong>Geschichte</strong>,<br />
sondern der Zusammenbruch eines Reiches strukturiert sein archivisches<br />
Gedächtnis. Von daher rechnet Wissensarchäologie mit Diskontinuitäten.<br />
Am 28. Dezember 1918 findet sich Max Leyh, aus dem Truppendienst<br />
kommend, zur Übernahme der Leitung des Bayerischen Kriegsarchivs in<br />
München ein:<br />
»Schon äußerlich vorteilhaft hervorgehoben durch seine zentrale Lage in dem den<br />
Hofgarten abschließenden, im Stile der italienischen Hochrenaissance erbauten<br />
und mit mächtigen Säulenordnungen geschmückten Prachtbau des Armeemuseumsgebäudes<br />
mit der weithin leuchtenden Aufschrift >Armis et httcns
670 ARCHIV<br />
Füßen. Der Versailler Vertrag schloß ein Weiterverbleiben der Anstalt im Reichsheere<br />
aus; die alte Armee löste sich auf dem Zersetzungwege über die Abwickelungsstellen<br />
immer mehr auf und es war nun die Frage: >Wohin mit dem<br />
Kriegsarchiv? < <strong>Im</strong> Reich hatte man sich unterdessen zur Errichtung des<br />
Reichsarchivs unter Aufnahme der Akten des Generalstabes und der höheren<br />
Kommandobehörden, überhaupt der operativen und taktischen Akten entschlossen;<br />
über den Verbleib der bei den Abwickelungstellen lagernden Masse der Akten<br />
aber war anfangs 1920 noch keine Entscheidung gefallen, und so verlief <strong>für</strong> Bayern<br />
die Lösung dieser Etatsfrage in der Weise, daß der bayerische Staat ab 1. April<br />
1920 das Kriegsarchiv auf dem damals nicht ungewöhnlichen Wege der Entmilitarisierung<br />
als bayerische Anstalt und ein Jahr später auch die Offiziere als bayerische<br />
Beamte übernahm.« <br />
Leyh erwähnt speziell die Lichtbildabteilung, eine Sammlung <strong>von</strong> Diapositiven,<br />
Negativen, LTd-, Lull-, I'hcger-Aulnahmen, die schon während des Krieges<br />
angelegt und aus den Beständen der heimkehrenden Truppen und <strong>von</strong> Einzelpersönlichkeiten<br />
ergänzt wird. »Unter diesem Material überwiegt die Fliegeraufnahme<br />
des vordersten Kampfgeländes, die sogenannte Bildmeldung, also das<br />
Material, dem vor allem kriegsgcschichtliche und kriegswissenschaftliche Bedeutung<br />
zukommt« - der Medienwechsel im Archivwesen kündigt<br />
sich an. Aktualität hat dieses Archiv nicht als historisches Gedächtnis,<br />
sondern als latente Gegenwart in actis, die jederzeit zur Reaktualisierung zur<br />
Verfügung steht; beim Auskunftsdienst der Abteilung II, der Kriegsabteilung,<br />
»handelt es sich weniger um überlieferte als um erlebte <strong>Geschichte</strong>, um das<br />
lebende Geschlecht, um Auskünfte, die sich auf die Abwickelung und die Versorgung<br />
der Angehörigen des alten Heeres beziehen, vor allem um Ansuchen<br />
der Pensions-, Versorgungs- und Gerichtsbehörden« . Der<br />
Krieg hat ein kollektives Gedächtnis produziert, das <strong>für</strong> eine Zeitlang den Begriff<br />
der Gesellschaft selbst ersetzt:<br />
»Nach einem Krieg, an dem fast die gesamte Bevölkerung des Landes irgendwie<br />
aktiv teilgenommen hat, laufen naturgemäß alle Fäden des Lebens noch zurück<br />
zum Heer, und diese Tatsache, daß die hier in Betracht kommenden Aktengruppen<br />
noch in keiner Weise archivreif sind und die Auskunftstätigkeit eigentlich <strong>von</strong><br />
den Behörden aus ihren Registraturen heraus geleistet werden müßte, nun aber<br />
infolge der plötzlichen Auflösung der Armee und des überstürzten Abbruches der<br />
Abwickelung dem K. A. zugefallen ist, spiegelt eben das Doppelgesicht de-s Kriegsarchivs<br />
wieder, das nur mit einem Teil seiner Bestände ein wirkliches Archiv ist,<br />
mit seinem Großteil aber eine Verwaltung- und Zentralauskunftstelle, ein unmittelbares<br />
Glied der Staatsverwaltung bildet« <br />
- ein latentes Gedächtnis, wie es sich in Form der Behörde des Bundesbeauf-<br />
tragten<strong>für</strong> die Unterlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR nach 1990<br />
noch einmal in Deutschland versammelte. Mit zunehmender Zeit wächst die<br />
Macht des Gedächtnisses über die Realitäten, die es spiegelte. Während das
DAS RI-ICI ISAKCI IIV: OPTIONEN UND RKAI.ITÄT 671<br />
Archiv <strong>von</strong> 1914 »nur ein verschwindend kleines Rad in dem großen Körper<br />
der Armee bildete«, enthält das <strong>von</strong> 1926 »die allerletzten Überbleibsel dieses<br />
Heeres selbst«, so daß zwar die Einrichtungen der alten Armee verschwunden<br />
sind, »jedoch die Menschen, die einst diesen Rahmen füllten, noch leben und<br />
aus ideellen oder materiellen Gründen immer wieder auf ihre militärischen<br />
Vergangenheit zurückkommen« . So wird das Trauma eines Krieges<br />
durch Historisierung therapiert und anschlußfähig; das Kriegsarchiv dient als<br />
Grundlage der <strong>Geschichte</strong> des Bayerischen Heeres und bezieht daraus seinen<br />
Mehrwert als Repräsentant einer fast dreihundertjährigen Vergangenheit der<br />
alten bayerischen Armee, »deren Fahnen, zerfetzt und blutgetränkt, nun in den<br />
Hallen des Armeemuseums schlafen und träumen <strong>von</strong> vergangenem Glanz -<br />
aber auch <strong>von</strong> künftiger Auferstehung« . <strong>Im</strong>prägniert und<br />
als Gedächtnis autorisiert ist das Archiv des [magmären der Nation mit der<br />
Blutspur des Realen mehr denn durch alle archivischen Schriftzüge.
672 ARCHIV<br />
Die Geburt des Reichsarchivs aus dem Generalstab<br />
Das deutsche Gedächtnis ist <strong>von</strong> archäologischen Situationen des Umbruchs<br />
und dem emplotment <strong>von</strong> Ironie gezeichnet. Auch die letztendliche Begründung,<br />
die arche des Reichsarchivs ist eine Folge des deutschen Zusammenbruchs<br />
1918/19 und steht mit ihm in ursächlichem Zusammenhang. Menschenund<br />
Datenströme konvergieren im Moment der Kapitulation, wo Truppenformationen<br />
und Verwaltungen der besetzten Gebiete mit ungeheuren Aktenmassen<br />
zurückströmen. Da das deutsche Heer mit seinen Institutionen, vor allem<br />
mit seinem Großen Generalstab nicht weiterbestehen würde, »ergab sich die<br />
Frage, wohin die jetzt freiwerdenden Aktenmassen wandern sollten« - etwa die Kriegstagebücher und die Akten der etwa<br />
200 regionalen Knegsgesellschalten. Der Kiste Weltkrieg hinterließ in Deutschland<br />
eine Hohlform: die Fassung des Militärs. Was <strong>von</strong> ihrer Institution blieb,<br />
sind dessen Räume; das Reichsarchiv wurde 1919 tatsächlich im Gebäude des<br />
großen Generaistabs in Berlin errichtet und Ende dieses Jahres in die ehemalige<br />
Kriegsschule auf den Brauhausberg in Potsdam verlegt. Nach der Auflösung<br />
des deutschen Generalstabs auf Verfügung der Alliierten in Versailles 1919 sucht<br />
der Armeegeneral Major <strong>von</strong> Seeckt nach einem Tarnprojekt, diese Institution<br />
fortzusetzen und wenn schon »nicht die Form, sondern den Geist zu erhalten« 1 .<br />
Zu diesem Zwecks bedient er sich des Mediums Archiv; in einem Memorandum<br />
vom 12. Juli 1919, adressiert an die Regierung der Republik (unter Ebert) bittet<br />
er um die Transformation der Kriegsgeschichtlichen Abteilung des vormaligen<br />
Generalstabs in ein Reichsarchiv. So bedient er sich nicht nur eines<br />
Begriffs, der schon das ganze 19. Jahrhundert hindurch als unerfüllte Virtualität<br />
das deutsche Archivwesen phantomisiert hatte, sondern argumentiert zugleich<br />
<strong>für</strong> eine pädagogisch-propagandistischen Nutzung des archivischen Gedächtnisses<br />
jenseits der rein funktionalen Mihtärgeschichte: Es gelte, die in den<br />
Archiven lagernden »toten Werte in werbende Kraft« <strong>für</strong> den ideellen und<br />
materiellen Neuaufbau des Staates und der Armee umzusetzen« 2 - Gedächtniskapital,<br />
das in Zirkulation gebracht werden soll.<br />
Aus dem Kreise der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabes<br />
erwachsen, fordert die Denkschrift <strong>von</strong> Seeckts <strong>für</strong> ein künftiges Reichsarchiv<br />
F. v. Rabenau, Seekt. Aus seinem Leben. 1918-1936, Leipzig 1940, 188. Hier zitiert<br />
nach: Reinhard Brühl, Entstehung und Konsolidierung des Reichsarchivs 1919-1923.<br />
I ; ,in Beitrag zum Thema Genenilstab und Milnäi^cschicliisschrcilnmi;, in: /.msclinlt<br />
<strong>für</strong> Militärgeschichte, 7. Jg. Heft 4 (1968), 423-438 (426)<br />
Deutsches Zentralarchiv Potsdam (jetzt Bundesarchiv Berlin-Lichtenberg), Bestand<br />
Reichsarchiv, Nr. 286, Bl. 98ff, zitiert nach: Brühl 1968: 428
Di!' GKBURT i)i:s RI-ICI ISAKCIIIVS AUS DI-:M GHNI-RALSTAB 673<br />
»die Aufgaben eines Archivs, die Aufgaben eines wissenschaftlichen Institutes<br />
und die Aufgaben einer lebenden Behörde« mit Zweigstellen im ganzen Reich:<br />
»Das Reichsarchiv mußte eine lebendige, in engem Zusammenhang mit der neuen<br />
Verwaltungsorganisation des Reichs arbeitende Behörde sein infolge seiner modernen<br />
Aktenbestände, die .unter anderen Verhältnissen noch <strong>für</strong> viele Jahrzehnte in<br />
der laufenden Geschäftsregistratur geblieben wären, und es müßte ein wissenschaftliches<br />
Institut sein, weil nur bei sofortiger Inangriffnahme der wissenschaftlichen<br />
Forschung an eine sichere und objektive Erkenntnis dieses größten<br />
Weltercignisses durch Umfragen und Nachfragen bei den führenden Persönlichkeiten,<br />
wie sie sich aus der Forschung infolge des Versagens und der Widersprüche<br />
der sämtlichen Quellen unmittelbar ergeben, zu denken war.« <br />
Die überarbeitete Fassung dieser Denkschrift vom 3. September läßt den Punkt<br />
Herausgabe einer Kriegsgeschichte lallen, hält aber an der Notwendigkeit eines<br />
wissenschaftlichen Forschungsinstituts (Kriegsforschung) fest. Die Schriften<br />
der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Reichsarchivs haben das »Generalstabswerk«<br />
(so Friedrich Meinecke, selbst ehemaliges Mitglied der am 17. Juli<br />
1920 auf Verfügung des Reichspräsidenten zur Beratung der wissenschaftlichen<br />
Arbeiten des Reichsarchivs gebildeten Historischen Kommission) tradiert/ Der<br />
Nachlaß Meinecke, 1887 bis 1901 Archivbeamter beim Geheimen Staatsarchiv<br />
in Berlin, speichert ebendort ein selbst-, d. h. archivbezügliches Typosknpt, das<br />
den epistemischen Hintergrund <strong>für</strong> die mit dem Reichsarchiv konzipierte Kombination<br />
aus archivischer Militärgedächtnismechanik und energetischer Aufladung<br />
durch den historischen Diskurs beschreibt. Am Beispiel des preußischen<br />
Soldaten im Militär beschreibt Meinecke zunächst die Apparatur:<br />
»Hier wurde er zu einem der unzähligen Stiftchen und Rädchen der großen Maschine,<br />
die nicht nur dazu bestimmt war, auf dem Schlachtfelde in Dampf und<br />
Donner zu erbrausen, sondern schon vorher in langen Friedensjahren als mechanisches<br />
Kunstwerk im Dienste der staatlichen Macht große Dienste zu leisten<br />
hatte, dabei als ein Selbstzweck behandelt wurde.« 4<br />
Doch »mit ausschließlich mechanischen Mitteln konnte auch dieser kunstreiche,<br />
aus Menschenleben gebildete Mechanismus nicht leistungsfähig gemacht wer-<br />
Friedrich Meinecke, Die deutsche Katastrophe, 2. Aufl. 1946, 67<br />
Geheimes Staatsarchiv PK Berlin, Repertorium 92 Nachlaß Meinecke, Nr. 100 Friedrich<br />
Meineckc, Militarismus und Hitlcrismus (unter Verweis auf die »bislang ungedruckte«<br />
Schrift: Die deutsche Katastrophe), in: Die Sammlung, 1. Jg., 6. lieh, März<br />
1946, Göttingen (V&R), 344-351. Vgl. ders., Die deutsche Katastrophe (1946), Kapitel<br />
VI, hier: 64-67 (identische Fassung). Siehe auch Barbara Stollberg-Rilingcr, Der Staat<br />
als Maschine: zur politischen Mctaphorik des absoluten Fürstenstaats, Berlin (Duncker<br />
& Humblot) 1986, bes. Kapitel 3.1: Friedrich der Große und die preußische »Staatsmaschine«,<br />
62-75
674 ARCHIV<br />
den«; erst die Fusion mit der politischen Energie im Zuge der Umwälzungen<br />
nach der französischen Revolution und durch die Mobilisierung des Geistes in<br />
der Goethezeit »führten ihr auch neues, frisches Blut aus den irrationalen Gebieten<br />
der Seele zu« . Das Reale <strong>von</strong> Infrastrukturen bedarf des symbolischen<br />
Surplus zur Mobilisierung der vorliegenden Ressourcen; auch ein Archiv wird<br />
ohne die Energie und enargeia historischer <strong>Im</strong>agination nicht einmal gelesen.<br />
»Der neue technisch-militärische Geist des 19. Jahrhunderts, der <strong>von</strong> der Maschine<br />
herkam, traf nun in dem <strong>von</strong> früherer Technik schon sehr vervollkommneten<br />
Gebilde der preußischen Armee aul etwas sehr Wahlverwandtcs. Das Schlagwort<br />
kam auf: >Die Waffe eine Wissenschaft, die Wissenschaft eine Waffe.< <br />
Und so bildete sich nun auch ein Kernorgan innerhalb des preußisch-deutschen<br />
Militarismus aus : der Große Generalstab. Wissenschafthchkeit, Rationalität<br />
und Energie schlössen in ihm einen Bund.« <br />
So definiert sich das Dispositiv des 19. Jahrhunderts. »Kein Staat ist mehr als<br />
Fabrik verwaltet worden als Preußen seit Friedrich Wilhelm des ersten Tode.« 5<br />
Und »so lebenszäh war dies Gebilde, so fest geprägt der Menschentyps, den er<br />
hervorbrachte, daß es« - anders als bei Umwandlung des Geheimen Staatsarchivs<br />
Dahlem in ein »historisches Archiv« nach endgültiger Auflösung Preußens 1947<br />
- »selbst den Versailler Frieden, der es zerstören wollte, überlebte durch getarnte<br />
Einrichtungen, - etwa die des Reichsarchivs, in dem die <strong>Geschichte</strong> des "Weltkrieges<br />
nun <strong>von</strong> den früheren Generalstäblern bearbeitet wurde« . Tatsächlich fordert Groener in einem Brief an Reichspräsidenten Ebert<br />
vom 17. September 1919 ausdrücklich den Generalstab, »wenn auch in anderer<br />
Form«, zu erhalten. 6 Militärische Disziplin und das Gedächtnis des Staates insistieren<br />
auf Kontinuität bis hin zur Dekonstruktion dieses Gefüges; die Lettern<br />
des militärischen Gedächtnisses lösen sich aus der zivilen Tarnung, als im August<br />
1936 auf Weisung Fricks das Heeres- aus dem Reichsarchive gelöst und dem<br />
Reichsknegsministenum zu(rück)geordnet wird. Non-diskursive Techniken der<br />
Ordnung erweisen sich als resistent gegenüber <strong>Geschichte</strong>n der Politik. »Auch<br />
der Sturz der Monarchie 1918 hat den Geist und den inneren Rhythmus des<br />
Archivlebens nicht ernstlich berührt« 7 ; eine vergleichende Ästhetik <strong>von</strong> Archiven<br />
in Momenten <strong>von</strong> Systemumbrüchen sagt immer wieder dies.<br />
Am 14. Dezember 1922 läßt die Reichswehrführung der dem Reichsarchiv<br />
beigegebene Historischen Kommission (u. a. Hans Delbrück) durch ihren Beauf-<br />
Novalis, zitiert (nach Grimms Deutschem Wörterbuch) in: H. G. Adler, Der verwaltete<br />
Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974, 882<br />
BA, Büro des Reichspräsidenten, Nr. 747, Bl. 80f., zitiert nach: Brühl 1968: 427<br />
I Icllmut Kretzschmar, Einleitung, in: Übersicht über die Bestände des Sächsischen<br />
Landeshauptarchivs und seiner Landesarchivc, Leipzig 1955, 7-28 (23). Dazu Musial<br />
1994:17
Du- GI-.BURT D!-:s RHICHSARCHIYS AUS DKM GI-:NI:KAI.STAH 675<br />
tragten Oberst Prager unverholen erklären, daß die Bezeichnung Archiv gewählt<br />
wurde, obwohl man sich darüber klar war, daß mit diesem <strong>Namen</strong> normalerweise<br />
ein Institut bezeichnet wird, das ausschließlich Akten sammelt und verwaltet.<br />
»Der Name sollte dem Feindbund erschweren, in dem Institut den Erben<br />
der knegsgeschichtlichen Abteilungen des ehemaligen Großen Generalstabes zu<br />
verfolgen.« 8 Auch der Freiherr vom Stein hat nach dem erzwungenen Rückzug<br />
aus dem politischen Leben seine Tätigkeit in der symbolischen Organisation<br />
historischer Identität, konkret die Initiative zur Begründung der Quelldatenbank<br />
Monumenta Germaniae Histonca, aufgenommen — Machtverschiebungen ins<br />
Symbolische. Mit der archivischen Konstruktion eines Reichsarchivs jedenfalls<br />
»konnte das Hundertausendmannheer der Reichswehr mit dem Geiste dieses<br />
Generalstabs erfüllt werden« . Meinecke sieht in der Briefkastenfirma<br />
Reichsarchiv des getarnten Generalstabs, mithin Papier verwaltend<br />
auf aufhebend, den logistischen Transfer <strong>von</strong> Weltkrieg I zu Weltkrieg II: »Dieses<br />
kleine Kadreheer der Reichswehr konnte dann wieder das Riesenheer des<br />
zweiten Weltkriegs ins Leben rufen und einen Generalstab da<strong>für</strong> schaffen, der<br />
die Tradition des früheren fortsetzte« . So hat die deutsche<br />
Katastrophe eine Wurzel im Archiv, das selbst darin in Trümmer fiel. Der Autor<br />
schreibt »<strong>für</strong> die Rettung des uns verbliebenen Restes deutscher Volks- und<br />
Kultursubstanz« unter Einsatz des »uns verbliebenen Rest der eignen Kraft«<br />
, und das heißt nach Kriegsende nicht <strong>von</strong> ungefähr<br />
blindness and insight als Gedächtnisschaltungen: »Ich war während der Niederschrift<br />
durch ein Augenleiden vielfach behindert und, <strong>von</strong> einigen geretteten<br />
Lesefrüchten abgesehen, fast ganz auf mein Gedächtnis angewiesen.« Es ist ein archäologischer Moment, ein Moment des Bruchs, <strong>von</strong> dem<br />
aus Meinecke schreibt - ein Moment, der das Schreiben über <strong>Geschichte</strong> überhaupt<br />
erst möglich macht. Die Erzählung (als Historie) steht außerhalb jenes<br />
letzten Reiches (sonst wäre ihr Erzähler mit ihm selbst verschwunden); sein<br />
Untergang ist als Einschreibung einer Irreversibilität als »<strong>Geschichte</strong>, die gegeben<br />
ist, . die der wirklich gesagten Dinge«. 9 Der »radikale Bruch mit unserer<br />
militaristischen Vergangenheit, den wir jetzt auf uns nehmen müssen«, führt<br />
Meinecke überhaupt zur Frage, »was aus unseren geschichtlichen Traditionen<br />
nun werden wird« .<br />
Ebd., Nr. 447, Bl. 40f ff., zitiert nach: Brühl 1968: 435f<br />
Michel Foucault, Archäologie des Wissens ( ;: "Paris 1969), übers, v. Ulrich Koppen,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1981, 184. Siehe Bernhard Siegert, Der Untergang des römischen<br />
Reiches, in: Hans Ulrich Gumbrccht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.), Paradoxien,<br />
Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1991,496
676 ARCHIV<br />
Mit dem 1. Januar 1920 tritt der Versailler Vertrag in Kraft, einen deutschen<br />
militärischen Generalstab untersagend; unter General Hans <strong>von</strong> Seeckt fungierte<br />
das neue Truppenamt als getarntes Surrogat des Großen Generalstabs.<br />
Seeckt als der neue heimliche Generalstabschef setzt sogleich drei Maßnahmen<br />
durch: Die Beibehaltung der Kreiskommissare im Osten <strong>für</strong> künftige Grenzschutzfragen,<br />
die Bearbeitung eines neuen Wehrgesetzes <strong>für</strong> die kleine Berufsarmee<br />
und die Gründung eines Reichsarchivs zur Sammlung aller militärischen<br />
Aktenbeständc des abgeschlossenen Krieges und Weiterführung der kriegsgeschichtlichen<br />
Arbeit des alten Generalstabes. Der letzte Chef der Knegsgeschichtlichen<br />
Abteilung, der Oberquartiermeister Generalmajor Hermann<br />
Merz v. Quirnheim, wird nach seiner Verabschiedung Präsident des Reichsarchivs.<br />
Generalmajor v. Haeften, vom Generalstab gleichfalls verabschiedet,<br />
übernimmt als Direktor im Reichsarchiv die Pierausgabe des amtlichen kriegsgeschichtlichen<br />
Werkes über den Krieg 1914/18. 10 Ein weiterer ehemaliger<br />
Generalstabsoffizier, der letzte Chef der Kartographischen Abteilung, Generalmajor<br />
a.D. Richard v. Müller, wechselt in das Rcichsamt <strong>für</strong> Landesaufnahme<br />
über und wird 1924 dessen Präsident. Auf ähnliche Weise versucht man, die im<br />
Versailler Vertrag verbotene Institution der Militär-Attachees getarnt weiterzuführen."<br />
Eine vollständig getarnte Fortsetzung des verbotenen Großen<br />
Generalstabes aber ist das Reichsarchiv nicht: »Es hatte nichts zu verbergen«<br />
; England und die USA stehen durch Verbindungsoffiziere<br />
im ständigen Kontakt mit dessen (später so umbenannter) Historischer Abteilung.<br />
Der Generalstab spricht Ordnung längst bevor er sie als Archiv formuliert;<br />
in der Stunde der Revolution vom November 1919 »erwies sich der<br />
Generalstab als Faktor <strong>von</strong> ausschlaggebender Bedeutung. Wer immer<br />
nach >Ordnung< schlechthin verlangte, fand hier einen Hoffnungsanker« . Denn »nicht nur siegreiche Revolutionen strahlen auf die<br />
Archive aus, auch gescheiterte oder unvollendete Revolutionen hinterlassen<br />
einen Widerhall in ihnen« . Die Berliner Volks-Zeitung<br />
vom 20. Februar 1922 gibt in einer Meldung auf der Titelseite unter der Schlagzeile<br />
»Das Reichsarchiv m Potsdam. Republikanische Dolchstoß-Propaganda«<br />
einen Artikel aus der Republikanischen Presse wider, worin der Kriegsgeschichtsschreibung<br />
auf Seiten des <strong>von</strong> ehemaligen preußischen Generalstäblern<br />
besetzten Reichsarchivs die Proliferation der Legende des Verrat des Heeres<br />
durch die Heimat vorgeworfen wird. Die als Ironie präsentierte Logik dieser<br />
<strong>Geschichte</strong> liegt im Spiel der institutionellen Ersetzungen:<br />
10 Beide gehören später zum Verschwörerkreis um den 20. Juni 1944<br />
11 Walter Görlitz, Kleine <strong>Geschichte</strong> des deutschen Gencralstabcs, Berlin (Haude & Spe-<br />
ner) 1967,238
Dll- 1 . Gr.UUKT D1S RllCI ISARCI IIVS AUS DI'.M GHNKRAI.STAB 677<br />
»Inzwischen sitzt im herrlichen Gebäude des ehemaligen Generalstabes,<br />
das ganze Rcichsministenum des Innern und übt per Fernrohr die Aufsicht<br />
über das Potsdamer Reichsarchiv aus. Aber mag es an der Ähnlichkeit der >genii<br />
locorum< liegen - denn das Rcichsarchiv sitzt in der ehemaligen Kriegsschule! -<br />
oder an welchen geheimnisvollen Gründen : Tatsache bleibt, daß hier die Gegner<br />
der Republik mit dem Gelde der Republik gefüttert werden um das<br />
Gedächtnis an die große Zeit wach zu erhalten und sich mit der Dolchstoßlegende<br />
herauszureden.« 12<br />
Kurt Tucholsky stellt 1922 fest, daß das Reichsarchiv auf Kosten der Republik<br />
»die Dolchstoßlegende ins Volk lügt« 1 - 1 :<br />
»Wir haben ein Reichsarchiv ..., das lügt, lügt, lügt. Glauben Sie ihm kein Wort -<br />
es sind Interessierte ..., die da schreiben dürfen. Allein wichtig ist vor allem, was<br />
Sie in ihren Schriften und im ganzen Archiv niemals finden werden: die Klagen<br />
und die Tränen eines unterdrückten Volkes . Glauben Sie dem Reichsarchiv<br />
nicht. So ist es nicht gewesen.« 14<br />
Kricgsgcschichlsscbrcibung<br />
Der blinde Fleck <strong>von</strong> archivgestützter Kriegsgeschichtsschreibung sind die Autoren<br />
als Anonyma. Mertz schlägt <strong>für</strong> die Edition des Reichsarchivs vor, die Verfasserfrage<br />
so zu lösen, daß auf dem Titelblatt nur das Reichsarchiv als solches<br />
figuriert. <strong>Im</strong> Vorwort oder in einer sonstigen orientierenden Bemerkung sollen<br />
jedoch die <strong>Namen</strong> der Mitarbeiter am einzelnen Band genannt werden: Demeter<br />
1969: 38>. Von dieser Regelung weicht schon die Ausgabe des 1. Bandes 1925,<br />
wo <strong>für</strong> das gesamte Werk Archivpräsident v. Mertz das Vorwort schrieb, entscheidend<br />
ab (Demeter): Es bleibt bei der alten Generalstabspraxis, daß dessen<br />
Offiziere nicht unter ihren <strong>Namen</strong> fungierten; die <strong>Namen</strong>snennung der Mitarbeiter<br />
fällt also weg. Wolfgang Foerster, der letzte Präsident der nachher aus der<br />
Kriegsgeschichtlichen Abteilung des Reichsarchivs entstandenen, selbständigen<br />
Forschungsanstalt <strong>für</strong> Kriegs- und Heeresgeschichte, schreibt hierzu post festum<br />
nach dem 2. Weltkrieg: »Das Archivwerk sollte ein Einheitswerk, kein Sammelwerk<br />
sein« - ein Gedächtniskörper als Kollcktivsingular.<br />
»Brauchen wir eine amtliche <strong>Geschichte</strong> des Weltkrieges?« fragt in<br />
12 Hier zitiert nach dem Mikrofilm Ztg 724 MR in der Berliner Staatsbibliothek (PK)<br />
13 Autorenkollektiv unter Leitung <strong>von</strong> Botho Brachmann, Archivwesen der Deutschen<br />
Demokratischen Republik. Theorie und Praxis, Berlin (VEB Deutscher Verlag der<br />
Wissenschaften) 19S4. 21. unter Bezut; auf: Kurt Tucholskv. Ein Pvreräeribuch. Auswahl<br />
192C bis 1923. Berlin 1969. 391<br />
14 Kurt Tucholsky, Wie war es -"' So war es -! In: ders.. Lerne lachen ohne zu weinen.<br />
Berlin 1972, 486
678 • ARCHIV<br />
einem Beitrag der D.A.Z. vom 9. Dezember 1923 der General der Infanterie a. D.<br />
v. Kühl und plädiert da<strong>für</strong> angesichts des aus finanziellen Gründen drohendem<br />
Abbaus des Reichsarchivs. Kühl verweist auf Frankreich, das gleich 1919 eine<br />
amtliche militärische Darstellung des Kriegs institutionalisierte, als besondere<br />
Organisation im Großen Generalstab, und zitiert ein Argument der französischen<br />
Kammer vom Sommern 1919, auf diese Weise erhalte man »ein äußerst wirksames<br />
Mittel, um auf die öffentliche Meinung aller Länder einzuwirken.« Kühl<br />
begründet die Architektur des deutschen Weltkriegswerks mit der dementsprechend<br />
notwendigen Unverzüghchkcit; nicht <strong>Geschichte</strong>, sondern Gegenwart ist<br />
die Adresse dieses Archivs. In informatisch vertrauter Parallelverarbeitung wurde<br />
der ganze Krieg zu diesem Zweck in eine Anzahl <strong>von</strong> Abschnitten zerlegt, »deren<br />
Bearbeitung gleichzeitig in Angriff genommen worden ist, so daß mit der Veröffentlichung<br />
der einzelnen Bände je nach der Beendigung und ohne Rücksicht auf<br />
die zeitliche Aufeinanderfolge des ganzes Werkes begonnen werden kann.« 15<br />
Demgegenüber existiert bislang in Deutschland allein die vom Marinearchiv unter<br />
Leitung des Vizeadmirals v. Mantey herausgegebene <strong>Geschichte</strong> des Krieges zur<br />
See 1914-1918, deren Vorrede zum ersten Band des Kreuzerkrieges das Buch<br />
selbst als ein Denkmal bestimmt, »bei allen vaterlandsliebenden Deutschen die<br />
Erinnerung wachzuhalten an die mannhafte Gestalt des deutschen Geschwaderchefs,<br />
des Vizeadmirals Graf v. Spee« .<br />
Ein Auszug aus dem mündlichen Bericht des Präsidenten des Reichsarchivs<br />
behandelt die Arbeit der Wissenschaftlichen Kommission unter Professor Max<br />
Sering, Herausgeber des achtbändigen Werks Die deutsche Kriegswirtschaft<br />
im Rereich der 'Heeresverwaltung 1914-1918. Volkswirtschaftliche Untersuchungen<br />
der ehemaligen Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission des<br />
Preussischen Kriegsministeriums (Berlin/Leipzig 1922), das seit 1918 in engem<br />
Anschluß an die Tätigkeit des preußischen Kriegsministeriums vorbereitet und<br />
dann nach Kriegsbeginn in wissenschaftliche Ausarbeitung genommen wird. 16<br />
Die wissenschaftliche Kommission ist 1915 <strong>von</strong> Walther Rathenau unter Einschaltung<br />
des Kaisers eingesetzt worden und soll das Kriegsministerium, später<br />
das Kriegsamt, in technisch-wirtschaftlichen Fragen beraten. 17 Dieses Werk<br />
hat das gleiche Schicksal wie die zwei Bände Technische Kriegserfahrung <strong>für</strong> die<br />
13<br />
Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz, Nachlaß Dclbrück Fase. 119 Nr.<br />
2, Zeitungsausschnitt<br />
16<br />
Abschrift (TS) I A 12788. / Anlage I., o. D., Bl. 1; Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer<br />
Kulturbcsitz, Nachlaß Delbrück, ebd.<br />
17<br />
Anmerkung in Peter Bcrz, 08/15. Ein Standard des 20. Jahrhunderts, München (Fink)<br />
2001, Absatz A.4 (»Eine modulare Weltkriegsruine«), 56, unter Verweis auf die<br />
maschinenschriftlichen Anmerkungen zu den Auszügen, gezeichnet »Minden-West.<br />
Oktober 1955 L. Cordes«
Du- GKBURT DI-:S RHICHSARCHIVS AUS DI-:M GHNERAI.STAB 679<br />
Friedenswirtschaft; nach seiner Herausgabe im Jahr 1923 wird es auf Veranlassung<br />
des Reichswehr-Ministeriums unter der Begründung der Geheimhaltung<br />
seines Inhalts beschlagnahmt und dem Ministerium zugewiesen, welches<br />
es kurz darauf einstampfen ließ. Lassen sich die beiden Werke wiederfinden?<br />
<strong>Im</strong> offiziellen Reichsarchiv-Werk Der Weltkrieg 1914 bis 1918 ist zu Rüstung<br />
und Kriegswirtschaft nur Band 1 erschienen, der lediglich den Kriegsausbruch<br />
behandelt. Einziges Dokument bleiben einige <strong>von</strong> L. Cordes im Oktober und<br />
November 1944 hergestellte Auszüge, die auf der Randleiste als Fotokopie (<strong>von</strong><br />
Mikrofilm?) gekennzeichnet sind. Was der physischen Vernichtung entgeht,<br />
sind die medialen doubles <strong>von</strong> Gedächtnis. Auf dem Deckblatt der Kopien im<br />
Militärarchiv Freiburg unter der Sigle Msg 128/4 ist der handschriftliche Vermerk<br />
Cordes Oktober 1944 zu lesen; die Urkunde als Bild gelesen oder vielmehr<br />
gesehen gibt sodann einen unleserlichen Stempel zu erkennen, vermutlich vom<br />
kopierten Exemplar des Buches stammend. »Nur in der letzten Zeile sind die<br />
handschriftlichen Einträge erkennbar: ... IX ... 486, die aber keine Aufschlüsse<br />
darüber geben, wo das Werk, falls Weltkrieg n + 1 es nicht verbrannt hat, auffindbar<br />
wäre« . Das Gedächtnis des Krieges ist auch als Beobachtung<br />
zweiter Ordnung eine Funktion seiner archivischen Lage. Lassen sich<br />
solche Verwerfungen, diese Archivlogik des Gedächtnisses noch (sinnvoll) als<br />
<strong>Geschichte</strong> erzählen?<br />
Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs bringt die Notwendigkeit,<br />
laufende Kriegstechnologien in zivile Nutzung zu überführen, den ehemaligen<br />
Leiter des Programms zum Einsatz wissenschaftlicher Forschung <strong>für</strong> Kriegszwecke,<br />
Vannevar Bush, auf den Vorschlag einer mikrofilmbasicrten Infonnations-<br />
und Gedächtnismaschine namens Memory Extender. 1 '' Am Ende <strong>von</strong><br />
Weltkrieg I spult sich ein analoger Mechanismus in der Dynamik <strong>von</strong> Wissensmobilisierung<br />
ab, wie es Berz anhand eines Schlüsseldokuments über die Fertigung<br />
<strong>von</strong> Maschinengewehren abliest: eine 21seitige Ausarbeitung aus dem<br />
Reichsarchiv, verfaßt nach 1923 <strong>von</strong> einem unbekannten Bearbeiter, »mit dem<br />
sprechenden Titel« (Berz): Erfahrungen des Weltkrieges in der Massenbeschaffung<br />
<strong>von</strong> Gerät, insbesondere <strong>von</strong> Maschinengewehren, bei unterteilter Fertigung<br />
(Einzelteilen, Untergruppen) durch eine größere Anzahl <strong>von</strong> Firmen und<br />
Fertigstellung bzw. Zusammenbau durch eine Stammfirma bzw. durch eine heereseigene<br />
Werkstatt.« 20 Mit der modularen Fertigung korrespondiert die modu-<br />
18 Technische Kriegserfahrungen <strong>für</strong> die Friedenswirtschaft. <strong>Im</strong> Rahmen der volkswirtschaftlichen<br />
Untersuchungen der ehemaligen Mitglieder der Wissenschaftlichen Kommission<br />
des Preussischen Kriegsministeriums gesammelt und herausgegeben vom<br />
Verein der deutschen Ingenieure, Berlin / Leipzig (de Gruyter) 1923<br />
19 Vanevar Bush, As wc may think, in: Atlantic Monthly, Juli 1945<br />
20 Berz 1997, a. a. O., unter Bezug auf: Freiburg Militärarchiv Msg. 2/v.775 / Archiv des
680 • ARCHIV<br />
lare Speicherung ihrer Blaupausen als Archiv. Gerät die Logistik dieser Module<br />
ins Schwanken, ist auch das Gedächtnis nicht mehr sicher. Das Delirium der<br />
Akten, die Schwierigkeit in der Arbeit der wissenschaftlichen Sichtungsabteilung<br />
des Kriegsgeschichtsabteilung des Reichsarchivs zur Beschreibung des<br />
Kriegsjahres 1914 liegt<br />
»in der unerwarteten Lückenhaftigkeit und tcilweiscn Unzuverlässigkeit des<br />
Aktcnmatcrials. Die Gründe <strong>für</strong> diese bedauerliche Erscheinung sind mannigfacher<br />
Art. In erster Linie zeigte es sich, daß in der Zeit des Fernsprechers und des<br />
Kraftwagens über die Entstehung entscheidcnde Entschlüsse, über wichtige<br />
mündliche Auseinandersetzung und auch <strong>von</strong> grundlegenden Befehlen und<br />
Anordnungen keinerlei oder nur mangelhafte Aufzeichnungen gemacht wurden.<br />
Dazu kam, daß vielerorts die Tagebücher in dem Drange der Ereignisse entweder<br />
überhaupt nicht oder nur höchst unvollständig geführt wurden.« <br />
Was ist es, das sich hier archiviert? »La transcription circule, toujours le probleme<br />
de l'archive, archive non maitnsable, ä cause de cette technique du<br />
recording en continuite avec l'anarchivc.« 2 ^ In Befehl und Signalvcrarbeitung<br />
kommt der Logozentrismus zu sich. <strong>Geschichte</strong> in Echtzeit kann nicht<br />
Geschichtsschreibung sein. Demgegenüber versagen die nachträglichen Verfahren<br />
der oral history oder die Analysen literarischer Memoiren:<br />
»Jeder Kriegsteilnehmer wird aber an sich selbst die Erfahrung gemacht haben, wie<br />
sehr sich die Ereignisse nach solch langer Zeit in der Erinnerung verschoben, wie<br />
die Vorstellung Ort und Zeit verwechselte usw. So kommt es, daß diese wichtigsten<br />
Quellen einen vielfach nur bedingten Wert besitzen. Dazu kommt, daß ganze<br />
Aktenteile fehlen. Sie waren verschwunden oder fanden sich unter ganz anderem<br />
Material, teilweise liegen sie noch an unbekannten Stellen.« <br />
<strong>Im</strong> Archiv kehrt das Reale nicht an seinen Ort zurück, sondern wird in eine<br />
symbolische Ordnung überführt - die Bedingung eines <strong>Im</strong>aginären namens<br />
<strong>Geschichte</strong>:<br />
»Bevor man also an eine wirkliche Geschichtsschreibung herangehen konnte,'<br />
mußte in diesen Dingen erst Wandlung geschaffen werden. Die Lücken in den<br />
Akten mußten geschlossen, ja ich darf sagen: das ganze Feldaktenarchiv mußte<br />
größtenteils erst aufgebaut und ausgebaut werden. Es ist ja sicher, daß die<br />
DIN, Promotion Woelker. Berz vermutet einige Exemplare der in Deutschland eingestampften<br />
Publikationen in russischen Archiven, nachdem die Bolschewiki 1917 sich<br />
am Modell der deutschen Kriegswirtschaft orientierten; etwa im Bestand: Reichsarchiv.<br />
Reichswirtschaftministerium (13 355 AE). Beauftragter <strong>für</strong> den Vierjahresplan,<br />
im Moskauer Osibi-Archiv Kniga Fondov 1525<br />
21 Jacques Derrida, Pour l'amour de Lacan, in: College International de Philosophie (Hg.),<br />
Lacan avec les philosophes, Paris 1991, 397-420 (400 u. 419; Hervorhebung W. E.)
Du: GKBURT DI:S RKICHSARCHIVS AUS DKM GKNHRALSTAB 681<br />
Führung der Akten und Kriegstagebücher in den Zeiten des späteren Stellungskrieges<br />
weit sorgsamer gewesen ist.« <br />
Das katechontische Prinzip des Archivs korrespondiert mit dem aufschiebenden<br />
Charakter des Stellungskriegs. Die Funktion der Narration ist demgegenüber<br />
heuristisch:.»Nur wenn wir nicht allein forschen, sonder auch beschreiben<br />
wollen, kommen wir ja auf die eigentlichen Lücken des Aktenmatenals« . Und das heißt: erst der semantische Vorgriff der Geschichtserzählung, also<br />
die Stiftung eines hypothetischen Zusammenhangs macht Lücken sichtbar. Der<br />
Fluchtpunkt ist also die Fülle, der gegenüber sich die Lücke abzeichnet; dem<br />
steht eine originäre Archäologie entgegen, die gerade <strong>von</strong> den Lücken ausgeht.<br />
»Mein Plan ist es: den Großen Krieg in seinem monumentalen Verlauf in großen<br />
Linien zu schildern« .<br />
Zugangsbedingungen, Gedächtnissperren und Effekte der Büroreform<br />
»Die Repertoncn des Rcichsarchivs werden den Benutzern grundsätzlich nicht<br />
vorgelegt«, besagt die Benutzerordnung <strong>von</strong> 1920. 22 Damit bleibt der logistische<br />
Kopf des archivischen Gedächtnisses, seine arche, dem Leser verborgen. Zu<br />
diesem Zeitpunkt ist das junge Archiv noch nicht selbstverständlich ein read<br />
only memory, sondern erinnert noch apotropäisch an seinen jüngstvergangenen<br />
Zustand als Arbeitsspeicher in actu, als random access memory einer Kriegsführung;<br />
den Benutzern ist es »streng verboten neue Schriftstücke irgendwelcher<br />
Art in die Akten des Reichsarchivs hineinzubringen« . Für aus<br />
der Benutzung <strong>von</strong> Archivalien des Reichsarchivs erwachsene wissenschaftliche<br />
Publikationen wird erwartet, ein Exemplar an die Bibliothek des Reichsarchivs<br />
abzuliefern . Das heißt Transformation <strong>von</strong> non-diskursiv gespei-<br />
chertem Archivgut in diskursiv verfügbares Bibliotheksgut (Jccdbach). Das<br />
Arbeitsgedächtnis des Berliner Innenministeriums (das System <strong>von</strong> Registra-<br />
turen in Haupt- und Unterabteilungen) ist unmittelbar an das Reichsarchiv<br />
gekoppelt:<br />
In den Registraturen wurden die Akten bis 1926/28 nach Schlagworten geführt, die<br />
ihrerseits durchnumeriert waren. Das Schlagwort, z. B. Zollsachen, ist also ein Teil<br />
der Signatur. Diese Schlagworte der einzelnen Registraturen sind ohne Rücksicht<br />
darauf, in welcher Abteilung sie zum Zeitpunkt der Abgabe an das Archiv bearbeitet,<br />
in welcher Registratur sie geführt worden waren, im ehemaligen Reichsar-<br />
22 Benutzerordnung <strong>für</strong> das Reichsarchiv (Typoskript), datiert Potsdam, 23. Nov. 1920,<br />
hier zitiert nach dem Exemplar im der Staatsbibliothek zu Berlin. Preussichcr Kulturbesitz,<br />
Nachlaß Delbrück Fase. 119 Nr. 2, § 9
682 ARCHIV<br />
chiv alphabetisch angeordnet und verzeichnet worden, eine Methode, die sich bei<br />
einer noch lebenden Behörde bei diesem Sachverhalt geradezu aufdrängte.« 23<br />
Damit ist es möglich, das archivalische Gedächtnis dieser Behörde als Speicherarray<br />
anzuschreiben und zu programmieren. Wo die Semantik <strong>von</strong> Akten zum<br />
Bestandteil ihrer eigenen Adresse als Gedächtnis wird, ist eine geschichtstheoretische<br />
Frage zum Verhältnis <strong>von</strong> Zuschreibung und <strong>Im</strong>manenz beantwortet,<br />
insofern der Sinn einer Übertragung in ihrem Vektor hegt: »Können Objekte der<br />
Vergangenheit ihren historischen Sinn nicht auch in sich haben?« 24 Bezüglich der<br />
Aktenordnung wirkt sich die Bürorelorm im Reichsministerium des Innern<br />
so aus, daß die Akten zwar weiterhin in den Abteilungsregistraturen geführt<br />
wurden, aber innerhalb derselben galten nicht mehr die Schlagworte als<br />
Ordnungsgesichts(und -geschichts)punkt, sondern man versuchte, das gesamte<br />
Aktenmaterial einschließlich des zu erwartenden vorausschauend mit Hilfe der<br />
Dezimalklassifikation zu gliedern. Da die gleichen Ziffern nun in jeder Abteilung<br />
wiederkehren, mußte die Abteilungsbezeichnung integrierender Bestandteil<br />
des Aktenzeichens selbst werden, um gleichzeitig als Geschäftszeichen<br />
verwendet werden zu können. Archivische Einschnitte sind hier Inkorporation<br />
der Institution in die Schrift. Die betriebswirtschaftlich inspirierte Durchführung<br />
der Büroreform (die der just-in-time-Logistik militärischer Nachrichtentechnik<br />
des Zweiten Weltkriegs vorgreift) empfiehlt sich auch aus lagcrungstechmschen<br />
Gründen; Gedächtnis hat Materialität als Raum. Der Teilbestand bis 1926/27,<br />
der im Reichsarchiv nach Sehlagworten alphabetisch geordnet und verzeichnet<br />
worden ist, verlangt damit nach Überdenken des Aufbaus. »Behielte man die<br />
Ordnung des Reichsarchivs bei, so ergäbe sich (nach Enders) folgendes Bild:<br />
1. Aktienwesen<br />
2. Arbeiterversicherung<br />
3. Armenwesen .<br />
4. Ausstellungssachcn<br />
5. Auswanderungswesen<br />
6. Banksachen<br />
60. Zollsachen<br />
Diese Ordnung läßt sich in der Programmiersprache C++ unter Rückgriff auf<br />
die entsprechenden libranes (gedächtnisoperative Module also) objektorientiert<br />
- 3 Gerhart Enders, Probleme des Provenienzpnnzips, in: Archivar und Historiker (Festschrift<br />
H. O. Meisner), Berlin 1956, 27-44 (33f)<br />
24 Jörn Rüscn, <strong>Geschichte</strong> sehen. Zur ästhetischen Konstitution historischer Sinnbildung,<br />
in: Monika Flacke (Hg.), Auf der Suche nach dem verlorenen Staat. Die Kunst der Parteien<br />
und Massenorganisationen der DDR, Berlin 1994, 28-39, Abschnitt »Das historische<br />
Manko sinnlich präsenter Vergangenheit« (31)
Du- GKBURT ni-:s RHICHSARCHIVS AUS DKM GKNHRAI.STAB 683<br />
als Sortierung schreiben, als Umordnung einer Folge <strong>von</strong> Objekten in eine<br />
Folge mit Ordnungsrelation 25 . Denn die Speicherstruktur der Computerhardware<br />
entspricht in der aufsteigenden Durchzählung <strong>von</strong> arrays der alphanumerischen<br />
Logistik des Reichsarchivs; der Rhythmus des Archivs laßt sich in<br />
Sortieralgorithmen fassen. Womit sich das reichsarchivische Gedächtnis des<br />
deutschen Staates als virtuelle Maschine nicht nur medienarchäologisch (statt<br />
historisch) beschreiben, sondern auch Ingangsetzen läßt 26 :<br />
#includc <br />
#mcludc <br />
#include <br />
int vergleich(const void :; "sl, const void ;: 's2)<br />
!<br />
return strcmp((char : ')sl, (char : ')s2);<br />
}<br />
void main()<br />
(<br />
chararchiv[10][80];<br />
for (int i=0; i
684 ARCHIV<br />
Moment der Historie 27 zu organlosen Maschinen und die Form des Gedächtnisses<br />
als kompatible Teilmenge <strong>von</strong> Informationsvcrbundsystcmen mechanisierbar<br />
- buchstäblich die Bedingung, das Gesetz und Dispositiv und zur<br />
<strong>Im</strong>plementierung entsprechender Hardware (etwa Lochkartentechniken). Für<br />
die Büroreform der Weimarer Republik gilt überhaupt, daß sie <strong>von</strong> ihren Urhebern<br />
als strukturelle Vereinfachung <strong>von</strong> Verwaltungsabläufen (Algorithmen<br />
mithin) gedacht war, etwa durch Auflösung der allgemeinen Registratur; »<strong>für</strong><br />
die untergeordnete Schicht der Registraturen« aber »sind es äußerliche<br />
Merkmale: Die mechanische Heftung und die Methode der Signierung der<br />
Dezimalklassifikation« 2S , wobei die Kopplung <strong>von</strong> Mechanisierung der Aktenkonfiguration<br />
und ihre numerische Klassifikation ihrerseits ein neues,<br />
mechanisierbares Dispositiv des Archivs ausbildet. Grund <strong>für</strong> zunächst<br />
zögernde Übernahme der mechanischen Hettung in Behörden ist die Erkenntnis,<br />
daß die klassische Fadenheftung nicht nur dauerhafter ist, die Schriftdokumente<br />
mithin als Verbund zur administrativen Aussage monumentalisiert,<br />
sondern auch den Akteninhalt besser sichert als die lose Kopplung der mechanischen<br />
Heftung, die daher einen Mangel an Archivfähigkeit zeitigt und in der<br />
Überführung <strong>von</strong> Behördenrepositur zum Archiv eine Umbettung in archivfähige<br />
Hefter erfordert. Damit ist die Differenz des archivischen Raums zur<br />
Zeit der Gegenwart als mechanische definiert. »Erst die Kriegswirtschaft<br />
des ersten Weltkriegs führte gewaltsam Schnellhefter und Stehordner in die<br />
Behörden ein«; Krieg mobilisiert nicht nur Truppen, sondern auch Akten<br />
»Mobilisierung des Inhalts« durch mechanische Heftung) unter Notwendigkeiten<br />
der Echtzeit .<br />
Die Umgestaltung des Reichsarchivs (1932/33)<br />
Anfang der 20er Jahre bemüht sich der ungarische Kultursminister Graf Kle-<br />
belsberg, Museen, Bibliotheken und Archive<br />
»in dem Gefüge des Staatsorganismus zu lockern, sie unter einen gemeinsamen<br />
Verwaltungsrat zu stellen, der, aus Beamten der Institute selbst und sachlich<br />
zuständigen Universitätsprofessoren bestehend, nach einheitlichen Gesichtspunkten<br />
sie leitet und enger als bisher mit der Wissenschaft verbindet. Mag dieser<br />
Weg <strong>für</strong> die Bibliotheken und Museen gangbar sein, <strong>für</strong> die staatlichen Archive ist<br />
er es nicht infolge ihres engen organischen 7Aisammcnhangcs mit dem Staate, aus<br />
27<br />
Das historische, also abgeschlossene Ereignis soll hier im Sinne Max Webers als<br />
»aktenkundige Tatsache« definiert gelten.<br />
28<br />
Johannes Papritz, Archivwissenschaft, 2. durchges. Ausgabe Marburg (Archivschule)<br />
1983, Bd. 2, Teil 11,2: Organisationsformen des Schriftgutes in Kanzlei und Registratur,<br />
zweiter Teil, 341
Dll. Gl.BURT DKS Rl.ICHSARCHIVS AUS DKM GKN1.RAI.STAB 685<br />
dem heraus sie entstanden sind, und infolge der Materie, die sie zu verwalten<br />
haben. Der Archivar ist ganz gewiß Jünger der historischen Wissenschaft, aber er<br />
ist und bleibt in erster Linie Beamter des Staates. Bei den Tragen, die das<br />
Archiv berühren, muß der Staat entscheiden, freilich nicht allein der augenblickliche<br />
Staat, sondern auch der mit seiner <strong>Geschichte</strong> unlösbar verbundene, ewig<br />
gedachte Staates eines Volkes, einer Nation.« 29<br />
Gegenüber dieser Vorschaltung <strong>von</strong> Staatsnähe als Definition des archivischen<br />
Gedächtnisses bedarf das aus dem Geist des deutschen Generalstabs geborene<br />
Reichsarchiv des Begriffs der Kultur zur diskursiven, tarnenden Legitimierung.<br />
In seiner Denkschrift betont Müsebeck, daß das Reichsarchiv <strong>von</strong> seiner Entstehung<br />
an sich bemüht, nicht nur zur <strong>Geschichte</strong> des Reiches als Staat, sondern<br />
auch zur <strong>Geschichte</strong> der »Wandlungen des deutschen Volkstums und des deutschen<br />
Nationalbewußtseins« Nachlässe und zeitgeschichtliche Sammlungen aus<br />
den letzten 150 Jahren an sich zu bringen - eine in den meisten Landesarchivverwaltungen<br />
seinerzeit wenig beachtete archivalische Aufgabe. Der (im vorliegenden<br />
Dokument laufend unterstrichene) folgende Satz nennt die doppelte,<br />
zugleich diskursive und non-diskursive Kodierung des Reichsarchivs: Staatsarchive<br />
sollen gleichzeitig Nationalarchive sein und die »geschichtliche Entwicklung<br />
nicht nur <strong>von</strong> oben her, vom Staate her, sondern zu gleicher Zeit <strong>von</strong> unten<br />
her, dem Volke her, als dem Träger des Nationalstaates zu fassen versuchen.« 30<br />
Dagegen steht auf Seiten der Kritiker die Forderung, die über den gedächtnistechnischen<br />
Aufgabenkreis des Reichsarchivs weit hinausgehenden Forschungen<br />
über die kulturelle Entwicklung Deutschlands während des Weltkrieges einzustellen<br />
und die Arbeitsgemeinschaft <strong>für</strong> Kulturgeschichte, deren Leitung bisher in<br />
den Händen Valentins lag, aufzulösen. 31 <strong>Im</strong> Sinne eines Diktums <strong>von</strong> Michel de<br />
Gerteau wird Kulturwissenschaft hier kriegswissenschaftlich analysiert. Mit dem<br />
Antritt Haeftens als Präsident des Reichsarchivs wird eine Arbeitsgruppe<br />
<strong>Geschichte</strong> der kulturellen Entwicklung Deutschlands während des Weltkrieges«<br />
(Entwurf vom April 1932) ins Leben gerufen 32 , darunter das <strong>von</strong> Poll bearbeitete<br />
Schwerpunktthema »Fürsorge des deutschen Heeres zur Erhaltung <strong>von</strong> Kunstschätzen,<br />
Archiven, Bibliotheken usw.« 33 - eine Selbstreferenz eines Archivwis-<br />
29<br />
Müsebeck 1923: 317, unter Bezug auf: Robert Gragger, Ein Gesetz über die Selbstverwaltung<br />
der Museen, Bibliotheken und Archive, im Scptcmberhch der Deutsche?!<br />
Rundschau<br />
30<br />
Bundesarchiv / militärisches Zwischenarchiv Potsdam, Denkschriften Ernst Müsebeck<br />
1932/33, 90 Mü 6/3, Bl. 32<br />
31<br />
Müsebeck: Denkschrift über die Zukunft des deutschen Archivswesens, Bl. 4<br />
32 Herrmann 1993: 281, unter Bezug auf die Verordnung des Präsidenten zum Beginn der<br />
Arbeiten zur kulturellen Entwicklung vom 12. 04.1932, BA P 15.06 Nr. 82 Bl. 1 u. Bl. 40<br />
33<br />
Vortrag Valentins v. 20. Juni 1933, in: BA P 15.06 Nr. 82 Bl. 26 u. 33, angeführt <strong>von</strong><br />
Herrmann 1993:282
686 ARCHIV<br />
sens, das zu sich kommt, als Poll seine Erkenntnisse nach 1945 »teilweise und<br />
angereichert durch die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges« publiziert. 34<br />
Für das Reichsarchiv ist der politische Einschnitt <strong>von</strong> 1933 pointiert faßbar;<br />
»warnend wiesen die Vorgänge beim Brande des Reichstagsgebäudes im Winter<br />
1933 , bei dem wichtige archivahsche Bestände zerstört worden sind, auf<br />
die auch den Archivalien des Reiches drohende Gefahr hm« . Müsebeck läßt damit den ideologischen Umbruch korrespondieren: »Nicht<br />
nur das Reichsarchiv, sondern das gesamte deutsche Archivwesen stehen vor<br />
einem Wendepunkt ihrer Entwicklung. Die grosse staatliche Umwälzung kann<br />
und darf nicht an ihnen vorübergehen« . Unter Verweis auf die<br />
Anlage Organisationsplan des Reichsarchivs nennt Müsebeck das douhle-hind<br />
seiner Institution: Alle wissenschaftlichen Aufgaben und Arbeiten, »die ihrem<br />
Wesen nach nicht zum Aufgabenkreis des Archivs gehören«, seien einzuschränken.<br />
»Ich beabsichtige eine klare Trennungslime zwischen archivalischen<br />
und wissenschaftlichen Arbeiten zu ziehen; nur die ersteren gehören zu dem<br />
Aufgabengebiet des Reichsarchivs, die letzteren zu denen der Historischen<br />
Reichskommission« . Sein Plädoyer <strong>für</strong> die Umgestaltung<br />
des Reichsarchivs verschaltet den Archivkörper mit seinem Betriebssystem;<br />
um es zur Lösung der ihm <strong>von</strong> der Reichsregierung gestellten Aufgaben zu<br />
befähigen, sei das Vorhandensein eines »nach Vorbildung, Berufsauffassung und<br />
Weltanschauung einheitlichen Beamtenkörpers« Vorbedingung:<br />
»Diesen Forderungen nach Einheitlichkeit in personeller Hinsicht ist jedoch bei der<br />
Begründung des Reichsarchivs im Jahre 1919 <strong>von</strong> Seiten der damaligen Regierung<br />
nicht Rechnung getragen worden, sie stand der nationalen Zielsetzung und den<br />
weltpolitischen Aufgaben des Reichsarchivs mit Mißtrauen, ja zum Teil ablehnend<br />
gegenüber. Aus diesem Mißtrauen heraus und gleichsam als Gegengewicht gegenüber<br />
den Träger des Gedankens der nationalen Wehrhaftigkeit und eines starken<br />
Nationalbewusstseins wurden zum Teil Persönlichkeiten in das Reichsarchiv<br />
gesetzt, die vom parlamentarischen Prinzip bestimmt, parteipolitisch links und ausschließlich<br />
pazifistische eingestellt waren. Dieser weltanschauliche Zwiespalt,<br />
mit dem das Rcichsarchiv gleichsam geboren wurde, hatte eine völlig uneinheitliche<br />
Zusammensetzung des Beamtenkörpers zur Folge.« <br />
Das Reichsarchiv mit seinen Abteilungen Berlin und Frankfurt/M. bildet das<br />
eigentliche Archiv des Reiches <strong>von</strong> 1815 bis zur Gegenwart, dessen Gedächtnis<br />
als Einfaltung, »denn es birgt <strong>für</strong> diese Zeit die staatlichen Zentralregistraturen,<br />
die <strong>für</strong> das Reich gearbeitet haben, in sich.« Erst durch den Erlaß der<br />
Reichsregierung vom 5. Dezember 1931 wird das Reichsarchiv zum ausdrücklichen<br />
Zentralarchiv des Reiches erhoben und seine statsrechthehe Stellung im<br />
34 Herrmann 1993: 282, unter Bezug auf: B. Poll, Archivgutschutz im Kriegsfall, in: Der<br />
Archivar 4 (1951) Sp. 13Off
Du- GEBURT DES REICHSARCHIVS AUS DEM GENERAESTAB 687<br />
Behördenorganismus (Müsebeck) des Reiches festgelegt, gefolgt durch das richtunggebende<br />
(ders.) Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom<br />
7. April 1933 (Reichsges.Blatt I 1933 S. 173). Das Gesetz des Archivs sind seine<br />
gedächtmspolitischen Vektoren. Weiterhin spiegelt das Gedächtnis des Staates<br />
dessen Struktur, und das heißt nach 1933 Führerschaft. Das deutsche Archivwesen<br />
müsse, »wenn es ein nützliches Glied im staatlichen Organismus bleiben<br />
will«, mit der staatlichen Entwicklung des Reiches Schritt halten und mit<br />
ihr in beständiger Fühlung bleiben. Und eben diese staatliche Entwicklung weise<br />
»zwangsläufig auf eine Zusammenfassung, um nicht zu sagen Vereinheitlichung<br />
des gesamten deutschen Archivwesens hm unter der Führung des Reiches, dessen<br />
Organ <strong>für</strong> alle archivalischen Aufgaben das Reichsarchiv ist« . Reich(s)weiten des Archivs sind auf Adressierbarkeit angewiesen,<br />
und damit in Metonymien und Synekdochen des deutschen Gedächtnisses verstrickt.<br />
Der Briefentwurf <strong>von</strong> Archivrat Rohr an Staatsarchivdirektor Winter<br />
vom 3. Januar 1940 nennt es:<br />
»<strong>Im</strong> Auftrage des Herrn DG habe ich heute eine Frage an Dich zu richten. Es handelt<br />
sich um die Benennung der künftigen Archive in den Reichsgauen. Bisher war<br />
immer <strong>von</strong> >Reichsarchivcn< die Rede . Von Herrn Mcisner ist nun dagegen<br />
eingewandt worden, daß diese Bezeichnung am besten nur einem Archiv beigelegt<br />
würde, nämlich dem jetzigen Reichsarchiv als dem Archiv <strong>für</strong> die Zentralinstanzen<br />
des Reiches. Der Ausdruck >Reich< enthalte immer eine Beziehung auf das<br />
Ganze der staatlichen Form unseres deutschen Volkes. Seine Anwendung auf die<br />
Archive in den Gauen sei daher nicht ganz glücklich. Nach meinem Empfinden<br />
zieht der Widerstand gegen die vom Generaldirektor gewünschte staatliche<br />
Lösung der Archivfrage im Reich einen guten Teil seiner Berechtigung, aus<br />
der Bezeichnung aller bisher staatlichen Archivgebilde in den Gauen als Reichsarchive.<br />
Das klingt zu stark nach Zentrahsation, nach Ausschaltung der Eigenbelange<br />
der einzelnen Landschaften. Meisner stellt demgegenüber zur Wahl<br />
>ReichsgauarchivStaatsarchiv< empfohlen. Da es künftig keinen Gegensatz zwischen einer<br />
Staatlichkeit des Reiches und der Länder mehr gibt, sondern nur noch einen einzigen,<br />
überall durchgehenden staatlichen Aufbau, den des Reiches, wäre dies vielleicht<br />
die glücklichste Lösung.« 3 " 1<br />
Reorganisation 1937 und die politische Askese des Archivs<br />
Eine Meldung des Deutschen Nachrichtenbüros sagt es: Am 1. April 1937<br />
erfolgt die haushaltmäßige und damit endgültige Trennung des Heeresarchivs<br />
Potsdam und der bisherigen Reichsarchivzweigstellen, nachdem bereits am 1.<br />
Oktober 1936 die militärischen Akten aus dem Bestand des Reichsarchivs her-<br />
35 Bundesarchiv, Abt. Potsdam (jetzt Berlin-Lichtcrfelde), R 146/40, Bl. 1 r.
688 ARCHIV<br />
ausgelöst und als Heeresarchiv Potsdam dem Reichskriegsministerium (Oberkommando<br />
des Heeres) unterstellt worden ist und am 1. April 1935 die Kriegs -<br />
geschichtliche Abteilung als Forschungsstelle ebcndorthin fortgcschaltet<br />
worden war. 36 Zu welchen Aporien der Versuch führen kann, im Archiv über<br />
Archive als <strong>Geschichte</strong> zu schreiben, manifestiert etwa folgender Fall: Als Hermann<br />
Görmg in seiner Eigenschaft als Preußischer Ministerpräsident die Eingliederung<br />
der Preußischen Archivverwaltung in eine Rcichs-Archivvcrivahiing<br />
plant, fragt er in einem Schreiben vom 9. Februar 1935 bei Reichswehrmimster<br />
v. Blomberg an, ob im Zuge dieser Neuordnung beabsichtigt sei, die aktuell ins<br />
Reichsarchiv Potsdam integrierte alte Knegsgeschichthche Abteilung des Generalstabs<br />
wieder als Einrichtung der Reichswehr aufleben zu lassen. »Für die<br />
Antwort Blombergs an Göring gibt es merkwürdigerweise zwei erheblich <strong>von</strong>einander<br />
abweichende Texte«; der eine, <strong>von</strong> Blomberg unterschrieben und mit<br />
Abgangsvermerk versehen, will dieses Heeresarchiv der Reichsarchivverwaltung<br />
eingegliedert lassen, während der andere Text, mit gleichem Ausstellungsdatum<br />
versehen, jedoch nur als Abschrift vorhanden, die Zustimmung zu einer<br />
Neuregelung im Sinne Görings gibt. »Lücken im überlieferten Schriftgut<br />
machen es zur Zeit unmöglich, einwandfrei zu klären, welcher der beiden Texte<br />
tatsächlich vom Reichswehrministerium abgeschickt wurde« 37 ; im Raum<br />
des Archivs bewegt sich der Historiker immer schon auf einer nur medienarchäologisch<br />
beschreibbaren Ebene, nämlich der Aufgezcichnetheit <strong>von</strong> Vergangenheit.<br />
Indem seine Texte daran anschließen, kommt es zu geschlossenen<br />
Schaltkreisen, die nur selbstreferentiell plausibel sind. Am Ende dieses unentscheidbaren<br />
Falles steht mit der erneuten Verselbständigung des Heeresarchivs<br />
die nicht minder tautologische Aussage des Chef des Truppenamtes, Generalleutnant<br />
{lieu-tenant der Gedächtnisdaten zugleich) Ludwig Beck: »das Heer<br />
verfügt in eigenen Archiven über seine Archivalien« . Und als Grundsatz <strong>für</strong> die Behandlung der militärischen Archivbestände<br />
in den im darauffolgenden Weltkrieg besetzten Gebieten verfügt der<br />
Chef des Generalstabes des Heeres, Generaloberst Halder, »daß wir alles entnehmen,<br />
was uns gehört und was im Augenblick unmittelbaren Nutzen bringe;<br />
daß wir alles abschreiben oder fotokopieren, was geschichtlichen Wert <strong>für</strong> uns<br />
30 Ebd., R 43 II / 860, Bl. 9, und Ernst Zipfel, Die Organisation des Reichsarchivs <strong>von</strong><br />
der Gründung bis zur Bildung der Wehrmachtsarchive (1919 bis 1937), in: Archivahsche<br />
Zeitschrift 45 (1939), 1-6 (3)<br />
37 Friedrich-Christian Stahl, Die Organisation des Hceresarchivwesens in Deutschland<br />
1936-1945, in: Heinz Boberach / Hans Booms (Hg.), Aus der Arbeit des Bundesarchivs.<br />
Beiträge zum Archivwesen, zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, Boppard<br />
(Boldt) 1978, 69-101 (73, Anm. 22), unter Bezug auf die Daten im Bestand RH 18/v.<br />
14 (Chef der Heeresarchive) im Bundesarchiv/Militärarchiv
DIK GKBURT DKS RI.ICI ISARCI nvs AUS DKM GKNKRALSTAB 689<br />
hat«. 38 Die Differenz <strong>von</strong> Gegenwart und Historie heißt Ausnahmezustand der<br />
Daten. Die unentscheidbare Archivlage des Blomberg-Schreibens an Göring<br />
mag als Ausnahmeerscheinung des quellenkundlichen Regelfalls erscheinen,<br />
erinnert aber daran, daß die symbolische Ordnung des archivhistorischen<br />
Raums, also d.\s '. r r.:i;r.r.äre Sis^itikit <strong>Geschichte</strong>. ; ^me r scher, vorn arbiträren<br />
sehen Beuteakten eintretten, befinden sich darunter auch in der Banque Nationale<br />
du Commerce in Paris aufgefundene Bestände zur Zurückweisung an die<br />
Heeresarchiv-Zweigstelle Danzig, die Stahl folgendermaßen beschreibt: »Handakten<br />
des polnischen Brigadegenerals (MP)alinowski (der erste Buchstabe ist<br />
unleserlich)« ; so verletzbar ist Gedächtnis in seiner völligen Abhängigkeit<br />
<strong>von</strong> der alphanumerische Adressierbarkeit.<br />
Militärisch funktionale, administrativ justiziable und kulturell bedeutende<br />
Akten werden zunächst noch nicht räumlich (»damit nicht durch Trennung vom<br />
Quellenmaterial die Forschung beeinträchtigt würde«), aber institutionell<br />
getrennt, nachdem sich das Reichsarchiv in seiner Genese nie völlig aus dem<br />
Schatten seines militärischen Charakters hatte lösen können. 39 Bereits 1934 werden<br />
die alten Gebäude weitgehend abgebrochen, am 10. November wird ein<br />
Neubau gerichtet, in dem Architektur und Speicher zusammenfallen: Das mit<br />
besonders kontruierten Schubschlösscr verschlossene, gegen Sonnenbestrahlung<br />
durch gelb getöntes Kathedralglas geschützte Aktenmagazin ist ein Eisengerüst,<br />
dessen Stützen vom Keller bis zum Dachboden durchgehen; die Aktenregale<br />
ihrerseits sind an den Stützen bzw. an den Deckenträgern aufgehängt, pures<br />
Gestell, schmucklos jenseits allen ästhetischen Historismus' und schon in der<br />
Aufstockung asymmetrisch zur Zahl der <strong>für</strong> Menschen gedachten Geschosse.<br />
Name (die Spur/trace der Vergangenheit) ist gleich Adresse (als Bahnung/Trasse<br />
des Gedächtnisses): »Die Zufahrt zum Aktenmagazin geschieht <strong>von</strong> der Hans<strong>von</strong>-Seeckt-Straße<br />
aus« 40 ; der militärhistorische Zweig des Reichsarchivs kehrt<br />
an seinen Ursprung im Generalstab zurück. Ein Runderlaß des Reichs- u. Preuß.<br />
Ministers des Innern vom 5. August 1937, betreffend der Aufbewahrung <strong>von</strong><br />
Schriftgut bei den staatliche Behörden sowie dessen Abgabe an die Archive,<br />
38<br />
Aus den »Notizen <strong>für</strong> seinen Nachfolger« des Chefs der Heeresarchive Rabenau RH<br />
18/v. 72 zitiert nach Stahl ebd., 84<br />
39<br />
Vgl. Müsebeck 1923: 310 u. 316; dort unterstreicht er den »organischen Zusammenhang«<br />
aller Archivabteilungen (militärisch, zivil, wirtschaftlich) gegenüber Tendenzen,<br />
aus den archivischen Subuniversen der Abteilungen selbstreferente Einheiten<br />
(eigenständige Spezialarchive) zu gestalten.<br />
40<br />
Rudolf Wiesen, Der Neubau des Heeresarchivs Potsdam, in: Archivalische Zeitschrift<br />
45 (1939), 7-15(13)
690 ARCHIV<br />
beschreibt die Scmiose <strong>von</strong> Akten in historische Dokumente. Archivgut, das<br />
nicht mehr in den laufenden Geschäftsbetrieb eingebunden ist, gehört in die Altregistratur<br />
(reponierte Registraturen). »Jedoch tritt alsdann seine Bedeutung als<br />
Material <strong>für</strong> die Erforschung des Werdeganges <strong>von</strong> Volk und Reich zunehmend<br />
in den Vordergrund, zumal staatliches Schriftgut aufs unmittelbarste die Volksund<br />
Staatsentwicklung wiederspiegelt« . Der Nationalsozialismus<br />
archiviert sich vorauseilend im Futur. Auf diese Rundschreiben<br />
antwortet der preußische Ministerpräsident aus Berlin am 13. September 1937:<br />
»Die in der Einleitung des Entwurfs enthaltene Begründung, daß das staatliche<br />
Archivgut seines historischen Wertes wegen (als Material <strong>für</strong> die Erforschung des<br />
Werdegangs <strong>von</strong> Volk und Reich) den staatlichen Schutz verdient, halte ich <strong>für</strong><br />
crgän/.ungsbedürlüg. Ausgangspunkt und Schwergewicht des staatlichen Archivwesens<br />
hegen m. E. in der Bewertung des Archivgutes als eines Rüstzeugs <strong>für</strong><br />
politische und Hoheitsaufgaben des Staates. Die Sicherung der archivalischen<br />
Überlieferung ist daher nicht nur historisch, sondern vor allem auch praktischstaatlich<br />
<strong>von</strong> Bedeutung.« <br />
Hört der Zugriff des Staats als Gedächtnisverwaltung auch im NS-Regime auf,<br />
wo das Subjekt als Definition beginnt? Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei<br />
signalisiert es Hitlers Stellvertreter in München, »daß der Führer und<br />
Reichskanzler dem Gesetzentwurf zum Schütze <strong>von</strong> Archivgut seine Zustimmung<br />
deshalb versagt hat, weil der Entwurf auch in der letzten Fassung zu sehr<br />
in die private Rechtssphäre des einzelnen eingreife« . Der Reichminister<br />
des Innern in Berlin bestimmt im Oktober 1941 demgegenüber im<br />
Rahmen eines Entwurf zur archivalischen Behandlung sipperikundlichcn Materials,<br />
daß es sich bei den »Quellen zum jüdischen Personenstandswesen« um<br />
ausdrücklich politisches Material handele. 41 Gedächtnispolitik aber ist nicht<br />
allein eine Funktion ihrer Ideologien, sondern auch ihrer Techniken. Ein<br />
Bericht zur Lage im Reichsarchiv Troppau erklärt die Geschwindigkeit des<br />
Zugriffs auf archivisches Gedächtnis zum vorrangigen Kriterium und empfiehlt<br />
die Anlage einer Bibliothekskartei, die nach den preußischen Instruktionen<br />
»autoralphabetisch und materienalphabetisch gehalten wird und unbedingt notwendig<br />
ist, soll nicht die Bücherei des Archivs sowohl <strong>für</strong> den Dienst als auch<br />
<strong>für</strong> die Benutzung eine tote Sammlung bleiben.« Da endlich im November das<br />
erste Stockwerk des Mitteltrakts des Archivgebäudes mit der Regaleinrichtung<br />
fertiggestellt sein soll, wird es möglich sein, die Gerichts- und anderen Behördenregistraturen,<br />
die <strong>für</strong> Ariernachweise und Behördenanfragen fortwährend<br />
gebraucht werden, aus ihrer derzeitigen z. T. unbenutzbaren Aufstellung »zu<br />
ordnen und neu und benutzbar aufzustellen« . Quod<br />
est in actis, gilt erst, wenn es im Speicher aktualisierbar, also adrcssicrbar ist.<br />
Bundesarchiv: R 43 II / 860 a, Bl. 25f
Du; GHBURT ni-;s RI-.ICI ISARCHIVS AUS DI-M GKNKRAI.STAB 691<br />
Die politische Ferne der Archive zum aktuellen parlamentarischen System,<br />
die in der Weimarer Republik verhängnisvoll war, wird im Nationalsozialismus<br />
zwar nicht zu einem Akt der Opposition, doch des Entzugs. Als Direktor der<br />
Archivabteilung des Reichsarchivs beruft sich Ernst Müsebeck, bei seiner<br />
Gedächtnisrede auf Hindenburg im Reichsarchiv am 2. August 1934 im Sinne<br />
Leopold <strong>von</strong> Rankes auf das Zurücktreten des Autors vor dem Archiv der<br />
<strong>Geschichte</strong>, also »<strong>von</strong> sich selber zu schweigen, still zu lauschen dem, was sie uns<br />
zu sagen hat, und sie zu uns reden zu lassen« 42 ; entsprechend kurz ist die Zeit<br />
des weiteren Verbleibens Müsebecks im Archiv. Unter dem Ausstellungstitel<br />
Reichsgedanken und Reich im Rahmen einer National-Sammlung Deutscher<br />
Anschauungsfundamente leistet das Reichsarchiv Öffentlichkeitsarbeit in einer<br />
den Kriterien wissenschaftlicher Datenpräsentation genügenden Form, die in<br />
einem Artikel <strong>von</strong> Karl-Martin Friedrich (»Ein Gang durch das Reichsarchiv in<br />
Potsdam«) in Der Angriff (Januar 1933) eben da<strong>für</strong> kritisiert wird: »Propaganda,<br />
die das Volk aufrüttelt, ist wertvoller als Objektivität, die gleichgültig läßt, das<br />
müssen wir beachten und sagen bei aller Anerkennung des Verdienstes dieser<br />
Ausstellung« . Politisierung des Speichers:<br />
Waren Archive bis dahin noch Arsenale juridischer Ansprüche (wenngleich<br />
durch das Dazwischentreten des historischen Blicks der Romantik auf das Mittelalter<br />
und seine Rechtsverhältnisse verklärt), sollen seit Ende des Ersten Weltkriegs<br />
Archive die Gedächtnisapparate politisch-revisionistischer Ansprüche<br />
(gegenüber Polen) und Rechtfertigungen (Friedensvertrag <strong>von</strong> Versailles) werden.<br />
Dieser dem Reichsarchiv, später dann auch dem Geheimen Staatsarchiv eingeschriebene<br />
Vektor (als Auswertungsauftrag) geht bis an die Grenzen der<br />
archivischen Funktion, die sich diskret und (gegenüber Geschichtsschreibung<br />
asketisch) auf Bewertung und Erschließung der Akten beschränkt.<br />
Das Bild- und Filmarchiv<br />
Wo das Reichsarchiv in der Aktenverwaltung die preußischen Archivtraditionen<br />
fortschreibt, setzen Medien die Differenz. Von Seeckt zieht die Konsequenz<br />
aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, als er in seinen Denkschriften vom<br />
12. Juli und 3. September 1919 <strong>für</strong> ein Reichsarchiv die Erweiterung des Aktenguts<br />
um die Bilddimension einfordert. Krieg verhilft der Photographie (Luftbildaufklärung,<br />
Vermessungswesen) und dem Film zum Einbruch in das<br />
Schriftreich des Archivs; der Aufbau einer speziellen Bild- und Fümsammlung<br />
erfolgte nach der Errichtung des Reichsarchivs in Potsdam am 5. September<br />
1919 auf der Grundlage des Filmbestandes <strong>von</strong> ca. 500 knegsgeschichthchen<br />
42 In: Wissen und Wehr 15 (1934), 505, zitiert hier nach: Herrmann 1993: 4081
692 ARCHIV<br />
und militärischen Lehrfilmen aus dem ehemaligen Bild- und Filmamt. 43 Die<br />
vertraute Ordnung der Akten wird zunächst auf die der Bilder abgebildet, also<br />
logozentristisch verschlagwortet. Für die Erschließung des Bild- und Plattenmaterials<br />
heißt dies, daß die Ordnung größtenteils »nach dem Provenzicnzprinzip<br />
der zugrundeliegenden Akten erfolgt«; <strong>für</strong> Recherche und Benutzung<br />
entsteht eine Kartothek <strong>von</strong> Papierabzügen« . Für den<br />
Bereich der Luftbildphotographie aber hat die militärische Praxis längst ein<br />
Archiv avant la lettre generiert, das den Speicher nicht im Sinne <strong>von</strong> Provenienzbewahrung,<br />
sondern der Operation <strong>von</strong> Feedback begreift. Die Auswertung<br />
der seit 1915 eingeflogenen Luftaufnahmen durch verschiedene Stäbe sowie<br />
Vermessungseinheiten und der immer wieder notwendige Vergleich neuer mit<br />
alten Aufnahmen desselben Objekts führten seit 1915 zur Numerierung und<br />
Beschriftung der Negative und weiter zu deren Archivierung. Die Glasnegative<br />
wurden auf einem unbelichteten Längsrand in Spiegelschrift auf der Schichtseite<br />
mit folgenden Daten versehen: Einheit, laufende Nummer des Negativs,<br />
Datum, Uhrzeit, Objekt oder Planquadrat, Flughöhe und Brennweite; in einer<br />
freien Ecke wurde die Nordrichtung als Pfeil eingeschrieben. Die (mit Ernst<br />
Jünger kalte) Logik des Mediums gibt emanzipiert den Maßstab des Blicks: »In<br />
die neuen, während des Krieges eingeführten Kameras waren Neigungs- und<br />
Kantungswinkel eingebaut, deren Winkelstand mitphotographiert wurde, um<br />
den Vermessungsformationen die zur Entzerrung der Aufnahme notwendigen<br />
Angaben liefern zu können.« 44 Das Reale der Apparate, im Unterschied zum<br />
symbolischen Schriftregime, schreibt so selbst den Inventarisierungsmodus<br />
vor - ein medienarchäologischer Bruch gegenüber dem Gedächtnis der Archive<br />
des 19. Jahrhunderts.<br />
Nicht gleichursprünghch, sondern mit einer Differenz, die das Verhältnis <strong>von</strong><br />
militärischer Infrastruktur und kulturwissenschaftlicher Ästhetik charakterisiert,<br />
überschneidet sich die Pragmatik der Neueinrichtung eines Reichsfilmarchivs<br />
mit einer gesellschaftspolitischen Funktion, indem der Sammlungsbereich<br />
auf alle »<strong>für</strong> die politische, kulturelle und soziale <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Reiches<br />
und Volkes wertvollen Filme« erweitert wird: »Sie repräsentieren in sich<br />
in besonderer Weise den modernen deutschen Staatstypus.« 45 Real aber scheiterte<br />
das Reichsarchiv an der Durchsetzung dieser Forderung, wie überhaupt<br />
43<br />
Findbücher zu Beständen des Bundesarchivs Bd. 8: Wochenschauen und Dokumentarfilme<br />
1895-1950 im Bundesarchiv-Filmarchiv (16mm-Verleihkopien), neubearb. v.<br />
Peter Bucher, Bundesarchiv Koblenz 1984, vi<br />
44<br />
Gerhard I leyl, Militärische Luftaufnahmen als Archivgut, in: Archivalischc Zeitschrift<br />
Bd. 73 (1978), 172-176 (173f)<br />
45<br />
Helmut Rogge: Das Reichsarchiv: In: Archivalische Zeitschrift 35 (1925), 119-133<br />
(129f), zitiert nach Bucher 1984, vi
Dli; Gl-BURT DKS Ri.ICHSARCHIVS AUS DKM Gl-NKRALSTAB 693<br />
die medienarchäologisch bahnbrechenden Erkenntnisse über die Archivwürdgkeit<br />
des Films nicht verhindern können, »daß die visuellen Dokumente,<br />
verglichen mit schriftlicher Überlieferung, nur geringes Ansehen in Fachkreisen<br />
genossen« . Die Gedächtnisenergie des Reichsarchivs<br />
speist sich aus dem Negativ der Drohung <strong>von</strong> Verlust, wie sie der Publizist<br />
Erwin Ackerknecht 1925 formuliert: »damit nicht mehr unersetzliches urkundliches<br />
Material spurlos verschwindet.« 46 Der Fümpolitiker Ackerknecht (R.<br />
Volz), Stadtbüchereidirektor in Stettin, verfaßt in Heft 3 <strong>von</strong> Bücherei und Bildungspflege<br />
(Stettin) einen Aufsatz über Ein internationales Filmarchiv in<br />
Deutschland. Die Furie des Verschwindens koinzidiert mit der Gedächtmslosigkeit<br />
des Mediums Film selbst, dessen Anfangsprodukte (auch <strong>für</strong> den Fall<br />
zahlreicher Kopien) fast unfindbar sind, nachdem er »in den ersten fünfzehn<br />
Jahren seines Bestehens rein unter dem Gesichtswinkel des >Aktualitätsreizes<<br />
gewertet wurde und nur solange etwas galt, als er zog.« 47 Zur Begründung eines<br />
Filmarchivs definiert Ackerknecht das neue Medium als kulturarchäologisch:<br />
Nur laufbildhche Urkunden vermögen Naturformen des Lebens solcher Völkern<br />
festzuhalten, welche »durch die Zivihsationsarbeit der weißen Rasse <br />
unaufhaltsam ihrem Ende zugetrieben« werden . Damit speist sich der kultur- als speicherwissenschafthche <strong>Im</strong>puls<br />
des neuen Mediums aus dergleichen Erfahrung, die Erich Moritz <strong>von</strong> Hornbostel<br />
zur Anlage seines ethnographischen Phonogrammarchivs bewegte. 48 Denn<br />
im Unterschied zum Medium Schrift registriert der Film als redundantes Informationsmedium<br />
grundsätzlich mehr an Kontextwissen, als die Kamera respektive<br />
der Regisseur beabsichtigt. Dies führt zum ethnographischen Blick auf die<br />
eigene Kultur, und zur medialen Retrohalluzination <strong>von</strong> Historie:<br />
»Was <strong>für</strong> ein reiches, anschauliches Material wird hier künftigen Geschlechtern<br />
aufbewahrt, die aus charakterologischen und geschichtlichen oder aus künstlerischen<br />
Gründen sowohl einzelne Ereignisse und Persönlichkeiten als überhaupt das<br />
typische Gehaben der verschiedenen Volksschichten in unserer Zeit und in den<br />
verschiedenen Ländern studieren wollen ! Denken wir uns laufbildliche<br />
>Wirkhchkeitsaufnahmen< aus dem Rokoko, aus der napoleonischen Zeit, aus dem<br />
Biedermeier, aus den 70er Jahren - wieviel wäre daran zu lernen.« <br />
46<br />
Ein internationales Filmarchiv in Deutschland, in: Lichtspielfragen, Berlin 1928, 117-<br />
127 (125), zitiert nach: Bucher 1984, vii<br />
47<br />
R. Volz, Ein deutsches Reichsfilmarchiv, in: Der Bildwart. Blätter <strong>für</strong> Volksbildung,<br />
Heft 11 (November 1925), 794-796 (794)<br />
4X<br />
Siehe W. E., Hornbostels Klangarchiv: Gedächtnis als Funktion <strong>von</strong> Dokumentationstechnik,<br />
in: Sebastian Klotz (Hg.), »Vom tönenden Wirbel menschlichen Tuns«:<br />
Erich M. <strong>von</strong> Hornbostel als Gestaltpsychologe, Archivar und Musikwissenschaftler,<br />
Berlin / Milow (Schibri) 1998, 116-131
694 ARCHIV<br />
Noch aber heißt das epistemologische Apriori des Archivs Buchstabe, nicht<br />
Bild; Ackerknecht zieht einen Vergleich zur Deutschen Bücherei in Leipzig (nur<br />
daß beim Film alle Länder der Welt, die Filme herstellen, planmäßig berücksichtigt<br />
werden müßten). »Das Archiv hätte das Seminar, die Reichsbibliothek<br />
des Films zu sein« . Es ist jedoch erst die Medienwachsamkeit<br />
der Nationalsozialisten, die im Zuge ihrer Umstrukturierung des<br />
deutschen Filmwesens die Grundlagen <strong>für</strong> ein zentrales deutsches Filmarchiv<br />
setzt; im März 1934 gründet die Rcichspropagandaleitung der NSDAP ein<br />
sogenanntes Vilrn-1deen-Archiv mit dem Ziel, nicht nur eine »Sammelstelle<br />
neuer Filmstoffe« zu schaffen, sondern vor allem die »Ideenkraft des Volkes<br />
<strong>für</strong> das weite Gebiet des Films nutzbar zu machen« - mithin das Archiv <strong>von</strong><br />
einer weitgehend passiven in eine aktive Agentur des Symbolischen transformierend.<br />
49 Die Durchführung der Erfassung <strong>von</strong> im Reiche auf diversen Ebenen<br />
zerstreuten Filmmaterialien gelingt nicht in allen Fällen (auch nicht im<br />
Rahmen geplanter Reich skulturarchive); der Kriegsausbruch tut den Ansätzen<br />
Abbruch. Diese Gegenwart verzeichnet vielmehr die Rückkehr <strong>von</strong> Annalistik<br />
und Chronik, die urälteste Begründung des Archivs, im neuen Medium:<br />
Goebbels legt den Akzent auf die Speicherung <strong>von</strong> Wochenschauen, und korrespondierend<br />
damit instauriert das Reichsministerium <strong>für</strong> Volksaufklärung<br />
und Propaganda ein Reichspressearchiv. 50 Die archivische Quellenlage besteht<br />
<strong>für</strong> die deutsch-germanische Vorgeschichte aus reiner Archäologie (Bodenaltertümer),<br />
<strong>für</strong> das Mittelalter aus monumentaler Urkundenüberlieferung, die<br />
dann durch das Aktenwesen der Frühneuzeit hin zum Dokumentbegriff<br />
beschleunigt und prozessuahsiert wird; das einer jungem Zeit angehörende<br />
Archivmaterial - Akten nämlich - »ist daher gleichsam das Medium, wodurch<br />
wir mit den Urkunden befreundet werden.« 51 So ist das Archiv zugleich selbst<br />
Medium und als Kanal Teil eines Mediums im kybernetischen Sinne. Schließlich<br />
überführen die publizistischen und technischen Medien der Moderne<br />
alle Unterlagen in einen Arbeitsspeicher <strong>von</strong> Jetztzeit .<br />
Unter dem Titel Dokumentation suchen die Reichsparteitags- und Olympiafilme<br />
Lern Riefenstahl unterdessen, mit kinematographischen Mitteln<br />
Denkmäler zu schaffen und somit die mediale Qualität der Flüchtigkeit unter<br />
dem Diskurs der Verewgigung zu subsumieren, dessen Gedächtnisagentur das<br />
49<br />
Nationalsozialistische Parteikorrespondenz Nr. 119 vom 23.5.1935, zitiert nach:<br />
Bucher 1984, ix<br />
50<br />
Dazu Wolfgang Kohre, Gegenwartsgeschichtliche Quellen und moderne Überlieferungsformen<br />
in öffentlichen Archiven, in: Der Archivar 8 (1955), Sp. 197-210 (Sp. 203)<br />
51<br />
Friedrich Ludwig Baron <strong>von</strong> Medem, Über die Stellung und Bedeutung der Archive<br />
im Staate, in: Jahrbücher der <strong>Geschichte</strong> und Staatskunst, hg. v. Karl Heinrich Ludiwg<br />
Pölitz, Bd. II, Leipzig 1830, 28-49 (35)
Du-: GKBURT DF.S RI-.ICI ISARCI IIVS AUS DI:M GHNKRAI.STAB 695<br />
Reichsfilmarchiv ist. 52 Auch nach Gründung des Reichsfilmarchivs erwirbt das<br />
Reichsarchiv demgegenüber vor allem noch militärische Filmbestände. Primär<br />
gilt es nicht, die ihm anvertrauten Bildstreifen der Gegenwart nutzbar zu<br />
machen, sondern diese »in möglichster Vollkommenheit <strong>für</strong> kommende Geschlechter<br />
zu bewahren«, damit so »eine Grundlage <strong>für</strong> die Kenntnis der Vergangenheit<br />
werde, wie sie uns anders im gleichen Maße nicht zur Verfügung<br />
steht.« 53 Als das Bundesarchiv durch Beschluß der Bundesregierung vom 24.<br />
März 1950 errichtet wird, erhält es anfangs nur die Aufgabe, das zivile und<br />
militärische Schriftgut bei den zentralen deutschen Regierungen und Verwaltungen<br />
zu erfassen und zu verwahren; »die nichtstaatliche Überlieferung wurde<br />
hingegen ebenso wenig berücksichtigt wie die nichtschriftliche, was mithin auch<br />
<strong>für</strong> den Film galt« . In Momenten des Anfangs wird das<br />
Archiv auf das staatsadmmistrativ Funktionale seines Wesens zurückgeworfen<br />
- ein wissensarchäologischer re/turn. Eine andere Wahrnehmung haben (Kultur-)Histonker,<br />
die in Weltkrieg II als Kriegstagebuchschreiber trainiert worden<br />
sind; 1950 wollen der Mediävist Percy Ernst Schramm und Walther<br />
Hubatsch auch das Gedächtnismedium Film in den Zuständigkeitsbereich des<br />
Bundesarchivs aufgenommen wissen »angesichts des Erfolges, den der nationalsozialistische<br />
Staat bei der Beeinflussung großer Massen unzweifelhaft errungen<br />
hatte« , konkret: Wochenschauen und<br />
Dokumentarfilme, nicht aber Spielfilme (den Großteil der NS-Filmproduktion).<br />
Mißtrauen gegenüber Fiktion macht blind <strong>für</strong> deren Realitätseffekt.<br />
Tatsächlich führt der audiovisuelle Propagandabedarf im Nationalsozialismus<br />
zu einer unvorhergesehenen Rückkopplung des Archivs an die Gegenwart. Ende<br />
der 30er Jahre verfügt die Ufa auf dem Babelsberger Filmgelände über ein sogenanntes<br />
Filmauswertungsarchiv auf dem Prinzip der Indexikahsierung <strong>von</strong><br />
Bildern und Tönen; sein Zweck galt der nutzbringenden Verwendung <strong>von</strong> Film-<br />
Restbeständen bereits hergestellter Spiel-, Werbe- und Kulturfilme sowie<br />
Wochenschauen <strong>für</strong> spätere Filmvorhaben (inklusive des gesamten Geräuschmaterials<br />
sowie der musikalischen Teile der Filme). Das so entstandene Bildregister<br />
umfaßt 1943 etwa 500.000 verschiedene Sujets, eine Filmbildmustcrsammlung -<br />
mithin eine bildbasierte Form der Bildsortierung - auf lexikaler Basis, die es dem<br />
Reflektanten ermöglicht, den Bildinhalt (etwa längere Fahraufnahmen) schon<br />
aus dem Text der Karteikarte zu erkennen:<br />
52 Heide Schlüpmann, Lumpensammler unter Denkmalpflegern. Anmerkungen zu Film<br />
und/als ephemeres Denkmal, in: Michael Diers (Hg.), Mo(nu)mente. Formen und<br />
Funktionen ephemerer Denkmäler, Berlin (Akademie) 1993, 203-207 (203)<br />
53 F. A. Raasche, Lichtbild und Film im Rahmen des Reichsarchivs, in: Der Bildwart.<br />
Blätter zur Volksbildung (1925) 4, 353 u. 355, zitiert nach: Herrmann 1993: 136
696 ARCHIV<br />
»Die starke Inanspruchnahme des Archivmaterials, zu einem gewissen Grade<br />
bedingt durch den Bedarf an Aufnahmen <strong>für</strong> Dokumentär- und propagandistische<br />
Filme <strong>für</strong> In- und Auslandseinsatz, zwang die Archivleitung zu einem immer tieferen<br />
Eindringen in die Materie und führte zu dem Aufbau einer besonderen >Auswertungs-Zentralc%<br />
der es in erster Linie obliegt, die vorhandenen wertvollen<br />
Filmbestände nochmals eingehend zu durchforschen, um noch nicht erfaßte Sujets<br />
einer späteren Verwertung zuführen zu können« 54<br />
- eine Form audiovisuellen Recyclings, das aus dem Archiv den Zwischenspeicher<br />
eines gegebenen, gegenwärtigen Zustands macht und aller kulturhistorischen<br />
Konnotation enthebt. 33<br />
Organisiertes Gedächtnis 1934: Datensynchronisation<br />
Ernst Wolgast, emeritierter Professor <strong>für</strong> Völker-, Staats- und Verwaltungsrecht,<br />
wendet sich am 27. Oktober 1934 aus Würzburg mit seinen Gedanken üher eine<br />
neue Einrichtung im Dritten Reich, sei es am Staat, sei es in der Partei an<br />
Rektor der Julius Maximilians-Universität - Gedanken, die ihn beschäftigen,<br />
seitdem er 1921 den 1915 angetretenen auswärtigen Dienst verlassen hat; sie<br />
»betreffen das Fehlen einer Organisation, deren Vorhandensein die Ausstattung<br />
des Reichs mit einem organisierten Gedächtnis< bedeuten würde, wenn ich mich<br />
so ausdrücken darf.« Es handelt sich hier um die mnemotechnische Analogiebildung<br />
zum organizistischen Staatsbegriff des 19. Jahrhunderts, als der Münchner<br />
Kultur- und Statistikprofessor Rühl den Staat und die (ausdrücklich) bürgerliche<br />
Gesellschaft als »das organisirte Volk« und zu dessen Beobachtung eine<br />
empirische Sozialwissenschaft definiert, die sich »durch gründliche statistische<br />
und historische Erforschung des Gesellschaftsorganismus«, also eher durch einen<br />
»historisch analytischen Theil, als in ihrem philosophisch contruetiven« auszeichnet.<br />
56 Solche Forschungsorganisation im <strong>Namen</strong> eines Organismus gründet<br />
das (und mündet im) Archiv. Die Schwere des Fehlens eines organisierten<br />
Reichsgedächtnisses akzentuiert Wolgast nun durch den (diesen body politic<br />
anthropomorphisierenden) Hinweis darauf, daß der Mensch ohne die Fähigkeit<br />
54 F. J. <strong>von</strong> Steinaecker, Das Filmauswertungsarchiv der Ufa, in: Der deutsche Film Nr.<br />
7 (1942/43), 14f (15). Dazu Rolf Aurich, Von Bildern und Träumen. Überall Filmgeschichte:<br />
Kinostadt Paris, in: ders. / Ulrich Kriest (Hg.), Der Ärger mit den Bildern.<br />
Die Filme <strong>von</strong> Harun Farocki, Konstanz (UVK Medien) 1998, 245-252 (246f)<br />
55 » wenn der Abfall selber rechnen kann«: Friedrich Kittler, Wenn das Bit Fleisch<br />
wird, in: Martin Klepper u. a. (Hg.), Hyperkultur: zur Fiktion des Computerzeitalters,<br />
Berlin / New York (de Gruyter) 1996, 150-162 (Schlußsatz)<br />
56 Wilhelm Heinrich Riehl, Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Vortrag in<br />
der öffentlichen Sitzung der kgl. Akademie der Wissenschaften, München 1864, 4 u. 14
Du: GI-BUKT DI:S RKICHSARCHIVS AUS UI:M GI-NKRALSTAB 697<br />
des Gedächtnisses nicht in der Lage ist, in Begriffen zu denken und also (politische)<br />
Urteile zu bilden:<br />
»Weil das Reich kein organisiertes Gedächtnis besitzt, so sind seine Urteile über<br />
die Fragen der inneren sowohl wie der auswärtigen Politik <strong>von</strong> dem persönlichen<br />
Erinnerungsvermögen der jeweiligen, wechselnden Amtsträger in Partei und Staat<br />
zu sehr abhängig . Die Sprunghaftigkeit etwa unserer auswärtigen Vorkriegspolitik<br />
dürfte hier einen ihrer Gründe haben« 57<br />
- ein Kredo <strong>von</strong> politischer Kultur als Funktion ihrer Speicher. Angesichts der<br />
anstehenden, vom Nationalsozialismus initiierten Weltwende (so Wolgast unter<br />
Bezug auf Hermann Stegemann) gilt es auch das Gedächtnis neu zu mobilisieren:<br />
»Wo das Deutsche Reich einen neuen Staats- und Sozialgedanken <strong>von</strong> unerhörter<br />
Sprengkraft in die Welt wirft, dürfte es in erhöhtem Maß gesammelter<br />
Urteilsbildung und folglich auch der Voraussetzung dazu bedürfen: eines organisierten<br />
Gedächtnisses« . Wolgast gibt - hier ganz medienarchäologisch<br />
- einen technischen Einschnitt als Ruptur der politischen Kommunikation an,<br />
den Einbruch des Telegraphen als Katastrophe narrativer Berichte als dem<br />
Medium der Diplomatie:<br />
»<strong>Im</strong> Auswärtigen Amt ist einmal ein gewisses organisiertes Gedächtnis vorhanden<br />
gewesen - damals, als es den Telegraphen noch nicht gab und als es einem ausreisenden<br />
Gesandten noch eine Darstellung der Beziehungen des Reichs bzw.<br />
Preußens zu dem betreffenden Empfangsstaat mitgegeben wurde. Die Abfassung<br />
der Darstellung zwang zur Sammlung der fraglichen Tatsachen und also zu einer<br />
gewissen Organisation des Gedächtnisses . Der Telegraph schien die Darstellung<br />
überflüssig zu machen.« <br />
Diplomatie fungiert damit als Effekt ihrer Übertragungsmedien. Wolgast jedenfalls<br />
kommt auf seine gedächtniswissenschafthehen Gedanken, als er 1915-17<br />
der vom Auswärtigen Amt resortierten und dem Reichskanzler unmittelbar<br />
unterstellten Zentralstelle <strong>für</strong> Auslandsdienst angehört, deren Aufgabe darin<br />
besteht, der Propaganda der Ringmächte entgegenzutreten. Aus der Stelle ist<br />
später die Reichspresseabteilung (dann Propagandaministerium) hervorgegangen.<br />
Die Stelle hat eine Abteilung zur Beobachtung der Weltpresse, genannt<br />
Pressekontrolle, ferner eine Bild- und Filambteilung, schließlich »in der Mitte<br />
zwischen diesen Abteilungen eine Hauptabteilung <strong>für</strong> die Organisation des<br />
Ganzen und <strong>für</strong> die Politik.« Von dieser Stelle aus erkennt Wolgast damals, »daß<br />
wie alle einzelnen Behörden, so auch das Reich dessen ermangelte, was ich oben<br />
organisiertes Gedächtnis< nannte« . Gedächtnis ist hier als<br />
Funktion <strong>von</strong> Nachrichten/cec//?^^ gemeint, als Datenbank in actn, als Syn-<br />
57 Bundesarchiv Koblenz, BA R 43 (Reichskanzlei / Reichsarchiv) I / 887, Bl. 138<br />
(Abschrift)
698 ARCHIV<br />
chronisationsleistung vielmehr denn als memory im geschichtsemphatischen<br />
Sinn. Praktischer Anlaß zu seiner Wahrnehmung war folgender:<br />
»Einer der Herren der >Zentralstelle< (Römer) hatte in seinen freien Stunden aus<br />
persönlichem Interesse längere Zeit alle Nachrichten über die Haltungen des Heiligen<br />
Stuhls gesammelt und geordnet. Dabei fand er, daß der Heilige Stuhl eine<br />
Linie verfolge, über die wir uns mit Recht beschweren durften. Darüber machte<br />
er eine Aufzeichnung. Diese wurde dem Auswärtigen Amt zugeleitet. Man kam<br />
zu dem Ergebnis, daß der Herr richtig beobachtet habe , und entschloß sich<br />
zu einer Demarche - mit Erfolg. Höchste Ver- und Bewunderung herrschte damals<br />
da<strong>für</strong>, daß solche Ergebnisse >ciner bloß registrierenden Tätigkeit< möglich seien.<br />
Jetzt hatte die >Zentralstelle< schlagend ihre Existenzberechtigung bewiesen.«<br />
<br />
Daß solche Clearing-Stellen selbst umso anfälliger <strong>für</strong> technische Übcrtragungsfehler<br />
sind (noise in communication), da Übertragung eben immer auch<br />
Kanäle mit ihrer eigenen Widerständigkeit involviert, hat ein Mitarbeiter des<br />
Deutschen I Iistonschen Instituts auch <strong>von</strong> Rom aus notiert. Der Korrespondent<br />
Alphons Victor Müller, lange Jahre Vertreter der antiklerikalen Berliner<br />
Täglichen Rundschau, evozierte unwillentlich einen Konflikt zwischen dem<br />
Papst und Preußen. Der Papst hatte in seiner Boromäus-Encyclica die Reformatoren<br />
als »Männer irdischen Sinnes« bezeichnet; im Telegramm nach Berlin,<br />
das Müller in lateinischen Lettern aufsetzte, »geriet der I-Punkt über das r,<br />
sodass der italienische Telegraphist statt >irdischvidisch< telegraphierte; in der<br />
Redaktion machte man daraus >viehischnur< wissenschaftlichen Arbeit der<br />
58 Archiv DHI Rom, Nachlaß Philipp Hiltebrandt, Nr. 2, Bl. 74
Dll- Gl-BURT I)1-:S RKICHSARCHIVS AUS UliM GliNfcRALSTAH 699<br />
Abfassung unterziehen wollte.« Alle Journalsnummern des jeweiligen Monats<br />
(etwa 1000) mußten durchgesehen, durchmustert »und zu einem Bild verwoben<br />
werden« - eine Arbeit <strong>von</strong> 3 bis 4 vollen Tagen. Doch als diese Berichte<br />
fortfallen, verliert auch die Arbeit der ganzen Zentralstelle ihre Kohärenz;<br />
schließlich verschwand sie selbst. »Rückschauend lässt sich feststellen, daß die<br />
Berichte ihr Rückgrat gebildet hatten, indem durch sie jedes einzelne Mitglied<br />
sich des Gesamtzusammenhanges bewusst wurde« . Die<br />
zwei Körper des Königs setzen sich in deutschen Behörden fort: »Jedes Amt<br />
ist mir, wie dem Staat, gleichsam als ein Mensch im Großen erschienen«; damit<br />
wird seine Einsicht in Nachrichtenkybernetik wieder reanthropoligisert.<br />
Schließlich gipfelt Wolgasts Eingabe als Konzeption des Führerprinzip in der<br />
Gedächtnisorganisation:<br />
»Der Staat ist als abstraktes Gebilde eines natürlichen Willens und eines natürlichen<br />
Gedächtnisses nicht fähig. Künstlich, durch Einrichtungen, muß er<br />
gcdächntis- , willens- und handlungsfähig gemacht werden. In der obersten Linie<br />
durch den sogenannten >Wcg der Gesetzgebung< hat die <strong>Geschichte</strong> den Staat<br />
künstlich willensfähig gemacht . Eine planmässige Ausstattung mit Gedächtnis<br />
hat nie stattgefunden. Etwa histonographische Kommissionen alten Stils können<br />
das Erforderliche nicht leisten. Andere Ansätze mag es geben, so natürlich in<br />
der Aktenführung jeder Behörde. Es fehlt jedoch das Moment der planmäßigen<br />
Bewusstmachung der eigenen Tätigkeit jeder Behörde und des Reichs. Diese planmäßige<br />
Bewusstmachung sollte m. E. jetzt umso mehr erfolgen, als das Reich des<br />
Nationalsozialismus nie betretene Wege b.eschreitet. .Es würde mir etwas vorschweben,<br />
daß in jeder Partei- und Amtsstelle <strong>von</strong> einiger Bedeutung ein Mitglied<br />
mit der Abfassung eines Monatsberichts über die Tätigkeit der Stelle beauftragt<br />
würde. Der Bericht dieser Stelle ginge an die nächste höhere Stelle. Hier würden<br />
die Sammelbcnchtc aus allen eingegangenen Einzelberichten angefertigt. Die Sammelberichtc<br />
würden wiederum nach oben geleitet, in beständiger Konzentration,<br />
bis schließlich alles in einem einzigen Reichsbericht gipfelte, der dem Führer und<br />
Reichskanzler vorzulegen wäre. Diese Berichtstätigkeit würde rein registrierend<br />
einhergehen, ohne das Handeln im Leben zu stören.« <br />
Reines Registrieren ist das Gedächtnis, der Arbeitsspeicher der Gegenwart als<br />
radikal präsentistische Operation. Ideologie wird daraus erst in der Bearbeitung<br />
des annahstischen Materials durch Narration; »auf der Linie des Reichs freilich<br />
müsste wahrscheinlich zur Bildung eines eigenen >Amts <strong>für</strong> die Geschichtsschreibung<br />
des Nationalsozialismus geschritten werden« ,<br />
etwa als Jahrbuch der Politik des Dritten Reichs. Der Chefs der Berliner Reichskanzlei<br />
vom 19. November 1934 bezweifelt die Notwendigkeit eines solchen<br />
Projekts, jenes Doubles des Reichsarchivs: »Ob wirklich ein Bedürfnis <strong>für</strong> die<br />
Errichtung eines organisierten Gcdächtnisses< besteht«? Die Virtualität <strong>von</strong> Wolgasts Vision ist selbst als Teilmenge in<br />
ein organisiertes Gedächtnisses eingegangen, das Bundesarchiv.
700 ARCHIV<br />
1945: Auflösung des Reichs als Archiv<br />
Alliierte Luftangriffe veranlassen Zipfel, zugleich Kommissar <strong>für</strong> den Archivschutz,<br />
im Frühjahr 1942 umfangreiche Auslagerungen <strong>für</strong> die ihm unterstellten<br />
Archive anzuordnen, wo<strong>von</strong> das Reichsarchiv zunächst nicht betroffen ist.<br />
Erstens gilt es geostrategisch als gesichert; zweitens steht das Reichsarchiv in<br />
einem spezifisch echtzeitlichen Rückkopplungsverhältnis zur Bürokratie in<br />
Berlin; seine noch wenig abgelagerten Bestände müssen <strong>für</strong> die abgebenden<br />
obersten Reichsbehörden in Berlin jederzeit schnell erreichbar bleiben, wie eine<br />
Umfrage im Juni/Juli 1942 bei den maßgeblichen Ministerien ergibt - ein Archiv wieder in Reich(s)wcitc der Gegenwart. Heeresarchivdirektor<br />
Ruppert kann in Potsdam in der Zeit <strong>von</strong> 1942-45 keine archivischen<br />
Ordnungsarbeiten mehr durchführen, »sondern nur noch Aktenzugänge <br />
registrieren«; so schreibt der Krieg den Archiven eine Rückkehr zur Echtzeit<br />
vor, zur Registratur als Zwischenspeicher nicht des Gedächtnisses, sondern<br />
administrativer Gegenwart. Ruppert kommt lediglich dazu, sich Allgemeine<br />
Übersichten über die Aktenbestände vorlegen zu lassen - reine Aufklärung. Die<br />
Zusammeballung seiner Archivmassen macht ihre generelle Sicherheitsverlagerung<br />
unmöglich; immobiles Gedächtnis (ein Monument) aber ist ein umso verletzlicheres<br />
Ziel <strong>für</strong> Luftangriffe. Was Friedrich <strong>von</strong> Rabenau, erster Chef des<br />
neugegründeten Heeresarchivs in Potsdam, »als Organisation mit umfangreichen<br />
Beständen hinterlassen hatte, löste sich knapp drei Jahre später in Nichts<br />
auf.« 59 Materiell blieben zwar zahlreiche Bestände erhalten, doch das, was die<br />
Differenz eines militärarchäologischen Schriftartefakts zur Archivalie ausmacht,<br />
nämlich seine gedächtnissystematische Einbindung, ist durch Krieg selbst paralysiert.<br />
Um an dieser Stelle vom Reichsarchiv auf die Archivalien des Alten<br />
Reiches zurückzukommen: Kriegsbedingte Deformation (Bomben- und Brandeinwirkung,<br />
Verschmorung der Pergamente und Verkohlung der Papiere) spaltet<br />
die Lesbarkeit des vormaligen archivischen Dokuments in die Bestandteile<br />
Physik (die reine Materie der Urkunde) und Information (Aufzeichnung); in<br />
Anbetracht der Kriegsverluste im Stadtarchiv Goslar etwa heißt es: »Ein kleiner<br />
Trost kann und muß es sein, daß die älteren vor 1400 liegenden Urkunden<br />
gedruckt im Goslarer Urkundenbuch vorliegen, während die jüngeren wenigstens<br />
ihrem Inhalt nach durch die Regesten der Findbiichcr erhalten geblieben<br />
59 Friedrich-Christian Stahl, Die Organisation des Heercsarchivwesens in Deutschland<br />
1936-1945, in: I lein/ Bobcrach / I lans Booms (1 Ig.), Aus der Arbeit des Rundesarchivs.<br />
Beiträge zum Archivwescn, zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, Boppard<br />
(Boldt) 1978, 69-101 (101), unter Bezug auf die Daten im Bestand RH 18/v. 43 (Chef<br />
der Heeresarchive) im Bundesarchiv/Militärarchiv sowie Bernhard Polls Nachruf <strong>für</strong><br />
Karl Ruppert in: Der Archivar 8 (1955), sp. 322
Du-: GKBURT oi;s RKICHSARCHIVS AUS DKM GI-NKRAI.STAB 701<br />
sind.« 60 An die Stelle des Originals (das fortan alle sekundären Ableitungen<br />
durch seine schlichte Präsenz nur noch autorisiert) tritt die mediale Reproduktion<br />
als primärer Gedächtnisträger. Bruchmann gibt eine eher naturwissenschaftlich<br />
präzise Beschreibung <strong>von</strong> hitzebedingten Siegelverformungen der im<br />
Krieg ausgelagerten Urkunden beschrieben; der archäologische Blick auf<br />
die Materie entsemantisiert die Diplome nicht minder wie die Brandeinwirkung<br />
selbst. Sein Zustandsbericht dementiert die Lesbarkeit einiger Dokumente und<br />
wirft sie (als Monumente) auf reine Bildlichkeit zurück; über die Urkunde<br />
mit der Signatur Stadt Goslar 36 etwa heißt es: »Siegel völlig geschmolzen,<br />
Seidenschnüre gänzlich verwachst; stärkste Verschmutzung, Verwachsung und<br />
Schrumpfung des Pergaments, stärkster Textverlust.« Dementsprechend<br />
schreibt sich auch der Schlußsatz des Beitrags formal-indcxikalisch (archäologisch),<br />
nicht historisch-semantisch: »Zweck und Absicht dieser Zeilen war<br />
nicht, wissenschaftliche Probleme aufzurollen. Es sollte vielmehr auf diese<br />
besonders eigenartige Form des Knegsschadens eines deutschen Archivs hingewiesen<br />
werden« .<br />
Zu Kriegsende werden die Bestände der Abteilung <strong>für</strong> die Aufnahme der<br />
Kriegstagebücher sowie die Kriegsgeschichtliche Abteilung des Heeres aus<br />
Luftschutzgründen an diverse Orte auch in Westdeutschland ausgelagert. Ein<br />
Teil der vom Beauftragten des Führers zur Vernichtung bestimmten Depots<br />
bleibt erhalten und gelangt schließlich ms Nationalarchiv Washington, darunter<br />
eine Reihe <strong>von</strong> Nachlässen. Diese erhalten als Zeichen ihrer Entfernung<br />
neben ihrem dokumentarischen Wert aus deutscher Sicht ein gedächtnismonumentales<br />
Surplus: »Möge das deutsche Archivgut, das nach der Vernichtung des<br />
Heeresarchivs Potsdam einen einzigartigen Nationalwert besitzt, bald zurückkehren!«<br />
61 Bedeutsame deutschen Akten über den Weltkrieg befinden sich also,<br />
soweit sie erhalten blieben, zunächst im Besitz der Alliierten; weitere Unterlagen<br />
dann, wie Veröffentlichungen anzeigten, noch in Privathand, wartend auf<br />
ein Militär- und Bundesarchiv nach Wiederherstellung der deutschen Souveränität.<br />
Erst <strong>von</strong> dem Moment an, wo die noch vorhandenen Quellen zur <strong>Geschichte</strong><br />
der jüngsten Vergangenheit wieder greifbar sind, ist es möglich, »die<br />
Glaubwürdigkeit der jetzt die deutschen Illustrierten füllenden, oft unverantwortlichen<br />
>Tatsachenberichte< nachzuprüfen und auch die Wünsche breiter<br />
Leserschichten nach sachlicher Aufklärung zu erfüllen« .<br />
Reichs- und Hccresarchiv arbeiten nach dem 8. Mai 1945 auf Weisung der<br />
60 Karl G. Bruchmann, Die Kr-icgsvcrluste und -schaden des Stadtarchivs Goslar, in:<br />
Festschrift Fdmund F.. Stengel /um 70. Geburtstag, Münster/ Köln (Böhlau) 1952,<br />
566-575 (570)'<br />
'"' Poll 1953: Sp. 74, unter Bezug auf den Thirteenth Annual Report of the Archivist of<br />
the United States 1946-1947, 67
702 ARCHIV<br />
sowjetischen Stadtkommandantur in Potsdam zunächst weiter, Aktentrümmer<br />
aus dem zerstörten Archivgebäude bergend. <strong>Im</strong> August 1945 werden Reichsund<br />
Heeresarchiv unter der Bezeichnung Archivverioaltung organisatorisch<br />
zusammengefaßt. Die trifft auf den Splitternachlaß des Reiches; trotz einer im<br />
August 1945 erlassenen Verfügung des Präsidenten der Provmzialverwaltung<br />
der Mark Brandenburg über die vollständige Erfassung und Bergung <strong>von</strong><br />
Archivgut sind in diesem Gebiet im Juni 1946 mindestens 475 Tonnen »unordentlich<br />
aufgehäuften deutschen Archivmaterials aufgefunden worden«. 62<br />
Archivmengen tendieren - katalysiert unter Kriegsbedingungen, die ihnen<br />
kurzfristig ein höchstes Organisationsmaß verleihen - zur Entropie. Das<br />
Militararchiv der DDR erhält im Dezember 1988 vom Generalstab der Sowjetarmee<br />
circa 40t militärisches Archivgut deutscher Provenienz zurück. 63 Schmid<br />
< 1956: 185> errechnet zur Feststellung der Verluste einen Wert, der Archivahen<br />
und ihre Fassungen nicht nach Semantik, sondern nach Format mißt:<br />
»Durchschnittliche Höhe der Auslagerungsbündel: 12 cm<br />
Durchschnittliches Gewicht: 7 kg<br />
Höhe des Aktenfachs im Reichsarchiv: 37 cm = 3 Bündel<br />
Höhe des Aktenfachs im Deutschen Zentralarchiv: 50 cm = 3-4 Bündel je nach<br />
Hohe der Stapel«<br />
So kalkulierbar ist deutsches Gedächtnis, in Archivquanten.<br />
( ' : Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Ld. Br., Rep. 205 A, Nr. 822, Bl. 14.<br />
Zitiert nach: Uwe Löbel, Neue Forschungsmöghchkcitcn zur preußisch-deutschen<br />
Hecresgeschichte. Zur Rückgabe <strong>von</strong> Akten des Potsdamer Heeresarchivs durch die<br />
Sowjetunion, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen 51 (1992) Heft 1, 143-149 (145)<br />
63 Dazu Helmut Otto, Der Bestand Kriegsgeschichtlichc Forschungsanstalt des Heeres<br />
im Bundesarchiv-, Militärisches Zwischenarchiv Potsdam, m: Mihtärgcschichtliche<br />
Mitteilung 51 (1992) Heft 2, 429-441
ARC'.I IIYTKANSI-T:R UNTIR K^KH-t;siii-.DiNtiUNc;i-:N 703<br />
Archivtransfer unter Kriegsbedingungen<br />
Nach dem Sieg der Revolutionsheere bei Fleurus am 26. Juni 1794, der die französische<br />
Herrschaft über das linke Rheinufer sichert, schickt die am 10. Februar<br />
1794 gegründete Commission temporaire des arts ihre Emissäre zum Zweck der<br />
Gedächtnisbesetzung: »d'inventoriser et de reunir dans des depöts convenables<br />
les livres, instrumens et autres objets des sciences et arts propres ä l'instruction<br />
pubhque«. 1 1794 faßt der Pariser Nationalkonvent Beschlüsse betreffs<br />
der Kunstwerküberführung aus besetzten Gebieten. Bezüglich der Rheinprovinz<br />
heißt das nach der Aufhebung der alten Kloster-, Kirchen- und Stiftsbibliotheken<br />
die Überführung ihrer Bestände entweder in die Pariser<br />
Nationalbibliothek oder in die neugegründeten Zentralschulen, deren Leiter<br />
»den Rest an Handschriften und Büchern in Speichern verkommen ließen«<br />
. So wird Gedächtnis auf die pure Materialität seiner Träger<br />
reduziert. Das Machtzentrum eines <strong>Im</strong>periums bedarf eines Zentralspeichers;<br />
andererseits aber lassen seine Objekte nicht alle als Realien dorthin<br />
verbringen. Von daher hieß Wissenspraxis in Paris Semiokolonisation 2 , der<br />
Transfer <strong>von</strong> Wissen in Zeichen und konkret: Signaturen. Durch ein Gesetz<br />
vom 3. Brumaire des Jahres IV (25. Oktober 1795) ist dem Institut National<br />
vorgeschrieben, jährlich sechs seiner Mitglieder auf die Reise zu schicken, »pour<br />
faire des recherches sur les diverses branches des connaissances humaines autres<br />
que l'agnculture«.<br />
1815 und 1870/71 aus der Sicht <strong>von</strong> 1915<br />
Besonders <strong>für</strong> das deutsch-französische Verhältnis gilt, daß jeder neue Krieg<br />
zunächst das Gedächtnis der vorherigen (dann seine Löschung) ist. Das (seinerzeit)<br />
Königliche Staatsarchiv Koblenz wendet sich mit dem Schreiben vom 29.<br />
August 1914 im Vorgriff auf künftige Siege an den Oberpräsidenten der preußischen<br />
Rheinprovinz betreffs deutscher Handschriften in Paris, die 1815 nicht<br />
zurückerstattet wurden (mit der Bitte um Weiterreichung des Schreibens an den<br />
Reichskanzler). In erheblichem Umfang war deutsches Archivgut unter Ludwig<br />
XIV, der Französischen Revolution und unter Napoleon I. nach Frankreich<br />
' Zitiert nach: Hermann Degering (Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin),<br />
Geraubte Schätze. Kölnische 1 Iandschriften in Paris und Brüssel, in: Beiträge zur Kölnischen<br />
<strong>Geschichte</strong> / Sprache / Gegenwart, hg. v. Verein Alt-Köln, 2. Bd., Heft 7<br />
(November 1915), 38ff<br />
2 Zu diesem Begriff Thomas Richards, Archive and Utopia, in: Rcprcscntations 37<br />
(Winter 1992), 104-135
704 ARCHIV<br />
gelangt. Diese Absentierung <strong>von</strong> Aufzeichnungen hinterließ in Deutschland<br />
selbst eine Schriftspur; viele deutsche Archive erstellen Übersichten der nach<br />
Frankreich entführten Bestände an Urkunden, Handschriften, Akten und Amtsbüchern.<br />
Bei der Einnahme <strong>von</strong> Paris im Kriege 1870/71 ist deutscherseits an die<br />
Zurücknahme der bis 1815 dorthin translozierten deutschen Archivalien<br />
anscheinend nicht gedacht worden. Für Monumente im ästhetischen Raum sieht<br />
das anders aus als <strong>für</strong> administrative Dokumente. »Will das Klagen kein Ende<br />
nehmen um die Beraubung unserer Kunstsäle und Bilder-Sammlungen? Haben<br />
wir solche Schätze aus dem Ausland erkauft und erbeutet, wohl dann, so laßt sie<br />
hinfahren, wir haben lange genug das Fremde angebetet, und darüber unser Eigenes<br />
vergessen«, heißt es im Artikel »Denkmahle« (Chiffre »H«) im Rheinischen<br />
Merkur (2. Jg. 1815/16) Nr. 263 vom 4. Juli 1815. Nr. 269 desselben Jahrgangs v.<br />
17. Juli 1815 listet ein Verzeichnis der Manuskripte, Bücher, Naturalien und<br />
Kunstsachen, welche die Franzosen aus Italien geführt haben, auf; Nr. 276<br />
schließlich v. 31. Juli 1815 fordert unter der Überschrift »Mahnung« den - mit<br />
dem Gesamtinventar der Villa Albani aus Rom in die Pariser Nationalbibliothek<br />
gelangten - handschriftlichen Nachlaß Johann Joachim Winckelmanns ausdrücklich<br />
im <strong>Namen</strong> des deutschen Volkes, also als kollektiven Besitz, zurück -<br />
als Todten-Opfer an einen preußischen Landsmann (Hinweis Esther Sunderkauf,<br />
Berlin). Die Archivkommission der deutschen Besatzer in Paris reaktiviert diese<br />
Forderung im Zweiten Weltkrieg. Die »Unterlassung <strong>von</strong> 1871« 3 jedenfalls<br />
soll im Ersten Weltkrieg <strong>für</strong> den Fall eines <strong>für</strong> Deutschland vorteilhaften Friedensschlusses<br />
dahingehend revidiert werden, daß die französische Regierung<br />
alle aus Deutschland stammenden und nicht nachweisbar käuflich erworbenen<br />
Handschriften und Kunstgegenstände zurückzugeben hat. Mit dem Friedenschluß<br />
nach dem preußisch-französischen Krieg <strong>von</strong> 1870/71 wurde zwar eine<br />
Kommission zur Feststellung deutscher kultureller Restitutionsansprüche gebildet,<br />
an der auch der Direktor der preußischen Staatsarchive, Max Duncker, beteiligt<br />
war, doch die erstellten Listen werden aber nie Gegenstand der<br />
Friedensverhandlungen: »teils weil die Vewaltungsjuristen Bedenken hatten, so<br />
weit zurückhegende Entfremdungen wieder aufzugreifen« - denn bevor Vergangenheit<br />
historisch-hermeneutisch verhandelt wird, steht sie juristisch zur<br />
Disposition -, teils weil Bismarck zu einem schnellen Friedenschluß mit Frankreich<br />
kommen will. In den Frankfurter Frieden wird lediglich ein Passus über<br />
die Archivfolgen <strong>für</strong> die Abtretung <strong>von</strong> Elsaß-Lothringen aufgenommen. <strong>Im</strong><br />
Ersten Weltkrieg werden wiederum Restitionsforderungen im Rahmen der deut-<br />
Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, I Rcp. 178, VII 2A 3b, Akte »Rückforderung<br />
der <strong>von</strong> Frankreich und Deutschland entführten Urkunden » 1914-1936
AKCIIIVTRANSIT.K UNT1-R KRIKGSUKIMNGUNGKN 705<br />
sehen Kncgszicldiskussion geltend gemacht, aber nicht weiter verfolgt, weil<br />
es sich als zwecklos herausstellt, allein auf Grundlage <strong>von</strong> Unterlagen der deutschen<br />
Archive Archivalienansprüche zu klären (die Originallisten in den<br />
Dienstakten der Pariser Bibliotheque Nationale); die deutsche Gegenlüberheferung<br />
ist nur fragmentarisch. 4 Damit wird die Historiographie <strong>von</strong> Archiven<br />
zur wissensarchäologischen Begründung ihrer selbst. Bereits im Oktober 1914<br />
bittet die Reichskanzlei um vom 26. Januar 1871 stammende Listen entsprechender<br />
Urkunden und anderer Geschichtsarchivalien; Artikel 3 des Friedensvertrags<br />
vom 10. Mai 1871 etwa betraf die deutsch-französische Kulturgutlage<br />
im Elsaß. <strong>Im</strong> Weltkrieg wird archivisches Gedächtnis militärisch beobachtetes<br />
Kapital. Nach einer Mitteilung aus dem Großen Hauptquartier regt der Statthalter<br />
in Elsaß-Lothringen unter Hinweis auf einen Vorgang aus dem Jahre<br />
1870 an, wie damals eine Kommission zu bilden, um in französischen Archiven<br />
nach Dokumenten und Urkunden zu suchen, »welche auf reichsländische<br />
Verhältnisse Bezug haben und ihrer Natur nach in reichsländische Archive<br />
gehören.« 5 Und so ist archivisch gespeicherte Zeit eine Funktion der Räume<br />
ihrer Interpretanten.<br />
Vergangene Zukunft eines Krieges: Der Minister der geistlichen und Unternchts-Angelegcnheiten<br />
in Berlin teilt dem Vizepräsidenten des Königlichen<br />
Staatsministeriums am 21. August 1915 sein Ersuchen an die betroffenen Provinzial-<br />
Oberpräsidenten mit, beschleunigt und »in möglichst unauffälliger<br />
Weise« zu ermitteln, welche Gemälde, Zeichnungen, Kupferstiche, Skulpturen,<br />
Medaillen, kunstgewerbliche Wertstücke, Handschriften, Druckwerke und sonstige<br />
Altertümer oder Erinnerungsstücke <strong>für</strong> eine Rückforderung <strong>von</strong> Frankreich<br />
in Betracht kommen. Wieder wird archivisches Gedächtnis an militärische<br />
Logistik rückgekoppelt. Der Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei antwortet<br />
dem Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten betreffs der<br />
Beschlagnahme französischer Kunstwerke im aktuellen Okkupationsgebiet, »die<br />
im Benehmen mit dem Preußischen Kultusministerium bestimmt werden könnten«,<br />
daß der Reichskanzler ihm anheimstellt, sich mit den zuständigen militärischen<br />
Stellen in Verbindung zu setzen
706 ARCHIV<br />
30. Juli 1915 in seinem Schreiben an den Staatssekretär des Innern in Berlin<br />
die Rückführungsbestimungen vom ersten Pariser Frieden am 30. Mai 1814<br />
sowie vom zweiten Pariser Frieden am 20. November 1815; die Rede ist hier <strong>von</strong><br />
einem »Riesenausmaß der vorangegangenen Entfremdungen«, dergegenüber die<br />
Gegenforderungen der siegreichen Alliierten lediglich »Schwäche, Enge und<br />
Einseitigkeit« verrieten; auch diesen Verpflichtungen war Frankreich zwischenzeitlich<br />
»nicht entfernt nachgekommen.« 6 Daher lagern noch deutsche Archivalien<br />
in Frankreich; die mit Pipin, Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen<br />
beginnenden Königs- und Kaiserurkunden <strong>für</strong> die alte Abtei St. Maximm in Trier<br />
etwa, die in der Bibliotheque Nationale Paris lagern, werden »zur Benützung<br />
nicht versandt und nicht nur nicht zweckmäßig, sondern geradezu widersinnig<br />
verwahrt«. Tangl kritisiert, daß in Paris eine Anzahl <strong>von</strong> Urkunden als Kodex<br />
gebunden vorliegt und wundert sich, daß bei dieser Art der Aufbewahrung<br />
»auch nur eines der stetem Seitendruck ausgesetzten Siegel noch ganz geblieben<br />
ist« . Es geht hier um die archivische Sicherung des Informationswerts<br />
jener äußeren Urkundenmerkmale (parerga), die durch Verwandlung in typographisches<br />
Reproduktion, im Reich der Bibliothek, wegfallen. Aktuelle Listen<br />
sollen (so Tangl) auf restlose Rückgabeforderung hinauslaufen. Demgegenüber<br />
stellt das Königliche Staatsarchiv Koblenz in einem Schreiben vom 27. September<br />
1915 an den Generaldirektor der Staatsarchive in Berlin, rheinische Archivalien<br />
in Frankreich betreffend, die archivwissenschaftlichen Gesetze über<br />
nationale Ideologien. Gemeinsam mit französischen Kommissaren war zu<br />
klären, welche Archivahen nach Inhalt und Empfänger aus rheinischen Archiven<br />
stammen, während Urkunden, Akten und Handschriften, die zwar deutsche<br />
Staaten und Orte betreffen (Pertinenzpnnzip), aber durch die auswärtigen Beziehungen<br />
früherer Jahrhunderte entstanden sind, in französische Archive gehören<br />
(Provenienz). Dagegen sollen lediglich alle die Akten <strong>von</strong> Frankreich abzufordern<br />
sein, die bei den Zentralbehörden in Paris in der Zeit <strong>von</strong> 1794-1813 durch<br />
die Verwaltung der rheinischen Departements erwachsen sind.<br />
Gedächtnispolitik ist eine Funktion <strong>von</strong> Archivlagen. Stand und Art der<br />
Ordnung der Akten französischer Verwaltungsbehörden sind »nicht <strong>von</strong> der<br />
Art, daß sich sichtbare Lücken nachweisen und umgrenzen ließen und daß aus<br />
solchen Lücken auf eine Beseitigung zu französischer Zeit geschlossen werden<br />
könnte.« Die Akten der älteren •yorfranzösischen Landesbehörden und Klöster<br />
wiederum sind »in so wechselreichem Maße mehr oder weniger vollkommen<br />
oder unvollkommen überliefert und die Unvollkommenheit durch so verschiedene<br />
Umstände zwischenzeitlicher Schicksale veranlaßt«, daß aus ihnen Schlüsse<br />
auf Umfang und Verbleib eines früheren Bestandes gleichfalls nicht gezogen<br />
GehStaAr Berlin, ebd., Abschrift I A 8468
ARCHIVTRANSH'R UNTHR KRIKGSBHDINGUNGHN 707<br />
werden können. 7 Damit ist der Sockel historischer Aussagen definiert durch die<br />
Kontingenzen seiner archivischen Grundlagen; Archivgenealogien verwischen<br />
das nationalhistorische Argument. Lücken werden erst sichtbar, wenn vorhandene<br />
Befunde benennbar sind. Nicht der historische Diskurs, sondern allein<br />
eine Ästhetik der Absenz, die Lücken zum Ausgangspunkt macht, statt sie<br />
unverzüglich mit <strong>Im</strong>agination zu füllen, vermag solchen Befunden Rechnung<br />
zu tragen. Archivische Diskursanalyse operiert den Rändern einer Leere. Für<br />
den Mai 1918 handelt der im Geheimen Staatsarchiv Berlin vorliegende Briefverkehr<br />
noch <strong>von</strong> der Bildung einer Kommission zur Bestimmung <strong>von</strong> Rückforderungslisten;<br />
nur die Sachlogik der Dokumentenablage im entsprechenden<br />
Dossier weiß, daß achtzehn Jahre später der Rücklauf der Akten mit Rückforderungslisten<br />
schon der Vorlauf ihrer Reaktivierung (in Weltkrieg II) ist. Am 4.<br />
August 1936 nämlich sendet der Direktor der Handschriftenabteilung der<br />
Preußische Staatsbibliothek dem Geheimen Staatsarchiv unter 300 Mark Wertversicherung<br />
sechs Aktenstücke des Direktoriums des Staatsarchivs betreffs der<br />
Reklamation <strong>von</strong> Archivalien aus Frankreich zurück, die seit Jahren zur Benutzung<br />
durch Professor Degering entliehen waren. Gleichzeitig mit der Bestätigung<br />
des Eingangs der Degering-Archivalien am 18. August 1936 bittet das<br />
Staatsarchiv um Mitteilung, wann und unter welchem Geschäftszeichen die<br />
Akten seinerzeit zur Benutzung durch Degering entliehen worden waren - ein<br />
Gedächtnis, das <strong>von</strong> seinen Verwaltern vergessen worden ist.<br />
Das Pariser Inventar (Weltkrieg II)<br />
Das archivische Gedächtnis wird zum Gesetz <strong>für</strong> Menschenübertragung, als auf<br />
der Grundlage des geheimen Zusatzprotokolls zum Hitler-Stahn-Pakt eine<br />
deutsche Archivkonimission in den der Sowjetunion zugeschlagenen baltischen<br />
Staaten Estland und Lettland flächendeckende, die Territorien symbolisch kartographierende<br />
Kopier- und Photographierprogramme dortiger Archivalien<br />
durchführt, um die auf Reichsgebiet umzusiedelnde deutsche Bevölkerung siedlungsarchäologisch<br />
zu dokumentieren: Archivtransfer, buchstäblich, die Kopplung<br />
<strong>von</strong> Memoria und Logistik, unterbrochen erst durch die deutsche Invasion<br />
der Sowjetunion 1941. 8 Ein Teil der <strong>von</strong> der Baltischen Archivkommission verfilmten<br />
Dokumente lagert heute in der Bibliothek des Herder-Instituts, Mar-<br />
Ebd., ergänzendes Schreiben vom 27. Oktober 1915<br />
Nils Brübach, Biographische Skizze, in: Johannes Papritz, Archivwissenschaft, Mikrofiche-Ausgabe<br />
Marburg (Archivschule) 1997, 27-39 (35). Über den daran gekoppelten<br />
historisch-politischen Diskurs am Beispiel des einst auch am Preußischen Historischen<br />
Institut in Rom tätigen Historikers Johancns Haller siehe (zu dessen 50. Todestag) Hans-<br />
Erich Volkmann, Als Polen noch der Erbfeind war, in: Die Zeit, 12. Dezember 1997, 48
708 ARCHIV<br />
bürg, das in mehr als einer Hinsicht die Kontinuität der deutschen Archiv-Ostforschung<br />
dar- und herstellt, indem es den Buch- und Zeitschriftenbestand der<br />
Berliner Stelle nach dem Krieg aus Amerika zurückerwarb. 9 Analog dazu spielt<br />
sich auch an der Westfront ein Gedächtniskneg ab. Angesichts des Zusammenbruchs<br />
der französischen Armee kommentiert der in die USA ausgewanderte<br />
(und <strong>von</strong> dort aus Archivwissen selbst zum Kriegseinsatz bringende) ehemalige<br />
deutsch-jüdische Archivar des Geheimen Staatsarchivs Berlin, Ernst Posner:<br />
»The overwhelming success of the Germans was attnbutable to the fact that<br />
they had entered the war with a better hling sy.stem.« 10 Shcrrod East, langjähriger<br />
Leiter der Departmental Records Branch der amerkamschen Streitkräfte,<br />
lobt Posners »contributions dunng World War II in the preparation of material<br />
for the use of the armed forces in Europe, on the protection and location of<br />
European archival and cultural resources«; ferner dessen Hilfe bei der Bewertung<br />
abgeführter Dokumente und der Evaluation <strong>von</strong> Restitutionsforderungen.'<br />
1 Hitler deklariert am 20. Mai 1940 intern den Tenor eines künftigen<br />
Friedenvertrages mit Frankreich: »Rückgabe des seit 400 Jahren dem deutschen<br />
Volk geraubten Gebietes und sonstiger Werte« 12 ; schon sind Archive im Spiel.<br />
Rosenberg sucht gleichzeitig in den besetzten Ländern auch Forschungsmaterial<br />
<strong>für</strong> die geplante Hohe Schule der NSDAP zu requirieren; auf der Ebene des<br />
Besatzungsregimes dekonstruiert sich die deutsche Archivpolitik. Ergebnis ist<br />
ein dreifacher Kompetenzkonflikt <strong>von</strong> in funktionale Subsysteme zerfallenen<br />
nationalsozialistischen Interessen: die Abgrenzung des Reichssicherheitshauptamtes<br />
(RSHA) und des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg (ERR) vom<br />
Kommissar <strong>für</strong> den Archivschutz und die Konkurrenz zwischen dem Reichssicherheitshauptamt<br />
und Rosenberg. Goebbels erwirkt unter dem 13. August<br />
1940 einen Führererlaß, alle widerrechtlich (allgemeiner »ohne unseren Willen«)<br />
in den Besitz der besetzten Länder gelangten deutschen Kulturgüter zu m-<br />
9 Siehe: Die Bibliothek des Herder Instituts. <strong>Geschichte</strong> - Bestände - Benutzung, Marburg<br />
(1 leider Institut) 1998, 611<br />
10 Ernst Posner, The Role of Records in German Administration [publiziert 1941 im<br />
Staff Information Circular.Nr. 11 der National Archivcs, Washington], in: Posner<br />
1967, 87ff (87). Posner setzt in diesem Papier den Akzent auf die deutsch-administrative<br />
Registratur als Medium der Nachrichtenein- und -aushänge (88).<br />
11 Zitiert in der Einleitung <strong>von</strong> Paul Lewinson zu: Archives & the Public Interest.<br />
Selected Essays by Ernst Posner, hg. v. Ken Munden, Wahsington (Public Affair)<br />
1967,7-19(18)<br />
12 Jodl-Tagebuch, 1940 V 20: Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem<br />
Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg, Bd. 1-47, Nürnberg 1947-1949, hier: Bd.<br />
28, Dok. 1809-Ps, 431, zitiert nach: Wolfgang Hans Stein (Hg.), Inventar <strong>von</strong> Quellen<br />
zur deutschen <strong>Geschichte</strong> in Pariser Archiven und Bibliotheken, Koblenz (Selbstverlag<br />
der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz) 1986, xxxix
AKCIUVTKANNN-K UNTI-.K KKII-.C;SKI-.I)IN(;UNC;I-N 709<br />
ventarisch erfassen; zur Durchführung dieser Aktion beruft er die Spitzen der<br />
deutschen Museen, Bibliotheken und Archive <strong>für</strong> den 22. August 1940 ins Propagandammisterium<br />
- ein Medienverbund im Dienste der Kulturinventarisation,<br />
und einmal mehr definiert sich Kultur als Funktion ihrer Speicher. Erste<br />
Listen werden vom Generaldirektor der Berliner Museen Otto Kümmel 13 , dem<br />
die Gesamtleitung der Aktion übertragen ist, dem Propagandammistenum<br />
übergeben; als Hitler jedoch Mitte Juli den Plan eines Friedensvertrages mit<br />
Frankreich vorläufig aufgibt, wird dieses Projekt zum Selbstläufer, zum selbstschreibenden<br />
Inventar. Die kontinuierliche Struktur der deutschen Archivverwaltung<br />
beweist sich am deutlichsten »unter Umständen, die wohl als einmalig<br />
bezeichnet werden können.« 1 ' 1 Der Haager Landknegsordnung entsprechend<br />
hat die deutsche Heeresleitung beim Einmarsch in Frankreich im Sommer 1940<br />
<strong>für</strong> den Schutz und die Erhaltung des Kulturgutes in den besetzten Gebieten zu<br />
sorgen; neben Kunst- und Bibhotheksschutz wird also am 17. Juni 1940 auch<br />
ein Archivschutz eingerichtet. Der vom Reichsinnenministerium mit der Wahrnehmung<br />
dieser Aufgabe in Deutschland und in den besetzten Gebieten beauftragte<br />
Generaldirektor des Reichsarchivs und der preußischen Staatsarchive<br />
Ernst Zipfel stellt eine Gruppe <strong>von</strong> Archivaren deutscher Staats- und Stadtarchive<br />
zusammen, um (so der Originaltitel) ein Inventar der französischen<br />
Archive und Bibliotheken zur <strong>Geschichte</strong> des Großdeutschen Reiches und Volkes<br />
zu erstellen. Tatsächlich ist dieses Inventar die Reprise eines schon vertrauten<br />
Unternehmens unter verkehrten Vorzeichen; während ihrer Besetzung des<br />
Rheinlandes analysierte die französische 8. Armee das Staatsarchiv <strong>von</strong> Speyer<br />
und veröffentlichte ein Inventar aller dort gespeicherten französischen Dokumente.<br />
15 Die Bevölkerung aber steht dieser schembaren Schutzmaßnahme skeptisch<br />
gegenüber: »They frequently considered them nothing more than Steps<br />
toward the future annexation of the country by the generous protector« 16 , denn<br />
13 Zu Kümmel siehe W. E., Museale Räume im nachliberalistischcn Zeitalter: Nationalsozialismus,<br />
Klassizismus, Antike(n), in: 1 lephaistos. New Ap pro ach es in Classical<br />
Archaeology and related l'ields. Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der<br />
Archäologie und angrenzender Gebiete 11/12 (1992/93), Bremen (Klartext), 187-206<br />
14 Georg Schnath, Zur Entstehungsgeschichte des Pariser Inventars. Persönliche Bemerkungen<br />
und Erinnerungen, in: Stein 1986: xix-xxv (xix)<br />
l:> M. Pfeiffer (Hg.), Inventaire analytique des fonds francais conserves aux archives de<br />
Spire, publie par les soins de M. le Lieutenant G. Vial-Mazel (VHIe Armee d'oecupation<br />
du Palatinat), 1919<br />
16 Ernst Posner, Public Records under Military Occupation [veröffentlicht als Miscellaneous<br />
Processed Document 43-13 der National Archives, Washington 1943 und im<br />
American Historical Review, Januar 1944], in: Posner 1967: 182-197 (187), unter Bezug<br />
auf: Philippe Lauer, Les Archives de la Lorrame pendant la guerre, in: Bibhotheque de<br />
l'Ecole des chartes 79 (1918), 256
710 ARCHIV<br />
die Erfassung des archivischen Gedächtnisses ist ein wissenskartographischer<br />
Akt symbolischer Reterntoriahsierung; »one cannot administer a country<br />
unless one knows how to obtain adequate statistical data.« 17<br />
<strong>Im</strong> Unterschied zur föderativen Pluralität deutscher Staatsarchive (seit 1919<br />
ergänzt durch ein Reichsarchiv) verfügt Frankreich über ein einziges (während<br />
der deutschen Besetzung <strong>für</strong> die Öffentlichkeit geschlossenes) Nationalarchiv,<br />
das damit zugleich die Infrastruktur und den symbolischer Ort des Nationalgedächtnisses<br />
(ab-)bildet; unter allen Pariser Archiven und Bibliotheken konzentrieren<br />
sich dort zwei Drittel der Archivalien mit deutschen Betreffen. Eine<br />
Parallele bildet der Speicher Nationalbibhothek. Ernst Jünger trifft am 30. September<br />
1942 im Katalogsaal der Pariser Nationalbibliothek auf Hermann Fuchs,<br />
der dort mit einer parallelen Inventarisierung deutscher Bestände befaßt ist;<br />
Jünger selbst aber sieht im Manusknptsaal an Objekten wie dem Evangeliar<br />
Karls des Großen und der Bibel Karls des Kahlen gerade nicht das nationallogistische<br />
Gedächtnis der Objekte, sondern ihren ästhetischen Mehrwert. Der<br />
Raum erscheint ihm als ein bober Schrein; »die museale Ordnung gewinnt die<br />
höchste Form, wenn an den auserlesenen Stücken zugleich Rehquiencharakter<br />
haftet.« Hier müßte dann, »im Gegenzuge der historischen Entwicklung«, die<br />
er zuvor anhand <strong>von</strong> Fuchs' Projekt eines Gesamtkatalogs der deutschen Bibliotheken<br />
als enzyklopädische Tendenz beschrieben hat, »ein neuer Klerus in<br />
die Kustodenstellungen eintreten.« Jünger ist sich der Schnittstelle zur Prosaik<br />
<strong>von</strong> Staat dabei bewußt: »Man kann das nicht <strong>von</strong> einem Staat erwarten, der das<br />
Grabmal des Unbekannten Soldaten durch Polizisten bewachen läßt.« 18 Georg<br />
Winter veröffentlicht 1941 einheitliche Richtlinien <strong>für</strong> die gesamte Inventarisierung<br />
der Quellen zur deutschen <strong>Geschichte</strong> in französischen, belgischen<br />
und niederländischen Archiven. 19 Sie hatten internen Charakter und regelten<br />
nicht nur Erlassungskriterien, sondern auch Formalien 20 , sind mithin also<br />
Monumente einer Infrastruktur <strong>von</strong> archivalischer Gedächtnisadministration,<br />
die sich dem Zugriff des <strong>Im</strong>aginären, also ideologischer Verwertung, zunächst<br />
17<br />
Hugo Kcrchnawe u. a., Die Militärverwaltung in den <strong>von</strong> den österreichisch-ungarischen<br />
Truppen besitzten Gebieten, Wien / New Haven 192, 83, zitiert nach: Posner<br />
[1943] 1967: 194f. Siehe auch Thomas Richards, Archive and Utopia, in: Representations<br />
37 (Winter 1992), 104-135<br />
1X<br />
Ernst Jünger, Das Erste Pariser Tagebuch, in: ders., Strahlungen, Tübingen (Heliopolis)<br />
1949, 174. Der Insektenforscher Jünger erkennt auch an der Partitur der Oper<br />
Pelleas et Melisandc <strong>von</strong> Debussy etwas ungemein Exaktes: »Sie glich der Planzeichnung<br />
eines elektrischen Schaltwerkes; die Notenköpfe waren wie kleine, gläserne Isolatoren<br />
an einer Leitung aufgereiht.«<br />
19<br />
In: Mitteilungsblatt der Preußischen Archivverwaltung (hg. v. Generaldirektor der<br />
Preußischen Staatsarchive) 1941: 59-68<br />
20<br />
Wolfgang Hans Stein, Erfassungs- und Bearbeitungsgrundsätze, in: ders. 1986, lxix
ARCHIVTRANSFKR UNTI-R KRH:GSBI:I)INGUNGI;N 711<br />
einmal entzieht, aber im Einzugsbereich derselben stattfindet. Dementsprechend<br />
ist die <strong>Geschichte</strong> dieses Inventars ein Fall der Oszillation zwischen Monument<br />
und Dokument, diskursiver und non-diskursiver Verhandlung der nationalen<br />
Vergangenheit Deutschlands als (Archiv-)Fremdkörper, an der Schnittstelle <strong>von</strong><br />
eigen und fremd, ein Dazwischen (Aufschub und Differenz zugleich, verschieden<br />
und verschiebend, differance im Sinne Derndas). Vergangene Zukunft ist<br />
schon der Zeithorizont der Pariser Archivalienverzeichnung im Moment der<br />
Erstellung; das Inventar, obgleich scheinbar rein administrativ angelegt, bildet<br />
doch immer schon eine Schnittstelle zum <strong>Im</strong>aginären der deutschen <strong>Geschichte</strong>.<br />
Ideologisch ist so das non-diskursive Speicher- Aufschreibesystem selbst durch<br />
den historisches Diskurs kodiert - »auf Generationen ein bleibendes Denkmal<br />
<strong>für</strong> den Kricgsemsatz deutscher Archivare und Historiker in Frankreich und ein<br />
unentbehrlicher Leitfaden <strong>für</strong> die deutsche Geschichtsforschung« .<br />
Seit der Teilung des Reiches Karls des Großen sind Franzosen und Deutsche<br />
Nachbarn; vornehmlich die Grenzregionen an Rhein, Maas und Mosel<br />
(das alte Teilreich Kaiser Lothars) sind da<strong>von</strong> »positiv befruchtet und leidend<br />
betroffen.« 21 <strong>Im</strong> Elsaß war es <strong>von</strong> französischer Seite zu Auslagerungen großen<br />
Umfangs in den unbesetzten Teil Frankreichs gekommen, der dem Zugriff<br />
der Pariser Archivkommission nicht offen stand. Durch die Quasiannektion<br />
(Stein) des Elsaß wird die Rückführung der Archivalien nach dem Ende der<br />
Kampfhandlungen in die Archive demgegenüber zu einer politisch höchst brisanten<br />
Frage der Archivahenausheferung; wieder dekonstruiert sich das Argument<br />
<strong>Geschichte</strong> als Funktion <strong>von</strong> Archivbereichen. Die französische Regierung<br />
in Vichy widersetzt sich dem deutschen Drängen; die Rückführung wird<br />
erst nach der völligen Besetzung Frankreichs im November 1942 durchgeführt.<br />
Obgleich strikt gedächtnisinfrastrukturell, als Vermessung archivischer<br />
Lagen aus der internen Perspektive der Archivare definiert, kippt die Pragmatik<br />
des Pariser Archivprojekts bisweilen ms <strong>Im</strong>aginäre. Es galt offiziell, die unwiederbringliche<br />
Gelegenheit zu nutzen, deutsche Betreffe aus Pariser<br />
beständen zu erarbeiten ; vielmehr und ausdrücklich als Tarnung<br />
aber dienen die Inventarisationsarbeiten tatsächlich 22 . Es gelte, »Frank-<br />
-' I'Yan/.-|oscf I Ieyen / |c;\n Fa vier, Vorwort / Prefacc, Inventar 1986: xv. S. a. W. I"..,<br />
Identität und Differenz. Johann Gottlieb Fichtcs Reden an die deutsche Nation, in:<br />
Tumult. Zeitschrift <strong>für</strong> Verkehrswissenschaft 10, München 1987, 141-161<br />
22 Torsten Musial, Zur <strong>Geschichte</strong> des Dritten Reichs: Staatliches Archivwesen in<br />
Deutschland 1933-1945, Diss. Humboldt-Universität Berlin 1994, Kapitel 5.6. »Frankreich«<br />
(175) ; s. a. Roth 1989: 99. Zur Invcntarisation als Tarnung unter verkehrten<br />
Vorzeichen siehe W. E., Symbolischer Tausch und der Tod (die Unmöglichkeit des<br />
Museum): das nationalsozialistische Projekt eines jüdischen Zentralmuseums in Prag,<br />
in: Geschichtswerkstatt 24 (Juli 1991), 45-56
712 ARCHIV<br />
reichs Archive gewissermaßen <strong>für</strong> Deutschland zu erobern.« 23 Bis zu diesem<br />
Punkt herrscht noch Archivjargon; die Schnittstelle zum Diskurs aber offenbart<br />
sich bei der im August 1943 veranstalteten Ausstellung Tausend Jahre deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> im Spiegel des Nationalarchivs anläßlich eines Besuchs des<br />
Militärbefehlshabers General Stülpnagel in den Pariser Archives Nationales,<br />
zusammengestellt <strong>von</strong> Archivkommissionsleiter Schnath. »Ebenso interessant<br />
wie das, was die Ausstellung zeigte, ist das, wie sie nicht zeigte«; sie<br />
beschränkt sich bewußt (Stein) darauf, nur Stücke französischer Provenienz zu<br />
zeigen, um eine Diskussion über die Verwahrung <strong>von</strong> Archivalien deutscher<br />
Provenienz vor oder mit Franzosen durch Uneingeweihte auszuschließen.<br />
»Hier zeigte sich so wieder deutlich der schmale Grad zwischen Wissenschaft<br />
und Politik, den die Archivkommission zu gehen hatte.« 24 Plant die Pariser<br />
Archivgruppe (mit Ausnahme Georg Winters in der Besprechung vom 25.<br />
Februar 1941) das Provenienzprinzip als gedächtnistechnisches Dispositiv zur<br />
Grundlage deutscher Rückforderungen an Frankreich zu machen, argumentieren<br />
die Archivdirektoren des Reiches mit ihrer Insistenz auf dem Pcrtinenzprmzip<br />
nicht primär archivwissenschaftlich, sondern ideologisch orientiert; auf<br />
der Konferenz der Leiter der Archivschutztruppen West im Berlin-Dahlemer<br />
Geheimen Staatsarchiv (dem Hort des preußisch-archivischen Provenienzprinzips)<br />
deklariert Ernst Zipfel am 8./9. April 1941 »nicht die Theorie unseres<br />
engen Fachs, sondern ausschließlich Vorteil des Reichs« als Vektor <strong>von</strong><br />
Rückgabeforderungen. Der Schlußbericht der Gruppe Archivwesen in der<br />
Militärverwaltung Frankreich listet die im April 1943 an Propagandaminister<br />
Goebbels weitergereichte Archivforderung auf, darunter die Akten der ehemaligen<br />
Interalliierten Rheinlandkommission und der Abstimmungskommission<br />
des Saarlands mit der Begründung, daß sie betreffsmäßig <strong>für</strong> Deutschland <strong>von</strong><br />
Bedeutung seien. 23 »Praktische und politische Gesichtspunkte geben da den<br />
Ausschlag« besonders mit Blick auf künftige Grenzverschiebungen 26 ; als Hilfswissenschaft<br />
einer politisierten Geo-Historie versagt die sonst im Raum des<br />
Diskreten, der fragmentarischen Daten, der wissensarchäologischen Diskontinuitäten<br />
und interpretatorischen Askese opererierende Archivkunde gegenüber<br />
23<br />
Aus dem vertraulichen Schlußbencht 1944 der Archivgruppe Frankreich: BA-MZA<br />
Potsdam, WF-10/21691, o. Bl.<br />
24<br />
Stein 1986: lii, unter Bezug auf: Zipfel: Erinnerungen, S. 29 - BA R 146/20<br />
23<br />
Hier zitiert nach dem Exemplar in den National Archives Washington, RG 239, Box<br />
25, 7, nach: Karl I lein/. Roth, Eine höhere Form des Plimderns. Der Abschlußbericht<br />
der »Gruppe Archivwesen« der deutschen Militärverwaltung in Frankreich 1940-1944,<br />
in: 1999. Zeitschrift <strong>für</strong> Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts, Heft 2/1989,<br />
Einleitung 79-93 (86); das Dokument ist reproduziert 93-112<br />
26<br />
BA Koblenz, R 146, Nr. 44, o. BL, zitiert nach: Musial 1994: 177f
ARCHIYTRANSFHK UNTKR KRIKGSBKDINGUNGHN 713<br />
dem Totalitätshorizont des NS-Regimes; als Alternative zur ideologisierten<br />
Historie wäre sie deren Widerstand. Gedächtnisarbeit als Inventarisierungsprojekt<br />
arbeitet radikal nicht-diskursiv; daher plädiert auf einer Wiener Besprechung<br />
der Freiherr <strong>von</strong> Mitis <strong>für</strong> ein Institut zur diskursiven Auswertung der<br />
archivischer Daten in Echtzeit, <strong>für</strong> ihre Transformation in ideologisch prozessierbare<br />
Information. Das Pariser Inventarisierungsprojekt bleibt zunächst<br />
unabhängig vom dortigen kulturpolitisch orientierten Deutschen Institut, bis<br />
daß er dort 1942 eingestellt wird, die personale Kopplung einer archivischen<br />
und historiographischen Funktion. 27<br />
Verschiedene Diskurse sind am Werk, wenn das archivische Gedächtnis zur<br />
Disposition steht. Zipfel fragt in einem Rundschreiben vom 17. Mai 1940 bei<br />
den ihm unterstellten Archiven an, welche Archivalienforderungen gegenüber<br />
den Niederlanden, Belgien und Frankreich <strong>von</strong> deutscher Seite erhoben werden<br />
konnten 2s ; die Umfrageergebnisse, hstenmäßig zusammengefaßt, unterscheiden<br />
zwischen rechtlich begründeten Forderungen und Forderungen in politischem,<br />
wissenschaftlichem oder archivischem Interesse. 2 ^ Steht das Inventansierungsprojekt<br />
also im reinen Dienst der Datenerfassung? Die Archivkommission<br />
bezieht Zeitschriftenexemplare <strong>von</strong> Die Dokumentation, zwanglose Mitteilungen<br />
- Organ der deutschen Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation. 30 Der Selbstbehauptung<br />
betroffener Archivare zum Trotz ist die diskrete archivische<br />
Datenerfassung im besetzten Land nicht unaffektiert <strong>von</strong> ihrer tentativen<br />
Transformation in ideologisch verwertbare Information (damit anschließbar<br />
Geschichtsbilder). <strong>Im</strong> Bundesarchiv / Militärarchiv (BAM) findet sich im<br />
Bestand Der Militärbefehlshaber in Frankreich eine Aktenlage »Propagandistische<br />
Auswertung der Tätigkeit der Gruppe Archivwesen, 23.8.1940-<br />
15.12.1943« mit Anordnungen, Beiträgen <strong>für</strong> Presse und Rundfunk sowie einer<br />
Sammlung französischer Zeitungsartikel <strong>von</strong> 1940 bis 1943. 31 Primäre Aufgabe<br />
Schnaths ist diesen Unterlagen zufolge, das Vorhandensein <strong>von</strong> Archivgut deut-<br />
27<br />
Bundesarchiv / Militärarchiv Freiburg/Br. (BAM), Findbuch Bestand RW 35 (Der<br />
Militärbefehlshaber in Frankreich), Punkt 3.5.1.2.2.1. Lageberichte; Archivsignatur:<br />
Nr. 365. Inhalt der Akte sind Dienstbesprechungen, 13.10.1940-15.6.1942, Bl. 202 (Bericht<br />
Pfeiffer)<br />
28<br />
Hauptstaatsarchiv Düseidorf, Dienstregsitatur A III 3<br />
29<br />
Bundesarchiv R 146/43, zitiert nach Stein 1986: Anm. 111<br />
30<br />
Bundesarchiv / Militärarchiv Freiburg/Br. (BAM), Findbuch Bestand RW 35: Der<br />
Militärbefehlshaber in Frankreich, Nr.379<br />
31<br />
Findbuch Bestand RW 35, Nr. 375. Siehe auch Wolf gang Mommsen (geb. 1907, Archivrat<br />
im späteren Bundesarchiv Koblenz, Fachgebiet Neuere <strong>Geschichte</strong>): Von den<br />
Archiv- und Registraturklauscln in den Staatsverträgen unter besonderer Berücksichtigung<br />
des Frankfurter Friedens <strong>von</strong> 1871, Ms. fertiggestellt 1941 XII -BA R 146/47;<br />
BAM RW 35/398
714 ARCHIV<br />
scher Herkunft festzustellen. Fest- als Vorstufe der Szc^erstellung, im Zusammenhang<br />
<strong>von</strong> Erfassung als Beherrschung? Die erstellte Forderungsliste umfaßt<br />
etwa 21000 Einheiten - Archivwissenschaften vermögen Historie zu quantifizieren.<br />
»Von all diesen Dokumenten hat die Gruppe Archivschutz nicht ein<br />
Blatt <strong>von</strong> seinem Ort entfernt«, rühmt sich die Kommission; die Verwirklichung<br />
der Forderungsliste blieb ausschließlich dem künftigen Friedensvertrag<br />
vorbehalten. Voreilige Eingriffe, wie sie der Chef der deutschen Heeresarchive<br />
in den ihm unterstellten militärischen Archivbeständen vornimmt, kommen im<br />
Ressort Schnaths »in keinem einzigen Falle vor« . Der einzige<br />
Fall, in dem Archivallen des Nationalarchivs auf Veranlassung der Gruppe<br />
Archivschutz vorüberghend entnommen werden, betrifft die Papiere der Serie<br />
T T {Rcjugies religionnaires), die sich das Reichssippen- und -siedlungshauptamt<br />
der SS zur Durcharbeitung und Photokopierung Lug um "Lug - buchstäblich<br />
- nach Deutschland entleiht 32 ; die anfordernde Stelle verspricht sich <strong>von</strong><br />
dieser Aktion nähere Aufschlüsse über die Herkunft und die rassischen Gegebenheiten<br />
der hugenottischen Zuwanderer in Deutschland nach 1685. »Sie sind<br />
bis zum letzten Blatt vollständig und unversehrt zurückgegeben worden«<br />
; ihre Information wird extrahiert, in transarchivahsche<br />
Gedächtnismaschinen eingespeist und in politische Entscheidungen verwandelt.<br />
Am Nachmittag des 11. September 1943 besucht Ernst jünger das Pariser<br />
Nationalarchiv, wo ihm der aus Hannover vertraute Schnath eine Reihe <strong>von</strong><br />
Akten zeigt, »in denen die deutsche mit der französischen <strong>Geschichte</strong> sich<br />
berührt«. Darunter fallen Jünger besonders Dokumente aus den päpstlichen<br />
Kanzleien auf: »Die Mönche, denen das Siegeln oblag, mußten Analphabeten,<br />
Fratres barbati sein, zur größeren Geheimhaltung.« Die Chancen der störungsfreien<br />
Signalübertragung stehen in einem umgekehrten Verhältnis zum Begehren<br />
der Hermeneutik - eine Dialektik <strong>von</strong> blindness and instght, welche in der<br />
Informationstheorie systematisiert worden ist. Folgt Jüngers »Gang durch die<br />
Magazine, in denen noch <strong>für</strong> Geschlechter <strong>von</strong> Archivaren und Bücherwürmen<br />
Atzung liegt.« 33 <strong>Geschichte</strong> aber heißt auch Interzeption, Abkürzung des<br />
Archivs, als archivisches wie narratives Ereignis. Am 10. November 1943 trifft<br />
Jünger in Paris erneut auf Schnath, der im Begriff ist, nach Hannover zu fahren,<br />
wo das Staatsarchiv, dessen Direktor er ist, nach alliierten Bombenangriffen<br />
großenteils in Flammen aufging. Vor allem verbrennen auch die Register, so daß<br />
der übrig gebliebene Vorrat <strong>von</strong> Akten, obgleich physisch intakt, »sich in eine<br />
unbewegliche Papiermasse verwandelte« - Speicher ohne Adresse sind keiner<br />
32<br />
Wobei die erfolgende Fotokopierung »das Original ersetzen soll«: Schlußbericht 1944<br />
nach Roth 1989: 103<br />
33<br />
Ernst Jünger, Das Zweite Pariser Tagebuch, in: ders., Strahlungen, Tübingen (Helio-<br />
polis) 1949,408
ARCI IIVTRANSI-HR UNTKR KRH-:GSBI-.I)INGUNGKN 715<br />
historischen Figuration mehr zugänglich, sondern entropische Mengen, reine<br />
Signifikantenmassen, die nicht mehr Gedächtnis, sondern in ihrer puren Mate-<br />
rialität Gegenwart sind. Es ist diese Gegenwart, die Gedächtnisträger zersetzt:<br />
»Wir sprachen über die Unterbringung seiner Schätze in Kalibergwerken. Dort ist<br />
die Trockenheit so groß, daß sie die Fäden brüchig macht, mit denen die Konvolute<br />
geheftet sind. Auch setzen sich an die Oberfläche der Stücke Salzknstalle an,<br />
die nach der Förderung Wasser anziehen. Der Schmerz des Archivars im Angesicht<br />
der Brände ist ganz besonders groß.« <br />
Es ergibt sich aus den Forschungen der Pariser Archivkommission, daß nach den<br />
Pariser Friedensschlüssen <strong>von</strong> 1814/15 wesentlich mehr Archivgut als vermutet<br />
an die ehemaligen deutschen Lagerstätten zurückgekehrt ist, allerdings vielfach<br />
unsystematisch, so daß sich die Notwendigkeit einer Klärung der damaligen<br />
Archivalienverschiebungen stellt . Das Auffinden der Abgabelisten<br />
des Urkunden- und Handschnftensammlers Maugerard ermöglicht eine<br />
genauere Überprüfung; das Problem der Pariser Arbeitsgruppe besteht jedoch<br />
nicht in der Masse des zu sichtenden Materials, sondern »es war theoretischer<br />
Natur.« Das Projekt konnte nur zu Ergebnissen führen, wenn streng nach fachwissenschaftlichen<br />
Prinzipien vorgegangen wurde (Provenienzbereinigung); »die<br />
Zielsetzung der ganzen Aktion aber war eine politische« .<br />
Politik und Archivethik im Widerstreit: diese Spannung kann aufgrund der Datenlage<br />
(auch in hier) nicht geklärt werden, sondern schreibt sich fortwährend weiter.<br />
Wenngleich die Inventare pragmatisch als Arbeitsinstrumente zur Klärung des<br />
<strong>für</strong> den Austausch bzw. <strong>für</strong> die Rückforderungen in Frage kommenden Materials<br />
dienen, erschöpfen sie sich nicht in dieser Funktion. Sind sie Produkt einer revisionistischen<br />
Intention oder der Autopoiesis <strong>von</strong> Archivverwaltung unter Kriegsbedingungen?<br />
Von Anfang an, so Stein, hat Zipfel die Archivkommissionen »in<br />
einem weiteren wissenschaftlichen Rahmen« konzipiert, in dem die Inventare eine<br />
eigenständige Funktion erfüllen - als wissensarchäologisches Monument, nicht als<br />
politisches Instrument. »Zipfel wußte natürlich, daß Archivallen letztlich auf<br />
Benutzung und also auf Forschung angelegt sind« - und nur vordergründig auf<br />
Machtpraxis? Das <strong>für</strong> die deutsche Geschichtsforschung wichtigste Archivmate-<br />
rial französischer Provenienz soll deshalb verfilmt und die Rückvergrößerungen<br />
in den interessierten deutschen Archiven deponiert werden. Die damalige Situation<br />
(1940/42) »bot technische Möglichkeiten, die auch bis heute trotz neuer For-<br />
schungsmittel zeitlich und finanziell noch nicht wieder erreichbar waren« und - im Unterschied zur napoleonischen Archivausbeutung- unab-<br />
hängig vom Kriegsausgang sind. Unter Knegsbedingungen kommt es nicht nur<br />
zu Technologieschüben aufgrund sonst nicht möglicher Konzentration <strong>von</strong> Res-<br />
sourcen, sondern auch zu Kurzschlüssen in ihrer Anwendung. Diskursstrategi-<br />
sches Ziel der Forschung soll »in politisch konjunktureller Ausrichtung« auf den
716 ARCHIV<br />
1940 gerade beendeten Westfeldzug sein, »die neuen Erwerbungen sowie das neue<br />
politische Verhältnis des Reiches zu den westlichen Völkern historisch zu unterbauen<br />
(und) die deutschen Ansprüche aus der <strong>Geschichte</strong> zu rechtfertigen«. 34 Die<br />
Pariser Archivkommission ihrerseits wird zum 31. März 1944 aufgehoben, da ihre<br />
Aufgaben erfüllt ist. Folgt die Landung der Alliierten in der Normandie; das Gedächtnis<br />
wird erneut umgeschrieben werden. Gleichzeitig bricht der digitale<br />
Rechner Colossus im Zentrum der englischen Kryptographie (Bletchley Park) mit<br />
dem Reich des Schriftguts, indem er die Chiffrier-Schreibmaschine Enigma (<strong>für</strong><br />
die cieutschen Wehrmachts- und Marinekodes), mithin den Schlüssel zum Reich,<br />
kleinrechnet 35 - Stoff <strong>für</strong> künftige Archive, in denen nicht nur Speicher und<br />
Adresse zusammenfallen, sondern auch die Differenzen <strong>von</strong> Provenienz und Pertinenz.<br />
Auf dem Höhepunkt der Ausweitung des deutschen Archivwesens werden<br />
bereits die Technologien <strong>für</strong> seine Alternativen generiert.<br />
Dienstbesprechungen (archiviert), Grenzlinien, Un/Ordnung<br />
<strong>Im</strong> Protokoll der Dienstbesprechung der Pariser Archivkommission vom 10.<br />
November 1940 fordert Hauptmann Winter als Stellvertreter des im Urlaub<br />
befindlichen Gruppenleiters »kein Treibenlassen der Dinge.« Für das Archivinventar<br />
liegen völlig fertiggestellte Bearbeitungen noch nicht vor. »Bei der Frage<br />
der Provenienz sind rasche und sichere Entscheidungen <strong>von</strong>nöten. Kein blosses<br />
Verharren auf der Oberfläche.« 36 Pfeiffer definiert die Arbeiten der Archivkommission<br />
in der Pariser Nationalbibhothek und ihre vektonelle Ausrichtung<br />
als Operationen im Gedächtnis des Gegners: Die »Anfertigung eines Gesamtinventars<br />
der <strong>für</strong> Deutschland in Betracht kommenden Geschichtsquellen in der<br />
Abteilung Manuskripte (nach Betreffprinzip)«, die »Trennung <strong>von</strong> Archiv- und<br />
Bibliotheksgut« sowie die »Feststellung, ob Provenienz deutsch« . Gedächtnismacht heißt nicht, die Dokumente m Sicherheit bringen zu<br />
müssen; es reicht, das Wissen um ihre Adressierung zu erwerben. Aktion Q<br />
betrifft in aller Direktheit alphabetischer Adressierung das Pariser Außenministerium,<br />
das Quai d'Orsay. Nach längerem Drängen erlangt Dr. Jagow Einblick<br />
ins dortige Archiv, das zwar »einen äußerlich sauberen Eindruck« macht,<br />
archivalisch aber »eine Fehllösung« darstellt, da die Akten »in ihrer Ordnung<br />
durcheinandergekommen« sind; »<strong>für</strong> die Herstellung der richtigen Reihenfolge<br />
34 Zipfel, zitiert nach Stein 1986: 1 f. (unter Bezug auf ein Tagungsprotokoll 27.-28.<br />
August 1940: Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 417 Nr. 123)<br />
35 Andrew Hodges, Alan Turing: Enigma, Berlin (Kammerer & Unverzagt) 1989, 233<br />
36 BA / MA Freiburg/Br. (BAM), Findbuch Bestand RW 35: Nr. 365, Dienstbespre-<br />
chungen, 1940-1942, Bl. 5
AkCMIVTRANSH.R UNIT.R KRII-.CSBI-DINCUNCI-N ' 717<br />
würden viele Monate erforderlich sein« . 37 »Da liegen sie dann, die<br />
Akten, wahrhaft unzugänglich, und zwar <strong>für</strong> Jeden.« Denn der Speicherplatz, an<br />
dem eine Akte hegt, ist es, der sie zu einer Waffe macht oder nicht. Dieser Ort<br />
liegt nicht in Panzerschränken und Waffenkammern, sondern etwa im Alphabet.<br />
Fragen der prinzipiell unabschließbaren Inventarisierung des deutschen<br />
Gedächtnisses enden an der Definition ihrer Grenzlinien. Konkret betrifft das<br />
die Anweisung, daß <strong>für</strong> die Erfassung <strong>von</strong> Archivahen deutscher Betreffe in<br />
Pariser Archiven die deutsche Reichsgrenze um 1530 (die Zeit seiner größten<br />
politischen Ausdehnung) da<strong>für</strong> zugrundegelegt werden soll. Jede Grenz- als<br />
Definitionsfrage aber bedarf der Einschränkung:<br />
»Die Grenzgebiete werden <strong>für</strong> das Inventar nur solange berücksichtigt als sie zum<br />
Reich gehört haben (Lothringen, staatsrechtlich vielfach unklar, bis Mitte des 16.<br />
Jahrh. ). Jedoch: Französische Herrschaft in Elsass-Lothringcn (1683-1871)<br />
nur als vorübergehende Fremdherrschaft betrachtet. Daher hier<strong>für</strong> alles Material<br />
aufzunehmen (das der französischen Verwaltung etwas grobschichtiger). Entsprechendes<br />
gilt <strong>für</strong> Luxemburg. Aufgenommen wird ferner <strong>für</strong> alle Gebiete Material,<br />
das <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> des deutschen Volkstums wichtig ist (annahmeweise: Akten<br />
über den Gebrauch der deutschen Sprache im französischen Lothringen).« <br />
Schnath plädiert <strong>für</strong> eine scharfe Unterscheidung zwischen Inventarsieruhg und<br />
Bearbeitung der Rückforderungsansprüche; hier verschränken sich Archiv und<br />
Gesetz:<br />
»Inventarisierung steht unter historischen Gesichtspunkten (Landschaften, die<br />
zum Reich gehört haben, <strong>für</strong> die Zeit und im Umfang ihrer Zugehörigkeit). Die<br />
genaue Abgrenzung der Rückforderungen dagegen kann erst entschieden werden,<br />
wenn die neue Grenze gesetzt ist. Nur um einen Anhaltspunkt zu schaffen, hat<br />
Reichsminister Dr. Göbbels die grösste Ausdehnung des Reiches als Richtschnur<br />
angegeben.« <br />
Der beschleunigte Krieg läßt keine Reflexion auf die erhobenen Datensätze mehr<br />
zu; der reine Akt des Aufschreibens reduziert die Forschung auf schnellsmöghche<br />
Registration: »Der Fortgang der Arbeit wird in der Hauptsache im Inventarisieren<br />
bestehen. Damit verschmolzen bleiben jedoch die Rückforderungsforschungen.«<br />
38 Ein Bericht vom Sommer 1940 über die zur Sicherstellung der<br />
französischen Archivbestände getroffenen Massnahmen 39 benennt die in Schloß<br />
37 Ebd., Bl. 46f. Der Historiker Hans Mommscn erinnert sich an die ihm durch Wilhelm<br />
Mommsen vermittelten Anekdote, daß die Franzosen beim Eintreffen im Quai d'Orsay<br />
im Hof auf brennende Akten stießen - die Unterlagen zur französischen Kolonisation<br />
im 16. und 17. Jahrhundert, die es unmöglich gemacht hätten, Kolonialverbrechen<br />
allein den Engländern nachzuhängen (Gespräch Potsdam, 30. Oktober 1997).<br />
38 Bl. 155, Niederschrift der Gruppenbesprechung vom 4. April 1941<br />
39 Paris, den 19. Juli 1940, gez. Plassmann, SS-Hauptsturmführer
718 ARCHIV<br />
Beaumesnil bei Bernay (Eure) untergebrachten Handschnftensammlungen der<br />
Pariser Archives Nationales. Dort haben deutsche Truppen gelagert und schwere<br />
Beschädigungen an Archivgut und Privateigentum des Schloßbesitzers Hans Fürstenberg<br />
zurückgelassen. Fürstenberg war ehemaliger Deutscher, »offenbar kein<br />
Jude«, und Verfasser des in seiner Bibliothek mehrfach vorhandenen Buches Das<br />
französische Buch im 18. Jahrhundert und in der Empirezeit (Gesellschaft der<br />
Bibliophilen, Weimar 1929). Mehrere Holzkisten aus den Beständen der Archives<br />
Nationales waren aufgebrochen und ihr Inhalt nur teilweise wieder auffindbar.<br />
»Andere Kisten, deren Inhalt aus dem 18. Jahrhundert stammt, waren geöffnet<br />
und der Inhalt als Abortpapier benutzt worden; der Abtritt war noch damit vollgestopft«<br />
. So schließt sich ein Kreis, der mit der Verwertung der<br />
inlolgc der Säkularisation <strong>von</strong> Klöstoi \uvhiven 1803 livigcwordoncn Dokumente<br />
durch Altpapierhändlern und ihren mühevollen Rückkauf durch geschichtsbcwußtere<br />
Archivare begonnen hat. Die Antinomie des Archivs heißt garbage.<br />
Der Krieg n ist das Gedächtnis des Krieges n + 1. Unter dem Stempel »Geheim!«<br />
meldet der Kommandostab Abt. [a/l leeresarchiv des Militärbclehlshabers<br />
in Frankreich aus Paris am 1. Februar 1941 betreffs der Erfassung <strong>von</strong><br />
Heeresakten und Heeresbüchereien, deutsche Heeresakten aus dem (Ersten)<br />
Weltkrieg seien nur in verschwindend geringem Umfang gefunden worden.<br />
»Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass solche noch in den »salles d'honneur«<br />
der französischen Kasernen oder in Archiven und Museen französischer<br />
Gemeinden vorhanden sind« . Schnath schreibt unter der Feldpostnummer<br />
06661 aus Paris am 29. November 1940 an den Generaldirektor der<br />
Archive über eine Verfügung des O.K.H.Gcn.Q. aus Anlaß der kurz zuvor<br />
. erfolgten Übermittelung »unseres berühmten Fundes«, des Aktenstückes der<br />
Obersten Heeresleitung Waffenstillstand 1918/19 an den Chef der Heeresarchive<br />
in Potsdam. Der Generalquartiermeister hat sich »aufs äußerste darüber erregt,<br />
daß ihm dieser Band <strong>von</strong> einer >zivilen Dienststelle im Reich< zugeleitet« worden<br />
ist . Ziviler Archivschutz operiert im Zeitraum vergangener<br />
Zukunft; die militärische Logik verschaltet unter Kriegsbedingungen Archivalien<br />
mit einer anderen Gedächtnislogik, zum strategischen Einsatz in Sofortzeit.<br />
Nicht nur um Dekodierung <strong>von</strong> Zugangsbedingungen zu Archiven und die<br />
Übertragungswege <strong>von</strong> Schlüsseldokumcnten zum Gedächtnis geht es hier, sondern<br />
auch um Schlüssclino(nu)mente: Am 13. Februar 1941 spricht der Chef der<br />
Heeresmuseen Admiral<br />
Lorey bei der Gruppe Archivwesen vor, um sich nach der Möglichkeit zu<br />
erkunden, die in der Schausammlung (Musce) des Pariser Nationalarchivs verwahrten<br />
Schlüssel rheinischer Städte »als Kriegsbeute durch sofortigen Zugriff<br />
einzuziehen.«
ARailVTRANSI-T.R UNTI-.R KRIHGSBkDINGUNGEN 719<br />
Archivtransfer im Protektorat Böhmen und Mähren<br />
Auf dem Höhepunkt der Sudetendeutschen Krise im September/Oktober 1938<br />
wird das Archiv mobilisiert: Archivare des Berliner Staatsarchivs sollen statistische<br />
Unterlagen liefern. Ein Gedächtnismedium, das bodenloser Abgrund aller<br />
Geschichtslektüren ist, wird hier zur definitonschen Grundlage stilisiert: »Auf<br />
Grund der letzten habsburgischen Statistiken <strong>für</strong> Böhmen vor dem ersten Weltkrieg<br />
hatten wir die ethnische Grenze zwischen den deutschen und tschechischen<br />
Gebieten exakt zu ziehen die äußerste Marge des Rechts.« 40 Mit der Besetzung<br />
des verbliebenen tschechischen Staatsgebiets im März 1939 war das deutsche<br />
Archivwesen erstmals zum Sachwalter des Archivwesens eines anderen<br />
Staates geworden. 41 Jenseits ideologischer, nationaler und militärischer Grenzen<br />
behauptet sich zunächst auch im Nationalsozialismus das Grundgesetz deutscher<br />
Archive - auf dem ihm eigenen Medium Papier. Eine Besprechung der deutschen<br />
Archivkommission am 24. April 1940 in Prag setzt, der preußischen Archivwissenschalt<br />
folgend, nachdrücklich fest, daß bei der Auswahl der Archivalien das<br />
Provenienzprinzip zugrunde zu legen sei. Bestände, die tschechische Beamte im<br />
September 1938 aus dem Sudetengebiet abtransportiert haben, werden in die dortigen<br />
Archive, vornehmlich in die Reichsarchive Troppau und Reichenberg,<br />
zurückverbracht. Archivtransfer ist vektoriell vom Prinzip der Provenienz<br />
getriggert, etwa Archivalien, welche die den Sprengein dieser Archive zugeschlagenen<br />
Gebiete betreffen. Aus dem Böhmischen Landesarchiv in Prag werden<br />
ca. 19000 Grundbücher nach dem Provenienzprinzip und 615 Urkunden<br />
nach der sogenannten Urprovenienz entfernt. Die Dekonstruktion des Provenienzprinzips<br />
hegt vielmehr im Zusatz der Präger Besprechung, m einem archivwissenschaftlichen<br />
Ausnahmezustand, wie er die Praxis des NS-Staats (unter<br />
dem Vorschein <strong>von</strong> Regularität im Grundsatz) prägt: »Falls aber Archivgut <strong>für</strong><br />
die Verwaltung oder die <strong>Geschichte</strong> eines Landes <strong>von</strong> Interesse wäre, müsse dieses<br />
natürlich Vorrang haben« . Auch die Anlage <strong>von</strong> Zwischenspeichern<br />
zählt zum Akt der Okkupation; em großer Teil <strong>von</strong> Archivgut<br />
wird als sogenannte Dauerleihgabe aus den tschechischen Archiven fortgeführt.<br />
Nach dem Ende des Krieges werden die Umlagerungen <strong>von</strong> den Alliierten wieder<br />
rückgängig gemacht - Verschichte.<br />
<strong>Im</strong> Protektorat Böhmen und Mähren wird am 1. September 1939 bei der Behörde<br />
des Reichsprotektorats in der Abteilung 1/3 (Allgemeine und Innere Verwaltung)<br />
ein Referat <strong>für</strong> Archivwesen und Schriftgut eingerichtet; mit der<br />
40<br />
Oskar Kossmann, Es begann in Polen: Erinnerungen eines Diplomaten und Ostforschers,<br />
Marburg (Koch) 2. Aufl. 1995, 176<br />
41<br />
Musial 1994: Kap. 5.1.1. »Protektorat Böhmen und Mähren« (144)
720 ARCHIV<br />
Einrichtung des Deutschen Staatsministenums kommt das Referat nunmehr als<br />
Archivreferat zum Ministerium des Innern. Leiter des Böhmischen Landesarchivs<br />
in Prag ist bis Ende 1941 der Tscheche Friedrich Jensovsk; er wird am 8. Oktober<br />
1941 verhaftet und stirbt wenig später im Konzentrationslager. Sein Nachfolger<br />
ist im Februar 1942 der Tschechendeutsche Anton Blaschka, zuvor als Soldat in<br />
der Heeresbücherei Prag eingesetzt. Zweierlei Verlagerung: Neben den Verwaltern<br />
des Gedächtnisses werden auch die Objekte in Lager verbracht; ab Oktober<br />
1942 beginnen wegen der zunehmenden Gefahr <strong>von</strong> Luftangriffen die Flüchtungen<br />
<strong>von</strong> Archivgut aus den Archiven des Protektorats. Die Bestände der Prager<br />
Archive werden größtenteils in Auslagerungsstellen außerhalb der Stadt gebracht;<br />
die wertvollsten Archivalien sind sicherheitsverfilmt. Der Ausnahmezustand<br />
des Krieges ist in der Lage, Akten ihrer Semantik zu entheben und Dokumente<br />
auf ihre pure Materialität, mithin also auf ihren Altpapiercharakter ohne semiotischen,<br />
signifikanten Mehrwert zu reduzieren. Da sich auch im Protektorat<br />
im Kriegsverlauf »der Drang zu Altpapiersammlungen« verstärkte, waren oft<br />
Abgesandte der Landesarchive unterwegs, um bei den nicht hauptamtlich verwalteten<br />
Stadtarchiven Kassationen zu überwachen; in Übereinkunft mit dem<br />
Archiv des Ministeriums des Innern taten sie dies auch bei örtlichen staatlichen<br />
Stellen . In der Sammlung der Gesetze und Verordnungen<br />
des Protektorates Böhmen und Mähren wird eine Regierungsverordnung vom<br />
1. Juni 1943 über die Errichtung des dem Ministerium des Innern in Prag angeschlossenen<br />
Sippenamtes <strong>für</strong> Böhmen und Mähren kundgemacht, nach dem<br />
Vorbild des Reichssippenamtes in Berlin. Dem steht das Amt <strong>für</strong> Sippenforschung<br />
der NSDAP beiseite, charakteristisch <strong>für</strong> den <strong>von</strong> der Partei aufgebauten<br />
Parallelstaat, der auch im Kompetenzstreit um das Zugriffsrecht <strong>von</strong><br />
Staatsarchiven sich immer wieder entfacht. Das Prager Amt steht unter deutscher<br />
Leitung: Sachgebiet I befaßt sich mit der Beschaffung <strong>von</strong> Urkunden <strong>für</strong> den<br />
amtlichen Abstammungsnachweis, Sachgebiet II führt die Überprüfung <strong>von</strong> unklaren<br />
und strittigen Abstammungsfällen, »insbesondere soweit es sich um fremdem<br />
Bluteinschlag handelt«, durch. Dem Sachgebiet III des Sippenamtes obliegt<br />
der Schutz der sippenkundlichen Schriftdenkmäler Böhmens und Mährens, »deren<br />
wichtigste, wie überall«, die konfessionellen Personenstandsregister sind. »Als<br />
eine kriegsbedingte vordringliche Aufgabe fällt dem Sippenamte u. a. die Überwachung<br />
der staatlichen Maßnahmen zum Schütze der sippenkundlichen Quellen<br />
gegen Luftkriegseinwirkung zu.« 42 So ist es im Sinne der Wissensarchäologie kein<br />
Zufall, daß dieser Aufsatz unmittelbar anschließt an den des Abteilungsleiters<br />
Kayser im Reichssippenamt Berlin, über »Photographische Vervielfältigung <strong>von</strong><br />
42 Artur Zechel, Das Sippenamt <strong>für</strong> Böhmen und Mähren, in: Familie, Sippe, Volk Bd.<br />
10 (Berlin 1943), 86ff (86)
ARCHIVTRANSI-T;R UNTKR KRH:GSBI:DINGUNGI-:N 721<br />
Kirchenbüchern«, mithin also: die Mikroverfilmung. Mikroverfilmungen in Paris<br />
und in Berlin bedeuten Durchsehen und Durcharbeiten <strong>von</strong> Akten, keine geschichtshermeneutische<br />
Lektüre - ein am Rande der Äußerlichkeit verbleibendes<br />
Verfahren. <strong>Im</strong> Prager Amt wird es <strong>für</strong> die Erfaßten, wenn sie jüdischer Herkunft<br />
sind, dabei um Leben und Tod gehen:<br />
»Wertvolle sippenkundliche Quellen, die nicht anderweitig bereits archivmäßig<br />
gesichert sind, wird das Sippenamt <strong>für</strong> Böhmen und Mähren in Zukunft zu erwerben<br />
trachten oder auf sonstige Weise ihre Sicherung herbeiführen. Die jüdischen<br />
Personenstandsregister Böhmens und Mährens befinden sich derzeit bei der Jüdischen<br />
Zcntralmatrik < in Prag , die sog. jüdischen Kontrollmatriken<br />
hingegen, die <strong>von</strong> katholischen Matnkelämtern geführt wurden, hat das Sippenamt<br />
bereits in seine Verwahrung übernommen. Sie stellen eine schätzenswerte<br />
Ergänzung der jüdischen Ongmalmatriken dar. Mit ihrer Verkartung wurde<br />
bereits begonnen.« 43<br />
Verkartung gibt das Medium vor, das Menschen in Daten verwandelt und<br />
signaltechnisch verschickbar macht; das Sachgebiet IV erfüllt nicht allein staatliche<br />
Verwaltungsaufgaben, »sondern verfolgt in der Hauptsache wissenschaftliche<br />
Ziele. Es umfaßt die vier Referate Quellenerschließung, Sippenforschung,<br />
Judentumskunde und Sozialanthropologie« .<br />
Ein Arbeitsstab (die Kommission Bittner) beschloß am 16. Dezember 1938<br />
den Entwurf <strong>für</strong> einen Staatsvertrag mit der Tschechoslowakei über die Aussonderung<br />
und Auslieferung des sudetendeutschen Archivguts, der auch nach<br />
der Anghederung des Protektorats Böhmen und Mähren an das Großdeutsche<br />
Reich als Grundlage <strong>für</strong> die Archivtrennungsarbeit beibehalten worden war.<br />
Seine Richtlinien beruhten auf dem Herkunftsgrundsatz (Provenienz),<br />
»obwohl die Tschechen nach 1918 Osterreich gegenüber in weitestem Maße <strong>von</strong><br />
den gleichfalls zunächst proklamierten Herkunftsgrundsatz abgewichen waren<br />
und obwohl die Anwendung dieses Grundsatzes <strong>für</strong> die begründeten Forderungen<br />
der Sudetendeutschen den Verzicht auf den Besitz des wertvollsten und<br />
umfangreichsten Q.uellenguts zu ihrer <strong>Geschichte</strong> bedeutete. Man muß sich diese<br />
Tatsachen stets vergegenwärtigen, wenn man die praktische Durchführung der<br />
Archivtrennung in Angriff nimmt. Nach meinem Da<strong>für</strong>halten wird es nicht möglich<br />
sein, den Herkunftsgrundsatz in allen Fällen starr und unbedingt einzuhalten.<br />
Das ergibt sich schon als Folge aus der <strong>von</strong> allen verwaltungsgeschichtlichen Gegebenheiten<br />
gänzlich unbeeinflußten neuen Grenzziehung zwischen Sudentenland<br />
und Protektorat.« 44<br />
Derselbe Zweite Weltkrieg aber, der ganze. Räume neu ordnet, führt auch das<br />
(wie auch die Gesetzgebung und -anwendung des Copyright) auf dem Begriff des<br />
43<br />
Zechel ebd., 86, unter Verweis auf den Aufsatz <strong>von</strong> Arthur Arndt, in: Familie, Sippe,<br />
Volk, 9. Jg. (1943), 30-32<br />
44<br />
Bundesarchiv, Bestand 15.06 / 35 (Reichsarchiv), betr. Archive im Protektorat, Bl. 32
722 ARCHIV<br />
Territoriums basierende Provenienzprinzip selbst an seine Grenzen und macht<br />
damit den Raum <strong>für</strong> ein Denken drei, das Gedächtnisdaten nicht mehr geo-,<br />
sondern infographisch denkt. Die deutschen gedächtnisstrategischen Argumente,<br />
die den nationalsozialistischen Besatzern zur Legitimation ihrer Ansprüche<br />
auf Archivahenokkupation und -rückführung gedient haben, schlagen<br />
auf Deutschland zurück. Auf einer Tagung <strong>von</strong> leitenden Archivaren am 25. Juni<br />
1946 in Bünde wird die Absicht der britischen Militärregierung bekannt, die in<br />
den Raum der jetzt britischen Besetzungszone geflüchteten deutschen Archive<br />
an ihren Ursprungsort (place of ongin) zurückzubringen ohne Rücksicht darauf,<br />
ob die deutsche Bevölkerung aus diesen Gebieten vertrieben wurde oder<br />
nicht. Doch wenn die Archivgrundlagen selbst neu begründet werden 4 " 1 , wird<br />
die Anwendung des Provenienzprinzips bodenlos. Ein Archivar beschreibt es<br />
<strong>für</strong> die abgetrennten ehemals deutschen Ostgebiete auf völkischer Grundlage:<br />
»Wenn die bisherige Bevölkerung vollkommen vertrieben wird und eine<br />
Neubesiedlung durch ein anderes Volk stattfindet, alle bisherigen Rechtsverhältnisse<br />
und Gesetze also erlöschen und vollkommen neue Besitz- und Rechtsverhältnisse<br />
und Behördenfunktionen neu begründet werden, dann sind die Archive<br />
des dort früher seßhaft gewesenen Volkes <strong>für</strong> die Behörden des neu siedelnden<br />
Volkes praktisch ohne jede Bedeutung selbst <strong>von</strong> den Registraturen der Behörden<br />
des früheren Volkes haben nur die Akten und Zeichnungen <strong>von</strong> erhalten gebliebenen<br />
technischen Anlägen noch praktischen Wert.« 46<br />
Was also nicht der Übersetzung bedarf, ist das non-diskursive, technische<br />
Gedächtnis des 20. Jahrhunderts. Wenn Gedächtniskarten aber historisch<br />
begründet werden, irren nach den Deterritoriahsierungen des Weltkriegs ihre<br />
Zeichen in der Ferne, deutungslos; »dann ergibt sich die Frage ob die Archive<br />
zum toten Raum oder zum Volke gehören. Wenn das vertriebene Volk unter<br />
fremde Völker zerstreut würde - was <strong>für</strong> das jüdische Gedächtnis tatsächlich<br />
der Fall geworden ist -, »als solches also zu existieren aufhörte« - was <strong>für</strong> das<br />
jüdische Gedächtnis <strong>von</strong> Seiten des Nationalsozialismus intendiert, aber nicht<br />
durchführbar gewesen ist -, »blieben die Archive, wenn man sie nicht auch<br />
vernichtete, als herrenloses Gut im leeren Raum zurück. Wenn das vertriebene<br />
Volk aber nur ein Volksteil ist, der in das Restgebiet seines Gesamtvolkes<br />
abgeschoben wird« - differance im Sinne Derndas, buchstäblich ein Verschieben,<br />
das eine Verschiedenheit setzt -, »bleibt in diesem Gesamtvolk ein<br />
Artspruchsbcrechtigtcr <strong>für</strong> die Archive aus dem Vertreibungsgebiet bestehen«<br />
. Diese Begründung aber nicht mehr vor dem Hintergrund einer<br />
45 <strong>Im</strong> Sinne <strong>von</strong> Jacques Derrida, Mal d'Archive, Paris 1995, dt.: Dem Archiv verschrieben,<br />
übers, v. H.-D. Gondek / II. Naumann Berlin (Brinkmann & Böse) 1997<br />
46 Hermann Kownatzki, Grenzen des Provenienzprinzips, in: Archivalische Zeitschrift<br />
Bd. 47(1951), 217-220 (217f)
AlU:i IIVTKANSIT.R UNT1-K KlU 1-XJSBI-.DINGUNGl'N 723<br />
Anbmdung des Archivs an die Verwaltungspraxis der Gegenwart, sondern nur<br />
noch unter Einsatz des historischen Diskurses möglich:<br />
»Braucht das Gesamtvolk diese Archive auch ebenso wenig wie das in dem Vertrcibungsgebiet<br />
neu siedelnde Volk zu praktischen Zwecken, so hat es doch zweifelsohne<br />
ein größeres wissenschaftliches Interesse an diesen Archiven, die eben die<br />
wichtigsten Quellen eines Teiles seines <strong>Geschichte</strong> darstellen. Welche Ansprüche<br />
aber hat der tote Raum an dem schriftlichen Niederschlag des Lebens seiner ehemaligen<br />
Bewohner?« <br />
Gedächtnisphantome, untot. Diese Überlegungen führen zu dem Ergebnis, »daß<br />
aus dem Provemenzpnnzip Schlußfolgerungen nur innerhalb der Kontinuität <strong>von</strong><br />
Volk und Raum gezogen werden können« . Genau diese Kontinuität, die<br />
<strong>Geschichte</strong> (als Subjekt wie als Objekt) verbirgt, hat das Jahr 1945 gebrochen.<br />
Aktenverscbub und -nichtung 1939-1945, und am Ende:<br />
das Telos des deutschen Archivwesens<br />
Inwieweit macht es (noch) Sinn, zwischen dem Gestell des archivischen Gedächtnisses,<br />
semer Hardware, und seiner Logistik, mithin seiner Software, und<br />
schließlich seinen Variablen zu trennen? Angesichts der Entleerung <strong>von</strong> Magazinen<br />
durch Aktenbergung im Luftkrieg Anfang der 40er Jahre heißt es im<br />
Rückblick auf zerstörte Archivgebäude, die archivische Substanz (der Ausdruck<br />
wird damals geläufig) sollte erhalten bleiben. 47 Genau diese noch mögliche<br />
Unterscheidung <strong>von</strong> Gestell und Datensubstanz aber ist es, welche die Epoche<br />
der Gedächtnisarchitekturen <strong>von</strong> der posthistoire der <strong>von</strong>-Neumann-Architektur<br />
(des Computers also) trennt. 48 Rauschen war in der Tat die Drohung des<br />
Übertragungsverlusts <strong>von</strong> Archivalien am Ende des Zweiten Weltkriegs, als ein<br />
Reich sich auflöste; die bereits vor und bei Ausbruch dieses Krieges ge<strong>für</strong>chteten<br />
Gefahren, denen der Ordnungs- und Erhaltungszustand <strong>von</strong> Archivalien auf<br />
Transporten, bei wiederholtem Ein- und Ausladen, »in der Behandlung durch<br />
fremde ungcschultc, vielleicht sogar böswillige Hilfskräfte« und dann während<br />
des Verbleibs in den Ausweichstellen ausgesetzt war, bilden einen ständigen<br />
Gegenstand der Sorge des Kommissars <strong>für</strong> den Archivschutz. Das Mitteilungsblatt<br />
der Archivverwaltung konzentrieren sich auf Hinweise zu Techniken des<br />
Bergens <strong>von</strong> Archivalien. Solange die Übertragung gespeicherter, an virtuelle<br />
Wilhelm Rohr, Die zentrale Lenkung deutscher Archivschutzmaßnahmen im Zweiten<br />
Weltkrieg, in: Der Archivar 3. Jg. Nr. 3 (Juli 1950), Sp. 105-122 (111)<br />
: Siehe Friedrich Kittler, There Is No Software, in: Stanford Literary Review 9.1 (Spring<br />
1992), 81-90 (89 u. 90); dt. in: ders., Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig<br />
(Reclam) 1993,225-242
724 ARCHIV<br />
Leser gerichtete Aussagen nicht digital kodiert ist, bringt der Kanal sein Rauschen<br />
ein; diese Verrauschung des Gedächtnisses als Adreßstruktur kulminiert<br />
unter demselben Kriegsdruck, der auf transatlantischer Seite zur forcierten, physikalisch<br />
implementierbaren Kopplung <strong>von</strong> Kybernetik, Mathematik und Informationstheorie<br />
führt: »Der entscheidende Faktor <strong>für</strong> diesen neuen Schritt war<br />
der Krieg.« 49 Ein Bericht über die Flüchtung <strong>von</strong> Kulturgütern der Stadt Görlitz<br />
vom April 1944 spricht <strong>von</strong> der mit der Bergungsarbeit einhergehenden<br />
»Zerstörung alter und wahldurchdachter Ordnung und einer Gefährdung<br />
unersetzlicher Gegenstände schon durch die Transporte«. 50 Der Krieg interveniert<br />
auch in der Physik der Datenträger selbst, deren internes Gedächtnis: <strong>Im</strong><br />
Goslarer Archiv schmelzen Wachssiegel unter Brandeinwirkung und löschen<br />
die Lesbarkeit ihrer Urkunden - eine Versiegelung zweiter Ordnung. 51 Unter<br />
solchen Bedingungen vollzieht sich auch die Überführung <strong>von</strong> Archiven in Programme,<br />
die das deutsche Gedächtnis meßbar machen:<br />
»Ein Instrument, dessen sich die K.f.d.A. <br />
bediente, um über die Lage bei den einzelnen Archiven jederzeit orientiert zu sein,<br />
war eine in seinem Büro geführte Kartei. Dann waren <strong>für</strong> jedes einzelne Archiv die<br />
eingetretenen Fhegerschäden, deren Art und Umfang sowie das zu ihrer Wiedergutmachung<br />
Veranlaßte, ferner alle Flüchtungen mit Angabe der Ausweichorte und<br />
<strong>von</strong> Art und Menge der geflüchteten Archivalien festgehalten. Sie wurde nach den<br />
eingehenden Berichten und Nachrichten laufend ergänzt. Als Maßstab, wie weit ein<br />
Archiv als gesichert anzusehen war, galt nunmehr in erster Linie der Prozentsatz<br />
der verlagerten Bestände, jeweils berechnet in bezug auf die Gesamtheit der bei dem<br />
Archiv überhaupt vorhandenen Archivalien und daneben gesondert <strong>für</strong> das Archivgut<br />
der höchsten historischen oder politischen Wertstufe.« <br />
Blockaden gegen Archivalientransfer errichtet Hitlers nichtveröffentlichter<br />
Erlaß über die Befehlsgewalt in einem Operationsgebiet innerhalb des Reiches<br />
vom 13. Juli 1944, ersetzt durch den ebenso unveröffentlichten zweiten Erlaß<br />
vom 20. September 1944. Dann wird <strong>für</strong> den Fall eines Vordringens feindlicher<br />
Kräfte auf deutsches Reichsgebiet angeordnet: »Die zivile Verwaltung bleibt im<br />
Operationsgebiet in vollem Umfange bestehen.« Der Reichsminister des Innern<br />
übermittelt infolgedessen am 12. Oktober 1944 den Reichsverteidigungskommissaren<br />
durch Fernschreiben, daß die Behördenleiter da<strong>für</strong> Verantwortung zu<br />
tragen hatten, bei drohendem Feindeinbruch alle wichtigen Akten, »insbesondere<br />
solche geheimer und politischer Art und solche, die <strong>für</strong> den Feind <strong>von</strong><br />
49<br />
Norbert Wiener, Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen<br />
und in der Maschine, Düsseldorf u. a. (Econ) 1992, 28<br />
50<br />
Peter Wenzel, Das Schicksal der Bestände des Görlitzer Ratsarchivs, in: Görlitzer<br />
Magazin, 7. Jg. (1993), 63-83 (68)<br />
51<br />
Siehe Karl C. Bruchmann, über Kriegsverluste und -schaden des Goslarer Archivs, in:<br />
Festschrift Edmund E. Stengel zum 70. Geburtstag, Münster / Köln 1952, 566-575
ARCHIVTRANSI-T:I< UNTI-R KRII ; .GSBIÜ)INGUNGI;N 725<br />
Bedeutung <strong>für</strong> seine Kriegsführung sein können, vernichtet werden. Dazu<br />
gehören auch Karteien der Einwohnermeldeämter, Wirtschaftsämter, Ernährungsämter,<br />
Arbeitsämter und dergl.«'Vor der Vernichtung des Verwaltungsgedächtnisses<br />
steht die seiner Adreßköpfe: der Karteien. Der letzte Satz ersucht,<br />
die nachgeordneten Behörden in einem anderen Medium, nämlich mündlich zu<br />
unterrichten. Die Vernichtung sollte nicht selbst eine Aktenspur hinterlassen,<br />
unauslöschlich; bis an die Gaskammern <strong>von</strong> Auschwitz aber gibt es immer<br />
einen Zeugen, solange administriert wird. Formal halten sich Aktenvernichtungen<br />
bei unabwendbarer Gefahr, daß Unterlagen in die Hände Unberufener<br />
zu fallen drohen, dabei an die Verschlußsachen-Anweisung vom 19. Juni 1935,<br />
d. h. sie geschehen »vor einem Zeugen, der ebenfalls dem zugelassenen Bearbeiterkreis<br />
angehören muß«; dieser hat sie auf Vollständigkeit zu prüfen, bevor sie<br />
in seiner Gegenwart durch den sogenannten elektrischen Wolf oder durch Feuer<br />
zu vernichten sind. Ȇber die Vernichtung ist eine Verhandlung aufzunehmen,<br />
die zu den Akten geht. Außerdem ist dies im Briefbuch zu vermerken.« Noch<br />
präziser sagt es Absatz 26: »Möglichst vollständige Vernichtungsverhandlung ist<br />
nachträglich aufzustellen.« 52 Die Vernichtungen erfassen kaum oder gar nicht<br />
Akten aus der Zeit vor 1933; die Absicht, alle schriftlichen Spuren des eigenen<br />
Herrschafts- und Operationssystems, also des nationalsozialistischen Betriebsgeheimnisses<br />
zu tilgen, führt in den letzten Kriegswochen zu wilden Kassationen.<br />
»Über diese Vorgänge setzt die schriftliche Überlieferung völlig aus«<br />
. Von den Kriegsverlusten des Magdeburger Stadtarchivs<br />
wiederum künden die Findmittel, die erhalten blieben, um auf diese leeren Speicherstellen<br />
zu verweisen (Ordnungsnummern, im Unterschied zu intrinsischen,<br />
dem Objekt selbst anhaftenden Charakteren, entkoppeln die Statthalterfunktion<br />
der pointer des Gedächtnisses <strong>von</strong> dessen Physik): »Alle Akten haben eine Signatur<br />
und sind deshalb als Eigentum der Stadt Magdeburg zu erkennen« 53 ; der<br />
blinde Fleck des Gedächtnisses ist das Betriebsgedächtnis des Archivs. Unter<br />
Kriegsendbedingungen aber wird auch die Archivalienflüchtung schon zur<br />
Gedächtnislöschung als Aufhebung <strong>von</strong> Adressierungsmöglichkeiten; die Akten<br />
der ausgelagerten Publikationsstelle des Berliner Staatsarchivs etwa werden<br />
Anfang 1945 unter Zurücklassung der Regale »unverpackt in den Wagen übereinander<br />
gestapelt« . Das Dispositiv tür Gedächtnis ist<br />
Gestell, und dessen Absenz die Katastrophe jeder Speicherstruktur.<br />
52 Alle Zitate nach: Hans-Stephan Brather, Aktenvernichtung durch deutsche Dienststellen<br />
beim Zusammenbruch des Faschismus, in: Archivmitteilungen 4/1958, 115-117<br />
-<br />
53 Tobias <strong>von</strong> Eisner, Alles verbrannt? Die verlorene Gemäldegalerie des Kaiser Friedrich<br />
Museums Magdeburg. Sammlungsverluste durch Kriegseinwirkungen und Folgeschäden,<br />
Magdeburg (Magdeburger Museen) 1995, 121
726 ARCHIV<br />
Am Rande der Negation, nämlich unter dem Vorschein des Archivalienschutzes,<br />
setzen die Bedingungen des Krieges auch in Deutschland jene Zentralisation<br />
der Archivadministration durch, die im föderativen Reich lange<br />
Phantasma geblieben war. Erneut fungiert dabei Preußen als Metonymie des<br />
Reiches selbst, indem es über ein administrativ funktionales Dispositiv, also<br />
einen Schaltplan verfügt, indem seit Sommer 1940 die anschwellenden Archivangelegenheiten<br />
des Reiches und der besetzten Gebiete im preußischen Archiv<br />
(auch unter Heranziehung <strong>von</strong> Kräften des Reichsarchivs Potsdam) mit dem<br />
Briefkopf Kommissar <strong>für</strong> den Archivschulz bearbeitet wurden. »Doch blieb es<br />
trotz einer zuletzt notwendig werdenden räumlichen Trennung bis zum Schluß<br />
des Krieges bei der durch die Person des Generaldirektors verkörperten, vom<br />
ihm sorglältigsl gewahrten tatsächlichen Einheit der beiden I lallten .seines Stabes«<br />
- Archivkörper, zum Zerreißen gespannt. Die zentrale<br />
Archivverwaltung wird zunächst als Adreßkopf einer postalischen Sendung<br />
behauptet und dann de facto installiert. Es ist die Erschließung einer weiteren<br />
Dimension, die Drohung des Luftkriegs, welche die Reich(s)weiten der zentralen<br />
Archivverwaltung neu definiert: das Reichsluftfahrtministerium verfaßt<br />
Richtlinien <strong>für</strong> die Durchführung des erweiterten Selbstschutzes in Museen,<br />
Büchereien, Archiven und ähnlichen Kultur statten.^ Schon vor Ausbruch des<br />
Zweiten Weltkriegs hatte sich die Diskussion um eine mögliche Unterstellung<br />
der Landesarchive unter die Reichsarchivverwaltung verschärft. 55 Indem Kultur<br />
eine Funktion ihrer Speicher ist, verhindert die Kulturhoheit der Länder notwendig<br />
eine zentrale Archivverwaltung. Gedächtnispolitisch ließ sich diese<br />
Zentralisierung nicht im Normalzustand der Bewahrung, sondern nur unter der<br />
Drohung des Verlust durchsetzen. Der Generaldirektor der Staatsarchive und<br />
Direktor des Reichsarchivs Potsdam, Zipfel, sieht seine Chance zur Zentralisierung<br />
der Archivverwaltung, als er im Weltkrieg das Zusatzamt des Kommissars<br />
<strong>für</strong> den Archivschutz und damit erstmals reichsweite Verfügungsgewalt erhält.<br />
Von Berlin aus verkündet er am 16. Dezember 1941 »Archivalische Maßnahmen<br />
in den eingegliederten und besetzten Gebieten«, und zugespitzt am 29. Juni 1942<br />
Maßnahmen betreffs des Schutzes <strong>von</strong> Akten der Reichskanzlei gegen Fliegergefahr<br />
. Bergbohm, Ministerialrat beim Preußischen Staatsministerium<br />
in Berlin, macht am 7. Juli 1941 gegenüber dem Ministerialdirektor<br />
r>4 Rohr 1950: Sp. 109. Und eine späte Notiz aus Wien: »Ihre Besorgnis über unseren<br />
Bombenschaden in Wien will ich ein bisserl beheben . Es ist ja viel größeres Leid,<br />
daß dieser Sachschaden doch gar nichts ausmacht. Wenn nur die Menschen erhalten<br />
bleiben Hoffentlich bringt uns das Jahre 1945 viel Gutes.« Bundesarchiv, Abt.<br />
Potsdam (jetzt Berlin-Lichterfelde), R 146/40, Bl. 144<br />
55 Bundesarchiv, Abt. Berlin-Lichterfelde, Bestand R 43 II / 860 a, Bl. 71, Dokument<br />
vom 11. Mai 1939
ARCIIIVTRANSI'T.R UNT1-.R KRIHGSBHDINGUNGHN 727<br />
Kntzinger (Reichskanzlei) in seiner Denkschrift, einen etwaigen Führererlaß<br />
über die Errichtung einer Reichsarchivspitze betreffend, Archivgeschichte zum<br />
Argument, zur Handlungsanweisung:<br />
»Das Archivwesen ist Ausdruck der gesamten Staatsverwaltung. Daher ist das<br />
preußische Archivwesen seit Hardenbergs bezw. Bismarcks Zeiten keinem Ressortminister,<br />
sondern dem Staatskanzler bzw. dem Preußischen Ministerpräsidenten<br />
unmittelbar unterstellt. Gewinnen diese partikulanstischen Bestebungen<br />
die Oberhand, so werden die einzelnen staatlichen Archive isoliert, und es entsteht<br />
ein Nebeneinander starrer, <strong>für</strong> sich arbeitender Gebilde ohne Zusammenhang und<br />
Ausrichtung und ohne die Möglichkeit des Einsatzes <strong>für</strong> Ziele, die über den einzelnen<br />
Gau hinausgehen.« <br />
Es geht um nichts weniger als die Neuverschaltung eines bislang parataktisch, parallelgcschaltcten<br />
deutschen Gedächtnisses in eine zentrale Speichereinheit. Ein<br />
Artefakt der deutschen Gedächtnisadministration hegt eingestreut in diese Akte;<br />
das Büro des FHQ bittet am 19. Januar 1942 um «Vorlage der Vorgänge über die<br />
sogen. >Archivspitze
728 ' ARCHIV<br />
Kehrseite: Jüdische Archivlektüren und Gedächtnislöschung<br />
Notierte (schriftfixierte), dann kodierte (mit Signaturen versehene) Schriftstücke<br />
bilden als Archiv nicht vergangene Wirklichkeiten ab (außer die Logistik <strong>von</strong><br />
Verwaltung selbst), sondern bilden - gleich Pixeln einer Bildmenge - die Grundlage<br />
<strong>für</strong> eine narrative Modellierung namens Historie. Hier wird dann eine serielle<br />
Unordnung <strong>von</strong> Daten in eine plausible Ordnung (Erzählung) transformiert.<br />
Die historische Lesart ist dabei eine künstliche. <strong>Im</strong> Winter des Jahres 1903 macht<br />
der Archivar Ezechiel Zivier den (1905 in Berlin realisierten) Vorschlag, ein Allgemeines<br />
Archiv <strong>für</strong> die Juden Deutschlands zu begründen, um aus jüdischen<br />
Körperschaften »ältere Akten und Dokumente, die <strong>für</strong> die laufenden Geschäfte<br />
nicht mehr <strong>von</strong> Belang sind«, also entkoppelt <strong>von</strong> Wirklichkeit als Verwaltungsmacht<br />
im Sinne Droysens (der in seiner Histonk die Transformation <strong>von</strong><br />
Geschäften in <strong>Geschichte</strong> beschreibt), »zur weiteren Aufbewahrung und Nutzbarmachung<br />
<strong>für</strong> geschichtliche und andere Forschungen abgeben könnte« 1 - ein<br />
Gesichtspunkt, der erst nach Einsetzung einer Historischen Kommission beim<br />
Deutsch-Israelischen Gemeindebund 1885 (unter Vorsitz und Mitarbeit der<br />
MGH-Protagonistcn Harry Bresslau und W. Wattenbach) virulent wird. Eine<br />
Inspektion der Dokumentenbestände süddeutscher jüdischer Gemeinden macht<br />
dem reisenden Archivar Zivier deutlich, daß <strong>von</strong> Archiven dort keine Rede sein<br />
kann, sondern vielmehr <strong>von</strong> Überresten in Speichern. Die Abfassung einer kontinuierlichen<br />
<strong>Geschichte</strong> der jeweiligen jüdischen Gemeinden ist auf dieser<br />
Grundlage nicht möglich; wo die Kunde hebräischer Schrift verstummt ist, werden<br />
die entsprechenden Schriftstücke ausgesondert. Anders im Fall der Neuordnung<br />
der Hamburger Deutsch-Jüdischen Gemeinde im 19. Jh., als sich die<br />
konservativen Vertreter da<strong>von</strong> scheuen, »dieses Material, das in hebräischer, d.<br />
h. in der heiligen Schrift niedergeschrieben war, zu vernichten oder als Altpapier<br />
zu verkaufen. Man ließ es aber ungeordnet liegen und konnte auch nicht verhindern,<br />
daß einzelne Aktenstücke und Archivahen verschwanden.« 2 Einmal<br />
aber in Unordnung und unregistriert, d. h. gedächtnissymbolisch unkodiert, liegt<br />
Ordnung allein in der diskreten Buchstabenfolge, also auf der wissensarchäologischen<br />
Ebene der Schriftstücke selbst. <strong>Im</strong> Sinne der <strong>von</strong> der Nachrichtentheorie<br />
entwickelten signal-to-noise-ratio in sinnvolle Historie damit unschreibbar.<br />
Nicht vor dem Hintergrund einer Historie als Fülle vergangenen Lebens, son-<br />
Ezechiel Zivier, Eine archivische Informationsreise, in: Monatsschrift <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
und Wissenschaft des Judentums, 49. Jg. (= N. K 13. Jg.) 1905, 209-254 (209)<br />
Der ehemalige Archivar der Breslauer Synagogengemeinde Bernhard Brilling, Das jüdische<br />
Archivwesen in Deutschland, in: Der Archivar, 13. Jg., Heft 2/3 (1960), Sp. 271-290<br />
(Sp. 285)
Jünisa-u-: ARCHIVI.I-KTÜRKN UND GI-DACHTNISI.ÖSCHUNG 729<br />
dem unter Berücksichtigung einer Absentierung ist diese Abwesenheit zu entziffern;<br />
nicht <strong>Geschichte</strong>, sondern ihr Mangel ist die ästhetische Voraussetzung<br />
des Studiums verbliebener Dokumente:<br />
»Bedenkt man aber, welches das Schicksal der alten jüdischen Ansiedlungen in<br />
Deutschland gewesen, und vergegenwärtigt sich vor allem die Tatsache, dass keiner<br />
der jüdischen Gemeinden ein dauerndes Bestehen vergönnt gewesen ist, dass<br />
auf jede Epoche einer grösseren Blüte eine Vernichtung der Gemeinde und Ausweisung<br />
sämtlicher Mitglieder zu folgen pflegte, so wird man die Spärlichkeit des<br />
Archivalienbestandes sehr erklärlich finden, und sich eher noch darüber wundern,<br />
dass sich soviel erhalten hat.« <br />
Gedächtnislöschung ist hier nicht allein Effekt einer judenverfolgenden Lokalpolitik,<br />
sondern auch der internen Vernachlässigung, der Interesselosigkeit<br />
der jüdischen Gemeinden selbst an alten, <strong>für</strong> die Verwaltung gleichgültig<br />
gewordenen Akten . Allein das Verhältnis der Juden zur Aussenwelt<br />
der jeweiligen Herrschaftsverhältnisse ist somit als Gedächtnis des Staates<br />
in entsprechenden Stadt-, Kommunal-oder Provinzialarchiven gespeichert<br />
. Das innere Leben der Gemeinden, das sich in öffentlichen<br />
Archiven nicht spiegelt, hegt in dort verbleibenden Schriftstücken bestenfalls<br />
fragmentarisch vor. Somit können samples, keine repräsentativen Suchschnitte<br />
gebildet werden. Jenseits der Erzählbarkeit aber speichert eine Zahlenmenge<br />
ein kalkulierbares Gedächtnis - erhaltene Rechnungsbücher, Einzelrechnungen<br />
und Belege. Nicht etwa nur in den Kanzleien der jüdischen Gemeinden<br />
gelte die sich bestätigende Tatsache, »dass die Aufbewahrung der Rechnungen<br />
und der Belege mit grösserer Sorgfalt zu geschehen pflegte, als die <strong>von</strong> anderen<br />
Dokumente« . Daneben sind es die Akten der jüdischen<br />
Gerichtsbarkeit, in denen sich eine autoreferentielle Wirklichkeit speichert.<br />
»Die Lektüre eines solchen Aktcnbündels ist durch die Unmittelbarkeit, mit<br />
der man hierdurch mitten in die Zeit, aus der die Akten stammen, hineinversetzt<br />
wird, belehrender als das Studium einer noch so gelehrten archäologischen<br />
Abhandlung« - eine wissensarchäologische Fehllektüre, die<br />
eine im juristischen Wahrnehmungsraster kodierte Wirklichkeitsregistrierung<br />
mit Leben selbst verwechselt. Das stochastisch Unwahrscheinliche hat erhöhte<br />
Überlieferungschancen; Intus- oder Darinvermerke auf Akten sollen »weniger<br />
das Wichtige als das Unerwartete herausheben« 3 . In die <strong>Geschichte</strong> geht nur<br />
ein, was aufgefallen ist (gut oder schlecht, bestenfalls: Mordfall- und deren Vorakten).<br />
Information der Historie ist deren Unfall, das (statistisch) Unwahrscheinliche.<br />
»Man muß auffällig werden, um in die Akten zu gelangen« 4 -<br />
Kodierung <strong>von</strong> Gewalt, buchstäblich.<br />
3 Heinrich Otto Meisner, Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig (2) 1952, 95<br />
4 Iselin Gundermann, Die Bestände des Historischenen Staatsarchivs Königsberg im
730 ARCHIV<br />
Ziviers Plädoyer <strong>für</strong> ein jüdisches Zentralarchiv in Deutschland entspringt<br />
der Einsicht in die symbolische Gedächtnismaschinerie. Nicht mehr die einzelne<br />
Urkunde (das diplomatische Paradigma der Monumenta Germaniae<br />
Historica), sondern die diskursgestiftete, als Archivserie aber non-diskursiv disponierte<br />
Relation macht Aussagen im Sinne historischer Semantik: »Ein einzelnes<br />
Schriftstück, das an und <strong>für</strong> sich ziemlich wertlos ist, gewinnt erst an<br />
Bedeutung, wenn es mit anderen in Zusammenhang gebracht wird« . Dazu bedarf die als Inhalt deklarierte Buchstabenmenge einer ihrerseits<br />
alphabetischen oder numerischen Kodierung. Denn archivische Zwecke können<br />
gespeicherte Schriftstücke erst dann erfüllen, »wenn sie registriert sind, d.<br />
h. wenn man überhaupt weiss, was vorhanden ist, und« - hier im Unterschied<br />
zu <strong>von</strong> Aufscß< Argumenten <strong>für</strong> ein Gencralrcpertonum <strong>von</strong> über Deutschland<br />
verstreuten Archivalien am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg - »sie<br />
müssen an einem zugänglichen Ort gesammelt daliegen« . So wird an<br />
Schriftstücken vorexerziert, was mit der Einführung <strong>von</strong> Personenkennziffern<br />
später zur Konzentration der Menschen selbst führt.<br />
Es gibt historische Lagen, die sich auf die Ablesbarkeit einziger Dossiers verdichten<br />
lassen. <strong>Im</strong> Rubrum einer Akte des Geheimen Staatsarchivs Preußischer<br />
Kulturbesitz Berlin-Dahlem wird die Rolle des Archivs selbst thematisch, indem<br />
es die <strong>Geschichte</strong> der Juden in Deutschland unter dem Nationalsozialismus mit<br />
einem (Durch-)Strich abkürzt: »Akte des Direktoriums der Staatsarchive, betr.<br />
das Gesamtarchiv der deutschen Juden in Berlin Deutschland<br />
sowie Archivalien betr. das Judentum Bd. 1 vom 10. Juni 1908 - 7. März 1939«. 5<br />
Wo Aktentitel Historiogramme schreiben, läßt sich <strong>Geschichte</strong> als Archiv - also<br />
in der Dokumentenordnung der Aktenbindung - aufzählen. Diese Sequenzierung<br />
hat die Statthalterfunktion <strong>von</strong> tatsächlich Vollzogenem. Koser als Generaldirektor<br />
der preußischen Staatsarchive in Berlin erklärt sich am 5. März 1910<br />
in einem Schreiben an das Staatsarchiv in Posen damit einverstanden, daß entsprechend<br />
einer Anfrage des Kuratoriums des 1905 gegründeten Gesamtarchivs<br />
der deutschen Juden in Berlin die durch behördliche Ablieferung dem Archiv<br />
zugehenden oder in eingesandten Kassationslisten aufgeführten Akten über<br />
jüdische Angelegenheiten, »soweit zur diesseitigen dauerden Aufbewahrung<br />
eine Veranlassung nicht vorliegt«, dem genannten Gesamtarchiv zur Übernahme<br />
angeboten werden. Nach Mitteilung des mit dessen Verwaltung betrauten, im<br />
Geheimen Staatsarchiv ausgebildeten Historikers Eugen Täubler wird dabei<br />
lediglich auf die Erwerbung älterer Archivalien Wert gelegt; die einschlägigen<br />
Geheimen Staatsarchiv Berlin, Vortrag im Rahmen der Interessengemeinschaft Genealogie,<br />
Stadtbibliothek Berlin, 3. März 1999; s. a. Arnold Esch, Überlieferungschance<br />
GehStAr Berlin, Repertorium 178 VII, Nummer 2E8, Bd. 1
JÜDISCHI: ARCIIIVI.r.KTüRKN UND GHDÄCHTNISI.ÖSCHUNG 731<br />
modernen Prozeßakten sollen außer Betracht bleiben . So<br />
bildet sich ein spezifischer Gedächtnisraum als Funktion archivischer (Aus-)<br />
Sonderung; die Neugründung eines Zentralarchivs zur Erforschung der Juden<br />
in Deutschland (Heidelberg) liest dann später unter verkehrten Vorzeichen,<br />
jenen Operatoren der Historiographie: »Ging es den jüdischen Historikern des<br />
Kaiserreichs darum, die jüdische <strong>Geschichte</strong> zu einem Teil der deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> zu machen, so schien es nach der Shoah und nach der Gründung des<br />
Staates Israel ein Verlangen zu geben, die jüdische <strong>Geschichte</strong> aus der deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> herauszulösen.« 6 Die Bildung des Jüdischen Gemeindearchivs in<br />
Breslau verdankte sich einmal den »inneren Auseinandersetzungen mit der zionistischen<br />
Idee und mit den religiös-konservativen Gruppen« , also keiner wie auch immer definierten historischen Notwendigkeit,<br />
sondern diskursstrategischer, funktionaler Gedächtnispositionierung. Die 1924<br />
in Berlin als Reaktionsformation auf die zunehmende innergemeindliche Distanzierung<br />
<strong>von</strong> der jüdischen Vergangenheit gegründete Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Jüdische Familienforschung wendet sich am 7. Februar 1930 an das Geheime<br />
Staatsarchiv mit dem Wunsch, Juden-Akten zu erhalten. Darauf reagiert das<br />
Archiv abschlägig unter Verweis darauf, daß staatliche Akten im Verbund des<br />
Staatsgedächtnisses verbleiben; bei dem Gesamtarchiv der deutschen Juden handele<br />
es sich um ein nicht-öffentliches Archiv, »das durchaus als privates Unternehmen<br />
aufgefasst werden muss. Wir halten es daher grundsätzlich <strong>für</strong><br />
angebracht, ihm staatliche Akten nicht anzuvertrauen.« 7 Der Aggregatzustand<br />
des kollektiven, gemeinhin sozial genannten Gedächtnisses markiert eine radikale<br />
Differenz zur staatlich gebundenen Logik des Speicherns. Daß ein und derselbe<br />
Speicher indes unter umgekehrten Vorzeichen (+/-) gedächtnisenergetisch<br />
umgepolt werden kann, indiziert die Umnutzung des <strong>von</strong> der Gesellschaft <strong>für</strong><br />
Jüdische Familienforschung mobiliserten genealogischen Materials im Dritten<br />
Reich nicht mehr <strong>für</strong> historische, sondern rassenpolitische Zwecke; »der Quellenstoff<br />
der jüdischen Archive war jetzt leider >aktuelles< Material geworden.<br />
Daher hinderten die Rassenämter, die selbst keine Sachverständigen <strong>für</strong> die<br />
Lesung der hebräischen Urkunden und Archivallen besaßen, die jüdischen<br />
Archive nicht in ihrer Sammeltätigkeit«, sondern förderten - analog zum Fall<br />
des unter deutscher Beobachtung fortgesetzten Jüdischen Zentralmuseums in<br />
Prag 1941/42 - die Selbstmemorisierung deutsch-jüdischer Kultur im Zuge ihrer<br />
Auslöschung . Analog zum Prager Museumsprojekt<br />
'' Peter Honigmann, lim Jahrhundert jüdisches Archivwesen in Deutschland, in:<br />
Archive und Gesellschaft. Referate des 66. Deutschen Archivtags [Hamburg, September<br />
1995], Siegburg (Schmitt) 1997, 129-142 (133f)<br />
7 ebd., Bl. 33, Aktennotiz v. 25. Februar 1930, gezeichnet Klingenborg und Posner
732 ARCHIV<br />
plant der Chef des Rassenpohtischen Amts in Breslau Fritz Arlt 1939 die Einrichtung<br />
eines Archivs zur Erforschung der Judenfrage als Summe aus Jüdischem<br />
Gemeindearchiv, Jüdisch-Theologischem Seminar, Jüdischer Gemeindebibliothek<br />
sowie weiterer beschlagnahmter Bestände. »So ist das Breslauer Jüdische<br />
Gemeindearchiv als einziges Überbleibsel der ehemaligen Breslauer Jüdischen<br />
Gemeine erhalten geblieben, nachdem die letzten dort verbliebenen Juden in den<br />
Jahren 1942-1945 deportiert worden war. <strong>Im</strong> Jahre 1947 wurden die auf dem<br />
Breslauer jüdischen Friedhof vorgefundenen Archivalien nach Lodz überführt«<br />
. Jacob Jacobson, Leiter des nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten<br />
in Gesamtarchiv der Juden in Deutschland umbenannten und<br />
1941 vom Reichssippenamt als Abteilung <strong>für</strong> jüdische Personenstandsregister<br />
bei»; Direktor des Rcicbssippenttmlcs offiziell übernommenen Gesamtarchivs in<br />
Berlin, muß - seinem Ausreisewunsch entgegen - die Stelle weiterführen, aber<br />
im Mai 1943 nach Theresienstadt deportiert . Ähnlich prekär<br />
liegt der Fall des Rabbiner Leo Baeck, dessen <strong>Namen</strong> heute eines der größten<br />
Archive zur <strong>Geschichte</strong> des Judentums in New York trägt. Baeck war seit 1933<br />
Präsident der Reichsvertretung der Deutschen Juden, später Reichsvereinigung<br />
der Juden in Deutschland umbenannt; seine umfangreiche Arbeit über Die Entwicklung<br />
der Rechtsstellung der Juden in Europa, vornehmlich in Deutschland<br />
hat er nach eigenen Angaben im Auftraf der nationalkonservativen Opposition<br />
um Carl Goerdeler verfaßt. Nun tauchte auf dem Dachboden des damaligen<br />
Jüdischen Gemeindehauses in Berlin einen Schnellhefter, aus dem hervorgeht,<br />
daß die Schrift auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes erstellt wurde: Am<br />
12. März 1942 ersucht Sturmbannführer Friedrich Suhr um die Vorlage dieser<br />
Arbeit binnen Dreimonatsfrist. Bleibt zu untersuchen, »wie weit sie vom<br />
Gestapo-Befehl geprägt ist, oder ob sie den Intentionen des Reichssicherheitshauptamtes<br />
zuwiderlief 8 - analog zum hermeneutischen Dilemma in der Lesart<br />
des NS-Propagandafilms <strong>von</strong> 1944 über Theresiestadt, der (fälschlich) unter dem<br />
Titel Der Führer schenkt den Juden eine Stadt im filmarchivischen Gedächtnis<br />
firmiert. Die Teilung der Bestände in historische Archivalien und genealogisches<br />
Material ist die Konsequenz der nationalsozialistischen Ausdifferenzierung<br />
zwischen antiquarischem und ideologisch-funktionalem Gedächtnis. Per Rundschreiben<br />
<strong>von</strong> Anfang des Jahres 1939 sind die jüdischen Gemeinden aufgefordert,<br />
ihre genealogischen Bestände zu verzeichnen; die betreffenden Register<br />
werden daraufhin auf dieser Grundlage eingezogen und vom Reichssippenamt<br />
als Zentralstelle <strong>für</strong> jüdische Personenstandsregister konzentriert. Der Luftkrieg<br />
zwingt seit 1943 nicht nur zur Auslagerung der Bestände nach Schloß Rathsfeld<br />
s Dazu Thomas Sparr, Aura <strong>von</strong> Größe und Tragik, in: Die Zeit Nr. 34 v. 16. August<br />
2001,30
JüDisciii-: ARCHIVI.HKTÜRHN UND GI-DÄCHTNISLÖSOIUNG 733<br />
am Kyffhäuser in Thüringen, sondern auch zu ihrer Mikroverfilmung. Tatsächlich<br />
werden die Originale durch Wasserschäden vernichtet; seitdem ist es nur<br />
noch möglich, diese Archive mit Hilfe <strong>von</strong> Mikrofilmen und Fotokopien zu<br />
rekonstruieren und logistisch zusammen- respektive auseinanderzuführen. So<br />
wird das deutsch-jüdische Gedächtnis medienarchäologisch virtualisiert.<br />
Das Gesamtarchiv in Berlin bittet am 24. Dezember 1931 Albert Brackmann,<br />
den Generaldirektor der Staatsarchive, um Erneuerung der Ermächtigung <strong>von</strong><br />
1910, Kassationslisten <strong>von</strong> Akten betreffs jüdischen Angelegenheiten zu erhalten,<br />
da es in steigendem Maß <strong>von</strong> Familiengeschichtsforschern in Anspruch<br />
genommen wird . Wenige Jahre später hat sich die Lage grundlegend<br />
geändert. Das archivalische Mitteilungsblatt vermerkt unter Punkt 11, die<br />
Aktenabgabe an das Gesamtarchiv der Juden in Deutschland zu Berlin betreffend,<br />
daß selbstverständlich die Verfügung vom 5. März 1910 hinfällig geworden<br />
sei. 9 1936 ist Instrument der nationalsozialistischen Rassenpolitik geworden,<br />
was <strong>für</strong> den Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß einmal das Kernprojekt des Germanischen<br />
Nationalmuseums Nürnberg gewesen ist - die Erfassung deutschen Archivguts<br />
im Inventar seines General-Repertonums. Der Schriftverkehr des Berliner Geheimen<br />
Staatsarchivs vom Dezember 1936 benennt ein geplantes Generalrepertonum<br />
über Judaica-Bestände in deutschen Archiven ; auch ein<br />
Schreiben desselben Archivs vom 5. April 1939 an den Generaldirektor der<br />
Staatsarchive behandelt »Findbuchauszüge betr. die Archivalien zur <strong>Geschichte</strong><br />
der Judenfrage« respektive das »Inventar über Archivallen, die sich auf das Judentum<br />
beziehen« 10 ; das Reichsinstitut <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschlands in<br />
München dankt <strong>für</strong> solche Listen . Post senptum sagt ein Dokument<br />
<strong>von</strong> 1943, daß das deutsch-jüdische Archivgedächtnis inzwischen nicht<br />
mehr symbolisch verzeichnet, sondern tatsächlich ergriffen wird:<br />
»Das ehemalige jüdische Zentralarchiv ist, wie ich Ihnen vertraulich mitteile, seinerzeit<br />
vom SD beschlagnahmt und dem Reichssippenamt zur vorläufigen Betreuuung<br />
übergeben worden. Das Reichssippenamt hat diejenigen Teile <strong>für</strong> sich<br />
ausgesondert, die es <strong>für</strong> seine Arbeiten braucht, leider aber auch Kassationen vorgenommen,<br />
ohne einen Archivfachmann zu Rate zu ziehen. Der Rest des Bestandes,<br />
die sogenannten historischen Bestände im Umfange <strong>von</strong> 1700 Paketen, ist vom<br />
Sicherheitshauptamt dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem zu treuen Händen<br />
überggeben worden. Er soll später auf die zuständigen Archive verteilt werden.«<br />
<br />
9<br />
A. a. O., Bl. 47: Abschrift f. Fr. A.2 E.8. Auszugsweise Abschrift aus dem Mitteilungsbl.<br />
r. 2v. 18.1.37-A.V.353/37<br />
10<br />
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Rep. 178 VII 2E8,<br />
Bd. 2, v. 8. März 1939-1944, Bl. 8
734 ARCHIV<br />
Ein Archivkörper wird hier an rassenstatistische Operationen gekoppelt. Wo Personen-<br />
über Speichcrkontrolle verläuft, erhalten Archive jene Bedeutung, die<br />
Brackmann auf dem deutschen Archivtag 1934 <strong>für</strong> die Zeit des neuen Reiches definierte:<br />
daß nämlich »<strong>für</strong> die Volkskörperforschung die Konservierung <strong>von</strong> sippenkundlichen<br />
Archivalien« Bedingung ist. Tatsächlich ist es der Aktenkorpus der<br />
Nation, auf dem sich die Observationstechniken in ihrer Exteriorität einschreiben:<br />
die »Zähmung und Steuerung dieses Körpers in seiner unvordenklichen<br />
Komplexität und Vergeßlichkeit.« 11 Das Archiv wird zum Ereignisort, indem<br />
seine Vermessung nicht nur Individualität dokumentierbar macht, sondern auch<br />
Kollektive. Das Feld der Überwachung bildet ein Netz des Schreibens und der<br />
Schrift; es überhäuft und erfaßt Individuen mit einer Unmasse <strong>von</strong> Dokumenten.<br />
»Von Anfang an waren die Prüfungsverfahren an ein System der Registrierung<br />
und Speicherung <strong>von</strong> Unterlagen angeschlossen.«'- Solche Satze aber, gemünzt<br />
auf einen historischen, also in Archiven erschlossenen Untersuchungsgegenstand,<br />
sind auch eine Allegone ihrer eigenen Operation; <strong>Geschichte</strong> ist Schriftmacht,<br />
Register und Kode als Subjekt (narratio rerum gestarum) wie als Objekt (res<br />
restae, in diesem Fall: Register und Inventare). Nichts anderes vollzieht das System<br />
der Archive: die Korrelierung <strong>von</strong> Elementen, »die Speicherung und Ordnung der<br />
Unterlagen, die Organisation <strong>von</strong> Vergleichsfeldern zum Zwecke der Klassifizierung,<br />
Kategonenbildung, Durchschnittsermittlung und Normenfixierung«; zu<br />
den grundlegenden Bedingungen einer Gedächtnisdisziplin in beiden Bedeutungen<br />
des Wortes gehören Aufzeichnungsverfahren, »welche die individuellen Daten<br />
lückelnlos in Spcichersysteme einbringen« . Archivische Praxis als<br />
Infrastruktunerung <strong>von</strong> Gedächtnis heißt Notierung, Auflistung und Tabelherung;<br />
dementsprechend hat sich die Geburt der Wissenschaften vom Volkskörper<br />
»in jenen ruhmlosen Archiven« zugetragen, welche die Datenvorlagen <strong>für</strong> das<br />
moderne System der Zwänge gegen diesen Kollektivkorpus erarbeitet haben<br />
. Der Unterschied <strong>von</strong> Archiven zu Medien (im nachrichtentechnischen<br />
Sinn) ist dabei einzig und allein, daß sie Daten nur sammeln, speichern und<br />
übertragen, nicht aber auch berechnen (sei es als Statistik, sei es als historiographische<br />
Erzählung). Archivische Speicherprozeduren setzen in Regimen, in denen<br />
sich Macht nicht mehr über Sichtbarkeit manifestiert, die Schwelle der beschreibbaren<br />
Individualität herab, indem sie Massendaten speichern. Es geht ihnen nicht<br />
um ein Monument <strong>für</strong> ein künftiges Gedächtnis (Historie), sondern Dokumentation<br />
<strong>für</strong> unverzügliche fallweise Auswertung. Damit aber liegt überhaupt kein<br />
" David Wcllbcry, Diskussionsbeitrat;, in: 1 lartmut Kggcrt / Ulrich Profitlich / Klaus R.<br />
Schcrpc (1 lg.), <strong>Geschichte</strong> als Literatur, Formen und Grenzen der Repräsentation <strong>von</strong><br />
Vergangenheit, Stuttgart (Metzler) 1990, 382f (in Anlehnung an Michel Foucault)<br />
'" Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, übers. Walter<br />
Seiner, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1977, 10. Aufl. 1992, 243f.
Jünisci-n: ARCIIIVI.UKTÜRKN UND GUDÄCHTNISI.ÖSCHUNG 735<br />
emphatisches Gedächtnis mehr vor, vielmehr die Überführung der Archivfunktionen<br />
in die Rückkopplungspraxis <strong>von</strong> Zwischenspeicherung und Gegenwart.<br />
<strong>Im</strong> nationalsozialistisch regierten Deutschland vollzieht genau dies; im Streit um<br />
das Recht zur Betreibung und Speicherung jüdischer Personenstandsregister verdrängt<br />
der Einsatzstab Rosenberg die Staatsarchive aus ihrer dementsprechenden<br />
Funktion. In diesem Moment zeigt sich das Staatsarchiv nicht als Instrument, sondern<br />
Widerstand <strong>von</strong> Disziphnarverordnung. 1939 weigern sich die Archivare,<br />
aufgrund der 2. VO zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung <strong>von</strong> Familiennamen<br />
v. 17. August 1938 Änderungen an jüdischen Archivalien vorzunehmen<br />
(die Zwangsstandardisierung jüdischer Vornamen in Israel bzw. Sara). Wo<br />
<strong>Namen</strong> zu Adressen <strong>von</strong> Personenstandgedächtnissen sind, bilden sie die Bedingung<br />
<strong>von</strong> Erinnerung als Findbarkeit überhaupt. »Man frage mich nicht, wer ich<br />
bin, und man sage mir nicht, ich solle der gleiche bleiben: das ist eine Moral des<br />
Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere.« 13 Der anonymisierenden Datenkontrolle<br />
gegenüber steht die anamnetische Arbeit des erzählenden Historikers,<br />
der den Daten aus dem Archiv wieder ein Gesicht zu verleihen sucht, prosopopoietisch.<br />
Mit einer Weisung des Reichs- und Preußischen Minister des Innern<br />
vom 22. Januar 1937 an die Preußische Archivverwaltung und das Reichsarchiv<br />
ergeht auf Betreiben des Reichsinstituts <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschland<br />
(Referat Judenfrage) der Auftrag, sämtliche im Besitz der Archive befindlichen<br />
Judaica vom 1. Januar 1937 an zu registrieren und listenmäßig zu erfassen. Das<br />
Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde (vormals Bestände Potsdam) speichert unter<br />
der Adresse 15.06 Nr. 55 (Bl. 21) dieses Schreiben, das selbst ein Programm zur<br />
Dokumentenspeicherung <strong>für</strong> staatliche Archive definiert; im Zustand des Archivs<br />
fallen, wissensarchäologisch betrachtet, Gedächtnisdaten und die Anweisung ihrer<br />
Aktivierung incins. Ergebnis der vorliegenden Anweisung soll ein Gesamtrepertonum<br />
über Judaica-Bestände in deutschen Archiven sein; <strong>für</strong> die Dauer der<br />
Erfassung sind die Aktengruppen <strong>für</strong> jüdische Leser gesperrt und damit aufgehoben.<br />
1941 definiert Wilhelm Grau im Publikationsorgan des Frankfurter Institut<br />
zur Erforschung der Judenfrage als dessen Aufgabe die »Sicherstellung«<br />
entsprechender Geschichtsquellen; da das Judentum sich stets wesentlich<br />
staatsfremd verhalte, habe es auch wenig Spuren in Staatsarchiven des 19. und 20.<br />
Jahrhunderts hinterlassen. Diese Absenz sei jedoch durch die Durchforstung<br />
behördenfremder Archive (Wirtschaft, Börse, Presse) zu kompensieren; Staatsarchive<br />
sind so nicht mehr deckungsgleich mit dem völkischen Gedächtnis der<br />
Nation. 14 Das Repertonum jüdischer Archivalien, einst Instrument nationalso-<br />
13 :;<br />
Michel Foucault, Archäologie des Wissens ( 'Paris 1969), Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1981,32<br />
14<br />
In: Weltkampf. Die Judenfrage in <strong>Geschichte</strong> und Gegenwart, hg. v. Wilhelm Grau,<br />
Bd. 1 u. 2 (April / September 1941), 17
736 ARCHIV<br />
zialistischer Rassenpolitik, ist heute, unter verkehrten Vorzeichen, die Bedingung<br />
eines Gedächtnisses, das sonst nicht denkbar wäre. In einzelnen Archiven bilden<br />
diese Vervielfältigungen bzw. Durchschläge oft den einzigen Nachweis vom einstmaligen<br />
Vorhandensein solcher Quellen gegenüber planmäßigen oder unsystematischen<br />
Vernichtungen sowie Knegsvcrlusten. 15<br />
Binantät <strong>von</strong> Absenz und Präsenz: Das archivische Gedächtnis der Juden in<br />
Deutschland, <strong>von</strong> den Nationalsozialisten einst instrumentalisiert im Kontext eines<br />
Vernichtungsplans, ist als mnemische Energie umpolbar. In einem Fernschreiben<br />
des SS-Gruppenführers Heydnch zum Pogrom vom 9./10. November 1938 wird<br />
angewiesen, in allen Synagogen und Geschäftsräumen der jüdischen Kultusgemeinden<br />
vorhandenes Archivmatenal polizeilich zu beschlagnahmen, »damit es<br />
nicht im Zuge der Demonstration zerstört wird.« Es komme dabei auf das »historisch<br />
wertvolle Material« an, nicht etwa auf neuere Steuerlisten usw. 16 »Sofern mit<br />
der Reihenfolge der Aufzählung der einzelnen Festlegungen im Telegramm eine<br />
Wertung verbunden war, rangierte die Sicherung der Archive sogar noch vor der<br />
Erfassung reicher und arbeitsfähiger Juden <strong>für</strong> die Konzentrationslager« . Nach dem Novemberpogrom 1938 wird <strong>von</strong> Seiten<br />
der Staatsarchive nicht nur eine verstärkte archivpflegensche Aufsicht über die<br />
beschlagnahmten jüdischen Archivalien, sondern auch die Aufteilung des jüdischen<br />
Gesamtarchivs in Berlin mit der Begründung gefordert, daß die »Ausscheidung<br />
des Judentums aus dem Leben des deutschen Volkes in ihr abschließendes<br />
Stadium getreten« sei. 17 Der Begriff der Ausscheidung - im Unterschied zum<br />
Begriff der differierenden Unterscheidung (Jacques Derridas Neologismus der differance)<br />
- ist dabei sowohl kollektivsymbolisch geladen (Volkskörper und Organismus)<br />
wie ein archivwissenschaftheher Fachterminus, der hier metonymisch <strong>von</strong><br />
Aktenspeicher- auf Menschenverwaltung übertragen ist. Nicht nur ist damit<br />
die <strong>von</strong> jüdischer Seite aus ehemals beabsichtigte Funktion des Gesamtarchivs,<br />
. Urkunden und Akten durch zentrale Inventarisierung »zu wissenschaftlichen und<br />
administrativen Zwecken vorzubereiten«, in Kopplung an NS- Administration<br />
gegen sich selbst pervertiert, sondern sein langfristiges Ziel, »Schicksale des allmählichen<br />
Verwachsens der Juden mit dem deutschen Volkskörper« historisch<br />
nachzuweisen; das Diskurselement Volkskörper wird seit 1933 deutschen Juden<br />
13 Matthias Herrmann, Das Reichsarchiv (1919-1945). Eine archivische Institution im<br />
Spannungsfeld der deutschen Politik, 2. (inhaltlich unveränderte) Ausgabe 1993, Diss.<br />
phil. Berlin: Humboldt-Universität, Bd. 2, Kapitel 8; 385ff (387)<br />
16 Zitiert <strong>von</strong> Herrmann 1993: 388f unter Bezug auf: Der Nürnberger Prozcss. Aus den<br />
Protokollen, Dokumenten und Materialien , ausgew. u. eingel. v. Peter Alfons<br />
Steiniger, Bd. II, Berlin (Rüttcns & Loening) 1962, 81 ff<br />
17 Schreiben des Direktors des Staatsarchivs Darmstadt Ludwig Clemm am 7. Dezember<br />
an Zipfel. GStA Berlin, Rep. 178, VII, Nr. 2 E 8, Bd. 1, Bl. 233, zitiert nach: Musial<br />
1994: 51; s. a. Herrmann 1993, 390
Jüniscin: ARCHIVI.I-.KTÜRI-N UND GHDÄCHTNISI.OSCHUNG 737<br />
gegenüber, gerade weil sie sich auf diese Sprachregelung eingelassen haben, umpolbar.<br />
18 Das Kollektivsymbol Volkskörper - gerade weil es, entgegen seiner vordergründig<br />
ideologisch-diskursiven <strong>Im</strong>plikationen, so unmittelbar an das Dispositiv<br />
<strong>von</strong> Statistik und Archiv gebunden ist, ja <strong>von</strong> ihnen geradezu hervorgebracht wird<br />
- überdauert später den Zusammenbruch des NS-Staats in dem technischen Maße,<br />
wie auch die Berechnung der Nation (in weitergeführter medialer Notation) sich<br />
fortschreibt: »Von der Geburt eines Menschen begleitet ein zentraler Staats-Computer<br />
sein ganzes Leben bis zum Tod. Er registriert <strong>für</strong> jeden Menschen alle <br />
gezeigten Informationen. Damit können Sie ihren Volkskörper jederzeit durchleuchten.«<br />
19 Zipfels Verordnung zur Sich er Stellung des Schrift- und Archivguts der<br />
Juden in Deutschland vom 28. November 1938 jedenfalls zielt auf die Zuweisung<br />
des durch NS-Behörden beschlagnahmten jüdischen Archivguts und des jüdischen<br />
Zentralarchivs an die Staatsarchive - ein Anliegen, dem sich NS-Organe wie<br />
Sicherheitsdienst, Geheime Staatspolizei, Sippenstelle, Partei- und Reichsinstitut<br />
<strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschlands widersetzen. 20 <strong>Im</strong> Gegenzug richtet<br />
die Sippenstelle im März 1939 in den Berliner Räumen des deutsch-jüdischen<br />
Gesamtarchivs die Zentralstelle <strong>für</strong> jüdische Personenstandsregister ein; »der Zugriff<br />
auf die jüdischen Archivalien blieb der preußischen Archivverwaltung vorerst<br />
versagt« . Archivisch sortierte Daten sind nicht deshalb<br />
schon im Raum der Vergangenheit; als Teil aktueller Administration sind Akten<br />
reaktivierbar, mithin also nicht mit historischer Semantik, sondern funktionaler<br />
Information geladen - Vorgänge, die nicht historiographisch, sondern gedächtniskybernetisch<br />
faßbar sind. Zwar werden in den preußischen Staatsarchiven<br />
entsprechende Datenmengen nach dem Provenienz gespeichert, doch erfolgt ihre<br />
Reaktivierung nach Betreff. Für die Vorbereitung einer Propagandaaktion benötigt<br />
das Reichsministerium <strong>für</strong> Volksaufklärung und Propaganda Mitte 1939<br />
»dringend Material über <strong>von</strong> Juden verübte politische Attentate«. 21 An die Stelle<br />
archäologischer Diskretion, des archivischen Wissens um die Diskontinuität<br />
gespeicherter Daten, rückt ein Zugriff, der alles Gedächtnis zur Funktion gegenwärtiger<br />
Politik macht, zum historischen Präsenz macht.<br />
18 Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen Juden, hg. v. Eugen Täubler, 1. Jg.<br />
(1909), Zur Einführung, 1-8 (lf)<br />
19 Oberingenieur F. Martin, Verwaltungsratspräsident der ORGA-RATIO AG Baden-<br />
Zürich, Elektronik und Automation. Ihre umwälzenden Auswirkungen in den nächsten<br />
Jahren [Vortrag vom 18. November 1963 vor Mitgliedern des Industneclubs e.V.<br />
Düsseldorf]. Druckschrift, inkludiert im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Signatur RW<br />
240 Nr. 1269, 20<br />
20 Musial 1994: 51, unter Bezug auf: Bundesarchiv Potsdam, RA, Nr. 7, Bl. 488-490<br />
21 Schreiben des Geheimen Staatsarchivs an den Generaldirektor der Staatsarchive am<br />
16. Mai 1939, ebd., Bl. 300r. Sachbearbeiter dieser Anfrage ist Staatsarchivassessor<br />
Wolfgang Mommsen, später Leiter des Bundesarchivs in Bonn.
738 ARCHIV<br />
In Berlin erfolgt erst die Errichtung der Zentralstelle <strong>für</strong> Jüdische Personenstandsregister,<br />
dann die Zurückdrängung <strong>von</strong> dessen jüdischen Mitarbeitern aus<br />
leitenden Funktionen; nicht anders müssen die eingearbeiteten Kräfte der Jüdischen<br />
Kultusgemeinde in Prag 1943 ihre Plätze zugunsten <strong>von</strong> »arisch versippte<br />
Juden« räumen und »verlegen ihren Wohnsitz nach Theresicnstadt«. 22 .<br />
Die Berliner Jüdische Gemeinde erhebt keinen Protest gegen die Inanspruchnahme<br />
des Materials durch Angestellte der Reichsstelle <strong>für</strong> Sippenforschung der<br />
NSDAP. 1941 wird die Zentralstelle aufgehoben, da die Speicherkontrolle <strong>von</strong><br />
jüdischen Bürgern sich erübrigt; sie hatte ihren Zweck erfüllt, Abstammungs- und<br />
Ausreiseunterlagen auszustellen. »Die Wannsee-Konferenz kann deshalb <strong>für</strong> die<br />
inländischen Archive kaum noch als Zäsur gelten« (Herrmann); das archivische<br />
Ereignis folgt einem anderen Zeittakt als das der Historie. »Bei aller Kenntnis<br />
über den Gang des Geschehens konnte das Archivwesen zumeist nur darauf hoffen,<br />
als letztes Glied in der Kette nach Auswertung des Schriftgutes berücksichtigt<br />
zu werden, um die Dokumentation über ein künftig nicht mehr vorhanden<br />
seiendes Kulturvolk aufzubewahren« . So bilden die jüdischen<br />
Archivalien bis 1945 zunehmend einen virtuellen Raum, das Gedächtnis<br />
einer Aktenkonstellation, die sich <strong>von</strong> der tatsächlich vollzogenen Historie unterscheidet.<br />
Solche archivische Textlagen sind nicht mehr in <strong>Geschichte</strong>(n) zu transformieren;<br />
administrative Kürzel und Aktenzeichen sind die Vektoren, aber nicht<br />
mehr erzählbaren Aussagen der Ereignisse.<br />
Folgen des Novemberpogroms<br />
Ein Bericht des Staatsarchivs Königsberg über Jüdische Familienregister in der<br />
Provinz Ostpreußen hat serielle Struktur: Listen der vergleiteten und unvergleiteten<br />
Juden, Popuationstabeilen, Synagogen Listen. 23 Ein Volk, dem keine<br />
Zukunft mehr zugewiesen war, wird nicht mehr erzählt, sondern zahlenmäßig<br />
erfaßt. Diese Daten sollten das Gedächtniskapital, die Datenbank einer künftigen<br />
Geschichtsschreibung als Stimme des Nationalsozialismus bilden; nur so<br />
erklärt sich, daß Vernichtungspolitik mit Datengedächtnis einhergeht. Der<br />
Reichsminister des Innern in Berlin unterstreicht - im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
- am 13. März 1939 gegenüber dem Direktor des Rcichsarchivs die Suprematie<br />
<strong>von</strong> nicht mehr nur juristisch-etatistischen, sondern ideologisch-diskursiven<br />
22 Ältestenrat der Juden in Prag, Bericht über das Jahr 1943, Yad Vashem Archive, Signatur<br />
FA-156. Mit Dank an Hanno Loewy, Leiter des Fritz Bauer Instituts in Frankfurt/M.,<br />
<strong>für</strong> die Übermittlung dieses Archiv-Funds.<br />
23 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Rep 178 VII 2E8, Bd.<br />
2, v. 8.3.1939-1944, Bl. 2 (Abschrift)
JÜDISCIIH ARCHIVU-;KTÜI
740 ARCHIV<br />
Gedächtnis kann, wenn postlagernd vorliegend, auch nachträglich beschlagnahmt<br />
werden. Das Staatsarchiv Königsberg wendet sich am 3. März 1939 an den<br />
lokalen Polizeipräsidenten, nachdem die dortige Synagogengemeinde einen Teil<br />
Ihrer Akten Vorjahren zunächst dem Jüdischen Zentralarchiv in Berlin, dann -<br />
nach Verzeichnung der Bestände - 1928 dem Königsberger Staatsarchiv als<br />
Depositum, d. h. unter Wahrung ihres Eigentumsrechts übergeben hat. »Heute<br />
beantragt die Synagogenmegemeinde die >Aushändigung< eines Aktenstückes.<br />
Ich bitte um Klärung der Rechtslage« . Antwortet die Geheime<br />
Staatspolizei Königsberg, 28. April 1939: »Soweit Akten der Synagogengemeinden<br />
Archivwert besassen, sind sie anlässlich der Judenaktion beschlagnahmt worden.<br />
Die zu einem früheren Zeitpunkt dem Staatsarchiv zur Aufbewahrung<br />
übergeben Akten können nicht anders behandelt werden wie die am 9.11.1938<br />
beschlagnahmten«. Gegen eine schriftliche, also mediatisicrte Auskunftscrteilung<br />
dagegen werden keine Bedenken erhoben ; Gedächtnismacht heißt hier<br />
Verfügung über das Reale, nicht das Symbolische der Akten. Der Generaldirektor<br />
der Staatlichen Archive Bayerns verteidigt (in seinem Schreiben vom 4. Mai<br />
1939 an den Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive) gegenüber Plänen der<br />
Reichsstelle <strong>für</strong> Sippenforschung, »Judenmatrikel an sich zu ziehen«, das archivische<br />
Recht zur Wahrung des Provenienzprinzips; eine solche Maßnahme würde<br />
eine den »Grundsätzen der archivalischen Herkunft völlig wiedersprechende<br />
Zerreissung einheitlicher Bestände bedeuten« . Hier erweist sich das<br />
preußisch-archivische Kredo der Datenspeicherung gemäß ihrer behördlichen<br />
Provenienz als-Widerstand gegenüber einer zu machtpolitischen Zwecken umdefinierten<br />
Logistik der Datenverwaltung. Tatsächlich folgt auch die Ordnung, die<br />
heutige Einsehbarkeit der archivischen Dokumentation dieses Schirftverkehrs der<br />
<strong>von</strong> der Archivordnung vorgesehenen Abfolge: provenient zusammengefügte<br />
Akten. Ein Rundschreiben aus Berlin vom 1. August 1939 an alle Staatsarchive<br />
reagiert auf die vom Reichsminister <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung<br />
erlassenen Richtlinien vom 15. Mai 1939 über den Schutz deutschen Kulturgutes<br />
gegen Abwanderung, konkret die »Mitnahme <strong>von</strong> Umzugsgut bei der<br />
Auswanderung <strong>von</strong> Juden« . Denn Gedächtniskultur ist eine Funktion<br />
ihrer Speicher, und diese sind in nationalen Dimensionen organisiert. Am 4. Januar<br />
1940 ergeht eine Rundfrage an die Staatsarchive betreffs jüdischer Achivalien und<br />
aktueller Arbeiten über Judenfragen in Archiven:<br />
»1. Welche jüdischen Archivalien sind bereits vor den Novemberereignissen des<br />
Jahres 1938 als Deposita der auf sonstige Weise in Staatsarchive gelangt?<br />
Wirtschaftsinformatik, Abschnitt »Information und Kommunikation«, in: Peter<br />
Rechenberg / Gustav Pomberger (Hg.), Informatik-Handbuch, München / Wien<br />
(Hanser) 1997, 859ff (860)
JÜDISCIII-: AIU:II[VÜ-;KTÜIU.N UND GUMCHTNISLÖSCHUNG 741<br />
2. Welche Arbeiten wesentlichen Inhalts über jüdische Probleme sind seit 1933 <strong>von</strong><br />
Beamten oder Benutzern des Staatsarchivs angefertigt worden?<br />
3. Was ist über das Schicksal der im November 1938 und sonst <strong>von</strong> den Polizeidienststellen,<br />
den Parteiformationen usw. erfaßten jüdischen Archivahen bekannt?« 2 ' 1<br />
Unter den Antworten findet sich ein Schreiben des Staatsarchivs Breslau vom<br />
30. Januar 1940. Das dortige Provinzialarchiv der schlesischen Judengemeinden<br />
war geschlossen und mitsamt der damit verbundenen Bücherei <strong>von</strong> der Gauleitung<br />
Schlesiens der NSDAP (Rassenpohtisches Amt) beschlagnahmt worden;<br />
unter Vcrfügungsvorbehalt des Rasscnpolitischen Amts wurde diese Gedächtnismaterie<br />
»vorläufig ungeachtet und unverzeichnet im Schlesischen Museum<br />
<strong>für</strong> Kunstgewerbe und Altertümer hier hinterlegt« . Breneke vom<br />
Geheimen Staatsarchiv in Berlin schreibt dem Generaldirektor der Staatsarchive<br />
am 7. Februar 1940 betreffs jüdischer Personenstandsregister. Diese wurden<br />
aufgrund der Gesetzgebung <strong>von</strong> 1812 bei Polizeibehörden gesondert geführt;<br />
davor existierten nur in den jüdischen Kultusgemeinden solche Listen:<br />
»Grundsätzlich muß m. E. daran festgehalten werden, daß ciiese Register zur dauernden<br />
Aufbewahrung in die zuständigen Archive gehören . Deren Anspruch<br />
der Reichssteile <strong>für</strong> Sippenforschung ist m.E. demnach abzulehnen. Eine<br />
Trennung der Register und Akten würde nicht nur allen Grundsätzen einer gesunden<br />
Archivverwaltung wiedersprechen . Rücksicht auf die Erhaltung des<br />
Zusammenhanges organisch erwachsener Registraturen noch viel bedenklicher<br />
als die Herausreißung der Register allein aus dem natürlichen Boden,<br />
auf dem sie erwachsen sind.« <br />
Erneut insistiert die archivästhetische Provenienz. Breneke weist auf Erfahrungen<br />
der letzten Jahre hin, daß nämlich »die Aufhellung dunkler und verworrener,<br />
darum eben oft besonders wichtiger Zuammenhänge aus den Akten häufig<br />
nur dem geschulte Auge des Archivars gelingt« . Denn das Archiv als<br />
spezifisches Gedächtnisaggregat speichert nicht nur Dokumente, sondern ist in<br />
seinem Betriebssystem selbst ein gedächtniswissendes Programm.<br />
Als Walter Frank, Leiter des Reichsinstituts <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> des neuen<br />
Deutschland, eine Recherche des Reichsarchivs nach dem Nachlaß Walther<br />
Rathenaus veranlaßt, resultiert dies in einem Kompetcnzkonflikt beider Institute.<br />
Zu einem entsprechenden Schreiben des Reichsführers SS (markiert durch<br />
die entpsrechende Sondertaste aus der Schreibmaschine) und Chefs des Sicherheitshauptamtes<br />
vom 19. September nimmt der Direktor des Reichsarchivs in<br />
Potsdam (9. Oktober 1939) an den Reichsminister.des Innern Stellung. Das<br />
Reichsarchiv hatte die Beschlagnahme der Rathenau-Papiere zwar mit Genehmigung<br />
des Reichsministeriums des Innern veranlaßt, doch auf Weisung des<br />
2( ' Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Rep. 178 VII 2E8,<br />
Bd. 2 v. 8. März 1939-1944, Bl. 39
742 ARCHIV<br />
Chefs des Sicherheitshauptamtes war das beschlagnahmte Schriftgut dem<br />
Reichsarchiv nicht ausgeliefert worden. »Diese Verfügung wird mit der<br />
politischen Aktualität des Materials begründet.« 27 Die Papiere sind bei Auflösung<br />
der Rathenaustiftung 1933 den Erben über das Reichsministerium des<br />
Innern zugewiesen worden; das Schreiben setzt nun ihre Beschlagnahmung in<br />
einen umfassenden, neudefinierten deutschen Gedächtniskontext. Die deutschen<br />
Archiwerwaltungen, so heißt es, haben seit je ihren Ehrgeiz dahin gesetzt, durch<br />
Veröffentlichungen <strong>von</strong> Quellenmaterial und <strong>von</strong> Darstellungen die ihr anvertrauten<br />
Dokumente einem weiteren Kreis zugänglich zu machen, wobei diese<br />
Publikationstätigkeit nicht auf rein historische Gegenstände beschränkt war; der<br />
Verfasser erinnert an die große Aktenpublikation des Wiener Haus-, Hof- und<br />
Staatsarchivs über den Weltkrieg »oder die ganz aktuelle Arbeit der Publikationsstelle<br />
des Preußischen Geheimen Staatsarchivs auf dem Gebiete der Ostpolitik«.<br />
Was heißt nun Aktualisierung der Akten, jener Sprach(arte)fakten 28 ?<br />
»Allerdings darf man Archiwerwaltungen nicht mit politischen Propagandainstituten<br />
verwechseln. Vielmehr mußten sich die Archivare oft darauf beschränken,<br />
ihr Schriftgut zu ordnen und seine Erschließung den mit Verwaltungsaufgaben<br />
nicht belasteten Vertretern der Wissenschaft anheimzustellen. Die Wissenschaft<br />
arbeitet nun freilich nicht nach einem rationalisierten Jahrcsplan, sie ist in<br />
ihren Zielsetzungen frei und unreglementert. Diese Ziele aber sind zu verschiedenen<br />
Zeiten verschieden. Als der König <strong>von</strong> Preußen jüdischen Täuflingen einen<br />
Dukaten überreichen ließ, war die Erörterung der Judenfrage nich so aktuell wie<br />
heute. Und als man Akten über <strong>Namen</strong>sänderungen in einem preußischen Ministerium<br />
Ausgang des 19. Jahrh. als Makulatur ansah und vernichtete, ahnte man<br />
nicht, welche Bedeutung eine spätere Zeit diesen amtlichen Aufzeichnungen beimessen<br />
würde. Man darf nicht mit den Maßstäben der Gegenwart an die Vergangenheit<br />
herantreten, sondern muß sie aus ihren eigenen Voraussetzungen<br />
beurteilen« <br />
- Historismus im Archiv. Das Schreiben schließt mit einem Wort zur Frage des<br />
Verbleibs politisch aktueller Akten angesichts der Faltungen <strong>von</strong> Aktcnlagen.<br />
Die Beschlagnahmungen durch die SS entziehen Akten der Forschung:<br />
»Wenn alles >Archivgut, das seinem Inhalt an in die gegenwärtige politische<br />
Lage hereinreichtpolitisch< bedeutsamen<br />
Akten <strong>von</strong> den Behörden oder politischen Stellen zurückbehalten, so ergäbe<br />
sich ferner eine willkürliche Zerreißung organischer Registraturzusammenhänge<br />
17 Geh. StaAr Berlin-Dahlem, Rep 178 Vll 2E8, Bd. 2 v. 8.3.1939-1944, Bl. 35, Abschrift<br />
2X »It is a Faktum, a fact of language«: Jacques Derrida, Mcmoires: for Paul de Man, New<br />
York / Guildford, Surrey (Columbia UP) 1986, 95
Jüuisciir. ARc:invLi-:K.'rüKi;N UND GEDÄCHTNISLÖSCHUNG 743<br />
und eine verhängnisvolle Zersplitterung des Stoffs. Tatsächlich liegen die Dinge ja<br />
auch anders. In allen größeren Archiven befindet sich amtliches und nichtamtliches<br />
Schriftgut, das <strong>von</strong> politischer Gegenwartsbedeutung ist. Als Rüstkammer<br />
<strong>für</strong> die Rechte und Interessen des Staates stellen die Archive derartiges Material<br />
den staatlichen Organen zur Verfügung und unterstützen mit ihrer Kenntnis<br />
geschichtlicher und organisatorischer Zusammenhänge die amtliche angestellten<br />
Nachforschungen.« <br />
Archive, hier ausdrücklich Arsenale der Kultur einer Gegenwart, verlangen also<br />
nach einer gedächtnisstrategischen Analyse.<br />
Archiv und Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage in Frankfurt/M. 1 ^<br />
SS-Obersturmbannführer Turowksi dokumentiert in Berlin am 1 1. März 1940<br />
betreffs der »Sicherstellung und Auswertung des aus jüdischem Besitz stammenden<br />
Archivguts«, er habe »zur leichteren Erschließung dieses oft an versteckter<br />
Stelle zu suchenden Materials« auf Anregung der Forschungsahteilung<br />
Judenfrage des Reichsinstituts <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschlands seit 1937<br />
besondere Judaica-Findbücher herstellen lassen. Vom Archivgut der jüdischen<br />
Kultusgemeinden ist vor 1933 nur wenig in die Staatsarchive gelangt, da die Juden<br />
in Deutschland »ihr eigenes (noch bestehendes)« - also aus dem nationalsozialistischen<br />
Rassendiskurs herausragenden - Gesamtarchiv in Berlin unterhielten, in<br />
welches sie aus dem ganzen Reich jüdische Archivallen zusammenzogen - <strong>von</strong><br />
einzelnen Archive jüdischer Gemeinden abgesehen, die bereits vor 1933 in »die<br />
sichere Obhut eines Staatsarchivs« gelangt seien. Allerdings war es nicht gelungen,<br />
rechtzeitig eine archivfachliche Aufsicht über das jüdische Archivwesen zu<br />
erreichen. »Es wäre dann nicht dahingekommen, daß bei den November-Ereignissen<br />
des Jahres 1938 umfangreiches und <strong>für</strong> die Erforschung der Judenfrage in<br />
Deutschland unersetzliches Archivgut in den Synagogen mitverbrannt ist«; das<br />
im November 1938 beschlagnahmte jüdische Archivgut wurde zunächst überallhin<br />
verstreut . Ein Vermerk des Geheimen Staatsarchivs nimmt<br />
Stellung zur Bitte der Forschungsabteilung des Reichsinstituts um Abschrift <strong>von</strong><br />
Findbüchern über jüdische Archivalien:<br />
»Die preußischen Staatsarchive sind s.Z. angewiesen worden, die Urkundenbestände<br />
zunächst überhaupt beiseite zu lassen. Urkunden lassen sich nicht summarisch<br />
inventarisieren, sie müssen stückweise verzeichnet werden. Dabei wäre zu<br />
29 Dazu Dieter Schiefelbein, Das »Institut zur Erforschung der Judenfragc Frankfurt am<br />
Main«. Vorgeschichte und Gründung 1935-1939, [-Yankfurt/M. 1994 (= Materialien<br />
Nr. 9 des Frankfurter Studien- und Dokumentationszentrums zur <strong>Geschichte</strong> und<br />
Wirkung des Holocaust / Fritz Bauer Institut, hg. in Zusammenarbeit mit dem Institut<br />
<strong>für</strong> Stadtgeschichtc, Frankfurt/M. )
744 ARCHIV<br />
überlegen, wieweit man bei der Verzeichnung gehen soll. Die Eigenart der mittlalterlichen<br />
Quellenüberlieferung bringt es mit sich, daß einzelne Erwähnungen <strong>von</strong><br />
Judennamen und ähnliches oft wertvoller sein können, als ganze Judenprivilegien<br />
mit ihrem oft stereotypen Inhalt. Man wird also bei der Aufstellung eines wissenschaftlichen<br />
Inventars der Judenarchivalien zweckmäßig das Mittelalter <br />
beiseite lassen, und mit der Aktenzeit (etwa 1500) beginnen« <br />
- genau an dieser Zeit- und Medienschwelle endet die Editionsepoche der MGH.<br />
Wo an die Stelle <strong>von</strong> Urkunden-Monumenten die <strong>von</strong> allem symbolischen<br />
Mehrwert entzauberten Akten-Dokumente treten, ordnen sich die Geschicke<br />
der Historie neu.<br />
In Frankfurt am Main findet am 26.-28. März die Eröffnungstagung des Instituts<br />
zur Erforschung der Judenfrage statt. Den Grundstock soll die Judaica-<br />
Sammlung der Frankfurter Stadtbibliothek bilden; eine Zeitschrift des Instituts<br />
unter dem Titel Weltkampf'ist vorgesehen. Reichsleiter Rosenberg dankt aus diesem<br />
Anlaß dem Reichsschatzmeister Schwarz <strong>für</strong> die Gesamtfinanzierung der<br />
vorerst virtuellen, nur als administratives Modell existierenden Hohen Schule;<br />
real an dieser NS-Hochschule ist zunächst allein die Frankfurter Zweigstelle. Ergänzend<br />
sollen Außenstellen an diversen I lochschulen errichtet werden. Damit<br />
übernimmt die NSDAP, wie Reichsleiter Rosenberg bei der Eröffnungsfeier weiter<br />
ausführt, »bewußt eine Verbindung mit der Wissenschaft«. Der Berliner<br />
Archivbeobachtcr berichtet weiter:<br />
»Die Neuerforschung der Gesetzte des Lebens zwingt zur Überprüfung der Lehren<br />
des 18. Jahrhunderts, die mit der Gleichheitslchrc auch die Weltanschauung<br />
der Wissenschaft in der Demokratie begründeten. Zu den Ergebnissen der exakten<br />
Naturwissenschaft Stellung zu nehmen, ist nicht Aufgabe des Nationalsozialismus.<br />
Besondere Bedeutung kommt aber den biologischen Gesetzen und<br />
seelischen Lehren zu; was das Schicksal des deutschen Menschen angeht, kann<br />
nicht gleichgültig sein.« 30<br />
Der vor Ort tätige Historiker Wilhelm Grau betont, die Judenfrage werde auch<br />
nach der Rückverlegung der jüdischen Stellungen nach Nordamerika Kampfgegenstand<br />
und Forschungsaufgabe bleiben. Mit Dilettantismus und Halbwissenschaft<br />
sei der Kampf gegen das Vergessen des Leids, das das Judentum den<br />
europäischen Völkern zugefügt hat, nicht zu führen. Man bedürfe da<strong>für</strong> der<br />
historisch-kritischen Methode sowie der Zusammenfassung in der Art der<br />
großen deutschen Gelehrten des vorigen Jahrhunderts« .<br />
Unter Kriegsbedingungen wird Gedächtnis in Echtzeit verhandelt; der »totale<br />
Zusammenbruch der europäischen Machtstellung des Judentums hat <strong>für</strong> die<br />
Erfassung wissenschaftlichen Materials zur Erforschung der Judenfrage Mög-<br />
GeStAr Bl. 106, gez. Papritz, Berlin-Dahlem, 9. April 1941, an den Reichsminister des<br />
Innern; hier: Bl. 10(Sv
JüDisci-n- ARCHIVI KKTÜRHN UND GI-:DÄC:HTNISI.ÖSCHUNG 745<br />
lichkeiten aufgetan, die, rechtzeitig und systematisch genutzt, zu einmaligen und<br />
einzigartigen Ergebnissen führen müssen« 31 . Nur Bruchstellen sind Fundstellen,<br />
Orte der Wissensarchäologie? In dem Moment, wo Wissen als historisch diskontinuiert<br />
begriffen wird, gilt seine allgemeine Zugänglichkeit als Gedächtnis:<br />
»Der Gegenstand der Judenfrage liegt hinter uns als ein abgeschlossenes,<br />
problemreiches Ganzes« . Das Recht auf Zugang zu diesem<br />
Wissen liegt dabei nicht mehr auf Seiten seiner Produzenten; die wissenschaftliche<br />
Begründung allgemeiner Verfügbarkeit dient vielmehr als Tarnung einer Enteignung.<br />
Die Frankfurter Bibliothek entsteht »aus fremden Bibliothekskörpern,<br />
die bisher in der Regel öffentlicher und allgemeiner nichtjüdischer Benutzung<br />
unzugänglich waren« . Zugänglichkeit wird nun nicht mehr<br />
sozial, religiös oder autoritär bestimmt, sondern ist nunmehr eine Funktion <strong>von</strong><br />
Kodes: Die neue Gedächtnismacht manifestiert sich, an der Schwelle zu ihrer<br />
Automatisierung, in symbolischen Operatoren 32 ; Grau kündigt eine völlige<br />
Neukatalogisierung, also Umkodierung sämtlicher nach Frankfurt gekommener<br />
Judaica- und Hebraica-Bestände als die dringlichste und wichtigste bibliothekarische<br />
Aufgabe seines Instituts an. Es müsse »aus den Büchcrmassen auf diese<br />
Weise erst eine wissenschaftliche Bibliothek in vollem Sinne des Wortes geschaffen<br />
werden« . Parallel zu diesem materialen Speicher organisiert<br />
das Reichsinstitut jür <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschland eine Bibliographie<br />
zur »Judenfrage als völkisches Problem« im virtuellen Raum, an dem zugleich<br />
die mediale Grenze <strong>von</strong> Leben (kontinuierliche Prozesse) und Lesen (diskrete<br />
Buchstaben) manifest wird: »den in fast alle Lebensgebiete hinabreichenden Verästelungen<br />
der Judenfrage ist auf dem Weg der Bibliographie nicht beizukommen.«<br />
33 Standardisierung des Bibliotheksspeichers macht die weitreichende<br />
Zirkulation dieses Wissens möglich. Nach dem <strong>für</strong> das deutsche Bibliothekswesen<br />
entwickelten Modell wünscht Grau entsprechende Titeldruckhefte, da »die<br />
unter dem Einfluß der europäischen Erneuerungsbewegungen allseits in Europa<br />
entstehenden Forschungsgemeinschaften zur Judenfrage eine kontinentale Fernleihe<br />
nach dem Kriege in Rechnung stellen lassen« . Die natio-<br />
31 Wilhelm Grau (Frankfurt/M.), Der Aufbau der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage<br />
in Frankfurt a. Main, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 59 (1942), 489-494<br />
(489)<br />
32 Die in diesen neuen Formen aufgeworfene Frage der Zugänglichkeit zu Speichern und<br />
Datenbanken macht Jean-Francois Lyotard zum zentralen Kriterium <strong>von</strong>: Das postmoderne<br />
Wissen. Ein Bericht, Wien (in: Theatrum machinarum 3/4) 1982; 2. Neuauflage<br />
Wien (Passagen) 1993, 192 (frz. La condition postmoderne, Paris 1993)<br />
33 E. Leipprand (Rez.), über: Volkman Eichstädt, Bibliographie zur <strong>Geschichte</strong> der<br />
Judenfrage, Bd. 1 (1750-1848), Hamburg (Hanseatische Verlagsanstalt) 1938, in: Zentralblatt<br />
<strong>für</strong> Bibliothekswesen 56 (1939), 371 f
746 ARCHIV<br />
nalsozialistische Rassentheone entkoppelt Wissen <strong>von</strong> seinen Trägern durch den<br />
Informationsbegriff. Dies betrifft auch die Ergänzungswünsche des Büchereibestands<br />
im Hauptarchiv der NSDAP in München: »Von der schöngeistigen,<br />
teilweise politischen Literatur interessieren nur Werke führender Juden und<br />
Emigranten im Ausland«, darunter Alfred Kantorowicz. 34 Exklusiv wird Gedächtnismacht<br />
nicht mit der Verfügung über die Bibliotheken; ebenso bedeutsam<br />
war das im Aufbau befindliche Archiv zur Judenfrage. Auf diesem Weg<br />
gingen wertvolle Archive jüdischer Organisationen und bekannter Einzelpersonen<br />
in den Besitz des Instituts über, darunter das Archiv der Allmnce israelite<br />
universelle in Paris und einzelne Rothschildarchive (auch das Archiv des Pariser<br />
Bankhauses). Wieder dient die Verwissenschaftlichung im dataprocessing als Tarnung<br />
der Enteignung: »Es handelt sich um Archive, die, wäre es nach dem Sinn<br />
ihrer Besitzer gegangen, niemals der Wissenschaft zugeführt worden wären«<br />
- unter Verweis auch auf die Sicherstellung <strong>von</strong> Archiven der<br />
großen Freimaurerlogen, die wirklichen arcana der Aufklärung. 35<br />
Jüdische Archivalien werden, zeitgleich zur Vernichtung ihrer lebenden<br />
Betreffe, gegen Kriegsverlust bewahrt, wie das Geheime Staatsarchiv am 29. Juli<br />
1942 gegenüber dem Generaldirektor der Staatsarchive betreffs der Judenakten<br />
beim Reichssippenamt betont; gleichwohl ist »eine genügende Sicherung der<br />
Judenakten gegen Luftgefahr an der gegenwärtigen Lagerungsstelle im 4.<br />
Stockwerk nicht vorhanden.« Die Verbnngung der Archivallen in den Keller ist<br />
nicht möglichen, »da diese Räume anderweitig in Anspruch genommen sind«<br />
- kein sicherer Gedächtnisort <strong>für</strong> jüdische Akten in Deutschland,<br />
nirgends. Ein Auszug aus dem archivahschen Mitteilungsblatt Nr. 6 Ziffer 6 vom<br />
20. Juli 1944, AV. 2000, definiert unter Punkt 6) die »Luftschutzmäßige Sicherung<br />
judenkundlicher Quellen« als Priorität <strong>für</strong> die Sicherung und Verhandlung<br />
des Gedächtnisses der Zukunft:<br />
»Von zuständiger Seite werde ich darauf aufmerksam gemacht, daß durch die Terrorangriffe<br />
der feindlichen Luftwaffe auch wichtige, übrigens nicht in Archiven aufbewahrte<br />
Quellen zur <strong>Geschichte</strong> des Judentums in Deutschland vernichtet worden<br />
sind, weil ihre rechtzeitige Bergung verabsäumt wurde. Diese empfindlichen Verluste<br />
geben dem in den Archiven vorhandenen judenkundhehen Schriftgut einen<br />
erhöhten Wert. Ich mache daher darauf aufmerksam, daß alles Material zur <strong>Geschichte</strong><br />
des jüdischen Einflusses zu den politisch-historisch wichtigen Gegenständen<br />
gehört und bevorzugt geborgen werden muß; insbesondere gilt dies <strong>von</strong><br />
34 GehStA Rep. 178 VII Nr. 2 E 19, Akten betreffend: Archive der NSDAP, Bd. 1 v.<br />
16.9.1936 , Archiv-Abteilung, Bl. 84, Abschrift<br />
3:> Siehe Lucian Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche<br />
Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit, Stuttgart<br />
(Klctt-Gotta) 1979 .
JÜDISCilh ARCHIVl.HkTÜRHN UND Gi:i)ÄCHTNUSI.ÖSCHUN(; 747<br />
geschlossenen Beständen, wie Archiven und Registraturen jüdischer Gemeinden,<br />
Nachlässen <strong>von</strong> Juden, größeren Registraturteilen staatlicher Behörden, die ausschließlich<br />
Judenfragen betreffen.« <br />
Das gesamte Archiv des Instituts zur Erforschung der Judenfrage übersteht die<br />
knegsbedmgte Auslagerung aus Frankfurt nach Hungen (Oberhessen) ohne<br />
Schaden. 36<br />
Aktenausgabe als Mikrophysik <strong>von</strong> Gedächtnismacht (Freund und Feind)<br />
Das Preußische Geheime Staatsarchiv gibt betreffs der Benutzungsangelegenheit<br />
des Dr. Jsmar Freund (Verf. v. 25. Januar 1936 - A.V.357/36) unter dem<br />
Datum Berlin, 12. Februar 1936, eine Zusammenfassung <strong>von</strong> dessen dortigen<br />
Arbeiten: »Quellen, <strong>Geschichte</strong> und systematische Darstellung der Rechtsstellung<br />
der Juden in Deutschland«, und zwar seit 1933 nicht mehr nur rechtswissenschaflich,<br />
sondern auch staatsbürgerliche Verhältnisse berührend. 37 Denn das<br />
archivische Gedächtnis kann als Diskurswaffe wissenschaftlich auch <strong>von</strong> der<br />
Gegenseite eingesetzt werden. Freund hatte sich zuvor zu einer schriftlichen<br />
Darlegung seiner Arbeit genötigt gesehen. 38 Die Verfügung 11.1253/36 schreibt<br />
ihm vor, alle Aktenauszüge vorzulegen: modulare Diskurskontrolle. Es folgt,<br />
archivintern, eine Übersicht über die <strong>von</strong> Dr Ismar Freund dem geheimen<br />
Staatsarchiv vorgelegten Aktenauszüge . Von dort ergeht am 28.<br />
Februar 1936 als Meldung an den Generaldirektor der Staatsarchive:<br />
»Diese Forschungen haben es also mit dem entscheidenden Abschnitt in der<br />
<strong>Geschichte</strong> des Verhältnisses des Preußischen Staates zum Judentum zu tun. Es<br />
braucht nicht besonders betont zu werden, daß jede einzelne Maßnahme, die die<br />
damaligen Behörden trafen und die sich in den Akten spiegeln, daß<br />
jedes dieser <strong>für</strong> Personen und Ideengeschichte so charakteristische Schreiben und<br />
Voten wieder eine sehr lebendige Beziehung zu bewegenden Gegenwartsfragen<br />
bekommen hat.« <br />
36 Siehe den Brief des Leiters Claus Schickert an den Generaldirektor der Staatsarchive<br />
(durch den Reichsminister des Innern zum Kommissar <strong>für</strong> den Archivschutz bestellt),<br />
unter der Sigle HS »DIE HOHE SCHULE Aussenstelle Frankfurt a.M., Instituts zur<br />
. Erforschung der Judenfrage« vom 5. September 1944. Die ursprüngliche Briefkopfadresse<br />
(Bockenheimer Landstr.) ist überstempelt: »Neue Anschrift: (16) Hungen /<br />
Oberhessen«. GeStaAr, Bl. 158<br />
37 GehStaAt (PK), HA I, Rep. 178 V Nr. 13 (Preußisches Staatsministerium), Akten betr.:<br />
Benutzung <strong>von</strong> Akten zur <strong>Geschichte</strong> des Judentums, Bd. 1 vom 8.3.35-31.12.42; Bl.<br />
26r-28r<br />
38 Dr. Ismar Freund, Berlin-Grunewald, Auerbachstr. 2, 30. Januar 1936, an Preuß. Geh.<br />
Staatsarchiv »7,u Nr. II 1253/36«, ebd., Bl. 30r-32r
748 ARCHIV<br />
So koppelt sich das Wissen des Archivs (das auch zur Ausstellungsvorbereitung<br />
<strong>von</strong> Der ewige Jude Archivalien bereitzustellen hatte 39 ) als Gedächtnis des Staates<br />
zurück an dessen aktuelle Administration <strong>von</strong> Ideologie. Ein <strong>von</strong> Walter Frank<br />
gezeichneter Brief (15. Februar 1937) spricht bezüglich der Archivrecherchen<br />
Jsmar Freunds <strong>von</strong> »tendenziöse Arbeiten«; eine Nachricht vom 3. Juni 1937<br />
an den Preußischen Ministerpräsidenten meldet schließlich, daß Freund sich mit<br />
dem Schreiben vom 25. Mai 1937 aus dem Geheimen Staatsarchiv zurückzieht.<br />
Frank, Präsident des Reichsinstituts <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des neuen Deutschlands,<br />
beharrt gegenüber den Ansprüchen der Dresdner Staatsakademie <strong>für</strong> Rassen- und<br />
Gesundheitspflege grundsätzlich auf der Benutzung <strong>von</strong> Archivalien zur <strong>Geschichte</strong><br />
der Judenfrage als Sache seines Hauses. 40 <strong>Im</strong> Streit um das nationalsozialistische<br />
Gedächtnismonopol (zum Ausschluß der deutschen Juden) herrscht<br />
Ressortkonkurrenz. 41 Brackmann regt am 6. März 1935 in einer Denkschrift an,<br />
die Benutzung <strong>von</strong> Akten zur <strong>Geschichte</strong> des Judentums in preußischen Archiven<br />
einzuschränken 42 ; am 20. Juni 1935 setzt er dieses Archivverbot mit Ausnahme<br />
der Familienforschung durch. Zipfel, Direktor des Reichsarchivs, will Ende 1938<br />
»unter den jetzt völlig veränderten Verhältnissen« Juden auch <strong>von</strong> Familienrecherchen<br />
ausschließen 43 ; so schnell setzt das Novemberpogrom die Differenz in<br />
der Gedächtnispolitik. Das Staatsarchiv Marburg läßt schließlich keine Archivbenutzung<br />
durch Juden mehr zu, (unter verkehrten Vorzeichen) »außer zur Beschaffung<br />
<strong>von</strong> Urkunden zum Abstammungsnachweis«. 44 In diesem Moment wird das<br />
Archiv nicht mehr die Quelle historischer Forschung, sondern ein Amt der<br />
Gegenwart. Zipfel definiert betreffs der »Archivbenutzung durch Juden und jüdische<br />
Mischlinge« die spezifischen Eigenschaften des Gedächtnismediums Archiv<br />
im antisemitischen Kontext: Zwar existiere ein Lehrverbot <strong>für</strong> jüdische Akademiker<br />
(etwa <strong>für</strong> Professor Hans Rothfels), aber in der freien Archivbenutzung<br />
liege noch eine »Lücke in der neuen Ordnung unseres Kulturlebens«; daß diese<br />
Lücke bisher nicht ausgefüllt wurde, erklärt sich aus dem besonderen Charakter<br />
der Archivarbeit: »Sie vollzieht sich abseits vom täglichen Geschehen der<br />
39 Bl. 147 r/v, Dokument Berlin 29. Oktober 1937<br />
40 Schreiben Berlin, den 11. Mai 1936, an den Preußischen Ministerpräsidenten<br />
41 In Nürnberg befaßte sich etwa das Museum <strong>für</strong> Rasse- und Volksgesundheit, wie<br />
aus seinem Schreiben an den Generaldirektor des Geheimen Staatsarchivs hervorgeht,<br />
mit einem Projekt Judengesetzte in Deutschland <strong>von</strong> der Vergangenheit bis zur<br />
Gegenwart.<br />
42 Torsten Musial, Zur <strong>Geschichte</strong> des Dritten Reichs: Staatliches Archivwesen in<br />
Deutschland 1933-1945, Diss. Humboldt-Universität zu Berlin 1994, 46, unter Bezug<br />
auf: GehStA Berlin, Rep. 92, NL Brackmann, Nr. 93, Bl. 568<br />
43 Schreiben an den Reichsminister des Innern v. 22. November 1938, ebd. Bl. 248r<br />
44 Schreiben v. 30. April 1939, ebd. Bl. 293r
JÜDISCHI-: ARCIIIVI.KKTÜRI-N UND GKDÄCHTNISLÖSCHUNG 749<br />
Gegenwart«. 45 Solange das Archiv der blinde Fleck des ideologischen Bewußtseins<br />
der Gegenwart ist, können »Juden heute noch dem deutschen Volke bisher<br />
unbekannte Dokumente der inneren und äusseren <strong>Geschichte</strong> erschliessen«<br />
. 46 Auch das Preußische Staatsarchiv in Hannover weist am 27. Januar 1938<br />
den Generaldirektor der Staatsarchive Berlin darauf hin, daß der Ariernachweis<br />
<strong>für</strong> Archivbenutzer noch nicht einführt worden ist (hier nicht länger nur Objekt,<br />
sondern Subjekt der Archivrecherche). Eine Liste nichtarischer Benutzer im<br />
Geheimen Staatsarchiv <strong>von</strong> 1937 macht diese Ausschlußpolitik konkret; später<br />
wird diese Jahresbilanz in Monatstabellen unter dem Titel Der Anteil der mchtanschen<br />
und der nicht rein ansehen Benutzer an der Gesamtbenutzung des Geheimen<br />
Staatsarchivs beschleunigt - ein Koeffizient der gleichzeitig<br />
verschärften Judenverfolgung, denn zu diesem Zeitpunkt wird die Präsenz <strong>von</strong><br />
Juden in Berlin selbst fraglich. Komplizierter ist die Quantifizierung und Qualifizierung<br />
der Archivbenutzung durch Juden ausländischer Staatsangehörigkeit; an<br />
den Staatsgrenzen endet auch die Gedächtnispolitik <strong>von</strong> Staatsarchiven. 47 Den<br />
Archivrecherchen des jüdischen Gemeindebibliothekars in Berlin Moritz Stern<br />
zum Thema Juden im Krieg <strong>von</strong> 1813-15 unterstellt das Geheime Staatsarchiv die<br />
Tarnung einer tatsächlichen Erforschung der sozialen und rechtlichen Verhältnisse<br />
der Juden in Preußen als Gegenargument der aktuellen Politik. 48 Ist aber solch ein<br />
Stoff <strong>von</strong> jüdischen Forschern erst einmal wissenschaftlich publiziert (so etwa<br />
Der Preußische Staat und die Juden 49 ),- so - stellt das Archiv fest - ist er auch <strong>für</strong><br />
NS-Forschungen nutzbar; alle archivische Gedächtnispolitik ist reversibel lesbar<br />
. Gedächtnis hat der, dem der Zugang zum Archiv nicht<br />
versperrt ist. Ein Schreiben aus dem Berlin-Dahlemer Archiv vom 16. August<br />
1939 betrifft Gengier, einen Mitarbeiter des (wie es hier heißt) Instituts zum<br />
45<br />
Schreiben aus Potsdam, 19. Januar 1938, an den Reichs- und Preußischen Minister des<br />
Innern, ebd. Bl. 158r<br />
46<br />
Dazu am Beispiel eines anderen deutsch-jüdischen Historikers: Peter Walther / W. E.,<br />
Ernst H. Kantorowicz. Eine archäo-biographische Skizze, in: Cornelia Vismann / W.<br />
E. (Hg.), Geschichtskörper. Zur Aktualität <strong>von</strong> Ernst H. Kantorowicz, München<br />
(Fink) 1998, 207-233. Aufgrund des Publikationsverbots deutschhistorischer Themen<br />
<strong>für</strong> jüdische Historiker <strong>von</strong> Seiten des nationalsozialistischen Regimes wich Kantorowicz<br />
folgerichtig auf Archive und Historien des mittelalterlichen Burgund und<br />
Englands aus.<br />
47<br />
Der Generaldirektor der Staatsarchive, Berlin 21. April 1938, ebd. Bl. 196r-197r<br />
48<br />
Schreiben an den Generaldirektor der Staatsarchive vom 7. September 1938, ebd.<br />
Bl. 240r-241r<br />
49<br />
Selma Stern, Der Preußische Staat und die Juden, Erster Teil: Die Zeit des Großen<br />
Kur<strong>für</strong>sten und Friedrichs I., Berlin (Schwetschke) 1925 (= Veröffentlichungen der<br />
Akademie <strong>für</strong> die Wissenschaft des Judentums. Historische Sektion, Bd. 3); darin<br />
Zweite Abtheilung: Akten
750 ARCHIV<br />
Studium der Judenfrage, speziell seine Darstellung über Das Wirken der Juden<br />
in der Deutschen Politik 1919 . Am 13. Februar 1940 heißt dieses<br />
Institut bereits (betreut durch das Reichsministerium <strong>für</strong> Volksaufklärung<br />
und Propaganda) Antisemitische Aktion? 0 Gedächtnispolitik ist dabei nicht auf<br />
antisemitische Aktionen beschränkt, sondern Teil eines umfassenden ideologischen<br />
Dispositivs. Das Reichsinstitut jür <strong>Geschichte</strong> des Neuen Deutschlands bittet<br />
nach Ausbruch es Zweiten Weltkriegs, Forschern keine Akten mit »Klagen<br />
über Persönlichkeiten und Zustände im deutschen Heere während des Weltkrieges,<br />
wie sie in Beschwerdebnefen an sozialdemokratische Führer vorgebracht<br />
worden sind«, zur Einsicht vorzulegen. Wenn militärische Interessen berührt<br />
sind, ist dies <strong>von</strong> der Kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres zu<br />
klären. 31 So segmentiert der neue Weltkrieg das Gedächtnis des alten in neuen<br />
Setzungen, und der Zugriff auf Akten wird <strong>von</strong> einer logistischen Frage eine<br />
höchst materielle Frage der Hardware; ein weiteres Blatt in der Akte zur Frage<br />
jüdischer Archiveinsicht stammt aus dem Staatsarchiv Königsberg vom 16.<br />
November 1942 und dokumentiert den Antrag des Reichsinstituts <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
des neuen Deutschlands beim Staatsarchiv um Entleihung <strong>von</strong> Akten zur <strong>Geschichte</strong><br />
der Judenfrage »unter Zusage sicherer Aufbewahrung in einem Panzerschrank«<br />
.<br />
Zur Disposition stehen in diesem Kontext nicht nur jüdische Archivalien, sondern<br />
auch jüdische (Patn-)Archivare (wie sie Jacques Dernda in Mal d'archwe mit<br />
Blick auf Sigmund Freuds Vater deklariert). Entsprechende Entlassungen aus dem<br />
Reichs- und dem Geheimen Staatsarchiv erfolgen mit dem Berufsbeamtengesetz<br />
<strong>von</strong> 1933; 1935 etwa scheidet Ernst Posner aus, als Emigrant in den USA dann<br />
während des Zweiten Weltkriegs deutsches Archivwissens stretegisch mobilisieren<br />
hilft. 52 Die Ausgrenzung deutsch-jüdischer Archivare aus Staatsarchiven<br />
wahrt dabei die formalen Regeln der Administration, jenes stahlharten Gehäuses,<br />
das durch seine notwendige Berücksichtigung auch totalitären Ideologien zu trotzen<br />
vermag. Posner erhält noch im Exil seine weiteren Bezüge; die Zahlungen<br />
werden erst 1940 aufgrund neuer Durchführungsbestimmungen zum Reichsbürgergesetz<br />
(<strong>von</strong> 1935) eingestellt. Archiv als Gedächtnis ist Kapital (und dessen<br />
potentielle Enteignung) auch im unmetaponschen Sinne. In der Epoche des<br />
Nationalsozialismus haben staatliche Archive die Aufgabe, möglichst schon vor<br />
dem Auswandcrungsfall Informationen über das in jüdischem Besitz befindliche<br />
Archivgut zu sammeln und dazu vor allem die <strong>von</strong> deutschen Juden aufzustel-<br />
D0<br />
Bl. 323r u. v., Geh. Staatsarchiv an den Generaldirektor der Staatsarchive<br />
31<br />
Schreiben Berlin, 26. März 1940, den Generaldirektor der Staatsarchive, ebd. Bl. 326r<br />
u.-v.<br />
32<br />
Siehe die biographische Einleitung zu Ernst Posner, Archives & the Public Interest.<br />
Selected Essays by Ernst Posner, hg. v. Ken Munden, Washington (Public Affair) 1967
JÜDlSCilK ARCMIVLKkTÜRHN UNI) GlüMCHTNlSI.OSCI IUNG 751<br />
lenden. Vermögensverzeichnisse durchzusehen. Eine wirtschaftliche tritt also<br />
neben die memonale Ökonomie, wie sie im Begriff des Inventars im Archivzusammenhang<br />
bislang rein wissensdokumentarisch gemeint war. Beamte begannen,<br />
die Judaica in den Staatsarchiven zu inventarisieren 53 , während deutsche Juden<br />
selbst demnächst zu Nummern in Konzentrationslagern werden sollten. In Überseehäfen<br />
wie Bremen lagert derweil das Gut <strong>von</strong> zur Emigration gezwungenen<br />
deutschen Juden in Containern zwischen - ein suspendiertes Gedächtnis cn souffrance^<br />
4 , Kapital, das seit Kriegsausbruch am 1. September 1939 gehortet und <strong>von</strong><br />
1942 an durch die deutschen Behörden zwangsverstcigert wird.' 1 "' So, wie jedes<br />
schaltbare Datenaufzeichnungsmedium auch zu deren Wiedergabe benutzbar ist,<br />
läßt sich auch das archivische Gedächtnis umpolen; Daten, scheinbar im Gedächtnisdienst,<br />
lesen sich so als Zugangs- und Abgangsverzeichnissen der Vernichtung<br />
<strong>von</strong> Menschen.<br />
Keine Mythenschau: Germania Judaica<br />
(die jüdische Perspektive) und Rassenkunde aus Akten (die NS-Perspektive)<br />
Rezensent »K.« bespricht 1935 den Band Germania Judaica^ <strong>für</strong> die Bayerische<br />
Israelische Gemeindezeitung? 7 Hier wird auf der Darstellungsebene der Konflikt<br />
deutlich, der sich in Fragen des deutsch-jüdischen Zugangs zu deutschen<br />
Staatsarchiven (Gedächtnismacht als Zugang zum Machthaber) niederschlägt:<br />
»Nicht ohne Bewegung nehmen wird den neuen ansehnlichen Band in die Hand,<br />
der die Darstellung der Siedelung <strong>von</strong> Juden auf deutschem Boden seit über 1000<br />
Jahren enthält. Die leidenschaftslose, streng gelehrte Wiedergabe der vorgefunden<br />
örtlichen Tatbestände mit sorgfältigen Quellennachweisen und Verweisungen,<br />
ohne Zusätze über Vermutungen und Deutungen, mit peinlicher Gewissenhaftig-<br />
53 Musial 1994: 50, unter Bezug auf: GchStA Berlin, Rcp. 90 N, Nr. 2 1, o. 131., und GStA<br />
Merseburg (jetzt: Berlin), Rep. 178, I, Nr. 4, Bl. 57<br />
54 Jacques Lacan weist auf den semantischen Nebensinn der französischen Formel vom<br />
lettre en souffrance: ein urv/.u st ellbarer Brief / Buchstabe. Dazu Elisabeth Weber in<br />
ihrer Frciburger Dissertation: Verfolgung und Trauma, Wien (Passagen) 1990; ferner<br />
Jacques Lacan, Das Seminar über E. A. Poes Der entwendete Brief, in: ders., Schriften<br />
I, hg. v. Norbert Haas, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1975 [ ;: -Ecrits, Paris 1966], 7-41 (28f)<br />
55 Über geraubte Bücher aus jüdischem Besitz in deutschen Bibliotheken als inverse<br />
»Beutekunst«: Rolf Michaelis, Worüber kein Gras wächst, in: Die Zeit v. 10. Oktober<br />
1997,61 •. ' :<br />
56 Germania Judaica, nach dem Tode <strong>von</strong> M. Brann hg. v. J. Ellbogen, A. Freimann u. H.<br />
Tykocinski, Bd. I (Einziger Band): Von den ältesten Zeiten bis 1238, Breslau (M. Sc H.<br />
Marcus) 1934af<br />
57 XI. Jg., Nr. 1, München, 1. Januar 1935, Rezension unter dem Titel »Germania Judaica.<br />
Zur Frühgeschichte der Juden in Deutschland«
752 ARCHIV<br />
keit sich jedes darstellerischen Schmuckes ä la mode enthaltend, ist im gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt doppelt eindrucksvoll.« <br />
Unter den Schreibbedingungen dieser Zeit heißt dieser Akzent auf positivistischer<br />
Datenverarbeitung Widerstand gegen ideologisch erhitzte Schreibweisen<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>. Rede (Diskurs) und Schweigen (Wissensarchäologie) bilden<br />
hier ein Oxymoron: »Es gibt keine beredteren Urkunden <strong>für</strong> das deutsche Heimatrecht<br />
der deutschen Juden als diese stummen, der Zeit und ihren Wirrungen<br />
entrückten Zeugnisse« , denn das Archiv als Depot ist ein Ort der Remanenz.<br />
Zumindest zwei Rhythmen - die der Historie und der Historiographie -<br />
werden hier wahrgenommen, Gedächtnis als Signifikant und als Signifikat:<br />
»Die Abfassungsgeschichte des Quellenwerkes, seine Entstehung <strong>von</strong> 1903, als zum<br />
ersten Male der Plan Gestalt gewann, bis zum Ende des Jahres 1934, spiegelt<br />
einen wichtigen Abschnitt deutsch-jüdischer Gclehrtengeschichtc. Der Herausgeber<br />
erzählt <strong>von</strong> dem Leidensweg dieser Dokumcntensämmlung . Große<br />
Gelehrte der älteren Generation starben während der Ausführung des Planes, jüngere<br />
rückten nach, der Weltkrieg brach aus: das Werden des umfangreichen Bandes<br />
ist selbst zur Chronik einer bitteren Zeit geworden. Wie ein >Memor-Buch<<br />
liest sich die Einleitung über die Genesis des großen Qucllcnwerkcs.« <br />
Medienarchäologisches Gedächtnis (die Überlieferung) und Historie als Gegenstand<br />
stehen im Widerstreit. Der behandelte Zeitabschnitt, der mit dem Jahr 1238<br />
endet - mit der sogenannten Judenordnung Kaiser Friedrichs II. - »bedingte ganz<br />
besondere, kaum zu bewältigende Schwierigkeiten in der Abfassung: Alle einschlägigen<br />
Nachrichten danken wir nur dem Zufall der Überlieferung. Gar manche<br />
Gemeinde mag älter sein als ihre Nennung in unseren Geschichtsquellen«<br />
. 58 Als <strong>Geschichte</strong> aber ist erst formulierbar, was metonymisch adressiert<br />
werden kann. Dann werden die historischen Aussagen des Rezensenten implizit<br />
zu wissenspohtischen Stellungnahmen gegenüber der völkischen Ideologie des<br />
Nationalsozialismus; Deutschland sei wie ganz Mitteleuropa in erhöhtem Maße<br />
ein Übergangs- und Mischrassen-Land. »Landschaft und historisches Schicksal<br />
haben mannigfache Menschentypen hervorgebracht, die sich heute zu >einem einheitlichen<br />
Geistesantlitz des deutschen Volkes< zusammenschließen« .<br />
Auf der anderen Seite steht die Rückkopplung des Volkskörpers an seinen Gedächtniskorpus:<br />
Das Medium zur obghgatonschen Erbringung <strong>von</strong> Ariernachweisen<br />
sind die Archive. Das preußische Archivwesen wird dadurch ebenso<br />
aktiviert wie dysfunktionalsiert; seine »Abneigung gegen diese Suche nach Abstammungsnachweisen<br />
gründete sich aber lediglich auf die Eintönigkeit und<br />
58 Siehe Arnold Esch, Arnold, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als<br />
methodisches Problem des Historikers, in: Historische Zeitschrift Bd. 240 (1985),<br />
529-570
Jüoisaih ARCHIVU:KTÜRI;N UND GHDACHTNISLÖSCIIUNG 753<br />
geringe Wissenschaftlichkeit dieses Tuns, nicht etwa gegen dessen rassistische<br />
Komponente« . Das Massendatenretneval zum Zweck des<br />
Ariernachweises führt zum archivischen Ausnahmezustand: Erich Weise schreibt<br />
am 11. November 1936 über 1936 den verstorbenen Archivar Heinrich Kochendörffer,<br />
daß dieser »in diesen Wochen, da das Archiv besonders unter der Arierflut<br />
zu leiden hatte«, allwöchentlich Sonnabendnachmittag und sonntags im<br />
Archiv gesessen und Geburtsscheine ausgestellt hat. »Alles, aber auch alles«<br />
andere sei »hier liegengeblieben , seit die Arier aufkamen« 59 - keine Zeit <strong>für</strong><br />
<strong>Geschichte</strong>. Das Archiv speichert dabei keine schon dokumentierte deutsch-jüdische<br />
Differenz, sondern setzt sie erst im Moment seiner ideologischen Programmierung;<br />
»eine der wichtigsten Voraussetzungen da<strong>für</strong>, die deutliche Abgrenzung<br />
<strong>von</strong> Juden und NichtJuden, wurde durch den exakten Nachweis der Abstammung<br />
geschaffen« . Der Leiter der bayerischen Archiwerwaltung<br />
Knöpfler sagt es auf dem 26. Archivtag 1936 im Klartext seines Mediums:<br />
»Es gibt keine praktische Rassenpolitik, ohne die Quellen nutzbar zu machen,<br />
welche uns <strong>von</strong> der Herkunft und dem Werdegang einer Rasse, eines Volkes<br />
Kunde geben keine Rassenpolitik ohne Archive, ohne Archivare.« 60<br />
Das ist Klartext. Die Praxis (vorgeblich) historischen Wissen heißt nicht Erzählung,<br />
sondern kalkuliertes Gedächtnis. (Auto-)Biographisch betrachtet, beobachtet,<br />
Tag <strong>für</strong> Tag aufgezeichnet, gespeichert und erzählt zu werden war einmal<br />
ein Privileg, doch modernen Disziphnarprozeduren kehren dieses Verhältnis um:<br />
sie setzen die Schwelle der beschreibbaren Individualität herab und machen aus<br />
der Beschreibung ein Medium der Kontrolle. »Es geht nicht mehr um ein Monument<br />
<strong>für</strong> ein künftiges Gedächtnis, sondern um ein Dokument <strong>für</strong> eine fallweise<br />
Auswertung« . Was der Fall gewesen ist (das Ereignis als<br />
Positivität der Aussage) aber entscheidet das Archiv im Akt der Registrierung.<br />
Und Historiographie, emsig mit der Transskription <strong>von</strong> Monumenten in Dokumente<br />
befaßt, wird zum unbewußten Komplizen dieser Praxis gerade dann, wenn<br />
sie (im Sinne Walter Benjamins) ihre Aufgabe darin zu sehen glaubt, vergangenen<br />
Dingen und Menschen dignkas zu restituieren. Schon in der Frühmoderne<br />
besteht der Staat darauf, daß seine Subjekte über Eigennamen verfügen, um sie<br />
in amtlichen Aufzeichnungen erfassen und damit persönliches Eigentum schätzen<br />
und besteuern zu können. 61 Grundlage der NS-Rassenpohtik ist die Faknzitat<br />
eines nicht-virtuellen Archivs, das Geburtsregister, ein Schriftregime, das<br />
Identität auf Papier festschreibt: als Personalausweis. Mit dieser Einschreibung<br />
59 Musial 1994: 47, unter Bezug auf: GStA Berlin, Rep. 92, Nachlaß Lüdicke, Nr. 9, o. Bl.<br />
60 Archive und Familienforschung, zitiert nach: Musial 1994: 49<br />
61 Stephen Greenblatt, Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen Weltbildern, Berlin<br />
(Wagenbach) 1991, 111, unter Verweis auf William E. Täte, The Parish Chcst: A Study<br />
in the Records of Parochial Administration in England, Cambridge 1946
754 ARCHIV<br />
auf dem administrativen Zweitkörper korrespondiert im Falle der Juden die chirurgische<br />
Beschneidung. Yerushalmi beschreibt anhand des Verhältnisses <strong>von</strong><br />
Vater (Jakob) und Sohn (Sigmund) Freud die »difficile transmission de la culture<br />
juive«; der Beweis der Beschneidung verweist - so der Schluß Derridas - auf das<br />
Regime des Archivs. 62 Diesem Regime ist auch der Historiker verschrieben, der<br />
- gekoppelt an das archivalischc Vetorecht gegenüber narrativen Behauptungen<br />
- selbst in Konfrontation mit dem Archonten des Archivs gerät, dem Staat. Die<br />
Adressierung des Personenstandgedächtnisses läuft über Eigennamen; ihre<br />
Umkodierung bedarf folglich eines Runderlasses des Reichs- u. Preußischen<br />
Ministeriums des Innern vom 23. März 1938, der die vor dem 30. Januar 1933<br />
genehmigte Möglichkeit zur germanisierenden Änderung jüdischer <strong>Namen</strong> wiederruft.<br />
Das Emanzipationsgesetz vom 11. März 1812 hat dies zunächst ermöglicht:<br />
Die preußische Ministerialbürokratie, »der eigentliche Träger des progressiv<br />
aufklärerischen Geistes« , entwickelte unter dem Freiherrn<br />
vom Stein und dann unter Hardenberg nicht nur die Pläne zur gesetzlichen Realisation<br />
der (nicht nur symbolischen, sondern vor allem zur ökonomischen und<br />
militärischen Mobilisierung gedachten) Gleichstellung <strong>von</strong> Juden und Christen<br />
in Deutschland, sondern installierte auch das Medium, das deren Gedächtnis darstellt<br />
- das staatliche Archivwesen. Die Archive waren es folglich, die <strong>von</strong> E. Zipfel<br />
1938 beauftragt werden, die Akten nach entsprechenden Vorgängen der<br />
<strong>Namen</strong>sänderung durchzusehen und die entdeckten Fälle den vorgesetzten Verwaltungen<br />
auf besonderen Formblättern unverzüglich anzuzeigen. 63 Bereits 1923<br />
jedoch, so verrät ein »Geh. Vermerk« des <strong>Namen</strong>sreferenten im Justizministerium,<br />
war an eine Aufstellung sämtlicher <strong>Namen</strong>sänderungen seit 1812 gedacht. 64<br />
Gedächtnis, das nicht zu Zwecken der Historiographie, sondern kurzfristig<br />
mobilisiert werden soll, bedarf nicht nur der Adresse, sondern auch des standardisierten<br />
Formats, um apparativ (und gar automatisch) anschreib- und berechenbar<br />
zu sein. Tatsächlich ist es der Verwaltungsentwicklung zu verdanken,<br />
daß sich die jüdischen <strong>Namen</strong>sänderungsanträge in Preußen <strong>von</strong> ca. 1840-1867<br />
und dann wieder <strong>von</strong> 1900 bis 1932 im Geheimen Staatsarchiv Berlin komplett<br />
erhalten haben, und »rechnet man sie hoch, so kann man hoffen, daß sie jene vermutete<br />
Kartographie der antisemitisch besetzten <strong>Namen</strong> fast <strong>von</strong> selber zeichnen«<br />
. So rückt Kalkülisierung an die<br />
•Stelle historischer Erzählung, denn allein numerisch würde sich daraus eine<br />
62<br />
Yoscf Hayim Yerushalmi, Lc Mo'i'sc de Freud. Judaisme termmable et interminable,<br />
Paris (Gallimard) 1993; Jacques Derrida, Mal d'Archive, Paris 1995<br />
M<br />
Musial 1994: 49, unter Be/.ug auf: RMBliV. 1938, 545-548, u. I [StA Dresden, Dienstreg.,<br />
Kap. XIII, Nr. 27, Bd. 1, o. Bl.<br />
64<br />
Dietz Bering, Der Name als Stigma: Antisemitismus im deutschen Alltag 1812-1933,<br />
Stuttgart (Klett-Cotta) 1987, 192f
JÜDISCHI. ARCHIVI.I-KTÜRHN UNO GKDÄCHTNISI.ÖSCHUNG 755<br />
Rangskala ergeben, die sich <strong>von</strong> besonders oft abgewählten <strong>Namen</strong> bis in zu einer<br />
Zone weniger oft abgewählter erstreckt. Nicht histonographisch, sondern statistisch<br />
fragt Bering, ob die aufgewiesene Rangfolge der <strong>Namen</strong> mit der des wirklichen<br />
Vorkommens dieser <strong>Namen</strong> (Häufigkeitsskala) identisch ist, so daß<br />
Markierungsskala und Vorkommensskala deckungsgleich überemandergelegt<br />
werden können. »Wenn das nicht der Fall, die antisemitische >Ladung< also ein<br />
unabhängiger Faktor ist, so kann man hoffen, ein Instrumentarium erarbeitet zu<br />
haben, dessen Auskunftskapazität nicht nur <strong>für</strong> <strong>Namen</strong>sforscher interessant<br />
ist« . <strong>Namen</strong>sfluchten dynamisieren das Archiv. Wo sich aus Listen ein<br />
Sortierprogramm statistischer Wahrscheinlichkeiten schreiben (also als stochastischer<br />
Prozeß beschreiben) läßt und damit aus der schieren Folge <strong>von</strong> Lettern<br />
Zahlen sprechen, versagt Erzählung. Tatsächlich sind hier »various probabilities<br />
mvolved - those of getting to certain stages in the process of forming messages,<br />
and thc probabilities that, when in those stages, certain Symbols be chosen next«<br />
. Verkehrswert ist discursive value; an der Schwelle zum<br />
Digitalen sind Diskurse »als schiere Outputmengen quantifizierbar und alle<br />
Archivierungsproblemc, mit Shannon, Kehrwerte <strong>von</strong> Redundanz.« 6 " 1 Redundanz<br />
ist derjenige Bestandteil der Struktur einer Botschaft, der nicht aus freier<br />
Wahl des Senders geschieht »but rather by the aeeepted statistical rules governing<br />
the use of the Symbols in question« . Die Diskussion um<br />
Buchstabenfolgen zur Erkennung jüdischer <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> Seiten der NS-Bürokratie<br />
gipfelt sehr konkret darin. Das Wesen der linguistischen Struktur <strong>von</strong><br />
<strong>Namen</strong> ist gerade darin zu suchen, »frei <strong>von</strong> semantischer Füllung den Benannten<br />
einfach zu indizieren« - nichts anderes meint die vektorielle<br />
Logik des Archivs und Shannon, wenn er sagt, daß »the semantic aspects<br />
of communication are irrelevant to the enginecrmg aspects« . Antisemiten aber können nicht »an solch inhaltsfreien, weil<br />
bedeutungslosen <strong>Namen</strong>« interessiert sein. »Erst das im <strong>Namen</strong> Gemeinte<br />
konnte aggressive Schubkraft geben« . Jüdische <strong>Namen</strong> aber sind<br />
nicht spezifisch (nach binärem System) erkennbar oder nicht erkennbar; lediglich<br />
»mehr oder weniger sicher« lassen sie sich ausmachen .<br />
Wo ein Kalkühsierung <strong>von</strong> Buchstabenfolgen über Menschenleben entscheidet,<br />
spitzt sie sich auf eine einzige Letter zu. Der Fall der drei Brüder Josephsohn, die<br />
ihren <strong>Namen</strong> in Jeffers ändern wollen, liegt nur <strong>für</strong> Geisteswissenschaften<br />
»außerhalb jeder Berechenbarkeit« (Bering). Der Berliner Polizeipräsident trägt<br />
dem Innenminister das Argument vor, daß der neue Name mit dem aktuellen<br />
<strong>Namen</strong> »eine gewisse Klangähnlichkeit« habe . »Der Mini-<br />
Friednch Kittler, Ein Verwaiser, in: Gesa Dane u. a. (Hg.), Anschlüsse. Versuche nach<br />
Michel Foucault, Tübingen (diskord) 1985, 141-146
756 ARCHIV<br />
ster sagte nein, vielleicht auch, weil er außer einem anlautenden >J< nun wirklich<br />
keine Ähnlichkeiten ausmachen konnte«; 1911 genehmigte er dann die dritte<br />
^iMjosephsen .<br />
Während aber die mathematische Theorie der Kommunikation (als Signalübertragung),<br />
mit deren historischer Formulierung kurz nach 1945 die Epoche<br />
dieser Arbeit wissensarchäologisch endet, weltkriegsbedingt <strong>von</strong> extrem beschleunigten<br />
Prozessen handelt, stellen demgegenüber Datenerstellung, Archivierung<br />
und Transfer im Begriff der Tradition (und der Gedächtniswissenschaften) eine<br />
extrem verlangsamte Variante dieses Prozesses, und Archivwissenschaft damit eine<br />
gebremste Spezifikation der kybernetischen En- und Dekodierung <strong>von</strong> Information<br />
dar. »The theory provides for very sophisticated transmitters and reveivers -<br />
such, for cxamplc, as possess >memones
BIBLIOTHEK<br />
Bibliotheksräume<br />
Die Institution der Bibliothek basiert weniger auf dem Primat der Übertragung<br />
denn auf der Funktion der Speicherung <strong>von</strong> Informationsträgern, die dann<br />
eine Schnittstelle zur Lesbarkeit (und damit zum diskursiven Wissenstransfer)<br />
bildet: Ihr Medium heißt Katalog, d. h. der Speicher mit bibliographischen<br />
Informationen zum Bestand (im Unterschied zur bestandsunabhängigen Bibliographie).<br />
1 Ist eine Buch-Ausleihe eine Übertragung im Sinne der Nachrichtentechnik<br />
oder lediglich deren Metapher, wie sie nur bedingt auf die<br />
Bibliothek rückübertragbar ist, ohne daß sich das Gedächtnisphänomen verflüssigt<br />
und schlicht zu einem historischen Vorläufer des Computers deklariert<br />
wird? 2 Demgegenüber ist das Archiv vornehmlich ein nicht-diskursiver, justiziabler<br />
Speicher mit der Binnendifferenzierung <strong>von</strong> monumentaler Urkunde<br />
(als Bild und Objekt) und dokumentarischer Akte (mit dem Akzent auf Prozeß<br />
und Information) und - im Unterschied zu einem weiteren Gedächtnismedium,<br />
dem Museum - durch die Vorgegebenheit seiner Klassifikation in der Struktur<br />
der Überlieferung definiert. 3 Gedächtnisinfrastruktur ist eine Funktion <strong>von</strong><br />
Hardware einerseits und programmatischen Entscheidungen andererseits. Erst<br />
die Lösung des bibliothekarischen Wissens vom konkreten Raum seiner Speicherung<br />
(so daß, analog zu der <strong>von</strong>-Neumann-Architektur des Computers,<br />
Programme wie Daten im ein und demselben Speicher lagern) macht diese Differenz<br />
zu einer wissensarchäologischen Epoche der Vergangenheit.<br />
Das Wissenschaftliche System<br />
1848/49, als Deutschland, sich politisch um- und unordnet und es im Paulskirchenparlament<br />
zu einem Vorspiel der deutschen Nationalbibliothek kommt,<br />
fragt F. FI. Germar, ob in öffentlichen Bibliotheken die Bücher nach einem wis-<br />
Günther Pflug, Die Wechselwirkung zwischen Bibhotheks- und Dokumentationswesen<br />
aus nationalbibliothekarischer Sicht, im Internet adressierbar unter: http://<br />
www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/infowiss/baust/Manpflug.html<br />
Eine Rückfrage <strong>von</strong> Uwe Jochum (Universitätsbibliothek Konstanz)<br />
Angelika Menne-Haritz, Schlüsselbcgriffe der Archivterminologic, Marburg (Archivschule)<br />
1992, 82
758 BlBLIOTI-IKK<br />
senschaftlichen Systeme aufgestellt werden sollen. 4 Für Privatbibliotheken sei<br />
die systematische Aufstellung und das Denken in (die optische Wahrnehmung<br />
steuernden) arrays plausibel,<br />
»bei denen auch ohne alle Ordnung, das gewünschte Buch leicht durch die Kenntnis<br />
seiner äusserlichen Gestalt herausgefunden wird. Wenn allmähliger Zuwachs<br />
die Uebersicht erschwert, so erleichtert man diese durch Zusammenstellung des<br />
verwandten Inhalts; und wird dann in diesen Abtheilungen die Zahl wieder zu<br />
gross, so trennt man dieselben in kleinere Unterabtheilungen. Hat man hinter diesen<br />
einigen leeren Raum gelassen, so reicht derselbe bei den geringen Mitteln zur<br />
Vermehrung <strong>für</strong> eine geraume Zeit hin; und ist er gefüllt, so hilft man sich durch<br />
Verschiebung einzelner Abtheilungen oder durch Umstellung der ganzen Bibliothek<br />
lieber, als dass man sich zur Anfertigung mehrfacher Catalogc entschliesst,<br />
ohne welche allerdings keine andere als die systematische Aufstellung zweckmässig<br />
sein kann.« <br />
In öffentlichen Bibliotheken löst sich die Ordnung der Dinge im realen Raum<br />
<strong>von</strong> der ihrer Adresse als Information. Ist ein Buch in einem Bibliothekskatalog<br />
durch einen Eintrag repräsentiert, wird dort nicht der gesamte Inhalt aufgeführt:<br />
»zu Gesicht kommen nur die Daten, die nötig sind, es zu identifizieren<br />
und im Regal zu finden.« 5 Germar beschreibt da<strong>für</strong> die Unzulänglichkeiten<br />
einer systematischen Aufstellung:<br />
»6) Da bei der systematischen Aufstellung jede Abtheilung ihre eigene Nummern-<br />
Reihe haben muss, weil in jeder die Zahl der Bücher fortwährend zunimmt, so ist<br />
die blosse Zahl nicht hinreichend, seine Stelle zu bezeichnen, sondern e.s müssen<br />
auch daneben die Zeichen der verschiedenen Abtheilungen des Systems auf und<br />
im Buche hinzugefügt werden. <br />
7) Auch die vielen leeren Räume hinter den Abtheilungen geben nicht bloss der<br />
Aufstellung ein unordentliches Ansehen, sondern verhindern auch die schnelle<br />
Wahrnehmung der fehlenden Bücher, mögen sie nun verliehen oder abhanden<br />
gekommen sein.<br />
»8) Ganze durch Schenkung oder Ankauf erworbene Büchersammlungen können<br />
nicht anders in die Bibliothek aufgenommen werden als durch eine gänzliche<br />
Zersplitterung in die nach dem einmal angenommenen System beliebten Abtheilungen,<br />
wodurch das Andenken an ihre vorigen Besitzer völlig vertilgt wird.«<br />
<br />
Demnach ist die systematische Aufstellung <strong>für</strong> öffentliche Bibliotheken überflüssig.<br />
An die Stelle des architektonischen Bibliotheksraums tritt das Arrangement<br />
einer Mnemotextur auf Papier. Germar verlangt zwei Formen <strong>von</strong> Katalogen, um<br />
Rekursivität zu ermöglichen (Programmieren und Speichern):<br />
In: Serapeum 10 (1849), 257-266<br />
Richard Rorty, ist der Begriff der Repräsentation obsolet?, in: Zeitschrift <strong>für</strong> philosophische<br />
Forschung 51, Heft 3 (1997), hier referiert unter der Sigle »so«, in: Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung v. 22. Oktober 1997
BlBl.lOTHKKSRÄUMli 759<br />
»1) Den systematischen oder wissenschaftlichen Catalog, in welchem jedes Buch<br />
nach seinem Hauptinhalte mit vollständigem Titel, mit Hinweisung auf die laufende<br />
Nummer und den nöthigen Bermerkungen eingetragen ist. Wäre aber der<br />
Inhalt ein mehrfacher , so müssen in den verschiedenen Abtheilungen des<br />
Systems wenigstens kurze Hinweisungen auf die Stelle des Catalogs, wo die ausführlichere<br />
Angabe zu finden ist, nebst der laufenden Nummer, gegeben werden.<br />
So kann also das Buch nach seinem verschiedenen Inhalte an mehreren Stellen<br />
gefunden werden, während das Buch selbst nur an einer einzigen stehen kann.<br />
2) Weil aber die Ansichten vom Inhalte eines Buchs
760 BlBI.IOTHHK<br />
erfolgt nach demselben Prinzip wie der Informationszugnff in einer Datenbank.«<br />
7 Dennoch gilt ein Gesetz, das vom Matenalen vorgeschrieben wird und<br />
eine Schnittstelle zum Ästhetischen bildet:<br />
»Die einzige Schwierigkeit, welche sich dabei etwa ergeben möchte, dürfte in dem<br />
sehr abweichenden Formate der Bücher liegen. Will man nicht unmässigen Platz<br />
verschwenden und zugleich durch auffallenden Mangel an Symmetrie das Auge<br />
beleidigen: so können nicht alle Locale so hoch gemacht werden, dass sie auch<br />
Folianten und Hoch-Quartanten aufnehmen können. Daher werden <strong>für</strong> diese<br />
eigene Zimmer mit einer besonderen Zahlen-Reihe nöthig sein.« <br />
Jede Ordnung ist gerade in solchen Bereichen »nichts als ein Schwebezustand<br />
überm Abgrund" (Walter Benjamin) - in Latenz gehaltene Unordnung. 8 Das<br />
einzige exakte Wissens verhält sich äußerlich zu Inhalt und Semantik: »das Wissen<br />
um das Erscheinungsjahr und das Format der Bücher«, die Regelrechtheit<br />
und Regalgerichtetheit des Bibho^e&sverzeichmsses . 1833 handelt Kapitel III der Bibliothekswissenschaft <strong>von</strong> Christian<br />
Molbech »Von Bibliothekskatalogen, dem wissenschaftlichen Bibliothekssystem<br />
und der Aufstellung der Bücher«. Der systematische Katalog leistet demnach,<br />
was die alphabetische Ordnung nicht vermag:<br />
»die absolute Nothwendigkeit nämlich, die Bibliothek auf die eine oder andre<br />
Weise in ein System zu bringen, da eine allgemein alphabetische Ordnung nicht<br />
denkbar ist, ist einleuchtend genug . Hier tritt uns aber gleich der Zweifel<br />
entgegen, ob eine Bibliothek nach einem bis in die kleinsten Unterabtheilungen<br />
sich erstreckende encyclopädischen System geordnet und aufgestellt<br />
werden darf, oder ob es ein abweichendes Princip giebt. man kann jenes<br />
encyclopädische System wie ein <strong>für</strong> die Ordnung der Bibliothek gegebenes Gesetz<br />
betrachten.« 9<br />
Jeder Bibliothek vorgeschaltet ist also das Gesetz dessen, was überhaupt geordnet<br />
werden kann, das Archiv (im Sinne <strong>von</strong> Michel Foucaults Archeologie du<br />
Bernhard Vief, Digitales Geld, in: Florian Rotzer (Hg.), Digitaler Schein. Ästhetik der<br />
elektronischen Medien, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1991, 117- 146 (124). Peter Berz<br />
wies unter dem Titel » :: ".hb.Funknonsbibliotheken« im Rahmen des Symposions Die<br />
Bibliothek als kulturelle Institution (28729. September 1998, Herzog-August-Bibliothek<br />
Wolfenbüttel) auf Metaphorik und Klartext <strong>von</strong> Programmiersprachen hin.<br />
Walter Benjamin, Ich packe meine Bibliothek aus. Eine Rede über das Sammeln, in:<br />
ders., Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedemann / Hermann Schweppenhäuser,<br />
Frankfurt/M. ( Suhrkamp) Bd. 4: Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen (hg. v. Tillmann<br />
Rexroth) 1991, »Denkbilder«, hier: 388-396 (388)<br />
Christian Molbech, Über Bibliothekswissenschaft oder Einrichtung und Verwaltung<br />
öffentlicher Bibliotheken, nach der zweiten Ausgabe des dänischen Originals übers,<br />
v. H. Ratjen, Leipzig 1833, 51
BlBi.lOTf IKKSRÄUME 761<br />
Savoir <strong>von</strong> 1969). Friedrich Adolf Ebert 10 , dem zunächst anonymen Rezensenten<br />
seines eigenen Lehrwerks, antwortet Schretnnger:<br />
»Ein Zufall, der einer Bibliothek ihre Kataloge und Numernbezeichnung <br />
rauben sollte, ohne die Bücher selbst zu vernichten (oder mitzurauben) ist minder<br />
denkbar, als ein solcher jenes das Ganze durchdringende Gesetz [Zitat Rec] durch<br />
den Tod der Bibliothekare oder durch Vernichtung, Entwertung u.s.w. des darüber<br />
verfaßten Dokumente, der Bibliothek entreissen könnte.«''<br />
1790 stellt analog dazu der Pariser Mechaniker und Waffenfabrikationskontrolleur<br />
Honore Blanc fest, daß die in Grenzregionen gelegenen Werkstätten feindlichen<br />
Einfällen gegenüber unsicher smd; die Umschaltung auf dezentrale,<br />
modulare Waffenfabrikation erst (parallehsiert auf Informationsverteilungsebene<br />
durch die Geburtsumständc des Internet in den USA nach Weltkrieg II) immunisiert<br />
ein System gegen die Verletzlichkeit <strong>von</strong> Subjekten. 12 Molbech definiert<br />
die dem entsprechende »rein mechanische Art, die Bücher aufzustellen« (und die<br />
er z. T. in der kaiserlichen Bibliothek in Wien, so wie in Prag realisiert findet), als<br />
Mechanik jenseits des Geistes und fragt rhetorisch, ob das Ordnen der Bücher<br />
einer Bibliothek »ganz unabhängig <strong>von</strong> der wissenschaftlichen Idee« sein könne,<br />
ob die bloßen Titel der Bücher »ohne Rücksicht auf den behandelten Gegenstand<br />
oder den Inhalt« - als unsemantische, wissensarchäologische Adressen also -<br />
»eine Anleitung, einleitendes Princip geben können <strong>für</strong> die Aufstellung« . Doch Speicherökonomie (Zweckmäßigkeit) ist eben nicht nur<br />
eine Funktion <strong>von</strong> Geschwindigkeit, sondern auch <strong>von</strong> Semantik als zusätzlicher<br />
Organisationsoption. Die Ordnung der Bücher einer Bibliothek in der bloßen<br />
Absicht, sie mit größerer Leichtigkeit und Schnelligkeit zu finden und herauszunehmen,<br />
sei ganz materiell und mechanisch, und »es würde sehr schwierig, ja<br />
unmöglich sein, eine allgemein leitende Idee <strong>für</strong> ein solches Unternehmen zu finden«<br />
. Nicht anders suchten auf der Ebene des Diskurses die<br />
Begriffe <strong>Geschichte</strong> und Fortschritt im 19. Jahrhundert die überkommenen, tradierten<br />
Daten der Vergangenheit entlang <strong>von</strong> Leitideen zu sortieren. Was als<br />
Gedächtnis verhandelt wird (Kant: »das judiciöse Memoriren«), ist tatsächlich eine<br />
Sortierfunktion, das Tableau der »Eintheüung eines Systems« (wie das <strong>von</strong> Linne)<br />
in Gedanken oder auch der »Abtheüungen eines sichtbar gemachten Ganzen« (z.<br />
B. in der Kartographie); schließlich die Topik, »d. I. ein Fachwerk« <strong>für</strong> allgemeine<br />
Begriffe, welches »durch Classeneintheilung, wie wenn man in einer Bibliothek<br />
die Bücher in Schränke mit verschiedenen Aufschriften vertheilt, die Erinnerung<br />
erleichtert.« 13 Gegen die mechanischen Vorteile eines solchen Systems steht<br />
10 Vgl. Friedrich Adolf Ebert, Die Bildung des Bibliothekars, Leipzig 1820<br />
11 Schrettinger 1808/29: 3. Heft, Vorrede, zitiert hier nach: Meynen 1997: 40<br />
12 Siehe Peter Berz, 08/15. Ein Standard des 20. Jahrhunderts, München (Fink) 2001, 17<br />
13 <strong>Im</strong>manuel Kant, über die strenge Trennung <strong>von</strong> Phantasie und Gedächtnis, in:
762 BiBi.ioTiu-K<br />
»die entschiedene Unlust, welche ein wissenschaftlich gebildeter Geist fühlen muß,<br />
wenn er ein Verfahren betrachtet, welches unter dem Schein einer wissenschaftlichen<br />
Ordnung doch eigentlich alle innere wissenschaftliche Verbindung zwischen<br />
den Schriften, die zu einem Fach gehören aufhebt, und welches im Grunde die<br />
Bücher doch nur wie eingebundenes Papier ansieht, das man nicht eigentlich ordnet,<br />
sondern nur hinstellt, zunächst mit Rücksicht auf den materiellen Raum und<br />
auf Bequemlichkeit, die zu einem Fach gehörenden Bücher nahe bei einander zu<br />
finden.« <br />
Das also heißt Kontingenz im realen Raum, dem Molbech »als Grundbegriff<br />
des BibJiothekssystcms« einen virtuellen Raum entgegenhält und fordert, daß<br />
Bücher »als Werke des Geistes dargestellt und deshalb nach einem geistigen,<br />
auf das Materielle, nämlich eingebundene Bücher, angewandten Pnncip geordnet<br />
werden müssen; nicht umgekehrt nach einem materiellen Princip (Raum<br />
und Größe), das man im Allgemeinen bei den Büchern oder deren Inhalt<br />
gebraucht, und dem man eine Art Anwendung auf das Geistige geben will«<br />
. Einbruch der Historie als Kontext in das in der Epoche<br />
der Aufklärung eingespielte enzyklopädische System der Einteilung einer Wissenschaft:<br />
Denn auch dieses fordert »nothwendig die Rücksichtnahme auf die<br />
wirkliche Beschaffenheit der Wissenschaft in einem gegebenen Zeitpunkt, und<br />
auf die wesentlichen Veränderungen oder Erweiterungen derselben« . Als Geist, als Spektrum lebt in dieser Hinsicht das Alte Reich<br />
fort:<br />
»So kann z. B. Deutschlands alte Eintheilung nach Kreisen, wo sie einmal eingeführt<br />
ist, ohne Schaden in der geographischen und historischen Literatur einer<br />
Bibliothek beibehalten werden, und viele uralte, aber in unserm auf dem Papier<br />
rechtlichen und legitimen Zeitalter verschlungene und auch in der wirklichen Geographie<br />
ausgestrichene Staaten haben in der Bibliothek eine durchaus nothwendige<br />
historische Existenz« <br />
- in der Kopenhagener Bibliothek etwa, wo die deutsche <strong>Geschichte</strong> ein entsprechend<br />
reiches Fach ist; hier wird die wissenschaftsdisziphnäre Ordnung mit<br />
der bibliothekswissenschaftlichen Bezeichnung identisch. Dort sind »die<br />
Specialgeschichten ganz nach der Kreiseintheilung der jetzt oder früher unabhängigen<br />
Reichslande geordnet« . Wie etwa die amerikanische<br />
Verfassung durch die Option <strong>von</strong> amendments ihre eigene<br />
Veränderbarkeit implementiert, wird man auch »niemals ein unveränderliches,<br />
mit Strenge gesetztes wissenschaftliches und bloß theoretisches System« aufstellen<br />
können . Die Bibliothek als Medium begreifen heißt, ihre<br />
Eigengesetzlichkeit als Kanal zu berücksichtigen. Molbech insistiert ausdrück-<br />
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht I, 1 (1798), als Extrakt in: Die Erfindung des<br />
Gedächtnisses, zsgest. u. eingel. v. Dietrich Harth, Frankfurt/M. (Keip) 1991, 95ff (96f)
BlBUOTHKKSRÄUME . • 763<br />
lieh auf der Differenz <strong>von</strong> wissenschaftlicher Enzyklopädie als System und als<br />
Praxis <strong>von</strong> Speicherverwaltung:<br />
»Daß das encyclopädische Bibliothekssystem in dem Reiche der Wissenschaften<br />
nicht allein ein anderes sein kann, sondern auch ein anderes sein muß, als das<br />
System, welches durch die wissenschaftliche Encyclopädie selbst begründet wird;<br />
daß jenes bibliothekarische eine kritisch modificirte Anwendung des letzern ist,<br />
oder daß zwischen der strengen encyclopädischen Theorie und der regellosen<br />
mechanischen Unordnung ein Mittelweg ist.« <br />
Daraus folgert Molbech pragmatisch den Grundsatz der »Ucbereinstimmung<br />
zwischen dem Platz der Bücher in dem wissenschaftlichen Kataloge und ihrem<br />
Standplatze in der Bibliothek« , und paraphrasiert die Grundsätze<br />
<strong>von</strong> Eberts Lehrbuch Die Bildung des Bibliothekars :<br />
Alles so viel als möglich auf historische Eintheilungsgründe zu begründen, »weil<br />
diese dem Leben so nahe verwandt sind, daß sie, selbst veraltet, sich weit treuer<br />
und leichter im Gedächtnisse aufwahren lassen, als veraltete encyclopädische<br />
und systematische Ansichten« . Nichts anderes<br />
meint das archivalische Provenienzprinzip als Gedächtnisordnung.<br />
»2) Alle idealen künstlichen und zu absrracten Eintheilungen vermeide man sorgfältig<br />
und bringe im Gegentheil das Praktisch-Homogene so nahe zusammen, als<br />
möglich. <br />
4) Die Grenze des bibliothekarischen Systems ist bald und leicht überschritten,<br />
sobald wir uns in das Feld der philosophischen Systematik verirren. Aber eben<br />
so wenig dürfen wir klemmüthig ein Buch nach dem andern den Miscellanschränken<br />
zutragen.<br />
5) Nicht die Form, sondern der Inhalt entscheidet bei dem Ordnen.<br />
6) Mit Freiheit im Ordnen verbinde man strenges Vermeiden aller Willkürlichkeit,<br />
aller Accommodation an locale oder andre bloß zufällige Gründe und Schwierigkeiten;<br />
diese können sich mit der Zeit verändern und wegfallen.« <br />
Dynamisierung des Feststehenden: denn den (Algo-)Rhythmu-s <strong>von</strong> Historie<br />
bestimmt die Zeit. Daß eben nicht" die Form des Buchs (»Einkleidung,<br />
Behandlung, Darstellung«), sondern sein Inhalt (»Materie, Stoff«) beim Ordnen<br />
entscheide (Ebert), kann Molbech »unmöglich als allgemeine Regel<br />
annehmen, da die Form in den meisten Fällen den Titel bestimmt, und dieser<br />
überhaupt die nächste Anleitung geben muß, dem Buch seinen Platz anzuweisen«<br />
. Platzanweisung ist das Stichwort, das in jener<br />
Epoche aus der non-diskursiven Praxis <strong>von</strong> Speicherverwaltung in den historischen<br />
Diskurs wandert, etwa ins (seit J. J. Winckelmann so gedachte) imaginäre<br />
Museum der Kunstgeschichte, wo der kunstgeschichtliche Stil- als<br />
Entwicklungsbegriff den Ort des Werks bestimmt und etwa unter der Direktion<br />
<strong>von</strong> Gustav Friedrich Waagen seit 1830 <strong>für</strong> die entsprechende Hängung<br />
der Bilder in der Berliner Nationalgalerie im realen Raum verantwortlich
764 Biiii.io! i ii.K<br />
zeichnet. 14 Für die Speicherverwaltung weist Molbech auf die <strong>von</strong> Reuß in<br />
Moskau entwickelte Methode, den wissenschaftlichen Katalog in einzelnen<br />
systematisch geordneten Blattiteln, »welche durch eine mechanische Einrichtung<br />
zusammen gehalten und in Capseln oder passenden Behältern aufbewahrt<br />
werden«, bestehen zu lassen . Was das Gedächtnis logistisch<br />
zusammenhält, ist damit eine Funktion seiner Mechanik.<br />
Klostcrästbctik (Schrettinger, Ostwald)<br />
Molbech widerspricht Eberts Gesichtspunkt der Beförderung <strong>von</strong> äußerer Eleganz<br />
in der Aufstellung der Bücher - »daß man immer jene Werke, welche einen<br />
gleichen oder ähnlichen Einband haben, zusammenstellt«, wodurch, wie er hinzufügt,<br />
die ganze Bibliothek ein »malerisches, mosaikartiges Ansehn bekömmt«<br />
. Die verbildlichte, an der ars memoriae orientierte Raumordnung<br />
und -ästhetik der Bibliothek sieht Molbech vielmehr durch reine Information<br />
ersetzt; Ästhetik als informatorischer Mehrwert wird nicht länger anerkannt. 15<br />
»Ohne Zweifel muß die Numerirung nicht vorgenommen werden, ehe die<br />
systematische Ordnung ganz beendigt ist und jedes Buch seinen definitiven<br />
Platz erhalten hat« ; der Numenerungsvorschlag nimmt Deweys<br />
Dezimalklassifikation strukturell vorweg. Molbech referiert Martin Willibald<br />
Schrettingers vierbändigen Versuch eines vollständigen Lehrbuches der Bibliothek-Wissenschaft<br />
oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines<br />
Bibliothekars in wissenschaftlicher Form abgefaßt (München 1808/29), die<br />
Administration (Geschäftsführung) an die Stelle <strong>von</strong> Hermeneutik im Raum<br />
des Gedächtnisses stellt, als buchstäblich alphanumerische Disposition:<br />
»In dem ersten Hefte nimmt er freilich eine vom Katalogsystem unabhängige Ordnung<br />
und Aufstellung der Bücher an, und gründet die Leichtigkeit und Sicherheit,<br />
jedes verlangte Buch in der Bibliothek zu finden und herbei zu schaffen, auf<br />
die Übung und Fertigkeit, die Kenntnis des Bibliothekssystems auf die darnach<br />
aufgestellte Büchermasse anzuwenden, als auf die mechanische Anleitung und<br />
alphabetische Ordnung der Nummern; hierin muß ich <strong>von</strong> des Verfassers Ansicht<br />
abweichen und annehmen, daß die Harmonie zwischen dem System im<br />
Kataloge und der Aufstellung der Bücher im Ganzen das nützlichste, natürlichste<br />
und consequentestc, wenn auch nicht in allen Fällen das bequemste Verfahren bei<br />
dem Ordnen einer Bibliothek ist.« <br />
H Zur Museumsarchäologic <strong>von</strong> Bilderhängungen in der Berliner Nationalgalerie siehe<br />
Florian Illies, Eine <strong>Geschichte</strong> der Sinnlichkeit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v.<br />
6. Juni 1998<br />
15 Dazu Carsten-Peter Warncke (Flg.), Ikonographie der Bibliotheken (= Wolfenbütteler<br />
Schriften zur <strong>Geschichte</strong> des Buchwesens, Bd. 17), Wiesbaden 1992
BllU.IOTI II-.KSKÄUM1- ' 765<br />
<strong>Im</strong> 2. Heft seiner Bibliothek-Wissenschaft (1808) erklärt Schrettinger dann den<br />
alphabetischen Katalog <strong>für</strong> nötiger als den systematischen; jeder Bibliotheksgelehrte<br />
hat sein eigenes System der Wissenschaften im Kopf, die alphabetische<br />
Ordnung aber »ist in allen Köpfen dieselbe« 16 . Was jenseits ideosynkratischer<br />
Ordnungen insistiert, sind im Unterbewußten die Lettern, so wie in der Hauptstaatsbibliothek<br />
München um 1810 nach dem Schema der Göttinger Bibliothek<br />
auf der Innenseite der Bücher (außen waren sie ohne Bezeichnung) mit Tinte<br />
die langatmige Signatur mit der Blattseitenangabe des Katalogs eingeschrieben<br />
wird . Schrettingers 3. Heft des Lehrbuchs (München<br />
1810) setzt den Akzent erneut auf eine soweit als möglich systematische Aufstellung<br />
und den alphabetischen Katalog wieder hintenan. Die in den sukzessiven<br />
Publikationen seiner Hefte fortgesetzten Modifikationen manifestieren,<br />
wissensarchäologisch seriell und nicht mit der Unterstellung einer historischen<br />
Entwicklung gelesen, daß das Verhältnis alphabetisch versus systematisch in der<br />
Bibliotheksordnung nicht dichotomisch als Alternative zu formulieren ist, sondern<br />
daß der logozentrische Begriff der Ordnung einer »mit großen chaotischen<br />
Massen ringenden Bibliothek« sich selbst ständig<br />
dekonstruiert. In der Diskussion des den Ausführungen Hilsenbecks vorangehenden<br />
Vortrags <strong>von</strong> Georg Leyh über »Systematische oder mechanische<br />
Aufstellung« plädiert Brunn (gegenüber der groben systematischen Aufstellung<br />
in Gruppen) <strong>für</strong> die rem mechanische unter Hinweis auf den Einbruch der technisch-naturwissenschafthchen<br />
Literatur in den klassischen, humanistisch bestimmten<br />
Raum der Bibliotheken, wo sogar die groben Scheidelinien nicht<br />
dauernd sind:<br />
»Beispiele sind die Elektrotechnik, die im gedruckten Katalog der Münchener<br />
Hochschule <strong>von</strong> 1881 und sogar im ersten Nachtrag <strong>von</strong> 1892 noch nicht als Fach<br />
existiert , ferner der Eisenbetonbau, der die Grenzen zwischen Hochbau und<br />
Ingenieurwesen verwischt hat, die energetische Auffassung des physikalischen<br />
Geschehens, die Strahlungstheone, weiter die Kinematographie usw.« <br />
So entstand die Deutsche Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation 1941 aus den spezifischen<br />
Bedürfnissen der technisch-naturwissenschaftlichen Bibliotheken, denen<br />
gegenüber die bislang fast ausnahmslos geisteswissenschaftlich ausgebildeten<br />
Bibliothekare argwöhnisch oder ablehend gegenüberstanden — eine paradigmatische Differenz in der Datenverarbeitung. Damit<br />
korrespondiert eine katalogkundhche Einsicht der Bibliothekswissenschaft.<br />
Gemäß der sozialempinschen Analyse deutscher Hochschulbibliotheken gilt,<br />
16 Adolf Hilsenbeck, Martin Schrettinger und die Aufstellung in der Königlichen Hofund<br />
Staatsbibliothek München, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 31 (1914), 407-<br />
433 (415)
766 BllW.IOTl IHK<br />
»daß <strong>für</strong> Geisteswissenschaftler ein erheblicher formaler Aufbereitungsaufwand<br />
der Bibliothek angestrebt werden muß, im Gegensatz zu einfacheren Suchstrategien<br />
<strong>für</strong> Naturwissenschaftler. Sind Bücher tatsächlich nur dann als »Werke des<br />
Geistes« anzuerkennen, wenn sie systematisch aufgestellt sind, und als bloßes<br />
»eingebundenes Papier« zu betrachten, wenn sie der akzessorischen oder der<br />
»vermischten scientifisch-alphabetische Methode« unterworfen sind ? »Für Geisteswissenschaftler ein großer Aufwand <strong>für</strong> die Kataloge,<br />
<strong>für</strong> die Naturwissenschaftler besonders großer Aufwand <strong>für</strong> die Art der Zur-<br />
Verfügung-Stellung der physischen Einheit Buch.« 17 Die Differenz hegt also in<br />
der Her/stellung, im wissensarchitektonischen Dispositiv, im Gestell. 1812 setzt<br />
Schrettinger auf den Vorrang der schnellen Auffindbarkeit <strong>von</strong> Wissen, woraus<br />
die Ordnung der Büchertitel unabhängig <strong>von</strong> der Aufstellung folgt - ein bibliothekarisches<br />
Votum im Streit der Fakultäten, nämlich das Ende ihrer Maßgeblichkeit<br />
als Klassifikationsprinzip . Dementsprechend<br />
führt die Universitätsbibliothek Wien seit 1884, die Berliner Königliche Bibliothek<br />
nach 1900 eine real absolute Trennung <strong>von</strong> Speicher- und Leseordnung ein,<br />
die allein durch Zuordnung in den symbolischen Maschinerien der katalogistischen<br />
Speicheradressierung relativ wieder zusammengeführt wird. 18 Für die elektronische<br />
Speicherverwaltung, die zwischen Gedächtnis und Programm nicht<br />
mehr trennt, wird diese Differenz nur noch ein Effekt entsprechender Oberflächengestaltung<br />
sein. Unter Abzug <strong>von</strong> Historie tritt das hinter ihrer narrativen<br />
Verfertigung stehende Dispositiv in seiner Nackheit zutage: Archiv und<br />
(vornehmlich in diesem Falle) Bibliothek. Die Schaltung <strong>von</strong> Aggregatzuständen<br />
der Wissensordnung tarnt sich hinter den Ansätzen zur historischen Erzählung;<br />
eine Bibhothekswissen(schaft)sgeschichte, die den Stellvertretern gewidmet<br />
ist (Meynen), wird somit zur Ausstellung ihrer eigenen Produktionsbedingungen.<br />
Hier schreibt sich ein Paradigma fort, welches Descartes mit seinen Regulae<br />
ad directionem ingenii setzte. Seitdem gilt es nicht mehr schlicht, Ähnlichkeiten<br />
<strong>von</strong> Wörtern und Sachen, <strong>von</strong> Überliefertem und Gesehenem als Signaturen der<br />
Welt und Markierungen auf der Dinge zu entziffern; Wissen <strong>von</strong> Ordnung verteilt,<br />
mißt, und verkettet vielmehr Identitäten und Unterschiede aufgrund <strong>von</strong><br />
formalen Operationen, die ein geordnetes Tableau überhaupt erst bilden: durch<br />
Zerlegung, also Analyse <strong>von</strong> Ganzheiten in Elemente und die Kombination,<br />
Rekombination und Verkettung dieser Elemente zu Serien, Reihen, Kolonnen.<br />
In der unendlichen Entfaltung der Substitutionen entsteht so ein Gitter oder<br />
archäologisches Raster des Wissens, welches das analoge Rauschen weltlicher<br />
17 Neubauer, zitiert nach: Klaus Haller, Katalogkunde: Formalkataloge u. formale Ordnungsmethoden,<br />
München / London / Paris (Säur) 1980, Abschnitt 72<br />
ls Siehe Heinrich Roloff, Lehrbuch der Sachkatalogisierung, 2. Aufl. Leipzig 1954, 4
Bim.ioTi ii-.KSRÄUMi-. 767<br />
Ähnlichkeiten diskret kalkulierbar macht. 19 Als disziplinäre Praxis meint<br />
das gerade in einer Epoche, welche antinomisch die <strong>Im</strong>agination <strong>von</strong> Vergangenheit<br />
als <strong>Geschichte</strong> zu generieren sich anschickt, den Raum des Archivs<br />
als Gesetz und Setzung des Sagbaren zugleich. Die Elemente darin sind austauschbar,<br />
da sie sich durch ihren Platz in einer Reihe und durch ihren Abstand<br />
<strong>von</strong>einander bestimm. An die Stelle des Territoriums tritt also als Grundeinheit<br />
der topologische Ort. als »Platz in einer Klassifizierung, der Kreuzungspunkt<br />
zwischen einer Linie und einer Kolonne, das Intervall in einer Reihe <strong>von</strong><br />
Intervallen«. 20<br />
Geht im säkularisierten Bayern nach 1803 die ehemals monastische Ordnung<br />
der Dinge in Bibliothekswissenschaft über (so die These <strong>von</strong> Glora Meynen),<br />
oder vollzieht sich ein abrupter Akt, die Überlagerung einer Wissensformation<br />
durch eine andere? Das Darstcllungsmodell Historie ist wenig geeignet, solchen<br />
Diskontinuitäten Rechnung zu tragen. Tatsächlich heißt es noch mitten im zweiten<br />
Weltkrieg in den USA, »the cataloger should possess the best traits of a scholar,<br />
an administrator, and a good clerical worker«. 21 Hat Martin Schrettingers<br />
Bibliothek-Wissenschaft nach 1800 das Dispositiv der Bücherordnung <strong>von</strong> Benediktinerregel<br />
auf Staatsräson umgestellt, wählt der Nobelpreisträger <strong>für</strong> Chemie,<br />
Wilhelm Ostwald, Vordenker des Monismus, seinerseits wieder monastische Formen<br />
der sozialen Organisation seines Modells. Wo der Monismus an die Stelle<br />
bisheriger Religion tritt, schreibt er doch deren Gesetz fort, deren Form als Institution:<br />
»Unter einem >Kloster< verstehe ich eine Anstalt, wo gleichgesinnte Menschen<br />
in Gruppen zusammenleben« .<br />
Schrettmger ist zunächst Benediktmermönch in Weißenohe bei Nürnberg, 1800<br />
mit dem Posten des Klosterbibhothekars. Sein Weg heraus »führt nicht in die<br />
Theologische Fakultät der Universtität <strong>von</strong> Königsberg«, sondern geradewegs in<br />
die Katastrophe dieses epistemischen Dispositivs: Noch bevor die dritte Säkulansationswelle<br />
zur Auswirkung kommt, fordert Schrettmger die Auflösung des<br />
eigenen Klosters; bevor das Kloster 1803 endgültig aufgelöst wird, richtet Schrettinger<br />
ein Stellengesuch an die Königliche Hof- und Centralbibliothek . Dort wird er 1802 aufgenommen, 1806 zum Kustos ernannt und 1839<br />
zum Unterbibliothekar, zum ersten Beamten der Bibliothek. Die Art, wie Schret-<br />
19<br />
Bcrz 2001: 28, unter Bezug auf Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Iiine<br />
Archäologie der Humanwissenschaften [*1966], Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1980, 81 ff<br />
20 ::<br />
Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses [ '1975],<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1977, 187<br />
21<br />
Margaret Mann, Introducnon to cataloging and the classification of books, 2. Autl.<br />
1943, zitiert nach: Hermann Fuchs, Kommentar zu den Instruktionen <strong>für</strong> die alphabetischen<br />
Kataloge der Preußischen Bibliotheken, Wiesbaden (Harrassowitz) 1955,<br />
Vorbemerkungen: Wesen und Zweck des alphabetischen Katalogs, 12
768 BIBLIOTHEK.<br />
tinger am Anfang seines Lehrbuches die Bibliothek definiert, trennt Religion <strong>von</strong><br />
Bücherwissenschaft: schlicht »eine beträchtliche Sammlung <strong>von</strong> Büchern«<br />
. Die Datenbank Bibliothek wird<br />
nicht mehr auf ein transzendentes Signifikat hin gelesen, das selbst den Kollektivsingular<br />
aller Bücher darstellt: die Bibel. Aus deren Wissensaggregation wird das<br />
offene System der wissenschaftlich-systematischen Bibliotheksordnung. Schrettinger<br />
gibt in der Fortsetzung seines Lehrbuchs eine Methode an, einen systematischen<br />
Katalog zu verfertigen, »welcher ein vollkommenes Inventanum über die<br />
ganze Bibliothek ausmacht, indem er die Titel der sämmtlichen Bibliothskwerke<br />
genau in der nemlichen Ordnung enthält, in welcher diese in der Bibliothek<br />
selbst aufgestellt sind« . <strong>Im</strong> zweiten Band (oder<br />
vierten, abschließenden I Jcil) seines Lehrbuch der Bibliothek-Wissenschaft, dessen<br />
erster Band in drei Heften 1808-1810 erschien, führt Schrettinger den gegenstandsbezogenen, alphabetischen Realkatalog ein, wie ihn auf<br />
ähnliche Weise Kayser in Ueber die Manipulation bei der Einrichtung einer<br />
Bibliothek (Bayreuth 1790: xic f.) angedacht hat - ein Instrument der Klassifikation<br />
<strong>von</strong> Wissen, in dem die bibliothekarische Tätigkeit wissenschaftlich gipfelt,<br />
»insofern nur in ihm die Reihenfolge der Titel durch den Inhalt der Bücher, d. h.<br />
innerlich bedingt und notwendig ist«, im Unterschied zur titelbezogenen, damit<br />
allen Formen der Arbitrantät ausgesetzten Adressierung. 22<br />
»Wir sehen also, daß Schrettinger in demselben Werke, welcher er 1829 mit dem vierten<br />
Hefte geschlossen hat, 19 Jahre früher das wissenschaftliche System <strong>für</strong> das Ordnen<br />
einer Bibliothek billigte und lehrte, welches er jetzt bekämpft und ganz verwirft.<br />
daß dagegen die erwähnten alphabetischen Spezialkataloge über jede Unterabtheilung<br />
der Wissenschaften und die Realregistcr über die Literatur oder einzelne<br />
literarische Materien, welche er alphabetische Realkataloge nennt, an die Stelle<br />
eines eigentlichen und universal-wissenschaftlichen Katalogs über alle in der Bibliothek<br />
vorhandenen Werke treffen müssen. er kommt bei jeder Gelegenheit auf<br />
die mechanische Aufstellung und Bequemlichkeit zurück, daß alle Ordnung in<br />
einer Bibliothek nur dahin geht, den Büchern einen Platz im Raum anzuweisen,<br />
damit Jeder im Stande sei, sie herausnehmen zu können.« <br />
Demgegenüber relativiert die Informatisation der Adressierung den Raumbegriff.<br />
Bereits Naude hat in seinem Advis pour dresser une bibliotheque die<br />
autopoietische Ordnung des Wissens durch die Einsicht betont:<br />
»daß nur die systematische Ordnung in und durch sich selbst ohne alle andere<br />
mechanische Hilfsmittel eine Bibliothek zugänglich und brauchbare macht, oder<br />
- 1 '' Rudoll l'ocke, Allgemeine Theorie der Klassifikation und kurzer I.iuwurl einer<br />
Instruktion <strong>für</strong> den Realkatalog, in: ders. (Hg.), Festschrift zur Begrüssung der sechsten<br />
Versammlung Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni 1905, Posen<br />
(Jalowicz) 1905, 5ff (7)
BlBI.KVI'HI-KSRÄUMK 769<br />
daß es allein durch diese Ordnung möglich ist, jedes Buch in einer Bibliothek <br />
zu finden. Ist man durch die bloße systematische Ordnung selbst ohne alle Kataloge<br />
im Stande, diesen Zweck zu erreichen; so ist einleuchtend, daß selbst in praktischer<br />
Rücksicht diese Ordnung, welche in sich genügend ist, vollkommener sein<br />
muß., als jede andere, welche eines oder mehrerer Kataloge bedarf, um ihrem<br />
Zwecke zu entsprechen.« .<br />
Molbechs Argumente gelten <strong>für</strong> die wissenschaftliche Gebrauchsbestimmung<br />
einer öffentlichen Bibliothek, und insofern als Differenz zum ideosynkratischen<br />
Raum des Sammlers: also »nicht nach willkürlichen, zufälligen, materiellen<br />
Bestimmungen wie z. B. nach dem Raum, dem Aussehen der Bücher, der<br />
Bequemlichkeit, sie holen zu können und dergh, sondern nach der Idee des<br />
mnern geistigen Zusammenhangs, nach der logisch oder wissenschaftlich richtigen<br />
Theilung und Unterabtheilung« . Schrettingers vermischtes<br />
System sei demgegenüber »eine unnatürliche Vereinigung des wissenschaftlichen<br />
Organismus und alphabetischen Mechanismus«. 23 Molbech schließt mit<br />
Worten Mehmels, der die Seele der Bibliothek in ihrer wissenschaftlichen Einrichtung<br />
lokalisiert: »Es muß unmöglich sein, mit einigem Ernst und Fleiß eine<br />
Bibliothek zu betrachten, ohne eine encyclopädische Übersicht des Stammbaums<br />
der Literatur zu bekommen« .<br />
Aufstellung und Katalog<br />
Friedrich Adolf Ebert lokalisiert 1820 das Wissen der Nation nicht im Inhalt der<br />
Bücher, sondern in den Katalogen, »in der Consignirung und Anordnung« ihrer<br />
Bibliotheken; der Bibliothekar »suche hier das Nationale der Anordnung auf«<br />
(wie es sich später in den Tastaturen der Schreibmaschinen und Zeichensätzen<br />
der Computer spiegelt). 24 Die Unordnung der deutschen Nation nach 1806 führt<br />
auch zu einer Umordnung der Gedächtnisagenturen; an die Stelle der monastischen<br />
Ordnung des Bibliothekswissens tritt mit der Säkularisation die Ordnung<br />
des Staates. Das Reichsgesetz vom 25. Februar 1803 überschreibt die vormalige<br />
Befehlsgewalt restlos dem Staat 25 ; nachdem die Klöster zunächst die Speerspitzen<br />
der Gedächtnisadressierung, nämlich Kataloge haben einreichen müssen,<br />
gehen das Potential der Büchermengen und die Klosterbibliothekare selbst in die<br />
23 Ebd., 243. Mithin steht die Schnittstelle Mensch-Maschine zur Disposition; das »Zustandekommen<br />
<strong>von</strong> Mechanismen nach organischem Vorbilde, sowie das Verständniss<br />
des Organismus mittels mechanischer Vorrichtungen«, beschreibt Ernst Kapp,<br />
Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus<br />
neuen Gesichtspunkten, Braunschweig (Westennann) 1877, Vorwort (vi)<br />
24 Friedrich Adolf Ebert, Die Bildung des Bibliothekars, Leipzig (Glück) 1820, 17 u. 15<br />
25 Meynen 1997: 35, unter Bezug auf den Reichsdeputationshauptschluß <strong>von</strong> 1803, § 35
770 Bim.ioriiKK<br />
neue Kontrolle ein. 26 Kontinuität und Bruch wirken bei der anfallenden Bücherneuordnung<br />
in einem Zug. Die Universitätsbibliothek Göttingen mit ihrem<br />
<strong>von</strong> Heyne und Reuß 1776-1790 geordneten Aufstellungs- und Katalogsystem<br />
steht bald im Mittelpunkt aller Erneuerungsdiskussionen: Sollte das Göttinger<br />
System in den Reglements der preußischen Reorganisationen und Neugründungen<br />
zum Muster erklärt werden? Sollten Bücher nur dann als Werke des<br />
Geistes anerkannt, wenn sie systematisch aufgestellt waren, und als bloßes eingebundenes<br />
Papier in ihrer schieren Materialität (also medienarchäologisch)<br />
betrachtet werden, wenn sie akzessonsch oder nach einer vermischten scientifisch-alphabetischen<br />
Methode sortiert waren? 27 Für die historische Aussage <strong>von</strong><br />
Buzäs gilt ihrerseits, daß sie nach einem Muster, nämlich dem der Historie, ihr<br />
Wissen über Vergangenheit filtriert und abgleicht. Das Modell Historie setzt das<br />
Dispositiv <strong>für</strong> Bibliotheksdenken; der Göttinger Johannes Füchsel sieht noch<br />
1922 <strong>für</strong> Universitätsbibliotheken keine andere Möglichkeit, als die Bücher »in<br />
den Zusammenhang des Schrifttums der Völker und Zeiten gereiht« aufzubewahren.<br />
28 Die Anhänger der Gruppenaufstellung, die bei Änderung der Aufstellung<br />
nicht die Gruppen-, sondern die akzessonsche Aufstellung wählen,<br />
propagieren diesen Sortierstil im Zusammenhang mit den Problemen der Hardware,<br />
nämlich des Bibliotheksbaus am Ende des 19. Jahrhunderts, und der<br />
Grund der Einführung der numerus c«rre«s-Aufstellung ist stets die Raumeinsparung<br />
- angefangen mit der Universitätsbibliothek Wien, die 1829 <strong>von</strong> der<br />
systematischen zur Gruppenaufstellung und 1884 zum numerus currens übergeht.<br />
Die Bestände der Deutschen Bücherei Leipzig, die allerdings einen Sonderfall<br />
darstellt, sind bereits bei ihrer Gründung akzessorisch aufgestellt.<br />
Ableitung einer administrativen Praxis: In behördlichen Registraturen ist seit<br />
Ende des 18. Jahrhunderts die innerhalb eines Jahres fortlaufende Numerierung<br />
der Akten ein Sortiermodus. Die <strong>von</strong> einer Kanzlei ausgehenden oder in sie eintreffenden<br />
Schriftstücke erhalten dabei vom 1. Januar eines Jahres ab fortlaufende<br />
Zahlen, wobei Anfrage und Antwort, Auftrag und Erledigung, die sich auf denselben<br />
Gegenstand beziehen, meist mit ein und derselben Zahl versehen werden.<br />
29 Auf dieser Ebene ist die historische Zeit zugunsten einer Struktur des<br />
Feedback aufgehoben.<br />
2I ' Hermann Hauke, Die Bedeutung der Säkularisation <strong>für</strong> die bayerischen Bibliotheken,<br />
in: Josef Kirmeier / Manfred Treml (Hg.), Glanz und Elend der alten Klöster: Säkularisation<br />
im bayerischen Oberland 1803, München (Süddeutscher Verlag) 1991, 87-97<br />
(87 u. 97)<br />
27 Buzas 1978: 130, unter Bc/ug auf: Molbech 1833. 61 f., u. M. Schrettinger, I landbuch<br />
der Bibliothek-Wissenschaft, 1834, 18t<br />
28 Buzas 1978: 132, unter Bezug auf: Johannes Füchsel, Entwurf einer Verwaltungsordnung<br />
<strong>für</strong> die deutschen Universitätsbibliotheken, in: ZfB 39 (1922), 401 f.<br />
2 '' Otto Stolz, Das Aufkommen der Numerierung der Akten in den Registraturen, in:
Blßl.lOTHHKSRÄUMl-: 771<br />
In der Wissensadministration des Nationalsozialismus kommt es 1939 zu<br />
einer systeminternen Umstellung. Mit dem 1. Doppelheft des 4. Jahrgangs (1939)<br />
verzeichnet die NS-Bibhographie Schrifttum nicht mehr nach publizistischen<br />
Medien differenziert (Buch, Zeitschrift, Zeitung), sondern nach sachlicher Ordnung.<br />
Movens ist die Insistenz des Politischen; »brauchbare Vorbilder <strong>für</strong> eine<br />
nationalsozialistische, also dem Wesen nach politische Systematik gab es nicht.<br />
So mußte ihre sachliche Ordnung letztlich eine systematische Darstellung<br />
des Nationalsozialismus werden, welchen <strong>Namen</strong> sie auch in der Überschrift<br />
trägt.« 30 Staat und parteiorientierte Bibliotheken fallen hier systematisch ineins;<br />
Vektor dieser Ausrichtung ist das Volk, der Versuch, »den Inhalt >Volk< zu fassen«;<br />
Bibhotheks- und Volksordnung bilden einander ab.<br />
Archivalische Zeitschrift, hg. v. d. Bayerische Archivverwaltung, 45. Bd. (= 3. Folge<br />
12. Bd.) München 1919 (Reprint Nendeln / Liechtenstein 1975), 128-132 (128)<br />
30 K. A. Sommer, Zur NS-Systematik, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 56 (1939),<br />
368-370(368)
772 BIBLIOTHEK<br />
Mechanisierung der Bibliothek<br />
Bibliothek und Programm: Das kollektive Gedächtnis, entziffert als Funktion<br />
seiner Speicher, erreicht im 19. Jahrhundert einen Umfang, der weder ein Individuum<br />
noch Notizbücher und Bücherkataloge in die Lage versetzt, den Inhalt<br />
<strong>von</strong> Bibliotheken zu memorieren und zu prozessualisieren. Die daraus resultierende<br />
Umschaltung der Dokumentation auf Karteikarten entspricht dabei<br />
»der Herausbildung eines echten äußeren Kortex«, denn bereits eine einfache<br />
bibliographische Kartei eröffnet eine solche Menge <strong>von</strong> Anordnungs- und<br />
Kombinationsmöglichkeiten, daß sie eine manuelle Maschine definiert. 1 In<br />
Kopplung mit der bibliothekarischen Dezimalklassifikation Melvil Deweys als<br />
»energischer Versuch, technische Einheitlichkeit in den systematischen Realkatalog<br />
zu bringen«, wird Bücherwissen damit berechenbar und der Katalog zur<br />
Sache selbst. 2 <strong>Im</strong> Bunde damit steht Vannevar Bushs Entwicklung des Rapid<br />
Selector; dieser Apparat wird den Bibliothekaren zugeschrieben. 3 Bushs mikrofilmbasierter<br />
Entwurf eines Memory Extender <strong>von</strong> 1945 findet als Schreibtisch<br />
statt; demgegenüber weiß die ausdrücklich an »Wissenschaftler und Ingenieure«<br />
adressierte Präsentation des Zeiß-Dokumentator-Systems der DDR (zur Mikroverfilmung<br />
<strong>von</strong> Schriftgut) nicht <strong>von</strong> automatisierten Techniken der Verknüpfung<br />
ah Schreibtisch, sondern vielmehr vom Schreibtisch als Speicher: »Auf<br />
Mikrofilm aufgenommen, findet dieses Material bequem im Schreibtisch Platz.<br />
Jedem Wissenschaftler seine Mikrobibliothek im Schreibtisch!« 4 <strong>Im</strong> Raum<br />
der Bibliothek (solange nicht die Schaltungsbibliotheken <strong>für</strong> Ingenicure und<br />
sogenannte libräries <strong>von</strong> Computerprogrammen selbst gemeint sind) gilt die<br />
Differenz <strong>von</strong> Kalkül und Programm, weshalb die Metaphorik dokumentationswissenschaftlicher<br />
Maschinen der Ordnung der Bibliothek eher folgt denn<br />
1 Andre Leroi-Gourhan, Hand und Wort: die Evolution <strong>von</strong> Technik, Sprache und<br />
Kunst, übers, v. Michael Bischoff, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 329; s. a. Kapitel<br />
VIII »Geste und Programm«<br />
2 Rudolf Focke, Allgemeine Theorie der Klassifikation und kurzer Entwurf einer<br />
Instruktion <strong>für</strong> den Realkatalog, in: ders. (Hg.), Festschrift zur Begrüssung der sechsten<br />
Versammlung Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni 1905, Posen<br />
(Jalowicz) 1905, 5ff (15); siehe ferner Hans Jakob Meier, Der Katalog ist die Sache<br />
selbst [über die Kunstsammlung des Karl of Arundel, London], in: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung v. 30. April 1997, N6<br />
3 Siehe etwa J. C. Green, The Rapid Selector - An Automatic Library, Rev. Doc. 17,<br />
Heft 3 (1950), 66-69, und den Aufsatz: Photoelcctric librarian, in: Electronics 22, Heft<br />
9 (l'-H 1 ))pitssiru, /iticri nach: Gabor ( )rosz. Übersieht über ehe Problematik der Dokumentationsselektoren,<br />
in: Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische Dokumentationsarbeit<br />
1, Heft 9 (November 1954), 173-178 (177f)<br />
4 Willi Pescht, Das Zeiss-Dokumentator-System - ein Mittel moderner Dokumentation,<br />
in: Dokumentation 1 (1953), 17-25 (25)
Mi-a-iANisn-RUNG OHR Biui.ioTin-k 773<br />
der des Archivs. 5 Was sich beim Akt der Katalogisierung an Ziffern und Übertragungen<br />
<strong>von</strong> Zettel zu Zettel fortschreibt, kann nicht aus eigener Kraft Kalküle<br />
starten, kontrollieren und wieder beenden; »erst modulare Systeme <br />
haben eine in Grenzen programmierbare Hardware als Gesetz kultureller,<br />
medial induzierter Gedächtnisregularitäten möglich gemacht.« 6 Damit korrespindieren<br />
modulare, mithin archivnahe Schreibweisen. Dem mechanistischen<br />
(Ein-)Lesen entspricht automatisiert die Prozessierung der Stapel sortierter<br />
Lochkarten in Charles Babbages Entwurf einer Analytical Engine, wo<strong>für</strong> er<br />
nicht die Leitmetapher des Archivs, sondern der Bibliothek wählt (ganz wie in<br />
der Sprache objektonentierten Programmierens). 7 Bibhotheksphantasien: »Der<br />
Geist als Besitzer dieses Schatzhauses hat in jedem Bild eine seiner Entwicklungsstufen<br />
vor sich . Diese Art Bibliothek des absoluten Geistes nennt<br />
Hegel Schädelstätte« . Die Schädelstätte des Geistes aber ist<br />
das Magazin nicht der Bibliothek, sondern vielmehr das Museum, wie es sich<br />
im frühen 19. Jahrhundert :n unmittelbarer Nachbarschaft zu Hegels Wohnung<br />
und Lehre am Berliner Lustgarten in Form <strong>von</strong> Schmkels Altem Museum baute,<br />
dem ersten Institut mit einer (kunst-)geschichthchen Bilderordnung. Dementsprechend<br />
ist Hegels Bild eine Halluzination, die sich dem Effekt eines anderen<br />
Gedächtnismediums verdankt.<br />
Bibhotheksmaschinen und Standorte: Gedächtnis versus Erinnerung (Hegel)<br />
G. W. F. Flegel hat das Gedächtnis als Schädelstätte des Geistes negativ und <strong>von</strong><br />
Erinnerung als Sich innerlich machen abgesetzt. 8 <strong>Im</strong> anbrechenden Zeitalter<br />
maschineller Industrieproduktion argumentiert der Philosoph im <strong>Namen</strong> des<br />
lebendigen Gesetzes gegen das tote Prinzip der Bewegung <strong>von</strong> Apparaten. 9 He-<br />
1 Siehe Gloria Mcynen, Bürokratien <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien, Bibliothek und Maschinen,<br />
Magisterarbeit Humboldt-Universität Berlin, Fakultät Kulturwissenschaften 1997,<br />
Kapitel III, 63<br />
6 Friedrich Kittler, Hardware, das unbekannte Wesen, in: Lab. Jahrbuch <strong>für</strong> Künste und<br />
Apparate 1996/97, hg. v. d. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien, Köln (Verlag Walther König)<br />
1997, 348-363 (350), unter Bezug auf: Anthony F. Hyrnan, Charles Babbagc, 1791-1871.<br />
Philosoph, Mathematiker, Computerpionier, Stuttgart 1987, und Esther Dyson u. a.,<br />
Cyberspace and the American Dream: A Magna Carta for the Knowledge of Age,<br />
Release 1.2, 22. August 1994, im Internet unter der Adresse: http://www.townhall.com/<br />
pff/posi tion.html<br />
Charles Babbagc, Passagcs from the I.itc of a Philosophcr, London IS64, 1 19<br />
8 Dazu Dietrich Harth (Hg.), Die Erfindung des Gedächtnisses, Frankfurt/M. 1991<br />
9 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des<br />
Naturrechts, seine Stelle m der praktischen Philosophie und sein Verhältniß zu den<br />
positiven Rechtswissenschaften ["'Kritisches Journal der Philosophie, hg. v. F. W. J.
774 BlBI.IOTIIKK<br />
gels Begriff des Geistes aber findet seine eigenen Grenzen in der Unmöglichkeit,<br />
»das Buchpapier, auf dem er selber stattfand, zu bezeichnen«. 10 Karl Rosenkranz<br />
hat Einblick in Hegels Nachlaß; in seiner Hegel-Biographie erklärt er, medienarchäolgisch,<br />
dessen Wissensmaschine:<br />
»Alles, was ihm bemerkenswerth schien schrieb er auf cm einzelnes Blatt,<br />
welches er oberhalb mit der allgemeinen Rubrik bezeichnete, unter welche der<br />
besondere Inhalt subsumirt werden mußte. In die Mitte des oberen Randes schrieb<br />
er dann mit großen Buchstaben, nicht selten mit Fracturschrift das Stichwort des<br />
Artikels. Diese Blätter selbst ordnete er <strong>für</strong> sich wieder nach dem Alphabet und<br />
war mittels dieser einfachen Vorrichtung im Stande, seine Excerpte jeden Augenblick<br />
zu benutzen. Bei allem Umziehen hat er diese Incunabcln seiner Bildung<br />
immer aufbewahrt. Sie hegen theils in Mappen, theils in Schiebfutteralen,<br />
denen auf dem Rücken eine orientierende Etikette aufgeklebt ist.« 1 '<br />
Ungeklärt - und mit größter Wahrscheinlichkeit iinklärbar - aber ist der Verbleib<br />
jenes Gestells. Archive speichern Papier, nicht Einbände. 12 Was verlorengeht,<br />
sind die Fußnoten der Philosophie. 13<br />
In seiner Philosophie hat Hegel das vergangene Denken aufgehoben, mithin<br />
als Gedächtnis formuliert. Von diesem Speicher aus kann (Philosophie-)<strong>Geschichte</strong><br />
nicht mehr fort-, sondern nur noch umgeschrieben werden, als beständiger<br />
Neuansatz, als Archäologie des Archivs. 14 Der mnemotechnische Akt des<br />
Abschreibens ist ein dem angehenden Historiker Friedrich Meinecke »verhasstes<br />
Wort: es ist so etwas mechanistisches, Geistloses, und andererseits wieder so<br />
schwer Betrügerisches, Diebisches. Und doch - », 15 Und dennoch: Geht das<br />
Schelling / ders., 2. Bd., 2. u. 3. Stück, Tübingen 1802], in: ders., Gesammelte Werke,<br />
hg. im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bd. 4: Jenaer Kritische Schriften,<br />
hg. v. Hartmut Büchner / Otto Pöggeler, Hamburg (Meiner) 1968, 482f<br />
10 Kittler ebd, unter Bezug auf: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomcnologie des<br />
Geistes, hg. v. Johannes Hoffmeister, 6. Aufl. Hamburg 1952, 88<br />
" Karl Rosenkranz, Georg Friedrich Wilhelm Hegels Leben, Berlin 1844, 12f. Dazu<br />
Friedrich Kittler, Die Nacht der Substanz, Bern (Benteli) 1989, 18f; auch in: Werner<br />
Künzel, Charles Babbage. Differenz-Maschinen: Exkurse zur Kartographie der technischen<br />
Kultur im 19. Jahrhundert, Berlin (Künzel) 1991, 28 ff<br />
12 In diesem Sinne äußert sich am 30. Oktober 1997 W. Schultze, Leiter des Archivs der<br />
Humboldt-Universität zu Berlin; auch die dortigen Hegehana (amtlicher Schriftverkehr)<br />
enthalten keinen Hinweis.<br />
13 Siehe Anthony Grafton, Die tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote, Berlin<br />
(Berlin Verlag) 1995, Kapitel 4 »Fußnoten und Philosophie«, 104-129, bes. 1 16f<br />
M Siehe Günter Figal, Der Geist, der stets verneint. Martin Fleidegger und die Negativität<br />
bei Hegel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. Juni 1994<br />
1:1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (Berlin), Rep. 92, Nachlaß Memecke,<br />
Nr 119, Kladden Persönliche Notizen, darunter: »Studien und Lesefrüchte, <strong>von</strong> Fr.<br />
Meinecke 1 889-«, 29: »Ein Capitel vom Abschreiben«
MKCHANISIKRUNG DHR BIBI.IOTHI-;K 775<br />
Abschreiben <strong>von</strong> der semantischen auf die buchstäbliche Aussagenebene über,<br />
<strong>von</strong> der Literatur zur Signatur und Titelaufnahme im Bibliotheksbetrieb, dann ist<br />
»accuracy in transcribing, in compiling notes of authonties, in copying everythmg<br />
the sine qua non of succcss«; aus einer »person of an habitually inaccurate<br />
turn of mind« kann daher nicht ein good cataloger werden 16 . Der Glaube, wesentliche<br />
Teile der Katalogarbeit können durch Bibliothekstechniker statt <strong>von</strong> diplomierten,<br />
wissenschaftlichen Bibliothekaren übernommen werden, sobald nur die<br />
Katalogvorschriften vereinfacht sind, sei absurd, heißt es in einem Kommentar zu<br />
den Instruktionen <strong>für</strong> die alphabetischen Kataloge der Preußischen Bibliotheken<br />
<strong>von</strong> 1899. 17 Bedarf Bibliotheksmechanik einer Schnittstelle zum (kultur-)wissenschafthchen<br />
Diskurs? Diesen Raum der Absurdität aber haben genau die Wissensspeichertechniken<br />
e i öffnet, welche die Modernisierung der Bibliotheken in<br />
Preußen und anderswo prägen, und gerade weil sie absurd sind, versprechen<br />
sie Effektivität, wo sich hermencutischc Zwischenschaltungen in Form humaner<br />
Interpretation als Blockade und Aufschub in der Ab- und Einarbeitung <strong>von</strong><br />
Buchwissen erweisen. Nolens volens insistiert, allen systematischen Ordnungen<br />
zum Trotz, in den Bibliotheken des 19. und folgenden Jahrhunderts auch die<br />
Option der Buchaufstellung nach laufender Nummer; innerhalb des gleichen<br />
Hauptfaches können Gruppen (etwa Auflagen folgend) gebildet werden. »Das<br />
wäre dann eine mechanische Aufstellung. Aber es würde sich empfehlen, das böse<br />
Wort mechanisch zu vermeiden, da es beunruhigend wirkt auf empfindliche<br />
Gemüter«, die der Sache selbst, der Gruppenaufstellung nicht abgeneigt sind. 18<br />
Solange operiert Gedächtnistechnik im Verborgenen des Geistes.<br />
Walter Benjamin definiert in seinen Thesen über den Begriff der <strong>Geschichte</strong>,<br />
daß Vergangenheit nur solange aktuell ist, solange sie abrutbar bleibt. Überhaupt<br />
setzt das Vergangene mit der Abrufbarkeit erst ein. Der maschinell immcdiate<br />
Zugriff auf den Speicher aber dementiert jeden emphatischen Gedächtnisbegriff.<br />
Solange die Bücheraufstellung die Ordnung des Wissens buchstäblich darstellt,<br />
ist der Katalog redundant: Doch wenngleich Bibliothekare teilweise noch Ende<br />
des 19. Jahrhunderts der Meinung waren, daß die systematische Aufstellung<br />
16 W. W. Bishop, handbook of modern library cataloging, 1914<br />
17 Hennann Fuchs, Kommentar zu den Instruktionen <strong>für</strong> die alphabetischen Kataloge<br />
der Preußischen Bibliotheken, Wiesbaden (Harrassowitz) 1955, Vorbemerkungen:<br />
Wesen und Zweck des alphabetischen Katalogs, 12<br />
18 Georg Leyh, Systematische oder mechanische Aufstellung?, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen,<br />
31. Jg. (1914), 398-407 (406). Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte<br />
Werke, hg. im Auftrag der Dt. Forschungsgemeinschaft, Bd. 20: Enzyklopädie<br />
der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), hg. v. Wolfgang Bonsiepen /<br />
Hans-Christian Lucas, Hamburg (Meiner) 1992, 462 (§ 463): »Es liegt nahe, das Gedächtniß<br />
als eine mechanische, als eine Thätigkeit des Sinnlosen zu fassen . Damit<br />
wird aber seine eigene Bedeutung, die es im Geiste hat, übersehen.«
776 BiiM.ioTtii-k<br />
Kataloge entbehrlich mache, »war man in der Praxis doch vom Anfang des Jahrhunderts<br />
an derselben Auffassung wie Petzholdt, daß Kataloge der Schlußstein<br />
in der Einrichtung einer Bibliothek seien, denn ohne diese sei sie nicht nur<br />
unvollkommen, sondern auch fast wertlos.« 19 Als Katalog ist der Adreßkopf die<br />
Bedingung der Operabilität des Speichers und des Zugriffs der Benutzer - Suprematie<br />
der Logistik (und Software) über die Hardware als Standortgebundenheit<br />
des Gedächtnisses. An die Stelle einer epistemologischen Begründung der Bibliothek<br />
tritt die praktische Funktionalität des Speichers. Die Dissoziation <strong>von</strong><br />
Magazin und Studium, die funktionale Umwandlung der Sammlungen <strong>für</strong><br />
Gelehrte in Gebrauchsbibhothekcn, sowie die wachsende Büchermenge selbst<br />
hatten ein fortschreitendes Abrücken der Bestände aus dem unmittelbaren<br />
Zugangsbereich der Benutzer in abgelegenere Behelfsräume zur Folge; diese Entfernung<br />
(um nicht zu sagen: Entfremdung) konnte nur durch Kataloge wettgemacht<br />
werden. »Insofern kann man daher den Beginn der diktatorischen Gewalt<br />
der Kataloge über die Bücher< als das Hauptmerkmal der Modernisierung in der<br />
Bibliotheksverwaltung betrachten.« 20 Das heißt nichts anderes als die Transition<br />
<strong>von</strong> literarischen Konfigurationen der Gedächtniskunst zur Steuerung durch<br />
Programme. Leyhs Angriff auf die systematische Aufstellung macht klar, daß<br />
jede Art <strong>von</strong> Sachkatalog zuallererst <strong>von</strong> der Standortgebundenheit befreit werden<br />
muß, wie sie Molbech zugunsten der Minimierung <strong>von</strong> Zugriffszeiten noch<br />
als grundsätzliche »Uebereinstimmung zwischen dem Platz der Bücher in dem<br />
wissenschaftl. Kataloge und ihrem Standplatze in der Bibliothek« deklarierte. 21<br />
Hanns Wilhelm Eppelsheimer erstellt später in Mainz einen standortfreien Sachkatalog,<br />
in dem der hierarchische Aufbau der Wissenschaftssystematik durch ein<br />
beliebig zu ordnendes, erweiterungs- und untergliederungsfähiges Nebeneinander<br />
der Fächer abgelöst wurde: dem Zug der industriellen Moderne zur Modulansierung<br />
entsprechend. Die Fächer selbst aber wurden »dem Zwang der<br />
Übersichtlichkeit durch Normung der formalen, immer wiederkehrenden Ele-<br />
19 Ladislaus Buzas, Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuesten Zeit (1800-1945),<br />
Wiesbaden (Reichert) 1978 (= Elemente des Buch- und Bibliothekswesens, Bd. 3), 134<br />
20 Buzas 1978: 134, unter Bezug auf: G. Leyh, Heynes Eintritt in die Göttinger Bibliothek,<br />
in: Aufsätze, Fritz Milkau gewidmet, Leipzig 1931, 223. Zur analogen Genealogie<br />
der Loslösung der Verzeichnung (Signaturen) <strong>von</strong> der Lagerung (Lokation) im<br />
Archivwesen siehe Johannes Papritz, Archivwissenschaft, Bd. 3, Teil 111,1: Archivische<br />
Ordnungslehre, Erster Teil, 2. Auflage Marburg (Archivschule) 1983, 203-231:<br />
»Die Signatur« (228ff)<br />
21 Christian Molbech, Über Bibliothekswissenschaft oder Einrichtung und Verwaltung<br />
öffentlicher Bibliotheken, nach der zweiten Ausgabe des dänischen Originals übers,<br />
v. H. Ratjen, Leipzig 1833, 72; dazu Ilse Schunke, Die systematischen Ordnungen und<br />
ihre Entwicklung. Versuch einer geschichtlichen Übersicht, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen<br />
Jg. 44 (August 1927), 377-400 (393)
MI;CHANISI!-:RUNG DKR BllSI.IOTHHK. 777<br />
mente der Literaturwerke und deren stets gleichbleibenden Reihenfolge (Schlüsselung)<br />
unterworfen. 22 Der Ausdruck Diktionärkatalog (ein Gedächtnis der<br />
Aufklärung) wird zunächst nur <strong>für</strong> die alphabetische, wörterbuchartige Anordnung<br />
und somit <strong>für</strong> den reinen Schlagwortkatalog gebraucht. Ansätze zu dieser<br />
Methode realisieren die Realkatalogpraxis der Königlichen Bibliothek Berlin und<br />
die Hilfstafeln der Brüsseler Dezimalklassifikation (1905); diese aber wird trotz<br />
Förderung durch den Deutschen Normenausschuß nur in der Landesbibliothek<br />
Bern (1909) und der Hochschulbibliothek Aachen (1927) sowie in kleinere<br />
naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Spezialbibhotheken<br />
eingeführt. An dieser wissensarchäologischen Nahtstelle trennen sich Geistesund<br />
exakte Wissenschaften; in der postrevolutionären Sowjetunion fordert<br />
A. Gastev die Mechanisierung selbst der Literatur unter der Losung Sätze nach<br />
dem Dezimalsystem. Damit wird die bibliothekarische Registrierung literarischer<br />
Kompositionen als metaleptisches rc-entry der Literatur zugeführt und zum<br />
Schaltkreis geschlossen. 23<br />
In Kapitel 100 <strong>von</strong> Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930)<br />
dringt General Stumm <strong>von</strong> Bordwehr in die Wiener Staatsbibliothek ein und<br />
sammelt Erfahrungen über Bibliotheken, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung<br />
- eigenschaftslose Räume allemal,'weil sie die Kenntnis aller Eigenschaften<br />
verwalten. Der Roman beschreibt den Katalog der Bibliothek als<br />
Hypertext:<br />
»Ich sage noch etwas wie <strong>von</strong> Eisenbahnfahrplänen, die es gestatten müssen, zwischen<br />
den Gedanken jede beliebige Verbindung und jeden Anschluß herzustellen,<br />
da wird er geradezu unheimlich höflich und bietet mir an,<br />
mich ins Katalogzuniner zu führen und dort allein zu lassen, obgleich das eigentlich<br />
verboten ist . Da war ich dann also wirklich im Allerheiligsten der Bibliothek.<br />
ich habe die Empfindung gehabt, in das Innere eines Schädels eingetreten<br />
zu sein; rings herum nichts wie diese Regale mit ihren Bücherzellen, und überall<br />
Leitern zum Herumsteigen, und auf den Gestellen und den Tischen nichts wie<br />
Kataloge und Bibliographien, so der ganze Succus des Wissens, und nirgends ein<br />
vernünftiges Buch zum Lesen, sondern nur Bücher über Bücher.«- 4<br />
22<br />
Buzäs 1978: 137f; über die Abwesenheit <strong>von</strong> Normung im archivischen Bereich siehe<br />
Papritz, op. cit., 102ff<br />
23<br />
Boris Arvatov, »Ein Packen <strong>von</strong> Ordern« <strong>von</strong> A. Gastev (1923), in: ders., Kunst und<br />
Produktion, hg. v. Hans Günther/ Karla Hielscher, München (Hanser) 1972, 104-106<br />
(106). S. a. Hermann Haußmann, Die Büroreform als Teil der Verwakungsreform,<br />
Berlin (Hehmanns) 1925, Paragraph »Mechanisierung der Verwaltung«, 24: »Auch in<br />
der Behandlung der Zeit muß größte Gleichmäßigkeit herrschen.«<br />
24<br />
Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbek (Rowohlt) 1978, 461. Siehe<br />
Günther Stocker, Schrift, Wissen und Gedächtnis: das Motiv der Bibliothek als Spiegel<br />
des Medienwandels im 20. Jahrhundert, Würzburg (Königshausen & Neumann)<br />
1997,111-123
778 Biui.ioTiiKK<br />
Musils General findet im Katalogzimmer unter anderem die Bibliographie der<br />
Bibliographien, also das alphabetische Verzeichnis der alphabetischen Verzeichnisse<br />
der Titel <strong>von</strong> Büchern und Aufsätzen. Die Sortierung des Wissens,<br />
das Gesetz und die Setzung des Sagbaren als Archiv respektive Bibliothek müssen<br />
<strong>von</strong> Inhalten absehen: »Es ist das Geheimnis aller guten Bibliothekare, daß<br />
sie <strong>von</strong> der ihnen anvertrauten Literatur niemals mehr als die Büchertitel und<br />
das Inhaltsverzeichnis lesen.« Bibliothekare lesen also niemals eines der Bücher?<br />
»Nie; mit Ausnahme der Kataloge« . 25 Gottfried Wilhelm Leibniz unterstreicht<br />
in seinem Vorschlag zur Einrichtung einer Bibliothek 1680 (dabei<br />
Archiv und Bibliothek ebenso indifferent gleichsetzend wie später Michel Foucault,<br />
und ganz im Sinne des kulturgeschichtlichen General-Repertonums des<br />
Frciherrn <strong>von</strong> Aulscß im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg): »Commc<br />
un Archif de meme une Bibhotheque n'est pas pour estre lüe. Gar eile ne doit<br />
servir que d'inventaire.« 26 Der Blick des Bibliothekars ist wissensarchäologisch,<br />
nicht hermeneutisch. 27 Wo Gedächtnisadressen zum Text <strong>von</strong> Lektüre werden,<br />
sind alphanumerische Signaturen und Ziffern zitierfähig; was Gustave Flaubert<br />
in seinem Romanfragment Bouvard et Pecuchet als enzyklopädisches Delirium<br />
(be)schreibt, ist die Rückseite des Spiegels gleichzeitig praktizierter Bibliotheksroutine.<br />
»Nachdem Flaubert diese Marionetten erschaffen oder postuliert<br />
hat, läßt er sie eine Bibliothek verschlingen, die sie nicht verstehen sollen.« 28 Am<br />
Ende kehren die beiden pensionierten Kopisten dahin zurück, wie vordem zu<br />
kopieren; tatsächlich verwandeln fünf Jahre Zusammenleben mit seinen Helden<br />
den Autor Flaubert selbst in Bouvard und Pecuchet. 29 Die Bibliothek extern<br />
durchzulesen, mit der Absicht, sie nicht zu verstehen, endet darin, sie transitiv<br />
zu schreiben.<br />
25 Über den am 1. Dezember 1998 verabschiedeten, seit dem 22. Mai 1780 an der Wiener<br />
Hof- und Nationalbibliothek fungierenden alten Nominalkatalog in Zcttelform:<br />
Hans Petschar / Ernst Strouhal / Hcimo Zobernig, Der Katalog. Ein historisches System<br />
geistiger Ordnung, Wien / New York (Springer) 1999<br />
2 '' Gottfried Wilhelm I.cibmz, Hinrichtung einer Bibliothek (November 1680], in: ders.,<br />
Politische Schriften, hg. v. Zcntralinstitut \. Philosophie an der Akademie d. Wissenschaften<br />
der DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie-Verlag) 1986, 349-353 (353)<br />
27 Siehe Peter Vodosck, »Der Bibliothekar, der liest, ist verloren.« Anmerkungen zur<br />
<strong>Geschichte</strong> eines Topos, in: Wolfenbüttelcr Notizen zur Buchgeschichte, 7. Jg., Heft<br />
3 SDczcmbcr) 1982,519-521<br />
2S Jorge Luis Borges, Verteidigung <strong>von</strong> Bouvard und Pecuchet, in: ders., Das Eine und<br />
die Vielen. Essays zur Literatur, München (Hanser) 1966, 101-107 (102)<br />
24 Ebd. Dazu Bernhard Sicgert, Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard<br />
und Pecuchet, in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der<br />
Kulturwissenschaft. 5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-40
MKCI IANISII-.RUNC; DI-:K BIHI.IOTHKK 779<br />
(Zu-)Ordnung, Formatierung und Weltformat (Wilhelm Ostwald)<br />
Gedächtnisynchromsierung erfordert die Standardisierung seiner Daten; die<br />
Zirkulation <strong>von</strong> Wissen ist eine Funktion der Kompatibilität seiner Institutionen<br />
und Standards. Nationale Räume, ihre Reich- und Bereichsweiten werden<br />
dadurch definiert - ein Gesetz dessen, was datenverarbeitet werden kann:<br />
»Mit den Formaten <strong>für</strong> Bücher, Broschüren, Zeitungen und Drucksachen aller Art<br />
verhält es sich gegenwärtig, wie es sich vor fünfzig Jahren in Deutschland mit den<br />
Münzen, den Maßen und den Gewichten verhalten hat. als dann durch die<br />
Vennannighu'tigung der Verkehrsbe/.iehungen diese verschiedenen hmheiten<br />
immer häufiger zu gleichzeitiger Anwendung gelangten, traten überall die argen<br />
Unbequemlichkeiten und Widersprüche in die Erscheinung, die ein solcher Mangel<br />
an hmheitlichkcit notwendig bewirkt.«' 0<br />
Es leiden darunter Bibhotheksräume und -formate wie die Produktion <strong>von</strong><br />
Büchereinbänden. Das Bibliotheksspeicherwesen steht im (<strong>für</strong> Geisteswissenschaften<br />
konstitutiven?) Verzug gegenüber der wirtschaftlichen Infrastruktur;<br />
»bekanntlich benutzt gegenwärtig in bezug auf Maß und Gewicht und die<br />
da<strong>von</strong> abhängigen elektrischen Maße fast die ganze Welt dieselben Einheiten«<br />
. Wilhelm Ostwald - der kurz vor der Jahrhundertwende während eines<br />
Chemiker-Kongresses in Brüssel mit Paul Otlet zusammengekommen war -<br />
fordert eine logisch-geometrische Relatiomerung der Formate:<br />
»Die Formate müssen aber untereinander in solcher Beziehung stehen, daß sie<br />
durch einfaches Falzen, d. h. durch Halbieren der Oberfläche aufeinander reduziert<br />
oder auseinander hergestellt werden können. da nur unter dieser Voraussetzung<br />
eine verlustlose Aufteilung der großen Bögen <strong>für</strong> kleine Formate<br />
möglich ist. Auch wird bekanntlich dieser Grundsatz technisch immer wieder festgehalten,<br />
indem man Folio, Quart, Oktav und Sedez durch Falzen aus ein und<br />
demselben Bogen erhält.« <br />
Das heißt nichts weniger als die Umstellung auf rriodulare Wissensverarbeitung<br />
und -speicherung. Aufgrund einer mathematisch anschreibbaren geometrischen<br />
Entfaltung errechnet Ostwald das Weltformat, eine an das metrische<br />
Maßsystem willkürlich^ 1 angeschlossene Formatreihe, geeignet <strong>für</strong> wissenschaftliche<br />
und technische Werke aller Art, »soweit nicht durch Talcln und<br />
Tabellen andere Formate bedingt werden«. Sein errechnetes Quartformat,'dessen<br />
Einführung er auch <strong>für</strong> Brief- und Aktenpapier empfiehlt, illustriert Ost-<br />
30 Wilhelm Ostwald, Das einheitliche Weltformat, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen<br />
Buchhandel Nr. 243 v. 18. Oktober 1911, Nichtamtlicher Teil, 12330-12333(12330)<br />
31 So die spätere Kritik durch W. Porstmann, Normenlehre. Grundlagen, Reform und<br />
Organisation der Maß- und Normensysteme. Dargestellt <strong>für</strong> Wissenschaft, Unterricht<br />
und Wirtschaft, Leipzig (Haase) 1917,217
780 BlBI.IOTIlHK<br />
wald als Sclbstrcfcrenz desselben Papiers, auf dem sein eigener Text gedruckt<br />
steht: »Das Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel hat bereits sehr nahe<br />
dies Format«. 32 Der <strong>von</strong> ihm skizzierte Vorzug ist auf die Speicherplätze bezogen,<br />
welche die Inhalte bergen, so daß etwa Blätter, die in diesem oder einem<br />
der größeren Formate hergestellt werden, sich durch einfaches Falzen auf<br />
Weltformat bringen lassen und »somit in einem Kasten oder in einem Bücherstand,<br />
welcher <strong>für</strong> solches Format eingerichtet ist, auch Unterkunft finden<br />
können« . Housing heißt hier, jenseits <strong>von</strong> Bedeutung, Inhalt als Funktion<br />
(s)einer Form 3 -':<br />
»Alle diejenigen Bücher, Broschüren und sonstigen Schriften, die im Weltformat<br />
erscheinen, .haben nun dadurch <strong>von</strong> vornherein den Vorzug, daß sie nicht nur in<br />
dasselbe Fach der Bibliothek passen, sondern etwa auch in derselben Mappe untergebracht<br />
werden können, in demselben Karton Raum finden, daß Anteile aus den<br />
verschiedenartigsten Büchern und Zeitschriften zu einem Bande vereinigt<br />
werden können,- so daß auch jeder Benutzer der Literatur sich das Werk, das<br />
er <strong>für</strong> seine persönlichen Zwecke braucht, aus verschiedenen Einzelwerken ohne<br />
Schwierigkeit wird zusammenstellen können, da die Gleichheit der Formate sogar<br />
gestattet, die Teile verschiedener Werke in demselben Einband zu vereinigen.«<br />
<br />
Die Internationale Assoziation der chemischen Gesellschaften beschließt im<br />
April 1911 die Vereinheitlichung des Formats <strong>von</strong> Zeitschriften verschiedener<br />
Nationen; Chemie ist das Fachgebiet des Nobelpreisträgers Oswald selbst.<br />
Nicht Geistes-, sondern Naturwissenschaften triggern Standardisierung. Der<br />
Geist weht nicht, wo er will, sondern ist durch die Kanäle seiner Übertragung<br />
mitdefiniert. Oswald setzt seinen Weltformatvorschlag in den Kontext eines<br />
epistemologi(sti)schen Dispositivs, wie es Paul Otlet im Brüsseler Mundaneum<br />
als Dokumentationswissenschaft zu institutionalisieren trachtet:<br />
»Diese Frage trat mir als ein Teil einer großen Anzahl anderer Probleme der Vereinheitlichung<br />
entgegen. Am stärksten vor Jahr und Tag in Brüssel, als ich dort<br />
einen Kongreß der internationalen Institutionen mitmachte, auf dem die Notwendigkeit<br />
<strong>von</strong> Vereinheitlichungen aller Art durch die rapid zunehmende Tatsache<br />
des Internationalismus, d. h. der internationalen Abhängigkeit der Menschen<br />
<strong>von</strong>einander sehr deutlich in die Erscheinung trat. somit gehört das Wcltformat<br />
zu derselben Reihe <strong>von</strong> Fragen, wie die noch ungelösten der Weltsprache und<br />
Weltmünzc.« <br />
32 Oswald 1911: 12331; s. a. Wilhelm Ostwald, Das Weltformat <strong>für</strong> Drucksachen, in:<br />
ders., Der energetische <strong>Im</strong>perativ, I. Reihe, Leipzig (Akademische Verlagsgesellschaft)<br />
1912,253-266(258)<br />
33 Vgl. Hayden White, The Content of the Form. Narrativc Discourse and Historical<br />
Representation, Baltimore / London (Johns Hopkins UP) 1987; dt. Übers. Frankfurt/M.<br />
(Fischer) 1990
Ml-CHANISII-RUNG Dl-R BlBI.IOTHHK . 781<br />
Die Standardisierung <strong>von</strong> Speicherformaten ist keine spezifische Erscheinung,<br />
sondern Teilmenge eint" umfassenderen Dispositivs der Zeichenökonomie, -<br />
Zirkulation und -speicherung (Bank, Kapital, Gedächtnis). Ostwalds Thesen<br />
vorgängig sind Karl W. Bührer und Adolf Saager mit ihrem Vorschlag eines<br />
Monojorrnals, dessen empirische Definition sich alsdann Oswalds mathematischer<br />
Bestimmung anpaßt; unter dem <strong>Namen</strong> Die Brücke zielt ein in München<br />
eingetragener Verein damit seit 1910 »auf alle anderen niederen Gebiete der geistigen<br />
Arbeit«, die einer gemeinsamen Organisation »am ehesten zugänglich<br />
sind und ihrer am dringendsten bedürfen« . 34 Oswalds Referenz <strong>für</strong> das<br />
Folioformat ist das Medium Zeitung. Seine Argumente über Formate aber lassen<br />
sich in Formeln besser fassen denn in Alltagssprache:<br />
»Für diejenigen unter den Fesern, welche den Wunsch haben, die hier in Worten<br />
gegebene Definition auch in mathematischer Form zu erlangen, sei bemerkt, daß<br />
die Formel 2 n/2 die ganze Reihe der oben gegebenen Tabelle darstellt. Gleichzeitig<br />
läßt die Finfachheit dieser Formel besonders deutlich erkennen, daß es sich<br />
wirklich um die einfachste aller denkbaren Definitionen der Formate handelt.<br />
Denn die Zahl 2 in dieser Formel stellt dar, daß die Formate durch Halbieren<br />
auseinander erhalten werden sollen, der Buchstabe n stellt die Reihe der ganzen<br />
Zahlen dar und drückt also die notwendigen verschieden großen Formate aus<br />
und der Nenner 2 des Bruches n/2 bedeutet endlich, daß die beiden Seiten<br />
des Formates in dem Verhältnis <strong>von</strong> 1 : 1 oder V2 zu einander stehen, wodurch<br />
sämtliche Formate untereinander geometrisch ähnlich werden.« <br />
So bricht mit dem Hälftungssatz eine veritable Filosofie der Schreibfläche^ in<br />
Form mathematischer Operatoren in den Raum der Lettern ein, das Börseblatt<br />
des Deutschen Buchhandels^, so wie das Pubhkationsmedium der Monisten-<br />
Bewegung, die Zeitschrift Das monistische Jahrhundert, ihrerseits nach moni-<br />
34 Siehe auch Karl Wilhelm Bührer / Adolf Saager, Die Welt-Registratur. Das Melvil-<br />
Deweysche Dezimal-System, München (Die Brücke) / Ansbach (Seybold) 1912, bes.<br />
14, über die Anarchie der Formate. Dazu umfassend Rolf Sachsse, Das Gehirn der<br />
Welt: 1912, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft zu Großbothen e.V.,<br />
5. Jg., Heft 1/2000, 38-57. Was der Freiherr <strong>von</strong> Aufscß <strong>für</strong> das General-Repertorium<br />
als zentrale Adrcß- und Auskunftsstclle des Germanischen Nationalmuseums im<br />
Raum deutscher Kulturgeschichte angedacht hat, wird hier- medientcchnisch, nämlich<br />
auf Standardisierung der Formate beruhend - mondiahsiert.<br />
35 Walter Porstmann, Karteikunde, 3. Aufl. Berlin 1939, 279. Dazu Gloria Meynen,<br />
Büroformate. Von DIN A4 zu Apollo 11, demnächst in: Christoph Tholen / Sigrid<br />
Schade (Hg.), Konfigurationen zwischen Kunst und Medien, München (Fink) 1998<br />
(Typoskript)<br />
36 Siehe Friedrich Kittler, Vom take-off der Operatoren. (Sprach-)Zeichen treten die<br />
Herrschaft an, in: Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen, Das Magazin, Heft<br />
1/1990,15-19
782 Bißuonii.K<br />
stischen Regeln formatiert ist. 37 Die Differenz <strong>von</strong> Kunst und Wissenschaft<br />
wird durch das Verhältnis zur Formatierung definiert:<br />
»In all den Fällen, wo das Format nicht durch besondere, künstlerische Zwecke,<br />
durch Rücksicht auf Reklame und ähnliche Faktoren bestimmt ist, wo auffallende<br />
und daher abweichende Formate erfordert werden, in all den Fällen also, wo das<br />
Format mehr oder weniger nebensächlich im Verhältnis zu dem Inhalt des Werkes<br />
ist, wird man ohne Bedenken zu dem Weltformat greifen. Es werden also alle<br />
technischen, wissenschaftlichen, industriellen, wirtschaftlichen usw. Publikationen<br />
ohne weiteres im Weltformat erscheinen können, soweit nicht andere<br />
Umstände das zurzeit noch verhindern. Man wird andererseits das Gebiet der<br />
künstlerischen Drucke und das Gebiet der Reklame den sonstigen >wilden< Formaten<br />
überlassen können und müssen.« <br />
Ostwalds Vorschlag fällt in das Vorfeld einer Institution, welche die einheitliche<br />
Speicherung deutscher Buchproduktion zu vollziehen sich anschickt: die<br />
Deutsche Bücherei, zu der in Leipzig 1913 der Grundstein gelegt wird. In dem<br />
Zusammenhang weist Ostwald darauf hm, daß die Einführung des Weltformats<br />
»ohne großen Nachteil sukzessive erfolgen« kann ; 1933<br />
formiert sich in derselben Stadt der entsprechende Gegendiskurs, der den Weg<br />
zu einer Medienarchäologie des Geistes noch in der Negation weist: »Was ist<br />
aus dem deutschen Buchdruck geworden, in dem Bestreben, ihn mit theoretischen<br />
Experimenten und Normung sogar des Geistes zu reglementieren?« 38<br />
Hans Hagemeyer, Leiter der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums,<br />
setzt 1934 Kultur <strong>von</strong> Organisation (und <strong>von</strong> Systemtheorie) ab: nicht um<br />
des Orgamsierens willen soll organisiert werden, sondern als Mittel zur kulturellen<br />
Formung. Hagemeyer spricht <strong>von</strong> Mittlertum, verweigert aber, diese<br />
Funktion als Medien zu benennen. SelbstrcferentieUe Organisation wird ein leeres<br />
Gehäuse und damit das, was jeder Speicher ist, bevor er mit Variablen als<br />
Gedächtnis gefüllt wird, reines Gestell, reines maschinisches Dispositiv. 39 Die<br />
Differenz <strong>von</strong> Gedächtnis und Erinnerung und ihre Beschreibung als Hierarchie<br />
ist damit eine politisch definierte.<br />
Ostwalds Mitstreiter in der Organisation Die Brücke, K. W. Bührer, begreift<br />
das Gedächtnis der Bücher radikal speichertechnisch (»ausschließlich Technisches«)<br />
als das standardisierte Anpassung ihrer Formate an die Ausmessungen<br />
des Gestells im Magazin. Die Bücherei im Weltformat macht es durch Raumer-<br />
37 Wilhelm Ostwald, Unser Format, in: Das monistische Jahrhundert. Zeitschrift <strong>für</strong> wissenschaftliche<br />
Weltanschauung und Weltgestaltung 1 (April 1912 bis März 1913), 104<br />
• 1X Der Leipziger Verleger Carl Ernst Poeschi druckt als Beilage im Archiv <strong>für</strong> Buchgewerbe<br />
und Gebrauchsgraphik, 70. Jg. (1933), 1 Ich 3, das Pamphlet: Gegen Mechanisierung<br />
- <strong>für</strong> die Persönlichkeit, 7<br />
y> Hans Hagemeyer, Der neue Mensch. Neue Aufgaben des Schrifttums und Mittlcr-<br />
Uims, Leipzig (Kichblatt) 1934,41
M : CV lANISII-KUNG Di-R BlBUOTHKK 783<br />
sparnis möglich, ganze Bibliotheken auf Schreibtischformat zu komprimieren,<br />
zur persönliche Kalkulation des Wissens, »der Individualität des Besitzers möglichst<br />
restlos angepaßt«; Abbildung 1 in Bührers Schrift (»Schreibtisch mit<br />
Schachteln im Weltformat«) zeigt diese Vorform eines Memory Extender. 40 1912<br />
illustriert Wilhelm Ostwald in Reihe 2 semer Monistische Sonntagspredigten<br />
4] (ein Plädoyer <strong>für</strong> Ordnungswissenschaften) die. Differenz <strong>von</strong> Ordnung und<br />
Zuordnung anhand der Organisation seiner auf verschiedene Wohnräume verteilten<br />
Privatbibhothek <strong>von</strong> ca. 20000 Bänden. An die Stelle eines geschichtsphilosophisch<br />
emphatischen Gedächtnisbegriffs tritt hier die wissensarchäologische<br />
Einsicht in seine Kybernetik: »Ich spare mir dadurch jede Gedächtnisarbeit, daß<br />
ich meine Bibliothek >geordnet, In dem Sinne definiert<br />
auch die Systemtheorie Niklas Luhmanns, daß der Zettelkasten sie schreibt: »Die<br />
feste Stellordnung braucht kein System. Es genügt <strong>für</strong> sie, daß man jedem Zettel<br />
eine Nummer gibt, sie gut sichtbar anbringt und diese Nummer und damit<br />
den Standort niemals ändert« — eine Strukturentscheidung zur Reduktion möglicher<br />
Arrangements, »die den Aufbau hoher Komplexität im Zettelkasten und<br />
damit seine Kommunikationsfähigkeit erst ermöglicht.« 42 Die Funktion des<br />
Gedächtnisses ist auf die der Sortierung depotenziert. Zuordnung ist die Beziehung<br />
der Glieder verschiedener Gruppen, etwa eine fortlaufende Reihe ganzer<br />
Zahlen zu den einzelnen Buchstandorten 43 ; in Form eines entsprechenden Zettelkatalogs,<br />
der neben der Nummer den Buchtitel erfaßt, ist die Organisation des<br />
Wissens jenseits der Standorte seiner Module möglich (und mithin die Umschaltung<br />
<strong>von</strong> ars memonae als Gedächtnistopographie auf Numerik als Gedächtnis<br />
<strong>von</strong> Schaltungen). Denn verzifferte Zettel ihrerseits können nach beliebigen<br />
Gesichtspunkten zugeordnet werden. »Die Ziffer und das Buch haben gar keine<br />
Ähnlichkeit miteinander; ebensowenig hat ihre natürhche Reihenfolge etwas zu<br />
tun mit der Reihenfolge der Bücher in meiner Bibliothek« ;<br />
40 K. W. Bührer, Raumnot und Weltformat, München (Die Brücke) 1912<br />
41 Leipzig 1912, 46. Predigt: Ordnung und Zuordnung, 361 ff<br />
42 Niklas Luhmann, Kommunikation mit Zettelkästen: Ein Erfahrungsbericht, in: ders.,<br />
Universität als Milieu, Bielefeld (Haux) 1992, 53-61 (55). Eine dem entgegengesetzte<br />
Ordnungsperspektive ist die des Archivars. Der Direktor des Preußischen Provinzial-<br />
Archivs in Düsseldorf schreibt angesichts der Auflösung der geistlichen Reichsstände<br />
in Deutschland 1803 und der daraus resultierenden Freisetzung <strong>von</strong> Archivmassen <strong>von</strong><br />
Urkundenvernichtung »durch alFe-'Art der Verzettelung«: jGarl Wilhelm v. Lancizolle.<br />
Denkschrift über die Preußischen Staats-Archive nebst vergleichenden Notizen über<br />
das Archivwesen einiger fremder Staaten, Berlin 1855, 1<br />
43 Wobei »<strong>für</strong> künftige Einschaltungen eine oder mehrere Nummern vakant« gelassen<br />
werden: Die Null schreibt sich ein. Johann Georg Scizingcr, Bibliotheks-Technik. Mit<br />
einem Beitrag zum Archivwesen [ 1855], 2. Ausgabe Leipzig (Costcnoblc) 1860, 14
784 BiBi.ioTi 11.K<br />
der wissensarchäologische Blick rechnet mit Äußerlichkeiten. Gegenüber der reinen<br />
Zuordnung erfüllen mechanische Gedächtnisapparate eine Zusatzfunktion:<br />
die systematischen Stellordnung. »Das Abwechseln <strong>von</strong> Zahlen und Buchstaben<br />
in der Numerierung <strong>von</strong> Zetteln ist zwar eine Gedächtnishilfe und ebenso eine<br />
optische Erleichterung beim Suchen <strong>von</strong> Zetteln«, doch erst ein Schlagwortregister<br />
schafft hermeneutische Orientierung: »Auch hier<strong>für</strong> ist die Numerierung der<br />
einzelnen Zettel unentbehrlich.« 44 So wird Logik zur Gruppenlehrc, mithin:<br />
Logistik. Der Unterscheidbarkeit der Dinge wird ihre Zählbarkeit und Meßbarkeit<br />
hinzugefügt, also ihre Mathematisierung. Ostwald kann durch das Verfahren<br />
der eindeutigen Zuordnung das Hantieren mit den Objekten selbst ersparen<br />
und es durch ein Operieren mit den zugeordneten Zeichen ersetzen . Diese zwar noch manufakturale, nun aber maschimsierbare Operation<br />
steht mit der Technik des General-Repertonums deutscher Kulturgeschichte<br />
im Germanischen Nationalmuseum unter der Ägide <strong>von</strong> Aufseß' dahingehend<br />
im Bunde, daß an die Stelle metonymischer oder gar synekdochischer Bezüge<br />
zwischen Objekt und Aufzeichnung (Information) die reine Exteriorität tritt,<br />
kalkulierbar (im Sinne <strong>von</strong> Leibniz 45 ) - eine regclgclcitetc Produktion der Zeichen,<br />
die auch auf kognitive Gegenstände Bezug nimmt und mit diesen zugleich<br />
operiert. »<strong>Im</strong> Kalkül werden die Zeichen autark gegenüber den möglichen<br />
Gegenständen ihrer Referenz.« 46 Es ist gerade die Absage der Organisation des<br />
Archivs an die Bedeutung seiner Inhalte, welche sie rechenbar macht. Ostwald<br />
übernimmt das operative Verhältnis <strong>von</strong> Objekt und Zahl aus Bereichen jenseits<br />
der Gcdächtniswissensorgamsation:<br />
»Wir beginnen zu begreifen, daß beispielsweise ein Riesendampfschiff , das <br />
ungefähr das Verwickeltste und Mannigfaltigste darstellt, was an zusammenhängenden<br />
Menschenwerken gegenwärtig überhaupt geleistet wird, noch bevor eine einzige<br />
Rippe <strong>von</strong> ihm aufgestellt wird, <strong>von</strong> A bis Z bis in jede Einzelheit auf dem<br />
Papier durchkonstruiert werden kann. durch kein anderes Mittel als das der<br />
Zuordnung. Jedem Teil des Schiffes ist, zunächst eine entsprechende Zeichnung<br />
auf dem Papier zugeordnet worden. Ferner sind alle die Stücke berechnet worden<br />
. rationell bis zum letzten Niet zu konstruieren.« <br />
Drawing tbings together (Bruno Latour): Dadurch, daß alle Teile zuvor auf dem<br />
Papier in Gestalt <strong>von</strong> Zeichnungen und Rechnungen ausführt werden, ist die<br />
44 Luhmann 1992: 56f. Siehe auch Markus Krajewski, Zettelwirtschaft. Die Geburt der<br />
Kartei aus dem Geist der Bibliothek, Berlin (Kadmos Kulturverlag) 2002<br />
4D Gottfried Wilhelm Leibniz, Apokatastasis (panton) [Urtext, Titel in griechischen Lettern],<br />
veröffentlicht im lateinischen Original und deutsch übersetzt durch und in: Max<br />
Ettlinger, Leibniz als Geschichtsphilosoph, München (Kösel & Pustet) 1921, 27-34<br />
46 Sybille Krämer, Kalküle als Repräsentation. Zur Genese des operativen Symbolismus<br />
in der Neuzeit, in: Hans-Jörg Rhcinberger et al. (Hg.), Räume des Wissens: Repräsentation,<br />
Codierung, Spur, Berlin (Akademie) 1997, 111-122 (118 u. 121)
MKCMANISIKRUNC; ni-:i< Bim.icvi'Hi-.K 785<br />
Arbeit auf dem Papier selbst die eigentliche Maschine - ein Gedanke, den Alan<br />
Tunng in die Computation umsetzen wird. Materie wird so (vom graphischen<br />
Supplement abgesehen) vollständig in Mathematisierbarkeit überführt. Die logistische<br />
Gliederung des archivisch-wissensarchäologischen Raums meint Gesetz<br />
und Setzung des Sagbaren zugleich. Sie steht damit im Bund mit Kulturtechniken<br />
der Hardware selbst. Gerade die Epoche, welche diskursiv mit Vergangenheit<br />
im Modus der historischen <strong>Im</strong>agination operiert, bringt sie im technischen<br />
Gedächtnis zum Verschwinden. Der Leiter der Waffenfabrik in Sprmgfield,<br />
Major Ripley, zeigt 1853 (unter dem Druck des Krimkriegs) einer britischen<br />
Kommission zehn Gewehre aus einem älteren Auftrag, manufaktunert <strong>von</strong> 1843<br />
bis 1853, »to be taken apart, the parts mdiscnminately mixed, and the ten guns<br />
were then successfully assembled by selectmg the parts at random from the general<br />
mass« . Das impliziert das »Verschwinden <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> in general mass und random access« - eine Praxis, der<br />
sich auch die Verwaltungsarchive des 19. Jahrhundert verschreiben. An die Stelle<br />
<strong>von</strong> Evolution tritt das Kurzzeitgedächtnis <strong>von</strong> recycling. Betroffen ist damit<br />
auch die Grundlage aller Bibliotheken: der Buchstabe. Medienarchäologie<br />
identifiziert die moderne Massenproduktion modularer Maschinen mit dem <strong>von</strong><br />
Gutenbergs beweglichen Lettern inaugurierten typographischen Kreislaut; unter<br />
dem Eindruck einer Wekknegserfahrung erinnert der Diplom-Ingenieur Bernd<br />
Buxbaum 1919 daran, daß die ältesten unter sich auswechselbaren Metaliteile,<br />
die Buchstaben-Lettern, durch Fertigguß hergestellt wurden. Die Bibliothekswissenschaft<br />
dieser Zeit spricht <strong>von</strong> Modulantät im Kontext der Büchergestelle,<br />
wo Funktionen der Raumersparnis das Primat der wissenschaftlichen Klassifikation<br />
ersetzen: »'Verstellbarkeit' wurde nun eine ingenieurstechnische Aufgabe«,<br />
und die arbeitsökonomische Verschiebung vom Band- zu Zettelkatalogen<br />
ersetzt beim Input und Einschieben <strong>von</strong> Büchern die traditionelle Neukatalogisierung<br />
durch »eine Verschiebung <strong>von</strong> Zetteln.« 47 Der Sachkatalog in Zettelform<br />
soll mit stichworttragenden Leitzettel durchschossen werden, um damit<br />
auch der systematischen Umformung jeder späteren Zeit gerecht zu werden.<br />
Dies ist, an den Grenzen zur mechanischen Datenverarbeitung, »eine nichts<br />
weniger als mechanische Arbeit, ist eine durchaus wissenschaftlich dispositive<br />
Leistung«, und Kataloge werden zu Apparaten : Dispositive<br />
des deutschen Gedächtnisses, buchstäblich. Verzettelte bibliotheksinterne Kataloge<br />
machen ihr Verdopplung als Benutzerkataloge mechanisierbar; Ziel ist die<br />
damit mögliche, <strong>von</strong> Bibliotheksdienern unabhängige, mithin automatisierte<br />
Selbstunterrichtung des Lesers - nach der allgemeinen Alphabetisie-<br />
Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig (Wiegandt) 1912, Kapitel VII (»Das Ma<br />
zin«), 100 u. 211
786 BiBi.ioTiiHk<br />
rung Preußens nach 1800 als Grundlegung des Verwaltungsstaats nun eine sekundäre<br />
Alphabetisierung auf der Ebene der Gedächtnisadressierung. »Zum Kennenlernen<br />
des Buches hilft auch das Katalogisieren« , die Alternative<br />
zum Lesen selbst. 48 Als Arnim Gräsel sein Handbuch der Bibliothekslehre 1902<br />
als völlig umgearbeitete 2. Auflage seiner Grundzüge der Bibliothekslehre ediert,<br />
muß er bereits eine ganze Anzahl <strong>von</strong> Abbildungen bemühen, um der Mechanik<br />
verschiedener äußerer Katalogformen - jener Extenontäten des Wissens - Herr<br />
zu werden (Lippmansche Verschlußkapsel, Soenneckens Katalogbücher, Staderinis<br />
Schcdano, Rudolphs Zettelkasten, Maas' Sammelapparat); die technische<br />
Zeichnung rückt an die Stelle der verbalen Deskription. Vor allem aber weiß<br />
Graesel, daß die <strong>von</strong> ihm diagnostizierte notwendige Standardisierung des<br />
Zettelformats (als Software) unabdingbar mit einer »Vereinheitlichung der Aufbewahrungsform«<br />
(als Hardware) zusammenläuft- ein genuin medienarchäologisches<br />
Argument. 49 Die konkreten Speichermöbel generieren hier als materielles<br />
Dispositiv die Methoden der Klassifikation. Die alphanumerische Vermessung<br />
<strong>von</strong> Speicherräumen ersetzt die enzyklopädischen Erzählungen des Wissens;<br />
modulare Maschinen der Speicherung und Übertragung bilden ein <strong>von</strong> Texten<br />
differentes Gedächtnis. <strong>Im</strong> Reich der Technik wird Optimierung durch Normalisierung<br />
der Einzelteile und kybernetische Präzision der Arbeit erreicht - genuin<br />
mediale Operationen. »Ohne Normalschraube kein Maschinenbau, ohne Normalprofile<br />
der Schienen keine Eisenbahn. Nicht anders steht es in der<br />
Bücherei« .<br />
»Libranans. arc now engmeers, and no libranan worth his sah considers books as litcrature,<br />
but merely as the stuft (he calls them >matenals< or >collections
MKCHANISIKRUNG DER BIBLIOTHEK 787<br />
Präzision mit literarischer Kultur. 51 Das amerikanische 19. Jahrhundert hat die<br />
Waffenproduktion mechanisiert; nichtsdestoweniger steigt die Anforderung an<br />
spezialisierte Handarbeit. Dessen Spuren aber sind nicht im Archiv des Symbolischen,<br />
schriftlich (also als Dokumente und Blaupausen) abgelegt, sondern<br />
vielmehr nur im Gedächtnis des Materials (also monumental und nicht historio,<br />
sondern archäographisch) faßbar. »The problem must be approached by archaeological<br />
methods«, denn allein die technischen Artefakte selbst, nicht ihre<br />
archivische Dokumentation geben Auskunft über die Tatsächlichkeit ihrer Verwendung<br />
- »a kind of direct contact with the individual artificers that cannot be<br />
attained in any other way.« 52 Ostwalds Konzepte, die Beschränktheit der Ressourcen<br />
Raum und Zeit durch Organisation zu überwinden, sind Teil einer Serie<br />
<strong>von</strong> wissensökonomischen Versuchen seiner Epoche, die sich durch die Diskretisierung<br />
<strong>von</strong> Zeit und Raum in Maß und Messung auszeichnen - im Film als<br />
chronophotographischem Aufzeichnungsmedium (Marey, Muybridge), in der<br />
industriellen Produktion und in der Arbeitsorganisation, der Psychotechnik, die<br />
Gastev in Moskau als Kritik an Ostwalds Paradigma formuliert: »Sie sortiert die<br />
Menschen, aber sie erzieht sie nicht.« 33 Die Herausforderung heißt also nach wie<br />
vor Kopplung <strong>von</strong> Kalkül und Semantik. Die 1923 in Rußland gegründete Zeitliga<br />
baut mit ihren analytischen Kriterien Zeit - System - Energie an einem Dispositiv,<br />
an das die algorithmische Ästhetik der Programmierung schließt: »statt<br />
>vielleicht< eine exakte Berechnung, statt >irgendwie< ein durchdachter Plan, statt<br />
>irgendwann< ein bestimmtes Datum.« 34<br />
Standardisierung des Alphabets und Mechanisierung des Karteikastens<br />
Ob dies nun eine Kontmgenz des redaktionellen Layouts war oder nicht: An<br />
Ostwalds Ausführung über das Weltformat schließt sich Paul Westheims Besprechung<br />
eines Buches <strong>von</strong> Karl Brandi, Unsere Schrift, an 35 , worin der deutschkulturwissenschaftiche<br />
Streit Antiqua versus Fraktur als national angemessene<br />
Schrift medienarchäologisch ausdifferenziert und damit dekonstruiert wird.<br />
Brandi weist nicht nur nach, daß die germanische Rune nicht <strong>von</strong> romanischen<br />
51<br />
Friedrich Kittlcr, Von der Fetter zum Bit, in: Horst Wenzel (Hg.), Gutenberg und die<br />
Neue Welt, München (Fink) 1994, 105-117(112)<br />
32<br />
Robert B. Gordon, Who Turned the Mechanical Fdeal into Mechanical Reality?, in:<br />
Technology atiti GuitUfe 29. Heft 4 (tyHH 744.77S (?4g><br />
33<br />
A. K. Gastew, Die Arbeitseinstellungen, Moskau 1924, 89. Siehe Franciska Baumgarten,<br />
Arbeitswissenschaft und Psychotechnik in Rußland, München / Berlin (Oldenbourg)<br />
1924,61<br />
54<br />
Aus der Zeitschrift Wrcmja, I Icft 1 (1923), 64, zitiert nach: Baumgarten 1924: I 12<br />
~° Karl Brandi, Unsere Schritt, Gotungen (Vandenhoek &i Ruprecht) 191 1
788 BiBi.ionikk<br />
Alphabeten adaptiert ist, sondern daß sich die Fraktur im Anschluß an die karolingische<br />
Minuskel entwickelt. Sie als eine deutsche Schrift hinzustellen gehe<br />
nicht an. Die Beziehung <strong>von</strong> Schrift und Kultur ist formalisierbar; die Ausdifferenzierung<br />
<strong>von</strong> Schrift beschreibt Brandi als Effekt wechselnder Schreibinstrumente<br />
und Beschreibstoffe. Erst die Druckschrift, konkret: der Zeichner <strong>von</strong><br />
Typen hat das Bestreben, sämtliche Zeichen einem Duktus zu unterwerfen. »Er<br />
gleicht aus«, obgleich historisch begründbar ist, daß eine stark differenzierte<br />
Schrift das Lesen erleichtert - ein Phänomen, das mit dem Informationbegriff<br />
der Nachrichtentheorie eher zu beantworten ist als <strong>von</strong> der Ästhetik.<br />
Bibliothekstechnisch erinnerte die Ablösung der Preußischen Instruktionen<br />
<strong>für</strong> Katalogisierung (seit 1899 erfolgte damit die Titelaufnahme nach grammatischer<br />
Wortfolge) durch die Regeln <strong>für</strong> die Alphabetische Katalogisierung (RAK)<br />
nach mechanischer Wortfolge daran: Die Normungen des Alphabets bedeuten<br />
non-diskursive Kristallisation. »Je weiter die Regel verbreitet ist, desto schlimmer<br />
ist es Änderungen daran vorzunehmen.« 56 Heinrich Schreiber, Universitäts-<br />
Bibliothekar in Leipzig, rezensiert 1930 ein Stück Literatur, das nicht <strong>von</strong> Geist,<br />
sondern <strong>von</strong> Buchstaben handelt: Die Einheits-ABC-Regeln, ergangen im<br />
Auftrag des Fachausschusses <strong>für</strong> Bürowesen beim Ausschuß <strong>für</strong> wirtschaftliche<br />
Verwaltung beim Reichskuratonum <strong>für</strong> Wirtschaftlichkeit. 57 Durch Regel 1 sind<br />
darin »sämtlichen Vorschriften verzahnt mit einer anderen veränderlichen<br />
Größe« (also Variablen): dem Duden. »Jede Änderung ist in 100000 Kartotheken<br />
zu beachten, kann in anderen 100000 gedruckten Registern nicht mehr<br />
berücksichtigt werden« . Der Reichssparkommissar regt die<br />
Annahme dieser Regeln in allen Behörden <strong>für</strong> Register, <strong>Namen</strong>sverzeichnisse,<br />
Fernsprech- und Adreßbücher, Registraturen und Karteien an - Schaltstellen des<br />
Schnft-Symbohschen, non-diskursive Dispositive des Diskurses. Das gilt noch<br />
aktuell <strong>für</strong> die Differenz <strong>von</strong> Kalkül und Programm: »Je umfangreicher und<br />
fester eingeführt Kartotheken sind, je länger die Dauer, auf die sie berechnet sind,<br />
desto schwerer wird auch nur die kleinste Änderung durchzuführen sein«<br />
. Wieder denkt Schreiber an die Bibliotheken: Selbst wenn<br />
sie <strong>für</strong> den Sonderfall der bibliothekarischen Ordnungshilfsmittel berechnet<br />
worden sind, hat sich dieses Kalkül nicht an allen Stellen einheitlich durchführen<br />
lassen. Wie etwa die Schreibung des <strong>Namen</strong>s de Lafontaine zu behandeln sei,<br />
bleibt unentschieden. »Allheilmittel: Verweisung« . Die<br />
Ästhetik <strong>von</strong> Hypercard als digitales Programm antwortet auf diese Mannigfaltigkeit,<br />
buchstäblich. Die Schwierigkeit des Ordnens besteht nicht im Ordnen,<br />
56<br />
Heinrich Schreiber, Normung des Alphabets, in: Mmverva-Zeitschrift, 6. Jg. Mai/Juni<br />
1930, Heft 5/6, 77-81 (77)<br />
57<br />
Bearb. <strong>von</strong> Fritz Prinzhorn u. Fritz Wlach, Berlin (Beuth) 1928 (RKW-Vcröffcntl. Nr.<br />
6; erste Aufl. 1923)
Ml-:CI-IANISII:RUNG DF.R BlBUOTHKK 789<br />
»sondern in der Sorge <strong>für</strong> das Auffinden.« Alle klassischen Ordnungsregeln<br />
gehen <strong>von</strong> der Voraussetzung aus, daß der Suchende genau dieselben Bestandteile<br />
des <strong>Namen</strong>s kennt wie einst der Ordnende. Das Findmedium Alphabet, wie<br />
das der digitalen Programmierung, geht <strong>von</strong> Identitäten, nicht Ähnlichkeiten aus;<br />
doch »man bedenke, daß Ort und Straße wechselnde Größen sind, der Beruf<br />
schwankend, mindestens in der Bezeichnung, sein kann« .<br />
Philologische Hermeneutik wird im Umgang mit Titeln der reinen Maschinenlesbarkeit<br />
gegenüber ins Feld geführt <strong>für</strong> das, was <strong>Geschichte</strong> ausmacht: Redundanz.<br />
»Die Wirklichkeit ist zu mannigfaltig, um sich in stets eindeutige Regeln<br />
zwingen zu lassen« . <strong>Im</strong> Streben der Normung nach<br />
Mechanisierung entbirgt sich demgegenüber negentropisch das Streben nach<br />
Rationalisierung. Der deutschstämmige Ingenieur Hermann Hollerith arbeitet<br />
Ende des 19. Jahrhunderts beim US-Census-Office, das seit 1790 in zehnjährigem<br />
Abstand Volkszählungen durchführt, an einer Vereinfachung des (auch<br />
zwischen race and color differenzierenden 58 ) Auswertungsverfahrens. Bislang<br />
wurden die Angaben <strong>von</strong> den Fragebögen auf Zahlblättchen übertragen, wo <strong>für</strong><br />
jede mögliche Antwort ein Feld vorgesehen war und bei der Auszählung eines<br />
Merkmals dann nur die jeweiligen Felder beachtet werden mußten; dies ist zwar<br />
eine weitgehende Formahsierung, setzt aber auch die Begrenzung der Anzahl<br />
möglicher Antworten voraus - die Vorgängigkeit des Archivs im Sinne <strong>von</strong><br />
Michel Foucaults Definition der Bedingung <strong>von</strong> Sagbarkeit. Demgegenüber<br />
kommt Hollerith auf die Idee, die systematisierten Merkmale auf dem Zahlblättchen<br />
statt mit einem Strich durch ein Loch zu kennzeichnen (angeblich bei<br />
einer Bahnfahrt, als er einen Schaffner beim Lochen der Fahrkarten beobachtete).<br />
Schrift wird durch Schaltung erlöst. So entwickelt er eine Maschine, die<br />
nunmehr in Form einer magnetischen Schaltung Löcher identifizizieren kann;<br />
elektrische Kontaktbürsten tasten die Karten ab und registrieren jede mögliche<br />
Lochung auf einem eigenen Zähler. Doch die Zahl der cinschreibbarcn Informationen<br />
ist durch die schiere Größe der Lochkarte begrenzt; es galt daher, die<br />
Informationen weitgehend zu formahsieren. Diese Lochschrift basiert als Kode<br />
auf dem Dezimalsystem und übersetzt Begriffe <strong>für</strong> Personen, Leistungen, Zeiten<br />
etc. gleichwertig in Zahlen - jenseits der narrativen Beschreibung. 59 Damit<br />
ist die in Bibhothcks- und Archivwesen praktizierte Dewey'sche Dezimalklassifikation<br />
mechanisierbar geworden, und das Gedächtnis maschinisierbar. »Nur<br />
auf amerikanischem Boden«, d. h. gekoppelt an einen tayloristischen Arbeksor-<br />
5X Dazu Friedrich W. Kistcnnann, Locating the Victims: The Nonrolc of Punched Card<br />
Technology and Census Work, in: IEEE Annais of the History of Computing 19, Heft<br />
2 (1997), 31-45(37)<br />
59 Götz Aly / Karl Heinz Roth, Die restlose Erfassung. Volkszählcn, Identifizieren, Aussondern<br />
im Nationalsozialismus, Berlin (Rotbuch) 1984, 16f
790 BlBI.lOTIIHK<br />
ganisationsbegriff, »konnten diese Maschinen entstehen.« 60 Maschine heißt dabei<br />
auch im Sinne Sigmund Freuds psychischer Apparat: »Das Taylor-System hat<br />
uns gelehrt, daß die Arbeitsleistung durch eine gewisse Mechanisierung der<br />
Arbeit quantitativ gewinnt. Solche Mechanisierung kann eintreten, sowohl nach<br />
der psychologischen als auch nach der sachlichen Seite hin.« 61<br />
Ein Neuerungsvorschlag <strong>von</strong> Seiten der Brücke war es, die Bücherei-Karteikarte<br />
mit Schlagworten gleich auf den Buchrücken zu projizieren; ein Registraturschema<br />
aus 19 Einzelpunkten sollte schon auf den ersten Blick sämtliche Abund<br />
Anfragen an den Inhalt beantworten - ein Interface also zwischen Buch und<br />
Nutzer. Womit die Meta-Datcn - wie bereits die Signaturen - tatsächlich am<br />
Buch sind, parergonal (wie das Inhaltsverzeichnis), und Teilmenge des Buchs<br />
selbst sind - vergleichbar der <strong>von</strong>-Neumann-Architektur des Computers, in dem<br />
Programme und Daten im selben Speicher abgelegt sind. Überhaupt ist der Karteikasten<br />
ein Protagonist der Brücken-Bewegung gewesen. Der Graphiker und<br />
Architekt Emil Pirchan, seit 1910 in München tätig, ist verantwortlich <strong>für</strong><br />
das graphische Layout der 5r#c£e-Publikationen; charakteristisch ist das Rahmen<br />
aller wichtigen Details in rechteckige Kästen und die Vorführung der<br />
Weltregistratur in einem Setzkasten-ähnlichen Gehäuse« -<br />
Papiermaschinen, ein Gestell im zwei- wie im dreidimensionalen Raum. Dementsprechend<br />
zeichnet Pirchan auch Entwürfe <strong>für</strong> Büros und Bibliotheken nach<br />
Einführung des Wcltformats, etwa in Bührers Publikation Raumnot und Weltformat;<br />
Speicherarchitektur wird zum Maßstab <strong>von</strong> Architektur überhaupt.<br />
Walter Porstmann, Karteikunde. Das Handbuch der Karteitechnik, 2. Aufl. Stuttgart<br />
(Verlag <strong>für</strong> Wirtschaft und Verkehr) 1928, 258. Hollerith gründet 1896 ein eigenes<br />
Unternehmen, ab 1924 in International Business Machines (IBM) umbenannt; in<br />
Deutschland antwortet Willy Hcidingcr 1910 mit der Dcutsche Hollerith Maschinen<br />
Gesellschaft (Dehomag) in Bcrlin-Lichterfclde<br />
Hermann Haußmann, Die Büroreform als Teil der Verwaltungsreform, Berlin (Hehmanns)<br />
1925, 22
ARCHÄOI.OGIK KINKR NATIONAI.BIBI.IOTHKK: DIK DKUTSCHH BÜCHI-RKI 791<br />
Archäologie einer Nationalbibhothek: Die Deutsche Bücherei<br />
Gedächtnisökonomische Kult(ur)stätten: Boris Groys beschreibt gesellschaftliche<br />
Institutionen wie Bibliotheken, Museen oder Archive als quasisakrale<br />
Kultstätten der Gegenwart, in die jeder Theorie- und Kulturproduzent hineindrängt,<br />
um sich in der <strong>Geschichte</strong> zu verewigen. 1 Auch der Bibliothekar des<br />
Frankfurter Paulskirchenparlaments Plath spricht 1848 <strong>von</strong> einem Tempel der<br />
Literatur, betonte aber zugleich das reale Korrelat dieser Metaphysik, den juridischen<br />
Vorteil einer nationalen Bibliothek in Bezug auf die Klärung <strong>von</strong> Autorenrechten.<br />
2 Gedächtnisagenturen sind strategisch verfaßt, d. h. sie folgen einer<br />
diskurspragmatischen Logistik. 3 Die Behauptung allegorisch verbrämter Zeit-<br />
Räume hat ein mediales Dispositiv, die Schrift als Medium der Verraumzeitlichung.<br />
In Form der Deutschen Bücherei hat es sich als Speicher konkretisiert.<br />
Als Archiv verbürgt sie das tatsächlich Geschriebene institutionell. Der Leipziger<br />
Bücherspeicher ist Monument und Medium; sein Kern ist nicht allein Symbol,<br />
sondern auch Information. Gedächtnis ist zugleich Subjekt und Objekt der<br />
Deutschen Bücherei; unter den Stichworten:<br />
Vergessen<br />
Vergiß<br />
Ennnerung(s-)<br />
Memorandum<br />
Memoriam<br />
Memorial<br />
Vergangenheit<br />
Tod<br />
Todestag<br />
Gedächtnis<br />
des alten Zentralkataloges der Deutschen Bücherei findet man Literatur im Bunde<br />
mit ihren eigenen Speichertechniken 4 , mit dem Wissen um die letterarische, buchstäblich<br />
alphanumerische Infrastruktur <strong>von</strong> Gedächtnis. Eine Kultur ist gegeben,<br />
wenn sie über Techniken und Institutionen der Remanenz verfügt, also eines<br />
Gedächtnisses zur Entnahme, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten?<br />
Boris Groys, Über das Neue. Versuch einer Kulturökonomie, München 1992<br />
Albert Paust, Die Idee einer deutschen Reichsbibliothek. Zur Vorgeschichte und<br />
Gründung der Deutschen Bücherei, Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei,<br />
Leipzig 1933, 5<br />
Kultur ist Handel mit Ideen; Interview mit Bons Groys (Thomas Mießgang), in: profilNr.<br />
1/4. Januar 1993, 70f<br />
Information v. Axel Doßmann (Berlin / Weimar)<br />
Siehe Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, Nachwort zur 2. erw. u. korr.<br />
Auflage 1987, München (Fink) 1987, bes. 429
792 BlBUOTHKK.<br />
Programm der Deutschen Bücherei ist es gewesen, das gesamte deutsche und<br />
fremdsprachige Schrifttum des Inlandes und das deutsche Schrifttum des Auslandes<br />
zu sammeln und verfügbar zu halten 6 , d. h. einen Zustand der Latenz des<br />
nationalen (Schnft-)Gedächtnisses zu gewähren - zwischen Bücherspeicher und<br />
Aktualisierung. Latenz ist auch der diskursive Grund <strong>für</strong> die Initiative zur Errichtung<br />
einer Deutschen Bücherei gewesen: das unvollendet gebliebene Projekt einer<br />
deutschen Nationalbibliothek.<br />
Das deutsche Gedächtnis war die längste Zeit kein Fundament, kein Archiv,<br />
sondern ein Abgrund; in diesem Sinne wirkte Erich Ehlermanns Plädoyer <strong>für</strong><br />
eine deutsche Nationalbibhothek 1912 noch in den Augen seiner Zeitgenossen<br />
»wie der kühne Entwurf eines phantasiebegabten Architekten«/ Bereits 1910<br />
legt Ehlcrmann als Verleger in Dresden und zweiter Vorsteher des Börsenvereins<br />
<strong>für</strong> den deutschen Buchhandel die streng vertrauliche Denkschrift Eine<br />
Reichsbibliothek in Leipzig vor, die 1927, nach der vollendeten Tatsache der<br />
Deutschen Bücherei als Institution, <strong>von</strong> der Gesellschaft der Freunde dieses<br />
Hauses in memonam neu gedruckt und diesmal veröffentlicht wird. Darin definiert<br />
Albert Paust auch die Differenz zwischen Deutscher Bücherei und der<br />
»Reichsbibliothek« (seine Anführungszeichen) <strong>von</strong> 1848/49: War die damalige<br />
Parlamentsbibliothek auf die politischen Grenzen des damals konzipierten deutschen<br />
Reichs beschränkt, ist die Leipziger Bücherei die »Zentralbibliothek des<br />
deutschsprachigen Schrifttums der Welt und an keinerlei politische Grenzen<br />
gebunden«. 8 Der Unterschied ist der zwischen Infrastruktur und Medium<br />
der Kommunikation (deutscher Buchhandel / deutsche Sprache). DEUTSCH-<br />
LAND blieb die längste Zeit eine Bibliotheks-Chimäre 9 , auch wenn die Fassade<br />
der Deutschen Bücherei und ihr Inneres schließlich mit supplementären Zeichen<br />
bestückt werden, die Nation erzählten. Die Baukonstruktion selbst aber steht<br />
bereits jenseits des Historismus, insofern sie, ganz funktional, auch äußerlich in<br />
der Fassade ihren inneren Zweck ausweist, nämlich »die Bücherspeicher mit<br />
ihrer charakteristischen Geschoß- und Fensteranordnung«
ARCHÄOI.OGII: I-INHR NATIONALBIBUOTHHK: DU-: DHUTSCHH BÜCIII-RHI 793<br />
62> - eine veritable Architextur. »Das Magazin erscheint deutlich nach außen<br />
hin. Die Fassade zeigt die Funktion der Räume, die hinter ihr liegen. Es wird <strong>von</strong><br />
innen nach außen gebaut« . 1916 bedarf es keiner historistischen<br />
Metaphern mehr <strong>für</strong> das nationale Gedächtnis; seine reale Struktur selbst<br />
ist exponierbar als Gestell und wissensdenkmalfähig. Das Magazinsystem installiert<br />
der Bibliothekar des British Museum in London jenseits der physischen<br />
Grenzen der Saalbibliothek erstmals 1853; »das Magazinsystem verzichtet mehr<br />
oder weniger auf architektonische Wirkungen«, eignet sich durch seine Modularität<br />
aber »in hervorragender Weise <strong>für</strong> die Anforderungen des heutigen Betriebes«,<br />
indem es »raumsparend und leicht erweiterungsfähig ist.« Die Einsicht des<br />
italienischen Emigranten und ehemaligen Ganbahkämpfers Panizzi stammt <strong>von</strong><br />
daher, »sich früher mit ganz anderen Dingen beschäftigt haben« 10 ; die wissensökonomische<br />
Balance zwischen Präsenz und Lager folgt hier einem strategischen<br />
(wenn nicht militärischen) Kalkül. Das Reale der Deutschen Bücherei<br />
als deutsches Gedächtnis steht schon bei der Grundsteinlegung im langen Schatten<br />
eines benachbarten Symbols, einer Erinnerung: das Leipziger Völkerschlachtdenkmal<br />
(welches dann auch das Bildmotiv des Zensurstempels der DB<br />
bildete). Es ist der Tag nach der kaiserlichen Inauguration dieses Monuments am<br />
18. Oktober 1913, der den ersten Spatenstich der Deutschen Bücherei nach sich<br />
zieht. Reale Knochen <strong>von</strong> Toten der Schlacht liegen dem Denkmal (es identifizierend)<br />
zugrunde; ihre transzendente Deutung als Gedächtnisort aber verdankt<br />
sich einem anderen Skelett <strong>von</strong> Signifikanten, dem Netzwerk deutscher Buchstaben<br />
als Literatur. Schriften partizipieren an der Ordnung der Dinge, »werfen<br />
also keine Sinnfragen auf, sondern benötigen Speicherplatz.«" Nicht allein<br />
makronational liegt die Gründung der Deutschen Bücherei in einem diskursiven<br />
Bezugs- und Einzugsfeld, sondern auch ihre konkreten topographischen Koordinaten<br />
schreiben diesen <strong>Namen</strong> Nation. Nicht nur ist sie ein nationaler<br />
Gedächtnis/?ort, sondern sie liegt an einem nationalen Gedächtnisort, jenem<br />
Deutschen Platz (seinerseits eine leere, baumumkränzte Wiese und gleichzeitig<br />
Rettungshubschrauberplatz), der im Zuge der Straße des 18. Oktober die Erinnerung<br />
an die Völkerschlacht vom Herbst 1813 spurt (Straße/Trasse/frace) und<br />
auf das nahegelegene Völkerschlachtdenkmal als monumentalen Fluchtpunkt<br />
verweist; das anliegende Neubaugebiet führt der Deutschen Bücherei neue Leser<br />
zu. 12 Die Bibliothek wird geortet in einer metonymischen Topographie, die den<br />
10 Heinrich Uhlendahl, Bibliotheken gestern und heute, Berlin (VDI) 1932, 147f.<br />
11 Uwe Jochum, Kleine Bibliotheksgeschichtc, Stuttgart (Reclam) 1993, Vorwort, 8<br />
12 Helmut Rötzsch, »Seht, Großes wird vollbracht.« Die Deutsche Bücherei im sozialistischen<br />
Staat der Arbeiter und Bauern, in: Jahrbuch der Deutschen Bücherei, Jg. 10<br />
(1974), 25
794 BlBl.lOTllKK<br />
Diskurs Deutsches Gedächtnis als regelgcleitetes System <strong>von</strong> Äußerungen 13 erst<br />
konstituiert. Der am 19. Oktober 1913 gelegte Grundstein der DB aber muß am<br />
25. Juli 1914 verlegt werden, weil sich das Baugrundstück als zu klein erweist. 14<br />
Der Raum der Nation ist keine homogene Fläche, sondern das network <strong>von</strong><br />
Infrastruktur - ein Effekt der strategischen Logistik Napoleons unter umgekehrten<br />
Vorzeichen. Verkehrswissenschaften als Diskursanalysen zeigen es an:<br />
Das Territorium Nation ist längst durch Verwaltungsbemessungen und kommunizierende<br />
Netzwerke bestimmt, und ihre Rede deren ideologischer Effekt.<br />
1913 wird nicht nur die Deutsche Bücherei gegründet und das Völkerschlachtdenkmal<br />
in Leipzig eingeweiht, sondern auch ein wichtiger Teilabschnitt des<br />
neuen Kopfbahnhofs. Leipzig löst Frankfurt/M. als Buchmetropole ab; der Verbund<br />
<strong>von</strong> Buch- und Messeverkehr, Ökonomie und Lettern ist schweigend am<br />
nationalen Werk, dessen literarisches Korpus die Deutsche Bücherei zu speichern<br />
sich anschickt.<br />
Zur Genealogie der Deutschen Bücherei aus dem Pflichtexemplar<br />
Die Beschreibung des literarischen Werkes <strong>von</strong> Denkern, buchstäblich gelesen,<br />
erfordert auch die Archäographie ihrer Fassung als Bibliothek - nicht nur <strong>von</strong><br />
Semantik also, auch ihres Medien-Dispositivs. Die Ursprünge der Deutschen<br />
Bücherei liegen im Plural; ihre <strong>Geschichte</strong> ist rissig und verzweigt sich. Heimlicher<br />
Agent der Skandierung ihrer Genealogie ist die Völkerschlacht, das Datum des 18.<br />
Oktobers. Ihre diskursive Grundsteinlegung (ein
ARCHÄOEOGIE EINER NATIONAEBIBEIOTHEK: DU: DEUTSCHE BÜCHEREI 795<br />
gelung der Gegenwart (in Frankreich landesweit seit 1536, in Deutschland - ein<br />
genaues Abbild der politischen Geographie - immer nur regionbezogen) entstammt<br />
nicht der unschuldigen Neugier des Geistes; die Geburt des nationalen<br />
Gedächtnisses ist vielmehr die Funktion präziser Überwachungspraxis:<br />
»Die Frage der Sammlung des nationalen Schrifttums ist bei allen Kulturvölkern<br />
naturgemäß eng verknüpft mit ihrer politischen Entwicklung. Sie ergab sich historisch<br />
aus der Einrichtung der Zensurexemplare, die nach erteilter Druckerlaubnis<br />
den führenden Bibliotheken überwiesen wurden um dadurch möglichst<br />
rasch der politischen eine geistige und kulturelle Zusammenfassung ihrer Völker<br />
folgen zu lassen.«" 1<br />
1869 wird im Norddeutschen Bund nach Verhandlungen über das Urheberrechtsgesetz<br />
der Gedanke einer zentralen Sammelstätte nationaler Literatur verworfen.<br />
1874 fordert der Leipziger Verlagsbuchhändler Eduard Brockhaus im<br />
Reichstag im Kontext der Debatte um das Preßgesetz die Vereinheitlichung<br />
der Pflichtexemplarregelung; deren Effekt wäre eine Zentralbibliothek gewesen.<br />
Ein Vorfahre des Leipziger Verlegers, Friedrich Arnold Brockhaus, hatte dem<br />
König <strong>von</strong> Sachsen bereits am 20. November 1819 eine Denkschrift unterbreitet,<br />
die zur Optimierung des Urheberrechtsschutzes anregte, der Deutsche Bund<br />
möge in Leipzig eine Centralbehörde zur Direktion des deutschen Buchhandels<br />
auf Basis <strong>von</strong> Pflichtexemplarsendung und Pubhkationsmeldung nach französischem<br />
Vorbild (Depot legal) einrichten; diese vergessene Vorüberlegung zur<br />
Leipziger Deutschen Bücherei <strong>von</strong> 1912 weist auf das originäre double-bind<br />
<strong>von</strong> materieller und virtueller Versammlung der deutschen Buchproduktion.<br />
»Von der kulturellen Bedeutung einer derartigen Sammlung war damals allerdings<br />
nicht die Rede ; nicht kulturelles Gedächtnis, sondern<br />
ein rechtsverbindlicher Speicher ist die Funktion einer Archivbibhothek. Die<br />
Realität der deutschen Reichseinigung aber schreibt die Antinomie dieses<br />
Begehrs: In Sachsen besteht seit 1870 kein solches Gesetz mehr. Nach Gründung<br />
der Deutschen Bücherei erfolgt die Erfassung der nationalen Literalität<br />
als Pflichtabgabe im Medium des Lieferantenbuchs, das <strong>für</strong> jede Herkunftsteile<br />
der Werke dieser Bücherei (Verleger, Private, Behörden, Vereine) Listenform<br />
hat, »die sofort übersehen läßt, ob und wie weit die Einzelnen ihre<br />
Veröffentlichung vollständig geliefert haben«. 17 Zunächst wird die Abgabe der<br />
Germanischen Nationalmuseum, Bd. 2: Michels März, Ausstellungskatalog (Verlag<br />
des GNM) Nürnberg 1998, 315-319 (315), unter Bezug auf Blum 1990: 120ff<br />
Paust 1933: 3; daß allerdings etwa in Berlin die Abgabe <strong>von</strong> Pflichtexemplaren an die<br />
Königliche Bibliothek nach 1800 mit der Bücherzensur nichts das geringste zu tun hat,<br />
betont Blum 1990: 116<br />
Börsenblatt [Nr. 209] v. 9. September 1913, wiederabgedruckt als Dokument Nr. 19<br />
in: Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig.
796 BIBLIOTHEK<br />
amtlichen Druckschriften des Reiches durch eine Verordnung <strong>von</strong> 1927 festgelegt,<br />
und 1935 folgt die Verpflichtung der bislang freiwilligen Ablieferung.<br />
Zunächst stößt der Wille zur Nationalbibliothek an die Grenzen der Kulturhoheit<br />
der Länder. Uneinigkeit herrscht darüber, ob eine solche Bibliothek als zentrales<br />
Archiv gegründet werden oder ob diese Aufgabenstellung Einrichtungen<br />
wie der Reichstagsbibhothek, der Bibliothek des Germanischen Museums oder<br />
der Königlichen Bibliothek in Berlin übertragen werden soll. Preußen versteht<br />
sich dabei als die Metonymie des deutschen Reichs; da Preußen im politischen<br />
Leben Deutschlands eine Vormachtstellung einimmt, ist die Berliner Königliche<br />
Bibliothek der Auffassung, daß ihr die führende Rolle im wissenschaftlichen<br />
Bibliothekswesen bei den nach 1880 in die Wege geleiteten progressiven Einhcitsbestrebungen<br />
auf bibliothekarischem Gebiet zukomme. 18 Bezeichnend<br />
da<strong>für</strong> ist der Umstand, daß sich diese Bibliothek mit dem Statut <strong>von</strong> 1885 die<br />
Aufgabe stellt, »in möglichster Vollständigkeit die deutsche Literatur zu<br />
sammeln«
ARCHÄOLOGIE F.INKR NATIONAIBIBI.IOTHEK: DIK DEUTSCHE BÜCHEREI 797<br />
eins oder im Anschluß an die Berliner Königliche Bibliothek zu inaugurieren.<br />
Die Antinomie zu Althoffs Plan der logistischen Zentralisierung deutschen<br />
Bibliothekswissens bildet das Schicksal seiner eigenen Korrespondenz: »die etwa<br />
3000 Briefe, die Althoff über ein Vierteljahrhundert jährlich schrieb oder diktierte,<br />
sind in den Nachlässen durch Emigration, Flucht und Vertreibung über<br />
die ganze Welt verstreut.« 21 1910 folgt die Denkschrift des Dresdner Buchhändlers<br />
und Zweiten Vorstehers des Börsenvereins, Erich Ehlermann, Eine Reichsbibliothek<br />
in Leipzig. Da abzusehen war, daß die Reichsregierung die Gründung<br />
einer Reichsbibhothek kaum billigen würde, sondern erwartete, daß der Börsenverein<br />
seine Verlagserzeugnisse dem Preußischen Staate zur Verfügung stellte,<br />
ergriff der Buchhandel als nichtstaatliche Organisation die Initiative und schuf in<br />
Leipzig die deutsche Nationalbibliothek. Ab September 1920 beteiligt sich das<br />
Reich allerdings zu zwei Dritteln an den Kosten der Deutschen Bücherei, die<br />
damit neben dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, dem Römisch-<br />
Germanischen Zentralmuseum in Mainz und dem Deutschen Museum in München<br />
zu einer national definierten Gedächtnisagentur avanciert. 22<br />
<strong>Im</strong> März 1910 stellt der Rat der Stadt Leipzig entsprechendes Baugelände zur<br />
Verfügung; das Land Sachsen übernimmt die Verpflichtung zum Bau eines repräsentativen<br />
Gebäudes - wo die efficaate ins Symbolische kippt. Der gesamte<br />
Plan stößt auf die Ablehnung des Generaldirektors der Königlichen Bibliothek<br />
Berlin, Adolf <strong>von</strong> Harnack; dessen Broschüre Die Benutzung der Königlichen<br />
Bibliothek und die deutsche Nationalbibliothek (Berlin 1912) ruft promt eine Gegenschrift<br />
auf den Plan, welche auf die gedächtnismediale Differenz zwischen<br />
residentem Bücherspeicher (Leipzig) und Ausleihbibliothek (der Berliner Fall)<br />
rekurnert. 23 <strong>Im</strong> Streit um den Titel Nationalbibhothek stellt Harnack nachträg-<br />
21 Bernhard vom Brocke, Friedrich Althoff (1839-1908). Forschungsstand und Quellenlage.<br />
Bemühungen um eine Biographie (zugleich ein Plädoyer <strong>für</strong> die Allgemeine Wissenschaftsgeschichte),<br />
in: ders. (Hg.), Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik<br />
im Industnczeitaltcr. Das »System Althoff« in historischer Perspektive, Hildesheim<br />
(Lax) 1991, 15-37 (35). In der vom Zentralen Staatsarchiv der DDR, Dienststelle Mcrseburg<br />
(seit 3. Oktober 1990 Geheimes Staatsarchiv, Preußischer Kulturbesitz, dann<br />
transferiert nach Berlin) firmierten die Geschäftspapiere <strong>von</strong> Friedrich Althoff in der<br />
Tektonikgruppe »Nachlässe«. Damit sind sie buchstäbliche Bausteine einer Archi(v)textur:<br />
Heinrich Waldmann, Der Nachlaß Friedrich Althoffs in Merseburg, in: Brocke<br />
(Hg.) 1991: 53-58 (53)<br />
22 Siehe Friedrich P. Kahlenbcrg, Sonderbereiche der Kulturverwaltung, in: Kurt G. A.<br />
(eserich, Hans Pohl, Georg-Christoph <strong>von</strong> Unruh (Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte,<br />
6 Bde, Stuttgart (Deutsche Verlagsgesellschaft) 19831t, Bd. 5, § 12, 720tt" (722f)<br />
23 Hans Schnorr <strong>von</strong> Carolsfeld, Deutsche Nationalbibhothek. Königliche Bibliothek<br />
und Königliche Hof- und Staatsbibliothek München, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen<br />
30 (1913), 58-r,2
798 BlBI.IOTliKK<br />
lieh richtig, daß »<strong>für</strong> die alten deutschen Bücher die deutsche Nationalbibliothek<br />
in den gemeinsamen Schätzen aller großen deutschen Bibliotheken besteht«; der<br />
Kollektivsingular des Deutschen Reichs verkörpert sich mithin im Gedächtnis<br />
der Textkorpora seiner Gutenberg-Galaxis. 24 In einer unveröffentlichten Denkschrift<br />
vom 29. Dezember 1911 definiert schließlich ein der nationalen Symbolik<br />
gegenüber eher indifferenter Pragmatiker, der Verlagsbuchhändler Albert<br />
Brockhaus, die künftige Aufgabenstellung einer Deutschen Bücherei als Archiv<br />
des gesamten deutschen Schrifttums. Die Gründungskurkunde wird am 3. Oktober<br />
1912 unterzeichnet; Stichdatum der Sammlungstätigkeit ist der 1. Januar<br />
1913, unter Zurückweisung des Arguments der Nachträglichkeit einer Bibliothek<br />
<strong>von</strong> 1913: denn voraussichtlich würden der Deutschen Bücherei in den<br />
nächsten Jahren noch große Massen allerer deutscher Literatur als Geschenke<br />
zugehen. «Zahlreiche wichtige ältere Werke werden fortwährend neu gedruckt«<br />
- das technische Dispositiv des Wissenssystems<br />
<strong>von</strong> 1913 heißt recycling; das Verhältnis <strong>von</strong> (Bücher-)Lager und (Gedächtnis-<br />
)Kapital wird neu kalibriert. Der wissensarchäologisch einsichtige Schnitt <strong>von</strong><br />
1913 scheint aus geistesgeschichtlicher Perspektive allerdings arbiträr; »so bliebe<br />
doch die Sammlung nach rückwärts ein jämmerlicher Torso«. 25 Ein Bibliothekar<br />
und Mitglied des deutschen Reichstags, Maximilian Pfeiffer, äußert sich am 11.<br />
Januar 1913 unter Bezug auf die Königliche Bibliothek Berlin und zur Verteidigung<br />
der gewachsenen Bestände der Münchener Bibliothek in der Bayerischen<br />
Staatszeitung zum Thema deutsche Nationalbibliothek und nennt so, was institutionell<br />
unausgesprochen-bleibt: »Man mag mit der Macht des Milliardärs sich<br />
mit Antiquitäten in verschwenderischer Fülle umgeben, man wird doch nicht der<br />
Erbe eines alten Geschlechts« - ein memonales Verhältnis, das heute nicht mehr<br />
zwischen München und Berlin, sondern zwischen Europa und Kalifornien gilt.<br />
Das Stichdatum der Sammlungen der Leipziger Deutschen Bücherei jedenfalls<br />
zieht die Konsequenz daraus, daß das literarische Kapital einer Nation mit Vollständigkeitsanspruch<br />
im <strong>Im</strong>aginären nur als <strong>Geschichte</strong> rekonstruierbar, als reales<br />
Magazin aber nicht retrospektiv zu leisten ist; als Archiv geht sie <strong>von</strong> der<br />
Registratur der Gegenwart aus. Der Akzent der Sammlungspolitik liegt seitdem<br />
auf der (zunehmend «
ARCHÄOI.OGIH l-INI-.K NATIONAl.BIBl.lOTHliK: Dli: DHUTSCI Ih BÜCI 1L1U.I 799<br />
genossen das Wichtigste, wichtiger als die Arbeit früherer Epochen, und deren<br />
Medium sind, namentlich, die vielen Zeitschriften, gegenüber der Retardation<br />
monumentaler Publikationen:<br />
»Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken sind heute noch in einem weitgehenden<br />
Historismus befangen. Die Vergangenheit und die historisch-antiquarischen<br />
Untesuchungen werden zu ungunsten der Gegenwart und ihrer Ziele<br />
überschätzt . Vielleicht kommt bald eine Zeit, die vornehmlich durch ihre eignen<br />
Gedanken und Bestrebungen in Atem gehalten wird und nicht Muße<br />
genug hat, sich daneben um die Vergangenheit noch viel zu kümmern. Dann werden<br />
bloße Büchermuseen und alle Bibliotheken, die ihren Ruhm in älteren Beständen<br />
sehen, an Gebrauchswert verlieren.« 2b<br />
Die Zäsur gegenüber diesem Bibliothek <strong>von</strong> Alexandria-Syndvom hat Weltkrieg<br />
I gesetzt, und der Aufbruch der Weimarer Republik.<br />
Das Verdrängte einer virtuellen Nationalbibliothek arbeitete auch nach dem<br />
Scheitern des Frankfurter Paulskirchenparlaments weiter, und die Lettern<br />
drängten und insistierten buchstäblich im Unterbewußten der Nation. Der<br />
Gedanke, ihre Bücherströme zusammenzufädeln, bekommt nach Errichtung<br />
des Norddeutschen Bundes partiell, und nach 1871 umfassend wieder den Rahmen<br />
einer staatlichen Autorität. »Dann geht kein deutsches Buch verloren«<br />
lautete die Option - ein Objektbegehren, das auch in der Diskussion<br />
um Sinn und Unsinn eines Deutschen Historischen Museums in den<br />
1980er Jahren der Bundesrepublik eine Rolle spielt. Die Energien dieses Diskurses<br />
verdanken sich dem Mangel, dem Verlust im Kontext der N(eg)ation,<br />
denn deutsch ist ein Sammelbegriff, dem nie strikt cm Stammesvolk wie die<br />
Franken in Frankreich oder die Angeln in England, sondern nur ein Konglomerat<br />
<strong>von</strong> Stämmen zuzuordnen, die sich <strong>von</strong> ihren Nachbarn abgrenzen wollten.<br />
»>Deutsch< bezeichnete also einen Mangel und zugleich den Versuch, ihn<br />
zu beheben: ein Ganzes, ein Eigenes, ein Festumgrenztes zu werden.« 27 Ganz<br />
konkret ist dieses Begehr in dem Wunsch der Deutschen Bücherei, auch Privatdrucke<br />
und Vereinsschriften zu erfassen, also »derartige Druckwerke, die ja<br />
in besonderem Grade der Gefahr spurlosen Verschwindens unterliegen«<br />
. Das buchstäbliche Gedächtnis der Nation verrät hier<br />
seine Kehrseite, die Kontrolle des Diskurses, dem sich nur das Vergessen ent-<br />
26 Hans Paalzow, Die Deutsche Bücherei in Leipzig. Vortrag gehalten auf dem Deutschen<br />
Bibliothekartag in Mainz am 16. Mai 1913; publiziert in: Börsenblatt <strong>für</strong> den<br />
Deutschen Buchhandel Nr. 129 v. 7. Juni 1913; Wiederabdruck in: Deutsche Bücherei<br />
1915:62-67(64)<br />
27 Martin Ahrends, Wer dazugehört. Fernseh-Vorschau zu einem Film <strong>von</strong> Flannes Heer,<br />
Deutschland - wo liegt es?, in: Die Zeit v. 9. März 1990. Vom »Mangel« und »Fehlen<br />
einer Stelle, die zur vollständigen Sammlung der deutschen Literatur verpflichtet<br />
gewesen wäre«, schreibt auch Schwenkel912: 537
800 BlBI.IOTI-IKK.<br />
zieht. Die nationale Vereinigung im Medium Buch ist ein Begriff, der <strong>von</strong><br />
Verlust spricht, <strong>von</strong> der Zerstörung, vom Verschwinden der Dinge: »Die Vorsilbe<br />
>ver< reflektiert auf den Abstand, die Umkehr, das Fehlen, die Trennung.<br />
Dabei handelt es sich immer um einen Bezug zu Gegenständen.« 28 Der Ausgangspunkt<br />
ist purer Mangel - Deutschland; dessen Diskurse tendieren zur<br />
monumentalen Verdinglichung. »Wir haben eine große Nationalliteratur«, verkündete<br />
Kurt Kehrbach 1880 in der Literarischen Korrespondenz aus bibliothekarischer<br />
Perspektive und verlangte eine Sammelstelle dieses deutschen<br />
Geisteslebens. Damit ist die Deutsche Bücherei als (H)Ort und Materialisierung<br />
der nationalen Sammlungen vorgegeben; anstelle <strong>von</strong> Geist steht dabei<br />
infrastrukturell die Arbeit am Katalog, also eher kybernetischen Operationen<br />
(Mikro-Gedächtnis) denn der emphatische Diskurs der Kulturspeicherung.<br />
Während also die romantische Historiographie sich anschickt, das Gedächtnis<br />
der Nation im <strong>Im</strong>aginären narrativ zu mobilisieren, verzichtet der Katalogisierungsdiskurs<br />
um 1800 auf philologische Geist-Metaphysik, um sich stattdessen<br />
mit den non-diskursiven, technischen Problemen der kleinen Handgriffe<br />
zu beschäftigen. Dies ist »keine unschuldige Bibliothekstechnik, sondern legitimiert<br />
>Operationen< (ein Lieblingsbegriff Kaysers), die den Wildwuchs der<br />
Schriften zurückschneiden«. 29 Andererseits sind Kataloge nicht einfach Instrumente<br />
zur Bewältigung täglicher Verwaltungsroutinen, »sondern stecken voller<br />
metaphysischer Mucken, deren Summe nicht in reiner Praxis aufgeht« . Medienarchäologie heißt hier also, die Schnitt- und Kippstellen <strong>von</strong> Infrastruktur<br />
und Symbohsierung aufzudecken. Am 8. September 1913 gibt der<br />
Geschäftsführende Ausschuß die Grundsätze <strong>für</strong> die Sammlung und Katalogisierung<br />
in der Deutschen Bücherei bekannt. Sie definieren die Schnittstelle und<br />
zugleich die Differenz der Bibliothek zum Archiv medial: »Nicht gesammelt<br />
werden Formulare aller Art sowie behördliche Schriftstücke, bei denen der<br />
Druck lediglich anstelle der sonst im Schriftverkehr üblichen Schrift getreten<br />
ist«; ungesammelt bleiben ferner »Druckschriften, die nur dem Zwecke des<br />
Gewerbes, des Handels oder des Verkehrs dienen sowie öffentliche Anschläge<br />
und Einblattdrucke jeder Art« 30 - also nicht die subliterarische Ebene <strong>von</strong><br />
Schriftverkehr.<br />
2X Peter Rech, Abwesenheit und Verwandlung. Das Kunstwerk als Übergangsobjekt,<br />
Basel / Frankfurt a. M. 1981, 83<br />
- y Uwe Jochum, Die Idole der Bibliothekare, Würzburg (Königshausen und Neumann)<br />
1995,83<br />
30 Bekanntmachung der Satzung <strong>für</strong> die Deutsche Bücherei, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den<br />
Deutschen Buchhandel Nr. 209 v. 9. September 1913; Wiederabdruck in: In: Deutsche<br />
Bücherei [Urkunden und Beiträge] 1915: 74-79
ARCHÄOLOGIE EINER NATIONAI.BIBI IOTIIEK: DIE DEUTSCHH BÜCHEREI 801<br />
Finale einer Nationalbibliothek: Arche 1913<br />
Eine Denkschrift aus Anlaß Einweihung der der Deutschen Bücherei (gleich<br />
der des benachbarten Völkerschlachtdenkmals, denn es geht um die Behauptung<br />
eines Nationalheihgtums) beschreibt deren Vorgeschichte als Symbol der<br />
deutschen Verirrungen mit finaler Erfüllung. 31 Am Ende hat der deutsche Geist<br />
sein materielles Korrelat gefunden, den Geistesspeicher der Deutschen Bücherei,<br />
dessen Architektur (der Monumentalbau) diesen Gedächtnisort zugleich als<br />
Allegorie nationaler Energien ausweist 32 . Analog zu den Geistessammeistätten<br />
(Ekstasen des logos) anderer Nationen (British Library London, Bibliotheque<br />
Nationale Paris, Biblioteca Nazionale Rom, Library of Congress Washington)<br />
sucht Deutschland den Totahtätshonzont der (ab einem bestimmten Datum)<br />
vollständigen, lückenlosen Erfassung der Literatur seines Sprachvolkes. 33 Beispiel<br />
da<strong>für</strong>, wie die Errichtung einer Nationalbibliothek der Gründung eines<br />
Nationalstaats virtuell vorauszugehen vermag, ist die Jüdische Nationalbibliothek<br />
in Jerusalem 1892. Eine Nationalbibliothek als Rückgrat der ganzen<br />
Literaturversorgung hat es in Deutschland bis dahin nicht gegeben. Die<br />
wissenschaftliche Buchbelieferung war vielmehr einem »perfekten, dezentralisierten<br />
System <strong>von</strong> Sammelschwerpunkten zu danken« 34 . <strong>Im</strong> Gründungsmoment<br />
der Deutschen Bücherei insistiert der Leiter der Münchner Hof- und<br />
Staatsbibliothek <strong>für</strong> eine deutschlandweite Verteilung der bibliothekarischen<br />
Arbeit anstelle einer Sammlung, angesichts der überragenden Sonderstellung<br />
Berlins und den alter Bestände der übrigen Bibliotheken als dem gemeinsamen<br />
Nationalgut - womit die Epoche des Kaiserreiches auch die Grenze des<br />
deutschen Buchgedächtnisses als Kollektivsingular gebildet hätte.'' 1 Als am<br />
3. Oktober 1990 die nationalbibliothekarische Wiedervereinigung Dcutsch-<br />
31 Hayden White spricht analog dazu in seinem Kapitel über die Geschichtsschreibung<br />
Leopold <strong>von</strong> Rankes vom Inszenierungsmuster der Komödie, das einer solchen histonographischen<br />
<strong>Im</strong>agination zugrunde liegt (Preußen als das happy end der Weltgeschichte):<br />
Metahistory. Die historische Einbildungskraft in Europa im 19. Jahrhundert,<br />
Stuttgart (Klett-Cotta) 1991<br />
32 Hanns Michael Crass, Das ikonographische Programm der Nationalbibliotheken des<br />
19. Jahrhunderts am Beispiel der Bibliotheque Nationale in Paris, in: Carsten-Peter<br />
Warncke (Hg.), Ikonographie der Bibliotheken, Wiesbaden 1992, 323 spricht <strong>von</strong> der<br />
DB Leipzig als nationaler Gedenkstätte.<br />
33 Mohrmann 1916: lOf. Zur Verbindlichkeit der Nationalbibliothek: Derrida 1978<br />
34 Elmar Mittler, In der Zange. Zum ersten gesamtldeutschen Bibliothekskongreß in Leipzig,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 1. Juni 1993<br />
33 Von Carolsfeld 1913: 61. Dazu Engelbert Plassmann, Bibhotheksgeschichte und Verfassungsgeschichte.<br />
Antrittsvorlesung Humboldt-Universität zu Berlin, Philos. Fak.<br />
Institut <strong>für</strong> Bibliothekswissenschaft, 15. Januar 1997, hg. v. Präsident der Humboldt-<br />
Universität zu Berlin 1997 (Heft 84), 23
802 BlBl.lOTHHK<br />
lands (die beiden Häuser in Leipzig und Frankfurt/M.) zu Der deutschen<br />
Bibliothek stattfindet, insisitiert die Kapitalisierung des bestimmten Artikels<br />
deiktisch auf etwas, das zusammengefügt, nicht aber identisch ist. Dis/semi/<br />
Nation als Entfernung einer Teilung erinnert hier an den wissensarchäologisch<br />
markanten Zug dieses Weges: »Alles Meistern der Entfernungen bringt überall<br />
keine Nähe.« 36 Aus dieser Lage erklärt sich die (erneute) Ausblendung des<br />
Atozotttf/bibliotheksbegriffs, die Klaus G. Säur als Symptom einer in Deutschland<br />
ausgeprägten semantischen Reserve liest: »Wenn wir heute in die >Brockhaus<br />
Enzyklopädie' schauen oder auf CD-Rom-Anlagen recherchieren oder<br />
onlinemäßig herumspielen, müssen wir feststellen, daß dieser Begriff in Wirklichkeit<br />
kaum benutzt wird.« 37 Schon unmittelbar vor Gründung der Deutschen<br />
Bücherei kommt es zur Debatte um ihre Benennung: nicht Bibliothek, sondern<br />
Bücherei sei als deutsche Bezeichnung zu wählen; Albert Brockhaus verlangt,<br />
den Titel des Archivs <strong>für</strong> kurrente neue deutsche Literatur ab dem 1. Januar<br />
1913 aufzuheben .<br />
Die symbolische Verknüpfung <strong>von</strong> Deutscher Bücherei und Völkerschlachtdenkmal<br />
in Leipzig besteht in der räumlichen Kontingenz und im Diskurs der<br />
Historie; mit den Kämpfen in jenen Oktobertagen 1813, hundert Jahre vor Gründung<br />
des Bücherspeichers, wurden die deutschen Lande nicht nur <strong>von</strong> der französischen<br />
Herrschaft befreit, »sondern auch die Voraussetzungen <strong>für</strong> ihre geistige<br />
und wirtschaftliche Entwicklung geschaffen.« 38 Die Befreiungskriege mobilisieren<br />
nicht nur Truppen, sondern auch Lettern; damit eine statistische Menschenmenge<br />
mit den postalischen Übertragungsmedien des Staates als Volk<br />
adressierbar ist, bedarf es ihrer buchstäblichen Bildung als Enkodierung im Symbolischen<br />
des Alphabets. Als zwischen 1805 und 1813 Heinrich Stephani ein<br />
System der öffentlichen Erziehung ausarbeitet, fordert er darin Volksleseanstalten<br />
mit einem pyramidalen System <strong>von</strong> National-, Stadt- und Dorfbibhotheken. 39 Als<br />
Ein solches Werk nationaler Infrastruktunerung ist die Deutsche Bücherei. Ein<br />
Börsenblatt-Artikel definiert die Verzögerung <strong>von</strong> Wunsch und Erfüllung dieses<br />
Projekts, seine dramatische Zeitstruktur, im Wissen um das fröhliche Finale: »kei-<br />
36<br />
Martin Heidegger, Das Ge-Stell, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 79: Bremer und Freiburger<br />
Vorträge, hier: Einblick in das was ist (Bremer Vorträge 1949), Frankfurt/M.<br />
(Vittorio Klostcrmann) 1994, 24-45 (24)<br />
37<br />
Klaus G. Säur, Ob NSDAP oder SED: Die Deutsche Bücherei umschiffte bravourös<br />
die Klippen, in: Börsenblatt 4/15. Januar 1993, 22-27 (22f). Von der Bezeichnung »Deutsche<br />
Nationalbibliothek« als »Contradictio in adjeeto« schreibt Schwenke 1912: 536<br />
38<br />
Börsenblatt Nr. 240 v. 22. Okt. 1913, wiederabgedruckt als Dokument Nr. 21 in: Deutsche<br />
Bücherei 1915<br />
39<br />
Dazu Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig (Wiegandt) 1912, 6f; s. a. Friedrich<br />
A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, 2. erw. u. korr. Auflage, München (Fink)<br />
1987
ARCHÄOLOGIE I-:INI-:K NATIONAUSIBLIOTHKK: DU-: DI-UTSCI-Ü-; BÜCIII-.RI-.I 803<br />
nen geeigneteren Zeitpunkt <strong>für</strong> die Verwirklichung dieser Schöpfung« habe es<br />
geben können als das Jahr der Jahrhundertfeier der Völkerschlacht.<br />
»Denn an dem Tage, da unsere Vorfahren das Joch der Fremdherrschaft abschüttelten,<br />
schlug auch der deutschen Literatur die Stunde der Befreiung. Wie<br />
stark diese Übereinstimmung zwischen dem Leben des deutschen Volkes und seiner<br />
Literatur ist, geht schon daraus hervor, daß am Anfange seines Schnftwesens<br />
wie seiner Erneuerung eine Bibelübersetzung steht, daß die Schriften Ernst Moritz<br />
Arndts, die Reden Fichtcs und die Lieder Schenkendorfs, Körners, Rückens u. a.<br />
nicht minder großen Anteil an dem Befreiungswerk <strong>von</strong> 1813 haben wie die Taten<br />
eines Blücher, York, Gneisenau, Scharnhorst und Stein.« <br />
Solche Werke aber bedürfen der Akzessierbarkeit; zu diesem Behufe fordert der<br />
Verleger Friedrich Christoph Perthes »ein halbjähriges, allgemeines Verzeichnis<br />
der neu erscheinenden Bücher ; daß allgemeine, gute und richtige Bücherkataloge,<br />
nebst andern literarischen Hilfsmitteln, sowie endlich mehrere allgemeine,<br />
die ganze Literatur umfassende kritische Institute vorhanden sind« 40 -<br />
Metadaten und Inventar (die spätere Deutsche Bibliographie). Nicht nur die<br />
Sammlung nationalen Schrifttums ist bei der Gründung der Deutschen Bücherei<br />
vorgesehen, sondern auch dessen bibliographische Verzeichnung: durch Ankauf<br />
der vormalig auf private Verlegerinitative herausgegebenen nationalen deutschen<br />
Bibliographie, der Hinncbs'scben Bibliographie und des Kayserschen Bücherlexikons<br />
durch den Börsenverein. 1916 wird durch die Bibliographische Abteilung<br />
des Börsenvereins das Tägliche Verzeichnis der Neuerscheinung des deutschen<br />
Buchhandels initiiert; 1921 wird diese Serviceleistung der Deutschen Bücherei<br />
selbst übertragen, die ab 1928 die Herausgabe des Monatlichen Verzeichnisses der<br />
reichsdeutschen amtlichen Druckschriften, die Neugestaltung des Wöchentlichen<br />
Verzeichnisses als Deutsche Natwnalbibliographie (Reihe A) und die gleichzeitige<br />
Herausgabe einer Reihe B <strong>für</strong> außerhalb des Buchhandels erscheinendes<br />
deutschsprachiges Schrifttum (ab 1931) übernimmt. Eine Hauptaufgabe der<br />
Deutschen Bücherei lag seitdem auf dem Gebiet der Bibliographie; bereits 1891,<br />
bevor die Titeldrucke der Königlichen Bibliothek in Berlin zu erscheinen beginnen,<br />
prüft die Preußische Unterrichtsverwaltung die Möglichkeit, <strong>von</strong> dem<br />
Drucksatz des Wöchentlichen Verzeichnisses einen besonderen Abdruck zu veranstalten,<br />
der den Bibliotheken als Katalogisierungsmatenal zu liefern wäre. Für<br />
Büchertitel heißt das: Der Moment, in dem eine Schrift das Licht der Publikation<br />
erblickt, ist auch schon ihr Eintritt ms Dunkel des Speichers. Geheimrat Siegismund<br />
verkündet in seiner Begrüßungsansprache den Journalisten des Auslands<br />
beim Besuch der neu eröffneten Deutschen Bücherei 1916, in diesem Gebäude<br />
40 Friedrich Christoph Perthes, Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseyns<br />
einer deutschen Literatur, Hamburg 1816; hier zitiert nach dem Nachdruck Stuttgart<br />
(Reclam) 1995, §7, 11
804 BlHUOTIlHK<br />
werde »die Idee zur Ausführung kommen«, die Erscheinungen des gesamten<br />
deutschen Schrifttums in einer Zentralbibliothek vom Tag der Gründung an zu<br />
sammeln und <strong>für</strong> die Dauer geordnet zur Verfügung zu halten. 41 <strong>Im</strong> double-bmd<br />
zwischen geschlossenem Archiv und öffentlicher wissenschaftlicher Bibliothek<br />
speichert die Deutsche Bücherei prinzipiell <strong>von</strong> jedem Werk nur ein Exemplar;<br />
seit 1920 ist sie dem Deutschen Leihverkehr angeschlossen. Rötzsch formuliert<br />
das Ziel, neben dem bisher inventarisierten einen Exemplar, dessen Benutzung<br />
durch Entleihungen gegeben ist, ein weiteres Exemplar zu erhalten, »das als<br />
unantastbares Archivstück der Nachwelt <strong>für</strong> alle Zeiten zur Verfügung stehen«<br />
soll . Das hermetische Archiv wird die Zukunft der Gedächtnisspeicher<br />
im Medicnzeitalter sein, die Entkopplung der Information <strong>von</strong> ihren<br />
verbindlichen, festgeschriebenen Trägern, die demgegenüber den Rekurs auf die<br />
Autorität der Existenz als Aussage der gedruckten Publikation bewahren.<br />
In seinem Plädoyer <strong>für</strong> die Bedeutung des deutschen Buchhandels als kulturpolitischem<br />
Dispositiv definiert Perthes denselben 1811 zum eigentlichen<br />
Medium <strong>von</strong> Literatur: »Deutschland hat keinen Mittelpunkt, keine Hauptstadt,<br />
keinen allgemeinen Beschützer <strong>für</strong> Wissenschaft, Kunst und Litteratur. - Die<br />
Gesammtheit muß dies ersetzen, - der Buchhandel ist das Mittel zur Einheit.« 42<br />
Und als Inhalt wird das Medium zur Form: »Die deutsche Nation ist eine<br />
lesende, reflectirende: die Litteratur ist ihr Mittel zur Cultur« . Das Faktum<br />
der Fernleihe dient auch dem Direktor der Königlichen Bibliothek in Berlin<br />
als Argument <strong>für</strong> die Forderung nach einer Expansion des Bestands: Sein<br />
Haus müsse in den Stand gesetzt werden, »mindestens keinen Bücherzettel mehr,<br />
auf dem ein wichtiges deutsches Werk verlangt wird, mit dem Bescheide >Nicht<br />
vorhanden* signieren zu müssen.« Harnack erzählt keine Nationalgeschichten,<br />
sondern argumentiert mit Zahlen, mithin Speicherfrequenzen: <strong>Im</strong> vergangenen<br />
Jahr mußten noch 107482 Bücherbestellzettel mit dem Vermerk Verliehen<br />
»bezeichnet« werden; demgegenüber gibt es nur ein Mittel, »um diese Zahl <br />
mit einem Schlage verschwinden zu lassen, nämlich die Umwandlung in eine Präsenzbibliothek«.<br />
43 Dasselbe Argument gereicht seinen Bibliotheksrivalen zum<br />
Plädoyer <strong>für</strong> die Errichtung einer Deutschen Bücherei in Leipzig. Hans Paalzow<br />
41 Zitiert in: Börsenblatt Nr. 179 v. 5. August 1915, wiederabgedruckt als Dokument 30<br />
in: Deutsche Bücherei 1915<br />
42 Zitiert nach dem Abdruck im Börsenblatt Nr. 132 v. 9. Juni 1884 = Perthes 1995: 81f<br />
43 Adolf Harnack, Die Benutzung der Königl. Bibliothek und die deutsche Nationalbibliothek,<br />
Berlin (Springer) 1912, zitiert in Dokument Nr. 6: Exzellenz Harnack und<br />
die Deutsche Bücherei, in: Deutsche Bücherei 1915. Zum späteren Anspruch der Berliner<br />
Staats- als »Reichsbibliothek« im nationalsozialistischen Kontext siehe Werner<br />
Schochow, Die Preußische Staatsbibliothek im Schatten der Politik oder Zwischen<br />
Selbstbehauptung und Anpassung, in: Vodosek / Komoroswki (Hg.) 1989: 25-48 (36f)
ARCHÄOI.QGII- KINI-R NATIONALBIBI.IOTHKK: DU-; DI;UTSCIIH BÜCH!-:RHI 805<br />
setzt in Nachfolge Harnacks dessen Klage auf dem Deutschen Bibliothekarstag<br />
in Mainz am 16. Mai 1913 fort; die Berliner Bibliothek werde durch die Gründung<br />
der Deutschen Bücherei selbst in Mitleidenschaft gezogen. Als Leiter des<br />
Anschaffungsdienstes der Königlichen Bibliothek hat er den Einfluß, den die<br />
Gründung der Deutschen Bücherei auf die Entwicklung in Berlin ausübt, »sozusagen<br />
am eigenen Leibe erfahren«. 44 Die Mikrophysik des gedächtnismedialen<br />
Einschnitts der Deutschen Bücherei im Moment des Ereignisses zu beschreiben<br />
aber war unmöglich: Paalzow weiß, daß »eine auf Grund des Aktenmatenals dargestellte<br />
ausführliche Entstehungsgeschichte der Deutschen Bücherei heute ein<br />
verfrühtes und verfehltes Beginnen wäre, das dem Historiker der Zukunft überlassen<br />
werden müsse« . Die vom Zeitverzug zwischen Administration und<br />
Archivierung vorgegebene Nachträglichkeit aller Reflexion über aktuelle Gegenwarten<br />
ist die Bedingung der Historiographie. Nicht nur die lkonographische<br />
und epigraphische Ausstattung erhebt die Deutsche Bücherei in den Rang einer<br />
nationalen Gedenkstätte; darauf weisen auch die memorialkalendarisch skandierte<br />
Tage der Baugeschichte hin, die mit Gedenktagen aus der deutschen<br />
<strong>Geschichte</strong> verbunden sind. Eingeweiht wird das Gebäude 1916 am seinerzeit im<br />
deutschen Bewußtsein noch präsenten Sedanstag, einem 2. September.<br />
Architekturen der Deutschen Bücherei<br />
Als am 25. September 1912 die Bekanntmachung des Entschlusses des Börsenvereins<br />
der Deutschen Buchändler erfolgt, in Leipzig einerseits (ausdrücklich)<br />
ein Archiv des deutschen Schnftums und des deutschen Buchhandels zu bilden,<br />
anderseits damit eine öffentliche, unentgeltlich an Ort und Stelle zur Benutzung<br />
freistehende Bibliothek zur Verfügung zu stellen, betrifft diese Freistellung konkret<br />
den Zugang und den Speicher:<br />
»Auch <strong>für</strong> die Katalogisierung der Deutschen Bücherei und die Aufstellung der<br />
Bücher wird der Verwaltungsrat die Fundamente legen müssen. Bei der Aufstellung<br />
wird in Betracht zu ziehen sein, daß die Büchermagazine erst allmählich ausgebaut<br />
werden können. Vielleicht wird die Aufstellung nach der laufenden<br />
Nummer das Richtige sein. Bei der Katalogisierung wird es sich namentlich darum<br />
handeln, ob ein Realkatalog angelegt werden soll und in welcher Art. Der Geschäftsführende<br />
Ausschuß ist der Meinung, daß diese Frage prinzipiell schon<br />
durch die Satzung entschieden ist, die in § 2 bestimmt, daß die Bücher nach wissenschaftlichen<br />
Grundsätzen zu verzeichnen sind.« <br />
Der Bericht Die Deutsche Bücherei im Bau benennt das Unternehmen Nationalbücherei<br />
als Funktion einer Infrastruktur - sowohl des Baus (»hohe eiserne Krane<br />
44 In: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel Nr. 129 v. 7. Juni 1913
806 BlKl.IOTIII-K.<br />
rollen«) als auch seiner Zweckplanung; die Rede ist <strong>von</strong> einer automatischen<br />
Eisenbahnverbindung zwischen den Gebäudeteilen. Die topographische Verortung<br />
plant das deutsche Gedächtnis in nüchterner Funktionalität: Nicht nur, daß<br />
vom benachbarten Neubau der Taubstummenanstalt »störende Geräusche <br />
nicht zu be<strong>für</strong>chten« sind, sondern auch der ebenfalls anliegende Kirchhof wird<br />
nur noch <strong>für</strong> Erbbegräbnisse benutzt; »so ist anzunehmen, daß er in hundert Jahren,<br />
wenn die Bücherspeicher der Deutschen Bücherei angefüllt sind, bereits<br />
geschlossen« und damit <strong>für</strong> den erweiterten Speicher nutzbar sein wird . Damit überschreibt der Raum buchstäblicher Signifikanten das Reale<br />
des Schlachtfelds, die Massengräber vom Oktober 1813, in dessen Datum sich die<br />
Deutsche Bücherei mit der Grundsteinlegung am 19. Oktober 1913 (nach der<br />
Einweihung des Völkerschlachtdcnkmals) symbolisch einschreibt und damit<br />
eine kontrollierte und kontrollierende Ged'ichtnisordnung herstellt, wo tatsächlich<br />
ein Palimpsest <strong>von</strong> Erinnerungsspuren vorliegt. Die Rolle der Bücherspeicher<br />
ist dabei keine Nebensache, sondern sie »kommen zu ihrem vollen Recht«<br />
; die Pragmatik <strong>von</strong> Gedächtnisadministration verbirgt sich nicht mehr<br />
hinter dem <strong>Im</strong>aginären einer repräsentativen Fassade, sondern stellt ihre Funktionalität<br />
selbst aus - Ende des (ästhetischen) Historismus und Beginn eines<br />
präsentistischen Umgangs mit den Datenbanken <strong>von</strong> Vergangenheit und<br />
Gegenwart. Das Interface zum Leser aber ist ein symbolisches, das an dieser<br />
Stelle jene archi(v)tektonische Infrastruktur dissimuliert. »Auf den Besucher,<br />
der über die Freitreppe zum Hauptportal im Erdgeschoß schreitet, schauen die<br />
Köpfe Gutenbergs, Bismarcks und Goethes herab« - eine prosopopoietische<br />
Einfädelung ins Labyrinth des Speichers, die vorweg genau das suggeriert, was<br />
Buchstaben nicht sind: Geister (statt schlicht: Integrale eines Speicher- und<br />
Ubertragungsmedienverbunds). 45 Sinnbildliche Figuren sollen darüber die (vom<br />
Katalogwesen des Hauses längst überholte) alte Ordnung des Wissens, nämlich<br />
»Technik und Kunst und die vier Fakultäten« verkörpern - der Baukörper der<br />
Bücherei halluziniert Figuren. Dann der Zugang zum logistischen Kopf, zum<br />
Betriebssystem des Gedächtnisimpenums:<br />
»Aus der Vorhalle drinnen öffnet sich ein Portal in Serpentinstein nach dem Katalograum<br />
hin, den jeder Besucher des Lesesaals berühren muß. Die Kataloge der<br />
Deutschen Bücherei, besonders der alphabetische, sollen nicht wie in vielen anderen<br />
Bibliotheken dem Publikum ängstlich ferngehalten oder nur nach mancherlei<br />
Formalitäten ausgeliefert werden; vielmehr will man hier die Besucher schon durch<br />
die Anordnung der Räume sanft und sicher zwingen, die Kataloge 7x\ benutzen,<br />
ehe sie den Lesesaal betreten. Last amerikanisch mutet die Neuerung der zwei<br />
43 S. a. W. E., Augen-Blicke Bismarcks: Hine historische Ausstellung als ephemeres Denkmal,<br />
in: Michael D-icrs (Hg.), Mo(nu)mcnte. Formen und Funktionen ephemerer Denkmäler,<br />
Weinheim (VCH) 1993, 283-297
ARCHÄOI.OGIH HINHR NATIONAI.BIBUOTHHK: DIH DHUTSCIIH BÜCHHRHI 807<br />
kleinen Schreibmaschinenzimmer in den Ecken des Lesesaales an, wo der geistige<br />
Arbeiter Auszüge, oder was ihm über den Büchern einfällt, sofort jungen Damen<br />
in die Maschine diktieren kann« 46<br />
- das Reich des Wissens ist an das der Sekretäre, und das heißt im 20. Jahrhundert:<br />
der Apparate, gekoppelt.<br />
Die Schlußsteinlegung der Deutschen Bücherei erfolgt zum 30. April 1915 am<br />
Turmbau über dem Haupttreppenhaus; in einer verlöteten Metallkapsel geborgen<br />
sind die Pläne und Abbildungen des Neubaues nebst Photographien aus einzelnen<br />
Abschnitten seiner Erbauung, ferner Druckschriften über Entstehung,<br />
Zwecke und Ziele der Deutschen Bücherei, Tageszeitungen und Kriegsgeld, »und<br />
endlich eine Urkunde über den Akt selbst«, in den Schlußstein eingeschlossen. 47<br />
Zwischen Archiv und Gedächtnis wird die Vorstellung des Gründungsaktes selbst<br />
rätselhaft; die Lösung heißt Beobachtung zweiter Ordnung. Die Einfügung der<br />
Urkunde zur Grundsteinlegung der Deutschen Bücherei am 19. Oktober 1913<br />
benennt den Akt der Gründung als Begründung in Akten, zwischen fondement<br />
und fondation 4S : »Zum ewigen Gedächtnis der denkwürdigen Weihestunde« birgt<br />
die Kapsel »in dem festgefügten Grundstein dieses Hauses« namentlich die Satzungen<br />
und Ordnungen des Börscnvcreins der Deutschen Buchhändler sowie die<br />
auf Veranlassung <strong>von</strong> Friedrich Althoff im Jahre 1906 verfaßte Denkschrift, die<br />
zum Beschluß der Institution führt. 49 Urkunden über den Akt der Gründung als<br />
Teil des Gründungsakts sind als Erinnerung nicht nur Wissen um die Gegenwart,<br />
sondern wissen dieses Wissen selbst als gegenwärtig, also als unterschieden <strong>von</strong><br />
der Gegenwart. So entsteht das Gedächtnis des Speichers Deutsche Bücherei als<br />
Produkt der Auseinandersetzung mit seiner Gedächtnisumwelt, als rekursive<br />
Bezugnahme dieses Systems auf sich selbst. 50 Diese Logik evoziert Allegorien.<br />
Am 31. Oktober 1913 referiert Karl Siegismund, Erster Vorsteher des Börsenvereins<br />
der Deutschen Buchändler zu Leipzig und Vorsitzender des Geschäftsführenden<br />
Ausschusses der Deutschen Bücherei, einen Pressebericht, der den<br />
Signifikantenspeicher selbst zum Geschichtszeichen erklärt: Die Kölnische Zeitung<br />
begrüßt die Gründung der Deutschen Bücherei als eine nationale Tat, die<br />
46 In: Börsenblatt Nr. 289 v. 14. Dez. 1914, wiederabgedruckt in: Deutsche Bücherei 1915<br />
47 Die Schlußsteinlegung zum Neubau der Deutschen Bücherei, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den<br />
Deutschen Buchhandel Nr. 106 vom 10. Mai 1915<br />
48 Zur Differenzierung zwischen (Be)Gründung und Grund(stein)legung - Institution<br />
und Gesetz des Archivs - siehe Mark Wigley, Postmortem Architecture: The Taste of<br />
Derrida, in: Perspecta. The Yale Architectural Journal 23 (1987), 157-172 (unter Bezug<br />
auf Kant, Nietzsche, Heidegger)<br />
49 Wiederabgedruckt als Dokument 23 in: Deutsche Bücherei 1915<br />
50 Hier formuliert in Anlehnung an Dirk Baeckcr, Überlegungen zur Form des Gedächtnisses,<br />
in: Siegfried J. Schmidt (I Ig.), Gedächtnis: Probleme und Perspektiven der interdisziplinären<br />
Gcdächtnisforscltung, Frankfurt/M. (Suhkamp) 1991, 337-359 (bes. 34Sff)
808 BlBUOTHF.K<br />
damit dem deutschen Geistesleben ein Ehrendenkmal errichte, wie schöner keines<br />
zu denken sei, verbunden mit der Hoffnung, »daß hier ein Ruhmeszeichen<br />
der deutschen Kultur ersteht, das dauernder ist als Erz«. 51 Erz aber ist das Medium,<br />
das die Buchstaben auf Dauer setzt, sistiert und damit Speicher- und übertragbar<br />
macht: Drucklettern, die entropische Bedingung aller Literatur.<br />
Walhallen<br />
Erst die narrative Bildrahmung des Bücherdepots Deutsche Bücherei transformiert<br />
Gedächtnis in Kulturgeschichte; das ikonographische Programm, nicht die<br />
Magazine, machen das Leipziger Haus zur Gedenkstätte im Sinne des nationalen<br />
<strong>Im</strong>aginären.' 12 Der Indexzettcl zu Alfred Langer, Künstlerischer Schmuck und<br />
vollendete Zweckmäßigkeit: Architektur und künstlerischer Schmuck der Deutschen<br />
Bücherei, Leipzig (Deutsche Bücherei) 1986, verrät es. Inspiration des<br />
Geistes durch Dichter, durch Wolken, durch Quellen und Musen heißt das Programm<br />
der künstlerischen Gestaltung 1916. Nach 1963 schreibt sich die Ästhetik<br />
der sozialistischen Gesellschaft in Form des nordwestlichen Anbaus ein und<br />
realisiert schlicht Technik als Bedingung keines Geistes, sondern der Bücherlagerung<br />
selbst. Zwei <strong>von</strong> Artur Seemann verfaßte Schriftzüge an den Schmalwänden<br />
des großen Lesesaals weisen die Deutsche Bücherei in vergoldeten<br />
Buchstaben als nationales Depot (Praxis) und als Weihestätte (Diskurs) aus:<br />
»Andern gabst du so viel, in Worten, in künstlichen Werken: Sichre dir selber<br />
einmal, Deutschland, dein reiches Geschenk« - Deutschland als Verausgabung.<br />
Dem Gesetz der Skandierung gemäß rückt hier der Name Deutschlands an die<br />
Stelle, wo die erste Zeile vom Wort spricht. Und gegenüber steht geschrieben:<br />
»Waffenplatz sei und Walhalla den Geistern der neuen Germanen, Spende auch<br />
Frieden und Trost, Kind einer eisernen Zeit.«" 13 Damit ist die Deutsche Bücherei<br />
- nach dem Vorbild der 1830-42 <strong>von</strong> Leo v. Klenze erbauten Regensburger Walhalla<br />
- als sakraler Raum der Nation benannt, und zugleich - im Verbund mit<br />
zwei Hochbildern in vergoldetem Eisenguß, welche am Schwellenort des Ein-<br />
51<br />
Börsenblatt [Nr. 255] v. 3. Nov. 1913, wiederabgedruckt als Dokument 22 in: Deutsche<br />
Bücherei 1915<br />
""- Hanns Michael Grass, Das ikonographischc Programm der Nationalbibhothcken des<br />
19. Jahrhunderts am Beispiel der Bibhotheque Nationale in Paris, in: Carsten-Peter<br />
Warnekc (Hg.), Ikonographie der Bibliotheken (= Wolfenbütteler Schriften zur<br />
<strong>Geschichte</strong> des Buchwesens, Bd. 17), Wiesbaden 1992, 323<br />
x<br />
' Hans Boekwitz, langzeitiger Direktor des Deutschen Buch- und Schriftmuseums der<br />
DB, erinnert in einem Aufsatz über Buch- und Schriftmuseen an die Klosterbibliotheken<br />
des Mittelalters: »claustrum sine armano quasi castrum sine armamentano«,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik 70, Heft 11/12 (1933)
ARCIIÄOI.OGIK KINKK NATIONAI.BIBUOTHKK: DlK Dl.UTSCHl. BÜCHHRKI 809<br />
gangs zum Zeitschnftenlesesaal die Inspiration des Dichters und des Gelehrten<br />
darstellen - sind die Geister nicht als metaphysische Wesen, sondern als Effekte<br />
des Mediums Schrift bestimmt. Waffenplatz <strong>für</strong> Geister der neuen Germanen:<br />
Der Leseraum wird zum topischen Aufmarschort <strong>für</strong> Wahrheit, die selbst eine<br />
strategische Kraft ist, nämlich - so Friedrich Nietzsche - ein bewegliches Heer<br />
rhetorisch-literarischer Tropen. Der Bildschmuck der Deutschen Bücherei macht<br />
sich die Figuralität allen Verstehens zunutze, indem er Lesen auf Allegorien des<br />
Nationalen ummünzt. Insofern das Nationale erst auf der Ebene der Repräsentation<br />
entzifferbar ist, gilt <strong>für</strong> seine Zeichen eine Variante der Semiotik (nach<br />
Ch. S. Pierce): daß nämlich die Deutung eines Zeichens nicht seine Bedeutung,<br />
sondern ein anderes Zeichen ist, ad infinitum. Das Allegorische bedeutet genau<br />
das Nichtsein dessen, was es vorstellt (Walter Benjamin): unproblematisch in<br />
einer Zeit, der das Nationale so selbstverständlich war, daß es jenseits der Ebene<br />
der Allegorie (auf der Ebene <strong>von</strong> Infrastruktur etwa) nicht gesucht zu werden<br />
brauchte. Jenes Sonnet Correspondances Charles Baudelaires, anhand dessen<br />
Paul de Man die illusorische Wiederbelebung des natürlichen Atems der Sprache<br />
gegenüber ihrer Versteinerung in literarischen Figuren, kurz: die Lektüre (in)<br />
der Bibliothek feststellt, gilt <strong>für</strong> den Leipziger Lesesaal konkret: »Un temple oü<br />
de vivant pihers / Laissent parfois sortir de confuses paroles. / L'homme y passe<br />
ä travers des forets de symboles / Qui l'observent avec des regards familiers.« 54<br />
Die Nennung der Walhalla im Innersten der Deutschen Bücherei ist nicht eine<br />
metaphorische Reminiszenz an das Bauwerk König Maximilians <strong>von</strong> Bayern bei<br />
Regensburg, sondern sein konkreter Nachvollzug, der das symbolische Netzwerk<br />
intra-nationaler Bezüge noch enger zurrt. Jede Bibliothek ist auch ein imaginäres<br />
Museum; die imagines der deutschen Geistesheroen, die festzuhalten<br />
Schiller durch einen Leitspruch vorgab (»Halte das Bild der Würdigen fest!«),<br />
sind in der Deutschen Bücherei konkret; »eine Walhalla <strong>für</strong> sich« bildet die<br />
»schon auf etwa 50 Nummern« angewachsene Zahl <strong>von</strong> Marmorbüsten, die<br />
- in Verkehrung <strong>von</strong> Schein und Stein - <strong>von</strong> der Vielfältigkeit des deutschen<br />
Geistes eine lebendige Vorstellung geben sollen. 55 Den deutschen Geistesspeicher<br />
als Walhalla malt auch 1973 monumental Anselm Kiefer unter dem Titel<br />
Deutsche Geisteshelden, indem er die <strong>Namen</strong> der Heroen buchstäblich einem<br />
Speicherraum einschreibt. 36 Eine verkable Architextur: keine Büsten darin,<br />
54 Paul de Man, Allegorien des Lesens, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 19SS, 18lff (»Anthropomorphismus<br />
und Trope in der Lyrik«), sowie lOff (Einleitung Walter Hamacher:<br />
»Unlesbarkeit«).<br />
5:1 Denkschrift zur Einweihungsfeier der Deutschen Bücherei des Börsenvercins der<br />
Deutschen Buchhändler zu Leipzig am 2. September 1916, Leipzig 1916, 83<br />
56 Sammlung Barbara & Eugene Schwanz, New York. Siehe Mark Rosenthal, Anselm<br />
Kiefer, Chicago/Philadelphia 1987, 28f
810 . Bim<br />
nur <strong>Namen</strong>, quer über die Leinwand geschrieben. »Die Leere selbst ist hier zum<br />
Monument geworden, zum Monument des kulturellen Gedächtnisses.« 57 <strong>Namen</strong><br />
sind, einem Diktum <strong>von</strong> Joseph Beuys <strong>von</strong> 1974 folgend, gleich Adresse, die<br />
Zugangsbedingung aller Erinnerung. Wie bei Regensburg 58 weist auch der<br />
Büstenbestand deutscher Geistesheroen in der Deutschen Bücherei sprachbedingt<br />
über die nationalen Grenzen marginal hinaus. Die Signaturen diverser<br />
Porträtkünstler fügen sich dabei einem gleichförmigen Größenmaß: Die Büsten<br />
korrespondieren mit den Lettern, der Software der Deutschen Bücherei, und<br />
diese Software heißt Druck, nicht Schrift. Lettern ohne Einbildung aber sind<br />
diskursiv nicht aktivierbar. So begründet sich auch die Notwendigkeit eines<br />
Ehrensaals im Münchener Deutschen Museum damit, daß es nicht ausreicht,<br />
»bloß die Zeugnisse der Schaffcskraft der bedeutendsten Männer zu erwerben<br />
und in lehrreicher Weise vorzuführen« - also die eigentliche technische Sammlung<br />
-, sondern auch »in irgendeiner Form die Persönlichkeit der Heroen der<br />
Wissenschaft, ihre äußere Erscheinung vor die Augen der Besucher hinzustellen,<br />
entweder als Monumente oder als Bildnisse.« 59 Das ist kein antiquarisches<br />
Gedächtnis, sondern - an der Schnittstelle <strong>von</strong> technischem Speicher und<br />
Diskurs - ein <strong>Im</strong>perativ, ausdrücklich Denkmalspolitik als Gedächtnishandlung<br />
. Friedrich Nietzsche hat (in seinen Unzeitgemäßen Betrachtungen)<br />
über den Nutzen und Nachteil der Historie <strong>für</strong> das Leben sinniert; in diesem<br />
Sinne definiert Exner die aktiv historische Zweckbestimmung des Deutschen<br />
Museums: »das überlebte Vergangene abzustoßen, die Gegenwart zu bereichern<br />
und das Werdende vorzubereiten« . Das technische Gedächtnis (selbst ein<br />
technisches Gestell, nämlich Museum) definiert sich als Differenz zum historistischen<br />
Geist. Dessen Privilegierung des diskreten Individuellen, der zur historischen<br />
Biographie neigt, steht im Widerstreit mit einem naturwissenschaftlichen<br />
Gedächtnis, das in der <strong>Geschichte</strong> nach Algorithmen des Fortschritts sucht und<br />
demgegenüber keinen random noise erlaubt:<br />
»Es gibt vielleicht nichts Bildenderes und Erhebenderes als eine gute Biographie;<br />
alicr in das strenge I.iniengelüge dvv <strong>Geschichte</strong> läßt sie 'sich nicht einfügen, weil<br />
die Motiv- und Seelcnforschung nicht nur die Sicherheit der <strong>Geschichte</strong> bedroht,<br />
sondern auch ihre eigentliche Aufgabe. Das große geschichtliche Werk, welches<br />
37 Aleida Assmann, Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze <strong>Geschichte</strong> der deutschen<br />
Bildungsidee, Erankfurt/M. u. a. (Campus) 1993, 112<br />
3S Für einen konkreten Vergleich zwischen den Rüsten deutscher I lernen in L\L'\- Rcyen.«burger<br />
Walhalla und denen in der Deutschen Bücherei siehe Jörg Träger, Der Weg nach<br />
Walhalla. Denkmallandschaft und Bildungsreise im 19. Jahrhundert, Regensburg<br />
(Bosse) 1987<br />
39 W. Exner, Der Ehrensaal des Deutschen Museums, Berlin (VDI) 1930 (= Deutsches<br />
Museum. Abhandlungen und Berichte, 2. Jg., Heft 2), 33
ARCHÄOLOGIH I;INI;R NATIONAUSIBUOTIIKK: DU; DKUTSCHI. BÜCHKKHI 811<br />
>Das Deutsche Museum< darstellt, ist das beste Rüstzeug, das die Technik <strong>von</strong> der<br />
<strong>Geschichte</strong> zu empfangen vermochte« ,<br />
mithin also als Gestell, nicht Erzählung. Fällt das narrative Paradigma der Historie<br />
fort, stellt sich allerdings das Problem ihrer Darstellung. Der Münchner<br />
Ehrensaal soll Zivilisation und Kultur des Deutschtums namentlich versinnbildlichen,<br />
»aber in welcher Reihenfolge?« Exner folgt einem eher wissenschaftsdenn<br />
geisteswissenschaftlichen Modell, präsentiert die Genealogie der Technik<br />
also in ihrem eigenen epistemischen Medium als Versuch einer Systematik der<br />
Wissenschaften: »Obwohl in vielen Fällen die alphabetische Ordnung der<br />
<strong>Namen</strong>reihe das einzige, aber innerlich unbegründete Auskunftsmittel darstellt«,<br />
will die Systematik höheren Ansprüchen genügen . Das Gelehrtenpantheon<br />
des Deutschen Museums teilt damit auf der Ebene <strong>von</strong> Repräsentation<br />
und Logistik des Wissens die Probleme, die der Leipziger Deutschen Bücherei<br />
als Aporien des Katalogisierung (und als Streit zwischen wissenschaftlicher<br />
Systematik und anderen Aufstellungsformen) vertraut sind. Exner entscheidet<br />
sich schließlich <strong>für</strong> die Darstellungsform der Pyramide der Wissenschaften, wie<br />
sie vom Vertreter einer Gesamtlehre der Wissenschaften, dem Monisten Wilhelm<br />
Ostwald, als wissensarchäologisches Schichtenmodell <strong>für</strong> die Klassifikation des<br />
Wissens entwickelt worden ist (Stuttgart 1929). Von den Grundwissenschaften<br />
steigt das Modell über Ingenieurswesen, dann Graphik und Elektrotechnik, Photographie<br />
und Kinematik bis hm zu den Wissenschaften des Lebens als solchem,<br />
kulminiert <strong>von</strong> der Soziologie (<strong>für</strong> Ostwald gleichbedeutend mit den Kulturwissenschaften<br />
überhaupt 60 ). Exner wählt dieses Modell <strong>für</strong> Anordnung und<br />
Vorführung der biographischen Monumente im Ehrensaal des Münchner<br />
Museums: nicht Gedächtnis, sondern System.<br />
Österreichs Anteil an der deutschen Kulturgeschichte wird in der Deutschen<br />
Bücherei durch Glasfenster festgehalten; der reale Krieg verzögerte die Ausführung<br />
der Versinnbildlichung dieser Bundesgenossenschaft. So lassen die beiden<br />
großen Statuen der Germania und Austria, die in der Eingangshalle eine<br />
symbolische Aufstellung erhalten sollen, zunächst noch auf sich warten;<br />
»solange der Janustcmpel noch nicht geschlossen ist und die beiden hohen<br />
Gestalten dem Ansturm im Westen und Osten Stand zu halten haben, können<br />
diese Halbgöttinnen die Wächterrolle in der Bücherei in cffigie noch nicht übernehmen«<br />
. In effigie: Die Nation entsteht erst auf der<br />
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Nachlaß / Archiv Wilhelm<br />
Ostwald, Signatur 4829: »Selbstdarstellung Wilhelm Ostwald (1923)«, MS, Bl. 49<br />
(erschienen in: D. Philosophie d. Gegenwart Bd IV Leipzig: Meiner); ebd. Signatur<br />
4964: »Bücherkataloge und die Pyramide der Wissenschaften«, bes.<br />
Bl. 50 (zum Begriff der »Zuordnung«)
812 ' Bdil.IOTHKK<br />
Ebene ihrer Repräsentation, durch Vermittlung <strong>von</strong> buchstäblichen oder hieroglyphischen<br />
Zeichen. Die beiden Wappenadler Österreichs und des Deutschen<br />
Reiches ziehen zudem in der Eingangshalle die Blicke des Betrachters<br />
beim Verlassen des Hauses auf sich. Die nationale Ausrichtung des Blicks ist<br />
total, als Lektüre (Bücher) und als Betrachtung (Bilder), um dieses Konservatorium<br />
deutschen Geistes auch zu einer Sehenswürdigkeit <strong>für</strong> die Beschauer<br />
zu machen. Walhallen allerortens im Kampf gegen Napoleon. Das Organ Geist<br />
der Zeit veröffentlichte 1811 eine Aufforderung an alle Schriftsteller des österreichischen<br />
Kaisertums, das Andenken der lebenden und toten Helden akut<br />
zu pflegen: »Eine Gallerie dieser Männer aufzustellen, würde diese Bestimmung<br />
am sichersten erfüllen! Aber diese hat eine zweite Ansicht, die ihr möglichste<br />
Vollständigkeit zur Pflicht macht, da sie auch <strong>für</strong> die Literaturgeschichte<br />
Oesterreichs einigen Werth haben soll.« 61 Dieses damit national doppelt kodierte<br />
geistige Kapital akkumuliert sich als Lexikon; der Freiherr v. Hormayr<br />
hat »in seinem berühmten Nationalwerke, >dem österreichischen Plutarch' die<br />
Interessen aller Völker des österreichischen Kaiserstaates zu einem gemeinsamen<br />
Patriotismus vereinigt.« Das geplante Gelehrtenlexikon soll nun das ganze<br />
österreichische <strong>Im</strong>perium umfassen, wie es im Jahre 1700 bestanden hat. Supplement<br />
und Bedingung <strong>für</strong> serielle Monumente der Literatur und Poesie aber<br />
ist die Prosa der Welt: Es folgen Normen-Vorgaben <strong>für</strong> die Form der Einsendungen<br />
(Name, Geburtsort, Publikationen, Bemerkungen zu Kupferstichen der<br />
Portraitierten). »Noch muß ich um portofreye Einsendung der Briefe bitten«,<br />
schließt Franz Sartori, k. k. Bücher-Revisor in Wien. Gedächtnis- und Übertragungsökonomie<br />
bedingen einander.<br />
Als museale Simulation eines (Be)Reiches, das politisch noch nicht existent<br />
war, stecken die Büsten <strong>von</strong> Personen deutscher Zunge, die in der Regensburger<br />
Walhalla ihre Heimstatt finden, ein Territorium deutscher Einheit ab, das<br />
zur Zeit der Einweihung des Bauwerks am 18. Oktober 1842 reine Fiktion ist;<br />
hier werden sie zur Funktion einer mnemotechnischen Strategie, d. h. Positionierung.<br />
Die Walhalla ist nicht nur der Ort, der historische Figuren räumlich<br />
zueinander in Beziehung setzt und somit ein Grundmuster <strong>für</strong> museologische<br />
Analyse darstellt 62 , sondern sie ihrerseits bereits positionsbestimmt: Schon der<br />
Platz des Bauwerks über der Donau unweit der Ruine einer einstigen Residenz<br />
der Karolinger schreibt sie ein in eine historische Topographie. Muscologistik<br />
ist verstrickt in das, was sie zum Thema macht: das Wissen <strong>von</strong> Verortungen.<br />
hl Geist der Zeit. Ein Journal <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong>, Geographie, Statistik, Politik und Kriegskunst,<br />
2. Bd., Brunn (Traßlcr) 1811, Anhang<br />
h2 Siehe Hans Petschar, Kulturgeschichte als Schachspiel: Vom Verhältnis der Historie<br />
mit den Humanwissenschaften. Variationen zu einer historischen Semiologie, Aachen<br />
(Rader) 1986
AKCHÄOI.OGIK I-:INI-:R NATIONAI.BIBI.IOTHKK: DU- DKUTSCHI- BÜCHURKI 813<br />
Bereits in der Konzeption der Walhalla blieb die Frage unentschieden, ob sie<br />
nun als Denkmal oder als Museum gedacht war. Von einer nationalen Weihestätte<br />
im Unterschied zum Begriff Museum, dem bestenfalls eine Art <strong>von</strong> Walhalla-Museum<br />
zur Speicherung der ausgemerzten Bestände (aus der Sicht des<br />
historischen Diskurses) überlebter Porträtbüsten zur Seite gestellt werden<br />
könne, spricht Paul Herre. 63 Die Befreiungshalle im nahegelegenen Kelheim,<br />
nicht minder ein Gedächtnisort der Befreiungskriege, macht diese Grenzziehung<br />
noch verschwommener, indem sie Gedanken des idealen Museums aufgreift,<br />
das in purer Symmetrie aufgeht. Die Architektur der Befreiungshalle geht<br />
<strong>von</strong> jener Bauform aus, die als Grundelement der Genealogie des klassischen<br />
Musentempels eingeschrieben ist: die Rotunde des römischen Pantheons. Daß<br />
Museologie sich nicht allein auf Objekte bezieht, sondern sich ebenfalls auf die<br />
Worte erstreckt, wird anhand <strong>von</strong> Walhalla und Befreiungshallc selbstredend<br />
deutlich. Hier nämlich figurieren neben den Skulpturen die <strong>Namen</strong> selbst als<br />
gleichrangige Ausstellungsobjekte 64 , im Klartext: deutsche Stämme, Feldherren,<br />
Schlachtfelder. In der Walhalla nicht als Monument, sondern als Gedächtnisadministration<br />
aber herrscht ein ständiges Ringen um den, der Aufstellung findet<br />
oder nicht; der museale Ort ist Schauplatz kontrollierter Erinnerungspolitik,<br />
<strong>von</strong> Memorialstrategien und der Gewalt des <strong>Im</strong>aginären. Karl Friedrich Schinkels<br />
unreahsierter Plan <strong>für</strong> einen Freiheitsdom in Berlin zur Kommemoration<br />
der Kriegsereignisse <strong>von</strong> 1813 sieht eine Krypta zur Bewahrung der Asche gefallener<br />
Kriegshelden als Währung des Gedächtnisses vor, sowie eine Walhalla aus<br />
entsprechenden Büsten im Interieur darüber, zur Repräsentation der deutschen<br />
Geisteskultur. Während das Monument nach außen repräsentativ wirkt, wirkt<br />
das, was im inneren Dom seinen Platz findet, tatsächlich »unmittelbar mehr aufs<br />
Innere.« 65 Diskursive, literarische Formen der Monumentahsierung kontextualisieren<br />
das materiale Monument. Das Krypta-mit-Tempel-Konzept entbirgt die<br />
autoritative Korrespondenz <strong>von</strong> Buchstaben und Knochen in der Idee einer<br />
Walhalla, die sich aus halla (Platz, Raum, Himmel / templum) und wal (Leichnam,<br />
Tod) ableitet . Das Metaphysische der Nation, ihr fortwährendes<br />
Gedächtnis, basiert hier auf der Zeit des Physischen (Verwesen).<br />
Gedächtnistechniken im Dienste nationaler Einigung bedürfen der Standardisierung.<br />
Standardisierung ist tatsächlich die essentielle Botschaft der Gestal-<br />
63 Paul Herrc, Deutsche Walhall. Finc Auseinandersetzung und ein Programm zu einem<br />
Ehrenmal des Deutschen Volkes, Potsdam 1930, 8 u. 98<br />
M Siehe Landbauamt Regensburg (Hg.), Walhalla. Amtlicher Führer, Regensburg (Bosse)<br />
1992, u. Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser (Hg.), Befreiungshallc in Kelheim.<br />
Amtlicher Führer, bearb. v. Manfred F. Fischer, München (Neue Presse) 1991<br />
65 Zitiert nach: Alfred Freiherr <strong>von</strong> Wolzogen, Aus Schinkels Nachlaß: Reisetagebücher,<br />
Briefe und Aphorismen 3, Berlin 1862/63, 193
814 BIBLIOTHEK<br />
tung des erneut die Walhalla evozierenden Basreliefs auf der Innenseite der<br />
Kuppel des Leipziger Völkerschlachtdenkmals. Was hier als endlose Reihe<br />
gleichförmiger Reiter in Waffen archaisch ausschaut, wie eine metahistorische<br />
Referenz auf eine prähistorische germanische Vergangenheit (im Kontrast zum<br />
medievahsierenden Historismus im Schmuck des Kyffhäuserdenkmals bei<br />
Nordhausen), ist die präzise Reflektion einer Modernisierung der ästhetischen<br />
(und Kriegs-)Wahrnehmung als Parallelismus der Form (Ferdinand Kodier). 66<br />
Während die Regcnsburger Walhalla das Dokument eines international goutierten<br />
neoklassizistischen Architekturalstils ist, der die nationalen Begrenzungen<br />
seiner jeweiligen Bedeutungen durch den Rahmen selbst dementiert, wird nicht<br />
nur die Deutsche Bücherei, sondern auch das räumlich und konzeptionell mit<br />
ihr korrespondierende Völkerschlachtdenkmal im französischen Journal UIllustration<br />
mit der mythischen Kriegs(toten)halle verglichen: »C'est du moins une<br />
volonte nette, de creer un style germanique, depouille de tout apport etranger,<br />
de toute reminiscence du passe greco-latin, un style digne des dieux farouches<br />
de la Walhalla.« 1 '' 7 Wie die Nationalbibliothck bedarf auch das Medium Museum<br />
einer sakralen Stiftung <strong>von</strong> Mehrwert im <strong>Im</strong>aginären der Walhalla, um sich in<br />
Differenz zu reinen Speichern als lokal, regional oder national identitätsstiftend<br />
auszuweisen:<br />
»Wenn wir damit <strong>von</strong> den Fragen der archäologischen Gruppierung Abschied<br />
nehmen, so erübrigt uns nur noch darauf hinzuweisen, daß außerdem in jedem<br />
historischen Museum noch eine besondere geschlossene Gruppe sich finden wird,<br />
in der die Darstellung <strong>von</strong> Begebenheiten der örtlichen <strong>Geschichte</strong>, die zugehörigen<br />
Erinnerungsstücke, sowie auch die Bildnisse lokalhistorisch wichtiger Persönlichkeiten<br />
und die Abbildungen heimatlicher Örtlichkeiten vereinigt sind. Auf<br />
eine solche vaterländische Gcdächtnishallc kann kein historisches Museum verzichten.«<br />
68<br />
Nicht die auf diskursive Schnittstellen angewiesenen Gedächtnisagenturen Bibliothek<br />
und Museum, allein das im Raum des Non-Diskursiven operierende<br />
Archivwesen, jenes arcanum impern, entzieht sich diesem Zwang zur Begründung<br />
in der mythischen Erzählung <strong>von</strong> Nation.<br />
Ml<br />
Siehe Peter Iluttcr, »Die feinste Barbarei«. Das Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig,<br />
Mainz 1990, 133 u. 153<br />
( 7<br />
' Zitiert <strong>von</strong> Mutter 1990: 186, nach: Deutsche Bauzeitung 102, 20. Dezember 1913, 945<br />
r s<br />
' Otto Lauffer, Das 1 listonsche Museum. Sem Wesen und Wirken und sein Unterschied<br />
<strong>von</strong> den Kunst- und Kunstgewerbe-Museen, in: Museumskunde. Zeitschrift <strong>für</strong> Verwaltung<br />
und Technik öffentlicher und privater Sammlungen, Bd. 111, Heft 3 (Berlin<br />
1907), Kapitel VI: Die Anordnung historisch-archäologischer Sammlungen, 235
ARCHÄOI.OGII-: I;INI-:K NATIONAI.BIBI.IOTHKK: DU. DHUTSCHI-; BÜCHKRHI 815<br />
Satzung, Pragmatik und Katalogisierung der Deutschen Bücherei<br />
Die Satzung der Deutschen Bücherei setzt eine Differenz zu den Drucksachen,<br />
die sie sammelt. Der aktuelle Stand der Medien schreibt an der Verfassung der<br />
Nationalbücherei mit; ihre Satzung sagt es in & 9, Ziffer 3 Grundsätze <strong>für</strong> die<br />
Sammlung amtlicher Drucksachen. Auszunehmen sind demnach zunächst<br />
grundsätzlich »Schriftstücke, die direkt <strong>von</strong> Handschrift oder Maschinenschrift<br />
(durch autographischen oder metallographischen Umdruck, mittels des Mimeographcn,<br />
des Roneo-Vcrfahrcns usw.) vervielfältigt sind« — es sei denn, sie seien<br />
<strong>von</strong> so erheblicher Wichtigkeit, um als Sammelobjekte in Betracht kommen<br />
. So bricht die Suprematie des kulturhistorischen Diskurses das<br />
Primat der Speicherökonomie. Ausgenommen bleiben ferner Formulare aller<br />
Art <strong>für</strong> den dienstlichen Gebrauch der Beamten wie <strong>für</strong> den Gebrauch des<br />
Publikums, behördliche Schriftstücke und Zirkularverfügungen, »bei denen der<br />
Buchdruck lediglich an Stelle der sonst im Geschäftsverkehr üblichen Schrift«<br />
getreten ist. Selbstverständlich sind »geheimzuhaltende Drucksachen in der<br />
Deutschen Bücherei zu sekretieren und <strong>von</strong> der Benutzung auszuschließen«<br />
. Es folgt eine Detaillierung der Speichertechnik als Papiermaschine; im<br />
Zusammenhang mit der diskutierten Titelaufnahme des Deutschen Gesamtkatalogs<br />
ist die Rede <strong>von</strong> einer »gut arbeitende Maschine, die an einem Tage<br />
ein bestimmtes Quantum Waren produzieren soll« . Das Inventar<br />
dient dem Besitzverzeichnis der Eingänge, als Rechnungsnachweis <strong>für</strong> angekaufte<br />
Werke und als Standortsverzeichnis <strong>für</strong> die Aufstellung der Bücher. Das<br />
Zugangsbuch, bestehend aus Folioblättern, rechnet Literatur:<br />
»Die Blätter sind mit Linien versehen und senkrecht in folgende Spalten geschieden:<br />
1. Laufende Nummer. 2. Tag des Eingangs. 3. Titel und Teilnahme der Werke.<br />
4. Hcrkunftstelle (Lieferamt). 5. Zahl der bibliographischen Bände. 9. Fachbezeichnung.<br />
Die Numerierung der Zugänge wird nach obigen Abteilungen<br />
und Größen getrennt und schließt jahrweise ab, so daß die Zittern nicht ms Ungemessene<br />
wachsen. Für die Abteilung >Bücher< bestimmt diese Zugangsnummer<br />
zugleich den Standort des Buches, gilt also als Signatur. Die Größen bezeichnet<br />
man zweckmäßig mit Buchstaben (A = 12° bis 18 cm, ), so daß die Signatur<br />
eines Buches folgende Form hat, z. B. 1913 C 513, d. h. Nr. 513 des Jahrgangs 1913,<br />
Quartreihe.« <br />
Somit erstellt sich der Zeitraum des Bibliothekspeichers über alphanumerische<br />
Adressen; den Büchern werden Daten eingeschrieben. Als Ergänzung zum<br />
Zugangsbuch wird <strong>für</strong> alle Fortsetzungen <strong>von</strong> Büchern, Serien und Zeitschriften<br />
»eine Liste in Zettelform (Kartonblätter <strong>von</strong> Quartgröße), alphabetisch<br />
geordnet«, angelegt . <strong>Im</strong> Unterschied zu Publikationen ist deren Verwaltung<br />
auf Modularität angelegt; die aufgeklärten Visionen einer Enzyklopädie<br />
des Wissens verzetteln sich. Auf dem Berliner Bibliothekartag 1906 plädiert
816 BIBUO'I • 111 •; K<br />
der Direktor der Leipziger Universitätsbibliothek Boysen in diesem Sinne<br />
da<strong>für</strong>, auch den geplanten Deutschen Gesamtkatalog nach Fertigstellung des<br />
Manuskripts »in Buchform auf zweiseitig und zugleich auf einseitig bedruckten,<br />
zum Zerschneiden brauchbaren Bogen zu drucken« - das vom Einband<br />
zusammengezwungene Medium der Bibliothek lost sich im Zuge ihrer Selbstorganisation<br />
in diskrete Module auf .<br />
Der Alphabetische Hauptkatalog weist über nationale Formate hinaus und<br />
wird als Zettelkatalog mit Karten im Weltformat <strong>von</strong> 7x12 cm angelegt. Zur<br />
Aufstellung »empfehlen sich Schränke mit Zettelkästen oder vielleicht noch<br />
mehr Gießener Kapseln <strong>von</strong> großer Lange zwecks Ausnutzung des Wandraums«<br />
; die räumliche Verfaßtheit dieses deutschen Gedächtnisses erzwingt eine<br />
ihr entsprechende Wissensökonomie. Die innere Anordnung des Katalogs folgt<br />
den Regeln der Preußischen Instruktionen. Die Satzung der Deutschen Bücherei<br />
definiert die Anlage eines Katalogs mit wissenschaftlicher Einteilung, supplementiert<br />
durch einen Schlagwortindex. Als Form des Katalogs figuriert erneut<br />
der Zettelkatalog, mit Leitkarten <strong>für</strong> die einzelnen Abschnitte. Bei wachsendem<br />
Umfang der Bestände gewährt er nicht genügend Übersicht und transformiert<br />
zweckmäßig in einen differenten Aggregatzustand, den Blattkatalog in Bandform.<br />
Sonderkataloge dienen der Erfassung jener Gattungen literarischer<br />
Erzeugnisse, die sich ihrem Titel nach nicht <strong>für</strong> die alphabetische Kataloge eigenen<br />
- Gedächtnis einer anderen Medienordnung, als Adresse noch zu bestimmen<br />
69 (Landkarten, Universitäts- und Schulschriften). Punkt VII der Statuten<br />
schließlich definiert die Schnittstelle zur Öffentlichkeit: Alphabetische Kataloge<br />
zum Gebrauch des Publikums in Zweitanfertigung, »schon um <strong>von</strong> diesem die<br />
Anführung der Signatur auf den Bestellzetteln verlangen zu können« .<br />
Ein zweiter systematischer Katalog <strong>für</strong> das Publikums ist vorderhand, also als<br />
Interface zum Diskurs, nicht erforderlich, da der <strong>für</strong> das interne Betriebssystem<br />
vorgesehene systematische Katalog mitbenutzt werden darf. Das Betriebssystem<br />
des Speichers macht sich an dieser Stelle transparent gegenüber dem Diskurs.<br />
Eine Ortsbegehung des deutschen Gedächtnisses<br />
Der Betrachter vor dem nationalen Monument der Deutschen Bücherei ist zunächst<br />
ratlos. Die Mauern des deutschen Gedächtnisses schweigen. Zur Rede<br />
bringt sie der Diskurs des Nationalen, der sie zur Allegone der Autorität des<br />
Kulturstaates schlechthin macht, jene unfaßliche Autorschaft aller dort aufge-<br />
69 Siehe Jacques Derrida, A titrier / Titel (noch zu bestimmen), in: Friedrich A. Kittler<br />
(Hg.), Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften. Programme des Poststrukturalismus,<br />
Paderborn/Münchcn/Bcrlin/Wien (Schöningh) 1978
ARCHÄOI.OGIH I-:INJ-:R NATIONAI.HLBI.IOTHKK: DU-: DHUTSCHI; BÜCHKRHI 817<br />
speicherten Texte. Wer das Gebäude betritt, der tut dies unter dem Blick dreier<br />
Büsten: Bismarck (schweigend wie der Bismarck-Turm <strong>von</strong> Leipzig-Lützschena,<br />
ein vergessener Signifikant, without bones), Gutenberg, Goethe. Die Monumentalisierung<br />
des nationalen Gedächtnisses (Gedenkens) und seine Medien<br />
werden hier zur Prosopopöie, 70 ist hier doch dem Buchstabenspeicher des nationalen<br />
Gedächtnisses Maske, Gesicht, Figur verliehen, persona einer Schrift, die<br />
grammophon halluziniert wird. Angenommen, die Prosopopöie sei die Trope<br />
des nationalen Gedächtnisses, dann liest sich die Büste Bismarcks selbstredend.<br />
Zur Statue erstarrt, ist sie die Allegorie jener Texte, die in der Bibliothek das<br />
deutsche Gedächtnis bilden. Wenn die Funktionalität eines Bücherspeichers ins<br />
Symbolische transformiert, gilt »das verbreitete Vorurteil, ein Nutzbau sei häßlich,<br />
nicht mehr« . Die Form der Deutschen Bücherei weist<br />
ihre Funktion aus, geht aber nicht völlig in dieser Bedeutung auf; supplementäre<br />
Elemente sind mit am Werk, in denen sich die nationale <strong>Im</strong>plikation verrät. Ihre<br />
figurative Ausstattung ist nicht schlicht Ornamentierung, sondern weist auf diese<br />
<strong>Im</strong>plikation hin. Mit der ausgezeichneten Belichtung der Räume im Innern korreliert<br />
das Gemälde einer Fackelträgerin (Lünette im Wandelgang), und neben<br />
anderen Sinnbildern figurieren in weiblicher Form »Schreiben, Lesen, Bilder<br />
malen und Bilder betrachten« (schon Piatons Sokrates analogisiert Lektüre und<br />
Bilderstudium) 71 . Die allegorische Selbstreferenz der Bibhothekspraxis ist an die<br />
der Nation gekoppelt; in dem sich der Eingangshalle anschließenden Gang sind<br />
der deutsche Reichsadler und der österreichische Doppeladler als farbiges Mosaik<br />
eingelassen, dessen notorische Inschrift aus Schillers Wilhelm Teil (»Wir<br />
wollen sein ein einzig Volk <strong>von</strong> Brüdern ...«) erst die deutsche Nachkriegsgeschichte<br />
unlesbar macht (um dann nach 1989 wieder, buchstäblich wissensarchäologisch,<br />
<strong>von</strong> ihrer Übertünchung freigelegt zu werden). Am Zugang zum<br />
großen Lesesaal prangten Marmorhochbilder des deutschen Kaisers und des<br />
sächsischen Königs; im Lesesaal deutsche Städtewappen, in den Glasfenstern der<br />
Wandelgänge unter anderem Darstellungen der ältesten deutschen Universitäten<br />
in Wien und Prag. Die nationale Vernetzung findet hier auf allen Ebenen als ikonographische<br />
Landkarte statt.<br />
Während das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg das nationale<br />
Gedächtnis auf der Ebene der materiellen Kultur zu monopolisieren trachtet,<br />
dient die Leipziger Deutsche Bücherei demselben Zweck buchstäblich, als Kollektivsingular<br />
jenes Nationalbuches, <strong>von</strong> dem Hegels Zeitgenosse Niethammer<br />
70 Siehe Bettine Menke, Rhetorik und Refcrentialität bei de Man und Benjamin, in: Sigrid<br />
Weigel (Hg.), Flaschenpost und Postkarte: Korrespondenzen zwischen Kritischer<br />
Theorie und Poststrukturalismus, Köln / Weimar / Wien (Böhlau) 1995, 49-70<br />
71 Alfred Langer, Künstlerischer Schmuck und vollendete Zweckmäßigkeit: Architektur<br />
und künstlerischer Schmuck der Deutschen Bücherei, Leipzig (Deutsche Bücherei) 1986
818 BllSI.IQTHKk<br />
zur Zeit der Leipziger Völkerschlacht auf der Ebene des Geistes träumt, als monumentales<br />
Editionsprojekt deutscher Klassiker, so wie die Monumenta Germaniae<br />
Histonca Deutschlands Geschichtsquellen bereitstellen. 72 Monumental<br />
ist auch die Deutsche Bücherei, die solcher Visionen im Schatten des Völkerschlachtdenkmals<br />
eingedenk ist. Der blinde Fleck eines Diskurses jedoch, der das<br />
Buch zum Medium des engineering nationaler Zeiträume wählt und mit dem<br />
Nationalbuch säkularisiert, was die Bibel <strong>für</strong> Juden- und Christentum bedeutet,<br />
ist Krieg. Die reine Aussage der topographischen Nähe <strong>von</strong> Deutscher Bücherei<br />
und Völkerschlachtdenkmal mahnt, daß es eines Kriegs bedurfte, um Bevölkerung<br />
in Volk zu transformieren. Die sehr konkrete Nähe zweier Gedächtnisorte<br />
(einmal im Symbolischen der Buchstaben, einmal im <strong>Im</strong>aginären des Denkmals<br />
operierend) an der Straßenachse namens 18. Oktober sagt es, metonymisch.<br />
Ein Plädoyer <strong>für</strong> die Finanzierung des Unternehmens Deutscher Gesamtkatalog<br />
<strong>von</strong> Seiten des Deutschen Reichs vergleicht die Operation ausdrücklich<br />
mit Kriegsführung; der Bedarf an Geld koppelt bibliothekarische Wissensökonomie<br />
an die Zirkulation analoger Zeichen (Papiergeld) - »kaufmännische<br />
Grundsätze« . Beide Subsysteme der Gesellschaft, Wissensorganiation<br />
und Betriebswirtschaft, finden ihre Teilhabe an einem gemeinsamen Dispositiv:<br />
der Lagerhaltung, Speicherverwaltung, dem Warentransfer (auf der Ebene<br />
der Kanäle) und -tausch (auf der Ebene des Kodes, der Nachricht respektive<br />
Information). Fick verweist <strong>für</strong> die Konzeption des Deutschen Gesamtkatalogs<br />
auf Walther Rathenaus Reflexionen (Leipzig 1908), daß auch die innere Verwaltung<br />
<strong>von</strong> Unternehmungen »insofern Massenwirkung ist, als ähnliche Einzelvorgänge<br />
und Erscheinungen sich täglich und ständig wiederholen«, so daß<br />
»minimale Defekte in der Leitung oder Organisation sich zu bedeutenden Wirkungen<br />
summieren können« 73 . Ein Vers aus Goethes Faust über dem Direktorenzimmer<br />
der Deutschen Bücherei signalisiert den Zusammenhang <strong>von</strong> Kapital,<br />
Lagerzeit und Wissen; eine Nationalbücherei ist kein Zeit-, sondern eine Raumspeicher:<br />
»Gebrauch der Zeit, sie eilt gar schnell <strong>von</strong> hinnen, doch Ordnung läßt<br />
dich Zeit gewinnen!« Womit bibliothekarische Klassifikationstechniken Abkürzungen<br />
<strong>von</strong> Zeit in Signaturen sind. Gedächtnis als Gestell: Die Infrastrukur <strong>von</strong><br />
Gedächtnistempeln (sacred Space) heißt Geheimnis und Sonderung (secret Space),<br />
das Wissen aller Memonalmachtagenturen. Die Hardware der Deutschen Bücherei<br />
sind ihr Magazin und das Bücherleitsystem: Unfehlbar ist das deutsche Gc-<br />
72 Dazu Aleida Assmann, Arbeit am national Gedächtnis. Eine kurze <strong>Geschichte</strong> der<br />
deutschen Bildungsidec, Frankfurt/M. u. a. (Campus) 1993<br />
73 Zitiert nach: Fick 1932: 12. Vgl. Bernhard Vief, Digitales Geld, in: Florian Rotzer<br />
(Hg.), Digitaler Schein. Ästhetik der elektronischen Medien, Frankfurt7M. (Suhrkamp)<br />
1991, 117- 146 (144, Anm. 26), unter Bezug auf Marshall McLuhan , Die magischen<br />
Kanäle {Under Standing Media), Düsseldorf u. a. (Econ) 1970, 99
ARGHÄOI.OGIH I:INI:R NATIONALBIBUOTHHK: DU-. DI-.UTSGIÜ. BÜGIH:RI-:I 819<br />
dächtnis als Technik (und - Hegels Differenzierung folgend - damit noch keine<br />
Erinnerung). Der 1992 installierte elektronische Büchertransport, der auch in die<br />
Vertikale geht, erreicht indes nicht die Perfektion <strong>von</strong> Versandhäusern, deren<br />
computergesteuerte Transportlogistik bis unmittelbar in die Magazinregale reicht.<br />
Strategie spätkapitalistischer Depots ist es, den Lagerbestand (also totes Kapital)<br />
auf ein Minimum zu reduzieren und die Warenproduktion auf den unmittelbaren<br />
Bedarf virtuell in Echtzeit abzustimmen. Die Minimierung des Lagers (storage<br />
hieß in der Von-Neumann'schen Maschine das, was der Computer heute<br />
memory nennt 74 ) bedeutet das Verschwinden des Gedächtnisses in der totalen<br />
Mobilisierung seiner Ressourcen. Dann gibt es nicht einmal mehr Gedächtnis,<br />
nur noch Logistik und Kybernetik. Diese Überführung <strong>von</strong> (Bücher-) Gedächtnis<br />
in die Zirkulation einer monetären Ökonomie (Währung als das, was bleibt)<br />
hat Goethe in der Göttinger Bibliothek antizipiert: »Man fühlt sich wie in der<br />
Gegenwart eines Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet«. 7 -" 5<br />
Schillers Motto<br />
Der Bau der Deutschen Bücherei (ab 1913) korrespondiert in seinen Sichtachsen<br />
mit dem Völkerschlachtdenkmal, dem Monument der Massenschlacht <strong>von</strong><br />
1813. Zwischen realen Knochen gefallener Soldaten und den symbolischen<br />
Buchstabenkörpern halluziniert sich die Vision <strong>von</strong> Signifikantengräbern, die<br />
einer eschatologischen Wiederbelebung harren. Reanimation ist Wiederlesung -<br />
auch ein Syndrom der Kulturwissenschaft, wie uns Karl Lamprecht, der Kurator<br />
der Halle der Kultur auf der internationalen Leipziger Messe <strong>für</strong> Graphik<br />
und Buchkunst (Bugra) 1914 lehrt: »Der Historiker muß der Vergangenheit<br />
Gegenwart einhauchen können, gleich Ezechiel dem Propheten: Er schreitet<br />
durch ein Gefilde voller Totengebeine, aber hinter ihm rauscht erwachendes<br />
Leben.« 76 Dem Golem Deutsche Bücherei in Leipzig ist an seiner Stirnseite die<br />
abendländische Verquickung <strong>von</strong> Phono- und Logozentrismus als Wendung und<br />
Revision in güldenen Lettern eingeschrieben (Jacques Derridas Grammatologie<br />
zum Trotz): »Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken.<br />
Durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt.« 77 Ein Jahrhundert<br />
74<br />
Eine informatikgenealogische Erinnerung <strong>von</strong> Wolfgang Coy (Humboldt-Universität<br />
Berlin)<br />
75<br />
J. W. v. Goethe, Tag- und Jahres liehe 1801: Artemis-Gedenkausgabe def Wecke, Briefe<br />
u. Gespräche, Zürich / Stuttgart 1948ff, Bd. 11, 682<br />
76<br />
Karl Lamprecht, Parahpomena der deutschen <strong>Geschichte</strong>, Wien 1910, 4<br />
77<br />
Die Vergessenheit dieses Sinnspruchs am (H)Ort der Gedanken selbst ist vielsagend. Er<br />
stammt <strong>von</strong> Friedrich Schiller, Gedichte: Der Spaziergang (1795, unter dem Titel »Elegie«<br />
in den Hören zuerst erschienen). Dazu Friedrich Meinecke, Schillers »Spaziergang«,
820 BlBI.IOTHHK<br />
zuvor hat Friedrich Ludwig Jahn die Sprache des deutschen Volkes als Schatz<br />
(also Speicher) definiert, in dem (etymologisch naheliegend) die »Urkunde seiner<br />
Bildungsgeschichte niedergelegt« ist; in jeder metaphysischen Ideologie ist das<br />
Wissen <strong>von</strong> Aufschreibesystemen immer schon mit am Werk. 78 An anderer Stelle<br />
heißt es (respektive der Notwendigkeit <strong>von</strong> Volksfesten) nicht minder schnft-,<br />
ecriture- und graphikbewußt: »Das Übersinnliche wird uns doch nur durch Bilder,<br />
Gedanken- und Wortbilder , wo ein Sinnbild als Schattenriß höhere<br />
Ahnungen gewährt« . Substanzlose Ideen erhalten durch die Medien<br />
ihrer Aufzeichnung erst einen Körper, werden (hier) zum Textkorpus der<br />
Nation, ganz wie Schillers Zeitgenosse Adam Müller 1812 die Buchdruckerkunst<br />
als zeiträumliches Übertragungsmedium der Beredsamkeit definiert, wobei er<br />
zugestehen muß, daß sich »die eigentliche Wirkung nach Maßgabe der Entfernung,<br />
wie die Wellenkreise im ruhigen Strome, welche das Schiff zieht, nach und<br />
nach in weiterer Entfernung schwächer und schwächer werden, verhält«. 79 Die<br />
Metaphorik dieser Aussage hält die elektronische Option offen, als Schrift<br />
begriffen, doch die Sprache der Elektrik verläuft weder über die Stimme noch<br />
über die Schrift. »Gleichermaßen auf beide verzichtet die Informatik.« 80 Und<br />
ganz im Sinne des Mottos der Deutschen Bücherei: »Die Schrift impliziert einen<br />
allgemeinen Sprachgebrauch, der dadurch sich auszeichnet, daß sich der Graphismus<br />
an der Stimme ausrichtet, sie aber gleichzeitig übercodiert und eine als<br />
Signifikant funktionierende fiktive Stimme der Höhen einführt« .<br />
Dort auch der Verweis auf mediales Verstehen: »Der Inhalt der Schrift ist Sprache,<br />
genauso wie das geschriebene Wort Inhalt des Buchdrucks ist und der<br />
Druck wieder Inhalt des Telegrafen ist.«' sl Friedrich Schiller selbst klagt über eine<br />
gewisse Flüchtigkeit, oder vielmehr über ein gewisses Verfliegen des Gedankens<br />
in der Sprache. Müller zitiert diesen größten Redner der Nation, der Dichtung<br />
als Medium nur wählte, »weil er gehört werden wollte« :<br />
»Spricht die Seele«, sagt Schiller, >so spricht, ach schon die Seele nicht mehr.
ARCHÄOI.OGH-: KINHR NATIONAI.BIBI.IOTHHK: DU-, DKUTSCHI-: BÜCHI-.RHI 821<br />
Für Frankreich sieht das anders aus: »In welchem bequemen, schwebenden Verhältnis<br />
steht dagegen der Franzose zu seiner Sprache: Spricht die Seele - so hat<br />
sie auch genau im Worte Platz« ; in Frankreich also ist<br />
das Reale an seinem Ort. Sprache definiert Müller als göttliches Siegel, durch das<br />
Gedanken erst veredelt (und archivierbar) werden: ein medialer Kanal, der die<br />
Botschaft determiniert. Das unbequeme Verhältnis des Deutschen zur Sprache<br />
(so schon G. E. Lessmgs Bezeichnung des Verhältnisses <strong>von</strong> ästhetischen Zeichen<br />
und der ihr unterstellten Bedeutung im Traktat Laokoon) ist dabei steuerungswissenschaftlich<br />
kanalisiert: »So regiert der deutsche Gelehrte auf dem<br />
Papier den Staat.« Einmal als artifizielles Medium, als Suprematie <strong>von</strong> Signifikanten<br />
eingespielt, wird sprachliche Rhetorik nicht mehr semiotisch, sondern<br />
nachnchtentechmsch, mithin also nicht mehr hermeneutisch, sondern kryptologisch<br />
beschreibbar:<br />
»In dem einen Augenblick hantieren wir mit der Sprache despotisch und eigenmächtig,<br />
als wenn sie ein erfundenes Wesen, eine Art <strong>von</strong> Chiffre oder Signal wäre,<br />
das man willkürlich verändert, wenn der Schlüssel in Feindes Hände gefallen ist; ist<br />
dem anderen Augenblick hantiert da<strong>für</strong> die Sprache mit uns, verwandelt wider<br />
unsern Willen die Gedanken unter unsern Händen, zähmt sie, bändigt sie.« <br />
Hier schreibt sich die Sensibilität der Napoleonischen Epoche <strong>für</strong> Kodes, zivile<br />
und militärische, kommunikative und technische. Die Analyse muß also ihren<br />
Ausgangycwez/s an Kriegsaktionen nehmen, »an denen sich neue Niveaus der Verflechtung<br />
<strong>von</strong> (Tele)kommunikationstechmkcn und Kriegführung in prägnanter<br />
Form zeigen«. 83 Schillers Vers an der Front der Deutschen Bücherei koppelt<br />
Schrift an das Medium des Buchdrucks (dessen Speicher die Institution darstellt,<br />
im Unterschied zum Urkunden-, akten- und manuskriptzentrierten Archiv). Zum<br />
Zeitpunkt der Fixierung dieser Lettern in Leipzig liest sich eine hundert Jahre<br />
zuvor, zur Zeit der Leipziger Völkerschlacht ausgesprochene Prognose wie die<br />
Vorwegnahme des den (an das Dispositiv der Post gekoppelten) Buchdruck überflügelnden<br />
Mediums Radio - Restitution der Rede nicht als logozentristische<br />
Metaphysik der Präsenz, sondern als Funktion einer Übertragungstechnik:<br />
»Es wird bald dahin gekommen sein, daß wir mit allen Flügeln der Buchdruckerkunst<br />
nicht weiter reichen, als mit der gewöhnlichen Stimme und mit aller Vervielfältigung<br />
unsrer Geistesprodukte nicht weiter reichen als mit einem gewöhnlichen<br />
Brief. und der vermeintlich so mächtige Hebel der Geister, die BuplldnJekerkunst,<br />
tritt zuletzt in die Reihe der gewöhnlichen Kopiermaschinen zurück.«* 4<br />
83 Stefan Kaufmann, Kommunikationstechnik und Kriegsführung 1815-1945: Stufen<br />
medialer Rüstung, München (Fink) 1996, Einleitung (10)<br />
X4 Müller 1812/1967: 157 (Rede IX. Von der neueren Schriftstellerei der Deutschen)
822 BIBLIOTHEK.<br />
Vorerst aber lautet das Übertragungsmedium der Stimme, schneller als aller Buchdruck<br />
körperloser Gedanken, Gerücht - akzeleriert durch den Ausnahmezustand<br />
eines Europakrieges. Solche Gedanken »fliegen schon <strong>von</strong> selbst umher auf allen<br />
Gassen, man braucht nur zu atmen, um sie zu haben; noch heut können<br />
Millionen Geister <strong>von</strong> dem rechten Feldherrn, wenn er kommt, wie mit einem<br />
Schlage ihr Losungswort erhalten« . Müller will nur noch gedruckt<br />
sehen, was schon gesprochen wurde - Druckerkunst »als eine dienende Beihülfe<br />
<strong>für</strong> die eigentliche rednerische Tat«, als Distributionsmedium . Dabei<br />
macht es einen Unterschied, ob der Leser »Lettern in seine Seele hineindrücken<br />
läßt, und sich leidend verhält«, oder bei der Lektüre anderer Schriften »dieselbige<br />
Seele zwischen den Zeilen spielen und einfügen läßt, was ihr beifällt«. Dem Buchdruck<br />
setzt Müller in agonalem Anachronismus zur Restitution der alten Würde<br />
des geschriebenen Wortes das Manuskript entgegen, wie es in Bibliotheken vergraben<br />
hegt und der wissensarchäologischen Entdeckung harrt (wie<br />
es das Quelleneditionsunternehmen der Monumenta Germaniae Historica fast<br />
zeitgleich in Angriff nehmen wird): »So sicher als die Werke des Homer oder des<br />
Piaton wandeln sie durch die Stürme der Jahrhunderte hindurch« .<br />
Ganz anders als Plato (in seinem Dialog Phaidon) aber vertraut Müller Handschrift<br />
in ihrem genuin medialen Prozeß und beschreibt sie in Begriffen der Nachrichtenübertragung<br />
(Tradition), <strong>von</strong> Gedächtnis als Adresse (Nachwelt) und <strong>von</strong><br />
Informationsrc'/r/eiW:<br />
»Aus dem Schutte versunkener Städte treten sie zur rechten Zeit ans Licht: an die<br />
Nachwelt gelangt jede ordentliche Adresse, und keinen zuverlässigen Boten an sie<br />
gibt es, als den eigenen Genius eines großen Werkes. Aber auch <strong>für</strong> die Gegenwart<br />
ist das Werk besser besorgt in der Abschrift als im Druck: niemand liest weniger,<br />
als der selbst viel Bücher hat, oder die Zuversicht, daß er jederzeit erreichen kann<br />
was er braucht.« <br />
Müller koppelt die Ökonomie des Geistes an die des Kapitals; im Bunde mit<br />
dem Medium beweglicher Lettern steht die Zirkulation des Geldes: »Die<br />
Excesse in der Anwendung der Schrift, der Buchdruckerkunst und des Metallgeldes<br />
sind zu Ende«; die Losung der Folgezeit wird sein: Rede und Schrift,<br />
Manuskripte. Schluß mit dem »Wunderglaube an die edlen Metalle und an<br />
die Presse« . Dementsprechend medienbewußt definiert auch Müllers<br />
Kronzeuge Schiller die umversalgeschichthche Wissensüberheferung der<br />
Kultur (im Wissen um einkalkulierte Wissenseinbußen), aber ebenso wie Müller<br />
nicht medienarchäologisch, insofern anstelle einer konsequenten Analyse der<br />
Techniken <strong>von</strong> Überlieferung der Weitgeist steht, »im Bunde mit allen empfundenen,<br />
großen, gottähnlichen Dingen« . Ganz nebenbei war<br />
es Hegel, der den Weitgeist nach der preußischen Niederlage in Jena sehr viel<br />
konkreter vorbeireiten sah; Jahre vor dieser Epiphanie, am 27. Mai 1789, hielt
ARCHÄOLOGIE I-:INHR NATIONAI.BIBLIOTHKK: DU- DKUTSCHI: BÜC:IIKRI-:I 823<br />
Schiller seine Jenaer Antrittsvorlesung als Professor <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> unter dem<br />
Titel Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? Analog<br />
zur Kontingenztheone der mittelalterlichen Scholastik ist das, was die Panoptik<br />
des Weltgeists überschauen kann, dem einzelnen Akademiker ein Trümmerhaufen<br />
an Überlieferungen (historische Quellen, Nachrichten der Gegenwart),<br />
da nicht alle Ereignisse zur Aufzeichnung kommen, vor allem aber als Organ<br />
der Tradition Mündlichkeit fungiert. Begebenheiten gehen damit als Mitteilung<br />
<strong>von</strong> Mund zu Mund, »und da sie durch Media gieng , die verändert werden<br />
und verändern«, schreiben Medien mit an Inhalt und Form der Botschaft,<br />
verrauschen sie. 85 1812 weiß der Historiker und Diplomat Barthold Georg Niebuhr<br />
über den antiken^>«£er histonae Herodot zu schreiben, daß kein Quellenstudium<br />
»Licht und Wahrheit gewähren kann, wenn der Leser nicht den<br />
Standpunkt faßt, <strong>von</strong> wo, und die Media kennt, wodurch der Schriftsteller sah,<br />
dessen Berichte er vernimmt.« 86 Die Sage, so Schiller weiter, läßt alle Begebenheiten<br />
vor dem Gehrauche der Schrift <strong>für</strong> die Weh(a.\s)geschichte, die erst im Diskurs<br />
narrativ-hnearer Argumentation überhaupt als Zusammenhang postuliert<br />
werden kann (<strong>Im</strong>manuel Kant), »so gut als verloren« gehen . Tatsächlich<br />
weiß diese Form der Übertragung <strong>von</strong> einer (dem Diskurs der Historie gegenüber)<br />
differenten Gedächtnismedialität. »Nur wenige Trümmer haben sich aus<br />
der Vorwelt in die Zeiten der Buchdruckerkunst gerettet« ; so legitimiert<br />
sich auch der <strong>Im</strong>puls zu vom Steins Editionsprojekt der Monumenta Germaniae<br />
historica nach 1819 aus der Notwendigkeit, ein dauerhaftes, d. h. operables, in<br />
reproduzierbare Texte überführtes Gedächtnisdispositiv, eine typographische<br />
Datenbank <strong>für</strong> künftige Historiographien zu setzen - einen Speicher zu akkumulieren<br />
als »Aggregat <strong>von</strong> Bruchstücken« . Schillers Mißtrauen<br />
erwacht ob solcher Medieneffekte negativer Filterung und wissenschaftlicher<br />
Unwiederbnngbchkeit und der Unzuverlässigkeit menschlicher Berichterstattung<br />
»bey dem ältesten historischen Denkmal, und es verläßt uns nicht einmal<br />
bey einer Chronik des heutigen Tages« ; das Bewußtsein <strong>von</strong> Techniken<br />
der Nachrichtenübertragung macht die Differenz <strong>von</strong> Vergangenheit und<br />
Gegenwart nichtig. »So viele Lücken in der Weltgeschichte entstehen, als es leere<br />
Strecken in der Ueberlieferung giebt« , doch diese Einsicht in Übertragungsverluste<br />
läßt Schiller dennoch blind <strong>für</strong> eine weitergehende Medienanalyse.<br />
Empirische Leerstellen im Archiv des kulturhistorischen Wissens, die<br />
85 Friedrich Schiller, Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?<br />
Reprint (Friedrich-Schiller-Universität Jena, wiss. bearb. v. Volker Wahl, Jenaer Reden<br />
und Schriften 1989) des Erstdrucks der Jenaer akademischen Antrittsrede aus dem<br />
Jahre 1789 (in: Der Teusche Merkur vom Jahre 1789, viertes Vierteljahr, Weimar), 126<br />
86 B. G. Niebuhr, Über die Geographie Herodots (1812), in: Kleine historische und philologische<br />
Schriften. Erste Sammlung, Bonn 1928, 132
824 BißuoniF.K<br />
der wissensarchäologisch diskret operierende Forscher konstatiert, sollen Geschichtsphilosophen<br />
unter Bezug auf teleologische Algorithmen der Weltgeschichte<br />
(»diese Folge <strong>von</strong> Erscheinungen, die in seine Vorstellung soviel<br />
Regelmäßigkeit und Absicht annahm« 87 ) divinieren oder zum System ergänzen<br />
- im abgeleiteten Medium der historischen <strong>Im</strong>agination und qua Analogie . 88 Einmal mit dem Programm einer Geschichtsphilosophie ausgestattet,<br />
durchwandert der Historiker mit diesem teleologischen Prinzip das Archiv noch<br />
einmal, um in seiner Speicheranordnung »die Ordnung der Dinge« selbst<br />
zu (er-)finden; ein 'gedächtnistechnisches Arrangement wird somit zur Information<br />
seiner Daten.<br />
87 Auch Luden definiert Historiographie als das Aufzeichnungssystem des Eigentümlichen<br />
eines Volkes, »wie es sich im Leben desselben, im Ablaufe der Zeit, geoffenbart<br />
hat«: Heinrich Luden, Einige Worte über das Studium der vaterländischen <strong>Geschichte</strong>.<br />
Vier öffentliche Vorlesungen, Jena 1810, 18<br />
88 Siehe Friedrich Kittler, Medien der Universalgeschichte bei Schiller, in: ders., Eine Kulturgeschichte<br />
der Kulturwissenschaft, München (Fink) 2000, 80ff
VKRLAUI-SrORMhN DI-'.R Dl-UTSC! Il-.N BÜCHKRKi 825<br />
Verlaufsformen der Deutschen Bücherei<br />
Jacques Derrida sucht mit seinem Neographismus differance nach einem Ausdruck<br />
der sich selbst schreibenden Differenz <strong>von</strong> gramma und phone. Der<br />
graphische Unterschied zur schlicht feststellenden, lexikalisch definierten difference<br />
manifestiert sich als schriftarchäologisches Monument, buchstäblich<br />
schweigend; er läßt sich ausschließlich schreiben oder lesen - in den Kanälen der<br />
Bibliothek. Durch ein stummes Zeichen macht er sich bemerkbar, wobei Derrida<br />
nicht nur an die Gestalt des Buchstabens denkt, sondern auch an jenen Text<br />
aus der Enzyklopädie <strong>von</strong> Hegel, wo der Körper des Zeichens mit der ägyptischen<br />
Pyramide verglichen wird: »Das a der differance ist also nicht vernehmbar,<br />
es bleibt stumm, verschwiegen und diskret, wie ein Grabmal.« 1 Keine<br />
Prosopopöie. Wird aber ein Buchraum zum Sprechen gebracht, ist die narrative<br />
Figuration unvermeidlich, welche die Struktur des Katalogs bereits verfehlt und<br />
aus archivischen Konfigurationen den Effekt <strong>von</strong> Temporalität (Erzählung)<br />
schlägt. Es dann kann nicht mehr <strong>von</strong> Signaturen und Buchstaben, sondern Geist<br />
die Rede sein. Schillers Motto an der Front der Deutschen Bücherei gibt den<br />
Blick auf die Materialisierung des Gezstospeichers in seinen Medien frei. So setzt<br />
auch die Dauerausstellung Buch und Gesellschaft in dem aus der ehemaligen<br />
buchgewerblichen Sammlung Gustav Klemm hervorgegangenen Deutschen<br />
Buch- und Schnftmuseum der Deutschen Bücherei als Instrument, mit dem das<br />
Buchgedächtnis seit 1950 metafigurativ seinen eigenen Diskurs reflektiert, im<br />
Zuge der Marx'sehen Verkehrung <strong>von</strong> Hegels Idealismus ganz auf den Nachweis<br />
der ökonomischen Bedingungen der Druck- und Lesekultur. Doch die Absage<br />
an die histonstischen Buchallegorien entkoppelte die Gutenberg-Galaxis nur<br />
scheinbar <strong>von</strong> ihrer Verstrickung in den Diskurs des Nationalen. »Der Besitz<br />
einer eigenen Schrift eint und hält ein Volk zusammen«, heißt es in einer<br />
Museumspublikation <strong>von</strong> 1954 (unter ausdrücklichem Verweis auf den Vielvölkerstaat<br />
Sowjetunion). 2 Daß die neuen Medien demgegenüber längst den Diskurs<br />
des Nationalen nicht mehr bündeln, sondern in Dutzenden <strong>von</strong> Kanälen<br />
zerstreuen, macht transparent, woran der sozialistische Staatsapparat auch<br />
scheiterte: an seiner Fixierung auf Schrift als Medium der Vorschriften und der<br />
Kulturspeicherung. 3 Sozialistische Medienerinnerung bleibt auf den medienar-<br />
Jacques Derrida, Die Differance, in: Peter Engelmann (Hg.), Postmoderne und<br />
Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart (Reclam)<br />
1990, 76-112 (77f)<br />
Hans H. Bockwitz, Inhalt, Aufgaben und Ziele des Deutschen Buch- und Schriftmuseums<br />
der Deutschen Bücherei, in: Papier und Druck, Jg. 3, 1954, Nr. W/12<br />
So Klaus Krippendorf, Principles of Information Storage and Retrieval in Society, in:<br />
General Systems Bd. 20 (1975), 15-34
828 BIBI<br />
Private Räume, in die das öffentliche Denkmal nicht reicht, werden so erfaßt<br />
nach dem Modell des Pfingstwunders (Heiliger Geist). Auch so disseminiert sich<br />
sacred Space, sprachlich und als Information. Doch <strong>für</strong> dasselbe Wilhelminische<br />
Kaiserreich gilt, daß die Ignoranz der Reichsinstanzen gegenüber den Erfordernissen<br />
einer gesamtnationalen Bibliotheksentwicklung und eines nationalen<br />
Buchmarktes in immer schrofferen Widerspruch zu den Notwendigkeiten der<br />
wissenschaftlichen, technischen und kulturellen Entwicklung, der Entwicklung<br />
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der bürgerlichen deutschen<br />
Nationalkultur geriet. 12 Am 25. September 1912 definiert eine Bekanntmachung<br />
des Börsenvereins das Ziel einer möglichst lückenlosen National-Bibliothek 13 .<br />
Da die Deutsche Bücherei am 3. Oktober 1912 als Archiv des deutschsprachigen<br />
Schrifttums gegründet wird, ist sie neben ihrer pragmatisch unmittelbaren<br />
Bibliotheksfunktion als Gedächtnis doppelt kodiert. Aus der Archivfunktion<br />
ergibt sich <strong>für</strong> Nationalbibliotheken die Verpflichtung, das nationale Schrifttum<br />
im Original archivahsch, d. h. auf unabsehbare Zeit zu bewahren und medialer<br />
Reproduktion und wechselnden Benutzungsinteressen gegenüber monumental,<br />
d. h. technisch neutral vorzuhalten. Bücher als Hardware kultureller Tradition<br />
»need to be preserved in their original form. Hence microcopying, particularly<br />
of newspapers, cannot be regarded as a justification for the destruetion of the<br />
Originals.« 14 Bücher gehen nicht in der gedruckten Information auf, die sie vermitteln,<br />
sondern haben ein eigenes Wissen als mediale Konfiguration aus Papier,<br />
Druck und Einband haben sie einen intnnsischen Wert (Knoche). Die DB speichert<br />
produktionsorientiert alle <strong>von</strong>einander abweichenden Auflagen desselben<br />
Buches, auch kolorierte Kuxusversionen einer s/w-Ausgabe; wenn mehrere<br />
Auflagen allerdings »nur im Papier oder im Einband <strong>von</strong>einander abweichen,<br />
so genügt es, wenn eine aufgenommen wird.« 15 An dieser Stelle scheidet sich der<br />
buchhändlerische vom kulturwissenschaftlichen Blick, <strong>für</strong> den selbst Exemplare<br />
desselben Buches »eine andere äußere Form und vor allem: eine eigene <strong>Geschichte</strong>«<br />
haben. 16 Nicht nur handschriftliche Marginalien versprechen hier<br />
unerwartete Information, sondern schon die Gebrauchsspuren in ihrer schieren<br />
12 75-Jahr-Feier der Deutschen Bücherei. Ansprache des Ministers <strong>für</strong> Hoch- und Fachschulwesen,<br />
Prof. Dr. h.c. Hans-Joachim Böhme, am 2. Oktober 1987 im Leipziger<br />
Schauspielhaus, in: Jahrbuch der Deutschen Bücherei, Jg. 23 (1987), 12<br />
13 Horst Bunke, Die Deutsche Bücherei im Bild, Leipzig (DB) 1982<br />
14 National Libraries: Their problems and prospects, Paris 1960 (UNESCO Manuals for<br />
Libraries 11), 36, zitiert nach: Rötzsch 1962: 3<br />
lri Grundsätze <strong>für</strong> die Sammlung <strong>von</strong> Büchern, die im Buchhandel erscheinen oder sonst<br />
im Handel sind, in: DB 1915: 75<br />
16 Michael Knoche (Direktor der Hcrzogin-Anna-Arnalia-Bibliothek in Weimar), Das<br />
Ende der alten Bibliothek und ihre Zukunft, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 175 v. 31.<br />
Juli 2002, 16
Vr.iu.Aursi-'OKMKN DI-:R DUUTSCHF.N BÜCHI-RI-.I 829<br />
Physik: weltanaloge Inschriften des Realen, allen symbolisch reproduzierbaren<br />
Lettern vorgängig, und daher eher medienarchäologisch denn sozial-, technik-,<br />
kunst- oder kulturgeschichtlich zugänglich.<br />
Die Definition <strong>von</strong> Deutschland als Sprachraum ist eine Antwort auf das <strong>von</strong><br />
Max Weber in Wirtschaft und Gesellschaft aufgeworfene Dilemma, demzufolge<br />
Nation ein Begriff ist, der »nicht nach empirischen gemeinsamen Qualitäten der<br />
ihr Zugerechneten definiert werden kann.« 17 1941 kommt es zur Ausweitung des<br />
Sammlungsgebiets auf Übersetzungen deutschsprachiger Veröffentlichungen<br />
und auf fremdsprachige Germanica. Deutschland als Buchspracheinheit überlebt<br />
auch die Teilung nach 1945, indem westdeutsche Verlage weiterhin das Leipziger<br />
Haus mit Belegexemplaren versorgen; in Zusammenarbeit mit der<br />
Deutschen Staatsbibliothek in Berlin bedeutete das die arbeitsteilige Wahrnehmung<br />
der Funktionen einer Nationalbibliothek der DDR. 1S Die Deutsche<br />
Bücherei tendiert implizit zur Nationalbibliothek, ausdrücklich aber stellt sie ein<br />
Gesamtarchiv des deutschen Schrifttums dar. Diesen die mediale Differenz <strong>von</strong><br />
Archiv und Bibliothek verwischenden Begriffsgebrauch, den er bei Wolfgang<br />
Proksch findet, kritisiert der Archivkundler Heinrich Otto Meisner: »Wort und<br />
Begriff Archiv sind überall dort nicht am Platze, wo es sich um bloße Sammlungen<br />
handelt, wo das Merkmal des organischen Wachstums fehlt«; anders liege<br />
die Sache beim Begriff Literaturarchiv P Eine rückwärtige Ergänzung der vor<br />
1913 erschienenen Nationalliteratur war nachträglich wünschenswert, da bis zu<br />
diesem Zeitpunkt keine deutsche Nationalbibliothek existierte, sondern vielmehr<br />
ein bibliothekarischer Kollektivkörper. Aus dieser Perspektive repräsentiert die<br />
Gesamtheit der deutschen wissenschaftlichen Universitäts- und Landesbibliotheken<br />
mit ihren Beständen trotz ihrer Unvollständigkeit in dieser Hinsicht die<br />
deutsche Nationalliteratur bis 1913. 20 Der Diskurs des Nationalen ist nicht im<br />
Realen, sondern im Symbolischen (dem Schriftarchiv der Sagbarkeit) verankert.<br />
Kein staatliches, sondern ein Projekt der Volkswagenstiftung gibt dem Plan einer<br />
Nationalbibliothek, die <strong>von</strong> Leipzig lediglich <strong>für</strong> den Zeitraum ab 1912 und <strong>von</strong><br />
17 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der Verstehenden Soziologie<br />
[1921], 4., neu v. Johannes Winckelmann hg. Auflage, Tübingen (Mohr) 1956, 528<br />
18 Jahrbuch der Deutschen Bücherei 23 (1987): 25<br />
19 Heinrich Otto Meisner, Archive, Bibliotheken, Literaturarchive, in: Archivalische<br />
Zeitschrift 50/51 (1955), 167-183 (178f), unter Bezug auf Wolfgang Proksch, Die Deutsche<br />
Bücherei in Leipzig. Ein Wegweiser <strong>für</strong> ihre Benutzer und ein Hilfsmittel zu ihrer<br />
Benutzung, 1935. Siehe auch 11. O. Meisner, Dokumentation und Archive, in: Dokumentation<br />
1, Heft 8 (1954), 149-154, gegen den »übertragenen Sinn« <strong>von</strong> Begriffen wie<br />
Archwabteilung zur Aufnahme sekretierter Bücher (149)<br />
20 Rötzsch 1962: 12. Der flottierende pointer »heute« bedarf des Ersatzes durch definitive<br />
Numerik, um die Zeitebenen der historischen Darstellung auseinanderhalten zu<br />
können.
830 BlBUOTIIFK<br />
Frankfurt/M. ab 1945 geleistet wird (da <strong>für</strong> historische Bestände, also Redundanz<br />
funktional kein Raum war), in Form der Sammlung deutscher Drucke 1450<br />
bis 1912 die historische Dimension, um »einen Ausgleich zu schaffen <strong>für</strong> das<br />
Fehlen einer historisch gewachsenen Nationalbibhothek« - um den Preis allerdings,<br />
daß sich die digitale Verzeichnung der Buchproduktion in ihrer Virtualität<br />
mehr und mehr <strong>von</strong> der Realität des gedruckten Textes löst. 21 . Auch hier<br />
aber heißt die Adresse nicht Architektur einer Bücherei, sondern elektronische<br />
Architextur. Christof Siemes formuliert es als speichermediales Hybrid: ein<br />
dezentrales Nationalarchiv soll hier das Äquivalent zu einer Nationalbibliothek<br />
sein. »Am Ende wird also kein Bauwerk stehen, sondern das Wissen darum, daß<br />
und wo jedes jemals in Deutschland oder im Ausland auf deutsch gedruckte<br />
Werk im Land verfügbar ist - eine Bibliothcque imaginairc.« 22<br />
Jenseits der Materialität <strong>von</strong> Architekturen und Texten erfüllt sich die vollständige<br />
Semiotisierung <strong>von</strong> Materialitäten der Wissenskommunikation qua<br />
Informatik. Systematische Verzeichnung ersetzt den materialen Bestand, der<br />
Index tritt an die Stelle der handgreiflichen Gegenstände (Archivalien, Manuskripte,<br />
Bücher, Musealien). Auch das heißt Dissemination, der Ersatz unverrückbarer<br />
lieux de memoirc durch den Nicht-Ort <strong>von</strong> infrastrukturiertem<br />
Wissen. Seit Kataloge und Bibliographien »nicht mehr ortsgebunden, riesige<br />
Zettelkästen und dickleibige Wälzer sind, sondern elektronische Datenbanken,<br />
sind gewaltige Buchbestände an kleinen Bildschirmen zu sichten« . In<br />
elektronischer Aktualität sind nicht nur Buchobjekte, sondern auch die Kataloge<br />
selbst orts-, d. h. magazinunabhängig geworden (und an ihre alte strukturelle<br />
Stelle im Verborgenen Programme als Differenz getreten). Dann hegt der<br />
Unterschied zum Versuch eines Deutschen Gesamtkatalogs, der <strong>für</strong> ca. 200<br />
Bände bis zum Jahr 2000 projektiert war, mit dem Zweiten Weltkrieg aber selbst<br />
zum Torso wurde 23 und damit ein Projekt mit sich riß, dessen Archäologie bis<br />
auf Goethes 1795er Einsicht zurückreicht, im Herzogtum Weimar das, was an<br />
realen Büchern in zerstreuten Bibliotheken nicht an einem zentralen Ort zusammenzubringen<br />
war, durch »virtuale Vereinigung« im Medium Gesamtkatalog<br />
zu verknüpfen. 24 »Es fällt hier die bis dahin in der Bibliothekssprache nicht<br />
21 Präsentation (Leporello) des Projekts in der Staatsbibliothek Potsdamer Platz, Berlin,<br />
März 1995. Ferner Bernhard Fabian, Der Staat als Sammler des nationalen Schrifttums,<br />
in: ders. (Hg.), Buchhandel - Bibliothek - Nationalbibliothek, Wiesbaden (Harrassowitz)<br />
1997, 21-52 (39 u. 44). Zur Vorgeschichte des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke<br />
siehe Komorowski 1989: 16<br />
— Christof Siemes, Die unendliche Bücherei, in: Die Zeit Nr. 31 v. 29. Juli 1994<br />
'•' Siehe Bernd 1 lagemann, Der deutsche Gesamtkatalog. Vergangenheit und Zukunft<br />
einer Idee, Wiesbaden (Harrassowitz) 1988<br />
24 Goethes Vortrag vor der Weimarer gelehrten Frcitagssozietät unter dem Titel: Über<br />
die verschiedenen Zweige der hiesigen Tätigkeit, zitiert nach: Eugen Paunel, Goethe
VI;RI.AU! : SI ; ORMI:N DI:R DL-;UTSCHI-:N BÜCHI-.RHI 831<br />
übliche Bezeichnung >virtuahterdynamisch< ersetzt« - was man noch besser versteht, wenn diese Dynamik an einen<br />
elektromechanischen Stromkreis angeschlossen ist. Virtual im Sinne <strong>von</strong> Platzhalterschaft<br />
<strong>für</strong> künftige Eintragungen durch weiße Zwischenblätter ist Goethes<br />
konkreter Plan <strong>für</strong> die Form des (Gesamt-)Katalogs vom 23. Mai 1798. 23 Die<br />
virtuelle Zentralisierung der preußischen Bibliotheken durch Bereitstellung <strong>von</strong><br />
Katalogzweitexemplaren in der Königlichen Bibliothek zu Berlin nach Plänen<br />
um 1900 hat genau dies leisten sollen; mit dieser logistischen Virtualität korrespondiert<br />
die deutsche Einrichtung der Fernleihe, die anstelle einer denkbaren<br />
nationalen Buchkonzentration auf die Berliner Königliche Bibliothek die deutsche<br />
Bibliothekslandschaft in Zerstreuung beließ. Nicht die realen Buchkörper,<br />
sondern ihre Metadaten werden in Berlin zusammengeführt; die dortige Zentralstelle<br />
der Deutschen Bibliotheken weist nicht so sehr die Orte, sondern die<br />
genauen Titel gesuchter Bücher nach: nicht Bibliotopik, sondern Bibliographie,<br />
eine nachrichtentechnische Verlagerung vom Ort des Speichers auf seine Adressierung<br />
als Bedingung der Übertragbarkeit <strong>von</strong> Information. 26<br />
»Gerade die Existenz des Auskunftsbüros führt uns täglich vor<br />
Augen, wie zersplittert der Besitzstand vor allem an nationaler Literatur in<br />
Deutschland ist und wie sehr uns trotz der Sammeltätigkeit der Königlichen<br />
Bibliothek die eine, alle anderen überragende Zentralbibliothek fehlt. Nur<br />
der Druck des Gesamtkatalogs, der nach seiner Vollendung ein großartiges Dokument<br />
deutschen Geisteslebens darstellen wird, wird auch die Möglichkeit bieten<br />
: die Deutsche Bibliographie.« <br />
Hier ersetzt, im Zeitalter nicht mehr der nationalen Monumente, sondern der<br />
Dokumentationswissenschaft, ein Knotenpunkt im Informationsnetzwerk die<br />
Notwendigkeit einer zentralen Architektur und Institution.<br />
Am 30. September 1942 weckt der Katalogsaal der Pariser Nationalbibhothek<br />
bei Ernst Jünger den lang gehegten Wunsch, »Folianten zu besitzen, in<br />
denen sich jedes gedruckte Buch nachschlagen ließe«. Ein textueller Zweitkörper<br />
(das Korpus) des Staats ist hier buchstäblich als kollektives Gedächtnis infrastrukturiert.<br />
Solche Hilfsmittel seien dem einzelnen nicht angemessen, sondern<br />
als Bibliothekar, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, Jg. 63, Heft 7/8 (Juli/August<br />
1949), 235-269(259)<br />
25 Siehe Karl Georg Brandis, Goethes Plan eines Gesamtkatalogs der weimarischen<br />
Bibliotheken, in: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 14 (1928), 152-165 (157)<br />
26 Richard Fick, Die Zentralstelle der Deutschen Bibliotheken (Das Berliner Auskunftsbureau<br />
und der Gesamtkatalog), in: Commission permanente des Congres<br />
internationaux des Archivistes et des Bibliothecaircs, Congres de Bruxellcs 1910.<br />
Actes, hg. v.J. Cuvclier / L. Stainier, Brüssel 1911, 399-449 (410)
832 . Bi<br />
»dem Maßstab des Großen Menschen, das heißt, des Staates angepaßt. So dieses<br />
System <strong>von</strong> Katalogen - man hat vor ihm den Eindruck einer geistigen<br />
Maschine, die ein im höchsten Maße methodischer Verstand entwarf.« 27 Und<br />
so ist der in solchen Katalogen blätternde Mensch {user) jenem »Effekt einer<br />
Rechenmaschine« vergleichbar, den Alan Turing beschrieb, »indem man eine<br />
Liste <strong>von</strong> Handlungsanweisungen niederschreibt und einen Menschen bittet,<br />
sie auszuführen. Eine derartige Kombination eines Menschen mit geschriebenen<br />
Instruktionen wird >Papiermaschine< genannt.« 28 Und an anderer Stelle<br />
beschreibt Turing in bibliothekswissenschaftlichen Begriffen die Optionen einer<br />
intelligenten Maschine, deren Gedächtnis »fruchtbare neue Formen des Indizierens«<br />
mit sich bringt. 29 Als eine solche Maschine hat Alain Resnais die Pariser<br />
Nationalbibhothek in seinem Film Toutc la me'moire du monde (1956)<br />
portraitiert. Ebendort trifft Jünger 1942 den »Dr. Fuchs, der<br />
einen Gesamtkatalog der deutschen Bibliotheken bearbeitet, in dem ein Hauptwerk<br />
menschlichen Bienenfleißes geschaffen wird« - Lese(n). Steht hinter dieser<br />
Ortsbegehung zur Weltkriegszeit ein dem Pariser Inventar der deutschen<br />
Archivkommission analoges Projekt zur Rückforderung <strong>von</strong> ehemals deutschen<br />
Buchbeständen?<br />
»Die Arbeit der großen Sammlung und Sichtung scheint erst zu beginnen; wir stehen<br />
hier vor einer neuen Chinoisene, vor einem neuen Mandarinentum, das zwar<br />
der schöpferischen Kraft entbehrt, doch sauber mit den geprägten Ideogrammen<br />
zu verfahren weiß. Man darf sich da<strong>von</strong> die Heraufkunft einer strengeren, bescheideneren,<br />
aber zugleich genußreicheren Wissenschaft versprechen, mit der verglichen<br />
die des 19. Jahrhunderts anarchische Züge besitzt.« <br />
Gustave Flaubert hat diese Situation des 19. Jahrhunderts in seinen Novellen Die<br />
Versuchung des Heiligen Antonius^ 0 sowie Bouvard et Pecuchet beschrieben,<br />
worin das kritische Bedürfnis nach Information (Worte und Dinge in eine sinnvolle<br />
Ordnung zu bringen) sich in der Geste ihrer Abschrift schon erschöpft. Der<br />
Versuch, das Archiv, die Bibliothek, das Museum zu (be-)schreiben endet in einer<br />
semiotischen Katastrophe der Verzeichnung; das autoreproduktive Medium<br />
Xerographie wird den Gedächtnisspeicher durch Vervielfältigung, und das elek-<br />
17 Ernst Jünger, Das Erste Pariser Tagebuch, in: ders., Strahlungen, Tübingen (Heliopolis)<br />
1949, 173<br />
2S Alan Turing, Intelligente Maschinen (1948), in: ders., Intelligence Service. Schriften, hg.<br />
v. Bernhard Dotzler / Friedrich Kittler, Berlin (Brinkmann & Böse) 1987, 91. Siehe<br />
auch: Bernhard J. Dotzler, Papiermaschinen. Versuch über Communication & Control<br />
in Literatur und Technik, Berlin (Akademie) 1997, »Vorsatz: Der Algorithmus«<br />
29 Alan Turing, Intelligent Machinery, a Heretical Theory, dt. in: ders. 1987: 7-15 (12)<br />
30 Dazu Peter Gendolla, Phantasien der Askese. Über die Entstehung innerer Bilder am<br />
Beispiel der »Versuchung des heiligen Antonius«, Heidelberg (Winter) 1991
VI:RLAUI''SI ; ORMI;N DKR DHUTSCHKN BÜCHI-.RKI 833<br />
tromsche Medium Hypertext den Index durch endlose Verweisbarkcit ersetzen. 11<br />
Die <strong>von</strong> Ernst Jünger prognostizierte neue Wissenschaft der Wissenszirkulation<br />
wird in der Tat konservative 'Lüge tragen »und in vielen Fällen eher an das 18.<br />
Jahrhundert anknüpfen, an Linne, an die Enzyklopädisten und an den Rationalismus<br />
in der Theologie« . Der Ort dieser Spekulation Jüngers<br />
zur Überführung <strong>von</strong> Wissensspeichern (Bücher) in das Wissen über ihre Adressierung<br />
(Gesamtkatalog), also eine Verschiebung <strong>von</strong> Signifikantenmengen zum<br />
Signifikat <strong>von</strong> Signifikanten (Signaturen) zweiter Ordnung, ist sein Nachmittag<br />
in der alten Pariser Nationalbibliothek. Wo Jünger auf den Enzyklopädismus<br />
des 18. Jahrhunderts zurückschaut, setzt die Signatur der Postmoderne<br />
Vektoren einer digitalen Zukunft, wobei Zugänglichkeit zu den Speichern nicht<br />
allein eine politische Frage der Informationskultur ist 32 , sondern auch eine Herausforderung<br />
auf der mikrophysischen Ebene <strong>von</strong> Hardware und Programm. JJ<br />
Das Neubauprojekt der Pariser Biblwtheque Nationale ist allerdings noch mit<br />
dem Plan gescheitert, alle historischen Buchbestände in EDV zu überführen.<br />
Doch steht diese virtuelle Lesekultur an der Schwelle zur Renaissance einer Wissensästhetik,<br />
die schon einmal den Raum der Museen, Archive und Bibliotheken<br />
(auch) als kognitiven begriffen hat. 34 Jünger ahnt, daß die Kybernetisierung des<br />
Wissens dessen Algonthmisierung im Sinne <strong>von</strong> logic and control heißt 35 , buchstäblich:<br />
»Mit diesen Geistern wird man besser leben, auch werden sie kontrol-<br />
31 Siehe W. E., (In)Differenz: Zur Ekstase der Originalität im Zeitalter der Fotokopie, in:<br />
Hans Ulrich Gumbrecht / Karl Ludwig Pfeiffer (Hg.), Materialität der Kommunikation,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 498-517 (511); ferner Bernhard Siegen, Frivoles<br />
Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pecuchet, in: Hans-Christian v.<br />
Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft. 5 Vorträge, Leipzig<br />
(Universitätsverlag) 1998,15-40<br />
32 »Die Öffentlichkeit müßte freien Zugang zu den Speichern und Datenbanken erhalten«:<br />
Jean-Francois Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien (in: Theatrum<br />
machinarum 3/4) 1982; 2. Neuauflage Wien (Passagen) 1993, 192; frz.: La condition<br />
postmoderne, Paris (Minuit) 1993<br />
33 Zu »Schwierigkeiten des Umgangs mit Büchern als Speicher« und »Zugänglichkeit<br />
<strong>von</strong> Speichermechanismen« siehe Alan Turing, The State of the Art. Lecture to the<br />
London Mathematical Society on 20th February 1947, dt. in: ders. 1987, 183-207 (187)<br />
34 Dazu Paula Findlen, The Museum: Its classical etymology and Renaissance genealogy,<br />
in: Journal for the History of Collections 1, Heft 1 (1989), 59-78, und W. E., Text und<br />
Objekt der Museologie: Für eine Archäologie der Museumswissenschaft, in: Katharina<br />
Flügel / Arnold Vogt (Hg.), Museologie als Wissenschaft und Beruf in der modernen<br />
Welt (= 3. Leipziger Gespräch zur Museologie, Bd. 3, hg. v. Institut <strong>für</strong> Museologie der<br />
Hochschule <strong>für</strong> Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig / FH), Weimar (Verlag und<br />
Datenbank <strong>für</strong> Geisteswissenschaften) 1995, 30-52<br />
35 Robert Kowalski, Algorithm = Logic + Control, in: Communications of the ACM 22<br />
(1979), 424-436
834 Bim.ioTiM-.K<br />
lierbar sein. Sie sind die Konservatoren in der Vernichtungswelt« .<br />
Während diese Worte sich schreiben, verzeichnen deutsche Kommissare die<br />
Bibliotheksbestände jüdischer Deportierter: Konservatoren im Dienste der Vernichtungswelt,<br />
wo<strong>für</strong> das ubiquitäre Gedächtnismedium Photographie bereits ein<br />
Dispositiv gesetzt hatte, »rcplacing not only the tangible but history and<br />
memory as well.« Der Besitz einer Daguerrotypie kommt im 19. Jahrhundert<br />
bereits der Verfügung über ihren Gegenstand gleich - »very nearly the same thing<br />
as carrying off the palace rtsclf« (Ruskin, aus Venedig). 36 Katalogische Semiotisicrung<br />
<strong>von</strong> Kultur macht nicht nur Objekte, sondern auch Menschen redundant.<br />
Für Konservatoren im Dienste der Vcrniclnungswelt, noch einmal, gilt an der<br />
Schwelle zum Digitalen: »Der Speicher sollte löschbar sein« .<br />
In Preußen führt nach 1848/49 die Resignation angesichts der geringen Aussichten<br />
aul die Hinrichtung einer deutschen Nationalbibliothek zu der Idee, »die<br />
über eine Vielzahl <strong>von</strong> Bibliotheken verstreuten Bestände zumindest in einem<br />
einzigen Katalog nachzuweisen, wenn sie schon nicht physisch an einem Orte<br />
zusammengetragen werden konnten«. 37 Der Historiker Heinrich <strong>von</strong> Treitschke<br />
argumentiert 1884 gegenüber der Option einer zentralen Versammlung realer<br />
Nationalbuchbestände unter Hinweis auf die Einzigartigkeit der Kultur(übertragungs)technik<br />
des deutschen Fernleihverkehrs: Diese virtuelle Kompensation<br />
realer Zertreutheit öffentlicher Bibliotheken »entspricht dem Charakter unserer<br />
Kultur.« 38 1921 formuliert Richard Fick den Mangel um: daß nämlich »die uns<br />
fehlende Nationalbibliothek durch die Gesamtheit der deutschen Bibliotheken<br />
dargestellt wird - ein Gedanke, der gerade in der jetzigen Not unseres Vaterlandes<br />
etwas Erhebendes hat« . Deutschland<br />
begreift sich so als Bibliothcks-Kollektivsmgular und als Körper aus Buchkorpora.<br />
So, wie <strong>für</strong> den Mcisterhistoriographen des 19. Jahrhunderts Leopold <strong>von</strong><br />
Ranke erst der Preußische Staat das happy cnd eines Dramas namens deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> ist, bleibt auch die virtualc Bibliothek in der Konzeption Goethes<br />
<strong>für</strong> das Herzogtum Weimar solange im Unvollendeten, also virtuell, bis daß der<br />
Preußische Gesamtkatalog diese Erinnerung ins Reich der vergangenen Zukunft<br />
verweist. 39 Nachdem der.Preußische Gesamtkatalog längst Metonymie eines<br />
Deutschen Gesamtkatalogs geworden ist, setzt Berlin in Übernahme der Kul-<br />
36<br />
David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985, 257<br />
37<br />
Bernd Hagenau, Der deutsche Gesamtkatalog: Vergangenheit und Zukunft einer Idee,<br />
. Wiesbaden (Harrassowitz) 1988, 5<br />
3lS<br />
Heinrich <strong>von</strong> Treitschke, Die Königliche Bibliothek in Berlin, in: Preußische Jahrbücher<br />
53 (1884), 473-492 (49!)<br />
39<br />
Brandis 1928: 165; über Rankes dramatische Inszenierung der deutschen <strong>Geschichte</strong><br />
als Komödie siehe Hayden White, Metahistory. The histoncal <strong>Im</strong>agination in nineteenth-century<br />
Europe, Baltimore, Man / London 1973; dt.: Metahistory. Die historische<br />
Einbildungskraft in Europa im 19. Jahrhundert, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991
V H R I . A U I ' S I O R M K N 1>HI< D H U T S C I IHN BüCI IHR Kl . 8 3 5<br />
turhoheit der Einzelländer 1935 ihn auch institutionell durch. Und wieder einmal<br />
bilden Speichermedien (der Gesamtkatalog als bibliothekstechnischer Apparat)<br />
und das <strong>Im</strong>aginäre der Nation eine Schnittstelle, denn der Generaldirektor<br />
der Preußischen Staatsbibliothek, Hugo Andres Krüß, stilisiert ihn nach zur<br />
»grandiosen Demonstration deutschen Kulturwillens« 40 . Die politische Gleichschaltung<br />
Deutschlands im Dritten Reich, »die alle partikulanstischen Hemmungen<br />
bei den außerpreußischen Bibliotheken beseitigte«, realisiert diese<br />
Umschaltung konkret durch einen Erlaß des Reichserziehungsministers vom 22.<br />
Mai vom Buchstaben B an, unter kommissarischer Leitung der Berliner Staatsbibliothek.<br />
41 So bleibt Preußen das Alcph des Reichsgcdächtnisses und »einstweilen<br />
das Schicksal des Buchstabens A dahingestellt, der nur in der Form des<br />
Preußischen Gesamtkatalogs, also ohne den Besitz der neuen Bibliotheken vorliegt<br />
und zunächst nicht einmal gedruckt werden soll« - Sendungen<br />
einer Letter. Der die Bestände aller wichtigen deutschen Bibliotheken<br />
umfassende Gesamtkatalog wurde als ein wahrhaft nationale Werk auch<br />
ideologisch aus dem Symbolischen ins <strong>Im</strong>aginäre, <strong>von</strong> der non-diskursiven Operation<br />
ins Diskursive umkodiert. 42 Retrospektiv, im Jahre 1961, widerspricht<br />
Hermann Fuchs allerdings der Auffassung, die Ausweitung des Preußischen<br />
zum Deutschen Gesamtkatalog im Jahre 1935 sei ein Politik um gewesen; vielmehr<br />
sei die Durchsetzung dieses Planes durch die politischen Verhältnisse nach<br />
1933 erleichtert worden . Zwei Modi <strong>von</strong> Ereignissen (im<br />
Sinne <strong>von</strong> Medienarchäologie und <strong>von</strong> Historie) prallen hier aufeinander.<br />
Die Druckschrift Erich Ehlermanns <strong>von</strong> 1910 Eine Reichsbibliothek in Leipzig<br />
definierte als Ziel einer deutschen allgemeinen Bibliothek absolute Vollständigkeit.<br />
Um nun satzungsgemäß die gesamte vom 1. Januar 1913 an erscheinende<br />
deutsche und fremdsprachige Literatur des Inlandes und die deutsche Literatur<br />
des Auslandes sammeln, aufbewahren, zur Verfügung halten und nach wissenschaftlichen<br />
Grundsätzen verzeichnen zu können, muß die verfügbare Masse<br />
über Autorennamen und Werktitel adressierbar sein, bestehend aus denselben<br />
Buchstaben des Alphabets, die auch ihren Inhalt ausmachen, so daß die Ordnung<br />
der <strong>Namen</strong> die Ordnung des Alphabets ist, dessen Sequenz und Lmeantät als<br />
Instrument der Beherrschung der Schrift dient. Jenseits dieser Ordnung der<br />
Schrift hegt der systematisch geordnete Sachkatalog, »der Realien im Netz seiner<br />
Systematik einzufangen trachtet« . Netz ist auch die<br />
Infrastruktur des nationalen Bibliothekswesens in Deutschland; die Struktur des<br />
deutschen Gesamtkatalogs gibt daher vor, was das Internet elektronisch einholt<br />
40 Zitiert nach einem Protokoll <strong>von</strong> Geog Leyh durch Schochow 1989: 34<br />
41 Hermann Fuchs, Der deutsche Gesamtkatalog, Leipzig (Harrassownz) 1936, 4f (=<br />
Sonderabdruck aus dem Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, Jg. 53, Heft 1-1 / 1936)<br />
42 Richard Fick 1936b, 463, zitiert nach: Hagenau 1988: 48
836 BlHUOTHl-K<br />
und als Mangel offenbart: In Deutschland »the regional Union catalogue reigns<br />
supreme, but it may be asked whether a network of such catalogues will in the<br />
long run function satisfactonly without a co-ordinatmg centre«. 43 Noch 1964<br />
wird ein das ganze Bundesgebiet überziehendes Netz <strong>von</strong> regionalen Katalogen<br />
weiterhin ausdrücklich als Ersatz <strong>für</strong> den im Krieg zerstörten Deutschen<br />
Gesamtkatalog bezeichnet. 44 1935 stellt die Erinnerung des vergangenen und die<br />
Antizipation des künftigen Weltkriegs als virtuelle Katastrophe das Projekt<br />
Gesamtkatalog noch in den Horizont einer anderen Zeitlichkeit:<br />
»Der Gesamtkatalog hat als Katalog und Bibliographie aber auch noch den Wert,<br />
den jede Vervielfältigung durch den Druck in sich trägt, daß er den enthaltenen<br />
Einzelheiten einen Grad <strong>von</strong> UnVergänglichkeit sichert, wie er nach menschlichem<br />
Ermessen in diesem Dingen überhaupt nur möglich ist. Als Katalog ersetzt er mit<br />
der Zeit die meist nur einmaligen, bei aller Pflege vergänglichen Einzelkatalogc der<br />
angeschlossenen Bibliotheken, macht sie damit unabhängig <strong>von</strong> etwaigen Katastrophen,<br />
die in einer Bibliothek nicht schlimmer wirken können, als wenn der<br />
Katalog verlorengeht.« 4 - 1<br />
Solch ein Kriegsverlust war 1945 Wirklichkeit, und um Haaresbreite wäre der<br />
gesamte Buchbestand der Deutschen Bücherei in die Sowjetunion deportiert<br />
worden. 46 Der Nation galt es also einen bibliothekarischen Zweitkörper, das<br />
Aufschreibesystem seiner realen Bibhothekskörper zu bilden; hier wird das<br />
Medium der Reproduktion an den Gedanken der dignitas non montur 47 staatlicher<br />
Souveränität selbst gekoppelt. Wo es um das Verhältnis <strong>von</strong> Bibliothekstechniken<br />
auf der einen Seite und Dasein auf der anderen Seite geht, herrscht in<br />
den Bibliothekswissenschaften Desinteresse am Geist »und die Hinwendung<br />
zum Korpus, nämlich dem sterblichen Körper der Menschen und der banalen<br />
Physis der Texte« (Jochuni) - es sei denn, daß die Herkunft der Schrift an einem<br />
Autor oder einer Körperschaft festgemacht wird. Daß eine Körperschaft überhaupt<br />
als Autor zu gelten vermag, liegt auch darin, »daß sie auf dem Korpus aus<br />
Papier als >body< genannt wird, so daß es sich also, wie die AACR <strong>von</strong> 1967 aus-<br />
43<br />
Leendert Brummel 1956, zitiert nach Jochum 1995: 66<br />
44<br />
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen,<br />
Hannover (Landtag) 1964, 57<br />
45<br />
Heinrich Schreiber 1935, zitiert nach: Hagenau 1988: 49f<br />
46<br />
Die verantwortliche Kommissarin, die Bibliothekarin Marganta Rudomino, hat dies<br />
unter Hinweis darauf verhindert, daß die Leipziger Bibliothek als Nationalgut <strong>für</strong> die<br />
kulturelle Wiedergeburt Deutschlands unabdingbar war. Dazu Ekaterina Genieva,<br />
Gennan Book Collections in Russian Libraries, in: The Spoils of War. World War II<br />
and Its Aftermath. The Loss, Reappearance, and Recovery of Cultural Property, hg. v.<br />
Elizabeth Simpson, New York (Harry N. Abrams) 1997, 221; ferner Bernhard Fabian,<br />
The book m the totalitanan context, in: Comparative Cnticism 23 (2001), 21-36<br />
47<br />
Dazu Ernst Kantorowicz, The King's two Bodies, Pnnceton 1957
VkKI.AUISl-ORMHN DI-.R DhUTSCHHN BÜCHKRI-I 837<br />
führen, um eine Organisation oder Gruppe <strong>von</strong> Personen handelt, >that is identified<br />
by a name and that acts or may act as an entity.
838 BIM<br />
puhert. 52 Direktor Uhlendahl insistiert in einem Artikel, daß bei dieser Arbeit<br />
keine Lücken denkbar sind 53 ; »inhaltliche Probleme der Veröffentlichungen hatten<br />
bei der Herstellung der Bibliogaphie unberücksichtigt zu bleiben.« 54 Heißt<br />
das Resistenz der Bibliothek (Dokumentation) gegen den Zugriff der Ideologie?<br />
Die Deutsche Bücherei hat bibliographische Sonderaufgaben zum Zwecke der<br />
NS-Verbotspolitik im Bereich des gedruckten Wortes zu erfüllen; eine Reihe<br />
<strong>von</strong> NS-Funktionären plädiert dabei nicht <strong>für</strong> Geheimoperationen, sondern <strong>für</strong><br />
den radikalen Ausschluß systemfeindlicher Schriften. Dem treten die Bibliothekare<br />
entgegen; sie setzten sich <strong>für</strong> eine weitere lückenlose Erfassung sämtlicher<br />
Druckschriften unabhängig vom Inhalt ein mit Stumpf und Stil ausgerottet^ jede Erinnerung an sie ausgelöscht werden.« 55<br />
Der Widerstreit <strong>von</strong> Speicherauftrag und einer Ideologie spezifischer Kulturlö-<br />
32 Analog dazu zieht der Danzigcr Museumsleiter Erich Kcyscr die Konsequenz <strong>für</strong> sein<br />
Medium: »Der Nationalsozialismus hat eine neue Wertung nicht nur einzelner geschichtlicher<br />
Persönlichkeiten und Ereignisse, sondern der <strong>Geschichte</strong> selbst herbeigeführt.«<br />
Ders., Die Veranschaulichung der <strong>Geschichte</strong>, in: Museumskunde Bd. 11<br />
(1939), 86-94 (86). Vgl. W. E., Museale Räume im nachliberalistischen Zeitalter: Nationalsozialismus,<br />
Klassizismus, Antike(n)«, in: Hephaistos. New Approaches in Classical<br />
Archaeology and related Fields. Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der<br />
Archäologie und angrenzender Gebiete 11/12 (1992/93), Bremen (Klartext), 187-206<br />
" >3 Heinrich Uhlendahl, Die nationalen Bibliographien, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen<br />
Buchhhandel v. 2. Januar 1936<br />
y4 Hildegard Riedel, Die faschistische Kultur- und Wissenschaftspolitik in ihren Auswirkungen<br />
auf das Buch- und Bibliothekswesen - speziell die Deutsche Nationalbibliothek,<br />
Dissertation zur Promotion A (Karl-Marx-Universität Leipzig, Sektion<br />
<strong>Geschichte</strong>), 15, September 1969, 138<br />
x " > Riedel 1969: 130; zur Einrichtung einer Dienststelle der politischen Polizei zur Überwachung<br />
der Büchersekretierung an der dem Propagandaministenum unterstellten<br />
Deutschen Bücherei siehe Manfred Komorowski, Die wissenschaftlichen Bibliotheken<br />
während des Nationalsozialismus, in: Peter Vodosek / ders. (Hg.), Bibliotheken<br />
während des Nationalsozialismus, Teil 1, Wiesbaden (Harrassowitz) 1989, 1-24 (6f)
VI-RI.AUI-'SI-ORMI-.N i)]-:i< DKUTSCI IHN BÜCHI-:RI-:I 839<br />
schung findet statt, als in NS-Deutschland nach der Reichskulturkammergesetzgebung<br />
nur noch Menschen arischer Herkunft schriftstellerisch tätig sein<br />
können. Da aber deutsche Juden <strong>von</strong> März 1935 bis September 1941 in einer<br />
kulturellen Zwangsorganisation, dem Reichsverband jüdischer Kulturbünde<br />
erfaßt werden, erhält die Deutsche Bücherei Schriften, die sie als außerhalb des<br />
Buchhandels erscheinend in der Deutschen Nationalbibliographie Reihe B gegebenenfalls<br />
aufnehmen kann. Die politisch-ideologischen Anliegen der Nationalsozialisten,<br />
die Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben auf der<br />
einen Seite und Erhaltung der Weltgeltung der deutschen Nationalbibhothek auf<br />
der anderen, geraten so in Widerspruch zueinander. Wenn die Deutsche Bücherei<br />
nicht allein ein Druckbuchstabenarchiv ist, also Speicher, sondern diese Daten<br />
auch verarbeitet (also ein Medium), dann ist ihre Ausstellungstätigkeit Teil<br />
der Bestanderschließung (Riedel). Hitlers Forderung »Gebt mir vier Jahre Zeit!«<br />
ist das Thema mehrerer Ausstellungen."' 6 <strong>Im</strong> diskursiven Bereich, an der Schnittstelle<br />
zur Öffentlichkeit, macht die Deutsche Bücherei dem Regime gegenüber<br />
Zugeständnise; gedächtnismaschinell bleibt sie resistent. Die bibliographische<br />
Auskunftstätigkeit der Deutschen Bücherei als Interface des Speichers zum<br />
gesellschaftlichen Umfeld ist vielleicht weniger als dialektische Berührung<br />
denn als kommunikationskybernetische Rückkopplung <strong>von</strong><br />
Gedächtnis und Umwelt formulierbar. Direktor Uhlendahl beschreibt es anläßlich<br />
des 25jährigen Bestehens der Deutschen Bücherei 1938:<br />
»Die Auskunftsstcllc ist- ein Mittelpunkt geworden, in dem die geistigen Interessen<br />
der Gegenwart zusammenströmen: Fragen der Weltanschauung, der Rechtsdeutung<br />
und der Geschichtsauffassung, des Arbeitsdienstes, der Wchrwissensehaft,<br />
der Rohstolle, der Kunststolle und was sonst mit dem 4-Jahrcsplan zusammenhängt.<br />
Hier fühlt man den Pulsschlag der Zeit.«" 1<br />
Der Speicher wird hier zum Meßinstrument einer gegebenen Gesellschaft. Mit<br />
dieser gedächtnispolitischen Positionierung der Deutschen Bücherei widerlegt<br />
Uhlendahl zugleich die <strong>von</strong> ihm und seinesgleichen oft strapazierte Behauptung<br />
vom unpolitischen Charakter der Bibhotheksarbeit. Verbrennung und Deportation<br />
<strong>von</strong> Büchern folgen administrativen Schaltungen, auf deren Bahnen auch<br />
Menschen verschickt werden können. Die Abschrift eines handgeschriebenen<br />
Berichts <strong>von</strong> Albert Paust, seinerzeit Bibliothekar an der Deutschen Bücherei<br />
(und ihr prominenter Historiograph), gibt Auskunft über seine Tätigkeit in der<br />
Bücherverwertungsstelle Wien:<br />
»<strong>Im</strong> Einvernehmen mit der Gestapo sind bis zum 20. Sept. zehn Buchhandlungen,<br />
Lagerräume und Privatwohnungen vollständig geräumt worden; nicht nur Bücher,<br />
56 Riedel 1969: Anlage 27: Ausstellungstätigkeit der Deutschen Bücherei 1933-1945<br />
57 In: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, Jg. 52 (1935) 9/10, 554
840 BfHL<br />
sondern auch Regale und zahlreiches sonstiges Mobiliar war abzutransportieren<br />
u. wurde zur Einrichtung der völlig leeren Räume der ehemaligen Loge >Humanitas<<br />
in der Dorotheergasse 12 verwendet. « 5S<br />
Auf der 4. Sitzung des Verwaltungsrats der Deutschen Bücherei am 15. Juli 1942<br />
im Sitzungssaal wird noch einmal die Verknüpfung der Reich(s)weite <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien<br />
armis et litteris erinnert, wo Rust auf Bestrebungen Italiens hin weist, »nach<br />
dem Kriege die Rolle des alten Roms zu spielen und die Kulturpropaganda Europas<br />
zu übernehmen. Diesen Plänen müsse man rechtzeitig entgegentreten und<br />
dazu gebe die Sammlung der Übersetzungen sowie der Werke über Deutschland<br />
ein wirksames Mittel an die Hand.« 59 Unterdessen sprengt das neue Medium<br />
Film nicht nur die klassische Kriegsführung, sondern auch dessen Gedächtnis aus<br />
der Umklammerung durch das Buchstabenmonopol. Der Militärbefehlshaber in<br />
Frankreich verfügt über eine Propagandaabteilung Film in Paris unter der Leitung<br />
<strong>von</strong> Sonderführer zur Überwachung und propagandistischen Beeinflussung<br />
de.s französischen Filmwesens; in der entsprechenden Kriegssammlung soll das<br />
gesamte seit Beginn des Krieges erschienene französische Filmschrifttum vertreten<br />
sein, »um dessen Wandlung unter deutscher Führung studieren zu können«<br />
.<br />
Die Expansion Deutschlands zum Großdeutschen Reich erweitert, der Satzung<br />
gemäß, auch der Geltungs- und Wirkungsbereich der Deutschen Bücherei; nicht<br />
erzählend, sondern »zahlenmäßig läßt sich dieser Vorgang noch nachweisen« an<br />
der Einbeziehung des tschechischen Schrifttums. Am 11. April 1940 wird die Protektorats-Regierung<br />
<strong>für</strong> Böhmen und Mähren gezwungen, eine Regierungsverordnung<br />
über die Ablieferung <strong>von</strong> Pflichtexemplaren an die Deutsche Bücherei<br />
zu erlassen. Die bibliographische Verzeichnung dieser tschechischen Veröffentlichungen<br />
erfolgt allerdings nicht, womit genau jene Übertragung (auf dem Postweg)<br />
ausgeschaltet ist, die in der Mediensituation dieser Jahre Bedingung <strong>von</strong><br />
Speicherung bleibt - solange Bibliothekslogistik, betriebsblind <strong>für</strong> die neuen<br />
technischen Standards, dem ihnen eigenen Medium der papierbasierten Druckbuchstaben<br />
verhaftet ist. Zwischen der Reich- und Bereichsweite bibliographischer<br />
Wissenskartographie herrscht eine Unscharfe. Unter Kriegsbedingungen<br />
schließlich gilt ein anderer Begriff <strong>von</strong> Öffentlichkeit; über den Anfragen an die<br />
Deutsche Bücherei über Kriegsprobleme steht nicht selten der Vermerk Die Literatursuche<br />
ist als geheim zu behandeln, z. B. die Anfrage der Luftkriegsakademie<br />
vom 29. Januar 1943 zu »Literatur über Flammenwerfer« .<br />
58 Bericht über die bisherige Sicherstellung des beschlagnahmten Schrifttums u. Vorschläge<br />
<strong>für</strong> die Büchcrverwertungsstelle des Reichspropagandamtes in Wien« (=<br />
Anlage 6 zu Riedel 1969)<br />
59 Riedel 1969, Anlage 15: Niederschrift der Sitzung
VHRI.AUI : SI ; ORMI:N DI-:R DEUTSCHEN BÜCHI;RI:I 841<br />
Damit ist die Nation wieder auf den Stand <strong>von</strong> 1806/1813 zurückgeworfen: die<br />
Mobilisierung <strong>von</strong> Wissen im Geheimen. Bereits dem Ausbruch des Krieges <strong>von</strong><br />
1914 stellte sich die Deutsche Bücherei (noch in statu nascendi) durch die Gründung<br />
einer Knegslitcratursammlung und wies sich damit ausdrücklich als Funktion<br />
des Nationalen aus. Der Widerstreit zwischen dem dokumentarischen<br />
Anspruch der Speicherung <strong>von</strong> Zeitgeschichtsdokumenten, auch »der verbotenen<br />
und nach § 41 St.-G-Bs. unbrauchbar zu machenden Druckschriften« und den Bedenken der Militärs dagegen löst sich damals allein<br />
durch administrative Vermittlung der Sächsischen Ministerien. Die vergangene<br />
Zukunft <strong>von</strong> kulturwissenschaftlichem Gedächtnis ist kein Gesichtspunkt <strong>für</strong><br />
Strategen (es sei denn, dieser Raum wird selbst knegswissenschaftlich definiert 60 ).<br />
60 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin (Merve) 1988, 20
842 BlBLIOTlIKK<br />
Die Paulskirchenbibliothek<br />
<strong>Im</strong> Kontext der Gründung der Deutschen Bücherei stellt Ernst Mohrmann 1914<br />
die sich auf die sogenannte Reichsbibhothek beziehenden Abschnitte aus dem<br />
Stenographischen Bericht über die Verhandlungen der deutschen constituirenen<br />
Nationalversammlung und die 1848 im Börsenblatt deutscher Buchhändler darüber<br />
erfolgten Bekanntmachungen zusammen. 1 Mohrmann vergleicht die Schaffung<br />
einer deutschen Reichsflotte mit der Reichseinheit auf geistiger Ebene; die<br />
Deutsche Bücherei ist das Telos einer 1 848er Bibliothek, »die gewissermaßen ihre<br />
Vorgeschichte verkörperte«. 2 Die Klärung der Frage nach der ersten Reichsbibliothek<br />
ist eine Funktion ideologischer <strong>Im</strong>pulse. 1914 spielt sie sich vor dem<br />
Hintergrund der Infragestellung Leipziger Nationalbibhotheksansprüche <strong>von</strong><br />
Seiten des Direktors der Königlichen Bibliothek Berlin ab, Adolf Harnack, der<br />
in seiner Broschüre Die Benutzung der Königlichen Bibliothek und die deutsche<br />
Nationalbibliothek daran erinnert, daß der Gedanke einer deutschen Nationalbibhothek<br />
bald nach der Gründung des Deutschen Reiches auftauchte und seitdem<br />
niemals ganz <strong>von</strong> der Tagesordnung verschwunden ist, wenn er auch<br />
zeitweise aufgehoben schien. Niemand könne damit als Vater dieses Gedankens<br />
gepriesen werden« 3 ; Nationalgcdächtms hat kein Subjekt. Den Gründern der<br />
Deutschen Bücherei war die Reichsbibhothek <strong>von</strong> 1848 - so das argumentum ex<br />
süentw - offensichtlich nicht mehr vertraut; »zwischen diesem gescheiterten<br />
Unternehmen und dem gelungenen <strong>von</strong> 1913 besteht kein ideengeschichtlicher<br />
Zusammenhang« 4 . Machen wir uns also daran, diese Korrelation als Diskontinuität<br />
zu schreiben, was einen Methodensprung erfordert: statt Ideengeschichte<br />
Medienarchäologie. Das Archiv besagt eindeutig Diskontinuität. Erst 1914, zwei<br />
Jahre nach ihrer Gründung, greift die Deutsche Bücherei erstmals auf die Frankfurter<br />
Parlamentsbibliothek zurück: man sieht Analogien im Funktionalen, vor-<br />
Siehe Franz Wiegard (Flg.), Stenographischer Bericht über die Verhandlungen der<br />
deutschen constituirenden Nationalversammlung in Frankfurt, Frankfurt/M. 1848<br />
Ernst Mohrmann, Der Vater des Gedankens einer Deutschen Nationalbibliothek, in:<br />
Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig: Urkunden<br />
und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung, 9. Ausg., Leipzig 1914, lOf<br />
(erschien zugleich in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel Jg. 81 (1914) Nr. 145<br />
v. 26. Juni 1914, 1033-1040; im Börsenblatt auch die Entwicklungsgeschichte der<br />
Bibliothek anhand <strong>von</strong> Protokollen der Nationalversammlung.<br />
Adolf Harnack, Die Benutzung der Königlichen Bibliothek und die deutsche Nationalbibliothek,<br />
Berlin: Springer, 1912. II. Abschnitt, 23, zitiert in: Mohrmann 1914<br />
Rudolf Blum, Nationalbibliographie und Nationalbibliothek: die Verzeichnung und<br />
Sammlung der nationalen Buchproduktion, besonders der deutschen, <strong>von</strong> den Anfängen<br />
bis zum Zweiten Weltkrieg, in: Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des Buchwesens Bd. 35,<br />
Frankfurt/M 1990, 1-294 (126)
N Du-: PAUi.sMKciikNmuuoTHi-K. 843<br />
rangig jedoch in ideell wirkenden Kräften; solche Energien tragen seitdem zum<br />
Selbstverständnis im <strong>Im</strong>aginären der Bibliothek bei. Aber nur eine Bedeutungsverschiebung<br />
<strong>von</strong> Parlaments- zu Reich sh\b\\oth.ek. macht diese ideologische differance<br />
der Historie möglich. Der Gedanke einer deutschen Reichsbibliothek sei<br />
schon 23 Jahre vor der Wiedererrichtung des Deutschen Reiches ausgesprochen<br />
worden, insistiert Mohrmann 1914, durch überkommerzienrat Heinrich Wilhelm<br />
Hahn, den Hannoveraner Buchhändler Verleger der Monumenta Germaniac<br />
Histonca. Gleichen wir diese Worte, diese Begriffe gegen das Wissen des<br />
Archivs ab.<br />
Vor- und Nachspiele der Parlamentsbibliothek<br />
Die erste deutsche Rcichsbibhothek entstand demnach im deutschen Revolutionsjahr<br />
1848. Diskurse bedürfen stabiler Referenten; 1848 bietet Hahn, »der in<br />
den vierziger Jahren der allgemeinen Sehnsucht nach deutscher Einheit auf seine<br />
Weise einen Stützpunkt zu geben suchte, indem er den Gedanken einer deutschen<br />
Reichsbibhothek anbahnte«, dem Paulskirchenparlament zu Frankfurt<br />
sein Verlagssortiment als einen solchen Grundstock an. <strong>Im</strong> Schreiben vom 15.<br />
Juli 1848 an die deutsche Nationalversammlung verspricht er, ihr »Werke historischen,<br />
politischen, statistischen, kriegswissenschafltichen und juristischen<br />
Inhalts«, darunter die Monumenta Germamae Histonca verehren zu wollen.^<br />
Seine Opferbereitschaft (Mohrmann) veranlaßt zahlreiche Berufsgenossen zu<br />
ähnlichen Gaben; in diesem Akt der Verausgabung transformiert eine pure Verwaltungsbibliothek<br />
zum nationaldiskursiv geladenen Ort. 6 Das Protokoll hält<br />
die Verhandlungen der 69. Sitzung der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung<br />
unter dem Vorsitz Heinrich v. Gagerns am 31. August 1848 fest.<br />
Der Abgeordnete Feßlcr erstattet im <strong>Namen</strong> des Pnontäts- und Pctitionsausschusses<br />
Bericht über das Anerbieten der Hahnschen Buchhandlung, und sein<br />
Antrag geht dahin, daß der Katalog der Hahnschen Buchhandlung jedem <strong>von</strong><br />
der Nationalversammlung eingesetzten Ausschuß zur Durchsicht übermittelt<br />
(»mitgeteilt«) werden soll, um dann wünschenswerte Werke zu kennzeichnen<br />
- Signatur im ursprünglichsten Sinne. Mohrmann hat nun das Kunststück zu<br />
vollbringen, aus einer ausdrücklichen Handbibliothek die Urszene der Reichs-<br />
5 Albert Paust, Die Idee einer deutschen Reichsbibliothek. Zur Vorgeschichte und<br />
Gründung der Deutschen Bücherei, Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei,<br />
Leipzig 1933, 4<br />
6 Zum Zusammenhang <strong>von</strong> Gabe, Opfer und Tausch (der <strong>von</strong> Marcel Mauss ethnographisch<br />
definierte Potlatsch) siehe Jacques Dernda, Donner le temps, in: Christoph<br />
Tholen u. a. (Hg.), Zeit-Zeichen. Aufschübe und Interferenzen zwischen Endzeit und<br />
Echtzeit, Weinheim (VCH / Acta Humaniora) 1990
844 BlBI.IOTIlHk<br />
bibhothek zu definieren. Faktisch handelt es sich 1848/49 nicht mehr und nicht<br />
weniger als um ein parlamentarisches Arbeitsinstrument; <strong>für</strong> eine zu schaffende<br />
Reichsbibliothek findet sich keine definitive Festlegung:<br />
»Sprach er bei seiner Schenkung vorerst auch nur die bescheidene<br />
Absicht aus, dem Parlament damit eine >Handbibliothek< schaffen zu helfen, die<br />
Tat war mehr und wurde vom Parlament selbst in voller Bedeutung sofort erkannt<br />
und gewürdigt. Wie mag er sich der Wertschätzung semer Gabe gefreut haben, die<br />
dann lag, daß sie ihm <strong>von</strong> der Nationalversammlung als patriotische Gabe zur<br />
ersten Begründung einer deutschen Rciihsbibliolhek verdankt wurde.« 7<br />
Somit wird der Begriff aktenkundig. Das Parlament beschließt zwar, auf Grund<br />
der Stiftungen diverser Abgeordneter und Buchhändler keineswegs nur eine<br />
Handbibliothek <strong>für</strong> die Arbeit der Abgeordneten, sondern eine Reichsbibliothek<br />
zu schaffen, verfügt aber über keine dementsprechen Instrumente, »denn<br />
Kredit war im Revolutionsjahr 1848 nicht zu haben« . Die<br />
Verlegerstiftung wird <strong>von</strong> der Volksvertretung vielmehr verinnerlicht, das heißt<br />
mit infrastrukturellen Mitteln befördert; alle privilegierten deutschen Postverwaltungen<br />
übernehmen entsprechende Büchersendungen portofrei. So real liest<br />
sich die nationale Sendung im Medium ihrer Übertragung; »diese Haltung der<br />
Länder war einer offiziellen Anerkennung der Reichsbibliothek gleichzusetzen«<br />
. In der 96. Sitzung der Nationalversammlung vom 13.<br />
Oktober 1848 läßt der Vorsitzende Heinrich v. Gagern eine Mitteilung (10.<br />
Oktober 1848) des Reichsministeriums der Finanzen verlesen, den portofreien<br />
Transport derjenigen Bücher betreffend; Beilage A im entsprechenden Protokoll<br />
formuliert den Zusammenhang <strong>von</strong> Format, Speicher und Übertragung:<br />
»Von Seite Preußens wird dabei vorausgesetzt, daß die betreffenden Sendungen<br />
nach Gewicht und Umfang zur Beförderung mit der Post überhaupt geeignet<br />
sind.« Preußen (nach Obengesagtem) und die Thurn und Taxis'sche<br />
Generalpostdirektion hatten schon früher Portobefreiung <strong>für</strong> alle gedruckten<br />
Sachen ohne Unterschied an die Nationalversammlung bewilligt. Eine entsprechende<br />
Mitteilung im Börseblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel Nr. 103<br />
vom 28. November 1848, unterzeichnet <strong>von</strong> dem am 25. Oktober zum Biblio-<br />
Mohnnann, ebd. Auch das Promemona des Bibliothekars Johann Heinrich Plath,<br />
betreffend die Reichsbibliothek, vom 7. März 1850 an die Hohe interimistische Bundeskommission,<br />
oszilliert zwischen parlamentarischer Hand- und nationaler Reichsbibliothek:<br />
So wurde Ende 1848 die ursprüngliche »Idee einer bloßen Handbibliothek<br />
<strong>für</strong>s Parlament aufgegeben und die einer großen National-Bibhothek gefaßt. <br />
Obwohl die Reichsbibliothek mit der Zeit eine allgemeine deutsche National-Bibliothek<br />
werden sollte, sollte sie doch die Bedürfnisse der National-Versammlung zunächst<br />
speziell mit befriedigen.« Zitiert hier nach dem Exemplar im Bundesarchiv, Außenstelle<br />
Frankfurt/M., Faszikel DB 62, <strong>von</strong>: Blum 1990: 280f
DIK PAUI.SKIRCHI-NIMIU.IOTHKK 845<br />
thekar der Nationalversammlung berufenen Johann Heinrich Plath in Frankfurt,<br />
benennt schließlich ausdrücklich die portofreie Buchsendung »zur Gründung<br />
einer deutschen Reichsbibliothek«. Bibliothekssekretär C. Wilhelm<br />
Semsen in Hannover wendet sich in einem Aufruf vom 22. Oktober 1848 (veröffentlich<br />
im Börsenblatt Nr. 96 vom 3. November 1848) an die deutschen Verleger<br />
mit der Bitte, auch den bestehenden öffentlichen Staatsbibliotheken ihre<br />
Verlagswerke zu schenken, nach Maßgabe einer Auswahl aus einzusendenden<br />
Verlagskatalogen: »Dann geht kein deutsches Buch ganz verloren, die reichen<br />
Früchte des mühsamen Strebens deutscher Buchhändler sind unseren Nachkommen<br />
gesichert«. Von 42 zunächst dazu bereiten Verlagsbuchhandlungen<br />
senden allerdings lediglich 18 ihre Veröffentlichungen ans Frankfurter Parlament.<br />
Dessen Bibliothek untersteht dem Innenministerium bis 6. Februar 1849,<br />
dann dem Reichsjustizminister Robert v. Mohl (August 1848 bis Mai 1849).<br />
Mohl war vor 1848 Oberbibliothekar in Tübingen; in seinen Lebenserinnerungen<br />
(Leipzig 1902) jedoch ist keine Rede <strong>von</strong> der Frankfurter Bibliothek.<br />
Soviel zu ihrer nationalsymbohschen Emphase: Aufgestellt auf der Galerie der<br />
Paulskirche, stellt diese Bibliothek zwar »ein Bild der erstrebten Einheit auch<br />
in seinen literarischen Erzeugnissen« dar (Paust), huscht aber ebensoschnell als<br />
Bild der Vergangenheit vorbei, um erst in einer neuen Jetztzeit reaktiviert zu<br />
werden: »Uns Deutschen der Gegenwart ist diese Zeit vor neunzig Jahren<br />
wieder greifbar nahe gerückt«, schreibt Paust unter Betonung der nationalsozialistischen<br />
Machtergreifung. Die monumentale Historie - so Nietzsche in<br />
Vom Nutzen und Nachteil der Historie <strong>für</strong> das Leben - täuscht durch Analogien,<br />
welche Zeitpunkte aufeinanderfaltet und damit Gedenkmomente tng-<br />
gert . Als ein Read Only Memory der deutschen Nation, museal<br />
geschlossen, wird enden, was als Radom Access Memory begann: die Reichsbibliothek.<br />
Paust selbst erinnert an die Notwendigkeit, die Zusammenhänge<br />
zwischen Paulskirchen- und Deutscher Bücherei »durch das über die Reichsbibliothek<br />
vorhandene Aktenmatenal klarer herauszustellen, als dies auf Grund<br />
der kurzen gedruckten Berichte« möglich ist; Medium des historischen Diskurses<br />
als Strategie ist die Publikation . Das Gedächtrusmedium<br />
Archiv aber gestattet keine narrativ geschlossene Aussage im Sinne der<br />
Ideologie.<br />
Ist die Paulskirchenbibhothek tatsächlich der historische Vorläufer einer deut-<br />
schen Nationalbibhothek? Dem histonographisch induzierten Akzent auf Kontinuität<br />
gegenüber hat Michel Foucault in seiner Archäologie des Wissens ein<br />
genealogisches Lektüreverfahren vorgeschlagen, das auf die Wahrnehmung <strong>von</strong><br />
(Ab)Brüchen setzt; Paul de Man erinnert an »archäologische Fragen, die uns dazu<br />
treiben, die Gegenwart aus der Identifikation der mehr oder weniger unmittelbar<br />
hinter uns liegenden Vergangenheit und dem <strong>von</strong> ihr zur Gegenwart führenden
846 BIISUOTI M-: K<br />
Prozeß abzuleiten«. 8 Ein dose reading des Archivs, auf dem solche Aussagen<br />
beruhen, offenbart allerdings eine höchst fragile Bindung zwischen dem Charakter<br />
einer pragmatischen Handbibliothek des Paulskirchenparlaments und<br />
ihrer diskursiven Überdeterminierung als Nationalbibhothek in statu nascendi.<br />
Schon das Schreiben Hahns vom 15. Juli 1848 wählt eine vom Gedanken der Nationalbibliothek<br />
abweichende Formulierung. 9 Aus den Protokollen der Nationalversammlung<br />
läßt sich nur am Rande ein Beweis <strong>für</strong> emphatisches Interesse<br />
an einer TV^fzow^/bibliothek ableiten ; Praxis des Parlaments<br />
war vielmehr die anliegende Administration des Gegebenen, d. h. die fortlaufende<br />
Bewältigung einer notwendigen infrastrukturellen Standardisierung politisch,<br />
kulturell und ökonomisch heterogener Elemente eines Raums, <strong>von</strong> dem noch<br />
nicht definiert war, inwieweit es sich dabei um Deutschland handelte. Unbehagen<br />
am Begriff der Reichsbibliothek weckt die dies kaum rechtfertigende Quellenlage.<br />
10 Vergangenheit läßt sich als narrativ konsistente Historie nur auf der<br />
Ebene <strong>von</strong> Erzählungen, d. h. historiographisch bereits aufbereiteten Grundlagentexten<br />
behaupten; bei Wiederauflösung der Bausteine solcher Texte in ihre<br />
Archivbestandteile bleibt nichts als ein Flickenteppich <strong>von</strong> Dokumentation,<br />
keine historische Autorität. <strong>Im</strong> Aktenmatenal des Paulskirchenparlaments findet<br />
sich ein Bewerbungsschreiben Plaths um den Posten eines Reichsbibliothekars<br />
gerade nicht - eine weitere Leerstelle im Versuch, das Begriffsphantom<br />
Reichsbibliothek im Raum des Archivs zu fassen. 11 Der in der Frankfurter Stadtbibhothek<br />
aufbewahrte Teil des Nachlasses des Abgeordneten und Mitglieds der<br />
Bibliothekskommission Jucho blieb solange unzugänglich, wie die Akten »noch<br />
in Kisten verpackt« lagerten, bis sie »doch einer Ordnung unterzogen« und damit<br />
adressierbar wurden . So fragil ist das Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Ordnung und Gedächtnis. Vom »Reichsbibhothekar« Johann Heinrich<br />
Plath (Anführungszeichen durch Paust) ist keinerlei handschriftlicher Nachlaß<br />
erhalten geblieben. 12 Die entsprechenden Kartons im Archiv der Deutschen<br />
Bücherei tragen die ambivalente Aufschrift Reichs- und Parlamentsbibliothek<br />
<strong>von</strong> 1848. Der Begriff Reichsbibliothek ist eine eher nachträgliche Zuschreibung;<br />
x<br />
Paul de Man, Shelleys Entstellung, in: ders., Ideologie des Ästhetischen, Frankfurt/M.<br />
1993, hg. v. Christoph Menkc, 147<br />
9<br />
Zitiert nach Ernst Mohrmann, in: Rötzsch 1962: 5<br />
10<br />
Johannes Jacobi, Anmerkungen zur Bibliothek der Deutschen Reichsversammlung<br />
<strong>von</strong> 1848/49, in: Bibliothek als Lebenselixier. Festschrift <strong>für</strong> Gottfried Rost zum 65.<br />
Geb. / Die Deutsche Bibliothek, hg. v. dems. / Erika Tröger, Leipzig u. a. (Die Dt.<br />
Bibliothek) 1996, 47-77 (53f), unter Bezug auf Blum 1990: 124<br />
" Brief Demeters v. 30. März 1935, im Nachlaß Paust, Archiv der Deutschen Bücherei<br />
Leipzig<br />
12<br />
Albert Paust, Dokumente zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsbibliothck <strong>von</strong> 1848 (Typosknpt),<br />
Blatt 3, in: Nachlaß Paust, Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig, 534/7/2
DllvPAUI.SKiRCI li.NI5IIH.IOTl IHK 8 4 7<br />
sie geschieht nach dem Scheitern der Nationalversammlung durch den Bibliothekar<br />
Plath vielmehr im Interesse einer Weiteranstellung durch eine deutsche<br />
Zentralbehörde. 13 Paust beruft sich auf Forschungen im Archiv des Germanischen<br />
Nationalmuseums Nürnberg und der Abteilung Frankfurt des Reichsarchivs,<br />
vor allem auf die Denkschriften Plaths zum Ziele einer Reichsbibliothek<br />
am 7. März 1850 und 7. August 1851 an die Interimistische Bundes-Central-<br />
Commission bzw. an die Deutsche Bundesversammlung. Am 11. Oktober 1851<br />
wird dort Plaths Vorschlag abgelehnt, da sie »die Gründung einer Deutschen<br />
Nationalbibliothek weder als eine Verpflichtung des Deutschen Bundes noch<br />
auch <strong>für</strong> jetzt im nationalen Interesse als ein Bedürfnis« anerkennen kann. 14<br />
Plath, mit der Auflösung des Paulskirchenparlaments ohne Bibliotheksbezug,<br />
weilt bereits Ende Mai 1851 in München, wieder bei wissenschaftlicher Arbeit.<br />
Die reale Lage der Parlamentsbibliothek in der Frankfurter Paulskirche<br />
1848/49 - zu bestimmten Zeiten auch der Öffentlichkeit zugänglich - bildet<br />
im Verbund mit dem gemalten <strong>Im</strong>aginären der Nation ein Triptychon: auf der<br />
Galerie in Schränken aufgestellt, die links und rechts der großen, vorn mit<br />
dem Bild der Germania geschmückten Orgel eingebaut sind.' 3 Der am 25.<br />
Oktober 1848 durch den Parlamentspräsidenten Heinrich v. Gagern verpflichtete<br />
Göttmger Privatdozent und Sinologe Plath erhält die ausdrückliche<br />
Amtsbezeichnung Reichsbibliothekar. Jenseits der <strong>von</strong> volkswirtschaftlichen<br />
oder anderen parlamentarischen Fachausschüssen ausgewählten Literatur msistiert<br />
der Abgeordnete Moritz Hartmann <strong>von</strong> Leitmeritz in der Sitzung am<br />
16. Dezember 1848 auch auf dem Erwerb literarischer N atwnalwerke (etwa<br />
Kaulbachs Reinecke Fuchs); Hartmann nennt ebenso ausdrücklich »unsere<br />
Nationalbibliothek«. 16 Und doch ist die Paulskirchensammlung nicht der<br />
Ursprung, sondern der Gründungsauftrag einer künftigen, zu begründende<br />
Reichsbibhothek . Mit dieser archc, die<br />
Ursprung als Order und als deren Transmission definiert, korrespondiert auch<br />
das Argument der Portofreiheit <strong>für</strong> entsprechende Bücherlieferungen, wobei<br />
13 Jacobi 1996: 66f. Zu Plath siehe: Herbert Franke, Zur Biographie <strong>von</strong> Johann Heinrich<br />
Plath (1802-1874), München 1960 (Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften),<br />
sowie die Korrespondenz Albert Pausts mit Archivrat Demeter im Reichsarchiv,<br />
Abteilung Frankfurt/M.<br />
14 Zitiert nach: Albert Paust, Die Reichsbibliothek <strong>von</strong> 1848 und die Deutsche Bücherei,<br />
Leipzig (Gesellschalt der Freunde der Deutschen Bücherei) 1938, 7. Siehe Protokolle<br />
der Deutschen Bundesversammlung vom Jahre 1851, Frankfurt/M. 1852, 434-437<br />
15 Gerhard Hahn, Die Reichstagsbibliothek zu Berlin - ein Spiegel deutscher <strong>Geschichte</strong>,<br />
Düsseldorf (Droste) 1997, 29, unter Bezug (u. a.) auf H. Bauer, »Gebundene« Zeugen<br />
der 48er Jahre. Besuch in der Bibliothek der Paulskirche, in: Neues Deutschland v. 28.<br />
Februar 1948<br />
16 Hahn 1997: 31, unter Bezug auf:Verhandlungen, Bd. VI.5, Nr. 137, 4138
848 BlBI.lOTHKK<br />
Reich hier die Reichweite der arche, des Gründungsakts selbst bedeutet, und<br />
die Nation ein postalisch definierter Raum. Carl Bernhardi, seit 1830 Nachfolgerjacob<br />
Grimms als Leiter der Kasseler Landesbibliothek und 1848/49 Mitglied<br />
der Frankfurter Bibliothekskommission, hatte mit einem Schreiben vom<br />
18. Oktober 1843 - erfolglos - der Preußischen Akademie der Wissenschalten<br />
in Berlin den Vorschlag einer deutschen Nationalbibhothek unterbreitet. Den<br />
Grundstock soll der Ankauf der Gotheschen Sammlung zu Weimar bilden; die<br />
eigentliche Grundlage aber wäre ein beim preußischen König zu erwirkendes<br />
Pflichtexemplargesetz nach französischem Vorbild gewesen, wo das depöt legal<br />
nicht historischem Bewußtsein, sondern der Ablieferung <strong>von</strong> Zensurcxemplaren<br />
zur Erlangung staatlicher Druckerlaubnis entsprang. Anlaß zu Bernhardis<br />
Vorstoß war die Einsicht in die infrastrukturell gesetzte Wissensbeschaffungsgrenze<br />
seines eigenen Versuchs gewesen, eine Sprachkarte <strong>von</strong> Deutschland zu<br />
erarbeiten: »daß die vorhandene Literatur unserer deutschen Mundarten meist<br />
in Gelegenheitsschriften besteht, oder in örtlichen Zeitschriften zerstreut ist,<br />
welche weder durch den Buchhandel zu erlangen sind, noch in öffentlichen<br />
Bibliotheken gesammelt zu werden pflegen.« 17 Das Gedächtnis der angedachten<br />
Bibliothek in ihrer Materialität generiert dann zugleich den symbolischen<br />
Raum ihrer Verzeichnung:<br />
»Die jährlich im Druck erscheinende und erst dann recht vollständig herzustellende<br />
Bibliographie <strong>von</strong> Deutschland bildete ja den Katalog, so daß die meisten<br />
Arbeiten durch Schreiber versehen werden könnten, welche den richtigen Eingang<br />
zu überwachen, <strong>für</strong> den Einband zu sorgen und bei der Aufstellung und Benutzung<br />
der Bücher Hülfe zu leisten hätten.« <br />
Unter der Aufsicht eines wissenschaftlich gebildeten Mannes könne diese Form<br />
<strong>von</strong> Aufzeichnung also durch Kräfte versehen werden, die gerade nicht hermeneutisch,<br />
sondern mechanisch auf das schauen, was sie sehen. 18 Deutschland<br />
konstituiert sich hier als Registrierung seines in Büchern gebundenen Geistes,<br />
als Bibliographie - ein Übertragungsmedium, mit dem »der Nachwelt das schönste<br />
Denkmal der geistigen Einheit Deutschlands überliefert werden« könne<br />
. Bernhardis Worte nehmen vorweg, was in Form der Deut-<br />
17 Joachim Rex, Karl Bernhardis Gedanken zur Errichtung einer deutsche Nationalbibliothek<br />
in der Periode des Hcranreifcns der bürgerlich-demokratischen Revolution<br />
(1843), in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 81 (1967) 9, 530-535 (532), unter Bezug<br />
auf: Archiv der (seinerzeitigen) Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin<br />
(jetzt Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Bestand AAW II: VI e,<br />
Bd. 7, Bl. 272f<br />
18 In Anspielung auf Herman Melville, Bartleby the Scrivener. A Story of Wall-Street<br />
(1853), dt. Ausgabe Stuttgart (Reclam) 1985
DIK PAUI.SKIRCHKNISIBUOTHUK 849<br />
sehen Bücherei in Leipzig 1913/16 Architektur wird: »eine so großartige literarische<br />
Walhalla«. So formuliert sich in der Semantik des <strong>Im</strong>aginären, was auf<br />
einer Setzung im Symbolischen ruht, auf Copyright als Gesetz: »Der deutsche<br />
Buchhandel ist durch die Maaßregeln des Bundestages zur Sicherstellung des<br />
literarischen Eigenthums in der neueren Zeit bedeutend gehoben worden«<br />
. Ein vom Akademiemitglied Jacob Grimm ausgearbeitetes Gutachten<br />
lehnt Bernhardis Ersuchen ab und möchte die vom existierenden Bibliotheksnetz<br />
zu sammelnde Literatur auf das Wertvolle, also eine Auswahl beschränkt<br />
wissen: »Wozu die übervollständige Anhäufung des Mittelmäßigen und Schlechten?«<br />
19 Die Akademie befaßt sich nicht in dem Maße mit der Frage einer Nationalbibhothek,<br />
wie sie sich 1819 und 1821 auf Wunsch des Staatskanzlers <strong>von</strong><br />
Hardenberg mit der Archivfrage auseinandergesetzt hat. Dem Staat steht das<br />
systeminterne Gedächtnis der Administration näher als kulturwissenschaftliche<br />
Dokumentation. Ein Brief der parlamentarischen Bibliothekskommission vom<br />
19. April 1849 an das Präsidium der verfassungsgebenden Nationalversammlung,<br />
<strong>von</strong> R. Bernhardi, G. R. Groß und Jordan unterzeichnet, trifft das fragile<br />
Verhältnis <strong>von</strong> Bibliothek und Revolutionsgedächtnis. »Möge nun die Bibliothek<br />
eine Parlamentsbibliothek bleiben, oder, wie wir noch immer hoffen<br />
, zu einer Reichsbibliothek erhoben werden« (das Erhabene der Nation<br />
nobilitiert den Arbeitsspeicher der Gegenwart): Mit Blick auf den demnächstigen<br />
Geschichtsforscher (also bereits im Begriff der vergangenen Zukunft) fordern<br />
die Unterzeichner Geldmittel zum Kauf <strong>von</strong> Flugschriften, Karikaturen »und<br />
ähnlichen Erzeugnissen des Volksgeistes«, wie sie <strong>von</strong> den regulären Druckereien<br />
und dem regelmäßigen Buchhandel der Paulskirchenbibliothek nicht<br />
geliefert werden; das Volk wählt sich seine eigenen Medien. Die Sammlung der<br />
Bücher, als die symbolische Versammlung der literarisch faßbaren Nation,<br />
wird bereits zur Funktion der Selbsthistorisierung des Parlaments; erst die<br />
Aufspeicherung <strong>von</strong> Zeitgeschehen im Medium Gutenbergs macht es möglich,<br />
es als Zeitgeschichte zu reflektieren. »So kann es kaum zweifelhaft bleiben, daß<br />
die <strong>Geschichte</strong> des Jahres 1848 und namentlich die <strong>Geschichte</strong> der deutschen<br />
Nationalversammlung derjenige Teil der Zeitgeschichte ist, über welche in<br />
der Parlamentsbibhotek alle Quellen möglichst vollständig sein sollten« .<br />
Das Büro der Nationalversammlung soll daher den Bibliothekar beauftragen,<br />
eine solche möglichst vollständige Sammlung anzulegen 20 - ein Denkmal der<br />
19 AAW II: VI e, Bd 7, Bl. 277, zitiert nach: Rcx 1967: 533<br />
20 Zitiert nach Hahn 1997: 32, und Anm. 15: »Das Schreiben befand sich im Nachlaß-<br />
Archiv <strong>von</strong> Friedrich Carl Biedermann m Leipzig, des Schriftführers und Vizepräsidenten<br />
der Nationalversammlung. die Abschrift wird im Hausarchiv der<br />
Deutschen Bibliothek in Leipzig verwahrt«, konkret in der Abschrift des Nachlasses<br />
<strong>von</strong> Albert Paust (Typoskript)
850 BlBLlOTHUK<br />
deutseben Einheit, wie es Albert Paust retrospektiv bezeichnet 21 , oder vielmehr<br />
ein wissensarchäologisches Monument? Der in dreißig Gebiete differenzierte<br />
Realkatalog der Paulskirchenbibliothek ist auf die tatsächliche Parlamentsarbeit<br />
zugeschnitten und dient der sachlichen Aufstellung der Werke ,<br />
darunter - parataktisch in Serie gestellt, nicht hierarchisiert - IV. Jurisprudenz,<br />
V. Staatswissenschaften, VI. Statistik und VII. <strong>Geschichte</strong>. Diese funktionale<br />
Ordnung (die Vektoren des Katalogs) dementiert in der Praxis die diskursive<br />
Verhandlung der Bibliothek als nationales Symbol, bzw. sie definiert den Begriff<br />
der Nation <strong>von</strong> ihrer non-diskursivcn Infrastruktur her: Gesetze, Verfassungen,<br />
Adreßbücher (III.).<br />
Von der Auflösung des Parlaments hat sich dessen Bibliothek nicht mehr<br />
erholt. Bei ihrer anschließenden Lagerung des realen Bestands im Germanischen<br />
Nationalmuseuni Nürnberg firmieren die Bücher denn auch nicht als Reichsund<br />
nicht als National-, sondern schlicht als Deutsche Parlementsbibliothek.<br />
Nach der Übergabe dieses Bestands an die Deutsche Bücherei in Leipzig 1938<br />
wird sie in deren Sitzungszimmer gesondert verwahrt - zugleich als Datenbank<br />
<strong>von</strong> 1848 wie auch als Museumsstück hinter Glas, im double-bind <strong>von</strong> Monument<br />
(funktionale Parlamentsbibliothek) und Dokument (historische Erinnerung<br />
an Anfänge einer deutschen Nationalbibliothek). Das eigentlich wissensarchäologische<br />
Monument aber ist der Originalkatalog aus fünf in Leder gebundenen<br />
Blockbänden in Queroktav als Format des Gedächtnisses. Seine Ordnung wird<br />
in Leipzig nicht fortgeführt. Obgleich die Frankfurter Bestände in Leipzig eine<br />
Art nachträglichen Grundstein der eigenen Institution darstellen sollen und<br />
historische Kontinuität suggerieren, markieren sie als Aussagesockel doch genau<br />
deren Dementi. Denn die Zwischenglieder dieser Kette fehlen. Beim Beschluß<br />
des deutschen Reichstages vom November 1871, eine Parlamentsbibliothek zu<br />
gründen, hatten Reichstagspräsident Eduard Simson, der frühere Präsident der<br />
Nationalversammlung <strong>von</strong> Dezember 1848 bis Mai 1849) und spätere Präsident<br />
des Norddeutschen Bundes (1867-1870), sowie die 21 anderen Abgeordneten des<br />
Reichstages, die bereits Mitglieder des Paulskirchenparlaments gewesen waren,<br />
die Bibliothek aus der Zeit des demokratischen Aufbruchs »offenbar vergessen;<br />
vielleicht fehlte ihnen in Berlin auch die Kenntnis über den Verbleib der Bibliothek«<br />
. Ein Gedächtnis, das nicht adressierbar ist, sagt nicht(s)<br />
aus. Die nach 1938 nach Leipzig gelangten Bestände der Parlamentsbibliothek<br />
werden dort neu katalogisiert und im Hauptkatalogen der Deutschen Bücherei<br />
nachgewiesen - ein wissensarchäologisch nachträglicher re-entry ins bibliothekarische<br />
Universum. »Damit sind sie <strong>für</strong> die allgemeine Benutzung erschlossen<br />
21 Alben Paust, Km Wegbereiter der Deutschen Bücherei, in: Börsenblatt (Leipziger<br />
Ausgabe) 119 (1952), 34/35, 611
Du-PAUI.SMRCHKNBIBLIOTHHK 851<br />
worden, was umso wichtiger ist, da infolge der Kriegsverluste der deutschen Bibliotheken<br />
manche Veröffentlichungen nur noch hier vorhanden sind.« .<br />
<strong>Im</strong> <strong>Namen</strong> der Nation<br />
Name und Referent: Der Titel Bibhotheque Nationale de France »mag einleuchtend<br />
sein, wenngleich der Begriff des Nationalen im Laufe der Jahrhunderte<br />
durchaus seine Bedeutung gewechselt hat. Die Funktionen der Library of Congress<br />
dagegen sind durch deren <strong>Namen</strong> nicht gedeckt«. 22 Den frühesten Ansatz<br />
mit der Bezeichnung Nationalbibhothek findet Kaltwasser in München 1802 <strong>für</strong><br />
die Münchner Hofbibliothek; er wird so zunächst <strong>von</strong> Kur<strong>für</strong>st Max IV. Joseph<br />
(1756-1825), dem späteren König verwendet, wenngleich offenbar semantisch<br />
anders kodiert. In einem Bericht das Buch er ausleihen betreffend der Hofbibliothek<br />
vom 18. Februar 1802 an das Kur<strong>für</strong>stliche geistliche Ministerialdepartement<br />
ist als Hauptzweck dieser Hof- und Nationalbibiothek definiert, »die nationale<br />
Bildung zu befördern und allen Wißbegierigen die nöthigen Hilfsquellen zu öffnen«<br />
. Eine analoge Funktion erfüllen die<br />
Bezeichnungen Natwnalhteratur und Nationaltheater seit Ende des 18. Jahrhunderts;<br />
Ziel ist jeweils die Bildung eines nationalen Bewußtseins, des Nationalgeists.<br />
Schiller wünscht 1784 in seinem Vortrag Die Schaubühne als eine moralische<br />
Anstalt betrachtet »eine Nationalbühne zu haben, so würden wir auch eine<br />
Nation« . Nach 1800 erhält das Beiwort national unter Bezug auf<br />
Frankreich eine antimonarchische Konnotation; der Bericht über die Benennung<br />
Nationalbibliothek vom 29. Oktober 1803 zur Weiterführung der Bezeichnung<br />
Nationalbibiothek <strong>für</strong> die Münchner Hofbibliothek vom 29. Oktober 1803 bleibt<br />
dementsprechend erfolglos. Seitdem zirkuliert diese Begriffsmünze dort nicht<br />
mehr. Anders die Außenperspektive; Edward Wilberforce fragt im Kapitel »The<br />
Royal Library« seines Buchs Social Life in Munich: »Why is it called Royal? <br />
it is more public in its nature than the British Museum which pretends to no such<br />
exalted titles«, den in München war die Benutzung auch ohne Empfehlungsschreiben<br />
möglich . Am 7. Juni 1836 legt Antonio Panizzi seine<br />
Gedanken über den Ausbau der Bibliothek des British Museum (British Library)<br />
vor: »In regard to extent it is a very extensive library, no doubt, absolutely spea-<br />
- J Franz Georg Kaltwasser, Von der »Bibliothequc du Roi« in Paris über die »(.'Kur<strong>für</strong>stliche<br />
Hof- und Nationalbibliothek« in München zur »Staatsbibliothek zu Berlin<br />
- Preußischer Kulturbesitz«. Über die <strong>Namen</strong> großer Forschungsbibliotheken, in:<br />
Daniela Lülfing / Günter Baron (Hg.), Tradition und Wandel: Festschrift <strong>für</strong> Richard<br />
Landwehrmeyer, Berlin (Staatsbibliothek) 1995, 67-81 (67)
852 BllH.IOTHUK.<br />
king; but as a national establishment forthis nation it is very poor.« 23 Panizzi definiert<br />
die unterschiedlichen Sammelprinzipien <strong>von</strong> Universitats- und Forschungsbibliotheken;<br />
<strong>für</strong> die Bibliothek des British Museum bevorzugt er gegenüber<br />
allgemeinen zeitgenössischen Werken »rare, ephemeral, voluminous and costly<br />
publications, which cannot be found any where eise, by persons not having access<br />
to great private collections« . Die Sammlung heißt, der enzyklopädischen<br />
Tradition der Kombination <strong>von</strong> Museum und Bibliothek folgend, British<br />
Museum Library, bis ein Parlamentsakt 1973 die Gründung der autonomen, durch<br />
den bestimmten Artikel markierten The British Library formahsiert. Nach Ende<br />
des Ersten Weltkrieges stellt sich in Wien die Frage einer Neubenennung der k. k.<br />
Hofbibliothek. Es folgt eine Eingabe der Hofbibliothek betreffend <strong>Namen</strong>sänderung<br />
in Nationalbibliothek vom 28. Juni 1920, Abt. II, nachdem <strong>Namen</strong> wie<br />
Staats-Zentral-Bibliothek oder Bundesbibliothek verworfen wurden:<br />
»Alle diese Erwägungen veranlassen die Direktion den Titel >National-Bibliothek<<br />
vorzuschlagen. Gewiss bestehen auch gegen ihn manche Einwände, und es wurde<br />
zum Beispiel <strong>von</strong> einigen Beamten der Bibliothek darauf hingewiesen, dass eine<br />
österreichische Nation< nicht existiere, ja dieser <strong>Namen</strong> sogar den künftigen<br />
Anschluss an Deutschland hemmen könnte. Es hat auch bis heute Niemand<br />
daran Anstoss genommen, dass neben dem germanischen Nationalmuseum ein<br />
bayrisches Nationalmuseum in München besteht.«<br />
Die Direktion begründet die <strong>Namen</strong>sgebung ferner mit der Ansicht, daß diese<br />
Bibliothek über den Rahmen als Hauptbibliothek Österreichs hinaus<br />
»ein Sammelpunkt <strong>für</strong> die nationale Literatur jener deutschen Stämme sein müssen,<br />
die jetzt unter fremdnationalc Herrschaft gekommen sind, besonders der kleinen<br />
Splitter, in den östlich und südlich gelegenen Staaten, also in Jugoslavien,<br />
Rumänien, Ungarn (das heute nicht mehr unmittelbar mit deutschem Geiste in<br />
Berühung steht wie früher), in Polen, aber auch und das vielleicht in besonderem<br />
Masse, in Italien, das Deutschsüdtirol und deutsche Teile Kärntcns annektiert hat.<br />
Die ausserordentliche Wichtigkeit dieser Frage ist gar nicht zu verkennen, sie<br />
wurde auch auf dem deutschen Bibliothekarstag in Weimar verhandelt . Hier<br />
ist aber dann >nationale< Arbeit im eigentlichsten Sinne des Wortes.« <br />
Am Ende steht in Deutschland Die Deutsche Bibliothek, aus der Deutschen<br />
Bibliothek in Frankfurt/M. und der Deutschen Bücherei in Leipzig nach der<br />
deutschen Wiedervereinigung zu einer Einrichtung zusammengeführt, »freilich<br />
an zwei Orten« (Kaltwasser). Der Beirat dieser Altneu-Bibliothek diskutierte die<br />
Frage der <strong>Namen</strong>sgebung auf seiner Sitzung am 23. Oktober 1990, wo der Name<br />
Bundesbibliothek kurz erörtert und dann als zu nichtssagend verworfen wurde.<br />
23 British Museum, Reports from committeees, London Bd. X 1836, 388, zitiert nach:<br />
Kaltwasser 1995: 76
Du PAUI.SKIRCHHNBIBUOTHKK 853<br />
Der Name Nationalbibliothek wurde in Erwägung gezogen, dann aber abgelehnt,<br />
da er der historischen Bibliotheksentwicklung in Deutschland nicht entspräche.<br />
Entgegen seiner möglichen wissensarchäologischen Begründung (in)<br />
der Paulskirchen-Parlamentsbibliothek gilt der Begriff als mißverständlich, da<br />
die Sammlungen der Bibliothek zwar deutschsprachig, aber länderübergreifend<br />
seien. So blieb es beim <strong>Namen</strong> Deutsche Bibliothek »unter nachträglicher Hinzufügung<br />
eines <strong>für</strong> den deutschen Sprachgebrauch etwas ungewöhnlichen >Die
854 BlBI.lOTHF.K<br />
Phantom, Geist - das deutsche Gedächtnis, ein Medienverbund, wie er sich in<br />
Archiv, Bibliothek und Museum institutionell vcrdinghcht. Als durch den Freiherrn<br />
v. Aufseß im Nürnberger Nationalmuseum ein Gesamtrepertorium, also<br />
ein Standortnachweis des Quellenmatenals zur deutschen <strong>Geschichte</strong> (Archiv),<br />
Literatur (Bibliothek) und Kunst (Museum) vorgesehen wird, ist daran die Idee<br />
einer »deutsch-historischen Nationalbibliothek« ausdrücklich gekoppelt,<br />
beschränkt auf die Zeit Karls des Großen bis zum Jahre 1650 (das Ende des<br />
30jähngen Krieges und die Durchsetzung der Reformation). Medium dieser<br />
Repcrtorisicrung ist eine doppelte Buch(nachweis)führung: Ein alphabetischer<br />
und mehrere detaillierte Sachkataloge erschließen den tatsächlich vorliegenden<br />
Eigenbestand, und als Teil des nationalen Dokumentationsprojekts entsteht in<br />
der Bibliothek das Generalrepertonum der Literatur als Zentralkatalog <strong>für</strong><br />
Handschriften und Drucke. Aufseß< Schwiegersohn Johann Caspar Beeg weilt<br />
1853 im dessen Auftrag in Frankfurt, um bei der Bundesversammlung die Anerkennung<br />
des Nürnberger Museums als nationale Institution vorzubereiten. Bei<br />
seiner Rückkehr nach Nürnberg bringt er die bis dahin erschienenen zehn Bände<br />
der Monumenta Germaniae Historica aus dem Bestand der ehemaligen Nationalbibliothek<br />
<strong>für</strong> die Bibliothek des Germanischen Museums mit, wo dieser Titel<br />
in der Bibliothek Aufseß zwar materiell, aber nicht auf der Informationsebene<br />
fehlte: Er war als ein besonderes Desideratum vorgemerkt, »und in der laufende<br />
Zählung des Standorts war eine Nummer da<strong>für</strong> ausgespart worden, so dass das<br />
Frankfurter Exemplar, Stiftung des Verlegers an die geplante Nationalbibliothek,<br />
dem Nürnberger Bestand sofort eingereiht werden konnte« .<br />
Vor allem diese Monumenta aber tauchen - als Widmungsexemplare <strong>von</strong> Aufseß<<br />
- im Museumskatalog später nicht auf und verbleiben bis heute, separiert<br />
<strong>von</strong> der Paulskirchenbibliothek, im Nürnberger Haus. Beeg reist wenig später,<br />
April 1853, zur Frühjahrsmesse nach Leipzig, um bei der Generalvertretung des<br />
deutschen Buchhandels da<strong>für</strong> zu werben, einschlägige Werke dem nationalen<br />
Unternehmen Germanisches Nationalmuscum als Geschenk zu überlassen. Ein<br />
erstes Rundschreiben des Museums vom 8. Juli 1853 ergeht an deutsche Verlagsbuchhandlungen<br />
mit der Bitte, sich zur kostenlosen Abgabe aller der Titel<br />
aus den laufenden Vcrlagsprogrammcn zu verpflichten, die thematisch in seinen<br />
Sammclbereich gehören. Hahn, ehedem schon Stifter der Frankfurter Parlamentsbibliothek,<br />
stellt die Produkte seines Verlags auch diesem grossen vaterländischen<br />
Institute zur Verfügung, und im Briefwechsel mit Aufseß veranlaßt<br />
ihn die Mitteilung <strong>von</strong> der Übergabe seines Frankfurter Exemplares der Monumenta<br />
nach Nürnberg zu der Bemerkung, dort habe es nun »den schönsten<br />
Ehrenplatz in ganz Deutschland erhalten« . Hier<br />
schreibt sich, buchstäblich, der zugleich monumentale, wissensarchäologisch diskrete<br />
und diskursive, national symbolisch kodierte Stellenwert dieser Edition.
Du-PAULSKIRCHI-:NBIBUOTHI-K . 855<br />
Der Frankfurter Reichsbibliothekar Plath hatte seinen Bestand beharrlich zu<br />
»einer lebendigen Litcrärgcschichtc Deutschlands« werden lassen und zugleich<br />
als »Denkmal der deutschen Einheit« darstellten wollen . Als im April 1855 dieser Bestand aus Nachschlagewerken, Lehrbüchern,<br />
Fachzeitschriften, Klassikerausgaben, Unterhaltungsliteratur und politischen<br />
Broschüren ans Germanische Nationalmuseum migriert 24 , werden<br />
entsprechend dem Konzept der dortigen Bibliothek aus dem ehemaligen Frankfurter<br />
Bestand »die etwa 200 inhaltlich einschlägigen Titel <strong>für</strong> die deutschhistorische<br />
Nationalbibliothek< ausgewählt, hier eingereiht und in die Kataloge<br />
eingearbeitet« - nur zum Teil eine funktional-symbolische<br />
Einbindung in die laufende Wissensarbeit also. Der Gedächtniswert dieser<br />
Bibliothek lag nicht im Wissenswert der individuellen Bucheinheiten, sondern<br />
in der Morphologie des Gesamtbestands als Anspruch einer Nationalbibliothek:<br />
»Doch konnten die allen Wissenschaften, allen Zweigen der Literatur angehörenden<br />
Bücher nicht sofort sämmtlich in die deutsch-historische, vorläufig die Zeit<br />
nach 1650 noch nicht berücksichtigende Bibliothek des Museums eingereiht werden.<br />
Einstweilen geschah dies mit etwa einem Sechstel des Ganzen, während der<br />
übrige größere Theil in derselben Anordnung, welche ihr in Frankfurt <strong>von</strong> dem<br />
provisorischen Bibliothekar der Nationalversammlung gegeben war, gesondert<br />
unter der Bezeichnung >Parlamcntsbibliothek< aufgestellt wurde.« 23<br />
Vibrierend zwischen ihrem konkreten Wissensgehalt und ihrer Funktion als<br />
nationalem Semiophorcn, wird die Parlamentsbibhothek also teihntegncrt:<br />
keine ideologische, sondern eine Ordnungsfrage, ein Dilemma zwischen Wissensarchäologie<br />
und historischem Bewußtsein. Bibliotheken oder Sammlungen,<br />
die die Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums als Ganzes erworben<br />
hat, sind in der Regel nicht als eine besondere Einheit im Katalog verzeichnet;<br />
vielmehr finden sich die einzelnen Werke ohne Beachtung ihrer Provenienz an<br />
den Sachstellen verzeichnet, die ihrem Inhalt entsprechen 26 - Suprematie <strong>von</strong><br />
Betreff über Herkunft. Die gesamte deutsch-historische Nationalbibliothek war<br />
ohne sachliche Untergliederung nach numerus currens aufgestellt; gesondert<br />
fanden sich allein Spezialbestände (Handschriften, frühe Drucke und Musikalien,<br />
Schriften der Akademien und historischen Vereine) sowie, neben der<br />
Frankfurter Parlamentsbibliothek, die gestiftete Privatbibliothek Wilhelmi,<br />
beide jedoch mit der genannten Ausnahme <strong>von</strong> in den Hauptbestand eingeghe-<br />
24 Albert Paust, Zum fünfundsiebzigjährigen Bestehen des Germanischen Nationalmuseums,<br />
in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel, Jg. 94, Nr. 190 u. 208 (1927), 1<br />
25 E. Hektor (Bibliothekssekretär des GNM), <strong>Geschichte</strong> des germanischen Museums<br />
<strong>von</strong> seinem Ursprünge bis zum Jahre 1862, Nürnberg 1863, 37<br />
26 Peter Kittel, Die Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz und ihr Alter<br />
Realkatalog, Berlin (SBB PK) 1994, 14
856 BlBUOTHI-K.<br />
derten (kultur-)histonschen Werken. Als Hauptkatalog dient im Germanischen<br />
Museum der Alphabetische Katalog, der seit 1855 im Druck erscheint (denn das<br />
durch v. Aufseß <strong>für</strong> das GNM vorgesehene Medium deutschen Gedächtnisses<br />
heißt Reproduktion). »Eine sachliche Gliederung erfolgte allein durch Kataloge,<br />
nicht bereits durch die Aufstellung« . Der Systematische Katalog<br />
folgte dabei dem <strong>für</strong> alle Sammlungen des Hauses verbindlichen System der<br />
deutschen Geschichts- und Altertumskunde <strong>von</strong> Aufseß'. Drei Schlagwortkataloge<br />
nach Personen, topographischen Begriffen und nach Sachen nehmen nicht<br />
nur selbständige Schriften, sondern auch Aufsätze und einzelne Kapitel <strong>von</strong><br />
Gesamtwerken auf. Die äußere Form der Blätter in den Sachkatalogen ist<br />
medienarchäologisch durch eine 1855 erschienene Schrift Johann Georg<br />
Seizingcrs überliefert, der dort einmal als Bibliothekssekretär diente und im<br />
Formular-Anhang seines Werks, das nicht <strong>von</strong> ungefähr den Klartextnamen<br />
Bibliothekstechmk trägt, ausschließlich Beispiele dieses Hauses veröffentlicht.<br />
Em gleichartiges Katalogsystem war <strong>für</strong> das Generalrepertonum der Literatur<br />
geplant, ein Dokumentationssystem bzw. Zentralkatalog (nach damaligem<br />
Begriff ein Idealkatalog). Über die eigenverzettelten Bestände aus gedruckten<br />
Verzeichnissen hinaus sucht man durch Adressierung der deutschen Staatsregierungen<br />
den Zugang zu den einzelnen Bibliotheken und erbittet <strong>von</strong> ihnen<br />
Verzeichnisse bisher nicht veröffentlichter Handschriftenbestände; folgerichtig<br />
scheitert das Nürnberger Bibliotheksprojekt am Widerspruch zwischen der<br />
Dimensionen dieser Aufgabe und den damaligen Möglichkeiten einer praktischen<br />
Durchführung - »ein Jahrhundert vor dem bibiothekarischen Einsatz des<br />
Computers, in einer Zeit ohne Hilfsmittel wie Fotokopien und Schreibmaschine«<br />
. Kommunikative und politische Infrastruktur (Post,<br />
föderative Staatlichkeit) bilden das Dispositiv des Gedächtnisplans, doch nur,<br />
wenn es <strong>von</strong> beschleunigten Medien frequentiert wird, ist seine Reich(s)weite<br />
realisierbar. Die Satzungsänderung des Germanischen Nationalmuseums <strong>von</strong><br />
1870 gibt das Konzept des Generalrepertoriums auf, womit die ursprünglich<br />
geplante Funktion des Hauses »als eine Art nationales Dokumentationszentrum<br />
<strong>für</strong> deutsche <strong>Geschichte</strong> und Kulturgeschichte« entfällt . Ist<br />
das politische Datum dieser Ruptur, die Reichsgründung, auch das wissenspoetische<br />
Datum einer neuen Bmnenorganisation des deutschen Gedächtnisses,<br />
oder schreibt diese Ruptur sich nicht schon vorher, als Monument der<br />
Asymmetrie, der Diskontinuitäten zwischen den eher medienentwicklungsbestimmten<br />
Rhythmen <strong>von</strong> Gedächtnisadministration und politischer <strong>Geschichte</strong>,<br />
zwischen Medienarchäologie und Historie? Gewiß zeitigt die Konstruktion der<br />
Reichseinigung 1871 Effekte auf dem Gebiet der Kultur(=)speicher, denn<br />
Preußen muß, im Tausch <strong>für</strong> die politische und militärische Unterordnung der<br />
24 Bundesstaaten, denselben weitgehende Autonomie auf kulturellem Gebiet
Du- PAUI.SKIRCHI-NBIBI.IOTHI-K 857<br />
zusichern. Der Schwerpunkt der Nürnberger Register aber liegt nach der<br />
1870er Satzungsänderung auf der Katalogisierung der eigenen, tatsächlichen<br />
Bestände; keine virtuelle Datenbank Deutschlands mehr liegt vor Augen oder<br />
in Sichtweite. Die Bibliothek wächst selbstläuferisch mit der Kontinuität ihrer<br />
Verlagsspenden, und als um 1880 die Institution einer deutschen Nationalbibliothek<br />
wiederum zur Diskussion gestellt wird, weist Petzholdt auf die<br />
Bestände des Nationalmuscums hin, mit der »ein sehr gedeihlicher Anfang<br />
gemacht« worden sei . Dasselbe 19. Jahrhundert,<br />
das die materielle Dimension der gedächtnisspeichernden Dinge archivisch,<br />
bibliothekarisch und museologisch <strong>für</strong> sich entdeckt, erlöst sie auch <strong>von</strong> dieser<br />
Bindung, indem sie deren Wissen in das Reich typographischer und visuell<br />
reproduzierter Verbindlichkeiten (Buchdruck und Bildarsenale) überführt.<br />
Fortan konstituiert sich das Nationale weniger in den Objekten denn in der<br />
medialen Dissemination. Die diesbezügliche Analogie <strong>von</strong> Deutscher Bücherei<br />
Leipzig und Germanischem Nationalmuseum Nürnberg liegt auf der Hand;<br />
durch nationale Wirren hindurch betrachten beide sich auch <strong>für</strong> die österreichisch-ungarische<br />
Doppelmonarchie, die Schweiz und das Großherzogtum<br />
Luxemburg zuständig. Was hier an Büchern eintrifft, sind dort die kulturhistorischen<br />
Musealien, so daß der nationale Anspruch mit dem staatlichen Träger<br />
nicht zur Deckung kommt. Beschränkt war die Paulskirchenbibhothek auf die<br />
politischen Grenzen des geplanten deutschen Reiches. Die Deutsche Bücherei<br />
speicherte demgegenüber deutschsprachiges Schrifttum der ganzen Welt: Transzendenz<br />
der Nation im Medium ihrer Übertragung.<br />
Bibhothekstransfer 1938: Mythos und archivische Evidenz im Widerstreit<br />
In einem Artikel des Fachorgans Börsenblatt (Nr. 181 v. 9. Juni 1938) verkündet<br />
Paust die Übereignung der Reichsbibliothek <strong>von</strong> 1848 an die Deutsche<br />
Bücherei. Der Bibliothekar Heerwagen vom Germanischen Nationalmuseum hält<br />
- ganz unter dem Eindruck des als Wiedervereinigung definierten Anschlusses<br />
Österreichs mit Deutschland - die Rede zur Feier in Leipzig und betont die Nähe<br />
beider Institutionen. 1849 waren die Bemühungen der Deutschen Nationalversammlung<br />
in Frankfurt zunichte geworden, »aber 1938 hat sich durch die Großtat<br />
des Führers ein alter Traum deutscher Sehnsucht noch erfüllen dürfen. Großdeutschland<br />
ist wieder auferstanden. Wir knüpfen an sein kraftvolles Symbol an«<br />
. In der Tat läßt sich nur symbolisch, im Diskurs einer ideologieanfälligen<br />
Historie, durch Berufung auf die Geschicke der Frankfurter Parlamentsbibliothek<br />
narrativ eine Kontinuität knüpfen, die de facto dementiert wurde<br />
durch ihr Vergessen <strong>von</strong> Seiten der Gründungsväter der Deutschen Bücherei.<br />
Kaum ist sie aber tatsächlich gegründet, kommt die Erinnerung; Gedächtnisa-
858 ' Bim.ioTiiHK<br />
genturen haben eine autopoietische Logik. Der Leipziger Direktor Heinrich<br />
Uhlendahl markiert schon kurz nach seinem Amtsantritt (1924) sein Anliegen, in<br />
den Besitz der Frankfurter Bibliothek zu gelangen; seine Kenntnis zieht er aus den<br />
Akten des Gründungsdirektors der Deutschen Bücherei, Gustav Wahl (1913-<br />
1917). Das Begehren hat seinen <strong>Im</strong>puls nicht in einer nur diffus zu definierenden<br />
kollektiven Erinnerung, sondern in der Konsequenz des Kurzzeitgedächtnisses<br />
<strong>von</strong> administrativen Registraturen.<br />
Das Germanische Nationalmuseum übereignet am 15. Mai 1938 in einem Festakt<br />
den Bestand P.irlament.sbibliothck als Jubiläumsgabe zum 25jähngcn Bestehen<br />
der nunmehr dem Propagandaministerium unterstehenden Leipziger<br />
Deutschen Bücherei, nachdem Mitgliedern des Verwaltungsrats des Germanischen<br />
Nationalmuseums im März dahingehend interveniert hatten. Die rituelle<br />
Logik äußerlicher Kalenderdaten, der Schauplatz des Jahres 1938, triggert mnemische<br />
Energie: »Es war ein eigenartiges Zusammentreffen, daß dies im gleichen<br />
Jahre geschah, in dem durch die Heimkehr Österreichs und des Sudetenlandes die<br />
großdeutschen Hoffnungen <strong>von</strong> 1848 ihre Erfüllung fanden«. 27 Verfolgen wir das<br />
Erscheinen dieser Aussage auf gedächtnisbctnebsinterner Ebene, in Aktenfaszikel<br />
Az/NA 534/7 Bd. 1. des Archivs der Deutschen Bücherei. Blatt 10 gibt unter<br />
dem Aktenzeichen Dir.276/38 vom 14. März 1938 ein Schreiben <strong>von</strong> Direktor<br />
Uhlendahl an den Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek Buttmann<br />
zu lesen, der sich <strong>für</strong> die Überlassung der Nürnberger Parlamentsbibliothek an<br />
die Leipziger Bücherei einsetzte. Auch Uhlendahl nutzt die Korrespondenz <strong>für</strong><br />
die Nebenbemerkung, daß Österreich bereits 1848/49 Mitstifter der Frankfurter<br />
Parlamentsbibliothek gewesen ist; die Entwicklung der Dinge werde es mit sich<br />
bringen, daß die österreichischen Bibliotheken »ihren Widerstand gegen den<br />
Anschluß an die Zentralkatalogisierung« der Deutschen Bücherei recht bald aufgeben.<br />
»Wird es hierzu noch eines besonderen Anstosses bedürfen?« So konkret<br />
ist die Bedeutung <strong>von</strong> Anschluß im Reich der Wissensmachttechniken, nämlich<br />
non-diskursive Schaltung (die lingua tertii imperii ist überhaupt eine Funktion<br />
technischer, nicht hermeneutischer Termini) 28 . Mithin zeitigt diese Logik ihren<br />
eigengesetzlichen, in logistischen Bedingungen <strong>von</strong> Soft- und Gegebenheiten <strong>von</strong><br />
Hardware begründeten Rhythmus, dysfunktional zur Zeit des politischen Ereignisses,<br />
wie ihn der Anschluß Österreichs durch Hitler darstellt. Die Antwort<br />
Buttmanns vom 21. März 1938 an Uhlendahl nennt die verzögerte Schaltung:<br />
»Wegen der Zentralkatalogisierung habe ich im Hinblick darauf, dass das berühmte<br />
Kulturabkommen mit Österreich nunmehr überholt ist, bereits vorgestern<br />
17 Albert Paust, Die erste großdeutsche Rcichsbibhothek <strong>von</strong> 1848, Leipzig 1941, in:<br />
Deutscher Wissenschaftlicher Dienst (Berlin) Nr. 64 v. 3. November 1941<br />
28 Viktor Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen, Berlin (Aufbau) 1947
Du-; PAUI.SKIRCHKNBIBUOTIII-K. 859<br />
mit Herrn Dr. Kummer gesprochen. Dieser teilte mir mit, der neue Leiter der Wiener<br />
Bibliothek, Dr. Heigl, habe sich bereits dahin geäussert, dass er im laufe d. J.<br />
keinerlei Änderung vornehmen könne, bis die Umstellung durchgeführt sei.<br />
Ich <strong>für</strong>chte, dass es hier noch weiter erhebliche Schwierigkeiten geben wird.«<br />
<br />
Die den Bibhothekstransfer betreffenden Dokumente auf Seiten des Nürnberger<br />
Museums, lange extern weitgehend unzugänglich, stehen vor ihrer erhellenden<br />
Veröffentlichung; dem Fachwissen ihrer Bearbeiterin zufolge findet sich<br />
dann kein Hinweis auf eine direkte Verknüpfung beider Ereignisse. Die Bibliothek<br />
des Museums sieht die Logik des Transfers <strong>von</strong> 1938 pragmatisch, aus der<br />
Institution heraus funktional, nicht nationalsymbolisch überdeterminiert: als<br />
schlichte Folge der thematischen Konzentration der Museumsbibliothek auf<br />
innerhäusliche Sachgebiete. »Das geschah mit einer gewissen Konsequenz hinsichtlich<br />
der gewandelten Aufgabenstellung des Germanischen Museums, das<br />
inzwischen mit dem Schwerpunkt auf der Kunstsammlung <strong>von</strong> den Intentionen<br />
seiner Frühgeschichte weit abgerückt war« - bis in die Gegenwart . Auch Paust spricht <strong>von</strong> dem durch Uhlendahl zu Verhandlungen mit<br />
Kohlhaußen richtig erkannten Moment, daß »Teile der Bibliothek des Museums,<br />
die nicht mehr der veränderten Zielstellung entsprachen, abgegeben werden sollten«<br />
. Mit dem Erwerb der Teilmenge Reichsbibhothek<br />
wollte das Nürnberger Museum einmal den Grundstock zu einer<br />
Nationalbibliothek legen; die Qualifizierung des Leipziger Äquivalents <strong>für</strong><br />
deren Abgabe aber nennt genau seine Neuakzentuierung (und Beschränkung)<br />
auf eine kunsthistorische Spezialbibliothek: »Ich glaube aber, dass als Tauschgabe<br />
auch Kunstliteratur der Gegenwart, soweit sie <strong>für</strong> das Germanische<br />
Museum <strong>von</strong> Wert ist, in Betracht kommt.« 29 Der Börsenverein in Leipzig meldet<br />
Uhlendahl am 17. August 1936 zunächst eine Finanzkrise; sein Vorschlag<br />
wird daher bis zum Eintreffen konkreter Forderungen <strong>von</strong> Nürnberger Seite<br />
zurückgestellt. Als Gegenleistung <strong>für</strong> den Transfer <strong>von</strong> 1938 erhält das Germanische<br />
Nationalmuseum am Ende 15000 Reichsmark in Form <strong>von</strong> Büchern<br />
durch die Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei und Freiexemplare<br />
angeschlossener Verlage.<br />
<strong>Im</strong> krassen Gegensatz zur diskursiven Überdeterminierung im <strong>Im</strong>aginären<br />
(als Äezc^sbibliothek) steht die medienarchäologische Mikroanatomie, die archivische<br />
Evidenz des Transfers dieses Bestands <strong>von</strong> Nürnberg nach Leipzig 1938.<br />
Hier gilt es, archäologische Schneisen in Archivlagen zu schlagen. Die Aktenablage<br />
der Vorgänge <strong>von</strong> 1938 im Archiv der Deutschen Bücherei gibt die chi-n^<br />
nologische Ordnung der Darstellung vor (auch modulare Wissenspartikel sind<br />
29 Archiv DB, fasc. Az/NA 534/7 Bd. 1, Bl. lf, Durchschlag Typoskript: »Dir. 821/36«
860 BIBI.IOTUKK<br />
immer schon symbolisch konfiguriert); was dabei in wissensarchäologischer<br />
(Ab-)Lage zusammenliegt, bildet nicht notwendig einen historisch zu behauptenden<br />
Zusammenhang. Dokumenten-Bausteine einer Gedächtnisarchitektur:<br />
Erst das syntaktische Zusammenfügen dieser durch formale Merkmale und das<br />
Material gekennzeichneten Signifikanten (die ihrerseits <strong>für</strong> sich je schon Signifikation<br />
haben) im historiographischen Gebrauch macht sie zur Teilmenge des<br />
Denotats <strong>Geschichte</strong> der Deutschen Bücherei?® Am 27. Juli 1936 wendet sich<br />
der Direktor der Deutschen Bücherei Uhlendahl an den Vorsteher des Börsenvereins<br />
der Deutschen Buchhändler zu Leipzig und Vorsitzenden des geschäftsführenden<br />
Ausschusses der Deutschen Bücherei, Verlagsbuchhändler Wilhelm<br />
Baur, Berlin. Sein Vorschlag aus Anlaß <strong>von</strong> 25 Jahren Vertrag zur Gründung der<br />
Deutschen Bücherei (am 3. Oktober 1937) ist die Gabe - und das bedeutet in<br />
diesem Kontext: die Übergabe - der 1848/49er Paulskirchen-Buchbestände,<br />
»eine erste Reichsbibliothek«, unter Erinnerung an die damalige Initiative <strong>von</strong><br />
Hahn und 40 weiteren Verlegern. Dieser Wissensspeicher ist auch leer <strong>von</strong> wissenspragmatischer<br />
Bedeutung ein templum:<br />
»Die Bestände stellen heute alles in allem keinen grösseren finanziellen Wert<br />
dar, da die Werke veraltet sind. Dagegen haben sie einen hohen Pietätswert,<br />
weniger <strong>für</strong> das Germanische Museum, dessen Bibliothek kunstgeschichtliche und<br />
volkskundliche Literatur sammelt, als <strong>für</strong> die Deutsche Bücherei, die in dieser<br />
Buchhandelsgründung ihre Vorläuferin sieht.« <br />
Der Text beruft sich auf eine Rücksprache mit dem Direktor des Germanischen<br />
Nationalmuseums: Zimmermann lege auf die Erhaltung der Bestände »keinen<br />
besonderen Wert, zumal sie in der Hauptsache Literatur enthalten, die <strong>für</strong> das<br />
Germanische Museum kaum <strong>von</strong> Wert ist.« Kulturwissenschaften 1937 sind nur<br />
bedingt an dem vornehmlich juristisch-statistischen Buchmaterial, eben der parlamentarischen<br />
Handbibliothek aus dem 19. Jahrhundert interessiert. »Er würde<br />
diese, wie er mir erklärte, am liebsten gegen einen wertvollen alten Kirchenaltar<br />
oder ähnliche Kunstgegenstände austauschen.« Fungiert in die (Wieder-) Ankunft<br />
der Wiener Reichsklemodien nach Nürnberg als <strong>von</strong> der Berliner Reichszentrale<br />
nach dem Anschluß Österreichs koordinierte Kompensation, als symbolisches<br />
Äquivalent <strong>für</strong> die Abgabe der Reichsbibliothek an Leipzig? Dieses Ereignis wirft<br />
seinen Schatten auf den Bibhothekstransfcr, ist aber als unmittelbarer Zusammenhang<br />
nicht nachweisbar; zu dieser Hypothese verführt allein das Wissen der<br />
Retrospektive. Genau an der Nahtstelle jenes Flickenteppichs, den eine auf die<br />
30 Am Beispiel des »archäologischen Wiederaufbaus« der Frauenkirche Dresden erläutert<br />
diese Gcschichtssemiose Ute Reinhardt, »Die Errichtung eines Wahrzeichens«.<br />
Zur medialen Bedeutungsproduktion beim Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden,<br />
Diplomarbeit FU Berlin, vorgelegt am 25. November 1996, bes. 9f
DIH PAUI.SKIRCHKNBIBUOTHHK 861<br />
Fragmente des Archivs gestützte Erzählung des Bibliothekstransfers <strong>von</strong> Nürnberg<br />
nach Leipzig darstellt, klafft eine Lücke im Speicher. Das Aktenfaszikel<br />
Az/NA 534/7 Bd. 1 im Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig (die Reichsbibliothek<br />
<strong>von</strong> 1848 und die Übergabe durch das Germanische Nationalmuseum<br />
1938 betreffend, den Zeitraum Juli 1936 bis November 1964 umfassend) wird am<br />
14. Juni 1995 paginiert. Das Begleitblatt vermerkt ausdrücklich die Besonderheit,<br />
daß die alte Zählung »vermutl. bis Bl. 10 recto« erfolgte; »Bl. 4-9 alter Zählung<br />
fehlen«. Stellt diese Lücke im Archiv ein bloßes Fehlen oder ein Verschweigen<br />
dar? Blatt 3 der alten Paginicrung wird fortgesetzt <strong>von</strong> Blatt 10. Erst die jetzige,<br />
neue Paginierung, die aus Blatt 10 nun Blatt 4 macht, ruft als Serie den Effekt <strong>von</strong><br />
prozessualer Konsistenz in der Abfolge hervor. Folgen wir den Akten wissensarchivologisch,<br />
d. h. in ihrer real vorliegenden, lagernden Sequenz. Blatt 4 (neue<br />
Paginierung) ist eine Aktennotiz betreffs der Bemühungen der Gesellschaft der<br />
Freunde der Deutschen Bücherei unter Arthur Meiner um den Erwerb der<br />
Reichsbibliothek
862 BlBl.lOTHHk<br />
sehe Gedächtnis des Paulskirchenparlaments. Der Nachlaß <strong>von</strong> Albert Paust im<br />
Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig birgt unter dem Titel<br />
Reichbibliothek <strong>von</strong> 1848 u. a. Kopien diverser Archivalien zum Thema ihrer einstigen<br />
Ausstellung in Frankfurt . Und in der Tat, als Datenbank<br />
ist ihre bibliothekarische /l«/stellung betroffen, als Monument ihre museale<br />
Exposition.<br />
Jede Aufstellung betrifft Speicherplätze. Der Durchschlag eines <strong>von</strong> Albert<br />
Paust als Bibliothekar an der Deutschen Bücherei gezeichneten Briefes an den<br />
Vorstand der Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, H. Heerwagen,<br />
gibt am 23. März 1938 Maße <strong>für</strong> die Aufstellung der Oktav-Quart-Foliobände<br />
der Parlamentsbibliothek . Speichergedächtnis rechnet<br />
nicht mit Inhalten, sondern mit Formaten. National(geschichtlich) überdeterminiert,<br />
muß es dennoch auf Historie Rücksicht nehmen: »Um die Bibliothek<br />
möglichst in historischem Rahmen unterzubringen, ist geplant, den da<strong>für</strong> vorgesehenen<br />
Raum mit Holzregalen im Stile der Zeit auszustatten. Die Antwort <strong>von</strong><br />
Direktor Kohlhaußen (GNM) an Paust, datiert Nürnberg, den 28. März 1938,<br />
behandelt präzise die Form des Gedächtnisses: »Die Regale II und III bestehen<br />
aus je 64 Fächern, <strong>von</strong> denen 7 leer stehen« . Speicherplätze, wartend auf<br />
künftige Komplementierung? Die Übertragung <strong>von</strong> Raumangaben und Regalmaßen<br />
bedarf keiner narrativen Verpackung; <strong>von</strong> daher Kohlhaußens Telegrammstil:<br />
»Alle Fächer sind gleichgross. Keine Sondergestelle <strong>für</strong> Folianten und<br />
Quartanten; Folianten überhaupt nur ganz wenige.« Skizzen liegen anbei. Die<br />
Aktennotiz des Schreibens Dir.335/38 vom 30. März 1938 an Meiner bestätigt<br />
das Eintreffen der vom GNM unterschriebenen Vereinbarung (datiert 4. März<br />
1938). Als Raum <strong>für</strong> (wieder in Anführungsstriche gesetzt) »die erste Reichsbibliothek«<br />
ist das erste Zimmer im 2. OG der Deutschen Bücherei rechts vom<br />
Vortragssaal vorgesehen, zu versehen nun mit »Frankfurt«-Fenstern (mit dem<br />
Bild Gutenbergs). »So wird die museale Parlamentsbibliothek, wenn sie aufgestellt<br />
ist, bereits vor dem Bibliothekszimmer mit dem Fenster beginnen« . Museahter ist so Frankfurter Bibliothek <strong>von</strong> einem funktionalen Handapparat<br />
zur wissensarchäologischen Inkunabel geworden. Der Entwurf einer<br />
Inschrift <strong>für</strong> diesen Raum der Parlamentsbibliothek DIE ERSTE REICHSBI-<br />
BLIOTHEK schreibt die usurpierte Genealogie statuarisch fest . Pausts<br />
Worte künden am 6. April 1938 <strong>von</strong> der Freude, »die ehemalige Parlamentsbibliothek<br />
als Vorläuferin der Deutschen Bücherei mit ihr auch äusserlich zu<br />
vereinen, sie damit der Vergessenheit zu entreissen und ihr als Symbol des grossdeutschen<br />
Gedankens, den auch die Deutsche Bücherei verkörpert, eine würdige<br />
Stätte zu bereiten« . Am 24. Mai 1938 werden<br />
Doubletten der Deutschen Bücherei zur Auswahl ans Germanische Nationalmuseum<br />
thematisch. Während die Katalogisierung der Parlamentsbibliothek fort-
Dli: PAUI.SMRCHKNBIBI.IOTHHK 863<br />
schreitet, fällt auf, daß Stücke fehlen . Solche Erkenntnis<br />
verdankt sich der wissensarchäologischen Wahrnehmung des Bestandes: nicht<br />
seiner narrativen Verhandlung als nationales Symbol, sondern seiner Informationsverarbeitung<br />
als Datenbank. 31 Auf dieser Ebene wird Gedächtnis präzise.<br />
Bereits am 4. November 1933 meldet die Neue Leipziger Zeitung, der Tempel<br />
der Literatur, als der die Deutsche Bücherei um 1850 vom Reichsbibliothekar<br />
Johann Heinrich Plath »prophetischen Blicks ersehnt« wurde, dürfe als<br />
»eines der erhabendsten Denkmäler deutscher Einheit« gelten . Diese Bestimmung erfüllt sich nominell 1938, als durch eine<br />
Inschrift in der Eingangshalle Hahn und Plath zu Wegbereitern der Deutschen<br />
Bücherei erklärt werden. Paust begründet den Mythos Reichsbibhothek aus den<br />
diskursiven Lcgitimationszwängen seiner Bücherei, die - als funktionale Agentur<br />
des Börsenvereins des deutschen Buchhandels gegründet - eines Fundaments<br />
im Symbolischen ermangelte. Die 1 848/49er Paulskirchenbibhothek firmiert in<br />
Leipzig seit 1938 unter der Bezeichnung Reichsbiblwthek 1848/49, doch die<br />
gestiftete Literatur <strong>von</strong> Verlagen wird in einem Widmungsvermerk des Bibhotheksguts<br />
inventarisiert als Eigentum der »Bibliothek der Deutschen Reichsversammlung«<br />
- Klarsicht des nicht-diskusiven Dispositivs <strong>von</strong> Besitznachweis (im<br />
Unterschied zum <strong>Im</strong>aginären der Kulturhistorie). Unter den Altbeständen befindet<br />
sich bis heute als Zeuge der einstigen Rolle als Nationalbibliothek der bereits erwähnte komplette Satz der Monumenta Germaniae Historica<br />
(damaliger Stand) aus der Frankfurter Parlamentsbibliothek; erneut figurieren<br />
die MGH neben ihrer Eigenschaft als Quelldatenbank hier als Metonymie<br />
der Reichshistoire. Der Leipziger Saal mit der Sammlung Reichsbibhothek birgt<br />
ferner authentische Sessel aus der Frankfurter Paulskirchenversammlung, disloziert<br />
auf immer <strong>von</strong> der Stätte ihrer einstigen Funktion 32 : Reliquien in einer<br />
Bücherei, deren wissensgenealogisch inneres Objekt die Reichsbibhothek darstellt.<br />
Deren Sachgruppierung folgt der vormaligen Interimsaufstellung im Germanischen<br />
Nationalmuseum; wie aber läßt sich ihr Mehrwert im <strong>Im</strong>aginären der<br />
Nation an Büchern zur Darstellung bringen? Schaukästen zeigen in Leipzig<br />
Dokumente zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsbibliothek. Die Parlamentsbibliothek<br />
untersteht in der Deutschen Bücherei bis 1993 dem dort integrierten Buch- und<br />
Schriftmuseum - ein Bedeutungswandel vom Bibliothekssubjekt zum musealen<br />
31 Siehe auch Archiv der Dß Leipzig AZ NA: 534/7/1 = Gegengaben an das GNM<br />
1838-55, u. a. mit Korrespondenz Pausts zur <strong>Geschichte</strong> und zu Verlusten der Parlamentsbibliothek<br />
32 »Denn Bleiben ist nirgends«: Vgl. die Notiz zur Versteigerung eines 1911 <strong>von</strong> Rainer<br />
Maria Rilke auf Schloß Duino besessenen Stuhls (hier im Kontext der Zerstreuung<br />
einer Bibliothek), unter der Siglc »ring« in: Frankfurter Allgemeiner Zeitung v. 13. Juni<br />
1997
864 Bim.ioTiii-.K<br />
Bibliotheksobjekt. Die Neuverzeichnung aller Titel auch im Gesamtkatalog der<br />
Deutschen Bücherei 33 bedeutet die endliche Einverleibung eines separat ausgestellten<br />
Bibliothekskörpers auf der Ebene der Wissensadressierung, dem wahren<br />
Ort <strong>von</strong> Gedächtnismacht.<br />
33 Archiv Deutsche Bücherei, AZ: NA 534/7/2 a = MS A. Paust zur <strong>Geschichte</strong> der<br />
Bibliotheken der Bundesvesammlung, ihrer Ministerialbiliothcken und zur RB <strong>von</strong><br />
1848; nicht publiziert
P l U . U ß K N I N DI-.N B l B I . I O I I I1KI N : S T A A T S B I M . I O T I IhK B l . R I l N 8 6 5<br />
Preußen in den Bibliotheken: Staatsbibliothek Berlin<br />
Bibliothek als Architektur: Hatte das Berliner Stadtschloß der Hohenzollern Hof,<br />
Theater und Bibliothek noch als Trias gefaßt, deren Elemente in der episteme der<br />
Repräsentation nahtlos ineinander überführbar waren, differenzieren sie sich mit<br />
dem Entwurf des Forum Fndenaanum (heutiger Bebelplatz) funktional aus; der<br />
Neubau <strong>für</strong> die Königliche Bibliothek erweist sich auch im Volksmund {Kommode)<br />
als Dispositiv (nämlich Fächer bereitzustellen), wenngleich funktionale<br />
Aspekte bei der Gcbäudeplanung eine untergeordnete Rolle spielten. Zu Beginn<br />
des 19. Jahrhunderts sind in dieser Bibliothek, binnenarchitektonisch, »mehrere<br />
Fächer, welche nach ihrer Natur vereint sein sollten, <strong>von</strong> einander getrennt worden«;<br />
kompensiert wird diese Fragmentierung der Wissensordnung durch Verlagerung<br />
der Architektur auf die Logistik der Adressierung, den mathematischen<br />
Raum: Durch ministerielle Verfügung vom 18. August 1827 erhalten sämtliche<br />
Repositonen hölzerne Schilder, welche eine Kurzangabe der dann aufgestellten<br />
Fächer enthalten, mit fortlaufenden Nummern versehen. 1 Seitdem wird die Frage<br />
der Aufstellung, jenseits gebauter Architektur und der damit verbundenen<br />
Gedächtnisortstechniken, »nicht <strong>von</strong> den Bücherräumen, sondern <strong>von</strong> dem<br />
Katalogzimmer aus« geortet, beurteilt und gesteuert. 2 »Wo auch die Einbände<br />
<strong>Geschichte</strong>n erzählen«, heißt es zum Einblick in den Rokokosaal der Herzogin-<br />
Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar 3 ; hier sind die Bücherreihen mit den ihrer<br />
Signaturen dem Raum der Bibliothek noch optisch eingeschrieben und fungieren<br />
damit selbst als Katalog. <strong>Geschichte</strong>n des Büchergebrauchs entziffert daran der<br />
kulturhistorische Blick; Medienarchäologie fokussiert demgegenüber die wissensgenealogischen<br />
Spur, also das, was dort an den Einbänden nicht erzählt, sondern<br />
zählt: das System der Signaturen. Was unter der Direktion <strong>von</strong> Goethe in<br />
der Saalbibliothek noch einsichtig ist, wird im System der Magazinbibliotheken<br />
zum Verschwinden gebracht: der materielle Zusammenhang <strong>von</strong> Buch und Signatur<br />
löst sich in eine variable, virtuelle Zuordnung auf.<br />
»Architekturen des Wissens sind <strong>von</strong> unhintergehbarer Positivität.« 4<br />
Nachdem Schinkel und Stüler sich mit Neubauplänen der Königlichen Biblio-<br />
Friedrich Wilken, <strong>Geschichte</strong> der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin (Duncker<br />
& Humblot) 1828,207<br />
Georg Leyh, Systematische oder mechanische Autstellung, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen,<br />
31. Jg. (1914), 407<br />
Legende des Photos zum Artikel <strong>von</strong> Michael Knoche, Das Ende der alten Bibliothek<br />
und ihre Zukunft, in: Süddeutsche Zeitung Nr. 175 v. 31. Juli 2002, 16<br />
Friedrich A. Kittlcr, Über romantische Datenverarbeitung, in: Ernst Behler /Jochen<br />
Hönsch (Hg.), Die Aktualität der Frühromantik, München / Paderborn (Schönmgh)<br />
1987,127-140(128)
866 BlM.IOTIIKK<br />
thek nicht hatten durchsetzen können, wird er, in funktionalem Anschluß an die<br />
Universität, 1903-1914 durch den Architekten Ernst <strong>von</strong> Ihne realisiert und <strong>von</strong><br />
einem panoptisch angelegten Kuppellesesaal nach Vorbildern in Paris und London<br />
dominiert. Dort findet die Aktualisierung der angekoppelten Bücherspeicher<br />
statt; die Energie <strong>von</strong> Gedächtnis hegt also jenseits der Speicher und ihrer<br />
quasi-militärischen Depotorganisation. Die Wirklichkeit dieser Speicher ist<br />
gegenüber barocker Rhetorik und Anschaulichkeit (Modell Saalbibliothek) in die<br />
Funktionale gerutscht, indem die Bauformen des Hauses so gewählt sind, »daß<br />
sie im Äußern und Innern das Gepräge eines der strengen Wissenschaft gewidmeten<br />
Baues zum Ausdruck bringen.« 5 Adolf v. Harnack, Generaldirektor der<br />
Königlichen Bibliothek in Berlin, benennt 1914 aus Anlaß der Einweihung den<br />
Neubau m ausdrücklicher Opposition zum bisherigen Repräsentationsparadigma<br />
<strong>von</strong> Wissenspoetik nicht mehr Prachtkatakombe, sondern eine/e5te Burg<br />
der Wahrheit als Gestell. 6 Aber auch Wahrheit ist nur der Vorschein <strong>von</strong> Speicherphantomen;<br />
ein Duplikat des Bestellzettels wird an die Stelle des geborgten<br />
Buches im Speicher gelegt und erweist alles Buchwissen als Funktion seiner<br />
buchstäblichen Adressierung. Solange bleibt Kultur an Zeichenlager, die nach<br />
dem Modell der Gutenberg-Galaxis formiert sind, gekoppelt. Erst die Transition<br />
des Buches vom Speicher in den Lesesaal bildet die Linie, die den Leser vom Verwaltungsapparat<br />
trennt. Von Nummern zur Gedankenübertragung: Das Wissen<br />
des Buches ergreift Besitz <strong>von</strong> Lesern unter den Bedingungen technischer Aufklärung;<br />
»die Tischbeleuchtung des Abends und die sich dann im Dunkel verlierende<br />
Höhe über ihnen wirkte auf sie wie ein Fluidum, das sie zu geistiger<br />
Konzentration befähigte« 7 - Bibliotheksphantasmen. Das <strong>Im</strong>aginäre haust zwischen<br />
dem Buch und der Lampe« 8 , fällt also mit einer Technologie zusammen. 9<br />
Der Berliner Kulminationspunkt <strong>von</strong> Speicherarchitektur ist zugleich ihre<br />
Entgrenzung, der Anfang vom Ende der Verortung des buchbasierten Wissens<br />
in Architektur, also vor Ort: »Seit dem Jahre 1907 fand ein solcher Zuwachs<br />
an Bücherbeständen statt, daß alle Vorausberechnungen über die Größe der<br />
Regierungs- und Baurat Adams, Der Neubau <strong>für</strong> die Königliche Bibliothek und die<br />
Akademie der Wissenschaften in Berlin, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 34. Jg.<br />
(1914), Nr. 29 v. 11. April 1914<br />
Die Rede des Generaldirektors ist wiedergegeben in: Paul Schwenke, Die Kinweihung<br />
der neuen Königlichen Bibliothek, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 31, Heft 4<br />
(1914), 145-162 (152 ff, hier: 153 u. 160)<br />
Wieland Schmidt, Von der Kur<strong>für</strong>stlichen Bibliothek zur Preußischen Staatsbibliothek<br />
- Geschichtlicher Überblick <strong>von</strong> 1661 bis 1945, in: Staatsbibliothek Preußischer<br />
Kulturbesitz, Wiesbaden 1978, 66<br />
Michel Foucault, Schriften zur Literatur, München (Nymphenburger Verlagsbuchhandlung)<br />
1974, 160<br />
Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900, München (Fink) 1985, 98.
PRI-'.Ulil-.N IN DI-.N BlBUOTHKKl-N: STAATSBIBLIOTHEK BHRI.IN 867<br />
Büchermagazine und die Bücherbeförderung sich als hinfällig erwiesen.« 10 Das<br />
aus solchen Einsichten resultierende speicherarchitektonische Prinzip, einen<br />
Zentralbau auf modulare Erweiterbarkeit hin anzulegen, kommt an den aporetischen<br />
Punkt, das (aus der wissenschaftlichen Katalogistik und in anderer Form<br />
aus der Komputistik vertraute) Gültigkeits- und Halteproblem: »Büchereien, die<br />
einer unbegrenzten Größe entgegengehen, sind mit Dutzenden an den Bau<br />
gewandten Millionen doch nur auf beschränkte Zeit ausreichend vorgesehen,<br />
obwohl ein großer Teil gleich <strong>für</strong> lange Jahre zinslos fertig da liegt und erhalten<br />
werden muß.« 11 Ein Blick in das architektonische Gestell der Berliner Bibliothek<br />
eröffnet Räume im Sinne der kupfergestochenen Carceri d'invenzione<br />
Giambattista Piranesis 12 ; jede linear-narrative Beschreibung (technisch als Ablauf<br />
<strong>von</strong> Druckzeilen vorgegeben) verhält sich dysfunktional zur Gedächtnis-Kybernetik<br />
des Speichers. Während die Schauseite und die mittlere Nord-Süd-Achse<br />
des Gebäudes der (seit 1918 so genannten) Preußischen Staatsbibliothek Unter<br />
den Linden <strong>von</strong> repräsentativen Kriterien bestimmt wird, richtet sich die Höhenentwicklung<br />
des Gebäudes nach den modularen Maßen der Büchergeschosse.<br />
An manchen Fassadenteilen entsprechen einem erkennbaren Stockwerk mehrere<br />
dahinter liegende Magazingeschosse: Speicher und optisches Interface liegen im<br />
Widerstreit. Um 1900 treten Gedächtnis als Infrastruktur und als Symbol auseinander<br />
.<br />
Preußische Instruktionen und Gesamtkatalog<br />
Preußen betreibt mit Bibliotheken Grenzlandpolitik; in Posen wird eine öffentliche<br />
Bibliothek zur Förderung des dortigen Deutschtums errichtet. Der einer<br />
Anregung des Historikers Heinrich <strong>von</strong> Treitschke folgende preußisch-deutsche<br />
Gesamtkatalog 13 ist die wissenstechnische Manifestation Preußens: »Hätte<br />
man diesen Katalog heute, dann könnte man Preußen aus den Bibliotheksbeständen<br />
rekonstruieren.« 14 Friedrich Althoff, jahrelang (1882-1907) <strong>für</strong> die wis-<br />
10 , Das neue Gebäude <strong>für</strong> die Königliche Bibliothek und die Akademie der<br />
Wissenschaften in Berlin, in: Deutsche Bauzeitung 48 (1914), 317 bis (passim) 394,<br />
hier: Nr. 37 v. 9. Mai 1914,354 .<br />
11 Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig (Wiegandt) 1912, 83<br />
12 So im Film <strong>von</strong> Alain Resnais über die Pariser Bibhotheque Nationale: Toute la<br />
memoire du monde (1956)<br />
13 Heinrich <strong>von</strong> Treitschke, in: Preußische Jahrbücher 53 (1884), 473-492. Dieser Aufsatz<br />
geht nach Angaben <strong>von</strong> H. Paalzovv seinerseits auf eine Anregung des Ministerialdirektors<br />
Althoff zurück: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 22 (1905), 408<br />
14 Uwe Jochum (Fachreferent ÜB Konstanz), Vortrag an der Kunsthochschule <strong>für</strong><br />
Medien Köln, 17. Mai 1996
868 Bim.urn IHK<br />
senschafthehen Bibliotheken in Preußen zuständiger Referent im preußischen<br />
Kultusministerium, faßt die Berliner Staatsbibliothek als Metonymie Deutschlands.<br />
Sein Ziel ist, Preußen in der Bewältigung übergreifender kultureller<br />
Aufgaben «stellvertretend <strong>für</strong> Deutschland handeln zu lassen« . Hier geht es nicht mehr um eine historische Sendung, sondern<br />
Geltung: Da Deutschland durch Preußen geeint ist, »braucht der deutsche Beruf<br />
Preußens nicht mehr aus der <strong>Geschichte</strong> bewiesen werden« 15 ; was also im Sinne<br />
der posthistoire ansteht, ist Gedächtnisadministration. 16 Die longue duree <strong>von</strong><br />
Bibliotheksgedächtnis bemißt sich in der Persistcnz <strong>von</strong> Katalogsystemen<br />
jenseits historischer Zäsuren, und so mag es dahingestellt bleiben, ob die <strong>Geschichte</strong><br />
der explizit Preußischen Staatsbibliothek in Maitagen des Jahres 1945<br />
endete oder mit der Auflösung des Staates Preußen durch den Beschluß des<br />
Alliierten Kontrollrates vom 25. Februar 1947. »Bloße Änderungen des<br />
<strong>Namen</strong>s haben die Identität der Bibliothek nicht berührt. <strong>Im</strong> Bewußtsein der<br />
Mitarbeiter bestand die Staatsbibliothek auch über den Mai 1945 fort« . Zäsuren und Kontinuitäten einer Bibliothek werden vom Rhythmus<br />
ihrer Katalogsysteme, nicht <strong>von</strong> Ereignisgeschichte bestimmt. Aufgabe<br />
einer Medienarchäologie <strong>von</strong> Gedächtnistechniken ist es, die Erinnerung an<br />
alternative Ordnungsoptionen aufrechtzuerhalten; keine teleologische Finalität<br />
der selbstverwirkhchten Geistesgeschichte, sondern Schaltungen sind es, die<br />
über die Realisierung <strong>von</strong> Wissensordnungen entscheiden. Der 1832 als cand.<br />
phil. in die Arbeit der Königlichen Bibliothek eingetretene und seitdem mit der<br />
Ordnung des Alphabetischen Katalogs betreute Eduard Buschmann sucht ein<br />
ideosynkratisches System der Einordnung <strong>von</strong> Anonyma durchzusetzen, das<br />
die Titel nicht nach der formalen Regel des ersten Substantivums oder Nomens<br />
placiert, sondern nach dem ersten Hauptsinnwort (als Zeiger der Gedächtnisadressierung).<br />
Sein Vorgesetzter Schrader kritisiert an diesem Verfahren des ausgebildeten<br />
Philologen das »consequentc Fernhalten jedes literarhistorischen<br />
15 M. Lehmann, Friedrich der Große und der Ursprung des siebenjährigen Krieges,<br />
Leipzig 1894, Vorwort. Zu diesem Satz im wissensstrategischen Kontext: Johannes<br />
Burkardt, Die Historischen Hilfswissenschaften in Marburg (17.-19. Jahrhundert),<br />
Marburg/Lahn (Institut <strong>für</strong> Historische Hilfswissenschaften) 1997, 128<br />
16 Zur dramatischen Inszenierung Preußens als ideologischer Erfüllung und happy end<br />
der deutschen <strong>Geschichte</strong> in der Historiographie Rankes siehe Hayden White, Metahistory.<br />
Die historische Einbildungskraft in Europa im 19. Jahrhundert, Stuttgart<br />
(Klett-Cotta) 1991. Weniger auf Seiten der Erzählung und mehr auf der <strong>von</strong> Statistik<br />
beschreibt der französische Mathematiker und Soziologe A. A. Cournot etwa zur gleichen<br />
Zeit in seinen Considerations sur la marche des idees et des evenements dans les<br />
temps modernes den etat final de la avdisation, die Ausbildung des Staates als administativen<br />
Endzustand, hg. v. Andre Robinet als Bd. 4 <strong>von</strong> A. A. Cournot, Oeuvres<br />
completes, Paris (Vrin) 1973, 22f
PRKUßKN IN DKN BlBl.iOTHKKHN: STAATSBIM.IOTHhK BhRLIN 869<br />
Interesses« - die Bedingung <strong>von</strong> Gedächtnis jenseits der Hermeneutik. Damit<br />
jeder Mensch jedes Buch im Katalog finden kann, ist die Einsicht in Buchstabenspeicher<br />
als streng formahsierte Regel mit der Blindheit der Literatur<br />
erkauft. Kultur zu verstehen heißt in der Moderne, sie in Gedächtnisagenturen<br />
zu speichern und zu ordnen. 17<br />
<strong>Im</strong> Begriff der Preußischen Instruktionen kommt das Ordnungsprinzip<br />
Preußen(s) zu sich is ; die am 10. Mai 1899 veröffentlichten Instruktionen <strong>für</strong> die<br />
alphabetischen Kataloge der preußischen Bibliotheken und <strong>für</strong> den preußischen<br />
Gesamtkatalog geben den Algorithmus bibliothekarischer Gedächtnisadressierung<br />
vor. In der Sprache der Kybernetik basiert das System auf Rückkopplung:<br />
Die Königliche Bibliothek in Berlin ordnet ihren Alphabetischen Katalog nach<br />
den Preußischen Instruktionen neu, schreibt ihn auf Karteikarten ab und<br />
schickt diese an die preußischen Universitätsbibliotheken zwischen 1903 und<br />
1922 in Umlauf, damit dort der identische Besitz an Büchern eingetragen und<br />
zusätzlicher Besitz an das Auskunftsbüro in Berlin rückgemeldet wurde. 19 Die<br />
Ausführbarkeit eines gesamtdeutschen Gesamtkatalogs aber wird politisch in<br />
Zweifel gezogen, denn auch hier fungierte Preußen als Metonymie des Reiches;<br />
Adolf Hilsenbeck aus München apostrophiert auf dem Bibliothekartag 1912 mit<br />
Ironie den abenteuerlichen Plan, sämtliche Katalogzettel der deutschen Bibliotheken<br />
»<strong>von</strong> der Maas bis an die Memel, <strong>von</strong> der Etsch bis an den Belt« in eine<br />
preußisch bestimmte Reihenfolge zu bringen .<br />
Einerseits wird bedauert, daß im deutschen Sprachgebiet keine der Pariser<br />
Nationalbibliothek oder der Bibliothek des British Museum entsprechende<br />
Anstalt vorhanden ist, in der das lückenlose Vorhandensein des gesamten<br />
Nationalschrifttums vorausgesetzt werden kann; andererseits hält gerade<br />
die Königliche Bibliothek Berlin, die zunächst zur Rolle einer Nationalbibliothek<br />
ausersehen ist, noch im 20. Jahrhundert am strengen Auswahlprinzip der<br />
Erwerbung fest. Von allem Übrigen soll sie »Typen sammeln, denn nur als<br />
Gattung, nicht als Individuum hat ein großer Teil des Gedruckten noch Wert.« 20<br />
Der buchstäbliche lettre circulaire begründet den preußischen Gesanitkatalog<br />
auf dem Weg der Standardisierung und Modularisierung bibliographischer<br />
Information, in einer Art Aufspeicherung qua Zirkulation, mit der auch die<br />
17 Siehe Heinrich Roloff, Aufstellung und Katalogisierung der Bestände, in: Deutsche<br />
Staatsbibliothek 1661-1961, Bd. 1: <strong>Geschichte</strong> und Gegenwart, Leipzig (VEB Verlag<br />
<strong>für</strong> Buch-und Bibliothekswesen) 1961, 131-174 (151 f)<br />
18 Instruktionen <strong>für</strong> die Alphabetischen Kataloge der Preuszischen Bibliotheken<br />
vom 10. Mai 1899, zweite Ausgabe in der Fassung vom 10. August 1908, Manualdruck<br />
1942, Berlin (Behrend) 1915<br />
19 Dazu Wolfgang Schmitz, Deutsche Bibliotheksgeschichte, Bern et al. (Lang) 1984, 166<br />
20 Emil Jacobs, Adolf <strong>von</strong> Harnack, in: ZfB 47 (1930), 369
870 Bim.ioTiii-K<br />
anschließende Herstellung <strong>von</strong> gedruckten Katalogzetteln im internationalen<br />
Format seit Dezember 1908 einhergeht - die <strong>von</strong> Wilhelm Ostwald optierte<br />
Transzendenz eines bislang geschlossenen Wissensformatierungssystems auf<br />
Betriebsebene. Die Bewilligung der Mittel <strong>für</strong> die Vorbereitung des Gesamtkatalogs<br />
erfolgt im Haushaltsjahr 1895/96, die Anordnung zu seiner Errichtung<br />
ergeht zusammen mit der Veröffentlichung der Preußischen Instruktionen im<br />
Erlaß vom 10. Mai 1899. Entsprechend ordnet sich der alphabetische Katalog<br />
der Berliner Bibliothek um und wird modulansiert: als Abschrift (1902-1908)<br />
<strong>für</strong> die Zwecke eines Umlauimanuskripls aul Zetteln in der Größe <strong>von</strong> 11x16<br />
cm, deren Umlauf in den preußischen Universitätsbibliotheken 1922 beendet<br />
ist. Die darauffolgende Manuskriptedition wirft auf den Bibliothekartagen und<br />
im Preußischen Beirat <strong>für</strong> Bibliothekwesen noch einmal die Frage der Drucklegung<br />
in alphabetischer oder systematischer Form sowie das Problem der<br />
Erweiterung zu emem deutschen Gesamtkatalog auf; die Entscheidung fällt<br />
zugunsten der alphabetischen als der flexibelsten, weil unsemantischen, höchst<br />
einschreibbaren Ordnung. Ist die Funktion der Zettel mit der Umschrift in die<br />
Bandkataloge zunächst erschöpft und damit intermediär (so daß sie teilweise<br />
vernichtet werden), erweisen sie sich fortschreitend in ihrer Flexibilität als dienlich<br />
<strong>für</strong> mancherlei andere Zwecke. So wird aus residenten Speichern ein mobiles<br />
Dispositiv, an das die Technik der Lochkarte nur noch anzuschließen<br />
braucht, und das Gedächtnis <strong>für</strong> die Ewigkeit (Bandkataloge) wird unter der<br />
Hand - d. h. auf Betriebsebene - diskret verzeitlicht. 21 Was als Hilfsmittel begonnen<br />
hatte, als Speichersekretariat auf papiermaschmeller Ebene 22 , wird zum<br />
Agenten des preußischen Buchgedächtnisses: Die Verwirklichung des Unternehmens<br />
Preußischer Gesamtkatalog bedeutet »einen neuen Abschnitt <strong>für</strong><br />
unseren Zettelkatalog, der hierbei eine Hauptrolle zu spielen berufen war«<br />
.<br />
Allen Speichersystemen der Moderne ist gemeinsam, daß sie die längste Zeit<br />
an schriftliche, alphanumerische Adrcssierungsformen gebunden waren und<br />
dementsprechend dem Leitmedium Bibliothek verpflichtet blieben; dies gilt<br />
metaphorisch auch noch <strong>für</strong> den in Konsequenz <strong>von</strong> Kommunikationsoptimierung<br />
unter Weltknegsbcdingungen konzipierten Memory Extender, eine mikrofilmbasierte<br />
Gedächtnismaschine (»a sort of mechanized private file and library«),<br />
21 Rudolf Kaiser, Der alphabetische Zettelkatalog. Ein geschichtlicher Überblick, in:<br />
Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek, hg. v. den wissenschaftlichen Beamten<br />
der Preußischen Staatsbibliothek, Berlin (Preußische Staatsbibliothek) 1921, 99-<br />
109 (101). Siehe auch Adalbcrt Hortzschansky, Die Königliche Bibliothek zu Berlin,<br />
Berlin 1908,65-69<br />
— »Ein oder zwei untere Beamte versehen die rein mechanischen Geschäfte.« Kaiser<br />
1921: 109
PREUISKN IN DI-:N BIBUOTMKKKN: STAATSBIBLIOTHEK BI-:RI.IN 871<br />
deren hyptertextueller Verknüpfungsmodus allerdings alle bibliothekarische<br />
Realkatalogik bereits unterläuft und die medienarchäologische Bruchstelle zur<br />
Epoche der Bibliothekskataloge darstellt - associative indexing ist die wissensarchäologische<br />
Grundlage <strong>für</strong> »a provision whereby any item may be caused at will<br />
to select immediately and automatically another.« 23 Kybernetik und Gedächtnis,<br />
Ordnung und Befehl, Katalog, Klassifizierung und Algorithmus: Speichertechniken<br />
folgen einem <strong>Im</strong>perativ, der Signalübertragung überhaupt erst in Gang<br />
setzt. Alphanumcrik steuert die Kanahsierung des buchgebundenen Wissens; die<br />
Signaturen setzen sich aus einem Großbuchstaben bzw. einem Gröl?- und einem<br />
Kleinbuchstaben und einer Nummer zusammen. Läßt sich die Datenstruktur<br />
eines Realkatalogs in Begriffen der Informatik, etwa als Algorithmus beschreiben?<br />
Spielte etwa beim Bibliothekar Leibniz bei der Katalogisierung sein mathematisches<br />
Interesse mit, anschließbar an seinen Begriff der Digitalisierung als<br />
Diskretisierung der Wissenspartikel? Die Frage der Lokalisierung <strong>von</strong> Wissen<br />
aber löst er nicht mit Algorithmen, sondern durch schlichte (und nicht doppelte)<br />
Indizierung mit alphabetisch geordneten Verfasser- und Schlagwortkatalogen. 24<br />
Damit hat er zwar eine alphabetisch-serielle Ordnng gedacht, die aber mit seinem<br />
Projekt einer Scientia Universahs, »einer kompletten Durchkalkühsierung<br />
<strong>von</strong> Wissen« (Jochum) im Widerstreit hegt.<br />
Realkatalogisierung<br />
G. H. Pertz, 1842-73 Direktor der Königlichen Bibliothek Berlin, fördert (nachdem<br />
er zuvor Archivar, Geschichtsschreiber und vor allem nach dem Tode<br />
Böhmers 1863 alleiniger Leiter und Organisator der Monumenta Germaniae<br />
Historica gewesen war) besonders die Geschichtswissenschaft. <strong>Im</strong> Neubau der<br />
Staatsbibliothek <strong>von</strong> 1920 ziehen schließlich auch die MGH mit Direktzugang<br />
zum Katalograum ein - ein Interface <strong>von</strong> Quelle und Wissensorganisation.<br />
Zuknnftw•eisend (Schochow) — d. h. sie setzend - wird die in der Ära Pertz in<br />
Angriff genommene Sacherschließung der Bestände. Johann Erich Biester verzichtet<br />
Anfang des 19. Jahrhunderts im Zuge des Projekts der Aufklärung, nach<br />
einem rationalen Prinzip das Ganze der Wissenschaft in eine endgültige systematische<br />
Ordnung bringen zu können, noch auf die mechanische Herstellung<br />
eines Realkatalogs; er hat dabei das Dresdner Beispiel vor Augen, eine Bibliothek<br />
ohne Katalog und Signaturen zugänglich zu halten, also die sich selbst erklärende<br />
23 Vannevar Bush, As we may think, in: Atlantic Monthly, Juli 1945, 101-108 (107). Siehe<br />
Gloria Meyncn, Bürokrieg, demnächst in: Sigrid Schade / Georg Christoph Tholen<br />
(Hg.), Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien, München (Fmk) 1998<br />
24 Ein Hinweis <strong>von</strong> Uwe Jochum (Konstanz)
872 BlBUOTHKK<br />
Ordnung des Wissens. 25 Damit korrespondiert in Berlin, daß erst 1845 die realen<br />
Bände mit dem Supplement äußerlicher Signaturschilder versehen werden;<br />
fortan ist die Administration des Wissens dessen Trägermedien eingeschrieben,<br />
buchstäblich mit am Werk. 1842-81 entsteht unter der Federführung des Naturwissenschaftlersjulius<br />
Schrader der universal-hierarchische Realkatalog, eine alle<br />
Wissenschaften umfassende Systematik. 26 Seit 1844 erfolgt die Erarbeitung eines<br />
systematischen Bandkatalogs, fertiggestellt 1881 unter Anwendung des auf jahrhundertelangen<br />
Zuwachs (tatsächlich fehl-)berechneten, zu Rissen im alphanumerischen<br />
System aus Fachbuchstaben und individuellen Ziffern lührenden<br />
elastischen Systems springender Nummern 2 ''. Unterstützt wird diese Technik<br />
durch ein Gutachten des Kustos der Hof- und Staatsbibliothek in München:<br />
Föhnnger plant neben dem alphabetischen Katalog <strong>für</strong> alle Bücher auch Fachkataloge,<br />
scheitert damit jedoch am Mangel humaner Arbeitszeit; <strong>von</strong> daher die<br />
Nutzung der »Standorts-(Nummern-)Repertorien über die einzelnen Aufstellungsfächer,<br />
welche vor der Hand die Stelle <strong>von</strong> Fachcatalogen vertreten« 28 . Die<br />
Ordnung des Raumes (Regale, Fächer) strukturiert die Ordnung des Wissens und<br />
den Speicherstil, inventarbezogen:<br />
»Die Art und Weise unserer Aufstellungsmethode ist eine systematischalphabetische,<br />
eine Zerfällung der Gesammtmasse in XII Hauptklassen u. dieser<br />
wieder in c. 180 Unterabteilungen /:Fächer:/ nach den 3 Formaten, in deren jedem<br />
die Bücher alphabetisch nach den <strong>Namen</strong> der Autoren aufestellt sind. Die Evidenthaltung<br />
des Alphabets, d. h. die Einreihung des neuen Zugangs wird durch<br />
Anwendung <strong>von</strong> Buchstaben-Exponenten erzielt. im Allgemeinen ist<br />
diese Aufstcllungsweise zuverläßig die beste, d. h. die brauchbarste, die es geben<br />
kann. Daß sie dem Ideal eines wissenschaftl. Bibliothek-Systems nicht entspreche,<br />
muß freilich zugegeben werden; allein, welche andere Aufstellung entspricht jenem<br />
Ideale ganz} Welche Verschwendung edler Kräfte ist es, wenn einem Phantome<br />
zulieb die Bibliothekare in höchsteigener Person das gräßliche Geschäft des<br />
Deponirens und Herbeiholens der Bücher zu versehen genothzüchtigt sind? Und<br />
wozu nutzt die nach den kleinsten systematischen Fasern durchgeführte Aufstel-<br />
2:1 Roloff 1961: 143, unter Bezug auf Georg Leyhs, Handbuch der Bibliothekswissenschaften,<br />
Bd. 3.2, 2.Aufl. 1957, 349, und F. Kreis, Die Königliche Bibliothek, 1936, 17<br />
:fi Geschichtlicher Abriß, 9-11 (10), in: Werner Schochow, 325 Jahre Staatsbibliothek in<br />
Berlin: das Haus und seine Leute; Buch u. Ausstellungskatalog, Wiesbaden (Reichert)<br />
1986<br />
27 Georg Heinrich Pertz, Die Königliche Bibliothek zu Berlin in den Jahren 1842 bis<br />
1867, Berlin 1867, 15, und Hortzschansky 1908: 64<br />
28 Dokument 7 (194f), in: Conrad Grau, Georg Heinrich Pertz (1795-1876) als Wissenschaftsorganisator.<br />
Dokumente über den Alltag und zur Professionahsierung der<br />
Geschichtswissenschaft, in: Jahrbuch <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> 37: Fortschritt und Reaktion im<br />
Geschichtsdenken der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hg. v. Hans Schleier, Berlin<br />
(Akademie) 1988, 177-204 (182)
PlU-UßKN IN Dl'N BlßUOTI IKKKN: S'l'AATSBIBl.IOTHKK BKRI.IN 873<br />
lung /: in die sich außer ihrem Urheber kein selbstdenkender Kopf ohne ziemliche<br />
Selbstverläugnung finden kann./ wenn Tausende <strong>von</strong> Büchern fortwährend<br />
ausgeliehen, also nicht am Fache sind?« 29<br />
Das alphabetisch geordnete Sachregister zum Systematischen Katalog der Staatsbibliothek<br />
Berlin Unter den Linden liest Archäologie, Architektur und Archivkunde<br />
in unmittelbarer Folge. Jedes Buch erhält eine individuelle Signatur in<br />
Gold aufgeprägt (das Stigma der Klassifikation), und das heißt Trennbarkeit <strong>von</strong><br />
Katalog (Adreßkopf) und Bestand - eine Trennung, die durch die symbolische<br />
Zuordnung aufgehoben wird, insofern der standortgebundene Katalog nicht nur<br />
die systematische Aufstellung der Bücher im Magazin exakt wiederspiegclt,<br />
sondern die systematischen Aufstellung selbst »als etwas dem deutschen Geiste<br />
Wahlverwandtes empfunden« wird: »Sonst hätten die Franzosen, kaum 1918 in<br />
Straßburg eingerückt, sie nicht sofort in der dortigen Universitätsbibliothek<br />
beseitigt.« 31 Die Nummer im Verzeichnis bestimmt dabei zugleich den Platz im<br />
Magazin - ein aus der <strong>von</strong>-Neumann-Architektur des Computers vertrautes<br />
Prinzip der Speicherverwaltung, das »mit einem Minimum <strong>von</strong> Arbeit ein Optimum<br />
<strong>von</strong> Leistung erzielt« . So wird der <strong>von</strong> Aby Warburg<br />
aus der Neurophysiologie Richard Semons aufgegriffene Begriff der mnemischen<br />
Energie berechenbar. 32 Die Aufnahme und Ordnung der Titel erfolgt dabei<br />
zunächst auf Zetteln, die dann in große Katalogbände im Folio-Format abgeschrieben<br />
werden und nicht nur selbst beliebig geordnet werden können, sondern<br />
ihrerseits auch die Neuordnung <strong>von</strong> Büchern bedingen - ein rekursives<br />
Programm. Auf der anderen Seite dieser Logistik steht der betriebswirtschaftliche<br />
Begriff der chaotischen Lagerhaltung, wo die Waren nicht mehr nach Warengruppen<br />
sortiert werden, sondern dahin wandern, wo aktuell ein Lagerplatz frei<br />
ist. Unsortiert folgen sie also dynamischen Suchkriterien wie der Zugriffszeit,<br />
nach dem Vorbild eines RAM-Speichers: »feste Speicheradresse, variabler Speicherinhalt.<br />
Die traditionellen Lager waren Festwertspeicher.« 33 Symbolische<br />
Repräsentation und infrastrukturelle Administration des Kulturgedächtnisses als<br />
29<br />
Heinrich Konrad Föhringer an Pcrtz, München, 22. März 1842, in: Grau 1988: 194<br />
30<br />
Deutsche Staatsbibliothek: Systematischer Katalog bis 1955 (Alter Realkatalog): Sachgruppen-<br />
und Signaturübersicht, zus.gest. v. e. Arbeitsgruppe d. Systemat. Kataloges<br />
unter I.tg. v. Marianne Caspcr u. mit e. F.inf. v. Peter Kittel, Hildesheim u. a.<br />
(Ulms) 1991, 187<br />
31<br />
Richard Pfennig, Unser Realkatalog, in: Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek<br />
1921: 109-113(112)<br />
32<br />
Siehe den Auszug Richard Semon, Der Engrammschatz des Gedächtnisses [1904], in:<br />
Uwe Fleckner (Hg.), Schatzkammern der Mnemosyne, Dresden (Verlag der Kunst)<br />
1995,206-212<br />
33<br />
Bernhard Vief, Digitales Geld, in: Florian Rotzer (Hg.), Digitaler Schein. Ästhetik der<br />
elektronischen Medien, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1991, 117- 146 (143, Anm. 11)
874 BIUI.IOTIIKK.<br />
Speicherarchitektur treten auseinander angesichts der Notwendigkeit neuer<br />
Lösungen in der Lagerung <strong>von</strong> Büchern. Der spätere Generaldirektor beschreibt<br />
die Königliche Bibliothek zu Berlin 1912:<br />
»Die großen, eindrucksvollen Säle mit den hohen luicherbedeckten Wanden sind<br />
verschwunden; in nüchterner Gleichmäßigkeit reiht sich in niedrigen Speichergeschossen,<br />
deren Anordnung vom Britischen Museum aus die Bibliothekswelt<br />
erobert hat, Gestell an Gestell, keinerlei ästhetische Freude weckend, aber außerordentlich<br />
praktisch: die Fassungskraft des Raumes ist ins mehrfache gesteigert,<br />
und die Zugänghchkeit der Bestände hat ungemein gewonnen.« 3 * 1<br />
Kriege sammeln: 1870/71, 1914 und 1939 (Berlin, Leipzig)<br />
Am 2. September 1873 geht der Berliner Königlichen Bibliothek aus der Privatbibliothek<br />
Wilhelms I. die Kriegssammlung zu, die dann im großen Mittelsaal<br />
der Bibliothek zu besichtigen und später unter Krieg 1870/71 benutzbar ist.<br />
Die auf Vollständigkeit abzielende Sammeltätigkeit hat mit der Kriegserklärung<br />
Frankreichs an Preußen selbst, also in einem Echtzeit-Verhältnis zum Geschehen,<br />
eingesetzt, organisiert vom kaiserlichen Bibliothekar, dem Geheimen<br />
Hofrat Louis Schneider. 35 Es handelt sich um eine bibliothekarische Parallelaktwn<br />
zum Krieg (Peter Berz) mit dem Ziel, das überreiche Material »zu einem<br />
literarischen Monumente, zu einer Trophäe der gesamten geistigen Tätigkeit<br />
vor, während und nach dem Kriege zu gestalten« .<br />
Zwischen Monument und Dokument, Ornament und Information: Kaiser Wilhelm<br />
sucht seine Kriegssammlung »nicht blos ein literarisches Denkmal<br />
jener großen Zeit, sondern auch eine nutzbare historische Quelle <strong>für</strong> spätere<br />
Generationen« zu sichern. 36 So gilt im Anschluß an Fouczuhs Archäologie<br />
des Wissens, daß auch Monumente aus Geist einen im vorliegenden Fall bibliothekstechnisch<br />
konstruierten Sockel haben. »Um zum Monument zu werden,<br />
muß nämlich die geistige Tätigkeit eines Krieges einer Bedingung unterworfen<br />
werden: sie darf nicht in der übrigen Bibliothek aufgehen«, sondern sie muß als<br />
geschlossener Bestand eigene Standorte und Signaturen haben, eigene Kataloge<br />
mit eigenen Ordnungsschmata und Ordnungsworten. 37 Separation und Dis-<br />
•'•' Fritz Milkau, Die Bibliotheken, in: Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der<br />
Gegenwart, 2., verb. u. verm. Aufl. Berlin u.a. (Tcubner) 1912, 580-631 (609f)<br />
33 Louis Schneider, Königliche Bibliothek, Berlin 1873, 4f<br />
36 Paul Hirsch, Die »Kriegssammlung« der Königlichen Bibliothek zu Berlin, in:<br />
Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. August Wilmanns zum 25. Mai 1903 gewidmet,<br />
Leipzig (Harrasowitz) 1903, 97-106 (101)<br />
37 Peter Berz, Weltkrieg/System. Die »Kriegssammlung 1914« der Staatsbibliothek Berlin<br />
und ihre Katalogik, in: Krieg und Literatur V (1993) Nr. 10, 105-130 (106)
PRI:UIU:N IN DHN BIBI.IOTHHM-N: STAATSBIBLIOTHEK BI-.RI.IN 875<br />
kretheit sind die Bedingung gedächtnisemphatisch aufgeladener Räume. Einordnung<br />
in die Register des Zivilen hätte jede Differenz zum Verschwinden<br />
gebracht: »Das Material hätte sich vertheilt und wäre in den Rubriken verschwunden,<br />
die Bilder hätten das Vorrecht ihrer Bedeutung an das Format der<br />
Mappe abtreten müssen« . Der Inhalt der Form ist demnach<br />
ein Effekt <strong>von</strong> Administration im Rahmen archivahscher Ordnungen. Die kaiserliche<br />
Schenkungsurkunde vom 20. Juni 1873 weist an, daß die Gegenstände<br />
»als eine untrennbare Sammlung, welche Ich persönlich habe erstellen lassen, in<br />
der Bibliothek abgesondert bewahrt werden«
876 BiBi.ioTiii-.k<br />
phische Apparate und Photographie); eintreffende Signale werden nicht durch<br />
symbolische Operationen der systematischen Katalogisierung sogleich in Information<br />
verwandelt, sondern bleiben, buchstäblich, im Zustand als datum. Nicht<br />
länger ist Krieg damit eine kategoriale Untermenge etwa der <strong>Geschichte</strong> (wie im<br />
alten Realkatalog), sondern wird selbst Subjekt einer Sammlung namens Krieg<br />
1914 (bis daß die Zerstückelung der Sammlung 1945 Schultzes Sachschema wieder<br />
zerreißt und erst auf Internetebene wieder zusammengeführt wird 42 ). Der<br />
Sachkatalog der Berliner Kriegssammlung wird modular, nämlich als Zettelkatalog<br />
angelegt, »unter bewußtem Verzicht auf jede apriorische Konstruktion oder<br />
ein fertiges wissenschaftliches Schema nur aus dem vorhandenen Material heraus«<br />
. Fortan hält sich die Architektur der Aufspeicherung an die Vorschrift der Gegebenheiten und nicht umgekehrt an das <strong>Im</strong>aginäre<br />
einer Systematik. An die Stelle <strong>von</strong> Historie tritt die Option einer vergangenen<br />
Zukunft; »um sich die Möglichkeit späterer Umordnung offen zu halten«, wird<br />
der Sachkatalog, der unter der Rubrik XIX Der Krieg in der Erinnerung sich<br />
selbst als Wissensobjekt enthält (»Knegsmuscen und Kriegssammlungen«), als<br />
Zettelkatalog angelegt. 43 Daß Zettel als Subjekt des Themas »Krieg« auch dessen<br />
Objekt sein können, erfährt Richard Dobel 1943, als Bomben die Kartei seiner<br />
8800 Goethe-Zitate völlig vernichten. Die Diskretisierung und Modularisierung<br />
solcher Datenbanken aber impliziert immer schon ihre Refigurierbarkeit (eine der<br />
Basisgedanken <strong>von</strong> Hypertext und Internet): »Noch im selben Jahr begann ich<br />
die Arbeit <strong>von</strong> neuem.« 44 Unter Kriegsbedingungen vollzieht sich also jene <strong>für</strong><br />
die Genealogie <strong>von</strong> Gedächtnistechniken prägnante Diskontinuität, deren Sondierung<br />
Aufgabe einer Medienarchäologie des Wissens ist. Das <strong>von</strong> den neuen<br />
Medien des Kriegs in Druck gesetzte Schrifttum (etwa Fliegerabwürfe) »sprengt<br />
bisherige Inhalte« und damit den Begriff <strong>von</strong> Literatur; Krieg wirkt zerstörend,<br />
aber eben »auch literarisch direkt produktiv.« Krieg sprengt jedoch nicht nur die<br />
Grenzen <strong>von</strong> Wissen als Objekt, sondern auch dessen Ordnung; die daraus resultierenden<br />
neuen Anforderungen an das Katalogwesen lassen sich »bloß auf Grund<br />
der bibliothekarischen Tradition nicht beantworten« .<br />
Auf der Ebene der Datenverarbeitung schreibt die Revolutionssammlung auf<br />
ministeriellen Erlaß vom 11. Dezember 1918 die Knegssammlung fort - um<br />
4 - Die Liste <strong>von</strong> Internet-Adressen zum Ersten Weltkrieg im Ausstellungskatalog 1999<br />
der Berliner Staatsbibliothek folgt Schultzes Einteilung in 20 Sachgruppen optional<br />
(79-86).<br />
4) Walther Schultzc, Schema des Sachkatalogs der Knegssammlung der Preußischen<br />
Staatsbibliothek, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, 36. Jg., 5. u. 6. Heft (1919), 108-<br />
126(108f u. 126)<br />
44 Lexikon der Goethe-Zitate, Zürich / Stuttgart (Artemis) 1968, Vorwort des Herausgebers<br />
(Richard Dobel)
PKI:UISI:N IN DI-.N Bim.K vn M-.KI-IN: STAATSHIBI.IOTHI.K BI-.RI.IN 877<br />
Stückwerk zu bleiben wie diese; »die Schuld daran ist in erster Linie allen jenen<br />
revolutionären Organisationen zuzumessen«, welche (anders als die Weitsicht<br />
Lenins in der russischen Oktoberrevolution) das Oxymoron eines Revolutionsarchivs<br />
nicht nachzuvollziehen bereit sind. 43 Die Modularisierung der Informationsspeicherung<br />
setzt sich mit der Anlage einer Zeitungsausschnittssammlung<br />
durch; Textverarbeitung im Speicher wird diskret. Der Krieg schaltet auch das<br />
Prozcdere seiner Selbstspeicherung im Katalogweisen in den Ausnahmezustand:<br />
Alles den Krieg betreffende wird eingereiht, »ohne Rücksicht darauf, ob es nach<br />
seinem Inhalt dem sonst in der Bibliothek geltenden Prinzip gemäß in einen anderen<br />
Katalog gehört hätte« . Random access sprengt die buchstäbliche<br />
Selbstreferentialität des preußischen Katalogwesens - auch durch an<br />
differente Medien gekoppelte Gedächtnisgattungen wie die Kriegsphotographie.<br />
Zunächst weigern sich die Bibliothekare, jene neuen Nachrichtenmedien vom<br />
Rande ihrer Gutenberg-Galaxis wahrzunehmen. Doch als den Kriegssammlungen<br />
Materialien zuströmen, »die außerhalb der gewohnten Buchstabenliteratur<br />
liegen«, erweist sich vielfach die durch die preußische Instruktion gebotene formale<br />
Behandlung »als ungenügend oder unpassend«. 46 Die Kartensammlung des<br />
Großen Generalstabs wird der Staatsbibliothek nach dessen Auflösung 1919 eingegliedert;<br />
das Reich der Buchstaben wird um das der Graphik erweitert. Am 1.<br />
April 1920 bricht mit der Lautabteüung das Reale der Frequenzaufzeichnung in<br />
die symbolische Ordnung der Lettern ein: »Die toten Buchstaben und Büchertexte<br />
werden hier durch die Ergänzung der Lautplatte lebendig und verkörpern<br />
eine wirkliche Lautbücherei.« 47 Damit wird der Schriftbegriff, durch den sich die<br />
Leipziger Deutsche Bücherei mitten im Weltkrieg frontal auszeichnet (ihr<br />
inschriftliches Schiller-Motto Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen<br />
Gedanken), grammophon - in einem Speichermedium, das (im Unterschied zu<br />
Druckbuchstaben) zwischen Signal und Geräusch nicht mehr trennt 48 . Weshalb<br />
45<br />
Wilhelm Krabbe, Die Revolutionssammlung, in: Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek,<br />
hg. v. de. wissenschaftlichen Beamten der Preußischen Staatsbibliothek, Berlin<br />
(Preußische Staatsbibliothek) 1921, 90f (91)<br />
46<br />
Walther Schultze, Die Katalogisierung der Kriegssammlungen, in: Verband deutscher<br />
Kriegssammlungen e. V., Mitteilungen 1920 Nr. 2, 41-54 (42). In der Berliner Staatsbibliothek<br />
ist diese Schrift unter der Signatur^ Krieg 1914/23715 gespeichert, die gleichzeitig<br />
nennt, was sie adressiert und den Durchbruch zur fortlaufenden Zählung jenseits<br />
wissensklassifikatonscher Erzählung signalisiert.<br />
47<br />
Wilhelm Docgen, Die Lautabteilung, in: Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek<br />
1921:253-258(253)<br />
4X<br />
»In Graphic und/oder Phonic des Titelworts >Sprache< steckt die Lautverbindung >ach>«:<br />
Friedrich A. Kittlcr, Aufschreibesysteme 1800 / 1900, München (Fink) 1985, 48. Dort<br />
auch die Abschnitte »Elemente <strong>von</strong> Sprache und Musik um 1800« (48ff); zum Einbruch<br />
der technischen Aufzeichnungsmedien: ders., Grammophon, Film, Typewntcr, Berlin
878 Biüi.iüTHi.K<br />
die Lautabteilung der Berliner Staatsbibliothek konsequent auch »Geräusche<br />
natürlicher und künstlicher Art und andere« aggregiert, etwa das »Rauschen der<br />
Blätter«. Was als literarische Poesie der Romantik begonnen hat 49 , kommt im Realen<br />
der transsymbohschen Aufzeichnungsmedien zu sich. Der Krieg, der diese<br />
neuen technischen Aufnahmemethoden (das glyphische System: »Eingravierung<br />
<strong>von</strong> Lautschwingungen mittels eines nach bestimmten Grundsätzen geschliffenen<br />
Saphirs oder Rubins auf eine Wachsplatte in Berliner Schrift«) durchsetzt, schreibt<br />
sich diesem neuen Gedächtnis selbst, als eenture automatique ein: »Gewehrfeuer<br />
(Theorie des Knalls), Fliegergeräusche«. Derselbe Krieg stellt nicht nur neue Aufzeichnungstechniken<br />
<strong>von</strong> Kultur, sondern auch deren Laborsituation zur Verfügung;<br />
zwischen dem 4. und 6. Oktober 1916 macht der Keltologe Rudolf<br />
Thurneysen im Lager Köln-Wahn im Auftrag der 1915 gegründeten Phonographischen<br />
Kommission Lautaufnahmen <strong>von</strong> Kriegsgefangenen nicht nur zu archäooder<br />
ethnologischen, sondern ebenso zu propagandistischen Zwecken. 50 Basis der<br />
Lautabteilung in der Berliner Bibliothek sind die während des Weltkriegs auf<br />
Anregung Doegens in Kriegsgefangenenlagern unter der wissenschaftlichen Leitung<br />
Stumpfs erstellten Aufnahmen; so wird aus Lager Speicher. 51 Die auf galvanoplastischem<br />
Wege in negative Kupferabzüge verwandelten Wachsplatten<br />
generieren eine neue, physikalisch induzierte Form <strong>von</strong> Denkmal: »Die Stimmen<br />
aller führenden Persönlichkeiten der Welt werden hier gleichsam in einem Stimmenmuseum<br />
festgehalten« . Weltkrieg II läßt diese Transformation <strong>von</strong><br />
schritt- in physikalisch basierte Monumente des deutschen Gedächtnisses eskalieren.<br />
Die Reorganisation der deutschen Wirtschaft im Zuge des Zweiten Weltkriegs<br />
bewirkt das produktionsbedingte Zusammenkommen <strong>von</strong> Menschen mit<br />
verschiedenen Dialekten aus diversen deutschen Reichsteilen in Mitteldeutschland;<br />
dort kommt es auf Kinderebene zu einer »Mischsprache«, deren Zusammenwachsen<br />
wissenschaftlich erschlossen werden soll, in diskreten Schritten. Das<br />
Archiv als Bedingung dessen, was überhaupt erfaßbar und damit buchstäblich sag-<br />
(Brinkmann & Böse) 1987. Das Vorwort hebt an mit einer Erinnerung an den Großen<br />
Generalstab der Weltkriege: »Medien bestimmen unsere Lage« (3).<br />
49 Siehe Paul de Man, Anthropomorphismus und Trope in der Lyrik, in: ders., Allegorien<br />
des Lesens, aus d. Amerikan. v. Werner Hamacher u. Peter Krumme, Frankfurt/<br />
M. (Suhrkamp) 1988, 179-204<br />
so Dazu Aimcc Torrc Brons, Propaganda mittels Urahnen. Die Keltologic im Dritten<br />
Reich, in: Berliner Zeitung Nr. 78 v. 2. April 1998, 15. Brons kommentiert: »Jede auf<br />
Nationalität bzw. Volkstum begründete Wissenschaft scheint besonders anfällig <strong>für</strong><br />
politische und ideologische Vereinnahmungen zu sein.«<br />
51 Doegen 1921: 255f. Siehe auch W. E., Hornbostels Klangarchiv: Gedächtnis als Funktion<br />
<strong>von</strong> Dokumentationstechnik, in: Sebastian Klotz (Hg.), »Vom tönenden Wirbel<br />
menschlichen Tuns«: Erich M. <strong>von</strong> Hornbostel als Gestaltpsychologe, Archivar und<br />
Musikwissenschaftler, Berlin / Milow (Schibri) 1998, 116-131
PRHUUI-N IN DKN BIBIJOIIII-.KI.N: STAATSBIBLIOTHEK BI-RUN 879<br />
bar ist, ist hier ein technisches Dispositiv, um »feinste, sehr allmähliche Vorgänge<br />
zu beobachten und festzuhalten - Sprachgeschwindigkeit, Pausen, Sprachmelodie.<br />
Erst die Erfindung der Wachsplatte hat überhaupt die Möglichkeit der wissenschaftlichen<br />
Arbeit auf diesem Gebiet gegeben.« 52 Der Nervenarzt Dr. Eberhard<br />
Zwirner suchte parallel dazu geistige Erkrankungen <strong>von</strong> Patienten in deren<br />
sprachlicher Artikulation nachzuvollziehen, wie sie »nur <strong>von</strong> dieser Grundlage<br />
aus festgestellt werden konnten«, und gründet 1935 am Kaiser-Wilhelm-Institut<br />
<strong>für</strong> Hirnforschung in Berlin-Buch ein Deutsches Spracharchiv mit Schallplatten<br />
und anderen »akustischen Dokumenten«. Daraus erwächst in Braunschweig das<br />
selbstständige Kaiser-Wilhelm-Institut <strong>für</strong> Phonometne, Deutsches Spracharchiv.<br />
Die Erschließung der Salzgitter-Erze durch die Reichswerke Hermann Göring<br />
bringen deutschstämmige Arbeitskräfte zusammen; hier hofft man nun »aus der<br />
gegenseitigen Durchdringung und Abschleifung der einzelnen Mundarten, das<br />
Entstehen einer >neuen UmgangsspracheMundartDie Sprache, der die Historiker<br />
bisher nachgelaufen sind wie der Junge dem Schmetterling, entwickelt sich jetzt<br />
vor unserem Auge und wie durch ein Vergrößerungsglas gesehen*, heißt es m einer<br />
Veröffentlichung <strong>von</strong> Dr. Dietrich Gerhard . Die vor mehr als vier Jahrzehnten<br />
in dem Buch <strong>von</strong> Theodor Siebs festgelegte Hochform der deutschen<br />
Sprache wird in der Wirklichkeit <strong>von</strong> niemand gesprochen, ein durch die verschiedene<br />
Dialekte und durch >Nachlässigkeiten< bestimmtes Mittelding nimmt ihren<br />
Platz ein. Zudem hat Siebs seinerzeit zwar die Art und Erzeugungsstelle der einzelnen<br />
Laute (Zunge, Gaumen, Kehle) festgelegt, nicht aber eine Normung <strong>von</strong><br />
Tonhöhe, Tonfall, Sprachgeschwindigkeit, Klangfarbe, der Pausen und der Sprachmelodie<br />
versucht. Neue Verfahren der Lautmessung, der >PhonometneLautdenkmal deutscher Mundarten zur Zeit Adolf Hitlers< versucht hat.« <br />
52 Artikel »Eine neue Umgangssprache?« in: Frankfurter Zeitung<br />
v. 16. Mai 1942
880 BlIU.IOTHKK<br />
Denn die Monumente des 20. Jahrhunderts nehmen Formen der mathematischen<br />
<strong>Im</strong>materialität an; das Gedächtnismedium ihrer Beschreibung ist nicht mehr der<br />
sprachliche Text, sondern das Diagramm: »Bei dem deutschen Spracharchiv handelt<br />
es sich um ein einzigartiges Forschungsinstitut , das zur Aufgabe hat,<br />
durch phonometnsche Schallplattenaufnahmcn das gesamte Erscheinungsbild<br />
der deutschen Sprache zu registrieren und zu beschreiben.« 53 Hier wird das Speichermedium<br />
vom Gedächtnis- zum Meßinstrument. Wo neben eine phonetischlinguistische<br />
Abteilung eine mathematisch-statistische Abteilung sowie eine<br />
physikalisch-technische Abteilung treten soll, sind nicht mehr Germanisten oder<br />
Philologen, sondern Mitarbeiter mit der Fähigkeit zu »umfangreichen Mess-,<br />
Zähl- und Rechenarbeiten« verlangt 54 :<br />
»Erforderlich ist jedoch ehe Anstellung eines Elektrotechnikers zur Überwachung<br />
der Apparatur, zur technischen Durchführung der Schallaufnahmen und zur Hilfeleistung<br />
bei den Überschneidungen der Magnetophon-Aufnahmen auf Wachs<br />
und bei der Auswertung der Schallplatten; ferner ein Photograph zur Durchführung<br />
anthropologischer Photographicn sowie <strong>von</strong> Tonfilmen zur Erforschung<br />
der gestikulatorischen Sprechbewegungen. Ein in dieser Weise aufgebautes<br />
Institut würde es möglich machen, die am Buch und Buchstaben hängende Sprachund<br />
Lautwissenschaft unter Beibehaltung der vergleichend-sprachwissenschaftlichen<br />
Aufgaben, unter Heranziehung naturwissenschaftlicher Voraussetzungen<br />
und Methoden zum lebendigen Sprechen und zu der sprechenden Person in ihrem<br />
natürlichen Lebenskreis hinzuführen.« <br />
- womit Leben in seiner Umwelt selbst archivierbar wird. Dahinter aber verbirgt<br />
sich eine Knegswissenschaft; als genannter Dr. Zwirner sich als Regimentsarzt<br />
sich um Versetzung an das Luftwaffenlazarett in Braunschweig bemüht, dann<br />
mit der Begründung, seine früheren Versuche über psychische und Sprachstörungen<br />
fortzusetzen, »die bei Sauerstoffmangel in grossen Flughöhen oder<br />
bei körperlichen Erschöpfungszuständen auftreten und gleichzeitig die<br />
Auswertung dieser Untersuchungen <strong>für</strong> das Deutsche Spracharchiv in Angriff«<br />
zu nehmen. 55 Wissensarchäologische Rupturen vollziehen sich auch innerhalb<br />
des Buchstabenbereichs. Unter Echtzeitbedingungen wird aus einem <strong>von</strong> der<br />
33 Auszugsweise Abschrift zum Dokument LG 1400 Bswg - 378 I. des Rcichsministers<br />
der Finanzen, Berlin, 21. Juni 1940, an die Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-<br />
Gesellschaft in Berlin (Schloß), in: Archiv zur <strong>Geschichte</strong> der Max-Planck-Gesellschaft,<br />
I. Abt., Rep. 0001 A, Nr. 2938<br />
54 Schreiben des Deutschen Spracharchivs (Staatliches Institut <strong>für</strong> Lautforschung) Braunschweig<br />
vom 16. Juni 1940 an den Braunschweigischen Minister <strong>für</strong> Volksbildung,<br />
zum Vorschlag der Umwandlung des Archivs ins ein Institut der Kaiser-Wilhelm-<br />
Gesellschaft<br />
55 Der Braunschweigische Minister <strong>für</strong> Volksbildung am 12. März 1942 (Aktenzeichen<br />
V I 407/42) an die Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin, ebd.
PRKUISKN IN I)I-:N BIBUOTHKKF.N: STAATSBIBLIOTHEK BKRI.IN 881<br />
bibliothekarischen Akzessionsabteilung vorgesehenen Objekt das Subjekt, der<br />
Generator eines Archivs, indem der Krieg selbst literarisch produktiv wird:<br />
»Neben die Literatur über den Krieg trat ein unmittelbar aus dem Krieg<br />
erwachsenes Schrifttum: ganz neue Literaturgattungen entstanden, wie Schützengraben-,<br />
Gefangenen-, Firmenzeitungen, Bildpropaganda u. dgl. mehr.« 36<br />
Es sind die Bestandsignaturen, die als Notation zwischen den Kriegssammlungen<br />
differenzieren: <strong>für</strong> 1870/71 als Knegs-SammL; <strong>für</strong> die Weltkriegssammlung<br />
1914-1918 Krieg 1914; der Waffengang <strong>von</strong> 1939-1945 schließlich heißt N.<br />
Kat. Krieg. Der Generaldirektor der Preußischen Staatsbibliothek Berlin wendet<br />
sich am 25. September 1939 an den Ministerrat <strong>für</strong> die Reichsverteidigung, Berlin<br />
unter Hinweis auf die Flüchtigkeit <strong>von</strong> Gedächtnis unter Kriegsbedingungen:<br />
»Die Preußische Staatsbibliothek als größte Bibliothek des Reiches legt entsprechend<br />
ihren grossen Sammlungen über den Krieg 1870/71 und über den Weltkrieg<br />
eine neue Kriegssammlung an. In diese Sammlung gehört alles gedruckte und vervielfältigte<br />
amtliche und nichtamtliche Material, das auf den Krieg bezug hat .<br />
In Ansehung der schnellen Vergänglichkeit vieler dieser Druckschriften und des<br />
hohen Wertes, den vor allem die Knegssammlung über den Weltkrieg 1914-18<br />
schon während der Dauer des Krieges und in der Nachkriegszeit erwiesen hat, bittet<br />
die Staatsbibliothek zu veranlassen, daß ihr alle Drucke dieser Art in einem<br />
Stück überwiesen werden, und daß sie in die entsprechenden Verteilerlisten<br />
aufgenommen wird. Alle Stücke, <strong>für</strong> die es verlangt wird, werden als streng geheim<br />
behandelt und bis auf weites <strong>von</strong> jeder Benutzung ausgeschlossen.«' 7<br />
Diese Sammlung sollte in gleicher Weise aufgebaut werden wie die zu den vorangegangenen<br />
Kriegen, eingeschränkt auf die Literatur zu den eigentlichen<br />
Kricgshandlungen. Sammlung und Katalog sind Fragment geblieben; der als<br />
Kartei angelegte ursprüngliche Sachkatalog ist im Krieg verlorengegangen und<br />
wird nach 1945 mit den Nachweisen der noch vorhandenen Bestände neu eingerichtet.<br />
Keine bessere Allegorie der <strong>Geschichte</strong> ist denkbar als die Ruine ihrer<br />
Speichermedien. »Die Sammlung >Krieg 1914< macht auch durch ihr eigenes<br />
Schicksal deutlich, daß Krieg kein Mittel der Politik sein darf« , aber tatsächlich Medium <strong>von</strong> Gedächtnispolitik ist.<br />
Die feierliche Einweihung der Kriegssammlung der Deutschen Bücherei<br />
erfolgt am 2. September 1916 als Mobilisierung der Lettern im Kriegsdienst, als<br />
»Mobilmachung des deutschen Buchhandels und eine völlige Neuorientierung<br />
56 Walther Schultze, Die Kriegssammlung, in: Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek<br />
1921: 77-89 (78); G. A. Belov, Zur <strong>Geschichte</strong>, Theorie und Praxis des Archivwesens<br />
in der UDSSR, Marburg (Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft) 1971, etwa 12: »Noch<br />
knallten Schüsse auf den Petrograder Straßen, als in den größten Verwaltungs- und<br />
historischen Archiven Kommissare und Rotgardisten erschienen.«<br />
57 Bundesarchiv Berlin, Bestand R 43 II / 860c, Bl. 105
882 BlBl.lOTHKK<br />
seiner Arbeit«. 58 Der Deutschen Bücherei ist in ihren Gründungsjahren die<br />
Kriegssammlung originär, nicht supplementär eingeschrieben - »kein verhätscheltes<br />
Anhängsel an einem schönen fertigen Bau«. 59 Diese Sammlung soll die<br />
Konversion des Krieges in historische Zeit ermöglichen, durch Konzentration auf<br />
Schriften über Ursachen und Anfang <strong>von</strong> Kriegen (etwa Thukydides' Peloponnesischer<br />
Krieg), denn »die eigentliche Kriegswissenschaft selbst ist im Kriege<br />
ziemlich schweigsam« . Die Echtzeitlogik <strong>von</strong> Kriegsnachrichten ist eine<br />
Provokation des historischen Diskurses der Distanz. Die Leipziger Bücherei enthält<br />
damit nicht nur eine Knegssammlung, sondern sie selbst ist Kriegsschauplatz,<br />
Waffenplatz gemäß ihrer Widmungsinschrift den Geistern der neuen Germanen<br />
im Leseraum als topischem Aufmarschort einer mobilen Armee buchstäblicher<br />
Truppen. Macht sich bereits der Bildschmuck der Deutschen Bücherei die Figuralität<br />
des lesenden Verstehens zunutze, indem er es auf Allegorien des Nationalen<br />
ummünzt; eröffnet der Weltkrieg seinerseits - parallel zu Aby Warburgs<br />
Erfahrung mit Kriegspropaganda, die zur Anlage seines Kriegsarchivs (verzettelte<br />
Zeitungsberichte) führt 60 - wie kein Literatur-Dokument neue Dimensionen ikonographischen<br />
Materials. Lebensmittelkarten etwa erhalten qua Aufspeicherung<br />
in der Deutschen Bücherei den Rang <strong>von</strong> Kulturdokumenten, wie sie gedruckte<br />
Texte kaum auszudrücken vermögen - der »erste schlagende Beweis einer neuen<br />
wirtschaftlichen Organisation«. 61 Ergänzend zum Bericht üher die Gründungsfeier<br />
des Deutschen Vereins <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum am 16. Dezember<br />
1917 publiziert die Druckschrift Bericht über die am 16. Dezember 1917 in Leipzig<br />
abgehaltene Besprechung <strong>von</strong> Vertretern der deutschen Kriegssammlungen<br />
den Beschluß einer Vereinsabteilung Der Weltkrieg in Leipzig. Dessen Zufuhr<br />
speist sich zunächst unmittelbar vom Schützengraben« 62 - hektographierte Blätter<br />
(Soldatenzeitungen), durch welche die Presse mit der Maschinenpistole um<br />
Echtzeit konkurriert und politische Zeitungen ersetzt, »erst recht« unter Nachrichtenbedingungen<br />
des Blitzkriegs . Da ein Großteil der Kriegssammelobjekte<br />
in das Gebiet des Buchwesens und der Graphik fällt oder sich doch<br />
deren Mittel zur Darstellung und Erklärung bedient, erscheint dieser Verein »als<br />
58 Otto Lerche, Die Kriegssammlungen der Deutschen Bücherei, Artikelserie in: Börsenblatt<br />
<strong>für</strong> den deutschen Buchhandel Nr. 272 v. 24. November 1914 ff, Nr. 1 - XTI (I)<br />
59 Lerche ebd., Artikel IV v. 576. Juni 1915<br />
60 Dazu Ulrich Raulff, Parallel gelesen: Die Schriften <strong>von</strong> Aby Warburg und Marc Bloch<br />
zwischen 1914 und 1924, in: Horst Bredekamp / Michael Dicrs / Charlotte Schoell-<br />
Glass (Hg.), Aby Warburg. Akten des internationalen Symposions Hamburg 1990,<br />
Weinheim (VCH) 1991, 167-178<br />
61 Lerche ebd., Artikel VIII (31. August 1916) u. IX (4. April 1917)<br />
hl Albert Paust, Die Kriegssammlungen der Deutschen Bücherei. 1914 und 1939, Leipzig<br />
(Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei) 1940, 4
PRI-UISKN IN IM-;N BIBUOTHI;KI-;N: STAATSBIBLIOTHEK BI-.RI.IN 883<br />
der gegebene Patron« ihrer Hortung. 63 Vorläufig soll damit das in Entstehung<br />
begriffene Reichskriegsmuseum (eine <strong>Im</strong>tative des Königlich Preußischen Knegsministenums)<br />
unterstützt werden, durch »Zurücklegung geeigneten Materials <strong>für</strong><br />
diesen Zweck« . Unter Kriegszeitbedingungen heißt Gedächtnis schlicht<br />
Zwischenlagerung. Nach 1918 teilt die Bibliothek des Großen Generalstabs dem<br />
Vorstand des Vereins <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum in Leipzig mit, daß seine<br />
eigene, während des Krieges vorgenommene Sammlung <strong>von</strong> Kriegsdrucksachen<br />
zum Abschluß gekommen, »geordnet sei und gemäss kriegsministerieller Verfügung<br />
die Verteilung des überzähligen Materials vorgenommen« werden soll<br />
. Aus der Redundanz des militärischen Arbeitsspeichers speist<br />
sich die Bibliothek als kulturelle Institution.<br />
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der den Krieg <strong>von</strong> 1914-1918 erst zum<br />
Ersten macht (und damit Krieg selbst in Serie stellt, der historischen £Vzählordnung<br />
zum Trotz), weckt auch die Medien seines Gedächtnisses. Albert Paust rät<br />
1940, die Knegssammmlung (I) als aktives Schrifttum in einer Sondersammlung<br />
zu speichern . Die Ausstellung zur zweiten Weltkriegssammlung<br />
soll »die in Erscheinung tretenden Parallelen« zur ersten manifestieren:<br />
»Die Tradition des Weltkrieges wurde wieder aufgenommen während der<br />
Besetzung des Sudetengaues« . Gemeint ist das <strong>von</strong> der Deutschen<br />
Bücherei als speicherwürdig klassifizierte Genre <strong>von</strong> Soldatenzeitungen und der<br />
Blätter der Heimat <strong>für</strong> die Front; »findet doch in solchen Zeugnissen die Volksverbundenheit<br />
und die Mahnung des Führers zur untrennbaren Einheit <strong>von</strong> äußerer<br />
und innerer Front einen sinnfälligen Ausdruck« « Buchstäblich „Aus-Druck":<br />
vgl. Anderson, Erfindung NAtion: Rolle der Printmedien im Nationaldiskurs». Dann die Blätter <strong>für</strong> die besetzten Gebiete und die propagandistischen<br />
Fliegerabwürje der Feinde (keine Bomben also) 64 . Die Leipziger<br />
Polizei kannte diese Angst schon im Oktober 1913, als Be<strong>für</strong>chtung im Rahmen<br />
der Einweihungszeremonie des Völkerschlachtdenkmals kurz vor Ausbruch des<br />
Ersten Weltkriegs: »Undenkbar ist auch der Fall nicht, daß ein ausländischer (etwa<br />
ein französischer) Flieger, um <strong>von</strong> sich reden zu machen, einträfe und irgendwie<br />
(Flagge, Abwerfen gedruckter Zettel) demonstrierte.« 65 . So verhalten sich Auf-<br />
63 Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35, Nr. 1198, Bd. I (Ergangen <strong>von</strong> dem Rate der Stadt Leipzig<br />
1917): Akten, den Deutschen Verein <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum und das<br />
Deutsche Kulturmuseum betreffend<br />
64 »Die deutsche Gegenpropaganda bediente sich natürlich gleichfalls der Aufklärung<br />
aus der Luft durch sachliche Darstellung der wahren Lage« . Vgl, Schultze<br />
1921: 84f (<strong>für</strong> die Kncgssammlung der Berliner Staatsbibliothek) und Gabriele d'Annunzios<br />
Literaturstreuung über Wien in Weltkrieg I; dazu: Hans Ulrich Gumbrecht /<br />
Friedrich Kittler (Hg.), Der Dichter als Kommandant. D'Annunzio erobert Fiume,<br />
München (Fink) 1996<br />
65 Staatsarchiv Leipzig, Akten der Amtshauptmannschaft Leipzig Nr. 1704, Polizeiamt
884 BlBUOTIIKK<br />
klärung als Propaganda und Aufklärung als militärische Sichtung gleich unmittelbar<br />
zur Kriegsführung. Unter dem Aspekt der Information werden ganze neue<br />
Gattungen zu bewahrenswerten Dokumenten erklärt: Maueranschläge und Plakate<br />
etwa, Monumente politischer Ikonographie, »denen häufig dokumentarischer<br />
Wert zukommt«. Die Schrift- und die meist künstlerisch gestalteten Bildplakate<br />
sind »unentbehrliche Mittel der Propaganda« . Diese Bildmengen<br />
werden in der Deutschen Bücherei katalogisiert und in einem Anhang zu dem<br />
speziellen Weltknegskatalog nachweisbar gemacht; »manche <strong>von</strong> ihnen wirken<br />
noch so aktuell, als wären sie heute entstanden, und sind deshalb in erster Linie<br />
mit ausgestellt« . <strong>Im</strong> gegenwärtigen Weltkrieg II ist deren Propagandawirkung<br />
noch bedeutend gesteigert ; <strong>von</strong> daher auch die Unterstützung<br />
des Sammlungsunternehmens seitens des Reichsministeriums <strong>für</strong> Volksaufklärung<br />
und Propaganda und entsprechende Zusendungen des Militärs. Unter der Hand<br />
beginnt sich das Gedächtnis des 20. Jahrhunderts bildbasiert zu rekonfigurieren.<br />
Katalogislik 1945ff<br />
Ein Teil der Berliner Bücherbestände steht heute in der Jagiellonischen Bibliothek<br />
zu Krakau - ein Effekt <strong>von</strong> Geschichtsenergie als differance; Grcnz-Verschiebung<br />
ist hier eine historisch dynamisierte, nicht national-ontologische<br />
Unterscheidung. Nach den ersten Luftangriffen auf Berlin hatte die Staatsbibliothek<br />
1941 begonnen, ihre Bestände auszulagern, einen Teil da<strong>von</strong> nach<br />
Schlesien in die Benediktinerabtei Grüssau. Der wurde nach Kriegsende entdeckt<br />
und polnischerseits beschlagnahmt; im Mai 1945 erklärt ein Regierungserlaß<br />
alle deutschen Vermögenswerte auf polnischem Boden zu Staatseigentum.<br />
Diese Buchbestände fallen Polen im Zuge der erzwungenen Westverschiebung<br />
des Staatsgebietes eher beiläufig zu, »gleichsam durch kartographischen Zufall.<br />
Dementsprechend behandeln die Polen das preußische Erbe auch nicht wie<br />
Raubritter, sondern eher wie Nachlaßverwalter.« Der intern als Berlinka<br />
bezeichnete, in den Katalogen der Bibliothek seinerseits nicht verzeichnete (und<br />
lückenhafte) Fundus wird, anhand der alten Signaturen sortiert, getrennt <strong>von</strong><br />
den Krakauer Eigenbeständen aufbewahrt 66 - secret Space, und in dieser Sekre-<br />
Stadt Leipzig, 1. Mai 1913, an Kgl. Kreishauptmannschaft Leipzig, betr. »Weihe des<br />
Völkerschlachtdenkmals«, Dazu W. E„ Monument. Transfer und Tt-ansläfidni Das<br />
deutsch-französische Gedächtnis der Leipziger Völkerschlacht, demnächst in: Etienne<br />
Francois et al. (Hg.), Deutsch-französischer Kulturtransfer<br />
66 Heinrich Wefing, Der Krakau-Komplex, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 9. Mai<br />
1997; ferner ders., Es führt kein Weg zurück. Asche und Beute: Preußens Bücher bleiben<br />
in Polen, ebd., 4./5. Oktober 1997, 35
PRKUßKN IN DKN BlKI.IOTI IHKKN: STAATSBIBUOTI II- K Bl'Rl.lN 885<br />
tierung dekontextuahsiert zum Mahnmal gegen den Krieg mit einer zweiten,<br />
allegorischen Bedeutung versehen. Ein Index, ein Verzeichnis <strong>von</strong> Schriften, ein<br />
Wiederauffindungssystem sagt nichts ohne das Wissen um seinen Gebrauch,<br />
denn erst damit sind Speicher diskursiv anschlußfähig. Bibliothekare verfügen<br />
darüber je exklusiver, desto unaufgezeichneter dieses Wissen um die genealogische<br />
Beschaffenheit ihrer Kataloge bleibt. Unter Kriegsbedingungen wird die<br />
Hardware des Gedächtnisses direkt aktiviert und der Blick auf seinen Inhalt<br />
entsemantisiert, so daß das Durcheinander in den Krakauer Regalen noch heute<br />
die Hast spiegelt, in dem die anfangs sehr sorgfältig organisierte Auslagerung<br />
der Preußischen Staatsbibliothek 1944 <strong>von</strong>statten ging und Bücher auf ihre<br />
medienarchäologische Materialität reduzierten, indem sie »nach Größe statt<br />
nach Inhalt sortiert, nur grob auf Listen verzeichnet« und auf verschiedenen<br />
Transportwegen in über dreißig verschiedene Fluchtorte im ganzen Reich<br />
geschafft wurden. »Der Kalte Krieg und die polnische Diskretion haben die<br />
Aufsplitterung jener Bestände, die in die einstigen deutschen Ostgebiete ausgelagert<br />
wurden, bis heute konserviert« . Der Kalte Krieg als<br />
katechontischer Geschichtskühlschrank. Die Berliner Bibliothek kann sich vorstellen,<br />
in Berlin vorhandene Doubletten mit Krakau zu tauschen; »die vom<br />
Zufall diktierte Zerrissenheit der organisch gewachsenen Büchersammlung aber<br />
vertraglich zu besiegeln«, lehnt sie strikt ab . Das Buchgedächtnis - ein<br />
technischer Korpus - jenes deutschen Reiches, das erst eine Ideologie zum<br />
Volkskörper metaphonsiert, wird auf diskursiver, also gedächtnispolitischer<br />
Ebene, selbst <strong>von</strong> organizistische Metaphern instrumentalisiert: »Gewachsene<br />
Bibliotheken sind lebendige Organismen. Ihnen kann man nicht einzelne Glieder<br />
entreißen, ohne das Ganze zu zerstören« (Klaus Garber 67 ). Vorschläge zum<br />
Verzicht auf die Berliner Ansprüche in Krakau übersehen die syntaktischen<br />
Sammlungszusammenhänge einer jahrhundertalten Bibliothek und ihre Referenzierung<br />
in einem medienhistorisch spezifischen Umfeld. »Die Staatsbibliothek<br />
ist das Gedächtnis Preußens und spiegelt in ihren Beständen in tausenderlei<br />
Facetten das Leben seiner Bürger« ; in seinen Tagebüchern<br />
notierte beispielsweise Karl August Varnhagen <strong>von</strong> Ense dreimal täglich das<br />
Wetter in Berlin. »Ein wahrer Schatz <strong>für</strong> Lokalhistoriker, <strong>für</strong> Bibliotheksbe-<br />
67 Zitiert in: Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz<br />
(Hg.), Vgrjagerp, verschollen, vernichtet ...: das Schicksal der im 2. Weltkrieg ausgelagerten<br />
Bestände der PreuiJischt'H Staatsbibliothek, öefll» (Stöfil 1M99, 10, Sieh« ftüeh<br />
W. E., Nicht Organismus und Geist, sondern Organisation und Apparat. Plädoyer <strong>für</strong><br />
archiv- und bibliothekswissenschaftliche Aufklärung über Gedächtnistechniken, in:<br />
Sichtungen. Archiv, Bibliothek, Literaturwissenschaft. Internationales Jahrbuch des<br />
Österreichischen Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek (Wien), 2.<br />
Jg. Wien (Turia + Kant) 1999, 129-139
886 BlHUOTI IKK<br />
nutzer in Krakau jedoch <strong>von</strong> eher marginalem Wert« , denn Daten werden<br />
zu Information erst im Rahmen eines bestimmten Kodes. Doch im Informationszcitalter,<br />
auf das die Berliner Staatsbibliothek in anderen Kontexten<br />
gerne rekurriert, klingt das historistische Plädoyer <strong>für</strong> die Rückkehr <strong>von</strong> Bibliotheksgut<br />
»an ihren angestammten ursprünglichen Standort« wenig überzeugend.<br />
Wo auf Hinterlassenschaften im physischen Zusammenhang gepocht wird<br />
- also die Physik des Gedächtnisses, nicht seine logistische Software (Metadaten)<br />
-, kehrt die Bibliothekswissenschaft wissensarchäologisch in längst überwundene<br />
Epochen - die Einheit der Materialität und des Informationswerts<br />
eines Buchs - zurück. Gewiß erweist sich <strong>für</strong> eine genaue wissenschaftliche<br />
Untersuchung <strong>von</strong> Handschriften, Autographen und Inkunabeln die Autopsie<br />
als unabdingbar; zur exakten Bestimmung »reicht die Benutzung <strong>von</strong> Vervielfältigungsmöghchkeiten<br />
wie Mikrofilm und Fotokopie nicht aus« Staatsbibliothek<br />
1995: 12>. Doch schon die Initiative des Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß <strong>für</strong> eine<br />
General-Repertorium deutscher Kulturgeschichtsgüter auf Reproduktions- und<br />
Informationsbasis am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg hat Mitte des<br />
19. Jahrhunderts gelehrt, Kulturwissenschaft auf medialer Basis zu betreiben.<br />
Mit Preußen lag einmal auch die Staatsbibliothek am Boden. »Wer soll das alles<br />
später wieder in Ordnung bringen?« fragt in der Endphase des Zweiten Weltkriegs,<br />
als der Berliner Bücherbestand ausgelagert wird, Hugo Andres Krüß,<br />
Generaldirektor der Staatsbibliothek. 68 <strong>Im</strong> Oktober 1944 wird ein Teil der Kartenabteilung<br />
noch in gehöriger Ordnung verpackt und ausgelagert; mit dem losen<br />
Versand entfällt dann aber die Anfertigung <strong>von</strong> Verzeichnissen, so daß, was an den<br />
Bergungsorten gestapelt liegt, jeder bibliothekarischen Ordnung bar, auf die pure<br />
Ordnung physischer Materialität reduziert ist und die wissensarchäologisch ablesbare<br />
Tendenz <strong>von</strong> Gedächtnis zur Entropie beschleunigt. 69 Auch in der ehemaligen<br />
Leipziger Reichsgenchtsbibhothek werden angesichts alliierter Luftangriffe<br />
die Büchermassen in Bewegung gesetzt, bis daß diese Sicherung ihre katalogische<br />
Adressierbarkeit sperrt und buchstäblich zum Objekt <strong>von</strong> Medienarchäologie<br />
macht. Für einen Großteil nämlich »blieb nichts anderes übrig als das >Stapeln
PRI-UKKN IN DI-:N BIISI.IOTIIUKKN: SIAAISHIÜLIOTIII:K BI:RUN 887<br />
Gedächtnis der Bibliothek folgt somit keiner symbolischen Ordnung mehr (Katalog),<br />
sondern wird zur unmittelbar physischen Gegebenheit ihrer Daten. Nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg verteilt sich die Literatur der Preußischen Staatsbibliothek<br />
völlig unsystematisch auf die Nachfolgehäuser in Berlin Ost und West<br />
Staatsbibliothek 1995: 7>; Krieg ist die stochastische Provokation aller Ordnung.<br />
Weltkrieg II trennt real das, was bibliothekslogistisch bereits als Separierung <strong>von</strong><br />
Magazin und Katalog vorlag; als die Kampflinien näher an Berlin rücken, wird der<br />
Realkatalog im April 1945 per Bahn Richtung Bergwerk Schönebeck auf den Weg<br />
gebracht. Erhalten geblieben ist der alphabetische Zettelkatalog - bis heute ein<br />
wissensarchäologisches Monument. Völlig verloren gingen der neue Katalog<br />
Technik 1926ff., das Genealogische Repertorium, der Missionskatalog und der<br />
Systematische Katalog Krieg 1914. So löscht sich das Gedächtnis eines Krieges n<br />
durch seine Folge n+1; Weltkrieg I hatte noch die staatsbibliothekarische Ausstellung<br />
der Kriegssammlung 1870/71 und damit das Gedächtnis des vergangenen<br />
Krieges getnggert. Das Ende eines Reiches reißt auch seine Bibhotheksordnung<br />
mit; wissensarchäologische Diskontinuitäten aber sind die Setzung neuer Dispositive:<br />
»Der Zeitpunkt <strong>für</strong> eine durchgreifende Reform kann nie günstiger<br />
sein als heute, wo die Niederlage eine so tiefe Cäsur in unser ganzes Leben<br />
gelegt hat, und wo ein großer, uns mit Rücksichtnahme belastender Katalog, der<br />
A. K., zu Grunde gegangen ist«. 71 Die Auflösung der Verbindung <strong>von</strong> Realkatalog<br />
und Signaturvergabe, <strong>von</strong> Sachkatalog und Aufstellung im Magazin soll<br />
durch den Verteilmodus numerus currens erreicht werden, doch erst ab 1960<br />
wird die Sachgruppcnaufstcllung abgebrochen zugunsten eines Jahres-numerus<br />
currens innerhalb weniger Formal- und Format-Gruppen: Ordnung durch<br />
Standardisierung. Finden sich Buchinformation und Standort einmal getrennt,<br />
sind Variablen supplementierbar; die Lückenkarteien (also der Ersatzkatalog)<br />
<strong>für</strong> die infolge des Zweiten Weltkriegs verlorengegangenen Katalogbändc enthalten<br />
nur die Nachweise über den Bestand vor 1945. Durch eine Reform der<br />
Aufstellung und der Signaturen im Jahr 1946 wurde der Katalog dann <strong>von</strong> der<br />
Bindung an die Aufstellung im Magazin ge- oder erlöst, indem die systematische<br />
Aufstellung der Bestände im Magazin abgebrochen und der Realkatalog<br />
als standortfreier Katalog weitergeführt wird. Die systematische Ordnung der<br />
Bücher ist so stabil wie der Kanon der Wissenschaften, deren Funktion sie bilden;<br />
die Reihenfolge der Fächer im Katalog folgte einmal der traditionellen Reihen-<br />
?l Heinz Ahlenstiel, Übet' tut* betHöbütechiiinehe Lage de*' St«mt»biliiiti(:liiük (Herlist 1945)<br />
- Dat. Berlin, den 28. August 1945, maschinenschr., 30 Bl. (10), zitiert nach: Peter Kittel,<br />
Ein fast unbekanntes Dokument aus dem Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin:<br />
Heinz Ahlenstiels Denkschrift Ȇber die betriebstechnische Lage der Staatbibliothek<br />
(Herbst 1945)«, in: Tradition und Wandel: Festschrift <strong>für</strong> Richard Landwehrmeyer,<br />
hg. v. Daniela Lülfing / Günther Baron, Berlin 1995 (StaBi), 101-107 (104)
888 BlBUOTHKK.<br />
folge der Fakultäten in den Universitäten. Fächer, die an den Universitäten zu<br />
Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht gelehrt wurden, müssen so an passender<br />
Stelle eingeschoben werden . Auch in der Wissenstopographie <strong>von</strong><br />
Speichern gilt, daß die Homogenisierung des Raums nur durch totale Pulverisierung<br />
und Fragmentierung erreicht werden kann. 72 Der Katalog als Tableau und<br />
schriftliche Bonifikation (Derek Gregory) zerfällt in die Mikromcchamk diverser<br />
Ordnungen, die vektoriell <strong>von</strong> den Hinsichten ihrer Ausrichtung, nicht aber <strong>von</strong><br />
einer transzendenten Wissensmetaphysik als Signifikat gesteuert sind. An dieser<br />
Nahtstelle zerbricht die wissensökonomische Einheit <strong>von</strong> Natur- und Geisteswissenschaften.<br />
Der Katalog Technik ordnet innerhalb der engsten Sachgruppen<br />
die Titel alphabetisch nach Verfassern bzw. Sachtiteln, während das allgemeine<br />
Prinzip der chronologischen Ordnung an verschiedenen Stellen im Katalog durch<br />
andere Ordnungen ersetzt worden ist, wenn dies <strong>für</strong> die Benutzung zweckmäßig<br />
war. An Katalogstellen mit biographischer Literatur etwa folgt die Ordnung dem<br />
Alphabet der <strong>Namen</strong>, oder Literatur über einzelne Orte dem Alphabet dieser<br />
Orte.<br />
Hatte die Binnenbezeichnung <strong>von</strong> Büchern m der Königlichen Bibliothek<br />
durch die laufende Zahl des Akzcssionskatalogs bereits auf »die <strong>Geschichte</strong> des<br />
Bandes bis zu seiner Aufstellung in der Bibliothek« verwiesen<br />
(tatsächlich Zählung statt Erzählung) und der Weltkriegskatalog erstmals<br />
die akzessonsche Aufstellung und damit die vom realen Magazin gelöste Standortfreiheit<br />
eröffnet, setzt sich die Sachkatalogisierung 1926 nicht <strong>von</strong> ungefähr<br />
mit dem Technikkatalog fort - der Einbruch <strong>von</strong> Technik als Wissensobjekt in<br />
die Techniken der Wissensordnung, die in ihrer Vierfakultätenteilung bis tief ins<br />
19. Jahrhundert lange keinen Raum <strong>für</strong> emergente Disziplinen bereithielt, führt<br />
zur Ruptur mit den Speichcrtraditionen des Geistes. Da sich im wesentlich gcisteswissenchaftlich<br />
orientierten. Kanon der deutschen (National-)Bibhotheken<br />
in Berlin, Leipzig und München kein Raum <strong>für</strong> Technik fand und so eine<br />
»immer breiter werdende Lücke« entstand - der negative Rand einer Diskurspraxis<br />
als Speicher -, fand ein auf technische Schriften und Technikgedächtnis<br />
zielender Bibliotheksbau seinen Ort als Annex zu einer differenten Gedächtnistechnik,<br />
dem Deutschen Museum in München, »im engsten Anschluß an seine<br />
Sammlungen« 7 - 1 - Rückkehr eines mit der Kunst- und Wunderkammer ausgestorbenen<br />
Gedächtmsmedienvcrbunds.<br />
72 Henri Lefebvre, La produetion de Pespacc, Paris 1974, 385; hier zitiert nach: David<br />
Harvey, Zeit und Raum im Projekt der Aufklärung, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Geschichtswissenschaft 6/1995/3, 345-365 (362)<br />
73 Walther <strong>von</strong> Dyck, Wege und Ziele des Deutschen Museums, Berlin (VDI) 1929 (=<br />
Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte, 1. Jg., Heft 1), 9
PRKUKKN IN DKN BIBI.IOTHKK.KN: STAATSBIBI.IOTHKK BKRI.IN 889<br />
Für Bibliotheken sind primäre Veröffentlichungen und Sekundärliteratur<br />
gleichrangig als Objekte <strong>von</strong> Signatur. Ein und dasselbe Medium Buchdruck<br />
standardisiert die klassifikatonsche Referenz und entdifferenziert die Trennung<br />
<strong>von</strong> Urkunde und Literatur; es ist allem eine heuristische Differenz der Lesarten,<br />
welche diese Unterscheidung auf Buchstabenebene wieder einführt. Jenseits<br />
der Literatur operiert heute die Abteilung Amtsdruckscbriften und Internationaler<br />
Amtlicher Schnftentausch der Staatsbibliothek zu Berlin (PK), Potsdamer<br />
Str. 33. Als Tauschzentrale internationaler amtlicher Schriften besteht ein solches<br />
network seit Gründung der Reichstauschstelle (1926-1945), die <strong>von</strong> 1934 bis<br />
1941 verwaltungsmäßig der Preußischen Staatsbibliothek angegliedert ist. 1862<br />
wurden preußische Behörden zur Abgabe ihrer Veröffentlichungen an die<br />
Königliche Bibliothek verpflichtet; im Schatten des Speichers diskursiven<br />
Bücherwissens operiert also ein ganz anderes Gedächtnis kybernetisch-administrativer<br />
Art.
890 BmuoTiiKK<br />
Lettern, buchstäblich: Literatur 1813, die Leipziger Bugra 1914<br />
und das Deutsche Kulturmuseum<br />
Buchstabengrab Deutsche Bücherei: In Gedächtnisorten der Nation ist ihr Vergessen<br />
immer schon angelegt. Eine Denkschrift Erich Ehlermanns (Dresden<br />
1912) erinnert daran, daß im Vorfeld der Deutschen Bücherei <strong>von</strong> einer Überschätzung<br />
des gedruckten Wortes gesprochen und die »Ansammlung einer<br />
ungeheuren Masse toten Materials be<strong>für</strong>chtet« wurde. Mit einer gewissen Berechtigung:<br />
Wer inmitten dieser Produktion stehe, »in der das Nichtige <strong>von</strong> Tag<br />
zu Tag mehr zu überwuchern scheint, wird versucht sein, eher eine Auswahl zu<br />
be<strong>für</strong>worten, als eine lückenlose Sammlung.« 1 Die Vollendung des nationalen<br />
Diskurses als vollständige Informa(tisa)tion heißt entropisches Rauschen. Dieser<br />
Be<strong>für</strong>chtung ist eine Stelle aus Piatons Dialog Phaidros zugedacht. Sokrates,<br />
der selbst nie ein schriftliches Wort, da<strong>für</strong> aber ein Aufschreibesystem namens<br />
Piaton hinterließ, benennt hier die Erinnerung der Philosophiegeschichte (die<br />
bis an die Grenzen der neuen Medien - und nicht weiter - führt). Schrift sei<br />
ganz entschieden der Malerei ähnlich; auch deren Schöpfungen stehen wie<br />
lebende Wesen da. Wenn man Bilder und Buchstaben aber nach etwas fragt, so<br />
schweigen sie. Sokrates beschreibt das read only memory der Buchstaben, die<br />
<strong>für</strong> den Leser, anstatt dialogisch zu antworten, immer nur dastehen - sowohl<br />
denjenigen gegenüber, <strong>für</strong> die sie berechnet und an die sie adressiert sind, als<br />
auch <strong>für</strong> die, die nichts verstehen. 2 Gilt das Gleiche wie vom toten Buchstaben<br />
auch <strong>von</strong> der Summe der Einzelbuchstaben, dem Alphabet? Kann <strong>von</strong> Schrift<br />
erst bei sinnvoller Zusammenstellung der Buchstaben zu Worten, Sätzen, zu<br />
einem fortlaufenden, lesbaren Text die Rede sein, und nicht schon im Fall <strong>von</strong><br />
alphabetischen Listen oder Signaturen? Ein Gang durch die Magazine der Deutschen<br />
Bücherei beim Anblick der endlosen Reihen der Bücher, Zeitschriften<br />
und anderer Schriftwerke läßt die mikroskopische Auffassung <strong>von</strong> der Schrift<br />
als einer sinnvollen Aufeinanderfolge und Anordnung der Einzelbuchstaben als<br />
Makroskopie zweiter Ordnung erscheinen: »Wir greifen einen Band ihrer<br />
Werke aus dem Bücherregal heraus und beginnen zu lesen und - vergessen die<br />
Welt um uns her. Da lebt doch alles, und dieses bewegte Leben soll uns durch<br />
' Zitiert nach: Ernst Mohrmann, Der Vater des Gedankens einer Deutschen Nationalbibliothck,<br />
in: Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu<br />
Leipzig: Urkunden und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung, 9. Ausg.,<br />
Leipzig 1914, 19f<br />
1 Piaton, Phaidros, 275 d, in: Sämtliche Werke, übers, v. F. Schleiermacher, Bd. 4, Hamburg<br />
1958, 56. Dazu Michael Wetzcl, Die Enden des Buches oder die Wiederkehr<br />
der Schrift. Von den literarischen zu den technischen Medien, Weinheim (VCH) 1991,<br />
11 ff.
LKTTKRN, BUCHSTÄBLICH 891<br />
toten Buchstaben übermittelt sein?« 3 Diskreten Signifikanten ist es eigen, daß<br />
sie sich nicht auf Dauer einer stabilen (Be-)Deutung zuschreiben lassen - auch<br />
dann nicht, wenn sich das festgeschriebene Gedächtnis einer Nation hinter Säulen<br />
im neo-klassizistischen Stil zurückzieht. 4 Nationalbibliotheken aber sind<br />
der Versuch, dem buchstäblich diskursiven Herumtreiben der Lettern einen<br />
autoritären Ort zuzuweisen. Insofern ist die Deutsche Bücherei nicht allem das<br />
passive Archiv des deutschen Schrifttums, sondern auch seine Definition, seine<br />
Setzung.<br />
Lettern 1813 (Fichte, MüffHng)<br />
Deutschland, als kulturpolitisches Medium des Abendlands begriffen, wird<br />
nach dem Zusammenbruch des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation<br />
zum Kulturgedächtnis und selbst als geisterwissenschafthches Phantom des<br />
Speichermediums Buch begriffen:<br />
»Vom Westfälischen bis zum Tilsiter Frieden haben wir Deutschen nur im geheimen<br />
und stillen weiter gelebt, durch Sprache und Schrift, ein unsichtbares geistiges<br />
Leben. Wenn aber diese Seelenwanderung auch noch aufhört , so werden<br />
wir alsdann nur durch einige Bücher in der Völkerwelt gespenstisch umherspuken.<br />
Sind wir, das alte ehrwürdige Mittelvolk und Mittlervolk Europas, einst<br />
untergegangen, so warnt die Leidensgeschichte am Scheidewege der Zukunft<br />
nachgeborne Völker.«''<br />
Die dem entgegengesetzte Historiker-Obsession, die Vergangenheit sprechen<br />
machen zu wollen - der Zug zur rhetorischen prosopopeia - teilt eine logozentristische<br />
Tradition, die Speicher und Leben gegenseitig ausschließt. <strong>Im</strong> Vorfeld<br />
der Leipziger Völkerschlacht, 1812, schreibt Adam Müller in seinen Zwölf Reden<br />
über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland vom k. k. Redoutengebäude<br />
in Wien aus den Mangel eines nationalen Körpers den Folgen des<br />
Buchdrucks zu, der buchstäblichen Dissemination der Worte, den Leser <strong>von</strong> der<br />
Stimme des Volkes trennend: In Deutschland gebe es »nur einzelne, die hören;<br />
es gibt kein Ganzes, keine Gemeinde, keine Stadt, keine Nation, die wie mit<br />
3 Julius Rodenberg, Toter Buchstabe - lebendige Schrift, in: Die Korrekturfahne.<br />
Betriebszeitung der Deutschen Bücherei. Sondernummer aus Anlaß des 50jährigen<br />
Bestehens der Deutschen Bücherei am 3. Oktober 1962, 25-27 (25)<br />
4 Wie etwa die Moskauer Staats-(vormals: Lenm-)Bibliothek<br />
5 Friedrich Ludwig Jahn, Deutsches Volkstum [""1810], hg. v. Franz Brummer, Leipzig<br />
(Reclam) o. J. [ca. 1 890], 33. Von der »Rettung der deutschen Nation durch ihre Autoren« handelt ein Artikel <strong>von</strong> Woltmann in: <strong>Geschichte</strong> und<br />
Politik (1806), 191-198
892 Bi<br />
Einem Ohre den Redner anhörte« 6 . Rhetorik heißt Überredung durch Anrede<br />
; technisch wird daraus standardisierte Adressierung, wie sie hundert<br />
Jahre später vom Rundfunk eingeholt wird. »Die Götter aber, die den Äther<br />
beherrschen, die Rundfunksender <strong>von</strong> Telefunken, bemühen sich, allen ihren<br />
Anhängern freundwillig zu Diensten zu sein, auf daß es bald keinen Einödwinkel<br />
in Deutschland mehr gäbe, wo nicht nach Unterhaltung und Belehrung sich<br />
sehnende Menschen aus dem Empfänger der Ruf ertönt: Achtung, Achtung!<br />
Hier ist der Rundfunksender der Rundfunkstunde!« 7 Und wenig spater, unter<br />
politisch totalitären Vorzeichen, die im Bunde mit dem Broadcast-Medium<br />
Radio selber stehen: »Der totale Rundfunk forderte vor allem Steigerung der<br />
kW-Lcistung um ein wesentliches. Der Rundfunk ist als politisches und künstlerisches<br />
Instrument nur dann <strong>von</strong> zuverlössiger Schlagfähigkcit, wenn über die<br />
Gesamtheit der deutschen Sender auch die Gesamtheit des deutschen Volkes<br />
angesprochen werden kann.« 8 Das inhärente Paradox, die Dekonstruktion jeder<br />
logozentnstisch vorgetragenen Botschaft durch die Form ihrer Übertragung,<br />
wird deutlich in Fichtes Reden an die deutsche Nation, die im Wintersemester<br />
1807/8 in der Berliner Akademie ausgesprochen werden, nationweite Verteilung<br />
aber erst in der Druckfassung <strong>von</strong> 1808 erreichen, also den toten Buchstaben<br />
anvertraut (wie die Knochen der Toten, auf die sich Fichte unter Zitierung des<br />
biblischen Propheten Ezechiel in seinen Reden selbst bezieht). 9 Das Medium<br />
zum engineenng eines deutschen Nationalbewußtseins ist nicht wirklich akustisch,<br />
sondern optisch: Lesen. »Allein nur Universitäten können auf die<br />
Bildung der ganzen, dieselbe Sprache redenden Nation einwirken«, schreibt Wilhelm<br />
<strong>von</strong> Humboldt inmitten der Berliner Krisenjahre. 10 Fichtes Rede ist zwar<br />
6<br />
Adam Müller, Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland,<br />
mit einem Essay und einem Nachwort <strong>von</strong> Walter Jens, Frankfurt/M. (Insel) 1967,1.<br />
Vorwort, 36. Dazu Aleida Assmann, Arbeit am nationalen Gedächtnis. Eine kurze<br />
<strong>Geschichte</strong> der deutschen Bildungsidee, Frankfurt/M. u. a. (Campus) 1993, 34 u. 44f<br />
7<br />
Dr. Winckler, in: Telefunken-Rundschau, 1. Jg. Heft 1 (1924), 1<br />
8<br />
J. G. Bachmann, Vier Jahre nationalsozialistischer Rundfunk, in: Der Rundfunk, Heft<br />
5(1937), 171<br />
9<br />
Siehe W. E., Identität und Differenz. Johann Gottheb Fichtes Reden an die deutsche<br />
Nation, in: Tumult. Zeitschrift <strong>für</strong> Verkehrswissenschaft 10, München 1987, 141-161.<br />
Zum misreading des geflügelten Bibelzitats (2. Kor. 3,6) »Der Buchstabe tötet, aber<br />
der Geist macht lebendig« siehe Julius Rodcnberg, Toter Buchstabe - lebendige<br />
Schrift, in: Die Korrekturfahne. Betriebszeitung der Deutschen Bücherei. Sondernummer<br />
aus Anlaß des 50jährigen Bestehens der Deutschen Buchen" am 3. Oktober<br />
1962,25-27(25)<br />
10<br />
Wilhelm <strong>von</strong> Humboldt, Antrag auf Errichtung der Universität Berlin (Mai 1809), in:<br />
ders., Werke in fünf Bänden, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1964, Bd. IV, 29-37 (30);<br />
siehe auch ders., Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen<br />
Anstalten in Berlin, ebd., 255-266
Lh'TTL'RN, BUCHSTÄBLICH 893<br />
<strong>von</strong> deutscher Sprache; ihr mediales Dispositiv aber sind hier die Buchstaben.<br />
Seine Vorlesung spricht in'Texten über Wirklichkeiten jenseits der Texte 11 ; die<br />
Pläne <strong>für</strong> die Berliner Universität schwankten medial unentschieden zwischen<br />
dem Ideal der »Kunst des Vortrags« (Schieiermacher) als unverwechselbarem<br />
mündlichen Ereignis und als »mündliches Buch« (Novalis). 12 Daß es der Universität<br />
gut anstehen würde, ihr paradigmatisches Medium gelegentlich zu wechseln,<br />
wurde laut gedacht. Als Basler Professor beschrieb Friedrich Nietzsche in<br />
seiner fünften Vorlesung Über die Zukunft unsrer Bildungs-Anstalten die Medialität<br />
der deutschen Universität als Auditorium. Der Zusammenhang zwischen<br />
Student und Universität sei nur durch das Ohr gegeben:<br />
»Wenn er spricht, wenn er sieht, ist er selbständig, das heißt unabhängig <strong>von</strong><br />
der Bildungsanstalt. Sehr häufig schreibt der Student zugleich, während er hört.<br />
Dies sind die Momente, in denen er an der Nabelschnur der Universität hängt. Er<br />
kann sich wählen, was er hören will, er braucht nicht zu glauben, was er hört, er<br />
kann das Ohr schließen, wenn er nicht hören mag.« 13<br />
Der äußerliche akademische Apparat als die in Tätigkeit gesetzte Bildungsmaschine<br />
der Universität aber ist nicht minder an einen symbolischen Schriftraum<br />
gekoppelt; durch wissenskartographische Beschriftung wird Deutschland<br />
im ganz etymologischen Wortsinn kultiviert:<br />
»Wir nähren nämlich in Deutschland die dunkle Vorstellung <strong>von</strong> einem großen<br />
geistigen Flächeninhalte unseres Landes, <strong>von</strong> einem literarischen Areal, das wie der<br />
wirkliche Boden unseres Landes auf den höchsten Grad der Kultur getrieben werden,<br />
und wo eigentlich kein Fleck unbenutzt bleiben sollte. Der deutsche Patriot<br />
hat seine stille Freude darüber, daß überhaupt geschrieben wird, daß eine so und<br />
so große Anzahl <strong>von</strong> Federn, wie der Staatswirt, daß so und so viele Pflüge in<br />
Bewegung sind.« <br />
Kulturtechnik, eine eenture automatique, eine Schreibmaschine, die nicht kümmert,<br />
wer schreibt und was ? Jenseits <strong>von</strong> Kultur aber, in strategischer Logistik, ist<br />
die Funktion <strong>von</strong> Schrift eine andere. Der aus der Leipziger Völkerschlacht <strong>von</strong><br />
f 813 vertraute General <strong>von</strong> Müffling tarnt als Schriftsteller nicht nur seine Autor-<br />
11 Fichtes »Realismus«, der ihn <strong>für</strong> Wirklichkeiten jenseits des Idealismus sensibel<br />
machte und mehr auf die Physik der Dinge denn die Metaphysik schauen ließ, unterstreicht<br />
der Historiker Otto'Dann in seiner Dissertation: Johann Gottheb Fichte und<br />
die Entwicklung des politischen Denkens in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts,<br />
Heidelberg 1968, 114 ff<br />
12 Da/.u Ernst Müller, Die Aufklärung in der Dialektik ihrer Institutionalisimmt!. Von<br />
Kants Streit der Fakultäten zur Humboldtschen Universität, in: Wolfgang Klein / Waltraud<br />
Naumann-Beyer (Hrsg.), Nach der Aufklärung? Beiträge zum Diskurs der Kulturwissenschaften,<br />
Berlin (Akademie) 1995, 141-150 (bes. 142ff)<br />
13 Friedrich Nietzsche, Werke in drei Bänden, hg. v. Karl Schlechta, München (Hanser)<br />
1954-56, Bd. III: 252f
894 BIBI.IOTHI-.K<br />
schaft (Signatur C. v. W.); in seinen Memoiren enthüllt er auch den Hof des<br />
Herzogs <strong>von</strong> Weimar als anti-napeoleonischen Kommunikationsknotenpunkt,<br />
dessen geheimer Plan dahin gegangen sei, »so wie seine Residenz bisher der Central-Punkt<br />
Deutschlands <strong>für</strong> Kunst und Wissenschaft war, es nun auch zum Central-Punkt<br />
der deutschen Freiheit zu machen, ohne die Aufmerksamkeit des<br />
französischen Machthabers auf sich zu ziehen.« 14 Das bedeutete Nachrichtendienst:<br />
»Die vielen litterarischen Correspondcnzen, welche in Weimar mit allen<br />
Theilen <strong>von</strong> Deutschland unterhalten wurden, die alte Gewohnheit des Herzogs<br />
sich <strong>von</strong> seinen charges d'Affaircs oder besoldeten Correspondcnzen, Nachrichten<br />
aus allen Theilen Europa's mitteilen zu lassen, erleichterte das Nachrichtenfach«<br />
. Das ist also die Funktion deutscher Literatur um 1806. Ihre Agenten<br />
haben nicht Geschehen ästhetisch zu bewältigen, sondern im Verborgenen, also<br />
jenseits der Erzählung, umso wirkungsvoller zu beschreiben, analog zu jener<br />
selbstasketischen Aufgabe (als Sich-Aufgeben), die Leopold <strong>von</strong> Ranke später der<br />
Geschichtsschreibung zuweist: Müfflings »Rolle bei diesem Treiben war, alles zu<br />
vermeiden, was das <strong>für</strong>stliche Ehepaar compromittiren konnte, und wenn ein<br />
Opfer gebracht werden mußte, mich selbst dazu zu bieten« . Klartext<br />
löste Poesie ab; nach dieser Lehre schreibt sich Müfflings Kriegsgeschichte <strong>von</strong><br />
1824 schlicht als Tatsachenbericht, der das Darstellungsideal der Historischen<br />
Schule vorwegnimmt: »Daher hatte ich mich auf das zu beschränken, was aus den<br />
Akten zu entnehmen war« - Primat der buchstäblichen Autopsie. Müffling<br />
schreibt, »was er gesehen, was er gehört und wo<strong>von</strong> er sich überzeugt hatte«, in<br />
wissensarchäologischer Datenaskese: »Durch Schlüsse die Lücken auszufüllen,<br />
und Vcrmuthungen zwischen die Wahrheiten zu stellen, schien ihm mit dem Vorsatz,<br />
der Nachwelt Materialien zur <strong>Geschichte</strong> zu hefern, völlig unvereinbar.« 15<br />
Keine subjektive Konjektur, sondern die <strong>von</strong> den Altertumswissenschaften her<br />
vertraute Tugend der diskreten, non-diskursiven Datenverarbeitung. Jede Geschichtsschreibung<br />
jenseits ihrer narrativen Inszenierung ist nackt. Hier schreibt<br />
sich keine geschichtsphlosophische Ästhetik, sondern eine Wahrnehmung (aisthesis),<br />
die sich vor allem einer militärisch geschulten Notwendigkeit verdankte:<br />
»Wie schwer es ist in ruhigen Augenblicken, nach einer ernsten Vorbereitung, vom<br />
Auffassen der Gegenstände, zur Verbindung und Trennung der Ideen überzugehen,<br />
um sich endlich daraus eine klare Ansicht zu entwickeln, kann jeder unbefangene<br />
Beobachter seiner selbst, täglich erfahren. Um wie viel schwerer ist es <strong>für</strong><br />
einen Soldaten an einem großen Schlachttage!« <br />
14<br />
Friedrich Carl Ferdinand Freiherr <strong>von</strong> Müiflmg (gen. Weiß), Aus meinem Leben, Berlin<br />
1851, 21<br />
'"' C. v. W. [Friedrich Karl Ferdinand <strong>von</strong> Müffling], Die preußisch-russische Campagne<br />
im Jahr 1813 <strong>von</strong> der Eröffnung bis zum Waffenstillstände vom 5. Juni 1813, Breslau<br />
u. a. (1813), Vorwort, iii
LLTTKRN, BUCHSTÄBLICH 895<br />
Der Verlauf des Geschehens vor Leipzig vom 15. bis 18. Oktober 1813 zeigt es:<br />
Schlachtbewegungen sind unbeschreiblich, denn sie sind strategische Heterotopie,<br />
die sich der Narration, also Linearität (es sei denn nachträglich) entzieht.<br />
<strong>Geschichte</strong> setzt aus zugunsten des Realen, im Verlauf einer Schlacht, insofern<br />
diese die drei Bedingungen Lacans <strong>für</strong> le reel erfüllt: Tod, Schmerz, Ekstase.<br />
»Man zeigt in der Farben-Lehre eine Tafel, mit allen bunten Farben des Regenbogens;<br />
die Tafel wird gedreht, und sie erscheint uns grau. So ist's am Abend<br />
einer großen Schlacht« . Literatur ist Waffe, nach 1806. Zu<br />
ihrer Übertragung bedurfte es einer kommunikationstechnischen Infrastruktur;<br />
über die Entfachung des Widerstands gegen Napoleon spricht Gncisenau <strong>von</strong><br />
einem Electrisierungs-System. Für Müffling bedeutet dies nicht nur ein konkretes<br />
Ressort: Zeitungsberichterstattung, sondern auch die Einsicht in das (narrativ)<br />
Undarstellbare: »Es läßt sich im Kriege nicht Alles sagen« . Tatsächlich ist das Nachrichtennetz die Ebene, auf der Napoleons Terntorialherrschaft<br />
zuvorderst zusammenbricht, längst bevor (und gerade bevor) die<br />
Alliierten sich ihm in der Schlacht bei Leipzig (wie die Völkerschlacht bei Müffling<br />
in aller Schlichtheit heißt 16 ) stellen: »Aus Vaterlandsliebe gab ihm, kein Sachse mehr Nachrichten« . Und Nachrichten(fehl)übertragung<br />
ist es, welche die Schlacht <strong>von</strong> Waterloo entscheidet. 17<br />
Goethe, Augenzeuge am Tatort Weimar, hat die Geschehnisse und die Person<br />
Müfflings im Roman kodiert - Wahlverwandtschaften: »Während in der Politik<br />
Müfflings und Carl Augusts die ahnungslose Literatur als solche zur Tarnung<br />
eines geheimen >Nachrichtenfachs< diente, tarnt die Literatur gerade umgekehrt<br />
Politik als Liebesroman.« 18 Das Symbolische birgt sich als Infrastruktur unter<br />
dem <strong>Im</strong>aginären. 1810 weiß Deutschland um Gedächtnis als Medium zur Massenmobihsierung:<br />
»Um zu wissen, was zu tun sei, darf es sich nur das große<br />
Archiv seiner Erfahrungen öffnen lassen; auf jedem Blatt wird es überzeugende<br />
Beweise finden« 19 ; dieses Archiv aber muß bibliothekarisch adressierbar sein, um<br />
diskursiv aktiviert werden zu können. Das-immaterielle Superzeichen Nation<br />
bedarf in der Tat der matenalen Übertragung. Die zunächst kleine Trägerschicht<br />
des nationalen Gedankens wird zur Massenbewegung erst durch die Möghch-<br />
16 Zur Begriffsarchäologie der Völkerschlacht siehe W. E., Präsenz der Toten und symbolisches<br />
Gedenken: Das Völkerschlachtdenkmal zwischen Monument und Epitaph,<br />
in: Katrin Keller / Elans-Dieter Schmid (Hg.), Vom Kult zur Kulisse. Das Völkerschlachtdenkmal<br />
als Gegenstand der Geschichtskultur, Leipzig (Univcrsitätsvcrlag)<br />
1995,62-77<br />
17 Stefan Zweig, Die Weltminutc <strong>von</strong> Waterloo (Napoleon, 18. Juni 1815), in: Sternstunden<br />
der Menschheit. Fünf historische Miniaturen, Leipzig 1927, 5-22<br />
1X Friedrich A. Kittler, Dichter - Mutter - Kind, München (Fink) 1991, 143<br />
19 Friedrich Ludwig Jahn, Deutsches Volkstum (1810), Bielefeld / Leipzig 1916, 31
896 BIBLIOTHEK<br />
keiten verbesserter Kommunikation: durch allgemeine Alphabetisierung als das<br />
Schulprogramm des preußischen Staats, durch die Rolle <strong>von</strong> Literatur, Lyrik im<br />
privaten Haushalt, Geheimverlage in der Schweiz, das Druck- und Verkehrswesen<br />
(Schnellstraßen, Eisenbahn), sowie durch akademische Sprachvereinheitlichung<br />
der Dialekte. Klarer noch manifestiert sich in einem Vorschlag <strong>von</strong> 1814<br />
zur Erinnerung an die Leipziger Völkerschlacht die deutsche Gedächtnispolitik<br />
als parole: Demzufolge soll ein Gebäude mit Denkmalcharakter errichtet werden,<br />
worin jährlich deutsche Gelehrte und Schriftsteller sich vereinigen, um die<br />
deutsche Sprache zu reinigen. 20 Bereinigt ist der Innenraum des Völkerschlachtdenkmals<br />
heute <strong>von</strong> der Erinnerung selbst; aus der parole der Historie wird<br />
purer Klang, jenseits des Logozentrismus. War es schon die Performance des<br />
Leipziger Männerchors, der am 18. Oktober 1913 zur Eröffnung des Denkmals<br />
»die eigenartige Akustik in diesem großen >Dome< zum Erklingen« zu bringen<br />
trachtete, mithin also eher mit der realen Physik eines Raums rechnet denn mit<br />
seinen Assoziationen im <strong>Im</strong>aginären, so ist dort ein heutiger Baritonsaxophonist<br />
an den Parametern Zeit und Raum gerade nicht im historischen Sinne, sondern<br />
als »Klangwanderung innerhalb der Dimension menschlicher Wahrnehmung«<br />
(Gert Anklam) interessiert. Damit operiert ein <strong>von</strong> Knut Becker ursprünglich<br />
<strong>für</strong> wissenschaftlich auswertbare Orgelklangdokumente entwickeltes Aufnahmesystem<br />
(Holistic Audio Recording Process), welches alle Elemente des klanglichen<br />
Ereignisses - also der physikalischen Aussage - nicht nur »möglichst real<br />
wiederzugeben«, sondern es auch als digitales Archiv (CD) zu speichern und zu<br />
tradieren vermag, »in keiner Weise nachträglich manipuliert« (Becker). Dies ist<br />
die (Re-)Archäologisierung einer monumentalen Wahrnehmung: Präsentistik<br />
statt Historismus, ein Zug, welcher der Architektur des Völkerschlachtdcnkmals<br />
schon 1913 originär eingeschrieben ist. 21<br />
Monumentalisierung findet nicht nur als Denkmal, sondern auch auf der Diskurs-Ebene<br />
(Sprachdenkmäler) statt. Gleich am Tage nach Inauguration des Völkerschlachtdenkmals<br />
wird in Leipzig denn auch der Grundstein zur Deutschen<br />
Bücherei gelegt, die als deutsches Gedächnis mit dem Denkmal ein unfehlbares<br />
Ensemble bildet und in Form einer expliziten Walhalla <strong>von</strong> Marmorbüsten deut-<br />
-° Siehe Meinhold Lurz, »Lieblich ertönt der Gesang des Sieges«. Projekte und Denkmäler<br />
der Völkerschlacht bei Leipzig aus den Jahren <strong>von</strong> 1814 bis 1894, in: kritische<br />
berichte 3/1988, 17-32<br />
1] Alle Zitate aus dem Bcgleittext zur Compact Disc: Gert Anklam (solo), konzert <strong>für</strong><br />
b., Live-Aufnahme aus der Kuppelhalle des Völkerschlachtdenkmals Leipzig<br />
am 7. Juni 1997, LC 1703 (eine Produktion des Label Labium, Ausführung M8<br />
Labor <strong>für</strong> Gestaltung); siehe ferner: I Ians-Christian <strong>von</strong> Herrmann, Die Macht des<br />
Raumes über den Ton. Zu Architektur und Akustik des Leipziger Völkcrschlachtdenkmals,<br />
in: Kaleidoskopien (Hg. Institut <strong>für</strong> Theaterwissenschaften, Universität<br />
Leipzig), Lieft 2/1997, 109-115
LLTILRN, BUCHSTÄBLICH 897<br />
scher Geistesheiden jenen Raum buchstäblich realisiert, den der gleichnamige<br />
Regensburger Denkmaltempel noch als Metapher baute. Knochen, Buchstaben,<br />
Signifikanten: Dmecta membra betreffen das Symbolische (Völkerschlachtdenkmal),<br />
das <strong>Im</strong>aginäre (Deutsche Bücherei) und das Reale (Völkerschlacht)<br />
zugleich. Viele der Denkmalentwürfe im Anschluß an 1813 zeigen eine eher lyrische<br />
Auffassung; die zunächst unmetaphorische Deutung <strong>von</strong> Volk als Heervolk,<br />
die den politischen Bezug zur Nation auf der Basis allgemeiner Wehrpflicht<br />
popularisiert, erfährt im Zuge der Semiose eine metonymische Verschiebung zu<br />
ideologischen Zwecken. In seinem Buch Ästhetische Feldzüge (Hamburg 1834),<br />
das zum Manifest der literarischen Bewegung Junges Deutschland wird, ersetzt<br />
Ludolf Wienbarg den romantischen durch einen politisierten, aktivistischen,<br />
anti-historistischen und prä-Nietzscheanischen <strong>Im</strong>puls, unter Attacken auf die<br />
inhärente Tendenz zur Spezialisierung in einer funktional differenzierten deutschen<br />
Gesellschaft 22 , als ironische Vision:<br />
»Ins Unendliche teilen müßte man die gelehrte Arbeit, wie es in Fabriken geschieht,<br />
wo der Eine den Knopf, der Andere den Schaft, der Dritte die Spitze der<br />
Nadel fabriziert. Der eine Professor verstände sich auf das Jahr 2000, der andere<br />
auf das Jahr 1999, oder der eine wäre gelehrt in der <strong>Geschichte</strong> aller großen Männer,<br />
deren Name mit dem Buchstaben A, der andere in der <strong>Geschichte</strong> der berühmten<br />
Männer, deren Name mit dem Buchstaben Z anfängt, und wie man sich noch<br />
weiter scherzhafterweise den lächerlichen Wirrwarr entknäueln mag, der aus der<br />
ungeheuerlichen Menge und Zerfallenheit des Stoffes mehr und mehr entspringen<br />
wird. Diesem maßlosen Wissen gegenüber steht ein Geist, dessen Kräfte nur<br />
zu wohl gemessen und abgewogen sind.« 23<br />
Das Zeitalter des Historismus, in seiner Akkumulation universalen Wissens,<br />
resultiert nicht geschichtsphilosophisch, sondern als Speicherpraxis in der Tat<br />
im Ersatz <strong>von</strong> (Welt)Geist durch die kaum wahrnehmbare bibliographische<br />
Ordnung des Alphabets; das technische Gedächtnis <strong>von</strong> Aufzeichnungssystemen<br />
tritt an die Stelle der Durcharbeitung nationaler Erinnerung. »Das bloße<br />
Wissen hat kein inneres Maß und Ziel, es geht ms Unendliche, sein Stoff zerfließt<br />
in Zentillionenteilchen« . Die flottierenden Lettern des<br />
Wissens streben nach Streuung; es bedarf eines transzendenten symbolischen<br />
Signifikanten vom Schlage des Völkerschlachtdenkmals (also der ästhetischen<br />
Dimension des Geschichtsbewußtseins), um einer buchstäblichen Sammlung<br />
wie der Deutschen Bücherei Bedeutung zu verleihen (»der Knochenbau als der<br />
22 Niklas Luhmann, Temporalisierung <strong>von</strong> Komplexität. Zur Semantik neuzeitlicher<br />
Zeitbegriffe, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie<br />
der modernen Gesellschaft, Bd. 1, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1980<br />
23 Wiederabdruck in: Flugblätter an die Deutsche Jugend, hg. v. d. Berliner Freie Stu-<br />
dentenschaft (Heft 12), Jena 1916,8
900 Bim.ioTiii-K<br />
schweigt Hegel, zeitgleich - weht nur, wo Infrastruktur ist. »Deutsche Literatur<br />
ist alles in Schrift Verfaßte und durch den Druck Verbreitete« , mithin also durch seinen medialen Kanal definierte. Gerade als Netzwerk<br />
ersetzt der Buchhandel die fehlende Kulturzentrale, wie später die Institution<br />
der Fernleihe die fehlende Nationalbibliothek. Perthes' formuliert sein Plädoyer<br />
<strong>für</strong> den deutschen Buchhandel in Begriffen, die ein solches Netz - ganz im Sinne<br />
des Internet - mit Rückkanal denkt, andererseits aber - und das ist die Differenz<br />
zum Internet - die mittelpunktslose Verknotung nicht formulieren mag:<br />
»In Deutschland können Wissenschaften und Künste nicht betrieben, nicht gefördert<br />
werden, wenn nicht durch alle Provinzen, wo Deutsch gesprochen wird, der<br />
Buchhandel <strong>von</strong> einem Punkt aus gehandhabt, wenn nicht <strong>von</strong> allen Provinzen aus<br />
gleichförmig wieder nach einem Punkt gestrebt würde. Deutschland hat keinen<br />
Mittelpunkt, keine Hauptstadt, keinen allgemeinen Beschützer <strong>für</strong> Wissenschaft,<br />
Kunst und Litieratur. - Die Gesammtheit muß dies ersetzen, - der Buchhandel ist<br />
das Mittel zur Einheit« <br />
mithin also deren Medium. Und als Inhalt wird das Medium zur Form: »Die<br />
deutsche Nation ist eine lesende, reflectirende: die Litteratur ist ihr Mittel zur<br />
Cultur« . Ist »die gemeinsame Sprache als das unverletzliche Bildungsmittel<br />
deutscher Stämme - heiligzuhalten <strong>für</strong> bessere Zeiten« das Medium der deutschen Leitkultur} Und die deutsche Einheit zuvorderst<br />
die »Einheit der deutschen Literatur« ? In gewisser Weise folgt<br />
dieses Medium bereits dem Techno-Dispositiv des broadeast, insofern es eine<br />
Funktion seiner zentrifugalen Distribution ist und daher einen Ort der Speicherung<br />
benötigt: »Die Möglichkeit, daß Werke des Geistes erscheinen« - hier im<br />
doppelten Sinn -, »bewirkt allein der deutsche Buchhandel, der, <strong>von</strong> einem<br />
Punkte, dem Stapelort Leipzig, ausgehend, nach den verstecktesten Winkeln hin<br />
reicht und <strong>von</strong> da aus, auf jenen einen Punkt zurückwirkend, das Gesamtpublikum<br />
zu Erlangung literarischer Zwecke in Anspruch nimmt« <br />
- also feedback, ein Rückkanal? Zweitens bedarf es da<strong>für</strong> eines legalistischen<br />
Dispositivs der Autorisation, hier buchstäblich: »Entschädigung der Autoren <strong>für</strong><br />
Bekanntmachung und Herausgabe ihrer Schriften« , als Urheberrechtsschutz<br />
und Honorierung, einhergehend mit einer Kapitalisierung des Mediums:<br />
»diese Verpflichtung des Publikums übernimmt der deutsche Buchhandel durch<br />
Zahlung des sogenannten Honorars, obwohl grade durch dasselbe das eigentliche<br />
Risiko entspringt« . Drittens eines Standards: »anständige Gestalt und<br />
korrekter Druck der erscheinenden Schriften und Werke« , also das<br />
im Format des Buchdrucks gesicherte Layout. Ferner einer Organisation, die das<br />
Individuum übersteigt, »damit kein wissenschaftliches Unternehmen, welchen<br />
Perthes, Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseins einer deutschen Literatur<br />
[1811 u. 1816]. Schriften, hg. v. Gerd Schulz, Stuttgart (Reclam) 1995, 8lf
Ll-TTKRN, BUCHSTÄBLICH 901<br />
Umfang es auch habe, aus Mangel an Unterstütztung unausgeführt bleibe« .<br />
Dazu bedarf es einer intakten Infrastruktur - die Grundlage aller medialen Dissemination<br />
- »keinen Ort und keinen Stand beim Vertrieb der Schriften unbeachtet<br />
zu lassen« , mithin Dezentrahtät, föderativ, als Signatur der deutschen<br />
im Unterschied zur französischen und englischen Lage - »in Hunderten <strong>von</strong><br />
Städten und Örtern die herrlichsten Geistesblüten« . Perthes fordert ferner<br />
»ein halbjähriges, allgemeines Verzeichnis der neu erscheinenden Bücher<br />
; daß allgemeine, gute und richtige Bücherkataloge, nebst andern literarischen<br />
Hlfsmittel, sowie endlich mehrere allgemeine, die ganze Literatur umfassende<br />
kritische Institute vorhanden sind« - Metadaten und Inventar<br />
(die spätere Deutsche Bibliographie) und das, was in der - tatsächlichen vom<br />
Börsenverein der deutschen Buchhändler gegründeten - Deutschen Bücherei<br />
endet, die im Jahr des Untergangs der Titanic begründet wird und 1916, hundert<br />
Jahre nach Perthes' Schrift, seine Tore öffnet. Infrastruktur wird hier selbst zum<br />
Medium / Monument, alternativ zu Denkmälern: »Wollen die Deutschen an<br />
ihren Buchhandel solche Ansprüche machen, so muß derselbe als ein Nationalgut<br />
und -institut beachtet werden« . Die diskursiven<br />
Effekte, die der Urheberrechtsschutz zeitigte, manifestieren sich in den<br />
Konsequenzen der durch Bundesbeschluß vom 6. November 1856 bestimmten<br />
Löschung der Verlagsprivilegien <strong>für</strong> Werke <strong>von</strong> vor dem 9. November 1837 verstorbenen<br />
Verfassern. Klassiker wie Goethe und Schiller gerieten damit aus der<br />
Exklusivität ihrer ehemalig exklusiven Verleger wie z. B. Cotta; promt gründet<br />
sich Reclams Universal-Bibliothek Mitte November 1867 mit Nummer 1 und 2<br />
- den beiden Teilen <strong>von</strong> Goethes Faust. iX So medienkulturtechnisch ist die<br />
Dekodierung <strong>von</strong> kanonischen Klassikern.<br />
DestiNationen der Palatina Heidelberg<br />
Nach der letztendlichen Niederlage Napoleons und der Besetzung <strong>von</strong> Paris<br />
durch die Alliierten 1815 ist die Gelegenheit zur Herausgabe älterer deutscher<br />
Rechtsquellen und Manuskripte günstig. Die Fachleute der gerade sich formierenden<br />
Edition Monumenta Germaniae Historica sehen sich zur Warnung vor<br />
dem physischen Verfall der Urkunden genötigt; so seien »nach den in den beiden<br />
letzten Decennien geübten Zerstörungen nur noch Trümmer da<strong>von</strong> zu retten.« 12<br />
31 Anhang zum Verständnis der Schrift »Der deutsche Buchhandel als Bedingung des<br />
Daseins einer deutschen Literatur«, in: Perthes 1995: 55-69 (65); siehe Annemarie Meiner,<br />
Reclam. <strong>Geschichte</strong> eines Verlages, 2. Aufl. 1961<br />
- 1 - Gutachten der der historisch-philologischen Klasse der Königlichen Akademie der<br />
Wissenschaften an das Kgl.-preußische Ministerium in Berlin (Verfasser: Sekretär<br />
Büchler), in: Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde, hg. v.
902 BIBLIOTHEK<br />
Die Trümmer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation korrespondieren<br />
mit denen seiner historischen Überlieferung; auch die aus der Heidelberger<br />
Bibliothek Palatino- 1622 an den päpstlichen Vatikan nach Rom transferierten,<br />
dann <strong>von</strong> Napoleon als Beutcgut nach Paris geholten Buch- und Manuskriptbestände<br />
stehen 1815 erneut zur Disposition. Der Hauptmann und spätere Feldmarschall<br />
<strong>von</strong> Müffling ist als preußischer Kommandant in Paris beauftragt mit<br />
der Rückführung <strong>von</strong> Beutegut. Ein Schreiben des Prorektors Friedrich Milkau<br />
und der Professoren des akademischen Senats der Universität Heidelberg vorn 30.<br />
Januar 1816 dankt Müffling <strong>für</strong> seine Bemühungen um die Rückgabe <strong>von</strong> 38<br />
ursprünglich dorther stammenden Handschriften - vorrangig griechische und<br />
lateinische Codices - aus der vatikanischen Bibliothek, die als Annex zu den<br />
Beständen der römischen Archive unter Napoleon nach Paris verbracht worden<br />
sind. Eine beigefügte handschriftliche Liste, der Catalogue des Manuscnts de<br />
L'anaenne bibliotheque Palatine qui apparüennent ä L'Umversite de Heidelberg<br />
& qui se trouvent encore dans la Biblotheque Royale ä Paris (Paris, 7. Okt. 1815),<br />
trägt ausdrücklich den handschriftlichen Vermerk Milkaus, daß es sich dabei um<br />
diejenigen Handschriften handelt, welche die Universität Heidelberg als Teil ihrer<br />
in Rom befindlichen und im Jahre 1622 dahin gebrachen Bibliothek einst verlor. 33<br />
Was 1622 noch eine Angelegenheit partikularer Staaten gewesen war, wird durch<br />
die Ereignisse <strong>von</strong> 1806-1815 zum Zcichenträger der Nation. Jenseits ihres philologischen<br />
Werts werden die Handschriften zum Inventar einer virtuellen Welt.<br />
Die preußischen Staatsminister Freiherren <strong>von</strong> Altenstein und <strong>von</strong> Humboldt<br />
betrachten »mit preiswürdigem Patriotismus diese Ansprüche unsrer Universität<br />
nicht als die besondere Sache einer einzelnen Lehranstalt, sondern als deutsche<br />
National-Angegenheit« und verheißen in Noten vom 23. August und 10. August<br />
1815 dem Großherzoglich Badischen Gesandten im Hauptquartier zu Paris ihre<br />
nachdrückliche Verwendung <strong>für</strong> das Anliegen der Heidelberger Universität, die<br />
betreffenden Bestände nicht nach Rom, sondern in die Pfalz zurückzuführen.<br />
Worauf Milkau am 2. September 1815 <strong>von</strong> dem Großherzoglichen Ministerium<br />
des Innern den Befehl erhält, sich schleunigst nach Paris zu begeben, zur weiteren<br />
Besorgung dieser Angelegenheit. 34 Waren die Heidelberger Handschriften in<br />
den Umbrüchen des Dreißigjährigen Krieges nach der Stadtbesetzung durch Tilly<br />
J. Lambert Büchler u. Carl Georg Dümge, Bd. 2, Frankfurt/M. (Andrcäische Buchhandlung)<br />
1820, 3-18(17f)<br />
j3 Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 92, Nachlaß des Feldmarschalls v. Müffling<br />
(12.6.1775-16.1.1851), A.7.<br />
34 Friedrich Wilkcn, <strong>Geschichte</strong> der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen<br />
Büchcrsammlungen, Heidelberg 1817, Kapitel IV: »Nachricht über die<br />
Zurückerstattung <strong>von</strong> 890 Handschriften der alten Biblwtheca Palatina an die Universität<br />
Heidelberg in den Jahren 1815 und 1816«, 238ff (239)
LI-:TTI-:RN, BUCHSTÄBLICH 903<br />
1622 als lokales Kapital nach Rom gelangt 35 , werden sie durch das Dazwischentreten<br />
der Befreiungskriege neu kodiert, semiotisch aufgeladen durch den<br />
nationalen Diskurs, der aus dem Akt der Ent-Fremdung sich generiert, aus<br />
dem konsumtiven Mangel also. Die symbolische Überdeterminierung, die retrospektive<br />
Nationalisierung dieser Gedächtniseinheit manifestiert sich in einem<br />
Schreiben der Universität vom 28. November 1815, in dem sie erklärt, daß die Palatimsche<br />
Sammlung »ursprünglich dem gemeinschaftlichen deutschen Vaterlande<br />
anghörc«, als »gemeinschaftliches deutsches Eigenthum treulich autgehoben und<br />
sowohl zur Bildung deutscher Jünglinge als <strong>für</strong> das Studium unsrer Alterthümer<br />
und Litteratur bestimmt bleiben solle« . Tatsächlich wird<br />
die rückgeführte Bibliothek in Heidelberg ein Forschungszentrum der älteren<br />
Germanistik und <strong>für</strong> den in Heidelberg lebenden Gervinus die Basis seiner Nationalliteraturgeschichte.<br />
Zunächst aber erwägt die französische Regierung nicht<br />
die Rückgabe erbeuteter Kunstschätze an Museen und Bibliotheken. So macht<br />
die römisch-päpstliche Delegation, darunter Antonio Canova, auch die Heidelberger<br />
Petition zu ihrer Sache, im Bunde mit v. Müffling, »welcher die militärischen<br />
Zurücknahmen leitete« . Auf Canovas Betreiben<br />
hatte Papst Pius VII. Chiaramonti bereits in einem Motupropno vom 1. Oktober<br />
1802 ein Gesetz erlassen, das die Ausfuhr <strong>von</strong> Kulturgütern verbot. 36 Die Entführung<br />
römischer Antiken durch Napoleon nach Paris führt dann zu Canovas<br />
minuta autografa: »La decomposition du Museum de Rome est la mort de toutes<br />
les connaisances, dont son umte est le prmcipe« 37 ; der Gegengedanke des<br />
Musee Napoleon will die Gesamtgeschichte der Kunst möchhehst vollständig darstellen.<br />
Nur mit Beutegut war das möglich . An die<br />
Stelle der lieux de memoire (etwa Rom) und <strong>von</strong> Tradition als Speicher im authentischen<br />
Kontext setzt sich der Diskurs der Historie, der die Objekte aus ihrer<br />
topographischen Bindung in einen virtuellen Raum, den einer unterstellten Entwicklung,<br />
übersetzt.<br />
So gelingt die Rückführung eines Teils der Palatina-lsAznus'knpte aus Paris<br />
nicht nach Rom, sondern nach Heidelberg. <strong>Im</strong> Zweiten Pariser Frieden wird die<br />
Rückgabe festgeschrieben und erfolgt am 7. Oktober. In Rom verbleiben damit<br />
nur Restbestände: »Ein letztes Mal kam in Zweiten Weltkrieg der Vorschlag einer<br />
Rückführung, der aber noch schneller zu den Akten gelegt wurde als gut 100<br />
Jahre vorher« . Denn nachdem Rom am 14. August 1943 zur<br />
35<br />
Zur Frage »Raub oder Rettung« siehe den Ausstellungskatalog: Bibhothcca Palatina,<br />
Textband, hg. v. Elmar Mittler u. a., Heidelberg (Braus) 1986, Kapitel »H«<br />
36<br />
Erike Jayme, Kunstwerk und Nation: Zuordnungsprobleme im internationalen Kulturgüterschutz,<br />
Heidelberg (Winter) 1991, 22<br />
37<br />
Museo Civico Bassano, Maniscritti Canoviani, E5 5591. Zitiert <strong>von</strong> Jayme 1990, 24,<br />
Anm. 73
904 BlHI.IOTHKK<br />
Offenen Stadt erklärt ist, ist an eine Zwangsüberführung der römischen<br />
Bestände nicht mehr zu denken. Heute transzendiert die Reichweite <strong>von</strong> Medien<br />
die materiellen Gedächtnisgrenzen der Nationen, und mithin die Übertragungsmöglichkeit<br />
das Speicherparadigma. <strong>Im</strong> Zeitalter der Reproduktionen und<br />
Mikrofilme ist »die Lage bei Büchern allerdings nahezu völlig entschärft«<br />
. Die Wiedergewinnung der Palatino, »<strong>für</strong> den deutschen<br />
Kulturraum« bedeutet heute, sie in andere Speichermedien einzuholen: die Verfilmung<br />
und Rückkopic der lateinischen Handschriften seit 1959 <strong>für</strong> die Heidelberger<br />
Universitätsbibliothek.<br />
Leipzig 1914: Die Internationale Ausstellung <strong>für</strong> Buchgewerbe und Graphik<br />
und deutsch-französische Frontstellungen<br />
Geist, Nation, Buch: Wenn eine Nation sich als Subjekt wie als Objekt im<br />
Druckspiegelbild erkennt, also in der lesenden und gelesenen (Auto-)Reflexion,<br />
heißt das Medium ihrer Identität Bibliothek. Weil sie sich immer fragt, ob sie dem<br />
Diskurs angemessen ist, das Wesentliche ihres Gegenstandes zu erfassen, tendiert<br />
diese Schrift immer zu metadiskursiver Reflexivität. Vor dem Hintergrund dieses<br />
Speichers hat Hegel das absolute Wissen als Gedächtnisfunktion definiert:<br />
»Das Ziel, das absolute Wissen, oder sich als Geist wissende Geist hat zu seinem<br />
Wege die Erinnerung der Geister, wie sie an ihnen selbst sind und die Organisation<br />
ihres Reiches vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freyen in<br />
der Form der Zufälligkeit erscheinenden Dascyns, ist die <strong>Geschichte</strong>, nach der<br />
Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wissenschaft des erscheinenden Wissens;<br />
beyde zusammen, die begriffene <strong>Geschichte</strong>, bilden die Erinnerung und die<br />
Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit seines<br />
Throns; ohne den er das leblose Einsame wäre; nur - >aus dem Kelche dieses<br />
Geisterreiches / schäumt ihm seine Unendlichkeit'.«-<br />
Mit dem Kelch dieses Geisterreichs moduliert Hegel den Schluß <strong>von</strong> Schillers Gedicht<br />
Die Freundschaft: »Freudlos war der große Weltenmeister, / Fühlte<br />
Mangel«, und bedarf daher der Symbohsation durch supplementäre Medien-als-<br />
Prothesen. »Darum schuf er Geister«, »Sel'ge Spiegel seiner Seligkeit« - ein Spiegelstadium,<br />
die Findung der eigenen Identität im Reflex des Anderen. 39 Geister<br />
als Spiegel bedeuteten um 1914 Buchdruck; die Leipziger Messe <strong>für</strong> Buchgewerbe<br />
und Graphik liest sich als »ein rechtes Spiegelbild der Kultur aller Völker<br />
und Zeiten auf Grund der schriftlichen und bildlichen Ausdrucksformen der-<br />
- 18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, hg. v. Wolfgang Bonsiepen<br />
u. Reinhard Heede (= Gesammelte Werke, Bd. 9), Hamburg (Meiner) 1980, 433f<br />
39 Anthologie auf das Jahr 1782, hg. v. Friedrich Schiller
LHTTI-RN, BUCHSTÄBLICH 905<br />
selben«. 40 Vielleicht meinen Herders Nationalcharaktere genau das - die Eindrücke,<br />
das <strong>Im</strong>pressum der Lettern (literarisches Korpus) auf den Körper der<br />
Nation, wo »kleine Verbindungen schon großen Sinn geben und doch Jahrhunderte<br />
nur Silben, Nationen nur Buchstaben und vielleicht Interpunktionen<br />
sind, die an sich nichts, zum leichtern Sinne des Ganzen aber 50 viel bedeuten!«<br />
41 Die Kluft zwischen der sozio-kulturellen Vision und der politischen<br />
Wirklichkeit führt in Deutschland zu kompensatorischen Bewegungen wie etwa<br />
dem Konzept des deutschen Buchs, fermentiert durch den <strong>Im</strong>perativ der protestantischen<br />
Reformation, sich auf den Originaltext zu beziehen. 42 Barbier<br />
spricht <strong>von</strong> »la placc nodalc tenuc effcctivemcnt par la chosc impnmce dans<br />
Pimaginaire collectif allemand«; das gedruckte Buch und die Tradition Gutenbergs<br />
nehmen im Prozeß der nationalen Integration Deutschlands einen grundsetzenden<br />
Stellenwert ein. Die Internationalität des Buchhandels transzendiert<br />
demgegenüber zunächst die nationalen Chauvinismen; als das Leipziger Völkerschlachtdenkmal<br />
1913 eine symbolische Front gegen den westlichen Nachbarn<br />
aufrichtet, ist Frankreich dennoch der erste Staat, der positiv auf die<br />
offizielle Einladung zur Teilnahme an der <strong>für</strong> 1914 vorgesehenen Leipziger<br />
Bugra antwortet. Das Ereignis der Leipziger Bugra bedarf der wissensarchäologischen<br />
Dekodierung ä plusiers niveaux: »La commemoration, pretexte ä une<br />
verkable mise en scene, cree directement, par son deroulement meme, l'objet<br />
qu'elle commemoire, de sorte que Papproche histonque pnvilegiee ne peut en<br />
etre que semiologique, c'est-ä-dire fonctionelle.« Ein Pariser<br />
Gesetz vom 7. August 1913 autorisiert ausdrücklich das Ministerium<br />
<strong>für</strong> Handel, Industrie, Post- und Tclegraphenwesen, sich <strong>für</strong> die Teilnahme an<br />
der internationalen Ausstellung in Leipzig 1914 einzusetzen - womit, nebenbei, Buch und Graphik bereits im Verbund mit ihren konkurrenten<br />
Übertragungsmedien genannt stehen. Diskursive Fronstellungen<br />
gegen Frankreich aber holen auch die Internationalität der Bugra <strong>von</strong> 1914 ein;<br />
1916 lenkt Ludwig Volkmann, erster Vorsteher des Deutschen Buchgewerbevereins,<br />
auf der Sitzung des Direktoriums der Bugra in Leipzig den Blick nach<br />
Frankreich:<br />
40 Geheimrat Ludwig Volkmann, erster Vorsitzender des Deutsehen Buchgewcrbevcreins,<br />
in seinem Vortrag: Deutsches Buchwesen und Schrifttum nach dem Kriege, Leipzig<br />
1916, abgedruckt in: Archiv <strong>für</strong> Buchgewerbe, 53. Bd., Sept.-Okt. 1916, Heft 9/<br />
10,218-222(218)<br />
41 Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie der <strong>Geschichte</strong> zur Bildung der<br />
Menschheit, hg. v. Hans Dietrich Irmscher, Stuttgart (Reclam jun.) 1990, 109<br />
42 Frederic Barbier, Un enjeu symbolique: le salon du Livre (BUGRA) de Leipzig en<br />
1914, in: Prefaces Nr. 13, Mai-Juni 1989, Dossier »Fascinations et resistances Allemands-francaises«,<br />
114-119 (114)
908<br />
Niederlagen 1806. Die schlichte Präsenz der Deutschen Bücherei am Deutschen<br />
Platz in Leipzig - am hermeneutischen Nullpunkt <strong>von</strong> <strong>Namen</strong>ssymbolik also -<br />
erinnert uns durch ihre sichtbare Nähe zum Völkerschlachtdenkmal daran, daß<br />
Napoleons Herausforderung auch auf der Ebene <strong>von</strong> Medien- als Signalspeicher-<br />
und Übertragungspolitik lag (seiner Meisterschaft). Napoleon weiß es<br />
1810: »L'imprimene est un arsenal qu'il importe de ne pas mettre ä la portee de<br />
tout le monde et des lors la politiquc doit en etre le juge.« 49<br />
Die Halle der Kultur bis an ein Deutsches Kulturmuseum<br />
Der ehemalige Leiter der Schnftsammlung des Stenographischen Landesamtes zu<br />
Dresden, Albert Schramm, übernimmt am 1. August 1913 die Leitung des Deutschen<br />
Buchgewerbe- und Schriftmuseums in Leipzig. Schramm fungiert ferner als<br />
ehrenamtlicher wissenschaftlicher Leiter der Bugra und bestimmt maßgeblich die<br />
Konzeption der Halle der Kultur. Die kognitive Topographie der Bugra verortete<br />
sie im Koordinatennetz eines quasi-sakralen Zeitraums, in Datum und Ort der<br />
Völkerschlacht: Dauert die internationale Ausstellung doch vom 6. Mai bis zum<br />
18. Oktober 1914, und ihr Gelände liegt (als perspektivischer Fluchtpunkt) im<br />
Zuge der Straße des 18. Oktober. Dem Besucher tat sich am Haupteingang als<br />
Fluchtpunkt der Sichtachse entlang der Fortsetzung der Straße des 18. Oktober<br />
durch das Ausstellungsgelände das Völkerschlachtdenkmal auf. Ein zeitgenössischer<br />
Berichterstatter beschreibt die Bugra 1914 als »Völkerausstellung auf dem<br />
Boden der einstigen Völkerschlacht«, und die Hoffnung der Veranstalter ist ein<br />
Beitrag zum Wettstreit der Völker, »in dem nicht Pulver und Blei, sondern Lettern<br />
und Druckerschwärze den Ausschlag gäben«. 50 Die Bugra 1914 liegt buchstäblich<br />
am Schnittpunkt <strong>von</strong> wissensökonomischer Infrastruktur (Buchgewerbe)<br />
und Kulturgeschichte; einmal mehr definiert sich hier Kultur als Funktion ihrer<br />
Ubertragungs- und Speichermedien im Sinne der Kultursemiotik <strong>von</strong> Jurij M.<br />
Lotman und B. A. Uspenskn. 51 Dem entspricht präzise die Konzeption der zentralen<br />
Halle der Kultur, wo »die Darstellung der steigenden Beherrschung irdischen<br />
Raumes und irdischer Zeit durch Schrift und Druck die beste und tiefste<br />
Aufgabe der Ausstellung« sein soll, da beide Medien, »insbesondere der Druck,<br />
v> Zitiert nach: Michael Wetzel, Skizze zum Beitrag: Das »diot«, geplant <strong>für</strong>: Friedrich<br />
Kittler / W. E. (Hg.), Medien - Revolution - Historie (unveröffentlicht)<br />
50 Alle Zitate nach: Lothar Poethe (Text), Bugra-Ansichten. Historische Bilder der Internationalen<br />
Ausstellung <strong>für</strong> Buchgewerbe und Faphik Lepzig 1914, Leipzig (Schmiedicke)<br />
1988, passim<br />
51 Zum semiotischen Mechanismus der Kultur, in: Semiotica Sovietica 2, hg. v. K. Eimer-<br />
macher, Aachen 1986, 853-880 (859)
Ll nT.RN, BUCHSTÄBLICH 909<br />
Folgeerscheinungen der Erhöhung des wirtschaftlichen Verkehrs und somit<br />
zugleich wirtschaftsgeschichtliche Erscheinungen« darstellen. 52 <strong>Im</strong> Juli 1923<br />
publiziert El Lissitzky im dadaistischen Organ Merz (Nr. 4) seine Thesen »Topographie<br />
der Typographie«. These 8 schließt an Lamprecht an, um ihn zu überbieten:<br />
»Der gedruckte Bogen überwindet Raum und Zeit. Der gedruckte Bogen, die<br />
Unendlichkeit der Bücher, muß überwunden werden. DIE ELEKTROBIBLIO-<br />
THEK.« 53 <strong>Im</strong> Text der erklärenden Ausstellungstafeln aber verklärt Lamprecht<br />
seine medienarchäologische Einsicht in Kulturtransfer zu völkerpsychologischen<br />
Metaphern: Schrift und Type, Graphik und Buchgewerbe seien nichts als entwicklungsmäßige<br />
Ausdrucksformen, also Funktionen des jeweiligen Seelenlebens?<br />
41 Schrift und Druck im funktional-symbolischen double-bind: »Ihren Zielen<br />
nach, die auf Herrschaft über Raum und Zeit hinauslaufen, gehören sie der<br />
<strong>Geschichte</strong> des Verkehrs an, also der Wirtschaftsgeschichte, ihren Mitteln nach,<br />
da sie wohl überall ursprünglich auf Zeichnung und Malerei zurückgehen, der<br />
Kunstgeschichte« . Die Ausstellungssegmente Vorzeiten und Urzeiten<br />
stellen die Alternativen zur Schrift selbst in den Vordergrund:<br />
»<strong>Im</strong> Anfang steht eine lineare und Flächenornamentik, welche dem flüchtigeren<br />
Blick älterer Forscher den Eindruck des Mathematischen machte, während sie heute<br />
bald als Ausfluß primitiver rhythmischer Bedürfnisse, bald als letzte und äußerste<br />
Redaktion ursprünglich sehr einfacher Zeichnungen, bald als direkte Nachahmung<br />
gewisser Handarbeitsmotive, z. B. des Flechtwerks erklärt wird.« <br />
Nach Kriegsausbruch im August 1914 bleibt die Ausstellung bis auf die<br />
Schließung der Pavilhons unmittelbarer deutscher Kriegsgegner zunächst intakt.<br />
Zwei Jahre später aber hat der Weltkrieg die museale Darstellung <strong>von</strong> Kultur in<br />
modulare Einheiten verwandelt: Die Betonhalle wird zu militärischen Zwecken<br />
angefordert, »wir mußten unsre Schätze aus ihr entfernen und provisorisch<br />
anderweitig unterbringen, und so hat hier wiederum Mars die Musen verdrängt«<br />
. Bleibt das Ziel,<br />
»dem großen Gedanken, der in der >Halle der Kultur< verkörpert -war, bleibende<br />
Gestalt und Wirkung zu verleihen. Wie dies geschehen kann und welche Zwecke<br />
damit erreicht werden sollen, da<strong>für</strong> haben wir organisationsgewöhnten und zielbewußten<br />
Deutschen wohl nicht nötig, die Franzosen zu befragen. Sicher ist, daß<br />
die Form gefunden werden muß, wenn die Sache als richtig erkannt wurde. <br />
Ob wir nun Buchhändler, Verleger, Buchdrucker, Schriftgießer, Steindrucker,<br />
52 Karl Lamprecht, Vorwort, in: Internationale Ausstellung rür Buchgewerbe und Graphik<br />
Leipzig 1914. Halle der Kultur, amtlicher Führer, iv u. v<br />
D3 Zitiert nach: Peter.Paul Schneider u. a., Literatur im Industnezeitalter Bd. 2, Ausstellungskatalog<br />
Schiller Nationalmuseum Marbach am Neckar (= Marbacher Kataloge<br />
42/2) 1987<br />
54 Textabdruck im Abschnitt »Grundausstcllung«, in: Halle der Kultur 1914, 1-16(16)
910 BlBI.IOTIIKk<br />
Buchbinder, Photographen usw. sind, oder Künstler und Schriftsteller, Lehrer und<br />
Beamte, Bibliothekare und Gelehrte, Sammler und Liebhaber. Was uns alle eint,<br />
sei der deutsche Geist und sein bildlicher und schriftlicher Ausdruck, sein unentbehrliches<br />
köstliches Gefäß: das Buch!« <br />
Da ist er wieder, Schillers »Kelch«. Geist, gemeint als content ofthe form (Hayden<br />
White), bedarf hier zunächst des Containers, und promt teilt Götz mit, daß<br />
die Kulturausstellung, auf der Bugra <strong>von</strong> seinem Amtsvorgänger Lamprecht<br />
geschaffen, nicht zerstört sei, sondern daß sie in Kisten wohlverpackt in dem Institut<br />
<strong>für</strong> Universalgeschichte der Leipziger Universität hege. 55 Es handelt sich dabei<br />
um die sogenannte Grundausstellung; der übrige Inhalt der Halle der Kultur wird<br />
größtenteils im Deutschen Buchgewerbe- und Schriftmuseum aufbewahrt. Aufgabe<br />
der Grundausstellung war es gewesen, ein historisch ordnendes Expose der<br />
Ausstellung vorzugeben, also »über das bloße Interesse an einzelnen Stücken und<br />
ihrer nächsten Umgebung« hinauszugehen. Historie fungiert als diskursives Ordnungsmittel<br />
gegenüber der non-diskursiven Ordnung <strong>von</strong> Speicher und Depot:<br />
»Sie will zeigen, wie sich Wirtschaftsleben und bildende, insbesondere zeichnende<br />
und malende Kunst parallel entwickelt und zu den Wirkungen einer immer höheren<br />
Beherrschung <strong>von</strong> Raum und Zeit verbunden haben und den Betrachter<br />
dadurch befähigen, in dem ungeheuren Nebeneinander <strong>von</strong> tausend und aber tausend<br />
Gegenständen in der 1 lalle der Kultur die leitenden Fäden in der Entwicklung<br />
zu finden.« <br />
Repercussions der Bugra: In den Archiven der Hoovcr Institution on War, Revolution<br />
and Peace auf dem Kampus der kalifornischen Stanford University lagert<br />
ein Typoskript Ueber die wissenschaftlichen Zwecke, denen die Sammlungen<br />
Eduard Fuchs ausschliesslich dienten. Darin figuriert die Bugra als Argument in<br />
den juristischen Verhandlungen um die <strong>von</strong> Seiten der Nationalsozialisten zur<br />
Schließung der Berliner Karikaturen-Sammlung Fuchs' vorgebrachten Argumente:<br />
»Der grosse Umfang, in dem die Sammlungen der direkten Oeffentlichkeit<br />
<strong>von</strong> uns dienstbar gemacht wurden, belegt u. a. schon die Tatsache, dass die<br />
gesamte kulturpolitische Abteilung der Leipziger Buch- und Grafikausstellung<br />
im Jahre 1914 {Bugra) aus den Bestaenden der Sammlung Fuchs bestritten war.« 56<br />
~° Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35, Nr. 1198, Bd. I (Ergangen vor dem Rate der Stadt Leipzig<br />
1917): Akten, den Deutschen Verein <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum und das Deutsche<br />
Kulturmuseum betreffend. Bl. 1-3: Archiv <strong>für</strong> Buchgewerbe, 53. Bd., Sept.-Okt.<br />
1916, Heft 9/10, darin: Bericht über Sitzung des Direktoriums der Weltausstellung <strong>für</strong><br />
Buchgewerbe und Graphik Leipzig 1914: Deutsches Buchwesen mid Schrifttum nach<br />
dem Kriege, 218-222(221)<br />
56 Bestand Nicolacvsky, Nachlaß Eduard Fuchs, Karton 619, Faszikel 6: »Materials collected<br />
in 1933-40, corresp. 1934«. Siehe W. E., Eduard Fuchs. Sammlung und Historie, in:<br />
Bernhard J. Dotzler / Helmar Schramm (Hg.), Cachaga. Fragmente zur <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong><br />
Poesie und <strong>Im</strong>agination (Festschrift Karlheinz Barck), Berlin (Akademie) 1996, 30-39
Ll-.TIT.kN, ÜUCI ISTÄBUCI I 91 1<br />
Ist es möglich, in der medienarchäologischen Darstellung Gedächtnissignaturen<br />
nicht selbst in Narration zu verwandeln? Das Stadtarchiv Leipzig lagert<br />
unter dem Titel Kap. 35 Nr. 1198 Akten, den Deutschen Verein <strong>für</strong> Buchwesen<br />
und Schrifttum (Deutsches Museum <strong>für</strong> Buch und Schrift zu Leipzig) betreffend.<br />
Die diskrete, modulare Sequenz <strong>von</strong> Textartefakten gibt Versatzstücke<br />
einer archäologischen Konstellation, nicht aber ein kohärentes Bild einer Vorund<br />
Frühgeschichte des Leiziger Projekts eines Deutschen Kulturmuseums.<br />
Stellen wir also diese Partikel vernetzt, aber nicht als Erzählung aus, nicht ikonisch<br />
(im Sinne der rhetorischen Anschaulichkeit <strong>von</strong> Geschichtsbildern), sondern<br />
indexikalisch, mithin der Logistik des Archivgedächtnisses selbst folgend.<br />
Damit wird das Archiv als Gedächtnisfilter, als Agentur der Infrastruktur <strong>von</strong><br />
Gedächtnis transparent. Vor aller Invention, aller Geschichts-Findung, hegt das<br />
Inventar. Die Leipziger Akten nennen als <strong>Im</strong>puls zur Gründung des Buchmuseums<br />
den Wunsch, national definiertes Geistesgut über den laufenden Krieg<br />
zu retten. 57 Am 16. Dezember 1917 erfolgt die Gründung des Deutschen Vereins<br />
<strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum als Trägerverein <strong>für</strong> ein Museum Buch &<br />
Schrift. Pamphlet und Satzungsentwurf des Vereins nennen als Ziele in §2 eine<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> deutsche Geisteskultur, die Organisation <strong>von</strong> Vorträgen und<br />
Wanderausstellungen, schließlich jenes Deutsche Kulturmuseum, das »ein<br />
umfassendes Bild der Entwicklung der geistigen Kultur <strong>von</strong> den einfachsten<br />
Anfängen bis zur höchsten Stufe bei den einzelnen Völkern zeigen« und neben<br />
der Schau- eine Studiensammlung und Bibliothek umfassen soll. Die Eröffnungsrede<br />
zur Gründungsfeier des Vereins im Dezember 1919 hält Volkmann<br />
in der Leipziger Gutenberghalle. Von der Bugra, die sich selbst weit über den<br />
engeren Rahmen einer gewerblichen Unternehmung hinaus »zu einem Kulturdokument<br />
<strong>von</strong> bleibender Bedeutung« entwickelt hat, sind »schon rein äußerlich<br />
geprochen so viel greifbare Werte erhalten geblieben«, daß deren dauernde<br />
Bewahrung und systematische Nutzbarmachung sich ohne weiteres geltend<br />
macht. 58 Währung, Dauern und Geltung: Der Diskurs <strong>von</strong> Graphik und Buchkunst<br />
gerinnt mithin also selbst zum Monument.<br />
»Den Kernpunkt der neuen Vereinigung wird gleichfalls ein Museum bilden .<br />
Und wenn man einwenden sollte, geistige Kultur ließe sich, wie rein Geistiges<br />
überhaupt, nicht restlos zur sichtbaren Erscheinung bringen, so darf erwidert werden,<br />
daß es auch hier eben der Geist ist, der sich den Körper baut: die Schrift und<br />
das Buch. Und die >Halle der Kultur< hat wohl den tatsächlichen Beweis da<strong>für</strong><br />
erbracht, wie die graphischen Ausdrucksmittel, wie Schrift und Buch, als Träger<br />
57<br />
Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35, Nr. 1198, Bd. I (Ergangen vor dem Rate der Stadt Leipzig<br />
1917, Bl. 386<br />
58<br />
Druckschrift: Deutscher Verein <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum. Bericht über die<br />
Gründungsfeier (16. Dez. 1917), 2ff (3)
912 BiHuoTiihk<br />
und Erhalter geistiger Werte über Raum und Zeit hinaus, ein anschauliches Bild<br />
<strong>von</strong> der Geisteskultur der Völker zu geben vermögen.« <br />
Wo nicht Bilder, sondern Schrift und Buch ein anschauliches Bild geben sollen,<br />
sehreibt sich eine protestantische Kulturästhetik: bilderfremd, schriftzentriert.<br />
<strong>Im</strong> Anschluß an die Gründungszeremonie erfolgt die Eröffnung der Deutschen<br />
Knegsgraphik-Ausstellung; »mitten in diesem Weltkrieg tritt mit dem heutigen<br />
Tag das Deutsche Kulturmuseum, wie es kurz heißen soll, ins Leben« . Die Reihe der Förderer (darunter Generalfeldmarschall <strong>von</strong> Hindenburg)<br />
verdeutlicht, daß dieses Museum <strong>von</strong> einer repräsentativen Gesamtheit im<br />
Reich getragen wurde; »die Organisation stellt dem Deutschen Museum in München,<br />
das der Technik gewidmet ist, ein Deutsches Museum <strong>für</strong> Geisteskultur entgegen,<br />
gegründet mitten im Weltkriege <strong>von</strong> uns Barbaren als Zeuge des Geistes,<br />
der unvermindert in unserem Volke waltet und die friedliche Kulturarbeit über<br />
alles stellt.« 39 Dem technischen Gedächtnis der Nation (Museum München) wird<br />
das Leipziger Museum der (Buch-)Kultur als Monument des Beharrungsvermögens<br />
nicht-funktionaler Semantik unter Kriegsbedingungen zur Seite gestellt.<br />
Längst schon reagiert Geisteswissen(schaft) nur noch auf die Vorgaben der<br />
Naturwissenschaften, bestimmt deren Epistemologie nicht länger. In Leipzig<br />
rüstet sie als Medienwissenschft auf. Die historische und künstlerische Abteilung<br />
des Leipziger Buch- und Schnftmuseums kommt zunächst in der ehemaligen<br />
Halle der Kultur zur Aufstellung, die technische Sammmlung im existierenden<br />
Buchgewerbehaus. Kulturgedächtnis heißt nicht museale Kristallisation, sondern<br />
Tradition (also Übertragung) einer Praxis; einen Bestandteil der Vereinbarungen<br />
zwischen dem Deutschen Buchgewerbevercin und dem Deutschen Verein <strong>für</strong><br />
Buchwesen und Schrifttum bildete die im Jahre 1915 als Deutsche Bihliothekarund<br />
Museumsheamten-Schule begründete Ausbildungsstätte, die seit ihrer Gründung<br />
dem Museum angeschlossen ist. Am 12. Oktober 1918 werden Museum,<br />
Bibliothek und Lesesaal bis auf weiteres im gesamten ersten Stockwerk des<br />
Monumentalbaus des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen an der Zeitzer<br />
Straße 8/14 untergebracht; damit ist das Deutsche Kulturmuseum eine weithin<br />
sichtbare Tatsache, nämlich zur institutionellen Aussage geworden 60 , der Kriegsniederlage<br />
zum Trotz: »Deutschland kann und wird sein Buchmuseum nicht<br />
untergehen lassen!« 61 Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, in einem Typo-<br />
39 Leipziger Abendzeitung v. 30. November 1917<br />
60 Das Deutsche Kulturmuseum in Leipzig, paraphiert »E.«, in: Leipziger Abendzeitung<br />
v. 13. Oktober 1918, hier zitiert nach dem Exemplar im Kapitel 35 Nr. 1198 Bd. 1 des<br />
Stadtarchivs Leipzig<br />
61 Ludwig Volkmann, Zehn Jahre nach der »Bugra«, in: Leipziger Kalender. Illustriertes<br />
Jahrbuch und Chronik, hg. v. Georg Merseburger, 12. Jg. (1925), Leipzig/Regensburg<br />
(Habbel & Naumann), 23ff (28)
Ll-.TTKRN, BUCHSTÄBLICH 913<br />
sknpt <strong>von</strong> 1935, wird nicht nur die Arbeitsteilung mit dem Deutschen Museum<br />
München (Technik, demgegenüber in Leipzig: die geistige Seite der Kultur), sondern<br />
auch die kultur-propagandistische Bedeutung dieser Gründung als ihr kultureller<br />
Sinn (sprich: Vektor) erinnert. 62<br />
Dieses Museum <strong>für</strong> Buch und Schrift, hervorgegangen aus den historischen und<br />
künstlerischen Beständen des Deutschen Buchgewerbemuseums, der Halle der<br />
Kultur der Bugra 1914, der Königlich Sächsischen Bibliographischen Sammlung<br />
Klemm und den Sammlungen des Deutschen Vereins <strong>für</strong> Buchwesen und<br />
Schrifttum, weist in seiner Schausammlung in lückenloser Folge die Entwicklungspenoden<br />
der Menschheitskultur nach, »soweit sie mit der Schrift und dem<br />
Buche in Verbindung stehen« - seinerseits anhand des linearen Leitmediums der<br />
Beschriftung, womit Schrift als Medium des historischen Diskurses museal selbstreferentiell<br />
und zur Bedingung einer Kulturbeobachtung zweiter Ordnung wird.<br />
Jenseits dieser Ausstellung <strong>von</strong> Schrift und Buch (»und des graphischen Ausdruckes<br />
überhaupt«) in historischer und künstlerischer Beziehung aber ist die<br />
Darstellung <strong>von</strong> Technik und Wirtschaft dieser Medien dem ebenfalls in Leipzig<br />
fortexistierenden Deutschen Buchgewerbemuseum überlassen . Die mediensemiotische Einsicht in Kultur als Funktion ihrer Speicherung<br />
und Übertragung 63 blendet damit die Darstellung der infrastrukturellen Bedingung<br />
kultureller Effekte aus, bedarf also offenbar dieses blinden Flecks, um seine<br />
Latenzen und Einsichten zirkulieren zu lassen und produziert so Differenzen<br />
auch institutionell. 64 Kaum ist das Museum am 12. Oktober 1918 der Öffentlichkeit<br />
übergeben, »brach die Revolution herein« - die konzentrierteste Form <strong>von</strong><br />
Öffentlichkeit; im Mai 1919, mit dem Anbruch einer neuen politischen Zeit, steigern<br />
sich Besucherzahlen wie Benutzung außerordentlich. 65 Die medienarchäologisch<br />
bemerkenswerte Gleichsetzung <strong>von</strong> Buch und Kultur aber führt zunächst<br />
zu Mißverständnissen, nachdem die Gründungsversammlung in Anlehnung an<br />
das Deutsche Museum in München und das Germanische Nationalmuseum in<br />
Nürnberg die <strong>Namen</strong>sform Deutsches Kulturmuseum wählt. Die öffentliche Sitzung<br />
der Stadtverordneten zu Leipzig am 8. Mai 1918 berät eine Vorlage, dem<br />
Deutschen Verein <strong>für</strong> Buchwesen und Schrifttum als zahlendes Mitglied beizutreten;<br />
eine längere Aussprache entsteht dabei über den <strong>Namen</strong> des Vereins, und<br />
62 Typoskript v. 4. Dezember 1935 zur Vorlage beim Oberbürgermeister in Leipzig,<br />
Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35 Nr. 1198, Bd. 3<br />
63 So Juri] M. Lotman / B. A. Uspenskij, Zum semiotischen Mechanismus der Kultur, in;<br />
Semiotica Sovietica 2, hg. v. K. Eimermacher, Aachen 1986, 853-88C<br />
64 Vgl. Niklas Luhmann, Sthenographie, in: Bielefelder Universitätszeitung, 17. Jg., Nr.<br />
148 (1987), 36; s. ders., Sthenographie und Euryalistik, in: H. U. Gumbrecht / K. L.<br />
Pfeiffer (Hg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche, Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1990, 58-82 (63)<br />
65 Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35 Nr. 1198, Bd. 1, Bl. 179
916 Bi<br />
ten, aber dem Helden, dessen <strong>Namen</strong> durch die Jahrhunderte leuchten wird, dem<br />
gilt dies literarische Denkmal, errichtet aus Dankbarkeit und Verehrung. <br />
Noch lebt dieser Mann ; noch umgeben ihn jene getreuen Mitkämpfer und<br />
Mithelfer, <strong>von</strong> denen ein stattlicher Teil die Denksteine zu diesem literarischen<br />
Denkmal hcrbeigctragen. Und noch <strong>von</strong> etwas anderem kündet uns dies<br />
Buch: daß es möglich ward, trotz der Ungunst der Gegenwart, unter der das Buchgewerbe<br />
besonders schwer leidet, es so schön und stattlich herzustellen - ein Sieg<br />
deutscher Arbeit und Tatkraft!« 74<br />
Der Weltkrieg hat die Umstellung <strong>von</strong> monumentalen auf dokumentarische<br />
Gedächtnisformen forciert und »die deutsche Organisationskunst allenthalben<br />
in den Mittelpunkt gerückt« . Die Deutsche Bücherei birgt<br />
unter der Signatur 1928 B 141 den Abdruck jener Rede Hugo <strong>von</strong> Hofmannsthals,<br />
die 1927 Das Schrifttum als geistigen Raum der Nation 75 definiert:<br />
»Alles Höhere, des Merkcns würdige aber, seit vielen Jahrhunderten, wird durch<br />
die Schrift überliefert; so reden wir vom Schrifttum und meinen damit nicht nur<br />
den Wust <strong>von</strong> Büchern , sondern Aufzeichnungen aller Art, wie sie zwischen<br />
den Menschen hin und her gehen, den nur <strong>für</strong> einen oder wenige bestimmten Brief,<br />
die Denkschrift, desgleichen auch die Anekdote, das Schlagwort, das politische<br />
oder geistige Glaubensbekenntnis, wie es das Zeitungsblatt bringt, lauter Formen,<br />
die ja zu Zeiten sehr wirksam werden können.« <br />
Damit setzt Hofmannsthal die deutsche Nation als Archiv, dem die Sammlungspolitik<br />
der Deutschen Bücherei Rechnung zu tragen sucht. Die Sprachnorm<br />
ist es, welche die Nation zusammenhält und dem Spiel widerstreitender Tendenzen<br />
(»der aristokratischen wie der nivellierenden, der revolutionären wie der<br />
konservativen«) buchstäblich Raum gewährt« . Kulturspeicher wie<br />
die Deutsche Bücherei sind Bedingung da<strong>für</strong>: »Der Raumbegriff, der aus diesem<br />
geistigen Ganzen emaniert, ist identisch mit dem Geisterraum, den die Nation<br />
in ihrem eigenen Bewusstsein und in dem der Welt einnimmt« . Wo<br />
Geist im Geisterraum sich vollzieht, beginnt Medientheorie: »Wir haben eine<br />
Literatur im uneigentlichen, konventionellen Sinne, die aufzählbar, aber nicht<br />
wahrhaft repräsentativ noch traditionsbildend ist« , mithin also als<br />
LitcrAturgescbicb te nicht crzählbar, da<strong>für</strong> als Depot adressierbar. Deutschlands<br />
Gedächtnis ist, wo die Bibliotheken walten. Schrifttum als geistiger Raum der<br />
Nation meint Literatur, beruht aber auf Schrift im Konkreten. Wilhelm Carl<br />
Grimm schrieb seine Archäologie der deutschen Schrift Über deutsche Runen<br />
»als Beitrag zur Einheit Deutschlands«. 76 Den Einbruch der Schrift als Monu-<br />
74 Paul Lindenberg (Hg.), Hindenburg-Dcnkmal <strong>für</strong> das deutsche Volk, Berlin (Vaterländischer<br />
Verlag C. A. Weller) 1925 l* 1922], Druck: G. Kreysing (Leipzig), »Zur Einführung«<br />
7:> Ausgabe München (Bremer Presse)<br />
76 Über deutsche Runen, Einführung W. Morgenroth / Arved Spreu, Berlin (Akademie-
LHTTHRN, BUCHSTÄBLICH 917<br />
ment in den Diskurs der Historie beschreibt ein Dokument aus dem Archiv des<br />
Museums <strong>für</strong> Völkerkunde in Leipzig, ein »F. Kr.« gezeichneter Brief vom 11.<br />
Februar 1938 an Johann Hofmann, den Direktor der Leipziger Stadtbibliothek:<br />
»Da Sie nun mit der Planung und Durchführung der historischen Abteilung der<br />
Gutenberg-Ausstellung betraut worden sind, möchte ich mir erlauben, Ihnen vorzuschlagen,<br />
in der ersten Gruppe (Zeit vor Gutenberg) auch die Runenschriften<br />
mit zu berücksichtigen, wie sie auf Runensteinen und Kalenderstäben überliefert<br />
und als Hausmarken noch heute erhalten sind. Dazu etwa auch Runensymbole an<br />
nordischen Bauwerken. Unser Museum könnte Ihnen mit Ausstellungsgütern<br />
da<strong>für</strong> dienen. Die Gruppe Runenschrift brauchte nicht übermäßig umfangreich zu<br />
sein. Aber als älteste nordische Schrift, die heute durch einige ihrer Zeichen Bedeutung<br />
gewonnen hat, dürfen doch wohl nicht fehlen, selbst angesichts der Tatsache,<br />
daß sie in Buchschrift und Druck späterer Zeiten nicht übergegangen ist.« 7 '<br />
Die tatsächliche Rede ist vom Eindringen der SS-Rune in die Schreibmaschinentastatur<br />
nationalsozialistischer Bürokratie (jene Wunde der symbolischen<br />
Ordnung, die 1945 mit ihr auch wieder verschwand). Medienarchäologisch wahrgenommen,<br />
bildet auch die Serie der Buchstaben einer jeweils national konfigurierten<br />
Schreibmaschinentastatur im Moment ihrer Aktivierung eine Aussage<br />
(obgleich die Tastatur und die darauf angezeigten Buchstaben selbst »keine Aussagen<br />
sind, sondern Sichtbarkeiten« 78 ). Indem der Computer die Tastatur der<br />
Standardschreibmaschine nur noch emuliert, wird auch diese Aussage liquidiert,<br />
d. h. vom Gesetz der Mechanik in den Fluß der digitalen Programmierbarkeit<br />
überführt. In dieser Einsicht mündet auch die Rekonstruktion der seit den Befreiungskriegen<br />
emphatisch geführten Debatte um die Privilegierung der vorgeblich<br />
deutschen, durch einen Erlaß Adolf Hitlers dann doch verbotenen (weil fadenscheinig<br />
als jüdisch deklarierten 79 ) Frakturschrift: »Mit den Möglichkeiten der<br />
Digitahsierung stehen auch >Tvpes before Gutenbcrg< mit gebrochenen Fonts<br />
die Türen wieder offen. Die Posthistoire der Fraktur kann beginnen.« 80 Am<br />
Ende steht die Entdeckung <strong>von</strong> Alphanumerik als Monument; Rodcnberg zählt<br />
Verlag) 1987. Siehe auch Wolfgang Pircher, Das verführte Ohr. Rhetorik und die Liebe<br />
zur Nation , in: Gerburg Treusch-Dieter u.a. (Hg.), Denkzettel Antike. Texte zum kulturellen<br />
Vergessen, Berlin (Reimer) 1989, 94, speziell: LITER
918 Bim.ioriii'K<br />
unter den Begriff typographisch wertvoll auch die Didotsche Logarithmen-<br />
Tafeln, obgleich sie dem Inhalt nach anspruchslos« sind .<br />
Gerade in der Drucktypenforschung spielt der Einzelbuchstabe eine medienarchäologisch<br />
aktive Rolle; Lettern »tragen sämtlich die Kennzeichen an sich, die<br />
uns den Weg in ihr historisches Werden und Wachsen und in ihre praktische Verwendung<br />
in den Drucken weisen« . Der Buch(staben)druck in der<br />
deutschen Klassik war zugleich Bedingung und Modus der Lektüre: »so nämlich,<br />
daß der Leser auf die Schriftzeichen weiter nicht achthaben mußte, also<br />
schnell lesen und sich ganz dem Text hingeben konnte. Die alphabetische Schrift<br />
ist wie die Atmosphäre des Textes, die sein Verständnis nicht stört, wohl aber den<br />
Genuß des Lesens trägt.« 81 Mit der Epoche der Deutschen Bücherei aber fällt<br />
diese zusätzliche Information zugunsten des standardisierten, damit speicherund<br />
übertragungstechnisch effektiveren Lesens fort. Das letzte lesbare Monument<br />
aber wird keine Type gewesen sein, sondern ein bit.<br />
81 Hannelore Schlaffer, Klassik und Romantik (Epochen der deutschen Literatur in Bildern),<br />
Stuttgart 1986, Kapitel »Die Optik des Buches: Die Schrift«
BUCH III:<br />
ERZÄHLEN
INVENTAR UND STATISTIK<br />
Nation und Inventar<br />
An der Spitze <strong>von</strong> Historikern der nouvellc histoire in Frankreich hat Pierre<br />
Nora mit seiner Edition Les lieux de memoire (Paris 1984ff) das Auseinandertreten<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> und alternativen Gedächtnissen dokumentiert. Die akademische<br />
Geschichtsschreibung vermag das kollektive Gedächtnis der Nation<br />
nicht mehr zu repräsentieren. 1 An die Stelle der diskursiven Suprematie des Kollektivsingulars<br />
<strong>Geschichte</strong> tritt die Inventarisierung kollektiver Gedächtnisorte<br />
und -topoi, also die Repluralisierung nicht nur der <strong>Geschichte</strong>, sondern der Weisen<br />
ihres Be- und Zugriffs selbst. Der Klappentext stellt es aus: »Entre memoire<br />
et histoire, Pexploration selective et savante de notre heritage collectif, qui tire sa<br />
justification la plus vraie de Pemotion qu< eveille encore en chaeun d'entre nous<br />
un reste d'identification vecue ä ces symboles ä demi effaces.« Nicht mehr<br />
Geschichtsschreibung, sondern Spurensicherung; statt <strong>Geschichte</strong> die Nation als<br />
Archiv: »La dispantion rapide de notre memoire nationale appelle aujourd'hui<br />
un inventaire des lieux oü eile s'est electivement incarnee et qui, par la volonte<br />
des hommes ou le travail des siecles, en sonst restes comme ses plus eclatants<br />
symboles: fetes, emblemes, monuments et commemorations, mais aussi eloges,<br />
archives, dictionnaires et musces« . Für Deutschland ist dieser Gedächtnisrhythmus<br />
mit einem anderen Zeit- und Sachindex versehen. »Un Allemand<br />
neu pourra jamais comprendre qu'une oeuvre d'art puisse etre un objet d'amour<br />
et autre chose qu'une mauere ä dissertations archeologiques.« 2 Das Medium<br />
<strong>von</strong> Inventansation aber ist nicht Kunstgeschichte, sondern Listen, die ein<br />
Archiv setzen, nicht abbilden: Ein Inventar »seeks to establish archives of <br />
heritage classified in such a way that each entry has a precise scientific content«<br />
- was die Schnittstelle zur direkten Anschließbarkeit automatisierter<br />
So hieß es in der Vorankündigung zur deutschen Ausgabe seiner programmatischen<br />
Aufsätze: Pierre Nora, Zwischen <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis, Berlin (Wagenbach) 1990<br />
Auguste Mftrguiüiet-, Sui* un piaidtivet- aliemand, IMI MeoeuH* >.)*• fat'fUU'M v, i • Juli i^1ft,<br />
83, zitiert nach: Otto Grautoff, Die Denkmalpflege im Urteil des Auslandes, in: Paul<br />
Clemen (Hg.), Kunstschutz im Kriege. Berichte über den Zustand der Kunstdenkmäler<br />
auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen und über die deutschen und österreichischen<br />
Maßnahmen zu ihrer Erhaltung, Rettung, Erforschung, 1. Bd.: Die<br />
Westfront, Leipzig (Seemann) 1919, 111-140(127)
922 INVI-NTAR UND STATISTIK<br />
Datenverarbeitung bildet. 3 Nicht Historie und nicht Autorschaft verwalten das<br />
Gedächtnis; das Inventar ist seine diskurssetzende Maschine. Die Aufgabe etwa,<br />
im Fall eines notorischen photohistorischen Nachlasses »den Code <strong>von</strong> Adgets<br />
Numerierung der Negative zu knacken«, übernahm das Museum, »um eine<br />
ästhetische Seele zu entdecken. Und fand statt dessen - eine Kartei. 4<br />
Der Ursprung solcher Maßnahmen reicht bis 1811/12 zurück, zeitgleich zur<br />
Mobilisierung deutschen Geschichtsbewußtseins im antinapoleonischen Befreiungskrieg.<br />
Erst dieser diskursive <strong>Im</strong>perativ richtet die Denkmäler in ihrer<br />
Referenz auf. Schinkel mahnt in seinem Bericht vom 17. August 1815 an das Ministerium<br />
des Innern Die Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer unseres Landes<br />
am Beispiel des Zustands der Schloßkirche in Wittenberg, am Schrein der Hl.<br />
drei Könige zu Köln und dem Domschatz zu Aachen, daß die Kunstdenkmale<br />
Volksgut sind, an ihrem Standort erhalten werden und nicht nach dem Beispiel<br />
der Franzosen in die Landeshauptstadt verbracht werden sollen. Paul Otwin Rave<br />
macht es anhand seines Urkundenberichts - also das Archiv schreibend - über die<br />
Anfänge der Denkmalpflege in Preußen deutlich: Das Umschalten <strong>von</strong> musealem<br />
Objekt- zum Informationstransfer (wodurch Denkmäler zu Zeichen transformieren)<br />
macht es möglich, das Reale an seinem Ort zu belassen 5 ; das gilt zumal,<br />
wenn die registrierten Daten (Zeichnungen, photographische Aufnahmen, Listen)<br />
selbst identisch übertragen werden müssen, was erst auf der Ebene <strong>von</strong> reproduzierbarem<br />
Gedächtnis Praxis werden kann. 6 Die Trennung <strong>von</strong> Hard- und<br />
Software des materiellen Gedächtnisses verbringt Erinnerung in ein archivsch-gedächtmsörtliches<br />
double-bind, das buchstäblich wird, wenn lieux de memoire<br />
(Frankreich) und Erinnerungsorte (Deutschland) auch gedächtnispolitisch ausem-<br />
Eugene Chouraqui, The Index and Filing System Used by the »Inventairc General des<br />
Monuments et des Richesses Artistiqucs de la France«, in: Computers and the Humanitics<br />
7, Heft 5 (Mai 1973), 273-285 (273)<br />
Rosalind E. Krauss, Die diskursiven Räume der Fotografie, in: dies., Die Originalität<br />
der Avantgarde und andere Mythen der Moderne, hg. v. Herta Wolf, Amsterdam /<br />
Dresden (Verlag der Kunst) 2000, 175-195(194)<br />
Paul Ortwin Rave, Die Anfänge der Denkmalpflege in Preußen. Ein Urkundenbericht<br />
aus der Zeit vor hundert Jahren, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, Jg. 1935, 34-<br />
44 (34f)<br />
So etwa die den Elsaß betreffenden Denkmalunterlagen im Pariser Palais Royal (archive<br />
de la commission des monuments histonques), deren Austausch nach 1870/71 zunächst<br />
unterblieb. 1901 wird eine entsprechende Ausstellung <strong>von</strong> Dokumentationen elsässischer<br />
Denkmäler mit Zeichnungen und Photographien »im Original oder in Kopie«<br />
bestückt; per Ministenal-Verfügung entsteht ebendort daraus am 19. Februar das Kaiserliche<br />
Denkmal-Archiv. Dort ist das materielle Kulturgedächtnis als Verzeichnis (und<br />
damit alphanumerisch) adressierbar: F. Woll) (I Ig.), Verzeichnis der Zeichnungen und<br />
Abbildungen der geschichtlichen Denkmäler in Elsass-Lothringen, Straßburg (Trübner)<br />
1903, Vorwort
NATION UND INVKNTAR 923<br />
anderfallen. 7 Schmkels Gutachten schlagen eine staatlich gelenkte Denkmalpflege<br />
vor, besonders deren listenmäßige Erfassung; das Antwortschreiben des Ministers<br />
<strong>von</strong> Schuckmann erklärt sein Einverständnis mit den Listen. 8 Staatskanzler <strong>von</strong><br />
Hardenberg nennt deren Objekte, nämlich ebenso Schrift- wie archäologische<br />
Monumente, in seinem Erlaß vom 18. Dezember 1821 an den westfälischen Oberpräsidenten<br />
Vincke ganz im Sinne <strong>von</strong> Monumenta Germamae histonca:<br />
»Wenn ich auch durch die rücksichtlich der Archive genommenen Maßregeln<br />
unter ihrer Mitwirkung hoffen darf, die schriftlichen Monumente der Vorzeit zu<br />
sichern und der Nachwelt aufzubewahren, so existieren doch noch andere Denkmale<br />
der Vergangenheit, die <strong>für</strong> die frühere <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> entscheidendem Interesse<br />
sind und in den Archiven nur selten eine Aufnahme finden können. Ich rechne<br />
hierher öffentliche Monumente <strong>von</strong> Stein oder Holz, Grabsteine und sonst<br />
Denkmale auf Verstorbene, alte Inschriften.« <br />
Vmcke erläßt am 29. Dezember 1819 eine Verfügung an die drei westfälischen<br />
Regierungen und Landräte, innerhalb <strong>von</strong> zwei Monaten Listen der vorhandenen<br />
Denkmäler einzureichen; das Staatsarchiv Münster birgt die 1821-1829 aufgestellten<br />
Verzeichnisse. 9 An der 1819 durch Preußen umgestalteten rheinischen<br />
Universität zu Bonn initiiert Hardenberg am 4. Januar 1820 ein Altertums-<br />
Museum <strong>für</strong> die rheinisch-westfälischen Provinzen. Sein Direktor Dorow erwirkt<br />
vom Kriegsministerium die Zusage, Bodenfunde abzuliefern, die beim Festungsbau<br />
oder sonstigen Königlichen Bauten zutage treten. Ein Erlaß des Königs vom<br />
20. Juni 1830 verfügt, daß den Stadtgememden die willkürliche Abtragung ihrer<br />
Stadtmauern, Tore, Türme, Wälle und anderer Verschluß- und Verteidigungsanlagen<br />
»weder in polizeilicher noch m militärischer noch in finanzieller Rücksicht<br />
gestattet werden kann« . Noch bestimmt der mihtänsch-infrastrukturelle<br />
Diskurs primär den Umgang mit überkommenen Bauwerken; erst<br />
7 Siehe Etiennc Francois, Von der wiedererlangten Nation zur »Nation wider Willen«.<br />
Kann man eine <strong>Geschichte</strong> der deutschen »Erinncrungsortc« schreiben?, in: ders. /<br />
Hannes Siegrist /Jakob Vogel (Hg.), Nation und Emotion. Deutschland und Frankreich<br />
im 19. und 20. Jahrhundert, Götingcn 1995, 93-107, und Pierre Nora, Das Abenteuer<br />
der Lieux de memoire, ebd., 83-92. Eine Fallstuche dieser difjerance, dieses ebenso<br />
Speicherdaten- wie ideologiegebundenen Gedächtnisauf- und verschubs liefert Winfried<br />
Speitkamp, Vom deutschen Nationaldenkmal zum französischen Erinnerungsort:<br />
Die Hohkönigsburg im Elsaß, in: Etiennc Francois u. a. (Flg.), Marianne-Germania.<br />
Deutsch-französischer Kulturtransfer im europäischen Kontext, Leipzig (Leipziger<br />
Universitätsverlag) 1998, Bd. 1, 207-229; s. a. W. E., Monument, Transfer und Translation:<br />
das deutsch-französische Gedächtnis der Leipziger Völkerschlacht, ebd., 183-206<br />
8 Ludwig Schreiner, Karl Friedrich Schinkel und die erste westfälische Denkmäler-<br />
Inventarisation. Ein Beitrag zur <strong>Geschichte</strong> der Denkmalpflege Westfalens, Recklinghausen<br />
(Bitter) 1968, 10<br />
v Oberpräsidium Münster, Nr. 2421; ferner Regierung Münster, Nr. 5164: Die Erhaltung<br />
der Denkmäler, 1822-1887
924 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
der sich formierende staatliche Denkmalschutz fügt dem auch ein historisches<br />
katechon hinzu. Am 1. Juli 1843 schließlich wird der Baurat Ferdinand <strong>von</strong> Quast<br />
erster Konservator Preußens. 10<br />
Metamorphosen des Denkmalbegriffs<br />
An die Stelle gewollter Denkmäler rückt nach 1800 das gewordene Denkmal<br />
(worauf J. G. Droysen mit seiner Ihstorik methodisch reagiert); unter der Ägide<br />
Karl Friedrich Schinkels gilt fortan die Kombination <strong>von</strong> Überrestcharakter<br />
(Materialität) und historischem Diskurs als ästhetische Qualität. Geschichtssemiotisch<br />
ist demzufolge Denkmal alles, »was als Zeichen der Vergangenheit<br />
gewisse Erinnerungen aus der Zeit oder an die Zeit, wo sie gefertigt wurden,<br />
erwecken will oder kann, vorzüglich aber Gegenstände menschlicher Kunst«. 11<br />
Datenaggregate, die als Gedächtnis <strong>von</strong> Vergangenheit wahrgenommen werden,<br />
transformieren im Kontext des historischen Diskurses zu Geschichtszeichen<br />
(Zeichen <strong>für</strong> Historie). Interpretant dieser Zeichenmengen ist der Staat; seine Verwaltung<br />
bedarf einer justiziablen Präzisierung des Denkmalbegnffs. Erste Gesetzentwürfe<br />
der 1880er Jahre definieren als Denkmäler alle unbeweglichen und<br />
beweglichen Gegenstände, die aus »einer abgelaufenen Kulturperiode« stammen<br />
und »als charakteristisches Wahrzeichen ihrer Entstehungszeit« kunstgeschichtlich<br />
oder »<strong>für</strong> die Erhaltung der Erinnerung an Vorgänge <strong>von</strong> hervorragendem<br />
historischem Interesse« als signifikant wahrgenommen werden . Die Vorstellung <strong>von</strong> Geschichtszeichen bedeutet die vektorielle<br />
Ausrichtung gestreuter Objekte durch einen historischen Metadiskurs.<br />
Der aber kann keine Berufungsinstanz sein, wenn er dem hermeneutischen Zirkel<br />
der Selbstbegründung verfällt. 1885 veröffentlicht der preußische Oberregierungsrat<br />
<strong>von</strong> Wussow im Auftrag des Kultusministeriums eine zweibändige<br />
Zusammenstellung und Dokumentation über die Erhaltung der Denkmäler in<br />
den Kulturstaaten der Gegenwart und bezweifelte, ob das Denkmal überhaupt<br />
zu definieren sei: vom subjektiven Unheil« hängt es ab, was als besonders bedeutsam<br />
<strong>für</strong> Kunst, <strong>Geschichte</strong> und Erinnerung anzusehen ist; hinreichende<br />
Bedingung <strong>für</strong> den Denkmalwert ist die schlichte Aussage, daß es »aus der Vergangenheit<br />
stammen« muß . Joseph Krayer<br />
kommt letztendlich in seiner rechtswissenschaftlichen Dissertation 1930 über die-<br />
1 Siehe Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin-Dahlem, Akten des Unterrichtsministeriums,<br />
»betreffend die Vorkehrung zur Erhaltung der Denkmäler und Überreste vaterländischer<br />
Künste«, U IV, Nr. 3, Bd. 1 (1815-1849)<br />
Brockhaus 1833, zitiert nach: Winfried Speitkamp, Die Verwaltung der <strong>Geschichte</strong>.<br />
Denkmalpflege und Staat in Deutschland 1871-1933, Göttingen (Vandenhoeck &<br />
Ruprecht) 1996, 84
NATION UND INVKNTAR 925<br />
sen Schluß nicht hinaus; eine Definition des Denkmals existiere nicht oder nur<br />
diffus. Der <strong>von</strong> Alexander <strong>von</strong> Humboldt geprägte Begriff des Naturdenkmals<br />
etwa stellt ein Oxymoron dar: die Natur als Künstlerin; »<strong>für</strong> den Juristen wird<br />
dadurch die Aufgabe, den Begriff Naturdenkmal zu definieren, in keiner Weise<br />
erleichtert.« 12 Wenn als Minimalkonsens zwischen Juristen, Verwaltungsbeamten,<br />
Denkmalpflegern und Kuntwissenschaftlern weiterhin lediglich zu gelten<br />
hatte, daß ein »als Denkmal anerkannter Gegenstand ein <strong>für</strong> allemal der Vergangenheit<br />
angehören mußte , entscheidet also die schlichte Beobachterdifferenz<br />
als der Moment, in der Gedächtnis- respektive Speicherdatenmengen<br />
operativ zu einem selbstreferentiellen System (Archiv) geschlossen werden. Was<br />
die Archive mobilisiert, kommt - als Geschichtsenergie - gerade <strong>von</strong> jenseits der<br />
Vergangenheit. Diskursiv formuliertes Interesse am Erhalt des Denkmals kann<br />
durch ein normiertes Verfahren erzielt werden, deren institutionelles Korrelat die<br />
Denkmalvereine bilden. Ihr Instrument heißt Registrierung und Inventar, nicht<br />
Interpretation: »Nicht mehr im absoluten Wert des Objekts, der gar nicht meßbar<br />
war, sondern im öffentlichen Zugriff, der sich formaljuristisch zunächst meist<br />
in der sogenannten >Klassierung
926 INVENTAR UND STATISTIK<br />
»Betrachtet werden, beobachtet werden, erzählt werden und Tag <strong>für</strong> Tag aufgezeichnet<br />
werden waren Privilegien. Die Disziplinarprozeduren nun kehren<br />
dieses Verhältnis um, sie setzen die Schwelle der bcschreibbaren Individualität herab<br />
und machen aus der Beschreibung ein Mittel der Kontrolle und eine Methode der<br />
Beherrschung. Es gehl nicht mehr um cm Monument <strong>für</strong> cm künftiges Gedächtnis,<br />
sondern um ein Dokument <strong>für</strong> eine fallweise Auswertung.« 15<br />
Was der Fall gewesen ist (Foucaults Positivität der Aussage) aber entscheidet<br />
das Denkmalarchiv im alphanumerischen Akt der Registrierung. Und Historiographie,<br />
emsig mit der Transsknption <strong>von</strong> Monumenten in Dokumente<br />
befaßt, wird zum Komplizen dieser Praxis.<br />
Am Anfang der Beschäftigung mit Denkmälern, im archäologischen Moment<br />
ihrer Wahrnehmung, stellt der Zeugni.swcrl »eine objektive Eigenschaft dar, denn<br />
er lag im Objekt« (Speitkamp)."' Tatsächlich aber handelt es sich vielmehr um<br />
vektorielle Zuschreibung denn <strong>Im</strong>manenz; es gibt kein emphatisches Gedächtnis<br />
der Dmge, aber Gedächtnispohtik. 17 Das Denkmal enthält nur scheinbar selbstbewußt<br />
die Erinnerung an Personen, Dinge oder Vorkommnisse und bezeugt<br />
Tradition, Herrschaft und Institutionen nicht intrinsisch. Die Vorstellung vom<br />
historischen Wert folgt chronologisch dem Zeugniswert und markiert den Beginn<br />
moderner Denkmalpflege, doch er haftet nicht selbstverständlich jedem Gegenstand<br />
an, der aus der Vergangenheit stammt; vielmehr ist er die Funktion einer<br />
Zuschreibung. Was - im Sinne des Zeugniswerts - als Information über Vergangenheit<br />
gilt, ist nicht schon <strong>Geschichte</strong>. Was Zeichen ist, läßt sich in Listen fassen<br />
18 ; Museen, Denkmalschutz und Archive stehen dadurch im Verbund der<br />
Gedächtnisagenturen. Erst der Kontext des Entwicklungsgedankens - der synekdochische<br />
<strong>Im</strong>perativ der Nation, der Erinnerungsimperativ als Funktion jedes<br />
15 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/<br />
M. (Suhrkamp), 246f. Dazu auch, paraphrasierend, Stefan Rieger, Memoria und Oblivio.<br />
Die Aufzeichnung des Menschen, in: Miltos Pechlivanos / ders. / Wolfgang Struck<br />
und Michael Weitz (Hg.), Einführung in die Literatuwissenschaft, Stuttgart / Weimar<br />
(Metzler) 1995, 378-392, bes. 38Off »Das Archiv des Menschen«<br />
16 Zur <strong>von</strong> den Modi ihrer Präsentation induzierten Unterscheidung <strong>von</strong> Überresten, die<br />
ihren historischen Sinn außer sich haben, und Relikten, die ihn an sich und in sich<br />
haben, siehe (in Anlehnung an J. G. Droysen) Jörn Rüscn, <strong>Geschichte</strong> sehen. Zur<br />
ästhetischen Konstitution historischer Smnbildung, in: Monika Macke (I lg.), Auf der<br />
Suche nach dem verlorenen Staat. Die Kunst der Parteien und Massenorganisationen<br />
der DDR, Berlin 1994, 28-39 (bes. 31)<br />
17 Demgegenüber: Detlef Hoffmann (Hg.), Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte und<br />
KZ-Denkmäler 1945-1995, Frankfurt/M. u. New York (Campus) 1998<br />
ls Siehe Paul Clanen, Anlange, Entwicklung und Ziele der rheinischen Denkmälerstatistik,<br />
in: Nachrichten-Blatt <strong>für</strong> rheinische I Ieimatpflege, Organ <strong>für</strong> Heimatmuseen,<br />
Denkmalpflege, Archivberatung, Natur- Landschaftsschutz, hg. v. Landeshauptmann<br />
der Rheinprovinz, 2. Jg. 1930/31, Heft 7/8, 105-109
NATION UND INVENTAR 927<br />
<strong>Im</strong>periums respektive Reichs - verleiht dem isolierten Monument das Moment<br />
eines historischen Stellen- als Mehrwerts. Geschichtsenergie geht nicht <strong>von</strong> ihren<br />
Objekten, sondern deren diskursiver Aufladung aus. Der Kunsthistoriker Paul<br />
Clemen, erster Konservator der Rheinprovinz, auf die nach 1815 ein Viertel der<br />
preußischen Denkmäler fällt, definiert die Aufgabe der Denkmalpflege als <strong>Im</strong>perativ,<br />
mithin selbst monumental: »das Bewußtsein der Verbindung mit der Vergangenheit<br />
lebendig zu halten, die Zeugen der Vergangenheit unversehrt zu<br />
bewahren und zu Ehren zu bringen«. 19 Metonymisch, nicht allegorisch wird das<br />
Artefakt an historisch kontextuahsierende Wahrnehmung, nicht archäologische<br />
Diskretion gebunden. Dem historischen Sinn entspricht die dokumentarische<br />
Lesart <strong>von</strong> Artefakten als Denkmälern, worunter zunächst alle Bauwerke zu fallen,<br />
»die <strong>für</strong> die Kunst und die <strong>Geschichte</strong> in irgendeiner Beziehung wertvoll<br />
sind und die charakteristischen Wahrzeichen eines vergangenen Zeitalters darstellen«<br />
20 . Medium dieses kunsthistorischen Bewußtseins aber sind radikal<br />
Techniken und Agenturen gegenwärtiger Aufspeicherung; 1895 beschließt die<br />
Provinzialkommission <strong>für</strong> die Denkmalpflege in der Rheinprovinz die Anfertigung<br />
<strong>von</strong> Kopien (Pausen) mittelalterlicher Wandmalereien, um »diese kunstgeschichtlich<br />
außerordentlich wertvollen Denkmäler, die zum Teil in ihrem<br />
Bestände gefährdet sind und immer mehr verschwinden und verbleichen, in<br />
ihrem jetzigen Zustand festzulegen«. Monumentalisierung geschieht hier durch<br />
den Akt der ikono-graphischen Fixierung; ihr zweiter Faktor heißt Materialsammlung<br />
<strong>für</strong> eine großangelegte Publikation. 21 Clemen nennt die hermeneutische<br />
Bedingung solcher bildarchivischen Unternehmen: vor allem zu sehen, zu<br />
reisen und nicht zu lesen; »daher das wunderbare Gedächtnis <strong>für</strong> einzelnes«. 22<br />
Unter der Hand aber steht diese Praxis längst im Schatten der auf der Speicherung<br />
photogrammetnscher Bauaufnahmen basierenden Preußischen Meß-<br />
19 Paul Clemen, Die Denkmalpflege in der Rheinprovinz, Düsseldorf 1896, 3<br />
20 Zitiert nach: Ausstellungskatalog »Der Rhein ist mein Schicksal geworden«. Paul Clemen<br />
1866-1947. Erster Provinzialkonservator der Rheinprovinz, Köln (Rheinland-<br />
Verlag) 1991,78<br />
21 Paul Clemen, Anfertigung <strong>von</strong> Kopien mittelalterlicher Malereien der Rheinprovinz,<br />
in: Bericht über die Thätigkeit der Provinzialkommission <strong>für</strong> die Denkmalpflege in<br />
der Rheinprovinz etc. 1897, Bonn 1897, 59. Dazu Wilfried I lansmann, Alexander<br />
Schnüttgen und Paul Clemen, in: I Iiltrud Westermann-Angerhausen (Mg.), Alexander<br />
Schnüttgcn. Colhgue iragmenta ne pereant. Gcdcnkschnft des Schnüttgen-<br />
Museums zum 150. Geburtstag seines Gründers, Köln 1993, 75-85 (78f)<br />
22 Paul Clemen, Alexander Schnüttgen, in: Kunstchronik und Kunstmark Nr. 9 v. 13.<br />
. Dezember 1918, 166, hier zitiert nach: I lansmann 84. <strong>Im</strong> Gegensatz dazu G. E. Lessing,<br />
der auf seiner Itahcnreise ca. 1770 nicht sieht, sondern liest: W. E., Not seeing<br />
Laocoon: Description on the Stage of Reason, demnächst in: John Bender u. a. (Hg.),<br />
Regimes of Description: In the Archive of the Eighteenth Century, Stanford UP 1999
928 INVTNTAR UND STATISTIK<br />
bildanstalt Albrecht Meydenbauers in Berlin, wo <strong>für</strong> die Kameraaugen die Alternative<br />
Lesen versus Sehen schon nicht mehr besteht. Bei der statistischen Inventarisation<br />
der Kunstdenkmäler der Rheinprovinz stellt sich heraus, daß die<br />
üb er gewissenhafte Durchforschung des historischen Materials die Fertigstellung<br />
des Werks unabsehbar aufschiebt; Archivierungspraxis und der diskursive<br />
Anspruch auf Veröffentlichung, Datenverarbeitung und Output geraten in Widerstreit<br />
. Logistisch manifestiert sich dies in der Reaktion<br />
der zuständigen Kommission, die Arbeit des Historikers und der des Kunsthistorikers<br />
zu trennen, dokumentarisches Textmaterial also <strong>von</strong> Bildverarbeitung<br />
operativ zu entkoppeln. Es sind verschiedene Modi <strong>von</strong> Vergangenheit, die in<br />
diversen Disziplinen registriert werden.<br />
Alois Riegl publiziert 1903 seine Theorie des Denkmals- als Alterswert: Demzufolge<br />
rezipiert der Betrachter ein Objekt nicht <strong>für</strong> seinen historischen Quellenwert,<br />
sondern er nimmt die in einem Objekt gespeicherte mnemische Energie<br />
wahr, Zeichen <strong>von</strong> Entwicklung, Vergehen oder Verfall. Der archäologische<br />
Blick gerinnt so selbst zur Ästhetik. Während der Alterswert abstrakt die Vergänglichkeit<br />
anzeigt, gibt der gewollte Erinnerungswert <strong>von</strong> Denkmalen Unvergänglichkeit<br />
vor - damit auch das, was sich der vollständigen Semiotisierung qua<br />
Aufzeichnung in seiner puren Matenalhaftigkeit entzieht. Demgegenüber gibt<br />
es eine monumentale Signifikation zweiten Grades, welche das Denkmal vom<br />
Signifikanten zum Signifikat macht: »Wir konservieren ein Denkmal nicht, weil<br />
wir es <strong>für</strong> schön halten, sondern weil es ein Stück unseres nationalen Daseins<br />
ist« 23 ; diskurspohtische Definitionen setzen die Beobachterdifferenz <strong>von</strong> Monument<br />
und Artefakt. Auch Denkmäler des Judentums geraten dem ästhetischen<br />
Historismus so endlich in den Blick (1897 wird in Frankfurt/M. die Gesellschaft<br />
zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler gegründet); ebenso technische Denkmäler,<br />
zumeist Relikte der vorindustriellen Epoche. Historisches Thema ist<br />
jeweils die letztvergangene Epoche einer Gegenwart. Das historistische Bewertungsfreiheitspostulat<br />
bewirkt subkutan die latente Demokratisierung des Denkmalgedankens:<br />
Anfang 1895 initiiert der Verband deutscher Architekten- und<br />
Ingenieur-Vereine die systematische Aufnahme und Sammlung der »charakteristischen<br />
Typen des deutschen Bauernhauses« . Ein<br />
Rundschreiben des preußischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten und des<br />
Innenministeriums vom Januar 1908 definiert auch Straßen- und Ortsbilder als<br />
geschlossene Denkmalensembles; selbst Stadtpläne und Straßennamen wurden<br />
nun als Objekte der Denkmalpflege diskutiert. Klassifikation <strong>von</strong> Denkmälern<br />
heißt dabei praktisch, sie formal in eine rechtlich verbindliche Liste einzutragen;<br />
diese staatliche Zuschreibuni; endet an den Grenzen des Privateigentums.<br />
J> Georg Dehio 1905, zitiert nach: Speitkamp 1 996: 90
NATION UND INVKNTAR 929<br />
Archäologische (als radikal präsentische) Wahrnehmung <strong>von</strong> Daten der<br />
Vergangenheit heißt Kritik an der historistischen Rekonstruktion baufälliger<br />
Denkmäler. Einer Denkschrift des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine<br />
<strong>von</strong> 1878 zufolge muß man Denkmäler «nun einmal hinnehmen,<br />
wie sie sind«: als diskrete Monumente. Dieses archäologische Moment aber wird<br />
diskursiv unverzüglich verklärt; gerade »in diesem originellen, malerischen und<br />
vielgestaltigen Wesen unserer, verschiedenen Zeiten entstammenden Baudenkmäler«<br />
liege ein poetischer Reiz, heterochrone Anbauten nicht entfernen . Inventarisieren ist data processing. 1899 nimmt das<br />
Fachorgan Die Denkmalpflege zur Wiederherstellung der Türme, Tore und Wehrgänge<br />
der ostpreußischen Deutschordenszentrale Marienburg Stellung. Da die<br />
schriftlich überlieferte Information über den Ursprungsbestand unzureichend ist,<br />
gilt es »das Mittelalter, wo es noch vorhanden« ist - also archäologisch präsent, in<br />
die Gegenwart hineinragend als monumentaler, katechontischer Zeit-Bunker, quer<br />
zur Historie als narrativer Abfolge - »aufzusuchen und die wehrbaulichen Einzelheiten<br />
aufzunehmen und zu verarbeiten.« Kritik an rein dokumentarischer,<br />
inventarisierender Denkmalwahrnehmung äußert sich im neuen Genre der Freihchmuseen;<br />
Relikte der Vergangenheit, ihres Kontextes beraubt, werden hier szenisch<br />
rekontextualisiert. Nach Georg Dehio haben Objekte ihre historische und<br />
künstlerische Bedeutung überhaupt nur »in dem bestimmten Zusammenhang, <strong>für</strong><br />
den sie geschaffen waren; sie aus demselben loslösen, heißt meistens die größere<br />
Hälfte ihres Wertes auslöschen« . Dagegen fordert<br />
Wissensarchäologie die Monumentalisierung (als Isolierung) <strong>von</strong> Datensätzen,<br />
um sie einer neuen Gruppierbarkeit und damit Beschreibung zugänglich zu<br />
machen, alternativ zur historiographischen, narrative Zusammenhänge suchenden<br />
Methode.<br />
Mit der kritischen Edition (und der philologischen Emendation) überkommener<br />
Texte korrespondiert eine denkmalpflegerische Praxis. Als sei die Arbeit<br />
der <strong>Geschichte</strong> mit dem Wuchern des Ornaments selbst gleichursprünglich, formuliert<br />
Franz Kugler die Notwendigkeit einer Restauration der Stiftskirche <strong>von</strong><br />
Quedlinburg und placiert das Bauwerk zwischen archäologischem Monument<br />
und historischem Dokument. Kugler möchte dieses Gebäude, »eins der heiligsten<br />
Monumente der vaterländischen <strong>Geschichte</strong>«, <strong>von</strong> den störenden prunkenden<br />
Dekorationen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts befreit<br />
und »in seiner alten Würde hergestellt« wissen. 24 Nichts anderes bedeutete seinerzeit<br />
die (als archäologische Operation verstandene) Befreiung der antiken<br />
Akropolis in Athen vom Schutt dazwischengeschobener Jahrhunderte, Völker<br />
24 Franz Kugler, Kunstbemerkungen. Aus Briefen des 1 lerausgebers, in: Museum, 2<br />
(1834), 142/144, zitiert nach: Klaus Voigtländer, Die Stiftskirche St. Servatii zu Quedlinburg,<br />
Berlin (Akademie) 1989, 31'
930 INVI-NTAR UND STATISTIK<br />
und <strong>Im</strong>perien, die Präparieren der Akropolis zum rein antik-klassischen Monument.<br />
Der Preis solch puristischer Einsichtnahme heißt Blindheit: Für die neugriechische<br />
Nation war (und ist) der Akropolisschutt lange verbunden mit der<br />
Ausblendung ihrer eigenen, nachantiken Tradition. 25 Spuren des Geschichtsverlaufs<br />
sollen nicht ihrerseits ahistorisch verleugnet zu werden. Das in mehreren<br />
Etappen ergänzte und unvollendete Straßburger Münster verkörpert gerade<br />
als Hybrid eine Fülle historischen Lebens (Dehio); demgegenüber stelle das baustilistisch<br />
homogen komplettierte Nationaldcnkmal Kölner Dom eine kalte<br />
archäologische Abstraktion dar. Genau das ist die Natur des archäologischen<br />
Blicks, im Unterschied zur narrativ erhitzten historischen <strong>Im</strong>agination. Puristischen<br />
Rekonstruktion vertritt ästhetisch die Verbindung <strong>von</strong> Architektur und<br />
Vegetation, Kultur und Natur, »zumal dies organisches Leben und Vergänglichkeit<br />
sinnfällig demonstrierte« - Strauchelwerk und<br />
Efeu an Ruinen sind demnach nicht schlichtparergon, sondern Auswuchs ihres<br />
historischen We(i)sens. Die Ästhetik des Historismus ist gleichzeitig der Grund<br />
seiner Krise; gegenüber der historischen Relativität in der Verhandlung und<br />
Konservierung des Ästhetischen fordert Paul Clemen 1928 non-diskursive Setzungen,<br />
etwa »Richtlinien, die bleibend sein sollten« . Zum Zeitpunkt der deutschen Reichsgründung gibt es zentrale<br />
Fachinstanzen <strong>für</strong> den Denkmalschutz allein in Bayern, das aus der Generalinspektion<br />
des plastischen Denkmäler des Mittelalters (1835) hervorgegangene<br />
Generalkonservatonum der Kunstdenkmäler und Altertümer. Die Grenzender<br />
Historie werden dort durch ihre Subdisziphnen gesetzt; der seit 1868 dem Ministerium<br />
des Innern <strong>für</strong> Kirchen- und Schulangelegenheiten zugeordnete Königliche<br />
Generalkonservator ist lediglich <strong>für</strong> die Denkmäler der sogenannten<br />
historischen Periode ab dem achten nachchristlichen Jahrhundert zuständig, die<br />
vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler bis zum achten Jahrhundert fallen in<br />
die Kompetenz der Anthropologisch-Prähistorischen Sammlung bei der Akademie<br />
der Wissenschaften.<br />
Gedächtnisadministration: Die verborgene Seite der historischen Repräsentation,<br />
der Symbolik <strong>von</strong> Historie, der lieux de memoire ist die Infrastruktur ihrer<br />
Verwaltung, das radikal Unhistorische der Akten-Aktualität. Die philosophische<br />
Fakultät der Universität Berlin stellt als Preisausschreiben der Grimmstiftung<br />
(Preisperiode 1891-93) die Aufgabe, die <strong>Geschichte</strong> des in Berlin Friedrich dem<br />
Großen errichteten Denkmals »<strong>von</strong> den ersten Anfängen ab aktenmäßig«, also<br />
buchstäblich wissensarchäologis.ch darzustellen und die da<strong>für</strong> sukzessive projektierten<br />
modellierte Skizzen sowohl als Zeichnungen »unter Heranziehung der dar-<br />
25 Justus Cobct, in: Journal <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> Nr. 4 (Juli 1982). Siehe W. E., Ausstellungsbencht:<br />
Die Akropolis <strong>von</strong> Athen - Verwandlungen eines klassischen Monuments<br />
(Universität Rssen), in: Ccschichtsciidiiktik 1/1984, 93f
NATION UND INVKNTAR 931<br />
auf bezüglichen Schriftstücke« zu beurteilen 26 . Das Denkmal, »wie es dasteht«<br />
(monumentalistisch also), ist in allen seinen Teilen zu beschreiben und mit den<br />
anderen dem König errichteten Statuen zu vergleichen. Der Widerstreit <strong>von</strong><br />
Denkmal und Verwaltung, <strong>von</strong> diskursiven und non-diskursiven Operatoren<br />
daran läuft quer durch die ausdrücklich aktenmäßige, also dem Archiv entlangschreibende<br />
Studie eines Wettbewerbteilnehmers, der feststellt, daß dabei »bedeutende<br />
Kollisionen zwischen meinen juristischen und den <strong>für</strong> die Preisaufgabe<br />
notwendigen kunsthistorischen Studien unvermeidlich« waren . Mcrcklcs Hauptqucllen sind die Akten des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin,<br />
die Akten des Kgl. Hausarchivs zu Berlin und die Akten des Archivs des<br />
Rauchmuseums (mit dem schriftlichen Nachlaß des Künstlers). Konsequenz des<br />
Aktenstudiums ist die Einsicht in Denkmalverwaltung als kateebon der Erinnerung.<br />
Das patriotische Gedächtnis schreibt sich im <strong>Namen</strong> des Archivs und seines<br />
Patriarchs; Geheimrat Friedlaender macht dem Autor »die in dieser Materie<br />
besonders schönen und wertvollen Schätze« des Geheimen Staatsarchivs in Berlin<br />
zugänglich, so daß er seinen Beitrag »unter der Ägide seines seit mehreren<br />
Generationen in der wissenschaftlichen Welt so hochangesehenen <strong>Namen</strong>s <br />
in das große deutsche Büchermeer« entsendet. Die Botschaft heißt <strong>Geschichte</strong>:<br />
»Möge aus der Entwicklung des Fnednchdenkmals <strong>für</strong> das künftige Kaiser<br />
Wilhelm-Monument die Lehre gezogen werden, daß ein großes Nationaldenkmal<br />
sich nicht einfach durch eine Kabmettsordre aus dem Boden stampfen läßt, sondern<br />
daß eine solche Idee jahrzehntelanger Entwicklung bedarf« . Besteht das dauernde Memorial in Buchstaben oder Denkmälern? Merckle<br />
verweist auf den Entwurf des jungen Gilly <strong>für</strong> ein Friedrich-Denkmal, eine Aquarellskizze,<br />
die jetzt »unter Glas und Rahmen« im Vorzimmer zum Sitzungssaale<br />
des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten hängt . Ein Tempel erhebt<br />
sich dann auf einem <strong>von</strong> gewölbten Bogengängen durchzogenen Unterbau mit<br />
den Gebeinen des Königs; in den anderen Räumen des Unterbaues werden seine<br />
Reliquien und eine Friedrichsbibliotbek aufbewahrt. Als Gedächtnis ist Vergangenheit<br />
archäologisch in Knochen, historisch in Buchstaben lesbar.<br />
Inventansation als Aufschreibesystem<br />
Die Behauptung einer Differenz <strong>von</strong> ergon und.parergon, <strong>von</strong> Werk und Beiwerk<br />
ist em pragmatisches Ontologem. Differenz <strong>von</strong> Form und Inhalt ist vielmehr ein<br />
Effekt <strong>von</strong> Übertragungsmedien, kvbernetisch eher denn ontologisch faßbar. <strong>Im</strong><br />
26 Zitiert nach: Kurt Merckle, Das Denkmal König Friedrichs des Großen in Berlin.<br />
Aktenmäßige <strong>Geschichte</strong> und Beschreibung des Monuments, Berlin (Hertz) 1894,<br />
Vorwon, v
932 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Findbuch des Archivs sind Aktensignaturen und in Katalogen der Bibliothek<br />
Buchtitel (gleich Aufsatztiteln) metonymisch Teil des Verzeichneten selbst, als<br />
parergon also am Werk. Das Zeichenregime der Inventarisation verbleibt im<br />
Medium der Buchstaben. Dagegen ist Bildern und Objekten gegenüber die alphanumerischen<br />
Signatur äußerlich, eine Beigabe. Rene Magritte hat auf das Spiel<br />
<strong>von</strong> Figur und Adressierung mit einer semioklastischen Gemäldesene geantwortet.<br />
27 Die Anordnung Nr. 3 über die Erfassung und Sicherung des staatlichen<br />
Eigentums im Bereich der Organe der staatlichen Verwaltung und staatlichen<br />
Einrichtungen - Inventarisation der musealen Objekte - vom 30. Oktober 1957<br />
des Ministers der Finanzen der DDR erklärt - im Kontext der Institution - das<br />
Inventar selbst zum wissensarchäologischen Monument. <strong>Im</strong> Museum ist es »als<br />
Urkunde zu behandeln, in Buchform mit numerierten Seiten zu führen und sicher<br />
aufzubewahren«; Eintragungen dürfen »nur auf Grund ordnungsgemäßer Unterlagen<br />
vorgenommen werden (Rechnungen, Protokolle usw.)«. Damit korreliert<br />
die Signatur; sie ist »am Objekt anzubringen. Ist eine Signierung am Objekt nicht<br />
möglich, sind die Behältnisse mit der Signatur zu versehen« 28 . Besteht ein (im<br />
Sinne <strong>von</strong> Derndas Denken der Spur und des Supplements 29 ) parergonales oder<br />
ornamentales Verhältnis <strong>von</strong> Signatur und Objekt? 30 Die Differenz <strong>von</strong> Parergon<br />
und Ornament ist eine funktionale. Nicht anders gilt <strong>für</strong> den laufenden Akt der<br />
Administration der Bibliotheken ein rein äußerlicher Zugang zu den Medieneinheiten,<br />
der Speichennhalte nicht liest, sondern verziffert. Und daß heißt im Zuge<br />
der Dcwcyschcn Dezimalklassijikation nicht metonymisch, sonder archäologisch<br />
vorzugehen, Wissensdaten als Monumente, nicht Dokumente zu verhandeln. Die<br />
Differenz <strong>von</strong> Inventarisieren und Dokumentation entspricht der Differenz<br />
zwischen Archäologie (äußerlicher Beschreibung) und Historie (Verstehen des<br />
Artefakts) im Sinne der methodischen Vorgabe Michel Foucaults 31 , so wie die<br />
Wissenschaft der Diplomatik immer schon die Diskrimination <strong>von</strong> inneren und<br />
äußeren Merkmalen einer Urkunde praktiziert hat. Mit dieser Methode legt die<br />
Edition der Monumenta Germaniae historica ein Sc/m/idenkmälerarchiv an.<br />
Die Verzeichnung <strong>von</strong> Denkmälern seit Beginn des 19. Jahrhunderts vollzieht<br />
sich meist im Rahmen <strong>von</strong> statistisch-topographischen Landesbeschreibungen<br />
oder als binnenadministrative Hilfsmittel : nicht-öffent-<br />
27 Dazu ders., Dies ist keine Pfeife, Berlin (Ullstein) 1983<br />
2S Zitiert nach: Heinz A. Knorr, Inventarisation und Sammlung in den Heimatmuseen,<br />
hg. v. d. Fachstcllc <strong>für</strong> Heimatmuseen, Halle/S, o. J. , 1 lft, § 2, (3), § 4 (i) u. (3)<br />
29 Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei, Wien (Passagen) 1992, Kapitel »Parergon«<br />
'° Siehe Martin Schrcttinger: Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft<br />
oder Anleitung zur vollkommenen Geschäftsführung eines Bibliothekars in<br />
wissenschaftlicher Form abgefaßt, 3 Bde., München 1829<br />
-" Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. 1973, Einleitung
NATION UND INVKNTAR 933<br />
lieh, non-diskursiv, infrastrukturell. Gedächtnismacht agiert gerade in der Epoche<br />
des Historismus im Verborgenen, jenseits der nationalen Allegorien (Denkmäler,<br />
<strong>Geschichte</strong>). Inventansation nach eigenständigen wissenschaftlichen<br />
Kriterien schreibt sich überhaupt erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts und bleibt<br />
zunächst schriftfixiert; Kugler formuliert demgegenüber in einer Promemoria<br />
vom 6. Mai 1846 die Bildung eines ausdrücklich archäologischen Archivs zur<br />
Aufbewahrung <strong>von</strong> Zeichnungen und Aufnahmen <strong>von</strong> Kunstdenkmälern, welches<br />
Monumente als Objekte historischer Ästhetik (im Unterschied zum Inventar<br />
als Setzung eines Archivs) abbildet? 2 Medium einer flächendeckenden, also<br />
standardisierungsbedürftigen Gedächtnisoperation ist das Formular; Bedingung<br />
<strong>für</strong> eine Erfassung prähistorischer Funde auf deutschem Boden ist, »dass man<br />
den Vereinen eine nach verschiedenen, noch festzusetzenden<br />
Gruppen sich ordnende Reihenfolge <strong>von</strong> wohlformuhrten Fragen vorlege«, eine<br />
Algorithmisierung archäologischer Datenverarbeitung avant la lettre, die aus<br />
eben diesem Grund sich lediglich auf die Beschreibung der Artefakte beschränken<br />
soll, unter Verzicht auf unbrauchbare Conjecturen (die als Kommentare nur<br />
parenthetisch ans Programm geschrieben werden). Neben die alphanumerische<br />
Auflistung tritt dabei das Einzeichnen unserer alten Gräber auf eine Karte, eine<br />
mithin bildstatistischc Form der Eintragung jenseits aller Semantik. Wissensarchäologische<br />
Kartographie, prähistorisches Grab und archäologische Grabung<br />
bilden einen Verbund im System der Aufschreibesysteme <strong>von</strong> Gedächtnis. »Die<br />
Feststellung der charakteristischen Kennzeichen der Alterthümer dieser früher<br />
so dunkeln Penode« ist überhaupt »nur auf dem Wege vergleichender Prüfung<br />
und Zusammenstellung möglich«, im Unterschied zur ästhetischen oder organisatorischen<br />
»Vereinzelung der archäologischen Bestrebungen in Deutschland«;<br />
erst die statistische Serienbildung und Synopsis, die <strong>von</strong> den Theoretikern des<br />
späten 19. Jahrhunderts so gerne mit der archäologischen Praxis in Parallele<br />
gesetzt wird 33 , generiert die wissensgeologische Formation namens Vorgeschichte,<br />
eine Historie, die nicht mehr abgebildet, sondern gebildet wird, ein<br />
Modell. 34 Wenn solche Fundmengen eine Nationalität beurkunden, ist der diskursive<br />
Anschluß an die Monumente Germaniae Historica als Konstrukt aus<br />
32 Felix Wolff, Denkmalarchive. Broschüre des gleichnamigen Vortrags, gehalten auf dem<br />
1. Denkmalarchivtag in Dresden am 24. September 1913, Berlin (Wilhelm Ernst &<br />
Sohn) 1913,5f, unter Be?ug auf v.- Wussow, Die Erhaltung der Denkmäler in dm Kulturstaaten<br />
der Gegenwart (1885)<br />
33 Gabriel Tardc, Les lois de l'imitation, Paris 1890, bes. Kapitel IV (Qu'est-ce que l'histoirc?),<br />
Absatz »L'Archeologie et la Statistiquc«, 99ff<br />
34 Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuseums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des<br />
Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabern) 1902, 1-72 (5f)
934 INVENTAR UND STATISTIK<br />
Relationen, nicht mehr den Daten selbst, geleistet (alle <strong>Geschichte</strong> als Funktion<br />
historischer <strong>Im</strong>agination findet allein im Raum zwischen den Lettern und Bildpunkten,<br />
in konstitutiven Leerstellen und Lücken statt). Ansonsten nämlich ist<br />
der Speicher Museum schlicht als tabellarische Auflistung <strong>von</strong> Artefakten, »zur<br />
Ergänzung des Erzählten« als Zahlenwerk also, adressierbar . Das Rheinland bewährt sich als Standortargument <strong>für</strong> das Römisch-<br />
Germanische Centralmuseum in Mainz, weil es »eine so zusammenhängende,<br />
ihren Charakter gegenseitig erklärende Reihe <strong>von</strong> Denkmälern unserer Vorzeit«<br />
aufweist; erst aufgrund eines Mindestmaß an statistischer monumentaler Information<br />
lassen sich »die unterschiedlichen Kennzeichen keltischer und germanischer<br />
Alterthümer sich prüfen und ermitteln«, also als mithin graphische<br />
Differenz- und nicht historiographische Identitätswerte (auch als Haltepunkte<br />
»<strong>für</strong> die Unterscheidung derselben <strong>von</strong> den slavischen an der Ostgrenze«). Hier<br />
ist auch die »Stelle, wo der erste Lichtstrahl historischer Aufzeichnung deutschen<br />
Boden berührt« (hier steht Rom <strong>für</strong> die Bedingungen <strong>von</strong> Historie selbst); zwei<br />
diverse Aggregatzustände <strong>von</strong> Gedächtnis als Aufschreibesystem (Inventar und<br />
Erzählung) prallen also aufeinander . Anknüpfungspunkt<br />
<strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> ist ihre (Be-)Schreibbarkeit; <strong>von</strong> daher entwickelt Lindenschmit<br />
(Vater) seine Methode, vom historisch Bekannten auszugehen und<br />
<strong>von</strong> dort aus zu älteren Zeiten zurückzugehen. Nationalist dabei ein prähistorischer<br />
Raum erst durch kartographische Rückprojektion und erneute Sortierung<br />
der Daten nach Differenzwerten: »Wenigstens lässt sich an den<br />
Denkmälern und Funden aus der Merowingerzeit das eigenthümhch Germanische<br />
in Form und Stil leicht <strong>von</strong> dem römischen sondern «.<br />
Die archäologisch-stochastische Streuung (die buchstäblich prähistorische<br />
Datenlandsehaft) widerstrebt dabei dem historischen Sinn; Lindenschmid (Vater)<br />
weigert sich, »das Unbekannte einem anderen Unbekannten an- oder einzuordnen«<br />
. Durch Ausgrabungen der Gräberfelder bei Selzen und<br />
Oberolm 35 gelingt ihm der Nachweis der fränkischen, damit national verortbaren<br />
Herkunft dieser Grabstätten; »die zünftige <strong>Lehrstuhl</strong>-Archäologie freilich,<br />
viele Jahre lang nur auf klassische Kunst dressiert, glaubte noch lange die deutsche<br />
Grabforschung übersehen zu müssen«, jene andere Form des Grabens in<br />
Erdböden und Archiven (MGH), so daß sich der an den Nationbegriff gekoppelte<br />
Historismus aus der Region, aus der Lokalhistorie (re-)generiert, im<br />
Gegensatz zur neoklassizistischen Ästhetik. Beider Schnittmenge ist das wissenschaftliche<br />
Bedürfnis, doch die Differenz liegt im ästhetischen (Humanismus)<br />
versus gedächtnisimperativen, romantischen <strong>Im</strong>puls {vaterländische Begeisterung<br />
35 Publiziert unter dem Titel: Das germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz<br />
Rheinhessen, 1848
NATION UND INVENTAR 935<br />
als Effekt der Befreiungskriege). 36 Erst mit der tatsächlichen Bewilligung einer<br />
Subvention des Mainzer Hauses durch den Reichstag am 16. November 1871,<br />
mithin also mit der Verreichlichung, und der virtuellen Option der Errichtung<br />
eines <strong>Lehrstuhl</strong>s <strong>für</strong> heimische Archäologie und die Erhebung des Römisch-Germanischen<br />
Central-Museums zur Studienanstalt dieser Disziplin, schließt sich<br />
dieser Widerstreit, auch wenn ein Arzt dem totkranken Museumsgründer verzeiht,<br />
daß mit seinem Tod auch das Inventar wieder in städtischen Besitz<br />
zurück-, das Museums also zerfallen wird. Erst, wenn an die Stelle des ideosynkratischen<br />
Sammlungsbegehrens <strong>von</strong> Individuen ein selbstlaufender Algorithmus<br />
namens <strong>Geschichte</strong> einer Gedächtnisagentur implementiert wird, überlebt<br />
sie ihre Begründer.<br />
Die mit einer Berliner Instruktion vom 24. Januar 1844 einsetzende offizielle<br />
Inventansation preußischer Denkmäler unter Ferdinand <strong>von</strong> Quast (mündend<br />
in der Publikation des ersten amtlichen preußischen Inventarbandes 1870)<br />
beginnt als Versuch, nach französischem Vorbild mit Hilfe entsprechender<br />
Fragebögen zu operieren. Quasts Fragebogen zur Inventansation der Kunstdenkmäler<br />
1844/45 (1. Fassung 37 ) erklärt einen Standard, nämlich ein Schema<br />
zum Ziel, »welches bei den verschiedenartigsten Ortschaften aller Provinzen<br />
der Monarchie gleichmäßig ausreichte«. Das Schema ruht auf quantitativ oder<br />
qualitativ binär gedachten Variablen, auf Eintragsvorgaben wie etwa Ist nicht<br />
vorhanden respektive Ist nicht zu bestimmen. Folgen wir diesem Fragenkatalog,<br />
der nicht zur umständlichen Erzählung, sondern zur Serienbildung auffordert:<br />
»Ist das Archiv in Ordnung gebracht und mit Registern versehen?«<br />
Und gibt es in einem Orte oder dessen Gemarkung »besondere, durch ihre <strong>Geschichte</strong><br />
oder Form ausgezeichnete Monumente«, etwa Bildsäulen, Rolande,<br />
Kreuze, Heihgenhäuschen, steinerne Lampen, Brunnen? »Stehen sie isolirt oder<br />
mit einem Gebäude verbunden?« . Form und <strong>Geschichte</strong> sind<br />
verschiedene Anschlußmöghchkciten <strong>von</strong> Relikten; die archäologische Situa-<br />
Ludwig Lindenschmit (Sohn), Erinnerungen als Randverzierungen zum Charakterbild<br />
Ludwig Lindcnschmits und zur <strong>Geschichte</strong> seines Lebenswerkes, in: Festschrift zur<br />
Feier des fünfundsiebzigjähngen Bestehens des Römisch-Germanischen Central-Museums<br />
zu Mainz 1927, Mainz (v. Zabcrn) 1927, 1-51 (9); s. a. W. E., Historismus im Verzug:<br />
Museale Antike(n)rezeption im britischen Neoklassizismus (und jenseits), Hagen<br />
(Margit Rottmann Medienverlag) 1992 (= Beiträge zur Geschichtskultur, Bd. 6). Lindenschmitt<br />
berichtet, daß sein auch künstlerisch tätiger Vater das entscheidende Omen<br />
zur Begründung des RGM in einer an Caspar David Friedrichs Gemälde erinnernden<br />
Vision bei Sonnenuntergang hatte; Lindenschmitts Ruinenromantik schlägt sich ihrerseits<br />
in wiederholten Bildern nieder (1 Off).<br />
Abgedruckt in: Lehcitas Buch, Ferdinand Quast und die Inventansation in Preußen,<br />
in: Ekkehard Mai / Stephen Waetzold (Hg.), Kunstverwaltung, Bau- und Denkmalpolitik<br />
im Kaiserreich, Berlin (Mann) 1981, 361-382 (371-382)
936 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
tion {isoliert) konkurriert mit der bau- oder kunsthistorisch kontextualisierbaren<br />
(verbunden). »Giebt es eine bestimmte <strong>Geschichte</strong> oder Sage, welche sich<br />
daran knüpft?« - Optionen der Kopplung an den historischen Diskurs.<br />
Die Fragen 21 (folgende) beziehen auch das römische und prähistorische<br />
Material ein, die (auch in der Konzeption des Germanischen Nationalmuseums<br />
Nürnberg) losen Enden der Textur deutscher Kulturhistone.<br />
Nicht narrativ im Sinne nationalgeschichtlicher Emphase, sondern gedächtnispragmatisch<br />
hatte Schinkel in der Denkschrift der Oberbaudeputation über<br />
die Erhaltung aller Denkmäler und Alterthümer unseres Landes vom 17. August<br />
1815 Verzeichnisse gefordert, als Grundlage <strong>für</strong> Erhaltungsmaßnahmen; die <strong>von</strong><br />
Schinkel festgesetzte Zeitgrenze <strong>von</strong> ca. 1650 deckt sich dabei mit der Objektorientierung<br />
des Germanischen Nationsmuseums. Die (buchstäblich nachträgliche)<br />
Differenz zwischen reiner Auflistung und Inventar heißt <strong>für</strong> Schinkel<br />
historisches Wissen; in einem Schreiben an Baurat Schauss in Köln 1827 wünscht<br />
er neben der architektonischen Prüfung die <strong>Geschichte</strong> der Gebäude - jedoch<br />
kann deren Ermittlung mit der Zeit erfolgen . Als<br />
nach dem Fehlschlag <strong>von</strong> Schinkels Plan einer eigenen Denkmalpflegebehörde<br />
die Anweisung des preußischen Innenministers an die Baubedienten jeder Provinz<br />
ergeht, bei ihren Bereisungen »alles dahin Gehörige aufzusuchen, zu verzeichnen<br />
und zu beschreiben«, erinnert dies zwar noch an die humanistische und<br />
aufgeklärte Tradition <strong>von</strong> Apodemik, der datensammelnden Reisebenchterstattung<br />
38 , aber nun als pragmatische Teilmenge staatsinterner Administration <strong>von</strong><br />
Infrastruktur. Analog zum Staatsinteresse an Meydenbauers photogrammetrischer<br />
Denkmaldokumentation als Meßbildanstalt (und nicht primär als - so<br />
Meydenbauers interne Bezeichnung - Denkmälerarchiv) ist der preußische<br />
Bezug zum architektonischen Monument funktional vielmehr denn symbolisch<br />
figuriert; der kulturhistorische Diskurs ist demgegenüber ein Oberflächeneffekt.<br />
So vertritt die Regierung Düsseldorf die Ansicht, daß die Erfolglosigkeit des<br />
Unternehmens der Quastschen Fragebögen zur Denkmälererfassung insgesamt<br />
in der bislang rein amtlichen Behandlung der Sache hegt. Denkmalinventansation<br />
als kulturhcrmeneutische Operation aber steht »ihrer inneren Beschaffenheit<br />
nach einem rein büreaukratischen Organismus fremd gegenüber«, verlangt<br />
»Freiheit in ihren Bewegungen« ; im Unterschied<br />
zur wissensarchäologischen Wahrnehmung ist sie also nicht archivisch strukturiert.<br />
Mangelnde Koordination verzögert also die Denkmalinventarisierung im<br />
Zitiert n.icli Buch 1981: 361; zur Apodemik (im Kontext <strong>von</strong> Statistik) siehe Justin<br />
Stagl, Die Methodisierung des Reisens im 16. Jahrhundert, in: Peter J. Brenner (Hg.),<br />
Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1989, 140-177
NATION UND INVKNTAR 937<br />
Preußen der Jahrhundertmitte. Wo Administration nicht zu standardisieren vermag,<br />
geschieht es im Diskurs; eine sich auf das Paradigma <strong>Geschichte</strong> einspielende<br />
Verhandlung der Daten gibt den Listen eine gemeinsame Bezugsgröße.<br />
Kuglers Pommersche Kunstgeschichte <strong>von</strong> 1840 ist zunächst als topographisches<br />
Inventarisierungsprojekt, als symbolisches Aufschreibesystem (mapping) unternommen<br />
worden, schlägt dann aber im Auftrag der Gesellschaft <strong>für</strong> pommersche<br />
<strong>Geschichte</strong> und Altertumskunde ms <strong>Im</strong>aginäre einer Historie um: Der Reichtum<br />
seiner Notizen schien ihm zu bedeutend, um ihn als bloßes Verzeichnis, nach<br />
Orten geordnet, auszuarbeiten; »es schien mir im Gegentheil doppelt vortheilhaft,<br />
die Kunstmonumente nach dem Gange der historischen Entwickelung<br />
aufeinander folgen zu lassen« . Der Rhythmik der<br />
Listen wird also ein Algorithmus unterstellt: die virtuelle Maschine <strong>Geschichte</strong><br />
(Entwickelung), gekoppelt an die Bezugsgröße der Nation, »hiedurch die Culturgeschichte<br />
des Vaterlandes ein vielleicht nicht unbedeutendes Material gewinnen<br />
dürfe«
938 INVI-NTAR UND STATISTIK<br />
Statistique monumentale du Calvados verwirklicht 39 ; die zentralstaatliche französische<br />
Verwaltungsstruktur begünstigt dabei den in jedem Wortsinn statistischen<br />
Zugriff. 40 Quasts 1844/45er Fragebogen zur landesweiten Denkmalerfassung verlangt<br />
neben Angaben zur Ortsgeschichte auch einen Ortsgrundriß samt Straßennamen,<br />
um die Denkmäler buchstäblich adressieren zu können. Erst damit wird<br />
aus der Listung <strong>von</strong> Monumenten (Daten) ihre Verhandelbarkeit als Dokumentation<br />
(Information). Das Inventar ist durch Paratexte angereichert, denn <strong>für</strong> die<br />
jeweilige Gemarkung wird nicht nur nach Wüstungen, Besonderheiten in der<br />
Landschaft, die Aufschluß über geschichtliche Ereignisse zu geben vermögen,<br />
Burgruinen, sonstigen Verteidigungsanlagen, vor- und frühgeschichthchen Denkmälern<br />
gefragt, sondern ebenso »Sagen, die sich an den ganzen Ort, an einzelne<br />
Gebäude oder Punkte in der Feldmark knüpfen, sind anzugeben« . Kurz: »merkwürdige Facta, die den Ort betreffen« sind,<br />
einmal in Relation mit einer systematischen Datenerfassung gesetzt, keine altertumswissenschaftliche<br />
Kuriositäten, sondern potentielle historische Information.<br />
Der wissensarchäologische Blick ist in der ersten Fassung <strong>von</strong> Quasts Fragebogen<br />
sehr konkret an die Wissensspeicher Archiv und Bibliothek gekoppelt; der<br />
Fragebogen verlangt ein vollständiges Verzeichnis aller die Denkmäler betreffenden<br />
gedruckten und ungedruckten Quellen einschließlich alter Flurkarten mit<br />
Hinweisen, wo dieselben zu finden sind. Archiv aber meint nicht allein die archivische,<br />
sondern die Gesamtheit <strong>von</strong> Information, als Text wie als Artefakt; so ist<br />
die Baugeschichte »darüber hinaus nicht nur anhand schriftlicher Überlieferung,<br />
sondern insbesondere mit Hilfe <strong>von</strong> Befunden, die der Bau selbst liefert, zu<br />
erschließen (Inschriften, Spolien, Veränderungen im Mauerwerk, vermauerte Fenster,<br />
Türen usw.)« . Die erwachende Sensibilität preußischer Archivare <strong>für</strong><br />
die Berücksichtigung der Provenienz <strong>von</strong> Dokumenten als Parameter ihrer Ordnung<br />
korrespondiert mit dem »intensiven Verständnis <strong>für</strong> das geschichtlich<br />
gewachsene Ensemble« (Buch) in Quast Fragebögen. Das Primat der Herkunft<br />
gilt <strong>für</strong> die Wahrnehmung <strong>von</strong> Aktenfonds wie <strong>für</strong> urbane Denkmalmengen;<br />
Schinkel blickt in seinem Gutachten zur St. Hedwigskirche in Berlin vom 1. Mai<br />
1819 nicht diskret auf das Monument, sondern par pro toto. Der Schlüssel zum<br />
morphologischen Verständnis <strong>von</strong> Städten in ihren Anlagen und äußeren Formen<br />
y) Hans Peter Hilger, Paul Clanen und die Dcnkmäler-lnventarisation in den Rheinlanden,<br />
in: Ekkchard Mai / Stephen Waetzold (I Ig.), Kunstvcrwaltung, Bau- und Dcnkmalpolitik<br />
im Kaiserreich, Berlin (Mann) 1981, 383-398<br />
40 Zur lnstitutionalisierun^ des Denkinalschutz^cdankcns in Österreich durch eine Ceniral-isonimissiori<br />
mit dem Ziel einer »archäologischen Statistik« um 1850 siehe Elisabeth<br />
Th. Hilschcr, Denkmalpflege und Musikwissenschaft. Einhundert Jahre<br />
Gesellschaft zur Herausgabe der Tonkunst in Österreich (1893-1993), Tutzing (Schnei-<br />
. der) 1995, 27-31 (29)
NATION UND INVENTAR 939<br />
ist »die historische Übersicht ihrer Entstehung und ihres Fortgangs, welche sich<br />
an den Monumenten und Bauwerken, die aus den verschiedenen Epochen übriggeblieben<br />
sind durch unmittelbare Anschauung ergibt« - aber eben erst,<br />
wenn durch Unterstellung eines historischen Zusammenhangs die synoptische<br />
Serie <strong>von</strong> Monumenten verzeitlicht wahrgenommen wird. »Selbst das Fehlerhafte<br />
wird in der historischen Reihe ein interessantes Glied sein und, an seinem<br />
Platze, manchen Wink und Aufschluß geben« ; der<br />
Diskurs der Historie versammelt nicht nur, er optimiert auch das Spektrum der<br />
Datenverarbeitung. In der historischen, also narrativ gefilterten Ästhetik werden<br />
monumentale Gegebenheiten zu Indizien, zur Spur der Historie, zum Dokument.<br />
Mit dieser Ästhetik ist eine politische Ordnung verbunden 41 : Denkmäler als<br />
Belegstücke im nach 1806-15 neu installierten Nationalgeschichtsdiskurs fungieren<br />
als anschauliche Belege einer vorgeblichen Ordnung, die das Mittelalter<br />
geprägt hatte, und damit eine pädagogisch konservative Funktion. 42 Historie als<br />
Technik der Herstellung nationalen Bewußtseins operiert im rhetorischen Modus<br />
des pars pro toto (isomorph mit der hier vorliegenden Operation, die Rekonstruktion<br />
der Gedächtnispolitik des 19. Jahrhunderts mit Dokumenten aus Archiv<br />
und Bibliothek zu begründen). Quast schreibt dieses semantische Gedächtniskapital<br />
zuch. jedem kleinsten Werke zu. An die Stelle politisch erfahrener Diskontinuität<br />
<strong>von</strong> Vergangenheit und Gegenwart tritt die symbolische Rettung ihrer<br />
Einheit im historischen Diskurs, der Monumente in ihre Bedeutungsschichten<br />
(Buch) zerlegt, mithin also mit historischer Semantik auflädt. Den Unterschied<br />
macht der historische Diskurs als Beobachterdifferenz:<br />
»Wir dürfen der <strong>Geschichte</strong> nicht so ins Angesicht schlagen, alle ihre Spuren zu<br />
vernichten und so die Fäden zu zerreißen, die uns mit der Vorzeit in organische<br />
Verbindung setzen. Welcher Unterschied wäre dann zwischen den wirklich alten<br />
Monumenten und deren mehr oder weniger gelungenen modernen Kopien? <br />
wir wollen die Jahrhunderte, welche uns <strong>von</strong> den alten Monumenten treffen, an<br />
deren zurückgelassenen Spuren erkennen, und durch sie zu jener ältesten Zeit hinaufgeleitet<br />
werden, um so unseres innigen Zusammenhanges mit ihnen uns bewußt<br />
zu werden.« <br />
Quast Fragebogen scheiterte an seinem Streben nach Vollständigkeit (wie auch<br />
das Kunstdatenerfassungssystem ICONCLASS heute in seinen Begriffsverzweigungen<br />
wuchert). Der Versuch, das Unternehmen staatlicherseits an Ortsverbände<br />
zu delegieren, erweist sich als undurchführbar. Kultusminister Mühler lehnt<br />
41 Siehe Hayden White, Die Bedeutung <strong>von</strong> Narrativität in der Darstellung der Wirklichkeit,<br />
in: ders., Die Bedeutung der Form. Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung,<br />
Frankfurt/M. 1990, 11-39<br />
42 Buch 1981: 367, unter Bezug auf Quasts Vorwort (gemeinsam mit Heinrich Otte) zur<br />
Zeit seh rift fü r ch r ist lieh c A rchäologie und Kunst
940 INVKNTAK UND STATISTIK<br />
1864 eine Versendung des Fragebogens in ganz Preußen aus der errechneten Dysfunktionalität<br />
<strong>von</strong> Kosten und Nutzen ab. Verbleiben regionale Initiativen wie<br />
etwa in der Provinz Hessen-Nassau, wo der Oberpräsident <strong>von</strong> Möller Ende<br />
1866 die Erstellung eines tabellarischen Inventanums verfügt, das in seiner Struktur<br />
mit dem Begriff der »Belebung eines correcten Nationalgefühls« korrespondiert.<br />
43 Denkmäler sind fortan im double-bind zwischen der Wahrnehmung als<br />
archäologisch diskretes Monument und als nationalhistorisches Dokument verfangen,<br />
wie es Georg Hager 1926 in einem Aufsatz über Die Erhaltung der<br />
Geschichts- und Kunstdenkmale und der nationale Gedanke hinsichtlich Gesamtdeutschlands,<br />
besonders aber der bayerischen Inventarisation definiert. Mit der<br />
Mobilisierung des nationalen Gedankens in den Freiheitskriegen und seiner Fermenticrung<br />
durch den deutsch-französischen Krieg 1870/71 »kann jedes Kunstdenkmal<br />
auch Denk- und Merkmal der Nation sein, die Inventarisation zum<br />
nationalen Anliegen werden. 44 Die Agenturen der Erfassung <strong>von</strong> Denkmaldaten<br />
der Vergangenheit werden selbst zu Monumenten, gilt doch <strong>für</strong> Kathedralen,<br />
Stadt-, Dorf- und Klosterkirchen, alte Rathäuser, Stadt- und Dorfanlagen, aber<br />
eben auch Museen und Sammlungen, Bibliotheken und Archive: »Alle diese<br />
Denkmale des Sinnens, Gestaltens und Handelns unserer Vorfahren, sie sind<br />
unser, wenn wir nur etwas <strong>von</strong> ihrem Geiste spüren« 45 ; die memorialenergetische<br />
Kodierung macht keine Differenz zwischen Beobachtung erster und zweiter<br />
Ordnung. Katalog, Topographie und Statistik sind das Instrumentarium der<br />
Inventarisation; ihre Autorität aber verdankt sie ihrem Charakter als Besitzstandsverzeichnis.<br />
Interpretant ist mithin der Staat. Die bayerische Denkmalpflege<br />
als Institution hebt mit einem Befehl <strong>von</strong> König Ludwig I. vom 12. Januar<br />
1826 zum Schutz der Stadtmauern und Stadtgräben an, die als die Formen der<br />
Städte angesprochen werden: »Der ästhetisch-formale Denkmalbegriff stand<br />
somit bereits über dem geschichtlichen« . Die Initiative zur<br />
tabellarischen Denkmalerfassung ergeht durch den Bayerischen Ingenieur- und<br />
Architekten-Verein 1881/82, wobei das Kultusministerium als Kanal, als Verteiler<br />
der Bögen an Behörden und Vereine fungiert. Das mapping einer Region fällt hier<br />
ineins mit der Reich(s)weite der kommunikativen Infrastruktur ihres Staats, denn<br />
die Erfassung wurde <strong>für</strong> ganz Bayern <strong>von</strong> Landbauämtern 1882-1885 durchgeführt,<br />
unter Beteiligung <strong>von</strong> Bahn- und Post-, Finanz- und Justizbeamten wie<br />
auch des Ingenieurkorps, »da die zuständigen Ministerien >mit Vergnügen erbötig<<br />
43 Vorwort des Bandes Hessen-Kassel (1867), zitiert nach Buch 1981: 369<br />
44 Wolfram I.übbcke, Georg Mager und die Inventarisation der Bau- und Kun.stenkmälcr<br />
in Bayern, in: Mai / Waet/.oldt 19X1: 399-416 (410f)<br />
4:1 Georg Hager, Die Erhaltung der Geschichts- und Kunstdenkmale und der nationale<br />
Gedanke, in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und<br />
Altertumsvereinc, Bd. 73/74, Nr. 4-6 (1925/26), Sp. 91-102 (Sp. 95)
NATION UND INVENTAR 941<br />
waren, die entsprechenden Weisungen zu geben« . Die<br />
Gemeinden aber antworten fast ausschließlich mit der Nennung <strong>von</strong> Mahnmalen<br />
des Kriegs <strong>von</strong> 1870/71; was in den Listen zählt, ist das Kurzzeitgedächtnis<br />
einer gegebenen Gegenwart. Das 1885 vom Kultusministerium gesammelte Material<br />
wird vom Architekten- und Ingenieur-Verein gebündelt und durch die Architekten<br />
Gustav <strong>von</strong> Bezold (Ko-Autor des ersten, Oberbayern beschreibenden<br />
Inventarbandes, 1894-1920 Erster Direktor des Germanischen Nationalmuseums<br />
in Nürnberg) und Georg Friedrich Seidel bearbeitet. Kopplung und Entkopplung<br />
<strong>von</strong> Museum und Denkmalinventar: Aufgrund einer Denkschrift Hagers<br />
<strong>von</strong> 1907 zur Neuorganisation des kgl. Generalkonservatoriums wird dasselbe<br />
vom Bayerischen Nationalmuseum getrennt. Das Gedächtnis der Denkmäler ist<br />
dabei eine Funktion ihrer Bildsortierung. Neben die Inventarisierung als integrierte<br />
Beschreibung in Wort und Bild kann auch eine Beschreibung ohne Bild<br />
oder eine Erfassung nur im Bild treten; »die Abbildung eines nicht beschriebenen<br />
Objektes kann in diesen frühen Inventaren als Inventarisierung gelten, da die<br />
Abbildungen zugleich Erfassungen <strong>von</strong> Denkmalkategorien sind, die im Text so<br />
gar nicht explizit werden« .<br />
Gedächtnispolitik im 19. Jahrhundert läßt sich nicht als Kronzeugin <strong>für</strong> eine<br />
informationsonentierte Verarbeitung <strong>von</strong> Daten der Vergangenheit anführen,<br />
insofern sie in der Selbstwahrnehmung der Agenten immer schon an den symbolischen<br />
Mehrwert des historischen Diskurses und der Nation gekoppelt ist, also<br />
im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong> vollzogen wird. Vielmehr gilt es, jenseits der histonographisch<br />
formulierten Oberfläche jener Selbstwahrnehmung, jene Praxis freizulegen,<br />
die Datenverwaltung unter der Hand als die Wirklichkeit jener Vergangenheit<br />
erweist. Ein Text des Generalkonservators der Kunstdenkmale und Altertümer<br />
Bayerns sagt es 1926 (obgleich der Autor Hager es seinerseits als Teilmenge<br />
einer Argumentation <strong>für</strong> nationale Geschichtsästhetik formuliert), wie sehr die<br />
Infrastrukturierung des Terrains nationalen Gedächtnisses der symbolischen Rede<br />
der Nation vorgängig ist. Der Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine<br />
war bereits lange vor der Errichtung des neuen Deutschen Reiches<br />
»ein Symbol des Gemeinsamkeitsbewußtseins des deutschen Volkes« gewesen:<br />
»Das aber ist die große Ruhmestat unserer Geschichts- und Altertumsvereine, daß<br />
in ihnen all die vielen Jahrzehnte hindurch weniger <strong>von</strong> dem nationalen Gedanken<br />
g e r e d e t als aus seinem Empfinden heraus unablässig und unentwegt g e h a n<br />
d e 1 t wurde. Wer zählt die Tausende <strong>von</strong> Bänden, die die geschichtlichen Publikationen<br />
der Vereine und Gesellschaften beziffern? Wer zählt die Bemühungen um<br />
die Erhaltung der Denkmale?«<br />
In der Tat, keiner histonographschen Erzählung kommt diese bezifferbare Praxis<br />
in den Blick. Mit dem Symbolischen des Sinnens, Gestaltens und Handelns<br />
korrespondiert in der Praxis <strong>von</strong> Gedächtnismedien Datenerfassung, -verar-
942 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
beitung und -Übertragung. Auf der Ebene dieser Praxis ist der nationale Diskurs<br />
nicht als kuturmetaphysische Begründung, sondern allein im Sinne der<br />
Justiziabilität wirksam: »Die Denkmale sind, gleichgültig in wessen Besitz sie<br />
rechtlich sich befinden, in höherem Sinne geistiger Besitz des ganzen Volkes, sie<br />
müssen als Nationalgut gelten« . Aus dieser Perspektive<br />
wird <strong>für</strong> Kunst- und Geschichtsdenkmale ein Rechtsanspruch auf Pflege und<br />
Erhaltung abgleitet, der sich diskurspraktisch in Verordnungen und Ausfuhrverboten<br />
einer ganzen Reihe <strong>von</strong> Kultur.staatcn niederschlägt.<br />
Jüdische Dcnkmalinvcntarisation (Bayern 1935)<br />
Heinrich Feuchtwanger, praxiserfahren in der Inventarisierung und Erfassung<br />
jüdischer Altertümer in Bayern und selbst Sammler jüdischer Kult- und Kunstgegenständc,<br />
legt auf Wunsch des Organs Mitteilungen des Jüdischen Lehrervereins<br />
<strong>für</strong> Bayern seine Auffassung über jüdische Denkmalpflege dar; Schriftleiter<br />
Max Adler unterstreicht die außerordentliche Wichtigkeit, die dieser Frage<br />
gerade in jetziger Zeit zukomme. Zur Verhandlung steht die Inventarisierung<br />
einer Absenz:<br />
»Geht man heute mit kunstforschenden jüdischen Augen durch unsere alten<br />
Gemeinden, so bietet sich fast übeall das gleiche Bild: Stillgelegte Synagogen, zerfallende<br />
Friedhöfe, aussterbende Gemeinen, isolierte und jüdisch verkümmernde<br />
Familien ohne Jugendnachwuchs; die spärlichen Reste der alt-ehrwürdgen Herlichkeit<br />
werden noch als wehmütige Reminiszenzen gezeigt: Formen ohne Inhalt!<br />
Solange noch ein Lehrer in der Gemeinde ist, hält er noch aufrecht, was zu retten<br />
ist, lehrt die Jugend, organisiert den Gottesdientes usw. Wenn aber auch er die<br />
Stelle aufgibt, dann folgt ein langsames Dahinsiechen bis zum gänzlichen Aussterben.<br />
So haben wir hier in Bayern während der letzten drei Jahrzehnte manch<br />
ehrwürdige Gemeinde begraben müssen, eine Entwicklung, deren Tempo sich in<br />
den beiden letzten Jahren noch erheblich beschleunigt hat.« 46<br />
Aus diesem Grund ruft er (nichtsahnend gegenüber dem drohenden Holocaust)<br />
zur Rettung all dessen auf, was an ideellen Werten sonst anonym und endgültig<br />
verschwinden würde; die Tatsache, daß allerortens der Ruf nach heimischer<br />
Denkmalpflege erhoben und Familienstammkunde getrieben, daß Heimatmuseen<br />
und Archive gegründet wurden, entsprang »einerseits dem erwachten historischen<br />
Sinn und dem Adelsstolz, andererseits aber auch dem Gefühl, daß Vieles<br />
am Rande des endgültigen Verfalls steht, wenn es nicht dauernd konserviert<br />
bleibt« . Aus diesem Grund unternimmt der Verband bayerischer israe-<br />
'"'Heinrich Feuchtwanger, Jüdische Denkmalspflege, in: Mitteilungen des Jüdischen<br />
Lehrerverseins <strong>für</strong> Bayern Nr. 3 / 1935, München, 15. März, enthalten in: Bayerische<br />
Israelische Gemeindezeitung, XL Jg., Nr. (•>, München, 15. März 1935, 7-9
NATION UND INVKNTAR 943<br />
litischer Gemeinden Forschungsarbeiten als »brauchbare Grundlagen <strong>für</strong> ethnologische<br />
Studien« und subventioniert Restaurierungsarbeit sowie Invcntarisation.<br />
Unter gedächtnisstrategisch zugespitzten Bedingungen betreibt<br />
dies im Zweiten Weltkrieg auch der Jüdische Ältestenrat in Prag, der dort unter<br />
deutscher Besatzung die Einrichtung eines Jüdischen Zentralmuseums zur<br />
kulturwissenschaftlichen Tarnung einer als Zwischenlagerung verstandenen<br />
Sammlung herrenloser jüdischer Kultusgegenstände vorbereitet. 47 Jüdische<br />
Denkmalpflege trennt die Dinge, die unter den Begriff Denkmal fallen: »Kultur<br />
und Kunst, oder mit anderen Worten - Pietätswerte und Kunstwerke« - eine<br />
Unterscheidung, die Walter Benjamins notorischer Aufsatz zu Aura und Kultwert<br />
<strong>von</strong> Kunstwerken etwa zeitgleich medienwissenschaftlich umakzentuiert<br />
(die Entwürfe <strong>von</strong> Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit<br />
gehen auf den Herbst 1935 zurück). 48<br />
»In den meisten kleinen Gemeinden vermodert leider die >Pietät< am Synagogenboden;<br />
es sind dies die alten Protokollbücher, Akten über Gemeinde-, Rabbinats- und<br />
Schulangelegenheiten, über Friedhöfe, Mazzohbäckerei, Eruw, Armen- und Fürsorgenwesen<br />
. All diese Akten müssen - gesichtet und geordnet - m einem verschließbaren<br />
Schrank untergebracht werden, und wenn man diese etwas undankbare<br />
Arbeit macht, so wird man meistens doch noch durch kleine Freuden entschädigt:<br />
Mitten unter diesem Berg <strong>von</strong> Papier finden sich einige Kostbarkeiten, die wen sind,<br />
gesondert unter Verschluß aufbewahrt zu werden, weil sie konzentrierten Wert <strong>für</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> und Familienforschung besitzen: Memorbücher , Friedhofsbücher<br />
(mit Angaben über z. T. längst versunkene Grabsteine), . All diese unscheinbaren<br />
kleinen handschriftlichen Büchlein besitzen Dauerwert und sollen mit gleicher<br />
Pietät, wie sie geschrieben sind, auch gehütet werden. aus altem privaten Speicherkram,<br />
aus den unbenutzten alten Betpulten sind oft ein komplettes Schass,<br />
Mischnajoth oder Maghsor zusammenzustellen. Und wenn dann solche Werke wieder<br />
da verwendet werden, wo daraus gelernt wird , so ist doch wieder das entstanden,<br />
was wir Alle wollen: neues Leben aus alten Ruinen.« <br />
Jüdische Friedhöfe wiederum »bieten dem oberflächlichen Beschauer ein trostloses<br />
Bild«, sind aber gerade in ihrer Unsystematik ruinenmelanchohsch umkodierbar.<br />
Die Unordnung der Epitaphe und das Durcheinander der Skelette<br />
bilden die Antithese zur historischen Ordnung:<br />
»Halb- und ganz verwitterte Steine, manche umgelegt, schief teilweise abgesunken,<br />
<strong>von</strong> Unkraut überwuchert usw. Weite Flächen - und gerade die ältesten Teile -<br />
47 Dazu W. E., Symbolischer Tausch und der Tod (die Unmöglichkeit des Museum): das<br />
nationalsozialistische Projekt eines jüdischen Zentralmuseums in Prag, in: Geschichtswerkstati<br />
24 (Juli 1991), 45-56<br />
4X Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf Tiedemann / I Iermann Schweppenhäuser,<br />
7 Bde (1.1 - 7.2) Frankfurt/M. (Suhrkamp) -1978-89, Bd. 1.2 (Abhandlungen),<br />
431-508, u. Bd. 1.3 (Anm. d. Hg.), 982-1063
944 1NVI-:NTAK UND S'i ATISTIK<br />
erscheinen unbelegt, da die Grabsteine versunken sind und die Ntur die Planicrungsarbeiten<br />
übernommen hat. Diese Friedhöfe lasse man so, wie sie sind:<br />
denn sie sind eigenartig schön in ihrer Unsystematik, in ihrer beschaulichen Ruhe,<br />
in ihrer stummen Sprache und in ihrer bescheidenen Größe. Verwittert ist das Zeichen<br />
des Erdvergehens und entspricht der bescheidenen Art unserer dort liegenden<br />
Väter . Man muß primär feststellen, wo und ob in der Umgegend Judenfriedhöfe<br />
(aufgelassene oder noch bclcgungsfähige) existieren, und welche Friedhöfe <strong>von</strong><br />
welchen Gemeinden (aufgelöste oder noch existierenden) belegt wurden, da nicht<br />
alle Gemeinden ihren eigenen 'guten Ort< hatten . Sodann ist - möglichst an<br />
Hand <strong>von</strong> alten Chewrah- oder Friedhofsbüchern - festzustellen, wie alt der Friedhof<br />
ist (welches der früheste, noch entzifferbar Grabstein ist.« <br />
Am Ende bedarf auch die Ästhetik der Dislokation wieder der Rückkopplkung<br />
an Schriftregister, um überhaupt entziffert werden zu können. Das Geheimnis<br />
der Adressierbarkeit <strong>von</strong> Gedächtnis ist die Ordnung des Archivs.<br />
Denkmalverwaltung und -schütz nach 1871<br />
Denkmalmventansation folgt Rhythmen, die nicht <strong>von</strong> den verzeichneten Dingen,<br />
sondern den Rahmenbedingungen ihrer Verzeichnung vorgegeben werden.<br />
Aus der Sicht der Folgegeneration ist das Jahr 1870 die Zeitbestimmung, bis zu<br />
welcher Denkmalzeichnungen gesammelt werden sollen; politische Zäsuren<br />
rekonfiguneren die Ordnung des Gedächtnisses im Widerstreit mit divergierenden<br />
Vektoren, etwa »eine bestimmte Epoche, ein geschichtlicher Abschnitt, lokale<br />
Verhältnisse« . Mit der territorialen Neuordnung und Reichsgründung<br />
<strong>von</strong> 1866 bis 1871 erhält das kalkulierbare <br />
Inventar Bedeutung als Dokumentation des kulturellen Besitzstands des Staats;<br />
dieser Zweck ist die wissensarchäologische Wahrheit hinter dem Diskurs <strong>von</strong><br />
Geschichtsbewußtsein, unter dem Denkmälerinentarisation öffentlich verhandelt<br />
wird. Seit 1871 etwa geht es in Elsaß-Lothringen um die Verzeichnung, d. h. auch:<br />
Berechenbarkeit kulturellen Kapitals; dieses Gedächtniskapital liegt nicht so sehr<br />
in den Monumenten, sondern der Infrastruktur ihrer Verwaltung. In Elsaß-<br />
Lothringen nämlich waren Begriff und Praxis des monument histonque classe aus<br />
der jüngstvergangenenen französischen Epoche vertraut; an dieses logistische Dispositiv<br />
eines Speichers (dem die konkreten Daten in die Pariser Archive der Commission<br />
des monuments histonques entzogen sind) koppelt die Denkmalpflege<br />
des nunmehr deutschen Reichslands an. Historisches Kulturbewußtsein als Inszenierung<br />
nationaler Differenz wird hier durch die institutionelle Kontinuität<br />
<strong>von</strong> Gedächtnistechniken unterlaufen . Als erste derartige Staatsemnehtung<br />
wird durch ministerielle Verfügung vom 19. Februar 1901 das Kaiserliche<br />
Denkmalarchiv zu Straßburg gegründet (impenum triggert memoria).<br />
Das flächendeckende Projekt einer Denkmalmventansierung bedarf einerseits der
NATION UND INVKNTAR 945<br />
Einbindung lokaler Geschichtsvercinc, andererseits der Synchronisierung der <strong>von</strong><br />
ihnen prohfenerten Daten. Die Berliner Kultusverwaltung bemüht sich daher um<br />
einheitliche Prinzipien der Denkmalerfassung im preußischen Königreich, seit<br />
1875 auch reichsweit. Statistische Aufschreibesysteme (also eine Operation im<br />
Symbolischen der Schriftordnung) kippen ins <strong>Im</strong>aginäre, wo Inventarbände <strong>von</strong><br />
vornherein repräsentativ und mit ihrem Bildmaterial auch auf den Landesruhm<br />
zielendes nationales Prachtwerk angelegt werden, wie es ein Kritiker in der Münchner<br />
Allgemeine Zeitung im Dezember 1896 als funktionale Verfehlung, als diskursive<br />
Ablenkung einer non-diskursiven Gedächtnisoperation moniert. Erst die<br />
Bebilderung des Schriftakts der Speicherung sichert dabei die Anschlußfähigkeit<br />
dieses Werks an die Option der (historischen) <strong>Im</strong>agiNatwn. Demgegenüber<br />
verhält sich der im Oktober 1896 erscheinende der erste Band der Bau- und<br />
Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg wissensarchäologisch diskret,<br />
indem die deskriptive Darstellung der Denkmäler sich fast völlig ästhetischer und<br />
weitgehend kunstgeschichtlicher Wertungen enthält und den Wandel eines Bauwerks<br />
vielmehr kommentarlos referiert. Das Äquivalent zum Kommentar ist<br />
vielmehr diagrammatische Information: beigefügte Photos, Ansichten, Längsund<br />
Querschnitte sowie Grundrissen. Als 1900 eine Umbesetzung der Inventarisationskommission<br />
erforderlich wird, »änderte das Projekt seinen Charakter«;<br />
die Bauanalysen im zweiten Band werden durch apodiktische Wertungen überlagert.<br />
»Kunstgeschichthche und ästhetische Kriterien fielen dabei in eins«<br />
.<br />
Da die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 den Zentralinstanzen<br />
gegenüber den Einzelstaaten wenig kulturpolitische Kompetenzen einräumt,<br />
beschränkt sich Berlins kunstpolitisches Engagement auf Zuschüsse <strong>für</strong><br />
Museumsunternehmen wie das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das<br />
Römisch-Germanische Museum in Mainz sowie zur Finanzierung prägnanter<br />
Nationaldenkmäler; 1892 wird auf Beschluß des Reichstags die <strong>von</strong> Theodor<br />
Mommsen lange geforderte Reichs-Limes-Kommission zur Untersuchung jener<br />
Grenzlinie gegründet, die Rom <strong>von</strong> Germanien, mithin Antike <strong>von</strong> Mittelalter<br />
trennt. Funktionale Interessen tnggern die Registrierung symbolischen Kapitals.<br />
Weder <strong>für</strong> Gesetzgebung noch <strong>für</strong> Finanzierung reichte die Berliner Planung einer<br />
reichsweiten Ihventarisation der Baudenkmäler - mit Ausnahme <strong>von</strong> Elsaß-<br />
Lothringen, das seit 1871 formal zunächst der Reichsregierung unterstand; weitreichend<br />
ist, was durch das <strong>Im</strong>perium gedeckt wird. Spielraum bietet hier<br />
supplementär das kaiserliche Dispositionsfonds, besonders unter Wilhelm II., der<br />
die Transformation diskreter archäologischer Trümmer in nationale Symbole als<br />
Akt der Scmiosc, mithin also als Technik beschreibt, um »die Reste einer großen<br />
Vergangenheit des gesamten deutschen Volkes aus den verschiedenen Zeitabschnitten,<br />
und in den verschiedenen Gauen des Reiches gelegen, vor weiterer Zer-
946 INVI-.NTAR UND STATISTIK<br />
Störung zu bewahren oder aus ihren Trümmern im neuen Glänze als Nationaldenkmäler<br />
wiedererstehen zu lassen« . Die<br />
Kopplung <strong>von</strong> Überrest, Vergangenheit und Gedächtnis (als Lager) wird im<br />
Medium der Nationalgeschichte diskursiv mobilisiert, deren Rhetorik metonymisch,<br />
in diesem Falle Trümmer reintegrierend, operiert. Das gilt <strong>für</strong> die Ebene der<br />
Denkmäler wie die ihrer Verzeichnung. Der Dresdner Tag <strong>für</strong> Denkmalpflege<br />
1900 beschließt auf Anregung <strong>von</strong> Georg Dehio, aus der »Vielzahl und Unheithchkeit«<br />
der Ländermventare einen einhieltich durchkonzipierten Auszug (das<br />
Handbuch der deutscher Kunstdenkmäler, 1905-1912) zu erstellen, subventioniert<br />
durch eine Reichsdotation, um - so die Antragsteller - ein »literarisches Ruhmesdenkmal<br />
deutscher Kunst und Wissenschaft« zu setzen , ein Denkmal zweiten Grades (Roland Barthcs' Semiologistik<br />
<strong>von</strong> Mythenbildung entsprechend). Denkmallandschaft und mapping: Gedächtnisräume<br />
werden politisch definiert. Dehios Handbuch beschränkte sich auf das<br />
Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen <strong>von</strong> 1871; Neuauflagen in der Weimarer<br />
Zeit verzeichnen Elsaß-Lothringen weiterhin. Innerhalb dieses Gitters gilt<br />
dann die bibliothekarische Logik; jeder Band ist rein topographisch-alphabetisch<br />
gegliedert. »Die Grenzen der deutschen Länder blieben dabei völlig unberücksichtigt«.<br />
Verreichlichung heißt - der Schreibmaschineric <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien folgend -<br />
Standardisierung, und Reichseinheit meint Formatierung. Während die Länderinventare<br />
den Eindruck <strong>von</strong> Uneinheithchkeit vermitteln, bringt Dehio reichsweit<br />
einheitliche Kriterien zur Anwendung . Getriggert<br />
wird die Reichsweite dieses Denkmälerarchivs durch Weltkrieg I; die Zerstörung<br />
der Bibliothek <strong>von</strong> Löwen durch deutsche Truppen im August 1914 mobilisiert,<br />
mit dem Trauma der Destruktion, auch das Bedürfnis <strong>von</strong> Dokumentation zur<br />
Rekonstruktion im Virtuellen wie im Realen. Der Widerstreit <strong>von</strong> Denkmalpflege<br />
und Krieg kommt in den Klärungsversuchen der Vorgänge um den Brand (nach<br />
der Beschießung) der Kathedrale <strong>von</strong> Reims September 1914 zum Ausbruch; im<br />
November 1914 erhält Paul Clemen den Auftrag, in Nordfrankreich die Kriegsschäden<br />
an Baudenkmälern zu verzeichnen, unterstützt durch die Oberste<br />
Heeresleitung. Das Inventar ist Medium im Vollzug diskurs- wie militärstrategischer<br />
Dekonstruktion. Hatten die Befreiungskriege <strong>von</strong> 1806-1815 noch neogotische<br />
Ruinenromantik getriggert, gekoppelt an die Emergenz historistischen<br />
Geschichtsbewußtseins, ist es ein Jahrhundert später der Weltkrieg, der nun auch<br />
das historische Fühlen an sich verändert, und die Grundsätze <strong>für</strong> die Denkmalpflege<br />
umwertet: »Der alte Ruinenbegnff und die Scheu, die Ruine zu berühren,<br />
wird und muß fallen. Es gibt der Ruinen zuviel. Ypern, Dixmuiden und<br />
Arras gegenüber versagen alle bisherigen Grundsätze der Denkmalpflege.« 49 So<br />
49 Paul Clemen, Die Baudenkmäler auf dem französischen Kriegsschauplatz, in: ders.<br />
(Hg.) 1919:36-74(73)
NATION UND INVENTAR 947<br />
wird Gcdächtnisarbcit neu konfiguriert, diesmal jenseits des hisiorisch-rcstaurativcn<br />
Diskurses. Eine einheitliche Reichsverwaltung <strong>von</strong> Denkmaidokumentation<br />
setzt der Krieg als Ausnahmezustand in den besetzten Gebieten durch; kriegsbedingte<br />
Einsicht in die Notwendigkeit <strong>von</strong> Kunstschutz in Echtzeit zur Kampfhandlung<br />
antizipiert einen solchen auch <strong>für</strong> den kommenden Krieg. Clemen<br />
fordert entsprechende Vorbereitungen schon in Fnedenszeiten (Verpackung,<br />
Information über Kriegstechniken <strong>von</strong> Artillerie und Luftkampf): »Auch die<br />
Kunstpflege braucht eine Art Mobilmachung« . Clemen als Vorstand des Tags <strong>für</strong> Denkmalpflege und Heimatschutz ist die<br />
treibende Kraft eines Reichsdenkmalschutzgesetzes. Grundlage ist ein Fragebogen<br />
an Länder und Provinzen zur Erstellung einer Kunstliste. Die Entscheidung<br />
über den Begriff des national wertvollen Kunstwerks soll beim Reich liegen und<br />
am Ende eine Redaktionskommission »mit diktatorischer Gewalt die sicher aus<br />
sehr verschiedenen Masstäben gebrachte Vorschlagsliste nach Rückfragen soweit<br />
notwendig und möglichst endgültig« feststellen »und auf das gleiche Niveau«<br />
bringen . Die Zusammenschaltung <strong>von</strong> Register und Diktat<br />
läuft auf Standardisierung hinaus, die Bedingung aller Mechanisierung <strong>von</strong><br />
Inventaren. Gerade im Grenzgebiet des Reichs soll eine Vernachlässigung hervorragender<br />
Baudenkmäler vermieden werden; die Identität des deutschen Denkmälerarchivs<br />
leitet sich aus der Beobachterdifferenz ab. Damit ist auch die<br />
Definition des Denkmals an sich tangiert, das die Zuschreibung mehrwertiger<br />
Eigenschaften einer Semiose, nicht seiner Materialität verdankt. Die Verfassung<br />
des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, welche die Kulturhoheit nach wie<br />
vor den Ländern überläßt, definiert in Artikel 150 Abs. I dennoch die Denkmalpflege<br />
als staatliche Aufgabe. Absatz 2 ergänzt die Funktion des Reiches, »die<br />
Abwanderung deutschen Kunstbesitzes in das Ausland zu verhüten« , ohne indes die da<strong>für</strong> notwendigen Behörden und Institutionen zu benennen.<br />
So hat der erste reichsweite Kunstwart Edwin Redslob minimale Entscheidungsbefugnisse<br />
und operiert daher im Symbolischen, mithin durch Erstellung<br />
einer Liste national wertvollen Kulturguts. Da das Reich durch die Weimarer Verfassung<br />
die Hoheit über Post, Eisenbahn und Wasserstraßen übernimmt, ist sein<br />
Einfluß als Bauherr, nicht aber als Schützer <strong>von</strong> Monumenten erheblich; Kulturgeschichte<br />
bildet nur bedingt eine Schnittstelle zur Infrastruktur. Denkmalschutz<br />
definiert sich aus der Negation, vom Rand einer Absenz her.<br />
Ausfuhr <strong>von</strong> Kulturgut (1939) und Kunstschutz in Weltkriegen<br />
Aufgrund einer Verordnung vom 11. Dezember 1919 (RGB1.I. S. 1961) bedarf<br />
die Ausfuhr <strong>von</strong> Werken der bildenden Kunst oder Werke <strong>von</strong> wissenschaftlicher,<br />
geschichtlicher oder sonstiger künstlerischer Bedeutung aus Deutschland der Ge-
948 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
nehmigung, sobald es in das Verzeichnis der Kunstwerke eingetragen war. Darauf<br />
bezieht sich ein Brief aus dem Reichsministerium des Innern an den Reichsminister<br />
<strong>für</strong> Volksaufklärung und Propaganda in Berlin vom 7. Januar 1939, der<br />
es <strong>für</strong> verfehlt und <strong>für</strong> unmöglich erklärt, den kulturellen Tauschverkehr eines<br />
Kultt4rvolkes mit dem Auslande in Gestalt einer solchen Anmeldepflicht unter<br />
Zwang zu stellen; vielmehr seien »Wille und Kraft der deutschen Kulturgestaltung<br />
mächtig genug«, um weiteres Kulturgut »in einem <strong>für</strong> Deutschland durchaus<br />
günstigen Wertverhältnis in das Reich hereinzuziehen«. Damit einher geht<br />
die Kritik der Tendenz, Werke der deutschen Kunst und Wissenschaft gegen die<br />
Außenwelt grundsätzlich abzuschirmen, und das Plädoyer <strong>für</strong> eine kräftige<br />
Durchdringung des Auslandes mit solchen Werken als »eines der wirkungsvollsten<br />
Mittel der Werbung <strong>für</strong> deutsche Art«. 50 Die Kehrseite dieses Diskurses ist<br />
die Praxis <strong>von</strong> Kunstschutz unter Kriegsbedingungen. Neue Methoden der<br />
Kriegsführung zeitigen Effekte auf den Denkmalschutz; an die Stelle des Vormarsches<br />
in breiter, geschlossener Front mit darauffolgendem Stellungskrieg treten<br />
im Zweiten Weltkrieg »Bewegungen der schnellen Truppen auf den Straßen,<br />
konzentrierte Angriffe der Luftwaffe und sehr heftige Einzelkämpfe an strategisch<br />
wichtigen Punkten« (Brückenköpfe, Straßenkreuzungen u.dgl.). 51 Daher<br />
ist muß Kunstschutz an Militärverwaltung gekoppelt werden, um seine Ziele<br />
nicht zu verfehlen - an die Rückkopplung <strong>von</strong> militärischer Logistik in Echtzeit.<br />
Da selbstverständlich das unerbittliche Gesetz des Kriegs mit seinen militärischen<br />
Notwendigkeiten dabei im Vordergrund steht, heißt der gedächtniskybernetische<br />
Effekte: »Die allgemeine Steuerung des Kunstschutzes hat sich das Oberkommando<br />
des Heeres vorbehalten«, und das heißt Priorität <strong>von</strong> Strategie vor Administration,<br />
<strong>von</strong> Übertragung vor Speicherung: »Die >Verwaltungsaufgaben< des<br />
Kunstschutzes haben gegenüber den >mihtänschen< naturgemäß in stärkerem<br />
Maße friedensmäßigen Charakter« .<br />
Luftbildarchäologie der vor- und frühgeschichtlichen Befestigungsanlagen in<br />
den besetzten Westgebieten, mit Unterstützung des Reichsministers der Luftfahrt<br />
und Oberbefehlshabers der Luftwaffe betneben, weist auf die Ruptur (wissens)archäologischer<br />
Wahrnehmungsschwellen durch die Zeit der Aviatik. Die<br />
Tätigkeit des kunstwissenschaftlichen Arbeitsstabes in Frankreich steht 1940/41<br />
unter der Leitung des Kunsthistorikers Metternich, unterstützt durch Kriegsverwaltungsrat<br />
<strong>von</strong> Tieschowitz, den früheren Leiter der photographischen<br />
Abteilung des Kunsthistorischen Instituts in Marburg. Grundlage dieser Arbeit<br />
50<br />
Rundesarchiv Berlin-Lichtenberg, Bestand R 43 II / 1236, Bl. 113 ff, betr.: Ausfuhr<br />
<strong>von</strong> Kulturgut, 1938 (151. 1 181)<br />
51<br />
Franz Graf Wolff Metternich, Der Kriegskunstschutz in den besetzten Gebieten<br />
Frankreichs und in Belgien. Organisation und Aufgaben, in: Deutsche Kunst und<br />
Denkmalpflege Jg. 1942/43, Heft 3/4, 26-40 (27)
NATION UND INVENTAR 949<br />
ist die photographische Tätgkeit, rückgekoppelt an die Auswertung vorhandenen<br />
französischen Bildmaterials der Commission des Monuments histonques und<br />
das Marburger photographische Archiv. Neben Baudenkmalen gilt Museumsgut<br />
als photographisch erfassenswert wie auch - in Verbindung mit den Organisationen<br />
<strong>für</strong> Bibliotheks- und Archivschutz bei der Miltärverwaltung -<br />
Bibliotheksbestände, namentlich Handschriften. Die beschleunigte Zeit <strong>von</strong><br />
Denkmalschutz uncr Kriegsbedingungen schaltet die sonst divergierenden<br />
Speichermedien zusammen. Die technische Qualität der Aufnahmen erneuert,<br />
ja bildet das Archiv:<br />
»So stellen sie ein Archiv dar, das in seiner Aktualität und auf Grund besonderer, seit<br />
Jahren ausgebildeter Spezialmethoden die entsprechenden bisherigen, vielfach veralteten<br />
Bildbestände übertrifft und in der Zukunft eine bedeutsame Quelle <strong>für</strong> die<br />
Forschung bilden wird. Der deutschen Forschung ist unter Ausnutzung einer<br />
einmalig gegebenen günstigen Gelegenheit <strong>für</strong> die Zukunft ein Material erschlossen<br />
worden, das in dieser Fülle und Qualität in der Vorkriegszeit nicht zu erlangen war<br />
und voraussichtlich auch später, nach Eintritt normaler Verhältnisse, aus technischen<br />
und anderen Gründen nicht gewonnen werden könnte.« <br />
Krieg mobilisiert auch die Ressourcen des Gedächtnisses in einer ansonsten<br />
undenkbaren Weise. Die Kehrseite dieses martialischen kairos heißt Speicherlöschung.<br />
52<br />
32 Siehe W. E., Unges(ch)ehene Museen: Bomben, Verschwinden, in: Martin Stingelin /<br />
Wolfgang Scherer (Hg.), HardWar / Soft War. Krieg und Medien 1914 bis 1945, München<br />
(Fink) 1991,197-218
950 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Zwischen Meßbildanstalt und imaginärem Museum:<br />
Meydenbauers photogrammetrisches Denkmäler-Archiv<br />
Technische Gedächtnisapparate implizieren die Reversibilität <strong>von</strong> Aufzeichnung,<br />
Speichern und Übertragen akustischer und optischer Daten. Hat die<br />
Technik der Perspektive den Bildraum der Renaissance eröffnet, bedeutet Photogrammetne<br />
deren apparative Umkehrung:<br />
»Die zeichnerische AnswertMtig dieser Vermessungen und einer mit möglichst<br />
breiter Uberdeckung geschlossenen Reihe perspektivisch durchaus richtiger photographischer<br />
>Mcßbildcr< zu geometrischen Rissen erfolgt nunmehr auf Grund<br />
der Umkehrung jener Regel der darstellenden Geometrie, nach denen der<br />
Baukünstler aus seinen Rissen ein perspektivisches Schaubild zu entwickeln<br />
pflegt.«'<br />
In Verwandtschaft mit dem archäologischen Blick (der als Grabung allerdings<br />
auch einen Eingriff in die beobachtete Materie darstellt) arbeitet die Photogrammetrie<br />
berührungsfrei: Empfindliche können so dennoch dokumentiert,<br />
nicht begehbares Gelände kann vermessen werden. Sie speichert Zustände, nicht<br />
Prozesse: Sind in den Aufnahmen Lage, Größe und Form des Objektes erst einmal<br />
büdmäßig konserviert, kann die Messung zu jedem späteren Zeitpunkt<br />
erfolgen, »selbst dann noch, wenn das Objekt inwischen verändert ist oder nicht<br />
mehr existiert.« Monumente werden in der photogrammetrischen<br />
Semiose unmittelbar zum registrierenden Medium, mithin also dem Symbolischen<br />
der Schrift entzogen:<br />
»Mit dem Auftreten der Photographic vollzieht sich eine völlige Umwälzung auf<br />
allen Gebieten des Wissens, das auf bildlicher Darstellung aufgebaut ist, nicht am<br />
wenigsten auf dem der Denkmalkunde. Die Unmöglichkeit der naturgetreuen<br />
Wiedergabe der künstlerischen Individualität des Originals ist mit einem<br />
Schlage beseitigt. Wenn man nun hinzunimmt, dass das photographische Bild<br />
unter gewissen Umständen eine geometrisch richtige Zentralprojcktion d. h. Perspektive<br />
sein kann, so ist leicht zu verstehen, dass aus einer geeigneten Photographie<br />
eines Bauwerkes auch dessen absolute Masse abgeleitet werden können und<br />
das bedeutet einen weiten ungeheuren Fortschritt in der Aufzeichnung der Baudenkmäler.<br />
Das Verfahren hierbei gibt die Messbildkunst (Photogrammetne) an<br />
die 1 land.« <br />
Historisches Archiv Wetzlar, Nachlaß Prof. Albrecht Meydenbaucr (1834-1921),<br />
Karton 1 •<br />
Preußische Akademie der Künste / Staatliche Bildstelle, Das alte Nürnberg in neuen<br />
Lichtbildern. Ausstellung zum 50jährigen Bestehen der Staatlichen Bildstelle (Meßbildanstalt)<br />
1885-1933, Berlin, August 1935, Pariser Platz 4; darin Sonderdruck (lose):<br />
v. Lüpke, Regicrungsrat, Vorsteher der Staatl. Bildstelle,<br />
»Die Staatliche Bildstelle und das Meßbildverfahren«, 6 S. (3)
MHYDUNBAUKRS I'HOTOGRAMMHTRISCIII-S DKNKMAI.KR-ARCI II\' 951<br />
Denn ein bildbasiertes Bildgedächtnis bildet rechenbare Realitäten nicht nur ab,<br />
sondern gibt sie überhaupt erst zu sehen - »eine vollkommene Übereinstimmung<br />
mit der Wirklichkeit im Ganzen«, wie sie bisher nur durch spezielle Einmessung<br />
auf trigonometrischem Weg <strong>für</strong> einzelne wenige Punkte bei umständlicher Winkelmessung<br />
und Rechnung möglich gewesen war. 2 Zwischen Kunstwerk und<br />
Aufzeichnung wird der subjektive Wahrnehmungsfilter nicht schon durch die<br />
reine Existenz des Apparats ausgeschaltet; intersubjektiv, also'standardisierbar,<br />
ist die photographische Aufnahme erst, wenn sie dokumentarisch exakt, also auf<br />
systematischer Meßebene <strong>von</strong>statten geht. Heinrich Wölffhn äußert sich angesichts<br />
der ihm vorliegenden Publikationen 1896 kritisch gegenüber der verbreiteten<br />
Ansicht, daß plastische Kunstwerke <strong>von</strong> jeder behebigen Seite her<br />
aufgenommen werden können, »und es bleibt völlig dem Ermessen des Photographen<br />
überlassen, unter welchem Winkel zur Figur er seine Maschine aufstellen<br />
will.« 3 Die Vorgabe des Archäologen Gerhart Rodenwaldt <strong>für</strong> die<br />
Photographien der Akropolisbauten in Athen lautet, die streng frontalen Ansichten<br />
der Architektur zu wählen - ein Effekt der Ästhetik, wie sie die Preußische<br />
Meßbildanstalt Berlin maßtechnisch vorgegeben hat. Heges Photographien<br />
unterlaufen diese Maßgabe allerdings als technische Funktion der Perspektive.<br />
Indem er <strong>für</strong> die Aufnahmen einen niedrigen Kamerastandpunkt wählt, bewirkt<br />
er (da aufgrund des Paralaxen-Ausglciches seiner Kamera eine perspektivische<br />
Verzerrung der Säulen nicht eintritt) eine visuelle Korrektur. »Die Gradlimgkeit<br />
der Baukanten oder Eckarchitrave auf den Hege-Photographien verschleiert aber<br />
gerade eine der Eigentümlichkeiten griechischer Architektur: die Kurvatur«, ein<br />
bereits 1835 entdecktes Phänomen. 4 Albrecht Meydenbauer, der Protagonist <strong>von</strong><br />
Denkmälerphotogrammctne in Deutschland, setzt gegenüber der völligen<br />
Unzuverlässigkeit des kunstgeschichtlichen Materials einen neuen technischen<br />
Richtwert <strong>für</strong> Wahrnehmung, damit ein Archiv als Gesetz des Sagbaren selbst:<br />
Sonderdruck A. Meydenbauer, Ein deutsches Denkmäler-Archiv. Ein Abschlusswort<br />
zum zwanzigjährigen Bestehen der königlichen Messbild-Anstalt in Berlin, Berlin<br />
(Januar) 1905, 11<br />
Heinrich Wölffhn, Wie man Skulpturen aufnehmen soll, in: Zeitschritt <strong>für</strong> Bildende<br />
Kunst, NF 7, Leipzig 1896, 224-228, zitiert nach: Bodo <strong>von</strong> Dewitz, Einleitung, in:<br />
Angelika Beckmann / ders. (Hg.), Dom - Tempel - Skulptur. Architekturphotographien<br />
<strong>von</strong> Walter Hege, Kataloghandbuch Agfa Foto-Historama Köln (Wiegand)<br />
1993,8-13 (9)<br />
Gerhild Hübner, Walter Hegcs Blick auf die griechische Antike, in: Katalog Hege<br />
1993, 41-52 (49), unter Bezug auf: Gerhart Rodenwaldt, Archäologische Gesellschaft.<br />
Sitzung am 4. Juni 1935, in: Archäologischer Anzeiger. Beiblatt zum Jahrbuch des<br />
Deutschen Archäologischen Institutes, 50. Jg. (1935), 353-364 (358), und ders. / Walter<br />
Hege, Griechische Tempel, Berlin 1936
952 . INVT.NTAR UND STATISTIK<br />
»Nur das Meßbild ist richtig« 5 ; und an die Stelle individuellen Ermessens tritt<br />
die trigonometrische Vermessung des Objekts. Fehler in der graphischen Darstellung<br />
eines Artefakts, welche »die individuelle Ansicht des Zeichners oder Stechers<br />
in die teuersten Kupferwerke hineingebracht« und damit Dissonanzen<br />
unter Kunstkennern und Archäologen hervorrief, werden fortan nicht noch in<br />
der Reproduktion multipliziert . In der Frühphase der<br />
Photographie gilt dieses technische Vertrauen noch nicht, weil der Wahrheitswert<br />
<strong>von</strong> Augenzeugenschaft nicht zwangsläufig an das epistemische Ding des<br />
Apparats gekoppelt ist. So heißt es in einem aktuellen Kommentar zu den Kupferstichen<br />
in der Prachtedition römischer Antiken aus englischen Sammlungen<br />
um 1800: »Few photographie lllustrations are more reliable or informative than<br />
Agar's prints, which are the finest ever made of sculpture. The small dotted lines<br />
unobtrusively mdicate restorations« 6 - eine Vorwegnahme, eine Spurung der<br />
Photographie durch ein ästhetisches Ideal, das nicht der Effekt, sondern das<br />
Andere der Mediengeschichte wäre. Die Hand des Kupferstechers gibt Aufschluß<br />
über die Seh- und Wahrnchmungsweisen der Antiken in seiner Zeit, die<br />
sich als subjektive Differenz zu indifferenten photographischen Reproduktionen<br />
<strong>von</strong> Skulpturen entziffern lassen. <strong>Im</strong> Duktus des Kupferstichs wird der<br />
Anblick <strong>von</strong> Antiken ästhetisch zeitgemäß berichtigt - heute damit eine Quelle<br />
zur Analyse neoklassizistischer Vision. Als Orthographie des museographischen<br />
Eigensinns gehören die Graphiken Agars dergleichen Handschrift an, die seinerzeit<br />
als archäologische Vermessung oder Kunstgeschichtsschreibung die<br />
Antike(n) abmaß. Die behutsame Stilisierung ihrer Lineatur (die Arbeit des Stichels)<br />
verrät Anderes über die Wahrheit und -nehmung der Antiken als objektivistische<br />
Kameraperspektiven, die, einer anderen Technik verschrieben, vom<br />
Hand-Werk (im Sinne der Gedanken Heideggers zur Schreibmaschine, deren<br />
Siegeszeug der <strong>für</strong> das Medium Text konsequent mit der medienarchäologischen<br />
Ruptur der Photogrammetne <strong>für</strong> das Medium Bild zusammenfällt) abgeschnit-<br />
Albrecht Meydenbauer, Der gegenwärtige Stand der Meßbildkunst, in: Zentralblatt<br />
der Bauverwaltung Nr. 84 v. 19. Oktober 1921, 517. So auch die sich in einer scheinbaren<br />
Tautologie dckonstruicrcndc, tatsächlich auf die technische Differenz <strong>von</strong><br />
Wahrheit (Evidenz) und Kalibrierung (Apparate) verweisende Schlußbemerkung in<br />
ders., Handbuch der Meßbildkunst. In Anwendung auf Baudenkmäler- und Reise-<br />
Aufnahmen, Halle/Saale 1912, 236: »das richtige Meßbild hat immer Recht!«<br />
Michael Clarke / Nicholas Penny, »The Arrogant Connoisseur«: Richard Payne Knight<br />
1751-1824, Oxford 1982, 149, über die <strong>von</strong> Richard Payne Knight im Auftrag der Londoner<br />
Society ot Dilettanti herausgegebenen Specimens of Anticnt Sculpture, Bd. 1,<br />
London 1809. Dazu auch W. E., Historismus im Verzug: Museale Antike(n)rezeption<br />
im britischen Neoklassizisinus (und jenseits), Hagen (Margit Rottmann Medienverlag)<br />
1992 (= Beiträge zur Geschichtskultur, Bd. 6)
MhYDKNBAUKRS IM lOTt /GKAMMl-TRiSU Ü\S DhNKMAl.KR-ARO HY 953<br />
ten und damit einer anderen Diskurspraxis zugewiesen sind. 7 Indem der Kupferstecher<br />
die Differenz <strong>von</strong> Original und Restauration an den vorliegenden<br />
Antiken durch punktierte Linien (in der Schwebe, gleich einem Schleier) markiert,<br />
streicht er sie geradezu heraus (mehr pointure denn peinture^) und macht<br />
die permeable Membran zwischen Anblick und <strong>Im</strong>agination sichtbar. Weniger<br />
pittoresk ist die medial induzierte aistbesis bei Anfertigung dieser photographischen<br />
Aufnahmen in Meydenbauers Epoche: »Das malerische Element muß<br />
ganz in den Hintergrund treten«, und die anzuwendende Kamera »muß mit<br />
Hilfsmitteln ausgerüstet werden, wie sie der Ingenieur bei seinen Meßinstrumenten<br />
hat«. 9 So tritt der Ingenieur an die Stelle des Archivars in der Aufzeichnung,<br />
Spcichcrung und Berechnung <strong>von</strong> (Bild-)Gedächtnis. Doch der Begriff der<br />
Zeichnung (die ecriture) als unsichtbares Supplement bleibt auch <strong>für</strong> Meydenbauer<br />
mit am technischen Werk, schreibt sich ihm ein: Für photogrammetrische<br />
Aufnahmen empfiehlt er die Einstellung <strong>von</strong> Kräften, die zunächst am Zeichentisch<br />
ausgebildet wurden; »der Begriff der Genauigkeit sitzt dann schon fest und<br />
steigert sich schnell beim Auftragen aus Meßbildern« .<br />
Die Hardware des Meßinstruments setzt die Differenz <strong>von</strong> hermeneutischer<br />
Ästhetik und wissensarchäologischer aisthesis. Wenn die Kamera dementsprechend<br />
als Meßinstrument ausgebildet ist, kann sie nicht solche Plattengrößen<br />
aufnehmen, wie sie künstlerische Bilder erfordern. »Der photographische Zweck<br />
tritt hinter den photogrammetrischen zurück« . Die<br />
Aufnahmen sollen tunlich <strong>von</strong> Personen durchgeführt werden, »die <strong>von</strong> keinerlei<br />
künstlerischen Rücksichten in ihrem Tun beeinflußt« wird .<br />
Linien erleiden nicht nur innerhalb jedes Objektivs eine Verschiebung nach<br />
dem Gauss'schen Gesetz der Hauptpunkte, sondern auch in den an hermeneutische<br />
Wahrnehmungsmuster gekoppelten Augen der Betrachter. Da das<br />
photographische Bild unter technisch kodierten, <strong>von</strong> der Apparatur festgelegten<br />
Bedingungen operiert und nicht unter intersubjektiven, mithin diskursiven<br />
Vereinbarungen, dekontextuahsiert es seine Objekte; gerade diese monumentale<br />
Abstraktion aber zeitigt diskursive Effekte, wenn die photogrammetrische<br />
7 »Wichtig war die Präzision, eine Maschine kann man nicht verschwommen malen«:<br />
Konrad Klaphek, Warum ich male, in: Ausstellungskatalog Konrad Klaphek, Hamburger<br />
Kunsthalle 1985, 23; zitiert nach: Peter Paul Schneider u. a., Literatur im Industriezeitalter<br />
Bd. 2, Ausstellungskatalog Schiller Nationalmuseum Marbach am Neckar<br />
(= Marbachcr Kataloge 42/2) 1987, Kapitel 36, 1021. Heideggers Kommentar zur<br />
Schreibmaschine aus demParmenides-Ma.nusknpt zitiert ebd., 999f<br />
lS Siehe das Kapitel »Parergon« in: Jacques Dcrrida, La vente cn peinture, Paris 1978,<br />
der darin unter Hinweis auf die Vernietung <strong>von</strong> Bildleinwand und Rahmen die angesprochene<br />
Analogie zur punktierten Linie weitertreibt.<br />
9 Meydenbauer 1912: Anhang II, 242, verfaßt 1865
956 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
ihren Medien differenzierten Dokumentation oder Darstellung, wie sie in G. E.<br />
Lessings kunstsemiotischem Traktat Laokoon oder Über die Grenzen der Mahlerey<br />
und Poesie (1766) angedacht sind, beschreibt Wiedemann als Möglichkeiten<br />
und Grenzen der Architekturphotogrammetne: Sprache erlaubt zwar eine detaillierte<br />
Beschreibung, bedarf dazu aber einer enormen Redundanz »und bleibt dennoch<br />
unvollständig und mißverständlich.« Bei der graphischen Darstellungen<br />
eines wiederzugebenen Objekts »kommt uns zugute, daß uns unser menschlicher<br />
Sehapparat mit einem Blick eine Fülle <strong>von</strong> Informationen in strukturierter Form<br />
vermittelt, während wir Texte nur sequentiell registrieren können.« 17 Nicht nur,<br />
daß unser Schreibwerkzeug »mit an unseren Gedanken« arbeitet (Friedrich<br />
Nietzsche in einem Brief an Heinrich Kocselitz, Venedig 19. Februar 1882) 18 ; um<br />
umgekehrt mit den jeweils verfügbaren Werkzeugen Elemente eines Bauwerkes<br />
in eine Graphik oder umgekehrt zu übertragen, »ist eine Form der Darstellung<br />
erforderlich, die diesen Werkzeugen Rechnung trägt« .<br />
Maß und Figur<br />
Architektur ist weitgehend ohne Datenverlust photogrammetrisch archivierbar,<br />
doch »the Special patina that time gives to it, is impossible to be reproduced.«<br />
19 Mit der Patina ist Zeit ablesbar im Materialen; Photogrammetrie aber zielt<br />
- hier ganz wissensarchäologisch - auf Strukturen. 20 »The photogrammetrie<br />
method eonsents the reconstruction, entering into the smallest details, of every<br />
portion of the photographed struetures.« Die Insistenz auf der Wiederherstellbarkeit<br />
des strukturellen Details schreibt sich vor dem Hintergrund des »atomic<br />
age, now always increasing« - »all famous monuments.can be dissolved at any<br />
time« . Damit wird Wirklichkeit als virtuelles Archiv, als<br />
Abbild gegenüber ihren Aufnahmen antizipiert; Photogrammetrien generieren<br />
geradezu Bilder ohne Vorbild. Das bundesdeutsche Mikrofilmlager relevanter<br />
Kultur- und Verwaltungsdokumente in einem Stollen bei Freiburg I. Br. dachte<br />
immer schon über den atomaren Fall des Originals BRD hinaus. Teil dieser Auflösung<br />
aber ist nicht erst der atomare Schlag, sondern bereits die digitale Dekomposition<br />
des Bildes in Zeichenketten; pixel sind die nuklearen Elemente der<br />
17 Albert Wiedemann, Orthophototechnik in der Architekturphotogrammetne - Möglichkeiten<br />
und Grenzen, in: Albertz / ders. (Hg.) 1997: 79-94 (79)<br />
IX In: Peter Paul Schneider u. a., Literatur im Industriezeitalter Bd. 2, Ausstellungskatalog<br />
Schiller Nationalmuseum Marbach am Neckar (= Marbacher Kataloge 42/2) 1987,<br />
Kapitel 36, 996IT (997)<br />
v> In: Archives Internationales de Photogrammetrie Bd. 11 (1954), 531 f (532)<br />
:o »Die Archäologie läßt die Struktur sehen.« Walter Seitter, Das politische Wissen im<br />
Nibelungenlied, Berlin (Mcrve) 1987, 29
MHYDI-NBAUKRS i'i IOTOGRAMMKTRISCHKS DI-;NKMÄI.I:R-ARCHIV 957<br />
Darstellung. Der funktionale Auftrag des photogrammetnschen Denkmälerarchivs<br />
heißt, das Baudenkmal der Nachwelt in Bild und Maß zu erhalten , in der Monumentalität eines analogen Speichermediums; heute<br />
fallen Bild und Maß digital in eins (und damit der Bildbegriff selbst fort). 21<br />
Das 19. Jahrhundert setzt vor Architekturabbildungen gerne Menschen als<br />
Maßfigur; Meydenbauers Photogrammetrie als angemessene Sachwidergabe 22<br />
ersetzt diese Maßeinheit Mensch durch Angaben der darstellenden Geometrie.<br />
Photos <strong>von</strong> Bauten machen sie so zu unantastbaren Museumsstücken, »wie hinter<br />
Glas« . Durch die scheinbare Selbstaufgabe des abbildenden<br />
Subjekts und das Verschwinden <strong>von</strong> Subjekten auf den Photos wird die Architektur<br />
zum positivistischen Sachsubstrat monumentalisiert . Der Historiker<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke hat Photographien den Relationen <strong>von</strong> Augenzeugen<br />
gleichgesetzt und sie als die echtesten unmittelbaren Urkunden, die <strong>von</strong> vergangenem<br />
Geschehen zeugen, bezeichnet. 24 Roland Barthes reduziert die Aussage<br />
der Photographie auf das deiktische ca a e'te, doch die Existenz der Photos respektive<br />
Filme beweist nicht so sehr, daß etwas gewesen ist, sondern, daß es einen Zeugen<br />
gab, daß eine Beobachtung überhaupt stattfand. 23 Planimetrische Darstellung<br />
reduziert den Bau auf seine Archi-Textur; die Perspektive - und mithin ihre<br />
Umkehrung in der photogrammetnschen Umzeichnung - »unterwirft jedes<br />
Raummaß dem Gesetz der Verkürzung« . Das ist der Preis <strong>für</strong><br />
die Übersetzbarkeit der Architektur in den Raum des Archivs: »Unsere Grundund<br />
Aufrisse gehören zum Musee imaginaire, dessen Objekte ohne Verhältnisse<br />
bleiben, ja bewußt verhältnislos, das heißt sachlich isoliert sind« . So wird<br />
Architektur zum Schriftbild, existent nur in der Fläche. Die Archivierung ist im<br />
Akt dieser Vermessung bereits angelegt. Diskursive und non-diskursive Darstellungsästhetik<br />
geraten in Konflikt, wo die Differenz zwischen dokumentarischer<br />
und monumentaler Wahrnehmung ins Spiel kommt. Ein zeitgenössischer Stich<br />
des Schlosses <strong>von</strong> Versailles dokumentiert es: »Die Inszenierung einer anwesen-<br />
21<br />
Siehe W. E. / Stefan Heidenreich, <strong>Im</strong>age retrieval und visuelles Wissen, in: Konferenzband<br />
EVA '97 Berlin (Electronic <strong>Im</strong>aging & the Visual Ans), Elektronische Bildverarbeitung<br />
& Kunst, Kultur, Historie, 12.-14. November 1997, abstract VI6<br />
22<br />
Heinrich Klotz, Über das Abbilden <strong>von</strong> Bauwerken, in: architectura. Zeitschrift <strong>für</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> der Baukunst 1/1971, 1-14 (1)<br />
23<br />
Unter Bezug auf: Nikolaus Pevsner, Europäische Architektur (München 1957)<br />
24<br />
Zitiert nach: Ulrich Borsdorf, Denkmal und Monument. Fabrik und Stadt auf Kruppschen<br />
Fotografien, in: Christian Jansen u. a. (Flg.), Von der Aufgabe der Freiheit: politische<br />
Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert<br />
(Festschrift <strong>für</strong> I lans Mommsen /um 5. November 1995), Berlin (Akademie Verlag)<br />
1995,619-634(634)<br />
2:1<br />
Die Filmwissenschaftlerin Gertrud Koch auf dem Kolloquium Was ist ein Bild?, 19.-<br />
21. Juni 1997, Cinemathek Köln
958 • INVI-NTAK UND STATISTIK<br />
den Gesellschaft entspricht der Wirklichkeit dieser Architektur, die durch Herrschaft<br />
eine Umwelt zum Besitz hat« . Die Ästhetik des Archivs<br />
(als Domäne der Architekturhistoriker) gerät in Widerstreit zur gebauten Wirklichkeit:<br />
Während der praktizierende Architekt die Notwendigkeit verspürt, »sein<br />
Monument zu humanisieren«, so kann sich der Theoretiker erlauben, »sein<br />
Monument nackt zu präsentieren. Der eine wirbt bei einem Klienten, der andere<br />
schreibt die <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> Denkmälern. Die Meßbildkamera schreibt sie nicht<br />
einmal mehr als <strong>Geschichte</strong>, sondern schreibt sie auf, medienarchäologisch. Das<br />
monokulare Papierbilder vermag keine Sensation <strong>von</strong> Entfernung und Plastik des<br />
Objekts zu vermitteln; das Stereoskop schließlich überwindet die Unbestimmtheit<br />
der photographischen Aufnahme. Stcreoskopie, im Unterschied zur Photogrammetrie,<br />
ermöglicht ein non-perspektivisches Bild, das <strong>von</strong> der Physiologie<br />
des menschlichen Blicks, nicht vom Apparat hervorgebracht wird 26 - eine kognitive,<br />
dennoch raciikal vom Apparat bedingte Konstruktion. Das Gehirn kombiniert<br />
die beiden Bilder derart, daß nur ein Bild gleich einer natürlichen Plastik<br />
wahrgenommen wird: »Wir kommen zum Bewußtsein der vor- und rückwärts<br />
stehenden Teile des Objektes, seiner Vertiefungen und Erhabenheit. Die Objekte<br />
werden mit einer Treue und Sicherheit vor Augen geführt, welche verblüffend<br />
wirkt« - wirksam als visuelles Äquivalent zur Rhetorik der<br />
Persuasion, vom Apparat geleistet, eine Verdinglichung der Technik der Rhetorik<br />
selbst.'»Das Stereoskop ist so recht das berufene Mittel <strong>für</strong> die Erinnerung an<br />
die Wirklichkeit« ; Erinnerung ist hier topisch<br />
(als medial induziertes cogmtwe mapping), nicht mehr zeitlich, und schon gar<br />
nicht mehr gedächtnisemphatisch definiert.<br />
Karrieren der Photogrammetne<br />
Wie läßt sich die Genealogie der Meßbildphotographie aussagen, ohne die<br />
Struktur der Messung als Inventarisierung nicht schon in ihrer historiographischen<br />
Erzählung verschwinden zu lassen? Als lose Kopplung der Befunde,<br />
wobei nur noch kalendarische Daten gleich Steuerzeichen die Differenz <strong>von</strong><br />
Archiv und Gegenwart setzen? Die Prioritäten in der Erfindung der Photogrammetrie<br />
verlaufen sich im Archiv. Lambert kommt 1759 in Straßburg auf<br />
den mathematischen Gedanken, durch Umkehrung geometrische Maße aus<br />
einem perspektivischen Bild abzuleiten. Beautemps-Beaupre sucht 1793 aus<br />
freihändig gezeichneten Perspektiven Skizzen eine Karte der Insel Santa Cruz<br />
aufzutragen. Erste Messungen mit Hilfe photographischer Bilder unternimmt<br />
-'' iehe Jonathan Crary, Techniken des Betrachters. Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert,<br />
Dresden (Verlag der Kunst) 1996
MI-;YDI;NBAUI:RS PHOTOGRAMMI-TRISCHHS DENKMALKR-ARCHIV 959<br />
der Italiener Porro; Mitteilung darüber erscheinen 1855. Ihm folgte der französische<br />
Ingenieur-Offizier Laussedat, mit der Aufnahme militärischer Karten<br />
jenseits der beschreibenden Geometrie betraut. In der Sitzung der französischen<br />
Photographischen Gesellschaft am 9. Januar 1863 legte Laussedat einen entsprechend<br />
kontruierten Apparat vor:<br />
»Die Aufgabe, Gegenstände, Monumente, wo<strong>von</strong> man die horizontalen und vertikalen<br />
Abrisse oder Plänen hat, in Perspektiven zu setzen, ist allen Künstlern<br />
bekannt. Die Lösung der umgekehrten Frage oder die Herstellung der Pläne durch<br />
die Perspektive ist jedoch weniger bekannt, weil man seltener die Gelegenheit hat,<br />
ihr in den Künsten zu begegnen. Es handelt sich nicht nur um den Plan oder<br />
Abriss eines Monuments <strong>von</strong> regelmässigen Formen, die in das Feld der beschreibenden<br />
Geometrie gehören, sondern man soll aus Landschaftsansichten, die weite<br />
Panorama's umfassen, die Messungselemente finden, die es gestatten, die topographische<br />
Karte eines mehr oder weniger beträchtlichen Terrains zu entwerfen mit<br />
allen natürlichen Zufälligkeiten, die sich dann begegnen, oder den durch Menschenhände<br />
dann aufgeführten Arbeiten.« 27<br />
Vollzieht sich technischer Fortschritt im 19. Jahrhundert qua Wissenstransfer,<br />
oder wird er <strong>von</strong> einem umfassenden Dispositiv an mehreren Stellen gleichursprünglich<br />
generiert? Wie eigenständig ist die Photogrammetne Meydenbauers?<br />
In seiner (verlorengegangenen) Denkschrift an den Preußischen Konservator<br />
der Kunstdenkmäler v. Quast 1860 taucht der Gedanke der Photogrammetrie<br />
offiziell auf (im Sinne einer diskursiven Aussage), respektive Restaurierungsarbeiten<br />
am Erfurter Dom unter Bauführung Meydenbauers; den gleichen Gedanken<br />
hat er einige Jahre zuvor an anderer Stelle erörtert. Erst am 3. Oktober 1867<br />
bewilligt der Minister <strong>für</strong> öffentliche Arbeiten ihm eine Studienreise nach Paris<br />
zum Abgleich der deutsch-französischen Kenntnisse über Photogrammetrie;<br />
bleibt die Frage nach dem Wissen des preußischen Kriegsministeriums über die<br />
französischen Versuchsarbeiten. Der damalige Stand in der Verbreitung <strong>von</strong> Literatur<br />
ließ fremdsprachige Schriften eines fremden Fachgebiets kaum lesbar werden-<br />
»es sei denn, man hätte aus gegebenem Anlaß direkt danach geforscht. Das<br />
aber konnte nicht sein, da es keine Anlaß <strong>für</strong> solche Recherchen gegeben hat«<br />
. Auch das Archiv der Gegenwart generiert Wissen erst im<br />
Moment seiner Adressierung. Inventio heißt auch Einbruch des Realen in die<br />
symbolische Ordnung klassischer Memonerungstechniken, wie ihn Kriege, Katastrophen<br />
und Unfälle darstellen. Meydenbauer versucht, das preußische Kriegsmmistenum<br />
vom Zweck der Photogrammetne mit einem Einsatz vor der Festung<br />
und im Terrain <strong>von</strong> Saarlouis zu überzeugen:<br />
Laudessat, zitiert nach: Heinrich Heinlein, Photographikon. Hülfsbuch auf Grund der<br />
neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in allen zweigen der photographischen Praxis<br />
, Leipzig (Spamer) 1864, 374f
960 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
»An Ort und Stelle angekommen, konnte wenige Minuten nach erfolgter Aufnahme<br />
das fertige Bild vorgezeigt werden. Dieser Umstand wird erst in seinem<br />
wahren Werth erkannt werden, wenn es sich darum handelt, bei irgend welcher<br />
Katastrophe, sei es auf dem Schlachtfelde, sei es auf der Eisenbahn oder dergleichen,<br />
allen späteren, sich theilweise widersprechenden Aussagen das nie lügende<br />
photographische Beweismittel entgegen zu stellen.« 28<br />
Damit ist nicht nur angedeutet, wie sehr das forensische Paradigma der Zeugenaussage<br />
an ein militärisches, nämlich aufklärungstechnisches Dispositiv<br />
gekoppelt ist, das sich Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten in der strategischen<br />
Sondierung nicht leisten darf; zum anderen belegt Meydenbauers Text,<br />
daß diskursive Begründungen hier eine medienarchäologische Grundlage in der<br />
photogrammetnschen Technik haben, welche »mit der hegemonialen Ausbreitung<br />
ihrer Sichtweise auch eine diskursive Strategie verfolgt, eine neue Wahrheitsrede<br />
etabliert«, die entsteht, sobald die scheinbar untrüglichen Bilder an<br />
entsprechender Stelle bearbeitet werden und zum Zuge kommen. Das Beweismittel<br />
Photographie »ist <strong>von</strong> Anfang an eine Technologie der Zerstörung, da die<br />
Kenntnis der genauen Konstruktion eines Gebäudes den einzigen Sinn hat, über<br />
die potentielle Lage des besten Treffers zu informieren.« 29<br />
Ein medienarchäologisches Datum: Unfall... und Archiv<br />
Nach einem Unfall bei der manuellen Bauaufnahme des Wetzlarer Domes vom<br />
Gerüst kommt Meydenbauer der Gedanke, das Messen <strong>von</strong> Hand durch die<br />
photographische Aufnahme zu ersetzen. Wo aber Lebensgefahr in der Vermessung<br />
ausgeschaltet wird, kommt es auch zur Ausschaltung des Subjekts; »dieser<br />
Gedanke, der die persönliche Mühe und Gefahr beim Aufmessen <strong>von</strong> Bauwerken<br />
ausschloß, war der Vater des Messbild-Verfahrens« 30 , wie Meydenbauer es<br />
im ersten Abschnitt seines Handbuchs darlegt. Ein <strong>von</strong> Meydenbauers Hand<br />
eingezeichneter Pfeil und die Eintragung September 58 auf einer Photographie<br />
28 Albrecht Meydenbauer, Die photographische Kamera als Messinstrument, in: Deutsche<br />
Bauzeitung (1869), 395, zitiert nach: Richard Doergens, Über »Photogrammetrie«<br />
und über die Thätigkeit des »Feld-Photographie-Detachements« im Kriege<br />
1870/71, in: Deutsche Photographischc Zeitung (1897) Nr. 39, 474 f.<br />
29 Daniel Gethmann, Daten und Fahrten. Die <strong>Geschichte</strong> der Kamerafahrt, »Cabiria«<br />
und Gabriele d'Annunzios Bildstratcgic, in: Man» Ulrich Gumbrucl-tt / Fi'iedi-ich Kittler<br />
/ Bernhard Siegert (Hg-), Der Dichter als Kommandant. D'Annunzio erobert<br />
Fiume, München (Fink) 1996, 147-174 (157f)<br />
J0 Albrecht Grimm, 120 Jahre Photogrammetrie in Deutschland. Das Tagebuch <strong>von</strong> Albrecht<br />
Meydenbauer, dem Nestor des Messbild-Verfahrens, veröffentlicht aus Anlaß<br />
des Jubiläums 1858/1978, München / Düsseldorf (Oldenbo.urg) 1978, 15ff
MHYDI-NUAUI-RS PHOTOGRAMMHTRISCHHS DEN KMÄI.I-:R-ARCHIV 961<br />
des Querschiffes vom Wetzlarer Dom markiert diesen Einbruch des Realen; ein<br />
pointer bedeutet die neue Form <strong>von</strong> Dokumentation. Die Rückseite der Photographie<br />
trägt den Bleistifteintrag »Wetzlar 1858. Die Gefahr des Absturzes mit<br />
=> bezeichnet. Veranlassung zur Erfindung der Meßbildkunst«. 31 Aus Meydenbauers<br />
autobiographischer Retrospektive wird dieser Unfall, im literarischen<br />
Kontext bereits auf einen schönen September Abend datiert, als pathetisches<br />
Schlüsselerlebnis inszeniert, dann durchaus der Dramatik <strong>von</strong> Heinrichs Schhemanns<br />
archäo-biographischer Selbstbiographie <strong>von</strong> 1892 verwandt: »Überhaupt<br />
archivierte er fast alles Geschriebene . Sein Leben kann wie ein großer Text<br />
interpretiert werden. 32 Nicht der Wetzlarer Unfallmoment, sondern sein Nachbild<br />
ist entscheidend <strong>für</strong> sein späteres Leben:<br />
Ich war gerettet, brach aber auf der inneren Wendeltreppe zusammen. In diesem<br />
nach Bruchteilen einer Sekunde sich abspielenden Vorganges trug sich noch ein<br />
anderer Vorgang zu. Nach meinen Kenntnisse der Fensterprofile sollte ein kleiner<br />
Absatz zur Befestigung der Verglasung nach b vorhanden sein , der aber nach a nicht vorhanden war, weil nur eine<br />
Schallöffnung, kein eigentliches Fenster dastand. Darin hätten die Fingerspitzen<br />
halt gefunden den Körper nachzuziehen. Beim Einschlagen der Hand fühlte ich<br />
den Mangel des Absatzes und empfand im kritischen Moment die darin liegende<br />
Gefahr als heftigen Schrecken. Da sass ich nun eine Weile, hörte auch noch das heftige<br />
Zurückschlagen des Kastens, war aber dann eine Zeitlang abwesend.« 3 '<br />
In der medizinischen Neurologic figuriert absence als Haupttyp des kleinen epileptischen<br />
Anfalls (Petit mal), der kurzfristigen Suspendierung und Desynchromsierung<br />
aller Wahrnehmung. Solche Bewußtseitspausen können gänzlich<br />
unbemerkt bleiben 34 ; dem entspricht eine Kinästhetik, wie sie Paul Virilio, ausgehend<br />
vom medizinischen Begriff der Pyknolepsie, in seiner Esthetique de la<br />
disparatwn (1980) mit den Techniken filmischer Apparate (etwa Etienne-Jules<br />
Mareys Chronophotographie) und Bergsons Chronotropismen korrehert. 33 Auf<br />
31<br />
Historisches Archiv Wetzlar, Nachlaß Prof. Albrecht. Meydenbauer (1834-1921),<br />
Karton 2, Nr. 4<br />
32<br />
Zur Reziprozität <strong>von</strong> Archäologie und Archiv als Subjekt und Ob]ekt, Fakt und Fiktion<br />
einer (Auto)Biographie siehe Justus Cobet, Heinrich Schliemann. Archäologe und<br />
Abenteurer, München (Beck) 1997, Einführung, lOf. »Die Quellenkritik fördert auch<br />
die Archäologie im engsten Sinne« .<br />
33<br />
Nachlaß Meydenbauer, Karton 1, Nr. 5: einige Seiten aus Meyderibaucrs Tagebuch auf<br />
6 Blättern und entsprechende 6 Abzijge rnif Transkription ()t. Aufschrift dujph Prpf.<br />
H. Köhnle, Düsseldorf, April 1970 an Prof. Rösch); betr. Unfall Wetzlar <br />
34<br />
Vgl. Marc A. Dichter, The epilepsies and convulsive disorders. In: Kurt J. Isselbacher<br />
u.a. (Hg.), Harrison's Principles of Internal Medicine, Bd. 2, 13.Aufl., New York u. a.<br />
1994, Kapitel 367, 2225<br />
35<br />
Vgl. Andrea Gnam, Die Absence als Ausbruch aus der mnemotechnischen Konditio-
962 INVI-INTAR UND STATISTIK<br />
eine photographische Apparatur läuft Meydenbauers Unfall als kognitiver Kurzschluß<br />
in der Tat hinaus. Beim Hinabsteigen sei ihm der Gedanke gekommen, ob<br />
nicht das Messen der Hand durch Umkehren des perspektivischen Sehens in<br />
Apparaten ersetzt werden kann; der desktop ersetzt fortan die riskante Arbeit vor<br />
Ort, bequeme Büroarbeit? 6 Nach dem Ernstfall der Testfall: In Verbindung mit<br />
der Bauabteilung des Arbeitsministeriums ergeht ein erster Erprobungsauftrag<br />
zum Nachzuweis, daß das Meßbild-Verfahren <strong>für</strong> die Denkmalpflege nutzbar zu<br />
machen ist. Protegiert durch den preußischen Kultusminister v. Gossler (der auch<br />
die optische Technologie der Momentphotographie und Anschütz' prä-kinematographisches<br />
Tachyskop unterstützt 37 ), wählt Meydenbauer als photogrammetrisches<br />
Versuchsobjekt die Elisabethkirche in seinem Wohnort Marburg; dort<br />
lagen als Gegenrechnung »zuverlässige Messungen vor, die eine Kontrolle ermöglichten.<br />
Die Arbeit bekam den Charakter eines durch unabhängige Messungen<br />
kontrollierten Versuches« . Die notwendig apparative Kontrolle<br />
<strong>von</strong> Brennweiten generiert einen neuen Begriff des Panoptizismus, der <strong>von</strong><br />
technischer Hardware diktierten Überwachung. Meydenbauers Ersuch um Beihilfe<br />
durch den Referendar v. d. Bickell wird negativ beschieden; Bickell selbst<br />
war über seinen Kunststudien im Justizfach gescheitert und plante ebenfalls eine<br />
umfassende Aufnahme der Kunstdenkmäler in einem Denkmäler-Archiv (das<br />
Wort ist <strong>von</strong> ihm geprägt), »aber ohne jede Kenntnis des Messbild-Verfahrens«<br />
.<br />
Das Wetzlarer Stadtarchiv speichert nicht nur Meydenbauers Unfallbeschreibung;<br />
dieser Unfall ist auch der Grund da<strong>für</strong>, daß seine Dokumente genau dort<br />
lesbar sind. Der Unfall <strong>von</strong> Wetzlar als Begründung der Photogrammetrie im<br />
Realen wird <strong>von</strong> der symbolischen Ordnung der Erinnerung eingeholt. Zunächst<br />
transkribiert Matilde Armbruster in Düsseldorf, die Enkelin Meydenbauers, das<br />
Manuskript der in Godesbcrg unvollendeten Selbstbiographie ihres Großvaters,<br />
in welchem der Unfall figuriert. Über Dr. Köhnle in Düsseldorf gelangen diese<br />
Unterlagen an Oberregierungsrat Dr.-Ing. Ewald in Berlin, der sie am 5. November<br />
1934 an Regierungsrat Theodor <strong>von</strong> Lüpke, Direktor der Staatlichen Bildstelle<br />
(Meßbildanstalt) in Berlin, weiterleitet; Köhnle (in seinem Anschreiben an<br />
Ewald) wünscht, wenigstens einen Teil mit Blick auf den lOOjährigen Geburtstag<br />
Meydenbauers und das 50jährige Bestehen der Messbildanstalt zu veröffent-<br />
nicrung: »Ein schöner Himmel bricht aus der Seele«, in: Gerhard Neumann (Hg.),<br />
Poststrukturalismus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft, Stuttgart / Weimar<br />
(Met/.lcr) 1997, 145-163<br />
1 Rudolf Meyer (Hg-), Albrecht Meydenbauer. Baukunst in historischen Fotografien,<br />
Leipzig (VEB Fotokinoverlag) 1985, 27<br />
Friedrich <strong>von</strong> Zglinicki, Der Weg des Films. Textband, Hildesheim / New York<br />
(Olms) 1979, 187
MI-:YDI-:NHAUI:RS PIIOTOGRAMMITRISCHHS DI-NKMÄLHR-ARO 963<br />
liehen. 38 Der Nachlaß Meydenbauer im Wetzlarer Archiv birgt in Karton III<br />
(Nr. 1) schließlich eine Mappe mit Korrespondenz betreffs der Übernahme des<br />
Nachlasses selbst, u. a. den handschriftlichen Brief Matilde Armbrusters mit dem<br />
Übergabeangebot:<br />
»Soweit mir bekannt ist, ist in dem Stadt-Archiv dort ein Vermerk zu finden, der<br />
die große Absturzgefahr, die Meydenbauer beim Vermessen des Domes 1858<br />
erlebte und die er durch seine Geistesgegenwart überstand, schildert. Dieses Erlebnis<br />
lag seiner Erfindung des Meßbildverfahrens zugrunde . Da die Erfindung<br />
der Photogrammetne ihren Anfang in Wetzlar nahm, fasste ich den Entschluß<br />
den Nachlass Wetzlar zu schenken, wenn Sie glauben, dass die kleine Sammlung im<br />
Archiv in Wetzlar Platz findet.« 39<br />
Archäologie, Ursprung, Archiv: Das Gedächtnis des Realen (der Unfall als Bedingung<br />
der Photogrammetne) kehrt buchstäblich an seinen Ort zurück. 40 Daß<br />
Matilde Armbruster ihrerseits Anfang der 60er Jahre in den Raum Wetzlar-Gießen<br />
umzog, »war ein biographischer Zufall und hatte mit dem Schlüsselereignis in der<br />
Laufbahn meines Urgroßvaters direkt nichts zu tun; diese Koinzidenz hat aber<br />
sicher meiner Mutter den Entschluß zu einem weiteren Umzug erleichtert«<br />
. Nach internen Verhandlungen zwischen Kreisund<br />
Stadtverwaltung gleicht das Schreiben des Archivleiters an Frau Armbruster,<br />
datiert auf den 28. August 1968, das institutionalisierte kollektive Gedächtnis<br />
Wetzlars mit dem <strong>von</strong> Meydenbauer ab. Bei der Ordnung und Sichtung dieses<br />
Nachlasses »kam uns deutlich ins Bewußtsein, daß das Wetzlarer Stadtarchiv aus<br />
verschiedenen Gründen tatsächlich der geeignete Aufbewahrungsort <strong>für</strong> das überaus<br />
wertvolle Material ist , zumal bis jetzt keinerlei Unterlagen über das<br />
Meßbildverfahren und seine Entstehung hier vorhanden waren« . Und das<br />
38<br />
Historisches Archiv Wetzlar, NL Prof. Albrecht Meydenbauer (1834-1921), Karton.<br />
2, Nr. 6<br />
39<br />
Eingangsstempel Kreisausschuß des Landrates Wetzlar, 27. Februar 1968, <br />
ges. Dr. Best. Siehe auch: Walter Armbruster, Brücken der Erinnerung -<br />
Gedanken zum 75. Todestag meines Urgroßvaters Albrecht Meydenbauer, in: Architekturphotogrammetrie<br />
gestern - heute - morgen. Wissenschaftliches Kolloquium<br />
zum 75. Todestag des Begründers der Architekturphotogrammetne Albrecht Meydenbauer<br />
in der Technische Universität Berlin am 15. November 1996, hg. v. Jörg<br />
Albertz / Albert Wiedemann, Berlin (Publikationsstelle der TU) 1997, 15-27, bes.<br />
25, Anm. 6 (Hier schließt sich Armbruster der Argumentation seiner Mutter nachdrücklich<br />
an.)<br />
40<br />
Zu »ordnen und sichten«, unter speziellem Bezug auf Meydenbaucrs Wetzlarer Unfall,<br />
siehe Harun Farockis Film Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988). Englische<br />
Textversion in: Discourse. Theoretical Studies in Media and Culture 15, Heft 3 (Frühjahr<br />
1993), 78-92. Siehe auch: ders., Die Wirklichkeit hätte zu beginnen, in: Ausstellungskatalog<br />
Fotovision. Projekt Fotografie nach 150 Jahren, Hannover (Sprengel-Museum)<br />
119-125
964 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
heißt, der Gegenwart ein Gedächtnis zu unterlegen. Gedächtnisenergie triggert<br />
Archivgeistcr: Das Wetzlarcr Archiv wird heute nicht nur vom gcnius loci des ehemals<br />
dort gespeicherten Reichskammergenchts heimgesucht, sondern beschwört<br />
auch das Phantom Meydenbauers, der dem Gedächtnis selbst neue Brennweiten<br />
eröffnete. Musing (in) the archive - das im Wetzlarer Nachlaß gelagerte Schreibmaschinen-Typoskript<br />
mit 32 Seiten des Tagebuchs <strong>von</strong> Meydenbauer sagt über<br />
die photogrammetrische Kampagne in den antiken Ruinen Syriens: »Die Bilder<br />
<strong>von</strong> Baibeck sind <strong>von</strong> seltener Schönheit, selbst in der Erinnerung bleiben sie haften.«<br />
Ein Bildmedium speichert hier nicht mehr nur, es generiert seinerseits<br />
Gedächtnis. Mit der Vorstellung einer photographischen Emanation korrespondiert<br />
das Ende des Vorworts zur typographischen Umschrift des Tagebuchs<br />
(Blatt 2): »Ich glaube nicht, dass ein Geist wie Meydenbauer sich jemals passiv verhält,<br />
seine Energie kann nicht verloren sein, sie wird im Weltgeschehen weiter<br />
ihren Dienst verrichten.«<br />
Ein <strong>Im</strong>puls <strong>von</strong> Meydenbauers Denkmälerarchiv war es, <strong>für</strong> den Fall der Destruktion<br />
<strong>von</strong> Gebäuden die Daten <strong>für</strong> deren vollständige Rekonstruktion latent<br />
zu halten. Weltkrieg II aber hat die Dokumentation der Königlich Preußischen<br />
Meßbildanstalt, die seit dem 1. April 1885 in der <strong>von</strong> Karl Friedrich Schinkel<br />
errichteteten ehemaligen Berliner Bauakademie operiert, selbst gelöscht undeine<br />
buchstäblich medienarchäologische Situation hinterlassen: die Glasplattenbestände<br />
des photogrammetrischen Archivs, nicht aber die Akten <strong>von</strong> dessen logistischer<br />
Administration. So ist eine annähernd vollständige und genaue <strong>Geschichte</strong><br />
der Meßbildanstalt und ihrer Nachfolgeinstitution (Staatliche Bildstelle) nicht darzustellen;<br />
in den entscheidenden Beständen des Preußischen Kultusministeriums<br />
(Rep. 76) im Geheimen Staatsarchiv verweisen die Fmdbücher auf vollständige<br />
Kriegsverluste bei allen die Meßbildanstalt und die Nachfolgerin betreffenden<br />
Akten zu Schriftwechsel, Planungen, Anträgen, Berichten und Personalangelegenheiten.<br />
41 Staatsarchivische arrays sind also vorgesehen <strong>für</strong> das Gedächtnis der<br />
Meßbildanstalt, die Speicherplätze selbst aber sind voids. Leerstellen nicht nur auf<br />
der Ebene des Symbolischen, also der Akten-Dokumentation, sondern auch des<br />
Realen, der Physik dieses Gedächtnisses. Historiographie pflegt nicht nur das Wissen<br />
<strong>von</strong> Quellen, sondern auch das ihrer Verfasser zu rekonstruieren; beiderlei<br />
Datenmengen finden im homogenen Medium Schriftarchiv statt. Medienarchäologie<br />
hingegen hat es nicht mehr schlicht mit Dokumenten, sondern auch mit den<br />
Monumenten ihrer Erstellung zu tun; neben das Schriftregime tritt die Konstruktion<br />
der Apparate. Denn Daten sind Ergebnisse eines Meß- oder Beobach-<br />
Reiner Koppe, Zur <strong>Geschichte</strong> und zum gegenwärtigen Stand des Meßbildarchivs, in:<br />
Albertz / Wiedemann 1997: 41-57 (41). Eine Liste noch vorliegender Archivalien<br />
außerhalb <strong>von</strong> Wetzlar gibt Meyer 1985.
MKYDKNHAUKRS PHOTOGRAMMHTRISCHKS DHNKMÄLHR-ARCHIV 965<br />
tungsprozesses; Quellen dagegen werden häufig als unmittelbarer Teil, als Überreste<br />
der gestrigen Welt angesehen - die ganze Differenz <strong>von</strong> Konstruktivismus<br />
und Hermeneutik. 42 Bislang wurden zwei authentische Meydenbauer-Kameras in<br />
der Schweiz aufgefunden; <strong>von</strong> den Bildern des Meßbildarchivs wurden jedoch<br />
keine damit aufgenommen. »Alle anderen historischen Kameras sind entweder<br />
zerstört oder müssen als verloren gegangen betrachtet werden. Genaue Daten zur<br />
Meßkamera-Orienierung stehen nicht zur Verfügung« und sollen vielmehr im<br />
Rahmen eines Forschungsprojekts {Bestimmung der Inneren Orientierung <strong>von</strong><br />
historischen Architekturaufnahmen des Berliner Meßbildarchivs) »nachträglich<br />
bestimmt werden« 43 - womit Datenrückpeilung (ein Begriff <strong>von</strong> Thomas Pynchon)<br />
ebenso das Archiv wie die Apparate meint. Diese innere Orientierung ist,<br />
im Unterschied zur Psyche <strong>von</strong> Historiographien, bestimmbar, rationalisierbar, d.<br />
h. rechenbar, als speicherarchäologische Diskontinuität datierbar.<br />
Photographie und Gedächtnis^<br />
Die Objekt-, Bild- und Textdepots der Speicheragenturen im 19. Jahrhundert<br />
(Museen, Archive und Quelleneditionen) werden in der Praxis nicht als Dispositive<br />
der Historie, sondern als Datenbanken behandelt, »deren Datenmenge<br />
numerisch so groß war, daß man über sie nur mehr virtuell zu verfügen vermochte«.<br />
45 Der virtuelle Raum zur Sortierung der Bilder und Daten ist der <strong>von</strong><br />
narrativer <strong>Geschichte</strong>. Neue Modi der Gedächtnissortierung sind als Effekt des<br />
Realen neuer Medien wie der Photographie angelegt, bleiben aber epistemologisch<br />
an vorgängigen Medien der Speicherung orientiert (Gegenstand eines<br />
neuen Speichermediums ist - frei nach McLuhan - jeweils das alte). Die im<br />
Umgang mit der alphanumerischen Ordnung des Archivs (seinem Paratext) vertraute<br />
Praxis liest und speichert auch photographische Indizien wie Urkunden;<br />
die rhetorische Präfiguration der Historiographie (Synekdoche und Metonymie<br />
als Bedingung <strong>von</strong> Kontextualisierung) ist schon im vorgängigen Akt der<br />
Speicherung am Werk, bei der Infrastrukturierung des Speichers und seiner<br />
42 Christian Fleck / Albert Müller, »Daten« und »Quellen«, in: Österreichische Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Geschichtswissenschaften'8, Heft 1 (1997), 101-126 (111), unter Anspielung<br />
auf Johann Gustav Dröysens Historik<br />
41 Chengshuang Li, Nachträgliche Kalibrierung der historischen Mcydcnbaucr-Kameras,<br />
in: Albertz / Wicdemann 1997: 63-77 (67)<br />
44 Siehe auch W. E., Ex-Positionen: Fotografie, Museum, Historie, in: Fotogeschichte.<br />
Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> und Ästhetik der Fotografie 35 (1990), 49-59<br />
43 Herta Wolf, Das Denkmälerarchiv Fotografie, in: Camera Austria 51/52 (1995), 133-<br />
145 (133); die Ordnung der vorliegenden Argumentation orientiert sich am Anmerkungsapparat<br />
dieses Aufsatzes.
966 INVENTAR UND STATISTIK<br />
Adressierung. Das technische Bildmedium Photographie ist durch Fragmentierungen,<br />
Detailsichten, Vergleichbarkeit, Entkontextuahsierung und die numerische<br />
Ordnung charakterisiert; Phototheorie bezeichnet sie überhaupt als<br />
metonymisches Verfahren: »Wobei die Metonymie dem Konzept des Archivs<br />
oder besser noch des Katalogs verglichen werden könnte, weil sie wie dieser die<br />
Ordnung des Nebeneinanders und damit der Zahl an die Stelle jeglicher anderer<br />
Struktur setzt« . Metonymie ist eine reduktive rhetorische<br />
Strategie, vermittels derer ein Teil <strong>für</strong> das Ganze in einer rein mechanischen<br />
Weise steht, ohne dabei irgendeinen organischen Bezug zu einer Totalität zu<br />
behaupten - im Unterschied zur integrativen Figur der Synekdoche, die genau<br />
dies suggeriert. 46 Das 19. Jahrhundert vermag Bildarchive nur in der Kopplung<br />
an alphabetische Textmedien zu adressieren, also per Eigennamen oder ikonographischer<br />
Verschlagwortung. Als der Photograph Baldus vom französischen<br />
Staatsministenum den Auftrag erhält, den Neubau des Pariser Louvre zu dokumentieren<br />
und in der diskreten Aufzeichnung architekturaler Module ästhetisch<br />
zwischen Bauzeichnung, d. h. zusammensetzender Konstruktion und Auflösung<br />
des Gebäudes als Ruine oszilliert, wird sein Inventarisierungsprogramm<br />
»durch die Gleichzeitigkeit <strong>von</strong> Bennenung und bildlicher Darstellung <br />
über den Informationsträger Buch in Umlauf gebracht« .<br />
Archiv, Bibliothek und Museum sind Subjekt wie Objekt <strong>von</strong> Gedächtnisarbeit;<br />
dieser Verbund ist dabei spezifisch medienqualitativ differenziert. Bevor<br />
Daten prozessiert im Medium der Erzählung als <strong>Geschichte</strong>(n) in Bibliotheken<br />
einstellbar sind, ist ihnen ihre Sammlung als Archiv vorgängig. Meydenbauer<br />
vergleicht das Organisationsprinzip seines Denkmälerarchivs mit dem der<br />
Bibliothek: Man finde in dessen Sammelbänden »alles in bequemster Zugänghchkeit,<br />
wie in einer Bibliothek« ; die<br />
Glasplatten selbst aber bilden cm non-diskursives Archiv. Das Archiv als vorherrschende<br />
Organisationsform photographischer Bedeutungskonstituierung<br />
ist ihm ursprünglich eingeschrieben: »bereits 1839, im ersten Jahr der Fotografie«<br />
. Das <strong>von</strong> der Staatlichen Bildstelle Berlin erstellte Verzeichnis<br />
der Aufnahmen des Meydenbauerschen Archivs unterstreicht im<br />
Vorwort zur 4. Auflage 1939, daß die Bewußtwerdung des geschichtlichen und<br />
künstlerischen Wertes <strong>von</strong> nationalen Baudenkmalen einhundert Jahre zuvor<br />
mit der etwa gleichzeitigen Erfindung der Photographie zusammenfiel - eine<br />
Kontingenz, aus der kein geschichtlicher Sinn, sondern eine medienarchäologische<br />
Konfiguration (eines neuen Archivs) ableitbar ist. Die Vorspurung <strong>von</strong><br />
Denkmal und Photographie ist der Wille zur Archivierung an der Schnittstelle<br />
16 Siehe Hayden White, Metahistory. The histoncal imaginauon in ninctcenth-century<br />
Europe, Baltimore, Mar. / London (Johns Hopkins UP) 1973, 31 ff
MKYDHNBAUURS I'HOTOGRAMML-:TRISCHI;S DI-:NK.MÄ[.I-:R-ARCIIIV 967<br />
<strong>von</strong> diskursiven und non-diskursiven Faktoren. Photographie als »Motor der<br />
Extentonahsierung <strong>von</strong> Erinnerungsspuren« 47 potenziert damit eine Eigenschaft,<br />
die bereits <strong>für</strong> Denkmalarchitektur gilt. Die dauerhafte Bewahrung<br />
macht die Photographie nicht zum Dokument des Denkmals, sondern zu seinem<br />
Äquivalent. »In diese Zeit hinein wurde Albrecht Meydenbauer geboren«<br />
. Die Funktion des Speichers wird vom Rand der Zerstörung<br />
her gedacht. Das gilt parallel <strong>für</strong> die Bewertung eines anderen, auf Negativen<br />
beruhenden Reproduktionsmedium musealer Bewahrung: »Die Dauerhaftigkeit<br />
des Gipses hört da auf, wo überhaupt auch die Existenz der Onginalalterthümer<br />
selbst zerstört wird, d. h. unter freiem Himmel in Regen und<br />
Frost oder feuchten Lokalen.« 48<br />
Gilt die Gleichursprünghchkeit <strong>von</strong> Denkmalinventansierung und Photographie?<br />
<strong>Im</strong> Medium Photographie wird das Archiv autoreferentiell; die ersten<br />
Daguerrotypien zeigen bevorzugt Sammlungen. Der Sekretär der französischen<br />
Academie des Sciences, der Physiker und Astronom F. J. D. Arago, träumt vom<br />
Gewinn <strong>für</strong> die kunsthistorische und archäologische Forschung, hätte sie schon<br />
bei Napoleons Ägyptcnfcldzug über Daguerrotypien verfügt, um Inschriften<br />
ohne fälschende Zeichnerhand zu reproduzieren:<br />
»Beim Anblick der ersten <strong>von</strong> Herrn Daguerre ausgestellten Bilder mußte sich<br />
Jedem der Gedanke aufdrängen, welchen ausserordentlichen Vortheil während der<br />
ägyptischen Expedition ein so genaues und schnelles Mittel der Wiedergabe<br />
gewährt haben würde; mußte Jedem beifallen, daß, wenn die Photographie schon<br />
im Jahre 1798 bekannt gewesen wäre, wir heute im Besitz getreuer Bilder einer<br />
guten Anzahl emblematischer Darstellungen sein würden, die der gelehrten Welt<br />
durch die Habgier der Araber & den Vandalismus gewisser Reisenden verloren<br />
gegangen sind. Um die Millionen und aber Millionen Hieroglyphen zu copiren,<br />
welche die großen Monumente <strong>von</strong> Theben, Memphis, Karnak u. s. w. sogar<br />
äußerlich bedecken, würde eine lange Reise <strong>von</strong> Jahren und würden Legionen <strong>von</strong><br />
Zeichnern erforderlich sein. Mittels des Daguerrotyps vermochte ein einziger<br />
Mensch diese unendliche Arbeit zu gutem Ende zu führen.« 4 ''<br />
Photographie bildet Sammlungen nicht schlicht ab, sondern generierte neue Formen<br />
der Organisation, Speicherung und Darstellung des Wissens, etwa Louis<br />
47 Bernd Busch, Das fotografische Gedächtnis, in: Kai-Uwe Hemken (Hg.), Gedächtnisbilder.<br />
Vergessen und Erinnern in der Gegenwartskunst, Leipzig (Reclam) 1996,<br />
186-204(187)<br />
4X Ludwig Lindenschmit (Sohn), Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuscums in Mainz, in: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des<br />
Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabern) 1902, 1-72 (24)<br />
49 Louis Arago, Das Daguerreotyp (1839), zitiert nach: Hubertus <strong>von</strong> Amelunxen, Die<br />
aufgehobene Zeit. Die Erfindung der Photographie durch William Henry Fox Talbot,<br />
Berlin (Nishen) 1988,58
968 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
Rousseaus Photographie zoologique. Welcher Maler oder Zeichner kann Blumen,<br />
Blätter etc. »mit mehr Wahrheit darstellen, die in den Vergrößerungen außerdem<br />
noch einen Blick in eine dem bloßen Auge unbekannte Welt gestatten!« Traer<br />
photographiert den Fuß einer Spinne und die Zungenspitze einer Stechfliege;<br />
nicht Partialobjekte <strong>von</strong> Lebendigem, sondern das Leben selbst soll im Medium<br />
kristallisieren:<br />
»Man erhält an grösscren Insekten die vollkommene Beibehaltung der natürlichen<br />
Stellung, wenn man dieselben in eine Glas mit eingetriebenem Stöpsel bringt, worin<br />
am Boden sich etwas Cyankalium befand. Die Tödtung findet in einigen<br />
Sekunden statt und man bemerkt nicht die geringsten Veränderungen in der Stellung<br />
des Insekts. So hat ein gelehrter Insektensammler, Sabatier, eine Methode entdeckt,<br />
die ihm gestattet, Positivs <strong>von</strong> lebenden Insekten zu erzeugen, die sehr rein<br />
und kräftig erscheinen.« <br />
Wo Apparate die Kriterien des Archivs umdefinieren, operieren sie quer durch<br />
Diskurse und Disziplinen. Auch Archäologie und Numismatik schlagen aus der<br />
Photographie Kapital durch die Vervielfältigung paläographischer Manuskripte,<br />
seltener Drucke, historischer Kupferstiche und Gemälde, antiker Urnen, Vasen<br />
und Münzen; somit sind den Wissbegiengen »Gegenstände zugänglich gemacht,<br />
die sonst im Verborgenen oder an fernen Orten aufbewahrt wurden und <strong>für</strong> die<br />
Wissenschaft so gut wie begraben waren« . Das neue<br />
Medium betreibt sekundäre Archäologie, wissensarchäographisch. Und da sie<br />
»den Wert einer Sache in ihren Ausstellungswert verwandelt, kann man zugleich<br />
behaupten, die Photographie verwandele die Welt in ein Warenhaus oder ein<br />
mauerloses Museum.« 50 Genau diese Vermutung steht bereits am Ursprung der<br />
Photographie. 1839 bemüht sich der Journalist und Kunstkritiker Jules Janin,<br />
eine Beschreibung der Daguerrotypie als »das treue Gedächtnis aller Denkmäler,<br />
aller Landstriche des Universums« zu geben - die »unablässige, spontane,<br />
unersättliche Reproduktion der hunderttausend Meisterwerke, die die<br />
<strong>Geschichte</strong> auf der Oberfläche der Erde errichtet bzw. umgestürzt hat« . Das musee imaginaire entfaltet Janin aus der Gleichheit<br />
aller Dinge vor der Kamera, die sich aus den alltäglichsten Gegenständen<br />
zuwendet, »die Hoffnung auf eine Generalinventur der sichtbaren Welt, auf die<br />
allmähliche Errichtung eines riesigen Bildarchivs und die totale Kommunizierbarkeit<br />
<strong>von</strong> Erlebnissen mittels der technischen Apparatur.« 51 Seit 1837 fungiert<br />
die französische Denkmälerkommission als Herausgeber eines Werkes namens<br />
Marianne Kesting, Die Diktatur der Photographie. Von der Nachahmung der Kunst bis<br />
zu ihrer Überwältigung, München/Zürich 1980, 21 f (in Anlehnung an Walter Benjamin)<br />
Bernd Busch, Das fotografische Gedächtnis, in: Kai-Uwe Hemken (Hg.), Gedächtnisbildcr.<br />
Vergessen und Erinnern in der Gegenwartskunst, Leipzig (Reclam) 1996,<br />
186-204(193)
MKYDHNBAUKRS PIIOTOGRAMMI-.TKISCHI-S DKNK.MÄLI-:R-ARCHIV 969<br />
Archives de la Commission des Monuments Histonques, um Objekte durch<br />
Umschalten <strong>von</strong> Abbildung in Dokumentation als Monumente <strong>für</strong> immerwährende<br />
Zeiten zu erhalten . Nur an den diskursiven<br />
Schnittstellen zum ästhetischen Diskurs also gilt hier das Bild; seine verborgene<br />
Infrastruktur aber heißt Graph, d. h. Aufzeichnung als Vermessung, <strong>für</strong> die seit<br />
1851 in Frankreich auch Photographie eingesetzt wird. Von diesem Moment an<br />
steht das Bild nicht mehr in einem metonymischen Verhältnis zu den Maßen<br />
des Archivs, sondern schreibt sich selbst darin ein. Und die Diagraphen, mit<br />
deren Hilfe das erste kopierte Museum in Versailles um 1830 entstand, waren<br />
nichts anderes als photogrammetrische Apparate: »Maschinen, die Vorbild und<br />
Abbild als Analogon begriffen, um ersteres vermittels der (automatisierten)<br />
Berechnung in eine Kopie überführen zu können«. 52<br />
Photogrammetne in Müitäreinsatz und Archäologie<br />
»Die Organisirung der Photographie <strong>für</strong>'s Militär ist beinahe in allen französischen<br />
Corps vollständig« . Was Kunstgeschichte mit<br />
der fuzzy logic <strong>von</strong> Stilgeschichte noch toleriert, verzeiht militärisches Kalkül<br />
— nicht. Als Meydenbauer zur institutionellen Durchsetzung der Photogrammetrie<br />
an das mächtigste aller Staatsunternehmen, das Militär und seinen Bedarf an<br />
Rekognizierungstechniken, appelliert, und angesichts der Festung Saarlouis<br />
1868 seine Vermessungstechnik zum Einsatz bringt, wird ihm eine Reihe <strong>von</strong><br />
Meßungenauigkeiten zum Verhängnis. Saarlouis ist der Ort, wohin Meydenbauers<br />
Vater, ein Mediziner, als Militärarzt zum 30. Infanterieregiment versetzt<br />
worden war, nachdem er am Befreiungskrieg gegen Napoleon als Kompame-<br />
Chirurgus teilgenommen hatte 33 ; der chirurgische Blick überträgt sich auf<br />
die Apparate des Sohnes. Der Knegsemsatz der Photogrammetne vor der Festung<br />
Straßburg bleibt ohne Effekt. <strong>Im</strong>merhin kommt es am 1. September 1870<br />
zur Mobilmachung des Feld-Photographie-Detachements, das in Mundolshcim<br />
mit der Vermessung der Belagerungsfront gegen Straßburg beginnt; als<br />
diese Festung am 28. September in aussichtsloser Lage kapituliert, sind die Vor-<br />
32 Herta Wolf, Fixieren - Vermessen: Zur Funktion fotografischer Registratur in der<br />
Moderne, in: Norbert Bolz u. a. (Hg.), Riskante Bilder, München (Fink) 1996, 239-<br />
258 (255f)<br />
53 Historisches Archiv Wetzlar, NL Prof. Albrecht Meydenbauer (1834-1921), Karton<br />
III, Couvert mit Aufsatz (TS) <strong>von</strong> Franz Gräff (St. Wendel), 1991: Albrecht Meydenbauer<br />
- ein grosser Sohn der Gemeinde Tholey . Anlage: Sterbe-<br />
Akte des Vaters <strong>von</strong> Albrecht Meydenbauer, Geburtsurkunde A. B. Vater: 1797 in<br />
Bahrendorf (Franken) geboren; seit 1825 als Distnktarzt in Tholey. Dort Gedenktafel<br />
Metzer Straße (Geburtshaus).
970 • INVKNTAR UND STATISTIK<br />
arbeiten zur Vermessung gerade erst abgeschlossen. »Wegen der auch unter<br />
Bedingungen des Stellungskrieges noch enormen Vorlaufzeiten verlor die Armee<br />
nahezu vollständig das Interesse an derartiger photographischer Aufklärung«<br />
; am 11. März 1871 wird die Abteilung in Berlin demobilisiert.<br />
Die Debatte verläuft daraufhin über die Frage: Konstruktionsfehler im<br />
Apparat oder im Verfahren? Meydenbauers Vortrag in Aachen beschwichtigt<br />
1881 im Streit mit Doergens (1879-1901 Professor <strong>für</strong> Geodäsie an der Technischen<br />
Hochschule Berlin), das Aufnahmegerät sei schlicht nicht justiert gewesen.<br />
54 Nach dem militärischen Scheitern vor Ort also soll die neue Technik »nur<br />
zur supponierten Vernichtung, sprich Muscalisierung <strong>von</strong> Gebäuden eingesetzt<br />
werden, nicht aber zur Vernichtung selber«
Ml-.YDKNBAUl-.RS I'l IOTOGRAMMKTRISCHHS DHNKMÄI.HR-ARCHIY 971<br />
es zwar 1910 zu Dokumentationen archäologisch interessanter Ruinen durch<br />
die preußische Meßbildanstalt (im Anschluß an die Dokumentation mittelalterlicher<br />
deutschen Bauruinen, um solche Monumente gegebenenfalls als Ruine<br />
wiederherstellen zu können), doch die meisten dieser Aufnahmen werden schon<br />
nicht mehr photogrammetnsch eingemessen. Erst die digitale Gegenwart macht<br />
Photovorlagen, auch uneingemesscn, rechen-, also meßbar (virtuelle Photogrammetrie).<br />
Zur Ausstellung kommen die griechischen Aufnahmen in Berlin<br />
(Lehrter Bahnhof) 1911. Auf den Ausstellungsbildern bleibt der photogrammetnsch<br />
unabdingbare Meßstreifen am oberen Bildrand mit sichtbar, ein Memento<br />
der Tatsache, daß der <strong>Im</strong>puls zu den Aufnahmen nicht im Ästhetischen, sondern<br />
im Inventarischen lag. Nicht sichtbar ist dieser Bildstreifen in den kommerziell<br />
vertriebenen Bilderbüchern der Anstalt; in diesem Medium muß sie ihre funktionale<br />
Begründung im Vermessungszweck subhmieren. Am Interface des<br />
Archivs zur Öffentlichkeit kippt das diskret vermessene Monument (als Information)<br />
ms Symbolische des national kodierten Denkmals. Der Versuch des<br />
Nachweises der Eignung photogrammetnscher Aufnahmen zur Darstellung<br />
künstlerischer Werte respektive die Aufheizung der Photographien selbst zu<br />
Kunstwerken kaschiert so ihre eigentliche Funktion: Aufzeichnung. In der Berliner<br />
Ausstellung wird das photogrammetnsche Bildgedächtms zum lkonostatischen<br />
Apparat; in der Mitte des Hauptraums sind Bilderständer, »die man wie<br />
die Seiten eines Albums umblättern konnte«, in zwei Reihen aufgestellt . War eines der in deutschen Bildungsanstalten verteilten Photobände<br />
mit Aufnahmen antiker Bauten Griechenlands die Grundlage <strong>für</strong> Heideggers<br />
Aufsatz über den Ursprung des Kunstwerks, der die Aura des Originals auf der<br />
Kenntnis <strong>von</strong> Reproduktionen behauptet?' 1 ' 1<br />
Meßaufnahmen verlangen keine ästhetischen Optionen. In der Schweiz zeichnet<br />
Hans Conrad Escher <strong>von</strong> der Linth Ende des 18. Jahrhunderts mit Hilfe (und<br />
als ausdrücklicher Effekt) <strong>von</strong> Panorama-Apparaturen Landschaften, um Gebirge<br />
zu inventarisieren; Ziel ist nicht malerische Schönheit, sondern die geognostische<br />
Analyse <strong>von</strong> Faltungsstrukturen.-"' 7 In einem Artikel zum 100. Geburtstage Albrecht<br />
Meydenbauers kommt <strong>von</strong> Lüpke 1934 auf die Spannung <strong>von</strong> Ästhetik und<br />
aislhesis in der photogrammetnschen Gedächtnisarbeit zurück:<br />
»Kin solches, noch so einwandfrei genaues Maßgcnppe bedeutet aber <strong>für</strong> den Bauforscher<br />
und DenkmalpHeger nicht mehr als vergleichsweise etwa <strong>für</strong> den Geologen<br />
der Höhenschichtenplan eines Gebirges. Denn gerade bei den baugeschichtlich<br />
' Siehe W. E., Framing the Fragment: Archaeology, Art, Museum, in: Paul Duro (Hg.),<br />
The Rhetoric of the Frame. Essays on the Boundaries of the Artwork, Cambridge /<br />
New York (Cambridge UP) 1996, 111-135<br />
Dazu Stephan Oettermann, Das Panorama. Die <strong>Geschichte</strong> eines Massenmediums,<br />
Frankfurt/M. (Syndikat) 1980, 271 (Hinweis Christoph Keller, Berlin)
974 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
<strong>von</strong> verfallenen Gebäuden überführbar« macht. 62 Diese Rechenleistung aber<br />
liegt gerade außerhalb der Medienkapazität des Denkmälerarchivs; ein wissensarchäologischer<br />
Bruch trennt es <strong>von</strong> der Epoche der Digitalität.<br />
Photographische Reich(s)weiten: Monumenta Germaniae<br />
Ein durch den preußischen Staatskanzler Hardenberg ergangener Erlaß <strong>von</strong><br />
1822 weist die archivischen Provinzinstanzen an, auch nicht-archivahsche<br />
Relikte der Vergangenheit zu verzeichnen. Das wahrscheinliche Modell da<strong>für</strong><br />
ist seinerseits <strong>von</strong> dem damaligen Ersten Geheimen Archivar auf der Plassenburg<br />
bei Bayreuth, Philipp Ernst Spieß, vorgefaßt. 63 Dessen Schrift empfiehlt,<br />
beim Abriß <strong>von</strong> Schlössern, Kirchen u. a. Bauwerken vorab Zeichnungen anzufertigen<br />
und im Archiv zu deponieren; mit der Zerstörung im Realen korrehert<br />
eine Aufbewahrung im Symbolischen, ein semiotischer Tausch, der die<br />
Destruktion diskursiv erst vertretbar macht. So seien vorab »genaue Abzeichnungen<br />
da<strong>von</strong> zu nehmen und diese im Archiv verwahrheh niederzulegen«; die<br />
inner- oder außerhalb eines solchen Gebäudes befindlichen Monumente sollen<br />
im Neubau wieder »an einem schicklichen Ort aufzurichten« sein.« 64 Es gibt<br />
eine Reziprozität <strong>von</strong> Archäologie und Archiv als symbolischer Tausch. Was an<br />
Münzen, Urnen und anderen Altertümern »bey Abreissung alter Gebäude in<br />
Grund-Sternen, auf dem Feld oder anderswo gefunden und angegraben« wird,<br />
da<strong>von</strong> muß der Archivar »ohn umgänglich Wisenschaft erhalten« .<br />
Bedingt der Abriß eines realen Gebäudes seinen Aufriß im Symbolischen der<br />
Zeichnung, verzeichnet das Archiv die mnemischen Werte. Der Wunsch einer<br />
landesweiten Denkmälerinventarisation (als Bildarchiv) korrespondiert mit der<br />
Forderung, daß »die Gegenwart eines Archivars ohnentbehrheh wäre«; das<br />
Moment der strukturierten Speicherung ist dem Akt der Aufzeichnung bereits<br />
62 Wolf 1995: 140, unter Bezug auf: Dieter Bartetzko, Halluzinierte <strong>Geschichte</strong>: Computer<br />
stellen Baudenkmäler wieder her, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 25. April<br />
1995,37<br />
63 Reinhart Strecke, Die westfälische Denkmälerinventarisation <strong>von</strong> 1822 und die<br />
Anfänge der Denkmalpflege in Preussen, in: Hans-Joachim Behr /Jürgen Kloosterhuis<br />
(Hg.), Ludwig Freiherr Vincke: ein westfälisches Profil zwischen Reform und<br />
Restauration in Preußen, Münster (Selbstverl. des Vereins <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und Altertumskunde<br />
Westfalens: Abt. Münster) 1994, 483-494 (493). Zu Spieß« Anregung eines<br />
frühen denkmalpflegerischen Erlasses Alexanders, des Markgrafen zu Brandenburg,<br />
in der Zeitschrift: Historische Litteratur <strong>für</strong> das Jahr 1781, hg. v. Johann Georg Meusel,<br />
1. Bd., Erlangen 1781, 270ff, siehe die Miszelle <strong>von</strong> Gustav A. Seyler, Zur <strong>Geschichte</strong><br />
der Denkmalpflege, in: Die Denkmalpflege, III. Jg. Nr. 9 (Berlin), Juli 1901<br />
64 Philipp Ernst Spieß, Von Archiven, 1777, 54
MI:VDI-:NBAUI:RS IM IOTOGRAMMI;TRISCHI:S DKNKMÄLI-IR-ARC! IIV 975<br />
vorgängig. 65 Mit der Photogrammetrie wird die Präsenz des Archivars durch<br />
die Kalibrierung des Apparats und das System der Meßpunkte selbst ersetzt.<br />
Die Differenz zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert im Modus der Inventansation<br />
wird durch Medienwechsel bestimmt - als das technische Gesetz dessen,<br />
was registriert werden kann. Endlich ersetzen die Vermessungsbilder gewissermaßen<br />
die Wirklichkeit , doch nicht im passiven<br />
Sinne der Bewahrung dessen, »was dem Fluß der Zeit oder den kommunikationstechnologischen<br />
Innovationen des beginnenden 20. Jahrhunderts zu weichen<br />
hatte«, sondern indem sie medienaktiv Sichtdispositiven zum Durchbruch<br />
verhalfen, welche als Photographien oder als Stereoskopien »die berufenen Mittel<br />
<strong>für</strong> die Erinnerung an eine zum Nachbildner gewordene Wirklichkeit <strong>von</strong><br />
sekundärer Bedeutung« waren . Das Königliche Denkmälerarchiv<br />
in Berlin (wie Meydenbauer es nennt) stellt dabei vielmehr ein Dispositiv<br />
denn ein eigentliches Archiv dar; seine photogrammetrischen Aulnahmen<br />
dienen als Vorlagen <strong>für</strong> das eigentlich intendierte Ziel, die perspektivisch regelgeleitete<br />
Aufzeichnung eines Bauwerks in Grund- und Aufriß . Dabei sind Relationen, nicht absolute Maße bestimmend - das<br />
medial induzierte Dazwischen der Ordnung der Dinge. Um 1900 realisiert der<br />
rheinische Denkmalschutz unter Paul Clemen die Option <strong>von</strong> Meydenbauers<br />
Meßbildunternehmen <strong>für</strong> die Kunstdenkmäleraufnahme, praktischen Denkmalpfleg<br />
und Bauforschung. Nicht nur setzt Clemen sich <strong>für</strong> den Ankauf sämtlicher<br />
unter Leitung Meydenbauers hergestellten Aufnahmen rheinischer<br />
Bauwerke ein; seit dem Sommersemester 1905 bietet er selbst Praktische Übungen<br />
im Photographieren und im Aufmessen <strong>von</strong> Gebäuden an. 66 Fortan bildet<br />
die Gedächtnistechnologie eine Schnittstelle zur Praxis <strong>von</strong> Kunstschutz.<br />
Ab 1870/71 organisiert sich das deutsche Gedächtnis auch reichsweit. Meydenbauer<br />
verweist 1884 auf die entsprechende Transformation der Monumenta<br />
Germamca histonca, »gewissermaßen als erste Regung des deutschen Nationalgefühls,<br />
nach kümmerlichem Fortschritt in der kaiserlosen schrecklichen Zeit« -<br />
Gedächtnisagenturen in Latenz - »jetzt vom Deutschen Reich fortgeführt«<br />
. Diesem Unternehmen der Edition deutscher Dokumente<br />
des Mittelalters stellt er 1894 den Vorschlag einer Edition <strong>von</strong> Monumenten<br />
im Sinne der Architektur zur Seite. Die Homologie appelliert an ein und<br />
dasselbe archivische Dispositiv aller möglichen (Kultur-)Histone: Ein Deutsches<br />
65 Spieß ebd., 54; dazu auch Bereut Schwinekörper, Zur <strong>Geschichte</strong> des Provenienzprinzips,<br />
in: Staatliche Archivverwaltung [DDR] (Hg.), Forschungen aus mitteldeutschen<br />
Archiven [Festschrift Hellmut Kretzschmar], Berlin (Rütten & Locning) 1956,<br />
48-65 (50)<br />
66 Ausstellungskatalog »Der Rhein ist mein Schicksal geworden«. Paul Clemen 1866-1947.<br />
Erster Provinzialkonservator der Rheinprovinz, Köln (Rheinland-Verlag) 1991, 70
976 INVENTAR UND STATISTIK<br />
Denkmäler-Archiv (Monumenta Germaniae). Meydenbauer denkt die Reichseinigung<br />
<strong>von</strong> 1870/71 symbolisch zurück:<br />
»Schon lange vor Vereinigung der Deutschen unter einem Kaiser war in Gelehrtenkrcisen<br />
das Bedürfniss hervorgetreten, alle schriftlichen Aufzeichnungen,<br />
welche auf die <strong>Geschichte</strong> der deutschen Länder Bezug hatten, in zuverlässiger<br />
Wiedergabe zu einem grossen Werke zu vereinigen. Es sollte ein Quellenwerk<br />
geschaffen werden, in dem die geschichtliche Forschung Alles bei einander fand,<br />
ohne die Einzelwerke an räumlich sehr entfernten und oft schwer zugänglichen<br />
Oiten erst suchen zu müssen.«'' 7<br />
Meydenbauer setzt die Erinnerung an die Monumenta Germaniae zugleich als<br />
Setzung ihrer Differenz ein, als Mahnung an »noch andere Dinge, die ebenso<br />
gemeinsames Gut des ganzes Volkes sind und seinem heutigen Thun und Denken<br />
noch unendlich näher stehen«, unmittelbare Dinge, also: Monumente im<br />
Sinne ihrer Präsenz. Das Gedächtnis der Bauten, ihre Architektur, steht dem kollektiven<br />
Bewußtsein näher als »die nur einem kleinen Kreis <strong>von</strong> Gelehrten wichtigen<br />
Schriftnachrichten« aus Archiven. Text und autopsiertes Objekt geraten in<br />
Widerstreit, wenn sie gemeinsam auf das Feld der Historie gezwungen werden:<br />
»Durch die ganze <strong>Geschichte</strong> hindurch haben sie eine unverfälschte und verständliche<br />
Sprache gesprochen; ganz im Gegensatz zu den Schriftnachrichten, in<br />
denen erst eine strenge Kritik mühsam Uebertreibung, Verfälschung und Missverständnisse<br />
ausmerzt, thun sie immer die reine Wahrheit kund. Begegnen beide<br />
sich auf dem gleichen Gebiet der <strong>Geschichte</strong>, so ist doch Eins auf das Andere zur<br />
Erklärung angewiesen. Wenn aber beide mit einander in Widerspruch gerathen,<br />
wird das Bauwerk immer Recht behalten müssen und mindestens die Unvollkommenheit<br />
der Schriftnachricht darthun.« <br />
Modell des intendierten Speichers bleiben nichtsdestrotz die MGH als Distributionsmedium.<br />
Vor der medienarchäologischen Schwelle zu photographischen<br />
Apparaten, die nicht nur - wie etwa die camera obscura -Licht reflektieren, sondern<br />
es auch zu speichern vermögen, stand die Sammlung <strong>von</strong> »zuverlässigen<br />
Bildern mit geometrischer Zeichnung und kritisch gesichteten historischen<br />
Nachrichten über die überkommenen Bauwerke«, die »wie die Einzelsachen der<br />
Monumenta histonca in Büchern hergestellt werden könnten«, vor einer technischen<br />
Unmöglichkeit. Apparative Optionen aber kommen nur in Kopplung an<br />
diskursive Energien zum Zug; erst die non-diskursive Kunst- und Bauinventarisation<br />
der Länder und Provinzen (also die Instrumente der Gedächtniskontrolle)<br />
schaffen überhaupt erst eine Aufmerksamkeit, die dann unter dem <strong>Namen</strong><br />
Geschichtsbewußtsein die frühere »Gleichgiltigkeit gegen die edelsten<br />
Güter unseres Volkes« diskursiv ablöst. Erst vor dem Hintergrund dieses infra-<br />
Albrecht Meydenbauer, Ein deutsches Denkmäler-Archiv (Monumenta Germaniae),<br />
in: Deutsche Bauzeitung 28, Nr. 102/103, Berlin (22. Dezember 1894), 629-631 (629)
MEYDENBAUERS PHOTOGRAMMETRISCHES DENKMÄLER-ARCHIV 977<br />
strukturellen Dispositivs aus Listen ist »die schleunige und erschöpfende Aufnahme<br />
der Bauwerke, gewissermassen ihre Festlegung in dem heutigen Zustande<br />
dringlich« . Eine Schnittstelle <strong>von</strong> Kulturgedächtnis<br />
und Infrastruktur bildet die Photogrammetrie auch auf Objektebene,<br />
weil mit ihrer Hilfe nicht nur »die Bauwerke der entferntesten Völker der Inder,<br />
Atzteken usw. einer kritischen Untersuchung <strong>von</strong> Fachmännern unterzogen<br />
werden können«, sondern auch die großen Bauwerke der Neuzeit: Eisenbahnbrücken,<br />
Viadukte, Wasserbauten . Zum<br />
Monument macht erst die Aufzeichnung das Objekt, durch dessen Arretierung<br />
und damit Klassifizierbarkeit, die Stetigkeit gegenüber dem beständigen Wandel<br />
des Artefakts erfordert. Auch transitorische Gebilde wie Wolken, die mehr als<br />
alle historischen Dinge sonst einer beständigen Veränderung unterworfen sind,<br />
sollen mittels der photographischen Apparatur eingefroren werden , wenngleich dies nie vollständig erreichbar ist: auch der Moment der<br />
Aufnahme unterliegt einer winzigen Zelterstreckung, die sich ablesen läßt. <strong>Im</strong><br />
unmittelbaren Anschluß an ein Blitzlicht der Natur, den Vulkanausbruch <strong>von</strong><br />
Krakatau 1882, stellt Jesse Form und Bewegung der auftretenden leuchtenden<br />
Wolken durch aus getrennten Stationen aufgenommene Meßbilder fest . Apparative Feststellung wird zur Aussage des sonst nicht<br />
mehr erzählbaren Katastrophischen, das Ereignis der Photogrammetrie; staubförmige<br />
Massen in Atmosphäre und Weltraum werden so erst beobachtbar und<br />
generieren ein wissensikonologisch rückkoppelbares Archiv der Energie, dessen<br />
Bilder nicht mehr im Allegorischen, sondern im Realen operieren. Das <strong>Im</strong>aginäre<br />
und Phantasmatische wird berechenbar, wenn es nicht mehr an das Medium der<br />
Erzählung, sondern der Maßgaben gekoppelt ist: »Da die Bilder der Fata raorgana<br />
objektiv sein müssen, so müssen sie auch durch Photographien festzuhalten<br />
sein«; um das Medium aber zum wissenschaftlichen statt romantischen<br />
Einsatz bringen zu können, muß der Untersuchende imstande sein, »jeder Aufgabe<br />
"wenigstens etwas, was an Maß streift, abgewinnen zu können« .<br />
Das Gedächtnis der Bilder ist korrupt. Alte Zeichnungen verschwundener Bauten<br />
sind unschätzbar trotz ihrer Unvollkommenheit in der Darstellung der Maße<br />
und Verhältnisse: »Es ist, als wenn <strong>von</strong> einem alten Manuskript schlechte, unverstandene<br />
Abschriften aus dritter und vierter Hand auf uns gekommen wären«.<br />
Demgegenüber eröffnet Photogrammetne die Option, noch präsente Bauwerke<br />
in ihrer reinen Monumentalität, als »zum Theil noch unverfälschte Urkunden« zu<br />
verrechnen . Das Bauwerk, als Urkunde wahrgenommen,<br />
versetzt die diplomatische Lesart des Begriffs wieder in den der Archäologie<br />
zurück. Die medienarchäologische Revolution aber vollzieht sich schneller, als<br />
Meydcnbaucrs Terminologie sie einzuholen vermag. Photographic war erst imstande,<br />
Material zu einem Dekmäler-Archiv zu liefern, nachdem es gelungen war,
978 ' INVKNTAK UND STATISTIK<br />
aus dem photographischen Bild absolute Maße und Verhältnisse herauszulesen.<br />
Ohne diese Kopplung an die darstellende Geometrie können namentlich die kleinen<br />
Photoformate des Handels nur das Laienauge befriedigen; »die strengeren<br />
Fragen des Archäologen und Architekten nach Maass, Konstruktion und baulicher<br />
Beschaffenheit bleiben unbeantwortet« . Photogrammetne<br />
leistet die Loslösung des Gedächtnisses <strong>von</strong> den topographischen<br />
lieux de memoire hinzu wissenstopologischen Orten:<br />
»Die Hauptaufgabe besteht in der Aufnahme, Sammlung und Aufbewahrung der<br />
photographischen Original-Negative, die mit besonderen, auf mathematischer<br />
Grundlage konstruirten Instrumenten hergestellt sind und auch ungewöhnlich<br />
deutliche Bilder ergeben, aus denen die Zeichnungen durch besondere<br />
Hilfskräfte aufgetragen werden können, ohne dass die Zeichner im Geringsten an<br />
Zeit und Ort gebunden sind. So kann nach 100 Jahren ein Bauwerk in Grund- und<br />
Aufnss mit allen Einzelheiten aufgezeichnet und nachgebaut werden, nachdem es<br />
selbst vom Erdboden verschwunden ist.« <br />
Das weist den Weg zu einem Gedächtnis, in deren Schatten Geschichtszeit aufgehoben<br />
ist. Die Drohung der Zersetzung des Gegenstands ist auch der <strong>Im</strong>puls<br />
<strong>für</strong> die andere monumentale Anwendung des neuen Mediums, die Urkundenreproduktion<br />
(im Kampf etwa gegen Tintenfraß, das Reale des Vergessens);<br />
Urkundenphotographic eröffnet die Option einer Reproduktion <strong>von</strong> Handschriften<br />
in integro . Mit der Entlokalisierung des Gedächtnisses<br />
der Objekte korrespondiert der archivästhetische Blick; das Durchblättern<br />
eines solchen Sammelbandes sei instruktiver als die Autopsie vor Ort, »da man<br />
durch Vergleichen zweier Bilder fast dasselbe erreicht, als durch Herumlaufen<br />
<strong>von</strong> der einen Seite eines grossen Gebäudes auf die andere, wobei die genaue Einprägung<br />
der Formen durch die zeitliche und räumliche Trennung des Sehens sehr<br />
erschwert wird« . Hier schreibt sich das mediale Dispositiv<br />
des Photoalbums und der Bildatlanten, in denen kulturelles Gedächtnis<br />
eine der möglichen Verteilungen zwischen Elementen im Raum wird, wie schon<br />
die Bilderwände in Galerien des 17. Jahrhunderts nicht schlicht visuelle Datenfluten,<br />
sondern mnemotechnische Anordnungen zeigten. 68 Andererseits entziffern<br />
wir das Paradigma der angehenden Dokumentationswissenschaften. Die in<br />
der vorliegenden Arbeit vorgenommene Konjunktion <strong>von</strong> Germanischem<br />
Nationalmuseum, Monumenta Germaniae Historica mit Archiven und Bibliotheken<br />
ist durch das 19. Jahrhundert selbst angewiesen. Meydenbauers Analogiebildung<br />
einer Edition <strong>von</strong> monumenta Germaniae arebaeologica sagt es:<br />
6S Siehe Matthias Bickenbach, Das Dispositiv des Albums. Mutation kultureller Erinnerung,<br />
in: Jürgen Fohrmann / Andrea Schütte / Wilhelm Voßkamp (Hg.), Medien der<br />
Präsenz (= Mediologie Bd. 3), Köln (Du Mont) 2001; ferner Michel Foucault, Andere<br />
Räume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute, Leipzig: Reclam 1990, 34-46 (37)
Ml'Yhi-.NHAUI.KN l'l IOT< K.KAMMI TRISC! II N Dl NKMAI I.K-AlUI IIY 979<br />
»Verschiedene Anläufe dazu sind auf Kosten des deutschen Reiches bereits<br />
gemacht, so die zeitig lmgange befindliche Limes-Forschung sowohl als das germanische<br />
Museum in Nürnberg, die als Theile eines grassen Ganzen schon vorweg<br />
genommen sind. Die jetzt noch isolirten Inventarien der Provinzen<br />
finden im deutschen Denkmäler-Archiv ihren natürlichen Vereinigungspunkt.<br />
Wenn ich nun noch die Beschreibung, Planzeichnung und kartographische<br />
Darstellung ihres Vorkommens der fast dem Volksbewusstsein verschwindenden<br />
Ringwälle anführe, so dürfte das Arbeitsgebiet der monumenta Germaniae<br />
umschrieben sein.« <br />
Meydenbauer erinnert ferner an den Vorschlag des Direktors des Germanischen<br />
Nationalmuseums Essenwein in Nürnberg, deutsche monumenta iconographica<br />
(mit Ausschluß der Bauwerke) zu edieren - eine Initiative, die trotz eingehender<br />
Verhandlungen der beteiligten Körperschaften ad acta gelegt wurde und so jetzt nachlesbar ist, als Archivdenkmal unter<br />
verkehrten Vorzeichen. Körperschaften stehen auf Seiten des Diskurses, Publikations-Korpora<br />
sind ihr Medium; Archivkörper sind ihr Grab.<br />
»Als erstes neues Reichsunternehmen ist das Germanische Museum in Nürnberg<br />
zu nennen. Jeder Besucher empfindet nach studenlangcm Durchwandern der<br />
mit Fleiss und Umsicht aufgehäuften Massen <strong>von</strong> Kunstschätzen, nicht immer<br />
ersten Ranges, bald Ermüdung. Die Schwierigkeit liegt im Anhäufen so vieler<br />
Kunstschätzc aus allen möglichen Gebieten in einem einzigen, noch dazu<br />
ursprünglich nicht einmal da<strong>für</strong> bestimmten Raum.« <br />
Meydenbauers Wiener Schüler Dolezal verweist unter dem Stichwort Germanisches<br />
Nationalmuseum in Nürnberg auf das semiotische double-bind d(ies)es<br />
Museums zwischen Objektsammlung und inventarisierender Aufzeichnung<br />
(respektive Reproduktion derselben); neben den materiellen Artefakten hat muß<br />
es auch »bildliche Darstellungen, Zeichnungen und Photographien <strong>von</strong> Baudenkmälern<br />
aufnehmen und der Nachwelt erhalten«. 69<br />
Grundsätzlich betrifft die rcichswcite Neuorganisation Deutschlands die<br />
Agenturen <strong>von</strong> Historie, Archiv und Archäologie ebenso wie die zweckwissenschaftlichen<br />
Bereiche Technik (Gründung des Deutschen Museums in München)<br />
und Physik (Physikalische Reichsanstalt); 1872 wird das Statistische<br />
Reichsamt gegründet. Geschichtspflege ist damit Teil eines umfassenderen Dispositivs<br />
der Datenorganisation, dessen Teilmenge sie nicht qua Infrastruktur ist;<br />
um Deutschland als Vergangenheit adressierbar zu machen, müssen seine<br />
Datenmengen nicht minder zweckwissenschaftlich vor- und aufbereitet werden.<br />
»Eine Kundgebung allgemeinen Charakters neuesten Datums nennt Meyden-<br />
69 E. Dolezal, Die Photographie und Photogrammetrie im Dienste der Denkmalpflege<br />
und das Denkmälerarchiv, Internationales Archiv <strong>für</strong> Photogrammetrie, 1. Bd.<br />
(1908/9), Wien / Leipzig 1909, 45-70 (50)
980 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Bauer die Errichtung des Museums <strong>von</strong> Meisterwerken der Naturwissenschaft<br />
und Technik in München und die physikalische Reichsanstalt, die »im Reiche<br />
aber nur einen sehr beschränkten Wirkungskreis hat« .<br />
Die epistemologische Struktur, die in jenen Unternehmungen diversester Disziplin<br />
als trait unaire durchscheint, ist der Zug, der Wille zur Kopplung <strong>von</strong> Aufzeichnung,<br />
Speicherung und Berechnung auf Basis <strong>von</strong> Vermessung. Daran<br />
gekoppelt steht ein unbestimmter, selbst aber bestimmender Raum, der des<br />
militärischen Befehls. Der preußisch-deutsche Monarch Wilhelm nimmt Patronagcn<br />
am konsequentesten im militärischen Fachbereich wahr, etwa die Mitteleuropäische<br />
Gradmessung, die der preußische General Baeyer als deutsche<br />
Unternehmung in internationalem Gewand anregt und leitet. Sie bot bald die<br />
Grundlage <strong>für</strong> eine Europäische, dann Internationale Erdmessung, eine »im<br />
Grunde deutsche Einrichtung unter internationaler Fassade«. 70 Nach 1871 heißt<br />
Reichsbildung vor allem Reichweite <strong>von</strong> Infrastruktur. Diese Struktunerung<br />
durchmißt Archive wie Ökonomien; die Hypothese der Nation bedarf der<br />
<strong>Im</strong>plementierung einer gemeinsamen Historie auf der Basis eines standardisierten<br />
Gedächtnisses nicht minder wie des Abgleichs <strong>von</strong> Maßsystemen zur<br />
Schaffung einer deutschen Verkehrs- und Wirtschaftseinheit. Standardisierung<br />
aber muß durchgesetzt werden und wird im Moment dieses Akts vom mathematischen<br />
zum politischen Problem. Dellbrück, vormals schon Organisator des<br />
preußischen Freihandelssystems, »sah als liberal-nationaler Bürokrat« (Gnewank)<br />
eine wesentliche Aufgabe des neu geschaffenen Staatswesens dann, die<br />
gemeinsamen Interessen der Nation auch auf der infrastrukturellen Ebene zu<br />
vertreten und konkret Garant deutscher Verkehrs- und Wirtschaftseinheit zu<br />
sein. Seit 1868 fungiert die Normaleichungskommission als erste wissenschaftliche<br />
Bundesbehörde <strong>für</strong> die Kontrolle des vom Norddeutschen Bundes angenommenen<br />
metrischen Maß- und Gewichtssysteme; dessen Leiter, der Berliner<br />
Astronom Wilhelm Förster, erarbeitet Vorschläge <strong>für</strong> eine wissenschaftliche<br />
Meterreform mit Zentralbüro in Paris. Auf einer diplomatischen Konferenz<br />
setzt Bismarck 1875 auf Delbrücks Betreiben gegen den Widerstand französischer<br />
und kleinstaatlicher Traditionalisten dieses Projekt durch, resultierend im<br />
Metervertrag vom 20. Mai. Auch in den folgenden Jahren ist es das Reichskanzleramt,<br />
das eine Reihe weiterer zweckwissenschaftlicher Reichsanstalten<br />
begründet, etwa 1872 das Statistische Reichsamt. Zwischen Historie und Statistik<br />
stehen die Baudenkmäler. Die Option ihrer maßgerechten Registrierung ist<br />
im Unterschied zu Unternehmen wie den Monumenta Germaniae Histonca<br />
: Unter Bezug auf die Kgl. Kabinettsorder v. 20. Juli 1861 Rolf Holmgren: Internat.<br />
Erdmessung, Diss. Tübingen 1927, hier zitiert nach: Karl Gnewank, Wissenschaft und<br />
Kunst in der Politik Kaiser Wilhelm 1. und Bismarcks, in: Archiv <strong>für</strong> Kulturgeschichte<br />
34(1952), 288-307(294)
MKYDHNBAUKRS PIIOTOGRAMMKTKISCHKS DKNKMÄI I:R-AI
982 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
Die Kopplung <strong>von</strong> Messung und Archiv bedarf der Standardisierung; in diesem<br />
Sinne plant Meydenbauer die Errichtung eines in Deutschland beheimateten<br />
Weltarchivs, das die Aufnahmen nicht allein speichern, sondern in deren<br />
Ermessen auch die Koordination der Aufnahmen liegen soll »und ihr Fortbestand<br />
im und als Bild« . Da es Ziel der Meßbildphotographie<br />
ist, auch »nach 100 Jahren ein Bauwerk in Grund- und Aufriss mit allen Einzelheiten«<br />
rekonstruieren zu können, selbst wenn es »vom Erdboden verschwunden<br />
ist« , bleibt nicht ein Simulakrum des Denkmals<br />
als Bild, sondern sein vermessenes Gedächtnis, ein Werk aus Gemotrie und<br />
Zahl. Historisches Interesse an der Vergangenheit erwacht gerade in dem Moment,<br />
wo der Gegenstand des Interesses buchstäblich zerfällt. Dieses momentum<br />
verbindet die Medien Photographie und Museum. In diesem Sinne wollen<br />
Denkmäler und Museen, Literatur und Film »zum Leben erwecken, was an<br />
Originalen vernichtet wurde.« Photographie aber macht die Differenz <strong>von</strong><br />
<strong>Geschichte</strong> als Ereignis und <strong>Geschichte</strong> als Museum unmöglich. Das Fotoarchiv<br />
Marburg mit seinen millionenfachen Negativen dokumentiert, wie das Gitter<br />
der Dinge längst durch den Archi(v)text des imaginären Museums ersetzt<br />
wird. Ganz im Sinne Meydenbauers vermag Photographie zu ȟberliefern, was<br />
physisch längst zerstört ist, und eröffnet damit die Möglichkeit zu dessen<br />
Rekonstruktion«; das Gedächtnis als Speicher der Dinge setzt sich über <strong>Geschichte</strong><br />
hinweg. 73 Auf dem 7. Internationalen Kongreß <strong>für</strong> Photogrammetrie<br />
in Washington (September 1952) macht der Ingenieur Placido Belfiore den Vorschlag<br />
eines International photogrammetrie archive of architectural masterpieces;<br />
seit 1972 gibt es tatsächlich eine Konvention der UNESCO Zum Schutz des<br />
natürlichen und kulturellen Erbes der Welt, die allen Mitgliedstaaten nahelegt,<br />
kulturell besonders kodierte Bauwerke in Photographien festzuhalten. Aus den<br />
archivierten Aufnahmen soll dann der Bauplan herausgelesen, d. h. herausgerechnet<br />
werden können; der Fall der Zerstörung wird <strong>von</strong> den Schutzmaßnahmen<br />
bereits mitgedacht. Der einzige Leser, der rechnet, wenn er liest,<br />
heißt Computer. Die virtuelle Rekonstruktion der prähistorischen Stadt und<br />
Ausgrabungsstätte <strong>von</strong> Catalhüyük (Anatohen) am Zentrum <strong>für</strong> Kunst und<br />
Medientechnologie in Karlsruhe setzt die nächste medienarchäologische<br />
Zäsur, nachdem die digitale Kamera nicht nur bei der Ausgrabung in situ<br />
zur Aufzeichnung eingesetzt wird, sondern auch zur Komplettierung der<br />
archäologischen Daten des britischen Ausgräberteams (Ian Hodder). Am Ende<br />
macht eine dreidimensionale cage den Gang durch die intakten Gebäude halluzinieren<br />
zu machen; an die Stelle der historischen Rekonstruktion tritt die<br />
73 Siehe Lutz Heusinger, »Foto-Dokumentation«, im Ausstellungskatalog Fotovision.<br />
Projekt Fotografie nach 150 Jahren, Hannover (Sprengel Museum) 1988, 37
MKYDHNBAUERS PHOTOGRAMMKTRISCHES DENKMÄLER-ARCHIV 983<br />
digitale Hochrechnung. 74 Auf dem Weg zur Dokumentationswissenschaft:<br />
Meydenbauers Denkmälerarchiv ist ein Medium im kommunikationstheoretischen<br />
Sinne, insofern es nicht schlicht speichert, sondern die Daten weiterverarbeitet,<br />
aus photographischen Bildern buchstäblich Gebäude-Aufzeichnungen<br />
macht und diese auf den Informationsträger Buch überträgt. Denn ein Denkmälcrarchiv<br />
muß seine »Schätze der Forschung auf geeignete und zweckdienliche<br />
Weise zugänglich machen.« Medium dieser Adressierung sind keine<br />
Erzählungen, sondern »praktisch und übersichtlich angelegte Kataloge«, die<br />
dem Forscher »zeigen, welche Denkmäler festgelegt sind und was er hier<strong>von</strong><br />
<strong>für</strong> seine Zwecke brauchen kann« . Datentransfer vollzieht<br />
sich also nicht als Erinnerung, sondern angeleitet durch non-diskursive/?omter.<br />
Die Infrastruktur des Wissensspeichers Denkmälerarchiv ist dementsprechend<br />
diskret, nicht narrativ angelegt; dem indexikalischen Ordnungsprinzip<br />
der Meydenbauerschen Bildplatten, »das sich erzählerischer <strong>Im</strong>plikation zu<br />
entledigen sucht, und das sich in numerischen Additionen präsentiert«, entspricht<br />
die Struktur seiner Bilderalben, welche den Inventarnummern des<br />
Speichers entsprechend die Ordnung des Dargestellten über die Abfolge<br />
enumeneren . Auf dem Weg zur Dokumentationswissenschaft<br />
praktiziert Meydenbauer eine Informatisierung seines Gegenstandes, wie<br />
sie durch des Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß im Medium eines kulturgeschichtlichen<br />
General-Repertorium deutscher Quellen und Denkmäler in der Leitzentrale<br />
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg als Medienverbund <strong>von</strong> Archiv,<br />
Bibliothek und Museum anvisiert, aber nicht verwirklicht wurde. Auch Meydenbauers<br />
Denkmälerarchiv soll neben Aufnahmen der Baudenkmäler auch<br />
Malerei, Skulptur und Objekte des Kunstgewerbes umfassen; neben den bildonentierten<br />
Speicher (Photographien) treten andere Formen graphischer<br />
Anschreibung <strong>von</strong> Gedächtnis - Druckwerke und handschriftliche Aufzeichnungen.<br />
Nicht der ästhetische, sondern der Informationswert ist der Vektor<br />
der Eintragung <strong>von</strong> Dokumenten in dieses Archiv; <strong>von</strong> daher die Supplcmentierung<br />
der Bilder durch technische Zeichnungen, um jene Verfluchung<br />
zu vermeiden, zu der die Privilegierung <strong>von</strong> Bildern in der Kunstwissenschaft<br />
geführt habe. »Es war die fotografische Oberfläche als Informationsträger,<br />
an die Meydenbauer unerschütterlich glaubte. Denn sie vermochte auf kleinstem<br />
Raum eine unüberbietbare Zahl an Informationen aufzubewahren«<br />
. Die optischen form pnnts sind den word pnnts als mediale<br />
Aufzeichnungssysteme dank der höheren Zahl an gespeicherter Informationen<br />
überlegen, so da die Größe des Informationsdepots selbst damit redu-<br />
Dazu Martin Emele, Camp. Das Catal Hüyük Archäologie & Medien Projekt, in:<br />
Mediagramm (Hochschule <strong>für</strong> Gestaltung, Karlsruhe), Ausgabe Januar 1996, 18t
984 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
ziert werden konnte - Speicherökonomie. 75 Dies erlaubt es, in einem Raum der<br />
Berliner Bau-Akademie <strong>von</strong> 4,75 x 5 Quadratmetern 12000 Negative zu komprimieren.<br />
Der Gedächtnischarakter <strong>von</strong> Speichern wird nicht allein durch seine<br />
diskursive Aufladung (nationale Geschichtskultur), sondern parergonal <strong>von</strong> seinen<br />
Formaten vorgegeben.<br />
Wo Bilder <strong>von</strong> Baudenkmälern als photogrammetnsche Aufmessung wieder<br />
zu Karten, also graphentheoretisch anschreibbar werden, heißt auch ihre Inventarisierung<br />
mapping und kommt somit auf ein Terrain zurück, das sich analog zur<br />
Logistik des Archivs verhält: »Das Luftbild ist einer maßstabgetreuen Karte<br />
bereits weitgehend ähnlich und gibt über diese hinaus eine wirklichkeitsgetreue<br />
Darstellung der topographischen Einzelheiten des Geländes.« 76 Das Inventarisierungssystem<br />
<strong>von</strong> Archiv, Bibliothek und Museum stellt der diskursiven Option<br />
historischer Erzählungen die Alternative der Bezifferbarkeit, also: non-diskursive<br />
Adressierbarkeit der Vergangenheit entgegen. <strong>Im</strong> Medium Archiv kommt hinzu,<br />
daß diese Verwandlung bereits eine Adaption der ihr zugrunde liegenden Wirklichkeit,<br />
nämlich der alphanumerischen Logistik <strong>von</strong> Verwaltungen und ihres nonnarrativen<br />
(da Entscheidungsfmdungskybernetik folgenden) Aktenverkehrs selbst<br />
liegt. Die Spezifik eines Archivs photogrammetrischer Aufnahmen wiederum liegt<br />
darin, daß Zahlenverhältnisse den Dokumenten nicht schlicht als archivisches Beiwerk<br />
extern hinzugefügt werden, sondern vektoriell das We(i)sen der Architekturaufnahmen<br />
als Monumente ausmachen. Der Akt der Registrierung, der<br />
Verzeichnung und Kontextuahsierung steht in einem supplementären Verhältnis<br />
zum Objekt, dem zeichentragenden Semiophor (Krzysztof Pomian). Das Photo<br />
einer archäologischen Grabung etwa zeigt ein links ein großes Tongefäß, rechts<br />
da<strong>von</strong> ein Holzschild mit Angabe des Grabungsorts, des Suchschnitts und der<br />
Grabnummer »on which the photograph IS identified for later research purpose«.<br />
77 Diese Form <strong>von</strong> /«sknption ist buchstäblich dem Gegenstand (dem Referenten<br />
des Fotos) eingeschrieben, im Unterschied zur äußerlichen Beschriftung<br />
der Photographie als Bestandteil des Archivs.<br />
75 Oliver Wendell Holmes, The Stereoscope and the Stereograph (1859), in: Alan Trachtenberg<br />
(Hg.), Classic Essays on Photography. Notes by Amy Weinstein Meyers, 2.<br />
Aufl. New Haven, Conn. 1980, 71-83 (77); dt. in: Kemp 1980: 114-121<br />
76 Fliegerstabsingenieur H. Chr. Wohlrab, Entwicklungsprobleme der Luftbild-Aufnahmegeräte,<br />
in: Zeitschrift <strong>für</strong> angewandte Photographie in Wissenschaft und Technik<br />
5 (1943), Heft 1,1, zitiert nach: Bernhard Siegert, L'Ombra della macchina alata.<br />
Gabriele d'Annunzios renovatio imperii im Licht der Luftkriegsgeschichte 1909-1940,<br />
in: Hans Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittlcr, ders. (Hg.), Der Dichter als Kommandant.<br />
D'Annunzio erobert Fiume, München (Fink) 1996, 261-306 (272)<br />
77 Louis M. Stumer, History of a Dig, in: Scicntific American, Bd. 192, Heft 3, 98ff (99)
MKYDENßAUKRS I'HOTOGRAMMKTRISCHl-S DI-NKMÄL.I-R-ARCHIV 985<br />
Zwischen Meßbildanstalt und Denkmälerarchiv: Die Adressierung der<br />
Gedächtnisagentur als Schnittstelle <strong>von</strong> Realem und Symbolischen<br />
<strong>Im</strong> Begriff des Denkmalarchivs prallen Monument und Dokument kognitiv aufeinander.<br />
Ein ausdrückliches Denkmalarchiv (Matthäikirchstr. 19, Berlin) läßt die<br />
preußische Provinz Brandenburg über ein monumentansches Gedächtnis verfügen.<br />
78 Der Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelengeheiten be<strong>für</strong>wortet<br />
am 2. Januar 1914 das Anliegen des Geheimen Archivrats und Professors F.<br />
Wolff, solche Denkmalarchive auch in anderen Provinzen der Monarchie einzurichten.<br />
Auf dem 1. Deutsche Denkmalarchivtag in Dresden fordert Wolff, auch<br />
Kaiserlicher Konservator der geschichtlichen Denkmäler in Elsaß-Lothringen<br />
und Vorstand des Kaiserlichen Denkmal-Archivs zu Straßburg im Elsaß, am 24.<br />
September 1913 die zentrale Distribution photographischer Denkmalaufnahmen<br />
durch die Königlich preußische Meßbildanstalt 79 und erinnert rückblickend an<br />
das, was in den Denkschriften <strong>von</strong> Schinkel, Kugler und Wussow be<strong>für</strong>wortet<br />
und aus den Berliner Zentralverfügungen vom 8. September 1853 und 27. Januar<br />
und vom 1. Juni 1854 hervorgeht: ein dezentrales Netzwerk <strong>von</strong> Denkmalarchiven;<br />
erst die Option der photographischen Kopie macht ein Zentralrepertorium<br />
möglich. Nach dem Vorbild des <strong>von</strong> Wolff geleiteten Denkmalarchivs<br />
wurden entsprechende Institute im Elsaß (Straßburg), in der Rheinprovinz (Bonn,<br />
Clemen und Renard); in Hessen (Darmstadt) und Sachsen (Dresden, Gurhtt und<br />
Brück) eingerichtet; ferner erläßt das Königlich preußische Ministerium der<br />
öffentlichen Arbeiten am 4. Dezember 1912 zunächst <strong>für</strong> die Provinz Brandenburg<br />
die Verfügung, alte, im Geschäftsgang nicht mehr gebrauchte Zeichnungen<br />
<strong>von</strong> Kunst- und Baudenkmälern an das Denkmalarchiv der Provinz Brandenburg<br />
abzugeben - eine Herausforderung des staatsarchivischen Gedächtnisraums. Das<br />
Königliche Geheime Staatsarchiv wendet sich betreffs der Abgabe <strong>von</strong> Zeichnungen<br />
an das Denkmalarchiv der Provinz Brandenburg (Antrag Wolff) an 16.<br />
Juli 1914 an den General-Direktor der preußischen Staatsarchive. Hier entscheiden<br />
Formate über Gedächtnisorte:<br />
»Bei den in Frage stehenden Zeichnungen handelt es sich durchweg um solche, die<br />
früher als Beilagen zu den Akten staatlicher Baubehörden gehört haben, bei letzteren<br />
aber getrennt <strong>von</strong> den Akten aufbewahrt worden sind, weil ihr Format<br />
unhandlich war und daher die Rücksicht auf ihre Erhaltung ein Einheften verbot.<br />
Leider tragen diese Pläne oft keine Hinweise, die einen unmittelbaren Schluß dar-<br />
78 Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, Rep. 178 Abt. VII, Akten des Direktoriums der<br />
Staatsarchive, betreffend: Denkmalarchive, Bd. 1 v. 20. Juni 1912 bis 1939, Bl. 10<br />
79 Denkmalarchive, Broschüre des gleichnamigen Vortrags, gehalten auf dem 1. Denkmalarchivtag<br />
in Dresden am 24. September 1913 <strong>von</strong> F. Wolff, Berlin (Wilhelm Ernst<br />
& Sohn) 1913, 17f
986 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
auf zuließe, welchen Akten bczw. welcher Registratur sie anzuschließen wären.<br />
Trotzdem müßte unseres Erachtcns aber grundsätzlich daran festgehalten<br />
werden, daß solche Zeichnungen, die staatlichen Registraturen entstammen, auch<br />
in den staatlichen Archiven aufzubewahren sind. Ein ideeller Zusammenhang mit<br />
den zugehörigen Akten würde zweckmäßig durch Verweise (<strong>von</strong> den Aktenrepertorien<br />
auf die Kartensammlung und umgekehrt) möglichst überall herzustellen<br />
sein . Schließlich würde es auch praktisch nicht ohne Bedenken sein,<br />
wenn unsere durchaus organisch erwachsenen Sammlungen durch das Herausreißen<br />
einzelner Stücke verstümmelt würden.« <br />
Die Modi der Kopplung <strong>von</strong> Text und Bild im Speicher sind also durchaus nondiskursiver<br />
Natur. Die preußische Papiergedächtnisagentur Staatsarchiv plädiert<br />
in aller Deutlichkeit gegen die »Hergabe <strong>von</strong> Plänen und<br />
Zeichnungen aus den Beständen des Geheimen Staatsarchivs« zugunsten eines<br />
Denkmalarchivs. Archivrat Wolff hat vielmehr im Schlußsatz seines am 24. Juli<br />
1912 an den Minister der geistlichen u. Unterrichtsangelegenheiten <strong>von</strong> Trott zu<br />
Solz gerichteten Schreibens selbst ausdrücklich bemerkt, daß es nicht den Grundregeln<br />
in der Denkmalarchive entspricht, Zeichnungen und Akten zu trennen:<br />
»Der Zweck der Einrichtung der Denkmalarchive dürfte doch dahin gehen,<br />
solche Zeichnungen pp., deren Erhaltung <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong> pp. der baulichen und<br />
sonstigen Denkmale <strong>von</strong> Wichtigkeit ist und die in den kleine Pfarr- und Ortsarchiven<br />
u.a.O. zerstreut sind und erfahrungsgemäß verwahrlost werden, vor dem<br />
Untergange zu retten und an einer (provinzialen) Zentralstelle der Forschung<br />
zugänglich zu machen. Aber auch das Betreben, im Denkmalarchiv alles derartige<br />
Material möglichst vollständig zu vereinigen, dürfte kaum ins Feld geführt<br />
werden können. Ganz abgesehen da<strong>von</strong>, daß dieser Gesichtspunkt <strong>für</strong> die Archivverwaltung<br />
wohl nicht maßgebend sein kann.« xo<br />
Die Unterzeichner plädieren vielmehr da<strong>für</strong>, den Geheimen Archivrats Wolff<br />
»<strong>für</strong> die Bereicherung der Sammlungen des Denkmalarchivs auf den Weg der<br />
photographischen Kopie zu verweisen« . Technische Reproduktion<br />
sprengt die vom archivischen Provenienzprinzip vorgegebene Geschlossenheit<br />
der Gedächtnisverarbeitung.<br />
Bereits in seiner 1860er Denkschrift an den preußischen Kultusminister v.<br />
Golar ist bei Meydenbauer die Rede vom Denkmäler-Archiv. Seine autobiographischen<br />
Skizze vom Oktober 1914 handelt an einer pointierten Stelle nicht<br />
minder <strong>von</strong> »unserem Denkmäler Archiv«. Das Wort sei nun sehr umgänglich;<br />
Meydenbauer sucht eine Technik zu diskursivieren. 81 In seiner Oszillation zwi-<br />
x0 GehStaAr, loc. cit., Bl. 34 com., signiert: Beicken - Müller - Lüderich<br />
Nl Historisches Archiv Wetzlar, Nachlaß Albrecht Meydenbauer (1834-1921), Karton 1;<br />
6.: Schulhefte, beschriftet A. Meydenbauer I - VI, mit handgeschriebener »<strong>Geschichte</strong><br />
<strong>von</strong> Albrecht Meydenbauer. Godesberg den 6. Okt. 14« (Titelblatt Heft I); endet mit<br />
Baalbeck-Reise 1902; hier: Heft V, erste Seite
Ml-YDl'NBAUKRS PHOTOGRAMMKTRISCHES DKNKMÄI.KR-ARCHIV 987<br />
sehen Meßbild-Anstalt und Archiv kippt der Begriff ins Symbolische. Wann ist<br />
eine Anstalt ein Archiv? Zunächst ist ihre Praxis vielmehr <strong>von</strong> Echtzeit und Feedback<br />
bestimmt. Die im Symbolischen operierende Institution einer Meßbildanstalt<br />
will Meydenbauer an das <strong>Im</strong>aginäre einer Kulturanstalt koppeln, um<br />
diskursiven Gewinn aus einer in sich non-diskursiv, nämlich technisch-administrativ<br />
und nicht im <strong>Namen</strong> der <strong>Geschichte</strong> operierenden Institution zu schlagen.<br />
An dieser Stelle kommt es zum funktionalen Widerstreit <strong>von</strong> Staat und Kunst;<br />
Meydenbauer gelingt es nicht, die offizielle Umbenennung und damit Umfunktionierung<br />
seiner Messbildanstalt in ein Denkmäler-Archiv durchzusetzen. Dies<br />
setzt implizit einen Verweis auf ein Archiv-Modul aus dem Centrc Michel Foucault<br />
(vormals Paris), nämlich die Begründung des Neologismus archeologie du<br />
savoir 82 . In einem Interview antwortet Foucault auf die Frage eines Studenten in<br />
Berkeley, ob seine Archäologie eine neue Methode oder schlicht eine Metapher<br />
meint, zunächst unter Bezug auf die altgriechische Bedeutung <strong>von</strong> arche als<br />
Beginn; doch »we also have the word >la arche< in French. The French word sigmfies<br />
the way in which discursive events have been registrated and can be extracted<br />
from the archive« - auch wenn der Grand Larousse encyclopedique (Paris<br />
1960) da<strong>von</strong> als archivkundhchem Fachterminus nichts weiß. »So archaeology<br />
refers to the kind of research which tries to dig out discursive events as if they were<br />
registered in an arche« 83 ; er meint hier tatsächlich, medienarchäologisch, die<br />
Anschreibweise der Gedächtnisagentur Archiv - im Unterschied zu seiner sonstigen,<br />
eigenwilligen Definition des Archivs . Während<br />
Meydenbauer seinerseits die Organisationsstruktur seines Instituts nicht nur mit<br />
einer Bibliothek vergleicht, sondern das Bildarchiv offiziell auch als Museum<br />
auszuweisen sucht, sieht die preußische Regierung den Aufwand durch den zu<br />
erwartenden Profit nicht gerechtfertig. »Was <strong>für</strong> Meydenbauer bald darauf als<br />
Denkmälerarchiv existierte, blieb <strong>für</strong> die preußische Regierung Messbildanstalt.« u<br />
Das Reale des Meßbilds (Zahlenverhältnisse) verhält sich - infrastruktureller<br />
Logik entsprechend - diskret gegenüber dem kulturgeschichtlichen Gedächtnis.<br />
Der Staat (Preußen) steht - im Unterschied zum historischen Raum der Nation -<br />
auf Seiten des Archivs als diskretem und rechenbarem Medium. Beruht die Adres-<br />
' s2 Gilles Dclcu/.c nannte den Foucault der Archäologie des Wissens »im nouvel archiviste«:<br />
ders., Foucault, Paris 1986, 11<br />
83 Dokument D 152: »Dialogue on Power. Michel Foucault and a group of students«, in:<br />
Quid (hg. v. Simeon Wade), Los Angeles 1976, 4-22, hier: 10. Leicht abweichend als<br />
frankophone Version in: Michel Foucault, Dits et Erits 1954-1988, Bd. III, Paris (Gallimard)<br />
1994, 468: »En francais, nous a<strong>von</strong>s aussi le mot , qui designe la<br />
maniere dont les evenements discursifs ont ete enregistres et peuvent etre extraits« -<br />
ein Versehen der phonographischen Transkription?<br />
84 Wolf 1995: 135f, unter Bezug auf: Meyer 1985: 41
988 INVENTAR UND STATISTIK<br />
sierbarkeit <strong>von</strong> Meydenbauers photogrammetrischer Sammlung auf Eigennamen<br />
(<strong>von</strong> Gebäuden und Orten), legt der Widerstreit um die Benennung der Institution<br />
selbst den funktionalen Interessenskonflikt zwischen Speicherung als technischer<br />
Operation und Gedächtnis als Dispositiv eines <strong>Im</strong>aginären namens<br />
Historie: »Das Preussische Denkmäler-Archiv hat nun unter der unglücklichen<br />
Bezeichnung als Messbildanstalt in den vergangenen 20 Jahren gelehrt, wie diese<br />
Erhaltung, technisch allen möglichen Anforderungen entsprechend, zu geschehen<br />
hat« . Preußen beharrt auf dem Titel Meßbild-Anstalt;<br />
auf Meydenbauers Begriff kommt die Photogrammetrie erst im <strong>Namen</strong> der Zeitschrift.<br />
85 Die diskursive Aktivierung der Bestände im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> Kulturgeschichte<br />
steht im Konflikt mit den Interessen eines Staates, der nicht verstehen,<br />
sondern registrieren will. »Unter diesen Zeichen arbeitet nun die >Messbild-<br />
Anstalt< unter Leitung des Verfassers weiter und hat sich zu einem Preussischen<br />
Denkmäler-Archiv entwickelt, ohne dass ihr bis jetzt diese allem richtige Bezeichnung<br />
beigelegt ist« . Für den Staat ist das Archiv im<br />
Sinne Foucaults das Gesetz (Gestell) dessen, was adressiert und damit justiziabel<br />
memoriert werden kann, im Unterschied zu einer Ästhetik, die das Archiv mit<br />
einem emphatischen Geschichtsbegriff imprägniert. Ein Aufsatz unter dem Titel<br />
»Der gegenwärtige Stand der Meßbildkunst« im Zentralblatt der Bauverwaltung<br />
Nr. 84 vom 19. Oktober 1921 ist Meydenbauers chrono-archivalisch letzte Äußerung<br />
zu fachlichen Fragen, unter Bezug auf Weltkriegserfahrungen mit Denkmalzerstörung:<br />
ein letzter Versuch, diesen Begriff auch institutionell <strong>für</strong> die <strong>von</strong><br />
ihm bis 1908 geleitete Anstalt durchzusetzen, denn das auf dem Meßbildverfahren<br />
begründete Denkmälerarchiv sei »in einer völligen Umwandlung begriffen<br />
und »jetzt schon <strong>von</strong> unschätzbarem Wert u. a. auch in Hinblick auf Flandern und<br />
auf die Isle de France, die Wiege der Gotik, wo der Krieg unersetzliche Lücken in<br />
den Denkmalbestand gerissen hat.« Die Arbeit des Krieges hat aus den Beständen<br />
der Anstalt tatsächlich archivische Dokumentation gemacht.<br />
Bereits die Preußische Meßbild-Anstalt proliferiert auf Anfrage Photo-Kopien<br />
<strong>von</strong> Objekten und Teilen nach Katalogen, welche ihre Beschreibung überflüssig<br />
machen oder in einem anderen Medium abkürzen und mithin aus dem Diskurs<br />
der Monumente in den der Akten, also den Raum des Archivs übersetzen: »So<br />
bald ein Bauteil Gegenstand einer Reparatur oder Veränderung wird, genügt<br />
ein Blick in den Sammelband, um eine in der Messbild-Anstalt bestellte<br />
Kopie statt langer Beschreibungen den Akten beizufügen« . Die <strong>von</strong> der Preußischen Mcßbildanstalt edierten Bildsammclbände sind in<br />
Landesdenkmalstellen einsehbar; deutsche Universitäten werden reichsweit mit<br />
Sätzen <strong>von</strong> je 200 Großphotos zwangsbeglückt (Herta Wolf). Die Umwandlung<br />
Ab 1909 firmiert eine Zeitschrift unter dem Titel Dasphotogrammetnsche Archiv
MKYDHNHAUKRS PHOTOGRAMMHTR1SCIÜ-S DI-NKMÄI.KR-ARCHIV • 989<br />
der Meßbildanstalt wenige Monate vor Meydenbauers Tod geschieht zum 1. Juli<br />
1921 aus der Notwendigkeit, sie mehr als bisher »wirtschaftlich auf eigene Füße<br />
zu stellen« und ihr mit dem Deutschen Kunstverlag ein Distnbutionsorgan<br />
beiseitezustellen; nun öffnet sich tatsächlich der diskursive Raum<br />
der Bibliothek anstelle des non-diskursiven Archivraums (den Mcydenbauer<br />
noch in Bibliotheksmetaphern gekleidet hat). Die Abkehr vom technisch definierten<br />
Format großer quadratischer Platten ist als Zugeständnis an den Diskurs<br />
erzwungen, der hier einmal der Technik ihre Standards vorschreibt:<br />
»Die streng-wissenschaftliche Grundlage des Meßbildverfahrens verlassend arbeitet<br />
daher die Anstalt jetzt meistens mit handlicheren Kameras und den landläufigen<br />
Längsformaten. Das ermöglicht, nun, einzelne Aufnahmen <strong>von</strong> vornherein<br />
noch mehr als früher auf bildliche Wirkung einzustellen und damit auch den Wünschen<br />
eines nicht lediglich <strong>von</strong> wissenschaftlichen Gesichtspunkten geleiteten Käuferkreiscs<br />
weiter entgegenzukommen.« <br />
Gleichzeitig erhält die nunmehrige Bildstelle einen kunstwissenschaftlichen<br />
Akzent, indem der Aufgabcnkreis der Anstalt grundsätzlich über die preußischen<br />
Grenzen hinaus auf ganz Deutschland und inhaltlich auf das gesamte Gebiet der<br />
Kunstwissenschaft ausgedehnt wird (Plastik, Malerei, Kleinkunst, Kunstgewerbe).<br />
Inventar Deutschland: Auch Photoplatten einschlägiger Aufnahmen <strong>von</strong> fremder<br />
Hand »sowie alle Mitteilungen über solche Bestände« werden nach Möglichkeit<br />
gesammelt und in die Registratur und Kataloge aufgenommen, um so mit der Zeit<br />
»einen Zentralnachweis der gesamten kunstwissenschaftlichen Photographien<br />
Deutschlands herauszubilden« - ein Nationalunternehmen, wie es -<br />
analog zum General-Repertorium des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg<br />
- nur durch Umschalten <strong>von</strong> Objekt auf Information möglich ist. Ein auf<br />
Berlin im Juli 1921 datiertes Mitteilungsblatt der Staatlichen Bildstelle dokumentiert<br />
das Scheitern des Projekts Meydenbauers, Baudenkmalwahrnehmung vom<br />
kunsthistorischen Blick auf ein Meßbarkeitsparadigma, <strong>von</strong> Ästhetik also auf<br />
aisthesis umzustellen; nachdem sich die Anstalt jahrzehntelang »im archäologischen<br />
Sinne und unter Zugrundelegung des Meßbildverfahrens« der photogrammetrischen<br />
Aufnahme deutscher Baudenkmäler gewidmet hat, wird sie nun in den<br />
Dienst der gesamten Kunstwissenschaft gestellt und die Anwendung des Meßbildverfahrens<br />
auf die unbedingt notwendigen Fälle beschränkt. Die Aufgaben heißt<br />
nun, »bildmäßige Schönheit mit der altgewohnten Präzision zu verbinden«<br />
. Kommentiert der aktuelle Leiter der Anstalt:<br />
»Die kurze Charakteristik der Arbeit der Meßbildanstalt als >im archäologischen<br />
Sinne« wirkt befremdend und ist sicherlich nicht <strong>von</strong> einem ihrer Mitarbeiter<br />
formuliert worden« ; tatsächlich aber ist hier, ex negativo (der<br />
Raum der Wissensarchäologie), ein (der Bauforschung vertrautes) buchstäblich<br />
medienarchäologisches Programm definiert, das an die Stelle <strong>von</strong> Erzählung und
990 INVENTAR UND STATISTIK<br />
Beschreibung Maß und Zahl setzt. Demgegenüber bedeutet der kommerziell<br />
bedingte Anschluß an die Reproduktionsästhetik der Kunstgeschichte seit 1921,<br />
resultierend in der zur Reproduktion vorgesehenen Spezialsammlung Deutsche<br />
Bildwerke, nicht nur eine Verschiebung <strong>von</strong> Archiv zu Bibliothek (Publikation),<br />
sondern Datenverlust auf der logistischen Adressierungsebene des Archivs selbst,<br />
der arche des Archivs. Durch Arbeiten zur Asthetisierung der Meßbildplatten<br />
(Abdeckung und Retusche) wurden auch wichtige schriftliche Informationen am<br />
Bildrand betreffend Aufnahmedatum, verwendete Objektive, Objektivverschiebung<br />
u. a. mit abgedeckt. Vor allem die aus den charakteristischen Randmarkierungen<br />
neben den Meßmarken konnte man die Numerierung der eingesetzten<br />
Instrumente erkennen, doch »um die gewünschten Rechteckformate zu erhalten<br />
und um in verschiedenen Labors wiederholbare >bildwirksame< Ausschnitte zu<br />
erzielen wurde der ursprüngliche Meßbildcharakter verfälscht« . Zu photogrammetrischen Einsätzen kommt die Bildstelle seit 1921 nur<br />
noch in Ausnahmefällen, etwa anläßlich deutscher archäologischer Grabungen in<br />
Ankara und Aizani (Türkei) sowie in Pacstum (Italien); so findet ein (mcclicn-<br />
)archäologisches Verfahren in der gleichnamigen Disziplin ihr Objekt. 1926 publiziert<br />
die Staatliche Bildstelle ein Verzeichnis der Aufnahmen (Berlin, Deutscher<br />
Kunstverlag). Von den Negativen hergestellte Kopien auf Bromsilberpapier werden<br />
zu Sammelbänden mit je fünfzig Blättern vereinigt, sind systematisch nach<br />
den Objekten geordnet und enthalten neben der Grundskizze des Bauwerkes<br />
auch die Angabe der Aufnahmestandpunkte: Sehepunkte (Chladenius), die Einsicht<br />
neuzeitlicher Historiographie, sind nicht länger subjektiv. 86<br />
Der Zerstörung vorbeugen:<br />
Die vergangene Zukunft <strong>von</strong> Meydenhauers Prognosen<br />
Bevor zwei Weltkriege Diskontinuitäten im Gedächtnis der Denkmäler setzen,<br />
denkt Meydenbauer den Bruch in der Kopplung <strong>von</strong> Technik und Ästhetik als<br />
Kritik der Moderne. Eine photogrammetrisch justierte Aufnahme gibt den<br />
räumlichen Gegenstand auf der Fläche nach den Regeln der projektiven Geometrie<br />
wieder. Die Umfunktionierung <strong>von</strong> Abbildern des autoptisch Wahrgenommenen<br />
zu Ausgangspunkten <strong>von</strong> Vermessung und die Umkehrung der<br />
Perspektive als Technik der Bildkonstruktion (Renaissance) zu einer analytischen<br />
Technik stellen eine wissensarchäologische Diskontinuität zwischen der<br />
Sh E. Dolczal, Zur Würdigung der Preußischen Meßbildanstalt in Berlin, in: Archivcs internationales<br />
de photogrammetric, 6. Jg. 1923, 36-45 (37). Zur histonographischen <strong>Im</strong>plikation<br />
siehe Reinhart Koselleck, Standortbindung und Zcithchkcit, in: ders./ Wolfgang<br />
J. Mommsen /Jörn Rüsen (Hg.), Objektivität und Parteilichkeit, München (dtv) 1977
MKYDKNBAUKRS PHOTOGRAMMKTRISCHHS DKNKMÄI.ER-ARCHIV 991<br />
Epoche der Repräsentation und der Epoche der mechanisierten Kalkulation,<br />
zwischen Erzählung und Zahl dar - eine Wirklichkeit, deren Wahrnehmung<br />
nicht mehr durch analoge, sondern digitale Muster bestimmt ist. Gegenüber der<br />
medialen Diskontinuität, die er mit den Apparaturen seines Denkmälerarchivs<br />
hart setzt, macht Meydenbauer die melancholische Erfahrung einer ästhetischen<br />
Diskontinuität, die Gedächtnis anstelle <strong>von</strong> Geschichtsbewußtsein setzt; sein<br />
Typoskript <strong>von</strong> 1906 gesteht es:<br />
»Alle Tradition ist unterbrochen. Die Alten verstehen die Jungen, diese ihre Lehrer<br />
nicht mehr. Die Tatsache macht sich mit einer Brutalität gelten . Die gesamte<br />
künstlerische Entwicklung aller Zeiten und Völker ist bis vor kurzem ein Continuum<br />
gewesen. Jeder Anfänger lernte erst bei den vorausgegangenen Meistern<br />
und zwar in den Zeiten höchster Kunstblüte direkt in persönlichem Verkehr. <br />
Das Auftreten der >? modernen Kunst< ist etwas Neues, das keine Wurzeln in<br />
der Vergangenheit hat. Die überlieferten Bauformen sind völlig verlassen.« 87<br />
Meydenbauer nennt <strong>für</strong> die Tatsache, daß die Moderne »innerhalb weniger Jahre<br />
die gesamten historisch gewordenen Bauformen bei Seite schieben konnte«<br />
, einen medial induzierten Grund: »Das heutzutage erforderliche<br />
bischen statisches Formengefühl lernt man jetzt aus Fotografien und Zeitschriften<br />
und das Gesehene wird unverstanden und unverdaut zusammengerührt.« 88<br />
Ein Jahr zuvor hat Meydenbauer selbst da<strong>für</strong> plädiert, historische Stilformen als<br />
Zeichenvorlagen zu speichern - die Voraussetzung <strong>für</strong> Historismus ist Gedächtnis.<br />
Nicht nur reale Bauwerke aufgrund materieller Zerstörung, sondern auch<br />
ihr ästhetisches Dispositiv gehen verloren:<br />
»Fort- und Weiterbilden kann man nur etwas, das vorhanden ist, auch wenn<br />
es abgestorben scheint. Unsere Zeit steht in einem solchen toten Punkt, der nur<br />
durch genaue Kenntnis des <strong>von</strong> unsern Vorfahren Geschaffenen überwunden werden<br />
kann. Die eilige Zeit hat die überlieferten Formen cies Lernens zerbrochen. Es<br />
müssen neue geschaffen werden, und dazu bietet das in dem Denkmäler-Archiv<br />
niedergelegte Material die einzige praktische Möglichkeit.« <br />
Schließlich begründet Meydenbauer, weshalb nur historische Bauwerke im Denkmälerarchiv<br />
Aufnahme finden: Alle Schöpfungen der neueren Zeit in Deutschland<br />
»etwa <strong>von</strong> der Nachschinkelschen Zeit ab« lassen »auch in den schönsten<br />
87 Historisches Archiv Wetzlar, NL Prof. Albrecht Meydenbauer (1834-1921), Karton<br />
1, Dokument Ni\ 30, TS Meydciitmuoi-, lii-itttttihcH und VÖI-HKWCH VW histurisvlu'ii BrtUformen<br />
(Dezember 1906), 25<br />
8
992 INVI-.NTAR UND STATISTIK<br />
Grossbildern den Beschauer kalt - eine weitere Mahnung, die aus jenen<br />
Zeiten überkommenen Reste wenigstens im messenden Bilde zu erhalten«<br />
. Das Archiv der Gegenwart kann in seiner Totalität<br />
nicht beschrieben werden (es sei denn, es 'würde generativ und nicht als Speicher<br />
gedacht) 89 ; <strong>von</strong> daher setzt der Diskurs der Moderne erst die <strong>für</strong> die Beobachtung<br />
<strong>von</strong> Kulturgeschichte notwendige Differenz.<br />
Zum absoluten Datum aber machen diese Differenz erst Kriegsplanung und -<br />
Wirklichkeit im NS-Staat. Dessen Auftrag weiterer Serien vorsorglicher Bauaufnahmen<br />
integriert Meydenbauers Verfahren, <strong>von</strong> Seiten des Erfinders gedacht als<br />
virtueller Ersatz <strong>von</strong> Knegsverlusten, in das Kalkül <strong>von</strong> Knegsführbarkeit. Nach<br />
der Bombardierung <strong>von</strong> Lübeck 1943 ergeht ein Führerbefehl zum photographischen<br />
Kunstluftschutz sowie die Aktion Das deutsche Monumentalbild 1944, und<br />
das nicht aus Liebe zur Kultur, zumal nicht als Eingeständnis zunehmender Substanzverluste<br />
im Lande (Rolf Sachsse), sondern im Vorgriff auf einen künftigen<br />
Kriegsverbrecherprozeß. Bereits im April 1942 war die bombensichere Unterbringung<br />
sämtlicher Kulturwerte (Martin Bormann) angeordnet worden; der<br />
Führerauftrag koppelt den Sicherumgsimperativ mit der Festlegung ihrer medialen<br />
Strategie. Dispositiv dieses Z?z/Wgedächtnisses einer antizipierten vergangenen<br />
Zukunft sind Denkmal/zsfe« nach Maßgabe früherer Dokumentationskampagnen<br />
etwa der Preußischen Meßbildanstalt 90 - eine durchgehende Alphanumensierung<br />
dieser Gedächtnisbilder. Die jeweils fünf Farbaufnahmen werden als Diapositive<br />
an entsprechend fünf verschiedenen Orten (etwa dem Münchner Zentrahnstitut<br />
<strong>für</strong> Kunstgeschichte) abgelegt; die Antwort des 20. Jahrhunderts auf Luftkrieg<br />
und ballistische Verwundbarkeit <strong>von</strong> Befehlszentralen heißt Dezentralisierung<br />
der Information. Gegenüber dein imaginären Museum der kunsthistorischen<br />
Diapositive hat bereits das reale Museum idealtypisch ein Archiv dargestellt, das<br />
»mitten in Deutschland« die Dinge vor Ort verfügbar macht, ohne daß ein Verlassen<br />
des Ortes nötig ist; der Einbruch der Diaprojektion in kunsthistorische<br />
Hörsäle überträgt diese mediale Logik ins Reich des Virtuellen. 91 Damit korre-<br />
89 Thomas Richards, Archive and Utopia, in: Representations 37 (Winter 1992), 104-135<br />
(104), unter Bezug auf Michel Foucault, Archaeology of Knowledge, New York 1972,<br />
130<br />
90 Rolf Sachsse, »Die größte Bewahrungsprobe <strong>für</strong> den Klcinfarbfilm«. Der Führerauftrag<br />
zur Dokumentation wertvoller Wand- und Deckenmalereien in historischen Bauwerken,<br />
in: Angelika Beckmann / Bodo <strong>von</strong> Dewitz (Hg.), Dom - Tempel - Skulptur.<br />
Archiickiurphoiographien <strong>von</strong> Waller I lege, Kataloghandbuch A^la I'oto-i Iistorama<br />
Köln (Wiegand) 1993, 68-72 (68 u. 70f), unter Bezug auf ein Telex-Rundschreiben <strong>von</strong><br />
Martin Bormann im Führerhauptquartier, Nr. 61/42 v. 5. Mai 1942, in: Bundesarchiv,<br />
Bestand NS 18/297, und auf: Preussische Meßbild-Anstalt (Hg.), Alphabetisches Verzeichnis<br />
der Meßbild-Aufnahmen und Platten, Berlin 1904<br />
91 Dazu Silke Wenk, Zeigen und Schweigen. Der kunsthistorische Diskurs und die Dia-
MI-:YI)!-:NBAUI-:RS i ) iKrroGRAMMi-:'i'Risc;in-;s DI-:NKMÄI.KK-ARC:IIIV 993<br />
spondiert die Auslagerung des Meßbildarchiv-Bestands an Negativen seit Beginn<br />
der alliierten Bombardements auf Berlin gemäß einer Anordnung aus dem<br />
Reichsministerium <strong>für</strong> Propaganda und Erziehung zum Kunstschutz, zunächst<br />
in die Keller des Berliner Schlosses - <strong>für</strong> dessen Rekonstruierbarkeit sie in der<br />
Gegenwart ihrerseits eine entscheidende Grundlage, eine medienarchäologische<br />
Fundierung also, bilden. Ähnlich hegt der Fall <strong>für</strong> die aktuelle Teilrekonstruktion<br />
des Potsdamer Stadtschlosses auf der Grundlage <strong>von</strong> a) Photographien der<br />
Königlich Preußischen Meßbildanstalt <strong>von</strong> 1912 und b) der durch Führerbefehl<br />
1942-44 erfolgten Dokumentation der Innenausstattung durch Farbdias. 92 So<br />
reversibel ist Gedächtnis. Mit der Reversibilität <strong>von</strong> Zeit, dem Dementi aller<br />
Historie, ist die Technik der Fotodokumentation selbst angesprochen. Die Kleinbilddiapositive<br />
der NS-Dokumentationskampagne haben zwar an diversen<br />
kunsthistorischen Instituten den Krieg, nicht aber den chemischen Verfall ihrer<br />
Farbwerte überlebt: »Somit verschwindet eine Dokumentation im Dickicht<br />
administrativer Quellen, die weder die Objekte selbst noch ihren medialen Transfer<br />
in die <strong>Geschichte</strong> hinein haben retten können«, schreibt Sachse < 1993: 71><br />
unter Bezug auf die Aussonderung solch verblaßter Diapositive durch ahnungslose<br />
Bibliothekare. Zwar erscheinen die Diapositive der Kunstlichtemulsionen<br />
durchweg »als blaß gelb- bis blaugrüne Enigmen , denen der bloße Augenschein<br />
heute keine Relevanz mehr <strong>für</strong> den originalen Farbcharakter geben<br />
würde«, doch vermag der digitale Rechner, buchstäblich medienarchäologisch,<br />
solch unsichtbare oder verrätselte Bilder wieder lesbar zu machen, etwa mit pigmentuntersuchenden<br />
Rekonstruktionen (wenn nicht der Objekte, so doch ihrer<br />
Abbilder), mithin in der Spur jener digitalen Dechiffrierung kryptotologischer<br />
Botschaften, mit denen der Zweite Weltkrieg den Computer selbst entwickelte. 9 - 1<br />
Infolge der Zerstörung der Staatlichen Bildstelle in der Nacht zum 2. März 1943<br />
jedenfalls wird das Negativarchiv gemeinsam mit den wichtigsten Findmitteln<br />
projektion, in: Sigrid Schade / Christoph Tholen (Hg.), Konfigurationen. Zwischen<br />
Kunst und Medien, München (Fink) 1999, 292-304 (bes. 297f), unter Bezug auf zwei<br />
Schriften Hermann Grimms, Vorgänger Heinrich Wölfflins auf dem Berliner <strong>Lehrstuhl</strong><br />
<strong>für</strong> Kunstgeschichte: Das Universitätsstudium der Neueren Kunstgeschichte, in:<br />
Deutsche Rundschau 1891, 390-413, und: Über die Umgestaltung der Universitätsvorlesungen<br />
durch die Einführung des Skioptikons, in: ders., Beiträge zur Deutschen<br />
Culturgeschichte, Berlin 1897, 276-395<br />
92 Dazu: Minervas Mythos. Fragmente und Dokumente des Potsdamer Stadtschlosses,<br />
KrtuloK der uloicliiiaiiiiucn Ausstellung Potsdam April-Juni 2001, hg, v, d, Stiftung<br />
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und der Unteren Denkmalschutzbehörde<br />
der Landeshauptstadt Potsdam, Belrin (Hentrich) 2001<br />
93 Sachsse 1993: 72, unter Bezug auf: Rudolf Gschwind, Restoration of Faded Colour<br />
Photographs by Digital <strong>Im</strong>age Processing, in: The Journal of Photographic Science,<br />
38. Jg. (1990), 193-196
994 INVI-NTAR. UND SIATISTIK<br />
(Zugangsjournal, Verzeichnisse mit den einzelnen Bildunterschriften in Loseblattform,<br />
Bände mit den Meßdaten zu sämtlichen Aufnahmen) in einem Bernburger<br />
Kalischacht eingemauert, denn nur im Verbund mit der alphanumerischen<br />
Basis seiner Logistik ist das Archiv als Gedächtnis operabel. In Form <strong>von</strong> 935<br />
Kisten gelangt dieser Bestand im Juli 1946 als Beutegut ins Staatliche Historische<br />
Museum nach Moskau, um größtenteils 1958 an die Regierung der DDR zurückgegeben<br />
zu werden. Wissenstransfer weiß um die entscheidenden Schwachstellen<br />
in Datenübertragungen, nämlich die Übertragungsdaten selbst: »Die ausgelagerten<br />
Kataloge, Verzeichnisse und vor allem die meßtechnischen Dokumentationen<br />
wurden nicht übergeben. Ihr Verbleib ist bis jetzt nicht nachgewiesen«<br />
und dient möglicherweise der internen russischen Bestimmbarkeit<br />
der einbehaltenen, auf ehemals ostpreußische Baudenkmäler bezogenen<br />
Photoplatten. Gerhard Strauß plant und realisiert 1957 um den Kern der zurückgekehrten<br />
Bestände eine Kunstgeschichtliche Bildstelle an der Humboldt-Universität<br />
zu Berlin; er selbst gehört dem wissenschaftlichen Aktiv an, das den Abriß<br />
des Berliner Schlosses dokumentiert, und operiert damit, analog zur praktischen<br />
Verkehrung <strong>von</strong> Meydenbauers Zwecksetzung des Mediums Photogrammetne,<br />
im Dienste der Zerstörung, nicht der Erhaltung. Unter der Leitung <strong>von</strong> Leopold<br />
Achilles werden die Photoplattenbestände, die in der im Rückgabeprotokoll<br />
der Sowjetunion schlicht nach Kistenvolumen berechneten, also gedächtnisarchäologischen<br />
Form nur ein Lager bilden, durch Neukatalogisierung (Ordnungsmittel<br />
<strong>für</strong> die Aufstellung der Negative) wieder zu einem Gedächtnis<br />
transformiert, also her-gestellt »und als Bildarchiv wieder nutzbar« gemacht<br />
. »Nur sehr wenige Platten trugen außer den Signaturen Beschriftungen,<br />
aus denen das aufgenommene Objekt ermittelt werden konnte« ; medienarchäologisch vermessene Monumente tragen zumeist nur noch die<br />
Spur <strong>von</strong> Information in sich.
Dl-R WISSKNSARCHÄOLOGISaiH BLICK: STATISTIK 995<br />
Der wissensarchäologische Blick: Statistik<br />
Muß Vergangenheit als <strong>Geschichte</strong> erzählt werden? »Si teile doit etre l'histoirc,<br />
ce n'est plus Line sciencc, c'est un genre de romans, une Branche de la htterature<br />
narrative«; <strong>Geschichte</strong> im Medium der Narration ist der privilegierte, nicht aber<br />
einzige Datenraum der Vergangenheit: »Pour apprecier les recits histonques, j'aurai<br />
ä recueilhr bien d'autres donnes.« 1 Den literarischen Zug seiner Epoche, die<br />
(wie Honore Balzac) Romane über Chemie, Bankwesen, Druckmaschinen<br />
schreibt, und am Ende Romane über »alle Provinzen, alle Städte, die Etagen jedes<br />
Hauses, jedes Individuums«, analysiert Gustave Flaubert präzise: »Das ist dann<br />
keine Literatur mehr, sondern Statistik oder Völkerkunde.« 2 Wo res gestae in Statistik<br />
verwandelt werden, heißt der Darstellungsmodus (und auch sein diskursiver<br />
Effekt) nicht mehr <strong>Geschichte</strong>. Kulturwissenschaften ist »klar, dass die <strong>von</strong><br />
der Statistik rationalisierten Erscheinungen keine geschichtlichen sind.« 3 Noch<br />
zu der Zeit, als G. W. F. Hegel die <strong>Geschichte</strong> philosophisch zur Sinngebung des<br />
Staates umdeutet, kann histona vor allem empirische Erkenntnis des Partikularen<br />
heißen 4 ; in der Tradition einer non-diskursiven notitia multarum rerum singulanurrv<br />
1 steht sie damit auch im Bunde mit dem Ursprung ihres Aufzeichnungsme-<br />
Pierre Claude Francois Daunou, Cours d'Etudes historiques, hg. v. Alphonse Honore<br />
Taillandier, Deheque u. a., Paris (20 Bde) 1842-49, Bd. 1, 46 u. 35<br />
Gustave Flaubert, Bouvard und Pecuchet, übers, v. Georg Goyert, Frankfurt/M. 1979;<br />
dazu Bernhard Siegert, Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und<br />
Pecuchet, in: Hans-Christian v. Herrmann / Matthias Middell (Hg.), Orte der Kulturwissenschaft.<br />
5 Vorträge, Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-40 (32f)<br />
Friedrich Jodl, Die Culturgcschichtsschreibung, ihre Entwicklung und ihr Problem,<br />
Halle 1878,53<br />
Etwa Gustav Klemm, Allgemeine Cultur-<strong>Geschichte</strong> der Menschheit, 1. Bd.: Die Einleitung<br />
und die Urzustände der Menschheit, Leipzig (Teubner) 1843, Einleitung, 1 u. 20f<br />
Hermann Conring (1606-1681), De auctoribus politicis, zitiert in: Pasquale Pasqumo,<br />
Politisches und historisches Interesse. »Statistik« und historische Staatslehre bei Gottfried<br />
Achenwall (1712-1772), in: Hans Erich Bödecker u. a. (Hg.), Aufklärung und<br />
<strong>Geschichte</strong>: Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Göttingen<br />
(Vandenhoeck & Ruprecht) 1986, 144-168 (155). Daß Historiographie ihrerseits<br />
statistisch quantifizierbar ist, demonstriert eine Tabelle über »Geschichtsschreibung<br />
1300-1600« in: Jean-Philippe Genet, Die kollektive Biographie <strong>von</strong> Mikropopulationen:<br />
Faktorenanalyse als Untersuchungsmethode, in: F. Irsigler (Hg.), Quantitative<br />
Methoden in der historisch-sozialwissenschafthchen Forschung in der Wirtschafts- und<br />
Sozialgeschichte der Vorneuzeit (1978), 69-100. Dazu Johannes Goedesch, Mathematik<br />
als Hilfswissenschaft in der <strong>Geschichte</strong> der Statistik und Staatsbeschreibung, in:<br />
Mohammed Rassem / Justin Stagl (Hg.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit:<br />
vornehmlich im 16.-18. Jahrhundert, Paderborn u. a. (Schöningh) 1980, 75-104 (85<br />
u. Tabelle 2)
996 INVI'.NTAR UND STATISTIK<br />
diums, das neuesten Funden zufolge nicht aus einer erzählenden Bilderschrift entstanden<br />
ist, sondern aus einem mesopotamischen System abstrakter Tonsymbole<br />
(calculi I Kalkül): »kein Mittel zur Speicherung und Kommunikation <strong>von</strong> narrativen<br />
Informationen , sondern ein Zählmittcl.« 6 Gedächtnisadministration<br />
heißt Umgang mit Datenbanken, nicht <strong>Geschichte</strong>n - nicht um die Autonomie<br />
des archivischen Universums einzufordern, »sondern um die Komplexität ihrer<br />
Beziehungen zu beschreiben: Überschneidung, Isomorphismus, Transformation,<br />
Übertragung«. 7 Der medienarchäologische Blick auf Vergangenheit als technisches<br />
Gedächtnis verhandelt entsprechend Daten (Monumente), nicht dokumentarische<br />
Erzählungen und steht damit auf Seiten des Seyenden, Statistik und<br />
Historie trennend (wenngleich beobachtete Eigenschaften nicht selbst schon<br />
Daten sind 8 ):<br />
»Wir wollen Data und Fakta sorglich <strong>von</strong> einander geschieden wissen, und<br />
behaupten, daß es Gewinn <strong>für</strong> die Sprache sey, die letzteren ausschließend dem<br />
historischen Gebiete zu überlassen, welchem aber dennoch niemals Statistik<br />
angehören soll. Wir setzen den Charakter des Faktum darin, daß eines Dinges<br />
Erscheinung in der Beziehung der Wirkung auf Ursache aufgefaßt werde.<br />
Das Paradoxon heißt: Mittle einen Gegenwart aus, die in dem unaufhaltsamen<br />
fließenden Strome der Zeit, dennoch nie aufhöre Gegenwart zu seyn, und die<br />
Du beliebig wieder zu finden vermagst, wie lange sie auch schon in der Vergangenheit<br />
untergegangen sey!« y<br />
Die Emergenz statistischer Quellen verdankt sich der spezifischen Neigung der<br />
Moderne zur Selbstbeobachtung, zur politischen und wirtschaftlichen Diagnose<br />
und Prognose. 10 Die in der vorliegenden Studie behandelte Epoche (1806-1945)<br />
deckt sich mit der <strong>von</strong> Statistik als (Staats-)Wissenschaft und endet mit Anbruch<br />
einer elektro(mecha)nisch implementierter Mathematik. Reinhart Koselleck<br />
6 Peter Damerow, Buchhalter erfanden die Schrift. Anmerkungen zu dem Buch Before<br />
Writing <strong>von</strong> Denise Schmandt-Besserat, Austin (University of Texas Press) 1992, in:<br />
Rechtshistorisches Journal 12 (1993), hg. v. Dieter Simon, 9-35 (28f). Grundlage der<br />
Rekonstruktion dieser These sind allerdings ihrerseits Speichermedien: Museen und<br />
private Sammlungen, welche die archäologische Situation der antiken Archive durch<br />
Verteilung zerstörten (ebd., 14).<br />
7 Michel Foucault, Die Wörter und die Bilder, dt. in: Michel Foucault / Walter Seiner,<br />
Das Spektrum der Genealogie, Bodenheim o. J. [1996], 9-13 (10)<br />
x Renate Mayntz, Kurt Holm u. Peter Hübner, Einführung in die Methoden der empirischen<br />
Soziologie, 5. Aufl. Opladen 1978, 33; dazu Christian Heck / Albert Müller,<br />
»Daten« und »Quellen«, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaften<br />
8, Heft 1 (1997), 101-126(114)<br />
9 Wilhelm Butte, Statistik als Wissenschaft, Eandshut 1808, 248 u. 242<br />
10 Wolfgang Kohte, Gegenwartsgeschichtliche Quellen und moderne Überlieferungsformen<br />
in öffentlichen Archiven, in: Der Archivar Jg. 8 (1955), Sp. 197-210 (200)
DF.R WISSLNSARCHÄOLOGISCHF BLICK: STATISTIK 997<br />
spricht <strong>für</strong> Preußen <strong>von</strong> einer zahlenfreudigen Generation 11 ; <strong>für</strong> denselben Zeitraum<br />
konstatiert Wolfgang Schaffner als Effekt der Numerisierung des Wissens:<br />
»Narration can no longer claim to be the privileged medium of representation.« 12<br />
Die statistische Faszination des 19. Jahrhunderts ist nicht nur die Kehrseite und<br />
Antinomie des Historismus, sondern steht auch im Bund mit dessen archivischem<br />
Dispositiv; die Faszination an Optionen der Mathematisierung des Zahlenwerks<br />
aber wird im Medium des Diskurses obsessiv an ideale und holistische<br />
Modelle zurückgebunden. Der Historiker Johann Droysen suchte die Untersuchung<br />
einer jeweiligen Gegenwart als Zuständlichkck (im Medium der Statistik)<br />
durch den Hinweis auf Trends zu ersetzen - Dynamisierung <strong>von</strong> Zeit im<br />
Medium der historischen Erzählung. 13 Eine Beschreibung <strong>von</strong> Relationen reicht<br />
nicht aus, um die Dynamik <strong>von</strong> Spannung zwischen Interessensgruppen als<br />
geschichtliche Bewegung zu definieren; »nur im Medium solcher zeitlichen<br />
Strukturen erhalten die empirischen Daten geschichtliche Qualität«
998 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
chäologische Schweigen buchstäblicher Datenverarbeitung durch Sekretäre, den<br />
»ausschließend schnfthche Betrieb der Staats- und gelehrten Angelegenheiten«<br />
und seinen Schauplatz (»statt der Rednerbühne einen Schreibtisch«)<br />
sieht Adam Müller 1812 als Grund <strong>für</strong> den Verfall der Rhetorik in Deutschland.<br />
Non-diskursive Prozessualisierung <strong>von</strong> Chiffren statt lebendiger Diskurs: »Wer<br />
überhaupt lernt reden aus dem Papier, aus der toten Schrift?« 15 Der dialogische<br />
Charakter der Rede, den Müller dagegensetzt, ist seinerseits agonal definiert und<br />
<strong>von</strong> taktischen, nicht Sinnkategorien der Napoleonischen Kriege bestimmt.<br />
Kybernetik und Kalkül: Es sei ein Wechselreden zwischen sich und seinem Gegner,<br />
welches der Feldherr beim Planen betreibt; er kann nicht siegen, »wenn er<br />
an irgendeiner Stelle seines Kalküls die Antworten, die Gegenwirkungen seines<br />
Feindes unbeachtet gelassen« hat .<br />
Das administrative System Preußens basiert vor der Entwicklung elektrischer<br />
Nachrichtentechniken auf demselben Medium wie Dichtung (Müller nennt<br />
Schiller) und Geschichtsschreibung. Müller übt eine Foucault'sche Tugend der<br />
hermeneutischen Askese in der Beobachtung: »Halten wir uns also vorläufig an<br />
die Erscheinung, wie sie einmal ist« . Macht (Polizey-Wissenschaft)<br />
und ihr Niederschlag als Historie teilen denselben Kommunikationskanal, das<br />
Alphabet. »Das macht es der heutigen Sozialgeschichtsschreibung so schwer« 16 :<br />
In Preußen, zunächst weitläufig ein Bauernstaat und damit großflächig analphabctisiert<br />
und - damit korrespondierend - eher auf Waren- denn auf Geldwirtschaft<br />
basierend, stößt die Speicherung <strong>von</strong> Informationen in Listen und<br />
Tabellen (die als Archiv im Sinne Foucaults den Begriff des Datums erst generieren),<br />
Zensus und Kataster als Machttechnik an eine immanente Mediengrenze.<br />
17 Während die sogenannte deutsche Universitätsstatistik noch mit der<br />
ethnographischen Methode (Gottfried Achenwall) operiert, im narrativen<br />
Modus, haben sich die preußischen Könige und ihre Bürokratie längst <strong>für</strong> die<br />
zahlenverarbeitende, nicht erzählende Tabellenstatistik entschieden; der Juristen-<br />
Sekretär Lohenstein etwa behandelt alles Vorgefundene als Daten eines einzigen<br />
Staatsarchivs (und koppelt diese zurück an Literatur zur Verfassung <strong>von</strong> Dra-<br />
1:1 Adam Müller, Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutsehland,<br />
mit einem Essay und einem Nachwort <strong>von</strong> Walter Jens, Frankfurt/M. (Insel) 1967, I.<br />
Vorwort, 40 u. 35ff<br />
16 Friedrich Kittler; Ein Subjekt der Dichtung, in: Gerhard Buhr u. a. (Hg.), Das Subjekt<br />
der Dichtung: Festschrift <strong>für</strong> Gerhard Kaiser, Würzburg (Königshausen u. Neumann)<br />
1990, 399ff (403); s. a. ders., Das Subjekt als Beamter, in: Manfred Frank, Gerard Raulet,<br />
Willem van Rcijen (Hg.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1988,401-420<br />
17 Gerd Spittler, Abstraktes Wissen als Herrschaftsbasis. Zur Entstehungsgeschichte<br />
bürokratischer Herrschaft im Bauernstaat Preußen, in: Kölner Zeitschrift <strong>für</strong> Soziologie<br />
und Sozialpsychologie, Jg. 32 (1980), 574-604 (578)
Dl R WISSKNSARC1 lÄOI.OGISCHh Bl.ICK: STATISTIK 999<br />
men). Das Fehlen <strong>von</strong> etwas wird als leere Rubrik, als nullum aufgeschrieben, ein<br />
papiermaschinelles Dispositiv, das eine spätere Generation in die Technik <strong>von</strong><br />
Lochkarten übersetzen wird. 18 Die Epoche des Historismus in Deutschland baut<br />
als staatliche Realität auf einem Zahlenspeicher und -werk. Genau demgegenüber<br />
bedarf es intermediärer Verwaltungsinstanzen (Präsenz des Pfarrers, Führung<br />
<strong>von</strong> Kirchenbüchern) als Schnittstellen zwischen Analphabeten und Beamtenschaft,<br />
die sich ihrerseits autopoietisch »im Sinne ihrer Selbststilisierung als<br />
geschlossene Körperschaft« (be-)schreibt. Dieser Effekt des dem Beamtenstand<br />
eigenen Schriftregimes schlägt auch auf die Natur ihrer Schriftspeicher, die<br />
preußischen Archive durch. Der Blick auf diese Lage erfordert den Verzicht aul<br />
»kausale Hypothesen und daraus folgernde Bewußtseinsanalysen«, doch »auf der<br />
Ebene historischer Erzählung läßt sich dieser Vorsatz nicht durchhalten, denn<br />
jede Erzählung impliziert, allein <strong>von</strong> der Sprache her, Begründungszusammenhänge«<br />
1000 • INVENTAR UND STATISTIK<br />
Begriffen zu erkennen; »for the first time the world was constituted by measurements<br />
or countings« , mithin also: Zahlen statt Erzählung.<br />
Die buchstäbliche Datenfülle der Encydopedie Diderots und d'Alemberts bis hin<br />
zu den Bevölkerungsbewegungen im revolutionären Frankreich (und jenseits)<br />
konfrontieren seit der Epoche der Aufklärung die europäische Erfahrung mit<br />
scheinbar regellos auftretenden Massen; seit 1800 stehen dann Hermeneutik und<br />
Statistik im Verbund. 20 Massenbewegungen und Massendaten: »Die Masse ist bei<br />
den Historikern im allgemeinen nicht beliebt«; zumal deutsche Geschichtsprofessoren,<br />
so Eduard Fuchs 21 , zeigen eine aus konservativer Gesinnung entspringende<br />
Abneigung gegen das, was er das unruhige Treiben des »Acheron«, mithin<br />
also das Unbewußte der Historie nennt. Acheronta movebo bewegte auch Sigmund<br />
Freud; hier geht es um Furcht vor dem Geschichtsun(ter)bewußten. Fuchs<br />
registriert, daß der Fluß, der in der griechischen Mythologie das Reich der Lebenden<br />
<strong>von</strong> dem der Toten scheidet, »den ursprüglichsten Absichten der Geschichtsschreibung,<br />
die psychologischen Zusammenhänge wirkungsvollen Geschehens<br />
aufzusuchen als etwas Fremdes, Feindliches und Unklares im Wege steht« - also<br />
dem Versuch, historischen Sinn als Intention hcrmeneutisch zu retten.<br />
»Die Geschichtsschreibung hat sich <strong>von</strong> ihrer künstlerischen Herkunft und deren<br />
Bestimmungen noch nicht loszulösen vermocht, daher baut sich der Historiker<br />
ebenso wie der Dramatiker mit Vorliebe ein Reich der Willensfreiheit auf, in welchem<br />
die Einzelnen aus fertig geformten Individualcharakteren entspringenden<br />
Willensakte miteinander ringen. Die Masse aber ist das Reich der Notwendigkeit,<br />
der Gebundenheit, der Determination. Sie ist Substanz des Geschehens, die alle<br />
Ursachen als latente Energien in sich bergen mag, sie ist aber nicht selbst die<br />
unmittelbare Ursache des Geschehens, so wie es sich tatsächlich vollzogen hat und<br />
wie es den Geschichtsschreiber interessiert. In seiner Welt regiert die freiwaltende<br />
Persönlichkeit.« 22<br />
Andererseits sind Kncgsheere Objekt der Geschichtsschreibung; die Beachtung,<br />
welche militärisch wirkende Massen finden, läßt sich daraus erklären, daß sie dem<br />
20 Dazu Inge Münz-Koenen u. a. (Hg.), Masse und Medium. Verschiebungen in der<br />
Ordnung des Wissens und der Ort der Literatur 1800 / 2000, Berlin (Akademie) 2002<br />
21 Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford University, Archivcs,<br />
Collection Niclaevsky, Nachlaß Eduard Fuchs, Box 619, file 6 (»Materials, 1933-40,<br />
Writings«), betr.: Europäische Kulturgeschichte VI-VIII, (Typoskript) »Massenbewegungen<br />
und Revolution. 1) Masse und Persönlichkeit«. Zum Nachlaß Fuchs siehe W.<br />
E., Eduard Fuchs. Sammlung und Historie, in: Bernhard J. Dotzlcr / Hclmar Schramm<br />
(Hg.), Cachnca. Fragmente zur <strong>Geschichte</strong> <strong>von</strong> Poesie und <strong>Im</strong>agination (I'cstSt'hrift<br />
Karlheinz Barck), Berlin 1996, 30-39<br />
22 Eduard Fuchs ebd.; s. a. W. E., <strong>Geschichte</strong> in der modernen Literatur, in: Klaus Bergmann<br />
/ Klaus Fröhlich / Annette Kuhn / Jörn Rüsen / Gerhard Schneider (Flg.),<br />
Handbuch der Geschichtsdidaktik, 5. überarbeitete Auflage, Scelzc-Velbcr (Kallmcyer'sche<br />
Verlagsbuchhandlung) 1997, 626-630
DI-:R WISSKNSARCHÄOLOGISCHI: BÜCK: STATISTIK 1001<br />
Historiker gegenüber eine sichtbare, umgrenzbare und ohne weiteres bestimmbare<br />
Grosse bilden, mithin also erforschbar sind:<br />
»Sie sind organisierte Massen, deren Gefüge deren geistige und moralische Physiognomie<br />
und deren Umfang fast immer mit ziemlicher Genauigkeit festgestellt<br />
werden kann. Wo immer es aber der Historiker mit einer unorganisierten Masse<br />
zu tun bekommt, tappert er im Dunkeln und er weicht schliesslich lieber diesen<br />
schrecklich ungefügten Dingen, die oft alle konkrete Bestimmbarkeit einbüssen<br />
und sich tief im Abstrakten verlieren, mit ein paar allgemeinen Redensarten aus.<br />
Wie soll man aber klare Bilder gewinnen <strong>von</strong> der Wucht, dem Umfang und<br />
der Wirkungsweise ungefüger, zerflicssender, zerstäubender Menschenmassen,<br />
wofern diese nicht wie eben das moderne Industrieproletariat sich selbst ein<br />
Gefüge geschaffen habe und als organisierte Körperschaft auf den Plan treten. <br />
und es ist nicht einmal bewusster Wille zur Uebertreibung, der die Aussagen<br />
bestimmt, sondern vielfach ehe mangelnde Fähigkeit, die Masse eines Stromes, in<br />
dem man selber schwimmt, rechnerisch abzuschätzen.« <br />
Historische <strong>Im</strong>agination bedarf der rhetorischen Figurierbarkeit ihres Datenmaterials,<br />
um zum Zuge, zur Darstellung kommen zu können. Für die historische<br />
Information heißt das Konfiguration: Daten müssen strukturiert sein, um berechenbar<br />
zu werden. Nur Form und Geformtes sind identifizierbar; so dient die<br />
Beobachtung großer Massen der Erkenntnis <strong>von</strong> Regelmäßigkeit in den scheinbar<br />
zufälligen Erscheinungen. »Man muss erst eine Menge einzelner und kleiner<br />
Fälle und viele Jahre sammeln und ganze Provinzen zusammennehmen, um<br />
dadurch die verborgenen Regeln der Ordnung an das Licht hervorzuziehen.<br />
Dann erst lernt man einsehen, wie übereinstimmend die Regeln dieser Ordnung<br />
sind.« 23 Heißen solche unsichtbaren Regeln Unsichtbare Hand oder Kybernetik?<br />
Süssmilch führt Gott als den unendlichen und genauen Anthmetikus an, welcher<br />
»alles Zeitliche und Natürliche nach Mass, Zahl und Gewicht bestimmt«. 24<br />
In dem Moment, wo Datenmassen an Messung gekoppelt werden, kommt das<br />
Archiv ins Spiel, denn solche Messungen sind keine harmlosen Eingriffe; ein<br />
System, in welchem solche Messungen vorkommen, weist eine Art Erinnerungsvermögen<br />
auf, da man an dem Zustandsparameter y erkennen kann, was <strong>für</strong> einen<br />
Wert ein anderer Zustandsparameter x zu einem früheren Zeitpunkt gehabt hat. 23<br />
23 Süssmilch, zitiert nach: V. John, Name und Wesen der Statistik, in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Schweizerische Stastistik 19. Jg., Bern 1883,97-112(102)<br />
24 Johann Peter Süssmilch, Die Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen<br />
Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben cnvie-<br />
«en, 2. Autl. öwt-liti l?ß|,§ I 7, ?,itici-t unci-ii julm jäüji J04, J,\,{ §li*nmil'-U limiti««mtiii<br />
Statistikbegriff siehe Ivo Schneider, Mathematisierung des Wahrscheinlichen und<br />
Anwendung auf Massenphänomene im 17. und 18. Jahrhundert, in: Rassem / Stagl<br />
(Hg.) 1980: 53-66 (61)<br />
2:1 L. Szlilard, Über die Entropieverminderung in einem themodvnamischen System bei<br />
Eingriffen intelligenter Wesen, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Physik (1929), 840-856 (842)
1002 INVENTAR UND STATISTIK<br />
Diese Erkennbarkeit aber ist <strong>für</strong> menschliche Augen (im Unterschied zur<br />
maschinellen Datenlese) an Sichtbarkeit gekoppelt. Datenmassen lassen sich,<br />
alternativ zu ihrer Erzählung, als Graphen darstellen. Wenn es Funktion der statistique<br />
sociologique ist Ȋ eclairer les faits sociaux par leur cote regulier, mesurable<br />
et nombrable«, ist sie (»comme ä l'archeologie«) an enregistrements steriles<br />
gebunden. Tarde benennt die epistemische Bedingung des wissensarchäologischen<br />
Blicks im 19. Jahrhundert als die Kehrseite des Historismus: die Analogie<br />
der graphischen Registnersysteme <strong>von</strong> Archäologie, Statistik und der methode<br />
^raphiquc in den Naturwissenschaften, »l'emploi de la methode grapinque de<br />
M. Marey ou l'observation des maladies par le myographe, le sphymographe, le<br />
pneumographe, sortes de statisticiens mecamques des contractions, des mouvements<br />
respiratoires« . Alles, was in Form <strong>von</strong> spatiotemporellen<br />
Daten exakt meßbar ist, s'expnme graphiquement. 2b <strong>Im</strong> Schatten einer<br />
erzählenden Historiographie operieren zahlbasierte Graphen.<br />
Statistik zwischen Staats-, National- und IIiljswissenschaft<br />
»Comment rediger ou presenter une histoire des sciences?« fragt Michel Serres,<br />
Herausgeber der Elements d'histoire des sciences (Paris 1989), um die Antwort<br />
in einer dem Vorwort angehängten Fußnote zu geben: als »Percolalion: desenption<br />
statistique de systemes constitues cTun grand nombre d'objets qui peuvent<br />
etre relies entre eux« . Medium dieser Datenkonfiguration ist<br />
das Archiv als Zustandsspeicherung des Staates; Statistik entsteht als historische<br />
Disziplin. Gottfried Achenwall setzt Statistik als Substantiv 1749. Während der<br />
deutsche Begriff Staat eindeutig ist, kann sich der lateinische Status sowohl auf<br />
einen politischen Körper wie auf den aktuellen Zustand einer Sache beziehen.<br />
So kann Statistik sowohl Staatswissenschaft wie die Beschreibung eines allgemeinen<br />
Zustands sein. »In practice, statistics - Schlözer's >stationary history< -<br />
was a nondesenpt enterpnse akin to pohtical geography.« 27 Achenwalls 1746er<br />
-''' Etiennc Jules Marey, La Methode Graphique clans les Sciences cxpenmentales, Paris<br />
(Masson) 1894, 1. Marey seinerseits verweist (zurück) auf die französische Übersetzung<br />
eines Werks <strong>von</strong> M. W. Playfair (Tableaux d'arithmetique lineaire du commerce,<br />
des finances et de la dette nationale d'Angleterre, Paris 1789), der in England die graphische<br />
Notation statistischer Daten einführt, »pour montrer que les courbes seules<br />
fönt apparaitrc clairemcnt la signification d'une statistique« (13).<br />
27 Theodore M. Porter, Lawless Society: Social Science and the Reinterprcrtation of Statistics<br />
in Germany, 1850-1880, in: Lorenz Krüger / Lorraine J. Daston / Michel Heidelberger<br />
(Hg.), The probalistic revolution, M IT (2. Aufl.) 1989, 351 -375 (352), unter<br />
Bczug auf: August Ludwig <strong>von</strong> Schlö/er, Theorie der Statistik nebst Ideen über das<br />
Studium der Politik überhaupt. Erstes Heft, Göttingen (V & R) 1804, Einleitung
DhR WISSI-NSARCHÄO1.OGISCHI-. BlJCK: STATISTIK 1003<br />
collegium statisticum macht, so Schlözer, zuerst einen Anfang (Wissensarchäologie<br />
der arche), indem es der »zerstreuten, stückweise schon vorhandenen<br />
Materie der Statistik eine scientivische Form zu geben« sowie eine Menge <strong>von</strong><br />
»heterogenen, aber zum gegebenen Zweck unentbehrlichen Daten unter einem<br />
Gesichtspunkt zu vereinen« sucht; zugleich erkennt Achenwall an, daß jene<br />
Materie der Statistik schon existiert, »seitdem es Regierungen, <strong>Geschichte</strong> und<br />
Reisebeschreibungen gibt« . Diese Datenästhetik<br />
ist Funktion einer pragmatischen Disposition: Der Franzose Deparcieux etwa<br />
entwickelt in .seinem !:ssay sur la probabdite de la durc'c de la vie hitmame <strong>von</strong><br />
1746 einen Grundgedanken des Versicherungstheoretikers Flalley mathematisch<br />
weiter; die aufgrund <strong>von</strong> Familien- und Klosteraufzeichnungen gewonnene<br />
Mortalitätstabelle wird die Grundlage - das Archiv - <strong>für</strong> die Tarife der allgemeinen<br />
französischen Altersversorgungskassen.<br />
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts bringt die deutsche wissenschaftliche Statistik<br />
ihre Objekt mit Zahlen zur Deckung, die bis 1860 mit der offiziellen Form <strong>von</strong><br />
Statistik identifiziert wird - »a >hfeless and mechamcal< practice that flattened the<br />
deheate social contours and Staatsmerkwürdigkeiten (disetinctive attnbutes of a<br />
given State) beneath the homogemzing force of bureaucratic centralization« . Zwischen Erzählung und Zahlen bewirkt die Emergenz der Sozialwissenschaften<br />
nicht unverzüglich eine Transformation der deskriptiven zur numerischen<br />
Statistik. Carl Knies will mit Zahlen vornehmlich Gesellschaft charakterisieren;<br />
ein Teil der akademischen Statistiker in Deutschland um 1850 aber läßt<br />
sich <strong>von</strong> der verbalen zur numerischen Beschreibung erst dann bewegen, nachdem<br />
auf der Grundlage <strong>von</strong> Tabellen eine entsprechend glaubwürdige Methode<br />
entwickelt worden ist - das Verdienst Quetelets. »With this change, statistics ceased<br />
to be frozen history and became something like what lt had long been in Great<br />
Britain and France, empirical political economy« .<br />
Die Worte Statista, statisticus kommen schon gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts<br />
in einer Bedeutung vor, die mit dem Begriff Staat in Verbindung steht.<br />
Die etymologische Rückführung verläuft vom lateinischen Status (Zustand)<br />
über die romanischen Umbildungen und Bedeutungen dieses Wortes hin zu<br />
Staat, so daß Statistik Wissenschaft, Kunde des Staates bedeuten kann »oder<br />
Kunde des Zustandes und des Zuständlichen« . Statistik steht<br />
insofern vielmehr im Bunde mit Juristen (denn mit Historikern), die bereits im<br />
alten Reich das Kollegium über Reichsgeschichte frequentierten, »um die laufenden<br />
Rechtsnormen, um den damaligen Zustand zu verstehen.« 28 Heinrich<br />
Luden schreibt <strong>von</strong> jenseits dieser Perspektive: »Jetzo hat das deutsche Reich<br />
- s Heinrich Luden, Kini^e Worte über das Studium der vaterländischen <strong>Geschichte</strong>. Vier<br />
öffentliche Vorlesungen, Jena 1810, 42f.
1004 INVKNTAK UND STATISTIK<br />
aufgehört, und wird nur noch in seinen Trümmern erblickt. die alten Formen<br />
werden zuverläßig nicht wiederkommen« . So ist die deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong> mithin eine Abfolge juristisch programmierter Zustände der<br />
Staatsmaschine. Der Begriff der Statistik oszilliert im double-bind zwischen<br />
Staatswissenschaft und Strukturanalyse (sprich Wissensarchäologie):<br />
»Diese Unsicherheit war durch die Vergleichung der deutschen >Statistiken< noch<br />
größer, denn sie litten an dem Mangel aller klaren Entscheidung über diesen Punkt.<br />
Durch die doppelte Bedeutung des etymologischen Grundwortes war zugleich<br />
eine Verbindung der beiden Bedeutungen nahe gelegt, wozu man bald schritt, um<br />
die Statistik als die Wissenschaft vom (gegenwärtigen) Zustande des Staates oder<br />
des Zuständlichen im Staate zu constituiren.« <br />
Bezeichnet Statistik begriffsgeschichtlich ursprünglich eine Staatswissenschaft,<br />
bilden etymologische Studien sich ein hybrides Gedächtnis, gegenhistorisch.<br />
Butte beantwortet in seiner Statistik als Wissenschaft (1802) die Frage Schlözers<br />
nach Erklärung des deutschen Wortes Staat durch Ableitung desselben <strong>von</strong> dem<br />
Persischen stathma als »Bezeichung der Orte, wo der König auf seinen Reisen<br />
einzukehren pflegt«; das Wort Stand I Status dagegen stamme <strong>von</strong> dem altgermamschen<br />
notsstallon oder notsstatton, »Staatsnotwendiger« . Der Etymologie nach wäre also Statistik Staatszustandswissenschaft<br />
. Als im Symbolischen <strong>von</strong> Numerik operierende<br />
Disziplin gewinnt sie ihre Energie durch die Anschheßbarkeit an Diskurse des<br />
<strong>Im</strong>aginären. Dann liegt ihr diskursiver Mehrwert: »Ganz verschwunden sind zu<br />
keiner Zeit diese nationalen Verschiedenheiten in der Auffassung und Behandlung<br />
der Statistik namentlich zwischen den erwähnten vier Völkern« . Die Lehren der allgemeinen Politik bedürfen <strong>für</strong> jeden Staat gewisser<br />
Modificatwnen - je nach dem bestimmten gegebenen Zustande des Staates.<br />
Statistik ist raumgreifend und gleichzeitig eine Provokation des Begriffs der<br />
Nation als Raum:<br />
»Eine Disciplin, die jene Modihcation untersuchen würde, möchte auch Statistik<br />
heißen. - Eine die allgemeine Politik in Bezug auf einen bestimmten Staat modifi-<br />
• cirende Wissenschaft hätte das größte Recht auf den <strong>Namen</strong> Statistik. Sie möchte<br />
noch speeiellc Statistik genannt werden, weil ihr Stoff ein speciell angegebener Staat<br />
wäre. Sie würde Politik des Raumes (als Staatsgebiets) sein, sowie die allgemeine<br />
Statistik uns <strong>Geschichte</strong> des Raumes (als Staatsgebiets) ist. - Die Statistik ist immer<br />
nur eine Vermittlerin; zuerst als allgemeine Statistik zwischen der Geographie und<br />
<strong>Geschichte</strong>, dann als spezielle zwischen der allgemeinen Politik und dem aus der<br />
<strong>Geschichte</strong> und Geographie bekannten Zustande eines gegebenen Staats.«- 1 ' 1<br />
Statistik ist Mitte des 19. Jahrhunderts keine spezifische Disziplin, sondern ein epistemisches<br />
Medium quer durch alle Disziplinen. Derselbe Medizinalpolitiker<br />
29 Kasimir Krzywicki, Die Aufgabe der Statistik, Dorpat 1844, 54ff
Di-.u WISSI'.NSAKCI iÄ(M.t)C;ISC:I ii-. BLICK: STATISTIK 1005<br />
Rudolf Virchow, der sich in Berlin auf den Feldern der Infrastruktur (Kanalisation),<br />
der Anthropologie, der Prähistorie und Museologie (mit der Unterbringung<br />
einer entsprechenden Sammlung im Pathologischen Institut) auszeichnet, propagiert<br />
die Gesundsheitsstatistik als »die einzige Möglichkeit, bestimmte bisher nicht<br />
erkannte Zusammenhänge <strong>von</strong> Krankheiten, Seuchen und Todesfällen aufzudecken«.<br />
30 So wird nicht mehr in rhetorischen Figuren, sondern als Zahlenwerk<br />
veranschaulicht, was als Relation zwischen den Dingen bislang unsichtbar war,<br />
nun aber berechenbar wird. Als Gutachter der Königlichen Wissenschaftlichen<br />
Deputation <strong>für</strong> das Medizinalwesen sucht er 1871 <strong>für</strong> die Medicinal-Statistik ein<br />
Reichsorgan zu gründen ; 1872 wird das seit 1862 existierende Berliner<br />
Statistische Amt auf Dauer institutionalisiert. Am 13. November 1872<br />
berichtet Virchow vor der Berliner Medizinischen Gesellschaft Ueber die Sterblichkeitsverhältmsse<br />
Berhn's, worin er die Verkartung individueller Sterbedaten als<br />
Apparat der Massenerhebung und geordneten Adressierbarkeit (das nomen<br />
morbi) darlegt. Auf dem internationalen Kongreß <strong>für</strong> Statistik in Berlin 1863 hat<br />
Virchow bereits die Übersichten Ueber Recrutirungs-Statistik und Die Morbilität,<br />
Invalidität und Mortalität der Militärbevölkerung als Vektor <strong>von</strong> Biostatistik definiert:<br />
Neben Schulkindern sind schließlich allein Militärangehörige lückenlos zu<br />
erfassen (die Bedingung <strong>von</strong> Statistik vor Markov). Das heißt Selbstbeobachtung<br />
des Staates als Inskription. Militärische Disziplin, archivischc Ordnung und statistische<br />
Analyse sind originär verkoppelt; demgegenüber erweisen sich auch kultur(gedächtms)wissenschafthche<br />
Großunternehmen wie die preußische<br />
Denkmälermventansation, die massenhafte Edition deutscher Geschichtsquellen<br />
<strong>von</strong> Seiten der Monumenta Germaniae Historica sowie das im Germanischen<br />
Nationalmuseum Nürnberg intendierte Generalrepertonum deutscher Kulturobjekte<br />
als Teilmengen eines nicht nach der Differenz <strong>von</strong> Geistes- und Naturwissenschaften,<br />
sondern den Medien ihrer Datenverarbeitung differenzierten<br />
Dispositivs, das im Begriff der Statistik zum inneren Objekt gerinnt. Eine nicht<br />
geschichtsphilosophisch subsumierte Kulturwissenschaft als »höhere Form des<br />
Enzyklopädismus« (Riehl) bedarf des Darstellungsmediums Erzählung kaum<br />
noch, sondern registriert und inventarisiert, speichert und überträgt Daten. 31<br />
Eine Drucksache/l« die Freunde der vaterländischen <strong>Geschichte</strong> und Statistik<br />
(ca. 1850) definiert die Aufgabe der »historisch-statistische Section« der Schlesischen<br />
Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde,<br />
die auf Mährens und Schlesiens <strong>Geschichte</strong> und Statistik sich beziehenden Quel-<br />
30 Heinz Simon / Peter Krietsch, Rudolf Virchow und Berlin, Berlin (Pathologisches<br />
Institut der Humboldt-Universität zu Berlin) 1985, 42<br />
31 Georg Steinhausen, autobiographischer Aufsatz, in: Sigfried Steinberg (Hg.), Die<br />
Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 1, Leipzig (Meiner)<br />
1925,233-274(240)
1006 INVICNTAR UND STATIS'I'IK<br />
len und Materiahen »zu sammeln, der Benützung und Verwendung durch Geschichtsschreiber<br />
und Statistiker zuzuführen, und wo möglich einzuwirken, daß<br />
durch die Kenntniß der vaterländischen <strong>Geschichte</strong> und des Zustandes der Gegenwart<br />
das Volksbewußtseyn geweckt und veredelt werde.« 32 Das Nachrichtenblatt<br />
der Wiener Historischen Kommission ruft um dieselbe Zeit (bezüglich der Steiermark)<br />
dazu auf, »<strong>Geschichte</strong> und Topographie, Genealogie und Statistik eines<br />
Landes und seiner Bewohner« als ungeheures Feld der Forschung zusammenzustellen<br />
33 ; diese parataktische Reihe weist der Historie nicht die Suprematie, sondern<br />
schlicht einen Ort im Datenraum und seiner Verarbeitung zu. <strong>Im</strong><br />
statistischen Druck erscheint auch das Volk nicht länger unter organizistischer 34<br />
Körpermetaphorik subsumiert, sondern in der mechanischen Folge <strong>von</strong> Lettern:<br />
Oesterreichisches Volksbuch. National-Encyclopädie. Alphabetische Darstellung<br />
des Wissenswürdigsten aus dem Gebiete des constitutionellen Staatslebens, der<br />
Gesetzkunde, Staatswirthschaft, <strong>Geschichte</strong>, Geographie, Statistik und Naturbescheibung,<br />
der Literatur und Kunst des österreichischen Kaiserreiches, Zweite Auflage,<br />
I. Heft (A-Archi), Wien 1850. 3S Zwischen A- und Archi setzt sich das Archiv<br />
als wissensarchäologisches Medium der alphabetischen Reihung selbst; in diesem<br />
Sinne will auch Jacques Derrida, das Archiv denkend, nicht mit dem Beginn<br />
beginnen, sondern mit dem Doppelsinn des Begriffs arche als Kommando . Die Listen der zu sammelnden Gegenstände in den Statuten <strong>für</strong> den<br />
Verein des tirolischen Nazionalmuseums in Innsbruck schreiben die Kopplung<br />
<strong>von</strong> ars und techne in der aus der Epoche der Aufklärung vertrauten Form<br />
fort, also klassifizierend und nicht subsumiert unter einer historischen Syntax:<br />
»A. In naturhistorischcr Minsicht<br />
B. In artistischer und technologischer I finsicht<br />
C. In historischer und statistischer 1 Iinsicht«,<br />
darunter dann »Antiquitates etc.«, eine »vaterländische Sammlung <strong>von</strong> Antiken«,<br />
Wappen und die »tirolische Urkunden-Sammlung«; ferner »eine vaterländische<br />
Bibliothek« samt Kartenwerk. 36 Auch die Statuten des historischen Vereins <strong>für</strong><br />
Kärnten lesen Gedächtnis statistisch eher denn als narrative Historie; Zweck des<br />
Vereins ist die Pflege der speziellen <strong>Geschichte</strong>, Statistik und Topographie des<br />
32 Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 178, Abt. VII Nr. I: Nachrichten über fremde<br />
Archive (auch historische Museen) 1844-1869, Bl. 20r<br />
33 Ebd., Bl. 123 = Notizenblatt No 24 (1855). Beilage zum Archiv <strong>für</strong> Kunde österreichischer<br />
Geschichtsqucllcn, h^. v. d. histor. (Kommission der kaiserlichen Akademie<br />
der Wissenschaften in Wien, S. 577, Einleitung<br />
34 Siehe Butte 1808: 195; ebd.: 242, über die Differenz <strong>von</strong> Statistik als »Aggregat« und<br />
»lebendiges Ganze <strong>von</strong> Kenntnissen«.<br />
35 GehStaAr Berlin, ebd., Bl. 15r-19v<br />
36 GehStAr ebd., 89ff, hier: 92r
DKR WISSKNSARCHÄOI.OGISCHI-: BLICK: STATISTIK 1007<br />
Herzogthums? 7 Alles, was die Vergangenheit an Überlieferungen, Nachrichten,<br />
Chroniken, Urkunden und Denkmälern der Religion, der Rechtspflege, der Verwaltung,<br />
der Industrie, des häuslichen Lebens, des Verkehres, der Kunst und<br />
Wissenschaften, der Sprache und der Gebräuche hinterlassen hat, wird damit<br />
zum Gegenstand der Erforschung, der Aufzeichnung und Sammlung. Unter diesem<br />
Aspekt ist auch Gegenwart Teil dieser Datenbank, »um der Nachwelt ein<br />
möglichst treues Bild derselben zu überliefern, oder wenigstens das geeignete<br />
Material zu einer solchen Darstellung zu sammeln und zu bewahren« . Damit sind auch auswärtige Archive und Sammlungen <strong>von</strong> vormals<br />
mit den inneren und äußeren Geschicken Kärntens in Verbindung stehenden<br />
Länder, in den Datenerfassungsbereich zu ziehen . Sind Reichweiten<br />
<strong>von</strong> Übertragung und Speicherung die Maßgabe, endet Gedächtnis - im Unterschied<br />
zur jewengen <strong>Geschichte</strong> - nicht an den Grenzen der Nation.<br />
Hier ganz dem <strong>von</strong> Kant gesetzten und <strong>von</strong> Foucault identifizierten epistemologischen<br />
Dispositiv des Menschen als empirisch-transzendentaler Doublette<br />
verschrieben 38 , definiert der Leiter des Königlich Württembergischen Statistikbüros<br />
Gustav Rümelin,<br />
»daß die Erfahrungswissenschaften vom Menschen, wenn sie auch nicht ohne<br />
unnatürlichen Zwang in Eine Disciplin zusammengedrängt werden können, doch<br />
eine Gruppe aneinandergränzender und verwandter Disciphnen bilden und<br />
sehr häufig, ja in der Regel Eine und dieselbe Ermittlung <strong>von</strong> Thatsachen in verschiedene<br />
Fächer einschlägt. Als die Aufgabe dieser Hilfswissenschaft bezeichnen<br />
wir nun kurz: die Ermittlung <strong>von</strong> Merkmalen menschlicher Gemeinschaften auf<br />
der Grundlage methodischer Beobachtung und Zählung ihrer gleichartigen Erscheinungen,<br />
und fassen dabei unter dem allgemeinen <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> Gemeinschaften<br />
sowohl natürlich Gruppen <strong>von</strong> Individuen, wie Völker, Staaten, Provinzen etc., als<br />
die einer gesonderten Betrachtung lahigen Lebenskreise, wie die politischen, wirtschaftlichen,<br />
geselligen, kirchlichen etc. Verhältnisse zusammen.« 3V<br />
Diese Diskretisierung der Schrift des Lebens als Abfolge <strong>von</strong> Charakteren hat es<br />
in den Raum der Speicher übertragbar und so zum epistemischen Ding gemacht. 40<br />
In Berlin wird die Formalisierung des Lebens konkret. Nachdem das Ana-<br />
37<br />
GehStAr ebd., Bl. 11 Off, hier: 111 r, § 1<br />
38<br />
Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge: eine Archäologie der Humanwissenschaften,<br />
übers. Ulrich Koppen, 9. Aufl. Frankfurt/M. 1990, Kapitel 9 »Der Mensch und<br />
sein Doppel«, 367-412 ( :: 'Les mots et les choses, Paris 1966). Über Statistik als empirische,<br />
als »Erlahrungswissenschaft«: Butte 1808: 242<br />
3y<br />
Gustav Rümelin, Zur Theorie der Statistik I. 1863, in: ders., Reden und Aufsätze,<br />
Tübingen (Laupp) 1875, 208-164 (222)<br />
40<br />
Vgl. Hans-Jörn Rheinberger, Von der Zelle zum Gen, in: ders. / Bettina Wahrig-<br />
Schmidt (Hg-), Räume des Wisens: Repräsentation, Codierung, Spur, Berlin (Akademie)<br />
1997,279(277)
1008 INVKNTAK UNO STATISTIK<br />
tomische Institut und Museum des Berliner Hospitals Charite in die Gründung<br />
der Berliner Universität 1810 einbezogen ist, verfügt 1811 die preußische Regierung,<br />
menschliche Mißgeburten im Land nach Berlin an den Direktor C. A.<br />
Rudolphi zu schicken (im Offiziellen Amtsblatt Preußens bindend verankert).<br />
Auch medizinische Statistik arbeitet flächendeckend. Virchows Eröffnungsrede<br />
<strong>für</strong> das Pathologische Museum (die Präparatesammlung) der Charite Berlin 1899<br />
übersetzt Monstren (das Andere des Monuments) aus dem singularen Raum der<br />
Kuriosität in den der Serie und macht aus ihnen so überhaupt erst Aussagen:<br />
»So zeigt der Janus unserer Sammlung auf der einen Seite ein sehr vollständiges<br />
Gesicht, während auf der anderen Seite eine Art <strong>von</strong> Mondkalb sitzt, das zu einer<br />
unförmigen Masse zusammengegangen ist. Diese Präparate werden genügen zu<br />
zeigen, daß ein vollständiges Verständnis dieser bizarren Mißbildungen nur durch<br />
die Betrachtung ganzer Reihen gewonnen werden kann . Das >Wunder< löst<br />
sich dann in eine Reihenfolge gesetzmäßiger Erscheinungen auf, welche <strong>für</strong> den<br />
Aberglauben gehören
DI:R WISSKNSARCHÄOI.OGISCHI: BLICK: STATISTIK 1009<br />
Der statistischen, <strong>von</strong> Krüger als materialistisch qualifizierten Einsicht in die Diskretheit<br />
<strong>von</strong> Wissens-, Speicher- und Datenmengen stemmt sich germanische<br />
Denkart zwar entgegen ; doch »je mehr die Maschinentechnik<br />
Platz gewinnt und >betriebsmäßige< Organisation überall durchgreift, je mehr<br />
die äußeren Mittel der Zivilisation an seelischem Räume in Anspruch nehmen,<br />
um so mehr werden lebendige Menschen vergewaltigt, ihre Wendigkeit,<br />
ihre Energie in Zweckhandeln, ihr rechnerischer Sinn steigert sich beliebig«<br />
. Medien fungieren hier nicht als Prothesen des Menschen, sondern<br />
umgekehrt. Unter solchen Bedingungen läßt sich der Ganzheitsbegriff nicht mehr<br />
idealistisch retten, sondern nur noch, wenn er selbst mechanistisch verstanden<br />
wird, als Gleichgewicht <strong>von</strong> unter einander »grundsätzlich unabhängigen, den<br />
newtonschen oder ihren entsprechenden Prinzipien gehorchenden Elementen«. 43<br />
Der wissenschaftliche Anspruch der Disziplin Statistik ruft den Einwand auf<br />
den Plan, die bloße Anwendung eines formellen Verfahrens, die Handhabung<br />
eines gewissen Beobachtungsmittels könne nicht den Inhalt einer besonderen<br />
Wissenschaft bilden, »so wenig, als man sich z. B. die Microscopie als eine Wissenschaft<br />
denken könne« - eine Definition <strong>von</strong> Medienwissenschaft<br />
avant la lettre. Demgegenüber verweist Rümelin auf andere, längst<br />
anerkannte Hilfswissenschaften, deren Wesen ebenfalls in der reinen Handhabung<br />
eines formellen Verfahrens besteht, speziell die philologische Kritik und<br />
Hermeneutik, deren Aufgabe nur darin bestehe, literarische Denkmale mit<br />
gelehrter Ausstattung herzustellen, so daß sie den Zwecken der verschiedenen<br />
Wissenschaften dienen können.<br />
»Solche heuristische Disciphnen, die den objeetiven Wissenschaften den unentbehrlichen<br />
Stoff in methodischer Bearbeitung liefern, haben das gleiche Verdienst,<br />
wie etwa der gelehrte Reisende, der ein unbekanntes Land erforscht hat und die<br />
Ergebnisse der Reise gleichsam auf den Tisch der Wissenschaft nieder legt, so daß<br />
der Naturforscher, wie der Philosoph, der Sprachgelehrte oder dev I listonkcr, der<br />
Nationalökonom oder auch der practische Kaufmann da<strong>von</strong> Gebrauch machen<br />
kann.« <br />
Und das heißt <strong>für</strong> die Statistiker als Sekretäre des Zeitgeists, Datenbanken zur<br />
Verfügung zu stellen. Statistik emanzipiert sich vom staatskundhchen Beiwerk<br />
zur Informationswissenschaft, zur gemeinsame Hilfsdisziplin aller Erfahrungswissenschaften<br />
vom Menschenleben:<br />
»Man könnte an allerhand mehr oder weniger bezeichnende <strong>Namen</strong>, an Observationistik,<br />
Empirologie, Empiristik des Menschen, sociale Heuristik und Aehnli-<br />
43 Hans Driesch, Über die grundsätzliche Unmöglichkeit einer »Vereinigung« <strong>von</strong> universaler<br />
Teleologie und Mechanismus, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie<br />
der Wisenschaften, Philosphisch-historische Klasse, Jg. 1914, 1. Abhandlung,<br />
Heidelberg (Winter) 1914, 1-18 (10)
1010 INVI-NTAR UNO STATISTIK<br />
ches denken, aber die Bemühung ist überflüssig; der Name ist schon da; sie heißt<br />
- Statistik. Sie führt diesen <strong>Namen</strong> jedoch nicht bei den Theoretikern, sondern nur<br />
in der Auffassung der Praktiker und im gemeinen Sprachgebrauch. Sie hat auf denselben<br />
auch kein unzweifelhaftes historisches, noch weniger ein etymologisches<br />
Recht, Die oben erwähnte Thatsachc, daß jene Hilfswissenschaft zuerst und lange<br />
blos im Dienst des Staates und der Staatswissenschaften gestanden ist, war die<br />
Ursache, daß ihr eigenthümlicher, methodologischer Charakter verborgen blieb<br />
und nur als unwesentliche Beigabe einer bestimmten staatswissenschaftlichen Disciplin,<br />
der Staats- oder Zustandskundc, erschien.« <br />
Die wissensarchäologische Bruchstelle der Statistik liegt in der Umsehaltung<br />
<strong>von</strong> Alphabeth auf Numerik:<br />
»Allein die Anwendung jenes fruchtbaren Beobachtungsmittcls der universellen<br />
Zählung dehnte sich bald auf eine Menge weder den Staat noch die Gesellschaft<br />
betreffender Objecte, wie physiologische, pathologische, psychologische etc. Fragen<br />
aus, und mußte den Gedanken an eine Trennung <strong>von</strong> Methode und Materie<br />
bald nahelegen. Da, wo die Statistik am sorgfältigsten ausgebildet wurde, <br />
mußten die Fachmänner zuerst bemerken, daß eine gewisse, stets mit Zahlen in<br />
Berührung stehende Methode das Eigenthümliche ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit<br />
sei und suchten daher ihr Fach zuerst aus den fremden Banden zu emaneipiren.«<br />
<br />
Die Beobachtungen und Berechnungen John Gaunts waren der Ausgangspunkt<br />
jener wissenschaftlichen Richtung, welche sich im <strong>Namen</strong> einer politischen<br />
Arithmetik »immer vollkommener zur >Beobachtungs- und Messungsdisciplin<<br />
der gesammten Gesellschaftswissenschaft entwickelte« . Politische<br />
Rechenkunst: Sir William Petty, Freund <strong>von</strong> Hobbes und Mitgbegründer<br />
der Royal Society, schreibt in der Vorrede seiner Poliücal Anthmetick<br />
(1679): »I have taken the course to express myself in Terms of Number,<br />
Weight, or Measure; to use only Arguments of Sense, and to consider only such<br />
Causes, as have visible Foundations in Nature« . Die Analyse <strong>von</strong><br />
Daten mit visible foundations in nature meint Wissensarchäologie buchstäblich;<br />
die rhetorische Veranschaulichungskategorie der enargeia ist am Werk bei der<br />
Flucht aus der Diskursivität in den (und die) exakten Wissenschaften. 44 Rümehn<br />
definiert dabei die Statistik als Archiv; als Wissenschaft muß sie, wenn sie<br />
aufhören will, ein unlogisches Gemisch und Conglomerat bunter Notizen und<br />
Data darzustellen, Position beziehen:<br />
»Historisch und etymologisch ist die Statistik nun allerdings das empirische Wissen,<br />
dessen der Statista, d. h. der Staatsmann oder der zu einer höheren staatlichen<br />
Thätigkeit Berufene außer der Jurisprudenz noch bedarf, eine Zusammenstellung<br />
<strong>von</strong> Notizen, die theils den Staat theils die Gesellschaft betreffen, ähnlich wie jetzt<br />
Zur enargeia siehe Carlo Ginzburg, Montrer et citer: La verite de l'histoire, in: Le<br />
Debat 56 (Sept./Okt. 1989), 43-54
DHR WISSENSARCHÄOI.OGISCHI: BÜCK: STATISTIK 1011<br />
etwa die sogenannte politische Geographie. Aber im Verlauf ihrer Entwicklung<br />
wuchs aus dem Bedürfnis nach exaeten Thatsachen jene eigenthümliche Methode<br />
heraus, durch rationelle Massenbeobachtung brauchbare Merkmale der socialen<br />
Collectivbegnffe in numerischer Fassung zu gewinnen, und die Natur und Tragweite<br />
dieser Methode führt zu einer socialen Empiristik, einer besonderen Hilfsdisciplin<br />
aller Gesellschaftswissenschaften, welche die variablen Erscheinungen des<br />
socialen Lebens in ihrer quantitativen Umgrenzung ermittelt und <strong>für</strong> den<br />
Gebrauch der verschiedenen Wissenschaften vorbereitet.« 4:><br />
Die nicht mehr auf erzählende, sondern zählende Fassung zielende Definition<br />
<strong>von</strong> Statistik gerät in Widerspruch zu ihrer eigenen Historie:<br />
»Die Staatenkunde hat unzweifelhaft den historischen Rechtstitel <strong>für</strong> jenen <strong>Namen</strong>,<br />
aber der Sprachgebrauch hat sich doch mehr dahin entschieden, bei Statistik an Zählungsergebnisse<br />
zu denken und die Gewinnung und Verarbeitung <strong>von</strong> solchen ein<br />
statistisches Verfahren zu nennen, andererseits aber etwa eine Darstellung der deutschen<br />
Reichsverfassung, der preußischen Kreisordnung, der russischen Agrannstitute<br />
nicht zur Statistik zu rechnen, sondern zum Staatsrecht oder zur Staatenkunde.<br />
Es wäre vielleicht besser gewesen , wenn man jener Methode, Begriffe durch<br />
Merkmale <strong>von</strong> numerischer Fassung zu bestimmen, den <strong>Namen</strong> der numerischen,<br />
statt der statistischen, der darauf begründeten technischen Disciplin den <strong>Namen</strong> der<br />
socialen Empiristik gegeben. Ungenau bleibt es, daß der Sprachgebrauch<br />
das Prädikat einer statistischen Notiz auch auf die Merkmale des Staates, wofern solche<br />
nur überhaupt einen ziffernmäßigen Ausdruck finden, anwendet, also z. B. die<br />
Budgetsätze, die Militärmacht, zumal da hier gesellschaftliche und staatliche Factoren<br />
in einander greifen, die Steuererträge auf die volkswirtschaftlichen, die Heeresziffer<br />
auf die Bevölkerungsverhältnisse zurückweisen.« <br />
Zahlenreihen sich an und <strong>für</strong> sich totes Material zum Beweis einer Behauptung,<br />
»wenn sie nicht mit den wesentlich entscheidenden Thatsachen zusammengebracht<br />
und daraus erklärt« werden. 46 So aber wird eine statistische Aussage, ein<br />
enonce im Sinne <strong>von</strong> Foucaults Archiv-Begriff, sogleich in ein Argument und<br />
damit dem Diskurs anverwandelt. Werden die besonderen Umstände mitgedacht,<br />
ist die Konversion <strong>von</strong> diskreten Mengen in Begriffe des historischen Kontexts<br />
möglich und damit Erzählung an Zahlen wieder anschließbar.<br />
Statistik und Historie: Beloch, Quetelet, Buckle, Droysen, Hegel<br />
Erzählung statt Statistik? Eine Pädagogik, die durch Verschreibung der Lektüre<br />
<strong>von</strong> Biographien das Interesse <strong>von</strong> Kindern auf <strong>Geschichte</strong> lenkt, verkennt das<br />
45 Gustav Rümelin, Zur Theorie der Statistik II. 1874, in: ders. 1875: 265-284 (278)<br />
46 Franz Kantorowicz, Rubelkurs und russische Getreideausfuhr. Eine Währungsstudie,<br />
Jena (Fischer) 1896, Schlußbemerkung (58) = 6. Bd., 3. Heft der Staatswissenschaftlichen<br />
Studien, hg. v. Ludwig Elster, Universität Breslau
1012 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Potential der Alternativen. Dem jungen Karl Julius Beloch war diese <strong>Geschichte</strong><br />
in Biographien, die immer nur buchstäblich subjektive Ausschnitte zeigt, zum<br />
Ekel, bis ihm Theodor Mommsens Römische <strong>Geschichte</strong> unter die Augen kam:<br />
»Außer der Statistik und der Uias hat kein anderes Buch einen so großen Einfluß<br />
auf meine geistige Entwicklung gehabt.« Tatsächlich hat ja gerade der Literaturnobelpreisträger<br />
Mommsen die Alternativen zur anekdotischen Geschichtsschreibung<br />
betont. Damit korrespondiert Belochs Interesse: »Unsere Historiker<br />
verstehen meist nichts <strong>von</strong> Statistik, und unseren Statistikern fehlt sehr oft der<br />
historische Sinn.« 47 Beloch spielt modulare Lektüren <strong>von</strong> Vergangenheit durch:<br />
»Auch in meinen Spielen hatten Geographie, <strong>Geschichte</strong> und Statistik eine wichtige<br />
Rolle. Die Erdteile wurden mit Klötzen aus dem Baukasten nachgebildet,<br />
natürlich dem Material entsprechend auf einfachste geometrische Formen reduziert.<br />
Später wurden die Erdteile aus Pappdeckeln ausgeschnitten und die Bevölkerung<br />
nach den statistischen Zahlen bemessen. Dabei ist mir zuerst der Begriff der<br />
Volksdichte aufgegangen, denn in Westeuropa, Indien und China hatten die Bewohner<br />
nicht Platz, während andere Länder fast leer blieben.« <br />
Die Bevölkerungsgeschichte des Altertums sei bis dahin Tummelplatz eines<br />
wüsten Dilettantismus gewesen; der daraus resultierende Agnostizismus, daß<br />
man <strong>von</strong> solchen Dingen überhaupt nichts wissen könne, führte »zum Verzicht<br />
auf jedes tiefere Verständnis der alten <strong>Geschichte</strong>«. Gekopppelt an das epistemische<br />
Ding der Statistik tritt ein solches Objekt überhaupt erst in Erscheinung.<br />
Medium dieser Tiefe ist <strong>für</strong> Beloch nicht Hermeneutik, sondern Rechnen; Wissensarchäologie<br />
verfallt hier nicht in die Metapher des Grabens, sondern meint<br />
dato, minmg als Flächensondierung:<br />
»Zunächst galt es, in einer zuverlässigen Arealstatistik auf Grund planimctrischer<br />
Messungen die sichere Basis zu schaffen . Denn eine Bevölkerungszahl ist gar<br />
nichts wert, wenn wir nicht wissen, auf welchen Flächenraum sie sich bezieht .<br />
Dann mußte das ganze, aus dem Altertum überlieferte bevölkerungsstatistische<br />
Material gesammelt und kritisch gesichtet werden. Endlich mußten alle diese<br />
Daten untereinander verglichen«<br />
und in eine kalkulierte Form gebracht werden . Historiographie<br />
ist das nicht.<br />
Der Mathematiker und Physiker Fourier tritt nach dem Sturz Napoleons an<br />
die Spitze des neugegründeten statistischen Büros der Stadt Paris; sein Einfluß<br />
erstreckt sich unmittelbar auf den belgischen Mathematiker und Astronomen<br />
47 Karl Julius Beloch, in: Die Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungcn,<br />
hg. v. Siegfrid Steinberg, Leipzig (Meiner) 1926, 3. Zu Mommsens Zugriff auf<br />
Historie siehe W. E. (Hg.), Die Unschreibbarkeit <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien. Theodor Mommsens<br />
Römische Kaisergeschichte und Heiner Müllers Echo, Weimar (Verlag & Datenbank<br />
<strong>für</strong> Geisteswissenschaften) 1995
DHR wissKNSARCHÄüi.ootscHi-: BI.ICK: STATISTIK 1013<br />
Quetelet. 48 G. F. Knapp, der diesen <strong>für</strong> seinen Versuch kritisiert, das Phantasma<br />
des Durchschnittsmenschen analog zu physischen Gesetzen zu definieren 49 ,<br />
weist in Hildcbrand's Jahrbüchern 50 nach, daß Quctelcts Hauptwerk, die Physique<br />
sociale (1869), fast ganz aus früheren Abhandlungen desselben Autors kompiliert<br />
ist. Knapp erklärt dies aus Quetelets modularer Arbeitstechnik, der »<strong>von</strong><br />
neuem Material oder neuen Gesichtspunkten in zahlreichen kleinen Notizen,<br />
welche er in den Bulletins der Brüsseler Akademie niederlegte, sogleich kurze<br />
Nachricht gab, daraus das Verwandte zu monographischen Abhandlungen vereinigte<br />
und erst auf dem Grunde dieser seine selbständig erscheinenden Werke<br />
aufbaute« . So korrespondiert die statistische Datenästhetik mit<br />
dem Effekt <strong>von</strong> Karteikästen. Die Physique sociale, so Knapp, ist »Mosaikwerk«,<br />
nicht einmal »Umguss« . Genau das aber ist der<br />
ganze agonale Unterschied zwischen narrativer und diskreter Datenbewältigung.<br />
Nach der deutschen Übersetzung (1859) <strong>von</strong> Henry Thomas Buckles Flistory of<br />
Civüizaüon in England (1857), welche die Theorien Quetelets histonographisch<br />
implementiert, kritisieren Historiker wie Droysen den britischen Autor als<br />
Autodidakten ohne philosophische Bildung, folglich nur zu blindem Empirizismus<br />
fähig. Buckle sieht, Droysen zufolge, nur die materielle Seite der Dinge,<br />
nicht ihre geistigen und ethischen . Eine unzusammenhängende<br />
Anhäufung <strong>von</strong> Tatsachen werde ganz ungehörig als <strong>Geschichte</strong> bezeichnet.<br />
51 Droysen setzt einer statistischen Rechenbarkeit der Vergangenheit die<br />
narrative Historie entgegen; das stochastische Element heißt dabei Leben als<br />
Raum des Kontinuierlichen, der diskret nicht berechnet werden kann: »Wenn<br />
man alles, was ein einzelner Mensch ist und hat und leistet, A nennt, so besteht<br />
dies A aus a + x, indem a alles umfaßt, was er durch äußere Umstände <strong>von</strong> seinen<br />
Land, Volk, Zeitalter u. s. w. hat und das verschwindend kleine x sein eigenes Zuthun,<br />
das Werk seines freien Willens ist.« Doch so verschwindend klein auch<br />
immer dies x sein mag, »es ist vom unendlichem Werth, sittlich und menschlich<br />
betrachtet allein <strong>von</strong> Werth« . Damit ist das Menschliche am Menschenwerk<br />
als statistische Abweichung definiert.<br />
»Die Farben, die Pinsel, die Leinwand, welche Raphael brauchte, waren aus Stoffen,<br />
die er nicht geschaffen; diese Materialien zeichnend und malend zu verwen-<br />
4S<br />
Über Quetelet und Berthier siehe Eric Brian, La mesure de l'Etat. Recherchcs sur la<br />
division social du travail statistique aux XVIII et XIXc siecle, 2 Bde, Diss. Paris<br />
(EHESS) 1990<br />
49<br />
Dazu Lindenfeld 1997: 240<br />
50<br />
Jg. 1871 160-167 u. 167-174; 342-358 u. 427-445; s. a. G. F. Knapp, Theorie des Bevölkerungswechsels,<br />
Braunschweig 1874<br />
51<br />
Johann Gustav Droysen, Die Erhebung der <strong>Geschichte</strong> zum Rang einer Wissenschaft,<br />
in: Historische Zeitschrift Bd. 9 (München 1863), 1-22 (8)
1014 INVF.NTAR UND STATISTIK<br />
den hatte er <strong>von</strong> den und den Meistern gelernt - aber daß auf diesen Anlaß,<br />
aus diesen materiellen und technischen Bedingungen, auf Grund solcher Ueberlieferungen<br />
und Anschauungen die Sixtina wurde, das ist in der Formel A = a + x<br />
das Verdienst des verschwindend kleinen x. Mag immerhin die Statistik zeigen,<br />
daß in dem bestimmten Lande so und so viele uneheliche Geburten vorkommen,<br />
mag in jener Formel A = a + x dieß a alle die Momente enthalten, die es<br />
>erklären
Dr.K WISSHNSAKCHAOLOGISCHH BLICK: STATISTIK 1015<br />
auf eine Mehrzahl <strong>von</strong> Geistern: »Geistige Freiheit der Menschheit, innere<br />
Durchgeistigung der Natürlichkeit, Gründung eines Geisterreiches, aus dessen<br />
Kelch dem absoluten Geiste seine Unendlichkeit schäumt, ist das absolute Ziel.«<br />
Unerbittlich aber insistiert das Paradigma der Meßbarkeit:<br />
»Die Gerechtigkeit verlangt, auch die Kehrseite des Bildes nicht zu verschweigen.<br />
wir verlangen <strong>für</strong> die Völker und Individuen noch mehr Selbständigkeit, als<br />
ihnen Hegel gestattet, gegenüber der Macht des absoluten Geistes; wir möchten<br />
über der teleologischen Betrachtung die exakte Bestimmung der wirkenden Ursachen<br />
und ihrer Gesetze weniger vernachlässigt wissen; wir haben besonders<br />
starke Bedenken gegen die hervorragende Rolle, welche die denkende Reflexion<br />
in dem Fortschritt der Entwicklung spielt.«"" 3 «<br />
Es sind die exakten Beobachtungwissenschaften, die nach dem Beispiel <strong>von</strong><br />
Newton etwa und Halley vornehmlich in Frankreich ihre epochemachende Ausbildung<br />
erfuhren; obenan Laplace mit seiner Mechanique Celeste seinem Essai<br />
philosophique sur la theone de la probabilite, das gründliche Untersuchungen<br />
über die mathematische Natur der Wahrscheinlichkeit anstellt. Demnach gibt es<br />
keinen Zufall: Nicht der äußere Eingriff eines nach Zwecken denkenden Geistes,<br />
sondern einzig das Gesetz der Kausalität beherrscht demnach die Welt der<br />
Erscheinungen« - ein berechenbarer, also mechanisierbarer Progress ersetzt hier<br />
das Walten des Weltgeists, asymptotisch.<br />
Das Gesetz der Statistik: Zustände und Transformationen<br />
Mit dem Ereignis Napoleon wechselt die deutsche Statistik ihren Charakter als<br />
Geheim- und Staatswissenschaft. Bevor der Freiherr vom Stein zum Initiator des<br />
deutschen Gedächtnisses Monumenta Germamae Histonca wird, richtet er auf<br />
der allen Archivierungen vorgeschalteten Verwaltungsebene 1805 <strong>für</strong> Preußen<br />
ein zentrales statistisch-geographisches Bureau ein; die Doppelschlacht <strong>von</strong> Jena-<br />
Auerstedt unterbricht das Unternehmen, das 1810 als »one of the first acts of<br />
national revival« wiedererrichtet wird, transformiert zur öffentlichen, also auch<br />
diskursiv operierenden Einrichtung. Droysen vergleicht sie mit der Institution<br />
des Großen Generalstabs <strong>für</strong> militärische Sachen; »in beiden Bereichen hat das<br />
Bedürfnis auf diese Kombination des Technischen und Historischen mit den laufenden<br />
Geschäften geführt«. Vorrang hat also die Option der immediaten Rückkopplung<br />
<strong>von</strong> Speicher und (Re-)Aktion im Unterschied zum emphatisch<br />
separierten Gedächtnis, wie es die archivkunclhche Differenz <strong>von</strong> den Archiven<br />
als Darstellung des »Verwaltungszustand der Vergangenheit« im absoluten<br />
Unterschied {Scheidewand) zu den Registraturen als Zustand »der heutigen<br />
53 K. Dieterich, Buckle und Hegel (II), in: Preußische Jahrbücher 1873: 463-481 (4801)
1016 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Administration« unterstreicht. 54 Zwei Zeilen in Richard Wagners Götterdämmerung<br />
sagen diese Differenz <strong>von</strong> Vergangenheit und Gegenwart als Funktion<br />
einer Beobachtung zweiter Ordnung in unnachahmlicher Prägnanz: »Hagen,<br />
was tust du / Hagen, was tatest du.« Dazwischen hegt der Tod Siegfrieds.<br />
Droysen treibt die Analogie <strong>von</strong> Statistik und Gedächtnis weiter; das Archiv<br />
soll »gleichsam das konstante historische Bureau der öffentlichen Tätigkeiten eines<br />
Staates« sein. 55 »There was some need for coordination of data« 56 ; die <strong>von</strong><br />
Reinhart Koselleck nachgewiesene Verdichtung <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>n zum Kollektivsingular<br />
(im <strong>Im</strong>aginären als Geschichtsphilosophie, im Narrativen als Geschichtsschreibung)<br />
findet sein mediales Korrelat auf der symbolischen Ebene der<br />
Verdichtung <strong>von</strong> Daten zur Gegebenheit des funktionalen Staats. 57 Das <strong>Im</strong>aginäre<br />
an jeder Art <strong>von</strong> historiograpischer, also narrativer Schilderung ist die Illusion<br />
eines zentrierten Bewußtseins, Umwelt so zu beobachten, ihre Strukturen und<br />
Prozesse zu erfassen und sich darzustellen, »als ob sie alle Elemente der formalen<br />
Kohärenz der Narrativität selbst besäßen. « 5S Nur daß neben die Form und Rhetorik<br />
der Erzählung das entsprechende Korrelat der Institutionen, Agenturen und<br />
Apparate zu treten hat, das solche Schilderung erst denkbar, plausibel und durchsetzbar<br />
macht - der blinde Fleck jeder metahistorischen Einsicht, bewußt (Version<br />
Jacques Derrida) oder unbewußt (Version Paul de Man). Von daher ist die<br />
narrative Form des historischen Diskurses »nur ein Medium <strong>für</strong> die Botschaft,<br />
das nicht mehr Wahrheitswert oder informatorischen Inhalt besitzt als jede andere<br />
formale Struktur, etwa eine mathematische Gleichung.« Von White ausdrücklich<br />
als Code betrachtet entspricht die Erzählung »einem Vehikel etwa im<br />
dem Sinne, in dem das Morsealphabet als Vehikel <strong>für</strong> die telegraphische Nachrichtenübermittlung<br />
dient« - oder im Sinne der mathematischen<br />
Theorie der Kommunikation. Das Bauunternehmen Nation bedarf der<br />
c/e^rzng-Stellen <strong>für</strong> die infrastrukturelle Administration einströmender Nach-<br />
34<br />
Friedrich Ludwig Baron <strong>von</strong> Mcdem, Über die Stellung und Bedeutung der Archive<br />
im Staate, in: Jahrbücher der <strong>Geschichte</strong> und Staatskunst, hg. v. Karl Heinrich Ludiwg<br />
Pölitz, Bd. II, Leipzig 1830, 28-49 (30)<br />
53<br />
Johann Gustav Droysen, Histonk. Historisch-kritische Ausgabe v. Peter Leyh 1: Die<br />
Vorlesungen <strong>von</strong> 1857, Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung aus den<br />
Handschriften, Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann / Holboog) 1977, 79<br />
%<br />
Ian Hacking, Prussian Numbcrs 1860-1882, in: Krüger / Daston / Heidelberger 1989:<br />
377-394 (378f)<br />
57<br />
Reinhart Koselleck, Artikel »<strong>Geschichte</strong>, Historie«, in: Otto Brunner/Werner<br />
Conze/Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Lexikon zur politisch-sozialen<br />
Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, 593-717<br />
Dii<br />
Hayden.Whitc, Das Problem der Erzählung in der modernen Geschichtstheorie, in:<br />
Pietro Rossi (Hg.), Theorie der modernen Geschichtssschreibung, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1987, 57-106 (69, hier unter Bezug auf Jacques Lacan)
Dl-.R WISSKNSARCHÄOLOGISCHl- Bl.lCK: STATISTIK 1017<br />
richtenmengen zu Wissenseinheiten und, resultierend daraus, ihres archivischen<br />
Gedächtnisses. Nicht nur, daß in jenen Jahren als Ereignis und in Form gedächtnissetzender<br />
Institutionen vom Schlage der Monumenta Germamae Histonca<br />
sich das vollzieht, was Hegel zeitgleich beschreibt: daß nämlich »Geschichtserzählung<br />
mit eigentlich geschichtlichen Taten und Begebenheiten gleichzeitig<br />
erscheine«. Vielmehr gilt auch auf der non-diskursiven Ebene der Statistik, daß<br />
dem Gedächtnis an Historie die archivische Setzung <strong>von</strong> Speichern vorgeschaltet<br />
ist. Der Begriff <strong>Geschichte</strong> vereinigt »die objektive sowohl als die subjektive<br />
Seite«, also die histona rerum und die res gestae; die innerliche gemeinsame<br />
Grundlage aber, »welche sie zusammen hervortreibt«, ist an einen dritten Begriff,<br />
das Medium des Registers gekoppelt und an die Grund-Legung des Archivs als<br />
Gesetz dessen, was überhaupt als <strong>Geschichte</strong> sagbar ist. »Der Staat erst führt<br />
einen Inhalt herbei, der <strong>für</strong> die Prosa der <strong>Geschichte</strong> nicht nur geeignet ist, sondern<br />
sie selbst mit erzeugt« (Hegel); dessen Logik ist im Diskurs beim Übergang<br />
<strong>von</strong> der Ebene des Faktums oder des Ereignisses auf die der Erzählung figurativ,<br />
also tropologisch mit im Spiel . White vergißt in der <strong>für</strong> die meisten<br />
Rhetoriktheorien charakteristischen medienarchäologischen Blindheit zu<br />
ergänzen, daß Faktum und Ereignis auch die Operatoren, die parerga <strong>von</strong> Kanzlei<br />
und Archiv, <strong>von</strong> Übertragung und Speicherung sind, deren Ordnung den<br />
Dokumenten nicht äußerlich, sondern mit am Werk ihrer Aussage ist. Das Wissen<br />
um die Differenz <strong>von</strong> Form(ular), logistischen Vektoren (Aktenzeichen) und<br />
Variablen der Speicherung (Archivsignaturen) eines Textartefakts hegt auf der<br />
Ebene der Beobachtung, der Lesung, nicht auf der Ebene der Zeichen selbst;<br />
gespeichert bilden sie immer nur alphanumerische Stnngs, Datcnclnster, die erst<br />
im Moment ihrer energetischen Mobilisierung (Hermeneutik) in Logistik und<br />
Inhalt zerfallen, und in die Differenz <strong>von</strong> Mikrozeit der Sigmfikantcnreaktivierung<br />
und Makrozeit der Historie auf der Ebene des Signifikats.<br />
Wo der Begriff des Vaterlands an die Stelle <strong>von</strong> genealogischem Familienandenken<br />
und patriarchalischen Traditionen tritt, <strong>für</strong> die »der gleichförmige Verlauf<br />
ihres Zustandes kein Gegenstand <strong>für</strong> die Erinnerung«, sondern Teil der<br />
Gegenwart ist 59 , erstrahlt auch über den aktenkundig gewordenen pragmata des<br />
Staats, dem gleichförmigen Algorithmus der Verwaltung, der glanzvolle Singular<br />
des Staats-Akts, das Meister-Philosophem hegelianisch geprägter Staatstheorie<br />
. Staatskunst als die praktische Anwendung der Staatswissenschaft<br />
sei ohne statistische Grundlagen nur Staatskunstelei. kQ Die preußische<br />
y> Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen zur Philosophie der <strong>Geschichte</strong>, hg. v.<br />
F. Brunstäd, Leipzig (Reclam) o. J. [1907], 103<br />
f '° Ernst Engel, Die Volkszählung, ihre Stellung zur Wissenschaft und ihre Aufgaben in<br />
der <strong>Geschichte</strong>, in: Zeitschrift des Königl. Preussischen Statistischen Bureaus 2 (1862),<br />
25-31 (26)
1018 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
Vorstellung eines in seinen statistisch und in Akten faßbaren Zuständen sich<br />
abbildenden und damit verwirklichenden Staats treibt die Datensammlungswut<br />
voran; die damit induzierten machtkybernetischen Rückkoppelungstechmken<br />
zeitigen Aktenberge. 61 Deren panoptische Übersicht heißt nicht mehr Abbildung,<br />
sondern mapping des Staates, eine mithin hypertextuelle Verknüpfung <strong>von</strong> Daten<br />
zu Informationsteppichen als archivischen Inventaren zweiter Ordnung, wie sie<br />
Gottfried Wilhelm Leibniz am Modell der Staatstafeln (und der ausdrücklichen<br />
Metaphonk des fernglaß <strong>für</strong> die Staats perspectif) längst vor den Preußischen<br />
Reformen entwickelt (und in der syntaktischen Ordnung der Worte das Ordnungs-<br />
und Speicherdenken seiner Epoche selbst ausstellt):<br />
»Alles aber nicht allem leicht zu finden, sondern auch was zusammen gehöret<br />
gleichsam in einen augenbück zu übersehen, ist ein weit größerer Vortheil, als der<br />
insgemein bey mtenvarn anzutreffen, daher ich dieses werck Staatstafeln nenne,<br />
dann das ist das amt einer tafel, daß die Conncexion der dinge sich darinn auf einmahl<br />
<strong>für</strong>stellet, die sonst ohn emühsames nachsehen nicht zusammen zu bringen.<br />
Solchen Vortheil der tafeln findet man bey Land und Seekarten, bey abrißen, bey<br />
der Buchhalterkunst und wohlgefaßten rechnungen, als welche ihre gewiße gleichsam<br />
Mathematische beständige Modell und form haben soll, dadurch alles in die<br />
enge getrieben, und augenscheinlich oder handgreiflich gemacht wird.« 62<br />
Was diese Datenästhetik der Aufklärung vom statistischen Modell der Romantik<br />
(also der Zeit nach den Befreiungskriegen) unterscheidet, ist der Ersatz <strong>von</strong> kartographischer<br />
durch geschichtsphilosophische Perspektivierung, der Zug zum Allgemeinen.<br />
»Mit törichtem Hochmut«, so Karl Brandi, wandte man sich »<strong>von</strong> den<br />
kleinen Dingen der Landschaften ab« und der Nationalgeschichte zu. 63 Jenseits<br />
des historistischen <strong>Im</strong>pulses aber schreibt sich in der Welt der reinen Administration<br />
die Datenverwaltung fort. Was in diskret folgenden Verarbeitungsschritten<br />
zu geordneten Textmassen gerinnt, das Archiv, ist bereits im Datenrückstau, im<br />
Arbeitsspeicher der statistischen Behörde Preußens angelegt. Die Jahresberichte,<br />
die aus den preußischen Provinzen <strong>von</strong> Berlin angefordert werden, gerinnen zu<br />
r>l Unter Bezug auf die Instruclum Jur das Königliche Statistische Bureau siehe Otto<br />
Behre, <strong>Geschichte</strong> der Statistik in Brandenburg-Preussen bis zur Gründung des<br />
Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin (Heymanns) 1905, 383<br />
62 Gottfried Wilhelm Leibniz, Entwurff gewisser Staats-Tafeln [Frühjahr 1680], in: ders.,<br />
Politische Schriften, hg. v. Zentralinstitut f. Philosophie an der Akademie d. Wisenschaften<br />
der DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie-Verlag) 1986, 340-349 (345)<br />
61 Karl Brandi, Über die Pflege der Landeskunde an dar Universität und durch die Gesellschaft<br />
der Wissenschaft, in: Mitteilungen des Universitätsbundes Göttingen, Jg. 17, Heft<br />
2 (1936), 9ff; dazu Gerd Heinrich, Historiographie der Bureaukratie. Studien zu den<br />
Anfängen historisch-landeskundlicher Forschung in Brandenburg-Preußen (1788-1837),<br />
in: Brandenburgische Jahrhunderte. Festgabe <strong>für</strong> Johannes Schultze zum 90. Geburtstag,<br />
hg. v. dems. / Werner Vogel, Berlin (Duncker & Humblot) 1971, 161-189 (186)
DI-:R WISSI-NSARCHÄOI.OGISCHI: BLICK: STATISTIK 1019<br />
einer »fast pedantische Annalistik der inneren <strong>Geschichte</strong> der preußischen<br />
Verwaltungsbezirke« und bilden als Annalistik zugleich<br />
die wissensarchäographische Alternative zur Historie selbst, eine Serie wissensarchäologisch<br />
diskreter Mo(nu)mente. Klaproth sieht in einer Denkschrift <strong>von</strong> 1807<br />
die Akten »bey dem immer fort gehenden Geschäften sich vermehren und<br />
einen Coloß bilden« 64 ; ein Rundschreiben des Staatsministeriums an die Oberpräsidenten<br />
der preußischen Provinzen sucht die Menge der einlaufenden Textstücke<br />
zu drosseln, da es sonst physisch unmöglich sei, die Berichte zu benutzen,<br />
bevor sie veraltet sind . So gilt also schon 1807,<br />
"was der Leiter des Statistischen Amts des Saarlands 1959 konstatiert: »daß in unserer<br />
schnellebigen Zeit nur eine zeitnahe Statistik ihren Zweck erfüllen kann.« 65<br />
Tatsächlich beginnt der Informationsprozeß mit physischen Konstellationen<br />
- ein anderer Name <strong>für</strong> Archiv in jenem datenarchäologischen<br />
Moment, wo Hard- und Software <strong>von</strong> Gedächtnis untrennbar sind.<br />
Koselleck unternimmt in seinem Exkurs eine präzise Medienarchäologie des Aufschreibesystems<br />
Preußen (und oszilliert dabei, wie Foucault, zwischen einer<br />
organologisch und elektromechanisch inspirierten, hohstischen oder kybernetischen<br />
Beschreibung dieser Zirkulation, dieses Schaltkreises), so daß die im Zentrum<br />
Berlin parallelgeschalteten und aknbisch archivierten Berichte aus den<br />
Provinzialverwaltungen hier Objekt und Subjekt (archivische Grundlage) seiner<br />
Beschreibung sind. Administration fungiert so als Subjekt der Historie und ihres<br />
Staus (als Begrenzung der jeweiligen Schreib- und Übertragungsmedien): »Was<br />
schriftlich berichtet wurde, beschränkte sich mehr und mehr auf einen Rückblick,<br />
so daß Zukunftsschwund und gleichsam historische Registratur korrespondierten«<br />
. Warum gleichsam, wenn die Realität <strong>von</strong><br />
Datenverwaltung so unmetaphorisch ist? Zu Beginn einer in Europa um 1800<br />
beschleunigten Zeiterfahrung gilt eine Beschreibung, die auch das Ende dieser<br />
Epoche definiert: das Verhältnis <strong>von</strong> Gegenwart (Echtzeit) und Historie (Verlangsamung)<br />
ist eine Funktion der Mechanisierung <strong>von</strong> Tabellenprogrammen<br />
. Nur daß anstelle der Historie hier tatsächlich der Zeitraum des<br />
Archivs, die Logistik <strong>von</strong> Berichten ad aeta tritt, und die »fast pedantische Annalistik<br />
der inneren <strong>Geschichte</strong> der preußischen Verwaltungsbezirke« zum Zweck des Berliner Jahresabschlußberichts die Vorderseite eines<br />
M Zitiert nach; Cni-1 Wiiiiulm Cu.imrtt-, üesidik-liu> tlcs Käfiitflich-Pi : 4:lißiät : hl;n GcheilTlüFI<br />
Staats- und Kabinettarchivs, hg. v. Meta Kuhnke, Köln / Weimar / Wien (Böhlau)<br />
1993, 139<br />
65 Josef Götz, Der Einsatz <strong>von</strong> technischen Hilfsmitteln und Maschinen aller Art (ohne<br />
elektronische Rechenanlagen) in der Statistik, in: Allgemeines Statistisches Archiv 43<br />
(1959), 341-347(341)
1020 INVHNTAR UND STATISTIK.<br />
Dispositivs darstellt, dessen Rückseite in Form des ersten Bandes der Monumenta<br />
Germaniae Historica zeitgleich den Ursprung deutscher Geschichtsschreibung in<br />
die frümittelalterlichen Annales auflöst.<br />
Das epistemologische Dispositiv dieser Datenverwaltungswissenschaften des<br />
19. Jahrhunderts, die Suche nach einem Gesetz (gekoppelt seit den 1830er Jahren<br />
an das Paradigma der Meßbarkeit in der Physik 66 ), korrespondiert mit der<br />
Institution des Archivs als statistisch-etatistische Datenstreuung. 67 Charakteristisch<br />
<strong>für</strong> die deutsche Statistik aber bleibt die Inklination zur Ablehnung der<br />
mathematischen zugunsten einer geschichtsideahstischen Option. Engels<br />
Begriff der Statistik ist roughly historkal - ein Vertreter<br />
der deutschen topographisch-geographisch-historischen Schule, die in Statistik<br />
gegenwärtige <strong>Geschichte</strong> sieht. Schlözer definierte <strong>Geschichte</strong> As fortlaufende<br />
Statistik und Statistik als stillstehende <strong>Geschichte</strong>. Hacking sieht darin ein epistemologisches<br />
Symptom: »People in Western Europe may have the liberal picture<br />
of independent atoms connected by mechanical or statistical law. Engel's<br />
compatnots further East have that organic Version of society, in which the individuals<br />
are constituted by their place within the social.« 68 1848 wird Engel mit<br />
der Expertise beauftragt, in einem journalistischen Streit zweier Tageszeitungen<br />
zu entscheiden - und zwar mit statistischen, nicht philologischen Argumenten.<br />
Hacking wählt <strong>für</strong> seine Rekonstruktion dieses Moments eine wissensarchäologische<br />
Metapher, buchstäblich: »For example, lf we find many shards in different<br />
archaeological sites, how many features of design must they share, how<br />
many differences must they lack, in order for us to say they are or are not from<br />
pottery of the same period of civilization?« . Tatsächlich<br />
hat sich inzwischen auch die Archäologie der mathematische Analyse kultureller<br />
Artefaktlagen verschrieben - als Provokation der Kulturhistorie. 69 Statistik<br />
macht das Unsichtbare jener imaginären Gemeinschaften namens Nation als<br />
Kollektivkörper (wie das Frontispiz zu Thomas Hobbes< Leviathan) transpa-<br />
66<br />
Dazu David Cahan, Meister der Messung. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt<br />
im Deutschen Kaiserreich, Wein heim u. a. 1992, 1992<br />
67<br />
Siehe Theodore M. Porter, The Rise of Stastistical Thinking 1820-1900, Princeton UP<br />
1986<br />
bS<br />
Hacking 1989: 383, unter Bezug auf: A. L. Schlözer, Theorie der Statistik, Göttinnen<br />
1804, Bd. 1, Einleitung<br />
69<br />
In diesem Sinne der Vortrag <strong>von</strong> Peter Rowsome und Peter Rauxloh, Analysing and<br />
Archiving Archaeology: the Practice of the Museum of London Archaeology Service,<br />
im Rahmen der Vortragsreihe Archive der Vergangenheit. Wissenstransfers zwischen<br />
Archäologie, Philosophie und Künsten, Humboldt-Universität Berlin, 27. Juni 2002.<br />
Zum mathematischen Anteil in Michel Foucaults Wissensarchäologie siehe Martin<br />
Kusch, Discursive formations and possible worlds. A reconstruetion of Foucault's<br />
archeology, in: Science Studies 1/1989, 17ff
DI-.R WISSI-:NSARCHÄC)I.OGISC:HK BI.IC:K: STATISTIK 1021<br />
rent, also das, was den Symbolisierungsformen <strong>von</strong> Denkmälern und <strong>Geschichte</strong>n<br />
entgeht. Dementsprechend ist ihre Darstellungsform ästhetisch unattraktiv<br />
und eine Funktion des entsprechenden Ressorts. Denn Statistik fällt nicht unter<br />
literarische, diskursive Kulturwissenschaft. So liegen die Gründe <strong>für</strong> die etwa<br />
im damaligen Frankreich häufige parlamentarische Opposition gegen die Statistik<br />
weniger in der Sache selbst als in der <strong>für</strong> die beabsichtigten Zwecke »unverständigen<br />
Form der Veröffentlichung der officiellen statistischen Arbeiten.« 70<br />
Die offizielle Statistik wird dort unter der Autorität des Ministers <strong>für</strong> Ackerbau<br />
und Handel vertertigt und als ministerielles Dokument angesehen - »was<br />
in England bei den <strong>von</strong> dem Präsidenten des Handelsbüreaus eingereichten<br />
Arbeiten nicht der Fall ist« . Dies berührt den diskursiven Status <strong>von</strong><br />
Statistik im Staat.<br />
Volk wird nach 1800 nicht allein durch militärische Mobilmachung neu<br />
bestimmt, sondern auch durch Zählung - die andere Seite ideologisch geladener<br />
Erzählungen der Nation als <strong>Geschichte</strong>. »Der Mensch handelt als Bruchtheil seines<br />
Volkes«; dieser Bruchteil aber wird nicht mathematisch identifiziert: »Auch<br />
das Volk ist ein Wesen (a son individualite) und hat gleichsam einen freien Willen;<br />
die Regelmässigkeit kommt zu Stande nicht sowohl durch den Willen des<br />
Einzelnen als durch die Gewohnheiten des ganz bestimmten Wesens (etre concret),<br />
das wir Volk nennen« . Der<br />
Name Statistik kommt lange nicht zur Deckung mit der Praxis politischer Arithmetik;<br />
1809 gilt dem Begründer der amtlichen Statistik Preussens (Hoffmann) die<br />
politische Arithmetik Pettys und nicht die Statistik Achenwalls als die Aufgabe<br />
der Staatsverwaltung. In seinem Promemorm vom 21. Februar dieses Jahres über<br />
die Einrichtung eines statistischen Bureaus in Preussen bemerkt er, an der Spitze<br />
müsse ein Mann stehen, welcher mit Hilfe der politischen Arithmetik »aus den<br />
rohen Materialien die fruchbaren Uebersichten ausziehen lässt, dieselben kombinirt<br />
und daraus thiels <strong>für</strong> die Ggenwart das gleichzeitige Ineinandergreifen der<br />
verschiedenen Gegenstände, theils <strong>für</strong> die Zukunft die successive Verbindung<br />
zwischen Ursachen und Folgen zu konstatiren sucht.« 71 Es gibt also eine Kopplung<br />
<strong>von</strong> Kybernetik, Administration und <strong>Geschichte</strong> (im modularen Zugnft auf<br />
Daten). Bald aber äußert sich Mißtrauen gegenüber der politischen Arithmetik<br />
als alleinigem Medium der Statistik (und deren Geistesaustreiber):<br />
"Zu einem hirnlosen Machwerk ist die Statistik ^c worden em/ij; durch die Schuld<br />
der politischen Anthmcukcr. l )iese ^cisilosen Menschen wahiucn und vcihiciie<br />
H'!l dfeTl Wrlhllj dsüt-s m -iP
1022 . INVHNTAR UND STATISTIK<br />
nur die Zahl der Quadratmeilen des Landes, seine Volksmenge, seine (relative)<br />
Bevölkerung, der Nation Einkommen und das liebe Vieh dazu!« 72<br />
Die ganze Wissenschaft der Statistik sei durch die politischen Arithmetiker »um<br />
alles Leben, um allen Geist gebracht und zu einem Skelett, zu einem wahren<br />
Kadaver herabgewürdigt« 73 . Die Diskurspraxis <strong>von</strong> Politikern und Statistikern,<br />
»die durch Zahlen und den gemeinen Kalkül alles abthun und abmessen, und<br />
durch das Körperliche, das gemessen und gewählt werden könne, das Geistige<br />
und die wahre Kraft der Staaten auf's Haar bestimmen wollen«, steht in der Tat<br />
konträr zur Hegeischen Staatsidealismus als Begründung Preußens. 74 Hegel nämlich<br />
faßt <strong>Geschichte</strong> als Selbstfortschritt eines Geistes durch die Epochen. Lueder<br />
deutet entsprechend die epistemologisehen, politischen und militärischen Revolutionen<br />
um 1800; die Statik des anaen regime wird durch einen dynamisierten<br />
Geschichtsbegriff ersetzt: Nachdem sich eine morsche Stütze und ein Riss und ein<br />
Lücke nach der anderen zeigten, »stürzte endlich das ganze Gebäude der<br />
Statistik zusammen, und mit diesem sank denn auch die Politik dahin, welche<br />
ohne Statistik ganz Nichts vermag« .<br />
Fallati nennt Statistik 1843 eine Zustandswissenschaft; ganz wie das System des<br />
Freiherrn v. Aufseß <strong>für</strong> das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg kulturhistorische<br />
Zustände <strong>von</strong> der <strong>Geschichte</strong> scheidet, trennt er zwischen einer<br />
abstrakten und einer konkreten Statistik. Das 1deal-Zuständhche ist die bemerkbare<br />
Erscheinung] das Real-umständliche ist »die Totalität jener Erscheinungen,<br />
welche sich schon dem gemeinen Bewusstsem als dauernde ankündigen im<br />
Strome der an ihnen vorüberrauschenden vergänglichen Thatsachen« - ganz im<br />
Sinne der monumentalen duree Fernand Braudels »alle Erscheinungen, quae<br />
vitam homims exedunt«: Religionen, Verfassungs- und Verwaltungsgesetze (denn<br />
Institutionen überdauern); Klima- und Bodenbeschaffenheit. Die abstrakte Statistik<br />
treibt politische Archäologie, indem ihr die Aufgabe obliegt, »dieses allgemeine<br />
Zuständlichc der Erscheinungen aus seiner Verborgenheit an's Licht zu<br />
kehren« 75 - Ausgrabungen in der Latenz eines datenarchivischen Dispositivs der<br />
Gegenwart. In der Tradition einer diskreten, epikuräischen Atomtheorie sind die<br />
als zufällig erscheinenden Tätlichen der abstrakten Statistik gerade weil sie in keinem<br />
Zusammenhang zu stehen scheinen, sondern wie einzelne Atome im Räume<br />
zeitlich wechselnd sich bewegen«, vorzüglich (aber keineswegs ausschließlich<br />
und notwendig) einer Bezeichnung durch die Zahl fähig. Die abstrakte Statistik<br />
72<br />
Götting. Gelehrten Anzeiger v.J. 1806, 84, zitiert nach: John 1883: 104<br />
73<br />
Ebd. 1807, 131, zitiert nach: John 1883: ebd.<br />
74<br />
Jenaer Allgem. Lit. Zeitung 1811, 130, zitiert nach John: ebd.<br />
75<br />
Johannes Fallati, Einleitung in die Wissenschaft der Statistik, Tübingen 1843, §§ 31 u.<br />
48; §§30 lit. b und 31
DI:R wissHNSARCHÄoi.oGisci-u-: BLICK: STATISTIK 1023<br />
operiert mit Zahleneinheiten verschiedener Werte, aus welchen durch Berechnung<br />
die »Einheit (Constanz?), in welcher die Verschiedenheiten der Einheiten<br />
sich ausgleichen, als das allgemein Zuständliche, zu finden ist« . Die autopoietischen Ergebnisse der Statistik bestehen laut Wilhelm Lexis'<br />
Theorie der Massenerscheinungen, vorzugsweise dann, daß sie »die angenäherte<br />
Konstanz gewisser numerischer Verhältnisse der Massenercheinungen feststellt,<br />
wodurch der Schein entsteht, als sei das menschliche Thun und Leiden Zahlengesetzen<br />
<strong>von</strong> mechanisch-naturwissenschaftlichem Charakter unterworfen«<br />
- eine Frage <strong>von</strong> computable numbers mithin. Fallati definiert die<br />
abstrakte in Differenz zur konkreten Statistik, indem er sie um den Zeithorizont<br />
erweitert, »namentlich durch den Anspruch, das Gesetz nicht nur der<br />
gegenwärtigen Erscheinungen, sondern auch jener der Vergangenheit und<br />
Zukunft zu finden« . Kommunikationstheoretisch formuliert, bemüht<br />
er sich also um ein Maß <strong>für</strong> das Verhältnis <strong>von</strong> Information im Unterschied zur<br />
Redundanz in den Datenbanken des Gedächtnisses. Wird Statistik zur Beobachtung<br />
zweiten Grades, sind nicht nur die Tatsachen, sondern auch der Blick<br />
auf sie statistisch faßbar. Nach längerer Beobachtung aller Fälle, in welchen das<br />
Wort Statistik und statistisch in Büchern und Zeitschriften aller Art zirkuliert,<br />
kommt Rümelm zu dem Schluß: »Es lässt sich geradezu >statistisch< beweisen,<br />
dass heute unter Statistik allgemein das Ergebnis irgend einer Zählung verstanden<br />
wird« . Folgert die Absage, die Loslösung der<br />
Statistik als Hilfswissenschaft <strong>von</strong> der Subordination unter die Geistesgschichte<br />
als master narratwe:<br />
»Und auch im >Saale der Wissenschaften ist der Statistik heute nicht mehr der<br />
Platz angewiesen neben der <strong>Geschichte</strong>, wie dies Achenwall annahm, sondern sie<br />
steht heute >nebcn der Astronomie, der Geodäsie und deren Töchtern der Familie<br />
der Messungsdiciphnenschildern< , sondern<br />
<strong>von</strong> den gesammelten bekannten Thatsachen im Wege der Folgerung, und in<br />
dem Gebiete der höchsten Ausbildung im Wege der Analyse zu dem unbekanntnen<br />
vorschrcitet, und so Wahrheiten zu präcisiren, zu kontrolliren, zu erhärten<br />
sucht.« <br />
Mit Blick auf den Kathcdersoziahsten Schmoller ist die Statistik heutigen Sinnes<br />
geradezu identisch mit der statistischen Richtung der national-öekonomik<br />
; Subjekt und Objekt der Wissensökonomie fallen hier in eins und eliminieren<br />
die Differenz zwischen historischen Wissenschaften und den Nachrichten<br />
über die Gegenwart. In einem Vortrag über Moralstatistik (1871) behandelt<br />
Knapp die statistische Qualität zur Messung <strong>von</strong> Dingen, »die sonst unmessbar<br />
wären«. Die bürgerliche Gesellschaft läßt sich somit statistisch modellieren. Die<br />
Moralstatistik zeigt dem Einzelnen zwar, daß er »nicht einmal eine Einheit der
1024 INVENTAR UND STATISTIK<br />
siebenten Dezimalstelle werth« ist, aber sie gibt ihm zugleich den Trost, daß sich<br />
»das grosse Ganze nur ändert durch die beim Einzelnen vollzogenen Aenderungen«.<br />
Sie ist damit eine »Messungsdisciphn im Dienste der Gesellschaftswissenschaft,<br />
gewidmet dem Studium der realen Verhältnisse« .<br />
Kontrolle heißt nicht länger Überwachen und Strafen, sondern liegt in den diskursiven<br />
Effekte der Messung selbst; als unsichtbare Gewalt symbolischer Infrastruktur<br />
wird die Statistik wieder auf den Begriff <strong>von</strong> Staatswissen(schaft)<br />
zurückgefaltet; die Beobachtung der gesellschaftlichen Thatsachen und ihrer<br />
Zusammenhänge liege einzig und allein in der Hand der amtlichen oder praktischen<br />
Statistik. »Die allseitigste Förderung und Pflege dieser socialen Obervation<br />
ist darum eine der wichtigsten Aufgaben der heutigen Gesellschaft und ihrer<br />
Gemeinwesen dieser Art« . Quetelet wendet statistische<br />
Methoden auf Fragen der Pflanzen-Physiologie, der Meteorologie, zur Sozialstatistik<br />
und Anthropologie an. Seine AnlhropomcLrie (1870) faßt den hornmc<br />
moyen als Durchschittswert; er sucht damit den Hang zum Verbrechen vektonell<br />
zu errechnen, mit jenem wissensarchäologisch kalten Blick des Statistikers, <strong>für</strong><br />
den Sir Francis Galton Ende des 19. Jahrhunderts im Medium seiner Komposit-<br />
Photographien ein bildliches Äquivalent der Daten- als Bildpunktverteilung findet.<br />
Portraits einer Person offenbaren demnach deren mentalen Charakter und<br />
machen ihn damit in symbolischen Charakteren meßbar. Entsprechend sieht Galton<br />
seine composkes als bildliche Äquivalente zu statistischen Tabellen. 76 In ähnlicher<br />
Weise bezeichnet auch James Clerk Maxwell in seiner Theory of Heat <strong>von</strong><br />
1872 als »statistical Information« einen virtuellen Wert, der jenseits archivischer<br />
Taxonomien gewonnen wird. 77 Ob gesundheitspolizeihche Einrichtungen (<strong>Im</strong>pfzwang<br />
etwa) oder andere Praktiken - <strong>für</strong> den Statistiker »muss Alles, was überhaupt<br />
z. B. auf die Sterblichkeit einwirkt, <strong>von</strong> gleichem Range sein, da er<br />
unbefangen die Erscheinung nehmen muss, wie sie ist, d. h. als Ergebnis des mannigfaltigsten<br />
Zusammenwirkens« . Die Tabellenstatistik begreift<br />
Ökonomien endgültig nicht mehr als Text und ist damit auch im Sinne der deskriptiven,<br />
quantifizierenden Sozialwissenschaften eine Provokation <strong>von</strong> kulturwissenschaftlicher<br />
thick descnption (Clifford Geertz), die dem Phantom der<br />
Narrativität nicht entkommt. Mit der edlen Statistik und der politischen Arithmetik<br />
teilt die Tabellenstatistik als gemeinsame Schnittmenge allein das Charakteristikon<br />
der Zahl und Ziffer:<br />
''Anke le 1 leescn, I);is Archiv. Die Inventarisierung des Menschen, m: Der Neue<br />
Mensch. Obsessionen des 20. Jahrhunderts, hg. v. Nicola Lcpp, Martin Roth u. Klaus<br />
Vogel, Katalog zur Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden v. 22. April<br />
bis 8. Augut 1999, Ostfildcrn-Ruit (Cantz) 1999, 114-141 (125)<br />
' 7 Dazu Thomas Richards, The linpenal Archive. Knowledge and the Fantasy of<br />
Empire, London / New York (Verso) 1993, 79f
Dl-R W1SSKNSARCHÄOI.OGISCHK Bl.lCK: STATISTIK 1025<br />
»Mit der Statistik AchenwalPs hat sie das gemein, dass sie die Thatsachen sammelt,<br />
ohne zur Untersuchung des Zusammenhangs derselben fortzuschreiten, ohne nach<br />
Mill's Ausdruck >das Geschäft des Folgerns< zu übernehmen; mit der politischen<br />
Arithmetik dagegen stimmt sie darin überein, dass sie nur ziffernmässige, messbare<br />
Thatsachen aufnimmt, ohne sich der >schillernden< Wortphrase der Göttinger<br />
Schule zu bedienen.« <br />
Gegen die narrative Fassung des Körpers der Nation steht ihre Dokumentation<br />
im diskreten Zahlenmonument. Befreit <strong>von</strong> semantischer Steuerung,<br />
ist sie an Elektrizität anschließbar; an die Stelle des Archivars tritt der Statistikingenieur.<br />
78 Obgleich die abstrakte Statistik »das dauernd Zuständliche oder<br />
vielmehr das Gesetzmäßige in den Erscheinungen« aufzufinden bemüht sind,<br />
ist doch Gegenstand drer Untersuchungen veränderliche Tatsachen, »wenn<br />
auch gleichartige«. Historischer Diskurs und statistische Information stehen im<br />
Widerstreit:<br />
»Selbst Schubert sagt noch im Anfange seines erwähnten Werkes: Die <strong>Geschichte</strong><br />
ist ein in sich abgeschlossenes Ganzes, die Staatskunde aber ein rastlos sich fortbildendes<br />
Wissen, das in allen seinen Theilen nie vollständig erkannt werden kann,<br />
weil es jeden Augenblick Veränderungen und Erweiterungen erfährt. Bei der<br />
<strong>Geschichte</strong> ist die Feststellung sicher begründeter Thatsachen - wenigstens möglich;<br />
bei der Staatskunde kann durch den notwendigen Charakter der Beweglichkeit,<br />
der in jedem organischen Leben cigenthümhch waltet - nur eine der Wahrheit<br />
möglichst genäherte Vorstellung gefordert werden.< Nicht unähnlich hatten schon<br />
Rühs und Spieker 7v die Statistik neben die neueste <strong>Geschichte</strong> gestellt. Es ist ganz<br />
falsch, daß die Statistik lehre was die Staaten gegenwärtig sind. Keineswegs ist die<br />
Aufgabe der Statistik, wie man vielleicht durch den <strong>Namen</strong> verführt, so oft<br />
behauptet hat, die stehenden sondern die fortschreitenden Verhältnisse der Staaten,<br />
die Regungen ihres Lebens zu verfolgen.« <br />
Hier schreibt sich jene algonthmische Ästhetik als Bcobachtungsanleitung, die<br />
Charles Babbagc etwa gleichzeitig als ersten mechanischen Computer, als analytical<br />
engine baut. 80 Die Differenz zu Achcnwalls Begriff der Statistik hegt<br />
in der Verzeitlichung des Zahlenwerks. »In unserer Kultur sind nämlich mindestens<br />
seit mehreren Jahrhunderten die Diskurse historisch miteinander verknüpft:<br />
die <strong>Geschichte</strong> ist das Element, in dem jegliches Geschehen<br />
Herman Hollerith, zitiert nach: Christoph Asendorf, Ströme und Strahlen. Das<br />
langsame Verschwinden der Maicne Lim 1900, Gießen (Anabas) 1989 (= Wcrkbund-<br />
Archiv, Bd. 18), Kapitel 1. »Formen der Zerlegung«, 16-32 (28)<br />
»*) Anzeige ihrer Zeitschrift <strong>für</strong> die neueste <strong>Geschichte</strong>, die Staaten- und Völkerkunde.<br />
Lüders Urthcil darüber in seiner kritischen <strong>Geschichte</strong> der Statistik. S. 842 ff.«<br />
'Siehe Anthony F. Hyman, Charles Babbage, 1791-1871. Philosoph, Mathematiker,<br />
Computerpionier, Stuttgart 1987
1026 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
entsteht, überlebt und untergeht.« 81 Selbst der Wissensarchäologe Foucault holt<br />
also die Differenz zwischen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Modi der<br />
Anschreibbarkeit <strong>von</strong> Daten (als Gegenwart und als Gedächtnis) in ein historiographisches<br />
Modell ein. Demgegenüber läßt sich gerade die Epoche der<br />
<strong>Geschichte</strong> ahistorisch (im Sinne ihrer Speicher) lesen, als archivische Gegebenheiten,<br />
in denen die Diskurse parataktisch gelagert und nicht in geschichtlicher,<br />
sondern vektorieller, signaltechnisch beschreibbaren Weise miteinander verbunden<br />
sind, als Kräftelehre. 82 Statistik löst nicht das (dem diskursanalytisch<br />
operierenden Strukturalismus vertraute) Problem der Beschreibung <strong>von</strong> Übergängen,<br />
sondern beschreibt Zustände im Sinne diskontinuierlicher epistemischer<br />
Lagen auf eine Weise, die <strong>von</strong> Linnes Systema naturae vertraut ist: »by analogy<br />
to a geographical map indicating the extent of the gaps separating the<br />
groups« 83 . Der Begriff der Statistik verhält sich affin zu Diskursanalysen vom<br />
Typus Foucault: Serien, Reihen sind ihr Gegenstand. In Die Ordnung des Diskurses<br />
referiert Foucault auf die wesentlich <strong>von</strong> Pierre Chaunu geprägte, mit seriellen<br />
Daten operierende Geschichtswissenschaft; es sind die Archive selbst, die<br />
zwangsläufig Serien hervorbringen. Es genügt eine Folge <strong>von</strong> Zeichen, Graphismen,<br />
Spuren zur Formierung einer Ausage; ein Zeichen/Diktum (Datum) ist<br />
durch seine Existenz schon Aussage. Der im Unterschied zum historischen Diskurs<br />
entsubjektivierte Archäologie-Begriff (entwickelt anhand einer Prahistorie,<br />
wo Subjekte per definitionem nicht vorkommen) korrespondiert mit dem kalten<br />
Blick der sociologie pure (Gabriel Tarde) Der Ästhetik statistische Tabellen entspricht<br />
die klassifikatorische Rhetorik der Enyklopädien; Naturkundemusseen<br />
präsentieren seit 1800 Insekten als Serien und Massen (im Unterschied zu individuellen<br />
Großtieren). Quantifizierbar sind (allein) Details. Gemäß der Einleitung<br />
in die Wissenschaft der Statistik hat die Statistik der Menschheit (als die<br />
weiteste Form der Statistik) den Zustand einer Zeit oder den Zustand aufeinander<br />
folgender Zeiten insofern zum Gegenstande, »als er in demselben unverändert<br />
bleibt« . Zum Gegenstand hat Statistik also das, was bleibt,<br />
mithin ist sie ein monumentaler Diskurs im Sinne der Datenformation. Ihre wissensarchäologische<br />
Qualität hegt darin, der Narration verborgene Relationen,<br />
Latenzen sichtbar zu machen. Zumindest ist dies eine Option in jener Inkubationszeit<br />
einer neuen Disziplin, die noch Definitionsräume ihrer Begriffsmächtigkeit<br />
zuläßt. »Die Erdkunde und die <strong>Geschichte</strong> bieten eine natürliche<br />
Beziehung zu einander, <strong>von</strong> welcher, wenn wir eine jede <strong>für</strong> sich betrachten, nur<br />
81 Michel Foucault, im Gespräch mit Raymond Bellour, in: Adelbert Reif (Hg.), Antworten<br />
der Strukturalisten, Hamburg (Hoffmann & Campe) 1973, 171<br />
S2 Zu diesem Begriff im Kontext der Statistik: Butte I 808: 230<br />
x3 John C. Greenc, Lcs Mots et les Choses, in: Julia Kristeva u. a. (Hg.), Essays in Scmiotics,<br />
Paris (Mouton) 1971, 230ff (234)
DHR WISSKNSARCHÄOI.OGISCHK BLICK: STATISTIK 1027<br />
klar zu Tage liegt, >daßinwiefern< sie besteht« - womit den Relationen<br />
<strong>von</strong> Aussagen Rechnung getragen wird. Dieses »inwiefern« zu untersuchen und<br />
darzustellen sei die Aufgabe der Wissenschaft Statistik als Disziplin; »demnach<br />
wäre es das Geschäft der Statistik, die Beziehungen zu entwickeln, welche zwischen<br />
dem Festen der Erde und dem Veränderlichen der Völker stattfinden«. 84<br />
Statistik schreibt Zeit/räume unter der Vorgabe, sie zu analysieren; sie ist somit<br />
das positive Äquivalent zur Leerformel des Archivs als »tous ces systemes<br />
d'enonces (evenements pour une part, et choses pour une autre)« 85 . Aussagen<br />
müssen nicht notwendig sprachliche Form annehmen; Alexander Moreau de<br />
Jonnes sagt in Elemens de statistiquc (Paris 1847, 1): »La statistique est la science<br />
des faits sociaux exprimes par de termes numeriques«. Von daher die Nähe der<br />
Statistik zur (bezüglich der hermeneutischen Trennung <strong>von</strong> Geistes- und Naturwissenschaften)<br />
Querschnittwissenschaft Archäologie; beide setzen zunächst<br />
auf diskrete Datenverarbeitung. Nicht als epistemologischer Zug ist Statistik<br />
faßbar, sondern erst in ihren widersprüchlichen Phänomenen, wo sie zur Aussage<br />
kristallisiert:<br />
»Man sieht, daß es sich hier um ganz verschiedene Dinge handelt; daß mit dem<br />
<strong>Namen</strong> Statistik mehrere Wissenschaften bezeichnet werden, über deren Grenzli-<br />
. nien nicht blos, wie etwa über die der Chemie und Physik die abschließenden<br />
Bestimmungen Schwierigkeiten verursachen könnten, sondern die sich einander<br />
ganz fremd sind. daß, wie Butte sagt, die Erscheinung der Definition einer<br />
Wissenschaft das untrügliche Merkmal ihres Eintritts in das äußere Leben ist.«<br />
<br />
Erst <strong>von</strong> dem Moment ab, wo Statistik als allgemeine Staats- und Gesellschaftswissenschaft<br />
mit mathematischen Verfahren der Wahrscheinlichkeitsrechnung<br />
und Funktionen der Molekularbewegung in Gasen gekoppelt wird,<br />
ist auch <strong>Geschichte</strong> im Begriff der Entropie faß- und ersetzbar (Alexandre<br />
Cournots Neologismus des postbistoire), als unerbittliches thermodynamisches<br />
Gesetz, daß geordnete Zustände zur Unordnung tendieren - ein Zeitpfeil, dem<br />
gegenüber sich die Ästhetik des Archivs als katechontisch erklärt und Gedächtniskultur<br />
als verzweifelter Energieaufwand, symbolische Ordnungen unwahrscheinlicherwcisc<br />
aufrechtzuerhalten. 86<br />
84<br />
Knies 1850: 6, unter Bezug auf: Kasimir Krywicki, Die Aufgabe der Statistik, Dorpat<br />
1844,47<br />
lS5<br />
Michel Foucault, Archeologie du Savoir, Paris 1969, 169<br />
sf><br />
Dazu Theodore M. Porter, A statistical survey of gases: Maxwell's social physics, in:<br />
Flistorical Studies in the.Physical Science, Bd. 12, Heft 1 (1981), 77-116
1028 INVHNTAR UND STATISTIK<br />
Visualisierung der Statistik:<br />
Otto Neuratb und das Deutsche Knegswirtscbaftsmuseum Leipzig<br />
An die Stelle des (sichtbaren) Ornaments der Nation tritt in der Moderne die<br />
Konzeption der Infrastruktur, und die Nerven des Volkskörpers heißen Straßennetz.<br />
W. H. Riehl als Professor in der zur epistemischen Aussage werdenden<br />
Fächerkombination Culturgeschichte und Statistik in München fordert Mitte des<br />
19. Jahrhunderts:<br />
»Also soll auch der Sozialpolitiken' den Straßen in den Leib sehen. Kr wird dann<br />
gleich dem gewürfelten Fuhrmanne in dem Unterbaue unserer Verkehrslinien ganz<br />
andere Dinge wahrnehmen als der gewöhnliche Beobachter. Er wird in dem<br />
Zusammenhange unserer neuen Straßennetze mit Land und Leuten, mit der<br />
gesamten Naturgeschichte des Volkes eine moderne Tatsache <strong>von</strong> unberechenbarer<br />
Wichtigkeit erkennen.« x7<br />
Staatsmacht stellt (sich) nicht mehr aus, sondern agiert unsichtbar umso effektiver.<br />
Keine Erzählung, sondern Zahlen werden ihr gerecht; in Lion Feuchtwangers<br />
/osep&ws-Rorhantrilogie steht dem Protagonisten, der den jüdischen<br />
Aufstand auf den Gegensatz Rom-Judäa reduziert, ein Rivale auch in der Form<br />
der Darstellung entgegen: »Justus dagegen schreibt ein Buch, das voll <strong>von</strong> >Ziffern<<br />
und >Statistiken< ist.« 88 Zwischen Ornament und Datum: In seiner<br />
<strong>Geschichte</strong> der englischen Volkswirthschajtslehre (1851) lobt Röscher die Political<br />
Arithmetick William Pettys und dessen analytischen Blick auf die Nerven des<br />
Staates, »während die Mehrzahl der Statistiker (im Sinne Achenwall's) nicht einmal<br />
durch die äusscrern Gewänder hindurchzudringen verstehe« . Denn das ist Statistik, welche »die wahre große Berechnung des Staates bot,<br />
seine <strong>Geschichte</strong> ohne Phrase, seinen Bildungsmesser ohne Gunst und Haß.« 89<br />
An den Schnittstellen zum Diskurs aber ist Statistik ein Darstellungsproblem.<br />
Die medienarchäologische Schaltstelle sowohl <strong>für</strong> Statistik als auch ihre augenfällige<br />
Darstellung in der Tradition rhetorischer enargeia^ 0 hat kein geringerer als<br />
der Meisterdenker der geisteswissenschaftlichen Hermeneutik <strong>für</strong> Bibliotheksspeicher<br />
angegeben:<br />
87<br />
Wilhelm Heinrich Riehl, Die Naturgeschichte des deutschen Volkes, zusammengefaßt<br />
u. hg. v. Günther Ipsen, Stuttgart 1935, 100<br />
8S<br />
Georg Lukäcs, Der historische Roman, Berlin (Aufbau) 1955, 318. Siehe W. E.,<br />
<strong>Geschichte</strong> in der modernen Literatur, in: Klaus Bergmann / Klaus Fröhlich / Annette<br />
Kuhn /Jörn Rüsen / Gerhard Schneider (Llg.), 1 landbuch der Geschichtsdidaktik, 5.<br />
überarbeitete Auflage, Seelze-Velber (Kallmeyer'sche Verlagsbuchhandlung) 1997,<br />
626-630<br />
89 Rezension <strong>von</strong> Bechers Aufsatz: Bevölkerungsverhältnisse der Österreich. Monarchie,<br />
in: Beilage der Augsb. Allg. Zeitung 1847 Nr. 232, zitiert nach: Knies 1850: 3<br />
90 Dazu Carlo Ginzburg, Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der <strong>Geschichte</strong>,
D l K \\ ISS1 NSAIU I IAO1 i K . I S U II Hl U K: S 1 M I M I K \02 l ><br />
»Von der hpochc der <strong>Geschichte</strong> ab, in welcher der Bücherdruck .uittntt und eine<br />
hinreichende Beweglichkeit erlangt hat, sind wir durch die Anwendung der statistischen<br />
Methode auf den Bestand der Bibliotheken imstande, die Intensität geistiger<br />
Bewegungen, die Verteilung des Interesses in einem bestimmten Zeitpunkt<br />
der Gesellschaft zu messen . Die Darstellung der Ergebnisse einer solchen Statistik<br />
wird durch graphische Darstellung sehr an Anschaulichkeit gewinnen.«'"<br />
Unter Führung des Deutschen Landwirtschaftsrates, des Deutschen Industrieund<br />
Handelstages und des Deutschen Handwerks- und Gewerbekammertages<br />
wird in Leipzig noch während des Ersten Weltkriegs das Deutsche Kriegswirtschaftsmuseum<br />
als Grundlage <strong>für</strong> ein künftiges deutsches Wirtschaftsmuseum<br />
gegründet. Die Sammlung ist soweit ausgebildet, sie im August 1918 in denselben<br />
provisorischen Räumlichkeiten auszustellen, die seinerzeit auch das Deutsche<br />
Kulturmuseum bergen, »welches in mehr als einer Richtung ähnliche<br />
Endziele wie das Knegswirtschaftsmuseum hat und sich mit ihm in willkommener<br />
Weise ergänzt.« 92 So real können Kulturgeschichte und Musealisierung<br />
<strong>von</strong> Infrastruktur als Sammlung zusammengelesen werden. Seit 1919 wird dem<br />
Projekt vom Reichswirtschaftsmmistenum gestattet, sich Reichswirtschaftsmuseum<br />
zu nennen. Bereits in einer Erklärung des Ausschusses des Deutschen<br />
Handelstages in Berlin vom 8. August 1917 (in demselben Jahr also, als W.<br />
Porstmanns Normenlehre erscheint) geht es darum, die Strukturen der sozioökonomischen<br />
Umwälzungen <strong>von</strong> Knegsdeutschland selbst zur Darstellung zu<br />
bringen. Dem deutschen Volk soll in mit den spezifischen Darstellungsformen<br />
und Arbeitsmethoden eines Museums »in leicht verständlicher Weise vor<br />
Augen« geführt werden, wie infolge der britischen Blockade die deutsche Wirtschaft<br />
das Gepräge einer auf sich selbst gestellten Volkswirtschaft und der Staat<br />
den Charakter eines abgeschlossenen Handelsstaates erhalten hat. 93 Krieg,<br />
in: Fernand Braudel u.a., Der Historiker als Menschenfresser. Über den Beruf des<br />
Geschichtsschreibers, Berlin (Wagenbach) 1990, 85-102<br />
91 Wilhelm Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften, Bd. 1, 3. Aufl. Leipzig / Berlin<br />
(Teubner) 1933 (unveränd. Neudruck der Ausgabe 1883), 115. Roland Wagner-<br />
Döbler hat unter der Fragestellung »Was ist eine Bibliothek?« auf der Tagung Wissenschaft<br />
- Informationszeitalter - Digitale Bibliothek der Gesellschaft <strong>für</strong> Wissenschaftsforschung<br />
e.V. und des Instituts <strong>für</strong> Bibliothekswissenschaft der Humboldt-<br />
Universität zu Berlin am 28. März 1998 in Berlin auf diese Stelle aufmerksam gemacht.<br />
In Georg Leyhs Ausführungen »Über Bibliotheksstatistik« in dem <strong>von</strong> dems. hg.<br />
Handbuch <strong>für</strong> Bibliothekswissenschaft, 2. vermehrte u. überarbeitete Auflage Wiesbaden<br />
(Harrassowitz) 1961, 757, stand dies längst vor aller Leseraugen, die es wissen<br />
wollten.<br />
92 Das Deutsche Kriegswirtschaftsmuseum (Vorläufiger Überblick), Veröffentlichungen<br />
des Dt. Kriegswirtschaftsmuseums zu Leipzig, Heft 3, Leipzig 1918, 16. S. a. Notiz u.<br />
Foto in: Der Leipziger, Heft 25., 20. Juni, 1929, 569f<br />
93 Bericht [...] über die Errichtung des Deutschen Kriegswirtschaftsmuseums (= Veröf-
1030 INVI-NTAR UND STATISTIK<br />
immer schon schneller als Gedächtnis, weckt den Sinn <strong>für</strong> Dokumentation in<br />
Echtzeit:<br />
»Schon jetzt während des Krieges muß mit der Arbeit begonnen und sie soweit<br />
fortgeführt werden, daß alles das, was mit der Beendigung des Krieges wieder verschwinden<br />
wird, ja jetzt schon täglich der Gefahr des Untergangs oder der Vergessenheit<br />
ausgesetzt ist, <strong>für</strong> das Museum festgehalten und gesichert wird. <br />
was auf diesem Gebiete geleistet werden kann, hat in geradezu vorbildlicher Weise<br />
die Hygiene-Ausstellung in Dresden gezeigt und lehrt uns auch jetzt immer wieder<br />
das Deutsche Museum in München. Lange Zahlenreihen und Tabellen statistischer<br />
Daten müssen vermieden und da<strong>für</strong> graphische, figürliche oder sonstige<br />
körperliche Darstellungen (plastische Demonstrationskörper) zur Versinnlichung<br />
<strong>von</strong> Größenverhältnissen und Veranschaulichung statistischer Zusammenstellungen<br />
gewählt werden.« 94<br />
Dieselbe Situation führt also einerseits zur Einsicht in die Notwendigkeit der<br />
Messung der Energie im Medium der statistischen Normen? 5 Gerade unan-<br />
schauliche Kategorien wie der statistische Verbrauch an Elektrizität bedürfen der<br />
Bildzeichen, »die so >gelesen< werden können wie <strong>von</strong> uns allen Buchstaben und<br />
<strong>von</strong> den Kundigen Noten« 96 - eine programmatische Ikonologie der Energie<br />
also. Andererseits verführt der museumspädagogische <strong>Im</strong>puls, der die aufbre-<br />
chende Weimarer Republik prägt, zu einer Didaktik, die solche Einsichten als<br />
diskursives Wissens wieder dissimuliert. Ein Protagonist des Wiener Vereins<br />
Ernst Mach, Otto Neurath, hat (im Sinne der rhetorischen Figur) enargetische^ 7 ,<br />
also veranschaulichende Formen der Statistik <strong>von</strong> Energien mit seiner Wiener<br />
Methode 1924 im dortigen Museum <strong>für</strong> Gesellschaft und Wirtschaft auf separat<br />
beleuchteten Tafeln zur Ausstellung gebracht: ein auf den Akt der musealen<br />
Kommunikation zentrierter Ansatz, abstrakte Zahlenwerke in mengenbildliche<br />
fentlichungen des Deutschen Kriegswirtschaftsmuseums zu Leipzig Lieft 2), Leipzig<br />
(Brandstetter) 1917, 17<br />
94 Ebd., 19; siehe die Abbildungen <strong>von</strong> Statistikkurven, etwa »Arbeitsleistungen in der<br />
Eisenindustrie«, im Fotoband Reichs-Wirtschaftsmuseum (Institut <strong>für</strong> deutsche Volkswirtschaft),<br />
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Bibliothek<br />
93 W. Porstmann, Normenlehre. Grundlagen, Reform und Organisation der Maß- und<br />
Normensysteme. Dargestellt <strong>für</strong> Wissenschaft, Unterricht und Wirtschaft, Leipzig<br />
(Haase) 1917,256<br />
96 Otto Neurath, Statistische Hieroglyphen, in: Österreichische Gemcindezeitung 3<br />
(1926) Nr. 10, 328-338, hier zitiert nach: ders., Wissenschaftliche Weltauffassung,<br />
Sozialismus und Logischer Empirismus, hg. v. Rainer Hegsclmann, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1979, 295- 301 (295)<br />
97 Dazu W. E., »Nothing but Text«? Wisscnsarchäologischc Anmerkungen zum Verhältnis<br />
<strong>von</strong> Kultursemiotik, New llistoncism und Archiv, in: Gerhard Neumann<br />
(Hg.), Poststrukturahsmus. Herausforderung an die Literaturwissenschaft, Stuttgart /<br />
Weimar (Metzler) 1997, 290-306, bes. Abschnitt III
DUR WISSUNSARCHÄOI.OGISCHI- BLICK: STATISTIK 1031<br />
Piktogramme mit selbsterklärender Ikomzität zurückzuübersetzen (wie es der<br />
<strong>von</strong> Marshall McLuhan in Understanding Media diagnostizierte »return to<br />
the lcon« und die Rück-Entwicklung <strong>von</strong> icons auf Bildschirmen <strong>von</strong> Rechnern<br />
erneut vollziehen). 98 Neuraths Optimierung in der didaktischen Visualisierung<br />
abstrakter Statistiken basiert auf einer graphischen Zeichensprache, die Zahlenln<br />
Symbolmengen übersetzt und als ISOTYPE (International System of Typographie<br />
Picture Education, 1934) im durch (<strong>von</strong> ihm so ausdrücklich diagnostiziert)<br />
optische Signale geprägten, bildmedialen Zeitalter der statistischen<br />
Hieroglyphen nicht nur <strong>für</strong> Museumsdesign verbindlich wird." Diese Visualisierung<br />
<strong>von</strong> sozialer Information, die Abkürzung <strong>von</strong> Daten in Bildern ist eine<br />
Technik der <strong>Im</strong>agination, die weniger mit der Figurativität akademischer und<br />
literarischer Historiographie im 19. Jahrhundert korrespondiert denn mit den<br />
Versuchen des Brüsseler Bibliographischen Instituts (Mundaneum), eine universale<br />
Klassifikation des Wissens durchzusetzen; so arbeitet Neurath nicht nur an<br />
Aufklärungstechniken zur international standardisierten Visualisierung gesellschaftlicher<br />
Tatbestände vermittels einer hohen Techmzität des Bildes (sein<br />
Begriff), als metasprachhehes Alphabet <strong>von</strong> Symbolen (Mcngcnbilder), (re-)kombinierbar<br />
nach festgelegten Regeln, sondern auch am Projekt der Enzyklopädie<br />
einer Einheitswissenschaft, die »besonderen Wert darauf legt, alles, was mit wissenschaftlicher<br />
Sprache, mit Formulierungsweise, Kalkül, Logik usw. zusammenhängt,<br />
zu behandeln.« 100 Diese Ablenkung vom (im wissensarchäologischen<br />
Sinn) statistischen Charakter archivischer Speicher macht erst möglich, daß<br />
Siehe Otto Neurath, Bildstatistik nach Wiener Methode in der Schule, Wien / Leipzig<br />
1933. Dazu Frank Hartmann, Sprechende Zeichen. Otto Neuraths revolutionäre<br />
Methode der Bildpädagogik, im Internet unter: http:/7thing.at/thing/e.journal/NeueMed/neurath.html<br />
(1. Februar 1997).<br />
Neurath nennt »bildhaften Eindrücke, Illustrationen, Lichtbilder, Filme. Dazu<br />
kommt das gesamte Reklamewescn«: 1926/1979: 295; an die bildstatistischen Bedürfnisse<br />
der altägyptischen Naturalwirtschaft knüpft er ausdrücklich an (296). Neurath<br />
rückt damit bis an die Grenzen der statistischen Ästhetiktheorie, an die <strong>von</strong> Max<br />
Bense versuchten Bestimmungen ästhetischer Redundanz und Entropie vor: »Die<br />
lebhaften Farben werden zur Kennzeichnung bestimmter Tatbestände verwendet,<br />
Grau deutet das »Unbestimmte«, zum Beispiel das >Nichtorganisierte< im Gegensatz<br />
zum Organisierten, an« (299). Vgl. Max Bense, Ästhetik und Programmierung [1966<br />
/ 1967], in: Bilder Digital. Computerkünstler in Deutschland 1986, hg. v. Alex u. Barbarn<br />
Rempk«mn, München (IWku} 19Sd, 22-3S, Sit'ta auch R. S, Mik-s, Tlu ! Design<br />
of educational exhibits, London (George Allen & Unwin) 1982, 7t<br />
Otto Neurath, Die neue Enzyklopädie, in: ders. 1979, 120-131 (128); über das <strong>von</strong><br />
Neurath in Den Flaag gegründete Mundaneum Institute seit 1933 und seine Vorstellung<br />
des Enzyklopädie-Projekts auf dem 1. Internationalen Kongreß <strong>für</strong> Einheit der<br />
Wissenschaft: Hegselmann ebd., 42
1032 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Gedächtnisverwaltung im <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong> passiert (und Bildstatistik seit<br />
1931 in der Sowjetunion zum Propagandamcdium Stalins wird).<br />
Neurath hat seine Einsichten im Ersten Weltkrieg gewonnen und <strong>für</strong> Organisationsfragen<br />
im österreichischen Kriegsministerium zum Einsatz gebracht.<br />
Der museumspädagogische Akzent liegt auch im Leipziger Kriegswirtschaftsmuseum,<br />
das er zu Kriegsende leitet, auf einer graphisch figurierten Schausammlung,<br />
auf der Bedingung jeglicher <strong>Im</strong>agination als Einprägung <strong>von</strong> Zahlen<br />
durch (Bild-) Erzählung. Diese graphische Methode liegt auf der Hand, wenn<br />
Kriegswirtschaftslehre als eine Wissenschaft »wie die Ballistik« begriffen wird,<br />
»die ebenfalls unabhängig da<strong>von</strong> ist, ob man <strong>für</strong> oder gegen die Verwendung<br />
<strong>von</strong> Kanonen eintritt.« 101 Neurath erinnert daran, daß gerade »die Neuregelung<br />
der Verwaltung und Wirtschaft in Frankreich durch die Französische Revolution<br />
auf Statistik gegründet werden« mußte. »Hervorragende Mathematiker<br />
mußten durch geschickte Verknüpfung vorhandener Daten und Schätzungen<br />
die gewünschten Aufklärungen über Nacht beschaffen, so wie etwa Rathenau<br />
die Kriegsrohstofforganisation Deutschlands«, so wird ein Gedächtnis als<br />
Datenbank gesetzt. 102 Der Krieg setzt nicht nur an die Stelle <strong>von</strong> (diskursiver)<br />
Verkehrswirtschaft eine (non-diskursive, kybernetische) Verwaltungswirtschaft<br />
; er generiert das empirische Material, aus dem solche Graphen<br />
sich speisen: Datenbanken <strong>für</strong> Physik, Bevölkerungswissenschaft, Ökonomie<br />
und Orgamsationslehre. Das machtvolle Wissen um die Mächtigkeit des<br />
dahinterstehenden Zahlenwerks aber entzieht sich - nicht anders als heute die<br />
Programmcodes hinter digitalen Monitoren derPreis <strong>für</strong> bildstatistische, eminent<br />
sozialpolitisch verstandene Aufklärung durch Symbohsierung als Adresse<br />
an proletarische Betrachter, den öffentlichen Blick:<br />
»Das Archiv wird vieles, was sich bei Einhaltung der oben angegebenen<br />
Grundsätze <strong>für</strong> die Schausammlung oder wegen seiner vertraulichen Natur <strong>für</strong> die<br />
allgemeine Öffentlichkeit nicht eignet, aber doch der dauernden Erinnerung und<br />
Aufbewahrung zu bleibendem Gedächtnis oder späterer wissenschaftlicher oder<br />
praktischer Verwendung wert ist, aufzunehmen haben. Auch das reiche Material<br />
rechnerischer, statistischer, zeichnerischer und sonstiger bildlicher Unterlagen, das<br />
sich in den Händen amtlicher und nichtamtlicher Stellen, Verbände, Vereine, Firmen<br />
und Einzelpersonen befindet und oft nur eine Last <strong>für</strong> sie bildet, wird eine<br />
wertvollen Bestandteil des Archivs abgeben.« <br />
101 Otto Neurath, Einführung in die Kriegswirtschaftslehre [1914], in: ders., Durch die<br />
Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, München 1919, 42-133 (43), zitiert nach: Rainer<br />
Hegselmann, Otto Neurath - Empiristischer Aufklärer und Sozialreformer, in:<br />
Neurath 1979: 7-78 (20f)<br />
102 Otto Neurath, Statistik und Sozialismus, in: ders. 1979: 288-294 (291)
DI.R wissKNSARCHÄoLociiscHi-; BLICK: STATISTIK 1033<br />
Speichert das (statistische) Archiv das Reelle einer gegebenen (sich in Daten zu<br />
lesen gebenden) Gegenwart, ihr mfrastrukturierendes Werk? Seine eigene Logik<br />
aber folgt, unhmtergehbar, der symbolischen Ordnung der Signifikanten durch<br />
Signaturen. Le reel (im Sinne Jacques Lacans) wäre gerade dasjenige, was außerhalb<br />
dieser Symbohsierung bleibt, deren Scheitern, das wesenhaft Nicht-Verdrängbare,<br />
ponetuation sans texte. An der Stelle, wo diesen Phänomenen ein Echo<br />
im Element der symbolisierenden Sprache antworten soll, findet sich un pur et<br />
simple trou. Erst wo die Einordnung in die symbolische Ordnung gelingt, ist<br />
Erinnern in einem gemeisamen Kode möglich; »alles hängt <strong>von</strong> der Weise dieser<br />
Integration ab.« 103 Das wahre Monument einer Nation ist die (allegorische, symbolische<br />
oder mathematische) Veranschaulichung ihrer Infrastruktur, und so soll<br />
das Leipziger Kriegswirtschaftsmuseum zum Einen »ein dauerndes Denkmal an<br />
Deutschlands schwerste und größte Zeit sein«, zugleich aber auch.praktische Aufgaben<br />
erfüllen, indem es »belehrend, anregend, befruchtend auf die kommende<br />
Zeit« wirken will und »die großen Errungenschaften des Krieges <strong>für</strong> die Aufgaben<br />
der deutschen Volkswirtschaft nutzbar machen« hilft .<br />
»Dabei braucht man durchaus nicht etwa an künftige erneute Waffengänge mit<br />
unseren Feinden zu denken. Auch Wirtschaftskriege und sonstige Mittel und Formen<br />
der Bekämpfung unseres Handels und unserer Industrie, wie wir sie ja schon<br />
in mannigfacher Gestalt durch die feindliche Presse angedeutet erhalten haben,<br />
können uns in eine ganz ähnliche Wirtschaftslage wie die jetzige bringen und zu<br />
ähnlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen wie jetzt nötigen. In solchen Fällen wird<br />
das Kriegswirtschaftsmuseum eine wertvolle Rüstkammer wirtschaftlicher Maßnahmen<br />
sein.« 104<br />
Der Krieg wird zum Archäologen und Aufklärer der Nation, denn er analysiert<br />
und offenbart ihre Infrastruktur; er legt die Fäden und inneren Beziehungen des<br />
weit verästelten Wirtschaftslebens offen, »und kaum jemals wohl wird uns wieder<br />
ein so tiefer Blick in die ganze Struktur unserer Volkswirtschaft bis hinab<br />
auf ihr Knochengerüst ermöglicht, als es jetzt während des Krieges der Fall ist«<br />
.<br />
103 Hermann Lang, Die Sprache und das Unbewußte: Jacques Lacans Grundlegung der<br />
Psychoanalyse, Frankfurt/M. (Suhrkamp), 2. Aufl. 1993, 146<br />
104 Bericht [...] über die Errichtung des Deutschen Kriegswirtschaftsmuseums (= Veröffentlichungen<br />
des Deutschen Kriegswirtschaftsmuseums zu Leipzig, Heft 2), Leipzig<br />
(Brandstetter) 1917, 21
1034 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Neue Gedächtnismaschinen: Statistik im Dienst des Dritten Reiches<br />
(Hollerith, Mikrofilm)<br />
Counting by numbers. <strong>Im</strong> frühen 20. Jahrhundert wird auch die deutsche Pädagogik<br />
in Statistik überführbar:<br />
»Un instituteur du pays souabe, en 1921, decida de livrer au public le bilan de sa<br />
carriere. Jugeant que les chiffres ctaient plus eloquents que les belies envolees<br />
pedagogiqucs, ll cstima qu'il ctait plus, simple d'cxpnmcr un condense de ses methodes<br />
par des statistiques. En trente ans de metier, il avait administre ä ses eleves 91 1<br />
500 coups de canne, 124 000 punitions au fouet, 209 000 retenues, 130 000 eoups de<br />
regle sur les paumes des mains, 10 200 coups de poing sur les oreilles, 223 700 gif les.<br />
>C'est ainsi qu'on forme la jeuncssc
NEUI-; GKDÄCHTNISMASCHINKN: STATISTIK IM DIKNST uns DRITTES REICHFS 1035<br />
Amt und Physik der Herrschaft 3 werden hier nicht länger im Sinne einer politischen<br />
Theologie, sondern arithmetisch konkret. Michel Foucault hat in seiner<br />
Archäologie des ärztlichen Blicks die Neuorganisation der Medizin als Praxis<br />
und Wissenschaft mit der Heraufkunft der pathologischen Anatomie analysiert;<br />
»der große Wendepunkt stellt sich ein, als man das Bedürfnis verspürt, die<br />
Leichname zu zergliedern, zu sezieren.« 4 Die Epoche endet mit der <strong>Im</strong>plementierung<br />
dieses sezierenden Blicks in Automaten; die frühneuzeithche Theorie<br />
<strong>von</strong> den zwei Körpern des Königs wird durch ein medienarchäologisches postscnplum<br />
in der Spätneuzcit fortgeschrieben. Zur Verhandlung steht also die<br />
maschinelle Verarbeitung des Datensatzes Statistik, die nach der Machübernahme<br />
des Nationalsozialismus als »>das Auge des Herrschers< mehr denn je an<br />
Bedeutung gewonnen hat«, da die Zentralisierung der Verwaltung die mathematisch<br />
und maschinell notwendige Standardisierung dieser Datenverarbeitung<br />
bedingt und alle Subsysteme m sein nunmehr »geschlossenes Staatssystem« eingliedert?<br />
Von der Bürokratie als Organismus, ihrem Vergleich mit der Krankheit<br />
eines Menschen und Maßnahmen zu ihrer Gesundung ist längst in der<br />
Weimarer Republik die Rede 6 , doch erst mit der systemischen Schließung des<br />
Datenkreises ist eine Rückkopplung möglich, eine datenbasierte Kybernetisierung<br />
und Mechanisierung der Regierung selbst, wie sie Goethe im Wissen um<br />
die Wissenschaft der politischen Arithmetik seiner Zeit nur andenken wollte:<br />
Auf die Behauptung, die Welt werde durch Zahlen regiert, reagiert er mit der<br />
pauschalen Aussage, »daß die Zahlen uns belehren, ob sie gut oder schlecht<br />
Counted for Pcrsccution: IBM's Rolc.in the Holocaust, in: Washington Jewish Weck,<br />
17. September 1998, im Internet unter: http://hometown.aol.com/mcrryeee/ibmstory2.htm<br />
. Darin besonders das Zitat: »If Hollerith lcases<br />
machines to the German statistical office, is Hollerith responsible for what the<br />
German statistical office does with that Information? poses Holocaust museum curator<br />
Luckert. >The German Hollerith Company may have produced the cards, but they<br />
wouldn't have been involved in [selecting ] the gröups for identification
1036 INVHNTAR UND STATISTIK .<br />
regiert werde.« 7 Erst wenn Beobachtungen individueller Erscheinungen, »welche<br />
<strong>von</strong> dem Leben der Menschheit ausgehen«, auch dahin zurückkehren<br />
, ist Menschenleben als Schaltung anschreib- und speicherbar;<br />
als entsprechendes Korrelat auf Hardware-Ebene sind Lochkartenkarteien<br />
»Maschinen zur Sammlung <strong>von</strong> Erinnerungen«. 8 Nur daß Erinnerung hier nicht<br />
emphatisches Gedächtnis meint, sondern kybernetische Anweisungen; der Weltkonzern<br />
IBM soll seine Firmenarchive <strong>für</strong> die Untersuchung dieser spezifischen<br />
Konstellation öffnen. Wo das Medium solcher Erinnerung nicht mehr die narrative<br />
Form der <strong>Geschichte</strong>(n) ist,.tritt - dem Titel der vorliegenden Arbeit einen<br />
anderen Sinn gebend - an die Stelle der Erzählung die Zählung. Für Lochkarten<br />
zur Fütterung <strong>von</strong> Hollerith-Maschinen »bestand im >Dritten Reich< eine geradezu<br />
unstillbare Nachfrage: Zählen, Erfassen, Sortieren - <strong>von</strong> dem auf >völkische<<br />
Identifizierung angelegten Zensus bereits des Jahres 1933 bis hin zur<br />
Feinabstimmung der Deportationszüge in Richtung Osten. Die waren allgegenwärtig.«<br />
9 Das Auge des Herrschers 10 heißt unter den Machtbedingungen im<br />
Deutschland <strong>von</strong> 1933 Massenbeobachtung, und der erste Vicrjahresplan des<br />
neuen Regimes erfordert die lnventurnahme eines Volkes. Den Einsatz mechanisierter<br />
Statistik »eröffnen die großen Rahmenbedingungen unseres Volkskörpers«<br />
in seinen gleichgeschalteten Korporationen (Deutsche Arbeitsfront etwa),<br />
wobei der Parteiverwaltungsapparat des beobachtenden Organs (die NSDAP)<br />
selbst Teilmenge dieser Organisationsform ist - und<br />
damit das Russel-Paradox auf den Plan ruft, wie es auch <strong>für</strong> das Computergedächtnis<br />
aktuell wird, sobald Daten wie Instruktionen im gleichen Speicher<br />
abgelegt werden. Kann sich ein System selbst regulieren?<br />
Das Innehalten der Gegenwart ist die Chance des Archivs. Keine Vergangenheit,<br />
sondern die Unterbrechung <strong>von</strong> Gegenwart öffnet den Raum <strong>von</strong> Historie.<br />
Inmitten des Kongresses Naziverbrechen gegen die Menschlichkeit in Polen<br />
und Europa in Warschau ist es am 16. April 1983 die Nachricht, das deutsche<br />
Bundesverfassungsgericht habe die geplante Volkszählung ausgesetzt, welche<br />
7 Zitiert nach: Zitiert nach: Otto Bohre, <strong>Geschichte</strong> der Statistik in Brandenburg-Prcussen<br />
bis zur Gründung des Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin (Heymänns) 1905,<br />
Vorwort, m<br />
s Andre Leroi-Gourhan, Hand und Wort: die Evolution <strong>von</strong> Technik, Sprache und<br />
Kunst, übers, v. Michael Bischoff, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 330<br />
9 Der Bochumer Historiker Norbert Frei (Rez.), Geschäft vor Moral, über: Edwin<br />
Black, IBM und der Holocaust. Die Verstrickung des Weltkonzerns in die Verbrechen<br />
der Nazis, München / Berlin (Propyläen) 2001<br />
10 Zur medialen Genese dieses Begriffs, fokussiert im Königsporträt auf der Medaille,<br />
siehe Louis Mann, Lo Portrait du roi, Paris (Minuit) 1981; Briefmarken transportieren<br />
seit dem 19. Jh. die Disscminierung des Herrscherblicks fort (Hinweis Bernhard<br />
Siegcrt, Berlin).
NI-UK GHDÄCHTNISMASCHINI-N: STATISTIK IM DIKNST DI-.S DRIIII.X RI-:K:HI:S 1037<br />
Götz Aly und K. H. Roth am selben Abend noch entscheiden läßt, zu diesem<br />
aktuellen Thema ebenso medienarchäologischen wie ideologiekritischen zu<br />
recherchieren. Aufgefallen war ihnen bereits auf dem Warschauer Kongreß, daß<br />
über die Mordtaten zwar viel gesprochen wurde, über die effiziente Methodik<br />
der Herrschaftsausübung (Foucaults »Technologien« der Macht, buchstäblich)<br />
aber so gut wie nicht: denn der polnische Sozialismus bediente sich selbst noch<br />
solch statistischer Praktiken. Liegt nicht schon in der Abstraktion des Menschen<br />
zur Ziffer ein fundamentaler Angriff auf seine Würde? fragen die Autoren;<br />
das Resultat ist eine Studie, welche die administrative Auflösung des<br />
gesellschaftlichen Lebens durch »das fortschreitende Zählen und Abspalten<br />
in Splitter und Partikel« rekonstruiert - ein Prozeß,<br />
der sich analog zur Diskretisierung <strong>von</strong> Gedächtnis als Archiv selbst liest. Denn<br />
seit jeher nimmt die Verwaltung auch personenbezogene Daten auf, »erfaßt,<br />
speichert, verarbeitet sie und gibt sie wieder ab; Verwaltung als informationsverarbeitendes<br />
System« 11 ist also immer schon Medium im nachrichtentechnischen<br />
Sinn. Allerdings stellt die mit neuer Informationstechnik prinzipiell<br />
mögliche, also den Raum einer Virtualität eröffnende beliebige Verknüpfbarkeit<br />
und Kombinierbarkeit <strong>von</strong> Daten aus verschiedenen Beständen in Sekundenschnelle<br />
»ein ahud gegenüber dem Zusammentragen derselben Daten <strong>von</strong><br />
Hand in einem wochen- und monatelangen Such- und Aufbereitungsprozeß (so<br />
er überhaupt unter diesen Bedingungen stattfinden kann)« dar . Dieser<br />
letzte Zusatz sagt es: Technisch induzierte Datenbanken generieren einen differenten<br />
Typus <strong>von</strong> Archiv, sind sein anderes Gesetz. Menschen werden nicht<br />
mehr der Fiktion einer Individualität namens Subjekt entsprechend verhandelt,<br />
sondern als diskrete Kategorien gestreut . Diese Kategorisierung<br />
ist eine Funktion <strong>von</strong> mechanisierter Organisation, Formularen und optimierten<br />
Maschinen - ein Prozess, dessen Genealogie Michel Foucault auch unter<br />
Rekurs auf Ernst Kantorowicz< Die zwei Körper des Königs als <strong>Geschichte</strong> der<br />
Personenkennziffer (Personalausweis) rekonstruiert hat: »Zu untersuchen wäre,<br />
was man Kantorowicz zu Ehren den >genngsten Körper des Verurteiltem nennen<br />
könnte.« 12<br />
11 Jürgen Ostermann, Datenschutz, in: Kurt G. A. Jeserich, Hans Pohl, Georg-Christoph<br />
<strong>von</strong> Unruh (Hg.), Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 5, Stuttgart (Deutsche<br />
Verlags-Anstalt) 1987, Kapitel XXI »Datenschutz«, 1114<br />
12 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1977, 41
1038 iNVl-NTAK UNI) STATISTIK<br />
Statistische Nachweisbarkeit und ihre Automation<br />
als Medium des Antisemitismus<br />
Die Verbindung <strong>von</strong> Archiv und Erinnerung lauft nicht zwangsläufig auf <strong>Geschichte</strong>^)<br />
hinaus. Um Politische Säuberungen und Antisemitismus im sozialistischen<br />
Osteuropa darstellen zu können, stützt sich Othmar Nikola Haberl auf<br />
statistisch Nachweisbares 13 , die langue des calculs (Condillac) - ein demographisches<br />
Kalkül. Statistik stellt auch das symbolische Widerlager realer Mengenverteilung<br />
<strong>von</strong> Menschen dar »in einer Epoche, in der sich uns der Raum in der<br />
Form <strong>von</strong> Lagerungsbeziehungen darbietet«, wo »Markierungen und Klassierungen<br />
<strong>für</strong> die Menschenelemente in bestimmten Lagen und zu bestimmten<br />
Zwecken gewählt werden« 14 , die nachträglich mit Archiv-Lagen selbst identisch<br />
sind. Für die deutsche Volkszählung <strong>von</strong> 1933 begründet die Dehomag, warum<br />
sie zur Datenauswertung 60spaltige und nicht die zunächst hinreichenden 45spaltigen<br />
Lochkarten verwendet: Es sei noch nicht zu übersehen, ob man sich »nicht<br />
noch entschließt, aus irgendwelchen staatspolitischen Erwägungen heraus weitere<br />
Angaben aus der Haushaltsliste auf die Lochkarte zu übernehmen.« 15 Optional<br />
wird diese Maschinerie damit zum Instrument der nationalsozialistischen<br />
Rassenideologie und deren Phobie vor Durchmischung des Blutes. Automatisierte<br />
Kartenzuführung in Sortier- und Tabelliermaschinen ermöglicht demgegenüber-<br />
in Begriffen der physikalischen Thermodynamik 16 , praktiziert als Statistik<br />
- eine negentropische Ordnungsoperation, nämlich, Menschen mit gleicher<br />
Nationalität in aufsteigender Reihenfolge nach diesem Merkmal auszusondern,<br />
da abschließend alle Karten mit gleicher Schlüsselzahl hintereinanderliegen. Vor-<br />
13<br />
In: Alte Synagoge Essen (Hg.), Jüdisches Leben in Böhmen und Mähren (Vortragsreihe<br />
im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung Das Jüdische Museum in<br />
Prag. Von schönen Gegenständen und ihren Besitzern), Essen 1992, 77ff<br />
14<br />
Michel Foucault, Andere Räume, in: zeitmitschrift. ästhetik & politik Nr. 1 / 1990, 4-<br />
15(6)<br />
15<br />
Hollerith Nachrichten, Heft 28/1933, zitiert nach: Götz Aly / Karl Heinz Roth, Die<br />
restlose Erfassung. Volkszählcn, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus,<br />
Berlin (Rotbuch) 1984, 17; diese nachhaltig grundlegende Studie wird in den vorliegenden<br />
Ausführungen auf ihre Archiv- und Bibhotheksmodule hin zurückgelcscn, um<br />
diese unter medienarchäologischen Aspekten zu rekonfigurieren.<br />
16<br />
Der Reichsführer SS Heinrich Himmler schreibt in seiner Eigenschaft als »Reichskommissar<br />
<strong>für</strong> die Festigung deutschen Volkstums« aus Berlin am20. November 1944<br />
an den Gauleiter <strong>von</strong> Danzig, Albert Forster, daß »viele Tropfen falsches Blut, die in<br />
einem Volkskörper bei einem Umformungsprozeß hereinkommen, niemals wieder<br />
gutzumachen sind.« Das Dokument in Privatbesitz (Nr. H 71/4) ist nachgewiesen im<br />
Ausstellungskatalog (Staatsbibliothek Berlin et al.): <strong>Im</strong>ago Poloniae. Das polnischlitauische<br />
Reich in Karten, Dokumenten und alten Drucken in der Sammlung <strong>von</strong><br />
Tomasz-Niewodniczanski, Bd. 1 (2002), 200f.
Ni-:ur. GI-.DÄCIITNISMASCIHNI-:N: STATISTIK IM DIF.NST DI:S DRIITIX RI-KJIIS 1039<br />
stufe zu dieser Aussonderung ist das Verfahren des Reichssippenamts, bei der<br />
Verkartung <strong>von</strong> Kirchenbüchern in Form <strong>von</strong> Doppeln eine Fremdstämmigen-<br />
Kartei anzulegen, »in besonderen Päckchen verpackt, besonders abgeliefert und<br />
registriert« - Modularisierung und Formatierung der Information bis hin zum<br />
Transportmedium. 17 Die Ästhetik der Programmierung (mit Variablen in<br />
Speicherplätzen) hält Einzug in Form <strong>von</strong> Stecktafeln, die automatisch bei der<br />
Änderung vorher bestimmter Merkmale {Gruppenwechsel) Zwischensummen<br />
ausdruckten und erneut zu zählen anfangen - <strong>Im</strong>plementierung des feedback. Die<br />
Leistungsfähigkeit <strong>von</strong> Sortiermaschinen mit drei Bürstenhaltern »in solcher Stellung,<br />
daß die drei Spalten der Abnormalen berührt wurden«, beschreiben die<br />
Hollerith-Mitteilungen (Nr. 3) 1913 unter dem Titel Absonderung der Abnormalen<br />
<strong>für</strong> das Statistische Büro in Kopenhagen als sinnreiche, weil rechen- und<br />
speicherzeitsparende Vorkehrung. Sortiermaschinen sondern aus, indem sie sortieren;<br />
die An- oder Abwesenheit <strong>von</strong> gestanzten Löchern an verschiedenenen<br />
Positionen entscheidet über die Berechnung. 18 In der reformierten (hier: standardisierten)<br />
Verwaltungspraxis der Weimarer Republik war diese Mechanik<br />
bereits angelegt: »Ein Formular kann mehrere Erledigungsmöglichkeiten berücksichtigen.<br />
Es wird im konkreten Fall durch Streichungen fixiert« . Die Lochkarte als Dispositiv beendet an ihrem Ort die energetische<br />
Epoche des Industnezeitalters und eröffnet die Mikrophysik <strong>von</strong> Informationssteuerung<br />
vor dem Hintergrund neuer Administrationsformen:<br />
»Der Begriff des Speichers, technisch genommen, umfaßte bisher Vorrichtungen,<br />
denen Energie in irgendeiner Form zugeführt wurde, und aus denen diese Energie<br />
im Augenblick des Gebrauchs wieder abgeleitet wurde. In letzter Zeit hat man<br />
aber den Begriff des Speichers erweitert und wendet ihn auch <strong>für</strong> Apparaturen an,<br />
die nicht >EnergienVorgänge< allgemein technischer Art sammeln und<br />
festhalten können, um sie im gegebenen Moment wieder zu reproduzieren. Es<br />
handelt sich hierbei zwar auch um Energien, aber sie sind so klein, daß ihr Speicher<br />
als Kraftquelle nicht mehr in Frage kommt.« 19<br />
Durch die Beschleunigung der Speicheraktivierung tritt der Begriff der gesammelten<br />
Energie in den Hintergrund und der eines fixierbaren und reproduktionsfabigen<br />
Vorganges in den Vordergrund; Kybernetik und Organisationswissen<br />
lesen das Gedächtnis allein unter dem Aspekt seiner Abrufbarkeit. <strong>Im</strong> Unter-<br />
17 Karl Themel, Wie verkarte ich Kirchenbücher? Der Aufbau einer alphabetischen Kirchenbuchkartei,<br />
hg. mit Unterstützung der Reichsstelle <strong>für</strong> Sippenforschung, Berlin<br />
(Verlag <strong>für</strong> Standesamtwesen) 1936, 49<br />
18 Zitiert nach: Aly / Roth 1984, 17f, unter Bezug auf den Abdruck dieses Dokuments<br />
in: IBM-Nachrichten 33 (1983), Heft 265, unter dem Titel »Neues <strong>von</strong> Gestern«; aus<br />
den Nürnberger Dokumenten NO-5194 referieren es Aly / Roth 1984: 57<br />
iy Festschrift Hollerith 1935, Kapitel »Die Lochkarte als Träger des Hollerith-Verfah-<br />
rens«, 83ff (84)
1040 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
schied zu vertrauten Speichern wie Schallplatte, Tbnfilmstrcifen, »ferner noch der<br />
magnetisierte Draht bei einem neuen Tonaufzeichnungsverfahren«, vermag der<br />
Schaltkreis der Lochkarte das Gespeicherte auch zu sortieren . Gerade das<br />
frühe Tonband (der BASF) aber wird hier in seiner Einsatzfähigkeit als (Zwischen-)Speichermedium<br />
der Datenverarbeitung verkannt. Alan Turing hat das<br />
Endlosband zur Bedingung des Computers selbst gemacht. Obgleich funktional<br />
kein Speichermedium, macht die Hollerith-Maschine Gedächtnis berechenbar;<br />
sie definiert den Gedächtnisbegriff, den Speicher der Daten des Deutschen in<br />
einer radikalen Weise neu. 20 Nicht allein tabellarische Daten, sondern Vorgänge<br />
werden so in der Lochkarte speicherbar, wobei Gedächtnis in Sortierung und die<br />
digitale Logik <strong>von</strong> An- und Abwesenheit überführt wird, denn die Form der<br />
Speicherung ist die Lochschrift. Sie drückt eine Zahlen aus, indem jede einzelne<br />
Lochstelle die Bedeutung einer Zahl hat und damit auch das Nichts semantisiert<br />
wird. »Demnach kann alles, was in Zahlen ausgedrückt werden kann, gespeichert<br />
werden« - eine Regeneration der Welt im Computing . Die <strong>von</strong> Connng<br />
und Achenwall begründete historisch-beschreibende Schule der Statistik<br />
wählte Darstellungsmittel wie die Geschichtsschreibung, Wortphrasen also, und<br />
verzichtet bei dem geringen Umfange, den sie den ziffernmäßigen Daten einräumt,<br />
auf eine Kalkülisierung der statistischer Relationen. Demgegenüber suchte<br />
die Schule der politischen Arithmetik nach statistischen Gesetzen und präfigunert<br />
damit mediale (also berechnende und speichernde) Datenverarbeitung -<br />
weshalb die lnstruction <strong>für</strong> das Königliche Statistische Bureau König Friedrich<br />
Wilhelms <strong>von</strong> Preußen (Berlin, 1. November 1805, gezeichnet auch durch den<br />
Freiherrn vom Stein) ausdrücklich verfügt, daß <strong>für</strong> alle »bei dem Bureau einkommenden<br />
Actcn und Nachweisungen nach und nach ein stastistisch geographisches<br />
Archiv gebildet« werde, um zu jedem Betreff »sichere Notizen, so oft<br />
sie verlangt werden, zu geben im Stande« zu sein <br />
- ein an die Kybernetik (als Staatsregierung) der Gegenwart selbst unmittelbar<br />
rückgekoppeltes, nicht als emphatisches Gedächtnis abgesetztes Archiv.<br />
»Wenn auch die Anhänger der plastischen Darstellung oder der Buchstabenschrift<br />
diese als die >höhere< Statistik bezeichneten und die Anhänger der >gemeinen< Zahlen-<br />
oder Tabellenstatistik >Tabellcnfabrikanten< schalten, so kann doch dieser<br />
bis in die Neuzeit reichende Streit zu Gunsten der Zahl als entschieden<br />
angesehen werden. Der amtlichen Statistik ist Schilderungsgegenstand nur das, was<br />
sich auf Größe und Zahl zurückführen und ziffernmäßig vergleichen läßt; sie<br />
summiert die Ergebnisse ihrer Untersuchungen nach bestimmten Rubriken,<br />
berechnet die Durchschnitts- und entwickelt die Verhältniszahlen, um schließlich<br />
das Ergebnis in Form tabellarischer und kartographischer Uebersichten und Vergleichungen<br />
zur Darstellung zu bringen.« <br />
20 Siehe Charles Tilly, Computers in Historical Analysis, in: Computers and the Humanities<br />
7, Heft 6 (1973), 323-336
NKUH GKDÄCI-ITNISMASCHINKN: STATISTIK IM DII-NST DI-;S DRITTEM REICHES 1041<br />
Da nun auch Vorgänge in Zahlen ausgedrückt werden können, verliert Statistik<br />
ihren bislang statischen Charakter; die Opposition <strong>von</strong> Zustand und Ereignis<br />
wird in eine Folge diskreter Zustände überführt. Ausgehend <strong>von</strong> der Special pur-<br />
/>ose-orientierten Einsicht, daß die Vorgänge, die beim Lochkartenverfahren<br />
interessieren, buchungs- und abrechnungstechnischer Natur sind, also ein Gebiet<br />
umfassen, in dem <strong>von</strong> Natur aus mit Zahlen operiert wird, die einen wert- oder<br />
ordnungsmäßigen Charakter haben, wird auch alles Übrige kodierbar, »indem<br />
man <strong>für</strong> irgendwelche Begriffe nach einer gewissen Übereinkunft Zahlen setzt«<br />
.<br />
Die Überführung deutscher Juden in ein numerisch adressierbares Zahlenwerk<br />
(bei gleichzeitiger Anonymisierung der namentlichen Identität) macht sie<br />
in einer Weise speicherbar, welche sie an die administrative Struktur des nationalsozialistischen<br />
Staaten anschließt und damit Deportation und Genozid als<br />
Programm durchführbar. So wird an Menschen realisiert, was in den bio-statistischen<br />
Erhebungen anderer Länder und Generationen als vollzogene Datensortierung<br />
im Virtuellen verblieb. Richard Korherr, der als Direktor des<br />
Statistischen Amtes der Stadt Würzburg 1937 eine systemtheoretisch reformulierbare<br />
21 Schnittstelle <strong>von</strong> Rasse und Umwelt, <strong>von</strong> Kulturphilosophie und Statistik<br />
deklariert, indem er auch die Massenerscheinung des Seelenlebens als<br />
Statistik, »nämlich eine in Worten«, definiert, hat im März 1943 in Form eines<br />
statistischen Berichts Die Endlösung der europäischen Judenfrage berechnet. 22<br />
Jacobus Lambertus Lentz, »der sich unter dem NS-Regime seinem aufgeklärten<br />
Traum vom Papiermenschen so nahe sah« , wird 1946 in<br />
Den Haag zu drei Jahren Haft verurteilt. Unterdessen hat Alan Tunng den Menschen<br />
längst zur Papiermaschine umgetauft. 23 Die Grenzen der Hermeneutik hegen<br />
- wie im Computing - in der absoluten Zuverlässigkeit, die im militärischen<br />
21 Von »Systemrasse« im Unterschied zur »biologischen Rasse« schreibt Josef Götz, Die<br />
amtliche Statistik und die Rassenforschung. Eine internationale statistische Studie, in:<br />
Allgemeines Statistisches Archiv 27, Heft 4 (1938), 415-422 (415); Götz differenziert<br />
die Applizierbarkeit <strong>von</strong> Statistik <strong>für</strong> »Rassenforschung« zwischen deutschem Reichsgebiet<br />
und den ehemaligen Kolonien (418).<br />
22 Dazu Dieter Schiefelbein, Das »Institut zur Erforschung der Judenfrage Frankfurt am<br />
Main«. Vorgeschichte und Gründung 1935-1939, Frankfurt/M. 1994 (= Materialien<br />
Nr. 9 des Frankfurter Studien- und Dokumentationszentrums zur <strong>Geschichte</strong> und<br />
Wirkung des Holocaust / Fritz Bauer Institut, hg. in Zusammenarbeit mit dem Institut<br />
<strong>für</strong> Stadtgeschichte, Frankfurt/M. ), 43, und Richard Korherr, Der Untergang der<br />
alten Kulturvölker. Eine Statistik in Worten, in: Allgemeines Statistisches Archiv 27,<br />
Heftl (1937), 29-50 (30 u. 40)<br />
23 Siehe Friedrich Kittler, Protccted Mode, in: Manfred Faßler / Wulf Halbach (Hg.), Inszenierungen<br />
<strong>von</strong> Information. Motive elektronischer Ordung, Gießen (I'ocus) 1992,<br />
82-92 (83)
1042* INVENTAR UND STATISTIK<br />
und administrativen Bereich Priorität gegenüber jedem Interpretationsspielraum<br />
hat; kalkulierbarer als der Begriff <strong>von</strong> Subjekt und Identität ist deren Verzifferung.<br />
Es fehlte auch im Lande Konrad Zuses eine Volksnumerierung als Bedingung<br />
der Normierung <strong>von</strong> Menschenbildern 24 ; der Initiator des Deutschen<br />
Instituts <strong>für</strong> Normung verkündet bereits zur Zeit seines Dienst im deutschen<br />
Heer <strong>von</strong> 1917, daß an die Normierung des Lebens nicht zu denken sei, bevor<br />
nicht auch die Normen der leblosen Welt energetisch studiert sind. 25<br />
»Wörter zu ordnen, ergibt viel mehr Fehlerquellen, als Zahlen zu ordnen, und<br />
erfordert mehr Verständnis, Kraft und Zeit. Man würde sehr viel Zeit und Arbeit<br />
sparen, wenn man die Menschen, die auf den Karteikarten eingetragen sind, nach<br />
Zahlen ordnen könnte. Welche Zahlen aber ? Eine Vereinfachung würde erst<br />
dann eintreten, wenn jeder Bewohner des Deutschen Reiches eine bestimmte<br />
Kennzahl hätte, eine Zahl, die ihn <strong>von</strong> der Geburt bis zum Tode begleitete.«<br />
<br />
Diese Computation rekonfiguriert das Archiv des Menschen weder kontingent<br />
noch semantisch:<br />
»Die Zahl, die jedem Menschen zugeordnet wird, dürfte keine beliebige, zufällige<br />
'fortlaufende Nummer< sein. Es müßte eine 'sprechende Zahl< sein, eine Zahl, aus<br />
der einige Grundtatsachen über den Kennzahlenträgcr zu erkennen sind, am<br />
besten die Grundtatsachen, die man bisher schon verwendete zur eindeutigen<br />
Bezeichnung eines Menschen neben seinem <strong>Namen</strong>: Geschlecht, Geburtsort und<br />
-zeit. Es müßte aber auch eine einfache Zahl ohne Sonderzeichen und ohne Tcilzahlen<br />
sein, die sich mühelos mit jeder anderen Zahl m eine Reihe bringen läßt und<br />
daher als leichtes Ordnungsmittel in Listen und Karteien dienen kann.« <br />
Das Stigma der Zahl wird den Menschen selbst eingebrannt, nicht mehr als Exteriorität,<br />
sondern als dessen Datenspur: »Jedenfalls liegt kein innerer Weg im<br />
Stoff, nach dem er eindeutig der Ziffernfolge zugeordnet werden könnte.« 26 Es<br />
geht um die Signalvsnkung äußerlich sichtbarer Ordnungsfaktorcn an Akteuregalen;<br />
das Aktenzeichen wird damit schon in die kommunikationspraktische<br />
Übertragung überführt. So genügen zur Adressierung des Speichers »oft ein<br />
Zeichen, ein Wort, und der ausführende Beamte weiß, was er zu tun hat«<br />
. Daten als Aktenaussage und Daten als Operatoren<br />
ihrer Übertragung und Speicherung konvergieren. An die Stelle der schlichten<br />
papierenen Verdopplung des Menschen tritt die berechnende Zahl, die Infor-<br />
24 Reichsarbeitsblatt 1944, zitiert nach: Aly / Roth 1984: 116<br />
25 Walter Porstmann, Normenlehre. Grundlagen, Reform und Organisation der Maßund<br />
Normensysteme. Dargestellt <strong>für</strong> Wissenschaft, Unterricht und Wirtschaft, Leipzig<br />
(Haase) 1917, vi<br />
2(> Walter Porstmann, Karteikunde. Das Handbuch der Karteitechnik, 2. Auf. Stuttgart<br />
(Verlag <strong>für</strong> Wirtschaft und Verkehr) 1928, 198
Ni'UU GHDÄCHTNISMASCHINUN: STATISTIK IM DIENST DKS DRITTEN REICHES 1043<br />
mation <strong>von</strong> Ort und Datenträgern entkoppelt, also deplazier- und ersetzbar<br />
macht. Keine alliierte Bombe auf ein zentrales Kataster sollte mehr »zigtausend<br />
Menschen zu unbeschriebenen Blättern« werden lassen .<br />
In den letzten Monaten des NS-Regimes wird an der allgemeinen Personenkennziffer<br />
gearbeitet; Motor dieser Entwicklung - hier fällt die Geschichtsmetapher<br />
mit ihrem Objekt zusammen - ist nicht mehr die Polizei, sondern das<br />
Maschinelle Berichtswesen der Wehrmacht und des Rüstungsministeriums, 1937<br />
mit Unterstüztung der Dehomag als Lochkartenstelle des Wchrwirtschaftstabs<br />
entstanden. Seine Optimierung heißt Kybernetik; nachdem der 1940 zum<br />
Reichsminister <strong>für</strong> Bewaffnung und Munition ernannte Ingenieur Fntz<br />
Todt zuvor Autobahn- und Bunkerbau organisiert hat, obliegt es unter seiner<br />
Ägide dem Maschinellen Berichtswesen, den rüstungswirtschaftlichen »Erfassungs-<br />
und Lenkungsapparat durch Standardisierung der Vordrucke <br />
flexibel zu machen« . Gedächtnislogistik und Aktenkunde<br />
fallen unter dem Druck der Gegenwart zusammen. Von den Wirtschaftszu<br />
Menschendaten: Ende November 1944 erhält Kurt Passow den Auftrag, das<br />
Maschinelle Berichtswesen weiterzuentwickeln und mit einem Teil des Personals<br />
aus dem SS-eigenen Maschinellen Zentralinstitut <strong>für</strong> optimale Menschenerfassung<br />
und -auswertung die Reichspersonalnummernkartei aufzubauen, um<br />
das allmählich zusammenbrechende Meldewesen vor Ort zu stabilisieren - die<br />
maschinelle Symbolordnung als Kompensation administrativer breakdowns.<br />
In der Kopplung <strong>von</strong> Datenspeicher und -Verarbeitung (Lochkarte und<br />
Karteiführung) wird das Maschinelle Berichtwesen nicht nur beschleunigt, sondern<br />
überhaupt erst zum Medium im Sinne der Nachrichtentechnik. Die Einsicht,<br />
daß dies im Zeitalter analoger Maschinen nur als Medienverbund, nämlich<br />
durch Kopplung aller vorhandenen Verfahren durchführbar war, ist Funktion<br />
der unerbittlichen Praxis des Krieges: »So arbeiteten im Maschinelles Benchtswesen<br />
Schreibmaschinen, Buchhaltungsmaschinen, Lochkarten, Vervielfältiger,<br />
Setzmaschinen, Druck, Mikroverfahren und Fernschreiber organisatorisch<br />
weitgehend zusammen. Der Veränderungs- und Nachrichtendienst war mit<br />
Erfolg besonders organisiert.« 27 Ein Führerbefehl vom 28. Dezember 1944 stellt<br />
sicher, daß das Erfassungswesen bis zur vollständigen Niederlage fortoperiert;<br />
statistische Erfassung geschieht nicht mehr nachträglich, sondern unter totalen<br />
Kriegsbedingungen in Echtzeit. Deren Haltepunkt ist nicht allein durch das Kapitulationsdatum<br />
definiert, sondern nicht minder durch die Hardware, die technologische<br />
Grenze dieser Erfassungssysteme (Endpunkt auch des umfaßten<br />
' Kurt Passow, Das »Maschinelle Berichtswesen« als Grundlage <strong>für</strong> die Führung im II.<br />
Weltkrieg, in: Wein-technische Monatshefte, b2. Jg., 1 Iel't 1-4 (1965), pasuni (1 left 4,<br />
»Zusammenfassung«); Passows Rückblick bleibt weithend unkritisch, sowohl was die<br />
Technik als auch die ideologischen Verstrickungen des MB betrifft.
1044 INVI-N'I'AR UND STATISTIK<br />
Zeitraums der vorliegenden Arbeit). Während seit dem Jahr 1946 die damaligen<br />
Besatzungsmächte den statistischen Landesämtern noch zu Lochkartenmaschinen<br />
verhelfen 28 , wird durch die Entwicklung programmgesteuerter Computer<br />
die bisherige Schallmauer der Berechenbarkeit überwunden; seitdem kann das<br />
gleiche Speicherwerk in beliebiger Ordnung zur Speicherung der Befehle als<br />
auch zur Speicherung der Zahlen oder anderer Informationen dienen. Damit<br />
wird der Gedächtmsbegnff selbst metaphorisch.<br />
Auf der Jahrestagung 1959 der Deutschen Statistischen Gesellschaft benennt<br />
Siegfried Koller, seinerzeit Regierungsdirektor am Statistischen Bundesamt in<br />
Wiesbaden, die neuen Möglichkeiten der automatisierten Auswertung statistischer<br />
Aufgaben: Informationsgewinn ist präziser gefaßt und enger auf die<br />
künftige Verwendung der Zahlen ausgerichtet; mit Hilfe der Diskriminanzanalyse<br />
läßt sich in der medizinischen Diganostik Krankheit A <strong>von</strong> Kranheit<br />
B statistisch trennen (wie Bevölkerungsgruppen ehedem). 29 »Die Apparatur<br />
hat eine nicht zu unterschätzende selektive Wirkung auf die Aufgabenstellung«<br />
; diese Emphase Kollers steht nicht nur in der Folge<br />
einer Einsicht Friedrich Nietzsches angesichts des neuen Mediums Schreibmaschine,<br />
daß die Schreibwerkzeuge die Gedanken mitformulieren, sondern<br />
erinnert im Kontext statistischer Praxis <strong>von</strong> Bevölkerungsaussonderung im<br />
Dritten Reich an die Selektion als Subjekt und Objekt der Datenverarbeitung.<br />
Elektronische Speicher erweitern den Horizont der Planbarkeit durch die<br />
Option der gleichzeitigen Rückkopplung, eröffnen mithin also einen kalkulierbaren<br />
Zukunftshorizont, wie es vorher nur der Begriff der <strong>Geschichte</strong><br />
selbst vermochte. 30 Historie als Statistik und Statistikgeschichte schließen sich<br />
kurz; »somit ist ein wesentlicher Teil der Entwicklung wieder in die Hände<br />
der Statistiker gelangt, welche ja schon Jahrzehnte vorher auf dem Wege über<br />
Lochkartengeräte Entscheidendes <strong>für</strong> die Datenverarbeitung beigetragen<br />
hatten.« 31 Um der Sache willen sei es klüger, »wenn der Statistiker selbst<br />
' 8 Josef Götz, Der Einsatz <strong>von</strong> technischen Hilfsmitteln und Maschinen aller Art (ohne<br />
elektronische Rcchenanlagcn) in der Statistik, in: Allgemeines Statistisches Archiv.<br />
Organ der Deutschen Statistischen Gesellschaft, 43. Bd. (München 1959), 341 ff (343).<br />
Der Autor ist, dem Buchstaben und der Sache nach, identisch mit Götz 1938.<br />
29 Siegfried Koller, Der Einfluß der Automatisierung auf die Aufgabenstellung der Statistik,<br />
in: Allgemeines Stastistisches Archiv 43 (1959), 363-368 (366)<br />
30 Reinhart Kosellcck, Vergangene Zukunft. Zur Semantk geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M.<br />
(Suhrkamp) 1979, und ders., Sprachwandel und sozialer Wandel im ausgehenden<br />
Ancicn Regime, in: Studien zum achtzehnten Jahrhundert Bd. 2/3 (1980),<br />
15-30 (bes. 28ff)<br />
31 Konrad Zuse, Einige Gesichtspunkte der Entwicklung programmgesteuerter Rechenanlagen<br />
in den letzten 20 Jahren, in: Allgemeines Statistisches Archiv 1959: 334-340<br />
(335; s. a. 338)
NI-UF, GKDÄCHTNISMASCHINHN: STATISTIK IM DII-:NST DHS DRITTF.S RI-ICHI-S 1045<br />
sich auch um die letzte Verwertung kümmert.« 32 Mit solchen Worten ist im<br />
Nationalsozialismus, jenseits ideologischer Überbauten, statistische Praxis wirkungsmächtig<br />
geworden, durch die Kopplung <strong>von</strong> Programm und Maschinerie<br />
(Staat, Ausübungsgewalt). Das Kennkartendoppel hat die Kennzeichnung der<br />
deutschen Juden im Dritten Reich nahezu automatisch herbeigeführt, indem die<br />
am 21. April 1939 zunächst zu Zwecken militärischer Konskription verfügte<br />
Volkskartei durch mit dem schwarzen Buchstaben/ gekennzeichnete Indexkarten<br />
<strong>für</strong> jüdische Bürger an rassistische Datenerhebung gekoppelt wurde.' 1<br />
So wird aus einer ideologischen Intention die Funktionalität eines Apparats,<br />
und in Kopplung an das Speichermedium Lochkartei wird dieser Apparat zu<br />
einem Ort des deutschen Gedächtnisses. 34 Die aufgrund der Nürnberger Rassengesetze<br />
erhobenen Daten der Volkszählung <strong>von</strong> 1939 waren auf einer Ergänzungskarte<br />
zum Zweck einer separaten, staatsarchivisch administrierten<br />
Reichskartei der deutschen Juden erfaßt, auch logistisch abgekoppelt <strong>von</strong> den<br />
tabellierten Lochkarten der eigentlichen Volkszählung. Individuelle, namentlich<br />
adressierbare Daten waren so maschinell lokahsierbar; bis in die Konzentrationslager<br />
wurde das Netz <strong>von</strong> Hollenth-Lochkartenmaschinen gezogen.<br />
Das deutsch-jüdische Verhältnis wurde so eine Funktion automatisierter, rekursiver<br />
(also durch Rücklauffähigkeit gekennzeichneter) Berechnung, schrecke<br />
allerdings vor dem letzten. Schritt - der kybernetisch anonymen Direktverschaltung<br />
<strong>von</strong> Lochkarte und genozidaler Maßnahme - zurück, wie ein ehemaliger<br />
Mitarbeiter der IBM Deutschland die Kernthesen <strong>von</strong> Aly/Roth und<br />
Luebke/Milton technikhistorisch korngiert. 33 Es blieb eine Instanz, ein unkal-<br />
32<br />
K. Krieger, Der Weg der Statistik zum Volk, in: Allgemeines Statistisches Archiv 23<br />
(1933/34), 619<br />
33<br />
Dazu Lucbkc / Milton 1994: 31 f. Zur Korrelation <strong>von</strong> Antisemitismus und Statistik im<br />
III. Reich und im Reichsarchiv siehe auch: Herrmann 1993: 413; s. a. Götz 1938: 417<br />
34<br />
Zur funktionalistischen Sicht auf die »Existenz eines solchen wissenschaftlich-polizeilichen<br />
Komplexes« im nationalsozialistischen Staat am Beispiel der Zigeunerpolitik<br />
siehe Michael Zimmermanns Beitrag in: Christian Jansen u. a. (Hg.), Von der<br />
Aufgabe der Freiheit: politische Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19.<br />
und 20. Jahrhundert (Festschrift <strong>für</strong> Hanns Mommsen zum 5. November 1995) Berlin<br />
(Akademie) 1995, bes. 426<br />
3D<br />
Friedrich W. Kistermann, Locating the Victims: The Nonrole of Punched Card Technology<br />
and Census Work, in: IEEE Annais of the History of Computing 19, Heft 2<br />
(1997), 31-45 (39ff), bes. 41: »Klaus Heinecken reports in 1942 that the Volkskartei<br />
was not used to locate the Jews«, unter Bezug auf: Allgemeines Statistisches Archiv 31<br />
(1942/43), 39-44. Der Stromkreis ist eine Anspielung auf die gleichnamige zeitgenössische<br />
Werkzeitschrift der DEHOMAG Berlin. Siehe auch Black 2001: 253 u. 498; ferner<br />
Raimar Zons, Domesday, Buchenwald, Weimar, in: Gert Theile (Hg.), Das Archiv<br />
der Goethezeit. Ordnung, Macht, Matrix (= Jahrbuch der Stiftung Weimarer Klassik,<br />
Bd. 1), München (Fink) 2001, 31-43 (37f)
1046 . INVKNTAK UND STATISTIK<br />
kuliertes Dazwischen, welche die Vollstreckung aufschieben konnte; in Figuren<br />
wie Oskar Schindler und Adolf Eichmann wird sie (unter positiven oder<br />
negativen Vorzeichen) namhaft, d. h. als Erinnerung benenn- und nicht schlicht<br />
als maschinelles Gedächtnis adressierbar (auch nach der Vernichtung entsprechender<br />
Lochkartenmengen <strong>von</strong> Seiten des kollabierenden NS-Systems).<br />
Erst im Medium <strong>von</strong> <strong>Namen</strong>s-, nicht Zahlenreihen werden Statistiken<br />
metonymisch Protagonisten des Gedenkens. Jüngste Aktenfunde aus dem Sonderarchiv<br />
des KGB in Moskau ließen auch die Bücher des (provisorischen)<br />
Standesamts des Konzentrationslagerns Auschwitz auftauchen, nämlich Sterbelisten,<br />
welche den Toten wieder <strong>Namen</strong> zuschreibbar machen, massenhaft.<br />
Mit den herkömmlichen Aufschreibesystemen der Historiographie war diese<br />
Datenmenge nicht mehr zu bewältigen, vielmehr mit Hilfe der EDV, an den<br />
Einbildungsgrenzen der klassischen Mnemonik, die ebenfalls in einer Katastrophe<br />
ihren Ausgangspunkt nahm (Simonides-Legende). 36 Dem stehen Charaktere<br />
entgegegen, die Leben nicht in <strong>Namen</strong>, sondern binären Daten<br />
adressieren. Eine Strichliste aus den Eichmann-Dokumenten ist das Werk eines<br />
deutschen Statistikers an der Verladerampe und schlüsselt die Geschlechts-,<br />
Alters- und Berufsgliederung <strong>von</strong> 1007 Juden auf, die am 11. Dezember 1941,<br />
10.45 Uhr mit dem Transportzug Do 38 den Abgangsbahnhof Düsseldorf-<br />
Derendorf in Richtung Riga verlassen haben. 37 In Böhmen und Mähren ist zum<br />
Jahresende 1943 <strong>von</strong> Seiten des (ausdrücklich) Apparats des <strong>von</strong> den deutschen<br />
Besatzern zwangsweise »<strong>für</strong> die Durchführung behördlicher Aufträge und <strong>für</strong><br />
Liquidierungsarbeiten« eingesetzten Ältestenrats der Juden in Prag (vormals<br />
Jüdische Kultusgcmcinde) »ein Rest <strong>von</strong> 8.485 Juden karteimässig erfasst«. Der<br />
Bericht spricht <strong>von</strong> Abbrucbsarbeiten iH (Hilberg nennt es die destruction des<br />
europäischen Judentums 39 ); im Medium der Statistik, die individuelle Gesichter<br />
zum Verschwinden bringt, heißt das Abrechnung und Kalkül. »Soweit die<br />
36<br />
Siehe Jan Parcer / Wolfgang Levermann / Thomas Grotum, Remembering the Holocaust:<br />
preservation and improved Accessibility of the Archives in the Memorial Oswiecim/Brzczinka<br />
(Auschwitz/Birkenau), in: Historical lnformatics: an Essential Tool for<br />
Historians? A Panel Convened by the Association for History and Computing at the<br />
nineteenth Annual Meeting of the Social Science History Association, Atlanta, Georgia,<br />
October 14th, 1994, 44-51. Zum Ordnungsparadigma klassischer Gedächtniskunst:<br />
Wolfgang Beilenhoff, Andere Orte: Sans Soleil als mediale Erinnerungsreise, in: Birgit<br />
Kämper / Thomas Tode (Hg.), Chris Marker. Filmessayist, München (Institut Francais /<br />
CICIM) 1997, 109-128(121)<br />
37<br />
Abgebildet in Aly / Roth 1984: 88f<br />
38<br />
Ältestenrat der Juden in Prag, Bericht über das Jahr 1943, Yad Vashem Archive, Signatur<br />
FA-156<br />
39<br />
Dt.: Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, 3 Bde. Frankfurt/M.<br />
(Fischer) 1994
Ni-uu GI'DÄCHTNISMASCHINKN: STATISTIK IM DIENST DES DRITTES REICHES 1047<br />
pure Statistik, Adolf Eichmann zu zitieren.« 40 Nicht <strong>von</strong> ungefähr kam auch<br />
Michel Foucault die Idee zur Anthologie <strong>von</strong> La vie des bommes infames, als er<br />
in der Pariser Nationalbibliothek auf ein Register der Festnahmen zu Beginn des<br />
18. Jahrhunderts stieß. Nun ging es ihm darum, den zu Nummern geronnenen<br />
Existenzen durch erzählende Histonsierung wieder ein Gesicht zu verleihen -<br />
exhumatwn des arcbives 41 ; doch biographische Funken aus dem Archiv zu schlagen<br />
heißt immer auch jene technologische Struktur der Indizierung zu verbergen,<br />
die sich hinter den anthropologisch versöhnlichen stories verbirgt. Angesichts der<br />
realen Einschrift <strong>von</strong> Zahlen und Graphemen versagt das symbolische Gedenken,<br />
es sei denn in Mimesis an diese Darstellung. Die <strong>Namen</strong> <strong>von</strong> 77297 Deportierten<br />
an den Wänden der Pinkas-Synagoge in Prag und das <strong>von</strong> der Stiftung Initiative<br />
Theresienstadt herausgegebene Gedenkbuch Theresienstadt machen Listen zum<br />
Epitaph; die Umgekommenen sind in alphabetischer Reihenfolge eingetragen.<br />
Noch einmal formiert die symbolische Ordnung Massen als Daten.<br />
Ein Mikrofilmprojekt des Reichssippenamts<br />
Nicht immer war die Statistik deutscher Juden das Medium externer Beobachtung,<br />
sondern meint zunächst auch den genitivus subiectwus. <strong>Im</strong> Oktober 1904<br />
wird <strong>von</strong> Seiten der jüdischen Gemeinschaft ein statistisches Büro gegründet;<br />
nach dem Ersten Weltkrieg zirkulieren die Blätter <strong>für</strong> Demographie, Statistik<br />
und Wirtschaftskunde der Juden. 1925 finanziert die jüdische Gemeinde im<br />
Preußischen Zensus die Erstellung einer jüdischen Statistik; 1933 werden die<br />
Daten der deutschen Volkszählung lebhaft in jüdischen Publikationsorganen<br />
diskutiert. 42 Unter den Bedingungen der sogenannten Endlösung und entsprechender<br />
Unsicherheiten in der Definition des Betroffenenkrcises aber wird statistisch-genealogische<br />
Nachweisbarkeit <strong>von</strong> Identität als Aktualisierung <strong>von</strong><br />
Akten eine Frage <strong>von</strong> Leben und Tod. 43 Anfang Februar 1942 fordert der<br />
40 Richard Glazar, Das Buch als Mahnmal, in: Der Tagcsspiegel (Berlin), November 1996<br />
41 Michel Foucault, La vie des hommes infames, in: Lcs Cahiers du ehemin Nr. 29 /<br />
Januar 1977, 12-29 (= ders., Dits et Ecrits Bd. III, Paris 1994, 237-253 (237)<br />
42 Kistermann 1997: 37, unter Bezug auf C. T. Prestel, Bevölkerungspohtik in der jüdischen<br />
Gemeinschaft in der Weimarer Republik - Ausdrück jüdischer Identität?, in:<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaft 41, Heft 8 (1993), 687-715, und Stastistisches<br />
Reichsamt, Volkszählung: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen<br />
der Volkszählung 1933, Heft 5: Die Glaubcns]uden im Deutschen Reich, Berlin<br />
(Verlag <strong>für</strong> Sozialpolitik, Wirtschaft und Statistik) 1936<br />
43 Zur Diskussion um die archivische Entbergung der lange als vernichtet geltenden Pariser<br />
»Judenkartei« aus der deutschen Besatzungszeit siehe W. E., Das Schweigen des<br />
Archivs erzeugt Ungeheuer (when memory comes), in: Werkstatt<strong>Geschichte</strong> 5 (August<br />
1993), Hamburg (Ergebnisse Verlag), Themenheft »Archive«, 39-45
1048 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
Sicherheitsdienst-yWettre/ere«£ Dannecker mit äußerster Dringlichkeit einen<br />
Abstammungsforscher an, um mit der Überprüfung <strong>von</strong> Juden und Judenmischlingen<br />
in Paris zu beginnen; den Kandidaten Kurt Steudtner erreicht »inmitten<br />
gegenwartsferner, historischer Forschungsarbeit« genau dieser »Ruf zu<br />
neuem kämpferischen Wirken im Land jenseits des Rheines«. 44 Ein Gutachten<br />
des Chefs des Reichssippenamts (Mayer) weist demgegenüber im März darauf<br />
hin, daß <strong>für</strong> eine Abstammungsforschung hinsichtlich jüdischer Ahnen in vermutlich<br />
70000 Fällen bei weitem nicht genügend Unterlagen verfügbar sind. 45<br />
So wird das Projekt aufgrund <strong>von</strong> Archivdatenverknappung gestoppt.<br />
Abteilung III des Reichssippenamts in Berlin obliegt unterdessen die Sicherheitsverfilmung<br />
deutscher Kirchenbücher, die in einfacher Ausfertigung seit dem<br />
16. Jahrhundert (Reformationszeit) existieren. Bereits im Juni 1933 erhebt Achim<br />
Gercke, der <strong>von</strong> Reichsinnenminister Wilhelm Frick ernannte Sachverständige<br />
<strong>für</strong> Rasseforschung, im <strong>Namen</strong> des deutschen Volkes den Anspruch auf diese Kirchenbücher,<br />
und zwar nicht auf deren Form, sondern den Inhalt dieser Bücher<br />
zur Korrelierung <strong>von</strong> Körpern und Papieren. 46 Auch <strong>von</strong> Klitzing definiert das<br />
Planziel, im nationalsozialistischen Staat »wenigstens den Inhalt der alten Bücher<br />
sicherzustellen. Schnell soll es gehen, weil es sonst an vielen Orten zu spät sein<br />
wird. Der Helfer ist die Lichtabschrift.« 47 Fortan ist - hier ganz im Sinne der Datenbankprojekte<br />
des 19. Jahrhunderts (MGH, General-Repertorium des GNM<br />
Brief an Hofmann v. 2. März 1942, zitiert nach: Christian Gerlach, Die Wannsee-Konferenz,<br />
das Schicksal der deutschen Juden und Hitlers politische Grundsatzentscheidung,<br />
alle Juden Europas zu ermorden, in: Werkstatt<strong>Geschichte</strong> 18 (1997), 7-44 (Anm. 191)<br />
Gerlach 1997: 39. Siehe auch W. E., Archival action: The pohtization of German archives<br />
from Read Only Memory into agencies of politics in the Weimar Republic and<br />
under the National Sociahst regime, demnächst in: History of the Human Sciences<br />
(1998)<br />
1 Gedruckter Vortrag <strong>von</strong> Achim Gercke, Die Aufgaben des Sachverständigen <strong>für</strong> Rasseforschung<br />
beim Reichsministerium des Innern, gehalten vor der Hauptversammlung<br />
der Zentralstelle <strong>für</strong> Deutsche Personen- und Familiengeschichte e.V. am 21. Juni 1933,<br />
Bundesarchiv, Bestand R 39, Nr. 1, hier zitiert nach: Manfred Gailus, Beihilfe zur Ausgrenzung.<br />
Die »Kirchenbuchstelle Alt-Berlin« in den Jahren 1936 bis 1945, in: Jahrbuch<br />
<strong>für</strong> Antisemitismusforschung 2, Frankfurt/M. u. New York (Campus) 1993,<br />
255-280 (256). Siehe auch ders., Für Gott, Volk, Blut und Rasse. Der Berliner Pfarrer<br />
Karl Themel und sein Beitrag zur Judenverfolgung, in: DieZeit Nr. 44 v. 25. Oktober<br />
2001, 100 (erw. Fassung in: Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaft, I left 9/2001). Zu<br />
Achim Gerckes vormaligem Archiv jür beriijssliiiidisuhc RasscnslaUsuk in der Göttinger<br />
Universitätsbibliothek siehe den Beitrag <strong>von</strong> Reimer Eck, in: Peter Vodosek /<br />
Manfred Komorowski (Hg.), Bibliotheken während des Nationalsozialismus, Teil 1,<br />
Wiesbaden (Harrassowitz) 1989, 327-334<br />
Kurt Hans <strong>von</strong> Klitzing, Rettung der Kirchenbücher, in: Familie, Sippe, Volk, 1. Jg.<br />
Heft 1 (1935), 11
Ni'UH GHDÄCHTNISMASCHINKN: STATISTIK IM DII.NST OKS DRITTFX RI:ICHI:S 1049<br />
Nürnberg) - Gedächtnis nicht mehr gebunden an spezifische Träger, sondern als<br />
Information übertragbar; die <strong>von</strong> Pfarrer Themel propagierte massenhafte Verkartung<br />
<strong>von</strong> Kirchenbüchern erlangt damit Priorität gegenüber einer alternativ<br />
dazu angedachten räumlichen Zusammenlegung der Bücher. Regale werden so<br />
nicht <strong>für</strong> Kirchenbücher, sondern als Kartothek gebaut und berechnet (10000<br />
Karten pro Meter). Wo Gedächtnis zunächst reiner Speicher (-thek) ist, stellt die<br />
Verkartung <strong>von</strong> Kirchenbüchern als Dispositiv des deutschen Ahnengedenkens<br />
bereits ein (wenngleich) »trockenes nüchternes, mühevolles Arbeiten, Rechnen<br />
und Zählen« dar - also eine genuin mediale Operation. »Es<br />
genügt nicht, mit Maschine zu buchen, es muß auch mit Maschine die Buchung<br />
wieder abgelesen und verrechnet werden« (Porstmann). Die Ordnung der Adressierung<br />
gibt den bereits mathematisierten, nach statistischer Streuung berechneten<br />
Raum vor: Die Bordlänge der Regale soll »auf die einzelnen Buchstaben<br />
aufgeteilt werden nach der Häufigkeit des Anfangsbuchstaben«, die einerseits<br />
verschieden und andererseits gerade in dieser Wahrscheinlichkeit eine seit<br />
ungefähr einhundert Jahren feststehende Größe ist . In Preußen sind<br />
seit 1803 vielfach Kirchenbücher vorgeschrieben (Vorschrift <strong>von</strong> Aufschreibesystemen<br />
heißt Gesetz), deren Seiten bereits ein ganz bestimmtes Schema und feststehende<br />
Rubriken haben. Genealogien liegen seitdem nicht mehr familienindividuell<br />
vor, sondern werden im Medium symbolischer Aufschreibesysteme<br />
generiert. Ein Volk wird archivisch verortet: An der Schnittstelle <strong>von</strong> res gestae<br />
und Registern wird zwischen 1770 und 1830 (die <strong>von</strong> Reinhart Koselleck definierte<br />
Sattelzeit, hier als dokumentationswissenschaftliche Epoche) in den<br />
deutschen Ländern schießlich die formularmäßige Kirchenbuchführung eingeführt,<br />
»die Eintragung aller wichtigen Tatsachen in die Register«. 4S Bis zu diesem<br />
Zeitpunkt hat die Art der Eintragung des einzelnen Falles im wesentlichen im<br />
Belieben des Kirchenbuchführers gestanden; mit dem Formular aber wird der<br />
Inhalt <strong>von</strong> Dokumenten zur Aussage ihrer Ordnung selbst. Dies ist genau<br />
die Zeit der Formierung moderner Staatsarchive; Datenspeicherung wird<br />
zur Funktion <strong>von</strong> Formaten und Information. Dabei sind technische Standardisierung<br />
und staatliches Dispositiv aneinander gekoppelt - die arche des<br />
Archivs. »Wie es an einer rechtlichen Grundlage fehlte, die Verkartung der Kirchenbücher<br />
als solche zu erzwingen, so war es erst recht unmöglich, einen Zwang<br />
<strong>für</strong> die Verkartung nach einem bestimmten Verfahren auszuüben.« 49 An die Stelle<br />
inhaltsfixierter Hermeneutik rückt die Trias <strong>von</strong> Semiotik, Semantik und Pragmatik.<br />
Gespeicherte Daten tragen ihren Sinn nicht in sich, sondern in Form archi-<br />
4S Gerhard Kayser (Abteilungsleiter, Reichssippenamt Berlin), Photographische Vervielfältigung<br />
<strong>von</strong> Kirchenbüchern, in: Familie, Sippe, Volk 10 (Berlin 1943), 83-86 (83)<br />
49 Ders., Kirchenbuch<strong>für</strong>sorge der Reichsstelle <strong>für</strong> Sippenforschung, in: Archivahsche<br />
Zeitschrift 45 (1939), 141-163 (157)
1050 ' INVENTAR UND STATISTIK<br />
vischer Operatoren an sich; ihr Inhalt wird durch Vektoren nicht repräsentiert,<br />
sondern bestimmt. Ein administativer Einschnitt ist die Einführung staatlicher<br />
Personenstandsregister (durch Standesämter) kurz nach der Reichsgründung<br />
1874. Bis 1933 liegen die Kirchenbücher wenig beachtet in den Pfarrämtern; erst<br />
nach der Machtergreifung durch die NSDAP erlangen sie infolge der Verabschiedung<br />
der Nürnberger Gesetze und der Einführung des Abstammungsnachweises<br />
eine Bedeutungsverschiebung. So ist das Jahr 1933 auch eine<br />
wissensarchivologische Zäsur. Die Beauftragten des Reichssippenamtes beginnen<br />
am 2. November- als Kombination <strong>von</strong> Systemkybernetik und <strong>Im</strong>plementierung<br />
<strong>von</strong> Daten in Hardware - mit der systematischen photographischen<br />
Vervielfältigung der Kirchenbücher; »sie wurde notwendig wegen des Verschleißes<br />
der Kirchenbücher infolge der ungeheuren, gegenüber der Zeit vor 1933<br />
um mindestens das 200-fache gestiegenen Beanspruchung« .<br />
Erstmals im deutschsprachigen Bereich wird also das photographische Vervielfältigungsverfahren<br />
auf archivische Massendaten angewandt. »Ownership of the<br />
records was to remain unchanged, but Steps were to be taken to care for the<br />
records« 50 ; Gedächtniskapital wird übertragbar. Maßgebender Gesichtspunkt ist<br />
die speicherökonomische, nicht geschichtsemphatische Sicherung der Gedächtnisvirtualität<br />
<strong>von</strong> Dokumenten (ihre vergangene Zukunft) durch Vervielfältigung<br />
auf kleinstem Raum: der Schutz vor Kriegseinwirkungen, Bränden und anderen<br />
Gefahren. Von daher die Bevorzugung der Aufnahme auf Filmstreifen gegenüber<br />
der unmittelbaren, zunächst kostengünstigeren Aufnahme auf lichtempfindlichem<br />
Papier (Photokopie); außerdem können <strong>von</strong> den Filmen als originalgetreuem<br />
Bild »Vergrößerungen in beliebiger Zahl hergestellt weren, ohne daß das<br />
Original weiter beansprucht wird« . Massendatenspeicherung<br />
bedarf der Standardisierung ihrer Formate; <strong>für</strong> die Zeit nach Beendigung des<br />
Weltkrieges ist eine straffe Zentralisierung in der Leitung der Aufnahmen und<br />
eine Dezentralisierung in der Durchführung beabsichtigt. Seit 1941 sorgt das<br />
Reichssippenamt da<strong>für</strong>, daß die Aufnahmen der kirchlichen Stellen in Übereinstimmung<br />
mit dem vom Reichssippenamt entwickelten Verfahren erfolgen. Und<br />
das ist keine Frage der Ideologie, sondern <strong>von</strong> Alphanumerik; neue Aufzeichnungsmedicn<br />
generieren neue Formen der Registrierung und Kodierung <strong>von</strong><br />
Gedächtnis: »Notwendig ist unter anderem auch eine einheitliche Bezifferung<br />
der Filme und die Führung einer Kartei über alle auf Filmstreifen aufgenommenen<br />
Kirchenbücher und über die Aufbewahrungsorte der Filmstreifen« . Der Verzicht auf die Lochung des Films (mit dem Kontophot-Gerät<br />
50 Steven W. Blodgett, The rolc of microfilming in the preservation and reconstruetion<br />
of documents, in: Memory of the world at nsk: archives destroyed, archives rcconstituted<br />
( = Archivum Bd. 42), München et al. (Säur) 1996, 299-309, passim
NKUK GKDÄCHTNISMASCHTNHN: STATISTIK IM DIHNST DKS DR/TTI-:\ RHICHI-S 1051<br />
Modell F <strong>für</strong> ungelochten Kinofilm in Rollen zu je 60 Metern = 900 Aufnahmen)<br />
gestattet die optimale Ausnutzung fast der gesamten Filmfläche. Als aber vor<br />
Kriegsausbruch in den Vereinigten Staaten die Genealogical Society in Utah<br />
Interesse zeigt, Kopien der Filme, die <strong>von</strong> deutschen Kirchenbüchern bis dahin<br />
aufgenommen sind, zu erhalten, erweist sich, daß die Filmindustrie über ein<br />
geeignetes Gerät zur Herstellung <strong>von</strong> Filmkopien ungelochter Filme nicht verfügt.<br />
Die neuen Sekretäre und Kopisten des Gedächtnisses müssen sich nicht verstehen<br />
können, aber kompatibel sein.<br />
Speichermcdicn in ihrer physikalisch-zeitlichen Erstreckung tendieren zur<br />
Unordnung (als folgten auch sie dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik). Dem<br />
setzt die Institution Regelmäßigkeit entgegen:<br />
»Sehr oft sind bei früheren Neubindungen Blätter an falscher Stelle eingebunden<br />
worden. Es muß eine laufende Numerierung der Seiten erfolgen. Eingerollte Ränder,<br />
eingeknickte Ecken müssen befestigt beseitigt werden. Jedes Buch erhält<br />
zur Unterscheidung einen Buchstaben, der die Landschaft bezeichnet, und eine laufende<br />
Nummer, z. B. A 2000 (= Berlin Nr. 2000). Dies Unterscheidungsmerkmal<br />
wird auf den <strong>für</strong> jedes Buch vor Beginn der Aufnahme angefertigten Arbcitszcttel<br />
und auf dem mitphotographicrtcn Kontrollstreifen eingetragen. Bei der Aufnahme<br />
befindet sich am Kopf des Buches der Kontrollstreifen, der neben dem Landschaftsbuchstaben<br />
und der laufenden Bandnummer auch die laufende Seitenzahl<br />
enthält, die mit der Paginierung des Buches übereinstimmen muß. Auf diese<br />
Weise wird eine Verwechslung <strong>von</strong> Aufnahmen unmöglich gemacht, es können auch<br />
nicht einzelne Seiten versehentlich überschlagen werden.« <br />
Technische Lesarten verbessern das Original, insofern sre die menschlichen<br />
Wahrnehmungsschwellen unterlaufen wie Pahmpsestphotographie. Bei Blättern<br />
mit Tintenfraß, der sich in der Mitte des 18. Jahrhunderts besonders häufig<br />
findet, hilft eine Uberbelichtung bis zu 30 Sekunden und eine entsprechend<br />
kürzere Entwicklung - eine differente, mediale Zeit der Entwicklung, die mit<br />
der <strong>von</strong> Historie als Erzählzeit nichts mehr gemein hat. Stark verblaßte Schrift<br />
wird durch Verwendung der Spezial-Hanau-Quarzlampe noch sichtbar. Medienarchäologie<br />
(hier auf Seiten des Apparats selbst) aber operieren strikt<br />
asemantisch; <strong>für</strong> verfärbte Vorlagen gilt buchstäblich, daß allem die menschliche<br />
Kogmtion semantische Trennungen vorzunehmen vermag. Film reagiert auf<br />
seine Vorlagen dann negativ und die Vergrößerung des Filmes zeigt an der<br />
betreffenden Stelle einen schwarzen Fleck; ebenso versagt das photographische<br />
Verfahren in Fällen, wenn die Schrift <strong>von</strong> der Rückseite des Blattes durchschlägt.<br />
»Dem menschlichen Auge ist es auch dann immer noch möglich, die<br />
Schriftzeichen der Vorderseite <strong>von</strong> denen der Rückseite auseinanderzuhalten,<br />
während die photographische Aufnahme beide Schriftzeichen in gleichmäßiger<br />
Stärke wiedergibt« . Die <strong>für</strong> jeden aufgenommenen Kirchenbuchband<br />
angefertigte Filmbeschrcibung wird imtphotographiert und in die <strong>von</strong> dem Film
1052 INVI-NTAK UND STATISTIK<br />
angefertige Vergrößerung als erstes Blatt mit eingebunden. Bild und Inventar<br />
werden <strong>von</strong> der Logik des Mediums zu einem Verbund integriert; sie generiert<br />
eine neue Form der doppelten Buchführung in chronologischer Serie:<br />
»Über alle aufgenommenen Kirchenbücher wird eine doppelte Kartei geführt. Die<br />
eine Kartei enthält die Filme nach laufenden Nummern in zeitlicher Folge, so wie<br />
die Aufnahmen durchgeführt worden sind . Die zweite Kartei wird nach<br />
Orten geführt, so daß jederzeit festgestellt werden kann, ob in einem bestimmten<br />
Ort schon Kirchenbücher aufgenommen worden sind . Damit Doppelaufnahmen<br />
durch verschiedene Stellen, die nichts <strong>von</strong>einander wissen, vermieden<br />
werden, wird in jedes aufgenommene Buch nach der Aufnahme vorn ein Zettel<br />
eingeklebt, aus dem hervorgeht, daß das Buch vom Reichssippenamt aufgenommen<br />
worden ist, auch in welchem Jahre dies geschehen ist.« <br />
Aufzeichnungsmedien sind Primärspeicher, bedürfen aber ihrerseits eines Speicher-Containers;<br />
je 5 bis 20 Filmrollen werden mit Papierstreifen zusammengehalten<br />
(auf denen die Filmnummern vermerkt steht) und in vulkanisierten,<br />
nach dem Inhalt ihrerseits wieder beschrifteten Fiberkästen aufbewahrt. 20 solcher<br />
Kästen sind in einer ebenfalls entsprechend beschrifteten flachen Holzkiste<br />
sortiert. Gegen die Eleganz historischer Narration steht die Askese <strong>von</strong> Speicherökonomie;<br />
das Mitphotographieren des Kopfstreifens mit Landschaftsbezeichnung,<br />
Filmnummer und Seitenzahl ist daher zwar<br />
»keine Verschönerung des photographischen Bildes, aber es kommt bei der Aufnahme<br />
der Kirchenbücher ja auch nicht auf Schönheit des Verfahrens, sondern auf<br />
die Zweckmäßigkeit an. Es muß alles dem Ziel untergeordnet werden, den Inhalt<br />
der Kirchenbücher einwandfrei und auf die Dauer zu sichern. Damit können<br />
dann die <strong>für</strong> die Sippenkunde und Bcvölkerungsgeschichte des deutschen Volkes<br />
wichtigsten Quellen ihrem Inhalt nach als gesichert gelten.« <br />
Wo nicht Kulturwissenschaft, sondern Datenerhebung gilt, ist es nicht das ästhetische<br />
Ornament, sondern die Information, die zählt., 51 Das Gedächtnis <strong>von</strong> Weltkrieg<br />
I triggert die vergangene Zukunft <strong>von</strong> Weltkrieg II als Speicher; im Januar<br />
1935 operieren Kameras zur Kirchenbuchaufnahme in Schlesien (Breslau) und im<br />
ostpreußischen Königsberg: »Destruction of records during World War I in East<br />
Prussia caused early concern for gathenng records there« . Das<br />
Projekt arbeitet flächendeckend, mit transimperialen Reich(s)weiten auch auf dem<br />
Gebiet der Sudetendeutschen, <strong>von</strong> wo aus Kirchenbücher zwischen 1939 und<br />
1943 nach Berlin zur Verfilmung gesendet wjerden; in Mesentz wurde zeitweilig<br />
eine Kamera vor Ort installiert, um Aufzeichnungen vormals deutscher Regionen<br />
in Polen umzuspeichern. Diese Daten sind an Lochkartenmaschinen an-<br />
Siehe W. E., Rhetorik des Ornaments, in: Ursula Franke / Heinz Paetzold (Hg.), Rhetorik<br />
des Ornaments und <strong>Geschichte</strong>. Studien zum Strukturwandel des Ornaments in<br />
der Moderne, Bonn (Bouvier) 1996, 283-301
NKUI- GHDACI ITNISMASCIIINI-.N: STATISTIK IM DllA'ST DF.S DlilEllS RE/CI/ES 1053<br />
schließbar, wurden aber nicht angeschlossen: Denn dann muß die Datenbuchung<br />
so <strong>von</strong>statten gehen, daß nicht mehr der. Mensch, sondern »die Maschine lesen<br />
kann« . Der Sichtungskasten bildet dazwischen eine<br />
Schnittstelle.) Als Pfarrer Themel, Propagator der Standardisierung der Datenerfassung<br />
durch Verkartung der Kirchenbücher, aus Anlaß des fünfjährigen<br />
Bestehens der Berliner Kirchenbuchstelle im Dezember 1941 eine Leistungsbilanz<br />
vorlegt, betont er gegenüber den (im Sinne der NS-Ideologie) dürftigen rassenkundhchen<br />
Befunden den ideellen Effekt: Die Forschungen seines Instituts<br />
habe »dem einzelnen Menschen der Gegenwart das Bewußtsein ,<br />
daß er getragen wird <strong>von</strong> der Blutsgemeinschaft des Volkes«. 32 Moderne Macht<br />
operiert nicht allein durch gezielte Eingriffe in Subjekte, sondern durch Genenerung<br />
einer intersubjektiven Paranoia der Aufspeicherung als Datensatz, die<br />
technisch induziert ist, sobald die Vorbedingung der Standardisierung <strong>von</strong><br />
Daten(träger)formaten erfüllt wird: »Die Überwachungsmöglichkeiten mit Hilfe<br />
karteimäßiger Anlagen sind gewaltig gesteigert« . <strong>Im</strong><br />
Unterschied zu vor- und frühneuzeitlichen Medien der Repräsentation <strong>von</strong><br />
Macht verdankt sich dieser Effekt der Diskretheit ihrer Dokumentationstechnik<br />
- im mathematischen Sinne und im Sinne <strong>von</strong> Verborgenheit; eine verkartete Kirchenbucheintragung<br />
gilt als »versteckt« nicht mehr im Sinne der Unsichtbarkeit,<br />
sondern durch ihre Zuweisung »an eine falsche Stelle« .<br />
Damit wird Sabotage eine Funktion der Mechanisierung <strong>von</strong> Mathematik/'' 1<br />
Eröffnet wird damit ein virtueller Raum: Nicht allein der konkrete {Arier -<br />
)Nachwcis, sondern die Logistik der Nachweisbarkeit, die sich in der Verzceisungskarte<br />
konkretisiert, ist am Zahlen-Werk. »Das beste Ordnungsmittel, das<br />
im Gegensatz zum Alfabet völlig einwandfrei aufgebaut ist« - und<br />
auf der sich Mechanisierbarkeit aufbaut - »ist die Ziffernfolge.«'' 4 Die Frage <strong>von</strong><br />
feedback and control (»Der Schreiber, der die Karten geschrieben hat, darf unter<br />
keinen Umständen sich selbst kontrollieren«) wird dabei zur Funktion einer<br />
Beobachtung «-ter Ordnung bis hin zur energetischen Arbeitszeitmessung des<br />
Aufschreibeapparats selbst . Überwachen und Strafen wird mit der<br />
Ordnung der Dinge selbst zusammengeschaltet: Maschinen und Pläne <strong>für</strong> ein<br />
physikalisches Observatorium im Gefolge dessen, was einmal preußische Pohzey-Ordnungen<br />
gewesen sind und seinen Gedächtnisort im Deutschen Museum<br />
finden wird. 53<br />
32 Karl Themel, Fünf Jahre Kirchcnbuchstellc Alt-Berlin, in: Familie, Sippe, Volk S<br />
(1942), 3-5 (5), zitiert nach Gailus 1993: 273f<br />
x1 Zur Schnittstelle <strong>von</strong> Karteitechnik (»Aufteilung der Zahl nach ihren Stellenwerten«)<br />
und der Dezimalklassifikation Deweys siehe Porstmann 1928: 204 u. 207<br />
54 Porstmann 1928: 197. Vgl. Themel 1936: 5 u. 54<br />
•^ Dazu PeterLundgren, Standardization - Testing - Regulation. Studies in the history
1054 INVKNTAR UND STATISTIK<br />
»Die photographische Vervielfältigung soll das Originalkirchcnbuch ersetzen,<br />
die Kartei als Hilfsmittel weist den Weg in das Kirchenbuch« ; jenseits<br />
des Atlantik konzipiert unterdessen der Koordinator kriegsrelevanter Forschung,<br />
Vannevar Bush, eine Maschine, die unter dem <strong>Namen</strong> Memory extender mikroverfilmte<br />
Daten aus Büchern, Blättern und Karten die Faksimilierung mit gedankenschnellem,<br />
assoziativem retneval koppelt und damit ein Medium generiert, das<br />
auch tun kann, was sein Name verheißt - das Gedächtnis gleichzeitig zu verstärken<br />
und auszugliedern. 56 Daß im Medium der modularisierten Informationsverarbeitung<br />
unabhängig vom Inhalt das später <strong>von</strong> Ted Nelson den elektronischen<br />
files implementierte Prinzip hypertextueller Verknüpfung bereits impliziert ist,<br />
weiß der deutsche Prophet des Karteiwesens, indem er <strong>von</strong> einem Denken in mehreren<br />
Richtungen zur Beherrschung verwickelter er Vorgänge (selbst aber noch in<br />
der Linearität des Buchdrucks) schreibt . Daß<br />
diese Entwicklung nicht nur der Aufklärung <strong>von</strong> Archivwissen gilt, sondern auch<br />
der Kryptoanalyse, weiß ein Fachmann <strong>für</strong> Büroreform schon lange vor Weltkrieg<br />
II: »Es gibt Chiffriermaschinen und Dechiffriermaschinen , die alle im Bürobetrieb<br />
zur Mechanisierung des Geschäftsganges mit Vorteil einzuschalten sind.<br />
Auch die Kurzschrift, das Telephon und die elektrische Klingel gehören hierher.«<br />
57 Die Umschaltung <strong>von</strong> Alphabet zu Signal schreibt sich hin. Da die<br />
Abschrift der Kirchenbücher <strong>für</strong> Jahrhunderte dauern soll, sei das Ablöschen der<br />
Schrift mit Löschblatt unter allen Umständen zu vermeiden .<br />
Die Kirchenbuchdateien aber werden zu Monumenten erst m der Distanz der<br />
wissensarchäologischen Diskontinuität; über eine Million Taufkarten und die zum<br />
Zweck der Judenverfolgung angelegte hremdsLärnmigcn-¥>.d.rtQi lagern heute »als<br />
ein Monument nationalsozialistischen Rassenwahns« im Evangelischen Zentralarchiv<br />
Berlin« .<br />
Verfilmung als Gedächtnisutopie:<br />
Genealogical Society und die Mikrophysik deutscher Speicher<br />
Der Überzeugung der Religionsgemeinschaft der Mormonen zufolge kann auch<br />
ein Verstorbener noch nachträglich, durch eine stellvertretende Taufe in Abwesenheit<br />
zum Christen erklärt werden. Gekoppelt ist diese Option an den Akt<br />
der Registration, des schriftlichen Nachweises: Kirchenbücher, Geburts- und<br />
Sterberegister. In Salt Lake City haben Mormonen ein entsprechendes Weltar-<br />
of the science-based regulatory State (Gcrmany and the U.S.A., 19th and 20th centuries),<br />
Kleine (Bielefeld) 1986, 8ff u. 28<br />
-"' Vannevar Bush, As We May Think, in: Atlantic Monthly 176 Nr. 1 (1945)<br />
37 Haußmann 1926: 27; vgl. Colin Burke, Information and Secrecy. Vannevar Bush,<br />
Ultra, and the Other Memex, London 1994
Ni;ui-: Gi;i)Äc;i ITNISMASCI IINI-N: STATISTIK IM DIKNST DI-.S DM HEX REICHES 1055<br />
chiv eingerichtet, einen genealogischen Datenraum, in dem die Adressierung<br />
des Gedächtnisses buchstäblich wird (und das Medium der Dokumentation<br />
<strong>von</strong> Leben - die dokumentierte Taufe - mit dem des Todes - ihre Aufhebung<br />
im Archiv - zur Deckung kommt). Alle Gläubigen sind aufgefordert, ihre<br />
eigene Familiengeschichte zu durchforschen und weltweit Heiratsurkunden,<br />
Geburtsurkunden und programmatisch alle anderen Formen schriftlicher<br />
Unterlagen zu sammeln und zu kopieren, die persönliche Unterlagen enthalten<br />
könnten. Die entsprechenden Emissäre versuchen, anhand der vorliegenden<br />
Unterlagen zunächst festzustellen, ob eine bestimmte Person wirklich<br />
gelebt hat - das Archiv betrifft das Niveau der Existenz als Aussage und die<br />
Zeit der Engel (die Photokopien werden <strong>für</strong> die Ewigkeit aufbewahrt). Das<br />
Archiv ist mit speziellen Türen ausgestattet, die sich im Falle eines Erdbebens<br />
oder Atomkriegs automatisch schließen. Was <strong>von</strong> Menschenleben übrigbleibt,<br />
sind Daten; ihr Archiv bildet hicht(s) ab, sondern generiert Wissensformen.<br />
»Die deutschen Zuhörer waren jedesmal entsetzt über die Idee dieser Datensammlung<br />
bei den Mormonen, da sie dies an die Nazi-Zeit und die damalige<br />
Nutzung gesammelter Daten erinnert.« 38 Die Erinnerung an genealogische<br />
Archivpraxis im Nationalsozialismus ist nicht eine willkürliche, sondern zeitgenaue<br />
Assoziation mit dem Versuch der Genealogical Society, Kirchenbuchaufzeichnungen<br />
auf Mikrofilm zu bewahren und künftiger Forschung<br />
zugänglich zu machen, gehen deren Initiativen doch bis auf 1938 zurück. Seitdem<br />
Speicher auf der Grundlage <strong>von</strong> Lochkarten oder Mikrofilm gedacht und<br />
realisiert werden, heißt Gedächtniswissenschaft Medienarchäologic. Die Speicherlogistik<br />
des klassischen Archivs zielt nicht auf programmatische Algorithmen.<br />
Weshalb der Untersuchungszeitraum dieser Studien auch mit dem<br />
take-off jener digitalen Rechenmaschinen endet, die lange nur mit flüchtigen<br />
oder minimalen Speichern ausgerüstet waren, den Akzent also auf Berechnung<br />
legten; demgegenüber war die Funktion <strong>von</strong> Dokumentenselektion in den<br />
nationalen Gedächtnisagenturen Deutschlands vielmehr ein umfangreicher<br />
»Memoria-Apparat«. 69<br />
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs werden Teile der Datenbank der Reichsstelle<br />
<strong>für</strong> Sippenforschung (RFS, nach 1940 Reichssippenamt RSA) <strong>von</strong> Berlin in<br />
thüringische Waldschlösser oder Salzminen nahe Magdeburg ausgelagert. Von<br />
58 Arnold Dreyblatt (im Gespräch mit Hannah Hurtzig, Berlin, 22. September 1994),<br />
Die Hypertext-Bibel, in: Theaterschnft 8 (Brüssel u. a.): Das Gedächtnis, 132-150<br />
(146/148), 1998<br />
59 Dieser Begriff stammt <strong>von</strong> Gabor ürosz, Übersicht über die Problematik der Dokumentationsselektoren,<br />
in: Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische Dokumentationsarbeit<br />
1, Heft 9 (November 1954), 173-178 (bes. 174, Fußnote 4).
1054 1NVT:NTAR UND STATISTIK<br />
»Die photographische Vervielfältigung soll das Onginalkirchenbuch ersetzen,<br />
die Kartei als Hilfsmittel weist den Weg in das Kirchenbuch« ; jenseits<br />
des Atlantik konzipiert unterdessen der Koordinator knegsrelevanter Forschung,<br />
Vannevar Bush, eine Maschine, die unter dem <strong>Namen</strong> Memory exlender mikroverfilmte<br />
Daten aus Büchern, Blättern und Karten die Faksimilierung mit gedankenschnellem,<br />
assoziativem retneval koppelt und damit ein Medium generiert, das<br />
auch tun kann, was sein Name verheißt - das Gedächtnis gleichzeitig zu verstärken<br />
und auszugliedern. 56 Daß im Medium der modulansierten Informationsverarbeitung<br />
unabhängig vom Inhalt das später <strong>von</strong> Ted Nelson den elektronischen<br />
files implementierte Prinzip hypertcxtueller Verknüpfung bereits impliziert ist,<br />
weiß der deutsche Prophet des Karteiwesens, indem er <strong>von</strong> einem Denken in mehreren<br />
Riehtungen zur Beherrschung vericjickeltcrer Vorgänge (selbst aber noch in<br />
der Linearität des Buchdrucks) schreibt . Daß<br />
diese Entwicklung nicht nur der Aufklärung <strong>von</strong> Archivwissen gilt, sondern auch<br />
der Kryptoanalyse, weiß ein Fachmann <strong>für</strong> Büroreform schon lange vor Weltkrieg<br />
II: »Es gibt Chiffnermaschincn und Dechiffriermaschincn , die alle im Bürobetrieb<br />
zur Mechanisierung des Geschäftsganges mit Vorteil einzuschalten sind.<br />
Auch die Kurzschrift, das Telephon und die elektrische Klingel gehören hierher.«<br />
37 Die Umschaltung <strong>von</strong> Alphabet zu Signal schreibt sich hin. Da die<br />
Abschrift der Kirchenbücher <strong>für</strong> Jahrhunderte dauern soll, sei das Ablöschen der<br />
Schrift mit Löschblatt unter allen Umständen zu vermeiden .<br />
Die Kirchenbuchdateien aber werden zu Monumenten erst in der Distanz der<br />
wissensarchäologischen Diskontinuität; über eine Million Tuifkarten und die zum<br />
Zweck der Judenverfolgung angelegte /remdstammigcn-KAVtci lagern heute »als<br />
ein Monument nationalsozialistischen Rassenwahns« im Evangelischen Zentralarchiv<br />
Berlin« .<br />
Verfilmung als Gedächtnisutopie:<br />
Genealogical Society und die Mikrophysik deutscher Speicher<br />
Der Überzeugung der Religionsgemeinschaft der Mormonen zufolge kann auch<br />
ein Verstorbener noch nachträglich, durch eine stellvertretende Taufe in Abwe-<br />
senheit zum Christen erklärt werden. Gekoppelt ist diese Option an den Akt<br />
der Registration, des schriftlichen Nachweises: Kirchenbücher, Geburts- und<br />
Sterberegister. In Salt Lake City haben Mormonen ein entsprechendes Wcltar-<br />
o) tho scicnce-based regulatory stau- (Gcrnunv and the U.S.A., 19th and 20th ecniuries),<br />
Kleine (Bielefeld) 1986, 8ff u. 28<br />
v ' Vannevar Bush, As Wo May Think, in: Atlantic Monthly 176 Nr. I (1945)<br />
37 Haußmann 1926: 27; vgl. Colin Burkc, Information and Secrecy. Vannevar Bush,<br />
Ultra, and the Üther Memcx, London 1994
NKUI- GI'.DÄCIITNISMASCIIINI-.N: STATISTIK IM DII-NST ni:s DKIiiis Ri:ic:iii : \ 1055<br />
chiv eingerichtet, einen genealogischen Datenraum, in dem die Adressierung<br />
des Gedächtnisses buchstäblich wird (und das Medium der Dokumentation<br />
<strong>von</strong> Leben - die dokumentierte Taufe - mit dem des Todes - ihre Aufhebung<br />
im Archiv - zur Deckung kommt). Alle Gläubigen sind aufgefordert, ihre<br />
eigene Familiengeschichte zu durchforschen und weltweit Heiratsurkunden,<br />
Geburtsurkunden und programmatisch alle anderen Formen schriftlicher<br />
Unterlagen zu sammeln und zu kopieren, die persönliche Unterlagen enthalten<br />
könnten. Die entsprechenden Emissäre versuchen, anhand der vorliegenden<br />
Unterlagen zunächst festzustellen, ob eine bestimmte Person wirklich<br />
gelebt hat - das Archiv betrifft das Niveau der Existenz als Aussage und die<br />
Zeit der Engel (die Photokopien werden <strong>für</strong> die Ewigkeit aufbewahrt). Das<br />
Archiv ist mit speziellen I Liren.ausgestattet, die sich im balle eines Erdbebens<br />
oder Atomknegs automatisch schließen. Was <strong>von</strong> Menschenleben übrigbleibt,<br />
sind Daten; ihr Archiv bildet nicht(s) ab, sondern generiert Wissensformen.<br />
»Die deutschen Zuhörer waren jedesmal entsetzt über die Idee dieser Datensammlung<br />
bei den Mormonen, da sie dies an die Nazi-Zeit und die damalige<br />
Nutzung gesammelter Daten erinnert.«-"^ Die Erinnerung an genealogische<br />
Archivpraxis im Nationalsozialismus ist nicht eine willkürliche, sondern zeitgenaue<br />
Assoziation mit dem Versuch der Genealogical Society, Kirchenbuchaufzeichnungen<br />
auf Mikrofilm zu bewahren und künftiger Forschung<br />
zugänglich zu machen, gehen deren Initiativen doch bis auf 1938 zurück. Seitdem<br />
Speicher auf der Grundlage <strong>von</strong> Lochkarten oder Mikrofilm gedacht und<br />
realisiert werden, heißt Gedäehtniswissenschalt Medienarchäologie. Die Speicherlogistik<br />
des klassischen Archivs zieh nicht auf programmatische Algorithmen.<br />
Weshalb der Untersuchungszeitraum dieser Studien auch mit dem<br />
takc-oj] jener digitalen Rechenmaschinen endet, die lange nur mit flüchtigen<br />
oder minimalen Speichern ausgerüstet waren, den Akzent also auf Berechnung<br />
legten; demgegenüber war die Funktion <strong>von</strong> Dokumentcnselektion in den<br />
nationalen Gedächtnisagenturen Deutschlands vielmehr ein umfangreicher<br />
»Memoria- Apparat«. 69<br />
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs werden Teile der Datenbank der Reichsstelle<br />
<strong>für</strong> Sippenforschung (RFS, nach 1940 Reicbssippenaynt RSA) <strong>von</strong> Berlin in<br />
thüringische Waldschlösser oder Salzminen nahe Magdeburg ausgelagert. Von<br />
?s Arnold Dreyblau (im Gespräch mit I hinnah 1 lurt/.ii;, B'erlm, 22. September 1994),<br />
Die Hypertext-Bibel, in: Thcaterschnk X (Brüssel u. a.): Das Gedächtnis, 132-150<br />
(146/148), 1998<br />
y> Dieser Begriff stammt <strong>von</strong> Gabor Orosz, Übersicht über die Problematik der Dokumcntationsselektorcn,<br />
in: Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische Dokumentationsarbeit<br />
1, Heft 9 (November 1954), 173-178 (bes. 174, Fußnote 4).
1056 INVHNTAR UND S'iv<br />
diesem Transfer hat der mit den RFS-Archiven bereits in Vorkriegszeiten vertraute<br />
Genealoge Paul Langheinrich Kenntnis. Das RFS hat ca. 16500 Mikrofilme<br />
und zahlreiche Papierkopien hinterlassen; vorrangig der Filmbcstand blieb<br />
unversehrt. In Wolfgrün und Eibenstock gründet Langheinnch 1946 ein Deutsches<br />
Archiv <strong>für</strong> Genealogie als Sammelpunkt (aller Speicherung vorgeschaltet).<br />
Als sich die Gelegenheit zur Raumnutzung ergibt, wandert diese Sammlung<br />
1948 an die Öffentliche Wissenschaftliche Bibliothek in Berlin (die heutige<br />
Staatsbibliothek) und wird unter Leitung des Ministeriums <strong>für</strong> Erziehung und<br />
Kultur als Deutsches Zenli alarchiv <strong>für</strong> Genealogie Berlin restauriert und<br />
bewahrt. 1948 hat Langheinrich den Versuch gemacht, die originalen Filmrollen<br />
auf 11 x 15cm-Mikrofiche umzukopieren, denn Rollfilm war schwer<br />
beschaffbar. 60 Diese Mikrofiche waren jedoch aus entflammbarem Material hergestellt<br />
und <strong>von</strong> daher im Datenverarbeitungsprozeß verwundbar; in Erwartung<br />
einer besseren Technologie wurde das Projekt daher arretiert. Denn quer<br />
zur narrativen, Kategonen der Kontinuität pnvilegierenden Logik der Historie<br />
setzen Medien wissensarchäologische Bockaden, D/skontmuitäten. In einer<br />
Direktive vom 2. Mai 1950 ordnet das Ministerium <strong>für</strong> Kultur die Verlagerung<br />
<strong>von</strong> Langhemnchs Zentralarchiv <strong>für</strong> Genealogie nach Potsdam an, wo es 1952<br />
bis 1965 als Deutsches Archiv <strong>für</strong> Genealogie Potsdam dem Zentralarchiv der<br />
DDR unterstand. <strong>Im</strong> Juli 1965 wurde der genealogische Bestand <strong>von</strong> ca. 250<br />
Regalmetern zum Landesarchiv in Leipzig überwiesen: so meßbar ist Vergangenheit.<br />
Auch optische Datenträger haben ihre Zeit. Das erfordert ihre Migration,<br />
die Umkopierung des Archivs; seit 1983 werden die alten Filme nicht mehr<br />
geographisch disloziert, sondern medial auf neue Datenträger transferiert. Nach<br />
wie vor ist das Archiv, wo Gedächtnismedium und -institution zusammenfallen,<br />
das Dispositiv des genealogischen Gedächtnisses; ein Drittes aber ist im<br />
Bunde, das zwischen Gedächtnis und Gegenwart keinen Unterschied mehr<br />
macht.<br />
Nach Weltkrieg II ist Archivästhetik vor allem eine Reaktionsformation auf<br />
die Erfahrung <strong>von</strong> Zerstörung. Mikroverfilmung wird nicht nur als definitive<br />
Schutzmöglichkeit gegen Totalverlust ermittelt, sondern auch im Sinne der Signaltheorie<br />
als Übertragungsmedium gelesen: das entstehende Negativ ist räumlich<br />
anspruchslos, beansprucht also wenig Speicherplatz; ferner kann es leicht<br />
transportiert werden. Darüber hinaus aber ergibt sich aus diesem technischen<br />
f '° Zur medienarchäologischen Rückkehr der vom antiken Papyrus vertrauten, vom<br />
Kodex dann verdrängten Rolle als »Schreibfläche« im Zeitalter »maschineller Erledigung<br />
<strong>von</strong> Schrift und Druck« siehe Porstmann 1928: 307ff (unter Verweis auch auf den<br />
Film; gleichzeitig implementiert das Endlosband der Tunng-Maschme dieses Prinzip<br />
virtuell)
Ni'ui-: GI-.DACI ITN.ISMASCHINI \: STATISTIK IM DU \NT DI-.S DRIIII \ Ri K.IIIS 1057<br />
Gedächtnis noch eine wesentliche wissensarchäologische Option, die gegenüber<br />
der Einzelexistenz <strong>von</strong> Originalen nicht erreichbar ist: Durch diese Verteilung<br />
und neuartige Zugänghchkcit der Archivalien können sie in einem ganz andern<br />
Maße als bisher als statistische Vergleichsmasse »<strong>für</strong> die Forschung und <strong>für</strong> die<br />
<strong>Geschichte</strong> lebendig werden«. 61 Die Latenz <strong>von</strong> Gedächtnis wird katechontisch<br />
im Medium; »wenn das auf Zeit aufzubewahrende Schriftgut verfilmt ist, haben<br />
wir trotz der Vernichtung der Originale nach wie vor die Möglichkeit, Akten,<br />
deren Archivwürdigkeit sich erst im Laufe der Zeit erweisen sollte, später zu<br />
reproduzieren.«'' 2 Denn es mag sein, daß der Diskurs Akten einen historischen<br />
Sinn zuweist, der ihre formals rein administrativ-funktionale Aussage zu Inhalt<br />
(als Quellenwert) umkodiert - eine semiotische Verschiebung, die nicht in der<br />
Semantik der Akten, sondern den Operatoren und Medien ihrer Speicherung<br />
angelegt ist. Die Differenz <strong>von</strong> Archivalie und Urkunde, <strong>von</strong> Verwaltungsarchiv<br />
und Editionen vom Typus Monumenta Germaniae Histonca, liegt im Begriff der<br />
Information; in der Moderne wird ein hoher Prozentsatz der erstellten, dauernd<br />
aufzubewahrenden Unterlagen »nicht mehr vom äußeren Bild oder der Beschaffenheit,<br />
sondern nur vom Inhalt her historische Bedeutung erlangen« . Das Zeitalter der Textmassen(re) produktion scheidet »historischkulturell<br />
wertvolles Archivgut (im Original)« <strong>von</strong> Massen-Schriftgut, das zwar<br />
ebenso auf Dauer, aber auch in der Form des Mikrofilms aufzubewahren ist<br />
; so wird auch das kulturwissenschaftliche Gedächtnis eine Funktion<br />
seiner Trägermedien. Die Organisation dieses Gedächtnisses wird durch »die<br />
modernen, sich ständig verbessernden Kommunikatinsmittel - Telefon, Fernschreiber,<br />
Vervielfältigungsanlagen, ADV, Mikrofilm, Datenfernübertragung«<br />
mitbestimmt ; mithin generieren diverse Medien auch diverse<br />
Anschreibbarkeiten <strong>von</strong> Gedächtnis überhaupt, replurahsieren es also im Unterschied<br />
zu seiner Homogenisierung im einkanahgen, weil rein schriftlichen<br />
Medium Historiographie. Mikroverfilmung ermöglicht den Anschluß an den<br />
Medienverbund der administrativen Automation (keine Tautologie) und erleichtert<br />
die Schaffung eines integrierten, Computer- und mikrofilmgestützten<br />
Dokumentation- und Informationssystems. Das läuft auf Komprimierung des<br />
Speichers hinaus; die Möglichkeit, alle Vorlagen ohne Übersetzung tu digitale<br />
Werte auf engstem Raum zu speichern und in einheitliche <strong>für</strong> die Dokumentation<br />
bearbeitbare Einheiten zu bringen, bildet »den unerläßlichen Analogspei-<br />
M Rudolf Bree, Sicherung deutscher Schnftdenkmäler,in: Der Archivar. Mitteilungsblatt<br />
<strong>für</strong> deutsches Archivwesen, VII. Jg., Heft 3 (August 1954), Sp. 1 97-200 (197f)<br />
'' 2 Kurt Schmitz, Mikrofilm und Dokumentation im Archivwesen der Kommunalverwaltung,<br />
in: Archiv und <strong>Geschichte</strong>. Festschrift Rudolf Brandts, hg. v. I lanns Peter<br />
Neuheuscr, Morst Schmitz u. Kurt Schmitz, Köln (Rheinland-Verlag) / Bonn (1 labelt-<br />
Vcrlag) 1978, 349-363 (359)
1058 INVT.NTAR UND STATISTIK<br />
eher, der die <strong>für</strong> die Weiterbearbeitung notwendigen Originalunterlagen in der<br />
erforderlichen Geschwindigkeit zur Verfügung stellt« . Mit der in der<br />
modernen Verwaltung angelegten Vervielfachung <strong>von</strong> Aktenbetreffen (Pertinenz)<br />
korrespondiert die Potenzierung der Ordnungsknterien ihres Archivs an der<br />
Schwelle zum Hypertext; Datenauswertungen »beziehen sich nicht mehr nur auf<br />
historische Zusammenhänge, sondern auch auf soziologische, wirtschaftliche,<br />
rechtliche und andere Fragen«; jenseits der Suprematie der Historie müssen<br />
Archive fortan »mehr Vorgänge nach mehreren Gesichtspunkten archivieren und<br />
dokumentieren müssen, um eine erhöhte Auskunftsbcreitschah zu erlangen«.<br />
Mikroverfilmung steht so nicht in einem supplementären Verhältnis zum Archiv,<br />
sondern ist seiner Funktionalität originär eingeschrieben oder schreibt sie gar vor,<br />
da bereits ein Teil der Unterlagen selbst durch Datenverarbeitung erstellt und<br />
direkt auf Mikrofilm ins Archiv ausgegeben wird. »Diese Vorgänge haben nie auf<br />
Papier gestanden« . Metamorphosen eines Mediums, das<br />
1870 zunächst zur Nachrichtenvermittlung aus dem belagerten Paris eingesetzt<br />
worden ist, <strong>von</strong> der Datenübertragung zur -spcichcrung: Sichcrhcit.sverfilmung<br />
<strong>von</strong> historisch wertvollen Unterlagen, Massenverfilmung <strong>von</strong> Akten aus Platzgründen<br />
und Ergänzungsverfilmung, »um einmalige vorhandene Archivbestände<br />
an verschiedenen Orten auswerten zu können oder um verschleppte Archive<br />
an ihrem Entstehungsort im Mikrofilm zur Verfügung zu haben« . Technische<br />
Zeichnungen und Pläne werden (in der jüngstvergangenen Epoche <strong>von</strong><br />
Schmitz) auf 35mm-Fihn aufgenommen und meistens als Einzelbilder in eine<br />
eigens <strong>für</strong> diese Zwecke geschaffene, international-genormte Filmlochkarte<br />
einmontiert, um sie mit Hilfe der Datenverarbeitung automatisch bearbeiten zu<br />
können. »Diese Arbeitsweise erlaubt eine Auswertung der Bestände, die ein Onginalarchiv<br />
nie bieten kann« . Nachdem es als Speicher des<br />
Staates oder Museum der Kultur in den vergangenen Jahrhunderten im <strong>Namen</strong><br />
der <strong>Geschichte</strong> betrieben wurde, ergreift nun das Gesetz der Medien das Gedächtnis<br />
des Archivs. Dies aufzuzählen aber ist an den Grenzen des Digitalen keine<br />
andere <strong>Geschichte</strong>, sondern nurmehr medienarchäologisch rekonfigunerbar.
Resümee<br />
•RHSUMHH 1059<br />
Kultur- als Gedächtniswisscnschaftcn der Datenspeicherung und -Übertragung,<br />
welche die Epoche des Historismus zugleich hervorgebracht und zugunsten des<br />
historischen Diskurses als Basis Großer Erzählungen (Nation etwa) an den Rand<br />
gedrängt hat, bedürfen der medienarchäologischen Perspektive, um <strong>für</strong> die Wissensgenealogie<br />
der Gegenwart wiederentdeckbar zu werden. Und dies nicht im<br />
Dienst eines Kontinuitätsanspruchs, sonders als Beihilfe zur Verabschiedung:<br />
»Unter dem Druck der Revolution der Kommunikationsmittel löst sich das Wissen<br />
aus den Organisationsformen, die ihm das neunzehnte Jahrhundert gegeben<br />
hat.« 1 Museen, Bibliotheken und Archive hören auf, sich primär als Stätten des<br />
Sammeins, Bcwahrens und Zurschaustcllcns eines als gegeben unterstellten Wissens<br />
zu begreifen und beginnen, als Labor der Wissens/?roduklion eine aktivere<br />
Rolle zu spielen - wobei selbst noch das Internet insofern einer klassischen<br />
Gedächtnis-Infrastruktur folgt, als daß der i-tscr vorfabrizierte Texte aus dem<br />
Speicher aufrult und unter dem Begntt hypertext einem zuvor konstruierten<br />
System <strong>von</strong> Verknüpfungen folgt.<br />
Die Gedächtnismacht eines Staates, das Gesetz dessen, was überhaupt als<br />
Erinnerung ausgesagt werden kann, bedarf der Remanenz-Institutionen, wenn<br />
sie mit dem symbolischen Kapital eines kulturellen Wissens und seiner nationalen<br />
Ansprüche rechnen will. Daher wird Deutschland im 19. Jahrhundert jenseits<br />
des historischen Diskurses und des ästhetischen Historismus, die Sache des<br />
Geistes bleiben, mit einer Gedächtnis-Infrastruktur in Form <strong>von</strong> Archiven,<br />
Bibliotheken, Museen, Editions- und Inventansierungsunternehmen versehen,<br />
die Datenbanken anlegen und Informationen in dem Sinne verarbeiten, wie Lotmann/Uspenski]<br />
Kultur semiotisch überhaupt definiert haben: als Funktion ihrer<br />
Speicher. Vektor dieser Arbeit war der Versuch, den Nachweis dieser im Sinne<br />
aller Hardware buchstäblichen Mnemotechniken zu führen, die im <strong>Namen</strong> des<br />
Diskurses <strong>Geschichte</strong> tatsächlich deren non-narrative Kehrseite und Alternativen<br />
in der Epoche des deutschen Historismus darstellen. Nach der militärischen<br />
Niederlage gegenüber Napoleon weiß Preußen, daß neben Heeres- und Verwaltungreform<br />
auch das Gedächtnis des Staates medial mobilisiert werden muß,<br />
um Ressourcen im <strong>Im</strong>aginären der Historie zu organisieren. Staatskanzler Hardenberg<br />
macht die Durchsetzung des Netzes preußischer Staatsarchive zur<br />
Ghefsache, und der Freiherr vom Stein initiiert daher nicht nur die preußischen<br />
Reformen, sondern folglich auch' die •Klonumcnla Uernuinnie histoncd, die<br />
Edition deutscher Geschichtsquellen des Mittelalters. Wenn es der <strong>Geschichte</strong><br />
1 Ulrich Raulff, Vergleichbar. Die Stiftung und die anderen,<br />
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 13. Februar 1998
1060 INVI NTAK UND STATISTIK<br />
bedarf, um die deutsche Nation als Raum mit zeitlicher Tiefe zu behaupten, muß<br />
cm Dispositiv in Form <strong>von</strong> Datenbanken gesetzt werden. Das Phantom einer<br />
Reichsbtbhothek als weitere Komponente im Verbund der Speichcrmedien (Editionen,<br />
Archive, Museen, Bibliotheken, Inventare) hört derweil nicht auf, den<br />
Ruin der Frankfurter Paulskirchen-Parlamentsbibliothek (1848/49) fortzuschreiben,<br />
bis daß die Leipziger Deutsche Bücherei als ausdrückliches Archiv<br />
deutschen Schriftguts genau in jenem Jahr 1913 gegründet wird, das die Leipziger<br />
Völkerschlacht nach hundert Jahren durch die Einweihung seines Denkmals<br />
reklamiert. Die buchstäbliche Nachbarschaft <strong>von</strong> Deutscher Bücherei und Völkerschlachtdenkmal<br />
macht eine Aussage über die Organisation nationalen<br />
Gedächtnisses im Symbolischen der Lettern, im <strong>Im</strong>aginären der Monumente und<br />
im Realen der Leichen. Zwischenzeitlich aber lagerte der Bestand der Paulskirchenbibliothek<br />
als wissensarchäologisches Monument und historisches Dokument<br />
katechontisch und gesondert jahrzehntelang in den Depots eines Ortes, der<br />
seinerseits gegenüber der politischen (und auch nach 1870/71 noch kulturhohcitlichen)<br />
Partikulation Deutschlands einen anderen Raum, eine Heterotopie,<br />
ein Widerlager darstellt: das durch den Freiherrn <strong>von</strong> Aufseß 1852 begründete<br />
Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Hier ist es nicht so sehr die Versammlung<br />
realer Artefakte, sondern das Unternehmen eines (jeneral-Rcpertonurns<br />
deutscher Archivallen, Bücher und Musealien bis 1650, das die kognitiven<br />
Karten deutscher Vergangenheit vermißt und inventarisiert. Der bemerkenswerte<br />
Versuch, aufgrund der logistischen Unmöglichkeit der Institution eines<br />
vollständigen Nationalmuseums die deutsche Kulturgeschichte als Information<br />
zu koordinieren, stellt einen Paradigmenwechsel medial induzierter Gedächtnisstrategien<br />
dar. Unter dem Mantel allegorischer und ideologischer 'Zurschaustellung<br />
bricht sich also ein pragmatisches Wissen um Gedächtnis- als<br />
Informations- und Dokumentationswissenschaft Bahn, nach dessen Vorbild<br />
nicht nur Text-, sondern auch Bildquellen organisiert werden (Essenweins Projekt<br />
der Monumenta Germaniae iconograpbtca). Nationales Gedächtnis als nnpenum,<br />
als (Be)Reichsweite <strong>von</strong> Datenerfassung, wird als non-diskursives<br />
Dispositiv organisiert, um Schnittstellen zum Diskurs des Nationalen bilden zu<br />
können. Dispositive aber tendieren zur Technik, und in dem Moment, wo sich<br />
die Verfahren der Datenerfassung vom Subjekt lösen (Albrecht Meydcnbauers<br />
photogrammetrische Inventarisierung deutscher Baudenkmäler) ist auch das,<br />
was einmal im Blick auf das <strong>Im</strong>aginäre eines Nationalkultur Deutsches Denkmälcrarchvv<br />
heißen sollte, tatsächlich um 1900 prosaisch zur Preußischen Meßbildanstalt<br />
geworden, und das Gedächtnis diesbezüglich eine reale Funktion<br />
seiner Meßinstrumente, korrespondierend mit 'Techniken der Statistik, an deren<br />
Ende die Operationen der Hollenth-Maschinen als Dementi aller Narration die<br />
Schnittstelle zur digitalen Epoche bilden. Instrumente aber kennen keine natio-
Ri.MJMi.i: 1061<br />
nalcn Grenzen mehr. In dem Moment, wo Daten nicht mehr als nationale Information<br />
kodiert, sondern als Wissen gerechnet, gespeichert Lind weitergegeben<br />
werden, sind nationale Archive, Bibliotheken, Museen sowie Editions- und<br />
Inventarisierungsunternehmen nicht mehr Zentren eines territorial und politisch<br />
definierten Gedächtnisses, sondern Knotenpunkte einer Wissensvernetzung, die<br />
- nachdem Projekte wie das Nürnberger General-Repertonum zunächst eben<br />
nicht nur an politischen und epistemologischen, sondern auch an medialen Grenzen<br />
seheitern - isjorld lade auf den Begriff, d. h. auf Programme, Kabel und<br />
Rechner gebracht worden ist. Eine Medienarchäologie des deutschen Gedächtnisses<br />
schaut nicht nur auf Archivalien, Musealien und Bücher, sondern auch auf<br />
die Fächer der Spcicherorte, deren Variablen sie sind. Sie versteht unter arebe<br />
nicht nur die Anfänge nationaler Gedächtnisagenturen, sondern das, was dieses<br />
Wort auch sagt: das System der Befehle, die diskurstaktisch jene Gedächtnistechniken<br />
in Gang setzen, deren Sinneffekte im historischen und kulturwissenschafthehen<br />
Diskurs dann als quasi metaphysische Gegebenheiten dissimulieren,<br />
was Gegebenheiten doch zunächst einmal sind: Daten, gespeichert. Das Verhältnis<br />
der Gründungsakte, die das System dieser Gedächtnisagenturen als Dispositiv<br />
des historischen Diskurses erst inaugurieren, zur disziplinären Matrix<br />
und Praxis des realen Faches Archäologie (welches Michel Foucaults Archäologie<br />
des Wissens gerade nicht thematisiert), wurde anhand des cpistemischen<br />
Widerstreits <strong>von</strong> Archäologie und Historie am Deutschen Historischen Institut<br />
und dem Deutschen Archäologischen Institut in Rom vor und nach 1900 thematisiert.<br />
Die am Beispiel des deutschen Gedächtnisses beschriebenen Prozesse<br />
der medialen Verknüpfung <strong>von</strong> Staat, Archiv, Bibliothek, Wissen und Macht lenken<br />
den Blick auf zentrale ['ragen der Zugangshedingungen <strong>von</strong> Information;<br />
Gedächtnis muß adrcssierbar sein, um operabel zu werden. Die Entscheidung,<br />
welches Wissens exklusiv des Staates oder der Forschung ist und welche Wissensverpfhehtung<br />
eine diskursive Schnittstelle gegenüber der Öffentlichkeit als<br />
Public domain bildet, das Spiel zwischen klassifizierten und deklassifizierten<br />
Speicherdaten in Archiven und Bibliotheken, die Ästhetik der Information zwischen<br />
Geheimnis und <strong>Im</strong>perativ der Gedächtnisbanken, das Auseinandertrcten<br />
<strong>von</strong> diskretem Wissensmonument und narrativer Dokumentation, <strong>von</strong> symbolischem<br />
<strong>Namen</strong> und verborgener Praktiken der Gedächtnisinstitutionen - all<br />
diese Konstellationen sind Funktionen medialer Operationen. Bis hm zu Formen<br />
der Aussperrung und -lagcrung deutsch-jüdischer Erinnerung im nationalsozialistischen<br />
Deutschland sind alle besprochenen Speichermedien daran<br />
beteiligt gewesen, den Begriff der Gedächtnismacht aus dem Reich des Symbolischen<br />
in Verfügung über reale Korper zu übersetzen.<br />
Deutsche Gedächtnisagenturen ab 1806 adressieren eine emphatische <strong>Geschichte</strong>,<br />
die noch keine ist, und 1945 ist sie keine mehr. Vielleicht läßt sich rücklickend
1062 INVI-:NTAI< UND STATISTIK<br />
eine epistemische Lage erst dann medicnarchaologisch beschreiben, wenn sie ihre<br />
Ränder <strong>von</strong> diesen zwei Grenzen her zu erkennen gibt, sich also einem Ende<br />
zuneigt und damit zur Epoche wird - in dem Moment, wo wir zu ahnen scheinen,<br />
daß die klassische <strong>von</strong> Trias Bibliothek, Archiv und Museum in ein und dasselbe<br />
Informations-, Speicher- und Übertragungsmedium überführt wird, wo<br />
anstelle <strong>von</strong> real an technischen Grenzen gescheiterten Gesamtrepertonen und -<br />
katalogen (Germanisches Nationalmuseum, Deutsche Bücherei) selbstständige<br />
Suchmaschincn auf der transnationalen Ebene des Internet treten 2 , während<br />
gleichzeitig die moderne, medial induzierte Trennung <strong>von</strong> Gedächtnis als Inhalt<br />
und als Adresse ineins geschaltet wird - Rückkehr der Rhetorik gegenüber der<br />
Klassifikation auf elektronischer Ebene. So, wie vor der Genese <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
als Drama historische Daten und rhetorische Figuren als schlichte Kombination<br />
denkbar waren 3 , erinnert heute die algonthmische Kopplung <strong>von</strong> Daten und Programmen<br />
an Alternativen zur Eintragung <strong>von</strong> Ereignissen auf einer Achse namens<br />
historische Entwicklung. In diesem Sinne sind Bibliothek und Archiv, die alles<br />
Sprechen katechontisch speichern, um es <strong>für</strong> immer sicherzustellen, nicht nur <strong>von</strong><br />
den Tyrannen, sondern auch <strong>von</strong> der Mathematik bedroht; in Maschinen implementiert<br />
führt sie in Form <strong>von</strong> Programmen - wie die Rhetorik als Verknüpfung<br />
<strong>von</strong> Aussagegruppen, als eine mögliche Form <strong>von</strong> Diskurs-Sukzession - auch aus,<br />
was sie sagt, im Unterschied zum Paradigma des 19. Jahrhunderts: der Klassifizierung,<br />
Inventarisierung, Repertonsierung. Es steht also nicht mehr Technik<br />
gegenüber dem Sachzwang (Tatsachen, Dokumente, Gesetze), nicht mehr der<br />
Diskurs gegenüber dem Archiv, sondern es herrscht »Rhetonsicrung der Sachlichkeil«.<br />
1 <strong>Im</strong> 19. Jahrhundert war die Bibliographie »der Codex diplomaticus der<br />
Litcrar-<strong>Geschichte</strong>, der sicherste Grad- und Höhenmesser der literarischen Cultur<br />
und Thätigkeit« im Unterschied «zum blosscn Adre.ssbuche <strong>für</strong> besondere<br />
Zwecke andrer Art«-" 1 . Wo literarische Kultur aber buchstäblich verstanden<br />
wird, als Funktion alphabetischer Speicher ,\n der Schwelle zur digitalen Verknüpfung<br />
vormals getrennter Gedachtniskanäle, entscheidet die Verfügung<br />
2 Zu den digitalen Optionen des Deutschen Bibliotheksinstituts in Berlin siehe Josef<br />
Zcns, Schlechte Zensuren <strong>für</strong> das Bibliotheksmstitut, in: Berliner Zeitung Nr. 276 v.<br />
26. November 1997<br />
3 Dazu Friedrich Kittler, Rhetorik der Macht und Macht der Rhetorik - Lohensteins<br />
Agrippina, in: Hans-Georg Pott (Hg.), Johann Christian Günther, Paderborn-München-Wien-Zürich<br />
1988,39-52<br />
4 Walter Seiner (Foucaults Thesen paraphrasierend), Zur Gegenwart anderer Wissen,<br />
in: Michel Foucault / ders., Das Spektrum der Genealogie, Bodcnhcmi (Philo) o. ].<br />
[1996], 94-1 12 (96, 103! u. III)<br />
1 F. A. Eben, Allgemeines bibliographisches Lexikon, Bd. I, Leip/i» 1821, Vorrede, v.-..<br />
. xü (v)
Rl-SÜMI. 1063<br />
über Adressen. Nehmen diejenigen, welche die Information verteilen, ein herrschendes<br />
Priesteramt in der Wissenschaft der Zukunft cm 6 , »so wie die alten<br />
Schleusenwärter Könige wurden« 7 ? Die neuen Steuermänner der Memorialmacht<br />
programmieren - Untersuchungsfelder künftiger Ex-Kulturwissenschaft.<br />
6 So der <strong>für</strong> den amerikanischen Präsident]. F. Kennedy angefertige Weinberg-Report,<br />
zitiert nach E. Lutterbeck, Die Bewältigung der Informationslawine, in: Elektronische<br />
Datenverarbeitung 12 (1-970), I Ich 3<br />
Peter R. l'Yank, Kybernetik m hvdrauhschen (ie.sellschahen; in: ders. (1 lg.), Von der<br />
systematischen Bibliographie zur Dokumentation, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1978,<br />
Einleitung, xxn
DEUTSCHE SPEICHER:<br />
DATENRÄUME DER BIBLIOTHEK UND<br />
DES(BILD)ARCHIVS
Datenräume: Literatur- und Quellenverzeichnis<br />
Bibliographie gedruckter Quellen ans der thematischen Epoche und ihres<br />
unmittelbaren Nachleben*<br />
Regierung*- und Baurat Adams, Der Neubau <strong>für</strong> die Königliche Bibliothek und die<br />
Akademie der Wissenschaften in Berlin, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 34. Jg.<br />
(1914) Nr. 23, 25u. 29<br />
Karl <strong>von</strong> Amira / Claudius <strong>von</strong> Schwerin, Rechtsarchäologie. Gegenstände, Formen und<br />
Symbole Germanischen Rechts, Teil 1: Einführung in die Rcchtsarchäologic. Berlin<br />
(Ahnenerbc-Stiftung) 1943<br />
. Das neue Gebäude <strong>für</strong> die Königliche Bibliothek und die Akademie der<br />
Wissenschaften m Berlin, in: Deutsche Bau/citung 4S (1914), 317-394<br />
1 1. Aubin / W. Kohte •' J. Papritz. (} lg.), Deutsche Ostforschung: Ergebnisse und Autgaben<br />
seit dem l'.rsten Weltkrieg, Bd. 1, Leipzig 1942<br />
1 lans Freiherr <strong>von</strong> und zu Aufsets. Sendschreiben an die erste allgemeine Versammlung<br />
deutscher Rechtsgelehrten , Nürnberg 1846<br />
ders., System der deutschen Gcschichts- und Alterthumskundc entworfen zum /wecke<br />
der Anordnungen der Sammlungen des germanischen Museums, 1X53<br />
ders., Zweite Denkschrift <strong>für</strong> die höchsten und hohen deutschen Regierungen, das germanische<br />
Nationalmuscum in Nürnberg betreffend, Nürnberg ((SNMl 1861<br />
ders., Das germanische Museum und seine nationalen Ziele. Denkschrift zur Frlauterungdesdem<br />
norddeutschen Bundesrath vorliegenden Haupt sehen Gutachtens über<br />
dieses Museum, Lindau (Stcttner) 1869<br />
Friedrich Bacthgen, Gedanken über die künftige Gestaltung der Monumenta Gcrmaniac<br />
Histonca, in: Ur- und Frühgeschichte als \ iistonsche Wissenschaft. Festschrift zum 60.<br />
Geburtstag <strong>von</strong> Krnst Wähle, hg. v. Fiorst Kirchner, \ leidelberg (Winter) 195C, 340-35C<br />
Paul Bailleu, Das Provenicnzpnnzip und dessen Anwendung im Berliner Geheimen<br />
Staatsarchive, in: Korrcspondenzblatt des Gesammtvcreins der deutschen<br />
Gcschichts- und Aiterthumsvereine 50 (Oktober / November 1902), 193-195<br />
FL Baumgarten, Archive und Bibliotheken in Frankreich und Deutschland, in: Preußische<br />
Jahrbücher Bd. 36 Heft 6 (1875), 626-654<br />
Otto Behre, <strong>Geschichte</strong> der Statistik in Brandenburg-Preussen bis zur Gründung des<br />
Königlichen Statistischen Bureaus. Berlin (Hcvmanns) 1905<br />
Ludwig Bittner, Das Wiener Haus , Hof- und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit, in:<br />
Archivalische Zeitschrift 35 (1925). 154-200<br />
Franz Bock, Die Kleinodien des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nebst<br />
den Kroninsiunu-n Böhmens, l ng.irns und der I oinbardci und ihren formverwandten<br />
ParalleL int und Staatsd 1SM<br />
|ohann Iriidi . '.i künden der I i Konige und K.uvci <strong>von</strong> ('onrad<br />
I. bis I \, i.M3. I i.inkfur ntrapp» \H\\<br />
ders., Regest.i 1 )ic Regesten J reichs unter den Karolingern<br />
751-918. hg. <strong>von</strong> i eichischen Ak. Wissenschaften, ncubearbeitet<br />
v. hngclbert ." . r u. vollendet 1 echner. Hildeshcim (Ulms)<br />
1966<br />
Albert Brackmann, 1 •\i\hnwissonscha! 1 . ;: schichtswissenschaftliche
1068 D/Vii \i UMI.: LlTl-.RATUR- UNI) Qt'l 1 1 JNVl-.R/.llCHNIS<br />
Fortbildung «im Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, in: Archivalische Zeitschrift<br />
40 (1941), 1-16<br />
ders., Eröffnungsansprache zum 25. Deutschen Archivtag in Wiesbaden, Abdruck in:<br />
Archivalische Zeitschrift 44 (1936), 1-5<br />
Karl Georg Brandis, Goethes Plan eines Gesamtkatalogs der weimarischen Bibliotheken,<br />
in: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 14 (1928), 152-165<br />
Adolf Brennekc, Archivkundc. Hin Beitrag zur Theorie und <strong>Geschichte</strong> des europäischen<br />
Archivwesens, bearbeitet <strong>von</strong> Wolfgang Lccsch, Leipzig (Kochler & Amelang)<br />
1953<br />
Harry Bresslau, <strong>Geschichte</strong> der Monumenta Germaniae historica, Hannover 1921<br />
ders., autobiographischer Aufsatz, in: Sigfried Steinberg (Hg.), Die Geschichtswissenschaft<br />
der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Bd. 2, Leipzig (Meiner) 1926, 1-55<br />
S. Brückheimer, Eine Gemeinde erlischt, in: Bayerische Israelische Gemeindezeitung,<br />
XL Jg., Nr. 13, München, 1. Juli 1935,289!<br />
Karl G. Bruchmann, Die Knegsverluste und -schaden des Stadtarchivs Goslar, in: Festschrift<br />
Edmund E. Stengel zum 70. Geburtstag, Münster / Köln (Böhlau) 1952, 566-<br />
575<br />
J. Lambert Biichlcr (Verf.), Gutachten der historisch-philologischen Klasse der Königlichen<br />
Akademie der Wissenschaften an das Kgl. preußische Ministerium in Berlin,<br />
in: Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> altere deutsche Geschichtskunde, hg. v. dems. u. Carl<br />
Georg Dümge. Bd. 2, Frankfurt/M. (Andreäischc Buchhandlung) 1 820, 3-18<br />
Karl Wilhelm Bührer, Raumnot und Weltformat, München (Die Brücke) / Ansbach<br />
(Seybold) 1912<br />
ders. / Adolf Saager, Die Welt-Registratur. Das Mclvil-Dcwcyschc Dczimal-Svstcm,<br />
München (Die Brücke) / Ansbach (Seybold) 1912<br />
Karl Bulling, Goethe als Erneuerer und Berater der jenaischen Bibliotheken, Jena (Frommann)<br />
1932<br />
Burchardi, Über die Verwendbarkeit der Photographic tur lerram und Architektur-<br />
Aufnahmen, in: Archiv <strong>für</strong> die Offiziere der kgl. Preußischen Artillerie- und Ingenieur-Korps<br />
32 (1868), 189-210<br />
G. A. H. Burckhardt, Die Archivtrage vordem Reichstage. Zugleich eine Entgegnung<br />
auf die v. 1 iagkc'sche Broschüre: Lieber die Wiederherstellung eines deutschen<br />
Reichsarchivs und die Reformen im Archivwesen, Weimar (Voigt) 186S<br />
Vannevar Bush, As we may think, in: Atlantic Monthly, Juli 1945, 101-108<br />
Wilhelm Butte, Statistik als Wissenschaft, l.andshut 1808<br />
Paul Clemen, Die Denkmalpflege in der Rhcmprovinz, Dusseidort 1896<br />
ders. (\ lg.), Kunstschutz im Kriege. Berichte über den Zustand der Kunstdenkmälcr auf<br />
den verschiedenen Kriegsschauplätzen und über die deutschen und österreichischen<br />
Maßnahmen zu ihrer Erhaltung, Rettung, Erforschung, 1. Bd. Die Westfront. Leipzig<br />
(Seemann)<br />
Hermann Degering. '• Schatze, kölnische 1 .thnhen in Paris und Brüssel.<br />
in: Beitrage /in K .eschiciuc Sprache .nw-irt, hg. \ Verein Alt-koin.<br />
2. Bd. lieft :HI 19IS). Wf<br />
Karl Demeter, I .mg Frankfurt a. Maut des isarchivs als I undst.me hu<br />
rheinische i. und Sippenforschung, in: Rht'i e Heimatpflege, Heft 3/1"<br />
361-368
ÜATl-'NRAUMI-.: Lrn-.KATUR- UNI) Qui.U.l.NVi RZI.ICHNI^ 1069<br />
K. Dieterich, Buckle und Hegel (I), in: Preußische Jahrbücher, hg. v. H. <strong>von</strong> Trcttschke<br />
/ W. Behrcnpfcnnig, 32. Bd., Berlin (Reimer) 1873, 257-302<br />
ders., Anfänge, Entwicklung und Ziele der rheinischen Denkmälerstatistik, in: Nachrichten-Blatt<br />
<strong>für</strong> rheinische I leimatptlege, Organ <strong>für</strong> Heimatmuseen, Denkmalpflege,<br />
Archivberatung, Natur- Landschaftsschutz, hg. v. Landeshauptmann der Rhcinprovinz,<br />
2. Jg. 1930/31, Hett 7/8, lQb-lüV<br />
Wilhelm Dilthey, Archive der Literatur in ihrer Bedeutung <strong>für</strong> das Studium der<br />
<strong>Geschichte</strong> der Philosophie, in: Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> der Philosophie, 11. Band 3.<br />
Heft, Berlin (Reimer) 1889, 343-367<br />
Richard Doergens, Über »Photogrammetrie« und über die Thätigkeit des »Fcld-Photographie-Detachcments«<br />
im Kriege 1870/71, in: Deutsche Photographische Zeitung<br />
(1897) Nr. 39, 474f<br />
E. Dolezal, Die Photographie und Photogrammetrie im Dienste der Denkmalpflege und<br />
das Denkmälcrarchiv, in: Internationales Archiv <strong>für</strong> Photogrammetrie, i. Bd.<br />
(1908/9), Wien / Leipzig 1909, 45-70<br />
ders., Zur Würdigung der Preußischen Meßbildanstalt in Berlin, in: Archives internationales<br />
de photogrammetrie, 6. Jg. 1923, 36-45<br />
1 lerbert Dominik, I lochwertige Schallaufzeichnung und Dokumentation, in: Deutsche<br />
G esc II schall lür Dokumentation (1 lg). Die Dokumentation und ihre Probleme, Leipzig<br />
(I larrassowitz) 1943, 46-50<br />
I Iermann Drcyhaus, Die ersten Vorschläge zur Errichtung eines Völkerschlachtdenkmals<br />
bei Leipzig, in: Zeitschrift tür <strong>Geschichte</strong> der Architektur VI (1913), 225-232<br />
Johann Gustav Droysen, Historik. Historisch-kritische Ausgabe v. Peter Levh 1: Die<br />
Vorlesungen <strong>von</strong> 1857, Rekonstruktion der ersten vollständigen Passung aus den<br />
Handschritten, Stuttgart-Bad Cannstatt (Frommann / Holboog) 1977<br />
ders.. Die Erhebung der <strong>Geschichte</strong> zum Rang einer Wissenschaft, in: Historische Zeitschrift<br />
Bd. 9 (München 1863), 1-22<br />
Walthcr <strong>von</strong> Dyck, Wege und Ziele des Deutschen Museums, Berlin (VDI) 142 1 » f-<br />
Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte, 1. Jg., Heft 1)<br />
Friedrich Adolf Ebert, Die Bildung des Bibliothekars, Leipzig (Glück) 1820<br />
Joseph Freiherr v. Eichendortt, Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen<br />
Ordensritter in Marienburg, Kömgsbeig (Thei'c) 1844<br />
Ernst Engel, Die Volkszählung, ihre Stellung zur Wissenschaft und ihre Autgabe m der<br />
<strong>Geschichte</strong>, in: Zeitschritt des Konigl. Preussischen Statistischen Bureaus 2 (1862),<br />
25-31<br />
Wilhelm Engel, Deutsches Mittelalter. Aufgabe und Weg seiner Erforschung, in: Deutsches<br />
Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters 1 (1937) Heft 1, 3-10<br />
Carl Erdmann, Das Grab Heinrichs L, in: Deutsches Archiv <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> des Mittelalters<br />
(namens des Rcichsinsitutes <strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde [Monumenta<br />
Germaniae histonca]), hg. v. Edmund E. Stengel, 4. Jg.. Hl, Weimar (Bohlau) 1940,<br />
1 leinrich August Erhard, Ideer<br />
Archivwesens, in: Zcitschn'<br />
August F.ssenwcm. I > .-crm.il<br />
Stand der Sanur und<br />
gaben, an den \e un^<br />
1978:993-1026<br />
wissenschaftlichen begiundung und Gestaltung des<br />
Archivkundc 1834: 183 247<br />
N.u • • 'museum. Beucht über den >;eueruv artigen<br />
UP . die nach\u n daraus et ^ i uien Auf<br />
Huts c et, Nürnberg 1870 = Den Kashnitz
1070 DATHNKAL Ml.: Ll'IT.KATUK- UNI) Q. , i NVhR/.l l( I l\ IS<br />
ders., Einige Worte zur Frage über die Aufgaben des germ. Museums, in: Kunst und<br />
Gewerbe Jg. 6(1872), 321-323<br />
ders. / Georg Karl Frommann, Die Aufgaben und die Mittel des germanischen<br />
Museums. Eine Denkschrift, Nürnberg (Literarisch-artistische Anstalt des germanischen<br />
Museums) 1872<br />
ders., Rehqmae medu aevt. Eine Denkschrift, Nürnberg (Literarisch-artistische Anstalt<br />
des germanischen Museums) 1884<br />
ders. /Johanna Mestorf, Katalog der im germanischen Museum befindlichen vorgeschichtlichen<br />
Denkmäler. Nürnberg 188(S<br />
Johannes Fallati, Einleitung in die Wissenschaft der Statistik, Tübingen 1843<br />
Festschrift zur 25-Jahrfeier der Deutschen Hollerith Maschinen Gesellschaft, Berlin 1935<br />
Heinrich Feuchtwanger, Jüdische Denkmalspflege, in: Mitteilungen des Jüdischen Lehrerverseins<br />
<strong>für</strong> Bayern Nr. 3 / 1935, München, 15. Mai/., enthalten in: Bayerische Israelische<br />
Gemeindezeitung, XL Jg., Nr. 6, München, 15. März 1935<br />
Richard Fick, Die Zentralstelle der Deutschen Bibliotheken, in: Commission permanente<br />
des Gongres internationaux des Archivistes et des Bibliothecaires, Congres de Bruxelles<br />
1910. Actes, hg. v.J. Cuvelier / L. Stainicr, Brüssel 191 1, 399-449<br />
ders.. Maßgebliches und Unmaßgebliches /um Problem des Deutschen Gesamtk.ualogs.<br />
Berlin (de Gruyter) 1932 (Sonderdruck aus: Minerva-Zeitschrift Jg. 8, 1932, I lefte 5/6<br />
und 7/8, 1-12<br />
Rudolf Focke, Allgemeine Theorie der Klassifikation und kurzer Entwurf einer Instruktion<br />
<strong>für</strong> den Realkatalog, in: ders. (I lg.), Festschrift zur Bcgrussung der sechsten Versammlung<br />
Deutscher Bibliothekare in Posen am 14. und 15. Juni 1905, Posen<br />
(Jalowicz) 1905, 5ff<br />
Lconhard Franz, Ist die Urgeschichte eine historische oder eine naturwissenschaftliche<br />
Disziplin?, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> deutsche Vorzeit, 2. Jg. Heft 4 (1926), 57-59<br />
W. Fnedcnsburg, Das Königlich Preußische I iistonsche Institut in Rom in den dreizehn<br />
ersten Jahren seines Bestehens 1888-1901, Anhang zu den Abhandlungen der Kgl.<br />
Preuß. Akad. d. Wiss. 1903, Berlin 1903<br />
! Icrmann Fuchs, Der deutsche Gesamtkatalog, Leipzig (Harrassowitz) 1936<br />
ders., Kommentar zu den Instruktionen <strong>für</strong> die alphabetischen Kataloge der Preußischen<br />
Bibliotheken, Wiesbaden (Harrassowitz) 1955<br />
Eduard Gerhard, Über archäologische Apparate und Museen, m: Denkmäler und 1 i<br />
schungen(= Archäologische Zeitung Jg. 16, Nr. 116/117/ 1858), Sp. 205-212<br />
Das Germanische National-Museum. Organismus und Sammlungen (Denkschriften des<br />
Germanischen National-Museums, Bd. 1), Abt. 1, Nürnberg 1856<br />
W. Giesebrecht, Die fränkischen Königsannalen und ihr Ursprung, in: Münchner Histo<br />
nsches Jahrbuch <strong>für</strong> 1865, hg. v. der historischen Glasse der k. Akademie der Wi\<br />
sens* n, München (Literarisch-artistische Anstalt / Cotu) 1865, 189-238<br />
Otto () ij;. Die Kriegssammlung der Bayerischen Staatsbibliothek, in: Zentralblat<br />
thekswesenjg. 36(1919), 158-166<br />
Jo ^mg <strong>von</strong> Goethe. Archiv des Dichters und Schriftsteilers, in: Goethe<br />
i X, kommentx " W.iltram >•» u. Fr ich Trun/, München (Beck), h<br />
,. 532H<br />
Joset (.J )ie am? ^e Stat und die R.\ orschung. Eine internationale stansn<br />
sehe - e, in: ' ;'mein uisnsehes \ 27, Heft 4 ; !4V\ 415-422
D \KÄUMk: Ll'l I KA'I I. \1> QUI-.I. 1C71<br />
Wilhelm Grau (Frankfurt/M.), Der Aufbau der Bibliothek zur Erforschung der Judenfrage<br />
in Frankfurt a. Main, in: Zcntralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 59 (1942), 489-494<br />
Ferdinand Gregorovius, Das Römische Staatsarchiv, in: Historische Zeitschrift, hg. v.<br />
Heinrich <strong>von</strong> Sybcl, 36. Bd. (München 1876), 141-165<br />
1072 D/NT! NRAUMI-: Ll'l I.KATUK- UND QUH !RZil< IIMS<br />
und Erfahrungen in allen Zweigen der photographischen Praxis , Leipzig (Spamer)<br />
1864<br />
Adolf Hilsenbeek, Martin Schrettinger und die Aufstellung in der Königlichen Hof- und<br />
Staatsbibliothek München, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 31 (1914), 407-433<br />
L. F. Höfer, Über Archive und Registraturen, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde 1<br />
(1833/34), I lamburg (Pcrthcs) 1834, 248-258<br />
Konstantin Höhlbaum, Über Archive. Zur Onentirung , in: ders. (Hg.), Mittheilungen<br />
aus dem Stadtarchiv <strong>von</strong> Köln, 1. Heft, Köln (DuMont) 1882<br />
Walter I lofmann. Der Raum der Bücherei. Aulnahmen und Grundrisse aus den Städtischen<br />
Bücherhailen zu Leipzig, Leipzig (C^uelle und Meyer) 1925<br />
Hugo <strong>von</strong> Hofmannsthal, Das Schrifttum als geistigen Raum der Nation, München<br />
(Bremer Presse) 1927<br />
O. Holder-Egger, Die Monumcma Germanuc und ihr neuester Kritiker. Eine Entgegnung,<br />
Hannover (Hahn) 1887<br />
Oliver Wendel! Holmes, The Stcreoscope and the Stereograph (1859), in: Alan Trachtenberg<br />
(Hg.), Glassic Essays on Photography. Notes by Amy Weinstein Meyers, 2.<br />
Aufl. New Haven, Conn. 1980, 71 -83<br />
Hortzschansky, Die Königliche Bibliothek zu Berlin, Berlin 1908<br />
Karl Hucke, Wie das Mährische Landesmuseum entstand, in: Zeitschrift des Mährischen<br />
Landesmuseums, N. F., III. Bd., Brunn 1943, 5-15<br />
Wilhelm <strong>von</strong> Humboldt, Antrag auf Errichtung der Universität Berlin (Mai 1809), in:<br />
ders., Werke in fünf Bänden, Darmstadt (Wiss. Buchgcs.) 1964, Bd. IV, 29-37<br />
ders., Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten<br />
in Berlin, ebd., 255-266<br />
Friedrich l.udwigjahn, Deutsches Volkstum | 1810], Bielefeld / Leipzig 1916<br />
Otto Jahn, Eduard Gerhard. Ein Lcbcnsabriss, in: Gesammelte Akademische Abhandlungen<br />
und Kleine Schriften <strong>von</strong> Eduard Gerhard, 2. Band, Berlin (Georg Reimer)<br />
1868, l-cxvii<br />
Friedrich Jodl, Die Culturgcschichtsschreibung, ihre Entwickclung und ihr Problem,<br />
Halle 1878<br />
V. John, Name und Wesen der Statistik, in: Zeitschritt <strong>für</strong> Schweizerische Stastistik 19.<br />
Jg., Bern 1883,97-112<br />
Ernst Jünger, Das Erste Pariser Tagebuch, in: ders., Strahlungen, Tübingen (Heliopolis)<br />
1949<br />
Hans Kaiser, Die Archive des alten Reichs bis 1806, in: Archivahsche Zeitschrift 35<br />
(1925), 205-22C<br />
ders.. Aus der Entwicklung der Archivkundc, in: Archivahsche Zeitschrift 37 (1927). 98-<br />
109<br />
Ernst H. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite, Hauptband, Berlin 1927, Neua<br />
gäbe Stuttgart (Klett-Cotta) 7. Aufl. 1994<br />
ders.. Über Grenzen, Möglichkeiten und Autgaben der Darstellung mitielaJterhc<br />
Gcschu Rede auf dem deutschen I Itstorikcr-Tag in 1 falle, 24. April 1930), ab<br />
druckt tmult. Schriften zur Verkehrswissenschaft 16: Kantorowicz, Wien 1^<br />
5-10<br />
Hermann antorowiez, Schriftvergleichung und Urkundenfälschung. Beitrag
DATI.NRAUMI.: LITI-.K - UNI) Ol.'l I.I.I-.NV1-K/I K .IIMs 1073<br />
<strong>Geschichte</strong> der Diplomatik im Mittelalter, in: Quellen und Forschungen aus Italienischen<br />
Archiven und Bibliotheken 9(1906), 38-56<br />
Ernst Kapp, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur F^ntstehungsgeschichte der<br />
Cultur aus neuen Gesichtspunkten, Braunschweig (Westermann) 1877<br />
Gerhard Kayser, Kirchenbuch<strong>für</strong>sorge der Reichsstelle <strong>für</strong> Sippenforschung, in: Archivahschc<br />
Zeitschrift 45 (1939), 141 -163<br />
ders., Photographische Vervielfältigung <strong>von</strong> Kirchenbüchern, in: Familie, Sippe, Volk 10<br />
(Berlin 1943), 83-86<br />
Paul Kehr, Zur <strong>Geschichte</strong> Ottos III., in: I Iistorische Zeitschrift Bd. 66, München / Leipzig<br />
1891,385-443<br />
ders., Die Kaiscrurkunden des Vatikanischen Archivs, in: Neues Archiv der Gesellschaft<br />
<strong>für</strong> ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der<br />
Quellenschriften deutschen <strong>Geschichte</strong>n des Mittelalters, 14. Bd., Hannover (Hahn)<br />
1889, 345-352(Text)<br />
ders., Das Archivwesen Italiens, m: Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München), Jg.<br />
1901, Nr. 172, Nr. 181, 185 u. 194<br />
ders., Das Preußische Historische Institut in Rom, in: Internationale Monatszeitschrift<br />
<strong>für</strong> Wissenschaft, Kunst und Technik, November 1913, Sp. 1-36<br />
ders., Ein Jahrhundert preußischer Archivverwaltung, in: Archivalischc Zeitschrift 35<br />
(1925), 3-21<br />
ders., Italienische Erinnerungen (Vorträge der Abt. f. Kulturwiss. d. Kaiser-Wilhelm-<br />
Intituts im Palazzo Zuccan, 1. Reihe, Heft 21), Wien (Schroll) 1940<br />
Wilhelm Kisky, Das Archiv der Rheinischen Provinzialverwaltung im Landeshaus in<br />
Düsseldorf, in: Rheinische I leimatptlege. Zeitschrift <strong>für</strong> Museumswesen, Denkmalpflege,<br />
Archivberatung. Volkstum, Natur- und Landschaftsschutz, 10. Jg. 1938. Heft<br />
3.342-345<br />
Gustav Klemm, I landbuch der germanischen Altertumskunde, Dresden 183(-><br />
ders., Allgemeine Gultur-<strong>Geschichte</strong> der Menschheit, 1. Bd.: Die Einleitung und die<br />
Urzustände der Menschheit, Leipzig (Teubner) 1843, Beilage: Fantasie über ein<br />
Museum <strong>für</strong> die Culturgeschichte der Menschheit, 352-362<br />
Viktor Klempcrer, LT1 [Lingua tertii imperii]. Notizbuch eines Philologen, Berlin (Aufbau)<br />
1947<br />
Meile Klinkenborg, <strong>Geschichte</strong> des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin, Abt. 2: Das<br />
Geheime Staatsarchiv im 17. und 18. Jahrhundert, Masch.abzug 1934<br />
Kurt Hans <strong>von</strong> Klit/ing, Rettung der Kirchenbücher, in: Familie, Sippe. Volk. 1 Jg. I Ich<br />
1 (1935), 11<br />
Gustav Adolph Knies, Die Statistik als sclbststandige Wissenschaft. Zur Losung des<br />
Wirrsals in der Theorie und Praxis dieser Wissenschaft, Kassel 1850<br />
Gustav Könnecke, Bilderatlas zur <strong>Geschichte</strong> der deutschen Nationalliteratur. Eine<br />
Ergänzung zu icder deutschen Literaturgeschichte. Nach den Quellen bearbeitet. 2<br />
Auflage Marburg (I-.lwert) 1912<br />
Heinrich Kohlhaulicn, Die Rcichskleinodicn, Berlin 193K<br />
den.. Die Bedeutung der Muieen <strong>für</strong> die Mi<br />
sehe Gesellschaft <strong>für</strong> Dokumentation<br />
Vorträge, gehalten auf der ersten Tagu<br />
tion vom 21. bis 24. September 1942 in<br />
Wolfgang Kohte", Gegenwartsgeschichtliu<br />
iKMlt und ihn<br />
Die Dokument<br />
; Deutschen Gv<br />
- .-mitl«<br />
unc<br />
-haft l. .<br />
•me<br />
- . nta<br />
mrg, Leipzig (Harrassowitz) 1943, 32-39<br />
Quellen und moderne Überlieferungsfor-<br />
men in öffentlichen Archiven, in: Der Archivar Jg. 8 (1955), Sp 197-210
1074 DATI-.NKAUMI.: LITI-.KATUK- UND QUI.I.I.I.NVI-:K/I.ICM\IS<br />
S. Koller, Der Einfluß der Automatisierung auf die Aufgabenstellung der Statistik, in:<br />
Allgemeines Statistisches Archiv 43 (1959), 363-368<br />
Ulrich Friedrich Kopp, Palaeographia entica, 4 Bdc, Mannheim (Selbstverlag) 1817-29<br />
Richard Korherr, Der Untergang der alten Kulturvölker. Eine Statistik in Worten, in:<br />
Allgemeines Statistisches Archiv 27, 1 Ich 1 (1937), 29-50<br />
Kcinhoid Koser, Über den gegenwärtigen Siand üci Archiv bischer, Forschung in<br />
Preußen, Leipzig (Hirzel) 1900<br />
ders., Die Neuordnung des preußischen Archivwesens durch den Staatskanzlcr Fürsten<br />
<strong>von</strong> Hardenberg, Leipzig (I lirzel) 1904<br />
Gustav Kossinna, Vortrag aut der Versammlung der deutschen Anthropologischen Gesellschaft<br />
in Kassel am 9. August 1895, in: Zeitschritt des Vereins <strong>für</strong> Volkskunde 6 (1896)<br />
ders., Die deutsche Vorgeschichte: eine hervorragend nationale Wissenschaft, 7. Auflage,<br />
durch Anmerkungen ergänzt v. Werner FIüllc, Leipzig (Kabitsch) 1936<br />
Hermann Kownatzki, Grenzen des Provenienzprinzips, in: Archivalische Zeitschrift Bd.<br />
47(1951), 217-220<br />
Joseph Krayer, Denkmalschutz. Inaugural-Disscrtation, Rechts- und Staatswissenschafthehe<br />
Fakultät der Bayer. Julius-Maximihans-Universität Würzburg, Wurzburg<br />
1930<br />
K. Krieger, Der Weg der Statistik zum Volk, m: Allgemeines Statistisches Archiv 23<br />
(1933/34)<br />
Paul Ladewig, Politik der Bücherei, Leipzig (Wiegandt) 1912<br />
ders., Über Kataloge <strong>für</strong> das Publikum, in: ZfB 31 (1914), 285-297<br />
Karl Lamprecht, Initial-Ornamentik des VIII. bis XIII. Jahrhunderts, Leipzig (Dürr)<br />
1882<br />
ders., Vorwort, in: Internationale Ausstellung <strong>für</strong> Buchgewerbe und Graphik Leipzi.;<br />
1914. Halle der Kultur, amtlicher Führer<br />
1 ,ul Wilhelm v. I.ancizoile, Dcnkschnli über die Preußischen Staats-Archive nebst vet<br />
gleichenden Notizen über das Archivwesen einiger Iremder Staaten, Berlin 1S55<br />
tto Lerche, Die Kriegssammlungen der Deutschen Bücherei, Artikelserie in: Borser<br />
blau <strong>für</strong> den deutschen Buchhandel Nr. 272 v. 24. November 1914 ff (Nr. I - XII)<br />
Otto Lauffer, Das Historische Museum. Sein Wesen und Wirken und sein Unterschied<br />
<strong>von</strong> den Kunst- und Kunstgewerbe-Museen [vier Teile], in: Museumskunde. Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Verwaltung und Technik öffentlicher und privater Sammlungen, Bd. 111<br />
(Berlin 1907)<br />
Gottfried Wilhelm Leibni/, Von nützlicher Einrichtung eines Archivi [ fv1.ii bis |uni<br />
1680]; Entwurf} gewißer Staatstafeln (Frühjahr 1680); Einrichtung einer Bibliothek<br />
[November 1680]; Bestellung eines Registratur-Amts 11680], in: ders.. Politische<br />
Schriften, hg. v. Zentralinstitut f. Philosophie an der Akademie d. Wissenschaften der<br />
DDR, 3. Bd. (1677-1689), Berlin (Akademie-Verlag) 1986, 332-353 u. 376-381<br />
i.inz Friedrich Leitschuh, Das Germanische Nationalmuscum in Nürnberg, Bambci<br />
1890<br />
icorg Leyh, Systematische oder mechanische Autstellung?. " Zentralblatt <strong>für</strong> Bibln<br />
thekswesen, 31. Jg. (1914). 398-407<br />
1 ix l.evh, Organisation und Aufgaben des Bayerischen Kn chivs, in: Arcrmalist!<br />
Zeiischnh 37 (München 1928; ki.tu- Reprint: Nviulcln . 142 153<br />
aul Lindenberg (Hg.), Hindenburg-Denkmal <strong>für</strong> das deut Volk, Berl s . uerlai<br />
discher Verlag C A. Weller) 1925 ( : 1922]
DATI NRÄUM! '. LniK.M'UR- UNI) QuHl.lJNVlRZTICHNIS 1075<br />
Ludwig Lindcnschmit (Sohn), Beitrage zur <strong>Geschichte</strong> des Römisch-Germanischen<br />
Centralmuseums in Main/, in: lestschnil zur Feier des tun!zig)ähngen Bestehens des<br />
Romisch-Germanischen Ccntralmuseums zu Mainz, Mainz (v. Zabcrn) 1902, 1-72<br />
ders., Erinnerungen als Randverzierungen zum Charakterbild Ludwig Lindenschmits<br />
und zur <strong>Geschichte</strong> seines Lebenswerkes, in: Festschrift zur Feier des tünfundsiebzigjähnger»<br />
Bestehens cics Römisch-Germanischen Central-Museums zu Mainz 1927,<br />
Mainz (v. Zabcrn) 1927, 1-5!<br />
Wilhelm und Ludwig Lindenschmit, Das Germanische Todtcnlager bei Selzen in der<br />
Provinz Rheinhessen ('"I848], Reprint Mainz (v. Zabern) 1969, mit einem Vorwort v.<br />
Kurt Böhncr<br />
Woldemar Lippert, Archivausstellungen. Erfahrungen und Gedanken, in: Archivahsche<br />
Zeitschrift, 37. Bd., München 1928 (Reprint Nendeln 1975), 110-124<br />
Victor Loewe, Das Deutsche Archivwesen. Seine <strong>Geschichte</strong> und Organisation, Breslau<br />
(Priebatsch) 1921<br />
Ottokar Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13.<br />
Jahrhunderts, 2. Bd., Berlin (3. Aufl.) 1887<br />
1 lemrich Luden, Einige Worte über das Studium der vaterländischen <strong>Geschichte</strong>. Vier<br />
öffentliche Vorlesungen, Jena 1810<br />
Paul Marc, Bibliothekswesen, in: Angewandte Photographie in Wissenschaft und Technik,<br />
hg. v. Karl-Wilhelm Wolf-Czapek, Berlin (Union) 1911, IV, 57-76<br />
Conrad Matschoß / Werner Lindner (Hg.), Technische Kulturdenkmale, i. A. der Agncola-Gcsellschaft<br />
beim Deutschen Museum, München (Bruckmann) 1932<br />
Friedrich Ludwig Baron <strong>von</strong> Medem, Über die Stellung und Bedeutung der Archive im<br />
Staate, in: Jahrbücher der <strong>Geschichte</strong> und Staatskunst, hg. v. Karl Heinrich Ludwig<br />
Pölitz, Bd. 11, Leipzig 1830, 28-49<br />
ders., Zur Archivwissenschaft, in: Zeitschrift tur Archivkunde, Diplomatik und<br />
<strong>Geschichte</strong>, hg. v. L. F. Hofer, H. A. Erhard u. dems., Bd. 1 (1833/34), Hamburg<br />
(Pci-thcs) 1934, 1-51<br />
ders.. Über den organischen Zusammenhang der Archive mit den Vcrwaltungsbehor<br />
den, ebd., Bd. 2(1835), 1-28<br />
Friedrich Meinecke, Erlebtes 1862-1901, Leipzig (Kochler & Amelang) 1941<br />
Monumcnta Gcrmaniac Histonca. Dienststelle Pommcrsfcldcn 1945-48, Höchstadt<br />
(Mcns) 1948 [= Otto Meyer, Berichte an die Zentraldirektion der Monumcnta Germaniae<br />
I listorica liir die Zeit vom Kriegsende bis zum 31. März 1948]<br />
Heinrich Otto Meisner, Die Archivdiebstahle 1 laucks. Tatsachen und Folgerungen, in:<br />
Archivalische Zeitschrift 36 (1926), 178-187<br />
ders., Aktenkunde. Ein Handbuch <strong>für</strong> Archivbenutzer mit besonderer Berücksichtigung<br />
Brandenburg-Preußens, Berlin (Mittler) 1935<br />
ders., Urkunden- und Aktenlchre der Neuzeit, 2. Aufl. Leipzig 1952<br />
ders., Dokumentation und Archive, in: Dokumentation 1, Hett S (1954), 149-154<br />
ders., Archive, Bibliotheken, Literatur archnc. in: Archivalische Zeitschrift 50, 51 < '<br />
167-183<br />
rt Mercklc. Da- • König Friedrichs des Großen in Berlin. Aktcnrrubigc<br />
beschichte umi .mg des Monuments, Berlin (Hertz) 1894<br />
• i/ Grat Woltt \ i )er Kt leokunstschutz in den besetzten Gebieten Frankreichs<br />
und in bi _;anisation und Aufgaben, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege<br />
Jg. T' . Hett 3 4, 26 40
1076 DATKNRAUMK: LITHKATUK- UND QUMI.I.KNVKR/KICHNIS<br />
Albrecht Mcydenbauer, liin deutsches Denkmäler-Archiv. Iiin Abschlusswort zum<br />
zwanzigjährigen Bestehen der königlichen Messbild-Anstalt in Berlin, Berlin 1905<br />
ders., Handbuch der Messbildkunst. In Anwendung auf Baudenkmäler- und Reise-Aufnahmen,<br />
Hallc/Saalc 1912<br />
ders., Der gegenwärtige Stand der Meßbiidkunst, in: Zcntralblatt der Bauverwaltung Nr.<br />
84, Oktober 1921<br />
Adolf Michaelis, <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Archäologischen Instituts I 829-1 S79, hg. v.<br />
d. Ccntraldircction des Archäologischen Instituts, Berlin (Asher) 1879<br />
ders., Die Aufgaben und Ziele des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts, in:<br />
Preußische Jahrbücher, 63. Bd., Januar bis Juni 1889 (Berlin 1889), 21-51<br />
Ernst Mohrmann, Der Vater des Gedankens einer Deutschen Nationalbibliothek, in:<br />
Deutsche Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig:<br />
Urkunden und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung, 9. Ausg., Leipzig<br />
(Börscnvcrcin der deutschen Buchhändler) 1914<br />
ders., Der Gedanke der Deutschen Bücherei, in: Denkschrift zur Emwcihungsfcier der<br />
Deutschen Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig am 2.<br />
September 1916, Leipzig 1916, 10-20<br />
Christian Molbeeh, Über Bibliothekswissenschaft oder Einrichtung und Verwaltung<br />
öffentlicher Bibliotheken, nach der zweiten Ausgabe des dänischen Originals übers,<br />
v. H. Ratjen, Leipzig 1833<br />
Theodor Mommsen. Tagebuch der französisch-italienischen Reise 1844/1845. hg. v. G.<br />
u. B. Walser, Bern u. Frankfurt/M. 1976<br />
ders.. Romisches Staatsrecht, 1. Bd., Leipzig M887<br />
Friedrich Carl Ferdinand Freiherr <strong>von</strong> Muftling (gen. Weiß), Aus meinem Leiten, Berlin<br />
1851<br />
ders. [C. v. W.], Die preußisch-russische Campagnc im Jahr 1813 <strong>von</strong> der Eröffnung bis<br />
zum Waffenstillstände vom 5. Juni 1813, Breslau u. a. 1813<br />
Adam Müller, Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland,<br />
mit einem Essay und einem Nachwort <strong>von</strong> Walter Jens, Frankfurt/M. (Insel) 1967<br />
Ernst Müller, Die Auflösung des Preußischen Staatsarchivs zu Wetzlar, in: Archivalisch<br />
Zeitschrift 37(1928), 132-141<br />
Ernst Müsebeck, Der systematische Autbau des Rcichsarchivs. in: Preußische Jahrbüclu<br />
191 (Jan.-März 1923), 294-318<br />
ders., Die nationalen Kulturaufgaben des Reichsarchivs, in: Archiv tur Politik uno<br />
<strong>Geschichte</strong> 2, Heft 10 (1924), 393-408<br />
ders.. Der Einfluß des Weltkrieges auf die archiv alische Methode, in: Archivalische Zeitschrift<br />
38 (= 3. Folge, V. Bd.) 1929, 135-150<br />
S. Muller / J. A. Feith / R. Fruin, Anleitung zum Ordnen und Beschreiben <strong>von</strong> Archiven,<br />
<strong>für</strong> deutsche Archivare bearbeitet v. Hans Kaiser, mit e. Vorwort v. Wilh. Wiegand,<br />
Leipzig (Harrassowitz) / Groningen (van der Kamp) 1905<br />
Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften [*1930], Ausgabe Reinbek (Rowohlt) 1978<br />
hto Neurath. BiK ! • • -• k nach Wiener Methode in der Schule, Wien / Leipzig 1933<br />
erv, WisscnscH \ Auffassung, Sozialismus und Logischer Empirismus, hg<br />
Rainer Hegsi•: nkhirt/M. (Suhrkamp) 1979<br />
Not unlui g, ! heken aul dci BU(>RA, m: /cntr.ilblati dir Bihlioihcksvt.<br />
sen, 29. Jg., i: 2), 533-535
DATI-NKAUMK LlTKKATl'R- UNI) QuHU.l-NVHR'/.i; IO1NIS 1077<br />
Hermann üncken. Aus Rankes Frühzcit, Gotha (Pcrthes) 1922<br />
Gabor Orosz, Übersicht über die Problematik der Dokumentationsselektoren, in:<br />
Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische Dokumentationsarbeit 1, Heft 9 (November<br />
1954), 173-178<br />
Wilhelm Ostwald, Das einheitliche Weltformat, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandei<br />
Nr. 243 v. 18. Oktober ivi i, Nichtamtlicher Teil, i2350-i2333<br />
ders.. Der energetische <strong>Im</strong>perativ, 1. Reihe, Leipzig (Akademische Verlagsgcsellschaft)<br />
1912<br />
der.. Das Gehirn der Welt, München (Die Brücke) 1912<br />
ders., Monistische Sonntagspredigten, Leipzig 1912<br />
Ludwig Freiherr <strong>von</strong> Pastor, Tagebücher, Briefe, Erinnerungen, hg. v. Wilhelm Wühr,<br />
Heidelberg (Kerle) 1950<br />
Albert Paust, Zum fünfundsicbzig)ährigen Bestehen des Germanischen Nationalmuscums,<br />
in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhandel, Jg. 94, Nr. 190 u. 208 (1927), 1<br />
ders., Die Idee einer deutschen Rcichsbibhothek. Zur Vorgeschichte und Gründung der<br />
Deutschen Bücherei, Gesellschaft der Freunde der Deutschen Bücherei, Leipzig 1933<br />
ders., Die Reichsbibliothek <strong>von</strong> 1848 und die Deutsche Bücherei, Leipzig (Gesellschaft<br />
der Freunde der Deutschen Bücherei) 1938<br />
ders., Die Kriegssammlungen der Deutschen Bücherei 1914 und 1939, Gesellschaft der<br />
Freunde der Deutschen Bücherei, Leipzig 1940<br />
Friedrich Christoph Perthes, Der deutsche Buchhandel als Bedingung des Daseyns einer<br />
deutschen Literatur, Hamburg 1816. Wiederabdruck als Anhang in: Helmut Hillcr /<br />
Wolfgang Strauß (Hg.), Der deutsche Buchhandel. Wesen, Gestalt, Autgabe, Hamburg<br />
(Verlag <strong>für</strong> Buchmarkt-Forschung) 1975; separat in der Ausgabe Stuttgart<br />
(Reclam) 1995<br />
Georg Heinrich Pertz, Italienische Reise, Hannover 1824<br />
ders. u. a. (Hg.), Monumcnta Germaniae Histonca (Scriptores m Folio) 1: Annalcs et<br />
chronica aevi Carohni, Hannover (Hahn) 1826; Nachdruck 1976<br />
ders., Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, 6 Bde. (* 1823-1831), Ausgabe Berlin<br />
(Reimer) 1849ff<br />
ders.. Die Königliche Bibliothek /u Berlin in den Jahren IS42 bis 1S67, Berlin (Schade)<br />
1867<br />
J. v. Pflugk-Harttung, Über die Herstellung der neuesten Abbildungen <strong>von</strong> Urkunden,<br />
in: Historische Zeitschrift 53 (1885), 95-99<br />
Ferdinand Piper, Einleitung in die Monumentale Theologie, Gotha 1867, Nachdruck<br />
Mittenwald (Mäander) 1978, mit einer Einleitung <strong>von</strong> Horst Bredekamp<br />
Walter Porstmann, Normenlehre. Grundlagen, Reform und Organisation der Mals- und<br />
Normensysteme. Dargestellt <strong>für</strong> Wissenschaft, Unterricht und Wirtschaft, Leipzig<br />
(Haase) 1917<br />
ders . K.irtcikunde P.T- Handbuch der Karteitechnik, 2. Auf. Stuttgart (Verlag <strong>für</strong> Wirts<br />
and " ^28<br />
Ern ».ncr, au des Geheimen St,i.uvir. u v^ m Ber!" Dahlem, in: Archivai<br />
/eil- l '2>). 23-39<br />
! ! .rieim. _ .^phische Reconv tiimp i. in: Verhandlungen<br />
ivsikalischen Gesellschaft /u Hi M, U i cip/ig (Barth) 1894,
1078 DATI-.NRÄUMK: LITIRATUK- UND QUI.I.LKNVIIRZKICHNIS<br />
Leopold <strong>von</strong> Ranke (Hg.), Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Freiherrn <strong>von</strong> Hardenberg,<br />
Bd. I-IV, Leipzig (Duncker & Humblot) 1877<br />
Paul Ortwin Rave, Die Anfänge der Denkmalpflege in Preußen. Ein Urkundenbericht<br />
aus der Zeit vor hundert Jahren, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, }g. 1935,<br />
34-44<br />
Oswald Redlich, Theodor Mommsen und die Monumenta Germaniae, in: ciers.. Ausgewählte<br />
Schriften, Zürich / Leipzig /Wien (Amalthea) 1928, 141-155<br />
Heinrich Ricken, Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Tübingen (Mohr), 2. Aufl.<br />
1910<br />
Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Wien /<br />
Leipzig (Braumullcr) 1903, 38<br />
Wilhelm Heinrich Riehl, Ueber den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Vortrag in der<br />
öffentlichen Sitzung der kgl. Akademie der Wissenschaften, München 1864<br />
ders., Die Naturgeschichte des deutschen Volkes, zusammengefaßt u. hg. v. Günther<br />
Ipsen, Leipzig (Kröner) 1935 ['•'Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer<br />
deutschen Social-Politik]<br />
Gerhard Rodenwaldt, Archäologisches Institut des Deutschen Reiches 1829-1929, Berlin<br />
(de Gruyter) 1929<br />
Helmut Rogge, Das Reichsarchiv, in: Archivalische Zeitschrift 35(1925), 119-133<br />
Karl Rosenkranz, Georg Friedrich Wilhelm Hegels Leben, Berlin 1844<br />
K. Rüdiger, Deutsche Größe. Ein Beispiel künstlerischer Ausstcllungsgcstaltung, in: Die<br />
Kunst im Deutschen Reich 5, Heft 1 (1941), 36ff<br />
Gustav Rümclin, Zur Theorie der Statistik I. 1 863, in: ders.. Reden und Autsätze, Tübingen<br />
(Laupp) 1875, 208-IM<br />
Dietrich Schafer, Das Preußische Historische Institut in Rom und die deutsche<br />
Geschichtswissenschaft, in: Internationale Monatsschrift <strong>für</strong> Wissenschaft Kunst und<br />
Technik, S. Jg., Nr. 4 (Jnu.u 1914). Sp. 394-420<br />
Egmond Schieisen, Der deutsch-französische Krieg 1870/71 m Wort und Bild, Reutlingen<br />
(Enßlin & Laiblin) <br />
A. L. Schlözcr, Theorie der Statistik, Göttingen 1804, Bd. 1<br />
Hans Schnorr <strong>von</strong> Carolsfcld, Deutsche Nationalbibliothek. Königliche Bibliothek und<br />
Königliche Hof- und Staatsbibliothek München, in: ZfB 30 (1913), 58-62<br />
Hubert Schrade, Das deutsche Nationaldcnkmal, München (Langen & Müller) 1934<br />
ders., Schicksal und Notwendigkeit der Kunst. Leipzig 1936<br />
Albert Schramm, Das Deutsche Buchmuseum zu Leipzig 1885-1925,-Leipzig (Deutsches<br />
Buchmuseum) 1925<br />
Heinrich Schreiber, Normung des Alphabets, in: Minverva-Zeitschrift, 6. Jg. Mai/Juni<br />
1930. Heft 5/6, 77-81<br />
Martin Schrettinger, Versuch eines voll igen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft<br />
als Anleitung zur vollkommenen < uftsführung eines Bibliothekars in wissenschaftlicher<br />
Form abgefaßt, 1. Bd. ; fetten) München 1808 u. 1810, 2. Bd. München<br />
1829<br />
ders., Handbuch der Bibhotheks-Wissenschaft, 1834<br />
Walther Schujtze, Schema des Sachkatalogs der Kncgssammlungder Pu '': sehen Staat<br />
bibliothek, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, 36. Jg., 5. u. 6. Hc<br />
: \9), 108-!.<br />
ders.. Die Katalogisierung der Kriegssammlungen, in: Mitteilungen ii rbands den<br />
scher Kriegssammlungen No. 2 (1920), 41-54
DATKNKÄUM!-:: LITERATUR- UND QUI-I.I.I-'NVI-KZKICIINI^ 1079<br />
ders.. Die Kriegssammlung, in: Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek, hg. v.<br />
d. wissenschaftlichen Beamten der Preußischen Staatsbibliothek, Berlin (Preußische<br />
Staatsbibliothek) 1921,77-89<br />
Karl Schumacher, Das Römisch-Germanische Central-Museum <strong>von</strong> 1901-1926, in: Festschrift<br />
zur Feier des fünfundsicbzigjähngen Bestehens des Römisch-Germanischen<br />
Ccniiai-MuSLürnä, Mainz (WücUcr.s) 1927, 57 97<br />
Ilse Schunkc, Die systematischen Ordnungen und ihre F.ntwicklung. Versuch einer<br />
geschichtlichen Übersicht, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen Jg. 44 (August 1927),<br />
377-400<br />
Paul Schwenke, Eine "Reichsbibliothek« ?, in: Zcntralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 2S<br />
(1911), 263-266<br />
ders., Deutsche Nationalbibliothek und Königliche Bibliothek, in: ZtB 29 (1912), 536-<br />
542<br />
ders., Die Einweihung der neuen Königlichen Bibliothek, in: ZfB 31 (1914) Heft 4, 145-<br />
162<br />
Johann Georg Seizingcr, Bibhotheks-Technik. Mit einem Beitrag zum Archivwesen<br />
[1855], 2. Ausgabe Leipzig (Costenoble) 1860<br />
Johannes Nepumuk Sepp, Meerfahrt nach Tyrus zur Ausgrabung der Kathedrale mit<br />
Barbarossa's Grab, Leipzig (Seemann) 1879<br />
Theodor v. Sickel, Monumenta Graphica medii aevi ex archivis et bibliothecis imperii<br />
Austnaci collccta edita jussu atque auspicus ministern eultus et publicae lnstructioms<br />
caes. reg. Vindobonac, neun Lieferungen 1859-1869, Schlußlieferung (10) 1882<br />
ders.. Romische Erinnerungen nebst ergänzenden Briefen und Aktenstücken, hg. v. Leo<br />
Santifaller, Wien (Universum) 1947<br />
Werner Sombart, Technik und Kultur, in: Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages<br />
[Oktober 1910 in Frankfurt/M.]. Reden und Vortrage. Tübingen (Mohr)<br />
1911 [Nachdruck Frankfurt/M. (Sauer & Auvermann) 1969], 63-83<br />
K. A. Sommer, Zur NS-Svstematik, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 56 (1939), 36S-<br />
370<br />
Louis Adalbert Springer, Die Neuaufstellung der vorgeschichtlichen Sammlungen des<br />
Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, in: Nachrichtenblatt <strong>für</strong> Deutsche Vorzeit,<br />
11. Jg. 1935, 199-204 (199f)<br />
Harold Steinacker, Diplomatik und 1 andeskunde. Etiautert am Stand der Forschung tür<br />
die östereichischen Alpenlander, in: Mitteilungen des Instituts <strong>für</strong> Österreichische<br />
Geschichtsforschung, XXXII. Bd., Innsbruck 191 1, 385-434<br />
F. ). Steinaecker, Das Filmauswcrtungsarchiv der Ufa, in: Der deutsche Film %•<br />
(1942/43), 14f<br />
Georg Steinhausen, in: Sigfried Steinberg (\ lg.). Die Geschichtswissenschaft der Ge>,<br />
wart in Selbstdarstellungen, Bd. 1, Leipzig (Meiner) 1925, 233-274<br />
Edmund E. Stengel, Über den Plan einer Zentralstelle <strong>für</strong> die Lichtbildaufnahme<br />
alteren Urkunden auf deutschem Boden. Nach einem Vortrag auf dem Deuts«.<br />
Archivtagc, in: Minerv tschntt. 6. Jg.. Marz/Apnl 1930, Heft 3/4, 33-36<br />
ders.. Das Deutsche Hist<br />
sehr. 14 Nr. 34 v. 1. D«.<br />
Dokumente zur Geschu<br />
Anjou. Teil I: Capitan.<br />
HJ. Sträube, Chr. P. >X<br />
Abhandlungen und Berichte, 2. Jg. Lieft 5)<br />
ie Institut in Rom 1888-1938, in: Forschungen u. !<br />
*S. 4CH<br />
.r Kastcllbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls 1<br />
. irb. v. Eduard S» Kurier, Leipzig 1912<br />
<strong>Im</strong> Beuth, Berlin VDI) 1930 (= Deutsches Muse,
1080 DATI NRAUMI.: LlTl.KATUR- UND Qui-i.l.KNVHR'/lJCHNIS<br />
William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, London 1844-1846; Reprint New<br />
York (DaCapo Press) 1969, mit einer Einführung <strong>von</strong> Beaumont Newhall)<br />
Gabriel Tarde, Les lois de l'imitation, Paris 1890<br />
Karl Themel, Wie verkarte ich Kirchenbücher? Der Aufbau einer alphabetischen Kirchenbuchkartei,<br />
hg. mit Unterstützung der Reichsstcllc <strong>für</strong> Sippenforschung, Berlin<br />
(Verlag <strong>für</strong> Standesamtwesen) l93b<br />
Friedrich Thimme, Die Aktenpublikationen des Auswärtigen Amtes und ihre Gegner,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Politik und <strong>Geschichte</strong>, 2. Jg. Heft 4/5 (1924), 467-478<br />
Hans Trebst (Hg.), Die Kataloge der größeren Bibliotheken des deutschen Sprachgebietes,<br />
Berlin (Schloss) 1935<br />
Heinrich <strong>von</strong> Treitschke, Die Königliche Bibliothek in Berlin, in: Preußische Jahrbücher<br />
53(1884), 473-492<br />
Heinrich Uhlendahl, Bibliotheken gestern und heute, Berlin (VDI) 1932<br />
ders., Die nationalen Bibliographien, in: Börsenblatt <strong>für</strong> den Deutschen Buchhhandel v.<br />
2. Januar 1936<br />
Hermann Usener, Philologie und Geisteswissenschaft [1882], in: ders., Vorträge und<br />
Aufsätze, Leipzig / Berlin (Teubner) 1907, 1-34<br />
Theodor Volbehr, Die Zukunft der deutschen Museen, Stuttgart (Schrecker & Schröder)<br />
1909<br />
Ludwig Volkmann, Deutsches Buchwesen und Schrifttum nach dem Kriege, in: Archiv<br />
<strong>für</strong> Buchgewerbe 53 (Sept.-Ükt. 1916), Heft 9/10, 218-222<br />
ders. , Zehn Jahre nach der »Bugra«, in: Leipziger Kalender. Illustriertes Jahrbuch und<br />
Chronik, hg. v. Georg Merseburger, 12. Jg. (1925), Leipzig/Regensburg (Habbel &<br />
Naumann), 23ff<br />
Bernhard Vollmer, Die Entführung niederrheinischen Archiv-, Bibhotheks- und Kunstguts<br />
durch den französischen Kommissar Maugcrard, in: Annalcn des historischen<br />
Vereins <strong>für</strong> den Niederrhein, Köln 1937, 120-132<br />
R. Volz, Ein deutsches Reichsfilmarchiv, in: Der Bildwart. Blatter <strong>für</strong> Volksbildung, Heft<br />
11 (November 1925), 794-796<br />
Wilhelm Wattenbach, Deutschlands Geschiciitsqueüeii im Mittelalter bis zur Mitte UL<br />
dreizehnten Jahrhunderts, 2 Bde, 3. umgearbeitete Auflage, Berlin (Wilhelm Hertz<br />
1873<br />
Franz Weber, Die vorgeschichtlichen Denkmale des Königreiches Bayern, Bd. 1, Mun<br />
chen (Kgl. Gencralkonservatonum der Kunstdenkmale und Altertümer Bayern;<br />
1909<br />
Arpad Wcixlgärtner, <strong>Geschichte</strong> im Widerschein der Rcichskleinodicn, Baden b. Wien<br />
Leipzig (Rohrer) 1938<br />
Ludolf Wienbarg, Ästhetische Fcldzute 'Hamburg 1834), Neuauflage Berlin Weim.i<br />
(Au 1%4<br />
Rudolf >cn, 1 cubau des I kvt hivs Potsdam, in: Archivalischc Zcitschn'<br />
45 . 7-l=><br />
Friedru . A ilken, .dichte der Bild Beraubung und Vernichtung der .Uten He<br />
delbergischen irsammlungen. i/ibcrg 1817<br />
ders., <strong>Geschichte</strong> j,; Königlichen Bibiu : iek zu Berlin, Berlin (Duncker & Humbio!<br />
1828
DATI-:NKAUMI-.: LITERATUR- UND QUOII NVF.RZI.ICHNIS 1081<br />
Felix Wolff (Hg.), Kaiserliches Denkmal-Archiv zu Straßburg, Straßburg (Trübner) 1905<br />
ders., Einrichtung und Tätigkeit der staatlichen Denkmalpflege im Elsaß in den Jahren<br />
1899-1909, Straßburg (Beust) 1909<br />
ders., Denkmaiarchive. Broschüre des gleichnamigen Vortrags, gehalten auf dem 1.<br />
Denkmalarchivtag in Dresden am 24. September 1913, Berlin (Wilhelm Ernst & Sohn)<br />
1913<br />
Artur Zechel, Das Sippenamt <strong>für</strong> Böhmen und Mähren, in: Familie, Sippe, Volk Bd. 10<br />
(Berlin 1943), 86ff<br />
J. Zenncck, Oskar <strong>von</strong> Muller. Berlin (VDI) 1934 (= Deutsches Museum. Abhandlungen<br />
und Berichte, 6. Jg., Heft 2)<br />
Ezcchiel Zivier, Eine archivische Informationsreise, in: Monatsschrift <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und<br />
Wissenschaft des Judentums, 49. Jg. (= N. F. 13. Jg.) 1903,209-254<br />
Konrad Zuse, Fmige Gesichtspunkte der Entwicklung programmgesteuerter Rechenanlagen<br />
in den letzten 20 Jahren, in: Allgemeines Statistisches Archiv 1959, 334-340<br />
Sekundärliteratur<br />
Johanna Aberle / Ina Prescher, Die Urkundensammlung des Historischen Seminars der<br />
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Rückblick und Bestandsaufnahme, in:<br />
Friedrich Beck / Botho Brachmann / Wolfgang Hempel (Flg.), Archivistica docet.<br />
Beiträge zur Archivwissenschaft und ihres interdisziplinären Umfelds, Potsdam (Verl.<br />
f. Berlin-Brandenburg) 1999, 524-557<br />
Hubertus <strong>von</strong> Amelunxcn, Die aufgehobene Zeit. Die Erfindung der Photographie<br />
durch William i lenry Fox Talbot, Berlin (Nishcn) 1988<br />
Armin Adam / Martin Stingelm (Hg.), Übertragung und Gesetz. Grundungsmythen,<br />
Knegsthcatcr und Untcrwerfungsstratcgien <strong>von</strong> Institutionen, Berlin (Akademie) 1995<br />
H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland,<br />
Tübingen 1974<br />
Architekturphotogrammctric gestern - heute - morgen. Wissenschaftliches Kolloquium<br />
zum 75. Todestag des Begründers der Architekturphotogrammetnc Albrecht Mevdenbauer<br />
in der Technische Universität Berlin am 15. November 1996, hg. v. Jörg<br />
Albertz / Albert Wicdcmann, Berlin (Publikationsstelle der TU) 1997<br />
Götz Aly ' Karl Heinz Roth, Die restlose Erfassung. Volkszahlen, Identifizieren, Aussondern<br />
im Nationalsozialismus, Berlin (Rotbuch) 1984; überarbeitete Neuausgabe<br />
Frankfurt/M. (Fischer) 2000<br />
Hans Andrcc, Schwabacher Judcnlettern, in: Mittelweg 3f>, 7. Jg., Heft 3 (1998), 70-91<br />
Andnan-Wcrburg, Irmtraud Frfr. <strong>von</strong>. Das Germansiche Nationalmuseum. Gründung<br />
und Fruhzeit, Nürnberg (Germanisches Nationalmuscum! 2002<br />
Archivar und Historiker. Studien zur Archiv- und Gcsc<br />
Geburtstag <strong>von</strong> Heinrich (>tto Meisner, hg. v. d. Sta.v<br />
Staatssckretarut tur Innere Angelegenheiten (DDR), hu<br />
Christoph Asendort, Strome und Strahlen. Das langsame ^<br />
1900, Gießen (Anabas! 1989<br />
Aleida Assmann, Arbeit am national Gedächtnis. Eine ku<br />
Bildungsidee, Frankfurt/M. u. a..(Campus) 1993<br />
>>\visNcsncrutt. Zum f>5.<br />
•> Archivverwaltung im<br />
:;& LiH-ning) 1956<br />
i Ti der Materie um<br />
der deutschen
1082 DATKNRÄUMI-.: Lrn-.KATUR-UNU QIJ!-:I.I.I-NV! ; .H/]-IC}INIS<br />
dies./ Dietrich Harth (Hg.), Kultur als I.cbenswelt und Monument, Franfurt/M.<br />
(Fischer) 1991<br />
dies., Zur Metaphorik der Erinnerung, in: Kai-Uwe Hemken (Fig.), Gedächtnisbilder.<br />
Vergessen und Erinnern in der Gegenwartskunst, Leipzig (Reclam) 1996, 16-46<br />
dies., Ermnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München<br />
^Bcck^ 1999<br />
Autorenkollektiv unter Leitung <strong>von</strong> Helmut Rötzsch, Die Deutsche Bücherei - DKdeutsche<br />
Nationalbibliothck, in: Deutsche Bücherei 1912-1962. Festschrift zum fünfzigjährigen<br />
Bestehen der Deutschen Nationalbibliothek, Leipzig 1962, 1-1K<br />
Peter Badura, Die Verwaltung als soziales System. Bemerkungen zu einer Theorie der<br />
Verwaltungswissenschaft <strong>von</strong> Niklas Luhmann, in: Die Öffentliche Verwaltung 23,<br />
Heft 1/2 (Januar 1970), 18-22<br />
Dirk Baeckcr, Überlegungen zur Form des Gedächtnisses, in: Siegfried J. Schmidt (Hg.),<br />
Gedächtnis: Probleme und Perspektiven der interdisziplinären Gedächtnisforschung,<br />
Frankfurt/M. (Suhkamp) 1991, 337-359<br />
ders., Anfang und Ende in der Geschichtsschreibung , in: Bernhard Dotzler (Hg.),<br />
Techno-Pathologien, München (Fink) 1992, 59-85<br />
Stephen Bann, The Clothing of Clio: The Reprcsentation of History in nineteenth-century<br />
England and France, Cambridge (UP) 1985<br />
ders., Poetik des Museums. Lenoir und Du Sommerard, in: Jörn Rusen / W. F. / Heinrich<br />
Th. Grutter (Hg.), <strong>Geschichte</strong> sehen. Beiträge zur Ästhetik historischer Museen,<br />
Pfaffcnwcilcr 1986, 35-49<br />
Roland Barthes, Le discours de l'histoirc, dt.: Historie und ihr Diskurs, in: Alternative.<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Literatur und Diskussion 11 (1968), 171-180<br />
ders., Ecnrc, verbe intransitif? (1970), in: ders., 'uvres completes, Bd. II f 1966-1973), hg.<br />
v. Eric Marty, Paris (Scuil) 1994, 273-280<br />
1 lans-Joachim Bohr /Jürgen Kloostcrhuis (I lg.), Ludwig Freiherr Vincke: ein westfälisches<br />
Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, Münster (Selbstvcrl. des<br />
Vereins <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> und Altertumskunde Westfalens: Abt. Münster) 1994<br />
Dietz Bering, Der Name als Stigma: Antisemitismus im deutschen Alltag 1812-1933,<br />
Stuttgart (Klett-Cotta) 1987<br />
Peter Herz, Weitkrieg/Svstem Die »Knegssammking 1914« der Staatsbibliothek Berlin<br />
und ihre Katalogik, in: Krieg und Literatur V (1993) Nr. 10, 105-130<br />
ders.. Der deutsche Normenausschuß. Zur Theorie und <strong>Geschichte</strong> einer technischen<br />
Institution in: Armin Adam / Martin Stingelm (Hg), Übertragung und Gesetz. Grundungsmythen,<br />
Knegstheater und Unterwertungsstrategien <strong>von</strong> Institutionen, Berlin<br />
(Akademie) 1995,221-236<br />
ders., 0815. Ein Standard des 20. Jahrhunderts, Humboldt-Universität Berlin 1997, Diss<br />
masch.; in/wischen publiziert: München (Fmk) 2001<br />
Edwin Black, IBM und der Holocaust. Die Verstrickung des Wcltkon/e! die \<br />
br ider N nchen / Berlin (Propyläen) 2001<br />
Hot-« rek thek des Deutschen Archäologischen Institut^ Rom,<br />
A ! Forschung des Landes Nordrhein-Westfalcn (Geisteswiss.)<br />
4
DATr-Ni<br />
fiche-Ausgabe Marburg (Archivschule) 1997, 27-39<br />
ders., Johannes Papritz (1898-1992) und die Entwicklung der Archivwissenschaft nach<br />
1945, in: Der Archivar, Jg. 51, Heft 4 (1998), Sp. 573-588<br />
Reinhard Brühl, Entstehung und Konsolidierung des Reichsarchivs 1919-1923. F'in Beitrag<br />
zum Thema Generalstab und Militärgeschichtsschreibung, in: Zeitschrift <strong>für</strong><br />
Militärgeschichte, 7. Jg. Heft 4 (1968), 423-438<br />
lelicitas Buch, Ferdinand Quast und die lnventansation in Preußen, in: F.kkehard Mai<br />
•' Stephen Waetzold (Flg.), Kunstverwaltung, Bau- und Denkmalpolmk im Kaiserreich,<br />
Berlin (Mann) 1981,361-382<br />
Lothar Burchardt, Gründung und Aufbau des preußischen Historischen Instituts in<br />
Rom, in: QFIAB 59/1979, 334-391<br />
Peter Bunan, Das Germanische Nationalmuseum und die deutsche Nation, in: Das Gcrm.imsche<br />
N/inonalmuseum Nürnberg 1852-1977, hg. v. Bernward Deneke u. Rainei<br />
- ' hen 1978, 127-262<br />
|o> , Die Historischen Hiliiwiiscnschaftcn in Martnirjj(|7,-19,Jahrhunl<br />
ahn (Institut <strong>für</strong> Historische HHfswissenschaf 497 (= elementa<br />
min Burkn Helmut Henne (Hg.i. (ictmanistik als Kultur^ .*. hart. Hermanr<br />
Paul: 150 v irtstag und 100 Jahre Deutsches Wörterbuch. H .chweig (Ans ei<br />
Scientia) 199?
1084 DATI-NRÄUMK: LITKRATUR- UND QUI-:I.LI-:NVI RZWCHNIS<br />
Michael Burleigh, Albert Brackmann (1871-1952) Ostforscher: The Ycars of Retiremcnt,<br />
in: Journal of Contemporary History 23 (1988), 573-588<br />
ders., Germany turns eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich, Cambridge<br />
u. a. 1989<br />
Herbert Butterfield, Man on His Past: The Studv o\ the History of Historical Scholarsu;~<br />
r- U,:J,.„ /i r_: :... n \ K%CC<br />
Ladislaus Buzäs, Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuesten Zeit (1800-1945), Wiesbaden<br />
(Reichert) 1978<br />
David Cahan, Meister der Messung ( : An Institute tor an F.mpirc): die Physikalisch-<br />
Technische Reichsanstalt im Deutschen Kaisereich, Wcinheim / New York / Basel /<br />
Cambridge (VCH) 1992<br />
Rafael Capurro, Information. Ein Beitrag zur etymologischen und ideengeschichtlichen<br />
Begründung des informationsbcgriHs, München / New York / London / Paris (K G<br />
Säur) 1978<br />
Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Berlin (Merve) 1988<br />
Owen Chadwick, Catholicism and Historv: The Opening of the Vatican Secret Archives,<br />
Cambridge 1978<br />
M. T. Clanchy, From Memory to wntten Retord: Kngland, 1066-1307, (Cambridge, Mass.<br />
(Harvard UP) 1979<br />
Susan Crane, (Not) Wnting History: Rethinking the Intcrsections of Personal Historv<br />
and Collective Memory with Hans <strong>von</strong> Aufscss, in: History & Memory 8:1 (Spring<br />
/Summer 1996), 5-29<br />
dies., Collccting and Historical Consciousness in Larly Nineteenth-Centurv Germany,<br />
Ithaca / London (Cornell UP) 2000<br />
Jonathan Crary, Teehniques of the Observer. On Vision and Modermtv in the nineteenth<br />
Century, Cambridge, Mass. / London (MIT) 1990; dt.: Techniken des Betrachters.<br />
Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden (Verlag der Kunst) 1996<br />
David Crowther, Archacology, Material Culture and Museums, in: Susan M. Pearce<br />
(Hg.), Museum Studies in Material Culture, London 1988, 35-46<br />
Krnst Robert Curtius. Goethes Aktcnfuhrung, in: Die Neue Rundschau 62 (1951), 110-<br />
121<br />
Otto Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland: 1770 - 1990, München (Beck<br />
1993<br />
Karl Demeter, Das Reichsarchiv. Tatsachen und Personen, I rankturt/M (Bernhard i\<br />
Gracfc) 1969<br />
Bernward Dencke, Das System der deutschen Gcschichts- und Altertumskunde di-<br />
Hans <strong>von</strong> und zu Aufscss und die Historiographie im 19. Jahrhundert, in: Anzeigt<br />
des GNM 1974. Nürnberg 1974, 144-158<br />
ders. / Rainer Kahsnit/ (1 lg.), Das ( ui manische Nationalmuseum Nürnberg ISS2-1V<br />
Ben 'u seiner <strong>Geschichte</strong>, i iftrag des Museums. München (Deuts Kunv<br />
verl, '"8<br />
eque 1 -ida, A titrier Titc 1 h IM \ rnnc- i-'nedneh A. K Hg<br />
Aus mg des Geistes aus d eiste- nscli. Programme de- :str\jk<br />
tur \ ^, Paderborn/Muiuhin-Kerlin Stln li)|97S<br />
„rs., ,N Archive, Paris 19V5, dt.: Dem \ iv ver eben, ubers. v. \; Gon<br />
dek Naumann Berlin (Brinkmann & Böse) 199
DATI-:NRAUMI-.: LITERATUR- UND 1085<br />
Michael Diers (Hg.), Mo(nu)mente. Formen und Funktionen ehernerer Denkmäler, Berlin<br />
(Akademie) 1993<br />
Bernhard J. Dotzler, Papiermaschinen. Versuch über Gommunication & Control in Literatur<br />
und Technik, Berlin (Akademie) 1996<br />
D. P. Dymond, Archaeology and History. A plea for reconciliation, London 1974<br />
Reinhard Eize / Arnoid hsch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-<br />
1988, Tübingen (Niemeycr) 1990<br />
Gerhart FLndcrs, Probleme des Provenienzprinzips, in: Archivar und Historiker (Festschrift<br />
H. O. Meisner), Berlin 1956, 27-44<br />
1 lans-Magnus Fnzcnsbcrger, Baukasten zu einer Theorie der Medien, m: Kursbuch 20<br />
(1975), 159-182<br />
Hans Wilhelm Eppelsheimer, Die Dokumentation in den Geisteswissenschaften, in:<br />
Nachrichten <strong>für</strong> Dokumentation 2 (1951), 87f<br />
Arnold F'sch, Überlieferungs-Chance und Überheterungs-Zutall als methodisches Problem<br />
des Historikers, in: Historische Zeitschrift 240 (1985), 529-570<br />
ders., Deutsche Geschichtswissenschah und das mittelalterliche Rom Von Ferdinand<br />
Grcgonvius zu Paul Kehr, in: 1 lartmut Bookmann / Kurt Jürgensen (Hg.), Nachdenken<br />
über <strong>Geschichte</strong>. Beitrage aus der Ökumene der Historiker. In memonam<br />
Karl Dietrich Erdmann, Neumunster (Wachholtz) 1991, 55-76<br />
ders., Die Lage der deutschen wissenschaftlichen Institute in Italien nach dem Ersten<br />
Weltkrieg und die Kontroverse über ihre Organisation. Paul Kchrs "Römische Mission«<br />
1919/1920, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken<br />
72(1992), 314-373<br />
ders. / Andreas Kiesewctter, Süditalicn unter den ersten Angiovinen: Abschritten aus<br />
den verlorenen Anjou-Registcrn im Nachlaß F.duard Sthamer, in: Quellen und Forschungen<br />
aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 74 (1994), 646-663<br />
Michel Espagne, Französisch-sächsischer Kuiturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert.<br />
Eine Problemskizzc, in: Comparativ. Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und<br />
vergleichenden Gescllschaftsforschung 2/1992, 100-121<br />
Bernhard Fabian, Die Reiorm des preußisch-deutschen Bibliothekswesens in der Ära<br />
Althott: Fortschritt oder Wcichenstellung in eine Sackgasse"', in: vom Brocke (i Ig.)<br />
1991:425-441<br />
ders.. Der Staat als Sammler des nationalen Schrifttums, in: ders. (Hg.), Buchhandel -<br />
Bibliothek - Nationalbibliothek, Wiesbaden (Flarrassowuz) 1997, 21-52<br />
Norbert Fichtner, Informationsspeichcrung. Technik, Theorie, Weltanschauung, Berlin<br />
(Akademie) 1977<br />
Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Ertor<br />
M.hung.2. Aul! Rinn ( Rcgenbcigl l l >5|<br />
Willy Flach (H > Amtliche ittcn 'ttentlichung des Staats.uchivs Weimar,<br />
Bd. 1 ( "^keit im < 'Ticn - 'uim, Teil 1: Die Schritten der Jahre<br />
1776-r Wenn ..hlau C<br />
ders. ,(>•> ;.;hi\. wchü -J 1 liNtonk- 1 Studien zur Archivuml<br />
( n iuswiNNcn- /um h5. Gcbu . onllcin' Hto Meisncr), hg. \.<br />
d. Staat t Archiwei uing im Staatsstk- nat tur Inn \ngelcgenheiten der<br />
DDR, Berlin (Rütten & Loenmg) 1956, 45-71
1086 DATI-NRÄUMI-:: LITERATUR- UND QUI;LU:NVI{RZUICHNIS<br />
Christian Fleck / Albert Müller, »Daten« und »Quellen«, in: Österreichische Zeitschrift<br />
<strong>für</strong> Geschichtswissenschaften 8, Heft 1 (1997), 101-126<br />
Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften<br />
[ :: 1966], 9. Aufl. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1990<br />
ders., Archäologie des Wissens [ : 1969], Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1973<br />
ders., un »Fantastique« de ia bibiiotheque, ubers. v. Annchcse botond, in: ders., Schritten<br />
zur Literatur, München (Nymphenburgcr Verlagsbuchhdl.) 1974, 157-177<br />
ders., Andere Räume, in: Karlheinz Barck / Peter Gcntc / Heidi Paris / Stefan Richter<br />
(1 lg.), Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik, Leipzig<br />
(Reclam), 3. Aufl. 1993, 34-46<br />
Josef Fleckenstein, Paul Kehr. Lehrer, Forscher und Wissenschaftsorganisator in Göttingen,<br />
Rom und Berlin, in: Hartmut Bookmann / Hermann Wellenreuther (Hg.),<br />
Geschichtswissenschaft in Göttingen. Eine Vorlesungsreihe, Götingen (Vandcnhoeck<br />
& Ruprecht) 1987, 239-260<br />
Uwe Flcckner (Flg.), Die Schatzkammern der Mnemosyne, Dresden (Verlag der Kunst)<br />
1995<br />
Peter R. Frank (Hg.), Von der systematischen Bibliographie zur Dokumenation, Darmstadt<br />
(Wiss. Buchgescllschaft) 1978<br />
I lorst Fuhrmann, Die Sorge um dun rechten Text, in: ders., Einladung ins Mittelalter,<br />
München 1987<br />
ders., Goethe, Frankfurt und die Anlange der Monumcnta Germaniae 1 listonca, in:<br />
Jahrbuch des Freien Deutschen 1 lochstifts 1995, Tübingen (Niemever) 1995, 2-22<br />
ders., Gclehnenlcbcn. Über die Monumenta Germaniae 1 listonca und ihre Mitarbeiter,<br />
in: Deutsches Archiv 50 (Ausgabe zum 175jährigen Bestehen der MGH) 1995, 1-31<br />
ders., »Sind eben alles Menschen gewesen«. Gelehrtenleben im 19. und 20. Jahrhundert.<br />
Dargestellt am Beispiel der Monumenta Germaniae Historica und ihrer Mitarbeiter,<br />
München (Beck) 1996<br />
Manfred Gailus, Beihilfe zur Ausgrenzung. Die »Kirchenbuchstelle Alt-Berlin« in den<br />
jahren 1936 bis 1945, in: Jahrbuch <strong>für</strong> Antisemitismusforschung 2, Frankfurt/M. u.<br />
New York (Campus) 1993, 255-280<br />
Robert Galitz / Brita Reimers (I lg.), Abv M. Warburg: »Ekstatische Nymphe .. trauernder<br />
Flußgott«. Portrait eines Gelehrten, Hamburg (Dölling & Galitz) 1995<br />
Geoffrev J. Giles (I lg.), AitJiivists and Histonans, German I hstoneai Institute, Washington<br />
1996 (Occasional Papers No. 17)<br />
Josef Götz. Der Einsatz <strong>von</strong> technischen Hilfsmitteln und Maschinen aller Art (ohne<br />
elektronische Rechenanlagen) in der Statistik, in: Allgemeines Statistisches Archiv.<br />
Organ der Deutschen Statistischen Gesellschaft, 43. Bd. (München 1959), 341-347<br />
Werner Goez, »Barbarossas Taufschale« - Goethes Beziehung zu den Monumenta Germaniae<br />
historica und seine Erfahrung mit der Geschichtswissenschaft, in. Deutsches<br />
Archiv <strong>für</strong> Erforschung des Mittelalters, 50. Jg. Heft I (1994), 73-88<br />
Rudi Goguel. Über die Mitwirkung deutscher Wissenschaftler am Okkupationsrcgi<br />
in Polen im zweiten Weltkrieg, utv cht an drei Institutionen der deutschen (><br />
forschung, Berlin, Phil. Diss. I lm> t Universität 19f>4<br />
1 lermann Goidbrunner, Von der C .M .• i zur Via Aureha Antica: .-<br />
Bibliothek des Deutschen Historie . . Instituts in Rom, in: El/«.<br />
liK'hcn (i«>l/, i>,is
DATF.NKAUM!.: LlTLKATUR- UN!) Qui-.l.l.l-.NVI-.R/KICHNlS 1087<br />
Jack Goody, The Logic of Writing and :he Organization of Society, Cambridge u. a.<br />
(Cambridge UP) 1986<br />
Roben B. Gordon, Who Turned the Mechanical Ideal into Mechanical Reality ?, in: Technology<br />
and Culture 29, Heft 4 (1988 744-778<br />
Conrad Grau, Georg Heinrich Pertz (1795-1876) als Wissenschaftsorganisator. Dokumente<br />
über den ÄiUag und zur Froiesstonaiisieiunj; uei GCM-HILIUS« issenschak, ;n:<br />
Jahrbuch <strong>für</strong> <strong>Geschichte</strong> 37: Fortschritt und Reaktion im Geschichtsdenken der<br />
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hg. v. Hans Schleier, Berlin (Akademie) 1988, 177-<br />
204<br />
Karl Gnewank, Wissenschaft und Kunst in der Politik Kaiser Wilhelm 1. und Bismarcks,<br />
in: Archiv <strong>für</strong> Kulturgeschichte 34 (1952), 288-307<br />
Albrecht Grimm, 120 Jahre Photogrammetne in Deutschland. Das Tagebuch <strong>von</strong> Albrecht<br />
Meydenbauer, dem Nestor des Messbild-verfahrens, veröffentlicht aus Anlaß<br />
des Jubiläums 1858/1978, München / Düsseldorf (üldcnbourg) 1978<br />
Bernd Hagenau, Der deutsche Gesamtkatalog: Vergangenheit und Zukunft einer Idee,<br />
Wiesbaden (Harrassowitz) 1988<br />
Gerhard Hahn, Die Reichstagsbibliothek zu Berlin - ein Spiegel deutscher <strong>Geschichte</strong>,<br />
Düsseldorf (Drösle) 1997<br />
F. Gerald Harn u. a., 1s the Past Still Prologue? 1 hstory and Archival Fducation. in:<br />
American Archivist 56 (Fall 1993), 718ff<br />
Olaf Hamann, Die Sammlung »Krieg 1914«, in: »Krieg 1914«. hme Sondersammlung<br />
der Staatsbibliothek zu Berlin, Ausstellungskatalog Berlin (Staatsbibliothek) 1999, 7-<br />
28<br />
Reimer Hansen / Wolfgang Ribbe (Hg.), Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und<br />
20. Jahrhundert. Persönlichkeiten und Institutionen, Berlin / New York (de Gruyter)<br />
1992<br />
Wilfried Hausmann, Alexander Schnüttgcn und Paul Clemen, in: Hiltrud Wcstermann-<br />
Angerhausen (Hg.), Alexander Schnüttgcn. Colligite fragmenta nc pereant. Gedenkschrift<br />
des Schnüttgcn-Muscums zum 150. Geburtstag seines Gründers, Köln 1993.<br />
75-85<br />
1 lermann 1 lauke. Die Bedeutung der Säkularisation tur die bayerischen Bibliotheken, in:<br />
Jose! Kiuneiei / Manfred Trcm! (! lg.). Glanz und Hlend der alten Kloster: Säkularisation<br />
im bayerischen Oberland 1803, München (Süddeutscher Verlag) 1991, 87-97<br />
Hans Hausherr, Die Lücke in den Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers lursten <strong>von</strong><br />
Hardenberg, in: Archivar und Historiker (Festschrift H. O. Meisner), Berlin 1936,<br />
457-51C<br />
Heesen, Anke te, Das Archiv. Die Inventarisierung des Menschen, in: Der Neue Mensch.<br />
Obsessionen des 20 Jahrhunderts, hg. v. Nicola Lepp, Martin Roth u. Klaus Vogel,<br />
Katalog zur Aus mg im Deutschen Hvgicne-Museum Dresden v. 22. April bis 8.<br />
Augut 1999, Üv -n-Ruit (Cant7l 1W, 114-141<br />
K'hcitas Heimann .k. "Was übrig Da«- Museum Judischer Altertumer in<br />
I 1.1-k'uM W22 ' ' ••l-'k'll'-T- VI ! • •<br />
\X ; ' 1W>; T- ,n dei miü ,iiui<br />
i '•, Marbut _ .-ichrtc in d •U'ii i<br />
ScVi • :;.. . . \llSlluktui 1 Ilstoi isih i MHlv<br />
Raum, in: S. F.vl M>II> / de:- C. Khalt 1 i Konrad (1 lg), fr md Kuitui<br />
'43
1088 DATI-NRAUMK: LITERATUR- UND QUI-:I.I.I-:NVI-:K.ZT.K;HNIS<br />
des Ausstellens. Beiträge zur Praxis, Theorie und Didaktik des Museum, Wien (Universitätsverlag)<br />
1992,39-45<br />
Gerd Heinrich, Historiographie der Bureaukratie. Studien zu den Anfängen historischlandeskundlicher<br />
Forschung in Brandenburg-Preußen (1788-1837), in: Brandenburgischejahrhunderte.<br />
Festgabe <strong>für</strong> Johannes Schuitze zum 90. Geburtstag, hg. v. dcms.<br />
1 » n u n rugii, ULIIIII \tvuuti\
DATI-NRALIMI-.: LITI-.RAI'UK- U N D QI.M-I I I-NVI-R/I-K IINIS 1089<br />
Rainer Kahsnitz, Museum und Denkmal. Überlegungen zu Gräbern, historischen Freskenzyklen<br />
und Ehrenhallen in Museen, in: Bernward Deneke / ders. (Hg.), Das<br />
kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert. Vorträge des Symposions<br />
im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, München (Prestel) 1977, 152-175<br />
Franz Georg Kaltwasser, Von der »Bibliotheque du Roi« in Paris über die »Chur<strong>für</strong>stüche<br />
Hof- und NaüoiuilbibÜGthck- in München zur -Staatsbibliothek zu Beim -<br />
Preußischer Kulturbcsitz«. Über die <strong>Namen</strong> großer Forschungsbibliotheken, in:<br />
Daniela Lülfing / Günter Baron (Hg.), Tradition und Wandel: Festschritt <strong>für</strong> Richard<br />
Landwehrmeyer, Berlin (Staatsbibliothek) 1995, 67-81<br />
Stefan Kaufmann, Kommunikationstechnik und Kricgstührung 1815-1945. Stuten<br />
medialer Rüstung, München (link) 1996<br />
Rainer-Maria Kiel, Goethe und das Bibliothekswesen in Jena und Weimar, in: Bibliothek<br />
und Wissenschaft Bd. 15 / 1981, 11 -82<br />
Paul Kirn, Lesefrüchte zum Thema: Umgang mit Urkunden, in: Archivalischc Zeitschrift<br />
50/51 (1955), 239-244<br />
Wilhelm Kisky, Das Archiv der Rheinischen Provmzialverwaltung im Landeshaus in<br />
Düsseldorf, in: Rheinische Heimatpflegc. Zeitschrift <strong>für</strong> Museumswesen, Denkmalpflege,<br />
Archivberatung, Volkstum, Natur- und Landschaftsschutz, 10. Jg. 1938, 1 Ich<br />
3,342-345<br />
Friedrich W. Kistermann, Locatmg the Victims: The Nonrolc of Punched Card Technology<br />
and Ccnsus Work, in: 1F.F.K Annais of the Historv ot Computing 19, Heft 2<br />
(1997), 31-45<br />
Peter Kittel, Die Staatsbibliothek vu Berlin Preußischer Kuhurbesitz und ihr Alter Realkatalog,<br />
Berlin (SBB PK) 1994<br />
ders., Hin fast unbekanntes Dokument aus dem Archiv der Staatsbibliothek zu Berlin:<br />
Heinz Ahlcnstiels Denkschrift Ȇber die betriebstechnische Lage der Staatbibliothek<br />
(Herbst 1945)», in: Tradition und Wandel: Festschrift <strong>für</strong> Richard Landwehrmeyer,<br />
hg. v. Daniela Lülfing / Günther Baron. Berlin 1995 (StaBi), 101-107<br />
Friedrich A. Kittler, Über romantische Datenverarbeitung, in: Lrnst Behier / Jochen<br />
Hörisch (Hg.), Die Aktualität der Fruhromantik. München / Paderborn (Schöningh)<br />
1987,127-140<br />
ders., Aufschreibesysteme 1800/1900, 2. erw. u. korr. Auflage, München (Fink) 1987<br />
ders.. Das Subjekt als Beamter, in: Manfred Frank / Gerard Rauiet / Willem v. Renen<br />
(Hg.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1988, 401-420<br />
ders.. Die Nacht der Substanz. Bern (Benteli) 1989<br />
ders., Museums on the Digital Fronticr. in: Thomas Keenan (Hg.). The FncK nt<br />
Museum, Barcelona (Fondacion Tapies) 1996, 67-80<br />
ders., Hardware, das unbekannte Wesen, in: Lab. Jahrbuch <strong>für</strong> Künste und App.it<br />
1996/97, hg. v. d. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien. Köln (Verlag Walther König) 19 -<br />
348-363<br />
ders.. Alphabetische Öffentlichkeit und telegraphisches Geheimnis. Teiegraphie \<br />
LJ i bis imcrinj». in: htienne Francois u. a. (HR.), Marianne-Germania<br />
Di i-frar >cher Kulturtranster im europaischen Kontext, Leipzig (Leipziger<br />
l-i .itätM , 1998. Bd. 2,491-506<br />
ders, i Kult chichte der Kulturwissenschaft, München (Fink) 2000<br />
Lutz klinkhamnuT, Die Abteilung -kunsisthut/- der deutschen Milu.u Verwaltung in<br />
Italien 1943-1945, in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und<br />
Bibliotheken 72/1992, 483-549
1090 DATI-NRAUMI : LITIRATUK- UND QUI-I.I INVIKZIICI INIS<br />
Sebastian Klotz, Von der Musica Mundana zum Phonogrammarchiv. Das Archivieren<br />
<strong>von</strong> Klängen in seinen allegorischen und realen Dimensionen, in: Lab. Jahrbuch<br />
1996/97 <strong>für</strong> Künste und Apparate, hg. v. d. Kunsthochschule <strong>für</strong> Medien mit dem<br />
Verein der Freunde der KHM, Köln (Walther König) 1997, 33-48<br />
ders. (Hg.), »Vom tönenden Wirbel menschlichen Tuns«: Erich M. <strong>von</strong> Hornbostcl als<br />
Gestaltpsycholoee. Archivar und Musikwissenschaftler. Berlin / Milow (Schibri) 1998<br />
Hans Koeppen, Das Archiv des Deutschen Ordens in Preußen, seine Bestände und seine<br />
wissenschaftliche Bedeutung, in: Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin<br />
1966,172-185<br />
Wolfgang Kohrc, Gcgcnwartsgeschichthchc Quellen und moderne Überliefet ungsformen<br />
in öffentlichen Archiven, in: Der Archivar 8 (1955), Sp. 197-210<br />
Reiner Koppe, Zur <strong>Geschichte</strong> und zum gegenwärtigen Stand des Meßbildarchivs, in:<br />
Jörg Albcrtz / Albert Wtcdcmann (I lg.), Architckturphotogrammetne gestern - heute<br />
-morgen, Berlin 1497,41-57<br />
1 lans-Gcorg Kolbe (I lg.), Wilhelm 1 lenzen und das Institut aul dem kapitoi, Mainz<br />
(Philipp <strong>von</strong> Zabcrn) 1984<br />
Reinhart Koselleck, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht,<br />
Verwaltung und soziale Bewegung <strong>von</strong> 1791 bis 18148 ('"1966), 2. berichtigte Auflage<br />
Stuttgart (Klett) 1975<br />
ders.. Vergangene Zukunft. Zur Semantk geschichtlicher Zeiten, Frankfurt/M. (Suhrkamp)<br />
1979<br />
Markus Krajcwski, Zettelwirtschaft. Die Geburt der Kartei aus dem Geist der Bibliothek,<br />
Berlin (Kadmos Kulturverlag) 2002<br />
Hellmut Kretzschmar, Gedanken über Archivinventare, in: Archivalische Zeitschrift<br />
50/51 (1955), 185-191<br />
Klaus Krippendorf, Principles of Information Storagc and Retneval in Society, in: Geiu<br />
ral Systems Bd. 20(1975). 15-34<br />
Meia Kuhnkc, Biographie ('ai I Wilhelm ('.nsm.iis, in: ( .ii I Wilhelm ( .ONMUI, (leschichtdes<br />
königlich-Preußischen Geheimen Staat-*- und kulnnelluicliivs, hg. \. Meta kuhnkc,<br />
Köln / Weimar / Wien (Bohlau) 1993<br />
Horst Kunze / Werner Dube, Zur Vorgeschichte der Deutschen Staatsbibliothek, in:<br />
Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961, Bd. 1, Leipzig 1961<br />
Renate Lachmann, Kulturscmiotischcr Prospekt, in: Anselm Haverkamp / dies., Memo<br />
ria. Vergessen und Erinnerung (= Poetik und Hermeneutik Bd. 15), München (Fink<br />
1993, xvu-xxvn<br />
! I. La Fontaine / Paul Otlet, Die Schaffung einer Umversalbibliographie [1895], in: Peter<br />
R. Frank (Hg.), Von der systematischen Bibliographie zur Dokumcnation, Darmstadt<br />
(Wiss. Buchgcscllschaft) 1978, 143-169<br />
Mtred Langer, Künstlerischer Schmuck und vollendete Zweckmäßigkeit: Architektur<br />
und künstlerischer Schmuck der Deutschen Bücherei, Leipzig (Deutsche Bucherei'<br />
1986<br />
ilther Latzke, Die Registraturen der Reichsmimstcricn der Provisorischen Zentrale<br />
walt - 49. in: Der Archivar 8 (I 1 - Sp. 187-198<br />
dolf , Die Fchrsche rechtsaret fische Bildsammlun Gregor Richte<br />
{Hu .is der Arbeit des Archiv. estschnft <strong>für</strong> Eberh. iiinncr, Stuttgai<br />
(Koi irner) 1986, 361-374<br />
Leesch, Das Institut <strong>für</strong> Archivwissenschaft und geschichtswissenschaftlich
•NKAUMi : I.ITI-KM'UR- l!\il> Ql'l-1 ! i WTRZI-K'I IN IS 1091<br />
Fortbildung (IfA) in Berlin-Dahlem (1930-1945), in: Gerd Heinrich / Werner Vogel<br />
(Hg.), Brandenburgische Jahrhunderte. Festgabe <strong>für</strong> Johannes Schultxe zum 90.<br />
Geburtstag, Berlin (Dunckcr & J lumblot) 1971, 219-254<br />
Jacques Le Goff, Stona e memona, Turin (Einaudi) 1982<br />
Joachim Lehmann, Von Stal.sfurt und Schönebeck nach Merseburg. Nachknegsschick-<br />
Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Selbstverl. des Geh. Staatsarchivs<br />
PK) 1996,131-154<br />
Andre Leroi-Gourhan, Hand und Wort: die Evolution <strong>von</strong> Technik, Sprache und Kunst,<br />
übers, v. Michael Bischoff, Frankfurt/M. (Suhrkamp) 19X8<br />
Achim Leube, Zur Ur- und Frühgeschichtsforschung in Berlin nach dem Tode Gustat<br />
Kossinnas bis 1945, in: Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 39, Heft 3/1998,<br />
373-428<br />
Georg I.eyh (1 lg.), 1 landbuch <strong>für</strong> Bibliothekswissenschaft, 2. vermehrte u. überarbeitete<br />
Autlage Wiesbaden (1 larrassowitz) 1961<br />
David F. Lindcnteld, The practical <strong>Im</strong>agination: the German science ot State in the nmeteenth<br />
Century, Chicago / London (University of Chicago Press) 1997<br />
Jurij M. Lotman, Das dynamische Modell eines semiotischen Sytems, in: ders., Kunst als<br />
Sprache. Untersuchungen zum Zeichencharakter <strong>von</strong> Literatur und Kunst, Leipzig<br />
(Reclam jun.) 1981,89-110<br />
ders. / B. A. Uspenskij, Zum semiotischen Mechanismus der Kultur [1971], in: Scmiotica<br />
Sovietica, hg. v. Karl F.imermacher, Bd. 2. Aachen (Rader) 1986, 853-880<br />
David Martin Luebkc / Svbil Milton, Locating the Victim: An Overview ot Census-<br />
Taking, Tabulation Technology, and Persccution in Nazi Gcrmanv, in: IEEE Annais<br />
of the History of Computing 16, Heft 3 (1994), 25-39<br />
Carl August I.ückerath, Prolegomena zur elektronischen Datenverarbeitung im Bereich<br />
der Geschichtswissenschaft, in: l listorische Zeitschrift 207. Bd. (1968), 265-296<br />
All l.udike, I' iscnbahnl.ihien mul I iscnbahnbau, in: l.ut/ Niethammer u. a., Bürgerliche<br />
Gesellschaft m Deutschland. I listorische Einblicke, tragen, Perspektiven, Frankfurt/Main<br />
1990, 101-119<br />
Niklas Luhmann, Gleichzeitigkeit und Synchronisation, in: ders.. Soziologische Autklärung<br />
5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990, 95-130<br />
ders., Kommunikation mit Zettelkästen: Ein Erfahrungsbericht, in: ders.. Universität iK<br />
Milieu, Bielefeld (Haux) 1992, 53-61<br />
Meinhold I.urz, »Lieblich ertönt der Gesang des Sieges«. Projekte und Denkmäler der<br />
Völkerschlacht bei I eipzig aus den Jahren <strong>von</strong> 1814 bis 1X44, in: kritische berichte<br />
3/1988, 17-32<br />
(ieorg Lutz, Die Nuntiaturbenchte und ihre Edition, in: Elze / Esch 1990: 87-122<br />
! t .in7 Manek, Bildmessung und De/imalklassifikation, in: Dokumentation I (1954^ Heft<br />
S. 160-167<br />
cl M Das Konzenti. lls h rbercsietutjdt - Ein Dokumentärem<br />
i '^ indischen Su net, H 1/ Bauer Institut i'Hg.), Auschwitz.<br />
( i'ran i. M. / New Yo .-.mpus! 19% (=<br />
| .-- irkuf . Holocaust). 31<br />
Mai Mcl<br />
) 197;<br />
;sciien Kanäle estandtng Med >usseldort u. a.<br />
Peter Marx / Eckart Pankoke, Publizität und Enthusiasmus. Staatsreprasentation und
1092 DATI-NKÄUMI:: LITKRATUR- UND Quiji.i.i-Nvr.R/.i-ici INIS<br />
romantische <strong>Im</strong>agination in der »deutschen Bewegung« 1789-1815, in: Jörg-Dieter<br />
Gauger/Justin Stagl (Hg.), Staatsrcpräscntation, Berlin (Reimer) 1992, 89-104<br />
Heinrich Otto Meisner, Archive und Museen, in: Archivmitteilungen 2/1957, 38-41<br />
ders., Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig (Kcohlcr & Amclang)<br />
1969, 941<br />
Ursula Mende, Zu einer deutschen Nationalbibliothek: Die Frankfurter Parlamentsbibliothck<br />
und das Nationalmuseum, in: 1848: Das Europa der Bilder, hg. v. Germanischen<br />
Nationalmuseum, Bd. 2: Michels März, Ausstellungskatalog (Verlag des GNM)<br />
Nürnberg 1998,315-319<br />
dies., Das Germanische Nationalmuseum, die Monumenta Germaniae historica und die<br />
Bibliothek der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Zur Vorgeschichte<br />
einer deutschen Nationalbibliothek, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums<br />
1999,203-225<br />
Wilfried Menghin, Die vor- und frühgeschichtliche Sammlung, in: Deneke / Kashnitz<br />
1978: 666-671<br />
ders., Obcrflacht: Zwischen Walhall und Paradies, im Ausstellungskatalog: Zwischen<br />
Walhall und Paradies. Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in<br />
Zusammenarbeit mit dem Museum <strong>für</strong> Vor- und Frühgeschichte SMPK, Sept.-Nov.<br />
1991 Zeughaus Berlin Undcr den Finden, Dl IM GmbH 1991, 81-84<br />
Angelika Mennc-1 lantz. Das Provcnicnzprmz.ip - ein Bewertungssurrogat? Neue Fragen<br />
zu einer alten Diskussion, in: Der Archivar 47, Heft 2 / 1994, 230-252<br />
dies.. Online-fähige Repertonen? Einige Überlegungen zur Interaktivität <strong>von</strong> Archivfindmitteln,<br />
in: Der Archivar 49 (1996), Sp. 603-610<br />
dies., Schriftgut oder Dokumente - Was sind die Spuren automatisierter Verwaltungsarbeit?,<br />
in: Archivalische Zeitschrift 79 (1996), 1-36<br />
Uwe Meves, Barthold Georg Niebuhrs Vorschläge zur Begründung einer wissenschaftlichen<br />
Disziplin »Deutsche Philologie« (1812-1816), in: Zeitschrift <strong>für</strong> Deutsche Philologie<br />
104 (1985), 321-356<br />
Rudolf Meyer (1 lg.), Albrecht Meydenbauer. Baukunst in historischen Fotografien, Leipzig<br />
1985<br />
Jörg Jochen Müller, Die ersten Germanistentage, in: ders. (Hg.), Germanistik und deutsche<br />
Nation 1806-1848. Zur Konstitution bürgerlichen Bewußtseins, Stuttgart (Metz-<br />
Icr) 1974,297-318<br />
Iorsten Musiai, Archive im Dritten Reich. Zur <strong>Geschichte</strong> des Staatlichen Archivwcsens<br />
in Deutschland 1933-1945, Diss. I lumboldt-Universitat Berlin 1994<br />
Walter Nissen, Das Schicksal der ausgelagerten Bestände des Preußischen Geheimen<br />
Staats-Archivs und des Brandenburg-Preußischen Haus-Archivs und ihr heutiger<br />
Zustand, in: Archivalische Zeitschrift 49 (I9S4), 139-148<br />
' :s.. Zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsarchividee im 19. Jahrhundert, in: Archivar und Histoiker.<br />
Studien zur Archiv- und Geschichtswissenschaft (Festschrift Heinrich Otto<br />
Meisner), hg. v. d. Staatl. Archivverwaltung im Staatssekretariat <strong>für</strong> Innere Angelegenheiten<br />
[DDR], Berlin (Rutten & Locnmg) 1956. 162-175<br />
i ie Nora, Zwischen <strong>Geschichte</strong> und Gedächtnis, Berlin (\\ bach) 1990<br />
ies M. Nyce ' Paul Kahn, A Machine for the Mmd: Vanne^ \h's Memex, in<br />
Hg), From Memcx to Hypertext: Vanncvar Bush and <strong>Im</strong>d's Machmv,<br />
)iego / London (Academic Press) 1991, 39-66
DATI-NRAUMI-: LITERATUR- UND QUI-J.I.I-NV!-;RZI-:K:H\IS 1093 1<br />
Willi Oberkrome, Volksgeschichtc: methodische Innovation und völkische Ideologisicrung<br />
in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1945, Göttinnen (Vandenhock &<br />
Ruprecht) 1993<br />
Helmut Otto, Der Bestand Kricgsgeschichthchc Forschungsanstalt des Heeres im Bundesarchiv-,<br />
Militärisches /.wtschcnarchiv Potsdam, in: Militargcschichtlichc Mittcihinj-<br />
51 MW?) I li_-ft 2, 42 l '-JJ!<br />
Johannes Papntz, Archivwissenschaft, 2. durchges. Ausgabe Marburg (Archivschule)<br />
1983; Mikrofiche-Ausgabe Marburg (Archivschule) 1997<br />
Pasqualc Pasquino, Politisches und historisches Interesse. »Statistik« und historische<br />
Staatslehre bei Gottfried Achenwall (1712-1772), in: Hans Erich Bödcckcr u. a. (Hg.),<br />
Aufklärung und <strong>Geschichte</strong>: Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18.<br />
Jahrhundert, Gottingen (Vandcnhoeck & Ruprecht) 1986, 144-168<br />
Kurt Passow, Das »Maschinelle Benchtswesen- als Grundlage <strong>für</strong> die Führung im 11.<br />
Weltkrieg, in: Wehrtechnische Monatshefte, 62. Jg., Heft 1-4 (1965), passim<br />
Fugen Paunel, Goethe als Bibliothekar, in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen, Jg. 63,<br />
Heft 7/8 (.Juli/August 1949). 235-269<br />
Jens Pctersen, Die Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten <strong>Geschichte</strong>, in: Elzc /<br />
Fsch 1990,21 1-238<br />
Marketa Petr.isovä, Collections ot tlie Gentral Jewish Museum (1942-1945). in: |ud.iica<br />
Bohemiae Jg. 24/1 (Prag 1988). 23-59<br />
Hans Petschar, Kulturgeschichte als Schachspiel: Vom Verhältnis der Historie mit den<br />
Humanwissenschaften. Variationen zu einer historischen Semiologie, Aachen (Rader)<br />
1986<br />
ders. / Ernst Strouhal / Hcimo Zobcrnig, Der Katalog. Ein historisches System geistiger<br />
Ordnung, Wien / New York (Springer) 1999<br />
Wolfgang Pircher, Das verführte Ohr. Rhetorik und die liebe zur Nation . in: Gerburg<br />
Trcusch-Dieter u.a. (I Ig.), Denkzettel Antike. Texte /um kulturellen Vci messen. V,<br />
im (Reimer) 19X9<br />
Karl Pivec, Die Stellung der I lilrsw isscnschattcn in der Gcschichtsw isscnschatt, in: •*•<br />
tcilungen des Österreichischen Instituts <strong>für</strong> Geschichtsforschung 54 (1941), 3-1^<br />
Volker Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790-187Q, München 1967<br />
Engelbert Piassmann, Bibiioihcksgeschichtc und Verfassungsgeschichte. Antnttsvo<br />
sung Humboldt-Universität zu Berlin, Philos. Fak. Institut <strong>für</strong> Bibhothekswisse<br />
schaft, 15. Januar 1997. Hrsg. vom Präsident der Humboldt-Universität zu Berlin<br />
1997 (Heft 84)<br />
ders.. Hundert fahre »Preußische Instruktionen«, Berlin (Logos) 2000<br />
Lothar Poethe, Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bücherei Leipzig,<br />
in: Hans Baier (Hg.), Medienstadt Leipzig, Leipzig 1992, 215-222<br />
Krzysztof Pomian, Les Archives. Du Tresor des chartes au Garan. in: Pierre Nora (Hi; .<br />
Lieux de memoirc. Bd. III (Les Irance), Paris (Galhmard) 1992. 163-2^<br />
Theo- M. P. I.awi v>cietv: Socul Si and the Reinterprei t<br />
Sti Gern \H^l in- Lorenz K- Lorraine ! Daston<br />
de<br />
35<br />
i-r(H hep- Evolution. hridge. M. MIT<br />
Kol.ti • •.er. Kultur als / tcm. Zur - tischen h \ üon !<br />
sc eher Grundbeg: Jeida ASM: 'Jürgen 1 ! (Hj;<br />
Lebenswclt und Monument, Franfurt/M. (Fischer) 1991, 34<br />
.)t St.<br />
hei f-i<br />
itl. 19<br />
rwiss<br />
ultur
1094 DATI-.NKÄUMI.: LI'I'I-.KATUK- UND QUH.I.KNVT.R/I-.ICIINIS<br />
Mohammed Rassem /Justin Stagl (Hg.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit,<br />
Paderborn u. a. (Schöningh) 1980; ferner dies. (Hg.), <strong>Geschichte</strong> der Staatsbeschreibung.<br />
Ausgewählte Quclicntexte 1456-1813, Berlin (Akademie) 1994<br />
Oskar Regele, Die Aktenskartierung im Wiener Kriegsarchiv in alter und neuer Zeit, in:<br />
Archivalische Zeitschrift Bd. 50/51 (1955), 2 I 7-221<br />
Joachim Rcx Karl RornharHi*; Gedanken zur Errichtung einer deutsche Nat:or.a!b;b!:o<br />
thek in der Periode des Heranreifens der bürgerlich-demokratischen Revolution<br />
(1843), in: Zentralblatt <strong>für</strong> Bibliothekswesen 81 (1967) 9, 530-535<br />
Thomas Richards, Archive and Utopia, in: Representations 37 (Winter 1992), 104-135;<br />
vollständig m: ders., The <strong>Im</strong>pcnal Archive. Knowledge and the Fantasy of Empire,<br />
London / New York (Verso) 1993<br />
Louis N. Ridenour, Computer Memones, in: Scientihc American 192, Heft 6 (Juni 1955),<br />
92-100<br />
Remigius Ritzler, Die Verschleppung der päpstlichen Archive unter Napoleon 1, in:<br />
Römische Historische Mitteilungen V1-VI1 (1962-64), 144-190<br />
Julius Rodenberg, Toter Buchstabe - lebendige Schrift, in: Die Korrekturfahne. Betriebszeitung<br />
der Deutschen Bücherei. Sondernummer aus Anlaß des 50jährigen Bestehens<br />
der Deutschen Bücherei am 3. Oktober 1962, 25-27<br />
Detlef Rößlcr, Kduard Gerhards »Monumentale Philologie«, in: Dem Archäologen<br />
Eduard Gerhard (1795-1867) zu seinem 200. Geburtstag, hg. v. Henning Wtede, Berlin<br />
1997 (Winckelmann-lnstitut der Humboldt-Universität 2), 55-61<br />
Johannes Rogalla <strong>von</strong> Bieberstein, Archiv, Bibliothek und Musem als Dokumentationsbereiche.<br />
Einheit und gegenseitige Abgrenzung, Pullach b. München (Verlag Dokumentation)<br />
1975<br />
Wilhelm Rohr, Die zentrale Lenkung deutscher Archivschutzmaßnahmen im Zweiten<br />
Weltkrieg, in: Der Archivar 3. Jg. Nr. 3 (Juli 1950), Sp. 105-122<br />
Heinrich Roloff, Aufstellung und Katalogisierung der Bestände, in: Deutsche Staatsbibliothek<br />
1661-1961, Bd. 1: <strong>Geschichte</strong> und Gegenwart, Leipzig (VFB Verlag Kr<br />
Buch-und Bibliothekswesen) 1961, 131-174<br />
Karl Heinz Roth, Eine höhere Form des Plünderiis. Der Abschlußbericht der »Gruppi<br />
Archivwesen« der deutschen Militärverwaltung in Frankreich 1940-1944, in: 199^<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Sozialgeschichtc des 20. und 21. Jahrhunderts, Heft 2/1989, Einleitung<br />
79-93<br />
Peter Rück (Hg.), Fotografische Sammlungen mittelalterlicher Urkunden in Europa<br />
<strong>Geschichte</strong>, Umfang, Aufbau und Verzcichnungsmcthoden der wichtigsten Urkun<br />
dcntotovammlungcn, Signunngm i'l'hoi bi-ikci I9SV, 141-15><br />
ders.. Palaographie und Ideologie: die deutsche Schrittwissensc hatt im Faktur-Antiqua<br />
Streit <strong>von</strong> 1871-1945. in: Signo. Revista de Historia de la Cultura F.scrita 1 (1994), IS<br />
33<br />
isabeth Rucker, Die Erwerbung des Goldenen Evangelienbuches <strong>von</strong> Echternach <strong>für</strong><br />
das Germanische Nationalmuscum Nürnberg, in: Rainer Kahnsitz / Ursula Mendt<br />
dies . Das Gold ' vangelun! .•nn Echternach. Eine Prunkhandschrift dell.J.<br />
nderts. Fr, n ' M. (S er) 1982<br />
v, P »iiotek de^ \tnischen nalmuseums Nurnln r Bibliotheksfo<br />
mm in (BEB) i ^4S2, 143<br />
>if Sachssc, »Die größte Bewahrungsprobe <strong>für</strong> den Klcinfarbfilrt . vr Fuhrerauftra^<br />
zur Dokumentation wertvoller Wand- und Deckenmalereien in historischen Bau
DATI-.NRÄUMI-:: LITI.KATUR- UND QL 1095<br />
werken, in: Angelika Beckmann / Bodo <strong>von</strong> Dewitz (Hg.), Dom - Tempel - Skulptur.<br />
Architekturphotographien <strong>von</strong> Walter Hege, Kataloghandbuch Agfa Foto-Historama<br />
Köln (Wicgand) 1993, 68-72<br />
ders., Das Gehirn der Welt: 1912, in: Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschatt<br />
zu Großbothcn e.V., 5. Jg., Heft 1/2000, 38-57<br />
Georg Wilhelm Sanu-, Aiuiivt um! Viiw.mun» - historische Provenienz und Probleme<br />
der Gegenwart, in: Der Archivar. 10. Jg., Januar 1957, Heft 1, Sp. 7-15<br />
Andreas Schelskc, Zeichen einer Bildkultur als Gedächtnis, in: Klaus Rehkämper / Klaus<br />
Sachs-Hombach (Hg.), Bild, Bildwahrnehmung, Bildverarbeitung. Wiesbaden (Deutscher<br />
Universitäts-Verlag) 1998, 59-68<br />
Dieter Schiefelbem, Das »Institut zur Erforschung der Judentrage Frankfurt am Main-.<br />
Vorgeschichte und Gründung 1935-1939, Frankfurt/M. 1994 (= Materialien Nr. 9 des<br />
Frankfurter Studien- und Dokumentationszentrums zur <strong>Geschichte</strong> und Wirkung<br />
des Holocaust / Fritz Bauer Institut)<br />
Wolfgang Schmale, Archäologie der Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit:<br />
ein deutsch-französisches Paradigma, München (Oldcnbourg) 1997<br />
Gerhard Schmidt, Verluste in den Beständen des ehemaligen Reichsarchivs im Zweiten<br />
Weltkrieg, in: Archivar und Flistoriker, hg. v. d. Staatlichen Archivverwaltung im<br />
Staatssekretariat <strong>für</strong> Innere Angelegenheiten , Berlin 1956<br />
ders.. Die Ordnungsmethoden innerhalb der Archivorganisationstypen, in: Archivmitteilungen<br />
3/1958, 81-84<br />
Siegfried J. Schmidt, <strong>Geschichte</strong> beobachten. <strong>Geschichte</strong> und Geschichtswissenschaft<br />
aus konstruktivistischer Sicht, in: Österreichische Zeitschrift <strong>für</strong> Geschichtswissenschaften<br />
8, Heft 1 (1997), 19-44<br />
Hermann Schmitz, Hegels Begriff der F.rinnerimg. in: Archiv <strong>für</strong> Begriffsgeschichte 9.<br />
Bonn (Bouvicr) 1964, 37-44<br />
Kurt Schmitz, Mikrofilm und Dokumentation im Archivwesen der Kommunaiveiwaltung,<br />
in: Archiv und Gcschihte. Festschrift Rudolf Brandts, hg. v. FLinns Peter<br />
Neuheuser, Florst Schmitz u. Kurt Schmitz, Köln (Rheinland-Verlag) ' Bonn<br />
(Habelt-Verlag) 1978, 349-363<br />
Peter Paul Schneider u. a., Literatur im Industriezeitalter Bd. 2, Ausstellungskatalog<br />
Schiller Nationalmuseum Marbach am Neckar (= Marbacher Kataloge 42/2) 1987<br />
Wnlfgang Schmitz. Deutsche Bibliotheksgeschichte, Bern et .'.!. 'Lang» I9S4<br />
Ulrich Johannes Schneider. Die Vergangenheit des Geistes. Finc Archäologie der Plnlosophiegeschichte,<br />
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 199C<br />
Werner Schnchow. ^25 |ahre Staatsbibliothek in Berlin: das } laus und seine Leute; Buch<br />
u. Ausstellungskatalog, Wiesbaden (Reichert) 1986<br />
Karen Schönwälder, Historiker und Politik. Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus,<br />
Frankfurt/M. / New York (Campus) 1992<br />
Ludwig Schreiner, Karl Friedrich Schinkel und die erste westfälische Denkmäler-lnventansation<br />
Fin Beitrag zur <strong>Geschichte</strong> der Denkmalpflege Westfalens, Recklmghau-<br />
dies., /um Wirker 1<br />
oder: Der lange V<br />
hard vom Brocki<br />
landcrsetzunucn über Aufgabe ul Gestalt des Preußischen<br />
njah •OCbis 19C3. in iien und Forschungen aus<br />
H.bh. .en 76 (1996) 3s<br />
>iin K tur ein deutsch dorisches Zentralinstitut<br />
aiser- V». dm-lnstitut <strong>für</strong><br />
.: sehe <strong>Geschichte</strong>, in: Bernibert<br />
Laitko (Hg.), Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesell
1096 DATHNRÄUMI:: LITERATUR- UM- QU ; i I-NIVI-;R/I-.IC:MNIS<br />
schaft und ihre Institute: Studien zu ihrer <strong>Geschichte</strong>. Das Harnack-Pnnzip, Berlin<br />
(de Gruyter) 1996, 423-444<br />
Ernst Schulin, Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch: Studien zur Entwicklung<br />
<strong>von</strong> Geschichtswissenschaft und historischem Denken, Göttingen 1979<br />
ders., Vom Beruf des Jahrhunderts <strong>für</strong> die <strong>Geschichte</strong>: das 19. Jh. als Epoche des Histousinus,<br />
m: Amoiu Lsen / Jens Peierscn (Hg.), Gescnichie und Gescmcntswisscnschatt<br />
in der Kultur Italiens und Deutschlands (Bibliothek des Deutschen Historischen<br />
Instituts in Rom 71), Tübingen 1989<br />
Berent Schwinekörper, Zur <strong>Geschichte</strong> des Provenienzprinzips, in: Staatliche Archivverwaltung<br />
[DDR] (Hg.), Forschungen aus mitteldeutschen Archiven [Festschrift<br />
I lellmut Krct/schnur|, Berlin (Rüiien & l.oening) 1956, 4X65<br />
Dieter Scrivenus, <strong>Geschichte</strong> des Nordrhein-Westfähschcs Hauptstaaisarchivs, Dusseldorf<br />
(Selbstverlag des Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchivs) 1983<br />
Walter Seitter, Zur Gegenwart anderer Wissen, in: Michel Foucault / ders., Das Spektrum<br />
der Genealogie, Bodenheim (Philo) o. J. [1996], 94-112<br />
Allan Sckula, The Body and the Archive, in: October 39 (1986), 3-64<br />
Claude E. Shannon / Warren Weaver, The mathematical theory of communication<br />
[ :; 1949], Urbana, 111. (University of Illinois Press), 1963; dt. Mathematische Grundlagen<br />
der Informationstheorie, übers, v. Helmut Dreßler, München (Oldenbourg)<br />
1976<br />
Bernhard Siegert, Relais: Geschicke der Literatur als Epoche der Post 1751-1913, Berlin<br />
(Brinkmann & Böse) 1993<br />
ders., Frivoles Wissen. Zur Logik der Zeichen nach Bouvard und Pceuchct, in: Hans<br />
Christian v. Herrmann / Matthias Middcll (Hg.), Orte der Kulturwissenschah. 5 Vortrage,<br />
Leipzig (Universitätsverlag) 1998, 15-4G<br />
Gunter Smolla, Gustav Kossinna nach 50 Jahren. Kein Nachruf, in: Acta Praehistorica<br />
et Archaeologicajg. 16/17, Berlin 1984/85, 9-14<br />
Winfried Speitkamp, Die Verwaltung der <strong>Geschichte</strong>. Denkmalpflege und Staat in<br />
Deutschland 1871-1933, Gottingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1996<br />
Gerd Spittler, Abstraktes Wissen als Herrschaftsbasis. Zur Entstehungsgeschichte bürokratischer<br />
Herrschaft im Bauernstaat Preußen, in: Kolner Zeitschrift <strong>für</strong> Soziologie<br />
und Sozialpsychologie, Jg. 32 (1980), 574-604<br />
Friedrich Christian Stahl, Die Organisation des FIccrcsarchivwesens in Deutschland<br />
1936-1945, in: Heinz Boberach / Hans Booms (Hg.), Aus der Arbeit des Bundesarchivs.<br />
Beiträge zum Archivwesen, zur Quellenkunde und Zeitgeschichte, Boppard<br />
(Boldt) 1978,69-101<br />
Jürgen Steen, Das Historische Museum Frankfurt am Main - Plan, Gründung und die<br />
ersten fünfundzwanzig Jahre, in: Almut Junker (Red.), Trophäe oder Leichenstein?<br />
Kulturgeschichtliche Aspekte des Gcschichtsbewuistscins in Frankfurt im 19. Jahrhundert,<br />
Frankfurt/M. (Historisches Museum) 1978, 23-48<br />
Woltgang \ lans Stein f I ig.), Inventar <strong>von</strong> Quellen zur deutschen <strong>Geschichte</strong> in Pause<br />
Archiven und thcken, Koblenz (Selbstverlag der Landesarchivverwaltum<br />
Rhcinland-Pfai S6<br />
ders., Archive als kt <strong>von</strong> Kulturimpen. n: I i Msche Archive in Deutsch<br />
land-deutsche ivc in Frankreich, in • I FM, Katharina Mitidell / Mat<br />
thias Middell (Hg.), Archiv und d ms hen zur mtcrkulturelki<br />
Überlieferung, Leipzig (Leipziger Univerv..-.;^erlag _-J0, 89-121<br />
ders., Thesen zur Logik der Archive, ebd., 58-62
D/YITNRAUMI.: LiTI RAT; K- l \'|) Qi i I i i WI.K/i IC 1097<br />
Martin Stingclin, Historie als »Versuch, das Heraklitische Werden [...] in Zeichen<br />
abzukürzen«. Zeichen und <strong>Geschichte</strong> in Nietzsches Spätwerk, in: Nietzsche-Studien<br />
22,28-41<br />
Günther Stocker, Schrift, Wissen und Gedächtnis: das Motiv der Bibliothek als Spiegel<br />
des Medienwandels im 20. Jahrhundert, Würzburg (Königshausen & Neumann) 1997<br />
Tiimann <strong>von</strong> Stockhausen, Die Nuiturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Architektur,<br />
Einrichtung und Organisation, Hamburg 1992<br />
Barbara Stollberg-Rihngcr, Der Staat als Maschine: zur politischen Metaphonk des absoluten<br />
Fürstenstaats, Berlin (Duncker & Humblot) 1986<br />
Michael Stollcis, <strong>Geschichte</strong> des öffentlichen Rechts in Deutschland, Bd. 1: Reichspubli/.istik<br />
und Pnlicevwisscnscluh, München (Beck) 198X<br />
Reinhart Strecke, Die westfälische Denkmalcrim entansation <strong>von</strong> 1X22 und die Anfängt<br />
der Denkmalpflege in Preussen, in: Behr / Kloosterhuis (Hg.) 1994: 483-494<br />
Wolfgang Struck, <strong>Geschichte</strong> als Bild und als Text. Historiographische Spurensicherung<br />
und Sinnerfahrung im 19. Jahrhundert, in: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske, hg<br />
v. Susi Kotzinger / Gabriele Rippl, Amsterdam / Atlanta, GA (Rodopi) 1994, 349-361<br />
Hans-Ulrich Thamer, <strong>Geschichte</strong> und Propaganda. Kulturhistorische Ausstellungen in<br />
der NS-Zeit, in: <strong>Geschichte</strong> und Gesellschaft 24 (1998), 349-381<br />
Dieter Timpe, Mündlichkeit und Schriftlichkeit als Basis der frührömischen Überlieferung,<br />
in: Jürgen v. Ungern-Sternberg (Hg), Vergangenheit in mündlicher Überlieferung,<br />
Stuttgart 1988, 266-287<br />
Jörg Träger, Der Weg nach Walhalla. Denkmallandschaft und Bildungsreise im 19. Jahrhundert,<br />
Regensburg(Bosse)19S7<br />
James M. O'Toolc, The Symbohc Signiticance ot Archives. in: I he American Archivist<br />
56, Heft 2 (Frühjahr 1993), 234-255<br />
Paolo Vian (I lg.), L'Archmo Scgrcto Vaticano e le RICCI ehe Stonche, Rom (Vatikan) I9S3<br />
Cornelia Vismann, Akten. Medientechnik und Recht, Frankfurt/M. (Fischer) 2CC0<br />
Peter Vodosek / Manfred Komorowski (Hg.), Bibliotheken wahrend des Nationalsozialismus,<br />
Teil 1, Wiesbaden (Harrassowitz) 1989<br />
Walter Vogel, Der Kampf um das geistige Erbe. Zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsarchividee<br />
und des Reichsarchivs als -geistiger Tempel deutscher Einheit«, Bonn (Bernhard &<br />
Gracfe) 1994<br />
I lana Volavkova, Schicksal des Jüdischen Museums in Prag, ubers. Erich Bertiett. Prag<br />
1965<br />
Bernhard Vollmer, Die Photographic und die Mikrophotographie als Hilfsmittel dei<br />
Archive, in: Archivalische Zeitschrift 47 (1951), 21 1-215<br />
( arstcn-Petcr Warncke (1 lg), Iko<br />
ten zur <strong>Geschichte</strong> des Buchwc<br />
f -Hannes Werner, Über P R u J<br />
^euron, in: Erbe und<br />
ieuron {Bcun>ner Ki<br />
hael Wctzel, Die En,<br />
phie der Bibliotheken (= Woltenbutieler Si<br />
Bd. 17), Wiesbaden 1992<br />
. und die Anfange der Palimpsesttorschun», ;<br />
Ktinische Monatsschrift, Bd. 73. Heft 2 (1997),<br />
!45<br />
der die Wiederkehr der Schrift. Von den litera-<br />
ischen zu den techni^ ;.
1098 DATI-NRÄUMI-: LITI-KATUK- UND QUH I FNVI-RZKICHNIS<br />
Baltimore, Man / London 1973; dt.: Metahistory. Die historische Einbildungskraft in<br />
Europa im 19. Jahrhundert, Stuttgart (Klett-Cotta) 1991<br />
ders., Die Bedeutung <strong>von</strong> Narrativität in der Darstellung der Wirklichkeit, in: ders.. Die<br />
Bedeutung der Form. Er/.ählstrukturen in der Geschichtsschreibung, Frankfurt/M.<br />
1990,11-39<br />
Lothar Wickert, Theodor Momrr.sen. Eine Bio< r raoh:c\ 4 Bde., Frankfurt/M. (Kloster<br />
mann)1959-1980<br />
ders., Beiträge zur <strong>Geschichte</strong> des Deutschen Archäologischen Instituts 1879 bis 1929,<br />
Mainz (Zabern) 1979<br />
l.ilk Wiesemann, Das |üdisciie Zenti.ilnmscum lür Mähren-Schlesien in Nikoisburg, in:<br />
Wiener Jahrhbuch tür jüdische <strong>Geschichte</strong>, Kultur und Museumswesen Jg. 1 (1994),<br />
107-131<br />
Georg Winter, Zur Vorgeschichte der Monumenta Gcrmaniac Historica, in: Neues<br />
Archiv der Gesellschaft tür altere deutsche Geschichtskundc, 47. Bd., unveränderte<br />
Neuausgabe Berlin (Weidmannsche Verlagsbuchhandlung) 1957, 1-30<br />
Herta Wolf, Das Denkmälerarchiv Fotografie, in: Camera Austria 51/52 (1995), 133-145<br />
dies., Fixieren - Vermessen: Zur Funktion fotografischer Registratur in der Moderne, in:<br />
Norbert Bolz u. a. (Hg.), Riskante Bilder, München (Fink) 1996, 239-258<br />
Manfred Wolf, Geschichtspflege und Identitätsstiftung. Provinzialarchiv und Altertumsverein<br />
als kulturpolitische Mittel zur Integration der Provinz Westfalen, in:<br />
Behr/ Kloostcrhuis 1994, 461-482<br />
Fritz Zimmermann, Die Stellung der Archive innerhalb eines Systems der Dokumentation,<br />
in: Archivalischc Zeitschrift 62 (1966), 87-125<br />
Gerhard Zimmermann, Das Hauptarchiv (ehemal. Prcuß. Geh. Staatsarchiv) in den<br />
ersten Nachricgsiahren, in: Der Archivar, 7. Jg. (Juli 1955), H. 3, Sp. 173-180<br />
ders.. I iardenbergs Versuch einer Reform der preußischen Archivverwaltimg und deren<br />
weitere Entwicklung bis 1933, in: Jahrbuch der Stiftung Preußischer Kulturbc-n /<br />
1966,69-87<br />
ders.. Das Ringen um die Vereinheitlichung des Archivwesens in Preußen und im Reu<br />
<strong>von</strong> 1933 bis 1945. in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesit/ 1967. 129-143<br />
Unpublizicrtc Typosknpte (Sekundärlüerati<br />
ilona Mevncn. Bürokratien <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien, Bibhuüiek und Maschinen, Magistcrarbcit<br />
Humboldt-Universität Berlin, Fakultät Kulturwissenschaften, <strong>Lehrstuhl</strong> <strong>Geschichte</strong><br />
und Ästhetik der Medien (Friedrich A. Kittlcr), 1997<br />
1 lildcgard Riedel, Die faschistische Kultur- und Wissenschaftspolitik in ihren Auswirkungen<br />
auf das Buch- und Bibliothekswesen - speziell die Deutsche Nationalbibhothek,<br />
Dissert. zur Promotion A {Karl-Marx-Universitat Leipzig, Sektion<br />
<strong>Geschichte</strong>), 1 nember 1969<br />
Dirk Rupnow, T Gedächtnis - (>ptcr Vernichtung und Erinnerung im »Dritte<br />
Reich« .»m Beispiel hidisihen Zenti r -useums- in !'• >_• 1942-1945, Diploma<br />
bcit am Institut <strong>für</strong> _e>chichte der Umwisität Wien, \'•''•"•>
Historische Zeitschriften<br />
D/Vi i NKÄUMk: LlTl-.kATL C- \1) Ql NVT.K/1-.ICI IMS<br />
1099<br />
Archiv der Gesellschaft <strong>für</strong> altere deutsche Geschichtskunde, hg. v. J. Lambert Büchler /<br />
Carl Georg Dümge, Frankfurt/M. (Andreäische Buchhandlung) 1820 ff.<br />
Archiv <strong>für</strong> Urkundenforschung, hg. v. Karl Brandi, Harry Bresslau u. Michael Tangl, Bd.<br />
1 Leipzig 1908 bis Bd. 44 (1944)<br />
Mittheilungen der Kgl. Preußischen Archivverwaltung, Heft 1 (1900) ff.<br />
Mitteilungen des Gesamtarchivs der deutschen |uden, hg. v. Lugen Tau hier, Leipzig<br />
(Fock) l.Jg. 1909ff<br />
Anzeiger <strong>für</strong> Kunde des deutschen Mittelalters (München IS32ff). h^. \. 1 lan.s I'ih. \.<br />
Aufscss<br />
Zeitschrift <strong>für</strong> Archivkunde, hg. v. L. L. Hofer, 11. A.Lrhard u. <strong>von</strong> L. B. v. Medem,<br />
Hamburg (Perthcs) 1934ff<br />
Reihen, Sammelbande, Ausstellungskataloge, Denkschriften<br />
Instruktionen <strong>für</strong> die Alphabetischen Kataloge der Preußischen Bibliotheken vom IC.<br />
Mai 1899, 2. Ausgabe in der Lassung vom 10. August 1908, Berlin (Behrend) 1913<br />
Deutsche Bücherei des Borsenvercins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Urkunden<br />
und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung. 10. Ausg. Leipzig (Borsenvcrcin<br />
der Deutschen Buchhändler) 1915<br />
Denkschrift zur Linweihungsfcier der Deutschen Bücherei des Borsenvercins der Deutschen<br />
Buchhändler zu Leipzig am 2. September 1916, Leipzig 1916<br />
Bericht über die Errichtung des Deutschen Kriegswirtschaftsmuseums (= V'cröt-<br />
. fentiiehungen des Deutschen Knegswirtschaftsmuseums zu Leipzig Heft 2). Leipzig<br />
s'Brandstcttcr! 1917<br />
Das Deutsche Kriegswirtschaftsmuseum (Vorläufiger Überblick), Veröffentlichungen<br />
des Dt. Knegswirtschaftsmuseums zu Leipzig, Heft 3, Leipzig 1918<br />
Fünfzehn Jahre Königliche und Staatsbibliothek, hg. v. de. wissenschaftlichen Beamten<br />
der Preußischen Staats' ->thck. Berlin (Preußische Staatsbibliothek) 1921. —S9<br />
Hans Freiherr <strong>von</strong> und / 'H-SV und die Anfange des Germanischen National<br />
scums. Ausstellungsk.i \umbetg 1972<br />
Bihliotheca Palatina, Ausstellungskatalog (Textband), hg. v. Flmar Mittler u. a.. Hei<br />
berg (Braus) 1986<br />
1
1100 DATI-NRÄUMI-.: LITI RATUK- UND QUKI.I.HNVKRZKICHNIS<br />
Fotovision. Projekt Fotografie nach 150 Jahren, bearb. v. Bernd Busch, Udo Liebelt u.<br />
Werner üeder, hg. v. Sprengel Museum Hannover, Hannover 1988<br />
Ausstellungskatalog »Der Rhein ist mein Schicksal geworden«. Paul Clemcn 1866-1947.<br />
Erster Provmzialkonservator der Rheinprovinz, Köln (Rheinland-Verlag) 1991<br />
Das Rcpcrtonum Gcnnanicum. FDV-gestüt/te Auswertung vatikanischer Quellen: neue<br />
Forschungsperspektiven, hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom 1992<br />
Zur <strong>Geschichte</strong> und Arbeit der Monumenta Gcrmnniac l listonca. Ausstellung anläßlich<br />
des 41. Deutschen Historikertages München, 17.-20. September 1996. Katalog, München<br />
(MGH) 1996<br />
Paul F. Kehr. Zugänge und Beitrage zu seinem Wirken und seiner Biographie. Veranstaltung<br />
zum 60. Geburtstag <strong>von</strong> Arnold Fsch am 20. Mai 1996, hg. v. Deutschen<br />
Historischen Institut in Rom, Tübingen (Niemeyer) 1997 [nicht im Buchhandel<br />
erhältlich]<br />
Die Bibliothek des Herder Instituts. <strong>Geschichte</strong> - Bestände - Benutzung, Marburg (1 lerder<br />
Institut) 1998<br />
Flankierende Publikationen des Verfassers<br />
Identität und Differenz. Johann Gottlieb Fichtes Reden an die deutsche Nation, in:<br />
Tumult. Zeitschrift <strong>für</strong> Verkehrswissenschatt 10, München 1987, 141-161<br />
Symbolischer Tausch und der Tod (die Unmöglichkeit des Museum): das nationalsozialistische<br />
Projekt eines lüdischen Zentralmuseums in Prag, in: Geschichtswerkstatt 24<br />
(Juli 1991), 45-56<br />
Unges(ch)ehene Museen: Bomben, Verschwinden, in: Martin Stingelm / Wolfgang Scherer<br />
(Hg ), HardW.ir / So»!War. Krieg und Medien !9!4 bis 194S. München (Fink)<br />
1991,197-218<br />
Museale Räume im nachliberalistischen Zeitalter: Nationalsozialismus, Klassizismus,<br />
Antikc(n), in: Hephaistos. New Approachcs in Classical Archaeologv and rclated<br />
Ficlds. Kritische Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Archäologie und angrenzender<br />
Gebiete 11/12 (1992/93). Bremen (Klartext), 187-206<br />
uen-Blickc Bismarck Monsche Ausstellung als ephemeres Denkmal, in:<br />
ICI Dicrs (Hg.). ntc Formen und Funktionen ephemerer Denkmaler,<br />
icim(VCH) 19'<br />
?<br />
* eigen des Archivs erzeugt Ungeheuer {üben memory a>rm>), in: Werksutt-<br />
• v-M'liK'hu' *» (AtiguM I'W). I lamluug (I rgd>nis\e Verlag), Tlu-nu-nlu-lt Anhivi-,<br />
W-45
DATI-.NRAUMI-.: Ll'l'l-.RATUK- UND Qui.l.UNVI.R/.i.K 11N1S 1101 1<br />
Arsenale der Erinnerung, Katalogbeitrag zur Ausstellung SPEICHER. Ein Versuch über<br />
die Darstellbarkeit <strong>von</strong> <strong>Geschichte</strong>/n, Offenes Kulturhaus Linz (I Ig.), Linz 1993. 63-<br />
72<br />
White Mythologies? Informatik statt Gcschichtc(n) - die Grenzen der Metahistory, in:<br />
Themenheft »Hayden White s Metahistorv twenty ycars after«, Storia della Storiografia<br />
25 (1994), Mailand (Jaca Book), 23-50<br />
(1 lg.), Die Unschreibbarkcit <strong>von</strong> <strong>Im</strong>perien. Theodor Mommscns Römische Kaisergeschichte<br />
und I leiner Müllers Echo, Weimar (Verlag & Datenbank <strong>für</strong> Geisteswissenschaften)<br />
1995<br />
Präsenz der Toten und symbolisches Gedenken: Das Völkerschlachtdenkmal zwischen<br />
Monument und Epitaph, in: Katrin Keller / Hans-Dieter Schmid (Hg), Vom Kult zur<br />
Kulisse. Das Völkerschlachtdenkmal als Gegenstand der Geschichtskultur, Leipzig<br />
(Umversitatsvcrlag) 1995, 62-77<br />
Cornelia Vismann / W. E., Die Streusandbüchse des Reiches: Preußen in den Archiven,<br />
in: Tumult. Schritten zur Verkehrswissenschah 21 (Themcnhch »preußisch-). Frankfurt/M.<br />
(Syndikat) 1995. 87-107<br />
Memory and (Disscmi)Nation: Volkerschlachtdcnkmal and Deutsche Bucherei at Leipzig<br />
1813/1913. Between Real Bones and Symbolic Letters, in: Journal ot llistonc.il<br />
Sociology 8, Heft 4 (1995), 329-351<br />
Archäologie Peencmünde Bausteine V2, gemeinsam mit Axel Doßmann, in: Ulrike Greiner-Kemptner<br />
/ Robert E. Riesinger (Hg.), Neue Mythographien. Gegenwartsmythen<br />
in der interdisziplinären Debatte, Köln / Wien (Böhlau) 1995, 46-71<br />
Texten ein Gesicht geben: Die Prosopopöic des Archivs im <strong>Namen</strong> Ernst Kantorowicz«,<br />
in: Ästhetik und Kommunikation, Heft 94/95, Jg. 25, Dezember 1996. 175-182<br />
Rhetorik des Ornaments, m. UIMII.I Franke / Heinz Paetzoid (Hg), Ornament und<br />
<strong>Geschichte</strong>. Studien zum Strukturwandel des Ornaments in der Moderne, Bonn<br />
(Bouvier) 1996,283-301<br />
Reisen ins Innere des Archivs, in: Ulrich Johannes Schneider / Jochen Kornehus<br />
Schütze (Hg.), Philosophie und Reisen, Leipzig (Leipziger Universitätsverlag) 1996,<br />
160-177<br />
Einbi<br />
F<br />
su<br />
4h<br />
ies Realen m die Visionen Roms: Das Jahr 1870, in: Stefan Germer Mich.u<br />
nermann I Bilder der Macht - Macht der Bilder: Zeitgeschichte in D.u<br />
;en de> I 1 ' underts, München / Berlin (Klmkhardt und Biermann) 19 i r<br />
it. UOOM 1 K-i I li>lnk.uisi .ils 1 K'konsiruktion dd MUH U;'^ I'ng. Berl;<br />
in. i - ibcth \Xii>er / CJm.Moph CJ. lluilcn (I lg.), l),\s Vcigewenu '• \iuiniu>cn<br />
Undarstellbaren. Wien (Tuna & Kant) IV97, 258-272
1102 DATI-NKAUMI-.: LITI-.RATUR- UND QUI•.I.I.KNVH
DAT! NRAUM1 : LlTLRATUK- UN! > i^Vl! ! ! NVI-.K/T l( ! !\ : IS 1 1 03<br />
ROM 1881: Die Medialität des Vatikanischen Geheimarchivs als Gesetz der Historie«,<br />
in: Hedwig Pompe / Leander Scholz (Hg.), Archivprozesse: Die Kommunikation der<br />
Aufbewahrung, Köln (DuMont) 2002, 54-72<br />
Zitierte und selbständig bcnut7c Arrhrvbestände<br />
Archiv zur <strong>Geschichte</strong> der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin; Bestand Bibliotheca i lertziana<br />
, bes. Kaiser-Wilhelm-Institut tür Kunst- und Kulturwissenschaft (Benennung<br />
1938-1945), 1. Abt., Repositur 6; Bestand Kaiser-Wilhelm-Institut tür Deutsche<br />
<strong>Geschichte</strong>, I. Abt., Rep. 20; I. Abt.. Rep. I A: Gencralverwaltung der KWG, Nr. 1041<br />
(Institut <strong>für</strong> Kulturforschung / Kulturfilm-Institut 2.6.33-4.7.35)<br />
Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig, läse. Az/NA 534/7 Bd. 1<br />
Archiv der Monumenta Germaniae Histonca München (Zentraldirektion), Rep. 338;<br />
ebd., Ordner Römische Bibliothek und Institut<br />
Archiv der Bcrlm-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Berlin, Findbuch<br />
(Bestand München) »Monumenta Gcrmamac i listonca. Ausfuhrliches Inhaltsverzeichnis<br />
zu: Repositur 338«<br />
Bundesarchiv: In die Forschungs- und Schreibjahre dieser Arbeit fielen die in Folge der<br />
deutsch-deutschen F.imgung vom I. Oktober 1990 erfolgten Diskontinuitäten und<br />
Dislokationen im ehemaligen DDR- und Bundesarchivwesen <strong>von</strong> Merseburg,<br />
Koblenz, über Potsdam bis hin nach Berlin-Lichtenberg. Zitierweisen der Archivalien<br />
folgen dem jeweiligen Stand(ort) und markieren damit das archivische Gedächtnis<br />
im Spiel <strong>von</strong> Synchronisation und Rückkopplung:<br />
Bundesarchiv / militärisches Zwischenarchiv Potsdam, Denkschriften Fernst Müsebeck<br />
1932/33.90 MÜ6/3<br />
Bundesarchiv / Militärarchiv Freiburg/Br. (BAM), Findbuch Bestand RW 35 (Der Militär<br />
befehlshabcr in Frankreich),.Punkt 3.5.1.2.2.1. Lageberichte; Archivsignatur: Nr. 365<br />
Bundesarchiv Berlin-Lichtenberg, Bestand BA R 43 (Reichskanzlei / Reichsarchiv) II<br />
1236 (Ausfuhr <strong>von</strong> Kulturgut), 1938; ebd., Bestand R 55 (Reichsministerium <strong>für</strong><br />
Volksaufklärung und Propaganda), fasc. 642, 643 u. 182<br />
Bundesarchiv, Bestand ZF 45 (OMGUS), FCR MFAA, 5/347-1 (Ernst Zipfel)<br />
Bundesarchiv, Bestai ! 46 (Rcichsarchiwerwaltung), Nr. 20, Memoiren Ernst Zipfel;<br />
ebd. Nr. 47, Man ; t \ lorst Schlechte, Der Kulturraub der Franzosen im Lichte<br />
archivalischer Fo! ngen<br />
Archiv de it.sehen Historischen Instituts Rom, Beilage (Typoskript, Abschritt <strong>von</strong><br />
Absil" u Alt. Reg. Nr. V P.uii Kehr, IVnk>chri!i über die Begründung eine*<br />
Institui Deutsche <strong>Geschichte</strong>, datiert 9. September 1913
1 104 DATI NRAUM!.: LlTHKATUR- UND Qui-l.l.l-NVKR/r.lCHNIS<br />
ebd., Registratur, Älterer Teil, Fasz. Nr. 12, Bl. 7: Carl Bcnrath (Bonn), Artikel in der<br />
Kölniscbc Zeitung vom 15. März 1886<br />
ebd., Registratur, Älterer Teil, Nr. 7 (altes Rubrum: »Akten betr. Verkehr m. d. Kultusministerium.<br />
Gutachtliche Äußerungen über sonstige Gegenstände«), »Abschrift <strong>von</strong><br />
Abschrift zu U I. 31003«: Berlin, den 6. November 1907: betrifft: F.rrichtiim» eines<br />
kunsthistorischen Instituts in Rom sowie die Gestaltung des Kaiserlich Deutschen<br />
Archäologischen Instituts in Rom<br />
Deutsches Archäologisches Institut in Rom, Archiv, Archäologen-Korrespondenzen<br />
Geheimes Staatsarchiv (PK) Berlin, Akten betreffend: Das Reichsinstitut <strong>für</strong> ältere deutsche<br />
Geschichtskunde. (Mon. German. hist.) Band 1 v. 4. Dezember 1937<br />
Geheimes Staatsarchiv Berlin, Rep. 178, Abt. VII, Nr. 1 (»Nachrichtenuber fremde<br />
Archive«), darin: Wilhelm Wattenbach, Die historischen Studien im Archiv, mit<br />
Bezug auf die Förderung derselben durch die Regierungen und die Landstände<br />
(Manuskript)<br />
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Akten des Direktoriums<br />
der Staatsarchive betrettend das Germanische Museum in Nürnberg, Bd. I v.<br />
1854 bis 1904, I. Rep 178 Abt. VII<br />
ebd., Akten des üirektonums der Staatsarchive, betrettend Denkmalarchive, Bd. 1 v. 20.<br />
Juni 1912 bis 1939, Rep. 178 Abt. VII<br />
•bd., Rep. 178 VII, Nr. 2, F 19, Akten betreffend: Archive der NSDAP. Bd. 1 v. 16. September<br />
1936 (-1944)<br />
bd., Rep. 178 V, Akten betr.: Die Ausstellung »Deutsche Größe«, Bd. vom 25. April<br />
1940-1941<br />
ebd., Rep. 178 V, Nr. 14 B, Akten betr: Ausstellung: Die Ncuordung Europas<br />
ebd., Akten betreffend: Institut <strong>für</strong> Archivwisscnschaft und geschichtswissenschaftliche<br />
Fortbildung, Band vom 3. Januar 1929-1945, Rep. 178 II Nr. 42, Generalia Nr. 42<br />
ebd., Findbuch Rep. 178, 2.3.31. Gcneraldirektonum der Staatsarchive 1823-1945<br />
ebd., Hauptabt. (HA) I, Repositur 178. Abt. XXXV, Nr. 8, Vol. 1: »Preußisches Staats<br />
ministenum. Akten betreffend: Das preußische historische Institut in Rom<br />
•bd., Rep. 178, Abt. VI1, Nr. I: Nachrichten über fremde Archive (auch historische<br />
Museen) 1844-1869<br />
Ul , I Rep |7X, VII 2A M\ Aku ••Ruikloukitini; du <strong>von</strong> Frankreich und I >euls«.hl.jnd<br />
entführten Urkunden - 1914-1936
D/ \\> QL i i i : 1C5<br />
ebd., Rcpertorium 178 VII, Nummer 2F8, Bd. 1, »Akte des Direktoriums der Staatsarchive,<br />
betr. das Gesamtarchiv der Juden in Deutschland sowie Archivalien betr. das<br />
Judentum« Bd. 1 vom 10. 6. 1908 - 7. 3. 1939 u. Bd. 2 vom 8.3.1939-1944<br />
ebd., Rep. 178 VII Nr. 2 F. 19, Akten betreffend: Archive der NSDAP, Bd. 1 v. 16.9.1936<br />
ebd., Rcp. 178 (Gencraldirektion der preußischen Staatsarchive) Nr. 1 1, Bd. 2, Denkschrift<br />
M. Lehmann (resp. Provcmenzpnnzip)<br />
Deutsches Archäologisches Institut Rom, Archiv, Karton 1 »<strong>Geschichte</strong> des Instituts«<br />
Archiv des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg, Akten zur Vorgeschichte des<br />
GNM, Karton Ia; Bericht über das Verhältnis des germanischen Museums zu dem<br />
römisch-germanischen Museum in Mainz (1856), Exemplar im Archiv des GNM,<br />
Akten zur Vorgeschichte des GNM. Karton la, 2<br />
I lauptstaatsarchiv Düsseldorf, Signatur RW 240 Nr. 1269<br />
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford L'mversity, Archives,<br />
Collection Niclacvsky, Nachlaß Eduard luchs<br />
Stadtarchiv Leipzig, Kap. 35, Nr. I I9S, Bd. I-III: Akten, den Deutschen Verein <strong>für</strong> Buchwesen<br />
und Schrifttum und das Deutsche Kulturmuseum betreffend; ferner Kap. 26<br />
A Nr. 100, Bd. 2<br />
Staatsarchiv Nürnberg, Rep. 5C2-I<br />
Staatliches Jüdisches Museums in Prag (ASJM), Archiv, »War Museum Fund«, bes.<br />
••Minutes ot t!v- working meetings ot the planning commission- (1942-44)<br />
Nachlasse<br />
(Geheimes Staatsau inv Berlin (Preußischer Kulturbesitz), Rep. 92, Nachlaß des Fcldmarschalls<br />
v. Müffling; ebd.. Rep. 92, Nachlaß Kehr, Sign. C Nr. 1-8; ebd. Rep. 92. Nachlaß<br />
Friedrich Meinecke; ebd., 11A I, Rep. 92, Nachlaß Albert Brackmann, Nr. 51<br />
Staatsbibliothek Berlin (PK), Nachlaß 1 Jans Delbruck<br />
Archiv der Bcrlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Berlin. Nachlaß<br />
Theodor Mommsen: ebd., Nachlaß Wilhelm Ostu. >U Wilhelm-Ostwaid-A' ' •<br />
Historisches Archiv der Stadt Wetzlar, Nachlaß Alh Mcydenbaucr (1834<br />
Nachlaß Philip Hiltebrandt, Archiv des Deutschen 1 i nschen Ins^ Ron<br />
Nachlaß Albert Paust, Archiv der Deutschen Bücherei Leipzig; darn Dokunii:::,<br />
zur <strong>Geschichte</strong> der Reichsbibliothek <strong>von</strong> 1848 (Tvposkript). 534
3106 DATI NRAUMI.: LITI-.RATUR- UND QUI:I.U;NVI:RZI.K ÜNIN<br />
Häufig verwendete Siglen <strong>für</strong> Institutionen<br />
DAI = Deutsches Archäologisches Institut (Rom)<br />
DB = Deutsche Bücherei (Leipzig)<br />
DI II = Deutsches, vormal Preußisches I fistonsches Institut (Rom)<br />
GNM = Germanisches Nationalmuscum (Nürnberg)<br />
MGH = Monumcnta Germaniae I Iistorica (Berlin / München)
Deutsche Speicher: Ein Bilderatlas 1<br />
Abbildungslegcnden (in der Reihenfolge ihrer Vorlage)<br />
Archi(v)tex(urcri<br />
1 Grundriß der Karthausc zu Nürnberg mit Bezeichnung der Hinrichtungen <strong>für</strong><br />
das germanische Museum, aus: Germanisches Nationalmuseum, Archiv, Registratur,<br />
Kapsel la<br />
2 Museale Halluzination: Wilhelm <strong>von</strong> Kaulbach, Öffnung der Gruft Karls des<br />
Großen im Dom zu Aachen durch Kaiser Otto III., Fresko 1859 (zerstört) in<br />
der Kartäuserkirche des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, aus: Andrian-Werburg,<br />
Irmtraud Frtr. <strong>von</strong>. Das Germansiche Nationalmuscum. Gründung<br />
und Frühzeit, Nürnberg (Germanisches Nationalmuseum) 2002, Abb. 16<br />
3, 4 Museale Versinnhchung des Wunsches, mit den Toten zu sprechen: Galerie<br />
<strong>von</strong> figurativen Grabplatten und Galerie mit Ritterrüstungen. Details aus: Ludwig<br />
Braun, Ansichten aus dem Germanischen Nationalmuscum (um 1868).<br />
Aus: Andrian-Werburg 2002, Abb. 36<br />
5 Haupteingang zur Deutschen Bücherei Leipzig mit Schillers Motto, aus:<br />
Denkschrift zur Einweihungsfeier der Deutschen Bücherei des Börsenvereins<br />
der Deutschen Buchhändler zu Leipzig am 2. September 1916, Leipzig 1916<br />
6 LInter der Beobachtung Bi.sm.irck.s: Fmgangstür zur Deutschen Bücherei<br />
I cip/ig, aus: 1 )enkschnli I9 I 6, Talel 4<br />
7 Typographischer Raum der Nation: »Das deutsche Volk, einig in seinen<br />
Stammen« in Nibclungenschnti 1897 u. a., aus der Festschrift: Fünfzig Jahre<br />
Reichsdruckerci 1879-1929. Beilage zum Archiv <strong>für</strong> Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik,<br />
Jg. 68 (Juli 1931), 239. Die Schriftproben sind Zeugnisse der<br />
Reichsdruckerei.<br />
8 Pn »Sie der dei<br />
(Innt.•nrai:<br />
• , aus: Wal<br />
Regen>k.-_.<br />
Bernha iv<br />
Arr<br />
^s^; ;<br />
ie und Literatur: Waiiu'<br />
er Fuh rer, hg. v. Landi 1 ^<br />
-ci Rc<br />
t Rej urg.<br />
Bildag^re^.u wie autii gekoppelt an den lc\!
1108 Di UM in Si'i i< in K: F.I\ BII.IM-KATI.AS<br />
9 Aussagensockel des Gedächtnisses: Bücherspeicher im Sockelgeschoß der<br />
Deutschen Bücherei Leipzig, aus: Denkschrift 1916, Tafel 7<br />
10 Technische Infrastruktur des nationalen Bücherspeichers: Kesselhaus der<br />
Deutschen Bücherei aus- ebd Tafel !C<br />
1 1 Grundriß der Gesamtausführung aller Gebäude (Erdgeschoß), aus: Deutsche<br />
Bücherei des Borsenvercins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Urkunden<br />
und Beiträge zu ihrer Begründung und Entwicklung, 10. Ausg. Leipzig (Borsenverem<br />
der Deutschen Buchhändler) 1915<br />
12 Modell der Deutschen Bücherei. Perspektivische Aufnahme der Hauptfassade,<br />
aus: ebd.<br />
13, 14 Gedächtnisstandardisierung: Schreibtisch mit Schachteln in Weltformat<br />
und Gross-Bücherei, in: K. W. Bührer, Raumnot und Weltformat, München<br />
(Die Brücke) 1912, Abb. I u. 9<br />
15 Giebel mit Inschrift, aus: Iselm Gundermann, Das Geheime Staatsarchiv m<br />
Berlin-Dahlem, in: Museumsjournal Heft I (1991), 24-25 (24)<br />
16 Neubau des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, 2. Magazingebäude,<br />
aus: Ernst Posner, Der Neubau des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem,<br />
in: Archivalische Zeitschrift 35 (1925), 23-39 (25)<br />
17 Neubau des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem, 6. Obergeschoß und<br />
3. Aktengeschoß, aus: ebd., 37<br />
18 <strong>Im</strong> Innern des Magazins: Neubau des Geheimen Staatsarchivs in Berlin-Dahlem,<br />
aus: ebd.. 3 1<br />
19 Blick in das alte M.v.-'.'in de- '• • 'heimcn Staatsarchivs, m: Gund um<br />
1991:25<br />
20 Deutsches Gedachtn Gen, otcll, .uis: Rudolf Wiesen, IK Neu-<br />
bau des Heeresarchivs V am, in: Ar tiiM.he Zeitschrift 45 (1939), 7-15 (11)<br />
21 Heeresarchiv Potsda v.irtensaal, aus: ebd.
Di I : TS< in Si'i K I I I K: E I N B I M )i 1109<br />
22 Schrank <strong>für</strong> das Denkmalarchiv der Provinz Brandenburg, entworfen <strong>von</strong> F.<br />
Wolff, in: ders., Denkmaiarchive. Broschüre des gleichnamigen Vortrags, gehalten<br />
auf dem 1. Denkmalarchivtag in Dresden am 24. September 1913, Berlin<br />
(Wilhelm Ernst & Sohn) 1913, 16<br />
23 Ein Blick in das Meßbildarchiv Berlin mit den <strong>von</strong> Albrecht Meydenbauer<br />
entworfenen Regalen, Aufnahme 1934 nach dem Umzug ins Marstallgebäude.<br />
aus: Reiner Koppe, Zur <strong>Geschichte</strong> und zum gegenwartigen Stand des Mcßbildarchivs,<br />
in: Jörg Albertz / Albert Wiedemann (Hg.), Architekturphotogrammetne<br />
gestern - heute - morgen, Berlin 1997, 41-57 (45)<br />
24 Rückkehr der Glasplatten des Meßbildarchivs nach Weltkrieg II in Holzkisten,<br />
Absender: Architekturmuseum der Akademie <strong>für</strong> Bau und Architektur<br />
USSR, Adressat: Staatliche Museen - Museumsinsel Berlin DDR, aus: ebd., 46<br />
Verzeichnung <strong>von</strong> Gedachtmsenergie<br />
25 Annalistik zwischen diskretem Aufschreibesystem <strong>von</strong> Zeit und Quelle <strong>für</strong><br />
<strong>Geschichte</strong>: hxtraki aus der typographischen Iransknption der Annalc* Scingallenses<br />
maiores, in: Monumenw Germaniae Historie«*, Reihe: Scnptores, Bd. I,<br />
hg. v. Georg Heinrich Pertz, Hannover (Hahn) 1826, 77<br />
26 Gedächtnisschritt als Bild: dasselbe Extrakt als kupterstichreproduktion des<br />
Originals, ebd., Tafel III<br />
27 »Schema der deutschen Gcschichts- und Alterthumskunde, nach welchem<br />
die Sammlungen des germanischen Museums geordnet sind« (Ausschnitt), aus:<br />
Hans <strong>von</strong> und zu Aufseß, System der deutschen Geschichts- und Alterthumskunde<br />
entworfen zum Zwecke der Anordnungen der Sammlungen des germanischen<br />
Museums, I N53<br />
28 Bibliothcksadressen als Subjekt und Ob|ekt <strong>von</strong> Ordnungsechmkcn: Titelblatt<br />
mit Stempel Ausgeschieden, aus: Johann Georg Seizinger, Bibliotheks-<br />
Technik. Mit einem Beitrag zum Archivwesen [1855], 2. Ausgabe l eipzig<br />
(Costenoble) 1860 (Exemplar Staatsbibliothek PK Berlin)<br />
29 Formular (Kaulogistik), am Beispiel der bibliothekarischen Verkartung der<br />
Schriften der Monumenta Germaniae Histonca, aus: ebd., Anhang Nr. 9
1110 Dr.uTscHi-. Si'Kiciii.K: EIN Bu.ni-.RATi.AS<br />
30 Bibliotheksstatistik als Graph: Tägliche Ausleihe (Monatsdurchschnitt), aus:<br />
Paul Ladewig, V. Bericht der Kruppschen Bücherhalle 1904-1907, Essen 1907<br />
31 Graphische Anschreibbarkeit des archäologischen Gedächtnisses als Funktion<br />
<strong>von</strong> Raum und Zeit: "Gesamtfrequenzkurve (G) und ihre Zerlegung in dxc<br />
Anteile Römisches (R) und Nichtrömisches (NR)«, Abb. 1 zu: Albrecht Dauber,<br />
Der Forschungsstand als innere Gültigkeitsgrenze der Fundkarte, dargestellt<br />
am Beispiel Nordbadens, in: Horst Kirchner (Hg.), Ur- und Frühgeschichte als<br />
Historische Wissenschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag <strong>von</strong> Ernst Wähle, Heidelberg<br />
(Winter) 1950, 99-111<br />
^2 Graphische Visualisierung statistischer Wirtschaftsdaten im Ausstellungsbereich<br />
des Deutschen Knegswutschaltsmuseums Leipzig, aus: Fotoalbum<br />
Reichs- und Wirtschaftsmuseum (Institut <strong>für</strong> deutsche Volkswirtschaft) Leipzig,<br />
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig (Bibliothek)<br />
33 Diagramm: Das Normformat und sein Gefolge, aus: Walter Porstmann, Karteikunde.<br />
Das Handbuch der Karteitechnik, 1. Auf. Stuttgart (Verlag <strong>für</strong> Wirtschaft<br />
und Verkehr) 1928, 326<br />
34 Die Schnittstelle <strong>von</strong> Handarbeit und Karteimaschine: Sichtungskasten, aus:<br />
ebd., 256<br />
35 Ordnungs-ABC, aus: Karl Themel, Wie verkarte ich Kirchenbücher? D
is(.iii Si'i.i(.iii-.k: E I N BÜ DI KAI I 1111<br />
Roth, Die restlose Erfassung. Volkszählen, Identifizieren, Aussondern im Nationalsozialismus,<br />
Berlin 1984, 8)<br />
40 Die sich selbst erklärende maschinenlesbare Kartei: Dreireihige Randlochkarte<br />
nach G. Grobe, aus: Gabor Orosz, Ubersiciu ü'uei die Problematik der<br />
Dokumentationsselektoren, in: Dokumentation. Zeitschrift <strong>für</strong> praktische<br />
Dokumentationsarbeit 1, Heft 9 (November 1954), 173-178, Abb. 8<br />
Dokumente / Monumente<br />
41 Numerische Adressierung <strong>von</strong> Realien: Abbildung <strong>von</strong> zwei gegenüberliegenden<br />
Inventarseiten aus dem Handkatalog <strong>von</strong> Ludwig I.indenschmit mit<br />
Fundstucken aus den Gräbern <strong>von</strong> I lalistatt, in: Jörn Street-Jensen, Christian<br />
Jürgensen Thomsen und Ludwig Lindenschmit. Eine Gclehrtenkorrespondenz<br />
aus der Frühzeit der Altertumskunde (1853-1864), Mainz (Verlag des Römisch-<br />
Germanischen Zentralmuseums) 1985, 140<br />
42 Dies- und icnseits der Allegorien <strong>von</strong> Historie: Das Vatikanische Geheimarchiv<br />
als Prunksaal, als Inventar und als Speicher. Kunstvoll verzierter Hol/schrank<br />
im Vestibül des sogenannten piano nobile (mit Dokumentation des<br />
Konzils <strong>von</strong> Trient), aus: Terzo Natalini u. a.. Das Geheimarchiv des Vatikan<br />
Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumenten, Stuttgart / Zürich<br />
(Belser) 1992.20<br />
43 Winkel d><br />
ebd., 44<br />
Li India (Raum der Findbücher) im vatikanischen Archiv, aus:<br />
44 »Keine Schaustücke <strong>von</strong> epochemachender Bedeutung«: Staatsarchiv<br />
Koblenz an den Generaldirektor der Staatsarchive, 10. Mai 1940, betr.: Vorbereitung<br />
der Ausstellung Deutsche Größe, aus: Geheimes Staatsarchiv (Preußischer<br />
Kulturbesit/.) Berlin, 1 lauptabteilung I, Rep. 178, Abt. V, Nr. 14A, Bl. 7<br />
45 Knegsdetormiertc Urkunde UBG II 402t. Nr. 404, photographisch vermessen,<br />
aus: Karl G. Bruchmann, Die Knegsveriuste und -schaden de«» ^t.uit.uchivs<br />
Goslar, in: F< hnft und I. Stengel Geburtstag, NF \oin<br />
(Böhlau) 195: ••.ft-5"<br />
l >)<br />
46Joseph Beu. -• 1974 \utnv ist gleich A<br />
Serie D Nr. 15016 (Postkarte)<br />
mc i.dition Staeck:
1114 D i - U T s r m . k Si'i K I I: I : l-:\ Hu I>I-.
Di. I II K: h : \ B l l 1)1 K 1115
1116<br />
Dl l 'S< >i> •< Sl'HCHI-.K: F.IN Bli.D! RAT! AA<br />
Öls deutsche Volk, einigt<br />
Das deutfthf Uolk, einig in feinen Stämmen und<br />
T)a« deutfrhe I3olh. **«!« hl fflüfT» StÄRSl<br />
Das dcutfcbcUoIk, einig in feinen Stamm<br />
Das draffdu t>dlk, einig in feinen Stimmen u<br />
Das deuffche Dolk. einig in feinen Stämmen und <strong>von</strong><br />
Das denrfdie Polk. einig in feinen Stammen und wn<br />
OQ« Deuttct>e ^3olk, einig in feinen 6tammen unJ)<br />
Dasdcutfche Volk, einig in feinen Stämmen und<br />
Ifes frutfä* DolC, einig in feinen Stämmen und<br />
th» &tutfdx "DolP, einig in feinen Stammen unö<br />
©aß btut^e IWU, efnio in feinen Ptömmmunt)<br />
ecev
D k U T . s c i i i . R Si'i'K I I I K : H I N B I I D I - K A T I . A S 1117
1118 Dr.UTSCHI-.R SlMICHl R: El\ BliiM.RATLAS<br />
11
13<br />
SPIJCHI.R: EIN BILDERATLAS 1119
112C Dl.UTSCHIK Sl'l.lCHl.R: ElN Bll.Dl.RATI.AS<br />
15
Dl CTSCHlfi S' 1 ! I'-Hl K: Ei\ Bli-Di H 1121
1122 Di L rscii! K SPI-.ICIII-.R: EIN BÜDLKAH AS<br />
19
L">!L- i
124 Di uTsrni K Si'Hc Hi K: EIN BIS nt RAT? AS<br />
23
*<br />
Dl-UTSCHI.K Sl'l ICH!,K:£!N BiU>hRATI.A5 1125<br />
honorr corenamr. RadtapiMt* igt»<br />
mntm Maturen*** ftrgttmt. et Aputoo»<br />
'rnelfitt tßtrttit- impftntnr<br />
Italien, intn'rrunt. et Langoiardus beiin v trennt<br />
> tmptralor otnt liiuiiou'iru* fiiiw tiux in rtgnun eiet<br />
i * finnci rmnt A|j»r«Tm pngntivrrunt. et partem tx tu -tr^un<br />
QOl ikoir rex o *mt mterfinlitr<br />
gOO- A*«'*rii a BaiBurut nH kranitum inrnt:. «hi * rm% eoram Chumei<br />
mt «in qnain plmnaw Aim m Terraemaiiu per /#*•<br />
gai. pnv- 906<br />
0O& Ai^lbertvi itcmt Frmm hunim nrrijiiur '<br />
908. Mmiemrmrum «mau exemtus ml A|imu orcidttur<br />
mi^nu «pfxriltt rl mullu 4unu »»011 ad monultnum wncti Galli.<br />
900. A^areni ffl Alwmmnmtmm<br />
910. Adaliyrro epuro/HtJ ohiit. Afrni mm /41ammmtt4 et FrmlKU<br />
ftte t'icerunt, et .Vvnci pmriem ex ets ocriderunt.<br />
gii hifll« ...nicti» .|,(il«lr MIK-II Stephaai «4 T»*p«rum («»(<br />
«•«
1126<br />
27<br />
DKLHV"III-.K SI*I-t!:RATI ,<br />
jetna Der bcutftytn<br />
nodi roddjnn bie<br />
L Jl, t g -T 4<br />
s sc >^k. s s n x ^r *3r ü M2» rs<br />
BIHLIOTIIKKS-TKCHMK<br />
KINK.M KK1TRAO Zt M A lO'H I Vs WKSIiN<br />
UEirzto.
29<br />
Einhardus<br />
741—829.<br />
H*nn<br />
3C<br />
Dri.Tscm-.k SIM-ICIII.K: EI\ BII.DI RATI.AS 1127<br />
Mo;<br />
VH 4152.<br />
T. 1. 8. 135.
1128 DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
31<br />
1<br />
i<br />
n<br />
§<br />
•<br />
«WM<br />
i<br />
| •<br />
iw k»<br />
> L 1/ J<br />
/ \ /yf<br />
w\T 1<br />
! ! i |J<br />
K<br />
If<br />
I\<br />
/'<br />
\<br />
i<br />
/<br />
* i.. jj<br />
1<br />
n<br />
1<br />
L<br />
i i<br />
/<br />
/<br />
Ulf<br />
'if<br />
*m u .<br />
• r<br />
1 1<br />
• -Ü<br />
4<br />
ml
33<br />
DEUTSCHER SPEICHER: ErN BILDERATLAS 1129
1130 DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
35<br />
36<br />
, et, ei. d. d<br />
ob, ot*=>ö, of, . .<br />
• üb; ue=fi, uf, . .<br />
j: 2)ic uuterftricfjenen Sudtfta&en<br />
Mefe Wegdn georbneten 3meifel8fäae ber „.-ft.,.<br />
•^•-ter flehen bic Knfö{ufj6u4p(itat tm Ä««<br />
ben fenfcec^ten unb maogete^ten a—a»8Rf^<br />
"•""" i, bei benen nid&tl neu au «<br />
Wf<br />
rolrb bereinigt, ba[) ber Jagrgang<br />
bii DoU^bHa otrfo ? *:<br />
ift_
37<br />
DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
1131
1132 DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
39
DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS 1133
1134 DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS<br />
. Dr.<br />
3or«worem u<br />
Lv«<br />
44<br />
43<br />
am<br />
I<br />
gtaatömlnlftttJum I<br />
ptdkfe-pbttUMV I O 4 ',1<br />
Betr«: Vorbereitung der Ausstellung<br />
„Deutsche Grosse"<br />
Verf. v. '». Mal WO - A.V. 2980 - :<br />
Das Staatsarchiv besitzt keine Sohmstdcke<br />
ron epochemachender Bedeutung, die f^Jr rtie<br />
geplante Ausstnllunfr geeignet wären.<br />
Für den Direktor:
n<br />
rn<br />
GO
DEUTSCHER SPEICHER: EIN BILDERATLAS 1135
Analytischer Index<br />
Seit dem medienhistorischen Einbruch <strong>von</strong> Seitenzahlen in den buchstäblichen<br />
Raum ist in jedem Buch, sofern es über einen Index verfugt, die hypertextuelle<br />
Alternative zur narrativ-linearen Lesart angelegt. Der Index ist nicht schlicht<br />
Beiwerk des Textkörpers, sondern ihm wesentlich implementiert - ein Schlüssel<br />
zu dessen Kodierung. Solange aber Bücher gedruckt und nicht auch elektronisch<br />
vorliegen, bleibt die Option der Volltextsuche versagt. Positiv<br />
gewendet, ergibt sich daraus die Chance zur Information durch strikte Selektion.<br />
An die Stelle eines erschöpfenden Personen-, Orts- und Sachverzeichnisses<br />
tritt daher eine Form des redigierten, akzentuierenden Index: keine<br />
mechanische, buchstäblich ein-eindeutige Begriffs-Suchmaschine, sondern ein<br />
ideosynkratisches Angebot des Autors an seine Leser.<br />
Abschreiben: 774f<br />
Abwesenheit, Absentierung: 281, 942,<br />
949, 961<br />
Achtzehnhundertsechs: 70f, 1061<br />
Administration der Speicher: 408, 607,<br />
710,930, 1039<br />
Adressierung, -barkeit: 103, 134, 252,<br />
296, 335, 426, 486, 555, 577, 621, 689,<br />
714, 776, 786, 803, 810, 864, 959<br />
Aggregatzustände: 30, 83, 487, 634,<br />
652,741<br />
Aktenspur: 725<br />
Algorithmen: 567, 597, 763, 937, 955<br />
Allegoresen, nationale: 409, 801, 809<br />
Alphanumerik: 227, 598, 759, 791, 992,<br />
1010<br />
Annalistik: 203<br />
Apparate: 49<br />
Arbeitsspeicher: 119, 188, 457, 600, 600<br />
arche: 31, 153, 221, 226, 322, 514, 545,<br />
569,637,987, 1006<br />
Archivasthetik: 283, 958, 978<br />
Archiv-Archäologie: 225<br />
A • -korper: 278,376,510.514,455.<br />
•i-32<br />
j.-ig:321<br />
tungen: 336<br />
c: 749, 751<br />
Archivtextur: 44, 305, 545, 557, 957<br />
Askese, hermeneutische: 712<br />
Aufschreibesystem: 108<br />
Aufzählung: 37, 585<br />
Aussagemodus, historischer: 396<br />
Aussagesockel: 494, 707, 874<br />
Automatisierung: 337<br />
Autopoiesis, archivische: 715, 858, 1023<br />
Autorisierung: 458<br />
Bausteine: 302<br />
Beobachterdifferenz: 82, 807, 992, 1016<br />
Bildsortierung: 248, 537, 541, 941, 965<br />
Blick, archäologischer: 363, 379, 950,<br />
1008, 1024<br />
body polittc: 115<br />
Bruchstellen: 29, 448, 745<br />
Buchdruck: 534, 788, 808, 820ff, 826f,<br />
891,898f, 908f<br />
Buchstaben(speicher): 372, 799<br />
Bürokratie: 107<br />
computable numbers: 254, 716, 1023,<br />
1041<br />
data mtmng: 30<br />
damnatio memonae: 435<br />
Daten: 236, 284, 389, 605, 1061<br />
dtstecta membra. 135, 6C3, 897<br />
|
1138 AN Am<br />
Datenasthetik u. -atsthesis: 76, 302, 316,<br />
953f, 989, 1003<br />
Datenbanken: 320, 480, 806, 1032<br />
Datenlagen: 175<br />
Datenrückpeilung: 965<br />
Datenströme: 316<br />
Datenübertragung: 355f, 403<br />
Datenprozessierung, diskrete: 99, 101,<br />
158, 303, 324, 375, 452, 474, 746,<br />
1007, 1025, 1037, 1053<br />
De/modularisierung: 190, 630 Anm. 34,<br />
816,1012<br />
Depot: 430<br />
derelicüo: 412<br />
DestiNation: 660<br />
disieeta membra: 362<br />
Diskontinuität: 241, 341, 484, 635, 669,<br />
767, 990<br />
Diskretion, wissensarchäoiogische:<br />
240, 367, 482, 494, 737<br />
Dislokation: 384<br />
Dispositiv des Speichers: 659<br />
Dokumentation: 538f, 550<br />
double-bind: 334, 374, 498, 613, 804,<br />
922, 978<br />
enargeia, Evidenz 516, 530, 566, 674,<br />
1010, 1030<br />
Energie, mnemische: 469, 599, 731, 858,<br />
866, 873<br />
engtneermg, nationales: 54, 408, 818,<br />
1025<br />
Entropie: 230, 340, 702, 886, 1027, 1051<br />
er/zählen: 68, 440f, 484, 522, 540, 888,<br />
916, 934, 945, 989f, 998, 1000<br />
Erzählung, digital: 133, 846, 991, 1011<br />
Erzählung, unmögliche: 431<br />
Erzählmaschine: 349<br />
Fehlanzeigen: 623<br />
Findbuch: 307<br />
Formate, Formatierung: 145, 592, 779f,<br />
985<br />
Frequenzen, akustische: 524, 551, 877,<br />
8%<br />
garbagr. 718
ISCHER INDEX<br />
Gedächtnisagenturen: 87, 417, 571, 639,<br />
869<br />
Gedächtnisarchäologie: 85<br />
Gedächtnisarchitektur: 245, 790<br />
Gedächtnisbunker: 161<br />
f -r5clsciitn:s:nipcratj»: 4*v, ^-«.o<br />
Gcdächtniskapiul: 84, 111, 672, 738,<br />
750f, 819, 944<br />
Gedächtniskybernetik: 47, 112, 273,<br />
300, 455, 476, 500, 503, 606, 648, 800,<br />
889, 948<br />
Gedächtnismacht: 86, 1061<br />
Gedächtnismaschine: 376, 499, 548,<br />
574, 583, 611 f, 684<br />
Gedächtnisorte: 1045<br />
Gedächtnispolitik: 323, 415, 690, 706,<br />
925<br />
Gedächtnisprothesen: 118<br />
Gedächtnisräume: 48<br />
Gedächtnistechniken: 61, 247<br />
Gedächtniswährung: 594<br />
Gedächtniswissenschaft: 268<br />
Gehäuse, Gestell: 588, 619, 766, 782,<br />
811<br />
<strong>Geschichte</strong>, archivnah: 126<br />
<strong>Geschichte</strong>, im <strong>Namen</strong> der: 519, 612,<br />
853,941, 1032, 1058f<br />
Geschichtskörper: 178f, 510<br />
Geschichtstheorie: 315<br />
Geschichtszeichen: 198, 924<br />
Gestell: 72<br />
Graphen, zahlenbasiert: 1002<br />
Halluzinationen, gedächtnismediale:<br />
529,693, 723<br />
Halteproblem: 867<br />
Hardware des Speichers: 266, 270, 368,<br />
453,723,818,885, 1019<br />
Hermeneutik: 636<br />
Historiogramm: 650<br />
<strong>Im</strong>aginäres: 35, 595, 680<br />
<strong>Im</strong>agination, historv K- ! '" ! ~-V 233,<br />
333,519<br />
Index: 328, 558, 8<br />
Infographie: 722<br />
Informationsisth« 24,<br />
1031 Anm. 99
Information retrieval: 146, 938<br />
Infrastruktur: 51, 60, 383, 429, 850,<br />
1028<br />
Institution des Gedächtnisses; 657<br />
Interpretanten: 705<br />
Inventar: 421 ff, 522<br />
Kalendarik: 405<br />
Kalkül: 202, 215, 397, 754, 77,2f, 998<br />
Kanal, infrastrukturell u. nachrichtentechnisch:<br />
57f, 491, 694, 821 ff, 900<br />
katechon: 67, 173, 256, 279, 295, 568,<br />
590,646,924,929,931, 1057<br />
Klassifizierung: 518<br />
Knochen / Buchstaben: 892, 897, 907<br />
Kodierung: 886, 1051<br />
Kollektivsingular: 329, 1016<br />
Kompaktus-Anlage: 347<br />
Komplexität und Reduktion: 326<br />
Konfiguration, Re-: 1002<br />
Kontingenz: 33f, 214, 966<br />
Kultur als Funktion <strong>von</strong> Gedächtnistechniken:<br />
77ff, 697, 709, 726, 740,<br />
899,914, 1059<br />
Kultur- als Medienwissenschaft: 83<br />
Kulturarchäologie: 526<br />
Kulturpoetik: 388<br />
Kulturtechnik: 105,893<br />
Lagerhaltung, chaotische: 492<br />
Latenzzustand: 559, 605, 665<br />
Leben, archiviert: 879f, 1055<br />
Leere, unfüllbar: 443, 463, 465, 792<br />
Lesbarkeit: 144<br />
Lettern: 917f<br />
Listen: 624, 921 f, 1046f<br />
Lochung: 789, 999<br />
Logistik der Speicher: 274, 474, 632<br />
Lücken, archivische: 361, 420, 445,<br />
602f, 681,861<br />
Mankoprotokoll: 432<br />
mapping: 285, 287, 301, 940, 946<br />
matrnal pbtlology: 140<br />
Materialität, physische: 231, 460f, 468,<br />
701<br />
Mathematisierung: 784f<br />
.Mechanik: 764<br />
ANALYTISCHER INDEX 1139<br />
Medienarchäologie: 26, 56, 72f, 246,<br />
250, 262, 633, 842, 1055<br />
Medienbewußtsein: 237<br />
Mediendifferenz: 691, 797, 1005<br />
Medienlogik: 178<br />
Medienverbund: 156, 245, 306, 539,<br />
643,854, 1043<br />
Medienwechsel: 975<br />
Medienwissenschaft: 912<br />
Metonymie Deutschlands: 117, 387,<br />
394, 444, 553, 687, 868<br />
Mikrophysik: 292, 294, 805, 833<br />
Mnemische Energie: 95, 300<br />
Mobilisierung: 719<br />
Module, modular: 13, 319, 342, 390,<br />
644, 654, 679f, 860, 870, 876<br />
Monument, diskret: 450, 506, 1025<br />
monumenta; 121 ff, 132<br />
Monumentalisierung: 40f, 344, 813,<br />
911,927<br />
Museologistik: 812<br />
Nachrichtendienst: 894, 1016f<br />
Narration als Medium der <strong>Geschichte</strong>:<br />
94, 728<br />
Neunzehnhundertfünfundvierzig: 74f<br />
noise: 138<br />
non-diskursiv: 27, 61, 81, 201, 419, 641,<br />
674,711,814,910,933<br />
non-narrativ: 141, 191, 360f, 911, 936,<br />
983, 997<br />
Nullpunkt, archäologischer: 365, 460<br />
numertts currens: 645, 692, 875<br />
Objektorientierung: 577<br />
Ordnung, symbolische: 471, 596, 689,<br />
730, 974<br />
Ordnung, alphabetische: 531, 549, 596,<br />
728, 835, 872f<br />
Pakctstelle, museale: 425, 437<br />
Papiermaschine: 512, 588, 832, 999,<br />
104lf<br />
Parataxe: 1%, 214, 478f, 498, 582<br />
parerga (am-Werk-Sein): 932, 1017<br />
pattern recognttton: 238<br />
Philologie, monumentale: 371<br />
Platzanweisung: 763<br />
I
1140 ANALYT<br />
poiesis> mediale: 399<br />
Positivismus: 180<br />
posthistotre: 69, 295<br />
Programmierung <strong>von</strong> Gedächtnis: 504,<br />
509,593,617,683,753, 1062f<br />
Prosopopöie: 64, 129, 318, 459, 609,<br />
735,äOo/817<br />
Räume, virtuelle: 151<br />
Rassenstatistik: 734<br />
Rauschen: 234,127, 491, 698, 724<br />
Reale, das: 331, 467, 470, 487, 521, 647,<br />
829, 895, 963, 1033<br />
Realien: 139,486,520<br />
Rearchäologisiemng: 465, Anm. 37<br />
Reduktion <strong>von</strong> Komplexität: 93<br />
Redundanz: 221, 239, 317, 755, 956<br />
Register, Registrierung: 489f, 572f<br />
Reich(s)weiten: 656, 904,, 980<br />
Reproduktion, technische: 377, 535,<br />
986<br />
Reste, Ruinen: 359, 471<br />
Reversibilität, temporale: 993<br />
Rückkopplung: 38, 275, 393, 501, 509,<br />
627,944, 1018<br />
sacred Space: 447, 587, 594, 828, 863,<br />
908<br />
Schaltungen: 39, 582<br />
Schnittstellen: 62f, 757, 839, 947, 971,<br />
977, 1060<br />
Schreiben, archivnah: 41, 597<br />
Schweigen, archäologisches: 477, 483<br />
Semantik, museale: 406<br />
Semiokolonisation: 703<br />
Seriation: 166, 205, 369, 446, 883, 1026<br />
Signifikantengräber: 819<br />
Signifikantenströme: 189, 249, 404f,<br />
602, 853<br />
Sortierung: 309, 51 lf, 561, 642, 739, 770<br />
Souveränität, europäische: 625<br />
Speicherästhetik: 144, 939, 1056<br />
Speichermedien: 6, 502<br />
Speicherplatz: 717, 862, 964
ISCHER INDEX<br />
Standardisierung: 255, 505, 513, 780,<br />
813f,982, 1049<br />
Statistik: 496ff, ,729<br />
Stochastik: 284, 490, 887, 934, 1013<br />
Stratigraphie: 230<br />
Subjektiosigkcit; 466<br />
Symbolische, das nationale: 358, 906<br />
Synapsen: 563<br />
Synchronisation: 135, 167, 494, 549,<br />
697f, 945<br />
Tabellen: 203<br />
Taktik: 272, 287<br />
Tiefenmetapher: 312<br />
Tradition, medientechnisch: 756<br />
Übertragen: 80, 545, 56lf, 597, 831, 994<br />
Übertragungsmedium: 310, 525, 757,<br />
844, 857<br />
Unfall des Archivs: 314<br />
Urkundensemiotik: 659<br />
Variablen: 205, 500<br />
Vektoren, pointer. 52, 277, 314 Anm.<br />
59,528,687,716,984, 1017<br />
Vergessen: 890<br />
Verkehrswissenschaft: 794<br />
Vermessen: 972, 981, 1001<br />
Verschichte: 39, 719<br />
Virtualisierung: 733, 830f„ 865, 973<br />
Widerstreit, historisch-archäologischer:<br />
346, 352, 481, 752, 855f, 1025<br />
Wissensarchäologie: 239, 332, 398, 488<br />
Wissens- und Machtkybernetik: 43,<br />
1021, 1036<br />
Wissenstopologie: 978<br />
Zahlenkolonncn: 428<br />
Zeitrhythmik: 386<br />
Zeitregistratur: 211, 664<br />
Zettel, Kartei, Hypertext: 783, 1054<br />
Zwischenlager: 413, 943
In Wolfgang Ernsts Studie wird die öffentlicher Einsichtnahme<br />
eher verborgene Kehrseile der Fabrikation <strong>von</strong> Vergangenheit<br />
als zur Verfügung stehenden Wissens, also das memorialkybernetische,<br />
materielle, technische (und damit auch rhetorische)<br />
Dispositiv dessen untersucht, was als historischer Diskurs<br />
im 19. und weit ins 20. Jahrhundert hinein seine phänomenologische<br />
Ausprägung fand. Zum Thema werden Irmlrroto<br />
jekfe aus der Welt der Archive, Bibliotheken, Museen und<br />
Institutionen der Datenverarbeitung <strong>von</strong> Vergangenheit in<br />
Deutschland sowie non-diskursive Hilfswissenschaften (Diplomatik,<br />
Statistik) als Aufzeichnungssysteme nationaler Zeiträume.<br />
Methodisch arbeitet diese Studie bewußt epistemologische<br />
Asymmetrien im Umgang mit Daten der Vergangenheit<br />
heraus: als Widerstreit zwischen Monument und Dokument,<br />
zwischen Gedächtnis und Erinnerung, zwischen Datum und<br />
Information, zwischen Archäologie und Historie.<br />
3-7705-3832-3