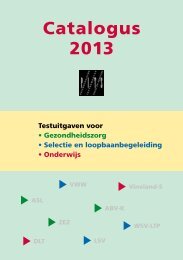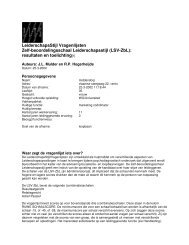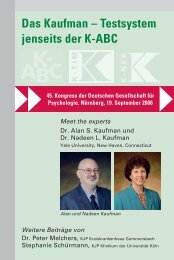K-ABC Interpr.Handb.90-98.indd - Pits
K-ABC Interpr.Handb.90-98.indd - Pits
K-ABC Interpr.Handb.90-98.indd - Pits
- TAGS
- pits
- www.pits-online.nl
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
K-<strong>ABC</strong><br />
Kaufman – Assessment Battery for Children<br />
Deutschsprachige Fassung von<br />
Peter Melchers und Ulrich Preuß<br />
<strong>Interpr</strong>etationshandbuch, Auflage 2006<br />
– Zur Aktualität des Verfahrens und seiner Normen (S. 90-95)<br />
– Der Untertest Gesichter und Orte (S. 95-98)<br />
Copyright © 2007 PITS B.V., Leiden,<br />
www.pits-online.nl, E-Mail: Info@pits-online.nl<br />
Alle Rechte vorbehalten. Aus dieser Ausgabe darf nichts vervielfältigt, als<br />
automatisierter Datenbestand gespeichert und öffentlich gemacht werden<br />
– in jeglicher Form und in jeglicher Weise, sei es elektronisch, mechanisch<br />
durch Fotokopien oder auf irgendeine andere Art – ohne vorherige schriftliche<br />
Zustimmung des Verlages.
Zur Aktualität des Verfahrens und seiner Normen<br />
Die deutschsprachige Fassung der K-<strong>ABC</strong> ist 1991 erschienen, so dass<br />
anlässlich der 7. Auflage im Jahre 2006 Fragen nach der Aktualität der K-<strong>ABC</strong><br />
als Untersuchungsmethode und nach der Aktualität der Normen zu stellen sind.<br />
Hierzu gab es auch drei kritische Stimmen, die nicht verschwiegen werden<br />
sollen. Kennern der Entwicklungen bei den Testverlagen in Europa, speziell<br />
im deutschsprachigen Bereich, sind die Hintergründe bekannt, die schließlich<br />
dazu führten, dass die K-<strong>ABC</strong> seit der 5. Auflage (2001) nicht mehr vom<br />
ehemaligen Verlag Swets & Zeitlinger, sondern vom neuen Verlag PITS in<br />
Leiden herausgegeben wird. Insofern verbietet es sich, auf die Kommentierung<br />
von Horn (2003) inhaltlich näher einzugehen. Ähnlich verhält es sich mit der<br />
Vergleichsarbeit von Preusche & Leiss (2003), die zwar keineswegs kritisch<br />
gegenüber der K-<strong>ABC</strong> ist, aber im Tenor ihre pro domo Motivation nicht ganz<br />
verbergen kann und darüber hinaus viele inkorrekte Darstellungen enthält.<br />
Deimel (2002) versuchte, in den Vorschlägen zur Diagnostik der Lese-<br />
Rechtschreibstörung generelle kategoriale Empfehlungen zum maximalen<br />
Alter verwendeter Testverfahren zu geben, und kommt so zu der Einschätzung,<br />
dass die Normen der K-<strong>ABC</strong> mittlerweile auch schon „etwas veraltet“ seien.<br />
Ohne Zweifel ist das Alter der Normierung speziell bei Leistungstests ein<br />
wichtiges Thema und eine aktuelle Normierung ist immer zu begrüßen, aber<br />
die von Deimel explizit gegebene Empfehlung, dass die Normierung auch bei<br />
Intelligenztests nicht älter als fünfzehn Jahre sein sollte, ist in ihrem pauschalen<br />
und unkritischen Gültigkeitsanspruch doch in Zweifel zu ziehen.<br />
Wenn für ein Verfahren wie die K-<strong>ABC</strong> eine große und der Repräsentativität<br />
zumindest nahe kommende Normierung trotz der Einschränkung durch<br />
Datenschutzauflagen und auch mit Gültigkeit für alle Regionen des<br />
deutschsprachigen Raums durchgeführt werden soll, dann ist dies mit einem<br />
solchen Aufwand verbunden, dass eine Neunormierung alle zehn Jahre nicht<br />
nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus inhaltlichen und motivationalen<br />
Gründen heraus nicht vorstellbar ist. Einige Autoren haben hier in den letzten<br />
Jahren die Alternative gewählt, „große“ Testverfahren mit Hilfe verhältnismäßig<br />
kleiner Untersuchungen (damit sind Stichproben gemeint, die z. T. deutlich<br />
unter 1000 Versuchspersonen liegen) zu normieren. Bei derart kleinen<br />
Normierungsstichproben zeigen sich aber regelhaft recht inhomogene Verläufe<br />
über das Alterskontinuum bzw. das Leistungskontinuum der Stichprobe sowie<br />
über die verschiedenen Bildungsgrade. Diese inhomogenen Verläufe müssen<br />
dann aufwändig statistisch mit varianzanalytischen Methoden korrigiert werden,<br />
was aus Sicht der K-<strong>ABC</strong> Autoren den Vorteil einer großen Stichprobe keinesfalls<br />
kompensieren kann. Insofern wird sich bei den „großen“ Leistungsdiagnostika<br />
immer wieder die Frage stellen, ob kleinen und dann schneller zu wiederholenden<br />
Normierungen oder einer großen stabilen Erhebung der Vorzug zu geben ist, die<br />
dann allerdings auch für längere Zeit Bestand haben muss. Im Folgenden soll<br />
gezeigt werden, dass die K-<strong>ABC</strong> das Kriterium einer stabilen und heute noch<br />
gültigen Normierung ohne Zweifel erfüllt.<br />
Über ihre bisherige Anwendungsgeschichte im deutschsprachigen Raum hat sich<br />
die K-<strong>ABC</strong> bei psychologischen und psychiatrischen Fragestellungen im Vorschul-<br />
2
und Schulalter zu dem am häufigsten angewendeten differenzierenden Verfahren<br />
zur Beurteilung der intellektuellen Leistungsfähigkeit entwickelt. Entsprechend<br />
wichtig ist die Belastbarkeit der normativen Grundlage, denn das Ergebnis der<br />
Leistungsdiagnostik trägt häufig wesentlich zu Entscheidungen bei, die von<br />
nachhaltiger Bedeutung für die Zukunft des betroffenen Kindes sind. Zentrale<br />
Frage bei einem Verfahren, dessen Normierungsuntersuchung nicht mehr ganz<br />
aktuell ist, ist das Auftreten des Flynn-Effekts (Flynn, 1984, 1987). Darunter wird<br />
eine „Verweichung“ oder Vereinfachung der Normen verstanden in dem Sinne,<br />
dass immer mehr Probanden höhere Rohwerte in einem gegebenen Verfahren<br />
erreichen als dies zum Zeitpunkt der Normierung der Fall war. Damit verschiebt<br />
sich der Mittelwert der Verteilung, was nur durch eine neue Normberechnung<br />
korrigierbar wäre. Als Folge werden immer mehr Versuchspersonen höhere<br />
Standardwerte zugeordnet, obwohl dies dann ihrer relativen Position in der<br />
Grundgesamtheit nicht entspricht. Als Ursache des Flynn-Effekts werden soziale,<br />
kognitive, genetische und andere Hypothesen diskutiert, eine eindeutige Klärung<br />
existiert bislang jedoch nicht. Für die <strong>Interpr</strong>etation eines Testergebnisses ist<br />
der Flynn-Effekt von Bedeutung, da die Versuchspersonen dadurch in Bezug<br />
auf ihre reale intellektuelle Leistungsfähigkeit überschätzt werden könnten, was<br />
insbesondere bei Kindern zu problematischen Überforderungsphänomenen<br />
beitragen kann. Weiter ist bekannt, dass sich der Flynn-Effekt deutlich stärker<br />
auf fluide als auf kristalline Tests auswirkt, bei Fertigkeitentests finden sich<br />
sogar häufig umgekehrte Phänomene, die von Rodgers (1998) beschrieben<br />
wurden. In Fertigkeitentests erreichen häufig immer weniger Probanden eine<br />
vergleichbar hohe Rohpunktzahl wie zum Zeitpunkt der Normierung, das heißt<br />
die Vergleichsgrundlage für den untersuchten Probanden wird immer „härter“,<br />
der Test wird immer schwerer.<br />
Eine besondere Stärke der K-<strong>ABC</strong> ist die parallele Erfassung von<br />
intellektuellen Fähigkeiten und erworbenen Fertigkeiten mit entsprechenden<br />
Vergleichsmöglichkeiten. Unter Annahme der vorstehend beschriebenen Effekte<br />
könnte somit das Problem auftreten, dass die Intelligenz zunehmend höher<br />
eingeschätzt wird, während die Fertigkeiten der untersuchten Probanden<br />
tendenziell zu niedrig eingeschätzt werden, was zu dem falschen Schluss führen<br />
könnte, dass bei den betroffenen Probanden hohe Entwicklungspotenziale bei<br />
entsprechender Förderung vorhanden seien. Als Beleg, dass dieses Problem bei<br />
der K-<strong>ABC</strong> auch fünfzehn Jahre nach ihrer Veröffentlichung nicht festzustellen<br />
ist, soll vor allem aus zwei Studien referiert werden.<br />
Während der Adaptation und Evaluation von zwei neuen Testverfahren<br />
für Jugendliche und Erwachsene, dem Kaufman – Neuropsychologischer<br />
Kurztest (K-NEK; Melchers & Schürmann, 2004) und dem Kaufman – Test<br />
zur Intelligenzmessung für Jugendliche und Erwachsene (K-TIM; Melchers,<br />
Schürmann & Scholten, 2006) fanden mehrere Vergleichsuntersuchungen<br />
dieser beiden neuen Verfahren mit der K-<strong>ABC</strong> statt. Während Sauter (2003)<br />
eine kinder- und jugendpsychiatrische Inanspruchnahmestichprobe im Alter von<br />
11;0 bis 12;5 Jahren untersuchte, zog Oest (2002) eine Feldstichprobe von 68<br />
Kindern im gleichen Altersbereich heran, die sich so weitgehend gleichmäßig<br />
aus Schülern verschiedener Schulformen zusammensetzte, dass hier von einer<br />
Annäherung an Repräsentativität gesprochen werden kann. Die Ergebnisse der<br />
Arbeit von Oest sind auf Tafel 4.6 dargestellt.<br />
3
Tafel 4.6: Korrelationen der Skalen- und Standardwerte des K-TIM mit den<br />
Standardwerten der K-<strong>ABC</strong> Skalen; N=68 (nach Oest, 2002)<br />
K-<strong>ABC</strong> Skala<br />
Untertest bzw. Skala Skala Skala Fertig- Sprach-<br />
Skala des K-TIM M SD einzelheit- ganzheit- intellek- keiten- freie<br />
lichen lichen tueller skala Skala<br />
Denkens Denkens Fähigkeiten<br />
Worträtsel 9,2 2,4 .28 .31 .37 .64 .23<br />
Auditives Verständnis 9,6 2,4 .25 .30 .34 .64 .33<br />
Doppelte Bedeutungen 9,8 2,1 .27 .48 .48 .56 .43<br />
Persönlichkeiten 10,0 2,7 -.07 .16 .08 .25 .06<br />
Symbole Lernen 9,8 2,2 .36 .40 .47 .54 .43<br />
Logische Denkschritte 9,8 2,6 .26 .49 .48 .37 .52<br />
Zeichen Entschlüsseln 10,3 2,6 .48 .63 .70 .49 .66<br />
Figurales Gedächtnis 9,6 2,4 .31 .61 .59 .47 .59<br />
Skala kristalliner Intelligenz 97,4 11,1 .25 .37 .39 .67 .32<br />
Skala fluider Intelligenz 99,2 12,1 .47 .67 .72 .59 .70<br />
Skala Gesamt-Intelligenz 98,0 10,9 .42 .60 .64 .73 .59<br />
Bei den Ergebnissen handelt es sich primär um Korrelationen zwischen<br />
den Skalen und Untertests des Kaufman – Tests zur Intelligenzmessung<br />
(K-TIM) und den Skalen der K-<strong>ABC</strong>, die als ein Teilbeleg zur Bestätigung<br />
der Konstruktvalidität des neuen Verfahrens dienten. Als Zusatzbefund kann<br />
festgestellt werden, wie eng der Altersanschluss der Normen im Vergleich<br />
der K-<strong>ABC</strong> als typisches Diagnostikum für Kinder mit dem K-TIM als einem<br />
Verfahren, das von der Konzeption her speziell für ältere Jugendliche und<br />
Erwachsene entworfen wurde, gelungen ist. Eine Stichprobe von insgesamt<br />
68 Probanden darf sicherlich nicht überinterpretiert werden, aber die geringe<br />
Diskrepanz der Mittelwerte für die im jeweiligen Verfahren gemessene<br />
Gesamtintelligenz (98,0 im K-TIM und 96,8 in der K-<strong>ABC</strong>) zeigt mit nur<br />
1,2 Standardwertpunkten, dass die normative Grundlage der K-<strong>ABC</strong> mit<br />
der aktuell für den K-TIM erhobenen absolut vergleichbar ist. Wichtiger als<br />
dieser Aspekt ist jedoch die isolierte Betrachtung der errechneten Mittelwerte<br />
für die Skalen der K-<strong>ABC</strong> in dieser Stichprobe. Für die Skala intellektueller<br />
Fähigkeiten wurde ein Mittelwert von 96,8 ermittelt, für die Fertigkeitenskala<br />
von 96,7. Mit einer Abweichung von 3,2 bzw. 3,3 Punkten vom idealer<br />
weise erwarteten Mittelwert liegen diese gemittelten Gesamtergebnisse für<br />
intellektuelle Fertigkeiten und erworbenen Fertigkeiten absolut in dem Bereich,<br />
der im Sinne unbeeinträchtigter Aktualität und Anwendbarkeit der Normen<br />
interpretiert werden kann. Erwartungskonträr ist, dass diese Abweichungen<br />
nach unten zeigen, da unter Annahme des Flynn-Effekts in Anbetracht des<br />
Alters der Normierung eine Abweichung nach oben erwartet wurde. Die<br />
Analyse der Stichprobe durch Oest ergab keine Hinweise auf nach unten stark<br />
abweichende „Ausreißer“ in der Stichprobe oder andere Phänomene, mit denen<br />
4<br />
K-<strong>ABC</strong> Mittelwert (M) 95,4 98,0 96,8 96,7 96,7<br />
Standardabweichung (SD) 11,3 11,5 9,1 12,0 11,3<br />
K-TIM = Kaufman – Test zur Intelligenzmessung
dieser Befund erklärt werden könnte. Er ist somit dahingehend zu interpretieren,<br />
dass bei der K-<strong>ABC</strong> kein relevanter Flynn-Effekt vorliegt und die normative<br />
Grundlage des Verfahrens auch fünfzehn Jahre nach seiner Veröffentlichung<br />
als unproblematisch anzusehen ist.<br />
Nicht unerwähnt bleiben soll die mit einem mittleren Standardwert von 95,4<br />
stärkere Abweichung der Skala einzelheitlichen Denkens gegenüber der<br />
Skala ganzheitlichen Denkens (98,0). Auch für diese leicht unterschiedliche<br />
Entwicklung ließ sich in der Stichprobe keine gute Begründung finden, so<br />
dass hier zwei Hypothesen in Betracht kommen. Zum einen ist denkbar,<br />
dass sich bei den Untertests der Skala einzelheitlichen Denkens, bei<br />
denen im Konzept wohl überlegt vor allem auditive Kurzzeitgedächtnis-<br />
leistungen und Seriationsfähigkeit eine Rolle spielen, im Zeitraum seit der<br />
Normierung eine partiell andere Entwicklung manifestiert hat als bei den<br />
Untertests der Skala ganzheitlichen Denkens. Im Hintergrund wären hier<br />
die Erwägungen einiger Entwicklungsforscher zu berücksichtigen, dass<br />
die Entwicklung auditiver Funktionen beim Kind durch die immer größere<br />
Prädominanz visueller Medien beeinträchtigt wird. Dieser Aspekt ist aus den<br />
vorliegenden Daten aber sicherlich nicht zu klären. Die andere Hypothese<br />
bezieht sich darauf, dass in der von Oest untersuchten Feldstichprobe der Anteil<br />
der unauffälligen Probanden möglicherweise nicht ganz so groß war, wie bei<br />
einer Feldstichprobe zu erwarten. Auch diese Überlegung ist nicht zu belegen,<br />
aber insoweit plausibel, als dass sich die sequenzielle Verarbeitung, die von der<br />
Skala einzelheitlichen Denkens gefordert wird, häufig als der stärker vulnerable<br />
Verarbeitungsanteil erweist.<br />
Preuß und Mitarbeiter untersuchten eine Stichprobe von 371 Schweizer Kindern<br />
im Alter von drei bis elf Jahren. Die Ergebnisse werden demnächst differenziert<br />
an anderer Stelle publiziert, daher sollen hier nur die Hauptergebnisse referiert<br />
werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen der K-<strong>ABC</strong>-Normierungsstichprobe<br />
waren drei interessante Aspekte festzustellen:<br />
Erstens zeigte die Skala intellektueller Fähigkeiten bei den Kindern im Schulalter<br />
keine relevante Abweichung von dem idealer weise erwarteten Mittelwert<br />
von 100 und bei den Kindern im Vorschulalter eine leichte Abweichung nach<br />
unten. Die Standardwerte für die Skala intellektueller Fähigkeiten bewegten<br />
sich zwischen 96 bei den dreijährigen und 98 bei den fünfjährigen Kindern,<br />
bei den Schulkindern lagen alle Ergebnisse um 100. Insofern zeigen sich bei<br />
dieser Schweizer Studie insgesamt etwas geringere Abweichungen als in der<br />
Untersuchung von Oest, die vorgefundenen Abweichungen zeigen aber die<br />
gleiche Richtung.<br />
Zweitens zeigte sich vergleichbar mit den Ergebnissen von Oest die deutlichste<br />
Abweichung bei der Skala einzelheitlichen Denkens.<br />
Drittens zeigte sich im Gegensatz zu den Ergebnissen von Oest bei den Schweizer<br />
Kindern eine etwas stärkere Abweichung der mittleren Standardwertergebnisse<br />
für die Fertigkeitenskala. Diese lagen im Schulalter zwischen 93 und 96, was<br />
als vorsichtiger Hinweis auf den von Rodgers beschriebenen Effekt interpretiert<br />
werden könnte. Zusammenfassend ist aber auch für wesentlich größere<br />
Untersuchung in der Schweiz festzustellen, dass ein relevanter Flynn-Effekt für<br />
die K-<strong>ABC</strong> nicht feststellbar war, die normative Grundlage des Verfahrens somit<br />
als weiterhin aktuell und belastbar angesehen werden kann.<br />
5
Ein „Normbeweis“ im Sinne von Gruppenvergleichen zum Nachweis fehlender<br />
signifikanter Unterschiede wurde hinsichtlich beider Studien nicht angestrebt,<br />
dazu sind die herangezogenen Stichproben teils zu klein und fraglich zu wenig<br />
repräsentativ. Sie sind andererseits aber groß und gut genug, um das Fehlen<br />
eines relevanten Flynn-Effekts zu belegen, und das ist hier der entscheidende<br />
Aspekt.<br />
Der Untertest Gesichter und Orte<br />
Die Aktualität der Inhalte wie der Normen für den Untertest Gesichter und Orte<br />
wird gelegentlich diskutiert, jedoch leider nur selten auf dem Hintergrund einer<br />
adäquaten Erkenntnisgrundlage. Die Tatsache, dass mit Gesichter und Orte nicht<br />
Intelligenz, sondern erworbene Fertigkeiten unter besonderer Berücksichtigung<br />
sozial-adaptiver und kultureller Aspekte des Lernens gemessen werden, sollte<br />
auch bei der <strong>Interpr</strong>etation dieses Untertests Berücksichtigung finden. Das<br />
Abfragen von beispielsweise Märcheninhalten innerhalb eines Untertests, der<br />
gezielt auch kulturabhängiges Wissen und Können erfassen soll, mag schwer<br />
mit der Vorstellung übereinstimmen, dass sich Kinder heute nur noch für die<br />
aktuellen medialen Inhalte interessieren, oder dass Märchen von den Eltern<br />
nicht mehr vermittelt würden, da sie zu grausam seien. Empirisch zeigt sich ein<br />
deutlich anderes Bild.<br />
In einem erneuten Rückgriff auf die Arbeit Oest zeigt Tafel 4.7 Mittelwerte,<br />
Standardabweichungen sowie die Abweichung vom idealer weise erwarteten<br />
Mittelwert für alle Untertests der K-<strong>ABC</strong> bei der schon beschriebenen Stichprobe.<br />
In Ergänzung zu den oben bereits gemachten Äußerungen ist festzustellen,<br />
dass sich bei den Untertests durchgängig eine ähnlich geringe Abweichung<br />
vom erwarteten Mittelwert zeigt wie bei den Skalen. Hervorzuheben ist jedoch,<br />
Tafel 4.7: Mittlere K-<strong>ABC</strong> Untertest – Skalenwerte und ihre Abweichungen vom<br />
theoretischen Mittelwert; N = 68 (Nach Oest, 2002)<br />
K-<strong>ABC</strong> Standard-<br />
Untertest bzw. Skala Minimum Maximum Mittelwert abweichung Abweichung *<br />
U3 Handbewegungen 6 14 9,9 2,18 - 0,1<br />
U5 Zahlennachsprechen 4 15 8,9 2,49 - 1,1<br />
U7 Wortreihe 4 14 8,8 2,41 - 1,2<br />
U4 Gestaltschließen 5 16 10,8 2,24 + 0,8<br />
U6 Dreiecke 3 13 10,4 1,95 + 0,4<br />
U8 Bildhaftes Ergänzen 3 13 8,8 2,70 - 1,2<br />
U9 Räumliches Gedächtnis 5 15 9,8 2,71 - 0,2<br />
U10 Fotoserie 4 13 8,9 2,60 - 1,1<br />
U12 Gesichter und Orte 77 120 98,3 10,70 - 1,7<br />
U13 Rechnen 74 117 97,8 10,02 - 2,2<br />
U14 Rätsel 68 122 95,7 14,75 - 4,3<br />
U16 Lesen/Verstehen 67 115 96,2 11,58 - 3,8<br />
* In dieser Spalte sind die Differenzen zwischen den Ergebnissen der untersuchten Stichprobe und den theoretisch<br />
erwarteten Mittelwerten von 10 (Skalenwerte) bzw. 100 (Standardwerte) dargestellt.<br />
6
dass bei den Untertests der Fertigkeitenskala Gesichter und Orte die absolut<br />
geringste Abweichung von dem idealer weise zu erwartenden Mittelwert zeigt.<br />
Allein dieses Ergebnis zeigt, dass die normative Grundlage von Gesichter und<br />
Orte genauso aktuell ist wie die des gesamten Verfahrens, was unabhängig<br />
von der Frage gilt, wie man zu dem Messkonzept dieses Untertests inhaltlich<br />
stehen mag.<br />
Gegenüber diesen Ausführungen könnte eingewendet werden, dass sich die<br />
psychometrischen bzw. normativen Probleme bei Gesichter und Orte nur in<br />
der unteren Hälfte des Altersbereichs zeigen, den die K-<strong>ABC</strong> abdeckt. Diese<br />
Frage ergibt sich aus dem Aspekt, dass vor allem Märchen in der inhaltlichen<br />
Konzeption von Gesichter und Orte für Kinder im Alter von fünf, sechs oder<br />
sieben Jahren eine größere Rolle spielen als für die hier herangezogenen<br />
Kinder im Alter von 11;0 bis 12;5 Jahren. Um dieser Frage weiter nachzugehen,<br />
wurde eine Stichprobe von 120 Kindern im Alter von drei bis neun Jahren<br />
untersucht, die als Inanspruchnahmestichprobe zu etwa gleichen Teilen aus<br />
dem Patientengut eines großen sozialpädiatrischen Zentrums und einer<br />
kleinen kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz stammen. Alle in diese<br />
Stichprobe aufgenommenen Kinder waren im Vorfeld und unabhängig von<br />
der hier durchgeführten Auswertung wegen klinischer Fragestellungen mit<br />
der K-<strong>ABC</strong> untersucht worden. Systematisch ausgeschlossen wurden Kinder,<br />
die wegen einer Intelligenzminderung im Sinne einer manifesten geistigen<br />
Behinderung, wegen einer autistischen Störung oder wegen Verhaltensauffälligkeiten<br />
bei Hochbegabung vorgestellt worden waren, darüber hinaus gab es<br />
keine Ausschlusskriterien.<br />
Die in Tafel 4.8 dargestellten mittleren Untertestergebnisse, die als Skalenwerte<br />
für die Untertests der Skala intellektueller Fähigkeiten und als Standardwerte<br />
für die Untertests der Fertigkeitenskala ausgedrückt sind, zeigen bei dieser<br />
Inanspruchnahmestichprobe naturgemäß nicht die gleiche Annäherung an<br />
den idealer weise zu erwartenden Mittelwert wie die weiter oben besprochenen<br />
Ergebnisse der Feldstichprobe. Die mittleren Standardwerte für die Gesamt-<br />
skalen wurden mit aufgelistet, um dem Leser den interessanten Vergleich<br />
zwischen Feld- und Inanspruchnahmestichprobe zu ermöglichen. So zeigt sich<br />
unter anderem, dass das Vorliegen psychischer Auffälligkeiten den Erwerb von<br />
Fertigkeiten offensichtlich stärker beeinträchtigt als die Entwicklung intellektueller<br />
Fähigkeiten.<br />
Im Hinblick auf die vorliegende Fragestellung ist der entscheidende Aspekt<br />
bei diesen mittleren Untertestergebnissen der Inanspruchnahmestichprobe<br />
jedoch, dass sich auch bei den wesentlich jüngeren Kindern keine relevante<br />
Abweichung des mittleren Untertestergebnisses für Gesichter und Orte zeigt,<br />
die über die Abweichungen der anderen Untertests der Fertigkeitenskala<br />
hinausgehen oder dem allgemeinen Trend, auch bei den Untertests des<br />
Intelligenzbereichs, widersprechen würde. Im Gegenteil, mit Ausnahme des<br />
Untertests Rätsel (Abweichung –9,9 Standardwertpunkte) zeigt Gesichter und<br />
Orte auch in der Inanspruchnahmestichprobe die niedrigste Abweichung aller<br />
Untertests der Fertigkeitenskala. Somit ist festzustellen, dass Gesichter und<br />
Orte nicht der „Ausnahmeuntertest“ in der Fertigkeitenskala ist, sondern ebenso<br />
wie die anderen Untertests weiterhin über die erforderliche normative Gültigkeit<br />
verfügt.<br />
7
Tafel 4.8: Mittlere K-<strong>ABC</strong> Testleistungen (Skalen und Standardwerte) und deren<br />
Abweichungen vom theoretischen Mittelwert bei einer kombinierten<br />
sozialpädiatrischen sowie kinder- und jugendpsychiatrischen Inanspruchnahmestichprobe;<br />
N = 120.<br />
K-<strong>ABC</strong> Standard-<br />
Untertest bzw. Skala Minimum Maximum Mittelwert abweichung Abweichung *<br />
U3 Handbewegungen 3 17 8,4 2,56 - 1,6<br />
U5 Zahlennachsprechen 3 15 8,1 2,52 - 1,9<br />
U7 Wortreihe 3 14 8,4 2,63 - 1,6<br />
U1 Zauberfenster 3 16 8,8 4,22 - 1,2<br />
U2 Wiedererkennen v.Gesichtern 5 16 10,9 2,18 + 0,9<br />
U4 Gestaltschließen 2 14 9,3 2,61 - 0,7<br />
U6 Dreiecke 2 17 8,5 3,17 - 1,5<br />
U8 Bildhaftes Ergänzen 4 14 8,7 2,56 - 1,3<br />
U9 Räumliches Gedächtnis 2 15 8,6 3,10 - 1,4<br />
U10 Fotoserie 5 15 8,3 2,18 - 1,7<br />
U11 Wortschatz 62 107 87,2 12,56 - 12,8<br />
U12 Gesichter und Orte 52 144 89,4 17,51 - 10,6<br />
U13 Rechnen 53 121 88,1 13,69 - 11,9<br />
U14 Rätsel 50 130 90,1 16,03 - 9,9<br />
U16 Lesen/Verstehen 64 128 89,0 16,20 - 11,0<br />
Skala einzelheitlichen Denkens 62 128 89,7 12,96 - 10,3<br />
Skala ganzheitlichen Denkens 55 124 91,8 13,46 - 8,2<br />
Skala intellektueller Fähigkeiten 61 114 90,7 10,73 - 9,3<br />
Fertigkeitenskala 47 130 86,5 16,66 - 13,5<br />
Sprachfreie Skala 57 119 90,5 13,36 - 9,5<br />
* In dieser Spalte sind die Differenzen zwischen den Ergebnissen der untersuchten Stichprobe und den theoretisch<br />
erwarteten Mittelwerten von 10 (Skalenwerte) bzw. 100 (Standardwerte) dargestellt.<br />
In einer Untersuchung an einer Stichprobe Schweizer Kinder (Preuß, 2006)<br />
zeigte sich jedoch, dass Gesichter und Orte einige problematische Items enthält,<br />
was zum Normierungszeitpunkt nicht festzustellen war. Um diesen Aspekten<br />
Rechnung zu tragen, wurde für Kinder, die keinen deutschen Akkulturations-<br />
hintergrund haben, ein teilweise geändertes <strong>Interpr</strong>etationsvorgehen<br />
vorgeschlagen (siehe Seite 43 des K-<strong>ABC</strong> Durchführungs- und Auswertungshandbuchs).<br />
Auch und gerade unter dem Aspekt dieser Modifikation<br />
sollte jedoch nicht übersehen werden, dass Gesichter und Orte bei Kindern<br />
mit deutschem Akkulturationshintergrund in aller Regel das beste Maß für<br />
häuslichen Fertigkeitenerwerb und Förderung darstellt, und somit häufig<br />
unverzichtbare <strong>Interpr</strong>etationsaspekte bietet.<br />
8