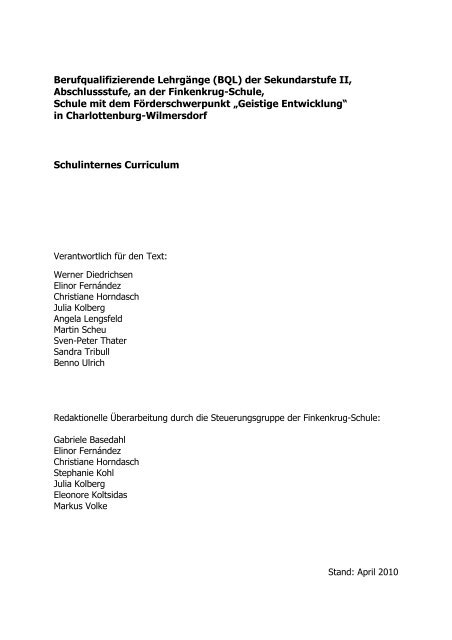BQL-Curriculum - Finkenkrug-Schule
BQL-Curriculum - Finkenkrug-Schule
BQL-Curriculum - Finkenkrug-Schule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Berufqualifizierende Lehrgänge (<strong>BQL</strong>) der Sekundarstufe II,<br />
Abschlussstufe, an der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong>,<br />
<strong>Schule</strong> mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“<br />
in Charlottenburg-Wilmersdorf<br />
Schulinternes <strong>Curriculum</strong><br />
Verantwortlich für den Text:<br />
Werner Diedrichsen<br />
Elinor Fernández<br />
Christiane Horndasch<br />
Julia Kolberg<br />
Angela Lengsfeld<br />
Martin Scheu<br />
Sven-Peter Thater<br />
Sandra Tribull<br />
Benno Ulrich<br />
Redaktionelle Überarbeitung durch die Steuerungsgruppe der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong>:<br />
Gabriele Basedahl<br />
Elinor Fernández<br />
Christiane Horndasch<br />
Stephanie Kohl<br />
Julia Kolberg<br />
Eleonore Koltsidas<br />
Markus Volke<br />
Stand: April 2010
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Bestandsaufnahme .................................................................................. 3<br />
2. Berufsqualifizierende Lehrgänge an der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> –<br />
Organisation und zeitlicher Ablauf .......................................................... 3<br />
3. Kompetenzerwerb ................................................................................... 4<br />
4. Arbeitsbereiche und Curricula ................................................................. 5<br />
4.1 <strong>BQL</strong> „Kiosk“ (S. Tribull, Sonderschullehrerin) ............................................................. 5<br />
4.2 <strong>BQL</strong> „Garten“ (S. Tribull, Sonderschullehrerin)........................................................... 5<br />
4.3 <strong>BQL</strong> „Hauswirtschaft“ (W. Diedrichsen, Sonderschullehrer) ......................................... 6<br />
4.4 <strong>BQL</strong> „Bäckerei“ (W. Diedrichsen, Sonderschullehrer) .................................................. 6<br />
4.5 <strong>BQL</strong> „Holz“ (B. Ulrich, Werkstattleiter und Pädagogische Unterrichtshilfe, und S-P.<br />
Thater, Lehramtsanwärter) ...................................................................................... 6<br />
4.6 <strong>BQL</strong> „Kunst“ (A. Lengsfeld und M. Scheu, Sonderschullehrer) ..................................... 7<br />
4.7 Lehrgangstage in den Lankwitzer Werkstätten, Kooperationspartner (Ch. Horndasch,<br />
Sonderschulrektorin) ............................................................................................... 7<br />
4.8 <strong>BQL</strong> „Medien“ am Beispiel „Digitale Fotografie“ (S-P. Thater, Lehramtsanwärter) ......... 8<br />
4.9 <strong>BQL</strong> „Schülerzeitung“ (Fr. Fernández, Sonderschullehrerin) ........................................ 9<br />
5. Evaluation und Ergebnispräsentation ................................................... 10<br />
6. Schlussbetrachtung ............................................................................... 11<br />
7. Verwendete und weiterführende Literatur ........................................... 12<br />
2
1. Bestandsaufnahme<br />
Die sich verändernde Sichtweise über die Teilhabe von Menschen mit Behinderung<br />
am Berufsleben machte in der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> eine organisatorische und inhaltliche<br />
Neuorientierung innerhalb der Abschlussstufe notwendig. So erschien vor allem<br />
das Klassenlehrerprinzip in der Abschlussstufe als nicht mehr zufriedenstellend und<br />
zeitgerecht.<br />
Die Stufenkonferenzen entwickelten neue Vorschläge, die in der Steuerungsgruppe<br />
diskutiert wurden.<br />
Die Schulkonferenz stimmte im Jahr 2006 der Umstrukturierung in ein Kurssystem<br />
(Berufsqualifizierende Lehrgänge) mit zwei Tagen pro Woche zu.<br />
Kooperationsverträge wurden geschlossen und inhaltlich diskutiert (Lankwitzer Werkstätten,<br />
Kommunale Galerie, Gartenarbeitsschule, Universität der Künste, Medienzentrum<br />
Clip).<br />
Eltern wurden an Elternabenden informiert und brachten Vorschläge ein.<br />
Neben der curricularen Planung von Lehr- und Lernprozessen stand die soziale<br />
Kompetenzerweiterung im Mittelpunkt. Die möglichst selbstbestimmte Teilhabe am<br />
gesellschaftlichen sowie beruflichen Leben ist das Ziel.<br />
Das hier vorliegende <strong>Curriculum</strong> informiert über Inhalt und Organisation der Berufsqualifizierenden<br />
Lehrgänge. Es dient gleichzeitig als verbindliche Arbeitsgrundlage für<br />
das Kollegium der <strong>Schule</strong>.<br />
2. Berufsqualifizierende Lehrgänge an der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong><br />
– Organisation und zeitlicher Ablauf<br />
An der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> werden im Rahmen der Berufsorientierung in den<br />
Abschlussstufen Berufsqualifizierende Lehrgänge angeboten.<br />
An zwei Tagen in der Woche findet für die 11. und 12. Jahrgangsstufe ein rotierendes<br />
Kurssystem statt. In den Lehrgängen arbeiten Schülerinnen und Schüler<br />
herausgelöst aus ihrem Klassenverband mit Schülerinnen und Schülern anderer<br />
Abschlussstufenklassen gemeinsam. Die Lehrgänge haben das Ziel, dass<br />
Schülerinnen und Schüler Erfahrungen in verschiedenen Berufssparten sammeln und<br />
dabei eigene Vorlieben feststellen können. Dies geschieht im Hinblick auf eine<br />
spätere Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) oder bei<br />
anderen Arbeitgebern. Tätigkeitsprofile und Arbeitsanforderungen in den <strong>BQL</strong> sind<br />
denen der realen Arbeitswelt angeglichen.<br />
Pro Schuljahr nimmt jede Schülerin und jeder Schüler der <strong>Finkenkrug</strong>schule an drei<br />
jeweils zehnwöchigen Kursen teil. Die einzelnen Kurse sind mit jeweils einer Woche<br />
Pause voneinander getrennt, in denen auf den neuen Arbeitsbereich vorbereitet wird.<br />
Mit Schuljahresbeginn setzen sich die zuständigen Pädagogenteams der Abschlussstufen<br />
zu einer kurzen Planungsphase zusammen, in der die möglichen Arbeitsplätze<br />
und -bereiche für jede Schülerin und jeden Schüler geplant werden.<br />
3
Schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler durchlaufen je nach ihren<br />
Fähigkeiten ebenfalls das rotierende Kurssystem. Sie haben jedoch zusätzlich die<br />
Möglichkeit, zwei- und vierwöchige Blockpraktika in den Tagesförderstätten oder<br />
speziellen Fördergruppen der Lankwitzer Werkstätten zu absolvieren. Um eine<br />
qualifizierte Vorbereitung auf das Berufsleben auch schwerstmehrfachbehinderter<br />
Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen, müssen Schulhelferstunden zur Verfügung<br />
stehen.<br />
Zu Beginn des letzten Schulbesuchsjahres können die Eltern oder Erziehungsberechtigten<br />
der Schülerin oder des Schülers einen Termin bei der Agentur für Arbeit für ihr<br />
Kind vereinbaren. Hierfür wenden sie sich an die für ihren Wohnort zuständige<br />
Agentur für Arbeit. Nach einem Erstgespräch wird die Familie an einen Reha-Berater<br />
der Agentur vermittelt und es kommt zu einem erneuten Termin.<br />
Am Ende des zehnten Schulbesuchsjahres meldet die Schulleitung die in Frage<br />
kommenden Schülerinnen und Schüler einer für die <strong>Schule</strong> arbeitenden Reha-<br />
Beraterin. Bei der Agentur für Arbeit Berlin Nord gibt es eine für die <strong>Finkenkrug</strong>-<br />
<strong>Schule</strong> zuständige Reha-Beraterin, die im Vorfeld der <strong>Schule</strong> einen Besuch abstattet<br />
und die in Frage kommenden Schüler kennenlernt. Die Eltern werden über diesen<br />
Vorgang unterrichtet.<br />
3. Kompetenzerwerb<br />
Leitziel der Berufsqualifizierenden Lehrgänge ist die kontinuierliche Erweiterung des<br />
individuellen Kompetenzinventars jeder Schülerin und jedes Schülers. In den folgenden<br />
vier Kompetenzbereichen sollen Fortschritte erzielt werden:<br />
Sachkompetenz<br />
- Aneignung von Fachwissen im jeweiligen Arbeitsbereich<br />
- Sammeln von praktischen Erfahrungen im jeweiligen Sektor<br />
Methodenkompetenz<br />
- Sicherheitsregeln beachten und einhalten<br />
- Arbeitsaufträge annehmen und erledigen können<br />
- Erfahrungen mit grundlegenden Techniken und Werkzeugen sammeln<br />
- eine Produktion planen und Teilarbeitsschritte durchführen können<br />
Personale Kompetenz<br />
- den veränderten zeitlichen Ablauf des Schulalltags annehmen können<br />
- das eigene Interesse an einer späteren Tätigkeit einschätzen können<br />
- die eigene Arbeitskraft realistisch einzuschätzen lernen<br />
Sozialkompetenz<br />
- im Team arbeitsteilig arbeiten können<br />
- eigenes Verhalten und dessen Konsequenzen abschätzen können, um Arbeitsablauf<br />
zu gewährleisten und andere nicht zu gefährden<br />
- Kontaktaufnahme und Arbeit mit wechselnden Bezugspersonen<br />
4
4. Arbeitsbereiche und Curricula<br />
An der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> werden folgende Arbeitsbereiche angeboten:<br />
- Kiosk<br />
- Gartenarbeit (Schulgarten, Kooperation mit der Gartenarbeitsschule<br />
Wilmersdorf)<br />
- Hauswirtschaft und Bäckerei (Lehrwohnung, Küche, Bäckerei)<br />
- Holzwerkstatt im Haus<br />
- Kunst (Kooperation mit der Kommunalen Galerie Wilmersdorf und<br />
der Universität der Künste, verschiedene Sekundarschulen)<br />
- Lehrgangstage in den Lankwitzer Werkstätten<br />
- Medien (Computer, Foto, Film; Kooperation mit dem Medienzentrum<br />
Clip (Schöneberg) im Rahmen von Filmprojekten)<br />
- Schülerzeitung (Kooperation mit der Berliner Zeitung)<br />
Mit den angebotenen Arbeitsbereichen kann die <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> optimal den<br />
Erwerb von Leitkompetenzen im Fach Arbeitslehre fördern.<br />
Die für die jeweiligen Arbeitsbereiche zuständigen Sonderschullehrer und Pädagogischen<br />
Unterrichtshilfen haben Curricula entworfen, überarbeitet und evaluiert. Sie<br />
sind an der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> klassenübergreifend gültig, wurden den einzelnen<br />
Gremien und der Schulleitung vorgelegt sowie dem gesamten Kollegium als Arbeitsgrundlage<br />
zur Verfügung gestellt. Sie werden im Folgenden zusammengetragen.<br />
Die Förderziele sind für jede Schülerin und jeden Schüler individuell und differenziert<br />
formuliert.<br />
4.1 <strong>BQL</strong> „Kiosk“ (S. Tribull, Sonderschullehrerin)<br />
Im Lernbereich „Kiosk“ sollen die Schüler möglichst in alle Prozesse, von der Planung,<br />
über den Verkauf bis hin zur Buchführung beteiligt sein. Weitere<br />
Informationen können Sie dem Schulprogramm der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> entnehmen.<br />
4.2 <strong>BQL</strong> „Garten“ (S. Tribull, Sonderschullehrerin)<br />
Der <strong>BQL</strong> „Garten“ findet regelmäßig einmal wöchentlich am außerschulischen Lernort<br />
Gartenarbeitsschule „Ilse Demme“<br />
Dillenburger Str. 57<br />
14199 Berlin<br />
statt. An einem anderen Tag der Woche arbeiten die Schüler im eigenen<br />
Schulgarten. Von Oktober bis ca. Mitte März nehmen die Schüler in der<br />
Gartenarbeitsschule an verschiedenen Projekten rund um den Bereich Gärtnerei bzw.<br />
Garten- und Landschaftspflege teil. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem<br />
Schulprogramm.<br />
5
4.3 <strong>BQL</strong> „Hauswirtschaft“ (W. Diedrichsen,<br />
Sonderschullehrer)<br />
Im <strong>BQL</strong> „Hauswirtschaft“ sollen Kompetenzen erworben werden, die den jungen<br />
Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich in entsprechenden Arbeitsfeldern nach<br />
Beendigung der Schulzeit zu qualifizieren.<br />
Über das gemeinsame Mittagessen in der schulischen <strong>BQL</strong>-Kantine werden die<br />
Schüler zunehmend auf die Situation ineiner berufsbezogenen Kantine vorbereitet<br />
und dafür erforderliche soziale Kompetenzen entwickelt.<br />
Der Lehrgang beinhaltet die Organisation der Kantine und beteiligt die Schüler an<br />
den Bereichen Planung, Einkauf und Zubereitung von Speisen (z.B. Salate,<br />
Nachtisch) für die <strong>BQL</strong>-Kantine. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem<br />
Schulprogramm.<br />
4.4 <strong>BQL</strong> „Bäckerei“ (W. Diedrichsen, Sonderschullehrer)<br />
Der <strong>BQL</strong> „Bäckerei“ bietet den Schülern vielfältige Möglichkeiten, sich in Hinblick auf<br />
Anforderungen im späteren Berufsleben zu qualifizieren und entsprechend<br />
Kompetenzen zu erweitern.<br />
Im Vordergrund des Lehrgangs steht die Produktion von Backwaren für den Verkauf<br />
(hier exemplarisch die Produktion von Brot). Dabei soll ein Produkt mit einer hohen<br />
Alltagsbedeutung zubereitet werden, das sich an ernährungswissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen orientiert (gesunde vollwertige Ernährung) und in der Qualität Marktfähigkeit<br />
erreicht. Die Produktion soll zudem einen quantitativen Rahmen erreichen,<br />
der für die Schüler über den Vertrieb einen erkennbaren Mehrwert erzielen lässt.<br />
Der Lehrgang beteiligt die Schüler an den Bereichen Planung, Einkauf, Zubereitung<br />
und Verkauf und beinhaltet produktorientiert die Behandlung und Fortführung<br />
diverser Aspekte des Rahmenplans in einem berufsspezifischen Bereich. Der Gewinn<br />
soll für die Schüler der <strong>BQL</strong> transparent und sinnvoll im schulischen<br />
Lebenszusammenhang Verwendung finden, z.B.<br />
- Organisation eines gemeinsamen <strong>BQL</strong>-Grillfestes am Ende des Schuljahres<br />
- Ergänzung des Mittagessens (Nachspeisen, Salate) in der <strong>BQL</strong>-Kantine im<br />
Rahmen des <strong>BQL</strong> „Hauswirtschaft“.<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
4.5 <strong>BQL</strong> „Holz“ (B. Ulrich, Werkstattleiter und Pädagogische<br />
Unterrichtshilfe, und S-P. Thater, Lehramtsanwärter)<br />
Die Arbeit in der Holzwerkstatt wird projektorientiert und produktzentriert durchgeführt,<br />
so dass sich hier eine Passung zwischen der Unterrichtsmethode des <strong>BQL</strong><br />
und der späteren Arbeitswelt der Schüler ergibt. Eigenständigkeit, Teamfähigkeit und<br />
Leistungsbereitschaft sollen gefördert und gefordert werden, um den Schülern einen<br />
Einblick in den Berufsalltag zu geben. Der Fokus der Schülertätigkeit liegt immer auf<br />
dem herzustellenden Produkt, dessen Komplexität und Schwierigkeitsgrad kontinuierlich<br />
gesteigert wird. Produkte, die möglichst selbständig unter Durchführung einzelner<br />
Planungsschritte und der anschließenden Serienfertigung hergestellt werden,<br />
6
sind: Schlüsselbretter, Tischtennisschläger, Ringwurfspiele, Vogelfutterhäuser, Bilderrahmen,<br />
Holzbilder, sowie Kooperations- und Auftragsarbeiten aus der <strong>Schule</strong> und<br />
von externen Auftraggebern. Anhand dieser Produkte werden aus aktuellen Problemstellungen<br />
Lehrgänge mit notwendigen Lerninhalten projektorientiert eingebettet.<br />
Entsprechende Versuche und praktische Übungen werden von den Schülern mit dem<br />
Ziel des selbsttätigen Erkenntnisgewinns durchgeführt.<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
4.6 <strong>BQL</strong> „Kunst“ (A. Lengsfeld und M. Scheu,<br />
Sonderschullehrer)<br />
Der Lernbereich unterstützt die Ausbildung von Handlungskompetenzen durch eine<br />
zunehmende Ausdifferenzierung von Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit.<br />
Über das Zusammenspiel von Produktion, Rezeption und Reflektion in ästhetischen<br />
Lernprozessen werden Sachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale und personale<br />
Kompetenz in enger Verflechtung miteinander weiterentwickelt.<br />
Alltagserscheinungen sind die Grundlage für die ästhetisch-künstlerischen Erfahrungen<br />
der Schülerinnen und Schüler. Sie wenden verschiedene Verfahrenstechniken an<br />
und setzen sich mit Eigenschaften unterschiedlicher Materialien auseinander. Die<br />
Schüler erweitern ihr elementares Erfahrungswissen über Gestaltungsfragen und<br />
Möglichkeiten. Dabei erlernen sie Fachbegriffe.<br />
Bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen Künstlern und ihren Werken erhalten<br />
sie Anregungen für eigenes Gestalten. Das Fach Kunst schafft Situationen und bietet<br />
Freiräume für individuelle ästhetische Erfahrungen, Erkenntnisse und Verhaltensmöglichkeiten.<br />
Die Schülerinnen und Schüler lernen, sich als handelnde Personen einzubringen.<br />
Sie haben im Fach Kunst die Möglichkeit ihre Empfindungen, Wahrnehmungen<br />
und Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen. Sie entwickeln Vertrauen in die<br />
eigenen Fähigkeiten, übernehmen Verantwortung und lernen das eigene Werk, bzw.<br />
eine Gruppenarbeit zu schätzen. Diese Arbeit fördert Neugier und Erfindungslust der<br />
Schüler. Im Umgang mit Werkzeugen und neuen Materialien, sowie in der Werkstatt<br />
oder im Fachraum müssen sie Regeln einhalten und Rücksicht nehmen.<br />
Innerhalb des <strong>BQL</strong> geht es auch um die Förderung der kommerziellen Verwertbarkeit<br />
der künstlerischen Erzeugnisse, sei es durch die Öffentlichkeitsarbeit im Internet, in<br />
Publikationen oder durch den Verkauf auf Ausstellungen. Ergebnisse werden ebenfalls<br />
auf der Website der <strong>Schule</strong> veröffentlich.<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
4.7 Lehrgangstage in den Lankwitzer Werkstätten, Kooperationspartner<br />
(Ch. Horndasch, Sonderschulrektorin)<br />
Die seit über vier Jahren bestehende Kooperation mit den Lankwitzer Werkstätten<br />
sieht vor, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer der <strong>BQL</strong> innerhalb der zwei<br />
Jahre ein- bis zweimal im Rahmen eines Kurses die Lankwitzer Werkstätten aufsucht.<br />
Die Werkstatt lernt ihre potenziellen zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im<br />
Vorfeld sehr gut kennen. Sie nimmt die Einteilung vor, in welchen Arbeitsbereich die<br />
7
Praktikanten eingeführt werden und wo sie voraussichtlich Einsatz finden. Eine grobe<br />
Orientierung, wobei Neigung und Wünsche der Schülerinnen und Schüler<br />
berücksichtigt werden, wird bereits im Vorfeld, z.B. im Rahmen von Vorgesprächen<br />
oder durch das Ausfüllen eines Fragebogens, vorgenommen. Für die Werkstatt<br />
erschließt sich, ob die Praktikantinnen und Praktikanten später die Werkstattfähigkeit<br />
erlangen werden, oder ob ein Förderplatz bereitgestellt werden muss.<br />
Standorte und Arbeitsbereiche<br />
Die Schülerinnen und Schüler der <strong>Finkenkrug</strong>schule können insgesamt an drei Standorten<br />
ihr Praktikum absolvieren. Der Standort wird nach den angebotenen Arbeitsbereichen<br />
sowie nach Schweregrad der Beeinträchtigung gewählt. An den Standorten<br />
Wilhelmsaue und Storkwinkel können die Praktikantinnen und Praktikanten in den<br />
Bereichen Computerwerkstatt, Druckerei, Fahrrad (Reparatur/ Laden), Hauswirtschaft<br />
(Kantine, Reinigung, Wäscheservice), Hausmeisterei, Keramik, Kerzenherstellung,<br />
Kunst, Malerei, Montage/ Metall, Seifenherstellung, Tischlerei und Verwaltung<br />
eingesetzt werden. Am Hohenzollerndamm gibt es neben den Bereichen Garten und<br />
Hausmeisterei die Möglichkeit, für Praktikantinnen und Praktikanten mit schweren<br />
und schwersten Beeinträchtigungen einen Platz in Tagesförderstätte oder Fördergruppe<br />
zu erhalten.<br />
Lernziele des Lehrgangs<br />
Leitziele der Lehrgangstage in den Lankwitzer Werkstätten, ohne die für die einzelnen<br />
Arbeitsbereiche spezifischen, inhaltlichen und methodischen Ziele wegen der<br />
Fülle der unterschiedlichen Bereiche nennen zu können, sind:<br />
- Erweiterung der sozialen Kompetenz<br />
- Abbau von Barrieren und Schwellenangst<br />
- Umgang mit wechselnden Kommunikationspartnern<br />
- Training sozialer Verhaltensweisen (z.B. Benehmen in der Kantine)<br />
- Unbedingte Pünktlichkeit<br />
- Ausdauer und weitgehende Selbstständigkeit<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
4.8 <strong>BQL</strong> „Medien“ am Beispiel „Digitale Fotografie“ (S-P.<br />
Thater, Lehramtsanwärter)<br />
Der <strong>BQL</strong> „Digitale Fotografie“ findet in Kooperation mit dem <strong>BQL</strong> „Schülerzeitung“<br />
statt und ist mit diesem eng verzahnt. Beide Kurse finden mit den gleichen Teilnehmern<br />
im Wechsel statt. So ist es für die Schüler und Schülerinnen möglich, die Produktionskette<br />
und den Herstellungsprozess der Schülerzeitung selbsttätig handelnd<br />
und gestaltend erfahren zu können und Einblicke in die journalistische Arbeit zu<br />
erhalten. Die Fotografien des Fotokurses stellen schon ein Produkt an sich dar, das<br />
durch die Einbindung in die Schülerzeitung einer noch breiteren Öffentlichkeit<br />
zugänglich gemacht wird und somit doppelte Bedeutung erlangt.<br />
Um die Vielseitigkeit des Mediums Fotografie umfassend vermitteln zu können, werden<br />
Themen aus der Lebenswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen aufgegriffen,<br />
die ein Arbeiten im Bereich der Dokumentation, der Personenfotografie und des<br />
künstlerischen Gestaltens ermöglichen. In jedem Bereich wird der Computer als<br />
Werkzeug für die Informationsbeschaffung und das Bearbeiten und Betrachten der<br />
8
Digitalfotos genutzt, sodass auch hier die Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen<br />
im Umgang mit dem Computer und dem Internet erweitert werden.<br />
Grundlagen der Förderung der Medienkompetenz in der Lerngruppe der Abschlussstufe<br />
bilden sowohl das Konzept der Medienerziehung an Berliner <strong>Schule</strong>n des<br />
Landesinstituts für <strong>Schule</strong> und Medien Berlin als auch die Erkenntnisse aus der theoretischen<br />
Betrachtung von Medien. Medienerzieherische Arbeit soll sich demnach an<br />
der Lebenswirklichkeit und dem Erfahrungshorizont der Schülerinnen und Schüler (�<br />
Situationsorientierung) orientieren und dabei auf dem individuellen sozial-kognitiven<br />
Entwicklungsstand (� Entwicklungsorientierung) aufbauen, sodass Medienerziehung<br />
nah an dem Entwicklungsstand und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler<br />
anschließt.<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
4.9 <strong>BQL</strong> „Schülerzeitung“ (Fr. Fernández,<br />
Sonderschullehrerin)<br />
Vierteljährlich erscheint in der <strong>Finkenkrug</strong>schule die Schülerzeitung SchulZ, die<br />
jeweils durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kurses erstellt wird. Die<br />
Zeitung wird in der <strong>Schule</strong> verkauft, kann aber auch von Eltern und sonstigen<br />
Interessierten im Abo bestellt werden. Sie kostet 2 €, für Schüler ermäßigt 1 €. Die<br />
Zeitung kann sich nicht selbst tragen und wird über den Förderverein „Freunde der<br />
<strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> e.V.“ unterstützt.<br />
Inhalt und Umfang der Zeitung richten sich nach den Möglichkeiten und Interessen<br />
der Redaktionsmitglieder. Feststehende Rubriken sind: Schulnachrichten, In eigener<br />
Sache, Geburtstage, Raten und Malen sowie Witze und Preisrätsel.<br />
Die Mindestvoraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang ist das Beherrschen der<br />
Lesestufe „Fotos/ Abbildungen“.<br />
Lernziele des Lehrgangs<br />
Kompetenzerweiterung in den Bereichen:<br />
Lesen und Schreiben<br />
- Sichten von Tageszeitungen (Fotos, Schlagzeilen, kurze Texte)<br />
- Teilnahme an Schulprojekten der Berliner Zeitung und der Berliner Morgenpost<br />
- Lesen von Leserbriefen und e-Mails<br />
- Lesen von Abbildungen und kurzen Texten im Internet<br />
- Abschreiben von Wörtern und kurzen Texten<br />
- Formulieren einfacher Sätze<br />
Umgang mit dem PC<br />
- Kennenlernen und Nutzen des Schreibprogramms Word (Groß- und Kleinschreibung,<br />
Schriftarten, Schriftgrößen)<br />
- Kennenlernen und Nutzen von Windows Publisher (Text- und Grafikfelder, Kopieren,<br />
Einfügen, Layout)<br />
- Öffnen und Schließen von Programmen<br />
- Umgang mit Scanner und Drucker<br />
- Nutzen des Internets zu Recherchezwecken (Kennenlernen von Suchmaschinen<br />
9
und relevanten Netzauftritten wie Google, Blinde Kuh, Zzzebra, Kidsnet etc.)<br />
Spracherweiterung<br />
- Kennenlernen und verwenden von Fachbegriffen (z.B. Presse, Redaktion, Artikel,<br />
Abonnement, Layout, Schlagzeile etc.)<br />
- Wiederkehrende Begriffe aus der Tagespresse kennen (Bundeskanzlerin, Sport,<br />
Ländernamen, Kriegsschauplätze etc.)<br />
- Einüben von Satzmustern, Fragestellungen u.ä. (Interviews, Umfragen)<br />
- Spontane Äußerungen im Redaktionsteam zu einem Thema<br />
- Gespräche im Redaktionsteam führen (zuhören, und antworten)<br />
Die Schülerzeitung wird bei unserem Kooperationspartner, den Lankwitzer Werkstätten<br />
gedruckt.<br />
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schulprogramm.<br />
5. Evaluation und Ergebnispräsentation<br />
Nach jedem Kursdurchlauf werden die <strong>BQL</strong> hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer<br />
Arbeitsergebnisse evaluiert. So finden regelmäßig Stufenkonferenzen der Klassenleitungen<br />
und der Kursleiter statt, um die <strong>Curriculum</strong>sarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln.<br />
Mit den Kooperationspartnern werden ggf. Besprechungen durchgeführt.<br />
Vor allem jedoch kommt es durch die regelmäßige Evaluation der individuellen<br />
Förderpläne zur Messung des Erwerbs von Kompetenzen, Fähig- und Fertigkeiten.<br />
Auch Reflexionsgespräche mit den Eltern oder Erziehern werden durchgeführt.<br />
Individuelle Auswertungsbögen, die auf den jeweiligen <strong>BQL</strong> zugeschnitten sind,<br />
kommen zum Einsatz und machen Ergebnisse vergleichbar.<br />
Die Arbeitsergebnisse werden öffentlich vor- und ausgestellt. Dabei ist nicht nur das<br />
Schulgebäude Ausstellungsort. Die <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> nutzt dabei bewusst ihre<br />
Kooperationspartner oder stellt gezielt Kontakte her. Folgende Beispiele sind zu<br />
nennen:<br />
- Ausstellungen im Kindermuseum Labyrinth, in der Kommunalen Galerie und in<br />
der Ägyptischen Botschaft<br />
- Filmprojekte im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft im Olympiastadion, im<br />
Eva-Kino, in der Sendung „Brisant“. 1. Preis für Filmarbeit zum Thema<br />
„Umwelt“ des Bezirkes Wilmersdorf.<br />
- Theaterprojekte in Zusammenarbeit mit der Schaubühne Berlin und der Brotfabrik<br />
Die öffentlich zugänglichen Events werden sehr stark von Eltern und deren Familien<br />
und Freunden besucht. Damit erfahren die Akzeptanz und der Stolz auf das eigene<br />
Kind eine sichtbare Dimension. Das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler<br />
wird gestärkt und die Motivation für die weitere Mitarbeit ist gegeben.<br />
Vor allem profitiert das gesamte Schulleben von den Ergebnissen der <strong>BQL</strong>. Regelmäßige<br />
Kunstausstellungen, die Herausgabe der Schülerzeitung, der Verkauf des<br />
selbstgebackenen Brotes, die Gestaltung des Vorgartens, der wöchentlich geöffnete<br />
Kiosk, hauseigene Reparaturmöglichkeiten oder individuelle Anpassungen von Mobiliar<br />
sowie das gemeinsame Essen mit Gästen, um nur einige Beispiele zu nennen,<br />
tragen im Wesentlichen zum lebendigen Schulalltag bei.<br />
10
6. Schlussbetrachtung<br />
Das Kurssystem ist ein in sich lernendes, vorbereitungsintensives System. Die<br />
Zusammensetzung der jeweiligen Lerngruppen bestimmt die Inhalte und Methoden.<br />
Die Binnendifferenzierung und Planung von Lernschritten für den Einzelnen nimmt<br />
breiten Raum ein. Die Anforderungen an die Vorbereitung der Teams sind massiv<br />
gestiegen, werden jedoch nicht als belastend empfunden. Die Arbeitsergebnisse sind<br />
sichtbar.<br />
Evaluation und Festsetzung der neuen Standards erfolgt in den <strong>BQL</strong>-Sitzungen und<br />
wird an die Steuerungsgruppe weitergegeben.<br />
Alle Schülerinnen und Schüler der <strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong>, die bisher die Berufsqualifizierenden<br />
Lehrgänge durchlaufen haben, konnten ohne Probleme in eine Werkstatt für<br />
behinderte Menschen aufgenommen werden. Die enge Zusammenarbeit zwischen<br />
<strong>Schule</strong>, Eltern, dem Arbeitsamt und den Werkstätten sorgen schon im Vorfeld dafür,<br />
dass die besonderen Begabungen und Neigungen des einzelnen Schülers und der<br />
einzelnen Schülerin erkannt werden.<br />
Im Rahmen der interdisziplinären Fallbesprechungen (Schüler, Eltern, Arbeitsamt,<br />
Kooperationsparter, <strong>Schule</strong>) wurde klar, dass die Schülerinnen und Schüler sich sehr<br />
deutlich über ihre Vorstellungen von einem erfüllten Arbeitsleben äußern können. Sie<br />
sind in der Lage, sich bewusst für eine Abteilung zu entscheiden und ihre Wünsche<br />
im Gespräch zu vertreten. Ängste und Unsicherheiten konnten durch die<br />
Konfrontation (Praktika) abgebaut werden. Bei allen Schülerinnen und Schülern ist<br />
eine deutliche Steigerung der Sozial- und Handlungskompetenz festzustellen.<br />
Ein großer Schritt in die Selbstbestimmung ist getan.<br />
Die neue Organisationsform mit einem erweiterten <strong>Curriculum</strong> und außerschulischen<br />
Kooperationspartnern trägt wesentlich dazu bei, dass alle Absolventen der<br />
<strong>Finkenkrug</strong>-<strong>Schule</strong> einen geeigneten Arbeitsplatz finden.<br />
11
7. Verwendete und weiterführende Literatur<br />
Paritätischer Wohlfahrtsverband (Hrsg.): Berufliche Integration (lern-)behinderter<br />
Jugendlicher – Berufliche Perspektiven für Förderschülerinnen und Förderschüler,<br />
„Paritätische Arbeitshilfe“, H.7, Berlin 2008.<br />
Reicheneder, Marlies: „Arbeitsschule“ und „Tätigkeitsorientiertes <strong>Curriculum</strong>“ –<br />
Lernarrangements für das „Duale Lernen“, in: Verband Sonderpädagogik e.V. (Hrsg.)<br />
Sonderpädagogik in Berlin 2009, Heft 3, 18-26.<br />
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der<br />
Bundesrepublik Deutschland: Empfehlungen zum Förderschwerpunkt geistige<br />
Entwicklung: Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 26.06.1998. Im Internet<br />
unter http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/PresseUndAktuelles/2000/geist.pdf [letzter<br />
Zugriff am 21.04.2010]<br />
Schulgesetz für das Land Berlin (Schulgesetz - SchulG) vom 26. Januar 2004, das<br />
zuletzt durch Gesetz vom 25. Januar 2010 sowie durch Artikel I des Gesetzes vom<br />
25. Januar 2010 geändert worden ist, hg von der Senatsverwaltung für Bildung,<br />
Wissenschaft und Forschung (Hrsg.): Im Internet unter<br />
http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/rechtsvorschriften/schulgesetz_25012010_ueberarb.pdf?start&ts=126691620<br />
5&file=schulgesetz_25012010_ueberarb.pdf [letzter Zugriff am 21.04.2010]<br />
Verordnung über die sonderpädagogische Förderung (Sonderpädagogikverordnung -<br />
SopädVO) vom 19. Januar 2005 in der Fassung vom 23. Juni 2009), hg von der<br />
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin (Hrsg.): Im<br />
Internet unter http://www.berlin.de/imperia/md/content/senbildung/rechtsvorschriften/sopaed_vo.pdf?start&ts=1266916205&file=sopaed_vo.pdf<br />
[letzter Zugriff am 21.04.2010<br />
Senatsverwaltung für Bildung , Wissenschaft und Forschung Berlin, Ministerium für<br />
Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen<br />
Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ (Entwurf), hg. von Bildung, Jugend und<br />
Sport des Landes Brandenburg, Behörde für <strong>Schule</strong> und Berufsbildung Hamburg,<br />
Berlin 2010.<br />
Bildung für Berlin, Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin, Qualitätsbereiche und<br />
Qualitätsmerkmale guter <strong>Schule</strong>n, hg. von der Senatsverwaltung für Bildung,<br />
Wissenschaft und Forschung, Berlin 2007.<br />
12