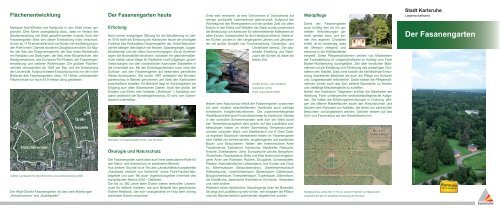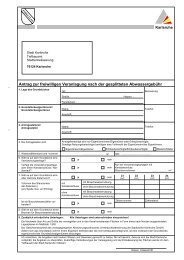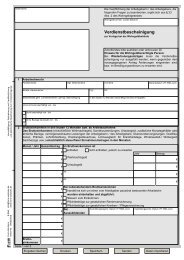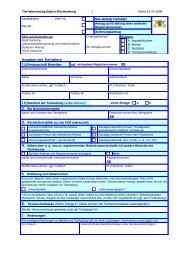Der Fasanengarten (PDF, 6.49 MB) - Karlsruhe
Der Fasanengarten (PDF, 6.49 MB) - Karlsruhe
Der Fasanengarten (PDF, 6.49 MB) - Karlsruhe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Flächenentwicklung<br />
Markgraf Karl-Wilhelm hat <strong>Karlsruhe</strong> in den Wald hinein gegründet.<br />
Dies führte zwangsläufig dazu, dass im Verlauf der<br />
Stadtentwicklung viel Wald geopfert werden musste. Auch der<br />
<strong>Fasanengarten</strong> blieb von dieser Entwicklung nicht verschont.<br />
Schon ab 1779 entwickelte sich von Süden her die Bebauung in<br />
den Park hinein. Damals wurde ein Zeughaus errichtet. Es folgten<br />
der Bau der Dragonerkaserne, der Bau eines Reithauses<br />
mit Reitplatz und Stallungen, der Bau einer Bürgerschule, des<br />
Realgymnasiums, des Durlacher-Tor-Platzes, der <strong>Fasanengarten</strong>siedlung<br />
und weiterer Wohnhäuser. Die größten Flächenverluste<br />
verursachten ab 1825 der Bau und die Entwicklung<br />
der Universität. Aufgrund dieser Entwicklung sind von der in der<br />
Blütezeit des <strong>Fasanengarten</strong>s etwa 110 Hektar umfassenden<br />
Fläche heute nur noch 44,9 Hektar übrig geblieben.<br />
Hirschbrunnen<br />
Grab-<br />
kapelle<br />
Luftbild: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 2008<br />
<strong>Der</strong> Wald-Distrikt <strong>Fasanengarten</strong> mit den zwei Abteilungen<br />
„Hirschbrunnen“ und „Grabkapelle“.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Fasanengarten</strong> heute<br />
Erholung<br />
Nach seiner endgültigen Öffnung für die Bevölkerung im Jahre<br />
1918 stellt die Erholung der <strong>Karlsruhe</strong>r heute die wichtigste<br />
Funktion des Parkwaldes <strong>Fasanengarten</strong> dar. Hohe Besucherzahlen<br />
belegen dies täglich von Neuem. Spaziergänger, Jogger,<br />
Studierende und die vielen Sonnenhungrigen, die an Sommertagen<br />
die Bocksblöße bevölkern, schätzen ihn gleichermaßen.<br />
Auch stellen seine Wege für Radfahrer und Fußgänger „grüne“<br />
Verbindungen von den nordöstlichen <strong>Karlsruhe</strong>r Stadtteilen in<br />
die Innenstadt dar. Mit der Schlossgartenbahn kann man den<br />
Schloss- und den <strong>Fasanengarten</strong> auf besonders gemütliche<br />
Weise durchqueren. Sie wurde 1967 anlässlich der Bundesgartenschau<br />
in Betrieb genommen und blieb den <strong>Karlsruhe</strong>rn<br />
anschließend erhalten. Ihr Bahnhof liegt im Schlossgarten am<br />
Eingang zum alten Botanischen Garten. Auch der große, bei<br />
Kindern und Eltern sehr beliebte („Robinson“-) Spielplatz entstand<br />
anlässlich der Bundesgartenschau. Er wird vom Gartenbauamt<br />
unterhalten.<br />
Kleinbahn im <strong>Fasanengarten</strong> (Foto: Lutz Chmelik)<br />
Ökologie und Naturschutz<br />
<strong>Der</strong> <strong>Fasanengarten</strong> spielt aber auch eine bedeutsame Rolle für<br />
den Natur- und Artenschutz im stadtnahen Bereich.<br />
Aus diesem Grunde ist er Teil des Landschaftsschutzgebietes<br />
„Hardtwald nördlich von <strong>Karlsruhe</strong>“ sowie Flora-Fauna-Habitatgebiet<br />
und zum Teil auch Vogelschutzgebiet innerhalb des<br />
europäischen Natura 2000 - Gebietes.<br />
Die bis zu 360 Jahre alten Eichen bieten wertvollen Lebensraum<br />
für seltene Insekten, wie zum Beispiel den geschützten<br />
Eichen-Heldbock, der sich vorzugsweise im Holz alter, sonnig<br />
stehender Eichen entwickelt.<br />
Einst weit verbreitet, ist sein Vorkommen in Deutschland auf<br />
wenige punktuelle Lebensräume geschrumpft. Aufgrund der<br />
Wärmegunst des Rheingrabens und der großen Zahl von alten<br />
Eichen in den Parks und Wäldern der Stadt wurde zunehmend<br />
die Bedeutung von <strong>Karlsruhe</strong> für wärmeliebende Käferarten an<br />
alten Eichen, insbesondere für den Heldbock erkannt. Diese alten<br />
Eichen wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten<br />
mit großer Sorgfalt von Forstverwaltung, Gartenbau- und<br />
Umweltamt betreut. Die dauerhafte<br />
Erhaltung und Nachzucht<br />
der Eichen ist dabei ein<br />
festes Ziel.<br />
Großer Eichen- oder Heldbock<br />
(Cerambyx cerdo)<br />
(Foto: Claus Wurst 2009)<br />
Neben dem Naturschutz erfüllt der <strong>Fasanengarten</strong> zusammen<br />
mit dem nördlich anschließenden Hardtwald auch wichtige<br />
klimatische Ausgleichsfunktionen. Die zusammenhängende<br />
Waldfläche bildet eine Frischluftschneise für <strong>Karlsruhe</strong>. Gerade<br />
in den schwülen Sommermonaten wirkt sich der Wald durch<br />
den Temperaturausgleich sehr positiv auf das Lokalklima aus.<br />
Messungen haben an einem Sommertag Temperaturunterschiede<br />
zwischen Wald- und Stadtbereich von 6 Grad Celsius<br />
ergeben! Botanisch Interessierte finden im <strong>Fasanengarten</strong><br />
eine Vielfalt von einheimischen, eingebürgerten und exotischen<br />
Baum- und Straucharten. Neben den einheimischen Arten<br />
Traubeneiche, Spitzahorn, Hainbuche, Waldkiefer, Rotbuche,<br />
Kirsche, Edelkastanie, Ulme, Europäische Lärche, Bergahorn,<br />
Winterlinde, Rosskastanie, Birke und Eibe finden sich eingebürgerte<br />
Arten wie Roteiche, Robinie, Douglasie, Schwarzkiefer,<br />
Platane, Abendländischer Lebensbaum und Exoten wie Gingko,<br />
Mammutbaum (Sequoiadendron), Urweltmammutbaum<br />
(Metasequoia), Lederhülsenbaum, Blasenbaum, Götterbaum,<br />
Blauglockenbaum, Trompetenbaum, Tulpenbaum, Silberahorn,<br />
die Goldlärche, Japanische Sicheltanne, Krimlinde, Atlaszeder<br />
und viele andere.<br />
Während eines herbstlichen Spaziergangs über die Bocksblöße<br />
zeigt die Laubfärbung sehr schön, wie sorgsam die Pflanz-<br />
orte der Bäume farblich aufeinander abgestimmt wurden.<br />
Waldpflege<br />
Damit der <strong>Fasanengarten</strong><br />
auch künftig den an ihn gestellten<br />
Anforderungen gerecht<br />
werden kann und seinen<br />
ihm eigenen Charakter<br />
erhält, ist es notwendig, dass<br />
der Mensch pflegend und<br />
steuernd in die Waldbestände<br />
eingreift. Diese Pflegemaßnahmen werden von Mitarbeitern<br />
der Forstabteilung im Liegenschaftsamt im Auftrag vom Forst<br />
Baden-Württemberg durchgeführt. Ziel aller forstlichen Maßnahmen<br />
ist die Erhaltung und Förderung des parkartigen Charakters<br />
des Waldes. Dazu sind sowohl die kleinflächige Erneuerung<br />
überalterter Bestände als auch die Pflege von Kulturen<br />
und Jungbeständen erforderlich. Dabei haben die Pflegemaßnahmen<br />
immer auch das Ziel, seltene Baumarten zu fördern<br />
und vielfältige Mischbestände zu schaffen.<br />
Neben den forstlichen Tätigkeiten erfüllen die Mitarbeiter der<br />
Abteilung Forst umfangreiche landschaftspflegerische Aufgaben.<br />
Sie halten die Erholungseinrichtungen in Ordnung, pflegen<br />
die offenen Rasenflächen sowie den Hirschbrunnen und<br />
säubern den Parkwald von Abfällen, die leider von zahlreichen<br />
Besuchern zurückgelassen werden. Schilder weisen auf das<br />
Grill- und Feuerverbot auf den Rasenflächen hin.<br />
Stadtgrundriss, entworfen 1718 von Johann Friedrich von Batzendorf,<br />
eingezeichnet sind in paralleler Anordnung drei Kirchen<br />
Stadt <strong>Karlsruhe</strong><br />
Liegenschaftsamt<br />
<strong>Der</strong> <strong>Fasanengarten</strong><br />
Foto: Lutz Chmelik
<strong>Der</strong> <strong>Fasanengarten</strong><br />
In unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von <strong>Karlsruhe</strong> erstreckt<br />
sich zwischen Campus Süd des <strong>Karlsruhe</strong>r Instituts für<br />
Technologie KIT (Universität), Schlossgarten, Wildparkstadion<br />
und Klosterweg der Parkwald „<strong>Fasanengarten</strong>“.<br />
Ursprung und Entwicklung des <strong>Fasanengarten</strong>s sind untrennbar<br />
mit der Geschichte der Stadt <strong>Karlsruhe</strong> verbunden. So<br />
spiegeln sich in seinem Wandel die jeweiligen politischen und<br />
gesellschaftlichen Gegebenheiten wider.<br />
Heute bildet der <strong>Fasanengarten</strong> eine grüne Oase für Erholung<br />
suchende Menschen inmitten einer pulsierenden Großstadt.<br />
Vom Hofjagdrevier zum Parkwald<br />
Entstehung<br />
Wo sich heute täglich Tausende von Menschen aufhalten, erstreckte<br />
sich bis vor nahezu 300 Jahren ein zusammenhängendes<br />
Wald- und Jagdgebiet der Markgrafen von Baden-Durlach.<br />
Doch noch vor der Gründung <strong>Karlsruhe</strong>s begann Markgraf Karl-<br />
Wilhelm (1679 - 1738) einen ehrgeizigen Plan umzusetzen: Im<br />
geliebten Jagdrevier wurden zunächst 300 Morgen Wald (75<br />
Hektar) für einen <strong>Fasanengarten</strong> umzäunt. Das westlich davon<br />
gelegene Waldareal wurde zu einem Lustgarten und einem<br />
Tiergarten im französischen Stil umgestaltet. Auf einer Waldlichtung<br />
im <strong>Fasanengarten</strong>, der „Bocksblöße“, wurde 1714 ein<br />
kleines Jagdhaus errichtet und damit der Grundstock für die<br />
Fasanerie gelegt. Nachdem die notwendigen Einrichtungen geschaffen<br />
waren, mussten aus dem ganzen Land Tiere an den<br />
Markgrafen abgeliefert werden. Parallel dazu wurde Wald gerodet,<br />
um Platz für das neue Residenzschloss zu schaffen. Weitere<br />
Rodungen erforderte die Anlage der nördlichen Fächeralleen<br />
zur Erschließung des Waldes. Als der Markgraf 1718 das<br />
neue Schloss <strong>Karlsruhe</strong> bezog,<br />
standen <strong>Fasanengarten</strong>, Tier- und<br />
Lustgarten schon in voller Blüte.<br />
Die Aufsicht über die Fasanerie hatte der „Fasanenmeister“,<br />
dessen Beruf von Generation zu Generation weiter vererbt wurde.<br />
Alle notwendigen Gebäude lagen um die Bocksblöße. Auch<br />
die heute noch vorhandenen chinesischen Teehäuschen entstanden<br />
ursprünglich als Feldhühnerhäuschen „à la chinoise“.<br />
Plan über den Herrschaftlichen <strong>Fasanengarten</strong> aus dem Jahr 1757<br />
(Foto: Stadtarchiv <strong>Karlsruhe</strong>)<br />
Zu Beginn umgab ein Holzzaun, später eine 3 Meter hohe Mauer<br />
aus Sandsteinen den <strong>Fasanengarten</strong> (Bau: 1768 - 1773). Sie<br />
ist heute nur noch in Teilen erhalten.<br />
Umgestaltung<br />
Markgraf Karl-Friedrich (1728 - 1811), Enkel Karl-Wilhelms und<br />
ab 1806 Großherzog von Baden, ließ anstelle des baufälligen<br />
Jagdhauses 1765 ein zweistöckiges Jagdhaus mit „chinesischem<br />
Dach und figurierter Fassade“ errichten – das Fasanenschlösschen.<br />
Die Pläne stammten von Friedrich von Keßlau,<br />
der auch das <strong>Karlsruhe</strong>r Residenzschloss entworfen hatte. <strong>Der</strong><br />
Markgraf fand so sehr Gefallen daran, dass er es wenig später<br />
als Jagd- und Lustschloss ausbauen und für die Fasanerie<br />
neue Gebäude errichten ließ. Unter Markgraf Karl-Friedrich erlebte<br />
der <strong>Fasanengarten</strong> einen weiteren Aus- und Umbau. <strong>Der</strong><br />
damals im westlichen Teil des heutigen Schlossparks gelegene<br />
Tiergarten wurde aufgehoben und nach dem herrschenden<br />
Zeitgeschmack in einen englischen Garten umgestaltet mit offenen<br />
Rasenplätzen und malerischen Baumgruppen. Anstelle<br />
dieses Tiergartens legte man im nördlichen Teil der Fasanerie<br />
einen Tierpark mit Hirschen, Rehen und „bengalischem Wildbret“<br />
an.<br />
Weiter nördlich entstand der<br />
Biberpark mit einer Reihe von<br />
Teichen. Dort kann man heute<br />
noch die „Biberburg“ erkennen.<br />
Ehemalige Biberburg im <strong>Fasanengarten</strong><br />
(Foto: Martin Schwarz, Stadtwiki<br />
<strong>Karlsruhe</strong>)<br />
Die baumumstandenen Senken, die man heute im Gelände<br />
vorfindet, waren ehemals Wildschweinsuhlen. Diese Mulden<br />
sind nach der Tulla‘schen Rheinkorrektur durch die Grundwasserabsenkung<br />
ausgetrocknet. Wie bereits der innerhalb<br />
des westlichen Schlosszirkels liegende Tiergarten wurde das<br />
Waldgartenstück um den neuen Tierpark und die Fasanerie unter<br />
Gartenbauinspektor Friedrich Schweickhardt in einen englischen<br />
Garten umgestaltet mit vielen ausländischen Baum- und<br />
Straucharten, Garten- und Lusthäuschen sowie künstlichen<br />
Tempelruinen. Insbesondere zwischen 1780 und 1790 wurden<br />
die Bepflanzungen des Parks fortgesetzt, wobei großer Wert<br />
auf Perspektiven, Farbunterschiede sowie Licht- und Schattenwechsel<br />
gelegt wurde.<br />
Bocksblöße mit chinesischen<br />
Teehäuschen aus dem Jahre 1764<br />
(Foto: Matthias Hoffmann,<br />
Forstliches Bildungszentrum)<br />
Schließung der Fasanerie<br />
Bis 1865 war die Fasanerie auf mehrere tausend Tiere angewachsen<br />
und hatte dem fürstlichen Hof weitreichendes<br />
Ansehen gebracht. Die Kosten waren jedoch dermaßen angewachsen,<br />
dass sich der Hof 1866 schließlich entschloss,<br />
die Fasanenzucht ganz aufzugeben. Auch der Tierpark wurde<br />
aufgelöst und das gesamte Areal umgestaltet. Ruhe und Stille<br />
zogen in den <strong>Fasanengarten</strong> ein. Für die großherzogliche Familie<br />
wurde er nun ein Ort der Erholung und Entspannung. Das<br />
Familienleben spielte sich im Park ab, das Schlösschen wurde<br />
als Prinzenschule und für kleine Gesellschaften auserwählter<br />
Gäste genutzt.<br />
Zwischenzeitlich beherbergte es im Krieg 1870/71 ein Lazarett.<br />
Ein heute noch sichtbares Zeichen der Verbundenheit der<br />
großherzoglichen Familie mit dem<br />
Park ist die Grabkapelle im neugotischen<br />
Stil, die 1896 vollendet wurde.<br />
Sie steht an der Kreuzung von<br />
Klosterweg und Lärchenallee. Es<br />
werden regelmäßige Sonderführungen<br />
angeboten (Info: www.schloesser-magazin.de/de/schloesser-undgaerten).<br />
Großherzogliche Grabkapelle aus dem Jahre<br />
1896 (Foto: Lutz Chmelik)<br />
Durch den <strong>Fasanengarten</strong> führte auch die Flucht des letzten<br />
badischen Großherzogs Friedrich II. am Abend des 11. November<br />
1918, als in den Wirren der Revolution das Schloss<br />
beschossen wurde. Mit der Abdankung Friedrichs am 22. November<br />
1918 wurde Baden zur Republik und der <strong>Fasanengarten</strong><br />
auf Dauer für die Öffentlichkeit freigegeben.<br />
Entwicklung zum Parkwald<br />
Ab 1923 wurde der <strong>Fasanengarten</strong> als Parkwald von der badischen,<br />
später von der Baden-Württembergischen Landesforstverwaltung<br />
betreut. Seit der Verwaltungsreform 2005 ist seine<br />
Pflege und Erhaltung an die untere Forstbehörde der Stadt<br />
<strong>Karlsruhe</strong> als Betriebsteil von Forst Baden-Württemberg übergegangen.<br />
Das Fasanenschlösschen beherbergt seit 1926 die<br />
Staatliche Forstschule <strong>Karlsruhe</strong>, heute Forstliches Bildungszentrum<br />
des Landesbetriebes Forst Baden-Württemberg. 1967<br />
war der westliche Teil des <strong>Fasanengarten</strong>s als zentraler Bereich<br />
in die Bundesgartenschau <strong>Karlsruhe</strong> einbezogen. Damals<br />
wurde er mit einer Vielzahl von Einrichtungen für Spiel, Sport<br />
und Erholung versehen, die zum größten Teil wieder abgebaut<br />
wurden. Heute ist der stadtnahe Parkwald ein äußerst beliebter<br />
und intensiv genutzter Erholungs- und Freizeitraum. An die<br />
geschichtsträchtige Vergangenheit<br />
als Fasanerie und<br />
Wildpark erinnern nur noch<br />
die wenigen historischen<br />
Gebäude und die Namen<br />
von Wegen und Alleen.<br />
GESCHICHTE DES FASANENGARTENS<br />
Markgraf Karl-Wilhelm von<br />
Baden-Durlach (1679-1738)<br />
Aus einem Kupferstich von Andreas<br />
Fasanenschlösschen aus<br />
Reinhard, Staatliche Kunsthalle <strong>Karlsruhe</strong> dem Jahr 1765 (Foto: Lutz Chmelik)<br />
www.forstbw.de<br />
1711<br />
1714<br />
1715<br />
1765<br />
1790<br />
1825<br />
1860/65<br />
1866<br />
1896<br />
1918<br />
1923<br />
1926<br />
1967<br />
heute<br />
Markgraf Karl-Wilhelm von Baden-Durlach gibt<br />
den Auftrag zur Anlage eines <strong>Fasanengarten</strong>s und<br />
Wildparks im Hardtwald<br />
Bau eines einstöckigen Jagdhauses an der<br />
„Bocksblöße“ und Einrichtung der Fasanerie<br />
Gründung der Stadt <strong>Karlsruhe</strong><br />
Bau des Fasanenschlösschens<br />
Umgestaltung des <strong>Fasanengarten</strong>s in eine englische<br />
Parkanlage<br />
Gründung der Technischen Hochschule auf dem<br />
Gelände des <strong>Fasanengarten</strong>s<br />
Höhepunkt der Entwicklung der Fasanerie und<br />
des Wildparks mit mehreren tausend Tieren<br />
Auflösung der Fasanerie und des Wildparks aus<br />
Kostengründen<br />
Fertigstellung der großherzoglichen Grabkapelle<br />
Öffnung als Park für die Bevölkerung<br />
Übergang der Betreuung des Parkwaldes „<strong>Fasanengarten</strong>“<br />
an die Forstverwaltung<br />
Fasanenschlösschen wird Sitz der Staatlichen<br />
Forstschule <strong>Karlsruhe</strong><br />
Einbeziehung des <strong>Fasanengarten</strong>s in die Bundesgartenschau<br />
<strong>Karlsruhe</strong><br />
Parkwald <strong>Fasanengarten</strong><br />
Weitere Informationen zum <strong>Fasanengarten</strong> unter:<br />
Stadt <strong>Karlsruhe</strong><br />
Liegenschaftsamt<br />
Abteilung Forst<br />
Weinweg 43<br />
76131 <strong>Karlsruhe</strong><br />
Telefon: 0721 133-7353<br />
E-Mail: forst@la.karlsruhe.de