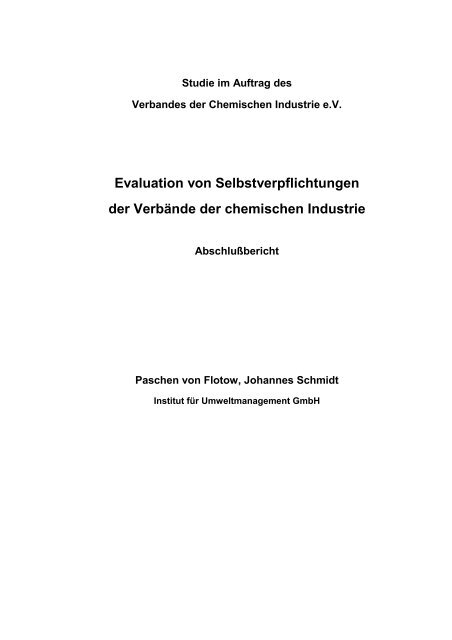Evaluation von Selbstverpflichtungen der Verbände der chemischen ...
Evaluation von Selbstverpflichtungen der Verbände der chemischen ...
Evaluation von Selbstverpflichtungen der Verbände der chemischen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Studie im Auftrag des<br />
Verbandes <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V.<br />
<strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
Abschlußbericht<br />
Paschen <strong>von</strong> Flotow, Johannes Schmidt<br />
Institut für Umweltmanagement GmbH
Paschen <strong>von</strong> Flotow, Johannes Schmidt:<br />
<strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
Oestrich-Winkel: Institut für Ökologie und Unternehmensführung, 2001<br />
(Arbeitspapiere des Instituts für Ökologie und Unternehmensführung e.V., Bd. 36)<br />
ISBN 3-922771-37-8<br />
ISSN 0938-5568<br />
II
Inhaltsübersicht<br />
ZUSAMMENFASSUNG (EXECUTIVE SUMMARY) .............................................................XI<br />
TEIL A: ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG ................................... 1<br />
EINLEITUNG: DIE DISKUSSION ÜBER SELBSTVERPFLICHTUNGEN ............................. 3<br />
I. ZUR ROLLE VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN IN DER MARKTWIRTSCHAFT .. 5<br />
1. GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN ................................................................... 5<br />
2. ZUM VERGLEICH VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN MIT ANDEREN<br />
UMWELTPOLITISCHEN INSTRUMENTEN............................................................... 6<br />
II. ZIELE UND METHODIK DER STUDIE ...................................................................... 9<br />
1. ZUM ZIEL DIESER STUDIE....................................................................................... 9<br />
2. METHODISCHE BEGRÜNDUNG DER STUDIENKONZEPTION ............................ 10<br />
III. GROBEVALUATION DER SELBSTVERPFLICHTUNGEN ..................................... 21<br />
1. VORGEHENSWEISE BEI DER GROBEVALUATION ............................................. 21<br />
2. ERGEBNISSE DER GROBEVALUATION............................................................... 21<br />
3. SCHLUßFOLGERUNGEN FÜR DIE WEITERE EVALUATION ............................... 24<br />
III
IV. DETAILEVALUATION VON VIER SELBSTVERPFLICHTUNGEN..........................26<br />
1. VORGEHENSWEISE BEI DER DETAILEVALUATION ...........................................26<br />
2. DIE ERGEBNISSE DER DETAILEVALUATION ......................................................27<br />
3. ZUSAMMENFASSENDES FAZIT ZU DEN VIER SELBSTVERPFLICHTUNGEN ... 53<br />
V. GESAMTBEWERTUNG UND SCHLUßFOLGERUNGEN .......................................56<br />
1. EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ DER IM DETAIL UNTERSUCHTEN<br />
SELBSTVERPFLICHTUNGEN ................................................................................56<br />
2. DER PROZEß DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG: ECKPUNKTE VON<br />
SELBSTVERPFLICHTUNGEN ................................................................................59<br />
3. SCHLUßFAZIT UND EMPFEHLUNG AN DEN VERBAND......................................65<br />
TEIL B: DOKUMENTATION DES ABSCHLUßWORKSHOPS<br />
AM 19. MÄRZ 2001................................................................ 67<br />
I. ZIEL UND ABLAUF DES WORKSHOPS.................................................................69<br />
II. DIE DISKUSSION DER EINZELNEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN .....................70<br />
III. SCHLUßFOLGERUNGEN UND ALLGEMEINE DISKUSSION.............................. 103<br />
ANHÄNGE......................................................................................................................... 123<br />
LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................... 150<br />
IV
Inhaltsverzeichnis<br />
ZUSAMMENFASSUNG (EXECUTIVE SUMMARY) .............................................................XI<br />
TEIL A: ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG ................................... 1<br />
EINLEITUNG: DIE DISKUSSION ÜBER SELBSTVERPFLICHTUNGEN ............................. 3<br />
I. ZUR ROLLE VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN IN DER MARKTWIRTSCHAFT .. 5<br />
1. GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN ................................................................... 5<br />
2. ZUM VERGLEICH VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN MIT ANDEREN<br />
UMWELTPOLITISCHEN INSTRUMENTEN............................................................... 6<br />
II. ZIELE UND METHODIK DER STUDIE ...................................................................... 9<br />
1. ZUM ZIEL DIESER STUDIE....................................................................................... 9<br />
2. METHODISCHE BEGRÜNDUNG DER STUDIENKONZEPTION ............................ 10<br />
2.1 Die Ergebnisse früherer Studien zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong>............................................................... 10<br />
2.1.1 S. LAUTENBACH, U. STEGER, P. WEIHRAUCH: Evaluierung freiwilliger Branchenabkommen im<br />
Umweltschutz: Ergebnisse eines Gutachtens und Workshops (Köln: BDI, 1992) ........................ 10<br />
2.1.2 K. RENNINGS et al. (ZEW): Nachhaltigkeit, Ordnungspolitik und freiwillige Selbstverpflichtung:<br />
Ordnungspolitische Grundregeln für eine Politik <strong>der</strong> Nachhaltigkeit und das Instrument <strong>der</strong><br />
freiwilligen Selbstverpflichtung im Umweltschutz (Heidelberg: Physica, 1996).......................... 12<br />
2.1.3 The Environmental Law Network International (ELNI, Hrsg.): Environmental Agreements: The<br />
Role and Effect of Environmental Agreements in Environmental Policies (Cameron May, 1998)<br />
....................................................................................................................................................... 13<br />
2.1.4 J. KNEBEL, L. WICKE, G. MICHAEL: <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und normersetzende Umweltverträge<br />
als Instrumente des Umweltschutzes (Berlin: Erich Schmidt 1999).............................................. 14<br />
2.1.5 Fazit ............................................................................................................................................... 16<br />
2.2. Methodik und Ablauf <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung ..................................................................... 17<br />
2.2.1 Zum Ansatz <strong>der</strong> Studie .................................................................................................................. 17<br />
2.2.2 Die Untersuchungsaspekte............................................................................................................. 18<br />
2.2.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>: ....................................................... 18<br />
2.2.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.......................................................... 19<br />
2.2.2.3 Weitere Aspekte........................................................................................................................ 19<br />
2.2.3 Formale Aspekte des Studienablaufs............................................................................................. 20<br />
V
III. GROBEVALUATION DER SELBSTVERPFLICHTUNGEN .....................................21<br />
1. VORGEHENSWEISE BEI DER GROBEVALUATION .............................................21<br />
2. ERGEBNISSE DER GROBEVALUATION ...............................................................21<br />
2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>..................................................................21<br />
2.1.1 Inhalt <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ....................................................................................................21<br />
2.1.2 Zielerreichung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> .....................................................................................22<br />
2.1.3 Vergleich mit Entwicklungspfaden ohne Selbstverpflichtung.......................................................22<br />
2.1.4 Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik .........................22<br />
2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>....................................................................23<br />
2.2.1 Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>...........................................23<br />
2.2.2 Marktstruktur .................................................................................................................................23<br />
2.3 Weitere Aspekte.....................................................................................................................................23<br />
2.3.1 Innovationswirkungen <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>..........................................................................23<br />
2.3.2 Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> .......................................................................23<br />
2.3.3 Monitoring <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ...........................................................................................23<br />
2.3.4 Arbeit des Verbandes.....................................................................................................................23<br />
3. SCHLUßFOLGERUNGEN FÜR DIE WEITERE EVALUATION ...............................24<br />
IV. DETAILEVALUATION VON VIER SELBSTVERPFLICHTUNGEN..........................26<br />
1. VORGEHENSWEISE BEI DER DETAILEVALUATION ...........................................26<br />
2. DIE ERGEBNISSE DER DETAILEVALUATION ......................................................27<br />
2.1 Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen .....................................................................................................................................27<br />
2.1.1 Auswahl <strong>der</strong> befragten Personen....................................................................................................27<br />
2.1.1.1 Unternehmen.............................................................................................................................27<br />
2.1.1.2 Auswahl <strong>der</strong> Behörden..............................................................................................................28<br />
2.1.1.3 Auswahl <strong>der</strong> Umweltverbände..................................................................................................28<br />
2.1.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation.....................................................................................................28<br />
2.1.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung .............................................................28<br />
2.1.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung...............................................................31<br />
2.1.2.3 Weitere Aspekte........................................................................................................................32<br />
2.2 Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen<br />
(insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit ..............................34<br />
2.2.1 Auswahl <strong>der</strong> befragten Personen....................................................................................................34<br />
2.2.1.1 Unternehmen.............................................................................................................................34<br />
2.2.1.2 Behörden...................................................................................................................................34<br />
2.2.1.3 Umweltverbände und -institute .................................................................................................35<br />
VI
2.2.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation .................................................................................................... 35<br />
2.2.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ............................................................. 35<br />
2.2.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung............................................................... 38<br />
2.2.2.3 Weitere Aspekte........................................................................................................................ 39<br />
2.3 Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz ...... 41<br />
2.3.1 Auswahl <strong>der</strong> Befragten .................................................................................................................. 41<br />
2.3.1.1 Unternehmen............................................................................................................................. 41<br />
2.3.1.2 Behörden................................................................................................................................... 41<br />
2.3.1.3 Umweltverbände....................................................................................................................... 41<br />
2.3.1.4 Nachgelagerte Unternehmen..................................................................................................... 41<br />
2.3.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation .................................................................................................... 42<br />
2.3.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>......................................................... 42<br />
2.3.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung............................................................... 44<br />
2.3.2.3 Weitere Aspekte........................................................................................................................ 45<br />
2.4 Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und holzverfärbende<br />
Organismen............................................................................................................................................ 46<br />
2.4.1 Auswahl <strong>der</strong> Befragten .................................................................................................................. 46<br />
2.4.1.1 Unternehmen............................................................................................................................. 46<br />
2.4.1.2 Behörden................................................................................................................................... 47<br />
2.4.1.3 Umweltverbände....................................................................................................................... 47<br />
2.4.1.4 Kunden(-verbände) ................................................................................................................... 47<br />
2.4.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation .................................................................................................... 47<br />
2.4.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ............................................................. 47<br />
2.4.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung............................................................... 50<br />
2.4.2.3 Weitere Aspekte........................................................................................................................ 51<br />
3. ZUSAMMENFASSENDES FAZIT ZU DEN VIER SELBSTVERPFLICHTUNGEN ... 53<br />
3.1 Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen..................................................................................................................................... 53<br />
3.2 Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen<br />
(insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit.............................. 54<br />
3.3 Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz ...... 54<br />
3.4 Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und holzverfärbende<br />
Organismen............................................................................................................................................ 55<br />
V. GESAMTBEWERTUNG UND SCHLUßFOLGERUNGEN ....................................... 56<br />
1. EFFEKTIVITÄT UND EFFIZIENZ DER IM DETAIL UNTERSUCHTEN<br />
SELBSTVERPFLICHTUNGEN ................................................................................ 56<br />
1.1 Ökologische Effektivität ....................................................................................................................... 56<br />
1.1.1 Zielerreichung................................................................................................................................ 56<br />
1.1.2 Verän<strong>der</strong>ung gegenüber einem Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung ............................... 56<br />
VII
1.1.3 Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik .........................57<br />
1.2 Ökonomische Effizienz..........................................................................................................................57<br />
1.3 Weitere Aspekte.....................................................................................................................................57<br />
1.4 Fazit zur Effektivität und Effizienz <strong>der</strong> untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> .................................58<br />
2. DER PROZEß DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG: ECKPUNKTE VON<br />
SELBSTVERPFLICHTUNGEN ................................................................................59<br />
2.1 Allgemeine Bemerkungen .....................................................................................................................59<br />
2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>..................................................................59<br />
2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>....................................................................60<br />
2.2.1 Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung................................................60<br />
2.2.2 Marktstruktur .................................................................................................................................61<br />
2.3 Weitere Aspekte.....................................................................................................................................62<br />
2.3.1 Sonstige Konsequenzen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ......................................................................62<br />
2.3.2 Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ...............................................................................................63<br />
2.3.3 Arbeit des Verbandes.....................................................................................................................64<br />
3. SCHLUßFAZIT UND EMPFEHLUNG AN DEN VERBAND......................................65<br />
TEIL B: DOKUMENTATION DES ABSCHLUßWORKSHOPS<br />
AM 19. MÄRZ 2001................................................................ 67<br />
I. ZIEL UND ABLAUF DES WORKSHOPS.................................................................69<br />
II. DIE DISKUSSION DER EINZELNEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN .....................70<br />
1. SELBSTVERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG DER CHEMISCHEN INDUSTRIE ZUR<br />
REDUKTION DER ENERGIEBEDINGTEN CO2-EMISSIONEN ...............................70<br />
1.1 Kommentar I Werner Ressing ..............................................................................................................71<br />
1.2 Kommentar II Stephan Ramesohl ........................................................................................................75<br />
1.3 Kommentar III Günther Keilitz ............................................................................................................79<br />
1.4 Diskussion ..............................................................................................................................................82<br />
VIII
2. SELBSTVERPFLICHTUNG DER CHEMISCHEN INDUSTRIE ZUR ERFASSUNG<br />
UND BEWERTUNG VON STOFFEN (INSBESONDERE ZWISCHENPRODUKTE)<br />
FÜR DIE VERBESSERUNG DER AUSSAGEFÄHIGKEIT ...................................... 83<br />
2.1 Kommentar I Christine Frank-Otto ..................................................................................................... 84<br />
2.2 Kommentar II Andreas Ahrens ............................................................................................................ 86<br />
2.3 Diskussion .............................................................................................................................................. 89<br />
3. SELBSTVERPFLICHTUNG ZUR KLASSIFIZIERUNG VON TEXTILHILFSMITTELN<br />
NACH IHRER GEWÄSSERRELEVANZ .................................................................. 90<br />
3.1 Kommentar I Lothar Noll..................................................................................................................... 91<br />
3.2 Kommentar II Harald Schönberger ..................................................................................................... 94<br />
3.3 Diskussion .............................................................................................................................................. 95<br />
4. SELBSTVERPFLICHTUNG ZU MITTELN ZUM SCHUTZ VON HOLZ GEGEN<br />
HOLZZERSTÖRENDE UND HOLZVERFÄRBENDE ORGANISMEN ..................... 96<br />
4.1 Kommentar I Josef-Theo Hein............................................................................................................. 97<br />
4.2 Kommentar II Hans Reifenstein .......................................................................................................... 99<br />
4.3 Diskussion ............................................................................................................................................ 102<br />
III. SCHLUßFOLGERUNGEN UND ALLGEMEINE DISKUSSION.............................. 103<br />
1. KOMMENTAR I: EVALUATION FREIWILLIGER SELBSTVERPFLICHTUNGEN<br />
AUS WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHER SICHT KLAUS RENNINGS ....... 104<br />
2. KOMMENTAR II: EVALUATION VON SELBSTVERPFLICHTUNGEN DER<br />
VERBÄNDE DER CHEMISCHEN INDUSTRIE – EINSCHÄTZUNG DER POLITIK<br />
HERLIND GUNDELACH........................................................................................ 110<br />
3. KOMMENTAR III THOMAS LENIUS ..................................................................... 113<br />
4. DISKUSSION......................................................................................................... 118<br />
IX
ANHÄNGE ......................................................................................... 123<br />
ANHANG 1: MITGLIEDER DES STEUERKREISES ......................................................... 125<br />
ANHANG 2: SELBSTVERPFLICHTUNGEN DER VERBÄNDE<br />
DER CHEMISCHEN INDUSTRIE .................................................................. 126<br />
ANHANG 3: GESPRÄCHSPARTNER IN DER GROBEVALUATION ............................... 129<br />
ANHANG 4: GESPRÄCHSPARTNER IN DER DETAILEVALUATION............................. 130<br />
ANHANG 5: FRAGEBOGEN FÜR DIE DETAILEVALUATION (BSP.: CO2-<br />
SELBSTVERPFLICHTUNG; FRAGEBOGEN UNTERNEHMEN) ................ 136<br />
ANHANG 6: TAGESORDNUNG DES WORKSHOPS VOM 19. MÄRZ 2001.................... 147<br />
ANHANG 7: TEILNEHMER DES WORKSHOPS VOM 19. MÄRZ 2001 ........................... 148<br />
LITERATURVERZEICHNIS ............................................................... 150<br />
X
Zusammenfassung (Executive Summary)<br />
Der VCI hat das Institut für Umweltmanagement GmbH beauftragt, anhand einer empirischen<br />
Untersuchung die bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong><br />
Industrie zu evaluieren.<br />
Die Studie verfolgt dabei zwei Ziele. Einerseits soll die ökologische Effektivität und ökonomische<br />
Effizienz <strong>der</strong> bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie untersucht<br />
werden.<br />
Zum zweiten soll die Studie Aufschluß darüber geben, welche Faktoren geprüft bzw. welche<br />
Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine Selbstverpflichtung als erfolgreich angesehen<br />
werden kann.<br />
Dazu wurde nach einer Sichtung <strong>der</strong> Literatur ein Untersuchungsdesign gewählt, das einen<br />
stärker empirisch ausgerichteten Zugang hat als bisherige Studien zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.<br />
In einem ersten Schritt wurden die bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im Rahmen einer<br />
Grobevaluation, bei <strong>der</strong> Gespräche mit Vertretern des VCI und <strong>der</strong> Fachverbände geführt<br />
wurden, zusammengestellt und summarisch untersucht. Im zweiten Schritt wurden vier ausgewählte<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> in einer Detailevaluation untersucht. Dabei wurden ausführliche<br />
Interviews mit betroffenen Unternehmen, Behördenvertretern und Umweltverbänden/<br />
-instituten geführt.<br />
In <strong>der</strong> Grobevaluation ließen sich die folgenden ersten Erkenntnisse gewinnen:<br />
• Die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> des Verbandes <strong>der</strong> Chemischen Industrie lassen sich in drei<br />
Kategorien unterteilen: die meisten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> beschäftigen sich mit <strong>der</strong> Reduktion<br />
o<strong>der</strong> Substitution <strong>von</strong> Stoffen, die in die Umwelt gelangen; die zweite Gruppe hat<br />
als primäres Ziel die Gewinnung und/o<strong>der</strong> Weitergabe <strong>von</strong> Informationen, insbeson<strong>der</strong>e<br />
für Behörden und Konsumenten; die dritte Gruppe beinhaltet solche, die den betroffenen<br />
Unternehmen Verfahrensanweisungen (bezüglich <strong>der</strong> Gestaltung <strong>von</strong> Produktionsabläufen<br />
o<strong>der</strong> Produkten) geben.<br />
• Die meisten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben die in ihnen festgesetzten Ziele erreicht.<br />
• Bevorstehende staatliche Regelungen und Verordnungen sowie die Kontakte mit staatlichen<br />
Stellen und Behörden sind in <strong>der</strong> überwiegenden Mehrzahl <strong>der</strong> Fälle die Auslöser für<br />
die Verabschiedung einer Selbstverpflichtung. In <strong>der</strong> Regel werden die <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
auch eng mit diesen Stellen abgestimmt.<br />
• Die Anfor<strong>der</strong>ungen an <strong>Selbstverpflichtungen</strong> sind im Laufe <strong>der</strong> Zeit gewachsen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
ein transparentes Monitoringsystem ist heute ein wichtiger Bestandteil einer<br />
Selbstverpflichtung.<br />
• In den <strong>Verbände</strong>n gibt es in Einzelfällen Informationen über die Kosten <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
und alternativen umweltpolitischen Instrumenten.<br />
XI
Für eine eingehen<strong>der</strong>e Untersuchung im Rahmen <strong>der</strong> Detailevaluation sollte aus je<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
drei genannten Kategorien <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> mindestens ein Fallbeispiel analysiert<br />
werden. Ausgewählt wurden die folgenden vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong>:<br />
• Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen;<br />
• Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen<br />
(insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit;<br />
• Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz;<br />
• Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und holzverfärbende<br />
Organismen.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Detailevaluation konnte zu den vier untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> folgendes<br />
festgestellt werden:<br />
1. Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen<br />
• Das Reduktionsziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung konnte bereits im Jahre 2000 erreicht werden.<br />
Die Erfüllung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wird vor allem <strong>von</strong> den Unternehmen sichergestellt,<br />
die im Energieausschuß des VCI zusammengeschlossen sind und den Hauptanteil des<br />
Energieverbrauchs <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ausmachen. Dieser relativ kleine Kreis <strong>von</strong><br />
tatsächlich betroffenen Unternehmen dürfte wesentlich dafür sein, daß das Ziel so frühzeitig<br />
erreicht worden ist.<br />
• Die meisten Maßnahmen, die im Rahmen dieser Selbstverpflichtung durchgeführt worden<br />
sind, waren für die Unternehmen wirtschaftlich rentabel, da sie zugleich zu Kostensenkungen<br />
führten; viele da<strong>von</strong> wurden unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführt.<br />
• Zusätzlich hat die Selbstverpflichtung in einigen Fällen Investitionsprojekte mit einer längeren<br />
Amortisationszeit ermöglicht. Darüber hinaus besteht eine Hauptwirkung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung in <strong>der</strong> Auslösung zahlreicher Verän<strong>der</strong>ungen in den Betriebsabläufen<br />
und Managementprozessen <strong>von</strong> Unternehmen, bei denen verstärkt auf Fragen <strong>der</strong> Energieeinsparung<br />
und Ressourcenschonung geachtet wurde; <strong>der</strong> CO2-Reduktionseffekt dieser<br />
Maßnahmen läßt sich jedoch nur schwer quantifizieren.<br />
• Ein kritischer Punkt ist bei dieser Selbstverpflichtung die Dokumentation <strong>der</strong> getroffenen<br />
Maßnahmen, die <strong>von</strong> mehreren Seiten als noch nicht transparent genug betrachtet wird.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e für die Umweltverbände gehört zur ökologischen Effektivität auch <strong>der</strong><br />
Nachweis, daß und wie sich durch die Selbstverpflichtung die Investitionsentscheidungen<br />
<strong>von</strong> Unternehmen verän<strong>der</strong>t haben. Durch die gegenwärtige Berichterstattung werde das<br />
aber nicht ausreichend transparent.<br />
XII
2. Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong><br />
Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
• In den Großunternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ist die Zielerreichung und die Erarbeitung<br />
des gefor<strong>der</strong>ten Basisdatensatzes vermutlich gewährleistet. Die Umsetzung in<br />
kleinen und mittleren Unternehmen schreitet ebenfalls voran, allerdings muß vor dem<br />
Hintergrund <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse die Zielerreichung dort noch als unsicher bezeichnet<br />
werden. Unternehmen berichten <strong>von</strong> Problemen sowohl bei <strong>der</strong> Erarbeitung des<br />
Basisdatensatzes als auch bei <strong>der</strong> Herstellung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit.<br />
• Manche Unternehmen fühlen sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung überhaupt nicht betroffen,<br />
bei an<strong>der</strong>en herrscht Unsicherheit über den Umfang <strong>der</strong> zu leistenden Arbeiten. Beklagt<br />
werden außerdem des öfteren hohe Kosten und eine mangelnde Hilfestellung <strong>von</strong> seiten<br />
des Verbandes.<br />
• Die Problematik <strong>der</strong> Selbstverpflichtung liegt darin, daß sich hier mehrere Zielsetzungen<br />
überlagern: Auf <strong>der</strong> einen Seite geht es um die Erarbeitung eines Mindestdatensatzes.<br />
Darüber hinaus ist dieser Datensatz aber nur eine Vorstufe für das eigentliche Ziel <strong>der</strong><br />
Aussagefähigkeit, die durch die Selbstverpflichtung erreicht werden soll. Gerade hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> Kommunikation und Akzeptanz dieses Zieles bestehen noch erhebliche Verbesserungspotentiale<br />
bei den Unternehmen und beim Verband.<br />
• Sowohl <strong>von</strong> den befragten Behördenvertretern als auch <strong>von</strong> den befragten Umweltverbänden<br />
wird die Selbstverpflichtung überwiegend kritisch beurteilt: <strong>der</strong> vorgesehene Datensatz<br />
wird als unzureichend angesehen und die erhobenen Daten seien aufgrund <strong>der</strong><br />
Erhebungsmethoden nicht ausreichend valide.<br />
3. Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz<br />
• Das Ziel <strong>der</strong> Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach dem in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung beschriebenen<br />
System wird aller Voraussicht nach termingemäß erreicht.<br />
• Über das Ziel <strong>der</strong> Informationsweitergabe hinaus kann da<strong>von</strong> ausgegangen werden, daß<br />
durch die Substitution <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln, die als beson<strong>der</strong>s umweltbelastend eingestuft<br />
worden sind, eine ökologische Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand eingetreten<br />
ist. Dazu war insbeson<strong>der</strong>e hilfreich, daß <strong>der</strong> Gesamtverband <strong>der</strong> Deutschen Textilveredlungsindustrie<br />
(TVI) seinerseits eine entsprechende Selbstverpflichtung verabschiedet<br />
hat, die den TVI-Mitgliedsfirmen empfiehlt, nur noch Mittel zu verwenden, die <strong>von</strong><br />
den Herstellern nach dem Konzept <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eingestuft wurden, und dabei<br />
nach Möglichkeit solche zu bevorzugen, die weniger gewässerrelevant sind.<br />
• Alle befragten Parteien sehen die Selbstverpflichtung als Schritt in die richtige Richtung<br />
an. Die Behörden haben aber den Wunsch, in Zukunft zusätzliche, aussagekräftigere<br />
Daten zu erhalten. Moniert wird in diesem Zusammenhang, daß eine durchgehende Umsetzungskontrolle<br />
fehle, daß Produkte anstelle <strong>von</strong> Einzelsubstanzen klassifiziert würden<br />
und daß die Einstufung nicht durch eine neutrale Stelle stattfinde.<br />
XIII
4. Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und<br />
holzverfärbende Organismen<br />
• Das Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wurde innerhalb <strong>der</strong> vorgesehenen Zeit nicht erreicht.<br />
Insgesamt muß die Zielerreichung noch als unsicher bezeichnet werden: es ist noch nicht<br />
absehbar, ob alle betroffenen Unternehmen die gefor<strong>der</strong>ten Einstufungen und Prüfverfahren<br />
tatsächlich durchgeführt haben bzw. durchführen werden.<br />
• Kritisch für die Verabschiedung und Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung war das nicht abgestimmte<br />
Vorgehen <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong>. Diesbezüglich wurde sowohl <strong>von</strong> den Unternehmen<br />
als auch <strong>von</strong> den Behörden Kritik geäußert. Die Interessen bezüglich einer<br />
Regelung sowie die Produktpolitiken <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> und ihrer Unternehmen waren außerordentlich<br />
unterschiedlich und heterogen.<br />
• Die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung hängt stark <strong>von</strong> <strong>der</strong> Unterstützung durch den<br />
Fachhandel ab. Hier werden <strong>von</strong> allen Beteiligten noch große Optimierungspotentiale gesehen.<br />
Der Einbezug des Fachhandels wird als noch nicht ausreichend eingeschätzt.<br />
Aus diesen <strong>Evaluation</strong>sergebnissen läßt sich bezüglich <strong>der</strong> Untersuchungsziele folgendes<br />
aussagen:<br />
a) Hinsichtlich <strong>der</strong> Effektivität und Effizienz läßt sich aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Untersuchung<br />
kein abschließendes Urteil über die untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ableiten. Die vorliegenden<br />
Daten und Einschätzungen <strong>der</strong> Befragten sind dafür nicht ausreichend.<br />
b) Aus <strong>der</strong> Untersuchung lassen sich jedoch Bedingungen bzw. Faktoren ableiten, <strong>der</strong>en<br />
Ausprägung vor bzw. während eines Verhandlungsprozesses bezüglich einer Selbstverpflichtung<br />
zu prüfen bzw. zu definieren wäre, um die Erfolgsaussichten abzuschätzen<br />
bzw. zu verbessern. Aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Untersuchung läßt sich <strong>der</strong> folgende Vorschlag<br />
einer Liste <strong>von</strong> Bedingungen bzw. Faktoren ableiten.<br />
• Klarheit <strong>der</strong> Zielsetzung: Hier ist zu prüfen, ob <strong>der</strong> spezifische Sachverhalt sich für<br />
eine Selbstverpflichtung mit eindeutigen, klaren Zielsetzungen eignet, die gegenüber<br />
den betroffenen Unternehmen kommunizierbar sind. In diesem Zusammenhang findet<br />
auch die Definition und Abgrenzung des zugrundeliegenden Sachverhalts bzw. Umweltproblems<br />
statt. Die Untersuchung hat gezeigt, daß sich für die Kommunikation <strong>von</strong><br />
Zielen gegenüber den Unternehmen meß- und operationalisierbare Inhalte einer<br />
Selbstverpflichtung eher eignen als nur allgemein formulierte Zielangaben.<br />
• Ökonomische Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für Unternehmen: Bei diesem<br />
Faktor ist abzuschätzen, welche Kosten und Erträge eine Selbstverpflichtung bei<br />
den betroffenen Unternehmen verursacht. Ökonomische Konsequenzen für die Unternehmen<br />
dürften zu den relevantesten Erfolgsfaktoren <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gehören.<br />
Allgemein dürfte gelten: Je höher die Kosten für die Umsetzung einer Selbstverpflichtung<br />
und je geringer o<strong>der</strong> auch nur: je unbestimmter die Kosten alternativer umweltpolitischer<br />
Maßnahmen, desto geringer ist die Bereitschaft und die Chance zur<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
XIV
• Ökonomische Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für den Verband: Ebenso<br />
sind für den Verband die Kosten zu berücksichtigen, die bei ihm im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung anfallen. Allgemein dürfte gelten: Je kritischer die Umsetzungschancen,<br />
desto höher werden die Kosten für den Verband sein, die Umsetzung<br />
sicherzustellen. Diese Verbandskosten sind – aus Sicht des Verbandes und <strong>der</strong> Unternehmen<br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie – nur zu rechtfertigen, wenn die Vorteile einer<br />
Selbstverpflichtung für die gesamte Industrie gegenüber einer rechtlichen Regelung<br />
deutlich überwiegen.<br />
• Heterogenität <strong>der</strong> betroffenen Unternehmen: Dieser Faktor legt das Augenmerk auf<br />
die Frage, wie heterogen die betroffenen Unternehmen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen<br />
und ihres Interesses an einer Umsetzung sind. Die Unterschiedlichkeit bzgl.<br />
Kompetenzen und Bereitschaft kann sich aus <strong>der</strong> Größe, den Produkten, den Märkten,<br />
etc. ergeben. Je heterogener die Interessenlage und Kompetenz, desto kritischer<br />
dürfte die Verhandlung und die Umsetzung sein.<br />
• Anzahl <strong>der</strong> betroffenen Unternehmen: Hier ist zu prüfen, wieviele Unternehmen <strong>von</strong><br />
<strong>der</strong> Umsetzung einer Selbstverpflichtung faktisch betroffen sind bzw. wären, unabhängig<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> formalen Betroffenheit aufgrund <strong>der</strong> Verbandsmitgliedschaft. Die untersuchten<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> zeigen, daß die Umsetzung umso schwieriger und komplexer<br />
ist, je mehr Unternehmen sich an <strong>der</strong> Umsetzung beteiligen müssen, um das<br />
gesetzte Ziel zu erreichen.<br />
• Wertschöpfungskette und Marktstruktur: Die Bedeutung vor- und nachgelagerter<br />
Unternehmen sowie die Marktgegebenheiten (internationale Dimension, Organisationsgrad)<br />
für die Umsetzung einer Selbstverpflichtung stehen bei <strong>der</strong> Überprüfung dieses<br />
Faktors im Vor<strong>der</strong>grund. Je weiter und differenzierter die Gruppe <strong>der</strong> betroffenen<br />
Akteure, desto kritischer dürfte die Umsetzung sein.<br />
• Anreize für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung: Unabhängig <strong>von</strong> den wirtschaftlichen<br />
Konsequenzen einer Selbstverpflichtung ist zu prüfen, ob sonstige Anreize<br />
für die Unternehmen bestehen o<strong>der</strong> geschaffen werden können, eine Selbstverpflichtung<br />
umzusetzen. Dieses Problem stellt sich insbeson<strong>der</strong>e dann, wenn es sich um eine<br />
Selbstverpflichtung handelt, die bei den Unternehmen Kosten verursacht o<strong>der</strong> wenn<br />
die Kostenfolgen umweltpolitischer Alternativen unklar sind. Dann fehlen ökonomische<br />
Anreize, die eine Einhaltung sicherstellen könnten.<br />
• Transparenz und Monitoring: Hier ist zu prüfen, wie die Selbstverpflichtung und ihr<br />
(unternehmensinternes und -externes) Monitoring gestaltet werden können, um eine<br />
ausreichende Transparenz sowohl innerhalb des Verbandes als auch gegenüber externen<br />
Anspruchsgruppen zu gewährleisten.<br />
• Verhandlungsmandat und -spielraum des Verbandes: Bei <strong>der</strong> Überprüfung dieses<br />
Punktes geht es vor allem um die Frage, ob eine Selbstverpflichtung <strong>von</strong> den Verbandsmitglie<strong>der</strong>n<br />
tatsächlich gewünscht wird und somit <strong>der</strong> Verband über ein faktisches<br />
Verhandlungsmandat <strong>von</strong> seiten seiner Mitglie<strong>der</strong> und einen genügend großen<br />
Spielraum verfügt, um eine Selbstverpflichtung auszuhandeln.<br />
XV
• Umsetzungskapazitäten des Verbandes: Um die Umsetzung einer Selbstverpflichtung<br />
adäquat zu begleiten, muß <strong>der</strong> Verband über die notwendigen Ressourcen (finanziell<br />
wie personell) verfügen. Je kritischer die Umsetzungschancen sind, desto mehr<br />
aktives Umsetzungsmanagement ist erfor<strong>der</strong>lich, um die Selbstverpflichtung zum Erfolg<br />
zu führen. Dabei spielt es für das Umsetzungsmanagement wahrscheinlich keine<br />
so große Rolle, ob die entsprechenden personellen Kapazitäten verbandsintern geschaffen<br />
o<strong>der</strong> extern zugekauft werden.<br />
XVI
Teil A:<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchung<br />
1
Einleitung: Die Diskussion über <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben sich als Mittel <strong>der</strong> Umweltpolitik in den vergangenen Jahren<br />
immer stärker etabliert und werden in vielen Bereichen eingesetzt. Gemäß einer neueren<br />
Studie (KNEBEL/WICKE/MICHAEL 1999, S. 301) beläuft sich die Anzahl <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>der</strong> Industrie auf 85. Da<strong>von</strong> wurde die Mehrzahl vom Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie<br />
(VCI) und seinen Fachverbänden abgegeben. Zwar gibt es in an<strong>der</strong>en Untersuchungen<br />
leicht abweichende Angaben über die Anzahl <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>, <strong>der</strong> Grund dafür<br />
liegt aber im wesentlichen in etwas unterschiedlichen Abgrenzungen, die in den Erhebungen<br />
zugrundegelegt werden. An dem Sachverhalt, daß die chemische Industrie den größten Teil<br />
<strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> deutschen Industrie abgegeben hat, än<strong>der</strong>t dies nichts.<br />
Das Instrument <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wird insbeson<strong>der</strong>e <strong>von</strong> <strong>der</strong> Industrie äußerst positiv<br />
bewertet. So nennt etwa GROHE (1999) als drei wichtige Vorteile <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
ihre Flexibiltät, ihre Schnelligkeit und die Möglichkeit zur dynamischen Weiterentwicklung:<br />
Die Flexibilität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> rühre daher, daß aufgrund <strong>von</strong> Verhandlungen<br />
zwischen den beteiligten Unternehmen die Belastungen so verteilt werden könnten, daß<br />
das ökologisch effektivste und ökonomisch effizienteste Ergebnis resultiere; darüber hinaus<br />
könnten sie schneller auf bestehende Umweltprobleme reagieren, da sie nicht mit dem zeitraubenden<br />
parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren belastet seien; und schließlich sei<br />
es möglich, eine Selbstverpflichtung im laufenden Prozeß ständig weiterzuentwickeln und<br />
kontinuierlich neuen Zielvorstellungen anzupassen, wohingegen bei staatlichen Instrumenten<br />
ein erneutes Gesetzgebungsverfahren erfor<strong>der</strong>lich sei.<br />
Auch <strong>der</strong> VCI nennt in seinem Positionspapier zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ähnliche Vorzüge,<br />
die mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong> verbunden seien (O.V. 1999, S. 8 f.): das Instrument stoße bei<br />
den Unternehmen auf große Akzeptanz, da die Industrie bei <strong>der</strong> Gestaltung des Inhalts beteiligt<br />
sei; Anpassungsspielräume und Kostenvorteile könnten genutzt werden, da den Unternehmen<br />
die Wege zur Zielerreichung freigestellt blieben; Selbstkontrolle durch die Wirtschaft<br />
trete an die Stelle <strong>der</strong> Staatskontrolle, was zu einer Entlastung des Staates führen<br />
könne; wirtschafts- und finanzpolitische Probleme fiskalischer Instrumente würden vermieden,<br />
da ökologische und ökonomische Fragen gleichrangig berücksichtigt würden; schließlich<br />
entsprächen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> dem Grundsatz <strong>der</strong> Subsidiarität, da spezifische<br />
Branchenprobleme mit diesem Instrument effizienter und eventuell auch schneller gelöst<br />
werden könnten.<br />
Zugleich sind aber <strong>Selbstverpflichtungen</strong> einer starken Kritik sowohl <strong>von</strong> Umweltverbänden<br />
als auch <strong>von</strong> (Teilen) <strong>der</strong> Wissenschaft und <strong>der</strong> Politik ausgesetzt. Diese Kritik bezieht sich<br />
vor allem darauf, daß <strong>Selbstverpflichtungen</strong> keinen ökologischen Fortschritt bedeuteten,<br />
son<strong>der</strong>n lediglich das festschrieben, was <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Unternehmen bzw. <strong>der</strong> Industrie ohnehin<br />
(z. B. im Rahmen des normalen Strukturwandels) vorgesehen sei; ein solcher „noregrets-Ansatz“<br />
würde es nicht rechtfertigen, auf an<strong>der</strong>e Instrumente <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
zu verzichten.<br />
Auch die Effizienz des Instrumentes sei nicht belegbar, da in <strong>der</strong> Regel entsprechende Anreizmechanismen<br />
fehlten, die eine effiziente Kostenaufteilung <strong>der</strong> Umweltschutzleistungen<br />
sicherstellen würden. Darüber hinaus werden auch grundsätzliche ordnungspolitische Be-<br />
3
denken gegen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> angeführt; insbeson<strong>der</strong>e würden sie durch ihren „korporatistischen“<br />
Ansatz nicht nur den Einsatz <strong>von</strong> marktwirtschaftlichen Instrumenten (wie z. B.<br />
Abgaben und handelbaren Emissionsrechten) behin<strong>der</strong>n, son<strong>der</strong>n auch das parlamentarische<br />
Gesetzgebungsverfahren umgehen (z. B. RENNINGS ET AL. 1996).<br />
Die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie wurden bisher nur in <strong>der</strong> Studie <strong>von</strong><br />
KNEBEL/WICKE/MICHAEL (1999) untersucht, in <strong>der</strong> eine Totalerhebung alle bestehenden<br />
Selbstverpflichtung <strong>der</strong> deutschen Industrie vorgenommen wurde (vgl. dazu Abschnitt<br />
II.2.1.4). Bisher jedoch fehlt eine eingehende Analyse <strong>der</strong> Erfahrungen mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie, die zugleich auch dem Verband Hinweise für den Einsatz<br />
und die Ausgestaltung dieses Instrumentes an die Hand gibt. Aus diesem Grunde wurde<br />
das Institut für Umweltmanagement GmbH beauftragt, eine Studie zur <strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie durchzuführen.<br />
Die Evaluierung soll dem VCI vor allem dazu dienen, die Effizienz und die Effektivität <strong>von</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu überprüfen sowie die Faktoren und Bedingungen herauszuarbeiten,<br />
die als Voraussetzung dafür angesehen werden können, daß eine Selbstverpflichtung die in<br />
ihr festgeschriebenen Ziele erreicht und zugleich <strong>von</strong> allen Beteiligten – Verband, Unternehmen,<br />
Behörden und weitere Anspruchsgruppen (wie z. B. Umweltverbände) – als wichtiger<br />
Beitrag zur Problemlösung angesehen wird. Dies soll im Rahmen einer verbandsinternen<br />
Standortbestimmung die Grundlage liefern für die Formulierung weiterer umweltpolitischer<br />
Strategien des Verbandes – insbeson<strong>der</strong>e im Hinblick auf den Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
sowie ihre Ausgestaltung.<br />
In diesem Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Studie zusammengefaßt. Der erste<br />
Abschnitt enthält zunächst einige konzeptionelle Überlegungen über die Rolle <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
in <strong>der</strong> Marktwirtschaft. Diese Überlegungen machen bereits deutlich, daß die<br />
Untersuchung und Bewertung <strong>von</strong> Selbstverpflichtung außerordentlich viele Aspekte umfaßt,<br />
die nicht alle erschöpfend behandelt werden können. Im zweiten Abschnitt werden daher<br />
zunächst die Ziele <strong>der</strong> Untersuchung dargestellt. Für die Ableitung des genauen Untersuchungsdesigns<br />
werden dann einige frühere Studien zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> kurz vorgestellt;<br />
aus diesen Studien lassen sich wichtige Schlußfolgerungen ziehen sowohl für die methodische<br />
Vorgehensweise als auch für die zu untersuchenden Aspekte, die beide anschließend<br />
erläutert werden. Kern <strong>der</strong> Vorgehensweise ist dabei die Unterteilung <strong>der</strong> Analyse in<br />
eine Grob- und eine Detailevaluation sowie eine stärker empirisch orientierte Herangehensweise<br />
als bei bestehenden Studien. Der dritte Abschnitt behandelt die Ergebnisse <strong>der</strong><br />
Grobevaluation, bei <strong>der</strong> 40 <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie im<br />
Rahmen <strong>von</strong> Gesprächen mit (Fach-)Verbandsvertretern untersucht worden sind. Aufgrund<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Grobevaluation wurden vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong> für eine eingehen<strong>der</strong>e<br />
Untersuchung ausgewählt. Im vierten Abschnitt werden die Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
beschrieben, in <strong>der</strong> ausführliche Gespräche mit betroffenen Unternehmen, Behörden und<br />
Umweltverbänden/-instituten geführt wurden. Der fünfte Abschnitt faßt die Untersuchungsergebnisse<br />
zusammen und zieht Schlußfolgerungen, die daraus für den Einsatz und die<br />
Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> abgeleitet werden.<br />
4
I. Zur Rolle <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in <strong>der</strong> Marktwirtschaft<br />
1. Grundsätzliche Überlegungen<br />
Welche Rolle können <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im Kontext einer demokratisch legitimierten<br />
marktwirtschaftlichen Ordnung spielen? Diese Frage näher zu betrachten, ist erfor<strong>der</strong>lich, um<br />
den Kontext aufzuzeigen, in dem sich die vorliegende Untersuchung abspielt, und um ihre<br />
Ergebnisse und Schlußfolgerungen einzuordnen. Zwar können an dieser Stelle keine endgültigen<br />
Antworten zur Rolle <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gegeben werden, aber es ist mindestens<br />
ebenso wichtig, die offenen Fragen zu formulieren, die sich im Zusammenhang mit<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> stellen.<br />
Die Rolle <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist vor dem Hintergrund einer demokratisch verfaßten<br />
Marktwirtschaft zu sehen. In dieser Ordnung ist idealtypischerweise <strong>der</strong> Staat für die Setzung<br />
<strong>der</strong> Rahmenbedingungen und damit für die Gewährleistung <strong>der</strong> Rechtssicherheit zuständig,<br />
während sich die Unternehmen innerhalb dieses für alle gültigen Rahmens bewegen und ihre<br />
einzelwirtschaftlichen Ziele verfolgen.<br />
Diese Rahmenordnung bezieht sich auch und beson<strong>der</strong>s auf die Sicherstellung öffentlicher<br />
Güter, <strong>der</strong>en Produktion o<strong>der</strong> Erhalt nicht durch den Markt gewährleistet werden kann<br />
(Marktversagen). Der Schutz <strong>der</strong> Umwelt als öffentliches Gut ist in diesem Zusammenhang<br />
ein beson<strong>der</strong>s wichtiges Gebiet. Das Instrumentarium des Staates beinhaltet dabei vor allem<br />
drei Bestandteile: Ordnungsrecht, Haftungsrecht und sog. marktwirtschaftliche Instrumente,<br />
wie z. B. Abgaben o<strong>der</strong> handelbare Emissionsrechte.<br />
Ordnungsrecht besteht vor allem aus Ge- und Verboten, wie z. B. zur Gefahrenabwehr, o<strong>der</strong><br />
auch aus Regelungen für die Genehmigung <strong>von</strong> Produktionsanlagen etc.<br />
Das Haftungsrecht soll Geschädigten einen Ausgleich für erlittene Schäden bieten, aber zugleich<br />
auch eine präventive Wirkung entfalten: Durch die Möglichkeit, für Schäden Dritter<br />
haften zu müssen, erhalten die Unternehmen einen Anreiz, <strong>der</strong>artige Schäden auch im eigenen<br />
Interesse weitestgehend zu vermeiden – sei es durch eine größere Sorgfalt, sei es durch<br />
eine Einschränkung ihrer Tätigkeiten.<br />
Die sogenannten marktwirtschaftlichen Instrumente bedienen sich des Preismechanismusses<br />
und verän<strong>der</strong>n relative Preise, so daß darüber eine Lenkungswirkung auftreten soll.<br />
So können etwa auf bestimmte Aktivitäten Abgaben festgesetzt werden, die <strong>von</strong> den Unternehmen<br />
zu entrichten sind. Alternativ werden Aktivitäten mengenmäßig durch die Ausgabe<br />
<strong>von</strong> handelbaren Emissionsrechten beschränkt, die unter den Beteiligten an einem solchen<br />
System frei handelbar sind. Auf diese Weise sollen einerseits umweltschädigende Aktivitäten<br />
eingeschränkt werden, an<strong>der</strong>erseits sollen die erfor<strong>der</strong>lichen Reduktionsanstrengungen dort<br />
getätigt werden, wo dies am kostengünstigsten möglich ist.<br />
In diesem idealtypischen Politikszenario wäre theoretisch kein Platz für <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n und Unternehmen. Die privatwirtschaftlichen Akteure verfolgen innerhalb <strong>der</strong><br />
staatlichen Rahmenordnung ihre Ziele, <strong>der</strong> Staat sorgt für die Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
und trifft institutionelle und regulatorische Vorkehrungen für Fälle des Marktversagens, z. B.<br />
5
in <strong>der</strong> Umweltpolitik. Alle etwaigen Regelungsnotwendigkeiten werden durch die Rahmenordnung<br />
des Staates bzw. <strong>der</strong>en Verän<strong>der</strong>ung und Anpassung abgedeckt.<br />
Damit diese so skizzierte Aufgabenverteilung aber auch wirklich reibungslos funktioniert,<br />
muß die staatliche Rahmenordnung vollständig sein, d.h. sie darf keine wichtigen Regelungslücken<br />
aufweisen, so daß relevante Probleme ungelöst bleiben. Oft aber ist z.B. das<br />
Ordnungsrecht mit <strong>der</strong> Bewältigung <strong>von</strong> Problemen im Rückstand, weil es etwa an die Erfor<strong>der</strong>nisse<br />
neuer technischer Entwicklungen nicht rasch genug angepaßt werden kann. Demgegenüber<br />
liegt die Vermutung nahe, daß die Industrie über <strong>der</strong>artige Entwicklungen besser<br />
informiert ist (weil sie diese ja auch selbst stark beeinflußt und gestaltet) und deshalb auch<br />
rascher reagieren kann; die technische Lösungskompetenz <strong>der</strong> Industrie könnte somit im<br />
Rahmen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> genutzt werden. Das Ausmaß und die Einsatzbereiche<br />
dieses Instruments hängen aber <strong>von</strong> vielen Faktoren ab.<br />
2. Zum Vergleich <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> mit an<strong>der</strong>en umweltpolitischen<br />
Instrumenten<br />
Die Wahl eines geeigneten, d.h. problemadäquaten, umweltpolitischen Instruments erfor<strong>der</strong>t<br />
eine rationale Entscheidungsgrundlage i.S. einer Abwägung <strong>der</strong> Folgewirkungen einzelner<br />
Instrumente. Neben <strong>der</strong> Frage, ob ein Instrument geeignet ist, ein bestimmtes Umweltproblem<br />
zu lösen, spielen auch die „Nebenwirkungen“ eines Instrumentes eine Rolle: die (wirtschaftlichen)<br />
Belastungen, die mit seiner Anwendung verbunden sind, die Aufwendungen für<br />
Implementation und Kontrolle, seine Verteilungswirkungen usw. Eine <strong>der</strong>artige, empirisch<br />
ausgerichtete, „Folgenabschätzung“ verschiedener politischer Instrumente wird in vielen Politikbereichen<br />
gefor<strong>der</strong>t, aber häufig nur ansatzweise praktiziert – so auch in <strong>der</strong> Umweltpolitik.<br />
Meist erfolgen solche Instrumentenabwägungen o<strong>der</strong> Folgenabschätzungen eher auf Basis<br />
<strong>von</strong> Plausibilitätsüberlegungen unter Rückgriff auf theoretische Konzepte o<strong>der</strong> empirische<br />
Erfahrung. Das Instrument <strong>der</strong> Selbstverpflichtung schneidet in <strong>der</strong> wissenschaftlichen (und<br />
auch öffentlichen) Diskussion im Vergleich insbeson<strong>der</strong>e mit den sog. marktwirtschaftlichen<br />
Instrumenten (Abgaben und handelbare Emissionsrechte) eher schlecht ab. Dies liegt vor<br />
allem daran, daß die Wirkungsweise <strong>der</strong> letztgenannten Instrumente auf relativ einfache<br />
Weise modelliert werden kann; im Rahmen dieser Modelle läßt sich zeigen, daß Abgaben<br />
und handelbare Emissionsrechte dazu führen, die Reduktion <strong>von</strong> umweltschädigenden Aktivitäten<br />
dort durchzuführen, wo dies am kostengünstigsten möglich ist. Denn je<strong>der</strong> Betroffene<br />
überlegt sich, ob es für ihn billiger ist, eine Reduktion durchzuführen, o<strong>der</strong> die Abgabe zu<br />
zahlen bzw. die notwendigen Emissionsrechte zu erwerben. In diesem Modellrahmen läßt<br />
sich so auch die gesamtwirtschaftliche Effizienz dieser Instrumente zeigen.<br />
Bei <strong>Selbstverpflichtungen</strong> fehlen <strong>der</strong>artige Modellierungen bisher weitgehend. Es existiert<br />
kein Modell, aus dem gefolgert werden kann, daß durch die Selbstverpflichtung quasi „<strong>von</strong><br />
selbst“, d.h. aufgrund des Eigeninteresses <strong>der</strong> beteiligten Akteure, die effiziente Erreichung<br />
<strong>von</strong> umweltpolitischen Zielen sichergestellt werden kann. In <strong>der</strong> Realität wird – sofern die<br />
Selbstverpflichtung nicht <strong>von</strong> vornherein gewisse Reduktionspflichten für jedes Unternehmen<br />
vorsieht – die Aufteilung <strong>der</strong> Reduktionsanstrengungen auf dem Verhandlungswege zwischen<br />
den betroffenen Unternehmen durchgeführt. Ob dies auch zu einer effizienten, d.h.<br />
6
kostenminimalen Aufteilung <strong>der</strong> Umweltschutzaufwendungen führt, darüber läßt sich a priori<br />
nichts sagen.<br />
Diese Beurteilung marktwirtschaftlicher Instrumente berücksichtigt aber zunächst nur den Effizienzgedanken,<br />
nicht jedoch an<strong>der</strong>e Wirkungen, z. B. verteilungspolitischer Art, die bei <strong>der</strong><br />
Bewertung <strong>von</strong> Instrumenten ebenfalls eine Rolle spielen (können).<br />
Aber auch das Ordnungsrecht wird in <strong>der</strong> öffentlichen Diskussion tendenziell positiver beurteilt<br />
als die Abgabe <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>, da hier <strong>der</strong> Staat klare Vorgaben setze, denen<br />
gegenüber die Inhalte <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> weniger anspruchsvoll seien.<br />
In diesem Zusammenhang ist das Staats- und Politikverständnis angesprochen, das ebenfalls<br />
eine wichtige Rolle spielt: Ist <strong>der</strong> Staat eher die Institution, die Verpflichtungen festlegt,<br />
die <strong>von</strong> den Bürgern und den Institutionen <strong>der</strong> Gesellschaft umzusetzen sind, o<strong>der</strong> muß <strong>der</strong><br />
Staat eher die Kooperation und den Diskurs mit gesellschaftlichen Gruppen suchen, um zu<br />
durchsetzbaren und weiterführenden umweltpolitischen Lösungen zu kommen? Insbeson<strong>der</strong>e<br />
im Falle eines <strong>der</strong>artigen „kooperativen“ Staates ist das Potential für <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
größer als bei einem eher traditionellen Staatsverständnis.<br />
Diese Überlegungen machen bereits deutlich, daß die einfache Gegenüberstellung „Staat<br />
setzt Rahmenordnung – Unternehmen verän<strong>der</strong>n entsprechend ihre Aktivitäten“ in dieser<br />
Reinheit nicht zutrifft. Vielmehr besteht unter Umständen durchaus ein Potential für <strong>Selbstverpflichtungen</strong>,<br />
so daß bestehende Regelungslücken durch das Handeln <strong>von</strong> Unternehmen<br />
und ihrer <strong>Verbände</strong> ganz o<strong>der</strong> teilweise geschlossen werden können.<br />
Ein <strong>der</strong>artiges Potential kann sich etwa aus den folgenden Gründen ergeben:<br />
• Ein erster Grund kann darin liegen, daß zu einem Problemfeld nicht ohne weiteres eine<br />
adäquate Umweltpolitik formuliert werden kann, weil Unsicherheiten über das anzustrebende<br />
Umweltziel bestehen o<strong>der</strong> weil ein Ziel nur schwer festlegbar und operationalisierbar<br />
ist. In diesem Falle können <strong>Selbstverpflichtungen</strong> Bausteine in einem Suchprozeß<br />
darstellen, in dem neue umweltpolitische Ziele diskutiert, ausprobiert und konkretisiert<br />
werden.<br />
• Ein zweiter Grund kann darin bestehen, daß zwar über die zugrundeliegenden Umweltziele<br />
Einigkeit herrscht, aber die adäquaten Instrumente zur Erreichung <strong>der</strong> Ziele umstritten<br />
sind. Solche Instrumente können in Verboten o<strong>der</strong> Einschränkungen bestimmter<br />
umweltschädlicher Tätigkeiten bestehen; dies ist aber nicht die einzige Möglichkeit, <strong>der</strong>artige<br />
Aktivitäten einzuschränken. Eine an<strong>der</strong>e Möglichkeit bestünde darin, gewisse Transparenz-<br />
und Informationspflichten <strong>der</strong> Unternehmen festzulegen; dabei stellen dann vermehrte<br />
Information und Transparenz keinen Selbstzweck dar: damit verbunden ist die<br />
Vermutung, daß über einen größeren Öffentlichkeits- o<strong>der</strong> Marktdruck umweltschädliche<br />
Aktivitäten verän<strong>der</strong>t o<strong>der</strong> eingeschränkt werden. Dafür finden sich in <strong>der</strong> neueren Literatur<br />
auch Beispiele (KONAR/COHEN 1997, KHANNA/QUIMIO/BOJILOWA 1998). Eine Selbstverpflichtung<br />
kann hier als eine Art Versuchslabor für verschiedene umweltpolitische Instrumente<br />
fungieren.<br />
• Drittens können das Ziel und die notwendigen Maßnahmen für seine Erreichung unbestritten<br />
sein, auch <strong>der</strong> Kreis <strong>von</strong> betroffenen Akteuren steht weitgehend fest. In diesem<br />
7
Fall ist <strong>der</strong> Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wahrscheinlich am unproblematischsten, da<br />
nur wenige Auffassungsunterschiede zwischen Staat und Verband bestehen dürften. Hier<br />
werden Praktikabilitätsüberlegungen den Ausschlag geben, ob eine Selbstverpflichtung<br />
o<strong>der</strong> eine rechtliche Regelung, wie z.B. eine Verordnung, eingesetzt wird. Falls sich eine<br />
Selbstverpflichtung in einem solchen Fall als praktikabel und zielführend erweist, spricht<br />
zusätzlich das Gebot <strong>der</strong> Verhältnismäßigkeit dafür, keine zusätzlichen staatlichen Eingriffe<br />
vorzusehen.<br />
• Schließlich ist es möglich, daß bestimmte Umweltziele und umweltpolitische Instrumente<br />
nicht durchsetzbar sind, weil die (wirtschaftlichen) Belastungen, die damit für die Betroffenen<br />
verbunden sind, als zu groß angesehen werden. Der Einsatz einer Selbstverpflichtung<br />
erscheint dann als eine <strong>von</strong> mehreren Möglichkeiten, um Umweltziele zu erreichen<br />
und zugleich die wirtschaftlichen Belastungen möglichst gering zu halten.<br />
All diese Überlegungen zur Rolle und zum Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> machen deutlich,<br />
daß für eine vollständige Bewertung <strong>der</strong> Vor- und Nachteile <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
eine Vielzahl <strong>von</strong> Faktoren berücksichtigt werden muß. Insbeson<strong>der</strong>e ist es erfor<strong>der</strong>lich, die<br />
unterschiedlichen Folgen <strong>von</strong> umweltpolitischen Maßnahmen miteinan<strong>der</strong> zu vergleichen,<br />
um zu einer fundierten Bewertung dieser Instrumente zu kommen. Dies ist bislang noch<br />
kaum erfolgt und kann auch in dieser Studie nicht o<strong>der</strong> nur in Ansätzen geleistet werden.<br />
Die vorliegende Arbeit soll daher in erster Linie einen Beitrag für die Diskussion um den Einsatz<br />
und die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> bieten, <strong>der</strong> dem Verband <strong>der</strong> Chemischen<br />
Industrie Hinweise für die eigene umweltpolitische Arbeit geben soll. Dabei ist es nicht<br />
möglich, alle Kontexte hinreichend zu beleuchten, die für eine umfassende Bewertung dieses<br />
Instrumentes analysiert werden müßten. Dies führt zu Ziel und Methodik <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Untersuchung, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden.<br />
8
II. Ziele und Methodik <strong>der</strong> Studie<br />
1. Zum Ziel dieser Studie<br />
Die Untersuchung ist nicht auf eine umfassende Bewertung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ausgerichtet,<br />
son<strong>der</strong>n hat die Untersuchung <strong>der</strong> zwei folgenden Probleme zum Ziel:<br />
1. Wie ist die ökologische Effektivität und die ökonomische Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
zu beurteilen?<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> ökologischen Effektivität geht es dabei um die Frage, ob die Selbstverpflichtung<br />
zu einer Verbesserung des zugrundeliegenden Umweltproblems geführt hat. Im<br />
einzelnen geht es darum, ob die Selbstverpflichtung ihre gesetzten Ziele erreicht hat, ob<br />
durch die Selbstverpflichtung größere ökologische Verbesserungen erreicht wurden als<br />
sie sich durch die Fortschreibung des bestehenden Trends bzw. ohne den Abschluß <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung ergeben hätten, und schließlich darum, ob durch die Selbstverpflichtung<br />
eine größere ökologische Wirkung erzielt wurde als durch an<strong>der</strong>e staatliche Instrumente.<br />
Bei <strong>der</strong> ökonomischen Effizienz geht es um die Frage, ob das gesetzte Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
auf eine kostenminimale Weise erreicht worden ist.<br />
2. Welche Faktoren müssen geprüft werden bzw. welche Bedingungen müssen gegeben<br />
sein, damit eine Selbstverpflichtung als erfolgreich angesehen werden kann? Dabei wird<br />
hier unter „erfolgreich“ verstanden, daß eine Selbstverpflichtung das in ihr festgelegte Ziel<br />
erreicht, daß das Ziel in möglichst kostengünstiger Weise erreicht wird und daß möglichst<br />
alle Beteiligten (Unternehmen, Verband, Behörden, Umweltverbände und an<strong>der</strong>e Anspruchsgruppen)<br />
die Selbstverpflichtung als wichtigen Beitrag zur Lösung des Umweltproblems<br />
ansehen.<br />
Mit diesem zweiten Fragenkomplex sind Punkte angesprochen, die vor allem für die verbandsinterne<br />
Diskussion um den Einsatz und die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
wesentlich sind. Die Hinweise, die aus <strong>der</strong> Untersuchung zu diesen Fragen abgeleitet<br />
werden können, sollen dem Verband Hilfestellungen für eine zielgerichtete Auswahl <strong>der</strong><br />
Einsatzbereiche sowie die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> geben. Dabei ist<br />
weitgehend unbestritten, daß die Erreichung des Zieles einer Selbstverpflichtung – und<br />
dies in einer möglichst kostengünstigen Weise – zu den notwendigen Voraussetzungen<br />
gehört, damit <strong>von</strong> einem Erfolg gesprochen werden kann. Für den Verband ist in <strong>der</strong> Außenkommunikation<br />
ebenfalls wichtig, daß auch <strong>von</strong> Externen eine Selbstverpflichtung als<br />
erfolgreich angesehen wird.<br />
Der primäre Adressat dieser Studie ist somit <strong>der</strong> Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie, dem einige<br />
Hinweise gegeben werden sollen, wie <strong>der</strong> Einsatz des Instruments „Selbstverpflichtung“<br />
9
verbessert werden kann. Aus dieser primären Zielsetzung ergeben sich drei Beschränkungen<br />
hinsichtlich des Gegenstandes <strong>der</strong> Studie:<br />
Es wird erstens keine juristische Analyse <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> durchgeführt und auch<br />
keine Definition <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> erarbeitet. Die Studie wählt diesbezüglich ein<br />
pragmatisches Vorgehen: als Selbstverpflichtung wird das angesehen, was <strong>von</strong> den <strong>Verbände</strong>n<br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie als solche benannt wird.<br />
Die Studie führt zweitens keine umfassende Vor- und Nachteilsanalyse <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
im allgemeinen durch. Dazu wäre eine Fülle zusätzlicher Fragen zu untersuchen.<br />
Damit verbunden ist, daß keine ausführliche Analyse des politischen, gesellschaftlichen und<br />
wirtschaftlichen Kontextes <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> stattfindet.<br />
Drittens werden in dieser Studie keine Empfehlungen an die Politik über die Bedeutung und<br />
den Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gegeben, wie das explizit o<strong>der</strong> implizit in vielen an<strong>der</strong>en<br />
Studien und Artikeln zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> intendiert ist, son<strong>der</strong>n es stehen Empfehlungen<br />
an den Verband im Vor<strong>der</strong>grund. Ein generelles politisches Urteil über <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
wird damit nicht ausgesprochen.<br />
2. Methodische Begründung <strong>der</strong> Studienkonzeption<br />
Bei <strong>der</strong> Konzeption <strong>der</strong> Studie konnte auf eine Reihe bereits bestehen<strong>der</strong> Studien zurückgegriffen<br />
werden, die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> analysiert haben, und die Anregungen für die Vorgehensweise<br />
in <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung geliefert haben. Daher werden zunächst die<br />
bestehenden Studien kurz referiert; daran anschließend werden, unter Einbezug <strong>der</strong> Methoden<br />
und Ergebnisse früherer Studien, Ablauf und Methodik <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung<br />
dargestellt.<br />
2.1 Die Ergebnisse früherer Studien zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
2.1.1 S. LAUTENBACH, U. STEGER, P. WEIHRAUCH: Evaluierung freiwilliger Branchenabkommen<br />
im Umweltschutz: Ergebnisse eines Gutachtens und Workshops<br />
(Köln: BDI, 1992)<br />
Das Gutachten <strong>von</strong> LAUTENBACH/STEGER/WEIHRAUCH untersucht sieben <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
bzw. freiwillige Vereinbarungen, die in unterschiedlichen Branchen abgegeben worden<br />
sind (die Jahreszahlen geben den Zeitpunkt des Abschlusses <strong>der</strong> Selbstverpflichtung bzw.<br />
<strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung an):<br />
• Faserzementindustrie: Freiwillige Vereinbarung mit dem Ziel <strong>der</strong> Verringerung (1982) bzw.<br />
des vollständigen Ersatzes (1984) <strong>von</strong> Asbest in Hochbauprodukten und des vollständigen<br />
Ersatzes <strong>von</strong> Asbest in Tiefbauprodukten (1988);<br />
• Aerosolindustrie: Reduzierung des Einsatzes <strong>von</strong> Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW)<br />
als Spraytreibgase (1976/77); Freiwillige Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Aerosol-Industrie zur<br />
Verringerung des Einsatzes <strong>von</strong> FCKW in Sprays (1987);<br />
• Lackindustrie: Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Lackindustrie zur Reduzierung <strong>der</strong> Anteile <strong>von</strong> Lösemitteln<br />
und Schwermetallen in Lacken und Farben (1984);<br />
10
• Wasch- und Reinigungsmittelindustrie: Freiwillige Zusage <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> IKW (Industrieverband<br />
Körperpflege- und Waschmittel e.V.), IPP (Industrieverband Putz- und Pflegemittel<br />
e.V.), FIR (Fachvereinigung Industriereiniger e.V.) und TEGEWA (Verband <strong>der</strong> Textilhilfsmittel-,<br />
Le<strong>der</strong>hilfsmittel- Gerbstoff- und Waschrohstoff-Industrie e.V.), in Wasch- und<br />
Reinigungsmitteln Alkylphenolethoxylate (APEO) zu ersetzen (1986);<br />
• Wasch- und Reinigungsmittelindustrie: Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> IKW, IPP, FIR<br />
und TEGEWA zur freiwilligen Mitteilung <strong>von</strong> Rahmenrezepturen und an<strong>der</strong>er Daten zur<br />
Beurteilung <strong>der</strong> Umweltverträglichkeit (1986);<br />
• Chemische Industrie: Freiwillige Überprüfung <strong>von</strong> Altstoffen (1982);<br />
• Rheinland-Pfälzische Industrie: Kooperationsabkommen zwischen <strong>der</strong> Rheinland-<br />
Pfälzischen Industrie und dem Land Rheinland-Pfalz zur Altlastensanierung (1986).<br />
Kriterium für die Beurteilung des Erfolges <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist in dieser Studie vor<br />
allem, ob diese ihre gesetzten Ziele erreicht haben. In <strong>der</strong> Studie werden dann die Rahmenbedingungen<br />
<strong>der</strong> einzelnen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und die kritischen Faktoren für das Gelingen<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> herausgearbeitet. Dabei stützen sich die Autoren im wesentlichen<br />
auf die Auswertung <strong>von</strong> Publikationen und öffentlich zugänglichen Statistiken sowie die<br />
Aussagen <strong>von</strong> befragten Verbandsvertretern. Hinsichtlich <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Erfolgsfaktoren für<br />
das Zustandekommen und die Zielerreichung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> liegt das Hauptaugenmerk<br />
<strong>der</strong> Autoren auf den Gegebenheiten des jeweiligen Marktes, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
betroffen ist.<br />
Insgesamt zeigt sich, daß auf seiten <strong>der</strong> direkt betroffenen Unternehmen insbeson<strong>der</strong>e die<br />
folgenden Faktoren positive Auswirkungen auf Abschluß und Erfolg <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
haben: eine hohe Wettbewerbsintensität, da sie die Innovationstätigkeit <strong>der</strong> Unternehmen<br />
stimuliere und aufgrund <strong>der</strong> hohen Reaktionsverbundenheit <strong>der</strong> Unternehmen eine Diffusion<br />
<strong>der</strong> Substitution umweltschädlicher Stoffe geför<strong>der</strong>t werde; ein hoher Anteil <strong>der</strong> Binnen-<br />
an <strong>der</strong> Gesamtnachfrage, so daß keine Gefahr besteht, daß Substitutionen umweltschädlicher<br />
Stoffe durch verstärkte Importe konterkariert werden; Verhandlungsstärke <strong>der</strong><br />
Anbieter gegenüber den Abnehmern im Falle <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu Zwischenprodukten,<br />
so daß <strong>der</strong>en Absatz weiter gesichert ist; geringe Kosten bei Substitutionen, die bei<br />
Realisierung kooperativer Lösungen aufzuwenden sind, wie z.B. niedrige Kosten für Forschung<br />
und Entwicklung sowie Investitionen.<br />
Auf seiten <strong>der</strong> Nachfrager im betroffenen Markt wirken sich die folgenden Faktoren günstig<br />
auf den Erfolg <strong>von</strong> Kooperationslösungen aus: hohes Umweltbewußtsein <strong>der</strong> Konsumenten,<br />
so daß <strong>der</strong> Absatz umweltfreundlicherer Substitute <strong>von</strong> Produkten begünstigt wird; geringe<br />
Preiserhöhungen bei gleichbleiben<strong>der</strong> o<strong>der</strong> verbesserter Qualität <strong>der</strong> Produkte; schließlich<br />
geringe Umrüstkosten <strong>der</strong> weiterverarbeitenden Industrie im Falle <strong>von</strong> Zwischenprodukten.<br />
11
2.1.2 K. RENNINGS et al. (ZEW): Nachhaltigkeit, Ordnungspolitik und freiwillige<br />
Selbstverpflichtung: Ordnungspolitische Grundregeln für eine Politik <strong>der</strong><br />
Nachhaltigkeit und das Instrument <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung im<br />
Umweltschutz (Heidelberg: Physica, 1996)<br />
Diese Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) untersucht <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
vor allem unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten und kommt in <strong>der</strong> Bewertung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu vorwiegend negativen Ergebnissen. Im einzelnen untersucht<br />
die Studie fünf Fallbeispiele:<br />
• die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zum Ausstieg aus FCKW;<br />
• die Klimaschutzerklärung <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft zur CO2-Reduktion <strong>von</strong> 1995;<br />
• die Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Autoindustrie zur Altautoverwertung;<br />
• das Duale System Deutschland (DSD), mit dem die Rücknahme und Verwertung <strong>von</strong><br />
Verpackungsabfall organisiert werden sollte;<br />
• die För<strong>der</strong>ung integrierter Umweltschutztechnik.<br />
Die einzelnen Fallbeispiele werden dann nach einem bestimmten Raster geprüft. Dabei werden<br />
u. a. folgende Fragen untersucht:<br />
• Welches umweltpolitische Ziel wird verfolgt? Wie ist dieses Ziel zu bewerten (wurde ggf.<br />
das ursprüngliche Ziel verwässert)? Sind die Maßnahmen geeignet, um das angestrebte<br />
Ziel zu erreichen?<br />
• Handelt es sich um eine marktkonforme Maßnahme? Wird etwa <strong>der</strong> Preismechanismus<br />
genutzt und daher möglichst wenig in die Entscheidungskompetenz <strong>der</strong> einzelnen eingegriffen?<br />
Hat außerdem die Ordnungspolitik Vorrang vor <strong>der</strong> Prozeßpolitik, d.h. wird ein<br />
langfristiger Ordnungsrahmen zur Verfügung gestellt, anstelle eine Vielzahl <strong>von</strong> Einzelmaßnahmen<br />
vorzusehen?<br />
• Ist die Maßnahme effizient? Werden Vermeidungs- und Transaktionskosten minimiert<br />
(statische Effizienz) und gibt es Anreize für weiteren technischen Fortschritt (dynamische<br />
Effizienz)?<br />
• Ist die Maßnahme institutionell beherrschbar o<strong>der</strong> stehen dem Vorbehalte bzw. Wi<strong>der</strong>stände<br />
<strong>von</strong> seiten des politisch-administrativen Systems sowie <strong>der</strong> betroffenen Akteure<br />
entgegen? Wie groß ist das Problem <strong>der</strong> Trittbrettfahrer?<br />
Das Urteil <strong>der</strong> Studie fällt weitgehend negativ aus. <strong>Selbstverpflichtungen</strong> werden nicht als<br />
marktwirtschaftliche Instrumente angesehen, da sie sich in <strong>der</strong> Regel nicht des Preismechanismusses<br />
bedienten, um das angestrebte Umweltziel zu erreichen. Vielmehr seien sie Ausdruck<br />
eines korporatistischen Ansatzes, bei dem oftmals auch die Kompetenzen des Parlaments<br />
umgangen würden. <strong>Selbstverpflichtungen</strong> entsprängen demgemäß einem „noregrets“-Ansatz,<br />
d. h. es würden in <strong>der</strong> Regel nur Maßnahmen durchgeführt, die betriebswirtschaftlich<br />
zumindest kostendeckend sind. Dieser Ansatz ist auf internationaler Ebene in <strong>der</strong><br />
Vergangenheit insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Klimapolitik stark diskutiert worden und wurde vor allem<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> amerikanischen Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten George Bush vertre-<br />
12
ten. Eine wissenschaftliche Flankierung erfuhr dieses Konzept durch WILLIAM NORDHAUS<br />
(1991), <strong>der</strong> die volkswirtschaftlichen Schäden durch den Treibhauseffekt als relativ klein einstufte<br />
und deshalb eine „no-regrets“-Strategie empfahl.<br />
Auch für die Kosteneffizienz findet die Studie keinen Beleg, da die <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
nicht mit Mechanismen verbunden werden, die für eine effiziente Kostenaufteilung sorgen<br />
könnten (z. B. Regelungen, die Abgaben o<strong>der</strong> handelbaren Emissionsrechten ähnlich sind).<br />
Auch eine dynamische Effizienz fehle, da die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in <strong>der</strong> Regel ein bestimmtes<br />
Ziel vorsehen, ohne aber Anreize für darüber hinausgehende Anstrengungen und<br />
weiteren technischen Fortschritt zu bieten.<br />
2.1.3 The Environmental Law Network International (ELNI, Hrsg.): Environmental<br />
Agreements: The Role and Effect of Environmental Agreements in Environmental<br />
Policies (Cameron May, 1998)<br />
In dieser Studie werden acht <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in Europa analysiert, darunter die folgenden<br />
beiden aus Deutschland:<br />
• die Selbstverpflichtung des Zentralverbandes <strong>der</strong> Elektrotechnik- und Elektronikindustrie<br />
(ZVEI) und des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE) zur Rücknahme<br />
<strong>von</strong> Altbatterien (Knopfzellen) und Verringerung des Quecksilbergehaltes in Alkali-<br />
Mangan-Batterien (1988);<br />
• die Selbstverpflichtung des Verbandes <strong>der</strong> Chemischen Industrie (VCI) zur Verringerung<br />
<strong>von</strong> EDTA in Gewässern (1991).<br />
Die Studie prüft die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nach vier Kriterien:<br />
• Eignung zum Umweltschutz (Effektivität);<br />
• Kosteneffizienz;<br />
• öffentliche Beteiligung und Demokratie;<br />
• soziale Akzeptanz.<br />
Dabei werden verfügbare Daten zu den <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ausgewertet und einige kurze<br />
Befragungen <strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n, Behörden und Umweltorganisationen durchgeführt. Die Untersuchung<br />
kommt – über alle acht untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> hinweg – zu folgenden<br />
Ergebnissen:<br />
• die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> führten zu einer Verbesserung <strong>der</strong> Umweltsituation und erreichten<br />
auch oft ihre gesteckten Ziele. Allerdings waren die Ziele, gemessen an den<br />
technischen Möglichkeiten, nicht übermäßig anspruchsvoll. Es konnte nicht gezeigt werden,<br />
daß <strong>Selbstverpflichtungen</strong> bessere o<strong>der</strong> schlechtere Ergebnisse hervorbringen als<br />
an<strong>der</strong>e Regulierungsinstrumente. Allerdings fanden sich auch keine Hinweise, daß<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> zügiger verabschiedet und durchgeführt werden können als staatliche<br />
Instrumente <strong>der</strong> Umweltpolitik.<br />
• Die Untersuchungen konnten nur wenig Informationen zu Kostendaten zutage för<strong>der</strong>n.<br />
Die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurden augenscheinlich abgeschlossen, ohne die Kosten ande-<br />
13
er Instrumente abzuschätzen. Es konnte keine Evidenz dafür gefunden werden, daß<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> kostengünstiger sind als an<strong>der</strong>e umweltpolitische Instrumente.<br />
• Die meisten <strong>der</strong> betrachteten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurden <strong>von</strong> Regierung und Industrie<br />
ohne Beteiligung weiterer Anspruchsgruppen ausgearbeitet. Die Studie findet keine Evidenz<br />
dafür, daß diese <strong>Selbstverpflichtungen</strong> durch Beteiligung weiterer Anspruchsgruppen<br />
hätten effektiver und erfolgreicher sein können.<br />
• Die soziale Akzeptanz des Instruments ist bei <strong>der</strong> Industrie beson<strong>der</strong>s hoch. Im Falle <strong>von</strong><br />
Behörden bzw. staatlichen Stellen ist die Resonanz gemischt, bei Umweltverbänden fällt<br />
die Resonanz mehrheitlich negativ aus.<br />
2.1.4 J. KNEBEL, L. WICKE, G. MICHAEL: <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und normersetzende<br />
Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes (Berlin: Erich Schmidt<br />
1999)<br />
Im ersten Teil dieser Studie werden die juristischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen<br />
des Einsatzes <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> behandelt. Im zweiten Teil wird eine Totalzusammenstellung<br />
und -bewertung <strong>der</strong> bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> vorgenommen.<br />
Dazu wurden an die betroffenen <strong>Verbände</strong> Fragebögen versandt, <strong>der</strong>en Beantwortung zu<br />
den einzelnen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> genauere Informationen liefern sollte.<br />
In <strong>der</strong> Studie werden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wie folgt definiert: rechtlich unverbindliche Zusagen<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft o<strong>der</strong> <strong>von</strong> einzelnen Branchen, ggf. auch einigen wenigen Firmen, Maßnahmen<br />
zum Umweltschutz durchzuführen o<strong>der</strong> umweltbelastende Aktivitäten zu unterlassen<br />
o<strong>der</strong> zu reduzieren, um bestimmte Umweltziele zu erreichen. Hat <strong>der</strong> Staat in irgendeiner<br />
Form mitgewirkt (Androhung an<strong>der</strong>er rechtlicher Regelungen, staatliche Anerkennung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung, staatliche Zusagen irgendwelcher Form etc.), liegt eine Selbstverpflichtung<br />
im engeren Sinne vor. Ohne staatliche Mitwirkung (keine Anerkennung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
durch Behörden, Staat sieht im betreffenden Bereich selbst keinen Handlungsbedarf<br />
und beabsichtigt auch keine rechtliche Regelung) liegt eine Selbstverpflichtung im<br />
weiteren Sinne vor. Von den untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> sind 36 <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
im weiteren Sinne, 49 sind <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im engeren Sinne.<br />
Die Studie bewertet den Erfolg <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> anhand <strong>von</strong> sieben Kriterien, die in<br />
<strong>der</strong> folgenden Tabelle – zusammen mit dem Bewertungsergebnis – kurz genannt werden.<br />
Insgesamt läßt sich festhalten, daß nach Auffassung <strong>von</strong> KNEBEL/WICKE/MICHAEL rund 80%<br />
<strong>der</strong> abgegebenen Selbstverrpflichtungen als erfolgreich anzusehen sind:<br />
14
Bewertung <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> bei KNEBEL/WICKE/MICHAEL (1999)<br />
Zugrundegelegtes Erfolgskriterium<br />
(Beschreibung <strong>der</strong> Kriterien und allfällige Bemerkungen<br />
sind <strong>der</strong> Studie selbst entnommen)<br />
Idealpolitisches Umwelt-Optimal-Kriterium: Ist die Selbstverpflichtung umweltbezogen dem Einsatz alternativer<br />
umweltpolitischer Instrumente o<strong>der</strong> Strategien – unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong>en tatsächlicher politischen Durchsetzbarkeit<br />
– überlegen, d, h. wird mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung <strong>der</strong> größte Umweltverbesserungserfolg sichergestellt?<br />
Realpolitisches Umwelt-Optimal-Kriterium: Wird mit <strong>der</strong> eingesetzten Selbstverpflichtung ein größerer umweltpolitischer<br />
Erfolg erreicht als mit umweltpolitischen Instrumenten, die unter den realpolitischen Gegebenheiten<br />
realistischerweise einsetz- und durchsetzbar wären (einschließlich <strong>der</strong> real erreichbaren Schärfe, Dosierung und<br />
Wirkung des Alternativ-Instrumentes)?<br />
Null-Alternativ-Kriterium bei <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im weiteren Sinn: Treten bei <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ohne<br />
substantielle staatliche Mitwirkung und bei fehlendem staatlichem Handlungswillen, d.h. im Vergleich zum Nichteinsatz<br />
alternativer umweltpolitischer Instrumente durch die freiwillig zugesagten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nennenswerte<br />
und erkennbare Umweltverbesserungen ein?<br />
Mit- und Ohne-(Selbstverpflichtungs-)Vergleichs-Kriterium: Ist durch bzw. mit Hilfe <strong>der</strong> Selbstverpflichtung <strong>der</strong><br />
Umweltzustand, <strong>der</strong> sich bei „Business as usual“ ergeben hätte, verbessert worden? Die Genauigkeit dieses Kriteriums<br />
hängt dabei da<strong>von</strong> ab, welche Informationen und Prognosen über die Business-as-usual-Entwicklung vorliegen.<br />
Einfaches Umweltverbesserungs-Kriterium: Sofern <strong>der</strong> Umweltzustand vor und nach <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
bekannt ist und eine Verbesserung stattgefunden hat, läßt sich das (äußerst schwache) Erfolgskriterium einführen,<br />
daß sich <strong>der</strong> Umweltzustand möglicherweise aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung verbessert hat. Eine Verbesserung<br />
ist aber bestenfalls nur ein Hinweis auf den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Positive Nebeneffekte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung: Hat es, abgesehen <strong>von</strong> direkten Umweltverbesserungen, positive<br />
Nebeneffekte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung gegeben (erhöhtes Umweltbewußtsein, Informationsaustausch, besseres<br />
Umweltmanagement, etc.)?<br />
Relatives Erfolgskriterium: Erreichung <strong>der</strong> selbstgesteckten Umweltziele <strong>der</strong> Selbstverpflichtung: Hat die<br />
Selbstverpflichtung ihre festgelegten Ziele erreicht? Dabei handelt es sich aber nur um ein relatives Kriterium, da<br />
das Ziel selbst ökologisch unbefriedigend sein kann o<strong>der</strong> die Selbstverpflichtung für die Erreichung des Zieles<br />
nicht kausal war.<br />
15<br />
Erfolgsquote bei<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
im engeren Sinne<br />
Erfolgsquote bei<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
im weiteren Sinne<br />
0 (0%) 0 (0 %)<br />
21 (43 %) (nicht zutreffend)<br />
(nicht zutreffend) 36 (100 %)<br />
33 (67 %) 36 (100 %)<br />
37 (76 %) 36 (100 %)<br />
38 (78 %) 36 (100 %)<br />
36 (74 %) 36 (100 %)
Als wichtige Erfolgsfaktoren <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nennen die Autoren:<br />
• starker Öffentlichkeits- bzw. Marktdruck;<br />
• starker staatlicher Druck mit schnell einsetzbaren ordnungspolitischen (o<strong>der</strong> Anreiz-)Instrumenten;<br />
• Monitoring;<br />
• Publikation <strong>von</strong> Fortschritten in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung;<br />
• relativ geringe Kosten o<strong>der</strong> Nachteile <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Mißerfolg einer Selbstverpflichtung ergibt sich für die<br />
Autoren bei einer Kumulation <strong>der</strong> folgenden „Mißerfolgsfaktoren“:<br />
• substantielle Kostenbelastung durch die Einhaltung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung;<br />
• fehlen<strong>der</strong> schnell wirken<strong>der</strong> staatlicher Druck – u.a. deshalb keine wirtschaftlichen Nachteile<br />
bei Nichteinhaltung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung;<br />
• fehlende Publikation <strong>der</strong> Erfolge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung und eventueller „Übeltäter“;<br />
• keine finanziellen und sonstigen Anreize.<br />
2.1.5 Fazit<br />
Ganz generell ist zu sagen, daß die bisherigen Studien zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in empirischer<br />
Hinsicht nicht sehr stark in die Tiefe gegangen sind:<br />
LAUTENBACH/STEGER/WEIHRAUCH beschränken sich im wesentlichen auf Gespräche mit Verbandsvertretern<br />
und auf die Auswertung vorhandener Daten und Literatur.<br />
RENNINGS ET AL. führen keine empirischen Untersuchungen i.e.S. durch. Die Autoren beschränken<br />
sich bei <strong>der</strong> Beurteilung auf die Auswertung vorhandener Literatur und Daten sowie<br />
darauf, ob bestimmte Bedingungen vorliegen, die die Einhaltung einzelner Kriterien sicherstellen:<br />
so wird etwa hinsichtlich Effizienz geprüft, ob die Selbstverpflichtung ökonomische<br />
Anreizinstrumente vorsieht, die aus ökonomisch-theoretischen Überlegungen heraus<br />
Effizienz sicherstellen, indem sie etwa marktpreisähnliche Anreize setzen. Da <strong>der</strong>artige Mechanismen<br />
in <strong>der</strong> Regel fehlten, könnten die entsprechenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> auch<br />
nicht effizient sein. Demgegenüber wird auf empirische Prüfungen im engeren Sinne verzichtet.<br />
Die empirische Ausrichtung <strong>der</strong> ELNI-Studie ist insofern stärker, als neben einer Auswertung<br />
<strong>der</strong> bestehenden Daten und <strong>der</strong> Literatur auch Vertreter <strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n, Behörden und Umweltorganisationen<br />
sowie – in Einzelfällen – Unternehmen befragt werden. Im wesentlichen<br />
wird allerdings nur mit einem (sehr kurzen) Fragebögen die Beurteilung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
erfragt, ohne auf Einzelheiten o<strong>der</strong> spezielle Erfahrungen <strong>der</strong> Befragten einzugehen.<br />
Die Studie <strong>von</strong> KNEBEL/WICKE/MICHAEL ist empirisch außerordentlich breit angelegt, an<strong>der</strong>erseits<br />
kann sie gerade deshalb bei <strong>der</strong> Untersuchung einzelner <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nicht in<br />
die Tiefe gehen: sie stützt sich bei <strong>der</strong> Analyse einer Selbstverpflichtung im wesentlichen auf<br />
16
je einen Fragebogen, <strong>der</strong> vom zuständigen Verband ausgefüllt wird, und geht nicht auf die<br />
unterschiedlichen Erfahrungen <strong>von</strong> Unternehmen, Behörden und Umweltverbänden ein.<br />
Allerdings macht die Studie mit ihrem Totalbewertungsansatz darauf aufmerksam, daß in<br />
den fallstudienorientierten Studien oftmals aufgrund bestimmter, möglicherweise nicht repräsentativer<br />
Fallbeispiele Erfolgsfaktoren <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> abgeleitet würden, die sich<br />
nicht auf an<strong>der</strong>e Beispiele übertragen ließen. Dem wollte die Studie durch eine möglichst<br />
umfassende Totalerhebung zu allen existierenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> vorbeugen. Auf <strong>der</strong><br />
an<strong>der</strong>en Seite wird <strong>von</strong> den Autoren aber auch eingeräumt, daß nur im Rahmen <strong>von</strong> Einzelfallstudien<br />
tatsächlich überprüft werden könne, ob die Vorzüge, die zugunsten <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
angeführt werden, in jedem Falle tatsächlich gegeben sind.<br />
2.2. Methodik und Ablauf <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung<br />
2.2.1 Zum Ansatz <strong>der</strong> Studie<br />
Ausgehend <strong>von</strong> den empirischen Defiziten früherer Studien, stützt sich die vorliegende Untersuchung<br />
methodisch im wesentlichen auf persönliche Interviews mit Vertretern <strong>der</strong> Chemieverbände,<br />
mit Vertretern <strong>von</strong> betroffenen Unternehmen, Behörden und Umweltverbänden.<br />
Diese Befragungen sollen zeigen, ob <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in <strong>der</strong> Wahrnehmung <strong>der</strong><br />
Betroffenen die in sie gesetzten Erwartungen hinsichtlich Effizienz und Effektivität erfüllen<br />
und welche Schlüsse sich daraus für den Einsatz und die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
ergeben. Die Erfahrungen <strong>der</strong>jenigen, die unmittelbar mit dem Abschluß und <strong>der</strong><br />
Umsetzung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu tun haben, sollen daher in dieser Studie in einem<br />
sehr viel detaillierteren Ausmaß genutzt werden als dies in bisherigen Studien <strong>der</strong> Fall war.<br />
Zusätzlich wird in <strong>der</strong> vorliegenden Studie eine Zweiteilung <strong>der</strong> <strong>Evaluation</strong> vorgenommen,<br />
um die Probleme einer möglicherweise nicht ausreichend breiten Fallstudienanalyse zu vermeiden:<br />
In einem ersten Schritt wurde eine Grobevaluation <strong>der</strong> bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie durchgeführt. Im Rahmen dieser Grobevaluation<br />
wurden in Gesprächen mit Vertretern des VCI und <strong>der</strong> zuständigen Fachverbände erste Informationen<br />
zu den bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> eingeholt (Kapitel III). Nach <strong>der</strong> Grobevaluation<br />
wurden vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong> für eine weitere Untersuchung ausgewählt.<br />
Im zweiten Schritt wurden in einer Detailevaluation die vier ausgewählten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
im Rahmen <strong>von</strong> Fallstudien näher untersucht (Kapitel IV). Zu je<strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
wurden neben den betroffenen Unternehmen auch Vertreter <strong>von</strong> Behörden sowie <strong>von</strong><br />
Umweltverbänden und -instituten befragt. Soweit erfor<strong>der</strong>lich, wurden zusätzlich noch vorund<br />
nachgelagerte Unternehmen in die Befragung einbezogen.<br />
Anschließend wurden die Ergebnisse <strong>der</strong> Grob- und Detailevaluation zusammengeführt und<br />
Schlußfolgerungen gezogen hinsichtlich Effizienz und Effektivität sowie hinsichtlich des Einsatzes<br />
und <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>von</strong> bestehenden und vor allem zukünftigen <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
(Kapitel V).<br />
17
2.2.2 Die Untersuchungsaspekte<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> Untersuchung wurden mehrere Aspekte untersucht, die im folgenden kurz<br />
skizziert und begründet werden. Die Darstellung <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse erfolgt anhand<br />
dieses Aspektrasters.<br />
2.2.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>:<br />
a) Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Im Rahmen dieses Aspektes wird kurz skizziert, welches Ziel die Selbstverpflichtung hat,<br />
welche Maßnahmen zur Zielerreichung vorgesehen sind und in welcher Frist diese umgesetzt<br />
sein sollen.<br />
b) Zielerreichung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Hier wird die Frage untersucht, in welchem Umfang die betroffenen Unternehmen die Selbstverpflichtung<br />
umgesetzt haben und wie <strong>von</strong> den Befragten die Zielerreichung sowie die erzielten<br />
ökologischen Verbesserungen beurteilt werden. Diese Frage, die auch in allen an<strong>der</strong>en<br />
Studien untersucht wurde, ist bezüglich <strong>der</strong> Beurteilung <strong>der</strong> ökologischen Effektivität einer<br />
Selbstverpflichtung zentral.<br />
c) Vergleich mit Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
Bedeutsam für die Beurteilung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist auch die Frage, ob und in welchem<br />
Maß die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> tatsächlich Maßnahmen ausgelöst haben im Sinne<br />
sonst nicht durchgeführter Maßnahmen und somit über das so genannte „Business as usual“<br />
hinausgehen. Die Einschätzung <strong>der</strong>artiger „zusätzlicher“ Maßnahmen ist für viele externe<br />
Anspruchsgruppen wie z.B. Umweltverbände ausschlaggebend bei <strong>der</strong> Beurteilung einer<br />
Selbstverpflichtung.<br />
Im allgemeinen wird unter „business as usual“ die Fortführung bestehen<strong>der</strong> Trends und Entwicklungen<br />
verstanden. Dazu kann auch die Durchführung bereits geplanter Investitionen<br />
etc. gehören. Im Einzelfall kann es relativ schwierig sein, genauere Angaben über den „business-as-usual“-Pfad<br />
zu machen. Hinzu kommt, daß es durchaus denkbar ist, daß Maßnahmen<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zwar ohnehin geplant und durchgeführt wurden und<br />
somit in <strong>der</strong> normalen Trendentwicklung liegen, die Selbstverpflichtung aber zumindest zu<br />
einer Stabilisierung dieses Trends geführt hat. Die Unterscheidung zur normalen Trendentwicklung<br />
ist ein wichtiger Punkt vor allem in <strong>der</strong> externen Kommunikation <strong>der</strong> Unternehmensverbände<br />
einer Selbstverpflichtung.<br />
Die Studie <strong>von</strong> KNEBEL/WICKE/MICHAEL sieht diesen Aspekt als eines <strong>von</strong> mehreren Erfolgskriterien<br />
an, beschränkt sich bei <strong>der</strong> Beurteilung aber – neben <strong>der</strong> Analyse <strong>der</strong> Fragebögen –<br />
auf Plausibiltätsüberlegungen und Literaturauswertungen. Dagegen soll in <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Untersuchung hierfür auf das Urteil <strong>der</strong> befragten Personen zurückgegriffen werden.<br />
18
d) Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Hier geht es um die Frage, ob mit einer Selbstverpflichtung eine größere o<strong>der</strong> zumindest eine<br />
gleich große Umweltverbesserung erzielt werden konnte als mit an<strong>der</strong>en umweltpolitischen<br />
Instrumenten. Auch hier sollen – wie<strong>der</strong>um an<strong>der</strong>s als bei KNEBEL/WICKE/MICHAEL, die<br />
diese Frage ebenfalls mit <strong>der</strong> Analyse <strong>von</strong> Fragebögen, Plausibilitätsüberlegungen und Literaturauswertungen<br />
angegangen sind – die Ansichten <strong>der</strong> unmittelbar Betroffenen für eine<br />
Bewertung genutzt werden.<br />
2.2.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
a) Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Dieser Abschnitt enthält die Einschätzungen <strong>der</strong> Befragten hinsichtlich <strong>der</strong> Kosten (und ggf.<br />
auch <strong>der</strong> Erträge), die im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung angefallen<br />
sind. Diese Frage spielt beispielsweise in <strong>der</strong> Studie <strong>von</strong> RENNINGS ET AL. eine große<br />
Rolle, wird dort allerdings vor allem auf <strong>der</strong> Basis <strong>von</strong> theoretischen Überlegungen untersucht.<br />
In <strong>der</strong> ELNI-Studie geht es ebenfalls um die Kosteneffizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>,<br />
wobei sich diese Studie in erster Linie auf öffentlich verfügbare Daten stützt. Demgegenüber<br />
haben in <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung die Einschätzungen <strong>von</strong> Unternehmen,<br />
Behörden und <strong>Verbände</strong>n größeres Gewicht.<br />
b) Marktstruktur<br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Marktstruktur geht es in dieser Studie vor allem um die Frage,<br />
inwieweit Unternehmen, die die Selbstverpflichtung nicht umsetzen, den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
(im Sinne <strong>der</strong> Zielerreichung) gefährden. Dabei ist insbeson<strong>der</strong>e das Problem<br />
<strong>von</strong> Nicht-Verbandsmitglie<strong>der</strong>n und <strong>von</strong> Importen angesprochen. Auch die Frage nach <strong>der</strong><br />
Bedeutung vor- und nachgelagerter Unternehmen spielt hier eine wichtige Rolle. In früheren<br />
Studien machen vor allem LAUTENBACH/STEGER/WEIHRAUCH auf die Bedeutung <strong>der</strong> Marktstruktur<br />
als wichtigen ökonomischen Erfolgsfaktor <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> aufmerksam,<br />
wobei sie diesen Faktor etwas breiter definieren als es hier geschieht.<br />
2.2.2.3 Weitere Aspekte<br />
a) Innovationswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung:<br />
Hier wird nach den Innovationen gefragt, die im Zuge einer Selbstverpflichtung (möglicherweise)<br />
induziert worden sind. Innovationen sind zwar kein zentraler Bestandteil <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>,<br />
sind aber möglicherweise eine bedeutsame Nebenwirkung, die die Umsetzung<br />
einer Selbstverpflichtung positiv beeinflussen könnten. Auch die ELNI-Studie behandelt<br />
die Frage <strong>von</strong> Innovationen, analysiert aber nur allgemein das innovative Potential <strong>von</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong>, ohne näher nach dem tatsächlichen Eintreten <strong>von</strong> Innovationen zu<br />
fragen.<br />
19
) Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung:<br />
Hier wird insbeson<strong>der</strong>e die Frage angesprochen, ob nach Einschätzung <strong>der</strong> Befragten die<br />
Selbstverpflichtung mit positiven Imageeffekten verbunden war. Auch diese sind kein zentraler<br />
Aspekt <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>, aber möglicherweise ein positiver Nebeneffekt, <strong>der</strong><br />
ihre Umsetzung beschleunigen kann. KNEBEL/WICKE/MICHAEL sehen positive Nebeneffekte<br />
als eines <strong>von</strong> mehreren Erfolgskriterien <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> an; deshalb wird auch in<br />
<strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung darauf eingegangen.<br />
c) Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Das Monitoring wird heute allgemein als zentraler Bestandteil einer Selbstverpflichtung angesehen.<br />
Daher werden in diesem Abschnitt Fragen des Monitorings und seine Beurteilung<br />
durch die Befragten vertieft.<br />
d) Arbeit des Verbandes<br />
Dieser Aspekt wurde bisher noch in keiner <strong>der</strong> bekannten Studien behandelt. Er ist wichtig,<br />
weil sich aus dem Urteil über die Arbeit des Verbandes wesentliche Anhaltspunkte ergeben<br />
können, um Schlußfolgerungen für die künftige Verbandstätigkeit hinsichtlich <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
ableiten zu können. Deshalb wurden die Befragten auch um Auskunft über die<br />
Arbeit des zuständigen Verbandes gebeten.<br />
2.2.3 Formale Aspekte des Studienablaufs<br />
Die Laufzeit <strong>der</strong> Studie betrug 15 Monate. Die Arbeit begann im Oktober 1999 und wurde im<br />
Dezember 2000 inhaltlich weitgehend abgeschlossen.<br />
Die Studie wurde begleitet <strong>von</strong> einem Steuerkreis, dem Vertreter des Verbandes <strong>der</strong> Chemischen<br />
Industrie und seiner Fachverbände angehörten, sowie Vertreter <strong>von</strong> Mitgliedsunternehmen<br />
und <strong>der</strong> Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Der Steuerkreis hat im<br />
Verlauf <strong>der</strong> Studie sechsmal getagt und die wesentlichen Schritte <strong>der</strong> Studie genehmigt. Der<br />
hier vorgelegte Abschlußbericht wurde <strong>von</strong> den Mitglie<strong>der</strong>n des Steuerkreises gegengelesen.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Grobevaluation wurden zwischen Oktober 1999 und Dezember 1999 siebzehn<br />
Gespräche mit Vertretern des VCI und <strong>der</strong> Fachverbände durchgeführt. Im Rahmen <strong>der</strong><br />
Detailevaluation wurden zwischen März und August 2000 sechzig ausführliche Interviews<br />
sowie insgesamt 27 telefonische Kurzinterviews mit Unternehmen, Behörden und Umweltverbänden/-instituten<br />
geführt.<br />
Den Befragten wurden die ausführlichen <strong>Evaluation</strong>sergebnisse zum Gegenlesen zugeschickt.<br />
Darüber hinaus wurden mit den beteiligten Unternehmen jeweils Workshops zur Diskussion<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse abgehalten.<br />
20
III. Grobevaluation <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
1. Vorgehensweise bei <strong>der</strong> Grobevaluation<br />
Die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurden zunächst vom VCI zusammengestellt. Um eine weitgehende<br />
Vollständigkeit zu gewährleisten, wurde eine entsprechende Umfrage bei den Fachverbänden<br />
durchgeführt. Diese ergab insgesamt 40 <strong>Selbstverpflichtungen</strong>. Eine Liste dieser<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> findet sich im Anhang.<br />
Zu den genannten 40 <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurden im Rahmen <strong>der</strong> Grobevaluation zwischen<br />
Oktober und Dezember 1999 insgesamt 17 Gespräche mit den zuständigen Personen<br />
beim VCI und den Fachverbänden geführt. Zu einigen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurden mehrere<br />
Personen befragt, z.T. gab auch eine Person Auskunft über mehrere <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.<br />
Die Liste <strong>der</strong> Gesprächspartner ist im Anhang aufgeführt.<br />
In diesen Gesprächen wurden erste Informationen zu den genannten Kriterien und Aspekten<br />
erhoben, die im folgenden Abschnitt zusammenfassend dargestellt sind. 1<br />
2. Ergebnisse <strong>der</strong> Grobevaluation<br />
2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
2.1.1 Inhalt <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Trotz <strong>der</strong> Vielfalt lassen sich die bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in drei große Gruppen<br />
einteilen:<br />
• Die meisten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> beschäftigen sich mit <strong>der</strong> Reduktion o<strong>der</strong> Substitution<br />
<strong>von</strong> Stoffen, seien dies Bestandteile <strong>von</strong> Produkten o<strong>der</strong> Abfallstoffe im Produktionsprozeß,<br />
die in die Umwelt gelangen.<br />
• Die zweite Gruppe <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> hat als primäres Ziel die Gewinnung<br />
und/o<strong>der</strong> Weitergabe <strong>von</strong> Informationen, insbeson<strong>der</strong>e für Behörden und Konsumenten.<br />
Dabei handelt es sich um die Angabe <strong>von</strong> Rezepturen und Inhaltsstoffen, Informationen<br />
über Gefährdungspotentiale u.ä.<br />
• Die dritte Gruppe <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> beinhaltet solche, die den betroffenen Unternehmen<br />
Verfahrensanweisungen geben: diese können sich etwa auf die Gestaltung <strong>von</strong><br />
Produktionsabläufen o<strong>der</strong> auf Produkte (Verpackungsgestaltung, Festlegung o<strong>der</strong> Ausschluß<br />
bestimmter Inhaltsstoffe etc.) beziehen.<br />
Obwohl in manchen Fällen die Einordnung einer Selbstverpflichtung nicht ganz leicht fällt,<br />
erfaßt diese Unterteilung wesentliche Kernpunkte <strong>der</strong> verschiedenen <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.<br />
1<br />
Ein ausführlicher Bericht über die Ergebnisse <strong>der</strong> Grobevaluation kann beim Institut für Umweltmanagement<br />
bezogen werden.<br />
21
Von den in <strong>der</strong> Grobevaluation untersuchten 40 <strong>Selbstverpflichtungen</strong> sind 21 Reduktionsverpflichtungen,<br />
8 sind Informationsverpflichtungen und 11 gehen auf an<strong>der</strong>weitige Verfahrensanweisungen<br />
ein.<br />
2.1.2 Zielerreichung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Die meisten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben das darin festgeschriebene Umweltziel erreicht.<br />
Von den 40 betrachteten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben 29 ihr Ziel erreicht, 4 haben das Ziel<br />
nicht erreicht und bei 7 ist noch keine abschließende Aussage möglich, da die Frist für die<br />
Umsetzung noch nicht erreicht und <strong>der</strong> Umsetzungsprozeß noch nicht abgeschlossen ist.<br />
2.1.3 Vergleich mit Entwicklungspfaden ohne Selbstverpflichtung<br />
Die Zielerreichung allein wird <strong>von</strong> einigen externen Anspruchsgruppen noch nicht als ausreichend<br />
angesehen, um <strong>von</strong> einem Erfolg einer Selbstverpflichtung zu sprechen. Hier kommen<br />
noch an<strong>der</strong>e Kriterien ins Spiel, die dementsprechend auch zu unterschiedlichen Beurteilungen<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> führen; insbeson<strong>der</strong>e die Frage, ob die Selbstverpflichtung zu<br />
einer Verbesserung <strong>der</strong> Umweltsituation gegenüber dem bereits bestehenden Trend geführt<br />
hat (Verbesserung gegenüber „business as usual“), ist hier <strong>von</strong> Bedeutung. Dazu konnten<br />
aber in <strong>der</strong> Grobevaluation noch keine näheren Informationen erhoben werden.<br />
2.1.4 Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
(Geplante) staatliche Regelungen sowie die Kontakte mit staatlichen Stellen und Behörden<br />
sind in <strong>der</strong> überwiegenden Mehrzahl <strong>der</strong> Fälle die Auslöser für die Verabschiedung einer<br />
Selbstverpflichtung. Dabei kann es einerseits darum gehen, eine gesetzliche Vorschrift durch<br />
eine Selbstverpflichtung anstelle einer Verordnung auszufüllen (z.B. im Falle <strong>der</strong> Mitteilung<br />
<strong>von</strong> Rahmenrezepturen <strong>von</strong> Wasch- und Reinigungsmitteln) o<strong>der</strong> aber geplante staatliche<br />
Maßnahmen zu verhin<strong>der</strong>n (z.B. im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ableitung<br />
<strong>von</strong> Ammonium). Oft genügen auch Hinweise <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Behörden, daß in einem<br />
bestimmten Bereich ein Umweltproblem gesehen wird, um die Verabschiedung einer Selbstverpflichtung<br />
anzuregen.<br />
Im Rahmen <strong>der</strong> Grobevaluation konnten noch keine näheren Informationen darüber erhoben<br />
werden, ob und inwieweit die Selbstverpflichtung gegenüber etwaigen geplanten staatlichen<br />
Regelungen effektiver war.<br />
Allerdings ist ein großer Teil <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> vor ihrer Verabschiedung nicht nur innerhalb<br />
des zuständigen Verbandes, son<strong>der</strong>n auch mit den zuständigen Behörden bzw. Ministerien<br />
abgestimmt worden. Zwar liegt juristisch in fast allen Fällen eine nicht einklagbare,<br />
einseitige Zusage <strong>der</strong> Industrie vor, dies berührt jedoch nicht ihre inhaltliche Abstimmung mit<br />
Behörden und staatlichen Stellen. Die Zeit für die Ausarbeitung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
reicht <strong>von</strong> wenigen Monaten bis (mehrheitlich) ein bis zwei Jahren, in Einzelfällen auch länger.<br />
22
2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
2.2.1 Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Sowohl beim VCI als auch bei den Fachverbänden liegen nur in wenigen Fällen Informationen<br />
über die entstandenen Kosten <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> vor. Dies gilt sowohl hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> Kosten für die betroffenen Firmen als auch hinsichtlich <strong>der</strong> Kosten des Verbandes<br />
selbst. Da <strong>der</strong>artige Kostendaten nicht vorliegen, sind auch keine Vergleiche mit den Kostenwirkungen<br />
an<strong>der</strong>er umweltpolitischer Instrumente möglich. Allerdings gehen die Befragten<br />
häufig da<strong>von</strong> aus, daß <strong>Selbstverpflichtungen</strong> insgesamt mit geringeren Kosten verbunden<br />
seien als staatliche Regelungen.<br />
2.2.2 Marktstruktur<br />
Generell ist innerhalb <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ein recht hoher Organisationsgrad zu konstatieren,<br />
<strong>der</strong> bei ca. 90 % liegt. Aufgrund dieses hohen Organisationsgrades gehen viele<br />
Verbandsvertreter da<strong>von</strong> aus, daß es im Inland nur wenige Unternehmen gibt, die eine<br />
Selbstverpflichtung nicht umsetzen. Die Zielerreichung sei daher durch solche „Trittbrettfahrer“<br />
im allgemeinen nicht gefährdet.<br />
2.3 Weitere Aspekte<br />
2.3.1 Innovationswirkungen <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Die Befragten berichten in zehn Fällen <strong>von</strong> vermuteten o<strong>der</strong> belegbaren Innovationswirkungen<br />
<strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>; dies reicht <strong>von</strong> Rezepturän<strong>der</strong>ungen bis hin zur Entwicklung<br />
<strong>von</strong> Substitutionsprodukten.<br />
2.3.2 Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Von weiteren Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wie z. B. einem größeren Imagegewinn<br />
o<strong>der</strong> ähnlichen Effekten wird kaum berichtet; dies habe nach Auskunft mehrerer Befragter<br />
bei <strong>der</strong> Abgabe <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> auch nicht im Vor<strong>der</strong>grund gestanden.<br />
2.3.3 Monitoring <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Es läßt sich beobachten, daß im Zeitverlauf die Anfor<strong>der</strong>ungen, die an <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
gestellt werden, insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich des Monitorings zugenommen haben. Die Kontrolle<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> war in früheren Fällen kein beson<strong>der</strong>s bedeutendes Thema;<br />
sofern überhaupt Kontroll- und Monitoringmaßnahmen vorgesehen waren, beschränkten sie<br />
sich häufig auf eine Berichterstattung durch die <strong>Verbände</strong> an die entsprechenden staatlichen<br />
Stellen bzw. die Öffentlichkeit. Neuere <strong>Selbstverpflichtungen</strong> enthalten demgegenüber oftmals<br />
ein recht detailliertes Monitoringkonzept, das auch neutrale Dritte für die Überprüfung<br />
<strong>der</strong> Vereinbarung vorsieht.<br />
2.3.4 Arbeit des Verbandes<br />
Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW), <strong>der</strong> die meisten Selbstverpflichtungserklärungen<br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie abgegeben hat, verfügt über ein stark formali-<br />
23
siertes System <strong>der</strong> Ausarbeitung und Verabschiedung <strong>der</strong>artiger Erklärungen. In den an<strong>der</strong>en<br />
Fachverbänden sowie dem VCI wird dagegen eher fallweise vorgegangen.<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> beinhalten häufig keine systematischen Umsetzungsmaßnahmen <strong>von</strong><br />
seiten des zuständigen (Fach-)Verbandes. In <strong>der</strong> Regel finden Informationsveranstaltungen<br />
statt. Zusätzlich wurden in einigen Fällen Umsetzungsleitlinien für die Unternehmen erarbeitet.<br />
Die <strong>Verbände</strong> haben hinsichtlich <strong>der</strong> Umsetzung einer Selbstverpflichtung keine direkte<br />
Durchgriffsmöglichkeit auf ihre Mitgliedsunternehmen. Die in vielen <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
verwendete Formel „... <strong>der</strong> Verband verpflichtet sich, seine Mitgliedsfirmen nachdrücklich dazu<br />
aufzufor<strong>der</strong>n...“ wurde gewählt, um klarzustellen, daß es sich um eine Verpflichtung des<br />
Verbandes, nicht <strong>der</strong> Einzelunternehmen handelt.<br />
Als formale Sanktion gegenüber Mitgliedsunternehmen, die sich nicht an die Selbstverpflichtung<br />
halten, existiert praktisch nur <strong>der</strong> Ausschluß aus dem Verband. Diese Sanktion<br />
wurde bisher in einem Falle <strong>von</strong> einem Fachverband praktiziert.<br />
Darüber hinaus gibt es prinzipiell verschiedene Möglichkeiten, Unternehmen zur Umsetzung<br />
einer Selbstverpflichtung anzuhalten, <strong>von</strong> Gesprächen mit Verbandsvertretern bis hin zur<br />
öffentlichen Nennung <strong>der</strong> Firmennamen, die eine Selbstverpflichtung nicht umsetzen.<br />
Allerdings werden auch diese Maßnahmen <strong>von</strong> den <strong>Verbände</strong>n nur selten angewendet. Dies<br />
liegt zum einen daran, daß <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Verbandsvertreter Gefahren für den verbandlichen<br />
Zusammenhalt befürchtet werden, wenn gegen einzelne Mitglie<strong>der</strong> vorgegangen werde. Zum<br />
an<strong>der</strong>en aber seien Sanktionsmaßnahmen aus zwei Gründen in <strong>der</strong> Regel nicht erfor<strong>der</strong>lich:<br />
Erstens geht nach Auskunft mehrerer Verbandsvertreter <strong>der</strong> Verabschiedung einer Selbstverpflichtung<br />
eine intensive verbandsinterne Diskussion voran; nach erfolgreichem Abschluß<br />
dieser Diskussion entstünden in <strong>der</strong> Regel kaum noch Probleme, die <strong>von</strong> einem mangelnden<br />
Umsetzungswillen o<strong>der</strong> bewußtem innerverbandlichen Trittbrettfahrer-Verhalten herrühren.<br />
Zweitens wird auf die gegenseitige Marktbeobachtung <strong>von</strong> Firmen hingewiesen, die die Einhaltung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> sicherstelle: Unternehmen achteten sehr darauf, daß ihre<br />
Konkurrenten die Selbstverpflichtung auch durchführen und sich nicht durch ein Unterlaufen<br />
einen etwaigen Kosten- o<strong>der</strong> Wettbewerbsvorteil sichern.<br />
3. Schlußfolgerungen für die weitere <strong>Evaluation</strong><br />
Die Grobevaluation hat es erlaubt, einen Überblick über die bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zu gewinnen. Hinsichtlich <strong>der</strong> Untersuchungsziele bezüglich<br />
<strong>der</strong> Effektivität und Effizienz sowie <strong>der</strong> Ableitung kritischer Faktoren konnten einige erste<br />
Hinweise erhalten werden, insgesamt war die Untersuchungsbasis aber noch zu schmal, um<br />
bereits Schlußfolgerungen ableiten zu können. Insbeson<strong>der</strong>e war es noch erfor<strong>der</strong>lich, die<br />
Aussagen <strong>der</strong> Verbandsvertreter mit den Ansichten <strong>der</strong> betroffenen Unternehmen, <strong>der</strong> Behörden<br />
und <strong>von</strong> Umweltverbänden zu kontrastieren. Aus diesem Grunde wurden in <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong> näher untersucht, da nur durch die detaillierte Betrachtung<br />
<strong>von</strong> Fallbeispielen sich nähere Schlüsse für den Einsatz und die Ausgestaltung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ziehen lassen. Dabei sollte es die vorgeschaltete Grobevaluation<br />
ermöglichen, eine Auswahl zu treffen, die das Spektrum an <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong><br />
Industrie möglichst gut wi<strong>der</strong>spiegelt.<br />
24
Bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> für die Detailevaluation erwies es sich aufgrund<br />
<strong>der</strong> Vielzahl <strong>von</strong> Erklärungen als nicht möglich, eine statistisch repräsentative Auswahl zu<br />
treffen. Jedoch sollte aus je<strong>der</strong> <strong>der</strong> drei ermittelten Gruppen (Reduktionsverpflichtungen, Informationsverpflichtungen,<br />
Verpflichtungen mit Verfahrensanweisungen) mindestens eine<br />
Selbstverpflichtung für die Detailevaluation herangezogen werden. Zusätzlich wurden einige<br />
eher pragmatische Kriterien angelegt, um zu einer Auswahl zu kommen.<br />
Aufgrund fehlen<strong>der</strong> Aktualität wurden keine <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>von</strong> vor 1990 untersucht.<br />
Eine wesentliche Ursache für die mangelnde Aktualität <strong>von</strong> älteren <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
liegt in <strong>der</strong> Tatsache, daß die an dieses Instrument gestellten Anfor<strong>der</strong>ungen im Zeitverlauf<br />
deutlich gewachsen sind. War beispielsweise in den ersten einseitigen Erklärungen <strong>der</strong><br />
Chemischen Industrie ein Monitoringsystem in den seltensten Fällen vorgesehen, gehört es<br />
heute fast zum Standard.<br />
Ferner wurden keine <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in die <strong>Evaluation</strong> einbezogen, die <strong>von</strong> einzelnen<br />
Firmen und nicht <strong>von</strong> einem (Fach-)Verband <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie abgegeben wurden.<br />
Darüber hinaus sollten nicht mehrere <strong>Selbstverpflichtungen</strong> evaluiert werden, die thematisch<br />
eng miteinan<strong>der</strong> verwandt sind bzw. dasselbe (Umwelt-)Problem zum Gegenstand haben,<br />
um das Themenfeld nicht zu eng zu fokussieren.<br />
Schließlich war es wichtig, daß <strong>von</strong> seiten des zuständigen (Fach-)Verbandes eine gewisse<br />
Bereitschaft zur Mitarbeit bei <strong>der</strong> Untersuchung signalisiert wurde, um die Erfolgswahrscheinlichkeit<br />
<strong>der</strong> Untersuchung zu vergrößern.<br />
Diese Kriterien führten zur Auswahl <strong>der</strong> folgenden vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong>:<br />
• Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen;<br />
• Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen<br />
(insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit;<br />
• Selbstverpflichtungserklärung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln (THM) nach ihrer<br />
Gewässerrelevanz;<br />
• Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und holzverfärbende<br />
Organismen.<br />
25
IV. Detailevaluation <strong>von</strong> vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
1. Vorgehensweise bei <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
In <strong>der</strong> Detailevaluation wurden betroffene Unternehmen, Vertreter <strong>von</strong> Behörden sowie Umweltverbände<br />
zu den genannten Untersuchungsaspekten befragt.<br />
Bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Befragten bestand nicht <strong>der</strong> Anspruch, die strengen Kriterien einer statistischen<br />
Repräsentativität zu erfüllen. Stattdessen ging es darum, eine Zielgruppe <strong>von</strong> sachund<br />
fachkundigen Personen auszuwählen, die es ermöglichten, ein aussagekräftiges Bild<br />
<strong>von</strong> den Wirkungen einer Selbstverpflichtung zu erarbeiten. Der Verband hat das Institut bei<br />
<strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> zu befragenden Personen, insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Unternehmen und Behördenvertreter,<br />
unterstützt.<br />
Bei <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> Umweltverbände und -institute wurde Gewicht darauf gelegt, solche Institutionen<br />
anzusprechen, die einerseits eine wichtige Rolle in <strong>der</strong> umweltpolitischen Debatte<br />
spielen, an<strong>der</strong>erseits auch inhaltlich-wissenschaftlich kompetent sind. Kontaktiert wurden <strong>der</strong><br />
Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland (BUND), <strong>der</strong> Naturschutzbund Deutschland<br />
(NABU), <strong>der</strong> World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace, das Öko-Institut und das Wuppertal-Institut.<br />
Allerdings konnte nicht mit allen <strong>Verbände</strong>n/Instituten ein Gespräch geführt<br />
werden.<br />
Das Institut für Umweltmanagement erarbeitete mit Unterstützung <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> die Gesprächsleitfäden,<br />
die den Interviews mit den betroffenen Unternehmen, Behörden und Umweltverbänden<br />
zugrundegelegt wurden.<br />
Die Gesprächsleitfäden wiesen sowohl über die verschiedenen zu befragenden Gruppen als<br />
auch über die einzelnen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> hinweg Parallelen auf. Dies diente dazu, einerseits<br />
eine gewisse Vergleichbarkeit <strong>der</strong> Ergebnisse zu gewährleisten, an<strong>der</strong>erseits die<br />
Einschätzungen <strong>von</strong> Gesprächspartnern aus verschiedenen Anspruchsgruppen zu bestimmten<br />
Fragen zu erheben. Die speziellen Fragen, die sich im Zusammenhang mit einzelnen<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> stellen, wurden aber dennoch bei <strong>der</strong> Konzeption berücksichtigt.<br />
Die Gesprächsleitfäden glie<strong>der</strong>ten sich in vier Teile:<br />
• Im ersten Teil werden einige allgemeine Fragen gestellt zur Person des/<strong>der</strong> Befragten<br />
und zu <strong>der</strong> Institution, in <strong>der</strong> er/sie arbeitet.<br />
• Der zweite Teil befaßt sich mit den Maßnahmen, die im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
durchgeführt wurden. Bei den Unternehmen stand die Frage im Vor<strong>der</strong>grund, welche konkreten<br />
betrieblichen Maßnahmen durchgeführt wurden und welche Kosten dadurch entstanden<br />
sind. Daneben wurde auch gefragt, welche Maßnahmen ohne Bestehen <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung bzw. im Falle einer an<strong>der</strong>en umweltpolitischen Maßnahme durchgeführt<br />
worden wären und welche Kosten dabei entstanden wären. Behörden und Umweltverbände<br />
wurden in diesem Zusammenhang um eine Einschätzung <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung in den Unternehmen gebeten.<br />
• Im dritten Teil des Gesprächsleitfadens ging es um das Umfeld <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Hier stand im Vor<strong>der</strong>grund, wie die Arbeit des zuständigen Verbandes und <strong>der</strong> Behörden<br />
26
ei Ausarbeitung und Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung gewertet wird, ob Zielkonflikte<br />
zwischen den Beteiligten bestanden und wie groß das Problem <strong>von</strong> Unternehmen eingeschätzt<br />
wird, die eine Selbstverpflichtung nicht umsetzen.<br />
• Der vierte Teil fragte nach einer Einschätzung des Erfolges <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Die potentiellen Gesprächspartner wurden zunächst brieflich und mit einer kurzen zweiseitigen<br />
Projektskizze über das Vorhaben informiert. Kopien <strong>der</strong> Schreiben an die Gesprächspartner<br />
gingen auch an die jeweils zuständigen Vertreter im VCI und in den Fachverbänden.<br />
Die Gespräche wurden im Rahmen eines persönlichen Besuches bei den Ansprechpartnern<br />
durchgeführt, bei denen dem Institut oft auch zusätzliche schriftliche Informationen zur Verfügung<br />
gestellt wurden. Nur in einigen wenigen Fällen wurde aus terminlichen Gründen auf<br />
Wunsch <strong>der</strong> Gesprächspartner die Befragung auf ein Telefoninterview beschränkt.<br />
Insgesamt wurden zwischen dem 27. März und dem 29. August 2000 sechzig ausführliche<br />
Gespräche geführt: 29 mit betroffenen Unternehmen, 13 mit Behörden, 8 mit Umweltverbänden/-instituten<br />
und 10 mit Kunden/-verbänden bzw. nachgelagerten Unternehmen. Hinzu<br />
kamen – im Rahmen <strong>der</strong> Untersuchung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffen – telefonische Kurzinterviews mit 13 kleinen und mittleren Unternehmen<br />
sowie mit 14 Personen in 12 Vollzugsbehörden. Eine vollständige Liste <strong>der</strong> Gesprächspartner<br />
findet sich im Anhang.<br />
Mit den befragten Unternehmen wurden die Ergebnisse <strong>der</strong> jeweiligen Untersuchung im<br />
Rahmen <strong>von</strong> Workshops diskutiert.<br />
2. Die Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
Im folgenden werden die Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation zu den vier untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
dargestellt. 2 Die Darstellung erfolgt wie<strong>der</strong>um anhand <strong>der</strong> in Abschnitt II.2.2.2<br />
genannten Aspekte. Vorgeschaltet sind jeweils einige kurze Bemerkungen zur Auswahl <strong>der</strong><br />
befragten Gesprächspartner.<br />
2.1 Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong><br />
energiebedingten CO2-Emissionen<br />
2.1.1 Auswahl <strong>der</strong> befragten Personen<br />
2.1.1.1 Unternehmen<br />
Die kontaktierten Unternehmen, die uns vom VCI genannt wurden, sind im Energieausschuß<br />
des VCI vertreten und gehören zu den größten Energieverbrauchern <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie.<br />
Sie sind daher <strong>von</strong> dieser Selbstverpflichtung in beson<strong>der</strong>em Maße betroffen.<br />
Es konnten mit sieben Unternehmen ausführliche Gespräche stattfinden. Eines <strong>der</strong> angeschriebenen<br />
Unternehmen bat darum, nicht an <strong>der</strong> Untersuchung teilzunehmen, da es zu ei-<br />
2<br />
Ein ausführlicher Bericht über die Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation kann beim Institut für Umweltmanagement<br />
bezogen werden.<br />
27
nem größeren Konzern gehöre, in dem die energiewirtschaftlichen Entscheidungen fallen.<br />
Ein weiteres Unternehmen bat aus Kapazitätsgründen darum, ein ausführliches Interview<br />
erst gegen Jahresende durchzuführen, weshalb es bei <strong>der</strong> Untersuchung nicht mehr berücksichtigt<br />
werden konnte.<br />
2.1.1.2 Auswahl <strong>der</strong> Behörden<br />
Das Bundesumweltministerium (BMU) und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) waren<br />
auf staatlicher Seite die Verhandlungspartner für die Selbstverpflichtung <strong>der</strong> deutschen Industrie<br />
zur Reduktion <strong>der</strong> CO2-Emissionen, die vom Bundesverband <strong>der</strong> Deutschen Industrie<br />
getragen wird. Diese beiden Behörden führen auch jährliche Gespräche mit den einzelnen<br />
Industrieverbänden über den Fortgang <strong>der</strong> Selbstverpflichtung. Das Umweltbundesamt<br />
(UBA) war an den Verhandlungen ebenfalls beteiligt, wenn auch nicht fe<strong>der</strong>führend.<br />
2.1.1.3 Auswahl <strong>der</strong> Umweltverbände<br />
Hier wurden <strong>der</strong> BUND, <strong>der</strong> NABU, das Öko-Institut und das Wuppertal-Institut angesprochen.<br />
Mit den Umweltverbänden und -instituten konnten insgesamt drei Gespräche geführt<br />
werden. Ein Verband sagte die Teilnahme an <strong>der</strong> Untersuchung aus Gründen fehlen<strong>der</strong> Kapazitäten<br />
ab.<br />
2.1.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
2.1.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Träger <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ist <strong>der</strong> VCI. Die Erklärung ist eingebettet in die Selbstverpflichtung<br />
zum Klimaschutz des Bundesverbandes <strong>der</strong> Deutschen Industrie (BDI). Sie wurde<br />
am 21.02.1996 abgegeben. Die darin enthaltenen Ziele sollen bis 2005 erreicht sein.<br />
Die chemische Industrie hat sich zum Ziel gesetzt, den spezifischen Energieverbrauch (bezogen<br />
auf den Index <strong>der</strong> Nettoproduktion) bis 2005 gegenüber dem Jahr 1990 um über 30 %<br />
zu verringern. Die absoluten energiebedingten CO2-Emissionen sollen bis zum Jahr 2005<br />
(gegenüber 1990) ebenfalls um über 30 % gesenkt werden. Dies entspricht einer Min<strong>der</strong>ung<br />
<strong>von</strong> 23,8 Mio. t. Dabei werden einige Voraussetzungen genannt, wie z. B. keine zusätzlichen<br />
ordnungsrechtlichen und fiskalischen Belastungen <strong>von</strong> seiten des Staates.<br />
Diese Selbstverpflichtung wird in Kürze abgelöst durch eine neue Erklärung, in <strong>der</strong> sich die<br />
chemische Industrie verpflichtet, bis 2012 die Emissionen <strong>der</strong> im Kyoto-Protokoll enthaltenen<br />
klimarelevanten Treibhausgase absolut um 45-50 % (gegenüber 1990) zu senken. Dies entspricht<br />
einer Reduktion <strong>von</strong> 91,2 Mio. t CO2-Äquivalenten im Jahre 1990 auf 50 bis 46 Mio. t<br />
CO2-Äquivalente im Jahre 2012. Diese neue Erklärung ist für den Verband ein Zeichen dafür,<br />
daß mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ein dynamischer Prozeß in Gang gesetzt worden sei, dessen<br />
Ziele fortlaufend angepaßt würden. Allerdings konnte diese neue Verpflichtung bei <strong>der</strong> Untersuchung<br />
noch nicht berücksichtigt werden.<br />
28
) Zielerreichung<br />
Das in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung festgelegte Ziel, die energiebedingten CO2-Emissionen bis<br />
2005 gegenüber 1990 um 30 % zu senken, ist nach den Zahlen des neuesten Monitoring-<br />
Berichts bereits im Jahre 2000 erreicht worden. Dabei summieren sich die CO2-Reduktionen<br />
<strong>der</strong> befragten Unternehmen auf 10,3 Mio. t, das sind gut 43 % <strong>der</strong> insgesamt <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong><br />
Industrie zugesagten Reduktion. Einige Maßnahmen wurden auch schon vor Abschluß<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführt: so wurde etwa <strong>von</strong> einem Unternehmen <strong>der</strong><br />
Bau einer Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage), <strong>der</strong>en Betrieb zu einer CO2-<br />
Reduktion um rund eine Mio. t pro Jahr führt, knapp zwei Jahre vor Abgabe <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
begonnen. Dies zeigt nach Auffassung eines Verbandsvertreters, daß <strong>von</strong> seiten<br />
<strong>der</strong> Industrie auch ohne eine Selbstverpflichtung im Rahmen des Responsible-Care-<br />
Programms Anstrengungen zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung durchgeführt<br />
würden. Die Selbstverpflichtung habe auch den Zweck verfolgt, die durchgeführten Maßnahmen<br />
nach außen zu kommunizieren.<br />
c) Vergleich mit Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
Ob die Erreichung des festgesetzten Zieles ausreicht, um <strong>der</strong> Selbstverpflichtung auch<br />
schon eine ökologische Effektivität zu bescheinigen, wird <strong>von</strong> den Befragten unterschiedlich<br />
beurteilt. Unternehmen und Behörden bejahen diese Frage; die Befragten in den Umweltverbänden<br />
sind hier skeptischer, da für sie die Reduktion im wesentlichen das Ergebnis des allgemeinen<br />
Strukturwandels (und des Zusammenbruchs <strong>der</strong> DDR-Wirtschaft) ist und weniger<br />
auf die Selbstverpflichtung zurückgeführt werden könne. Ein Unternehmensvertreter weist in<br />
diesem Zusammenhang darauf hin, daß zugleich auch durch Investitionen in energieeffizientere<br />
Produktionsanlagen für den Neuaufbau in den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n gesorgt worden<br />
sei.<br />
Für die Umweltverbände gehört zur ökologischen Effektivität auch <strong>der</strong> Nachweis, daß und<br />
wie sich durch die Selbstverpflichtung die Investitionsentscheidungen <strong>von</strong> Unternehmen in<br />
Richtung einer stärkeren Berücksichtigung <strong>von</strong> Fragen des Klimaschutzes und <strong>der</strong> CO2-<br />
Reduktion verän<strong>der</strong>t haben. Nur so könne <strong>der</strong> Verzicht auf an<strong>der</strong>e umweltpolitische Instrumente<br />
gerechtfertigt werden. Durch das bestehende Monitoring und die Dokumentation werde<br />
das aber nicht hinreichend transparent.<br />
Auf die Frage, ob die genannten Maßnahmen auch ohne Selbstverpflichtung durchgeführt<br />
worden wären, antwortet ein Unternehmen mit Nein. Zwar standen auch in diesem Unternehmen<br />
entsprechende (Re-)Investitionen an, aber es hätten anstelle <strong>der</strong> im Lichte <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung gewählten Technik auch gleichpreisige Alternativen zur Verfügung gestanden,<br />
die durchaus (auch aufgrund <strong>der</strong> Liberalisierung <strong>der</strong> Energiemärkte) überlegenswert<br />
gewesen wären. Neben <strong>der</strong> Selbstverpflichtung haben dabei auch noch an<strong>der</strong>e Argumente<br />
eine Rolle gespielt, wie z. B. Fragen <strong>der</strong> Standards hinsichtlich <strong>der</strong> „best available<br />
technologies“.<br />
Drei Unternehmen geben sich in bezug auf diese Frage unentschieden: Ein Unternehmen<br />
führt an, daß die Projekte zwar grundsätzlich ausgeführt worden wären, sie aber in ihrer konkreten<br />
Ausgestaltung etwas an<strong>der</strong>s ausgefallen wären, wenn es die Selbstverpflichtung nicht<br />
gegeben hätte. Durch die Selbstverpflichtung wurde hier ein größeres Augenmerk auf Fra-<br />
29
gen des Umweltschutzes und des energetischen Wirkungsgrades gelegt. Dieses Unternehmen<br />
führt als eine <strong>von</strong> mehreren zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
den Bau einer Restwasserturbine an, die ohne die Selbstverpflichtung nicht durchgeführt<br />
worden wäre; dabei würden nur aufgrund <strong>der</strong> Einspeisevergütung die Erträge in etwa<br />
den Aufwänden entsprechen. Ein weiteres Unternehmen führt an, daß manche Maßnahmen<br />
auch ohne die Selbstverpflichtung durchgeführt worden wären (so etwa die Erstellung einer<br />
Anlage zur Kraft-Wärme-Kopplung – KWK), an<strong>der</strong>e aber nicht (z. B. die Umstellung des Primärenergieträgers<br />
<strong>von</strong> Öl auf Gas). Als zusätzliche Maßnahmen nennt dieses Unternehmen<br />
die Erweiterung des Berichtskreises im Umweltbericht, so daß jetzt die CO2-Emissionen konzernweit<br />
erfaßt würden. Ein drittes Unternehmen führt an, daß seine Investitionen zwar alle<br />
einen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt hätten, aber ohne die Selbstverpflichtung einige<br />
da<strong>von</strong> „auf <strong>der</strong> Kippe“ gestanden hätten; die Selbstverpflichtung war hier ein zusätzliches<br />
Argument für die Durchführung des Projektes. Als zusätzliche Maßnahme führt dieses Unternehmen<br />
darüber hinaus die Einbettung <strong>der</strong> CO2-Reduktion in das Responsible-Care-<br />
Programm des Unternehmens ein.<br />
Drei Unternehmen geben an, daß sie die genannten Maßnahmen auch ohne Bestehen <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung durchgeführt hätten. Diese Unternehmen wurden durch die Selbstverpflichtung<br />
nach eigener Aussage auch nicht zu zusätzlichen Maßnahmen angeregt. Die Reduktionen<br />
dieser Unternehmen belaufen sich auf insgesamt 6,17 Mio. t CO2/a, das sind<br />
knapp 60 % <strong>der</strong> gesamten CO2-Reduktionen aller befragten Unternehmen und knapp 26 %<br />
<strong>der</strong> gesamten <strong>von</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zugesagten Reduktionen.<br />
Sowohl aus den Aussagen <strong>von</strong> einigen Unternehmen als auch aus den Aussagen <strong>der</strong> Umweltverbände/-institute<br />
kann geschlossen werden, daß eine Hauptwirkung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
in zahlreichen, für sich genommen eher kleinen, Verbesserungen und organisatorischen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen zu sehen ist, die ebenfalls zu Verringerungen des Energieverbrauchs<br />
und <strong>der</strong> CO2-Emissionen führten, im einzelnen in ihrer Reduktionswirkung nur<br />
schwer zu quantifizieren sind, aber insgesamt betrachtet durchaus bedeutsam sein können:<br />
die Entwicklung eines größeren Bewußtseins in den Unternehmen für Fragen <strong>der</strong> Energieverwendung;<br />
<strong>der</strong> Aufbau neuer Kommunikationswege innerhalb <strong>von</strong> Unternehmen zu Fragen<br />
des Energiemanagements; die Entwicklung entsprechen<strong>der</strong> Umwelt- und Energiemanagementsysteme,<br />
usw. Dies zeigt nach Auffassung sowohl eines <strong>der</strong> Unternehmensvertreter als<br />
auch eines <strong>der</strong> befragten Behördenvertreter, daß die Selbstverpflichtung durchaus über<br />
„business as usual“ hinausgegangen sei.<br />
d) Vergleich mit möglichen Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Umweltpolitische Maßnahmen wie die Wärmenutzungsverordnung o<strong>der</strong> eine striktere Öko-<br />
Steuer wurden durch die Politik nicht eingeführt. Zwar kann – auch <strong>von</strong> den Befragten – nicht<br />
eindeutig gesagt werden, in welchem Umfang die Selbstverpflichtung kausal dafür war, daß<br />
diese Regelungen nicht bzw. nicht in einem größeren Ausmaß eingeführt worden sind, eine<br />
gewisse Rolle hat die Selbstverpflichtung aber sicher gespielt.<br />
Offen muß an dieser Stelle allerdings bleiben, welchen CO2-Reduktionseffekt diese umweltpolitischen<br />
Maßnahmen gehabt hätten. We<strong>der</strong> die Behörden noch die Unternehmen vermögen<br />
die Reduktionswirkungen alternativer Instrumente anzugeben. Genauere Angaben können<br />
die Unternehmen zu den wirtschaftlichen Belastungen einer Öko-Steuer machen; in ei-<br />
30
nem Unternehmen wurden auch detaillierte Berechnungen angestellt, um die Belastungen<br />
durch die verschiedenen diskutierten Öko-Steuer-Modelle zu quantifizieren. Dabei bleibt aber<br />
noch unklar, ob die Unternehmen tatsächlich in nennenswertem Umfang mit Produktionsverlagerungen<br />
reagiert hätten, wie es <strong>von</strong> einigen angegeben wird, was wie<strong>der</strong>um die Abschätzung<br />
des Reduktionseffektes erschwert.<br />
2.1.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Die Maßnahmen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung waren für die beteiligten Unternehmen<br />
insgesamt wirtschaftlich rentabel, dies wird auch <strong>von</strong> allen Gesprächspartnern so gesehen.<br />
Da<strong>von</strong> bleibt unberührt, daß es sich bei den durchgeführten Maßnahmen oft um große Investitionen<br />
handelt, <strong>der</strong>en Rentabilität sich immer auch im internationalen Standortvergleich<br />
behaupten muß. Des weiteren hängt die Rentabilität auch <strong>von</strong> <strong>der</strong> Energiepreisentwicklung<br />
ab, über die ex ante nur begründete Vermutungen angestellt werden können; daher ist eine<br />
<strong>der</strong>artige Investition immer auch mit einem unternehmerischen Risiko behaftet. Ein Unternehmensvertreter<br />
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die Selbstverpflichtung es<br />
erlaubt habe, die getroffenen Maßnahmen in den normalen Investitionszyklus <strong>der</strong> Unternehmen<br />
zu integrieren.<br />
In den Fällen, in denen sich die Maßnahmen wirtschaftlich nicht rentiert haben, waren sie<br />
meist aufgrund behördlicher Emissionsauflagen erfor<strong>der</strong>lich. Ein Beispiel dafür ist etwa <strong>der</strong><br />
mehrfach genannte Wechsel des Primärenergieträgers <strong>von</strong> Kohle/Öl auf Gas, <strong>der</strong> durch behördliche<br />
Auflagen zur Luftreinhaltung ausgelöst wurde.<br />
In einigen Fällen haben Unternehmen da<strong>von</strong> berichtet, daß aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
für entsprechende Investitionsprojekte längere Pay-back-Perioden akzeptiert werden als sie<br />
sonst in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie üblich sind. Damit wurden zusätzliche Projekte erst möglich,<br />
die ohne die Selbstverpflichtung nicht angestoßen worden wären. Bei den befragten<br />
Unternehmen konnten drei <strong>von</strong> verlängerten Pay-back-Perioden berichten. Dabei wird dieser<br />
Effekt in einem Falle mit einem größeren Projekt in Verbindung gebracht, in den an<strong>der</strong>en<br />
Fällen geht es um kleinere Projekte.<br />
Daß die Wärmenutzungsverordnung sowie eine (striktere) Öko-Steuer nicht zustandegekommen<br />
sind, hat für die Unternehmen zweifellos eine Abwendung <strong>von</strong> wirtschaftlichen Belastungen<br />
bedeutet. Soweit den Unternehmen zusätzliche Belastungen durch die Selbstverpflichtung<br />
(nicht <strong>der</strong> Umsetzungsmaßnahmen) entstanden sind, sind diese im wesentlichen<br />
auf die Notwendigkeit <strong>der</strong> Berichterstattung im Rahmen des Monitorings zurückzuführen.<br />
b) Marktstruktur<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Erreichung des Zieles <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ist hier eine Beson<strong>der</strong>heit <strong>der</strong><br />
<strong>chemischen</strong> Industrie und ihrer Struktur wichtig: Die Befragten gehen mehrheitlich da<strong>von</strong><br />
aus, daß die Selbstverpflichtung im wesentlichen <strong>von</strong> den Unternehmen erfüllt wird und erfüllt<br />
werden muß, die im Energieausschuß des VCI zusammengeschlossen sind. Diese machen<br />
den Hauptanteil des Energieverbrauchs in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie aus (ca. 65 %).<br />
31
Mehrere Befragte nehmen an, daß mittlere und kleine Unternehmen zur Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung wenig beitragen. Dies wird allerdings für die Zielerreichung auch als nicht<br />
wesentlich angesehen. Hier ist entscheidend, daß die Selbstverpflichtung nicht einzelne Unternehmen<br />
bindet, son<strong>der</strong>n die Branche insgesamt. Die Unternehmen im Energieausschuß<br />
des VCI gelten dabei als die Hauptverantwortlichen für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
2.1.2.3 Weitere Aspekte<br />
a) Innovationswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Vier <strong>der</strong> befragten Unternehmen konstatieren Innovationen im Zusammenhang mit <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung. Zwei dieser Unternehmen berichten <strong>von</strong> Innovationen in technischen<br />
Verfahren; ein weiteres Unternehmen nennt den Einsatz <strong>der</strong> GuD-Technik bei <strong>der</strong> Energieerzeugung<br />
als Innovation (ein an<strong>der</strong>es Unternehmen, das ebenfalls eine GuD-Anlage in Betrieb<br />
genommen hat, sieht dies jedoch nicht als Innovation an). Darüber hinaus wird <strong>von</strong> einem<br />
weiteren Unternehmen die Entwicklung eines Energiemanagementsystems als Innovation<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung gesehen.<br />
Die Befragten in den Behörden gehen da<strong>von</strong> aus, daß es im Zuge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
auch zu Innovationen gekommen ist, wenngleich sie nicht sicher angeben können, welcher<br />
Art sie sind (ein Befragter spricht <strong>von</strong> Verfahrensinnovationen).<br />
Nach Ansicht eines <strong>der</strong> Befragten in den Umweltverbänden/-instituten för<strong>der</strong>t die Selbstverpflichtung<br />
keine Innovationen. Wenn es überhaupt zu Innovationen gekommen sei, dann nur<br />
in eingeschränktem Maße. Dabei wird nicht bestritten, daß es „Begleiteffekte“ im Sinne <strong>von</strong><br />
verstärkten Diskussionen und entsprechendem Bewußtsein in den Unternehmen gebe, die<br />
aber <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wirkung her als nicht son<strong>der</strong>lich wesentlich angesehen werden.<br />
Auch die beiden an<strong>der</strong>en Befragten in den Umweltverbänden/-instituten gehen da<strong>von</strong> aus,<br />
daß es keine technischen Innovationen durch die Selbstverpflichtung gab, dafür aber soziale<br />
Innovationen: in den Unternehmen entstanden neue Kommunikationswege für Fragen <strong>der</strong><br />
Energiewirtschaft, und energiebezogene Investitionen wurden genauer analysiert.<br />
b) Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Sechs Unternehmen berichten <strong>von</strong> Imageeffekten, die durch die Selbstverpflichtung entstanden<br />
sind; dies reicht <strong>von</strong> positiver Resonanz in <strong>der</strong> Region bis zu positiven Berichten in den<br />
Medien. Ebenfalls nennen sechs Unternehmen verbesserte Behördenkontakte aufgrund <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung, was sich etwa in kürzeren Genehmigungsfristen für neue Anlagen ausdrückt;<br />
allerdings wird dies nicht immer ausschließlich auf die Selbstverpflichtung zurückgeführt.<br />
Alle Befragten in den Behörden merken als positiv an, daß es im Zuge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
zu besseren Kontakten zu Unternehmen und <strong>Verbände</strong>n gekommen sei.<br />
Einer <strong>der</strong> Befragten in den Umweltverbänden/-instituten sagt, daß die Selbstverpflichtung<br />
prinzipiell ein sinnvolles Instrument sein könnte, um ein neues Rollenverständnis zwischen<br />
Staat und Industrie zu schaffen. Die Selbstverpflichtung würde die Möglichkeit bieten, einen<br />
32
Lernprozeß sowie neues Wissen zu generieren. Diesbezüglich gebe es aber in Deutschland<br />
einen Mangel, das Instrument werde nicht für solche Prozesse genutzt.<br />
c) Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Das Monitoring erfolgt über das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung<br />
(RWI). Es beinhaltet: den Verbrauch fossiler Energieträger zur Energiebereitstellung und<br />
Fremdstrom, wobei Daten des Statistischen Bundesamtes genutzt werden; den spezifischen<br />
Energieverbrauch mit Hilfe des Nettoproduktionsindex; die energiebedingten CO2-<br />
Emissionen, ermittelt aus dem Verbrauch fossiler Energieträger zur Energiebereitstellung;<br />
den Primärchemikalienverbrauch anhand <strong>von</strong> Daten des VCI; schließlich die Dokumentation<br />
energiesparen<strong>der</strong> Maßnahmen anhand <strong>von</strong> Beispielen.<br />
Die Dokumentation im Rahmen des Monitorings wird noch als stark verbesserungswürdig<br />
angesehen, sowohl vom Verband selbst als auch <strong>von</strong> Behörden und Umweltverbänden. Gegenwärtig<br />
kann <strong>der</strong> Verband ca. 40 % <strong>der</strong> statistisch ausgewiesenen CO2-Reduktionen mit<br />
konkreten Maßnahmen belegen und plausibilisieren. In diesem Zusammenhang wird insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>von</strong> Umweltverbänden eine größere Transparenz gefor<strong>der</strong>t, um erkennen zu können,<br />
wie sich die Aktivitäten <strong>von</strong> Unternehmen hinsichtlich des Klimaschutzes und <strong>der</strong> Reduktion<br />
<strong>von</strong> CO2 aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung verän<strong>der</strong>t haben. Dies ist für diese Gruppen<br />
vor allem dann <strong>von</strong> Bedeutung, wenn zugleich aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung auf an<strong>der</strong>e<br />
umweltpolitische Instrumente verzichtet werden soll.<br />
Verstärkte Anstrengungen in <strong>der</strong> Dokumentation zeigen allerdings auch zwei Probleme: Zum<br />
einen verlangt eine detailliertere Dokumentation sowohl bei den Unternehmen als auch beim<br />
Verband vermutlich die Bereitstellung größerer Kapazitäten als bisher, was zugleich auch die<br />
als gering eingestuften administrativen Belastungen im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
vergrößern könnte. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite sehen Firmen auch ihre Geschäftsgeheimnisse<br />
gefährdet, wenn in vermehrtem Umfang über Maßnahmen im Rahmen <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung berichtet wird.<br />
d) Arbeit des Verbandes<br />
Probleme in <strong>der</strong> Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Verband sind bei dieser<br />
Selbstverpflichtung nicht eingetreten. Dies ist – ähnlich wie im Falle <strong>der</strong> Marktstruktur – darin<br />
begründet, daß die Unternehmen, die vornehmlich zur Erfüllung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung beitragen,<br />
zugleich auch sehr stark in <strong>der</strong> Verbandsarbeit eingebunden sind und die Ausgestaltung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung <strong>von</strong> Anfang an stark mitbestimmt haben. Bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung hat zusätzlich <strong>der</strong> Verband <strong>der</strong> industriellen Energie- und Kraftwirtschaft<br />
e.V. (VIK) Hilfestellung geleistet.<br />
Gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen ist die Selbstverpflichtung in geringerem<br />
Ausmaß kommuniziert worden. Hier gab es einzelne Workshops und Seminare, die jedoch<br />
nicht in einen kontinuierlichen Prozeß eingebunden worden sind.<br />
Gerade dies wird aber insbeson<strong>der</strong>e <strong>von</strong> Umweltverbänden und -instituten für notwendig gehalten,<br />
wenn die Selbstverpflichtung weiterhin ein Bestandteil <strong>der</strong> Klimapolitik bleiben soll.<br />
Der Verband, so <strong>der</strong> Vorwurf, habe die Möglichkeiten zum Wissenstransfer und zur Initiierung<br />
eines Lernprozesses, wie sie in einer Selbstverpflichtung angelegt seien, nicht ausrei-<br />
33
chend genutzt; dadurch seien bestehende Potentiale, wie z. B. Reduktionsmöglichkeiten<br />
durch die Optimierung <strong>von</strong> technischen Verfahren, nicht ausgeschöpft worden.<br />
2.2 Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
2.2.1 Auswahl <strong>der</strong> befragten Personen<br />
2.2.1.1 Unternehmen<br />
Bei den befragten Unternehmen sind zwei Gruppen zu unterscheiden. Zunächst wurden<br />
ausführliche Gespräche mit acht Unternehmen geführt, denen <strong>der</strong> in Abschnitt IV.1 genannte<br />
Gesprächsleitfaden zugrunde lag. Die zu kontaktierenden Firmen und Behörden wurden dem<br />
Institut vom VCI zur Verfügung gestellt. Das Firmensample zeigt, daß bei <strong>der</strong> Befragung zunächst<br />
vor allem Großunternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie im Vor<strong>der</strong>grund standen, die<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Stoffmenge her den größten Teil <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ausmachen. Es wurden<br />
aber auch kleinere und mittelständische Firmen berücksichtigt.<br />
Diese ausführlichen Interviews wurden durch weitere Gespräche mit kleinen und mittleren<br />
Unternehmen ergänzt. Diesen Gesprächen lag ein stark verkürzter Gesprächsleitfaden zugrunde.<br />
Gefragt wurde in diesen Gesprächen danach, ob die Selbstverpflichtung im Unternehmen<br />
bekannt ist und umgesetzt wird, auf welche Weise die Umsetzung geschieht und<br />
wie die Selbstverpflichtung sowie die diesbezügliche Arbeit des VCI eingeschätzt wird. Für<br />
die Gespräche wurde dem Institut vom VCI eine Liste mit 20 Unternehmensadressen zur<br />
Verfügung gestellt. Aus diesen Adressen wählte das Institut per Zufall 13 Unternehmen aus,<br />
die anschließend brieflich kontaktiert wurden. Die Gespräche erfolgten dann im Rahmen <strong>von</strong><br />
Telefon-Interviews.<br />
2.2.1.2 Behörden<br />
Bei <strong>der</strong> Befragung <strong>der</strong> Behörden sind ebenfalls zwei Gruppen zu unterscheiden. Zunächst<br />
wurden die Behörden kontaktiert, die größtenteils vom VCI als Ansprechpartner genannt<br />
wurden. Allerdings wollten einige Behörden sich an <strong>der</strong> Untersuchung nicht beteiligen. Angeführt<br />
wurden hierfür z.T. Zeitmangel, z.T. aber fühlten sich die genannten Personen für die<br />
Selbstverpflichtung nicht zuständig o<strong>der</strong> nicht ausreichend kompetent. Das Institut wurde in<br />
diesem Zusammenhang auch auf an<strong>der</strong>e Gesprächspartner in <strong>der</strong>selben Behörde verwiesen,<br />
allerdings oft mit dem gleichen Ergebnis. Insgesamt konnten nur drei ausführliche Gespräche<br />
mit Behördenvertretern stattfinden.<br />
Zusätzlich wurden kurze Gespräche mit Vollzugsbehörden (Gewerbeaufsichtsämter, Umweltämter<br />
etc.) geführt. Bei dieser Befragung sollte geklärt werden, ob diesen Behörden die<br />
Selbstverpflichtung bekannt ist, die dabei erhobenen Daten bereits <strong>von</strong> den Behörden genutzt<br />
worden sind und wie die Selbstverpflichtung <strong>von</strong> den Vollzugsbehörden eingeschätzt<br />
wird. Die Vollzugsbehörden bzw. die dortigen Ansprechpartner wurden im Rahmen <strong>der</strong> Telefoninterviews<br />
mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen erfragt.<br />
34
2.2.1.3 Umweltverbände und -institute<br />
Hier wurden <strong>der</strong> BUND, <strong>der</strong> NABU, Greenpeace, <strong>der</strong> WWF, das Öko-Institut und das Wuppertal-Institut<br />
angesprochen. Allerdings konnten nur drei Gespräche geführt werden. Ein Ansprechpartner<br />
fühlte sich für diese Selbstverpflichtung nicht kompetent, zwei <strong>Verbände</strong> baten<br />
darum, aus Gründen fehlen<strong>der</strong> Kapazitäten bzw. aus Zeitmangel nicht teilzunehmen.<br />
2.2.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
2.2.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Träger <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ist <strong>der</strong> VCI. Die Verpflichtung wurde am 23.09.1997 abgegeben.<br />
Ihre Ziele sollen nach ca. fünf Jahren erreicht sein. Es handelt sich um eine einseitige<br />
Zusage <strong>der</strong> Industrie.<br />
Der VCI verpflichtet sich, darauf hinzuwirken, daß die Mitgliedsfirmen verschiedene Schritte<br />
unternehmen, um Informationen über die in einem Unternehmen gehandhabten Stoffe zur<br />
Verfügung zu haben. Die in einem Unternehmen gehandhabten Stoffe (dazu gehören alle<br />
hergestellten, zugekauften sowie betriebsinternen Stoffe, einschließlich <strong>der</strong> isolierfähigen<br />
Zwischenprodukte) sollen intern erfaßt und dokumentiert werden. Die Erfassung soll sich dabei<br />
auf Stoffe mit einer Menge <strong>von</strong> mehr als 1 Tonne/Jahr beziehen.<br />
Die für die Sicherheit und den Umweltschutz relevanten Daten sollen zusammengetragen<br />
und gegebenenfalls durch Analogiebetrachtungen und weitere Prüfungen ergänzt werden.<br />
Aussagen sollten vorliegen zu: physikalisch-chemische Grunddaten (Wasserlöslichkeit,<br />
Dampfdruck), akute Toxizität (LD50), akute aquatische Toxizität, biologische Abbaubarkeit,<br />
gegebenenfalls auch weitere Parameter (krebserzeugende o<strong>der</strong> erbgutverän<strong>der</strong>nde Eigenschaften).<br />
Außerdem sollen organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die sicherstellen,<br />
daß die Unternehmen bei Bedarf zu den gehandhabten Stoffen aussagefähig sind. Darüber<br />
hinaus gehört es zur Selbstverpflichtung, daß die Behörden auf die Daten <strong>der</strong> Unternehmen<br />
zugreifen können.<br />
Der VCI hat als Hilfestellung für die Firmen eine Umsetzungsleitlinie erarbeitet, die den Unternehmen<br />
Hinweise für die Erarbeitung <strong>der</strong> Datensätze und die Herstellung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
geben soll. Diese Leitlinie wurde auch an alle Unternehmen versandt.<br />
Zur Umsetzung wurden vom VCI alle Mitgliedsfirmen angeschrieben. Im Rahmen <strong>der</strong> Berichterstattung<br />
zu Responsible Care werden die Firmen über die Fortschritte bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung befragt.<br />
b) Zielerreichung<br />
Aussagen zur Zielerreichung sind im Falle dieser Selbstverpflichtung schwierig, da sie mehrere<br />
Ziele verfolgt, die auf verschiedenen Ebenen liegen. Auf einer obersten Ebene ist das<br />
Ziel des verantwortlichen Umgangs mit Stoffen zu sehen, wie es im Responsible-Care-<br />
Programm <strong>der</strong> Chemischen Industrie nie<strong>der</strong>gelegt ist und als dessen Bestandteil die Selbstverpflichtung<br />
zu sehen ist. Auf einer zweiten Ebene ist das Ziel <strong>der</strong> Aussagefähigkeit ange-<br />
35
siedelt: Firmen sollen zu bestimmten Fragen bei einem Störfall gewisse Mindestaussagen<br />
treffen können. Auf <strong>der</strong> dritten Ebene liegt das Ziel <strong>der</strong> Erarbeitung eines Mindestdatensatzes,<br />
<strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um die Basis <strong>der</strong> Aussagefähigkeit darstellen soll.<br />
In den meisten befragten Unternehmen ist die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung noch nicht<br />
abgeschlossen. Dennoch ist in den großen Firmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie nach Einschätzung<br />
<strong>der</strong> Befragten gewährleistet, daß die Erarbeitung des Datensatzes sowie die Herstellung<br />
<strong>der</strong> Aussagefähigkeit zum vorgesehenen Zeitpunkt erreicht wird. Größere Firmen gehen<br />
oft noch über die Anfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung hinaus, indem sie zusätzliche Daten<br />
erheben und die gewonnenen Informationen in Form <strong>von</strong> Stoffdossiers aufbereiten, die bei<br />
einem Störfall unmittelbar für die Information <strong>der</strong> Öffentlichkeit verwendet werden können.<br />
Dagegen herrscht insbeson<strong>der</strong>e in kleineren und mittleren Unternehmen Unsicherheit über<br />
den notwendigen Umfang <strong>der</strong> zu leistenden Arbeiten. Hier wird auch des öfteren die mangelnde<br />
Hilfestellung <strong>von</strong> seiten des Verbandes gerügt. Daran zeigt sich, daß im Verband und<br />
bei den Unternehmen z. T. unterschiedliche Vorstellungen über das Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
bestehen: Der Verband versteht die Selbstverpflichtung in erster Linie als Anregung für<br />
die Firmen, für sich selbst ein passendes System zur Herstellung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit zu<br />
erarbeiten; dagegen wird die Selbstverpflichtung <strong>von</strong> vielen Firmen als Auffor<strong>der</strong>ung angesehen,<br />
ein (eher formales) Stoffdatenprogramm abzuarbeiten. Dabei bleibt aber unberücksichtigt,<br />
daß über den Mindestdatensatz hinaus auch eine Beurteilung und Einschätzung <strong>der</strong><br />
Stoffe erfolgen muß, die es erlaubt, nach außen hin gültige und informative Aussagen treffen<br />
zu können. Lediglich zwei Unternehmen, die selbst schon Störfallerfahrungen gemacht haben,<br />
berichten, daß <strong>der</strong> Mindestdatensatz allein dafür nicht ausreiche, son<strong>der</strong>n durch entsprechende<br />
Beurteilungen ergänzt werden müsse, die im Bedarfsfall nach außen gegeben<br />
werden könnten.<br />
Manche kleinere und mittlere Unternehmen fühlen sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung überhaupt<br />
nicht betroffen; begründet wird das damit, daß sie Rühr- und Mischbetriebe seien, in<br />
denen keine <strong>chemischen</strong> Umwandlungen stattfänden. Diese Unternehmen beziehen die<br />
Selbstverpflichtung ausschließlich auf Zwischenprodukte, die bisher noch nirgends erfaßt<br />
seien, aber in ihren Betrieben nicht anfallen würden. Zwar gibt es auch in diesen Firmen<br />
Stoffinformationssysteme o<strong>der</strong> Sicherheitsdatenblätter, jedoch kein systematisches Programm<br />
zur Vervollständigung <strong>von</strong> Datensätzen.<br />
Zwar sehen eigentlich alle befragten Unternehmen die Selbstverpflichtung als sinnvoll an<br />
(und beurteilen ihre eigene Aussagefähigkeit insgesamt als recht gut), insbeson<strong>der</strong>e in kleineren<br />
Unternehmen wird jedoch zugleich auf die Schwierigkeiten <strong>der</strong> Umsetzung hingewiesen.<br />
Bereits die Erarbeitung des Mindestdatensatzes stellt kleinere und mittlere Unternehmen<br />
nach eigenen Aussagen oftmals vor Probleme, die u.a. auf Schwierigkeiten bei <strong>der</strong> Datenerhebung<br />
(Erfor<strong>der</strong>nis <strong>von</strong> Tests, unzureichende Daten <strong>von</strong> Vorlieferanten) und auf fehlende<br />
Umsetzungskapazitäten zurückgeführt werden.<br />
Die Einschätzung bei den befragten Behörden ist zwiespältig. Während die Vertreter einer<br />
Bundesbehörde und einer Landesbehörde abwartend positiv eingestellt sind, war in einem<br />
Gespräch mit dem Vertreter einer an<strong>der</strong>en Bundesbehörde eine starke Ablehnung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung festzustellen. Bei dieser Ablehnung spielen die Inhalte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
eine zentrale Rolle: <strong>der</strong> Datensatz wird als unzureichend angesehen und die erho-<br />
36
enen Daten seien aufgrund <strong>der</strong> Erhebungsmethoden nicht wirklich valide. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
wird <strong>von</strong> diesem Befragten <strong>der</strong> Rückgriff auf Analogiebetrachtungen und die Auswertungen<br />
früherer Erfahrungen, wie sie in <strong>der</strong> Umsetzungsleitlinie zur Selbstverpflichtung angeführt<br />
werden, kritisch beurteilt; dies würde darauf hinauslaufen, daß die Firmen sich auf die Aussage<br />
zurückzögen, daß mit den entsprechenden Stoffen schon seit langem umgegangen<br />
würde und keine Probleme o<strong>der</strong> Krankheiten aufgetreten seien. Demgegenüber könnten nur<br />
mit naturwissenschaftlichen Prüfmethoden objektivierbare Daten gewonnen werden. Dementsprechend<br />
wird auch die Aussagefähigkeit <strong>der</strong> Unternehmen sehr viel skeptischer beurteilt<br />
als es in <strong>der</strong> Selbsteinschätzung <strong>der</strong> meisten Unternehmen zum Ausdruck kommt.<br />
Was die Rolle <strong>der</strong> Vollzugsbehörden angeht, vertritt <strong>der</strong> VCI den Standpunkt, diese Behörden<br />
sollten die Daten nutzen, die im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung erarbeitet werden. Bei<br />
entsprechend positiven Reaktionen <strong>der</strong> Vollzugsbehörden könnte gegenüber <strong>der</strong> Politik argumentiert<br />
werden, daß eine gesetzliche Regelung zur Prüfung <strong>von</strong> Stoffen nicht erfor<strong>der</strong>lich<br />
sei. Allerdings kennen die befragten Vollzugsbehörden in fast allen Fällen die Selbstverpflichtung<br />
nicht o<strong>der</strong> allenfalls ungefähr und haben auch noch kaum auf die Datensätze zurückgegriffen.<br />
In diesem Zusammenhang ist bei einigen befragten Unternehmen spürbar, daß sie an<strong>der</strong>e<br />
Vorstellungen über den Einbezug <strong>der</strong> Vollzugsbehörden haben als <strong>der</strong> Verband: Während es<br />
auf seiten des Verbandes für sinnvoll erachtet wird, wenn Vollzugsbehörden auf die Daten<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung zurückgreifen, sind einige Unternehmen in dieser Hinsicht eher reserviert<br />
und haben deshalb bei den Telefoninterviews keine Vollzugsbehörden o<strong>der</strong> Ansprechpartner<br />
in den Behörden genannt.<br />
Von seiten <strong>der</strong> Umweltverbände wird vor allem kritisiert, daß die im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
erhobenen Parameter nicht ausreichend seien und weitere Daten erhoben werden<br />
müßten, insbeson<strong>der</strong>e zu chronischer Toxizität und Akkumulation.<br />
c) Vergleich mit Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
Sechs Unternehmen, die ausführlich befragt worden sind, geben an, daß sie Maßnahmen<br />
durchgeführt haben, die über die Inhalte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung hinausgehen. Dies bezieht<br />
sich in fünf Fällen auf die Erhebung <strong>von</strong> zusätzlichen Daten gegenüber dem in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
gefor<strong>der</strong>ten Mindestdatensatz. In zwei Fällen bezieht sich diese Aussage auf<br />
die Einführung <strong>von</strong> Umweltmanagementsystemen bzw. eines Management-Systems für Product<br />
Stewardship.<br />
Sieben <strong>der</strong> ausführlich befragten Unternehmen geben an, daß sie auch schon unabhängig<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Maßnahmen mit ähnlichen Zielsetzungen (Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffen) geplant und durchgeführt hätten, die auch unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
(weiter) durchgeführt worden wären. Ein Unternehmen versieht das allerdings<br />
mit <strong>der</strong> Einschränkung, daß diese Maßnahmen ohne die Selbstverpflichtung nicht so systematisch<br />
durchgeführt worden wären. Dabei sagen fünf Unternehmen, daß diese eigenständig<br />
geplanten Maßnahmen zu einer gleich großen Aussagefähigkeit <strong>der</strong> Firma geführt hätten<br />
wie die Selbstverpflichtung; ein Unternehmen gibt an, daß diese eigenständig geplanten<br />
Maßnahmen zu einer höheren Aussagefähigkeit geführt hätten als die Vorgaben <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
(aufgrund <strong>der</strong> größeren Datenmenge). Das Unternehmen, das die eigenständig<br />
37
geplanten Maßnahmen ohne die Selbstverpflichtung mit weniger Systematik angegangen<br />
wäre, sagt, daß diese eigenen Maßnahmen eine geringere Aussagefähigkeit zur Folge gehabt<br />
hätten als durch die Selbstverpflichtung: ohne die Selbstverpflichtung wäre es nicht zur<br />
eigenen Formulierung <strong>von</strong> Störfalldossiers gekommen.<br />
Fast alle ausführlich befragten Unternehmen fanden die Selbstverpflichtung insofern hilfreich,<br />
als sie innerhalb des eigenen Hauses ein wichtiges zusätzliches Argument für die<br />
Durchführung <strong>der</strong> Maßnahmen war, einen Motivationsschub bedeutete und auch die Gewährung<br />
<strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen finanziellen Mittel erleichtert hat. Allerdings berichtet ein Unternehmen<br />
auch vom gegenteiligen Effekt: die Tatsache, daß die Selbstverpflichtung eine freiwillige<br />
Maßnahme war, habe es erschwert, die erfor<strong>der</strong>lichen Ressourcen für die Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung zu bekommen.<br />
d) Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Die meisten befragten Unternehmen gehen da<strong>von</strong> aus, daß im Falle einer rechtlichen Regelung<br />
aufwendigere und teurere Prüfungen vorgeschrieben worden wären; höchstwahrscheinlich,<br />
so <strong>der</strong> Tenor <strong>der</strong> Befragten, könnte man bei einer rechtlichen Regelung nicht so ohne<br />
weiteres auf Analogiebetrachtungen o<strong>der</strong> Erfahrungswerte zurückgreifen, son<strong>der</strong>n müßte in<br />
jedem Falle bestimmte Testverfahren durchführen. In ihrer Mehrzahl gehen die Unternehmen<br />
aber da<strong>von</strong> aus, daß trotz aufwendigerer Prüfungsverfahren keine verbesserte Aussagefähigkeit<br />
resultieren würde. Dies wird allerdings sowohl <strong>von</strong> einem <strong>der</strong> befragten Umweltverbände<br />
als auch <strong>von</strong> einem <strong>der</strong> befragten Behördenvertreter bezweifelt. Diese beiden Befragten<br />
gehen da<strong>von</strong> aus, daß aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit ihrem (teilweisen) Rückgriff<br />
auf Analogiebetrachtungen keine ausreichend validen Daten gewonnen werden könnten.<br />
Nur mit naturwissenschaftlichen Prüfmethoden, so einer <strong>der</strong> Befragten, sei dies möglich.<br />
Da die Unterstützung <strong>der</strong> Behörden für diese Selbstverpflichtung keineswegs ungeteilt ist,<br />
hängt es aller Voraussicht nach auch stark <strong>von</strong> <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ab,<br />
ob zu einem späteren Zeitpunkt doch noch eine rechtliche Regelung verabschiedet wird.<br />
Offen muß bleiben, ob sich das grundlegende Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung, nämlich eine Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Aussagefähigkeit <strong>von</strong> Firmen sowie ein verantwortlicherer Umgang mit Stoffen,<br />
eher durch eine gesetzliche Regelung hätte erreichen lassen. Einige Aussagen <strong>von</strong> Firmenvertretern<br />
deuten darauf hin, daß die Bereitstellung des notwendigen Personals und <strong>der</strong><br />
erfor<strong>der</strong>lichen Kapaziäten zur Erarbeitung <strong>von</strong> Datensätzen mit einer gesetzlichen Regelung<br />
in einigen Fällen einfacher durchzusetzen gewesen wäre. Ob dies aber auch positive Wirkungen<br />
auf die Eigenverantwortlichkeit <strong>von</strong> Unternehmen gehabt hätte, muß offen bleiben.<br />
2.2.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Durch die Selbstverpflichtung sind auf die Unternehmen zusätzliche Kosten für die notwendigen<br />
Datenbeschaffungen und Prüfungen zugekommen. Unmittelbare positive wirtschaftliche<br />
Effekte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung haben die Unternehmen keine festgestellt. Allerdings gehen<br />
die Unternehmen in ihrer Mehrzahl da<strong>von</strong> aus, daß die Kosten im Falle einer rechtlichen<br />
Regelung höher gewesen wären.<br />
38
Insbeson<strong>der</strong>e kleinere und mittlere Unternehmen weisen auf die hohen finanziellen und personellen<br />
Kapazitäten hin, die für die Erarbeitung auch nur des Mindestdatensatzes erfor<strong>der</strong>lich,<br />
aber oft nicht vorhanden seien. Genannt werden hier fehlende Kapazitäten für die<br />
Durchführung <strong>der</strong> notwendigen Recherchen und Tests o<strong>der</strong> auch fehlende Hilfestellungen<br />
<strong>von</strong> seiten des Verbandes.<br />
Genauere quantitative Schätzungen können aber nur <strong>von</strong> einigen wenigen Unternehmen abgegeben<br />
werden, wobei es sich in erster Linie um die Großunternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
handelt, die für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eigene Projektgruppen eingerichtet<br />
haben. In kleineren Unternehmen wurden die Kosten für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
meist nicht separat erfaßt.<br />
b) Marktstruktur<br />
Die Beson<strong>der</strong>heit dieser Selbstverpflichtung besteht – im Unterschied zur Selbstverpflichtung<br />
zur Reduktion <strong>von</strong> CO2-Emissionen – darin, daß durch sie jedes einzelne Unternehmen zu<br />
entsprechenden Maßnahmen veranlaßt werden soll; die Untätigkeit einzelner Firmen kann<br />
hier nicht (o<strong>der</strong> jedenfalls nicht ohne weiteres) durch Maßnahmen an<strong>der</strong>er Firmen ersetzt<br />
werden.<br />
Gegenüber den Möglichkeiten insbeson<strong>der</strong>e kleinerer Unternehmen, die Selbstverpflichtung<br />
umzusetzen, besteht bei vielen Befragten, sowohl in Unternehmen als auch in Behörden und<br />
Umweltverbänden, eine gewisse Skepsis. Begründet wird dies in <strong>der</strong> Regel mit fehlen<strong>der</strong><br />
Kompetenz o<strong>der</strong> auch mit fehlenden Kapazitäten.<br />
2.2.2.3 Weitere Aspekte<br />
a) Innovationswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
In einigen Fällen werden Innovationen erwähnt, zu denen es bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
gekommen sei, so etwa ein neues Störfallmanagement o<strong>der</strong> die Entwicklung<br />
eines eigenen Bewertungsschemas für Stoffe. Von technischen Innovationen im engeren<br />
Sinne wie z.B. Substitutionen <strong>von</strong> Stoffen o<strong>der</strong> ähnlichem wird hingegen kaum berichtet.<br />
Darin liegt auch einer <strong>der</strong> Hauptkritikpunkte eines Umweltverbandes: Die Selbstverpflichtung<br />
liefere keine Anreize, Verän<strong>der</strong>ungen und Substitutionen in den verwendeten Stoffen vorzunehmen.<br />
b) Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Sechs Unternehmen nutzen die gewonnenen Informationen auch für an<strong>der</strong>e Zwecke wie z.B.<br />
in <strong>der</strong> Produktentwicklung o<strong>der</strong> für die Aktualisierung ihrer Sicherheitsdatenblätter. Drei Unternehmen<br />
berichten <strong>von</strong> einem größeren Vertrauen in <strong>der</strong> Öffentlichkeit (dabei weist ein<br />
Unternehmen auf den Dialogprozeß hin, den es mit einem Umweltverband aufgebaut habe),<br />
zwei auch <strong>von</strong> positiven Reaktionen <strong>der</strong> Behörden.<br />
Ein Befragter aus den Umweltverbänden/-instituten nennt sog. „soft effects“, wie die Entstehung<br />
<strong>von</strong> Dialogprozessen, in die allerdings auch noch an<strong>der</strong>e Stakehol<strong>der</strong> (Mitarbeiter,<br />
39
Kunden) hätten einbezogen werden müssen. Ferner sei das Bewußtsein für die Bedeutung<br />
<strong>von</strong> Zwischenprodukten geför<strong>der</strong>t worden.<br />
c) Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Die Unternehmen werden vom VCI jährlich im Rahmen <strong>der</strong> Responsible-Care-Umfrage über<br />
die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung befragt. Im Jahr 2000 beteiligten sich an dieser Umfrage<br />
797 Unternehmen, die ca. 84% <strong>der</strong> Mitarbeiter <strong>der</strong> gesamten <strong>chemischen</strong> Industrie repräsentieren.<br />
Gemäß den Ergebnissen dieser Umfrage liegen für 76% <strong>der</strong> Stoffe Stoffdokumentationen<br />
vor, die die erfor<strong>der</strong>lichen Mindestdaten und -aussagen enthalten. 88% <strong>der</strong><br />
Unternehmen haben ein Notfallauskunftssystem installiert.<br />
Eines <strong>der</strong> befragten Unternehmen bemängelt in diesem Zusammenhang, daß <strong>der</strong> VCI nicht<br />
eindringlich genug bei den Unternehmen auf die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung bzw. auf<br />
entsprechende Berichterstattung zur Umsetzung dränge. Für einen <strong>der</strong> Befragten aus den<br />
Umweltverbänden/-instituten sind die genannten Zahlen noch nicht zufriedenstellend, insbeson<strong>der</strong>e<br />
angesichts <strong>der</strong> Tatsache, daß die Frist für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
allmählich verstreiche.<br />
d) Arbeit des Verbandes<br />
Von verbandsinternen Problemen bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wurde bei <strong>der</strong><br />
Befragung nur wenig berichtet. Allerdings kann das darauf zurückzuführen sein, daß <strong>der</strong><br />
Großteil <strong>der</strong> dazu im Rahmen <strong>der</strong> ausführlichen Interviews befragten Firmen selbst an <strong>der</strong><br />
Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung beteiligt gewesen ist.<br />
Befragte, insbeson<strong>der</strong>e aus kleinen und mittleren Unternehmen, monierten, daß die Selbstverpflichtung<br />
vor allem <strong>von</strong> den Möglichkeiten <strong>der</strong> Großunternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
ausgehe und die Kapazitäten und Probleme kleinerer Unternehmen zu wenig berücksichtige.<br />
Sehr oft wird eine verstärkte Hilfestellung <strong>von</strong> seiten des Verbandes bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
und ein größerer Austausch <strong>von</strong> Stoffdaten zwischen Unternehmen angemahnt, um<br />
Doppelarbeiten zu vermeiden. Noch weiter gehen For<strong>der</strong>ungen, auf bestehende Stoffdossiers<br />
insbeson<strong>der</strong>e größerer Unternehmen zurückgreifen zu können.<br />
Insgesamt wird hier nochmals eine Diskrepanz zwischen <strong>der</strong> Auffassung des Verbandes und<br />
vieler Unternehmen sichtbar: Einerseits soll die Selbstverpflichtung in erster Linie eine Anregung<br />
für die Unternehmen sein, selbst über die für sie zweckmäßigste Umsetzung nachzudenken.<br />
Dementsprechend hat <strong>der</strong> Verband ganz bewußt darauf verzichtet, Ausführungsanleitungen<br />
für die Unternehmen (evtl. verbunden mit Checklisten, Computerprogrammen etc.)<br />
auszuarbeiten. Dies wird <strong>von</strong> seiten des Verbandes auch gar nicht als möglich erachtet. Die<br />
bestehende Umsetzungsleitlinie sieht <strong>der</strong> Verband bereits als sehr detailliert und informativ<br />
an. Das Problem liege eher darin, daß sie <strong>von</strong> den Unternehmen nicht ausreichend zur<br />
Kenntnis genommen werde. An<strong>der</strong>erseits wird oft <strong>von</strong> den Unternehmen eine größere Hilfestellung<br />
bei <strong>der</strong> Umsetzung gewünscht.<br />
40
2.3 Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz<br />
2.3.1 Auswahl <strong>der</strong> Befragten<br />
2.3.1.1 Unternehmen<br />
Die Unternehmen sowie die dort relevanten Ansprechpartner wurden dem Institut vom Verband<br />
<strong>der</strong> Textilhilfsmittel-, Le<strong>der</strong>hilfsmittel-, Gerbstoff- und Waschrohstoff-Industrie e.V.<br />
(TEGEWA) benannt. Vor <strong>der</strong> Kontaktaufnahme des Institutes mit den Unternehmen wurden<br />
diese zudem durch den Verband über die Durchführung <strong>der</strong> Untersuchung informiert. Eine<br />
weitere vorbereitende Maßnahme war die Vorstellung <strong>der</strong> Untersuchung im Rahmen einer<br />
Sitzung des TEGEWA-Fachausschusses Ökologie, bei <strong>der</strong> viele <strong>der</strong> später befragten Unternehmen<br />
vertreten waren. Anschließend wurden in allen sieben Unternehmen persönliche<br />
Gespräche geführt.<br />
2.3.1.2 Behörden<br />
Aufgrund <strong>von</strong> Vorschlägen des Verbandes TEGEWA waren ursprünglich nur zwei Behördenvertreter<br />
für die Befragung vorgesehen. Da eine <strong>der</strong> Personen aus Zeitgründen <strong>von</strong> einer<br />
Teilnahme an <strong>der</strong> Befragung Abstand nahm, wurden im Verlauf <strong>der</strong> Untersuchung noch<br />
weitere Ansprechpartner in den Behörden kontaktiert. Insgesamt konnten drei <strong>der</strong> sieben<br />
Personen, die hinsichtlich einer Beteiligung an <strong>der</strong> Untersuchung angesprochen wurden,<br />
persönlich interviewt werden. Die übrigen vier Personen wollten sich entwe<strong>der</strong> nicht an <strong>der</strong><br />
Untersuchung beteiligen o<strong>der</strong> sahen sich zu dem Thema nicht als ausreichend kompetent<br />
an.<br />
2.3.1.3 Umweltverbände<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Umweltverbände und -institute waren drei Gespräche geplant. Die Auswahl<br />
<strong>der</strong> Ansprechpartner wurde in Abstimmung mit dem Verband TEGEWA aufgrund <strong>von</strong> Vorschlägen<br />
des Institutes vorgenommen. Zustande kamen letztendlich zwei Gespräche. Ein<br />
Verband sagte aus Gründen fehlen<strong>der</strong> personeller und zeitlicher Kapazitäten eine Teilnahme<br />
ab.<br />
2.3.1.4 Nachgelagerte Unternehmen<br />
Auch hinsichtlich <strong>der</strong> nachgelagerten Unternehmen wurde in Absprache mit dem Verband<br />
TEGEWA eine Auswahl <strong>von</strong> Ansprechpartnern vorgenommen. Als relevant wurden zunächst<br />
Textilveredler, -hersteller sowie <strong>der</strong> -handel erachtet. Es zeigte sich aber recht schnell, daß<br />
die Unternehmen des Textilhandels offenbar nicht im erwarteten Maß <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
betroffen sind. Viele <strong>der</strong> Ansprechpartner aus dieser Branche sahen sich nicht<br />
o<strong>der</strong> nur eingeschränkt in <strong>der</strong> Lage, zu diesbezüglichen Auswirkungen/Erfahrungen Auskunft<br />
zu geben. Dem weitgehenden Wegfall dieser Befragungsgruppe wurde durch eine verstärkte<br />
Berücksichtigung <strong>der</strong> Textilveredlungsindustrie Rechnung getragen. Hier konnten in zwei<br />
Betrieben sowie mit dem Gesamtverband <strong>der</strong> Deutschen Textilveredlungsindustrie (TVI) Gespräche<br />
geführt werden.<br />
41
2.3.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
2.3.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
a) Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Träger <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ist <strong>der</strong> Verband TEGEWA. Die Erklärung wurde am 17. November<br />
1997 unterzeichnet. Die Umsetzung <strong>der</strong> darin enthaltenen Ziele ist in einem mehrstufigen<br />
Verfahren bis zum 31.03.2001 avisiert.<br />
Die Selbstverpflichtung sieht vor, daß die im Verband TEGEWA zusammengeschlossenen<br />
Unternehmen die <strong>von</strong> ihnen hergestellten und vertriebenen Textilhilfsmittel nach einem in <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung detailliert beschriebenen Klassifizierungskonzept in drei Klassen einordnen<br />
(I: wenig abwasserrelevant, II: abwasserrelevant, III: stark abwasserrelevant). Die Klassifizierung<br />
erfolgt auf <strong>der</strong> Basis <strong>von</strong> Daten sowohl für die Zubereitung als auch für die Inhaltsstoffe.<br />
Die Einstufungsdaten müssen intern dokumentiert werden. Liegen zu einem Textilhilfsmittel<br />
bis 01.01.2001 keine Daten vor, erfolgt die Einstufung in Klasse III. Mit dieser<br />
Klassifizierung ist zugleich die (implizite) Zielsetzung verbunden, Textilhilfsmittel <strong>der</strong> Abwasserrelevanzstufe<br />
III weitgehend durch Mittel mit niedrigeren Abwasserrelevanzstufen zu substituieren.<br />
Zur Umsetzung führt <strong>der</strong> Verband Informationsveranstaltungen für seine Mitgliedsfirmen<br />
durch.<br />
Der TVI-Verband hat seinerseits eine entsprechende Selbstverpflichtung verabschiedet, die<br />
den TVI-Mitgliedsfirmen empfiehlt, nur noch Mittel zu verwenden, die <strong>von</strong> den Herstellern<br />
nach dem Konzept <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eingestuft wurden, und dabei nach Möglichkeit<br />
solche zu bevorzugen, die weniger gewässerrelevant sind.<br />
b) Zielerreichung<br />
Die Befragungsergebnisse lassen vermuten, daß die in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung vorgesehene<br />
Klassifikation <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach <strong>der</strong> Gewässerrelevanz bereits zum Zeitpunkt <strong>der</strong><br />
Untersuchung weitgehend erfolgt ist. In Verbindung mit den ersten vom TEGEWA-Verband<br />
erhobenen Monitoringdaten kann da<strong>von</strong> ausgegangen werden, daß die Selbstverpflichtung<br />
auch insofern effektiv ist, als zunehmend Textilhilfsmittel mit einer geringeren Abwasserrelevanz<br />
verkauft/eingesetzt werden. So geht sowohl die Mehrheit <strong>der</strong> befragten Unternehmensvertreter<br />
als auch die Mehrheit <strong>der</strong> befragten Behördenvertreter <strong>von</strong> einer ökologischen Verbesserung<br />
aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung aus. Auch die Befragung in den Textilveredlungsbetrieben<br />
bestätigt tendenziell den zunehmenden Einsatz <strong>von</strong> weniger abwasserrelevanten<br />
Hilfsmitteln.<br />
Von seiten <strong>der</strong> Umweltverbände wird eine ökologische Verbesserung aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, in einem Fall geht man jedoch da<strong>von</strong><br />
aus, daß <strong>der</strong> durch die Selbstverpflichtung erzielte ökologische Vorteil durch einen Anstieg<br />
<strong>der</strong> Verkaufsmengen überkompensiert wird. Allerdings zeigt sich aufgrund <strong>von</strong> Erhebungen<br />
des Verbandes TEGEWA, daß diese Befürchtung bisher nicht eingetreten ist.<br />
42
Da die Selbstverpflichtung ein produktionsbezogenes Umweltproblem behandelt, ist <strong>der</strong> Nutzen<br />
für den Endverbraucher <strong>von</strong> Textilien nur mittelbar gegeben. Zwar kommt eine Umweltverbesserung<br />
in einem bestimmten räumlichen Umkreis (z.B. Deutschland) theoretisch auch<br />
dem dort ansässigen Käufer/Träger <strong>von</strong> Textilien zugute, wird <strong>von</strong> diesem aber nicht unmittelbar<br />
wahrgenommen. Gestützt wird diese Aussage <strong>von</strong> den Befragungsergebnissen: Vier<br />
<strong>der</strong> sieben Gesprächspartner aus den Unternehmen sprechen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung einen<br />
Nutzen für den Endverbraucher <strong>von</strong> Textilien ab, drei konstatieren einen <strong>der</strong>artigen ökologischen<br />
Kundennutzen.<br />
Die befragten Behördenvertreter gehen zwar <strong>von</strong> einem aus <strong>der</strong> Selbstverpflichtung resultierenden<br />
ökologischen Kundennutzen aus, beim Endverbraucher herrsche diesbezüglich aber<br />
oftmals Unkenntnis.<br />
Auch die befragten Personen aus <strong>der</strong> Textilveredlungsindustrie führen an, es sei aufgrund<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu einem indirekten ökologischen Kundennutzen gekommen, <strong>der</strong><br />
aber vom Endverbraucher kaum zur Kenntnis genommen werde.<br />
c) Vergleich mit Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
Hinsichtlich unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung geplanter o<strong>der</strong> vorgenommener Maßnahmen<br />
mit ähnlicher Zielsetzung läßt sich die Aussage treffen, daß in zwei Firmen offenbar<br />
bereits zuvor Verfahren zur ökologischen Produktoptimierung bzw. Bewertung vorhanden<br />
waren. Die betreffenden Unternehmensvertreter geben aber an, daß infolge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
eine bessere Umweltschutzwirkung erzielt werden konnte. Die übrigen fünf Unternehmen<br />
geben an, keine <strong>der</strong>artigen Alternativmaßnahmen umgesetzt o<strong>der</strong> verfolgt zu haben.<br />
In keinem <strong>der</strong> befragten Unternehmen hätte man die Durchführung alternativer Maßnahmen<br />
in Eigenregie dem Abschluß <strong>der</strong> Selbstverpflichtung vorgezogen.<br />
Zwei <strong>der</strong> drei befragten Behördenvertreter konstatieren ebenso, es sei aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
zu einer ökologischen Verbesserung gegenüber dem „business as usual“ gekommen.<br />
Einer <strong>der</strong> Befragten aus den Umweltverbänden/-instituten geht aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
allenfalls <strong>von</strong> einem leichtem Rückgang im Einsatz <strong>von</strong> Stoffen <strong>der</strong> Abwasserrelevanzstufe<br />
3 aus. Dieser Effekt werde aber durch einen Anstieg im Gesamtverbrauch <strong>von</strong><br />
Textilhilfsmitteln mehr als aufgehoben – wie bereits oben gesagt wurde, zeigen Erhebungen<br />
des Verbandes TEGEWA, daß diese Befürchtung bisher nicht eingetreten ist.<br />
d) Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Es kann aufgrund <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse nicht mit Sicherheit ausgesagt werden, welche<br />
Wirkungen eine rechtliche Regelung im Vergleich mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung gehabt<br />
hätte. Je zwei <strong>der</strong> befragten Unternehmensvertreter befürchteten jedoch im Falle einer rechtlichen<br />
Regelung die verstärkte Freigabe <strong>von</strong> Informationen und Know-how an die Behörden,<br />
einen höheren Aufwand sowie Verbote. Jeweils drei <strong>der</strong> Befragten gehen da<strong>von</strong> aus, daß mit<br />
einer rechtlichen Regelung eine bessere bzw. schlechtere Umweltschutzwirkung hätte erzielt<br />
werden können. In einem Unternehmen hätte man eine in etwa gleiche Schutzwirkung erwartet.<br />
Sechs Unternehmensvertreter sind <strong>der</strong> Meinung, daß ein Gesetz im Vergleich zur<br />
43
Selbstverpflichtung zu größeren wirtschaftlichen Nachteilen geführt hätte. Alle befragten Personen<br />
ziehen die Selbstverpflichtung einer gesetzlichen Regelung vor.<br />
Von den Behörden wird eine rechtliche Regelung nicht unbedingt als ökologisch wirksamer,<br />
aber als für die Unternehmen ökonomisch vorteilhafter und besser kontrollierbar angesehen.<br />
Damit verbunden wäre nach Angaben eines Behördenvertreters dann aber auch ein höherer<br />
behördlicher Arbeitsaufwand für Kontrolle, Information und Koordination gewesen.<br />
Von beiden befragten Vertretern <strong>der</strong> Umweltverbände und -institute wird eine rechtliche Regelung<br />
grundsätzlich als wirksamer erachtet als die freiwillige Selbstverpflichtung.<br />
Von den nachgelagerten Unternehmen wird die Selbstverpflichtung einer rechtlichen Regelung<br />
vorgezogen. Der Gesprächspartner aus <strong>der</strong> Textilherstellung konstatiert jedoch, daß die<br />
Selbstverpflichtung nicht die Notwendigkeit einer wirkungsvollen internationalen Regelung<br />
ersetze.<br />
2.3.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Es kann aufgrund <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse da<strong>von</strong> ausgegangen werden, daß den Herstellern<br />
<strong>von</strong> Textilhilfsmitteln im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Kosten entstanden<br />
sind. Von fünf <strong>der</strong> sieben Unternehmen wurde diesbezüglich eine Schätzung abgegeben.<br />
Die Schätzwerte für die Umsetzungskosten liegen zwischen 10.000,- und 250.000,- DM,<br />
wobei die Summe <strong>von</strong> <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> zu begutachtenden Textilhilfsmittel abhängt. Berücksichtigt<br />
wurde für die Einschätzung in <strong>der</strong> Regel nur <strong>der</strong> Arbeitsaufwand für die Begutachtung/Einstufung<br />
<strong>der</strong> Produkte. In allen sieben Unternehmen herrscht Einigkeit darüber, daß<br />
sich aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung keine positiven wirtschaftlichen Effekte eingestellt haben.<br />
Sechs <strong>der</strong> sieben befragten Unternehmensvertreter geben an, vor Abschluß <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
keine Abschätzung <strong>der</strong> daraus resultierenden Aufwendungen/Erträge vorgenommen<br />
zu haben.<br />
Von seiten <strong>der</strong> Behörden sowie <strong>der</strong> Umweltverbände werden die Kosten, die den Herstellern<br />
<strong>von</strong> Textilhilfsmitteln im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung entstanden sind, nicht<br />
so einheitlich gesehen. Einer <strong>der</strong> drei befragten Behördenvertreter geht da<strong>von</strong> aus, daß die<br />
ökonomischen Auswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für die Unternehmen eher nachteilig<br />
gewesen sind. Die übrigen Befragten aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Behörden sind diesbezüglich unentschieden,<br />
erwarten aber, daß sich die durchgeführten Maßnahmen langfristig für die Industrie<br />
lohnen werden. Der Aufwand, <strong>der</strong> den Behörden bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
entstanden ist, wird <strong>von</strong> einem Behördenvertreter mit einem halben Mannjahr angegeben.<br />
Von den beiden Befragten aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Umweltverbände und -institute konstatiert<br />
ein Gesprächspartner, daß Kosten infolge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für die Hersteller<br />
<strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nur eine untergeordnete Rolle spielen dürften.<br />
Insgesamt kann aufgrund <strong>der</strong> Befragungsergebnisse nicht entschieden werden, ob eine<br />
rechtliche Regelung möglicherweise wirtschaftlich vorteilhafter für die Industrie und/o<strong>der</strong> die<br />
Behörden gewesen wäre als die freiwillige Vereinbarung. Die Schätzungen über die entstandenen<br />
bzw. alternativen Kosten im Falle einer rechtlichen Regelung sind zu unbestimmt, um<br />
hierzu eine Aussage treffen zu können. Bemerkenswert ist, daß die Behörden einer rechtlichen<br />
Regelung nicht per se eine bessere Schutzwirkung einräumen, eine <strong>der</strong>artige Regelung<br />
aber möglicherweise als wirtschaftlich vorteilhafter für die Unternehmen ansehen.<br />
44
) Marktstruktur<br />
Unternehmen, die die Selbstverpflichtung nicht umsetzen, sind unter Berücksichtigung <strong>der</strong><br />
Befragungsergebnisse offenbar nicht <strong>von</strong> allzu großer Bedeutung. Von den Unternehmensvertretern<br />
vermutet nur einer <strong>der</strong> sieben Ansprechpartner <strong>der</strong>artige Trittbrettfahrer im Inland<br />
und hier auch nur bei Unternehmen, die nicht im Verband organisiert sind. Vier Unternehmensvertreter<br />
führen an, es gebe ausländische Firmen, die die Selbstverpflichtung nicht umsetzen.<br />
Von externer Seite, insbeson<strong>der</strong>e <strong>von</strong> Behörden, Umweltverbänden/-instituten sowie dem<br />
befragten Textilhersteller, wird ein zu gering ausgeprägtes gemeinschaftliches Vorgehen bei<br />
<strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung moniert. Möglicherweise ist in Zukunft eine stärkere<br />
Aufklärung/Einbindung <strong>der</strong> Unternehmen entlang <strong>der</strong> textilen Kette zu verfolgen, um die erfolgreiche<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung weiter zu unterstützen.<br />
An<strong>der</strong>erseits ist die parallele Verabschiedung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung des TVI-Verbandes als<br />
wichtiger Schritt anzusehen, um die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu erleichtern.<br />
2.3.2.3 Weitere Aspekte<br />
a) Innovationswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Die Befragungsergebnisse lassen darauf schließen, daß aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung die<br />
Hersteller <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln ihre Produktpalette in Richtung Textilhilfsmittel mit geringerer<br />
Abwasserrelevanz verän<strong>der</strong>t haben. Nur <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Umweltverbände geht man eher<br />
nicht da<strong>von</strong> aus, daß die Selbstverpflichtung zu Innovationen in den Unternehmen geführt<br />
hat.<br />
b) Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Als relevante Schwierigkeit bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung führten drei Unternehmensvertreter<br />
die Informationsbeschaffung bei den Vorlieferanten an. Nur in Einzelfällen<br />
wurden technische Schwierigkeiten o<strong>der</strong> Probleme bei <strong>der</strong> Vermittlung des Themas, insbeson<strong>der</strong>e<br />
<strong>der</strong> Unterschiede zwischen Abwasserrelevanzstufen und Wassergefährdungsklassen,<br />
benannt. Zwei Unternehmen gaben an, überhaupt keine Probleme bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung gehabt zu haben.<br />
Weitere Konsequenzen, die aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eingetreten sind, werden in erster<br />
Linie in puncto organisatorischem und personellem Aufwand gesehen, gefolgt <strong>von</strong> verbesserten<br />
Behördenkontakten und – in nur einem Fall - einem größeren Vertrauen <strong>der</strong> Öffentlichkeit.<br />
Hinsichtlich eines Erfolges <strong>der</strong> Selbstverpflichtung in bezug auf einen Imageeffekt in <strong>der</strong> Öffentlichkeit<br />
sind vier <strong>der</strong> befragten Unternehmensvertreter unentschieden, zwei werten sie<br />
als nicht erfolgreich, einer als erfolgreich. Hinsichtlich <strong>der</strong> Imagewirkung in <strong>der</strong> Politik tendieren<br />
die Befragten eher zu einer positiven Sicht <strong>der</strong> Selbstverpflichtung: Vier sprechen hier<br />
<strong>von</strong> einem Erfolg, drei sind unentschieden.<br />
Auch nach Auffassung <strong>der</strong> Behörden haben die Unternehmen mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung einen Imageeffekt in <strong>der</strong> Politik erzielt.<br />
45
c) Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Das Monitoring erfolgt durch eine stichprobenweise Zuordnungsüberprüfung durch einen<br />
vom Verband TEGEWA zu benennenden Experten. Bis 31.03.2001 erfolgt ein erster Bericht<br />
über die Ergebnisse an das Umweltministerium.<br />
Von seiten <strong>der</strong> Behörden wird in diesem Zusammenhang moniert, daß eine durchgehende<br />
Umsetzungskontrolle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung fehle und die Stoffe nicht durch eine neutrale<br />
Stelle eingestuft würden.<br />
d) Arbeit des Verbandes<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Befragungsergebnisse läßt sich die Aussage treffen, daß die Zusammenarbeit<br />
mit dem Verband TEGEWA <strong>von</strong> allen Befragten überwiegend als positiv beurteilt wird. Ungeachtet<br />
dieser guten Zusammenarbeit wird die Selbstverpflichtung <strong>von</strong> den Vertretern <strong>der</strong><br />
Behörden und Umweltverbände/-institute als noch nicht anspruchsvoll genug erachtet. Auch<br />
aus <strong>der</strong> Textilveredlungsindustrie wird diesbezüglich eine Stimme laut. Von den Behördenvertretern<br />
wird neben den unter „Monitoring“ schon genannten Aspekten moniert, daß toxikologische<br />
Belange zuwenig berücksichtigt würden und nur Produkte anstelle <strong>von</strong> Einzelsubstanzen<br />
klassifiziert würden.<br />
Von einem <strong>der</strong> beiden Vertreter aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> Umweltverbände/-institute wird zudem<br />
Kritik daran geübt, daß die Rezepturen <strong>der</strong> Textilhilfsmittel selbst nicht offengelegt werden.<br />
Es sollten zumindest die wichtigsten Inhaltsstoffe unter Angabe <strong>von</strong> prozentualen Spannen<br />
genannt werden.<br />
Nach Angaben <strong>der</strong> Unternehmensvertreter hat es we<strong>der</strong> mit dem Verband TEGEWA noch<br />
mit den <strong>Verbände</strong>n VCI und TVI Zielkonflikte gegeben. Nur ein Ansprechpartner äußert, <strong>der</strong><br />
TVI habe <strong>von</strong> den Textilhilfsmittelherstellern zu viele Daten erhalten wollen. Tendenziell läßt<br />
sich daraus <strong>der</strong> Schluß ableiten, daß <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Kunden mehr Daten verlangt werden als<br />
die Hersteller zu liefern bereit sind.<br />
2.4 Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende<br />
und holzverfärbende Organismen<br />
2.4.1 Auswahl <strong>der</strong> Befragten<br />
2.4.1.1 Unternehmen<br />
Von den Ansprechpartnern in den Fachverbänden, Deutsche Bauchemie e.V. und Verband<br />
<strong>der</strong> Lackindustrie (VdL), wurden dem Institut für Umweltmanagement zunächst eine Reihe<br />
<strong>von</strong> Unternehmen benannt. Aus diesen wählte das Institut je vier per Zufall aus. Die Stichprobe<br />
<strong>von</strong> insgesamt acht Unternehmen wurde anschließend durch das Institut für Umweltmanagement<br />
angeschrieben. Es konnten mit Vertretern <strong>von</strong> sieben <strong>der</strong> acht Unternehmen<br />
Gespräche geführt werden. Das achte Unternehmen nutzte den zur Vorbereitung des Gespräches<br />
übersandten Fragebogen, um diesen unmittelbar auszufüllen und dem Institut zukommen<br />
zu lassen. Somit liegen die Informationen aus allen acht Unternehmen <strong>der</strong> Stichprobe<br />
vor.<br />
46
2.4.1.2 Behörden<br />
Im Falle <strong>der</strong> Auswahl <strong>der</strong> zu befragenden Behördenvertreter wurde analog zur Unternehmensauswahl<br />
vorgegangen. Von den <strong>Verbände</strong>n wurde zunächst eine Reihe <strong>von</strong> relevanten<br />
Ansprechpartnern benannt, aus denen das Institut für Umweltmanagement vier Personen<br />
auswählte. Im Zuge <strong>der</strong> Befragung stellte es sich als sinnvoll heraus, die Stichprobe um einen<br />
weiteren Ansprechpartner zu vergrößern. Von diesen fünf ausgewählten Behördenvertretern<br />
konnte mit vier Personen ein persönliches Gespräch geführt werden. Eine <strong>der</strong> Personen<br />
war aus Zeitgründen nicht zu einem Interview bereit und verwies auf Ansprechpartner in<br />
an<strong>der</strong>en Behörden.<br />
2.4.1.3 Umweltverbände<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Umweltverbände und -institute waren drei Gespräche geplant. Die Auswahl<br />
<strong>der</strong> Ansprechpartner wurde in Abstimmung mit den Fachverbänden aufgrund <strong>von</strong> Vorschlägen<br />
des Institutes vorgenommen. Zustande kamen letztendlich zwei Gespräche. Ein Verband<br />
sagte aus Gründen fehlen<strong>der</strong> personeller und zeitlicher Kapazitäten die Teilnahme ab.<br />
2.4.1.4 Kunden(-verbände)<br />
Auch hinsichtlich <strong>der</strong> nachgelagerten Unternehmen wurde in Absprache mit den Fachverbänden<br />
eine Auswahl <strong>von</strong> Unternehmen/<strong>Verbände</strong>n vorgenommen. Die Ermittlung <strong>der</strong> Ansprechpartner<br />
sowie die Vereinbarung <strong>der</strong> Gesprächstermine mit dem Handel sowie mit den<br />
Verwen<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Holz- und Bläueschutzmitteln gestaltete sich insgesamt als schwierig. Nicht<br />
selten war bei den entsprechenden Gesprächspartnern die Kenntnis um die Selbstverpflichtung<br />
und ihrer Folgen nicht o<strong>der</strong> nur in geringem Maße vorhanden. Im Falle des Handels gilt<br />
es auch eine geringe Bereitschaft hinsichtlich einer Beteiligung an <strong>der</strong> Untersuchung zu konstatieren.<br />
Von neun kontaktierten Ansprechpartnern wurden mit drei Personen Gespräche geführt. Ein<br />
weiterer Ansprechpartner benutzte eine Kurzversion des vom Institut erstellten Fragebogens,<br />
um eine Umfrage bei seinen Verbandsmitglie<strong>der</strong>n durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Befragung<br />
wurden dem Institut anonymisiert zur Verfügung gestellt.<br />
Vier <strong>der</strong> fünf verbleibenden Ansprechpartner waren nicht zu einem Gespräch bereit. Ein<br />
weiterer Ansprechpartner verstarb innerhalb <strong>der</strong> Befragungsperiode.<br />
2.4.2 Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
2.4.2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Träger <strong>der</strong> Selbstverpflichtung sind <strong>der</strong> VCI, die Deutsche Bauchemie e.V. und <strong>der</strong> VdL. Die<br />
Erklärung wurde am 10.10.1997 abgegeben. Die darin festgelegten Ziele sollen nach einem<br />
Jahr erreicht werden.<br />
Die Selbstverpflichtung bezieht sich auf (a) Holzschutzmittel mit vorbeugen<strong>der</strong> Wirksamkeit<br />
gegen holzzerstörende und/o<strong>der</strong> holzverfärbende Organismen, (b) Holzschutzmittel mit be-<br />
47
kämpfen<strong>der</strong> Wirksamkeit gegen holzzerstörende Organismen und (c) Bläueschutzmittel<br />
(Holzschutzmittel mit vorbeugen<strong>der</strong> Wirksamkeit gegen holzverfärbende Organismen) als<br />
Teil eines Beschichtungssystems.<br />
Die Selbstverpflichtung sieht vor: Keine Abgabe <strong>von</strong> Holz- und Bläueschutzmitteln zur vorbeugenden<br />
Verwendung in Innenräumen; Beschränkung <strong>der</strong> Gebindegröße für Privatanwen<strong>der</strong>;<br />
Kennzeichnung <strong>der</strong> Produkte bezüglich Wirkstoffen und Wirksamkeit sowie Abgabe<br />
<strong>von</strong> Hinweisen zum sicheren Umgang mit den Produkten; Gütesicherung <strong>der</strong> Produkte<br />
(Wirkstoffe etc.). Für Holzschutzmittel gemäß (a) und (b) ist eine freiwillige amtliche Überprüfung<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Gütesicherung nach RAL-GZ 830, für Bläueschutzmittel gemäß (c)<br />
ist eine freiwillige amtliche Überprüfung im Rahmen eines Registrierverfahrens beim Umweltbundesamt<br />
vorgesehen.<br />
Das RAL-Verfahren zur Gütesicherung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln besteht seit 1985 und steht<br />
grundsätzlich auch Bläueschutzmitteln offen, die gemäß DIN EN 152 überprüft werden. Im<br />
Jahr 1990 wurde erstmals <strong>der</strong> Beschluß gefaßt, ein eigenes Gütezeichen für Bläueschutzmittel<br />
zu entwickeln. Nach entsprechen<strong>der</strong> Auftragserteilung an das RAL im Jahr 1993 bestand<br />
für Bläueschutzmittel 1996 das erste Mal die Möglichkeit, ein eigenes RAL-Gütesiegel<br />
zu erhalten. Die Bundesbehörden sind an <strong>der</strong> Umsetzung des Verfahrens beteiligt.<br />
Das Registrierungsverfahren für Bläueschutzmittel wurde erst im Zuge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
konzipiert. Es wird vom Umweltbundesamt (UBA) betreut und sieht keine Anwendung<br />
auf Holzschutzmittel mit vorbeugen<strong>der</strong> Wirksamkeit gegen holzzerstörende und/o<strong>der</strong> holzverfärbende<br />
Organismen bzw. Holzschutzmittel mit bekämpfen<strong>der</strong> Wirksamkeit gegen holzzerstörende<br />
Organismen vor. Der VdL hat im Dezember 1998 die Richtlinie zur Registrierung<br />
<strong>von</strong> Bläueschutzmitteln (VdL-RL 05) herausgegeben; zusätzlich hat <strong>der</strong> Verband Informationsveranstaltungen<br />
durchgeführt.<br />
b) Zielerreichung<br />
Alle sieben Befragten, <strong>der</strong>en Firmen in <strong>der</strong> Produktion <strong>von</strong> Holz- und Bläueschutzmitteln tätig<br />
sind, bestätigen, Warnhinweise sowie Angaben zu Wirkstoffen und <strong>der</strong> Wirksamkeit auf den<br />
Produkten aufgebracht zu haben. Für ein Unternehmen, das als Wirkstoffhersteller tätig ist,<br />
sind diese Maßnahmen nicht <strong>von</strong> Bedeutung. Eine Überprüfung <strong>der</strong> Produkte gemäß RAL-<br />
Verfahren erfolgt in vier, gemäß UBA-Registrierungsverfahren in drei Unternehmen. Drei <strong>der</strong><br />
vier Betriebe, die angeben, das RAL-Verfahren durchzuführen, planen nach eigenen Aussagen<br />
für die Zukunft zudem die Durchführung des Registrierungsverfahrens bzw. haben sich<br />
diesbezüglich noch nicht letztendlich entschieden.<br />
Allerdings gehen nahezu alle Befragten da<strong>von</strong> aus, daß es Firmen gibt, die die Selbstverpflichtung<br />
nicht umsetzen. Von vielen Gesprächspartnern wird zudem eine mangelnde Unterstützung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung durch den Handel konstatiert. Ein Ansprechpartner äußerte<br />
als Grund dafür, es gebe in dieser Branche einen starken Trend zur Eigenmarke. Der<br />
Preisvorteil gegenüber den Markenprodukten betrage dabei rund 20 bis 30 Prozent.<br />
Hauptziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ist eine verbesserte Kundeninformation und eine erhöhte<br />
Verbrauchersicherheit. Die <strong>von</strong> den befragten Unternehmen in diesem Zusammenhang<br />
durchgeführten Maßnahmen bestehen in <strong>der</strong> Regel in <strong>der</strong> Angabe bzw. Verän<strong>der</strong>ung <strong>von</strong><br />
Gebindetexten (Warnhinweise, Wirkstoffe, etc.) sowie <strong>der</strong> Einführung bzw. Fortschreibung<br />
48
einer amtlichen Produktüberprüfung. Ökologische Effekte aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
sind somit nur implizit zu erwarten, da man da<strong>von</strong> ausgehen kann, daß beispielsweise durch<br />
eine Angabe <strong>der</strong> Wirkstoffe sowie Verfahren <strong>der</strong> Güteüberwachung/Registrierung Überdosierungen<br />
<strong>von</strong> Bioziden weitgehend vermieden werden.<br />
Da die vorliegende Untersuchung fast ausschließlich auf Einschätzungen <strong>von</strong> wenigen Einzelpersonen<br />
beruht, ist es schwer zu belegen, ob durch die Selbstverpflichtung real eine erhöhte<br />
Verbrauchersicherheit bzw. eine bessere Umweltwirkung erreicht wurde. Ob sich diese<br />
Effekte wirklich eingestellt haben und wie sie sich in Zukunft entwickeln, könnte nur durch eine<br />
langfristige Untersuchung auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong> Anwen<strong>der</strong> sowie durch eine begleitende<br />
Auswertung <strong>der</strong> Monitoringdaten erfolgen. Bei vergleichen<strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Meinungen<br />
und Standpunkte <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung befragten Personen<br />
(-gruppen) gelangt man aber zu dem Schluß, daß nur die Umweltverbände <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
ihre ökologische Effektivität absprechen. So lasse sich, gemäß dem Kommentar<br />
eines Umweltverbandes, mit einer per se unverbindlichen Selbstverpflichtung im Holzschutzmittelbereich<br />
kein Schutz des Verbrauchers und <strong>der</strong> Umwelt erreichen. Es fehle die<br />
Sicherheit vor „schwarzen Schafen“ und Importprodukten aus dem Ausland.<br />
Demgegenüber gehen sowohl die Vertreter <strong>der</strong> Unternehmen als auch die Vertreter <strong>der</strong> Behörden<br />
und <strong>der</strong> nachgelagerten Unternehmen <strong>von</strong> einer aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
gestiegenen Verbrauchersicherheit und zum Teil auch <strong>von</strong> positiven ökologischen Effekten<br />
aus. In Frage gestellt werden diese Effekte nach Angaben einiger Befragter durch ein mangelndes<br />
Bewußtsein <strong>der</strong> Endverbraucher/Anwen<strong>der</strong>. Insgesamt erscheint es somit als wahrscheinlich,<br />
daß aufgrund <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung eine Verbesserung hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Aspekte Verbraucherschutz und Ökologie im Vergleich mit dem Ausgangszustand eingetreten<br />
ist.<br />
c) Vergleich mit Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
Fünf <strong>der</strong> befragten acht Unternehmen geben an, das Gros <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
festgelegten Maßnahmen bereits vor ihrer Abgabe realisiert zu haben. Die Selbstverpflichtung<br />
hat in diesen Fällen aber zu einer Vereinheitlichung geführt. Keiner <strong>der</strong> Befragten bereut<br />
den Abschluß <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung: Fünf Unternehmensvertreter sprechen sich<br />
nach wie vor für die Selbstverpflichtung aus, zwei sind unentschieden, und einer macht diesbezüglich<br />
keine Angaben. Insgesamt wird den unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung geplanten<br />
Maßnahmen aber eine bessere bzw. zumindest gleich gute Schutzwirkung hinsichtlich<br />
Umwelt- und Verbraucherschutz zugesprochen wie bei Abschluß <strong>der</strong> Regelung. Uneinigkeit<br />
herrscht darüber, ob die alleinige Durchführung <strong>der</strong> vielfach ohnehin geplanten Maßnahmen<br />
(ohne Abschluß <strong>der</strong> Selbstverpflichtung) für die Unternehmen wirtschaftlich vorteilhafter<br />
gewesen wäre o<strong>der</strong> nicht. Je drei <strong>der</strong> acht Befragten entscheiden sich für die eine<br />
bzw. an<strong>der</strong>e Antwortvorgabe, in einem Fall erfolgt keine Angabe und einer <strong>der</strong> Befragten<br />
hätte mehr o<strong>der</strong> weniger gleiche wirtschaftliche Auswirkungen erwartet.<br />
Die Mehrheit <strong>der</strong> befragten Behördenvertreter geht insgesamt da<strong>von</strong> aus, daß aufgrund <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung eine gewisse Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand erreicht<br />
werden konnte, was die Aspekte Ökologie und Verbraucherschutz angeht.<br />
49
Einer <strong>der</strong> beiden Befragten aus den Umweltverbänden/-instituten erhofft sich aus den im<br />
Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung vorgenommenen Produktkennzeichnungen eine ökologische<br />
Verbesserung sowie eine höhere Verbrauchersicherheit im Vergleich mit dem Ausgangszustand.<br />
Der zweite Befragte sieht die Selbstverpflichtung insgesamt als unzureichend<br />
an, äußert sich aber nicht explizit zu diesem Punkt.<br />
d) Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Ein eindeutiger Vergleich <strong>der</strong> Effekte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit Wirkungen möglicher Regelungen<br />
im Bereich <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik war rückwirkend kaum durchzuführen. Die<br />
Unternehmen gehen da<strong>von</strong> aus, mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung kurzfristig eine<br />
rechtliche Regelung abgewendet zu haben. Ob und, falls ja, wie schnell eine <strong>der</strong>artige Regelung<br />
umgesetzt worden wäre, kann aus heutiger Sicht nicht mit Sicherheit beurteilt werden.<br />
Ebenfalls keine klare Aussage ergibt sich hinsichtlich <strong>der</strong> Frage, ob sich durch eine rechtliche<br />
Regelung eine effektivere Wirkung hätte erreichen lassen, was den Schutz <strong>der</strong> Verbraucher<br />
bzw. <strong>der</strong> Umwelt angeht. Während dies <strong>von</strong> den Behördenvertretern sowie <strong>von</strong> einem<br />
Umweltverband als wahrscheinlich erachtet wird, herrscht seitens <strong>der</strong> Chemieunternehmen<br />
sowie <strong>der</strong> nachgelagerten Betriebe keine einheitliche Meinung vor. Je zwei <strong>der</strong> acht befragten<br />
Unternehmensvertreter sprechen einer rechtlichen Regelung eine bessere bzw.<br />
schlechtere Schutzwirkung zu als in Folge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung erreicht wurde. Die übrigen<br />
vier Befragten gehen <strong>von</strong> einer mehr o<strong>der</strong> weniger identischen Schutzwirkung aus. Von<br />
den Gesprächspartnern aus den nachgelagerten Unternehmen sind nur wenige <strong>der</strong> Meinung,<br />
daß sich mit einer rechtlichen Regelung eine bessere Wirkung hinsichtlich Umweltund<br />
Verbraucherschutz hätte erreichen lassen als mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
2.4.2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Meinungen <strong>der</strong> befragten Personengruppen kann man das Resümee<br />
ziehen, daß die Selbstverpflichtung bei den meisten Beteiligten Kosten verursacht<br />
hat. Deren Höhe kann aber nur in den seltensten Fällen und dann auch nur vage beziffert<br />
werden. Die Frage, ob die Selbstverpflichtung eine ökonomisch effiziente Lösung darstellt,<br />
kann somit nicht abschließend beantwortet werden.<br />
Die Behördenvertreter gehen in <strong>der</strong> Regel da<strong>von</strong> aus, daß sich im Zuge <strong>der</strong> Biozidgesetzgebung<br />
langfristig ökonomische Vorteile für die Unternehmen einstellen werden, die die Selbstverpflichtung<br />
umgesetzt haben.<br />
b) Marktstruktur<br />
In allen befragten Personengruppen geht man <strong>von</strong> <strong>der</strong> Existenz <strong>von</strong> Unternehmen aus, die<br />
die Selbstverpflichtung nicht umsetzen bzw. unterstützen. Insbeson<strong>der</strong>e dem Handel scheint<br />
eine wichtige Rolle bei <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zuzukommen, <strong>der</strong> er aber<br />
nach Einschätzung vieler Befragter nur unzureichend gerecht wird.<br />
50
Wie sehr die Unternehmen, die die Selbstverpflichtung nicht umsetzen/unterstützen, den<br />
Erfolg <strong>der</strong> freiwilligen Vereinbarung in Frage stellen, kann aufgrund <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung<br />
nicht abschließend beantwortet werden. Notwendig wäre dazu ein Mengenvergleich<br />
<strong>der</strong> in Deutschland abgesetzten Holz- und Bläueschutzmittel, differenziert nach selbstverpflichtungs-konformen<br />
und nicht selbstverpflichtungs-konformen Produkten.<br />
Je zwei Unternehmensvertreter gehen da<strong>von</strong> aus, daß die Firmen, die die Selbstverpflichtung<br />
nicht umsetzen, <strong>der</strong>en Erfolg in hohem bzw. geringem Ausmaß in Frage stellen. Ein<br />
Gesprächspartner ist hinsichtlich dieser Frage unentschieden, drei machen keine Angabe.<br />
Von den befragten Behördenvertretern sehen zwei den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durch<br />
Unternehmen, die die Selbstverpflichtung nicht unterstützen, in hohem Maße in Frage gestellt,<br />
ein weiterer Gesprächspartner nur in geringem Maße. Der vierte <strong>der</strong> befragten Behördenvertreter<br />
ist diesbezüglich unentschieden.<br />
Die im Kommentar eines Umweltverbandes getroffene Aussage, es fehle <strong>der</strong> Schutz vor<br />
schwarzen Schafen und Importprodukten aus dem Ausland, zeigt, daß dieser Verband dem<br />
Problem <strong>der</strong> Trittbrettfahrer eine hohe Bedeutung beimißt.<br />
Insgesamt scheint es am dringlichsten, den Handel verstärkt in die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
einzubinden. Auf diese Weise ließe sich eine stärkere Aufklärung <strong>der</strong> Endverbraucher<br />
erreichen, wodurch gleichzeitig die Relevanz <strong>von</strong> Trittbrettfahrern reduziert werden<br />
dürfte.<br />
2.4.2.3 Weitere Aspekte<br />
a) Innovationswirkungen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Nach Einschätzung <strong>der</strong> Befragten bestehen Innovationen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
im wesentlichen aus Rezepturän<strong>der</strong>ungen <strong>von</strong> Holz- und Bläueschutzmitteln. Der tatsächliche<br />
Innovationsgrad solcher Rezepturän<strong>der</strong>ungen läßt sich jedoch nur schwer beurteilen.<br />
Bei vergleichen<strong>der</strong> Betrachtung <strong>der</strong> Aussagen <strong>der</strong> verschiedenen Personengruppen scheint<br />
es, als ob die Behörden <strong>der</strong> Selbstverpflichtung stärkere Innovationswirkungen zuschreiben<br />
als sich gemäß den Angaben <strong>der</strong> Unternehmensvertreter real eingestellt haben.<br />
b) Sonstige Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Die Hälfte <strong>der</strong> acht befragten Unternehmensvertreter konstatiert, es hätten sich keine<br />
Schwierigkeiten infolge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ergeben. Die übrigen Befragten bemängeln<br />
z.T. Unklarheiten sowie die lange Bearbeitungsdauer beim Registrierungsverfahren für<br />
Bläueschutzmittel, hohe Umsetzungskosten und technische Schwierigkeiten.<br />
Weitere positive o<strong>der</strong> negative Konsequenzen haben sich nach Aussagen <strong>der</strong> befragten<br />
Personen nur in drei Unternehmen eingestellt: angeführt werden positive Imageeffekte, personeller<br />
Aufwand und organisatorischer Aufwand (je zweimal genannt) sowie verbesserte<br />
Behördenkontakte (einmal genannt).<br />
Zwei Behördenvertreter führen neue Erkenntnisse hinsichtlich Praktiken <strong>der</strong> Biozidverwendung/-deklaration<br />
in Deckschichten <strong>von</strong> Beschichtungssystemen als weitere Konsequenzen<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung an.<br />
51
Ein Gespräch mit dem Vertreter des Umweltverbandes brachte die Kritik zum Ausdruck, die<br />
Selbstverpflichtung schreibe quasi das RAL-Verfahren zur Güteüberwachung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln<br />
fest und entspreche damit nicht den Anfor<strong>der</strong>ungen, die <strong>der</strong> Umweltverband an<br />
eine Selbstverpflichtung in diesem Bereich stellen würde. Weiterhin sei die Selbstverpflichtung<br />
zumindest mitverantwortlich für die langen Übergangsfristen bis zur Umsetzung <strong>der</strong><br />
Biozidgesetzgebung.<br />
c) Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Der Monitoring-Bericht des VCI für 1999 hält bezüglich <strong>der</strong> zulassungspflichtigen Holzschutzmittel<br />
fest, daß auf Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Deutschen Bauchemie mehr als 95% dieser Produkte<br />
entfallen. Mit RAL-Gütezeichen sind 246 Produkte gekennzeichnet, was laut Bericht<br />
einem Anteil am potentiellen Gesamtmarkt <strong>von</strong> etwa 70% entsprechen dürfte.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Bläueschutzmittel kommt <strong>der</strong> Bericht zu dem Schluß, daß nach einer Abschätzung<br />
nach dem Marktanteil ca. 35% <strong>der</strong> Produkte nach dem VdL-Verfahren beim Umweltbundesamt<br />
angemeldet sind, 15% über die RAL-Gütegemeinschaft und 30% we<strong>der</strong> nach<br />
dem VdL-Verfahren noch über die Gütegemeinschaft registriert sind. Weitere 20% sollen<br />
nach dem Vorliegen noch fehlen<strong>der</strong> Rahmenrezepturen registriert werden.<br />
d) Arbeit des Verbandes<br />
Je zwei <strong>der</strong> acht befragten Unternehmensvertreter konstatieren Zielkonflikte mit dem VdL<br />
bzw. <strong>der</strong> Deutschen Bauchemie bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung. Die Konflikte<br />
mit dem VdL werden dabei auf die Tatsache zurückgeführt, daß dieser sich nicht den bestehenden<br />
Gütesicherungsverfahren beim RAL anschließen wollte. Die Kritik an <strong>der</strong> Deutschen<br />
Bauchemie wird in einem Fall damit begründet, daß <strong>der</strong> Verband versucht habe, eine Monopolstellung<br />
zu erlangen bzw. selbst eine gesetzliche Regelung zu konzipieren. Ein weiterer<br />
Befragter konstatiert Interessenkonflikte seines Unternehmens mit <strong>der</strong> Gütegemeinschaft<br />
Holzschutzmittel. Die unterschiedliche Beurteilung <strong>der</strong> Fachverbände durch die Unternehmen<br />
dürfte u.a. daraus resultieren, daß jeweils vier Unternehmen befragt wurden, die sich<br />
eher dem VdL bzw. <strong>der</strong> Deutschen Bauchemie verbunden fühlen.<br />
Die Befragung zeigt hier, daß diesbezügliche Konflikte auf Gegensätze zwischen verschiedenen<br />
Produktbereichen (Holzschutzmittel vs. Bläueschutzmittel als Teil eines Beschichtungssystems)<br />
beruhen, die wie<strong>der</strong>um auf unterschiedliche Produkt-„Philosophien“ zurückzuführen<br />
sind; dies erschwerte die Abgabe einer gemeinsamen Selbstverpflichtung. Hinzu<br />
kommt, daß die Deutsche Bauchemie zunächst eine rechtliche Regelung des Holzschutzmittel-Sektors<br />
angestrebt hat, während <strong>der</strong> VdL <strong>von</strong> Anfang an eine freiwillige Regelung in<br />
Gestalt einer Selbstverpflichtung befürwortet hat.<br />
Von seiten <strong>der</strong> Behörden sowie <strong>der</strong> nachgelagerten Unternehmen wird insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong><br />
VdL kritisiert. Als Kritikpunkte werden angeführt, daß sich <strong>der</strong> VdL auch nach <strong>der</strong> entsprechenden<br />
Erweiterung des Verfahrens nicht dem RAL angeschlossen habe, daß <strong>der</strong> Aspekt<br />
<strong>der</strong> Filmschutzmittel nicht geregelt und die Überwachung/Gütesicherung im Rahmen des<br />
Registrierungsverfahrens zu wenig anspruchsvoll ausgefallen sei. Allgemein wird das nicht<br />
abgestimmte Auftreten <strong>der</strong> beiden <strong>Verbände</strong> in <strong>der</strong> Öffentlichkeit kritisiert. In dieser externen<br />
Wahrnehmung scheint zum Tragen zu kommen, daß die Bestrebung <strong>der</strong> Industrie, eigenver-<br />
52
antwortlich zu handeln, durch interne Unstimmigkeiten und mangelnde Kommunikation bei<br />
<strong>der</strong> Ausarbeitung nachhaltig überschattet wurde.<br />
Ein Ansprechpartner aus <strong>der</strong> Gruppe <strong>der</strong> nachgelagerten Unternehmen konstatiert, nicht mit<br />
in die Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eingebunden gewesen zu sein, obwohl dies<br />
grundsätzlich sehr positiv gesehen worden wäre. Von zwei Gesprächspartnern wird eine unzureichende<br />
Informationspolitik <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie moniert; in einem<br />
Fall wird diese Kritik direkt an den VdL gerichtet.<br />
Für die Zukunft scheint es angeraten, bei <strong>der</strong> Konzeption <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> durch<br />
mehrere <strong>Verbände</strong> zunächst einen internen Konsens zu erzielen, bevor man in die Verhandlung<br />
mit externen Gruppen geht. Fraglich ist, ob es sinnvoll ist, <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in<br />
Bereichen zu konzipieren, wo sich ein <strong>der</strong>artiger inhaltlicher Konsens – aus welchen Gründen<br />
auch immer – nicht erzielen läßt. Aus den Untersuchungsergebnissen läßt sich ableiten,<br />
daß es <strong>von</strong> externen Anspruchsgruppen als negativ empfunden wird, wenn eine einseitige<br />
Zusage <strong>der</strong> Industrie <strong>von</strong> dieser nicht uneingeschränkt und einheitlich vertreten wird.<br />
Weiterhin wird es für sinnvoll erachtet, bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung stärker<br />
nachgelagerte Unternehmen – wie z.B. den Handel – einzubinden. Es erscheint aufgrund <strong>der</strong><br />
Untersuchungsergebnisse sehr wahrscheinlich, daß sich auf diese Weise <strong>der</strong> Erfolg <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung stark verbessern läßt.<br />
3. Zusammenfassendes Fazit zu den vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
3.1 Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen<br />
Das Reduktionsziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung konnte bereits im Jahre 2000 erreicht werden.<br />
Die Erfüllung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wird vor allem <strong>von</strong> den Unternehmen sichergestellt, die<br />
im Energieausschuß des VCI zusammengeschlossen sind und den Hauptanteil des Energieverbrauchs<br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ausmachen. Dieser relativ kleine Kreis <strong>von</strong> tatsächlich<br />
betroffenen Unternehmen dürfte wesentlich dafür sein, daß das Ziel so frühzeitig erreicht<br />
worden ist.<br />
Die meisten Maßnahmen, die im Rahmen dieser Selbstverpflichtung durchgeführt worden<br />
sind, waren für die Unternehmen wirtschaftlich rentabel, da sie zugleich zu Kostensenkungen<br />
führten; viele da<strong>von</strong> wurden unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführt.<br />
Zusätzlich hat die Selbstverpflichtung in einigen Fällen Investitionsprojekte mit einer längeren<br />
Amortisationszeit ermöglicht. Darüber hinaus besteht eine Hauptwirkung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
in <strong>der</strong> Auslösung zahlreicher Verän<strong>der</strong>ungen in den Betriebsabläufen und Managementprozessen<br />
<strong>von</strong> Unternehmen, bei denen verstärkt auf Fragen <strong>der</strong> Energieeinsparung<br />
und Ressourcenschonung geachtet wurde; <strong>der</strong> CO2-Reduktionseffekt dieser Maßnahmen<br />
läßt sich jedoch nur schwer quantifizieren.<br />
Ein kritischer Punkt ist bei dieser Selbstverpflichtung die Dokumentation <strong>der</strong> getroffenen<br />
Maßnahmen, die <strong>von</strong> mehreren Seiten als noch nicht transparent genug betrachtet wird. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
für die Umweltverbände gehört zur ökologischen Effektivität auch <strong>der</strong> Nachweis,<br />
daß und wie sich durch die Selbstverpflichtung die Investitionsentscheidungen <strong>von</strong> Unter-<br />
53
nehmen verän<strong>der</strong>t haben. Durch die gegenwärtige Berichterstattung werde das aber nicht<br />
ausreichend transparent.<br />
3.2 Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong><br />
Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
In den Großunternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ist die Zielerreichung und die Erarbeitung<br />
des gefor<strong>der</strong>ten Basisdatensatzes vermutlich gewährleistet. Die Umsetzung in kleinen und<br />
mittleren Unternehmen schreitet ebenfalls voran, allerdings muß vor dem Hintergrund <strong>der</strong><br />
Untersuchungsergebnisse die Zielerreichung dort noch als unsicher bezeichnet werden.<br />
Unternehmen berichten <strong>von</strong> Problemen sowohl bei <strong>der</strong> Erarbeitung des Basisdatensatzes als<br />
auch bei <strong>der</strong> Herstellung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit.<br />
Manche Unternehmen fühlen sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung überhaupt nicht betroffen, bei<br />
an<strong>der</strong>en herrscht Unsicherheit über den Umfang <strong>der</strong> zu leistenden Arbeiten. Beklagt werden<br />
außerdem des öfteren hohe Kosten und eine mangelnde Hilfestellung <strong>von</strong> seiten des Verbandes.<br />
Die Problematik <strong>der</strong> Selbstverpflichtung liegt darin, daß sich hier mehrere Zielsetzungen<br />
überlagern: Auf <strong>der</strong> einen Seite geht es um die Erarbeitung eines Mindestdatensatzes. Darüber<br />
hinaus ist dieser Datensatz aber nur eine Vorstufe für das eigentliche Ziel <strong>der</strong> Aussagefähigkeit,<br />
die durch die Selbstverpflichtung erreicht werden soll. Gerade hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Kommunikation und Akzeptanz dieses Zieles bestehen noch erhebliche Verbesserungspotentiale<br />
bei den Unternehmen und beim Verband.<br />
Sowohl <strong>von</strong> den befragten Behördenvertretern als auch <strong>von</strong> den befragten Umweltverbänden<br />
wird die Selbstverpflichtung überwiegend kritisch beurteilt: <strong>der</strong> vorgesehene Datensatz wird<br />
als unzureichend angesehen und die erhobenen Daten seien aufgrund <strong>der</strong> Erhebungsmethoden<br />
nicht ausreichend valide.<br />
3.3 Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach dem in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung beschriebenen<br />
System wird aller Voraussicht nach termingemäß erreicht.<br />
Über das Ziel <strong>der</strong> Informationsweitergabe hinaus kann da<strong>von</strong> ausgegangen werden, daß<br />
durch die Substitution <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln, die als beson<strong>der</strong>s umweltbelastend eingestuft<br />
worden sind, eine ökologische Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand eingetreten<br />
ist. Dazu war insbeson<strong>der</strong>e hilfreich, daß <strong>der</strong> Gesamtverband <strong>der</strong> Deutschen Textilveredlungsindustrie<br />
(TVI) seinerseits eine entsprechende Selbstverpflichtung verabschiedet hat,<br />
die den TVI-Mitgliedsfirmen empfiehlt, nur noch Mittel zu verwenden, die <strong>von</strong> den Herstellern<br />
nach dem Konzept <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eingestuft wurden, und dabei nach Möglichkeit<br />
solche zu bevorzugen, die weniger gewässerrelevant sind.<br />
Alle befragten Parteien sehen die Selbstverpflichtung als Schritt in die richtige Richtung an.<br />
Die Behörden haben aber den Wunsch, in Zukunft zusätzliche, aussagekräftigere Daten zu<br />
erhalten. Moniert wird in diesem Zusammenhang, daß eine durchgehende Umsetzungskon-<br />
54
trolle fehle, daß Produkte anstelle <strong>von</strong> Einzelsubstanzen klassifiziert würden und daß die<br />
Einstufung nicht durch eine neutrale Stelle stattfinde.<br />
3.4 Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und<br />
holzverfärbende Organismen<br />
Das Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wurde innerhalb <strong>der</strong> vorgesehenen Zeit nicht erreicht. Insgesamt<br />
muß die Zielerreichung noch als unsicher bezeichnet werden: es ist noch nicht absehbar,<br />
ob alle betroffenen Unternehmen die gefor<strong>der</strong>ten Einstufungen und Prüfverfahren<br />
tatsächlich durchgeführt haben bzw. durchführen werden.<br />
Kritisch für die Verabschiedung und Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung war das nicht abgestimmte<br />
Vorgehen <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong>. Diesbezüglich wurde sowohl <strong>von</strong> den Unternehmen<br />
als auch <strong>von</strong> den Behörden Kritik geäußert. Die Interessen bezüglich einer Regelung<br />
sowie die Produktpolitiken <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> und ihrer Unternehmen waren außerordentlich<br />
unterschiedlich und heterogen.<br />
Die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung hängt stark <strong>von</strong> <strong>der</strong> Unterstützung durch den Fachhandel<br />
ab. Hier werden <strong>von</strong> allen Beteiligten noch große Optimierungspotentiale gesehen.<br />
Der Einbezug des Fachhandels wird als noch nicht ausreichend eingeschätzt.<br />
55
V. Gesamtbewertung und Schlußfolgerungen<br />
Die vorliegende Untersuchung sollte einerseits die ökologische Effektivität und ökonomische<br />
Effizienz <strong>der</strong> bestehenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie untersuchen und<br />
an<strong>der</strong>erseits Aufschluß darüber geben, welche Faktoren geprüft bzw. welche Voraussetzungen<br />
gegeben sein müssen, damit eine Selbstverpflichtung als erfolgreich angesehen werden<br />
kann.<br />
In diesem Abschnitt werden zunächst die untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> hinsichtlich<br />
ökologischer Effektivität und ökonomischer Effizienz abschließend bewertet. Daran anschließend<br />
werden aus den Ergebnissen einige Schlußfolgerungen für Eckpunkte <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
abgeleitet, die bei Konzeption und Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> berücksichtigt<br />
werden sollten.<br />
1. Effektivität und Effizienz <strong>der</strong> im Detail untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
1.1 Ökologische Effektivität<br />
1.1.1 Zielerreichung<br />
In den Fällen CO2 und Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln kann da<strong>von</strong> ausgegangen werden,<br />
daß das vorgesehene Ziel erreicht ist bzw. wird.<br />
Bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen bereitet schon die Erarbeitung<br />
des Basisdatensatzes manchen Firmen Schwierigkeiten; daß das weitergehende<br />
Ziel <strong>der</strong> Aussagefähigkeit <strong>von</strong> allen betroffenen Unternehmen tatsächlich erreicht wird, muß<br />
auf Basis <strong>der</strong> Untersuchungsergebnisse als unsicher bezeichnet werden.<br />
Auch bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln ist noch nicht abzusehen,<br />
ob tatsächlich das Ziel <strong>von</strong> allen betroffenen Unternehmen erreicht bzw. die Selbstverpflichtung<br />
umgesetzt wird. Innerhalb <strong>der</strong> vorgesehenen Zeit wurde das Ziel nicht erreicht.<br />
1.1.2 Verän<strong>der</strong>ung gegenüber einem Entwicklungspfad ohne Selbstverpflichtung<br />
In den Fällen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen, <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
zu Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln und <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holzund<br />
Bläueschutzmitteln gab es z.T. bereits entsprechende Maßnahmen <strong>von</strong> führenden Unternehmen,<br />
die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gehen aber vom Anspruch her oft weiter als die entsprechenden<br />
Maßnahmen <strong>der</strong> Unternehmen. Außerdem bezieht sich die Selbstverpflichtung<br />
auch auf solche Unternehmen, die bisher keine Maßnahmen eingeleitet haben.<br />
Im Falle <strong>der</strong> CO2-Selbstverpflichtung läßt sich feststellen, daß große Investitionen getätigt<br />
wurden, zu einem großen Teil auch unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Selbstverpflichtung. Die Selbstverpflichtung<br />
hat über diese Investitionen hinaus zusätzlich einige Projekte ermöglicht, die eine<br />
längere Amortisationszeit aufwiesen als sie in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie üblich sind. Außerdem<br />
wurden zahlreiche, für sich genommen jeweils kleine, Verän<strong>der</strong>ungen in den Betriebsabläufen<br />
und Managementprozessen <strong>von</strong> Unternehmen ausgelöst und geför<strong>der</strong>t (grö-<br />
56
ßeres Engagement, genauere Analyse <strong>von</strong> Energieprozessen, neue Management- und<br />
Kommunikationsinstrumente etc.), die in <strong>der</strong> Summe eine hohe Bedeutung haben können. In<br />
diesen Fällen ist es aber schwierig, die zusätzlich erreichte CO2-Reduktion zu quantifizieren.<br />
1.1.3 Vergleich mit Wirkungen möglicher Regelungen <strong>der</strong> staatlichen Umweltpolitik<br />
Die Informationslage ist nicht ausreichend, um hier ein Urteil abgeben zu können. Einerseits<br />
war die alternativ diskutierte rechtliche Regelung meist zu unscharf, um ihre potentiellen Wirkungen<br />
abzuschätzen, an<strong>der</strong>erseits ist auch in den Fällen, in denen eine relativ klare umweltpolitische<br />
Alternative im Raum stand, die Reaktion <strong>der</strong> Unternehmen und dementsprechend<br />
die umweltpolitische Wirksamkeit <strong>der</strong> staatlichen Instrumente nur sehr unvollkommen<br />
abzuschätzen.<br />
1.2 Ökonomische Effizienz<br />
Die Erkenntnisse, die im Rahmen dieser Studie zu dieser Frage gewonnen werden konnten,<br />
müssen in Betracht ziehen, daß die Erhebung <strong>von</strong> zuverlässigen Daten sich vor allem in<br />
zweierlei Hinsicht als schwierig herausgestellt hat: bei <strong>der</strong> Erhebung <strong>von</strong> Kosten, die durch<br />
die Umsetzung einer Selbstverpflichtung entstanden sind, und bei <strong>der</strong> Erhebung <strong>von</strong> Daten<br />
und Einschätzungen zu möglichen Referenzentwicklungen.<br />
In vielen Fällen konnten die Befragten nur sehr ungefähre Schätzungen abgeben, insbeson<strong>der</strong>e<br />
was die Kosten und Erträge <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> sowie die Wirkungen alternativer<br />
umweltpolitischer Instrumente betrifft. Hinsichtlich <strong>der</strong> Erhebung <strong>von</strong> Kostendaten ist dieses<br />
Problem vor allem auf zwei Ursachen zurückzuführen: Zum einen haben die Unternehmen<br />
bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung die Kosten dafür nicht <strong>von</strong> vornherein separat<br />
erfaßt, daher ist es ex post schwierig, zu zuverlässigen Daten zu kommen. Zum zweiten<br />
wurden teilweise die Kostendarstellungen aus Gründen des Geheimnisschutzes nicht offengelegt.<br />
Sowohl auf seiten <strong>der</strong> Unternehmen als auch auf seiten <strong>der</strong> Behörden und <strong>Verbände</strong> konnten<br />
aus den genannten Gründen praktisch keine zuverlässigen Schätzungen über die angefallenen<br />
Kosten <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> bzw. die Kosten alternativer umweltpolitischer Instrumente<br />
erhoben werden.<br />
Lediglich im Falle <strong>der</strong> CO2-Selbstverpflichtung geht die überwiegende Mehrheit <strong>der</strong> Unternehmen<br />
da<strong>von</strong> aus, daß die durchgeführten Maßnahmen wirtschaftlich rentabel waren und<br />
rechtliche Regelungen (Öko-Steuer o<strong>der</strong> Wärmenutzungsverordnung) teurer gekommen wären.<br />
Dies ist ein gewisses Indiz dafür, daß diese Selbstverpflichtung für die chemische Industrie<br />
eine kostengünstige Lösung darstellt. In allen an<strong>der</strong>en Fällen wird zwar ebenfalls da<strong>von</strong><br />
ausgegangen, daß rechtliche Regelungen für die Unternehmen höhere Belastungen bedeutet<br />
hätten als die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung, aber dies kann meist nicht quantifiziert<br />
werden.<br />
1.3 Weitere Aspekte<br />
Unter den weiteren Aspekten, die – zumindest potentiell – für die Beurteilung <strong>von</strong> Effektivität<br />
und Effizienz eine wichtige Rolle spielen können, sind vor allem die Innovationswirkungen<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und sonstige Konsequenzen, wie z.B. Imageeffekte, zu nennen.<br />
57
Wenn sich über <strong>Selbstverpflichtungen</strong> das Branchen- bzw. Unternehmensimage verbessert<br />
o<strong>der</strong> in den Unternehmen Innovationen induziert werden, so kann dies indirekt auch die ökonomischen<br />
Effekte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung verän<strong>der</strong>n – beispielsweise dann, wenn Verbraucher<br />
die Bestrebungen <strong>der</strong> Industrie durch ihr Einkaufsverhalten honorieren o<strong>der</strong> sich durch<br />
Innovationen Einspareffekte erzielen ließen.<br />
Die untersuchten Fallbeispiele zeigen allerdings, daß diese indirekten Wirkungen eine eher<br />
untergeordnete Rolle spielen; im Vor<strong>der</strong>grund stand die Abwendung einer rechtlichen Regelung.<br />
Innovationen wurden durch die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nur in wenigen Fällen angeregt<br />
und werden auch <strong>von</strong> Verbandsvertretern nicht als zentraler Bestandteil einer Selbstverpflichtung<br />
bzw. als entscheidende Wirkung einer Selbstverpflichtung angesehen. Auch <strong>der</strong><br />
Imageeffekt steht gegenüber <strong>der</strong> Abwendung rechtlicher Regelungen im Hintergrund.<br />
1.4 Fazit zur Effektivität und Effizienz <strong>der</strong> untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Die genannten Probleme bei <strong>der</strong> Datenerhebung schränken die Beurteilung <strong>der</strong> Effektivität<br />
und Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ein. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite ist festzuhalten, daß dieses<br />
Fehlen <strong>von</strong> sicheren Datengrundlagen in gleicher Weise bei <strong>der</strong> Folgenabschätzung an<strong>der</strong>er<br />
umweltpolitischer Instrumente auftritt; daher kann aus <strong>der</strong> fehlenden Datengrundlage<br />
für die Beurteilung <strong>der</strong> Wirkungen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nicht zwingend auf die Übero<strong>der</strong><br />
Unterlegenheit an<strong>der</strong>er Instrumente geschlossen werden.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> unzureichenden Daten und Einschätzungen kann daher – mit Ausnahme <strong>der</strong><br />
Aussagen zur Zielerreichung – kein generelles Urteil über die Effektivität und Effizienz <strong>der</strong><br />
vier untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong> abgegeben werden.<br />
Damit ist allerdings keine Bewertung über die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im allgemeinen und ihre<br />
Rolle im politischen und gesamtwirtschaftlichen Kontext gesprochen; dies war auch nicht die<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Studie und aufgrund ihres Designs nicht möglich. Die Ergebnisse hinsichtlich<br />
Effektivität und Effizienz zeigen allerdings, daß sowohl ein positives als auch ein negatives<br />
Urteil hierzu einer erheblichen Verbesserung <strong>der</strong> Datenbasis bedarf.<br />
Auch frühere Studien, die in Abschnitt II.2.1 referiert sind, haben bei <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Kosteneffizienz<br />
kaum Hinweise für die ökonomische Über- o<strong>der</strong> Unterlegenheit <strong>der</strong> untersuchten<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> gefunden (so z.B. die ELNI-Studie). Soweit Vergleiche mit alternativen<br />
Referenzpfaden vorgenommen worden sind (z.B. KNEBEL/WICKE/MICHAEL), waren diese<br />
stark <strong>von</strong> Plausibilitätsüberlegungen abhängig.<br />
Unabhängig <strong>von</strong> dieser Frage lassen sich aber aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Untersuchung wesentlich<br />
präzisere Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit des Verbandes mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
ableiten als sie auf Basis bisheriger Studien möglich gewesen wären. Die Antworten<br />
und Einschätzungen <strong>der</strong> Befragten sowie die Erhärtung <strong>der</strong> Befragungsergebnisse in<br />
den Workshops und damit die Organisation <strong>der</strong> Studie als gemeinsamer Lernprozeß erlauben<br />
die Definition handlungsleiten<strong>der</strong> Eckpunkte, die beim Einsatz und bei <strong>der</strong> Ausgestaltung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu beachten sind.<br />
58
2. Der Prozeß <strong>der</strong> Entscheidungsfindung: Eckpunkte <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
2.1 Allgemeine Bemerkungen<br />
Aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Grobevaluation und <strong>der</strong> Detailevaluation <strong>von</strong> vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
lassen sich wichtige Bedingungen bzw. Faktoren ableiten, die geprüft werden sollten,<br />
um den Erfolg einer Selbstverpflichtung zu unterstützen. Erfolg wird dabei in dem Sinne verstanden,<br />
daß die Selbstverpflichtung das in ihr nie<strong>der</strong>gelegte Ziel erreicht, <strong>von</strong> möglichst allen<br />
Beteiligten (Unternehmen, Verband, Behörden, Umweltverbände und an<strong>der</strong>e Anspruchsgruppen)<br />
als wichtiger Beitrag zur Lösung eines Umweltproblems angesehen wird, und das<br />
Ziel in einer möglichst kostengünstigen Weise erreicht.<br />
Die Studie hat gezeigt, daß dieser Erfolg nicht „naturgegeben“ ist, d.h. er ergibt sich nicht<br />
selbstverständlich aus <strong>der</strong> Anwendung des Instrumentes Selbstverpflichtung. Es wird vorgeschlagen,<br />
den Prozeß <strong>der</strong> Entscheidungsfindung, ob in einem speziellen Fall eine Selbstverpflichtung<br />
eingegangen und wie sie gestaltet werden soll, systematisch zu strukturieren. Aus<br />
<strong>der</strong> Sicht des Instituts scheint es sinnvoll, eine Liste <strong>von</strong> Bedingungen und Faktoren zu entwickeln,<br />
<strong>der</strong>en Ausprägung vor bzw. während eines Verhandlungsprozesses bezüglich einer<br />
Selbstverpflichtung zu prüfen bzw. zu definieren wäre, um die Erfolgsaussichten abzuschätzen<br />
bzw. zu verbessern.<br />
Diese Eckpunkte <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> lassen sich wie<strong>der</strong>um anhand des Rasters <strong>der</strong><br />
Untersuchungsaspekte darstellen.<br />
2.1 Zur ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Im Zusammenhang mit <strong>der</strong> ökologischen Effektivität <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im Sinne <strong>der</strong><br />
Zielerreichung steht <strong>der</strong> Inhalt <strong>der</strong> Selbstverpflichtung und hierbei die Klarheit <strong>der</strong> Zielsetzung<br />
im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Hier ist zu klären, ob <strong>der</strong> spezifische Sachverhalt sich für eine Selbstverpflichtung mit eindeutigen,<br />
klaren Zielsetzungen eignet, die gegenüber den betroffenen Unternehmen kommunizierbar<br />
sind. In diesem Zusammenhang findet auch die Definition und Abgrenzung des<br />
zugrundeliegenden Sachverhalts bzw. Umweltproblems statt. Die Untersuchung hat gezeigt,<br />
daß sich für die Kommunikation <strong>von</strong> Zielen gegenüber den Unternehmen meß- und operationalisierbare<br />
Inhalte einer Selbstverpflichtung eher eignen als nur allgemein formulierte<br />
Zielangaben.<br />
Deutlich wird dies an <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen, bei<br />
<strong>der</strong> sich im Grunde mehrere Zielsetzungen überlagern: Auf <strong>der</strong> einen Seite geht es um die<br />
Erarbeitung eines Mindestdatensatzes, wie er in <strong>der</strong> Selbstverpflichtung aufgeführt ist. Darüber<br />
hinaus ist dieser Datensatz aber nur eine Vorstufe für das eigentliche Ziel <strong>der</strong> Aussagefähigkeit,<br />
die durch die Selbstverpflichtung erreicht werden soll. Gerade hinsichtlich <strong>der</strong><br />
Kommunikation und Akzeptanz dieses Zieles bestehen noch erhebliche Verbesserungspotentiale<br />
bei den Unternehmen und beim Verband.<br />
59
2.2 Zur ökonomischen Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
2.2.1 Ökonomische Kosten und Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
a) Ökonomische Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für Unternehmen<br />
Hier ist abzuschätzen, welche Kosten und Erträge eine Selbstverpflichtung bei den betroffenen<br />
Unternehmen verursacht. Ökonomische Konsequenzen für die Unternehmen dürften zu<br />
den relevantesten Erfolgsfaktoren <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gehören.<br />
Der größte Anreiz für die Mitgliedsunternehmen des VCI, <strong>Selbstverpflichtungen</strong> umzusetzen,<br />
dürfte dann bestehen, wenn damit gegenüber dem umweltpolitischen Ausgangszustand ein<br />
absoluter ökonomischer Vorteil für die Firmen verbunden ist.<br />
Im Falle eines relativen wirtschaftlichen Vorteils fallen zwar Kosten an, diese sind aber geringer<br />
als bei einem sonst zu erwartenden Alternativzustand. An<strong>der</strong>s ausgedrückt wird durch<br />
die Selbstverpflichtung eine für die Industrie wirtschaftlich (noch) nachteiligere Regelung abgewendet.<br />
Während im Falle absoluter wirtschaftlicher Vorteile ein unmittelbarer Anreiz für<br />
die Betriebe besteht, die Maßnahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung umzusetzen, gilt es im zweiten<br />
Fall, den Unternehmen die Sinnhaftigkeit <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung klar zu kommunizieren.<br />
Dies ist umso mehr erfor<strong>der</strong>lich, als <strong>der</strong> VCI keine Möglichkeit hat, direkt auf die<br />
Unternehmen durchzugreifen und sie zur Einhaltung einer Selbstverpflichtung anzuhalten.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung geführten Gespräche läßt sich<br />
konstatieren, daß die relevanten umweltpolitischen Alternativen in den Unternehmen oft zu<br />
wenig bekannt waren, um als Anreiz für die Umsetzung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu dienen.<br />
Bemerkenswert ist auch, daß in den befragten Unternehmen <strong>der</strong> Chemieindustrie nur in relativ<br />
wenigen Fällen Kenntnisse über die Umsetzungskosten <strong>der</strong> jeweiligen <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
vorhanden waren, respektive geäußert wurden. Sofern diesbezüglich Angaben gemacht<br />
wurden, handelte es sich in <strong>der</strong> Regel um grobe Schätzwerte.<br />
Allgemein dürfte gelten: Je höher die Kosten für die Umsetzung einer Selbstverpflichtung<br />
und je geringer bzw. je unbestimmter die Kosten alternativer umweltpolitischer Maßnahmen,<br />
desto geringer ist die Bereitschaft und die Chance zur Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Zusätzlich ist die beson<strong>der</strong>e Struktur <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zu bedenken, die dazu führt,<br />
daß die Kostenbelastungen <strong>der</strong> Unternehmen möglicherweise sehr unterschiedlich ausfallen.<br />
Um kleine und mittlere Unternehmen nicht gegenüber <strong>der</strong> Großindustrie zu benachteiligen,<br />
sollte geprüft werden, welche Unternehmen durch eine Selbstverpflichtung gebunden werden<br />
und ob die Umsetzung <strong>der</strong> geplanten Maßnahmen den Möglichkeiten dieser Betriebe<br />
entspricht.<br />
b) Ökonomische Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für den Verband<br />
Ebenso sind für den Verband die Kosten zu berücksichtigen, die bei ihm im Zusammenhang<br />
mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung anfallen. Da letztendlich <strong>der</strong> Verband gegenüber <strong>der</strong> Politik und<br />
<strong>der</strong> Öffentlichkeit für die Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung verantwortlich ist, muß er selbst<br />
auch entsprechende Ressourcen einsetzen, um die Umsetzung zu gewährleisten. Die Prüfung<br />
<strong>der</strong> übrigen Eckpunkte kann hier bereits eine erste Schätzung <strong>der</strong> anfallenden Gesamt-<br />
60
kosten für den Verband ermöglichen. Allgemein dürfte gelten: Je kritischer die Umsetzungschancen,<br />
desto höher werden die Kosten für den Verband sein, die Umsetzung sicherzustellen.<br />
Diese Verbandskosten sind – aus Sicht des Verbandes und <strong>der</strong> Unternehmen <strong>der</strong><br />
<strong>chemischen</strong> Industrie – nur zu rechtfertigen, wenn die Vorteile einer Selbstverpflichtung für<br />
die gesamte Industrie gegenüber einer rechtlichen Regelung deutlich überwiegen.<br />
2.2.2 Marktstruktur<br />
a) Heterogenität <strong>der</strong> betroffenen Unternehmen<br />
Hier ist zu prüfen, wie heterogen die betroffenen Unternehmen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen<br />
und ihres Interesses an einer Umsetzung sind. Die Unterschiedlichkeit bzgl. Kompetenzen<br />
und Bereitschaft kann sich aus <strong>der</strong> Unternehmensgröße, den Produkten, den<br />
Märkten, etc. ergeben. Je heterogener die Interessenlage und Kompetenz, desto kritischer<br />
dürften die Verhandlung und die Umsetzung sein.<br />
Das Problem <strong>der</strong> Heterogenität <strong>von</strong> Firmen bzw. <strong>Verbände</strong>n und <strong>der</strong>en Interessen kommt<br />
sowohl im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen als auch<br />
bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln deutlich zum Ausdruck: Im ersten<br />
Fall bringen die 1700 Unternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie sehr verschiedene Voraussetzungen<br />
mit, auch was den Umsetzungswillen und die Umsetzungsmöglichkeiten einer<br />
solchen Selbstverpflichtung angeht. Bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln<br />
waren die Produktpolitiken und umweltpolitischen Überzeugungen <strong>der</strong> Beteiligten<br />
sehr verschieden, was sich unmittelbar nachteilig auf die Konzeption und Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung auswirkt.<br />
b) Anzahl <strong>der</strong> betroffenen Unternehmen<br />
Bei diesem Faktor ist die Frage angesprochen, wieviele Unternehmen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Umsetzung<br />
einer Selbstverpflichtung faktisch betroffen sind bzw. wären, unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> formalen<br />
Betroffenheit aufgrund <strong>der</strong> Verbandsmitgliedschaft. Die untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
zeigen, daß die Umsetzung umso schwieriger und komplexer ist, je mehr Unternehmen sich<br />
an <strong>der</strong> Umsetzung beteiligen müssen, um das gesetzte Ziel zu erreichen.<br />
Diesbezüglich stellen die CO2-Selbstverpflichtung und die Selbstverpflichtung zur Erfassung<br />
und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen zwei Pole dar: Obwohl sich beide Vereinbarungen an alle Mitgliedsunternehmen<br />
des VCI richten, spielen für die Umsetzung <strong>der</strong> CO2-Selbstverpflichtung<br />
faktisch die Unternehmen des Energieausschusses die Hauptrolle. Dagegen muß die<br />
Selbstverpflichtung zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen auch tatsächlich <strong>von</strong> allen<br />
1700 Unternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie umgesetzt werden.<br />
c) Wertschöpfungskette und Marktgegebenheiten<br />
Die Bedeutung, die vor- und nachgelagerte Unternehmen sowie die Marktgegebenheiten<br />
(internationale Dimension, Organisationsgrad) für die Umsetzung einer Selbstverpflichtung<br />
haben, ist ebenfalls zu klären.<br />
61
Verschiedene Umweltprobleme lassen sich nicht allein innerhalb eines Fachverbandes bzw.<br />
innerhalb <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie behandeln und erfor<strong>der</strong>n die Mitarbeit vor- und nachgelagerter<br />
Unternehmen.<br />
Dies ist deutlich im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln und<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln: Bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Textilhilfsmitteln<br />
ist <strong>der</strong> Einbezug <strong>der</strong> Textilveredler weitgehend gelungen, während im Falle <strong>der</strong><br />
Holz- und Bläueschutzmittel die Integration des hier sehr wichtigen (Fach-)Handels nur unzureichend<br />
erfolgte.<br />
Auch die Probleme bei <strong>der</strong> – nur in <strong>der</strong> Grobevaluation behandelten – Selbstverpflichtung zur<br />
Reduktion <strong>von</strong> EDTA sind darauf zurückzuführen, daß die betroffenen Unternehmen an<strong>der</strong>er<br />
Branchen nicht bzw. zu wenig berücksichtigt worden sind. Generell gilt: eine Selbstverpflichtung<br />
ist umso einfacher umzusetzen, je geringer die Bedeutung vor- und nachgelagerter<br />
Unternehmen für ihre Umsetzung ist. Umgekehrt ist zu prüfen, wie bei einer hohen Bedeutung<br />
an<strong>der</strong>er Unternehmen und Branchen <strong>der</strong>en adäquater Einbezug gewährleistet werden<br />
kann.<br />
Die Gegebenheiten des Marktes sind ebenfalls ein für den Erfolg <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
relevanter Aspekt. Im Zuge <strong>der</strong> Globalisierung gewinnt dabei auch die internationale Dimension<br />
zunehmend an Bedeutung. Eine Selbstverpflichtung, <strong>der</strong>en Umsetzung für die betroffenen<br />
Verbandsunternehmen zu wesentlichen Wettbewerbsnachteilen im Vergleich zu ihren<br />
internationalen Mitbewerbern führt, stellt den Erfolg einer <strong>der</strong>artigen Regelung, zumindest<br />
aus Sicht <strong>der</strong> Mitgliedsunternehmen, nachhaltig in Frage. Dieser Aspekt ist daher bei <strong>der</strong><br />
Entscheidung über den Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ebenfalls zu prüfen.<br />
2.3 Weitere Aspekte<br />
2.3.1 Sonstige Konsequenzen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Unabhängig <strong>von</strong> den wirtschaftlichen Konsequenzen einer Selbstverpflichtung sollte überprüft<br />
werden, ob sonstige Anreize für die Unternehmen bestehen o<strong>der</strong> geschaffen werden<br />
können, eine Selbstverpflichtung umzusetzen. Dieses Problem stellt sich insbeson<strong>der</strong>e dann,<br />
wenn es sich um eine Selbstverpflichtung handelt, die bei den Unternehmen Kosten verursacht<br />
o<strong>der</strong> wenn die Kostenfolgen umweltpolitischer Alternativen unklar sind. Dann fehlen<br />
unmnittelbare ökonomische Anreize, die eine Einhaltung sicherstellen könnten.<br />
Das Fehlen einer geeigneten Anreizstruktur zeigt sich insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong> Stoffen. An<strong>der</strong>s als die CO2-Selbstverpflichtung bedeutet<br />
ihre Umsetzung für die Unternehmen keine wirtschaftlichen Vorteile; sie ist auch nicht<br />
– an<strong>der</strong>s als etwa die Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln, <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
nur 33 Unternehmen betroffen sind – durch gegenseitige Kontrolle <strong>der</strong> Firmen und fallweise<br />
Intervention des Verbandes umsetzbar. Die umweltpolitischen o<strong>der</strong> auch haftungsrechtlichen<br />
Konsequenzen einer fehlenden Aussagefähigkeit sind offensichtlich für viele Unternehmen<br />
zu weit entfernt, um als Anreiz wirksam zu werden.<br />
Diese Frage nach den Anreizen für die Umsetzung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist für den<br />
Verband <strong>von</strong> zentraler Bedeutung; denn einerseits wird vom Verband als Unterzeichner einer<br />
Selbstverpflichtung erwartet, daß er die Verantwortung für die Umsetzung einer Selbstver-<br />
62
pflichtung übernimmt, an<strong>der</strong>erseits kann die tatsächliche Umsetzung nur durch die Unternehmen<br />
erfolgen. Das Ansehen und die Glaubwürdigkeit des Verbandes in Politik und Öffentlichkeit<br />
wird somit <strong>von</strong> Mitgliedsunternehmen, die eine Trittbrettfahrer-Rolle einnehmen,<br />
in Frage gestellt. Dies gilt insbeson<strong>der</strong>e, wenn <strong>der</strong>artige Trittbrettfahrer die Zielerreichung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung gefährden o<strong>der</strong> gar verhin<strong>der</strong>n. Nicht o<strong>der</strong> nicht zum angekündigten<br />
Termin erreichte Ziele o<strong>der</strong> Vorgaben dürften <strong>von</strong> externer Seite erhebliche Zweifel daran<br />
aufkommen lassen, daß die Industrie in <strong>der</strong> Lage ist, Probleme in weitgehen<strong>der</strong> Eigenregie<br />
zu lösen.<br />
Allerdings darf nicht übersehen werden, daß sich genau hier schon die Grenzen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
zeigen, da dem Verband nur wenig „harte“ Möglichkeiten offenstehen, wirksame<br />
Anreize zu setzen. Möglicherweise sollte verstärkt darüber nachgedacht werden, Umsetzungsmaßnahmen<br />
im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung öffentlich zu kommunizieren und<br />
dabei auch die Namen <strong>der</strong> betreffenden Firmen zu nennen. Dies könnte – unter Ausnutzung<br />
des so entstehenden Imagegewinns – für an<strong>der</strong>e Unternehmen ein Anlaß zur Nachahmung<br />
sein. Ein noch weitergehen<strong>der</strong> Schritt könnte sein, auch solche Unternehmen namentlich zu<br />
nennen, die die Selbstverpflichtung nicht umsetzen.<br />
Drastischere Sanktionsmöglichkeiten, wie sie teilweise <strong>von</strong> externer Seite gefor<strong>der</strong>t werden,<br />
dürften sich allerdings nur schwer mit <strong>der</strong> Natur <strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n vereinbaren lassen.<br />
2.3.2 Monitoring <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Die Gestaltung des Monitorings einer Selbstverpflichtung ist ein wesentlicher Faktor, um eine<br />
ausreichende Transparenz sowohl innerhalb des Verbandes als auch gegenüber externen<br />
Anspruchsgruppen zu gewährleisten. Darüber hinaus kann ein solches System auch als<br />
wichtiger Anreiz für die Mitgliedsunternehmen dienen, <strong>der</strong>artige Regelungen umzusetzen.<br />
Entscheidend für die externe Akzeptanz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist eine ausführliche Berichterstattung<br />
über die Fortschritte und die getroffenen Maßnahmen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Ein Monitoringsystem ist zwar nicht <strong>der</strong> Garant für die öffentliche Akzeptanz<br />
einer Selbstverpflichtung, aber das Fehlen eines <strong>der</strong>artigen Systems stellt die Glaubwürdigkeit<br />
einer Selbstverpflichtung mit Sicherheit in Frage. Es ist zu prüfen, ob eventuell in Zukunft<br />
mehr Ressourcen für die Umsetzungskontrolle, Dokumentation und Außenkommunikation<br />
eingesetzt werden sollten, als es in <strong>der</strong> Vergangenheit <strong>der</strong> Fall war. Dazu gehört auch die<br />
Einrichtung ein internen Monitorings in den Unternehmen selbst, damit die Unternehmen in<br />
<strong>der</strong> Lage sind, für sich die Zielerreichung einer Selbstverpflichtung zu kontrollieren.<br />
Allerdings besteht bezüglich <strong>der</strong> externen Dokumentation die Möglichkeit, daß im Zuge einer<br />
intensiveren Berichterstattung gerade <strong>der</strong> Vorteil, <strong>der</strong> üblicherweise mit einer Selbstverpflichtung<br />
in Verbindung gebracht wird, verlorengehen könnte: In <strong>der</strong> Regel wird nämlich argumentiert,<br />
daß eine Selbstverpflichtung mit sehr viel geringerem bürokratischen Aufwand<br />
verbunden ist. Eine transparente Berichterstattung verlangt indes einen sehr viel höheren<br />
Aufwand, <strong>der</strong> ziemlich sicher auch mit einer vermehrten Bürokratie verbunden ist. Hier ist vor<br />
Abschluß einer Selbstverpflichtung zu prüfen, welcher Aufwand erfor<strong>der</strong>lich ist, um nach außen<br />
hin transparent und glaubwürdig zu sein.<br />
Zusätzlich spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle, daß die Unternehmen im Rahmen einer<br />
transparenten Berichterstattung gefor<strong>der</strong>t sind, getroffene Maßnahmen möglichst aus-<br />
63
führlich zu dokumentieren; dabei können aber auch Geschäftsgeheimnisse tangiert sein.<br />
Auch dieser Trade-off zwischen Transparenz und Geheimnisschutz ist vor Abgabe einer<br />
Selbstverpflichtung zu prüfen.<br />
2.3.3 Arbeit des Verbandes<br />
a) Verhandlungsmandat und -spielraum des Verbandes<br />
Hier ist zu prüfen, ob <strong>der</strong> Verband unter Beachtung <strong>der</strong> Interessen seiner Mitglie<strong>der</strong> und des<br />
ökologischen Sachverhaltes, um den es geht, über ein faktisches Verhandlungsmandat und<br />
einen genügend großen Spielraum verfügt, um eine Selbstverpflichtung auszuhandeln. Dabei<br />
spielen sowohl verbandsexterne als auch -interne Faktoren eine wesentliche Rolle.<br />
Beispiele für verbandsinterne Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluß einer Selbstverpflichtung<br />
sind ausreichende personelle Kapazitäten, fachliche Kompetenz sowie die<br />
weitgehende Einigkeit darüber, daß eine <strong>der</strong>artige Regelung auch wirklich gewünscht wird.<br />
Hier ist insbeson<strong>der</strong>e <strong>von</strong> Bedeutung, ob die <strong>Verbände</strong> seitens ihrer Mitglie<strong>der</strong> ein faktisches<br />
Mandat haben, eine entsprechende Regelung auszuhandeln.<br />
Der letztgenannte Punkt war im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln<br />
<strong>von</strong> zentraler Bedeutung. Während einer <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong> bzw. seine Mitglie<strong>der</strong><br />
lange Zeit eine rechtliche Regelung präferierten, bevorzugte <strong>der</strong> an<strong>der</strong>e Verband <strong>von</strong> Anfang<br />
an eine freiwillige Regelung. Die Unstimmigkeiten im Vorgehen wirkten sich auch nach <strong>der</strong><br />
Verständigung auf die Art <strong>der</strong> anzustrebenden Regelung nachteilig auf den zeitlichen Ablauf<br />
<strong>der</strong> Ausarbeitungsphase sowie die inhaltliche Klarheit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung aus.<br />
Als Beispiele für verbandsexterne Aspekte seien an dieser Stelle die politische Lage und<br />
gute Kontakte zu den relevanten Ansprechpartnern in den Behörden angeführt. Die vorliegende<br />
Untersuchung ergab jedoch keinen Anlaß zu <strong>der</strong> Vermutung, daß hier wesentliche<br />
Defizite seitens <strong>der</strong> verbandlichen Tätigkeit bestehen.<br />
Zur Steigerung <strong>der</strong> öffentlichen Akzeptanz <strong>von</strong> freiwilligen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ist zu überlegen,<br />
ob eine Beteiligung <strong>von</strong> externen Anspruchsgruppen, wie z.B. Umweltverbänden, an<br />
<strong>der</strong> Ausarbeitung sinnvoll ist. Zwar wird auch <strong>von</strong> den Umweltverbänden selbst meist nicht<br />
die direkte Beteiligung an <strong>der</strong> Formulierung einer Selbstverpflichtung gefor<strong>der</strong>t, aber eine<br />
frühzeitige Konsultation und Diskussion mit externen Anspruchsgruppen könnte für eine Vergrößerung<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Akzeptanz einer Selbstverpflichtung för<strong>der</strong>lich sein.<br />
b) Umsetzungskapazitäten des Verbandes<br />
Um die Umsetzung einer Selbstverpflichtung adäquat begleiten zu können, ist zu klären, ob<br />
<strong>der</strong> Verband dafür über die notwendigen Ressourcen (finanziell wie personell) verfügt. Je<br />
kritischer die Umsetzungschancen sind, desto mehr aktives Umsetzungsmanagement ist<br />
erfor<strong>der</strong>lich, um die Selbstverpflichtung zum Erfolg zu führen. Dabei spielt es für das Umsetzungsmanagement<br />
wahrscheinlich keine so große Rolle, ob die entsprechenden personellen<br />
Kapazitäten verbandsintern geschaffen o<strong>der</strong> extern zugekauft werden.<br />
Dieses Problem zeigt sich insbeson<strong>der</strong>e im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Erfassung und<br />
Bewertung <strong>von</strong> Stoffen: die fehlenden personellen Kapazitäten scheinen in diesem Falle ein<br />
64
sehr relevanter Engpaßfaktor zu sein. So gilt es, 1700 Mitgliedsunternehmen über die Regelung<br />
zu informieren, sie zu ihrer Umsetzung anzuhalten und entsprechende Hilfestellungen<br />
anzubieten.<br />
Viele Unternehmen wünschen sich im Rahmen dieser Selbstverpflichtung auch detailliertere<br />
Handlungsanweisungen und Hilfen des Verbandes, was auch wie<strong>der</strong>um einen entsprechenden<br />
Ressourceneinsatz bedeutet. Auch im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holz- und Bläueschutzmitteln<br />
wünschte sich ein Unternehmen eine detailliertere Umsetzungsanleitung.<br />
3. Schlußfazit und Empfehlung an den Verband<br />
Gemessen an <strong>der</strong> Zielsetzung <strong>der</strong> Untersuchung, nämlich <strong>der</strong> Beurteilung <strong>von</strong> ökologischer<br />
Effektivität und ökonomischer Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>, kann bezüglich <strong>der</strong> Aussagekraft<br />
<strong>der</strong> Studie zusammenfassend folgendes festgestellt werden:<br />
• Datenlage: Trotz hoher Bereitschaft <strong>der</strong> beteiligten Unternehmen, Behörden und <strong>Verbände</strong><br />
war es schwierig, die Effektivität und Effizienz <strong>der</strong> untersuchten <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
präzise zu bewerten. Die Gründe dafür liegen insbeson<strong>der</strong>e in folgenden Schwierigkeiten:<br />
Die Zuordnung <strong>von</strong> Maßnahmen und Kosten zu einer Selbstverpflichtung ist unscharf.<br />
Genauso unscharf bleiben die Möglichkeiten, Maßnahmen und Kosten für einen alternativen<br />
Referenzpfad zu bestimmen. Darüber hinaus ist teilweise das Ziel selbst unscharf,<br />
weil es nicht immer quantitativ bestimmt ist.<br />
• Breite <strong>der</strong> Studie: Einschränkend muß festgestellt werden, daß nur vier <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
detailliert untersucht wurden. Sie sind allerdings so unterschiedlich, daß die Vielfalt<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zumindest exemplarisch deutlich wird. Ob eine breiter angelegte<br />
empirische Untersuchung zu wesentlich an<strong>der</strong>en Ergebnissen gekommen wäre,<br />
sei dahingestellt.<br />
• Handlungsrelevanz: Neben dem Erkenntnisinteresse verfolgte die Studie ein Handlungsinteresse.<br />
Es galt, Empfehlungen abzuleiten zur Steigerung <strong>der</strong> Effektivität und Effizienz<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>. Hierin liegt nach Einschätzung des Instituts die Stärke<br />
<strong>der</strong> Studie. Die empirische Tiefe und Breite <strong>der</strong> Studie scheint hinreichend, um einen Katalog<br />
<strong>von</strong> erfolgsrelevanten Eckpunkten zu begründen, die helfen können, die Nutzung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> als Instrument <strong>der</strong> (verbandlichen) Umweltpolitik zu unterstützen.<br />
Die Empfehlung des Institutes an den Verband geht deshalb dahin, vor Abschluß künftiger<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> die in dieser Studie erarbeiteten Eckpunkte <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
kritisch zu prüfen. Sie eignen sich aus Sicht des Institutes sowohl für die Prüfung, ob eine<br />
Selbstverpflichtung für das zugrundeliegende Umweltproblem tatsächlich (aus Sicht des<br />
Verbandes) die geeignete Lösung ist, als auch als Gestaltungsdimensionen bzw. -kriterien<br />
für die Ausformulierung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>. Dazu könnte es hilfreich sein, in Anlehnung<br />
an die hier vorgeschlagenen Eckpunkte einen Leitfaden mit detaillierteren Erfolgskriterien<br />
zu entwickeln.<br />
In demokratisch verfaßten Marktwirtschaften wird das Unternehmensverhalten durch Markt<br />
und Wettbewerb sowie staatliche Regulierungen bestimmt. Unternehmen erbringen in diesem<br />
extern vorgegebenen Rahmen ihre Leistungen in Eigenverantwortung. In einem gewis-<br />
65
sen Ausmaß haben Unternehmen dabei einen Handlungsspielraum, eine über die unmittelbare<br />
wirtschaftliche Verantwortung hinausweisende gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen,<br />
die nicht vom Markt induziert o<strong>der</strong> durch Regulierung erzwungen ist. <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
<strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n können in bestimmten Fällen helfen, diese gesellschaftliche<br />
Verantwortung <strong>von</strong> Unternehmen zu bündeln und zu akzentuieren.<br />
Politik und Gesellschaft befinden sich dabei in einem offenen Lernprozeß, in dem das Instrument<br />
„Selbstverpflichtung <strong>von</strong> <strong>Verbände</strong>n“ im Wettbewerb mit an<strong>der</strong>en (Regulierungs-)<br />
Konzepten steht. Eine sorgfältige Konzeption und Umsetzung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
dürfte dem Verband in diesem Prozeß helfen, im „Wettbewerb <strong>der</strong> Konzepte“ Lösungen auszuarbeiten,<br />
die effektiv, politisch stabil und wirtschaftlich effizient sind. Des weiteren können<br />
funktionierende und allgemein akzeptierte <strong>Selbstverpflichtungen</strong> die Wahrnehmung <strong>von</strong><br />
Selbstverantwortung auf seiten <strong>der</strong> Unternehmen zusätzlich stärken und so dazu beitragen,<br />
den wirtschaftlichen Wettbewerb selbst in Bahnen zu lenken, die dem Responsible-Care-<br />
Gedanken des Verbandes entsprechen.<br />
66
Teil B:<br />
Dokumentation des<br />
Abschlußworkshops<br />
am 19. März 2001<br />
67
I. Ziel und Ablauf des Workshops<br />
Im Rahmen eines Workshops am 19. März 2001 in den Räumen des VCI wurden die Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung vorgestellt. Ziel des Workshops war es, die Vorgehensweise<br />
und Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchung sowie die Vorschläge des Institutes hinsichtlich<br />
des Einsatzes und <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> noch einmal gesamthaft<br />
in einem größeren Rahmen zu diskutieren und daraus erste Schlußfolgerungen für die weitere<br />
Verbandsarbeit mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong> ableiten zu können.<br />
Eingeladen waren dazu die Personen, die im Rahmen <strong>der</strong> Studie befragt worden sind, sowie<br />
weitere Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Den Teilnehmern wurde die Zusammenfassung<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse (<strong>der</strong> Teil A dieses Abschlußberichts) vor dem Workshop als<br />
Diskussionspapier zugeschickt. Darüber hinaus hatten im Januar 2001 die Befragten die<br />
Detailanalyse <strong>der</strong> jeweiligen Selbstverpflichtung zur Kommentierung zugeschickt bekommen.<br />
Insgesamt haben 112 Personen an <strong>der</strong> Veranstaltung teilgenommen. Eine Liste <strong>der</strong> Teilnehmer<br />
findet sich im Anhang.<br />
Der Ablauf des Workshops gestaltete sich wie folgt: Nach einer kurzen Einführung durch den<br />
Hauptgeschäftsführer des VCI, Herrn Dr. Wilfried Sahm, wurde zunächst die Vorgehensweise<br />
und Methodik <strong>der</strong> Studie durch das Institut vorgestellt. Anschließend folgte die Diskussion<br />
<strong>der</strong> Ergebnisse zu den einzelnen <strong>Selbstverpflichtungen</strong>. Dazu stellte jeweils zunächst das<br />
Institut die wichtigsten Ergebnisse zu einer Selbstverpflichtung vor; anschließend nahmen<br />
Personen zu den Ergebnissen Stellung, die zu <strong>der</strong> jeweiligen Selbstverpflichtung befragt<br />
worden sind, und es folgte eine kurze Diskussion im Plenum. Nach <strong>der</strong> Behandlung <strong>der</strong> einzelnen<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> stellte das Institut seine Schlußfolgerungen vor, die nach seiner<br />
Ansicht für den Einsatz und die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu ziehen sind. Dazu<br />
sowie zu <strong>der</strong> Studie insgesamt haben anschließend drei externe Experten aus Wissenschaft,<br />
Politik und Umweltverbänden Stellung genommen. Daran schloß sich eine allgemeine<br />
Diskussion an. Prof. Herwig Hulpke <strong>von</strong> <strong>der</strong> Bayer AG gab abschließend seine Einschätzung<br />
ab zu Schlußfolgerungen und dem weiteren Vorgehen aus Sicht <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie.<br />
Der folgende Abschnitt 2 enthält die Texte <strong>der</strong> Kurzreferate, die zu den Ergebnissen <strong>der</strong> einzelnen<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> gehalten worden sind; jeweils im Anschluß an die Referate wird<br />
die Plenumsdiskussion zusammengefaßt.<br />
Abschnitt 3 beinhaltet zunächst die Texte <strong>der</strong> drei Referate, die zu den Ergebnissen und <strong>der</strong><br />
Studie insgesamt gehalten wurden und dokumentiert anschließend die wichtigsten Punkte<br />
<strong>der</strong> generellen Diskussion.<br />
69
II. Die Diskussion <strong>der</strong> einzelnen <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Zunächst stellte das Institut für Umweltmanagement die wichtigsten Punkte hinsichtlich Vorgehensweise<br />
und Methodik <strong>der</strong> Untersuchung vor. Inhaltlich entsprachen diese Ausführungen<br />
dem Kapitel II des Endberichts <strong>der</strong> Studie. Zu diesen Ausführungen gab es keine weitere<br />
Diskussion.<br />
1. Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion<br />
<strong>der</strong> energiebedingten CO2-Emissionen<br />
Zunächst stellte das Institut die wichtigsten Ergebnisse zu dieser Selbstverpflichtung vor. Inhaltlich<br />
entsprachen diese Ausführungen dem Teil A, Kapitel IV.2.1 des vorliegenden Berichts.<br />
Zu den Ergebnissen dieser <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben folgende Personen Stellung genommen:<br />
• MinRat Werner Ressing, Bundeswirtschaftsministerium, Bonn;<br />
• Dr.-Ing. Stephan Ramesohl, Wuppertal-Institut für Klima Umwelt Energie, Wuppertal;<br />
• Dipl.-Ing. Günther Keilitz, Wacker-Chemie GmbH, Burghausen.<br />
70
1.1 Kommentar I<br />
Werner Ressing<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Detailevaluation möchte ich hier zunächst noch etwas zur Genesis<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung sagen, da die diesbezüglichen Aussagen <strong>der</strong> Unternehmen –<br />
insbeson<strong>der</strong>e zur Rolle <strong>der</strong> Behörden, die <strong>von</strong> den Unternehmen als weitgehend passiv beschrieben<br />
werden – mich doch etwas verwun<strong>der</strong>t haben.<br />
Im Jahre 1990 kam es zum ersten Regierungsbeschluß zur CO2-Reduktion (vorgesehen war<br />
eine Reduktion um 25% gegenüber 1987). Damit verbunden war im Rahmen des Klimaschutzprogramms<br />
<strong>der</strong> Plan einer nationalen CO2-Abgabe: Der damalige Bundesumweltminister<br />
Töpfer schlug eine Abgabe <strong>von</strong> 10 DM pro Tonne CO2 vor. Dies stieß auf den Wi<strong>der</strong>stand<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft, und es kam zu den ersten Vorschlägen zur CO2-Selbstverpflichtung,<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>von</strong> seiten des BDI, des VCI, des DIHT und des VIK. Die Bundesregierung hat<br />
daraufhin intensiv mit <strong>der</strong> Wirtschaft über drei Jahre verhandelt, die Verhandlungen führten<br />
aber nicht zum Erfolg. Der Grund dafür war: Die Wirtschaft for<strong>der</strong>te <strong>von</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung<br />
damals, alle Pläne für eine kombinierte CO2-/Energiesteuer fallen zu lassen, und auch bei<br />
<strong>der</strong> EU für ein Ende <strong>der</strong> Diskussion o<strong>der</strong> zumindest für eine entsprechende Ausnahmeregelung<br />
zu sorgen. Dies konnte aber <strong>von</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung nicht geleistet werden, weil sie<br />
Mitinitiator war eines international abgestimmten Vorgehens im Rahmen einer CO2-<br />
/Energiebesteuerung.<br />
1995, kurz vor dem Klimagipfel, kam es dann zu einer Initiative seitens <strong>der</strong> Bundesregierung:<br />
Der „Startschuß“ für die heutige Selbstverpflichtungserklärung war ein Schreiben des damaligen<br />
Staatssekretärs <strong>von</strong> Würzen an die Vorsitzenden <strong>von</strong> VDEW und VIK, mit dem ein Weg<br />
aus <strong>der</strong> Sackgasse versucht werden sollte. Die entscheidenden Sätze aus dem Schreiben<br />
sind: „Vorrangig ist an eine entsprechende ‚Selbstverpflichtungserklärung‘ <strong>der</strong> öffentlichen<br />
und industriellen Kraftwerksbetreiber [...] gedacht. Dies hätte den Vorteil, daß sich ein eventuelles<br />
ordnungsrechtliches Vorgehen im Rahmen einer 13. BImSchV o<strong>der</strong> einer WärmenutzungsVO<br />
vermeiden ließe“. Dies hat bewirkt, daß 1995 die erste Erklärung abgegeben wurde.<br />
Diese wurde sofort <strong>von</strong> den Umweltverbänden kritisiert als zu weich, weil das Ziel war,<br />
auf <strong>der</strong> Basis <strong>von</strong> 1987 den spezifischen Energieverbrauch „um bis zu 20%“ zu senken.<br />
Durch den Klimagipfel wurde das Ziel umgestellt auf das Basisjahr 1990, so daß dann 1996<br />
auf Druck <strong>der</strong> Regierung jeweils in Einzelgesprächen aktualisierte Erklärungen mit präzisierten<br />
Zielen abgegeben wurden.<br />
1996 wurde auch das Monitoringsystem eingeführt, das zwischen Regierung und BDI abgestimmt<br />
war. Gleichzeitig hat die Regierung klar gemacht, daß es keine Selbstverpflichtung<br />
ohne mögliche Sanktionsmechanismen geben werde: Damit blieb das „Damoklesschwert“<br />
<strong>der</strong> Einführung <strong>von</strong> Steuern o<strong>der</strong> <strong>von</strong> Ordnungsrecht (WärmenutzungsVO) bestehen.<br />
Nach dem Regierungswechsel wurde 1999 die Ökosteuer eingeführt. Damals stand die<br />
Selbstverpflichtung aufgrund <strong>der</strong> heftigen Reaktion <strong>der</strong> Wirtschaft auf <strong>der</strong> Kippe. Schließlich<br />
konnte durch reduzierte Steuersätze für die Wirtschaft ein Kompromiß erzielt werden. Entscheidend<br />
war dabei aber auch, daß die Selbstverpflichtung mit ein Grund war, <strong>von</strong> seiten<br />
<strong>der</strong> EU diese Steuerbegünstigung, die ja als Beihilfe gilt, zu genehmigen.<br />
71
Die Selbstverpflichtung wurde <strong>von</strong> <strong>der</strong> Bundesregierung immer auch als dynamischer Prozeß<br />
angesehen. Auf Vorschlag des BMWi wurde diese Selbstverpflichtung, wie auch international<br />
gefor<strong>der</strong>t, in einen politischen Vertrag gegossen, <strong>der</strong> dann nach intensiven Verhandlungen<br />
am 9. November 2000 unterzeichnet werden konnte. Dabei wurden die Ziele<br />
angepaßt:<br />
• es werden alle Kyoto-Gase einbezogen;<br />
• bis 2005 soll <strong>der</strong> spezifische Ausstoß um 28% gesenkt werden, bis 2012 um 35%;<br />
• die absoluten Emissionen sollen um nochmals jeweils 10 Mio. t bis 2005 und 2012 sinken.<br />
Aus Sicht <strong>der</strong> Bundesregierung müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein, damit eine<br />
Selbstverpflichtung erfolgreich ist:<br />
• es müssen verläßliche Rahmenbedingungen für Politik und Wirtschaft herrschen. Damit<br />
ist auch die Herausbildung eines Vertrauensverhältnisses erfor<strong>der</strong>lich, da eine solche<br />
Selbstverpflichtung ja über mehrere Jahre laufen soll;<br />
• es darf keine Selbstverpflichtung ohne evtl. Sanktionsmechanismen geben;<br />
• es müssen anspruchsvolle Zielsetzungen vorliegen;<br />
• es muß ein unabhängiges transparentes Monitoring vorliegen. Hier ist noch einiges zu<br />
tun, aber wenn man den ersten Monitoring-Bericht für das Jahr 1996 mit dem aktuellen<br />
vergleicht, sieht man, daß eigentlich jährlich eine Verbesserung stattgefunden hat;<br />
• <strong>der</strong> Prozeß muß dynamisiert werden, d.h. es muß eine Zielanpassung vorgenommen<br />
werden, falls dies erfor<strong>der</strong>lich ist. Aus Sicht <strong>der</strong> Bundesregierung wird mit <strong>der</strong> Erklärung<br />
für die neue Klimavereinbarung für alle Branchen eine Zielanpassung erfolgen, auch im<br />
Hinblick auf die übrigen Kyoto-Gase.<br />
Wenn wir uns ansehen, wie die entsprechenden absoluten Emissionen gesunken sind, sieht<br />
man, daß innerhalb <strong>der</strong> Industrie <strong>der</strong> VCI den Löwenanteil hat mit insgesamt 21,5 Mio. t; des<br />
weiteren sieht man, daß im Grunde genommen in allen Bereichen eine absolute Senkung<br />
<strong>der</strong> CO2-Emissionen erfolgt ist, obwohl die Erklärungen einiger Sektoren nur den spezifischen<br />
Ausstoß betreffen.<br />
72
Entwicklung <strong>der</strong> CO2 -Em issionen in<br />
verschiedenen Sektoren <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
Feuerfest-Industrie<br />
Fliesen- und Plattenindustrie<br />
Zuckerindustrie<br />
Ziegelindustrie<br />
Kalkindustrie<br />
K a liin d u strie<br />
Textilindustrie<br />
Glasindustrie<br />
Zementindustrie<br />
Papierindustrie<br />
NE-Metallindustrie<br />
Chemischen Industrie<br />
Stahlindustrie<br />
0,3<br />
0,4<br />
0,6<br />
0,7<br />
2,2<br />
2,3<br />
1,7<br />
2,4<br />
2,9<br />
3,2<br />
1,5<br />
4,7<br />
5,5<br />
5,8<br />
5,3<br />
6,4<br />
9,8<br />
13,0<br />
10,7<br />
14,4<br />
12,0<br />
14,6<br />
73<br />
44,0<br />
65,5<br />
60,2<br />
69,9<br />
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0<br />
Mio. Tonnen<br />
Basis Jahr 1998<br />
Betrachtet man die drei großen Blöcke: Verkehr, Gebäudebestand und Industrie, so ist <strong>der</strong><br />
Industriesektor <strong>der</strong> einzige, in dem die CO2-Emissionen nachhaltig gesunken sind, und wo<br />
sie nach <strong>der</strong> Selbstverpflichtung auch weiter sinken werden. In den beiden an<strong>der</strong>en Bereichen<br />
sind die Emissionen noch gestiegen und werden vermutlich auch noch weiter steigen;<br />
insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Verkehr ist hier das Sorgenkind.<br />
Ganz kurz nochmal ein Blick auf die erreichte Senkung des CO2-Ausstoßes im Verhältnis<br />
zum Basisjahr 1990: die Industrie insgesamt hat ihre Emissionen auf 82,8% gegenüber 1990<br />
gesenkt, die chemische Industrie auf 75%.<br />
Entwicklung <strong>der</strong> CO2 -Emissionen in verschiedenen Sektoren<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung vom Basis Jahr (1990) bis 1998<br />
K a liin d u s trie<br />
S ta h lin d u strie<br />
Zementindustrie<br />
Papierindustrie<br />
Chemischen Industrie<br />
Glasindustrie<br />
VDEW<br />
N E -M e ta llin d u strie<br />
Industrie gesamt<br />
Fliesen- und Plattenindustrie<br />
T e xtilin d u strie<br />
Kalkindustrie<br />
Feuerfest-Industrie<br />
Zuckerindustrie<br />
Ziegelindustrie<br />
Basis Jahr<br />
31,9%<br />
67,2%<br />
70,8%<br />
74,3%<br />
75,0%<br />
75,4%<br />
77,1%<br />
82,2%<br />
82,8%<br />
85,7%<br />
86,1%<br />
89,6%<br />
90,6%<br />
94,8%<br />
95,7%<br />
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%<br />
100,0%
Wie sieht daher die Zielgerade aus? Im Vergleich aller <strong>Verbände</strong> müssen wir sagen, daß einige<br />
ihr Ziel praktisch schon übererfüllt haben, einige sind noch weit <strong>von</strong> ihrem Ziel entfernt.<br />
Der VCI liegt dabei schon etwas unterhalb <strong>der</strong> Zielgeraden, d.h. er hat sein Ziel schon etwas<br />
übererfüllt. Bei „Business as usual“ wäre es wahrscheinlich nur zu einer Senkung des CO2-<br />
Ausstoßes um 8% bzw. – unter Berücksichtigung des Energieträgermixes – um 15-20% gekommen.<br />
Mio Tomnnen CO<br />
2<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
1990<br />
VCI Zielgerade (absolut)<br />
Ist 1990<br />
65,5 Mio t<br />
1995<br />
Ist 1998<br />
49,4 Mio t<br />
74<br />
1998<br />
2000<br />
Ziel 2005<br />
41,7 Mio t<br />
Fazit aus Sicht <strong>der</strong> Bundesregierung: Die Erfolge sprechen für sich. Entscheidend ist, daß<br />
neben <strong>der</strong> Setzung <strong>von</strong> anspruchsvollen Zielen diese Ziele auch erreicht werden o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s<br />
gesagt: nur die Tore zählen.<br />
2005
1.2 Kommentar II<br />
Stephan Ramesohl<br />
Ausgangspunkt:<br />
Die Klimaschutzerklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie muß ein dynamischer Prozeß <strong>der</strong><br />
kontinuierlichen Zielanpassung und -verschärfung im Rahmen einer zukunftsfähigen<br />
Entwicklung sein.<br />
Die Erklärung <strong>der</strong> deutschen Industrie zur Klimavorsorge steht im Kontext <strong>der</strong> nationalen<br />
CO2-Reduktionsverpflichtungen <strong>der</strong> Bundesrepublik im Rahmen des Kyoto-Protokolls. Die<br />
dort getroffenen Zielvereinbarungen sind dabei nur ein erster Schritt zu den unvermeidlichen,<br />
weitaus anspruchsvolleren Min<strong>der</strong>ungsnotwendigkeiten in den Industrielän<strong>der</strong>n, die <strong>der</strong><br />
IPCC auf –50% bis 2030 und –80% in 2050 gemessen am Niveau <strong>von</strong> 1990 beziffert. Die in<br />
<strong>der</strong> Klimaschutzerklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie genannten Treibhausgas-<br />
Reduktionsziele sind damit kein Zweck an sich, <strong>der</strong> eine genaue Punktlandung erfor<strong>der</strong>t. Die<br />
induzierten Maßnahmen müssen vielmehr als längst überfälliger Einstieg in eine ressourcenschonende<br />
und öko-effiziente Produktionsweise im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung<br />
gesehen werden. Über die genannten Ziele hinaus müssen deshalb alle Möglichkeiten<br />
genutzt werden, um vorhandene Effizienzpotentiale zu erschließen, durch Innovation neue<br />
Handlungsräume zu schaffen und langfristig zukunftsfähige Produktionsstrukturen zu etablieren.<br />
Für die Diskussion <strong>der</strong> aktuellen Klimaschutzerklärung gilt damit:<br />
Die Leistung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie kann nicht alleine daran gemessen werden, ob sie ihre<br />
„Hausaufgaben“ im Rahmen <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung gemacht hat, son<strong>der</strong>n ebenfalls<br />
daran, inwieweit sie darüber hinaus aktiv an einer weiteren Senkung <strong>der</strong> Umweltwirkungen<br />
arbeitet. Die Klimaschutzerklärung muß also als ein dynamischer Prozeß <strong>der</strong> kontinuierlichen<br />
Zielanpassung und -verschärfung gesehen werden.<br />
Empirische Beobachtung:<br />
Bislang wenig Einfluß auf Investitionsplanungen, aber Stärkung <strong>der</strong> Rolle des Energieund<br />
Umweltmanagements im Unternehmen<br />
Die Untersuchung des Instituts für Umweltmanagement liefert interessante Einblicke in die<br />
Umsetzung <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung in Unternehmen <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie. Die Aussagen<br />
bestätigen dabei die Ergebnisse einer empirischen Analyse <strong>von</strong> energiebezogenen<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> in Europa (KRARUP/RAMESOHL 2000, RAMESOHL/KRISTOF 2000):<br />
• Große Investitionen in die Energieversorgungsinfrastruktur und Produktionsprozesse werden<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung kaum bzw. gar nicht beeinflußt. Aufgrund <strong>der</strong> oft sehr<br />
hohen Kapitalbedarfe, langen Planungszeiten und ihrer strategischen Bedeutung werden<br />
bzw. wurden diese Maßnahmen unabhängig <strong>von</strong> <strong>der</strong> Erklärung geplant und durchgeführt.<br />
• In Einzelfällen zeigt sich, daß bei Investitionen, die zwar wirtschaftlich waren, aber auf <strong>der</strong><br />
"Kippe" standen, die Verpflichtung den letztendlichen Ausschlag gegeben hat, z.B. indem<br />
eine etwas längere Amortisationszeit als üblich akzeptiert wurde.<br />
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß die Klimaschutzerklärung in kurzbis<br />
mittelfristiger Perspektive wenig Einfluß auf eine Än<strong>der</strong>ung des Investitionsverhaltens<br />
75
ausübt. Die Erreichung <strong>der</strong> selbstdefinierten Ziele ist damit zwar ein rechnerischer Beitrag<br />
zum nationalen Klimaschutzziel, im Sinne des oben angesprochenen, dringend notwendigen<br />
Wandels <strong>der</strong> Produktionsstrukturen hin zu weniger Ressourcenverbrauch reicht diese Wirkung<br />
nicht aus.<br />
Vor diesem Hintergrund ist positiv zu bemerken, daß die Klimaschutzerklärung offensichtlich<br />
einen indirekten, langfristigen Effekt erwarten läßt: In den empirischen Analysen wurde beobachtet,<br />
daß die Verbandserklärung die Bedeutung des Themas Klimaschutz verstärkt und<br />
ein neues Bewußtsein für die Notwendigkeit <strong>von</strong> Reduktionsmaßnahmen entsteht. Fallbeispiele<br />
aus den Unternehmen zeigen, daß Energie- und Klimaschutzaspekte stärker als bisher<br />
in Entscheidungen miteinbezogen und eher ganzheitliche Bewertungen vorgenommen<br />
werden. Analog zu vergleichbaren Themen wie Arbeitsschutz etc. kann mit einer anhaltenden<br />
und weitreichenden Wirkung allerdings erst dann gerechnet werden, wenn Klimaschutz<br />
durch Mitarbeiterschulungen, Motivationsmaßnahmen usw. ein integraler Leitgedanke täglichen<br />
Handelns wird. Es gilt somit, die begonnen Aktivitäten weiterzuführen und zu verstetigen.<br />
Für eine Bewertung <strong>der</strong> „weichen“ Wirkungen <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung muß dazu berücksichtigt<br />
werden, daß im Moment die Umsetzung <strong>der</strong> Erklärung im wesentlichen durch die<br />
wenigen, großen Unternehmen getragen wird, die den Energieausschuß des VCI bilden. Sie<br />
repräsentieren zwar den größten Teil des Branchenenergieverbrauchs, dennoch bleibt zu<br />
bemängeln, daß eine weitreichende Verbreitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung in die gesamte<br />
Branche – z.B. in Verbindung mit dem Responsible-Care-Programm – noch nicht stattfand.<br />
Dies ist ein Defizit <strong>der</strong> bisherigen Umsetzung durch den Verband, und es stellt sich die prinzipielle<br />
Frage, inwieweit in einer heterogenen, wettbewerbsgeprägten und stark fragmentierten<br />
Branche wie <strong>der</strong> Chemieindustrie überhaupt kollektives Handeln organisiert werden<br />
kann.<br />
Schlußfolgerung:<br />
Lern- und Verbesserungsprozesse müssen organisiert und institutionalisiert werden.<br />
Angesichts <strong>der</strong> vorhandenen Schwachstellen muß die Wirkung <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung<br />
durch kontinuierliche Lern- und Verbesserungsprozesse weiter verbessert werden. Auf Branchen-<br />
wie auf Bundesebene müssen die seit den ersten Monitoringberichten erkannten Defizite<br />
zügig eliminiert werden (KRISTOF ET AL. 1997). Die im November 2000 getroffene Vereinbarung<br />
zwischen Bundesregierung und Industrie ist hierzu ein erster Schritt, ohne die<br />
Realisierung durch anspruchsvolle Branchenerklärungen bleibt die Aktualisierung <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung<br />
allerdings nur Makulatur. Da die Erfahrungen <strong>der</strong> Vergangenheit vor allem<br />
durch Zeitverzögerungen und unzureichende Reaktionen auf identifizierte Mängel geprägt<br />
sind, ist es erfor<strong>der</strong>lich,<br />
• klare und verbindliche Abläufe und Terminstrukturen zu etablieren, die den Prozeßfortschritt<br />
sichern, und<br />
• konkrete Festlegungen zu treffen, in welcher Form auf Abweichungen, Probleme und<br />
Zielverfehlungen zu reagieren ist.<br />
76
In diesem Sinne ist die Klimaschutzerklärung als ein Management-Tool zu organisieren, das<br />
wie analoge Systeme in <strong>der</strong> Unternehmenspraxis <strong>von</strong> stringenten Zielvorgaben, Zeitplänen,<br />
Controllingmechanismen und Revisionen geprägt wird (Abb. 1). Im Rahmen eines anspruchsvollen<br />
Management by Objectives bleibt die Flexibilität und Dezentralität des Instruments<br />
erhalten, während gleichzeitig die Suche nach Reduktionspotentialen vorangetrieben<br />
wird. Aufbauend auf den Management- und Controllingzyklen im Unternehmen bietet das<br />
allgemeine Monitoring dann die Möglichkeit für politisches Lernen (policy learning).<br />
Abb. 1: Organisation <strong>von</strong> Lern- und Verbesserungsprozesse im Rahmen <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung<br />
Politikebene<br />
Definition <strong>der</strong><br />
Ziele und Rahmenbedingungen<br />
für<br />
Klimapolitik in<br />
<strong>der</strong> Industrie<br />
Interaktionsebene<br />
Unternehmensebene<br />
Verhandlung<br />
<strong>von</strong> Zielen und<br />
Abläufen<br />
Definition <strong>der</strong><br />
Unternehmensziele<br />
& Aktionspläne<br />
Revision <strong>der</strong><br />
Ziele und Rahmenbedingungen<br />
für<br />
Klimapolitik in<br />
<strong>der</strong> Industrie<br />
<strong>Evaluation</strong><br />
Monitoring<br />
Aktion<br />
77<br />
Neu-Verhandlung<br />
<strong>von</strong> Zielen und<br />
Abläufen<br />
Revision <strong>der</strong><br />
Unternehmensziele<br />
& Aktionspläne<br />
Revision <strong>der</strong><br />
Ziele und Rahmenbedingungen<br />
für<br />
Klimapolitik in<br />
<strong>der</strong> Industrie<br />
<strong>Evaluation</strong><br />
Monitoring<br />
Neue<br />
Aktion<br />
Fazit:<br />
Das Instrument birgt beson<strong>der</strong>e Chancen, die durch verstärktes Engagement noch erschlossen<br />
werden müssen.<br />
Die beson<strong>der</strong>en Chancen des Instruments <strong>der</strong> Klimaschutzerklärung liegen darin, in <strong>der</strong><br />
Branche eine anhaltende und letztlich selbstverstärkende Eigendynamik bei <strong>der</strong> Suche nach<br />
Handlungsmöglichkeiten anzustoßen. Die skizzierten Elemente eines Management-Tools<br />
sind dabei die Voraussetzung, den Impuls zu erhalten und durch die permanent wie<strong>der</strong>kehrenden<br />
Anfor<strong>der</strong>ungen stetig neue Anreize für Maßnahmen zu setzen. Wenn dies gelingt,<br />
kann die Klimaschutzerklärung einen originären Beitrag zu Klima- und Umweltpolitik leisten,<br />
<strong>der</strong> in dieser Form <strong>von</strong> an<strong>der</strong>en Instrumenten nicht erreicht wird. Es ist deshalb eine große<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für den VCI, als Verband in Zusammenarbeit mit allen Mitgliedsunterneh-
men, die dafür notwendigen kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozesse zu organisieren.<br />
Als konkrete Ansatzpunkte bieten sich u.a. folgende Aspekte an:<br />
• verstärkte Kommunikation <strong>der</strong> Initiative im gesamten Verband, insbeson<strong>der</strong>e mit Blick auf<br />
KMU;<br />
• explizite Bekenntnisse <strong>der</strong> einzelnen Mitgliedsfirmen zur Unterstützung <strong>der</strong> Verbandserklärung<br />
z.B. in Form schriftlicher Erklärungen;<br />
• explizite Kopplung mit existierenden Initiativen wie Responsible Care o<strong>der</strong> Öko-Audit/ISO14001,<br />
u.a. hinsichtlich <strong>der</strong> Zielvereinbarungen, Dokumentation etc.;<br />
• stärkeres Engagement des Verbandes als Koordinator <strong>von</strong> technologischen Diffusionsprozessen<br />
und Schwerpunktaktionen (z.B. Elektromotorenoffensive in Kooperation mit<br />
ZVEI).<br />
Mit Blick auf die eingangs formulierte strategische Fragestellung ist es neben <strong>der</strong> Weiterentwicklung<br />
<strong>der</strong> Klimaschutzerklärung zusätzlich erfor<strong>der</strong>lich, den Fokus <strong>der</strong> Aktivitäten systematisch<br />
auszuweiten. Für die Chemieindustrie als rohstoffintensiver Sektor bedeutet dies einerseits<br />
die Diskussion <strong>der</strong> Verknüpfungen <strong>von</strong> Energie- und Stoffströmen in <strong>der</strong> Produktion<br />
und den dort verborgenen Min<strong>der</strong>ungspotentialen. An<strong>der</strong>erseits müssen durch integrierte,<br />
branchenübergreifende Analysen die Möglichkeiten für ökoeffiziente Produkte und Dienstleistungen<br />
analysiert werden, bei denen die chemische Industrie z.B. in Form neuer Werkstoffe<br />
eine wichtige Rolle spielen wird.<br />
78
1.3 Kommentar III<br />
Günther Keilitz<br />
Die chemische Industrie hat sich verpflichtet, im Sinne <strong>der</strong> weltweiten Initiative Responsible<br />
Care und Sustainable Development zu handeln und den Schutz <strong>von</strong> Gesundheit und Umwelt<br />
sowie die Sicherheit <strong>von</strong> Mitarbeitern und Mitbürgern aus eigener Verantwortung kontinuierlich<br />
zu verbessern. Entscheidend dabei ist, daß sich „individuelles, gesellschaftliches, wirtschaftliches<br />
und politisches Handeln gleichrangig am ökologischen, ökonomischen und sozialen<br />
Gleichgewicht zu orientieren haben“ (Umweltpakt Bayern II).<br />
Im Energiebereich bezog sich die Selbstverpflichtung bisher auf eine Verbesserung <strong>der</strong><br />
Energieeffizienz und Reduktion <strong>der</strong> CO2-Emissionen. In ihrer weiterentwickelten Selbstverpflichtung<br />
hat die chemische Industrie auch die an<strong>der</strong>en im Kyoto-Protokoll genannten klimarelevanten<br />
Gase (N2O, CH4, HFCs, PFCs und SF6) eingeschlossen. Trotz <strong>der</strong> unbestritten<br />
großen Erfolge mit diesem Instrument wird die Selbstverpflichtung <strong>von</strong> Umweltverbänden<br />
und auch <strong>von</strong> manchen Politikern kritisch betrachtet. Man hört abwertende Äußerungen wie<br />
„Business as Usual“ o<strong>der</strong> gar „Mogelpackung“. Ich möchte dazu zwei Dinge sagen:<br />
1. Der Natur ist es gleichgültig, ob eine Selbstverpflichtung als „Business as Usual“ gesehen<br />
wird o<strong>der</strong> als „Mogelpackung“. Für die Natur zählen nur die absoluten Emissionswerte.<br />
2. Die deutsche Industrie hat ihre Hausaufgaben gemacht: die bis 2005 zugesagten CO2-<br />
Reduktionen sind bereits heute erreicht. Die chemische Industrie hat mit ihrer Verpflichtung,<br />
die absoluten CO2-Emissionen um 30% zu senken, einen beson<strong>der</strong>en Beitrag hierzu<br />
geleistet. Sie hat sich darüber hinaus Anfang 2001 in einer weiterentwickelten Selbstverpflichtung<br />
anspruchvolle neue Ziele gesteckt :<br />
• Die Reduzierung aller Treibhausgase um 45–50% im Zeitraum 1990 bis 2008/12;<br />
• Verbesserung <strong>der</strong> Energieeffizienz um 35–40% im gleichen Zeitraum.<br />
Trotz dieser großen Erfolge stellt sich die Frage nach <strong>der</strong> best practice: Ist Selbstverpflichtung<br />
wirklich das Mittel <strong>der</strong> ersten Wahl? Der VCI meint „ja“ und das möchte ich im Folgenden<br />
erläutern:<br />
Die chemische Industrie versteht unter Selbstverpflichtung nicht nur, mit einigen ausgewählten<br />
Projekten ein paar Tonnen CO2 zu sparen. Die Selbstverpflichtung zum umweltbewußten<br />
Handeln ist vielmehr als integraler Bestandteil einer neuen Unternehmenspolitik zu sehen.<br />
Selbstverpflichtung wurde in die Management-Instrumente integriert. Die Ergebnisse werden<br />
regelmäßig <strong>von</strong> externen Auditoren im Rahmen <strong>der</strong> integrierten Management-System-Audits<br />
(IMS) überprüft. Einige Chemiefirmen haben sich darüber hinaus auch nach <strong>der</strong> EG-Öko-<br />
Auditverordnung validieren lassen. Hierzu hat sich zum Beispiel auch die Firma Wacker im<br />
Rahmen des Umweltpakts Bayern verpflichtet. Die Validierung sämtlicher Standorte in <strong>der</strong><br />
BRD konnte bis Ende 2000 erfolgreich abgeschlossen werden.<br />
Trotz des dadurch erreichten hohen Umweltstandards ist aus meiner Sicht für ein nachhaltiges<br />
Handeln die Motivation und Einbeziehung <strong>der</strong> Mitarbeiter <strong>von</strong> entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung.<br />
In diesem Sinne werden zum Beispiel in <strong>der</strong> Wacker-Chemie Umweltziele in Mitarbei-<br />
79
tergesprächen kommuniziert und festgelegt. Die Zielerreichung geht gemäß <strong>der</strong> geltenden<br />
Betriebsvereinbarung damit unmittelbar in die Gehaltsfindung des einzelnen Mitarbeiters ein.<br />
Die Wacker-Chemie betreibt ein umfassendes Öko-Monitoring. Die Ergebnisse werden zu<br />
einem <strong>der</strong> Öffentlichkeit zugänglichen Umweltbericht zusammengefaßt. Ein regelmäßig<br />
stattfinden<strong>der</strong> Umwelttag gibt die Möglichkeit, diese Ergebnisse <strong>der</strong> Öffentlichkeit vorzustellen<br />
und zu diskutieren.<br />
Die Grundsätze <strong>der</strong> Selbstverpflichtung sind schließlich auch in die Planungsrichtlinien eingeflossen.<br />
So wird zum Beispiel jedes Projekt auf dem Genehmigungsweg hinsichtlich Energieeffizienz<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> zentralen Fachstelle Energie geprüft. Hinsichtlich Umweltrelevanz benötigt<br />
es die Genehmigung <strong>der</strong> zentralen Umweltschutzabteilung.<br />
Aus <strong>der</strong> Vielzahl <strong>von</strong> Projekten, die zu Umweltverbesserungen geführt haben, möchte ich ein<br />
Beispiel herausgreifen, das eindrucksvoll die Bedeutung und beson<strong>der</strong>e Wirkung einer<br />
Selbstverpflichtung demonstriert:<br />
In einem exothermen <strong>chemischen</strong> Prozeß wird Kühlwasser zur Kühlung <strong>der</strong> Reaktoren eingesetzt.<br />
Das Kühlwasser erreicht am Austritt eine verhältnismäßig hohe Temperatur, die sich<br />
grundsätzlich noch energetisch verwerten ließe. So reifte bereits vor 12 Jahren die Idee, diese<br />
Abwärme zu nutzen und einen Heißwasserkreis zur Versorgung <strong>von</strong> Wärmeverbrauchern<br />
zu errichten.<br />
Das Projekt scheiterte damals an dem überraschend hohen Aufwand im Vergleich zur konventionellen<br />
Dampferzeugung im vorhandenen Dampfkraftwerk. Obwohl die Abwärme kostenfrei<br />
in die Investitionsrechnung eingesetzt wurde, ergab die ermittelte Brennstoffeinsparung<br />
nur eine Geldrückflußzeit <strong>von</strong> mehr als sieben Jahren. Außerdem standen soft-barriers<br />
– wie Bequemlichkeit und geringe Risikobereitschaft – dem Projekt entgegen. Der Betrieb<br />
war nicht bereit, ohne kommerziellen Nutzen zusätzliche Verantwortung zu übernehmen.<br />
Durch die Selbstverpflichtung än<strong>der</strong>te sich die Situation grundlegend: Über die soft-barriers<br />
wurde gar nicht mehr diskutiert, im Gegenteil, alle Beteiligten waren bemüht, eine optimale<br />
Lösung zu finden. Es blieb nur noch die Frage nach <strong>der</strong> Wirtschaftlichkeit. Und hier gelang<br />
ein gesamtheitlicher Ansatz, <strong>der</strong> schließlich zum Erfolg führte: Es wurde nicht nur die Brennstoffeinsparung<br />
für die vermiedene Dampferzeugung betrachtet, son<strong>der</strong>n die individuelle<br />
energetische Situation des gesamten Produktionsstandortes. So wurde nicht nur die vermiedene<br />
Kühlwassermenge zusätzlich in Ansatz gebracht, son<strong>der</strong>n auch die Tatsache, daß<br />
hierdurch notwendige Erweiterungsinvestitionen für die Kühlwasseranlagen geschoben werden<br />
konnten.<br />
Das Gesamtergebnis <strong>der</strong> ganzheitlichen Betrachtung brachte eine hervorragende Geldrückflußzeit<br />
<strong>von</strong> nur 2,79 Jahren! Das Projekt wurde realisiert. Es bringt heute eine CO2-<br />
Einsparung <strong>von</strong> ca. 15.000 t/a.<br />
Zusammenfassung:<br />
Ich habe versucht, die „beson<strong>der</strong>en Anstrengungen“ <strong>der</strong> Industrie an Beispielen <strong>der</strong> Wacker-<br />
Chemie zu erläutern. Als wichtigste Punkte möchte ich festhalten:<br />
80
• Jedes Projekt wird auf dem Genehmigungsweg unter Energieeffizienz und Ökogesichtspunkten<br />
geprüft.<br />
• Für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung <strong>von</strong> Investitionsrechnungen ist <strong>der</strong> ganzheitliche<br />
Ansatz entscheidend.<br />
• Bei wirtschaftlich etwa gleichwertigen Alternativen wird die ökologisch überlegenere Variante<br />
realisiert.<br />
• Der Erfolg liegt in <strong>der</strong> Hand <strong>der</strong> Mitarbeiter! Je<strong>der</strong> Mitarbeiter muß <strong>von</strong> <strong>der</strong> Notwendigkeit<br />
eines nachhaltigen Handelns überzeugt sein. Je<strong>der</strong> Mitarbeiter muß motiviert sein, seinen<br />
Beitrag hierzu zu leisten.<br />
• Responsible Care und Sustainable Development werden damit Teil <strong>der</strong> Firmenkultur. Responsible<br />
Care und Sustainable Development werden Business as Usual!<br />
81
1.4 Diskussion<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie werden zur Kenntnis genommen und nicht in Frage gestellt.<br />
Die Diskussion über die Selbstverpflichtung fokussierte sich vor allem auf das Ziel <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung bzw. auf den Prozeß <strong>der</strong> Zielfindung. Die Tatsache, daß das Ziel <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung erreicht wird, wurde <strong>von</strong> keinem Teilnehmer in Frage gestellt. Allerdings<br />
wird diskutiert, ob das Reduktionsziel sachgerecht sei. Hier wurde <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Industrie<br />
auf folgende Aspekte hingewiesen<br />
• Bei <strong>der</strong> Zielformulierung dürfe <strong>der</strong> ökonomische Aspekt, vor allem unter Berücksichtigung<br />
<strong>der</strong> internationalen Dimension, nicht vernachlässigt werden.<br />
• Die Diskussion solle sich möglichst auf die Effektivität und Effizienz <strong>der</strong> abgeschlossenen<br />
Selbstverpflichtung fokussieren und nicht so sehr auf die Diskussion möglicher wünschbarer<br />
Ziele. Denn je diffuser die Ziele formuliert seien, desto schwieriger sei die Zielerreichung.<br />
Diesen Aspekten wurde entgegengehalten, daß gerade <strong>der</strong> permanente Zielsetzungs-, Controlling-<br />
und Revisionsprozeß als zentraler Bestandteil einer solchen Selbstverpflichtung angesehen<br />
werden müsse. Denn angesichts <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Reduktionen in den kommenden<br />
Dekaden seien dauernde Suchprozesse erfor<strong>der</strong>lich, bei denen ständig neu geprüft<br />
werden müsse, an welchen Stellen man mit <strong>der</strong> Reduktion noch weiterkommen könne; jede<br />
machbare Einsparung sei <strong>von</strong> Bedeutung.<br />
Neben den Zielen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung wurde auch die Bedeutung des politischen Vertrages<br />
diskutiert, den Herr Ressing in seinem Referat erwähnt hatte. Hierzu wurde darauf hingewiesen,<br />
daß das Abschließen eines politischen Vertrages zwar keine juristische, aber eine<br />
politische Bindewirkung habe. Zugleich dürfe die Politik das Heft aber nicht aus <strong>der</strong> Hand<br />
geben und müsse über Sanktionsdrohungen verfügen, da dann <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im allgemeinen<br />
umso wirksamer seien.<br />
82
2. Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung<br />
<strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
Zunächst stellte das Institut die wichtigsten Ergebnisse zu dieser Selbstverpflichtung vor. Inhaltlich<br />
entsprachen diese Ausführungen dem Teil A, Kapitel IV.2.2, des vorliegenden Berichts.<br />
Zu den Ergebnissen dieser <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben folgende Personen Stellung genommen:<br />
• Dr. Christine Frank-Otto, BASF AG, Ludwigshafen;<br />
• Andreas Ahrens, Institut für Ökologie und Politik GmbH (ökopol), Hamburg.<br />
83
2.1 Kommentar I<br />
Christine Frank-Otto<br />
Die Selbstverpflichtung zur Datenlage gehandhabter Stoffe ist die bisher weitestreichende<br />
und umfassendste VCI-Selbstverpflichtung,<br />
• da jedes Mitgliedsunternehmen betroffen ist und<br />
• nicht nur Einzelwerte zu erfassen, son<strong>der</strong>n umfangreiche Aufgaben zu erfüllen sind.<br />
Zur Unterstützung wurden <strong>von</strong> seiten des VCI ein umfangreicher Leitfaden verteilt sowie Informationsveranstaltungen<br />
abgehalten.<br />
Die <strong>der</strong> VCI-Selbstverpflichtung zugrundeliegenden Vorgaben wurden detailliert mit dem<br />
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) abgestimmt. Die<br />
damalige Umweltministerin Frau Dr. Angela Merkel äußerte sich in <strong>der</strong> Pressemitteilung anläßlich<br />
<strong>der</strong> Übergabe <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durch den VCI-Präsidenten Dr. Jürgen Strube<br />
wie folgt:<br />
„...Diese Anstrengung fügt sich nicht nur vorbildhaft in die Tätigkeiten im Rahmen <strong>der</strong> weltweiten<br />
Initiative Responsible Care ® - Verantwortliches Handeln <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie ein,<br />
son<strong>der</strong>n sie ergänzt auch die bestehenden rechtlichen Regelungen auf europäischer und<br />
deutscher Ebene und trägt damit wesentlich zur Verbesserung <strong>der</strong> Chemikaliensicherheit<br />
bei.“<br />
Die <strong>von</strong> <strong>der</strong> VCI-Selbstverpflichtung vorgeschriebene Datenerhebung und -qualität wird<br />
mittlerweile auch vom EU-Weißbuch Strategie für eine zukünftige Chemikalienpolitik bestätigt:<br />
• Das Weißbuch for<strong>der</strong>t sog. basic information für Stoffe > 1 t/a. Es ist da<strong>von</strong> auszugehen,<br />
daß sich diese mit den <strong>von</strong> <strong>der</strong> VCI-Selbstverpflichtung gefor<strong>der</strong>ten Daten weitgehend<br />
decken.<br />
• Das Weißbuch sieht – wie auch die VCI-Selbstverpflichtung – Screening-Tests und SAR<br />
für die Ermittlung <strong>von</strong> Daten vor.<br />
Für kleinere und mittlere Mitgliedsunternehmen stellt die VCI-Selbstverpflichtung eine höhere<br />
Belastung im Rahmen ihrer Produktsicherheitsaufgaben als bisher dar. Die geleisteten Arbeiten<br />
stellen jedoch eine Vorbereitung auf künftige Anfor<strong>der</strong>ungen des Weißbuches an<br />
Weiterverarbeiter dar.<br />
Die VCI-Selbstverpflichtung hat kein Pendant auf europäischer Ebene, d.h. seit Jahren besteht<br />
eine Mehrbelastung für die deutsche chemische Industrie im Vergleich zu europäischen<br />
Unternehmen.<br />
Das Weißbuch gleicht erstmals diese Ungleichbehandlung aus, indem EU-weite Vorgaben<br />
für hergestellte und/o<strong>der</strong> importierte Stoffe > 1 t/a bestehen.<br />
84
Gemäß <strong>der</strong> VCI-Selbstverpflichtung sollen innerhalb <strong>von</strong> fünf Jahren, d. h. bis September<br />
2002, Mindestdaten zu gehandhabten Stoffen erarbeitet sein.<br />
Die VCI-Selbstverpflichtung stellt jedoch kein statisches System dar, das hier seinen Abschluß<br />
finden wird. Auch über diesen Zieltermin hinaus werden die Mitgliedsunternehmen<br />
künftig die gleichen Ansprüche an die Datenlage neu hinzukommen<strong>der</strong> Stoffe anlegen.<br />
85
2.2 Kommentar II<br />
Andreas Ahrens<br />
Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
• Die betriebsinterne Verfügbarkeit <strong>der</strong> für den Schutz des Menschen und <strong>der</strong> Umwelt erfor<strong>der</strong>lichen<br />
Informationen für hergestellte und zugekaufte Stoffe einschließlich intern gehandhabter<br />
Zwischenprodukte soll sichergestellt werden.<br />
• Kommentar: Das Ziel ist begrüßenswert, entspricht aber in erheblichem Umfang <strong>der</strong> geltenden<br />
Gesetzeslage im Arbeitnehmerschutz und bei <strong>der</strong> Klassifizierung und Kennzeichnung<br />
<strong>von</strong> Chemikalien.<br />
Das Ziel wurde unklar kommuniziert<br />
• Welcher Akteur wird aussagefähiger – Stoffhersteller o<strong>der</strong> auch Formulierer und Handel?<br />
• Worüber wird er aussagefähiger – Stoffeigenschaften o<strong>der</strong> Risiko in bestimmten Expositionsfällen?<br />
• Wozu sind die Aussagen nutzbar – Anlagensicherheit, Umweltschutz, Produktsicherheit?<br />
• Wem gegenüber wird er aussagefähiger – Nachbarschaft, Behörden, Kunden?<br />
• Welchen Grad an Sicherheit haben die Aussagen – Screeninglevel o<strong>der</strong> Bewertung?<br />
Akteursspezifische Umsetzung notwendig<br />
• Auf 1500 große Unternehmen in <strong>der</strong> EU entfallen 72% des Chemie-Umsatzes. Große<br />
Stoffhersteller verfügen über Datenzugangsmöglichkeiten und Managementkapazität, die<br />
eine Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung relativ leicht machen.<br />
• An<strong>der</strong>s ist die Situation für die 36.000 KMUs. Kleine Stoffhersteller, Formulierer und <strong>der</strong><br />
Chemikalienhandel benötigen externe Beratung durch den Verband o<strong>der</strong> beauftragte<br />
Dienstleister, um die Selbstverpflichtung umzusetzen.<br />
86
Der Verwendungszweck des Mindestdatensatzes<br />
muß definiert werden.<br />
Mindest-<br />
Datensatz<br />
Der Mindestdatensatz dient <strong>der</strong><br />
Identifikation möglicher Problem-bereiche<br />
und <strong>der</strong> Prioritätensetzung<br />
87<br />
S H E<br />
Management<br />
Product<br />
Stewardship<br />
Umfang des Mindestdatensatzes<br />
Kriterium VCI Lit Invitro<br />
QSAR<br />
P Ja<br />
B Ja<br />
Takut, Säuger Ja<br />
Takut, aquat Ja<br />
Tcarc + mut ?<br />
Trepro Nein<br />
Tendokrin Nein<br />
Nein<br />
Tsensi<br />
Erfor<strong>der</strong>liche Daten und Datenquellen<br />
invivo<br />
• Der Mindestdatensatz sollte Aussagen darüber erlauben, ob ein Stoffe PBT*-<br />
Eigenschaften o<strong>der</strong> CMR-Eigenschaften hat.<br />
• Die Daten können <strong>der</strong> Literatur entnommen werden. Vielfach sind auch ausreichend zuverlässige<br />
Invitro-Tests und/o<strong>der</strong> Quantitative Struktur-Wirkungsbeziehungen (QSAR)<br />
verfügbar. Auf neue Tierversuche sollte bei <strong>der</strong> Erhebung des Mindestdatensatzes, soweit<br />
möglich, verzichtet werden.
Mögliche Nutzung des Mindestdatensatzes<br />
• Erstinformation im Störfall;<br />
• Identifikation <strong>von</strong> Stoffen mit potentieller Besorgnis und Prioritätensetzung je nach erwartetem<br />
Expositionstyp;<br />
• Vorläufige Einstufung nach 67/548;<br />
• Vorläufige Risikoabschätzung.<br />
Mindestdatensatz über potentielle Exposition für jeden Stoff erfor<strong>der</strong>lich<br />
• Grundlegende Expositionstypen geben Orientierung:<br />
• Intermediate bei chemischer Produktion;<br />
• „Geschlossene“ industrielle Anwendungsprozesse;<br />
• „Geschlossene“ Prozeß-Produkt-Kette;<br />
• Offene Verwendung in Arbeits- und/o<strong>der</strong> Wohnumwelt und/o<strong>der</strong> natürlicher Umwelt;<br />
• Verwendung in Nahrung und auf <strong>der</strong> Haut.<br />
Anregungen zur Weiterentwicklung<br />
• Die Datenverwendung sollte praxisnah und klar definiert werden.<br />
• Zu jedem Stoff ist ein paralleler Mindestdatensatz zur potentiellen Exposition anzulegen.<br />
• Es sind Anleitungen zur Umsetzung in <strong>der</strong> betrieblichen Praxis (einschließlich Datenquellen)<br />
erfor<strong>der</strong>lich (Training, Beratung, Anreize).<br />
• Es sollte ein System zur Erfolgskontrolle entwickelt werden.<br />
Vorgeschlagenes Format für den Leistungsbericht<br />
• Definierter Datensatz und Methodik;<br />
• Anzahl und Größe <strong>der</strong> Unternehmen, die sich beteiligen (Statistik);<br />
• Anzahl <strong>der</strong> Stoffe > 1 t/a pro Unternehmen;<br />
• Datenverfügbarkeit pro Endpunkt im Minimaldatensatz pro Stoff und Unternehmen;<br />
• Die Entwicklung dieser Indikatoren kann <strong>der</strong> Leistungsmessung dienen.<br />
88
2.3 Diskussion<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie werden zur Kenntnis genommen und nicht in Frage gestellt.<br />
In <strong>der</strong> Diskussion war das Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ein zentraler Punkt.<br />
Es wurden unterschiedliche Auffassungen darüber geäußert, was das Ziel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
gewesen sei bzw. sein solle. Eine Auffassung war, daß die Selbstverpflichtung im<br />
wesentlichen die Generierung eines bestimmten Minimaldatensatzes vorsehe und daß alle<br />
weitergehenden Überlegungen, z.B. hinsichtlich <strong>der</strong> Mindestaussagefähigkeit, eher als problematisch<br />
anzusehen seien. Insbeson<strong>der</strong>e reiche <strong>der</strong> Mindestdatensatz nicht für eine Risikobewertung<br />
aus, son<strong>der</strong>n sei in erster Linie für eine Prioritätensetzung für die genauere<br />
Stoffbewertung sinnvoll. Diesbezüglich wurde auch erneut darauf hingewiesen, daß es unproduktiv<br />
sei, im Nachhinein über zusätzliche wünschbare Ziele zu sprechen. Die Ergebnisse<br />
<strong>der</strong> Studie hätten überdies gezeigt, daß schon dieser erste Schritt, die Erhebung eines begrenzten<br />
Datensatzes, mit Schwierigkeiten verbunden gewesen sei.<br />
Eine an<strong>der</strong>e Auffassung war, daß die Definition einer Mindestaussagefähigkeit als <strong>der</strong> wesentliche<br />
Punkt dieser Selbstverpflichtung anzusehen sei; dies habe es vor <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
nicht gegeben, so daß damit Maßstäbe gesetzt worden seien. In einem an<strong>der</strong>en<br />
Beitrag wurde aber auch vermerkt, daß bei <strong>der</strong> Selbstverpflichtung eine Vermischung <strong>der</strong><br />
Ziele stattgefunden habe: so sei es einerseits um die Aussagefähigkeit gegangen, an<strong>der</strong>erseits<br />
um das Schaffen einer gewissen Systematik für die interne Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffdaten.<br />
In mehreren Beiträgen wurde darauf hingewiesen, daß es in erster Linie darauf angekommen<br />
sei, einen Prozeß anzustoßen, <strong>der</strong> zu Verbesserungen führe. Diesbezüglich wurde<br />
auch auf die Folgeaktivitäten in Unternehmen hingewiesen, die durch die Selbstverpflichtung<br />
angestoßen worden seien.<br />
Unverständnis wurde in einem Diskussionsbeitrag darüber geäußert, daß das Bundesumweltministerium<br />
nicht zu einer Stellungnahme im Rahmen <strong>der</strong> Untersuchung bereit gewesen<br />
sei, obwohl die Selbstverpflichtung mit dem Ministerium abgesprochen worden sei.<br />
Neben <strong>der</strong> Zieldefinition ging es in <strong>der</strong> Diskussion auch um einen kontinuierlichen Controlling-Prozeß,<br />
um zu gewährleisten, daß sowohl unternehmensintern als auch unternehmensextern<br />
Leistungsnachweise und Leistungskontrollen möglich sind. Diese seien wie<strong>der</strong>um<br />
die Basis für die erfolgreiche Umsetzung einer Selbstverpflichtung und die Schaffung <strong>von</strong><br />
Transparenz. Hier wurde einerseits auf den bestehenden Umsetzungsleitfaden verwiesen;<br />
an<strong>der</strong>erseits wurde darauf hingewiesen, daß ein solcher Leitfaden nicht den Dialog mit den<br />
Unternehmen und <strong>der</strong>en Beratung ersetze.<br />
89
3. Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer<br />
Gewässerrelevanz<br />
Zunächst stellte das Institut die wichtigsten Ergebnisse zu dieser Selbstverpflichtung vor. Inhaltlich<br />
entsprachen diese Ausführungen dem Teil A, Kapitel IV.2.3, des vorliegenden Berichts.<br />
Zu den Ergebnissen dieser <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben folgende Personen Stellung genommen:<br />
• Lothar Noll, Verband TEGEWA e.V., Frankfurt;<br />
• Dr. Harald Schönberger, freiberuflicher Umweltingenieur, Freiburg.<br />
90
3.1 Kommentar I<br />
Lothar Noll<br />
Ende <strong>der</strong> 80er und Anfang <strong>der</strong> 90er Jahre wurde die Öffentlichkeit und auch die Politik für die<br />
Frage sensibilisiert, ob <strong>von</strong> Bekleidungstextilien Gefahren für den Menschen und die Umwelt<br />
ausgehen können. Ursache hierfür waren Veröffentlichungen wie „Gift im Klei<strong>der</strong>schrank“,<br />
„Kleidungsgifte“ und Fernsehbeiträge wie „Die zweite Haut“ usw...<br />
Vor diesem Hintergrund hat sich die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und <strong>der</strong><br />
Umwelt“ in <strong>der</strong> Legislaturperiode 1990 bis 1994 auch mit dem Bedürfnisfeld Textilien befaßt<br />
und in ihrem Abschlußbericht 1994 eine Reihe <strong>von</strong> Empfehlungen ausgesprochen. Eine dieser<br />
Empfehlungen war die Einrichtung einer Informationssammelstelle zur ökologischen<br />
Klassifizierung <strong>von</strong> Farb- und Textilhilfsmitteln national und in <strong>der</strong> EU.<br />
Die Umweltministerkonferenz des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> (UMK) hat diese Empfehlung aufgegriffen<br />
und das BMU gebeten, mit den <strong>Verbände</strong>n <strong>der</strong> THM-Hersteller und <strong>der</strong> Textilindustrie<br />
in Verhandlungen einzutreten mit dem Ziel, eine Zentralstelle/Informationssammelstelle<br />
zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln hinsichtlich ihrer gewässerökologischen Bedeutung<br />
einzurichten.<br />
Nach Bekanntwerden dieser Auffor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> UMK an das BMU hat <strong>der</strong> Verband TEGEWA<br />
unverzüglich Kontakt mit dem Gesamtverband <strong>der</strong> Deutschen Textilveredlungsindustrie (TVI-<br />
Verband) und den Umweltministerien <strong>der</strong>jenigen Län<strong>der</strong> aufgenommen, in denen die Textilveredlungsindustrie<br />
schwerpunktmäßig ansässig ist, dies sind Baden-Württemberg, Hessen,<br />
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen-Anhalt.<br />
Ziel dieser Gespräche war, die Einrichtung einer Zentralstelle zu vermeiden, weil eine solche<br />
• einen unnötigen bürokratischen Aufwand und das Gegenteil <strong>von</strong> "Deregulierung",<br />
• einen Schritt in Richtung Zulassung und<br />
• eine Einschränkung <strong>der</strong> Produktentwicklung bei den Herstellern <strong>von</strong> Textilchemikalien<br />
bedeutet hätte.<br />
Die vom Verband vorgetragenen Argumente haben die UMK offensichtlich überzeugt: Die<br />
Empfehlung zur Einrichtung einer Zentralstelle wurde aufgegeben.<br />
Allerdings hat die UMK im Jahre 1995 dem BMU den Auftrag gegeben, zusammen mit den<br />
Län<strong>der</strong>n und den <strong>Verbände</strong>n TEGEWA und TVI eine ökologische Bewertung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln<br />
vorzunehmen, die es den Anwen<strong>der</strong>n ermöglicht, beson<strong>der</strong>s umweltverträgliche Produkte<br />
auszuwählen, insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich ihrer gewässerökologischen Bedeutung.<br />
Der Verband TEGEWA hat diesen Auftrag angenommen und zusammen mit dem TVI-<br />
Verband und den Behörden in eigener Initiative ein pragmatisches Thema zur Beurteilung<br />
<strong>der</strong> ökologischen Verträglichkeit <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln erarbeitet, das<br />
• eine Zentralstelle und Behördenkontrolle entbehrlich macht,<br />
• auf vorhandenen Daten (Sicherheitsdatenblätter) aufbaut,<br />
91
• nicht zu einem „zahlenmäßigen ranking“ <strong>der</strong> THM führt und<br />
• nicht nur national, son<strong>der</strong>n auch europäisch eingeführt werden kann.<br />
Nach zweijährigen Beratungen hat <strong>der</strong> Verband im November 1997 dem BMU die "Selbstverpflichtung<br />
zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz" übergeben,<br />
in <strong>der</strong> er zusagt, seinen Mitgliedsfirmen zu empfehlen, die <strong>von</strong> ihnen hergestellten und<br />
in Verkehr gebrachten Textilhilfsmittel in die Abwasser-Relevanz-Stufen (ARS)<br />
• ARS I = wenig abwasserrelevant<br />
• ARS II = abwasserrelevant<br />
• ARS III = stark abwasserrelevant<br />
einzustufen.<br />
In Ergänzung zur Selbstverpflichtung des Verbandes TEGEWA hat <strong>der</strong> TVI-Verband ebenfalls<br />
eine Selbstverpflichtung abgegeben, in <strong>der</strong> er dem BMU gegenüber zusagt, seinen Mitgliedsfirmen<br />
zu empfehlen, nur noch solche Textilhilfsmittel zu verwenden, die nach dem<br />
Klassifizierungskonzept eingestuft sind, und dabei nach Möglichkeit solche zu bevorzugen,<br />
die weniger gewässerrelevant sind.<br />
Zum Stand <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung und dem Monitoring, das als ein wesentlicher<br />
"Baustein" <strong>der</strong> Selbstverpflichtung dem BMU gegenüber zugesagt worden ist, ist folgendes<br />
festzuhalten:<br />
• Januar 1999: Erhebung <strong>von</strong> Anzahl und Mengen <strong>der</strong> den ARS-Stufen zugeordneten und<br />
im Inland verkauften Textilhilfsmittel.<br />
• März 1999: Erster Bericht an das BMU über Ist-Zustand. Zu diesem ersten Bericht hat<br />
das BMU mitgeteilt, daß es durch die vom Verband TEGEWA ausgesprochene Selbstverpflichtung<br />
gelungen ist, einen positiven Trend zugunsten <strong>der</strong> Umwelt in Gang zu setzen.<br />
Das BMU hebt insbeson<strong>der</strong>e hervor, daß es den Anwen<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nun<br />
erst möglich ist, sich durch die Wahl des als wenig abwasserrelevant eingestuften Produktes<br />
umweltgerecht zu verhalten.<br />
• April 1999: Beginn <strong>der</strong> stichprobenartigen Überprüfung <strong>der</strong> Klassifizierung durch einen<br />
<strong>von</strong> TEGEWA benannten Experten (Monitoring). Von 33 THM herstellenden Unternehmen<br />
sind bislang 16 Firmen untersucht. Die Überprüfung <strong>von</strong> 9 Unternehmen erfolgt in diesem<br />
Jahr, die <strong>der</strong> verbleibenden 8 im Jahr 2002.<br />
Bei dem Monitoringverfahren hat sich gezeigt, daß<br />
• <strong>der</strong> Bekanntheitsgrad bei Kunden inzwischen sehr hoch ist,<br />
• die ARS einen wichtigen Faktor im Beschaffungswesen darstellen,<br />
• <strong>der</strong> ökologische Wettbewerb zwischen THM-Herstellern voll zum Tragen kommt,<br />
• die ARS-Einstufungen zur Bereinigung des Sortiments genutzt werden und<br />
• die Einstufung sämtlicher THM bereits Ende 2000 erfolgt war.<br />
92
• März 2001: Erster Bericht über die Wirksamkeit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung an das BMU. In<br />
diesem Bericht werden dem BMU auch die Ergebnisse <strong>der</strong> weitergeführten Umfrage über<br />
die in Deutschland verkauften Anzahl und Mengen an THM mitgeteilt. Die Erhebung zeigt,<br />
daß die Mengen an ARS-III-Stoffen <strong>von</strong> 1997 bis zum Jahr 2000 um 67 %, die ARS-II-<br />
Stoffe um 20 % abgenommen haben, während die ARS-I-Stoffe einen Anstieg <strong>von</strong> 6 %<br />
aufweisen.<br />
Als Fazit ist festzuhalten, daß die TEGEWA-Mitgliedsfirmen die große Verantwortung, die sie<br />
mit <strong>der</strong> Erfüllung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für das Image <strong>der</strong> gesamten Branche übernommen<br />
haben, erkannt und ernst genommen haben. Was bleibt, ist <strong>der</strong> Wunsch nach einer europäischen<br />
Harmonisierung, damit nicht weiterhin uneingestufte Textilhilfsmittel mit in <strong>der</strong> Bundesrepublik<br />
hergestellten Produkten konkurrieren können, die<br />
• entwe<strong>der</strong> den Makel einer ARS-III-Einstufung tragen o<strong>der</strong><br />
• aufgrund vorgenommener Rezepturumstellungen preislich unterlegen sind.<br />
Einen Ansatz hierfür bieten die im Rahmen <strong>der</strong> IPPC-Richtlinie (integrated pollution prevention<br />
control) zu ermittelnden „best verfügbaren Techniken“ (best available techniques – BAT)<br />
zur Reduzierung <strong>von</strong> Emissionen <strong>der</strong> wichtigsten Industrien. Die EU hat zugesagt, das TE-<br />
GEWA-Selbstverpflichtungskonzept als „Kandidaten“ für die BAT in die entsprechenden Dokumente<br />
aufzunehmen.<br />
93
3.2 Kommentar II<br />
Harald Schönberger<br />
Rahmenbedingungen nach Enquete-Kommission-Empfehlung 1994 u. UMK-Beschluß<br />
vom 12. Mai 1995<br />
• Ordnungsrechtliche Regelung auf Basis ChemG scheidet praktisch aus<br />
• Kräftegleichgewicht gegeben – Vereinbarung einer freiwilligen Selbstverpflichtung erfor<strong>der</strong>t<br />
hohes Maß an Konsens<br />
• Heterogenes Meinungsbild auf Industrie-und Behördenseite<br />
� hohes Maß an gemeinsamer Motivation und Kompromissbereitschaft unverzichtbar<br />
Erreichtes und weitere Entwicklung<br />
• Schritt in die richtige Richtung:<br />
• Reduzierung <strong>der</strong> ARS-III-Produkte allein positiviert die Selbstverpflichtung<br />
• Entwicklung angestoßen<br />
• Weitere Entwicklung sicherstellen:<br />
• Erster Bericht an das BMU bis 31. März 2001 – Standortbestimmung<br />
• Umsetzungskontrolle – auch bei Textilveredlungsbetrieben (Vorschlag: 50 Einsatzstofflisten<br />
auswerten)<br />
• Europäische Dimension – Aufnahme in „BREF Textile Industry“ als Anfang<br />
94
3.3 Diskussion<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie werden zur Kenntnis genommen und nicht in Frage gestellt.<br />
In <strong>der</strong> Diskussion wird diese Selbstverpflichtung übereinstimmend als ein Erfolg bezeichnet.<br />
Dafür sei, so ein Votum, die Klarheit des Zieles und <strong>der</strong> gemeinsame Wille zur Umsetzung<br />
entscheidend gewesen.<br />
In <strong>der</strong> Diskussion äußerte ein Vertreter des Umweltbundesamtes (UBA) den Wunsch, die<br />
Aussagekraft <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu präzisieren, auch durch Bereitstellung zusätzlicher<br />
Daten.<br />
Zusätzlich wurde auch nach <strong>der</strong> Bedeutung <strong>von</strong> Nichtverbandsmitglie<strong>der</strong>n gefragt. Hierzu<br />
wurde festgestellt daß Nichtverbandsmitglie<strong>der</strong> bei dieser Selbstverpflichtung keine allzu<br />
große Rolle spielten, da die Unternehmen des Verbandes den Markt zu ca. 95% abdecken<br />
würden.<br />
95
4. Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende<br />
und holzverfärbende Organismen<br />
Zunächst stellte das Institut die wichtigsten Ergebnisse zu dieser Selbstverpflichtung vor. Inhaltlich<br />
entsprachen diese Ausführungen dem Teil A, Kapitel IV.2.4, des vorliegenden Berichts.<br />
Zu den Ergebnissen dieser <strong>Selbstverpflichtungen</strong> haben folgende Personen Stellung genommen:<br />
• Dr. Josef-Theo Hein, Dyrup Deutschland GmbH, Mönchengladbach;<br />
• Dr. Hans Reifenstein, Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin<br />
(BgVV), Berlin.<br />
96
4.1 Kommentar I<br />
Josef-Theo Hein<br />
Die Auswirkungen <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung werden durchweg positiv beurteilt, sowohl<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Industrie als auch <strong>von</strong> den Behörden. Es ist gelungen, einen großen Schritt in<br />
Richtung Verbraucherschutz nach vorne zu gehen, ohne eine Monopolstellung für ein bestimmtes<br />
System zu manifestieren.<br />
Die Ausgangslage wurde 1994 durch einen Brief des damaligen Bundesgesundheitsamtes<br />
an alle Kunden <strong>der</strong> Farb- und Lackindustrie hervorgerufen, „nur noch RAL-Produkte zu verwenden“.<br />
Als Begründung wurde <strong>der</strong> riesige, große, graue Markt <strong>von</strong> mehr als 2000 Produkten angeführt.<br />
Zu dem damaligen Zeitpunkt wurden insbeson<strong>der</strong>e die Bläueschutz-Produkte und alle<br />
an<strong>der</strong>en Lasuren und Farben als grauer Markt ausgegrenzt, da diese kein RAL-<br />
Holzschutzmittel-Gütezeichen hatten. Diese Farben, Lasuren und Grundierungen konnten<br />
prinzipiell kein RAL-Gütezeichen haben, da hierfür überhaupt kein Bewertungsverfahren vorgesehen<br />
war. Dadurch wurde <strong>der</strong> Handel stark verunsichert. Die Initiative des Lackverbandes<br />
hat diesen Mißstand aufgezeigt und dafür gesorgt, daß eine freiwillige Selbstverpflichtung<br />
möglich wurde, um diesen angeblichen grauen Markt ein großes Stück vorwärts zu regulieren.<br />
Dabei stand für die Bläueschutzgrundierungen im Vor<strong>der</strong>grund, die Bestandteile eines Beschichtungssystems<br />
sind, ein vereinfachtes Registrierverfahren zu etablieren. Der Hintergrund<br />
war, den Verbraucherschutz sicherzustellen und die Methodik <strong>der</strong> Rahmenrezepturen<br />
zu nutzen, so wie es auch in <strong>der</strong> Biozid-Richtlinie vorgesehen ist. Ziel war ein einfaches, kostengünstigeres<br />
Verfahren, um eine breite Akzeptanz im Markt zu erhalten.<br />
Es muß hier jedoch deutlich herausgestellt werden, daß seitens des Ministeriums und <strong>der</strong><br />
Behörden ungleiche Maßstäbe gesetzt wurden, in <strong>der</strong> Art, daß das Registrierverfahren für<br />
die Bewertung durch die Behörden kostenpflichtig ist und die RAL-Gütegemeinschaft für ihre<br />
Mitglie<strong>der</strong> weiterhin eine kostenfreie Bewertung durch die Behörden erhält. Es wurde deutlich,<br />
daß ein privater Verein die Kosten nach Belieben rauf- o<strong>der</strong> runtersetzen kann, ohne<br />
dem Zwang durch eine neutrale Kontrolle zu unterliegen.<br />
Ein weiteres Manko war, das die Verabschiedung <strong>der</strong> Rahmenrezepturen durch alle Beteiligten,<br />
d.h. die komplette Bewertung, insgesamt zu einer mehrjährigen Verzögerung geführt<br />
hat, so daß insgesamt die in <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung vorgesehene Zeitspanne<br />
nicht realisiert werden konnte. Ich möchte hier nicht dem Einen o<strong>der</strong> dem An<strong>der</strong>en einen<br />
Schwarzen Peter zuschieben, son<strong>der</strong>n insgesamt ist dies ein nicht erfreuliches Ergebnis, da<br />
dadurch de facto die Registrierung zugunsten <strong>der</strong> RAL-Gütegemeinschaft über einen Zeitraum<br />
hinweg blockiert wurde. Dies ist aber nicht <strong>der</strong> Registrierstelle beim UBA anzulasten.<br />
Ein Monitoringverfahren zum positiven Ausloten <strong>der</strong> Umsetzung ist selbstverständlich notwendig.<br />
Das in diesem speziellen Fall, auf Wunsch des Bundesumweltministeriums, festgelegte Monitoringsystem<br />
hat keinen positiven „Steuerungseffekt“, da es als zusätzliche Hürde eher abschreckend<br />
wirkt. Die Firmen, die die freiwillige Selbstverpflichtung umsetzen, werden zu-<br />
97
sätzlich belastet und diejenigen, die nicht teilnehmen o<strong>der</strong> diese umgehen, haben keine Zusatzkosten<br />
und werden so belohnt.<br />
Insgesamt läßt sich durchweg ein positives Fazit ziehen, da durch diese freiwillige Selbstverpflichtung<br />
Industrie und Behörden gemeinsam gelernt haben, bestimmte Praktiken zu erproben<br />
und wir die Hoffnung haben, daß diese Arbeit und Vorleistung gewürdigt werden bei <strong>der</strong><br />
Umsetzung in ein nationales Biozidgesetz, sprich insbeson<strong>der</strong>e bei <strong>der</strong> Erweiterung <strong>der</strong><br />
Chemikalien-Verbotsverordnung und den dann später notwendigen Verordnungen und Erlassen.<br />
Weiterhin kann konstatiert werden, daß dieser große, graue Markt in <strong>der</strong> vorhandenen dargestellten<br />
Form nicht existent ist, da eindeutige Marktforschungsergebnisse z.B. <strong>der</strong> GfK<br />
(Gesellschaft für Konsumforschung) belegen, daß ein Großteil <strong>der</strong> verkauften Produkte im<br />
Baumarkt und auch im Fachhandelsbereich den Maßgaben <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung<br />
entsprechen.<br />
Positiv läßt sich weiterhin vermerken, daß durch die freiwillige Selbstverpflichtung Aktionen<br />
und Interessen <strong>der</strong> Mitgliedsfirmen des Lackverbandes und <strong>der</strong> Deutschen Bauchemie, respektive<br />
<strong>der</strong> RAL-Gütegemeinschaft, irgendwie in gemeinsamen Zielen gebündelt werden<br />
können.<br />
Ich denke z.B. an die Abwasch- o<strong>der</strong> Auswaschversuche, die vom Umweltbundesamt gefor<strong>der</strong>t<br />
werden, o<strong>der</strong> die Berücksichtigung <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung bei <strong>der</strong> Umsetzung<br />
<strong>der</strong> europäischen Biozidgesetzgebung in nationales Recht.<br />
Trotz unterschiedlicher Standpunkte muß hier die Industrie unter dem Segel des VCI und mit<br />
Unterstützung <strong>der</strong> Behörden die Zukunft aktiv gestalten und dazu eignen sich freiwillige<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> besser als Gesetze.<br />
98
4.2 Kommentar II<br />
Hans Reifenstein<br />
Die Verwendung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln ist in <strong>der</strong> Vergangenheit im Zusammenhang mit gesundheitsbezogenen<br />
Verbraucherschutzfragen heftig in <strong>der</strong> Öffentlichkeit diskutiert worden.<br />
Der Holzschutzmittelprozeß beim Landgericht Frankfurt hat verdeutlicht, daß eine nicht<br />
sachgerechte Verwendung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln – insbeson<strong>der</strong>e in Innenräumen – zu Befindlichkeitsstörungen<br />
bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bzw. Schädigungen<br />
führen kann. Die sichere Anwendung <strong>der</strong>artig kritischer Produkte ist somit <strong>von</strong> folgenden Bedingungen<br />
abhängig zu machen:<br />
Holzschutzmittel müssen<br />
• wirksam sein,<br />
• gesundheitlich und umweltbezogen unbedenklich sein,<br />
• sachgerecht und bestimmungsgemäß verwendet werden.<br />
Diese Bedingungen werden gegenwärtig in Deutschland in einigen Bereichen des <strong>chemischen</strong><br />
Holzschutzes, und zwar im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Holzschutzmittel<br />
beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) und bei <strong>der</strong> Verleihung des RAL-Gütezeichens<br />
Holzschutzmittel durch die Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e. V., erfüllt. Mit diesen<br />
Prüfverfahren konnten grundlegende Normen des <strong>chemischen</strong> Holz- und Verbraucherschutzes<br />
durchgesetzt und ein hoher Stand an Anwen<strong>der</strong>- und Verbrauchersicherheit bei <strong>der</strong><br />
Verwendung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln erreicht werden. Dennoch verbleiben erhebliche Kritikpunkte<br />
und Defizite im Verbraucherschutz, weil sich in Ermangelung gesetzlicher Regelungen<br />
für Holzschutzmittel neben den geprüften Produkten eine Vielzahl <strong>von</strong> Holzschutzmitteln<br />
auf dem Markt befindet, die nicht auf Wirksamkeit sowie gesundheitliche und umweltbezogene<br />
Unbedenklichkeit geprüft wurden und mangelhafte Kennzeichnungen, Warn- und Verwendungshinweise<br />
aufweisen.<br />
Mit <strong>der</strong> „Freiwilligen Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende<br />
und/o<strong>der</strong> holzverfärbende Organismen des Verbandes <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V.<br />
(VCI), <strong>der</strong> Deutschen Bauchemie e. V. und des Verbandes <strong>der</strong> Lackindustrie e. V. (VdL)“<br />
sollte in <strong>der</strong> Übergangsphase bis zur Umsetzung <strong>der</strong> europäischen Biozid-Richtlinie ein Beitrag<br />
zur Verbesserung des Verbraucher- und Umweltschutzes bei <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong><br />
Holzschutzmitteln durch folgende Maßnahmen geleistet werden:<br />
• Keine Abgabe <strong>von</strong> Holzschutzmitteln an den Verbraucher zur vorbeugenden Anwendung<br />
in Innenräumen;<br />
• Begrenzung <strong>der</strong> Gebindegrößen für Holzschutzmittel mit bekämpfen<strong>der</strong> Wirkung;<br />
• eindeutige Kennzeichnung <strong>der</strong> Holzschutzmittel;<br />
• freiwillige amtliche Überprüfung <strong>der</strong> Holzschutzmittel – soweit sie nicht bereits einer Zulassungspflicht<br />
durch das DIBt unterliegen – im Rahmen <strong>der</strong> Gütesicherung nach RAL-GZ<br />
830;<br />
99
• freiwillige amtliche Überprüfung <strong>der</strong> Bläueschutzmittel im Rahmen eines Registrierverfahrens<br />
beim UBA;<br />
• Fremdüberwachung bzw. Stichprobenkontrolle <strong>der</strong> geprüften Produkte.<br />
Von allen beteiligten Kreisen wurde die Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> Industrie als ein<br />
praktikables Instrument <strong>der</strong> Deregulierung und beispielhaft für das Kooperationsprinzip zwischen<br />
Staat und Industrie gewürdigt. Beson<strong>der</strong>s hervorgehoben wurden die freiwillige Überprüfung<br />
<strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Holzschutzmittel, d.h. ein Nachweis ihrer Wirksamkeit sowie ihrer<br />
Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, und ihre verbrauchergerechte<br />
Kennzeichnung als ein entscheiden<strong>der</strong> Schritt zur Verbesserung des Verbraucherbzw.<br />
Innenraumschutzes.<br />
Die Einbeziehung des Handels in die Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Hersteller wurde als wichtig angesehen,<br />
weil insbeson<strong>der</strong>e in den Bau- und Heimwerkermärkten nicht nur Holzschutzmittel<br />
bestimmter Hersteller, son<strong>der</strong>n auch Holzschutzmittel unter dem Namen <strong>von</strong> Handelsmarken<br />
verkauft werden. Deshalb wurde auch die Zusage des Groß- und Einzelhandels begrüßt, das<br />
Sortiment <strong>der</strong> angebotenen Holzschutzmittel auf die Einhaltung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu<br />
überprüfen und bei Abweichungen eine mögliche Anpassung <strong>der</strong> Produkte mit den beteiligten<br />
Herstellern und Lieferanten zu erreichen.<br />
Eine erste Zwischenbilanz <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung fällt aus <strong>der</strong> Sicht des<br />
Verbraucherschutzes unbefriedigend aus. Schon bei <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
traten die unterschiedlichen Interessen <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong> über Inhalt und Zielsetzung<br />
offen zutage. Obwohl die Selbstverpflichtung eindeutig auf eine Verbesserung des<br />
Anwen<strong>der</strong>- und Verbraucherschutzes bei <strong>der</strong> Verwendung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln ausgerichtet<br />
werden sollte, versuchte <strong>der</strong> VdL, seine „holzschützenden Produkte“ <strong>von</strong> den klassischen<br />
Holzschutzmitteln durch eigene Produktdefinitionen abzugrenzen.<br />
Das mit einer gesundheitlichen Bewertung <strong>der</strong> Holzschutzmittel eingebundene BgVV konnte<br />
die strittigen Diskussionen <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong> über Holzschutzmittel- und Bläueschutzmitteldefinitionen<br />
und die Etablierung eines weiteren Prüfverfahrens für Bläueschutzmittel<br />
nicht nachvollziehen, zumal sowohl auf europäischer als auch nationaler Ebene Holzschutz-<br />
bzw. Bläueschutzmittel eindeutig definiert sind und Bläueschutzmittel problemlos einer<br />
Überprüfung nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 830 hätten unterzogen<br />
werden können.<br />
Wenn auch mit dem beim UBA durchgeführten Registrierverfahren für Bläueschutzmittel<br />
unter Verwendung <strong>von</strong> Rahmenrezepturen erste Erfahrungen zur vereinfachten Bewertung<br />
<strong>von</strong> Biozid-Produkten im Hinblick auf die Umsetzung <strong>der</strong> Biozid-Richtlinie gesammelt werden<br />
konnten, zeichnet sich jedoch bisher keine wesentliche Verbesserung des Verbraucherschutzes<br />
bei <strong>der</strong> Verwendung dieser Produktgruppe ab. Von den ursprünglich für die Registrierung<br />
vorgesehenen 80 Produkten haben bisher nur 23 das Registrierverfahren beim<br />
UBA durchlaufen und da<strong>von</strong> konnte bei Stichprobenkontrollen in Baumärkten lediglich ein<br />
Produkt ausfindig gemacht werden, das zum Verkauf angeboten wurde und mit einer verbrauchergerechten<br />
Kennzeichnung versehen war.<br />
Kritisch ist zum Registrierverfahren für Bläueschutzmittel als Teil eines Beschichtungssystems<br />
zu bemerken, daß durch die in den Deckanstrichen teilweise enthaltenen filmschüt-<br />
100
zenden bioziden Wirkstoffe eine vereinfachte gesundheitliche und umweltbezogene Bewertung<br />
<strong>der</strong> Bläueschutzmittel unterlaufen wird. Bei den filmschützenden Wirkstoffen, die nicht<br />
Gegenstand <strong>der</strong> Selbstverpflichtung sind, handelt es sich oft um die gleichen Holzschutzmittelwirkstoffe<br />
mit gleichen o<strong>der</strong> höheren Konzentrationen, die in den Bläueschutzmitteln<br />
enthalten sind und somit zu erhöhten Biozid-Expositionen führen können. Die gesundheitliche<br />
Bewertung <strong>der</strong> Bläueschutzmittel als Teil eines Beschichtungssystems kann deshalb nur<br />
unter Einbeziehung des Biozidgehaltes <strong>der</strong> Deckanstriche verbrauchergerecht erfolgen. Die<br />
Nichtbeachtung <strong>der</strong> filmschützenden Wirkstoffe bei <strong>der</strong> gesundheitlichen Bewertung <strong>der</strong><br />
Holzschutzmittel bedarf einer Klärung bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung, weil ansonsten<br />
<strong>der</strong> Verbraucherschutz beim Umgang mit diesen Produkten in Frage gestellt wird.<br />
Etwa 70% <strong>der</strong> verbrauchernahen Holzschutzmittel werden gegenwärtig durch „holzschützende<br />
Produkte“ <strong>der</strong> Lackindustrie abgedeckt, während die eigentlichen Holzschutzmittel mit<br />
RAL-Gütezeichen nur mit etwa 30% vertreten sind.<br />
Stichprobenkontrollen in großen Baumärkten zeigten die bisherige unzureichende Umsetzung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung auf:<br />
• Überwiegendes Angebot <strong>von</strong> „holzschützenden Produkten“ mit folgenden Mängeln:<br />
• kein amtlicher Nachweis <strong>der</strong> Wirksamkeit;<br />
• keine Prüfung auf gesundheits- und umweltbezogene Unbedenklichkeit;<br />
• mangelhafte bis irreführende Anwen<strong>der</strong>hinweise für den Verbraucher wie verharmlosende<br />
Angaben bzw. Hinweise z.B. „umweltfreundlich“, „gesundheitlich unbedenklich“,<br />
„nicht kennzeichnungspflichtig“, „für innen und außen“ u.a.;<br />
• kein o<strong>der</strong> nur geringes Angebot geprüfter Holzschutzmittel;<br />
• keine Kenntnis über das RAL-Gütezeichen Holzschutzmittel beim Verkaufspersonal;<br />
• Angebot <strong>von</strong> geprüften und nichtgeprüften Produkten des gleichen Herstellers.<br />
Im Fachhandel für den professionellen Anwendungsbereich werden dem Kunden dagegen<br />
geprüfte Holzschutzmittel mit qualifizierter Fachberatung für eine sachgerechte und bestimmungsgemäße<br />
Anwendung angeboten.<br />
Zusammenfassend kann aus <strong>der</strong> Sicht des BgVV festgestellt werden, daß die Zielstellung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung bisher nicht erreicht wurde. Als Hauptursachen werden die unterschiedlichen<br />
Interessen <strong>der</strong> beteiligten <strong>Verbände</strong> bei <strong>der</strong> Vermarktung ihrer Produkte und<br />
auch die mangelhafte Unterstützung durch den Handel gesehen. Eine durchgreifende Verbesserung<br />
des Verbraucherschutzes bei <strong>der</strong> Anwendung <strong>von</strong> Holzschutzmitteln im „do-ityourself“-Bereich<br />
erscheint angesichts <strong>der</strong> undurchsichtigen Situation auf dem Holzschutzmittelmarkt<br />
gegenwärtig wenig realistisch, so daß einer ordnungspolitischen Regelung gegenüber<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Vorzug zu geben ist.<br />
101
4.3 Diskussion<br />
Die Ergebnisse <strong>der</strong> Studie werden zur Kenntnis genommen und nicht in Frage gestellt.<br />
Die Diskussion machte – wie auch die Aussagen <strong>der</strong> Referenten – deutlich, daß die Einschätzung<br />
über den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung sehr geteilt ist.<br />
Überdies wurde in <strong>der</strong> Diskussion die Frage aufgeworfen, wie <strong>der</strong> Umsetzungsstand <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung sei, da dies auch nach den Ausführungen noch unklar sei. Hierzu wurde<br />
die Antwort gegeben, daß 42% <strong>der</strong> Industriemarken und 75% <strong>der</strong> Handelsmarken inzwischen<br />
entwe<strong>der</strong> im Registrierverfahren o<strong>der</strong> im RAL-Verfahren erfaßt seien.<br />
In einem Votum wurde die Frage aufgeworfen, ob denn nicht <strong>der</strong> Konsument selbst dafür<br />
verantwortlich sei, daß er die entsprechenden Produkte bekomme o<strong>der</strong> auch nicht bekomme.<br />
Dieser Ansicht wurde <strong>von</strong> an<strong>der</strong>en Teilnehmern wi<strong>der</strong>sprochen; je<strong>der</strong> Konsument habe<br />
ein Anrecht auf entsprechende Produktinformationen.<br />
Die Frage des Einbezug des Fachhandels wurde stark diskutiert. Es wurde darauf hingewiesen,<br />
daß es zwar diesbezügliche Absichtserklärungen gegeben habe, aber eine wirkliche Initiative<br />
nicht zustandegekommen sei.<br />
102
III. Schlußfolgerungen und allgemeine Diskussion<br />
Zunächst stellte das Institut die Schlußfolgerungen vor, die aus seiner Sicht für den Einsatz<br />
und die Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu ziehen sind. Inhaltlich entsprachen diese<br />
Ausführungen dem Teil A, Kapitel V, des vorliegenden Berichts.<br />
Dazu und zur Studie insgesamt sowie zum Instrument <strong>der</strong> Selbstverpflichtung allgemein haben<br />
die folgenden Personen Stellung genommen:<br />
• Dr. Klaus Rennings, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung;<br />
• Dr. Herlind Gundelach, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft<br />
und Forsten;<br />
• Thomas Lenius, Chemiereferent beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland.<br />
103
1. Kommentar I: <strong>Evaluation</strong> freiwilliger <strong>Selbstverpflichtungen</strong> aus<br />
wirtschaftswissenschaftlicher Sicht<br />
Klaus Rennings<br />
a) Begrifflichkeit und Thesen<br />
Kooperationslösungen zeichnen sich dadurch aus, daß Unternehmen miteinan<strong>der</strong> o<strong>der</strong> mit<br />
Dritten (Staat, Öffentlichkeit) Absprachen treffen. In <strong>der</strong> deutschen Umweltpolitik dominieren<br />
Kooperationen in Form <strong>von</strong> ‘freiwilligen’ <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und Vereinbarungen zwischen<br />
Unternehmen, Branchen o<strong>der</strong> <strong>Verbände</strong>n einerseits und dem Staat an<strong>der</strong>erseits.<br />
Der Versuch einer Einordnung ‘freiwilliger’ <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> Wirtschaft im Umweltschutz<br />
(FSV) zeigt, daß die Unterschiede bzw. die Charakteristika im Vergleich zu traditionellen<br />
hoheitlichen Instrumenten wie Ordnungsrecht (z.B. eine Wärmenutzungsverordnung<br />
mit Vorschriften zum Einsatz bestimmter Technologien) und Abgaben (z.B. eine CO2-<br />
/Energiesteuer) in einem an<strong>der</strong>en Entscheidungsprozeß bei <strong>der</strong> Ziel- und Maßnahmenauswahl<br />
sowie in an<strong>der</strong>en Durchsetzungsmechanismen (Abschnitt b) liegen, aber nicht in einem<br />
typischen Wirkungsmechanismus auf die Konsum- und Investitionsentscheidungen <strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />
Akteure (Abschnitt c). Daher können FSV auch nicht per se als „marktwirtschaftlich“<br />
o<strong>der</strong> „ökonomisch“ bezeichnet werden (Abschnitt d). Es resultiert eine skeptische Bewertung<br />
<strong>von</strong> FSV im allgemeinen sowie <strong>der</strong> Klimaschutzerklärungen im speziellen in bezug<br />
auf ihre Ordnungskonformität im Rahmen einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft<br />
(Abschnitt e).<br />
b) Hoheitlicher versus korporatistischer Gestaltungsrahmen<br />
‘Freiwillige’ Umweltschutzmaßnahmen weichen vom klassischen Muster des hoheitlich handelnden<br />
Staates, <strong>der</strong> die Ziele und Instrumente <strong>der</strong> Umweltpolitik durch den Erlaß <strong>von</strong><br />
Rechtsnormen festlegt, ab. Stattdessen tritt <strong>der</strong> Staat mit den Betroffenen in Verhandlungen<br />
über Schutzziele und Instrumentenwahl und nutzt dabei die Drohung, hoheitlich Normen zu<br />
erlassen, als Ausgangspunkt für das Aushandeln einer ‘freiwilligen’ Absprache.<br />
Im Gegensatz zum traditionellen hoheitlichen Handeln sucht <strong>der</strong> Staat – im Sinne des Kooperationsprinzips<br />
– eine Lösung über den Weg <strong>der</strong> Konsensbildung und begibt sich in ein<br />
Tauschverhältnis. Grundsätzlich lassen sich Kooperationslösungen nämlich als Tauschgeschäfte<br />
interpretieren, bei denen sich die Industrie eine ‘freiwillige’ Selbstverpflichtung zu einem<br />
bestimmten Verhalten auferlegt und <strong>der</strong> Staat als Gegenleistung auf eine Festschreibung<br />
des gewünschten Verhaltens verzichtet (MURSWIEK 1988:988). Für die staatliche Seite<br />
besteht <strong>der</strong> Preis für eine solche Absprache häufig in Abstrichen am anvisierten Schutzniveau<br />
(vgl. RENNINGS, BROCKMANN und BERGMANN 1996:199ff.).<br />
Ihr Verhandlungscharakter läßt es angemessen erscheinen, FSV nicht als Instrument <strong>der</strong><br />
Umweltpolitik zu bezeichnen, son<strong>der</strong>n als einen korporatistischen umweltpolitischen Gestaltungsrahmen,<br />
<strong>der</strong> sich vom klassischen hoheitlichen Gestaltungsrahmen unterscheidet. Ist<br />
<strong>von</strong> einem korporatistischen Ansatz die Rede, so ist auch leicht nachvollziehbar, daß sich die<br />
104
Diskussion um die Sinnhaftigkeit <strong>von</strong> FSV auf Fragen <strong>der</strong> Zielverwässerung und <strong>der</strong> Kontrollmöglichkeiten<br />
konzentriert hat.<br />
Es sollte aber nicht übersehen werden, daß im bisher dominierenden hoheitlichen Verfahren<br />
schon einige korporatistische Elemente vorzufinden sind, die <strong>von</strong> Lobby-Aktivitäten im Vorfeld<br />
<strong>von</strong> Verordnungen und Gesetzen bis zur Mitwirkung bei <strong>der</strong> konkreten Ausgestaltung<br />
<strong>von</strong> Technischen Anweisungen reichen. Insgesamt ist aber dennoch im Vergleich zu an<strong>der</strong>en<br />
Instrumenten die Mitwirkung <strong>der</strong> Wirtschaft größer. Dies bedeutet auch, daß die Wirtschaft<br />
einen deutlich stärkeren Einfluß auf den Grad <strong>der</strong> angestrebten Zielerreichung (Höhe<br />
und Zeitpunkt) und die Instrumentenwahl ausüben kann.<br />
Staatlicherseits sollte man sich darüber im klaren sein, daß die Verhandlungsbereitschaft <strong>der</strong><br />
Wirtschaft regelmäßig nur soweit reicht, wie ein wirtschaftliches Eigeninteresse besteht. Der<br />
Schutz <strong>der</strong> Umwelt ist für die betroffenen Unternehmen kein Wert an sich, son<strong>der</strong>n muß sich<br />
mit eigenen (wirtschaftlichen) Interessen decken. Daher ist da<strong>von</strong> auszugehen, daß FSV vor<br />
allem das Potential an sogenannten „No-Regrets“-Maßnahmen ausschöpfen, das heißt solcher<br />
Maßnahmen, die sich durch induzierte Kosteneinsparungen selbst finanzieren (siehe<br />
auch EEA 1997, Vol. 2:45f.). Diese Annahme wird durch die vom VCI in Auftrag gegebene<br />
Studie weitgehend bestätigt. Wo substantielle „No-Regrets“-Potentiale vorhanden sind, wie<br />
zum Beispiel im Klimaschutz, haben FSV durchaus ihre Berechtigung. Es sollte jedoch auch<br />
klar sein, daß an<strong>der</strong>e Instrumente wie Ökosteuern, Ordnungsrecht o<strong>der</strong> Emissions Trading<br />
zum Zug kommen müssen, wenn die Ziele über „No Regrets“ hinausgehen.<br />
Wesentlich an FSV ist die Tatsache, daß <strong>der</strong> Staat keine vertraglichen o<strong>der</strong> hoheitlichen<br />
Möglichkeiten hat, ihre Einlösung zu erzwingen. Er ist allein auf das Wohlverhalten <strong>der</strong> Unternehmerverbände<br />
und auf die Disziplin <strong>der</strong> den <strong>Verbände</strong>n angehörenden Unternehmen<br />
bzw. auf die Durchsetzungsfähigkeit <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> gegenüber ihren Mitglie<strong>der</strong>n angewiesen.<br />
Diese neigen, wie die Fallbeispiele <strong>der</strong> VCI-Studie zeigen, bei kostspieligen Maßnahmen dazu,<br />
eine Trittbrettfahrerposition einzunehmen.<br />
Es ist jedoch zu beachten, daß ein Ersatz für fehlende rechtliche Bindungen an ‘freiwillige’<br />
Zusagen darin bestehen kann, daß die Zusagen immer wie<strong>der</strong> neu verhandelt werden. Im<br />
Rahmen solcher „wie<strong>der</strong>holter Spiele“ können stabile Min<strong>der</strong>ungszusagen erreicht werden,<br />
die über ein Business as Usual hinausgehen (vgl. SCHMELZER 1996).<br />
„Wie<strong>der</strong>holte Spiele“ bedeuten, daß FSV als eine Kette sich aneinan<strong>der</strong>reihen<strong>der</strong> ‘freiwilliger’<br />
Zusagen organisiert werden, wie dies etwa bei den deutschen Klimaschutzerklärungen <strong>der</strong><br />
Wirtschaft <strong>der</strong> Fall ist. Durch solche revolvierenden <strong>Selbstverpflichtungen</strong>, die über ein Monitoring<br />
zudem einer ständigen Ziel- und Erfolgskontrolle unterliegen sollten, können die beteiligten<br />
Unternehmen untereinan<strong>der</strong> sowie gegenüber dem Staat und <strong>der</strong> Öffentlichkeit das<br />
Vertrauen aufbauen, das nötig ist, um Trittbrettfahrerprobleme zu überwinden und auch anspruchsvollere<br />
Zusagen auszusprechen.<br />
c) Wirkungsmechanismen<br />
In <strong>der</strong> Literatur werden FSV mitunter als „sonstige Instrumente“ neben die Kategorien „ordnungsrechtliche“<br />
und „ökonomische“ Instrumente eingestuft. Die Enquete-Kommission<br />
„Schutz des Menschen und <strong>der</strong> Umwelt“ zum Beispiel faßt informatorische, organisatorische<br />
105
und ‘freiwillige’ Maßnahmen zusammen als „Maßnahmen, die ein aktives Verhalten in Richtung<br />
eines vorbeugenden Umweltschutzes för<strong>der</strong>n, ohne daß dies gesetzlich vorgeschrieben<br />
ist.“ (ENQUETE-KOMMISSION 1994:667). Dies ist eine juristisch orientierte Abgrenzung.<br />
Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht nehmen ökonomische und ordnungsrechtliche Instrumente<br />
bei gegebenen Präferenzen (Haushalte) und Technologien (Unternehmen) direkten<br />
(Ordnungsrecht) o<strong>der</strong> indirekten (ökonomische Instrumente) Einfluß auf die Wahlentscheidungen<br />
zwischen verschiedenen Handlungsoptionen. Informatorische Instrumente wirken<br />
persuasiv auf die Präferenzen und den Informationsstand <strong>der</strong> Haushalte und Unternehmer<br />
ein. Wie diese Einwirkung erfolgt, zeigt die nachstehende entscheidungsorientierte Systematisierung<br />
<strong>von</strong> MICHAELIS (1996:26). Er unterscheidet in:<br />
• Ordnungsrechtliche Instrumente: „Umweltpolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, die<br />
Menge <strong>der</strong> zulässigen Alternativen zu begrenzen ...“.<br />
• Ökonomische Instrumente: „Umweltpolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, die mit<br />
den einzelnen Alternativen verbundenen Nutzen bzw. Kosten zu beeinflussen ...“.<br />
• Informatorische bzw. suasorische Instrumente: „Umweltpolitische Maßnahmen, die darauf<br />
abzielen, die Informationen und Wertvorstellungen des Entscheidungsträgers zu beeinflussen<br />
...“.<br />
Mit Alternativen sind dabei die Handlungsoptionen zur Vermeidung <strong>von</strong> Umweltbelastungen<br />
gemeint, über die <strong>der</strong> betrachtete Entscheidungsträger, zum Beispiel ein Haushalt o<strong>der</strong> ein<br />
Unternehmen, verfügt.<br />
Aus dieser systematisierenden Einordnung wird deutlich, daß sowohl Ordnungsrecht und<br />
ökonomische Instrumente als auch informatorische Instrumente einen jeweils eigenen Charakter<br />
aufweisen. Eine eigenständige Einordnung <strong>von</strong> FSV ist hingegen nicht möglich. Der<br />
Grund liegt darin, daß FSV grundsätzlich nicht über einen eigenständigen Wirkungsmechanismus<br />
verfügen. Dieser ist vielmehr Verhandlungsergebnis; oft wird <strong>der</strong> Mechanismus zur<br />
Erreichung eines Ziels in <strong>der</strong> FSV auch gänzlich offen gelassen und erst in <strong>der</strong> Umsetzungsphase<br />
<strong>von</strong> den <strong>Verbände</strong>n und/o<strong>der</strong> den Unternehmen gewählt. So ist es vorstellbar, innerhalb<br />
einer FSV sowohl ökonomische Instrumente (z.B. Gebührensysteme) einzurichten als<br />
auch <strong>von</strong> (quasi) ordnungsrechtlichen Maßnahmen Gebrauch zu machen (z.B. brancheninterne<br />
technische Richtlinien). Auch informatorische Instrumente können zur Anwendung<br />
kommen.<br />
d) „Marktwirtschaftlichkeit“<br />
FSV werden ökonomische Vorteile zugesprochen, da zum Beispiel gegenüber pauschalierenden<br />
und unflexiblen Vorschriften des Ordnungsrechts Umweltschutzziele globaler festgelegt<br />
werden und die verpflichtenden Branchen selbst entscheiden können, mit welchen Mitteln<br />
sie diese Ziele erreichen (MURSWIEK 1988:988). Zur Frage <strong>der</strong> Effektivität, d.h. ob das<br />
gesetzte Ziel mit dem avisierten Instrumentarium auch erreicht wird, wurde bereits in Abschnitt<br />
b angemerkt, daß <strong>der</strong> Staat im Rahmen einer korporatistischen Politik u.U. Abstriche<br />
am angestrebten Zielniveau hinzunehmen hat. Aber auch die tatsächliche Umsetzung eines<br />
wie immer gewählten Umweltzieles innerhalb einer FSV ist durch das Trittbrettfahrerproblem<br />
106
gefährdet. Dieses Problem fällt umso stärker ins Gewicht, je inhomogener die Branche und<br />
je unüberschaubarer die Firmenanzahl ist. Diese Probleme werden in <strong>der</strong> Studie des Instituts<br />
für Umweltmanagement deutlich thematisiert, mit entsprechenden Empfehlungen an den<br />
VCI, <strong>der</strong> sich in <strong>der</strong>artigen Situation fragen muß, ob er gut beraten ist, sich überhaupt auf eine<br />
FSV einzulassen.<br />
Bliebe noch die Frage, ob FSV aufgrund <strong>der</strong> freien Instrumentenwahl ökonomische Vorteile<br />
zugesprochen werden können, sprich, ob sie effizient sind in dem Sinne, daß die Zielerreichung<br />
zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten erfolgt. In <strong>der</strong> umweltpolitischen Diskussion<br />
werden FSV jedenfalls mitunter als „marktwirtschaftliches“ o<strong>der</strong> „ökonomisches“ Instrument<br />
dargestellt, obwohl sie sich – wie im vorherigen Abschnitt erläutert – nicht <strong>von</strong> ihrer Natur her<br />
des Marktmechanismus als gesellschaftlichem Koordinationsverfahren bedienen und nicht<br />
notwendig am Gefüge <strong>der</strong> relativen Preise ansetzen. Diese Einschätzung rührt offenbar <strong>von</strong><br />
einer sprachlichen Assoziation her: Der Wirtschaft als dem wesentlichen unter Anpassungsdruck<br />
stehenden Akteur wird durch den korporatistischen Gestaltungsrahmen ein starkes<br />
Mitspracherecht in <strong>der</strong> Zielwahl und Maßnahmengestaltung eingeräumt (siehe Abschnitt b).<br />
Verhandlungen zwischen Staat und Wirtschaft führen aber nicht zwangsläufig zum Einsatz<br />
marktwirtschaftlicher Instrumente. Es ist eher zu erwarten, daß ein Verband Instrumente<br />
wählt, die sich innerhalb <strong>der</strong> Branche am leichtesten durchsetzen lassen.<br />
Wenn aber nicht <strong>von</strong> ökonomischen Instrumenten Gebrauch gemacht wird, bildet sich auch<br />
kein einheitliches Preissignal für die Umweltnutzung heraus, an dem die einzelnen Verbandsmitglie<strong>der</strong><br />
ihre Entscheidungen ausrichten könnten. Damit erscheint eine gesamtwirtschaftlich<br />
effiziente Allokation als keineswegs gesichert, son<strong>der</strong>n als eher unwahrscheinlich.<br />
Vor diesem Hintergrund ist beispielsweise die Aussage, daß <strong>Selbstverpflichtungen</strong> „die Ziele<br />
<strong>der</strong> Klimavorsorge viel effizienter erfüllen als eine Steuer o<strong>der</strong> Abgabe und diese überflüssig<br />
machen“ (DIHT 1995:9), kritisch zu betrachten.<br />
Die Erfahrung zeigt, daß es nur wenige Ausnahmen <strong>von</strong> FSV gibt, die auf marktkonforme<br />
preisliche Anreize zurückgreifen. Zu diesen Ausnahmen zählt <strong>der</strong> „Grüne Punkt“, <strong>der</strong> ökonomisch<br />
als Abgabe charakterisiert werden kann, die zur verursachungsgerechten Anlastung<br />
<strong>der</strong> Kosten beiträgt, die mit <strong>der</strong> Entsorgung <strong>von</strong> Verpackungen verbunden sind.<br />
e) Ordnungspolitische Bewertung<br />
Die Eignung eines Instrumentes läßt sich ordnungspolitisch danach beurteilen, ob es auf <strong>der</strong><br />
systematisch richtigen Ebene ansetzt. Nach HOMANN und PIES (1991:611) sind <strong>der</strong> „systematische<br />
Ort <strong>der</strong> Moral in einer Marktwirtschaft ... die Ordnungsregeln“. Das Handlungssystem<br />
<strong>von</strong> Marktwirtschaften, so die Argumentation, bestehe aus zwei Stufen: Spielregeln und<br />
Spielzügen. Während sich For<strong>der</strong>ungen nach umweltgerechtem Verhalten in den Spielregeln<br />
(z.B. Gesetzen) nie<strong>der</strong>schlagen müssen, sollten die Spielzüge (d.h. die Wettbewerbshandlungen<br />
<strong>der</strong> Unternehmen) in einer Marktwirtschaft allein an Effizienzkriterien ausgerichtet<br />
sein. Es wäre systematisch verfehlt, <strong>von</strong> einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen zusätzliche<br />
– über bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinausgehende – Umweltschutzleistungen<br />
zu verlangen und ihm damit wirtschaftliche Verluste o<strong>der</strong> gar den Ruin zu bescheren.<br />
„Angesichts dieser Problemstruktur“, so HOMANN und PIES (ebenda:612), „hilft nur eines:<br />
eine für alle Konkurrenten kollektiv verbindliche Festsetzung <strong>von</strong> Umweltstandards, sei es<br />
107
durch eine sanktionsbewehrte kollektive Selbstbindung <strong>der</strong> Unternehmer (Branchenvereinbarung),<br />
sei es durch den Staat.“<br />
Auch FSV ohne rechtliche Bindung können ordnungskonforme Lösungen darstellen, wenn<br />
sie an den Spielregeln ansetzen und es gelingt, trittbrettfahrendes Verhalten zu unterbinden.<br />
Da <strong>Verbände</strong> aber normalerweise über keine wirksamen Sanktionsmechanismen gegenüber<br />
ihren Mitglie<strong>der</strong>n verfügen, so daß keine verbindlichen Spielregeln vereinbart werden können,<br />
verlagert sich <strong>der</strong> Ansatz <strong>der</strong> Problemlösung zu den Spielzügen, also auf die systematisch<br />
falsche Ebene. Eine Ausnahme stellen FSV dar, die als wie<strong>der</strong>holte Spiele organisiert<br />
sind (siehe Abschnitt b).<br />
Generell ist das Ansinnen des Staates beim Einsatz „weicher“ Instrumente wie ‘freiwilliger’<br />
Umweltschutzmaßnahmen <strong>der</strong> Wirtschaft, die Einflußsphäre staatlicher Macht auf das notwendige<br />
Maß zu beschränken. Dies birgt aber die Gefahr in sich, die damit verbundene umweltpolitische<br />
Verantwortung mehr o<strong>der</strong> weniger preiszugeben. Zudem wird umweltpolitische<br />
Verantwortung in erster Linie an die Wirtschaft delegiert, so daß unter Verletzung des Kongruenzprinzips<br />
die Gefahr des Ausschlusses betroffener o<strong>der</strong> interessierter Dritter besteht,<br />
die im Rahmen hoheitlicher Maßnahmen einbezogen worden wären (vgl. KOHL-<br />
HAAS/PRAETORIUS 1994:59). Ein Beispiel ist die Struktur des Dualen Systems Deutschland,<br />
die zumindest in den Anfängen zu relativ wenig Wettbewerb führte. Die damit einhergehenden<br />
Kosten in Form relativ hoher Nutzungsgebühren für den Grünen Punkt waren <strong>von</strong> Dritten,<br />
den Verbrauchern, zu tragen.<br />
Im Kern stellt die Kritik darauf ab, daß Unternehmen nur dann nachhaltig wirtschaften werden,<br />
wenn ein entsprechen<strong>der</strong> Ordnungsrahmen bzw. klare Politikvorgaben sie für dieses<br />
Verhalten belohnen bzw. eindeutige Rahmenbedingungen aufzeigen. Ein auf ‘freiwillige’ Lösungen<br />
setzen<strong>der</strong> Ansatz verzichtet dagegen weitgehend auf einen solchen Orientierungsrahmen,<br />
<strong>der</strong> erst ein an ökologischen Zielen orientiertes Such- und Entdeckungsverfahren in<br />
Gang setzen kann.<br />
f) Fazit<br />
‘Freiwillige’ <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im allgemeinen und die Klimaschutzerklärungen <strong>der</strong> deutschen<br />
Wirtschaft im speziellen stellen weniger ein Instrument denn einen Gestaltungsrahmen<br />
<strong>der</strong> Umweltpolitik dar. Sie sind das Ergebnis <strong>von</strong> Verhandlungen zwischen Regierung<br />
und Wirtschaft. Ihr Verhandlungscharakter führt dazu, daß häufig Zeitverzögerungen und<br />
Zielverwässerungen festzustellen sind; oft wird kaum mehr als das versprochen, was ohnehin<br />
im Rahmen <strong>der</strong> betrieblichen Investitionszyklen geplant war. Zudem weisen FSV keinen<br />
typischen Wirkungsmechanismus auf die Konsum- und Investitionsentscheidungen <strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />
Akteure auf und können daher auch nicht per se als „marktwirtschaftlich“ o<strong>der</strong><br />
„ökonomisch“ bezeichnet werden. Die Ordnungskonformität im Rahmen einer sozialen und<br />
ökologischen Marktwirtschaft ist insgesamt skeptisch zu sehen, da u.U. zuviel umweltpolitische<br />
Verantwortung vom Staat an die Wirtschaft delegiert wird und zudem die Gefahr <strong>von</strong><br />
Vereinbarungen zu Lasten Dritter besteht.<br />
Eine wichtige Einsatzbedingung für FSV besteht folglich darin, daß <strong>der</strong> Staat anspruchsvolle<br />
Ziele festlegt, die durch eine zu verhandelnde FSV zu erreichen sind, und sich als Drohung<br />
108
einen Rückgriff auf hoheitliche Maßnahmen stets vorbehält. Der Einsatz <strong>von</strong> ökonomischen<br />
Instrumenten im Rahmen <strong>von</strong> FSV ist in <strong>der</strong> Regel zu begrüßen, da dies die gesamtwirtschaftliche<br />
Effizienz <strong>der</strong> Umweltpolitik för<strong>der</strong>t. Die für FSV typischen Trittbrettfahrerprobleme<br />
können durch eine rechtliche Bindung <strong>der</strong> Zusagen o<strong>der</strong> – wenn dies beispielsweise wegen<br />
<strong>der</strong> großen Zahl betroffener Unternehmen kaum vertretbar erscheint – durch die Organisation<br />
<strong>von</strong> FSV als „wie<strong>der</strong>holte Spiele“ verringert werden. Unabhängig <strong>von</strong> diesen Vorschlägen<br />
sind gewisse Stärken <strong>von</strong> FSV, so auch <strong>der</strong> Klimaschutzerklärungen, dann zu erkennen,<br />
wenn sie einen Informationsaustausch zwischen Unternehmen anregen. In diesem Sinne<br />
können sie auch stets sinnvoll flankierend zu hoheitlichen Maßnahmen eingesetzt werden.<br />
109
2. Kommentar II: <strong>Evaluation</strong> <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>chemischen</strong> Industrie – Einschätzung <strong>der</strong> Politik<br />
Herlind Gundelach<br />
Zu diesem Thema fühle ich mich in doppelter Weise angesprochen, einmal als<br />
• Umweltpolitikerin und als<br />
• Politologin, <strong>der</strong>en Aufgabe es ist, Entwicklungen zu analysieren und Strukturen aufzuzeigen.<br />
Lassen Sie mich zunächst als Umweltpolitikerin sprechen. Die Umweltpolitik hat im Gegensatz<br />
zu den meisten an<strong>der</strong>en Politikfel<strong>der</strong>n eine relativ kurze Geschichte. Sie hat in den<br />
siebziger Jahren angefangen als Reparaturpolitik – Stichworte: Waldsterben, Gewässerverschmutzung,<br />
blauer Himmel an <strong>der</strong> Ruhr – mit den dafür geeigneten politischen Instrumenten<br />
und Techniken. Dies waren das Ordnungsrecht als das unmittelbar und am schnellsten<br />
wirkende politische Instrument sowie die sog. end-of-the-pipe-Technologien, d.h. nachgeschaltete<br />
Techniken. Ich erinnere an das Rieseninvestitionsprogramm <strong>der</strong> deutschen Wirtschaft<br />
zur Installierung <strong>der</strong> sog. Rauchgasentschwefelungsanlagen.<br />
In den neunziger Jahren, also nach rund 20 Jahren, waren allenthalben, in allen Umweltmedien,<br />
in Boden, Wasser und Luft, große Erfolge zu verzeichnen, auf die ich nicht im einzelnen<br />
eingehen möchte. Die Umweltpolitik war an einem Wendepunkt angekommen, ja man<br />
kann sogar <strong>von</strong> einem Paradigmenwechsel sprechen. Stand bislang die Nachsorge im Vor<strong>der</strong>grund,<br />
so wurde sie nun abgelöst <strong>von</strong> dem Grundsatz <strong>der</strong> Vorsorge. Auf <strong>der</strong> internationalen<br />
Ebene war dieser Paradigmenwechsel in Deutschland verbunden mit <strong>der</strong> 2. UN-<br />
Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro, auf <strong>der</strong> sich die internationale<br />
Staatenwelt auf das Leitbild <strong>der</strong> nachhaltigen Entwicklung verständigte und dies auch in ihrem<br />
Handlungsprogramm, <strong>der</strong> Agenda 21, nie<strong>der</strong>schrieb. Auch darin wird ausdrücklich auf<br />
den Gedanken <strong>der</strong> Vorsorge Bezug genommen.<br />
Vorsorge, d.h. Handeln mit Wirkung in die Zukunft hinein, ist für die Politik jedoch ungleich<br />
schwerer durchzusetzen als das klassische Ordnungsrecht, dies geht am besten in Kooperation<br />
mit den Betroffenen, mit den um ihre Prozesse und Techniken Wissenden. Insoweit<br />
hängen das Kooperationsprinzip und das Vorsorgeprinzip in <strong>der</strong> Umweltpolitik ganz eng zusammen.<br />
Und beide wie<strong>der</strong>um binden sich ein in das Prinzip <strong>der</strong> Subsidiarität, eines <strong>der</strong><br />
Grundprinzipien <strong>der</strong> Christlichen Soziallehre, <strong>von</strong> <strong>der</strong> die Umweltpolitik <strong>der</strong> CDU ganz wesentlich<br />
geprägt ist.<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> sind mit Sicherheit ein ganz wichtiges Instrument einer vorsorgenden<br />
Umweltpolitik, weil sie das Eigeninteresse, aber auch die Eigenverantwortung <strong>der</strong> Wirtschaft<br />
zusammenbinden mit <strong>der</strong> Aufgabe des Staates, eine Politik zur Erhaltung <strong>der</strong> natürlichen<br />
Lebensgrundlagen für die heutige wie für die kommenden Generationen zu gestalten und<br />
durchzusetzen.<br />
Soweit meine Aussagen als Umweltpolitikerin. Als Politologin bin ich gehalten, diese Entwicklung<br />
zu analysieren und sie unter dem Blickwinkel unverzichtbarer Anfor<strong>der</strong>ungen an ein<br />
demokratisches Gemeinwesen zu beurteilen.<br />
110
Vorausgeschickt, daß die Wirtschaft in <strong>der</strong> Regel immer erst dann zu dem Instrument <strong>der</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> greift – wie die Erfahrung gezeigt hat –, wenn ordnungsrechtliche<br />
Maßnahmen drohen, d.h. wenn die Politik Handlungsbedarf ausgemacht hat, müssen an ein<br />
solches Instrument auch unter demokratietheoretischen Aspekten hohe Anfor<strong>der</strong>ungen gestellt<br />
werden.<br />
Dazu zählen ganz wesentlich die Rechte des Parlaments als das entscheidende Rechtsetzungs-<br />
und Kontrollorgan in einer parlamentarischen Demokratie. Alle Untersuchungen <strong>der</strong><br />
bisher abgeschlossenen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zeigen jedoch, daß diese in <strong>der</strong> Regel im<br />
stillen Kämmerlein zwischen wenigen ausgehandelt werden, auch auf Seiten <strong>der</strong> Wirtschaft<br />
sind meist nur die <strong>Verbände</strong> und große Unternehmen einbezogen, und oft sind es auch nur<br />
die, die am ehesten in <strong>der</strong> Lage sind, die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu erfüllen – ich verweise<br />
auch auf die uns heute vorliegende Untersuchung – o<strong>der</strong> die zumindest den Löwenanteil<br />
stellen. Am Parlament jedoch gehen diese Verhandlungen in <strong>der</strong> Regel vorbei.<br />
Weil dieses Defizit nicht wegzudiskutieren und auch aus <strong>der</strong> Natur <strong>der</strong> Sache nicht aufhebbar<br />
ist, muß m.E. bei Abschluß, Durchführung und Monitoring um so mehr Wert auf Transparenz<br />
und Nachvollziehbarkeit gelegt werden. Insoweit kommt dem Controlling eine zentrale<br />
Bedeutung zu.<br />
Dies ist auch in <strong>der</strong> Zwischenzeit bei allen Beteiligten unbestritten. Das sog. Monitoring wird<br />
daher in <strong>der</strong> Regel unabhängigen Wissenschaftseinrichtungen übertragen, um Objektivität<br />
und Transparenz zu gewährleisten. Aber nicht nur das unabhängige Monitoring ist wichtig,<br />
um das entstandene „Demokratiedefizit“ zu heilen. Meines Erachtens sind hier noch zwei<br />
weitere Punkte wesentlich.<br />
Das sind zum einen Inhalt und Umfang <strong>der</strong> Selbstverpflichtung. Wenn hier nur business as<br />
usual o<strong>der</strong>, wie es in Fachkreisen heißt, nur sog. no-regret-Maßnahmen festgeschrieben<br />
werden, d.h. Ziele, die durch normalen technischen Fortschritt und die ohnehin geplanten Investitionszyklen<br />
sowieso erreicht worden wären, dann diskreditiert sich dieses Instrument auf<br />
Dauer selbst, denn dann wird es zu dem, dessen es <strong>von</strong> seinen Gegnern manchmal verdächtigt<br />
wird: <strong>der</strong> Versuch <strong>der</strong> Wirtschaft, sich so unbehelligt und komfortabel wie möglich<br />
aus dem umweltpolitisch Gebotenen herauszustehlen.<br />
Der zweite Punkt zielt auf die in aller Regel fehlenden Sanktionsmechanismen. Gemeint sind<br />
hier zum einen die innerverbandlichen Sanktionsmechanismen, d.h. den Unterzeichnern <strong>der</strong><br />
Vereinbarung auf Seiten <strong>der</strong> Wirtschaft fehlt die rechtliche o<strong>der</strong> tatsächliche Handhabe dem<br />
einzelnen Branchenunternehmen gegenüber, es auf die zugesagte Leistung zu verpflichten.<br />
Zum an<strong>der</strong>en fehlt auch <strong>der</strong> Politik <strong>der</strong> Sanktionsmechanismus, die Einhaltung <strong>der</strong> Zusage<br />
notfalls mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen; sie kann allenfalls mit Ordnungsrecht drohen<br />
und es schließlich doch noch – dann allerdings unter erheblicher zeitlicher Verzögerung –<br />
zum Einsatz bringen. Soweit mir bekannt ist, gehen Überlegungen in <strong>der</strong> Europäischen Gemeinschaft,<br />
die ebenfalls über <strong>Selbstverpflichtungen</strong> intensiv nachdenkt, dahin, hier ggf. mit<br />
dem Instrument öffentlich-rechtlicher Verträge zu arbeiten, in denen Konventionalstrafen<br />
o<strong>der</strong> ähnliches <strong>von</strong> vornherein festgelegt werden können.<br />
Mein Fazit heute ist: <strong>Selbstverpflichtungen</strong> können ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung<br />
umweltpolitischer Ziele sein, wenn sie folgende Merkmale aufweisen:<br />
111
• Zielintegrität, d.h. anspruchsvolle, über sog. no regret-Maßnahmen hinausgehende Zielvereinbarungen;<br />
• Unabhängiges Monitoring, das Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicherstellt;<br />
• Sanktionsmechanismen zumindest innerverbandlicher Art, die Trittbrettfahren auf Dauer<br />
verhin<strong>der</strong>n.<br />
112
3. Kommentar III<br />
Thomas Lenius<br />
a) Einführung<br />
„<strong>Selbstverpflichtungen</strong>“ galten Mitte <strong>der</strong> Neuziger Jahre als en vogue und entwickelten sich<br />
fast zum Dogma <strong>der</strong> Umweltpolitik. Der Staat sollte dabei unter dem Deckmantel einer Deregulierungsdebatte<br />
in <strong>der</strong> Umweltpolitik fast vollständig auf ordnungspolitische Handlungsansätze<br />
verzichten. Die Erfahrungen aus <strong>der</strong> Deregulierungseuphorie zeigen heute ihre Auswirkungen.<br />
Die Än<strong>der</strong>ungen des Genehmigungsrechtes Anfang <strong>der</strong> neunziger Jahre haben<br />
z.B. in Brandenburg zu etwa 50 größeren illegalen Abfallagern, <strong>der</strong>en Entsorgung rund 75<br />
Mio. DM kosten würde, geführt. Einer <strong>der</strong> Gründe war sicherlich, daß die aktuell vorgeschriebene<br />
baurechtliche Genehmigung nicht ausreichend ist, um illegalen Lagerbetrieb zu<br />
verhin<strong>der</strong>n. Die abfall- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsfreiheit wurde 1993<br />
eingeführt.<br />
Die Modeerscheinung „Selbstverpflichtung“ hat sich überlebt. So hat z.B. die „Selbstverpflichtung<br />
<strong>der</strong> Automobilindustrie zur umweltgerechten Altautoverwertung“ bei <strong>der</strong> inländischen<br />
umweltgerechten Verwertung <strong>von</strong> Altautos versagt. Der Monitoringbericht <strong>der</strong> ARGE<br />
Altauto vom April 2000 zeigte dementsprechend die Mängel <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung.<br />
Beide Beispiele zeigen, daß kein Weg an einer klaren Analyse, welches umweltpolitische Instrument<br />
das geeignete darstellt, vorbeigeht. Bei <strong>der</strong> Wahl des geeigneten Instrumentes <strong>der</strong><br />
Umweltpolitik muß immer das zu erreichende Ziel im Vor<strong>der</strong>grund stehen. Dabei ist die Wahl<br />
des Instrumentes auch <strong>von</strong> <strong>der</strong> Bedeutung des Schutzzieles abhängig. Bei Schutzzielen <strong>von</strong><br />
übergeordneter Bedeutung, die zu einer (in angemessenen Zeiträumen) nicht reversiblen<br />
Gefährdung führen, sind grundsätzlich ordnungsrechtliche o<strong>der</strong> marktorientierte Instrumente<br />
zu bevorzugen.<br />
b) Begriffsbestimmung<br />
Unter dem Sammelbegriff „<strong>Selbstverpflichtungen</strong> in <strong>der</strong> Umweltpolitik“ können drei Arten <strong>von</strong><br />
Instrumenten unterschieden werden, die <strong>der</strong>zeit in <strong>der</strong> allgemeinen umweltpolitischen Diskussion<br />
Verwendung finden:<br />
1. <strong>Selbstverpflichtungen</strong>;<br />
2. „freiwillige“ Vereinbarungen;<br />
3. öffentlich-rechtliche Verträge.<br />
Die Begriffe können unter dem Begriff korporatistische Instrumente zusammengefaßt werden.<br />
Als korporatistisch bezeichnet man solche umweltpolitischen Instrumente, bei denen <strong>der</strong><br />
Staat auf umweltrechtliche Handlungsoptionen aufgrund <strong>von</strong> Eigeninitiativen <strong>der</strong> Wirtschaft<br />
bzw. zugunsten <strong>von</strong> Verträgen o<strong>der</strong> Vereinbarungen mit <strong>der</strong> Wirtschaft verzichtet.<br />
113
ad 1) <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Als <strong>Selbstverpflichtungen</strong> werden freiwillige Initiativen <strong>der</strong> Wirtschaft verstanden, bei denen<br />
keine Verhandlungen zwischen Staat und Wirtschaft stattfinden.<br />
Der Staat verzichtet hierbei nicht auf umweltpolitische Handlungsoptionen. Die Motivation<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft zu solchen <strong>Selbstverpflichtungen</strong> liegt in <strong>der</strong> Regel in Marketinggesichtspunkten<br />
bzw. in <strong>der</strong> gesteigerten Akzeptanz des Unternehmens o<strong>der</strong> Wirtschaftszweiges in<br />
<strong>der</strong> öffentlichen Meinung. Zudem kann die Wirtschaft hierdurch staatlichem Handeln zuvorkommen<br />
und dadurch umweltpolitische Handlungen überflüssig machen.<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> im oben beschriebenen Sinne stellen somit kein umweltpolitisches Instrument<br />
des Staates dar, da dieser am Zustandekommen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung nicht beteiligt<br />
ist.<br />
ad 2) „freiwillige“ Vereinbarungen<br />
Als „freiwillige“ Vereinbarungen <strong>der</strong> Wirtschaft werden Zusagen <strong>der</strong> Wirtschaft zur Umsetzung<br />
umweltpolitischer Ziele im Rahmen einer Vereinbarung mit staatlichen Stellen bezeichnet.<br />
Im Gegenzug zu den Zusagen <strong>der</strong> Wirtschaft verzichtet <strong>der</strong> Staat auf bestimmte umweltpolitische<br />
Handlungsoptionen. Solche Vereinbarungen werden in <strong>der</strong> Regel zwischen Staat und<br />
Wirtschaftsverbänden in übergreifenden umweltpolitischen Fragen abgeschlossen. Häufig<br />
sind sie nur in Einschränkung als „freiwillig“ zu bezeichnen, da die Wirtschaft solche Vereinbarungen<br />
meist nur abschließt, wenn ansonsten die Verabschiedung <strong>von</strong> strengeren Regelungen<br />
droht.<br />
ad 3) öffentlich-rechtliche Verträge<br />
Als öffentlich-rechtlicher Vertrag werden rechtsverbindliche, einklagbare Verträge zwischen<br />
staatlichen Stellen und Unternehmen o<strong>der</strong> Wirtschaftsverbänden verstanden.<br />
In diesem Vertrag gehen beide Beteiligte Verpflichtungen ein. Die Verpflichtung des Staates<br />
beinhaltet dabei in <strong>der</strong> Regel den (zeitlichen) Verzicht auf bestimmte umweltpolitische<br />
Handlungsoptionen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag kann insbeson<strong>der</strong>e bei konkreten begrenzten<br />
Umweltproblemen, wie beispielsweise bei einem Vertrag zwischen einem Wirtschaftsunternehmen<br />
und einer Kommune, Anwendung finden.<br />
c) Beurteilung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen<br />
Grundvoraussetzung für die Anwendung des Instrumentes ist, daß nicht das umweltpolitische<br />
Ziel, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Weg zur Zielerreichung Gegenstand <strong>der</strong> Verhandlungen ist. Die umweltpolitischen<br />
Ziele müssen, entsprechend den Zielfestlegungen bei ordnungsrechtlichen<br />
114
Instrumenten, im gesellschaftlichen Diskurs unter Wahrung demokratischer Prinzipien festgelegt<br />
werden.<br />
Durch die Anwendung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen gibt <strong>der</strong><br />
Staat zeitweise umweltpolitische Handlungsoptionen auf. Nach Abschluß entsprechen<strong>der</strong><br />
Vereinbarungen werden sich weitergehende For<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Regel erst bei Scheitern<br />
o<strong>der</strong> bei Ablauf politisch durchsetzen lassen. Ferner hat die Erfahrung <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
gezeigt, daß die Verhandlungen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Wirtschaft häufig dazu mißbraucht wurden, um die<br />
umweltpolitischen Ziele, teilweise bis zur Unkenntlichkeit, aufzuweichen bzw. dringend notwendige<br />
Entscheidungen zum Teil um Jahre hinauszuzögern. Zudem unterliegen das Zustandekommen<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> o<strong>der</strong> „freiwilligen“ Vereinbarungen hinsichtlich ihrer<br />
Angemessenheit nach <strong>der</strong> gegenwärtigen Vorgehensweise einer geringen demokratischen<br />
Kontrolle.<br />
d) Defizite <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen in <strong>der</strong> aktuellen<br />
Politik<br />
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ist gegen eine Umweltpolitik, die<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen pauschal als das geeignetste Mittel<br />
zur Lösung <strong>von</strong> Umweltproblemen versteht.<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen sind in den meisten bisherigen Fällen<br />
aus folgenden Gründen abzulehnen:<br />
• Reduktionsversprechen (sofern solche Bestandteil <strong>der</strong> Vereinbarung waren) werden oft<br />
nicht eingehalten; <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen werden oft nur<br />
zur Verzögerung <strong>von</strong> staatlichen Maßnahmen mißbraucht.<br />
• Fragen in bezug auf die Sanktionsmechanismen und das Monitoring bleiben häufig ungeklärt.<br />
• Interessen <strong>von</strong> gesellschaftlichen Gruppen, die nicht am Verhandlungsprozeß beteiligt<br />
sind, werden regelmäßig vernachlässigt.<br />
• <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen können zu Wettbewerbsverzerrungen<br />
führen.<br />
• Häufig werden lediglich Umweltziele erreicht, die aufgrund des „normalen“ Strukturwandels<br />
ohnehin erreicht worden wären.<br />
e) BUND-Position zur Auswahl des geeigneten umweltpolitischen Instruments<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen sind im Rahmen eines Policy Mix zur<br />
Lösung <strong>von</strong> Umweltproblemen nur dann akzeptabel, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:<br />
115
I. Allgemeines Verfahren <strong>der</strong> Erarbeitung einer umweltpolitischen Strategie<br />
1. Formulierung <strong>von</strong> Umweltzielen.<br />
2. Identifikation möglicher sinnvoller umweltpolitischer Instrumente zur Erreichung <strong>der</strong> Ziele.<br />
3. Bewertung <strong>der</strong> gefundenen Instrumente bezüglich ihrer ökologischen, ökonomischen und<br />
gesellschaftlichen Wirkungen.<br />
4. Auswahl des am besten geeigneten Instruments zur Erreichung <strong>der</strong> Umweltziele.<br />
II. Notwendige Vorbedingungen für akzeptable <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen<br />
• Der Staat muß über glaubhafte Drohpotentiale verfügen. Bei negativem Verhandlungsergebnis<br />
müssen an<strong>der</strong>e Maßnahmen (z.B. Ordnungsrecht, Steuern) anwendbar sein. Dies<br />
bringt in vielen Fällen die Wirtschaft erst an den Verhandlungstisch und kann Verpflichtungen<br />
auf weitreichende Umweltziele ermöglichen.<br />
• Die Zahl <strong>der</strong> betroffen Wirtschaftsverbände muß klein, ihr Organisationsgrad hoch sein.<br />
• Juristische Einwände (z.B. Kartellrecht, EU-Recht) müssen überprüft werden.<br />
III. Verfahren <strong>der</strong> Erarbeitung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
• Grundsätzlich ist das Einsatzgebiet „toxische Substanzen“ ungeeignet für den Einsatz <strong>von</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen, da hier ordnungsrechtliche Eingriffe<br />
unerläßlich und zur Abwehr akuter, langfristiger und insbeson<strong>der</strong>e irreversibler Gefährdungen<br />
auch rechtlich vorgeschrieben sind.<br />
• Am Verhandlungsprozeß müssen alle betroffenen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt<br />
werden (z.B. Verbraucher- und Umweltverbände).<br />
• Ergebnisse und Zwischenergebnisse des Verhandlungsprozesses müssen veröffentlicht<br />
und begründet werden, um eine öffentliche demokratische Kontrolle zu ermöglichen.<br />
IV.Inhalt <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
• Für die Erreichung <strong>von</strong> Zielen und Zwischenzielen muß ein exakt definierter Zeitrahmen<br />
erarbeitet werden. In <strong>der</strong> Vergangenheit hat sich gezeigt, daß ein überschaubarer zeitlicher<br />
Rahmen wesentlich zum Erfolg <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen<br />
beiträgt.<br />
116
• Ziele und Zwischenziele müssen quantifizierbar und überprüfbar sein. Wichtig ist hierbei,<br />
Ziele konkret in absoluten Zahlen festzulegen, um zu vermeiden, daß Verbrauchssteigerungen<br />
etc. die Emissionsreduktionen wie<strong>der</strong> „auffressen“.<br />
• Es müssen Sanktionsmöglichkeiten für den Fall <strong>der</strong> Nichterfüllung bestehen, die trotzdem<br />
eine zeitnahe Erreichung <strong>der</strong> Umweltziele ermöglichen.<br />
• Ein unabhängiges Monitoring gewährleistet die Überwachung des Erreichten und macht<br />
ein frühes Eingreifen bei Nichterfüllung möglich. Die Finanzierung des Monitoring muß<br />
Bestandteil <strong>der</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwilligen“ Vereinbarungen sein.<br />
f) Fazit<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und „freiwillige“ Vereinbarungen können als ein Instrument unter vielen<br />
einen Beitrag zur Lösung <strong>von</strong> Umweltproblemen leisten. Die Auswahl dieses Instrumentes<br />
muß sich jedoch an klar definierten Rahmenbedingungen orientieren. Die Auswahl des geeigneten<br />
Instrumentes muß hierbei insbeson<strong>der</strong>e auf einer fundierten Sachanalyse beruhen.<br />
117
4. Diskussion<br />
a) Bedeutung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und ihrer Ziele im allgemeinen<br />
In <strong>der</strong> Diskussion wurde sehr viel über die grundsätzliche Bedeutung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
und ihre adäquaten Ziele diskutiert.<br />
In einem Votum wurde darauf hingewiesen, daß in einer globalisierten Welt Unternehmen<br />
mehr Regelverantwortung übernehmen müßten; demgegenüber sei das <strong>von</strong> Frau Gundelach<br />
beklagte Demokratiedefizit zu relativieren, da es um die relevanten Alternativen gehe. Eine<br />
Selbstverpflichtung müsse <strong>von</strong> den Unternehmen als Vermögenswert angesehen werden,<br />
<strong>der</strong> dafür stehe, daß die Branche glaubwürdig Versprechungen abgeben und einhalten könne;<br />
diese Glaubwürdigkeit müsse jedoch erarbeitet werden, daher müsse in <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
investiert werden. Wichtig sei es in diesem Zusammenhang auch, die Klarheit <strong>der</strong><br />
Kommunikation nach außen sicherzustellen. Hier wurde nochmals auf die Unklarheit bezüglich<br />
des Umsetzungsstandes <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Holzschutzmitteln hingewiesen; eine<br />
solche Unklarkeit sei für die Kommunikation nach außen nicht hilfreich.<br />
In Zusammenhang mit den Zielen <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurde in einem Votum darauf<br />
verwiesen, daß das „Leistungscharisma“ <strong>von</strong> Zielen nicht unterschätzt werden solle. In<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> würden oft Dinge angestrebt, die sich über das Ordnungsrecht nicht<br />
erreichen ließen, unabhängig da<strong>von</strong>, welcher Druck hinter dem Ordnungsrecht stehe. Durch<br />
Druck alleine ließen sich insbeson<strong>der</strong>e komplexe Probleme nicht lösen, weshalb die Bedeutung<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nicht unterschätzt werden solle.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Ziele <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> wurde die For<strong>der</strong>ung geäußert, diese Ziele<br />
sollten über das Business as usual hinausgehen; verbunden mit einer größeren Transparenz<br />
sei dann auch das Demokratiedefizit hinnehmbar. Bei <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
sei auch denkbar, daß erreichte Ziele einer Selbstverpflichtung bei Anwendung<br />
an<strong>der</strong>er umweltpolitischer Instrumente angerechnet werden könnten. Diese Kombination <strong>von</strong><br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> mit an<strong>der</strong>en Instrumenten wurde auch <strong>von</strong> einem an<strong>der</strong>en Teilnehmer<br />
als sinnvoll erachtet.<br />
Bezüglich des Demokratiedefizits wurde <strong>von</strong> einem Teilnehmer festgestellt, daß es in an<strong>der</strong>en<br />
Län<strong>der</strong>n einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozeß gebe, bei dem auch die Sanktionen<br />
bei Nichterreichen <strong>der</strong> Ziele gleich mitverhandelt würden.<br />
Ein Teilnehmer plädierte für Pragmatismus in <strong>der</strong> Diskussion um <strong>Selbstverpflichtungen</strong>. Sie<br />
sollten als ein Instrument <strong>von</strong> vielen diskutiert und nicht mit dem Anspruch ökologisch überragen<strong>der</strong><br />
Zielsetzungen befrachtet werden.<br />
b) Ziele einzelner <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Neben <strong>der</strong> allgemeinen Diskussion wurde auch die Diskussion über die Ziele einzelner<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> noch einmal aufgegriffen.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> CO2-Selbstverpflichtung wurde geäußert, daß die Reduktion vor allem auf<br />
den Strukturwandel in den neuen Bundeslän<strong>der</strong>n und den Strukturwandel in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong><br />
118
Industrie allgemein zurückzuführen sei. Demgegenüber habe die Selbstverpflichtung kaum<br />
Investitionsentscheidungen beeinflußt.<br />
Dem wurde <strong>von</strong> seiten eines Unternehmens stark wi<strong>der</strong>sprochen. In einem an<strong>der</strong>en Votum<br />
wurde darauf hingewiesen, daß auch in den alten Bundeslän<strong>der</strong>n die Emissionen gesunken<br />
seien.<br />
Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer warf die Frage auf, ob im Falle <strong>von</strong> Energie- o<strong>der</strong> CO2-Steuern nicht<br />
exorbitant hohe Steuersätze erfor<strong>der</strong>lich seien, um eine Reduktionswirkung zu erzielen, und<br />
daher die Selbstverpflichtung vorzuziehen sei. Dem wurde aber entgegengehalten, daß hohe<br />
Steuersätze nur ein theoretisches Problem seien, während sich empirisch keine Beispiele<br />
dafür finden ließen. Das Beispiel des amerikanischen Lizenzmarktes für SO2 zeige überdies,<br />
daß die Befürchtungen bezüglich <strong>der</strong> Kosten übertrieben gewesen seien: die Zertifikatspreise<br />
hätten nur ein Zehntel dessen betragen, was zunächst geschätzt worden sei. Die Einführung<br />
<strong>von</strong> Steuern und Zertifikaten erfolge schrittweise, so daß es zu Innovationen komme,<br />
die exorbitante Steuersätze vermieden. Überdies sollten Steuern und <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
nicht als Entwe<strong>der</strong>-O<strong>der</strong> diskutiert werden; die Einführung <strong>von</strong> Steuern könnte etwa an die<br />
Vorlage eines Selbstverpflichtungs-Konzeptes gebunden werden.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Zwischenprodukten berichtet ein Unternehmensvertreter,<br />
daß sich dadurch ein Ethos entwickelt habe, das über die Einzelprobleme bei Stoffen<br />
hinaus zu weiteren Entwicklungen und Prüfungen hinsichtlich <strong>der</strong> besseren Stoffnutzung und<br />
<strong>der</strong> Folgeentwicklung <strong>von</strong> Stoffen geführt habe. Ein an<strong>der</strong>er Unternehmensvertreter verweist<br />
darauf, daß das Hauptproblem weniger das Vorhandensein <strong>von</strong> Daten als vielmehr ihre<br />
Verfügbarkeit im Störfall gewesen sei. Hier sei durch die Selbstverpflichtung vieles ausgelöst<br />
worden. Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer führte allerdings an, daß es nicht nur um die Frage <strong>der</strong><br />
Verfügbarkeit ginge; oftmals seien Daten zu Zwischenprodukten tatsächlich schwierig zu bekommen.<br />
c) Monitoring<br />
Die Frage des Monitorings <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> spielte in <strong>der</strong> Diskussion ebenfalls eine<br />
wichtige Rolle.<br />
Hinsichtlich <strong>der</strong> CO2-Selbstverpflichtung wurde <strong>von</strong> einem Teilnehmer darauf hingewiesen,<br />
daß ein quantitativ meßbarer Erfolg erzielt worden sei; die Ziele seien nicht nur erreicht, son<strong>der</strong>n<br />
auch übertroffen worden. Im Rahmen des Monitoring-Prozesses würden die erzielten<br />
Reduktionen quantifiziert und auch mit einzelnen Projekten belegt; demzufolge sei die Kritik<br />
am fehlenden Monitoring in diesem Falle gegenstandslos. Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer wies darauf<br />
hin, daß auch im Falle <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Textilhilfsmitteln ein entsprechendes<br />
quantitatives Monitoring existiere.<br />
Hier wurde als Antwort darauf hingewiesen, daß sich die Kritik nicht auf die erzielten Reduktionen<br />
o<strong>der</strong> das Monitoring beziehe, son<strong>der</strong>n auf die Dokumentation <strong>der</strong> Maßnahmen. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
komme es Kritikern darauf an zu erfahren, was durch die Selbstverpflichtung an zusätzlichen<br />
Maßnahmen ausgelöst worden sei; dies werde vor allem dann als bedeutend angesehen,<br />
wenn mit <strong>der</strong> Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Verzicht auf an<strong>der</strong>e umweltpolitische Instrumente<br />
gerechtfertigt werden solle.<br />
119
Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß die chemische Industrie<br />
40% ihrer Reduktionen mit Maßnahmen belegen könne. Zwar wäre eine höhere Quote<br />
wünschenswert, aber sie liege schon höher als bei an<strong>der</strong>en <strong>Verbände</strong>n.<br />
d) Transparenz<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Schaffung <strong>von</strong> Transparenz zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> regte ein Teilnehmer an,<br />
ein Forum – evtl. im Internet – zu schaffen, in dem sowohl die <strong>Selbstverpflichtungen</strong> als auch<br />
die Berichterstattung dazu veröffentlicht werden. Berichte in mehrjährigem Abstand seien für<br />
die Schaffung <strong>von</strong> Transparenz nicht ausreichend. Werde sie hergestellt, steige auch die Akzeptanz<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.<br />
Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer pflichtete grundsätzlich bei, daß Firmen, die eine Selbstverpflichtung<br />
umsetzen, etwa über das Internet erkennbar sein müßten. Die Frage sei aber, ob durch<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> immer eine Transparenz hergestellt werden könne; dies sei keineswegs<br />
immer erwünscht. So habe etwa <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> als Erster einen Stoff klassifiziere, einen<br />
Marktnachteil; hier seien deshalb rechtliche Regelungen vorzuziehen. Nur dort, wo etwa<br />
Anbieter und Kunde ein gemeinsames Interesse haben, könne es zu erfolgversprechenden<br />
Vereinbarungen kommen. Dieser Meinung wurde aber entgegengehalten, daß die Klassifizierung<br />
<strong>von</strong> Stoffen auch ein Mittel sein könne, um auf den Markt Druck auszuüben.<br />
Die Frage <strong>der</strong> Transparenz war auch ganz allgemein ein wichtiger Diskussionspunkt, nicht<br />
nur im Zusammenhang <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>: Ein Unternehmensvertreter wies darauf<br />
hin, daß in vielen Umweltberichten, die gemäß <strong>der</strong> CEFIC-Berichterstattungs-Richtlinie erstellt<br />
seien, bereits Transparenz hergestellt werde; oft würden die Umweltberichte aber nicht<br />
ausreichend analysiert. Ein an<strong>der</strong>er Teilnehmer hielt dem jedoch entgegen, daß bestimmte<br />
wichtige Fragen in Umweltberichten überhaupt nicht thematisiert würden.<br />
e) Ausländische Erfahrungen mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
Auch die Erfahrungen mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong> im Ausland, insbeson<strong>der</strong>e Europa, wurden<br />
kurz diskutiert.<br />
Ein Vertreter <strong>der</strong> EU stellte fest, daß die Diskussion auf europäischer Ebene genauso kompliziert<br />
sei wie auf <strong>der</strong> nationalen Ebene. Einerseits würden die Ziele selbst diskutiert, an<strong>der</strong>erseits<br />
gehe es um das Spannungsfeld zwischen einem möglichen Demokratiedefizit und<br />
dem Bestreben, <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nicht zu kompliziert auszugestalten. Das Europäische<br />
Parlament und <strong>der</strong> Europäische Rat hätten Bedenken dagegen angemeldet, daß die Europäische<br />
Kommission <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gegenzeichne, daher werde jetzt eine Rahmenrichtlinie<br />
bzw. Rahmenvereinbarung für <strong>Selbstverpflichtungen</strong> entworfen, über die die Kommission<br />
im Sommer berichten werde. Insbeson<strong>der</strong>e werde es dabei um die Frage gehen, wie<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> in das europäische Rechtssystem eingebunden werden können, wenn<br />
zugleich ihre Effizienz erhalten bleiben solle.<br />
Bezüglich <strong>der</strong> Erfahrungen in an<strong>der</strong>en europäischen Län<strong>der</strong>n berichtet ein Teilnehmer hinsichtlich<br />
<strong>der</strong> CO2-<strong>Selbstverpflichtungen</strong>, daß <strong>der</strong> VCI sich bemühe, auf <strong>der</strong> CEFIC-Ebene<br />
120
das deutsche Modell zu etablieren; zwar habe sich CEFIC ein Reduktionsziel gesetzt, allerdings<br />
fehle noch die Bereitschaft auf seiten des CEFIC, zu einer entsprechenden Vereinbarung<br />
mit <strong>der</strong> Europäischen Kommission bzw. dem Europäischen Parlament zu kommen. Bezüglich<br />
<strong>der</strong> Erfahrungen mit <strong>Selbstverpflichtungen</strong> in England und Holland wird folgendes berichtet:<br />
das englische Modell sei ähnlich wie das deutsche, nur weniger streng in den Zielsetzungen.<br />
Dagegen sei es um das holländische Modell sehr still geworden; dieses Modell habe<br />
zunächst bestimmte Ziele (Covenants) vorgesehen, nach <strong>der</strong>en Erreichung sollen nun Produktionsverfahren<br />
bezüglich ihres Energieverbrauchs bzw. CO2-Ausstoßes verglichen werden<br />
(benchmarking); die 10-15% besten Verfahren sollen dann <strong>von</strong> <strong>der</strong> Öko-Steuer ausgenommen<br />
werden. Dieses Modell stoße in <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie auf Probleme, weil es<br />
keine wirklich vergleichbaren Prozesse, son<strong>der</strong>n nur Unikate gebe.<br />
f) Abschließende Bemerkungen<br />
Paschen <strong>von</strong> Flotow, Institut für Umweltmanagement, stellt abschließend fest, daß die Studie<br />
zwei Zielebenen verfolgte: zum einen ein Erkenntnisziel und zum an<strong>der</strong>en ein Handlungsziel.<br />
Einerseits ging es darum, für den VCI und seine Mitglie<strong>der</strong> Erkenntnisse bezüglich <strong>der</strong> Effektivität<br />
und Effizienz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> zu gewinnen. Der Erkenntnisgewinn <strong>der</strong> Studie<br />
liegt in hinreichend begründeten und differenzierten analytischen Ergebnissen, wenn auch<br />
die ursprünglichen Ziele einer Quantifizierung nur zum Teil erreicht werden konnten. Der Erkenntnisgewinn<br />
reicht allerdings aus, um hinsichtlich des zweiten Ziels – des Handlungsziels<br />
– Vorschläge zur Verbesserung <strong>der</strong> Effektivität und Effizienz abzuleiten: auf <strong>der</strong> Ebene <strong>der</strong><br />
Umsetzung, <strong>der</strong> Dynamisierung o<strong>der</strong> auch <strong>der</strong> Kommunikation <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong>.<br />
Möglicherweise könnten diese Handlungsempfehlungen auch dazu dienen, die Akzeptanz<br />
<strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> auf <strong>der</strong> politischen und gesellschaftlichen Ebene zu erhöhen und<br />
damit ihre Stabilität zu steigern. Dann könnte das ein Beispiel dafür werden, daß freie Gesellschaften<br />
neue Ideen <strong>der</strong> Regulierung erarbeiten, die auch einer freiheitlichen Gestaltung<br />
gerecht würden.<br />
Professor Dr. Herwig Hulpke, Bayer AG, nennt in seinen abschließenden Bemerkungen zwei<br />
Punkte, die durch die Studie für den VCI erbracht worden seien:<br />
• Die Studie habe dem Verband wertvolle empirische Hinweise für die Bewertung bereits<br />
abgeschlossener <strong>Selbstverpflichtungen</strong> gegeben<br />
• darüber hinaus habe sie hilfreiche Handlungsempfehlungen für den Abschluß zukünftiger<br />
<strong>Selbstverpflichtungen</strong> sowie wichtige Hinweise für die Überprüfung <strong>der</strong> politischen Position<br />
des Verbandes gegeben<br />
Für das weitere Vorgehen werden <strong>von</strong> Herrn Hulpke die folgenden zwei Punkte genannt:<br />
• Der Verband wird die Studienergebnisse veröffentlichen und den transparenten Dialog<br />
über den Instrumenteneinsatz fortsetzen.<br />
• Darüber hinaus soll aus den Ergebnissen <strong>der</strong> Studie ein Leitfaden erstellt werden.<br />
121
122
Anhänge<br />
123
124
Anhang 1: Mitglie<strong>der</strong> des Steuerkreises<br />
Dr. Frauke Druckrey (VCI, verantwortlich)<br />
Axel D. Angermann (VCI)<br />
Dr. Rüdiger Baunemann (VKE)<br />
Bernd Berressem (Fachverband <strong>der</strong> Photo<strong>chemischen</strong> Industrie e.V.)<br />
Peter Braun (VCI)<br />
Dr. Dietmar Eichstädt (VdL)<br />
Dr. Dieter Fink (VCI)<br />
Prof. Dr. Herwig Hulpke (Bayer AG)<br />
Dr. Petra Je<strong>der</strong> (VCI)<br />
Dr. Martin Kanert (Verband <strong>der</strong> Mineralfarbenindustrie e.V.)<br />
Hartmut Löschner (IG BCE)<br />
Lothar Noll (TEGEWA)<br />
Dr. Peter Olschewski (IKW)<br />
Dr. Jörg Rothermel (VCI)<br />
Dr. Jochen Rudolph (Degussa-Hüls AG)<br />
Norbert Schröter (Deutsche Bauchemie e.V.)<br />
Dr. Rudolf Staudigl (Wacker-Chemie AG)<br />
Dietrich Wittmeyer (VCI)<br />
125
Anhang 2: <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> <strong>Verbände</strong> <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
Verband Titel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Jahr<br />
IKW Angabe zusätzlicher Warnhinweise bei Geschirrspülmitteln 1980/89<br />
Deutsche Bauchemie<br />
Verzicht <strong>der</strong> Holzschutzmittelindustrie auf die Herstellung PCBhaltiger<br />
Mittel<br />
VdL Selbstverpflichtung über die Reduzierung <strong>der</strong> Anteile <strong>von</strong> Lösemitteln<br />
und Schwermetallverbindungen <strong>von</strong> Lacken und Farben<br />
126<br />
1984<br />
1984<br />
IKW, IPP Vereinbarung über hypochlorithaltige Haushaltsreiniger 1985<br />
VCI, IPP, IKW,<br />
IGA, IPS<br />
Anbringung kin<strong>der</strong>gesicherter Verschlüsse bei stark reizenden<br />
bzw. ätzenden Produkten<br />
VKE Verzicht auf den Einsatz polybromierter Diphenylether (PBDE) als<br />
Flammschutzmittel für Kunststoffe<br />
VdL Vereinbarung zur Verringerung umweltbelasten<strong>der</strong> Wirkstoffe in<br />
Unterwasserfarben für den Bootsanstrich<br />
IKW, IPP, IHO,<br />
TEGEWA<br />
IKW, IPP, IHO<br />
TEGEWA<br />
Zusage über den Verzicht auf Alkylphenolethoxylate (APEO) in<br />
Wasch- und Reinigungsmitteln<br />
Mitteilung <strong>der</strong> Rahmenrezepturen und sonstiger Angaben zur Umweltverträglichkeit<br />
<strong>von</strong> Wasch- und Reinigungsmitteln nach § 9<br />
WMG<br />
VCI Programm zur Vermin<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Ableitung <strong>von</strong> Ammonium im<br />
Abwasser <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
VCI, Verband d.<br />
Dt. Chemikalien<br />
Groß- und Außenhandels<br />
Verband <strong>der</strong> Mineralfarbenindustrie<br />
1985<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
1986<br />
Verhaltenskodex für die Ausfuhr <strong>von</strong> gefährlichen Chemikalien 1986<br />
Freiwillige Vereinbarung über die Herstellung und das Inverkehrbringen<br />
<strong>von</strong> Fingermalfarben<br />
IGA Erklärung über die Reduzierung des Einsatzes vollhalogenierter<br />
FCKW in Spraydosen<br />
IPP, IHO [FachvereinigungIndustriereiniger],<br />
TEGEWA<br />
1987<br />
1987<br />
Verzicht auf leichtflüchtige CKW in Wasch- und Reinigungsmitteln 1987<br />
IKW Deklaration <strong>der</strong> Inhaltsstoffe <strong>von</strong> Kosmetika nach dem amerikanischen<br />
CTFA-System<br />
IKW Verzicht auf Tierversuche für kosmetische Fertigprodukte sowie<br />
Veröffentlichung eines Leitfadens über Alternativmethoden<br />
1988<br />
1989/92
Verband Titel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Jahr<br />
IKW Ersatz des Weichspüler-Inhaltsstoffes DSDMAC durch schneller<br />
und besser abbaubare Substanzen<br />
VCI Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur stufenweisen<br />
Einstellung <strong>der</strong> Produktion vollhalogenierter FCKW<br />
VCI Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Rücknahme und<br />
Verwertung <strong>von</strong> FCKW und Altölen aus Kälte- und Klimageräten<br />
127<br />
1990<br />
1990<br />
1990<br />
VCI Erklärung zur Reduzierung <strong>der</strong> Gewässerbelastung durch EDTA 1991<br />
VCI Vereinbarung zwischen <strong>der</strong> Gemeinde Rotterdam und dem Verband<br />
<strong>der</strong> Chemischen Industrie<br />
IKW Freiwillige Mitteilung <strong>der</strong> Rahmenrezepturen <strong>von</strong> Wasch- und Reinigungsmitteln<br />
an das BGA und die Informations- und Behandlungszentren<br />
für Vergiftungen<br />
IKW Empfehlungen zum Einsatz <strong>von</strong> Moschus-Xylol in kosmetischen<br />
Mitteln sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln<br />
1991<br />
1993<br />
1993<br />
IHO Verzicht auf Großgebinde für Peressigsäure (PES) 1994<br />
IKW Code of Practice zur Gewährleistung <strong>der</strong> Verbrauchersicherheit<br />
bei Giebel-Karton-Verpackungen für Wasch- und Reinigungsmittel<br />
VCI Vereinbarung zwischen <strong>der</strong> Gemeinde Rotterdam und dem Verband<br />
<strong>der</strong> Chemischen Industrie<br />
Verband <strong>der</strong> Mineralfarbenindustrie,<br />
Verband<br />
<strong>der</strong> Druckfarbenindustrie<br />
1995<br />
1995<br />
Rohstoff-Ausschlußliste für Druckfarben und zugehörige Produkte 1996<br />
VCI Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Hersteller <strong>von</strong> XPS zur Umstellung auf H-<br />
FCKW-freie Dämmplatten<br />
VCI Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion<br />
<strong>der</strong> energiebedingten CO2-Emissionen<br />
IKW Selbstverpflichtung zur detaillierten Informationsweitergabe an<br />
Verbraucher- o<strong>der</strong> Umweltorganisationen bezüglich gentechnisch<br />
hergestellter Enzyme<br />
VCI Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und<br />
Bewertung <strong>von</strong> Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die<br />
Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
IKW Meldeverfahren kosmetischer Rahmenrezepturen an die Zentralstelle<br />
für Vergiftungen beim BgVV<br />
TEGEWA Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach<br />
ihrer Gewässerrelevanz<br />
1996<br />
1996<br />
1996<br />
1997<br />
1997<br />
1997
Verband Titel <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Jahr<br />
IKW, europäischerEnzymverband<br />
AMFEP<br />
VCI, Deutsche<br />
Bauchemie, VdL<br />
Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Waschmittelhersteller zur Auskunft gegenüber<br />
dem Umweltbundesamt über die in Wasch- und Reinigungsmitteln<br />
eingesetzten Enzyme<br />
Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende<br />
und holzverfärbende Organismen<br />
128<br />
1997<br />
1997<br />
IKW Code Umweltgerechtes Handeln 1997<br />
IKW Selbstverpflichtung <strong>der</strong> Waschmittelhersteller zur Kennzeichnung<br />
<strong>der</strong> Reichweite aller Waschmittel<br />
Fachverband<br />
<strong>der</strong> Photo<strong>chemischen</strong>Industrie<br />
Selbstverpflichtung zur Reduzierung schwer abbaubarer Komplexbildner<br />
in <strong>der</strong> Photobranche<br />
TEGEWA Selbstverpflichtung zum Verzicht auf den Einsatz <strong>von</strong> APEO in<br />
Polyacrylamid-Emulsionspolymeren zum Zwecke <strong>der</strong> Abwasserund<br />
Klärschlammbehandlung<br />
Deutsche Bauchemie<br />
1997<br />
1998<br />
1998<br />
Branchenregelung „Chromatarme Zemente und Produkte“ 1998
Anhang 3: Gesprächspartner in <strong>der</strong> Grobevaluation<br />
Dr. Rüdiger Baunemann (VKE)<br />
Bernd Berressem (Fachverband <strong>der</strong> Photo<strong>chemischen</strong> Industrie)<br />
Dr. Dietmar Eichstädt (Verband <strong>der</strong> Lackindustrie)<br />
Birgit Engelhardt (VCI)<br />
Dr. Dieter Fink (VCI)<br />
Dr. Robert Fischer (Verband <strong>der</strong> Mineralfarbenindustrie)<br />
Dr. Walter Gekeler (IHO)<br />
Matthias Ibel (IGA)<br />
Dr. Martin Kanert (Verband <strong>der</strong> Mineralfarbenindustrie)<br />
Dr. Michael Lulei (VCI)<br />
Prof. Dr. Franz Na<strong>der</strong> (VCI)<br />
Dr. Heinz Günter Nösler<br />
Lothar Noll (TEGEWA)<br />
Dr. Peter Olschewski (IKW)<br />
Norbert Schröter (Deutsche Bauchemie)<br />
Harthmuth Skalicky (VCI)<br />
Dietrich Wittmeyer (VCI)<br />
129
Anhang 4: Gesprächspartner in <strong>der</strong> Detailevaluation<br />
a) Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong> energiebedingten<br />
CO2-Emissionen<br />
Unternehmen (mit 7 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Dipl.-Ing. Horst-Heinrich Bieling<br />
BASF Aktiengesellschaft<br />
Ludwigshafen<br />
Dipl-Ing. Eberhard Kretschmer<br />
BSL Olefinverbund GmbH<br />
Merseburg<br />
Dr. Christof Bauer<br />
Degussa Hüls AG<br />
Hanau (Wolfgang)<br />
Dipl.-Ing. Heinrich Dietl<br />
SKW Trostberg AG<br />
Trostberg<br />
Dr. Wolfgang Kristof<br />
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH<br />
Lutherstadt Wittenberg<br />
Behörden<br />
MinRat Werner Ressing<br />
Bundesministerium für Wirtschaft<br />
und Technologie<br />
Bonn<br />
Dr. Klaus Becker<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
130<br />
Dr. Detlef Schmitz<br />
Bayer AG<br />
Leverkusen<br />
Dipl.-Ing. Günter Keilitz<br />
Wacker-Chemie GmbH<br />
Burghausen<br />
Dipl.-Ing. Martin Sydow<br />
Schering AG<br />
Berlin<br />
Dipl.-Ing. Peter Hassel<br />
Rhodia Acetow GmbH<br />
Freiburg<br />
Dieter Bamberger<br />
Röhm GmbH Chemische Fabrik<br />
Darmstadt<br />
MR Franzjosef Schafhausen<br />
Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
Berlin<br />
Umweltverbände/-institute<br />
(mit 3 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Susanne Hempen<br />
Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.<br />
Bonn<br />
Felix Matthes<br />
Öko-Institut e.V.<br />
Berlin<br />
Matthias Seiche<br />
BUND e.V.<br />
Berlin<br />
Stephan Ramesohl<br />
Wuppertal-Institut<br />
Wuppertal
) Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung <strong>von</strong><br />
Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit<br />
Unternehmen (ausführliche Interviews)<br />
Dr. Klaus Reucker<br />
Weilburger Lackfabrik<br />
Weilburg<br />
Ingo Schmieschek<br />
Schramm Lacke GmbH<br />
Offenbach am Main<br />
Dr. Christine Frank-Otto<br />
BASF AG<br />
Ludwigshafen<br />
Dr. Hans-Jürgen Wiegand<br />
Degussa-Hüls AG<br />
Marl<br />
Dr. Andrea Paetz<br />
Bayer AG<br />
Leverkusen<br />
131<br />
Dr. Bernd Mertschenk<br />
SKW Trostberg<br />
Trostberg<br />
Dr. Friedhelm Bartnik<br />
Henkel KgaA<br />
Düsseldorf<br />
Dr. Rainer Neuhaus<br />
Rütgers Organics GmbH<br />
Mannheim<br />
Dr. Frank Engel<br />
Wacker Chemie GmbH –<br />
Burghausen<br />
Kleine und mittlere Unternehmen (aus den folgenden 20 Adressen wurden zufällig 13<br />
Unternehmen für telefonische Kurzinterviews ausgewählt)<br />
Dr. Reinhard Müller<br />
Dow Deutschland Inc.<br />
Rheinmünster<br />
Herr Langhammer, Herr Burcheister<br />
Siegwerk Druckfarben GmbH & Co KG<br />
Siegburg<br />
Herr Dr. Breitbach<br />
Stockhausen GmbH & Co. KG<br />
Krefeld<br />
Frau H. Hochscherf<br />
DESOWAG GmbH & Co. KG<br />
Rheinberg<br />
Herr Wegner UMS<br />
Worlée-Chemie GmbH<br />
Lauenburg<br />
Herr Dr. Jakob<br />
Dr. Th. Böhme KG<br />
Chemische Fabrik GmbH & Co<br />
Geretsried<br />
Herr Dr. W. Matthias Bühler<br />
Grünau Illertissen GmbH<br />
Illertissen<br />
Julia Szincsák<br />
Follmann & Co<br />
Gesellschaft für Chemiewerkstoffe<br />
und Verfahrenstechnik mbH & Co KG<br />
Minden<br />
Ulrich Busch<br />
Bakelite AG<br />
Duisburg<br />
Dr. Thomas Brenner<br />
Deutsche Amphibolin-Werke<br />
<strong>von</strong> Robert Murjahn GmbH & Co KG<br />
Ober-Ramstadt<br />
Karl-Heinz Diehl<br />
Schülke & Mayr GmbH<br />
Nor<strong>der</strong>stedt<br />
Herr Funk<br />
StoCretec GmbH<br />
Stühlingen<br />
Florian Schramm<br />
Coates Screen Inks GmbH<br />
Wie<strong>der</strong>hold Siebdruckfarben<br />
Nürnberg<br />
Erhardt Fiebiger<br />
Zschimmer & Schwarz GmbH & Co<br />
Chemische Fabriken<br />
Lahnstein
Ingo Najda<br />
Hercules GmbH<br />
Bad Sobernheim<br />
Herr Dr. Kuhlmann<br />
Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH<br />
Werk Wülfrath<br />
Wülfrath<br />
Udo Nebendahl<br />
CONDEA Chemie GmbH<br />
Brunsbüttel<br />
132<br />
Frau Hiltrud Meyer<br />
Remmers Bauchemie GmbH<br />
Löningen<br />
Dr. Marc Hombeck<br />
BODE CHEMIE GmbH & Co<br />
Hamburg<br />
Dr. Günther Hahn<br />
Goldschmidt AG<br />
Essen<br />
Behörden (ausführliche Interviews)<br />
(mit 3 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Dr. Wilfried Mahlmann<br />
Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
Bonn<br />
Dr. Helmut Klein<br />
Bundesministerium für Arbeit<br />
und Sozialordnung<br />
Bonn<br />
Dr. Jan Ahlers<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Dr. Rainer Meffert<br />
Ministerium für Umwelt und Forsten des<br />
Landes Rheinland-Pfalz<br />
Mainz<br />
Dr. Goedecke, Dr. Arndt<br />
Bundesanstalt für Arbeitsschutz<br />
und Arbeitsmedizin<br />
Dortmund<br />
Dr. Horst Neidhard<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Prof. Dr. Gun<strong>der</strong>t-Remy<br />
BgVV<br />
Berlin<br />
Vollzugsbehörden und BG-Chemie (telefonische KurzInterviews)<br />
Herr Dr. Hänsler<br />
Bayerisches Landesamt f. Umweltschutz<br />
Augsburg<br />
Herr Dr. Siglmüller<br />
Gewerbeaufsichtsamt München-Land<br />
München<br />
Herr Dr. Thom<br />
Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg<br />
Oldenburg<br />
Frau März, Frau Schenk<br />
Landratsamt Bad Tölz-Wolfrathshausen<br />
Bad Tölz<br />
Herr Fuhrmann<br />
Staatliches Amt für Arbeitsschutz<br />
Mönchengladbach<br />
Mönchengladbach<br />
Herr Manz<br />
Staatliches Umweltamt Krefeld<br />
Krefeld<br />
Herr Dr. Bartels<br />
Berufsgenossenschaft Chemie<br />
Heidelberg<br />
Frau Dr. Stahlberg<br />
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt<br />
Neustadt<br />
Herr Kremeskoetter<br />
Landesumweltamt Essen<br />
Essen<br />
Herr Strobel<br />
Landratsamt Neu-Ulm<br />
Sachgebiet Immissionsschutz<br />
Neu-Ulm<br />
Frau Notthoff, Frau Jorg<br />
Staatliches Amt für Arbeitsschutz Essen<br />
Essen<br />
Frau Parensen<br />
Staatliches Umweltamt Itzehoe<br />
Itzehoe
Umweltverbände (mit 3 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Susanne Hempen<br />
Naturschutzbund Deutschland e.V.<br />
Bonn<br />
Manfred Krautter<br />
Greenpeace e.V.<br />
Hamburg<br />
Andreas Ahrens<br />
ökopol<br />
Institut für Ökologie und Politik GmbH<br />
Bremen<br />
(befragt als Vertreter des WWF)<br />
133<br />
Dr. Michael Rieß<br />
BUND e.V.<br />
Bremen<br />
Rainer Grießhammer<br />
Öko-Institut Freiburg<br />
Freiburg<br />
Justus <strong>von</strong> Geibler<br />
Wuppertal-Institut<br />
Wuppertal<br />
c) Selbstverpflichtung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln nach ihrer Gewässerrelevanz<br />
Unternehmen<br />
Dr. Ulrich Sewekow<br />
Bayer AG<br />
Leverkusen<br />
Dr. Kaspar Schlüter<br />
Cognis Deutschland GmbH<br />
Düsseldorf<br />
Hubert Knörzer<br />
CHT R. Beitlich GmbH<br />
Tübingen<br />
Dr. Hans-Ludwig Panke<br />
Clariant GmbH<br />
Frankfurt<br />
Dr. Werner Streit<br />
BASF AG<br />
Ludwigshafen<br />
Robert Puk<br />
Ciba Spezialitätenchemie<br />
Pfersee GmbH<br />
Langweid<br />
Peter Thölen<br />
Thor-Chemie GmbH<br />
Speyer<br />
Behörden (mit 3 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Bernd Mehlhorn<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Frank Tiedtke<br />
Staatliches Umweltamt Minden<br />
Minden<br />
Dr. Horst Fischer<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Herr Ministerialrat Dr. Kraus<br />
Bundesministerium für Umwelt<br />
Bonn<br />
Frau Dr. Paulini<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Harald Schönberger<br />
Regierungspräsidium Freiburg<br />
Freiburg<br />
Herr Dr. Platzeck<br />
BgVV<br />
Berlin
Umweltverbände/-institute<br />
(mit 2 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Dr. Michael Rieß<br />
BUND<br />
Bremen<br />
Susanne Hempen<br />
Naturschutzbund Deutschland e.V.<br />
Bonn<br />
134<br />
Dr. Rainer Grießhammer<br />
Öko-Institut e.V.<br />
Freiburg<br />
Kunden(-verbände)/Handel<br />
(mit 4 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Herr Dr. Aretz<br />
Otto-Versand Hamburg GmbH & Co.<br />
Hamburg<br />
Dr. Hartmut Reetz<br />
Gesamtverband <strong>der</strong> deutschen<br />
Textilveredlungsindustrie e.V.<br />
Eschborn<br />
Ulf Köppe<br />
Textilveredlung<br />
an <strong>der</strong> Wiese GmbH<br />
Lörrach<br />
Dreilän<strong>der</strong>eck<br />
Textilveredlungs GmbH<br />
Kreuzmattstr. 2<br />
79664 Wehr<br />
Frau Heinrichs<br />
Karstadt AG<br />
Essen<br />
Dr. Karen Schmidt<br />
Klaus Steilmann GmbH & Co. KG<br />
Damen- u. Mädchenbekleidung<br />
Bochum<br />
Herr Dipl.-Ing. W. Janas<br />
HKS Textil-Dienste GmbH<br />
Bad Säckingen<br />
Herr R.B. Smeets<br />
KBC Manufaktur Koechlin<br />
Baumgartner & Co. GmbH<br />
Lörrach<br />
Textil-Veredlung Wehr GmbH<br />
Industriestraße 30<br />
79664 Wehr<br />
d) Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende und<br />
holzverfärbende Organismen<br />
Unternehmen<br />
Verband <strong>der</strong> Lackindustrie e.V. Deutsche Bauchemie e.V.<br />
Dr. Ulrich Platzeck<br />
Dr. Hans-Günter Seltmann<br />
Deutsche Amphibolin-Werke<br />
MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.<br />
v. Robert Murjahn GmbH & Co.KG<br />
Ober-Ramdstadt<br />
Essen<br />
Ulrich Ditzen<br />
Eckart Krogoll<br />
DESOWAG GmbH<br />
Kulba-Bauchemie GmbH & Co. KG<br />
Rheinberg<br />
Ansbach-Brodswinden<br />
Ernst Häring<br />
Frau Dr. Schmidt-Sonnenschein<br />
Akzo Nobel Deco GmbH<br />
Bayer AG<br />
Köln<br />
Leverkusen
Dr. Josef-Theo Hein<br />
Dyrup Deutschland GmbH<br />
Mönchengladbach<br />
135<br />
Dr. Volker Barth<br />
Rüttgers Organics GmbH<br />
Mannheim<br />
Behörden (mit 4 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
MinRat Dr. Wilfried Mahlmann<br />
Bundesministerium für Umwelt,<br />
Naturschutz und Reaktorsicherheit<br />
Bonn<br />
Uwe-Jens Lucks<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Dr. rer. nat. Dieter Rudolph<br />
Bundesanstalt für Materialforschung<br />
und -prüfung (BAM)<br />
Berlin<br />
Christine Däumling<br />
Umweltbundesamt<br />
Berlin<br />
Dr. Hans Reifenstein<br />
Bundesamt für gesundheitlichen<br />
Verbraucherschutz und Veterinärmedizin<br />
Berlin<br />
Umweltverbände/-institute<br />
(mit 2 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Dr. Rainer Grießhammer<br />
Öko-Institut e.V.<br />
Freiburg<br />
Susanne Hempen<br />
Naturschutzbund Deutschland e.V.<br />
Bonn<br />
Dr. Michael Rieß<br />
BUND e.V.<br />
Bremen<br />
Kunden(-verbände) (mit 4 <strong>der</strong> kontaktierten Personen wurden Interviews durchgeführt)<br />
Holger Haring<br />
Bundesinnungsverband des deutschen<br />
Maler- und Lackiererhandwerks<br />
Frankfurt<br />
Wilfried Ristau<br />
Bundesverband Deutscher Heimwerker-,<br />
Bau- und Gartenfachmärkte e.V. (BHB)<br />
Bonn<br />
Herr Botschen<br />
Obi-Systemzentrale<br />
Wermelskirchen<br />
Herr Plümer<br />
Bundesverband Großhandel Heim & Farbe<br />
e.V.<br />
Haan<br />
Heinz-Karl Jenisch<br />
Bundesverbandes Farben- und<br />
Tapetenhandel e.V.<br />
Frankfurt<br />
Eike Gehrts<br />
Verband <strong>der</strong> Fenster- und Fassadenhersteller<br />
Frankfurt am Main<br />
Bodo Tegethoff<br />
Arbeitsgemeinschaft <strong>der</strong><br />
Verbraucherverbände e.V. (AgV)<br />
Bonn<br />
Herr Dr. Bau<strong>der</strong><br />
toom BauMarkt GmbH<br />
Köln (Braunsfeld)<br />
Frau Jäger<br />
HORNBACH<br />
Baumarkt-Aktiengesellschaft<br />
Bornheim bei Landau/Pfalz
Anhang 5: Fragebogen für die Detailevaluation<br />
(Bsp.: CO2-Selbstverpflichtung; Fragebogen Unternehmen)<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Fragebogen richtet sich an die Unternehmen <strong>der</strong><br />
<strong>chemischen</strong> Industrie und soll dazu dienen, Erfahrungen im Einsatz <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong><br />
zu evaluieren. Hintergrund dieser Untersuchung ist, daß:<br />
• <strong>Selbstverpflichtungen</strong> nicht nur in Deutschland, son<strong>der</strong>n auch auf europäischer Ebene<br />
zunehmend eingesetzt werden, dabei aber<br />
• keine umfassende Analyse und Bewertung <strong>der</strong> Begleitumstände, Maßnahmen, Wirkungen<br />
und insbeson<strong>der</strong>e des Erfolges <strong>von</strong> <strong>Selbstverpflichtungen</strong> vorliegt.<br />
Die Studie, die vom BGB-Vorstand des VCI in Auftrag gegeben wurde, hat zum Ziel, aufgrund<br />
<strong>der</strong> Befragung und <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Befragung, die Möglichkeiten (und Grenzen) für<br />
den weiteren Einsatz <strong>von</strong> freiwilligen Vereinbarungen/Selbstverpflichtungserklärungen<br />
– auch im Hinblick auf die politische Diskussion im Bereich des Klimaschutzes – zu überprüfen.<br />
Aus Sicht <strong>der</strong> Unternehmen dürfte insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Untersuchungsaspekt „ökonomische<br />
Effizienz/ökologische Effektivität“ freiwilliger Vereinbarungen <strong>von</strong> Interesse sein. Dabei geht<br />
es um die Frage, ob die Abgabe einer freiwilligen Erklärung unter Kosten-/Nutzen-<br />
Gesichtspunkten in jedem Fall die beste Lösung darstellt o<strong>der</strong> ob Alternativen bestehen, bei<br />
denen <strong>der</strong> gleiche bzw. ein größerer Nutzen ggf. mit einem geringeren Aufwand erreicht<br />
worden wäre.<br />
Vor diesem Hintergrund hoffen wir auf Ihre Unterstützung, insbeson<strong>der</strong>e was die Angaben zu<br />
Kosten/Erträgen angeht, die im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung angefallen sind. Alle Daten<br />
und Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und<br />
– auch an den Verband – nur in anonymisierter Form weitergegeben. Für Ihre Bemühungen<br />
möchten wir Ihnen bereits im voraus danken.<br />
Name des Interviewers:<br />
Name <strong>der</strong> Firma:<br />
Name des Gesprächspartners:<br />
Position des Gesprächspartners:<br />
Ort des Gesprächs:<br />
Datum des Gesprächs:<br />
Beginn: Ende:<br />
136
Glie<strong>der</strong>ung des Gesprächsleitfadens:<br />
I. Allgemeine Fragen<br />
II. Maßnahmen und Konsequenzen<br />
III. Umfeld <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
IV. Einschätzung des Erfolges<br />
__________________________________________________________________________<br />
I. Allgemeine Fragen<br />
1. Seit wann sind Sie persönlich in die Selbstverpflichtung involviert?<br />
2. Welchem Verband bzw. welchen <strong>Verbände</strong>n gehört Ihr Unternehmen an?<br />
a)VCI ❏<br />
b)___________________ ❏<br />
3. Wie hoch ist <strong>der</strong> jährliche Umsatz Ihres Unternehmens?<br />
4. Wieviele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen?<br />
II. Maßnahmen und Konsequenzen<br />
5. Hat die Selbstverpflichtung die Investitionsentscheidungen Ihres Unternehmens beeinflußt<br />
und wenn ja, wie?<br />
a) Ja, bei Investitionen wird immer die CO2-ärmste/energiesparendste<br />
Technik gewählt ❏<br />
b) Ja, bei Investitionen wird bei weitgehen<strong>der</strong> Kostengleichheit die<br />
CO2-ärmste/energiesparendste Technik gewählt ❏<br />
c) Ja, _____________________________________ ❏<br />
d) Nein ❏<br />
e) weiß nicht ❏<br />
6. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten konkreten Maßnahmen, die Ihr Unternehmen<br />
im Zuge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung umgesetzt hat?<br />
M1)<br />
M2)<br />
M3)<br />
M4)<br />
137
7. Welche Vermin<strong>der</strong>ungen an CO2-Emissionen bzw. an bezogenen/verbrauchten Energiemengen<br />
hat Ihr Unternehmen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durch die o.g. Maßnahmen<br />
erreicht (Prozent)?<br />
M1)<br />
M2)<br />
M3)<br />
M4)<br />
8. Haben sich bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> genannten Maßnahmen im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
unerwartete Schwierigkeiten für Ihr Unternehmen ergeben?<br />
M1 M2 M3 M4<br />
a) Ja, technische Schwierigkeiten ❏ ❏ ❏ ❏<br />
b) Ja, hohe Umsetzungskosten ❏ ❏ ❏ ❏<br />
c) Ja, ________________________ ❏ ❏ ❏ ❏<br />
d) Nein, keine unerwarteten Schwierigkeiten ❏ ❏ ❏ ❏<br />
e) Nein, überhaupt keine Schwierigkeiten ❏ ❏ ❏ ❏<br />
f) weiß nicht ❏ ❏ ❏ ❏<br />
9. Haben sich die oben genannten im Rahmen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführten Maßnahmen<br />
wirtschaftlich gelohnt? (Begründung)<br />
M1 M2 M3 M4<br />
a) Ja ❏ ❏ ❏ ❏<br />
b) Nein ❏ ❏ ❏ ❏<br />
c) unentschieden ❏ ❏ ❏ ❏<br />
10. Hat Ihr Unternehmen die sich aus <strong>der</strong> Teilnahme an <strong>der</strong> Selbstverpflichtung bzw. aus<br />
möglichen Alternativen insgesamt ergebenden Aufwendungen/Erträge vorher kalkuliert?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
11. Liegen die sich aus <strong>der</strong> Teilnahme an <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für Ihr Unternehmen ergebenden<br />
Aufwendungen/Erträge insgesamt innerhalb des kalkulierten Rahmens?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
138
12. Haben sich die im Zuge <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführten Maßnahmen für Ihr Unternehmen<br />
wirtschaftlich insgesamt gelohnt? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
13. Ist es bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zu Innovationen in Ihrem Unternehmen<br />
gekommen?<br />
a) Ja ❏, welche:<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
14. Gab es weitere positive o<strong>der</strong> negative Konsequenzen <strong>der</strong> Selbstverpflichtung für Ihr Unternehmen?<br />
a) Ja, Imageeffekte ❏<br />
b) Ja, verbesserte Behördenkontakte ❏<br />
c) Ja, personeller Aufwand ❏<br />
d) Ja, organisatorischer Aufwand ❏<br />
e) Ja, _____________________ ❏<br />
f) Nein ❏<br />
g) weiß nicht ❏<br />
15. Wäre aus Sicht Ihres Unternehmens ggf. eine konkrete Vorgabe <strong>der</strong> im Rahmen <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung durchzuführenden Maßnahmen erwünscht gewesen? (Begründung)<br />
a)Ja ❏<br />
b)Nein ❏<br />
c)unentschieden ❏<br />
16. Könnten Sie uns zu den aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführten Maßnahmen<br />
Daten/Unterlagen (evtl. auch zu Kosten und Nutzen) überlassen?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
17. Bei welchem Ansprechpartner wären gegebenenfalls weitere diesbezügliche Daten zu<br />
erhalten?<br />
139
18. Hätte Ihr Unternehmen die aufgrund <strong>der</strong> Selbstverpflichtung durchgeführten Maßnahmen<br />
ohnehin (auch ohne Bestehen <strong>der</strong> freiwilligen Erklärung) umgesetzt? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
19. Hat die Selbstverpflichtung Ihr Unternehmen über die ohnehin durchgeführten Maßnahmen<br />
hinaus zu zusätzlichen Aktivitäten veranlaßt?<br />
a) Ja ❏ welche: _______________________________<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
20. Hat sich Ihr Unternehmen mit den möglichen Konsequenzen einer Öko-Steuer ohne<br />
Ausnahmeregelungen auseinan<strong>der</strong>gesetzt?<br />
a)Ja ❏<br />
b)Nein ❏<br />
c)weiß nicht ❏<br />
21. Welche Maßnahmen hätte Ihr Unternehmen im Falle einer solchen Öko-Steuer ohne<br />
Ausnahmeregelung durchgeführt?<br />
M1<br />
M2<br />
M3<br />
M4<br />
22. Wie beurteilen Sie die möglichen Wirkungen einer solchen Steuerlösung ohne Ausnahmeregelung<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> CO2-Emissionen bzw. <strong>der</strong> verbrauchten Energiemengen Ihres<br />
Unternehmens im Vergleich zur Selbstverpflichtung? (Begründung)<br />
a)mehr CO2/Energie gespart ❏<br />
b)etwa gleich große Wirkung ❏<br />
c)weniger CO2/Energie gespart ❏<br />
d)unentschieden ❏<br />
23. Wäre eine Öko-Steuer ohne Ausnahmeregelung für Ihr Unternehmen im Vergleich zur<br />
Selbstverpflichtung wirtschaftlich vorteilhafter gewesen? (Begründung)<br />
a)Ja ❏<br />
b)Nein ❏<br />
c)unentschieden ❏<br />
140
24. Hätten Sie die Öko-Steuer ohne Ausnahmeregelung gegenüber <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
vorgezogen? (Begründung)<br />
a)Ja ❏<br />
b)Nein ❏<br />
c)unentschieden ❏<br />
Umfeld <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
25. Warum wurde die Selbstverpflichtung Ihrer Meinung nach abgeschlossen?<br />
a) Lösung eines Umweltproblems ❏<br />
b) Erzielen eines Imageeffektes ❏<br />
c) Reaktion auf äußeren Druck ❏<br />
d) Erzielung eines internationalen Wettbewerbsvorteils ❏<br />
e) Abwendung einer Ökosteuer ❏<br />
f) Erzielung ökonomischer Vorteile ❏<br />
g) _______________________ ❏<br />
h) weiß nicht ❏<br />
26. Ist Ihr Unternehmen an <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung beteiligt gewesen?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
27. Gab bzw. gibt es hausinterne Wi<strong>der</strong>stände gegenüber einer Teilnahme an <strong>der</strong> freiwilligen<br />
Selbstverpflichtung?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) weiß nicht ❏<br />
28. Falls dies <strong>der</strong> Fall ist, wie sehr behin<strong>der</strong>n diese hausinternen Wi<strong>der</strong>stände Ihrer Meinung<br />
nach die erfolgreiche Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung (Begründung)?<br />
a) Starke Behin<strong>der</strong>ung ❏<br />
b) Geringe Behin<strong>der</strong>ung ❏<br />
c) Keine Behin<strong>der</strong>ung ❏<br />
d) unentschieden ❏<br />
141
29. Was waren die Hauptinteressen Ihres Unternehmens bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung?<br />
a) Lösung eines Umweltproblems ❏<br />
b) Erzielen eines Imageeffektes ❏<br />
c) Reaktion auf äußeren Druck ❏<br />
d) Erzielung eines internationalen Wettbewerbsvorteils ❏<br />
e) Abwendung einer Ökosteuer ❏<br />
f) Erzielung ökonomischer Vorteile ❏<br />
g) _______________________ ❏<br />
h) weiß nicht ❏<br />
30. Gab es Zielkonflikte zwischen den Interessen Ihres Unternehmens und dem VCI in bezug<br />
auf die Selbstverpflichtung, und wenn ja, welche?<br />
a) Ja ❏, welche:<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
31. Wurden die Interessen Ihres Unternehmens in bezug auf die Selbstverpflichtung vom VCI<br />
ausreichend berücksichtigt und wenn nein, was hätte man besser machen können?<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏, besser wäre gewesen:<br />
c) unentschieden ❏<br />
32. Welche Rolle hat <strong>der</strong> Verband bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Ihrer Meinung<br />
nach übernommen?<br />
a) Initiation <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung ❏<br />
b) Koordination des Ausarbeitungsprozesses ❏<br />
c) Maßgebliche Gestaltung des Ausarbeitungsprozesses ❏<br />
d) Maßgebliche Gestaltung <strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ❏<br />
e) keine ❏<br />
f) weiß nicht ❏<br />
33. Sind Sie im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit <strong>der</strong> Rolle<br />
des Verbandes zufrieden? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
142
34. Welche Rolle hat <strong>der</strong> Verband bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Ihrer Meinung<br />
nach übernommen?<br />
a) Informationsveranstaltungen für Unternehmen ❏<br />
b) Beratung <strong>der</strong> Firmen ❏<br />
c) Information <strong>der</strong> Behörden ❏<br />
d) Organisation des Monitoring ❏<br />
e) Information <strong>der</strong> Öffentlichkeit ❏<br />
f) ❏<br />
g) keine ❏<br />
h) weiß nicht ❏<br />
35. Sind Sie im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit <strong>der</strong> Rolle<br />
des Verbandes zufrieden? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
36. Welche Rolle haben die Behörden bei <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Ihrer<br />
Meinung nach übernommen?<br />
a) Initiation <strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung ❏<br />
b) Koordination des Ausarbeitungsprozesses ❏<br />
c) Maßgebliche Gestaltung des Ausarbeitungsprozesses ❏<br />
d) Maßgebliche Gestaltung <strong>der</strong> Inhalte <strong>der</strong> Selbstverpflichtung ❏<br />
e) ❏<br />
f) keine ❏<br />
g) weiß nicht ❏<br />
37. Sind Sie im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Ausarbeitung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit <strong>der</strong> Rolle<br />
<strong>der</strong> Behörden zufrieden? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c)unentschieden ❏<br />
143
38. Welche Rolle haben die Behörden bei <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung Ihrer Meinung<br />
nach übernommen?<br />
a) Informationsveranstaltungen für Unternehmen ❏<br />
b) Beratung <strong>der</strong> Firmen ❏<br />
c) Organisation des Monitoring ❏<br />
d) Information <strong>der</strong> Öffentlichkeit ❏<br />
e) ❏<br />
f) keine ❏<br />
g) weiß nicht ❏<br />
39. Sind Sie im Zusammenhang mit <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung mit <strong>der</strong> Rolle<br />
<strong>der</strong> Behörden zufrieden? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
40. Wurde die Selbstverpflichtung Ihrer Ansicht nach <strong>von</strong> <strong>der</strong> Politik ausreichend gewürdigt?<br />
(Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
41. Gibt es Ihrer Einschätzung nach Unternehmen, die nicht zur Umsetzung <strong>der</strong> Selbstverpflichtung<br />
beitragen?<br />
a) Ja, inländische Firmen, die im Verband sind ❏<br />
b) Ja, inländische Firmen, die nicht im Verband sind ❏<br />
c) Ja, ausländische Firmen ❏<br />
d) Nein ❏<br />
e) weiß nicht ❏<br />
42. Wie sehr stellen diese Unternehmen Ihrer Meinung nach die erfolgreiche Umsetzung <strong>der</strong><br />
Selbstverpflichtung in Frage?<br />
a) in hohem Maße ❏<br />
b) unentschieden ❏<br />
c) in geringem Maße ❏<br />
d) gar nicht ❏<br />
144
43. Wäre Ihrer Meinung nach eine Beteiligung <strong>von</strong> Umweltverbänden bei <strong>der</strong> Ausarbeitung<br />
<strong>der</strong> Selbstverpflichtung sinnvoll gewesen? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
44. Denken Sie, daß das Instrument <strong>der</strong> Selbstverpflichtung zur Behandlung dieses Umweltproblems<br />
international aufgegriffen wird?<br />
a) Ja, weltweit ❏<br />
b) Ja, auf europäischer Ebene ❏<br />
c) Ja, in einzelnen Län<strong>der</strong>n ❏<br />
d) Nein ❏<br />
e) unentschieden ❏<br />
45. Würden Sie es begrüßen, wenn das Instrument <strong>der</strong> Selbstverpflichtung international aufgegriffen<br />
wird?<br />
a) Ja, weltweit ❏<br />
b) Ja, auf europäischer Ebene ❏<br />
c) Ja, in einzelnen Län<strong>der</strong>n ❏<br />
d) Nein ❏<br />
e) unentschieden ❏<br />
IV. Einschätzung des Erfolges<br />
46. Halten Sie die Selbstverpflichtung für sinnvoll? (Begründung)<br />
a) Ja ❏<br />
b) Nein ❏<br />
c) unentschieden ❏<br />
47. Wie beurteilen Sie den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung insgesamt?<br />
a) erfolgreich ❏<br />
b) unentschieden ❏<br />
c) nicht erfolgreich ❏<br />
145
48. Wie beurteilen Sie den Erfolg <strong>der</strong> Selbstverpflichtung unter ökonomischen, ökologischen<br />
und Imagegesichtspunkten?<br />
erfolgreich unentschieden nicht erfolgreich<br />
a) Ökonomie ❏ ❏ ❏<br />
b) Ökologie ❏ ❏ ❏<br />
c) Image in <strong>der</strong> Öffentlichkeit ❏ ❏ ❏<br />
d) Image in <strong>der</strong> Politik ❏ ❏ ❏<br />
49. Welcher dieser Erfolgsindikatoren ist nach Ihrer Einschätzung am bedeutendsten?<br />
a) Ökonomie ❏<br />
b) Ökologie ❏<br />
c) Image in <strong>der</strong> Öffentlichkeit ❏<br />
d) Image in <strong>der</strong> Politik ❏<br />
Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!<br />
146
Anhang 6: Tagesordnung des Workshops vom 19. März 2001<br />
Frankfurt, VCI, Karlstraße 21, 13. Stock, Raum 1 und 2<br />
Mo<strong>der</strong>ation: Dr. Frauke Druckrey, VCI<br />
Prof. Dr. Herwig Hulpke, Bayer AG<br />
Dr. Jochen Rudolph, Degussa AG<br />
10.30 Begrüßung<br />
Dr. Wilfried Sahm, VCI<br />
10.45 Vorstellung <strong>der</strong> Methodik und <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> Studie<br />
Dr. Paschen <strong>von</strong> Flotow, Dr. Johannes Schmidt, Institut für Umweltmanagement<br />
11.30 Kommentare zu den Ergebnissen <strong>der</strong> Studie <strong>von</strong> seiten <strong>der</strong> Befragten einschließlich<br />
kurzer Diskussionen im Plenum<br />
• Selbstverpflichtungserklärung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Reduktion <strong>der</strong><br />
energiebedingten CO2-Emissionen:<br />
MinRat Werner Ressing, Bundeswirtschaftsministerium<br />
Dr. Stephan Ramesohl, Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie<br />
Günther Keilitz, Wacker-Chemie GmbH<br />
• Selbstverpflichtung <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie zur Erfassung und Bewertung<br />
<strong>von</strong> Stoffen (insbeson<strong>der</strong>e Zwischenprodukte) für die Verbesserung <strong>der</strong> Aussagefähigkeit:<br />
Dr. Christine Frank-Otto, BASF AG<br />
Andreas Ahrens, ökopol (consultant to WWF)<br />
• Selbstverpflichtungserklärung zur Klassifizierung <strong>von</strong> Textilhilfsmitteln (THM)<br />
nach ihrer Gewässerrelevanz:<br />
Lothar Noll, TEGEWA<br />
Dr. Harald Schönberger<br />
• Selbstverpflichtung zu Mitteln zum Schutz <strong>von</strong> Holz gegen holzzerstörende<br />
und holzverfärbende Organismen:<br />
Dr. Josef-Theo Hein, Dyrup Deutschland GmbH<br />
Dr. Hans Reifenstein, BgVV<br />
13.00 Mittagspause<br />
14.00 Schlußfolgerungen aus <strong>der</strong> Sicht des Institutes<br />
Dr. Paschen <strong>von</strong> Flotow, Dr. Johannes Schmidt, Institut für Umweltmanagement<br />
14.30 Externe Einschätzungen und Kommentare mit anschließen<strong>der</strong> Diskussion im<br />
Plenum<br />
• Wissenschaft: Dr. Klaus Rennings, ZEW<br />
• Politik: Dr. Herlind Gundelach, Staatssekretärin im hessischen<br />
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten<br />
• Umweltverbände: Thomas Lenius, BUND e.V.<br />
16.00 Einschätzungen und weiteres Vorgehen aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> <strong>chemischen</strong> Industrie<br />
Prof. Dr. Herwig Hulpke, Bayer AG<br />
16.30 Ende des Workshops<br />
147
Anhang 7: Teilnehmer des Workshops vom 19. März 2001<br />
Titel Vorname Nachname Unternehmen ADR-Ort<br />
Andreas Ahrens Institut für Ökologie und Politik GmbH - Ökopol Hamburg<br />
Waldemar Bahr IG Bergbau, Chemie, Energie Hannover<br />
Dr.-Ing. Klaus Bartels BG-Chemie Heidelberg<br />
Dr. Volker Barth Rütgers Organics GmbH Mannheim<br />
Dr. Friedhelm Bartnik Henkel KGaA Düsseldorf<br />
Wolfgang Baur Umweltministerium Baden-Württemberg Stuttgart<br />
Dr. Klaus Becker Umweltbundesamt Berlin<br />
Dr. Wolf-Rüdiger Bias BASF AG Ludwigshafen<br />
Wolfgang Blümel Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Berlin<br />
Anke Borchardt Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Frankfurt<br />
Dr. Joachim Born Merck KGaA Darmstadt<br />
Dipl.-Ing. Eberhard Bre<strong>der</strong>eck Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Frankfurt<br />
Ulrich Busch Bakelite AG Duisburg<br />
Dr. Hans Certa CONDEA Chemie GmbH Marl<br />
Dr. Andreas Dally Evangelische Akademie Loccum Rheburg-Loccum<br />
Hans F. Daniel Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Christine Däumling Umweltbundesamt Berlin<br />
Birgit Dette Öko-Institut e.V. Darmstadt<br />
Dr. Frauke Druckrey Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Volker Ebert Wacker - Chemie GmbH Burghausen<br />
Dipl.-Ing. Ulrike Egert Kapp-Chemie GmbH Miehlen<br />
Dr. Dietmar Eichstädt Verband <strong>der</strong> Lackindustrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Dieter Fink Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Manfred Finzenhagen Bayer AG Leverkusen<br />
Dr. Christine Frank-Otto BASF AG Ludwigshafen<br />
Gerd Fuchs Arbeitsgemeinschaft für Umweltfragen e. V. Bonn<br />
Dr. Winfried Golla Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Baden-Baden<br />
Dr. Volker Golzke Bayer AG Leverkusen<br />
Peter Graßmann Deutsche Bauchemie e. V. Frankfurt<br />
Dipl.-Chem. Helga Griethe Süd - Chemie AG<br />
Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft<br />
Moosburg<br />
Dr. Herlind Gundelach und Forsten Wiesbaden<br />
Dr. Peter Hardt Stockhausen GmbH & Co. KG Krefeld<br />
Dr. Udo Hartmann DaimlerChrysler AG Stuttgart<br />
Dipl.-Ing. Peter Hassel Rhodia Acetow AG Freiburg<br />
Rolf-D. Häßler Institut für Umweltmanagement GmbH Oestrich-Winkel<br />
Dr. Josef-Theo Hein Dyrup Deutschland GmbH Mönchengladbach<br />
Michael Hertz ISP Marl GmbH Marl<br />
Marion Hitzeroth Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Günter Hollmann Dow Deutschland Inc. Stade<br />
Prof. Dr. Herwig Hulpke Bayer AG Leverkusen<br />
Petra Jahn-Stahnecker BASF AG Ludwigshafen<br />
Jochen Jantsch Dow Deutschland Inc. Schwalbach<br />
Dipl.-Ing. Günter Keilitz Wacker-Chemie GmbH Burghausen<br />
Dr.-Ing. Thomas Kellerhoff Degussa AG Hanau<br />
Dr. Helmut Klein Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Bonn<br />
Dipl.-Ing. Hermann Köhler Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Frankfurt<br />
Dipl.-Ing. Eberhard Kretschmer BSL Olefinverbund GmbH Merseburg<br />
Dr. Wolfgang Kristof SKW Stickstoffabrik Piesteritz GmbH Lutherstadt Wittenberg<br />
RA Claudia Kurz Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Frankfurt<br />
Dr. Hartmut Lang BASF AG Berlin<br />
Dr. Rainer Langenberg Bayer AG Leverkusen<br />
Heike Leitschuh-Fecht Frankfurt<br />
Thomas Lenius BUND e.V. Berlin<br />
Dr. Sabine Lindner Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt e.V. Bonn<br />
Dr. Ursula Lohmann Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Ludwigshafen<br />
Uwe-Jens Lucks Umweltbundesamt Berlin<br />
148
Dr. Holger Mahr-George BASF AG Ludwigshafen<br />
Dr. Mang Regierungspräsidium Darmstadt Darmstadt<br />
Dr. Rudolf Maul Ciba Spezialitätenchemie Lampertheim GmbH Lampertheim<br />
RA Carola Maute-Stephan Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Baden-Baden<br />
Bernd Mehlhorn Umweltbundesamt Berlin<br />
Dr. Lothar Meinzer BASF AG Ludwigshafen<br />
Michael Mersmann IG Bergbau, Chemie, Energie, Hannover<br />
Dr. Klaus Mittelbach Bundesverband <strong>der</strong> Deutschen Industrie Berlin<br />
Ingo Najda Hercules GmbH Bad Sobernheim<br />
Dipl.-Kfm. Lothar Noll Verband TEGEWA e.V. Frankfurt<br />
Dr. Matthias Peters Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e. V. Hannover<br />
Dr. Reinhard Quick Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie Brüssel<br />
Dr. Stephan Ramesohl Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie Wuppertal<br />
Dipl.-Ing. Detlef Reese 3M Deutschland GmbH Neuss<br />
Dipl.-Ing. Hartmut Reetz TVI-Verband e.V. Eschborn<br />
Dr. Hans Reifenstein BgVV Berlin<br />
Dr. Klaus Rennings Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim<br />
MinRat Werner Ressing Bundeswirtschaftsministerium Bonn<br />
Dipl.-Soz. Julia Roloff Internationales Hochschulinstitut Zittau Zittau<br />
Dr. Gerd Romanowski Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Roland Römer Dr. Th. Böhme KG Geretsried<br />
Dr. Thomas Roth Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Jörg Rothermel Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. rer. nat. Dieter Rudolph Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin<br />
Dr. Jochen Rudolph Degussa AG Frankfurt<br />
Dr. Wilfried Sahm Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Frank Andreas Schendel Bayer AG Leverkusen<br />
Klaus Schindler Ciba Spezialitätenchemie AG Basel<br />
Dr. Kaspar Schlüter Cognis Deutschland GmbH Düsseldorf<br />
Dr. Jürgen Schmickler Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Düsseldorf<br />
Dr. Johannes Schmidt Institut für Umweltmanagement GmbH Oestrich-Winkel<br />
Dr. Roland Schmierer Clariant Verwaltungsges. mbH Sulzbach<br />
Dr. Detlef Schmitz Bayer AG Leverkusen<br />
Gabriele Schnei<strong>der</strong> Industrievereinigung Chemiefaser e.V. Frankfurt<br />
Dr. Harald Schönberger Regierungspräsidium Freiburg Freiburg<br />
Dipl.-Ing. Norbert Schröter Deutsche Bauchemie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Hans-Peter Schwenzfeier PolymerLatex GmbH & Co KG Marl<br />
Dr. Eberhard Seifert Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie Wuppertal<br />
Achim Seitz Institut für Umweltmanagement GmbH Oestrich-Winkel<br />
Dr. Birgit Sewekow Bayer AG Leverkusen<br />
Dr. Ulrich Sewekow Bayer AG Leverkusen<br />
Dipl.-Ing. Hartmuth Skalicky Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Dr. Manfred Spindler Degussa AG<br />
Verband des Deutschen Chemikalien-Groß- und<br />
Frankfurt<br />
Dipl.-Volksw. Peter Steinbach Außenhandels e.V. Köln<br />
Prof. Dr. Ursula Stephan Halle<br />
Dr. Andreas Suchanek Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt<br />
Dipl.-Ing. Martin Sydow Schering AG Berlin<br />
Frank Tiedtke Staatliches Umweltamt Minden Minden<br />
Dr. Susanne Trebert-Haeberlin Deutsche Shell Chemie GmbH Eschborn<br />
Dr. Bernd Vogler Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. Wiesbaden<br />
Dr. Paschen <strong>von</strong> Flotow Institut für Umweltmanagement GmbH Oestrich-Winkel<br />
Justus <strong>von</strong> Geibler Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie Wuppertal<br />
Dr. Horst <strong>von</strong> Holleben Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Tobias Weidemann Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
Stefan Weis IG Bergbau, Chemie, Energie Hannover<br />
Dipl.-Volksw. Dietrich Wittmeyer Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie e.V. Frankfurt<br />
149
Literaturverzeichnis<br />
DIHT (1995), Klimaschutzpolitik - Globale Strategien und nationale Anstrengungen zur Vermin<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> CO2-Emissionen. Bonn.<br />
EEA [EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY] (1997), Environmental Agreements: Environmental<br />
Effectiveness. Vol. 1 und Vol. 2 (Case Studies), Environmental Issues Series No. 3, Kopenhagen.<br />
ENQUETE-KOMMISSION „SCHUTZ DES MENSCHEN UND DER UMWELT“ DES DEUTSCHEN<br />
BUNDESTAGES (Hrsg.) (1994), Die Industriegesellschaft gestalten - Perspektiven für einen<br />
nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. Bonn.<br />
ENVIRONMENTAL LAW NETWORK INTERNATIONAL (ELNI, Hrsg., 1998): Environmental Agreements:<br />
The Role and Effect of Environmental Agreements in Environmental Policies. Cameron<br />
May.<br />
GROHE, R. (1999): „<strong>Selbstverpflichtungen</strong> und Vereinbarungen im Umweltschutz“. Gewerbearchiv<br />
HOMANN, KARL / PIES, INGO (1991), „Wirtschaftsethik und Gefangenendilemma“. In: WiSt,<br />
Jg. 20, Heft 12, S. 608-614.<br />
KHANNA, M., QUIMIO, W.R.H., BOJILOVA, D. (1998): „Toxics Release Information: A Policy<br />
Tool for Environmental Protection“. Journal of Environmental Economics and Management,<br />
Bd. 36, S. 243-266.<br />
KNEBEL, J., WICKE, L., MICHAEL, G. (1999): <strong>Selbstverpflichtungen</strong> und normersetzende Umweltverträge<br />
als Instrumente des Umweltschutzes. Berlin: Erich Schmidt.<br />
KOHLHAAS, MICHAEL /PRAETORIUS, BARBARA (1994), <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> Industrie zur<br />
CO2-Reduktion. Berlin.<br />
KONAR, S., COHEN, M.A. (1997): „Information As Regulation: The Effect of Community Right<br />
to Know Laws on Toxic Emissions“. Journal of Environmental Economics and Management,<br />
Bd. 32, S. 109-124.<br />
KRARUP, S., RAMESOHL S. (2000): Voluntary Agreements in Energy Policy – Implementation<br />
and Efficiency; The Final Report from the project Voluntary Agreement – Implementation<br />
and Efficiency (VAIE). AKF Forlaget, Copenhagen. http: // www.akf.dk/vaie<br />
KRISTOF K., RAMESOHL S., SCHMUTZLER T. (1997): "Die aktualisierte Erklärung <strong>der</strong> deutschen<br />
Wirtschaft zur Klimavorsorge - Große Worte, keine Taten?" Wuppertal-Paper Nr. 71<br />
März 1997, Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie, Wuppertal<br />
LAUTENBACH, S., STEGER, U., WEIHRAUCH, P. (1992): Evaluierung freiwilliger Branchenabkommen<br />
im Umweltschutz: Ergebnisse eines Gutachtens und Workshops. Köln: BDI.<br />
MICHAELIS, PETER (1996), Ökonomische Instrumente in <strong>der</strong> Umweltpolitik. Heidelberg.<br />
MURSWIEK, DIETRICH (1988), „Freiheit und Freiwilligkeit im Umweltrecht“. In: Juristen Zeitung,<br />
43. Jg., Heft 21, S. 985-993.<br />
NORDHAUS, W. (1991): „To slow or not to slow? The economics of the greenhouse effect“.<br />
Economic Journal, Bd. 101, Nr. 407, S. 920-937.<br />
O.V. (1998): Position des VCI zu <strong>Selbstverpflichtungen</strong> als Instrument <strong>der</strong> Umweltpolitik. mimeo,<br />
Frankfurt: Verband <strong>der</strong> Chemischen Industrie.<br />
RAMESOHL, S. AND K. KRISTOF (2000): Voluntary Agreements – Implementation and Efficiency.<br />
The German Country Study. Case studies in the sectors of cement and glass. Wuppertal<br />
Institute for Climate Environment Energy, Wuppertal.<br />
150
RENNINGS, K., ET AL. (1996): Nachhaltigkeit, Ordnungspolitik und freiwillige Selbstverpflichtung:<br />
Ordnungspolitische Grundlagen für eine Politik <strong>der</strong> Nachhaltigkeit und das Instrument<br />
<strong>der</strong> freiwilligen Selbstverpflichtung im Umweltschutz. Heidelberg: Physica.<br />
RENNINGS, KLAUS / BROCKMANN, KARL LUDWIG / BERGMANN, HEIDI (1996), „Ordnungspolitische<br />
Bewertung freiwilliger <strong>Selbstverpflichtungen</strong> <strong>der</strong> Wirtschaft im Umweltschutz“. In:<br />
Klaus Rennings et al. (Hrsg.), Nachhaltigkeit, Ordnungspolitik und freiwillige Selbstverpflichtung.<br />
Heidelberg, Teil II (S. 131-292).<br />
SCHMELZER, DIRK (1996), Voluntary Agreements in Environmental Policy: Negotiating Emission<br />
Reductions. Europa Universität Viadrina, Frankfurt (O<strong>der</strong>), Fakultät für Wirtschaftswissenschaften,<br />
Working Paper No. 68.<br />
151