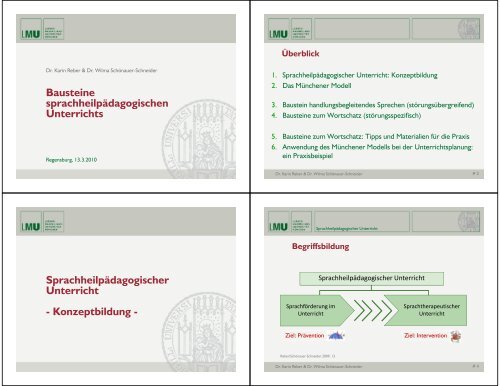Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...
Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...
Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts - Deutsche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
<strong>Bausteine</strong><br />
<strong>sprachheilpädagogischen</strong><br />
<strong>Unterrichts</strong><br />
Regensburg, 13.3.2010<br />
Sprachheilpädagogischer<br />
Unterricht<br />
- Konzeptbildung -<br />
Überblick<br />
1. Sprachheilpädagogischer Unterricht: Konzeptbildung<br />
2. Das Münchener Modell<br />
3. Baustein handlungsbegleitendes Sprechen (störungsübergreifend)<br />
4. <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz (störungsspezifisch)<br />
5. <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz: Tipps und Materialien für die Praxis<br />
6. Anwendung des Münchener Modells bei der <strong>Unterrichts</strong>planung:<br />
ein Praxisbeispiel<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />
Begriffsbildung<br />
Sprachförderung im<br />
Unterricht<br />
Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Sprachtherapeutischer<br />
Unterricht<br />
Ziel: Prävention Ziel: Intervention<br />
Reber/Schönauer-Schneider 2009, 13<br />
# 2<br />
# 4
Sprachförderung<br />
Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />
Sprachheilpädagogischer<br />
Unterricht<br />
Sprachtherapeutischer<br />
Unterricht<br />
Ziel: Prävention Ziel: Intervention<br />
Zielgruppe: Kinder mit Risikofaktoren im<br />
Bereich Sprache<br />
Zielgruppe: Kinder mit Sprachbehinderungen<br />
Unspezifische Maßnahmen Spezifische sprachtherapeutische Maßnahmen<br />
auf der Basis einer individuellen sprachlichen<br />
Förderdiagnostik<br />
Durchgeführt von Pädagogen Durchgeführt von Pädagogen mit vertiefter<br />
Qualifikation im Bereich Sprache<br />
An jeglichen Bildungseinrichtungen An Bildungseinrichtungen, in denen Lehrer mit<br />
derartiger Qualifikation tätig sind<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 15<br />
Das Münchener Modell<br />
Dreifache Aufgabe shp. <strong>Unterrichts</strong><br />
Sprache<br />
Sprachheilpädagogischer<br />
Unterricht<br />
Bildung Erziehung<br />
Orthmann 1969: „Dualismusproblematik“, Holler-Zittlau/Gück 2001: „Triasproblematik“<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 20<br />
# 5<br />
# 7<br />
Das Münchener Modell<br />
Das Münchener Modell<br />
Das Münchener Modell<br />
sprachliche Lernvoraussetzungen<br />
Intention<br />
Inhalt<br />
� sprachliche Lehr-/Lernziele � sprachheilpäd. Inhalte<br />
�� sprachliche Förderziele �� prototyp. <strong>Unterrichts</strong>kontexte<br />
Methode<br />
� störungsübergreif. Methoden<br />
� störungsspezifische Methoden<br />
Interaktion<br />
� <strong>Unterrichts</strong>form<br />
� Gruppenzusammensetzung<br />
sprachliche Folgen<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider Reber/Schönauer-Schneider 2009, 21<br />
Medium<br />
� Lehrersprache<br />
� sprachheilpäd. Medien<br />
Organisation<br />
� Schulübergreifende Orga.formen<br />
� Schulinterne Organisationsformen<br />
# 8
Das Münchener Modell<br />
� Sprachliche Voraussetzungen<br />
Grundlage für einen effektiven <strong>sprachheilpädagogischen</strong> Unterricht:<br />
Genaue Kenntnis der sprachlichen Lernausgangslage der Schüler<br />
<strong>Unterrichts</strong>beobachtung im Bereich Sprache<br />
Sprachliche Gruppenverfahren (falls vorhanden)<br />
(Sprach-)Kriteriengeleitete Schülerbeobachtung<br />
Sprachliche Einzeldiagnostik<br />
Sprachliche Voraussetzungen<br />
der Schüler<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Das Münchener Modell<br />
Allg. Beobachtungsbogen<br />
Gruppentests<br />
Beobachtungsbögen zu den<br />
einzelnen Sprachebenen<br />
Einzeltests<br />
Reber/Schönauer-Schneider 2009<br />
� Intention: Klassenbezogene Sprachförderziele<br />
Mon. Förderbereich Förderziele Wortschatz<br />
Sept. Pragmatik - Erfassen sprachl.Voraussetzungen<br />
- Gesprächsregeln<br />
Okt. Sprachverständnis ...<br />
Gefühle, Person, Gemeinschaft (SU, L)<br />
Nov. Grammatik - Subjekt-Verb-Kongruenz Ernährung, Obst und Gemüse (SU)<br />
Dez. Aussprache ...<br />
Jan. Grammatik - Einfache Nebensätze (weil,<br />
wenn)<br />
Feb. Aussprache ...<br />
Kalender (SU), Pinguine (Projekt)<br />
März Grammatik / Pragmatik - Einfache Geschichtenstrukturen Uhr / Uhrzeit (SU), Schlossgespenst (L)<br />
April Grammatik Akkusativ Hecke im Jahreslauf (SU)<br />
Mai Sprachverständnis ...<br />
Juni Grammatik Dativ Freizeitgestaltung am Ort, Schule und<br />
Schulumgebung (SU, Geometrie)<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
SU: Sachunterricht, L: Lektüre<br />
# 9<br />
# 11<br />
� Intention<br />
Das Münchener Modell<br />
Ausgangspunkt Schüler<br />
Sprachförderziele<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Primat der Sprachlernprozesse<br />
Der Igel klaut<br />
die Apfel.<br />
Das Münchener Modell<br />
Ausgangspunkt Inhalt<br />
Lehrplan- und Lernziele<br />
� Inhalt: prototypische <strong>Unterrichts</strong>kontexte<br />
Wochenplan & Freiarbeit<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
MSW NDW MW<br />
# 10<br />
# 12
Original:<br />
Das Münchener Modell<br />
Vereinfachungen:<br />
� Medien Der Wolf begegnet einem kleinen, grünen Tier.<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Das Münchener Modell<br />
Er fragt:<br />
„Wer ist der Stärkste im ganzen Land?“<br />
� Organisation: schulübergreifend<br />
Sprachheilpädagogischer Unterricht<br />
schulische<br />
außer- außer-<br />
Organisationsformen<br />
schulisch<br />
Integrative<br />
Förderschule Regelschule<br />
Einrichtungen<br />
Vorschulische Einrichtungen<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Kooperation<br />
Weitere<br />
Einrichtungen,<br />
z. B. Praxen<br />
für<br />
Sprachtherapie<br />
# 13<br />
# 15<br />
Das Münchener Modell<br />
� Interaktion<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
?<br />
Das Münchener Modell<br />
� Organisation: schulintern<br />
Sprachheilpädagoge Regelschulpädagoge<br />
Sprachtherapie in der Schule<br />
(einzeln oder Kleinstgruppe)<br />
Sprachtherapeutischer<br />
Unterricht (Großgruppe)<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Förderunterricht Sprache<br />
(Kleingruppe)<br />
Sprachförderung im Unterricht<br />
(Großgruppe)<br />
# 14<br />
# 16
<strong>Bausteine</strong><br />
Das Münchener Modell<br />
� Methoden: <strong>Bausteine</strong><br />
Störungsübergreifende<br />
Methoden<br />
Störungsspezifische<br />
Methoden<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Lehrersprache<br />
Metasprache<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Aussprache<br />
Wortschatz<br />
Grammatik<br />
Kommunikation<br />
Sprachverständnis<br />
Schriftsprache<br />
Redefluss<br />
Zur Bedeutung handlungsbegleitenden<br />
Sprechens<br />
Von der Handlung zur inneren Sprache:<br />
Handlung<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Handlungsbegleitendes<br />
Sprechen<br />
vgl. auch Weigl/Reddemann-Tschaikner 2002; Bruner 1979; Wygotski 1934<br />
Innere Sprache<br />
# 17<br />
# 19<br />
Baustein<br />
handlungsbegleitendes Sprechen<br />
(störungsübergreifend)<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Problemstellung:<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen ist schwer!<br />
<strong>Unterrichts</strong>beispiel:<br />
Einführung Stellenwertsystem ZR 20<br />
(bündeln)<br />
Probleme: vgl. Film Bündeln<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 20
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Versprachlichung<br />
• Rahmengeschichte zur Einbettung des mathematischen Problems<br />
(Kindgemäßheit): Situation Parkgarage<br />
• Wahl der konkreten Versprachlichung<br />
• Visualisierung der Versprachlichung (z.B. Wortkarten, dynamisches<br />
Tafelbild)<br />
• Schritte: Handlung → handlungsbegleitendes Sprechen → innere<br />
Sprache<br />
• Erfahrung: Gerade in Mathematik immer wieder auf eingeführte<br />
Versprachlichungen zurückgreifen!<br />
Prototypische Kontexte für Versprachlichung bzw. handlungsbegleitendes<br />
Sprechen: Mathematik, Bildergeschichten, Sachunterricht, Rechtschreiben<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Schritte zur inneren Sprache<br />
Handlung<br />
1. Modellhaftes Versprachlichen<br />
und Handlung des Lehrers<br />
2. Modellhaftes Versprachlichen<br />
mit Handlung des Schülers<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Handlungsbegl.<br />
Sprechen<br />
3. Maskiertes Versprachlichen<br />
4. Selbstständiges Versprachlichen<br />
5. Flüsterndes Versprachlichen<br />
Wochenplan<br />
Innere Sprache<br />
# 21<br />
6. Inneres Versprachlichen<br />
# 23<br />
Handlungsbegleitendes Sprechen<br />
Visualisierung der Versprachlichung:<br />
Acht rote Autos stehen in der Parkgarage<br />
Drei blaue Autos warten vor der Parkgarage.<br />
Der Parkwächter ruft: „Stopp!“<br />
„Zuerst fahren ... rein,<br />
dann fahren ... rein.“<br />
Zehnerübergang<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
<strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz<br />
(störungsspezifisch)<br />
# 22
Prävention<br />
Intervention<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Prävention im Unterricht<br />
• <strong>Unterrichts</strong>prinzip Wortschatzarbeit<br />
• Arbeit mit Wortfeldern und Kollokationen<br />
• Einbeziehen kindlicher Interessen<br />
• Lernen mit allen Sinnen<br />
• Einsatz der Lehrersprache zur Betonung und<br />
Hervorhebung<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Existierende Therapieansätze<br />
Elaborationstherapie nach Glück 2000<br />
Kauschke/Siegmüller: Patholinguistischer Ansatz (PLAN)<br />
Wiedenmann: Wortschatzerwerb mit allen Sinnen<br />
German 2002: Wortabruftraining<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 26<br />
# 28
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Grundsätzliches zur <strong>Unterrichts</strong>planung<br />
Auswahl eines Auswahl des Auswahl des<br />
Rahmenthemas Wortschatzes Formates<br />
Klassische Themen<br />
Lehrplan (v.a.<br />
Sachunterricht)<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Interesse<br />
Alltagsrelevanz<br />
Phonolog. Kompl.<br />
Wortart<br />
Konkretheit<br />
Anzahl Begriffe<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
<strong>Unterrichts</strong>form<br />
EIS-Prinzip<br />
Elaboration Lemma und Lexem: Alltagsbeispiel<br />
Pumuckl Elefant<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 29<br />
# 31<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Intervention: <strong>Bausteine</strong> zum Wortschatz<br />
Semantik / Lexikon<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Elaboration Lemma<br />
Elaboration Lexem<br />
Abruftraining<br />
Strategietraining<br />
Wortbedeutung im Kontext<br />
(Kollokationen, Metaphern)<br />
Selbstmanagement<br />
Fachbegriffe<br />
Rahmenhandlungen und Rituale<br />
Elaboration Lemma/Lexem 1: Semantische Relationen<br />
Hyponym<br />
Hyperonym<br />
Grundlage: Netzwerkmodelle<br />
Glück 2000<br />
Kohyponyme<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 30<br />
Außerdem:<br />
Kontradiktion, Opposition, Antonymie<br />
Synonymie<br />
Meronymie<br />
# 32
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Elaboration Lemma/Lexem 2: Multimodale Markenmixe<br />
• Authentische Lernsituationen: <strong>Unterrichts</strong>gänge,<br />
außerschulische Lernorte<br />
• Klassische Spielmaterialien: Kaufladen, Autorennbahn, ...<br />
• Sinnesparcours (taktil-kinästhetisch, olfaktorisch,<br />
gustatorisch, akustisch, visuell)<br />
• Einsatz von Realgegenständen, Fühlsäckchen<br />
• Projektorientiertes, themenorientiertes Arbeiten<br />
• Spielformat „Blinde Kuh“<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Abruftraining: Schaffen eines geeigneten<br />
Abrufkontextes – Hinweise (cues)<br />
Beispiel ?<br />
• Semantischer Hinweis<br />
• Phonologischer Hinweis<br />
• Morphologischer Hinweis<br />
• Syntaktischer Hinweis<br />
• Episodischer Hinweis<br />
• Prozeduraler Hinweis<br />
• Graphemischer Hinweis<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Orange<br />
# 33<br />
# 35<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Abruftraining: Erhöhen der Abrufhäufigkeit<br />
Geeignete Situationen im Unterricht:<br />
• Hochfrequentes Wiederholen von Begriffen: Projekte<br />
• Bereiche: Sachunterricht, Deutsch<br />
• Spielformen: Kim-Spiele, Stadt-Land-Fluss, Memory, Domino, Memory<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Strategietraining 1<br />
Strategien des eigenständigen Wortschatzerwerbs:<br />
• Unterstreichen von schwierigen Wörtern in Texten<br />
• Gezieltes Nachfragen und evtl. Notieren des Ergebnisses<br />
• Nachschlagen in Lexika<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 34<br />
# 36
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Strategietraining 2<br />
Verwenden von Memostrategien:<br />
• Rehearsal-Training (lautes oder leises Vorsprechen, Glück<br />
2000)<br />
• Bewusster, wiederholter Einsatz des Wortes<br />
• Eselsbrücken<br />
• Loci-Methode<br />
• Lernstrategien des Fremdsprachenunterrichts<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Wortbedeutung im Kontext: Kollokationen<br />
Im Fokus hier: syntagmatische Beziehungen von Wörtern<br />
• Kollokationen<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 37<br />
# 39<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Strategietraining 3<br />
Kompensationsstrategien:<br />
• Verwendung von Synonymen, Umschreibungen und<br />
unspezifischen Wörtern<br />
• Umschreibungen oder Wortneuschöpfungen<br />
• Verwendung von Gesten (Zeigen, pantomimische Hilfen)<br />
• Visualisierung (Bilder)<br />
• Anbahnung einer Fragehaltung (vgl. Monitoring des<br />
Sprachverstehens, Sitzung Sprachverständnis) MSV<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Bsp. Kollokationen 1:<br />
Welchen Begriff umschreiben die Kinder?<br />
Populäre Spielformate:<br />
• Ich sehe was, was du nicht siehst ...<br />
• Dalli dalli<br />
• Dingsda<br />
• Tabu<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Begriffsrätsel<br />
0:33 – 0:53<br />
# 38<br />
0:30 – 1:58<br />
# 40
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Bsp. Kollokationen 2:<br />
Was gehört nicht dazu?<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Wildegger-Lack 2008<br />
Wortbedeutung im Kontext: Redewendungen und<br />
Metaphern<br />
• Redewendungen: „da beißt die Maus keinen Faden ab“<br />
• Metaphern: „Wüstenschiff“<br />
<strong>Unterrichts</strong>beispiel: metasprachliche Technik „sprachliche<br />
Erklärung“<br />
L: Was meint er denn damit: ‚Da beißt die Maus keinen Faden ab’?<br />
Wo ist denn da jetzt eine Maus?<br />
S1: Das hat doch nichts mit Mäusen zu tun!<br />
S2: Das sagt man einfach so.<br />
L: Wie könnte er das noch anders sagen?<br />
S3: Er könnte sagen: Das ist einfach so.<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 41<br />
# 43<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Bsp. Kollokationen mal anders: Fehlersuchbücher<br />
Butschkow 2003<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Selbstmanagement<br />
Butschkow 2003<br />
• Nach Wörtern und deren Bedeutung fragen (vgl. MSV)<br />
• Selbstanwendung von Abrufhilfen<br />
• Erwerb von Memo- und Kompensationsstrategien<br />
• Eigenbeobachtung und -korrektur<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 42<br />
# 44
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Fachbegriffe: Einsatz von Metasprache<br />
?<br />
Laut<br />
Sprachliche Erklärung: Laut<br />
Visualisierung: Wortstamm<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Bsp. fragende Charaktere: Tüddelsen<br />
Tüddelsen<br />
MovingMind 2003<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Einbettung in eine Handlung:<br />
Mehrgraphe („Buchstabenfreunde“)<br />
Jan hat Hunger.<br />
Schrift: Satz<br />
# 45<br />
# 47<br />
Semantisch-lexikalische Störungen<br />
Rahmenhandlungen und Rituale im Unterricht<br />
• Ritual Wortschatz-Kiste (als Schatzkiste)<br />
• Ritual „Wort des Tages“ bzw. „Wort der Woche“<br />
• Ritual „Wissensquiz am Wochenende“<br />
• Ritual „Begriffsklärung“ und „Nachfragen“<br />
• Ritual „nachfragende Handpuppe oder Figur“<br />
• Fragende Charaktere aus<br />
bekannten Geschichten<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Zusammenfassung<br />
Loewe/Loewe 2008<br />
• Das Münchener Modell integriert Aspekte aus verschiedenen Modellen<br />
der Planung <strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong> (bildungstheoretisch,<br />
lerntheoretisch, lernzielorientiert, konstruktivistisch) und fokussiert dabei<br />
das „Primat der Sprachlernprozesse“.<br />
• Es ermöglicht sprachheilpädagogische <strong>Unterrichts</strong>planung: Dies schließt<br />
eine gezielte Prävention und Intervention im Bereich Sprache ein.<br />
• Qualitatives Herzstück sind die methodischen <strong>Bausteine</strong>: Es existieren<br />
störungsübergreifende und störungsspezifische Methoden.<br />
• Zur Prävention wurden Vorschläge zur Sprachförderung gemacht, zur<br />
Intervention wurden methodische <strong>Bausteine</strong> sprachtherapeutischen<br />
<strong>Unterrichts</strong> vorgestellt.<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 46<br />
# 48
Ausblick<br />
• Die Qualität <strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong> hängt wesentlich von der<br />
Methodenkompetenz der Lehrkraft ab<br />
• Sprachheilpädagogischer Unterricht kann unabhängig vom Förderort an<br />
allen Schularten stattfinden; Voraussetzung sind fachkompetente Lehrkräfte<br />
• Sprachheilpädagogischer Unterricht bedarf, um in Zukunft bestehen zu<br />
können, vermehrter <strong>Unterrichts</strong>forschung<br />
• Bildungspolitisch muss der Fokus von der Intervention hin zur Prävention gehen<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Zentrale Literatur<br />
dbs (<strong>Deutsche</strong>r Bundesverband der akademischen Sprachtherapeuten) (2007):<br />
Sprachentwicklung ist kein Kinderspiel... Sprachförderung oder Sprachtherapie?<br />
Eine Informationsbroschüre (zu beziehen über www.dbs-ev.de).<br />
Dannenbauer, F. M. (1997): Grammatik. In: Baumgartner, S., Füssenich, I. (Hrsg.):<br />
Sprachtherapie mit Kindern. 3. Aufl. Ernst Reinhardt, München/Basel, 123-203.<br />
Grohnfeldt, M./Schönauer-Schneider, W. (2007): Merkmale <strong>sprachheilpädagogischen</strong><br />
<strong>Unterrichts</strong> im Förderschwerpunkt Sprache. In: Heimlich, U., Wember, F. B.<br />
(Hrsg.): Didaktik des <strong>Unterrichts</strong> im Förderschwerpunkt „Lernen“. Stuttgart,<br />
Kohlhammer, 240-252.<br />
Hartmann, E. (2008): (2008): Konzeption und Diagnostik von schriftsprachlichen<br />
Lernstörungen im Responsiveness-to-Intervention-Modell: eine kritische<br />
Würdigung. In: VHN 77, 123-137.<br />
Luger, V. (2006): Versprecher. Voraussetzungen – Entstehung – Interpretation des<br />
mentalen Lexikons.VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken.<br />
Press, H. J. (2006): Der kleine Herr Jakob. Bildergeschichten. Band 3. Beltz & Gelberg:<br />
Weinheim/Basel.<br />
Reber, K./Schönauer-Schneider, W. (2009): <strong>Bausteine</strong><br />
<strong>sprachheilpädagogischen</strong> <strong>Unterrichts</strong>. Ernst Reinhardt Verlag,<br />
München/Basel.<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
# 49<br />
# 51<br />
Dr. Karin Reber & Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Dr. Karin Reber<br />
Kontakt<br />
Sonderschullehrerin im Hochschuldienst<br />
(Sprachheilpädagogik, Informatik)<br />
Sprachheilpädagogin M.A.<br />
Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik<br />
Leopoldstr. 13<br />
80802 München<br />
karin.reber@gmx.de<br />
„Früh fördern statt spät reparieren“<br />
(Baumert/Maaz in MaxPlanckForschung 4/2008)<br />
Dr. Wilma Schönauer-Schneider<br />
Akademische Rätin<br />
Sonderschullehrerin (Sprachheilpädagogik,<br />
Verhaltensgestörtenpädagogik)<br />
Sprachheilpädagogin M.A.<br />
Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik<br />
Leopoldstr. 13<br />
80802 München<br />
schoenauer@lmu.de<br />
# 50<br />
52