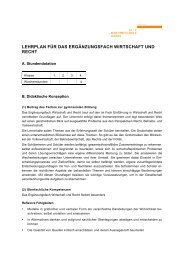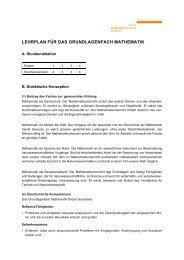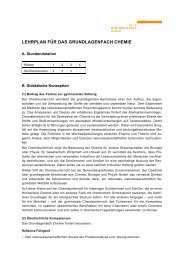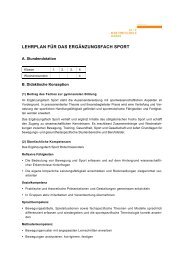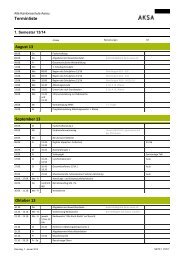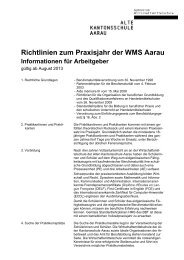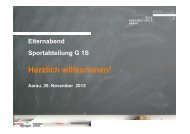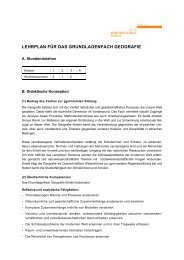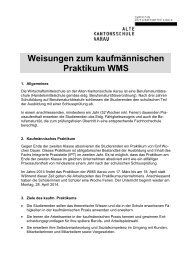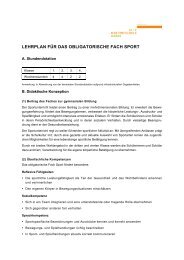Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau
Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau
Interdisziplinäre Projektarbeit IDP - Alte Kantonsschule Aarau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Interdisziplinäre</strong><br />
<strong>Projektarbeit</strong> <strong>IDP</strong><br />
an der Informatikmittelschule <strong>Aarau</strong><br />
Wegleitung, Schuljahr 2012/13
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Bestimmungen zur <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong><br />
Seite<br />
2<br />
1.1 Begriff und Zielsetzung 2<br />
1.2 Grundsätze 2<br />
1.2.1 Wahl des Themas und der betreuenden Lehrpersonen 2<br />
1.2.2 Betreuung 3<br />
1.2.3 Zeitlicher Rahmen 3<br />
1.2.4 Bewertung 3<br />
1.2.5 Entschädigung der Lehrpersonen 3<br />
2. Ausführungsbestimmungen 4<br />
2.1 Zeitplan 4<br />
2.2 Verantwortlichkeiten 4<br />
2.2.1 Studierende 4<br />
2.2.2 Betreuende Lehrperson VBR 5<br />
2.2.4 Betreuende Lehrpersonen zweiter Themenbereich 5<br />
2.2.5 Schulleitung 5<br />
2.3 Disposition 6<br />
2.4 Projektvertrag 6<br />
2.5 Titelblatt 6<br />
2.6 Plagiat 7<br />
2.7 Erklärung 7<br />
3. Beurteilungskriterien 8<br />
3.1 Produkt: Inhalt 8<br />
3.2 Produkt: Form 8<br />
3.3 Arbeitsprozess 9<br />
3.4 Gewichtung der einzelnen Beurteilungsfelder 10<br />
4. Hinweise für die Studierenden 10<br />
Seite - 1
1. Bestimmungen <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> <strong>IDP</strong><br />
1.1. Begriff und Zielsetzung<br />
Rahmenlehrplan des BBT für die Berufsmaturität (kaufmännische Richtung):<br />
„Im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen wird eine <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> durchgeführt.<br />
Zwei oder mehrere Fächer müssen daran beteiligt sein. Die <strong>Projektarbeit</strong> ist mit mindestens 40<br />
Lektionen dotiert. Sie ist von den Lernenden umfassend zu dokumentieren.<br />
Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> muss einerseits einen konkreten Bezug zur Arbeitswelt haben,<br />
darf andererseits aber eine allgemeine gesellschaftliche und kulturelle Perspektive nicht ausser<br />
Acht lassen. Problemorientierte Themen aus den Fachbereichen sollen durch sinnvolle interdisziplinäre<br />
Fragestellungen vernetzt und vor dem Hintergrund von berufsbezogenen Erfahrungen<br />
handlungsorientiert behandelt werden. Sprachen sollen dabei nicht einfach instrumentell, sondern<br />
auch auf Grund ihres eigenständigen kulturellen Beitrags einbezogen werden.<br />
Die Arbeit soll als wichtigstes Ziel die kombinierte und kreative Anwendung von Ressourcen im<br />
Hinblick auf den Aufbau von Kompetenzen ermöglichen, insbesondere die Analyse von Problemsituationen,<br />
die Auswahl, die Planung und Anwendung von Lösungsstrategien, die kritische Überprüfung<br />
von Prozessen und Resultaten, die adäquate Repräsentation der Resultate. Dabei soll<br />
sowohl auf Selbstständigkeit als auch auf die Zusammenarbeit besonders geachtet werden.“<br />
Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> baut inhaltlich auf dem erworbenen Fachwissen auf. Sie ist eine<br />
schriftlich verfasste oder kommentierte Arbeit, die eine selbstständige, persönliche Auseinandersetzung<br />
mit einer Problemstellung dokumentiert.<br />
Die Studierenden verfassen in einem Team von 3 bis 4 Personen eine grössere eigenständige Arbeit,<br />
die logisch aufgebaut und klar strukturiert ist. Die Fachlehrperson VBR kann die Gruppenzusammensetzung<br />
gegebenenfalls festlegen. Die Studierenden gehen von einer anspruchsvollen<br />
Fragestellung aus und wenden zur Bearbeitung angemessene fachspezifische Methoden und<br />
Hilfsmittel an.<br />
1.2. Grundsätze<br />
1.2.1 Wahl des Themas und Wahl der betreuenden Lehrperson<br />
Die <strong>IDP</strong>A wird am Ende der zweiten Klasse im Fach VBR im Rahmen von rund 8 Lektionen mit<br />
dem Schwerpunkt Projektmethoden (Zitieren, Interview, Umfrage, Beobachtung) eingeführt und im<br />
ersten Semester der dritten Klasse geschrieben.<br />
Der eine Themenbereich stammt somit aus dem Fach Wirtschaft und Recht. Die Fachlehrperson<br />
VBR wird die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Fachs <strong>IDP</strong>A in die wesentlichen Grundlagen<br />
der <strong>Projektarbeit</strong> einführen und die Arbeiten betreuen.<br />
Die Wahl des konkreten Themas und der den zweiten Themenbereich der interdisziplinären Arbeit<br />
betreuenden Lehrperson liegt in der Verantwortung der Studierenden; die Fachlehrperson VBR<br />
kann auch geeignete Themen vorgeben. Die genaue Themenfestlegung und -eingrenzung erfolgt<br />
im Konsens zwischen den Studierenden und den betreuenden Lehrpersonen.<br />
Das zweite Fach muss ein promotionswirksames Fach sein. Für die Betreuung des zweiten Themenbereichs<br />
fragen die Studierenden in erster Linie die Abteilungsfachlehrpersonen an. Sofern<br />
diese die Arbeit nicht mehr übernehmen kann, dürfen die Studierenden andere Lehrpersonen dieses<br />
Fachgebietes anfragen, bei denen sie ihre <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> verfassen wollen. Die<br />
Abteilungsfachlehrperson übernimmt in der Folge die Note der abteilungsfremden Fachlehrperson<br />
für die Jahresnote der dritten Klasse.<br />
Seite - 2
1.2.2 Betreuung<br />
Aufgabe der betreuenden Lehrpersonen ist es, die Studierenden zu beraten, zu begleiten und die<br />
<strong>Projektarbeit</strong> zu bewerten.<br />
Die Lehrperson entscheidet, welche und wie viele Arbeiten sie in Bezug auf den zweiten Themenbereich<br />
betreuen kann. In der Regel übernimmt eine Lehrperson dafür nicht mehr als 4 <strong>Interdisziplinäre</strong><br />
<strong>Projektarbeit</strong>en.<br />
Wenn besondere Gründe vorliegen, kann eine Lehrperson zur Betreuung einer <strong>Interdisziplinäre</strong>n<br />
<strong>Projektarbeit</strong> verpflichtet werden.<br />
1.2.3 Zeitlicher Rahmen<br />
Für die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> sind in der Stundentafel im ersten Semester der 3. Klasse<br />
IMS total 2 Semesterlektionen eingesetzt. Die Arbeit beginnt mit der Themenfindung am Ende der<br />
zweiten Klasse und wird mit der Abgabe am Ende der ersten Woche nach den Sportferien abgeschlossen.<br />
1.2.4 Bewertung<br />
Die Bewertung der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong> erfolgt gemäss Rahmenlehrplan durch die Lehrpersonen<br />
der betroffenen mindestens zwei Fächer. Jede der beteiligten Lehrpersonen erteilt für die<br />
Arbeit unter ihrem fachlichen Aspekt je eine Note; diese Noten müssen nicht übereinstimmen.<br />
Dabei werden neben dem fachlichen Wissen und Können insbesondere die zu Grunde liegenden<br />
Kompetenzen und die mit der Arbeit dokumentierten Fertigkeiten sowie Arbeitsprozesse beurteilt.<br />
Bezüglich der formalen Anforderungen (Zitierweise etc.) gelten die Vorgaben des Handbuchs für<br />
den Projektunterricht.<br />
Die Bewertung fliesst mit einem Gewicht von je einem Viertel in die Erfahrungsnoten (Zeugnisnote<br />
der dritten Klasse IMS) der beteiligten Fächer ein. Die Noten sind in ganzen Noten, halben Noten<br />
oder Viertelnoten auszudrücken.<br />
Die Note für die <strong>IDP</strong>A wird nicht ins Zwischenzeugnis der dritten Klasse einberechnet; der Einbezug<br />
erfolgt erst am Ende der dritten Klasse. Die Arbeit wird mit dem Titel und der Note ins Berufsmaturitätszeugnis<br />
aufgenommen.<br />
Gruppenarbeiten werden in der Regel als Gesamtheit beurteilt, d.h. alle Schüler erhalten die gleiche<br />
Note. In begründeten Fällen kann die betreuende Lehrperson von diesem Grundsatz Abstand<br />
nehmen und jedem Gruppenmitglied eine separate Note erteilen. In diesem Fall ist die jeweilige<br />
Autorschaft im Einzelnen auszuweisen.<br />
Die Bewertung wird den Schülerinnen und Schülern auf den Beurteilungsbögen <strong>IDP</strong>A (Detailbogen<br />
und allgemeine Beurteilung) mitgeteilt. Sofern die Bewertung in den beiden beteiligten Fächern unterschiedlich<br />
ausfällt, sind zwei fachspezifische Detailbögen abzugeben.<br />
1.2.5 Entschädigung der Lehrpersonen<br />
Die Entschädigung der betreuenden Lehrpersonen ist pauschal geregelt. Die Lehrperson im Fach<br />
VBR, welche die <strong>IDP</strong>A mit den Gruppen einführt, wird mit einer Jahreslektion entschädigt.<br />
Für den zweiten Themenbereich werden pro beteiligter Lehrperson unabhängig von der Gruppengrösse<br />
im Rahmen der Kompensationsregelung 6 Stunden gutgeschrieben.<br />
Seite - 3
2. Ausführungsbestimmungen<br />
2.1 Zeitplan<br />
2. Klasse, bis Ende März 2012 Information der Schüler und Schülerinnen durch die Schul-<br />
leitung, Abgabe der Wegleitung, Start der Themenfindung.<br />
2. Klasse, bis Mitte Juni 2012 Folgende Punkte sind geregelt:<br />
� Gruppen sind gebildet<br />
� Themen, Fragestellung und Disposition liegen vor<br />
� Betreuer bzw. Betreuerin sind festgelegt.<br />
3. Klasse, bis 24. August 2012 Die überarbeitete Disposition liegt definitiv vor und ist von<br />
beiden Lehrpersonen genehmigt, Projektvertrag von allen<br />
Beteiligten unterschrieben.<br />
gemäss Vereinbarung Zwischen- und Lernberichte können von den betreuenden<br />
Lehrpersonen nach individueller Vereinbarung verlangt<br />
werden.<br />
3. Klasse, 15. Februar 2013 Die <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong> liegt abgeschlossen vor<br />
und wird in dreifacher Ausführung dem Sekretariat eingereicht<br />
sowie elektronisch für die Docoloc-Kontrolle der<br />
Fachlehrperson VBR abgegeben.<br />
3. Klasse, bis Ende März 2013 Die Schlussbesprechung der beteiligten Lehrpersonen mit<br />
der Gruppe schliesst die Arbeit ab. Die Noten werden bekannt<br />
gegeben und schriftlich begründet.<br />
2.2 Verantwortlichkeiten<br />
2.2.1 Studierende<br />
Die Studierenden gehen gemäss Zeitplan (2.1) vor:<br />
• Sie suchen Ideen für ihre <strong>Interdisziplinäre</strong> <strong>Projektarbeit</strong>, besprechen sie mit der Fachlehrperson<br />
VBR und entwickeln sie weiter.<br />
• Sie entscheiden sich für ein Thema, verfassen eine Disposition (s. Punkt 2.3) und suchen die<br />
betreuende Lehrperson für den zweiten Bereich.<br />
• Sie melden die Gruppenmitglieder, das Thema sowie die beteiligten Lehrpersonen der Fachlehrperson<br />
VBR.<br />
• Sie unterschreiben den Vertrag betreffend Docoloc-Kontrolle (Plagiatsprävention).<br />
• Sie verfassen ein Projektjournal, in welchem sie ihr Vorgehen festhalten. Das Arbeitsjournal<br />
liegt bei Besprechungen mit den Betreuungspersonen vor und wird nach Beendigung der Arbeit<br />
mit dieser abgegeben. Es dient der Dokumentation, Reflexion und Planung des Arbeitsprozesses<br />
und kann zur Beurteilung des Prozesses herangezogen werden.<br />
• Sie erklären schriftlich, die Arbeit selbständig verfasst und alle Zitate, verwendete Literatur und<br />
Quellen vorschriftsgemäss angegeben zu haben (Redlichkeitsbestätigung). Diese Bestätigung<br />
ist ein Bestandteil der Arbeit.<br />
• Sie reichen die schriftliche Dokumentation in sauberer Ausführung fristgerecht in drei Exemplaren<br />
dem Sekretariat ein (je ein Exemplar für die betreuenden Lehrpersonen, ein Exemplar für<br />
die Schule) und stellen der Fachlehrperson VBR die Datei elektronisch für die Docoloc-Kontrolle<br />
zu.<br />
Seite - 4
2.2.2 Betreuende Lehrperson VBR<br />
Die betreuende Fachlehrperson VBR<br />
• unterstützt die Studierenden bei der Festlegung des Themas<br />
• bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie ein Thema mit der vorgelegten Disposition zur Betreuung<br />
akzeptiert<br />
• legt bis zum Beginn der Septemberwoche der Schulleitung eine Liste mit den Namen der Studierenden,<br />
ihren Betreuern oder Betreuerinnen sowie den Themen und den betroffenen Fächern<br />
der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong>en zur Genehmigung vor<br />
• unterstützt die Studierenden auf Anfrage bei der Materialsuche<br />
• bespricht mit den Studierenden in bestimmten zeitlichen Abständen die Arbeit<br />
• bespricht die Arbeit nach Abschluss derselben mit den Studierenden, nach Möglichkeit zusammen<br />
mit der anderen beteiligten Lehrperson<br />
• bewertet die Arbeit und teilt den Studierenden die Note für ihren Teil mit<br />
• erstellt einen eigenen schriftlichen Beurteilungsbogen, sofern die fachspezifische Bewertung<br />
nicht einheitlich ausfällt.<br />
2.2.3 Betreuende Lehrpersonen zweiter Themenbereich<br />
Die betreuende Lehrperson<br />
• unterstützt die Studierenden bei der Festlegung des Themas<br />
• bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie ein Thema mit der vorgelegten Disposition zur Betreuung<br />
akzeptiert<br />
• unterstützt die Studierenden auf Anfrage bei der Materialsuche<br />
• bespricht mit den Studierenden mindestens zweimal die Arbeit<br />
• bespricht die Arbeit nach Abschluss derselben mit den Studierenden, nach Möglichkeit zusammen<br />
mit der anderen beteiligten Lehrperson<br />
• erstellt in Zusammenarbeit mit der Fachlehrperson VBR zu Handen der Studierenden einen<br />
Bericht zur Arbeit mit einer schriftliche Bewertung (Beurteilungsbögen)<br />
• teilt den Studierenden die Note für ihren Teil mit.<br />
2.2.4 Schulleitung<br />
Die Schulleitung<br />
• legt die notwendigen Termine fest<br />
• organisiert die Information der Studierenden<br />
• sorgt dafür, dass die Studierenden eine Wegleitung erhalten<br />
• entscheidet in Konfliktfällen<br />
• entscheidet nach Rücksprache mit den betroffenen Lehrpersonen definitiv über die Betreuung<br />
• genehmigt und veröffentlicht die Themenliste<br />
• teilt den Studierenden notfalls, unter Berücksichtigung der vorliegenden Disposition, die betreuenden<br />
Lehrpersonen zu<br />
• bestimmt im Fall von Betrug die zu ergreifenden Massnahmen.<br />
Seite - 5
2.3 Disposition<br />
Die Disposition enthält<br />
• Arbeitstitel<br />
• Thematische Beschreibung, Eingrenzung<br />
• Wissensstand, mögliche Quellen<br />
• Begriffsbestimmungen<br />
• Projektziele<br />
• Methode und Vorgehen<br />
• Zeitplan.<br />
2.4 Projektvertrag<br />
Ein Projektvertrag enthält<br />
• die Disposition als integrierten Bestandteil<br />
• Minimalziele<br />
• mögliche Erweiterungen des Themas<br />
• die Sprache, in der die Arbeit verfasst wird, sofern es nicht Deutsch ist<br />
• einen Terminplan mit Zeitpunkten für Zwischenbeurteilungen<br />
• Hinweis auf die Beurteilungskriterien, insbesondere auf die themenspezifischen<br />
• Vereinbarung über die Darstellung von Zitaten, Literatur- und Quellenangaben<br />
Ein Projektvertrag kann in begründeten Fällen im Verlauf der Arbeit abgeändert werden, wenn beide<br />
Seiten einverstanden sind.<br />
2.5 Titelblatt<br />
Das Titelblatt der fertigen Arbeit muss folgende Angaben enthalten:<br />
• Titel der Arbeit mit Untertitel<br />
• Name und Abteilung der Verfasserinnen / der Verfasser<br />
• Name der Schule<br />
• Name der betreuenden Lehrpersonen / eingereicht bei ...<br />
• Datum der Abgabe: Monat, Jahr.<br />
Seite - 6
2.6 Plagiat<br />
Unter einem Plagiat ist die ganze oder teilweise Übernahme eines fremden Werks ohne Angabe<br />
der Quelle und des Urhebers bzw. der Urheberin zu verstehen. Das Plagiat ist eine Verletzung des<br />
Urheberrechts. Kürzere Passagen eines fremden Werkes dürfen zitiert werden. Dies setzt aber eine<br />
Kennzeichnung des Zitats und eine Angabe der Quelle voraus. Folgende Handlungen stellen<br />
ein Plagiat im weiteren Sinne dar:<br />
a) Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein Werk, das von einer anderen Person auf Auftrag<br />
erstellt wurde («Ghostwriter»), unter ihrem bzw. seinem Namen ein.<br />
b) Die Verfasserin bzw. der Verfasser reicht ein fremdes Werk unter ihrem bzw. seinem Namen<br />
ein (Vollplagiat).<br />
c) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übersetzt fremdsprachige Texte oder Teile von fremd<br />
sprachigen Texten und gibt sie ohne Quellenangabe als eigene aus (Übersetzungsplagiat).<br />
d) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk, ohne die<br />
Quelle mit einem Zitat kenntlich zu machen. Dazu gehört namentlich auch das Verwenden von<br />
Textteilen aus dem Internet ohne Quellenangabe.<br />
e) Die Verfasserin bzw. der Verfasser übernimmt Textteile aus einem fremden Werk und nimmt<br />
leichte Textanpassungen und -umstellungen vor (Paraphrasieren), ohne die Quelle mit einem<br />
Zitat kenntlich zu machen.<br />
Wissenschaftlicher Ethos verlangt, dass geistige Schöpfungen, Ideen, Theorien anderer Perso-nen<br />
durch ein Zitat kenntlich gemacht werden, auch wenn sie im Text bloss sinngemäss wieder-gegeben<br />
sind.<br />
Folgen bei Plagiatsfällen<br />
Ein Plagiat ist ein Diziplinarverstoss und muss der Schulleitung gemeldet werden. Die Schulleitung<br />
führt eine Untersuchung und entscheidet über die Massnahmen.<br />
2.7 Erklärung<br />
Die Arbeit enthält eine Erklärung, welche die Einmaligkeit der Arbeit ausdrückt und von den Studierenden<br />
unterzeichnet wird.<br />
„Ich erkläre hiermit,<br />
- dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Benutzung der angegebenen Quellen verfasst habe.<br />
Diese Arbeit hat noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />
Seite - 7
3. Beurteilungskriterien<br />
3.1 Produkt: Inhalt<br />
3.1.1 Fragestellung und Methodenwahl<br />
• Wird das eigene Erkenntnisinteresse klar dargelegt?<br />
• Wird die Fragestellung bzw. die gestalterische Problemstellung verständlich dargestellt?<br />
• Ist die Untersuchungsmethode dem Thema angemessen?<br />
• Wird die gewählte Methode konsequent durchgeführt?<br />
3.1.2 Bewältigung des Themas<br />
• Wird das Thema eingegrenzt und erläutert?<br />
• Wird das eingegrenzte Thema in einer angemessenen Breite, jedoch mit eindeutigen Schwerpunkten<br />
behandelt?<br />
• Bei gestalterischen Arbeiten: Wird die Absicht oder Fragestellung konsequent verfolgt und<br />
sichtbar gemacht (Visualisierung)?<br />
3.1.3 Nutzung von Wissen<br />
• Werden Quellen, Daten, Versuchsergebnisse und andere Wissensbestände sorgfältig und<br />
sachrichtig verarbeitet?<br />
• Wird Sekundärliteratur in angemessenem Umfang und mit Sorgfalt genutzt?<br />
• Werden fremde Gedanken als solche ausgewiesen (Quellen- und Literaturangaben, Zitate)?<br />
3.1.4 Sachliche Qualität<br />
• Sind die Aussagen fachlich-inhaltlich richtig bzw. angemessen?<br />
• Werden Tatsachenaussagen und eigene Meinung unterschieden?<br />
• Sind die Ergebnisse der Untersuchung überzeugend?<br />
• Bei gestalterischen Arbeiten: Stehen Inhalt und Form in einer sich gegenseitig steigernden<br />
Wechselbeziehung?<br />
3.1.5 Eigenständigkeit und Originalität<br />
• Zeichnen sich Themenwahl und Methode durch Selbstständigkeit aus?<br />
• Werden persönliche Schlussfolgerungen gezogen?<br />
• Enthält die Arbeit originelle Gedanken bzw. eine originelle Gestaltungsidee?<br />
3.2. Produkt: Form<br />
3.2.1 Darstellung<br />
• Ist die Arbeit übersichtlich gegliedert?<br />
• Weist die Arbeit ein sorgfältiges Layout auf?<br />
• Sind die Illustrationen (Grafiken, Zeichnungen, Foto-Reproduktionen usw.) von guter Qualität?<br />
3.2.2 Sprache<br />
• Ist die Sprache korrekt und verständlich?<br />
• Werden die Schlüsselbegriffe definiert oder umschrieben (z.B. durch Aufzählung von Merkmalen)?<br />
3.2.3 Zitate, Quellenangaben<br />
• Wird korrekt zitiert (z.B. nach der Wegleitung der Schule, nach fachspezifischen Standards)?<br />
• Sind die Quellenangaben vollständig und korrekt?<br />
Seite - 8
3.3 Arbeitsprozess<br />
3.3.1 Disposition<br />
• Ist sie verständlich und übersichtlich?<br />
• Ist sie sachlogisch vertretbar?<br />
3.3.2 Methode<br />
• Wendet der/die Studierende in der Untersuchung eine plausible themenspezifische Methode<br />
an?<br />
• Wie erklärt der/die Studierende sein/ihr methodisches Vorgehen in der Arbeit selbst?<br />
• Ueberprüft und revidiert der/die Studierende wenn nötig das Vorgehen?<br />
3.3.3 Fortschritte<br />
• Wie sind die Fortschritte bezüglich Sache und Methode im Verlauf der Arbeit zu beurteilen?<br />
• Entwickelt der/die Studierende im Verlauf des Arbeitsprozesses ein differenziertes Problembewusstsein?<br />
3.3.4 Zuverlässigkeit<br />
• Hält der/die Studierende den Vertrag, andere Vereinbarungen und Termine ein?<br />
3.3.5 Selbstständigkeit<br />
• Wie selbstständig steuert der/die Studierende den Arbeitsprozess?<br />
• Kann der/die Studierende Impulse der Lehrperson selbstständig verarbeiten?<br />
• Kann der/die Studierende sein/ihr Produkt und sein/ihr Vorgehen realistisch beurteilen?<br />
3.3.6 Wie wird die Arbeit organisiert ?<br />
• Geht die Gruppe nach einem Arbeitsplan vor?<br />
• Wird die Arbeit innerhalb der Gruppe sinnvoll organisiert (z.B. Einsatz von Computer, Suchen<br />
und Bestellen von Büchern?)<br />
• Weist die Maturaarbeit eine einheitliche Form auf (z.B. Zitierweise, Quellenangaben, Computer-Einstellungen)<br />
3.3.7 Wie arbeitet die Gruppe zusammen?<br />
• Sind die Arbeitsanteile der Gruppenmitglieder ausgewogen (keine Chauffeur/Trittbrettfahrer-Situation)?<br />
• Sind die Rollen und Arbeitsanteile in der Gruppe geklärt (Wer ist für welche Fragestellung,<br />
welchen Arbeitsschritt, welchen Teil der Arbeit verantwortlich, wer übernimmt Leitungs-<br />
und Koordinationsfunktion)?<br />
Die Gewichtung der Kriterien innerhalb der einzelnen Beurteilungsfelder Produkt Inhalt, Produkt<br />
Form und Prozess ist abhängig vom jeweiligen Thema.<br />
Seite - 9
3. 4 Gewichtung der einzelnen Beurteilungsfelder<br />
Produkt: Inhalt 50 – 60 %<br />
Produkt: Form 20 – 30 % Produkt total: 80 %<br />
Arbeitsprozess 20 %<br />
Notenskala:<br />
Es ist eine lineare Skala anzuwenden.<br />
4. Hinweise für die Studierenden<br />
• Der Umfang der <strong>Interdisziplinäre</strong>n <strong>Projektarbeit</strong> beträgt bei einer Dreiergruppe in der Regel 30<br />
bis 35 computergeschriebene Seiten, bei einer Vierergruppe steigt der Umfang auf 40 bis 45<br />
Seiten an. Diese Seitenangaben verstehen sich mit ohne Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Tabellen<br />
und Abbildungen, Quellenverzeichnis und Anhang, bei einem Zeilenabstand von 1.5.<br />
• Wenn ein anderes Produkt den Schwerpunkt bildet, kann der schriftliche Teil reduziert werden.<br />
In jedem Fall entscheiden die betreuenden Lehrpersonen, ob die Arbeit in Bezug auf den Umfang<br />
genügt.<br />
• Die äussere Form der schriftlichen Arbeit (insbesondere Quellenangaben und Zitate) muss den<br />
Unterlagen des Projektunterrichts entsprechen:<br />
März 2012<br />
ALTE KANTONSSCHULE AARAU<br />
Ulrich Salm, Leiter WMS<br />
Seite - 10