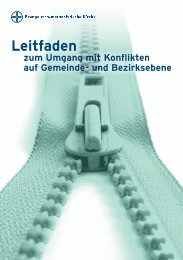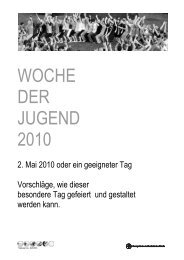Referat von Theo Schaad, ehemaliger Geschäftsführer des SEK
Referat von Theo Schaad, ehemaliger Geschäftsführer des SEK
Referat von Theo Schaad, ehemaliger Geschäftsführer des SEK
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Kirche vor den Herausforderungen<br />
gesellschaftlicher Megatrends<br />
Ein Gesprächsbeitrag zur Positionierung<br />
der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Gesellschaft
- 2 -<br />
© <strong>Theo</strong> <strong>Schaad</strong>, Lilienweg 70, 3098 Köniz, Tel. 031 971 88 00, Mail: theo.schaad@bluewin.ch
- 3 -<br />
1. Die Studie „Die Zukunft der Reformierten“<br />
Im Jahr 2010 erschien die Studie „Die Zukunft der Reformierten“ 1 , verfasst vom Lausanner<br />
Religionssoziologen Prof. Dr. Jörg Stolz und seiner Assistentin Edmée Ballif. Sie geht auf<br />
einen Auftrag <strong>des</strong> Schweizerischen Evangelischen Kirchenbun<strong>des</strong> <strong>SEK</strong> an das Observatoire<br />
<strong>des</strong> Religions en Suisse der Universität Lausanne zurück. Der Rat <strong>SEK</strong> suchte im Zuge der<br />
geplanten Verfassungsrevision nach Grundlagen für die zukünftigen Herausforderungen an<br />
die Kirchen. Die Studie stellt in einem ersten Teil acht so genannte Megatrends in der Gesellschaft<br />
vor, welche für die Arbeit der Kirchen relevant sind und erwägt deren Auswirkungen.<br />
In einem zweiten Teil referiert sie die bisher <strong>von</strong> den reformierten Kirchen unternommenen<br />
Studien und Bemühungen um die Bewältigung der Zukunft. Die Studie befasst sich weitgehend<br />
mit dem Typus der Volkskirche, auch wenn sie einen kurzen Abschnitt über die EMK<br />
enthält. Es lohnt sich, zuerst einen kurzen Blick auf die beiden Typen „Volkskirchen“ und<br />
„Freikirchen“ zu werfen.<br />
1.1 Die Volks- und Lan<strong>des</strong>kirchen<br />
Unter reformierten Volkskirchen sind einerseits diejenigen Kirchen zu verstehen, die aus der<br />
Reformation hervorgegangen sind und an den jeweiligen Orten die römisch-katholische Kirche<br />
abgelöst hatten. Sie kennen die Tradition, dass die Christengemeinde der Bürgergemeinde<br />
entspricht und haben im Zuge <strong>des</strong> Westfälischen Friedens (1648) <strong>des</strong> „cuius regio<br />
eius religio“ (wessen Gebiet, <strong>des</strong>sen Religion) bis in die napoleonische Zeit hinein weitergeführt.<br />
Andrerseits verstehen sich auch diejenigen Kirchen als Volkskirchen, die in den Gebieten,<br />
die die Reformation nicht angenommen hatten, im Laufe der Zeit durch Migration entstanden<br />
sind (vor allem in der Zentral- und Südschweiz). Sie haben z.T. erst gegen Ende <strong>des</strong> 20.<br />
Jahrhunderts den Status <strong>von</strong> öffentlich-rechtlichen Körperschaften erhalten.<br />
Diese Volks- und Lan<strong>des</strong>kirchen sehen sich bis heute als Teil der Gesellschaft. Ihre Aufgabe<br />
ist das Verweben <strong>von</strong> biblischer Botschaft und Zivilgesellschaft und die spirituelle Begleitung<br />
all derer ist, die sich als reformiert verstehen. Sie gehen da<strong>von</strong> aus, dass die Mitgliedschaft<br />
in der Kirche das traditionell normale und nicht an ein Bekenntnis gebunden ist. Sie gewähren<br />
dem Individuum den Raum, den es beansprucht. Sichtbar sind sie in der Gemeinschaft<br />
der Kerngemeinde, die zusammen Gottesdienste feiert, sich zu gemeinschaftlichen und kulturellen<br />
Anlässen trifft und diakonisch engagiert.<br />
1.2 Die Freikirchen<br />
Der Unterschied zwischen den Volks- und Freikirchen liegt weitgehend darin, dass diese nie<br />
mit dem Staat verbunden waren und nicht an ein bestimmtes Gebiet gebunden sind. Sie definieren<br />
sich über den Inhalt der <strong>von</strong> ihnen verkündigten biblischen Botschaft. Die Evangelisch-methodistische<br />
Kirche stützt sich dabei sowohl auf die altkirchlichen Bekenntnisse als<br />
auch auf die in der Kirchenverfassung genannten Grundlagentexte. Wer Mitglied der EMK<br />
wird, bekennt sich zu Jesus Christus als seinem Herrn und Heiland, der Offenbarung Gottes<br />
allein in der Heiligen Schrift und dem Willen, das Leben „entsprechend der verliehenen Gnade“<br />
zu gestalten. Sichtbar wird auch sie im Feiern der Gottesdienste, in gemeinschaftlichen<br />
Anlässen und im diakonischen Dienst.<br />
_____________________<br />
1 J. Stolz/E. Ballif, Die Zukunft der Reformierten, <strong>Theo</strong>logischer Verlag Zürich, 2010
- 4 -<br />
Unter den Freikirchen in der Schweiz nimmt die EMK insofern eine Sonderstellung ein als sie<br />
Teil einer weltumspannenden evangelischen Kirche und grössenmässig den reformierten<br />
Kirchen durchaus ebenbürtig ist. Der Weltbund der methodistischen Kirchen zählt etwa<br />
gleich viele Mitglieder wie die World Communion of Reformed Churches.<br />
2. Die acht gesellschaftlichen Megatrends und ihre Chancen für die EMK<br />
Die EMK hat in den über 40 Jahren seit der Vereinigung der Methodistenkirche mit der<br />
Evangelischen Gemeinschaft im Jahre 1969 rund 60% ihrer Mitglieder verloren. Sie macht<br />
sich heute ernsthaft Gedanken über ihre Zukunft. Es bietet sich darum an, die Situation der<br />
EMK an den Ergebnissen der Studie „Die Zukunft der Reformierten“, besonders an den acht<br />
gesellschaftlichen Trends zu messen.<br />
2.1 Entflechtung gesellschaftlicher Teilsysteme <strong>von</strong> Religion<br />
Die Studie schreibt, „dass die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche wie Recht, Politik,<br />
Bildung, Gesundheit, Erziehung, Wissenschaft, und eben auch Religion immer weiter<br />
‚auseinander treten’ und immer mehr nach eigenen Gesetzen ablaufen.“ (Stolz, S. 28). Im<br />
Besonderen weist die Studie hin auf die Entflechtung <strong>von</strong> Kirche und Staat, Kirche und Erziehungssystem,<br />
Kirche und Teilsystemen im Marktbereich. Der heutige Trend erscheint als Abschluss<br />
einer Bewegung, die sich mit dem ausgehenden Mittelalter angebahnt hatte. Die<br />
Zeit, in der das menschliche und gesellschaftliche Leben als grosse Einheit, durchdringen<br />
<strong>von</strong> der <strong>Theo</strong>logie und überwacht durch die Kirche verstanden wurde, ist endgültig vorbei.<br />
Eigentlich sind diese Entflechtungen im System der Freikirche bereits angelegt. Mit dem<br />
Staat hat sie ein ausgesprochenes „Nicht-Verhältnis“. Sie muss sich wie jede andere ideelle<br />
Gruppierung im Vereinsrecht organisieren. Die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme wie<br />
Recht, Politik, Bildung, Gesundheit, Erziehung wurden immer als ein Gegenüber verstanden.<br />
In der Verkündigung wurde wenig darauf Bezug genommen. Sie wurden höchstens als Instrumente<br />
für die Verkündigung <strong>des</strong> Evangeliums in Wort und Tat genutzt. Die EMK betrieb<br />
in der Schweiz im letzten Jahrhundert zahlreiche kirchliche Einrichtungen im Bereich der Beherbergung<br />
(Hotels), <strong>des</strong> Buchdrucks und Verlagswesens, der Bildung<br />
(Haushaltungsschule), <strong>des</strong> Sozialen (Kinderheim) und im Gesundheitswesen (Diakonissenhäuser<br />
mit angeschlossenen Spitalbetrieben). Fast alle diese Verbindungen wurden in den<br />
letzten Jahren aufgelöst. Sie wurden als nicht mehr ihrem Zweck entsprechend verstanden.<br />
Die Entflechtungen, wie sie die Studie schildert, erscheint zunächst als ein Verlust für die Kirchen,<br />
vor allem die Volks- und Lan<strong>des</strong>kirchen. Ihr Einfluss auf diese Gebiete ist verschwunden.<br />
Sie eröffnen ihnen aber auch eine ausgesprochene Chance. Die Studie schreibt: „Wissenschaftler<br />
suchen dann vor allem innerwissenschaftliche Anerkennung (Reputation), Politiker<br />
Wahlerfolge, Journalisten Ereignisse mit Neuheits- und Skandalwert usw., wobei sie gegenüber<br />
den Kriterien und Zielen <strong>von</strong> Akteuren anderer Teilsysteme (relativ) gleichgültig werden“<br />
(Stolz, S. 29). Dies gibt der christlichen Botschaft eine ganz neue Freiheit. Die früheren<br />
inhaltlichen Konkurrenten der Kirchen, die Philosophie und die Naturwissenschaften, haben<br />
sich weitgehend aus der Auseinandersetzung mit der Kirche herausgelöst. Die Philosophie<br />
hat sich weit zurückgezogen und die Auseinandersetzung zwischen Naturwissenschaft und<br />
<strong>Theo</strong>logie findet hauptsächlich noch in den Köpfen <strong>von</strong> Lehrern und Journalisten statt, welche<br />
die Kirche als zurückgeblieben zeichnen wollen, ohne den heutigen Stand evangelischer<br />
Schöpfungstheologie zur Kenntnis zu nehmen. Das aktuelle Gespräch zwischen <strong>Theo</strong>logen<br />
und Neurologen zur Frage <strong>des</strong> freien Willens findet auf hohem Niveau statt.<br />
Die Entflechtung der gesellschaftlichen Teilsysteme <strong>von</strong> Religion hat zur Folge, dass die<br />
evangelische Botschaft als das „ganz Andere“ verkündigt werden kann, ohne mit bestehen-
- 5 -<br />
den Systemen zu kollidieren. Die kirchliche Verkündigung hat damit eine ganz neue Freiheit<br />
gewonnen.<br />
Die Gefahr dieser Situation besteht für die Freikirche allerdings darin, dass sie die anderen<br />
gesellschaftlichen Teilsysteme neben der eigenen Existenz und der zu verkündigenden Botschaft<br />
als sekundär und wenig wichtig erachtet. Wissenschaftsfeindlichkeit droht sich immer<br />
wieder breit zu machen. Im Rahmen ihrer Schöpfungs- und Gnadentheologie hat die EMK<br />
die Leistungen dieser Teilsysteme – sei es der Wissenschaft, der Technik, der Wirtschaft<br />
und anderen - zur Kenntnis zu nehmen, zu würdigen und zu untersuchen, wie die befreiende<br />
Botschaft <strong>von</strong> der Gnade Gottes zum Menschen in seiner Systemverhaftung spricht.<br />
2.2 Die Individualisierung<br />
„Individualisierung bedeutet, dass Individuen zunehmend aus traditionellen Sozialstrukturen<br />
entlassen werden. Die Menschen sind nicht mehr über ihre Familien- und Geschlechtszugehörigkeit<br />
zeit ihres Lebens auf eine soziale Schicht, eine Konfession, eine mögliche soziale<br />
Rolle, einen fixen Wohnort festgelegt“ (Stolz, Seite 35).<br />
Diesen Trend bekommt die EMK schmerzlich zu spüren. Die Zahl <strong>von</strong> Jugendlichen, die ihre<br />
Sozialisation weitgehend in der Gemeinde gefunden haben und dabei bleiben, hat dramatisch<br />
abgenommen. Die EMK kann nicht mehr einfach auf die nachfolgenden Generationen<br />
aus den eigenen Reihen zählen, sondern muss Mitglieder immer wieder neu finden.<br />
Es war eine der Stärken <strong>des</strong> Methodismus, dass er den Menschen nicht nur die befreiende<br />
Gnade Gottes gepredigt, sondern ihnen gleichzeitig eine Form <strong>von</strong> Gemeinschaft angeboten<br />
hat, in der sie den Glauben leben, stärken und vertiefen konnten. In der Kleingruppe der<br />
Klasse und in der Gemeinde stellt er eine Sozialstruktur zur Verfügung, in der sich Menschen<br />
verstanden und gehalten fühlten.<br />
Die Studie stellt fest, dass das Angebot <strong>von</strong> solchen Sozialstrukturen im säkularen Bereich<br />
gewachsen ist (siehe 2.5 Aufschwung säkularer Konkurrenten <strong>von</strong> Kirche). Individualisierung<br />
bedeutet, dass ein Verlassen <strong>von</strong> Sozialstrukturen, d.h. <strong>von</strong> Familie, Religionsgemeinschaft,<br />
aber auch politischer Partei oder Interessengruppen wie Vereinen keine Frage der Treue im<br />
ethischen Sinn mehr ist.<br />
Individualisierung bedeutet Vereinzelung. Gerade die Freikirchen haben Menschen angesprochen,<br />
die aus irgendeinem Grund aus ihrer religiösen und wertebestimmten Sozialstruktur<br />
herausgelöst waren. Bischof F. Schäfer nannte sie in einer Ordinationspredigt einmal „die<br />
Unbehausten“. Es sind Menschen, die ungeachtet ihrer Geschichte und Herkunft nach Antworten<br />
auf Lebensfragen und Halt in Religion suchen und ihre Spiritualität leben möchten.<br />
Diese Gruppe <strong>von</strong> Menschen nimmt im Zuge der Individualisierung rasant zu. Die Einladung<br />
in die Nachfolge Jesu gib ihnen Richtung und Ziel zur Lebensgestaltung, sei es als vereinzelter<br />
Mensch oder als Gemeinschaft suchen<strong>des</strong> Individuum.<br />
Der Trend zur Vereinzelung stellt aber die Frage nach der Sozialgestalt <strong>von</strong> Kirche. Der „Erfolg“<br />
der Kirche wird in der Regel an der Zahl ihrer Mitglieder gemessen; die Medien gehen<br />
sogar nur <strong>von</strong> der Zahl der Gottesdienstbesuchenden aus. Es wird kaum gefragt, was die<br />
biblische Botschaft inhaltlich den Menschen gebracht hat und bringt. Die Verkündigung <strong>von</strong><br />
Glauben, Liebe und Hoffnung, basierend auf der schöpferischen Kraft Gottes, hat die christliche<br />
Kultur geprägt und tut dies weiterhin. Das erste Ziel der Kirche ist diese Verkündigung,<br />
die den Menschen verändert. Dass daraus auch eine Sozialgestalt wächst, ist zweitrangig.<br />
Die Erfahrung zeigt, dass sich Glaubende immer zusammengefunden und Gemeinden gebildet<br />
haben.
- 6 -<br />
Die Geschichte der EMK zeigt, dass das Angebot <strong>von</strong> Gemeinschaft dem vereinzelten Menschen<br />
eine grosse Hilfe war. Wenn man aber die heutige Diskussion um die Zukunft der Kirche<br />
verfolgt, wächst der Eindruck, dass „die Gemeinde“ einen höheren Stellenwert erhalten<br />
hat als das Individuum. Wenn das so ist, stellt der Trend zur Individualisierung tatsächlich<br />
eine grosse Bedrohung für die Kirche dar. Wenn es aber gelingt, dem Inhalt der Verkündigung<br />
Priorität einzuräumen, eröffnet die Individualisierung grosse Möglichkeiten, Menschen<br />
mit der Botschaft Jesu zu erreichen.<br />
2.3 Neue Lebensformen und „Lebensstil-Milieus“<br />
„Wenn durch Individualisierung vormals relativ stabile Klassenzugehörigkeiten und traditionelle<br />
sozialmoralische und territoriale Milieus zerstört werden, kommt die Frage auf, wie die<br />
Menschen einander noch ’einordnen’ können. Woher soll man wissen, mit wem man es zu<br />
tun hat, mit wem man Kontakt aufnehmen soll, mit wem es sich ‚lohnt’, Freundschaften und<br />
Bekanntschaften aufzunehmen? Hier helfen die neu entstehenden ‚Lebensstil-Milieus’. Sie<br />
zeichnen sich neben je eigenem Ressourcenzugang und Lebensformen auch durch einen je<br />
unterschiedlichen ‚Lebensstil’, mit zugehörigen Werten, Normen, typischen Zielen, Freizeitbeschäftigungen,<br />
ästhetischen Vorlieben etc. aus.“ (Stolz, Seite 42).<br />
Die „Lebensstil-Milieus“ wurden vom Heidelberger Sinus-Institut für die Belange der Werbung<br />
entwickelt. Es werden zehn Milieus definiert, denen die Menschen zugeordnet werden<br />
und deren Verhalten analysiert wird. Eine Untersuchung einer Schweizer Lan<strong>des</strong>kirche hat<br />
ergeben, dass ihre aktiven Mitglieder gerade aus drei <strong>von</strong> diesen zehn Milieus stammen.<br />
Die gestellten Fragen sind für die Kirchen nicht neu. Der Beginn der methodistischen Bewegung<br />
in England hatte gerade damit zu tun, dass die durch die Industrialisierung entstandenen<br />
Schichten <strong>von</strong> der Staatskirche vernachlässigt worden waren. Aber Wesley wandte sich<br />
nicht nur ihnen zu. Seine Tagebücher und seine Korrespondenz zeigen, dass er mit Menschen<br />
aus allen Ständen in Verbindung stand. Er wandte sich an alle, die die Predigt vom<br />
Heil in Christus hören wollten. Grundsätzlich ist da<strong>von</strong> auszugehen, dass die biblische Botschaft<br />
allen Menschen in allen Milieus gilt. Nun kann sich eine Kirche natürlich entscheiden,<br />
sich mit der Botschaft an eine ganz bestimmte Schicht der Bevölkerung zu wenden, wie dies<br />
z.B. die Heilsarmee tut (die sich aber gerade nicht als Kirche versteht). Aber an dieser Stelle<br />
hat die EMK heute ein Problem.<br />
Im Jahr 1968 vereinigten sich in der Schweiz zwei Freikirchen zur Evangelisch-methodistischen<br />
Kirche: Die Methodistenkirche und die Evangelische Gemeinschaft. Im Rückblick -<br />
und aufgrund <strong>von</strong> Erfahrungen <strong>des</strong> Autors in Gemeinden aus beiden Herkunftskirchen - kann<br />
gesagt werden, dass es einen grundlegenden Unterschied im Selbstverständnis dieser Kirchen<br />
gab, der nie aufgearbeitet wurde: Die Methodistenkirche umfasste Menschen aus den<br />
verschiedensten Lebensmilieus. Sie bot ihnen einen Ort, an dem sie ihren Glauben stärken<br />
konnten, um ihn je wieder in ihrem Milieu zu leben. Die Evangelische Gemeinschaft versuchte,<br />
selber Lebensstil-Milieu mit den ihr „zugehörigen Werten, Normen, typischen Zielen, Freizeitbeschäftigungen,<br />
ästhetischen Vorlieben etc.“ (s.o.) zu sein. Mag diese Darstellung auch<br />
schwarz/weiss gezeichnet sein, sie zeigt das Problem. Die EMK müsste die Frage diskutieren,<br />
ob sie nicht das kühne Wagnis eingehen müsste, ihre Botschaft wieder so zu fassen,<br />
dass Menschen aus den verschiedensten Lebensstil-Milieus Antworten auf ihre Fragen finden<br />
und den Glauben leben können ohne ihr eigenes Milieu verlassen zu müssen.<br />
Ein solcher Weg würde an die Gestaltung <strong>des</strong> Gemeindeprogrammes hohe Anforderungen<br />
stellen. Einerseits sollte die Möglichkeit, in der Gemeinde eine Sozialstruktur zu bilden, nicht<br />
verloren gehen. Es müsste aber auch möglich sein, dass Menschen aus den verschiedensten<br />
Milieus sich darin zusammenfinden - vor allem zum Feiern <strong>des</strong> Gottesdienstes und der<br />
Sakramente, aber auch zum Austausch in Glaubensfragen und im Erwachsenenkatechumenat<br />
- ohne diese als eigenes Lebensstil-Milieu in Anspruch nehmen zu müssen.
- 7 -<br />
Verheerend wäre es, wenn sich die EMK zu einem eigenen Lebensstil-Milieu entwickeln würde,<br />
in dem nur Gleichgesinnte Platz finden. So kann man zwar auch Gemeinde sein - aber<br />
nicht Kirche als Verkündigerin der universalen Gnade Gottes.<br />
2.4 Wertewandel<br />
„Wen die Individuen durch Individualisierung faktisch gezwungen sind, immer mehr selbst zu<br />
entscheiden und dadurch immer unterschiedlicher werden, so benötigen sie Werte, welche<br />
diesem Sachverhalt angemessen sind. … Hatte man noch in der 1. Hälfte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts<br />
in weiten Teilen der westlichen Gesellschaften Pflicht- und Akzeptanzwerte hoch gehalten,<br />
also etwa Disziplin, Gehorsam, Pflichterfüllung, Treue, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit<br />
usw., so wurden diese Werte mehr und mehr (und in einem Schub dann in den sechziger<br />
Jahren) durch Selbstentfaltungswerte ersetzt. Hierzu gehören“ (nach Helmut Klages,<br />
1985) „einerseits hedonistische Werte wie die Suche nach Genuss, Abenteuer, Spannung,<br />
Emotionalität wie auch individualistische Werte wie z.B. Kreativität, Spontaneität, Selbstverwirklichung,<br />
Toleranz oder Ungebundenheit“ (Stolz, Seite 45).<br />
Wie geht eine Kirche, die sehr viel Arbeit darauf verwendet, in ihren sozialen Grundsätzen<br />
und im sozialen Bekenntnis Antwort auf Lebensfragen zu geben, mit diesem Wertewandel<br />
um? Entscheidet sie sich für ein weitgehen<strong>des</strong> Festhalten an Akzeptanzwerten und gegen<br />
heutige Formen, in denen sich der Individualismus ausprägt?<br />
Hier wäre zu erinnern an die in der methodistischen <strong>Theo</strong>logie übliche Unterscheidung <strong>von</strong><br />
„essentials“ und „opinions“, also <strong>von</strong> dem, was grundlegend für den christlichen Glauben<br />
steht und dem, was daraus folgt. Die essenzielle Verkündigung der Gnade Gottes muss<br />
auch die Nach-68-er-Generation erreichen können, ohne sie ins Korsett der Pflicht- und Akzeptanzwerte<br />
der ersten Hälfte <strong>des</strong> 20. Jahrhunderts zu zwängen. Im Diskurs über die „opinions“<br />
ist die Vielfalt <strong>des</strong>sen zu entdecken, was die grundlegende Verkündigung in Menschen<br />
unterschiedlicher Prägung bewirkt. Oder als Bild beschrieben: Die Kirche hat nicht die Leitplanken<br />
christlicher Werte zu bestimmen, sondern Christus als Leitlinie zu verstehen, an der<br />
sich die Glaubenden unterschiedlichster Milieus und Sozialstrukturen ausrichten können.<br />
Ein Beispiel: Die Abkehr der Gesellschaft <strong>von</strong> den Pflicht- und Akzeptanzwerten zeigt sich<br />
heute ganz besonders in den Sozialstrukturen <strong>von</strong> Ehe und Familie. Sie standen unter der<br />
Pflicht, gelingen zu müssen. Die Forderung <strong>von</strong> Treue und Verantwortung war grundlegend.<br />
Heute werden diese Formen <strong>des</strong> Zusammenlebens vielmehr als Willenskonstrukte verstanden.<br />
Eine Ehe bleibt so lange bestehen, als die beiden Partner es wollen und die Familie<br />
bleibt so lange beisammen, als der Wille, Verantwortung über die Generationengrenzen hinweg<br />
wahrzunehmen, da ist. Aufgabe der Kirche ist es, diesen Willen anzuerkennen und Eheleute<br />
und Familien in diesem Willen zu bestärken.<br />
Die Studie sagt, „dass die Individuen sich <strong>von</strong> der Institution Kirche nichts mehr sagen lassen.<br />
Kirchen können wohl noch zum Denken anregen, aber kein ‚Wahrheiten’ mehr durchsetzen“<br />
(Stolz, Seite 46). Als Beobachtung ist dies sicher richtig. Aber ist es wirklich die Aufgabe<br />
der Kirche „Wahrheiten durchzusetzen“? Die erste Wahrheit, die sie zu verkündigen<br />
hat, ist die Zuverlässigkeit der Gnade Gottes, der Zuspruch der schöpferischen Kraft Gottes,<br />
die das Leben der Menschen verändert. Die konkrete Auswirkung wird immer diskutiert werden,<br />
grundsätzlich gilt aber das „denken und denken lassen“.<br />
2.5 Aufschwung säkularer Konkurrenten <strong>von</strong> Kirche
- 8 -<br />
„Da die Individuen in immer mehr Bereichen zu Nachfragern und Anbietern werden und alle<br />
ihre Mitgliedschaften als frei wählbar erscheinen, werden auch Kirchenmitgliedschaft, religiöse<br />
Praxis, Gemeinschaft, religiöser Glaube und Diakonie zu ’Angeboten’, welche man<br />
‚nachfragen’ kann, bzw. für welche man seine Zeit und Energie ‚anbieten’ kann. In modernen<br />
Gesellschaften sehen sich alle diese ‚Produkte’ der Kirchen einer sehr scharfen säkularen<br />
Konkurrenz ausgesetzt“ (Stolz, Seiten 46f).<br />
Die Studie verwendet in diesem Abschnitt für die Tätigkeit der Kirchen die Sprache der Wirtschaft.<br />
Sie spricht <strong>von</strong> Angebot und Nachfrage, Produkten und Konkurrenz. Bisher hat sich<br />
die Kirche dagegen gewehrt, auf dieser Ebene mit anderen „Anbietern“ verglichen zu werden.<br />
Zu heilig ist ihr ihre Botschaft, zu einmalig für den Menschen.<br />
Aber gerade darum kann sie sich der Konkurrenz stellen und braucht sie nicht zu fürchten.<br />
Sie muss sich aber die Frage gefallen lassen, was denn ihre „unique selling proposition<br />
USP“ sei, das Merkmal, das die Kirche im Wettbewerb deutlich <strong>von</strong> den anderen Angeboten<br />
abhebt. Was ist denn ihr Produkt, das sie anzubieten hat?<br />
Die Studie sieht sie vor allem in formalen Grössen wie religiöser Praxis, Gemeinschaft und<br />
Diakonie. Doch das greift zu kurz. Diese Formen sind gefüllt mit einem Inhalt. Es geht um die<br />
Botschaft, welche die Kirche auszurichten hat.<br />
Traditionellerweise hat die Jährliche Konferenz der EMK die Frage zu stellen: „Was predigen<br />
wir?“ Es wäre interessant, festzuhalten, was die Schwerpunkte der heutigen Verkündigung in<br />
der Kirche sind. In den sechziger Jahren <strong>des</strong> letzten Jahrhunderts hat die Krise der Evangelisation<br />
eingesetzt. Die Botschaft <strong>von</strong> der Begnadigung <strong>des</strong> Sünders, der Aufruf zur Umkehr,<br />
die Themen <strong>von</strong> Verlorenheit und Rettung scheinen seither nicht mehr zu greifen.<br />
Es muss neu überlegt werden, welches die Anknüpfungspunkte im menschlichen Leben<br />
sind, auf welche Bedürfnisse <strong>des</strong> Menschen die biblische Botschaft zuerst eine Antwort gibt.<br />
Dazu gehören eindeutig Lebensübergänge und -brüche: Geburt (Taufe), Übergänge (Konfirmation,<br />
Trauung) und der Tod (Trauerfeier). An diesen Punkten hat die Kirche die Möglichkeit,<br />
ihre Botschaft als Antwort auf die Sinnfrage zu geben, ebenso in Seelsorge- und Beratungsgesprächen.<br />
Nur: Was ist die Antwort? Da liegt eine grosse theologische Aufgabe vor,<br />
die angepackt werden muss.<br />
Die Kirche hat das Auftreten säkularer Konkurrenz nicht zu fürchten, wenn sie die theologische<br />
Arbeit nicht scheut, ihre Botschaft – ohne <strong>des</strong>halb die Kernbotschaft aufzugeben – an<br />
den Bedürfnissen der Menschen auszurichten. Die Kommunikationsspezialisten sprechen<br />
<strong>von</strong> „adressatengerecht“ anstelle <strong>von</strong> absendergerecht“. Die Studie ist darin ganz ernst zu<br />
nehmen, dass sie die Art der Vermittlung der Botschaft sorgfältig überdenken muss. Aber<br />
auch hier gilt, dass die Form dem Inhalt folgen muss und nicht umgekehrt.<br />
2.6 Religiöse Pluralisierung und die Zunahme der Konfessionslosen<br />
Die Zahl der Konfessionslosen in der Schweiz ist zwischen 1970 und 2000 <strong>von</strong> 1% auf 11%<br />
angestiegen, die Zahl der Muslime <strong>von</strong> 0.3% auf 4.2%. Diese Zahlen dürften nach Auswertung<br />
der Volkszählung 2010 nochmals markant gestiegen sein.<br />
Für die Existenz der Freikirchen sind diese Zahlen insofern <strong>von</strong> Belang, als die ansteigende<br />
Zahl der Konfessionslosen auch ein Indiz ist dafür, dass Religion nicht mehr zwingend mit<br />
der Zugehörigkeit zu einer Institution verbunden ist. Diese „Entinstitutionalisierung“ erlebt die<br />
EMK darin, dass die Zahl der Mitglieder immer kleiner wird gegenüber der Zahl derer, die<br />
zwar <strong>von</strong> der Kirche erreicht werden, ihr aber nicht formell angehören.
- 9 -<br />
In diesem Zusammenhang muss die Frage gestellt werden, ob für die EMK die Veränderung<br />
der Mitgliederzahl das wichtigste Kriterium in ihrer Entwicklung sei. Wenn früher gesagt wurde,<br />
dass die Wirkung <strong>des</strong> Methodismus sich nur zu einem kleinen Teil in der Kirche selbst<br />
manifestiere, eine grosser Teil aber über sie hinausgehe, dann ist das auch für die Zukunft<br />
mit zu bedenken.<br />
Zur religiösen Pluralisierung gehören auch die Migrations-Gemeinden. Zugewanderte aus<br />
anderen Kontinenten und Kulturen bilden eigene Gemeinden, in denen sie ihre Religiosität<br />
leben. Zahlreiche Gemeinden der EMK haben diesen Gemeinden nicht nur Räume zur Verfügung<br />
gestellt, sondern auch die Zusammenarbeit gesucht. Die Organisationsformen der<br />
EMK sind eine hilfreiche Möglichkeit, solche Gemeinden in die Kirche zu integrieren und ihnen<br />
doch ihre kulturelle Selbständigkeit zu lassen.<br />
2.7 Informationsgesellschaft und neue Technologien<br />
„Der Eintritt in die Informationsgesellschaft hat für die reformierten Kirchen einschneidende<br />
Folgen. Die Gemeinden und Kirchen müssen sich in und mit Hilfe der Massenmedien darstellen.<br />
Sie stehen dabei in einer wachsenden Konkurrenz mit einer Vielzahl <strong>von</strong> anderen sozialen<br />
Akteuren um das knappe Gut der Aufmerksamkeit“ (Stolz, Seite 52).<br />
Auch die Botschaft der Kirche ist zuerst einmal Information. Und um diese zu vermitteln sind<br />
die neuen Technologien bestens geeignet. Sie ist aber gleichzeitig menschliche Zusprache,<br />
die <strong>von</strong> Mensch zu Mensch gehen muss. Die Neigung in der Kirche gross, vor allem auf die<br />
Verkündigung <strong>von</strong> Mensch zu Mensch zu setzen, da die aktive Beteiligung an der Informationsgesellschaft<br />
mit relativ hohen Kosten verbunden ist. Die EMK ist zu klein und hat zu wenig<br />
finanzielle Ressourcen, um in diesem Bereich ein „Player“ zu sein. Trotzdem darf das Anliegen<br />
nicht ausser acht gelassen werden.<br />
Aufmerksamkeit in den Medien wird erreicht über Themen und Persönlichkeiten. In der Kirche<br />
müsste überlegt werden, welche thematischen Schwerpunkte so aufgearbeitet werden<br />
könnten, dass diese in den Medien zum Tragen kämen. Dasselbe gilt für den Aufbau <strong>von</strong><br />
Persönlichkeiten, die für kompetente Auskünfte zur Verfügung stünden.<br />
Das Medienkonzept der EMK ist immer wieder daraufhin zu untersuchen, welchen Anteil an<br />
personellen und finanziellen Ressourcen in eine angemessene Medienarbeit zu investieren<br />
sind.<br />
2.8 Die „Wiederkehr“ der Religion<br />
Die Studie nennt diesen Trend, um sogleich zu betonen, dass er keiner sei. „Für eine Rückkehr<br />
der Religion(en) auf der Ebene faktisch gelebter Religiosität kann – aufs Ganze gesehen<br />
– in der Schweiz keine Rede sein.“ Auf einer anderen Ebene ist das Interesse an Religion<br />
aber durchaus gewachsen: „Nicht zuletzt aufgrund der Verunsicherungen durch den Islam<br />
ist das Interesse an den christlichen Kirchen im Allgemeinen und auch das politische und<br />
staatliche Interesse an starken und verlässlichen christlichen Kirchen in der Schweiz gestiegen“<br />
(Stolz, S. 53). Die Kirchen stehen tatsächlich vor der Situation, dass einerseits in Politik<br />
und Wirtschaft vermehrt nach ihrem inhaltlichen Beitrag gefragt wird und andrerseits die<br />
kirchliche Basis schmaler wird.<br />
Das Phänomen dürfte mit anderen Trends eng zusammenhängen, z.B. der Entflechtung der<br />
gesellschaftlichen Teilsysteme, aber auch mit der Individualisierung. Persönliche Religiosität<br />
trägt nicht mehr das Stigma <strong>des</strong> unaufgeklärten Menschen, sondern wird respektiert. Und die<br />
Zugehörigkeit zu einer Freikirche bedeutet nicht mehr ein Ausscheren aus der Zivilgesellschaft,<br />
sie ist in der Vielfalt der Lebensmilieus akzeptiert. So liegen im Phänomen, dass Reli-
- 10 -<br />
gion gesellschaftlich wieder eine Rolle spielt, durchaus auch eine Chance für die Arbeit der<br />
EMK.<br />
3. Folgerungen<br />
Die in der Studie aufgeführten Trends zeigen, dass sich die Gesellschaft, das Umfeld der Kirche,<br />
in den letzten 50 Jahren massiv verändert hat. Die stark rückläufigen Mitgliederzahlen<br />
der EMK deuten darauf hin, dass es ihr nicht gelungen ist, sich diesen Veränderungen anzupassen.<br />
Die Veränderungen in der Gesellschaft, insbesondere die zunehmende Säkularisierung, lassen<br />
in der Kirche schnell den Gedanken aufkommen, dass diese sich gegen die Kirche wende.<br />
Wird diesem Gedanken gefolgt, droht schnell die Gettoisierung. Eine genauere Betrachtung<br />
der Trends zeigt aber, dass diese durchaus auch Chancen eröffnen für das kirchliche<br />
Wirken. Will die Kirche ihrem Auftrag gerecht werden, müssen sie ernst genommen werden.<br />
Die Kirche muss zur festen Überzeugung kommen, dass sie in ihrer Verkündigung, ihrer Botschaft<br />
an die Menschen, etwas Einmaliges in die Hand bekommen hat, das ihr <strong>von</strong> niemandem<br />
streitig gemacht werden noch inhaltlich überboten werden kann. Sie benötigt das Vertrauen<br />
in die lebensbejahende Botschaft <strong>des</strong> Evangeliums. Sie muss wieder da<strong>von</strong> überzeugt<br />
sein, dass sie das Licht in der Hand hält, das nicht unter einem Gefäss verborgen werden<br />
soll, sondern auf den Leuchter gehört, damit es gesehen wird. Sie braucht das Vertrauen<br />
darauf, dass die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben kann.<br />
Die Studie weist eine grosse Zahl <strong>von</strong> Tabellen und Diagrammen auf, welche die grossen<br />
Veränderungen anhand statistischer Zahlen aufzeigen. Für die Kirche ist es wichtig, dass sie<br />
hinter diesen Zahlen die Menschen sieht. Es sind aber nicht mehr die Menschen aus der ersten<br />
Hälfte <strong>des</strong> letzten Jahrhunderts, die im Versuch, die Pflicht- und Akzeptanzwerte ihrer<br />
Zeit zu erfüllen, zu scheitern drohen und <strong>von</strong> der Botschaft der rechtfertigenden Gnade getröstet<br />
werden. Es sind Menschen, die sich <strong>von</strong> der Bevormundung durch Institutionen gelöst<br />
haben und im Sinne der Individualisierung sich selber zu definieren versuchen. Die Kirche<br />
muss diesem Menschen auf Augenhöhe begegnen und sehr genau hinhören, nach welchem<br />
Zuspruch er fragt.<br />
Ein Beispiel: Die Studie „Die Zukunft der Reformierten führte an Ostern 2010 zu einem Artikel<br />
in der „NZZ am Sonntag“ mit der Nachricht, dass die Reformierten im Jahre 2050 noch<br />
maximal 20% der Bevölkerung ausmachen werden. Zahlreiche Mediengespräche waren die<br />
Folge dieser Nachricht. In einem Telefonat mit einem Journalisten betonte ich, dass sich die<br />
Kirche in Zukunft vermehrt über ihre Inhalte werde definieren müssen. „Was sind denn die<br />
Inhalte der Kirche? Geben sie mir drei Stichworte“ forderte der Journalist. Ich nannte „Glaube,<br />
Liebe, Hoffnung“. Der Glaube an den Schöpfergott und die Geschöpflichkeit <strong>des</strong> Menschen,<br />
die Liebe zu Gott, zu den Menschen und zu sich selbst und die Hoffnung, die durch<br />
Ostern markiert wird – nämlich, dass nichts so bleiben muss, wie es ist“. „Das ist ein Satz,<br />
den ich mir merke: Es muss nichts so bleiben, wie es ist!“ reagierte der Journalist fast euphorisch.<br />
Da hatte offensichtlich evangelische Botschaft jemanden existentiell erreicht.<br />
Nachdem die Vorstellungen <strong>von</strong> Himmel und Hölle, <strong>von</strong> einer ewigen Seligkeit und einer<br />
ewigen Verdammnis nicht mehr die Grundsorge <strong>des</strong> Menschen sind, muss nach dem Ziel<br />
der „Operation Evangelium“ gefragt werden. Geht es nicht im Grunde genommen darum,<br />
dass das Leben – und gemeint ist das materielle Leben zwischen Geburt und Tod – gelingt,<br />
also nicht verloren geht?<br />
In einer Diskussion meinte der frühere Systematik-Dozenten an der Hochschule für <strong>Theo</strong>logie<br />
in Reutlingen, Dr. Manfred Marquart: „Wir müssten in der Verkündigung <strong>von</strong> den Paulusbriefen<br />
zu den Evangelien zurückkehren, zu dem, was Jesus gesagt und getan hat.“ Inhalt-
- 11 -<br />
lich könnte das heissen, dass dem individualisierten Menschen, der sich fragt: „Bin ich derjenige,<br />
der ich sein könnte, sein möchte, sein sollte? Wie kann ich mich selber weiter<br />
entfalten?“ zugesagt wird: „Du bist so angenommen, wie Du bist. Du bist <strong>von</strong> Deinem Schöpfer<br />
anerkannt. Entwickle Dich weiter und sei getrost.“<br />
Nicht <strong>von</strong> ungefähr hat sich eine grosse reformierte Kantonalkirche in der Schweiz als „Such-<br />
und Weggemeinschaft“ bezeichnet. Sie umfasst mit diesem Begriff alle evangelischen Einwohner<br />
<strong>des</strong> betreffenden Kantons. Die EMK darf aber ruhig sagen, dass sie nicht nur auf der<br />
Suche ist, sondern gefunden hat: Den erlebbaren Glauben, das sich bestätigende Vertrauen<br />
in die Gnade Gottes.<br />
Nebst diesen inhaltlichen Fragen stellen sich auch die formalen: „Wie predigen wir?“. Mit Anlässen<br />
im Bereich der Gemeinde (Gottesdienste, Erwachsenenbildung, Themengruppen)<br />
sind heute kaum mehr Menschen zu erreichen, die nicht zur Kirche gehören. Da ist der „Aufschwung<br />
säkularer Konkurrenten“ zu sehr spürbar. Ausnahmen bilden noch die Kasualien.<br />
Die zahlreichen Experimente mit Gottesdiensten zeigen unterschiedliche Ergebnisse. Zu fragen<br />
ist aber, ob hier die formalen Veränderungen tatsächlich der Verkündigung der Botschaft<br />
dienen – und wenn ja, welcher.<br />
Wichtig für die Verbreitung der biblischen Botschaft sind nach wie vor die Glaubenden selbst.<br />
Das beginnt in der Familie, im Weitergeben der biblischen Geschichten durch Eltern und<br />
Grosseltern. Diese anzuleiten und zu unterstützen ist Basisaufgabe der Kirche.<br />
Dann ist es das Leben der Glaubenden – je in ihrem Lebensmilieu und ihrer Sozialstruktur,<br />
ihr Umgang mit Lebens- und Existenzfragen, aber auch ihre Getrostheit und ihre Ausstrahlung,<br />
die letztendlich Träger der christlichen Botschaft sind. Darin müssen sie <strong>von</strong> der Kirche<br />
gefördert und bestärkt werden. Es ist eigentlich ein „zurück zu den Wurzeln“ der methodistischen<br />
Bewegung.<br />
Als Modell der Kirche (und nicht nur der EMK) schwebt mir ein Bild vor: Das mittelalterliche<br />
Kloster wird gebildet <strong>von</strong> einer Gruppe <strong>von</strong> Menschen, die nach bestimmten Regeln leben.<br />
Sie wissen sich für das Umland verantwortlich, ohne ihm seine Regeln aufzudrängen. Aber<br />
die Menschen im Umland wissen: Dort, wo diese Menschen Gott feiern und anbeten, dort<br />
geschieht das Wesentliche und ich finde Antworten auf meine Fragen.<br />
Köniz, 22. Februar 2012/TS