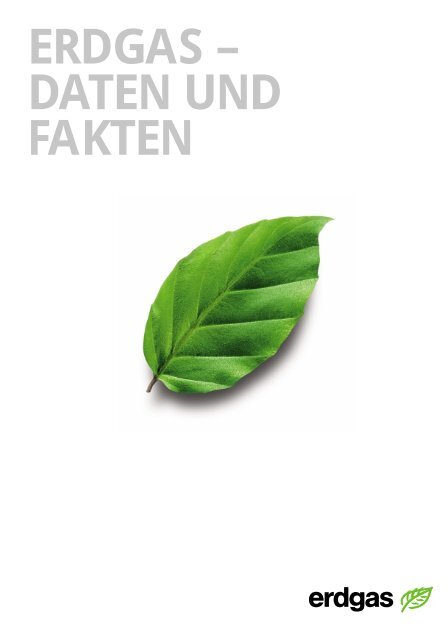ERDGAS – DATEN UND FAKTEN TABELLEN ... - Erdgas Zürich AG
ERDGAS – DATEN UND FAKTEN TABELLEN ... - Erdgas Zürich AG
ERDGAS – DATEN UND FAKTEN TABELLEN ... - Erdgas Zürich AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>DATEN</strong> <strong>UND</strong><br />
<strong>FAKTEN</strong>
Seit seiner Einführung zu Beginn der 70er-Jahre<br />
ist <strong>Erdgas</strong> zur zweitwichtigsten Wärmeenergie<br />
unseres Landes herangewachsen. Durch die<br />
Substitution anderer Energieträger leistet <strong>Erdgas</strong><br />
einen wesentlichen Beitrag zur Luftreinhaltung,<br />
zu einer Reduktion der Emission von Treibhausgasen<br />
und zu einer ausgewogeneren Energieversorgung<br />
unseres Landes.<br />
Mit der zunehmenden Bedeutung von <strong>Erdgas</strong> für die Energieversorgung<br />
wächst auch das Bedürfnis der Bevölkerung nach Information<br />
über diesen Energieträger und den Wirtschaftszweig, der für die<br />
Beschaffung und Verteilung verantwortlich ist. Die Broschüre<br />
«<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten» kommt diesem Wunsch entgegen. Sie<br />
vermittelt aktuelles Grundwissen rund um <strong>Erdgas</strong> und liefert damit<br />
die Grundlagen, die für die energiepolitische Meinungsbildung erforderlich<br />
sind.<br />
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG)<br />
Grütlistrasse 44<br />
Postfach<br />
8027 <strong>Zürich</strong><br />
Telefon 044 288 31 31<br />
Telefax 044 202 18 34<br />
vsg@erdgas.ch<br />
www.erdgas.ch<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 3
INHALT<br />
<strong>ERDGAS</strong> IN DER ENERGIEVERSORGUNG DER SCHWEIZ 5<br />
Energiepolitische Grundlagen 6<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> die zweitwichtigste Wärmeenergie der Schweiz 8<br />
WOHER STAMMT <strong>ERDGAS</strong>? 9<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Ursprung, Vorkommen, Förderung 10<br />
<strong>Erdgas</strong> weltweit 12<br />
<strong>Erdgas</strong> in Europa 14<br />
EIGENSCHAFTEN VON <strong>ERDGAS</strong> 17<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> der natürliche Brennstoff 18<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> die sparsame Energie 19<br />
<strong>Erdgas</strong> und Umwelt 20<br />
<strong>Erdgas</strong> und Sicherheit 22<br />
Zukunftsweisende Entwicklungen 23<br />
DIE SCHWEIZERISCHE GASWIRTSCHAFT 25<br />
Historischer Rückblick 26<br />
Struktur der schweizerischen Gaswirtschaft 28<br />
Organisation der schweizerischen Gaswirtschaft 29<br />
<strong>Erdgas</strong>beschaffung und Versorgungssicherheit 31<br />
Transport und Verteilung im Inland 32<br />
<strong>Erdgas</strong>speicherung 34<br />
Die Gaswirtschaft als Wirtschaftszweig 35<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> im Brennpunkt der Zukunft 37<br />
BEIL<strong>AG</strong>E<br />
Tabellen und Grafiken<br />
4 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten
<strong>ERDGAS</strong><br />
IN DER ENERGIE-<br />
VERSORGUNG<br />
DER SCHWEIZ
ENERGIEPOLITISCHE GR<strong>UND</strong>L<strong>AG</strong>EN<br />
Flüssige Brenn- und Treibstoffe auf Erdölbasis, Strom und <strong>Erdgas</strong> sind<br />
die wichtigsten Energieträger für die schweizerische Energieversorgung.<br />
Kohle hat nur noch einen geringen Anteil. Fernwärme und<br />
erneuerbare Energien wie Sonnen- und Windenergie, Holz und Biogas<br />
gewinnen an Bedeutung, können aber bis auf weiteres nur einen<br />
untergeordneten Beitrag zur Energieversorgung leisten.<br />
ZUSTÄNDIGE B<strong>UND</strong>ESBEHÖRDEN<br />
Auf nationaler Ebene fällt der Energiebereich in die Zuständigkeit des<br />
Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und<br />
Kommunikation (UVEK), dem das Bundesamt für Energie (BFE) untersteht.<br />
Von der ökologischen Seite her gestaltet das ebenfalls dem<br />
UVEK unterstellte Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft<br />
(BUWAL) die nationale Energiepolitik mit.<br />
ENERGIEPOLITISCHE LEITLINIEN<br />
Seit den Jahren nach 1970 ist die Forderung nach einer Diversifikation<br />
der Energieträger eine stets bestätigte Zielsetzung der<br />
schweizerischen Energiepolitik. In den 80er-Jahren rückten zusätzlich<br />
ökologische Aspekte in den Vordergrund: Die Reduktion der energiebedingten<br />
Schadstoffe wurde zum vordringlichen Ziel, ebenso die<br />
rationelle Energieverwendung. Schliesslich kamen in den 90er-Jahren<br />
Bestrebungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen hinzu wegen<br />
des befürchteten, vom Menschen verursachten Treibhauseffekts.<br />
Alle erwähnten Zielsetzungen lassen sich unter dem Begriff der<br />
Nachhaltigkeit subsumieren.<br />
6 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
MARKTÖFFNUNG<br />
Seit mehreren Jahren sind die Themen Energiesteuern und Marktöffnung<br />
Gegenstand politischer Diskussionen. Nach der Ablehnung<br />
des Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG) im Jahre 2002 wird der Entwurf<br />
für ein Gasmarktgesetz (GMG) vorläufig nicht weiter bearbeitet.<br />
Anders als beim Strom besteht beim Gas kein gesetzgeberischer<br />
Handlungsbedarf. Denn mit Artikel 13 des Rohrleitungsgesetzes gibt<br />
es seit 1964 eine Rechtsgrundlage für eine Durchleitung durch Dritte<br />
im Hochdruckbereich. Auf dieser Basis finden seit 2001 <strong>Erdgas</strong>transporte<br />
von der deutschen Grenze durch die Schweiz nach Italien statt.<br />
Die für einen verhandelten Netzzugang erforderlichen Grundlagen<br />
wurden von der schweizerischen Gaswirtschaft erarbeitet.<br />
RECHTSGR<strong>UND</strong>L<strong>AG</strong>EN AUF B<strong>UND</strong>ESEBENE<br />
Der Energieartikel (Artikel 89 der Bundesverfassung) und das auf dieser<br />
Basis erlassene Energiegesetz sind die wichtigsten energiepolitischen<br />
Rechtsgrundlagen. Das Energiegesetz ist zusammen mit der<br />
ausführenden Energieverordnung seit dem 1.1.1999 in Kraft. Diese<br />
Rechtsgrundlagen sollen zu einer ausreichenden, breit gefächerten,<br />
sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Energieversorgung<br />
beitragen. Bezweckt wird insbesondere auch eine sparsame<br />
und rationelle Energienutzung. Kooperation und Subsidiarität sind<br />
bestimmende Werte des Energiegesetzes.<br />
Der Umweltschutzartikel (Artikel 74 BV) bildet die Basis der umweltpolitischen<br />
Massnahmen. Er wird hauptsächlich durch das Umweltschutzgesetz<br />
und die darauf basierenden Verordnungen konkretisiert.<br />
Bezüglich der Lufthygiene sind für den Betrieb von Feuerungsanlagen<br />
die Vorschriften der im Jahre 1986 in Kraft gesetzten und 1992 sowie<br />
1997 revidierten Luftreinhalteverordnung des Bundes (LRV) massgebend.<br />
Sie legt Emissionsgrenzwerte fest.
1999 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die<br />
Reduktion der CO2-Emissionen verabschiedet. Das Gesetz bezweckt<br />
eine Verminderung der CO2-Emissionen aus der Nutzung fossiler<br />
Energieträger um gesamthaft 10 Prozent (Brennstoffe 15 Prozent,<br />
Treibstoffe 8 Prozent) bis 2010 bezogen auf 1990. Freiwillige Massnahmen<br />
der Verbraucher stehen dabei im Vordergrund: Eine Abgabe<br />
kann eingeführt werden, wenn das Reduktionsziel mit den freiwilligen<br />
Massnahmen (zusammen mit den energie-, verkehrs-, umweltund<br />
finanzpolitischen Massnahmen des Bundes) nicht erreicht wird.<br />
Bundessache ist auch die Gesetzgebung über Rohrleitungsanlagen<br />
zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- und<br />
Treibstoffe. Das Eidgenössische Rohrleitungsgesetz, die<br />
zugehörigen Verordnungen und auf dem Umweltschutzgesetz<br />
basierende Erlasse wie die Störfallverordnung<br />
und die Bodenschutzrichtlinien sind<br />
massgebend für den Bau und Betrieb von<br />
Gasleitungen und Nebenanlagen.<br />
ENERGIEABGABEN<br />
Treibstoffe unterstanden der Warenumsatzsteuer<br />
WUST. Seit dem Übergang von der WUST zur Mehrwertsteuer<br />
MWST (1995) sind auch Strom und Brennstoffe dieser Steuer unterstellt.<br />
Auf <strong>Erdgas</strong> und Erdölprodukte wird zusätzlich die Mineralölsteuer<br />
erhoben. Die Volksabstimmungen von 2000 und 2001<br />
haben gezeigt, dass Energieabgaben in Form von Förderabgaben<br />
oder einer ökologischen Steuerreform nicht mehrheitsfähig sind.<br />
Eine CO2-Lenkungsabgabe, die sich auf das geltende CO2-Gesetz stützt, kann eingeführt werden. Der Abgabeertrag müsste an<br />
Bevölkerung und Wirtschaft rückerstattet werden. Entsprechende<br />
Absichten stehen aber in Konkurrenz zu Überlegungen, welche eine<br />
Die Politik bestimmt den Energie-Kurs der Schweiz.<br />
minimale Belastung der flüssigen Treibstoffe zur Finanzierung von<br />
Massnahmen vorsehen, welche mit den Bestimmungen von CO2- Gesetz und Kyoto-Protokoll kompatibel und zielführend sind.<br />
RECHTSGR<strong>UND</strong>L<strong>AG</strong>EN IN KANTONEN <strong>UND</strong> GEMEINDEN<br />
Die Aufgabenteilung zwischen Bund und<br />
Kantonen ist im Energieartikel respektive<br />
im Energiegesetz festgeschrieben. Der Zuständigkeitsbereich<br />
der Kantone umfasst in<br />
erster Linie den Gebäudebereich. Wichtige<br />
Vorgaben betreffend den spezifischen Energieverbrauch<br />
von Gebäuden werden durch die kantonalen<br />
Energiegesetze oder -verordnungen geregelt.<br />
So schreiben mehrere Kantone vor, dass mit fossilen<br />
Energien beheizte Gebäude einen bestimmten<br />
Prozentsatz des Energieverbrauchs durch erneuerbare<br />
Energien abdecken müssen oder eine überdurchschnittliche Wärmedämmung<br />
aufzuweisen haben. Innerhalb des kantonalen Rahmens<br />
können auch die Gemeinden Vorschriften erlassen, soweit sie nicht<br />
sogar gesetzlich dazu verpflichtet sind. Einen hohen Stellenwert hat<br />
die Energiepolitik angesichts der lufthygienischen Probleme besonders<br />
in den grossen Städten und Agglomerationen.<br />
ENERGIE-ORGANISATIONEN<br />
Die Branchen der Hauptenergieträger verfügen über eigene Organisationen,<br />
welche ihre Interessen in Markt, Politik und Öffentlichkeit<br />
vertreten. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Organisationen und<br />
Gruppierungen, die sich mit Energiefragen beschäftigen, so das<br />
«Energieforum Schweiz», die «Schweizerische Energiestiftung», der<br />
«Energie-Konsumenten-Verband», die «Interessengemeinschaft<br />
energieintensiver Branchen» und die Umweltorganisationen.<br />
Die Gaswirtschaft ist ein wichtiger Partner in der schweizerischen<br />
Energiewirtschaft. Zusammen mit ihren Branchenorganisationen tragen<br />
die Gasversorgungen zur sicheren, wirtschaftlichen und umweltschonenden<br />
Energieversorgung unseres Landes bei.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 7
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong> DIE ZWEITWICHTIGSTE<br />
WÄRMEENERGIE DER SCHWEIZ<br />
<strong>ERDGAS</strong>-ERSCHLIESSUNG DER SCHWEIZ<br />
<strong>Erdgas</strong> wurde in der Schweiz erstmals 1969 auf<br />
regionaler Basis eingeführt. In grossem Massstab<br />
wurde der damals für unser Land neue Energieträger<br />
nutzbar, als 1974 die internationale <strong>Erdgas</strong>leitung<br />
Niederlande <strong>–</strong> Italien und die ersten nationalen Transportsysteme<br />
von Swissgas und den Regionalgesellschaften in der Ostschweiz,<br />
im Mittelland und in der Westschweiz in Betrieb genommen<br />
wurden.<br />
Die Transport- und Verteilinfrastruktur wurde seither kontinuierlich<br />
ausgebaut: Ausgehend von den gut erschlossenen Verbrauchszentren<br />
im Mittelland sowie in der West- und Ostschweiz, wurde das Versorgungsnetz<br />
zunehmend verfeinert und auf benachbarte Regionen und<br />
Gemeinden ausgedehnt (siehe Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
ABSATZENTWICKLUNG<br />
Im Zuge dieses Ausbaus hat <strong>Erdgas</strong> als Wärmeenergie eine erhebliche<br />
Bedeutung für die Energieversorgung der Schweiz erlangt. Im<br />
Wärmemarkt steht <strong>Erdgas</strong> heute hinter dem Heizöl an zweiter Stelle.<br />
Der beträchtliche Zuwachs des <strong>Erdgas</strong>anteils ist im wesentlichen auf<br />
die Verlagerung des Energiekonsums von anderen fossilen<br />
Brennstoffen auf das umweltschonendere <strong>Erdgas</strong> zurückzuführen.<br />
8 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
VERBRAUCHERGRUPPEN<br />
<strong>Erdgas</strong> wird im Haushalt zur Warmwasseraufbereitung, zum<br />
Heizen und Kochen eingesetzt. Die wichtigste Anwendung von<br />
<strong>Erdgas</strong> in der Industrie ist die Erzeugung von Prozesswärme in Form<br />
von Dampf oder Heisswasser. Zudem wird <strong>Erdgas</strong> auch in Wärmeprozessen<br />
mit direkter Anwendung der Flamme oder ihrer Abgase<br />
benutzt, so in der Metallindustrie zum Schmelzen, Glühen und<br />
Härten oder in der keramischen Industrie zum Trocknen und Brennen.<br />
Im Gewerbe- und Dienstleistungssektor wird <strong>Erdgas</strong> unter anderem<br />
in Bäckereien, Gärtnereien, Grossküchen und chemischen Reinigungsbetrieben<br />
verwendet (siehe Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
<strong>Erdgas</strong> wird zunehmend auch für die kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung<br />
sowie zum Antrieb von Fahrzeugen eingesetzt.<br />
Gasmotoren produzieren Strom und Wärme.
WOHER STAMMT<br />
<strong>ERDGAS</strong>?
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong><br />
URSPRUNG, VORKOMMEN, FÖRDERUNG<br />
ENTSTEHUNG AUS PLANKTON <strong>UND</strong> ALGEN<br />
Das heute genutzte <strong>Erdgas</strong> ist aus organischen Stoffen entstanden. Es<br />
wurde bei der Entstehung von Erdöl beziehungsweise von Kohlelagerstätten<br />
gebildet. Ausgangsmaterial waren abgestorbene Reste<br />
von Plankton und Algen flacher Urmeere, die auf den Meeresgrund<br />
absanken und dort <strong>–</strong> von Bakterien zersetzt <strong>–</strong> als Faulschlamm vergärten.<br />
Aus Ablagerungen von feinkörnigem Festlandschutt (Ton,<br />
Sand, Kalk) wurde Erdölmuttergestein. Das darin enthaltene organische<br />
Material wurde in eine feste, erdölartige Substanz, das Bitumen,<br />
umgewandelt. Bei fortschreitendem Absinken des Meeresgrundes<br />
und zunehmender Überlagerung des Muttergesteins durch jüngere<br />
Sedimente bildeten sich unter wachsendem Druck und steigenden<br />
Temperaturen aus dem Bitumen flüssige und gasförmige Kohlenwasserstoffe.<br />
Es entstand schweres, dann leichtes Öl und schliesslich <strong>–</strong> bei<br />
entsprechend hohen Drücken und Temperaturen <strong>–</strong> <strong>Erdgas</strong>. Solches<br />
<strong>Erdgas</strong> ist in kohlenwasserstoffhöffigen Becken weit verbreitet.<br />
ENTSTEHUNG AUS PFLANZEN<br />
Ausgangsmaterial des anderen <strong>Erdgas</strong>lieferanten, der Kohle, waren<br />
vor allem höhere Pflanzen aus früheren Erdzeitaltern, besonders aus<br />
dem Karbon. Durch rasches Absinken des Erdbodens gelangte das<br />
pflanzliche Material in tiefere Erdschichten, wo es im sogenannten<br />
Inkohlungsprozess der Reihe nach in Torf, Braunkohle, Steinkohle<br />
und Anthrazit umgewandelt wurde. Während der Inkohlung kam es<br />
zur Abspaltung gasförmiger Reaktionsprodukte, besonders von<br />
Methan. <strong>Erdgas</strong>vorkommen, die bei der Bildung von Kohle entstanden,<br />
sind beispielsweise die Felder in den Niederlanden und in der<br />
südlichen Nordsee.<br />
10 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
TIEFENGAS-THEORIE<br />
Andere Theorien besagen, dass im Erdinnern auch <strong>Erdgas</strong> nicht organischen<br />
Ursprungs vorkommt, das durch Bruchstellen an die Oberfläche<br />
tritt. Als Beweis wird unter anderem die Tatsache angeführt,<br />
dass bei Vulkanausbrüchen und Erdbeben meist auch Gasausstösse<br />
beobachtet werden. Nach diesen Theorien müssten in genügenden<br />
Tiefen praktisch überall auf der Erde riesige Gasvorkommen zu finden<br />
sein, die dort bei der Entstehung der Erde eingeschlossen wurden.<br />
Auch in der Schweiz werden solche Tiefengasvorkommen vermutet.<br />
BILDUNG VON L<strong>AG</strong>ERSTÄTTEN<br />
Durch das Gewicht der überlagernden Schichten wurde das Muttergestein<br />
mit zunehmender Absenkung immer stärker zusammengedrückt.<br />
Dabei wurde Erdöl und/oder <strong>Erdgas</strong> ausgepresst. Wegen<br />
ihres geringen spezifischen Gewichts und der Oberflächenspannung<br />
stiegen Erdöl und <strong>Erdgas</strong> über Risse und Hohlräume in höher gelegene,<br />
poröse Gesteinsschichten empor. Die Wanderung fand dort<br />
ein Ende, wo das poröse Gestein von undurchlässigen Deckschichten<br />
(etwa Ton) überlagert wurde. Zu grösseren <strong>Erdgas</strong>ansammlungen<br />
konnte es allerdings nur dort kommen, wo diese Deckschichten eine<br />
ausreichend mächtige Schicht aus Speichergestein (Sandstein,<br />
Dolomit, klüftige Kalke) nach oben abschlossen und eine so genannte<br />
Fangstruktur vorhanden war.
Fangstrukturen bildeten sich durch Biegung oder Bruch von Gesteinsschichten<br />
bei Bewegungen der Erdkruste. Sie bestehen häufig<br />
aus einer Wölbung der Deckschicht, in der sich das<br />
aufsteigende <strong>Erdgas</strong> sammelt.<br />
Die Verbreitung gasführender Speicherformationen<br />
beschränkt sich auf Gebiete, in denen<br />
sich vor Urzeiten Meere oder Kohlesümpfe ausdehnten<br />
und durch Ablagerungen poröse Sedimentgesteine<br />
gebildet wurden.<br />
<strong>ERDGAS</strong>SUCHE<br />
Beim Aufsuchen und Erschliessen von <strong>Erdgas</strong>lagerstätten (Exploration)<br />
spielt die Geophysik eine wichtige Rolle. Mit ihrer Hilfe wird der<br />
geologische Aufbau des Untergrundes erforscht. Das wichtigste Verfahren<br />
ist die Seismik, die Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Erschütterungen<br />
im Untergrund untersucht, die durch kleine Sprengungen<br />
ausgelöst werden. An der Oberfläche registrieren Seismographen<br />
die von den Gesteinsschichten reflektierten Wellen. Die<br />
Messdaten erlauben Rückschlüsse auf die Gesteinsstrukturen bis in<br />
mehrere tausend Meter Tiefe.<br />
Suche nach <strong>Erdgas</strong>feldern unter dem Meeresgrund.<br />
Zur Untersuchung und Erschliessung potenzieller <strong>Erdgas</strong>lagerstätten<br />
müssen zum Teil sehr tiefe Bohrungen niedergebracht werden, die<br />
technisch und finanziell aufwändig sind, besonders wenn es sich um<br />
Unterwasser-Explorationen handelt. Dabei steht der Bohrturm auf<br />
schwimmenden oder fest verankerten Plattformen <strong>–</strong> wahren technischen<br />
Wunderwerken.<br />
FÖRDERUNG<br />
Hat die Exploration eine wirtschaftlich ausbeutbare Lagerstätte nachgewiesen,<br />
werden die Produktionsanlagen erstellt; das <strong>Erdgas</strong>feld<br />
wird mit einer Vielzahl von Bohrlöchern erschlossen. In Feldsammelstellen<br />
laufen die Leitungen der einzelnen Förderbohrungen zusammen.<br />
Der Förderdruck wird auf den Fernleitungsdruck reduziert und<br />
das <strong>Erdgas</strong> in die Pipeline eingespeist.<br />
Komplizierter und aufwändiger ist die Förderung von Offshore-Vorkommen.<br />
Hier werden je nach Wassertiefe und Umweltbedingungen<br />
Bohrschiffe und -plattformen eingesetzt.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 11
<strong>ERDGAS</strong> WELTWEIT<br />
DIE <strong>ERDGAS</strong>-RESERVEN <strong>UND</strong> IHRE VERTEILUNG<br />
Gemessen am heutigen Verbrauch reichen die gesicherten, das heisst<br />
durch Bohrungen nachgewiesenen, <strong>Erdgas</strong>vorräte noch über 60<br />
Jahre (Erdöl: rund 40 Jahre). Zählt man die geschätzten zusätzlich<br />
gewinnbaren Ressourcen dazu, sind es 130 Jahre. Dazu kommen die<br />
«unkonventionellen Vorkommen», wie Tiefengas und Methanhydrat.<br />
Weil in den letzten 25 Jahren mehr <strong>Erdgas</strong> neu entdeckt als verbraucht<br />
wurde, hat die Reichweite der Ressourcen trotz wachsendem<br />
Konsum laufend zugenommen.<br />
Die grössten <strong>Erdgas</strong>vorräte der Welt befinden sich auf dem Gebiet der<br />
ehemaligen Sowjetunion. Deren Nachfolgestaaten verfügen über<br />
rund 40 Prozent der weltweiten Reserven, wobei der Hauptteil auf<br />
Russland entfällt, zu dessen Territorium die grossen Vorkommen in<br />
Sibirien gehören. Die zweitgrössten <strong>Erdgas</strong>-Reserven liegen im Mittleren<br />
Osten, vor allem im Iran. Diese Vorkommen werden zur Zeit noch<br />
wenig genutzt. Für die Zukunft sind grössere Erschliessungsprojekte<br />
und der Aufbau von Infrastrukturen für den <strong>Erdgas</strong>export geplant.<br />
Beachtliche Vorräte befinden sich auch in Nord- und Westafrika,<br />
Ostasien, Nordamerika, Lateinamerika und Westeuropa. In Russland<br />
wird weltweit am meisten <strong>Erdgas</strong> gefördert. An zweiter Stelle der<br />
Förderländer stehen die USA, gefolgt von Kanada. In Westeuropa<br />
führt Grossbritannien die Rangliste der Förderländer an vor Norwegen<br />
und den Niederlanden (siehe Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
12 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
WELT-<strong>ERDGAS</strong>HANDEL<br />
<strong>Erdgas</strong> wird international in der Regel auf der Basis langfristiger<br />
Verträge gehandelt. Bei <strong>Erdgas</strong>lieferverträgen sind Laufzeiten von<br />
20<strong>–</strong>25 Jahren üblich, weil Milliardeninvestitionen für Prospektion,<br />
Förderung, Transport und Verteilung erforderlich sind. Die daraus<br />
resultierende starke gegenseitige Interessenbindung zwischen<br />
Produzenten und Abnehmern trägt in hohem Masse zur Versorgungssicherheit<br />
bei. Die weltweit steigende Nachfrage, die laufende<br />
Entdeckung neuer Vorkommen rund um den Erdball und der Ausbau<br />
der Ferntransportsysteme führen zu einer zunehmenden Globalisierung<br />
des <strong>Erdgas</strong>handels.<br />
Auf dem europäischen <strong>Erdgas</strong>markt sind seit einiger Zeit grosse<br />
Veränderungen im Gange. So engagierten sich grosse Stromkonzerne<br />
zunächst für die Deckung des Eigenbedarfs beim Kraftwerksbetrieb<br />
im Gasmarkt. Inzwischen sind aber auch Aktivitäten im
<strong>Erdgas</strong>handel, Kooperationen mit etablierten<br />
Unternehmen im Gasmarkt sowie Firmenzusammenschlüsse<br />
zu beobachten. Bei den grossen<br />
Ölkonzernen zeichnet sich ein Strategiewechsel<br />
ab: Konzentrierten sie ihre <strong>Erdgas</strong>tätigkeiten in Europa bisher<br />
explizit auf die Förderung, so beabsichtigen jetzt beispielsweise<br />
die beiden Konzerne Shell und ExxonMobil, direkt ins europäische<br />
<strong>Erdgas</strong>vertriebs- und -handelsgeschäft einzusteigen.<br />
Als Folge der EU-Gasmarktliberalisierung entstanden für kurzfristig<br />
gehandeltes <strong>Erdgas</strong> die Handelsplätze Zeebrugge (Belgien) und<br />
Bunde-Oude an der deutsch-belgischen Grenze. Sie erfüllen die<br />
Funktion einer Börse für Tages-, Wochen-, Quartals- oder Jahreskäufe.<br />
Auf der Basis kurzfristigen Angebots und kurzfristiger Nachfrage<br />
entsteht ein publizierter Marktpreis.<br />
<strong>ERDGAS</strong>TRANSPORT WELTWEIT<br />
Perfektionierte Technologien ermöglichen den interkontinentalen<br />
<strong>Erdgas</strong>transport. Sie erlauben die Nutzung von Gasvorkommen, die<br />
weit von den Verbrauchszentren entfernt sind. Der Transport erfolgt<br />
über Tausende von Kilometern in Überland- und Unterwasser-Pipelines<br />
oder per Tanker, die das <strong>Erdgas</strong> in verflüssigter Form mitführen.<br />
WELT-<strong>ERDGAS</strong>VERBRAUCH<br />
In den kommenden Jahren wird weltweit ein starkes Wachstum des<br />
<strong>Erdgas</strong>verbrauchs erwartet. Die Gründe liegen einerseits im wachsenden<br />
Energiebedarf insbesondere in den Schwellenländern.<br />
Anderseits sind die industrialisierten Länder bestrebt, Kohle und<br />
Erdöl aus ökologischen Gründen durch das umweltschonendere<br />
<strong>Erdgas</strong> zu substituieren und die Abhängigkeit vom Öl abzubauen. So<br />
werden zum Beispiel Kraftwerke statt mit Öl oder Kohle zunehmend<br />
mit <strong>Erdgas</strong> befeuert.<br />
Auf Grund seiner langfristigen Verfügbarkeit, seiner Wirtschaftlichkeit<br />
und seiner ökologischen Qualitäten ist <strong>Erdgas</strong> im Bereich der Wärmeproduktion<br />
gegenüber anderen fossilen Brennstoffen im Vorteil.<br />
Namhafte Fachleute bezeichnen das <strong>Erdgas</strong> als eigentliche «Brückenenergie»,<br />
die in ein nachfossiles, möglicherweise von Wasserstoff<br />
und Solarenergie geprägtes Zeitalter überleiten könnte.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 13
<strong>ERDGAS</strong> IN EUROPA<br />
ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN <strong>ERDGAS</strong>WIRTSCHAFT<br />
Die meisten Länder Westeuropas verfügen über <strong>Erdgas</strong>vorkommen,<br />
die insbesondere in den Niederlanden, Deutschland und Italien schon<br />
seit längerer Zeit genutzt werden. Eine international kooperierende<br />
europäische <strong>Erdgas</strong>wirtschaft bildete sich in den 60er-Jahren, als in<br />
den Niederlanden grosse <strong>Erdgas</strong>vorkommen entdeckt wurden. Inzwischen<br />
entwickelten sich Norwegen und die Niederlande, wo seit<br />
Ende der 70er-Jahre in der Nordsee <strong>Erdgas</strong> gefördert wird, zu den<br />
führenden europäischen <strong>Erdgas</strong>-Exporteuren. Die grössten <strong>Erdgas</strong>verbraucher<br />
Westeuropas sind Grossbritannien, Deutschland, Italien,<br />
Frankreich und die Niederlande (siehe Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
<strong>ERDGAS</strong>ANTEIL IN WESTEUROPA<br />
Der Anteil von <strong>Erdgas</strong> am Primärenergieverbrauch liegt in Westeuropa<br />
durchschnittlich bei 23 Prozent. An der Spitze stehen die<br />
Niederlande, Grossbritannien und Italien. Im westeuropäischen Vergleich<br />
ist der Anteil der Schweiz deutlich unterdurchschnittlich. In<br />
anderen Ländern wie Dänemark, Irland und Spanien ist die <strong>Erdgas</strong>versorgung<br />
noch jung oder noch im Aufbau (Portugal, Griechenland).<br />
Die Entwicklung der <strong>Erdgas</strong>versorgung widerspiegelt die<br />
Bestrebungen der westeuropäischen Länder, die Energieversorgung<br />
im Interesse der Versorgungssicherheit zu diversifizieren und die<br />
Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern (siehe Beilage «Tabellen und<br />
Grafiken»).<br />
14 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
EUROPÄISCHE <strong>ERDGAS</strong>VORRÄTE<br />
Die in Westeuropa vorhandenen <strong>Erdgas</strong>vorräte ermöglichen den<br />
westeuropäischen Staaten einen hohen Grad der Eigenversorgung.<br />
Die grössten europäischen <strong>Erdgas</strong>vorräte befinden sich vor der norwegischen<br />
Küste (Troll-Feld mit 1’300 Milliarden Kubikmeter), in den<br />
Niederlanden und Grossbritannien. Da Norwegen bis heute selbst<br />
kein <strong>Erdgas</strong> verbraucht, geht die gesamte Fördermenge in den<br />
Export. Grossbritannien, Norwegen und die Niederlande sind die<br />
grössten europäischen <strong>Erdgas</strong>produzenten in Westeuropa.<br />
Bei gleichbleibender Jahresförderung reichen die sicher gewinnbaren<br />
westeuropäischen <strong>Erdgas</strong>vorräte von 5’300 Milliarden Kubikmeter<br />
für rund 20 Jahre, wobei mit zusätzlich gewinnbaren Ressourcen in<br />
der Grössenordnung von 6’000 Milliarden Kubikmeter gerechnet<br />
wird. Die statische Reichweite der gesamten westeuropäischen<br />
<strong>Erdgas</strong>reserven ist somit auf über 40 Jahre zu veranschlagen (siehe<br />
Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
<strong>ERDGAS</strong> IM EU-BINNENMARKT<br />
Nach langjährigen Verhandlungen trat am 10. August 1998 die EU-<br />
Gasrichtlinie 98/30 in Kraft. Die EU-Mitgliedstaaten wurden verpflichtet,<br />
diese Direktive, deren Ziel die Verwirklichung eines wettbewerbsorientierten<br />
<strong>Erdgas</strong>marktes war, innert zwei Jahren ab Inkrafttreten,<br />
in nationales Recht umzusetzen.
Die Richtlinie brachte eine Reihe von Neuerungen:<br />
Netzzugang für Dritte: Die Richtlinie stellte zwei Systeme zur<br />
Wahl, nämlich den Netzzugang auf Vertragsbasis und den geregelten<br />
Netzzugang. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten entschied sich für<br />
die Anwendung des geregelten Netzzugangs und somit für einen<br />
Regulator. Bei diesem Vorgehen besteht das Netzzugangsrecht auf<br />
der Basis publizierter Tarife.<br />
Schrittweise Marktöffnung: Die Richtlinie sah eine etappenweise<br />
Öffnung der <strong>Erdgas</strong>märkte in drei Schritten bis 2008 vor. So sollte der<br />
<strong>Erdgas</strong>industrie die Möglichkeit geboten werden, sich dem neuen<br />
Umfeld auf geordnete Weise anpassen zu können.<br />
Unbundling: Zudem sah die Richtlinie vor, dass integrierte<br />
<strong>Erdgas</strong>unternehmen in ihrer internen Buchführung<br />
für die Aktivitäten Transport, Verteilung<br />
und Speicherung je eine separate Rechnung führen<br />
müssen.<br />
In einem Bericht über den Stand der Liberalisierung<br />
kam die EU-Kommission bereits 1999 zum<br />
Schluss, dass das erklärte Ziel einer Liberalisierung<br />
von 33 Prozent des gesamten <strong>Erdgas</strong>marktes<br />
in der EU bis zum Jahre 2008 möglichst schon viel früher<br />
erreicht werden sollte.<br />
Zur Beschleunigung des Liberalisierungsprozesses hat das Europäische<br />
Parlament am 4. Juni 2003 mehrere Richtlinien verabschiedet,<br />
welche die EU-Staaten zur raschen Öffnung der Elektrizitätsund<br />
<strong>Erdgas</strong>märkte verpflichten. Demnach sollen ab 1. Juli 2007 alle<br />
privaten Strom- und Gaskunden in der Europäischen Union ihre<br />
Anbieter frei wählen können, Gewerbekunden schon drei Jahre früher.<br />
Neben dem Öffnungsfahrplan enthalten die neuen Richtlinien zahlreiche<br />
Regelungen zum Schutz der Endkunden mit weitgehenden<br />
Auflagen zur Gewährleistung des Service public.<br />
Bis zum 1. Juli 2004 sind unter anderem folgende Vorgaben in den<br />
Mitgliedstaaten umzusetzen:<br />
Allen Gewerbekunden muss eine freie Wahl des Strom- und<br />
Gaslieferanten möglich sein. Ab 1. Juli 2007 muss diese Auswahlfreiheit<br />
auch für private Kunden umgesetzt sein.<br />
In allen Mitgliedstaaten müssen Regulierungsstellen<br />
mit einem EU-einheitlichen Mindestsatz<br />
von Aufgaben eingerichtet werden. Diese<br />
Stellen prüfen und genehmigen Tarifierungsmethoden<br />
für den Netzzugang vor ihrem Inkrafttreten, nehmen<br />
Monitoring-Aufgaben wahr und fungieren als<br />
Streitbeilegungsstelle bei Beschwerden gegen Netzbetreiber.<br />
Der Netzbereich muss von den übrigen Aktivitäten der Strom- und<br />
Gasversorger gesellschaftsrechtlich getrennt werden, um mehr<br />
Transparenz zu gewährleisten und Diskriminierungen gegenüber<br />
anderen Strom- und Gasanbietern wirksam kontrollieren zu können.<br />
Für Verteilnetzbetreiber gilt diese Pflicht ab 1. Juli 2007 und nur,<br />
wenn sie mehr als 100’000 Kunden versorgen.<br />
In welchem Mass die Konsumenten von der Möglichkeit der freien<br />
Wahl des Lieferanten bei vollständiger Marktöffnung Gebrauch<br />
machen, ist noch offen. Von denjenigen Kunden, die diese Möglichkeit<br />
bereits haben, hat nur eine vergleichsweise geringe Zahl einen<br />
Lieferantenwechsel vollzogen.<br />
Die EU bestimmt die Energiepolitik Europas.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 15
Die EU-Kommission setzt sich gegenwärtig verstärkt auch mit<br />
Fragen der Versorgungssicherheit auseinander. Aus diesem<br />
Grunde beurteilt sie heute die langfristigen Lieferverträge<br />
wesentlich positiver als noch zu Beginn der<br />
Liberalisierungsdiskussionen und wünscht ausdrücklich,<br />
dass solche Verträge auch in Zukunft<br />
in der <strong>Erdgas</strong>versorgung eine wichtige Rolle<br />
spielen.<br />
Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, ist sie<br />
rechtlich nicht verpflichtet, die Richtlinie anzuwenden.<br />
Angesichts ihrer umfassenden Integration<br />
in das europäische <strong>Erdgas</strong>verbundsystem und der angestrebten<br />
Revitalisierung der Wirtschaft wird die Schweiz nachziehen. Die<br />
Gaswirtschaft erwartet, dass Lösungen gefunden werden, welche<br />
die schweizerischen Gegebenheiten berücksichtigen.<br />
EUROPÄISCHES TRANSPORTNETZ<br />
Seit den 60er-Jahren nutzen die westeuropäischen Gasgesellschaften<br />
das wachsende internationale <strong>Erdgas</strong>angebot. Dafür wurde in den<br />
vergangenen Jahrzehnten ein engmaschiges <strong>Erdgas</strong>-Transportnetz<br />
Moderne Anlage für die sichere Gasversorgung.<br />
16 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
von rund 175’000 km Länge ausgebaut. Das europäische <strong>Erdgas</strong>verbundsystem<br />
reicht von der Nord- und Ostsee bis zum Mittelmeer<br />
und vom Atlantik bis nach Osteuropa und Sibirien. Es ermöglicht die<br />
Nutzung der Vorkommen in verschiedenen Fördergebieten, die Diversifikation<br />
der Transportwege sowie den internationalen Mengenabtausch<br />
bei allfälligen Lieferengpässen und wird laufend weiter ausgebaut.<br />
Neben dem Transport durch Ferngasleitungen wird <strong>Erdgas</strong><br />
auch hochverdichtet als LNG (Liquefied<br />
Natural Gas) in flüssiger Form in Tankern zu<br />
einer wachsenden Zahl von Spezialterminals in<br />
Europa befördert (siehe Beilage «Tabellen und<br />
Grafiken»).<br />
INTERNATIONALE PARTNERSCHAFT<br />
Der kontinentweite <strong>Erdgas</strong>verbund ist das Ergebnis<br />
intensiver grenzüberschreitender Zusammenarbeit innerhalb<br />
der europäischen <strong>Erdgas</strong>wirtschaft. Grosse, international<br />
tätige Unternehmen beschaffen das <strong>Erdgas</strong> und geben es an ihre<br />
Abnehmer weiter. Leistungsfähige Transportsysteme und die notwendige<br />
Infrastruktur (Verteilnetze, Speicheranlagen, Druckreduzierund<br />
Messstationen) ermöglichen eine kosteneffiziente Lieferung von<br />
<strong>Erdgas</strong>. Die internationale Verflechtung der Interessen von Produzenten,<br />
Lieferanten und Abnehmern trägt entscheidend zur Sicherheit<br />
und Wirtschaftlichkeit der <strong>Erdgas</strong>versorgung bei.<br />
EUROPA DES <strong>ERDGAS</strong>ES<br />
Das Europa des <strong>Erdgas</strong>es ist längst Realität; die schweizerische<br />
<strong>Erdgas</strong>wirtschaft ist fest darin integriert. 1990 wurde «Eurogas» mit<br />
Sitz in Brüssel gegründet, eine Vereinigung zur Förderung der wissenschaftlichen,<br />
wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Entwicklung<br />
der europäischen <strong>Erdgas</strong>wirtschaft. Sie vertritt die gemeinsamen<br />
Interessen gegenüber internationalen Organisationen, insbesondere<br />
der Europäischen Union, und fördert den Informations- und<br />
Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern. In «Eurogas» vertreten<br />
sind Spitzenverbände und Unternehmungen der west- und mitteleuropäischen<br />
Gaswirtschaft.
EIGENSCHAFTEN<br />
VON <strong>ERDGAS</strong>
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong> DER NATÜRLICHE BRENNSTOFF<br />
NATÜRLICHES PRODUKT<br />
<strong>Erdgas</strong> ist ein ungiftiges Naturprodukt. Es besteht zu über 90 Prozent<br />
aus der brennbaren Kohlenwasserstoff-Verbindung Methan (CH4 ),<br />
einem farb- und geruchlosen Gas, das auch bei der Gärung von<br />
Biomasse unter Luftabschluss (beispielsweise in Reisfeldern, in<br />
Abfalldeponien und Kläranlagen) entsteht. <strong>Erdgas</strong> muss je nach<br />
Beschaffenheit nach der Förderung lediglich von Fremdstoffen gereinigt<br />
und getrocknet, jedoch nicht raffiniert werden.<br />
HOHER WIRKUNGSGRAD<br />
<strong>Erdgas</strong> lässt sich als Primärenergie praktisch so einsetzen, wie es<br />
gefördert wird. Gewinnung, Reinigung und Transport von <strong>Erdgas</strong><br />
benötigen nur wenig Energie. Sein Wirkungsgrad als Primärenergie<br />
liegt deshalb über 90 Prozent. Ausser Strom aus Wasserkraft erreicht<br />
kein anderer Energieträger einen solchen Wert.<br />
Terminal für den Umschlag von verflüssigtem <strong>Erdgas</strong>.<br />
18 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
VERFLÜSSIGTES <strong>ERDGAS</strong><br />
<strong>Erdgas</strong> lässt sich bei Abkühlung auf rund -160°C verflüssigen, wobei<br />
sich sein Volumen auf rund 1 /600 reduziert. Dadurch eignet sich<br />
Liquefied Natural Gas (LNG) für den interkontinentalen Transport in<br />
Spezialtankern und für die Lagerung in gut isolierten Tanks.<br />
IDEALE WÄRMEENERGIE<br />
Andere Brenn- und Treibstoffe müssen zuerst in einen gasförmigen<br />
Zustand gebracht werden, damit sie brennen. <strong>Erdgas</strong> wird bereits im<br />
Idealzustand gewonnen und steht direkt ab Leitung in brennbarer<br />
Form zur Verfügung. <strong>Erdgas</strong> ist demnach von Natur aus eine ideale<br />
Wärmeenergie.
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong> DIE SPARSAME ENERGIE<br />
Energiesparen heisst nicht nur «weniger brauchen», sondern auch<br />
«besser ausnützen».<br />
OPTIMALE ENERGIENUTZUNG<br />
<strong>Erdgas</strong> wird so verwendet, wie es aus der Leitung<br />
kommt. Als direkt nutzbare Primärenergie<br />
erlaubt <strong>Erdgas</strong> gegenüber Sekundärenergien<br />
(Heizöl, Strom), deren Aufbereitung mit Umwandlungsprozessen<br />
und entsprechenden Verlusten<br />
verbunden ist, erhebliche Energieeinsparungen.<br />
Entsprechend kleiner ist beim <strong>Erdgas</strong><br />
der Primärenergiebedarf für die gleiche Energieleistung.<br />
Da <strong>Erdgas</strong> in gasförmigem Zustand vorliegt, sind aufwändige und<br />
kostspielige Einrichtungen zur Vorwärmung und Vergasung, wie sie<br />
für andere Brennstoffe erforderlich sind, nicht nötig. <strong>Erdgas</strong> verbrennt<br />
als gasförmiger Brennstoff nahezu vollständig, dadurch kann<br />
sein Energieinhalt optimal genutzt werden.<br />
WIRTSCHAFTLICH, PLATZSPAREND <strong>UND</strong> BEQUEM<br />
Die Anwendung von <strong>Erdgas</strong> ist rationell und verbrennungstechnisch<br />
problemlos. Die bei korrekt eingestellten Feuerungseinrichtungen<br />
russ- und rauchfreie Verbrennung reduziert den Aufwand für<br />
Wartung und Unterhalt. Da keine Tank- oder Lagerräume für die<br />
Vorratshaltung beim Verbraucher nötig sind, entfallen auch die<br />
damit verbundenen Investitions- und Nebenkosten. Moderne<br />
<strong>Erdgas</strong>heizungen sind extrem platzsparend und können überall im<br />
Haus <strong>–</strong> vom Keller über den Korridor bis zum Dachstock <strong>–</strong> installiert<br />
werden. Anstelle eines gemauerten Kamins genügt oft ein kosten-<br />
günstiges Abgasrohr. Zudem kommt <strong>Erdgas</strong><br />
automatisch rund um die Uhr ins Haus; es entstehen<br />
keine Umtriebe für Bestellung und<br />
Lieferung, die Bezahlung erfolgt erst nach dem<br />
Verbrauch.<br />
ENERGIESPARENDE TECHNOLOGIEN<br />
<strong>Erdgas</strong> ist aufgrund seiner chemisch-physikalischen Eigenschaften<br />
besonders geeignet für energiesparende Technologien, zum Beispiel<br />
für die auf der Nutzung der Abgaswärme beruhende Kondensationstechnik,<br />
mit der sich im Vergleich zu konventionellen<br />
Heizungsanlagen bis zu 15 Prozent Energie einsparen lassen. Energie<br />
sparen lässt sich auch mit modulierenden Brennern. Sie passen ihre<br />
Leistung stufenlos dem Bedarf an, statt immer auf Hochtouren zu<br />
laufen und ständig ein- und auszuschalten, wie dies bei herkömmlichen<br />
Brennern der Fall ist. Auch bei der mit hohem Wirkungsgrad<br />
arbeitenden gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Nutzwärme in<br />
sogenannten Blockheizkraftwerken werden vorzugsweise Gasmotoren<br />
oder -turbinen eingesetzt. <strong>Erdgas</strong> bietet ferner bei der Erzeugung<br />
von Prozesswärme in Industrie und Gewerbe besondere Vorteile, weil<br />
die Wärme der praktisch schwefelfreien Abgase problemlos zurückgewonnen<br />
werden kann. Zudem lässt sich <strong>Erdgas</strong> wirtschaftlich mit<br />
anderen Energien kombinieren, etwa mit Heizöl in Zweistoff-Feuerungen<br />
oder mit Sonnenenergie zur Wassererwärmung. Auch aufbereitetes<br />
Biogas aus Abfallvergärungsanlagen kann in das <strong>Erdgas</strong>netz<br />
eingespeist und für den Antrieb schadstoffarmer Gasfahrzeuge<br />
verwendet werden.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 19
<strong>ERDGAS</strong> <strong>UND</strong> UMWELT<br />
Umweltschutz ist eine umfassende Aufgabe. Dabei geht es nicht nur<br />
um die Reinhaltung der Luft und den Schutz von Böden und Gewässern,<br />
sondern auch um die Erhaltung der Landschaft, die Lösung<br />
von Abfall- und Entsorgungsproblemen und die Reduktion energieund<br />
emissionsintensiver Transporte.<br />
LANDSCHAFTS-, BODEN- <strong>UND</strong> GEWÄSSERSCHUTZ<br />
<strong>Erdgas</strong> wird unterirdisch, ohne Beeinträchtigung der Landschaft und<br />
ohne Belastung der Verkehrswege, vom Bohrloch zum Verbraucher<br />
befördert. Es enthält keine Stoffe, die für Menschen, Tiere oder<br />
Pflanzen giftig sind und Böden oder Gewässer verunreinigen könnten.<br />
Für den Bau von <strong>Erdgas</strong>-Transportleitungen braucht es eine Umweltverträglichkeitsprüfung.<br />
Bei der Verlegung werden die Bodenschutz-Richtlinien<br />
des Bundes beachtet, die zum Schutz der Ertragsfähigkeit<br />
des landwirtschaftlich genutzten Bodens und der Erhaltung<br />
der standorttypischen Vegetation erlassen wurden.<br />
20 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
ÖKOLOGISCHE VORTEILE VON <strong>ERDGAS</strong><br />
• keine emissionsverursachenden Umwandlungsprozesse<br />
• unterirdischer Transport, also kein Schwerverkehr (kein Lärm,<br />
keine Abgase)<br />
• ungiftig für Mensch und Tier<br />
• ungiftig für Böden und Gewässer<br />
• nahezu schwefelfrei<br />
• frei von organisch gebundenem Stickstoff<br />
• schadstoffarme Verbrennung<br />
• vergleichsweise niedrige CO2-Emissionen • kein Staub<br />
• kein Russ<br />
• keine Schwermetalle<br />
• keine Entsorgungsprobleme
LUFTREINHALTUNG<br />
<strong>Erdgas</strong> verbrennt bei korrekt eingestelltem Brenner ohne Russ und<br />
Staub.<br />
Im Unterschied zu den anderen fossilen Brennstoffen enthält <strong>Erdgas</strong><br />
praktisch keinen Schwefel. Der Schwefeldioxidgehalt (SO2 ) der Abgase<br />
von Gasfeuerungen ist daher verschwindend gering. Die<br />
Verwendung von <strong>Erdgas</strong> anstelle von Heizöl erspart unserer Umwelt<br />
jedes Jahr eine Emissionsfracht von einigen Tausend Tonnen SO2 .<br />
Im Gegensatz zum Heizöl weist <strong>Erdgas</strong> keinen organisch gebundenen<br />
Stickstoff auf. Bei gleichen Verbrennungsbedingungen produziert<br />
es deshalb entsprechend weniger Stickoxide (NOx ). Wegen des<br />
Gehalts an gebundenem Stickstoff im Heizöl (25 mg/kg bis 350<br />
mg/kg) gilt in der Luftreinhalteverordnung des Bundes (LRV) für<br />
Ölfeuerungen ein um 50 Prozent höherer Stickoxid-Grenzwert (120<br />
mg/m3 Abgas) als für Gasfeuerungen (80 mg/m3 Abgas).<br />
TREIBHAUSEFFEKT<br />
<strong>Erdgas</strong> hat von allen fossilen Energien den<br />
geringsten Gehalt an Kohlenstoff (C) und den<br />
höchsten Anteil an Wasserstoff (H). Bezogen<br />
auf den gleichen Energiegehalt werden bei der<br />
Verbrennung von <strong>Erdgas</strong> etwa 25 Prozent weniger<br />
Kohlendioxid (CO2 ) produziert als bei der Verbrennung<br />
von Heizöl. CO2 hat nach den heutigen Erkenntnissen<br />
einen wesentlichen Einfluss auf die Erwärmung der Erdatmosphäre.<br />
Der Einsatz von <strong>Erdgas</strong> anstelle anderer fossiler Energien trägt<br />
zur Entlastung der Atmosphäre von CO2 und damit zur Milderung<br />
des Treibhauseffekts bei. Das gilt auch unter Berücksichtigung der<br />
geringen Methanverluste aus <strong>Erdgas</strong>leitungen, die in der Schweiz<br />
wenige Promille des landesweiten <strong>Erdgas</strong>absatzes ausmachen.<br />
Werden alle Emissionen von treibhauswirksamen Gasen auf der<br />
gesamten Versorgungskette von <strong>Erdgas</strong> und Heizöl zusammengezählt<br />
und auf die Treibhauswirksamkeit umgerechnet, schneidet<br />
<strong>Erdgas</strong> rund 25 Prozent besser ab als Heizöl. Für neue Leitungen oder<br />
Hochdruckleitungen sieht die Bilanz noch besser aus (siehe Beilage<br />
«Tabellen und Grafiken»).<br />
Prüfung von Gasgeräten beim SVGW.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 21
<strong>ERDGAS</strong> <strong>UND</strong> SICHERHEIT<br />
Jeder Energieträger birgt auch Risiken. Die Gasversorgungen unternehmen<br />
grosse Anstrengungen, um die Sicherheit beim Umgang mit<br />
<strong>Erdgas</strong> zu gewährleisten:<br />
• Die <strong>Erdgas</strong>leitungen liegen geschützt unter der Erde und werden<br />
durch Mess- und Regelanlagen ständig überwacht.<br />
• Die korrosionsgeschützten Leitungen und Anlagen werden von<br />
den Gasversorgungen periodisch kontrolliert und wenn nötig<br />
saniert.<br />
• <strong>Erdgas</strong> ist ungiftig. Von Natur aus geruchlos, wird es künstlich mit<br />
dem typischen Gasgeruch odoriert, damit austretendes Gas sofort<br />
wahrgenommen wird.<br />
• Arbeiten an Gasversorgungseinrichtungen und Installationen von<br />
Gasapparaten dürfen nur von gastechnisch geschulten Fachleuten<br />
ausgeführt werden.<br />
• Bau und Betrieb von Gasleitungen und Nebenanlagen sind durch<br />
strenge Gesetze, Verordnungen und technische Richtlinien geregelt.<br />
• Gasgeräte müssen eine Baumusterprüfung bestehen, bevor sie in<br />
den Handel kommen. Jede Installation wird von einem Installationskontrolleur<br />
geprüft.<br />
• Die Gasversorgungen und Gerätelieferanten bieten Wartungsund<br />
Reparaturdienste an. Bei jeder Gasversorgung steht rund um<br />
die Uhr ein Pikettdienst in Bereitschaft.<br />
22 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
Dank diesen vielfältigen Vorkehrungen ist <strong>Erdgas</strong> bei Einhaltung der<br />
Vorschriften eine sichere Energie. Gemäss Unfallstatistik stehen in<br />
der Schweiz im langjährigen Mittel jährlich lediglich ein bis zwei der<br />
über zweitausend tödlichen Unfälle in Zusammenhang mit leitungsgebundenem<br />
Gas. Das Risiko ist somit erheblich geringer als etwa<br />
beim Sport oder im Strassenverkehr.<br />
Regelmässige Kontrolle der Hochdruckleitungen.
ZUKUNFTSWEISENDE ENTWICKLUNGEN<br />
Bei der Entwicklung immer schadstoffärmerer<br />
und sparsamerer <strong>Erdgas</strong>geräte hat in den letzten<br />
Jahren ein eigentlicher Technologiesprung<br />
stattgefunden: Der Trend geht in Richtung<br />
flammenloser Brenner, die <strong>Erdgas</strong> auf chemischem oder elektrochemischem<br />
Weg praktisch schadstofffrei in Wärme umwandeln. Die<br />
Möglichkeiten von <strong>Erdgas</strong> sind damit allerdings technisch noch<br />
nicht ausgereizt. Weltweit wird auch an der Weiterentwicklung und<br />
Vermarktung erdgasbetriebener Fahrzeuge gearbeitet.<br />
BRENNSTOFFZELLEN<br />
Eine Brennstoffzelle funktioniert ähnlich wie eine Batterie. Sie wandelt<br />
<strong>Erdgas</strong> zusammen mit Sauerstoff in einem elektrochemischen<br />
Prozess in Strom und Wärme um. Dabei entstehen extrem wenig<br />
Schadstoffe und wesentlich weniger CO2 als in konventionellen<br />
Verbrennungsanlagen. Der elektrische Wirkungsgrad ist erheblich<br />
höher als bei vergleichbaren herkömmlichen Systemen. Zudem erzeugt<br />
der Prozess weder Vibrationen noch Lärm. Brennstoffzellen<br />
sind innovative Entwicklungen, die künftig die heutigen Blockheizkraftwerke<br />
und sogar grosse thermische Kraftwerke ersetzen könnten.<br />
Sie werden auch für den kleineren Strom- und Wärmebedarf in<br />
Wohnbauten und für den Antrieb von Fahrzeugen entwickelt.<br />
Die schweizerische Gaswirtschaft hat die Entwicklung der Hexis-<br />
Hochtemperatur-Brennstoffzelle durch den Technologiekonzern<br />
Sulzer in Winterthur mit namhaften Beiträgen aus ihrem Forschungs-,<br />
Entwicklungs- und Förderungsfonds FOGA unterstützt und beteiligt<br />
sich am Feldtest-Programm.<br />
Zellstapel der Brennstoffzelle von Sulzer Hexis.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 23
<strong>ERDGAS</strong>FAHRZEUGE<br />
Weltweit gibt es über eine Million erdgasbetriebener Fahrzeuge. Sie<br />
fahren nachweislich besonders schadstoffarm. In der Schweiz leisteten<br />
unter anderen die Compagnie Industrielle et Commerciale du<br />
Gaz in Vevey in Zusammenarbeit mit der ETH Lausanne, die Fachhochschule<br />
Zentralschweiz und die Eidgenössische Materialprüfungsund<br />
Forschungsanstalt EMPA im Bereich Personenwagen wesentliche<br />
Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die schweizerische Gaswirtschaft<br />
unterstützt die Entwicklung und Verbreitung von <strong>Erdgas</strong>-<br />
<strong>Erdgas</strong>-Tankstelle für Busse und Autos in Vaduz.<br />
24 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
fahrzeugen und -betankungsanlagen mit Beiträgen aus ihrem<br />
Forschungs-, Entwicklungs- und Förderungsfonds FOGA. Sie nimmt<br />
Koordinationsaufgaben wahr und beteiligt sich an Pilot- und Förderprojekten.<br />
Die Schweizer Gaswirtschaft hat sich zum Ziel gesetzt, bis<br />
2006 rund 100 Tankstellen für <strong>Erdgas</strong>fahrzeuge entlang der Hauptverkehrsachsen<br />
und in den dicht besiedelten Regionen zu bauen. Um<br />
<strong>Erdgas</strong> und Biogas als Treibstoff gesamtschweizerisch erfolgreich im<br />
Markt einzuführen, wurde 2003 die gasmobil <strong>AG</strong> gegründet. Sie<br />
koordiniert das nationale Marketing und will Flottenbetreiber zum<br />
Umsteigen auf <strong>Erdgas</strong> motivieren. Zudem bietet sie technische Unterstützung<br />
beim Ausbau eines flächendeckenden Tankstellennetzes<br />
und bei der Zulassung von <strong>Erdgas</strong>fahrzeugen.
DIE<br />
SCHWEIZERISCHE<br />
GASWIRTSCHAFT
HISTORISCHER RÜCKBLICK<br />
BOOM DER GRÜNDERJAHRE<br />
1843 wurde in Bern das erste schweizerische Gaswerk in Betrieb<br />
genommen. In rascher Folge entstanden in der zweiten Hälfte des<br />
19. Jahrhunderts in zahlreichen weiteren Städten und Gemeinden<br />
lokale Gaswerke, in denen durch Destillation von Kohle und Holz das<br />
zur Beleuchtung von Strassen, Fabriken und Wohnhäusern eingesetzte<br />
Leuchtgas produziert wurde. Die Gasbeleuchtung stellte damals<br />
gegenüber der herkömmlichen Beleuchtung mit Kerzen und Öllampen<br />
einen enormen Fortschritt dar. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts<br />
hielt das Gas auch in der Küche Einzug, wo es das Holz ablöste.<br />
Der Absatz von Leuchtgas ging mit dem Aufkommen der elektrischen<br />
Beleuchtung allmählich zurück. Bis zum Ausbruch des Ersten<br />
Weltkrieges wurden in der Schweiz 100 Gaswerke gegründet, deren<br />
wirtschaftlicher Erfolg nicht nur auf dem Gasabsatz, sondern auch<br />
auf dem Verkauf von Koks und Teer als Nebenprodukte der Gaserzeugung,<br />
beruhte. Die Gasproduktion war damals sehr arbeitsintensiv<br />
<strong>–</strong> 1938 beispielsweise beschäftigte die Gasindustrie rund 3’500<br />
Mitarbeiter, mehr als doppelt so viele wie heute.<br />
26 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
SCHWIERIGE ZEITEN<br />
Von einer Erholungsphase in der Zwischenkriegszeit abgesehen,<br />
durchlief die Gaswirtschaft vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis<br />
zur Einführung von <strong>Erdgas</strong> Anfang der 70er-Jahre schwierige Zeiten.<br />
Da die Schweiz nicht über nennenswerte abbauwürdige Kohlevorkommen<br />
verfügt, gerieten die Gaswerke in den beiden Weltkriegen<br />
infolge der Verknappung und enormen Verteuerung der<br />
importierten Kohle in arge wirtschaftliche Bedrängnis. Seit den 30er-<br />
Jahren erwuchs ihnen im Bereich des Kochens und der Warmwasserproduktion<br />
zunehmend Konkurrenz durch die Elektrizität, die auf<br />
grosse Reserven billiger Wasserkraft zurückgreifen konnte. Als weiterer<br />
Konkurrent begann in den 50er-Jahren das Heizöl den Wärmemarkt<br />
zu erobern. Dadurch wurde auch der Absatz von Koks immer<br />
Gasproduktion aus Kohle im Gaswerk.
schwieriger. Mit der Umstellung der Gasproduktion auf kostengünstigere<br />
Methoden (Propan-Luftmischanlagen, Leichtbenzin-Spaltanlagen)<br />
und dem gleichzeitigen Aufbau grosser Fernversorgungs- und<br />
Verbundsysteme mit zentraler Produktion erzielte man in den 60er-<br />
Jahren zwar eine Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit. Trotzdem<br />
sank der Gasanteil am schweizerischen Energieverbrauch bis Ende<br />
der 60er-Jahre auf weniger als 2 Prozent, während der Anteil der<br />
Ölprodukte auf rund 80 Prozent stieg.<br />
ÜBERGANG ZUR <strong>ERDGAS</strong>WIRTSCHAFT<br />
Die Einführung von <strong>Erdgas</strong> in der Schweiz zu Beginn der 70er-Jahre<br />
stellte die Gaswirtschaft auf eine völlig neue Grundlage. Der Bezug<br />
dieses Energieträgers aus einem internationalen Leitungsnetz ermöglichte<br />
den Verzicht auf lokale, kosten- und arbeitsintensive Gas-Produktionsanlagen.<br />
So existieren nur noch drei sogenannte Inselwerke,<br />
die nicht an das <strong>Erdgas</strong>netz angeschlossen sind und ihre Abnehmer<br />
mit einem Flüssiggas-Luft-Gemisch versorgen (Einsiedeln, Interlaken,<br />
Schwyz). Die Ölkrisen der 70er-Jahre und das wachsende Umweltbewusstsein<br />
schufen günstige Rahmenbedingungen für die Akzeptanz<br />
des umweltschonenden <strong>Erdgas</strong>es auf dem Wärmemarkt.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 27
STRUKTUR DER SCHWEIZERISCHEN<br />
GASWIRTSCHAFT<br />
AUFBAU VON DER BASIS<br />
Aufgrund der historischen Entwicklung ist die schweizerische Gaswirtschaft<br />
«von unten», das heisst von den Städten und Gemeinden<br />
her, aufgebaut. Von wenigen privaten Gesellschaften abgesehen,<br />
sind die rund 100 Endverteiler traditionell Kommunalbetriebe, denen<br />
oft auch die Elektrizitäts-, Wasser- oder Fernwärmeversorgung übertragen<br />
ist. Im Hinblick auf die Marktöffnung geht der Trend bei diesen<br />
öffentlich-rechtlichen Unternehmen zur Verselbständigung und<br />
Konzentration (siehe Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
Die lokalen Gasversorgungen sind in einer der vier Regionalgesellschaften<br />
zusammengeschlossen, von denen sie das <strong>Erdgas</strong> beziehen.<br />
Die Regionalgesellschaften ihrerseits sind auf nationaler Ebene<br />
Aktionäre der 1971 gegründeten Swissgas, Schweizerische Aktien-<br />
28 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
gesellschaft für <strong>Erdgas</strong>. Sie beschafft den überwiegenden Teil des<br />
<strong>Erdgas</strong>es und transportiert es zu den Regionalgesellschaften. Die<br />
politischen, wirtschaftlichen und imagebildenden Interessen der<br />
Branche nimmt als Dachorganisation der Verband der Schweizerischen<br />
Gasindustrie (VSG) wahr, während sich der Schweizerische<br />
Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) mit den wissenschaftlichen<br />
und technischen Aspekten befasst.
ORGANISATION DER SCHWEIZERISCHEN<br />
GASWIRTSCHAFT<br />
ZENTRALORGANISATIONEN DER<br />
GASWIRTSCHAFT<br />
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG),<br />
Grütlistrasse 44 / Postfach, 8027 <strong>Zürich</strong><br />
Gegründet 1920<br />
Zweck/Aufgaben:<br />
• Wahrung der branchen- und energiepolitischen Interessen der<br />
schweizerischen Gaswirtschaft<br />
• Imagebildende Kommunikation für das Produkt <strong>Erdgas</strong><br />
• Allgemeine Marketing- und Meinungsforschung sowie Verkaufsunterstützung<br />
für die Gasversorgungsunternehmen (GVU)<br />
• Öffentlichkeitsarbeit sowie Unterstützung der GVU<br />
• Behandlung technischer Fragen, soweit relevant für Energiepolitik<br />
und Marketing (in Zusammenarbeit mit dem SVGW)<br />
• Förderung der Aus- und Weiterbildung (soweit nicht fachtechnisch)<br />
• Gewährung von Krediten als Trägerorganisation des FOGA<br />
• Mitwirkung in internationalen Organisationen<br />
• Beschaffung von Rohstoffen für die Inselwerke<br />
Schweizerischer Verein des Gas- und<br />
Wasserfaches (SVGW),<br />
Grütlistrasse 44 / Postfach, 8027 <strong>Zürich</strong><br />
Gegründet 1873<br />
Zweck/Aufgaben:<br />
• Förderung des Gas- und Wasserfachs in technischer und technisch-wissenschaftlicher<br />
Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung<br />
der Sicherheit, der Hygiene und einer zuverlässigen Versorgung<br />
• Ausarbeitung von technischen Vorschriften wie Richtlinien, Leitsätzen,<br />
Empfehlungen sowie Mitarbeit bei der europäischen Normierung<br />
• Weiterbildung und Förderung der Berufsausbildung im Gas- und<br />
Wasserfach<br />
• Zertifizierung und Prüfung von Apparaten und Bauteilen für Gasund<br />
Wasserversorgungsanlagen und -installationen<br />
• Kontrolle von gasführenden Rohrleitungsanlagen<br />
• Förderung der Arbeitssicherheit<br />
• Technische Beratung und Auskünfte für Mitglieder, Behörden,<br />
Wirtschaft und Öffentlichkeit<br />
• Studien, Expertisen und Gutachten bei Stör- und Schadenfällen<br />
• Publikation der Fachzeitschrift gwa (Gas, Wasser, Abwasser)<br />
• Qualitätssicherung in Versorgungsunternehmen<br />
• Förderung neuer <strong>Erdgas</strong>anwendungen und neuer Technologien<br />
• Administrative und fachliche Begleitung des FOGA<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 29
GESELLSCHAFTEN DER <strong>ERDGAS</strong>VERSORGUNG<br />
SWISSGAS, Schweizerische Aktiengesellschaft für <strong>Erdgas</strong>,<br />
Grütlistrasse 44 / Postfach, 8027 <strong>Zürich</strong><br />
Gegründet 1971<br />
Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Regionalgesellschaften:<br />
• <strong>Erdgas</strong>beschaffung und Versorgung der Schweiz mit <strong>Erdgas</strong> in<br />
jeder Form<br />
• Wahrung der Interessen der Branche im In- und Ausland.<br />
Aktionäre: EGO, GVM, Gaznat (je 25,98 %), EGZ (5,61 %)<br />
und VSG (16,45 %).<br />
Transitgas <strong>AG</strong>,<br />
Baumackerstrasse 46, 8050 <strong>Zürich</strong><br />
Gegründet 1971<br />
Aufgaben:<br />
• <strong>Erdgas</strong>transport von der Grenze Deutschland <strong>–</strong> Schweiz bei Wallbach<br />
(<strong>AG</strong>) und Frankreich <strong>–</strong> Schweiz bei Rodersdorf (SO) bis zum<br />
Griespass (VS) an der Grenze Schweiz <strong>–</strong> Italien<br />
• Bau und Betrieb des entsprechenden <strong>Erdgas</strong>-Transportsystems;<br />
entlang der Hauptleitung bestehen mehrere Übergabestationen<br />
für Gasbezüge der Schweiz.<br />
Aktionäre: Swissgas (51%), Eni S.p.A. (46 %) und Ruhrgas <strong>AG</strong> (3 %).<br />
30 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
Gasverbund Mittelland <strong>AG</strong> (GVM),<br />
Untertalweg 32, Postfach 360, 4144 Arlesheim<br />
Gegründet 1964<br />
<strong>Erdgas</strong> Ostschweiz <strong>AG</strong> (EGO),<br />
Bernerstrasse, 8010 <strong>Zürich</strong><br />
Gegründet 1966<br />
Gaznat S.A., Société pour l’approvisionnement et le transport<br />
du gaz naturel en Suisse romande,<br />
Av. Géneral-Guisan 28, 1800 Vevey<br />
Gegründet 1968<br />
<strong>Erdgas</strong> Zentralschweiz <strong>AG</strong> (EGZ),<br />
Industriestrasse 6, 6002 Luzern<br />
Gegründet 1973<br />
Zollmessstation in Zuzgen (<strong>AG</strong>).
<strong>ERDGAS</strong>BESCHAFFUNG<br />
<strong>UND</strong> VERSORGUNGSSICHERHEIT<br />
LANGFRISTIGE VERSORGUNG<br />
Die Beschaffung von <strong>Erdgas</strong> ist mit langfristigen Lieferverträgen<br />
sichergestellt, die in der Regel über Zeiträume von 20<strong>–</strong>25<br />
Jahren abgeschlossen werden.<br />
BESCHAFFUNGSVERTRÄGE<br />
Verträge der Swissgas decken rund drei Viertel<br />
des schweizerischen <strong>Erdgas</strong>bedarfs. Sie wurden<br />
mit der deutschen Ruhrgas <strong>AG</strong> (längste Laufzeit<br />
bis 2020) und mit der niederländischen Gasunie<br />
(Laufzeit bis 2016) abgeschlossen. Ferner besteht<br />
seit 1987 mit Ruhrgas ein langfristiger Vertrag<br />
über die Lieferung von <strong>Erdgas</strong> aus der ehemaligen Sowjetunion, der<br />
bis 2008 dauert. Ruhrgas hat sich in diesem Vertrag verpflichtet, bei<br />
einer allfälligen Störung der russischen <strong>Erdgas</strong>lieferungen Aushilfsmengen<br />
bereitzustellen. Alle genannten Verträge sind mit einer Verlängerungsklausel<br />
versehen.<br />
Die restlichen Gasmengen werden von einzelnen Regionalgesellschaften<br />
direkt aus Frankreich und Deutschland beschafft. Von besonderer<br />
Bedeutung ist der bis 2019 laufende Vertrag der Westschweizer Regionalgesellschaft<br />
Gaznat S.A. mit der Gaz de France über die Nutzung<br />
von Kapazitäten im <strong>Erdgas</strong>speicher von Etrez bei Lyon. Für das Tessin<br />
erfolgt die Beschaffung direkt durch den lokalen Versorger, die<br />
Aziende Industriali di Lugano (AIL), beim italienischen Lieferanten Eni.<br />
BEZUGSWEGE<br />
Die Integration der Schweiz ins westeuropäische <strong>Erdgas</strong>-Transportsystem<br />
wird laufend optimiert. Zur Zeit ist unser Land über 11 internationale<br />
Einspeisungen mit dem europäischen Transportnetz ver-<br />
bunden. Die Diversifikation der Versorgungsrouten<br />
ist ein wichtiges Element der Versorgungssicherheit<br />
(siehe Beilage «Tabellen und<br />
Grafiken»).<br />
EINHEIMISCHE <strong>ERDGAS</strong>VORKOMMEN<br />
Von 1985 bis 1994 wurde in Finsterwald im Entlebuch<br />
ein kleines <strong>Erdgas</strong>vorkommen ausgebeutet. Es wurden rund<br />
73 Mio. Kubikmeter <strong>Erdgas</strong> gefördert. Stark sinkende Fördermengen<br />
und niedrige <strong>Erdgas</strong>preise führten zur Einstellung der Förderung<br />
im Frühjahr 1994. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde auch<br />
die inländische Gas- und Ölexploration durch die Swisspetrol Holding<br />
<strong>AG</strong> und ihre Tochtergesellschaften aufgegeben. Bestrebungen verschiedener<br />
Gesellschaften zur Wiederaufnahme der Exploration in<br />
der Schweiz sind im Gang.<br />
VERSORGUNGSSICHERHEIT<br />
Die nationale <strong>Erdgas</strong>versorgung funktioniert auch während extremen<br />
Kälteperioden einwandfrei. Die Versorgungssicherheit des <strong>Erdgas</strong>es<br />
beruht im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:<br />
• Langfristige Reichweite der Ressourcen<br />
• Diversifikation der Bezugsquellen und -wege<br />
• Langfristige Beschaffungsverträge mit zuverlässigen Lieferanten<br />
• Enge Vermaschung der Transportsysteme<br />
• Benutzung grenznaher Speicheranlagen<br />
• International starke gegenseitige Interessenbindung zwischen<br />
Produzenten, Lieferanten und Abnehmern<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 31
TRANSPORT <strong>UND</strong> VERTEILUNG<br />
IM INLAND<br />
NATIONALE EBENE<br />
Die wichtigste Einfuhrroute ist die internationale <strong>Erdgas</strong>leitung von<br />
den Niederlanden nach Italien. Über diese Route werden rund 80%<br />
der schweizerischen <strong>Erdgas</strong>bezüge abgewickelt. Sie durchquert die<br />
Schweiz auf einem Teilstück von rund 165 km von Wallbach östlich<br />
von Rheinfelden bis zum Griespass im Oberwallis. Die Importe von<br />
Swissgas werden über Abnahme- und Zollmessstationen entlang der<br />
Transitgas-Leitung abgewickelt. Sie befinden sich in Zeiningen (<strong>AG</strong>),<br />
Zuzgen (<strong>AG</strong>), Däniken (SO), Staffelbach (<strong>AG</strong>), Ruswil (LU) und<br />
Obergesteln (VS). In Ruswil ist eine Kompressorenstation installiert, in<br />
der das Gas verdichtet wird. Solche Stationen sind für den Transport<br />
von <strong>Erdgas</strong> über grössere Strecken notwendig; sie werden bei<br />
Fernleitungen normalerweise im Abstand von etwa 150 km installiert.<br />
Transportleitungen von Swissgas und den Regionalgesellschaften befördern<br />
das <strong>Erdgas</strong> von der Transitgas-Leitung in die einzelnen Regionen.<br />
Die <strong>Erdgas</strong> Ostschweiz <strong>AG</strong> (EGO) wird ab den Zollmessstationen<br />
Zuzgen und Staffelbach versorgt. Die Gasverbund Mittelland <strong>AG</strong><br />
(GVM) bezieht <strong>Erdgas</strong> ab den Stationen Zeiningen, Däniken, Staffelbach<br />
und Ruswil. Die Versorgung der Gaznat S.A. erfolgt über die<br />
Zollmessstationen Ruswil und Obergesteln. Ab Ruswil wird ferner die<br />
<strong>Erdgas</strong> Zentralschweiz <strong>AG</strong> (EGZ) beliefert. Daneben betreiben EGO,<br />
GVM und Gaznat eigene Zollmessstationen, die an der Grenze gelegen<br />
sind und über die sie ihre eigenen Importe abwickeln.<br />
32 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
DURCHLEITUNG FÜR DRITTE<br />
In der Schweiz besteht schon seit Mitte der 60er-Jahre mit Artikel13<br />
des Rohrleitungsgesetzes eine Regelung für Transporte Dritter auf<br />
dem Hochdrucknetz (Druck > 5 bar). Auf dem Transitgas-System<br />
werden Transit-Transporte für Dritte seit 2001 durch Eni und Swissgas<br />
durchgeführt. Die Betreiber von regionalen Hochdrucknetzen<br />
haben Regelungen getroffen, um den Netzzugang Dritter nach einheitlichen<br />
Grundsätzen zu ermöglichen. Hierfür wurden zwischen<br />
Swissgas und den Regionalgesellschaften so genannte Transportkoordinations-Vereinbarungen<br />
abgeschlossen und bei Swissgas eine<br />
Koordinationsstelle Durchleitung eingerichtet (siehe Beilage «Tabellen<br />
und Grafiken»).
REGIONALE <strong>UND</strong> LOKALE EBENE<br />
Das schweizerische Transport- und Verteilnetz hat eine Länge von<br />
rund 15’800 km. Die Leitungen des Transportnetzes werden mit<br />
einem Druck von über 5 bar betrieben. Bis zur Einspeisung in die<br />
lokalen Verteilnetze ist eine Reduzierung des Druckes in mehreren<br />
Stufen bis 100 mbar und weniger erforderlich (Niederdruck).<br />
Die Regionalgesellschaften betreiben wichtige regionale Transportnetze,<br />
über die die lokalen <strong>Erdgas</strong>versorgungen beliefert<br />
werden. Einzelne Grossabnehmer werden direkt von<br />
den Regionalgesellschaften bedient.<br />
Das <strong>Erdgas</strong>netz wird gesamtschweizerisch in<br />
Betriebszentralen rund um die Uhr überwacht<br />
und gesteuert. Dabei werden die erforderlichen<br />
Messdaten registriert <strong>–</strong> eine unerlässliche Kontrolle<br />
und ein Beitrag zur Betriebssicherheit des<br />
Leitungssystems.<br />
AUSBAU DES TRANSPORTNETZES<br />
Im Interesse der langfristigen Versorgungssicherheit und um die steigende<br />
Nachfrage nach <strong>Erdgas</strong> decken zu können, haben die zuständigen<br />
Gesellschaften zwischen 1994 und 2003 das Hochdrucknetz<br />
ausgebaut und damit die gesamtschweizerische Transportkapazität<br />
stark erhöht. Die jährlichen Transportmengen auf dem Transitgas-<br />
System betragen rund 18 Milliarden Kubikmeter. Davon sind rund 2,5<br />
Milliarden Kubikmeter für den Schweizer Markt bestimmt. (siehe<br />
Beilage «Tabellen und Grafiken»).<br />
Kompressorenstation in Ruswil (LU).<br />
Speziell zu erwähnen ist der Ausbau des Transitgas-Systems<br />
in den Jahren 1998 bis 2003. Wegen des steigenden <strong>Erdgas</strong>bedarfs<br />
in Italien schloss die italienische Snam S.p.A. (heute Eni S.p.A.)<br />
1997 mit den Niederlanden und Norwegen neue Bezugsverträge ab.<br />
Um dieses <strong>Erdgas</strong> von Nord- nach Südeuropa zu transportieren,<br />
mussten die bestehenden Kapazitäten erweitert und das Transitgas-<br />
System ausgebaut werden:<br />
• Bau einer neuen, 55 km langen Leitung von Rodersdorf (SO) nach<br />
Lostorf (SO) für den Transport von <strong>Erdgas</strong> aus Norwegen über<br />
Frankreich zum bestehenden Transitgas-Netz.<br />
• Bau einer 37 km langen Parallelleitung von 1’200 mm Durchmesser<br />
aus dem Raum Däniken (SO) nach Ruswil (LU).<br />
• Leistungserhöhung der Verdichterstation Ruswil auf 60 MW.<br />
• Ersatz der 94 km langen 850-mm-Leitung von Ruswil zur Grenze<br />
Schweiz/Italien beim Griespass (VS) durch Rohre von 1200 mm<br />
Durchmesser.<br />
Die Investitionen für dieses Grossprojekt beliefen sich auf über<br />
1 Milliarde Franken. Der Ausbau des Transitgas-Systems und der vorgelagerten<br />
Systeme im Ausland stärken die Stellung der Schweiz im<br />
europäischen Gasverbund und erhöhen die Versorgungssicherheit in<br />
der Schweiz zusätzlich.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 33
<strong>ERDGAS</strong>SPEICHERUNG<br />
<strong>ERDGAS</strong>-GROSSSPEICHER<br />
Weltweit verwendet die <strong>Erdgas</strong>wirtschaft als Grossspeicher Kavernen<br />
in mächtigen Salzstöcken, aufgelassene Bergwerke, ausgeförderte<br />
<strong>Erdgas</strong>- und Erdölfelder sowie Aquiferstrukturen.<br />
Ein Aquiferspeicher setzt geeignete geologische Strukturen voraus:<br />
porösen, durchlässigen, wassergesättigten Sandstein, Kalk oder Dolomit<br />
in günstiger Lage <strong>–</strong> überdeckt von gasundurchlässigen Schichten,<br />
etwa aus Ton oder Mergel. Das zu lagernde Gas wird in die<br />
Gesteinsporen eingepresst; der Druck des umgebenden Wassers im<br />
Speichergestein sowie die gasundurchlässige Deckschicht verhindern<br />
das Entweichen des Gases. So entsteht eine Art künstlich geschaffenes<br />
<strong>Erdgas</strong>feld.<br />
Wo geeignete geologische Formationen fehlen, kann <strong>Erdgas</strong> auch in<br />
verflüssigter Form in gut isolierten Behältern gespeichert werden.<br />
SPEICHERFORSCHUNG IN DER SCHWEIZ<br />
Die Möglichkeiten der <strong>Erdgas</strong>speicherung in der Schweiz wurden seit<br />
Mitte der 70er Jahre mit grossem Aufwand erforscht, seit Ende 1980<br />
durch die dafür gegründete Swissgas-Speicher Aktiengesellschaft.<br />
Bisher konnte noch keine für die <strong>Erdgas</strong>speicherung geeignete Struktur<br />
gefunden werden. Solange in der Schweiz keine ausreichenden<br />
Speichermöglichkeiten für <strong>Erdgas</strong> bestehen, müssen Ersatzpflichtlager<br />
mit Heizöl gehalten werden, an denen sich die <strong>Erdgas</strong>importeure<br />
finanziell zu beteiligen haben. Im unwahrscheinlichen Fall eines Lieferengpasses<br />
beim <strong>Erdgas</strong> könnten damit die Zweistoffkunden auf<br />
Heizöl umstellen, während die verbleibenden <strong>Erdgas</strong>mengen primär<br />
34 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
für die Versorgung der Einstoffkunden eingesetzt würden. Seit 2003<br />
werden gemäss der Verordnung über die Pflichtlagerhaltung von<br />
<strong>Erdgas</strong> neu auch Dritt-<strong>Erdgas</strong>importeure verpflichtet, sich an der<br />
bestehenden Ersatzpflichtlagerhaltung zu beteiligen.<br />
SCHWEIZERISCHES AUSGLEICHSKONZEPT<br />
<strong>Erdgas</strong> wird als sogenannte Bandenergie kontinuierlich gefördert<br />
und aus den Fördergebieten angeliefert. Der <strong>Erdgas</strong>verbrauch ist<br />
jedoch starken saisonalen Schwankungen unterworfen. Daraus<br />
ergibt sich das Bedürfnis nach <strong>Erdgas</strong>-Grossspeichern, mit denen die<br />
jahreszeitlich bedingten Verbrauchsschwankungen ausgeglichen<br />
werden können. Das Leitungsnetz sowie die Kugel- oder Röhrenspeicher<br />
der Gasversorgungen haben eine Pufferfunktion. Die darin<br />
gespeicherte <strong>Erdgas</strong>menge dient dem Ausgleich tageszeitlicher<br />
Bedarfsspitzen und zur Überbrückung kurzfristiger Störungen. In<br />
Volketswil (ZH) verfügt die <strong>Erdgas</strong> <strong>Zürich</strong> <strong>AG</strong> über den grössten<br />
Röhrenspeicher Europas mit einer Speicherkapazität von rund<br />
710’000 m3 bei einem Druck von 70 bar. Mangels inländischen<br />
Grossspeichern werden die Verbrauchsschwankungen in der Schweiz<br />
gegenwärtig durch entsprechend gestaltete Importverträge, den<br />
Erwerb von Speicherrechten im grenznahen Ausland, die Speichereinrichtungen<br />
der Gasversorgungen und durch unterbrechbare Lieferungen<br />
an grössere <strong>Erdgas</strong>bezüger ausgeglichen. Für die Versorgungssicherheit<br />
der Schweiz fällt ins Gewicht, dass ihre <strong>Erdgas</strong>lieferanten<br />
über riesige Speicheranlagen verfügen.<br />
<strong>Erdgas</strong>-Grossspeicher in Rheden (Deutschland).
DIE GASWIRTSCHAFT<br />
ALS WIRTSCHAFTSZWEIG<br />
WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG<br />
Seit der <strong>Erdgas</strong>-Einführung in der Schweiz wurden<br />
für den Leitungsbau und für die gaswirtschaftliche<br />
Infrastruktur mehr als 4 Milliarden<br />
Franken investiert. Diese Zahl zeigt, dass die volkswirtschaftliche<br />
Bedeutung der Gaswirtschaft weit über den Bereich der Energieversorgung<br />
hinausreicht. Die Gaswirtschaft ist ein wichtiger Auftraggeber<br />
für Ingenieur- und Planungsfirmen, Tiefbauunternehmen und<br />
Gasgerätefabrikanten, Hersteller von Röhren, Fittings, Mess- und<br />
Regelgeräten sowie Geologen, Bohrtechniker und weitere Berufsgruppen.<br />
FORSCHUNG <strong>UND</strong> ENTWICKLUNG<br />
Forschung und Entwicklung im Bereich der Anwendung von <strong>Erdgas</strong><br />
wird in der Schweiz primär von der Industrie beziehungsweise von<br />
den Gerätelieferanten geleistet. Zur Unterstützung von Projekten, die<br />
den sparsamen und sicheren Einsatz von <strong>Erdgas</strong> fördern und der<br />
Entwicklung neuer Technologien dienen, gründeten die Mitglieder<br />
des VSG 1992 einen verbandseigenen Forschungs-, Entwicklungsund<br />
Förderungsfonds (FOGA). Er wird von den im VSG zusammengeschlossenen<br />
Gasversorgungen durch eine Abgabe auf die importierte<br />
<strong>Erdgas</strong>menge solidarisch finanziert.<br />
PREISBILDUNG<br />
Hauptkomponenten des Preises bei der <strong>Erdgas</strong>beschaffung<br />
sind der Arbeitspreis, der Leistungspreis und<br />
Preiszuschläge.<br />
Arbeitspreis: Unter dem Arbeitspreis versteht man den Preis für die<br />
Ware, also für die Energie, in Rappen/Kilowattstunde. Dieser orientiert<br />
sich am Ölpreis und wird meist viertel- oder halbjährlich diesem<br />
Preisindex angepasst. Die Indexierung gewährleistet die Wettbewerbsfähigkeit<br />
von <strong>Erdgas</strong> beim Endverbraucher.<br />
Leistungspreis: Der Leistungspreis ist das Entgelt für die festen<br />
Kosten des vorgelagerten Systems, also der Preis für die bereitgestellte<br />
Transportkapazität.<br />
Preiszuschläge: Die importierten <strong>Erdgas</strong>mengen werden mit verschiedenen<br />
Zuschlägen wie Fiskalabgaben (Mineralölsteuer und<br />
Mehrwertsteuer) und Beiträgen an die Pflichtlagerhaltung belastet.<br />
Erweiterung der Transitgas-Leitung durch die Schweiz.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 35
Die lokalen Gasversorgungen verteilen das <strong>Erdgas</strong> an die Endverbraucher<br />
innerhalb einer bestimmten Kundengruppe zu gleichen<br />
Preisen, die überwiegend aus einem Grundpreis sowie einem<br />
Arbeitspreis bestehen. Meistens werden diese beiden Preiselemente<br />
zusammengefasst. Durch die Bildung von Kunden- oder Tarifgruppen<br />
wird der Bezugscharakteristik der einzelnen Verbrauchersegmente<br />
und der Konkurrenzsituation im Wärmemarkt Rechnung getragen.<br />
Oft werden mit Grossverbrauchern spezielle Verträge abgeschlossen,<br />
welche die individuellen Gegebenheiten berücksichtigen. Die<br />
Kompezenz zur Preisgestaltung liegt bei den einzelnen Gasversorgungsunternehmen.<br />
Die Festsetzung der Tarife orientiert sich am<br />
Prinzip der Eigenwirtschaftlichkeit.<br />
36 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten<br />
GESCHÄFTSPOLITIK<br />
Die Geschäftspolitik der schweizerischen Gasversorgungsunternehmen<br />
richtet sich nach dem Grundsatz, <strong>Erdgas</strong> möglichst sicher und<br />
kostengünstig in unser Land zu bringen und den Konsumenten zu<br />
konkurrenzfähigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.<br />
Die überwiegende Mehrheit der schweizerischen Gasversorgungen<br />
ist im Eigentum der öffentlichen Hand, oft im Rahmen von kommunalen<br />
Querverbundunternehmen (Stadtwerke). Im Hinblick auf die<br />
kommende Liberalisierung sind Bestrebungen im Gang, kommunale<br />
Gasversorgungen rechtlich zu verselbständigen oder zu privatisieren.<br />
Damit soll ihre unternehmerische Handlungsfähigkeit gesteigert und<br />
ihre Positionierung im Wettbewerb verbessert werden. Im gleichen<br />
Zusammenhang sind entstehende Allianzen und Kooperationen zu<br />
nennen, mit welchen sich Synergien und Grössenvorteile nutzen<br />
lassen.
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong> IM BRENNPUNKT DER ZUKUNFT<br />
VERSORGUNGSPOLITISCHE <strong>UND</strong><br />
ÖKOLOGISCHE GESICHTSPUNKTE<br />
Wenn es um die Energieversorgung von morgen geht, gebietet<br />
die Vernunft, dass wir schon heute alle verfügbaren<br />
Energieträger nutzen <strong>–</strong> und jeden gezielt für<br />
jene Bedürfnisse und Anwendungen einsetzen, für<br />
die er sich am besten eignet. Dazu zwingt uns<br />
die Endlichkeit der Ressourcen.<br />
Für die Schweiz heisst dies, die Energieversorgung<br />
noch mehr aus der Abhängigkeit eines einzelnen<br />
Energieträgers, dem Erdöl, zu lösen und<br />
auf eine breitere Grundlage zu stellen.<br />
Dabei sprechen vor allem die umweltschonenden Eigenschaften von<br />
<strong>Erdgas</strong> für den vermehrten Einsatz dieses Energieträgers. Die Erhaltung<br />
einer intakten Umwelt ist zu einer vordringlichen, ja überlebenswichtigen<br />
Aufgabe der heutigen Gesellschaft geworden.<br />
ZIELSETZUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN GASWIRTSCHAFT<br />
Die Nachfrage nach <strong>Erdgas</strong> wird in den kommenden Jahren weiter<br />
wachsen. Mittelfristig, im Laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre, strebt<br />
die Gaswirtschaft der Schweiz einen Gasanteil am Energieverbrauch<br />
an, der dem heutigen Durchschnitt der EU-Länder (rund 23 Prozent)<br />
entspricht. Die Möglichkeiten dazu liegen primär in der Verdichtung<br />
bestehender Netze, in der Erschliessung neuer Regionen und<br />
Gemeinden sowie in der Gewinnung neuer Kunden. Zudem dürften<br />
neue Anwendungsgebiete die Nachfrage erhöhen. Im Vordergrund<br />
der Erwartungen stehen dabei die Stromproduktion mit <strong>Erdgas</strong><br />
(Wärme-Kraft-Kopplung, Brennstoffzellen) sowie der Marktaufbau<br />
für erdgasbetriebene Fahrzeuge.<br />
ENERGIEPOLITIK DES B<strong>UND</strong>ES<br />
Ein weiterer Faktor, der die Zukunft von <strong>Erdgas</strong><br />
in der Schweiz mitbestimmt, ist die Energiepolitik<br />
des Bundes. Ein Hauptziel ist die Stabilisierung und<br />
längerfristig die Senkung des Ausstosses von Kohlendioxid.<br />
Die Zunahme des <strong>Erdgas</strong>anteils an der schweizerischen<br />
Energiebilanz und die Substitution von Heizöl durch das<br />
kohlenstoffärmere <strong>Erdgas</strong> entspricht dieser Zielsetzung. Die Eidgenössischen<br />
Räte haben eine Revision des Mineralölgesetzes in die<br />
Wege geleitet mit der Absicht, durch eine signifikante Reduktion der<br />
Mineralölsteuer auf Gastreibstoffen Fahrzeuge mit klimaschonenden<br />
Treibstoffen zu fördern und so die CO2- und Luftschadstoff-Emissionen<br />
markant zu senken. Besonders gross ist das CO2-Reduktions potenzial bei der Kombination von <strong>Erdgas</strong> und Biogas. Im Jahr 2003<br />
haben Biogasproduzenten und Vertreter der Gaswirtschaft eine<br />
Rahmenvereinbarung abgeschlossen, welche vorsieht, dass aufbereitetes<br />
Biogas im Umfang von 10 Prozent der in der Schweiz als Treibstoff<br />
abgesetzten <strong>Erdgas</strong>menge von Gasversorgungsunternehmen<br />
übernommen und zur Vermarktung als Treibstoff ins <strong>Erdgas</strong>netz eingespeist<br />
wird.<br />
ANSPORN FÜR DIE ZUKUNFT<br />
Die erfolgreiche Entwicklung der schweizerischen <strong>Erdgas</strong>versorgung<br />
ist für die Gaswirtschaft Bestätigung und zugleich Ansporn, ihre<br />
Anstrengungen für eine sichere, möglichst breit diversifizierte und<br />
umweltverträgliche Energieversorgung weiter fortzusetzen.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten 37
<strong>ERDGAS</strong> <strong>–</strong><br />
<strong>DATEN</strong> <strong>UND</strong><br />
<strong>FAKTEN</strong><br />
<strong>TABELLEN</strong> <strong>UND</strong> GRAFIKEN<br />
2006/07<br />
Basis: 2005
GESAMTER ENDENERGIEVERBRAUCH<br />
Der Endenergieverbrauch zeigt die starke<br />
Abhängigkeit der Schweiz von Erdölprodukten.<br />
Während der Anteil der Elektrizität in<br />
den letzten Jahren leicht steigend ist, trägt<br />
das <strong>Erdgas</strong> in wachsendem Mass zur<br />
Diversifikation der Energiebilanz und damit<br />
zur Sicherung der Energieversorgung in der<br />
Schweiz bei.<br />
ENTWICKLUNG DES<br />
ENDENERGIEVERBRAUCHS<br />
Der Endenergieverbrauch hängt eng mit der<br />
wirtschaftlichen Entwicklung zusammen. So<br />
stieg zwischen 1950 und 1973 der Verbrauch<br />
von Brenn- und Treibstoffen auf Erdölbasis<br />
ständig. Die Bedeutung der einzelnen<br />
Energieträger hat sich stark verändert,<br />
das Heizöl hat die Kohle abgelöst. Seit der<br />
ersten Ölkrise (1973) tragen Strom und <strong>Erdgas</strong><br />
in wachsendem Masse zur Substitution<br />
der Erdölbrennstoffe bei.<br />
2 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken<br />
in 1000 TJ<br />
56.5%<br />
8.1%<br />
12.2%<br />
23.2%<br />
900<br />
850<br />
800<br />
750<br />
700<br />
650<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1950 1960 1970 1980 1990 2005<br />
1) TJ:3.6 = GWh<br />
Für Vergleiche mit anderen<br />
Energieträgern wird der Heizwert<br />
(Hu) verwendet.<br />
TJ 1)<br />
Erdölprodukte 502’890<br />
Elektrizität 206’390<br />
<strong>Erdgas</strong> 108’820<br />
Diverse 72’340<br />
Kohle: 5’580<br />
Holz: 30’450<br />
Fernwärme: 16’010<br />
Industrieabfalle: 12’050<br />
Übrige erneuerbare<br />
Energien: 8’250<br />
Total 890’440<br />
Übrige erneuerbare<br />
Energien ■<br />
Fernwärme ■<br />
Elektrizität ■<br />
<strong>Erdgas</strong> ■<br />
Treibstoffe ■<br />
Erdölbrennstoffe ■<br />
Abfälle ■<br />
Kohle ■<br />
Holz ■
1970 2’044<br />
1972 2’531<br />
1974 4’183<br />
1976 6’306<br />
1978 6’928<br />
1980 9’372<br />
1982 11’058<br />
1984 14’017<br />
1986 15’117<br />
1988 16’606<br />
1990 19’578<br />
1992 23’325<br />
1994 24’108<br />
1996 28’467<br />
1997 27’294<br />
1998 28’199<br />
1999 29’302<br />
2000 29’390<br />
2001 30’506<br />
2002 29’989<br />
2003 31’672<br />
2004 32’713<br />
2005 33’589<br />
GWh<br />
GWh<br />
Deutschland 18’372<br />
Italien 1’705<br />
Frankreich 3’838<br />
Russland* 3’882<br />
Niederlande 8’164<br />
Total 35’961<br />
* indirekt gemäss Vertrag<br />
mit Deutschland<br />
0 5’000 10’000 15’000 20’000 25’000 30’000<br />
51.1%<br />
10.8%<br />
22.7%<br />
10.7%<br />
4.7%<br />
ENTWICKLUNG DES ENDVERBRAUCHS<br />
VON <strong>ERDGAS</strong><br />
Die Nachfrage nach <strong>Erdgas</strong> ist seit seiner<br />
Einführung Anfang der 70er-Jahre rasch<br />
gestiegen. In den letzten 17 Jahren hat sich<br />
der <strong>Erdgas</strong>verbrauch mehr als verdoppelt.<br />
Der Energieträger <strong>Erdgas</strong> ist damit zu einer<br />
unverzichtbaren Säule der schweizerischen<br />
Energieversorgung geworden.<br />
<strong>ERDGAS</strong>LIEFERANTEN<br />
DER SCHWEIZ 2005<br />
Das in der Schweiz verwendete <strong>Erdgas</strong> wird<br />
zu 100 Prozent importiert. Die wichtigsten<br />
Lieferländer sind Deutschland und die Niederlanden.<br />
Mit Deutschland besteht zudem<br />
ein Vertrag über die explizite Lieferung von<br />
<strong>Erdgas</strong> aus russischer Provenienz (2005:<br />
3’882 GWh). Der effektive Anteil russischen<br />
<strong>Erdgas</strong>es an allen Lieferungen in die Schweiz<br />
ist nicht exakt quantifizierbar und dürfte sich<br />
zwischen 15 und 20 Prozent bewegen.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken 3
GASVERBRAUCH NACH<br />
VERBRAUCHERGRUPPEN 2005<br />
Hauptabnehmer von <strong>Erdgas</strong> sind die Industrie<br />
und die Haushalte. Während die Industrie<br />
<strong>Erdgas</strong> vorwiegend zur Erzeugung von<br />
Prozesswärme in der Produktion verwendet,<br />
stehen bei den Haushalten die Anwendungen<br />
Raumheizung, Warmwasserbereitung<br />
und Kochen im Vordergrund.<br />
INVESTITIONEN DER SCHWEIZERISCHEN<br />
GASWIRTSCHAFT<br />
In die Erweiterung und Erneuerung des<br />
Transport- und Verteilleitungsnetzes investiert<br />
die schweizerische Gaswirtschaft grosse<br />
Summen. Damit schafft sie die Voraussetzungen<br />
für eine zukunftsorientierte, leistungsfähige<br />
und sichere <strong>Erdgas</strong>versorgung.<br />
4 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken<br />
in Mio. CHF<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
92<br />
108<br />
127<br />
408<br />
1997 1998<br />
123<br />
454<br />
92<br />
463<br />
100<br />
473<br />
103<br />
112<br />
147<br />
40<br />
191<br />
49<br />
179<br />
10<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />
% 2004 2005<br />
39.3 39.3<br />
6.7 6.7<br />
21.8 21.8<br />
32.2 32.2<br />
TJ 2004 2005<br />
■ Haushalte 41’660 42’790<br />
■ Industrie 34’130 35’050<br />
■ Dienstleistungen 23’110 23’730<br />
■ Übrige 1) 7’060 7’250<br />
Total 105’960 108’820<br />
1) Statistische Differenz inkl. Landwirtschaft & Verkehr<br />
Investitionen total Mio. CHF<br />
1995 275<br />
1996 146<br />
1997 200<br />
1998 535<br />
1999 577<br />
2000 555<br />
2001 573<br />
2002 215<br />
2003 187<br />
2004 240<br />
2005 189<br />
Verteilung ■<br />
Transport ■
Genève<br />
Westeuropa<br />
Russland<br />
Algerien<br />
Übrige<br />
Vallorbe<br />
Delémont<br />
Solothurn<br />
Neuchâtel<br />
Bern<br />
Fribourg<br />
Lausanne<br />
Sion<br />
Basel<br />
Thun<br />
55%<br />
9%<br />
Schaffhausen<br />
Aarau<br />
<strong>Zürich</strong><br />
Luzern Zug<br />
Frauenfeld<br />
Schwyz<br />
Chiasso<br />
11%<br />
Einsiedeln<br />
Lugano<br />
Glarus<br />
25%<br />
St. Gallen<br />
Vaduz<br />
Chur<br />
HAUPTNETZ DER SCHWEIZERISCHEN<br />
<strong>ERDGAS</strong>VERSORGUNG<br />
Transeuropäische Transportleitung<br />
Transportleitung<br />
Geplante Transportleitung<br />
Einspeisung<br />
Mögliche oder geplante Einspeisung<br />
Einspeisung in Lokalnetz<br />
● Gasversorgungen<br />
■ Inselwerke mit lokaler Gasproduktion<br />
(Stadtgas)<br />
Anzahl lokale Gasversorgungen 124<br />
Anzahl gasversorgte Gemeinden 836<br />
Länge des Rohrleitungsnetzes 16’638 km<br />
<strong>–</strong> davon Transportnetz (> 5 bar) 2’190 km<br />
<strong>–</strong> davon Verteilnetz (bis 5 bar) 14’448 km<br />
<strong>ERDGAS</strong>AUFKOMMEN IN<br />
WESTEUROPA 2005<br />
Die westeuropäische <strong>Erdgas</strong>nachfrage wird<br />
zu rund 55 Prozent durch eigene Produktion<br />
abgedeckt. Die übrigen 45 Prozent stammen<br />
vorwiegend aus Russland und Algerien.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken 5
WICHTIGSTE LEITUNGEN DES EURO-<br />
PÄISCHEN <strong>ERDGAS</strong>-TRANSPORTNETZES<br />
Die Gesamtlänge des europäischen <strong>Erdgas</strong>-<br />
Transportnetzes beträgt rund 185’000 km.<br />
Mit einer optimalen Diversifikation von<br />
Bezugsquellen und Transportwegen ist ein<br />
Höchstmass an Versorgungssicherheit garantiert.<br />
Transporte von<br />
verflüssigtem <strong>Erdgas</strong><br />
<strong>Erdgas</strong>pipelines<br />
Bohrinseln und<br />
Unterwasserleitungen<br />
Planung/Bau<br />
El Ferrol<br />
Madrid<br />
Lisboa<br />
Huelva Cordoba<br />
6 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken<br />
Bacton<br />
Hamburg Warschau<br />
Canvey<br />
Emden<br />
London<br />
Zeebrugge<br />
Essen<br />
Berlin<br />
Dunkerque<br />
Bruxelles<br />
Saar-<br />
Le Havre brückenWaidhaus<br />
Dresden<br />
Prag Uzgorod<br />
Paris<br />
Montoir<br />
Nancy<br />
Bern<br />
Wien<br />
Passau<br />
München<br />
Budapest<br />
Arzew<br />
Cartagena<br />
Statfjord Gullfaks<br />
Brent Kollsens<br />
Troll<br />
Heimdal<br />
Kårstø<br />
Frigg<br />
Fos-sur-mer<br />
Barcelona<br />
Sleipner<br />
Alger<br />
Cod<br />
Ekofisk<br />
Tyra<br />
Milano<br />
Lyon<br />
La Spezia<br />
Skikda Tunis<br />
Roma<br />
Stockholm<br />
Palermo<br />
Ljubljana<br />
Helsinki<br />
Belgrad<br />
Bukarest<br />
Sofia<br />
Minsk<br />
Athen<br />
Quelle: Ruhrgas
Schweden 41.9<br />
Schweiz 129.5<br />
Irland 162.8<br />
Finnland 167.5<br />
Dänemark 209.3<br />
Österreich 376.8<br />
Belgien 683.7<br />
Spanien 1’353.5<br />
Niederlande 1’651.2<br />
Frankreich 1’897.7<br />
Italien 3’306.9<br />
Deutschland 3’581.4<br />
Grossbritannien 4’353.5<br />
PJ (Ho)<br />
Schweden 1.7<br />
Schweiz 10.3<br />
Finnland 11.0<br />
Frankreich 14.8<br />
Spanien 19.9<br />
Deutschland 22.7<br />
Dänemark 22.9<br />
Irland 23.4<br />
Österreich 23.7<br />
EU 25 24.8<br />
Belgien 26.1<br />
Italien 37.8<br />
Grossbritannien 39.7<br />
Niederlande 45.0<br />
%<br />
0 1’000 2’000 3’000 4’000<br />
0 10 20 30 40<br />
<strong>ERDGAS</strong>VERBRAUCH<br />
IN WESTEUROPÄISCHEN LÄNDERN 2005<br />
Die grössten Verbraucherländer in Westeuropa<br />
sind Grossbritannien und Deutschland,<br />
gefolgt von Italien, Frankreich und den<br />
Niederlanden. An europäischen Massstäben<br />
gemessen ist der <strong>Erdgas</strong>verbrauch in der<br />
Schweiz gering.<br />
<strong>ERDGAS</strong>ANTEIL AM<br />
PRIMÄRENERGIEVERBRAUCH IN<br />
WESTEUROPÄISCHEN LÄNDERN 2005<br />
Der Anteil von <strong>Erdgas</strong> am Primärenergieverbrauch<br />
beträgt in Westeuropa durchschnittlich<br />
25 Prozent. Hohe Anteile weisen<br />
die Niederlande, Grossbritannien und Italien<br />
auf. Im europäischen Vergleich ist der Anteil<br />
in der Schweiz deutlich unterdurchschnittlich.<br />
Ein Nachholbedarf ist gegeben.<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken 7
SICHER GEWINNBARE RESERVEN<br />
VON <strong>ERDGAS</strong> 2005<br />
Die bedeutendsten sicher gewinnbaren <strong>Erdgas</strong>reserven<br />
befinden sich im Mittleren<br />
Osten sowie auf dem Gebiet der ehemaligen<br />
Sowjetunion. In Westeuropa verfügen die<br />
Niederlande und Norwegen über die grössten<br />
Vorräte. Gemessen an der heutigen<br />
Weltjahresförderung reichen die <strong>Erdgas</strong>reserven<br />
für rund 65 Jahre. Zählt man die<br />
geschätzten zusätzlichen Ressourcen dazu,<br />
sind es ca. 130 Jahre.<br />
WELTFÖRDERUNG <strong>ERDGAS</strong> 2005<br />
Die grössten <strong>Erdgas</strong>-Produzentenländer sind<br />
Russland, die USA und Kanada. Westeuropa<br />
ist zur Zeit die viertgrösste Förderregion<br />
weltweit. Im Mittleren Osten ist die Förderung<br />
trotz riesiger Reserven vergleichsweise<br />
gering.<br />
8 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken<br />
32.5%<br />
28.3%<br />
40.1%<br />
27.5%<br />
11.6%<br />
3.1%<br />
4.1%<br />
4.8%<br />
3.9%<br />
8.3%<br />
10.4%<br />
12.0%<br />
8.0%<br />
5.4%<br />
Mrd. m 3<br />
Mittlerer Osten 72’130<br />
Russland & Eurasien 58’510<br />
Afrika 14’390<br />
Asien, Ozeanien 14’840<br />
Lateinamerika 7’020<br />
Nordamerika 7’460<br />
Europa 5’520<br />
Welt 179’870<br />
Mrd. m 3<br />
Russland & Eurasien 760<br />
Mittlerer Osten 293<br />
Afrika 163<br />
Nordamerika 750<br />
Asien, Ozeanien 360<br />
Lateinamerika 136<br />
Europa 301<br />
Welt 2’763
in g/kWh Brennstoffeinsatz<br />
Steinkohle 392<br />
Heizöl schwer 304<br />
Heizöl EL bzw. Oeko-Öl 293<br />
<strong>Erdgas</strong> 219<br />
Methan-Freisetzung auf<br />
der Versorgungskette,<br />
gerechnet als CO2<br />
(Betrachtungszeitraum<br />
100 Jahre) ■<br />
CO2-Freisetzung auf<br />
der Versorgungskette ■<br />
CO2-Freisetzung bei<br />
der Verbrennung ■<br />
mg/m 3<br />
Heizöl schwer 450<br />
Heizöl leicht 120<br />
<strong>Erdgas</strong> 80<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
392<br />
28<br />
11<br />
353<br />
Steinkohle<br />
304<br />
5<br />
25<br />
274<br />
Heizöl<br />
schwer<br />
Heizöl<br />
schwer<br />
293<br />
5<br />
25<br />
263<br />
219<br />
10<br />
11<br />
198<br />
Heizöl EL<br />
bzw. Oeko-Öl <strong>Erdgas</strong><br />
Heizöl<br />
leicht <strong>Erdgas</strong><br />
FREISETZUNG VON KOHLENDIOXID<br />
(CO2) <strong>UND</strong> METHAN (CH4) BEI DER<br />
NUTZUNG FOSSILER ENERGIETRÄGER<br />
<strong>Erdgas</strong> hat von allen fossilen Energien den<br />
geringsten Gehalt an Kohlenstoff (C) und<br />
den höchsten Anteil an Wasserstoff (H). Im<br />
Vergleich zum Heizöl wird bei der Verbrennung<br />
von <strong>Erdgas</strong> 25 Prozent weniger<br />
Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Der Einsatz<br />
von <strong>Erdgas</strong> anstelle anderer fossiler Energien<br />
trägt zur Entlastung der Atmosphäre von<br />
CO2 und damit zur Milderung des Treibhauseffekts<br />
bei.<br />
STICKOXID-GRENZWERTE DER<br />
LUFTREINHALTEVERORDNUNG LRV<br />
Im Gegensatz zum Heizöl weist <strong>Erdgas</strong> keinen<br />
organisch gebundenen Stickstoff auf.<br />
Bei gleichen Verbrennungsbedingungen<br />
produziert es deshalb entsprechend weniger<br />
Stickoxide (NOX). Wegen des Gehalts an<br />
gebundenem Stickstoff im Heizöl gilt in der<br />
Luftreinhalteverordnung (LRV) für Ölfeuerungen<br />
ein um 50 Prozent höherer Stickoxid-<br />
Grenzwert (120 mg/m3 Abgas) als für<br />
Gasfeuerungen (80 mg/m3 Abgas).<br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken 9
MITGLIEDERVERZEICHNIS VSG<br />
Total 88 Mitglieder<br />
IBAarau <strong>Erdgas</strong> <strong>AG</strong><br />
Obere Vorstadt 37<br />
5001 Aarau<br />
Gas- und Wasserversorgung<br />
Soodring 23<br />
8134 Adliswil<br />
Gasverbund Mittelland <strong>AG</strong><br />
Postfach 360<br />
4144 Arlesheim<br />
Commune d'Aubonne<br />
Service du Gaz<br />
Place du Marché 12<br />
1170 Aubonne<br />
Regionalwerke <strong>AG</strong> Baden<br />
Haselstrasse 15<br />
5401 Baden<br />
IWB<br />
Margarethenstrasse 40<br />
4002 Basel<br />
Metanord SA<br />
Casella postale 2085<br />
6500 Bellinzona<br />
Energie Wasser Bern<br />
Monbijoustrasse 11<br />
3001 Bern<br />
Energie Service Biel/Bienne (ESB)<br />
Gottstattstrasse 4<br />
2504 Biel<br />
IBB <strong>Erdgas</strong> <strong>AG</strong><br />
Untere Hofstatt 4<br />
5201 Brugg<br />
Localnet <strong>AG</strong><br />
Bernstrasse 102<br />
3401 Burgdorf<br />
<strong>AG</strong>E SA<br />
Piazza Bernasconi 6<br />
6830 Chiasso<br />
IBC Energie Wasser Chur<br />
Felsenaustrasse 29<br />
7004 Chur<br />
GANSA<br />
Gaz neuchâtelois S.A.<br />
Les Vernets<br />
2035 Corcelles/NE<br />
COSVEGAZ S.A.<br />
Distribution de gaz naturel<br />
Ch. de Jolimont 2<br />
1304 Cossonay-Ville<br />
Régiogaz S.A.<br />
Rue de Fer 6<br />
2800 Delémont<br />
Stadt Dietikon<br />
Gasversorgung<br />
Bremgartnerstrasse 22<br />
8953 Dietikon<br />
Glattwerk <strong>AG</strong><br />
Usterstrasse 111<br />
8600 Dübendorf<br />
Gaswerk Einsiedeln <strong>AG</strong><br />
Postfach 162<br />
8840 Einsiedeln<br />
Technische Betriebe Flawil<br />
Wilerstrasse 163<br />
9230 Flawil 2<br />
Werkbetriebe Frauenfeld<br />
<strong>Erdgas</strong>, Wasser, Strom<br />
Gaswerkstrasse 13<br />
8503 Frauenfeld<br />
EW Höfe <strong>AG</strong><br />
Schwerzistrasse 37<br />
8807 Freienbach<br />
10 <strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken<br />
Services Industriels de Genève SIG<br />
Service du gaz<br />
Case postale 2777<br />
1211 Genève 2<br />
FRIGAZ S.A.<br />
Rte des Fluides 1<br />
1762 Givisiez<br />
Werkbetriebe Glarus<br />
Feldstrasse 1<br />
8750 Glarus<br />
Stadtwerke<br />
Bischofszellerstrasse 90<br />
9201 Gossau<br />
Städtische Werke Grenchen<br />
Marktplatz 22<br />
2540 Grenchen<br />
Gaswerk Herisau <strong>AG</strong><br />
Kasernenstrasse 36<br />
9102 Herisau<br />
Gemeindewerke Horgen<br />
Seestrasse 335<br />
8810 Horgen<br />
Industrielle Betriebe Interlaken<br />
Fabrikstrasse 8<br />
3800 Interlaken<br />
Gas- und Wasserversorgung<br />
Kilchberg<br />
Alte Landstrasse 110<br />
8802 Kilchberg<br />
Stadtwerke Konstanz GmbH<br />
Abt. Gasversorgung<br />
Max-Stromeyer-Strasse 21-29<br />
DE <strong>–</strong> 78467 Konstanz<br />
Technische Betriebe Kreuzlingen<br />
Nationalstrasse 27<br />
8280 Kreuzlingen<br />
Gemeindewerke Küsnacht<br />
Gasversorgung<br />
Tobelweg 4<br />
8700 Küsnacht<br />
SIM S.A.<br />
Rue du Collège 30<br />
2301 La Chaux-de-Fonds<br />
Industrielle Betriebe Langenthal<br />
Talstrasse 29<br />
4900 Langenthal<br />
Services Industriels<br />
Service du gaz & cad<br />
Ch. de Pierre-de-Plan 2<br />
1005 Lausanne<br />
SWL Energie <strong>AG</strong><br />
Werkhofstrasse 10<br />
5600 Lenzburg 1<br />
Aziende Industriali<br />
di Lugano (AIL) SA<br />
Sezione Gas<br />
Via della Posta 8<br />
6900 Lugano<br />
<strong>Erdgas</strong> Zentralschweiz <strong>AG</strong><br />
Industriestrasse 6<br />
6002 Luzern<br />
ewl Energie Wasser Luzern<br />
Industriestrasse 6<br />
6002 Luzern<br />
Sinergy Commerce S.A.<br />
Av. du Gd-St-Bernard 8<br />
1920 Martigny 1<br />
EVS <strong>Erdgas</strong>versorgung<br />
Sarganserland <strong>AG</strong><br />
Gonzenweg 1<br />
8887 Mels<br />
Services industriels<br />
Service du gaz<br />
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1<br />
1110 Morges<br />
Commune de Moudon<br />
Service du gaz<br />
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1<br />
1510 Moudon<br />
Gemeindebetriebe Muri<br />
Gasversorgung<br />
Thunstrasse 74<br />
3074 Muri bei Bern<br />
Services industriels Neuchâtel<br />
Quai Max-Petitpierre 4<br />
2000 Neuchâtel<br />
Technische Betriebe Uzwil<br />
<strong>Erdgas</strong> und Wasser<br />
Hummelweg 3<br />
9244 Niederuzwil
Services industriels de Nyon<br />
Pl. du Château 10<br />
1260 Nyon<br />
a.en Aare Energie <strong>AG</strong><br />
Solothurnerstrasse 21<br />
4601 Olten<br />
Urbagaz S.A.<br />
Hôtel de Ville<br />
1350 Orbe<br />
<strong>Erdgas</strong> Obersee <strong>AG</strong><br />
Gaswerkstrasse 1<br />
8640 Rapperswil<br />
Gas- und Wasserversorgung<br />
Richterswil<br />
Glarnerstrasse 33<br />
8805 Richterswil<br />
Gasversorgung Romanshorn <strong>AG</strong><br />
Egnacherweg 6b<br />
8590 Romanshorn<br />
Gemeindewerke Rüti<br />
Werkstrasse 27<br />
8630 Rüti/ZH<br />
LGV Liechtensteinische<br />
Gasversorgung<br />
Im Rietacker 4<br />
FL <strong>–</strong> 9494 Schaan<br />
Gas- und Wasserwerk<br />
der Gemeinde Neuhausen<br />
8201 Schaffhausen<br />
Städtische Werke Schaffhausen<br />
und Neuhausen am Rheinfall<br />
Mühlenstrasse 19<br />
8201 Schaffhausen<br />
Stadtverwaltung Schlieren<br />
Werke, Versorgung und Anlagen<br />
Gas- und Wasserversorgung<br />
Bernstrasse 72<br />
8952 Schlieren<br />
<strong>Erdgas</strong> Innerschwyz <strong>AG</strong><br />
Bahnhofstrasse 182<br />
6423 Seewen SZ<br />
SOGAVAL S.A.<br />
Rue de l'Industrie 43<br />
1951 Sion<br />
Regio Energie Solothurn<br />
Rötistrasse 17<br />
4502 Solothurn<br />
Commune de Sainte-Croix<br />
Service technique<br />
Rue Neuve 11<br />
1450 Ste-Croix<br />
Sankt Galler Stadtwerke<br />
Vadianstrasse 6<br />
9001 St. Gallen<br />
Services techniques<br />
Service du gaz<br />
Rue Agassiz 4<br />
2610 St-Imier<br />
GRAV<strong>AG</strong> <strong>Erdgas</strong> <strong>AG</strong><br />
Industriestrasse 21<br />
9430 St. Margrethen<br />
Gemeinde Thalwil<br />
DLZ Infrastruktur<br />
Dorfstrasse 10<br />
8800 Thalwil<br />
Energie Thun <strong>AG</strong><br />
Industriestrasse 6<br />
3607 Thun<br />
Energie Uster <strong>AG</strong><br />
Oberlandstrasse 78<br />
8610 Uster 1<br />
Société Electrique du Châtelard<br />
Grand-Rue 1<br />
1337 Vallorbe<br />
Holdigaz S.A.<br />
Case postale<br />
1800 Vevey 1<br />
GAZNAT S.A.<br />
Av. Général-Guisan 28<br />
1800 Vevey<br />
Städtische Werke Wädenswil<br />
Eintrachtstrasse 24<br />
8820 Wädenswil<br />
die werke<br />
versorgung wallisellen ag<br />
Zentralstrasse 9<br />
8304 Wallisellen<br />
erdgas<br />
toggenburg werdenberg ag<br />
Auweg<br />
9630 Wattwil<br />
Technische Betriebe<br />
Weinfelden <strong>AG</strong><br />
Weststrasse 8<br />
8570 Weinfelden<br />
Gemeindewerke Wetzikon<br />
Usterstrasse 181<br />
8621 Wetzikon<br />
Technische Betriebe Wil<br />
Postfach 137<br />
9501 Wil<br />
Stadtwerk Winterthur<br />
Untere Vogelsangstrasse 11<br />
8402 Winterthur<br />
IBW Energie <strong>AG</strong><br />
Steingasse 31<br />
5610 Wohlen (<strong>AG</strong>) 2<br />
Service des Energies<br />
Rue de l'Ancien-Stand<br />
1401 Yverdon-les-Bains<br />
StWZ Energie <strong>AG</strong><br />
Mühlegasse 7<br />
4800 Zofingen<br />
Gemeindewerke Zollikon<br />
Rietstrasse 38<br />
8702 Zollikon<br />
Wasserwerke Zug <strong>AG</strong><br />
Chollerstrasse 24<br />
6301 Zug<br />
<strong>Erdgas</strong> Ostschweiz <strong>AG</strong><br />
Bernerstrasse<br />
8010 <strong>Zürich</strong><br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>Zürich</strong> <strong>AG</strong><br />
Aargauerstrasse 182<br />
8010 <strong>Zürich</strong><br />
Schweizerischer Verein des<br />
Gas- und Wasserfaches SVGW<br />
Grütlistrasse 44<br />
Postfach<br />
8027 <strong>Zürich</strong><br />
Swissgas<br />
Schweiz. Aktiengesellschaft<br />
für <strong>Erdgas</strong><br />
Grütlistrasse 44<br />
Postfach<br />
8027 <strong>Zürich</strong><br />
<strong>Erdgas</strong> <strong>–</strong> Daten und Fakten / Tabellen und Grafiken 11
Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), Grütlistrasse 44, Postfach, 8027 <strong>Zürich</strong><br />
Telefon: 044 288 31 31, Telefax: 044 202 18 34, E-Mail: vsg@erdgas.ch, www.erdgas.ch