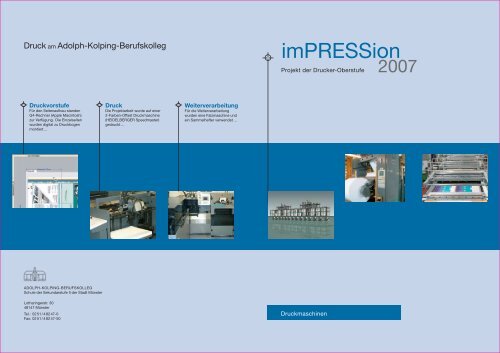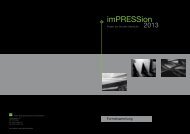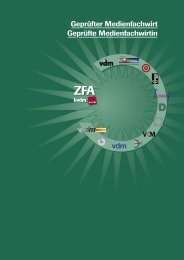Druck am Adolph-Kolping-Berufskolleg
Druck am Adolph-Kolping-Berufskolleg
Druck am Adolph-Kolping-Berufskolleg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Druck</strong> <strong>am</strong> <strong>Adolph</strong>-<strong>Kolping</strong>-<strong>Berufskolleg</strong><br />
<strong>Druck</strong>vorstufe<br />
Für den Seitenaufbau standen<br />
G4-Rechner (Apple Macintosh)<br />
zur Verfügung. Die Einzelseiten<br />
wurden digital zu <strong>Druck</strong>bogen<br />
montiert…<br />
ADOLPH-KOLPING-BERUFSKOLLEG<br />
Schule der Sekundarstufe II der Stadt Münster<br />
Lotharingerstr. 30<br />
48147 Münster<br />
Tel.: 02 51 / 4 82 47-0<br />
Fax: 02 51 / 4 82 47-50<br />
<strong>Druck</strong><br />
Die Projektarbeit wurde auf einer<br />
2-Farben-Offset <strong>Druck</strong>maschine<br />
(HEIDELBERGER Speedmaster)<br />
gedruckt…<br />
Weiterverarbeitung<br />
Für die Weiterverarbeitung<br />
wurden eine Falzmaschine und<br />
ein S<strong>am</strong>melhefter verwendet…<br />
imPRESSion<br />
2007<br />
Projekt der <strong>Druck</strong>er-Oberstufe<br />
<strong>Druck</strong>maschinen
2<br />
<strong>Druck</strong>erabschlussklasse 2006 / 2007<br />
Hinten (stehend) Christopher Göbel, Igor Förderer, Daniel Brömmelhaus, Kevin Pattberg, Andreas Kleimeyer,<br />
Alexander Gaidies, Marco Segeler, Stefan Drabinski, Philipp Nießing, Stefan ten Venne,<br />
Jens Dupslaff, Rainer Hippers, Christian Nienhaus, Thomas Kapell, Matthias Lewalski<br />
Vorne Nicole Jöster, Gabi Westerhoff, Pascal Pottmeier, Sven Fleck, Waldemar Martens,<br />
Jonas Hoffmann<br />
Nicht auf dem Bild Tobias Schalles, Tobias Zimmer<br />
Hinweis Der vorliegende 16-Seiter wurde in Projektarbeit selbstständig und eigenverantwortlich durch<br />
die Schüler der <strong>Druck</strong>erklasse erstellt.<br />
Die Umschlaggestaltung erfolgte durch Schüler der Mediengestalterklassen der Mittelstufe.<br />
4.3 T<strong>am</strong>pondruck<br />
Der T<strong>am</strong>pondruck ist ein Tiefdruckverfahren. Exemplarische<br />
Produkte, die man im T<strong>am</strong>pondruckverfahren bedrucken<br />
kann sind z. B. Tastaturen, Handys, Babyflaschen,<br />
Schnuller, Feuerzeuge und vieles mehr.<br />
<strong>Druck</strong>formherstellung (Beispiel: Wasserklischee)<br />
Für den T<strong>am</strong>pondruck braucht man ein Klischee und einen<br />
Film, der das gewünschte <strong>Druck</strong>motiv beinhaltet. Das Klischee<br />
wird mit dem Film durch UV-Licht belichtet. Beim<br />
Belichten werden die Stellen gehärtet, die auf dem Film nicht<br />
geschwärzt sind. Nach der Belichtung wird das Klischee mit<br />
Wasser ausgewaschen. Es lösen sich nur die geschwärzten<br />
Stellen (wo kein UV-Licht hink<strong>am</strong>). Das Tiefdruckklischee ist<br />
fertig.<br />
Komponente einer T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
Einrichten einer T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
Als erstes nehmen wir das Klischee und stanzen in allen<br />
vier Ecken Löcher, um das Klischee in der T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
zu befestigen.<br />
Der zweite Schritt ist die passende Anlage zu bauen, so<br />
dass der Bedruckstoff nicht verrutschen kann. Dann befestigen<br />
wir die Anlage an der unteren Haltung bei der T<strong>am</strong>pondruckmaschine.<br />
Danch erfolgt die Auswahl des T<strong>am</strong>ponkissens. Das ist<br />
eines der wichtigsten Dinge, die man für den T<strong>am</strong>pondruck<br />
braucht.<br />
Die T<strong>am</strong>ponkissen bestehen aus Silikonkautschuk. Es gibt<br />
sehr viele verschiedene Formen und unterschiedliche Härtungsstufen.<br />
Danach legen wir den Bedruckstoff in die Anlage und richten<br />
die Maschine für den <strong>Druck</strong>vorgang ein. Das heisst, dass<br />
wir den Stand des <strong>Druck</strong>motives nach Kundenwunsch einrichten<br />
müssen.<br />
Ebenso ist die Einstellung des <strong>Druck</strong>es von entscheidender<br />
Bedeutung, um das das <strong>Druck</strong>bild genauestens übertragen<br />
zu können.<br />
Vorwort und T<strong>am</strong>pondruck<br />
und Inhaltsverzeichnis<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Rakel<br />
T<strong>am</strong>ponkissen<br />
Klischee<br />
Anlagepult<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Die Farbe wird jetzt angemischt. Die im T<strong>am</strong>pondruck eingesetzte<br />
Farbe ist niedrigviskos, fast so wie Wasser. Oft ist<br />
1. noch Siebdruckmaschinen die Verdünnung der ............................................. Farbe erforderlich, um den Tro4<br />
ckenprozess zu steuern. Die Farbe wird in einen Behälter<br />
1.1 der Maschine Handdrucktische eingefüllt. .................................................... Der Behälter schiebt die Farbe über 4<br />
das Klischee (Igor Förderer, hin Pascal und Lohmann) her. Die Näpfchen werden gefüllt und<br />
1.2 beim Zurückgehen Halbautomaten bleiben ...................................................... die vertieften Näpfchen mit Far- 4<br />
be gefüllt. (Christopher Göbel, Gabriele Westerhoff)<br />
1.3 Dreiviertelautomaten .............................................. 4<br />
(Christopher Göbel, Gabriele Westerhoff)<br />
1.4 <strong>Druck</strong>en Vollautomaten mit Maschine: ........................................................ 5<br />
An der (Kevin Maschine Pattberg, Tobias ist Schalles) eine Halterung für das Klischee, für<br />
1.5 das T<strong>am</strong>ponkissen, Mehrfarblinien ........................................................ für die Anlage und ein Behälter für die 5<br />
Farbe. (Kevin Pattberg, Tobias Schalles)<br />
Die Maschine bzw. die Füllrakel zieht die Farbe über das<br />
Klischee. Das Klischee ist einmal in dem Farbbehälter befestigt<br />
oder das Klischee ist an der Maschine befestigt und der<br />
2. Topf ist Offsetdruckmaschinen oben drauf. Wenn die ........................................... Rakel wieder zurückfährt, zieht 6<br />
sie die Farbe mit zurück und in den vertieften Stellen des Kli-<br />
2.1 schees Bogenoffsetmaschinen (dem <strong>Druck</strong>motiv) bleibt .......................................... die Farbe. Wenn die Rakel 6<br />
zurück (Stefan fährt, Drabinski, geht das Christian T<strong>am</strong>ponkissen Nienhaus) (Silikonkissen) mit und<br />
2.2 fährt dann Bogenoffsetmaschinen runter bzw. drückt mit sich Wendeeinrichtung auf das Klischee ...... mit der 7<br />
Farbe. (Rainer Nach Hippers, dem Vorgang Philipp Nießing) fährt es wieder hoch. An dem T<strong>am</strong>-<br />
2.3 ponkissen Rollenrotationsmaschinen haftet jetzt die Farbe. (Zeitung) Das T<strong>am</strong>ponkissen ...................... fährt mit 8<br />
der Farbe (Jonas nach Hoffmann) vorne, gleichzeitig füllt die Rakel die Vertie-<br />
2.4 fungen Rollenrotationsmaschinen wieder mit Farbe. In der Zeit (Illustration) fährt das .................. T<strong>am</strong>ponkissen 9<br />
runter (Andreas und drückt Kleimeyer, das Matthias <strong>Druck</strong>motiv Lewalski) bzw. die Farbe auf den<br />
2.5 Bedruckstoff. Direct Imaging Variieren ........................................................ läßt sich neben dem <strong>Druck</strong> auch das 10<br />
Hin- und (Daniel Herfahren Brömmelhaus, des Pascal Kissens Pottmeier) und des Rakels bezogen auf<br />
2.6 die Geschwindigkeit.<br />
DICOweb (Sven Fleck, Marco Segeler) ............................. 11<br />
Das Wichtigste beim T<strong>am</strong>pondruck ist das Klischee. Es ist<br />
sehr empfindlich, sobald nur ein winziger Kratzer im <strong>Druck</strong>-<br />
3. motiv Flexodruckmaschinen ist kann dieses schon ............................................ nicht mehr verwendet werden, 12<br />
da Kratzer mitdrucken würden. Die Standzeit der <strong>Druck</strong>form<br />
3.1 (Klischee) Einzylinderdruckmaschinen ist begrenzt, dementsprechend ................................... muss man sehr auf 12<br />
Verschleißerscheinungen (Waldemar Martens) der <strong>Druck</strong>form (Klischee) achten.<br />
3.2 Mehrzylinderdruckmaschinen ................................ 12<br />
(Waldemar Martens)<br />
4. Tiefdruckmaschinen ............................................... 13<br />
4.1 Illustrationstiefdruckmaschinen ............................. 13<br />
(Jens Dupslaff)<br />
4.2 Verpackungstiefdruckmaschinen ........................... 14<br />
(Alexander Gaidies, Stefan ten Venne)<br />
4.3 T<strong>am</strong>pondruckmaschinen ........................................ 15<br />
(Nicole Jöster)<br />
T<strong>am</strong>ponsdruckmaschine der Firma Kent, Stuttgart<br />
15 3
Siebdruckmaschinen (Handddrucktisch, Halbautomat, Dreiviertelautomat)<br />
1. Siebdruckmaschinen<br />
Handdrucktisch mit parallel abhebenden Siebrahmen<br />
1.1 Handdrucktische<br />
Hauptbestandteil ist ein massiver <strong>Druck</strong>tisch mit glatter<br />
Oberfläche. An dem Tisch ist eine Tischschwinge befestigt.<br />
Diese Tischschwinge hält das Sieb, so dass man das Sieb<br />
mit einem Scharnier absenken kann.<br />
Am Siebrahmen ist eine Führungsleiste für die Rakel<br />
befestigt. Der <strong>Druck</strong>er gibt Farbe auf das Sieb und zieht die<br />
Rakel mit gleichmäßigem <strong>Druck</strong> über die Fläche. Die Farbe<br />
dringt durch die offenen Bildstellen auf den Bedruckstoff.<br />
Die Arbeit <strong>am</strong> Handdrucktisch wird durch das Ansaugen<br />
des <strong>Druck</strong>bogens erleichtert, da der Bedruckstoff sich nicht<br />
verschieben kann. Das Vakuumsystem besteht aus einer perforierten<br />
<strong>Druck</strong>platte, einem Vakuumbecken mit Luftschacht<br />
und einem Absaugmotor (siehe Grafik). Wenn der <strong>Druck</strong>rahmen<br />
zur <strong>Druck</strong>platte gebracht wird, wird mittels einem an der<br />
Tischschwinge befestigten Stahldraht oder einer Stange ein<br />
Luftschacht geöffnet, wodurch das Vakuumsystem in Gang<br />
gesetzt wird. Nach dem <strong>Druck</strong>vorgang wird das Produkt<br />
manuell aufgenommen und zum Trocknen ausgelegt.<br />
Im manuellen Siebdruck wird mit nur einer <strong>Druck</strong>rakel gearbeitet.<br />
Die <strong>Druck</strong>leistung beträgt ca. 200-300 <strong>Druck</strong>/h. Die<br />
üblichen <strong>Druck</strong>produkte sind T-Shirts und Kleinauflagen.<br />
perforierte <strong>Druck</strong>platte<br />
Schematische Darstellung eines Vakuumtisches<br />
Vakuumraum<br />
Vakuumgebläse Luftschieber<br />
1.2 Halbautomaten<br />
Der Halbautomat funktioniert im Prinzip wie ein Handdrucktisch,<br />
jedoch ist der <strong>Druck</strong>vorgang automatisiert. Der<br />
Bogen wird per Hand angelegt. Durch <strong>Druck</strong> auf das Fußpedal<br />
wird der <strong>Druck</strong>bogen durch den perforierten <strong>Druck</strong>tisch<br />
mittels eines Vakuums festgehalten. Er kann so nicht mehr<br />
verrutschen. Das Sieb fährt nun automatisch bis zum angegebenen<br />
Absprung (notwendiger Abstand zwischen Sieb<br />
und Bedruckstoff) herunter. Die Rakel flutet und drückt die<br />
Farbe durch die offenen Siebmaschen. Das Sieb fährt wieder<br />
in die Ausgangsposition. Der bedruckte Bogen muss nun<br />
von Hand zum Trocknen abgelegt werden.<br />
Neben dem THIEME Aufkleben 1000 von Anlegemarken sind in Halb-<br />
automaten meistens auch feste Anlegemarken integriert.<br />
Abhängig von der Tischbewegung versinken die Marken im<br />
Tisch. Der <strong>Druck</strong>bogen wird dann nur noch vom Vakuum<br />
festgehalten.<br />
Siebdruckhalbautomat<br />
Halbautomatische Flachbett -Siebdruckmaschine<br />
mit fahrbarem <strong>Druck</strong>tisch<br />
1.3 Dreiviertelautomat<br />
Bei einem Dreiviertelautomat muss der Bogen nur noch<br />
von Hand angelegt werden. Der <strong>Druck</strong>tisch fährt wiederum<br />
unter das Sieb, wo der Bogen bedruckt wird. Danach fährt<br />
er wieder in die ursprüngliche Position. Nachfolgend wird<br />
der Bogen von den Greifern entgegengenommen. Sie greifen<br />
den Bogen und geben ihn an einen Durchlauftrockner<br />
weiter. Im Durchlauftrockner befinden sich zahlreiche Luftdüsen,<br />
welche die Bogen trocknen. Am Ende des Trockvorganges<br />
werden die Bogen von dem sog. Abstapler in Empfang<br />
genommen.<br />
Solche Maschinen werden bis zu einem <strong>Druck</strong>format von<br />
120 x 340 cm eingesetzt.<br />
Laut Herstellerangaben sind häufig um die 800 <strong>Druck</strong> pro<br />
Stunde möglich. Diese Werte können aber nur unter optimalen<br />
Bedingungen erreicht werden. Dies ist allerdings nur selten<br />
der Fall.<br />
1.4 Vollautomaten<br />
Im Gegensatz zu allen anderen Siebdruckmaschinen wie<br />
Handdrucktische, Halb- und Dreiviertelautomaten arbeitet<br />
diese Maschine vollautomatisch.<br />
Exemplarisch möchten wir hier die Zylinderdruckmaschine<br />
vorstellen, mit der man flexible <strong>Druck</strong>güter wie z. B. Kunststoff-Folien<br />
bedruckt.<br />
Das Einlegen des Bedruckstoffes in die Maschine wird<br />
durch einen Anleger oder eine spezielle Zuführvorrichtung<br />
automatisch ausgeführt (a). Bei Zylindersiebdruckmaschinen<br />
wird das <strong>Druck</strong>material (e) durch einen Zylinder abgewickelt.<br />
Die <strong>Druck</strong>form (c) bewegt sich über den <strong>Druck</strong>zylinder<br />
(d) und ist mit dessen Umdrehungen synchron. Die fest stehende<br />
Rakel (b) steht über dem Scheitelpunkt des Zylinders<br />
und druckt in dieser Stellung während des <strong>Druck</strong>vorgangs<br />
auf das Sieb. Auf Grund des schmalen Berührungsstreifens<br />
der Rakel braucht die Zylindersiebdruckmaschine nur einen<br />
ganz geringen Absprung.<br />
Vollautomaten gibt es auch als Flachbettmaschine. Der<br />
Flachdruck wird zum Bedrucken von flexiblen und starren<br />
Bedruckstoffen verwendet, wie z.B Kunststoff-Folien oder<br />
Kunststoffplatten.<br />
a = <strong>Druck</strong>richtung<br />
b = Rakel<br />
c = <strong>Druck</strong>form<br />
d = <strong>Druck</strong>gut<br />
Siebdruckmaschinen (Vollautomat, Mehrfarblinien)<br />
Vollautomat mit drei <strong>Druck</strong>werken (Thieme 5000)<br />
Die Formate der angebotenen Flachbettmaschinen variieren.<br />
Im großformatigen Bereich variieren die angebotenen<br />
Maschinen. So hat zum Beispiel die Thieme 5070 ein maximales<br />
<strong>Druck</strong>format von 1600 x 2600 mm.<br />
Diese <strong>Druck</strong>maschinen werden als Mehrfarbenlinien z.B.<br />
für Großauflagen verwendet, wie sie häufig bei Werbeschildern<br />
vorkommen. Mehrfarblinien sind <strong>Druck</strong>maschinen, die<br />
vollautomatisch mehrere Farben (max. 6) nacheinander drucken.<br />
Hierbei werden mehrere <strong>Druck</strong>module aneinander<br />
gekoppelt und die Trockenstationen befinden sich zwischen<br />
den einzelnen <strong>Druck</strong>werken, um die Farbe vor dem nächsten<br />
<strong>Druck</strong> zu trocknen, deswegen werden bei Mehrfarbenstraßen<br />
vorzugsweise UV-Farben verwendet.<br />
Exemplarische Leitungsdaten der Thieme 5000<br />
<strong>Druck</strong>leistung: bis 3000 m2/h Exemplarische Leitungsdaten der Thieme 5000<br />
<strong>Druck</strong>leistung: bis 3000 m<br />
(in Abhängigkeit des <strong>Druck</strong>formats)<br />
<strong>Druck</strong>formate: bis 2000 x 3050 mm<br />
<strong>Druck</strong>gut: bis 10 mm Stärke<br />
Rüstzeit: < 5 Minuten pro Farbstation<br />
2/h<br />
(in Abhängigkeit des <strong>Druck</strong>formats)<br />
<strong>Druck</strong>formate: bis 2000 x 3050 mm<br />
<strong>Druck</strong>gut: bis 10 mm Stärke<br />
Rüstzeit: < 5 Minuten pro Farbstation<br />
Mehrfarblinie (Thieme, Teningen)<br />
4 5<br />
c<br />
e<br />
c<br />
b<br />
b<br />
d<br />
d<br />
a<br />
a<br />
1.5 Mehrfarblinien
2. Offsetdruckmaschinen<br />
2.1 Bogenoffsetdruck<br />
Eine Bogenoffsetdruckmaschine besteht aus einem Anleger,<br />
dem <strong>Druck</strong>werk und der Auslage.<br />
Anleger<br />
In Abhängigkeit vom Maschinentyp (hier ist vor allen Dingen<br />
das Format gemeint) werden in <strong>Druck</strong>maschinen zwei<br />
unterschiedliche Anlegersysteme unterschieden. Zum einen<br />
ist das der Einzelbogenanleger und zum anderen ist das der<br />
Schuppenanleger<br />
Schuppenanleger<br />
Beim Schuppenanleger erfassen Trennsauger den obersten<br />
Bogen an der Hinterkante und heben ihn vom Papierstapel.<br />
Schleppsauger übernehmen ihn und schieben ihn auf<br />
den Anlegertisch, wo entweder ein System von Bändern und<br />
Rollen oder Saugbändern den Weitertransport zur Bogenanlage<br />
übernimmt.<br />
Einzelbogenanleger<br />
Beim Einzelbogenanleger erfasst eine Saugstange mit vielen<br />
Einzelsaugern den obersten Bogen einige Millimeter hinter<br />
der Vorderkante, trennt ihn vom Stapel und übergibt<br />
ihn an die Zuführgreifer. Diese führen dann<br />
das Papier zu den Vordermarken.<br />
<strong>Druck</strong>werk<br />
Ein typisches Offsetdruckwerk in Reihenbauweise<br />
besteht aus einem Farbwerk, Feuchtwerk,<br />
<strong>Druck</strong>plattenzylinder, Gummituchzylinder<br />
und Gegendruckzylinder.<br />
Feuchtwerk<br />
Das Nassoffsetdruckverfahren benötigt vor<br />
der Einfärbung eine <strong>Druck</strong>formfeuchtung. Das<br />
Feuchtwerk muss dazu eine möglichst gleichmäßig<br />
dünne Wasserschicht auf die bildfreien<br />
Plattenstellen aufbringen.<br />
5<br />
3<br />
4<br />
2<br />
Offsetdruckmaschinen (Bogen)<br />
6<br />
7 8<br />
Farbwerk<br />
Durch Einstellen der einzelnen Farbzonen <strong>am</strong> Duktor wird die<br />
Farbe differenziert an den Farbheber abgegeben. Der Heber<br />
gibt die benötigte Farbe an die Farbwalzen weiter (Material:<br />
Gummi bzw. Rilsan).<br />
Bogenauslage<br />
Die Auslegegreifer (Kettengreifer) übernehmen den Bogen<br />
vom <strong>Druck</strong>zylinder, führen ihn mit der bedruckten Seite nach<br />
innen über eine Trommel und bringen ihn zum Auslagestapel.<br />
Puderbestäuber<br />
Der frische <strong>Druck</strong> darf nicht verschmieren oder verkratzen.<br />
Aus diesem Grund erfolgt ein Bepudern der frisch bedruckten<br />
Bogen. Somit wird eine Trennschicht zwischen zwei aufeinanderliegenden<br />
Bogen geschafffen, die ein Ablegen vermeidet.<br />
1<br />
Heidelberg Speedmaster 74<br />
1. Anleger<br />
2. <strong>Druck</strong>plattenzylinder<br />
3. Gummituchzylinder<br />
4. Gegendruckzylinder<br />
5. Auslage<br />
6. Farbkasten<br />
7. Feuchtwerk<br />
8. Anlagetisch<br />
2.2 Bogenoffsetmaschinen mit Wendeeinrichtung<br />
Bogenoffsetmaschinen mit Wendeeinrichtung sind ganz<br />
normale Bogenoffsetmaschinen. Besonderheit hierbei ist die<br />
Wendeeinrichtung, die es erlaubt, den Bogen in einem Durchgang<br />
beidseitig zu bedrucken. Dabei wird der Bogen in der<br />
Maschine umstülpt. Dieses System besteht aus einer Übergabetrommel,<br />
einer Speichertrommel und einer Wendetrommel.<br />
Die Übergabetrommel führt den einseitig bedruckten<br />
Bogen vom Gegendruckzylinder zur Speichertrommel. Die<br />
Speichertrommel ist ca 2,5 mal so groß wie der Gegendruckzylinder.<br />
An der Wendetrommel befinden sich mehrere Zangengreifer.<br />
Um das genauer darzustellen, wird die Arbeitsweise<br />
der Wendeeinrichtung in 4 Phasen erläutert:<br />
Phase 1: Der Zangengreifer dreht sich um 180° dem Bogen<br />
entgegen, also in die Drehrichtung der Wendetrommel.<br />
Phase 2: Der Zangengreifer erfasst den Bogen an der<br />
Bogenhinterkante und zieht ihn mit. Der Greifer an<br />
der Bogenvorderkante gibt den Bogen frei.<br />
Phase 3: Der Zangengreifer nimmt den Bogen in die Drehrichtung<br />
der Wendetrommel mit. Dabei schwenkt<br />
er um 180°.<br />
Phase 4: Der Zangengreifer übergibt den Bogen an den<br />
nachfolgenden Gegendruckzylinder.<br />
<strong>Druck</strong>zylinderoberfläche im Widerdruck<br />
Um ein Ablegen und Aufbauen der <strong>Druck</strong>farbe gering zu<br />
halten, werden die Zylinder und die Übergabetrommel mit<br />
Spezialoberflächen gefertigt, z. B. werden sie leicht angeraut.<br />
Wendetrommel Zangengreifer<br />
Speichertrommel<br />
Schematische Darstellung einer Wendeeinheit (Heidelberg)<br />
Offsetdruckmaschine mit Wendeeinrichtung<br />
Übergabetrommel<br />
Saugersystem zur<br />
Bogenstraffung<br />
Bei allen Maschinen muss der Bogen vor der Wendung<br />
nach hinten und seitlich gestrafft werden. Dies ist notwendig,<br />
um eine einwandfreie Bogenübergabe an das nachfolgende<br />
Greifersystem zu gewährleisten. Ferner würde bei locker liegendem<br />
Bogen die Schöndruckseite auf dem Gegendruckzylinder<br />
des nächsten <strong>Druck</strong>werks ggf. dublieren.<br />
Die oben angesprochene Bogenstraffung im hinteren<br />
Bogenbereich erfolgt auf der großen Übergabetrommel durch<br />
exzentrisch drehende Sauger, die dabei den Bogen festhalten.<br />
Die Saugluftleiste lässt sich regulieren.<br />
6 7<br />
Sauger<br />
������ ������<br />
Bogenstraffung mit exzentrisch drehenden Saugern
Rollenrotationsmaschinen (Zeitung)<br />
2.3 Rollenrotationsmaschinen für den Zeitungsdruck<br />
Rollenrotationsmaschinen für den Zeitungsdruck arbeiten<br />
heutzutage mit dem Prinzip des Cold-Offset. Auf Cold-Offset-Maschinen<br />
werden Zeitungen, zeitungsähnliche Produkte<br />
(Anzeigenblätter), einfachere Zeitschriften oder Werbeschriften<br />
hauptsächlich auf ungestrichenem Papier gedruckt.<br />
Diese Maschinen brauchen im Gegensatz zu den Heat-Set-<br />
Maschinen keine Heißlufttrocknung und keine Kühlgrupppe.<br />
Zehnzylinderdruckwerk<br />
Ein Beispiel für ein <strong>Druck</strong>werk an Rollenrotationsmaschinen<br />
für den Zeitungsbereich ist das Zehnzylinderdruckwerk,<br />
das gerade bei großen Zeitungsdruckmaschinen zur<br />
Anwendung kommt. Statt eines Gegendruckzylinders gibt<br />
es hier zwei Gegendruckzylinder.<br />
Das bringt viele Vorteile.<br />
Bei der abgebildeten <strong>Druck</strong>einheit<br />
sind die Gummizylinder<br />
schwenkbar angeordnet,<br />
so dass entweder nach dem<br />
Prinzip Gummi gegen Gummi<br />
oder Gummi gegen <strong>Druck</strong>zylinder<br />
gefahren werden<br />
kann, was die Flexibilität dieser<br />
Maschinen noch einmal<br />
unterstreicht.<br />
Variationen einer Rollenoffsetdruckmaschine<br />
Bei Zeitungsrotationsmaschinen gibt es mehrere Varianten<br />
von Produktionsmöglichkeiten. Eine Zeitung hat zwar immer<br />
das gleiche Erscheinungsbild, der Umfang und die Farbbelegung<br />
wechseln aber sehr stark bei den einzelnen Ausgaben.<br />
Die Maschinen müssen deshalb für den variablen Einsatz<br />
konstruiert werden.<br />
Bei den Zeitungen gibt es vom Umfang her sehr große<br />
Unterschiede: Kleinere Regionalzeitungen haben teilweise<br />
nur 24 oder 32 Seiten, überregionale Zeitungen haben auch<br />
unter der Woche 64 und mehr Seiten, <strong>am</strong> Wochenende oder<br />
durch Beilagen geht ihr Umfang bis weit über 100 Seiten. Des<br />
Weiteren kommen noch die sehr unterschiedlichen Auflagenhöhen<br />
als Faktor hinzu. Bei Regionalzeitungen sind es einige<br />
Zehntausend Exemplare täglich, die man in Einfachproduktion<br />
herstellen kann. Die großen Tageszeitungen dagegen<br />
haben täglich eine Auflagenhöhe von mehreren Hunderttausend.<br />
Sie müssen in Mehrfachproduktion gedruckt werden,<br />
die über mehrere Falzwerke gleichzeitig ausgelegt werden.<br />
Die Maschinen sind demnach auch sehr unterschiedlich.<br />
Für die kleineren Regionalzeitungen genügen manchmal<br />
wenige <strong>Druck</strong>werke, während die Maschinen für die großen<br />
Tageszeitungen wahre Giganten sind, mit deutlich über<br />
100 Metern Länge. Die beiden Beispiele zeigen eine kleine<br />
Maschine für eine regionale Zeitung in verschiedenen Produktionsmöglichkeiten.<br />
Im Beispiel A und B sieht man einen Ausschnitt einer MAN<br />
Cromoman.<br />
Im Produktionsbeispiel A laufen drei Papierbahnen, wobei<br />
jede Papierbahn auf der Vorder- und Rückseite mit jeweils 2<br />
Seiten (2/1 farbig) durch die einzelnen <strong>Druck</strong>werke bedruckt<br />
wird. Anschließend werden die Papierbahnen übereinander<br />
geführt und im Falzapparat weiterverarbeitet. Dieser falzt<br />
dann auf ein Produkt mit 12 Seiten.<br />
Produktionsbeispiel A: Produktion mit 3 Papierbahnen<br />
Im Produktionsbeispiel B laufen zwei Papierbahnen. Die<br />
vordere Bahn läuft nicht wie beim Beispiel A nur durch das<br />
erste, sondern auch direkt durch das zweite <strong>Druck</strong>werk.<br />
Durch diese variable Einstellung läßt sich die Farbigkeit des<br />
Produktes erhöhen (4/2 farbig). Das <strong>Druck</strong>werk führt keine<br />
eigene Papierbahn, so dass der Umfang des Produktes kleiner<br />
wird. Nach den einzelnen <strong>Druck</strong>werken werden die Bahnen<br />
übereinander geführt und dem Falzapparat zugeführt, wo<br />
diese dann zu einem Produkt mit 8 Seiten gefalzt werden.<br />
Produktionsbeispiel B: Produktion mit 2 Papierbahnen<br />
2.4 Rollenoffsetmaschinen (Illustrationsdruck)<br />
Papierlauf<br />
Rollenoffsetmaschinen haben im Gegensatz zu Bogenoffsetmaschinen<br />
einen anderen Papierzulauf. Während bei einer<br />
Bogenoffsetmaschine einzelne Papierbogen durch Greifersysteme<br />
durch die Maschine „gezogen“ werden, wird das<br />
Papier der Rollenoffsetmaschine von einer Rolle Papierbahn<br />
durch die Maschine geleitet. Das Papier wird hierbei erst nach<br />
dem <strong>Druck</strong>prozess geschnitten und noch in der Maschine<br />
gefalzt und weiterverarbeitet.<br />
Farbe<br />
Für den Illustrationsrollenoffsetbereich werden Farben mit<br />
einem hohen Anteil von hochsiedenden Mineralölen (Heatset-<br />
Ölen) eingesetzt. Die im Illustrationsrollenoffsetdruck eingesetzten<br />
Heatset-Farben haben einen Anteil von ca. 20% bis<br />
40% an hochsiedenden Mineralölen. Die Trocknung der Farben<br />
erfolgt durch das Verd<strong>am</strong>pfen des enthaltenen Mineralöls.<br />
Als Trockenaggregate dienen dabei spezielle Trockner.<br />
D<strong>am</strong>it das Mineralöl richtig verd<strong>am</strong>pft, muss es min. 1 sek.<br />
bei ca. 130 °C erwärmt werden. Hierfür muss der Trockner bei<br />
einer Bahngeschwindigkeit von 14 Meter pro Sekunde (das<br />
entspricht ca. 50 Kilometer pro Stunde) 14 Meter lang sein.<br />
Nach diesem Vorgang wird das Papier über 3-6 Kühlwalzen<br />
geleitet, die mit Kühlmittel durchflossen werden. Durch das<br />
Papierabrollung<br />
MAN LITHOMAN (Abbildung: MAN Roland) <strong>Druck</strong>maschinen AG<br />
Rollenrotationsmaschinen (Illustration)<br />
schlagartige Abkühlen erstarrt das Harz und bindet so die<br />
Pigmente auf den Bedruckstoff. Somit erklärt sich auch der<br />
Glanz des Rollenoffsetdrucks. Nach der Kühlwalzengruppe<br />
wird auf die Papierbahn eine Silikon-Wasser-Mischung aufgetragen,<br />
um die Papieroberfläche mit einem Gleitfilm zu versehen<br />
und somit das Abschmieren der Farbe im Falzapparat<br />
zu verhindern.<br />
Maschinenkombinationen<br />
Maschinen können im Rollenrotationsbereich auch kombiniert<br />
werden. Hierbei werden verschiedene Kombinationsmöglichkeiten<br />
unterschieden.<br />
Duplex-Maschine<br />
Zwei Maschinen werden nebeneinander gestellt.<br />
Tandem-Maschine<br />
Zwei Maschinen werden hintereinander gekoppelt.<br />
Etagen-Maschine<br />
Zwei Maschinen werden übereinander gestellt.<br />
Der Vorteil der Kopplung ist, dass beide Maschinen meistens<br />
jeweils ein Falzwerk besitzen und sie können somit im<br />
Einzelbetrieb zwei verschiedene Produkte gleichzeitig produzieren<br />
oder sie können gekoppelt auch ein Produkt mit größerem<br />
Umfang produzieren.<br />
8 9<br />
Bahneinlauf<br />
<strong>Druck</strong>werke<br />
Trockner<br />
Leitstand<br />
Falzapparat
2.5 Direct Imaging<br />
Das Direct Imaging Konzept möchten wir hier anhand der<br />
Quickmaster 46-DI der Heidelberger <strong>Druck</strong>maschinen AG<br />
näher erläutern.<br />
Ein technologisch faszinierendes Konzept ist zweifelsohne,<br />
die Daten des digital beschriebenen <strong>Druck</strong>auftrags direkt in<br />
die <strong>Druck</strong>maschine zu übertragen, ohne die Zwischenschritte<br />
der offline Film- und/oder Plattenherstellung und das folgende<br />
manuelle Einspannen in der Maschine.<br />
Computer to Press / Direct Imaging System - Quickmaster DI<br />
Direct Imaging<br />
Das manuell unterstützte Einspannen der bebilderten Platten<br />
in die Maschine ist auch bei Computer to Plate eine Notwendigkeit,<br />
die einen Zeitaufwand erfordert. Bei Computer to<br />
Press ist die manuelle Handhabung von bebilderten <strong>Druck</strong>platten<br />
nicht mehr erforderlich. Die verwendete <strong>Druck</strong>form<br />
wird inline, also innerhalb der Produktionsmaschine, passergenau<br />
erzeugt.<br />
Auslage<br />
<strong>Druck</strong>werke<br />
<strong>Druck</strong>formmaterial<br />
Bebilderungssystem<br />
Quickmaster DI 46 Pro (Foto: Heidelberger <strong>Druck</strong>maschinen AG)<br />
Mit dem StatusTool erhält der Anwender auf einen Blick den Ist-<br />
Zustand des Quickmaster DI-Systems.<br />
Die <strong>Druck</strong>maschine ist in der Satellitenbauweise gebaut.<br />
Um einen vierfachgroßen <strong>Druck</strong>zylinder sind vier <strong>Druck</strong>werke<br />
mit je einem Platten- und Gummituchzylinder angeordnet.<br />
Der Bogen wird von einer Saugstange vom Stapel<br />
genommen und über ein Feed-roll-System an einen Greifer<br />
des <strong>Druck</strong>zylinders übergeben und dann an allen vier <strong>Druck</strong>werken<br />
vorbeigeführt. Dieser <strong>Druck</strong> in einem Greiferschluss<br />
garantiert einen guten Passer. Bevor der Bogen an die Auslegegreifer<br />
übergeben wird, ist er in voller Länge bedruckt.<br />
Der <strong>Druck</strong> ist weitgehend automatisiert, wobei das Feuchten<br />
der Platte entfällt, da ausschließlich im wasserlosen Offsetdruck<br />
gedruckt wird.<br />
<strong>Druck</strong>werke<br />
Gegendruckzylinder<br />
Anleger<br />
2.6 DICOweb<br />
Die DICOweb von MAN Roland ist ein Computer-to-Press -<br />
Offsetdrucksystem. DICO bedeutet: Digital Change Over. Mit<br />
DICOweb ist es möglich, die <strong>Druck</strong>formen in der Maschine<br />
zu bebildern, zu löschen und erneut zu bebildern. Dabei integriert<br />
DICOweb die Technologie aller Prozessstufen: Informationsverarbeitung,<br />
Datenkommunikation, digitale Vorstufe<br />
– bis hin zum <strong>Druck</strong>prozess und zur integrierten Weiterverarbeitung.<br />
Konzipiert wurde diese Maschine für den Short-Run-<br />
Color-Markt, d. h. kleine, mehrfarbige Auflagen.<br />
Aufbau und Besonderheiten:<br />
Aus einem Baukasten modularer und miteinander kompatibler<br />
Komponenten bzw. Aggregate wird das aufeinander<br />
abgestimmte digitale Offsetdrucksystem mit Computer- to-<br />
Press realisiert. Die Maschine kann aus beliebig vielen Doppeldruckwerken,<br />
verschiedenen Ausbaustufen jedes einzelnen<br />
<strong>Druck</strong>werkes sowie unterschiedlichen Zusatz- und Weiterverarbeitungsaggregaten<br />
aufgebaut werden. Für die jederzeit<br />
mögliche Um- und Aufrüstbarkeit der Maschine wurde ein<br />
Schnittstellenkonzept entwickelt, in das alle Elemente nahtlos<br />
eingefügt werden können. Der spätere Ausbau bzw. Umbau<br />
ist jederzeit ohne aufwändige Umstrukturierung möglich.<br />
Vielseitige Modularität und hohe Kompatibilität der Systembestandteile<br />
<strong>Druck</strong>werk im Einzelnen:<br />
Die Computer-to-Press Be- und Entbilderung ermöglicht<br />
es, die <strong>Druck</strong>formherstellung mit der durchgehenden Sleevetechnologie<br />
zu verbinden. Zus<strong>am</strong>men mit dem Einzelantrieb<br />
ist das die Voraussetzung für die große Formatvariabilität. Die<br />
Formatvariabilität wird durch Sleeve-Wechsel erreicht.<br />
Einerseits gibt es<br />
Sleeves mit unterschiedlicherWandstärke,<br />
um die <strong>Druck</strong>länge<br />
zu verändern, andererseits<br />
gibt es den<br />
Tausch der Grundzylinder<br />
für größere Formatsprünge.<br />
Die DICOweb<br />
Maschine ist, wie auch<br />
bei Illustrationsrollenmaschinen<br />
üblich, mit<br />
Doppeldruckwerken,<br />
die im Gummi/Gummi-<br />
DICOweb<br />
Prinzip arbeiten, ausgestattet. Das bedeutet automatisch den<br />
gleichzeitigen <strong>Druck</strong> von Vorder- und Rückseite. Es handelt<br />
sich um ein Nassoffsetsystem, bei dem der Antrieb durch Einzelzylindermotoren<br />
stattfindet. Die Farbversorgung und die<br />
Registerregelung sind vollautomatisch.<br />
Der <strong>Druck</strong>formwechsel dauert ca. 8 Minuten ohne Zylinderbewegung.<br />
Die Dauer des Wechsels ist formatabhängig. Wie<br />
bei einer „normalen" Offsetdruckmaschine gibt es eine automatische<br />
Waschanlage.<br />
Herstellung einer <strong>Druck</strong>form:<br />
Bebilderung: Fixierung: Löschvorgang:<br />
1 Laser 1 Heizelement 1 DICOwipe<br />
2 DICOtape 2 DICOfleece<br />
3 Sleeve-Oberfläche 3 Sleeve-Oberfläche<br />
Bebilderung der <strong>Druck</strong>formen:<br />
Die DICO-Bebilderung basiert auf der Thermotransfertechnologie,<br />
bei der ein Transferband (DICOtape) das Bild<br />
auf die Oberfläche des Sleeves aufbringt. Das Transferband<br />
besteht aus einem dünnen Trägerfilm, auf dem sich eine<br />
Transferschicht befindet. Diese Schicht wird mit einem Laser<br />
Punkt für Punkt auf den Sleeve übertragen. Die übertragenden<br />
Punkte bilden die farbführenden Bereiche.<br />
Fixieren und Konditionieren:<br />
Um eine gute Auflagenbeständigkeit zu erzielen, wird im<br />
zweiten Schritt des Bebilderungsprozesses das Thermotransfermaterial<br />
erhitzt und dadurch das Bild auf dem Formzylinder<br />
fixiert. Danach erfolgt die Konditionierung, bei der<br />
eine Hydrophilierlösung aufgetragen wird, um die Wasserführung<br />
durch die Stahloberfläche des Zylinders sicherzustellen.<br />
D<strong>am</strong>it ist die <strong>Druck</strong>form für den konventionellen Nass-Offset<br />
fertiggestellt.<br />
Löschen und Wiederbebildern:<br />
Zunächst wird der rotierende Zylinder mit einem Reinigungsvlies<br />
(DICOfleece) und einem Lösemittel (DICOwipe)<br />
von der Farbe gereinigt und gleichmäßig aufgeraut.<br />
Im zweiten Schritt wird das Thermotransfermaterial auf dem<br />
Zylinder mit Hilfe einer speziellen Löschlösung (DICOdel)<br />
entfernt. Nach dem Trocknen ist der Zylinder bereit für die<br />
Bebilderung. In Mechanik und Funktion ist die Löscheinrichtung<br />
der DICOweb vergleichbar mit einer Gummituchwaschanlage.<br />
10 11
12<br />
3. Flexodruck<br />
Flexodruckmaschinen werden überwiegend als Rollenmaschinen<br />
konstruiert. Dabei lassen sich folgende Konstruktionen<br />
unterscheiden:<br />
- Einzylindermaschinen<br />
- Mehrzylindermaschinen<br />
3.1 Einzylindermaschinen<br />
Bei Einzylinder-Flexodruckmaschinen sind die <strong>Druck</strong>werke<br />
satellitenförmig um den gemeins<strong>am</strong>en Gegendruckzylinder<br />
angeordnet (Satellitenbauweise). Dies ermöglicht eine kompakte<br />
<strong>Druck</strong>maschinenbauweise. Ein Vorteil dieser Maschinen<br />
ist die gute Passergenauigkeit. Sie wird dadurch gewährleistet,<br />
dass alle Farbwerke einen großen gemeins<strong>am</strong>en<br />
Gegendruckzylinder nutzen. Der Bedruckstoff liegt während<br />
des ges<strong>am</strong>ten <strong>Druck</strong>vorganges auf dem großen Gegendruckzylinder<br />
und erreicht somit eine hohe Lagestabilität.<br />
Abbildung: Zentralzylinderbauweise<br />
Vier bis zehn Farbwerke können um einen zentralen<br />
Gegendruckzylinder (Durchmesser über 2 Meter und<br />
Bahnbreiten von 300 mm bis 3000 mm) angeordnet<br />
werden. Mit Hilfe eines Monitors kann man die verwendeten<br />
Farben zueinanderfahren. Vor dem ersten <strong>Druck</strong>werk wird<br />
der Bedruckstoff vorbehandelt, um die Farbübertragung<br />
zu gewährleisten. Nach jedem Farbwerk erfolgt eine<br />
Zwischentrocknung, danach beginnt eine Kompakttrocknung.<br />
In dieser Trockenstation wird das Material mit 50°<br />
Celsius getrocknet. Nach der Trocknung besteht für den<br />
Maschinenführer die Möglichkeit, die Bahn bei laufender<br />
Maschine an einem Leitstand zu kontrollieren. Danach wird<br />
die Rolle zur Aufwicklung geleitet.<br />
3.2 Mehrzylindermaschine<br />
Mehrzylindermaschinen (Einzelzylinder) lassen sich in zwei<br />
Hauptbauweisen unterscheiden:<br />
– Ständerbauweise<br />
– Reihenbauweise<br />
Die Mehrzylindermaschinen kennzeichnen sich dadurch,<br />
dass jedes <strong>Druck</strong>werk mit einem eigenen Gegendruckzylinder<br />
ausgestattet ist.<br />
<strong>Druck</strong>erklasse Flexodruck 2004 bis 2007 Tiefdruckmaschinen Vorwort und Inhaltsverzeichnis<br />
(Illustration)<br />
Mehrzylinderdruckmaschinen in Kompaktbauweise<br />
Sie werden aufgrund der schlechten Registerhaltigkeit<br />
(etwa +- 0,2 mm im Längsregister) häufig für einfachere<br />
Abbildung: Flexodruckmaschinen in Kompaktbauweise<br />
<strong>Druck</strong>aufträge eingesetzt. Ein Vorteil der Mehrzylindermaschinen<br />
in Kompaktbauweise ist, dass bei entsprechender<br />
Bahnführung beidseitig gedruckt werden kann.<br />
Reihenbauweise<br />
Bei diesem Maschinentyp werden gleiche <strong>Druck</strong>werke in<br />
Reihe hintereinander angeordnet. Die Materialbahn wird üblicherweise<br />
zwischen den <strong>Druck</strong>werken umgelenkt, um Trockner<br />
mit entsprechender Trockungsstrecke sowie Bahnspannungs-<br />
und -führungselemente unterzubringen. Die Reihenbauweise<br />
hat sich zuerst bei Schmalbahnmaschinen (bis ca.<br />
500 mm Bahnbreite) für den Etikettendruck durchgesetzt.<br />
Direktantriebe der einzelnen <strong>Druck</strong>werke ermöglichen lange<br />
Maschinenverkettungen und hohe Registerhaltigkeit in Verbindung<br />
mit hochwertigen Bahnlaufkontrollen (auch bei flexiblem<br />
Material).<br />
Abbildung: Flexodruckmaschinen in Reihenbauweise<br />
Flexodruckwerke sind austauschbar und mit <strong>Druck</strong>werken<br />
anderer <strong>Druck</strong>werke kombinierbar (z. B. Offset- oder<br />
Tiefdruckwerken). Man spricht dann von Hybrid-<strong>Druck</strong>systemen.<br />
4. Tiefdruckmaschinen<br />
4.1 Illustrationstiefdruckmaschinen<br />
Die Herstellung der <strong>Druck</strong>form ist im Tiefdruck sehr kostenintensiv.<br />
Daher ist der Tiefdruck prädestiniert für Auftraäge<br />
mit hohen Auflagen. Ein wichtiger Anwendungsbereich<br />
des Tiefdruckes ist der Illustrationstiefdruck. Dieser bezieht<br />
sich auf die Produktion von Zeitschriften (Illustrierte) oder<br />
Versandhauskatalogen.<br />
Abwicklung<br />
Der Rollenwechsel geschieht durch einen zweiarmigen<br />
Rollenwechsler (fliegender Rollenwechsel). Wegen der großen<br />
Trägheitsmasse der breiten Papierrollen werden diese<br />
durch Gurtsysteme (Gurtpendel) beschleunigt. Tiefdruck-<br />
Rollenträger sind für hohe Gewichtslasten ausgelegt. Die<br />
Rolleneinbringung ist aufgrund der enormen Massen der Rollen<br />
durchgängig automatisiert.<br />
Abbildung: Aufbau eines Tiefdruckrollenträgers<br />
("Fliegender Rollenwechsel")<br />
<strong>Druck</strong><br />
Zum Füllen der vertieften Formelemente (Rasternäpfchen)<br />
mit Tiefdruckfarbe werden verschiedene Farbsysteme eingesetzt.<br />
Eine Möglichkeit ist das Einfärben mit Hilfe einer Farbwanne,<br />
in die der rotierende Zylinder eintaucht. Danach wird<br />
die überschüssige Farbe auf dem <strong>Druck</strong>formzylinder (3) mit<br />
einer Rakel (6) abgerakelt, so dass nur die Farbe in den Näpfchen<br />
auf das Papier gelangt. Die eigentliche Rakel besteht<br />
aus einem dünnen, verschleißfesten Stahlband, das in eine<br />
Rakelhalterung eingespannt wird. Ein Presseur (4) drückt den<br />
Bedruckstoff auf den Zylinder.<br />
Trocknung<br />
Die Tiefdruckfarbe hat eine niedrige Viskosität (dünnflüssig).<br />
Nach dem <strong>Druck</strong>en wird die Farbe in ein Trockenaggregat<br />
geleitet, wo das in der Farbe enthaltene Lösemittel<br />
vedunstet und sich die <strong>Druck</strong>farbe somit verfestigt (8).<br />
2<br />
7<br />
Abbildung: Aufbau eines Tiefdruckwerkes mit Trockenaggregat<br />
1 Bahneinlauf 5 Registerwalzen<br />
2 Bahnauslauf 6 Rakel<br />
3 <strong>Druck</strong>formzylinder 7 Zylinderwagen<br />
Registerwalzen<br />
4 Presseur 8 Trockeneinrichtung<br />
8<br />
4<br />
3<br />
Die getrocknete Papierbahn wird dann in das nächste<br />
<strong>Druck</strong>werk geleitet. Im Anschluss an den <strong>Druck</strong>vorgang läuft<br />
die Papierbahn in den Falzapparat.<br />
Falzung:<br />
Im Vergleich zum festformatigen Falzapparat der Rollenoffsetmaschinen<br />
ist der typische Falzapparat von Tiefdruckmaschinen<br />
vom Format her betrachtet variabel aufgebaut.<br />
Der Grund dafür sind die im Tiefdruck unterschiedlich einsetzbaren<br />
<strong>Druck</strong>formzylinder (die Zyinder können im Gegensatz<br />
zum Rollenoffset im Durchmesser und d<strong>am</strong>it auch im<br />
Umfang variieren).<br />
6<br />
5<br />
1<br />
13
214<br />
Schwenkrad zur Aufnahme<br />
der Rollen<br />
4.2 Verpackungstiefdruckmaschinen<br />
Seitengestell<br />
Anpress- und<br />
Im Verpackungstiefdruck unterscheiden Abschneidvorrichtung<br />
sich die Maschinen<br />
von denen, die im Illustrationstiefdruck eingesetzt werden.<br />
Im Gegensatz zum Illustrationstiefdruck werden hier<br />
andere Farben (Lösemittel) verwendet und der Bedruckstoff<br />
ist ein anderer (Aluminuim, Kunststoffe etc.). Aufgrund der<br />
gestiegenen Qualitätsansprüche werden heute Maschinen für<br />
Verpackungen eingesetzt, die sieben oder acht <strong>Druck</strong>werke<br />
verwenden (zzgl. Werke für die Inline-Veredelung). Die hohe<br />
Anzahl der <strong>Druck</strong>werke ist demnach auch durch die Verwen- neue<br />
dung von Sonderfarben Restrolle (Hausfarben) begründet. Rolle<br />
<strong>Druck</strong>erabschlussklasse Tiefdruckmaschinen <strong>Druck</strong>erklasse 2004 (Verpackung)<br />
bis 2006 2007 / 2007<br />
Vorwort T<strong>am</strong>pondruck<br />
und Inhaltsverzeichnis<br />
Abbildung: Aufwicklung<br />
Die <strong>Druck</strong>werke<br />
In jedem <strong>Druck</strong>werk befindet sich ein <strong>Druck</strong>werkwagen (mit<br />
Farbpumpe, Farbbürste, Farbwanne, Farbrücklaufkasten) auf<br />
dem der Zylinder aufgebracht wird.<br />
Hinten (stehend) Christopher Göbel, Igor Förderer, Daniel Brömmelhaus, Kevin Pattberg, Andreas Kleimeyer,<br />
Abbildung: Heliostar® G Alexander Gaidies, Marco Segeler, Stefan Drabinski, Philipp Nießing, Stefan ten Venne,<br />
Jens Dupslaff, Rainer Hippers, Christian Nienhaus, Thomas Kapell, Matthias Lewalski<br />
Ab- Vorne und Aufrollung Nicole Jöster, Gabi Westerhoff, Pascal Pottmeier, Sven Fleck, Waldemar Trockner Martens, 1<br />
Zur Ab- und Aufwicklung Jonas werden Hoffmann an Verpackungstiefdruckmaschinen<br />
Nonstop-Wickelmaschinen für den vollautomatischen<br />
Nicht auf Rollenwechsel dem Bild eingesetzt. Tobias Schalles, Tobias Zimmer<br />
Seitengestell<br />
Schwenkrad zur Aufnahme<br />
der Rollen<br />
Anpress- und<br />
Abschneidvorrichtung<br />
Schwenkantrieb<br />
neue Aufrollung<br />
Schwenkrad<br />
zur Aufnahme<br />
der Rollen<br />
Trockner 2<br />
Kühlwalze<br />
nach Anpress- der und <strong>Druck</strong>werkwagen<br />
volle<br />
Trocknung<br />
Abschneidvorrichtung (Einschubsystem)<br />
Rolle<br />
<strong>Druck</strong>formzylinder<br />
Anpress- und<br />
Abschneidvorrichtung<br />
Schwenkantrieb<br />
Abbildung: <strong>Druck</strong>werk (Quelle: Kipphan, Handbuch der Printmedien)<br />
Restrolle<br />
neue<br />
Rolle<br />
Die Trocknung<br />
Die Bahn läuft je nach Bedarf durch einen Trockenkasten<br />
oder durch 2 Kästen (je <strong>Druck</strong>werk) um das Verdunsten des<br />
neue Aufrollung Lösemittels durch Wärmeeinfluss zu beschleunigen. Dabei<br />
Schwenkradhat<br />
die Heizwirkung Einfluss auf die Rapportlänge.<br />
zur Aufnahme<br />
der Rollen<br />
Hinweis<br />
Schwenkantrieb<br />
Computergestützte<br />
Schwenkantrieb<br />
Produktion<br />
Seitengestell<br />
Der vorliegende 16-Seiter wurde in Projektarbeit Die selbstständig komplette und Produktion eigenverantwortlich ist rechnergestützt durch und kann ent-<br />
Abbildung: Abwicklung die Schüler der <strong>Druck</strong>erklasse erstellt. sprechend vom Leitstand aus gesteuert werden (Bahnspan-<br />
Die Umschlaggestaltung erfolgte durch Schüler der Mediengestalterklassen der Mittelstufe.<br />
volle<br />
Rolle<br />
Seitengestell<br />
4.3 T<strong>am</strong>pondruck<br />
Der T<strong>am</strong>pondruck ist ein Tiefdruckverfahren. Exemplarische<br />
Produkte, die man im T<strong>am</strong>pondruckverfahren bedrucken<br />
kann sind z. B. Tastaturen, Handys, Babyflaschen,<br />
Schnuller, Feuerzeuge und vieles mehr.<br />
<strong>Druck</strong>formherstellung (Beispiel: Wasserklischee)<br />
Für den T<strong>am</strong>pondruck braucht man ein Klischee und einen<br />
Film, der das gewünschte <strong>Druck</strong>motiv beinhaltet. Das Klischee<br />
wird mit dem Film durch UV-Licht belichtet. Beim<br />
Belichten werden die Stellen gehärtet, die auf dem Film nicht<br />
geschwärzt sind. Nach der Belichtung wird das Klischee mit<br />
Wasser ausgewaschen. Es lösen sich nur die geschwärzten<br />
Stellen (wo kein UV-Licht hink<strong>am</strong>). Das Tiefdruckklischee ist<br />
fertig.<br />
Komponente einer T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
Rakel<br />
T<strong>am</strong>ponkissen<br />
Klischee<br />
Anlagepult<br />
Einrichten einer T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
Als erstes nehmen wir das Klischee und stanzen in allen<br />
vier Ecken Löcher, um das Klischee in der T<strong>am</strong>pondruckmaschine<br />
zu befestigen.<br />
Der zweite Schritt ist die passende Anlage zu bauen, so<br />
dass der Bedruckstoff nicht verrutschen kann. Dann befestigen<br />
wir die Anlage an der unteren Haltung bei der T<strong>am</strong>pondruckmaschine.<br />
Danch erfolgt die Auswahl des T<strong>am</strong>ponkissens. Das ist<br />
eines der wichtigsten Dinge, die man für den T<strong>am</strong>pondruck<br />
braucht.<br />
Die T<strong>am</strong>ponkissen bestehen aus Silikonkautschuk. Es gibt<br />
sehr viele verschiedene Formen und unterschiedliche Härtungsstufen.<br />
Danach legen wir den Bedruckstoff in die Anlage und richten<br />
die Maschine für den <strong>Druck</strong>vorgang ein. Das heisst, dass<br />
wir den Stand des <strong>Druck</strong>motives nach Kundenwunsch einrichten<br />
müssen.<br />
Ebenso ist die Einstellung des <strong>Druck</strong>es von entscheidender<br />
Bedeutung, um das das <strong>Druck</strong>bild genauestens übertragen<br />
zu können.<br />
Die Farbe wird jetzt angemischt. Die im T<strong>am</strong>pondruck eingesetzte<br />
Farbe ist niedrigviskos, fast so wie Wasser. Oft ist<br />
noch die Verdünnung der Farbe erforderlich, um den Trockenprozess<br />
zu steuern. Die Farbe wird in einen Behälter<br />
der Maschine eingefüllt. Der Behälter schiebt die Farbe über<br />
das Klischee hin und her. Die Näpfchen werden gefüllt und<br />
beim Zurückgehen bleiben die vertieften Näpfchen mit Farbe<br />
gefüllt.<br />
<strong>Druck</strong>en mit Maschine:<br />
An der Maschine ist eine Halterung für das Klischee, für<br />
das T<strong>am</strong>ponkissen, für die Anlage und ein Behälter für die<br />
Farbe.<br />
Die Maschine bzw. die Füllrakel zieht die Farbe über das<br />
Klischee. Das Klischee ist einmal in dem Farbbehälter befestigt<br />
oder das Klischee ist an der Maschine befestigt und der<br />
Topf ist oben drauf. Wenn die Rakel wieder zurückfährt, zieht<br />
sie die Farbe mit zurück und in den vertieften Stellen des Klischees<br />
(dem <strong>Druck</strong>motiv) bleibt die Farbe. Wenn die Rakel<br />
zurück fährt, geht das T<strong>am</strong>ponkissen (Silikonkissen) mit und<br />
fährt dann runter bzw. drückt sich auf das Klischee mit der<br />
Farbe. Nach dem Vorgang fährt es wieder hoch. An dem T<strong>am</strong>ponkissen<br />
haftet jetzt die Farbe. Das T<strong>am</strong>ponkissen fährt mit<br />
der Farbe nach vorne, gleichzeitig füllt die Rakel die Vertiefungen<br />
wieder mit Farbe. In der Zeit fährt das T<strong>am</strong>ponkissen<br />
runter und drückt das <strong>Druck</strong>motiv bzw. die Farbe auf den<br />
Bedruckstoff. Variieren läßt sich neben dem <strong>Druck</strong> auch das<br />
Hin- und Herfahren des Kissens und des Rakels bezogen auf<br />
die Geschwindigkeit.<br />
Das Wichtigste beim T<strong>am</strong>pondruck ist das Klischee. Es ist<br />
sehr empfindlich, sobald nur ein winziger Kratzer im <strong>Druck</strong>motiv<br />
ist kann dieses schon nicht mehr verwendet werden,<br />
da Kratzer mitdrucken würden. Die Standzeit der <strong>Druck</strong>form<br />
(Klischee) ist begrenzt, dementsprechend muss man sehr auf<br />
Verschleißerscheinungen der <strong>Druck</strong>form (Klischee) achten.<br />
T<strong>am</strong>ponsdruckmaschine der Firma Kent, Stuttgart<br />
15