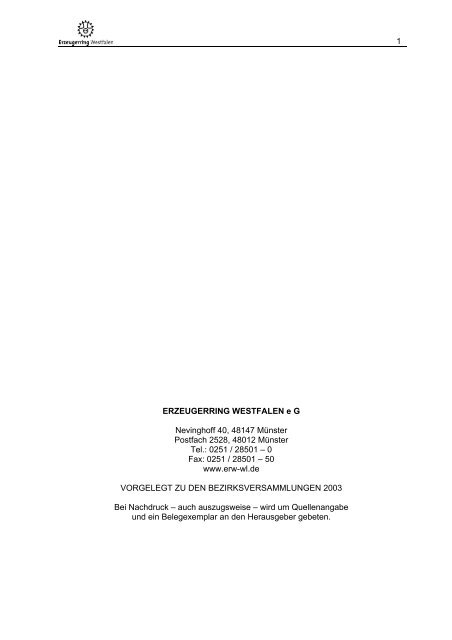Jahresbericht 2002 - Erzeugerring Westfalen e.G.
Jahresbericht 2002 - Erzeugerring Westfalen e.G.
Jahresbericht 2002 - Erzeugerring Westfalen e.G.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ERZEUGERRING WESTFALEN e G<br />
Nevinghoff 40, 48147 Münster<br />
Postfach 2528, 48012 Münster<br />
Tel.: 0251 / 28501 – 0<br />
Fax: 0251 / 28501 – 50<br />
www.erw-wl.de<br />
VORGELEGT ZU DEN BEZIRKSVERSAMMLUNGEN 2003<br />
Bei Nachdruck – auch auszugsweise – wird um Quellenangabe<br />
und ein Belegexemplar an den Herausgeber gebeten.<br />
1
Inhalt<br />
Seite<br />
1 Vorwort<br />
Helmut Bergerbusch 5<br />
2 Geschäftsbericht<br />
Christa Niemann<br />
6<br />
3 Schweinemast – Jahresergebnisse 2001/<strong>2002</strong><br />
Georg Freisfeld<br />
12<br />
4 Ferkelerzeugung – Jahresergebnisse 2001/<strong>2002</strong><br />
Reinhard Hinken<br />
15<br />
5 Neu: Milchviehberatung<br />
Christa Niemann<br />
18<br />
6 Was ein Umrauschtag heute kostet<br />
Georg Freisfeld<br />
19<br />
7 Zukunftsorientierte Erfolgsstrategien für die Schweinemast<br />
-Fortbildung für Mäster-<br />
Georg Freisfeld<br />
23<br />
8 SNW–Piétraineber – auf „Herz und Nieren“ geprüft<br />
Dr. Markus Haarannen, Schweineerzeuger Nord-West<br />
25<br />
9 Leistungsreserven bei Ferkelerzeugern mobilisieren<br />
Dr. Anja Riesenbeck, GFS<br />
29<br />
10 Einmalimpfung gegen Mykoplasmen<br />
Dr. Andreas Becker, Pfizer<br />
33<br />
11 Nach BESTSCHWEIN nun auch BESTFERKEL<br />
Christian Disselmann, Westfleisch Hamm<br />
34<br />
12 Salmonellenkontrolle im Schweinebestand<br />
Dr. Thomas Große Beilage – PIC Regionaltierarzt<br />
37<br />
13 CCM-Silierverluste vermeiden – Futterhygiene sichern<br />
Dr. Sabine Rahn, RCG<br />
40<br />
14 Gruppenhaltung für tragende Sauen<br />
Franz-Josef Eling und Bernd Debbert<br />
43<br />
15 Neues Tierarzneimittelgesetz<br />
Dr. Werner Schulze-Grotthoff, LK <strong>Westfalen</strong>-Lippe<br />
45<br />
16 Abluftreinigung – Technik der Zukunft<br />
Michael Marks, RCG<br />
47<br />
17 Gemeinsam zum Betriebserfolg – eine Betriebsreportage<br />
Werner Winkelkötter<br />
51<br />
18 Fütterung von Ferkeln und Mastschweinen unter dem Einfluss verschiedener<br />
Viruserkrankungen<br />
Dr. Maria Mester<br />
54<br />
19 Closed Herd Multiplication – Chance und Risiko<br />
Christian Seeber, JSR<br />
61<br />
20 Wachstum in der Sauenhaltung – Neue Ansätze und Perspektiven<br />
Heinz Thier, BSB-GmbH – Landw. Buchstelle, Münster<br />
64<br />
21 Änderung in der Betriebszweigauswertung Schweinemast<br />
Willi Rottler, VzF-Verbund<br />
68<br />
22 Fruchtbarkeitsmonitoring<br />
Norbert Oenning, Sigrid Johanning<br />
70<br />
23 Qualität und Sicherheit (Q + S)<br />
Christa Niemann<br />
74<br />
24 Mitglieder der Verwaltungsorgane 75<br />
25 Mitarbeiter des ERW 76<br />
3
4<br />
Sehr geehrtes Mitglied,<br />
nach den gesetzlichen Bestimmungen<br />
sind wir verpflichtet, unseren Geschäfts-<br />
betrieb auf den Kreis der Mitglieder zu<br />
beschränken, die landwirtschaftliche Be-<br />
triebe führen.<br />
Sofern Ihre Mitgliedschaft, Anschrift oder<br />
die genannten Voraussetzungen nicht mehr<br />
zutreffen, bitten wir Sie, uns die Änderungen<br />
umgehend mitzuteilen.<br />
Wir möchten darauf hinweisen, dass jeweils<br />
der Hofbesitzer die Mitgliedschaft erwerben<br />
muss. Hofbesitzer ist in der Regel der Eigen-<br />
tümer, wenn nicht ein Nießbrauch-, Pacht- oder<br />
ähnliches Rechtsverhältnis besteht.<br />
Mit genossenschaftlichem Gruß<br />
DER VORSTAND<br />
Druckfehler<br />
"Wenn Sie einen Druckfehler finden,<br />
bedenken Sie bitte, dass war<br />
beabsichtigt.<br />
Unser <strong>Jahresbericht</strong> bringt für jeden<br />
etwas, denn es gibt Leute, die immer<br />
nach Fehlern suchen"
1. Vorwort<br />
Sehr geehrtes Mitglied,<br />
in Zeiten, in denen Ihre betrieblichen Entscheidungen beeinflusst<br />
durch<br />
- wirtschaftliche Höhen und Tiefen<br />
- stark ideologisch geprägte politische Rahmenbedingungen<br />
- eine sich ständig verändernde europäische Wettbewerbssituation<br />
gefällt werden müssen, möchte ich mich bei Ihnen für das<br />
entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.<br />
Ihre aktive Mitarbeit und rege Inanspruchnahme unserer Beratung<br />
ist uns, dem Ehrenamt, ständiger Ansporn, den <strong>Erzeugerring</strong><br />
in ihrem Sinne zu gestalten, Problemlösungen zu<br />
suchen und zukunftsweisende Projekte zu begleiten.<br />
Der Erfolg Ihrer Betriebe und Familien ist der Maßstab für<br />
unser Denken und Handeln.<br />
Durch Kontinuität und Kreativität wollen und werden wir auch<br />
in Zukunft für Sie Partner in vielen Bereichen sein.<br />
Für das Jahr 2003 wünsche ich uns einen intensiven Gedankenaustausch<br />
und eine konstruktive Zusammenarbeit.<br />
Helmut Bergerbusch<br />
Aufsichtsratsvorsitzender<br />
5
6<br />
2 Geschäftsbericht <strong>2002</strong><br />
Das abgelaufene Jahr hat der Landwirtschaft in vielerlei Hinsicht viele Probleme beschert.<br />
Es hat zwar keine großen Seuchenzüge wie im Vorjahr gegeben. Dennoch war es wirtschaftlich<br />
und politisch ein sehr unruhiges Jahr. Die Unsicherheit innerhalb der Landwirtschaft war<br />
noch nie so groß.<br />
Verschiedene neue Vorschriften wie die Schweinehaltungsverordnung oder das Tierarzneimittelneuordnungsgesetz<br />
haben ebenso wie die Steuerdiskussion zum Jahresende dazu<br />
beigetragen, dass deutlich weniger in die Schweinehaltung investiert wurde als in der Vergangenheit.<br />
Der Strukturwandel hat auch im Jahr <strong>2002</strong> nicht halt gemacht. Im Gegenteil, es gab deutlich<br />
mehr Betriebsaufgaben als in der Vergangenheit, selbst größere Betriebe haben für sich die<br />
Konsequenzen gezogen und sind aus der Produktion ausgestiegen.<br />
Um das Verbrauchervertrauen nach den verschiedenen Skandalen wieder zu gewinnen, hat<br />
die Landwirtschaft zusammen mit den Berufsverbänden, Beratungsträgern, den Futtermittelherstellern,<br />
der Fleischbranche und Fachverbänden das Sicherungssystem „Qualität und<br />
Sicherheit“ auf den Weg gebracht.<br />
Die Landwirtschaft muss diese Chance nutzen, um das Verbrauchervertrauen wieder zu sichern,<br />
und den Weg des Lebensmittels Fleisch offen legen.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> beschreitet im nächsten Jahr neue Wege, um langfristig die eigene Existenz<br />
zu sichern. Ab Anfang 2003 wird neben der Beratung im Schweinebereich auch die<br />
Milchviehberatung angeboten. Die bisherigen Erfahrungen mit den Schweinen sollen genutzt<br />
werden, um eine ähnliche Beratung für Milchkühe anzubieten, wie sie bei den Sauenbetrieben<br />
durchgeführt wird.<br />
Mitgliederbewegungen<br />
In <strong>Westfalen</strong> wie auch in allen anderen Bundesländern ist der Strukturwandel immer weiter<br />
fortgeschritten. Viele Betriebe, darunter auch existenzfähige, scheiden aus der Produktion<br />
aus, da die derzeitigen und zukünftigen Rahmenbedingungen keine Anreize zum Verbleiben<br />
in der Produktion schaffen.<br />
Ganz anders sieht es dagegen bei den <strong>Erzeugerring</strong>-Betrieben aus. Wer intensive Beratung<br />
in Anspruch nimmt, beabsichtigt normalerweise, in der Produktion zu bleiben. Daher ist auch<br />
die Quote der ausscheidenden Betriebe im ERW sehr viel niedriger als im Landesschnitt.<br />
Im Jahr <strong>2002</strong> hat der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> insgesamt 905 aktive Betriebe betreut. Auf<br />
Produktionsrichtungen aufgeteilt waren das 468 Mäster, 310 Ferkelerzeuger, 113 kombinierte<br />
Betriebe und 14 Ferkelaufzuchtstationen.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> hat insgesamt 43 neue Mitgliedsbetriebe bekommen, Kündigungen gab es<br />
46, davon waren 26 aktive Betriebe. Die Berater haben in <strong>2002</strong> etwa 6.740 einzelbetriebliche<br />
Beratungen durchgeführt.<br />
Seminare/Fortbildungen<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> als Spezialberatungsunternehmen bietet neben der Intensiv-<br />
Beratung auch verschiedene Seminare und Fortbildungsveranstaltungen für Schweinehalter<br />
an.
Seminar für Sauenhalter 24.02. - 25.02.<strong>2002</strong><br />
In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Hannover fand im Februar <strong>2002</strong> ein Seminar<br />
für Sauenhalter an der IPC Plant Dier in Horst statt.<br />
Themenschwerpunkte bildeten die Optimierung von Haltung und Lüftung, um die Atemwegserkrankungen<br />
zu verringern. Die Schulung war verbunden mit einem Besuch des Sauenstalles<br />
von Horst.<br />
Wichtig für die Teilnehmer waren besonders die am Rande der Veranstaltung stattfindenden<br />
Gespräche mit den Berufskollegen. Dort wurden eine Menge Erfahrungen und wertvolle<br />
Tipps ausgetauscht, um die Sauenhaltung zu verbessern.<br />
Bezirksversammlungen 05.03. – 20.03.<strong>2002</strong><br />
Anfang März <strong>2002</strong> fanden die Bezirksversammlungen des <strong>Erzeugerring</strong>es <strong>Westfalen</strong> statt.<br />
Insgesamt waren es sechs Veranstaltungen, die regional von Brakel bis Rhede-Vardingholt<br />
reichten.<br />
Themenschwerpunkte waren:<br />
- das Artikelgesetz – welche Folgen für die Landwirtschaft<br />
- Schadnager – Vorbeugung, Bekämpfung und Dokumentation<br />
- Auswertungen – Mast und Ferkelerzeugung<br />
- Sensorfütterung – wichtige Tipps für den richtigen Umgang<br />
In den Versammlungen greifen wir immer aktuelle Themen auf und laden Gastreferenten ein,<br />
um möglichst umfassende und kompetente Informationen zu liefern.<br />
Großes Interesse gab es bei dem Thema Artikelgesetz und die Folgen.<br />
Aber auch die Schadnager waren ein wichtiges Thema, da im Rahmen von Q + S die Bekämpfung<br />
nachgewiesen und dokumentiert werden muss.<br />
Der richtige Umgang mit der Sensorfütterung ist nach wie vor nicht ganz einfach und Praxiserfahrungen<br />
wurden dankbar aufgenommen.<br />
KonRAT-Seminar 29.05.<strong>2002</strong><br />
Das Kontrollprogramm KonRAT unterstützt die Kontrolle von Schlachtabrechnungen. Es erlaubt<br />
weiterhin die Überprüfung von Masken und den Maskenvergleich von verschiedenen<br />
Abrechnungsmasken. Die praktische Anwendung von KonRAT konnten Landwirte auf dem<br />
KonRAT-Seminar erlernen. Jeder Teilnehmer hatte einen PC zur Verfügung und konnte die<br />
eigenen Schlachtabrechnungen erfassen und auswerten. Durch diese praktischen Übungen<br />
waren die Teilnehmer am Ende des Tages in der Lage, eigene Schlachtabrechnungen zu<br />
erfassen, auszuwerten und das Ergebnis zu interpretieren.<br />
Ferkelerzeuger-Versammlungen 26.11. – 10.12.<strong>2002</strong><br />
Direkt nach der Eurotier fanden unsere Ferkelerzeuger-Versammlungen statt. Ähnlich wie<br />
die Bezirksversammlungen werden diese in den Regionen abgehalten. Insgesamt gab es<br />
sechs Veranstaltungen.<br />
Themenschwerpunkte waren:<br />
- Jahresauswertungen – Tendenzen und Ergebnisse<br />
- Wachstum in der Sauenhaltung – Neue Ansätze und Perspektiven<br />
- Gruppenhaltung für Sauen – verschiedene Systeme<br />
- Säureeinsatz in der Fütterung – Möglichkeiten und Chancen<br />
Bei dem Thema „Wachstum in der Sauenhaltung“ ging es insbesondere um neue Formen<br />
von Kooperationen. Hier wurde teilweise sehr kontrovers diskutiert.<br />
7
8<br />
Die neue Schweinehaltungsverordnung schreibt die Gruppenhaltung vor. Verschiedene Systeme<br />
wurden mit Stärken und Schwächen vorgestellt.<br />
In Zukunft kann der Säureeinsatz in der Fütterung noch sehr wichtig werden. Gesetzliche<br />
Vorschriften und auch die Bedingungen während der Ernte werden den Einsatz fördern.<br />
Crash-Kurs für Schweinemäster 12.12.<strong>2002</strong><br />
Erstmals fand ein Crash-Kurs für Schweinemäster unter der Überschrift „Zukunftsorientierte<br />
Erfolgsstrategien für die Schweinemast“ statt. Diese Fortbildung für Mäster wird zusammen<br />
von der GFS und dem <strong>Erzeugerring</strong> veranstaltet. Die Themenschwerpunkte lagen beim<br />
Stallbau (gesetzliche Vorschriften, Fütterungs- und Haltungstechnik), Zusammenarbeit zwischen<br />
Ferkelerzeuger und Mäster, Betriebszweiganalyse und die GFS-Nachkommenprüfung<br />
und die Auswertung der Autofom-Schlachtdaten.<br />
Insgesamt war dieses Seminar sehr gelungen, die Teilnehmer waren mit dem Tag überaus<br />
zufrieden.<br />
Am 10. April 2003 wird ein weiterer Crash-Kurs für Schweinemäster folgen.<br />
Eurotier <strong>2002</strong><br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> war auf der letzten Eurotier zum ersten Mal auf dem Gemeinschaftsstand<br />
der deutschen Schweineproduzenten vertreten. Dieser große Stand war regional<br />
aufgeteilt, der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> befand sich im nordrhein-westfälischen Teil zusammen<br />
mit den Organisationen SNW, GFS, rheinischer <strong>Erzeugerring</strong>, Westfleisch und<br />
SUS.<br />
Die Besucherzahlen waren sehr hoch, viele Mitgliedsbetriebe und auch viele Nichtkunden<br />
haben uns auf unserem Stand besucht. Es wurden intensive Fachgespräche geführt, wir<br />
waren aber auch Anlaufpunkt für manchen müden Eurotier-Besucher.<br />
Für die Messebesucher war es günstig, alle westfälischen Organisationen auf einem Stand<br />
zu finden. Dieses Konzept wird sowohl auf den Unternehmertagen in der Halle Münsterland<br />
im Februar 2003 als auch bei der nächsten Eurotier 2004 wieder umgesetzt werden.<br />
Unternehmertage 2003<br />
Im Februar 2003 fanden die Unternehmertage in der Halle Münsterland statt. Auch diesmal<br />
hat sich der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> auf dem Gemeinschaftsstand zusammen mit dem SNW,<br />
der GFS, dem <strong>Erzeugerring</strong> Münsterland und der Westfleisch präsentiert.<br />
Wie in den vergangenen Jahren wurde diese Regional-Messe von den hiesigen Landwirten<br />
sehr gut angenommen. Es fanden intensive Gespräche sowohl mit Kunden als auch mit<br />
Neu-Kunden statt.<br />
Die Öffnungszeiten von 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr erlauben es vielen Landwirten, diese Messe<br />
zu besuchen.<br />
Fruchtbarkeitsmonitoring<br />
Speziell für Sauenhalter wird schon seit 1997 das Fruchtbarkeitsmonitoring angeboten. Dazu<br />
stellen Ferkelerzeuger ihre Daten aus den Sauenplanern zur Verfügung.<br />
Das Fruchtbarkeitsmonitoring hilft in erster Linie dem Ferkelerzeuger, Schwachstellen im<br />
Betrieb aufzudecken und zu beheben.<br />
Gleichzeitig werden die Daten von der GFS auch dazu genutzt, um die Besamungseber hinsichtlich<br />
Fruchtbarkeit und Erbfehlern zu bewerten.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> erstellt aus den Sauenplanerdaten verschiedene Auswertungen,<br />
die für Beratungszwecke auf den einzelnen Betrieben genutzt werden.
KonRAT<br />
Das Kontrollprogramm KonRAT wurde vom <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> entwickelt, um<br />
Schlachtabrechnungen kontrollieren zu können. Weiter kann KonRAT auch berechnen, was<br />
die Schweine bei unterschiedlichen Masken gebracht hätten. Die Maskenvielfalt ist im vergangenen<br />
Jahr durch die Euroumstellung stark gestiegen.<br />
Alle gängigen Abrechnungsmasken werden laufend vom <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> erfasst und<br />
allen KonRAT-Anwendern im Internet (www.erw-wl.de) zum Herunterladen zur Verfügung<br />
gestellt. Jeder Anwender kann sich die gewünschte Abrechnungsmaske aus dem Internet<br />
herunterladen und über die entsprechende Schnittstelle ins KonRAT importieren.<br />
So kann jeder sicher sein, mit der richtigen Maske zu arbeiten und die Abrechnungen auf<br />
Ungereimtheiten untersuchen.<br />
Ab 2003 können die Masken aus KonRAT auch genutzt werden, um mit dem neuen Mastprogramm<br />
des <strong>Erzeugerring</strong>es auch die Sortierungsdifferenz bei den Schlachtschweinen zu<br />
berechnen.<br />
Qualität und Sicherheit<br />
Dieses Sicherungssystem für die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln stellt an alle Beteiligten<br />
neue Anforderungen. Jede Stufe dokumentiert den eigenen Produktionsprozess und<br />
bestätigt der folgenden Stufe, dass alle Anforderungen beachtet worden sind. Auf diese<br />
Weise entsteht ein kontrollierter und nachprüfbarer Warenfluss bis zur Ladentheke.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> hat im vergangenen Jahr seine Beratung auch auf den Q+S-<br />
Bereich ausgedehnt.<br />
Um für die Mitglieder Ansprechpartner in allen Fragen sein zu können, ist der ERW Systemberater<br />
für Q+S geworden. Damit steht er als Bindeglied zwischen Q+S und den landwirtschaftlichen<br />
Betrieben.<br />
Direkt vor Ort auf den landwirtschaftlichen Betrieben berät der ERW seine Mitglieder in allen<br />
Fragen rund um Q+S. Steht ein Audit an, wird vorab ein Probeaudit gemacht, um im eigentlichen<br />
Audit möglichst gut abzuschneiden. Die Berater haben ihre Erfahrungen von anderen<br />
Audits mit eingebracht, und konnten wertvolle Tipps weitergeben.<br />
Bei den regulären Betriebsbesuchen achten die Berater darauf, dass die Anforderungen von<br />
Q+S auch weiterhin eingehalten werden. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf das<br />
Verbrauchervertrauen und das Auftreten von neuen Skandalen.<br />
Neu: Milchviehberatung<br />
Seit nunmehr 40 Jahren berät der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> Schweinehalter erfolgreich in allen<br />
Fragen rund um`s Schwein.<br />
Bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern ist der <strong>Erzeugerring</strong> auf den Bereich Milchviehberatung<br />
gestoßen. In <strong>Westfalen</strong> fehlte hier eine Intensiv-Beratung.<br />
Zahlreiche <strong>Erzeugerring</strong>-Betriebe haben neben der Schweineproduktion auch Milchvieh auf<br />
dem Betrieb. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass Bedarf an neutraler, intensiver Milchviehberatung<br />
besteht.<br />
Seit November <strong>2002</strong> hat der ERW einen Milchviehberater eingestellt. Zunächst wird er in<br />
Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausgebildet, wo es schon eine lange Tradition der<br />
Milchvieh-Spezialberatungsringe gibt. Außerdem wird er bei Organisationen, die im Bereich<br />
Milchvieh tätig sind, wie z.B. die Rinderunion West, hospitieren und verschiedene Lehrgänge<br />
besuchen.<br />
9
10<br />
Die erste Kontaktaufnahme mit potentiellen Kunden hat gezeigt, dass der Aufbau der Milchviehberatung<br />
gelingen wird. Im Januar 2003 wird direkt mit der Beratung auf den ersten<br />
Milchviehbetrieben begonnen werden. Siehe dazu auch Seite 18.<br />
Umzug der Geschäftsstelle<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> hat seine Geschäftsstelle seit rund 13 Jahren beim Landeskontrollverband<br />
(LKV) in Münster. Da der LKV einen größeren Raumbedarf hat, wurde dem<br />
ERW die Räume gekündigt.<br />
Etwa zeitgleich haben die Schweineerzeuger Nord-West ihren Neubau in Senden-Bösensell<br />
geplant.<br />
Verschiedene Gespräche haben zu der Lösung geführt, dass der ERW im Neubau der<br />
Schweineerzeuger Nord-West die erforderlichen Räume mieten wird.<br />
Der Umzug wird im Laufe des Sommers 2003 stattfinden.<br />
Die Vorteile der räumlichen Nähe verschiedener Organisationen, die im Schweinebereich<br />
tätig sind, liegen auf der Hand. Viele Kundenbetriebe sind sowohl beim <strong>Erzeugerring</strong> als<br />
auch beim SNW Kunde. Die entsprechenden Mitarbeiter beider Organisationen können bei<br />
der räumlichen Nähe häufiger miteinander sprechen. Probleme lassen sich viel schneller<br />
aufarbeiten.<br />
Mitarbeiter<br />
Seit dem 15. Februar <strong>2002</strong> ist Frau Sigrid Johanning aus Hopsten mit einer halben Stelle in<br />
der Geschäftsstelle beschäftigt. Durch den Umzug in die neue Geschäftsstelle fallen viele<br />
zusätzliche Arbeiten an, die erledigt werden müssen. Frau Johanning hat an der Fachhochschule<br />
in Osnabrück Agrarwirtschaft studiert.<br />
Herr Gerd Faber aus Nottuln ist zum 31. März <strong>2002</strong> in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.<br />
Herr Faber ist seit fast 31 Jahren in der Beratung für den <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong><br />
tätig gewesen. Die Verdienste wurden in einer gemeinsamen Feierstunde mit seinen Betrieben<br />
gewürdigt.<br />
Herr Sebastian Knöppel hat den Bezirk von Herr Faber übernommen.<br />
Da die Zahl der Betriebe je Berater im westlichen Münsterland stark angestiegen ist und<br />
noch ein großes Potential an Betrieben vorhanden ist, hat die Geschäftsführung entschieden,<br />
weitere zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.<br />
Daher sind Herr Thomas Lordieck aus Senden-Ottmarsbocholt und Herr Christian Wernsmann<br />
aus Schöppingen zum 1. September <strong>2002</strong> bei <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> eingestellt worden.<br />
Herr Lordieck war vorher beim Betriebshilfsdienst und als Betriebsleiter eines schweinehaltenden<br />
Betriebes tätig.<br />
Herr Wernsmann hat an der Fachhochschule in Osnabrück Agrarwirtschaft studiert. Beide<br />
durchlaufen zunächst eine etwa halbjährige Ausbildungszeit beim <strong>Erzeugerring</strong>, bevor sie<br />
auf landwirtschaftlichen Betrieben zur eigenständigen Beratung eingesetzt werden.<br />
Durch die Einstellung dieser beiden Herren wird sich die teilweise angespannte Arbeitssituation<br />
im westlichen Münsterland deutlich entspannen.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> bietet seit Januar 2003, wie weiter oben beschrieben, den Bereich<br />
Milchviehberatung an. Herr Rainer Schluse aus Rhede ist seit dem 1. November <strong>2002</strong><br />
beim <strong>Erzeugerring</strong> eingestellt worden. Herr Schluse hat nach seiner landwirtschaftlichen<br />
Lehre an der Fachhochschule in Soest Agrarwirtschaft studiert. Seine Ausbildung zum<br />
Milchviehberater durchläuft er in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo es schon über<br />
einen langen Zeitraum Milchvieh-Spezialberatungsringe gibt.
Ehrungen von Mitarbeitern<br />
Frau Christa Niemann feierte am 1. Mai <strong>2002</strong> ihr 20-jähriges Dienstjubiläum. Für ihre verantwortungsvolle<br />
Tätigkeit als Geschäftsführerin des <strong>Erzeugerring</strong>s, die sie seit 1997 ausübt,<br />
möchten wir ihr an dieser Stelle danken.<br />
Vorstand<br />
Herr Klaus Happe aus Rüthen-Kneblinghausen ist im Oktober <strong>2002</strong> aus persönlichen Gründen<br />
aus dem Vorstand des <strong>Erzeugerring</strong>s ausgeschieden. Er war seit 1989 ehrenamtlich für<br />
den ERW tätig. Im August 1992 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Die Aufgaben,<br />
die diese Position mit sich bringt, hat er mit einer Hingabe erfüllt, für die wir ihm an dieser<br />
Stelle ganz herzlich danken möchten. Nach seinem Rücktritt hat Herr Gisbert Welling aus<br />
Brakel-Hampenhausen den Vorstandsvorsitz übernommen.<br />
Herr Bernhard Heiming aus Dorsten-Lembeck ist seit dem 10. Dezember <strong>2002</strong> vom Aufsichtsrat<br />
in den Vorstand gewählt worden. Herr Heiming bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen<br />
Betrieb mit Sauen und Milchkühen.<br />
Aufsichtsrat<br />
Herr Peter Piekenbrock aus Nordkirchen ist im Dezember <strong>2002</strong> aus persönlichen Gründen<br />
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Herr Piekenbrock war seit 1991 im Aufsichtsrat und<br />
hat zusammen mit Herrn Happe die Geschicke des ERW gelenkt. Seit 1993 hat er mit sehr<br />
viel Engagement den Vorsitz des Aufsichtsrates geleitet. Auch ihm möchten wir ganz herzlich<br />
für seine geleistete Arbeit danken.<br />
Seine Nachfolge hat Herr Helmut Bergerbusch aus Südlohn angetreten. Herr Bergerbusch<br />
bewirtschaftet einen Sauenbetrieb. Er war bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender.<br />
Neuer Stellvertreter ist Herr Franz-Josef Hüppe aus Riesenbeck. Herr Hüppe bewirtschaftet<br />
ebenfalls einen Sauenbetrieb.<br />
Förderung<br />
Für das Jahr <strong>2002</strong> hat der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> Fördermittel aus der Gemeinschaftaufgabe<br />
von Bund und Land erhalten. Hierfür bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich.<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> setzt sich für alle Fragen rund um die Schweineproduktion ein.<br />
Die Beratung begleitet neue Verfahren in der Praxis, Erfahrungen werden über die Berater<br />
an andere Betriebe weitergegeben.<br />
11
12<br />
3 Schweinemast – Jahresergebnisse 2001/<strong>2002</strong><br />
Erlöse rückgängig<br />
Das Wirtschaftsjahr 2001/ <strong>2002</strong> ist ohne große Seuchenzüge und Betriebssperrungen über<br />
die Bühne gegangen. Doch leider ist noch keine Ruhe für den Alltag in Sicht. Gerade die<br />
wachstumswilligen Mäster müssen sich in Zukunft immer mehr den politischen Forderungen<br />
stellen. In rasanter Geschwindigkeit prasseln Erlasse und Verordnungen auf die tierhaltende<br />
Landwirtschaft nieder. Die Lebensmittelindustrie fordert eine immer gläserne Produktion von<br />
Schweinefleisch und erhöht damit die Schreibarbeit auf den Betrieben enorm. Die Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Landwirtschaft in NRW gerät immer mehr unter Druck. Erschwerend wirken<br />
geringere Schlachtkörpererlöse bei stabilen Ferkeleinkaufspreisen.<br />
Im Durchschnitt wurden von den 532 ausgewerteten Betrieben 1854 Mastschweine verkauft,<br />
das bedeutet einen Anstieg der insgesamt produzierten Mastschweine im Vergleich zum<br />
Vorjahr. An dieser Stelle spiegelt sich der weiter anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft<br />
wieder. Die Anzahl der Betriebe verringert sich, die Tierzahlen pro Betrieb vergrößern<br />
sich.<br />
Tabelle 1: Entwicklung der Schweinemast in den vergangenen 10 Jahren<br />
WJ Betriebe<br />
* )<br />
Tierzahl<br />
Mast-<br />
ende<br />
Mast-<br />
periode<br />
kg<br />
Ver-<br />
luste<br />
%<br />
Tageszunahme<br />
g<br />
Futter-<br />
verwertung<br />
1:<br />
Futter-<br />
kosten<br />
DM/kg<br />
Zuwachs <br />
Ferkelkosten<br />
DM/kg<br />
Erlös<br />
DM/kg<br />
92/93 591 666.648 26-114 3,8 650 3,05 1,27 3,85 2,36 35<br />
93/94 595 698.530 27-115 3,7 658 3,03 1,13 3,34 2,13 33<br />
94/95 585 710.190 27-117 3,7 664 3,01 1,08 4,00 2,25 33<br />
95/96 575 750.967 27-118 3,8 671 3,00 1,06 4,30 2,43 46<br />
96/97 559 774.215 28-119 3,2 687 2,98 1,11 5,00 2,77 59<br />
97/98 565 830.557 28-119 3,2 704 2,95 1,07 4,55 2,58 39<br />
98/99 542 904.056 28-118 2,9 716 2,93 0,92 2,70 1,60 14<br />
99/00 486 857.672 28-118 3,3 722 2,90 0,92 3,61 1,97 29<br />
00/01 537 982.017 28-119 3,5 728 2,90 0,50 2,38 1,70 34<br />
DB I<br />
DM je<br />
100 kg-<br />
Schwein<br />
01/02 532 986.328 28-120 4,2 716 2,91 0,50 2,30 1,48 18,76**<br />
Mittel<br />
10 J.<br />
557 816.118 28-118 3,5 692 3,00 0,54 2,07 1,24<br />
* Die Daten dieser Betriebe sind im ganzen Wirtschaftsjahr erfasst und ausgewertet worden.<br />
** Ab dem WJ 01/02 ist der DB I durch den Überschuss ersetzt worden.<br />
Die Schlachtgewichte sind im Vergleich zu den Vorjahren noch mal erhöht worden und erstmals<br />
auf 120 kg Lebendgewicht je verkauftem Mastschwein angestiegen. Ein Hauptgrund für<br />
diese Erhöhung des Schlachtgewichtes sind unter anderem die geänderten Masken, die<br />
gemeinsam mit der Währungsumstellung gleichzeitig die Schlachtgewichtsgrenzen um 2 kg<br />
heraufgesetzt haben. Wie auch im Vorjahr sind keine Unterschiede in den Schlachtgewich-
ten in Abhängigkeit zu den Vermarktungssystemen zu beobachten. Auch der Erlös / kg<br />
Schlachtgewicht ist sowohl bei AutoFOM vermarkteten als auch bei FOM vermarkteten<br />
Schweinen mit 1,48 € / kg Schlachtgewicht gleich.<br />
Die Futterkosten je kg Zuwachs liegen genau wie im Vorjahr bei 0,50 €. Die Kosten je kg<br />
Ferkel sind von 2,38 € um 8 Cent auf 2,30 € gesunken. Aufgrund der geringeren Erlöse pro<br />
Mastschwein ist der DB I, welcher jetzt durch den Überschuss ersetzt wurde, um fast die<br />
Hälfte auf 18,76 € je 100 kg Schwein gesunken.<br />
Ein neuer Begriff in der diesjährigen Auswertung sind die Direktkostenfreien Leistungen<br />
(DKfL). Dieser Wert ist Grundbaustein für die darauffolgende Vollkostenrechnung. In diesem<br />
Wert sind die vorhandenen Tiere mit ihren tatsächlichen Einkaufspreisen bewertet und<br />
die Bestandsveränderung voll mit einberechnet worden. Die DKfL betragen im abgeschlossenen<br />
Wirtschaftsjahr 18,27 € je 100 kg Fleischzuwachs.<br />
Tageszunahmen in g<br />
740<br />
720<br />
700<br />
680<br />
660<br />
640<br />
620<br />
600<br />
580<br />
560<br />
88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02<br />
Wirtschaftsjahr<br />
Tageszunahmen in g Verluste in %<br />
In den letzten 14 Jahren sind die Tageszunahmen stetig verbessert worden. Auf den ersten<br />
Blick scheint im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr ein drastischer Rückgang der Tagezunahmen<br />
vorzuliegen. Stark beeinflusst wird dieser Wert allerdings von der neuen Berechnung,<br />
hier wurde der Einstalltag im Gegensatz zu älteren Auswertungen mit hinzugezählt.<br />
Dadurch sind die Gewichtszunahmen auf einen Tag mehr verteilt und somit geringer.<br />
Die Verluste steigen wie auch in den 3 Jahren zuvor stetig an. Gerade der Circovirus schafft<br />
Probleme im Anfang der Mast und gilt als Hauptursache für Totalverluste.<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
13<br />
Verluste in %
14<br />
Futterherstellung und Zusammensetzung<br />
Tabelle 2: Futterherstellung und Zusammensetzung<br />
Alleinfutter Selbstmischer Selbstmischer<br />
mit Einsatz v. Nebenprodukten<br />
Tageszunahmen g 730 715 720<br />
Verluste % 4,3 4,2 3,9<br />
MFA % 56,9 55,9 56,0<br />
Ind.Pkt/ kg SG 0,98 0,97 0,97<br />
Schlachtgewicht kg 94,27 94,04 93,75<br />
Futterkosten / dt 19,13 16,99 16,50<br />
FVW 1: 2,91 2,91 2,81<br />
Futterkosten in € / kg<br />
Zuwachs<br />
0,56 0,50 0,46<br />
Erlös / MS in € 140,94 139,98 139,70<br />
Überschuss / MS in € 18,20 23,00 24,44<br />
In Tabelle 2 sind die Unterschiede der Futterherstellung und der Zusammensetzung aufgeführt.<br />
Gerade für Betriebsleiter, die nur schwierig eine Neubaugenehmigung für einen Maststall<br />
erhalten, stellt sich oft die Frage, ob in ihrer Nachbarschaft nicht besser ein Stall zuzupachten<br />
wäre.<br />
Mit der separaten Betriebsstätte kommt die Frage der Futterzuteilung. Das Alleinfutter ist aus<br />
produktionstechnischer Sicht am besten geeignet; die Tageszunahmen sind 10 bis 15 g höher,<br />
ebenfalls sind die MFA-Anteile und Indexpunkte je kg Schlachtgewicht bei den mit Alleinfutter<br />
gemästeten Tieren am besten. Daraus folgt auch ein höherer Schlachtkörpererlös<br />
als bei selbstgemischten Futtermitteln.<br />
Das Alleinfutter verliert aber an Attraktivität, wenn man sich die Futterpreise ansieht. Die<br />
Mehrkosten von ca. 2,60 € pro dt Futter wirken sich voll auf den Überschuss pro verkauftem<br />
Mastschwein aus. Mäster, die Nebenprodukte einsetzten, erzielten einen Überschuss von<br />
24,44 € je Schwein. Während der Schnitt der Selbstmischer auch noch 23,00 € Überschuss<br />
erzielten, kamen die Mäster mit Alleinfuttereinsatz nur auf 18,20 € je verkauftem Mastschwein.<br />
Bei diesen Überschussdifferenzen bleibt die Mast mit selbstgemischtem Futter auch bei zugepachteten<br />
Ställen (vorausgesetzt die Fütterungs- und Mischanlage arbeitet einwandfrei)<br />
zu empfehlen.
4 Ferkelerzeugung – Jahresergebnisse 2001/<strong>2002</strong><br />
Im Laufe des Wirtschaftsjahres 2001/<strong>2002</strong> entwickelten sich die Erlöse bei den Ferkeln weniger<br />
ungünstig als bei den Mastschweinen. Während die Sauenhalter 2% je Ferkel weniger<br />
erzielten, mussten die Mäster beim Mastschweineerlös ein Minus von 13% hinnehmen.<br />
Im zehnjährigen Vergleich (Tabelle 1) war das Wirtschaftsjahr 2001/<strong>2002</strong> ökonomisch ein<br />
erfolgreiches Jahr. Die „Direktkostenfreie Leistung“ (früher Deckungsbeitrag) lag mit 617,- €<br />
je Sau um 94,- € über dem zehnjährigen Mittel von 523,- € je Sau und Jahr.<br />
Tabelle 1: Entwicklung der Ferkelerzeugung in den vergangenen 10 Jahren<br />
WJ<br />
Betriebe Sauen je Sau und<br />
Jahr<br />
ge- Typ I je Würfe aufsamt<br />
*) Betr.<br />
gez.<br />
Ferkel<br />
Verluste<br />
in %<br />
Ferkelverkauf<br />
kg €<br />
je je kg<br />
Tier<br />
15<br />
Futter je Sau je Sau und Jahr<br />
dt € Aufwand<br />
€<br />
DB I<br />
DKFL<br />
**)<br />
92/93 604 481 74 2,1 18,8 16,7 24,7 2,72 10,6 245,- 624,- 699,-<br />
93/94 517 434 86 2,1 19,0 16,8 26,7 1,62 10,9 222,- 615,- 289,-<br />
94/95 489 411 88 2,1 18,9 16,9 27,8 1,96 11,0 221,- 624,- 465,-<br />
95/96 464 390 96 2,2 19,1 17,3 27,9 2,11 11,1 218,- 645,- 539,-<br />
96/97 406 365 97 2,2 19,7 16,9 28,2 2,45 11,1 235,- 703,- 725,-<br />
97/98 428 365 105 2,2 20,1 15,7 28,0 2,26 11,4 227,- 691,- 591,-<br />
98/99 412 336 116 2,3 20,2 15,8 28,7 1,32 11,3 203,- 623,- 179,-<br />
99/00 381 340 125 2,3 20,3 15,8 28,7 1,77 11,4 202,- 649,- 426,-<br />
00/01 371 324 131 2,3 20,4 15,9 28,1 2,31 11,4 212,- 719,- 703,-<br />
01/02 360 319 138 2,3 20,3 16,6 28,5 2,22 11,5 216,- 750,- 617,-<br />
Mittel<br />
10<br />
Jahre<br />
443<br />
377<br />
106<br />
2,2<br />
19,7<br />
16,4<br />
27,7<br />
2,07<br />
11,2<br />
220,-<br />
664,-<br />
*) Typ I: Die Daten dieser Betriebe wurden im ganzen Wirtschaftsjahr erfasst und ausgewertet.<br />
Nur Ferkelerzeuger mit Ferkelaufzucht.<br />
**)DKFL = Direktkostenfreie Leistung. Gilt ab WJ 2001/<strong>2002</strong>. Wegen veränderter Bewertung der<br />
Tierbestände ist die DKFL nicht unmittelbar mit den Deckungsbeiträgen der Vorjahre vergleichbar.<br />
Der Aufwand liegt mit 750,- € um 31,- € höher als im WJ 2000/2001 und hat damit einen<br />
Höchststand im zehnjährigen Mittel erreicht. Gestiegen sind die Kosten für die<br />
Bestandsaufstockung (+15 €), Remontierung (+3 €), Futter (+7 €), und Tierarzt (+6 €).<br />
Obwohl letztere nominal gestiegen sind, ist gegenüber dem Vorjahr der Anteil der reinen<br />
Medikamentenkosten auf ca. 30% der Gesamttierarztkosten gefallen. Den größten Anteil von<br />
knapp 50 % machen die Kosten für die Impfung von Sauen und Ferkeln aus. Bei den erfolgreichen<br />
Betrieben sind es sogar über 60%.<br />
Infolge gesundheitlicher Probleme, die sich vor allem durch die höheren Ferkelverluste zeigten,<br />
konnte bei den biologischen Kennzahlen das Vorjahresniveau nicht gehalten werden.<br />
Im WJ 2001/<strong>2002</strong> sind die Ferkelverluste (mit 16,6%) seit 6 Jahren wieder gestiegen. Außerhalb<br />
<strong>Westfalen</strong>s ist ein Trend erhöhter Verluste ebenfalls zu beobachten. Die genaue<br />
Ursache dieser Entwicklung ist unklar. Vermutlich spielt aber die zunehmende Circovirus-<br />
523,-
16<br />
Problematik eine Rolle. Die aufgezogenen Ferkel je Sau und Jahr sind deshalb um 0,1 Ferkel<br />
auf 20,3 Ferkel je Sau gesunken. Die Wurfzahl und die Wurfgröße haben sich gegenüber<br />
dem Vorjahr nicht verändert.<br />
Die Sauenbestände sind auch in diesem Jahr gewachsen. Alle vom <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong><br />
ausgewerteten Betriebe hielten im Durchschnitt 145 Sauen. Davon hielten die Betriebe mit<br />
Verkauf von Standardferkeln (Tabelle 1: Typ I) durchschnittlich 138 Sauen und die Betriebe<br />
mit Verkauf von Absatzferkeln (Typ II) durchschnittlich 218 Sauen. Der Anteil dieser Betriebe<br />
(TYP II) beträgt nur 7,5% aller im WJ 2001/<strong>2002</strong> ausgewerteten Betriebe.<br />
Die erfolgreichen Betriebe haben die größeren Sauenbestände<br />
Tabelle 2: Die 10 % erfolgreichen Betriebe - sortiert nach Direktkostenfreier Leistung<br />
Erfolgreiche<br />
10 Prozent<br />
Durchschnitt<br />
(Betriebstyp I)<br />
Differenz zum<br />
Durchschnitt<br />
Anzahl Sauen / Betrieb 208 138 +70<br />
lebend geborene Ferkel / Wurf 11,1 10,7 +0,4<br />
Würfe / Sau 2,39 2,27 +0,12<br />
lebend geb. Ferkel / Sau und Jahr 26,6 24,3 +2,3<br />
Ferkelverluste (%) 13,9 16,6 -2,7<br />
aufgezogene Ferkel / Sau und Jahr 22,9 20,3 +2,6<br />
Remontierung (%) 39,3 42,5 -3,2<br />
Remontierungskosten (€ / Sau) 113,- 127,- -14,-<br />
Gesamtfutterkosten (€ / Sau) 425,- 421,- +4,-<br />
Tierarztkosten (€ / Sau) 86,- 85,- +1,-<br />
Besamungskosten (€ / Sau) 23,- 21,- +2,-<br />
Sonstige variable Kosten (€ / Sau) 73,- 76,- -3,-<br />
Direktkosten insgesamt (€ / Sau) 738,- 750,- -12,-<br />
Verkaufsgewicht je Ferkel (kg) 29,1 28,5 +0,6<br />
Verkaufserlös je Ferkel (€ / Ferkel) 67,00 63,40 +3,60<br />
Ferkelerlös je Sau (€ / Sau) 1500,- 1260,- +240,-<br />
Schlachterlös je Sau (€ / Sau) 76,- 88,- -12,-<br />
Gesamterlös je Sau (€ / Sau) 1605,- 1367,- +238,-<br />
Direktkostenfreie Leistung (€ / Sau) 867,- 617,- +250,-<br />
In der Tabelle 2 werden die 10 Prozent erfolgreichen Betriebe - sortiert nach „Direktkostenfreier<br />
Leistung“ - mit den Durchschnittswerten im <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> verglichen. Auffallend<br />
ist, dass die erfolgreichen Betriebe mit 208 produzierenden Sauen deutlich mehr Tiere<br />
als der Durchschnitt der Betriebe vom Betriebstyp I mit 138 Sauen hielten.<br />
Die oberen 10 Prozent der Betriebe erzielten 867,- € DKFL je Sau und Jahr. Das sind 250,- €<br />
mehr als der Durchschnitt aller Betriebe mit Verkauf von Standardferkeln.
Dieser Unterschied liegt vor allem darin begründet:<br />
1. die erfolgreichen Betriebe zogen 2,6 Ferkel je Sau und Jahr mehr auf<br />
2. die erfolgreichen Betriebe erlösten 3,60 € mehr pro Ferkel, wobei das Verkaufsgewicht<br />
um 0,6 kg je Ferkel höher lag als im Durchschnitt.<br />
Zu Punkt 1: Grundlage der besseren biologischen Leistungen bei den erfolgreichen Betrieben<br />
ist die gute Fruchtbarkeit der Sauen, verbunden mit einem guten Gesundheitsstatus der<br />
Tiere (weniger Sauenverluste, niedrigere Remontierungsraten, niedrigere Ferkelverluste).<br />
Sie hatten pro Jahr 2,3 mehr lebend geborene Ferkel als die „Durchschnittssau“ (plus 0,4<br />
Ferkel je Wurf, plus 0,12 Würfe je Sau und Jahr). Gleichzeitig konnten die Ferkelverluste auf<br />
„nur“ 13,9% begrenzt werden. Saugferkelverluste lassen sich am effektivsten durch eine intensive<br />
Vor- und Nachsorge um den Geburtszeitpunkt senken. Dieses gilt für die Behandlung<br />
von Sauen und Ferkeln. Bei großen Würfen (> 11,3 leb. geb. Ferkel) hat sich der Einsatz<br />
von Ferkelammen bewährt. Ausgewogene Fütterung und eine ausreichende Remontierung<br />
der Sauenherde (35 – 40%) beeinflussen das Geburtsgewicht der Saugferkel und damit<br />
deren Überlebensrate.<br />
Die Remontierungsquote lag bei den erfolgreichen Betrieben auch im Wirtschaftsjahr<br />
2001/<strong>2002</strong> mit 39,3% signifikant niedriger als das Mittel des <strong>Erzeugerring</strong>es <strong>Westfalen</strong> mit<br />
42,5%. Die niedrigere Quote kam dadurch zustande, dass weniger Sauen vorzeitig abgehen<br />
mussten. Eine Sau wird i.d.R. vorzeitig gemerzt, wenn sie krank, verletzt oder nicht tragend<br />
ist. Die Remontierungskosten lagen um 14,- € je Bestandssau niedriger als im Durchschnitt<br />
(127,- € / Sau), da die Gruppe der 10% erfolgreichen Betriebe ihre Jungsauen um ca. 10,- €<br />
je Tier günstiger einkauften. Hierbei kommt eine Kostendegression aufgrund der großen<br />
Sauenbestände und somit der größeren Mengen an Jungsauen, die benötigt werden, zum<br />
Tragen.<br />
Zu Punkt 2: Bei gleichem Verkaufsgewicht liegt der Unterschied immerhin noch bei 2,90 € je<br />
Ferkel. Dieser Mehrerlös ist mit den deutlich besseren Betriebsstrukturen bei den erfolgreichen<br />
Betrieben zu erklären. Das heißt, es können dem Markt die gewünschten großen Verkaufspartien<br />
angeboten werden. Das Impfprogramm der Ferkel und somit die Impfkosten je<br />
Ferkel unterscheiden sich nicht wesentlich von den anderen Betrieben.<br />
Die „Direktkosten“ (Aufwand) liegen beim oberen Zehntel mit 738,- € je Sau etwas niedriger<br />
als im Durchschnitt (750,- € je Sau). Dieses liegt im wesentlichen in den oben erwähnten<br />
niedrigen Remontierungskosten begründet.<br />
Bemerkenswert ist, dass die Tierarztkosten bei beiden Gruppen in etwa gleich hoch sind.<br />
Hier schlagen beim oberen Zehntel die Impfkosten der Ferkel zu Buche, weil pro Sau mehr<br />
Ferkel geimpft werden müssen. Die Kosten für die Ferkelimpfungen werden in der Regel an<br />
den Ferkelabnehmer weitergegeben.<br />
Schlussbetrachtung<br />
Die Region <strong>Westfalen</strong>-Lippe ist nach wie vor ein Ferkelzuschussgebiet. Hinzu kommt, dass<br />
es von Zeit zu Zeit immer wieder zu einem gesundheitsbedingten Rückgang des Ferkelangebotes<br />
kommt. Hierbei sind nach wie vor saisonale Schwankungen zu erkennen. Wenn<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> in Kürze den AK-Status 10 (Anerkennung als AK-freie Region) erlangt,<br />
kommen auf Importferkeln in Hinblick ihres AK-Status´ größere Anforderungen zu. Um den<br />
Staus „Amtlich AK frei“ zu bekommen, muss ein Sauenbestand (natürlich) frei von AK sein,<br />
und die Tiere dürfen mindestens ein Jahr lang nicht geimpft worden sein.<br />
Diese Umstände dürften dazu führen, dass auch im Jahr 2003 die Ferkelangebote nicht zu<br />
üppig ausfallen werden und somit zufriedenstellende Ferkelerlöse erzielt werden können.<br />
17
18<br />
5 Neu: Milchviehberatung<br />
Ab dem Jahr 2003 bietet der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> Milchviehberatung an, die ähnlich wie<br />
in der Sauenhaltung aufgebaut wird.<br />
Es finden regelmäßige Betriebsbesuche im Abstand von 6-10 Wochen statt, die immer mit<br />
einem Stalldurchgang in betriebseigener Kleidung beginnen.<br />
Die Inaugenscheinnahme der Tiere und des Stalles ist die wichtigste Grundlage der Beratung.<br />
Viele Probleme lassen sich im Stall schon früher erkennen, als über das Auswerten<br />
von Daten.<br />
Es werden laufend Daten zur Betriebszweig-Auswertung gesammelt und ausgewertet. So<br />
kann man regelmäßig im laufenden Jahr die Erzeugungskosten pro kg Milch ermitteln und<br />
damit die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion beurteilen. Wenn nötig, kann so rechtzeitig in<br />
die laufende Produktion eingegriffen werden.<br />
Grundlage ist eine saubere Datenerfassung, um später die Daten auch vergleichen zu können.<br />
Dabei muss die mengenmäßige Erfassung des Grundfutters und auch die geldliche<br />
Bewertung nach einem einheitlichen Schema erfolgen.<br />
Um die eigenen Ergebnisse besser beurteilen zu können, werden regelmäßig über alle Betriebe<br />
anonyme Hitlisten erstellt. Mit ihrer Hilfe können im Beratungsgespräch Ansatzpunkte<br />
gesucht werden, um die eigene Produktion zu verbessern.<br />
Die LKV-Daten (Ergebnisse der Milchkontrolle oder Milchgüteprüfung) können mit dem ZMS-<br />
Programm ausgewertet werden. Dieses Programm ist in der Lage, die LKV-Daten sehr übersichtlich<br />
auszuwerten. Verschiedene Tabellen und Graphiken zeigen sehr anschaulich die<br />
Problembereiche auf.<br />
Da der Berater nicht nach jeder Milchkontrolle auf den Betrieb kommt, kann er von zu Hause<br />
auf die Daten zugreifen und nötigenfalls den Betrieb benachrichtigen, wenn etwas auffällig<br />
ist.<br />
Ausschlaggebend für eine gute Milchleistung ist das Futter. Selbstverständlich werden Futterberechnungen<br />
gemacht, die das vorhandene Grundfutter miteinbeziehen und den nötigen<br />
Kraftfutteraufwand ermitteln.<br />
Dabei sind die Auswertungen des ZMS-Programmes besonders wichtig, da sich durch dieses<br />
Programm Fütterungsfehler leichter erkennen lassen.<br />
Die Milchviehberater werden Ansprechpartner für alle Fragen rund um`s Milchvieh sein. Dabei<br />
werden wir mit den Organisationen, die im Milchviehbereich tätig sind, eng zusammenarbeiten.<br />
Weiter planen wir, auch für Milchviehhalter regionale Fortbildungsveranstaltungen anzubieten.<br />
Es sollen dort aktuelle fachliche Themen aufgegriffen werden.<br />
Ansprechpartner in allen Fragen rund um`s Milchvieh<br />
Herr Rainer Schluse, Milchvieh-Spezialberater<br />
Sommersstegge 4<br />
46414 Rhede<br />
Telefon: 02872-2688<br />
Handy: 0179-7341680
6 Was ein Umrauschtag heute kostet<br />
Wie wirken sich mehr lebend geborene Ferkel, weniger Saugferkelverluste oder eine verringerte<br />
Umrauschquote auf den Deckungsbeitrag aus? Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> hat nachgerechnet.<br />
Rund 2 € kostet ein Umrauschtag. Ein Prozent weniger Saugferkelverluste bringen einen um<br />
10 € höheren Deckungsbeitrag je Sau. Von diesen Kenngrößen gehen viele Sauenhalter<br />
heute aus. Doch stimmen die Annahmen überhaupt? Schlägt das Umrauschen nicht viel<br />
stärker zu Buche als angenommen?<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> hat mit aktuellen Zahlen nachgerechnet. Dabei wurde geprüft,<br />
wie sich der Deckungsbeitrag (DB) verändert, wenn die Wurfgröße zunimmt, die Saugferkelverluste<br />
sinken und die Verlusttage zurückgehen.<br />
Neues Computerprogramm gibt Auskunft<br />
Alle Berechnungen wurden mit einem neuen PC- Programm durchgeführt, das den Deckungsbeitrag<br />
pro Sau bei Änderung einer Variablen neu berechnet. Die Kosten und Erlöse,<br />
auf die das Programm zurückgreift, stammen aus den letzten Wirtschaftsjahren. Um die Genauigkeit<br />
der Berechnungen weiter zu erhöhen, werden zusätzlich Daten aus den letzten<br />
zehn Wirtschaftsjahren einbezogen. Sämtliche Daten stammen aus knapp 500 Mitgliedsbetrieben<br />
des <strong>Erzeugerring</strong>es mit Ferkelerzeugung.<br />
Die durchschnittlichen Kosten und Erlöse der Betriebe sind in Tabelle 1 aufgeführt.<br />
Tabelle 1: Kosten und Erlöse in der Sauenhaltung 1)<br />
Futterkosten (€/ Sau) 212<br />
Futterkosten (€/ Ferkel) 10<br />
Besamungskosten (€/ Sau) 21<br />
Tierarztkosten (€/ Sau) 77<br />
Jungsaueneinkauf (€/ Sau) 308<br />
Remontierungskosten (€/ Sau) 2) 129<br />
Sonstige Kosten (€/ Sau) 76<br />
Erlöse<br />
Schlachterlöse pro (€/ Bestandsau) 3)<br />
Ferkelerlös (25 kg), (€/ Ferkel)<br />
1) Wirtschaftsjahr 2000/ 2001<br />
2) die Remontierungkosten wurden ermittelt aus der Remontierungsrate und dem Jungsauenpreis<br />
3) bei 2,5 Jahren Nutzungsdauer (anteilig pro Jahr)<br />
Für das Sauenfutter mussten die Betriebsleiter im Wirtschaftsjahr 2000/2001 zum Beispiel<br />
212 € pro Sau und Jahr ausgeben, während das Ferkelfutter 10 € pro Ferkel kostete. Die<br />
Besamungskosten lagen bei 21 €, die Tierarztkosten bei 77 €. Die Remontierungskosten, die<br />
aus der Remontierungsrate und dem Jungsauenpreis ermittelt wurden, lagen im Schnitt bei<br />
129 €. Auf der Erlösseite wurden folgende Daten ermittelt. Umgerechnet auf ein Jahr lag der<br />
Schlachterlös für eine Bestandssau bei durchschnittlich 89 €. Für ein 25-kg-Ferkel wurden<br />
65 € erlöst.<br />
Um nun zeigen zu können, wie sich der Deckungsbeitrag verändert, wenn zum Beispiel 0,1<br />
Ferkel pro Wurf mehr lebend geboren werden bzw. die Saugferkelverluste um 1% sinken,<br />
wurden Beispielsdaten in das Programm eingegeben. Die Daten können jederzeit an die<br />
betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.<br />
89<br />
65<br />
19
20<br />
Tabelle 2: So ändert sich der Deckungsbeitrag bei optimierten Leistungen<br />
Abgesetzte Ferkel/Sau/Jahr<br />
Lebend geborene Ferkel/Wurf<br />
Würfe/ Jahr<br />
Abgesetzte Ferkel/ Wurf<br />
Verluste, %<br />
Produktionstage<br />
Leistungstage<br />
Tragetage<br />
Säugetage<br />
Absetz-Belegtage (ABT)<br />
Ammentage<br />
Verlusttage<br />
Umrauschtage (URT)<br />
Abortverlusttage<br />
Tage Absetzen- Verkauf<br />
Tage Belegen-Verkauf<br />
DB, €/Sau<br />
DB-Veränderung nach<br />
Optimierung, €/Sau<br />
DB-Veränderung,<br />
€/200er Herde<br />
Betriebsdaten<br />
1)<br />
Optimiert nach<br />
LGF/Wurf 2) Verluste ABT 3) URT 4) TVVA 5) TVVB 6)<br />
22,6 22,8 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7<br />
11,08 11,18 11,08 11,08 11,08 11,08 11,08<br />
2,28 2,28 2,28 2,29 2,29 2,29 2,29<br />
9,90 9,99 10,01 9,90 9,90 9,90 9,90<br />
10,68 10,68 9,68 10,68 10,68 10,68 10,68<br />
160,2 160,2 160,2 159,2 159,2 159,2 159,2<br />
148,3 148,3 148,3 147,3 148,3 148,3 148,3<br />
115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0<br />
26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0<br />
6,8 6,8 6,8 5,8 6,8 6,8 6,8<br />
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />
11,88 11,9 11,9 11,9 10,9 10,9 10,9<br />
5,46 5,5 5,5 5,5 4,46 5,5 5,5<br />
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />
1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,90 1,9<br />
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5<br />
740 751 753 747 747 747 747<br />
11,00 13,65 3,30 3,30 3,30 3,30<br />
2200 2729 660 660 660 660<br />
1) Daten beispielhaft vorgegeben, 2) lebend geborene Ferkel pro Wurf, 3) Absetz-Beleg-Tage, 4) Umrauschtage 5) Tage vom<br />
Absetzen bis zum Verkauf der Sau, 6) Tage vom Belegen bis zum Verkauf der Sau<br />
Wie in Tabelle 2 in der Spalte Betriebsdaten dargestellt, erreichte der Beispielsbetrieb im<br />
Schnitt pro Wurf 11,08 lebend geborene Ferkel. Die Zahl der Würfe lag bei 2,28. Pro Wurf<br />
konnten 9,90 Ferkel abgesetzt werden, so dass eine Gesamtleistung von 22,6 abgesetzten<br />
Ferkeln erzielt werden konnte. Die durchschnittlichen Saugferkelverluste lagen bei 10,68%.<br />
Zwischen dem Absetzen der Sauen und dem Belegen lagen durchschnittlich 6,8 Tage, die<br />
Umrauschtage beliefen sich im Schnitt auf 5,46 Tage. Durchschnittlich 1,9 Tage dauert es,<br />
bis Altsauen nach dem Absetzen verkauft wurden. Sauen, die zwar belegt wurden, aus unterschiedlichen<br />
Gründen nach dem Belegen ausscheiden mussten, wurden im Schnitt 2,5<br />
Tage nach dem Belegen verkauft.
14 € höherer Deckungsbeitrag bei 1% weniger Verlusten<br />
Nach Eingabe aller Daten war es möglich, den durchschnittlichen Deckungsbeitrag je Sau zu<br />
berechnen, wenn sich ein einzelnes Leistungsmerkmal ändert. Steigt zum Beispiel die Anzahl<br />
der lebend geborenen Ferkel pro Wurf von 11,08 auf 11,18 Tiere, verbessert sich der<br />
Deckungsbeitrag pro Sau von 740 auf 751 €. Vorausgesetzt, alle anderen<br />
Produktionsvariablen bleiben konstant, würden dann nämlich nicht mehr 22,6 Ferkel pro Sau<br />
und Jahr abgesetzt, sondern 22,8 Ferkel. Bei einem Sauenbestand von 200 Tieren könnte<br />
so ein zusätzlicher Deckungsbeitrag von 2200 € erzielt werden.<br />
Eine um 0,1 Ferkel pro Wurf verbesserte Wurfleistung kann durch die Optimierung des<br />
Deckmanagements realisiert werden. Sauenhalter sollten bei kleinen Würfen zum Beispiel<br />
kontrollieren, ob bestimmte Eber Würfe mit geringen Ferkelzahlen produzieren. Wenn ja,<br />
muss dieser Eber gemerzt bzw. bei künstlicher Besamung muss der Eber gewechselt werden.<br />
Das gleiche gilt bei Sauen, bei denen die Fruchtbarkeit zu wünschen übrig lässt.<br />
Gelingt es den Betrieben, die durchschnittlichen Saugferkelverluste um 1% von 10,68 auf<br />
9,68% zu senken, erhöht sich der Deckungsbeitrag bei einem Leistungsniveau von 22,8 abgesetzten<br />
Ferkeln nicht wie häufig angenommen um 10 € pro Sau, sondern um satte 13,65 €<br />
pro Tier. Umgerechnet auf die Beispielsherde mit 200 Sauen ergibt sich so ein um 2730 €<br />
höherer Deckungsbeitrag.<br />
Potenzial, um die Saugferkelverluste zu reduzieren, gibt es reichlich. Zu kontrollieren ist zum<br />
Beispiel, ob MMA-Probleme im Bestand die Ursache für hohe Verluste sein können. Außerdem<br />
sollten die Gelenke der Saugferkel regelmäßig kontrolliert werden. Sind diese wund<br />
gescheuert, sind Ausfälle aufgrund von Streptokokkeninfektionen vorprogrammiert.<br />
Können schließlich die Verlust- bzw. Leertage im Bestand um 1 Tag reduziert werden, lässt<br />
sich ein um 3,30 € höherer Deckungsbeitrag erzielen. Das gilt sowohl bei der Senkung der<br />
Absetz-Beleg-Tage (ABT), bei der Reduzierung der Umrauschtage (URT), aber auch dann,<br />
wenn die Tage vom Absetzen bis zum Verkauf (TVVA) oder die Tage vom Belegen bis zum<br />
Verkauf (TVVB) um 1 Tag reduziert werden.<br />
Die Absetz-Beleg-Tage lassen sich zum Beispiel durch eine intensive Stimulation reduzieren.<br />
Zu überlegen ist, den Eber nicht erst am Tag der Besamung vor die Sau zu stellen, sondern<br />
mit der stundenweisen Stimulierung bereits am 2. oder 3. Tag nach dem Absetzen zu<br />
beginnen.<br />
Wie verändern sich die Kosten bei unterschiedlichen Erlösen?<br />
Da sich der entgangene Deckungsbeitrag mit dem Preis- bzw. Leistungsniveau ändert, stellt<br />
sich die Frage: Welche Auswirkungen haben der Ferkelpreis bzw. das Leistungsniveau auf<br />
die Kosten pro Umrauschtag bzw. pro Prozentpunkt Saugferkelverluste?<br />
Tabelle 3: So wirkt sich der Ferkelpreis auf den entgangenen Deckungsbeitrag aus<br />
Ferkelpreis € 40 45 50 55<br />
abgesetzte Ferkel/Sau/Jahr 22,6 22,6 22,6 22,6<br />
Kosten pro Umrauschtag € 1,82 2,13 2,43 2,72<br />
Kosten pro % Saugferkelverluste € 7,54 8,79 10,04 11,29<br />
Mit steigenden Ferkelpreisen erhöhen sich auch die Kosten pro Umrauschtag.<br />
In Tabelle 3 sind zunächst nur die Auswirkungen dargestellt, wenn sich der Ferkelpreis verändert<br />
und das Leistungsniveau konstant bleibt. Bei einem Preisniveau von 40 € und 22,6<br />
abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr kostet ein Umrauschtag 1,82 €. Werden für die Ferkel<br />
45 € pro Tier erlöst, kostet jeder zusätzliche Umrauschtag 2,13 €, bei einem Preisniveau von<br />
50 € sind es 2,43 €.<br />
21
22<br />
Betrachtet man die Auswirkungen unterschiedlicher Ferkelpreise auf die Kosten pro Prozentpunkt<br />
Saugferkelverluste, ergibt sich folgendes Bild. Bei einem Preisniveau von 40 € und<br />
22,6 abgesetzten Ferkeln kosten 1% mehr Saugferkelverluste 7,54 €. Können pro Ferkel 50<br />
€ erlöst werden, kostet jedes zusätzliche Prozent Saugferkelverluste 10,04 €. Sogar 11,29 €<br />
kosten 1 % mehr Saugferkelverluste bei einem Ferkelpreis von 55 €.<br />
Tabelle 4: So wirkt sich das Leistungsniveau auf den entgangenen Deckungsbeitrag aus<br />
Ferkelpreis € 55 55 55 55<br />
abgesetzte Ferkel/Sau/Jahr 21,5 22,0 23,0 24,0<br />
Kosten pro Umrauschtag € 2,60 2,66 2,78 2,90<br />
Kosten pro % Saugferkelverluste € 10,76 11,02 11,53 12,04<br />
Mit zunehmendem Leistungsniveau wird jedes Prozent Saugferkelverluste teurer.<br />
In Tabelle 4 sind nun die Auswirkungen unterschiedlicher Leistungen auf die Kosten pro Umrauschtag<br />
bzw. pro Prozentpunkt Saugferkelverluste dargestellt.<br />
Bei einem Ferkelpreis von 55 € und 21,5 abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr kostet ein<br />
Umrauschtag 2,60 €, während 1 % höhere Saugferkelverluste mit 10,76 € zu Buche schlagen.<br />
Steigt die Herdenleistung auf 23 abgesetzte Ferkel, kostet jeder zusätzliche Umrauschtag<br />
2,78 €, 1 % höhere Saugferkelverluste 11,53 €. Die Kosten steigen weiter, wenn die<br />
Herdenleistung zunimmt. Bei 24 abgesetzten Ferkeln pro Sau und Jahr belaufen sich die<br />
Kosten pro Umrauschtag auf 2,90 €, während die Kosten pro Prozentpunkt Saugferkelverluste<br />
auf 12,04 € steigen. Zu erklären ist der Unterschied dadurch, weil ein größerer Wurf ein<br />
höheres geldliches Potenzial besitzt und der Umrauschtag den ganzen Wurf betrifft.<br />
Fazit<br />
Das oberste Ziel in der Ferkelerzeugung muss sein, die biologischen Leistungen in allen Bereichen<br />
weiter zu verbessern.<br />
Zunächst gilt es, die Leistungsmerkmale zu optimieren, die den größten Einfluss auf das<br />
wirtschaftliche Ergebnis haben. Zu nennen sind hier die Wurfgrößen, die Saugferkelverluste<br />
sowie die Verlust- bzw. Leertage.<br />
Wie die aktuellen Berechnungen zeigen, führt allein die Erhöhung der Wurfgröße um 0,1<br />
Ferkel pro Wurf zu einem um 11 € höheren Deckungsbeitrag pro Sau.<br />
Durch die Senkung der Saugferkelverluste um 1 % haben Ferkelerzeuger die Möglichkeit,<br />
den Deckungsbeitrag pro Sau um fast 14 € zu steigern.<br />
Rund 3,30 € mehr Deckungsbeitrag sind zu realisieren, wenn die Verlusttage um einen Tag<br />
gesenkt werden. Das gilt sowohl für die Umrauschtage, die Leertage als auch für die Absetz-<br />
Beleg-Tage.<br />
Neues Computerprogramm vereinfacht die Auswertung<br />
Das vom <strong>Erzeugerring</strong> genutzte Computerprogramm für die Auswertung in Ferkel erzeugenden<br />
Betrieben wurde von Melanie Große Vorspohl im Rahmen einer Diplomarbeit an der<br />
Fachhochschule in Soest entwickelt. Unterstützt wurde die Arbeit vom <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong>,<br />
der Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung (GFS) und dem Bundeshybridzuchtprogramm.
7 Zukunftsorientierte Erfolgsstrategien für die<br />
Schweinemast<br />
Zusammen mit der GFS (Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung) bietet der<br />
<strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> jetzt einen neuen „Crashkurs“ für Schweinemäster an. Der erste<br />
Crashkurs dieser Art fand Anfang Dezember <strong>2002</strong> in Ascheberg statt. Neben der Schlachtschweinevermarktung<br />
wurden in dem eintägigen Seminar Themen wie: die GFS- Endproduktprüfung,<br />
die Zusammenarbeit zwischen Ferkelerzeuger und Mäster bei der Besamungseberauswahl,<br />
sowie Fragen rund um den Stallbau (gesetzliche Vorschriften, Fütterungs- und<br />
Haltungstechnik usw.) behandelt. Ausführlich wird bei diesem Crashkurs zudem auf die Betriebszweiganalyse<br />
bei Schweinemästern und auf Erweiterungsmöglichkeiten eingegangen.<br />
Um den Schweinemästern einen Einblick in die Arbeit der Genossenschaft zu vermitteln,<br />
erläuterte GFS- Mitarbeiter Andreas Närmann unter anderem die Grundlagen der GFS-<br />
Nachkommenprüfung. Hierbei werden die ersten Ferkel der jungen „Prüfeber“ in ausgewählten<br />
Praxisbetrieben gemästet. Anschließend wird sowohl die Mast- als auch die Schlachtleistung<br />
der Schweine erfasst. Die Leistungen der Nachkommen gehen dann in die GFS-<br />
Zuchtwertschätzung des Jungebers ein und entscheiden über dessen weitere Zukunft: Die<br />
besten Eber aus GFS- Endproduktprüfung und Nachkommenprüfung auf Station (LPA- Prüfung)<br />
werden in die sogenannte Top- Genetik- Gruppe eingestuft. Die Eber mit schlechteren<br />
Nachkommenleistungen gehen zum Schlachten.<br />
Gemeinsame Eberauswahl<br />
Wie <strong>Erzeugerring</strong>berater Franz-Josef Eling berichtete, haben immer mehr Mäster erkannt,<br />
dass sich der Einsatz leistungsstarker Genetik lohnt. Folgerichtig drängen sie bei „ihren“ Ferkelerzeugern<br />
darauf, die Sauen mit entsprechenden Ebern zu belegen. Die Mehrkosten für<br />
das Top-Genetik-Sperma schlagen sich dann zwar im Ferkelpreis nieder, angesichts der im<br />
Mittel auch besseren Mast- und Schlachtleistungen lohnt sich diese Investition. Auswertungen<br />
der GFS haben es gezeigt.<br />
Da sich Eber der Top-Genetik-Fraktion in ihrem Vererbungsprofil deutlich voneinander unterscheiden,<br />
plädierte Franz-Josef Eling für eine ganz gezielte Eberauswahl. Dabei sollten<br />
die Betriebe bereits bei der Spermabestellung berücksichtigen, welche Sauengrundlage vorhanden<br />
ist und mit welcher Fütterungstechnik die Ferkel bzw. Schweine später gemästet<br />
werden sollen. So kann bei der GFS beispielsweise gezielt Samen von eher frohwüchsigen,<br />
von sehr fleischreichen oder von mehr bauchbetonten Piétrain-Top-Genetik-Ebern bestellt<br />
werden, um in der späteren Mast möglichst einheitliche Partien im Stall zu haben. Dies vereinfacht<br />
die Fütterung und erleichtert die Vermarktung.<br />
Kostengünstig wachsen<br />
Eine Analyse der Schweinemast aus steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht gelang<br />
Elmar Backmann von der Steuerberatungsgesellschaft Dr. Gemmeke GmbH im niedersächsischen<br />
Bruchhausen. Wie der Unternehmensberater erläuterte, sollten die Betriebe die biologischen<br />
Leistungen stetig maßvoll steigern, ohne dabei die für die Erlöse so wichtigen<br />
Schlachtleistungsparameter aus den Augen zu verlieren. Parallel dazu müssten die Stückkosten<br />
möglichst niedrig gehalten werden, um in der Schweinemast im langfristigen Schnitt<br />
eine lukrative Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erreichen.<br />
Notwendige Wachstumsschritte müssen kostenbewusst erfolgen, mahnte Backmann. Das<br />
gelte sowohl für den Bereich Stallbau als auch hinsichtlich der Flächenaufstockung. Gerade<br />
hier seien in der Vergangenheit oft Fehler gemacht worden, wenn es Probleme mit der Vieheinheitengrenze<br />
oder mit den Vorgaben der Düngeverordnung gab. In guten „Schweinejah-<br />
23
24<br />
ren“ wurden dann Fläche zu überhöhten Preisen zugepachtet, ohne zu bedenken, dass die<br />
Erweiterungspacht mit 100 bis 150 Euro je ha aus der Veredlungswirtschaft „subventioniert“<br />
werden muss. Hier sollte in Zukunft verstärkt nach Alternativen zur Flächenaufstockung Ausschau<br />
gehalten werden, riet der Steuerfachmann.<br />
Was für die Flächenausstattung gilt, zählt für den Stallbau ebenso: Hohe Festkosten verteuern<br />
die Produktion und können in Preistälern über die Wirtschaftlichkeit der Mast entscheiden.<br />
Backmann empfahl daher, einen Stallbau nur zu realisieren, wenn die Nettoerstellungskosten<br />
360 €/Mastschweineplatz nicht überschreiten. Im Zweifel sollten die Betriebe sonst<br />
lieber auf die Baumaßnahme verzichten und die vorhandenen Produktionskapazitäten möglichst<br />
effizient nutzen.<br />
Vorteile für Großgruppen<br />
Ob man heutzutage angesichts der umfangreichen bau- und umweltrechtlichen Auflagen in<br />
Deutschland allerdings noch einen Stall für 360 €/Mastplatz bauen kann, wagte Michael<br />
Marks zu bezweifeln. In günstigen Einzelfällen möge das gelingen, so der Stallbau- und<br />
Stallklimaberater der RCG in Münster, im Normalfall wohl eher nicht.<br />
Marks ging dann die lange „Litanei“ der zu beachtenden Tier- und Umweltschutzvorgaben<br />
durch, wobei sich zeigte, dass die klassische Aufstallung der Mastschweine am Quertrog mit<br />
Flüssigfütterung hinsichtlich der Baukosten heute von Nachteil ist. Das hängt unter anderem<br />
mit den Flächenvorgaben aus dem nordrhein-westfälischen Schweineerlass zusammen. Dort<br />
werden für Schweine mit 81 bis 110 kg Lebendgewicht in der Großgruppe mit mehr als 15<br />
Tieren 0,85 m²/Schwein gefordert, während jedem Schwein in der Kleingruppe (weniger als<br />
15 Tiere) mindestens 1 m² Buchtenfläche zur Verfügung stehen muss.<br />
Den Abschluss des neuen Schweinmast-Crashkurses bildete die Auswertung von AutoFOM-<br />
Schlachtdaten unter Zuhilfenahme des Internets. Hier erläuterten Franz-Josef Eling und<br />
Markus Mönikes das Beratungsangebot des <strong>Erzeugerring</strong>es <strong>Westfalen</strong> und erklärten an Beispielsdatensätzen,<br />
wie man die Ergebnisse zur Verbesserung der Produktion und Optimierung<br />
der Schweinevermarktung nutzen kann. Außerdem stellte Herr Mönikes die aktuelle<br />
Version des Computerprogrammes „KonRAT“ vor, mit dessen Hilfe der Landwirt seine<br />
Schlachtabrechnung überprüfen kann.<br />
Weitere Kurse dieser Art folgen im Frühjahr 2003. Informationen dazu erhalten Sie beim<br />
ERW unter Tel: 0251/ 285010 oder im Internet unter www.erw-wl.de!
8 SNW-Piétraineber – auf „Herz und Nieren“ geprüft<br />
Wer auf Dauer erfolgreich Ferkel erzeugen will, muss hochwertige Genetik einsetzen. Dies<br />
betrifft nicht nur die Sauenherkünfte sondern auch den Ebereinsatz.<br />
Dem Schweineerzeuger Nord – West (SNW) e.V. in Münster steht mit etwa 1500 eingetragenen<br />
Piétrainsauen eine solide Basis für die züchterische Bearbeitung der Vaterlinien zur<br />
Verfügung. Um eine hinreichende Sicherheit beim Einsatz von Endproduktebern in der Ferkelerzeugerstufe<br />
zu erreichen, ist ein Prüfsystem notwendig, welches über das genetische<br />
Leistungsvermögen eines Vatertieres Auskunft gibt. Darüber hinaus setzt die Zuchtwahl auf<br />
die verschiedensten Merkmale. Deren Erfassung und Prüfung werden vorausgesetzt.<br />
Stationsprüfung<br />
In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer <strong>Westfalen</strong> – Lippe und Weser - Ems<br />
erfolgt deshalb in den Leistungsprüfungsanstalten (LPA) Haus Düsse und Quakenbrück eine<br />
Stationsprüfung. Die Einzelheiten dieses Prüfungsverfahrens sind durch die vom „Ausschuss<br />
für Leistungsprüfungen und Zuchtwertfeststellung beim Schwein“ (ALZ) erarbeitete Richtlinie<br />
umfassend geregelt.<br />
Der Vorteil der Stationsprüfung besteht darin, dass sich die Umweltbedingungen weitgehend<br />
vereinheitlichen lassen. Hinzu kommt, dass diese Prüfungsform geeignet ist, Merkmale zu<br />
erfassen, die einen hohen personellen und apparativen Messaufwand erfordern. Diesen Vorteilen<br />
stehen allerdings die hohen Prüfkosten je Tier gegenüber, die Untersuchungen mit<br />
sehr großen Stückzahlen unmöglich machen. Für eine effektive Zuchtarbeit ist die Stationsprüfung<br />
jedoch unerlässlich.<br />
In Abhängigkeit von dem Verhältnis zwischen dem Zuchttier, dessen Zuchtwert geschätzt<br />
werden soll und dem Tier, das die zur Zuchtwertschätzung genutzten Leistungsinformationen<br />
erbringt, werden die Leistungsprüfungen nach der Herkunft der Information für die<br />
Zuchtwertschätzung als Eigenleistungs-, Geschwister- oder Nachkommenprüfung bezeichnet.<br />
Bei der Prüfung für die Rasse Piétrain handelt es sich um eine kombinierte Geschwister-/<br />
Nachkommenprüfung, da die Ergebnisse sowohl zur Zuchtwertschätzung von Jungebern<br />
aufgrund der Geschwisterinformationen als auch von Ebern und Sauen aufgrund ihrer Nachkommenleistungen<br />
dienen.<br />
Anmeldung und Ablauf der Prüfung<br />
Die Züchter des SNW e.V. melden die zu prüfenden Gruppen bis zu einem Alter von 14 Tagen<br />
beim Zuchtverband an. Bei den Vaterlinien werden jeweils zwei weibliche Tiere eines<br />
Wurfes zur LPA – Prüfung angemeldet. Bei der Eingabe der Anmeldedaten in die EDV erfolgt<br />
zunächst eine Überprüfung der von Vater und Mutter vorliegenden Leistungszahlen.<br />
Dies ist unbedingt erforderlich, da nur die besten Leistungsvererber einer Population für die<br />
Weiterzucht genutzt werden sollen. Auf diese Weise erfolgt schon bei der Prüfungsanmeldung<br />
eine erste Selektion.<br />
Nach erfolgreicher Anmeldung werden die Prüfanstalten und die Züchter über die zu schickenden<br />
Gruppen benachrichtigt. Die Anlieferung der Ferkel erfolgt bis zu einem Lebendgewicht<br />
von 28 kg. Die Prüfung erstreckt sich über den Gewichtsabschnitt von 30 bis 105 kg.<br />
Während der Prüfung wird eine Mischung ad libitum verabreicht. Gehalten werden die Prüftiere<br />
strohlos auf Teilspaltenboden in Zweierbuchten. In dem angegebenen Prüfungsabschnitt<br />
werden die Mastleistungsmerkmale tägliche Zunahme und der Futteraufwand je kg<br />
Zuwachs sowie schlachtgewichtsbezogen die Nettoprüftagszunahme sowie der Nettofutteraufwand<br />
je kg Zuwachs ermittelt.<br />
25
26<br />
Nach Erreichen des Prüfungsendgewichtes, welches für alle Rassen auf 85 kg Schlachtgewicht<br />
(warm) festgelegt worden ist, erfolgt die Ermittlung des Schlachtkörperwertes, d. h. der<br />
Schlachtkörperzusammensetzung und der Fleischbeschaffenheit.<br />
Die Schlachtkörperzusammensetzung wird unter anderem durch die Merkmale durchschnittliche<br />
Rückenspeckdicke, Rückenmuskelfläche und Fettfläche (am Anschnitt zwischen 13.<br />
und 14. Brustwirbel), Seitenspeckdicke, Speckdicke über der Rückenmuskelfläche, das<br />
Schinkengewicht, die Schlachtkörperlänge sowie die Bauchqualität erfasst. Auf der Grundlage<br />
ausgewählter Messwerte erfolgt die Schätzung des Fleischanteils mit Hilfe einer Regressionsgleichung,<br />
der sogenannten „Bonner Formel“. Die Fleischbeschaffenheit wird durch<br />
früh- und spätpostmortale pH- und Leitfähigkeitsmessungen im Kotelett und Schinken sowie<br />
die Fleischhelligkeitsmessung mit dem „Opto - Star“ – Gerät 24 h p.m. erfasst.<br />
Nach Abschluss der Prüfung erhalten der Zuchtverband und die jeweiligen Züchter der geschickten<br />
Gruppen die Prüfungsergebnisse in Form eines Prüfungsberichtes für jeweils eine<br />
Vollgeschwistergruppe mit Angabe der Einzeltierdaten. Der Zuchtverband wertet die in der<br />
LPA erzielten Leistungen für jede Rasse bzw. Herkunft kontinuierlich aus, und nutzt die Daten<br />
der LPA - Prüfungen für die BLUP - Zuchtwertschätzung. Bei dieser Vorausschätzung<br />
des genetischen Wertes eines Jungebers werden die Merkmale Tageszunahme, Futterverbrauch<br />
je kg Zuwachs (Futterverwertung), Fleischanteil nach Bonner Formel und der LF24<br />
– Wert in die Berechnung des Zuchtwertes einbezogen. Dabei werden alle verfügbaren Verwandteninformationen<br />
zur Schätzung des Jungeber – Zuchtwertes genutzt. Wird dieser<br />
Jungeber dann beispielsweise in Auktionskatalogen bzw. in den Stallkörungskatalogen zum<br />
Verkauf angeboten, sind die Angaben zum Zuchtwert und vieles mehr im Katalog abgedruckt.<br />
Mit diesen Angaben kann sich der potentielle Käufer ein Bild vom Wert des Tieres<br />
machen.
Übersicht 1: Erläuterung der Katalogangaben für einen Jungeber<br />
Eber 129906 / 11<br />
7 / 7<br />
Vater<br />
Vaters Vaters<br />
Vaters Mutter<br />
13472<br />
12418<br />
BLUP ZW . 121<br />
V.<br />
127823<br />
PI<br />
PI<br />
PI<br />
BLUP - Gesamtzuchtwert<br />
M.<br />
PI<br />
13472<br />
10 / 10<br />
2 / 2<br />
(<br />
173<br />
NZW<br />
161<br />
NZW<br />
HB-Nr. der Mutter<br />
mit Spitzennr. des Ferkels<br />
Zitzenzahl links / rechts<br />
MIXER<br />
MAXEL<br />
BEGGA<br />
2,01<br />
2,10<br />
HB - Nr<br />
+1,4<br />
838<br />
+11<br />
899<br />
+42<br />
Rasse<br />
NP<br />
Name<br />
geb. 08.04.02<br />
MHS - Status<br />
Mutter<br />
Muters Vater<br />
Mutters Mutter<br />
BLUP – Teilzuchtwerte für<br />
-tägliche Zunahme<br />
-Futterverbrauch / kg Zuwachs<br />
-Fleischanteil<br />
-LF 24 -Wert<br />
+0,2<br />
2,40<br />
+0,02<br />
2,33<br />
+0,06<br />
97<br />
101<br />
Futteraufnahme / kg / Tag<br />
Alter bei Mastende (Tage)<br />
62,0<br />
61,2<br />
129906<br />
11369<br />
124597<br />
Zl.<br />
+0,9<br />
64,8<br />
+0,9<br />
64,6<br />
-0,1<br />
Geburtsdatum des Jungebers<br />
PI<br />
PI<br />
PI<br />
2 / 2 W.<br />
FRANCA<br />
PAN<br />
FAZORA<br />
10,5 / 10,0<br />
PP<br />
27<br />
Zuchtleistung der Mutter<br />
(Im Durchschnitt von 2 Würfen<br />
hat die Mutter 10,5 Ferkel<br />
geboren und 10,0 Ferkel<br />
aufgezogen)<br />
1,7<br />
1,7<br />
63,7<br />
63,1<br />
56<br />
55<br />
Rückenmuskelfläche (cm<br />
Schlachtkörperlänge (cm)<br />
2 )<br />
Futterverbrauch / kg Zuwachs<br />
Ø tägliche Zunahme (g)<br />
Rückenspeckdicke (cm)<br />
Fleischanteil im<br />
Bauch (Gruber Formel)<br />
Opto<br />
LF 24<br />
Fleischanteil (%)<br />
7,2<br />
+0,2<br />
5,5<br />
-1,0<br />
-0,4)
28<br />
Wie solche Katalogangaben aussehen, und was sich dahinter verbirgt, ist in Übersicht 1<br />
dargestellt.<br />
Dort sind sowohl der BLUP – Gesamtzuchtwert (in unserem Beispiel 121 Punkte), als auch<br />
die BLUP – Teilzuchtwerte dargestellt. Die ökonomisch gewichteten Teilzuchtwerte des<br />
Jungebers resultieren aus dem Produkt des Durchschnitts der jeweiligen Naturalzuchtwerte<br />
der beiden Eltern mit den entsprechenden ökonomischen Gewichten.<br />
Die Berechnung der ökonomischen Teilzuchtwerte geht aus Übersicht 2 hervor.<br />
Übersicht 2: Ökonomische Gewichtungsfaktoren für die Berechnung der ökonomischen<br />
Teilzuchtwerte<br />
Tageszunahme Futterverwertung Fleischanteil LF24<br />
Naturalzuchtwert Vater + 11 + 0,02 + 0,9 + 0,2<br />
Naturalzuchtwert Mutter + 42 + 0,06 - 0,1 - 1,0<br />
Ø Vater, Mutter + 27 + 0,04 + 0,4 - 0,4<br />
Faktor 0,05 € / g 5,11 € / kg 2,30 € / % + 1,02 € / ms<br />
Ökonomischer Teilzuchtwert<br />
+ 1,4 + 0,2 + 0,9 - 0,4<br />
Die Stationsprüfung ist jedoch nicht alleine ausschlaggebend für die Zuchttauglichkeit eines<br />
Ebers. Die Ergebnisse aus der Geschwisterprüfung bzw. die Pedigree – Informationen über<br />
Vaters – und Muttersseite und alles was sonst noch zur Zuchtwertschätzung des Jungebers<br />
herangezogen wird, sind zwar sehr wichtig, ohne entsprechend gute Ergebnisse beim Eigenleistungstest<br />
wird jedoch kein Eber zur Körung zugelassen.<br />
Jeder zur Körung vorgestellte Eber muss bestimmte Mindestwerte beim BLUP – Zuchtwert<br />
und bei den Eigenleistungsmerkmalen erfüllen (Lebenstagszunahme, Rückenspeckdicke).<br />
Hinsichtlich der Prüfungsanforderungen muss die Mutter mit mindestens zwei und der Vater<br />
mit mindestens sechs Tieren geprüft sein.<br />
Darüber hinaus sieht sich die Körkommission das Erscheinungsbild des Jungebers genau an<br />
und entscheidet, ob dieser für den Zuchteinsatz zugelassen wird oder nicht.<br />
Fazit<br />
Stationsprüfungen liefern unverzichtbare Informationen für eine effektive Zuchtarbeit. Sie<br />
liefern die grundlegenden Daten für die Zuchtwertschätzung und Selektion. Darüber hinaus<br />
geben die ermittelten Ergebnisse Züchtern und Ferkelerzeugern wichtige Entscheidungshilfen<br />
bei der Wahl der einzusetzenden Genetik.
9 Leistungsreserven bei Ferkelerzeugern mobilisieren<br />
Wie Referenzwert- und Deckmanagementanalyse auf Grundlage der Sauenplanerdaten<br />
dabei helfen können<br />
Betriebe mit hoher Leistung haben erkannt, dass nur mit einer konsequenten Dokumentation<br />
die Betriebsdaten erfasst und analysiert werden können. Um die Fülle an Daten über den<br />
Sauenplaner hinaus nutzen zu können, ist die so genannte Referenzwertanalyse entwickelt<br />
worden. Diese hat das Ziel, an Hand der Produktionsdaten Schwachstellen aufzuzeigen,<br />
aber auch Leistungsreserven zu mobilisieren.<br />
Grundlage zur Ermittlung der Referenzwerte liefern die Leistungsdaten der Ferkelerzeugerbetriebe<br />
aus dem Fruchtbarkeitsmonitoring der GFS. An der Erstellung der<br />
Referenzwertanalyse sind neben der GFS der SNW, der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong>, Herr Prof.<br />
Brandt von der Universität Gießen und Frau Dr. Engels (Lohne) beteiligt.<br />
Die wichtigen Merkmale im Reproduktionsgeschehen eines Ferkelerzeugers sind in Übersicht<br />
1 aufgelistet.<br />
Übersicht 1: Leistungsmerkmale im Reproduktionsgeschehen<br />
1. Altersstruktur der Herde, Referenz: LGF/Wurf *<br />
2. Prozentuale Verteilung, erste Belegung nach dem Absetzen, Referenz: Absatzbelegtage*<br />
3. Prozentuale Verteilung > 1. Belegung nach dem Absetzen (Umrauscher), Referenz:<br />
Absatzbelegtage*<br />
4. Prozentuale Verteilung aller Belegungen nach dem Absetzen, Referenz: Absatzbelegtage*<br />
5. Mittel lebend geborener Ferkel nach Wurfnummer, Referenz: LGF/Wurf*<br />
6. Mittel abgesetzter Ferkel nach Wurfnummer, Referenz: AGF/Wurf*<br />
7. Mittel totgeborener Ferkel nach Wurfnummer, Referenz: LGF/Wurf*<br />
8. Mittel Saugferkelverluste nach Wurfnummer, Referenz: LGF/Wurf*<br />
9. Verteilung leb. geb. Ferkel bei Jungsauen, Referenz: LGF/Wurf*<br />
10. Verteilung leb. geb. Ferkel beim 2. Wurf, Referenz: LGF/Wurf*<br />
11. Verteilung leb. geb. Ferkel beim 3. – 5. Wurf, Referenz: LGF/Wurf*<br />
12. Verteilung leb. geb. Ferkel ab > 5. Wurf, Referenz: LGF/Wurf*<br />
* Die Auswahl der 25 % besten Betriebe erfolgte anhand dieses Merkmales.<br />
Für jedes einzelne Merkmal wurde der Mittelwert von den 25% besten Betrieben errechnet<br />
und dieser Wert als Referenzwert festgelegt. Mit der Referenzwertanalyse ist es möglich,<br />
Daten eines speziellen Betriebes in Bezug zu den „Besten“ (Referenzwerte) zu setzen und<br />
so Schwachstellen aufzuzeigen, aber vor allem Leistungsreserven zu mobilisieren. Außerdem<br />
besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Produktionszeiträume nebeneinander mit den<br />
Referenzwerten zu vergleichen. Neben dem vierjährigen Produktionszeitraum werden auch<br />
die Daten des aktuellen Geschehens im letzten Jahr ausgewertet. Die grafische Darstellung<br />
erleichtert hierbei die Auswertung, da die Produktionsdaten des auszuwertenden Betriebes<br />
zusammen mit den Referenzwerten ein anschauliches Bild ergeben, Unterschiede werden<br />
optisch herausgehoben.<br />
Neben den üblichen Produktionskennzahlen des Sauenplaners wird bei der Referenzwertanalyse<br />
Wert auf die Aufschlüsselung der Leistungsinformationen unterschiedlicher Wurfnummern<br />
(Jungsauen, 2. Wurf, 3.-5. Wurf, ab 5. Wurf) gelegt. Auch der Altersstruktur der<br />
Herde wird große Aufmerksamkeit geschenkt.<br />
29
30<br />
Möglichst viele lebende Ferkel pro Sau und Jahr abzusetzen ist das Ziel eines jeden Ferkelerzeugers.<br />
Der Grundstein hierzu wird im Deckzentrum gelegt, denn nur bei einer Besamung<br />
zum ovulationsnahen Zeitpunkt können höchste Befruchtungsraten erzielt werden.<br />
Die Analyse des Deckmanagements ist daher zur Steigerung der Fruchtbarkeit von hoher<br />
Wichtigkeit. Neben der Auswertung der Absatzbelegtage liefern auch die Parameter „Verteilung<br />
lebend geborener Ferkel“ (getrennt zwischen Jungsauen, 2.Wurf und 3.-5. Wurf) Hinweise<br />
auf nicht optimale Besamungszeitpunkte.<br />
Eine sinnvolle Ergänzung der Referenzwertanalyse stellt in diesem Zusammenhang die<br />
Deckmanagementanalyse dar. Durch konsequente Dokumentation von Duldungsbeginn und<br />
–ende durch zweimal tägliche Brunstkontrolle (möglichst zur gleichen Zeit) und der erfolgten<br />
Besamungen können mögliche Schwachpunkte aufgezeigt werden, die bei normaler Betrachtung<br />
nicht bemerkt worden wären.<br />
Anhand der Duldungsdauer wird der theoretische Zeitpunkt der Ovulation ermittelt. Unter<br />
Annahme, dass die Sau am Ende des zweiten Drittels der Duldung ovuliert, werden alle Besamungen,<br />
die 16 vor bis 4 Stunden nach der ermittelten Ovulation durchgeführt worden<br />
sind, als termingerecht bewertet. Die computergestützte Auswertung gibt für jede Sau die so<br />
genannten „Treffer“ im Hinblick auf ovulationsnahe Besamungen an.<br />
Die Interpretation der erhobenen Werte ist nun der Schlüssel, um Fruchtbarkeitsreserven zu<br />
mobilisieren. An einem Bespielbetrieb soll nun verdeutlicht werden, wie die Referenzwertanalyse<br />
Leistungsreserven eines Betriebes offen legen kann.<br />
Betrieb Solms (Name geändert) besamt nicht optimal<br />
Bei Auswertung des Produktions- und Leistungsberichtes des Betriebes Solms zeigt die Anzahl<br />
der im Mittel abgesetzten Ferkel noch Leistungsreserven, v. a. bei den niedrigen Wurfnummern.<br />
Auffällig ist außerdem eine erhöhte Anzahl von Umrauschern.<br />
Die Abbildung „Verteilung lebend geborener Ferkel bei Jungsauen“ (Abb. 1) verdeutlicht,<br />
dass die Gruppen 5-7 Ferkel stärker und 12-14 Ferkel geringer vertreten sind als bei den<br />
Referenzbetrieben. Bei den Wurfstärken 10 und 11 hat sich die Fruchtbarkeitslage im letzten<br />
Jahr um 5-10% gegenüber dem vorherigen Produktionszeitraum verbessert.<br />
Abbildung 1:
Bei den abgesetzten Sauen weicht die „Prozentuale Verteilung, 1. Belegung nach dem Absetzen“<br />
(Abb. 2) stark von den Referenzwerten ab. Mehr als 75% der Sauen werden am Tag<br />
5 belegt, bei den Referenzbetrieben sind es nur ca. 63%.<br />
Abbildung 2:<br />
Abbildung 3:<br />
In Abbildung 3 (Prozentuale Verteilung der Umrauschbelegungen = > 1. Belegung nach dem<br />
Absetzen) ist zu erkennen, dass der Betrieb eine sehr gute Umrauschkontrolle durchführt.<br />
Über 55% aller Umrauscher werden in der nächsten Rausche (18-23 Tage) wieder belegt.<br />
31
32<br />
Damit liegt der Betrieb deutlich höher als die Referenzbetriebe. Der hohe Anteil regelmäßiger<br />
Umrauscher ist allerdings ein Hinweis auf ein nicht optimales Besamungsmanagement.<br />
Offensichtlich wurde ein Teil der Sauen zu früh oder zu spät belegt, die im Zyklus nach drei<br />
Wochen umrauschen.<br />
Aufgrund dieser ausgewerteten Daten ist es sinnvoll, eine Deckmanagementanalyse durchzuführen,<br />
da offensichtlich der optimale Besamungszeitpunkt nicht bei jeder Sau erkannt<br />
wird.<br />
Die Altersstruktur der Herde (Abb. 4) zeigt, dass im letzten Jahr zu wenig Jungsauen remontiert<br />
worden sind. Hier ist darauf zu achten, dass zukünftig zusätzliche Tiere remontiert werden.<br />
Auf die Schlachtsauenselektion ist ein weiteres besonderes Augenmerk zu richten, um<br />
einer Überalterung vorzubeugen bzw. leistungsschwache Altsauen zeitig zu merzen. Insbesondere<br />
Sauen, die ab dem 6. Wurf trotz hoher Lebensleistung einen leistungsschwachen<br />
Wurf haben, müssen zum Schlachten.<br />
Abbildung 4:<br />
Fazit<br />
Mit der Referenzwertanalyse lassen sich die Sauenplanerdaten noch effektiver nutzen. Die<br />
grafische Darstellung der Betriebsdaten neben den Mittelwerten der besten Betriebe heben<br />
die Unterschiede für die wichtigsten Merkmale in der Reproduktionsstatistik heraus. Eine<br />
sinnvolle Ergänzung stellt die Deckmanagementanalyse dar. Für jeden Betrieb ergeben sich<br />
auf dieser Grundlage individuelle Beratungsansätze.
10 Einmalimpfung gegen Mykoplasmen<br />
Als im Sommer <strong>2002</strong> der Einmalimpfstoff „Stellamune One“ von Pfizer auf den Markt kam,<br />
entschieden sich einige Mitgliedsbetriebe des <strong>Erzeugerring</strong>es, anstatt der herkömmlichen<br />
Zweimalimpfung, diesen neuen Impfstoff (nur noch eine Impfung ab der 3. Lebenswoche)<br />
einzusetzen.<br />
In einem geschlossenen Mitgliedsbetrieb des <strong>Erzeugerring</strong>es mit 250 Sauen und anschließender<br />
Mast wurde diese Umstellungsphase vom Ringberater Robert Wenning in der Praxis<br />
genau beobachtet und dokumentiert, um sich ein eigenes Bild über die Mastleistung der<br />
neuen Impfgruppen machen.<br />
Die Auswertung von mittlerweile 500 Mastschweinen spiegelt das hohe Leistungsniveau<br />
wieder: Die Tageszunahmen schwanken zwischen 740 – 760 g und die Verlustrate liegt bei<br />
konstant 2 %. Ein Influenzaschub im November <strong>2002</strong> heilte ohne Medikation aus.<br />
Der Betriebsleiter bleibt weiterhin bei der Einmalimpfung gegen Mykoplasmen. Die Auswertung<br />
ergab, dass im Vergleich zur vorherigen Zweimalimpfung konstante Mastleistungen<br />
erzielt wurden (Wirtschaftsjahr 2001/<strong>2002</strong>: 746 g TZ, 2,2% Verluste), aber der Arbeitsaufwand<br />
und der Impfstress für Mensch und Tier durch die Einmalimpfung wesentlich reduziert<br />
wurde. Hinzu kommt, dass sich dieser wässrige Einmalimpfstoff genau so gut wie die herkömmlichen<br />
Impfstoffe spritzen lässt.<br />
33
34<br />
11 Nach BESTSCHWEIN nun auch BESTFERKEL<br />
Qualitätsfleisch-Erzeugung beginnt im Ferkelerzeugerbetrieb. Von daher ist es nur konsequent,<br />
dass die Charta der „Qualität und Sicherheit GmbH“ ab dem 1. Januar 2004 vorschreibt,<br />
dass alle neu aufgestallten Ferkel die QS-Richtlinien erfüllen.<br />
Vertrag plus 3 Anlagen<br />
Im Vorgriff darauf bietet WESTFLEISCH ab sofort Ferkelerzeugern einen „BESTFERKEL-<br />
Vermarktungsvertrag“ an, in dem<br />
- der Zukauf von Jungsauen<br />
- der Verkauf von Ferkeln bzw. Schlachtschweinen und<br />
- der Verkauf von Schlachtsauen<br />
zukunftsorientiert geregelt sind.<br />
Basis dessen sind die Regularien der „Qualität und Sicherheit für Lebensmittel GmbH“ sowie<br />
die spezifischen Anforderungen des BESTSCHWEIN- Vermarktungsprogramms. Der Vertrag<br />
mit insgesamt 8 Paragraphen kann in den nachfolgenden Jahren von beiden Partnern mit<br />
einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden. Details zum Kauf von Zuchtsauen, zur Vermarktung<br />
von BESTFERKELN und zur Vermarktung von Schlachtsauen sind in den Anlagen<br />
I bis III geregelt, und diese können – den Marktgegebenheiten entsprechend – von WEST-<br />
FLEISCH nach schriftlicher Vorankündigung innerhalb von vier Wochen abgeändert werden.<br />
In diesem Fall hat der Erzeuger das Recht zur außerordentlichen Kündigung.<br />
Für Ferkelerzeuger sind vor allem folgende Regeln und Bedingungen wichtig<br />
Es sollen vorrangig Sauen jener Herkünfte gehalten werden, die von WESTFLEISCH anerkannt<br />
sind. Das sind derzeit Westhybrid, PIC und BHZP. Zukaufsperma wird vorrangig von<br />
Ebern aus der Vorschlagsliste von WESTFLEISCH bezogen. Die Ferkelerzeugung erfolgt<br />
nach „Guter Fachlicher Praxis“, wobei die gesetzlichen Tierhaltungs- und Tierschutzbestimmungen<br />
ebenso wie die Vorschriften der Viehverkehrsverordnung einzuhalten sind. Gefüttert<br />
werden die Tiere bedarfsgerecht mit Futtermitteln von gelisteten Herstellern und Komponenten<br />
gemäß der Positivliste. Und schließlich: die fachtierärztliche Bestandsbetreuung hat auf<br />
Basis eines schriftlichen Betreuungsvertrages zu erfolgen.<br />
Die Einhaltung der „Guten Fachlichen Praxis“ und weiterer QS-Regularien ist durch regelmäßige<br />
Audits einer neutralen Kontrollorganisation per Testat nachzuweisen. Alle Vorgänge<br />
hinsichtlich Futtermittelbezug, Zu- und Verkäufe von Tieren sowie tierärztliche Behandlungen<br />
sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Jeder Ferkel-Lieferung an WESTFLEISCH ist ein<br />
Ferkel-Testat beizufügen. Ab 1. Januar 2004 ist - den QS-Vorschriften entsprechend - auch<br />
in der Ferkelaufzucht auf den Einsatz von antibiotisch wirksamen Leistungsförderern zu verzichten.<br />
Hinsichtlich des vorgeschriebenen Salmonellen-Monitorings gilt zunächst: Erst wenn<br />
bei Kontrollen der Schlachtschweine Auffälligkeiten festgestellt werden, ist auch die Ferkelherkunft<br />
zu untersuchen.<br />
Ganz wichtig: Der Ferkelerzeuger wird mit Abschluss eines BESTFERKEL-<br />
Vermarktungsvertrages Mitglied der WESTFLEISCH eG. Ferkelerzeuger können sich nun<br />
entscheiden, ob sie<br />
1. lediglich den Zukauf der Jungsauen vertraglich regeln; ob sie<br />
2. alle anfallenden BESTFERKEL bzw. alle Schlachtschweine nach BESTSCHWEIN-<br />
Vertrag vermarkten oder ob sie auch<br />
3. alle Schlachtsauen vertraglich geregelt an WESTFLEISCH abgeben.
Die Konditionen des BESTFERKEL-Vermarktungsvertrages an Hand von drei unterschiedlichen<br />
Bestandsgrößen:<br />
Tabelle1:<br />
Bestandsgröße Betrieb A<br />
80 Sauen<br />
1. Nur Zukauf von Jungsauen<br />
2. Verkauf der Ferkel bzw.<br />
Schlachtschweine + Verkauf<br />
der Altsauen<br />
3. Zukauf der Jungsauen +<br />
Verkauf der Altsauen +<br />
Verkauf der Ferkel bzw.<br />
der Schlachtschweine<br />
Betrieb B<br />
200 Sauen<br />
Betrieb C<br />
300 Sauen<br />
Sonderbonus Sonderbonus Sonderbonus<br />
Sonderbonus+<br />
Erstauditprämie<br />
256 €<br />
Sonderbonus<br />
+ Erstauditprämie<br />
+ Vertragsbonus<br />
12 € / Jungsau<br />
24 JS * 12 €<br />
= 288 € + 256 €<br />
gesamt im 1. Jahr 546 €<br />
+ Sonderboni<br />
3-Punkte-Vertragsbonus, sofern ...<br />
Sonderbonus+<br />
Erstauditprämie<br />
256 €<br />
Sonderbonus<br />
+ Erstauditprämie<br />
+ Vertragsbonus<br />
15 € / Jungsau<br />
66 JS * 15 €<br />
= 990 € + 256 €<br />
1.246 €<br />
+ Sonderboni<br />
Sonderbonus+<br />
Erstauditprämie<br />
256 €<br />
35<br />
Sonderbonus<br />
+ Erstauditprämie<br />
+ Vertragsbonus<br />
18 € / Jungsau<br />
100 JS * 18 €<br />
= 1.800 € + 256 €<br />
2.056 €<br />
+ Sonderboni<br />
Unabhängig davon, ob nun Alternative 1, 2 oder 3 bzw. eine beliebige Kombination dieser<br />
Alternativen gewählt wird: WESTFLEISCH verpflichtet sich, alle Zuchttiere entsprechend<br />
auszuliefern und Schlachtsauen sowie Ferkel- und Schlachtschweine abzunehmen und abzurechnen.<br />
Bei positivem Geschäftsverlauf wird je gehandeltem Tier ein Sonderbonus in<br />
Aussicht gestellt, der anteilmäßig dem Geschäftsguthabenkonto gutzuschreiben ist.<br />
Erzeugern, die Ferkel und Schlachtsauen an WESTFLEISCH vermarkten, honoriert WEST-<br />
FLEISCH das erfolgreiche Erst-Audit durch eine neutrale Kontrollorganisation mit einer Prämie<br />
von 256 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Nach Abzug der Audit-Gebühren wird der Differenzbetrag<br />
dem Geschäftsguthabenkonto gutgeschrieben.<br />
Neben den vereinbarten Rabatten beim Bezug von Jungsauen und Zuschlägen und Boni bei<br />
der Vermarktung von Ferkeln und Altsauen zahlt WESTFLEISCH nach Ablauf des Kalenderjahres<br />
einen weiteren 3-Punkte-Vertragsbonus für die umfassende Form der Zusammenarbeit.<br />
Dieser Bonus wird gezahlt, wenn je gehaltener Stammsau wenigstens 30 % remontiert<br />
wurden und je gelieferter Stammsau mindestens 18 Ferkel angedient oder die entsprechende<br />
Anzahl Schlachtschweine und alle Schlachtsauen auf vertraglicher Basis mit WEST-<br />
FLEISCH vermarktet wurden.<br />
Mitmachen lohnt sich<br />
Dieser 3-Punkte-Vertragsbonus beträgt bei Abnahme von<br />
- bis zu 30 Jungsauen 12 € je Jungsau<br />
- 31 – 75 Jungsauen 15 € je Jungsau<br />
- über 75 Jungsauen 18 € je Jungsau
36<br />
In Tabelle 1 ist für drei Bestandsgrößen beispielhaft aufgeführt, was die drei Vertrags-<br />
Alternativen hinsichtlich Sonderbonus, Erst-Audit-Prämie und Vertragsbonus bedeuten. Die<br />
Höhe der Sonderboni ist selbstverständlich davon abhängig, ob WESTFLEISCH das Geschäftsjahr<br />
mit Gewinn abschließen konnte.<br />
Wichtig ist auch noch dies: Alle Regelungen gelten auch für den Bezug von Jungsauen über<br />
die PIC-WESTFLEISCH Vertriebs GmbH. Die bisherige Preisliste für Zuchtschweine einschließlich<br />
der dort genannten Mengenrabatte gilt selbstverständlich unverändert weiter.<br />
BESTSCHWEIN<br />
Die Abschlüsse der BESTSCHWEIN-Verträge gehen zügig voran, Stand Ende Dezember<br />
<strong>2002</strong> nutzen über 1.200 Betriebe die Vorteile der QS-Vermarktungsverträge von WEST-<br />
FLEISCH. Zusammen sorgen sie für ein Gesamt-Volumen von mehr als 2 Mio. Schlachtschweinen.
12 Salmonellenkontrolle im Schweinebestand<br />
Bereits seit mehreren Jahren wird über Salmonelleninfektionen in<br />
Schweinebeständen diskutiert. Diese sind grundsätzlich auch auf Menschen<br />
übertragbar und spielen daher in der Fleischhygiene eine wesentliche<br />
Rolle. Inzwischen ist der Salmonellenstatus von Schweinen und<br />
Schweinefleisch ein wesentliches Qualitätskriterium geworden, so dass<br />
sich in Zukunft jeder zukunftsorientierte Betrieb mit dem Thema "Salmonellenkontrolle"<br />
beschäftigen muss.<br />
Wie wird der Status eines Bestandes erfasst?<br />
Zur Erfassung des Status von Schweineherden werden am Schlachthof<br />
stichprobenartig Fleischsaftproben genommen und auf Antikörper gegen<br />
verschiedene Salmonellentypen untersucht. Alternativ können auch im Bestand<br />
Blutproben genommen werden, so wie es in allen PIC-Vermehrungs-<br />
und Aufzuchtbetrieben seit Jahren alle 4 Wochen geschieht. Werden in<br />
einer Probe vermehrt Antikörper gegen Salmonellen festgestellt, so wird<br />
das Ergebnis als positiv bezeichnet, denn es ist davon auszugehen, dass<br />
dieses Tier in der letzten Zeit eine Salmonelleninfektion erlitten hat. Die<br />
Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen der jeweils letzten 12 Monate<br />
werden zusammengefasst und jeder Bestand anhand des Anteils Antikörper-positiver Tiere<br />
einer bestimmten Kategorie mit entsprechenden Konsequenzen zugeordnet:<br />
Anteil positiver Tiere Kategorie Maßnahme<br />
unter 20% I Keine<br />
20% bis 40% II Beratung<br />
über 40% III<br />
Beratung + Maßnahmen<br />
zur Reduktion der Salmonellenbelastung<br />
37
38<br />
Konsequentes Hygienemanagement ist wichtig!<br />
Kein Betrieb kann sich wirklich sicher vor der Infektion mit Salmonellen schützen, weil diese<br />
Erreger – anders als viele andere Bakterien und Viren – praktisch überall vorhanden sein<br />
können.<br />
Deswegen ist das realistische Ziel nicht die Freiheit, sondern die Kontrolle im Sinne einer<br />
Keimreduktion im Schweinebestand. Antibiotika sind hier in aller Regel wenig hilfreich, vielmehr<br />
sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, die der Tierhalter schon vorsorglich umsetzen<br />
kann und die alle ein Ziel haben: Den Eintrag von außen in den Stall und die Verschleppung<br />
innerhalb des Bestandes zu vermeiden. Dafür ist die konsequente Einhaltung<br />
bzw. Durchführung allgemeiner Hygienemaßnahmen wichtig, die auch nach der Schweinehaltungshygieneverordnung<br />
vorgeschrieben sind.<br />
Besondere Bedeutung kommt der konsequenten Ratten- und Mäusebekämpfung zu, weil<br />
diese die Erreger von außen in den Bestand und auch innerhalb des Bestandes verschleppen.<br />
Ebenso gehören Hunde, Katzen oder Vögel nicht in den Schweinestall.<br />
Futter einschließlich CCM muss sauber gelagert und vor Schadnagern und Vögeln gesichert<br />
werden. Innerhalb des Bestandes muss jede Gruppe konsequent für sich geführt werden,<br />
Umstallen zwischen den Gruppen darf es nicht geben. Die Buchten sollen sauber und trocken<br />
sein. Regelmäßiges Abschieben der Kotflächen muss überflüssig sein, denn dadurch<br />
werden Krankheitskeime verschleppt. Die konsequente Reinigung nach jeder Verladung oder<br />
Räumung eines Abteils mit anschließender Desinfektion muss zum Standard gehören.<br />
Dabei ist genauestens darauf zu achten, dass kein Schmutz oder Reinigungsnebel direkt<br />
oder über die Zuluft an die Schweine gelangt, denn im aufgewirbelten Kot sind massenhaft<br />
Krankheitserreger vorhanden.<br />
Natürliche Abwehrkräfte stärken!<br />
Besondere Bedeutung hat die Erhaltung der natürlichen Abwehrbereitschaft<br />
der Schweine. So gilt es Stress zu vermeiden,<br />
denn bekanntermaßen führt dieser zu massiver Erregerausscheidung<br />
bereits infizierter Tiere. Das Umstallen bzw. Neugruppieren<br />
ist schon deswegen unbedingt auf ein Mindestmaß<br />
zu begrenzen.
Auch unausgewogene Fütterung kann ein Risiko sein. Insbesondere die Auswahl der Futterkomponenten<br />
und der Zustand des Futters ist von Bedeutung: Hohe Gerstenanteile<br />
sind günstiger zu bewerten als viel Weizen. Grob geschrotete Hofmischungen schneiden<br />
in der Statistik besser ab als pelletierte Fertigfutter. Der Magen stellt mit seinem sauren<br />
Inhalt eine natürliche Barriere für Krankheitserreger dar, die durch die Fütterung unterstützt<br />
werden sollte. So ist bekannt, dass die vorsorgliche Ansäuerung des Futters durch<br />
den Zusatz organischer Säuren in Richtung eines pH-Wertes von 4,5 ein sehr wichtiger<br />
Beitrag zur Salmonellenbekämpfung ist.<br />
In mehreren Ländern wird auch die ‚Fermentierung‘ von Flüssigfutter propagiert, wobei<br />
das Futter bereits mehrere Stunden vor dem Verfüttern angemischt und im Laufe der Zeit<br />
sauer wird. Hiervon ist dringend abzuraten, weil es dabei zum Abbau wichtiger Nährstoffe<br />
und zur Bildung schädlicher Abbauprodukte kommt.<br />
Zu begrüßen sind dagegen neuere Entwicklungen, die eine kontrollierte Fermentation<br />
bestimmter Milchsäurebakterien zum Ziel haben und die dem Futter kurz vor der Verfütterung<br />
zugesetzt werden. Hier kommt es durch die gezielte Besiedlung mit nützlichen<br />
Milchsäurebakterien zu einer Verdrängung schädlicher Krankheitskeime.<br />
Was ist in Problembeständen zu tun?<br />
Werden in einem Bestand hohe Konzentrationen von Salmonellenantikörpern festgestellt, so<br />
muss sich der Betrieb in aller Regel durch einen spezialisierten Tierarzt beraten lassen. Dieser<br />
wird als erstes die Hygienemaßnahmen prüfen und Schwachstellen erkennen. Je nach<br />
Lage des einzelnen Falles sind zusätzliche Untersuchungen und Probennahmen (Kot, Umgebungstupfer,<br />
Haustiere usw.) - vorwiegend zur bakteriologischen Untersuchung – nötig,<br />
um die Eintrags- oder Reinfektionsquellen im Bestand zu erkennen und zu beseitigen. Bei<br />
klinischen Erkrankungen (Fieber, Durchfall) kann eine antibiotische Behandlung erforderlich<br />
sein. Inzwischen wird aber auch sehr erfolgreich Lactulose (Ergänzungsfutter) zur Reduktion<br />
der Salmonellenbelastung eingesetzt. Auch eine Schutzimpfung ist möglich, denn seit Herbst<br />
<strong>2002</strong> ist ein Lebendimpfstoff verfügbar.<br />
39
40<br />
13 CCM: Silierverluste vermeiden – Futterhygiene sichern<br />
Nach wie vor ist die Sicherung der aeroben Stabilität, d.h. die Stabilität der Silage unter Lufteinfluß,<br />
und damit die Futterhygiene die zentrale Aufgabe bei der Silierung von CCM. Aufgrund<br />
der schnellen Verfügbarkeit der Nährstoffe, insbesondere der Kohlenhydrate gilt CCM<br />
als besonders anfällig. Doch immer wieder gibt es Probleme mit Nacherwärmung bzw.<br />
Nachgärung der Silagen. Finden diese Umsetzungen statt, sind die Auswirkungen für die<br />
Qualität schwerwiegend: Sie reichen über Nährstoff- und Energieverluste bis hin zur Fütterungsuntauglichkeit<br />
betroffener Silagen.<br />
Ursachen der Nacherwärmung<br />
Die Ursachen der Nacherwärmung sind hinlänglich bekannt. Es sind in erster Linie die Hefen,<br />
die dafür verantwortlich sind. Aber auch Schimmelpilze gewinnen zunehmend als Problemverursacher<br />
an Bedeutung. Sowohl Hefen wie auch Schimmelpilze setzen den Restzucker<br />
und die Milchsäure um. Dabei entsteht Wärme, das äußere Signal ihrer Aktivität. Die<br />
dabei entstehenden Verluste sind enorm. Werden die Hefen erstmal aktiv, sind Nährstoffverluste<br />
von bis zu 20 % und mehr nicht auszuschließen. Darüber hinaus ist CCM mit deutlich<br />
erhöhten Hefegehalten als sehr problematisch für die Fütterung anzusehen. Neben Nährstoffen<br />
und Energie geht auch Trockenmasse verloren. Neben den hohen Verlusten verschlechtert<br />
sich darüber hinaus zunehmend der Hygienestatus des CCM. Betroffene Partien sind in<br />
der Regel als fütterungsuntauglich einzuordnen und müssen großzügig aussortiert werden.<br />
Sorgfalt beim Einsilieren<br />
Hefen und Schimmelpilze überleben während der Lagerung im CCM. Ihre Entwicklung ist<br />
immer an die Gegenwart von Luftsauerstoff gebunden. Bereits kleinste Mengen an Sauerstoff<br />
reichen aus, um ein Wachstum anzuregen. Deshalb muß bereits bei der Einlagerung<br />
des CCM sehr sorgfältig gearbeitet werden. Nachfolgend genannte Silierfehler begünstigen<br />
die Entwicklung dieser Mikroorganismen.<br />
- Der TS – Gehalt des CCM liegt oberhalb der angestrebten 58 – 60 % TS.<br />
- Das CCM wurde nicht ausreichend verdichtet.<br />
- Das Silo wurde nicht sofort oder nur unzureichend abgedeckt.<br />
In diesen Fällen muß während der gesamten Lagerung mit einem sogenannten Luftstreß<br />
gerechnet werden. Auch ein mangelhafter Vorschub in den Sommermonaten fördert die<br />
Entwicklung der Hefen und Schimmelpilze. Das Ausmaß der folgenden Nacherwärmung<br />
hängt dann entscheidend davon ab, wie sorgfältig bei der Einlagerung gearbeitet wurde. Der<br />
mögliche Sauerstoffeintrag in das Silo ist immer vom Grad der Verdichtung, dem Zeitpunkt<br />
und der Art der Abdeckung und der Entnahmestrategie abhängig. Aber auch wenn hier sehr<br />
sorgfältig gearbeitet wurde, bleibt immer ein Restrisiko.<br />
Besonders in den Sommermonaten steigen die Anforderungen an die Stabilität von Silagen.<br />
Nicht immer gelingt es, den nötigen Vorschub von 2 – 3 Metern pro Woche zu erreichen. Da<br />
alle nachträglichen Maßnahmen, z.B. die Anschnittflächenbehandlung mit Propionsäure, nur<br />
begrenzten Erfolg haben, gewinnt der vorbeugende und gezielte Einsatz von Siliermitteln<br />
zunehmend an Bedeutung. Denn neben der Siliertechnik und dem Silagemanagement entscheidet<br />
auch das Vorhandensein von Hemmstoffen (z.B. Essigsäure, Propionsäure) inwieweit<br />
Hefen und Schimmelpilze nach der Auslagerung eine Rolle spielen können.<br />
Richtige Mittelwahl<br />
Um Nacherwärmung sicher zu vermeiden, wird CCM zunehmend bereits bei der Einlagerung<br />
mit speziellen Siliermitteln behandelt. Jedoch muß das richtige Siliermittel ausgewählt wer-
den (Tabelle 1). Nicht jedes auf dem Markt angebotene Produkt ist in der Lage, Nacherwärmung<br />
zuverlässig zu vermeiden. So kann man z.B. nicht davon ausgehen, dass die traditionellen<br />
biologischen Siliermittel auf der Basis sogenannter homofermentativer Milchsäurebakterien<br />
helfen, Hefen und Schimmelpilze zu unterdrücken. Sie können das Gegenteil bewirken<br />
und Nacherwärmung und Verschimmelung sogar noch forcieren.<br />
Auch bei den chemischen Produkten muss unterschieden werden. Während Propionsäure<br />
eine gute Wirkung gegen Schimmelpilze und manche Hefen zeigt, wirkt Ameisensäure vergleichsweise<br />
gut gegen Hefen und Bakterien. Ein Effekt gegen Schimmelpilze ist von ihr jedoch<br />
nicht zu erwarten.<br />
Tabelle 1: Siliermittel für CCM (Beispiele)<br />
Siliermittel<br />
Propionsäure<br />
Lupro – Mix NC<br />
CCM - Stabilizer<br />
Neue Produkte<br />
Zusammensetzung<br />
99 % Propionsäure<br />
38 % Propionsäure<br />
34 % Ameisensäure<br />
Heterofermentative<br />
Milchsäurebakterien<br />
41<br />
Aufwandmenge (je to CCM)<br />
1 - 12 Monate Lagerung: 0,6 %<br />
1 - 6 Monate Lagerung: 0,5 %<br />
6 - 12 Monate Lagerung: 0,7 %<br />
1 - 12 Monate Lagerung: 12 g<br />
Bisher gab es keine Alternativen zum Einsatz von reinen Säuren bzw. sogenannten NC –<br />
Säuren. Seit ca. 2 Jahren wurde die Produktpalette um rein biologische Siliermittel erweitert.<br />
Bei gleicher Wirkungssicherheit ist die Anwendung wesentlich einfacher geworden. Diese<br />
Produkte (z.B. CCM – Stabilizer) sind weder korrosiv noch ätzend. Die Technik wird geschont<br />
und es werden keine besonderen Anforderungen z.B. an die Dosiertechnik gestellt.<br />
Die Wirkung dieser Produkte lässt sich wie folgt beschreiben: Speziell für CCM herausselektierte<br />
sogenannte heterofermentative Milchsäurebakterien unterstützen einerseits die erwünschte<br />
Milchsäuregärung und sind darüber hinaus in der Lage, durch gezielte Stoffumwandlung<br />
verschiedene Hemmstoffe zu bilden.<br />
So entsteht zum Beispiel Essigsäure und Propylenglycol. Von beiden Stoffen ist hinlänglich<br />
bekannt, dass sie Hefen und Schimmelpilze in ihrer Entwicklung hemmen. Um eine ausreichende<br />
Menge an Hemmstoffen bilden zu können, werden sehr große Bakterienmengen je g<br />
CCM benötigt. Die von Grassilagen und Maissilagen bekannten Mindestimpfdichten von<br />
100.000 Bakterien je g Silage reichen hier nicht aus.<br />
Damit darüber hinaus die Siliermittelwirkung voll zum Tragen kommt, gilt das Gleiche, wie<br />
bei allen anderen biologischen Siliermitteln: Silier- und Entnahmetechnik müssen besonders<br />
gut sein. Darüber hinaus muss die für alle Silagen geltende Mindestlagerungszeit von 4<br />
bis 6 Wochen eingehalten werden.<br />
Praxistest bestanden<br />
Inzwischen liegen eine Vielzahl von Praxisergebnissen zu dieser Produktneuheit vor. Ihr<br />
Einsatz hat sich bewährt und kann sich durchaus mit den für CCM bewährten Säuren bzw.<br />
Säuregemischen messen. So konnten z.B. nach Einsatz vom CCM – Stabilizer (Tabelle 2)<br />
während der gesamten Lagerungszeit in den behandelten Silagen weder Hefen noch<br />
Schimmelpilze nachgewiesen werden. Auch bei der Entnahme in den Sommermonaten er-
42<br />
höhten sich die Keimdichten nicht. Der gezielte Einsatz vom CCM – Stabilizer verbesserte<br />
die Lagerstabilität des behandelten CCM und die Futterhygiene war gesichert.<br />
Tabelle 2:<br />
Untersuchungen zur Lagerstabilität von mit CCM – Stabilizer behandeltem CCM<br />
Probenahme<br />
TS<br />
pH-Wert<br />
Hefen<br />
Schimmelpilze<br />
Milchsäurebakterien<br />
Sonstige Bakterien<br />
Einheit<br />
%<br />
kbE / g<br />
kbE / g<br />
kbE / g<br />
kbE / g<br />
08.03.2001<br />
61,4<br />
4,3<br />
< 470<br />
< 20<br />
4,4 x 10 8<br />
< 350<br />
08.06.2001<br />
61,0<br />
4,2<br />
< 120<br />
< 60<br />
2,7 x 10 7<br />
< 800<br />
10.07.2001<br />
60,1<br />
4,3<br />
< 100<br />
< 20<br />
1,2 x 10 8<br />
< 350<br />
kbE / g - kolonienbildende Einheiten pro g CCM<br />
Orientierungswerte für verderbanzeigende Mikroorganismen: Hefen < 100.000 kbe/g; Schimmelpilze <<br />
5.000 kbe/g; Bakterien < 100.000 kbe/g<br />
Fazit<br />
Damit Nacherwärmung und Probleme mit der Futterhygiene nach dem Öffnen des Silos kein<br />
Thema werden, gewinnt der gezielte Einsatz von entsprechenden Siliermitteln in CCM weiter<br />
an Bedeutung. Neben den bewährten Säuren bzw. Säuregemischen befinden sich jetzt auch<br />
biologische Produkte auf dem Markt. Diese vereinfachen die Siliermittelanwendung erheblich.
14 Gruppenhaltung für tragende Sauen<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Seit dem Inkrafttreten des Erlasses zur Haltung von Zuchtschweinen in NRW vom<br />
4.10.<strong>2002</strong> ist für Neubauten die Gruppenhaltung von Sauen vom 2. Tag nach dem Absetzen<br />
bis 7 Tage vor dem Abferkeln Pflicht.<br />
Vorgeschriebene Stallgrundflächen sind :<br />
- ab 150 kg Lebendgewicht 2,5 m² je Tier<br />
- Gruppen < 6 Sauen mit 2,75 m² je Tier (+10%)<br />
- Gruppen > 25 Sauen mit 2,2 m² je Tier<br />
- Gruppen > 40 Sauen mit 2,0 m² je Tier<br />
In der Praxis finden schon viele verschiedene Verfahren Anwendung. Neue Haltungsformen<br />
werden nach den neuen Rahmenbedingungen entwickelt. Nachfolgend sind verschiedene<br />
Verfahren erläutert, die in der Praxis Anwendung gefunden haben.<br />
Ein bewährtes und übersichtliches Haltungssystem sind die Selbstfang-Kastenstände. Die<br />
Übersicht und Kontrollmöglichkeiten sind einfach, sie sind auch für den Einsatz bei Fremd-<br />
Arbeitskräften gut geeignet. Alle Sauenplätze können belegt werden, Reserveplätze brauchen<br />
nicht vorgehalten zu werden. Nachteil ist jedoch, dass der Investitions- und Platzbedarf<br />
durch den erhöhten Materialaufwand um ca. 10 bis 20% höher ist.<br />
Die Nutzung von Altgebäuden ist bei den Selbstfang-Kastenständen nur bedingt möglich.<br />
Selbstfangbesamungsbuchten sind gerade im Deckzentrum sinnvoll, um mehr Ruhe in<br />
den ersten 28 Trächtigkeitstagen zu bekommen. Rangniedrige Tiere haben hierbei die Möglichkeit,<br />
sich zurückzuziehen und so Konflikten auszuweichen.<br />
Die Dribbelfütterung ermöglicht eine gute Übersicht und einfache Tierkontrolle, weil alle<br />
Sauen gleichzeitig fressen können. Das Verfahren eignet sich gut zur Nutzung von Altgebäuden.<br />
Für nicht systemtaugliche Tiere müssen mindestens 15% Reserveplätze vorgehalten<br />
werden. Da eine individuelle Fütterung nicht möglich ist, müssen die Gruppen (6-10 Tiere)<br />
nach Körperkondition und Trächtigkeitsstadium zusammengestallt werden.<br />
Die Flüssigfütterung am Quertrog eignet sich besonders für Betriebe mit vorhandener<br />
Flüssigfütterung. Auch bei diesem System ist die Kontrolle und Betreuung einfach. Durch<br />
unterschiedliches Fressverhalten wachsen die Gruppen stärker auseinander. Deshalb dürfen<br />
maximal 6 Sauen mit ähnlicher Kondition und gleichem Trächtigkeitsstadium je Ventil<br />
gefüttert werden. Weiterhin sind Reserveplätze für gruppenungeeignete Sauen erforderlich.<br />
Der Platzbedarf ist aufgrund der Kleingruppen größer. Bei diesem Verfahren muss besonders<br />
auf gute Futterhygiene geachtet werden.<br />
Ein weiteres Flüssigfütterungssystem mit Einzeltierzuteilung ist die Belados-Station. Pro<br />
Station können 30 Sauen gehalten werden. Der geringe Flächenbedarf und die flexible Altgebäudenutzung<br />
sind die Vorteile dieses Systems. Es erfordert einen höheren Beobachtungs-<br />
und Kontrollaufwand. Die Station wird zur Zeit noch weiterentwickelt, da Tiere leicht<br />
am Trog abgedrängt werden und andere Sauen als vorgesehen das Futter aufnehmen können.<br />
Die niedrigsten Investitionskosten entstehen bei der Sattfütterung am Trockenautomat.<br />
Eine einfache Technik mit geringem Platzbedarf macht eine optimale Platzausnutzung möglich.<br />
Allerdings erhöhen sich die Futterkosten um mehr als 10%. Altsauen werden oftmals<br />
überkonditioniert und jüngere Sauen bekommen aufgrund der geringen Energiedichte des<br />
43
44<br />
Futters zu wenig Nährstoffe. Die Kontrolle bei diesem System ist schwierig und der Kontrollaufwand<br />
hoch.<br />
Der Breinuckel ist ein sehr variables System. Es können sowohl Klein- als auch Großgruppen<br />
gebildet werden. Wie bei allen computergesteuerten Verfahren ist eine Kontrolle der<br />
Technik erforderlich, d.h. die Grundeinstellung muss geprüft werden, das Futter muss ausgelitert<br />
werden, das Fressprotokoll muss überprüft werden, die Chips müssen kontrolliert<br />
werden, die Daten müssen gepflegt werden (Sauen, Futterkurven). Auch das Anlernen von<br />
Sauen an das System erfordert einen erhöhten Zeitaufwand.<br />
Die Abruffütterung ist das einzige System mit der Möglichkeit, Sauen zu selektieren. Die<br />
tierindividuelle Fütterung und die gute Altgebäudeausnutzung sind weitere Vorteile dieses<br />
Verfahrens. Es können 45 bis 55 Tiere je Station gehalten werden. Der Betreuungsaufwand<br />
und auch die Investitionskosten sind höher als in anderen Systemen. Für das Anlernen der<br />
Sauen bei der Abruffütterung ist mit einem erhöhten Zeitaufwand zu rechnen.<br />
Neben den gerade beschriebenen unterschiedlichen Verfahren zur Gruppenhaltung werden<br />
in Zukunft noch weitere Verfahren entwickelt werden.<br />
Als wichtigster Grundsatz gilt, das System auf den Betrieb und den Landwirt anzupassen.<br />
Computerscheue Betriebsleiter sollten technikarme Verfahren wählen. Außerdem muss das<br />
System auf die betrieblichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Vorhandene Systeme sollten<br />
weiter genutzt bzw. ergänzt werden können. Ist beispielsweise vorgesehen, Altgebäude<br />
weiter zu nutzen, muss die Planung darauf Rücksicht nehmen.<br />
Einige Systeme (Flüssigfütterung, Dribbelfütterung, Breiautomat) sind nicht für Wechselgruppen<br />
geeignet. Teilweise müssen die Gruppen geteilt werden, damit die Sauen nach<br />
Kondition und Alter sortiert werden können. Beim Breinuckel und den Abrufstationen dagegen<br />
können stabile Gruppen wie auch Wechselgruppen gehalten werden.<br />
Einige Systeme ermöglichen keine tierindividuelle Fütterung, andere Systeme dagegen gewährleisten<br />
eine gezielte Einzeltierfutterzuteilung.<br />
Bei der Sattfütterung ist zu beachten, dass deutlich höhere variable Kosten durch erhöhten<br />
Futteraufwand entstehen können.<br />
Außer der Haltung der Sauen in Selbstfangkastenständen sind bei allen anderen Verfahren<br />
bis zu 15% Reserveplätze vorzuhalten.<br />
Der Betreuungsaufwand ist je nach Verfahren unterschiedlich hoch und stellt besondere<br />
Anforderungen an die Tierhalter.<br />
Vor einer Entscheidung für ein System ist eine umfangreiche Information über die Weiterentwicklung<br />
und Funktionsfähigkeit der Systeme erforderlich.
15 Neues Tierarzneimittelrecht<br />
Das seit dem 1. November <strong>2002</strong> geltende neue Tierarzneimittelrecht bringt nicht nur für<br />
Tierärzte, sondern insbesondere auch für alle Halter von Lebensmittel liefernden Tieren, d.<br />
h. in der Regel auch für alle Schweinehalter erhebliche Neuerungen, von denen die Wichtigsten<br />
hier dargestellt werden sollen.<br />
Oberster Grundsatz<br />
Der oberste Grundsatz ist, dass nur noch zugelassene Fertigarzneimittel auf der Grundlage<br />
einer ordnungsgemäßen Untersuchung, Diagnosestellung und Indikationsfeststellung vom<br />
Tierarzt abgegeben werden dürfen. Der Einsatz der Arzneimittel muss im Behandlungsbuch<br />
dokumentiert werden. Die Kontrolle des Behandlungserfolges ist sicherzustellen.<br />
Eine Vielzahl von Einzelregelungen<br />
Vorab ist festzuhalten, dass der Halter von Tieren nach dem Tierschutzgesetz die Verpflichtung<br />
hat, kranke Tiere zu behandeln bzw. behandeln zu lassen. Der Einsatz von Arzneimitteln<br />
muss im gesetzlichen Rahmen unter Sicherstellung des Verbraucherschutzes erfolgen.<br />
Grundsätzlich ist bei jedem neuen Erkrankungsfall der Tierarzt hinzuzuziehen, der im Rahmen<br />
einer „ordnungsgemäßen Behandlung“ die notwendigen Untersuchungen durchführt<br />
und dann die Indikation für die Anwendung eines Arzneimittels stellt. Ausnahmen von dieser<br />
grundsätzlichen Erforderlichkeit einer Untersuchung vor Ort sind nur in engem Umfang statthaft.<br />
Sie müssen vom Tierarzt begründet werden und sind nur glaubhaft, wenn der Tierarzt<br />
den Betrieb hervorragend kennt und im besonderen Maße mit ihm und seiner konkreten<br />
Problemstellung vertraut ist. Denkbar wäre eine solche Ausnahme insbesondere für jene<br />
Einzelerkrankungsfälle, die innerhalb der nachfolgenden sieben Tage mit den gleichen<br />
Krankheitssymptomen bei weiteren Tieren auftreten und bei denen eine Soforttherapie medizinisch<br />
notwendig ist (Beispiel: MMA-Erkrankung der Sau). Der Behandlungserfolg ist in<br />
jedem Fall spätestens nach sieben Tagen zu kontrollieren. Es bleibt also festzuhalten, dass<br />
eine Arzneimittelabgabe ohne klinische Erstdiagnose durch den Tierarzt arzneimittelrechtlich<br />
nicht erlaubt ist.<br />
Die Abgabe von Arzneimitteln ist zum Teil zeitlich und mengenmäßig erheblich begrenzt<br />
worden mit dem Ziel, eine Vorratshaltung von Arzneimitteln in den Schweine haltenden Betrieben<br />
zu unterbinden: so gilt für die Abgabe von Tierarzneimitteln für die Anwendung bei<br />
Lebensmittel liefernden Tieren in der Regel eine zeitliche Begrenzung auf maximal sieben<br />
Tage, d.h. die Abgabe von z. B. Antibiotika ist auf eine Menge begrenzt, die für eine Behandlung<br />
notwendig ist, jedoch für nicht mehr als sieben Tage. Nur wenn die Zulassungsbedingungen<br />
eines Antibiotikums eine längere Anwendungsdauer vorsehen und letzteres aus<br />
medizinischer Sicht notwendig erscheint, kann das Antibiotikum für eine längere Anwendungsdauer<br />
vom Tierarzt abgegeben werden. Ist das Behandlungsziel nach sieben Tagen<br />
nicht erreicht, kann der Tierarzt nach der Kontrolle des Behandlungserfolges eine Fortsetzung<br />
der Medikamentierung im medizinisch erforderlichen Umfang wiederum für max. sieben<br />
Tage vornehmen.<br />
Andere Fertigarzneimittel (nicht Antibiotika mit systemischer Wirkung) sowie ausschließlich<br />
lokal eingesetzte und lokal wirkende Antibiotika (z. B. Wundpuder, intrauterine = in die Gebärmutter/<br />
intramammäre = in das Gesäuge eingebrachte AB-Gaben) dürfen - soweit medizinisch<br />
zur Erreichung des Behandlungszieles erforderlich - bis max. 31 Tage dann abgegeben<br />
werden, wenn der Bestand im Rahmen einer Bestandsbetreuung mindestens einmal<br />
monatlich vom Tierarzt begutachtet wird. Bei der im Rahmen der Begutachtung durchzuführenden<br />
Untersuchung muss die Indikation festgestellt und eine schriftliche Dokumentation<br />
erfolgen.<br />
45
46<br />
Erfolgt keine Bestandsbetreuung mit monatlicher Begutachtung, dürfen auch diese Arzneimittel<br />
nur für einen Bedarf von max. sieben Tagen abgegeben werden.<br />
Restmengen von Arzneimitteln (angebrochene und nicht angebrochene Flaschen/Packungen)<br />
dürfen nach Abschluss einer Behandlung im landwirtschaftlichen Betrieb<br />
verbleiben und sollten ordnungsgemäß (kühl, frostfrei, dunkel, sauber etc.) gelagert werden.<br />
Sie können bei späteren Tiererkrankungen verbraucht werden, aber nur, wenn wiederum<br />
zuvor die Konsultation des Tierarztes vorgenommen worden ist. Arzneimittel, deren Verfallsdatum<br />
abgelaufen ist oder bei denen Qualitätsmängel (Verschmutzung, Ausflockung, Trübung<br />
/ Verfärbung etc.) festgestellt werden können, sind fachgerecht zu entsorgen. Dieses<br />
kann z. B. über öffentliche Apotheken oder über die tierärztlichen Hausapotheken erfolgen.<br />
Arzneimittelvormischungen (AMV) zum Einmischen in die hofeigene Futtermischanlage<br />
können vom Tierarzt nicht mehr direkt bezogen werden (= Abgabeverbot). Ersatzweise gibt<br />
es für die Versorgung erkrankter Tiere über den Trog bzw. über die Tränke die sogenannten<br />
„Arzneimittel-(Pulver) zur oralen Verabreichung“ als Fertigarzneimittel im Handel und können<br />
vom Tierarzt bezogen werden. Auch diese dürfen nur nach tierärztlicher Konsultation (wie<br />
oben zuvor beschrieben) zum Einsatz kommen. Diese Arzneimittel mit der Zulassung zur<br />
oralen Anwendung können per „Top - dressing“ löffelweise über das Futter gegeben werden<br />
oder in größeren Tiergruppen besser über die landwirtschaftliche Futtermischanlage homogen<br />
eingemischt zum Einsatz kommen. Es muss sichergestellt sein, dass die zu behandelnden<br />
Tiere die vom Tierarzt verordnete Dosis auch tatsächlich erhalten. Wichtig ist außerdem,<br />
dass nur die Tiere Arzneimittel erhalten, bei denen der Tierarzt die Behandlung angeordnet<br />
hat. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass nach dem Einmischen über die Futtermischanlage<br />
die Behältnisse und Rohrleitungen von den Arzneimittelwirkstoffen soweit gereinigt<br />
werden, dass ein Verschleppungsrisiko von Arzneimittelrückständen nahezu ausgeschlossen<br />
werden kann.<br />
Eisenpräparate für ungeborene Ferkel dürfen im Voraus abgegeben werden. § 12 Abs. 5<br />
der Verordnung über tierärztliche Hausapotheken sieht vor, dass von dem Abgabeverbot für<br />
noch nicht geborene Tiere abgewichen werden kann, sofern die Anwendung bei den neugeborenen<br />
Tieren innerhalb der ersten Lebenswoche notwendig ist. Bei verschreibungspflichtigen<br />
Eisenpräparaten mit Wartezeit ist die Abgabe im Rahmen der neuen 7-/31-<br />
Tageregelung möglich. Bei den verschreibungspflichtigen Eisenpräparaten ohne Wartezeit<br />
liegt die Verantwortung über den Zeitraum, für den das Eisenpräparat abgeben werden darf,<br />
im Einzelfall beim Tierarzt. Eisenpräparate, die lediglich apothekenpflichtig sind, können ohne<br />
Fristenbeschränkung abgegeben werden.<br />
Arzneimittel für zootechnische Maßnahmen (z. B. Hormonpräparate zur Brunstsynchronisation<br />
bei gesunden Tieren) dürfen vom Tierarzt nur abgegeben werden, wenn er zuvor eine<br />
Notwendigkeit (Indikation) festgestellt hat. Dabei hat er auch zu prüfen, ob evtl. Gegenanzeigen<br />
für den Einsatz dieser Präparate vorliegen.<br />
Jede Arzneimittelanwendung beim Lebensmittel liefernden Tier muss dokumentiert werden<br />
im sog. Behandlungsbuch. Für diesen Zweck kann das vom <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> und<br />
GFS entwickelte, in DIN A5 Größe gebundene Behandlungsbuch hervorragend genutzt<br />
werden. Die erfolgten Behandlungen müssen mit der Unterschrift des Behandelnden abgezeichnet<br />
sein und einen gesicherten, nachvollziehbaren Überblick über den Einsatz der mittels<br />
Abgabebeleg erhaltenen Tierarzneimittel bieten.
16 Abluftreinigung – Technik der Zukunft<br />
Angesichts des BImSchG (Bundesimmissions-Schutzgesetz) und der Neufassung der TA-<br />
Luft (technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) tritt der Schutz der Umwelt in allen Bereichen<br />
in den Vordergrund. Bedingt durch das Artikelgesetz fallen zum jetzigen Zeitpunkt<br />
deutlich mehr Betriebe unter das BImSchG als das noch vor zwei Jahren war. Vor allem die<br />
50 GV und 2 GV/ha (2,49 GV/ha) Regelung sorgt dafür, dass auch verhältnismäßig kleine<br />
Betriebe mit nur wenigen Tieren unter diese Regelungen fallen. Vor allem werden heute<br />
auch die Rindviehbestände mit in die Beurteilung einbezogen, was früher nicht der Fall war.<br />
Den besonderen Schutz verdienen nach heutiger Beurteilung sowohl Wohngebiete als auch<br />
Naherholungsgebiete und besondere Ökosysteme und schützenswerte Pflanzen. Spricht<br />
man von Schutz, so geht es vorrangig um den Schutz vor Geruch, vor Staub und vor Ammoniak,<br />
die alle drei in der Stallluft enthalten sind und über die Abluft in die Umwelt befördert<br />
werden. Diese Stoffklassen sind sehr unterschiedlich zu beurteilen.<br />
Ammoniak (NH3) ist ein Gas, das beim Abbau organischer Substanz entsteht. Es ist im<br />
Stall immer vorhanden, darf aber nur mit einer Konzentration von 20 ppm im Stall vorkommen<br />
(Grenzwert der Schweinehaltungsverordnung).<br />
Staub besteht aus kleinsten Partikeln, die in der Luft schweben und ist in der Natur in nahezu<br />
jeder Luft vorhanden. In der Stallluft besteht er im wesentlichen aus Futterresten, Hautschuppen,<br />
der Vorbelastung der Frischluft und z.B. aus Einstreu.<br />
Geruch entsteht im wesentlichen aus Geruchsmolekülen, die vom Kot, den Tieren und dem<br />
Futter abgegeben werden. Beim Geruch stellt sich immer die Frage, wie unangenehm oder<br />
angenehm ist der Geruch. Nur ein für die Nase unangenehmer Geruch wird als Belästigung<br />
empfunden. So nimmt man den Geruch von Blumen oder frischem Heu positiv und den Geruch<br />
von Exkrementen negativ wahr.<br />
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass immer mehr Genehmigungen für Schweineställe<br />
mit Auflagen belegt werden. Eine der häufigsten Forderungen ist dabei die Ausrüstung<br />
des Stalles mit einer Abluftreinigungsanlage.<br />
Doch Abluftreinigung ist nicht gleich Abluftreinigung. Es gibt verschiedene Techniken zur<br />
Reinigung, die hier kurz vorgestellt werden sollen.<br />
Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen der chemischen, der physikalischen und<br />
der biologischen Reinigung.<br />
Biofilter<br />
Biofilter werden schon seit mehreren Jahren in Tierhaltungsanlagen eingebaut. Der Biofilter<br />
beruht auf dem Abbau der Abluftinhaltsstoffe mit Hilfe von Mikroorganismen. Hauptziel eines<br />
Biofilters ist es, die Abluft von Gerüchen zu befreien.<br />
Als Materialien für einen Biofilter eignen sich z.b. Rindenmulch, Wurzelholz, Reisig oder<br />
auch Kompost. Bei der Auswahl der Materialien ist zu beachten, dass feinere Materialien<br />
den Strömungswiderstand drastisch erhöhen können. In der Praxis wird deshalb in aller Regel<br />
ein Mix aus feinen und gröberen Anteilen gewählt, um einen erträglichen Strömungswiderstand<br />
zu erhalten. Der Aufbau eines klassischen Biofilters kann man der Abbildung 1 entnehmen.<br />
Das verwendete Material hat eine Haltbarkeit von 5-10 Jahren. Wichtig für die Arbeit<br />
der Mikroorganismen ist, dass diese nicht austrocknen. Deshalb ist eine Befeuchtung<br />
der Anlage von großer Bedeutung. Gleichzeitig sollte die Luft, die in den Filter einströmt,<br />
schon staubarm sein, damit sich der Filter nicht so schnell zusetzen kann. Eine Vorbehandlung<br />
der Abluft mit z.B. einer Sprühbefeuchtung ist deshalb sinnvoll. Dimensioniert wird der<br />
Filter als Flachbettfilter mit einer Fläche von 2-4 m²/Mastplatz.<br />
47
48<br />
Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Biofilters<br />
Abluftwäscher<br />
Ein ganz anderes Verfahren stellt die Abluftreinigung per Wäscher dar. Die Abluftwäscher<br />
können drei Aufgaben erfüllen. Sie können Ammoniak aus der Luft heraus waschen und sie<br />
entstauben und befeuchten. Bei der chemischen Abluftreinigung wird durch den Einsatz von<br />
Schwefelsäure das Ammoniak durch die Säure als Ammoniumsulfat gebunden.<br />
Abbildung 2: Abluftwäscher Systemskizze (Lais 1996)<br />
Der Abluftwäscher kann sehr hohe Ammoniakminderungen und gleichzeitig eine gute<br />
Staubminderung erreichen, doch bei der Geruchsminderung ist die Leistung der Abluftwäscher<br />
nicht gut.<br />
Kombinationsverfahren<br />
Neben diesen speziellen Reinigern, die nicht in allen Teilbereichen eine gute Leistung bringen<br />
können, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in mehrstufigen Verfahren verschiedene
Systeme zu kombinieren. Zweistufige Verfahren bestehen vielfach aus einem chemischen<br />
Abluftwäscher und einem Biofilter. Damit lassen sich 90 % des Ammoniaks und mehr als 70<br />
% des Staubs binden. Bei den Gerüchen findet dabei zwar eine Minderung ein, doch ist diese<br />
nicht so hoch. Bei den dreistufigen Verfahren, die aus einem Wasserwäscher, einem<br />
chemischen Wäscher und einem Biofilter bestehen, werden Ammoniak und Staub zu 90 %<br />
gebunden und ebenso ist mit einer guten Geruchsbindung zu rechnen.<br />
Abbildung 3: 3-stufiger Reiniger (Schematischer Aufbau, Schier 2003)<br />
Kosten<br />
Bei der Installation einer Abluftreinigung für den Stall ist mit hohen Kosten zu rechnen. Die<br />
Investitionskosten richten sich dabei nach dem Luftvolumen, das gefiltert werden muss und<br />
den Luftanteilen, die heraus gefiltert werden müssen. Neben den Investitionskosten kommen<br />
mehr oder weniger hohe Kosten für den laufenden Betrieb hinzu. Das sind z.B. Kosten für<br />
Strom und Wasser oder auch Kosten für die Schwefelsäure bei den chemischen Wäschern.<br />
Die Kosten hängen stark von der Größe der Anlage ab. Generell gilt aber, dass größere Anlagen<br />
in der Relation zum Mastplatz preiswerter sind.<br />
Bei den Kostenberechnungen gibt es aber zur Zeit drei Seiten. Institutionen, die solche Anlagen<br />
projektieren oder deren Bau fördern, rechnen eine Abluftreinigungsanlage eher schön.<br />
Gegner der Abluftreinigung rechnen diese Technik in der Regel so, dass sie absolut unwirtschaftlich<br />
ist. Je nach Technik sind aber Kosten von 6-8 € pro Mastschwein (nicht pro Platz)<br />
durchaus realistisch, wenn man sowohl für den Bau der Abluftreinigungsanlage alle Zusatzkosten<br />
rechnet und vor allem die laufenden Kosten genau erfasst. Schon allein die zusätzlichen<br />
Energiekosten der Ventilatoren und Pumpen können bis zu 2 € pro Schwein betragen.<br />
Fazit<br />
Zusammenfassend muss man sagen, dass es zwar auf dem Markt durchaus Techniken gibt,<br />
die sowohl beim Geruch, beim Staub als auch bei der Minderung der Ammoniakemissionen<br />
mit guten Wirkungsgraden aufwarten können. Die Wirtschaftlichkeit dieser Reinigungsmög-<br />
49
50<br />
lichkeiten ist aber vor allem in der Schweinemast zum heutigen Zeitpunkt kaum gegeben.<br />
Aus diesem Grund wäre es falsch, die Abluftreinigung als Stand der Technik zu bezeichnen.<br />
Es mag vereinzelt Gründe geben, eine solche Technik zu akzeptieren, um eine Genehmigung<br />
für einen Neubau zu erhalten. Das Ziel, alle Stallungen mit einer solch kostenintensiven<br />
Technik auszurüsten darf auf keinen Fall verfolgt werden, weil das die wirtschaftliche<br />
Situation in der Schweinehaltung kaum zulässt.
17 Gemeinsam zum Betriebserfolg<br />
In der schnelllebigen Zeit mit dem starken Strukturwandel und dem ständigen Wachstum<br />
wird es für viele Betriebe schwierig, den Anforderungen noch gerecht zu werden. Deshalb ist<br />
die gute Zusammenarbeit und das offene Verständnis untereinander für die zwei Generationen<br />
auf einem Betrieb eine wichtige Voraussetzung.<br />
Der Familienbetrieb Wißling in Beckum ist ein Beispiel, wo durch eine gute Zusammenarbeit<br />
von zwei Generationen in den letzten 10 Jahren die Betriebsentwicklung entscheidend mit<br />
beeinflusst wurde!<br />
Ist-Situation<br />
Vor 10 Jahren wurden im Betrieb Alfons Wißling 85 Sauen im geschlossenen System mit<br />
500 Mastplätzen gehalten. Nachdem der Sohn Egbert Wißling seine Ausbildung als staatlich<br />
geprüfter Landwirt erfolgreich beendet hatte und ein Praktikum in Frankreich absolvierte,<br />
stieg er in den elterlichen Betrieb ein.<br />
Gemeinsam wurden die Möglichkeiten der Betriebsentwicklung diskutiert und kalkuliert. Im<br />
Jahr 1995 wurde ein Betrieb mit 400 Ferkelaufzuchtplätzen und 420 Mastplätzen und der<br />
dazugehörigen Fläche gepachtet. Nach der Renovierung des Maststalles wurde eine Flüssigfütterung<br />
installiert. Die Flatdeckplätze wurden repariert und zum Teil zur Großgruppenhaltung<br />
umfunktioniert. Da die eigene Sauenhaltung noch nicht genügend Ferkel zur Kapazitätsauslastung<br />
brachten, wurden über den Handel Absatzferkel mit 6-8 kg zugekauft.<br />
Die Mastschweinehaltung wurde durch eine neue und damit einer verbesserten Fütterung<br />
optimiert. Durch die Phasenfütterung und eine bessere Futterhygiene konnte die Leistung<br />
der Tiere und somit die Wirtschaftlichkeit der Schweinemast gesteigert werden.<br />
Die Sauenherde aufstocken<br />
Da sich der Bezug von Absatzferkeln schwieriger gestaltete, die Ferkelqualitäten und der<br />
Immunstatus der Tiere schlechter wurde, entschlossen sich Vater und Sohn zur Aufstockung<br />
der Sauenherde.<br />
Der Anbau eines neuen Abferkelstalles mit Deckzentrum im Jahr 1997 führte zur Aufstockung<br />
der Sauenherde auf knapp 180 Sauen.<br />
Die Abferkelabteile wurden mit Ferkelnestern, die über die Hauswasserheizung beheizt werden,<br />
gebaut. Das Deckzentrum wurde nach dem derzeitig neuesten Stand der Technik mit<br />
großen Fensterflächen und einer Lichtleiste über den Besamungskastenständen errichtet.<br />
Die Bewegungsfläche des Ebers vor den Kastenständen führt zu einem intensiven Kontakt<br />
mit den Sauen und somit zu einer guten Rauschestimulierung.<br />
Im Hinblick auf die neue Haltungsverordnung für Sauen, die mehr Freilauf vorsieht, entschloss<br />
sich die Familie Wißling zum Umbau des alten Deckzentrums. Es wurde eine Gruppenhaltung<br />
für tragende Sauen mit der Belladosfütterung erstellt. Diese wurde an die schon<br />
vorhandene Flüssigfütterung gekoppelt, um auch das CCM einsetzen zu können.<br />
Nach ersten Anfangsschwierigkeiten mit der Technik funktioniert diese jetzt fast störungsfrei.<br />
Nicht zufriedenstellend ist das Verhalten der Sauen während der Fütterung. Der Kampf der<br />
Sauen untereinander ist immer wieder zu erkennen und führt dazu, dass die Kondition der<br />
Sauen unterschiedlicher wird. Um den optimalen Futterzustand der Sauenherde erhalten zu<br />
können, sind häufiger Sauen aus dem System auszugliedern und in einen Kastenstand umzubuchten.<br />
51
52<br />
Die Ferkelaufzucht modernisieren<br />
Im Jahr Frühjahr <strong>2002</strong> wurde der neue Ferkelaufzuchtstall mit 8 Abteilen mit je 150 Plätzen<br />
und einem Krankenabteil / Resteabteil fertiggestellt. Die Großgruppen mit der sensorgesteuerten<br />
Fütterung der Firma Schauer und der verbesserten Klimaführung gegenüber dem alten<br />
Stall zeigt schon zu Anfang eine Verbesserung der Leistung und der Gesundheit der Ferkel.<br />
Anschließend wurde der alte Flatdeckstall zu Abferkelbuchten umgebaut, um die Anzahl der<br />
Abferkelplätze für die jetzt auf 300 Sauen gestiegene Herdengröße anzupassen.<br />
Die alten jetzt freigewordenen Flatdeckplätze im Pachtstall wurden mit wenig Baukosten zu<br />
Mast- und Resteplätzen umgebaut.<br />
Durch die Belastung während der verschiedenen Bauphasen konnte die überdurchschnittliche<br />
biologische Leistung nicht so gesteigert werden, wie man es sich gewünscht hätte. Denn<br />
alle Baumaßnahmen wurden durch Eigenleistungen unterstützt, die dann von der Betreuungszeit<br />
der Tiere abgezweigt werden musste.<br />
Weiterhin sind auch die Tiere des Betriebes Wißling nicht von den Erkrankungen wie Mycoplasmen,<br />
PRRS und Circovirus verschont geblieben. Diese haben die Leistungen und die<br />
Wirtschaftlichkeit der Schweinehaltung belastet. Auch die erhebliche Aufstockung in einem<br />
kurzen Zeitraum zeigte Immunitätsschwächen bei der gesamten Herde.<br />
Hohe Arbeitsbelastung<br />
Durch das Impfen der Sauen und Ferkel gegen PRRS und Mycoplasmen konnte die Immunität<br />
der Herde und die Ferkelqualität verbessert werden.<br />
Die höheren Arbeitszeiten durch die jetzt erreichte Betriebsgröße wird durch Vater und Sohn,<br />
einen Auszubildenden und andere Aushilfskräfte bewältigt.<br />
Die größere Gruppenhaltung und der 14 Tage - Rhythmus führen zu einem rationelleren Arbeitsablauf.<br />
Dadurch wird Zeit eingespart. Mittlerweile sind alle Stallabteilungen mit auto -<br />
matischen Fütterungsanlagen ausgestattet, So wird für die Fütterung der Tiere weniger Zeit<br />
benötigt.<br />
Damit der Arbeitsablauf auch funktioniert, bedarf es einer guten Koordination und Absprache<br />
untereinander und Verständnis miteinander. Die Ereignisse des Tages und/oder die Aufgabenverteilung<br />
werden während oder nach den gemeinsamen Mahlzeiten besprochen und<br />
festgelegt.<br />
Bild: Herr Egbert Wißling (links) mit Berater Werner Winkelkötter
Ziele für 2003<br />
Als Ziel für das Jahr 2003 hat sich der Betrieb jetzt eine Leistungssteigerung der Sauenherde<br />
sowohl in der Ferkelaufzucht als auch in der Mast gesetzt. Durch die bessere Betreuung<br />
der Tiere und die schnellere Erkennung von Problemen hofft man, diese Ziele möglichst bald<br />
zu erreichen. Einen Vorteil der großen Sauenherde und der Gruppenhaltung im 14 Tage -<br />
Rhythmus bietet das Verkaufen von großen Ferkelpartien. Sie sind (auch im Direktverkehr)<br />
besser zu vermarkten und verbessern durch höhere Aufschläge die Wirtschaftlichkeit der<br />
Sauenhaltung.<br />
Es ist zu hoffen, dass die Vitalität und die Gesundheit der Tiere nicht durch neue Krankheitseinbrüche<br />
Rückschläge erleidet.<br />
Ebenso wichtig ist es auch, dass die Gesundheit und die Zusammenarbeit im Familienbetrieb<br />
erhalten bleibt.<br />
53
54<br />
18 Fütterung von Ferkeln und Mastschweinen unter dem<br />
Einfluß verschiedener Viruserkrankungen<br />
Ziel eines jeden Landwirtes bzw. Ferkelaufzüchters und Schweinemästers ist das Erreichen<br />
einer hohen Lebenstageszunahme nach dem Absetzen bei gleichzeitig hohem Gesundheitsstatus<br />
der Tiere. In der letzten Zeit wird das Erreichen dieser Ziele durch zwei Gegebenheiten<br />
erschwert:<br />
• der Verzicht eventl. das Verbot der antibiotischen Leistungsförderer im Futter,<br />
• das Auftreten von neuen viralen Erkrankungen.<br />
Ernährungswissenschaftler, sowohl in der Human-, wie auch in der Tiermedizin, denken über<br />
Ansätze in der Ernährung zur Steigerung der Immunität nach.<br />
Bei den Ferkeln bietet sich besonders die Phase der Ferkelaufzucht für eine Aktivierung der<br />
Stoffwechsel- und Immunitätslage an. Vielen Ferkelaufzüchtern sind sowohl Coli- und Streptokokken-,<br />
wie auch PRRS- und CIRCO-Erkrankungen bekannt. Auf der anderen Seite sind<br />
gute Leistungen in der Ferkelaufzucht Voraussetzung für die Produktion guter Mastferkel<br />
(siehe Abb. 1):<br />
Abb. 1<br />
180<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Beziehung zwischen der täglichen Zunahme in der 1. Woche<br />
nach dem Absetzen und dem Alter bei Schlachtung<br />
Tage<br />
< 0 0 bis 110 > 110<br />
g tgl. Zunahme in der 1. Woche nach dem Absetzen<br />
University of Georgia, 1990<br />
In der ersten Woche nach dem Absetzen ist die Futteraufnahme der Ferkel (in Abhängigkeit<br />
von der Klimagestaltung) häufig zu gering. Sieht man sich die Abbildung 2 auf der folgenden<br />
Seite über die Entwicklung von Verdauungsenzymen an, so bilden die Ferkel am 5./6. Tag<br />
nach dem Absetzen aufgrund einer geringen Futteraufnahme in den ersten Tagen nur noch<br />
sehr wenig Enzyme. Hier besteht also ein deutliches Missverhältnis zwischen einer langsam<br />
steigenden Futteraufnahme und der in der ersten Woche reduzierten Enzymproduktion.
Abb. 2<br />
Um diese Differenz möglichst klein zu halten, sollten die Ferkel nach dem Absetzen in einen<br />
gut vorgewärmten Aufzuchtstall kommen. Wenn die Ferkel in einer Ecke liegen und frieren,<br />
fressen sie wesentlich später, als wenn ihnen so warm ist, dass sie gleich mit dem Spielen<br />
und der Futter- und Wasseraufnahme beginnen. Mit einer Fußbodenheizung sollte die<br />
Raumtemperatur daher mindestens 28°C beim Einstallen betragen, ohne Fußbodenheizung<br />
ist sie hingegen auf 30°-31°C zu erhöhen. Viele Betriebe, die mit 24-28°C beim Einstallen<br />
ohne Fußbodenheizung fahren, haben Probleme mit schlechtem Wachstum bzw. Verlusten<br />
oder mit Durchfall in der ersten Woche nach dem Absetzen. Durch eine Temperaturerhöhung<br />
konnte häufig eine Verbesserung der Situation erreicht werden.<br />
Abb. 3<br />
Trypsinaktivität<br />
Entwicklung der Verdauungsenzyme und Einfluß des Absetzens<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Trypsin<br />
Amylase<br />
Lipase<br />
Absetzen<br />
0 1 2 3 4 5 6<br />
Alter (Wochen)<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Lipase<br />
Amylase<br />
Trypsin<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
(x1000) Lipase / Amylaseaktivität<br />
Lindemann et al. (1986)<br />
Enzymproduktion beim Ferkel schnell in Gang bringen<br />
alt bekannt:<br />
- Absetzzeit haben einen großen Einfluß<br />
- Futterzusammensetzung auf die Enzymaktivität<br />
neu (Makking, 1993):<br />
Drei Tage nach dem Absetzen hängt die Menge des gebildeten Enzyms Trypsin von<br />
der Eiweißquelle ab.<br />
Magermilchpulver hohe Enzymaktivität im Dünndarm<br />
Fischmehl?! geringe Trypsinaktivität, hohe Chymotrypsinaktivität<br />
aber:<br />
Futteraufnahme hatte einen noch größeren Effekt auf die Enzymaktivität als die<br />
Eiweißquelle.<br />
55
56<br />
In der ersten Woche nach dem Absetzen sollte die Anfütterung in möglichst vielen Einzelgaben<br />
bei gleichzeitiger Kontrolle der Wasseraufnahme erfolgen, um die Ferkel zu aktivieren<br />
(auch die Ferkel werden beim Säugen von der Mutter gerufen). Wie die Abbildung 3 zeigt,<br />
hängt nach Untersuchungen von Makking (1993) die Enzymbildung bei den Ferkeln in der<br />
ersten Woche nach dem Absetzen entscheidend von der Futteraufnahme ab.<br />
In der ersten Phase entscheidet die Schmackhaftigkeit des Futters, sowie das häufige Futterangebot,<br />
aber auch die Verdaulichkeit des Futters über den Erfolg in der gesamten Ferkelaufzucht.<br />
Je mehr Futter die Ferkel in den ersten Tagen aufnehmen, desto höher ist die<br />
Enzymausschüttung aus dem Magen- und Darmkanal. Verhindert bzw. reduziert man den<br />
Abfall der Enzymaktivität in den ersten Tagen, so fließt auch nicht so viel unverdauter Darminhalt<br />
in den hinteren Verdauungsabschnitt ab, so dass den Coli-Keimen weniger Angriffsmöglichkeiten<br />
geboten werden. Bei hoher Futteraufnahme haben die Milchsäurebakterien<br />
hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Die dabei entstehende Milchsäure wirkt hemmend<br />
auf eine überschießende Coli-Keim-Entwicklung. Um dieses Wachstum der Milchsäurebakterien<br />
zu forcieren, empfiehlt es sich, mit Zuckergehalten von 8-10 % aus Dextrose und<br />
Molkenpulver zu fahren. Diese Gehalte führen auch zu einer hohen Schmackhaftigkeit und<br />
Verdaulichkeit des Futters, bieten aber auch durchfallerregenden Coli-Keimen hervorragende<br />
Entwicklungsmöglichkeiten. Hier muss durch den Einsatz guter Fettquellen in ausreichender<br />
Höhe, stabilisierender Eiweißquellen, geringer Mengen an Hefen und von Stoffen<br />
aus dem Zusatzstoffbereich gegenreguliert werden.<br />
Um besonders die Situation am 5./6. Tag nach dem Absetzen zu entschärfen, empfiehlt sich<br />
hier eventuell der Einsatz bestimmter Zusatzstoffe (z.B. Kombination freier und geschützter<br />
Säuren), da der 5./6. Tag nach dem Absetzen typisch für einen auftretenden Coli-Durchfall<br />
ist.<br />
In den ersten 10 Tagen nach dem Absetzen ist der Einsatz guter Fettquellen im Ferkelfutter<br />
zu begrüßen, da das Enzymsystem der Ferkel gut auf die Fettverdauung ausgerichtet ist<br />
(vgl. Abb. 2). Außerdem ist das Fett in der Lage, regulierend auf eine zu starke Entwicklung<br />
der Bakterienflora einzuwirken. Rohfettgehalte von bis zu 10% können bei guter Fettqualität<br />
in den ersten 10 Tagen nach dem Absetzen von den Ferkeln gut verwertet und verdaut werden.<br />
Hoch verdauliche Eiweißquellen mit einem für Ferkel optimalen Aminogramm (Kartoffelprotein,<br />
Molkenprotein) stärken einerseits die Immunabwehr der Ferkel und wirken andererseits<br />
positiv auf die Enzymbildung der Ferkel.<br />
Laufen die ersten 10 Tage nach dem Absetzen problemlos ab, so entwickeln sich die Ferkel<br />
in der Regel bei guter Qualität des Ferkelfutters bis ca. 12 kg erfolgreich weiter. In dieser<br />
Phase ist noch der Einsatz hoch verdaulicher Eiweißquellen zu fordern (Kartoffelprotein,<br />
Molkenprotein). Man sollte nicht über 10-12% Sojaschrot in der Ration kommen, da dem<br />
Sojaschrot allergene Substanzen nachgesagt werden, die in dieser Phase einer Ödemkrankheit<br />
eventuell Vorschub leisten können. Die Schmackhaftigkeit, die Energieausstattung<br />
und die Verdaulichkeit des Futters sind für eine homogene Weiterentwicklung der Ferkelgruppe<br />
entscheidend. Auch wird hier die Grundlage für ein hohes Proteinansatzvermögen<br />
der Ferkel (somit der späteren Magerfleischprozente) und eine gute Futterverwertung gelegt.<br />
Die Säurebindungskapazität im Futter ist für die Ausnutzung der Mineralstoffe, sowie die<br />
Aktivität der Verdauung wichtig und sollte bei der Auswahl der Proteinkomponenten und der<br />
Mineralstoffquellen berücksichtigt werden.
Abb.4:<br />
Abb. 5<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Auswirkungen der Auslösung der Immunisierungsaktivität auf<br />
Futteraufnahme und Wachstum<br />
Quelle: Stahly (1993)<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Verdaulichkeitskoeffizienten von verschiedenen Proteinquellen<br />
bei Ferkeln in Abhängigkeit vom Lebensalter<br />
Lebensalter (Wochen)<br />
Proteinquelle 3,5 4,5 5,5<br />
Milchprodukte 93 95 95<br />
Soja 71 75 87<br />
Kartoffeln 93 95<br />
G:\3wiv\vorträge\mariafol\110500.ppt 05/00<br />
Grad der<br />
Immunitätsaktivierung<br />
(Krankheit)<br />
Absetzalter + 33 Tage<br />
Durchschnitt<br />
Futteraufnahme (kg/pro Tag) gering 1,08<br />
hoch 0,84<br />
Tageszunahme (kg/pro Tag) gering 0,60<br />
hoch 0,41<br />
57
58<br />
In den letzten Jahren bekommen sowohl die Ferkel wie auch die Mastschweine aufgrund<br />
zunehmender viraler Infektionen in der Mast Probleme. Dabei fallen häufig einzelne blasse<br />
und gelbe Mastschweine oder Minderzunahmen in der gesamten Gruppe auf. Auch gibt es<br />
viele Ferkelaufzüchter, deren Tiere Probleme mit Colienterotoxämie, Streptokokken oder<br />
Durchfall haben. In den letzten Jahren bestätigten Untersuchungen, dass die Ferkel sich in<br />
dieser Phase mit viralen Erkrankungen (PRRS/Circo-Viren) auseinandersetzen und dabei<br />
bakteriellen Erkrankungen Vorschub leisten. Aufgrund einer ständig aktivierten Immunabwehr<br />
zeigen die Ferkel verminderte Mastleistungen, besonders wenn in einem Ferkelaufzuchtraum<br />
verschiedene Ferkelgruppen/Altersgruppen zusammensgestellt werden.<br />
Aus dem Symptomenbild der Ferkel und Mastschweine ergeben sich Fragen nach dem Ablauf<br />
der Verdauungsvorgänge bei diesen Tieren. Besonders bei der Erkrankung durch Circoviren<br />
stellt sich immer wieder die Frage nach der Pathogenität des Erregers selbst und den<br />
Einflüssen durch die Immunität der Ferkel. Auch die Haltung, Fütterung und das gesamte<br />
Management scheinen den Ablauf der Erkrankung beeinflussen zu können (...“dass in einem<br />
Betrieb mit PMWS die PMWS-Infektion generalisiert ist und von langer Dauer und dass das<br />
Virus sowohl in Schweinen mit klinischer Symptomatologie als auch in augenscheinlich gesunden<br />
Tieren, die Kontakt mit Kranken hatten, nachgewiesen werden kann“, Vorträge Barcelona<br />
1999).<br />
Die Abkürzung PMWS steht für „Postweaning, Multisystem and Wasting Syndrom“. Bei diesem<br />
Syndrom fragt man sich von der Stoffwechsel- und Verdauungsphysiologie her, warum<br />
die Ferkel blass werden. Rein physiologisch liegt bei blassen Ferkeln eine Störung in der<br />
Blutbildung oder Blutgerinnung vor. Die dritte Möglichkeit könnte auch sein, dass die Ferkel<br />
Blut verlieren, z.B. durch ein Magengeschwür in die Bauchhöhle.<br />
An der Blutbildung sind neben den Spurenelementen die Vitamine C, B6, B12 und die Folsäure<br />
beteiligt. Für die Blutgerinnung spielen dagegen Vitamin K und Calcium eine wichtige<br />
Rolle.<br />
Abb. 6<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Die bei PMWS am häufigsten beobachteten mikroskopischen Läsionen<br />
Läsion Häufigkeit Prozentsatz<br />
Lymphorgane:<br />
Lymphozytäre Depletion 129/148 87,2 %<br />
Entzündliche histiozytäre Infiltration 114/148 77,0 %<br />
Auftreten von Einschlusskörperchen 67/148 45,3 %<br />
Auftreten von Synzytien 54/148 36,5 %<br />
Multifokale Nekrose<br />
Lunge:<br />
18/148 12,2 %<br />
Interstitielle Pneumonie<br />
Leber<br />
130/148 87,8 %<br />
Leichte bis mäßige Entzündung 82/148 55,4 %<br />
Schwere Entzündung und Zerstörung von Parenchym<br />
Niere:<br />
11/148 7,4 %<br />
Interstitielle Nephritis 67/148 45,3 %
Untersuchungen an Schweinen mit PMWS zeigen, dass bei 55,4 % dieser Schweine die<br />
Leber als zentrales Verdauungsorgan nicht optimal arbeitete (vgl. Abb. 6).<br />
Die Tiere mit Ikterus zeigen schwere Läsionen. Von der Ernährungsphysiologie werden bei<br />
Lebererkrankungen häufig spezielle Diäten empfohlen, um die Leber zu entlasten, bzw. ihre<br />
Aufgaben zu unterstützen. Nehmen wir z.B. das Vitamin C, da gesunde Schweine dieses<br />
Vitamin selbst bilden können. Im Ferkel- und Mastschweinefutter ist Vitamin C aufgrund des<br />
Preises und einer schlechten Preßstabilität selten enthalten. Da Vitamin C in der Leber aus<br />
Kohlenhydraten gebildet wird, ist es natürlich fraglich, ob dieser Syntheseweg bei lebergeschädigten<br />
Ferkeln in ausreichender Menge stattfindet. Außerdem erhöht sich bei chronischen<br />
Infektionserkrankungen der Vitamin C - Bedarf vermutlich infolge einer gesteigerten<br />
Corticoidsynthese im Körper. Sicherlich ist bei Schweinen, die eine Erkrankung der Stoffwechselorgane<br />
(Leber/Niere) aufweisen, von einer geänderten Stoffwechselphysiologie auszugehen.<br />
Was heißt das nun für die Konzeption von Schweinefuttern in dieser Phase? Von den Vitaminen<br />
und Spurenelementen kann man die Diskussion an vielen einzelnen Elementen aufzeigen.<br />
Beispielsweise kann die Anämie/Blässe der Ferkel und Mastschweine vermutlich<br />
eher mit einer verminderten Folsäurebildung in der Leber erklärt werden als mit dem immer<br />
wieder erwähnten Eisenmangelsyndrom. Folsäure ist neben Vitamin C und B12 am Aufbau<br />
der roten Blutkörperchen und des roten Blutfarbstoffes beteiligt. So erklärt sich die Empfehlung<br />
des Zusatzes von 0.3% MIAVIT Circolin zum bestehenden Prämix in diesem Lebensabschnitt<br />
der Schweine, um eine möglichst hohe Unterstützung des Stoffwechsels zu erreichen.<br />
Durch eine richtige Kombination der Vitamine zueinander wird eine Entlastung der<br />
verschiedenen Verdauungsorgane angestrebt.<br />
Bei der Konzeption des Futters selbst ist ein kritisches Augenmerk auf den Fettgehalt in der<br />
Ration zu legen, da auf der einen Seite das Enzymsystem der Schweine zu diesem Zeitpunkt<br />
auch schon recht gut die Stärke verdauen kann und auf der anderen Seite der Fettabbau<br />
die Leber sehr stark belastet. Sojaschrot stellt in diesem Lebensabschnitt eine<br />
schmackhafte und preiswerte Proteinquelle dar. Wichtig ist natürlich der Einsatz synthetischer<br />
Aminosäuren und eine ausreichende Proteinversorgung (Ferkel und Mastschweine mit<br />
viralen Infektionen setzen sich verstärkt mit bakteriellen Sekundär-Infektionen auseinander<br />
und brauchen für die AK-Bildung hochwertige Proteinquellen). Berichte aus der Bretagne<br />
weisen darauf hin, dass Ferkel vor dem eigentlichen Auftreten des „PMWS-Syndroms“ eine<br />
Fieberphase durchmachen. Unter längeren Fieberphasen ist häufig die Sekretion von Verdauungsenzymen<br />
ins Darmlumen reduziert. Daher könnte es bei einer speziellen Diät zur<br />
Reduzierung des „PMWS-Syndroms“ sinnvoll sein, die Rohfasergehalte des Futters zu begrenzen,<br />
um die Verdaulichkeit der Ration zu erhöhen.<br />
Abb. 7<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Wege des Endotoxins im gesunden Körper<br />
G:\3wiv\vorträge\mariafol\endotox.ppt 01/00<br />
Darm / Infektionsherd<br />
Endotoxin<br />
Blutzellen, Lipoproteine<br />
Leber<br />
Endotoxin - Abbau<br />
Endotoxin - Ausscheidung<br />
über Darm, Lunge und Euter<br />
Quelle: Priv.-Doz. Dr. Knut Fischer<br />
59
60<br />
In den ersten 10 Tagen nach dem Absetzen bzw. in den ersten 14 Tagen nach dem Einstallen<br />
in die Mast macht ein Teil der Ferkel bzw. der Mastschweine eine Coli-Infektion durch.<br />
Diese Infektion muss nicht immer zu Durchfall führen, aber die Bakterien vermehren sich und<br />
sterben anschließend wieder ab. Die Bestandteile der Zellwand gramnegativer Bakterien<br />
nennt man Endotoxine. Im gesunden Organismus entgiftet die Leber die Endotoxine. Arbeitet<br />
die Leber nicht optimal, gelangen die Endotoxine ins Blut und führen zu einer Aktivierung<br />
der Blutgerinnung (vgl. Abb 7+8).<br />
Abb. 8<br />
Einige Ferkel zeigen unter diesem Symptombild Ohrrandnekrosen (Differentialdiagnose: Eperythrozoonose<br />
u.a. abklären). Ist die Blutgerinnung über längere Zeit aktiviert, kommt es<br />
zu einem Verbrauch der Gerinnungsfaktoren. Da das fettlösliche Vitamin K bei Leberproblemen<br />
zum Teil schlechter resorbiert wird, zeigen Ferkel u. Mastschweine mit einer gesteigerten<br />
Blutgerinnung nach einer gewissen Zeit Symptome der Verbrauchskoagulopathie (Blässe,<br />
Hautblutungen). Der Zusatz von MIAVIT Circolin zum Futter unterstützt die Funktion der<br />
Leber sowie der übrigen Stoffwechselorgane. MIAVIT Circolin enthält u.a. das Vitamin K3,<br />
da eine höhere Dosierung gleich zu Beginn einer Resorptionsstörung über einen Zeitraum<br />
von drei Wochen die verminderte Resorption ausgleichen kann. An vielen einzelnen Zusatzstoffen<br />
kann man einen unter der PMWS-Symptomatik geänderten Bedarf aufzeigen. Über<br />
eine spezielle Futterkonzeption und den Zusatz von MIAVIT Circolin wird diesem veränderten<br />
Bedarf Rechnung getragen, was zu einer Unterstützung der Ferkel und einer Steigerung<br />
der Immunität führt.<br />
Zusammenfassung<br />
G:\3wiv\vorträge\mariafol\endotox.ppt 01/00<br />
MIAVIT, Dr. Hans W. Niemeyer GmbH & Co. KG<br />
Beverner Straße 31 - 49632 Essen (Oldb)<br />
Telefon: 05434/82-0 - Fax: 05434/8282<br />
Wege des Endotoxins bei eingeschränkter Organfunktion<br />
Darm / Infektionsherd<br />
Endotoxin<br />
Lunge / Leber<br />
Endotoxin<br />
Blutkreislauf<br />
Endotoxin<br />
Erhöhung der Darmpermeabilität<br />
Endotoxin<br />
Endotoxämie,<br />
Gerinnungsaktivierung,<br />
Mutiorganversagen,<br />
Tod<br />
Quelle: Priv.-Doz. Dr. Knut Fischer<br />
Folgende Fütterungs- und Managementmaßnahmen lassen sich bei viralen Infektionen zusammenfassen:<br />
1. Trennung unterschiedlicher Altersgruppen sowohl in der Ferkelaufzucht wie auch in<br />
der Mast (abteilweise Rein-Raus)<br />
2. Zweiphasige Fütterung der Ferkel (FAZ I: 6 – ca. 12/13 kg ↔ „Cirko-Futter“ ab ca. 3<br />
Wochen nach dem Absetzen)<br />
3. Mast: beim Auftreten typischer PMWS- bzw. Haut-Nieren-Symthome:<br />
Einsatz eines „Cirko-Futters“<br />
4. Anforderungen an ein „Cirko-Futter“<br />
a) Begrenzung der Rohfett- und Rohfasergehalte<br />
b) hohe Aminosäurenversorgung der Schweine<br />
c) Unterstützung der Leber sowie der übrigen Verdauungsorgane durch Circolin<br />
5. Angebot von ausreichend Sauerstoff an die Tiere, um den Gasaustausch in der Lunge<br />
zu unterstützen.
19 Closed Herd Multiplication – Chance und Risiko<br />
Begriff<br />
Der Begriff “Closed Herd Multiplication” (CHM) wurde ursprünglich in den USA und in Großbritannien<br />
für die Vermehrung von Jungsauen in kommerziellen Sauenherden ohne Tierzukauf<br />
verwendet. In Deutschland wurde dieser Begriff „verzerrt“ und steht allgemein für Eigenbestandsvermehrung,<br />
das heisst die Bereitstellung von Jungsauen aus der eigenen Herde.<br />
Warum Eigenbestandsvermehrung?<br />
Vor allem Betriebe, die eine weitgehende gesundheitliche Abschottung anstreben, ziehen<br />
CHM in Betracht. Das Prinzip beruht darauf, den Tierzukauf als mögliche Eintragsquelle von<br />
Erregern in den Bestand auszuschließen, in dem Jungsauen nicht zugekauft, sondern im<br />
Betrieb nachgezogen werden. Die Jungsaueneingliederung gestaltet sich einfacher, weil die<br />
Tiere bereits seit Geburt mit dem Erregerspektrum des Bestandes vertraut sind. Insgesamt<br />
soll so eine Verbesserung der Immunitätslage der gesamten Herde erreicht werden.<br />
Varianten<br />
JSR Hybrid Hirschmann bietet verschiedene Konzepte für die CHM an. Dadurch können<br />
individuelle Zuchtprogramme für die einzelnen Betriebe erstellt werden.<br />
Folgende Modelle der Eigenbestandsvermehrung gibt es:<br />
1) Mit „fester“ Großelternherde (definierte Genetik, ohne wechselnde Genanteile)<br />
• mit Remontierung der Großeltern „von außen“<br />
• mit Eigenremontierung auch der Großelterntiere<br />
2) Ohne „feste“ Großelternherde (wechselnde Genanteile)<br />
• Wechselkreuzungsverfahren mit 2 oder mehr Linien, etwa 10 % der Herde werden<br />
laufend für die Zuchtanpaarungen festgelegt.<br />
Das für die Eigenremontierung benötigte Reinzuchtsperma kann aus der JSR-eigenen KB-<br />
Station in Trebbichau in Sachsen-Anhalt oder von regionalen KB-Stationen bezogen werden.<br />
Der CHM-Betrieb wird in die JSR Hybrid Hirschmann Zuchtdatenbank aufgenommen und<br />
nimmt mit den Reinzuchttieren an der JSR-Zuchtwertschätzung teil. Hierdurch werden für die<br />
Reinzuchttiere des CHM-Betriebes Zuchtwerte erstellt, die durch die Integration in die europäische<br />
JSR-BLUP Zuchtwertschätzung ständig aktualisiert werden.<br />
Was muss beachtet werden?<br />
Die verschiedenen Systeme bieten nicht nur Vorteile, auch die Risiken dürfen nicht aus den<br />
Augen verloren werden.<br />
Rein züchterisch sind die Varianten mit „fester“ Großelternherde eindeutig zu bevorzugen.<br />
Sie schöpfen die Möglichkeiten der individuellen Heterosis zu 100 % (Großelternherde – F1-<br />
Anpaarung) aus. In der Produktionsherde werden sowohl individuelle als auch maternale<br />
Heterosiseffekte zu 100% genutzt. Anders sieht es bei der Reinzuchtanpaarung aus. Hier ist<br />
mit keinerlei Heterosiseffekten zu rechnen.<br />
Ohnehin macht ein vollständiges Abkoppeln von Zukäufen bei dem Modell mit „fester“ Großelternherde<br />
erst ab Beständen mit mehreren tausend Sauen wirklich Sinn. Bei kleineren<br />
Herden ist die Urgroßelternpopulation realistisch betrachtet für eine effektive Zuchtarbeit zu<br />
klein. Nichtsdestotrotz trifft man in der Praxis immer wieder auf Versuche, diese Variante<br />
61
62<br />
umzusetzen. Die Zuchtunternehmen geben in diesen Fällen dem Willen des Kunden angesichts<br />
eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks nach.<br />
Bei der Variante Wechselkreuzungsverfahren werden bei der Nutzung von zwei Linien die<br />
individuelle und maternale Heterosis zu je 66% und bei der Nutzung von drei Linien zu je<br />
86% ausgeschöpft. In der Praxis trifft man häufig – wahrscheinlich zu Recht – die Meinung<br />
an, dass die Endprodukte aufgrund der uneinheitlichen Genanteile mehr streuen. Der Vorteil<br />
dieses Modells liegt darin begründet, dass sich wesentlich kleinere Sauenherden „komplett“<br />
schließen lassen.<br />
Es ist aber zu beachten, dass hierbei indirekt auf die Umweltbedingungen der eigenen Sauenherde<br />
selektiert wird (Die besten Sauen setzen sich durch und werden zur Zucht genutzt,<br />
das sind häufig die bezüglich des genetischen Potenziales fettesten Sauen!). Dieses Prinzip<br />
kommt übrigens auch bei einer definierten Großelternherde ohne Remontierung von außen<br />
zum Tragen. Das Zuchtunternehmen ist hier in besonderer Verantwortung, die richtigen Beratungsempfehlungen<br />
zu geben!<br />
Bei Ferkelerzeugern, die bisher die erzeugten Ferkel oder Läufer nicht im selben Betrieb<br />
aufgezogen und gemästet haben, ist ein weiterer gesundheitlicher Aspekt zu bedenken. Mit<br />
den aufwachsenden Jungsauen steht dann eine Altersgruppe im Kontakt mit der Sauenherde,<br />
die es vorher nicht gegeben hat. Da sich viele Erreger sozusagen als „Kinderkrankheit“ in<br />
bestimmten Altersperioden stärker vermehren, kann hieraus ein neuer Erregerdruck auf die<br />
Bestandssauen entstehen, wenn nicht durch bauliche und Managementmaßnahmen Vorsorge<br />
getroffen wird.
Fazit / Trends<br />
Einige gesundheitliche Aspekte sprechen für die Selbsterzeugung von Jungsauen. CHM<br />
macht aber erst ab einer bestimmten Herdengröße (je nach Modell) Sinn. Es ist unbedingt zu<br />
beachten, dass die Selbsterzeugung der Jungsauen mindestens nach den Standards eines<br />
professionellen Aufzüchters zu erfolgen hat. Bei Einhaltung dieser Standards und ehrlicher<br />
Einbeziehung aller Kosten liegen diese nicht wesentlich unter den Kosten einer zugekauften<br />
Jungsau. Die gesundheitlichen Vorteile, die sich aus dem Verzicht auf den Zukauf ergeben<br />
können, kommen nur dann voll zum Tragen, wenn auch an allen anderen Fronten die Einschleppung<br />
von Erregern minimiert wird. Es ist zu beachten, dass mit Eigenbestandsvermehrung<br />
auch gewisse gesundheitliche „Risiken“ eingegangen werden. Immerhin hat man, sofern<br />
die Aufzucht nicht separat liegt, wachsende Tiere, also potenzielle Keimausscheider im<br />
Bestand. Nicht nur aus diesem Grund haben sich in den neuen Bundesländern große, hochproduktive<br />
Sauenherden, weg von der Closed-Herd-Multiplication, hin zum Zukauf von Jungsauen<br />
mit definiertem Gesundheitsstatus entschieden.<br />
Alle diese Aspekte müssen bei einer Entscheidung für oder gegen CHM bedacht werden.<br />
Wenn CHM ein passendes Modell für den Betrieb sein könnte, sollte zuvor in jedem Fall ein<br />
individuelles Konzept mit dem JSR-Berater erarbeitet werden. Das Zuchtunternehmen JSR<br />
Hybrid Hirschmann verfügt über die entsprechenden Erfahrungen und kann bei der Erarbeitung<br />
und Umsetzung eines für den Betrieb maßgeschneiderten Konzeptes tatkräftig zur Seite<br />
stehen.<br />
63
64<br />
20 Wachstum in der Sauenhaltung – Neue Ansätze und<br />
Perspektiven<br />
Wenn von Wachstum in landwirtschaftlichen Betrieben die Rede ist, dann wird dies immer<br />
wieder mit den gleichen Argumenten begründet. Wachstum soll wettbewerbsfähige Betriebs-<br />
und Produktionseinheiten schaffen, rationalisieren, das Einkommen verbessern, einen existenzfähigen<br />
Hof in die nächste Generation führen, um damit dem Hofnachfolger eine Zukunft<br />
zu sichern. Das Schlagwort lautet auch heute noch "Wachsen oder Weichen".<br />
Wachstum um jeden Preis? Wo sind die Grenzen?<br />
Betrachten wir zunächst die klassischen Produktionsfaktoren.<br />
Arbeit: Familienarbeitskräfte sind begrenzt, jedoch in den Jahren des Generationswechsels<br />
vorübergehend stärker verfügbar. Qualifizierte Fremdarbeitskräfte sind am<br />
Arbeitsmarkt nur schwer zu bekommen und dann fast nicht bezahlbar. Immer<br />
mehr Arbeitszeit erfordert heute die Bürokratie und "fesselt" den Landwirt mehr<br />
und mehr an den Schreibtisch.<br />
Boden: Der Grund und Boden ist nicht nur eine wichtige Produktionsgrundlage im Betrieb,<br />
sondern begrenzt über die Vieh- und Dungeinheiten auch die Tierhaltung.<br />
Kapital: Die Finanzierung eines landwirtschaftlichen Betriebes erhält in Zukunft einen höheren<br />
Stellenwert, denn die finanzierenden Banken werden u. a. durch "Basel II"<br />
bei der Kreditvergabe immer restriktiver.<br />
Gebäude: Neue Baugenehmigungen werden erschwert durch das Bundesimmissionsschutzgesetz,<br />
die Tierhaltungsverordnung und das Artikelgesetz.<br />
Die politischen Rahmenbedingungen stimmen den landwirtschaftlichen Unternehmer nicht<br />
investitionsfreudig. Der überzogene Umwelt-, Natur- und Tierschutz stellt immer wieder die<br />
Landwirtschaft in der öffentlichen Meinung an den "Pranger".<br />
Die Nachfolgeregelungen zur Agenda 2000 werden heute vor dem Hintergrund der EU-<br />
Osterweiterung in der Politik diskutiert. Eines ist heute schon sicher, die Transferzahlungen<br />
an die Landwirtschaft werden zukünftig deutlich geringer ausfallen, auch vor dem Hintergrund<br />
der hohen Defizite der öffentlichen Haushalte.<br />
Die gesellschaftlichen Veränderungen, die schnelllebige Zeit, der Wertewandel geht auch an<br />
der Landwirtschaft nicht vorbei. Freizeit und Konsum, das Abtauchen in die Anonymität, Unverbindlichkeit,<br />
mit wenig Aufwand viel erreichen, das ist heute vielen Menschen wichtig.<br />
Diese Verhaltensmuster sind nicht unbedingt erstrebenswert, gehen jedoch auch an der jungen<br />
Generation auf den Höfen nicht vorbei.<br />
Wenn wir von Wachstum in der Landwirtschaft reden, dann muss gerade heute neben den<br />
betriebswirtschaftlichen und ökonomischen Bereichen auch die Lebensqualität, Familie, Urlaub<br />
und Freizeit Berücksichtigung finden. Wachstum darf nicht dazu führen, dass die Familien<br />
zu "Sklaven der eigenen Betriebe" werden.<br />
Die Situation in den Sauen haltenden Betrieben<br />
Wachstumsbetriebe haben mit arbeitswirtschaftlichen Engpässen, knapper Fläche bei hohen<br />
Pachtpreisen und hohen Kapitaldiensten zu kämpfen. Die Festkosten steigen vor allem
in den Kostenbereichen Zinsen, Pachten und Arbeitserledigung. Risiken wie Preiseinbrüche<br />
und Gesundheitsstatus des Tierbestandes steigen. Der Druck und die Belastung auf den<br />
Unternehmer nehmen zu - Management und Betriebsführung stellen immer höhere Anforderungen.<br />
Dies führt auf Dauer zu Gesundheitsproblemen, Stress, sinkender Lebensqualität,<br />
Auseinandersetzungen in der Familie und womöglich zu Problemen mit der Hofnachfolge.<br />
Ziel muss es sein, die Zukunftssicherung des Betriebes durch betriebswirtschaftliches sinnvolles<br />
Wachstum unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Belange zu erreichen.<br />
Wachstum muss persönlichen Freiraum lassen oder schaffen und darf nicht einengen.<br />
Kleinere und mittelfristig auslaufende Betriebe haben erschwerte Chancen für ein einzelbetriebliches<br />
Wachstum. Aufgrund wirtschaftlicher Zwänge und fehlender Hofnachfolge werden<br />
diese Betriebe zum Ausstieg aus der Landwirtschaft gezwungen. Gerade diese Landwirte<br />
wollen jedoch gerne weiter bis zum Rentenalter in der Landwirtschaft tätig bleiben und<br />
keine außerlandwirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen.<br />
Eine Alternative und Perspektive kann das kooperative Wachstum sein.<br />
Zwei oder mehrere Sauen haltende Betriebe gehen partnerschaftlich aufeinander zu und<br />
verfolgen das gemeinsame Ziel: Bewirtschaftung der Betriebe in Kooperation.<br />
Dies kann in mehreren Schritten nach und nach erfolgen.<br />
Zunächst müssen Betriebs- und Produktionsabläufe angeglichen werden. Die Sauenherden<br />
sollten die gleiche Genetik haben, gleiche Impf- und Hygieneprogramme, ggf. durch den<br />
gleichen Hoftierarzt betreut werden, Fütterung und Herden-Management, aber vor allen Dingen<br />
den gleichen Absetzrhythmus.<br />
Betrieb A<br />
Ist: 120 Sauen<br />
Plan: 240 Sauen<br />
Betrieb C<br />
Ist: 100 Sauen<br />
Plan: 220 Sauen<br />
IST-Betriebe: 480 Sauen<br />
Plan-Betriebe: 820 Sauen<br />
Ferkelaufzucht<br />
Gesellschaft<br />
18.000 Ferkel<br />
Betrieb B<br />
Ist: 200 Sauen<br />
Plan: 360 Sauen<br />
In dieser Anpassungsphase bewirtschaftet jeder Partner seinen Betrieb selbständig und einzelbetrieblich<br />
weiter. Nach der "Angleichungsphase" ergeben sich für die Partnerbetriebe<br />
schon Vorteile im gemeinsamen Einkauf von Produktionsmitteln, in der Vermarktung der<br />
65<br />
Betrieb D<br />
Ist: 60 Sauen<br />
Plan: keine Sauen, Ferkelaufzucht
66<br />
Ferkel (große, gleiche Partien), sowie bessere Tiergesundheit durch gemeinsame Problemanalyse.<br />
Jeder Landwirt kann den Partner qualifiziert im Krankheits- oder Urlaubsfall vertreten,<br />
da im Partnerbetrieb alles wie im eigenen Betrieb abläuft. Arbeitskraftreserven können<br />
auf den Partnerbetrieben eingesetzt werden, gemeinsame Fremdarbeitskräfte können beschäftigt<br />
und entsprechend dem Arbeitsbedarf des jeweiligen Betriebes eingesetzt werden.<br />
Der nächste Schritt kann eine gemeinsame Ferkelaufzucht sein.<br />
Die Ferkelaufzucht wird von den Einzelbetrieben ausgelagert und findet in einer gemeinsamen<br />
Ferkelaufzuchtgesellschaft statt. Der Aufzuchtstall kann auf einem der Partnerbetriebe,<br />
der ggf. seine Sauenhaltung aufgibt, stehen. Denkbar wäre auch das gemeinsame Anpachten<br />
eines Betriebes, wobei die Altgebäude zu Ferkelaufzuchtställen umgebaut werden könnten.<br />
Die Gestaltung sollte so gewählt werden, dass das gemeinsame Vermögen in der Gesellschaft<br />
möglichst gering ist und sich auf das Vieh- und Umlaufvermögen beschränkt. Dadurch<br />
wird das Ausscheiden und die Aufnahme eines Gesellschafters wesentlich unproblematischer.<br />
Das Auslagern der Ferkelaufzucht hat entscheidende Vorteile. Verbesserte Tiergesundheit,<br />
denn der Reinfektionsdruck aus der Ferkelaufzucht in den Sauenbereich entfällt. Der Emmissionsdruck<br />
wird geringer, dadurch bereitet die TA – Luft weniger Probleme. Die Tierhaltungsverordnung<br />
verlangt in Zukunft, die Sauen im Wartestall in Gruppen zu halten. Durch<br />
das Auslagern der Ferkel können im Sauenbetrieb die frei werdenden Gebäude durch Umbaumaßnahmen<br />
der Sauenhaltung mehr Platz bieten.<br />
Sonderbetriebsvermögen<br />
der Gesellschafter<br />
Definierte<br />
Arbeitsleistung<br />
Maschinen/<br />
Betriebsvorr.<br />
Kapital<br />
Ferkelaufzucht-Gesellschaft<br />
Eigentumsverhältnisse und Gewinnverteilung<br />
Vorabvergütung<br />
zur Nutzung<br />
Vorabvergütung<br />
zur Nutzung<br />
Ferkelaufzucht<br />
Gesellschaft<br />
Gemeinsames<br />
Vermögen<br />
•Vieh<br />
•Vorräte<br />
Gewinn<br />
an die Gesellschafter<br />
A B C D<br />
Vorabvergütung<br />
zur Nutzung<br />
Vorabvergütung<br />
zur Nutzung<br />
Sonderbetriebsvermögen<br />
der Gesellschafter<br />
Acker<br />
Gebäude<br />
Volle<br />
Arbeitsleistung
Durch die gemeinsame Ferkelaufzucht kann nunmehr jeder einzelne Betrieb in der Sauenhaltung<br />
weiter wachsen. Jeder an der Ferkelaufzucht beteiligte Betrieb kann sich so unabhängig<br />
vom Partnerbetrieb weiterentwickeln.<br />
Die Ferkelaufzuchtgesellschaft rechnet mit dem Einzelbetrieb die gelieferten Babyferkel ab.<br />
Der gemeinsam erwirtschaftete Gewinn wird an die Gesellschafter ausgezahlt. Zunächst<br />
Vorabvergütungen an die Gesellschafter für überlassene Wirtschaftsgüter und für geleistete<br />
Arbeit. Der Restgewinn wird sowohl nach Umsatz (gelieferte Ferkel) als auch nach Gesellschaftsanteilen<br />
verteilt.<br />
Zusammenfassend bietet die gemeinsame Ferkelaufzucht sowie die abgestimmte Sauenhaltung<br />
(durch klare Zielvorgaben) viele Vorteile, nicht nur betriebswirtschaftlicher Art, sondern<br />
berücksichtigt auch den Anspruch auf Lebensqualität. Der Sauenhalter ist kein "Einzelkämpfer"<br />
mehr, sondern ergänzt sich um die Fähigkeiten seiner Partner. Landwirte müssen<br />
nicht vorzeitig aus der aktiven Landwirtschaft ausscheiden, weil kein Hofnachfolger vorhanden<br />
ist oder der Betrieb nicht mehr genug Einkommen erwirtschaftet. In der Kooperation haben<br />
diese weiterhin die Möglichkeit, in der Landwirtschaft tätig zu sein und hierüber ausreichend<br />
Einkommen zu erzielen.<br />
Zukunftsorientierte Landwirte gewinnen durch Reserven ausschöpfende Kooperationen, u. a.<br />
Zeit für Familie und Urlaub.<br />
Für einen Hofnachfolger spielt die Größe des eigenen Betriebes nicht mehr die Rolle, denn<br />
er kann sich in die Kooperation einbringen.<br />
Kooperationspartner sind keine Konkurrenten mehr, wenn es um Zupachtungen von Flächen<br />
und Betrieben geht.<br />
Die Auslastung der Maschinen verbessert sich durch eine überbetriebliche Einsatzmöglichkeit<br />
deutlich.<br />
Gemeinsame Arbeitskräfte, die für den Einzelnen wirtschaftlich nicht tragbar wären, können<br />
sinnvoll beschäftigt werden.<br />
Diese neuen Ansätze zum Wachstum in der Sauenhaltung beinhalten hohe Chancen und ein<br />
geringes Risiko.<br />
67
68<br />
21 Änderungen in der Betriebszweigauswertung Schweinemast<br />
Ab dem Wirtschaftsjahr 2001/<strong>2002</strong> werden in der Auswertung der <strong>Erzeugerring</strong>e neben der<br />
EURO-Umstellung noch weitere Auswertungskennzahlen verändert.<br />
Die im Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) organisierten <strong>Erzeugerring</strong>e<br />
und Beratungsorganisationen haben festgelegt, dass ab dem WJ 2001/02 die Empfehlungen<br />
der DLG für die neue Betriebszweigauswertung umgesetzt werden.<br />
DLG-Empfehlung ökonomische Kenngrößen<br />
in der Betriebszweigauswertung<br />
Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung<br />
Ertrag Leistung<br />
Variabler Aufwand Direkte Kosten<br />
Deckungsbeitrag Direktkostenfreie Leistung<br />
Deutlich wird dies durch Einführung des Begriffes „Direktkostenfreie Leistung“, der den bislang<br />
gebräuchlichen „Deckungsbeitrag“ ablöst. Der wesentliche Unterschied bei der Berechnung<br />
liegt in der Zuordnung der Bestandsveränderung. Im Deckungsbeitrag wurde die Bestandsveränderung<br />
als Teil des Aufwandes gebucht. In der neuen Auswertung wird die Bestandsveränderung<br />
mit Vorzeichenwechsel auf der Leistungsseite (Ertrag) berücksichtigt.<br />
Spezielle Änderungen in der Schweinemast<br />
Berechnung der Futtertage<br />
Die unterschiedlichen Berechnungen der Futtertage werden vereinheitlicht. Ab dem Wirtschaftsjahr<br />
2001/<strong>2002</strong> gelten alle Tage, einschließlich des Ablieferungstages, als Futtertage,<br />
mit Ausnahme des Zugangstages. Dadurch verringert sich die berechnete Zunahme im Mittel<br />
um 5 - 8 g je Tier und Tag.<br />
Berechnung der Verluste in %<br />
Immer mehr Betriebe arbeiten im Rein-Raus-Verfahren. Dadurch ist das Verhältnis zwischen<br />
zugekauften und verkauften Tieren nicht mehr ausgeglichen, sodass es in vielen Fällen zu<br />
großen Unterschieden zwischen den Betrieben und Zeiträumen in der Auswertung kommt.<br />
Deshalb wird die Berechnung der Verluste in % ab dem Wirtschaftsjahr 2001/<strong>2002</strong> geändert:<br />
• Alte Formel: Anzahl Verluste / Anzahl zugekaufte Tiere * 100<br />
• Neue Formel: Anzahl Verluste / Anzahl Zuwachstiere * 100<br />
Berechnungsbeispiel Zuwachstiere<br />
Verkauf 786 Tiere mit 120,0 kg, Zukauf 866 Tiere mit 29,9 kg. Das Zuwachstier hat 90,1 kg.<br />
Der Gesamtzuwachs wird durch den Zuwachs (90,1 kg) im Auswertungszeitraum geteilt, also<br />
76.760 kg Gesamtzuwachs durch 90,1 kg ergibt 852 Zuwachstiere.<br />
Notschlachtung<br />
Der Begriff „Notschlachtung“ wird durch den Begriff „vorzeitiger Verkauf“ ersetzt.
Neue Bestandsbewertung<br />
Durch das Rein-Raus-Verfahren entstehen große Differenzen zwischen Anfangs- und Endbestand<br />
bei den Tierzahlen und dem im Bestand erzeugten Zuwachs.<br />
Aus diesem Grund wird die Bestandsbewertung in den Mastbetrieben seit diesem Wirtschaftsjahr<br />
auf Basis der Herstellungskosten berechnet. Dabei erfolgt die Bewertung der<br />
zum Stichtag (z.B.01.07.2001) im Stall befindlichen Tiere wie folgt.<br />
Zunächst werden die Zukaufskosten der Ferkel auf der Basis des gebuchten Zukaufspreises<br />
und den Anlieferungsgewichten errechnet und anschließend die am betreffenden Stichtag<br />
geschätzten Gewichte mit Produktionskosten je kg Zuwachs bewertet. Die für diese Bestandsbewertung<br />
zugrunde gelegten Produktionskosten entsprechen den Direktkosten, abzüglich<br />
der Kosten für Ferkelzukauf im Auswertungszeitraum.<br />
Neue Auswertungskennzahlen<br />
Die Tierzahlen bei Zu- und Verkauf in Rein-Raus-Betrieben innerhalb eines Auswertungszeitraumes<br />
weichen vielfach stark voneinander ab. Damit ist der Begriff „Deckungsbeitrag je<br />
verkauftes Mastschwein“ als repräsentative Bezugsgröße und Vergleichskennzahl zwischen<br />
Betrieben nicht mehr geeignet.<br />
Die im Zentralverband der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) organisierten <strong>Erzeugerring</strong>e<br />
und Beratungsorganisationen haben deshalb festgelegt, ab dem Wirtschaftsjahr<br />
2001/<strong>2002</strong> mit folgenden Kennzahlen auszuwerten:<br />
Direktkostenfreie Leistung je 100 kg Zuwachs<br />
Berechnung: Direktkostenfreie Leistung in € / gesamten Zuwachs in kg * 100 kg Zuwachs<br />
Direktkostenfreie Leistung je Zuwachstier<br />
Berechnung: Direktkostenfreie Leistung in € / gesamten Zuwachs in kg * kg Zuwachstier<br />
Direktkostenfreie Leistung je Mastplatz<br />
Berechnung: Direktkostenfreie Leistung in € / Mastplätze<br />
Direktkostenfreie Leistung je m² Stallfläche<br />
Berechnung: Direktkostenfreie Leistung in € / m² Stallfläche<br />
(Definition nach <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong>)<br />
Mit der Bewertung und der Auswertung auf der Basis je kg Zuwachs haben die <strong>Erzeugerring</strong>e<br />
und Beratungsorganisationen zukünftig die Möglichkeit, unterschiedliche Produktionssysteme<br />
auf Basis der „Direktkostenfreien Leistung“ zu vergleichen und die jeweiligen Vorteile<br />
zu bewerten. Dieser Bezug auf den Zuwachs wurde in der Vergangenheit schon bei den Futterkennzahlen<br />
(z.B. Futterkosten je kg Zuwachs) erfolgreich angewendet.<br />
69
70<br />
22 Fruchtbarkeitsmonitoring<br />
Seit 1997 stellen Ferkelerzeuger ihre Daten aus den Sauenplanern für das Fruchtbarkeitsmonitoring<br />
(FM) zur Verfügung. Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> führt seitdem diese Auswertungen<br />
durch. Zu den weiteren mitwirkenden Organisationen gehören: die Schweineerzeuger<br />
Nord-West (SNW), die Genossenschaft zur Förderung der Schweinehaltung (GFS), der<br />
<strong>Erzeugerring</strong> Minden-Ravensberg-Lippe und die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im<br />
Raum Osnabrück.<br />
Das FM soll in erster Linie dem Ferkelerzeuger helfen, Schwachstellen im Betrieb aufzudecken<br />
und zu beheben.<br />
Gleichzeitig werden die Daten von der GFS genutzt, um die Besamungseber hinsichtlich<br />
Fruchtbarkeit und Erbfehlervererbung zu bewerten. Die <strong>Erzeugerring</strong>e führen zunächst die<br />
betriebliche und überbetriebliche Datensammlung durch. Aus diesen Datensammlungen erstellt<br />
der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> individuelle Auswertungen, die für Beratungszwecke auf<br />
den einzelnen Betrieben genutzt werden.<br />
Die Auswertungen zum Fruchtbarkeitsmonitoring erfolgen zweimal jährlich. Sie beinhaltet<br />
folgende Punkte:<br />
• Jeder Betrieb bekommt eine überbetriebliche Produktionsstatistik (Hitliste), wo er sich<br />
individuell mit anderen Betrieben vergleichen kann<br />
• Dazu wird eine überbetriebliche Auswertung mit wechselndem Schwerpunktthema<br />
(z.B. jahreszeitlich abhängige Leistungsschwankungen, Absetz-Beleg-Tage, Umrauscher)<br />
durchgeführt<br />
• Zu dem jeweiligen Schwerpunktthema erfolgt eine einzelbetriebliche Auswertung<br />
Exakte Dateneingabe durch die Landwirte<br />
Bei dem letzten Monitoring im Herbst <strong>2002</strong> stellten 91 Betriebe ihre Daten aus dem db-<br />
Sauenplaner zur Verfügung. Wichtig für die Teilnahme am FM ist eine sorgfältige Dateneingabe<br />
des Landwirtes oder Beraters.<br />
• Jeder verwendete Eber muss über seine Herdbuchnummer eingegeben werden<br />
• Bei einer Mischbelegung müssen alle verwendeten Eber erfasst werden<br />
• Die Ferkel müssen auf Anomalien geprüft und diese exakt im Sauenplaner erfasst<br />
werden<br />
Beispiele aus den Spezialauswertungen vom Herbst <strong>2002</strong><br />
Schwerpunkt der Herbstauswertung war die genauere Analyse der Absetz-Beleg-Tage.<br />
In den Abbildungen 1 und 2 stellen die Säulen jeweils die gesamt geborenen Ferkel pro Wurf<br />
(GGF/Wurf) und die Linien die Anzahl der Würfe in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen<br />
(ABT) dar. Als Datengrundlage dienten die Sauenplaner - Daten von März 2001 bis Februar<br />
<strong>2002</strong>.<br />
An diesen Abbildungen lässt sich erkennen, dass im Musterbetrieb (Abb. 1) der Grossteil der<br />
Sauen einheitlich, d.h. 5 Tage nach dem Absetzen, belegt wurden. Die meisten geborenen<br />
Ferkel gibt es in den Referenzbetrieben (Abb. 2) bei Sauen, die 4 bis 5 Tage nach dem Absetzen<br />
pünktlich rauschen, und bei Sauen die 10 bis 55 Tage nach dem Absetzen rauschen.<br />
Die bessere Regeneration der sehr spät rauschenden Sauen ist der Hauptgrund für die höhere<br />
Wurfleistung.<br />
Wichtig bei den Abbildungen 1 - 4 ist, die Säulen und Linien immer im Zusammenhang zu<br />
betrachten. Der Musterbetrieb z.B. hat die höchste Anzahl an GGF (12,5 GGF) bei einer Belegung<br />
am 4. und 7. Absetz-Beleg-Tag, allerdings stehen hinter diesen beiden Säulen nur<br />
jeweils zwei Würfe (siehe Abbildung 1 und 3).
Abbildung 1: GGF in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen (Musterbetrieb)<br />
GGF/Wurf<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
55<br />
Absetz-Beleg-Tage<br />
GGF/ Wurf Betrieb Anzahl Würfe Betrieb<br />
Abbildung 2: GGF in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen (Ø 91 Betriebe)<br />
GGF/Wurf<br />
14,0<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
55<br />
Absetz-Beleg-Tage<br />
GGF/Wurf Ø 91 Betriebe Anzahl Würfe Ø 91 Betriebe<br />
Wenig gesamt geborene Ferkel haben oftmals viele Ursachen.<br />
Durch Stress und Krankheiten können die Embryonen frühzeitig absterben. Ungünstiger Belegungszeitpunkt,<br />
schlechte Hygiene beim Belegen, zuviel Futter nach dem Belegen oder<br />
eine schlechte Qualität des Futters führen ebenfalls zu einer geringeren Fruchtbarkeit. Aber<br />
auch die Spermaqualität oder die Fruchtbarkeit der Sauenrasse kann eine Ursache für kleine<br />
Würfen sein.<br />
In der Abbildung 3 und 4 stellen die Säulen die Umrauscher in % und die Linie die Anzahl<br />
der Belegungen in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen dar.<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Anzahl Würfe<br />
Anzahl Würfe<br />
71
72<br />
Abbildung 3: Umrauscher in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen (Musterbetrieb)<br />
Umrauscher %<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
55<br />
Absetz-Beleg-Tage<br />
Umrauscher Betrieb Anzahl Belegungen Betrieb<br />
Abb. 4: Umrauscher in Abhängigkeit zu den Absetz-Beleg-Tagen (Ø der 91 Betriebe)<br />
Umrauscher %<br />
25,0%<br />
20,0%<br />
15,0%<br />
10,0%<br />
5,0%<br />
0,0%<br />
55<br />
Absetz-Beleg-Tage<br />
Umrauscher Ø 91 Betriebe Anzahl Belegungen Ø 91 Betriebe<br />
In den 91 Referenzbetrieben (Abb. 4) gibt es die wenigsten Umrauscher bei den Sauen, die<br />
bis zum 6. Tag nach dem Absetzen belegt worden sind. Spätrauschende Sauen tendieren<br />
somit eher zum Umrauschen.<br />
Dass dieses von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist, zeigt die Abbildung 3. In diesem Einzelbetrieb<br />
werden fast alle Sauen nach dem 4. ABT besamt.<br />
Anhand dieser Grafiken lassen sich Tendenzen zum Belegen erkennen. Unberücksichtigt<br />
bleibt jedoch, ob der Betrieb abends oder morgens beginnt zu belegen, bzw. die Sauen abzusetzen.<br />
Ebenfalls ist hier nur der Anfang der Belegung zu erkennen. Der optimale Belegzeitpunkt<br />
liegt 12 Stunden vor bis 4 Stunden nach der Ovulation, der hieraus nicht hervorgeht.<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Anzahl Belegungen<br />
Anzahl Belegungen
Abbildung 5: Sofortbelegquote<br />
% Verteilung der Belegungen<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
90,2% Betrieb<br />
93,5% Ø besten 10%<br />
55<br />
Verteilung der Belegungen Betrieb Verteilung der Belegungen Ø besten 10%<br />
In der Abbildung 5 wird der Musterbetrieb mit den besten 10% der Betriebe im Bezug auf<br />
Verteilung der Belegungen und der Sofortbelegquote verglichen.<br />
Die Sofortbelegquote errechnet sich aus der gesamten Anzahl an Belegungen, geteilt durch<br />
die Anzahl der Belegungen vom ersten bis einschließlich den siebten Tag nach dem Absetzen.<br />
Sie bezieht sich in diesem Fall auf dem Zeitraum März 2001 bis Februar <strong>2002</strong>.<br />
Die Sofortbelegquote liegt bei den besten 10 % der Betriebe bei 93,5 %. Der Beispielbetrieb<br />
belegt 90,2 % seiner Sauen bis zum siebten Tag nach dem Absetzen.<br />
Fazit<br />
Durch die genauere Analyse von Sauenplanerdaten können einzelbetriebliche Probleme<br />
klarer dargestellt und mit Hilfe von Referenzberieben vergleichbar gemacht werden. Mit der<br />
Unterstützung der Beratung werden dann Ansätze zur Leistungssteigerung in den speziellen<br />
Bereichen erarbeitet. Voraussetzung sind allerdings eine exakte Erfassung der Belegungen<br />
mit dem jeweiligen Eber und die Prüfung von Anomalien mit Eingabe in den Sauenplaner.<br />
73
74<br />
23 Qualität und Sicherheit (Q + S)<br />
Der <strong>Erzeugerring</strong> <strong>Westfalen</strong> hat im vergangenen Jahr seine Beratung auch auf den Bereich<br />
Q+S ausgedehnt.<br />
Um für die Mitglieder Ansprechpartner in allen Fragen sein zu können, ist der ERW Systemberater<br />
für Q+S geworden. Damit steht er als Bindeglied zwischen Q+S/QPNW und den<br />
landwirtschaftlichen Betrieben.<br />
Das Sicherungssystem für die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln stellt an alle Beteiligten<br />
neue Anforderungen. Jede Stufe dokumentiert den eigenen Produktionsprozess und bestätigt<br />
der folgenden Stufe, dass alle Anforderungen beachtet worden sind. Auf diese Weise<br />
entsteht ein kontrollierter und nachprüfbarer Warenfluss bis zur Ladentheke.<br />
Hilfe vor Ort<br />
Direkt vor Ort auf den landwirtschaftlichen Betrieben berät der ERW seine Mitglieder in allen<br />
Fragen rund um Q+S. Steht ein Audit an, macht der Berater vorab ein Probeaudit, damit der<br />
Betrieb im eigentlichen Audit möglichst gut abschneidet. Die Berater geben ihre Erfahrungen<br />
von früheren Audits an ihre Betriebe weiter.<br />
Den Q+S-Standard muss ein Betrieb aber nicht nur zum Audit halten, sondern das ganze<br />
Jahr hindurch.<br />
Darum achten die Berater bei den regulären Betriebsbesuchen darauf, dass die Anforderungen<br />
von Q+S auch weiterhin eingehalten werden. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf<br />
das Verbrauchervertrauen und das Auftreten von neuen Skandalen.<br />
Denn gerade in Krisenzeiten, wenn Meldungen über verbotene Stoffe durch die Presse geistern,<br />
müssen Betriebe in der Lage sein, umgehend zu beweisen, dass die Gefahr nicht von<br />
ihren Produkten ausgeht. Und das geht nur, wenn die Dokumentation laufend aktualisiert<br />
wird und keine Lücken bestehen.<br />
Q +S auch für Ferkelerzeuger<br />
Ab dem Jahr 2004 wird auch die Stufe der Ferkelerzeugung offiziell mit in das QS-System<br />
einbezogen. Auf diese Weise wird dann die gesamte Produktionskette geschlossen.<br />
Unsere Berater werden auch den Ferkelerzeugern beratend zur Seite stehen. Probeaudits<br />
sind auch hier sinnvoll und sollten mit dem Berater gemeinsam vor dem eigentlichen Audit<br />
durchgeführt werden.<br />
Die Zukunft von Q+S<br />
Entscheidend für den Erfolg von Q+S wird die Akzeptanz der an der Produktionskette Beteiligten<br />
sein.<br />
Der Lebensmitteleinzelhandel hat schon einen großen Schritt getan, Ketten wie Kaiser`s<br />
Tengelmann, Edeka-Nord und Südwest, Wal-Mart und Rewe können bereits Q+S-Ware anbieten.<br />
Die weitere Akzeptanz hängt auch davon ab, wie groß das Angebot an Q+S-Fleisch in der<br />
nächsten Zeit sein wird. Und dazu muss die landwirtschaftliche Schiene beitragen.<br />
Aber auch viele Landwirte haben sich schon nach Q+S anerkennen lassen, und die Bereitschaft<br />
von weiteren Landwirten ist auch vorhanden.<br />
Wichtig ist in diesem Zusammenhang besonders, dass das Q+S-System von allen Beteiligten<br />
weiterhin „gelebt“ wird. Auch wenn keine Lebensmittelskandal den Markt beeinflussen,<br />
muss jeder in seinem Bereich die Dokumentation aktuell halten, um im Notfall einen lückenlosen<br />
Nachweis führen zu können.
24 Mitglieder und Verwaltungsorgane<br />
Mitglieder des Vorstandes<br />
Welling, Vorsitzender<br />
Haveresch<br />
Telefon Fax<br />
Gisbert Parkstraße 9 33034 Brakel-<br />
Hampenhausen<br />
05645/9180 05645/1893<br />
Willi Estern 52 48712 Gescher 02542/2599 02542/954819<br />
Heiming Bernhard Im Zitter 9 46286 Dorsten-<br />
Lembeck<br />
02369/98061 02369/98062<br />
Lödige jun. Werner Laakeweg 33 32839 Steinheim 05233/4775 05233/3913<br />
Rotgeri<br />
Mitglieder des Aufsichtsrates<br />
Ulrich Hölterweg 59 59590 Geseke 02942/6633 02942/6630<br />
Telefon Fax<br />
Bergerbusch,<br />
Vorsitzender<br />
Helmut Venn 27 46354 Südlohn 02563/98354 02563/98356<br />
Dietz Theo Kirchweg 3 59519 Möhnesee-<br />
Westrich<br />
02924/5137 02924/2047<br />
Grösbrink Franz Fichtenweg 48712 Gescher- 02863/1293 02863/380312<br />
18<br />
Hochmoor<br />
Hüppe Franz- Bevergerner 48477 Hörstel- 05459/9544 05459/9545<br />
Josef Str. 242<br />
Riesenbeck<br />
Laurenz Hermann Gut<br />
Lüttinghaus<br />
48607 Ochtrup 02553/4720 02553/3098<br />
Meiwes Heinrich Südeschweg<br />
60<br />
33397 Rietberg-Bokel 02944/1242 02944/587547<br />
Pries Albert Schirl 29 48346 Ostbevern 02532/7218 02532/963511<br />
75
76<br />
25 Mitarbeiter des ERW<br />
Ringberater Telefon Fax E-Mail<br />
Betzemeier, M. Karolinenweg 7 32805 Horn-Bad-<br />
Meinberg<br />
05234/69701 05234/69711 betzemeier@web.de<br />
Bosse, H. Albert-Schwei- 48268 Greven 02571/800185 02571/800186 Hans.Bosse@ttzer-Str.51online.de<br />
Debbert, B. Birkenweg 18 48291 Telgte 02504/6528 02504/6538 debbert@t-online.de<br />
Eling, F.-J. Oberm Rohlande<br />
100<br />
58710 Menden 02373/984607 02373/984608 Spitthof@t-online.de<br />
Henneke,H. Prof.-Jostes-Str.<br />
24<br />
49219 Glandorf 05426/5363 05426/5364<br />
Kemper, R. Lippstätter Str. 59581 Warstein- 02925/2136 02925/800832 Kemperrai-<br />
14<br />
Waldhausen<br />
ner@gmx.de<br />
Klüppel, J. Heidekamp 18 46325 Borken- 02861/901623 02861/901624 Josef.klueppel@t-<br />
Borkenwirthe<br />
online.de<br />
Knöppel, S. Lessingstr. 4 44147 Dortmund 0231/1898842 0231/1898801 knoeppel.45@gmx.de<br />
Lüke, P. Gropperweg 7 59929 Brilon 02961/8665 02961/52581 p.lueke@web.de<br />
Mönikes, M. Eggestr. 12 33178 Borchen-<br />
Dörenhagen<br />
Oenning, N. Borkenwirther 46325 Borken-<br />
Str. 58<br />
Weseke<br />
Raming, J. Alte Salzstr. 67 59069 Hamm-<br />
Rhynern<br />
Rößmann, E. Veilchengasse 46325 Borken-<br />
12<br />
Burlo<br />
05293/9229031 05293/9229030 Ma_Moenikes@hot<br />
mail.de<br />
02862/2694 02862/2154 n.oenning@tonline.de<br />
02385/3038 02385/68638<br />
02862/588407 02862/588408 elisabeth.roessmann@<br />
gmx. de<br />
02526/1573 02526/1562<br />
Suntrup, F. Sudfeld 9 48324 Sendenhorst<br />
Suntrup, W. Kantstr. 28 48324 Senden- 02526/1276 02526/950155 Wilhelm.Suntrup@t-<br />
horst<br />
online.de<br />
Tücking, S. Grütlohner Weg 46325 Borken 02861/600162 02861/91530 Tuecking-Borken@t-<br />
70<br />
online.de<br />
Wenning, R. Look 4 46354 Südlohn 02862/2398 02862/588202 R.Wenn@gmx.de<br />
Winkelkötter, Im Stuftei 5 59320 Ostenfelde 02524/4185 02524/3529 W.Winkelkoetter@t-<br />
W.<br />
online.de<br />
Wortmann, B. Spreewaldweg 8 48308 Senden 02597/8602 02597/5161 erw.wortmann@gmx<br />
.de<br />
Mitarbeiter der Geschäftsstelle Münster 02 51 / 28 50 10 E-Mail<br />
Niemann, C. Gelsbach 19 48477 Hörstel-Riesenbeck niemann@erw-wl.de<br />
Bartling, S. Hagebuttenweg 46 48341 Altenberge info@erw-wl.de<br />
Brand, I. Keplerstr. 11 48346 Ostbevern<br />
Freisfeld, G. Ostereckern 11 59387 Ascheberg freisfeld@erw-wl.de<br />
Hinken, R. Hansaring 67 48268 Greven hinken@erw-wl.de<br />
Johanning, S. Am Dewesberg 3 48496 Hopsten johanning@erw-wl. de<br />
Marks, M. Homerstr. 41 46348 Raesfeld marksrcg@aol.com<br />
Martin, M. Karl-Wagenfeld-Str. 10 49525 Lengerich martin@erw-wl.de<br />
Neue Ringberater (Stand 01.11.<strong>2002</strong>)<br />
Lordieck, T. Kreuzbauerschaft 48308 Senden- 02598/1488 02598/929456 T.Lordieck@t-<br />
11<br />
Ottmarsbocholt<br />
online.de<br />
Wernsmann, C. Ramsberg 33 48624<br />
02555/437 02555/984859 Christian.<br />
Schöppingen<br />
Wernsmann@tonline.de<br />
Schluse, R. Sommersstegge 4 46414 Rhede 02872/2688 02872/809951 Rainer_Schluse@<br />
yahoo.de