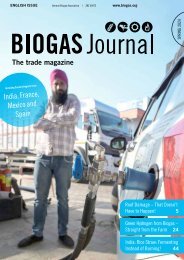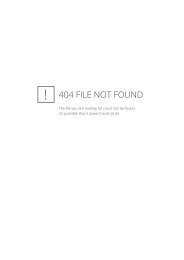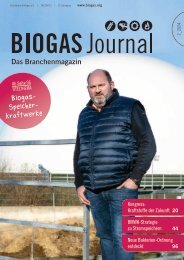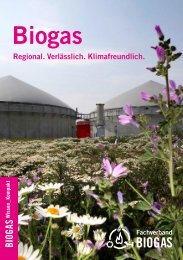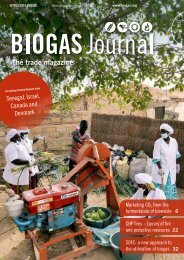4_2021 Leseprobe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
www.biogas.org Fachverband Biogas e.V. | ZKZ 50073 | 24. Jahrgang<br />
4_<strong>2021</strong><br />
BI<br />
GAS Journal<br />
Das Fachmagazin der Biogas-Branche<br />
Biokraftstoffe: THG-Quote<br />
steigt an S. 32<br />
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
R<br />
-<br />
ab<br />
Seite<br />
54<br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
Rohbiogas in der<br />
Metallurgie S. 102<br />
Philippinen: Biogas aus<br />
Ananasabfällen S. 120
INHALT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Alles aus einer Hand -<br />
Ihren Anforderungen entsprechend!<br />
Adsorber<br />
Produktion<br />
Flachbett- &<br />
Schüttbettadsorber<br />
auf Basis<br />
nachwachsender<br />
Rohstoffe<br />
Kunststoff &<br />
Edelstahl<br />
Aktivkohle-Wechsel<br />
kurze<br />
Reaktionszeit<br />
Entsorgung<br />
inkl. Nachweis<br />
kurze Lieferzeiten<br />
flexible<br />
Liefermengen<br />
Logistik<br />
Auslegung inkl.<br />
Standzeitberechnung<br />
Optimierungsberatung<br />
Qualitätskontrolle<br />
Service<br />
Labor<br />
Beladungsuntersuchung<br />
Natürlich besser!<br />
• Dotierte Aktivkohle<br />
zur Entschwefelung &<br />
Reinigung von technischen<br />
Gasen<br />
• entfernt zusätzlich in<br />
einem Schritt Siloxane,<br />
VOC´s und Mercaptane<br />
• hergestellt in Deutschland<br />
• lange Standzeiten, weniger<br />
Wechsel<br />
Sparen Sie Kohle und sichern Sie sich ihr Angebot!<br />
AdFiS products GmbH<br />
Am Kellerholz 14<br />
2<br />
D-17166 Teterow<br />
Telefon: +49 (0) 3996 15 97-0<br />
Fax: +49 (0) 3996 15 97-99<br />
E-Mail: sales@adfis.de<br />
web: www.adfis.de
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
EDITORIAL<br />
Positive Signale<br />
kurz vor der Wahl<br />
Liebe Leserinnen und Leser,<br />
die aktuelle Legislaturperiode der Großen Koalition neigt<br />
sich dem Ende entgegen. Ende Juni findet die letzte Sitzungswoche<br />
im Bundestag statt. Danach folgt ein intensiver<br />
Wahlkampf, bevor wir Bürger*innen zur Urne<br />
gebeten werden und über die politische Ausrichtung unseres<br />
Landes entscheiden dürfen. Auch die Biogasbranche<br />
fragt sich, welche Partei die Weichen im Sinne einer<br />
positiven Weiterentwicklung der Branche stellt.<br />
Eine Entscheidungshilfe beinhaltet diese Ausgabe des<br />
Biogas Journals ab Seite 34. Dort lesen Sie die Antworten<br />
von Politiker*innen zu Fragen zur Bundestagswahl.<br />
Leider haben nicht alle Parteien bis Redaktionsschluss<br />
geantwortet.<br />
Die Besonderheit unserer Branche ist, dass wir uns<br />
nicht nur auf Energiepolitik fokussieren können. Gleichermaßen<br />
haben die Umwelt- und Landwirtschaftspolitik<br />
Einfluss auf den Betrieb der Anlagen, unabhängig<br />
davon, ob die Anlagen Abfälle, Reststoffe wie Gülle und<br />
Mist oder nachwachsende Rohstoffe einsetzen. Umso<br />
spannender wird es nach der Wahl zu beobachten sein,<br />
welche Koalitionspartner sich finden werden und was<br />
im Koalitionsvertrag zur Entwicklung der Erneuerbaren<br />
Energien im Allgemeinen und zu Biogas im Besonderen<br />
enthalten sein wird.<br />
Aber noch wird nicht gewählt, und die bestehende Koalition<br />
hat im Bereich Energie- und Klimapolitik zum<br />
Ende hin nochmal Aktivität entfaltet – mit durchaus positiven<br />
Signalen für unsere Branche: So zeichnet sich<br />
beim EEG-Reparaturgesetz (siehe Artikel auf Seite 30)<br />
ab, dass die Bundesregierung die fehlerhafte Umsetzung<br />
des Flexzuschlags im EEG <strong>2021</strong> korrigiert. Betreiber<br />
von Biogasanlagen haben damit auch wieder in<br />
der Anschlussförderung einen Anspruch auf den Flexzuschlag,<br />
wie es im EEG 2017 bereits vorgesehen war<br />
und was Fortführungsperspektiven eröffnet. Das ist auf<br />
der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite hat die<br />
Politik durch das Hin und Her Vertrauen in der Branche<br />
verspielt – mal wieder.<br />
Positive Signale gibt es zudem im Mobilitätssektor. Die<br />
Umsetzung der RED II im Bundes-Immissionsschutzgesetz<br />
(BImSchG) eröffnet unserer Branche neue Optionen.<br />
Es wurden ambitionierte Treibhausgasquotenziele<br />
für 2030 verabschiedet, zu denen Biomethan einen wesentlichen<br />
Beitrag leisten kann und das mit Rahmenbedingungen,<br />
die wirtschaftliche Neu- und Umstellungskonzepte<br />
ermöglichen.<br />
Es ist also nicht alles negativ, was die aktuelle Bundesregierung<br />
auf den Weg gebracht hat. Eine klare Strategie<br />
zu Biogas sieht jedoch sicher anders aus, zumal<br />
neben der „wechselhaften“ Ausgestaltung der Förderbedingungen<br />
die neuen zusätzlichen Anforderungen an<br />
die Anlagen den Betrieb zunehmend erschweren. Auch<br />
deswegen ist der Schwerpunkt dieses Heftes Optionen<br />
zur Aufbereitung von Gärprodukten gewidmet. Auf der<br />
einen Seite, um Auflagen aus dem Dünge- und Genehmigungsrecht<br />
gerecht zu werden, und auf der anderen<br />
Seite, um neue Erlösoptionen zu erschließen.<br />
Was unsere Branche von der neuen Bundesregierung –<br />
unabhängig von der resultierenden Koalition – benötigt,<br />
sind konsistente Rahmenbedingungen, so dass die<br />
beispielsweise im EEG festgelegten Ziele auch in der<br />
Praxis umgesetzt werden können. Wir haben die Wahl,<br />
wem wir dies am ehesten zutrauen.<br />
Herzlichst Ihr<br />
Dr. Stefan Rauh,<br />
Geschäftsführer des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
3
INHALT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
Ṟ<br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
19<br />
EDITORIAL<br />
3 Positive Signale kurz vor der Wahl<br />
Von Dr. Stefan Rauh, Geschäftsführer<br />
des Fachverbandes Biogas e.V.<br />
AKTUELLES<br />
6 Meldungen<br />
8 Bücher<br />
10 Termine<br />
12 Biogas-Kids<br />
14 Abfallvergärungstag, Teil II<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
19 5. Bayerische Biogasfachtagung, Teil 2<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
26 BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
30 Reparatur des EEG <strong>2021</strong> abgeschlossen:<br />
Flexzuschlag gesichert!<br />
Von Jörg Schäfer<br />
32 Neue Chancen für Biogas und<br />
Biomethan im Kraftstoffsektor<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
34 Interviews zur Bundestagswahl<br />
CDU /CSU, SPD und Die Grünen<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
42 Biogas mit doppelter Wertschöpfung<br />
Von Bernward Janzing<br />
44 dena-Leitstudie „Aufbruch in<br />
die Klimaneutralität“: Angriff auf<br />
Planungshoheiten (?)<br />
Von Heinz Wraneschitz<br />
50 Wasserstoff ersetzt Steinkohle<br />
Von Dierk Jensen<br />
TITELTHEMA<br />
54 Stickstoff eliminieren, Phosphor<br />
mit Feststoff exportieren<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
62 Technologie-Kaskade zerlegt<br />
Wirtschaftsdünger<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH)<br />
Martin Bensmann<br />
68 „Dampfveredelung“ des Gärrests<br />
Von Christian Dany<br />
PRAXIS<br />
72 Aufbereitung von Gärresten und<br />
KWK-Bonusfähigkeit<br />
Von Dipl.-Ing. Univ. Arnold Multerer<br />
76 Redispatch 2.0 – Ein nächster Schritt zur<br />
Systemintegration Erneuerbarer Energien<br />
Von M.Sc. Florian Strippel<br />
80 Optimierter Betrieb im<br />
Regelleistungsmarkt<br />
Von Thomas Gaul<br />
4
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INHALT<br />
TITELFOTO: MARTIN BENSMANN I FOTOS: MARTIN BENSMANN, WERKBILD, ADOBE STOCK_YURII ZUSHCHYK UND FACHVERBAND BIOGAS E.V.<br />
90 132<br />
84 Mit VisuFlex Flexibilität sichtbar machen<br />
Von Thomas Gaul<br />
86 Biomethan<br />
Wie weiter ohne vermiedene<br />
Netzentgelte?<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
90 Mit intensiver Wärmenutzung sinkende<br />
Stromerlöse kompensieren<br />
Von Rainer Casaretto und Dr. Petra Rabe<br />
94 Wärme aus Biogas, Holz und Wind<br />
Von Christian Dany<br />
100 Anlagen des Monats<br />
WISSENSCHAFT<br />
102 Untersuchungen zum Direkteinsatz von<br />
Biogas in Metallurgiebetrieben<br />
Von Elisabeth Grube, Patrick Heinrich,<br />
Marcus Röder und Nico Steyer<br />
106 Bakterien auf der Spur – neues Verfahren<br />
zur Kontrolle der Prozessbiologie<br />
Von Dr. Sabine Peters, Ulrich Krause und Dr.<br />
Stefan Dröge<br />
114 „Gazelle“ weist nach: Modellgestütztes<br />
Fütterungsmanagement ermöglicht<br />
flexible Prozessführung<br />
Von Eric Mauky, Manuel Winkler,<br />
Christian Krebs, Ulf Müller, Dirk Rabe,<br />
Sören Weinrich und Jörg Kretzschmar<br />
INTERNATIONAL<br />
Philippinen<br />
120 Umwandlung von Ananasabfällen<br />
in Biogas<br />
Von Medina Berbic<br />
Südkorea<br />
123 Mandarinensaftproduktion – aus<br />
Reststoffen wird Biogas gewonnen<br />
Von Achim Kaiser<br />
VERBAND<br />
Aus der Geschäftsstelle<br />
124 Aktionismus zum Ende der<br />
Legislaturperiode<br />
Von Dr. Stefan Rauh und<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
128 Regionales<br />
130 Jetzt sozial gerechte CO 2<br />
-Bepreisung<br />
auf den Weg bringen<br />
Von Dr. Simone Peter, BEE<br />
132 Dreharbeiten für die Aktionswoche<br />
Artenvielfalt<br />
RECHT<br />
134 Stellungnahme zum KWK-Bonus bei<br />
Holztrocknung und Handlungsempfehlung<br />
zum Flexibilitätszuschlag für Biogasbestandsanlagen<br />
Von Birthe Kaps und Martin Teichmann<br />
PRODUKTNEWS<br />
136 Produktnews<br />
138 Impressum<br />
Beilagenhinweis:<br />
Das Biogas Journal enthält Beilagen<br />
der Firmen Emission Partner<br />
und ONERGYS .<br />
5
AKTUELLES<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Zuckerhirse: Süßes versprechen<br />
für die Umwelt<br />
Die von Forschenden<br />
des KIT entwickelte<br />
Hirsesorte KIT1 akkumuliert<br />
sehr viel Zucker<br />
und gedeiht besonders<br />
gut unter gemäßigten<br />
Klimabedingungen.<br />
Karlsruhe – Zuckerhirse lässt sich zur Herstellung von<br />
Biogas, Biokraftstoffen und neuen Polymeren nutzen.<br />
Zudem kann sie dazu beitragen, Phosphatdünger zu<br />
ersetzen. Eine am Karlsruher Institut für Technologie<br />
(KIT) entwickelte neue Zuckerhirsesorte akkumuliert<br />
besonders viel Zucker und gedeiht unter heimischen<br />
Bedingungen.<br />
Wie die Forschenden in der Zeitschrift Industrial Crops<br />
& Products berichten, hängen der Zuckertransport und<br />
die Zuckerakkumulation mit dem Bau der Leitungsbahnen<br />
der Pflanzen zusammen. Dies ergab ein Vergleich<br />
zwischen Zucker- und Körnerhirse. Eine Strategie, den<br />
Treibhausgasausstoß zu verringern, besteht darin, sogenannte<br />
C4-Pflanzen anzubauen. Diese betreiben besonders<br />
effizient Photosynthese, binden daher Kohlendioxid<br />
(CO 2<br />
) besser und bauen mehr Biomasse auf als<br />
andere Pflanzen. Gewöhnlich sind sie an sonnige und<br />
warme Standorte gebunden.<br />
Zu den C4-Pflanzen gehört die Sorghumhirse, auch<br />
Mohrenhirse genannt, eine Hirseart aus der Gattung<br />
Sorghum in der Familie der Süßgräser. Die besonders<br />
zuckerhaltigen Sorten heißen Zuckerhirse. Zu den weiteren<br />
Sorten gehört die als Futtermittel eingesetzte<br />
Körnerhirse. Sorghumhirse lässt sich auf schwer zu bewirtschaftenden<br />
sogenannten Grenzertragsflächen anbauen,<br />
sodass sie nicht mit sonstigen Nahrungs- oder<br />
Futterpflanzen in Konkurrenz tritt.<br />
Eine neue Zuckerhirsesorte namens KIT1 hat Dr. Adnan<br />
Kanbar in der Arbeitsgruppe Molekulare Zellbiologie<br />
unter Leitung von Professor Peter Nick am Botanischen<br />
Institut des KIT entwickelt. KIT1 akkumuliert<br />
besonders viel Zucker und gedeiht besonders gut unter<br />
gemäßigten Klimabedingungen. Sie lässt sich sowohl<br />
energetisch zur Herstellung von Biogas und Biokraftstoffen<br />
als auch stofflich zur Produktion neuer Polymere<br />
nutzen. Der geschätzte Zuckerertrag je Hektar<br />
liegt bei über 4,4 Tonnen, was knapp 3.000 Litern Bioethanol<br />
entspräche. Darüber hinaus lassen sich die bei<br />
der Biogasherstellung anfallenden Gärreste als Dünger<br />
nutzen, der den knapp werdenden Phosphatdünger ersetzen<br />
kann.<br />
Auf die Anatomie des Pflanzenstängels<br />
kommt es an<br />
Forschende im Nick-Labor am Institut für Angewandte<br />
Biowissenschaften und am Institut für Technische Chemie<br />
des KIT sowie bei der ARCUS Greencycling Technology<br />
in Ludwigsburg haben nun die Zuckerhirsesorte<br />
KIT1 und die Körnerhirsesorte Razinieh miteinander<br />
verglichen, um die unterschiedliche Zuckerakkumulation<br />
im Pflanzenstängel zu untersuchen.<br />
Dazu zählen die verdickten Bereiche oder Knoten (Nodien)<br />
und die schmalen Bereiche oder Abstände zwischen<br />
den Knoten (Internodien), aber auch Transkripte<br />
wichtiger Saccharose-Transporter-Gene sowie Stressreaktionen<br />
der Pflanzen bei hoher Salzkonzentration im<br />
Boden. Sowohl bei KIT1 als auch bei Razinieh war die<br />
Zuckerakkumulation in den mittleren Internodien am<br />
höchsten.<br />
Allerdings zeigte sich ein Zusammenhang zwischen der<br />
Zuckerakkumulation und dem Bau der Leitungsbahnen,<br />
die dem Transport von Wasser, gelösten Stoffen<br />
und organischen Substanzen dienen. Die Leitungsbahnen<br />
sind zu Leitbündeln gruppiert. Diese bestehen aus<br />
dem Phloem (Bastteil) und dem Xylem (Holzteil). Im<br />
Phloem werden vor allem Zucker und Aminosäuren, im<br />
Xylem vor allem Wasser und anorganische Salze transportiert;<br />
zudem übernimmt das Xylem eine stützende<br />
Funktion.<br />
Die Untersuchung ergab, dass bei KIT1 und fünf<br />
weiteren Zuckerhirsesorten im Stängel die Phloem-<br />
Querschnittsfläche wesentlich größer als die Xylem-<br />
Querschnittsfläche ist – der Unterschied ist viel ausgeprägter<br />
als bei der Körnerhirsesorte Razinieh. „Unsere<br />
Studie ist die erste, die sich mit dem Zusammenhang<br />
zwischen dem Bau der Leitbündel und der Zuckerakkumulation<br />
im Stängel befasst“, sagt Nick.<br />
Wie die Studie weiter ergab, führte Salzstress zu höherer<br />
Zuckerakkumulation in KIT1 als in Razinieh. Die<br />
Expression von Saccharose-Transporter-Genen ist in<br />
den Blättern von KIT1 unter normalen Bedingungen<br />
höher und steigt unter Salzstress deutlich an. „Neben<br />
den anatomischen Faktoren könnten auch molekulare<br />
Faktoren die Zuckerakkumulation im Stängel regulieren“,<br />
erläutert Kanbar. „Auf jeden Fall kommt KIT1 mit<br />
Salzstress besser zurecht.“<br />
FOTO: BOTANISCHES INSTITUT, KIT<br />
6
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
Wiegand-Glas produziert mit<br />
Biomethan von bmp greengas<br />
FOTO: WIEGAND-GLAS<br />
München / Steinbach am Wald – Die bmp greengas<br />
GmbH, einer der führenden Biomethan-<br />
Vermarkter Europas, und die Wiegand-Glas<br />
Unternehmensgruppe, Spezialist für hochwertige<br />
Verpackungskonzepte, haben eine<br />
Zusammenarbeit im Bereich der Glasproduktion<br />
beschlossen. Nachdem die soulproducts<br />
GmbH den Wunsch geäußert hat, ihre<br />
Glastrinkflaschen künftig mit Biomethan zu<br />
produzieren, wird Wiegand-Glas seit Februar<br />
<strong>2021</strong> von bmp greengas beliefert. Die<br />
soulbottles werden nun ausschließlich mit<br />
dem grünen Gas produziert und die CO 2<br />
-<br />
Emissionen damit deutlich gesenkt.<br />
Das Angebot der klimaneutralen Glasflaschen<br />
ist Teil des „Eco2Bottle“-Konzeptes,<br />
einer Initiative von Wiegand-Glas für noch<br />
umweltverträglichere Verpackungslösungen.<br />
Was im Jahr 2020 als Maßnahmenpaket<br />
mit zusätzlichem Kompensationsangebot<br />
für Weinflaschen begann, ist nun<br />
um die Flaschenproduktion unter anderem<br />
für die soulproducts GmbH mit Biomethan<br />
erweitert worden.<br />
„Unsere Kundin soulproducts GmbH steht<br />
mit ihren soulbottles für nachhaltige, plastikfreie<br />
und stylische Trinkflaschen. Ihre<br />
Anfrage nach einer Umstellung der Produktion<br />
auf Biomethan war der Anlass für<br />
uns, unser Konzept ‚Eco2Bottle‘ nochmals<br />
zu überarbeiten und eine durch und durch<br />
grüne und regionale Flaschenproduktion<br />
anzubieten“, berichtet Lukas Neubauer,<br />
Leiter Controlling & Unternehmensentwicklung<br />
bei Wiegand-Glas. „Wir setzen<br />
nun für alle soulbottles neben recyceltem<br />
Glas außerdem Biomethan im Produktionsprozess<br />
ein. So haben wir den CO 2<br />
-Fußabdruck<br />
des Endprodukts nochmal signifikant<br />
reduziert.“<br />
Das lässt sich im Falle der soulbottles auch<br />
in Zahlen ausdrücken: Durch den Einsatz<br />
von Biomethan werden – zusammen mit<br />
erhöhtem Altglaseinsatz, einer optimierten<br />
Transportverpackung und der Nutzung von<br />
Ökostrom – die Emissionen im Vergleich<br />
zur ursprünglichen 1,0-Liter-soulbottle um<br />
mehr als 75 Prozent reduziert.<br />
„Wir optimieren unsere Produktion seit<br />
Jahren kontinuierlich, um unsere Emissionen<br />
zu senken. Der Umstieg auf Biomethan<br />
bei der Glasherstellung ist ein<br />
absoluter Meilenstein für uns“, sagt Julian<br />
Offermann, Einkäufer bei der soulproducts<br />
GmbH. „Wir freuen uns, dass wir unseren<br />
langjährigen Partner Wiegand-Glas so<br />
schnell von der Idee überzeugen konnten<br />
und sie das Eco2Bottle-Konzept um unser<br />
Produkt erweitert haben.“ Um die Beschaffung<br />
und Vermarktung des Biomethans<br />
kümmert sich die bmp greengas GmbH.<br />
Dabei werden sämtliche Anforderungen<br />
von Wiegand-Glas und soulproducts erfüllt:<br />
Das grüne Gas entsteht aus Siedlungsabfällen<br />
und ist damit ein perfektes Beispiel für<br />
funktionierende Kreislaufwirtschaft. Zudem<br />
stammt das Biomethan aus Deutschland<br />
und schafft damit bereits bei der Herstellung<br />
und beim Transport eine CO 2<br />
-arme<br />
Wertschöpfungskette.<br />
„Das Schmelzen von Glas und die Herstellung<br />
von Glasverpackungen sind enorm<br />
energieaufwändig“, sagt Regina Hafner,<br />
bei bmp greengas für Industriekunden verantwortlich.<br />
„Glashütten wie Wiegand-Glas<br />
unterliegen der gesetzlich verpflichtenden<br />
CO 2<br />
-Abgabe im Rahmen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes<br />
(BEHG) und des<br />
europäischen Emissionshandels (EU-ETS).<br />
Die Umstellung einzelner Produktionslinien<br />
von fossilen Rohstoffen auf Biomethan<br />
befreit teilweise von den genannten CO 2<br />
-<br />
Abgaben und leistet einen wesentlichen<br />
Beitrag zum Schutz des Klimas. Das Handeln<br />
von Wiegand-Glas und soulproducts<br />
zeigt, dass Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz<br />
keine Gegensätze sein müssen.“<br />
7
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
BÜCHER<br />
Was hat die Mücke je für uns getan?<br />
Sobald es im Frühjahr warm wird, schwirren sie durch<br />
die Luft – manchmal schon bei warmem Wetter im Februar.<br />
Und sie verschwinden erst wieder für ein paar Monate,<br />
wenn es im Herbst kalt wird. An Sommerabenden<br />
tanzen sie in Schwärmen im Abendrot und kündigen<br />
gutes Wetter für den nächsten Tag<br />
an. Wenn sie uns aber an schönen<br />
Abenden im Garten oder auf der<br />
Terrasse stechen und uns den<br />
Nachtschlaf rauben, dann verwünschen<br />
wir sie sicherlich jedes<br />
Mal: Die Rede ist von Mücken.<br />
Schon oft habe ich mich gefragt,<br />
welchen biologischen Sinn diese<br />
Quälgeister haben.<br />
Die Autorinnen Frauke Fischer<br />
und Hilke Oberhansberg haben<br />
ein Buch darüber geschrieben<br />
mit dem schönen Titel: „Was hat<br />
die Mücke je für uns getan?“. Sie<br />
erklären darin, was biologische<br />
Vielfalt für unser Leben bedeutet.<br />
Der Naturfilmer und Buchautor<br />
Dirk Steffens schreibt im Vorwort,<br />
dass von allen lebenden Säugetieren<br />
nur 4 Prozent Wildtiere sind.<br />
Die anderen 96 Prozent seien Menschen und Haustiere.<br />
Seit 1970 habe der Mensch die Zahl der Wirbeltiere<br />
auf der Erde um 60 Prozent reduziert. Die Vielfalt an<br />
Arten sei die Voraussetzung für das Funktionieren von<br />
Ökosystemen, von deren Leistungen unser aller Leben<br />
abhänge.<br />
Das Buch ist in drei Hauptteile mit insgesamt 12 Kapiteln<br />
gegliedert. Im ersten Teil werden Fragen erörtert<br />
wie zum Beispiel, was Biodiversität ist, wie Arten<br />
entstehen beziehungsweise warum sie verschwinden.<br />
Die Autorinnen führen aus, was Ökosysteme sind und<br />
warum sie für die Menschen so wichtig sind. In Kapitel<br />
2 vergleichen sie unter anderem verschiedene Regionen<br />
anhand der vorkommenden Arten. Anhand von fünf<br />
Punkten erklären sie aufschlussreich die Ursachen für<br />
die Veränderung von Ökosystemen.<br />
Im zweiten Teil des Buches, der sieben Kapitel enthält,<br />
werden vor allem die Zusammenhänge zwischen Biodiversität<br />
und Essen, Gesundheit, Sicherheit, Stadt,<br />
Reisen, Energie und Technik thematisiert. Und dort,<br />
auf Seite 65, wird dann endlich auch die Frage des<br />
Buchtitels beantwortet: Sie spielen „eine wichtige Rolle<br />
im Word Wide Web of Life. Tausende von Mückenarten<br />
und Abermillionen von Individuen sind wichtige<br />
Nahrung für Vögel, Fledermäuse, Fische, Reptilien<br />
und Amphibien. Ohne Mücken hätten die es schwer.<br />
[…] Aber nicht nur als Nahrung für andere Tiere erfüllen<br />
Mücken wichtige ökologische Aufgaben. Sie<br />
sind auch Bestäuber vieler Nutzpflanzen. Weil jede<br />
Blüte anders aussieht, brauchen<br />
Blüten ein möglichst vielfältiges<br />
Set verschiedener Bestäuber –<br />
Bienen allein reichen da nicht.“<br />
Aber das war dann auch schon<br />
die Erläuterung im Wesentlichen.<br />
Im Mittelpunkt des zweiten Teils<br />
steht nicht die Mücke als singuläres<br />
Lebewesen, sondern Hauptthema<br />
sind Ökosysteme und deren<br />
Erhaltung und Schutz, aber auch<br />
die Auswirkungen menschlichen<br />
Handelns auf diese. Es ist also das<br />
Credo der Biodiversität.<br />
Teil III mit drei Kapiteln beendet<br />
die Ausführungen. Zu Beginn des<br />
10. Kapitels stellen die Autorinnen<br />
die Frage nach der Moral von<br />
der Geschichte. Das heißt, wenn<br />
also Biodiversität und Ökosysteme<br />
für die Menschheit so wichtig<br />
sind, sind dann nur die schützenswert, die dem Wohl<br />
der Menschen dienen? Darf dann, was den Menschen<br />
nicht nützt, den Bach runtergehen? Und eine weitere<br />
wichtige Frage stellen die Autorinnen: Muss denn alles<br />
in der Natur zu unserem Nutzen existieren und daraus<br />
erst seine Existenzberechtigung erhalten?<br />
Das Buch macht deutlich, dass der Mensch mit seinem<br />
Ökosystem Erde kooperieren muss und es eben nicht<br />
gnadenlos ausbeuten kann. Und: dass auch „Plagegeisterarten“<br />
wie die Mücke einen Wert haben. Dass<br />
vom Menschen ungenutzte Naturräume geschützt werden<br />
müssen. Dass in Anspruch genommene Naturräume<br />
weniger intensiv genutzt werden und gegebenenfalls<br />
revitalisiert werden müssen. Der Menschheit wird<br />
es in Zukunft nur gutgehen und sie wird langfristig nur<br />
überleben, wenn sie ihre Art der kriegerischen Ausbeutung<br />
der Ökosysteme aufgibt.<br />
Rezension: Martin Bensmann<br />
Oekom Verlag, München. Frauke Fischer und<br />
Hilke Oberhansberg, 2. Auflage, 2020, 219 Seiten,<br />
Klebebindung, zahlreiche farbige Bilder und Grafiken.<br />
D: 20,00 Euro. A: 20,60 Euro.<br />
ISBN: 978-3-96238-209-4<br />
8
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
clean air is our engine<br />
AKTUELLES<br />
KATALYSATOREN<br />
Katalysatormontage an<br />
Jenbacher 312-BHKW leicht gemacht<br />
M A D E<br />
I N<br />
G E R M A N Y<br />
Ab Lager verfügbar!<br />
Art.-Nr. 1496<br />
EP-AL 514-75-2-2.1-AWT<br />
Standardkatalysator für Jenbacher 312,<br />
Einsatz von zwei Katalysatoren und<br />
einer Leerhülse<br />
1.925,00 € pro Stück zzgl. USt.<br />
Montageset bestehend aus:<br />
Passenden Dichtungen,<br />
Schrauben, Plombenset,<br />
Handschuhen, Drahtbürste<br />
und Kupferpaste<br />
Art.-Nr. 2952<br />
EP-AL 496-120-3-2.1-ME387-<br />
FL519-S inkl. Montageset<br />
passend für EnviTec Jenbacher<br />
mit 525 kW Vorkammer<br />
3.095,00 € zzgl. USt.<br />
ANGEBOT<br />
Weitere Informationen sowie das Montagevideo<br />
für die Abgaswärmetauscher finden Sie in<br />
unserem Onlineshop www.bhkwteile.de.<br />
Sie sind interessiert<br />
an einem Angebot?<br />
Dann melden Sie sich unter<br />
info@emission-partner.de<br />
oder +49 4498 92 326 - 26<br />
Möchten Sie es doch lieber<br />
professionell montieren lassen?<br />
Dann melden Sie sich<br />
bei unserem Service unter<br />
service@emission-partner.de<br />
oder +49 4498 92 326 - 111<br />
oder MONTAGE?<br />
Emission Partner GmbH & Co. KG<br />
Industriestraße 5<br />
D-26683 Saterland-Ramsloh<br />
Telefon: +49 4498 92 326 - 26<br />
E-Mail: info@emission-partner.de<br />
Web: www.emission-partner.de9
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
TERMINE<br />
21. Juli<br />
12. Biogastagung: Biogas – da geht noch was!<br />
Online<br />
https://www.lwk-niedersachsen.de<br />
16. September<br />
3. Bayerischer Biogas-Branchentreff<br />
Straubing<br />
www.biogas-branchentreff.de<br />
16. September<br />
Web-Seminar: „Biogene Rest- und Abfallstoffe<br />
in Australien – Marktentwicklung und Geschäftschancen<br />
für deutsche Unternehmen“<br />
Online<br />
www.german-energy-solutions.de<br />
22. und 23. September<br />
Handelsblatt Jahrestagung<br />
Gas <strong>2021</strong><br />
Online<br />
www.handelsblatt-gas.de<br />
22. bis 24. September<br />
International Online Conference<br />
“Progress in Biogas V”<br />
Kirchberg<br />
ibbk-biogas.com<br />
23. September<br />
5. Norddeutscher Biogas-Branchentreff<br />
Rendsburg<br />
www.biogas-branchentreff.de<br />
7. Oktober<br />
TRwS 793-1 – Biogasanlagen (Regelwerk<br />
aktuell) Web-Seminar<br />
Online<br />
eva.dwa.de<br />
27. und 28. Oktober<br />
The Future of Renewable Energy<br />
www.acieu.net<br />
Diese und weitere Termine rund um die<br />
Biogasnutzung in Deutschland und der Welt<br />
finden Sie auf der Seite www.biogas.org<br />
unter „Termine“.<br />
Digital<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
Im 31. Jahr geht die BIOGAS Convention<br />
& Trade Fair erneut neue Wege!<br />
Wir wollen den Wünschen unserer<br />
Besucher und Teilnehmer, Mitglieder<br />
und Aussteller entsprechen: Die<br />
Messe soll live stattfinden, die Tagung<br />
digital. Daher sind wir dieses Jahr auf<br />
beiden Wegen für Sie da:<br />
www.biogas-convention.com<br />
29. Juli<br />
Web-Seminar: Vorbereitung EEG-<br />
Ausschreibungen September <strong>2021</strong><br />
5. August<br />
Web-Seminar: Vorbereitung EEG-<br />
Ausschreibungen September <strong>2021</strong><br />
21. Oktober<br />
Web-Seminar: Prüf- und Dokument a-<br />
tionspflichten – Ein Überblick<br />
22./<br />
23.<br />
Sep<br />
DIGITAL<br />
EDITION<br />
Handelsblatt Jahrestagung<br />
Gas <strong>2021</strong><br />
Jetzt anmelden:<br />
www.handelsblatt-gas.de<br />
Brückentechnologie oder<br />
klimaneutrale Zukunft<br />
• Politische und strategische<br />
Positionierung<br />
• Supply & Demand im Gasmarkt –<br />
globale Aspekte<br />
• Gas als Energieträger im<br />
Strommarkt<br />
• Wasserstoff: Game Changer der<br />
Energiewende?<br />
10
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
11
BIOGAS-KIDS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Bio + Bio = doppelt gut<br />
Familie Kückmann mit den Kindern Lotta und Mats, Foto: Andrea Schneider<br />
Mein Experiment<br />
An den Feldrändern blühen jetzt<br />
wieder rot leuchtende Mohnblüten.<br />
Aus deren Blütenblättern lässt<br />
sich ganz einfach Wasserfarbe<br />
herstellen. Die Farbstoffe in der<br />
Mohnblüte sind wasserlöslich<br />
und werden durch Zerreiben der<br />
Blütenblätter freigesetzt.<br />
Du benötigst: eine Handvoll roter<br />
Mohnblüten-Blätter, einen Mörser, etwas feinen Sand, ein paar<br />
Tropfen Wasser, ein Glas und ein Teesieb.<br />
Du reißt die Blütenblätter mit der Hand in kleine Stücke und gibst<br />
sie zusammen mit dem Sand und etwas Wasser in den Mörser. Mit<br />
dem Stein oder Stößel werden die Blütenblätter zerrieben, bis ein<br />
roter Saft entsteht. Je mehr Tropfen Wasser du hinzugibst, desto<br />
mehr Farbe erhältst du. Nimmst du weniger Wasser, wird die<br />
Farbe kräftiger. Hänge das Teesieb in ein hohes Glas und gib den<br />
Blütensaft hinein. Im Glas befindet sich nun die reine dunkelrote<br />
Farbe. Nimm einen Pinsel und Papier und probiere die Farbe aus.<br />
Das Rot dunkelt sehr schnell nach, deshalb ist die Farbe auf dem<br />
Papier nicht mehr so leuchtend rot, sondern lila!<br />
Bei den landwirtschaftlichen Betrieben gibt es ja durchaus<br />
Unterschiede. Gemeint sind nicht Milchvieh- oder Ackerbaubetriebe.<br />
Vielmehr redet man auf der einen Seite von<br />
den konventionellen Betrieben, die auf ihren Feldern<br />
chemische Pflanzenschutzmittel oder Mineraldünger einsetzen.<br />
Auf der anderen Seite sind es die Bio-Betriebe, die<br />
das nicht dürfen und auch sonst strenge Regeln beachten<br />
müssen, damit sie ihre Produkte mit einem Bio-Siegel<br />
verkaufen können. Dürfen die denn auch Biogas erzeugen?<br />
Die Antwort ist ein klares Ja – schließlich passen<br />
ökologische Bewirtschaftung und umweltfreundliche<br />
Energieerzeugung hervorragend zusammen. Bestes Beispiel<br />
dafür ist der Sandsteinhof von Familie Kückmann in<br />
Havixbeck im Münsterland. Der Biolandbetrieb (Bioland<br />
ist einer der wichtigen ökologischen Anbauverbände) betreibt<br />
seine Biogasanlage seit 2010. Von der ökologischen<br />
Bewirtschaftung profitieren auch die Biogas-Bakterien.<br />
Sie werden vielseitig mit Silomais und Kleegras sowie<br />
mit Rinder-, Schweine- und Pferdemist gefüttert. Dazu<br />
kommt Jauche von anderen Bio-Betrieben. In zwei Blockheizkraftwerken<br />
(BHKW) wird aus dem Biogas Energie<br />
erzeugt. Eines arbeitet direkt am Hof und produziert<br />
Strom. Das Zweite steht in der Nachbarschaft. Eine soziale<br />
Einrichtung für Behinderte nutzt die im BHKW erzeugte<br />
Wärme. Das Heim kann so seinen Wärmebedarf zu einem<br />
Drittel – ebenfalls ökologisch – aus Biogas decken. Insgesamt<br />
erzeugen die Kückmanns<br />
mit ihrer Anlage pro Jahr 3,5 Millionen<br />
Kilowatt-Stunden (kWh)<br />
Strom und 1,5 Millionen kWh<br />
Wärme. In der Summe vermeidet<br />
die Biogasanlage damit pro Jahr<br />
3.850 Tonnen klimaschädliches<br />
CO 2 . Und weil der Sandsteinhof<br />
auch ein Ferienhof ist, zeigen<br />
die Kückmanns ihren Gästen immer gerne, wie gut die<br />
Bio-Landwirtschaft in Verbindung mit der Biogas-Erzeugung<br />
für den Betrieb und für uns alle ist. Schau dir am<br />
besten mal das Video mit Herrn Kückmann an.<br />
Spiel die Energiewende!<br />
Der richtige Weg für die Energiewende<br />
und mehr Erneuerbare Energien?<br />
Das kannst du auch spielerisch<br />
mit Freunden oder in der<br />
Schule erleben – mit dem<br />
„Energie wende-Kompass“.<br />
Das Spiel gibt es kostenlos als<br />
Download. Einfach ausdrucken,<br />
Vorlagen ausschneiden<br />
und richtig zusammenkleben.<br />
Fertig ist der Kompass und<br />
du kannst loslegen, in welche<br />
Richtung du die Energiewende haben<br />
willst. Dabei geht es auch um Stromnetze,<br />
Wärme kraftwerke und Energieeffizienz.<br />
Das wäre doch ein super Tipp<br />
für deine Schulklasse! Den Download<br />
für den Energiewende-Kompass und<br />
andere Spiele findest du auf der Seite<br />
www.energie-macht-schule.de. Oder<br />
nutze gleich den QR-Code.<br />
www.agrarkids.de<br />
Landwirtschaft entdecken und verstehen –<br />
Die Fachzeitschrift für Kinder<br />
12
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Motortausch<br />
auf dc13 ETA<br />
AKTUELLES<br />
Jetzt<br />
schlägt´s 13!<br />
SParen Sie Bis<br />
zu 15.000 EUR<br />
pro Jahr !<br />
Aus Alt wird Effizient! Jetzt auf den<br />
neuen SCANIA DC13 ETA umbauen<br />
und bis zu 43 % Wirkungsgrad<br />
realisieren!<br />
Wirkungsgrad<br />
bis zu 43 %<br />
Erneuern Sie Ihr BHKW mit SCANIA DC12 oder Doosan V8 Motor mit unseren<br />
cleveren Upgrade-Varianten auf den neuen SCANIA DC13 ETA. Sagenhafte 43 %<br />
Wirkungsgrad bei 265 kW el<br />
Leistung verbessern die Rentabilität Ihrer Biogasanlage<br />
deutlich.<br />
„ETA“ steht für einen von agriKomp weiterentwickelten SCANIA DC13 Motor, der<br />
in Sachen Wirkungsgrad keine Kompromisse macht. In Zusammenarbeit mit uns<br />
wurden etliche Pakete auf SCANIA DC13 ETA entwickelt, die exklusiv nur bei uns<br />
erhältlich sind. Neben Komplettumbausets sowie Tauschmotoren für die oben<br />
genannten Aggregate bieten wir Ihnen auch individuelle Performance-Sets an,<br />
um den höheren Wirkungsgrad auch bei den Kunden realisieren zu können, die<br />
bereits erfolgreich mit uns auf einen DC13-Gasmotor umgebaut haben.<br />
Mehr Informationen finden Sie unter DC13eta.serviceunion.de.<br />
Rendsburg<br />
Pritzwalk<br />
Verschiedene Gründe sprechen für eine Optimierung:<br />
Ahaus<br />
Neustadt a. r.<br />
Höherer Wirkungsgrad<br />
Erhöhte Verfügbarkeit durch<br />
geringere Standzeiten<br />
Wechsel auf moderne emissionsoptimierte<br />
Mehr<br />
Infos?<br />
Bannberscheid<br />
Merkendorf<br />
Sangershausen<br />
Gas-Otto Technologie<br />
BODNEGG<br />
Wartungs- und Substratkosten senken<br />
Verbrennungsoptimiert durch<br />
verbesserte Kolben<br />
Geringere Abgastemperatur<br />
Ihr Regionaler Partner. Rund um Biogas. Bundesweit.<br />
Bundesweit!<br />
HOTLINE:<br />
09826 65959 - 911<br />
13
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
ABFALLVERGÄRUNGSTAG, TEIL II<br />
Wechsel in neue<br />
Vergütungsperiode<br />
genau planen<br />
Im neuen EEG <strong>2021</strong><br />
hatte der Gesetzgeber<br />
die Inanspruchnahme<br />
des Flexzuschlags<br />
gestrichen, wenn in der<br />
ersten Vergütungsperiode<br />
die Flexprämie<br />
schon beansprucht<br />
worden ist. Mittlerweile<br />
hat die Politik<br />
aufgrund von starken<br />
Argumenten aus der<br />
Biogasbranche diese<br />
Regelung korrigiert.<br />
In dieser Ausgabe des Biogas Journals setzen wir die Berichterstattung über den Abfallvergärungstag<br />
fort. An dieser Stelle werden die Ausführungen bezüglich der Auswirkungen des<br />
EEG <strong>2021</strong> für Abfallvergärungsanlagen thematisiert.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Rechtsanwalt Dr. Helmut Loibl referierte<br />
zum Thema „Welche Chancen und Risiken<br />
bringt das EEG <strong>2021</strong> für Abfallvergärungsanlagen?“.<br />
Er eröffnete seinen Vortrag mit<br />
dem wichtigen Hinweis, dass es sowohl für<br />
Bestandsanlagen, die am Ende ihrer ersten Vergütungsperiode<br />
angelangt sind, als auch für Neuanlagen zwei<br />
Ausschreibungstermine pro Jahr gibt: Der erste Termin<br />
ist der 1. März und der zweite Termin ist der 1. September.<br />
Außerdem sei das Ausschreibungsvolumen erhöht worden.<br />
Jetzt würden insgesamt 600 Megawatt (MW) an<br />
Leistung pro Jahr ausgeschrieben – 300 MW zur Frühjahrs-<br />
und 300 MW zur Herbstausschreibung. Zudem<br />
sei die Vergütung angehoben worden, für Bestandsanlagen<br />
auf 18,4 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) und<br />
für Neuanlagen auf 16,4 ct/kWh. Ab 2022 unterliege<br />
die Vergütung einer Degression von 1 Prozent pro Jahr.<br />
Einen Zuschlag gebe es für Kleinanlagen, die es im<br />
Abfallbereich sicher so nicht gibt. „Wenn Anlagen bis<br />
500 kW installierte Leistung in den nächsten Jahren<br />
in die Ausschreibung gehen, dann erhalten sie 0,5 ct/<br />
kWh zusätzlich. Allerdings müssen die Anlagen ihre<br />
installierte Leistung mehr als doppelt überbauen. Das<br />
heißt, über 100 kW installierte Leistung bekomme ich<br />
nur für maximal 45 Prozent der installierten Leistung<br />
Geld. Dann kann eine 500-kW-Anlage maximal 225 kW<br />
produzieren. Man kommt dann mit Flexzuschlag auf<br />
über 20 ct/kWh. Egal, ob Abfall- oder NawaRo-Anlage“,<br />
führte Dr. Loibl aus.<br />
Höherer Flexzuschlag und strengere<br />
Anforderungen für den Erhalt<br />
Wer in die neue Vergütungsperiode wechselt, der bekomme<br />
grundsätzlich den Flexzuschlag. Das waren<br />
bislang 40 Euro pro kW und Jahr ohne irgendeine weitere<br />
Anforderung. Mit dem neuen EEG <strong>2021</strong> wurde<br />
der Flexzuschlag auf 65 Euro pro kW und Jahr erhöht.<br />
Anlagenbetreiber erhalten den Flexzuschlag nach EEG<br />
<strong>2021</strong> aber nur noch, wenn sie sehr strenge Anforderungen<br />
erfüllen. Dr. Loibl sagte zum Beispiel, dass Betreiber<br />
in jedem Kalenderjahr mindestens 85 Prozent<br />
der gesamten installierten Leistung erzeugen müssen,<br />
und zwar an mindestens 4.000 Viertelstunden im Jahr.<br />
„Wenn ich das nicht schaffe, dann bekomme ich in<br />
dem betreffenden Jahr keinen Flexzuschlag. Nur wer<br />
die Leistung so fährt, der bekommt ihn“, betonte der<br />
Jurist. Es gebe keine Vorgaben, wann diese Viertelstunden<br />
produziert werden müssen. Man könne Sommer-<br />
Winter-Betrieb machen oder jeden Tag im Jahr für nur<br />
vier Stunden Volllast fahren. Und dann seien auch die<br />
betroffen, die flexibilisiert haben. Die hätten das nicht<br />
FOTO: LANDPIXEL.EU<br />
14
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INNOVATIVE<br />
EINBRINGTECHNIK<br />
FÜR BIOGAS- UND<br />
RECYCLINGANLAGEN<br />
AKTUELLES<br />
allein wegen des Erhalts der Flexprämie gemacht,<br />
sondern weil in der nächsten Förderperiode<br />
die installierte Leistung mindestens<br />
doppelt überbaut sein muss und<br />
der Flexzuschlag bislang in Aussicht war.<br />
Im neuen EEG hatte der Gesetzgeber die<br />
Inanspruchnahme des Flexzuschlags gestrichen,<br />
wenn in der ersten Vergütungsperiode<br />
die Flexprämie schon beansprucht<br />
worden war. Mittlerweile hat die Politik<br />
aufgrund von starken Argumenten aus der<br />
Biogasbranche diese Regelung korrigiert.<br />
Das heißt, wer die Flexprämie in der ersten<br />
Vergütungsperiode bereits erhalten hat,<br />
der bekommt in der Anschlussförderung einen<br />
Flexzuschlag in Höhe von 50 Euro pro<br />
Kilowatt installierte Leistung – also für die<br />
Leistung, die auch schon die Flexprämie<br />
bekommen hat. Der Betreiber erhält die 65<br />
Euro pro kW nur, wenn er nochmal mehr<br />
Leistung zubaut – also für den überschießenden<br />
Teil, für den noch keine Flexprämie<br />
gezahlt wurde. Hinweis: Die EU-Kommission<br />
muss dazu noch ihr OK geben.<br />
Flexzuschlag-Regelung –<br />
Verfassungsbeschwerde nötig?<br />
Wer also die Flexprämie bekommen hat in<br />
der ersten Förderperiode, der habe einen<br />
deutlichen Nachteil in der Anschlussförderung.<br />
Und das gelte auch für die Betreiber,<br />
die schon im letzten Jahr einen Zuschlag in<br />
der Ausschreibung erhalten haben, obwohl<br />
das EEG <strong>2021</strong> noch gar nicht gegolten<br />
habe. Dr. Loibl hält das für rechtswidrig.<br />
Allein schon, weil die Inanspruchnahme<br />
der Flexprämie freiwillig war, die mindestens<br />
doppelte Überbauung aber eine<br />
Zwangsmaßnahme darstelle. Er möchte<br />
dagegen juristisch vorgehen und eine Verfassungsbeschwerde<br />
beim Bundesverfassungsgericht<br />
einlegen, um diese Regelung<br />
zu kippen.<br />
Allerdings könnte das jetzt evtl. hinfällig<br />
werden: Der Bundestag hat aktuell ein<br />
Änderungsgesetz auf den Weg gebracht,<br />
wonach all diejenigen, die vor <strong>2021</strong> einen<br />
Zuschlag erhalten haben, weiterhin wie früher<br />
die 40 Euro Flexzuschlag bekommen<br />
sollen. Diejenigen, die erst zukünftig in die<br />
Ausschreibung gehen, sollen für den Anteil,<br />
für den sie Flexprämie bekommen haben,<br />
künftig einen Flexzuschlag mit „nur“ 50<br />
Euro pro kW und Jahr und für den restlichen<br />
Anteil einen Flexzuschlag mit 65 Euro/kW<br />
und Jahr erhalten. Das große Problem besteht<br />
darin, dass die EU dem zustimmen<br />
muss und die Frist für die Verfassungsbeschwerde<br />
zum Ende <strong>2021</strong> abläuft. Wenn<br />
also die Regelung bis dahin nicht in Kraft<br />
ist, wird man vorsorglich eine Verfassungsbeschwerde<br />
erheben müssen.<br />
Welche Chancen bieten sich aber nun für<br />
bestehende Abfallvergärungsanlagen?<br />
Dazu führte Dr. Loibl aus: „Wenn Sie die<br />
ersten 20 Jahre EEG-Förderung ausgeschöpft<br />
haben, dann können Sie an der<br />
Ausschreibungssystematik des EEG <strong>2021</strong><br />
teilnehmen und versuchen, sich für weitere<br />
zehn Jahre eine Vergütung zu sichern. Das<br />
theoretische Höchstgebot wäre, wenn Sie<br />
in <strong>2021</strong> bieten wollen, 18,40 ct/kWh. Die<br />
bekommen Sie aber niemals. Grund: Anders<br />
als bei NawaRo-Anlagen würde Ihre Vergütung<br />
ansteigen. Das heißt, Sie dürfen die<br />
18,40 ct/kWh bieten, bekommen auch den<br />
Zuschlag dafür, aber Sie bekommen nur den<br />
Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre<br />
vor der Ausschreibung ausgezahlt.“<br />
So kommt es laut Dr. Loibl also darauf an,<br />
was die Anlagen durchschnittlich noch an<br />
alter EEG-Vergütung erhalten hat. Zur Erläuterung<br />
führte er folgendes Beispiel an:<br />
Eine Abfallvergärungsanlage mit 800 kW<br />
installierter elektrischer Leistung hat in<br />
2020 im Schnitt 13,2 ct/kWh, in 2019<br />
13,0 ct/kWh und in 2018 im Schnitt 12,8<br />
ct/kWh erhalten. Der Durchschnitt liege bei<br />
13 ct/kWh. Die Anlage könne somit mit 13<br />
ct/kWh ins Gebot gehen und beim Erhalt<br />
des Zuschlages diese Vergütung für weitere<br />
zehn Jahre beanspruchen. Wenn die<br />
800-kW-Anlage keine Flexprämie erhalten<br />
habe, dann bekomme sie den Flexzuschlag<br />
in Höhe von 65 Euro pro kW beim Einhalten<br />
der entsprechenden Fahrweise.<br />
Taktieren und kalkulieren<br />
Die Ausschreibungsvergütung steige mit<br />
dem Flexzuschlag im Beispielsfall sogar<br />
während der Folgejahre von 13 auf 14,67<br />
ct/kWh. Das heißt, die Abfallanlagen würden<br />
in der Folgeausschreibung mindestens<br />
die bisherige Vergütung erhalten. Dazu ein<br />
Fall aus seiner Beratungspraxis: Ein Betreiber<br />
hat seine Anlage flexibilisiert. 500 kW<br />
waren vorhanden, ein 500-kW-Aggregat<br />
ist hinzugekommen. Die Anlage hat 14 ct/<br />
kWh Durchschnittsvergütung. Der Betreiber<br />
habe sich gefragt: Soll ich das neue<br />
BHKW in <strong>2021</strong> anschließen und die Flexprämie<br />
geltend machen oder lasse ich es<br />
ein paar Jahre stehen und nehme später<br />
nur den Flexzuschlag?<br />
15<br />
NEU!<br />
Jetzt auch als BIG-Mix Globe!<br />
Der BIG-Mix im ISO Seecontainer<br />
für den weltweiten Einsatz.<br />
BIG-Mix 35 bis 313m³<br />
effektiver Vorschub bei niedrigem<br />
Eigenstromverbrauch<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Biomischer 12 bis 80m³<br />
für 100% Mist und Grassilage<br />
massive Edelstahlkonstruktion<br />
mit Misch- und Aufbereitungsbereich<br />
auf Wunsch komplett aus Edelstahl<br />
KOMBI-Mix 8 und 12m³<br />
speziell für Kleinbiogasanlagen<br />
optional mit Vertikalmischschnecke<br />
für unterschiedlichste Substrate<br />
komplett aus Edelstahl<br />
Konrad Pumpe GmbH<br />
Fon +49 2526 93290<br />
Mail info@pumpegmbh.de<br />
www.pumpegmbh.de
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Die Anlage hat Förderperiode 1 bis Ende 2025. Er könnte<br />
für die Restlaufzeit, so Dr. Loibl, noch Flexprämie<br />
erhalten, also für die restlichen fünf Jahre. Die Flexprämie<br />
würde dann 325.000 Euro betragen. Wenn er<br />
warte und das neue BHKW erst in 2026 anmeldet und<br />
die Flexprämie jetzt nicht in Anspruch nehme, dann<br />
bekomme er für volle zehn Jahre den Flexzuschlag und<br />
der betrage dann gut 650.000 Euro, was die doppelte<br />
Summe ist. Und so liege es auf der Hand: Man warte<br />
mit dem Anschluss des neuen BHKW – „und ich würde<br />
Ihnen Recht geben, hätten Sie eine NawaRo-Anlage.<br />
Im Abfallbereich schaut es aber in vielerlei Hinsicht<br />
ganz anders aus“.<br />
Die Abfallanlage im Beispiel habe aktuell 14 ct/kWh<br />
Durchschnittsvergütung. Würde der Betreiber jetzt die<br />
Flexprämie anmelden – und das BHKW steht ja schon –,<br />
erhöhe sich die Durchschnittsvergütung von 14 ct/kWh<br />
auf 15,65 ct/kWh. Loibl folgerte: „Wenn ich in 2024<br />
erst in die Folgeausschreibung gehe, kann ich in der<br />
Folgeausschreibung diese 1,65 ct/kWh höher bieten.<br />
Das macht über die zehn Jahre der Vergütungsperiode<br />
II allein schon 650.000 Euro aus. Auch wenn der<br />
Flexzuschlag gar nicht mehr kommt. Und ich kann jetzt<br />
in der Vergütungsperiode I mit der Flexprämie zusätzlich<br />
noch 325.000 Euro geltend machen. Das ist also<br />
deutlich besser, als auf den Flexzuschlag zu warten.“<br />
Bei Abfallvergärungsanlagen lohne es sich quasi, erst<br />
zu flexibilisieren, um die Durchschnittsvergütung hoch<br />
zu bekommen.<br />
Einschränkungen für Anlagen, die<br />
Bioabfälle vergären<br />
Neben der Begrenzung auf die durchschnittliche Vergütung<br />
der letzten drei Jahre seien Bioabfallvergärungsanlagen<br />
auch beschränkt, und zwar von Gesetzes<br />
wegen. Bei den Bioabfallanlagen handele es sich<br />
um diejenigen, die Biomasse nach drei bestimmten<br />
Schlüsselnummern einsetzen, wie zum Beispiel Grüngut,<br />
Biotonneninhalt oder Marktabfälle. Also die klassischen<br />
Bioabfallanlagen, die um 16 ct/kWh bekommen<br />
hätten. Die erhielten in der Ausschreibung oder auch<br />
als Neuanlage unabhängig vom Zuschlagswert maximal<br />
14,30 ct/kWh für die ersten 500 kW und maximal<br />
12,54 ct/kWh für die darüber hinausgehende Leistung.<br />
Positiv zu bewerten sei, dass die Degression für diese<br />
Bioabfallanlagen nur 0,5 Prozent betrage, die immer<br />
ab Mitte des Jahres greife. Im EEG <strong>2021</strong> „gilt die geringere<br />
Vergütung nur noch für den Anteil des Stroms, der<br />
aus diesen Schlüsselnummern erzeugt wird. Im EEG<br />
2017 galt dies noch für den Gesamtstrom der Anlage.<br />
Wie sollen Betreiber aber ermitteln, welcher Bioabfall<br />
oder welcher Abfall in der Anlage welche Kilowattstunde<br />
erzeugt hat? Hier ist zu empfehlen, das von einem<br />
Umweltgutachter berechnen zu lassen“, riet der Fachanwalt.<br />
Wer sonstige Stoffe einsetze, der sei nicht beschränkt<br />
auf diesen Wert, sondern auf den Zuschlagswert beziehungsweise<br />
den Durchschnittswert der letzten drei<br />
Jahre. Jetzt könne man auf die Idee kommen, dass die<br />
Bioabfallanlage 18,4 ct/kWh bietet und setzt künftig<br />
nur noch 50 Prozent Bioabfall ein. Dann bekomme<br />
sie für 50 Prozent den geringeren Wert und für den<br />
Rest den Zuschlagswert. „Diese Regelung geht aber<br />
trotzdem meistens nicht auf. Grund: Die meisten Bioabfallvergärungsanlagen<br />
haben keine 150 Tage hydraulische<br />
Verweilzeit. Und die müssen sie auch nicht<br />
haben, weil die Bioabfallanlagen davon ausgenommen<br />
sind, wenn mindestens 90 Prozent des Inputmaterials<br />
aus den drei Schlüsselnummern stammt. Wenn man<br />
aber die 90 Masseprozent unterschreitet und ist in der<br />
Über - Unterdrucksicherung ÜU-TT<br />
Volle Kontrolle auf einen Blick<br />
Mich gibt es in<br />
verschiedenen Größen<br />
Bei Über- oder Unterdruck<br />
kann ich ein elektronisches<br />
Warnsignal geben<br />
Ich kann einen breiten<br />
Druckbereich abdecken<br />
Für den Frostschutz<br />
bin ich isoliert<br />
Ich bin DLG geprüft<br />
Wenn es mir zu kalt wird,<br />
kann eine elektrische<br />
Heizung angebaut werden<br />
16<br />
biogaskontor.de
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
Ausschreibung und muss die 150 Tage eigentlich einhalten,<br />
dann bekomme ich gar keine Vergütung mehr“,<br />
machte Loibl aufmerksam.<br />
Neue Anlagen erhalten mehr Vergütung<br />
Alternative zur Folgeausschreibung, in der man zehn<br />
Jahre das bekommt, was man bisher an Vergütung hatte,<br />
ist der Neubau einer Anlage. Grund: weil man in der<br />
Ausschreibung 16,4 ct/kWh für volle 20 Jahre bekommen<br />
kann. Da erhalte man regelmäßig mehr Vergütung<br />
als man bisher bekomme habe. Und den Flexzuschlag<br />
erhielten die Neuanlagen zudem. Man bekomme also<br />
als Neuanlage einen Zuschlag und dürfe alle Substrate<br />
einsetzen, die Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung<br />
sind.<br />
Die 2005er Anlage mit 14 ct Durchschnittsvergütung,<br />
die gehe nicht in die Folgeausschreibung, sondern die<br />
errichte ein neues Satelliten-BHKW in 1 Kilometer Entfernung<br />
mit einer Wärmesenke vor Ort. Am Satellitenstandort<br />
werde ein 1.000-kW-BHKW aufgestellt, um<br />
damit 45 Prozent der installierten Leistung abzufahren.<br />
Die entsprechenden Vorgaben für Satellitenstandorte<br />
seien einzuhalten.<br />
„Man kann natürlich auch eine Neugenehmigung für<br />
eine Gesamtanlage einholen. Aber wenn man sich die<br />
heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen anschaut,<br />
dann wissen Sie, dass heute so eine Anlage im hohen<br />
zweistelligen Millionenbereich kostet. Daher wäre es<br />
viel interessanter, ein Satelliten-BHKW zu versetzen –<br />
dorthin, wo nur ein BHKW benötigt wird und auch die<br />
Genehmigung einfacher ist“, führte Loibl weiter aus.<br />
Wer seine Genehmigung habe, der müsse sich drei Wochen<br />
vor dem Ausschreibungstermin im Marktstammdatenregister<br />
eintragen. Wer beispielsweise an der<br />
Ausschreibung im September dieses Jahres teilnehmen<br />
will, der biete 16,40 ct/kWh. Nach dem Erhalt des<br />
Zuschlags dürfe der Betreiber nicht Strom mit 1.000<br />
kW produzieren, sondern nur mit 450 kW. Die Anlage<br />
bekomme rund 650.000 Euro an Stromvergütung ausgezahlt.<br />
Hinzu komme noch der Flexzuschlag. „Dann<br />
kommt die Anlage im Durchschnitt auf über 18 ct/kWh,<br />
was für eine Abfallanlage ein ordentlicher Wert ist“,<br />
schlussfolgerte Loibl. Und das nur aus dem Satelliten-<br />
BHKW für volle 20 Jahre.<br />
Wärmesenken erschließen<br />
„Wer auch nur ansatzweise eine interessante Wärmesenke<br />
in der Nähe habe, der sollte sich intensiv über<br />
diese Möglichkeit Gedanken machen. Aber: Diese<br />
Chance haben nur Anlagen, die 150 Tage hydraulische<br />
Verweilzeit einhalten. Kann eine Anlage das nicht,<br />
kann sie in der Folgeausschreibung auch kein Satelliten-BHKW<br />
aufstellen“, wiederholte Loibl. In dem<br />
konkreten Beispielfall würde der Betreiber die Anlage<br />
bis Ende <strong>2021</strong> ganz normal weiterbetreiben. Also 450<br />
kW mit Flexprämie, und die Vergütung würde 15,56 ct/<br />
kWh betragen.<br />
Parallel sollte nach dem Zuschlag das Satelliten-<br />
BHKW errichtet werden. Ab Anfang 2023 empfehle es<br />
sich, das Satelliten-BHKW in Betrieb zu nehmen – es<br />
solle aber noch nicht durchgängig in Volllast betrieben<br />
werden. Es müsse vielmehr so betrieben werden, dass<br />
der Betreiber den Flexzuschlag bekommt. „Das heißt,<br />
im Betrieb mit 18,04 ct/kWh, die Biogasanlage müsste<br />
nur mit Teillast laufen, um die Flexprämie zu bekommen“,<br />
führte Loibl aus. Insgesamt käme man in diesem<br />
Zeitraum auf knapp 17 ct/kWh.<br />
In 2024 solle die Biogasanlage an der Folgeausschreibung<br />
teilnehmen. Ab 2026 würde der Satellit mit seinen<br />
rund 18 Cent die volle Leistung bringen.<br />
17
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Abfallvergärungsanlagen<br />
bekommen laut<br />
Dr. Loibl beim Wechsel<br />
in das EEG <strong>2021</strong> nur<br />
den Durchschnitt der<br />
letzten drei Kalenderjahre<br />
vor der Ausschreibung<br />
als Vergütung<br />
ausgezahlt.<br />
Die Biogasanlage hätte eventuell einen Zuschlag und<br />
würde nur noch insoweit betrieben, als dass man sie<br />
für die Fermenterheizung und Hygienisierung benötigt.<br />
Das EEG <strong>2021</strong> sei aber leider in sich nicht konsistent.<br />
Grund: Wer eine Ausschreibungsvergütung am Satellitenstandort<br />
bekomme, der sei nicht mehr verpflichtet,<br />
die Fermenterbeheizung über Erneuerbare Energien zu<br />
gewährleisten, sondern das sei auch mit fossilen Energieträgern<br />
möglich.<br />
150 Tage Verweilzeit einhalten<br />
„Je nachdem wie sehr die Anlage am Standort weiterläuft,<br />
liege ich zwischen 17 und 18 ct/kWh für die<br />
restliche Laufzeit – also für volle 20 Jahre. Dann wäre<br />
es auch sinnvoll, mehr Abfälle in die Anlage zu geben,<br />
um mehr Gas zu produzieren. Sie müssen aber darauf<br />
achten, dass Sie die 150 Tage hydraulische Verweilzeit<br />
nicht unterschreiten. Das heißt, Neuanlagen können –<br />
insbesondere Satelliten-BHKW, die kostengünstiger<br />
zu errichten sind – meist deutlich mehr Vergütung<br />
erhalten als Bestandsanlagen“, betonte Loibl. Die<br />
Verwerter von Speiseresten müssten künftig 150 Tage<br />
Verweilzeit nachweisen – sonst drohe der Vergütungsausfall<br />
für ein ganzes Kalenderjahr. Wer die 150 Tage<br />
nur knapp schaffe, der müsse eventuell die Einsatzstoffmenge<br />
reduzieren. Das müsse aber ökonomisch<br />
bewertet werden.<br />
Eine ganz wichtige Neuerung im EEG <strong>2021</strong> ist, dass<br />
in der Ausschreibung beim Unterschreiten der ausgeschriebenen<br />
Leistung künftig nur noch 80 Prozent der<br />
abgegebenen Gebote einen Zuschlag erhalten. Neuanlagen<br />
und Bestandsanlagen werden dabei gesondert<br />
gewertet. 80 Prozent werden bezuschlagt, 20 Prozent<br />
fallen raus. „Das hat Auswirkungen auf die Gebotshöhe.<br />
Es fallen die raus, die die höchsten Gebote abgegeben<br />
haben. Wer also 18,40 ct/kWh bietet, der ist eher<br />
raus als der, der 18,30 ct/kWh bietet. Wenn aber alle<br />
dasselbe Gebot abgeben, dann fliegt der raus mit der<br />
größten gebotenen Leistung. Das heißt, je höher die<br />
Leistung, umso mehr sollte man gehalten sein, ein geringeres<br />
Gebot abzugeben“, gab Loibl zu bedenken.<br />
Nun sei es aber bei Abfallvergärungsanlagen sowieso<br />
so, dass sie regelmäßig deutlich drunter sind, denn<br />
sie würden mit den Bestandsanlagen nicht 18,40 ct/<br />
kWh bieten, weil der Wert im Dreijahresdurchschnitt<br />
nicht erreicht werde. Wenn eine Anlage im Dreijahresdurchschnitt<br />
15,50 ct/kWh habe, dann sei es sehr<br />
wahrscheinlich, dass sie einen Zuschlag bekommt.<br />
Bestandsanlagen hätten früher erst nach einem Jahr<br />
ins nächste EEG-System wechseln können. Das habe<br />
sich geändert. Jetzt gehe das schon nach drei Monaten.<br />
Spätestens nach drei Jahren muss die Anlagen ins<br />
nächste EEG gewechselt haben.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
FOTO: JÖRG BÖTHLING<br />
18
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
5. BAYERISCHE BIOGASFACHTAGUNG, TEIL 2<br />
Gärdünger reproduzieren<br />
mehr Humus als Stroh<br />
Die Substrataufbereitung<br />
wird in<br />
Zukunft an Bedeutung<br />
gewinnen, da immer<br />
mehr Reststoffe in<br />
Biogasanlagen vergoren<br />
werden.<br />
Am 2. und 3. März fand die Dingolfinger Biogasfachtagung digital mit rund 130<br />
Teilnehmer*innen statt. Am zweiten Veranstaltungstag ging es unter anderem um die<br />
technische Umsetzung der Strohvergärung mit Substrataufbereitung sowie um das<br />
Thema Strohabfuhr versus Humusaufbau.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
FOTO: LANDPIXEL.EU<br />
Rainer Kissel von der Bayerischen Landesanstalt<br />
für Landwirtschaft (LfL) in Freising<br />
stellte zu Beginn seines Vortrages die Frage:<br />
„Warum spielt die Substrataufbereitung in<br />
Zukunft eine größere Rolle?“ Er gab selbst<br />
die Antwort: „Weil der Anteil landwirtschaftlicher Koppelprodukte<br />
in den landwirtschaftlichen Biogasanlagen<br />
voraussichtlich zunehmen wird. Dabei geht es vor allem<br />
um die Vergärung von jeglicher Art von Stroh, aber auch<br />
von Festmist.“<br />
Die Hauptursache für den zunehmenden Einsatz von<br />
Koppelprodukten liege darin, weil das EEG <strong>2021</strong> vor allem<br />
die Verwendung von Silomais begrenzt auf maximal<br />
40 Prozent der Frischmasse. Das habe zur Folge, dass<br />
in Biobetrieben und in Grünlandregionen künftig mehr<br />
Grasaufwüchse und Kleegras vergoren werden würden.<br />
Bei diesen Inputstoffen spiele die Aufbereitung eine<br />
große Rolle.<br />
Bei der Substrataufbereitung gibt es laut Kissel zwei<br />
entscheidende Punkte:<br />
a. Biomasse und Prozessenergie sollen eingespart<br />
werden.<br />
b. Der Rühraufwand soll gering sein, die Bildung von<br />
Schwimmdecken soll verhindert werden.<br />
Aufschluss: Mikroben sollen leichter<br />
an Kohlenhydrate kommen<br />
„Beim technischen Aufschluss geht es darum, die Cellulose-<br />
und Hemicellulosefasern aufzuspalten und vom<br />
Lignin zu trennen. So soll den Archaeen und Bakterien<br />
eine Biomasse zur Verfügung gestellt werden, die<br />
leichter zugänglich ist. Außerdem geht es darum, die<br />
Oberfläche des Substrates zu vergrößern, sodass die<br />
Mikroorganismen das Substrat intensiver besiedeln<br />
können“, führte Kissel aus.<br />
Die Substrataufbereitung solle schlussendlich die Methanausbeute<br />
steigern, den Substratabbau beschleunigen,<br />
die Viskosität des Substrates im Fermenter<br />
verbessern, Rühr- und Pumpenergie einsparen, die<br />
technischen Komponenten weniger verschleißen sowie<br />
Schwimmschicht- und Schaumbildung verhindern. Als<br />
Folgen der Substrataufbereitung nannte der Referent:<br />
ffzusätzlicher Energieaufwand,<br />
ffzusätzlicher Investitionsbedarf,<br />
ffbei bestimmten Verfahren können sich Hemm -<br />
stoffe bilden,<br />
ffbei externer Aufbereitung besteht immer das<br />
Risiko, dass es außerhalb des Fermenters zu<br />
Verlusten kommt.<br />
19
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Die Gärrestrückführung<br />
vom Silomais<br />
hat einen doppelt<br />
so hohen Effekt auf<br />
die Veränderung der<br />
Humusgehalte als der<br />
Verbleib des Strohs<br />
auf den Flächen.<br />
Die Aufbereitungsverfahren teilte Kissel ein in chemische,<br />
biologische und physikalische Verfahren. Biologische<br />
Verfahren hätten den Vorteil, dass sie keinen<br />
zusätzlichen Energieaufwand benötigen. Bei den biologischen<br />
Verfahren erfolge der Aufschluss der Cellulose<br />
und Hemicellulose durch Enzyme. Es gebe auch<br />
die Möglichkeit, Substrate mit Pilzen aufzuschließen.<br />
Pilze würden einerseits lignocellolytische Enzyme produzieren<br />
und darüber hinaus mit ihren Hyphen einen<br />
mechanischen Aufschluss bewirken.<br />
In der Forschung sei im Labor festgestellt worden, dass<br />
Pilze bis zu 50 Prozent Gasertragssteigerung realisieren<br />
lassen. Die Risiken bei Pilzen seien allerdings, dass es<br />
durch den Verbrauch von Kohlenhydraten zu Energieverlusten<br />
kommen kann und dass sie eine Phenolhemmung<br />
verursachen können. In der Praxis würden Pilze nicht<br />
in großem Maßstab eingesetzt. Eine weitere biologische<br />
Aufschlussmöglichkeit sei, die Enzymkonzentration im<br />
Fermenter durch Zugabe von außen zu erhöhen. Es sei<br />
jedoch darauf zu achten, dass der finanzielle Mehraufwand<br />
nicht die Ertragssteigerung überlagert.<br />
Physikalische Verfahren erwärmen<br />
das Substrat<br />
Im Weiteren ging er auf physikalische Aufschlussverfahren<br />
ein. In Versuchen sei Biomasse<br />
vor dem Fermenter mittels einer Fräswalze<br />
aufgefasert worden. „Bei der Behandlung von<br />
Mist konnten wir eine Temperaturerhöhung auf<br />
37 Grad Celsius feststellen, was zu Energieverlusten<br />
führen kann. In Batch-Gärversuchen<br />
sind die Gasausbeuten von behandeltem und<br />
unbehandeltem Material verglichen worden.<br />
Es konnte kein signifikanter Gasmehrertrag<br />
durch die Behandlung festgestellt werden“,<br />
berichtete Kissel. Als zweites ging er auf ein<br />
sogenanntes internes Verfahren ein. Dazu wird<br />
das Substrat erst dem Fermenter und dann<br />
über eine Pumpleitung verschiedenen Geräten<br />
zugeführt. Bis zu 80 Kubikmeter Durchsatz pro<br />
Stunde waren möglich. Getestet worden sind<br />
Mais, Szavasigras, Festmist und Grassilage.<br />
Die Substrate hätten sich stärker erwärmt als<br />
in dem Fräswalzen-Verfahren. Das Szavasigras<br />
habe sich zum Beispiel von 20 Grad Celsius<br />
auf 56 Grad Celsius erwärmt. Eine Steigerung<br />
des Gasertrages sei kaum feststellbar gewesen.<br />
Als drittes physikalisches Verfahren stellte Kissel<br />
die Hammermühle vor. Die Geräte hätten<br />
eine elektrische Anschlussleistung von 20 bis<br />
100 Kilowatt. Es handele sich um ein externes<br />
Verfahren, das aber in die Substratleitung integriert<br />
werden könnte. In der Hammermühle<br />
befänden sich kleine Schlegel, die das Material<br />
zerkleinern. Die Substratausgangstemperatur<br />
habe 4 Grad Celsius betragen. Nach der Hammermühle<br />
habe das Substrat eine Temperatur<br />
von 26 Grad Celsius aufgewiesen. Eine Gasertragssteigerung<br />
habe man nicht festgestellt. Die Durchsatzleistung<br />
sei abhängig vom Halmgut und von der<br />
Siebgröße. Das Verfahren sei relativ verschleißträchtig.<br />
Eine vierte Behandlungsmethode stellt der Einsatz des<br />
Extruders dar. Die elektrische Anschlussleistung der<br />
Maschinen liegt zwischen 26 und 110 Kilowatt. Der<br />
Zerkleinerungsgrad liegt bei einem Millimeter. Nach<br />
Kissels Darstellung erreichen die Extruder Durchsätze<br />
von 2 bis 4 Tonnen pro Stunde. Beim Einsatz von<br />
Grassilage und Szavasigras konnte eine deutliche Erwärmung<br />
auf 56 Grad Celsius gemessen werden. „Wir<br />
haben festgestellt, dass sich die Gasausbeute durch<br />
diese Technologie steigern lässt. Bei Mais und Mist ist<br />
die Steigerung tendenziell um 5 Prozent nachweisbar.<br />
Andere Forschungseinrichtungen haben nach dem<br />
Extrudieren von Maissilage eine Steigerung der Gaserträge<br />
von 7 bis 14 Prozent erreicht nach zweimaliger<br />
Behandlung. Bei Grassilage sollen es sogar 19 bis 26<br />
Prozent gewesen sein“, informierte Kissel. Der Energieaufwand<br />
sei mit 10 bis 25 Kilowattstunden pro Tonne<br />
Material relativ hoch.<br />
FOTO: MARTIN BENSMANN<br />
20
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
Arnold Eindampfer für flüssige Gärreste<br />
= +<br />
Flüssige Gärreste<br />
100 % Nährstoffe<br />
Eindampfer<br />
Klares Wasser<br />
0 % Nährstoffe<br />
Konzentrat<br />
99,99 % Nährstoffe<br />
• Volumenreduktion bis 90% Endlagerausbau wird unnötig<br />
• Einleitfähiges Kondensat<br />
• Abwärme nutzen KWK Bonus<br />
• Reduktion der Transportkosten<br />
• Aufkonzentrierung der Nährstoffe<br />
• Absolut geruchsfrei durch Vakuum-Betrieb<br />
• Durch anschließende Trocknung Verkauf von hochwertigen Düngerpellets<br />
• Kein zusätzlicher Personalaufwand durch autonome Steuerung<br />
Arnold Eindampfer statt Endlagerausbau<br />
Energieverbrauch pro<br />
1000l Wasserverdampfung:<br />
• 250 kWh thermisch<br />
• 15 kWh elektrisch<br />
Bild:<br />
Anlage Niedersachsen<br />
Reservieren Sie einen Besuchstermin oder verlangen Sie ein unverbindliches Preisangebot<br />
Arnold & Partner AG<br />
Industrie Nord 12 CH-6105 Schachen +41 (0) 41 499 60 00 www.arnoldbiogastechnik.ch info@arnoldbiogastechnik.ch<br />
21
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Die physikalischen Aufschlussverfahren würden gegenüber<br />
den Kontrollvarianten zu Beginn der Vergärung eine<br />
sehr hohe Abbaukinetik bewirken. Mit zunehmender<br />
Fermentationsdauer gehe der Effekt jedoch zurück. Das<br />
sei bei allen vier Substraten so gewesen. Sehr deutlich<br />
sei der Abbau bei strohhaltigem Mist gewesen. Bei strohreichem<br />
Mist hätten die physikalischen Verfahren positive<br />
Effekte. Bei ligninarmen Substraten konnten die physikalischen<br />
Aufschlussverfahren keine Effekte zeigen.<br />
Boden organische Substanz geben<br />
Sebastian Parzefall vom Technologie- und Förderzentrum<br />
(TFZ) in Straubing stellte in seinem Vortrag<br />
Ergebnisse aus Gärdüngerversuchen in Bayern dar,<br />
in denen der Humusaufbau beziehungsweise -abbau<br />
untersucht wurde. Welche Auswirkungen die Strohabfuhr<br />
auf die Bodenfruchtbarkeit hat, war die zentrale<br />
Frage in den Versuchen. „Das Problem bei der energetischen<br />
Nutzung landwirtschaftlicher Biomasse<br />
ist, dass in der Regel ein Großteil der oberirdischen<br />
Biomasse abgefahren wird. Nach dem Biogasprozess<br />
wird zwar ein Teil der organischen Substanz aufs Feld<br />
zurückgebracht, aber zumindest zu Versuchsbeginn<br />
2009 und auch jetzt ist die Humusreproduktionsleistung<br />
von Gärresten noch nicht endgültig geklärt“,<br />
führte Parzefall aus.<br />
Zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit müsse der Boden<br />
mit ausreichend organischer Substanz versorgt werden.<br />
Die organische Substanz sei wichtig für den Erhalt des<br />
Humus, des Bodenlebens und der Bodenstruktur. Die<br />
Versuche seien von 2009 bis 2018 gelaufen, an vier<br />
Standorten in Bayern. Die Fruchtfolge war Silomais-Winterweizen,<br />
ohne Zwischenfruchtanbau. Einmal pro Jahr<br />
wurde der Boden gepflügt. Zwei der Versuchsstandorte<br />
befanden sich in Niederbayern (Aulfing und Straubing).<br />
In Aulfing ist der Boden eher sandig mit 14 Prozent Tongehalt.<br />
In Straubing ist die Versuchsfläche überwiegend<br />
Lößboden mit hohem Schluff- und mittlerem Tongehalt.<br />
Ein weiterer Versuchsstandort war Röckingen in Mittelfranken,<br />
wo der Boden den höchsten Tongehalt aufweist.<br />
In Reuth in Mittelfranken ist der Boden eher leichter mit<br />
hohem Schluffgehalt. Die Niederschläge waren laut Parzefall<br />
im Versuchszeitraum an allen Standorten ähnlich,<br />
bei ungefähr 700 Millimeter, und entsprachen ungefähr –<br />
bis auf Straubing – dem langjährigen Mittel.<br />
Sechs Versuchsvarianten<br />
Die Versuchsvarianten unterschieden sich in den Biomasseabfuhren<br />
und -rückführungen (sechs Varianten).<br />
Stroh blieb entweder auf dem Feld oder es wurde abgefahren.<br />
Auch die Rückführung der Gärreste sei variiert<br />
worden. Die Varianten:<br />
Biogas Journal 210x140<br />
Runderneuerung von Gummikolben für Kolbenpumpen!<br />
Alter beschädigter Kolben Altes Gummi ist entfernt Der erneut vulkanisierte Kolben<br />
22<br />
Technische Handelsonderneming<br />
Ersatzteile für die meisten üblichen Kolbenpumpen<br />
Registrieren und sofort kaufen in unserem Webshop!<br />
Tel.: 0031-(0)545-482157<br />
eMail.: info@benedict-tho.nl<br />
WWW.BENEDICT-THO.NL
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
V1: mineralische Düngung, Strohabfuhr ohne<br />
Rückfuhr.<br />
V2: mineralische Düngung, Stroh blieb auf der Fläche.<br />
V3 + V4: hier erfolgte eine Gärrestrückführung proportional<br />
zur Maisabfuhr. Einmal mit Strohverbleib<br />
und einmal ohne plus mineralischer Düngung.<br />
V5: extreme Gärrestrückführung. Gärrest proportional<br />
zur Mais- und Weizenabfuhr gedüngt plus<br />
Aufschlag von 20 Prozent. Damit habe man eine<br />
mögliche überproportionale Gärrestdüngung auf<br />
hofnahen Flächen simulieren wollen. Minimale<br />
mineralische Düngung. Diese Variante ist aber<br />
aufgrund der Bestimmungen der aktuellen Düngeverordnung<br />
so nicht mehr praktikabel und wegen<br />
der Stickstoffverluste nicht zu empfehlen.<br />
V6: mit Rindergülle gedüngt. Rindergülle wurde<br />
hier entsprechend dem Gärrest in der V3 und V4<br />
gedüngt.<br />
Die Gärreste hatten typischerweise 5 Prozent Trockensubstanzgehalt<br />
(TS) mit 3,9 Kilogramm Gesamt-<br />
Stickstoff und einem pH-Wert von 7,7. Die Rindergülle<br />
hatte einen TS-Gehalt von 8 Prozent und etwas geringere<br />
Stickstoffgehalte. Die Gärreste der verschiedenen<br />
Biogasanlagen schwankten je nach Inputstoffen sehr<br />
stark hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe. In den Versuchen<br />
war keine Biogasanlage dabei, die Stroh vergoren hatte.<br />
Die organische Düngung sei im Frühjahr zu den jeweiligen<br />
Kulturen ausgebracht worden. Beim Mais vor der<br />
Saat und beim Winterweizen in der Regel zu Vegetationsbeginn.<br />
Dazu wurden spezielle Parzellengülletankwagen<br />
verwendet, um möglichst exakt den Dung<br />
applizieren zu können. Die Höhe der Stickstoffdüngung<br />
allgemein sei so bemessen worden, dass kein Einfluss<br />
aufgrund der Zufuhr von organischer Substanz eintritt.<br />
„Das heißt, man sollte möglichst identische Einträge<br />
an organischer Substanz in Form von Ernte- und Wurzelresten<br />
in allen Varianten haben, damit die Unterschiede<br />
in den Varianten nur in der Rückführung der organischen<br />
Dünger oder dem Strohverbleib bestehen“,<br />
erklärte Parzefall. Die Stroherträge seien in allen Varianten<br />
gleich gewesen – bis auf den Standort Straubing.<br />
45 Dezitonnen Stroh wurden im Durchschnitt geerntet.<br />
Die meiste organische Substanz sei in der Variante<br />
mit der Rindergülle über den gesamten Versuchszeitraum<br />
zugeführt worden. Allgemein sei durch Stroh im<br />
Vergleich zu V3 und V4 in etwa die eineinhalbfache<br />
Menge an organischer Substanz zugeführt worden im<br />
Vergleich zu Gärresten. Das sei wichtig im Hinblick<br />
auf die spätere Betrachtung der Entwicklung der Humusgehalte.<br />
DEIN<br />
KL55.8T<br />
DEINE<br />
AUFGABE<br />
Einzigartig mit Allradlenkung<br />
DEINE<br />
ZEIT<br />
Eindrucksvolle Leistungsdaten, technische Innovation und<br />
hochwertige Qualität machen den KL55.8T zu etwas Einzigartigem.<br />
Überzeugen Sie sich selbst von dem Kramer Teleskopradlader.<br />
Mehr erfahren unter: www.kramer.de/KL55.8T<br />
23
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Strohabfuhr oder -verbleib – keine<br />
Beeinflussung der Aggregatstabilität<br />
„Die Aggregatstabilität beschreibt die Widerstandsfähigkeit<br />
der Bodenaggregate gegenüber Niederschlägen.<br />
Sie ist entscheidend, damit bei Starkregenereignissen<br />
der Boden nicht verschlämmt und möglichst<br />
nicht erodiert. Die Strohabfuhr oder dessen Verbleib<br />
hat im Grunde keine Auswirkungen auf die Aggregatstabilität“,<br />
machte Parzefall deutlich. Nach zehn<br />
Jahren Versuchslaufzeit sei festzustellen, dass die<br />
organische Düngung einen leicht positiven Effekt hinsichtlich<br />
der Vermeidung von Verschlämmungen und<br />
der Erosion der Böden hat.<br />
Auch seien keine entscheidenden Auswirkungen der<br />
unterschiedlichen organischen Düngung auf die Lagerungsdichte<br />
und auf das Gesamtporenvolumen sichtbar<br />
gewesen. Die Gärrestdüngung habe keine negativen<br />
Auswirkungen auf die Aggregatstabilität gehabt.<br />
In den Rindergüllevarianten sei die Infiltrationsrate<br />
des organischen Düngers in den Boden am höchsten<br />
gewesen. „Das hat damit zu tun, dass in diesen Parzellen<br />
die höchste Regenwurmdichte gezählt werden<br />
konnte“, klärte Parzefall auf.<br />
Insgesamt seien die Humusgehalte während der Versuchslaufzeit<br />
an drei von vier Standorten zurückgegangen.<br />
Nur am Standort Aulfing hätten die Gehalte in der<br />
dritten Variante zugenommen. V1 habe den stärksten<br />
Humusrückgang gezeigt. „Man sieht zwar an den Ergebnissen,<br />
dass der Strohverbleib keine signifikanten<br />
Effekte auf die Humusgehalte hatte, aber trotzdem war<br />
es sichtbar, wenn das Stroh auf den Flächen blieb,<br />
dass der Humusabbau geringer war. Wenn wir V1 und<br />
V2 sowie V3 und V4 miteinander vergleichen, dann<br />
ergibt sich ein signifikanter Einfluss des Strohs auf die<br />
Veränderung der Humusgehalte. Gleiches gilt auch für<br />
die Gärreste, also im Vergleich der V1 mit V3 und V2<br />
mit V4“, sagte Parzefall.<br />
Die Gärrestrückführung vom Silomais habe einen doppelt<br />
so hohen Effekt auf die Veränderung der Humusgehalte<br />
als der Verbleib des Strohs auf den Flächen.<br />
Die Gärreste hätten eine dreimal so hohe Humusreproduktionsleistung<br />
als das Stroh. Das deute darauf hin,<br />
dass die organische Substanz in Gärresten eine höhere<br />
Stabilität habe und somit eine höhere Humusreproduktionsleistung.<br />
Wenn Gärdünger vollständig zurückgeführt<br />
würden, dann sei davon auszugehen, dass dies<br />
einen ähnlichen Effekt auf die Humusgehalte hat, als<br />
wenn die organische Substanz, die vergoren wird, auf<br />
dem Feld bleibt.<br />
Die letzte Untersuchung der Humusgehalte stammte<br />
aus dem Frühjahr 2018, sodass das vom Weizen anfallende<br />
Stroh in der Humusbilanz noch nicht enthalten<br />
war. Die mikrobielle Biomasse wurde indirekt über die<br />
substratinduzierte Respiration ermittelt. Dabei zeigten<br />
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Varianten.<br />
Nach Parzefalls Informationen war aber deutlich<br />
feststellbar, dass mit zunehmender organischer<br />
Düngung die mikrobielle Aktivität im Boden zunimmt<br />
und die höchste Aktivität in den Varianten mit Rindergülle<br />
ermittelt werden konnte. Grund: Mit der Rindergülle<br />
sei auch die größte Menge an leicht umsetzbarer<br />
organischer Substanz zugeführt worden.<br />
Strohverbleib – tiefgrabende Regenwürmer<br />
profitieren<br />
Ein gleiches Bild habe sich auch bei der Besiedlungsdichte<br />
der Regenwürmer gezeigt, die im gesamten<br />
Versuch unterdurchschnittlich war im Vergleich zum<br />
bayernweiten Durchschnitt. Dieser liegt ungefähr bei<br />
145 Regenwürmern pro Quadratmeter. Dieser Wert sei<br />
nur in der Rindergüllevariante erreicht worden. Der<br />
Einfluss des Strohs auf die Regenwurmdichte sei zwar<br />
nicht signifikant gewesen, aber dennoch nachweisbar.<br />
Parzefall meinte, dass die Regenwurmdichte auch wegen<br />
des jährlichen Pflügens nicht so hoch gewesen ist.<br />
Vor allem die tiefgrabenden Regenwürmer profitierten<br />
davon, wenn das Stroh auf der Bodenoberfläche liegen<br />
bleibt. Wohingegen die Mineralbodenarten vom Pflügen<br />
profitiert hätten.<br />
„Wichtig ist, dass zur Ernährung des Bodenlebens<br />
leicht abbaubare Kohlenstoff-Verbindungen zur Verfügung<br />
stehen, wie es zum Beispiel bei den Rindergüllevarianten<br />
der Fall ist. Von den Gärdüngern ist keine<br />
schädliche Wirkung auf das Bodenleben ausgegangen.<br />
Die Gärdüngeranwendung im Rahmen der guten fachlichen<br />
Praxis lässt keine Verschlechterung der Bodenstruktur<br />
sowie negative Auswirkungen auf die Bodenlebewesen<br />
erwarten“, resümierte Parzefall.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
24
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES Anzeige<br />
ANZEIGE<br />
Kompetenzzentrum für Biogasanalytik<br />
und -forschung wächst weiter<br />
Die ISF GmbH ist das Zentrallabor der Union Agricole Holding AG und befasst sich<br />
seit 2007 intensiv mit Biogasanalytik und -forschung. Sie gilt als Biogas-Keimzelle der<br />
Unternehmensgruppe. Jetzt werden unter ihrem Dach alle Bereiche der Biogasanalytik<br />
am Standort Wahlstedt zusammengefasst. Was das für die ISF GmbH und die Biogasanlagen-Betreiber<br />
bedeutet, erklärt uns Geschäftsführer Dietmar Ramhold.<br />
Die ISF GmbH leistet wissenschaftliche<br />
Basisarbeit, angewandte Forschung und<br />
Analytik für die Unternehmensgruppe.<br />
Was bedeutet die Erweiterung der Labordienstleistung?<br />
Die ISF GmbH stellt das zentrale Labor- und<br />
Untersuchungszentrum der Unternehmensgruppe<br />
dar. Seit 2007 arbeiten wir intensiv im<br />
Bereich der Biogasforschung und -analytik<br />
und verfügen mittlerweile über die größten<br />
Forschungskapazitäten im Biogasbereich der<br />
freien Wirtschaft.<br />
Laboranalysen zu den unterschiedlichen<br />
Abschnitten im Biogasprozess haben bisher<br />
die ISF GmbH (Wahlstedt) und die Bonalytic<br />
GmbH (Troisdorf) in höchster, nachvollziehbarer<br />
Qualität erstellt. Hierzu gehören: Untersuchungen<br />
des Energiepotenzials von Substraten,<br />
Analysen von Fermenterinhalten zur<br />
Überwachung der Prozessbiologie, Untersuchungen<br />
der Gärreste auf deren Düngewert<br />
sowie Leckage-Messungen an Biogasanlagen.<br />
Um auch in Zukunft Maßstäbe im Bereich<br />
der Biogasforschung und -analytik setzen zu<br />
können, sind ab 01.07.<strong>2021</strong> alle Labordienstleistungen<br />
für Biogasanlagen in der Unternehmensabteilung<br />
ISF analytics in dem Zentrallabor<br />
am Standort Wahlstedt gebündelt.<br />
Warum wird die Analytik zukünftig nur<br />
noch an einem Standort betrieben?<br />
Mit der Verschmelzung aller Laborleistungen<br />
entsteht ein Kompetenzzentrum für Biogasanalytik<br />
und -forschung, in dem alle Synergien<br />
voll ausgeschöpft werden können. Auf<br />
dieser Basis kann die Unternehmensgruppe<br />
auch zukünftig als richtungsweisender Impulsgeber<br />
für die Biogasbranche agieren.<br />
Argumente, die bei der Entscheidung für<br />
den Standort Wahlstedt sprachen, waren<br />
die vorhandenen Räumlichkeiten des dort<br />
2013 neu gebauten Labor- und Technikum-<br />
Komplexes. Sie erfüllen alle Anforderungen<br />
an Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz und<br />
bieten Raum für eine starke Mannschaft aus<br />
Chemikern, Biologen, Umwelttechnikern und<br />
vor allem sachkundigen Laborkräften.<br />
Welche Herausforderungen bringt die Verschmelzung<br />
der ISF GmbH und der Bonalytic<br />
GmbH mit sich?<br />
Der etablierte Bereich der Biogasanalytik in<br />
der ISF GmbH erfährt eine organisatorische<br />
Neugestaltung.<br />
Zukünftig werden wir neben den 25.000 Futtermittelproben<br />
und 5.000 Biogas-Fermenterproben<br />
weitere 10.000 Biogasproben in<br />
Wahlstedt bearbeiten. Die Aufstockung der<br />
Analysetechnik schafft erforderliche Kapazitäten.<br />
Zudem erhöhen wir durch den Aufbau<br />
redundanter Systeme unsere Zuverlässigkeit,<br />
Ergebnisse zeitnah zu liefern. Durch<br />
verbesserte Methoden verkürzt sich z. B.<br />
bei der Spurenelementanalyse die Bearbeitungszeit<br />
um bis zu 25 %.<br />
Die ISF GmbH hat einen Mitarbeiter-Zuwachs<br />
von knapp 30 % erfahren – glücklicherweise<br />
mit einem Teil der vorhandenen Expertise<br />
der Kollegen der Bonalytic GmbH.<br />
Nach welchen Qualitätsstandards arbeitet<br />
die ISF GmbH?<br />
Für Anlagenbetreiber ist die Aussagekraft der<br />
Analysenergebnisse ein ausschlaggebendes<br />
Qualitätskriterium. Sie hängt ab von der<br />
höchstmöglichen Genauigkeit mit der das<br />
Labor in seiner täglichen Routine arbeitet.<br />
Vielfältige Versuchsreihen, langjährige Erfahrungen<br />
und modernste Laboreinrichtungen<br />
ermöglichen uns ein außerordentliches<br />
Niveau an Exaktheit der Analytik.<br />
Die konstant hohe Qualität unserer Analysen<br />
ist uns sehr wichtig, an ihr lassen wir uns<br />
messen: Zur unabhängigen Labor-Qualitätskontrolle<br />
nutzen wir seit Jahren erfolgreich<br />
die Teilnahme an den Labor-Ringversuchen<br />
der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.<br />
Dietmar Ramhold, Geschäftsführer der ISF GmbH<br />
Welche Veränderungen ergeben sich für<br />
den Kunden durch die Neuorganisation?<br />
Die kontinuierliche Überwachung der biologischen<br />
Prozesse ist für den Betrieb einer Biogasanalage<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Für unsere Kunden ändert sich am Ablauf von<br />
Probenahme und Versand kaum etwas. Neu<br />
sind lediglich der Standort und die gebündelte<br />
Kompetenz.<br />
Nach wie vor können Betreiber von Biogasanlagen<br />
flexible Analysen-Pakete über<br />
die Vertriebsunternehmen buchen und bedarfsorientiert<br />
einsetzen. Die Mitarbeiter<br />
der Schaumann BioEnergy GmbH und der<br />
Schaumann BioEnergy Consult GmbH stehen<br />
allen Kunden und Interessierten beratend<br />
zur Seite.<br />
Unser Leistungsspektrum<br />
Analytik<br />
- Substratanalytik<br />
- Überwachung der Prozessbiologie<br />
(Fermenteranalytik)<br />
- Bestimmung des Biogaspotenzials<br />
(Gärtests)<br />
- Detektion von Biogas-Leckagen<br />
Forschung<br />
Produktentwicklung<br />
www.is-forschung.de<br />
25
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2021</strong><br />
<strong>2021</strong> ist noch nicht „wie immer“, aber die 31. Jahrestagung des Fachverbandes Biogas e. V. will das<br />
Beste aus den Umständen machen: Vom 22. bis 26. November wird das Hauptprogramm auf der<br />
BIOGAS Convention Digital präsentiert und zwei Wochen später, vom 7. bis 9. Dezember, folgt die<br />
BIOGAS Trade Fair als Livemesse!<br />
Der Fachverband hat es sich<br />
nicht leicht gemacht mit der<br />
Entscheidung zur Durchführung<br />
der BIOGAS Convention<br />
& Trade Fair <strong>2021</strong>. Dank zahlreicher<br />
Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft,<br />
vom Firmenbeirat und von unseren<br />
Ausstellern ist die Entscheidung für eine<br />
Live-Fachmesse und eine Digital-Tagung<br />
gefallen:<br />
BIOGAS Convention Digital:<br />
22. bis 26. November <strong>2021</strong><br />
BIOGAS Trade Fair Live:<br />
7. bis 9. Dezember <strong>2021</strong> in Nürnberg<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
Digital<br />
Auf der BIOGAS Convention Digital <strong>2021</strong><br />
wird es viel zu diskutieren geben: Die aktuellen<br />
politischen Entwicklungen rund<br />
um Energie- und Klimapolitik nach der<br />
Bundestagswahl, neue Gesetze und Regelungen,<br />
die Position der Biogasbranche<br />
und deren Selbstverständnis. Kraftstoffe<br />
und Grüne Gase, von Wasserstoff bis Gashandel,<br />
sind die Themen der Zukunft. Es<br />
wird gezeigt, dass Gesetze und technische<br />
Regelwerke meisterbar<br />
sind, wenn sie nicht als<br />
„Feind“ betrachtet, sondern<br />
als unverzichtbarer<br />
Teil für sichere und nachhaltige<br />
Anlagen begriffen<br />
werden.<br />
Sichere Anlagen wiederum<br />
verbessern auch das<br />
Image der Branche. Aktuelle<br />
Rechtsfragen und<br />
Urteile stehen ebenso<br />
auf dem Programm wie<br />
die dynamischen Entwicklungen<br />
im Düngerecht und bei der<br />
Abfallvergärung. Auch die Dauerbrenner<br />
Emissionen, das Störfallrecht und die<br />
Auswirkungen der RED II und Nachhaltigkeitsverordnungen<br />
werden ausführlich<br />
diskutiert.<br />
Die Herausforderungen für die Biogasbranche<br />
werden also nicht weniger! Biogasanlagenbetreiber<br />
und Biogasfirmen müssen<br />
sich darauf einstellen und aktiv nach Lösungen<br />
suchen. Wer sich jetzt engagiert<br />
und neue Wege geht, wer bereit ist für Veränderungen,<br />
wer auf geänderte Rahmenbedingungen<br />
reagieren oder sogar über diese<br />
hinausgehen kann, der hat gute Chancen,<br />
auch in Zukunft erfolgreich zu arbeiten.<br />
Die digitale Plattform wird daher <strong>2021</strong><br />
allen Besucher:innen viel Gelegenheit zur<br />
Interaktion bieten, angefangen von der Diskussion<br />
mit den Experten über den virtuellen<br />
Biogas-Treff mit anderen Teilnehmern<br />
bis hin zu Umfragen oder Feedbackrunden.<br />
Für unsere internationalen Teilnehmer, die<br />
nicht anreisen können, bietet die digitale<br />
Plattform die Chance, sich mit Experten<br />
und anderen Teilnehmern auszutauschen<br />
und Einblicke in die deutsche Biogasbranche<br />
oder internationale Projekte zu erhalten.<br />
Gemeinsam mit den ausstellenden Firmen<br />
ist ein englischsprachiges Programm<br />
in Planung, das von internationalen Gästen<br />
kostenfrei wahrgenommen werden kann.<br />
Auf der BIOGAS Trade Fair Live vom 7. bis<br />
9. Dezember <strong>2021</strong> in Nürnberg können<br />
dann die Gespräche der Tagung fortgesetzt<br />
werden. Und nicht nur das: Es besteht auf<br />
der Messe die Möglichkeit, neue Techniken,<br />
Geräte, Software wieder live zu sehen<br />
und zu fühlen. So können Investitionen für<br />
neue Perspektivfelder vorbereitet oder sogar<br />
schon getätigt werden. Für Besucher bietet<br />
sich damit im Dezember die Chance, auf einer<br />
der ersten wieder in Präsenz stattfindenden<br />
Messen Geschäftspartner persönlich zu<br />
treffen und sich über wichtige Themen zu<br />
informieren und auszutauschen.<br />
Das Team vom Fachverband freut sich darauf,<br />
Mitglieder und Branchenvertreter nach<br />
zwei Jahren persönlich auf der Messe, im<br />
BIOGAS Treff und im BIOGAS Fachforum<br />
zu begrüßen. Das BIOGAS Fachforum kann<br />
von jedem Messebesucher kostenfrei besucht<br />
werden.<br />
Bleiben Sie auf dem Laufenden: In wenigen<br />
Wochen werden wir auf www.biogasconvention.com<br />
das Programm der BIO-<br />
GAS Convention <strong>2021</strong> veröffentlichen.<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair <strong>2021</strong> in Kürze:<br />
ffBIOGAS Convention Digital vom 22. bis 26.11.<strong>2021</strong><br />
ffBIOGAS Trade Fair Live in Nürnberg vom 7. bis 9.12.<strong>2021</strong><br />
ffObligatorische Online-Vorabregistrierung für Teilnehmer und Messebesucher, auch für Mitglieder.<br />
ffKostenfreies Grundangebot der digitalen Plattform (Firmenübersicht und -kontakte, BIOGAS Fachforum digital,<br />
Chat-Optionen, Diskussionsräume etc.). Das Hauptvortragsprogramm bleibt kostenpflichtig.<br />
ffAlle Live-Messebesucher erhalten automatisch einen kostenfreien Zugang zum Grundangebot der digitalen Plattform.<br />
Weitere Informationen: www.biogas-convention.com<br />
07. – 09. Dezember <strong>2021</strong><br />
Messe Nürnberg<br />
26
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
ERFAHRUNG<br />
IST DIE BASIS<br />
JEDER INNOVATION<br />
Bei allem, was wir tun, verlieren wir nie aus den Augen, worum es für Sie geht:<br />
effiziente Technik und eine einfache Handhabe.<br />
Als Erfinder der elastomerbeschichteten Drehkolbenpumpe und Innovationstreiber für<br />
Einbring- und Aufbereitungstechnik sehen wir uns bei Vogelsang dem guten Ruf der deutschen<br />
Maschinenbauindustrie und ihrem Beitrag zur Energiewende verpflichtet. Seit der Gründung<br />
des Unternehmens 1929 liefern wir technische Lösungen, deren Funktionalität, Qualität<br />
und Zuverlässigkeit von unseren Kunden weltweit hoch geschätzt werden und unseren Wettbewerbern<br />
als Vorbild dienen.<br />
Unser umfassendes Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Biogas nutzen<br />
wir, um unseren Kunden als kompetenter Partner zur Seite zu stehen. Mit schlagkräftiger<br />
Pump-, Zerkleinerungs-, Desintegrations- und Feststoffdosiertechnik ebenso wie mit unseren<br />
individuellen Beratungsleistungen.<br />
VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY<br />
vogelsang.info<br />
27
AKTUELLES BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
ANZEIGE<br />
MECHANISCHE AUFBEREITUNG VON FASERIGEN<br />
ABFALL- UND RESTSTOFFEN FÜR BIOGASANLAGEN<br />
MIT DER KAHL KOLLERMÜHLE<br />
Kollermühle von AMANDUS KAHL Stroh bietet ein hohes Biogaspotenzial<br />
Energiemais ist nach wie vor das am häufigsten<br />
verwendete Gärsubstrat für Biogasanlagen. Allerdings<br />
wurde in den vergangenen Jahren verstärkt<br />
nach Alternativen gesucht, Mais für die Biogaserzeugung<br />
anteilig zu ersetzen. Landwirtschaftliche<br />
Abfall- und Reststoffe wie Festmist, Stroh und<br />
andere Ernterückstände, aber auch Landschaftspflegematerial<br />
und Grünschnitt von öffentlichen<br />
Flächen sowie forstwirtschaftliche Reststoffe<br />
bieten hier ein enormes Biogaspotential.<br />
Im Zusammenhang mit der Nutzung der beschriebenen<br />
Abfall- und Reststoffe rückt verstärkt<br />
die Substrataufbereitung für die Biogasanlagen<br />
in den Fokus. Durch eine gezielte Substrataufbereitung<br />
soll zum einen die Methanausbeute<br />
gesteigert und der Abbau der Biomasse beschleunigt,<br />
zum anderen die Förderfähigkeit<br />
des Substrates gesteigert und die Schaum- und<br />
Schwimmschichtneigung reduziert werden. Hierfür<br />
können unterschiedliche chemische, biologische<br />
und physikalische Verfahren zum Einsatz<br />
kommen.<br />
AMANDUS KAHL ist ein international bekanntes<br />
Maschinenbauunternehmen aus Reinbek bei<br />
Hamburg mit mehr als 140 Jahren Erfahrung<br />
im Maschinen und Anlagenbau. Eine der Kernmaschinen<br />
des Unternehmens ist die Flachmatrizenpresse,<br />
welche weltweit für die Pelletierung<br />
unterschiedlicher Produkte aus verschiedenen<br />
Industrien genutzt wird. Basierend auf den Prinzipien<br />
dieser Flachmatrizenpresse hat AMANDUS<br />
KAHL die Kollermühle für die Zerfaserung nasser<br />
Holzhackschnitzel zur Herstellung von Brennstoffpellets<br />
entwickelt. Die Vermahlungseigenschaften<br />
der Kollermühle für die Holzhackschnitzel können<br />
optimal für die Substrataufbereitung rohfaserhaltiger<br />
Reststoffe zum Einsatz in Biogasanlagen<br />
genutzt werden. Des Weiteren ist die Kollermühle<br />
gegenüber Schneid- und Hammermühlen im<br />
Betrieb wesentlich energiesparender und kostengünstiger.<br />
Für die Substrataufbereitung wird das Eingangsmaterial<br />
aus einem Dosierbunker (bspw. Futtermischwagen)<br />
gleichmäßig in die KAHL Kollermühle<br />
dosiert.<br />
Das Produkt fällt mittels Schwerkraft auf die<br />
Flachmatrize und wird durch die Überrollung der<br />
Kollerrollen zerfasert. Durch die Zerfaserung wer-<br />
28
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
AKTUELLES<br />
AMANDUS<br />
KAHL<br />
ANZEIGE<br />
den die Zellen im Stroh geöffnet, sodass die Luft<br />
besser entweichen kann. Dies minimiert das Risiko<br />
zur Bildung von Schaum- und Schwimmschichten<br />
im Fermenter.<br />
Eine erste Pilotanlage zur Zerfaserung von Stroh,<br />
Gras und Festmist mit einer Kollermühle von<br />
AMANDUS KAHL läuft in Dänemark. Hier kommt<br />
vorwiegend nasses, als Einstreu für Tiere ungeeignetes<br />
Stroh zum Einsatz. Die Feuchtigkeit<br />
des Eingangsprodukts kann zwischen 15% und<br />
70% variieren, allerdings ist die Verarbeitung im<br />
Feuchtigkeitsbereich von 40–50% am effektivsten.<br />
Um den Feuchtigkeitsgehalt sehr nassen<br />
Strohs zu reduzieren, werden in der Anlage in<br />
Dänemark Haferschalen beigemischt, sodass das<br />
Eingangsmaterial der Kollermühle durchgehend<br />
eine Feuchtigkeit von 40–50% aufweist. Bei der<br />
hier eingesetzten Kollermühle handelt es sich um<br />
den Maschinentyp 45–1250. Die Zahl 1250 steht<br />
für den Matrizendurchmesser von 1.250mm. Die<br />
Matrize hat eine Lochung von 16mm, kann je nach<br />
gewünschtem Mahlgrad dahingehend jedoch angepasst<br />
werden. Die Kapazität dieser Kollermühle<br />
beträgt 15 t/h. Nach Überrollung des Stroh-Hafer-<br />
Gemischs wird die zerfaserte Biomasse in einem<br />
Rührwerksbehälter mit Gülle vermischt und in den<br />
Fermenter der Biogasanlage gepumpt.<br />
Das auf der Kollermühle zerfaserte Stroh wurde<br />
von der Aarhus Universität in Bezug auf die Gasausbeute<br />
mit lediglich geschnittenem Stroh verglichen.<br />
Die Gasproduktion von gekollertem Stroh<br />
ist um mehr als 30% größer als bei normal geschnittenem<br />
Stroh. Mit dem zerfaserten Produkt<br />
ist es möglich, die gleiche Gasausbeute, welche<br />
man mit geschnittenem Stroh nach 30 Tagen erhält,<br />
bereits nach 17 Tagen zu erreichen, was eine<br />
deutliche Effizientssteigerung der Anlage bedeutet<br />
(siehe Abb. 1).<br />
Auch bei der Zerfaserung von Gräsern ist ein<br />
deutlicher Mehrwert zu erkennen. Nach kurzer<br />
Verweilzeit beträgt die Gasausbeute des zerfaserten<br />
Grases >100% – die Gasausbeute von<br />
unbehandelten Gräsern nach 30 Tagen, kann mit<br />
den zerfaserten bereits nach 20 Tagen realisiert<br />
werden (siehe Abb. 2).<br />
Die zerfaserte Biomasse ist besser dosierfähig<br />
und kann in Verbindung mit Gülle gut in die<br />
Fermenter gepumpt werden, ohne Schaum- und<br />
Schwimmstoffe zu bilden. Dies ermöglicht den<br />
Einsatz unterschiedlicher Rest- und Abfallstoffe<br />
in den Biogasanlagen und führt dazu, dass<br />
bestehende Biogasanlagen ihre Gasproduktion<br />
steigern können, ohne das Fermentervolumen<br />
dabei zu vergrößern. Zusätzlich können Betreiber<br />
bestehender Anlagen durch den Einsatz der beschriebenen<br />
Biomassen im Vergleich zu Silomais<br />
oder Nebenprodukten der Lebensmittelproduktion<br />
Geld sparen, ohne die totale Gasausbeute zu<br />
verringern. Zu guter Letzt können diese Gärreste<br />
problemlos pelletiert werden und den Feldern als<br />
hochwertiger Dünger zu Gute kommen. Für die<br />
Zerfaserung mittels Kollermühle und eine anschließende<br />
Pelletierung der Gärreste ist AMANDUS KAHL<br />
Ihr zuverlässiger Partner.<br />
Gas (L CH4/kg VS)<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
0<br />
0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70<br />
Dage<br />
Dage<br />
Gas (L CH4/kg VS)<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
Hvedehalm snittet<br />
Hvedehalm snittet og grinded<br />
Frøgræs<br />
Grinded frøgræs<br />
Abb. 1: Møller, Aarhus Universität, November 2017 Abb. 2: Møller, Aarhus Universität, November 2017<br />
QR-Code scannen und mehr erfahren<br />
AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG · Germany<br />
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.com<br />
29
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Reparatur des EEG <strong>2021</strong> abgeschlossen:<br />
Flexzuschlag gesichert!<br />
Kurz vor der politischen Sommerpause hat die Biogasbranche noch einen wichtigen Erfolg erzielt: Bestandsanlagen,<br />
die die Flexprämie in der ersten Vergütungsperiode erhalten haben, können in der Anschlussförderung<br />
für bereits geförderte Leistung den Flexzuschlag bekommen.<br />
Von Jörg Schäfer<br />
Die vergangenen Monate glichen<br />
einer Achterbahnfahrt. Nach<br />
Jahren der Stagnation, in denen<br />
die Entscheidungen aus<br />
Berlin den Anschein erweckten,<br />
Biogas spiele keine Rolle in den energiepolitischen<br />
Plänen der Bundesregierung,<br />
kamen mit der Debatte um das EEG <strong>2021</strong><br />
erstmals wieder hoffnungsvolle Signale<br />
aus der Bundeshauptstadt: Die Ausschreibungsvolumina<br />
für Strom aus Bioenergie<br />
wurden von 150 auf 600 Megawatt pro Jahr<br />
angehoben, ebenso die Gebotshöchstwerte<br />
für Neu- und Bestandsanlagen; der Flexdeckel<br />
wurde gestrichen und der Flexzuschlag<br />
erhöht, sogar die Sondervergütungsklasse<br />
für Güllekleinanlagen wurde ausgeweitet.<br />
Doch dann kam nach anfänglicher Euphorie<br />
kurz vor Weihnachten, quasi durch die<br />
Hintertür, die Streichung des Flexzuschlags<br />
für Bestandsanlagen. Angeblicher Grund:<br />
beihilferechtliche Bedenken aus dem Bundeswirtschaftsministerium.<br />
Ein wirtschaftlicher<br />
Weiterbetrieb tausender Anlagen war<br />
so wieder infrage gestellt. Fachverbands-<br />
Präsident Horst Seide verglich die einst<br />
zukunftsweisende EEG-Novelle zu Recht<br />
mit einer angezogenen Handbremse in voller<br />
Fahrt.<br />
Nachdem das EEG <strong>2021</strong> dann im neuen<br />
Jahr in Kraft trat, begannen in Berlin die<br />
ersten Versuche, die gröbsten Schwachstellen<br />
auszubessern. Allen voran die unsägliche<br />
Neuregelung des Flexzuschlags. Unter<br />
Zuhilfenahme juristischer Fachexpertise<br />
konnte durch die Anwaltskanzlei von Bredow<br />
Valentin Herz klargestellt werden, dass<br />
die neuen Anforderungen an die Flexibilisierung<br />
von Biogas sowie die laufenden<br />
Kosten die Notwendigkeit des Investitionszuschusses<br />
auch im zweiten Vergütungszeitraum<br />
dringend erforderlich machen.<br />
Dies ließe sich auch jederzeit gegenüber<br />
der EU rechtfertigen, so die Anwälte.<br />
Erst zögern, dann positive Signale<br />
aus Abgeordnetenbüros<br />
Und man merkte, so langsam schien sich<br />
etwas zu bewegen im politischen Berlin.<br />
Nach vorerst ausweichenden Antworten<br />
aus Ministerien und Abgeordnetenbüros<br />
kam zunehmend häufiger das Signal, dass<br />
man das EEG womöglich doch noch im<br />
Omnibus-Verfahren, also im Kielwasser<br />
eines noch zu verhandelnden Gesetzes,<br />
erneut aufschnüren könnte. Das war das<br />
Aufbruchs-Signal für die Branche! Zahlreiche<br />
Positionspapiere wurden geschrieben,<br />
zahllose Gespräche geführt. Alles kam auf<br />
den Tisch: die endogene Mengensteuerung,<br />
die Südquote, die Anschlussregelung<br />
für kleine Gülleanlagen und natürlich auch<br />
das Herzensanliegen der Biogasbranche:<br />
der Flexzuschlag.<br />
Auch die Clearingstelle EEG/KWKG brachte<br />
sich ein und unterbreitete ihre Änderungsempfehlungen.<br />
Teil des Expertengremiums<br />
waren neben wissenschaftlichen Institutionen<br />
und Juristen auch Branchenvertreter<br />
wie der Fachverband Biogas. Nach Aufrufen<br />
aus der Mitgliedschaft, die eigenen<br />
Wahlkreis-Abgeordneten anzusprechen,<br />
brannte in Berlin förmlich die Luft. Zahlreiche<br />
Abgeordnete verständigten sich darauf,<br />
den Flexzuschlag noch einmal anzugehen.<br />
Und das letztlich mit Erfolg!<br />
Am 25. Juni beschloss der Bundestag endlich<br />
ein Reparatur-EEG und damit einhergehend<br />
eine echte Anschluss-Perspektive<br />
für tausende Biogasanlagenbetreiber. Die<br />
Streichung des Flexzuschlags für Biogasanlagen<br />
im zweiten EEG-Vergütungszeitraum<br />
wurde zurückgenommen. Somit konnte die<br />
für die Branche so wichtige Regelung aus<br />
dem EEG 2017 wieder hergestellt werden.<br />
Laut des Beschlusses können Biogasanlagenbetreiber<br />
zukünftig wieder einen<br />
Flexzuschlag in Höhe von 50 Euro je installiertem<br />
Kilowatt geltend machen, sofern<br />
sie bereits im ersten Vergütungszeitraum<br />
für flexibilisierte Leistung die Flexprämie<br />
erhalten haben. Zusätzliche installierte<br />
Flex-Leistung kann 65 Euro je Kilowatt in<br />
Anspruch nehmen.<br />
Gleichwohl steht die Regelung unter dem<br />
Zustimmungsvorbehalt seitens der EU.<br />
Doch wir bleiben zuversichtlich, dass auch<br />
die Europäische Kommission die Notwendigkeit<br />
des Flexibilitätszuschlages anerkennen<br />
wird. Und was die anderen verbleibenden<br />
Baustellen anbelangt – die nächste<br />
EEG-Novelle nach der Bundestagswahl ist<br />
quasi vorprogrammiert.<br />
Autor<br />
Jörg Schäfer<br />
Referent im Referat Politik<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
EUREF Campus 16 · 10829 Berlin<br />
030/2 75 81 79-0<br />
berlin@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
FOTO: ADOBE STOCK/THEEVENING<br />
30
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
HOLEN SIE MEHR<br />
RAUS AUS IHRER<br />
BIOGASANLAGE<br />
WANGEN<br />
Das modulare System zum<br />
zuverlässigen Schutz von Anlagen.<br />
MAX.<br />
DURCHFLUSSMENGE<br />
m 3 /h<br />
MAX.<br />
DIFFERENZDRUCK<br />
bar 6<br />
POLITIK<br />
1.250 *<br />
MAX.<br />
DREHZAHL<br />
DER SCHNEIDEMESSER<br />
min -1 3.000<br />
* Angaben gelten bei Wasser als Medium<br />
Geringe Verschleißkosten<br />
und niedriger Energieeinsatz<br />
optimieren die Effizienz<br />
Ihrer Anlage.<br />
Das modulare System besteht aus dem X-TRACT<br />
(Fremdkörperabscheider) und dem X-CUT (Zerkleinerer),<br />
läuft wie geschmiert, scheidet extrem gut ab und bietet<br />
mehr Schutz vor schädigenden Störstoffen wie z.B.<br />
Steine. Die hochbelastbare Heavy-Duty-Dichtung,<br />
der Hochleistungs-Zerkleinerer und der großvolumige<br />
Absetzbehälter garantieren den optimalen Einsatz und die<br />
maximale Servicefreundlichkeit.<br />
Substrat vorher:<br />
Grobes, mit Störstoffen<br />
durchsetztes Medium<br />
Substrat nachher:<br />
Fein gehäckseltes,<br />
breiartiges Medium<br />
ohne Störstoffe.<br />
Qualität entsteht im Detail. Und in WANGEN.<br />
WWW.WANGEN.COM 31
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Neue Chancen für Biogas und<br />
Biomethan im Kraftstoffsektor<br />
Aus dem frisch novellierten Bundes-Immissionsschutzgesetz („BImSchG“) ergeben sich<br />
neue zukunftsweisende Möglichkeiten für den Einsatz von Biogas und Biomethan. Die<br />
Treibhausgasminderungsquote („THG-Quote“), mit dem die Emissionsminderung im Verkehr<br />
geregelt wird, steigt bis 2030 stark an. Dies kommt insbesondere abfallstämmigem<br />
Biomethan zugute. Aber auch für Wasserstoff aus Biomasse gibt es neue Impulse.<br />
Von Sandra Rostek und Dr. Guido Ehrhardt<br />
Seit Jahren blicken wir mit Spannung der<br />
Umsetzung der EU-Richtlinie für Erneuerbare<br />
Energien im Verkehr entgegen, denn<br />
die EU hatte schon lange erkannt, dass<br />
auch Biomethan und Co. neben der Elektromobilität<br />
wichtige Optionen für den Klimaschutz im<br />
Verkehr sind. Als Ende September letzten Jahres dann<br />
der lang ersehnte Referentenentwurf aus dem Bundesumweltministerium<br />
(BMU) kam, waren wir geschockt:<br />
Statt einer Weiterentwicklung der THG-Quote schlug<br />
das BMU absolute Stagnation vor.<br />
Bis etwa 2025, so der ursprüngliche Vorschlag, sollte<br />
die THG-Quote mehr oder weniger auf dem Niveau von<br />
heute verharren, eine weitere Anpassung für die Jahre<br />
danach wurde erst gar nicht vorgenommen. Die unbestreitbar<br />
vorhandenen Potenziale der Elektromobilität,<br />
fortschrittlicher Biokraftstoffe sowie der bereits voll im<br />
Markt integrierten Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse<br />
wurden komplett negiert. Neue „Erfüllungsoptionen“<br />
zur Verbesserung der THG-Bilanz des Kraftstoffmixes,<br />
wie etwa Wasserstoff, wurden ignoriert, erst recht, wenn<br />
dieser aus biogenen Quellen stammt. Klimaschutz im<br />
Verkehr? – Fehlanzeige, zumindest wenn es nach dem<br />
BMU ging.<br />
Umso erleichterter sind wir nun, ein knappes Dreivierteljahr<br />
später, über das letztlich dann doch sehr zuversichtlich<br />
stimmende Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens.<br />
Brachte schon die Ressortabstimmung<br />
eindeutige Lichtblicke und Verbesserungen mit sich,<br />
so war es insbesondere das parlamentarische Verfahren,<br />
in dem eine offene und breite Diskussion stattfand,<br />
in der wir auch als Hauptstadtbüro Bioenergie Akzente<br />
setzen konnten, unter anderem durch die Benennung<br />
als Sachverständige für die Öffentliche Anhörung. Die<br />
Berichterstatter der Union und SPD zeigten sich ebenso<br />
einig und beherzt in der Sache und auch erfreulich<br />
kampfeslustig gegenüber dem bis zuletzt leider sehr<br />
rückwärtsgewandten BMU.<br />
Nun zu den Inhalten: Die THG-Quote im Verkehrssektor<br />
soll von 6 Prozent im Jahr <strong>2021</strong> auf insgesamt 25<br />
Prozent in 2030 ansteigen. Das ist ein beachtliches<br />
Ambitionsniveau, das allen Erfüllungsoptionen genügend<br />
Raum lässt: Bewährte Optionen wie Biokraftstoffe<br />
aus Anbaubiomasse sind gedeckelt und werden deshalb<br />
voraussichtlich nur stabil bleiben, während neue<br />
Optionen wie fortschrittliche Biokraftstoffe und grüner<br />
Wasserstoff neue Impulse erfahren und die Chance erhalten,<br />
in den kommenden Jahren aufzuwachsen.<br />
Wer Biomethan einsetzt, erreicht schneller<br />
vorgeschriebene THG-Minderung<br />
Die heutige „Nische“ Biomethan, die in der derzeitigen<br />
Quote noch eine untergeordnete Rolle spielt,<br />
dürfte dabei künftig stark an Bedeutung gewinnen.<br />
Dies zum einen durch die sogenannte „Unterquote“<br />
für fortschrittliche Biokraftstoffe, die besagt, dass ein<br />
bestimmter Prozentsatz der Quote mindestens und<br />
ausschließlich durch die in diesem Segment von der<br />
EU vorgegebenen Optionen zu decken sind, unter anderem<br />
Biomethan aus Gülle. Dies aber zum anderen<br />
auch durch die besonders hohen THG-Einsparungen<br />
gerade beim Einsatz von Gülle in Biogasanlagen, die<br />
Biomethan zu einer besonders attraktiven Erfüllungsoption<br />
für die quotenverpflichteten Mineralölkonzerne<br />
machen. Wer Biomethan einsetzt, erreicht schneller<br />
die vorgeschriebene THG-Minderung als mit einigen<br />
anderen Möglichkeiten, die teilweise eine geringere<br />
THG-Einsparung aufweisen.<br />
Auch wir können heute nur den Blick in die Glaskugel<br />
wagen und Prognosen aufstellen, wie groß dieser Markt<br />
letztlich für Biomethan ausfallen wird. Diese Szenarien<br />
hängen von vielen Faktoren ab, insbesondere von<br />
der insgesamt Markt bestimmenden Entwicklung der<br />
Elektromobilität und dem Energieverbrauch im Verkehr.<br />
Wir schätzen jedoch, dass der Bedarf an fortschrittlichen<br />
Biokraftstoffen, der aus der Neuregelung<br />
erwachsen könnte, etwa 30 Terawattstunden (TWh)<br />
umfassen dürfte.<br />
Wenn auch nur die Hälfte davon aus Biomethan zum<br />
Beispiel in Form von Bio-CNG oder Bio-LNG gedeckt<br />
32
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
FOTO: JÖRG BÖTHLING<br />
wird, dann entspricht dies mehr als einer Verdoppelung<br />
des gesamten heutigen Biomethanmarkts in Deutschland<br />
mit gut 200 größeren Produktionsanlagen. Hier<br />
entstehen folglich ein realer neuer Markt und eine echte<br />
Alternative zur Strom- und Wärmeerzeugung für viele<br />
neue und bestehende Biogasanlagen. Hier entsteht<br />
eine neue Zukunftsperspektive!<br />
2025 erreicht Gesamtquote 10,5 %<br />
Zudem ist es uns auch gelungen, deutlich zu machen,<br />
dass der Klimaschutz im Verkehr nicht auf die lange<br />
Bank geschoben werden darf und dass dies auch überhaupt<br />
nicht erforderlich ist. Auch kurz- bis mittelfristig<br />
stehen, entgegen der Auffassung des BMU, genügend<br />
Optionen zur Verfügung, die einen Anstieg der Quote<br />
auch zwischen 2022 und 2025 nicht nur rechtfertigen,<br />
sondern im Sinne einer ambitionierten Klimapolitik<br />
auch erfordern. Schon 2022 soll die Quote nun um<br />
1 Prozentpunkt ansteigen auf 7 Prozent (%), 2023 auf<br />
8 %, 2024 auf 9,25 % und schließlich soll sie 2025 bei<br />
10,5 % liegen. Dies bedeutet: Wer mit dem Gedanken<br />
spielt, in den Kraftstoffmarkt einzusteigen, hat jetzt<br />
eine klare Perspektive!<br />
Auch wichtig: Die Förderung weniger nachhaltiger Optionen,<br />
die umweltschädliche Nebeneffekte mit sich<br />
bringen, allen voran Palmöl, wird zurückgefahren.<br />
Palmöl soll in wenigen Jahren gar nicht mehr anrechenbar<br />
sein; die Förderung von Abwässern aus der<br />
Palmölindustrie, die aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt<br />
ebenfalls als fortschrittlicher Kraftstoff gelten,<br />
wird eingeschränkt.<br />
Ein weiteres zentrales Thema der Verhandlungen war<br />
der biogene Wasserstoff, wie er beispielsweise aus der<br />
Dampfreformation von Biogas gewonnen wird. Gemäß<br />
BMU-Entwurf sollte Wasserstoff nur auf die Quote<br />
anrechenbar sein, wenn er aus Elektrolyse gewonnen<br />
wird, nicht aber, wenn er aus Biomasse gewonnen<br />
wird. Die – aus unserer Sicht absurde – Begründung<br />
war, der biogene Wasserstoff würde in Konkurrenz zum<br />
Hochlauf der Elektrolyse stehen, denn – hört, hört – der<br />
biogene Wasserstoff sei kurzfristig verfügbar und sogar<br />
kostengünstiger. Das BMU selbst hatte also die besten<br />
Gründe geliefert, warum biogener Wasserstoff absolut<br />
Sinn macht.<br />
Wasserstoff aus Abfallbiomasse ab<br />
Juli 2023 auf Quote anrechenbar<br />
Nach zähen Diskussionen ist es uns gelungen, dass zumindest<br />
der pauschale Ausschluss des biogenen Wasserstoffs<br />
zurückgenommen wurde. Nach Festlegung<br />
bestimmter Kriterien soll Wasserstoff aus abfallstämmiger<br />
Biomasse ab 1. Juli 2023 dann auf die Quote<br />
anrechenbar sein, wenn dieser Wasserstoff als Kraftstoff<br />
im Straßenverkehr eingesetzt wird. Auch wenn<br />
dies heute noch wie Zukunftsmusik klingt – wir sind<br />
überzeugt, dass sich auch hier ein neues Marktfenster<br />
für die Bioenergie öffnet.<br />
Von Konkurrenz kann keine Rede sein: Elektrolyse und<br />
Biogas-Dampfreformation ergänzen und verstärken sich<br />
gegenseitig und sorgen dafür, dass der Einstieg in die<br />
Wasserstoffwirtschaft kurzfristig gelingt. Ein typisches<br />
Anwendungsbeispiel wäre die Brennstoffzellen-Busflotte<br />
einer kleineren Stadt, die nicht über größere Windund<br />
PV-Kapazitäten verfügt, dafür aber über Biomasse,<br />
und die so versorgt werden könnte. Denn bereits eine<br />
400-kW-Biogasanlage kann den Wasserstoffbedarf von<br />
12 bis 16 Bussen mit Brennstoffzellenantrieb versorgen.<br />
Darüber hinaus enthält das Gesetz<br />
den Auftrag an das BMU, zu prüfen,<br />
inwieweit auch der Einsatz von<br />
biogenem Wasserstoff als<br />
Grundstoff in Raffinerien<br />
eine sinnvolle Ergänzung<br />
des Straußes an Erfüllungsoptionen<br />
sein<br />
könnte.<br />
Die zentrale Botschaft<br />
des BIm-<br />
SchG lautet: ALLE<br />
Erfüllungsoptionen<br />
werden benötigt,<br />
um die Mammutaufgabe<br />
Klimaschutz<br />
im Verkehrssektor zu<br />
bewältigen. Biomethan<br />
und Biogas werden zunehmend<br />
wichtiger werden,<br />
was sich erstmals in konkreten<br />
Aufwuchspfaden wiederfindet.<br />
Mit dem biogenen Wasserstoff haben<br />
wir ein innovatives neues Anwendungsfeld<br />
für unsere Technologie, das gerade in Zeiten, in denen<br />
alle Welt ausschließlich über Wasserstoff zu sprechen<br />
scheint, auch uns Teil dieses Gesprächs werden lässt.<br />
Die nächste Novelle des BImSchG fällt übrigens in die<br />
nächste Legislaturperiode. Man darf gespannt sein, wie<br />
das Instrument der THG-Quote weiterentwickelt wird –<br />
denn eines darf man nicht vergessen: 25 Prozent THG-<br />
Minderung im Verkehr sind sicher gut; aber sie reichen<br />
natürlich nicht für die beschlossene Klimaneutralität<br />
bis 2045!<br />
Autoren<br />
Sandra Rostek<br />
Leiterin des Berliner Büros<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
Dr. Guido Ehrhardt<br />
Leiter des Referats Politik<br />
im Fachverband Biogas e.V.<br />
030/2 75 81 79-0<br />
berlin@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
33
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INTERVIEW ZUR BUNDESTAGSWAHL<br />
CDU/CSU<br />
„Die CSU war es, die Pläne verhindert hat,<br />
die Biomasse insgesamt abzuwracken“<br />
Im Gespräch mit Dr. Andreas Lenz, Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und<br />
Energie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Berichterstatter des Ausschusses<br />
für seine Bundestagsfraktion.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Dr. Andreas Lenz<br />
Biogas Journal: Herr Dr. Lenz, zum Redaktionsschluss<br />
dieser Ausgabe des Biogas Journals lag noch kein Wahlprogramm<br />
der Unionsfraktion vor. Wir hätten dennoch<br />
gern folgende Fragen beantwortet: In der vergangenen<br />
Legislaturperiode hat vor allem die<br />
CDU die Energiewende in allen Sektoren<br />
ausgebremst. Während einerseits ambitionierte<br />
Klimaziele gesteckt wurden,<br />
mangelt es andererseits an rechtlichen<br />
Rahmenbedingungen, die die<br />
Ziele erreichbar werden lassen. Wie<br />
wollen Sie bei den Themen Klimaschutz<br />
und Energiewende sowohl<br />
Vertrauen als auch Wähler*innen<br />
zurückgewinnen?<br />
Dr. Andreas Lenz: Fakt ist doch, dass<br />
wir die letzten vier Jahre Rekordzahlen<br />
beim Zubau der Erneuerbaren gesehen<br />
haben. Wir stehen jetzt bei 50 Prozent Anteil<br />
Erneuerbare am Bruttostromverbrauch.<br />
Das ist auch jetzt schon eine systemische Herausforderung.<br />
Stichwort Netzausbau. Klar ist aber<br />
auch: Wir brauchen angesichts der Klimaziele noch<br />
wesentlich höhere Ausbauziele. Wir als CSU haben<br />
uns als einzige Kraft für Biogas in diesem Kontext<br />
eingesetzt und sehen die entsprechenden Stärken<br />
dieses Energieträgers. Um es mal ganz offen zu sagen:<br />
Die CSU war es, die Pläne verhindert hat, die Biomasse<br />
insgesamt „abzuwracken“.<br />
Biogas Journal: Welche Rolle spielt die Bioenergieerzeugung<br />
für CDU/CSU im künftigen Erneuerbare-Energien-Mix?<br />
Dr. Lenz: Wir wollen den Bestand am Markt halten. Wir<br />
sehen zudem Potenzial für die Bioenergie, gerade was<br />
den Mobilitätssektor, aber auch den Wärmebereich anbelangt.<br />
Zudem gibt es aus unserer Sicht auch für größere<br />
Anlagen Potenzial, gerade was die Umrüstung auf<br />
Biomasse betrifft, etwa auch bei alten Kohlestandorten.<br />
Biogas Journal: Das neue EEG <strong>2021</strong> sichert weder<br />
den Anlagenbestand noch löst es Investitionen in<br />
Neuanlagen aus. Die Märzausschreibung hat gezeigt,<br />
dass die ausgeschriebene Leistung bei weitem nicht<br />
ausgeschöpft worden ist. Werden CDU/CSU bei einer<br />
Regierungsbeteiligung das aktuelle EEG frühzeitig<br />
überarbeiten und die Mängel beseitigen? Sprich endogene<br />
Mengensteuerung abschaffen sowie die Nord-<br />
Süd-Ausschreibung – weil verzerrender Wettbewerb –<br />
rückgängig machen?<br />
Dr. Lenz: Es gab im EEG <strong>2021</strong> schon auch Verbesserungen<br />
für die Bioenergie. Die erhöhten Ausschreibungsmengen<br />
sind ein Beitrag dazu, dass die im Klimaschutzplan<br />
2030 angelegten Ziele erreicht werden<br />
können. Natürlich muss man gewährleisten, dass die<br />
Ausschreibungen auch dazu führen, dass die entsprechenden<br />
Mengen am Markt bleiben – darum geht es.<br />
Und klar ist auch, dass es, wie bisher schon, immer<br />
wieder Nachjustierungen beim EEG braucht. Der um<br />
0,5 Cent pro Kilowattstunde erhöhte Zuschlagswert für<br />
kleine Anlagen mit einer installierten Leistung bis 500<br />
Kilowatt in der Ausschreibung (Neu- und Bestandsanlagen)<br />
soll die wettbewerblichen Nachteile und höheren<br />
Kosten kleinerer Anlagen gegenüber größeren Anlagen<br />
ausgleichen.<br />
Den Flexzuschlag und die Flexprämie haben wir unter<br />
hohem Einsatz ja bereits gesetzlich wieder verankert.<br />
Die Nord-Süd-Ausschreibung wurde vom Ministerium<br />
mit dem Ziel einer besseren Abstimmung zwischen<br />
Erneuerbaren-Ausbau und Netzausbau eingeführt.<br />
Biogas Journal: Laut aktuellem, überarbeitetem Klimaschutzpaket<br />
der Bundesregierung wurden auf Druck<br />
des Bundesverfassungsgerichts ehrgeizigere Klimaschutzziele<br />
in einzelnen Sektoren beschlossen. Für die<br />
Landwirtschaft bedeutet dies: zusätzlich 4 Millionen<br />
Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent an Treibhausgasen bis 2030<br />
einzusparen – nun also insgesamt 16 statt 12 Millionen<br />
Tonnen. Wie soll die Landwirtschaft das ohne vernünftige<br />
Perspektiven für die Biogasproduktion schaffen?<br />
Dr. Lenz: Die Herausforderungen durch die Klimaschutzziele<br />
sind für die Landwirtschaft auch mit Einbeziehung<br />
von Biogas schon sehr hoch. Aus meiner<br />
Sicht müssen CO 2<br />
-Senken auch der Landwirtschaft<br />
FOTO: CDU/ANDRÉ WAHBA<br />
34
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
entsprechend gutgeschrieben werden. Zudem<br />
brauchen wir aus meiner Sicht stärkere<br />
Anreize, was die Güllevergärung betrifft.<br />
Biogas Journal: Wenn Biogasanlagen nicht<br />
weiterbetrieben werden, dann droht in vielen<br />
Dörfern die Wärmeversorgung durch<br />
Abschalten der Biogas-Blockheizkraftwerke<br />
zu enden. Die Wärmewende scheint<br />
zu scheitern und der Rückschritt in die<br />
klimabelastende Erdgaswärmeversorgung<br />
scheint somit unaufhaltsam. Preiswerte<br />
Wärmeversorgung wird so zur Geschichte –<br />
insbesondere, da die fossilen Energieträger<br />
durch das BEHG in den nächsten<br />
Jahren aufgrund der CO 2<br />
-Abgabe teurer<br />
werden. Was wollen CDU/CSU gegen diese<br />
sich abzeichnende Entwicklung unternehmen?<br />
Dr. Lenz: Klar – die Wärmenetze betrieben<br />
durch Biogas sollen erhalten bleiben!<br />
Dafür muss gesorgt werden. Das ist durch<br />
eine Ausschreibung, so unliebsam diese<br />
auch mir persönlich ist, auch möglich. Es<br />
muss aber auch von den Verbrauchern und<br />
Beziehern der Wärme ein fairer Preis dafür<br />
bezahlt werden. Wärme kann nicht nur als<br />
„Abfallprodukt“ der Stromerzeugung gesehen<br />
werden.<br />
Biogas Journal: Thema Mobilität: Gerade<br />
die Union macht sich für Elektromobilität<br />
stark. Und auch Wasserstoff erfreut sich<br />
in Ihrer Partei großer Beliebtheit. Aber ist<br />
die technologische Einengung im Bereich<br />
des Individualverkehrs nicht falsch? Selbst<br />
wenn in 2030 rund 10 Millionen Elektro-<br />
Pkw und ein paar Wasserstoffautos auf den<br />
Straßen unterwegs sind, dann fahren da<br />
immer noch etwa 35 Millionen Verbrenner<br />
herum. Müssten nicht CO 2<br />
-arme Kraftstoffe<br />
wie Biomethan – produziert auf Basis von<br />
landwirtschaftlichen Reststoffen und ökologisch<br />
wertvoller Anbaubiomasse (Blüh-/<br />
Wildpflanzen und Co.) – gleichermaßen<br />
gefördert und Gasfahrzeuge in den Markt<br />
gebracht werden? Oder wie sollen in 2030<br />
rund zwei Drittel des deutschen Fahrzeugbestands<br />
klimaneutral gestellt werden? Haben<br />
die Christdemokraten gar nicht im Blick,<br />
dass Rohstoffe (seltene Erden) für die Elektromobilität<br />
nicht nachhaltig, sondern unter<br />
prekären Umwelt- und Arbeitsbedingungen<br />
aus der Erde geholt werden und auch die<br />
Verlagerung der Wasserstoffproduktion nach<br />
Afrika nicht per se nachhaltig ist?<br />
Dr. Lenz: Biomethan soll eine wichtige Rolle<br />
in der Mobilität der Zukunft spielen. Gerade<br />
weil Biomethan gegenüber beispielsweise<br />
Power-to-X Technologien durchaus<br />
auch preislich wettbewerbsfähig ist. Die<br />
EU-Vorgaben machen das nicht gerade einfach,<br />
trotzdem sollten hier weitere Anstrengungen<br />
unternommen werden. Es sollte<br />
insgesamt ein technologieoffener Ansatz<br />
verfolgt werden. Als ideologische Treiber<br />
der Elektromobilität fallen mir auch eher<br />
andere auf.<br />
Biogas Journal: Herr Dr. Lenz, vielen Dank<br />
für das Gespräch!<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
PlurryMaxx, der Nasszerkleinerer<br />
Ihre Vorteile<br />
Wenig störungsanfällig<br />
• keine Gegenschneide<br />
• der Gärprozess läuft besser ab<br />
• der PlurryMaxx kann keine Unterbrechung der<br />
Anlagenfunktion verursachen<br />
• sehr variable Einsatzmöglichkeit<br />
• äußerst robust gegen Störstoffe<br />
40%<br />
Zuschuss vom<br />
Staat!<br />
PlurryMaxx:<br />
Vergleichsweise<br />
das allerbeste<br />
Gerät!<br />
Mehrertrag durch Kavitation<br />
• Oberflächenvergrößerung des organischen Material<br />
• weniger Eigenstromverbrauch der gesamte Biogasanlage<br />
Erhöhte Substrateffizienz<br />
• ein größerer Einsatz von Reststoffen aus der<br />
Landwirtschaft wird möglich<br />
• ermöglicht den verstärkten Einsatz von Mist, Stroh<br />
und Ganzpflanzensilage (GPS) als Faulsubstrate<br />
Erhöhter Ertrag, niedrigere Kosten.<br />
Doetinchem (NL) | +31 (0)314 368 238 | energy@wopereis.nl | www.wopereis.nl<br />
35
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INTERVIEW ZUR BUNDESTAGSWAHL<br />
SPD<br />
„Ich stehe der Mengensteuerung<br />
kritisch gegenüber“<br />
Im Gespräch mit Johann Saathoff, energiepolitischer Koordinator der SPD-Bundestagsfraktion,<br />
über die Bedeutung der Biogasnutzung, Energiewende und Klimaschutz in der<br />
Landwirtschaft.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Johann Saathoff<br />
Biogas Journal: Herr Saathoff, im „Zukunftsprogramm“<br />
(Programm zur diesjährigen Bundestagswahl) Ihrer<br />
Partei ist unter Punkt 2.1 Zukunftsmission Deutschland<br />
dargestellt, wie sich die SPD ein klimaneutrales<br />
Deutschland vorstellt beziehungsweise<br />
wie sie das erreichen will. Leider ist dort<br />
nicht aufgeführt, wie sich die SPD zur<br />
Bioenergie-/Biogasproduktion positioniert.<br />
Spielt die Bioenergieerzeugung<br />
für die SPD im künftigen Erneuerbare-Energien-Mix<br />
keine Rolle mehr?<br />
Wenn doch, welche?<br />
Johann Saathoff: Die Bioenergie<br />
spielt für die SPD im erneuerbaren<br />
Energiemix selbstverständlich eine<br />
Rolle. Wir haben in den vergangenen<br />
Jahren immer deutlich gemacht, dass<br />
eine flexible Stromerzeugung aus Biogas<br />
ein wichtiger Faktor auf dem Weg hin<br />
zu einer Welt aus 100 Prozent Erneuerbaren<br />
ist, denn sie kann ihre Stromerzeugung in die Zeiten<br />
schieben, in denen zu wenig Wind weht oder die<br />
Sonne nicht scheint. Das war für uns Richtschnur bei<br />
allen EEG-Novellen der letzten Jahre.<br />
Biogas Journal: Das neue EEG <strong>2021</strong> sichert weder<br />
den Anlagenbestand noch löst es Investitionen in<br />
Neuanlagen aus. Die Märzausschreibung hat gezeigt,<br />
dass die ausgeschriebene Leistung bei weitem nicht<br />
ausgeschöpft worden ist. Wird die SPD bei einer Regierungsbeteiligung<br />
das aktuelle EEG frühzeitig überarbeiten<br />
und die Mängel beseitigen? Sprich endogene<br />
Mengensteuerung abschaffen sowie die Nord-Süd-<br />
Ausschreibung – weil verzerrender Wettbewerb – rückgängig<br />
machen?<br />
Saathoff: Wir haben den Flexzuschlag ja in diesem Jahr<br />
nochmal verändert, nachdem beim EEG <strong>2021</strong> das Ergebnis<br />
an dieser Stelle nicht zufriedenstellend war. Das<br />
Thema Mengensteuerung hat uns nicht nur beim Biogas<br />
ereilt. Auch beim Wind und bei PV gibt es so etwas<br />
schon. Ich stehe dem insgesamt sehr kritisch gegenüber,<br />
denn mit dem Green Deal und dem erhöhten Klimaschutzziel<br />
der EU brauchen wir natürlich viel mehr<br />
erneuerbaren Strom. Meine Kollegen und ich stehen<br />
dazu im Austausch mit Kommissionspräsident Frans<br />
Timmermans. Wir werden das Instrument Mengensteuerung<br />
wie auch die anderen Instrumente im Bereich<br />
Biogas genau beleuchten und bei Bedarf anpassen.<br />
Biogas Journal: Laut aktuellem, überarbeitetem Klimaschutzpaket<br />
der Bundesregierung – SPD ist beteiligt –<br />
wurden auf Druck des Bundesverfassungsgerichts<br />
ambitionierte Klimaschutzziele in einzelnen Sektoren<br />
beschlossen. Für die Landwirtschaft bedeutet dies: zusätzlich<br />
4 Millionen Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent an Treibhausgasen<br />
bis 2030 einzusparen –nun also insgesamt<br />
16 statt 12 Millionen Tonnen. Wie soll die Landwirtschaft<br />
das ohne vernünftige Perspektiven für die Biogasproduktion<br />
schaffen?<br />
Saathoff: Es gibt in der Landwirtschaft eine Reihe von<br />
Maßnahmen und Instrumenten, die zur Einsparung<br />
von Treibhausgasen beitragen können. Die Biogasproduktion<br />
ist eines davon, vor allem wenn möglichst viel<br />
Gülle zum Einsatz kommt. Gerade beim Thema Güllevergärung<br />
setzen wir uns für eine Ausweitung ein. Es<br />
ist allerdings auch eine Finanzierungsfrage. Wenn die<br />
Allgemeinheit die zusätzlichen Einsparungen in der<br />
Landwirtschaft neben anderen Leistungen wie den Direktzahlungen<br />
finanziert, kann ich diese Einsparungen<br />
nur bedingt der Landwirtschaft zurechnen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium<br />
sollte Geld aus seinem<br />
Anteil am EKF in die Hand nehmen, die EEG-Umlage<br />
will ich aber nicht weiter strapazieren. Zumal die ohnehin<br />
gedeckelt ist und Mehrkosten direkt aus Steuern<br />
gegenfinanziert werden müssen.<br />
Biogas Journal: Wenn Biogasanlagen nicht weiterbetrieben<br />
werden, dann droht in vielen Dörfern die Wärmeversorgung<br />
durch Abschalten der Biogas-Blockheizkraftwerke<br />
zu enden. Die Wärmewende scheint zu<br />
scheitern und der Rückschritt in die klimabelastende<br />
Erdgaswärmeversorgung scheint somit unaufhaltsam.<br />
Preiswerte Wärmeversorgung wird so zur Geschichte –<br />
insbesondere, da die fossilen Energieträger durch das<br />
FOTO: SPD<br />
36
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
BEHG in den nächsten Jahren aufgrund<br />
der CO 2<br />
-Abgabe teurer werden. Was will die<br />
SPD gegen diese sich abzeichnende Entwicklung<br />
unternehmen?<br />
Saathoff: Eine aus dem EEG subventionierte<br />
Wärmeversorgung ist ja eigentlich<br />
nur für die Nutzer preiswert. Es gab eine<br />
Förderung aus dem EEG über 20 Jahre und<br />
für einige Anlagen über weitere 10 Jahre.<br />
Schon mit der zehnjährigen Anschlussvergütung<br />
haben wir mit einem Grundsatz<br />
des EEG gebrochen, nämlich dass man nur<br />
für 20 Jahre Förderung bekommt. Da die<br />
fossilen Energieträger in den kommenden<br />
Jahren schrittweise teurer werden, wird<br />
die Wirtschaftlichkeitslücke aber immer<br />
kleiner werden. Wir haben uns beim EEG<br />
<strong>2021</strong> sehr für die Wiedereinführung eines<br />
Biomethan-Segments eingesetzt. Die Einspeisung<br />
des Biomethans ins Gasnetz ist<br />
in meinen Augen eigentlich viel besser als<br />
der Zwischenschritt über die Verstromung.<br />
Biogas Journal: Thema Mobilität: Auch die<br />
SPD macht sich für die Elektromobilität<br />
stark. Und Wasserstoff erfreut sich ebenfalls<br />
in Ihrer Partei großer Beliebtheit. Aber<br />
ist die technologische Einengung im Bereich<br />
des Individualverkehrs nicht falsch?<br />
Selbst wenn in 2030 rund 10 Millionen<br />
Elektro-Pkw und ein paar Wasserstoffautos<br />
auf den Straßen unterwegs sind, dann fahren<br />
da immer noch etwa 35 Millionen Verbrenner<br />
herum. Müssten nicht CO 2<br />
-arme<br />
Kraftstoffe wie Biomethan – produziert auf<br />
Basis von landwirtschaftlichen Reststoffen<br />
und ökologisch wertvoller Anbaubiomasse<br />
(Blüh-/Wildpflanzen und Co.) – gleichermaßen<br />
gefördert und Gasfahrzeuge in den<br />
Markt gebracht werden? Oder wie sollen<br />
in 2030 rund zwei Drittel des deutschen<br />
Fahrzeugbestands klimaneutral gestellt<br />
werden? Haben die Sozialdemokraten gar<br />
nicht im Blick, dass Rohstoffe (seltene Erden)<br />
für die Elektromobilität nicht nachhaltig,<br />
sondern unter prekären Umwelt- und<br />
Arbeitsbedingungen aus der Erde geholt<br />
werden und auch die Verlagerung der Wasserstoffproduktion<br />
nach Afrika nicht per se<br />
nachhaltig ist?<br />
Saathoff: Im Verkehrsbereich haben wir<br />
in den vergangenen Jahren unsere Klimaschutzziele<br />
stets verfehlt. Das wollen wir<br />
ändern. Deshalb haben wir einen langsam<br />
ansteigenden CO 2<br />
-Preis eingeführt. Allerdings<br />
haben die unterschiedlichen Parteien<br />
auch unterschiedliche Vorstellungen<br />
davon, wie sich der CO 2<br />
-Preis vor allem<br />
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts<br />
entwickeln soll. Mit der SPD werden<br />
Benzin und Heizöl zunächst nicht weiter<br />
als bislang schon beschlossen verteuert.<br />
CNG-betriebene Fahrzeuge sind heute eine<br />
günstige Alternative vor allem im Vergleich<br />
zu Elektroautos. Bio-CNG wird dabei auch<br />
in Zukunft seinen Platz haben, auch wenn<br />
aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit das<br />
Volumen sicher nicht stark wachsen wird.<br />
Biogas Journal: Herr Saathoff, vielen Dank<br />
für das Gespräch!<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
Wir machen Ihre Biogasanlage fit für die Zukunft.<br />
Die Schmack Service-Kompetenz:<br />
Lassen Sie sich beraten –<br />
kompetent und unverbindlich!<br />
Betriebsführung<br />
Modernisierung<br />
Technischer<br />
Service<br />
Biogasanlage<br />
Biologischer<br />
Service<br />
Profitieren Sie jetzt von mehr als 20 Jahren<br />
Biogas-Know-how.<br />
Schmack ist der kompetente Service-Partner rund<br />
um Ihre Biogasanlage. Von der Beratung über<br />
Optimierung bis hin zur Betriebsführung sind wir<br />
gerne für Sie da. www.schmack-biogas.de<br />
Schmack Biogas Service GmbH · 24-Stunden-Service-Hotline: Tel. +49 (0) 9431 751-277<br />
info@schmack-biogas.com<br />
37
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INTERVIEW ZUR BUNDESTAGSWAHL<br />
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN<br />
„Wir wollen die Energieerzeugung aus<br />
Biomasseanlagen erhalten“<br />
Im Gespräch mit Dr. Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Bundestagsfraktion<br />
Bündnis 90/Die Grünen, über die Relevanz von Biogasanlagen, Klimaschutz in der Landwirtschaft<br />
sowie die Wärme- und Mobilitätswende.<br />
Interviewer: Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Dr. Julia Verlinden<br />
Biogas Journal: Frau Dr. Verlinden, im Programmentwurf<br />
zur diesjährigen Bundestagswahl „Deutschland.<br />
Alles ist drin.“ Ihrer Partei wird in Kapitel 1 dargestellt,<br />
wie sich die Grünen ein klimaneutrales Deutschland<br />
vorstellen beziehungsweise wie sie das<br />
erreichen wollen. Leider finden sich in dem<br />
Programmentwurf keine Positionen zur<br />
Bioenergie-/Biogasproduktion. Spielt<br />
die Bioenergieerzeugung für die Grünen<br />
im künftigen Erneuerbare-Energien-Mix<br />
keine Rolle mehr? Wenn<br />
doch, welche?<br />
Dr. Julia Verlinden: Bioenergie ist<br />
wertvoll und wird auch im künftigen<br />
Energiemix eine Rolle spielen. Wir<br />
wollen dafür sorgen, dass Bioenergieanlagen<br />
weiterhin zur Verfügung<br />
stehen und vor allem dann und dort zum<br />
Einsatz kommen, wo keine ausreichende<br />
Versorgung mit erneuerbarem Strom aus<br />
Wind- und Solarkraftwerken möglich ist. Bei der<br />
Erzeugung von Bioenergie soll die Verwertung von<br />
Rest- und Abfallstoffen oberste Priorität haben.<br />
Biogas Journal: Das neue EEG <strong>2021</strong> sichert weder<br />
den Anlagenbestand im Biogassektor noch<br />
löst es Investitionen in Neuanlagen aus. Die Märzausschreibung<br />
dieses Jahr hat gezeigt, dass die ausgeschriebene<br />
Leistung bei weitem nicht ausgeschöpft<br />
worden ist. Werden die Grünen bei einer Regierungsbeteiligung<br />
das aktuelle EEG frühzeitig überarbeiten und<br />
die Mängel beseitigen? Sprich endogene Mengensteuerung<br />
abschaffen sowie die Nord-Süd-Ausschreibung<br />
– weil verzerrender Wettbewerb – rückgängig machen?<br />
Dr. Verlinden: Biogasanlagen leisten einen wichtigen<br />
Beitrag zur Systemstabilität. In diesem Sinne wollen<br />
wir die Energieerzeugung aus Biomasseanlagen erhalten<br />
und zum Beispiel die Flexibilisierung der Anlagen<br />
weiter unterstützen. Welche Rahmenbedingungen darüber<br />
hinaus konkret angepasst werden müssen, zum<br />
Beispiel angepasste Gebotshöchstwerte von Neu- und<br />
Altanlagen, muss im Rahmen der unbedingt notwendigen<br />
Überarbeitung des EEG evaluiert und konkretisiert<br />
werden. Im Moment verhindern die Vorgaben der<br />
schwarz-roten Bundesregierung einen schnellen und<br />
flächendeckenden Ausbau der Erneuerbaren Energien.<br />
Biogas Journal: Laut aktuellem, überarbeitetem Klimaschutzpaket<br />
der Bundesregierung wurden auf Druck<br />
des Bundesverfassungsgerichts ambitionierte Klimaschutzziele<br />
in einzelnen Sektoren beschlossen. Für die<br />
Landwirtschaft bedeutet dies: zusätzlich 4 Millionen<br />
Tonnen CO 2<br />
-Äquivalent an Treibhausgasen bis 2030<br />
einzusparen –nun also insgesamt 16 statt 12 Millionen<br />
Tonnen. Wie soll die Landwirtschaft das ohne vernünftige<br />
Perspektiven für die Biogasproduktion schaffen?<br />
Dr. Verlinden: Für die Landwirtschaft gilt wie für alle<br />
Bereiche: Es ist ein Maßnahmenmix, der uns erfolgreich<br />
auf den Weg von Klimaschutz und Nachhaltigkeit<br />
bringt. Neben der Bioenergieerzeugung sind hier aus<br />
grüner Sicht vor allem folgende Stichworte zu nennen:<br />
Tierzahlen in der Landwirtschaft reduzieren, auf heimische<br />
Futtermittel setzen, landwirtschaftliche Böden<br />
als Kohlenstoffsenke konsequent nutzen und schützen,<br />
Grünlandumbruch stoppen, Ökolandbau stärker<br />
fördern.<br />
Biogas Journal: Wenn Biogasanlagen nicht weiterbetrieben<br />
werden, dann droht in vielen Dörfern die Wärmeversorgung<br />
durch Abschalten der Biogas-Blockheizkraftwerke<br />
zu enden. Die Wärmewende scheint zu<br />
scheitern und der Rückschritt in die klimabelastende<br />
Erdgaswärmeversorgung scheint somit unaufhaltsam.<br />
Preiswerte Wärmeversorgung wird so zur Geschichte –<br />
insbesondere, da die fossilen Energieträger durch das<br />
BEHG in den nächsten Jahren aufgrund der CO 2<br />
-Abgabe<br />
teurer werden. Was wollen die Grünen gegen diese<br />
sich abzeichnende Entwicklung unternehmen?<br />
Dr. Verlinden: Dezentrale Biogas-Kraft-Wärme-Kopplung<br />
leistet in regionalen Wärmenetzen einen wichtigen<br />
Beitrag zur Wärmeerzeugung. Die Umstellung auf Erdgas<br />
ist aus Klimasicht keine Alternative. Daher treten<br />
wir für eine auskömmliche Anschlussfinanzierung für<br />
bestehende Biogasanlagen ein. Diese sollte einen flexi-<br />
FOTO: RAINER KURZEDER<br />
38
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
blen, systemdienlichen Betrieb der Anlagen unterstützen<br />
und die sinnvolle und wichtige Wärmeauskopplung<br />
erhalten. Durch eine Förderung von Wärmespeichern<br />
wollen wir das zusätzlich unterstützen. Die wirtschaftliche<br />
Konkurrenzfähigkeit von Biogasanlagen wird sich<br />
mit steigendem CO 2<br />
-Preis auf fossile Brennstoffe gegenüber<br />
fossilen Anlagen ohnehin verbessern. Dies ist<br />
ein wichtiger Lenkungseffekt der CO 2<br />
-Bepreisung.<br />
Biogas Journal: Ihre Partei widmet sich im Wahlprogramm<br />
auch dem Thema Mobilität. In dem Zusammenhang<br />
ist von Elektromobilität und Wasserstoff die Rede.<br />
Aber: Selbst wenn in 2030 rund 10 Millionen Elektro-<br />
Pkw und ein paar Wasserstoffautos auf den Straßen<br />
unterwegs sind, dann fahren da immer noch etwa 35<br />
Millionen Verbrenner herum. Müssten nicht CO 2<br />
-arme<br />
Kraftstoffe wie Biomethan – produziert auf Basis von<br />
landwirtschaftlichen Reststoffen und ökologisch wertvoller<br />
Anbaubiomasse (Blüh-/Wildpflanzen und Co.) –<br />
gleichermaßen gefördert und Gasfahrzeuge in den Markt<br />
gebracht werden? Oder wie sollen in 2030 rund zwei<br />
Drittel des deutschen Fahrzeugbestands klimaneutral<br />
gestellt werden? Haben die Grünen gar nicht im Blick,<br />
dass Rohstoffe (seltene Erden) für die Elektromobilität<br />
nicht nachhaltig, sondern unter prekären Umwelt- und<br />
Arbeitsbedingungen aus der Erde geholt werden?<br />
Dr. Verlinden: Bioenergie ist zu wertvoll, um sie in ineffizienten<br />
Pkw-Motoren zu verbrennen. Sie sollte spezifischen<br />
Anwendungen in Industrie, Wärmeerzeugung<br />
und im Stromsystem vorbehalten bleiben. Im Pkw-<br />
Sektor gibt es mit der Elektromobilität eine sinnvolle<br />
und energieeffiziente Alternative zum Verbrenner. Wir<br />
setzen aber nicht nur auf Klimaschutz, sondern zugleich<br />
auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung –<br />
Stichwort Lieferkettengesetz – und hohe Anforderungen<br />
beim Recycling von allen wertvollen Rohstoffen.<br />
Diese Anforderungen erfüllen übrigens herkömmliche<br />
Verbrennungsmotoren bis heute nicht.<br />
Biogas Journal: Frau Dr. Verlinden, vielen Dank für<br />
das Gespräch!<br />
Interviewer<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
„Ein Produktionsprozess mit<br />
unzähligen Stellschrauben –<br />
Wir haben die passenden<br />
Spurenelemente und Enzyme!“<br />
Eike Henning Lammers,<br />
Einer der Macher.<br />
TerraVis GmbH<br />
Industrieweg 110<br />
48155 Münster<br />
Tel.: 0251.682 - 2055<br />
info@terravis-biogas.de<br />
www.terravis-biogas.de<br />
FELD<br />
SILO<br />
FERMENTER<br />
ENERGIE<br />
39
27,5 %<br />
21,7 %<br />
– 1 –<br />
1<br />
1<br />
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Materialien für Ihre<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Sie planen ein Hoffest, bekommen eine Schulklasse<br />
zu Besuch oder werden zum Wärmelieferanten?!<br />
Der Fachverband bietet Ihnen für (fast) jede Gelegenheit<br />
die passenden Materialien.<br />
Shop<br />
Bierdeckel<br />
10 cm 0<br />
DVD<br />
Unterrichtsfilm<br />
Erneuerbare Energien<br />
Bestellnr.: WV-021<br />
5 Stück für Mitglieder<br />
kostenlos, bei größeren<br />
Mengen bitte nachfragen<br />
Auch auf Youtube (FVBiogas)<br />
und zum Download auf Vimeo<br />
eine DVD für Schulen kostenlos<br />
Bestellungen an:<br />
andrea.horbelt@biogas.org<br />
Broschüre<br />
Biogas-Wissen<br />
Grundlegende Informationen rund um<br />
die Biogasnutzung in Deutschland<br />
Biogas<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Broschüren<br />
Die Biogas Know-how-Serie –<br />
auch online verfügbar<br />
DIN A5-Format, 28 Seiten<br />
Bestellnr.: BVK-23 (deutsch)<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Broschüre<br />
BIOGAS Wissen_Kompakt<br />
BIOGAS<br />
Safety first!<br />
Guidelines for the safe use<br />
of biogas technology<br />
Biogas to<br />
Biomethane<br />
Düngen mit<br />
Gärprodukten<br />
Biogas aus<br />
Bioabfall<br />
Wärmeflyer – für Anbieter<br />
von Biogaswärme<br />
Weitere Informationen<br />
www.biogas.org<br />
Informieren Sie Ihre Kunden über<br />
die Vorteile von Biogaswärme<br />
DIN A6 Format, 4-seitig<br />
Bestellnr.: WV-022<br />
Für Mitglieder kostenlos<br />
Jetzt<br />
neu<br />
Biogaswärme<br />
sicher, günstig, klimafreundlich<br />
In Biogasanlagen entsteht bei der Stromproduktion immer auch Wärme.<br />
Diese kann in der Umgebung der Biogasanlage genutzt werden - z.B. in<br />
benachbarten Häusern, Schulen, Schwimmbädern oder Turnhallen.<br />
Heizen mit Biogaswärme bietet viele Vorteile – für den Wärmeabnehmer,<br />
für die Region und für unsere Umwelt.<br />
BIOGAS Know-how_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-024<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Know-how_3<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-018<br />
(englisch)<br />
BIOGAS Wissen_2<br />
DIN A4-Format,<br />
68 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-025<br />
(deutsch)<br />
ein Heft kostenlos<br />
bei mehreren Heften berechnen wir Versand und Verpackung<br />
BIOGAS Wissen_3<br />
DIN A4-Format,<br />
64 Seiten<br />
Best.Nr.: KL-022<br />
(deutsch)<br />
kann immer<br />
n gespeichert und je nach Bedarf in Energie umgewandelt<br />
uch wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint.<br />
iert unsere Stromnetze und ist für die technische Umsetnergiewende<br />
von entscheidender Bedeutung.<br />
Energiedörfer mit Biogas<br />
Biogas eignet sich hervorragend für die<br />
lokale Energieversorgung – und für neue<br />
Energiekonzepte in Kommunen und<br />
Regionen. Zahlreiche Wärmenetze, die<br />
teilweise genossenschaftlich betrieben<br />
werden, unterstreichen dieses Potenzial.<br />
Regionale Wertschöpfung<br />
Biogasanlagen produzieren dort Energie,<br />
wo sie gebraucht wird: In den Regionen.<br />
Das Geld für den Bau, den Betrieb und<br />
die Instandhaltung der Anlagen bleibt<br />
vor Ort – und fließt nicht in die Taschen<br />
der Ölmultis. Das sichert die regionale<br />
Energieversorgung und ist ein aktiver<br />
Beitrag zur Friedenspolitik.<br />
... und artenreich<br />
Faltblätter<br />
Viele Landwirte verzichten freiwi lig auf einen Teil ihres Gasertrages und setzen<br />
Pflanzen ein, die einen ökologischen Mehrwert für Mensch und Natur haben.<br />
„Die Biogasnutzung bietet die Möglichkeit,<br />
unterschiedlichste Pflanzen sinnvo l anzubauen<br />
und damit einerseits den Boden und das<br />
Grundwasser zu schützen und andererseits die<br />
Artenvielfalt auf den Feldern zu erhöhen.<br />
Das sieht nicht nur schön aus – es ist auch<br />
ein wichtiger Beitrag für den dringend<br />
notwendigen Schutz unserer Insekten.“<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die to Biogas-<br />
go<br />
erzeugung und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Handliche Fakten zur<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
Biogasnutzung<br />
m info@biogas.org<br />
Peter Maske, Präsident Deutscher Imkerbund e.V.<br />
www.biogas.org<br />
11,8 x 11 cm<br />
Über gezielte Agrar-Fördermaßnahmen könnte<br />
Biogas einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt<br />
leisten.<br />
Eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden<br />
Alternativen Energiepflanzen bietet die Seite<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
1_Bestellnr.: BVK-37<br />
2_Bestellnr.: BVK-44<br />
3_Bestellnr.: BVK-45<br />
4_Bestellnr.: BVK-46<br />
5_Bestellnr.: BVK-48<br />
bis zu 20 Ex. kostenlos<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
Wissen_to go_1<br />
BIOGAS<br />
Biogas to go<br />
Artenvielfalt<br />
mit Biogas<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas kann alles<br />
< - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - >< - - - - - - - - - - - 118 mm - - - - - - - - - - - > < - - - - - - - - - - - 116 mm - - - - - - - - - - - ><br />
Das Recycling von Bioabfä len in Biogasanlagen findet über die Vergärung und Kompostierung<br />
statt. Durch biologische Abbauprozesse entsteht in den Fermentern aus<br />
den Kartoffelschalen, dem Pizzarest und dem abgelaufenen Joghurt der Energieträger<br />
Biogas. Übrig bleibt ein hochwertiger Dünger, das sogenannte Gärprodukt.<br />
Dieses liefert a le wichtigen Nähr- und Humusstoffe für das erneute Pflanzenwachstum.<br />
Damit schließt sich der Nährstoffkreislauf. Die Vergärung in Biogasanlagen<br />
steht damit ganz klar vor der Verbrennung oder Deponierung.<br />
tuFige<br />
ierAchie<br />
ndung<br />
eislauf)<br />
rgetische) Verwertung<br />
Potenzial und Perspektive<br />
Die erste Biomethananlage Deutschlands ging 2006 im bayerischen Pliening in<br />
Betrieb. Im Jahr 2018 waren es bereits über 200. So viele wie in keinem anderen<br />
europäischen Land. Zusammen speisen diese Anlagen rund zehn Terawattstunden<br />
Biomethan ins deutsche Gasnetz ein – das entspricht etwa zwölf Prozent der<br />
hierzulande geförderten Erdgasmenge bzw. etwa einem Prozent des nationalen<br />
Erdgasbedarfs. Biomethan verdrängt fossile Energieträger aus dem Markt und<br />
trägt damit zur Versorgungssicherheit bei.<br />
Die Einspeisung von Biomethan ins Gasnetz<br />
ermöglicht es, den Energieträger Biogas<br />
über mehrere Monate zu speichern.<br />
Damit ist Biogas eine hervorragende Ergänzung<br />
zu den fluktuierenden Erneuerbaren<br />
Energien Wind und Sonne und ein<br />
wichtiges Bindeglied der Energiewende.<br />
Auch für kleinere Biogasanlagen kann sich<br />
die Aufbereitung von Biogas zu Biomethan<br />
rechnen. Für den Anlagenbetreiber eröffnen<br />
sich damit vielversprechende Perspektiven<br />
– und auch die Wertschöpfung in<br />
der Region bekommt neue Impulse.<br />
„Wenn unsere Nahrung<br />
schon in der Tonne statt<br />
auf dem Teller landet, dann<br />
sollte sie wenigstens noch<br />
sinnvoll genutzt werden“<br />
... mit großer Bedeutung<br />
Über die Hälfte unseres Endenergieverbrauchs wird für die Wärmeerzeugung eingesetzt.<br />
Um die Energiewende zu schaffen müssen wir auch und gerade bei der<br />
Wärmebereitste lung konsequent auf regenerative Energien setzen. Bioenergie ist<br />
dabei die Nr. 1 unter den Erneuerbaren. Mit der Abwärme der Biogasanlagen können<br />
schon heute über eine Mi lion Haushalte mit klimafreundlicher Heizenergie versorgt<br />
werden. Oder auch viele andere Wärmeabnehmer, wie die Beispiele in diesem<br />
Booklet zeigen.<br />
Georg Hackl, Rode legende<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche und<br />
europäische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und –nutzung für die bundesweite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoffversorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Wissen_to go_2<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
BIOGAS<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas ist der vielseitigste erneuerbare Energieträger. Das umweltfreundliche<br />
Gas kann sowohl zur Strom- und Wärmegewinnung wie<br />
auch als Kraftstoff eingesetzt werden. Damit ist Biogas eine wichtige<br />
Säule für die bürgernahe und bezahlbare Energiewende!<br />
Strom aus Biogas<br />
v<br />
Biogas versorgt schon heute Millionen Haushalte in<br />
Deutschland mit klimafreundlichem Strom. Bei der<br />
Stromgewinnung im Blockheizkraftwerk entsteht automatisch<br />
auch Wärme.<br />
Wärme aus Biogas<br />
Mit Biogaswärme können zum Beispiel private Haushalte,<br />
kommunale Einrichtungen wie Schulen, Schwimmbäder<br />
und Turnhallen, Gewerbebetriebe oder Gewächshäuser<br />
beheizt werden.<br />
<br />
Kraftstoff aus Biogas<br />
Zu Biomethan aufbereitetes Biogas kann als klimafreundlicher<br />
und effizienter Kraftstoff von jedem CNG<br />
(compressed natural gas)-Fahrzeug getankt werden. Mit<br />
dem Biomethanertrag von einem Hektar Wildpflanzen<br />
kann ein Pkw einmal um die Erde fahren.<br />
Biogas aus<br />
Bioabfällen<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Biogas ist bunt ...<br />
Biogas entsteht durch die Vergärung biogener Stoffe in einem luftdicht abgeschlossenen<br />
Behälter, dem sogenannten Fermenter. Vergoren werden kann fast a les,<br />
was biologischen Ursprungs ist: Gü le und Mist, Bioabfä le - oder Energiepflanzen.<br />
Letztere werden von den Landwirten extra angebaut. Ende 2018 wuchsen auf gut<br />
1,4 Millionen Hektar Energiepflanzen für den Einsatz<br />
in Biogasanlagen. Das sind rund acht Prozent<br />
der landwirtschaftlichen Nutzfläche.<br />
Fast jede Pflanze eignet sich für die Vergärung:<br />
bunte Wildblumen, weiß blühender Buchweizen<br />
oder die gelb blühende Durchwachsene Silphie.<br />
Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem Gas- und<br />
damit Stromertrag. Aus einem Hektar Mais können<br />
ca. 21.000 Kilowattstunden Strom erzeugt<br />
werden. Bei der bunten Alternative Wildpflanzen<br />
liegt der Energieertrag etwa bei der Hälfte.<br />
Zahlreiche Institute und Hochschulen, aber auch<br />
viele Landwirte testen die verschiedensten Pflanzen<br />
auf ihre Biogastauglichkeit. In den letzten<br />
Jahren konnten dabei große Fortschritte erzielt<br />
werden und die Palette der potenziellen Energiepflanzen<br />
wächst kontinuierlich.<br />
Booklet-Artenvielfalt 2018.indd 1 11.07.19 13:48<br />
Endenergieverbrauch in Deutschland im Jahr 2019 nach Strom,<br />
Wärme und Verkehr<br />
in Mi liarden Kilowa tstunden<br />
Wärme und Kälte<br />
(ohne Strom):<br />
1.216,7 Mrd. kWh<br />
50,9 %<br />
*der Stromverbrauch für Wärme und<br />
©2020 Agentur für Erneuerbare Energien e.V.<br />
gesamt<br />
2.391 Mrd. kWh<br />
Verkehr ist im Endenergieverbrauch Strom enthalten.<br />
Que le: eigene Darste lung auf Basis von AGEB/AGEE-Stat<br />
Stand: 3/2020<br />
Ne tostromverbrauch*:<br />
517,8 Mrd. kWh<br />
Verkehr (ohne Strom<br />
und int. Luftverkehr):<br />
656,8 Mrd. kWh<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Der Fachverband Biogas e.V. ist mit über<br />
4.700 Mitgliedern die größte deutsche<br />
und europä ische Interessenvertretung der<br />
Biogas-Branche.<br />
Ziel der Verbandsarbeit ist es, die Biogaserzeugung<br />
und -nutzung für die bundes weite<br />
Strom-, Wärme- und Kraftstoff versorgung zu<br />
erhalten und auszubauen.<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
A +49 (0)8161 984 660<br />
m info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
Wissen_to go_3<br />
BIOGAS<br />
Wissen_to go_4<br />
BIOGAS<br />
Biomethan<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Wissen_to go_5<br />
BIOGAS<br />
u<br />
Biogas-Wärme<br />
Handliche Fakten<br />
zur Biogasnutzung<br />
Gelebte Kreislaufwirtschaft<br />
Wo Lebensmittel erzeugt und verbraucht werden, entsteht immer auch Abfa l. Das<br />
wird sich nie ganz vermeiden lassen. Seien es die Kartoffelschalen bei der Chips-<br />
Herstellung, die nicht ganz aufgegessene Pizza im Restaurant oder der abgelaufene<br />
Joghurt im Kühlregal.<br />
In der 5-stufigen Abfa lhierarchie des Kreislaufwirtschaftgesetzes hat die<br />
Vermeidung von Abfä len höchste Priorität. Gefolgt von der Wiederverwendung<br />
von Lebensmitteln – beispielsweise durch die Tafeln.<br />
An dritter Ste le kommt das Recycling, um (Nährstoff)Kreisläufe zu<br />
schließen und das Abfa laufkommen zu reduzieren. Dann erst folgt<br />
die energetische Verwertung (z.B. in Mü lverbrennungsanlagen)<br />
und ganz am Ende steht die Beseitigung, sprich die Ablagerung<br />
oder Deponierung, die zu vermeiden ist. FÜNFs<br />
<br />
Was ist Biomethan?<br />
Biogas besteht zu 50 – 60 Prozent aus dem brennbaren Gas<br />
Methan (CH 4 ); der Rest ist überwiegend Kohlendioxid (CO 2 ).<br />
ABFALLh<br />
Bei der Auf bereitung von Biogas zu Biomethan werden die nichtbrennbaren<br />
Gase abgetrennt, so dass möglichst reines Methan übrig bleibt. Dies kann über<br />
verschiedene Verfahren geschehen (siehe Innenteil). Das so erzeugte Biomethan<br />
hat die gleichen chemisch-physikalischen Eigenschaften wie Erdgas<br />
und kann problemlos ins Gasnetz eingespeist werden.<br />
Mit der Einspeisung von Biomethan ins<br />
Gasnetz kann der Ort der Erzeugung vom<br />
Ort der Nutzung entkoppelt werden. Das<br />
eingespeiste Biomethan kann an beliebiger<br />
Ste le aus dem Netz entnommen und<br />
entweder in einem Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) zu Strom und Wärme umgewandelt<br />
werden, in der Gasheizung eingesetzt<br />
oder an einer Gastankste le von<br />
jedem handelsüblichen CNG-Fahrzeug<br />
getankt werden.<br />
<br />
Ein Nebenprodukt ...<br />
Comic<br />
Die kleine Geschichte von<br />
Julius & seinen Freunden<br />
… oder wie man ganz einfach<br />
Biogas gewinnen kann.<br />
1. Vermeidung<br />
2. Wiederverwe<br />
3. Recycling (Kr<br />
4. Sonstige (ene<br />
5. Beseitigung<br />
A5 quer, Bestellnr.: BVK-21<br />
In der Regel werden Biogasanlagen gebaut, um klimafreundlichen Strom zu produzieren.<br />
Dafür wird das durch Vergärung organischer Masse erzeugte Biogas über<br />
eine Gasleitung zum Blockheizkraftwerk (BHKW) geleitet. Das BHKW ist eine Kombination<br />
aus Motor und Generator. Durch die Verbrennung des Gases im Motor wird<br />
Strom erzeugt – und dabei entsteht automatisch auch Wärme.<br />
Der Strom wird in das Stromnetz eingespeist und kann als Ökostrom vom Endverbraucher<br />
genutzt werden. Für das „Nebenprodukt“ Wärme gibt es viele verschiedene<br />
Einsatzmöglichkeiten ...<br />
Regional.<br />
Verlässlich.<br />
Klimafreundlich.<br />
bis 20 Hefte kostenlos,<br />
darüber 50 Cent / Heft<br />
40
Um die Erderhitzung zu stoppen müssen wir auf Erneuerbare Energien umsteigen.<br />
Sonne und Wind stehen uns unbegrenzt und kostenlos zur<br />
Verfügung. Aber nicht immer. Deshalb brauchen wir zusätzliche regenerative<br />
Quellen, die verlässlich zur Verfügung stehen. So wie Biogas.<br />
Das in den Fermentern bei der Vergärung von Gülle, Bioabfall und<br />
Energiepflanzen entstehende Gas kann gespeichert und je nach Bedarf<br />
kurzfristig in Strom und Wärme umgewandelt werden. So wird der<br />
Wind- und Solarstrom genutzt, wenn er entsteht - und Biogas springt ein,<br />
sobald Sonne und Wind eine Pause machen.<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH hat zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) mit<br />
einer Leistung von je 250 kW. Darin wird aus Biogas Strom und Wärme<br />
erzeugt.<br />
Die Kraftwerke werden von den Stadtwerken XY ferngesteuert. Je nach<br />
Strombedarf können sie an- oder abgeschaltet werden. Wenn das<br />
Stromnetz voll ist, wird das Biogas in der Kuppel des Fermenters<br />
gespeichert. Und wenn Strombedarf besteht, können die BHKWs<br />
innerhalb weniger Sekunden ihre maximale Leistung von 500 kW abrufen.<br />
Biogasanlage Biogas GmbH<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse,<br />
z.B. biologische Abfälle, nachwachsende Rohstoffe und Gülle,<br />
zu Biogas und Gärprodukten um.<br />
Das erzeugte Biogas wird in der Gashaube aufgefangen<br />
und von hier über Gasleitungen zum<br />
Blockheizkraftwerk (BHKW) transportiert.<br />
Im BHKW wird aus dem Biogas<br />
Strom und Wärme erzeugt.<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur Entschwefelung<br />
und Entwässerung<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungs technik für die<br />
Um wandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Schild - so funktioniert eine Anlage A0 quer.indd 1 16.06.16 11:00<br />
Planeten.<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
6<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
Strom<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Bioma se<br />
(Silo, Annahmestelle, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu ver<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bio<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwä serung<br />
gärende Bioma se oder Reststo fe<br />
aus diesen heraus<br />
ma se<br />
6<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 gf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Bio<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechen<br />
methan<br />
der Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
1<br />
Strom<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmeste le, Gü legrube)<br />
2 gf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigung systeme für die zu vergärende<br />
Bioma se oder Reststo fe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Bioma se in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Bioma<br />
se<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Ga speicher zur kurz und mi telfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigung systeme zur<br />
Entschwefelung und Entwä serung<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
Strom<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte ( gf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flü sigtrennung, Trocknung,<br />
Pe letierung etc.)<br />
1<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
Fast jede Pflanze kann in Biogasanlagen vergoren und zu Strom<br />
und Wärme umgewandelt werden – auch jene, die in der Lebensund<br />
Futtermittelproduktion keine Verwendung finden.<br />
Das bei der Energieerzeugung freigesetzte CO 2 entspricht in etwa<br />
der Menge, die die Pflanzen während Ihres Wachstums gebunden<br />
haben.<br />
Durchwachsene Silphie<br />
Franken-Therme Bad Windsheim<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Regionale Biogasanlage<br />
Biogas trägt dazu bei, dass unsere Felder bunter und artenreicher<br />
werden. Blühende Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie bieten<br />
vor allem Lebensraum für Insekten und Wildtiere und verbessern<br />
die Bodengesundheit.<br />
Die Pflanzen benötigen in der Regel keine Pflanzenschutzmittel,<br />
schonen die Umwelt und schützen den Boden vor Auswaschung.<br />
Wildpflanzenmischung<br />
Wärmeabnehmer Freibad<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs- oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring- / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz- und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Biomasse, z.B. biologische Abfälle,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gülle, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfasst folgende Komponenten:<br />
1<br />
2<br />
9<br />
3<br />
5 4<br />
3<br />
12<br />
8<br />
1 Lager für die zu vergärende Biomasse<br />
(Silo, Annahmestelle, Güllegrube)<br />
2 ggf. Aufbereitung, Sortierungs oder<br />
Reinigungssysteme für die zu vergärende<br />
Biomasse oder Reststoffe<br />
3 Einbring / Pumptechnik transportiert<br />
die Biomasse in die Fermenter bzw.<br />
aus diesen heraus<br />
4 Rührwerke vermischen die Bakterien<br />
im Fermenter mit der frischen Biomasse<br />
5 Heizung – die übliche Gärtemperatur<br />
liegt bei 40 °C<br />
6 Gasspeicher zur kurz und mittelfristigen<br />
Speicherung des Biogases<br />
7 Gasreinigungssysteme zur<br />
Entschwefelung und Entwässerung<br />
6<br />
6<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom- und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest-/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
FV Anlagenschild A0 quer.indd 1 11.02.16 16:10<br />
6<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
8<br />
7<br />
5<br />
8<br />
Wärme<br />
11<br />
Strom<br />
11<br />
11<br />
Erdgasnetz<br />
10<br />
Strom<br />
Strom<br />
Erdgasnetz<br />
8 Pumpleitungen für Gärsubstrate<br />
und Biogasleitungen<br />
9 Sicherheitstechnik: Drucksicherungen,<br />
Sicherheitsventile<br />
10 Blockheizkraftwerk für die gleichzeitige<br />
Strom und Wärmeproduktion<br />
11 ggf. Aufbereitungstechnik für die<br />
Umwandlung von Biogas zu Biomethan<br />
12 Lagerbehälter für die ausgefaulten<br />
Gärprodukte (ggf. mit entsprechender<br />
Technik zur Weiterverarbeitung<br />
(Fest/Flüssigtrennung, Trocknung,<br />
Pelletierung etc.)<br />
10<br />
10<br />
Erdgasnetz<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
SHOP<br />
Variable Schilder<br />
Feldschilder<br />
zu einem von Ihnen gewählten Thema mit<br />
unterschiedlichem Layout und unterschiedlicher<br />
Farbgebung.<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-007<br />
Bitte kontaktieren Sie uns!<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Diese Biogasanlage<br />
schützt unser Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Klimaschutz .<br />
Die Erderhitzung ist die größte Bedrohung für den Fortbestand unseres<br />
Wir müssen unser Klima schützen und den Ausstoß von CO 2<br />
drastisch reduzieren. Jetzt.<br />
Mit den Erneuerbaren Energien haben wir die Chance, dies zu scha fen.<br />
Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag auf unserem Weg in eine<br />
klimafreundliche Zukunft.<br />
.durch Biogas<br />
Die Biogasanlage Biogas GmbH erzeugt im Jahr 300.000 Kilowattstunden<br />
Strom. Das entspricht dem Verbrauch von 100 durchschni tlichen<br />
Haushalten.<br />
Die bei der Stromerzeugung anfa lende Wärme wird im Sta l und im<br />
Wohnhaus eingesetzt und außerdem zur Holztrocknung genutzt. In der<br />
Summe spart diese Biogasanlage 450 Tonnen CO 2 ein, die beim Einsatz<br />
fossiler Energieträger wie Kohle und Öl freigesetzt worden wären.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohstoffe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
Alternative Energiepflanzen<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-003<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Dieses Feld liefert Energie<br />
und schützt das Klima<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Maisfeld<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr. FA-002<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Das entspricht 380 Flügen von München nach New York und zurück.<br />
Diese Biogasanlage erzeugt Strom<br />
wenn er gebraucht wird<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogas ist flexibel!<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Energie pflanzen ...<br />
Energiepflanzen<br />
... Vielfalt ernten<br />
Diese Biogasanlage schafft<br />
regionale Wertschöpfung<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Die im Fermenter befindlichen Bakterien wandeln die Bioma se, z.B. biologische Abfä le,<br />
nachwachsende Rohsto fe und Gü le, zu Biogas und Gärprodukten um. Das erzeugte Biogas<br />
wird in der Gashaube aufgefangen und von hier über Gasleitungen zum Blockheizkraftwerk<br />
(BHKW) transportiert. Im BHKW wird aus dem Biogas Strom und Wärme erzeugt.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme,<br />
Techniken und Funktionsweisen. Der übliche Aufbau umfa st folgende Komponenten:<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.farbe-ins-feld.de<br />
www.biogas.org<br />
Energie für die Region…<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Schild<br />
„So funktioniert eine Biogasanlage“<br />
Zeigen Sie Wanderern und Gästen die Funktionsweise Franken-Therme Bad Winsheim<br />
einer Biogasanlage<br />
Biogas Wärme<br />
Vorteile<br />
Die Franken-Therme ist an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Bad<br />
DIN A0-Format<br />
Windsheim angeschlossen. 30 Prozent des Wärmeangebotes der Stadtwerke<br />
werden von der Biogasanlage der Bio-Energie Bad Windsheim<br />
erzeugt.<br />
Bestellnr.: FA-008<br />
80 Euro<br />
(inkl. Versand)<br />
Seit dem Jahr 2009 erzeugt die Biogasanlage Biogas GmbH Strom für 700<br />
Haushalte und versorgt außerdem 26 Privathaushalte, die Schule, das<br />
Altenheim und das Rathaus mit umweltfreundlicher Wärme. Die Substrate<br />
für die Energieerzeugung bezieht die Biogasanlage vo lständig von<br />
Landwirten aus der Umgebung. Das nach der Vergärung entstehende<br />
Gärprodukt geht als hochwertiger Dünger zurück auf die Felder.<br />
www.biogas.org<br />
Die Kilowa tstunde Biogaswärme kostet die Haushalte im Schni t zwei Cent weniger<br />
als die Wärme aus Heizöl.<br />
Durch das bei den Heizkosten gesparte Geld konnte Neustadt neue Sportgeräte für<br />
die Schule kaufen und den Gemeinschaftsraum im Altenheim renovieren.<br />
Der Bau der Anlagenteile, die Wartung und Erweiterung der Biogasanlage generiert<br />
weitere Jobs bei Handwerksbetrieben in der Umgebung.<br />
Vom Anbau vielfältiger Energiepflanzen profitieren die Bienen und mit ihnen die<br />
Imker in der Region.<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. www.biogas.org<br />
Als Kunde der Stadtwerke profitiert die Franken-Therme direkt von der<br />
umwelt- und klimafreundlichen Wärmegewinnung aus Biogas. So<br />
werden die Thermal-Badelandschaft, das Dampferlebnisbad und die<br />
Sauna zu rund einem Drittel mit Biogaswärme beheizt.<br />
– Die Biogaswärme wird in einer Biogasanlage in Bad Windsheim erzeugt:<br />
Dies stärkt die Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert<br />
die Wirtschaftskraft in der Region.<br />
– Durch die umweltfreundliche Biogaswärme werden pro Jahr rund<br />
300.000 Liter Heizöl eingespart und damit knapp 800 Tonnen<br />
Kohlendioxid (CO 2 ) weniger ausgestoßen.<br />
– Neben der Wärme erzeugt die Biogasanlage der Bio-Energie<br />
Bad Windsheim jährlich Strom für mehr als 1.200 Haushalte.<br />
Anlagenschild (individuell)<br />
Informieren Sie Wanderer und Gäste über Ihre Biogasanlage<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-001<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
Diese Biogasanlage erzeugt<br />
Strom und Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Biogasanlage Bad Windsheim<br />
Die Fakten …<br />
Leistung der Anlage<br />
400 kW el<br />
Mit Strom versorgte Haushalte 800<br />
Wärmebereitstellung<br />
Schwimmbad und Wärmenetz<br />
Eingesetzte Substrate Gülle, Mist,<br />
Landschaftspflegematerial,<br />
Maissilage, Grassilage<br />
Besonderheit an der Anlage<br />
Gärpoduktaufbereitung (Herstellung eines hochwertigen Düngers)<br />
… sprechen für sich!<br />
Logo<br />
Die deutschen Biogasanlagen erzeugen schon heute<br />
Strom für Millionen Haushalte<br />
Biogasanlagen reduzieren den CO 2 -Ausstoß<br />
und produzieren nahezu klimaneutral Strom und Wärme<br />
Biogas-Strom stabilisiert das Stromnetz<br />
und sichert eine gleichmäßige Versorgung<br />
Biogasanlagen<br />
sichern vielen Landwirten die Existenz<br />
In Biogasanlagen vergorene Gülle stinkt nicht und ist<br />
ein hervorragender Dünger<br />
Biogasanlagen bringen<br />
Arbeitsplätze und Wertschöpfung<br />
in die ländliche Region<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Jetzt<br />
alle Schilder<br />
80 Euro<br />
inkl. Versand<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Bei der Ausgestaltung von Biogasanlagen<br />
gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher<br />
Systeme, Techniken und<br />
Funktionsweisen. Der übliche Aufbau<br />
umfasst folgende Komponenten:<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.biogas.org<br />
1<br />
11<br />
2<br />
6<br />
8<br />
9<br />
7<br />
3<br />
Erdgasnetz<br />
5 4<br />
5<br />
10<br />
8<br />
3<br />
12<br />
8<br />
Strom<br />
Wärme<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern: Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
www.biogas.org<br />
Wärmeschild groß<br />
(allgemein)<br />
mit allgemeinen Informationen<br />
zum Einsatz von Biogaswärme<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-006<br />
80 Euro (inkl. Versand)<br />
(individuell)<br />
mit Ihren individuellen Angaben<br />
zum Wärmenutzungskonzept<br />
DIN A0-Format<br />
Bestellnr.: FA-005<br />
Fermenter<br />
Banner<br />
2x3 m wetterfeste Folie<br />
Wahlweise mit Ihrem Logo<br />
und Ihrer Homepage<br />
Bestellnr.: WV-019<br />
90 Euro<br />
(inkl. Versand)<br />
Diese Biogasanlage<br />
liefert Energie<br />
und schützt das Klima!<br />
Diese Biogasanlage<br />
liefert Energie<br />
und schützt das Klima!<br />
www.biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
BIOGAS Wärme<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich.<br />
Umweltfreundliche Wärme – vom Land, für’s Land<br />
Biogas Wärme …<br />
In Deutschland gibt es viele tausend Biogasanlagen, die umweltfreundliches<br />
Biogas erzeugen. Dieser Energieträger wird mittels eines Motors<br />
im Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt. Die dabei frei werdende<br />
Wärme sichert die lokale Versorgung und dient als Heizenergie in:<br />
• öffentlichen Einrichtungen, z.B. Schwimmbädern, Schulen, Turnhallen<br />
• Wohngebieten und Bioenergie-Dörfern<br />
• Ställen und Gewächshäusern<br />
• Unternehmen, z.B. Gärtnereien, Gastronomie, Industrie<br />
… aus der Region<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Biogaswärme wird in einer nahe gelegenen Biogasanlage erzeugt. Dies stärkt die<br />
Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und fördert die Wirtschaftskraft in<br />
der Region.<br />
Viele Dörfer und Kommunen setzen auf Biogas, um eine autarke Energieversorgung<br />
vor Ort anzubieten.<br />
Mit Biogaswärme können die jährlichen Kosten für Wärmeenergie deutlich gesenkt<br />
und langfristig stabil gehalten werden.<br />
Durch die umweltfreundliche Biogaswärme wird Heizöl bzw. Erdgas eingespart und<br />
damit weniger Kohlendioxid (CO 2 ) ausgestoßen.<br />
So funktioniert eine Biogasanlage<br />
www.biogas.org<br />
Bestellungen bitte per E-Mail an info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
41
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Biogas mit<br />
doppelter<br />
Wertschöpfung<br />
Mais ist für die<br />
Milchsäuregewinnung<br />
geeignet. Die pflanzlichen<br />
Reste könnten<br />
anschließend vergoren<br />
werden.<br />
Baden-Württemberg hat eine bundesweit bislang einmalige Strategie zur Förderung<br />
der Bioökonomie gestartet – unter anderem sollen Biogasanlagen mit der Gewinnung<br />
von Fasern oder sogenannten Plattformchemikalien gekoppelt werden.<br />
Von Bernward Janzing<br />
Im ersten Moment klingt das Projekt noch sehr<br />
allgemein: Man werde „eine Konzeption für eine<br />
zukunftsorientierte, wirtschaftlich und ökologisch<br />
tragfähige Weiterentwicklung des Biogasanlagenbestandes<br />
in Baden-Württemberg nach Auslaufen<br />
der garantierten EEG-Vergütung erarbeiten“. So nüchtern<br />
steht es geschrieben in der südwestdeutschen<br />
„Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie“.<br />
Und doch hat Baden-Württemberg Großes vor mit seinen<br />
Biogasanlagen – zumindest mit einem Teil davon.<br />
Denn das Land will Bestandsanlagen dabei unterstützen,<br />
dass sie „beispielsweise durch Diversifizierung der<br />
Einsatzstoffe und der Produktpalette“ ein „wichtiges<br />
Element für bioökonomisch geprägte Wertschöpfungsketten<br />
in der Fläche“ werden können. Biogasanlagen<br />
sollen also eingebunden werden in ein umfassendes<br />
Konzept zur stofflichen Nutzung von Pflanzen – mit<br />
dem Ziel, dass von der gesamten Pflanzenmasse am<br />
Ende nur noch jene Stoffe im Fermenter landen, die<br />
nicht anderweitig nutzbar sind.<br />
Bioökonomie: für etwa 30 Prozent der<br />
Anlagen im Ländle eine Chance<br />
Das werde zwar nicht allen bestehenden Anlagen ein<br />
Überleben sichern, räumt Alexander Möndel vom Referat<br />
Bioökonomie im Ministerium für Ernährung,<br />
Ländlicher Raum und Verbraucherschutz (MLR) in<br />
Stuttgart ein. Aber für rund 30 Prozent der 950 Biogasanlagen<br />
im Land könnten sich dadurch Perspektiven<br />
ergeben in der absehbar anstehenden Post-EEG-Ära.<br />
In Baden-Württemberg habe man, was das Gros der<br />
Biogasanlagen betrifft, noch rund ein Jahrzehnt Zeit,<br />
um Nachfolgelösungen zu erarbeiten. Diese Zeit gelte<br />
es nun zu nutzen. Baden-Württemberg sei mit seiner<br />
Bioökonomiestrategie in Deutschland „absolut vorne“,<br />
ist Möndel überzeugt.<br />
Die Optionen sind vielfältig. Man kann aus den Pflanzen<br />
zum Beispiel vorab die Fasern gewinnen. Die<br />
höchste Wertschöpfung erziele man dann beim Einsatz<br />
als Verpackungsmaterial, sagt Jörg Messner, staatlicher<br />
Biogasberater beim Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg<br />
(LAZ BW) in Aulendorf. Denkbar sei<br />
aber auch die Fertigung von Dämmstoffen oder Hartfaserplatten.<br />
Darüber hinaus könnten sogenannte Plattformchemikalien<br />
attraktiv sein. Das sind Grundchemikalien, die<br />
aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden<br />
und sich als Synthesebausteine für zahlreiche weitere<br />
Chemikalien eignen. Speziell Milchsäure, ein vielfältiger<br />
Rohstoff der chemischen Industrie, gehört dazu.<br />
Oder man gewinnt Proteine, die wahlweise als Futtermittel<br />
oder auch in der chemischen Industrie einge-<br />
FOTO: ADOBE STOCK_COUNTRYPIXEL<br />
42
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
FOTO: ADOBE STOCK_INGO BARTUSSEK<br />
setzt werden können. Egal, was man aus<br />
dem Stoffstrom vorab herauszieht – der jeweils<br />
verbleibende Rest wird in jedem Fall<br />
in einer Biogasanlage energetisch genutzt.<br />
Biomasse zu Chemikalien und<br />
Energie veredeln<br />
Forscher der Universität Hohenheim untersuchen<br />
zusammen mit dem Karlsruher<br />
Institut für Technologie (KIT) in der Biogas-<br />
Forschungsanlage „Unterer Lindenhof“<br />
bereits die Einbindung einer kleineen<br />
Bioraffinerie in einen bäuerlichen Betrieb.<br />
„Wenn man verschiedene Prozesse effizient<br />
hintereinander schaltet, wird Biomasse<br />
entlang der ganzen Wertschöpfungskette<br />
zu Lebensmitteln, Futtermitteln, Werkstoffen,<br />
Materialien, Chemikalien und Energie<br />
veredelt“, sagt Professor Nicolaus Dahmen<br />
vom Institut für Katalyseforschung und<br />
-technologie am KIT.<br />
Und Professorin Andrea Kruse vom Fachgebiet<br />
Konversionstechnologien nachwachsender<br />
Rohstoffe an der Universität Hohenheim<br />
sagt: „Unser Hauptanliegen ist,<br />
Kreisläufe zu schließen“. Diese seien im<br />
Laufe der Zeit verlorengegangen. Das Spektrum<br />
der Wertschöpfung rund um das Biogas<br />
ist damit noch längst nicht erschöpft.<br />
Es lassen sich alternativ auch schlicht neue<br />
Absatzmärkte für Biogas schaffen, etwa im<br />
Sektor der Mobilität. Wichtig ist hier eine<br />
lokale Nutzung oder Vermarktung, zum<br />
Beispiel durch eigene Traktoren oder eine<br />
eigene Tankstelle. Entsprechend forscht<br />
die Universität Hohenheim am „Unteren<br />
Lindenhof“ auch am Thema Bio-LNG, also<br />
Bioökonomiestrategie:<br />
Biogasanlagen sollen<br />
ein wichtiges Element<br />
für bioökonomisch<br />
geprägte Wertschöpfungsketten<br />
in der<br />
Fläche werden – so will<br />
es die Landespolitik.<br />
der Gewinnung und Verflüssigung von Biomethan<br />
auf kleinskaliger Ebene.<br />
Und schließlich steht auch das Thema<br />
„CO 2<br />
-farming“ auf der Agenda: Konzepte,<br />
die Humus aufbauen und somit CO 2<br />
im Boden<br />
binden, könnten im Zuge steigender<br />
Preise von CO 2<br />
im Emissionshandel als negative<br />
Emissionen auch Einnahmen erzielen.<br />
Die Suche nach einer stofflichen Nutzung<br />
von Teilen der Anbaubiomasse ist im<br />
Segment der Fasergewinnung schon<br />
Bis zu 40% Energie-Förderung<br />
beim Tausch für den neuen Dosierer erhalten<br />
Wir beraten Sie gerne<br />
Biogas Höre GmbH<br />
78359 Orsingen<br />
Tel. : 07774 - 6910<br />
www.hoere-biogas.de<br />
info@hoere-biogas.de<br />
• Individuelle Projektierung<br />
• Dosiersysteme von 8-150m³<br />
• Flächendeckendes Servicenetz<br />
• Hervorragende<br />
Ersatzteilversorgung<br />
• Geringe Energiekosten<br />
• Minimaler Verschleiß<br />
durch Edelstahlauskleidung 43
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Luzerne (Bild rechts)<br />
und Kleegras (Bild<br />
links) könnten in Zukunft<br />
als Proteinquellen<br />
infrage kommen.<br />
Bei der Kaskadennutzung<br />
ließen sich auch<br />
hier die Reststoffe<br />
vergären.<br />
am weitesten fortgeschritten. Hier ist vor allem ein Projekt<br />
hervorzuheben, das auf der Durchwachsenen Silphie<br />
basiert. Es wird von den Landwirtschaftsbetrieben<br />
des Energieparks Hahnennest in der Gemeinde Ostrach<br />
maßgeblich vorangetrieben.<br />
Verpackungen aus Silphie-Fasern<br />
Das Konzept: Nach der Silierung der Pflanzen werden<br />
die Fasern vom restlichen Stoffstrom getrennt. Während<br />
der Rest in die Biogasanlage geht, werden die<br />
Silphie-Fasern in einer Papierfabrik zur<br />
Herstellung von Verpackungsmaterial<br />
genutzt. „Das ist<br />
wie beim Metzger“, sagt<br />
Möndel, „jedes Teil<br />
des Ganzen wird dort<br />
eingesetzt, wo es die<br />
bestmögliche Wertschöpfung<br />
erzielt“.<br />
Einen ersten Abnehmer<br />
für das Papier<br />
gibt es auch schon:<br />
die Schwarz Gruppe in<br />
Neckarsulm, zu der die<br />
Handelsketten Kaufland<br />
und Lidl gehören. Sie setzt<br />
vor allem auf Verpackungsanwendungen<br />
mit direktem Lebensmittelkontakt.<br />
„Nach einer erfolgreichen Pilotphase werden<br />
die Verpackungen auf Basis der Silphie-Pflanze nun<br />
erstmals im Bereich Obst und Gemüse bei Kaufland<br />
in den Handel gebracht“, sagt eine Sprecherin der<br />
Schwarz Gruppe. Neben dem Ersatz von konventionellen<br />
Papier- und Kartonageverpackungen sollen die<br />
Silphie-Produkte in Zukunft zudem als Alternative für<br />
Kunststoffverpackungen getestet werden. Der Markenauftritt<br />
des Silphie-Papiers erfolgt unter dem Namen<br />
OutNature.<br />
Theoretisch kann bei diesem Konzept nicht nur die<br />
Faser als attraktiver Wertstoff abfallen, es könnte sogar<br />
der Biogasprozess profitieren. Denn ohne Fasern<br />
wird das Substrat besser pumpfähig, was auch den<br />
Gärprozess verbessern könnte. Außerdem wird weniger<br />
Energie zum Rühren benötigt und auch der Bedarf an<br />
Gärbehältervolumen reduziert sich. „So könnten wir<br />
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, sagt Hans<br />
Oechsner von der Universität Hohenheim: „Wir gewinnen<br />
neben der Energie ein zweites Produkt, und die<br />
Biogaserzeugung wird effizienter.“<br />
Die große Herausforderung der neuen Biogaswelt liegt<br />
in ihrer Vielfältigkeit. „Jede Anlage hat ihren eigenen<br />
Charakter“, sagt MLR-Experte Möndel. Je nach Größe<br />
der Anlage, je nach eingesetztem Substrat und Abnehmerstruktur<br />
können die Konzepte stark variieren. Denn<br />
zwingend nötig sind regionale Vermarktungskonzepte.<br />
Die Zeiten der Biogasprojekte von der Stange sind damit<br />
vorbei.<br />
Langfristig steht das Ziel im Blick, die zusätzlich entstehenden<br />
Wertstoffe so gut zu vermarkten, dass die<br />
anschließende Biogaserzeugung aus den Reststoffen<br />
kostendeckend realisierbar ist; dass Betreiber von Biogasanlagen<br />
also langfristig mit den Preisen am Strommarkt<br />
auskommen können, ergänzt durch eine mögliche<br />
Eigenversorgung mit Strom und auch Wärme.<br />
Milchsäure aus Mais, Proteine aus<br />
Kleegras und Luzerne<br />
Abhängig davon, welche Stoffe aus dem Substrat extrahiert<br />
werden sollen, muss man die Rohstoffpflanzen<br />
auswählen. Bei Fasern steht die Silphie ganz oben auf<br />
der Liste, der Mais hingegen ist hier außen vor. Er wiederum<br />
ist wegen seines hohen Stärkegehalts für die<br />
Milchsäuregewinnung geeignet. Will man hingegen<br />
Proteine nutzen, bieten sich Gras, Kleegras und die<br />
Luzerne an. Bei Kraftstoffen unterdessen müssen aufgrund<br />
der europäischen „Renewable Energy Directive<br />
II“ (RED II) mehr Reststoffe, wie etwa Gülle, eingesetzt<br />
werden. Zumindest für den Anfang bieten sich eher die<br />
größeren Biogasanlagen für solche Konzepte an. Die<br />
Landwirte in Hahnennest sind in der Megawattklasse<br />
unterwegs, doch auch schon darunter, etwa ab 500<br />
Kilowatt (elektrische Leistung) gelten derzeit Projekte<br />
als denkbar. Dabei müsse aber nicht zwingend eine<br />
einzelne Anlage diese Größe erreichen: „Die Zusammenarbeit<br />
von mehreren kleineren Höfen kann auch<br />
eine Option sein“, sagt Biogasberater Messner vom LAZ<br />
BW. Der Blick richte sich hier vor allem auf den Anlagenbestand,<br />
denn es gehe darum, die Infrastruktur zu<br />
erhalten. Neuanlagen, welche vor allem Kleinanlagen<br />
zur Nutzung von Gülle und anderen Reststoffen sind,<br />
stehen hier nicht im Fokus.<br />
Beim MLR verweist Möndel unterdessen darauf, dass<br />
die Weiterentwicklung des Biogasanlagenbestandes<br />
schon alleine deswegen dringend notwendig sei, weil<br />
das Land Baden-Württemberg gemäß dem Biodiversitätsstärkungsgesetz<br />
den Ökolandbau bis zum Jahr<br />
2030 auf 30 bis 40 Prozent ausweiten wolle. Denn<br />
in der Fruchtfolge des Ökolandbaus werde zwingend<br />
Kleegras benötigt. Um dieses zu verwerten, brauche es<br />
entweder Rinder – doch deren Bestand soll auch sinken<br />
– oder eben eine „Betonkuh“, also einen Fermenter.<br />
Damit dürfte der Biogasbranche auch ein Imagewandel<br />
bevorstehen. Bislang durch die Vermaisung angekratzt,<br />
dürfte das Renommee sich wieder verbessern, sobald<br />
deutlich wird, dass ökologischer Landbau mitunter auf<br />
die Erzeugung von Biogas sogar angewiesen ist.<br />
Autor<br />
Bernward Janzing<br />
Freier Journalist<br />
Wilhelmstr. 24a · 79098 Freiburg<br />
07 61/202 23 53<br />
bernward.janzing@t-online.de<br />
FOTOS: LANDPIXEL.EU<br />
44
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
Stück für Stück –<br />
Gemeinsam Grün<br />
Ihre Biogas-Anlage als Teil des grünen Kraftwerks<br />
Mit der Direktvermarktung von EWE schaffen wir:<br />
Flexibilität: Steuern Sie mit uns Ihre Stromproduktion und profitieren von Mehrerlösen<br />
durch optimalen Fahrplanbetrieb.<br />
Sicherheit: verlässliche Einnahmen durch Stromdirektvermarktung und sicherer Zugang zu den<br />
Energiemärkten der Zukunft mit einem starken Partner an ihrer Seite.<br />
Transparenz: Kostenloses Stromcockpit für 360° Sicht auf Erzeugung, Märkte, Verträge und Abrechnungen.<br />
Jetzt individuell beraten lassen:<br />
ewe.de/grueneskraftwerk<br />
0441 803-2299<br />
virtuelleskraftwerk@ewe.de<br />
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg, info@ewe.de<br />
45
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
dena-Leitstudie „Aufbruch in<br />
die Klimaneutralität“: Angriff<br />
auf Planungshoheiten(?)<br />
Einen „Systementwicklungsplan“ für die gesamte hiesige Energie-Infrastruktur: Diese<br />
Forderung, über alle Sektoren hinweg zu denken, hat die Deutsche Energie-Agentur (dena)<br />
im Dezember 2020 als Zwischenbericht für die „Netzstudie III“ veröffentlicht. Reaktionen:<br />
kaum feststellbar. Das muss verwundern.<br />
Von Heinz Wraneschitz<br />
Die existierenden Planungsprozesse zeigen,<br />
dass sie in ihrer aktuellen Form nur eingeschränkt<br />
dafür geeignet sind, grundsätzliche<br />
Fragen zu beantworten, die für eine<br />
integrierte Infrastrukturplanung von großer<br />
Bedeutung sind.“ Das ist heftige dena-Kritik an alle<br />
Beteiligten, die rund um die deutsche Energiewende-<br />
Politik tätig sind. Und sie ist für jedermensch wörtlich<br />
nachzulesen auf Seite 15 der 26-seitigen Druckschrift<br />
„dena-Zwischenbericht - Der Systementwicklungsplan:<br />
Umsetzungsvorschlag für eine integrierte Infrastrukturplanung<br />
in Deutschland.“<br />
Eigentlich wäre zu erwarten gewesen, dass alle von<br />
der dena auf die Füße Getretenen lauthals und schnell<br />
„Protest“ oder „Zeter und Mordio“ rufen würden. Doch<br />
tatsächlich passiert ist bis Redaktionsschluss vonseiten<br />
der „konventionellen“ Energiewirtschaft, der Bundesregierung<br />
und der Bundesnetzagentur praktisch<br />
nichts.<br />
Koordinierter Ansatz statt Stückwerk<br />
gefordert<br />
Schon die ersten Sätze der Zusammenfassung sind eine<br />
schallende Ohrfeige für alle Verantwortlichen: „Eine erfolgreiche<br />
Energiewende muss integriert und sektorübergreifend<br />
gedacht werden. Denn Treibhausgasneutralität<br />
kann nur erreicht werden, wenn die Sektoren weiter<br />
zusammenwachsen. Die aktuelle Energieinfrastrukturplanung<br />
[…] findet für die verschiedenen Netzebenen<br />
und Sektoren in separaten Planungsprozessen mit teils<br />
abweichenden Ausgangspunkten statt.“ Die dena und<br />
der von ihr mit der Studie beauftragte Planer BET kritisieren:<br />
„Für die Energieinfrastrukturen Strom, Gas,<br />
Wasserstoff und Wärme werden die Planungen in unabhängigen<br />
Prozessen vorangetrieben“, es finde „keine<br />
Optimierung über alle Infrastrukturen hinweg statt“.<br />
„Verschiedene Methoden, unterschiedliche Zeitpunkte<br />
der Erstellung und Planungshorizonte sowie teils inkonsistente<br />
Zielvorgaben stehen einer gemeinsamen<br />
FOTO: HEINZ WRANESCHITZ<br />
46
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
Planungsgrundlage im Weg“, heißt es weiter. Und gerade<br />
der Netzentwicklungsplan (NEP) Strom zeige: Es<br />
gebe „einen großen gesellschaftlichen und politischen<br />
Beratungsbedarf zum Energiesystem der Zukunft“.<br />
Die „Entwicklungsoptionen des Energiesystems insgesamt“<br />
würden nicht beachtet: Es fehlen schlichtweg<br />
die „Entscheidungen in vorgelagerten politischen Prozessen“.<br />
SEP soll Ordnung bringen<br />
Deshalb schlägt die dena als Weg aus dem Planungs-<br />
Tohuwabohu einen Systementwicklungsplan (SEP) vor.<br />
Der sei „eine konsistente Grundlage für die weiteren<br />
Planungsprozesse“, mache „Optimierungspotenziale<br />
der integrierten Energiewelt nutzbar und unterstützt<br />
politische Entscheidungen“. Doch dafür „muss der<br />
SEP in einen periodischen, transparenten, partizipativen<br />
und schließlich politisch legitimierten Prozess eingebunden<br />
werden“. Damit bekomme „die weitere Infrastrukturplanung<br />
die nötige Verbindlichkeit. Und alle<br />
Stakeholder können den Prozess als legitime Grundlage<br />
dafür akzeptieren“, sind sich dena und BET sicher.<br />
Aber warum wird solch fundierte Kritik an der bundesdeutschen<br />
Energienetzplanung von besagten<br />
„Stakeholdern“ totgeschwiegen? Das erinnert an die<br />
Studie „Der zellulare Ansatz“ der Energietechnischen<br />
Gesellschaft VDE-ETG vor genau sechs Jahren. Die<br />
hat gezeigt, „wie Stromnetzausbau durch den Zusammenschluss<br />
von austarierten ‚Energiezellen‘ auf<br />
lokaler Ebene reduziert werden kann“. Doch die darin<br />
berechneten 40 Prozent reduzierten notwendigen<br />
Stromnetzausbau-Kapazitäten sind bis heute nicht in<br />
das Bundesbedarfsplangesetz eingeflossen. Auch wenn<br />
das Gesetz offiziell immer wieder den echten (Strom-)<br />
Netzausbaubedarfen angepasst wird.<br />
Doch die dena-Forderung nach einem SEP geht wesentlich<br />
weiter als der (2019 fortgeschriebene) „Zellulare<br />
Ansatz“ der VDE-ETG. Denn der SEP berücksichtigt<br />
alle Energie-Bereiche – Wärme, Strom, Gas und<br />
Wasserstoff – sowie die notwendige Kopplung all dieser<br />
Sektoren. Doch wie bereits erwähnt: Noch nicht einmal<br />
den Stromnetz-Plänen der VDE-ETG öffnen sich Übertragungsnetzbetreiber<br />
(ÜNB), die Bundesnetzagentur<br />
(BNetzA) und deren Dienstherr, das Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Energie (BMWi) bisher.<br />
EU-Kommission verklagt Deutschland –<br />
BMWi und BNetzA sind sich zu nah<br />
Für viele Kritiker aus Umweltverbänden steht fest: Zwischen<br />
politischem Auftraggeber BMWi, den zu überwachenden<br />
ÜNB und dem offiziell als unabhängig zu<br />
geltenden Kontrolleur BNetzA passt kein Blatt<br />
Gut zu wissen!<br />
Die Fachverband Biogas service GmbH kümmert sich um die Organisation<br />
und Durchführung von Schulungen und Fachveranstaltungen. Wir bieten<br />
Beratungsangebote im Bereich der Energieerzeugung durch Biogasanlagen<br />
für Hersteller, Dienstleister und Betreiber an.<br />
Unser aktuelles Veranstaltungsangebot finden Sie unter:<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
Aktuelle<br />
Branchenthemen:<br />
eeG, Ausschreibungen,<br />
zukunftsoptionen, sicherheit,<br />
Düngerecht u.v.m.<br />
sPReCHen sie<br />
uns An!<br />
© Fotolia_Countrypixel<br />
Fachverband Biogas Service GmbH<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
0049 8161 / 984660<br />
service-gmbH@biogas.org<br />
47
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Planer wie BET<br />
kritisieren: „Für die<br />
Energieinfrastrukturen<br />
Strom, Gas, Wasserstoff<br />
und Wärme<br />
werden die Planungen<br />
in unabhängigen<br />
Prozessen vorangetrieben“,<br />
es finde „keine<br />
Optimierung über alle<br />
Infrastrukturen hinweg<br />
statt“.<br />
Papier. Das sieht offensichtlich die EU-Kommission<br />
ähnlich: Die hat die Bundesrepublik Deutschland Ende<br />
2018 vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Denn<br />
die BNetzA – sie soll den monopolisierten Markt der<br />
ÜNB kontrollieren – ist dem BMWi nachgeordnet. Das<br />
war für die EU-Kommission Grund genug, die Unabhängigkeit<br />
der BNetzA anzuzweifeln. Neben jenen besagten<br />
Akteuren Bundesregierung, BNetzA und Strom-<br />
ÜNB geht nun also die dena mit ihrer SEP-Forderung<br />
auch Planer für Wärme-, Gas- und Wasserstoff-Netze<br />
wegen deren unkoordiniertem Vorgehen an.<br />
Doch die Energie-Agentur selbst ist auch nicht unumstritten.<br />
Zum Beispiel beim gemeinnützigen Verein<br />
LobbyControl. Der hat die dena anlässlich des drei Monate<br />
nach dem SEP-Papier im März <strong>2021</strong> veröffentlichten<br />
Zwischenberichts der „dena-Leitstudie Aufbruch<br />
Klimaneutralität“ wegen des „intransparenten<br />
und einseitigen Sponsoringmodells scharf kritisiert“.<br />
Aus Sicht der Nichtregierungsorganisation ist „die<br />
Studie nicht wissenschaftlich neutral, da sie weitestgehend<br />
von Unternehmen finanziert wird. Diese sogenannten<br />
‚Partner‘, darunter Fossil-Konzerne wie RWE<br />
und Thyssengas, bestimmen auch die Inhalte mit. Sie<br />
haben sich ihren Einfluss mit jeweils bis zu 35.000<br />
Euro erkauft.“ Laut LobbyControl räumt die dena dem<br />
Beirat kein Stimmrecht bei der entstehenden dena-<br />
Netzstudie III ein, „die Sponsoring-Unternehmen haben<br />
aber privilegierten Einfluss“.<br />
Fell kritisiert dena<br />
Während LobbyControl sich bei den dena-Studien „für<br />
Transparenz, eine demokratische Kontrolle und klare<br />
Schranken der Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit“<br />
einsetzt, hat die Kritik von Hans-Josef Fell<br />
eine andere Zielrichtung: Dem Ex-Grünen-Bundestagsabgeordneten<br />
und heutigen Präsidenten der Energy<br />
Watch Group sind vor allem die Zeiträume zu lang,<br />
in denen die dena Klimaneutralität erreichen will; das<br />
erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion.<br />
In einer ersten Stellungnahme auf den Leitstudien-Zwischenbericht<br />
hatte Fell angeprangert: „Die dena ignoriert<br />
vollkommen die Dramatik der Erdüberhitzung und<br />
zudem umfangreiche weltweite Forschungsergebnisse,<br />
nach denen 100 Prozent Erneuerbare Energien bei entsprechendem<br />
politischen Willen bis 2030 technisch<br />
und ökonomisch umsetzbar sind.“ Außerdem sah er<br />
„die Leitstudie wie von der fossilen Wirtschaft diktiert:<br />
Klimaneutralität müsse es erst bis 2050 geben, um<br />
dem Klimaschutz gerecht zu werden. Kein Wort davon,<br />
dass die Atmosphäre heute schon zu voll mit Treibhausgasen<br />
ist und sie deshalb keine Neuemissionen mehr<br />
verträgt.“<br />
SEP-Ideen kontra GroKo-Pläne<br />
Doch zurück zum dena-Vorschlag für einen Systementwicklungsplan<br />
SEP. „Der SEP-Prozess gliedert sich in<br />
drei Phasen: Grundlagen schaffen, Handlungsoptionen<br />
bewerten und Entscheidungen herbeiführen.“ Das liest<br />
sich wie Hänschen und Lieschen Müller beim gemeinsamen<br />
Einkaufen. Und im Detail laufen die SEP-Ideen<br />
sogar den aktuellen Plänen der Regierung entgegen:<br />
Immer wieder ist von GroKo-Seite zu hören, man wolle<br />
„Planungshemmnisse beseitigen“ – also Bürgerrechte<br />
einschränken.<br />
Die dena dagegen will beim Netzausbau sogar „Beteiligungsmöglichkeiten<br />
und Akzeptanz verbessern. Die<br />
Planungsprozesse sehen an vielen Stellen öffentliche<br />
Beteiligungsmöglichkeiten vor“, ist zu lesen, und dass<br />
„es mehrfach die Möglichkeit zur Einflussnahme“ gebe.<br />
Nicht zu vergessen die Angebote von „Netzbetreibern<br />
und Bürgerdialog Stromnetz für informelle Informationen<br />
und Gespräche direkt vor Ort“. Dennoch aber „fehlt<br />
in betroffenen Regionen oft die Akzeptanz für den Bau<br />
insbesondere von Stromleitungen. Eine Ursache dafür<br />
ist das sogenannte Beteiligungsparadoxon“: Das Interesse<br />
an Maßnahmen mit fortschreitendem Planungsund<br />
Umsetzungsstand steige, während gleichzeitig die<br />
Einflussmöglichkeiten abnähmen.<br />
„Das kann zu Frustration der Beteiligten führen, da<br />
zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beteiligung grundsätzliche<br />
Entscheidungen bereits getroffen sind. Dadurch<br />
kann bei Betroffenen der Eindruck entstehen,<br />
mit ihren Anliegen immer einen Schritt zu spät zu<br />
kommen.“ Damit beschreibt die dena genau das, was<br />
beispielsweise zurzeit in Bayern bei Tennet-Plänen zu<br />
Höchstspannungsleitungen von Nord nach Süd wie Ost<br />
nach West zu erleben ist. Doch eine Lösung für dieses<br />
„Beteiligungsparadoxon“ bietet auch die dena zumindest<br />
im Zwischenbericht nicht an.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. Heinz Wraneschitz<br />
Feld-am-See-Ring 15a<br />
91452 Wilhermsdorf<br />
0 91 02/31 81 62<br />
heinz.wraneschitz@t-online.de<br />
www.bildtext.de · www.wran.de<br />
FOTO: LANDPIXEL.EU<br />
48
ê<br />
ê<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
Schreiber<br />
Anlagenbau<br />
Industrie | Biogas | Sondermaschinen | Klärtechnik<br />
DOSIER-MISCHERSCHNECKE 2.0<br />
mit einer Windung komplett V2A<br />
Unsere bewährte Mischerschnecke durch viel Erfahrung<br />
verbessert und weiterentwickelt<br />
durch verbesserte Geometrie der Windung,<br />
Reduzierung des Stromverbrauchs<br />
hergestellt aus V2A – 10 mm<br />
zwei Räumschwerter aus 15 mm V2A<br />
6 Messerhalter<br />
mit großer Serviceöffnung inkl. Abdeckung<br />
optional Ausräumer (rot) erhältlich<br />
für alle gängigen Hersteller<br />
lieferbar<br />
SEPARATORSCHNECKEN<br />
INDSTANDSETZUNG<br />
Wir warten und erhalten Separatorschnecken<br />
sämtlicher Hersteller!<br />
Aufarbeitung von abgenutzten Schnecken<br />
speziell entwickeltes Hartauftrag-Verfahren<br />
Rundschleifen auf Siebkorb-Maß<br />
mehr Pressleistung durch optimierte Geometrie<br />
hoher Verschleißschutz<br />
EGAL<br />
WELCHER<br />
HER-<br />
STELLER!<br />
FERMENTER ZU DICK?<br />
GASERTRAG ZU NIEDRIG?<br />
RÜHRWERKE AM ANSCHLAG?<br />
AS COMPACT CRUSHER<br />
einfacher Einbau vor/nach einer Pumpe<br />
einfache Steuerung<br />
integrierter Fremdkörperabscheider<br />
einfacher Messeraustausch<br />
geringe Unterhaltskosten<br />
Messersatz für nur 24 € erhältlich<br />
bis zu 120 m³/h Durchsatz<br />
mehr Gasertrag aus Problemstoffen/Verkürzung der Verweilzeit<br />
IE3 oder wahlweise IE4 Elektromotor<br />
mechanische verschleißfreie Dichtung<br />
extrem starke langlebige Lagerung<br />
Fermenter wird homogener und fließfähiger –<br />
bessere Ausnutzung<br />
problemloses vergasen von großen Mengen:<br />
Mist, Stroh, GPS oder andere Problemsubstrate<br />
zerkleinert/zerfasert<br />
- mechanisch durch extrem<br />
schnell drehende Messer<br />
- durch Kavitation, die bei der<br />
hohen Drehzahl entsteht<br />
verhindert Schwimmschichten<br />
dünnere Gülle beim Ausbringen<br />
verkürzt die Rührzeiten<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
BIS ZU<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
40 %<br />
ZUSCHUSS<br />
KFW 295<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
ê<br />
Gasaufbereitung | Substrataufbereitung | Separation | Trocknungsanlagen | Instandsetzungen | Sonderanfertigung49<br />
Tel.: 07305 95 61 501 | info@schreiber-anlagenbau.de | www.schreiber-anlagenbau.de
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Wasserstoff ersetzt Steinkohle<br />
Die Bauphase des Kohlekraftwerks Moorburg dauerte länger als seine Betriebszeit. Kaum<br />
ist es im Zuge des Kohleausstiegs nun endgültig stillgelegt, soll es zum Standort eines der<br />
größten Wasserstoff-Projekte Deutschlands werden. Damit verkörpert Moorburg auf einzigartige<br />
Weise die Energiepolitik der letzten beiden Jahrzehnte.<br />
Von Dierk Jensen<br />
Besoffene Gleichzeitigkeit: Als in Berlin Ende<br />
der Neunzigerjahre die rot-grüne Koalition<br />
unter SPD-Kanzler Schröder am ersten Erneuerbaren-Energien-Gesetz<br />
(EEG) feilte,<br />
wurde unter sozialdemokratischer Mehrheit<br />
in Hamburg noch eifrig an einem neuen großen Kohlekraftwerk<br />
geplant. Es sollte dort errichtet werden, wo<br />
an gleicher Stelle früher ein Gaskraftwerk stand, das in<br />
den Achtzigerjahren abgerissen wurde.<br />
Dann kam CDU-Mann Ole von Beust. Er übernahm nach<br />
jahrzehntelanger sozialdemokratischer Vorherrschaft<br />
im reichen Hamburg das Amt des Ersten Bürgermeisters<br />
und proklamierte fortan die Losung einer „wachsenden<br />
Stadt“. En passant wurde die stadteigene HEW<br />
an den schwedischen Staatskonzern Vattenfall – ganz<br />
im Sinne der christdemokratischen Marktgläubigkeit<br />
– veräußert. Die Schweden vollendeten dann schließlich<br />
das, was heute, nach nur ein paar Jahren Betrieb,<br />
eine gigantische Industrieruine ist: das Kohlekraftwerk<br />
Moorburg. Ein atemberaubend teurer Tempel der energiepolitischen<br />
Kurzsichtigkeit, der klimapolitischen<br />
Ignoranz und eines städtischen Unvermögens, das die<br />
Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig zu erkennen wusste.<br />
Wer über den alten Elbtunnel, der von Harburg zur<br />
größten Flussinsel Europas über die Süderelbe führt,<br />
spazieren geht, der sieht das nur ungefähr eineinhalb<br />
Kilometer entfernt liegende Betonmonstrum im Westen.<br />
Davor befindet sich das weitläufige Öllager von<br />
Shell, dahinter liegt der Ort Moorburg, der zwischen<br />
Kraftwerk und dem sich stetig ausweitenden Hafen um<br />
seine Zukunft ringt. Und etwas weiter in nordwestliche<br />
Richtung ragt die backsteinerne Kirche des schon<br />
längst vom Hafen verdrängten früheren Fischerdorfes<br />
Altenwerder wacker in den Abendhimmel.<br />
Zeugnis der „alten“ Wirtschaft<br />
Es besteht kein Zweifel: Moorburg, das stillgelegte<br />
Kohlekraftwerk, das seit Jahreswechsel keinen Dampf<br />
in den Himmel abgibt, das untergegangene Altenwerder<br />
und der gesamte Hamburger Hafen verkörpern die<br />
klassische, fossil geprägte Wachstumswirtschaft. Einzig<br />
zwei 5-Megawatt-Windenergieanlagen vom Hersteller<br />
Enercon signalisieren einen Aufbruch in eine neue,<br />
noch vage Ära.<br />
Das Moorburger Kraftwerk sei, damit rühmte sich der<br />
Betreiber Vattenfall immer wieder, eines der modernsten<br />
Kohlekraftwerke der Welt. Es soll durch hohe Effizienz<br />
geglänzt haben. Alles Attribute, die auch im<br />
FOTOS: JÖRG BÖTHLING<br />
50
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
Anlagenbau<br />
Steinkohlekraftwerk Moorburg: Ein atemberaubend teurer Tempel<br />
der energiepolitischen Kurzsichtigkeit, der klimapolitischen<br />
Ignoranz und eines städtischen Unvermögens, das die Zeichen<br />
der Zeit nicht rechtzeitig zu erkennen wusste.<br />
Informationszentrum, das in den wenigen<br />
Jahren des Betriebes auf dem Kraftwerksgelände<br />
etabliert war, den Gästen aus aller<br />
Welt vermittelt wurden. „Das Interesse an<br />
der Kraftwerkstechnologie war riesengroß“,<br />
bestätigt Gudrun Bode vom einstigen I-<br />
Zentrum, das bis zur Betriebsstilllegung<br />
über 30.000 Besucher empfing. Ob Besuchern<br />
aus Indien oder China auch verraten<br />
wurde, dass die Effizienz potenziell zwar<br />
hochgeschätzt wurde, aber die Wärmeauskoppelung<br />
für die Fernwärme von Hamburg<br />
nie zustande kam, bleibt jedoch fraglich.<br />
Weshalb kam es eigentlich nie zur Nutzung<br />
der Wärme? Die Antwort spiegelt den energiepolitischen<br />
Eiertanz in Deutschland<br />
während der Merkel-Ära wider. Während<br />
der bis 2010 amtierende schwarz-grüne<br />
Senat unter Ole von Beust den Bau von<br />
Moorburg juristisch nicht mehr verhindern<br />
wollte und nach gebetsmühlenartiger Aussage<br />
der Grünen auch nicht mehr konnte,<br />
hielt eine darauffolgende SPD-Landesregierung<br />
unter Olaf Scholz an Moorburg<br />
in alter sozialdemokratischer Affinität zur<br />
Steinkohle fest. Jedoch konnte Scholz<br />
während seiner Amtszeit nicht verhindern,<br />
dass sich die Hamburger, initiiert vom<br />
Umweltverband BUND, in einem Volksentscheid<br />
für den Rückkauf der Gas- und<br />
Stromnetze entschieden.<br />
Kein Brennstoff mehr<br />
aus Übersee<br />
Wie auch immer: Zum Bau einer<br />
Fernwärmeleitung in die<br />
Stadt kam es nie. Allerdings war<br />
die Volksabstimmung schon zu<br />
spät, um die Inbetriebnahme<br />
von Moorburg noch verhindern<br />
zu können. Nach acht Jahren<br />
Bauzeit, von der Dauer nur<br />
noch von der Elbphilharmonie<br />
übertroffen, ging das 1.600<br />
Megawatt große Kraftwerk ans<br />
Netz. Fortan brachten Schiffe<br />
die Steinkohle aus Übersee die<br />
Elbe hinauf. Aus Kolumbien,<br />
aus Australien oder sonst wo<br />
her. Die Hamburger Öffentlichkeit<br />
hat sich darüber nicht<br />
sonderlich geschert. Tatsächlich<br />
waren es nur wenige, die<br />
sich auch nach Betriebsstart<br />
weiter mit der drei Milliarden<br />
teuren CO 2<br />
-Schleuder beschäftigt<br />
haben. Neben Robin Wood,<br />
Greenpeace, manchen Protagonisten<br />
der Erneuerbaren Energien und<br />
einigen wenigen Medien, wie zum Beispiel<br />
der Regionalausgabe der taz, hat sich vor<br />
allem der BUND in den letzten Jahren als<br />
unbeugsamer Widersacher des Moorburger<br />
Kohletempels profiliert.<br />
Allen voran Manfred Braasch, der von<br />
1996 bis vor einigen Wochen Geschäftsführer<br />
des Hamburger Landesverbandes<br />
BUND war. Er wetterte unverdrossen<br />
gegen Moorburg, weil es die CO 2<br />
-Bilanz<br />
Hamburgs gänzlich verhagelte und die<br />
Wärmeversorgung beim Bau einer Wärmeleitung<br />
vom Kraftwerk unter die Elbe in die<br />
Stadtmitte langfristig strategisch in eine<br />
falsche Richtung lenken würde. Zudem<br />
würde durch die Kühlung der Kraftwerksblöcke<br />
die Fauna in der Elbe in große Mitleidenschaft<br />
gezogen werden. Darüber hinaus<br />
engagierte sich Braasch auch für die<br />
Rekommunalisierung der Energienetze,<br />
um die Energiewende wieder in städtische<br />
Verantwortung zu legen. Wie alle wissen: Er<br />
tat es mit großem Erfolg.<br />
So galt Braasch im Hamburger Umfeld als<br />
größter Opponent des rot-grünen Senats,<br />
der in den vergangenen Jahren wenig überzeugende<br />
klima- und umweltpolitische<br />
Kompromisse einging. Denn der Senat hat<br />
zum Beispiel die Elbvertiefung befürwortet<br />
oder dass der belastete Hafenschlick<br />
51<br />
Jetzt Energiefresser<br />
tauschen, CO 2 einsparen<br />
und bis zu 40 % BAFA<br />
Förderung sichern!<br />
Huning Feststoffdosierer –<br />
wir informieren Sie gern:<br />
Süd: Georg Mittermeier, 0163-6080418<br />
g.mittermeier@huning-anlagenbau.de<br />
Nord: Martin Esch, 0163-6080420<br />
m.esch@huning-anlagenbau.de<br />
EIN UNTERNEHMEN<br />
DER HUNING GRUPPE<br />
HUNING Anlagenbau GmbH & Co. KG<br />
Wellingholzhausener Str. 6, D-49324 Melle<br />
Tel. +49 (0) 54 22/6 08-2 60<br />
www.huning-anlagenbau.de
POLITIK<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Investoren planen Milliardeninvestitionen,<br />
um<br />
am Kraftwerksstandort<br />
Moorburg in großem<br />
Stil in die Wasserstoffproduktion<br />
einsteigen<br />
zu können.<br />
weiterhin im schleswig-holsteinischen Wattenmeer verklappt<br />
wird. Auch die voranschreitende Versiegelung<br />
des Stadtgebiets im Zuge der ambitionierten Wohnbaupolitik<br />
wird billigend in Kauf genommen.<br />
Ex-BUND-Mann wechselt in<br />
Umweltbehörde<br />
Dabei hat der Verlust an Grün mittlerweile atemberaubende<br />
Ausmaße angenommen: Viele Grünflächen sind<br />
verschwunden und auch im Hafengebiet sollen in Folge<br />
einer ungebremsten Industriepolitik die letzten Waldbeziehungsweise<br />
Forstflächen geopfert werden. Von<br />
daher differieren grüne Ansprüche nicht selten mit der<br />
realpolitischen Wirklichkeit. Und nun wechselt der rotgrüne<br />
Widersacher Braasch im Juli <strong>2021</strong> ausgerechnet<br />
in die Umweltbehörde, dem der grüne Umweltsenator<br />
Jens Kerstan vorsteht. Dort soll der Ökotrophologe<br />
die Geschäftsstelle eines neu gebildeten<br />
Klimabeirates leiten. Dass dies den amtierenden<br />
SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher<br />
nicht so richtig ins Konzept passt, wurde direkt<br />
nach der Bekanntgabe der Personalie deutlich.<br />
Tschentscher betonte, Braasch habe in<br />
seiner neuen Rolle „neue Loyalitätspflichten“.<br />
Umso interessanter wird es werden, inwieweit<br />
Braasch sich seiner konsequenten Haltung für<br />
Klima- und Umweltschutz in den Reihen der<br />
Umweltbehörde noch treu bleiben kann.<br />
Doch hat Braasch mit dem endgültigen Aus<br />
von Moorburg am 7. Juli <strong>2021</strong> vielleicht genau<br />
den richtigen Zeitpunkt erwischt. „Ich begrüße<br />
die angedachte Nachnutzung“, unterstrich<br />
er in seinen letzten Tagen als Geschäftsführer<br />
des BUND. Soll doch mit dem teuren Ende von<br />
Moorburg, für das Vattenfall rund 300 Millionen<br />
Euro im Zuge des Kohleausstiegs erhält,<br />
von heute auf morgen mit aller Macht eine neue, klimafreundliche<br />
Ära beginnen.<br />
Nun soll Wasserstoffwirtschaft den<br />
Wandel bringen<br />
Und zwar mithilfe von Fördermitteln im Rahmen der<br />
nationalen Wasserstoffstrategie und zugleich auch mit<br />
Rückendeckung aus Europa. Brüssel hat den Standort<br />
im Hafen, direkt an Hochspannungsleitungen und<br />
in unmittelbarer Nähe zu Industrien wie Kupfer- und<br />
Stahlproduktion, zu europaweiter Bedeutung erkoren,<br />
um den Weg in ein bereits im Jahr 2045 dekarbonisiertes<br />
Europa überhaupt gehen zu können. Sehr zur<br />
Freude vom parteilosen Hamburger Wirtschaftssenator<br />
Michael Westhagemann, der sich gerne als Vordenker<br />
eines Hamburger Wasserstoff-Hub positioniert.<br />
52
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
POLITIK<br />
Als früherer Manager bei Siemens ist er mit vielen<br />
großen Industrieunternehmen gut vernetzt, die er im<br />
selbsterklärten Hamburger Wasserstoffverbund begeistern<br />
möchte. Tatsächlich beteiligen sich an Bau und<br />
Betrieb des Elektrolyseurs mit einer Leistung von 100<br />
Megawatt Leistung sowohl Vattenfall, Shell, Mitsubishi<br />
Heavy Industries (MHI) als auch die städtische Wärme<br />
Hamburg, die die Abwärme des Elektrolyseurs in ihr<br />
Netz einspeisen will. Dabei soll die Anlage so aufgebaut<br />
sein, dass sie jederzeit erweitert werden kann. „Denn<br />
wenn wir ehrlich sind, reichen die 100 Megawatt Leistung<br />
dazu, nur einen Bruchteil der Industrie mit Wasserstoff<br />
zu versorgen“, weiß Michael Westhagemann.<br />
„Wir benötigen das Zehnfache.“<br />
Ziel sei es deshalb, bis 2030 die Leistung der Anlage<br />
zu verdoppeln oder gar zu verdreifachen. Arne Langner,<br />
Sprecher des benachbarten Stahlherstellers Arcelor<br />
Mittal spricht von einem Standortvorteil, weil sowohl<br />
Strom- als auch Gasnetze bereits vorhanden seien. Die<br />
Beteiligten wollen insgesamt 1,6 Milliarden Euro investieren,<br />
rund 520 Millionen Euro fließen aus dem<br />
Bundeshaushalt. „Ich begrüße die Folgevorhaben am<br />
Standort Moorburg sehr“, bekräftigt indessen auch Jan<br />
Rispens, der als Geschäftsführer des Hamburger Erneuerbaren<br />
Energieclusters seit vielen Jahren versucht,<br />
die unterschiedlichen Akteure an Elbe und Alster miteinander<br />
zu vernetzen.<br />
Weitere Wasserstoffakteure kündigen<br />
sich an<br />
Bemerkenswert deshalb auch für Rispens, dass am<br />
Standort Moorburg Ende Februar neben Vattenfall & Co.<br />
plötzlich ein weiteres Konsortium mit neuen Projektideen<br />
sich an die Öffentlichkeit wandte. Das Trio von der<br />
HH2E AG mit Alexander Voigt als Vorstandsvorsitzender,<br />
Uniper SE und Siemens Energy AG plant auf dem<br />
Gelände vom stillgelegten Kohlekraftwerk ein, wie sie es<br />
bezeichnen, „ikonografisches Zukunftskraftwerk“.<br />
Die drei Player beabsichtigen dort einen 200 Megawatt<br />
leistenden Elektrolyseur, eine moderne Gasturbine<br />
in einer Größenordnung von 60 bis 100 Megawatt<br />
sowie einen Hochtemperaturspeicher zu installieren.<br />
So überschlagen sich derzeit die hehren Absichtserklärungen,<br />
denn auch Eon Hanse will auf der Basis von<br />
erneuerbarem Strom – zwar nicht auf der Betonplatte<br />
des Kohlekraftwerks, aber im Hamburger Hafen – einen<br />
Elektrolyseur zur Wasserstoffproduktion schon in naher<br />
Zukunft realisieren.<br />
Bis aber die neue, grüne Ära in Moorburg wirklich starten<br />
kann, wird es noch einige Zeit brauchen, vielleicht<br />
sogar bis 2024, bis die Konstruktion des Kohlekraftwerks<br />
endgültig demontiert ist und alle Öle und sonstigen<br />
problembelasteten Reststoffe fachgerecht entsorgt<br />
sind. Gudrun Bode von Vattenfall beziffert die Kosten<br />
dafür auf rund 50 Millionen Euro.<br />
Ernüchterndes Fazit: Viele Moorburgs wird sich eine<br />
Wohlstandsgesellschaft wohl nicht mehr erlauben können<br />
– es fehlen die Ressourcen und es wird unbezahlbar.<br />
Umso erstaunlicher daher, wie schnell die große<br />
Industrie doch in der Lage zu sein scheint, den Hebel<br />
umzulegen. Mit dem Blick zurück ist das bitter, mit<br />
dem Blick nach vorne macht es Hoffnung. Ade Moorburg,<br />
ahoi Moorburg!<br />
Autor<br />
Dierk Jensen<br />
Freier Journalist<br />
Bundesstr. 76 · 20144 Hamburg<br />
040/40 18 68 89<br />
dierk.jensen@gmx.de<br />
www.dierkjensen.de<br />
HEAVY-DUTY<br />
RÜHRWERKE<br />
Sichern Sie sich durch die<br />
effizientesten Rührwerke<br />
am Markt bis zu<br />
40% Förderung<br />
der Investitionskosten<br />
durch die BAFA
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
Ṟ<br />
PRAXIS / TITEL BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
Stickstoff<br />
eliminieren,<br />
Phosphor<br />
mit Feststoff<br />
exportieren<br />
54<br />
Biatex-Green-Anlage. Von links: Gabi Bloomfield (Vertrieb<br />
und Marekting), Daniel Kollmann (Projektleiter) und<br />
Geschäftsführer Stefan Sziwek. In dem grünen Container, der<br />
innen geteilt ist, befinden sich ein kleines Labor in der einen<br />
Hälfte und in der anderen die Kompressoren, die die Luft für<br />
die Belüftung des Belebungs- und des Anamoxbeckens (Betonbehälter<br />
rechts) bereitstellen. Oben auf dem Container ist<br />
der Grobseparator zu sehen. In dem Raum dahinter befindet<br />
sich die Feinseparation.
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Die düngerechtlichen Vorgaben schränken die ausbringbaren Nährstoffmengen ein. In<br />
Regionen mit hohem Nährstoffanfall und knapp verfügbaren Flächen sowie relativ hohen<br />
Kosten für Nährstoffexporte kann die gezielte Wirtschaftsdüngerbehandlung zur Nährstoffreduktion<br />
und -fraktionierung eine Option sein.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
In Lamstedt (Niedersachsen), nördlich von Bremervörde,<br />
ist seit Ende 2020 eine Gärdünger-<br />
Behandlungsanlage in Betrieb, die die im Gärrest<br />
enthaltene Stickstoffmenge durch biologischen<br />
Abbau des Ammoniumanteils deutlich reduziert<br />
und den Nährstoff Phosphor zu einem Großteil in den<br />
separierten Feststoff überführt. Geplant und gebaut hat<br />
die Anlage die Firma Biatex GmbH aus Rheine (NRW).<br />
Nach nur fünf Monaten Bau- und Testzeit konnte die<br />
Anlage im vergangenen November den Regelbetrieb<br />
aufnehmen.<br />
Die Funktionsweise der Biatex Green-Anlage stellt sich<br />
wie folgt dar: Am Anfang werden mit einer projektspezifischen<br />
Feststoffabtrennung, die auf die Einsatzstoffe<br />
angepasst wird, die Feststoffe so weit wie technisch<br />
möglich ohne Chemikalien und Flockungshilfsmittel<br />
abgetrennt. Anschließend werden sie in einer biologischen,<br />
zweistufigen Behandlung mit natürlichen Anamoxmikroganismen<br />
abgebaut.<br />
In Lamstedt wird das ausgegorene, flüssige Gärsubstrat<br />
mit einem Trockensubstanzgehalt (TS) von<br />
durchschnittlich 10 bis 12 Prozent mit einer Exzenterschneckenpumpe<br />
vom Gärdüngerlager in einen runden<br />
Betonbehälter gepumpt, der im Fall der Pilotanlage<br />
ebenerdig in den Boden eingebaut worden ist. Die Vorgrube,<br />
in der sich kein Rührwerk befindet, hat ein Fassungsvermögen<br />
von 6 Kubikmeter (m³) und wird immer<br />
anlagenindividuell dimensioniert. Die Vorgrube ist das<br />
Vorlagebehältnis, das den Press-Schneckenseparator<br />
mit Material versorgt. Er ist so eingestellt, dass er einen<br />
Feststoffanteil mit durchschnittlich 25 Prozent TS-<br />
Gehalt abtrennt.<br />
Grob- und Feinseparation der Feststoffe<br />
„Der ‚Grob-Separator‘ stellt das erste Technikglied in<br />
der Feststoffabtrennung dar. Bei der zweiten Technikkomponente<br />
handelt es sich um eine Feinseparation.<br />
Genauer gesagt ist es ein Vakuumseparator von<br />
Im Bild hinten die<br />
Biogasanlage und die<br />
Blockheizkraftwerke<br />
davor. Vorne knapp zu<br />
erkennen der mittlere<br />
Vorlagebehälter für<br />
das Belebungsbecken,<br />
dahinter das rötlichbraun<br />
eingefärbte<br />
Anamoxbecken.<br />
FOTOS: MARTIN BENSMANN<br />
55
PRAXIS / TITEL BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
Ṟ<br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
Blick von oben vom Steg, der mittig<br />
über den Betonbehälter führt, in das<br />
Belebungsbecken. Sehr gut zu erkennen<br />
sind die schwimmenden Füllkörper,<br />
die das Schäumen des Substrates<br />
verhindern sollen. Oben links der<br />
kleine runde, mittig im großen Betonbehälter<br />
angeordnete Behälter, der die<br />
fertig separierte Flüssigkeit aufnimmt<br />
und bevorratet. Unten im Bild ist<br />
ein Edelstahlkasten zu sehen. Der<br />
befindet sich im Belebungsbecken und<br />
dient als erster freier Überlauf vom<br />
Belebungs- zum Anamoxbecken. Der<br />
zweite freie Überlauf ist im Anamoxbecken<br />
eingebaut, über den der fertig<br />
aufbereitete Gärdünger – in diesem<br />
Fall das Kaliwasser – zur Lagerung<br />
abgeleitet wird. In den freien Überlauf<br />
drückt sich das Substrat immer von<br />
unten hinein.<br />
FOTOS: MARTIN BENSMANN<br />
Links oben im Bild befindet sich der Grobseparator. Links<br />
unten sind die Schurren zu sehen, die den Feststoff aus der<br />
Feinseparation ausleiten. Die Feinseparatoren befinden sich<br />
links hinter der Wand. Unten sammelt sich der abgetrennte<br />
Feststoff, der hinten zu einem Haufen aufgestapelt wird.<br />
Acht Feinseparatoren trennen nach dem<br />
Grobseparator weitere Feststoffanteile aus<br />
dem Gärdünger ab.<br />
56
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Blick von oben in den Vorlagebehälter mit der fertig<br />
separierten Flüssigkeit. Aus diesem Behältnis<br />
wird das Belebungsbecken gespeist.<br />
Replace<br />
your agitator<br />
and cut your<br />
costs !<br />
Improve the efficiency of your<br />
biogas plant and reduce your<br />
energy costs. Simply replace your<br />
old 18.5 kW submersible agitator<br />
with one of Stallkamp’s extremely<br />
efficient 11 kW models and save<br />
up to 4000 Euro p.a.* without<br />
losing any performance. In the<br />
majority of cases the exchange<br />
will pay off within the first year.<br />
Don’t hesitate and contact our<br />
specialists!<br />
Daniel Kollmann am Bogensieb, das vor dem Ablauf der fertig<br />
behandelten Flüssigkeit die enthaltenen Anamoxbakterien zu einem<br />
Großteil zurückhalten soll. Das vom Bogensieb abgetrennte<br />
Material fließt zurück ins Anamoxbecken, der größere Rest wird<br />
ins Gärdüngerlager gepumpt.<br />
Probenmaterial aus dem Anamoxbecken. Die rötliche<br />
Färbung stammt von den Anamoxbakterien.<br />
| pump<br />
| store<br />
| agitate<br />
| separate<br />
* The total amount of savings depends on run-time and<br />
effectiveness of the existent agitator, cost of electricity,<br />
dry matter content and fermenter configuration.<br />
57<br />
Tel. +49 4443 9666-0<br />
www.stallkamp.de<br />
MADE IN DINKLAGE
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Blick in den leeren Betonbehälter, in dem der Stickstoffabbau stattfindet. Oben auf dem Steg befindet sich im Edel -<br />
stahlkasten das Bogensieb. In dem mittleren Rundbehälter wird das Filtrat, das vom Feinseparator kommt, zwischengespeichert.<br />
Aus diesem Behälter wird das Belebungsbecken (oben im Bild) versorgt. Links und rechts sind die<br />
betonierten Trennwände erkennbar, die den äußeren Ring unterbrechen und Belebungsbecken und Anamoxbecken<br />
voneinander trennen. Links an die Trennwand geschraubt befindet sich der freie Überlauf des Anamoxbeckens.<br />
der Firma BETEBE in Vreden (NRW), der dank seiner<br />
mikroperforierten Lochungen weitere Feststoffanteile<br />
und somit bereits einen großen Anteil Phosphor und<br />
organischen Stickstoff in die feste Fraktion überführt“,<br />
erläuterte Biatex-Geschäftsführer Stefan Sziwek. Die<br />
abgeschiedene flüssige Phase der ersten Separationsstufe<br />
wird in eine offene Wanne geleitet, aus der die<br />
acht Feinseparatoren die Flüssigkeit ziehen.<br />
Die mikroperforierte Lochung des Feinseparators hat<br />
eine Größe von 80 Mikrometer (µm). Die Lochungen<br />
werden von einem umlaufenden Wendel gereinigt, was<br />
deren Verstopfung verhindert.<br />
Der TS-Gehalt im Feststoff, der<br />
die Feinseparation verlässt, ist<br />
auf etwa 18 Prozent eingestellt.<br />
Während der erste Separator<br />
etwa 70 bis 90 Prozent der Gesamtfeststofffracht<br />
entfernt,<br />
schleust der Feinseparator weitere<br />
5 bis 15 Prozent des Gesamtfeststoffanteils<br />
heraus. Mit<br />
der Separationsstufe werden 70<br />
bis 90 Prozent des Phosphors,<br />
der im unbehandelten Gärdünger<br />
enthalten ist, in die Feststofffraktion<br />
überführt. Das erste<br />
Technikglied wird laut Sziwek<br />
immer projektspezifisch ausgelegt<br />
und im Fall Lamstdet demnächst<br />
weiter optimiert.<br />
Im Fugat, also in der fertig separierten<br />
flüssigen Phase, liegt<br />
der TS-Gehalt im Durchschnitt<br />
zwischen 2 und 4 Prozent, was<br />
im Wesentlichen an der hohen<br />
Salzfracht vom Hühnertrockenkot<br />
liegt. Biatex versucht derzeit, mit weiteren Abtrennverfahren<br />
diesen TS-Gehalt weiter zu reduzieren.<br />
Vor der weiteren biologischen Behandlung wird das<br />
Fugat in ein sogenanntes Absetzbecken gepumpt, in<br />
dem restliche Feststoffpartikel sedimentieren können.<br />
Dieses Absetzbecken ist ein runder, offener Betonbehälter,<br />
der mittig in einem größeren Betonrundbehälter<br />
platziert ist. So entsteht ein Ringbehältnis um das<br />
Absetzbecken herum. Zwei Betonwände, die zwischen<br />
Außenwand und Absetzbecken eingebaut worden sind,<br />
trennen den Ring in zwei Hälften.<br />
FOTO: BIATEX GMBH<br />
Weniger Aufwand, mehr Ertrag!<br />
Dank flexibler Vermarktung Ihrer Biogasanlage.<br />
+ Direktvermarktung<br />
+ Fahrplanoptimierung<br />
+ Regelenergie-Vermarktung<br />
Mehr erfahren unter www.trianel.com/biogas<br />
Trianel GmbH | Krefelder Straße 203 | 52070 Aachen<br />
Offizieller Vertriebs partner<br />
+49 241 413 20-340<br />
vertrieb-vermarktung@trianel.com<br />
013.0121012_Trianel_Biogas_AZ_175x77_BiogasJournal_RZ.indd 1 29.03.21 11:19<br />
58
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
FOTO: MARTIN BENSMANN<br />
Belebungs- und Anamoxbecken<br />
„Die eine Ringhälfte dient als sogenanntes Belebungsbecken,<br />
die andere Ringhälfte wird als Anamoxbecken<br />
bezeichnet. Das Belebungsbecken wird aus dem Absetzbecken<br />
gespeist. Im Belebungsbecken wird von<br />
unten intensiv Luft eingeblasen, die von einem Kompressor<br />
bereitgestellt wird. Auch das Anamoxbecken<br />
wird belüftet, jedoch deutlich weniger intensiv als das<br />
Belebungsbecken. Das Belebungsbecken ist die erste<br />
Stickstoffreduktionsstufe. Durch das Lufteinblasen<br />
entsteht Schaum auf dem Flüssigkeitsspiegel. Um<br />
dem vorzubeugen, schwimmen Kunststoffkörper auf<br />
der Oberfläche“, beschreibt Sziwek diesen Prozessschritt.<br />
Immer wenn das Belebungsbecken mit Fugat gespeist<br />
wird, strömt über einen freien Überlauf Flüssigkeit in<br />
das Anamoxbecken. Das hat seinen Namen von den<br />
sogenannten Anamoxbakterien, die dort in der Inbetriebnahmephase<br />
eindosiert werden. Diese Bakterien<br />
ernähren sich von Stickstoff und bauen ihn somit ab.<br />
Die Bakterien werden von Biatex bei der Inbetriebnahme<br />
einmalig eingeimpft. Es werden bewusst keine<br />
Chemikalien oder Polymere eingesetzt, um keine<br />
schwer abbaubaren Stoffe in den Düngekreislauf einzubringen.<br />
Da diese Anamoxbakterien sehr langsam wachsen,<br />
sind sie im Markt nur begrenzt verfügbar. Im Gesamtverfahren<br />
wird der Stoffwechselprozess der Deammonifikation<br />
genutzt. Dabei wird Ammonium mit Nitrit<br />
direkt zu molekularem Stickstoff umgesetzt – also zu<br />
N 2<br />
. Gleichzeitig erfolgt ein Abbau von Kohlenstoff.<br />
Das Ammonium darf also in der vierstufigen Reaktionsfolge<br />
nicht zu Nitrat reduziert werden. Mit dem<br />
Biatex-Green-Verfahren lässt sich der Ammoniumgehalt<br />
des unbehandelten Gärdüngers um über 90 Prozent<br />
reduzieren.<br />
Gärdünger in der 6 Kubikmeter fassenden Vorgrube,<br />
aus der die Separatoren gespeist werden.<br />
Bogensieb hält Anamoxbakterien zurück<br />
„Die Anamoxbakterien sind sehr klein. Sie würden über<br />
den Ablauf des Anamoxbeckens entweichen. Um das<br />
zu verhindern, ist ein patentiertes Bogensieb verbaut<br />
worden. Hierdurch müssen die Anamoxmikroorganismen<br />
nicht mehr nachgeimpft werden. Damit sind wir<br />
in der Lage, die Bakterien zurückzuhalten. Das Sieb<br />
selektiert die Bakterien vom Feinschlammanteil ab“,<br />
erklärt Sziwek.<br />
Die Verweilzeit des Gärdüngers in der Behandlungsanlage<br />
beträgt je nach Ausgangsmaterial zwischen<br />
8 und 16 Tage. In beiden Becken hat der zu behandelnde<br />
Gärdünger eine Temperatur von etwa 30 Grad<br />
Celsius. Nach einer anfänglichen Aufheizphase kommt<br />
es im Prozess zu einer exothermen Reaktion, sodass<br />
im Normalbetrieb keine externe Wärmezufuhr notwendig<br />
ist. Auf der Pilotanlage hat der unbehandelte<br />
Gärdünger einen pH-Wert von 8,3 bis 8,7. Im<br />
PUMPENTECHNIK<br />
OBERSCHWABEN<br />
Hardtstraße 24 a<br />
D-88090 Immenstaad<br />
Phone +49 (0) 7545 / 911 747<br />
Mobil +49 (0) 152 / 22 16 46 94<br />
info@pt-ob.de | www.pt-ob.de<br />
... aus einem Guss gefertigt<br />
... hohe Verschleißfestigkeit 60 HRC<br />
Spezialbeschichtung 1.350 HV<br />
... geringes Gewicht<br />
... wirtschaftlicher Pumpenbetrieb<br />
HOHLROTOREN<br />
FÜR EXZENTERSCHNECKENPUMPEN<br />
…der Fabrikate: Allweiler, Armatec, BSA, Bauer, Fliegl,<br />
Joskin, Netzsch, Seepex, Streumix, Wangen, Vogelsang, 59 uvm.
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Mit Wasser gefülltes<br />
Belebungsbecken<br />
(rechts) mit auf dem<br />
Boden montierten<br />
Belüftungsdüsen.<br />
Das wollten wir in Lamstedt aber nicht, weil dann für<br />
die Schlammabtrennung Polymere eingesetzt werden<br />
müssen. Wir wollen auch kein klares Wasser produzieren,<br />
das wir in Gräben oder Vorfluter einleiten könnten.<br />
Wir wollen vielmehr die Kulturpflanzen unter trockener<br />
werdenden Klimabedingungen mit Flüssigkeit versorgen.<br />
An Nährstoffen sind im Endprodukt im Wesentlichen<br />
Kalium und Magnesium sowie etwas mineralischer<br />
Stickstoff enthalten“, informiert Sziwek.<br />
Messwerte bezogen auf die Pilotanlage in Lamstedt<br />
Zulauf<br />
vor Separation<br />
Ablauf<br />
nach Biatex Green<br />
von bis von bis<br />
TS-Gehalt 9,5 13 1,6 5<br />
ph-Wert 8,2 8,7 7,4 7,7<br />
Gesamt-N kg/t 9 10,5 0,8 2,1<br />
NH 4<br />
-N kg/t 4,8 6,1 0,28 1,2<br />
Gesamt-P kg/t 8,5 9,8 0,08 1,7<br />
Biokohle aus Feststoffen gewinnen<br />
Demnächst soll an dem Standort noch eine HTC-Anlage<br />
errichtet werden. Dann wird mittels Hydrothermaler<br />
Carbonisierung sogenannte Biokohle aus den<br />
abgetrennten Feststoffen produziert. Die Diversifizierung<br />
der Einnahmen einer Biogasanlage sei wichtig<br />
für deren heutigen und künftigen Erfolg. Nur Strom zu<br />
produzieren sei insbesondere unter den neuen EEG-<br />
Bedingungen künftig kaum mehr möglich.<br />
Die Biogasanlage vor Ort nahm 2011 ihren Betrieb<br />
auf. Sie besteht aus einem Fermenter (1.470 m³), einem<br />
Nachgärer (1.470 m³) und einem Gärdüngerlager<br />
(4.394 m³). Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) mit 400<br />
Kilowatt elektrischer Leistung verwertet das Biogas.<br />
Der Motor ist nicht flexibilisiert und läuft sozusagen im<br />
24/7-Betrieb. Mit einem Teil der BHKW-Abwärme wird<br />
ein in der Nähe befindlicher Hühnerstall versorgt. Dort<br />
werden medizinische Eier produziert für die Medikamentenherstellung.<br />
Vergoren werden in der Biogasanlage Silomais, Hühnertrockenkot<br />
und Rindergülle. Die Verweilzeit beträgt<br />
in Fermenter und Nachgärer 120 Tage, die Gärtemperatur<br />
liegt bei 39 bis 40 Grad Celsius. Laut Sziwek ist<br />
die Rinderhaltung in der Region stark verbreitet. Somit<br />
sei ein großes Potenzial zur Biogasproduktion vorhanden.<br />
Er wolle künftig auch den Anteil an Rindergülle/-<br />
mist erhöhen und den teuren Silomaisanteil senken.<br />
Die Rindergülle werde aus der Region geliefert. Eventuell<br />
steigt er demnächst ganz aus der Biogasverstromung<br />
aus und produziert Biomethan für den Kraftstoffmarkt.<br />
Eins steht aber jetzt schon fest: Ein Nährstoffüberschuss-Problem<br />
hat er nicht mehr.<br />
Hinweis: Eine Besichtigung der Anlage ist<br />
nach Terminvereinbarung unter der<br />
Mobil-Nr. 01 51/59 46 14 56 möglich.<br />
fertig behandelten Gärdünger liegt der pH-Wert bei zirka<br />
7,5. Sziwek geht es mit diesem Verfahren darum,<br />
die Nährstoffüberschussprobleme zu lösen und einen<br />
transportwürdigen flüssigen Wirtschaftsdünger zu produzieren,<br />
ohne Chemikalien einzusetzen. „Möglich ist<br />
die Nachschaltung einer Nachreinigung mit Ultrafiltration,<br />
um die Salzfracht im Gärrest weiter zu reduzieren.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
FOTO: BIATEX GMBH<br />
60
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Rund, schnell und flexibel<br />
Marktführer in der Herstellung und Montage von Stahlbeton-<br />
Fertigteilbehältern für die Biogas Industie.<br />
Hohe Qualität - Vorgefertigte Elemente<br />
in kontrollierter Umgebung<br />
Robuste Stahlbetonelemente - Auch ins<br />
Erdreich eingebundene Varianten möglich<br />
Flexible Produktpalette - Durchmesser<br />
bis 70 m und Wandhöhen bis 14 m<br />
Optimierte Baumethode - Sichere und<br />
schnelle Vor-Ort-Montage<br />
Kurze Bauzeiten - Kalkulierbare und<br />
schnelle Realisierung<br />
Kostengünstig - Ausgelegt für eine<br />
Lebensdauer von 50 Jahren<br />
Biogaskongress <strong>2021</strong><br />
29./30. September <strong>2021</strong> (Online)<br />
Termin bitte<br />
vormerken<br />
Weitere Infos unter: https://veranstaltungen.fnr.de/biogaskongress<br />
A-CONSULT GmbH<br />
Werner-Von-Siemens-Str. 8 • D-24837 Schleswig<br />
Tel. 04621 855094 0 • Fax: 04621 855094 20<br />
info@aconsult.de • www.aconsult.de<br />
Medienpartner<br />
BI<br />
GAS Journal<br />
KOMPONENTEN FÜR BIOGASANLAGEN<br />
QUALITÄT<br />
AUS<br />
VERANTWORTUNG<br />
■ Fermenterrührwerke für Wand- und<br />
Deckeneinbau Robuste und leistungsstarke Bauweise energieeinsparend<br />
+ hocheffizient.<br />
■ Separatoren für Biogasanlagen<br />
stationär / als mobile Einheit<br />
BIS ZU<br />
40%<br />
ZUSCHUSS<br />
DURCH KFW<br />
MÖGLICH<br />
■ Rührwerke für Nachgärbehälter<br />
und Endlager<br />
■ Pumptechnik für Biogasanlagen<br />
■ Panoramaschaugläser Nachrüstung möglich<br />
PAULMICHL GmbH<br />
Kisslegger Straße 13<br />
88299 Leutkirch<br />
Tel. 0 75 63/84 71<br />
Fax 0 75 63/80 12<br />
www.paulmichl-gmbh.de<br />
MAPRO International LOGO.pdf 1 12.11.13 10:21<br />
MAPRO ® GASvERdIchTER<br />
volumenströme bis zu 3600 m³/h<br />
und drücke bis zu 3,2 bar g<br />
A Company of<br />
MAPRO ® INTERNATIONAL S.p.A.<br />
www.maproint.com<br />
WARTUNG ZUM FESTPREIS<br />
MAPRO ® Deutschland GmbH<br />
Tiefenbroicher Weg 35/B2 · D-40472 Düsseldorf<br />
Tel.: +49 211 98485400 · Fax: +49 211 98485420<br />
www.maprodeutschland.com · deutschland@maproint.com<br />
61
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Technologie-<br />
Kaskade zerlegt<br />
Wirtschaftsdünger<br />
Die kluge Verknüpfung verschiedener Technologien<br />
miteinander lässt neue Düngerprodukte und Wertstoffe<br />
entstehen. Eine kreislauforientierte Lösungskaskade<br />
für landwirtschaftliche Betriebe und Biogasanlagen<br />
in Regionen mit Nährstoffüberschüssen aus<br />
anfallenden Wirtschaftsdüngern.<br />
Von Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Von links: André<br />
Schillingmann, die<br />
Geschäftsführer Dieter<br />
und Hartmut Schillingmann.<br />
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
Ṟ<br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
Es ist nun schon mittlerweile sieben Jahre her,<br />
dass ich die Firma REW Regenis - Regenerative<br />
Energie Wirtschaftssysteme GmbH<br />
in Quakenbrück (Niedersachsen) besucht<br />
habe. Damals wurde die Separations- und<br />
Trocknungstechnik sowohl in der Fertigung als auch<br />
im Praxisbetrieb angeschaut – siehe Bericht im Biogas<br />
Journal 6_2014, Seite 48 bis 51. Schon damals hatte<br />
das Unternehmen zahlreiche Ideen im Köcher. Nun war<br />
es mal wieder an der Zeit zu schauen, was es an neuen<br />
Entwicklungen gibt.<br />
Beim Grundprinzip der Separationstechnik hat sich<br />
einiges verändert. Die Pressschnecke zieht – im Gegensatz<br />
zu vielen anderen Modellen im Markt – den<br />
Gärdünger oder die Gülle durch den Separator, wodurch<br />
ein voll geschlossenes Verfahren mit einem vom<br />
Siebkorb getrennten, durchbruchsicheren Ringspaltstopfen<br />
ermöglicht wird. Dieser Stopfen wird nicht<br />
durch Verschleiß erzeugende und Energie zehrende<br />
Gegenklappen aufgebaut und gesichert, sondern ist<br />
von der Form und vom Aufbau als solcher durchbruchsicher.<br />
„Neu ist, dass die Welle vorne und hinten gelagert ist,<br />
wodurch immer Siebkorb und Welle voll zentriert sind.<br />
Dadurch reduzieren wir den Verschleiß und erhöhen<br />
außerdem die Betriebssicherheit der Separatoren“,<br />
erläuterte Geschäftsführer Dr.-Ing. Dieter Schillingmann.<br />
Regenis legt neuerdings das Gesamtsystem<br />
Welle, Siebkorb und Ringspaltstopfen kundenspezifisch<br />
so aus, dass der Düngerschlamm entweder mehr<br />
in den Feststoff (zum Beispiel mit dem Modell „GE<br />
Super“ als MaisEinsparer) oder gezielt in das Filtrat<br />
gelangt (GE Super dry zur Produktion von zum Beispiel<br />
Einstreu mit hohem Trockensubstanzgehalt).<br />
Stationäre und mobile Separatoren<br />
Von den Separatoren gibt es zwei Größen, die zu vier<br />
verschiedenen Typen mit unterschiedlichen Durchsatzmengen<br />
von 1 m³ bis 100 m³ pro Stunde aufgebaut<br />
werden können. Die Separatoren können an der<br />
Biogasanlage und/oder mobil zur Gülleseparation eingesetzt<br />
werden. Die Separatoren sind in der Lage –<br />
je nach Zielstellung, Aufbau und Inputmaterial –,<br />
Feststoffe mit bis zu 45 Prozent Trockensubstanz-(TS)<br />
gehalt zu produzieren. Allerdings: je höher der TS-<br />
Gehalt, desto geringer wird der Durchsatz pro Stunde.<br />
„Im Feststoff befindet sich vor allem der Nährstoff<br />
Phosphor, aber auch organischer Stickstoff ist in großen<br />
Mengen enthalten. „Die abseparierte Flüssigkeit,<br />
das Filtrat, kann im Falle der Separation – im Bereich<br />
der Tierproduktion ohne Biogasanlage – entsprechend<br />
düngertechnisch an die Hoftorbilanz angepasst werden.<br />
Dies ist zum Beispiel mit einfachen Verfahren wie<br />
Sedimentation, Fällung, Flotation, MAP-Gewinnung<br />
usw. möglich oder es kann in Synergie mit einer Biogasanlage<br />
und unserem ‚GT Trockner/Verdampfer‘ weiter<br />
aufbereitet werden“, erklärte Dieter Schillingmann<br />
weitere Optionen.<br />
Nur Gülleinhaltsstoffe vergären<br />
Die mobilen Separatoren heißen bei Regenis „Maiseinsparer“.<br />
Dieter Schillingmann erklärt die Idee dahinter:<br />
„Wir sind davon überzeugt, dass die Gülle – so wie<br />
sie im Stall anfällt – nicht vergoren werden sollte, da<br />
zum einen der Flüssigkeitsanteil zu hoch und der energiehaltige<br />
Feststoffanteil zu gering ist und zum anderen<br />
durch die Frischgülleseparation Emissionen reduziert<br />
werden können. Gerade im Winter muss man sich<br />
manchmal die Frage stellen, ob mehr Energie aus der<br />
FOTO: MARTIN BENSMANN<br />
62
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
Im 40-Fuß-Container: Hier an der einen Stirnseite befindet<br />
sich oben der Separator, der aus dem darunter stehenden<br />
runden Behälter mit Gärsubstrat versorgt wird. Die<br />
abgepresste feste Fraktion wird vom Separator an den<br />
dahinterliegenden Trockner übergeben.<br />
Blick auf den Verdampfungstrockner. Hier erkennt man die hochwertige Isolierung.<br />
50 % der „reingesteckten“ Rauchgaswärme kann zurückgewonnen werden.<br />
FOTOS: WERKBILDER<br />
Pyrolyseanlage: Sie befindet sich ebenfalls in einem 40-Fuß-Container. Vorne links befindet sich der<br />
Brenner, der zum Start der Anlage mit Biogas befeuert werden kann. In dem Container befindet sich<br />
auch ein Trocknermodul, das über dem Pyrolysereaktor angeordnet ist.<br />
Gülle herauskommt, als durch Transporte,<br />
Aufheizen, Pumpen und Rühren reingesteckt<br />
werden muss. Wir plädieren dafür,<br />
die Rinder- beziehungsweise Schweinegülle<br />
stallnah zu separieren und anschließend<br />
insbesondere den abgetrennten Feststoff<br />
möglichst frisch zu vergären“, betonte<br />
Schillingmann. Versuche hätten gezeigt,<br />
dass man aus 10.000 Tonnen frischer<br />
Rindergülle im Jahr etwa 2.000 Tonnen<br />
Feststoffe abseparieren kann. Damit lassen<br />
sich über 1.000 Tonnen Mais pro Jahr<br />
einsparen, daher der Name „Regenis ME“,<br />
wobei „ME“ für „MaisEinsparer“ steht.<br />
In der Technologiekette kann optional nach<br />
dem Separator die Trockner/Verdampfereinheit<br />
zur Hygienisierung der abgetrennten<br />
Feststoffe und zur Produktion von<br />
Flüssigdünger angeschlossen werden.<br />
Beide Prozessstufen, also Separation und<br />
Trocknung/Verdampfung, arbeiten „Hand<br />
in Hand“ und können in einem 40-Fuß-<br />
Container Platz finden. Das grundsätzliche<br />
Trocknungs-/Verdampfungskonzept mit<br />
dem rauchgasbeheizten Doppelmantelrohr<br />
hat sich nicht verändert.<br />
Neu bei dem GT-Trockner/Verdampfer sind<br />
aber die sogenannten FLEX-Tools. Das<br />
heißt, dass<br />
a. zwischen Separator und Trockner ein<br />
Zusatzaustragsförderer installiert werden<br />
kann, dass<br />
b. in den Verdampfungsraum des indirekt<br />
beheizten Trockners zusätzlich Filtrat<br />
eingedüst werden kann, dass<br />
c. statt Einwellentrockner optional auch<br />
ein Doppelwellentrockner/Verdampfer<br />
geliefert werden kann. So kann je nach<br />
Input und Verfügbarkeit von Wärme<br />
pro Containeranlage ein Durch-<br />
63
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Pyrolyseanlage: Oben der Trockner und darunter der Pyrolysereaktor. Oben rechts über dem<br />
schrägen Kasten werden die heißen Dämpfe aus dem Trockner abgeführt.<br />
Pyrolyseanlage mit Feststoffeintrag ganz links im Bild.<br />
Pyrolyseanlage von der anderen Stirnseite des Containers<br />
betrachtet: Der Elektromotor treibt die Förderschnecke<br />
im Trockner an. Links im Bild als Nr. 1 gekennzeichnet<br />
verlässt der getrocknete Feststoff den Trockner. Darunter<br />
mit Nr. 2 markiert ist eine Schnecke verbaut, die den<br />
ausgetragenen Feststoff in den Pyrolysereaktor einträgt.<br />
Über den Kanal (Nr. 3) werden die heißen Dämpfe zum<br />
Auskondensieren abgeführt.<br />
satz von 5.000 bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr an<br />
Gärrest verarbeitet werden. Hinter dem Separator<br />
können dann von 60 Kilogramm pro Stunde (kg/h)<br />
bis zu 600 kg/h separierter Feststoff mit einem<br />
TS-Gehalt von 15 bis 30 Prozent und hinter dem<br />
Trockner ein TS-Gehalt je nach Zielstellung von 30<br />
bis 90 Prozent erreicht werden. Um für den Kunden<br />
die richtige Anlage konzipieren zu können, wird von<br />
Regenis unter Einbindung der Biogasanlage jeweils<br />
eine Massen- und Düngerbilanz erstellt.<br />
Das Trockenprodukt kann – neben Düngerverwendung –<br />
auch dank eines Feuchtesensors zielgenau getrocknet<br />
werden, um es dann<br />
a. als Einstreu mit zum Beispiel 40<br />
bis 60 Prozent TS zu nutzen,<br />
b. als Eingangsprodukt für die Kompostierung oder<br />
als Torfersatzprodukt mit 50 bis 70 Prozent TS<br />
zu verwenden,<br />
c. mit 75 bis 90 Prozent TS zu Energiepellets und/<br />
oder Energiebriketts zu verarbeiten oder<br />
d. als Faserersatzstoff für kompostierbare Blumentöpfe<br />
bzw. als Papierersatzstoff für Isolier- und<br />
Verpackungsprozesse usw. mit 80 bis 90 Prozent<br />
TS zu nutzen.<br />
Der eingetragene Feststoff verbleibt etwa eine Stunde<br />
bei 90 bis 100 Grad Celsius im Trockner, bis er am Ende<br />
mit rund 30 Grad Celsius im einfachen Feststoffgärrestlager<br />
ankommt. In der Austragschnecke kann die<br />
Temperatur des Trockengutes sowie die Feuchtigkeit<br />
online gemessen werden. Außerdem sind dort Sprüh-<br />
FOTOS: MARTIN BENSMANN (2), WERKBILD (1)<br />
64
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
düsen verbaut, über die Wasser eingesprüht<br />
werden kann, falls das Material zu trocken<br />
geworden ist. Die heißen BHKW-Abgase<br />
strömen mit bis zu 500 Grad Celsius – zur<br />
indirekten Beheizung über Strahlung und<br />
Kontakt – durch das Doppelmantelrohr. Neu<br />
ist ebenfalls, dass im selben Container zwei<br />
Trocknerrohreinheiten nebeneinander installiert<br />
und betrieben werden können, was<br />
den Durchsatz verdoppelt.<br />
Verdampfungstrockner erzeugt<br />
Feststoff- und Flüssigdünger<br />
80 Prozent des im Gärrest enthaltenen<br />
Ammoniumstickstoffs sind im Filtrat und<br />
etwa 20 Prozent sind im abgetrennten,<br />
zu trocknenden Feststoff enthalten, die<br />
beim Trocknen entgast werden. „Unter<br />
der Wäscher- und Kühlkolonne wird das<br />
sogenannte Ammoniumwasser in einer<br />
geschlossenen Wanne aufgefangen. Unten<br />
in der Wanne ist eine Förderschnecke<br />
verbaut. Die sich absetzenden Staub-<br />
Sedimente werden zusammen mit dem<br />
erzeugten Ammoniumwasser und dem im<br />
Separator separierten Filtrat als ammoniumreicher<br />
Dünger – ohne größere Faserstoffe<br />
– ins Düngerlager gepumpt.<br />
Dieser durch die Kombination des Separators<br />
mit dem Trockner/Verdampfer<br />
erzeugte Flüssigdünger ist ein hochwertiger,<br />
pH-Wert neutraler, wenig organischen<br />
Stickstoff, aber viel Ammoniumstickstoff<br />
enthaltender Flüssigdünger, der sich im<br />
Pflanzenbau gut verwenden lässt. „Der<br />
Flüssigdünger ist leicht pumpbar, geht<br />
schnell ohne große N-Verluste in den Boden<br />
an die Pflanzenwurzel heran, vermeidet<br />
Verätzungen auf den Pflanzenblättern und<br />
ist gerade zur Hauptwachstumszeit schnell<br />
pflanzenverfügbar“, erklärte M.Sc. André<br />
Schillingmann, der der Sohn von Dieter<br />
Schillingmann ist und seit drei Jahren im<br />
Unternehmen mitarbeitet.<br />
„Der Clou ist“, ergänzt Schillingmann-Junior,<br />
„dass so der relativ träge organische<br />
Stickstoff zusammen mit dem hohen Kohlenstoffanteil<br />
und rund der Hälfte des Phosphors<br />
überwiegend im Feststoff ist. Dieser<br />
hygienisierte Feststoff kann dann ideal als<br />
Humusbildner im Rahmen der Fruchtfolgen<br />
verwertet werden, während der im GT<br />
erzeugte Flüssigdünger mit den Hauptnährstoffen<br />
Ammonium-N, Phosphor und<br />
Kalium direkt im Pflanzenbestand verwertet<br />
wird und so zu bestem Wachstum führt.“<br />
PRAXIS / TITEL<br />
Mischen – Fördern –<br />
Zerkleinern<br />
Ihr Partner für die Energie<br />
der Zukunft<br />
Als Weltmarktführer von Exzenterschneckenpumpen<br />
und Spezialist in der<br />
Biogastechnologie bieten wir für die<br />
Biogasproduktion angepasste Misch- und<br />
Fördersysteme. Die Einsatzmöglichkeiten<br />
unserer NEMO® Exzenterschneckenpumpen,<br />
TORNADO® Drehkolbenpumpen<br />
sowie NETZSCH Zerkleinerungssysteme<br />
reichen vom Mischen über Fördern bis hin<br />
zum Zerkleinern.<br />
NEMO® B.Max®<br />
Mischpumpe<br />
FOTO: WERKBILD<br />
Rechts im Bild ist die Desorptions-Verdampferkolonne zu sehen. Das Filtrat (flüssige Phase), das den<br />
Separator verlässt, wird in die Desorptions-Verdampferkolonne gepumpt. Der Desorptionsanlage werden<br />
zudem die heißen Rauchgasabgase aus dem Doppelmantelrohr des Trockners sowie die heißen Dämpfe<br />
aus dem zu trocknenden Feststoff zugeführt. Hier wird dann der Ammoniumstickstoff aus dem Filtrat<br />
und aus den zugeführten Gasen als Ammoniak ausgetrieben. Das Ammoniak strömt dann zur Adsorptionskolonne<br />
(links im Bild).<br />
65<br />
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH<br />
Geschäftsfeld Umwelt & Energie<br />
Tel.: +49 8638 63-1010<br />
info.nps@netzsch.com<br />
www.netzsch.com
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Adsorptionsanlage, in der das Ammoniak mit Schwefelsäure<br />
im Gegenstromverfahren ausgewaschen wird<br />
und als Ammonium-Sulfat-Lösung anfällt. Ein Regenis-<br />
Mitarbeiter bei der Vormontage der Anlage in der<br />
Werkhalle in Quakenbrück. Alle Komponenten werden<br />
immer in den Werkhallen zunächst einmal probeweise<br />
zusammengebaut.<br />
André Schillingmann zeigt an der einen<br />
Stirnseite der Desorptionsanlage die<br />
Umwälzpumpen (rot) für das Filtrat und<br />
die Verdrängerpumpe (blau) zum<br />
Abpumpen des ausgegasten Filtrats.<br />
Pyrolyse erweitert<br />
Wertschöpfungsoptionen<br />
Der sehr trockene und fast stickstofffreie<br />
Feststoff lässt sich zu weiteren Produkten,<br />
wie zum Beispiel Biokohle, veredeln. Regenis<br />
bietet dazu eine selbst entwickelte<br />
Pyrolyseanlage an. Schillingmann betonte,<br />
dass die Pyrolyse für den einwandfreien<br />
Betrieb einen nahezu stickstofffreien getrockneten<br />
Feststoff benötigt. Die Pyrolyseeinheit<br />
bringen die Entwickler ebenfalls<br />
in einem 40-Fuß-Container unter. Sie wird<br />
waagerecht auf dem Containerboden verschraubt.<br />
Über dem Pyrolysekessel wird<br />
der Standard GT-Trockner/Verdampfer<br />
waagerecht eingebaut. Der Feststoff wird<br />
von außen über einen Vorlagebunker in den<br />
Trockner gegeben.<br />
Am anderen Ende des Trockners verlässt<br />
der getrocknete Feststoff diesen über eine<br />
Austragschnecke. Sie ist verbunden<br />
mit einer Eintragsschnecke,<br />
die den trockenen Feststoff in<br />
den Pyrolysekessel fördert. Darin<br />
findet laut André Schillingmann<br />
die Verkohlung statt bei einer<br />
Temperatur von rund 400 Grad<br />
Celsius. Feststoff aus Gülle oder<br />
besser Gärdünger ist nach rund 20<br />
Minuten fertig verkohlt und kann<br />
am anderen Ende des Pyrolysereaktors<br />
ausgetragen werden, wobei<br />
die Mineraldüngerbestandteile<br />
nicht verbrannt oder verglast sind,<br />
sondern als pflanzenverfügbarer<br />
Feststoffdünger zusammen mit der<br />
Biokohle aus dem Reaktor herauskommen.<br />
Im Container befindet sich zur<br />
Beheizung des Pyrolyserohres ein<br />
speziell entwickelter Brenner, der<br />
in der Aufheizphase Rohbiogas<br />
verbrennt. „Wenn die Pyrolyse eine<br />
Temperatur von etwa 350 Grad<br />
Celsius erreicht hat, entstehen<br />
Pyrolysegase, die in der Dauerheizphase<br />
ausschließlich den Brenner versorgen und<br />
so die notwendige Prozessenergie bereitstellen“,<br />
skizziert André Schillingmann<br />
den Ablauf.<br />
Der Pyrolysekessel ist auch ein Doppelmantelrohr<br />
mit innen beheizbarer Prozessschnecke<br />
genauso wie der Trockner/Verdampfer,<br />
nur mit dem Unterschied, dass<br />
ein anderes Temperaturniveau gefahren<br />
FOTOS: MARTIN BENSMANN<br />
Referenznummer suchen.<br />
Passendes Ersatzteil finden.<br />
32090-00028 Ölfilter<br />
Finden<br />
ÜBER 15.000 FILTER ONLINE VERFÜGBAR<br />
66
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
wird. Ein Drittel bis 50 Prozent der Input-<br />
Trockensubstanz kann nach der Pyrolyse<br />
als Biokohle abgeschöpft werden. Der andere<br />
Anteil ist in die Gasphase übergegangen<br />
und wird als Prozessenergie verwertet.<br />
Desorption und Ammoniak-<br />
Strippung<br />
Nun noch einmal zurück zum Separator<br />
und dem dort anfallenden Filtrat, also der<br />
abgetrennten flüssigen Phase. Für deren<br />
Weiterbehandlung hat das Regenisteam<br />
ein sogenanntes Düngerwerk entwickelt,<br />
das aus einer Desorptions- und Verdampferkolonne<br />
sowie einer Absorbtionskolonne<br />
besteht. Bei der Desorptions-Verdampferkolonne<br />
handelt es sich um einen hochwertigen,<br />
voll isolierten V4A-Edelstahltank,<br />
der in einem Tank-Containerrahmen verbaut<br />
ist.<br />
Diese Kolonne wird direkt neben dem<br />
Trocknungscontainer aufgestellt und hat<br />
ein Volumen von etwa 24 Kubikmeter.<br />
Das Filtrat verlässt den Separator in Richtung<br />
Desorptions-Verdampferkolonne. Die<br />
Kolonne ist immer zu rund einem Drittel<br />
mit Filtrat gefüllt. Das Filtrat wird aus<br />
dem Tank entnommen und über mehrere<br />
Düsen, die sich direkt über dem Tank befinden,<br />
in den Gasraum der Desorptions-<br />
Verdampferkolonne gesprüht.<br />
Der überhitzte Dampf, der im Trockner<br />
„umsonst“ anfällt, wird in dieser Variante<br />
nicht zur Ammoniakwassergewinnung<br />
partiell kondensiert, sondern wird synergetisch<br />
zur Desorbtion (Abtrennung des<br />
Ammoniums aus dem Filtrat zu Ammoniak<br />
in die Luft) des Filtrats genutzt.<br />
Auf der Stirnseite des Tank-Containergestells<br />
befinden sich zwei Umwälzpumpen<br />
(redundantes System) für das Filtrat<br />
und eine Schneckenverdrängerpumpe<br />
zum Abpumpen des ausgegasten Filtrats<br />
(Dünnwasser). Die durchschnittliche Verweildauer<br />
des Filtrats in der Desorbtions-/<br />
Verdampferkolonne beträgt rund sechs<br />
Stunden. Der Prozess läuft kontinuierlich<br />
und vollautomatisch.<br />
Absorbtionskolonne erzeugt ASL<br />
Das stickstoffreiche, mit Feuchtigkeit<br />
gesättige Gas, das in der Desorptionsstufe<br />
anfällt, wird mittels Brüdenverdichter<br />
angesogen und in die Absorbtionskolonne<br />
gedrückt. Die zirka 10 Meter hohe Absorbtionskolonne<br />
ist einstufig konzipiert und<br />
wird von unten nach oben durchströmt.<br />
In der Absorbtionskolonne befinden sich<br />
Kunststofffüllkörper, über die von oben im<br />
Gegenstrom 78-prozentige Schwefelsäure<br />
verrieselt wird. Unten in der Waschkolonne<br />
fällt dann Ammoniumsulfat-Lösung (ASL)<br />
an, die in einem darunter befindlichen<br />
doppelwandigen Behälter zwischengespeichert<br />
wird. Der Behälter ist immer etwa zur<br />
Hälfte bis zwei Drittel des Volumens gefüllt.<br />
In regelmäßigen Abständen wird ein<br />
Teil der ASL beim Erreichen der eingestellten<br />
Konzentration abgepumpt, so dass sie<br />
zu Düngezwecken verwendet werden kann.<br />
Den Schornstein der Absorbtionskolonne<br />
verlassen am Schluss inerte Gase aus den<br />
BHKW und dem Trockner/Verdampfer zusammen<br />
als Träger für die Feuchtluft.<br />
Die dargestellte Technologie-Kaskade<br />
zeigt, dass lokale Kreislaufwirtschaft möglich<br />
ist, die sich auch mit Kläranlagen<br />
sowie Kompostierungsanlagen hervorragend<br />
kombinieren ließe. Aus organischen<br />
Reststoffen wie Wirtschaftsdüngern, Klärschlamm,<br />
Gärrest oder Bioabfällen können<br />
Energie und Nährstoffe gezielt und effizient<br />
gewonnen und kann der Dünger dem<br />
Pflanzenbau zurückgegeben werden.<br />
Auf die sehr energieintensiv hergestellten<br />
Mineraldünger könnte bei konsequenter<br />
Ausführung – insbesondere auch seitens<br />
der Kläranlagen – in Landwirtschaft und<br />
Gartenbau zunehmend mehr und mehr verzichtet<br />
werden. Lokale Energiewende mit<br />
Kombikraftwerken der Erneuerbaren-Energieerzeugungsarten<br />
– wobei Biogasanlagen<br />
eine besondere Bedeutung zukommt –<br />
können so zum Grundstein der agrarischen<br />
und gartenbaulichen Nährstoffwende werden.<br />
Autor<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Redakteur Biogas Journal<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
0 54 09/90 69 426<br />
martin.bensmann@biogas.org<br />
EEG – WEITERGEDACHT.<br />
Jetzt mit Satelliten-BHKW flexibilisieren und Ihre Biogasanlage<br />
weiterhin hochprofitabel betreiben. Wir beraten Sie!<br />
Sprechen Sie<br />
uns an:<br />
T 02568 9347-0<br />
© PointImages | fotolia.de<br />
67<br />
2G Energy AG | www.2-g.de
G<br />
Ä<br />
R<br />
D<br />
Ü<br />
N<br />
G<br />
E<br />
Ṟ<br />
A<br />
U<br />
F<br />
B<br />
E<br />
R<br />
E<br />
I<br />
T<br />
U<br />
N<br />
G<br />
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
„Dampfveredelung“<br />
des Gärrests<br />
Die dreistufige Gärrest-<br />
Verdampfungsanlage<br />
auf dem Hof von<br />
Michael Pellmeyer – im<br />
Vordergrund ein IBC-<br />
Container mit Rapsöl –,<br />
das zur Unterdrückung<br />
der Schaumbildung<br />
des Gärrests eingesetzt<br />
wird.<br />
Zur Behandlung des Gärrests seiner Abfall-Biogasanlage hat Michael Pellmeyer in eine<br />
Vakuumverdampfungs-Anlage investiert. Damit lässt sich die zu lagernde und auszubringende<br />
Dungmenge drastisch reduzieren und stattdessen ein handelbarer Mineraldünger<br />
gewinnen.<br />
Von Christian Dany<br />
Ich rufe die Bürger auf, in die Biergärten zu gehen.“<br />
Michael Pellmeyers scherzhaft klingender Appell<br />
von Anfang Mai hat einen ernsten Hintergrund:<br />
„Wegen der Coronamaßnahmen läuft die Biogasanlage<br />
zurzeit nur mit einer Auslastung von 30<br />
Prozent.“ Gefüttert wird die Anlage nämlich nicht nur<br />
mit Gülle, Mist und Futterabraum aus der Milchviehhaltung<br />
am Hof, sondern auch mit Speiseresten aus<br />
der Gastronomie, Fettabscheiderinhalten und Milchschlämmen.<br />
Pellmeyers Vater Josef, Biogaspionier und lange Jahre<br />
Präsident des Fachverbandes Biogas e.V., hat die Abfallanlage<br />
im Jahr 1996 gebaut. Mittlerweile sind vier<br />
Blockheizkraftwerke (BHKW) mit einer installierten<br />
elektrischen Leistung von insgesamt 1.140 Kilowatt<br />
(kW el<br />
) angeschlossen.<br />
Die Pellmeyers sind auf dem Eggertshof daheim; einem<br />
600 Jahre alten Anwesen, das 3 Kilometer von<br />
der Dom- und Universitätsstadt Freising in Oberbayern<br />
entfernt liegt. 2018 hat Michael den Landwirtschaftsund<br />
Biogasbetrieb übernommen und im gleichen Jahr<br />
ist die Gärdüngerveredelungs-Anlage gebaut worden.<br />
Genau auf diese Anlage wirkt sich der schwache Teillastbetrieb<br />
der Biogasanlage aus, denn es fehlt der nötige<br />
Wärme-Input. Doch zum Glück hat Pellmeyer eine<br />
zweite Biogasanlage, die er etwa 400 Meter entfernt<br />
betreibt. In dieser Anlage setzt er nachwachsende Rohstoffe<br />
ein und erzeugt Biomethan. Von dort bekommt<br />
die Gärrestveredelung die nötige Wärme.<br />
„Lagervolumen einzusparen war für mich die Hauptmotivation,<br />
die Gärrestverdampfungs-Anlage zu bauen“,<br />
sagt Michael Pellmeyer. Das sollte gelingen durch eine<br />
Aufkonzentration und Vermarktung der Nährstoffe, vor<br />
allem des ASL-Düngers (Ammoniumsulfatlösung). Der<br />
34-Jährige prognostiziert mittelfristig einen Verkaufspreis<br />
von 40 Euro pro Tonne ASL.<br />
„Das Geschäft läuft erst langsam an“, räumt er allerdings<br />
ein. Vor kurzem habe er einen ganzen Lastzug<br />
an einen Großhändler verkaufen können. „Die ASL aus<br />
dem Gärrest-Verdampfungsprozess enthält 7 Prozent<br />
Ammonium-Stickstoff und 7 Prozent Schwefel. Sie<br />
ist ein klassisches Substitut für Mineraldünger. Wich-<br />
FOTOS: CHRISTIAN DANY<br />
68
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
„Lagervolumen einzusparen<br />
war für mich die Hauptmotivation,<br />
die Gärrestverdampfungs-Anlage<br />
zu bauen“<br />
Michael Pellmeyer<br />
Der schwarze Tank bevorratet die im Prozess eingesetzte<br />
Schwefelsäure.<br />
Vom Industrie- zum<br />
Gärrestverdampfer<br />
Die MKR Metzger GmbH ist ein zwar relativ kleines,<br />
aber international tätiges Unternehmen, das auf<br />
die Trennung von Flüssigkeiten spezialisiert ist<br />
und vor allem Industrieverdampfer fertigt. MKR<br />
steht für „Metzger Kühlschmierstoff-Recycling“.<br />
In dieser Technik hat das 1990 von Anderl Metzger<br />
gegründete Unternehmen seinen Ursprung. Heute<br />
führt Anderls Sohn Thomas Metzger zusammen<br />
mit dem langjährigen Technischen Leiter Ralf<br />
Xalter die Geschäfte der Firma, die in Monheim im<br />
Kreis Donau-Ries rund 50 Mitarbeiter beschäftigt.<br />
Im Jahr 2009 begann die Entwicklung von Gärrestverdampfern.<br />
Mittlerweile ist eine Biogas-Sparte<br />
aufgebaut worden mit eigenem Personal in den<br />
Bereichen Service, Projektierung, Konstruktion<br />
und Vertrieb. Das erste einstufige Verfahren wurde<br />
2013 auf den Markt gebracht. Seit 2016 werden<br />
mehrstufige Gärrestverdampfungs-Verfahren<br />
angeboten. Inzwischen stellt MKR Metzger bis zu<br />
vierstufige Verfahren in zwei Größenstufen her.<br />
Zuletzt hat die Firma ein Verfahren zur Verdampfung<br />
von Schweinegülle entwickelt: Bei diesem<br />
wird ein elektrisch betriebener Verdampfer eingesetzt.<br />
Hier gibt das Unternehmen eine mögliche<br />
Reduktion der Schweinegülle von 90 Prozent an.<br />
www.mkr-cleanwater.de<br />
tig ist für mich, dass Schwefel dabei ist.<br />
Das spielt eine immer größere Rolle“, beschreibt<br />
er die wichtigsten Vermarktungs-<br />
Parameter.<br />
Michael Köhnlechner vom Anlagenhersteller<br />
MKR Metzger GmbH aus Bayerisch-<br />
Schwaben (siehe Kasten) erläutert die<br />
Technologie der dreistufigen Vakuumverdampfungsanlage<br />
auf Pellmeyers Hof. Sie<br />
arbeite mit einem Wärme-Input von 500<br />
bis 600 kW. „Für die Verdampfung wird<br />
die separierte Flüssigphase des Gärrests<br />
eingesetzt“, erklärt der Biotechnologe<br />
den Verfahrensablauf, „die Partikelgröße<br />
muss unter 0,25 Millimeter sein. Deshalb<br />
verwenden wir eine Pressschnecke mit<br />
nachgeschaltetem Mikroseparator.“ Die<br />
Wärme vom BHKW werde der ersten Stufe<br />
zugeführt, der Flüssig-Gärrest und die<br />
Schwefelsäure jeder der drei Stufen direkt.<br />
Jede Stufe bestehe aus Verdampfer, Brüdenwäscher<br />
und Kondensator.<br />
Niedrige Verdampfungstemperatur<br />
dank Unterdruck<br />
„Im Verdampfer wird ein Unterdruck von<br />
150 bis 250 Millibar erzeugt. Dadurch<br />
kocht das Wasser bei 50 bis 60 Grad Celsius“,<br />
erklärt Köhnlechner die Funktionsweise,<br />
„Gase werden aus der Flüssigphase<br />
ausgetrieben und es entsteht ein Dampf-<br />
Gas-Gemisch. Weil wir auf diesem Temperaturniveau<br />
arbeiten, kann die BHKW-Abwärme<br />
genutzt werden. Der Verdampfer passt<br />
sich automatisch der verfügbaren Wärme<br />
an und arbeitet von 65 Grad Celsius bis zur<br />
Volllast bei 85 Grad Celsius hoch flexibel.“<br />
Dann zeigt er auf die etwas schmaleren<br />
Kunststoffzylinder: „Das sind die Brüdenwäscher.<br />
Hier wird der Stickstoff vom<br />
Wasserdampf abgeschieden.“ Durch die<br />
Reaktion mit Schwefelsäure werde das<br />
Ammoniakgas in gelöstes Ammoniumsulfat<br />
umgewandelt. Über den Kondensator<br />
beheize der Wasserdampf dann die nächste<br />
Verdampferstufe. Im Kondensator werde<br />
jeweils das aus dem Dampf entstehende<br />
Destillat abgeschieden.<br />
69<br />
wir bringen<br />
alles wieder<br />
ins reine.<br />
wir übernehmen für sie<br />
die lieferung und den tausch<br />
der aktivkohle.<br />
die notwendigen ressourcen<br />
wie geeignete maschinentechnik<br />
und fachpersonal<br />
stellen wir ihnen gerne<br />
zur verfügung.<br />
unsere auf die speziellen<br />
anforderungen optimierte<br />
maschinentechnik<br />
ermöglicht es<br />
die aktivkohle nahezu staubund<br />
schmutzfrei<br />
aus- und einzubauen.<br />
Siemensstr. 32, 35638 Leun<br />
06473 411596<br />
info@aks-heimann.de
PRAXIS / TITEL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Zur Verdampfungsanlage gehört der<br />
Schaltschrank mit Steuerungsdisplay.<br />
Edelstahltanks zur Lagerung des<br />
ASL-Düngers. <br />
„Von Stufe zu Stufe ergibt sich ein leichter Temperaturverlust,<br />
was zu weniger Vakuum und weniger Verdampfungsleistung<br />
führt“, erklärt der Vertriebsmitarbeiter.<br />
Je Stufe befände sich nur etwa 1 Kubikmeter Gärrest<br />
im System, das dadurch beweglicher sei. „Durch einen<br />
verfahrenstechnischen Kniff und ohne Chemie schafft<br />
die Anlage eine pH-Wert-Anhebung“, lächelt Köhnlechner.<br />
Näheres lässt er sich nicht entlocken. Mit einem<br />
pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5 sei die ASL somit pflanzenverträglich<br />
und könne direkt ausgebracht werden.<br />
Spezielle Kunststoffe statt Edelstahl<br />
Die Jahre der Entwicklung hätten auch für das Unternehmen<br />
aus der Industrie-Verfahrenstechnik eine<br />
Lernkurve bedeutet: „Deshalb verwenden wir heute für<br />
alle Komponenten, die mit ASL und Schwefelsäure in<br />
Berührung kommen, spezielle Kunststoffe. Die sind beständiger<br />
als Edelstahl und 100 Prozent korrosionsfrei.<br />
Außerdem legen wir Wert auf eine übersichtliche Verrohrung<br />
und gute Zugänglichkeit. Deswegen bieten wir<br />
keine Containerlösungen an“, schildert Köhnlechner<br />
die wichtigsten Vorteile der MKR-Technik.<br />
Die Anlagen seien so aufgebaut, dass Schwefelsäure<br />
und Gärrest nicht vermischt werden könnten: „Dadurch<br />
vermeiden wir Schäden am Beton von Lagerbehältern<br />
durch angesäuerten Gärrest. Darüber hinaus setzen wir<br />
zur Reinigung keine Bürstensysteme im Gärrest ein,<br />
wodurch wir einen deutlich geringeren Wartungsaufwand<br />
haben.“ Köhnlechner: „Alles, was sich bewegt,<br />
kann kaputtgehen. Stattdessen werden regelmäßig<br />
automatische Spülungen durchgeführt: Nacheinander<br />
saure und alkalische Spülungen entfernen selbst feinste<br />
organische und mineralische Ablagerungen, die mit<br />
Bürsten nicht erfasst werden würden.“<br />
Die Effizienz der Anlage werde als Destillatleistung<br />
gemessen: „Dank mehrstufigem System und gutem<br />
Wärmeübergang durch die zweite Fest/Flüssig-Separationsstufe<br />
erreichen wir Spitzenwerte bei der Energieeffizienz“,<br />
versichert Köhnlechner. Mit einer Kilowattstunde<br />
Wärme erzeuge die dreistufige Anlage 3,5 Liter<br />
Wasser. Die vierstufige Anlage schaffe bis zu 4,3 Liter.<br />
Schließlich bilanziert er die Stoffströme: „Die Anlage<br />
auf Pellmeyers Betrieb ist auf eine Jahresmenge von<br />
20.000 bis 30.000 Kubikmeter Flüssig-Gärrest ausgelegt.<br />
Aus dem Verdampfungsprozess entstehen 3 Prozent<br />
ASL, rund 57 Prozent als Destillat abgeschiedenes<br />
Wasser und etwa 40 Prozent Konzentrat. Die genauen<br />
Anteile sind vom Stickstoff- und Trockensubstanz-Gehalt<br />
im Gärrest abhängig.“ „Das Wasser wird zum Teil<br />
durch einen Verdunstungskühler verdampft. Bei dem<br />
dreistufigen Aufbau schafft es der Verdunstungskühler,<br />
mit der Restwärme aus dem Verdampfungsprozess<br />
rund ein Drittel des Wassers zu verdampfen“, erläutert<br />
Köhnlechner. Einstufige Anlagen könnten zwar theore-<br />
70
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS / TITEL<br />
tisch das gesamte Wasser verdampfen, seien aber mit<br />
einer Destillatleistung von nur rund 1,5 Liter pro Kilowattstunde<br />
(l/kWh th<br />
) bei weitem nicht so effizient. Der<br />
Rest des Wassers stehe für andere Verwendungen zur<br />
Verfügung, wie Beregnung oder Reinigung, und könne<br />
unter günstigen Bedingungen auch für die Einleitung<br />
in Vorfluter oder kommunale Abwasserkanalisationen<br />
geeignet sein. „Bei der Einleitung in Oberflächengewässer<br />
verlangen die Behörden in der Regel eine Sicherheitsstufe<br />
durch eine biologische Nachklärung“,<br />
so Köhnlechner, „soll in die Kanalisation eingeleitet<br />
werden, geht es hauptsächlich um die Abstimmung<br />
des Volumenstroms mit der Kapazität der angeschlossenen<br />
Kläranlage.“ Das Konzentrat, also der „eingedickte“<br />
Gärrest mit Trockensubstanz-Gehalten von<br />
meist zwischen 4 und 8 Prozent, werde ins Gärrestlager<br />
gepumpt. Für die Lagerung und Ausbringung des<br />
Gärrestes sei also eine Mengenreduktion von rund 60<br />
Prozent zu erreichen.<br />
Für eine dreistufige Verdampfungsanlage in der Größe<br />
von der auf Pellmeyers Betrieb müsse Köhnlechner<br />
zufolge eine Investition von rund 800.000 Euro veranschlagt<br />
werden. Hinzu käme die Peripherie: Fest/Flüssig-Separation,<br />
ein 15 Kubikmeter großer Lagertank für<br />
die Schwefelsäure, fünf ASL-Tanks á 55 Kubikmeter,<br />
der Verdunstungskühler und das Betriebsgebäude. Da<br />
in manchen Fällen der Gärrest zum Schäumen neige,<br />
werde Rapsöl eingesetzt, was bei den Betriebskosten<br />
einzukalkulieren sei.<br />
„Die Wirtschaftlichkeit einer Gärrest-Verdampfungsanlage<br />
hängt von der Nährstoffproblematik und den<br />
Ausbringkosten ab. Beim Verdampfungsprozess ist<br />
mit Aufbereitungskosten von 10 bis 15 Euro pro Kubikmeter<br />
reduzierter Menge zu rechnen“, umreißt er<br />
die entscheidenden Parameter, „deshalb ist bei Abfallanlagen<br />
ohne eigene Ausbringflächen, die ein Gärrest-<br />
Verbringungskonzept brauchen, sehr oft die Rentabilität<br />
gegeben.“<br />
Links: Michael<br />
Pellmeyer sagt, dass<br />
der ASL-Verkauf erst<br />
langsam anläuft.<br />
Rechts: Michael<br />
Köhnlechner: „Im<br />
Verdampfer wird ein<br />
Unterdruck von 150 bis<br />
250 Millibar erzeugt.<br />
Dadurch kocht das<br />
Wasser bei 50 bis 60<br />
Grad Celsius.“<br />
Unscheinbar, aber nicht unwichtig: der Verdunstungskühler im<br />
Hintergrund; im Vordergrund ein Container mit einem Biofilter für<br />
die Abluftvakuumstation und die Hallenentlüftung.<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403<br />
01 60/97 900 831<br />
christian.dany@web.de<br />
71
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Aufbereitung von Gärresten und<br />
KWK-Bonusfähigkeit<br />
Biogasanlagen, die sich im EEG 2009 befinden, können beim Betrieb einer Aufbereitungsanlage zur<br />
Düngemittelherstellung den Kraft-Wärme-Kopplungs-Bonus (KWK-Bonus) erhalten. Lesen Sie, welche<br />
Voraussetzungen erfüllt sein müssen.<br />
Von Dipl.-Ing. Univ. Arnold Multerer<br />
Die verschärfte Düngeverordnung<br />
und der wachsende Kostendruck<br />
im Bereich der Biogaserzeugung<br />
steigern zunehmend<br />
die Anforderungen an die Ausbringung<br />
von Gärresten/Gärprodukten.<br />
Das Aufbereiten von Gärprodukten bietet<br />
Biogasanlagenbetreibern eine Möglichkeit,<br />
Transportkosten zu reduzieren und trägt<br />
zur Entschärfung regionaler Nährstoffüberschüsse<br />
bei. Durch die damit einhergehende<br />
Aufkonzentration von Nährstoffen<br />
können transportwürdigere Düngemittel<br />
hergestellt werden als die in der landwirtschaftlichen<br />
Tierhaltung anfallenden organischen<br />
Reststoffe wie Gülle und Mist.<br />
Eine überregionale landwirtschaftliche<br />
Nährstoffverlagerung in Deutschland mit<br />
allen Vor- und Nachteilen wird durch entsprechende<br />
Aufbereitungsanlagen von<br />
Gärprodukten praktikabler. Viele Biogasanlagenbetreiber<br />
versprechen sich hiervon<br />
eine Steigerung der Erlössituation und eine<br />
damit einhergehende Zukunftsfähigkeit<br />
ihrer Anlage nach Ablauf des 20-jährigen<br />
Vergütungszeitraumes des EEG. Mit der<br />
Nutzung noch ungenutzter Prozesswärme<br />
der an Biogasanlagen vorhandenen Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW) kann im Geltungsbereich<br />
des EEG 2009 unter bestimmten<br />
Voraussetzungen eine erhöhte Vergütung<br />
für den erzeugten elektrischen Strom beansprucht<br />
werden. Hierzu kann der KWK-<br />
Bonus für „die Nutzung als Prozesswärme<br />
zur Aufbereitung von Gärresten zum Zweck<br />
der Düngemittelherstellung“ [§ 27 (4) Nr. 3<br />
in Verbindung mit Anlage 3 der Positivliste<br />
III Nr. 7. EEG 2009] beantragt werden.<br />
Anspruchsvoraussetzungen bei<br />
der Düngemittelherstellung<br />
Für die Begründung des Anspruchs muss<br />
grundsätzlich ein BHKW in Betrieb sein,<br />
das gleichzeitig Strom und Prozesswärme<br />
aus regenerativen Energieträgern erzeugt.<br />
Als Nachweis für die Produktion des KWK-<br />
Stromes nach den anerkannten Regeln der<br />
Technik sollen dem Umweltgutachter geeignete<br />
Unterlagen des BHKW-Herstellers<br />
zur Verfügung gestellt werden. In der Regel<br />
ist ein Datenblatt über ein serienmäßig<br />
hergestelltes BHKW zu den wesentlichen<br />
Daten wie thermischer und elektrischer<br />
Leistung sowie ausgewiesener Stromkennzahl<br />
ausreichend. Falls dieses Datenblatt<br />
nicht vorhanden ist, kann alternativ die Ermittlung<br />
der Daten über die Anforderungen<br />
des von der Arbeitsgemeinschaft für Wärme<br />
und Heizkraftwirtschaft (AGFW) herausgegebenen<br />
Arbeitsblattes FW 308 erfolgen<br />
(Anlage 3 II) 1. EEG 2009).<br />
Die Prozesswärme, die zum Zweck der Düngemittelherstellung<br />
genutzt wird, kann sowohl<br />
über den Wärmetauscher des BHKW<br />
als auch über die Abgaswärme erzeugt<br />
werden. Grundsätzlich ist die im Aufbereitungsprozess<br />
verwendete Wärmemenge<br />
messtechnisch zu erfassen. Dies wird in<br />
der Regel über einen geeichten Wärmemengenzähler<br />
(WMZ) gewährleistet. Der<br />
Anspruch auf den KWK-Bonus muss mindestens<br />
einmal jährlich durch einen Umweltgutachter<br />
mit einer Zulassung für den<br />
Bereich Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren<br />
Energien bestätigt werden. Dazu<br />
sollen dem Umweltgutachter einschlägige<br />
Aufzeichnungen und Dokumente zur Verfügung<br />
gestellt werden.<br />
Bei einem Vor-Ort-Termin nimmt er die<br />
Anlage in Augenschein und prüft die Voraussetzungen<br />
der KWK-Bonusfähigkeit bei<br />
einem gemeinsamen Rundgang mit dem<br />
Anlagenbetreiber. Da der Gesetzgeber keine<br />
Konkretisierung des Sachverhaltes der<br />
<br />
<br />
FOTOS: ARNOLD MULTERER<br />
72
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
<br />
Düngemittelherstellung im EEG und einschlägigen<br />
Gesetzestexten vornimmt, werden<br />
im Folgenden die fünf Spezifizierungen<br />
aus der Leitlinie des Umweltgutachterausschusses<br />
(Aufgabenleitlinie EEG, Stand<br />
2013) erläutert, die der Betreiber beachten<br />
sollte.<br />
1. Darstellung der Technik des Gärresttrockners:<br />
Die technische Weiterentwicklung<br />
der Trocknungsanlagen in den vergangenen<br />
zehn Jahren und Professionalisierung<br />
des Marktes stellt in der Regel sicher, dass<br />
ausreichende technische Unterlagen des<br />
Herstellers (zum Beispiel Datenblätter, Anlagenfließbild,<br />
R+I-Schema) vorliegen. Ergänzend<br />
nimmt der Umweltgutachter mit<br />
dem Betreiber auch entsprechende Auslesungen<br />
aus der Systemsteuerung (siehe<br />
Bild 1) beim Vor-Ort-Termin vor.<br />
2. Darlegung der Trocknungseffizienz: Die<br />
Leitlinie des Umweltgutachterausschusses<br />
gibt einen Richtwert mit 1,5 Kilowattstunden<br />
thermischer Energie<br />
pro Kilogramm (kWh th<br />
./kg)<br />
verdampften Wassers an.<br />
Zur vollständigen Dokumentation<br />
sollte der Anlagenbetreiber<br />
ein Trocknungsbuch<br />
führen. Hierzu sollen Trockensubstanz-(TS)-Bestimmungen<br />
durchgeführt und<br />
die Menge des Input- und<br />
Outputmaterials sowie die<br />
verbrauchte Wärmemenge<br />
pro Charge erfasst werden.<br />
Diese Angaben werden<br />
durch den Umweltgutachter<br />
überprüft und rechnerisch<br />
plausibilisiert. Insbesondere<br />
neu in Betrieb genommene<br />
Aufbereitungsanlagen<br />
verfügen bereits über dazugehörige Sensorik<br />
(siehe Bild 2), um dauerhaft den Wassergehalt<br />
des Materials zu bestimmen.<br />
3. Einhaltung der Anforderungen der Düngemittelverordnung:<br />
Hierbei ist insbesondere<br />
auf die sachgerechte Lagerung zur<br />
Vermeidung von stofflichen Veränderungen<br />
des hergestellten Düngemittels und auf<br />
mögliche Umweltschäden zu verweisen.<br />
Das Bild 3 zeigt ein Positivbeispiel für angepasste<br />
Lagerung des Düngemittels. Witterungsschutz<br />
und angemessene Bodenbeschichtung<br />
verhindern eine Auswaschung<br />
von Nährstoffen in das Grundwasser.<br />
Seit einigen Jahren werden immer häufiger<br />
Eindampfungsanlagen, die nach dem<br />
Vakuumprinzip funktionieren, am Markt<br />
angeboten. Bei dieser Aufbereitungstechnik<br />
wird in der Regel Flüssigdünger als<br />
Ammoniumsulfat-Lösung (ASL) extrahiert.<br />
Laut Düngemittelverordnung, Anlage 1,<br />
1.1, müssen „Düngemittel (...) sich in einem<br />
festen Aggregatzustand befinden, es<br />
sei denn, die Typenbeschreibung lässt einen<br />
anderen Aggregatzustand zu.“ Die Anwendung<br />
von Flüssigdünger ist sowohl in<br />
der Landwirtschaft als auch im Garten- und<br />
Landschaftsbau gängige Praxis. Hierüber<br />
sollte sich der Betreiber eine entsprechende<br />
Bestätigung der Herstellerfirma bezüglich<br />
des hergestellten Düngemittels aushändigen<br />
lassen.<br />
4. Nachweis der Qualitätssicherung: Der<br />
hergestellte Dünger soll durch einen Träger<br />
regelmäßiger Güteüberwachung im Sinne<br />
der Bioabfallverordnung (zum Beispiel<br />
Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.)<br />
qualifiziert werden. Das Bild 4 zeigt zwei<br />
hergestellte Düngemittel: gepresste Düngemittelpellets<br />
(links) und getrocknetes<br />
loses Düngemittel (rechts).<br />
5. Detaillierte Darstellung der Vertriebswege<br />
zur Vermarktung des Düngemittels:<br />
Dabei ist zu beachten, dass das hergestellte<br />
Düngemittel keiner anderweitigen Nutzung,<br />
wie zum Beispiel als Einstreu oder<br />
der thermischen Verwertung, zugeführt<br />
werden darf. Wird der hergestellte Dünger<br />
im Wesentlichen an Landwirte oder Biomasse-Lieferanten<br />
abgegeben, können die<br />
Vertriebswege zum Beispiel über Rechnungen<br />
oder Aufzeichnungen nach § 3 der Verordnung<br />
über das Inverkehrbringen und Befördern<br />
von Wirtschaftsdünger (WDüngV)<br />
nachgewiesen werden. Eine Nutzung des<br />
Düngemittels in „der zugehörigen Landwirtschaft“<br />
widerspricht dem Sachverhalt<br />
grundsätzlich nicht.<br />
Eine „Aufbereitung von Gärresten zum<br />
Zwecke der Düngemittelherstellung“ impliziert,<br />
dass es sich um ein sepa-<br />
<br />
73
KWK-Bonus: Positivliste III<br />
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
KWK-Bonus: ✓ Wärmeeinspeisung Positivliste in IIIein Netz<br />
Prozessschema der Wärmenutzung aus der Biogasanlage im Wärmenetz<br />
KWK-Bonus: Positivliste III<br />
✓ Wärmeeinspeisung in ein Netz<br />
KWK-Bonus: Positivliste III<br />
➡<br />
Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Grantner (Umweltgutachter DE-V-0284)<br />
OmniCert GmbH - Kreuzstr. 5, 93077 Bad Abbach<br />
www.omnicert.de / Tel 09405 956-224<br />
Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Grantner (Umweltgutachter DE-V-0284)<br />
OmniCert GmbH - Kreuzstr. 5, 93077 Bad Abbach<br />
www.omnicert.de / Tel 09405 956-224<br />
rates Aufbereitungsverfahren handelt und<br />
dies außerhalb der Anlage stattfindet, da<br />
im Biogaskreislauf das Material als Gärprodukt<br />
www.omnicert.de vorliegt. / Tel 09405 956-224 Beim flüssigen beziehungs-<br />
Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Grantner (Umweltgutachter DE-V-0284)<br />
OmniCert GmbH - Kreuzstr. 5, 93077 Bad Abbach<br />
weise festen Gärprodukt, das üblicherweise<br />
durch Separation entsteht, handelt es<br />
sich bereits um Material, das zur Düngung<br />
ohne weitere Aufbereitung eingesetzt werden<br />
kann und in der gängigen Praxis auch<br />
✓<br />
✓<br />
Netz > 400 m<br />
✓ Wärmeeinspeisung in ein Netz<br />
✓ Verluste < 25 %<br />
✓ Wärmeeinspeisung in ein Netz<br />
➡<br />
Dipl.-Ing. (FH) Thorsten Grantner (Umweltgutachter DE-V-0284)<br />
OmniCert GmbH - Kreuzstr. 5, 93077 Bad Abbach<br />
www.omnicert.de / Tel 09405 956-224<br />
➡<br />
➡<br />
✓<br />
Netz > 400 m<br />
✓ Verluste < 25 %<br />
Netz > 400 m<br />
✓ Verluste < 25 %<br />
✓ Netz > 400 m<br />
abgegebene Nutzwärme voll anrechenbar auf den Stromanteil<br />
✓ Verluste < 25 %<br />
abgegebene Nutzwärme voll anrechenbar auf den Stromanteil<br />
abgegebene Nutzwärme voll anrechenbar auf den Stromanteil<br />
ERT eV<br />
abgegebene Nutzwärme voll anrechenbar auf den Stromanteil Quelle: OmniCert Umweltgutachter GmbH<br />
ERT eV<br />
wird. Um dem Zweck der Düngemittelherstellung<br />
zu entsprechen, soll der ERT durch eV die<br />
Aufbereitung erzeugte Dünger nicht in den<br />
Biogasanlagenkreislauf zurückgespeist,<br />
ERT eV<br />
sondern separat gelagert werden. Ansonsten<br />
handelt es sich um eine Rückführung in<br />
den Biogasanlagenprozess (Eindickung der<br />
Anlage) und entspricht nicht dem eigentlichen<br />
Zweck der Düngemittelherstellung.<br />
Gärresttrocknung im Wärmenetz<br />
Wird der Gärresttrockner in einem Wärmenetz<br />
betrieben, ist die Anspruchsvoraussetzung<br />
nach § 27 (4) Nr. 3 in Verbindung<br />
mit Anlage 3 der Positivliste III Nr. 2. EEG<br />
2009 ausschlaggebend. Folgende Kriterien<br />
sind generell zu prüfen: Das Wärmenetz<br />
muss eine Trassenlänge von mehr als 400<br />
Meter aufweisen. Die Netzverluste von weniger<br />
als 25 Prozent des jährlich abgenommenen<br />
Nutzwärmebedarfes der Wärmekunden<br />
werden eingehalten.<br />
Als Nachweis muss die Wärme an allen<br />
Einspeisepunkten in das Netz und an allen<br />
Abnehmern messtechnisch erfasst werden.<br />
Diese abgenommene Nutzwärme ist zu<br />
summieren und als Bezugsgröße (= 100<br />
Prozent) zur Berechnung der Netzverluste<br />
zu verwenden. Dem gegenüberzustellen<br />
ist die Summe der Einspeisung der KWK-<br />
Anlage(n) sowie weiterer gegebenenfalls<br />
in das Wärmenetz einspeisender Wärmequellen<br />
im Betrachtungszeitraum. Die<br />
Abbildung zeigt das Prozessschema der<br />
Wärmenutzung aus der Biogasanlage im<br />
Wärmenetz. Eine weitergehende Prüfung<br />
Grünes Licht für die<br />
Zukunft von Biomethan!<br />
Mit einem Handelsvolumen von über 3 TWh sind wir Deutschlands führender Vermarkter für Biomethan.<br />
Wir wissen, wie Ihre Biomethananlage langfristig wirtschaftlich bleibt und haben Antworten auf die Fragen:<br />
€<br />
Lohnt sich ein Umstieg auf<br />
die Erzeugung aus Mist und Gülle?<br />
Wie kann ich mich für Neu- und<br />
Nachinvestitionen absichern?<br />
?<br />
Welche Lösungen gibt es nach<br />
Ablauf der EEG-Förderung?<br />
Gemeinsam handeln<br />
für eine grüne Zukunft.<br />
74<br />
Machen Sie mit!<br />
Wir beraten Sie gerne.<br />
+49 (0) 89 309 05 87 - 290<br />
purchase@bmp-greengas.de<br />
www.bmp-greengas.de
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
des Trocknungsprozesses im Wärmenetz ist<br />
im EEG nicht explizit definiert. Angesichts<br />
der zu erwartenden Investitionssumme<br />
einer professionellen Anlagentrocknungstechnik<br />
im mittleren sechsstelligen Bereich<br />
wird dem Anlagenbetreiber empfohlen,<br />
sich am eben beschriebenen Ablauf<br />
der Konkretisierung des Sachverhaltes der<br />
Düngemittelherstellung zu orientieren.<br />
Potenzialabschätzung für<br />
nutzbare KWK-Wärme<br />
Im Folgenden wird das theoretische Potenzial<br />
berechnet, um einen Anhaltspunkt<br />
zu geben, wieviel ungenutzte Prozesswärme<br />
auch für Gärresteaufbereitungen zur<br />
Verfügung stehen könnte. Zur Konkretisierung<br />
des Potenzials von ungenutzter<br />
Prozesswärme werden 547 Biogasanlagen<br />
mit Direktverstromung vor Ort, die nach<br />
dem EEG 2009 den KWK-Bonus in Anspruch<br />
nehmen könnten, herangezogen.<br />
Die folgende Auswertung stützt sich auf<br />
den Datensatz der Firma OmniCert Umweltgutachter<br />
GmbH, der von Annika Engelbrecht<br />
und Yvonne Münich anhand der<br />
Jahresendgutachten des Berichtszeitraumes<br />
2019 ausgearbeitet wurde.<br />
Der überwiegende Anteil der 547 Biogasanlagen<br />
befindet sich im süddeutschen Raum.<br />
21 Anlagen nehmen den KWK-Bonus nach<br />
EEG 2009 für die Gärresteaufbereitung<br />
bereits in Anspruch, was 3,8 Prozent der<br />
bewerteten Anlagen entspricht. Dazu wurden<br />
46 Gigawattstunden (GWh) thermische<br />
Trocknungsenergie aufgewendet. Die<br />
durchschnittliche Bemessungsleistung der<br />
547 Anlagen liegt bei 342 Kilowatt elektrischer<br />
Leistung (kW el.<br />
). Hiervon wurde den<br />
Betreibern durchschnittlich ein Anteil von<br />
190 kW el<br />
. als KWK-Strom nach EEG 2009<br />
vergütungsfähig bescheinigt. Somit könnte<br />
rein rechnerisch noch ein Anteil von 152<br />
kW el<br />
. als vergütungsfähiger KWK-Strom pro<br />
Anlage zur Verfügung stehen. Das würde<br />
einem gegenwärtigen Potenzial von 163<br />
Kilowatt thermischer Leistung (kWth.) pro<br />
Anlage entsprechen.<br />
Im Rahmen des EEG 2009 sind auf Grundlage<br />
der Branchenzahlen des Fachverbandes<br />
Biogas e.V. grundsätzlich 6.088 Biogasanlagen<br />
KWK-Bonus anspruchsberechtigt.<br />
Hochgerechnet auf diesen Anlagenbestand<br />
würde das der Summe von 8.106 Gigawattstunden<br />
thermischer Energie entsprechen.<br />
Zum Vergleich könnte das im Jahr 2020<br />
in Betrieb genommene umstrittene Steinkohlekraftwerk<br />
Datteln 4, das von Uniper<br />
als „eines der modernsten Steinkohlekraftwerke<br />
der Welt“ betitelt wird, maximal 40<br />
Prozent davon als thermische Fernwärmeleistung<br />
jährlich auskoppeln. In der Praxis<br />
kommt natürlich eine Gärresteaufbereitung<br />
nur für einen Bruchteil der Anlagen in Frage,<br />
wo dieses Potenzial auch wirtschaftlich<br />
genutzt werden kann.<br />
Autor<br />
Arnold Multerer<br />
Dipl.-Ing. Univ. für Umweltplanung<br />
Umweltgutachter (DE-V-0392)<br />
OmniCert Umweltgutachter GmbH<br />
Kaiser-Heinrich-II.-Straße 4 · 93077 Bad Abbach<br />
0 94 05/94 985-42<br />
arnold.multerer@omnicert.de<br />
www.umweltgutachter.de<br />
MASSENBILANZ<br />
Abb. Gärrestverdampfung<br />
75
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Der Redispatch 2.0<br />
ist ein Planprozess, in<br />
dem der Netzbetreiber<br />
versucht, Engpässe<br />
schon vor dem<br />
eigentlichen Entstehen<br />
zu prognostizieren und<br />
Maßnahmenkombinationen<br />
zu wählen, mit<br />
denen der Engpass<br />
möglichst effizient und<br />
kostengünstig aufgelöst<br />
werden kann.<br />
Redispatch 2.0 – Ein nächster Schritt zur<br />
Systemintegration Erneuerbarer Energien<br />
Der 1. Oktober <strong>2021</strong> wird für viele Betreiber von Biogasanlagen, insbesondere in Norddeutschland,<br />
einer der wichtigsten Tage dieses Jahres. Ab diesem Datum tritt der sogenannte<br />
„Redispatch 2.0“ in Kraft, der das bestehende Einspeisemanagement ablösen wird.<br />
Von M.Sc. Florian Strippel<br />
Das Inkrafttreten des „Redispatch 2.0“ ist<br />
ein notwendiger Schritt in eine Zukunft, in<br />
der das deutsche Stromversorgungssystem<br />
vorrangig von Erneuerbaren Energien geprägt<br />
sein wird. Der zunehmende Anteil von<br />
Wind- und Photovoltaikanlagen setzt die Netze durch<br />
die Volatilität stärker unter Druck. Während die Netze<br />
in der Nacht und ohne Wind ausreichende Kapazitäten<br />
zur Durchleitung von Strom haben, kann es an stürmischen<br />
oder sehr sonnigen Tagen zu regionalen Engpässen<br />
kommen.<br />
Grundsätzlich ist ein hoher regenerativer Anteil an der<br />
Stromerzeugung das erklärte Ziel der Energiewende.<br />
Ein stürmischer Tag an der Nordsee ist daher zunächst<br />
erstrebenswert, da mit einer hohen Stromproduktion<br />
der Offshore-Windenergieanlagen gerechnet werden<br />
kann. Dafür können konventionelle Kraftwerke ausgeschaltet<br />
und aus gesamtdeutscher Sicht kann dafür<br />
gesorgt werden, dass Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen<br />
sind.<br />
Ein Problem in diesen Zeiträumen ist allerdings, dass<br />
der an der Küste Niedersachsens produzierte Strom<br />
auch an die Alpen geliefert werden muss. Obwohl ein<br />
Bedarf besteht, kann es in diesem Fall zu Überlastungen<br />
der Leitungen kommen, weshalb Anlagen vereinzelt<br />
abgeschaltet werden müssen.<br />
Diese engpassbedingten Abschaltungen stehen im<br />
Zentrum des Redispatch 2.0. Betroffene Anlagenbetreiber<br />
könnten sich nun fragen, was die Neuerung<br />
dieses Prozesses ist, da mit dem bekannten Einspeisemanagement<br />
ebenfalls Netzengpässe bewirtschaftet<br />
wurden. Die Antwort auf diese Frage ist, dass der Redispatch<br />
2.0 ein Planprozess ist, in dem der Netzbetreiber<br />
versucht, Engpässe schon vor dem eigentlichen Entstehen<br />
zu prognostizieren und Maßnahmenkombinationen<br />
zu wählen, mit denen der Engpass möglichst effizient<br />
und kostengünstig aufgelöst werden kann. Dies ist ein<br />
entscheidender Unterschied zum Einspeisemanagement,<br />
das eher als Notfallmaßnahme bezeichnet werden<br />
kann.<br />
FOTO: ADOBE STOCK_ML1413<br />
76
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
Anlagen ab einer installierten<br />
Leistung von 100 kW betroffen<br />
Damit dieser Prozess gelingen kann, ist<br />
der Netzbetreiber auf verschiedene Daten<br />
der Anlagen angewiesen. Mithilfe<br />
der gesammelten Daten aller Anlagen<br />
kann dann genau bestimmt werden, an<br />
welchen Stellen im Netz ein Engpass auftreten<br />
könnte. Da die Datenmeldungen<br />
zum Teil jedoch sehr umfangreich sind,<br />
sind vorerst Anlagen ab einer installierten<br />
Leistung von 100 Kilowatt (kW) vom<br />
Redispatch 2.0 betroffen. Dabei gilt der<br />
Redispatch 2.0 nicht nur für Biogasanlagen,<br />
sondern gleichermaßen für Windund<br />
Photovoltaikanlagen, KWK-Anlagen,<br />
aber auch konventionelle Anlagen. Das<br />
System ist damit für die meisten Stromerzeugungsanlagen<br />
identisch und unterscheidet<br />
sich nur hinsichtlich der Daten,<br />
die geliefert werden müssen.<br />
Ein wichtiger Aspekt für Anlagen, die<br />
dem Regelungsbereich des EEG unterliegen,<br />
ist jedoch der Einspeisevorrang<br />
des erzeugten Stroms. Dieses zentrale<br />
Element wurde durch sogenannte „Mindestfaktoren“<br />
im Redispatch 2.0 berücksichtigt. Der<br />
Mindestfaktor besagt, dass eine Anlage auf der Basis<br />
von Erneuerbaren Energien nur dann geregelt werden<br />
darf, wenn mehr als die zehnfache konventionelle Leistung<br />
abgeregelt werden müsste, um den gleichen Entlastungseffekt<br />
des Netzes zu erzielen.<br />
Die Abrufentscheidung des Netzbetreibers, welche Anlage<br />
zum Redispatch herangezogen wird, ist allerdings<br />
kostenbasiert. Dies bedeutet, dass die Maßnahmenkombination<br />
zur Engpassbehebung gewählt wird, die<br />
am kostengünstigsten ist. Aus diesem Grund wird es ab<br />
dem 1. Oktober einen einheitlichen „Kalkulatorischen<br />
Preis“ für alle Erneuerbare-Energien-Anlagen geben.<br />
Dieser fiktive Preis soll aus bundesdeutscher Sicht das<br />
Verhältnis 1:10 des Mindestfaktors widerspiegeln. Für<br />
Anlagenbetreiber ist es wichtig zu wissen, dass dieser<br />
„Kalkulatorische Preis“ nicht mit der potenziellen Entschädigung<br />
der Anlage zusammenhängt, sondern lediglich<br />
der Auswahlentscheidung des Netzbetreibers dient.<br />
Datenlieferverpflichtungen für<br />
Anlagenbetreiber<br />
Damit der Prozess funktionieren kann, müssen Anlagenbetreiber<br />
verschiedene Daten an die Netzbetreiber<br />
übermitteln. Diese können im Wesentlichen in die vier<br />
Kategorien „Stammdaten“, „Echtzeitdaten“,<br />
Immer. Sicher. Dicht.<br />
Individuelle Ringraumdichtung HRD LAU<br />
DICHTEN SIE IHREN LAGERBEHÄLTER SICHER AB<br />
www.hauff-technik.de<br />
Anzeige_Biogasjournal_175x1188mm.indd 1 07.05.<strong>2021</strong> 09:36:04<br />
77
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
„Planungsdaten“ und „Nichtbeanspruchbarkeiten“<br />
untergliedert werden. Welche der Daten übermittelt<br />
werden müssen, hängt mit dem sogenannten Bilanzierungsmodell<br />
zusammen, bei dem aus zwei verschiedenen<br />
Optionen gewählt werden kann.<br />
Die erste Option stellt das sogenannte „Prognosemodell“<br />
dar. In diesem Modell prognostiziert der Netzbetreiber<br />
selbst, wie die Stromerzeugung der Anlage<br />
in der Zukunft aussehen wird. Eine Übermittlung von<br />
Planungsdaten ist daher nicht notwendig. Dies ist<br />
natürlich bei fluktuierenden Erzeugungsanlagen aufgrund<br />
von genauen Wetterprognosen besser möglich<br />
als bei frei steuerbaren Anlagen, wie zum Beispiel<br />
Biogasanlagen. Aus diesem Grund kann eine zweite<br />
Option gewählt werden, bei der es sich um das „Planwertmodell“<br />
handelt. In diesem Modell werden Daten<br />
des Fahrplans an den Netzbetreiber übermittelt, sodass<br />
dieser genau weiß, welche Leistung die Anlage in<br />
der Zukunft bereitstellen wird.<br />
Neu: „Einsatzverantwortliche“<br />
Die unterschiedlichen Datenkategorien verdeutlichen,<br />
dass der Prozess komplex ist und viele unterschiedliche<br />
Meldungen zu machen sind, die Anlagenbetreiber<br />
zum Teil überfordern können. Aus diesem Grund<br />
wurden verschiedene Marktrollen definiert. Im Zentrum<br />
steht dabei der sogenannte „Einsatzverantwortliche“,<br />
der für einen großen Teil der Datenlieferungen<br />
verantwortlicht ist. Diese Marktrolle muss nicht vom<br />
Anlagenbetreiber selbst wahrgenommen werden, sondern<br />
kann an einen externen Dienstleister abgegeben<br />
werden.<br />
Da die Direktvermarktungsunternehmen in vielen<br />
Fällen ohnehin über eine Vielzahl der geforderten Daten<br />
verfügen, um den Strom über Handelsgeschäfte<br />
vermarkten zu können, werden diese in den meisten<br />
Fällen die Rolle als Einsatzverantwortlicher übernehmen<br />
können. Dabei muss jedoch beachtet werden,<br />
dass dies kein Automatismus oder eine Pflicht ist. Der<br />
Direktvermarkter kann anbieten, dass er für einen Anlagenbetreiber<br />
die Rolle des Einsatzverantwortlichen<br />
übernimmt, muss dieses jedoch nicht tun.<br />
In der Praxis werden viele Direktvermarkter die Rolle<br />
des Einsatzverantwortlichen übernehmen. Insbesondere<br />
die Umsetzung des Planwertmodells wird für<br />
Biogasanlagenbetreiber nur in Kooperation mit dem<br />
Direktvermarkter möglich sein. Dieses Modell wird<br />
insbesondere für Anlagen in der Regelenergie wichtig<br />
werden, denn natürlich muss ein Netzbetreiber wissen,<br />
ob beispielsweise positive Regelenergie angeboten<br />
wird, um die Anlage nicht zufälligerweise zeitgleich<br />
zum negativen Redispatch und damit zur Abregelung<br />
heranzuziehen.<br />
Da die Systemumstellung zum 1. Oktober sehr viele<br />
Anlagen betreffen wird, sind umfangreiche vorbereitende<br />
Maßnahmen notwendig. Der Redispatch 2.0<br />
wird damit nicht erst im Herbst, sondern bereits jetzt<br />
für viele Betreiber relevant. Zahlreiche Betreiber wurden<br />
bereits von den Netzbetreibern mit der Bitte angeschrieben,<br />
verschiedene Stammdaten zu liefern. An<br />
dieser Stelle ist es wichtig, frühzeitig mit dem jeweiligen<br />
Direktvermarkter in Kontakt zu treten und die<br />
Frage zu klären, ob dieser perspektivisch die Rolle des<br />
Einsatzverantwortlichen übernimmt. Weiterhin sind<br />
Details zur Datenlieferung und den Bilanzierungsmodellen<br />
abzustimmen.<br />
Kommt es dann ab Oktober zu Schaltungen, sollen die<br />
betroffenen Anlagen laut Aussage der Bundesnetzagentur<br />
„weder besser noch schlechter als ohne die<br />
Maßnahme gestellt werden“. Der Betreiber wird also,<br />
wie bereits im Einspeisemanagement auch, finanziell<br />
entschädigt. Kosten können beispielsweise durch das<br />
Abfackeln des Gases während einer Abschaltung oder<br />
auch durch die Bereitstellung einer Ersatzwärmeversorgung<br />
in einem Wärmenetz entstehen. Der Anlagenbetreiber<br />
hat in diesen Fällen das Recht, dass der<br />
durch den Netzbetreiber entstandene Schaden ausgeglichen<br />
wird.<br />
Leider sind die Vorgaben des Systems äußerst komplex<br />
und der Fachverband Biogas e.V. steht über die<br />
verschiedenen Gremien im ständigen Austausch mit<br />
den beteiligten Akteuren, um Regelungen zu erwirken,<br />
die für die Branche umsetzbar und praxisnah sind. Zur<br />
Information der Mitglieder wurden bereits zahlreiche<br />
kostenfreie Webinfo-Seminare angeboten, an denen<br />
über 600 der Mitglieder teilgenommen haben. Weiterhin<br />
wird eine Arbeitshilfe zur Thematik veröffentlicht<br />
werden.<br />
Auch wenn die Neuerungen, die auf die Branche zukommen,<br />
komplex sind, so können sie auch eine Chance für<br />
die Bioenergie sein, den Stellenwert für das Stromversorgungssystem<br />
zu verdeutlichen. Flexibel steuerbare<br />
Biogasanlagen können ein entscheidender Baustein zur<br />
sicheren und verlässlichen Stromproduktion sein. Diese<br />
Rolle wird in Zukunft wichtiger denn je.<br />
Autor<br />
M.Sc. Florian Strippel<br />
Leiter des Referats Stromnetze<br />
und Systemdienstleistungen<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
78
Installationsbeispiel<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PROBLEME MIT DER<br />
GASSPEICHERNUTZUNG?<br />
Keine optimale Gasspeichervolumen Nutzung<br />
Mangelnder Niveauausgleich<br />
Falsche Flussrichtung des Gases<br />
PRAXIS<br />
DIE LÖSUNG<br />
Das “BioBG Gasfördergebläse”<br />
Sorgt für optimalen Gasdruck-Ausgleich.<br />
Effizient und kostengünstig.<br />
OHNE BioBG Gasfördergebläse.<br />
Gasmembrane nicht gleichmäßig gespannt.<br />
MIT BioBG<br />
Gasfördergebläse<br />
keine Verluste.<br />
Einfachste Einbindung in alle<br />
Rohrleitungen/Rohrleitungsarten.<br />
Installation über<br />
Flansch Verbindung.<br />
! Kein Gasverlust<br />
! Keine Fahrplanuntreue<br />
! Flexible Fahrweise<br />
! Keine wirtschaftlichen<br />
Verluste<br />
EINFACH UND SCHNELL INSTALLIERT!<br />
Infos unter www.biobg.de oder<br />
rufen Sie uns einfach an!<br />
Tel.: 0 44 09 - 66 67 20<br />
MIT BioBG Gasfördergebläse.<br />
In der Praxis bewährt<br />
Das BioBG Gasfördergebläse arbeitet<br />
erfolgreich auf unserer anliegenden<br />
Biogasanlage.<br />
Die Vorteile für Sie:<br />
- Keine Auslösung des Unterdruckschalters<br />
bei der Substratentnahme<br />
- Niveauausgleich der Gasblasenfüllstände<br />
- Kein Abblasen bei hoher Gasproduktion<br />
- Optimale Nutzung aller Gasspeicher<br />
- Geringe Wartungskosten<br />
- Keine Verdichtereigenschaften<br />
- Verschleißarm<br />
BioBG GmbH<br />
Webers Flach 1 – 26655 Westerstede-Ocholt<br />
Tel.: +49 (0) 4409 - 666 720<br />
Fax: +49 (0) 4409 - 666 722<br />
E-Mail: info@biobg.de – Internet: www.biobg.de 79
PRAXIS<br />
Die Biogasanlage der<br />
Klostergas GbR verarbeitet<br />
BIOGAS JOURNAL pro Jahr | rund 4_<strong>2021</strong> 10.000<br />
Tonnen Rindermist.<br />
Optimierter Betrieb im<br />
Regelleistungsmarkt<br />
Wenn Biogasanlagen konsequent flexibilisiert werden, können sie auch die anspruchsvolle<br />
Primärregelleistung (PRL) erbringen. Doch mit dem Wechsel auf die Vier-Stunden-Zeitscheibenregelung<br />
wird es komplizierter, den Fahrplan für den optimalen BHKW-Betrieb<br />
selbst zu erstellen. Lars Grünewald, der im Süden Niedersachsens eine flexible Biogasanlage<br />
betreibt, hat sich daher entschieden, diese Tätigkeit in die Hände seines Direktvermarkters<br />
zu legen.<br />
Von Thomas Gaul<br />
In der landschaftlich reizvollen Lage des Weserberglands<br />
befindet sich das Klostergut Hilwartshausen.<br />
Das traditionsreiche Kloster in der Nähe von Hannoversch<br />
Münden hat eine lange Geschichte hinter<br />
sich. Gegründet wurde das Kloster bereits im Jahr<br />
960. Nur durch eine Bundesstraße getrennt, steht die<br />
Biogasanlage von Lars Grünewald. Sie wurde 2011<br />
neben den Wirtschaftsgebäuden des eigenständigen<br />
landwirtschaftlichen Betriebes errichtet.<br />
Dabei handelt es sich um einen Ackerbaubetrieb mit<br />
Rinderhaltung, der zusammen mit einem weiteren Gesellschafter<br />
als Klostergas GbR betrieben wird. Grünewald<br />
mästet 600 Bullen. Sie liefern auch einen Großteil<br />
des Substrates für die Biogasanlage, berichtet Lars<br />
Grünewald: „Wir setzen jährlich rund 10.000 Tonnen<br />
Rindermist in der Biogasanlage ein.“<br />
Daneben werden noch 3.500 Tonnen Hühnertrockenkot<br />
und 1.800 Tonnen Körnermaisstroh eingesetzt. Das<br />
wurde im Herbst mit Feldhäcksler und Ladewagen geerntet<br />
und einsiliert. Der Substratmix wird durch Kleegras-Silage<br />
ergänzt. „Wir versuchen, einen Großteil des<br />
Substratbedarfs mit Reststoffen zu bestreiten“, betont<br />
Grünewald. „Wir haben einen Bedarf von 600 Tonnen<br />
Mais, den wir für die Anlage benötigen. Den Rest decken<br />
wir auch mit Zwischenfrüchten.“<br />
Für die Versorgung einer elektrischen Leistung von 500<br />
Kilowatt (kW) reichen inzwischen 15 Hektar Mais aus.<br />
Beim Anbau der nachwachsenden Rohstoffe ist er inzwischen<br />
nicht mehr nur auf eigene Flächen angewiesen.<br />
„Viele Landwirte in der Nachbarschaft möchten<br />
für uns Mais anbauen.“ Ein Grund dafür ist, dass im<br />
Ackerbau die Probleme mit Ackerfuchsschwanz zunehmen<br />
und Mais die Fruchtfolge so sinnvoll ergänzt.<br />
Die Biogasanlage wurde im Lauf der Jahre optimiert<br />
und erweitert. Nach und nach wurden drei Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW) mit einer Leistung von insgesamt<br />
1,15 Megawatt installiert. Mit einem Mitsubishi-Motor<br />
startete Grünewald 2016 die Flexibilisierung. Der Motor<br />
läuft wärmegeführt, da die Wärme auf dem Klostergut<br />
zur Getreidetrocknung und zum Beheizen der<br />
Gebäude genutzt wird. Da es sich dort um historische<br />
Gebäude handelt, ist der Wärmebedarf entsprechend<br />
hoch.<br />
Der Strom wird bereits seit 2012 direkt vermarktet.<br />
Über die Direktvermarktung gelang der Einstieg in die<br />
Märkte für Regelenergie. Bei dem zuständigen Über-<br />
FOTOS: THOMAS GAUL<br />
80
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
NEU:<br />
PRAXIS<br />
UltraPract® PG<br />
Der Beschleuniger für<br />
schwer vergärbare<br />
Substratmischungen!<br />
Hochwirksam, mit<br />
patentiertem Enzymprofil<br />
Klaus Anduschus (links) von e2m und Betreiber Lars Grünewald prüfen die Silage aus Körnermaisstroh.<br />
stock.adobe.com / © JonathanSchöps<br />
Steigern Sie die<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Ihrer Biogasanlage.<br />
» Stabilisiert den Anlagenbetrieb<br />
beim Einsatz von<br />
„Problem-Substraten”<br />
(Mist + GPS, Grassilage).<br />
Lars Grünewald setzt beim Substratmix auch auf Zwischenfrüchte.<br />
» Maximiert die Geschwindigkeit<br />
der Biogasbildung.<br />
tragungsnetzbetreiber TenneT wurden die<br />
BHKW zunächst für die Sekundär- und<br />
die Minutenreserve (MRL) präqualifiziert.<br />
Durch die Flexibilisierung kann Lars Grünewald<br />
auch Primärregelleistung (PRL)<br />
bereitstellen.<br />
Fahrplanbetrieb selbst entwickelt<br />
Zunächst wurden die drei BHKW-Motoren<br />
mit 250 kW, 265 kW und 500 kW nach<br />
einem Fahrplan betrieben, den Lars Grünewald<br />
selbst entwickelt hatte. „Dazu habe<br />
ich mich im Internet über die Preisentwicklung<br />
an der Leipziger Strombörse EEX informiert“,<br />
blickt er zurück. Doch als sein<br />
Direktvermarkter e2m mit dem Produkt<br />
OptimusFlex auf den Markt kam, schwenkte<br />
Grünewald um. Denn der Aufwand für<br />
das Erstellen individueller Fahrpläne hat<br />
sich noch einmal erhöht.<br />
Ein Grund dafür ist die tägliche Regelleistungsauktion<br />
für PRL, die am 1. Juli 2020<br />
eingeführt wurde. Damit fand ein Wechsel<br />
auf Zeitscheiben von jeweils vier Stunden<br />
statt – analog zu den bereits bestehenden<br />
Zeitscheiben für Sekundärregelleistung<br />
(SRL) und MRL. Für bereits flexibilisierte<br />
Biogasanlagen wie die von Lars Grü-<br />
» Optimiert die Substratverwertung<br />
und damit die<br />
Wirtschaftlichkeit der Biogasanlage.<br />
81<br />
+49 (0)30 6670 - 2056 » www.biopract-abt.de
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
„Die Regelenergie<br />
hat wieder einen<br />
Wert“<br />
Lars Grünewald<br />
Nach und nach wurden<br />
drei Blockheizkraftwerke<br />
(BHKW) mit<br />
einer Leistung von insgesamt<br />
1,15 Megawatt<br />
installiert.<br />
Die Anlage fügt sich<br />
harmonisch in die<br />
Landschaft des Weserberglandes<br />
ein.<br />
newald boten sich damit neue Chancen. Zusammen mit<br />
Klaus Anduschus, e2m-Teamleiter Vertrieb Landwirtschaft,<br />
wurden die wesentlichen Parameter der Biogasanlage<br />
erfasst und zum Erstellen eines Fahrplans in das<br />
System eingegeben. Dabei wurden die Besonderheiten<br />
der Anlagenkonstellation wie des Gasspeichers mit einem<br />
Volumen von 3.386 Kubikmetern ebenso erfasst<br />
wie die von den Motorenherstellern vorgegebenen Restriktionen<br />
wie Anzahl der Starts / Stopps und Wartungsintervalle.<br />
Aber auch der Wärmebedarf wurde berücksichtigt,<br />
wobei sich Grünewald und Anduschus hier an<br />
einem durchschnittlich kalten Wintertag orientierten.<br />
Für den Spitzenbedarf steht auch noch ein zusätzlicher<br />
Heizkessel bereit, der mit Holz-Hackschnitzeln betrieben<br />
wird.<br />
2. Quartal <strong>2021</strong> – Regelenergievermarktung<br />
interessanter<br />
Der Fahrplan berücksichtigt auch die Preisentwicklung<br />
an den Strom- und Regelleistungsmärkten. Der Markt<br />
für Regelenergie ist nun wieder interessant geworden.<br />
Das gilt insbesondere für das zweite Quartal <strong>2021</strong>. Die<br />
deutschen Übertragungsnetzbetreiber gaben im ersten<br />
Quartal etwa 7,1 Millionen (Mio.) Euro für die Primärregelleistung<br />
(PRL) aus. Im gleichen Zeitraum kostete<br />
die Sekundärregelleistung (SRL) positiv 24,1 Mio.<br />
Euro und negativ 10,1 Mio. Euro.<br />
Nach Einschätzung von e2m wird das zweite Quartal<br />
<strong>2021</strong> diese Werte und alle Ergebnisse der Quartale<br />
2020 weit übertreffen. Seit Mitte April sehen die Experten<br />
der e2m eine Hochpreisphase, die insbesondere<br />
Anfang Mai einen Höhepunkt erreicht hat. Grund hierfür<br />
ist insbesondere die ausgeprägte Wartungssaison<br />
konventioneller Marktteilnehmer. Vor einem Jahr, zum<br />
ersten Lockdown, wurden Wartungsarbeiten teilweise<br />
verschoben, die nun nachgeholt würden.<br />
Außerdem treiben das wechselhafte Wetter sowie eine<br />
gewisse Marktdynamik die Preise weiter. So setzen sich<br />
die schon im vorangegangenen Jahr gestiegenen Erlöschancen<br />
für positive SRL auch in diesem Jahr weiter<br />
fort. Dieser Trend wird fundamental durch gestiegene<br />
Brennstoffkosten und CO 2<br />
-Preise gestützt, die insbesondere<br />
für konventionelle Marktteilnehmer die Kosten<br />
nach oben treiben.<br />
Die Leistung von negativer SRL ist insbesondere<br />
während verbrauchsschwacher Perioden mit hoher<br />
Wind- oder Solareinspeisung lukrativ. Dies trifft beispielsweise<br />
auf den Monat Mai mit seinen zahlreichen<br />
Feiertagen zu. Für positive und negative SRL gilt gleichermaßen,<br />
dass der Regelarbeitsmarkt den kompetitiven<br />
Druck auf Leistungspreisauktionen senkt, was wie-<br />
82
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
derum zu messbar höheren Preisen für die<br />
Bereitstellung von Flexibilität führt. „Die<br />
Regelenergie hat wieder einen Wert“, freut<br />
sich Lars Grünewald. In den vergangenen<br />
Monaten konnte ein Zusatzerlös von etwa<br />
2.000 Euro monatlich erzielt werden.<br />
Beim Betrachten des Fahrplans fällt auf,<br />
dass die Motorenbetriebszeit die Vier-<br />
Stunden-Zeitscheibe schneidet. „Das ist<br />
jedoch nicht weiter schlimm“, sagt Klaus<br />
Anduschus von e2m. Die Motoren sollen<br />
mindestens zwei Stunden laufen. So wurde<br />
es vorher vereinbart. Um den Verschleiß zu<br />
minimieren, wird die Betriebstemperatur<br />
bei 60 Grad Celsius gehalten.<br />
Bei unvorhergesehenen Maßnahmen kann<br />
der Fahrplan jedoch noch kurzfristig geändert<br />
werden: „Bis morgens 8.00 Uhr kann<br />
ich für den Folgetag noch Veränderungen<br />
vornehmen“, sagt Grünewald. Entsprechend<br />
den vorliegenden Daten werden<br />
die BHKW dann durch e2m automatisch<br />
gesteuert. Zur Optimierung gehört, die<br />
Stromproduktion in die Wochenzeiten zu<br />
verlegen, in denen die erwartete Stromnachfrage<br />
am höchsten ist.<br />
Grünewald könnte darauf reagieren, indem<br />
er die Fütterung vor dem Wochenende reduziert.<br />
Doch angesichts der von ihm eingesetzten<br />
Substrate hält er diese Möglichkeit<br />
für wenig realistisch. Die Biologie seiner<br />
Anlage ist auf die Reststoffe eingestellt<br />
und reagiert eher träge. Eine Anpassung<br />
der Fütterung wäre für ihn leichter möglich,<br />
wenn er Substrate wie Getreideschrot<br />
oder Zuckerrüben einsetzen würde, die ein<br />
schnelles Hochfahren der Gasproduktion<br />
ermöglichen.<br />
Optimierter Wärmepuffer würde<br />
Flexibilität erhöhen<br />
Die Fahrweise nach OptimusFlex bringt Lars<br />
Grünewald einen jährlichen Mehrerlös von<br />
20.000 Euro. Mit der Direktvermarktung<br />
hatte er zuvor bereits einen Mehrerlös von<br />
5.000 Euro realisiert. Derzeit ist es die Gasspeicherkapazität,<br />
die die Flexibilität der<br />
Anlage gemäß dem Fahrplan vorgibt. Weiter<br />
erhöhen ließe sich die Flexibilität mit einem<br />
Pufferspeicher. Denn derzeit muss die<br />
Wärmeverteilung in den Fahrplan integriert<br />
werden.<br />
Die BHKW-Motoren müssen jetzt mitunter<br />
laufen, obwohl die Signale vom Strommarkt<br />
dies gar nicht erfordern. Da jedoch der Wärmebedarf<br />
von insgesamt 360 kW des Klostergutes<br />
gedeckt werden muss, laufen die<br />
Motoren. Für den Wärmespeicher wäre ein<br />
Der Bullenstall befindet sich neben der Biogasanlage.<br />
Volumen von 105 m 3 ausreichend, haben<br />
Klaus Anduschus und Lars Grünewald ermittelt.<br />
Die Umstellung des Fahrplans zahlt sich für<br />
Lars Grünewald aus. „SRL und Fahrplan ist<br />
wertvoller als der reine Fahrplanbetrieb,<br />
selbst wenn die Vier-Stunden-Zeitscheiben<br />
in die Regelenergie verschoben werden.“<br />
Über den Fahrplanbetrieb hinaus ergeben<br />
sich weitere Vorteile für den Anlagenbetreiber:<br />
Als Teilnehmer am Regelenergie-Markt<br />
ist er vom Redispatch befreit.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
83
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Mit VisuFlex Flexibilität<br />
sichtbar machen<br />
Der flexible Betrieb von Biogasanlagen ist ein großer Vorteil. Dieses starke Argument für<br />
den Energieträger Biogas kann bislang nicht richtig ausgespielt werden. Denn in vielen<br />
Veröffentlichungen und Diskussionen wird das nicht berücksichtigt. Mit einer Darstellung<br />
in Echtzeit will das Projekt VisuFlex das ändern.<br />
Von Thomas Gaul<br />
Biogas hat einen erheblichen Vorteil gegenüber<br />
anderen Erneuerbaren Energien: Es<br />
kann nicht nur bedarfsgerecht erzeugt,<br />
sondern auch flexibel verstromt werden.<br />
Bei hoher Netzbelastung lassen sich die<br />
Biogas-Blockheizkraftwerke (BHKW) herunterfahren<br />
und das Netz so freimachen für Wind- und Solarstrom.<br />
Bei Strombedarf hingegen eignen sich Biogas und Biomethan<br />
als Reservekapazität: Sie werden so zu „Batterien“<br />
für die Stromversorgung in Engpasszeiten.<br />
Doch in der Politik und in der Öffentlichkeit kommt diese<br />
Botschaft häufig gar nicht an: In Veröffentlichungen<br />
erscheint die Stromeinspeisung häufig nur als grünes<br />
Band der Grundlast. Die Effekte der Flexibilisierung<br />
bleiben bislang unsichtbar. Der Wert real existierender<br />
Biogas-Speicherkraftwerke für den Strommarkt wird<br />
nicht wahrgenommen.<br />
Dabei dürfte die Bedeutung von Stromlieferanten,<br />
die auf Strompreisschwankungen flexibel reagieren,<br />
insbesondere vor dem Hintergrund der fluktuierenden<br />
Einspeisung aus Photovoltaik und Windkraft, in den<br />
nächsten Jahren weiter zunehmen. Flexible Speicherkraftwerke<br />
werden gebraucht. Das wird sich auch in den<br />
künftig zu erzielenden Strompreisen widerspiegeln.<br />
Mit der Direktvermarktung und der Flexibilitätsprämie<br />
des EEG fördert die Bundesregierung die Anpassung<br />
von Biogasanlagen an das Stromnetz der Zukunft. Laut<br />
einer Studie des Deutschen Biomasseforschungszentrums<br />
(DBFZ) erhalten aktuell etwa 3.300 Biogas- und<br />
Biomethan-BHKW mit einer installierten elektrischen<br />
Leistung von rund 2,2 Gigawatt die sogenannte Flexprämie.<br />
Obwohl die Stromeinspeisung zu Hochpreisphasen<br />
Mehrerlöse verspricht, fahren die meisten<br />
dieser Anlagen trotzdem bislang nicht marktpreisorientiert.<br />
Die Preissteuerung funktioniert<br />
Mit dem Projekt „Visualisierung der Netz-/Systemdienlichkeit<br />
flexibilisierter Biogasanlagen – VisuFlex“ soll<br />
gezeigt werden, dass die Strompreise sehr genau der<br />
Residuallast folgen und somit eine geeignete Steuerungsgröße<br />
darstellen. Unter Einbindung von Direktvermarktern<br />
und den „Flexperten“ wurden anhand<br />
definierter Kriterien zukunftsweisend flexibilisierte<br />
Anlagen identifiziert und wurde deren aufsummierte<br />
Stromeinspeisung den Strompreisen sowie der Residuallast<br />
gegenübergestellt.<br />
Die Auswertung erfolgte rückwirkend für den Zeitraum<br />
1. Januar 2019 bis 30. Juni 2020. Das Ergebnis der<br />
ersten Projektphase zeigt, dass die ausgewählten Biogasanlagen<br />
sehr zuverlässig zu Zeiten von Last- und<br />
Preisspitzen einspeisen und somit optimal markt- und<br />
systemdienlich betrieben werden. Ergebnis: Die ausgewählten<br />
Biogasanlagen speisen sehr zuverlässig zu Zeiten<br />
von Last- und Preisspitzen ein, werden also optimal<br />
markt- und systemdienlich betrieben. Das Vorhaben<br />
wurde durch die Agrarservice Lass GmbH mithilfe des<br />
Flexperten-Netzwerkes bearbeitet.<br />
Um die Effekte der Flexibilisierung für die Öffentlichkeit,<br />
die Politik, aber auch als Vorbild für andere Biogasanlagenbetreiber<br />
deutlich sichtbar zu machen, wird<br />
in einer nun an den Start gehenden zweiten Projektphase<br />
die Visualisierung der Stromeinspeisung flexibilisierter<br />
Biogasanlagen auf einer separaten Plattform<br />
in Echtzeit angestrebt. Daraus ließe sich über die Zeit<br />
auch der Zuwachs fahrplanoptimierter Biogasanlagen<br />
ableiten.<br />
In einem vom Bundesministerium für Ernährung und<br />
Landwirtschaft durch die Fachagentur Nachwachsende<br />
Rohstoffe e. V. (FNR) geförderten Projekt wird gezeigt,<br />
dass die Strompreise sehr genau der Residuallast<br />
folgen und somit eine geeignete Steuerungsgröße für<br />
die Betriebsweise von Biogasanlagen darstellen. Unter<br />
Einbindung verschiedener Direktvermarkter wurden<br />
anhand definierter Kriterien die Biogasanlagen<br />
identifiziert, die tatsächlich bedarfsgerecht betrieben<br />
werden. Deren aufsummierte Stromeinspeisung wurde<br />
den Strompreisen sowie der Residuallast gegenübergestellt.<br />
Die neue Plattform soll über die Website der FNR zu erreichen<br />
sein, wie FNR-Mitarbeiterin Jessica Hudde auf<br />
Anfrage mitteilte. Ein Startdatum konnte sie allerdings<br />
84
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
noch nicht nennen. Die bisherigen Daten<br />
für den zurückliegenden Zeitraum sind<br />
über die Websites von SMARD und Agora<br />
Energiewende abzurufen.<br />
Anlagenbetrieb für die Zeit nach<br />
dem EEG<br />
Einen anderen Ansatz wählt das Vorhaben<br />
„Optimierung des Betriebs und Designs<br />
von Biogasanlagen für eine bedarfsgerechte,<br />
flexibilisierte und effiziente Biogasproduktion<br />
unter Berücksichtigung der<br />
Prozessstabilität als Post-EEG Strategie<br />
(OptiFlex)“. Ein Forscherteam um die Universität<br />
Hohenheim will diesen Ansatz weiterentwickeln.<br />
Den Grundstein dafür legte das Deutsche<br />
Biomasseforschungszentrum (DBFZ) mit<br />
seinem Prozessmodell für die sogenannte<br />
prädiktive (vorhersagbare) Fütterung. Bei<br />
diesem Modell geben Netzfahrpläne den<br />
zu erwartenden Stromverbrauch vor. Ein<br />
Optimierungsalgorithmus findet dann die<br />
optimale Fütterungsmenge und das bestmögliche<br />
Mischungsverhältnis der verfügbaren<br />
Substrate.<br />
Dieser Ansatz hat 2015 den Biogas-Innovationspreis<br />
gewonnen. Mit ihm lassen sich<br />
Einsparungen bei Investitionen für zusätzliche<br />
Gasspeicher von bis zu 50 Prozent<br />
realisieren. Anpassungsbedarf gibt es noch<br />
bei der Eintrags- und Rührtechnik, die große<br />
Substratmengen in kurzen Zeiträumen<br />
optimal bewegen muss. Hier setzt OptiFlex<br />
an: Die Forscher wollen weitere Regelalgorithmen<br />
für alle zentralen und peripheren<br />
Anlagenkomponenten entwickeln.<br />
Neben den Rührwerken betrifft dies auch<br />
Einrichtungen zum Substrataufschluss,<br />
die definierte Substrateigenschaften bereitstellen<br />
müssen. Auch hier wird an<br />
Vorläuferprojekte angeknüpft, etwa an die<br />
Arbeiten des Fraunhofer-Instituts für Keramische<br />
Technologien und Systeme IKTS<br />
über die Zusammenhänge zwischen Substrateigenschaften,<br />
Prozessbedingungen,<br />
Strömungsprofil im Reaktor und Biogasausbeute.<br />
Praktisch erprobt wird die neue Systemlösung<br />
in der Forschungsbiogasanlage<br />
„Unterer Lindenhof“ der Uni Hohenheim.<br />
Das OptiFlex-Konzept soll sich nicht nur<br />
zur Ausrüstung neuer, sondern auch zur<br />
Nachrüstung bestehender Anlagen eignen.<br />
Es kann als „Post-EEG-Strategie“ einen<br />
Beitrag dazu leisten, Biogasanlagen effizienter<br />
und zukunftsfähiger zu machen. Im<br />
Idealfall erzeugen flexible Biogasanlagen<br />
bedarfsgerechten Strom so wirtschaftlich,<br />
dass sich ihr Betrieb auch ohne die gesicherte<br />
Vergütung des EEG erzeugen lässt.<br />
Autor<br />
Thomas Gaul<br />
Freier Journalist<br />
Im Wehrfeld 19a · 30989 Gehrden<br />
01 72/512 71 71<br />
gaul-gehrden@t-online.de<br />
Sichern Sie sich Ihren kostenfreien und<br />
individuellen Musterfahrplan!<br />
Anfragen gerne per E-Mail: kundencenter@e2m.energy<br />
DIE BESTEN FAHRPLÄNE VOM MARKTFÜHRER<br />
85<br />
www.e2m.energy
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
BIOMETHAN<br />
Wie weiter ohne vermiedene<br />
Netzentgelte?<br />
Seit 2010 gilt, dass bei Biomethananlagen nach 10 Jahren die Vergütung der vermiedenen<br />
Netzentgelte entfällt. Bereits 2017 hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) bei einer<br />
Analyse von 18 Anlagen die negativen Folgen für die Wirtschaftlichkeit aufgezeigt. Zudem<br />
enden oft nach 10 Jahren auch die Abnahmeverträge für das Biomethan. Neue Lieferpreise<br />
und Konditionen müssen ausgehandelt werden, weitere Einnahmeverluste für den Produzenten<br />
sind möglich. Viele Anlagen können daran scheitern, gleichwohl sind grüne Gase<br />
für die Energiewende wichtig. Wie sehen einzelne Akteure diese Herausforderung und wie<br />
nehmen sie Kurs in Richtung Zukunft?<br />
Von EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
Daniel Königs betreibt mit seinem Vater und<br />
dessen Partner Nellen die Biogas- und<br />
Biomethananlage auf dem Schelmrather<br />
Hof in Neuss. Da die Einspeiseanlage seit<br />
2010 läuft, ist auch hier die Vergütung der<br />
vermiedenen Netzentgelte entfallen. Nach einer insgesamt<br />
recht positiven Zusammenarbeit mit den lokalen<br />
Stadtwerken wurden gleichzeitig neue Abnahmeverträge<br />
mit Preisen auf niedrigerem Niveau als bisher ausgehandelt.<br />
Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadtwerke im<br />
Sommer von L- auf H-Gas umstellen und die Anlage von<br />
Königs + Nellen am Ende des Verteilnetzes als<br />
erste an der Reihe ist. Konsequenzen sind,<br />
dass die Konditionierung in der Übergangszeit<br />
etwas schwieriger einzustellen ist und dass<br />
im Sommer auch nicht mehr die volle Produktionskapazität<br />
abgenommen werden kann. Ein Anschluss an<br />
das naheliegende Transportleitungsnetz ist derzeit aus<br />
Kostengründen ausgeschlossen.<br />
Angesichts auslaufender Biomethanlieferverträge haben<br />
die Betreiber schon im Vorfeld beschlossen, auf<br />
die neuen Chancen in Richtung Biomethankraftstoff zu<br />
setzen, und sich dabei bereits 2019 nach REDcert zertifizieren<br />
lassen. Sie fokussieren ihren Substratmix nun<br />
auf Reststoffe wie Pferdemist und haben die Anlage<br />
durch neue Fütterungs- und Zerkleinerungstechnik<br />
sowie die Behälter auf die Vergärung<br />
anspruchsvoller Stoffe entsprechend<br />
erweitert und ertüchtigt.<br />
Konsequent:<br />
Biogasaufbereitung<br />
Schelmrather Hof und<br />
CNG-betriebener Pkw<br />
des Betreibers.<br />
86
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
FOTOS: SCHALLER<br />
Flottenbetreiber sollten auch an<br />
Biomethan denken<br />
„Viele haben nur Elektro- und Wasserstoffmobilität<br />
als einzige Alternativen zum Diesel im Blick. Das erschwert<br />
innovative regionale Projekte mit Biomethan<br />
enorm. Außer, die Beteiligten werden durch Richtlinien,<br />
gezwungen etwas zu ändern, erst dann bekommt<br />
Bio-CNG durch den großen Kostenvorteil Aufmerksamkeit“,<br />
berichtet Daniel Königs.<br />
Er verfolgt aber den eigenen Weg weiterhin mit Konsequenz.<br />
„Leider haben die Stadtwerke unser Angebot<br />
nicht angenommen, unser Biomethan an ihren CNG-<br />
Tankstellen einzusetzen. Jetzt planen wir, eine eigene<br />
Tankstelle zu errichten, um selbst die Verkehrswende<br />
mitzugestalten.“<br />
Auch im Rahmen seiner Masterarbeit arbeitet er sich<br />
in die unübersichtlichen Zertifizierungs- und Vermarktungsregeln<br />
ein. Er wird am Ball bleiben, um das Beste<br />
für den Betrieb und das gemeinsame Ziel Umweltschutz<br />
herauszuholen, denn er sieht trotz der lokalen<br />
Hindernisse große Absatzchancen für Biomethan auf<br />
dem Kraftstoffmarkt. „Allerdings frage ich mich auch,<br />
woher die jetzt schon immer größer werdenden Mengen<br />
an Ökostrom und Biomethan als Kraftstoff kommen<br />
können“, so Königs weiter.<br />
Betrieb immer wieder neu erfunden<br />
Dipl.-Ing. agr. Bernd-Josef Wenning und sein Vater<br />
sind in Rhede im westlichen Münsterland Biogasproduzenten<br />
der ersten Stunde und betreiben zudem seit<br />
10 Jahren eine Biogasaufbereitung. Auf die Frage, wie<br />
er mit dem Verlust der entfallenden Netzentgelte umgehe,<br />
antwortet er sogleich, dass es ihren Betrieb eigentlich<br />
schon längst nicht mehr geben dürfte, hätten<br />
sie sich nicht immer neu erfunden.<br />
Sein Vater hat 1980 nach der zweiten Ölkrise mit sehr<br />
viel Mut und Pioniergeist die erste deutsche Biogasanlage<br />
in Betrieb genommen, um für seinen landwirtschaftlichen<br />
Betrieb inklusive einer Brennerei eine<br />
weitestgehende Energieautarkie bei der Dampferzeugung<br />
zu erzielen. Als vor 15 Jahren der wirtschaftliche<br />
Betrieb ihres Blockheizkraftwerks (BHKW) nicht mehr<br />
gegeben war, haben sich Vater und Sohn bereits damals<br />
bei RWE darum bemüht, ins Erdgasnetz einspeisen<br />
zu können – zunächst erfolglos.<br />
2007 entwickelte Fraunhofer eine der ersten ORC-Anlagen<br />
auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Wenning,<br />
die dort mit dem größten der drei BHKW gekoppelt war<br />
und zusätzlichen Strom aus der Abgaswärme erzeugte.<br />
Dadurch ergab sich der Kontakt zur Abteilung für regenerative<br />
Energien bei Eon. Mit Inkrafttreten der neuen<br />
Netzzugangsverordnung und mit Eon als Partner konnte<br />
die Biogaseinspeisung ins RWE-Netz schließlich<br />
realisiert werden.<br />
Nun versorgt die Anlage Abnehmer in den nahegelegenen<br />
Orten Rhede und Bocholt. Neben der Bedienung<br />
des Wärmemarktes kann Bernd-Josef Wenning dank<br />
Zertifizierung seines Betriebes<br />
über Eon auch Mineralölkonzerne<br />
mit Kraftstoff beliefern.<br />
Damit und wegen der höheren<br />
Anrechnung der Gülle könne<br />
er den Wegfall der Vergütung<br />
der entfallenen Netzentgelte<br />
ausgleichen.<br />
Nach mehr als vierzigjähriger<br />
Biogaserfahrung ist er weiterhin<br />
zuversichtlich, auf das<br />
richtige Pferd zu setzen. „Um<br />
uns in der Energie breit aufzustellen,<br />
brauchen wir neben<br />
Strom und Wasserstoff auch<br />
Biomethan und Biodiesel im<br />
Portfolio unseres Energiesystems.<br />
Wir sind auch weiterhin<br />
bestrebt, innovative Wege zu<br />
gehen, zum Beispiel durch<br />
die Nutzung von CO 2<br />
aus der<br />
Aminwäsche und grünen Wasserstoff“,<br />
lässt Wenning einblicken.<br />
bmp greengas handelt mit<br />
grünen Gasen und stellt sein<br />
Lieferantenportfolio in Orientierung an die aktuellen<br />
und künftigen Märkte zusammen. Stefan Schneider,<br />
Head of Sales und Purchasing, sieht, dass neben dem<br />
sogenannten EEG-Markt als Basis zunehmend die Industrieversorgung<br />
mit grünen Gasen und die Belieferung<br />
mit Kraftstoff im Transportsektor von Bedeutung<br />
sind. Aber es ginge nicht nur um vertriebliche Unterstützung,<br />
auch zur Minimierung des Absatzrisikos böten<br />
Händler wie bmp greengas Vorteile.<br />
„Nicht jeder Produzent kann seine Gasmengen kontinuierlich<br />
absetzen. Wir übernehmen das Gas der<br />
Lieferanten und kümmern<br />
uns um die Vermarktung –<br />
bundesweit, aber auch international.<br />
Der Produzent<br />
wiederum kann sich auf sein<br />
Kerngeschäft konzentrieren.<br />
Jeder macht so, was er am<br />
besten kann“, sagt Schneider.<br />
Die Höhe des Lieferpreises<br />
sei dadurch auch abhängig<br />
vom übernommenen Risiko,<br />
man arbeite sowohl mit<br />
Einmallieferungen als auch mit Langzeitverträgen<br />
mit Zeiträumen von bis zu 15 Jahren. Dabei sei Ende<br />
letzten Jahres ein absolutes Preistief zu verzeichnen<br />
gewesen, doch mittlerweile verbessere sich die Situation.<br />
Schließlich setze man sich als Unternehmen<br />
gemeinsam mit Lieferanten und Abnehmern dafür ein,<br />
die Klimaziele durch grüne Gase zu erreichen.<br />
Aufwändig: die Anpassung<br />
der vorhandenen<br />
Anlagentechnik an<br />
neue Substrate, wie<br />
zum Beispiel Pferdemist.<br />
„Wir übernehmen das<br />
Gas der Lieferanten<br />
und kümmern uns um<br />
die Vermarktung“<br />
Stefan Schneider<br />
87
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Fortschrittlich: Dipl.-Agr. Ing.<br />
Bernd-Josef Wenning.<br />
„Wir sind schnell, wir<br />
können liefern!“<br />
Horst Seide, Betreiber<br />
einer Biogasanlage und<br />
mehrerer Biomethantankstellen<br />
sowie Präsident des<br />
Fachverbandes Biogas,<br />
zeichnet auch ein insgesamt<br />
positives Bild: „Nach<br />
längerer Durststrecke für<br />
Betreiber von Biomethananlagen<br />
tun sich bei der<br />
Marktentwicklung nun in<br />
zweifacher Hinsicht Lichtblicke<br />
auf: Erstens bietet<br />
das EEG jetzt größere<br />
Ausschreibevolumina, die<br />
auch wirtschaftlich zu erfüllen sein müssten.<br />
Biogas bzw. Biomethan bietet ja dem<br />
Stromsektor große Vorteile mit einer derzeitigen<br />
Speicherreserve von einem Jahr und<br />
der punktgenau möglichen Lieferkapazität.<br />
Zweitens entwickelt sich der Kraftstoffsektor<br />
vielversprechend, weil die Quoten für<br />
die Verwertung von Gülle, Mist, Stroh und<br />
anderen Abfällen bei der Treibhausgas-Bilanzierung<br />
besonders vorteilhaft<br />
gewertet werden.“<br />
Seiner Meinung nach<br />
dürfte sich ein erheblich<br />
größerer Markt im<br />
Kraftstoffsektor als im<br />
Stromsektor auftun und<br />
wirtschaftlich umsetzbare<br />
Geschäftsmodelle für<br />
Betreiber bieten. Schon<br />
im vergangenen Jahr<br />
habe sich der Absatz von<br />
beispielsweise verflüssigtem<br />
Gas in Form von LNG<br />
verdreifacht. Natürlich<br />
seien gewisse Schwierigkeiten<br />
zu bewältigen, angefangen<br />
von der Umstellung auf andere<br />
Substrate über die Zertifizierung sowie bei<br />
genehmigungsrechtlichen Verfahren zur<br />
Anpassung an die Veränderungen. Die entfallenen<br />
Netzentgelte wieder zu vergüten,<br />
wird zwar weiterhin seitens des Fachverbandes<br />
gefordert, jedoch sieht Seide hier<br />
keine positiven Signale seitens der Politik.<br />
Dennoch dürfe sich der Aufwand wiederum<br />
lohnen, denn die Chancen zur Ausschöpfung<br />
der Biomethanpotenziale seien groß.<br />
„Alle bestehenden Biogasanlagen zusammengenommen<br />
haben eine Biomethankapazität<br />
von 11,6 Terawattstunden pro Jahr<br />
(TWh/a), mit dem bisher nicht genutzten<br />
Aufkommen an Gülle und Mist ergäben<br />
sich theoretisch nochmals 20 TWh/a, aus<br />
Stroh kann auch eine ähnliche Größenordnung<br />
erzeugt werden“, prognostiziert<br />
Seide.<br />
Aufgrund der Nachfrage ließe sich die Biomethanproduktion<br />
verdoppeln bis verdreifachen.<br />
Ähnlich hohe Effekte seien auch<br />
von der Weiterentwicklung im Bereich<br />
Power-to-Gas zu erwarten. Nun bliebe erst<br />
einmal abzuwarten, welche Weichen die<br />
neue Bundesregierung stellen wird, dann<br />
könne man im Herbst neue Aktivitäten abstimmen<br />
und anstoßen. Seide betont: „Wir<br />
sind schnell, wir können dann liefern!“<br />
Grüne pro Biogas und neuem<br />
Strommarktdesign<br />
Von politischer Seite erklärt Julia Verlinden<br />
von den Grünen, dass sie sich weiter-<br />
Geisberger BGJ 4_<strong>2021</strong>.pdf 1 07.06.21 12:58<br />
Geisberger BGJ 4_<strong>2021</strong>.pdf 1 07.06.21 12:58<br />
Hassenham Hassenham 4 4<br />
84419<br />
84419<br />
Schwindegg<br />
Schwindegg<br />
Tel.: +49(0)8082-27190-0<br />
Tel.: 88 +49(0)8082-27190-0<br />
www.geisberger-gmbh.de<br />
www.geisberger-gmbh.de<br />
BHKW-Power-Systeme<br />
WELT-<br />
NEUHEIT<br />
schwarzstartfähig<br />
notstromfähig<br />
Inselbetrieb<br />
Inselbetrieb<br />
mit<br />
mit<br />
Biogas<br />
Biogas<br />
50-550<br />
50-550<br />
kW<br />
kW
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
FOTO: PRIVAT<br />
hin für Biomethan einsetzen werden. „Als<br />
Grüne Bundestagsfraktion setzen wir uns<br />
dafür ein, dass die Energieerzeugung aus<br />
Biogas- und Biomethananlagen erhalten<br />
bleibt. Die Anlagen sollen dabei möglichst<br />
weitgehend auf Rest- und Abfallstoffe sowie<br />
ökologisch sinnvolle Substrate umgestellt<br />
werden. Biomethan und damit die<br />
Einspeisung von grünem Gas in die Netze<br />
leistet einen wichtigen Beitrag zur Systemstabilität“,<br />
ist Verlinden überzeugt.<br />
Und sie ergänzt: „Ein zukunftsweisender<br />
Baustein ist es daher, Vor-Ort-Verstromungsanlagen<br />
– wo möglich – auf die<br />
Biogasaufbereitung und -einspeisung umzurüsten<br />
und kleine Anlagen zusammenzuschließen.<br />
Die Rahmenbedingungen, wie<br />
etwa die Gebotshöchstwerte von Neu- und<br />
Altanlagen, sollten entsprechend angepasst<br />
werden.“<br />
Insgesamt sei es notwendig, das Strommarktdesign<br />
auf neue Füße zu stellen und<br />
Abgaben und Umlagen neu auszurichten,<br />
um einer sicheren und kostengünstigen<br />
Stromversorgung mit 100 Prozent Erneuerbaren<br />
Energien den Weg zu ebnen. Hierfür<br />
hätten die Grünen als Bundestagsfraktion<br />
erst kürzlich einen Vorschlag für ein neues<br />
Strommarktdesign veröffentlicht.<br />
Shell will grüner werden<br />
Wenn auch jeweils individuelle Bedingungen<br />
bestehen, so äußern sich alle Akteure<br />
zuversichtlich. Ein gutes Signal ist auch das<br />
Urteil aus Den Haag, das Shell verpflichten<br />
soll, den CO 2<br />
-Ausstoß bis 2030 deutlich zu<br />
verringern. Nicht erst seit diesem Richterspruch<br />
bemühen sich die Mineralölkonzerne<br />
aktiv um Nachhaltigkeit. „Die Weichen<br />
für eine nachhaltigere Zukunft als Netto-<br />
Null-Emissionen-Unternehmen haben wir<br />
schon gestellt, wie unter anderem der Bau<br />
einer Anlage für Grünen Wasserstoff und<br />
unsere geplante Bio-LNG-Anlage für den<br />
Schwerlastverkehr belegen,“ erklären Vertreter<br />
der Shell Rheinland Raffinerie am<br />
20. Mai <strong>2021</strong> anlässlich der Gründung des<br />
„Energy Campus“.<br />
Dieser soll als Synergie-Plattform die Zusammenarbeit<br />
von Shell mit führenden Vertreterinnen<br />
und Vertretern aus Forschung<br />
und Lehre, Unternehmenspartnern sowie<br />
innovativen Start-ups fördern, um gemeinsam<br />
neue Lösungen für die Energiewende<br />
speziell im Rheinischen Revier zu entwickeln<br />
und auf diese Weise aktiv zum Erreichen<br />
der deutschen Nachhaltigkeits- und<br />
Klimaziele beizutragen.<br />
Es geht allen um gemeinsame Ziele, allerdings<br />
bleibt abzuwarten, wie die Wertschöpfungskette<br />
– vom Familienbetrieb<br />
am einen Ende bis zum Großkonzern am<br />
anderen – ein für alle auskömmliches Einkommen<br />
bietet. Letztendlich ist das die<br />
Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung<br />
politischer Zielsetzungen zum Klimaschutz.<br />
Autorin<br />
EUR ING Marie-Luise Schaller<br />
ML Schaller Consulting<br />
mls@mlschaller.com<br />
www.mlschaller.com<br />
Fachfirma der Bauwerksabdichtung<br />
DR. KERNER<br />
Denken und Handeln für die Zukunft<br />
Ich bin Erfinder der Auffangwanne aus Kunststoffbahnen und habe über 60 Jahre Berufserfahrung als Selbstständiger.<br />
Die Auskleidung mit HDPE ist nachhaltig, weil sie keine Nachbehandlung oder Pflege benötigt. Sie hat eine<br />
Haltbarkeit von mindestens 100 Jahren.<br />
Wir kleiden nach meinem System Behälter jeglicher Größen und Formen aus und versehen sie mit einem<br />
Leckage-Erkennungs-System (LES). Einwandige Behälter können zu doppelwandigen umgerüstet werden. Das<br />
Verfahren ist geeignet für Fermenter, Nachgärer und Endlager.<br />
Die Auskleidung ist gegen aggressive Medien beständig.<br />
Unsere Leistungen:<br />
• Bodenabdichtungen (Tiefbau)<br />
• Behälterabdichtungen, Leckschutzauskleidung<br />
• Schwimmbad- und Teichabdichtungen<br />
Kontakt:<br />
Dipl.-Ing.-Agr. Franz Kerner<br />
Hohewartstr. 131<br />
70469 Stuttgart<br />
Tel.: 0711 – 81 44 59 I Fax: 0711 – 85 34 19 I E-Mail: info@dr-ing-kerner.de I Website: www.dr-ing-kerner.de<br />
89
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Mit intensiver<br />
Wärmenutzung<br />
sinkende<br />
Stromerlöse<br />
kompensieren<br />
Die Fischmast ist<br />
eine Möglichkeit,<br />
die erzeugte Energie<br />
einer Biogasanlage zu<br />
verwerten.<br />
In nächster Zeit endet für immer mehr Biogasanlagen der erste Vergütungszeitraum im<br />
EEG. Für Betreiber der Anlagen stellen sich damit Zukunftsfragen. Die Kernfrage ist: Wie<br />
die Anlage weiterbetreiben bei sinkenden Stromerlösen in der EEG-Anschlussförderung?<br />
Klar ist, dass die Substratkosten sinken und zusätzliche Einnahmequellen erschlossen<br />
werden müssen. Nachfolgend ein Modell-Beispiel mit einer Lohn-Fischmast, in dem die<br />
Wärmenutzung eine größere Bedeutung gewinnt.<br />
Von Rainer Casaretto und Dr. Petra Rabe<br />
Die fiktive bestehende Biogasanlage fällt 2024<br />
aus der Festvergütung des 2004er EEG. Der<br />
Betreiber sieht in der Stromerzeugung aus<br />
Biogas keine vernünftige Perspektive für die<br />
Zukunft. Die erzeugte thermische Energie kann derzeit<br />
nicht verwertet werden und muss in den Sommermonaten<br />
weggekühlt werden. Die Altanlage ist ausgelegt<br />
für 1,6 Megawatt (MW) elektrische Leistung und setzt<br />
bisher 21.000 Tonnen (t) Maissilage, 5.800 t Zuckerrüben,<br />
2.500 t Hühnertrockenkot (HTK) und 1.600 t<br />
Rindermist ein.<br />
Das Behältervolumen beträgt 7.300 Kubikmeter (m³)<br />
in der Fermentation und 15.000 m³ zur Lagerung. Eine<br />
bestehende Aquakultur benötigt eine Ausweitung ihrer<br />
Produktion um weitere 400 Tonnen Schlachtgewicht<br />
pro Jahr. Sie hat den Marktzugang, übernimmt eine<br />
Abnahmegarantie für diese 400 Tonnen und garantiert<br />
einen Mindestpreis pro Kilogramm Schlachtgewicht.<br />
Die Aufgabe für die bestehende Biogasanlage besteht<br />
darin, die für die Fischmast benötigte Wärme und<br />
Elektrizität zu liefern und die Setzlinge, die ihr von der<br />
Aquakultur geliefert werden, bis zum Schlachtgewicht<br />
zu mästen (Lohnmästerei). Gleichzeitig sollen die<br />
Kosten für die eingesetzten Substrate gesenkt werden,<br />
indem vorwiegend landwirtschaftliche Reststoffe in<br />
der Biogasanlage eingesetzt werden. Um diese in der<br />
Biogasanlage verwerten zu können, ist das Vorschalten<br />
einer semi-aeroben Hydrolyse vor den Fermenter<br />
vorgesehen.<br />
Die notwendige Investition in eine Anlage zur Fischmast<br />
und ihr Betrieb erfolgen innerhalb der Biogas-<br />
Gesellschaft, die Abgabe von Strom und Wärme ist<br />
damit ein betriebsinterner Verbrauch. Zwischen Biogasabteilung<br />
und Fischmastabteilung wird verrechnet,<br />
Unternehmensziel ist nicht mehr die Erzeugung<br />
von elektrischer Energie, sondern die Erzeugung von<br />
ökologisch besonders wertvollem Fischfleisch, das frei<br />
von Antibiotika und Mikroplastik ist und zudem eine<br />
negative CO 2<br />
-Bilanz aufweist.<br />
Im Folgenden simulieren wir eine Musteranlage auf<br />
Basis der bestehenden Anlage. Die Anlage sei per<br />
2024 vollständig abgeschrieben und schuldenfrei.<br />
FOTO: ADOBE STOCK_YURII ZUSHCHYK<br />
90
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
Tabelle 1: Technische Parameter<br />
Tabelle 2: Rezeptur<br />
Stromerzeugung<br />
4.459.599 kWh<br />
Geflügelmist<br />
2.350 t<br />
Wärmeerzeugung<br />
5.224.200 kWh<br />
Stroh<br />
3.716 t<br />
Eigenstromverbrauch Gärstrecke<br />
334.852 kWh<br />
Summe Rohstoffe<br />
6.066 t<br />
Wärmeverbrauch Gärstecke 28,00 %<br />
Rohgasmenge aus dieser Rezeptur<br />
1.840.100 Nm³<br />
Wärmeverbrauch Gärstecke<br />
1.462.776 kWh<br />
Mittlere Rohgasmenge je Tonne der Rezeptur<br />
303,35 Nm³<br />
Stromverbrauch Fischmast<br />
275.700 kWh<br />
Methangehalt im Rohgas der Rezeptur 59,30 %<br />
Wärmeverbrauch Fischmast<br />
3.650.000 kWh<br />
Methanmenge<br />
1.091.179 Nm³<br />
Gesamtwärmeverbrauch<br />
5.112.776 kWh<br />
Mittlere Methanmenge je Tonne aus der Rezeptur<br />
179,88 Nm³<br />
Stromverkauf nach Eigenverbrauch<br />
3.849.047 kWh<br />
Gesamte gewonnene Bioenergie<br />
10.876.875 kWh<br />
Ausschreibungserlös<br />
12,79 ct/kWh el<br />
Mittlere Energiedichte pro Tonne Rohstoff<br />
1.793 kWh<br />
Ausschreibungserlös 492.293 €<br />
Quelle: Dr. Rabe und eigene Berechnungen<br />
Abseparierte Gärrestmasse<br />
Quelle: Dr. Rabe und eigene Berechnungen<br />
8.541 t<br />
Tabelle 3: Herleitung der Kosten für elektrische und<br />
thermische Energie<br />
Tabelle 4: Investition in eine Fischmastanlage für<br />
400 Tonnen Schlachtgewicht pro Jahr<br />
Zugeführte Bioenergie<br />
Erzeugte BHKW-Energie<br />
Verlust<br />
10.876.875 kWh<br />
9.683.799 kWh<br />
1.193.076 kWh<br />
Gebäude und maschinelle Anlagen 2.000.000 €<br />
Bodenwert 250.000 €<br />
Investitionssumme 2.250.000 €<br />
Produktionskosten 547.991 € 5,66 ct/kWh<br />
Produktionskosten el. 252.362 € 2,61 ct/kWh el<br />
Produktionskosten th. 295.629 € 3,05 ct/kWh th<br />
Förderfähige Summe 2.000.000 €<br />
Verlorener Zuschuss 47 %<br />
Verlorener Zuschuss 940.000 €<br />
Eigenkapital 250.000 €<br />
Fremdkapital 1.060.000 €<br />
Es werden also keine Buchungen für Abschreibungen<br />
oder Fremdkapitalzinsen aus der Altanlage stattfinden.<br />
Die folgenden Berechnungen erfolgen ohne jeglichen<br />
Aufschlag von Steuern oder Gebühren. Die sich so ergebenden<br />
Werte können die Leser somit um ihre individuellen<br />
Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen<br />
ergänzen.<br />
Ausgangsdaten für die neue Simulationsrechnung gemäß<br />
Fischmastbedarf: Der Betreiber geht von einem<br />
Ausschreibungserlös von 12,79 Cent (ct) je Kilowattstunde<br />
(kWh) elektrisch aus, da er sich in der Nordregion<br />
befindet (siehe hierzu Seite 46 im Biogas-Journal-<br />
Sonderheft vom Februar <strong>2021</strong>). Der nebenstehenden<br />
Tabelle 2 kann man entnehmen, dass der Massestrom<br />
auf 6.066 t signifikant reduziert wurde. Die abseparierte<br />
Gärrestmasse beträgt mit 8.541 t mehr als die<br />
zugeführte Rohstoffmasse, weil die zur Verdünnung<br />
benötigte Fischgülle in der festen Phase der Gärrestmasse<br />
enthalten ist.<br />
Hier wurde auf der Basis der rheologischen Anforderungen<br />
genau berechnet, welche Menge Fischgülle<br />
zugeführt werden muss, um die Durchmischbarkeit<br />
zu gewährleisten. Der Methangehalt wurde durch die<br />
semi-aerobe Hydrolyse auf 59,30 Prozent angehoben,<br />
die mittlere Energiedichte aus Stroh und Geflügelmist<br />
beträgt 1.793 kWh, die NH 4<br />
-N-Fracht liegt bei 5,0<br />
Gramm pro Liter.<br />
Tabelle 3 zeigt die dem Blockheizkraftwerk (BHKW)<br />
zugeführte Bioenergie aus den fermentierten Rohstoffen,<br />
die vom BHKW daraus erzeugte Energie in elektrischer<br />
und thermischer Form sowie den Energieverlust,<br />
der produktionsimmanent ist. Würde man, wie branchenüblich,<br />
nur die Kosten in ct pro kWh elektrisch<br />
ausdrücken, ergäben sich: 5,66 ÷ 0,41 = 13,80 ct/<br />
kWh ohne AfA, Gebühren und Zinsen aus Altschulden.<br />
Tabelle 4 ermöglicht uns eine genaue Zuordnung der<br />
jeweiligen Kosten in der Fischmast.<br />
Tabelle 4 zeigt die Summe, für die der Betreiber/Investor<br />
haftet. Das sind die 250.000 Euro Eigenkapital<br />
durch einen möglichen Verlust des eingebrachten Geländes<br />
und die Haftung für das geliehene Fremdkapital<br />
von 1.060.000 Euro. Sein Unternehmerlohn<br />
91
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Tabelle 5: Kostenkalkulation Fischmast für 400 t<br />
Schlachtgewicht pro Jahr<br />
Futtermenge<br />
360,00 t<br />
Futterkosten pro kg 0,97 €<br />
Summe Futterkosten 349.200 €<br />
Setzlinge 290.000<br />
Kosten pro Setzling 0,17 €<br />
Summe Kosten der Setzlinge 49.300 €<br />
Personalkosten 40.000 €<br />
Verwurf 1,00 %<br />
Verwurf<br />
4,00 t<br />
Transportkosten pro kg 0,13 €<br />
Transportkosten Schlachtmenge 51.480 €<br />
Jahresstrombedarf<br />
Preis je kWh Strom von der betriebseigenen BGA<br />
275.716 kWh<br />
0,00 ct/kWh<br />
Stromkosten 0 €<br />
Jahreswärmebedarf<br />
Preis je kWh Wärme von der betriebseigenen BGA<br />
3.650.000 kWh<br />
0,00 ct/kWh<br />
Wärmekosten 0 €<br />
Wasserbedarf 30.000 m³<br />
Preis je m³ 0,80 €<br />
Wasserkosten 24.000 €<br />
Gesamtkosten Fischmast 513.980 €<br />
Tabelle 6: Kalkulation aller Erlöse<br />
Erlöskalkulation für verkaufte Fischmenge<br />
Tabelle 7: Investorensicht ohne mögliche Erlöse<br />
aus dem Verkauf von Gewürzen (Aquaponik) oder<br />
CO 2<br />
-Erlösen<br />
396,00 t<br />
Preis pro kg Schlachtgewicht Wels 2,02 €<br />
Umsatzerlös aus der Fischmast 798.092 €<br />
Stromerlös in der Ausschreibung 492.293 €<br />
Umsatzerlös gesamt 1.290.385 €<br />
Erlössumme Fischmast 798.092 €<br />
Erlössumme Stromverkauf 492.293 €<br />
Kostensumme BGA und Fischmast ohne Investitions-<br />
und Risikokosten der Fischmast und der<br />
Altschulden<br />
1.061.971 €<br />
Risikozinssatz 7,46 %<br />
Risikokosten = Unternehmerlohn für mögliche<br />
Fremdkapitalhaftung und Eigenkapitalverlust<br />
97.726 €<br />
Fremdkapitalzinsen 4,00 %<br />
Betrachtungszeit in Jahren 10<br />
Annuität aus Altschulden 0 €<br />
Annuität aus der Investition in die Fischmast 130.688 €<br />
Delta 0 €<br />
max-F 1.060.000 €<br />
muss also mindestens die Risikokosten für diese Summe<br />
von 1.310.000 Euro decken und rechtfertigen.<br />
Tabelle 5 zeigt die reinen Betriebskosten aus der Lohnmast<br />
ohne die Annuität für das Fremdkapital und ohne<br />
Risikokosten. In Tabelle 7 ist die Kostensumme der<br />
BGA (Betriebskosten, Rohstoffkosten und Annuität<br />
aus der nötigen Zusatzinvestition in die semi-aerobe-<br />
Hydrolyse) enthalten. Diese Kostensumme erhöht sich<br />
nun um die Kosten für das getragene Unternehmerrisiko<br />
mit einem Zinssatz von 7,46 Prozent auf 1.310.000<br />
Euro und der Annuität für 1.060.000 Euro. Das Delta<br />
zwischen Kosten und Erlösen beträgt bei einem Erlös<br />
von 2,02 Euro pro kg Schlachtgewicht null.<br />
Betrüge es weniger als null, wäre das aufgenommene<br />
Fremdkapital nur zu bedienen, wenn sich die Risikokosten<br />
reduzieren würden. Kämen hingegen Zusatzerlöse<br />
aus dem Verkauf von CO 2<br />
-Zertifikaten oder dem Verkauf<br />
von Gewürzen aus Aquaponik zum Tragen, könnte<br />
bei einem unveränderten Preis pro kg Schlachtgewicht<br />
auch der Preis je kWh Stromerlös in der Ausschreibung<br />
abgesenkt werden.<br />
Dieser Fachartikel zeigt auf, wie sehr der benötigte<br />
Strompreis einer konventionellen Biogasanlage durch<br />
Wärmeerlöse bestimmt wird. Schon in der Vergangenheit<br />
hätte die mögliche Wärmeleistung eines BHKW<br />
deutlich höher liegen können, wenn nicht Fehlanreize<br />
im Sinne der Stromkennzahl dies verhindert hätten. Die<br />
intensivere Wärmenutzung ist also eine Möglichkeit,<br />
sinkende Stromerlöse auszugleichen. Nun können und<br />
sollen nicht alle Biogasanlagen künftig Fische mästen.<br />
Es geht vielmehr darum, kreative Ideen zu finden, um<br />
den Weiterbetrieb von Biogasanlagen bei überschaubarem<br />
Risiko zu erreichen.<br />
Autoren<br />
Dipl. Des. (FH) Rainer Casaretto<br />
Konzeption und Rentabilitätsrechnung<br />
BIOGAS-AKADEMIE ®<br />
info@biogas-akademie.de<br />
Dr. Petra Rabe<br />
Verfahrenstechnische Auslegungsplanung<br />
Bionova Biogas GmbH<br />
rabe@bionova-biogas.de<br />
92
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
Biogas, was sonst.<br />
Wir planen und bauen Biogas-Anlagen für alle Einsatzstoffe<br />
• Herstellerunabhängige Anlagenerweiterung und -umbau<br />
• Wir beraten und unterstützen bei der Teilnahme an der Ausschreibung<br />
• Neues zur EEG Reform <strong>2021</strong>, fragen sie einfach nach!<br />
• 25 Jahre Erfahrung<br />
Rechtsanwälte und Notare<br />
Seit vielen Jahren beraten und vertreten wir vornehmlich<br />
Betreiber und Planer kompetent und umfassend im<br />
- Recht der Erneuerbaren<br />
- Energien<br />
- Vertragsrecht<br />
- Gewährleistungsrecht<br />
- Energiewirtschaftsrecht<br />
- Umweltrecht<br />
- Immissionsschutzrecht<br />
- öffentlichen Baurecht<br />
- Planungsrecht<br />
Kastanienweg 9, D-59555 Lippstadt<br />
Tel.: 02941/97000 Fax: 02941/970050<br />
Ihre Ansprechpartner:<br />
RAuN Franz-Josef Tigges*<br />
RAuN Andreas Schäfermeier**<br />
RA W. Andreas Lahme*<br />
RA Dr. Oliver Frank*<br />
RA Martina Beese<br />
RA Daniel Birkhölzer*<br />
RAuN Katharina Vieweg-Puschmann LL.M.<br />
Maîtrise en droit<br />
* Fachanwalt für Verwaltungsrecht<br />
** Fachanwalt für Insolvenzrecht<br />
kanzlei@engemann-und-partner.de<br />
www.engemann-und-partner.de<br />
Biogas-Aufbereitungsanlagen<br />
• Biogas zur Tankstelle oder in das Erdgasnetz<br />
Monovergärung von Geflügelmist<br />
• Verfahren (patentiert)<br />
www.aev-energy.de<br />
AEV Energy GmbH®<br />
Hohendölzschener Str. 1a<br />
01187 Dresden<br />
+49 (0) 351 / 467 1301<br />
info@aev-energy.de<br />
AEV Energy GmbH ® – Büro Regensburg<br />
Gutweinstraße 5<br />
93059 Regensburg<br />
+49 (0) 941 / 897 9670<br />
info@aev-energy.de<br />
Die Gutachtergemeinschaft Biogas ist ein<br />
Team selbstständiger Experten verschiedenster<br />
Fachrichtungen, das Sie umfassend<br />
und kompetent zu allen Fragen rund<br />
um Biogasanlagen beraten und unterstützen<br />
kann.<br />
Gutachter<br />
Gemeinschaft<br />
Biogas<br />
Gutachtergemeinschaft Biogas GmbH<br />
Lantbertstr. 50 . 85356 Freising<br />
Tel +49 / 8161/ 88 49 546<br />
E-Mail info@gg-biogas.de<br />
www.gg-biogas.de<br />
Zweigniederlassung Lübeck:<br />
Ovendorferstr. 35 . 23570 Lübeck<br />
Tel +49 / 4502 / 7779 05<br />
Sachverständigenbüros<br />
auch in Krefeld, Burscheid (Köln) und Lüneburg<br />
Wertgutachten (Ertrags-, Zeit- und Verkehrswert)<br />
Erneuerungsgutachten zur EEG-Laufzeitverlängerung<br />
Schadensgutachten (Technik, Bau, Biologie)<br />
Bescheinigungen von Umweltgutachtern<br />
Gutachten zu Investitionsentscheidungen<br />
Wir machen Ihr Biogas CLEAN und COOL!<br />
Individuelle Anlagen von Züblin Umwelttechnik<br />
zur Reinigung und Kühlung von Biogas<br />
• CarbonEx Aktivkohlefilter zur<br />
Feinentschwefelung von Biogas<br />
• GasCon Gaskühlmodul zur<br />
Kühlung von Biogas<br />
• BioSulfidEx zur biologischen<br />
Entschwefelung von Biogas<br />
• BioBF Kostengünstiges System zur<br />
biologischen Vorentschwefelung<br />
NEU!<br />
Züblin Umwelttechnik GmbH, Maulbronner Weg 32, 71706 Markgröningen<br />
Tel. +49 7145 9324-209 • umwelttechnik@zueblin.de • zueblin-umwelttechnik.com<br />
93
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Wärme aus Biogas,<br />
Holz und Wind<br />
Lucy Gronitz vom Ingenieurbüro<br />
Sing zeigt<br />
auf die Power-to-Heat-<br />
Anlage. Sie besteht aus<br />
drei gleichen Modulen<br />
und leistet insgesamt<br />
4,7 MW el<br />
.<br />
Mit einem für den ländlichen Raum neuartigen Sektorenkopplungs-Projekt baut die<br />
oberbayerische Gemeinde Fuchstal derzeit ihre Wärmeversorgung aus: Überschüssiger<br />
Windstrom soll mit einer Power-to-Heat-Anlage in Wärme umgewandelt und in einem<br />
5.000 Kubikmeter großen „Wärmetopf“ gespeichert werden. Parallel dazu wurde die<br />
Wärmeerzeugung einer Biogasanlage um ein komplettes Holzheizwerk erweitert.<br />
Von Christian Dany<br />
In der Gemeinde Fuchstal beginnt die Energiezukunft.<br />
Was so unbestimmt bedeutungsschwanger<br />
klingt, gilt in der im Voralpengebiet direkt am Lech<br />
gelegenen Gemeinde ganz konkret: „Energiezukunft<br />
Fuchstal“ heißt das neue Großprojekt, das<br />
dort zurzeit umgesetzt wird. Zentral gelegen zwischen<br />
den Hauptorten Asch und Leeder baut die Gemeinde<br />
eine Heizzentrale, in der aus überschüssigem Windstrom<br />
Wärme produziert und einem 5.000 Kubikmeter<br />
(m³) großen Speicher zugeführt wird.<br />
Bei den vier Fuchstaler Windrädern mit 12 Megawatt<br />
(MW) Gesamtleistung sind rund 600.000 Kilowattstunden<br />
(kWh) Strom im Jahr von der Abregelung<br />
bei negativen Börsenstrom-Preisen gemäß Paragraf<br />
51 EEG betroffen. Weil gleichzeitig das Nahwärmenetz<br />
step-by-step wächst, hat die 4.000-Einwohner-<br />
Gemeinde zusammen mit einem Ingenieurbüro das<br />
Sektorenkopplungs-Projekt entwickelt, zu dem auch<br />
noch ein Batteriespeicher gehört. Die Investitionssumme<br />
des Projektes von 5,2 Millionen (Mio.) Euro wird<br />
vom Bundesumweltministerium (BMU) im Rahmen<br />
der Nationalen Klimaschutzinitiative mit 3,9 Mio. Euro<br />
gefördert.<br />
Regionalstrom und Wärmenetz<br />
Fuchstal ist weit über seine Grenzen hinaus als Vorreiterkommune<br />
für Erneuerbare Energien bekannt. Mehr<br />
als das Anderthalbfache des Stromverbrauchs in der<br />
gesamten Gemeinde wird hier aus Windkraft, Photovoltaik,<br />
Biogas und Kleinwasserkraft vor Ort erzeugt. Seit<br />
letztem Jahr können die Bürger „Fuxstrom“ beziehen;<br />
eine eigene, von einem Regionalstrom-Kooperationspartner<br />
angebotene Strommarke. Das Wärmenetz mit 4<br />
Kilometern Trassenlänge und 150 Anschlussnehmern<br />
betreibt die Gemeinde selbst, während die Wärme von<br />
einem Biogas-Unternehmen geliefert wird.<br />
Die im Außenbereich von Leeder gelegene Biogasanlage<br />
von Roland Gröber und Werner Ruf trägt mittlerweile<br />
verstärkt zur „Energiezukunft“ bei: Sie ist schon<br />
über eine 1,2 Kilometer lange Leitung mit der neuen<br />
Heizzentrale verbunden. Weil die Anlage mit ihrer Wärmeauskopplung<br />
von rund 600 Kilowatt (kW) zu klein<br />
für das wachsende Netz geworden war, hat die Gemeinde<br />
nach einer weiteren Wärmequelle gesucht. „Wir haben<br />
angeboten, auch die Spitzenlast mit CO 2<br />
-neutraler<br />
Wärme aus Waldhackschnitzeln zu decken und die<br />
Wärme aus einer Hand zu liefern. Im Wärmelieferver-<br />
FOTOS: CHRISTIAN DANY<br />
94
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
„Energiezukunft“ im Bau: Die Gemeinde Fuchstal baut zurzeit ihre neue Heizzentrale. Hier<br />
wird eigentlich keine Energie erzeugt, sondern Energie umgewandelt und gespeichert.<br />
Mit Power-to-Heat wird aus überschüssigem Windstrom Wärme zur Zwischenlagerung in<br />
einem 5.000 m³ großen Speicher.<br />
Der 5.000-m³-Wärmespeicher: Das Heizwasser ist<br />
bereits eingefüllt. Als nächstes wird eine Dämmschicht<br />
angebracht und der Speicher dann mit<br />
einer grün-grauen Trapezblech-Haut verkleidet.<br />
trag ist festgehalten, dass wir bevorzugt Hackschnitzel<br />
aus dem Gemeindewald beziehen“, verrät Ruf. So bauten<br />
Gröber und er letztes Jahr am Biogas-Standort ein<br />
komplettes Holzheizwerk mit 1 MW Feuerungswärmeleistung<br />
und investierten dafür 1,5 Mio. Euro.<br />
Gegen neue Gärstrecke entschieden<br />
Das sei Ruf zufolge eine wohlüberlegte unternehmerische<br />
Entscheidung gewesen. Wesentlicher Vorteil sei,<br />
dass Teile der erforderlichen Logistik an dem Standort<br />
schon da seien: eine Fahrzeugwaage etwa, das Bürogebäude<br />
und natürlich der Anschluss ans Wärmenetz.<br />
Zwar hätten auch Spitzenlastdeckung im Wärmenetz<br />
und Flexibilisierung der Biogasanlage miteinander<br />
verbunden werden können, aber: „Mit dem Zubau von<br />
BHKW-Leistung wäre es nicht getan gewesen. Ich krieg<br />
im Winter nicht mehr Gas aus dem System raus. Das<br />
heißt, wir hätten eine komplett neue Gärstrecke und<br />
einen Gasspeicher dazubauen müssen.“<br />
„In der Ausbildung hab ich viel über Hydraulik und<br />
Pumpenergie gelernt“, sagt Ruf. Der Fischwirtschaftsmeister<br />
betreibt eine eigene Fischzucht und wenige<br />
Kilometer entfernt eine weitere Biogasanlage, die ein<br />
Seniorenheim mit Wärme versorgt. Ruf denkt in Effizienzkategorien:<br />
Solarstrom vom eigenen Betriebsgebäude<br />
im Verbund mit einem Batteriespeicher deckt<br />
den Eigenstrom-Verbrauch der Biogasanlage in Leeder.<br />
Diese ging 2005 ans Netz. 2012 wurde die An-<br />
Heizkreisverteiler mit<br />
den zwei Platten-<br />
Wärmetauschern im<br />
Betriebsgebäude.<br />
Power-to-Heat-Anlage.<br />
95
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
„Die Energiewende bei<br />
uns daheim“ ist eine<br />
Karte an der Tür von<br />
Bürgermeister Erwin<br />
Karg betitelt.<br />
schlussleistung von 750 auf 1.000 kW erhöht. Das<br />
Biogas wird seitdem in vier gleichen Blockheizkraftwerken<br />
(BHKW) verwertet, jedes leistet 250 kW el<br />
und<br />
200 kWth. Der hohe elektrische Wirkungsgrad ist dem<br />
sogenannten „Compounder“ zu verdanken, mit dem<br />
die Motoren ausgestattet sind. „Das ist eine dem Turbolader<br />
nachgeschaltete Turbine zur Nutzung des Abgasdrucks“,<br />
erklärt der Energiewirt.<br />
Jahreszeitliche Verschiebung<br />
Ruf glaubt an die Zukunft von Biogas hier am Standort:<br />
„In zwei oder drei Jahren gehen wir in die Ausschreibung.“<br />
Ihm ist bewusst, dass er mit der bestehenden<br />
Ausstattung aufgrund der Flexibilisierungsanforderungen<br />
dann auf 450 kW Bemessungsleistung reduzieren<br />
muss. Das möchte er durch jahreszeitliche Verschiebung<br />
– Ruf: „der größte Vorteil der Biogaserzeugung“ –<br />
erfüllen. Ein oder zwei BHKW könnten dann im Sommer<br />
zeitweise stillstehen. Dank des großen Wärmespeichers<br />
der Gemeinde reiche die Biogaswärme dennoch<br />
für die sommerliche Grundlast.<br />
Für die neue Hackschnitzel-Trocknung wird in Leeder<br />
Restwärme eingesetzt: zum einen von den Ladeluftkühlern<br />
der vier BHKW gewonnene, noch 50 bis 60<br />
Grad Celsius warme Luft. Zum anderen lässt sich das<br />
rücklaufende Heizwasser des Wärmenetzes, das im<br />
Sommer wegen der geringen Abnahme noch 60 Grad<br />
Celsius hat, zur Erwärmung der Trocknungsluft nutzen.<br />
Das senkt die Rücklauftemperatur auf 50 Grad Celsius,<br />
verbessert die Temperaturspreizung und damit die Effizienz<br />
im Netz. Ruf hat bislang auch den Netzbetrieb<br />
betreut. Rechtzeitig zum Bau der Heizzentrale hat die<br />
Gemeinde nun hierfür einen Techniker eingestellt. Um<br />
die Heizzentrale und ihre Bestandteile zu erklären, ist<br />
Lucy Gronitz vom planenden Ingenieurbüro Sing in<br />
Landsberg aus der nahen Kreisstadt auf die Baustelle<br />
gekommen: In einer Ecke des Grundstücks befindet<br />
sich die Trafostation, in der der Windstrom auf 690<br />
Volt Wechselspannung umgespannt wird und dann zur<br />
Power-to-Heat-(P2H) Anlage gelangt. Der Elektroheizer<br />
hat eine Leistungsaufnahme von etwa 4,7 MW.<br />
Batteriespeicher mit 3,2 MWh Kapazität<br />
„Die Anlage besteht aus drei gleichen Modulen“, erläutert<br />
Gronitz, „das sind Durchlauferhitzer mit Heizstäben,<br />
die als Ohmscher Widerstand wirken. Der Wirkungsgrad<br />
liegt bei 95 Prozent.“ In einem Container<br />
werde noch der Batteriespeicher mit einer Kapazität<br />
von 3,2 Megawattstunden (MWh) und einer Ladeleis-<br />
EXCELLENCE – MADE TO LAST<br />
WEGWEISENDE<br />
SEPARATIONSTECHNIK<br />
• höchste Durchbruchsicherheit und<br />
TS-Gehalte bis zu 38 % dank<br />
Multi Disc Technik<br />
• Förderschnecke mit Faserstoffbürste<br />
verhindert metallische Reibung und ANDERE REDEN.<br />
sorgt für lange Stand zeiten und WIR MACHEN.<br />
kon tinuierliche Selbstreinigung des<br />
Filtersiebes<br />
• anschlussfertige Komplettaggregate<br />
mit perfekt aufeinander abgestimmten<br />
Komponenten: Separator, Pumpe und<br />
Steuerungstechnik „aus einer Hand“<br />
• vier Baugrößen mit max. Durchsatzleistung<br />
von 150 m³/h je Gerät<br />
96<br />
Börger GmbH • D-46325 Borken-Weseke • Tel. +49 2862 9103 0 • info@boerger.de<br />
www.boerger.de
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
„Die ideale Vorlauftemperatur<br />
soll künftig bei<br />
80 Grad Celsius liegen“<br />
Lucy Gronitz<br />
tung von 5,8 MW el<br />
untergebracht. Falls mehr Strom<br />
ankomme, als die P2H-Anlage aufnehmen könne oder<br />
wenn der Wärmespeicher schon voll beladen sein sollte,<br />
wandere der Strom in den Lithium-Ionen-Speicher,<br />
der dann zeitversetzt die Energie zur Wärmeerzeugung<br />
bereitstelle. „Wärmespeicher und P2H-Anlage sind<br />
hydraulisch vom Wärmenetz getrennt. Das verhindert<br />
bei einer möglichen Leckage im Netz ein Austreten von<br />
Riesenmengen an Wasser aus dem Wärmespeicher“,<br />
begründet Gronitz die indirekte Einbindung. Die Kegeldachspitze<br />
des Stahlriesen sei 16 Meter hoch bei<br />
einem Durchmesser von 20 Meter. Soeben habe die<br />
Befüllung des 5.000 m³ fassenden Wärmespeichers<br />
mit Wasser abgeschlossen werden können.<br />
„Wenn der Speicher dann in Betrieb ist, wird die Wärme<br />
geschichtet zwischengespeichert und im Bedarfsfall<br />
über den Plattenwärmetauscher ins Netz abgegeben“,<br />
so die Planerin. Sowohl die Speicherung der Wärme<br />
über längere Zeiten als auch die Ein- und Ausspeisung<br />
über Wärmetauscher sorgten für Verluste, sodass das<br />
Ingenieurbüro mit einem Wirkungsgrad des Speichers<br />
von 80 Prozent rechne.<br />
„Die P2H-Anlage speist den Wärmespeicher mit 95<br />
Grad heißem Wasser. Bei einem Wärmetausch-Vorgang<br />
verlieren wir 5 Grad Celsius Temperatur“, erklärt Gronitz,<br />
„bislang ist das Netz mit einer Vorlauftemperatur<br />
von 78 Grad Celsius und 55 Grad Celsius im Rücklauf<br />
betrieben worden. Die ideale Vorlauftemperatur soll<br />
künftig bei 80 Grad Celsius liegen, was im Normalfall<br />
von der Biogasanlage erreicht werden kann. Falls sie<br />
dennoch darunter liegt, wird zusätzlich die gespeicherte<br />
Wärme aus dem Wärmespeicher genutzt, um die<br />
Temperatur anzuheben.“ Der Großwärmespeicher solle<br />
optimal in die Landschaft integriert werden. Hierzu<br />
werde das Grundstück noch umlaufend begrünt. Außerdem<br />
bekomme der Speicher unten eine grüne und oben<br />
eine graue Trapezblechverkleidung.<br />
Bei der Besprechung im Rathaus zeigt sich Bürgermeister<br />
Erwin Karg hoch zufrieden, dass die Wärmversorgung<br />
jetzt auf drei soliden Beinen steht: Biogas und der<br />
„Wärmetopf“, wie die Fuchstaler ihren Großspeicher<br />
nennen, in der Grundlast und Holzhackschnitzel in der<br />
Spitzenlast. Etwas besorgt über die Wirtschaftlichkeit<br />
des Modells, aus Windstrom Wärme zu erzeugen,<br />
Werner Ruf am<br />
Steuerungsdisplay der<br />
Wärmeauskopplung<br />
von Biogas-BHKW<br />
und Holzheizwerk. Erstaunlich<br />
ist, dass der<br />
Holzheizkessel im Mai<br />
wegen der anhaltenden<br />
Kälte noch in Betrieb<br />
sein musste.<br />
RondoDry<br />
Rotationstrockner zur<br />
Verdunstung von Flüssigkeiten.<br />
Modular | Effizient | Leistungsstark<br />
• Bis zu 4.000 m 3 Massenreduzierung<br />
• Stromkostenneutral durch eingesparte<br />
Notkühlerlaufzeiten<br />
• Bis zu 80 % Abscheidung des org. NH4-N und<br />
daraus Herstellung von mineralischer ASL<br />
Infos unter +49 8631 307-0<br />
97
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Hackschnitzel-Lager<br />
auf dem Holzheizwerk<br />
des Unternehmens<br />
Gröber-Ruf sowie die<br />
Hackschnitzel-Trocknungsanlage.<br />
ist allerdings Gerhard Schmid, Geschäftsstellenleiter<br />
der Verwaltungsgemeinschaft im Rathaus. Der Grund:<br />
Obwohl die Fuchstaler ihren eigenen Strom nutzen,<br />
müssen sie womöglich die volle EEG-Umlage zahlen.<br />
„‚Eigenversorgung‘ [ist] der Verbrauch von Strom, den<br />
eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren<br />
räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage<br />
selbst verbraucht, wenn der Strom nicht<br />
durch ein Netz durchgeleitet wird und diese Person<br />
die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt“, definiert<br />
Paragraf 3 Nr. 19 EEG.<br />
Gemeindeeigene Mittelspannungsleitung<br />
Um dieser Definition zu entsprechen, müssen einige<br />
Hürden genommen werden: Der Windpark wird eigentlich<br />
von der „Bürgerwindkraft Fuchstal GmbH & Co.<br />
KG“ betrieben. An der KG mit 116 Investoren hält die<br />
Im Betriebsgebäude der Heizzentrale sind drei Ausgleichsbehälter für<br />
Volumenänderungen des Heizwassers im Wärmenetz untergebracht.<br />
Die Biogasanlage von Roland Gröber und Werner Ruf liefert die<br />
Grundlast für das gemeindeeigene Nahwärmenetz. Im Hintergrund<br />
(schwarz) ist das neue Holzheizwerk zu erkennen.<br />
Gemeinde 49 Prozent der Anteile. „Sobald die Windräder<br />
wegen negativer Strompreise abgeregelt werden<br />
müssen, pachten wir als Gemeinde sie und werden<br />
Anlagenbetreiber“, erläutert Schmid. Damit wollen die<br />
Fuchstaler neue Wege beschreiten. Schmid kennt keinen<br />
anderen Fall, in dem ein derartiges Pachtmodell<br />
umgesetzt worden wäre. Auch die Vorgabe, den Strom<br />
nicht durch ein Netz durchzuleiten, erfülle die Gemeinde:<br />
„Wir haben eine 8,9 Kilometer lange Mittelspannungsleitung<br />
von dem in einem Waldgebiet gelegenen<br />
Windpark bis zur Heizzentrale verlegen lassen“, sagt<br />
Schmid. Der Leitungsbau, der im Umfang der BMU-<br />
Förderung enthalten sei, habe 700.000 Euro gekostet.<br />
Strittig ist jedoch der „unmittelbare räumliche Zusammenhang“.<br />
Selbst der „Leitfaden zur Eigenversorgung“<br />
der Bundesnetzagentur nennt hier keine eindeutige<br />
Entfernung, sondern führt als Kriterium eine „qualifizierte<br />
räumlich-funktionale Nähe-Beziehung“ an. Bürgermeister<br />
Karg bringt das auf die Palme: „Wegen 10H<br />
müssen wir mit der Windkraft kilometerweit vom Ort<br />
weg und hier sollen wir dafür noch zusätzlich benachteiligt<br />
werden.“<br />
98
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
Ziel: privilegierte Eigenversorgung<br />
Klar ist: Erkennt der Übertragungsnetzbetreiber den<br />
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang an, gilt das<br />
Fuchstaler Projekt durch die Nutzung erneuerbaren<br />
Stroms als „privilegierte Eigenversorgung“ und muss<br />
nur 40 Prozent EEG-Umlage zahlen. Ab 2022 wären<br />
das 2,4 anstatt 6,0 Cent pro kWh – ein gravierender<br />
Unterschied, denn 6,5 Cent Brutto-Arbeitspreis kostet<br />
in Fuchstal der Nahwärmebezug. „Wenn dann auch<br />
noch 2 Cent Stromsteuer dazukommen, wird es ein<br />
‚Draufzahl-Geschäft‘“, sagt Schmid, in der Zweitfunktion<br />
auch Kämmerer der Gemeinde.<br />
Noch im Sommer soll die „Energiezukunft“ in Fuchstal<br />
mit der Inbetriebnahme der Heizzentrale starten;<br />
Gronitz zufolge erstmal im „Handbetrieb“. Rechtzeitig<br />
zum Beginn der Heizperiode soll dann aber die Steuerung<br />
für den automatischen Betrieb erprobt sein.<br />
„Sowohl mit den Windkraftanlagen als auch dem Wärmenetz<br />
verdient die Gemeinde gutes Geld“, beteuert<br />
Schmid, „wir wollen mit unseren Projekten den Grundstein<br />
für folgende Generationen legen, damit diese auf<br />
eine nachhaltige, möglichst unabhängige Energieversorgung<br />
aufbauen können.“<br />
Autor<br />
Christian Dany<br />
Freier Journalist<br />
Gablonzer Str. 21 · 86807 Buchloe<br />
0 82 41/911 403<br />
01 60/97 900 831<br />
christian.dany@web.de<br />
Roland Gröber (links) und Werner Ruf.<br />
STELLENMARKT<br />
Zur professionellen Unterstützung unseres Bereiches Technik suchen wir baldmöglichst<br />
am Standort Kiel eine fachlich versierte und menschlich überzeugende<br />
Persönlichkeit als<br />
Planungs- und Projektingenieur m/w/d<br />
für den Bereich erneuerbare Energien – Biogasanlagen<br />
Ihre Aufgaben:<br />
• Eigenverantwortliche Umsetzung von regenerativen Energieprojekten<br />
• Einholung und Zusammenstellung aller erforderlichen Informationen, Dokumente,<br />
Gutachten und Stellungnahmen im Rahmen der Genehmigungsverfahren<br />
• Planung und Konzeptionierung von Anlagen im Bereich Biogasanlagen und<br />
Biogasaufbereitungsanlagen<br />
• Dimensionierung von technischen Lösungen<br />
Ihre Qualifikation:<br />
• abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium als Diplom-Ingenieur/in oder Master<br />
in der Fachrichtung Verfahrenstechnik, Maschinenbau, Umwelttechnik, Abwassertechnik<br />
(neue Technologien) oder vergleichbar<br />
• Berufserfahrung im Bereich Biogas- oder Großanlagenbau<br />
• Gewissenhafte, selbstständige sowie strukturierte Arbeitsweise<br />
Was wir bieten:<br />
• Leistungsgerechte Vergütung<br />
• Eigenverantwortliches Aufgabengebiet<br />
• Familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung<br />
• Kurze Wege und rasche Entscheidungen<br />
• Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten<br />
• Teamorientiertes Arbeitsumfeld<br />
• Tiefgarage und Poolwagen<br />
Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen Arbeitsplatz zum<br />
nächst möglichen Zeitpunkt und eine leistungsgerechte<br />
Vergütung. Wenn Sie sich in diesem Anforderungsprofil wiederfinden,<br />
nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf oder senden<br />
uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen zu.<br />
Susanne Köhler · C4 Energie AG · Sophienblatt 60<br />
24114 Kiel · skoehler@c4energie.de · www.c4energie.de<br />
NEUE PERSPEKTIVEN<br />
Technisches Know-how, Qualität und Engagement<br />
zeichnen die Florack Energie GmbH<br />
als Teil des Führungsteams der Heinsberger<br />
Biogasanlage aus. Unsere motivierten Kolleginnen<br />
und Kollegen brauchen Verstärkung.<br />
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir<br />
Sie in Teilzeit als<br />
KOORDINATOR<br />
BIOGASANLAGE (m/w/d)<br />
Ihre Leidenschaft ist die nachhaltige Energiegewinnung<br />
und -versorgung, Sie kennen sich<br />
aus mit den technischen Komponenten einer<br />
Biogasanlage und haben Interesse an kaufmännischen<br />
Aufgaben im Energiebereich?<br />
Sie sind motiviert, teamfähig und bereit verantwortungsvolle<br />
Aufgaben zu übernehmen?<br />
Dann bewerben Sie sich noch heute bei<br />
Ina Florack.<br />
Florack Energie GmbH<br />
Markt 22 · 52525 Heinsberg<br />
info-energie@florack.de<br />
www.florack-energie.de<br />
www.team-vk.de<br />
99
PRAXIS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Anlage des Monats Mai<br />
Unsere Biogasanlage des Monats<br />
Mai steht im hohen Norden<br />
kurz vor der dänischen Grenze<br />
und heißt Anlage Biogas Hof<br />
Obdrup. Die 2005 in Betrieb<br />
gegangene NawaRo-Anlage wird von sieben<br />
Gesellschaftern betrieben und hat eine<br />
elektrische installierte Gesamtleistung von<br />
1,64 Megawatt. Vergoren werden Mais sowie<br />
Getreide-Ganzpflanzensilage und Sarvaszigras.<br />
Der Strom wird direkt vermarktet; die Wärme<br />
gelangt über Wärmeleitungen zu Schulen,<br />
Kindergärten, Altenheimen, Wohnsiedlungen,<br />
einem Freibad und einem<br />
landwirtschaftlichen Großbetrieb. Die<br />
Biogasanlage hat bereits an zahlreichen<br />
Forschungsprojekten teilgenommen und<br />
auch im Bereich alternative Energiepflanzen<br />
viel ausprobiert. Insgesamt vermeidet<br />
sie pro Jahr rund 7.000 Tonnen CO 2<br />
.<br />
Anlage des Monats Juni<br />
Auch die Biogasanlage des Monats Juni kommt aus dem Norden und<br />
steht im ostfriesischen Ardorf. Die Gemeinschaftsanlage Naturgas<br />
Ardorf GmbH & Co.KG hat eine installierte elektrische Leistung von<br />
3,21 Megawatt, die sich auf sieben flexibilisierte Blockheizkraftwerke<br />
verteilt. Diese<br />
erzeugen rund 16 Millionen Kilowattstunden<br />
klimafreundlichen<br />
Strom pro Jahr, was dem Bedarf<br />
von über 5.000 Haushalten entspricht.<br />
Mit der dabei anfallenden<br />
Wärme werden 140 Häuser,<br />
eine Schule, eine Turnhalle, ein<br />
Schwimmbecken, das Gemeindehaus<br />
und eine Kirche versorgt. Die<br />
Anlage vermeidet pro Jahr rund<br />
10.000 Tonnen CO 2<br />
.<br />
100
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
PRAXIS<br />
IHR PARTNER FÜR FÖRDER-,<br />
DOSIER- UND ZUFÜHRTECHNIK<br />
VARIO DOSIERCONTAINER<br />
von 7m³ bis 265m³<br />
einzigartiges Vario Schubbodensystem<br />
für 100% Grassilage und Mist<br />
in Teil- und Volledelstahl Ausführung<br />
geringer Energiebedarf<br />
Passende Rührtechnik für jedes Substrat<br />
VARIO COMPACT<br />
– Alle Rührwerkstypen<br />
– Über 25 Jahre Erfahrung<br />
– Optimierung, Nachrüstung, Tausch<br />
7m³ | 11m³| 16m³<br />
Tel. +49.7522.707.965.0 www.streisal.de<br />
speziell für Biogas-Kleinanlagen<br />
einzigartiges Vario Schubbodensystem<br />
für 100% Grassilage und Mist<br />
in Teil- und Volledelstahl Ausführung<br />
MOBILE NOTFÜTTERUNG<br />
9x in Deutschland<br />
weitere Produkte auf<br />
www.terbrack-maschinenbau.de<br />
101<br />
Terbrack Maschinenbau GmbH<br />
Tel.: +49 2564 394 487 - 0<br />
mail: technik@terbrack-maschinenbau.de<br />
www.terbrack-maschinenbau.de
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Untersuchungen zum Direkteinsatz von<br />
Biogas in Metallurgiebetrieben<br />
Im AiF-Projekt „Direkteinsatz von Rohbiogas in der Metallurgie zur Senkung der CO 2<br />
-<br />
Emissionen (MetaCOO)“ wurde der Biogaseinsatz in Thermoprozessanlagen als alternativer<br />
Energieträger zur Substitution von Erdgas untersucht. Zu den Zielen des Projektes zählten<br />
die Ermittlung des deutschlandweiten Energie- beziehungsweise (bzw.) Erdgasbedarfs sowie<br />
des Biogaspotenzials. Außerdem wurden die Auswirkungen des Biogaseinsatzes auf die<br />
Prozess- und Produktqualität im Hinblick auf eine technische Umsetzung für die Wärmebereitstellung<br />
in metallurgischen Thermoprozessen untersucht. Mit den gewonnenen Erkenntnissen<br />
könnte eine Umsetzung in einem Demonstrationsvorhaben einen entscheidenden<br />
Impuls bekommen.<br />
Von Elisabeth Grube, Patrick Heinrich, Marcus Röder und Nico Steyer<br />
Die Metallurgie zählt zu einer der deutschen<br />
Branchen, die einen sehr hohen Energiebedarf<br />
aufweist sowie hohe Treibhausgas-<br />
(THG)-Emissionen verursacht. Allein die<br />
berichtspflichtigen PRTR-Betriebe (PRTR:<br />
Pollutant Release and Transfer Register) der Roheisenund<br />
Stahlerzeugung haben einen Anteil von 6,4 Prozent<br />
der deutschlandweiten CO 2<br />
-Emissionen (Stand 2018;<br />
Quellen auf Nachfrage bei Autor:innen erhältlich).<br />
Vor allem die Prozesswärmebereitstellung erfolgt zumeist<br />
durch die Verbrennung von Erdgas. Biogas wird<br />
zurzeit in Deutschland entweder teilaufbereitet in<br />
Blockheizkraftwerken (BHKW) zur Strom- und Wärmeerzeugung<br />
eingesetzt oder aber nach einer aufwändigen<br />
Aufbereitung zu Biomethan ins Erdgasnetz<br />
eingespeist. Da seit diesem Jahr bei immer mehr Biogasanlagen<br />
die EEG-Vergütung endet, gewinnt die Suche<br />
nach neuen und lukrativen Einsatzmöglichkeiten<br />
für das produzierte Biogas stetig an Bedeutung. Der<br />
Einsatz in der Metallindustrie kann dabei eine lohnende<br />
Alternative darstellen.<br />
Durch die Verwendung von Biogas als Beimischkomponente<br />
zum Prozessgas kann ein „Greening“ der Herstellungsprozesse<br />
in der Metallindustrie durch die direkte<br />
Einsparung von CO 2<br />
erfolgen sowie der CO 2<br />
-Footprint<br />
der Produkte verbessert werden. Generell kann die Prozessgasumstellung<br />
auf Biogas eine Möglichkeit sein,<br />
um die klimapolitischen Ziele für den sehr energieintensiven<br />
Metallurgiesektor zu erreichen.<br />
Untersuchung der Biogaszumischung auf<br />
Verbrennungsverhalten<br />
Biogas weist im Vergleich zu Erdgas eine andere Gaszusammensetzung<br />
und damit einhergehend einen an-<br />
Mobile Brennkammer des GWI sowie Gasaufbereitung des DBI an der<br />
Biogasanlage der Stadtwerke Bielefeld am Standort Dornberg.<br />
Entnahme wärmebehandelter<br />
Metallproben.<br />
FOTOS: GWI<br />
102
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
Gegenüberstellung der Biogasanlagen (nach Produktionsgröße) und der Metallurgiestandorte.<br />
QUELLE: GWI<br />
deren Heizwert sowie eine andere Dichte<br />
auf. Zur Bewertung der Brennerfunktion<br />
bei unterschiedlichen Substitutionsraten<br />
wurden in den Technika des Gastechnologischen<br />
Instituts gGmbH (DBI) sowie des<br />
Gas- und Wärme-Instituts Essen e.V.(GWI)<br />
Experimente an Nieder- bzw. Hochtemperaturversuchsanlagen<br />
durchgeführt.<br />
Bei der Niedertemperaturanlage handelte<br />
es sich um ein Prüfflammrohr mit 30 Kilowatt<br />
(kW) Feuerungsleistung. In einem<br />
Hochtemperaturversuchsofen wurden zwei<br />
unterschiedliche industrielle Brenner mit<br />
verschiedenen Verfahren [konventioneller<br />
Diffusionsbrenner, flammenlose Oxidation<br />
(FLOX ® )] untersucht. Ziel war, den Einfluss<br />
des schwankenden Energiegehalts bei variierter<br />
Gaszusammensetzung (Erdgas und<br />
Biogas) zu bestimmen.<br />
Das Biogas wurde synthetisch als Gasgemisch<br />
bestehend aus Erdgas (>91 Volumenprozent<br />
CH 4<br />
) und Kohlenstoffdioxid<br />
hergestellt. Bei den Versuchen wurde die<br />
Zumischung von Biogas bis zu einer vollständigen<br />
Substitution von Erdgas erprobt<br />
(entsprechend 50 Volumenprozent CH 4<br />
bzw. Erdgas und 50 Volumenprozent CO 2<br />
im Brenngas). Es wurde festgestellt, dass<br />
eine Biogaszumischung bei herkömmlichen<br />
Erdgasbrennern bis hin zu hohen Substitutionsraten<br />
realisierbar ist, es aber ab<br />
einem Biogasanteil von 80 Volumenprozent<br />
zu Flammeninstabilitäten kommt.<br />
Im Allgemeinen führte der Biogaseinsatz<br />
zu geringeren Verbrennungstemperaturen,<br />
die sich mindernd auf die Stickoxidbildung<br />
auswirken, allerdings in der Prozessführung<br />
berücksichtigt werden müssen. Eine<br />
Änderung an der Brennerperipherie war in<br />
den Testfällen nicht notwendig, allerdings<br />
müssen die leistungsbezogen größeren<br />
Brenngasvolumenströme im Hinblick auf<br />
beispielsweise effektivere Rohrquerschnitte<br />
und Vordrücke in der realen Anwendung<br />
berücksichtigt werden.<br />
Feldversuch an der Biogasanlage<br />
Bielefeld-Dornberg<br />
Für die Untersuchung der Einflüsse der veränderten<br />
Verbrennungsatmosphäre sowie<br />
von (Roh-)Biogas auf die Eigenschaften<br />
metallischer Werkstoffe wurde ein Feldversuch<br />
an einer Biogasanlage der Stadtwerke<br />
Bielefeld im Stadtteil Dornberg durchgeführt.<br />
Für den Feldversuch wurde seitens<br />
des DBI eine Gasreinigung und -analyse<br />
mit einer mobilen Brennkammer des GWI<br />
gekoppelt. In den Versuchen erfolgte die<br />
Entnahme des Biogases über einen Bypass<br />
an der Gasfackel der Biogasanlage. Um sowohl<br />
die Restkonzentration an Ammoniak<br />
als auch Schwefelwasserstoff aus dem Gas<br />
zu entfernen, wurde eine Gasreinigung bestehend<br />
aus zwei Kolonnen (befüllt mit Aktivkohle<br />
bzw. Eisenmasse) gefertigt. Eine<br />
Gasanalyse fand sowohl vom Rohgas (ohne<br />
Durchströmen der Kolonnen) als auch vom<br />
Reingas (nach Durchströmen der Kolonnen)<br />
statt und konnte somit auch bei den<br />
Versuchen mit ungereinigtem Gas, bei dem<br />
die Kolonnen der Gasaufbereitung vollständig<br />
umgangen wurden, vorgenommen<br />
werden.<br />
Die Brennkammer ist in drei Zonen gegliedert,<br />
die separat von unten beladen werden<br />
können und in denen unterschiedliche<br />
Temperaturen vorherrschen. Für die Versuche<br />
kam ein konventioneller Erdgas-Gebläsebrenner<br />
mit einer maximalen Leistung<br />
von 110 kW zum Einsatz. In den Versuchen<br />
wurden NE-Metall- und Stahlproben<br />
103
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
bei unterschiedlichen Temperaturniveaus<br />
und Verweilzeiten wärmebehandelt sowie<br />
Aluminiumschmelzproben erzeugt.<br />
In Langzeitversuchen wurden Temperaturen<br />
von 750 bis 1.100 Grad Celsius über<br />
Zeiträume von 10 bis 20 Tagen konstant<br />
gehalten. Diese wurden bewusst länger<br />
als typische Verweilzeiten entsprechender<br />
Wärmebehandlungsvorgänge gewählt, um<br />
eventuelle (negative) Einflüsse deutlicher<br />
zu erfassen. In den Versuchen konnten unter<br />
anderem Homogenisierungs- und Glühprozesse<br />
von unlegierten und legierten<br />
Stählen sowie Bronze, Rotguss und das<br />
Schmelzen von Aluminium betrachtet werden.<br />
Die mit gereinigtem und ungereinigtem<br />
Biogas behandelten Proben wurden<br />
metallurgisch mittels Licht- und Rasterelektronenmikroskop<br />
sowie Energiedispersiver<br />
Röntgenspektroskopie untersucht<br />
und die Ergebnisse verglichen. Für die<br />
betrachteten Edelstähle und Aluminium<br />
konnten keine Einflüsse des Brenngases<br />
bzw. der Legierung festgestellt werden.<br />
Für reale Prozesse mit deutlich kürzeren<br />
Verweilzeiten wird daher ein Einfluss von<br />
Rohbiogas auf die Produktqualität als unwahrscheinlich<br />
angesehen. Bei NE-Metallen<br />
sowie unlegierten Stählen konnten<br />
Einlagerungen von Spurenbestandteilen<br />
aus der Verbrennungsatmosphäre bei Einsatz<br />
von Rohbiogas nachgewiesen werden.<br />
Hier sind eine genauere Quantifizierung<br />
und Betrachtung des Einflusses der Verweilzeit<br />
in Detailuntersuchungen zu empfehlen.<br />
Deutschlandweite Analyse zur<br />
Einsatzmöglichkeit von Biogas in<br />
Metallurgiebetrieben<br />
Um Biogas in Metallurgiebetrieben einsetzen<br />
zu können, müssen sich die Biogasanlagen<br />
in räumlicher Nähe zum Metallurgiebetrieb<br />
befinden. In Deutschland<br />
befinden sich die meisten Biogasanlagen<br />
in den stark von Landwirtschaft geprägten<br />
Bundesländern wie beispielsweise Niedersachsen<br />
und Bayern. In diesen Gebieten<br />
sind jedoch vergleichsweise wenig Metallurgiebetriebe<br />
ansässig.<br />
Metallurgiebetriebe sind vermehrt in industriell<br />
geprägten Regionen Deutschlands<br />
angesiedelt wie beispielsweise dem<br />
Ruhrgebiet. Es gibt somit hier bereits eine<br />
räumliche Diskrepanz zwischen vorhandenem<br />
Biogaspotenzial und benötigtem Energiebedarf.<br />
Trotz allem weisen etwa 90 Prozent<br />
der betrachteten Metallurgiebetriebe<br />
mindestens eine Biogasanlage im Umkreis<br />
von 10 Kilometer auf.<br />
Ziel der Analyse war, Metallurgiebetriebe<br />
zu identifizieren, die genügend große Biogaspotenziale<br />
in räumlicher Nähe aufweisen<br />
und die somit einen wirtschaftlichen<br />
Betrieb gewährleisten können. In Deutschland<br />
existiert ein breites Spektrum an Metallurgiebetrieben,<br />
von mittelständischen<br />
Unternehmen bis hin zu großen Industriekonzernen.<br />
Daraus resultieren stark variierende<br />
Energiebedarfe je Betrieb.<br />
Die benötigten Energiebedarfe der Metallurgiebetriebe<br />
liegen bei den wenigen aber<br />
sehr großen Konzernen deutlich über den<br />
zur Verfügung stehenden Biogaspotenzialen.<br />
Diese haben jedoch einen signifikanten<br />
Anteil am Gesamtenergiebedarf der<br />
Branche sowie an den THG-Emissionen.<br />
Bei etwa der Hälfte der betrachteten Me-<br />
Service rund um den Gasmotor<br />
Service vor Ort • Fachwerkstatt • Vertrieb Gasmotoren<br />
Der BHKW-Spezialist<br />
für Motoren mit<br />
Erd-, Bio- und<br />
Sondergasbetrieb<br />
Speller Str. 12 • 49832 Beesten<br />
Tel.: 05905 945 82-0 • Fax: -11<br />
E-Mail: info@eps-bhkw.de<br />
Internet: www.eps-bhkw.de<br />
Neumodule für den<br />
Flexbetrieb<br />
von 75 - 3.000 kWel. im<br />
Container, Betonhaube oder als<br />
Gebäudeeinbindung<br />
Stützpunkte: Beesten • Rostock • Wilhelmshaven • Magdeburg<br />
104
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
tallurgiebetriebe reichte jedoch bereits<br />
eine Biogasanlage zur 100-prozentigen<br />
Energieversorgung aus. Dabei handelte es<br />
sich um kleine Betriebe mit nur geringen<br />
Energiebedarfen.<br />
Im Rahmen des Projektes konnte in Bezug<br />
auf den Erdgasbedarf der Metallurgiebetriebe<br />
in Deutschland eine maximale Substitution<br />
von 9 Prozent durch Biogas ermittelt<br />
werden. Hierdurch können jedoch die gesamten<br />
CO 2<br />
-Emissionen in der Metallurgie,<br />
die auch von der Kohleverbrennung ausgehen,<br />
um lediglich 0,5 Prozent gesenkt werden.<br />
Hinzu kommt, dass Biogas zwar in der<br />
Verbrennung emissionsneutral ist. Durch<br />
nötige Vorketten, wie die Düngung von Feldern,<br />
werden jedoch THG gebildet. Auch<br />
ökonomisch gibt es aktuell trotz geplanter<br />
steigender CO 2<br />
-Emissionshandelkosten für<br />
Erdgas keinen wirtschaftlichen Anreiz für<br />
Metallurgiebetriebe, Erdgas durch Biogas<br />
(teilweise) zu ersetzen, da dieses bis um<br />
das Dreifache teurer wäre.<br />
Fazit: Als Ergebnis des Projektes kann festgehalten<br />
werden, dass der Biogaseinsatz<br />
zur Erdgassubstitution in der Metallurgie<br />
aus verfahrenstechnischer Sicht bis hin zu<br />
einem hohen Substitutionsgrad (bis zu 80<br />
Volumenprozent in den Versuchen) sowie in<br />
Bezug auf die Wärmebehandlung der Metallerzeugnisse<br />
kein Problem darstellt. Jedoch<br />
kann der Großteil der Energiebedarfe,<br />
vor allem der Großunternehmen, nicht mit<br />
den in der Nähe befindlichen Biogasanlagen<br />
gedeckt werden. Hingegen könnte der<br />
(teilweise) Einsatz von Biogas als Energieträger<br />
für Betriebe mit geringen Energiebedarfen<br />
und kurzen Wegen zu nahegelegenen<br />
Biogasanlagen eine Option darstellen<br />
und damit ein Emissions-Einsparpotenzial<br />
für diese Betriebe generieren.<br />
Hinweis: Das IGF-Vorhaben 20155 BG<br />
der Forschungsvereinigung Gas- und<br />
Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) wurde<br />
über die AiF im Rahmen des Programms<br />
zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung<br />
(IGF) vom Bundesministerium<br />
für Wirtschaft und Energie aufgrund<br />
eines Beschlusses des Deutschen<br />
Bundestages gefördert.<br />
Autoren<br />
Elisabeth Grube<br />
Projektleiterin<br />
DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg<br />
0 37 31/41 95 329<br />
elisabeth.grube@dbi-gruppe.de<br />
Patrick Heinrich<br />
Projektleiter<br />
DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg<br />
0 37 31/41 95 374<br />
patrick.heinrich@dbi-gruppe.de<br />
Marcus Röder<br />
Projektleiter<br />
Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI)<br />
02 01/36 18 288<br />
roeder@gwi-essen.de<br />
Nico Steyer<br />
Projektleiter<br />
DBI – Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg<br />
0 37 31/41 95 336<br />
nico.steyer@dbi-gruppe.de<br />
WIR FÖRDERN DIE BIOGASWIRTSCHAFT<br />
VON MORGEN.<br />
Die Herausforderungen für Biogasanlagen sind groß.<br />
Wir meistern sie gemeinsam - mit intelligenten, leistungsstarken und<br />
energieeffizienten Lösungen für die Lagerung, Aufbereitung und<br />
Verwendung von Gülle und Gärresten.<br />
Mehr Informationen auf www.saveco-water.de<br />
CHIOR TM VPH Langwellenpumpe<br />
SEPCOM TM<br />
Separatoren<br />
SEPCOM TM<br />
Mikrofiltration<br />
CHIOR TM<br />
Langwellenrührwerke<br />
CHIOR TM SE<br />
Tauchmotorrührwerke<br />
+ Hohe Pumpleistung dank Ansaugung von<br />
oben<br />
+ Doppeltes Schneidsystem für eine optimale<br />
Schneideffizienz<br />
+ Optionales Edelstahl-Pumpengehäuse bei<br />
wechselhaften pH-Werten<br />
+ Antriebsleistungen von 7,5 – 22 kW<br />
105
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Versuchsstand:<br />
100-Liter-Durchflussfermenter<br />
mit automatisierter<br />
Fütterung<br />
(PFI-Technikum).<br />
Bakterien auf der Spur –<br />
neues Verfahren zur Kontrolle<br />
der Prozessbiologie<br />
Stabilität und Leistungsfähigkeit der Biogas-Fermentation hängen maßgeblich von der<br />
Zellzahl und Aktivität der Mikroorganismen ab. Dennoch beschränkt sich die typische<br />
Prozessanalyse meist auf chemisch-physikalische Messungen, obwohl hier Auffälligkeiten<br />
häufig erst dann auftreten, wenn prozessbiologische Störungen bereits aufgetreten oder<br />
weit fortgeschritten sind. Dem Einsatz von molekularbiologischen Methoden, die Veränderungen<br />
und Ungleichgewichte innerhalb von mikrobiellen Gemeinschaften erkennen<br />
können, stand bisher der hohe Zeit- und Kostenaufwand im Weg. Neu entwickelte molekular<br />
basierte Schnelltests sind mittlerweile marktreif und ergänzen die klassische Fermenteranalytik<br />
ideal.<br />
Von: Dr. Sabine Peters 1 , Ulrich Krause 1 und Dr. Stefan Dröge 2<br />
106
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
Ein kontinuierlicher Fermentationsablauf<br />
ist eine zentrale<br />
Voraussetzung für den<br />
wirtschaftlichen Betrieb von<br />
Biogasanlagen. Störungen<br />
wie Überfütterung, Fütterungswechsel,<br />
Nährstoff- beziehungsweise (bzw.)<br />
Spurenelementmangel beruhen in der<br />
Regel auf Ungleichgewichten in der Zusammensetzung<br />
der komplexen mikrobiellen<br />
Gemeinschaft. Die biologische<br />
Prozessüberwachung sollte daher ein<br />
wesentliches Element des Anlagenmanagements<br />
sein.<br />
Die typische Überwachung der Prozessbiologie<br />
fokussiert jedoch nach wie vor<br />
auf bestimmte Stoffwechselprodukte<br />
(flüchtige organische Säuren), Nährstoffe<br />
und Spurenelemente sowie potenziell<br />
inhibierende Substanzen (zum<br />
Beispiel Ammonium), die chemischphysikalisch<br />
bestimmt werden. Die<br />
regelmäßige Überwachung dieser Parameter<br />
ist für die Beurteilung der Prozessbiologie<br />
sehr wichtig und wird es<br />
auch zukünftig bleiben. Als Frühindikatoren<br />
sind sie allerdings nur bedingt<br />
geeinigt, weil Auffälligkeiten häufig erst<br />
dann auftreten, wenn eine prozessbiologische<br />
Störung bereits eingetreten<br />
bzw. weit fortgeschritten ist.<br />
Zur Früherkennung sind molekularbiologische<br />
Methoden, die zentrale<br />
mikrobielle Gruppen im Fermenter direkt analysieren<br />
können, wesentlich besser geeignet. Auch wenn die<br />
entsprechenden Methoden und Techniken in der Forschung<br />
etabliert sind, fehlte es bislang an praxis- und<br />
anwendertauglichen Testverfahren. Die Entwicklung<br />
solcher molekularer Schnelltests war Gegenstand eines<br />
kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojektes<br />
(„FerMiQ“) der AMODIA Bioservice und des Prüf- und<br />
Forschungsinstituts Pirmasens.<br />
Relevante mikrobielle Gruppen in<br />
Biogasanlagen<br />
In Biogasfermentern sind verschiedene Gruppen von<br />
Mikroorganismen aktiv: Hydrolytische Bakterien bauen<br />
langkettige Substrate zu kleineren Molekülen ab. Dabei<br />
entstehen unter Abspaltung von Wasserstoff letztendlich<br />
flüchtige organische Säuren (FOS) und CO 2<br />
. Diese<br />
Moleküle werden von methanogenen Archaeen („Methanogenen“)<br />
zu Methan umgesetzt.<br />
Die in Biogasfermentern bisher nachgewiesenen Methanogenen<br />
unterscheiden sich dabei in ihren Stoffwechselwegen:<br />
Methanosaeten setzen Essigsäure<br />
direkt zu Methan und CO 2<br />
um. Dies können Methanosarcinaceen<br />
auch. Zusätzlich können sie, genau<br />
wie Methanobacteriaceen und Methanomicrobiaceen,<br />
Methan aus CO 2<br />
und H 2<br />
erzeugen. Dieser Wasserstoff<br />
muss jedoch von syntrophen Bakterien angereicht werden,<br />
die damit ebenfalls Schlüsselorganismen für die<br />
Methanogenese sind.<br />
Analyse der Biogas-Populationen mit<br />
DNA-basierten Methoden<br />
Molekularbiologische Methoden nutzen aus, dass die<br />
DNA-Sequenz für jeden Organismus charakteristisch<br />
ist. Eine Messung, welche Sequenzen in einem Biogasfermenter<br />
wie häufig vorkommen, bestimmt so die<br />
Zusammensetzung der Mikroorganismen im Fermenter.<br />
So wurde im Projekt zum Beispiel die Sequenz eines<br />
Bakteriums identifiziert, das sensibel auf Schwankungen<br />
der Fermenterbiologie reagiert. Ist die gesuchte<br />
Sequenz erst einmal bekannt, kann mithilfe der<br />
qPCR-Technik (quantitative Polymerase-Kettenreaktion)<br />
deren DNA-Konzentration in der untersuchten Probe<br />
absolut quantifiziert werden. Diese korreliert mit der<br />
Konzentration der jeweiligen Mikroorganismen.<br />
Im Rahmen des Projektes wurden unter anderem<br />
drei qPCR-Systeme für Fermenterproben entwickelt:<br />
„qBac“ für die Bakterien, „qMeth“ für die Methanogenen<br />
und „qSyn“ für das vorgenannte Bakterium, das<br />
sensibel auf Prozessänderungen reagiert.<br />
Simulation bestimmter Fermenterzustände<br />
unter praxisnahen Bedingungen<br />
Überfütterungen durch hohe Faulraumbelastungen<br />
und/oder kurze hydraulische Verweilzeiten sowie Substratwechsel<br />
zählen zu den typischen prozessbiologischen<br />
Störungen. Um zu untersuchen, wie die Fermenterbiologie<br />
darauf reagiert und ob die entwickelten<br />
qPCR-Systeme als Frühindikatoren geeignet sind,<br />
wurden kontinuierliche Gärtests in automatisierten<br />
100-Liter-Durchflussfermentern durchgeführt (siehe<br />
Foto), in denen diese Zustände unter zwei praxisnahen<br />
Bedingungen herbeigeführt wurden.<br />
Fermenter C zeigt eine dauerhafte Monovergärung<br />
einer Triticale-GPS mit hohen TS- (>35 Prozent) und<br />
Rohfasergehalten (27 Prozent). Zum Anfahren des Fermenters<br />
wurden Enzyme zugegeben, so dass mögliche<br />
Effekte eines Enzymentzugs auf die Zusammensetzung<br />
der mikrobiellen Gemeinschaft im Fermenter beobachtet<br />
werden konnten.<br />
Im Versuchsansatz D wurde die Raumbelastung durch<br />
stufenweise zunehmende Fütterung mit Mais (später:<br />
Mais/Triticale-Mischung) bis zur Überlastung gesteigert.<br />
Daraus resultierte parallel eine Verringerung der<br />
hydraulischen Verweilzeit von 95 auf 34 Tage (siehe<br />
Tabelle). Nach der erzeugten schweren Prozessstörung<br />
wurde versucht, den Fermenter mit der Gabe von Spurenelementen<br />
wieder aufzufangen.<br />
Die Vergärungsexperimente wurden jeweils über einen<br />
Zeitraum von sechs Monaten vorgenommen, um<br />
mindestens zwei hydraulische Verweilzeiten im<br />
107
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Werte bei Mono-Fermentation mit Triticale-GPS<br />
[10^y Kopien/g] [mg/l]<br />
[kg oTS/m³]<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4.500<br />
3.000<br />
1.500<br />
0<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
qMeth ⊕<br />
qMeth ⵔ<br />
Mono-Fermentation mit Triticale-GPS<br />
Enzymgabe<br />
qMeth ⊖<br />
qSyn ⊕<br />
qSyn ⵔ<br />
qSyn ⊖<br />
01-27<br />
01-27<br />
03-02<br />
organische Raumbelastung<br />
Säuren<br />
Trockensubstanz<br />
Methanproduktion<br />
qBac<br />
Schaden<br />
qMeth<br />
5<br />
03-02<br />
DNA Konzentration<br />
qSyn<br />
4<br />
11-25 12-16 01-06 01-27 02-17 03-09 03-30 04-20<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
[%]<br />
[Nl/d]<br />
Untersuchungszeitraum zu berücksichtigen. Während<br />
der Versuchslaufzeit wurden kontinuierlich Gasmengen<br />
und Gasqualität überwacht und wöchentlich Proben<br />
genommen, die sowohl auf chemisch-physikalische<br />
Prozessparameter (FOS, NH 4<br />
-N, pH, TS, oTS) als auch<br />
mit den molekularbiologischen qPCR-Systemen untersucht<br />
wurden.<br />
Entsprechend gliedern sich die Abbildungen: Im oberen<br />
Teil ist der zeitliche Verlauf der Fütterung (organische<br />
Raumbelastung, Enzymgabe) sowie der daraus<br />
entstandene Trockensubstanzanteil dargestellt. Der<br />
mittlere Teil zeigt die Messwerte für Essig- und Propionsäure<br />
sowie die Methanproduktion. Die ermittelten<br />
DNA-Konzentrationen der drei qPCR-Systeme sind im<br />
unteren Teil abgebildet.<br />
Versuchsansatz C: Mono-Fermentation<br />
mit Triticale-GPS<br />
Hier (siehe Abbildung 1) führte das im Abbauverhalten<br />
kritische Fütterungssubstrat bereits beim Anfahren zu<br />
einem deutlichen Anstieg der Essig- und Propionsäuregehalte<br />
auf etwa 3.300 bzw. 2.000 Milligramm pro<br />
Kilogramm (mg/kg). Nach einem kurzzeitigen Rückgang<br />
(reduzierte Fütterung) stiegen die Propionsäuregehalte<br />
weiter auf über 4.000 mg/kg („03-02“). Der<br />
anschließende schnelle und deutliche Rückgang der<br />
Propionsäure korrelierte interessanterweise relativ eng<br />
mit dem Ende der Enzymzugabe in der Woche davor.<br />
Dies könnte auf eine verstärkte Zuckerfreisetzung infolge<br />
des Enzymeinsatzes hindeuten. Der Methanertrag<br />
folgt zeitverzögert dem Verlauf der Raumbelastung und<br />
108
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
Verfahrenstechnische Parameter bei der Durchführung der<br />
dynamischen Gärtests<br />
Fermenter Reaktor C Reaktor D<br />
Arbeitsvolumen (l) 70 70<br />
Temperatur (°C) 40 40<br />
Hydraulische Verweilzeit (d) 95 - 105 34 - 95<br />
Raumbelastung([kg oTS/m 3 ) 3 - 3,65* 3 - 8,7*<br />
Substrate GPS (Triticale) Maissilage/GPS (Triticale)<br />
Supplement Enzym** SE-Mischung***<br />
*exklusive Anfahrphase,<br />
**phasenweise Zugabe (ab Start für 2 Monate; Sigma CelliTec, Cellulase / Hemicellulase - Mischung),<br />
*** phasenweise Zugabe (nach Prozessstörung für 6 Wochen)<br />
schwankte zwischen 40 und 60 Normliter<br />
pro Tag (Nl/d) [= spezifischer Methanertrag<br />
von 225 bis 275 Nl/kg organische Trockensubstanz<br />
(oTS)]. Kurz nach der Einstellung<br />
der Enzymzugabe, also parallel zum darauf<br />
folgenden verstärkten Säureabbau, traten<br />
über einen Zeitraum von zirka vier Wochen<br />
signifikant höhere Methanerträge von rund<br />
70 Nl/d auf.<br />
Dies lässt sich durch die zusätzliche Gasbildung<br />
aus dem Säureabbau erklären.<br />
Unter Berücksichtigung der leicht erhöhten<br />
Raumbelastung folgte eine Phase mit<br />
unterdurchschnittlichen Methanerträgen<br />
von rund 50 Nl/d. Zum Ende des Versuchs<br />
war wiederum ein deutlicher Anstieg der<br />
Methanerträge feststellbar. Auffällig ist der<br />
kontinuierliche Anstieg des TS-Gehaltes<br />
über den Versuchszeitraum. Erst im letzten<br />
Drittel stabilisierte sich der Wert auf<br />
sehr hohem Niveau (>13 Prozent). Hierin<br />
und auf Basis der insgesamt niedrigen<br />
spezifischen Biogaserträge zeigt sich, dass<br />
faserreiche Substrate bereits bei mittleren<br />
Raumbelastungen zur partiellen Überlastung<br />
der Fermenterbiologie sowie verminderten<br />
Abbauraten führen.<br />
Trotz des schwierigen Fütterungssubstrates<br />
bleiben die DNA-Konzentrationen der<br />
Bakterien und der Methanogenen in der<br />
Anfangsphase konstant auf einem Niveau,<br />
das zu einer stabilen Methanbildung geeignet<br />
scheint. Mit dem Absetzen des Enzyms<br />
verschlechtern sich die Werte jedoch und<br />
fallen kontinuierlich. Gleiches gilt für die<br />
DNA-Konzentration des syntrophen Bakteriums<br />
(qSyn). Interessant ist, dass die Methanproduktion<br />
ab dem 20. Januar 2020<br />
steigt, obwohl die DNA-Konzentrationen<br />
der Methanogenen und des syntrophen<br />
Bakteriums kontinuierlich weiter fallen.<br />
Zu dem Zeitpunkt, an dem die Methanproduktion<br />
schließlich zurückgeht (23. März<br />
2020), sind die DNA-Konzentrationen der<br />
Methanogenen im Vergleich mit dem Anfangszustand<br />
um den Faktor 1.000 [von<br />
109,5 auf 106,4 Kopien pro Gramm (g)],<br />
also um drei Größenordnungen gesunken.<br />
Gleiches gilt für die DNA-Konzentrationen<br />
des syntrophen Bakteriums, die von 107,4<br />
auf 104,3 Kopien/g abnehmen. Dieser<br />
schlechte Zustand der Fermenterbiologie<br />
wird von keinem chemisch-physikalischen<br />
Parameter angezeigt. Im Gegenteil deuten<br />
die fallenden Säurekonzentrationen eher<br />
auf eine Erholung des Fermenters hin.<br />
Aus diesen Daten wurde sowohl für die<br />
Methanogenen als auch für das syntrophe<br />
Bakterium versucht, jeweils zwei Schwellenwerte<br />
festzulegen, die die DNA-Konzentrationen<br />
in drei Bereiche teilen: Oberhalb<br />
von K+ (grün) funktioniert die Fermenterbiologie<br />
gut („ⴲ“). Unterhalb von K- (rot)<br />
befindet sich die Fermenterbiologie in kritischem<br />
Zustand („ⴱ“). Und in dem Bereich<br />
zwischen diesen Schwellen („ⵔ“) sollten<br />
Maßnahmen eingeleitet werden, um die<br />
Fermenterbiologie wieder zu verbessern.<br />
Dieser Bereich ist in der jeweiligen Farbe<br />
der Mikroorganismen eingefärbt (hellgelb:<br />
Methanogene, hellblau: syntrophes Bakterium).<br />
Zwischen den Zeitpunkten (gestrichelte<br />
senkrechte Linien), an denen die<br />
obere (grün) und die untere (rot) Schwelle<br />
unterschritten werden, liegen trotz konstanter<br />
Fütterung fünf Wochen.<br />
109<br />
Durch energie+agrar habe ich einfach<br />
“<br />
mehr Spaß mit meiner Biogasanlage. ”<br />
Oppmale Beratung<br />
und innovaave<br />
Produkte für Ihre<br />
Fermenter-Bakterien<br />
Höhere Substratausnutzung<br />
Bessere Rührfähigkeit<br />
Stabile biologische Prozesse<br />
Einsparung von Gärrestlager<br />
Senkung der Nährstoffmenge<br />
Repowering der Biologie<br />
Denn Ihre Biogas-Bakterien<br />
können mehr!<br />
energiePLUSagrar GmbH<br />
Tel.: +49 7365 41 700 70<br />
Web: www.energiePLUSagrar.de<br />
E-Mail: buero@energiePLUSagrar.de
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Abbildung 2: Zeitlicher Verlauf der Werte bei stufenweise steigender Fütterung<br />
mit Mais/Mais-Triticale<br />
[10^y Kopien/g] [mg/l]<br />
[kg oTS/m³]<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
12.000<br />
9.000<br />
6.000<br />
3.000<br />
0<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
Steigende Fütterung mit Mais/Mais-Triticale<br />
qSyn ⊕<br />
qSyn ⵔ<br />
qSyn ⊖<br />
qMeth ⊕<br />
qMeth ⵔ<br />
qMeth ⊖<br />
03-23<br />
03-30<br />
organische Raumbelastung<br />
Säuren<br />
Trockensubstanz<br />
Methanproduktion<br />
03-23<br />
Gabe von<br />
Spurenelementen<br />
qBac<br />
qMeth<br />
5<br />
03-30<br />
DNA Konzentration<br />
qSyn<br />
4<br />
11-25 12-16 01-06 01-27 02-17 03-09 03-30 04-20 05-11<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
180<br />
150<br />
120<br />
90<br />
60<br />
30<br />
[%]<br />
[Nl/d]<br />
Versuchsansatz D: Steigende Fütterung mit<br />
Mais bzw. einer Mais/Triticale-Mischung<br />
Bei reiner Maisfütterung (siehe Abbildung 2) erwies<br />
sich die Fermenterbiologie als sehr stabil. Bis zu einer<br />
Raumbelastung von 6 Kilogramm (kg) oTS pro<br />
Kubikmeter (m 3 ) ergaben die chemischen Analysen<br />
keine signifikante Akkumulation organischer Säuren.<br />
Durch zusätzliche Fütterung von Triticale-GPS wurde<br />
die Raumbelastung bis zum Maximalwert von 8,7 kg<br />
oTS/m 3 gesteigert.<br />
Mit der zusätzlichen GPS-Fütterung gingen die Methanerträge<br />
zunächst deutlich von Werten oberhalb<br />
150 Nl/d (ca. 400 Nl/kg oTS) auf zirka 110 Nl/d zurück,<br />
bevor sie schnell wieder Werte um 150 Nl/d erreichten.<br />
Ab einer Raumbelastung von 7 kg oTS/m 3<br />
liefern chemische Analysen (vor allem Propionsäure)<br />
erste Hinweise einer Prozessüberlastung, die sich im<br />
Anschluss durch den schnellen und drastischen Anstieg<br />
der Säuregehalte manifestieren.<br />
Dies galt insbesondere für Propionsäure (hellblaue Kurve)<br />
und weitere langkettige organische Säuren (C3 bis<br />
C6 Säuren; ohne Abbildung), während die Essigsäure<br />
auf relativ niedrigem Niveau verblieb. Im Maximum<br />
wurden mit über 9.000 mg/kg extrem hohe Propionsäuregehalte<br />
erreicht, was zu einem drastischen Einbruch<br />
der Gasproduktion bei gleichzeitig rückläufigen Methangehalten<br />
führte. Zu diesem Zeitpunkt wäre auch bei<br />
einer Praxisanlage, ohne dass weitere Mess- oder<br />
110
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
ÜBERWACHUNG VON BIOGAS-ANLAGEN<br />
Gemeinschaftlich. Vorausdenkend.<br />
Engagiert.<br />
»Mit Hochdruck für unser Klima.«<br />
(unbekannt)<br />
Christian Falke<br />
Biogas 401<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
Biogas 905<br />
Mehrkanal-Gasanalysator<br />
SENSOREN<br />
Die beiden Gas-Analysatoren Biogas 401<br />
und Biogas 905 über wachen kontinuierlich<br />
oder dis kon ti nuierlich die Qualität des<br />
Biogases auf die Gaskompo nenten hin.<br />
Optional warnen zusätzliche Umgebungsluft-Sensoren<br />
frühzeitig vor gesundheitsge<br />
fähr denden, explo sions fähigen und<br />
nichtbrenn baren Gasen und Dämpfen.<br />
❯❯❯ Biogas Know-how seit 2001 ❮❮❮<br />
EINSATZBEREICHE:<br />
■ Biogas-Produktionsanlagen<br />
■ Kläranlagen<br />
■ Deponien<br />
Kontakt<br />
Salomonstr. 19, 04103 Leipzig<br />
Telefon: 0341/978566-0<br />
Fax: 0341/978566-99<br />
E-Mail: kontakt@prometheus-recht.de<br />
www.prometheus-recht.de<br />
GTR 210 IR<br />
CH 4 + CO 2<br />
TOX 592<br />
O 2 + H 2 S<br />
Trierer Str. 23 – 25 · 52078 Aachen<br />
Tel. (02 41) 97 69-0 · www.ados.de<br />
s e i t 1 9 0 0<br />
Interimsmanagement<br />
für Biogasanlagen<br />
Im Insolvenzfall oder bei Betreiberwechsel<br />
übernehmen wir lang- oder kurzfristig die<br />
technische/ kaufmännische Betriebsführung<br />
WELTEC BIOPOWER GmbH<br />
Zum Langenberg 2 • 49377 Vechta<br />
www.weltec-biopower.de<br />
Organic energy worldwide<br />
Ihr Ansprechpartner: Andre Zurwellen<br />
Tel. 04441-999 78-900<br />
a.zurwellen@weltec-biopower.de<br />
111
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Sensordaten vorliegen, das Auftreten einer prozessbiologischen<br />
Störung für den Betreiber deutlich erkennbar.<br />
Als typische Korrekturmaßnahme wurde daraufhin zunächst<br />
die Fütterungsmenge halbiert mit paralleler Zudosierung<br />
von Spurenelementen. Da die Säuregehalte<br />
zunächst nicht zurückgingen, wurde die Fütterung des<br />
Fermenters vollständig eingestellt. Erst danach kam es<br />
zu einem langsamen Rückgang der Säuren. Bis zum<br />
weitgehenden Abbau der Säuren und der Wiederaufnahme<br />
der Fütterung dauerte es rund drei Wochen. Auch<br />
die DNA-Konzentrationen der drei qPCR-Systeme zeigen,<br />
dass die Fermenterbiologie lange Zeit stabil bleibt.<br />
Ab dem 2. März 2020, also bei einer Raumbelastung<br />
von 6,4 kg oTS/m 3 , beginnt als erstes die Konzentration<br />
der Methanogenen nennenswert zu sinken. Eine Woche<br />
später beträgt diese Reduktion bei den Methanogenen<br />
bereits eine knappe halbe Größenordnung (109,9 auf<br />
109,5 Kopien/g). Vergleichbares gilt beim syntrophen<br />
Bakterium (107,8 auf 107,0 Kopien/g). Nutzt man die<br />
Propionsäurebildung als Indikator für den Zustand der<br />
Fermenterbiologie, so ergeben sich erstaunlicherweise<br />
die gleichen Schwellenwerte wie bei Fermenter C, die<br />
die Konzentrationsbereiche mit guter bzw. kritischer<br />
Funktion trennen.<br />
Am 23. März 2020 unterschreiten die Konzentrationen<br />
der Methanogenen und des syntrophen Bakteriums die<br />
jeweiligen oberen Schwellenwerte (grün), eine Woche<br />
später sogar die jeweiligen unteren Schwellenwerte<br />
(rot). Wenn diese rapide Verschlechterung der Indikator-Werte<br />
der Fermenterbiologie (Faktor 10 pro Woche)<br />
zur Steuerung genutzt worden wäre, hätte man die Fütterung<br />
bereits 14 Tage früher anpassen können, als es<br />
tatsächlich erfolgte.<br />
Fazit: Die Ergebnisse der Fermentationsexperimente<br />
zeigen praxisrelevante Probleme bei der aktuellen<br />
chemisch-basierten Prozessüberwachung, insbesondere<br />
die schnelle Akkumulation organischer Säuren<br />
bei grenzwertig hohen Raumbelastungen. In der Praxis<br />
führt dies häufig dazu, dass Prozessstörungen erst zu<br />
einem späten Zeitpunkt erkannt werden. Ebenso sind<br />
die Gasmenge sowie der Methangehalt, die Betreiber<br />
laborunabhängig vor Ort messen können, nur sehr bedingt<br />
als Frühindikator geeignet.<br />
Die Messung der DNA-Konzentrationen der an der<br />
Fermentation beteiligten Mikroorganismen erlaubt<br />
direkte Rückschlüsse auf den Zustand der Fermenterbiologie.<br />
Für die DNA-Konzentrationen der Methanogenen<br />
und des syntrophen Bakteriums konnten<br />
jeweils zwei Schwellenwerte K+ und K- identifiziert<br />
werden, die als eine Art „Ampel-Indikator“ für die<br />
Fermenterbiologie dienen können: Oberhalb von K+<br />
(„grüner Bereich“) funktioniert die Fermenterbiologie<br />
Save the dates!<br />
» Energie- & Klimapolitik<br />
» Zukunftsprojekte<br />
» Recht & Regelwerke<br />
» Abfallvergärung<br />
» Praxisberichte<br />
» BIOGAS Fachforum<br />
digital & live<br />
22. – 26. November <strong>2021</strong><br />
Digital<br />
Save<br />
the dates!<br />
7. – 9. Dezember <strong>2021</strong><br />
NCC Mitte, Messegelände Nürnberg<br />
112<br />
Aktuelle Informationen und Anmeldung:<br />
www.biogas-convention.com
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
gut; es sind keine Maßnahmen erforderlich. Zwischen<br />
K+ und K- („gelber Bereich“) können erste Maßnahmen<br />
die Fermenterbiologie wieder verbessern. Und<br />
unterhalb von K- („roter Bereich“) befindet sich die<br />
Fermenterbiologie in kritischem Zustand, was drastische<br />
Maßnahmen erfordert.<br />
Bemerkenswerterweise sind diese Schwellen in beiden<br />
unterschiedlichen Versuchsansätzen gleich. Sie<br />
scheinen also universeller gültig zu sein, als dies angesichts<br />
der drastischen Unterschiede in der Fütterung<br />
zu erwarten war. Allerdings liegen bei der Fütterung<br />
mit Mais die DNA-Konzentrationen bei „normaler<br />
Fütterung“ deutlich weiter oberhalb von K+ als bei der<br />
Fütterung mit Triticale-GPS. Bei den DNA-Konzentrationen<br />
der Bakterien sind diese Effekte nicht ganz<br />
so deutlich und nicht ganz so einheitlich. So beträgt<br />
die Abnahme maximal 2 (Fermenter C) bzw. 2,5 Größenordnungen<br />
(Fermenter D). Und zwischenzeitlich<br />
steigen die Werte sogar an, obwohl die beiden anderen<br />
DNA-Konzentrationen weiter abnehmen.<br />
Ausblick: Die Überwachung der Fermenterbiologie<br />
durch die Messung von DNA-Konzentrationen der beteiligten<br />
Mikroorganismen erlaubt insbesondere bei<br />
kritischen Betriebsereignissen wie Störungen oder bei<br />
Substratumstellungen eine bessere Überwachung und<br />
Beurteilung der getroffenen Maßnahmen. Die DNA-<br />
Konzentrationen könnten als Steuerungsparameter<br />
genutzt werden, um den Methanertrag oder den Substratmix<br />
zu optimieren.<br />
Danksagung: Das AiF-Projekt „FerMiQ“ wurde vom<br />
Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen der<br />
ZIM-Initiative (Zentrales Innovationsmanagement)<br />
gefördert.<br />
Autoren<br />
Dr. Sabine Peters 1<br />
Ulrich Krause 1<br />
Dr. Stefan Dröge 2<br />
1<br />
AMODIA Bioservice GmbH<br />
Rebenring 31 · 38106 Braunschweig<br />
05 31/260 17 64<br />
www.amodia.com<br />
2<br />
Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.<br />
Abteilungsleiter<br />
Biotechnologie, Mikrobiologie<br />
Marie-Curie-Str. 19 · 66953 Pirmasens<br />
0 63 31/24 90 846<br />
www.pfi-germany.de<br />
BerstscheiBen sichern Biogasanlagen<br />
Zertifizierte Berstscheiben schützen präzise und zuverlässig<br />
vor unzulässigen Über- und Unterdrücken<br />
Um den sicheren und reibungslosen<br />
Betrieb von Biogasanlagen zu gewährleisten,<br />
bauen viele Betreiber auf<br />
ateX-zertifizierte Berstscheiben.<br />
Deren Vorteile sind:<br />
niedrige ansprechdrücke ab 5 mbar ü:<br />
Die Berstscheiben werden mit Ansprechdrücken<br />
ab 5 mbar ü hergestellt –<br />
z.B. als reine Überdruckabsicherung<br />
oder auch als Schutz vor unzulässigen<br />
Über und Unterdrücken.<br />
Permanenter schutz rund um die Uhr:<br />
Sie sind auf einen Ansprechdruck unterhalb<br />
des Designdrucks der Anlagen<br />
eingestellt und reagieren gezielt auf<br />
die Druckdifferenz. Bei Erreichen des<br />
eingestellten Druckes geben sie die Entlastungsfläche<br />
zuverlässig frei. Einmal<br />
eingestellt, lassen sich diese Ansprechdrücke<br />
nicht mehr verändern.<br />
Zertifizierte sicherheit:<br />
Prüfzeugnisse belegen die<br />
hohe Präzision der Berstscheiben,<br />
die selbst Biogasanlagen<br />
mit Foliendächern verlässlich<br />
schützen.<br />
Wartungsfreie anwendung:<br />
Die wartungsfreien Berstscheiben<br />
bestehen aus Edelstahl<br />
und PTFEDichtfolie, sind<br />
gegenüber Biogas beständig<br />
und arbeiten vollkommen<br />
autonom.<br />
einfacher einbau: Der Einbau ist<br />
unkompliziert. Auch bei bestehenden<br />
Anlagen sind Berstscheiben<br />
nachrüstbar.<br />
Kontakt<br />
schwing Verfahrenstechnik gmbh<br />
Oderstraße 7<br />
47506 NeukirchenVluyn<br />
Tel. +49 2845 9300<br />
mail@schwingpmt.de<br />
www.schwingpmt.de 113
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Foto 1: Forschungsbiogasanlage<br />
des DBFZ.<br />
„Gazelle“ weist nach:<br />
Modellgestütztes Fütterungsmanagement<br />
ermöglicht<br />
flexible Prozessführung<br />
Übergeordnetes Ziel des Forschungsvorhabens „Gazelle – Ganzheitliche Regelung von<br />
Biogasanlagen zur Flexibilisierung und energetischen Optimierung“ (Förderkennzeichen<br />
100267056 SAB/EFRE) war die Weiterentwicklung eines modellbasierten Regelungsverfahrens<br />
zur bedarfsgerechten Regelung von Biogasanlagen (BGA) unter Einbeziehung<br />
aller Anlagenkomponenten (siehe Abbildung 1). Ein besonderer Fokus des Forschungsprojektes<br />
lag auf der praktischen Umsetzbarkeit des Regelungsverfahrens. Dafür stand<br />
sowohl die Forschungsbiogasanlage (FBGA) des DBFZ als auch die Biogasanlage des<br />
Lehr- und Versuchsguts Köllitsch zur Verfügung.<br />
Von Eric Mauky 1 , Manuel Winkler 1 , Christian Krebs 1 , Ulf Müller 1 , Dirk Rabe 2 ,<br />
Sören Weinrich 1 und Jörg Kretzschmar 1<br />
Eine variable, bedarfsgerechte Biogaserzeugung<br />
kann Spielräume zur Flexibilisierung<br />
von Biogasanlagen nutzbar machen, die<br />
sonst nur mit sehr großen und kostenintensiven<br />
Gasspeichervolumina zu realisieren<br />
wären. Insbesondere das Fütterungsmanagement<br />
kann einen signifikanten Beitrag zur Erhöhung der Anlagenflexibilität<br />
leisten. Je nach Ausstattung der Biogasanlage,<br />
vorhandenen Substraten und gewünschter<br />
Flexibilität resultieren verschiedene Konzepte, die mit<br />
114
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
Mit Fütterungsmanagement Flexspielräume<br />
erschließen<br />
Insbesondere in der gemeinsamen Betrachtung von<br />
Gasspeicher und Fütterungsmanagement liegt ein großes<br />
Potenzial. Zum einen können mittels Fütterungsmanagement<br />
Flexibilisierungsspielräume erschlossen<br />
werden, da bei gleichbleibender Fütterung große Gasspeichervolumina<br />
benötigen würden. Zum anderen<br />
kann ein modellgestütztes Fütterungsmanagement<br />
dazu dienen, vorhandene Gasspeicher stärker zur Bereitstellung<br />
von Flexibilität zu nutzen.<br />
Durch ein modellgestütztes Fütterungsmanagement<br />
kann der Biogasprozess in unterschiedlichem Maße<br />
durch:<br />
ffden Zeitpunkt der Fütterungsration,<br />
ffdie Menge der Fütterungsration,<br />
ffdie Zusammensetzung (Substratanteile) der Fütterungsration<br />
und<br />
unterschiedlichem Aufwand verbunden sind. In einem<br />
von fluktuierenden Erneuerbaren Energien geprägten<br />
Energiesystem gewinnt der Ausgleich von Angebot<br />
und Nachfrage zunehmend an Bedeutung. Biogasanlagen<br />
nehmen unter den Erneuerbaren Energien<br />
eine Sonderstellung ein, da die Energiebereitstellung<br />
durch den bedarfsgerechten Einsatz der Substrate<br />
beziehungsweise (bzw.) der Speicherung des Gases<br />
flexibel steuerbar ist. Sie stellen damit einen erfolgversprechenden<br />
Baustein für die Transformation des<br />
deutschen Energiesystems dar.<br />
ffderen Beschaffenheit und Struktur (zum Beispiel<br />
durch Desintegration)<br />
beeinflusst werden.<br />
Die FBGA des DBFZ (siehe Foto 1) verfügt über eine<br />
installierte elektrische Leistung von 75 Kilowatt (kW).<br />
Von den insgesamt sieben zur Verfügung stehenden Behältern<br />
wurden ein Hochfermenter mit Festdach [189<br />
Kubikmeter (m³) Nutzvolumen], ein Nachgärer und<br />
ein Gärrestlager (jeweils 215 m 3 ) in Reihe betrieben.<br />
Nachgärer und Gärrestlager sind jeweils mit Doppelmembrangasspeichern<br />
(zusammen 300 m³) ausgestattet.<br />
Beschickt wurde nur der Hochfermenter, einerseits<br />
mit Rindergülle, andererseits mit Feststoff über einen<br />
Feststoffbeschicker.<br />
Je nach experimenteller Fragestellung wurde ein Gemisch<br />
aus Maissilage, Grassilage, Apfeltrester, Zuckerrübe<br />
und Getreideschrot verwendet. Die<br />
Abbildung 1: Vereinfachtes Schema des modellbasierten Regelungsverfahrens im Forschungsprojekt „Gazelle“<br />
115
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Foto 2: Biogasanlage des Lehr- und Versuchsguts Köllitsch.<br />
jeweiligen Anteile der Feststoffe variierten je nach<br />
Versuchsphase. Die mittlere Raumbelastung lag im<br />
Bereich von 2,7 bis 4,2 Kilogramm (kg) organischer<br />
Trockensubstanz (oTS) pro Kubikmeter ( m 3 ) und Tag.<br />
Die BGA Köllitsch (siehe Foto 2) ist mit einer installierten<br />
elektrischen Leistung von 104 kW ausgestattet.<br />
Der Fermenter und das Zwischenlager besitzen<br />
ein Nutzvolumen von 1.250 m 3 bzw. 1.640 m 3 mit<br />
jeweils einem aufgesetzten Doppelmembrangasspeicher<br />
(350 m 3 und 450 m 3 ). Einerseits wird Rindergülle<br />
vergoren. Zum anderen wurde je nach experimenteller<br />
Fragestellung ein Substratmix aus Rinderfestmist,<br />
Maissilage, Grassilage und Getreideschrot eingesetzt.<br />
Das Feststoffsubstrat wird über eine Hammermühle<br />
vorzerkleinert und direkt dosiert. Die Raumbelastung<br />
lag im Bereich von 1,8 bis 2,1 kg oTS pro m 3 und Tag.<br />
Foto 3: Mobile Messtechnik zur Bestimmung der Biogasproduktionsrate an der BGA Köllitsch.<br />
Beispielhafte Umsetzung der flexiblen,<br />
modellgestützten Fütterung<br />
Ziel der Versuche an der FBGA des DBFZ war die praktische<br />
Demonstration der modellgestützten Regelung<br />
der Fütterung sowie des Blockheizkraftwerks (BHKW).<br />
Mithilfe der Software wurden Beschickungszeiten und<br />
-mengen des Feststoffs einerseits und Schaltzeiten des<br />
BHKW andererseits berechnet. Die Übertragung an die<br />
Biogasanlage erfolgte manuell. Um die Vergleichbarkeit<br />
der flexiblen zur konstanten Fütterung zu gewährleisten,<br />
wurde dieselbe mittlere Raumbelastung pro<br />
Woche verwendet. Der berechnete Mehrerlös (Stromerlös<br />
ohne Einbezug der Flexibilitätsprämie) bei diesen<br />
Versuchen lag rund 17 Prozent höher als bei konstantem<br />
BHKW-Betrieb.<br />
Ziel der Versuche an der Biogasanlage Köllitsch war,<br />
die praktische Umsetzbarkeit der flexiblen Fütterung<br />
mit möglichst geringen Eingriffen in die technischen<br />
und betrieblichen Abläufe an einer Biogasanlage aufzuzeigen.<br />
Es wurden diverse vorher berechnete Fütterungsszenarien<br />
bei unterschiedlichem Substratmix für<br />
Teillast- und Volllastbetrieb des BHKW realisiert.<br />
Der Datenaustausch sowie die Abstimmung zwischen<br />
dem DBFZ und dem Anlagenfahrer erfolgte in wöchentlichen<br />
Intervallen. Abbildung 2 zeigt beispielhaft eine<br />
Woche mit Fütterung im Rahmen üblicher Arbeitszeiten<br />
sowie eine moderate Absenkung der Fütterung am<br />
Wochenende. Durch diese einfachen Eingriffe in den<br />
Betrieb der Biogasanlage konnte die Biogasproduktionsrate<br />
(erzeugte Menge Biogas pro Zeit) um bis zu 40<br />
Prozent erhöht bzw. bis zu 10 Prozent gegenüber der<br />
durchschnittlichen Biogasproduktionsrate bei konstanter<br />
Beschickung reduziert werden.<br />
Herausforderungen bei der Flexibilisierung<br />
Zur Flexibilisierung der Gasproduktion bedarf es eines<br />
erheblichen Anteils schnell abbaubarer Substrate, wie<br />
Apfeltrester, Getreideschrot oder Zuckerrübensilage.<br />
Der Anteil an Rindergülle lag in den Versuchen immer<br />
über 50 Prozent bezogen auf die Frischmasse (FM),<br />
der Anteil schnell vergärbarer Substrate lag bei bis zu<br />
32 Prozent FM (bzw. 45 bis 55 Prozent oTS). Die restlichen<br />
bis zu 18 Prozent FM entfallen auf langsam bis<br />
mittelschnell vergärbare Feststoff-Substrate wie Maisund<br />
Grassilage.<br />
Zur möglichst genauen Dosierung und guten Durchmischung<br />
der einzelnen Substratanteile an der FBGA<br />
mussten die Substrate mithilfe eines Radladers durchmischt<br />
werden. Als Alternative bietet sich der Betrieb<br />
von mehreren unabhängigen Feststoffbeschickern an.<br />
Beim Einsatz von Apfeltrester, Zuckerrübe und Getreideschrot<br />
an der FBGA kam es nach mehreren großen<br />
Zugaben regelmäßig zur Schaumbildung, die durch Zugabe<br />
eines Antischaummittels vermindert wurde. Bei<br />
größeren Beschickungsmengen am späten Nachmittag<br />
und Abend war deshalb teilweise eine verlängerte Anwesenheit<br />
eines Anlagenfahrers notwendig.<br />
116
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Abbildung 2: Beispielhafter Verlauf der Biogasproduktionsrate an der Biogasanlage<br />
Köllitsch bei täglicher Fütterung, wochentags zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr<br />
und Reduktion am Wochenende<br />
BIOGASANALYSE<br />
SSM 6000<br />
WISSENSCHAFT<br />
der Klassiker für die Analyse<br />
von CH 4<br />
, H 2<br />
S, CO 2<br />
, H 2<br />
und O 2<br />
mit und ohne Gasaufbereitung<br />
* proCAL für SSM 6000, ist<br />
die vollautomatische,<br />
prüfgaslose Kalibrierung<br />
für NO x<br />
, CO und O 2<br />
, mehrere<br />
Meßstellen (44. BlmSchV.)<br />
*<br />
SSM 6000 ECO<br />
Abbildung 3: Zusammenfassung der Herausforderungen bei der modellgestützten<br />
Flexibilisierung mit Priorisierung für eine praktische Umsetzung<br />
Politik<br />
Bedarf an zuverlässiger, robuster<br />
Messtechnik<br />
Gasmanagement<br />
Personal<br />
Anforderungen an<br />
das Personal<br />
Arbeitsabläufe<br />
Kommunikation<br />
Redundanz / Fallback<br />
FOS/TAC<br />
automatischer Titrator<br />
zur Bestimmung<br />
von FOS, TAC und<br />
FOS/TAC<br />
Schaumbekämpfung/<br />
-kontrolle<br />
Substratmanagement<br />
Beanspruchung / Abnutzung<br />
Prozesstechnische Regelung<br />
An der BGA Köllitsch konnten hingegen<br />
kaum Schaumereignisse festgestellt werden,<br />
ein aktives Eingreifen war hier nicht<br />
notwendig. Ursächlich werden zum einen<br />
die Raumbelastungsunterschiede, geringere<br />
Anteile an kritischen Substraten<br />
(zum Beispiel Getreideschrot) als auch die<br />
geometrischen Verhältnisse der Fermenter<br />
(Hochfermenter FBGA versus Flachfermenter<br />
BGA Köllitsch) und damit ein unterschiedliches<br />
Aufsteigen von Gasblasen<br />
gesehen. Trotz der teilweise hohen Anteile<br />
schnell vergärbarer Substrate und großer<br />
Priorisierung in drei Schritten<br />
1 hohe Priorität<br />
1 mittlere Priorität<br />
3 niedrige Priorität<br />
Einzelbeschickungen (Tages-Raumbelastungen<br />
von bis zu 10 kg oTS pro m 3 und<br />
Tag) konnte keine Versäuerung der Prozesse<br />
beobachtet werden. Dies deckt sich mit<br />
eigenen Beobachtungen sowie Untersuchungen<br />
von anderen Forschungsinstituten.<br />
An der FBGA wurde die Gasproduktion des<br />
Hauptfermenters kontinuierlich gemessen.<br />
Hier zeigte sich, dass zur Abdeckung des<br />
großen Messbereichs [etwa 5 bis 50 m³ pro<br />
Stunde (h)] auf zwei verschiedene Messsysteme<br />
– einen Trommelgaszähler<br />
GASANALYSENTECHNIK<br />
BIOGASANALYSENTECHNIK<br />
WASSERANALYSENTECHNIK<br />
AGRARMESSTECHNIK<br />
www.pronova.de<br />
TRAS 120<br />
44. BlmSchV.<br />
sprechen<br />
Sie uns an!<br />
PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG<br />
Groninger Straße 25 I 13347 Berlin<br />
Tel +49 (0)30 455085-0 I info@pronova.de<br />
117
WISSENSCHAFT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Abbildung 4: Symbolische Einordung der verschiedenen Umsetzungskomplexitäten in Bezug zu der<br />
zu erreichenden Flexibilität und des notwendigen Aufwandes im Forschungsprojekt „Gazelle“<br />
(zirka 1 bis 14 m³ pro h) und Staudrucksonden (rund 9<br />
bis 100 m³ pro h) – zurückgegriffen werden musste. Als<br />
weitere Schlüsselgröße erwies sich die Messung und<br />
Überwachung des Gasspeicherfüllstandes.<br />
Hier konnte die Software im unteren Füllstandsbereich<br />
(≤50 Prozent), in dem die hydrostatische und die Seilzugmessung<br />
zu ungenau waren, wertvolle Informationen<br />
liefern. An der Biogasanlage Köllitsch war anfänglich<br />
keine Gasproduktionsmessung vorhanden. Daher wurde<br />
im Zuge des Forschungsvorhabens ein modulares Messsystem<br />
auf Ultraschallbasis zwischen Hauptfermenter,<br />
Zwischenlager und BHKW installiert (siehe Foto 3).<br />
Automatisierungsgrad und Personalbedarf<br />
an Betriebsweise anpassen<br />
Grundsätzlich war bei allen Versuchen ein höherer Personalbedarf<br />
aufgrund komplexerer Abläufe (Substrataufbereitung,<br />
Substratzugabe, Prozessüberwachung)<br />
®<br />
UTS SEPARATIONSTECHNIK<br />
MAXIMALE ABSCHEIDERATEN.<br />
KOMPROMISSLOS HOCHWERTIG.<br />
»<br />
Effiziente Separation<br />
von Gülle & Gärresten<br />
» Volumenreduktion & vereinfachte<br />
Ausbringung mit Schleppschlauch<br />
» Günstige Eigenproduktion von<br />
Einstreu aus Rindergülle (Bedding)<br />
» Geringer Verschleiß & einfache Wartung<br />
BHKW-Service<br />
· Regelwartungen<br />
· Teil- und Komplettrevisionen<br />
· Neu- und Ummotorisierungen<br />
· Lieferung von Austauschmotoren und Komponenten<br />
· Ersatzteilvertrieb<br />
Wir machen ihren Motor fit für die 44.BimSchV.<br />
NoX Überwachung/Regelung bis zum kompletten SCR System.<br />
Ihr Partner in Sachen Motorentechnik<br />
UTS Products GmbH · Telefon: 02923 - 610940<br />
www.anaergia-technologies.com<br />
Industriestr. 7 · 49716 Meppen · Tel. 05931-9844-0 · kem@kloska.com<br />
118
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
WISSENSCHAFT<br />
notwendig. Die im Forschungsprojekt umgesetzte Betriebsart<br />
der modellgestützten flexiblen Fütterung ist<br />
aufgrund noch fehlender Automatisierung anfällig für<br />
Übermittlungs- und Bedienfehler. Es sind zukünftig geeignete<br />
Schnittstellen zum Daten- oder Informationsaustausch<br />
zwischen Regelung und Anlagenpersonal<br />
erforderlich.<br />
Im Rahmen der flexiblen Fütterung ist das Anlagenpersonal<br />
verstärkt gefordert, wachsam zu agieren und öfter<br />
Fütterungspläne und Betriebsweisen zu kontrollieren.<br />
Auch starre Arbeitszeitregelungen stellen eine Herausforderung<br />
dar. Weiterhin müssen Regeln für Störfälle<br />
erarbeitet und abgestimmt werden.<br />
Zusammenfassend konnten im Forschungsprojekt<br />
„Gazelle“ an der FBGA des DBFZ sowie der Anlage<br />
Köllitsch die in Abbildung 3 gelisteten Herausforderungen,<br />
inklusive Priorisierung beim flexiblen Anlagenbetrieb,<br />
identifiziert werden. Die Ergebnisse des<br />
Forschungsprojektes „Gazelle“ zeigen, dass mit dem<br />
modellgestützten Fütterungsmanagement, einer Biogasvolumenstrommessung<br />
sowie vorhandenem Gasspeicher<br />
eine flexible Prozessführung praktisch realisiert<br />
werden kann (siehe Abbildung 4).<br />
Dieses Potenzial kann durch den gezielten Einsatz von<br />
schnell abbaubaren Substraten gesteigert werden. Im<br />
Rahmen der praktischen Umsetzung ist allerdings mit<br />
erhöhten Aufwendungen hinsichtlich Prozesskontrolle<br />
(zum Beispiel Schaumbildung), Personal und Kommunikation<br />
zu rechnen. Der konkrete ökonomische Mehrwert<br />
ist dabei an jeder Anlage individuell zu ermitteln.<br />
1<br />
DBFZ – Deutsches Biomasseforschungszentrum<br />
gemeinnützige GmbH<br />
2<br />
Lehr- und Versuchsgut Köllitsch<br />
Europäische Union<br />
Hinweis: Das Forschungsvorhaben „Gazelle“ wurde<br />
unter dem Förderkennzeichen 100267056 vom<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie<br />
dem Freistaat Sachsen gefördert.<br />
Kontakt<br />
Dr. Jörg Kretzschmar<br />
Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH<br />
Torgauer Str. 116 · 04347 Leipzig<br />
03 41/24 34 419<br />
joerg.kretzschmar@dbfz.de<br />
www.dfbz.de<br />
Sichere Erträge bei<br />
jedem Wetter –<br />
Schutz bei Hagel,<br />
Sturm, Starkregen<br />
und Frost.<br />
Leistungsumfang:<br />
• Finanzielle Sicherheit bei Hagel,<br />
Sturm, Starkregen und Frost<br />
• Keine Prämienerhöhung nach<br />
Schaden<br />
• Kein Nachschuss,<br />
kein Sicherheitszuschlag<br />
• Flexible und bedarfsgerechte<br />
Selbstbehalte<br />
Jansen & Özgürbüz OHG<br />
Allianz Generalvertretung<br />
Telefon 021 61.57 59 79 0<br />
jansen.oezguerbuez@allianz.de<br />
www.jansen-oezguerbuez.de<br />
119
INTERNATIONAL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Manila<br />
PHILIPPINEN<br />
Umwandlung von<br />
Ananasabfällen in Biogas<br />
Die Philippinen sind ein Archipel in Südostasien, der aus mehr als 7.000 Inseln im Pazifischen<br />
Ozean besteht. Mit einer langen Gesamtküste sind die Philippinen mit unberührten<br />
weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser gesegnet. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft<br />
der Filipinos erhöht das Potenzial der Philippinen, eines der Top-Destinationen<br />
für Urlaub und exotische Reisen mit preisgünstigen Optionen zu werden. Aber die<br />
Philippinen haben auch andere unsichtbare Potenziale, versteckt in Form von Energie.<br />
Von Medina Berbic<br />
Die Biogastechnologie wurde 1965 auf<br />
den Philippinen von Dr. Felix D. Maramba<br />
eingeführt, einem Agrar- und Maschinenbauingenieur,<br />
der dort noch heute als<br />
wichtiger Wissenschaftler und Entwickler<br />
von Biogasanwendungen bekannt ist. Zum Zeitpunkt<br />
ihrer Einführung erhielt die Biogastechnologie keine<br />
soziale oder wirtschaftliche Unterstützung als Methode<br />
der Energieerzeugung, da Kraftstoff billig und leicht<br />
verfügbar war. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis die<br />
Technologie an ökologischer und kommerzieller Bedeutung<br />
gewann.<br />
Die Ölkrise von 1973 hat die Philippinen in ähnlicher<br />
Weise getroffen wie die größte Ölpest in der Geschichte<br />
des Landes. Nach der Krise wurde den Erneuerbaren<br />
Energien mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wobei der<br />
Schwerpunkt auf der Entwicklung und Nutzung von<br />
Wasserkraft, Geothermie und Solarenergie lag. Die<br />
Biogasindustrie mit ihrer komplexen Technologie begann<br />
viel später, Anfang des 21. Jahrhunderts (2000),<br />
nachdem sie verschiedene Studien durchgeführt und<br />
das Potenzial von Biomasse analysiert hatte. Praktische<br />
Anwendungen waren bisher nur kleine Biogasanlagen<br />
für den Heimgebrauch, da Großanlagen aufgrund<br />
der Allgegenwart von Kohle zur Stromerzeugung<br />
wirtschaftlich nicht realisierbar waren.<br />
Nach dem Beitritt der Philippinen zum Pariser Klimaabkommen<br />
im Jahr 2017, als sich das Land verpflichtete,<br />
die Treibhausgasemissionen um 70 Prozent zu<br />
reduzieren und die erneuerbaren Energiequellen bis<br />
2030 auf 35 Prozent zu erhöhen, begann die Biogastechnologie<br />
eine größere Rolle bei der Erreichung<br />
FOTOS: LIPP GMBH<br />
120
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INTERNATIONAL<br />
dieses Ziels zu spielen. Das große Potenzial der Philippinen<br />
als Agrarland liegt in den großen Mengen an<br />
Bioabfällen, ein Problem, mit dem die philippinische<br />
Regierung zu kämpfen hat.<br />
4.700 MW könnten mit allen organischen<br />
Abfällen realisiert werden<br />
Das Abfallwirtschaftssystem ist in der Praxis noch nicht<br />
etabliert, und der gesammelte Bioabfall ist unsortiert,<br />
vermischt mit Kunststoff und anderem Abfall. Weiteres<br />
Potenzial liegt in Siedlungsabfällen, Tiermist –<br />
die Schweineproduktion ist eine der wichtigsten Industrien<br />
auf den Philippinen –, Fischabfällen und Abfällen<br />
aus exotischen Früchten. So zeigt eine Studie<br />
der U.S. Energy Association aus dem Jahr 2015, dass<br />
4.700 Megawatt (MW) Energie erzeugt werden könnten,<br />
wenn alle organischen Abfälle auf den Philippinen<br />
genutzt würden.<br />
Trotz dieses hohen Potenzials ist die Biogastechnologie<br />
und ihre Umsetzung auf den Philippinen noch<br />
nicht weit verbreitet. Es gibt nicht genügend soziale<br />
und wirtschaftliche Unterstützung, um den Mangel an<br />
Informationen und Erfahrungen auszugleichen und<br />
Herstellern und Entwicklern von Biogastechnologie<br />
zum Erfolg zu verhelfen.<br />
Einige große Biogasanlagen mit einer durchschnittlichen<br />
Leistung von 1 MW wurden gebaut, aber der<br />
größte Teil des Potenzials ist noch ungenutzt. Gleichzeitig<br />
ist das Land immer noch stark von Kohle für<br />
die Stromerzeugung abhängig und hat im Vergleich zu<br />
anderen asiatischen Ländern die höchsten Energiekosten.<br />
Dies betrifft nicht nur die philippinische Bevölkerung,<br />
sondern auch die globale Wettbewerbsfähigkeit<br />
des Landes.<br />
Dole – Reststoffe zu Biogas<br />
Mindanao, die zweitgrößte Insel der Philippinen (nach<br />
Luzon), liegt in der südlichen Region des Archipels.<br />
Die größte Ananas-Dosenfabrik der Philippinen, Dole<br />
Philippines, Inc., befindet sich hier. Das Unternehmen<br />
verfügt über zwei Betriebsstandorte, Surallah und Polomolok,<br />
und verarbeitet Fruchtsäfte und Konserven<br />
aus Ananas sowie aus kleineren Mengen anderer exotischer<br />
Früchte wie Bananen und Mangos. Dole Philippines,<br />
Inc. ist Teil des Unternehmens Dole, einem<br />
internationalen Marktführer mit einem umfangreichen<br />
Sortiment an hochwertigen exotischen Früchten und<br />
daraus hergestellten Produkten. Ihre Produkte sind in<br />
jedem Supermarkt in Deutschland zu finden.<br />
Dole Philippines, Inc. produzierte 2018 mehr als<br />
180.000 Tonnen organische Abfälle (Ananasschalen –<br />
basierend auf den statistischen Daten des Unternehmens),<br />
und die Menge wird in den kommenden<br />
Jahren voraussichtlich wachsen. Der unverarbeitete<br />
Ananasrückstand wurde kompostiert. Dabei entweicht<br />
Methan in die Atmosphäre. Die Verwendung der unverarbeiteten<br />
Ananasrückstände auf diese Weise machte<br />
jedoch auf die hohen Methanemissionen und den unzureichenden<br />
Verbrauch der reichhaltigen Nährstoffe<br />
im Dünger aufmerksam. Dies führte zur Ermittlung<br />
von Möglichkeiten zur Verbesserung des Abfallbewirtschaftungssystems<br />
mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen<br />
zu reduzieren und die Qualität von Düngemitteln<br />
zu erhöhen.<br />
So wurde ermittelt, dass die Gewinnung des aus der<br />
anaeroben Vergärung von Ananasschalenabfällen<br />
erzeugten Methans die CO 2<br />
-Emissionen um etwa<br />
50.000 Tonnen pro Jahr reduzieren kann. Im Gegenzug<br />
kann dieses Methan anstelle fossiler Brennstoffe<br />
verwendet werden, um Strom und Dampf in der Fabrik<br />
zu erzeugen. Diese wichtigen Erkenntnisse und die<br />
CO 2<br />
-Kompensation spielten eine wichtige Rolle bei<br />
der Entscheidung, eine industrielle Biogasanlage mit<br />
einer Gesamtleistung von 7,9 MW zu installieren. Es<br />
handelt sich um zwei Biogasanlagen, eine in Surallah<br />
mit einer Leistung von 2,9 MW und eine in Polomolok<br />
mit einer Leistung von 5 MW. Die geschätzten Kosten<br />
für die Realisierung dieses Projekts beliefen sich auf<br />
eine Milliarde philippinischer Pesos (16,7 Millionen<br />
Euro).<br />
Mit Unterstützung des Joint Crediting Mechanism<br />
(JCM), eines von der japanischen Regierung eingeführten<br />
Progamms, war es möglich, eine Kofinanzierung<br />
zu sichern, um diese Idee umzusetzen. Das<br />
JMC-Programm unterstützt die Verringerung der weltweiten<br />
Treibhausgasemissionen durch die Förderung<br />
fortschrittlicher kohlenstoffarmer Technologien und<br />
Systeme in Entwicklungsländern. Mit diesem Finanzierungsprogramm<br />
werden 172 Projekte in 17 verschiedenen<br />
Entwicklungsländern unterstützt. Das Biogasprojekt<br />
auf den Philippinen trägt den Titel „Biogas<br />
Power Generation and Fuel Conversion“.<br />
121
INTERNATIONAL<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Wie wurde Lipp Teil des<br />
Projekts?<br />
Die deutsche Firma Lipp GmbH<br />
ist auf dem internationalen Biogasmarkt<br />
mit ihrem einzigartigen<br />
„Doppelfalz-System“ und<br />
Tanks aus Verinox®-Material<br />
bekannt. Das Unternehmen bot<br />
Lösungen für die Realisierung<br />
dieser beiden großen Biogasanlagen<br />
und der Verarbeitung<br />
von Ananasrückständen, einem<br />
Rohstoff, der nicht ausreichend<br />
erforscht wurde. Darüber hinaus<br />
galt die deutsche Biogastechnologie<br />
als geeignet, um<br />
die hohen Anforderungen an<br />
einen JCM-Zuschuss zu erfüllen<br />
und um den langfristigen<br />
und zuverlässigen Betrieb der<br />
Biogasanlage zu gewährleisten.<br />
Lipp wurde von MetPower Venture<br />
Partners, dem offiziellen<br />
Auftragnehmer des Projekts,<br />
mit der Entwicklung und dem<br />
Bau von zwei Biogasanlagen<br />
beauftragt, die in die Canning-<br />
Anlagen Surallah und Polomolok<br />
(Süd-Cotabato, Philippinen)<br />
integriert werden sollen.<br />
Der erste Entwurf von Vormachbarkeitsstudien<br />
für diese beiden<br />
Großanlagen wurde 2017<br />
gestartet. Zwei Jahre waren nötig,<br />
um die endgültigen Pläne<br />
fertigzustellen und alle erforderlichen<br />
Genehmigungen und<br />
Aufträge zu erhalten.<br />
Der Biogasanlagenkomplex in<br />
Surallah besteht aus folgenden Lipp-Komponenten:<br />
zwei Lipp-ECO-Fermentern mit jeweils 5.000 Kubikmeter<br />
(m 3 ) Volumen, mit einer zusätzlichen 8.300 m 3<br />
fassenden Gasspeichermembran, einem Puffertank<br />
mit einem Volumen von 2.500 m 3 und einem weiteren<br />
Puffertank mit einem Volumen von 900 m 3 . Der Biogasanlagenkomplex<br />
in Polomolok besteht aus folgenden<br />
Komponenten: drei Lipp-ECO-Gärbehältern mit jeweils<br />
6.000 m 3 Volumen, mit einer zusätzlichen 8.300 m 3<br />
fassenden Gasspeichermembran, einem Puffertank<br />
mit einem Volumen von 5.000 m 3 und einem weiteren<br />
Puffertank mit einem Volumen von 1.300 m 3 .<br />
Der Bau der ersten Biogasanlage in Surallah begann<br />
2019, aber aufgrund der Auswirkungen von Covid-19<br />
im Jahr 2020 wurde der Bau um einige Monate verschoben.<br />
Zusätzliche Schwierigkeiten mit internationalen<br />
Reisebeschränkungen und Quarantäneprotokollen<br />
haben die weitere Arbeit vor Ort stark beeinträchtigt.<br />
Dank der guten Zusammenarbeit und Organisation aller<br />
Beteiligten wurde die Arbeit jedoch bis zur Inbetriebnahme<br />
abgeschlossen. Hoffentlich wird die Anlage in<br />
den nächsten Monaten voll in Betrieb sein.<br />
Der Bau der zweiten Biogasanlage in Polomolok mit<br />
einem geplanten Start im Jahr 2020 musste wegen<br />
der Covid-19-Pandemie ebenfalls verschoben werden.<br />
Trotz der aktuellen Situation ist das Lipp-Team vor einiger<br />
Zeit auf den Philippinen angekommen und arbeitet<br />
weiter vor Ort. Sobald die beiden Anlagen voll einsatzfähig<br />
sind, werden sie 100 Prozent der Ananas-Abfälle<br />
zur Erzeugung Erneuerbarer Energien nutzen und zur<br />
Verringerung von Treibhausgasen und Luftschadstoffemissionen<br />
sowie zur Senkung der Stromkosten für Dole<br />
beitragen.<br />
Bildungsprojekt für Filipinos –<br />
Biogasausbildung<br />
„Kann ich Methan riechen?“, „Riecht es nicht<br />
schlecht?“, „Was kann ich mit Biogas machen?“ – diese<br />
Fragen verdeutlichen den Mangel an Informationen<br />
und Erfahrungen mit der Biogasproduktion in diesem<br />
Land. Aus diesem Grund führte das Unternehmen Lipp<br />
ein zusätzliches Promotion-Projekt auf den Philippinen<br />
mit pädagogischen Inhalten durch. Im Rahmen eines<br />
develoPPP.de-Projektprogramms wurden erfahrene<br />
deutsche Biogasexperten vom Fachverband Biogas e.V.<br />
und von Lipp, von einem lokalen Partner, der Deutsch-<br />
Philippinischen Industrie- und Handelskammer (AHK<br />
Philippinen), unterstützt, Biogasschulungen durchzuführen<br />
und ein Biogaslabor einzurichten. Dieses Projekt<br />
beinhaltete auch den Transfer von technischem<br />
Know-how sowie eine gründliche und umfassende<br />
theoretische und praktische Ausbildung einschließlich<br />
Sicherheitstraining.<br />
Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten die Experten<br />
des Fachverbandes Biogas e.V. nicht auf die Philippinen<br />
reisen, um die erste Schulung vor Ort durchzuführen,<br />
sondern es wurde ein virtuelles Trainingsprogramm<br />
organisiert. Das mit sechs Blöcken zu je drei Stunden<br />
ausgelegte Training wurde im März <strong>2021</strong> mit 70 Teilnehmern<br />
veranstaltet. Das develoPPP.de-Projekt wurde<br />
von der Deutschen Investitionsgesellschaft (DEG) mit<br />
öffentlichen Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ,<br />
www.developpp.de) kofinanziert. Das BMZ kann die<br />
innovativen Projekte und kommerziellen Investitionen<br />
Ihres Unternehmens in Entwicklungs- und Schwellenländern<br />
unterstützen, sofern sie langfristige Vorteile für<br />
die lokale Bevölkerung bieten.<br />
Autorin<br />
Medina Berbic<br />
Lipp GmbH<br />
m.berbic@lipp-system.de<br />
122
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
INTERNATIONAL<br />
SÜDKOREA<br />
Seoul<br />
Mandarinensaftproduktion – aus<br />
Reststoffen wird Biogas gewonnen<br />
Im Herzen von Jeju, der mit Abstand größten südkoreanischen Insel, durfte das in Ostwürttemberg<br />
ansässige Unternehmen Lipp an einem beeindruckenden Projekt teilnehmen, bei dem ein System zur<br />
umweltverträglichen Verwertung von Rückständen aus der Herstellung von Mandarinensaft gesucht<br />
und innerhalb von nur zehn Monaten verwirklicht wurde.<br />
Von Achim Kaiser<br />
FOTO: LIPP GMBH<br />
Jeju ist eine subtropische Vulkaninsel,<br />
die 100 Kilometer südlich<br />
der koreanischen Halbinsel liegt,<br />
in etwa so groß wie Mallorca ist<br />
und aufgrund ihres milden Klimas<br />
optimale Voraussetzungen für den Anbau<br />
von Zitruspflanzen besitzt. Darüber hinaus<br />
ist die Insel dank ihrer üppigen und vielfältigen<br />
Natur sowie seiner weiten Strände<br />
ein beliebter Anlaufpunkt auf Kreuzfahrten<br />
durch Ostasien.<br />
China ist mit einem Marktanteil von 55<br />
Prozent weltweit gesehen der mit Abstand<br />
größte Produzent von Mandarinen. Südkorea,<br />
wo sich der Anbau auf Jeju beschränkt,<br />
belegt mit einem Anteil von knapp 2 Prozent<br />
den zehnten Platz. Aufgrund des milden<br />
Klimas gedeihen auf dieser Insel über<br />
40 verschiedene Sorten. Die Mandarinenernte<br />
findet auf Jeju im Zeitraum Oktober<br />
bis Februar statt. Durch ihre hohen Gehalte<br />
an den Vitaminen A und C, Calcium sowie<br />
Kalium gilt das bekannte Winterobst als<br />
sehr gesundes Nahrungsmittel. Die Verarbeitung<br />
zu Saft ist vor allem aufgrund einer<br />
strengen Vorschrift, die vorsieht, dass Mandarinensaft<br />
zu 100 Prozent aus Früchten<br />
bestehen muss, eher selten.<br />
Auf Jeju befindet sich die einzige südkoreanische<br />
Produktionsstätte für Mandarinensaft.<br />
Ihre Verarbeitungskapazität wurde in<br />
den letzten Jahren stetig gesteigert. Die anfallenden<br />
Pressrückstände aus der Saftproduktion<br />
werden in einem Entwässerungssystem<br />
weiterverarbeitet. Der dabei anfallende<br />
Presskuchen findet Verwendung in der Rinderfütterung<br />
und die dünne Flüssigphase<br />
dient als Futter für die Biogasanlage.<br />
Da in der Getränkeindustrie die Anforderungen<br />
an die Qualität von Frisch- und<br />
Prozesswasser hoch sind, führte die Steigerung<br />
der Saftproduktion dazu, dass die<br />
Reinigungsleistung der aerob betriebenen<br />
Kläranlage an ihre Grenzen kam. Folglich<br />
wurde in den letzten Jahren die Aufbereitung<br />
auf eine Wasserqualität, die zur Einleitung<br />
in den Vorfluter ausreichend ist,<br />
immer aufwändiger. Die Ursache lag darin,<br />
dass der Biochemische Sauerstoffbedarf<br />
(BSB), der die Sauerstoffmenge angibt, die<br />
zum biologischen Abbau der organischen<br />
Verbindungen im Abwasser durch Bakterien<br />
benötigt wird, mit 165 Gramm pro Liter<br />
deutlich über dem zulässigen Grenzwert<br />
lag. Vor dem Hintergrund, dass auf der Insel<br />
Jeju hohe staatliche Umweltauflagen<br />
einzuhalten sind, mussten hier Lösungen<br />
gefunden wurden.<br />
Anlagenbau und<br />
Betriebserfahrungen<br />
Bei der Produktion von Mandarinensaft<br />
handelt es sich nicht um ein ganzjähriges,<br />
sondern um ein saisonales Geschäft, das zu<br />
Beginn der Ernte startet und etwas mehr als<br />
ein halbes Jahr dauert. Für eine gleichmäßige<br />
Betriebsleistung der zu errichtenden<br />
Biogasanlage waren deshalb zur Lagerung<br />
der Mandarinensaft-Reste vier stehende<br />
Behälter mit einem Lagervolumen von insgesamt<br />
20.000 Kubikmetern notwendig.<br />
Um eine maximale Dichtheit zu erreichen,<br />
wurden diese, sowie alle weiteren von der<br />
Firma Lipp gelieferten Behälter, mit dem<br />
patentierten Doppelfalzsystem aus einem<br />
Edelstahl-Verbundmaterial hergestellt.<br />
Es handelt sich dabei um einen Universalfermenter<br />
(850 Kubikmeter) zur anaeroben<br />
Vorbehandlung des hochbelasteten Abwassers<br />
vor der aeroben Weiterbehandlung in<br />
der kommunalen Kläranlage und einen<br />
Misch- und ein Pufferbehälter. Deren Volumen<br />
beträgt jeweils 100 Kubikmeter. Das<br />
im Fermenter produzierte Biogas wird zur<br />
Wärmeerzeugung für die Abwasserbehandlungsanlage<br />
und die Produktionsstätte genutzt.<br />
Die komplette Anlage wurde 2019<br />
in Betrieb genommen. Seitdem läuft sie<br />
erfolgreich und erreicht beim Abwasser<br />
sehr gute BSB-Werte von unter 3 Gramm<br />
pro Liter.<br />
Autor<br />
Achim Kaiser<br />
Geschäftsführer der FnBB e.V.<br />
und Projektingenieur bei der IBBK<br />
Fachgruppe Biogas GmbH<br />
kaiser@fnbb.de<br />
123
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Aus der<br />
Verbandsarbeit<br />
BERICHT AUS DER GESCHÄFTSSTELLE<br />
Aktionismus zum Ende<br />
der Legislaturperiode<br />
Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode verabschiedet die<br />
scheidende Bundesregierung zahlreiche Gesetze, Verordnungen<br />
und Förderprogramme. Dies ist für unsere Mitarbeitenden in den<br />
Geschäftsstellen genauso eine Herausforderung wie für unsere in<br />
den Gremien ehrenamtlich Aktiven. Gesetzestexte müssen schnell<br />
analysiert und Stellungnahmen geschrieben werden.<br />
Von Dr. Stefan Rauh und Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Ein Beispiel ist die Novelle des Klimaschutzgesetzes mit einer halbtägigen<br />
Stellungnahmefrist. Ziel unserer Stellungnahme ist eine Anerkennung<br />
der Klimaschutzleistung der Bioenergie. Auch zwei Baustellen rund um<br />
das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) werden voraussichtlich noch<br />
vor der Sommerpause geschlossen. Zum einen soll die Regelung zum<br />
Flexzuschlag korrigiert werden, was für die Perspektive der Biogasbranche höchste<br />
Relevanz hat. Es geht vor allem darum, dass Anlagen in der Anschlussvergütung<br />
den Flexzuschlag ebenfalls bekommen können. In diesem Zusammenhang war der<br />
Fachverband Biogas e.V. am Runden Tisch der Clearingstelle beteiligt, bei dem eine<br />
Korrekturfassung für das EEG ausgearbeitet wurde, die den Belangen der Branche<br />
entspricht.<br />
Korrekturen am EEG mit Licht und Schatten<br />
Zum anderen legte das Bundeskabinett eine Verordnung zur Umsetzung des EEG<br />
<strong>2021</strong> vor. Dabei soll unter anderem eine Verordnungsermächtigung zur Einführung<br />
einer Anschlussvergütung für kleine Gülle vergärende Biogasanlagen nach Ablauf<br />
ihres ersten Vergütungszeitraums umgesetzt werden. Das im Entwurf festgelegte<br />
Vergütungsniveau bietet keine echte Anschlussperspektive und erlaubt langfristig<br />
keinen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Anlagen. Sandra Rostek aus dem Hauptstadtbüro<br />
Bioenergie war zur Ausschusssitzung zu Änderungen des EEG in den Bundestag<br />
geladen und konnte den Unmut der Branche an dem Vorschlag adressieren.<br />
Im Mai beschloss der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Weiterentwicklung der<br />
Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) im Verkehrssektor. Zwischen dem absolut<br />
desaströsen Erstentwurf und der nun beschlossenen finalen Fassung liegen<br />
Welten. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, vieles entscheidend zu verbessern:<br />
Die Treibhausgasminderungsquote wird von derzeit 6 in jährlichen Schritten auf 25<br />
Prozent im Jahr 2030 angehoben.<br />
124
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Engagiert. Aktiv. Vor Ort. Und in Berlin: Der Fachverband Biogas e.V.<br />
Dies bringt Klimaschutz auf die Straße und<br />
Planungssicherheit für alle Erfüllungsoptionen,<br />
darunter Biomethan als Kraftstoff.<br />
Des Weiteren konnte erreicht werden, dass<br />
auch biogener Wasserstoff ab 1. Juli 2023<br />
bei Einsatz im Verkehr auf die THG-Quote<br />
anrechenbar ist. Unterm Strich also ein<br />
gutes Ergebnis, das Biogas Perspektiven<br />
abseits des EEG aufzeigt.<br />
Aktuelle Entwicklungen im<br />
Referat Abfall, Düngung und<br />
Hygiene<br />
Ende Mai wurde der langjährige Leiter des<br />
Referates, David Wilken, verabschiedet. Er<br />
übernimmt neue Aufgaben bei der Gütegemeinschaft<br />
Kompost (BGK) und bleibt<br />
der Branche damit verbunden. Die Verantwortung<br />
für das Referat übernimmt jetzt<br />
Mathias Hartel, der bereits umfangreiche<br />
Erfahrungen und Kompetenzen in dem<br />
Themenfeld sammeln konnte.<br />
Im Zuge der Evaluierung der Stoffstrombilanzverordnung<br />
gab es mehrere Gespräche<br />
mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium<br />
(BMEL) und internen Gremien. Erstes Ziel<br />
war, mit Praxisdaten zu zeigen, dass die Bilanzierung<br />
mit dem derzeitigen System gerade<br />
bei flächenlosen Biogasanlagen überwiegend<br />
zu Abweichungen führt. Gründe hierfür<br />
sind, dass die Standardwerte auf Betriebsebene<br />
die Realität derzeit nicht abbilden.<br />
Für mögliche Lösungsansätze wurden in<br />
der Geschäftsstelle weiterführende Berechnungen<br />
auf der Basis von Praxisdaten<br />
vorgenommen. Die Ergebnisse der Berechnungen<br />
werden in den Evaluierungsbericht,<br />
der bis Ende des Jahres seitens des BMEL<br />
fertiggestellt wird, einfließen. Weitere Gespräche<br />
sind zudem mit dem BMU geplant.<br />
Zur Vorbereitung der Beratungen haben wir<br />
nun einen Testlauf mit einigen freiwilligen<br />
Betreibern gestartet, die sich nach unserem<br />
Aufruf im Betreiberfax gemeldet haben.<br />
Web-Seminare zum Vollzug der<br />
Düngeverordnung<br />
Zur Umsetzung der DüV finden aktuell in<br />
mehreren Bundesländern Web-Seminare<br />
statt. Die Referenten kommen von den zuständigen<br />
Behörden zur Ausweisung der roten<br />
Gebiete und von die Vollzugsbehörden<br />
zur Umsetzung düngerechtlicher Anforderungen.<br />
Durch die vermehrten Anfragen aus<br />
der Mitgliedschaft bietet sich mit dieser<br />
Veranstaltung die Möglichkeit, Antworten<br />
zu aktuellen Fragen aus erster Hand zu erlangen.<br />
Kleine Novelle der<br />
Bioabfallverordnung<br />
Im Zuge der kleinen Novelle der BioAbfV<br />
wurden mehrere Gespräche mit dem Bundesumweltministerium<br />
und den Gremien<br />
zur Einführung eines Kontrollwertes durchgeführt.<br />
Bereits in der ersten Stellungnahme<br />
und der gemeinsamen Erklärung der<br />
Verbände wurde die Dringlichkeit einer Berücksichtigung<br />
der Herkunft der Bioabfälle<br />
und ein mögliches Rückweisungsrecht<br />
zum Vorschlag der Einführung eines Kontrollwertes<br />
und der Bezug zu Kunststoffen<br />
hervorgehoben. Offen ist, ob die positiven<br />
Gespräche auch in der Fortführung des<br />
Gesetzgebungsverfahren so berücksichtigt<br />
werden. Aktuell werden durch das statistische<br />
Bundesamt Abfragen zum Erfüllungsaufwand<br />
vorgenommen, um die Kosten<br />
durch die neue BioAbfV abzuschätzen.<br />
Referat Energierecht beschäftigt<br />
sich mit aktuellen Praxisfragen<br />
rund um das EEG<br />
Innovative Firmen der Branche haben in<br />
den vergangenen Jahren eine ORC-Technik<br />
zur Stromerzeugung entwickelt, die nicht<br />
den Abgasstrom, sondern die Hitze nutzt,<br />
die normalerweise über Wärmetauscher<br />
vom Blockheizkraftwerk (BHKW) weggeführt<br />
wird. Aus rechtlicher Sicht ergibt sich<br />
hier für uns die Frage, ob nur der mittels<br />
der ORC-Technik erzeugte Strom oder der<br />
gesamte Strom mit dem Technologiebonus<br />
in Höhe von 2 Cent pro Kilowattstunde prämiert<br />
wird. In Gesprächen mit Netzbetreibern<br />
setzen wir uns für die Vergütung der<br />
gesamten Strommenge ein.<br />
Mit dem EEG <strong>2021</strong> wurde als Vergütungsvoraussetzung<br />
neu in das Gesetz aufgenommen,<br />
dass Anlagen hocheffizient sein müssen.<br />
In seiner Stellungnahme, aber auch<br />
in vielen Gesprächen hat der Fachverband<br />
Biogas e.V. (FvB) darauf hingewiesen, dass<br />
die entsprechenden Regeln unklar und wenig<br />
praxisgerecht sind. Aufgrund der Tatsache,<br />
dass Güllekleinanlagen manchmal<br />
nur eine geringe oder keine Wärmenutzung<br />
außerhalb des Fermenters haben, wird nun<br />
von einem sehr großen Netzbetreiber die<br />
Frage gestellt, ob diese kleinen Güllekleinanlagen<br />
überhaupt KWK-Anlagen sind. Der<br />
FvB strebt eine Einigung mit dem Netzbetreiber<br />
an.<br />
Redispatch 2.0 – Gespräche mit<br />
Bundesnetzagentur<br />
Die Umsetzung des Redispatch 2.0 schreitet<br />
weiter voran und mittlerweile haben<br />
viele unserer Mitglieder Anschreiben<br />
Fachverband Biogas Service GmbH<br />
– Testlauf der Düngeberatungen<br />
Ab Oktober werden wir über unsere Service<br />
GmbH Düngeberatungen für Mitglieder des<br />
Verbands anbieten. Der Schwerpunkt wird<br />
dabei auf Bayern und Niedersachsen liegen.<br />
Immer wenn wir Energie brauchen, kann Biogas liefern:<br />
Bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter.<br />
Regional. Verlässlich. Klimafreundlich. Biogas kann‘s!<br />
125
VERBAND<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
von ihren Anschlussnetzbetreibern bekommen.<br />
Leider stellen sich trotz umfangreicher<br />
Dokumente der BNetzA und des<br />
BDEW zahlreiche Fragen für die praktische<br />
Umsetzung. Um die Probleme der Branche<br />
darzustellen, haben wir im Mai ein Gespräch<br />
mit der Bundesnetzagentur geführt.<br />
Zusammen mit unserem Dachverband,<br />
dem Bundesverband Erneuerbare Energie<br />
e.V., haben wir zahlreiche Punkte angesprochen,<br />
deren Umsetzung aktuell noch sehr<br />
unklar ist.<br />
Im Biogasbereich ist dies unter anderem<br />
die für viele Betreiber wichtige Eigenversorgung,<br />
die im Rahmen des neuen Systems<br />
nachrangig geregelt werden soll. Um<br />
unsere Mitglieder bei der Umsetzung zu unterstützen,<br />
haben wir eine Arbeitshilfe zum<br />
Redispatch 2.0 veröffentlicht sowie ein<br />
Hintergrundpapier zur Direktvermarktung,<br />
da den Direktvermarktern als potentiellen<br />
„Einsatzverantwortlichen“ eine Schlüsselrolle<br />
im Redispatch 2.0 zukommt. Insbesondere<br />
Betreiber, die aktuell noch nicht in<br />
der Direktvermarktung sind, beschäftigen<br />
sich daher verstärkt mit dem Thema.<br />
Vermehrt wurde an die Geschäftsstelle<br />
die Frage herangetragen, unter welchen<br />
EEG- und öffentlich-rechtlichen Vorgaben<br />
Kartoffeln in Biogasanlagen eingesetzt werden<br />
können, die eigentlich zur Herstellung<br />
von Pommes geerntet wurden. Diese Frage<br />
wurde in der Geschäftsstelle umfassend<br />
rechtlich beleuchtet und das Ergebnis wird<br />
alsbald im Biogas-Journal veröffentlicht.<br />
800 Mitglieder zu Vorgaben<br />
der Nachhaltigkeitsverordnung<br />
geschult<br />
Auch das zweite Quartal <strong>2021</strong> war sehr<br />
rege für den Veranstaltungsbereich des<br />
FvB. Um das diesjährige Konzept für die<br />
BIOGAS Convention & Trade Fair festzulegen,<br />
wurde eine Mitgliederumfrage durchgeführt,<br />
in der Firmen und Aussteller individuell<br />
befragt wurden. Das Ergebnis ist,<br />
dass erstmalig der Tagungsteil „BIOGAS<br />
Convention“ vom 22. bis 26. November<br />
<strong>2021</strong> digital stattfinden wird, gefolgt von<br />
der Live-Fachmesse „BIOGAS Trade Fair“<br />
vom 7. bis 9. Dezember <strong>2021</strong> in der Nürnberg<br />
Messe.<br />
Um den neuen Sicherheits- und Hygieneregeln<br />
gerecht zu werden, wird zudem an der<br />
Einführung eines umfassenden elektronischen<br />
Registrierungs- und Einlasssystems<br />
gearbeitet.<br />
Acht Web-Infoseminare zur Umsetzung der<br />
Nachhaltigkeitsverordnung wurden organisiert<br />
und mit an die 800 Teilnehmern überaus<br />
erfolgreich durchgeführt. Bei den Veranstaltungen<br />
mit besonderen Zielgruppen<br />
konnte der zweite Erfahrungsaustausch für<br />
zur Prüfung befähigte Personen auf Biogasanlagen<br />
gemäß Betriebssicherheitsverordnung<br />
(BetrSichV) ebenfalls erfolgreich<br />
veranstaltet werden. Der Erfahrungsaustausch<br />
für zur Prüfung befähigte Personen<br />
soll nun analog dem Erfahrungsaustausch<br />
für Sachverständige gemäß Paragraf 29<br />
b BImSchG jährlich durchgeführt werden<br />
und damit einen festen Platz im Terminkalender<br />
erhalten.<br />
Im Messebereich ging es in die Planung<br />
der Gemeinschaftsstände für die BIOGAS<br />
Trade Fair <strong>2021</strong> und die IFAT 2022, die<br />
beide einen hohen Zuspruch erhalten haben.<br />
Im Schulungsverbund zogen nach<br />
den coronabedingten Schwierigkeiten<br />
Angebot und Nachfrage an Schulungen<br />
wieder deutlich an, und Ende des zweiten<br />
Quartals konnten neben den Online-Schulungen,<br />
die in jedem Fall bis Ende Oktober<br />
aufrechterhalten werden sollen, wieder<br />
erste Präsenzveranstaltungen stattfinden.<br />
In diesem Zusammenhang konnte auch<br />
der zehntausendste erfolgreich geschulte<br />
Teilnehmer seit dem Bestehen des Schulungsverbunds<br />
gefeiert werden. In welchem<br />
Rahmen zukünftig weiterhin Online-Schulungen<br />
möglich sind und angeboten werden<br />
können, diskutiert gerade der Fachbeirat<br />
des Schulungsverbundes.<br />
LAI-Beschluss zum<br />
Luftreinhaltebonus weiterhin<br />
in Diskussion<br />
Wenig zufriedenstellend ist die seit September<br />
2020 laufende Diskussion um den<br />
LAI-Beschluss zum Erhalt des Luftreinhaltebonus.<br />
Der vom FvB dringend angemerkte<br />
Überarbeitungs- und Ergänzungsbedarf<br />
des Beschlusses wird immer noch<br />
in der dafür zuständigen Bund-Länder-<br />
Arbeitsgruppe (AISV) diskutiert. Der FvB<br />
ist im ständigen Austausch mit beteiligten<br />
Ländervertretern und versucht die kommenden<br />
ergänzenden Vollzugshinweise so<br />
praxistauglich wie möglich auszugestalten.<br />
In jedem Fall sollen die technischen Umund<br />
Nachrüstungen bis Ende des Jahres<br />
abgeschlossen sein und ab dem nächsten<br />
Jahr eine umfangreiche Dokumentation<br />
erfolgen, die dann regelmäßig von den zugelassenen<br />
Messinstituten geprüft und bestätigt<br />
werden soll.<br />
Umsetzung der Technischen<br />
Regeln<br />
Nach wie vor nehmen die zahlreichen<br />
Umsetzungsfragen zur TRAS 120 einen<br />
Schwerpunkt der Mitgliederanfragen ein.<br />
Immer wieder herrscht große Unsicherheit<br />
bei allen beteiligten Behörden, Betreibern,<br />
Sachverständigen und Firmen, welche Anforderungen<br />
aus der TRAS 120 umgesetzt<br />
werden müssen beziehungsweise welche<br />
Forderungen verhältnismäßig sind. Der FvB<br />
erneuert daher regelmäßig seine Kritik an diversen<br />
Details der TRAS 120 und versucht,<br />
bei der zuständigen Kommission für Anlagensicherheit<br />
(KAS) eine zeitnahe punktuelle<br />
Überarbeitung der TRAS 120 herbeizuführen.<br />
Insbesondere in Bayern führt eine<br />
im Vergleich zu anderen Ländern sehr strikte<br />
Umsetzung zu erheblichen Diskussionen,<br />
die inzwischen auch auf politischer Ebene<br />
erörtert werden. Der FvB hatte seine Kritik<br />
an der TRAS-Umsetzung in Brandbriefen an<br />
die zuständigen Ministerien zum Ausdruck<br />
gebracht. Weiter voranschreitet die Überarbeitung<br />
der TRGS 529: Unter Einbindung<br />
der Arbeitsgruppe Spurenelemente des FvB<br />
konnten die Themen „fermentierbare Säcke“<br />
sowie die CLP-Einstufung von EDTAchelasierten<br />
Spurenelemente diskutiert<br />
werden. Weitere Themen in der Überarbeitung<br />
sind die sichere Ausgestaltung von Gärprodukttrocknungsanlagen,<br />
die sichere Instandhaltung<br />
sowie der sichere Einsatz von<br />
besonderen Einsatzstoffen (Bioabfällen).<br />
126
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
VERBAND<br />
TA Luft<br />
Weiterhin ist die im Juni beschlossene novellierte TA<br />
Luft der Arbeitsschwerpunkt im Referat Genehmigung.<br />
Im Rahmen des Bundesratsverfahrens konnten einige<br />
positive Änderungen in den biogasrelevanten Kapiteln<br />
erreicht werden. Der jetzt finale Stand der TA Luft<br />
bedarf aber einer intensiven Analyse und Diskussion<br />
bezüglich möglicher Interpretationen und Probleme.<br />
Aus diesem Grund findet jetzt eine Abstimmung mit<br />
relevanten Gremien im FvB statt.<br />
Mit dem Beschluss der TA Luft wurde auch eine Überarbeitung<br />
der VDI 3475-4 – „Emissionsminderung -<br />
Biogasanlagen in der Landwirtschaft“ gestartet. Die<br />
dazugehörige Arbeitsgruppe – mit Beteiligung des FvB –<br />
hat im Juni in einer ersten Sitzung den notwendigen<br />
Änderungsbedarf festgestellt und den weiteren Ablauf<br />
der Überarbeitung festgelegt.<br />
Wahljahr im Fachverband Biogas e.V.<br />
Im „Superwahljahr“ <strong>2021</strong> werden für die Biogasbranche<br />
wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Es finden<br />
dabei nicht nur die Bundestagswahl und Wahlen<br />
in vielen Bundesländern statt, auch im FvB stehen<br />
wieder die Wahlen der Gremien an, die laut Satzung<br />
im vierjährigen Turnus abgehalten werden müssen. Den<br />
Abschluss des Wahljahres wird die Wahl eines neuen<br />
Präsidiums bilden, die im Rahmen der Mitgliederversammlung<br />
stattfinden wird. Bereits vorab werden in<br />
den Beiräten und Arbeitskreisen sowie vor allem in den<br />
Regionalgruppen die Ämter (Regionalgruppen- und<br />
Betreibersprecher*innen) neu vergeben.<br />
In vielen Regionen konnten bereits ausreichend Kandidatinnen<br />
und Kandidaten gefunden werden, in<br />
manchen Regionen besteht noch Bedarf an weiteren<br />
Bewerber*innen. Sollten Sie Interesse haben, ein Ehrenamt<br />
in Ihrer Regionalgruppe zu übernehmen, melden<br />
Sie sich gerne in der Geschäftsstelle in Freising bei<br />
Carolin Langwieser.<br />
Die Kandidatensuche soll in den kommenden Wochen<br />
abgeschlossen und mit den Wahlen begonnen werden.<br />
In welcher Form die Wahlen stattfinden, entscheiden<br />
die Regionalgruppen. Sollte ein Vor-Ort-Termin nicht<br />
gewünscht sein, werden Briefwahlen durchgeführt. Dabei<br />
würde die Vorstellung der zu wählenden Personen<br />
vorab in einer digitalen Regionalgruppen-Veranstaltung<br />
erfolgen.<br />
Außerordentliche Mitgliederversammlung<br />
beschließt Erweiterung des Präsidiums<br />
Am 16. Juni fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung<br />
statt, zu der knapp 200 Mitglieder angemeldet<br />
waren. Diese wurde bedingt durch die aktuellen<br />
Einschränkungen als Webkonferenz abgehalten.<br />
Anlass war die Erweiterung des Präsidiums in der im<br />
Herbst/Winter anstehenden Präsidiumswahl. Die Mitgliederversammlung<br />
beschloss eine Erweiterung um<br />
zwei Personen. Weiterhin standen Satzungsänderungen<br />
zu Onlineverfahren für die Einladung, Wahlen und<br />
Durchführungen von Versammlungen des FvB auf der<br />
Tagesordnung. Diese Änderungen wurden ebenfalls<br />
beschlossen. Auf Antrag aus der Mitgliedschaft wurde<br />
zudem beschlossen, eine Biogaschronik anlässlich<br />
des 30-jährigen Verbandsjubiläums zu erstellen und<br />
die Beitragsehrlichkeit der Mitglieder bei der nächsten<br />
Beitragserhebung zu verbessern.<br />
Autoren<br />
Dr. Stefan Rauh<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Manuel Maciejczyk<br />
Geschäftsführer<br />
Fachverband Biogas e.V.<br />
Angerbrunnenstr. 12 · 85356 Freising<br />
0 81 61/98 46 60<br />
info@biogas.org<br />
www.biogas.org<br />
®<br />
FerroSorp DG<br />
H S-Bindung im Fermenter<br />
2<br />
®<br />
FerroSorp S<br />
Externe Entschwefelung<br />
Klinopmin ®<br />
Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg<br />
• Rohrleitungsbau<br />
• Sanierung und Beschichtung von Biogasbehältern<br />
• Dachkonstruktionen für Biogasbehälter<br />
• Hochwertige Rührwerks- und Pumpentechnik<br />
• Externe Gasspeicherung<br />
• Wartungs- und Kontrollgänge<br />
• Hochwertige Ersatz- und Anbauteile<br />
• Montage & Service mit geschultem Fachpersonal<br />
Nesemeier GmbH<br />
Industriestraße 10 | 32825 Blomberg<br />
Tel.: +49 5235 50287 0<br />
info@nesemeier-gmbh.de<br />
www.nesemeier-gmbh.de<br />
Entschwefeln Sie mit Eisenhydroxid!<br />
(auf Basis von Gesteinsmehl)<br />
Prozessoptimierung<br />
127
VERBAND<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
LEE NIEDERSACHSEN-BREMEN E.V.<br />
Peter Beeken (links)<br />
und Gustav Wehner<br />
(Vorstand LEE) im<br />
Gespräch mit Umweltminister<br />
Olaf Lies<br />
(rechts).<br />
Ocholter Biogasanlage spart jährlich<br />
bis zu 2.000 Tonnen CO 2<br />
ein<br />
Auf Einladung des Landesverbandes Erneuerbare<br />
Energien Niedersachsen-Bremen<br />
(LEE) e.V. besuchten am 24. April Niedersachsens<br />
Umwelt- und Klimaschutzminister<br />
Olaf Lies sowie Jens Nacke, Landtagsabgeordneter,<br />
und Lars Schmidt-Berg, stellvertretender<br />
Bürgermeister von Westerstede, Peter Beekens Biogasanlage<br />
in Ocholt. Anlässlich des Tags der Erneuerbaren<br />
Energien verschafften sich die Politiker einen Eindruck<br />
von der Leistungsfähigkeit, die in der Bioenergie steckt.<br />
Eines wurde sofort deutlich: Der Klimaschutzaspekt<br />
von Biogasanlagen ist unübersehbar. So spart Peter<br />
Beekens Anlage, die zahlreiche Gebäude in der Umgebung<br />
mit Wärme versorgt, jährlich bis 700.000 Liter<br />
Heizöl ein. Und vermeidet damit den Ausstoß von bis<br />
zu 2.000 Tonnen CO 2<br />
.<br />
Peter Beeken, Geschäftsführer der Erste Biogas Ocholt<br />
GmbH & Co. KG, richtete klare Worte an die Landesregierung:<br />
„Biogasanlagen tragen dazu bei, dass Niedersachsen<br />
seine Klimaschutzziele erreicht. Gleichzeitig<br />
schafft die Branche Arbeitsplätze und sorgt für Wertschöpfung<br />
vor Ort. Wir haben aber mit einer ganzen<br />
Reihe von Problemen zu kämpfen. So fehlt uns beispielsweise<br />
eine ganzheitliche Strategie für das Thema<br />
Wärme. Das merken wir vor allen Dingen bei Abschaltungen<br />
und beim jetzigen Einspeisemanagement. Auch<br />
beim geplanten Redispatch 2.0 gibt es keine Strategie<br />
für Wärmelieferungen.“ Biogas gilt als Joker unter den<br />
Erneuerbaren Energien, denn es kann als Ausgleichsenergie<br />
zu Wind und Sonne eingesetzt werden. Die<br />
Anlagenbetreiber fordern von der Politik jedoch eine<br />
vernünftige Finanzierung ein. Denn aktuell wird der<br />
flexible Einsatz nicht genügend nachgefragt und auch<br />
nicht lokal geregelt.<br />
Beeken hob bei der Besichtigung der Biogasanlage hervor,<br />
dass sich viele Anlagenbetreiber für Biodiversität<br />
einsetzen. „Es ist nicht so, dass wir unbedingt hochenergetischen<br />
Mais verwenden wollen. Es ist vielmehr<br />
so, dass andere pflanzliche Inputstoffe und auch Gülle<br />
aufgrund ihrer geringeren Energieleistung weniger<br />
wirtschaftlich sind, zumal die Lagerproblematik nicht<br />
geklärt ist.“ Gerade der Einsatz von Gülle leiste einen<br />
erheblichen Beitrag zur Treibhausgasminderung.<br />
Alle Beteiligten waren sich einig, dass Biogasanlagen<br />
einen wichtigen Baustein in der niedersächsischen<br />
Klimaschutzstrategie darstellen. Um das Potenzial der<br />
Anlagen aber auszuschöpfen, müssten die wirtschaftlichen<br />
und rechtlichen Rahmenbedingungen jedoch<br />
verbessert werden.<br />
Autor<br />
Lars Günsel<br />
Pressesprecher<br />
LEE Niedersachsen-Bremen e.V.<br />
Herrenstr. 6 · 30159 Hannover<br />
05 11/72 73 67-330<br />
l.guensel@lee-nds-hb.de<br />
www.lee-nds-hb.de<br />
128
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
VERBAND<br />
LEE-Branchentag zeigt Politik<br />
Handlungsbedarf bei Biogas auf<br />
FOTOS: LEE NIEDERSACHSEN-BREMEN E.V.<br />
Droht eine Energielücke, weil<br />
Deutschland in den nächsten<br />
Jahren nach und nach sämtliche<br />
Kohle- und Gaskraftwerke<br />
abschaltet? Bei der Antwort waren<br />
sich die Teilnehmer*innen des „Branchentag<br />
mobil“ am 2. Juni einig: Ja, wenn<br />
nicht massiv an Erneuerbaren Energien<br />
zugebaut wird. Das „Ob“ war also geklärt.<br />
Doch über das „Wie“ wurde heftig gestritten.<br />
Mehrere Spitzenpolitiker aus Bund und<br />
Land stellten sich dabei den unbequemen<br />
Fragen und konkreten Forderungen des<br />
LEE-Vorstands. So auch Carsten Müller,<br />
CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages<br />
und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft<br />
und Energie, und Niedersachsens Umweltminister<br />
Olaf Lies.<br />
Biogasanlagenbetreiber und LEE-Vorstandsmitglied<br />
Thorsten Kruse stellte klar,<br />
dass der Zubau an niedersächsischen Biogasanlagen<br />
stagniert. So gehen bis 2025<br />
insgesamt 435 Anlagen mit einer Leistung<br />
von 230 Megawatt aus der EEG-Förderung,<br />
bis 2030 könnten es sogar 600 Megawatt<br />
sein. Bis 2035 könnte die Technologie in<br />
Niedersachsen im Wesentlichen abgewickelt<br />
sein.<br />
Der Einsatz von Bio-LNG im Verkehrssektor<br />
lohnt sich nur beim Einsatz von Reststoffen.<br />
Doch gerade hier, so Kruse weiter,<br />
werden durch das Wasserrecht hohe Hürden<br />
errichtet. Auch bereitet die Auslegung<br />
der niedersächsischen Düngeverordnung<br />
durch das Landwirtschaftsministerium der<br />
Branche Kopfzerbrechen.<br />
Thorsten Kruse fragte konkret: „Wie soll ich<br />
mich an einer Ausschreibung beteiligen,<br />
wenn ich bereits die Flexprämie bekommen<br />
habe und nicht mehr mit dem Flexzuschlag<br />
kalkulieren kann, dann noch bei<br />
Unterzeichnung der Ausschreibung die endogene<br />
Mengensteuerung greift und meine<br />
Anlage auch noch im Norden steht, so dass<br />
erst der Süden den Zuschlag bekommt?“<br />
Die Antwort lieferte er gleich selbst: „Das<br />
geht nicht!“<br />
Carsten Müller sagte der Branche in seinem<br />
Statement zu, dass das EEG-Reparaturgesetz<br />
die additive Nutzung von Flexprämie<br />
und Flexzuschlag für Biogasanlagen sicherstellen<br />
wird. Olaf Lies versprach, sich<br />
für eine beschleunigte Bearbeitung der<br />
drängenden genehmigungsrechtlichen<br />
Probleme auf niedersächsischer Ebene<br />
einzusetzen.<br />
Autor<br />
Lars Günsel<br />
Pressesprecher<br />
LEE Niedersachsen-Bremen e.V.<br />
Herrenstr. 6 · 30159 Hannover<br />
05 11/72 73 67-330<br />
l.guensel@lee-nds-hb.de<br />
www.lee-nds-hb.de<br />
Thorsten Kruse (rechts)<br />
richtete deutlich Worte<br />
an die teilnehmenden<br />
Politiker. Neben ihm<br />
Steffen Warneboldt,<br />
Geschäftsführer der<br />
WindStrom GmbH.<br />
Nicht<br />
vergessen!<br />
Der Anzeigenschluss<br />
für die Ausgabe 5_<strong>2021</strong><br />
ist am 13. August<br />
BI<br />
GAS Journal<br />
• Doppel- /Dreimembrangasspeicher<br />
• „Flex“- Reingasspeicher<br />
• Emissionsschutzabdeckungen<br />
• Behälterauskleidungen mit<br />
Leckagekontrolle<br />
• Erdbecken für Gülle- und<br />
Wirtschaftsdünger (JGS-Zulassung),<br />
Silosickersaft, Rübenmus<br />
ceno.sattler.com<br />
Sattler Ceno<br />
TOP-TEX GmbH<br />
Am Eggenkamp 14<br />
D-48268 Greven<br />
Tel.: +49 2571 969 0<br />
biogas@sattler.com<br />
129
VERBAND<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Jetzt sozial gerechte CO 2<br />
-Bepreisung<br />
auf den Weg bringen<br />
Gastbeitrag von Dr. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE)<br />
Die Diskussion um die Bepreisung<br />
von Kohlendioxid (CO 2<br />
)<br />
nimmt aktuell erneut an Fahrt<br />
auf. Der BEE setzt sich bereits<br />
seit 2017 für eine ehrliche Bepreisung<br />
des klimaschädlichen CO 2<br />
ein,<br />
um klimaschädliche Technologien verursachergerecht<br />
zu belasten und faire Wettbewerbsbedingungen<br />
für saubere Alternativen<br />
wie Erneuerbare Energien, Speicher<br />
oder Technologien der Sektorenkopplung<br />
zu schaffen.<br />
Der Fokus liegt dabei auf der sozialen und<br />
gerechten Aufteilung der Kosten. Im Wärmebereich<br />
etwa soll ein Rückerstattungsmodell<br />
dafür sorgen, dass Bürgerinnen<br />
und Bürger eine Pro-Kopf-Rückerstattung<br />
erhalten, die sie von Zusatzkosten<br />
für klimafreundliches Verhalten befreit.<br />
Angesichts der Novellierung des Klimaschutzgesetzes<br />
(KSG) hat der BEE sein<br />
CO 2<br />
-Bepreisungsmodell nun weiterentwickelt<br />
und zeigt, dass bei den im Brennstoffemissionshandelsgesetz<br />
(BEHG) erfassten<br />
Sektoren Wärme und Verkehr die<br />
Möglichkeit besteht, effiziente finanzielle<br />
Anreize zur Vermeidung von CO 2<br />
zu setzen<br />
und gleichzeitig die soziale Tragbarkeit zu<br />
wahren.<br />
Eine CO 2<br />
-Bepreisung ist eine gut wirksame<br />
ökonomische Maßnahme, die gewährleistet,<br />
dass sich auf dem Markt Preissignale<br />
für saubere Technologien entfalten. Ohne<br />
CO 2<br />
-Bepreisung oder mit einer zu niedrigen<br />
CO 2<br />
-Bepreisung findet eine Marktverzerrung<br />
zugunsten klimaschädigender<br />
Technologien statt. Eine Weiterentwicklung<br />
der nationalen CO 2<br />
-Bepreisung ist daher<br />
bestens geeignet, um für zukunftsfähige<br />
Klimaschutztechnologien bessere Wettbewerbsbedingungen<br />
zu erreichen und damit<br />
den Standort zukunftsfest zu machen.<br />
Wie kann dies im Wärme- und Verkehrssektor<br />
konkret gelingen? Zunächst sind in<br />
Anbetracht des nachgeschärften nationalen<br />
Klimaziels von 55 auf 65 Prozent Treibhausgasreduktion<br />
bis 2030 die im BEHG<br />
festgelegten CO 2<br />
-Preispfade anzupassen.<br />
Aktuelle Studien, etwa des Mercator Instituts,<br />
zeigen, dass der festgelegte CO 2<br />
-<br />
Preispfad von 55 bis 65 Euro pro Tonne<br />
CO 2<br />
bis 2025/26 bereits für das<br />
alte Klimaziel nicht ausreichend<br />
war.<br />
Durch das angepasste<br />
Klimaschutzziel, das<br />
den Zielen von Paris<br />
noch nicht einmal<br />
vollends entspricht,<br />
müssen zusätzlich<br />
105 Millionen Tonnen<br />
Treibhausgase<br />
vermieden werden.<br />
Berechnungen des Beratungsinstituts<br />
R2B für den<br />
Verband kommunaler Unternehmen<br />
e.V. (VKU) zeigen, dass hierfür ein kontinuierlicher<br />
Anstieg des CO 2<br />
-Preises auf 300<br />
Euro pro Tonne bis 2030 erforderlich ist.<br />
Um eine sprunghafte Erhöhung im Jahr<br />
2030 zu vermeiden, wird ein relativ zügig<br />
ansteigender Preis empfohlen, der ab dem<br />
Jahr 2022 jährlich um 30 Euro zu steigern<br />
ist. Werden die Ziele zur CO 2<br />
-Einsparung erreicht,<br />
kann die stufenweise Anhebung des<br />
CO 2<br />
-Preises ausgesetzt oder abgeschwächt<br />
werden.<br />
Den hier berechneten Kosten liegen im Gebäudebereich<br />
etwa energetische Sanierungen<br />
und das Umrüsten auf erneuerbaren<br />
Heizungstechnologien wie Wärmepumpen,<br />
Solarthermie oder Pelletsheizungen zugrunde.<br />
Der BEE schlägt über den Wärmeund<br />
Verkehrssektor hinaus auch eine flankierende<br />
CO 2<br />
-Bepreisung im Stromsektor<br />
auf nationaler Ebene vor. Hier hat jedoch<br />
die Reformierung des Strommarktdesigns<br />
oberste Priorität. Die Stromsteuer sollte auf<br />
das europarechtlich mögliche Minimum<br />
abgesenkt und die Kosten der Befreiung<br />
der energieintensiven Unternehmen sollten<br />
von der EEG-Umlage im Rahmen der<br />
„Besonderen Ausgleichsregelung“ vom<br />
Bundeshaushalt übernommen werden. Dabei<br />
würden die Stromkosten um rund 3,5<br />
Cent je Kilowattstunde gesenkt. Die CO 2<br />
-<br />
Bepreisung macht es indes möglich, dass<br />
sich private, staatliche und wirtschaftliche<br />
Akteure auf die Transformation<br />
in den Sektoren einstellen<br />
können. Sie bedeutet<br />
enorme konjunkturelle<br />
Anreize für den Zukunftsmarkt<br />
der erneuerbaren<br />
Technologien<br />
und auch eine<br />
Wiederbelebung des<br />
Marktes nach der<br />
Corona-Pandemie.<br />
Eine Reihe begleitender<br />
steuer- und förderpolitischer<br />
Maßnahmen mit einem<br />
starken Fokus auf private Haushalte<br />
sowie kleine und mittlere Unternehmen ist<br />
erforderlich, um Innovationen und Investitionen<br />
kurzfristig auszulösen.<br />
Daneben sind Instrumente des Ordnungsrechts<br />
zu nutzen, um die vorgeschlagenen<br />
Maßnahmen sozial gerecht umzusetzen.<br />
Der BEE sieht dabei konkret vor, die durch<br />
eine CO 2<br />
-Bepreisung erzielten Einnahmen<br />
vollständig an Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise<br />
Unternehmen zurückzugeben.<br />
Die Rückerstattung erfolgt innerhalb<br />
der Sektoren. Für die Wirtschaft beziehungsweise<br />
Industrie sollte geprüft werden,<br />
ob eine Rückerstattung innerhalb der<br />
einzelnen Branchen zu einer gerechteren<br />
Verteilung der CO 2<br />
-Kosten führt und größere<br />
Anreize für Investitionen setzt.<br />
Bürgerinnen und Bürger sollen im Wärmesektor<br />
eine sichtbare Pro-Kopf-Rückerstattung<br />
als direkten Bonus einmal jährlich<br />
über die Finanzämter erhalten. In der Mobilität<br />
soll bei Anhebung der Treibhausgasminderungsquoten<br />
auf Anreizsysteme für<br />
Elektromobilität und Erneuerbare Kraftstoffe<br />
sowie auf die erforderliche Infrastruktur<br />
gesetzt, der öffentliche Verkehr gestärkt<br />
und der Flugverkehr zügig auf grünes<br />
Kerosin umgestellt werden.<br />
130
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
VERBAND<br />
THERM<br />
Keine Korrosionsbeschichtung des Behälters<br />
Kein Gasvolumen gem. Störfall Verordnung<br />
www.n-e-st.de<br />
Tel.: 02561 449 10 10<br />
Abgaswärmetauscher<br />
Dampferzeuger<br />
Gaskühler / Gaserwärmer<br />
Sonderanwendungen<br />
Zusatzkomponenten<br />
Energiepark 26/28 91732 Merkendorf<br />
+49 9826-65 889-0 info@enkotherm.de<br />
www.enkotherm.de<br />
Klärung von belastetem Niederschlagswasser?<br />
Wir liefern Ihnen die passenden Anlagen!<br />
Bisher in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen…<br />
www.delphin-ws.de<br />
Tank und Apparate Barth GmbH<br />
Werner-von-Siemens-Str. 36<br />
76694 Forst<br />
Tel. 07251 / 9151-0<br />
FAX 07251 / 9151-75<br />
info@barth-tank.de<br />
Tanks neu / gebrauchT<br />
Lösch-/Regenwasserbehälter, Pufferspeicher,<br />
Flüssigdüngertankanlagen,<br />
Diesel-, Heizöl- und Pflanzenölbehälter,<br />
Edelstahlbehälter<br />
von 1.000 – 300.000 Ltr. Inhalt<br />
zu verkaufen.<br />
- Industriedemontagen -<br />
BIOGASBEHÄLTER – Fermenter, Gärrestlager, Vorgruben, ...<br />
WOLF SYSTEM GMBH | Am Stadtwald 20 | 94486 Osterhofen<br />
09932 37-0 | mail@wolfsystem.de | WWW.WOLFSYSTEM.DE<br />
Bauen mit System!<br />
131
VERBAND<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Dreharbeiten für die<br />
Aktionswoche Artenvielfalt<br />
Was haben die verschiedenen Interessengruppen<br />
eigentlich von blühenden<br />
Energiepflanzen? Die Imker, Jäger und<br />
Naturschützer? Und natürlich auch<br />
die Biogasanlagen-Betreiber?<br />
Dieser Frage ist der Hackl Schorsch im Vorfeld der Aktionswoche<br />
Artenvielfalt nachgegangen. Er hat dabei viele<br />
interessante Dinge erfahren – und viele spannende<br />
Menschen und tolle Projekte kennengelernt.<br />
Die vier Filme könnt ihr ab Anfang Juli auf dem Youtube-Kanal<br />
des Fachverbandes anschauen (FVBiogas).<br />
Hier schon mal vorab ein paar Impressionen von den<br />
Drehtagen.<br />
FOTOS: FACHVERBAND BIOGAS E.V.<br />
132
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
VERBAND<br />
Ihr könnt<br />
die Aktionswoche Artenvielfalt<br />
aktiv unterstützen: Postet Fotos von<br />
euren Flächen in den sozialen Medien unter<br />
dem Hashtag #blühendesLeben, nutzt dazu gerne<br />
auch die Banner, Sharepics und Grafiken auf der<br />
Seite aktionswoche.biogas.org. Teilt und liked die<br />
Beiträge der anderen Teilnehmer.<br />
Zeigen wir, wie bunt und artenreich unsere<br />
Felder dank Biogas schon sind – und<br />
erklären wir, welche Chance Biogas für<br />
mehr Artenvielfalt und<br />
Biodiversität bietet.<br />
133
RECHT<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Stellungnahme zum KWK-Bonus bei Holztrocknung<br />
und Handlungsempfehlung zum Flexibilitätszuschlag<br />
für Biogasbestandsanlagen<br />
Die Clearingstelle EEG | KWKG hat eine Stellungnahme zum KWK-Bonus nach der Wärmenetzklausel bei Holztrocknung<br />
abgegeben und eine Handlungsempfehlung zur Anwendung und Auslegung des in Paragraph (§) 50a<br />
Absatz 1 Satz 2 EEG <strong>2021</strong> geregelten Flexibilitätszuschlages für Biogasbestandsanlagen veröffentlicht.<br />
Von Birthe Kaps und Martin Teichmann<br />
Auf Ersuchen des Landgerichts<br />
Lüneburg hat die Clearingstelle<br />
in der Stellungnahme mit<br />
grundsätzlicher Bedeutung<br />
2020/1-IV/Stn 1 geklärt, unter<br />
welchen Voraussetzungen der Anspruch<br />
auf den Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-<br />
Bonus nach der sogenannten Wärmenetzklausel<br />
des EEG 2009 (Anlage 3 Nr. III.2)<br />
besteht, wenn ein an das Wärmenetz angeschlossener<br />
Abnehmer eine Holztrocknungsanlage<br />
ist.<br />
Die Clearingstelle hat zunächst festgestellt,<br />
dass die gesamte in das Wärmenetz eingespeiste<br />
Wärme bereits die Wärmenutzung<br />
im Sinne von Anlage 3 Nr. I.2 EEG 2009<br />
darstellt und nicht erst die dem Wärmenetz<br />
nachgelagerten Verbräuche. Zudem<br />
müssen die sonstigen Anforderungen der<br />
weiteren Wärmenutzungen in der Positivliste<br />
(Anlage 3 Nr. II EEG 2009) für den<br />
Anspruch nach der Wärmenetzklausel<br />
nicht zusätzlich eingehalten werden, auch<br />
wenn die dem Wärmenetz nachgelagerten<br />
Verbräuche einer anderen in der Positivliste<br />
genannten Wärmenutzung unterfallen.<br />
Unter Nutzwärmebedarf im Sinne der Wärmenetzklausel<br />
fallen nur diejenigen von<br />
den einzelnen Wärmeabnehmern aus dem<br />
Netz bezogenen Wärmemengen, die mit einer<br />
„sinnvollen Nutzung“ korrespondieren<br />
(vgl. Rn. 32 ff. der Stellungnahme). Die<br />
Bestimmung des Nutzwärmebedarfs kann<br />
sowohl durch Messung als auch durch Berechnung<br />
bestimmt werden. Die jeweiligen<br />
Werte sind im Umweltgutachten insbesondere<br />
bei unüblichen und auffälligen Werten<br />
zu plausibilisieren.<br />
Für die Plausibilisierung können für den<br />
Nutzwärmebedarf die Standardwerte des<br />
Kuratoriums für Technik und Bauwesen<br />
in der Landwirtschaft (KTBL) oder andere<br />
Richt- oder Grenzwerte der allgemein anerkannten<br />
Fachliteratur herangezogen werden.<br />
Bei Einhaltung der Grenzwerte ist keine<br />
weitere Plausibilisierung erforderlich,<br />
umgekehrt erfordert die Überschreitung<br />
eine weitergehende Plausibilisierung.<br />
Die zusätzliche Einhaltung der sogenannten<br />
Generalklausel (Anlage 3 Nr. I.3 EEG<br />
2009 – nachweislicher Ersatz fossiler<br />
Energieträger) ist für den Anspruch auf den<br />
KWK-Bonus nach der Wärmenetzklausel<br />
nicht erforderlich. Auch ist eine räumliche<br />
Nähe zwischen dem Wärmeerzeuger und<br />
der an das Netz angeschlossenen Holztrocknungsanlage<br />
als Verbraucher ebenso<br />
wie das Überwiegen des Anteils der aus<br />
dem Netz bezogenen Wärmemenge durch<br />
die Holztrocknungsanlage gegenüber den<br />
anderen Wärmeentnahmen für einen Anspruch<br />
nach der Wärmenetzklausel grundsätzlich<br />
unerheblich.<br />
Handlungsempfehlung zum<br />
Flexibilitätszuschlag für<br />
Biogasbestandsanlagen<br />
Der jüngst von der Clearingstelle EEG|KWKG<br />
moderierte „Runde Tisch“ mit Vertretern<br />
mehrerer Bioenergieverbände sowie verschiedener<br />
Forschungseinrichtungen und<br />
weiteren Experten brachte nach intensiver<br />
Diskussion eine von allen Beteiligten getragene<br />
Handlungsempfehlung 2 für eine<br />
klarstellende Gesetzesänderung von § 50a<br />
Absatz 1 Satz 2 EEG <strong>2021</strong> hervor.<br />
Anlass für die Handlungsempfehlung sind<br />
die seit Jahresbeginn aus Sicht der Branche<br />
aufgekommenen unüberwindbaren<br />
Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung<br />
von § 50a Absatz 1 Satz 2 EEG<br />
<strong>2021</strong>. Diese hätten zu einer erheblichen<br />
Investitionszurückhaltung geführt, nachdem<br />
der für einen Weiterbetrieb von flexibilisierten<br />
Biogasbestandsanlagen erforderliche<br />
finanzielle Förderbedarf im zweiten<br />
Vergütungszeitraum nicht rechtssicher auf<br />
jene Regelung gestützt werden könne. Eine<br />
Klarstellung sei daher dringend geboten,<br />
um im Interesse des Klimaschutzes sowohl<br />
den weiteren Anlagenausbau zu ermöglichen<br />
als auch einen sonst gar drohenden<br />
Anlagenabbau zu verhindern.<br />
Im Einzelnen setzt sich die Handlungsempfehlung<br />
ausführlich mit den Aspekten der<br />
zusätzlich flexibel bereitgestellten Leistung<br />
und den maßgeblichen (Förder-) Zeiträumen<br />
auseinander. Es wird dazu vorgeschlagen,<br />
§ 50a Absatz 1 Satz 1 EEG anhand<br />
einer neu gefassten Rechenformel klarer zu<br />
formulieren.<br />
Des Weiteren regen Vertreter der Bioenergieverbände<br />
in der Handlungsempfehlung<br />
an, dass der Anspruch auf den Flexibilitätszuschlag<br />
für die bereits mit der Flexibilitätsprämie<br />
geförderte Anlagenleistung<br />
nicht gestrichen, sondern „mit Augenmaß“<br />
gekürzt werde. Ebenso sollten zur weiteren<br />
Flexibilisierung von Biogasbestandsanlagen<br />
neue Impulse, insbesondere durch<br />
eine Reform des § 50b EEG <strong>2021</strong>, gegeben<br />
werden.<br />
1<br />
Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/stellungnv/2020/1/Stn.<br />
2<br />
Abrufbar unter: https://www.clearingstelleeeg-kwkg.de/sonstiges/5994.<br />
Autoren<br />
Birthe Kaps und Martin Teichmann<br />
Mitglieder der Clearingstelle EEG | KWKG<br />
Charlottenstraße 65 · 10117 Berlin<br />
030/206 14 16-0<br />
post@clearingstelle-eeg-kwkg.de<br />
134
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
RECHT<br />
Arma Bio - Mix Flüssigfütterung<br />
... für den sicheren Betrieb<br />
Tel. 0172/513 43 91<br />
www.as-j.de<br />
Doppelmembrangasspeicher | Emissionsschutzabdeckungen<br />
Gasspeicher | EPDM-Hauben<br />
Leckagefolien<br />
Baur Folien GmbH<br />
Gewerbestraße 6<br />
D-87787 Wolfertschwenden<br />
0 83 34 99 99 1-0<br />
0 83 34 99 99 1-99<br />
info@baur-folien.de<br />
d www.baur-folien.de<br />
Entlastung des Antriebes<br />
durch Lagerstuhlbauweise<br />
Schubbodensanierung<br />
in verstärkter<br />
Edelstahl-Lösung<br />
Nachstellbarer Stator mit<br />
bis zu 3- facher Lebensdauer<br />
Axel Hagemeier GmbH & Co. KG<br />
Am Wasserfeld 8 • 27389 Fintel<br />
Tel.: 04265 / 13 65<br />
Fax: 04265 / 83 94<br />
E-Mail: info@axel-hagemeier.de<br />
Web: www.axel-hagemeier.de<br />
135<br />
Große Wartungsöffnungen zum<br />
entfernen von Stör- und Fremdstoffen<br />
ARMATEC - FTS<br />
GmbH & Co. KG<br />
Friedrich-List-Strasse 7<br />
D-88353 Kisslegg<br />
+49 (0) 7563 / 909020<br />
+49 (0) 7563 / 90902299<br />
info@armatec-fts.de<br />
www.armatec-fts.com
PRODUKTNEWS<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Neue Eisele-Blockpumpe BP<br />
Die trocken aufgestellte Pumpe, die<br />
stehend oder liegend genutzt wird,<br />
kann auf einem stabilen Grundrahmen<br />
aufgebaut werden und dient vorrangig<br />
zum Pumpen von Gülle und Gärresten.<br />
Das Unternehmen Eisele, Hersteller von<br />
Pumpen und Rührwerken für den Agrarund<br />
Biogasbereich, hat als Neuentwicklung<br />
die Eisele-Blockpumpe BP eingeführt<br />
und damit eine weitere Kreiselpumpe ins<br />
Produktportfolio übernommen. Die trocken<br />
aufgestellte Pumpe, die stehend oder liegend<br />
genutzt wird, kann auf einem stabilen<br />
Grundrahmen aufgebaut werden und<br />
dient vorrangig zum Pumpen von Gülle<br />
und Gärresten. Einbauten in Bereichen mit<br />
begrenzten Platzverhältnissen werden dadurch<br />
auch ermöglicht.<br />
Insgesamt stehen fünf Modelle mit Drehstrommotoren<br />
(Effizienzklasse IE3, wahlweise<br />
IE4) von 11 kW bis 30 kW zur Verfügung.<br />
Diese fördern bis zu 7.200 Liter pro<br />
Minute und erreichen Förderhöhen von bis<br />
zu 25 Meter. Motor- und mediumseitig sind<br />
Gleitringdichtungen in Tandemanordnung<br />
im Ölbad verbaut.<br />
Die trockenlaufsicheren Pumpen sind<br />
mit den bewährten Widia-Reißkanten auf<br />
Einströmdüse und Schneckenflügel ausgestattet<br />
und zerreißen somit zuverlässig<br />
Faserstoffe.<br />
Ein Ansaugstutzen DN200 in Edelstahl<br />
wird serienmäßig mitgeliefert. Eine lange<br />
Lebensdauer der Eisele-Blockpumpen,<br />
für die auch die anderen Eisele-Geräte<br />
bekannt sind, wird dadurch gewährleistet.<br />
Die Eisele-Blockpumpe lässt sich mit einem<br />
Frequenzumrichter kombinieren und<br />
ist nach den aktuellen BAFA-Förderrichtlinien<br />
förderfähig.<br />
Weitere Infos unter www.eisele.de<br />
FOTO: EISELE<br />
Eisele-Stabrührwerk ESR 204<br />
Das Stabrührwerk<br />
ESR 204 ist mit einem<br />
Elektromotor mit 15 kW<br />
(zugelassen für Ex-Schutz<br />
Zone 2) ausgestattet.<br />
Die Firma Eisele hat das Stabrührwerk ESR<br />
204 in das Produktprogramm übernommen.<br />
Ab sofort ist das Unternehmen damit<br />
in der Lage, moderne Biogasanlagen noch<br />
umfangreicher mit Rühr- und Pumptechnik<br />
aus einer Hand zu beliefern. Die Stabrührwerke<br />
sind bereits seit mehreren Jahren<br />
auf Biogasanlagen in ganz Deutschland,<br />
Österreich und der Schweiz im Einsatz und<br />
haben höchste Ansprüche an Lebenserwartung,<br />
Wartungsfreundlichkeit und Rührleistung<br />
erfüllt.<br />
Das ESR 204 ist mit einem Elektromotor<br />
mit 15 kW (zugelassen für Ex-Schutz Zone<br />
2) ausgestattet und sorgt mit seinen maximal<br />
100 Umdrehungen pro Minute und einem<br />
Propeller mit einem Durchmesser von<br />
140 Zentimeter für höchste Schubkräfte<br />
und maximale Rührergebnisse. Mit einer<br />
Wellenlänge von 450 Zentimeter besteht<br />
die Möglichkeit, das Rührwerk auf unterschiedlichste<br />
Behältermaße anzupassen.<br />
Die Neigungsverstellung erfolgt wahlweise<br />
mechanisch oder hydraulisch.<br />
Ein zentrales Schmiersystem versorgt alle<br />
Lager permanent mit frischen Schmierstoffen.<br />
Groß dimensionierte Lager und hochverschleißfeste<br />
Gleitringdichtungen sorgen<br />
für maximale Standzeiten und optional ist<br />
das ESR 204 für Decken- oder Wandmontage<br />
erhältlich. Zusätzlich ist das Eisele-<br />
Stab rührwerk mit einem Soft-Starter oder<br />
Frequenzumrichter kombinierbar und somit<br />
nach den aktuellen BAFA-Förderrichtlinien<br />
förderfähig.<br />
Weitere Infos unter www.eisele.de<br />
FOTO: EISELE<br />
Wave-Box 4.0/Kombi-Max<br />
Die Wave-Box ist eine Neuentwicklung<br />
der PRE GmbH für den Hochleistungsaufschluss<br />
faseriger Substrate. Mittels einer<br />
reversiblen Pumpe wird Fermenter-Substrat<br />
oder Gärrest kontinuierlich durch eine<br />
intelligente Leitungsführung optimal in<br />
den Wirkbereich von Ultraschall erzeugenden<br />
„Sonotroden“ gebracht. Die Wave-Box<br />
wird im Bypass betrieben und ist sowohl in<br />
den PRE-Hochleistungsfermenter und die<br />
PRE-Kombihydrolyse integrierbar als auch<br />
für bestehende Biogasanlagen nachrüstbar.<br />
Wesentlicher Bestandteil ist das entwickelte<br />
Hochleistungs-Ultraschall-System. Dazu<br />
gehören ein Volumendurchflussmessgerät,<br />
eine druck- und volumengeregelte Pumpe,<br />
Wave-Box an einer<br />
Biogasanlage<br />
errichtet.<br />
Sensoren, Spülleitungen sowie eine selbst<br />
optimierende und selbst überwachende<br />
Steuereinheit. Ultraschall ist Schall mit<br />
Frequenzen jenseits des Hörschalls, also<br />
von 20 Kilohertz bis in den Megahertzbereich.<br />
Gelangt Biomasse in den Wirkbereich der<br />
Schallwellen, werden zunächst organische<br />
Agglomerate zerlegt und die Gesamtoberfläche<br />
der Biomassesuspension wird<br />
vergrößert. Weitergehende Beschallung<br />
öffnet Pflanzenzellen und Bakterienzellen.<br />
Dadurch zerreißen Fasern und Zellinhaltsstoffe<br />
treten aus. Die neueste Generation<br />
der selbst entwickelten Wave-Box entstand<br />
in enger Kooperation mit der Universität<br />
Rostock und dem Leibnitz Institut für<br />
Plasmaforschung und Technologie. Bereits<br />
vorhandene Wave Boxen sind mit Plasmatechnik<br />
nachrüstbar.<br />
Weitere Infos unter www.pre-mv.de<br />
FOTO: PRE GMBH<br />
136
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
Elektro<br />
Hagl<br />
+ Motoren Generatoren<br />
+ Notstromaggregate<br />
+ Schaltanlagen<br />
Ihr Partner<br />
in Sachen<br />
BHKW<br />
Komplettmodule 50kW-530kW<br />
Gas & Diesel Service<br />
www.biogas-hagl.de · T. 0 84 52 . 73 51 50<br />
Individuelle Beratung und Konzepte<br />
• Anlagenerweiterung und -flexibilisierung<br />
• Optimierung des Anlagenbetriebes<br />
• Genehmigungsplanung<br />
• Vorbereitung, Betreuung sämtlicher Prüfungen<br />
neutral, herstellerunabhängig, kompetent<br />
Tel +49 (0)5844 976213 | mail@biogas-planung.de<br />
Gut zu wissen!<br />
Die Fachverband Biogas service GmbH kümmert sich um die Organisation<br />
und Durchführung von Schulungen und Fachveranstaltungen. Wir bieten<br />
Beratungsangebote im Bereich der Energieerzeugung durch Biogasanlagen<br />
für Hersteller, Dienstleister und Betreiber an.<br />
Unser aktuelles Veranstaltungsangebot finden Sie unter:<br />
www.service-gmbh.biogas.org<br />
Aktuelle<br />
Branchenthemen:<br />
eeG, Ausschreibungen,<br />
zukunftsoptionen, sicherheit,<br />
Düngerecht u.v.m.<br />
sPReCHen sie<br />
uns An!<br />
© Fotolia_Countrypixel<br />
Fachverband Biogas Service GmbH<br />
Angerbrunnenstr. 12<br />
85356 Freising<br />
0049 8161 / 984660<br />
service-gmbH@biogas.org<br />
137
IMPRESSUM<br />
BIOGAS JOURNAL | 4_<strong>2021</strong><br />
85 x 56,5<br />
IMPRESSUM<br />
Pumpen &<br />
Rührwerke<br />
für Landwirtschaft und Biogas<br />
www.eisele.de<br />
Herausgeber:<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Dr. Claudius da Costa Gomez (V.i.S.d.P.)<br />
Andrea Horbelt (redaktionelle Mitarbeit)<br />
Angerbrunnenstraße 12 · 85356 Freising<br />
Tel. 0 81 61/98 46 60<br />
Fax: 0 81 61/98 46 70<br />
E-Mail: info@biogas.org<br />
Internet: www.biogas.org<br />
Biogas-<br />
Additive<br />
www.aat-substrathandel.de<br />
038852 - 6040<br />
ISSN 1619-8913<br />
Redaktion:<br />
Dipl.-Ing. agr. (FH) Martin Bensmann<br />
Fachverband Biogas e. V.<br />
Tel. 0 54 09/9 06 94 26<br />
E-Mail: martin.bensmann@biogas.org<br />
Anzeigenverwaltung & Layout:<br />
bigbenreklamebureau GmbH<br />
An der Surheide 29 · 28870 Ottersberg-Fischerhude<br />
Tel. 0 42 93/890 89-0<br />
Fax: 0 42 93/890 89-29<br />
E-Mail: info@bb-rb.de<br />
Internet: www.bb-rb.de<br />
Druck: Druckhaus Fromm, Osnabrück<br />
Das BIOGAS Journal erscheint sechsmal im Jahr auf Deutsch.<br />
Zusätzlich erscheinen zwei Ausgaben in englischer Sprache.<br />
07374-1882 www.reck-agrar.com<br />
RÜHRTECHNIK<br />
Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich<br />
geschützt. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben<br />
die Meinung des Verfassers wieder, die nicht unbedingt mit der<br />
Position des Fachverbandes Biogas e.V. übereinstimmen muss.<br />
Nachdruck, Aufnahme in Datenbanken, Onlinedienste und Internet,<br />
Vervielfältigungen auf Datenträgern wie CD-Rom nur nach vorheriger<br />
schriftlicher Zustimmung. Bei Einsendungen an die Redaktion<br />
wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung<br />
vorausgesetzt. Für unverlangt eingehende Einsendungen<br />
wird keine Haftung übernommen. Die Redaktion behält sich vor,<br />
Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen.<br />
138
ca. 100x gasdichter als herkömmliche<br />
– den DLG-Anforderungen<br />
entsprechende – Silofolie<br />
einfacheres, schnelleres Verlegen<br />
sehr hohe Energiedichte in der Silage<br />
Breite (bis 64m) und Länge frei konfektionierbar<br />
extrem belastbare und dehnfähige Folie<br />
Gewährleistet die UV-Stabilität<br />
Sorgt für eine extreme Dehn- und Reißfestigkeit<br />
Verleiht eine einzigartige Geschmeidigkeit<br />
Verbindet die Schichten miteinander<br />
Gewährleistet eine extrem hohe Sauerstoffbarriere<br />
Verbindet die Schichten miteinander<br />
Verleiht eine einzigartige Geschmeidigkeit<br />
Sorgt für eine extreme Dehn- und Reißfestigkeit<br />
Gewährleistet die UV-Stabilität<br />
weniger Nacherwärmung<br />
weniger Schimmelbildung<br />
18 Monate UV-stabil<br />
Beständig gegenüber Temperatur<br />
und Gärsäuren<br />
Die Hydrosil|Familie<br />
Nutzen Sie das Potential Ihrer Silage voll aus !<br />
Hydro<br />
PI.X<br />
Hydro<br />
PI.XE<br />
Hydro<br />
DUO<br />
Hydro<br />
HF<br />
Verhindert Silierverluste vor dem Öffnen<br />
Rasche pH-Wert-Senkung<br />
Verbesserung der Stabilität<br />
Qualität der Silage wird signifikant erhöht<br />
Verluste vom Anschnitt werden reduziert<br />
Erwärmung und Schimmelbildung wird erfolgreich vorgebeugt<br />
Stabilisiert Gras-, GPS-, und Maissilagen unterschiedlicher TS-Gehalte gleichermaßen<br />
Einfach ein runde Sache!<br />
Hocheffiziente Spurenelemente mit höchster biologischer<br />
Verfügbarkeit<br />
Keine versteckten Gefahren wie Stäube oder versehentlich<br />
angerissene Säcke<br />
Transparente Zusammensetzung und Anpassung<br />
Fermentierbare Folie, staubfrei<br />
Einfache, CO2-freundliche Lieferung per Paketdienst<br />
Stabiliesiert den Fermentationsprozess<br />
Einfache, sichere und kräfteschonende Anwendung<br />
SaM-Power GmbH<br />
Schmiedestraße 9 · 27419 Lengenbostel<br />
Fon: (0 42 82) 6 34 99 - 0 · Fax: (0 42 82) 6 34 99 - 19<br />
Mail: info@sam-power.de · www.sam-power.de<br />
139
Rausholen, was drin ist.<br />
Aktivkohle | Wechselservice<br />
für Ihre Biogasanlage<br />
Aktivkohle<br />
Regenerierung/Entsorgung<br />
Ihre Vorteile:<br />
Hochleistungs- & Standardkohle<br />
direkt ab Lager verfügbar<br />
Eigener Fuhrpark<br />
reduzierte Transportkosten<br />
durch effiziente Routenplanung<br />
One Man-Full Service<br />
nur ein Termin für Ihre Anlage<br />
Schnelle Lieferung<br />
Standard-, Express-Versand<br />
und 24/7-Service<br />
LKW mit Kran<br />
Autarkes Arbeiten vor Ort!<br />
Service/Bestellung<br />
Thomasburg<br />
Berlin<br />
Essen<br />
Wechselservice<br />
Routenplanung<br />
Anlieferung<br />
Anlagenbau | Kältetechnik<br />
Rausholen, was drin ist.<br />
Lieferung | Wechselservice | Entsorgung<br />
QR-Code scannen<br />
und alle Produkte<br />
anschauen.<br />
Aktivkohle24 Tel: 0201 9999 5757 info@aktivkohle24.com www.aktivkohle24.com